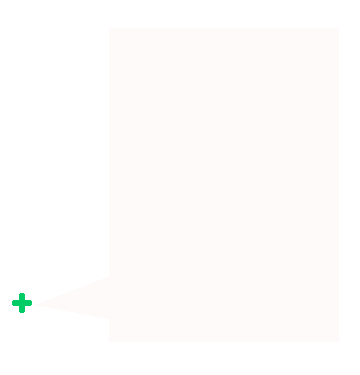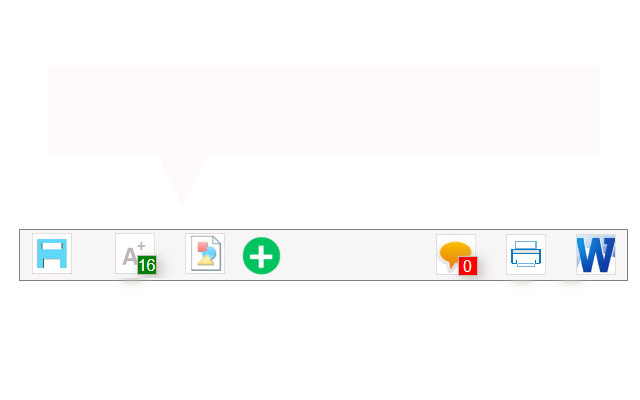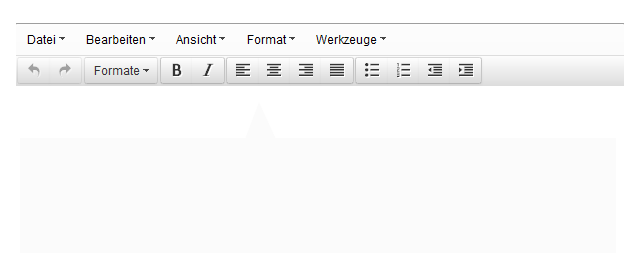Zurzeit sind 537 Biographien in Arbeit und davon 304 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 183

Das Ahrtal ist eine sehr fruchtbare Landschaft, in dem der begehrte Rotwein wächst und getrunken wird.
Aber auch die berühmte "Apollinarius"-Quelle in Bad Neuenahr, die mit ihrem Mineralwasser sogar das britische Königshaus beliefert. Es entwickelt aus dem Vulkangestein den besonderen Charakter und wird in der ganzen Welt verkauft.
Die Flutwelle, die das Ahrtal 2021 verwüstet hat, hinterlässt wohl für immer gravierende Spuren. Jahrhunderte alte Brücken, Häuser, Dorfkerne, Infrastrukturen und Bahngleise sind durch die Kraft des Wassers zerstört worden
Mineralwasser, "Sprudel", wie man bei uns sagt, gibt es aber auch aus der Sinziger Quelle.
Sinzig, das ist mein Heimatort und der wurde damals noch auf manchen Ortsschildern mit "Bad Sinzig" angeschrieben.
Es gab sogar ein Freibad, das mit diesem Mineralwasser gefüllt
wurde. Man konnte erst zwei Tage nach dem Einlassen gut darin schwimmen, weil es vorher einfach zu kalt war.
Heute gibt es das Schwimmbad nicht mehr. Die Ansprüche haben sich verändert und die neue Generation weiss wohl nichts mehr davon.
Meine Art zu sprechen, verrät mich aber noch immer als Rheinländer, obwohl ich seit 1991 einen Schweizer Pass besitze und bald seit 50 Jahren in Zürich lebe.
Die Wurzeln bleiben wohl für immer von der Vulkanerde gefärbt und geprägt und das ist auch gut so.
Von meinen vier biologischen Grosseltern habe ich nur eine Grossmutter, die Sybilla Frensch, geborene Wirtz, die Mutter meiner Mutter kennen gelernt.
Sie wurde am 25. Oktober 1880 in Rolandswert, nahe bei Bad Godesberg/Bonn geboren und ist am 27. März 1977, also mit 97 Jahren in ihrem eigenem zu Hause in Oberwinter, in dem sie seit ihrer Hochzeit gewohnt hat, verstorben.
Sie hat mein Leben bis in mein 38. Lebensjahr mehr oder weniger begleitet, in der Kindheit wohl sehr geprägt.
Die Eltern von Sibylla hiessen Johann Josef Wirtz und Anna Maria Liehsem; er wurde am 27. Februar 1847 geboren und ist am 22. Februar 1939 gestorben, sie wurde am 17. Juli 1849 geboren und ist am 29. Juni 1882 verstorben.
Sie hatten in Rolandswerth eine Bäckerei, der Urgrossvater war Bäcker. Die Urgrossmutter ist mit 33 Jahren verstorben und hinterliess die zwei Töchter Anna und Sibylla. Der Vater heiratete wieder und aus dieser Ehe kamen noch ein Sohn Josef und vier Mädchen Josefine, Christine, Maria und Katharina hervor. Meine Grossmutter hat niemals von Halbgeschwistern gesprochen. Der Urgrossvater hatte im Alter von 92 Jahren Schnee gefegt, ist dabei gestürzt und kam mit einem Oberschenkelhalsbruch ins Spital. An einer Bett-Lungenentzündung ist er dann gestorben. Meine Grossmutter ging – wurde geschickt – mit etwa 14 Jahren nach Belgien in ein Nonnenkloster. Dort sollte sie "den Haushalt" erlernen. In dem Kloster gab es Chor- (Frauen aus wohlhabenden Familien) und Laien-Schwestern. Die Chorschwestern hatte immer weisse Tischtücher und bekamen besseres Essen. Die Laienschwestern hatten blankgescheuerte Tische und sehr einfaches Essen, obwohl diese körperlich sehr hart arbeiten mussten. Als sie dort einmal angefragt wurde, ob sie nicht auch in den Orden eintreten wolle, hat sie klar gesagt, dass es ihr gar nicht passe, dass die Nonnen nicht gleich behandelt würden. Ihr wurde erklärt, dass die Chorschwestern in der Welt draussen auch ein besseres Leben gehabt hätten und es deshalb so schon richtig sei. Überzeugend war diese Erklärung für die Grossmutter aber nicht.
Mir etwa 22 Jahren hat sie in Oberwinter ihren Mann Peter Frensch geheiratet. Sie konnten im Elternhaus von Peter eine Wohnung beziehen, wo das fliessende Wasser aus dem Brunnen mit der Wasserpumpe gehoben wurde.
Sie hat erlebt, dass es im Haus nur wenige elektrische Lichtquellen geben durfte und deshalb eine Glühbirne zwei Räume beleuchtet hat.
So hatten zwar beide etwas Licht, aber auch weniger Intimität, was in Kauf zu nehmen war. Heute unmöglich, schön nur die Vorstellung, aber damals war man froh über den Fortschritt.
Ihre Schwiegermutter hiess Gertrud, geborene Clausen, war am 24. Oktober 1845 geboren und starb am 11, Februar 1915. Weil diese eine junge Frau im Haus hatte, wollte sie nicht mehr selber kochen. Da war sie aber bei der Sibylle an die Falsche geraten! Die ging, wenn sie bis am Nachmittag ihre Arbeiten in Haus und Garten gemacht hatte, mir einem Korb ins Dorf oder an den Rhein. Wenn sie zurück kam, hatte sie Papier zerknüllt in den Korb gelegt und ein Tuch darüber ausgebreitet. Die Schwiegermutter hat am Abend, wenn ihr Sohn heimkam, sorgenvoll von der jungen Frau berichtet, die so grosszügig einkaufte - wie es ihr schien - das Geld unter die Leute brachte.
Bald bekamen Peter und Sybilla Frensch ihren ersten Sohn Hans am 15. Juli 1904. Ein Jahr später kam der zweite Sohn Josef, drei Jahre später meine Mutter Sibylla, 2 Jahre später die Anna und 1915 die Maria auf die Welt.
Den Schwiegereltern wurde es wohl zu laut und sie sind ausgezogen nach Oberwesel/Engehöll. Da war ein Sohn von ihnen Kaplan und in dem Pfarrhaus war Platz für die Eltern. In der Engehöll wohnte schon ein anderer Sohn von ihnen und hatte dort eine Schreinerei. Es gab noch zwei Söhne, Herrmann und Johann, sie wohnten in Remagen und in Oberwinter.
Bei der Bahn gab es in dieser Zeit den Lohn nur viermal im Jahr. Also musste das Geld für drei Monate reichen. Die Sibylla verteilte das Geld in drei Umschläge und jeder musste für je einen Monat reichen. Durch dieses Lohnsystem sind viele Familien in Not geraten, nicht aber meine Grosseltern. Sie hielten immer mindestens ein Schwein, Hühner, einige Ziegen und später noch Schafe. Ihnen gehörten sehr viele Obstbäume und an zwei Stellen hatten sie einen Gemüsegarten. Die Arbeit musste grösstenteils von der Grossmutter bewältigt werden. Bestimmt haben die Kinder mithelfen müssen, denn der Grossvater war jeden Tag zirka 14 Stunden bei der Arbeit.

Peter Frensch, geboren am 22. September 1872, Weichenwärter bei der Deutschen Bundesbahn in Oberwinter, gestorben am 8. Februar 1937, und
Matthias Monreal, geboren am 13. März 1880, Maschinenbauschlosser, gestorben am 28. Mai 1961
Beide Grossväter habe ich leider nicht kennen gelernt. Der Peter ist 1937 verstorben, der Matthias war nicht in unserer Nähe; über ihn wurde auch nie gesprochen. Er habe die Familie verlassen, das war alles, was ich wusste.
Peter Frensch war bei der Deutschen Bahn angestellt. Er hat an einem Bahnübergang gearbeitet. Dort musste er von Hand die Weichen und die Signale verstellen und auch die Bahnschranken schliessen. Die Eisenbahn war damals in ihren Anfängen, Züge sind wohl nicht viele gefahren. Alle natürlich mit Dampf, nicht so schnell, dafür aber laut. 12 Stunden habe sein Arbeitstag gedauert. Für den Weg zu seinem Arbeitsort benötigte er, zu Fuss natürlich, auch eine halbe Stunde oder mehr. So kamen also schnell 13 Stunden, 6 mal in der Woche, zusammen.
Der Grossvater sei ein sehr bescheidener, ganz auf die Familie konzentrierter Mensch gewesen. Die Anstellung bei der Bahn war ein gesicherter Arbeitsplatz. Er war Beamter und musste nicht mit dem Verlust der Stelle rechnen.
In Köln war die Verwaltung der Eisenbahn. Da musste er ab und zu erscheinen. Als Beamter hatte er ja Freifahrtenscheine und so war das kein Problem. Von einer solchen Reise habe er immer Schokolade mitgebracht. Er hat stets Bruchschokolade gekauft, weil es dann für das gleiche Geld viel mehr gegeben habe. Es waren ja fünf Kinder da! Einmal, als er von dieser Reise zurückkam, war er völlig durchnässt. Auf die Frage, weshalb er denn seinen Schirm nicht geöffnet habe, meinte er, in der Stadt habe es so viele Menschen, die hätten ihm den Schirm wahrscheinlich zerdrückt und deshalb habe er ihn nicht geöffnet.
Weil er bei der Deutschen Bahn gearbeitet hat, musste er 1914/1918 nicht als Soldat in den Krieg einrücken. In diesem Krieg sind unendlich viele junge Menschen gestorben, weil sie die Grenze zu verteidigen hatten. Die Franzosen wollten ihre Grenze unbedingt bis an das linksseitige Ufer des Rheins verlegen. Das war ihr Ziel. Das wäre genau der Streckenabschnitt gewesen, an dem der Peter beschäftigt war, sein Arbeitsplatz. Also der eigene Wohnort, das eigene Haus hätte dann zu Frankreich und nicht mehr zum Deutschen Reich gehört. Das bedeutete für sehr viele Menschen Angst, Unsicherheit und Wut. Die Rheinländer wollten ihr Zuhause bestimmt niemals verlieren. In der Schule hat meine Mutter ein Gedicht lernen müssen, wo es hiess: «Sie sollen ihn nicht haben, den freien Deutschen Rhein». Die Mutter konnte alle Strophen bis ins hohe Alter:
Sie sollen ihn nicht haben,
Den freien deutschen Rhein,
Ob sie wie gierige Raben,
Sich heiser danach schrein,
Solang er ruhig wallend
Sein grünes Kleid noch trägt,
Solang ein Ruder schallend
In seine Wogen schlägt.
Sie sollen ihn nicht haben,
Den freien deutschen Rhein,
Sie sollen ihn nicht haben,
Den freien deutschen Rhein.
Sie sollen ihn nicht haben,
Den freien deutschen Rhein,
Solang sich Herzen laben
An seiner Feuerwein,
Solang in seinem Strome
Noch fest die Felsen stehen,
Solang sich hohe Dome
in seinem Spiegel sehn.
Sie sollen ihn nicht haben,
Den freien deutschen Rhein,
Sie sollen ihn nicht haben,
Den freien deutschen Rhein.
Sie sollen ihn nicht haben,
Den freien deutschen Rhein,
Solang noch deutsche Knaben
Um schlanke Dirnen frei'n.
Solang die Flosse hebet
Ein Fisch auf seinem Grund,
Solang ein Lied noch lebet
In seiner Sänger Mund.
Sie sollen ihn nicht haben,
Den freien deutschen Rhein,
Bis seine Flut begraben
Des letzten Manns Gebein!
(Niklaus Becker, "Der freie Rhein".)
Die Eisenbahner waren «kampfbereit». Sie wollten ihren sicheren Arbeitsplatz und ihre Häuser oder Wohnungen auf keinen Fall an die Franzosen verlieren.
Mein Grossvater Matthias Monreal, der Vater meines Vaters, geb. 1880 - 1961
er hat gelebt, aber in unserer Familie existierte er nicht.
Nie wurde über ihn gesprochen, einfach gar nichts.
Als Kind hat es mich wohl auch nicht sonderlich berührt, denn zu den Geschwistern von meinem Vater hatten wir auch nur wenig kontakt, obwohl der Bruder meines Vaters mit seiner Frau und den beiden Töchtern Maria und Käthe mitten in unserer Stadt gewohnt haben und die Mädchen in die selbe Schule wie wir, mein Bruder und ich gegangen sind.
Erst als ich älter geworden bin, habe ich nach dem Grossvater gefragt und da erfuhr ich, dass er vor vielen Jahren seine Familie verlassen habe.
Einen Grund dafür wurde mir aber nicht angegeben, aber aus der Haltung meines Vaters heraus spürte ich, das ich da besser nicht weiter nachfragen sollte.
Ich glaube, meine Mutter hat es einmal erwähnt, dieser Grossvater sei einmal vor unserem Haus gewesen, aber der Vater habe ihn nicht hinein gelassen.
Er wollte, aus was für Gründen auch immer, keinen Kontakt mehr mit ihm !
Viele Jahre habe ich mir oft Gedanken gemacht, aus welchen Gründen in den 30ger Jahren ein Mann seine Familie verlassen könnte ?
War es wegen einer anderen Frau oder gar wegen einem Mann?
Erst die Ahnenforschung, die ich vor wenigen Jahren gemacht habe, hat Licht in diese Frage gebracht.
Es war die Politische Ueberzeugung ! Der Wunsch, Frieden mit den Franzosen und dafür Landverlust !
Es gab eine Vereinigung von Männern, die sich «Separatisten» nannten. Sie hatten zum Ziel, dem Streit mit den Franzosen ein Ende zu setzen, Tod und Blutvergiessen zu beenden und den Franzosen das Rheinland zu übergeben. Es gab so etwas wie Krieg zwischen - Besitz-Erhalten - oder - Frieden mit dem Nachbarn Frankreich - und dafür das Rheinland opfern.
Ausgerechnet mein Grossvater Matthias war bei diesen Separatisten und kämpfte gegen die Eisenbahner. Es muss zu massiven Bedrohungen gekommen sein, offenbar waren die Separatisten stärker und es kam zur Ausweisung vieler Eisenbahner. Zu denen gehörte auch die Familie Peter Frensch. Sie mussten das Haus, den Wohnort Oberwinter verlassen, sind bis in die Lüneburger Heide geflüchtet. Dort, aufgeteilt bei drei verschiedenen Familien, an drei verschieden Orten, haben sie ein Obdach gefunden. Nur sonntags haben sie sich in der Kirche getroffen. Die Ungewissheit, ob sie wieder in ihr Haus zurück können, war gross. In Oberwinter gab es einen evangelischen Pfarrer, er hiess Saxer, der sich für die «Ausgewiesenen» einsetzte. Nach zwei Monaten kam ein Brief von dem Pfarrer, dass die Lage sich beruhigt habe in Oberwinter und die Familie könne wieder nach Hause zurück kehren. Den Grossvater hat diese Geschichte sehr gestresst. Er habe sich nie mehr richtig wohl gefühlt und sei nachher immer kränklich gewesen. 1937 ist er dann zu Hause verstorben.
Meine zwei Grossväter kämpften also gegeneinander ohne eine Ahnung zu haben, dass sie einmal gemeinsame Grosskinder haben würden. Wahrscheinlich haben sie sich gar nicht gekannt.
Für den Grossvater Matthias Monreal, der ja als Separatist gekämpft hatte, wurde die Situation im Anfang der dreissiger Jahre auch ungemütlich. Als der Adolf Hitler an Macht gewann, war das Thema genau umgekehrt und das Deutsche Reich sollte grösser und grösser werden. Die Separatisten waren nun Staatsfeinde, die verfolgt wurden und ihr Leben war nicht mehr sicher. Also mussten sie flüchten, ihre Familien verlassen. Das war also der Grund, dass ich ihn nie kennen gelernt habe. Mein Vater konnte mit der Situation schlecht umgehen und hat es seinem Vater nie verziehen, dass er sich selber, weil er Separatist war, in diese Lage gebracht hatte, flüchten zu müssen. Seine Frau blieb ohne Absicherung mit drei Kindern zurück, er war im Ausland. Der Matthias war gelernter Schlosser, er konnte vorher sicher recht gut für seine Familie sorgen. Nun war er in Elsass-Lothringen, in einem Gebiet von Frankreich, das je nach Machtverhältnis mal deutsch oder französisch war und auch die Sprache war dort kein Hindernis.
Er hat, als seine Frau Cäcilia in Sinzig 1935 verstorben war, in Schilligheim am 16. Juli 1938 seine zweite Ehefrau, Berthe Zwick, aus Lauterburg geheiratet. Beide haben in Lauterburg am Schlossplatz 37 gewohnt. Der Grossvater ist am 28.Mai 1961 verstorben. Schade habe ich ihn nie kennen gelernt, aber mein Vater konnte ihm das Verlassen der Familie nie verzeihen. Als der Grossvater uns einmal besuchen wollte, hat er ihm keinen Einlass ins Haus gewährt. Die Schwester meines Vaters, Cäcilia, ist mit ihrer Tochter Sibylle, meiner Cousine, einmal bei ihm in Lauterburg zu Besuch gewesen. Die Sibylle hat mir sehr genau von diesem Besuch erzählt. Dadurch wurde für mich das Geheimnis endlich gelüftet, über das nie gesprochen worden war.

Sibylla Frensch, geborene Wirtz, geboren am 25. Oktober 1880 in Rolandswerth/Melem, gestorben am 27. März 1977, und
Cäcilia Monreal, geborene Kleufer, geboren am 25. März 1879 in Hönningen/Rhein, gestorben am 22. April 1935.
Sie war, bis zu ihrem Tode mit 97 Jahren, eine wichtige, sehr geachtete Person in unserer Familie, die ihre Kinder geprägt und gefördert hat. Mit etwa 70 Jahren, um 1950, hat sie jedem ihrer Kinder als Startkapital ein Stück Land als Vorerbe gegeben, damit sie sich im vom Krieg zerstörten Land eine Existenz aufbauen konnten. In ihren letzte zwei Lebensjahren war sie auf Hilfe angewiesen, die sie durch ihre aufopferungsvollen Töchter Anna und Maria erhalten hat.
Über meine Oma Cäcilia Monreal wurde von meinen Eltern fast nichts erzählt. Ihre Eltern waren Heinrich Kleufer, geb. am 12.Oktober 1838 in Sinzig, von Beruf Schuhmacher und Christina Hubertina, geborene Walgenbach, geboren am 13. Februar 1843. Cäcilia hatte mitten in Sinzig am Marktplatz gewohnt. Heute steht an dieser Stelle ein Geschäft. Ich habe aber ihr Wohnhaus noch gekannt. Ein Sohn von ihr, der Heinrich mit seiner Frau und den beiden Töchtern hat die Wohnung nach ihrem Tode 1935 übernommen. Sie ist an Krebs verstorben und habe in den letzten Wochen sehr viele Schmerzen ertragen müssen. Ich besitze ein Foto von ihr, wo sie vor ihrem Haus steht. Darauf sieht sie mit sich und der Welt sehr zufrieden aus. Sie war ja viele Jahre Alleinerziehende und hat die Familie als Bahnschrankenwärterin mit sehr kleinem Einkommen durchgebracht. So war sie bestimmt stolz auf ihre drei nun erwachsenen Kinder. Einige Jahre habe ich die Blumen auf ihrem Grab auf dem Friedhof in Sinzig gepflegt.

Sibyilla, geb.Frensch, geboren am 4.10.1908, gestorben am 13. Juli 1996 und
Matthias Monreal, geboren am 4. Mai 1910, gestorben am 13. November 1993
Mit Freund und Schalk in den Augen hat uns, meinem älteren Bruder Heinz Walter und mir, am 11. September 1993 unser Vater den doch recht überschaubaren Saal in der Alten Post in Bad Breisig gezeigt, wo er, vor mehr als 60 Jahren, seine Billy zum ersten Mal gesehen hat. Aus irgend einem Anlass war dort eine Tanzveranstaltung. Die Mutter war mit anderen Bekannten oder Freunden dort. Mein Vater kam etwas später an, hat beim Betreten des Saales die Billy gesehen und es habe sofort bei ihm gefunkt. Als die Billy auf der Tanzfläche war, hat er am Tisch angefragt, ob da wohl noch ein Platz frei sei. So sass er, als die Billy vom Tanz zurück kam, gerade neben ihr. Das war 1933, der Beginn einer lebenslangen Beziehung, einer 59-jährigen Ehe, aus der mein Bruder Heinz Walter und ich in diese Welt gekommen sind.

1933, die Machtergreifung von Hitler, der Beginn von Unruhe, Hetze und Unsicherheit im ganzen Land. Auf der anderen Seite aber bestimmt auch Hoffnung, dass die wirtschaftlich stagnierende Lage im Land wieder neuen Schub erhalten und es für alle Arbeit, Geld und eine Verbesserung der Lebenssituation ergeben würde. Angst und Hoffnung, dazwischen aufkeimende Zuneigung, Liebe und Zukunftspläne, die wohl nicht so einfach zu haben waren. Der Matthias hatte ein Handicap, nicht zu übersehen. Durch einen Unfall hatte er 1927 seinen linken Unterarm verloren. Er trug zwar eine Prothese, aber damals habe man der Mutter zu verstehen gegeben, weshalb sie eine Beziehung mit einem "Krüppel" haben müsse, wobei es doch bestimmt noch viele andere Chancen gäbe. Die Liebe hat gesiegt und im Frühling 1934 wurde Verlobung gefeiert. Am 11. September 1934 war die Hochzeit und ein Jahr später wurde mein Bruder Heinz Walter geboren. Die junge Familie wohnte in Sinzig in der Renngasse zur Miete. Matthias war in Sinzig aufgewachsen und arbeitete dort in der Plattenfabrik als Portier. Die Platten- Mosaikfabrik war und ist noch heute eine grosse Arbeitgeberin für sehr viele Sinziger und Menschen aus den umliegenden Dörfern. Wand- und Bodenplatten wurden und werden noch immer dort fabriziert. Sinzig war eine Stadt mit damals etwa 4500 Einwohnern. Jeder kannte fast jeden und der Vater als Portier auch noch die Arbeiter aus den umliegenden Dörfern.
Der Pfarrer, damals eine sehr wichtige Person in der Stadt, denn fast alle Sinziger waren katholisch, hatte einen grossen Einfluss auf seine Schäfchen, und seine Meinung galt auch bei den Wahlen. Unterstützt wurde er von Kaplänen und einigen Klosterfrauen, die auch ein kleines Altersheim, Entbindungsstation, ambulante Krankenpflege und den Kindergarten geleitet haben. Zwei Ärzte, eine Hebamme, eine Apotheke, der Bürgermeister mit seinen Stadträten, das war die Prominenz in der Stadt. Die junge Familie zügelte in die Nähe der Fabrik, wo der Vater arbeitete, in eine grössere Wohnung. Im Juni 1939 wurde ich, der zweite Sohn, geboren.
Die politische Lage hatte sich verschärft. Hitler, die Partei der NSDAP, also die Nazis, die von ihnen bestellten Ortsgruppenleiter, das war nun die neue Prominenz der Stadt. Alle, die sich nicht «freiwillig» der Partei anschlossen, mussten mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes rechnen. Die arische Abstammung war zu der Zeit sehr wichtig, musste mit der Bescheinigung des Pfarrers aus dem Taufregister belegt und mit dem Stempel besiegelt werden. So war es für das junge Paar, mit nicht so geläufigen Namen, eine aufwendige Aktion, von allen Vorfahren diese Einträge aus den Kirchenbüchern zu beschaffen.
Im September ist der grausame zweite Weltkrieg ausgebrochen. Viele jüdische Menschen, die in Sinzig gelebt haben, waren schon vorher deportiert werden, oder, die es noch geschafft haben, sind geflüchtet. Die Synagoge war ein Jahr vorher, am 9. November 1938, geplündert und angezündet worden.
1939 im Juni, kam ich in meine Familie. Bestimmt war es die denkbar ungünstigste Zeit, einen Säugling zu haben, der leider nicht so pflegeleicht war. So, wie es mir erzählt wurde, habe ich, wenn ich nach dem Stillen nicht ganz vorsichtig angehoben wurde, erbrochen und deshalb kaum an Gewicht zugenommen.
Der Vater, weil er nur einen Arm hatte, wurde nicht für den Militärdienst einberufen. Das war für unsere Familie sehr positiv, denn alle jungen Männer mussten Kriegsdienst leisten. Ob und wie sie ihre Familie wieder sehen würden, das fragten sich sicher viele.
Der Hitler mit seinen Getreuen hat Polen, Tschechien, England, Niederlande, Frankreich, Russland und andere Länder bedroht, angegriffen, bombardieret und gemordet ohne Ende. Im eigenen Land musste rationalisiert und gespart werden, alles Geld wurde für Rüstung und Munition gebraucht. Kupferkessel, Kirchenglocken und Ähnliches wurden beschlagnahmt und eingeschmolzen. Die Frauen haben warme Socken gestrickt und Handschuhe für die Soldaten an der Front. In erster Linie haben sie nebst der Erziehung der Kinder in dieser Zeit die Arbeit der Männer, die ja im Krieg waren, übernehmen müssen. Den Betrieb selbständig führen und ihr Geld verwalten, oft zum ersten Mal überhaupt. Das war eine Entwicklung, die es bis zu dieser Zeit wohl noch nie gegeben hatte. In fast allen Familien war vorher der Mann das Oberhaupt, der bestimmt hat, ob oder was mit dem Geld oder Hab und Gut gemacht wird oder wie der Betrieb geführt werden muss oder soll. Die Frauen waren vorher in der zweiten Reihe gewesen und nun mussten sie es plötzlich können: Körperlich grosse Leistungen erbringen, den Mann ersetzen, selbstständig entscheiden. Die grosse Sorge im Nacken, was mit ihrem Ehemann passiere, wie er den Krieg überlebe oder wie verletzt oder krank er zurückkomme. Im Radio, es durften nur deutsche Sender gehört werden, wurde meist nur vom Sieg und weiterem Vormarsch gesprochen, von der Vergrösserung des deutschen Reichs.
Da hatten wir es in unserer Familie besser. Das Unglück des Vaters mit 17 Jahren war nun unser Glück. Er war zu Hause, wir waren zusammen und das war sehr, sehr viel in dieser Zeit. 1943/44 hatte Hitler mit seinen Kriegen mit und in all den Ländern auch sehr viele Feinde, die Deutschland mit Bomben eindeckten. So war die Heimat plötzlich auch nicht mehr sicher. Unsere Wohnung war sehr nahe an der Bahn und in etwa 800 Meter Entfernung zum Haus gab es eine Bahnbrücke über die Ahr. Das Ziel für die Feinde war es, diese Brücke zu zerstören, dann wäre die linksseitige Bahnstrecke am Rhein unterbrochen gewesen. Damals war es schwierig, punktgenau ein Ziel mit einer Bombe zu treffen, so fielen die Bomben in einem Umkreis von zwei bis drei Kilometer. Wir hatten lange Zeit Glück, mussten immer wenn es Flieger bzw. Bombenalarm gab, egal Tag oder Nacht, schnell in den mit Holz abgestützten Luftschutzkeller. Nach so einem Alarm in der Nacht sollten die Eltern möglichst bald wieder einschlafen, weil sie am Morgen früh aufstehen mussten, um zügig die anstehenden Arbeiten zu erledigen. Am Tag gab es unvorhersehbare Zwangsunterbrechungen durch den Bombenalarm. 1944, an einem Vormittag, die Mutter hatte meinen Bruder und mich mit einer Milchkanne zu einem Bauern geschickt, gab es wieder Bombenalarm. Mein Bruder ist mit mir unterwegs ins nächste Haus gegangen und wir konnten dort in einen Luftschutzkeller. Das Haus gleich neben unserer Wohnung bekam bei diesem Angriff einen Volltreffer ab und der auch dort nur mit Holz abgestützte Keller ist eingestürzt, sieben Menschen sind gestorben. Es war die Nachbarsfamilie, sie hatten Kinder in unserem Alter, und wir waren vorher sehr oft bei ihnen und haben miteinander gespielt. An diesem Vormittag zum Glück nicht. Sonst wären wir da auch mit grosser Wahrscheinlichkeit bei den Toten gewesen.
Unser Haus, direkt neben dem Volltreffer, war unbewohnbar geworden. Die Mutter hatte nur wenige Tage vorher die «guten» Gläser, das «gute» Geschirr oder wertvolle Sachen im Keller in Kisten verpackt und im Sand eingelagert. Vieles in der Wohnung war kaputt, die Schränke waren durch die Wucht und Erschütterung umgefallen, aber wir hatten überlebt!!!! Mein Bruder und ich wurden mit unserem Rucksack, der in dieser Zeit immer von der Mutter mit dem Nötigsten gepackt und mit Namen und Adresse versehen bereitgestellt war, zur Grossmutter und den Tanten gebracht. Sie wohnten zehn Kilometer von uns entfernt und dort war es sicherer. Die Eltern, zum Glück war der Vater auch da, haben eine andere Wohnung gesucht und eine kleine Behelfswohnung gefunden. Alle noch brauchbaren Gegenstände und Sachen hatten darin Platz und wir hatten wieder ein Zuhause. Die im Sand vergrabenen Kisten mit den Wertsachen hatten den Angriff überstanden.
Matthias und Billy, nun seit zehn Jahren verheiratet mussten mit fast nichts neu starten und das Ende des Krieges war nicht abzusehen. Ein Bruder von meinem Vater und zwei Brüder meiner Mutter kämpften irgendwo an einer Front und nur sehr selten erhielt die Familie ein Lebenszeichen von ihnen. Die Situation war in den meisten Familien ähnlich und alle hatten grosse Sorgen. Es ging bei den meisten Familien ums Überleben. Die Angst, Unsicherheit, wie geht es heute oder morgen weiter, prägten den Alltag. In vielen Familien kamen "grosse staatliche Dokumente" an, dass ihr Sohn oder Ehemann für den Führer und das Vaterland sein Leben geopfert habe. Aus den Städten Köln und Bonn kamen Ausgebombte in unseren Ort in der Hoffnung, weniger Zeit im Keller oder Bunker zu verbringen und zu überleben. Überall, wo es möglich war, haben die Leute Höhlen in Abhänge oder die Berge gegraben.
Und wirklich, als im Frühjahr 1945 die Amerikaner Teile des Rheinlands besetzten, wurden wir aus unserer Notwohnung vertrieben und mussten plötzlich ausziehen, durften nichts mitnehmen. Zum Glück hatten die Eltern an einem kleinen Berg, zusammen mit zwei uns gut bekannten Familien, zwei kleine Holzhäuschen gebaut, die durch einen Stollen im Berg miteinander verbunden waren und wir waren froh, dass wir noch eine Höhlenwohnung hatten. Trinkwasser mussten wir aus einer Pumpe im Tal hochtragen. Die Eltern und die zwei anderen Familien, zusammen auf engstem Raum, mussten einfach funktionieren und mit sehr vielen Einschränkungen zurecht kommen.
Wir konnten vom Berg aus unser Behelfsheim beobachten, sehen, was in der Umgebung passierte. Es waren vier Amerikaner im Haus, einer sprach ein wenig deutsch. Einmal bin ich mit meiner Mutter ins Haus gegangen. Sie hatte Wäsche eingeweicht und wollte diese etwas auswaschen und im Estrich zum trocknen aufhängen. Das wurde erlaubt und ich sass bei den Amis in der Stube. Sie gaben mir Schokolade und waren sehr freundlich zu mir. Ihre Füsse hatten sie auf dem Tisch ausgestreckt, was bei uns niemals erlaubt gewesen wäre. So habe ich reklamiert und ihnen gesagt, dass man das nicht dürfe und die Mutter bestimmt schimpfen würde, wenn sie das sähe. Der "Dolmetscher" hat das übersetzt und die Soldaten fanden mich lustig und haben gelacht.
Nach einigen Tagen oder wenigen Wochen zogen die Soldaten wieder ab und die Mutter ging zurück ins Behelfsheim, als diese am Zusammenpacken waren. Sie sah, wie unser Radio und die schöne Uhr mit Westminstergong bereit lagen, die Soldaten wollten sie mitnehmen. Das liess die Mutter nicht zu und beschützte diese Gegenstände, bis die Soldaten weg waren.
Danach haben die Eltern eine gar nicht schöne Entdeckung gemacht. Weil das Wasser sehr oft abgestellt wurde, funktionierte auch die Spülung im WC nicht. Die Amis hatten dann in die von der Mutter immer sehr sorgsam behüteten Einmachgläser geschissen und gepinkelt, diese mit dem Dichtungsgummi und dem Deckel mit Spannbügel verschlossen draussen vor das Haus abgestellt. Schweren Herzens und mit Ekel mussten die Eltern die Gläser entsorgen, obwohl man in dieser Zeit keine neuen mehr kaufen konnte.
«Von Liebe sprach damals keiner», so heisst der Titel eines Buches, das Jahre später über diese Kriegszeit geschrieben wurde. In Liebe und Verlässlichkeit haben Matthias und Billy diese Herausforderung überstanden und mein Bruder und ich, wir waren eingebunden, ein Urvertrauen konnte wachsen, wir haben uns sicher und geborgen gefühlt. Für den Vater hatte das Wohl seiner Familie oberste Priorität, er wäre zu allem bereit gewesen, unser Überleben zu sichern. Davon war und bin ich noch bis heute überzeugt. Was er in seiner Jugend vermissen musste, wollte er seiner Familie geben, auch unter den schwierigsten Kriegsverhältnissen.

Am 8. Mai 1945 kam, die von so vielen, durch die fünf Jahre des grausamen Krieges geschundenen, verunsicherten, teils kranken Menschen ersehnte Kapitulation, das Ende des brutalen Krieges.
Nach einigen weiteren schlechten, aber sich langsam verbessernden Jahren, kam 1948 die Währungsreform. Die Reichsmark wurde ersetzt durch die D-Mark und jeder Deutsche erhielt ein Startgeld von 40 D-Mark. Vom Vermögen der Reichsmark blieben genau zehn Prozent. Vermögend waren da nur noch wenige!
Matthias und seine Billy konnten ihren grossen Garten an der Renngasse, heute steht dort das Altersheim der Stadt, für 5000 D-Mark verkaufen. Das war damals sehr viel Geld. So hatten sie Bargeld und konnten bei einer Versteigerung ein renovationsbedürftiges Bauernhaus auf der Grabenstrasse 18 kaufen. Der Traum vom eigenen Haus war erfüllt, aber bis es ein gut funktionierendes Traumhaus wurde, waren sehr, sehr viele Arbeits-Stunden, -Tage, -Wochen und -Jahre nötig.
Der Bruder meines Vaters kam krank aus dem Krieg zurück und die Brüder meiner Mutter waren gezeichnet, aber heil zurück gekommen. Die Familie war wieder vollständig und langsam gab es normale Verhältnisse. Der wirtschaftliche Aufschwung, Konjunktur war das Schlagwort dieser Zeit, hatte die Menschen, das ganze Land erfasst. Freude am Leben, vergessen was gewesen und erlebt worden war, gutes Essen und sich etwas leisten, wenn möglich etwas mehr als die Nachbarn, so ähnlich war die Entwicklung in diesem Land. Aus dem Osten geflüchtete Menschen kamen in unsere Stadt. Sehr schnell bauten sie sich Eigenheime, arbeiteten und blieben. Sie waren lange Zeit nicht sehr willkommen im Rheinland. Der Matthias hatte weniger Probleme mit den Flüchtlingen, weil er durch seine Arbeit als Portier in der Fabrik sehr viele persönlich kannte und sehr schnell auch ihre Fähigkeiten kennen lernte, hatte er einen eher rationalen Zugang zu ihnen gefunden. Die Billy war da komplizierter und der Gedanke, dass einer ihrer Söhne so ein «Flüchtlingsmädchen» mit nach Hause bringen und sie sogar noch Schwiegertochter werden könnte, war ein Schreckenszenario. Fremd und evangelisch, nein, soweit wäre die christliche Nächstenliebe dann doch nicht gegangen. Wir waren katholisch, und das war richtig! Der Matthias war nicht sooo katholisch, für ihn wäre das wohl kein Problem gewesen. Er konnte sich sein ganzes Leben eher mit etwas Neuem arrangieren. Für ihn war wichtig, dass es für seine Billy gestimmt hat. Er hatte absolut auch «seine Linie», aber ich habe ihn stets als sehr ausgeglichen erlebt. Er konnte mit fast allen Menschen einen Weg finden, sich zurück nehmen, die andere Person akzeptieren wie sie war. Das Wohl seiner Familie hatte für ihn immer erste Priorität. Die Billy war eher das Gegenteil. Sich zurücknehmen, die Bedürfnisse der Mitmenschen akzeptieren, das war für sie nicht so einfach. Ihre Grundsätze waren nicht verhandelbar. Zum Beispiel musste das Mittagessen genau um 12 Uhr fertig auf dem Tisch stehen, nicht eine Minute später, lieber eine Minute früher.
Die Eltern waren einmal in Spanien im Urlaub. In dem Hotel wurde am Morgen erst nach 8 Uhr der Ofen angefeuert und das Kaffeewasser aufgestellt. Das ging für sie überhaupt nicht und es waren keine richtigen Ferien. Auch die Bauarbeiter! Sie hatten nur drei oder vier Steine auf eine Karre geladen. Ihr Kommentar: «So kann man doch niemals zu etwas kommen; so wird das Haus ja nie fertig!»
Die Geschwister meines Vaters und ihre Familien wurden durch die Mutter stark auf Distanz gehalten, die familiären Kontakte fast ganz auf die Geschwister der Mutter und die Grossmutter ausgerichtet. Vielleicht hatte das ja etwas mit der Geschichte meines Grossvaters zu tun. Gesprochen wurde darüber aber das ganze Leben lang nicht. Es war einfach so, der Vater hat nie interveniert. Offenbar konnte er damit leben.
Als die Eltern 40 Jahre verheiratet waren, haben wir besprochen, dass wir, die Kernfamilie, uns jedes Jahr an ihrem Hochzeitstag treffen, um gemeinsam etwas zu unternehmen, dem Tag eine besondere Note zu geben, man wisse ja nicht, ob sie die 50 – Goldene Hochzeit – feiern können. Sie konnten es. Und nur ein Jahr hat zu den 60 Ehejahren gefehlt. Dieses Fest wäre dann im Saal der «Alten Post» gefeiert worden, wo alles begonnen hatte.
Die Eltern wohnten bis zuletzt in einer Einlegerwohnung in der eigenen Liegenschaft, mein Bruder und seine Familie wohnten in der Hauptwohnung. Der Vater hat bis ins hohe Alter immer gut funktioniert und hat, weil seine Billy nach zwei Hüftoperationen schlecht gehen konnte, alles eingekauft und Vorräte im Keller angelegt. Er hat es nicht einfach gehabt, er musste ihr bei sehr vielen Tätigkeiten im Haushalt helfen, und das immer sofort. Einmal, hat mir meine Schwägerin später erzählt, sei der Vater um elf Uhr vormittags, ganz erschöpft zu ihr gekommen und habe gesagt: "Stell dir vor, jetzt hat sie schon 75 mal 'Matthias, komm hilf mir!' gerufen".
Einmal musste er einen Kopfsalat kaufen gehen. Die Mutter prüfte am Küchentisch dann die Festigkeit des Salats und war gar nicht erfreut, sondern ordentlich erbost, dass er mit dieser schlechten Qualität zufrieden war und die Verkäuferin es gewagt hatte, ihm diesen halb verwelkten Salat anzudrehen. Sie verlangte, dass er zurück gehen und den Salat umtauschen sollte. Brav gehorchte der Vater, aber er ging nicht den Salatkopf umtauschen, sondern er entsorgte ihn unterwegs und kaufte einen neuen. Nun war der Familienfrieden wieder hergestellt.
Der Vater hat niemals etwas gesagt, wenn er gesundheitliche Probleme hatte. Als es ihm mit 83 Jahren sichtbar schlecht ging, wollte er auf keinen Fall ins Spital. Leider kam er dann doch nicht um einen Spitaleintritt herum. Nach zwei Tagen, am letzten Tag seines Lebens, hat er gespürt, dass er sterben wird. Mein Bruder hat ihn am Nachmittag besucht und er wollte, dass ein Notar komme, damit er eine Vollmacht für die Bankgeschäfte ausstellen könnte, weil seine Frau sonst nicht ans Bargeld kommen würde. Seine Enkeltochter hat ihn am Abend mit ihrem Mann besucht und er hat auch ihnen gesagt, dass er den nächsten Tag nicht mehr erleben werde. Auf die Nachfrage meines Bruders beim Arzt, erhielt er die Auskunft, dass der Vater in wenigen Tagen entlassen würde, seine Sorge sei unbegründet. Er ist dann ohne Kampf in der Nacht leider verstorben, so wie er es gespürt und gesagt hatte.
Die Billy, nun allein, hat noch drei Jahre, mit Hilfe meines Bruders und seiner Frau, selbstständig in einer Wohnung gewohnt.
Anfänglich war das für beide Seiten nicht einfach. Die Mutter konnte jetzt nicht mehr den Matthias rufen, wenn sie etwas brauchte. Die neue Situation war für alle eine grosse Herausforderung und natürlich gab es Reibereien. Ein Beispiel: Die Schwägerin besorgte die Einkäufe jetzt mit dem Auto dort, wo sie mit dem Auto auf einen Parkplatz fahren und die Waren einladen konnte. Das war für die Mutter aber nicht der richtige Laden. Sie verlangte, dass sie in "ihrem" Laden, wo der Vater immer hingegangen war, einkaufen sollte. Ziemlich klar setzte sich meine Schwägerin durch und sagte deutlich, wenn sie damit nicht zufrieden sei, dann müsse sie halt jemand anderen suchen, um für sie einzukaufen. Damit musste sich die Mutter wohl mit Zähneknirschen zufrieden geben und den "neuen" Laden akzeptieren.
Beide ruhen nun wieder vereint auf dem Friedhof in Sinzig und ein Grabstein zeugt von ihrem gelebten Leben.




Am 9. Juni 1939 wurde ich um 8.45 Uhr in Sinzig am Boffertsweg, also zu Hause, geboren. Offenbar war die Schwangerschaft ohne Probleme verlaufen, der Arzt und die Hebamme hatten keine Bedenken geäussert. Dass ich als «normales» Kind auf die Welt kam, war mit unendlich viel Glück verbunden. Damals kannte nur mein Vater seine Blutgruppe. Er hatte A positiv und die Mutter hatte A negativ, was aber keiner wusste. Das bedeutet, dass die Mutter bei der ersten Schwangerschaft mit meinem Bruder, vier Jahre vorher, Antikörper gegen A positiv entwickeln konnte. Bei einer zweiten Schwangerschaft kommt es dadurch häufig zu körperlichen Schäden beim Kind. Sehr oft sind diese Neugeborenen behindert, haben zum Beispiel einen Wasserkopf, Missbildungen oder andere körperliche Einschränkungen. Diese Erkenntnisse hatte man 1939 noch nicht. Erst 30 Jahre später, als bei meiner Mutter eine Blutgruppenbestimmung wegen einer Operation durchgeführt wurde, hat ihr der Arzt erklärt und es fast nicht glauben können, dass es bei ihrer zweiten Geburt, also bei mir, keine sichtbaren Schäden gegeben habe. Ich musste mich bei diesem Arzt zur Begutachtung vorstellen. Bis heute geht es mir gut und ich bin schon bald 85 Jahre alt.
Trotz dem Krieg hatte ich eine unbeschwerte schöne Kindheit. Mein Umfeld war in Ordnung, mehr braucht man als Kind wohl nicht. Ich hatte gute Eltern, einen Bruder, eine Grossmutter, Onkel und Tanten, freundliche Nachbarn, alle haben mich behütet, gefördert und hatten Freude an mir. Ich war wohl ein sehr lebhaftes, neugieriges und mitteilsames Kind. Bei einer Tante zu Besuch musste – sollte - ich jeweils fünf Minuten ruhig an der Wand stehen bleiben, die Hände an die Hosennaht, was wohl nur selten gelungen ist. Ich höre sie noch heute sagen: "Wie heisst du?" und darauf musste ich sagen, "Ich bin der Hans Gerd Zappelphilipp Monreal".
Mein Bruder war «pflegeleichter», ruhig und brav, hat wenig Sachen oder seine Kleider kaputt gemacht. Ich konnte seine Kleider im entsprechenden Alter anziehen und sie habe noch sehr gut ausgesehen. Nach mir hätte sie niemand mehr gebrauchen können, sie waren verschlissen.
Bei einer Familienfeier, ich war zirka vier Jahre alt, wurden Fotos gemacht. Beim ersten Bild bin ich fröhlich und strahle. Als aber ein zweites Foto gemacht werden sollte, mit allen Verwandten, habe ich mich schreiend gesträubt, noch einmal abfotografiert zu werden. Ich war schon der Kleine in der Familie und noch mehr «ab»-fotografiert hätte mich doch noch kleiner gemacht, dachte ich wohl.
Als ich sechs Jahre alt war, war der zweite Weltkrieg zu Ende. Wir wohnten in der Behelfswohnung und im August war die Einschulung in die Volksschule in Sinzig. Die Lehrer waren, nach dem Kindergarten die ersten fremden Menschen, denen ich gehorchen musste. Ich war nicht der beste Schüler, und so viele Stunden still sitzen, dem Lehrer zuhören, das war nicht meine Stärke. In den ersten Schuljahren gab es noch «Schulspeisung» für die Schüler, weil nach dem Krieg die Ernährung in vielen Familien problematisch war. Oft gab es Suppen oder einen Brei, das hat mir meistens nicht zugesagt und ich habe auf das Essen verzichtet.
An einem Ostersonntag war ich bei meiner Grossmutter in Oberwinter zu Besuch. Ich war etwa sieben Jahre alt und ging mit meiner Tante Maria ins Hochamt. Die Tante sang im Kirchenchor und irgendwann wurde das «Halleluja» von Händel gesungen. Nach meinem Empfinden haben sie zwanzigmal oder mehr *Halleluja* gesungen. Ich habe immer wieder zur Empore hochgeschaut und den Kopf geschüttelt. Nach kurzer Zeit war mir klar, dass diese Sänger nicht normal sein konnten und wollte mir das nicht länger anhören. Ich stand auf, dann verliess ich die Kirche demonstrativ. Bei der Grossmutter zu Hause angekommen, sie bereitete das Mittagsmahl, fragte sie erstaunt, ob der Gottesdienst schon zu Ende sei. Aufgeregt berichtete ich ihr, dass die Leute vom Kirchenchor wohl verrückt geworden waren und nicht aufgehört hätten, Halleluja zu singen.
Vor Weihnachten hatte der Lehrer etliche Grittibänzen, bei uns heissen sie Hietze, von einer Bäckerei bekommen, aber nicht genug für alle Schüler. Ich habe einen erhalten, der Lehrer sagte, weil ich immer so schlecht aussehe. Ich war glücklich und habe den Hietz nicht gegessen, sondern der Mutter gezeigt und ihr ganz stolz erklärt, dass ich ihn, weil ich immer so schlecht aussehe, bekommen habe. Sie habe sich umgedreht, damit ich ihre Tränen nicht sehen sollte, hat sie mir Jahre später erzählt.
Wir hatten zu Hause damals Kaninchen, nicht etwa als Streicheltiere, sondern als Fleischlieferanten, sowie Hühner und eine Gans. Mein Bruder und ich, wir hätten sehr gerne einen Hund gehabt, aber es gab eine Erklärung vom Vater: Ein Hund braucht Futter, aber die Gans bewacht das Haus genauso gut und legt alle zwei Tage ein Ei. Das braucht die Mutter, um das Essen zu verbessern oder einen leckeren Kuchen zu backen, das sei wichtiger.
Nach dem Kriegsende haben wir Kinder beim Spielen im Wald, in verlassenen Wehrmachtsbefestigungen, noch verschlossene Dosen von der Armeeverpflegung gefunden. Diese haben wir mit Stolz nach Hause gebracht, denn oft waren das Nahrungsmittel, die man in dieser Zeit nicht mehr kaufen konnte.
Ab und zu fanden wir aber auch Munition, Zündschnüre und Karbid. Diese "wertvollen" Sachen konnten wir nicht nach Hause bringen, sonst hätte es mit den Eltern natürlich Ärger gegeben. Wir mussten sie in unseren sicheren Verstecken aufheben. Aber für uns war es damals sehr spannend, wenn wir damit eine "Sprengung" inszenieren konnten. Die Gefahren wurden uns erst bewusst, als ein Junge seine Hand und den Unterarm verloren hatte und ein anderer sein Augenlicht. Nun hatten wir den Ärger mit den Eltern doch, und sie mit uns. Das war eine Lehre für unser Leben und die Munition definitiv kein Spielzeug mehr für uns
Nach dem Krieg gab es Lebensmittelmarken, je nach Grösse und Anzahl der Familienmitglieder. Diese Märkli konnten für Grundnahrungsmittel in den Geschäften eingelöst werden. Wer Selbstversorger war, also Hühner, Kaninchen und so weiter hatte, erhielt entsprechend weniger Märkli. Wurde ein Tier geschlachtet, dann konnte man mit dem Kopf oder der Pfote bei dem Wirtschaftsamt ein Tier abmelden. Den Kopf konnte man aber behalten und so wurden mit einem Kopf auch von den Nachbarn oder Verwandten noch einige Tiere abgemeldet.
In der Zeit nach dem Krieg bis zu Währungsreform 1948 hatte nicht Geld einen Wert, sondern es blühte ein reger Tauschhandel. Schwarzmarkt, so hiess das, dort waren Wein, Zigaretten, Tee und Kaffee oder edle Gebrauchsartikel zum Tauschen nötig. Es war verboten, und wenn eine Kontrolle der Besatzungsvertreter auftauchte, rafften alle ihre Sachen zusammen und rannten davon. Unser Vater war in dieser Zeit in der Fabrik auch für die Bewachung und Betreuung von Kriegsgefangenen aus verschiedenen Ländern zuständig. Kriegsgefangenen standen bestimmte Rationen von Zigaretten, Tabak, Tee oder Kaffee, Schokolade und Körperpflegemittel zu. Alles sehr wertvolle und gefragte Sachen, die auf dem Schwarzmarkt und bei den Bauern gegen Fleisch, Butter, Kartoffeln oder Weizen eingetauscht werden konnten. Die Mutter hat für die Kriegsgefangenen aus Stoffresten kleine Gebetsteppiche genäht, sie war ja Schneiderin. Dafür bekam der Vater dann Zigaretten, Schokolade oder Kaffee. So hatte er gute Zahlungsmittel für den Schwarzmarkt.
Zu Verwandten in der Eifel, in Niederzissen auf dem Bausenberg, sie wohnten in einem Vulkankrater sehr abgelegen, fuhr der Vater mit einem alten Velo und ohne Gangschaltung mit nur einem Arm jede Woche einmal. Er hat dort geholfen, was und wo er konnte. Die Mutter hat für die Verwandten die Kleider geflickt und als Dank erhielt er Lebensmittel, manchmal sogar einen feinen Kuchen.
Wenn der Vater von einer «Hamstertour» nach Hause kam, wurde ich unter einem Vorwand nach draussen geschickt, damit ich nicht sehen konnte, was er mitgebracht hatte. Einige Male vorher habe ich, natürlich ganz stolz, den Nachbarn erzählt, was der Vater so alles bekommen hat und wie gut es uns geht. Alle in der Nachbarschaft kämpften damals ums Überleben. Die Versorgung der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz war durch die französische Besatzung überhaupt nicht gewährleistet. In der amerikanisch besetzen Zone in Nordrhein-Westfalen sei die Versorgung um einiges besser gewesen.
Die Grossmutter in Oberwinter hatte zu dieser Zeit einige Schafe. Deren Wolle wurde gesponnen, zum Teil auch gefärbt und zu Mützen, Handschuhen, Pullover und Schals verstrickt. So kamen wir warm und gesund durch den Winter. Im Frühling, wenn es kleine Lämmchen gab, hatte sie gute Tauschobjekte.
Die Grossmutter hatte sehr viele Obstbäume. Die ganze Verwandtschaft hat mitgeholfen bei der Ernte. Auf einer etwas abgelegenen Wiese standen viele Apfelbäume. Bei der Ernte musste jeder Apfel einzeln abgepflückt und sorgfältig behandelt werden. Die Äpfel waren Nahrung für den Winter und wurden im Keller gelagert. Die Tanten Änne und Maria waren da sehr genau. Oft hat unser Onkel Joseph mitgeholfen bei der Ernte. Bei ihm sollte/musste alles sehr schnell gehen, Qualität hin oder her. Zur Mittagszeit gingen die Tanten nach Hause um selber zu essen, und für uns brachten sie eine gute Suppe, die die Oma für alle gekocht hatte. In der Zeit als die Tanten weg waren, hatte der Onkel das Kommando auf der Obstwiese, und das hiess: Schütteln statt pflücken. Die Äpfel, die das Schütteln sichtbar angeschlagen überstanden hatten, kamen zum Fallobst. Aus ihnen wurde Apfelsaft. Alle scheinbar «weich» gefallenen Äpfel galten als gepflückt. Regelmässig wunderten sich unsere Tanten, wie fleissig wir in ihrer Abwesenheit gepflückt hatten. Am Abend fuhren wir mit so viel, als wir tragen konnten, mit dem Zug, es gab damals einen Extrawagen für «Reisende mit Traglasten», von Oberwinter nach Sinzig. Unsere Mutter hat das kostbare Obst zum Teil gleich verarbeitet, gelagert oder gedörrt. In unserem Abstellraum hingen immer Leinensäckchen mit gedörrtem Obst. Da durften wir Kinder uns selbständig bedienen, wenn wir Hunger hatten.
Es war eine Familie aus Oberwinter, die in Sinzig einen Obst- und Gemüsegarten hatte. Sie mussten alles in die umgekehrte Richtung transportieren. Tauschen, das war ohnehin in dieser Zeit das grosse Thema, also wieso nicht auch den Garten. Nach sehr vielen Gesprächen erhielt die Mutter als Erbvorbezug einen Obstgarten in Oberwinter, den sie mit dem Obstgarten in Sinzig der anderen Familie tauschen konnte. So hatten wir also ein gutes Stück Land mitten in der Stadt Sinzig. Ein paar Jahre später war auch daraus ein Obstgarten geworden und mein Bruder und ich mussten mithelfen das Obst in Körben zu ernten. Die grossen Körbe wurden auf ein Handwägelchen gestellt, darüber eine Leiter gelegt und die kleineren Körbe in Reih und Glied auf die Leiter gestellt. Das ganze musste noch mit einem Seil fixiert werden, denn die Wege waren zum Teil uneben und holperig. Mein Bruder an der Deichsel gab das Tempo vor und auf je einer Seite des Wagens liefen mein Vater und ich. Wir mussten manchmal Gegensteuer geben, damit die kostbare Fracht nicht umkippen konnte und wir mussten natürlich auch stossen. Mich erinnerte dieses Fuhrwerk an Zigeuner und so sang ich einmal aus voller Kehle mein Lieblingslied "Lustig ist das Zigeunerleben" von dem ich einige Strophen kannte, während wir durch die Strassen von Sinzig nach Hause zogen. Erst viele Jahre später gestand mir mein Bruder, dass er, der eher scheu und zurückhaltend war, sich dermassen geschämt habe, dass er mich am liebsten umgebracht hätte.
Wir wohnten ja immer noch im Behelfsheim, sehr beengt, und so entstand schnell der Wunsch und Plan, auf dem Land dieses Obstgartens ein Haus zu bauen. Ein Flachbau sollte es werden und wenn es nötig würde, sollte später noch ein Stockwerk darauf gebaut werden. Ein Architekt machte den Bauplan, der in der Stadt Sinzig und in Ahrweiler bei der Kreisbehörde eingereicht werden musste. Von der Kreisbehörde kam er bald und genehmigt, aber von der Stadt Sinzig mit Veränderungswünschen und nicht genehmigt zurück. Das passierte so einige Male, was die Eltern sehr gestresst hat. Der Vater hat mit einem der Stadträte gesprochen und den Grund der Ablehnung erfahren. Neben dem Garten war ein kleines Alters- und Entbindungsheim, das der Stadt gehörte. Die Stadt plante eine Erweiterung in die Richtung unseres Gartens. Deshalb mussten die Eltern ihre Baupläne streichen. Die Stadt wollte unser Land gegen ein anderes umtauschen. Da stimmte aber für die Eltern keines und sie haben der Stadt das Land verkauft. Inzwischen war ja 1948 die Währungsreform, Geld hatte wieder einen Wert und für das Grundstück gab es fünf tausend D-Mark. In jener Zeit war das ein grosses Vermögen in einem vom Krieg in jeder Beziehung ausgebluteten Land.
Nie zuvor hatte ich die Eltern so unruhig und die Weltlage beobachtend erlebt. Sie besassen fünftausend D-Mark auf der Bank und hatten schon zweimal eine Währungsreform in ihrem Land erlebt. Vom Ersparten blieben jedesmal zehn Prozent übrig. So wollten sie also so schnell als möglich für das Geld einen Gegenwert, dem keine Geldentwertung etwas anhaben konnte. Sie kauften um 1950 ein altes Bauernhaus in Sinzig. Der Bauer, dem das Haus gehörte, war in den letzten Tagen des Krieges von einer Bombe getroffen worden. Von seinem Ross, dem Wagen und ihm hatte man überhaupt nichts mehr finden können. Die Erben habe das Anwesen aufgeteilt und bei einer Versteigerung erhielten die Meistbietenden den Zuschlag. In dieser Zeit gab es wohl nur wenige Menschen, die bei einer Versteigerung mitbieten konnten. Die Eltern erhielten den Zuschlag für das Haus für siebentausend siebenhundert D-Mark.
An und in diesem Haus war in den letzten fünfzehn Jahren bestimmt nichts erneuert worden, aber es war bewohnbar, sehr schlicht und einfach. Im Hof lag noch der Misthaufen, es gab ehemalige Ställe für Kühe, Pferde, Schweine, Ziegen und Hühner. Das WC, ein Plumpsklo, war hinter dem Misthaufen. Am Abend oder in der Nacht begegneten einem bei einem Besuch dort Mäuse und Ratten. Ein WC im Haus, war die erste Arbeit, die gemacht wurde. Mit sehr viel Eigenarbeit wurde Zimmer um Zimmer renoviert und das Dach musste neu gedeckt werden. Endlich hatten wir Platz und waren glücklich. Die Eltern hatten Geld zum Umbauen zurückgehalten und eine Hypothek aufgenommen. Die Hypothekarzinsen betrugen damals dreizehn Prozent. Monat für Monat hat der Vater Geld auf die Bank gebracht und uns Buben immer das Bankbüchlein gezeigt. Wenn er im Monat Januar und Februar einzahlte, wurde die Schuld nicht kleiner, es waren dann nur die Zinsen bezahlt. Erst ab März wurden die Schulden weniger. Keine Schule hätte das anschaulicher vermitteln können, was es bedeutet, Schulden zu haben und Zinsen zahlen zu müssen. Wir vier waren bestrebt, dass die Schuld so schnell als möglich abbezahlt war und wir kein Geld mehr für die Zinsen bezahlen müssten.
Acht Jahre Volksschule, so war das Schulsystem damals aufgebaut, hatte ich mit vierzehn Jahren erreicht. Damals war es auch normal, dass man mit vierzehn Jahren eine Lehre begann. Ich hatte keine richtige Vorstellung, was ich lernen könnte oder sollte. Der Vater hat für mich eine Lehrstelle in der Keramikfabrik gefunden in ihrer betriebseigenen Schlosserei. «Handwerk hat goldenen Boden», das war ein Grundgedanke nach dem Krieg, wo sich noch alles um den Wiederaufbau des Landes gedreht hat. Ich war nicht sehr erfreut über den Entscheid des Vaters und die Arbeit war sehr anstrengend und schwer für mich. Der Vorteil, eine Lehrstelle in einem industriellen Betrieb zu haben, war, dass es geregelte Arbeitszeiten gab. An jedem zweiten Samstag hatte ich frei, an dem andern Samstag war die Arbeitszeit bis zwölf Uhr. Einmal in der Woche fuhr ich nach Ahrweiler in die Berufsschule und nach drei Lehrjahren absolvierte ich die Gesellenprüfung bei der Industrie- und Handelskammer in Koblenz und habe sie mit Erfolg bestanden. Nun war ich Betriebsschlosser-Geselle. Ich blieb dem Betrieb noch weitere drei Jahre treu.

In meinem Heimatort gab es für die Freizeitgestaltung hauptsächlich kirchliche Vereine oder Gruppen. Ich hatte mich als vierzehn Jähriger den Pfadfindern angeschlossen und wurde auch Messdiener. Alles, was mit Kirche, Klöster, Hilfe für sozial Benachteiligte zu tun hatte, interessierte mich sehr und am liebsten hätte ich in einem Spital gearbeitet statt in der Schlosserei. Manchmal fuhren wir mit den Pfadfindern nach Maria Laach, einer Benediktiner-Abtei in unsere Nähe. Als Pfadfinder hatten wir öfters Kontakt mit den Mönchen, feierten die Liturgie und Stundengebete mit und durften die Klausur und den Klostergarten besuchen. Ich lebte in diesen Stunden in «meiner Welt», war begeistert und wäre am liebsten dort geblieben. Durch die katholischen Jugendvereine hatten wir aber auch viel und oft Kontakt mit den Frauen- und Mädchengruppen. Ich hatte keine Annäherungsschwierigkeiten. Einige von den Freunden hatten in dieser Zeit schon eine feste Freundin. Aber immer wenn es im Umgang mit einer jungen Frau um mehr Nähe ging, gab es in mir eine Blockade, und «jemand» in mir rief «Stopp»! Im Rheinland war damals der grösste Teil der Bevölkerung katholisch. Es galt die Ansicht, wenn man nicht heiraten will/kann, dann wird man am besten Pfarrer oder man geht ins Kloster. Einige Männer und Frauen aus der Gemeinde hatten diesen Weg gewählt, waren Nonnen, Pastor oder in einem Priesterseminar. Mein grösster Wunsch war es, Mönch im Kloster Maria Laach zu werden. An einem Sonntag habe ich das Kloster besucht und mitgeteilt, dass ich gerne Mönch werden möchte. Ein Mönch hat mich einige Stunden durch das Kloster geführt, alles erklärt und am Ende des Tages gefragt, was meine Eltern sagten, dass ich diesen Lebensweg wählen möchte. Voller Überzeugung habe ich ihm erklärt, dass meine Eltern sehr gut katholisch seien, sie sich bestimmt über meinen Entschluss freuen würden. Aber sie wüssten noch nichts davon. Dann meinte der Mönch, er sei sich da gar nicht so sicher, er kenne auch andere Geschichten. Am Sonntagabend, wieder zu Hause, habe ich meiner Mutter von meinem Lebensplan und meinem Besuch im Kloster erzählt. Sie war sprachlos und meinte nur, ich sollte das dem Vater erzählen. Meinen Vater hatte ich immer als offenen, lösungsorientierten, mich fördernden Menschen erlebt. An diesem Sonntagabend lernte ich einen ganz anderen Vater kennen. Ein richtiger Tobsuchtsanfall platzte aus ihm heraus. Laut und vehement hat er mich in den Senkel gestellt und mir klar gemacht, dass ich die Sch….idee aber sofort vergessen müsse, sonst könne er für nichts garantieren. Lieber würde er mich totschlagen, so hätte er die Gewissheit, dass ich nie für den Rest des Lebens eingesperrt sei. Die Mutter, ebenfalls in grosser Aufregung, flehte ihn an: Matthias, nicht so laut, die Leute bleiben ja schon stehen auf der Strasse". Oje, für mich stürzte eine Welt zusammen. Der Vater war fest überzeugt, dass der Pfarrer oder der Vikar mich zu diesem Lebensentwurf verleitet oder überredet hätten. Das stimmte aber überhaupt nicht. Niemand hatte mich beeinflusst; es war mein Gefühl und die feste Überzeugung, dass ich berufen war, diesen Weg zu gehen. Das Thema Kloster wurde von meinen Eltern strickt nicht mehr angesprochen. Man ging zur Tagesordnung über und ich hatte nicht mehr den Mut, über meinen Wunsch und meine Überzeugung zu sprechen. Immer wieder habe ich mich gefragt, was der Vater für einen so schwerwiegenden Grund hatte, meinen Plan auf gar keinen Fall zu unterstützen und zu verbieten. Ich war weiter bei den Pfadfindern aktiv, leitete eine Gruppe, und später war ich der Stammesführer. Mein Bruder war beim Wassersport im Rhein mit Boot und Kanu aktiv und hatte auch noch keine Freundin. Unser Familienleben war eigentlich sehr schön, gemeinsam haben wir weiter das Haus erneuert, Obst geerntet und finanzielle Sorgen gab es auch keine mehr.

Im Deutschen Bundestag hatte man am Ende Fünfzigerjahre die Ansicht, dass Deutschland wieder aufrüsten müsse und führte die Wehrpflicht ein. Ab Jahrgang 1937 sollte, musste man Wehrdienst leisten. So wurde auch ich Soldat, musste einrücken. Ich glaube, die Eltern waren nicht so überzeugt oder begeistert von diesem "Aufrüsten" und das es gut ist, wieder Soldaten auszubilden. Aber sie haben wohl gedacht, dass es für mich in dieser Situation sehr gut sein könnte und ich bei der Militärausbildung die Idee mit dem Kloster vergessen werde.
Sie hatten sich getäuscht. Auch wenn das Klosterthema nie mehr angesprochen worden war, meine Einstellung und Überzeugung hatte sich nicht verändert. Ich habe mich dann für eine Gemeinschaft entschlossen, die ein reiner Brüderorden war. Dieser Orden hatte auch Spitäler, kümmerte sich um alte Menschen und geistig Behinderte. Dort habe ich, wenn ich beim Militär frei hatte, öfters einen Besuch gemacht und mich angemeldet und alles geklärt für den Eintritt nach der Militärszeit. Ich wollte nach der Dienstzeit nicht zu Hause starten, hatte wohl Angst, dass mir die Eltern dann wieder Steine in den Weg legen würden. Ich habe ihnen, ehe der Militärdienst zu Ende ging, meine Pläne eröffnet. Für sie war das nun wohl auch eine andere Situation. Sie waren nicht begeistert aber haben es akzeptiert.

Der Tag begann um fünf Uhr früh, und endete am Abend um halb neun mit striktem Silenzium (Schweigen). Die Zeit dazwischen war ausgefüllt mit Gebet, Gottesdienst, Arbeit und Schule. Die Mahlzeiten, es war gerade Fastenzeit, wurden schweigend eingenommen. Sie waren einfach, aber ausreichend. An Festtagen war es erlaubt, nach einer kurzen Lesung, bei den Mahlzeiten zu sprechen. Die Stundengebete wurden auf Latein rezitiert, das musste erst gelernt werden.

Nach sechs Monaten erhielt ich das Ordensgewand und wurde Novize. Das Ordensgewand, Habit genannt, also eine bis zu den Füssen reichende Kutte, in den Hüften zusammen gehalten mit einem weissen Strick, dem Zingulum, ohne Knoten. Auf der rechten Seite wurde ein sehr grosser Rosenkranz angehängt, der natürlich jeden Tag in Gemeinschaft kniend gebetet wurde.
Diese feierliche Einkleidung geschah in der Klosterkirche. Ich, nur mit Hose und und Hemd ohne Kragen bekleidet, so wie der Heilige Franziskus, der Namens- und Regelgeber der Gemeinschaft, seine kostbaren Kleider seinem Vater zurückgegeben hatte und fortan nur mit der Kutte bekleidet, nach diesem Vorbild sollte nun auch mein weiteres Leben verlaufen.
Mit dem Ordensgewand erhielt ich auch meinen Ordensnamen, der von den "Oberen" für mich bestimmt worden war. Mein "weltlicher" Name Hans Gerd galt ab sofort nicht mehr. Von nun an hiess ich Bruder Cherubin.
Bei dieser Zeremonie waren auch meine Eltern, mein Bruder, Verwandte und Bekannte anwesend. Es flossen bestimmt auch einige Tränen, denn nun wurde aus meiner Entscheidung sichtbare und vollzogene Realität. Familie, das war von nun an die Gemeinschaft der Mitbrüder. Um das allen Bezugspersonen zu vermitteln, was es für ein Jahr verboten, Besuche von Eltern, Verwandten und Freunden zu empfangen.
Der Novizenstatus galt für die nächsten zwei Jahre.
Im Noviziat waren wir eine Gruppe von mehr als zwanzig meist jungen Männern. Der Novizenmeister war der Chef, verantwortlich, dass alle Regeln befolgt und eingehalten wurden. Selten alleine, niemals zu zweit, immer zu dritt, das war für mich eine ganz neue Weisung, die sehr oft zitiert wurde. Mit dem Habit, der bis zu den Füssen reichte, musste ich mich erst einmal arrangieren. Schreiten, langsam, mit in den Ärmeln versteckten Händen, so sollte es sein. Auf einer Treppe zwei Stufen auf einmal nehmen, das war verboten. "Alle Hast kommt vom Teufel", das habe ich oft gehört. Manchmal, wenn ich einigermassen sicher war, dass sich niemand in der Nähe befand, es ohnehin meist eilig hatte, habe ich den Habit bis zu den Knien hoch gehoben und so konnte ich ohne zu stolpern 2 Stufen auf einmal nehmen.
Für den gemeinsamen Einzug des ganzen Konvents in die Kirche kamen alle Brüder vorher, die Glocken "riefen" und erinnerten uns, in der Statio (Vorraum der Kirche) zusammen und stellten uns auf, immer zwei nebeneinander nach Ordensalter, also wir Novizen ganz vorne, es folgten die zeitlichen Professbrüder, dann die mit dem ewigen Gelübde und am Schluss der Ordensobere.
Beim Einzug in die Kirche tauchte der, der rechts in der Reihe war, seine Finger in das Weihwasserbecken, welches an der rechten Wand angebracht war, und reichte seinem Nachbarn links das geweihte Wasser auf seine Fingerspitzen, so dass dieser nicht vor dem andern durchgreifen und sich verrenken musste, um an das Wasser zu gelangen. Danach bekreuzigten wir uns.
Berührungen waren ja sonst nicht erlaubt und so war meine Sensibilität wohl stärker ausgeprägt. Je nachdem, welcher Bruder neben mir ging, und von dem ich das Weihwasser bekam oder es ihm gab, erregte mich das sexuell ziemlich heftig, ausgerechnet beim Einzug in die Kirche! Und die Erregung blieb dann eine Weile.
Das durfte doch nicht sein, und ich fragte mich, weshalb es bei einem, der mir irgendwie besonders gefiel und den ich mochte, so geschah, und bei andern passierte nichts. War da vielleicht der Teufel im Spiel?
Ich war 23 Jahre alt, hatte meine sexuelle Orientierung noch nicht gefunden, sie war noch verborgen und musste unterdrückt werden, sonst wäre es ja Sünde gegen das sechste Gebot gewesen.
Selbstbefriedigung, das durfte ja auch nicht praktiziert werden, und wenn es trotzdem passierte, war es Sünde und musste bei der wöchentlichen Beichte bekannt, also ausgesprochen, bereut und um Vergebung gebeten werden. Ich konnte mich diesbezüglich lange enthalten und meine Vorhaut am Penis verengte sich. Wenn ich sie doch für die Reinigung zurückziehen musste, riss die feine Haut auf und es blutete. Das hat mich stark beunruhigt und sagte es dem Novizenmeister, was mir sehr schwer fiel. Er hat einen Termin beim Urologen abgemacht und ein Mitbruder brachte mich mit dem Auto in seine Praxis. Der Urologe schaute sich das Problem an, der Mitbruder war bei der Untersuchung angeblich zu meinem Schutz anwesend, und der Urologe stellte die Diagnose: Phimose. Die Lösung: Operation.
Ein Termin wurde im von Ordensschwestern geleiteten Spital festgelegt. Damals, 1963, machte man für diesen kleinen Eingriff eine Vollnarkose, ich bliebe für eine Woche stationär in der Stadt im Spital. Nur ein bewährter Krankenpfleger durfte den Verbandwechsel ausführen und die Eiswickel bringen. Die Ordensschwestern haben mich besucht und geschaut, dass alles seine Richtigkeit hatte und haben mich mit frommer Lektüre versorgt.
Im Winter besuchte eine, mir von der katholischen Jugend her gut bekannte junge Frau, sie war Arztgehilfin, einen Kurs für Praxis-Labor in dem Dorf, wo unser Kloster war. Sie kam zum Gottesdienst in unsere Klosterkirche. Einmal hatte ich sie entdeckt, bin nach der Messe hinaus auf den Vorplatz der Kirche gelaufen und haben mit ihr gesprochen. Sie wohnte ja in der gleichen Strasse, wie meine Eltern. Also ergab sich eine willkommene, wenn auch verbotene Gelegenheit, Grüsse an meine Eltern, die mich nicht besuchen durften, ausrichten zu lassen. So trafen wir uns sehr oft nach der Messe und sie brachte mir manchmal eine kleines Geschenk von den Eltern und ich konnte durch sie Briefe mitgeben, die ich ja sonst nur offen, vom Novizenmeister gelesen, hätte versenden können. Sie wurde zur Nachrichten-Überbringerin, was sie sehr gerne gemacht hat.
Durch diese "Aktionen" lernte mein Bruder sie besser kennen, nach einiger Zeit gab es eine Verlobung und später haben sie geheiratet und sind es auch heute noch.

Nach zweieinhalb Jahren habe ich die ersten, zeitlich auf drei Jahre beschränkten Gelübde, abgelegt: Armut, Keuschheit und Gehorsam. Als Symbol für dieses Versprechen wurden in das Zingulum drei Knoten gemacht, die mich ständig daran erinnern sollten. Zusätzlich zum Habit kam noch das Skapulier, ein etwa 60 Zentimeter breiter Überwurf, der vorn und hinten den Körper bedeckte. Die Hände hatten nun ihren Platz unter dem Skapulier. Sitzen sollte man nicht darauf, es sollte immer schön und glatt aussehen.
Die Schulung in Latein, Theologie, Exegese, Kirchen- und Ordensgeschichte ging weiter. Natürlich immer unterbrochen vom Arbeiten, denn wir waren ja Selbstversorger. Das Kloster betrieb eine grosse Landwirtschaft, Schreiner-. Schlosser- und Elektriker-Werkstätten, eine Bäckerei, Metzgerei, Schneiderei und Wäscherei. Je nach Bedarf mussten wir jungen Brüder überall aushelfen. Auch bei der Ernte wurden wir eingesetzt. Wir waren bei solchen Einsätzen meistens eine sehr fröhliche und lustige Gemeinschaft.
Sonst änderte sich nicht viel in meinem Leben, der Kampf mit den Versuchungen blieb.
Am nahe gelegenen Fluss hatten die Brüder vor langer Zeit einen Kanal gegraben und eine Turbine gebaut, die das Kloster mit Strom versorgte. Dieser Kanal war, wie die ganze Stromanlage, eingezäunt und konnte nur von den Brüdern betreten werden. Der Kanal wurde im Sommer als Schwimmbad benützt. Wenn sich wenigstens drei Mitbrüder frei machen konnten, durften diese zusammen baden gehen.
Einmal, wir waren zu dritt in diesem "Schwimmbad", ist einem Mitbruder eingefallen, dass er einen wichtigen Termin vergessen hatte. Also musste er gehen und ein Bruder und ich blieben, denn es war ein sonniger Nachmittag. So lagen wir nebeneinander auf der Wiese, die Sonnte heizte unsere sonst verhüllten Körper gewaltig auf und langsam verbeulten sich unsere üppig geschnittenen Badehosen. Aus Angst, jemand könnte uns sehen, zogen wir uns ins Turbinenhaus zurück und nach wenigen Minuten waren die störenden Badehosen am Boden. Es brauchte nur wenig, und wir beide hatten einen wohltuenden Erguss. Schön, erlösend, aber gleichzeitig auch schlimm. Es konnte ja nicht unser persönliches Geheimnis bleiben, wir mussten es beichten. Noch heute, wenn es in unserem Lift nach Oel riecht, bin ich in Gedanken in dem Turbinenraum, wo es recht stark nach Schmieroel roch. Der Geruch bleibt wohl für immer in meinem Kopf.
Nach fünf Jahren im Mutterhaus wurde ich in eine "Filiale" versetzt, die auch die Trägerschaft für das ordenseigene Spital hatte. Es war eine kleine Kommunität, alles viel lockerer und persönlicher als im Mutterhaus. Angeschlossen an dieses Spital war eine Krankenpflegeschule und dort durfte ich den Beruf der Krankenpflege erlernen. Ein sehr lange gehegter Wunsch ging für mich in Erfüllung. Die Pflege im Spital und auch die Krankenpflegeschule wurde von Ordensschwestern geleitet.
Der kleine Brüderkonvent war wie eine Familie, die Jüngsten etwa 25, die Ältesten über 80. So hatte ich Kloster noch gar nicht erlebt.
Dem Orden gehörte das Spital, einige Brüder arbeiteten in der Verwaltung. Der juristisch oberste Leiter war ein Mitbruder, Bruder Johannes Bosco. Er war mir schon aufgefallen, als ich noch vom Militär aus hin und wieder zu einem Besuch ins Mutterhaus gekommen bin. Er war irgendwie besonders, obwohl doch alle die gleiche Kutte trugen, in sich gekehrt durch die langen Flure wandelten oder in der Kirche zu sehen waren. Aber mit ihm verband mich etwas, obwohl er mich, wie alle andern, auch nur freundlich, aber zurückhaltend begrüsst hatte. Nun war ich also im gleichen kleinen Konvent mit ihm zusammen. Das machte mein Leben als Schüler irgendwie schöner und leichter. Unsere Zellen waren Wand an Wand. So ein Zufall, aber im Kloster war das je eher der Wille Gottes, denn er bestimmte unser Leben. An einem Sonntagmorgen nach dem Gottesdienst war freie Zeit bis zum Mittagsgebet. Ich war in meiner Zelle und mein Nachbar klopfte an meine Türe. Besuche in der Zelle waren verboten, ihn habe ich aber gerne eintreten lassen. Bei einem früheren Fest hatte er meine Eltern kennen gelernt. Wir haben uns über meine Herkunft unterhalten und zur besseren Erläuterung habe ich ein Fotoalbum hervorgeholt. Um das anschauen zu können mussten wir uns neben einander auf das Bett setzten, denn ich hatte ja nur einen Stuhl. Beim erzählen, erklären, kamen wir uns körperlich näher und näher, haben alle Regeln und Gelübde vergessen. All unsere Gefühle, Zuneigung und heimlichen Wünsche nach normaler menschlicher Nähe, welche jahrelang unterdrückt wurden, werden mussten, ist an diesem Sonntagvormittag aus uns herausgestossen. Erst die Glocke, welche das Mittagsgebet ankündigte, rief uns in die Wirklichkeit zurück.
Was um Himmels Willen war da mit uns geschehen? Es war am 16. Juli 1967, der Sonntag, an dem unsere Partnerschaft begann und die bis am 15. Juni 2002, dem Todestag des Johannes Bosco, bestanden hat.
So gut es ging haben wir still und leise, so diskret wie nur möglich fünf Jahre lang unsere Liebesbeziehung im Kloster gelebt. In ständiger Angst und mit schrecklich schlechtem Gewissen. Dass es einem Mitbruder auffallen und er es dem Generaloberer melden könnte, und wir dann sofort unser Zuhause, das Kloster, mit Schande verlassen müssten, das hat wie ein Damoklesschwert unser Leben belastet. Zu dem war es ja auch eine Sünde, die man hätte beichten sollen. Weil wir es selber aber nicht als Sünde empfanden, haben wir es nicht gebeichtet.
Mit dieser Angst und dem schlechten Gewissen wollten wir nicht länger leben. Nach einem längeren Prozess der Auseinandersetzung mit der Frage, wie es weitergehen sollte. entschlossen wir uns, das Kloster zu verlassen.

Es war uns klar, dass wir den Austritt aus dem Kloster planen mussten. Inzwischen hatte ich ja, wie mein Mitbruder Johannes Bosco, mit weltlichem Namen hiess er Günter Dutz, auch das Staatsexamen in der Krankenpflege gemacht. Wir kannten eine Krankenschwester in der Schweiz, die eine leitende Stelle im Unispital hatte. Mit ihr haben wir diskret und geheim Kontakt aufgenommen und sie in unsere Pläne vom Austritt eingeweiht. Sie konnte mit der Pflegedienstleitung des Kantonsspitals eine Anstellung vereinbaren. Alles musste auf Treu und Glauben basieren, weil wir unsere Zeugnisse und Diplome, die im Archiv der Klosterleitung aufgehoben waren, nicht kopieren und als Bewerbung abschicken konnten. So erhielten wir einen provisorischen Anstellungsvertrag ab dem 1. April 1974. Beim Austritt aus dem Kloster erhielten wir natürlich unsere Unterlagen ausgehändigt und konnten sie dem Spital mit unserer Bewerbung übermitteln.
Ich hatte meinen Austritt auf Ende Februar 1974 vorgesehen und Günter sollte noch zwei Wochen länger im Kloster ausharren, damit es nicht nach einer gemeinsamen Sache aussehen sollte. Ende März sind wir dann in die Schweiz eingereist, mussten in Basel die Untersuchung der Grenzsanität über uns ergehen lassen. Das war kurz vor Mittag, die Beamten machten Pause und so mussten wir zwei Stunden auf das Resultat warten. Man wünschte uns «einen Guten», aber wir hatten vor lauter Angst, es könnte sich ein Befund herausstellen, keinen Appetit. Es gab aber glücklicherweise keinen Befund und wir konnten die Weiterreise nach Zürich antreten und unsere zwei Koffer, die wir aufgegeben hatten, in Empfang nehmen.

Der grosse Unterschied aber, wir waren freie Menschen, auch wenn wir noch einige Zeit auf die Dispensierung von unseren Gelübden, das musste in Rom entschieden werden, warten mussten.

Die Lehrzeit für das wirkliche Leben konnte beginnen. Wir waren bereits 35 und 37 Jahre alt! Plötzlich mussten wir selber dafür sorgen, dass der Tisch gedeckt und etwas auf dem Teller lag, die Rechnungen bezahlt und die Wäsche gewaschen wurde. Wenn ich in einem Laden etwas eingekauft hatte, erschrak ich jedes Mal, dass man mir für den kleinen Einkauf so viel Geld abverlangte. Anfänglich hatte ich stets das Gefühl, die Kassiererin spüre, dass ich unerfahren war im Umgang mit Geld und sie mir jeden Preis verlangen könne. Zu Hause habe für lange Zeit die Ware auf den Tisch gestellt, den Kassenbon daneben gelegt, kontrolliert und nachgerechnet. Es hatte immer ganz genau gestimmt! Ich musste lernen, mit dem Geld umzugehen, da hatte ich in meinem bisherigen Leben keine Erfahrung sammeln können, oder hatte es während der Zeit im Kloster einfach vergessen. Die Kleider, die wir aus dem Kloster mitgebracht hatten, waren natürlich alle schwarz. Damit wollten wir nun nicht mehr herum laufen. Es sollte ja auch nicht jeder wissen, dass wir aus dem Kloster kamen. Ich erinnere mich noch sehr gut an die erste Hose, die ich gekauft habe. Sie war ziemlich gross kariert, farblich recht bunt und unten an den Beinen sehr breit geschnitten. Nachdem ich sie ein paarmal getragen hatte, beulten meine Knie sie auch nach vorne stark auseinander. Zu einem Clown hätte sie bestimmt gut gepasst, aber nicht zu mir.
Das erste Jahr war voll gepackt mit lernen, im Spital, wie auch privat. Ausloten, wie es geht und feststellen, dass es viele unbekannte Themen gibt, die im Kloster ausgeblendet waren. «Die böse Welt da draussen!», das meinte alles, was ausserhalb des Klosters war. In dieser Welt mussten wir nun leben und irgendwie den Weg finden. Zum Glück waren wir zu zweit und nach etwa vier Monaten kam noch ein dritter ehemaliger Klosterbruder zu uns, der auch ausgetreten war. Weil er ausgebildeter Heilerzieher war, konnten wir im Mathilde-Escher-Heim in Zürich ohne Problem eine Anstellung für ihn finden und er konnte sogar in dem Heim wohnen. So waren wir wieder eine kleine Gemeinschaft, ohne Kloster, freie Menschen.

Nach gut einem Jahr haben Günter und ich zu ersten Mal in unserem Leben eine Wohnung gemietet. Leider mit mässigem Erfolg und finanziell für unsere Verhältnisse grossen Einbussen. Nach nur zwei Wochen am neuen Ort haben wir gemerkt, dass wir es dort nicht lange aushalten würden. Die Frau vom Hauswart, er selber hat wenig bis gar nichts im Mehrfamilienhaus gemacht, hatte noch einen Nebenberuf, den sie nachts auf der Strasse ausübte, das ging nicht für uns. Zwei Jahre haben wir gesucht, bis wir eine sehr schöne Wohnung mit grossem Balkon im Seefeld gefunden haben. Nun wurde es für uns in Zürich so richtig schön. Wir hatten langsam Fuss gefasst und einen kleinen Bekanntenkreis aufgebaut. Oft hatten wir Besucher aus Deutschland, denen es, ohne ein Hotel in Zürich bezahlen zu müssen, für zwei bis sechs Wochen in der Schweiz sehr gut gefallen hat. Der Weg von der Wohnung zum See und ins Stadtzentrum war kurz. Mit voller Verpflegung im Haus liess es sich für die Besucher, in der "teuren Schweiz", gut Ferien machen. Wir waren stolz, dass wir das so anbieten konnten.
Im Spital hatten wir uns gut etabliert. Ich hatte nach zwei Jahren in der Dermatologie die Stationsleitung übernommen, und so waren wir finanziell gut aufgestellt. Günter arbeitete auf der Notfallstation im 24-Stunden-Schichtbetrieb, früh, spät oder nachts. So war fast immer jemand von uns zu Hause und konnte sich um die Gäste kümmern und kochen.
Im Spital haben wir es oft erlebt, dass uns Patienten erzählten, sie hätten viele Jahre hart gearbeitet um nach der Pensionierung schöne Urlaubsreisen machen zu können. Aber es nun, wegen ihren gesundheitlichen Problemen, nicht mehr möglich war. Wir machten das genau umgekehrt, denn in jedem Jahr suchten wir uns ein schönes Ziel aus und bereisten verschiedene Länder und Kontinente mit Bus, Zug oder Flugzeug, versuchten, das jeweilige Land und deren Bewohner «kennen» zu lernen. Geografie, das ist mir in der Schule immer sehr abstrakt vorgekommen und blieb nicht in meinem Kopf. Nachdem ich selber aber fremde Landschaften gesehen und erlebt hatte, blieb mir das viel leichter im Gedächtnis.

Einmal, als die Tanten bei uns ankamen, strich Tante Änne mit dem Finger über den oberen Türrahmen und rief dann laut ihrer Schwester zu: " Hier ist es genau so sauber wie bei uns!"
Der Papagei war meist nur in der Nacht in seinem Käfig. Am morgen durfte er raus und konnte sich an seinen Lieblingsplätzen aufhalten. Die Tanten haben sich immer sehr mit ihm beschäftigt, er begrüsste sie mehrmals, rief "Guten Morgen" und nannte laut und deutlich ihre Namen. Am Abend, wenn der Jacko langsam seine Ruhe haben wollte, rief er bestimmt zehn Mal oder mehr "Gute Nacht" und die Tanten haben dann mit sehr schlechtem Gewissen noch ihren Film im Fernsehen zu Ende geschaut, und deckten danach in aller Eile den Käfig mit einem Tuch ab,
Einmal hatte sich der Papagei hinter einem Vorhang versteckt. Als die Tanten, die ja auch viel mit Putzen und Haushalten beschäftigt waren, ihn vermissten, ging die Sucherei los. Alles Suchen und Rufen nützte nichts, der Vogel gab keine Antwort. Die armen Tanten verzweifelten fast, der Jacko war verschwunden.
Sie haben gesucht, gebetet, sich gegenseitig die Schuld am Verschwinden gegeben, denn eine musste ja beim Lüften einen Fehler gemacht haben. Das konnte, durfte nicht sein! Die sonst immer perfekten Tanten, in deren Augen nur die anderen Fehler machten oder sich nicht richtig verhielten! Eine ihrer häufigen Erklärungen, fast ihr Lebensleitsatz, war: " Jeder kann machen, wie er will. Wir machen es so, und so ist es auch richtig!"
Nach einigen endlosen Stunden spazierte Jacko aus seinem Versteck hervor, und die Tanten fielen sich um den Hals und weinten vor Glück.
Die Autofahrten mit ihnen waren fast kriminell. Maria steuerte, Änne schaute nach dem Weg. Wenn es an einer Kreuzung mehrere Wegweiser hatte, dann konnte Änne sie alle nicht so schnell lesen und einordnen. Maria hielt dann an, mitten auf der Kreuzung, Änne stieg aus und las die Beschriftungen in aller Ruhe, damit sie nicht falsch fuhren. Wenn andere Autofahrer hupten oder mit dem Finger an die Stirn tippten, meinte Änne: "Die sehen doch, dass wir hier fremd sind!"
Einmal war eine Ampel für das Empfinden der Tanten zu lange auf rot geblieben. Da verlor Änne die Geduld und sagte: "Maria, fahr los, wir haben sehr viele durchgelassen, jetzt sind wir dran!" Und Maria fuhr los, bei roter Ampel!
Später dachte ich und konnte mir gut vorstellen, dass meine Mutter wohl oft unter ihren Schwestern gelitten haben muss. Diese wussten sicher besser, wie man Kinder erzieht (sie hatten beide keine) und was die Mutter alles falsch machte mit uns. Trotzdem war der Kontakt zwischen unserer Familie und den Tanten immer sehr herzlich.

Günter wollte aber zurück zum ursprünglichen Glauben. So hat er sich bei einer jüdischen Gemeinschaft, die nicht so streng orthodox war, angemeldet und konnte bei einem Rabbiner Unterricht nehmen. Für ihn war das eine spannende, lehrreiche Zeit, er kam zum Entschluss, seine Religion zu wechseln. Wohl auch um einen Schlussstrich mit dem Klosterleben zu vollziehen. So wurden in unserem Haushalt christliche und auch jüdische Feiertage gelebt.
Ich hatte weniger Schwierigkeiten mit meinem Glauben, denn die Beziehung zu Gott war und ist in beiden Religionen genau gleich. Für mich sind die menschlichen Beziehungen entscheidend, diese müssen stimmen für mich.
Oft habe ich ihn begleitet, wenn er zu einer meist sehr interessanten Veranstaltung in die Synagoge ging. Dass wir dort als Männerpaar auftraten, daran wurde nie Anstoss genommen.
Durch die neuen Kontakte mit interessanten, im Nachhinein spannenden Lebens-/Überlebensgeschichten von liebenswürdigen Menschen, wurde auch mein Leben bereichert, mein Horizont geöffnet und erweitert.
Mit einem älteren jüdischen Ehepaar, sie wohnten ganz in unserer Nähe, haben wir uns befreundet. Sie stammten auch aus Deutschland und hatten mit sehr viel Glück den Holocaust überlebt. Sie hatten keine Kinder, aber für uns wurden sie wie "Elternersatz". Sie waren bald 80 Jahre, wir noch nicht 50 Jahre alt und daher passte das ja auch.
Die Frau, Paula, musste, um mit ihren erlebten, traumatischen Ereignissen zurecht zu kommen, seit Jahren Psychopharmaka einnehmen. Diese beeinflussten mehr und mehr ihre Blutwerte. Also brauchte sie Infusionen. Ihr Hausarzt hatte seine Praxis im gleichen Haus und auf demselben Stockwerk wie unser befreundetes Ehepaar. Er verordnete ein bis zweimal im Monat eine Bluttransfusion, die ich ihr an meinen freien Tagen verabreicht habe. Als diplomierter Krankenpfleger durfte ich das, machte es im Spital bei meinen Patienten ja auch sehr oft. Paula war sehr glücklich darüber und erholte sich allmählich. Ihre stete Müdigkeit und Kraftlosigkeit verschwanden.
Als in diesem sehr gepflegten Haus eine 5-Zimmerwohnung frei wurde, haben Herr und Frau Rothschild, wie das Ehepaar hiess, sich stark bei der Verwaltung eingesetzt, dass wir, mein Partner und ich, diese Wohnung mieten konnten.
Das hat unsere Beziehung noch intensiver gemacht. Oft kamen sie zu uns zum Nachtessen, denn Günter kochte gerne, sehr gut und reichlich.
Die Tischgespräche, sie waren inspiriert von ihrem erfahrungsreichen Leben und dem Kampf ums Überleben in der Nazi-Zeit, haben meine Einstellung gegenüber der katholischen Kirche sehr oft in Frage gestellt, denn bei den Katholiken waren seit Jahrhunderten die Juden das Feindbild schlechthin, weil sie Jesus ans Kreuz nagelten und töten liessen. Auch wenn den alten Kirchenvätern und Gelehrten klar und bekannt war, dass es in der jüdischen Tradition nie eine Kreuzigung gegeben hat. Kreuzigungen kannten nur die Römer und führten diese bei ihren Gegenspielern auch aus. An der These, dass die Juden die Kreuzigung von Jesus vollbracht hätten, wurde strikte fest gehalten, es musste ja einen triftigen Grund für diese "neue" Reiligion gegeben haben.
Die Freundschaft und die Beziehung zu diesem alten Ehepaar hat meine Leben geprägt, mich reifer und aufmerksamer gemacht. Lernen, das ist eine lebenslange Aufgabe, das wurde mir klar.
Günter engagierte sich in der jüdischen Gemeinde und konnte nach zwei Jahren konvertieren. Er nahm den Namen Eli an, der auch im Ausweis eingetragen wurde.
Wirklich zur Ruhe und Erfüllung kamen seine Seele und sein Naturell trotzdem nicht. Auch im Beruf trat er auf der Stelle, obwohl er grosse Fähigkeiten besass. Er bewarb sich nicht für eine bessere Position, sondern glaubte, seine Vorgesetzten würden seine Talente und Erfahrungen im Spitalführungsbereich ja kennen und müssten auf ihn zukommen. Das geschah nicht und er fühlte sich unterfordert. Ich hatte bereits nach zwei Jahren im Spital die Leitung einer Station übernommen, er blieb unentdeckt, obwohl er bestimmt, in seinen Augen, die besseren Fähigkeiten hatte als ich.

Phasenweise war sein Alkoholkonsum so hoch, dass es seine Vorgesetzten im Spital bemerkten. Sie veranlassten, dass der Personalarzt ihn spontan zu sich rufen, eine Blutprobe oder einen Atemtest machen sollte. Nachdem dies einige Male positiv ausgefallen war, hat der Personalarzt eine Einweisung in eine geschlossene Psychiatrie-Abteilung angeordnet. Das war ganz schlimm für ihn, aber auch für mich. Er hatte keine Wahl, er musste diese Demütigung über sich ergehen lassen. Drei lange Wochen war er in der Klinik, dort sehr angepasst und fast ein Musterpatient. Für mich waren die Besuche bei ihm sehr deprimierend, ich konnte mir nicht vorstellen, dass er in dieser traurigen Umgebung gesund oder verändert werden könnte.
Anschliessend an diesen Klinikaufenthalt wurde eine Einzeltherapie bei einem Psychiater angeordnet; bei den Therapiesitzungendurfte durfte ich oft dabei sein. Für Eli war es immer sehr wichtig, dass seine Krankheit eine Depression ist und er nicht als Alkoholiker abgestempelt wurde. Es war wohl beides und für mich eine ständige Verunsicherung. Ich hatte aber jetzt in der Person des Psychiaters einen Ansprechpartner. Wenn er wieder einmal abgestürzt war und der Absturz einige Tage anhielt, konnte ich durch ihn eine Einweisung in eine Klinik veranlassen um ihn zu schützen. Es gab oft für mehrere Monate sehr gute Phasen. Dann blühten wir beide richtig auf und haben diese Zeiten sehr genossen.

Der Druck vom Arbeitsplatz her gab es nun nicht mehr, er war befreit, aber leider nicht von der Krankheit. Regelmässig rief er mich am Vormittag an meinem Arbeitsplatz an. Für ihn war es sehr wichtig, mich zu hören. Für mich war die Arbeit in der Klinik eine sehr gute Abwechslung und meine Gedanken waren weit weg von zu Hause. Meistens erst auf dem Heimweg machte ich mir Gedanken über die Situation, die mich wohl wieder erwartete. Für Eli war es ja auch kein einfaches Leben, nur zu Hause, ohne eine rechte Aufgabe den Tag zu verbringen. Er, der sich doch stets als sehr kompetent, gebildet und mit grossem Wissen und grosser Lebenserfahrung ausgestattet eingeschätzt hat, er war jetzt nicht mehr gefragt.

So hatten wir ab Juli 2001 ganz viel freie Zeit und keine Verantwortung mehr für die Patienten und Mitarbeiter. Zum ersten Mal in unserem Leben nur noch für uns selber. Wir kauften sofort ein Generalabonnement bei der SBB, wir hatten kein Auto. Unsere Lieblingsdestination, das Tessin, besuchten wir oft und gerne. Aber auch Städte und Berge waren unsere Ziele.
Eine von uns seit vielen Jahren bevorzugte Freizeitaktivität war FKK, was sogar in Zürich auf dem "Inseli Werd" möglich war, einem kleinen Stück Land zwischen der Limmat und einem Turbinenkanal in Höngg. Meist schwule Männer trafen sich dort zum sonnenbaden und schwimmen im Kanal, der eine recht starke Strömung hatte. Irgendjemand hatte ein grosses Seil zwischen Bäumen über den Kanal gespannt. An diesem Seil konnte man sich festhalten und die Strömung des Wassers so richtig spüren. Manchmal "hingen" ganze Männertrauben an diesem Seil und alle waren zufrieden und fröhlich. Obwohl es nicht verboten war, nackt zu baden, kam es früher schon mal vor, dass plötzlich eine Alarmruf "Schmier" die Runde machte. Gute Beobachter hatten dann eine Polizeikontrolle entdeckt und alle zogen sich ganz schnell die bereit liegende Badehose an.
Eli und ich waren, so oft es möglich war, dort und machten gerne einen Spaziergang über das Inseli, auch um Ausschau zu halten, was es so alles "zu Bestaunen" gab. Aber natürlich auch, um Freunde und Bekannte zu treffen.
Augenkontakt signalisierte Interesse, das gab es manchmal auch bei uns, obwohl wir uns als Paar fühlten und es auch bleiben wollten. Einem jüngeren Mann aus Schaffhausen waren wir aufgefallen, er zeigte Interesse an mir und er wollte mich näher kennen lernen. Wie ein Detektiv hatte er unsere Namen und unsere Adresse ausfindig gemacht.
Einige Tage später war ein an mich adressierter Brief in unserem Briefkasten. Darin lud mich eben dieser Mann aus Schaffhausen ein, ihn zu besuchen. Es war ein glücklicher Zufall, dass ich den Brief vor Eli in die Hände bekam und ihn vor ihm verbergen konnte, denn er hätte diese Anmache schlecht ertragen. Sofort habe ich den Mann angerufen, dass ich ihn auch gerne kennen lernen möchte, aber das ginge nur gemeinsam mit meinem Partner. Darum möge er den Brief doch nochmals, aber an uns beide schreiben. Ich wollte Eli ja nicht hintergehen und darum kam ein heimlicher Besuch bei ihm in Schaffhausen für mich nicht in Frage.
Zwei Tage später brachte der Postbote den neuformulierten Brief zu uns. Eli war erstaunt, aber da er immer offen war für neue Bekanntschaften, luden wir Ruedi zum Essen bei uns zu Hause ein. Es entstand eine freundschaftliche Beziehung. Wir haben uns in grösseren Abständen einige Jahre immer wieder besucht und ausgetauscht. In unserem Adressbuch hatten wir seine Anschrift eingetragen und ihm von unseren Reisen immer wieder Kartengrüsse geschickt.
Es ging Eli und mir sehr gut, als Rentner konnten wir unseren Rhythmus leben und es gemütlich nehmen. Wenn immer möglich machten wir am Abend nach dem Essen einen Spaziergang am See, oder wir besuchten Aufführungen im Opernhaus, ein Konzert in der Tonhalle, besuchten Museem oder Lesungen. Wir wollten nachholen, was während der Berufsjahre nur bedingt möglich gewesen war. Im Mai haben wir zum ersten Mal für drei Tage eine Reise mit dem Glacier Express vom Wallis ins Bündnerland gemacht.
Jedes Jahr besuchte uns Bruder Reinhard, ein Ordensbruder aus "unserem" ehemaligen Kloster. Offiziell verbrachte er seine Ferien bei seinem Bruder, denn zu "abtrünnigen Ehemaligen" zu fahren, das hätten die Oberen nicht erlaubt. Er fühlte sich immer sehr wohl bei uns und wir konnten ihm einiges von der Schweiz zeigen.
Im Januar 2002 wurde Eli 65 Jahre alt. Die erste AHV war für ihn, der doch immer Existanzängste hatte, auf sein Konto überwiesen worden. Das war ein grosses Ereignis für ihn. Aus Anlass von seinem Geburtstag haben wir eine Woche in einem kleinen Bergdorf im Domleschg, in Feldis, verbracht. In diesem Dorf hatten wir 1974, als wir in die Schweiz eingewandert waren, unsere ersten Ferien verbracht. Wir waren glücklich, dass wir nach so vielen Jahren nun dieses Dorf im Schnee erleben und zu dem Hausberg Mutta aufsteigen konnten, so wie damals.

Einen Tag später rief uns die Haushälterin eines Pfarrers aus dem Saargebiet an und teilte mit, dass der Pfarrer an einem Aneurisma ganz plötzlich im Alter von 65 Jahren verstorben ist. Dieser Pfarrer war ein Pfadifreund und Nachbar aus meinem Heimatort, wir hatten ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu ihm und er hatte uns in Zürich schon einige Male besucht.
Es war sofort klar: Ich reise ins Saargebiet zur Beerdigung.
Die feierliche Beisetzung war am Freitagnachmittag. Ich bin also am Morgen mit dem Zug dorthin gefahren, hatte ein Zimmer im Hotel gebucht, weil es für die Rückfahrt am Abend zu spät geworden wäre.
Am Samstag, den 15. Juni 2002 reiste ich zurück und war um 15 Uhr wieder in Zürich. Zu Hause angekommen erwartete mich sehr sorgenvoll unser Mitbruder. Der Eli sitze schon sehr lange auf dem WC und auf sein Rufen habe er keine Antwort bekommen.
Ich öffnete die WC-Türe: Oh Gott, ich sah meinen Eli leblos, leicht zur Wand gekippt, dort sitzen. Ich konnte nicht glauben, was ich da sah, nein, das musste eine Täuschung sein.
Leider war es Wirklichkeit. Ich kam von einer Beerdigung und fand zu Hause einen Toten. Da rutscht der Boden unter den Füssen einfach ab. Was soll, muss ich tun? Ich rief unseren Hausarzt an und er kam bald. An diesen sonnigen, sommerlichen Samstagnachmittag hätte er sicheres Schöneres zu tun gewusst. Auch er konnte nicht mehr helfen: Eli war tot.
Weil es vorher keine Anzeichen gegeben, Eli sich wohlgefühlt hatte, war das ein "aussergewöhnlicher Todesfall", der gemeldet und abgeklärt werden musste. Das veranlasste der Hausarzt und gut eine Stunde später kamen zwei Polizisten, ein Staatsanwalt, ein Forensiker und ein Kriminalbeamter in die Wohnung. Sie haben Eli vom WC auf das Bett getragen und erste Untersuchungen angestellt. Der Klosterbruder und ich, wir wurden getrennt befragt, verhört und alle Aussagen wurden protokolliert.
Nicht fühlen, trauern, weinen, nur funktionieren war jetzt gefordert, trotz der Hilflosigkeit. In der Hölle kann es nicht schlimmer sein!
Eine gerichtsmedizinische Untersuchung wurde angeordnet und sie nahmen Eli mit und brachten ihn in die Pathologie des UNI-Spitals. Zeit zum Abschiednehmen blieb fast keine für mich, es war Samstagabend und die Beamten freuten sich wohl auch auf ihren Feierabend.
Im Nachhinein habe ich mir oft überlegt, wie ich diesen traurigen, schrecklichen Nachmittag und die Nacht darauf überstanden habe.
Eli war der Jüngste von sieben Geschwistern, denen ich am Telefon diese traurige Nachricht mitteilen musste.
Die älteste Schwester, Hilde, zu ihr hatten wir den engsten Kontakt und sie kannte sich durch ihre vielen Besuche sehr gut aus bei uns, sie kam sofort nach Zürich und übernahm den Haushalt, sie war früher Köchin. Ich war froh, hatte ich sie und den Mitbruder an meiner Seite, das half mir sehr in dieser traurigen Lage.
Einen Termin für die Beerdigung konnten wir erst festlegen, nachdem die Leiche von der Pathologie freigegeben wurde, was nach drei Tagen geschah. Das Resultat der Untersuchung: Plötzlicher Herztod und 1,5 Promille waren in der Blutanalyse gemessen worden. Der Alkohol war wohl der wahre Grund für seinen Tod.
Weil er auf dem jüdischen Friedhof begraben wurde, waren Gespräche mit dem sehr menschlichen und verständnisvollen Rabbiner nötig. Er wurde in diesen Tagen ganz wichtig für mich und ich habe viele Stunden mit ihm zusammen gesessen und geredet, was mir sehr geholfen hat.
Geholfen hat mir auch eine Nachbarin aus unserem Haus. Sie kam und fragte, was sie für mich tun könnte. Da sie einen PC und einen Drucker hatte, habe ich ihr unser Adressbuch gegeben. Sie hat dann mehr als hundert Klebeetiketten mit den Adressen ausgedruckt. So konnte der Klosterbruder den Versand der Todesanzeigen ganz einfach machen.
Eli wurde an einem Freitagvormittag auf dem Isrealitischen Friedhof in einem ganz einfachen Sarg beigesetzt. Vier seiner Geschwister, einige Nichten und Neffen waren anwesend, sowie viele Menschen aus der jüdischen Gemeinde, Freunde und ehemalige Arbeitskolleginnen von ihm und von mir. Es war der traurigste Moment in unserer Beziehung, die 35 Jahre mein Leben prägte. Der Sarg verschwand langsam vor meinen Augen, die Tränen vernebelten das Geschehen. So hilflos und alleine hatte ich mich noch nie in meinem Leben gefühlt.
Schon öfters hatte ich an einem Grab gestanden, aber die Gefühle waren niemals so intensiv. Selbst bei der Beerdigung meiner Eltern habe ich mich nicht so gefühlt, sie waren alt und hatten ihre Aufgabe mit Erfolg abgeschlossen. Sie durften gehen. Aber Eli, der war noch viel zu jung um zu sterben.
Für die Trauergäste hatte ich ganz bewusst einen von uns sehr oft besuchten Ort ausgewählt für das Mittagessen: Die Terrasse der Fischerstube am See, wo wir zehn Tage vorher noch fröhlich meinen Geburtstag gefeiert hatten. Die Trauerfeier sollte an einem besonderen Ort ihren Abschluss finden und im Gedächtnis bleiben, nicht der Verlust, der so still und doch so dramatisch verlaufen ist.

Noch nie in meinem Leben hatte ich gekocht. Einkaufen und kochen, das war immer Elis Hobby und Leidenschaft, ich war höchstens für den Salat oder das Dessert zuständig.
Alleine in der Wohnung, die eingerichtet war um ohne Probleme 20 bis 30 Gäste zu bewirten, und ich nur noch einen Teller, ein Glas oder eine Kaffetasse benützte, das war eine neue Erfahrung.
Mein Partner, mit dem ich 35 interessante, aufregende und meist auch sehr schöne Zeiten durchlebt, gemeinsam gestaltet und geplant hatte, war nicht mehr auf dieser Welt. Das erste Mal in meinem Leben war ich auf mich allein gestellt. Eine neue Erfahrung und eine Tatsache, an die ich mich erst gewöhnen sollte / musste. Das Telefon wurde sehr wichtig, der Bekannten-, Freundes- und Verwandten-Kreis war gross. Einige Stunden am Tag war ich am Draht. Ich war 63 Jahre alt, pensioniert, wohnte in einer 5-Zimmerwohnung, die für mich allein zu gross und auch zu teuer war.

Nach einigem Hin und Her stand fest: Ich würde die Wohnung behalten. Sie war mit sehr viel Erinnerungen und mit Gegenständen, Möbeln, Bildern und Teppichen sehr gut gefüllt und ein Umzug hätte sehr viel Verzicht und Verlust bedeutet. Das wollte ich nicht auch noch ertragen müssen.
Und trotzdem kam es ganz anders. Etwa ein halbes Jahr nach dem Tode von Eli, brachte mir die Post einen Brief, den ich einige Male lesen musste und lange Zeit nicht wusste, wie ich den zu deuten hätte.
Aus dem Freundes- und Bekanntenkreis kam diese Post. Es war eine Anfrage von dem acht Jahre jüngeren Mann, den wir ein paar Jahre zuvor auf dem Inseli Werd kennen gelernt hatten und der mir schon einmal einen Brief geschrieben hatte. Was ums Himmelswillen wollte der denn wohl mit mir besprechen? Ich war, fühlte mich noch in der Beziehung mit Eli, auch wenn er nicht mehr lebte. Es war alles so neu für mich, ich war noch nicht frei, durchlebte ganz bewusst die schmerzliche Erfahrung mit der Endlichkeit, die so plötzlich mein Leben verändert hatte.
Nach einigen Tagen wagte ich doch einen Telefonanruf an Ruedi und wir machten ab, uns für einen Spaziergang am Zürichsee zu treffen. Beim Gehen spricht es sich leichter. Er war ein interessanter Zuhörer, ich musste ja immer noch von meiner schrecklichen Erfahrung erzählen. Nach etwa zwei Stunden haben wir uns am Bürkliplatz verabschiedet, er fuhr mit dem Tram 2 in den Kreis 4 und ich ebenfalls mit dem Tram 2 in die andere Richtung ins Seefeld. Erst später hat er mir gestanden, dass er enttäuscht gewesen war über die schnelle Verabschiedung. Er hätte sich innigst noch nach einer Begegnung anderer Dimension gesehnt.....
Die Sympathie, das Interesse und seine ruhige besonnene Art hatten mich wohl beeindruckt und wir telefonierten nun öfters miteinander.
Ich weiss nicht mehr wie viele Wochen (oder waren es nur Tage?) es dauerte, bis ich ihn zu mir oder er mich zu sich eingeladen hatte.
Er wohnte im Kreis 4 an der Erismannstrasse in einer 5-Zimmer-Eigentumswohnung im 4. Stock ohne Lift, ich an der Dufourstrasse in einer 5-Zimmer-Mietwohnung im 5. Stock mit Lift. Wir beide waren mit unserer Wohnsituation sehr zufrieden und suchten auch keine Veränderung.

Das war also ein erstes "Probewohnen", zusammenleben mit Familienanschluss.
Im Frühling begannen wir uns nach Eigentumswohnungen in Neubauten zu interessieren, nicht etwa, weil wir zusammen ziehen wollten, sondern nur weil Ruedi seiner Schwester bei der Wohnungssuche half, da sie in Zürich eine Eigentumswohnung suchte. Es war sehr interessant zu sehen, was für Wohnungen da zu welchem Preis angeboten wurden.
Wir waren uns langsam näher gekommen, die gegenseitige Skepsis war verschwunden und die Liebe zu einander gewachsen, der Wunsch nach Nähe und Zweisamkeit stärker geworden.
Ruedi war geschieden, hatte eine 5-jährigen Partnerschaft mit einem Mann hinter sich und war schon einige Jahre wieder Single. Er war Sozialarbeiter und arbeitete auf einer Beratungsstelle bei der Stadt Zürich. Nach und nach lernte ich auch seine fünf Geschwister kennen, die gut in der Schweiz verteilt mit ihren Familien lebten. Ich fühlte mich willkommen in der aufgeschlossenen grossen Familie, was mir ein gutes Gefühl gab.
Wir verbrachten immer mehr Zeit zusammen. In meinem Bekanntenkreis war wohl auch spürbar geworden, dass ich wieder am Leben teilnahm und die Bekannten und Freunde sich nicht mehr so stark um mich kümmern mussten. So wurden die diesbezüglichen Telefonate immer weniger.
Die Suche im Internet nach einer Eigentumswohnung für Ruedis Schwester hatte langsam einen anderen Schwerpunkt bekommen: Es wurden tolle Wohnung angeboten, allerdings sehr teuer, die auch für uns geeignet schienen.
Unsere Vorstellung über noch schöneres, und vor allem gemeinsames Wohnen gingen einigermassen in die gleiche Richtung. Es sollte eine Attikawohnung mit grosser Terrasse sein, ruhig und doch zentral gelegen.
Mein verstorbener Partner und ich hatten ein Testament verfasst, dass die gemeinsamen Gegenstände in der Wohnung und das Ersparte jeweils dem überlebenden von uns beiden gehören sollte. So war ich finanziell gut abgesichert, obwohl ich als Frühpensionierter noch keine hohe Rente erhielt.

Dies tönte attraktiv, wir wollten uns dieses Angebot ansehen!
Wir fuhren an die angegebene Adresse, fanden das Gebäude, ein langes Terrassenhaus mit sieben Eingängen und im höchsten Teil zehn Stockwerken. Leider war Sonntag und wir getrauten uns nicht, die Bewohner der ausgeschriebenen Wohnung zu stören.
Ungeduldig erwarteten wir den Montag und riefen an.
Ruedi wohnte im 4. Stock, ich selber im 5.Stock und, 4 und 5 ergibt zusammengezählt 9, im 9. Stock befand sich die uns interessierende Wohnung! Wenn das kein Zeichen des Himmels war!
Die Wohnung war gepflegt, hatte nebst der Terrasse noch eine grossen Balkon und eine eingebaute Sauna. Von der 60 Quadratmeter grossen Terrasse waren etwa 18 Quadratmeter als Wintergarten abgetrennt, mit grossen Glas-Schiebetüren. Und die Aussicht von der Terrasse! Fast die ganze Stadt lag uns zu Füssen: Hönggerberg, Käferberg, Zürichberg bis hoch nach Witikon, links rum das Limmattal, Altstetten, Albisrieden und der Üetliberg. Nur ein Blick auf den See fehlte! Dafür war das Haus dann doch zu wenig hoch.
Rund um die Terrasse waren Pflanzentröge eingebaut mit Rosen, Lavendel und verschiedenen Nadelgehölzen.
Nur etwas hätte attraktiver sein können: Das Haus stammte aus den 70-er-Jahren und war demzufolge architektonisch nicht so grosszügig und modern, wie es dem aktuellen Komfort entsprach.
Aber das spielte keine Rolle, es war für uns eine Traumwohnung und wir wollten sie haben.
Vorsichtig fragten wir nach, ob es andere Interessenten gebe. Natürlich seien wir nicht die einzigen, die von der Lage und dem Objekt begeistert wären, sagten die Besitzer.
Der Preis war für unsere Verhältnisse sehr hoch. Aber wir waren zu zweit und so machte es für jeden ja "nur" die Hälfte. Und da offenbar noch andere Bewerber da waren, fehlte uns der Mut, den Preis etwas zu drücken zu versuchen. Wir wollten auf jeden Fall gewinnen!
Jetzt war überlegen, beraten, Abklärungen treffen und nochmals eine Besichtigung am Abend angesagt. Gegenseitiges Vertrauen musste aufgebaut werden. Wir hatten uns gegenseitig zum Nachtessen eingeladen, Details wurden besprochen. Der Deal kam zustande.
Gleichzeitig musste Ruedi seine Wohnung verkaufen, damit er seinen Anteil an der gemeinsamen Wohnung bezahlen konnte. Aber da war ja seine Schwester, die auf diese Weise zu einer eigenen Wohnung kam. Auch dieser Deal kam zu Stande.
Nach einigen Gesprächen und Verhandlungen mit unseren Banken konnte der entscheidende Akt, die Überschreibung auf dem Grundbuchamt und die Freisetzung des Geldes durch die Bank, vollzogen werden.
Inzwischen war es Herbst geworden. Der Grundstein für den neuen Lebensabschnitt gelegt.
Normalerweise kann ich sehr gut schlafen. Aber in dieser Nacht vor dem "Schreiben", da habe ich kein Auge zugetan.
Wir waren jetzt die Besitzer dieser Traumwohnung. Ausgeräumt entdeckten wir einiges, was wir erneuern, noch schöner und praktischer haben wollten. Der "Umbau", der neue Anstrich, die Reinigung dauerten etwa sechs Wochen, aber wir hatten ja jeder seine Wohnung.
Ich brauchte einen Nachmieter, was jedoch bei der Wohnlage im Seefeld kein Problem war, einen zu finden.
Nun kam die grosse Frage: Was und von wem sollten welche Möbel, Einrichtungs- und Haushaltgegenstände gezügelt werden? Ein Möbellager und überfüllte Schränke wollten wir ja nicht haben. Besonders schöne Gegenstände erhielten den Vorzug. Aber was sind schöne Gegenstände? Da gingen die Ansichten sehr auseinander, das musste ich lernen. Ich war überzeugt, dass meine Sachen alle ganz besonders schön und wertvoll seien. Ich musste mich zurücknehmen und Ruedi den gleichen Platz für seine Ansprüche einräumen. Es fiel uns beiden sehr schwer, die eigene Wohnungseinrichtung zu reduzieren, jeder war mit seinen Sachen vertraut und hing an ihnen. Vieles, was einem jahrelang gehört hatte und liebgewonnen wurde, musste zurückgelassen werden. Es brauchte viele Gespräche und Entscheidungen, die auch schmerzten, aber wir mussten die Vernunft walten lassen.

Jeder von uns hatte einen ganz anderen Hintergrund. Also die Ansichten, wie man was richtig macht und ob es überhaupt sein muss, die gingen bei uns zum Teil weit auseinander. Wir hatten verschiedene Werte. Darüber musste geredet werden, Zugeständnisse, Kompromisse mussten gemacht werden oder auch mal die Meinung zu ändern, das musste alles gelernt werden.
Ich bin ein Rheinländer aus Deutschland, von Werten meiner Eltern, die ich wohl ohne sie gross zu hinterfragen übernommen hatte, geprägt. Meine Kindheit war vom Krieg überschattet und die entbehrungsreiche Nachkriegszeit hat Spuren hinterlassen. Vieles für mich war, ist immer noch, eine Leitlinie in meinem Leben. Wurzeln, die sich trotz Einbürgerung und rotem Pass seit vielen Jahren doch nur wenig angepasst oder verändert haben.
Ruedi, ein echter Schweizer, auf einem Bauernhof aufgewachsen, lernte zu Hause für sein Leben ganz andere Werte kennen und leben und hat auch einen anderen Umgang damit. Als Sozialarbeiter hat er gelernt, dass er anderen nur sinnvoll helfen kann, wenn es ihm selber gut geht. Ich als Krankenpfleger hatte gelernt, aufopferungsvoll zu sein und das eigene Wohlergehen hintenan zu stellen. Von Selbstpflege habe ich erst fast am Ende meiner beruflichen Tätigkeit etwas gehört.
So verschiedene Welten nun unter einem Dach und in einer Wohnung, das muss Reibungen und Diskussionen erzeugen. Ruedi war ja noch berufstätig, ging also früh aus dem Haus und kam meist erst gegen Abend wieder heim. Ich als Rentner kümmerte mich um den Haushalt und sorgte für das gemeinsame Abendessen. Nie in meinem bisherigen Leben hatte ich mich ums Kochen gekümmert, das war absolut das Ressort von Eli gewesen. Damals hiess es, wenn ich ihm in der Küche etwas helfen wollte: "Geh mir aus den Füssen, du störst mich!" Nun war ich plötzlich der Chef in der Küche, zumindest an Werktagen. Und das erst noch bei einem Partner, der Vegetarier war. Meine "Küche" war eher "deutsche Küche", während Ruedi mehr auf "italienische Küche" eingestellt war. Er hatte (noch mit seiner Frau) einige Jahre in Italien gelebt und liebte das südliche Land.
Ich bekam langsam Freude am Kochen und heute, da er auch längst pensioniert ist, lösen wir uns ganz nach Lust und Laune ab und kommen mit unseren unterschiedlichen Schwerpunkten gut zurecht.

Am 31. März 2004 "wagten" wir den Schritt. Er fühlte sich aber nicht als Wagnis an, wir waren beide ohne Zweifel überzeugt, das es so richtig war. Ganz allein und bescheiden liessen wir unsere Partnerschaft auf dem Standesamt eintragen und beschlossen den "Akt" mit einem Spaziergang am See und einem Abendessen in der Blinden Kuh, ein Restaurant, das von Blinden und Sehbehinderten geführt wird.
Eine eingetragene Partnerschaft hat rechtlich aber doch einige Unterschiede zur Ehe. Für die Schwulengemeinschaft war das, leider erst in zwei Kantonen, ein erster Schritt zur rechtlichen Akzeptanz.
Nur drei Jahre später kam es ganzschweizerisch zu einer Volksabstimmung über die eingetragene Partnerschaft, welche mit sehr hohem Mehr angenommen wurde. Das kantonale Recht wurde somit hinfällig, die Partnerschaft musste erneut standesamtlich eingetragen werden.
Natürlich machten wir auch diesen Schritt wieder ohne das Gefühl eines Wagnisses. Aber nicht mehr so still und leise, wie beim ersten Mal. Die Töchter von Ruedi sollten dabei sein, und da meine Verwandtschaft nicht in der Nähe war, lud ich ein paar ehemalige Kolleginnen vom Spital dazu ein. Es ging nur darum, uns am 10. Mai 2010 beim standesamtlichen Akt zu begleiten und nachher bei einem gemeinsamen Drink anzustossen. Anlässlich dieser Gelegenheit erfuhren wir von der älteren Tochter von Ruedi, dass sich bei ihr Nachwuchs angekündigt hatte.
Ein grösseres Fest wollten wir etwas später mit unseren Familien und Freunden feiern: Ich war ja vor noch nicht allzu langer Zeit 70 geworden und Ruedi stand kurz vor seiner (2 Jahre vorzeitigen) Pensionierung. Das waren genügend Gründe für ein Fest. Unsere Geschwister mit ihren Partnerinnen und Partnern waren eingeladen, Mein Bruder mit der Frau, seine Tochter und sein Sohn mit Frau und seinen zwei Kindern (das ist meine ganze Verwandtschaft), die Töchter mit Partnern und auch die Ex-Frau von Ruedi mit ihrem neuen Mann und eine ganze Anzahl von Freunden und Bekannten. Mit einem gemieteten Tram liessen wir uns durch die Stadt Zürich fahren und den Tag in einem gemieteten Saal mit Party-Service bei einem feinen Essen ausklingen. Es wurden mehrere Darbietungen dargeboten und Ruedi und ich spielten zwei Sketchs von Loriot ("Das Ei ist hart" und "Feierabend"). Wir bekamen im Nachhinein viele Rückmeldungen, dass "unser Fest" auch den Eingeladenen viel Spass und Freude bereitet hatte. Uns selber hatte es auch gefallen.
Der Kampf der LGBTQ-Gemeinschaft (Lesbian-Gay-Bi-Transgender-Queer-Gemeinschaft) ging und geht aber weiter und die Politik ist daran, ein Gesetz für eine "Ehe für alle" auszuarbeiten. Konservativ-christliche Kreise haben zwar auch diesmal wieder das Referendum angekündigt aber die Chance, dass die Schweizerische Bevölkerung endlich LGBTQ-Menschen rechtlich nicht mehr diskriminieren will, ist gross. Sicher werden auch wir wieder den Schritt tun. Noch ist nicht bekannt, ob eingetragene Partnerschaften automatisch den Ehestatus bekommen, oder ob wir uns ein drittes Mal standesamtlich "trauen" dürfen.

Vor rund drei Jahren hat die Schweizeriche Bevölkerung bei Eidgenössischen Abstimmungen ein sehr deutliches JA gesagt für die Ehe für Alle, also Frau - Mann, oder Frau - Frau, oder Mann - Mann.
Der Jahrzehntelange Kampf für diese Rechte, er hat sich gelohnt.
Kirchliche, religiöse Kreise oder Kräfte konnten es in der heutigen Zeit nicht mehr verhindern.
Endlich gibt es ein klares Ja und eine Ausrichtung auf und für die Liebe zu einem Menschen, mit dem man leben möchte.
Nicht ein "Versorgungsaspekt" mit einem engen und lange Zeit einzigen Blick auf das tradiotionelle Modell, Vater - Mutter - Kinder, das auch keine Garantie für eine lebenslange Beziehung hat und Bewährungszeiten oft nicht übersteht.
So durften wir dann im Juli 2022 endlich unsere Liebe, Beziehung auf dem Standesamt in Zürich als Ehe umwandeln lassen.
Das war in den 19 Jahren der Partnerschaft der dritte Eintrag für die gleiche Beziehung auf dem Standesamt, manchmal brauchts wirklich einen sehr langen Atem und zähes "Dranbleiben" mit der Hoffnung, "es chunt scho guet" !
Diesen Willen habe ich,- wir - scheinbar, obwohl ich inzwischen schon sehr alt, aber zum Glück noch gesund bin.
Mein Leben mit Ruedi ist spannend, erfüllt und mit vielen Ueberraschungen, abwechslungsreich und schön.
Gerne noch lange, mit vielen glücklichen "Zufällen".