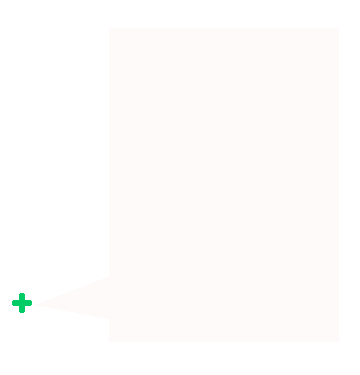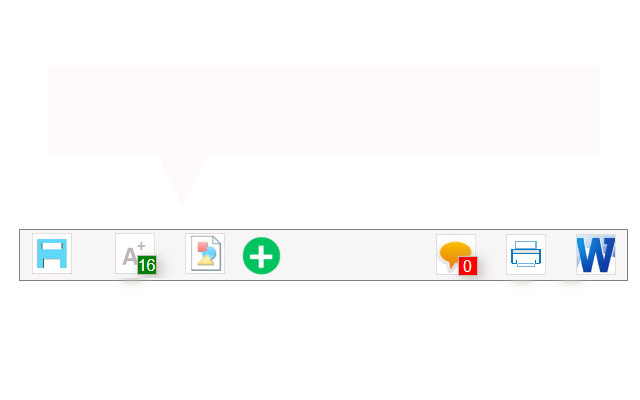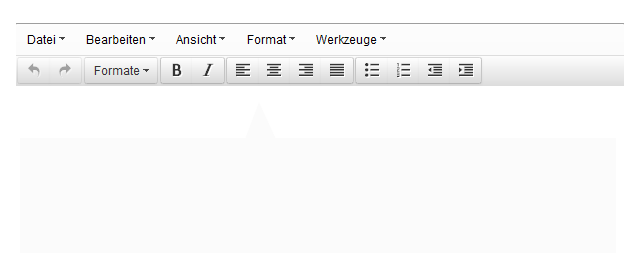Zurzeit sind 537 Biographien in Arbeit und davon 304 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 183

Noch deutete nichts daraufhin, als ich an jenem 24. Dezember 1963 erwachte, dass dies einer dieser Tage sein wird, an die man sich ein Leben lang erinnert. Noch war alles wie immer. Durch die Frostblumen am Fenster meines Zimmers sah ich wie Deda, mein Grossvater, vor unserem Haus Schnee schaufelte. Aus der Küche duftete es nach frisch gebackenem Brot und gekochter Milch.
"Morgen ist der Heilige Abend", hatte meine Grossmutter am Abend zuvor zu mir gesagt. "Ich werde heute Nacht zwei Brote backen. Damit wir genug über die Festtage haben."
Majka, so nannte ich meine Grossmutter, hätte nie an einem Feiertag ein Brot gebacken, geputzt, genäht oder Wäsche gewaschen. An einem Feiertag zu arbeiten, war eine grosse Sünde. "Alles was man an einem Feiertag macht, wird entweder nicht gelingen, oder kaputtgehen", pflegte sie zu sagen.
Ich überlegte gerade, ob das Brot bereits genug abgekühlt war, damit wir zum Frühstück etwas davon kosten durften, als meine Mutter in das Schlafzimmer stürmte.
"Katica", rief sie leise. "Zieh dich schnell an! Majka ist am Melken und Deda am Schnee schaufeln!"
Aufgeregt sprang ich aus dem Bett. Mutter hatte meine Kleider schon am Abend bereitgelegt. Drei Unterhosen, drei paar Strümpfe, zwei Unterhemden, drei meiner schönsten Winterblusen, zwei gestrickte Jäckchen.
"In dieser Reihenfolge anziehen."
Sie hatte alles so hingelegt, dass zuerst die etwas engeren Stücke drankommen und dann die bequemeren. Das klappte dann auch hervorragend bis auf die Strümpfe. Das dritte Paar kriegte ich nicht hin. Sie waren einfach zu eng. Auch mit Hilfe von Mutter ging es nicht. Sie stopfte sie kurzerhand in meine Schultasche. Dann musterte sie mich genau.
"Es sieht wie immer aus. Majka wird nichts bemerken."
"Gut, dass Katica mehrere Schichten angezogen hat", sagte Grossmutter als sie etwas später in die Küche kam. "Es ist bitterkalt draussen."
Mutter und ich sahen uns verstohlen an. Von wegen sieht wie immer aus! Dem Adlerauge von Majka, entging nichts. Mein Herz hämmerte. Zum Glück war es kalt! Sonst wären wir jetzt schon aufgeflogen.
Seit der Scheidung meiner Eltern lebten Mutter und ich bei ihren Eltern. Mir gefiel das Leben mit den Grosseltern. Bei ihnen fühlte ich mich zuhause. Doch meine Mutter träumte davon, irgendwann weg zu gehen. Weg von den Eltern, weg von unserem Dorf. Sie hatte sogar eine Ausbildung zur Schneiderin beim Dorfschneider gemacht, damit sie sich in der Kleiderfabrik der naheliegenden Stadt Zrenjanin um eine Stelle bewerben konnte. Um in der Übung zu bleiben, nähte sie alle meine Kleider. Sie wurde zu einer richtigen Künstlerin. Kein Kind in unserer Strasse war so gut angezogen wie ich. Wenn sie Stoffe oder Zubehör brauchte, ging sie in die Stadt. Ich durfte sie dabei begleiten.
Für die Reise in die Stadt trug meine Mutter stets ihre schönsten Kleider, schminkte die Lippen und zog die Augenbrauen nach. Ich war stolz, wenn sich Männer auf der Spazierpromenade nach ihr umdrehten. Eine so schöne Mutter hatte niemand von meinen Spielkameraden im Dorf. Sie war gross und schlank und ihre braunen Haare mussten mit vielen kleinen Klammern gebändigt werden. Ihre Haut war nicht von der Sonne gebräunt, wie die Haut von vielen anderen Frauen aus dem Dorf. Mein Grossvater achtete stets darauf, dass sie bei starkem Sonnenschein nicht auf dem Feld arbeiten musste.
In der Stadt wurde meine Mutter zu einer anderen Person. Sie scherzte und lachte mit wildfremden Leuten. Auch schimpfte sie nie mit mir, wenn wir dort waren. War nie ungeduldig. Wir gingen einkaufen und assen Eis in ihrem Lieblingscafé an der Spazierpromenade. Manchmal gingen wir ins Kino, wenn es eine Nachmittagsvorstellung gab. Einmal durfte ich sogar ins Puppentheater. Abends wenn wir dann mit dem letzten Zug nach Hause fuhren, legte ich meinen Kopf auf ihren Schoss und hörte zu, wie sie von den Erlebnissen des Tages schwärmte.
"Katica, eines Tages werde ich dort leben", hatte sie mal zu mir gesagt.
"Wie willst du das machen?", fragte ich leise. Ich war kurz vor dem Einschlafen.
"Ich weiss es noch nicht. Vielleicht finde ich dort Arbeit. Oder ich heirate einen Mann aus der Stadt."
"Darf ich dann auch mitkommen?", fragte ich und setzte mich auf. Ich war beunruhigt, weil sie "ich" und nicht "wir" gesagt hatte.
"Natürlich mein Kind! Ohne dich gehe ich nirgendwo hin."
Das reichte mir. Auch wenn meine Mutter launisch und ungeduldig sein konnte, wollte ich nicht ohne sie leben. Auch nicht bei meinen geliebten Grosseltern.
Eines Tages schien Mutters Ziel, einen Mann in der Stadt zu finden, ein bisschen näher zu kommen. Im Abendzug nach Boka setzte sich ein Mann zu uns, obwohl auch andere Plätze frei waren. Sie kamen schnell ins Gespräch.
Von nun an setzte er sich jedes Mal zu uns, wenn wir nach Hause fuhren. Er war von Beruf Elektriker und arbeitete bei der Bahn als technischer Begleiter der Züge. Ich war damals erst sechs Jahre alt, aber dass sich was zwischen ihnen anbahnte, sah sogar ich. Ein langer Händedruck da, eine nette Bemerkung dort. Bald durfte ich nicht mehr auf ihrem Schoss schlafen, sondern auf der gegenüberliegenden Bank. Onkel Radivoj, so durfte ich ihn nennen, sass jetzt neben ihr. Sie waren ein schönes Paar. Sie, mit ihren braunen Haaren und der Haut wie Alabaster. Er, sonnengebräunt mit pechschwarzen Haaren und den Augen eines Zigeuners. Ich freute mich für sie. Ich freute mich auch für mich. Denn so glücklich hatte ich sie noch nie gesehen. Und wenn sie glücklich war, ging es mir auch gut.
"Was würdest du sagen, wenn wir nach Zrenjanin umziehen würden?" fragte meine Mutter nach einigen Wochen auf dem Weg nach Hause, nach einem Ausflug in die Stadt. Onkel Radivoj sass neben ihr. Er hielt ihre Hand.
"Das wäre schön!", antwortete ich.
Mutters Freund setzte sich zu mir und nahm mich auf den Schoss. Er streichelte meine Haare.
"Und würde es dir gefallen, wenn ich dein neuer Vater wäre?"
Ich sah ihn an. Er strahlte über das ganze Gesicht.
"Oh, ja! Das würde mir sehr gefallen", sagte ich und presste meinen Kopf an seine Schulter. Ja, ich hätte gerne wieder einen Vater gehabt. Meinen eigenen Vater sah ich so gut wie nie. Abgesehen davon mochte ich Onkel Radivoj. Er war immer gut gelaunt und interessierte sich für mich und meine kleine Welt. Das kannte ich bisher nicht. In unserer Familie interessierte niemanden was ein Kind dachte. Er brachte mir auch immer etwas Süsses mit. Sachen die ich in unserem Laden in Boka nie gesehen hatte. Doch das Beste an ihm war, dass er Mutter glücklich machte. Sehr glücklich.
"Das freut mich mein Kind", sagte er und küsste mich auf die Haare.
"Radivoj und ich werden heiraten. Aber Majka und Deda dürfen es noch nicht erfahren", sagte meine Mutter, als wir aus dem Zug stiegen.
"Wieso nicht?" Mir gefiel es nicht, etwas vor Majka und Deda zu verheimlichen.
"Sie mögen ihn nicht", antwortete sie.
"Kennen sie ihn?"
"Nein. Sie haben ihn noch nie gesehen. Aber sie mögen ihn nicht, weil er ein Serbe ist."
"Er ist ein Serbe?"
Das hätte ich nicht gedacht. Ein Serbe zu sein war nicht so gut. In den Augen meiner Grosseltern. Ich wusste zwar nicht warum, aber so war es.
"Warum ist das so schlimm?", fragte ich. Ich war verunsichert. Was mein Grossvater sagte, war für mich unumstösslich.
"Das ist ein alter Zopf. Hat etwas mit der Kirche zu tun. Aber das interessiert heute niemanden mehr. Nur noch die alten Leute."
"Und wie willst du es machen?", fragte ich.
"Wir haben bereits einen Plan. Ich sage es dir, wenn alles klar ist."
"Ist gut." Ich war mir nicht mehr sicher, ob ich mich darüber freute. Dass meine Grosseltern gegen ihn waren, beschäftigte mich.
"Katica, du darfst auf keinen Fall etwas Majka und Deda verraten! Sonst werde ich ohne dich gehen müssen."
"Keine Angst, Mama! Ich werde bestimmt nichts verraten."
Dieses Versprechen einzuhalten war nicht schwierig. Meine Grosseltern waren wortkarge Leute. Sie sprachen nie mit mir über Dinge, die nichts mit dem Alltag zu tun hatten. So kam ich nie in Versuchung mich zu verraten.
In den folgenden Tagen hörte ich oft meine Mutter mit ihrem Vater wegen Onkel Radivoj streiten. Doch alles was er gegen ihn sagte, prallte von ihr ab.
"Du wirst es bereuen, mein Kind, glaube mir", beteuerte er immer wieder.
"Sicher nicht!", pflegte sie zu antworten.
"Woher weisst du das so sicher?"
"Weil ich ihn liebe!"
"Liebe! Liebe! Was weisst du schon über die Liebe?"
"Was wisst ihr schon?" Meine Mutter ereiferte sich manchmal so sehr, dass sie respektlos wurde. "Ich musste Paul heiraten, weil ihr ihn für den Richtigen gehalten habt. Und wo sind wir heute? Geschieden!"
Paul war mein Vater.
"Es war nicht nur seine Schuld", sagte Grossvater bissig.
"Er ist ein unfähiger Schwachkopf! Radivoj ist ein fleissiger Mann. Mit einer guten Stellung bei der Bahn. Auch privat macht er Strominstallationen in den Häusern."
"Aber er ist geschieden! Mit drei Kindern!"
"Ich habe auch zwei Kinder!"
"Genau das ist ja das Problem! Kannst du dir vorstellen, was es bedeutet fünf Kinder grosszuziehen? Du bist nicht gerade die liebe Mami..."
"Willst du sagen, dass ich meine Kinder nicht liebe?"
"Nein, das will ich keinesfalls sagen! Aber du bist nicht die Frau, die alles für ihre Kinder opfert. Fünf Kinder sind eine Riesenverantwortung. Und sie verlangen Opfer. Viele Opfer!"
"Das kriege ich hin! Ihr werdet es sehen."
"Katarina", mein Grossvater brachte das letzte schlagende Argument. "Das sind fremde Kinder! Eigene Kinder stehen einem viel näher. Mit ihnen ist man durch das Blut verbunden."
Auch das stiess auf taube Ohren. Keiner von Ihnen wich von seinem Standpunkt ab. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, weiss ich, dass mein Grossvater seine Tochter sehr gut gekannt hatte. Er hatte die Katastrophe, die sich um sie anbahnte, bereits geahnt.
"Ich werde ihn heiraten, mit oder ohne euren Segen", drohte sie.
Und darum trug ich jetzt drei paar Unterhosen und zwei paar Hosen. Meine Mutter hatte sich entschieden, an diesem Tag mit Onkel Radivoj durchzubrennen. Und ich durfte mitgehen, was mich sehr glücklich machte. Und auch ein wenig traurig. Weil ich meine Grosseltern deshalb belügen musste.
Im Klassenzimmer angekommen setzte ich mich an meinen Platz. Neben meiner Schwester Anna, die zwar ein Jahr älter als ich war aber in die gleiche Klasse ging. Als sechsjährige war ich überdurchschnittlich gross und in der Entwicklung viel weiter als alle anderen Kinder des Jahrgangs 1957. Abgesehen davon ist mein Geburtstag im Februar und das Schuljahr fing im September an.
Meine Schwester und ich kannten uns vor der ersten Klasse nicht. Ich wusste zwar, dass ich eine Schwester hatte, die bei meinem Vater lebte, weil das Gericht es so wollte. Aber ich hatte sie noch nie gesehen. Zu jener Zeit wurden Kinder in Jugoslawien nach einer Scheidung dem Elternteil zugeteilt, der finanziell bessergestellt war. Falls die beiden Elternteile gleichwertige Einkommen hatten, wurden die Kinder aufgeteilt. Das jüngere Kind wurde immer der Mutter zugeteilt. So kam es dazu, dass ich mit meiner Mutter bei ihren Eltern lebte und meine Schwester mit unserem Vater bei seinen. Da wir in verschiedenen Dörfern wohnten, sahen wir uns nie. Ich lernte sie erst kennen, als die Schule anfing. Sie kam in unser Dorf zur Schule, da es dort wo sie lebte keine Schule gab. Anna und ich verstanden uns auf Anhieb. Ich genoss die gemeinsame Zeit mir ihr in der Schule. Mit ihren blonden Locken und ihrem fröhlichen Wesen kam sie mir wie ein Engel vor. Manchmal kam sie nach der Schule mit mir nach Hause und blieb, bis Vater sie abholte. Der Abschied war stets von unzähligen Tränen begleitet.
Kurz vor dem Mittag klopfte es an der Klassenzimmertür. Es war Mutter. Endlich! Den ganzen Morgen schon wartete ich schwitzend in meiner Ausreisser-Montur darauf. Sie bat um Erlaubnis mich und Anna kurz rauszunehmen. Wir gingen in den Schulhof. Mutters Augen waren rot und geschwollen vom Weinen. Sie schnäuzte sich ständig. So sollte sie Onkel Radivoj nicht sehen, dachte ich. Mit der roten Nase sieht sie gar nicht gut aus.
"Was ist los, Mama?", fragte Anna erschrocken. Mutter heulte drauflos. Anna fing auch an zu weinen und presste sich an sie.
"Ich gehe weg", sagte Mutter schluchzend nach einer Weile.
"Wohin?", fragte Anna.
"Nach Zrenjanin", antwortete sie. "Ich nehme Katica mit. Wir werden uns eine Weile nicht sehen."
Annas schöne blaue Augen erstarrten. Sie sah Mutter ungläubig an.
"Und ich? Du nimmst nur Katica mit?", fragte sie. Mutter brach schon wieder in Tränen aus.
"Ich kann dich nicht mitnehmen", sagte sie. "Du gehörst zu deinem Vater."
"Bitte Mama!" Anna presste sich fest an unsere Mutter. "Lass mich nicht hier. Ich bin auch dein Kind!"
Jetzt fing auch ich an zu weinen. Anna tat mir Leid. Mutter und ich gingen gemeinsam weg, während sie bei einem Vater, den sie kaum kannte, und seiner neuen Frau, die sie nicht mochte, bleiben musste.
"Bitte Mama nimm mich auch mit. Ich bin nicht gerne bei Vater."
"Das geht nicht, mein Kind. Das Gericht hat dich deinem Vater zugeteilt. Da kann ich nichts machen!"
"Frag ihn doch!", flehte Anna sie an. "Er ist sicher froh, wenn ich weg bin. Seine neue Frau mag mich nicht. Und ich mag sie auch nicht."
Die Schulglocke meldete das Ende der Stunde. Unsere Lehrerin gesellte sich zu uns. Sie unterhielt sich leise mit Mutter. Die Zeit drängte. In einer Stunde fuhr der Zug nach Zrenjanin. Wir mussten noch zu Fuss zum Bahnhof. Die Lehrerin redete jetzt auf Anna ein.
"Es geht nicht anders jetzt, aber bald darfst du auch nach Zrenjanin. Zu Mama. Sie hat mir versprochen, dich so schnell wie möglich zu holen."
Anscheinend hatte das Wort der Lehrerin ausreichend Gewicht. Langsam beruhigte sich Anna. Als Mutter und ich uns auf den Weg machten, winkte sie uns bereits fröhlich nach. Noch wusste niemand von uns, dass noch viele Jahre vergehen sollten, bis Mama ihr Versprechen einlösen konnte. 
(1) Majka i Deda - meine Grosseltern

(2) Das Haus meiner Grosseltern

(3) Meine Eltern im Jahr 1955

Vom ersten Tag an lief in Mutters Ehe mit Onkel Radivoj alles schief, was schief laufen konnte. So wie meine Grosseltern ihren auf Biegen und Brechen erzwungenen Schwiegersohn nicht mochten, mochten auch seine Eltern meine Mutter nicht. Aus dem gleichen Grund. Weil wir Kroaten und sie Serben waren. Sie mochten auch mich, ein sechsjähriges Kind nicht.
Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn meine Mutter eine Frau gewesen wäre, die zu allem Ja und Amen gesagt hätte. Aber das war sie nicht. Sie war stur, engstirnig und ertrug keine Kritik. Abgesehen davon mochte sie Kinder nie besonders. Warum sie einen Mann mit drei Kinder geheiratet hatte, habe ich nie begriffen.
Anfänglich versuchte mein Stiefvater zwischen ihr und seinen Eltern zu vermitteln. Er beruhigte alle, nahm keine Stellung. Aber mit jedem neuen Tag wurde es schlimmer. Und die Streithähne verbissener.
"Wir werden bald ausziehen", hörte ich ihn oft zu meiner Mutter sagen, wenn sie sich über seine Eltern beschwerte. "Hab’ Geduld."
"Wohin ausziehen?", fragte sie. "In eine private Mietwohnung?"
Zu jener Zeit wohnten in Jugoslawien nur arme Leute in privaten Mietwohnungen.
"Nein. Wir werden ein eigenes Haus bauen. Ich bin auf der Suche nach einem Bauplatz."
"Haben wir das Geld?"
"Ich habe etwas auf die Seite gelegt. Für die Parzelle wird es reichen. Unsere Eltern werden wohl noch was für den Bau beisteuern."
"Deine vielleicht", sagte sie. "Weil sie froh sind mich loszuwerden. Aber meine geben dir sicher nichts."
Einige Wochen später kam mein Stiefvater früher nach Hause.
"Zieh deine Jacke an," sagte er zu Mutter. "Wir fahren mit dem Motorrad weg."
Als sie zurückkamen, strahlten die beiden. Ich freute mich darüber. Wenn Mutter gute Laune hatte, ging es uns allen gut. Beim Abendessen erfuhren wir den Grund ihrer Fröhlichkeit.
"Ich habe eine Bauparzelle gefunden", sagte mein Stiefvater. "Wir haben heute den Vertrag unterschrieben. Gleich nächste Woche fangen wir an, das Nebenhaus zu bauen. Die Bauleute sind schon organisiert."
Zu jener Zeit war es üblich, zuerst ein kleines Haus am Rand der Parzelle zu bauen. Es bestand meistens aus einer Wohnküche und zwei Schlafzimmern. Draussen noch ein WC-Häuschen. Ein Bad zu bauen war nicht üblich in unseren Kreisen. Nur reiche Leute hatten damals ein Bad. Das Haus wurde so gebaut, dass man dort wohnen konnte, während man das grosse Wohnhaus baute. Deshalb auch die Bezeichnung "Nebenhaus". Später diente es meistens als Sommerküche, oder man vermietete es, um etwas Geld zu verdienen.
"Und die Kinder?", sagte Grossvater. Er sah dabei seine drei Enkelkinder an.
"Was meinst du mit ‘Kinder’?", fragte mein Stiefvater.
"Nimmst du sie mit?"
"Natürlich nehme ich sie mit!", antwortete sein Sohn. "Was für eine Frage!"
"Die mögen die da nicht." Sein Vater zeigte auf mich und meine Mutter. Er nannte uns nie mit Vornamen.
"Hör auf!", sagte mein Stiefvater. "Ich will nichts davon hören."
Doch einige Tage später nahm der Grossvater das Thema beim Essen wieder auf.
"Die Kinder wollen nicht mit euch nach Bagljas ziehen. Bagljas war der Name des Stadtteils, in dem unser Haus gebaut werden sollte. Ich freute mich riesig, dass wir dort wohnen würden. Es war zu jener Zeit ein richtiges Modequartier in der Stadt. Neue Häuser wuchsen dort über Nacht. Auch Schulen und Läden. Alles neu und supermodern.
"Was wissen die, was sie wollen?", antwortete mein Stiefvater. "Das sind doch Kinder."
Ich war zu jener Zeit sechs Jahre alt, Meine Stiefschwestern acht und zehn und der Stiefbruder zwölf.
"Frag sie doch!", insistierte der Grossvater.
"Ich lasse mir nicht von Kindern vorschreiben, was ich tun soll", antwortete sein Sohn. "Ende der Diskussion."
"Ich komme bestimmt nicht mit", sagte plötzlich mein Stiefbruder. Er sah seinen Vater furchtlos an.
"Warum nicht, wenn ich fragen darf?" Fragte sein Vater. "Magst du meine Frau auch nicht?"
"Ich möchte lieber bei Oma und Opa bleiben", antwortete er. "Sonst sind sie ganz alleine."
"Sagt doch was, Kinder!", forderte Grossvater auch die Mädchen auf. "Sagt doch was ihr mir erzählt habt."
"Wir möchten lieber zu unserer Mama", antwortete die jüngste kaum hörbar.
"Na das ist was neues!", regte sich ihr Vater auf. "Das Gericht hat euch mir zugesprochen. Dafür gibt es einen wichtigen Grund. Eure Mutter ist nämlich nicht in der Lage, sich um euch zu kümmern!" Er schrie jetzt. Niemand wagte etwas zu sagen. Das Geschirr klirrte, als er mit der Faust auf den Tisch schlug. Dann stürzte er zur Tür. Gleich hörten wir sein Motorrad losfahren.
"An allem bist du schuld, du kroatisches Miststück!", schnauzte die Grossmutter meine Mutter an und verliess die Küche. Ihr Mann folgte ihr. Wir Kinder schauten uns ratlos an. Dass sich alle stritten, war bei uns normal, daran waren wir gewohnt. Aber dass meine Stiefgeschwister nicht mit uns nach Bagljas ziehen wollten, machte mich sehr traurig.
"Wollen wir Karten spielen?", sagte mein Stiefbruder nach einer Weile.
"Oh ja!", schrien seine Schwestern und ich vor Freude.
Und während meine Mutter in ihrem Zimmer laut weinte und die Grosseltern das Radio aufdrehten, um es nicht hören zu müssen, spielten wir Kinder fröhlich Karten. 
(1) Ich in der Zeit, als Mutter den Stiefvater kennengelernt hatte - 1963

Ich glaube, ich war die einzige, die an jenem Tag glücklich war. Da unser Haus nur zwei Zimmer hatte, sollten die Mädchen und ich gemeinsam in einem Zimmer schlafen. Bisher schlief ich auf einem kleinen Sofa im Zimmer der Eltern. Nachts, wenn ich nicht schlafen konnte, durfte ich kein Licht machen. Stiefvater ging normalerweise früh ins Bett, da er um 4 Uhr morgens aufstehen musste, das Licht würde ihn stören, meinte Mutter. Im Wohnzimmer durfte ich nicht sein, weil dies die Grosseltern störte. Wie viele Nächte hatte ich schlaflos in meinem Bett verbracht! Wie oft hatte ich nach einem Alptraum still liegen müssen, während die Angst mit ihren kalten Fingern meine Kehle zudrückte! Nicht mit den Eltern im gleichen Zimmer zu schlafen, war für mich der Inbegriff des Glücks.
Die ersten Woche im neuen Haus verliefen wunderbar. Mutter strahlte vor Glück weil sie ihre verhassten Schwiegereltern nicht mehr sehen musste. Sie war wie neu geboren. Mit meinen Stiefschwestern im gleichen Bett zu schlafen, war auch sehr lustig. Auch gab es viele Kinder in der Nachbarschaft. So verbrachten wir die meiste Zeit, wenn wir nicht in der Schule waren, draussen am spielen. Oft gingen wir zum Sportflugplatz, der nur zehn Minuten zu Fuss von unserem Haus entfernt war. Es war faszinierend, den Motorflugzeugen zuzuschauen, wie sie über die holprige Piste rollten, um dann wie ein Riesenvogel elegant durch die Luft zu gleiten. Vor allem liebten wir es, den Fallschirmspringern zuzusehen, wenn sie ihre Schirme minuziös und mit unglaublicher Präzision auf dem Gras zusammenlegten. Ja, das war eine schöne Zeit!
Doch das Glück dauert nie ewig. Nach der Sonne kommt irgendwann der Regen. An einem Samstag Nachmittag fingen meine Stiefschwestern, in unserem Garten eine Hütte zu bauen. Mutter gab ihnen alte Leintücher, Holzbretter, Jutesäcke, Nägel und einen Hammer. Mit grossem Fleiss machten sie sich an die Arbeit. Bauen war nicht meine Sache. Ich spielte mit unseren Katzen und sah ihnen zu. Knapp bevor es dunkel wurde, war alles fertig.
"Dürfen wir draussen übernachten?", fragte Olgica, die ältere, als meine Mutter das Meisterwerk begutachtete.
"Von mir aus", sagte sie. "Aber zieht euch warm an. In der Nacht wird es kühler. Katica, du sollst das dicke Nachthemd anziehen."
Ich war mir nicht sicher, ob ich draussen wirklich übernachten wollte. Auf dem Stroh zu schlafen, statt auf unserer weichen Matratze! Nein, die Vorstellung machte keine Freude. Doch bevor ich etwas sagen konnte, kam die Rettung aus der Reihe meiner Schwestern.
"Ich weiss nicht, ob das eine gute Idee ist", sagte Olgica, die ältere. "Wir haben hier kein Licht, falls sie nicht einschlafen kann."
"Macht wie ihr es wollt", sagte meine Mutter und ging ins Haus.
"Glaub' mir es ist besser so", sagte Vesela, die jüngere.
"Kein Problem.", antwortete ich. "Ich mag eh nicht draussen schlafen."
Als ich am nächsten morgen erwachte, ging ich gleich zu ihnen in die Hütte. Doch sie war leer! Zuerst dachte ich, dass sie mir einen Streich spielten und sah mich vorsichtig um. Der Garten war überblickbar, sie hätten nirgendwo anders sein können. Mit ungutem Gefühl ging ich in unser Schlafzimmer und öffnete den Kleiderschrank. Alle ihre Kleider waren weg. Und ich hatte nichts bemerkt! Hoffentlich wird Mutter nicht denken, dass ich etwas davon wusste.
Die Eltern schliefen noch, als ich ihr Schlafzimmer betrat. Ich rüttelte an Mutters Schulter.
"Mama!"
Sie war sofort wach. "Was ist?"
"Olgica und Vesela sind weg!", sagte ich den Tränen nach.
"Was?" Wie von Wespe gestochen sprang sie auf. Das weckte auch den Stiefvater.
"Was ist passiert?", sagte er und rieb sich die Augen.
"Katica sagt, dass Olgica und Vesela weg sind."
"Wie weg?"
"Die Hütte ist leer. Und ihre Kleider sind auch weg." Ich fing an zu weinen.
"Mach mir einen Kaffee", sagte er zu Mutter und zündete sich eine Zigarette an.
Eine halbe Stunde später schwang er sich auf das Motorrad. Erstaunlicherweise machte Mutter mir keine Vorwürfe. Sie war viel zu verärgert über ihre Stiefkinder, um auch noch über mich nachzudenken. Gott sei Dank! Nach und nach liess meine Angst nach. Wir warteten gespannt auf den Stiefvater.
Er kam erst am Nachmittag. Sein Atem roch nach Schnaps. Der finstere Ausdruck seines Gesichts versprach nichts Gutes.
"Wo bist du so lange?", schimpfte Mutter. "Wir drehen fast durch!"
"Setz dich!", befahl er. "Wir müssen reden."
"Sind sie bei den Alten?", fragte meine Mutter ungeduldig.
"Nein. Sie sind nicht bei den Alten!" Er betonte das Wort "Alten" ganz besonders.
"Bei ihrer Mutter?"
"Ja!"
"Was für undankbare Bengel!", schimpfte sie vor sich hin. "Wie sind sie dorthin gekommen? Mit dem ganzen Gepäck."
"Milkas Bruder hat alles organisiert. Milka war Stiefvaters Exfrau. Die Mutter der beiden."
"Jetzt ist es klar, warum sie draussen übernachten wollten. Schlau. Wie konnten Sie nur die Kleider in der Nacht rausschmuggeln? Hast du nichts gehört?" Sie sah mich an.
"Nein!", rief ich laut. "Ich habe gar nichts gehört."
"Und was jetzt?" Sie sah jetzt ihren Mann an. "Bringst du sie zurück?"
"Nein."
"Wie nein? Wovon sollen sie dort leben? Sie arbeitet nicht."
"Nicht mein Problem. Sie haben sich für ihre Mutter entschieden."
"Das Gericht hat aber entschieden…"
"Sie will nochmals vors Gericht. Sie will die Kinder für sich beanspruchen."
"Das lässt du doch nicht zu, oder?"
"Warum nicht?"
"Weil du dann Alimente zahlen musst! Für drei Kinder!"
Er sah sie verärgert an. "Ist das das einzige, das dir zu denken gibt? Die Alimente?"
"Natürlich nicht! Aber wie sollen wir unser Haus bauen, wenn du das ganze Geld ihrer Mutter gibst?"
"Sie wollen nicht mehr mit dir leben."
"Was? Sie geben mir die Schuld?"
"Sie haben ihrer Mutter erzählt, dass du sie geschlagen hast."
"Das ist nicht wahr! Ich habe sie nie geschlagen!"
"Sie behaupten was anderes."
"Ab und zu mal eine Ohrfeige schadet nichts. Katica hat es auch nicht geschadet."
"Sie kennt nichts anderes." Er sah mich mitleidig an. "Meine Kinder wurden nie geschlagen."
"Dann sollen die Kinder machen was sie wollen? Wie soll ich sie dann erziehen, wenn man sie nicht anfassen darf?"
"Dich zu heiraten, war der grösste Fehler meines Lebens." Er schüttelte den Kopf. "Ich dachte, dass du meinen Kindern eine gute Mutter sein wirst."
"Dann hast du mich also nur geheiratet, um eine Mutter für deine Kinder zu bekommen?"
"Nein, aber ich dachte, weil du selber schon Kinder hast…"
Totenstille legte sich über unsere kleine Küche. Ich war hin und her gerissen. Einerseits freute es mich, dass er ihr endlich mal die Meinung gesagt hatte, anderseits tat sie mir Leid. Wie kompliziert meine Mutter auch war, ich liebte sie. Auch hatte ich nie gesehen, dass sie seine Kinder geschlagen hat. Meistens war ich die, die bestraft wurde, wenn sie über uns verärgert war. Doch wenn ich ehrlich sein sollte, taten ihre Ohrfeigen nicht wirklich weh. Ich meine körperlich. Es war einfach nur demütigend, wenn man eine bekam.
"Und jetzt?", fragte sie. "Wie geht’s jetzt weiter?"
"Ich weiss nicht", antwortete er und ging zur Tür.
"Übrigens", sagte er und sah nochmals zurück. "Jetzt können wir es uns nicht mehr leisten, deine Tochter zu uns zu holen. Wenn ich die Alimente zahlen muss…"
"Das ist nicht fair! Du hast es mir versprochen!"
"Ja. Das stimmt. Aber damals wusste ich nicht, dass ich bald die Alimente für drei Kinder zahlen muss."
"Das ist nicht gerecht!", schrie meine Mutter. " Anna kann nichts dafür. Und ich habe es ihr versprochen!"
"Na ja, daran hättest du denken sollen, bevor du meine Kinder von zu Hause vertrieben hast."
Er kam erst nach drei Tagen zurück. Dann stritten sie sich den ganzen Abend lang. Ich zog mich in mein Zimmer zurück. Die Versöhnung danach war nicht zu überhören. Egal wie stark ich mir die Ohren zudrückte. Von nun an war das unser Leben. Das ständige Hin und Her meiner Eltern zwischen Liebe und Hass. Oft ging er tagelang weg. Jedes mal hoffte ich, dass er nicht mehr zurückkommen würde. Oder, dass ihn Mutter nicht mehr wollte. Doch er kam immer wieder. Und sie nahm ihn.

(1) Mutter und Stiefvater vor unserem "Nebenhaus"

Ich erwachte, weil jemand meinen Namen rief.
"Katica! Katica!"
Was war das? In unserem Schlafzimmer brannte das Licht. Meine Stiefschwestern und meine Schwester Anna waren schon wach. Es war Besuchswochenende. Da Stiefvater neuerdings für seine Kinder Alimente zahlen musste, bestand er darauf, dass sie ein mal pro Monat übers Wochenende bei uns sind. Anna durfte dann auch kommen. Ich liebte diese gemeinsamen Wochenenden! Meine Schwestern fehlten mir. Das Leben des Einzelkindes, das ich lebte seit sie weg waren, gefiel mir nicht. Wenn sie da waren, gingen die Eltern meistens aus. Da wir damals noch keinen Fernseher hatten, machten wir meistens eine Schüssel voll Popcorn und spielten den ganzen Abend Karten.
"Was ist los?", fragte ich erschrocken, als ich Anna weinen sah.
"Ich höre Mama schreien!", antwortete sie.
Wir horchten.
"Katica! Kinder! Helft mir!" Ihre Schreie kamen von draussen.
Wir stürzten uns zum Fenster. Der Vollmond hatte die Nacht zum Tag gemacht. Mutter lag auf dem Boden. Der Schnee um ihren Kopf färbte sich rot. Mein Stiefvater sass auf ihrer Brust. Er schlug mit den Fäusten auf sie ein. Immer wieder. Immer wieder. Noch nie hatte ich gesehen, dass jemand so geschlagen wurde. Weder in meiner Familie noch sonst irgendwo. Meine Mutter versuchte sich aufzurichten. Sie sah zu uns.
"Kinder! Helft mir!" rief sie.
Er presste seine Hand auf ihren Mund, drückte sie wieder auf den Boden. Das ist der Teufel persönlich, dachte ich, während mir ein kalter Schauer die Nackenhaare sträubte.
Im Nachbarhaus ging das Licht an. Tante Mica, die Schwester meines Stiefvaters, öffnete die Haustür.
"Gott sei Dank!", sagte meine Stiefschwester, Olgica.
Doch so schnell wie die Tür aufgegangen war, ging sie wieder zu.
Mutter schien das auch bemerkt zu haben. "Mica!", schrie sie. "Bitte! Hilf mir!"
Das Licht im Nachbarhaus erlosch. Wie ihre Eltern, mochte Tante Mica meine Mutter nicht. Wir Kinder sahen uns an.
"Wie kann sie nur so sein?", sagte Olgica. Das Verhalten ihrer Tante war auch für sie unbegreiflich, obwohl sie meine Mutter nicht besonders mochte.
"Ein Wort von ihr, und Vater hätte aufgehört. Wie kann sie nur so sein?" Jetzt weinte auch sie.
"Warum hilft mir denn niemand? Kinder! Bitte!"
Unsere Haustür war geschlossen. Wie immer, wenn die Eltern weggingen. Einen Schlüssel auf der Innenseite gab es nicht. Wir versuchten das Fenster zu öffnen. Doch es war vollständig gefroren.
Meine Mutter sah, dass unsere Bemühungen nicht fruchteten. "Schlägt die Scheibe ein!", schrie sie.
Wir schauten uns nach einem Gegenstand um, mit welchem wir die Fensterscheibe einschlagen konnten. Es gab nichts, was einigermassen dafür geeignet gewesen wäre.
Plötzlich wurde es ruhig. Mutter regte sich nicht mehr. Mein Stiefvater liess von ihr ab und kam auf das Haus zu. Wir flüchteten uns ins Bett. Ich löschte schnell das Licht. In seinem Delirium schien er uns nicht bemerkt zu haben. Er öffnete die Haustür und ging geradewegs ins Schlafzimmer.
Wir stürzten uns nach draussen. Mutter setzte sich auf. Sie schien nicht bewusstlos zu sein. Sie hatte nur so getan, damit er aufhört auf sie einzuschlagen, hatte sie uns später gesagt.
Wir halfen ihr ins Haus. Im hellen Licht der Küche schrien wir auf. Ihr Gesicht war eine einzige blutige Fleischmasse. Sie sah zum Spiegel an der Wand.
"Kinder, ihr müsst mich ins Krankenhaus bringen.", sagte sie gefasst. "Ich kann nicht alleine gehen. Ich sehe fast nichts mehr."
In unserer Strasse hatte damals noch niemand ein Telefon. So zogen Anna und ich uns an und begleiteten Mutter zum Krankenhaus. Zu Fuss. Es dauerte fast eine Stunde bis wir dort ankamen. Bei beissender Kälte. Die Notaufnahme setzte uns sofort in einen Krankenwagen, der uns in die städtische Augenklinik brachte.
Vierzehn Tage verbrachte sie in der Augenklinik. Mit allen verfügbaren Mitteln kämpften die Ärzte um ihr Augenlicht. Verzweifelt sass mein Stiefvater Tag für Tag an ihrem Bett. Er schien Höllenqualen zu leiden. Ich konnte das nicht verstehen. Wie kann man jemanden, den man liebt, so zusammenschlagen? Und er liebte sie offensichtlich. Was war zwischen ihnen geschehen, dass er jegliche Kontrolle über sich verlor?
Mich wird nie ein Mann schlagen!, schwor ich an einem Abend, während ich mit Stiefvater an ihrem Bett sass und zu einem Gott betete, an den ich eigentlich nicht glaubte.

Ein Mann mit dem traurigsten Gesicht, das ich je sah, stand an unserer Tür. Es war Sommer 1969. Mutter und ich assen gerade zu Abend.
"Guten Abend", sagte er. "Bist du Katarina?"
Zu jener Zeit duzten sich in Jugoslawien alle. Nur alte Leute und die Obrigkeit wurden mit "Sie" angesprochen.
"Ja.", antwortete meine Mutter und stand auf. Sie wirkte beunruhigt.
"Ich bin von der Bahngesellschaft, sagte der Mann. "Es tut mir Leid, ich habe schlechte Nachrichten."
Ihr Gesicht wurde kreideweiss.
"Ist was mit Radivoj?"
Auch nach ihrer Rückkehr aus dem Krankenhaus blieb meine Mutter bei ihrem Mann. Warum sie das tat, habe ich nie begriffen. War ihr Stolz so gross, dass sie lieber in einer katastrophalen Ehe lebte, als ihren Eltern zuzugeben, dass sie doch recht hatten? Oder war es diese eigenartige Liebe, die ich nie verstand und die sie auf eine unerklärliche Weise aneinander kettete?
Der Besucher räusperte sich.
"Dein Mann liegt im Krankenhaus.", sagte er leise. "Er ist von einem elektrischen Mast gefallen."
"Wie schlimm ist es?", fragte sie.
"Sehr schlimm. Seine Wirbelsäule ist gebrochen."
"Die Wirbelsäule?"
"Ja", sagte der Mann. "Es tut mir Leid."
Ich brauchte eine ganze Weile um die Bedeutung dessen, was der Besucher gerade gesagt hatte, zu begreifen. Mein Stiefvater lag schwer verletzt im Krankenhaus? Vielleicht wird er sogar sterben? Mutter verdeckte die Augen mit den Händen. Ihre Schultern bebten.
Auch mein Herz schlug plötzlich heftig. Meine Augen füllten sich mit Tränen. Warum? Ich konnte das nicht verstehen. Wie oft hatte ich ihm nach jenem Abend, als er Mutter zusammenschlug, den Tod gewünscht! Warum war ich plötzlich so traurig?
"Ich bin gekommen um euch ins Krankenhaus zu bringen.", sagte der Mann. "Bitte beeilt euch! Es sieht nicht gut aus."
Auf dem Empfang der Intensivstation sagte uns eine Krankenschwester, dass wir auf den zuständigen Arzt warten müssen.
"Lebt er noch?", fragte meine Mutter, als der Arzt kurz darauf kam.
"Ja, er lebt", sagte er. "Aber er ist noch nicht über dem Berg. Es steht uns eine über alles entscheidende Nacht bevor."
"Wird er gelähmt?", fragte sie.
Ich warf einen schnellen Blick zum Arzt. Es war mir äusserst peinlich, dass Mutter gleich diese Frage gestellt hatte. War jetzt nicht das Wichtigste, dass er nicht stirbt?
"Das wissen wir noch nicht", antwortete er. "Das war nicht so gut, dass man ihn in einen Fiat 500 reingequetscht hat. Sein Rückenmark wurde dadurch sehr beschädigt. Es hängt nur noch an einem seidenen Faden. Wenn es nicht komplett getrennt wird, hat dein Mann eine Chance, irgendwann wieder gehen zu können."
"Und wenn doch?"
"Das spielt doch jetzt keine Rolle, Mama", mischte ich mich ein. "Warten wir einfach ab."
"Deine Tochter hat recht. Es ist noch zu früh, um eine definitive Aussage zu machen."
"Darf ich über Nacht bei ihm bleiben?", fragte Mutter.
"Sicher. Solange du willst", antwortete der Doktor und verabschiedete sich von uns. Ehrfürchtig folgten Mutter und ich der Krankenschwester durch die Schläuche und Lämpchen der Intensivstation. Im letzten Bett, ganz in der Ecke, lag er. Klein und hilflos, wirkte er in dem grossen Bett. Seine dunkle, sonnengebrannte Haut sah noch dunkler aus in der weissen Bettwäsche. Er schlief nicht, doch er nahm uns nicht wahr. Seine Augen schauten über uns hinweg. Meine Mutter küsste ihn. Ich sah wie sie sich bemühte leise zu weinen. Spontan fasste ich seine Hand. Sie war heiss. Er erwiderte meinen Druck nicht.
Wir verbrachten die ganze Nacht weinend an seinem Bett. Es spielte keine Rolle mehr, was für ein Ehemann, was für ein Vater er war. Er war ein Teil unseres Lebens. In den fünf Jahren waren wir zu einer Familie geworden. Ob wir es wollten oder nicht.
"Mama", sagte ich irgendwann gegen Morgen. "Ich wünsche mir aus der tiefsten Seele, dass er weiterlebt. Ich möchte nicht, dass er stirbt."
"Ich auch", sagte sie.
"Falls sie dich fragen, ob sie die Geräte abstellen sollen, sag nein."
"Sie fragen das sicher nicht."
"Falls doch."
"Und was machen wir, wenn er gelähmt bleibt?", sagte sie und fing wieder an zu weinen.
"Lieber gelähmt als tot.", erwiderte ich.
"Ich weiss nicht, ob das seine Wahl wäre."
“Genau”, antwortete ich. “Du weisst es nicht.”

Noch einige Jahre nach seinem Unfall glaubte mein Stiefvater, dass es irgendwo einen Heiler gab, der ihn aus dem Rollstuhl herausholen könnte. Schliesslich war sein Rückenmark nicht ganz getrennt. Zu jener Zeit kaufte meine Mutter einen alten Fiat 500 und machte die Autoprüfung. Nach seiner Rückkehr aus dem Rehabilitationszentrum fuhr sie ihn überall hin, auch zu Heilern die hunderte von Kilometern entfernt waren.
In der Zeit als Stiefvater im Krankenhaus lag, holte meine Mutter Anna endlich zu uns. Ohne ihn zu fragen. Obwohl wir uns in all den Jahren ein wenig von einander entfremdet hatten, war ich überglücklich sie endlich immer bei mir zu haben. Wir stritten nie. Wir liebten uns. Und wenn die Eltern weg waren, hiess es für uns – Party! Vor allem als wir in die Berufsschule kamen. Die Menge des servierten Alkohols und die Lautstärke der Musik an unseren Partys wurden bei unseren Freunden zu Messwerten einer guten Party definiert. Meine Mutter hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie uns oft und lange alleine liessen, aber das Bedürfnis, ihren Mann in seinem Kampf zu unterstützen, war grösser. So liess sie uns immer genug Geld zu Hause, damit es uns an nichts fehlte. Doch nach zwei Partys war unser Geld für Alkohol und Zigaretten verbraucht und dann hiess es sparen. In jener Zeit haben meine Schwester und ich gelernt, wie man mit Mehl, Wasser und Salz mehrere Tage überleben kann. Auch heute noch gibt mir das ein beruhigendes Gefühl. Mich kann keine Krise so schnell erschüttern. Wenigstens was das Essen anbelangt.
Doch bekanntlich hat alles mal ein Ende. Ohne Vorwarnung, von einem Tag auf den anderen, waren unsere wilden Zeiten vorbei. Mutter und Stiefvater kamen gerade von einer Reise zurück. Wie immer brachte ihn Mutter sofort ins Bett, damit er die Wirbelsäule entspannen kann. Dann kam sie zu uns in die Küche. Normalerweise erzählte sie gleich wie es war und was sie alles erlebt hatten. Doch dieses Mal sah sie nachdenklich aus.
"Das war die letzte Reise, denke ich", sagte sie.
"Was ist passiert?", fragten Anna und ich gleichzeitig.
"Der Arzt bei dem wir waren, ist ein richtiger Arzt mit zusätzlichen Naturheiler-Fähigkeiten. Er ist auf solche Fälle wie Radivoj spezialisiert. Er hat ihm gesagt, dass er sein Geld nicht mehr zum Fenster rausschmeissen sollte."
"Das hat er gesagt? So direkt ins Gesicht?" Anna war über so viel Rücksichtslosigkeit eines Arztes entsetzt.
"Wortwörtlich", antwortete Mutter. "Er hat gesagt ‘Radivoj, du wirst NIE MEHR laufen können. Akzeptiere es endlich. Dein Rückenmark ist kaputt, da nützen keine Massagen, warme Bäder oder Hefe-Kuren. Hör nicht auf die Scharlatane. Schmeiss dein Geld nicht zum Fenster raus.’"
"Und wie hat er reagiert?"
"Ruhig. Hat sich bedankt, und wir machten uns gleich auf den Weg nach Hause."
Wir drei sahen uns besorgt an. Bald wird uns ein rauer Wind entgegen wehen. Sein ganzes Leben war auf die Reisen zu den Heilern ausgerichtet. Das Scheitern war keine Option. Wie soll er jetzt weiter leben? Ohne diese Hoffnung. Ohne diesen Antrieb.
Doch wir hatten uns getäuscht. Und wie! Gleich am nächsten Tag fing er an Bücher zu lesen. Zuerst las er sich durch meine Geschichtsbücher durch. Über den Balkan und über die Entstehung von Jugoslawien. Dann fing er an Bücher zu kaufen. Ganze Editionen. Er las alles über politische Themen wie Kapitalismus, Kommunismus, Marxismus, Leninismus, Sozialismus. Bald wurde er zu einem glühenden Kommunisten. Jugoslawien war zwar ein sozialistischer Staat, aber die Kommunistische Partei war auch bei uns die einzige zugelassene Partei. Eigentlich war damals nicht aussergewöhnlich, ein überzeugter Kommunist zu sein. Das waren wir alle. Die Alten mit weniger Überzeugung, die Jungen mit mehr. Wir glaubten an unser System und unseren Staat. Auf der Welt gab es kein anderes Land, das die Arbeiterselbstverwaltung als Staatsform hatte. Auch hatten wir viel mehr Freiheiten als die Menschen in anderen kommunistischen Ländern. Dank dem, dass wir nicht zum Ostblock gehörten, durften wir auch das Land verlassen. Wir durften überall reisen. Das schätzten wir sehr und liebten unseren Präsidenten Tito dafür.
Bei meinem Stiefvater war die Begeisterung etwas übertrieben. Er wurde richtig obsessiv. In seinem Leben gab es nur noch Platz für den Kommunismus. Sogar "Das Kapital" von Marx und Engels las er, wobei ich mir nicht sicher bin, wieviel davon er wirklich verstanden hatte. Ich hatte das Buch für mich gekauft, doch nach kurzer Zeit gab ich auf, weil ich kein Wort davon verstand.
Wie die meisten Menschen die an etwas Höheres glauben, wollte auch mein Stiefvater den Kommunismus jedem beibringen. Er politisierte den ganzen Tag lang. Sobald er ein Opfer fand, versuchte er ihn zu bekehren.
"Wir haben die beste Staatsform die man sich vorstellen kann", pflegte er zu sagen. "Unser Staat ist einzigartig! Ein Arbeiterstaat! Das gibt es nirgendwo auf der Welt. Und was tun wir? Wir nutzen es aus. Jeder bedient sich wo er kann, aber was gibt man zurück? Nur das was man muss. Ihr habt keine Ahnung wie das im Kapitalismus geht. Dort gibt es keine garantierten Arbeitsplätze, keine freie Gesundheitsversorgung wie bei uns. Dort kann man nicht während der Kaffeepause nach Hause fahren, um mit der Frau zu frühstücken, oder einer privaten Angelegenheit nachzugehen."
Zu dem Pamphlet über die Einzigartigkeit unseres Staates gehörte gezwungenermassen auch die Schimpftirade über die Undankbarkeit des Volkes.
"Korruption und Bürokratie überall wo man hinschaut! Überall wird gelogen und betrogen von höchsten Stellen bis zu dem Fussvolk. Alle bedienen sich mit beiden Händen aber keiner denkt, dass man auch etwas zurückgeben sollte."
Es gab auch Themen, die sich aus Aktualitäten ergaben. Wie zum Beispiel sein Lieblingsthema "der dekadente Westen". Es ergab sich, als es bekannt wurde, dass westliche Länder temporäre Arbeitskräfte in den Branchen wie Landwirtschaft, Bau oder Tourismus suchten. Als einziges kommunistisches Land unterzeichnete Jugoslawien mit diversen westeuropäischen Ländern ein entsprechendes Abkommen, das die Ein- und Ausreise der Arbeitskräfte regeln sollte. Er sprach von nichts anderem, bezog sich dabei nicht auf ein einzelnes Land. Er benutzte für alle den gleichen Ausdruck "der Westen".
Bald mieden die Besucher unser Haus, weil sie wussten, ist man einmal drin, konnte man sich aus den Klauen meines Stiefvaters nicht mehr befreien. Der Rollstuhl-Bonus spielte mit. Sie hatten Mitleid mit ihm und liefen nicht einfach davon, wie sie es bei einem nicht Invaliden getan hätten.
Mutter und ich konnten nicht fliehen. Jeden Tag beim Mittagessen mussten wir seine politische Schule über uns ergehen lassen. Es fing meistens mit dem Satz an "Wie kann man nur in den Westen gehen? Wie kann man einen Staat, der uns so viel gibt, verraten? Sehen die nicht, dass dies ein Verrat an unsere Sache ist?"
Wir liessen ihn reden, stellten seine Meinung ja nie in Frage. Sonst würde die Rede noch viel länger dauern. Meine Mutter interessierte es eh nicht, was er zu sagen hatte, ich tat nur so, als ob es mich nicht interessierte, um ihn zu ärgern. Politisch war ich aber genau auf seiner Linie. Wenn ich auch nicht so fanatisch wie er war. Auch ich konnte nicht verstehen, dass unsere Landsleute in Scharen nach Deutschland oder in die Schweiz gingen.
"Dass der Westen dekadent ist, ist schon schlimm genug. Aber er beutet auch schamlos Menschen aus. Viel zu lange Arbeitszeiten, fast keine freien Tage, keine bezahlten Ferien. Eine Krankenversicherung gibt es nicht, man muss alles selbst bezahlen, wenn man krank ist. Genau dagegen haben wir im Zweiten Weltkrieg gekämpft! Und jetzt sieh uns an."
Da Mutter in der Kleiderfabrik arbeitete und die Schwester und ich zu Schule gingen, verbrachte er den grössten Teil des Tages allein zu Hause. An den Rollstuhl gefesselt. Damals gab es den Begriff "Behindertengerecht" noch nicht. Aber auch sonst waren die Gehsteige in unserer Stadt voller Löcher und mit einem Zimmerstuhl wäre er nicht weit gekommen. Am Vormittag las er die Tageszeitung von der ersten bis zur letzten Seite, inklusive die Anzeigen. Nachmittags hörte er sich patriotischen Sendungen im Radio an, abends schaute er fern, mit Vorliebe die Partisanenfilme aus dem Zweiten Weltkrieg, „Made in Jugoslavija“. Bevor ich mich in die unergründlichen Tiefen des Teenager Daseins verirrte, schaute ich gerne solche Filme gemeinsam mit ihm und Mutter an. So wurden wir immer wieder daran erinnert, wem wir das gute Leben im besten Land der Welt zu verdanken hatten.
"Wir haben die Kapitalisten zum Teufel geschickt, weil wir nicht mehr ausgebeutet werden wollten. Und nun schau dir die Leute an!", wiederholte er immer wieder.
Auch wenn ich nicht wie er das Bedürfnis hatte, jeden zu bekehren, glaubte auch ich, dass wir im besten Land der Welt lebten. Einem Land in dem die Sorge um die Menschen höher, als die um das Geld gewertet wurde. Einem Land in dem alle gleich waren. Nie werde ich mein Land verraten, schwor ich mir. Nie werde ich zu den Kapitalisten überlaufen!
(1) Ich, die Kommunistin 1973

"Anna hat für mich eine Stelle in der Schweiz gefunden!"
Wie eine Kriegserklärung schmetterte ich diese Worte meinem Stiefvater ins Gesicht. Sein Mund, der gerade die heisse Nudelsuppe schlürfte, blieb offen.
"Was hat sie?"
"Mir eine Stelle in der Schweiz gefunden!"
So muss sich Caesar gefühlt haben, als er Brutus unter seinen Attentätern erkannte, dachte ich, als meine Augen seinen begegneten. Nie hatte er gedacht, dass ausgerechnet ich zu den Kapitalisten überlaufen würde. Er kannte meine Einstellung. Die Loyalität zu unserem Staat war das Einzige, das uns wirklich verband.
"Ich habe gedacht, du gehst nicht zu den Kapitalisten", sagte er nach einer Weile. Dann tauchte er den Löffel wieder in den Teller mit der Suppe ein. Dabei bemühte er sich gleichgültig auszusehen.
"Hab’s mir anders überlegt."
"So plötzlich?"
"Ja. So plötzlich."
Nein, es war nicht so plötzlich. Schon eine Weile konnte die Liebe zu meinem Land die ewigen Streitereien meiner Eltern nicht mehr ausgleichen. Die stritten zwar nicht mehr so intensiv wie früher, dafür ständig. Sie stritten um alles. Manchmal waren es Banalitäten, die es nicht Wert waren, dass man sich darüber streitet.
Bevor Anna ein Jahr zuvor in die Schweiz ging, konnte ich mir nicht vorstellen, irgendwo anders als in Zrenjanin zu leben. Ich liebte die Stadt in der ich aufgewachsen war. Ich liebte das Gefühl dort zu Hause zu sein. In meiner Stadt kannte ich jede Strasse, jede Kreuzung, jeden Park, jedes Denkmal. Ich wusste wo es den besten Burek gab, die besten Cremeschnitten, die beste Limonade. Ich kannte jeden Pfad und jede wilde Badestelle am Ufer unseres Flusses, der sich gemächlich durch die Stadt schlängelte. Ich wusste welcher Laden über Mittag schloss und welcher nicht, wann würde die neue Schuh-Kollektion im "Borovo" eintreffen und ab wann die neuen Stoffe im "Tekstil" angeboten würden. Ja, ich liebte meine Stadt, und ich liebte das Gefühl der Vertrautheit, das mich in ihr stets begleitete. Ich dachte nie, dass ich je das Bedürfnis verspüren könnte, sie zu verlassen. An einem anderen Ort zu leben.
Der einzige Grund, den ich mir vorstellen konnte, meine Stadt zu verlassen, war meinen Freund Bata zu heiraten. Einen Jungen, der im Nachbardorf meiner Grosseltern lebte, und mit dem ich mich seit einigen Monaten traf. Aber Bata war noch nicht so weit. Und meine Eltern fühlten sich immer mehr wie ein Stein im Schuh. Auch schrieb mir Anna, dass dies, was der Stiefvater den ganzen Tag erzählte, ein Blödsinn war. Ihr gefiel es sehr gut in der Schweiz. Die Arbeit war nicht schwer, sie hatte regelmässig frei, und sein eigenes Geld zu verdienen, wäre eine grossartige Sache.
"Im Westen muss man arbeiten. Da gibt es keine Mama die einem alles macht", sagte er und führte den Löffel zu den Lippen. Die Nudeln schlugen über seine Wangen, als er die Suppe laut einschlürfte. Mit einem Küchentuch wischte er sich die Wangen ab und tauchte den Löffel wieder in den Teller ein.
Meinem Stiefvater zuzusehen, wie er Nudelsuppe ass, war ein Affront an den guten Geschmack. Ich fragte mich, warum er die Suppe so heiss, direkt vom Kochherd ass, wenn er so sehr schlürfen musste, um sich die Lippen und die Zunge nicht zu verbrennen. Und warum Mutter die Nudeln nicht zerkleinert, damit er sich nicht so sehr über den Teller beugen musste, weil sie sonst vom Löffel wieder runtergleiten würden.
"Woher willst du das wissen?", antwortete ich.
Einen Augenblick sah er mich erstaunt über den Tellerrand an. Mit einer Antwort hatte er wohl nicht gerechnet.
"Was wissen?", fragte er.
"Wie viel man dort arbeitet und wie man dort lebt. Du warst noch nie dort."
"Man muss nicht dort gewesen sein, um zu wissen wie Kapitalismus funktioniert."
"Wenn es dort so schlimm ist und hier so gut", sprach ich weiter. "Warum gehen dann so viele weg von hier?"
"Die alle sind geblendet von der westlichen Propaganda."
"Und warum kommen sie nicht zurück? Es zwingt sie niemand dort zu bleiben!"
"Wegen des Geldes! Die wollen all die teuren, neumodischen Dinge kaufen, die man in den amerikanischen Filmen sieht. Dafür nehmen sie alles in Kauf. Deine Schwester war stets die beste Schülerin. Und Jungkommunistin. Sie könnte hier eine Geschäftsführerin sein. Aber nein, sie geht lieber dorthin um Geschirr zu waschen. Weil sie dort mehr verdient. Damit sie sich all das unnütze Zeug kaufen kann, das die Jugend heute als absolut notwendig betrachtet."
Grundsätzlich hatte er Recht, aber ich hätte das natürlich nie zugegeben. Wie ich, hatte auch meine Schwester die Berufsmatura abgeschlossen. Wir beide hätten irgendwann gute Jobs in Jugoslawien bekommen.
"Das werde ich nie verstehen.", sagte er nach einer Pause.
Als meine Schwester gegangen war, konnte ich es auch nicht verstehen. Der Westen war ein ideologischer Feind. Man verkauft seine Überzeugung nicht für ein paar Franken. Aber in mir musste noch irgendeine undichte Stelle gewesen sein, die von der Propagandamaschinerie des Kommunismus übersehen wurde.
Die Vorstellung, ein unabhängiges Leben weit von meinen Eltern zu leben, war mehr als verlockend.
"Und womit willst du den Pass und die Reise bezahlen?", fragte er spöttisch.
Soweit hatte ich mir die Sache noch nicht überlegt. Aber es wurde mir in diesem Augenblick klar, dass er es nicht finanzieren würde. Aus Prinzip nicht.
"Auch wirst du warten müssen bis du volljährig bist. Wir geben dir keine Unterschrift für den Pass."
Das hatte ich mir auch nicht überlegt, dass ich als Minderjährige die Erlaubnis meiner Eltern benötigte, um einen Pass zu beantragen. Ich musste also noch ein halbes Jahr warten, bis ich achtzehn werde. Das war ja nicht so schlimm. Immerhin musste ich noch das Geld für die Reise beschaffen. Meine Schwester hatte auch eine temporäre Arbeit angenommen, um das Geld für die Reise in die Schweiz zu verdienen. Sie hatte Stiefvater nicht einmal gefragt, ob er es bezahlen würde. Sie hatte den Stolz von unserer Mutter geerbt. Für mich hingegen war es selbstverständlich, dass die Eltern alles bezahlten. Das war ihre Pflicht, dachte ich. Ich streckte die Hand aus und das Geld kam.
"Wir könnten dir das Geld geben", sagte meine Grossmutter als ich ihr von diesem Gespräch erzählte.
Im Gegensatz zu den Eltern die mir auf die Nerven gingen, liebte ich meine Grosseltern immer noch sehr. Und sie liebten mich. Sie hätten alles für mich getan. In diesem Fall hätten sie sogar ihrem Schwiegersohn zusätzlich einen Strich durch die Rechnung ziehen können. Doch sie waren Bauern. Ihr Geld war schwer verdientes Geld. Ich wollte nicht, dass sie es für diese Sache ausgeben, zumal ich selbst noch nicht wusste, ob ich sie wirklich durchziehen würde.
"Das ist lieb", antwortete ich, "aber ich weiss nicht, ob ich euch das Geld je zurückgeben kann. Deshalb möchte ich es lieber selbst verdienen."
"In der Landwirtschaftlichen Genossenschaft kann man als Tagelöhner arbeiten", mischte sich mein Grossvater in das Gespräch ein.
"Ja?", fragte ich anstandshalber. Es machte mich überhaupt nicht an, auf dem Feld zu arbeiten. Mir reichte es, dass ich ab und zu meinen Grosseltern helfen musste.
"Man verdient recht gut, habe ich gehört", sagte er.
"Ach ja?" Das war schon interessanter.
"Kann ich das überhaupt?", fragte ich.
"Sie zeigen dir schon was du machen musst. Und du kannst jederzeit aufhören, wenn es dir nicht gefällt."
Das war gut. Keine Verpflichtung. Kannst jederzeit aufhören. Und meine Eltern müssten es gar nicht erfahren, falls es mir zu anstrengend werden sollte. Mutters "Ich wusste, dass du zu faul dafür bist", wollte ich mir auf keinen Fall anhören müssen.
"Wo kann ich mich melden?", fragte ich.
"Nirgendwo. Du gehst ins Zentrum und stellst dich zu den anderen hin."
"Zu welchen anderen?"
"Eben zu denen die auch dort warten."
"Und wie erkenne ich sie?"
"Am Morgen um sechs wartet sonst niemand dort."
"Am Morgen um sechs?" So früh aufgestanden war ich in meinem Leben nie! "Ist so früh schon hell?"
Grossvater lachte. "Bis ihr auf dem Feld seid, bestimmt."
(1) Unser Haus in Zrenjanin

(2) Meine Eltern in den 80-ern

Bereits am nächsten Morgen wartete ich im Dorfzentrum mit anderen Arbeitswilligen auf den Traktor, der uns abholen sollte. Das Dorf erwachte nur langsam. Hie und da fuhr ein Pferdegespann oder ein Traktor vorbei. Es roch nach Schweineställen, Misthaufen und Diesel. Ich fröstelte. Es war kühl für Juni. Hätte ich nur auf meine Grossmutter gehört und einen Pullover mitgenommen! Manchmal sollte man doch auf die Alten hören. Noch eine ganze Weile wird die Sonne brauchen, um den Morgennebel aus dem Weg zu räumen.
Mein Grossvater hat mir angeraten, mich vorzudrängen, falls viele warten sollten.
"Sobald der Traktoranhänger voll ist, fährt er los", sagte er.
Vordrängen! Wie soll ich, ein mageres Mädchen aus der Stadt, mit den kräftigen Landarbeitern um den Platz kämpfen?
Verstohlen beobachtete ich die Menschen um mich herum. Müde, ausgelaugte Gesichter. Eine etwas ältere, ungepflegte Frau, mit den Händen eines Bauarbeiters zerdrückte mit dem Fuss bereits ihre dritte Zigarette im Strassenstaub. Dabei hustete sie schrecklich und spuckte den grässlichen Auswurf auf den Boden. Ein grosser, junger Mann sah mich genau und ohne Hemmungen an. Seine blutunterlaufenen Augen verrieten einen mit Alkohol beladenen Vorabend. Ich fühlte mich, als ob ich von einem anderen Planeten wäre.
Was habe ich mit diesen Leuten zu tun?, fragte ich mich, während das Unbehagen in mir stieg. Ich bereute es bereits, dass ich mich auf diese Sache eingelassen hatte. Mein Stolz liess aber nicht zu, nach Hause zu gehen, ohne wenigstens versucht zu haben.
"Die Bushaltestelle ist dort", sagte plötzlich der Mann mit den blutuntergelaufenen Augen. Er zeigte auf die andere Strassenseite. Alle sahen mich an. Ich fühlte wie mein Gesicht purpurrot wurde.
"Ich warte nicht auf den Bus", antwortete ich schroff. Dabei montierte ich meinen finstersten Gesichtsausdruck.
"Wirklich?" Er sah mich ungläubig an. "Du willst aufs Feld?"
"Ja.", antwortete ich steif.
"Du siehst nicht aus, als ob du je etwas gearbeitet hättest." Er zeigte auf meine Hände. "Die Nägel werden den Tag nicht überstehen."
Ich hörte wie jemand kichert. Doch bevor ich etwas antworten konnte, wurden alle unruhig. Ein Traktor nahte. Als ich die kleine Ladefläche sah, wusste ich, dass nicht alle einen Platz bekommen werden. Das Fahrzeug hielt an. Ein unglaubliches Gedränge entstand. Ich wurde buchstäblich überrannt von Arbeitswilligen bei denen es wahrscheinlich um mehr ging, als wie bei mir um ihren Kopf durchzusetzen. Ich fasste meinen ganzen Mut zusammen und schluckte den Stolz herunter. Schliesslich war ich jetzt hier. Schon für das Aufstehen mitten in der Nacht sollte ich belohnt werden.
Mag ich damals mager gewesen sein, aber schwach war ich nicht. Ich stiess mit den Ellenbögen links und rechts und liess mich von der Masse ziehen. Als ich beim Traktor angekommen war, fasste ich den Seitenrand der Ladefläche und schwang mich hoch, vorbei an den älteren Semestern, die warten mussten bis sie über die Metalltreppe steigen konnten. Nicht ohne Schadenfreude stellte ich fest, dass der Mann, der mich angesprochen hatte, keinen Platz bekam. Die hustende und spuckende Frau schon.
Wir fuhren ungefähr eine halbe Stunde, bis wir das Feld der Landwirtschaftlichen Genossenschaft erreicht hatten. Nach dem Aussteigen wurden unsere Namen aufgeschrieben und die Arbeit erklärt. Wir arbeiteten im Akkord, wurde uns gesagt. Der Massstab war die Reihe. Je nachdem wie viele Reihen man geschafft hat, bekam man mehr oder weniger Geld ausbezahlt. Jemand drückte mir eine Hacke in die Hand. Ich erinnere mich nicht mehr genau, aber ich glaube es war Mais den wir vom Unkraut befreien mussten.
"Dein erstes Mal?", fragte die hustende Frau. Sie wurde direkt in die Reihe neben mir eingeteilt.
"In der Landwirtschaftlichen Genossenschaft schon", antwortete ich. "Aber gehackt habe ich schon bei meinen Grosseltern auf dem Feld."
"Mein Name ist Dana", sagte sie und hielt mir ihre Zigarettenschachtel hin. Sie rauchte die gleiche Marke wie ich, "Filter 57".
"Ich bin Katica", sagte ich und nahm eine Zigarette aus der Packung.
Sie erklärte mir wie eine Hacke richtig eingesetzt werden sollte, damit man einerseits schneller vorwärts kam, andrerseits damit die Aufsicht nicht zu meckern hatte.
"Wir haben heute Nenad als Brigadier", sagte sie und zeigte auf den Mann der mir vorhin die Hacke gab. "Ein richtiger Bastard. Er sieht jeden Fehler und zieht ihn dir vom Lohn ab."
"Welchen Fehler?", fragte ich. Ich gab meiner Stimme bewusst einen sarkastischen Ton. "Was kann man da falsch machen?"
"Das wirst du noch sehen", antwortete sie.
Ich war kein verwöhntes Kind. Ich musste manchmal auch zu Hause schwere körperliche Arbeiten verrichten. Vor allem als wir unser Haus gebaut hatten. Da musste jeder mithelfen, alt oder jung, stark oder schwach. Doch eine solche Arbeit hatte ich noch nie gemacht! Das Unkraut sass tief im ausgetrockneten Boden, schon beim ersten Versuch wusste ich was Dana mit "falsch machen" gemeint hatte. Man musste das Unkraut immer mit den Wurzeln herausziehen, damit es nicht sofort wieder spriesst. Damit man die gesamte Pflanze herausziehen kann, musste man sowohl den grünen Teil, als auch die Wurzel mit Fingern halten und sie dann mit kreisenden Bewegungen herausziehen. Falls die Pflanze feststeckte, nahm man die Hacke zu Hilfe und lockerte den Boden um sie herum. Manches Unkraut sass so tief, dass man mehrere Minuten benötigte, um es komplett herauszuziehen. Das ging auf Kosten der Zeit, das heisst man kam nicht so schnell voran und verdiente somit automatisch weniger. Für mich als Anfänger war nicht nur die Technik das Problem. Den ganzen Tag gebeugt oder auf den Knien die schier unendlichen Reihen zu durchlaufen, war eine regelrechte Tortur.
Ich weiss nicht, ob ich die Arbeit ohne Dana geschafft hätte. Anfänglich stand mir meine Abneigung gegen ihr Aussehen im Weg. Ihr Husten und das Spucken ekelten mich an. Aber diese Frau schaffte es innerhalb kürzester Zeit mein Herz zu erobern. Sie war einfach faszinierend. Mit ihrer tiefen Raucherstimme erzählte sie die schlüpfrigsten und doppeldeutigsten Witze, die ich je gehört hatte, als ob sie dafür auch im Akkord bezahlt gewesen wäre. Und obwohl ihr Benehmen ziemlich peinlich und ihre Sprache schrecklich obszön war, bewunderte ich sie. Denn sie schien zu wissen was sie sagt und wie sie auf die anderen wirkte, aber das war ihr offenbar egal.
Als der Brigadier zu uns kam, um meine Arbeitsweise zu inspizieren, jagte sie ihn regelrecht fort.
"Ziehe Leine", schnauzte sie ihn an. "Ich sorge dafür, dass Katica die Arbeit richtig macht!"
"Seit wann bist du der Brigadier?", kläffte er zurück.
"Du hast doch Augen, du Wichser", schimpfte sie. "Du siehst, dass ich sie angelernt habe."
"Ich will es trotzdem sehen."
"Was willst du sehen? Ihren Arsch? Du Perverser!"
"Jetzt reichts!" Er schrie jetzt fast.
Sie stand auf und ging auf ihn zu. Dann öffnete sie die Knöpfe ihrer Bluse. Ihre Brüste quollen aus ihrem Büstenhalter.
"Das kannst du sehen, du alter Sack!" Dann hob sie ihren breiten Rock hoch. "Oder das!"
Der Brigadier sah zur Seite. "Blödes Weib", schimpfte er und ging weiter.
"Perversling!", rief sie ihm hinterher. Dann sah sie mich an. "Er versucht immer bei hübschen Mädchen den starken Mann zu markieren. Er hätte jetzt etliches gefunden was du nicht gut gemacht hast. Und am Abend hätte er dann grosszügig darüber weggeschaut. Und du wärest ihm dann zu Dank verpflichtet."
"Hast du keine Angst, dass er dich rausschmeisst?"
"Das kann er gar nicht! Er ist nur ein kleiner Wurm der sich wichtig macht."
So selbstbewusst wollte ich auch sein. Nach aussen markierte ich immer die Coole, aber tief in meinem Inneren war ich unsicher und verletzlich. Und stets bedacht den anderen zu gefallen. Als wir am Abend auf dem Rückweg ins Dorf waren, setzte ich mich auf dem Traktor neben Dana.
"Mädchen, ich hätte nie gedacht, dass du den ganzen Tag durchstehst", plauderte sie darauf los, als sie meine Hände mit den drei abgebrochenen Nägeln und den Blasen auf den Handflächen sah. "Alle Achtung Kleines!"
Ein grösseres Kompliment hätte mir niemand machen können. Diese ungepflegte, vorlaute, vom Leben gezeichnete Frau fand ein Mädchen wie mich grossartig. Ich war mächtig stolz! Nun wusste ich, dass ich auch im Westen überleben werde. Ich war nicht faul. Ich brauchte nur die richtige Motivation.

Ich erinnere mich genau an jenen Augenblick, als ich am 4. Juni 1975 zum ersten Mal den schweizerischen Boden betrat. Die Bahnhofsuhr in Buchs zeigte halb acht. Ein unfreundlicher, kalter Wind, blies mir feuchte Luft ins Gesicht. In meiner dünnen Sommerjacke fühlte sich Juni wie Februar an. Ich sah mich um. In welche Richtung sollte ich gehen? Die Menschen die ich im Zug kennengelernt hatte, und die versprachen, mir am Bahnhof zu helfen, waren plötzlich verschwunden. Die Zweckgemeinschaft in der wir die letzten 24 Stunden gemeinsam verbrachten, schien ihre Gültigkeit bereits verloren zu haben. Jeder folgte seinem eigenen Weg, seinem eigenen Schicksal. Meine Gedanken fühlten sich wie ein Karussell an. Die Angst vor Unbekanntem sass mir im Nacken. Mit meinem ersten Schritt in diesem Neuland wurde die freudige Erwartung, mit der ich gestern in Belgrad losfuhr, in den kalten Betonboden unter meinen Füssen gestampft.
Irgendwo roch es nach frischem Brot. Mein Magen knurrte. Doch die wenigen Dinars und die 50 Schweizerfranken in meinem Portemonnaie durfte ich nicht antasten, sie waren als Notgroschen gedacht. Eine unerklärliche Traurigkeit wälzte auch den letzten positiven Gedanken in mir nieder. Eigentlich hätte ich glücklich sein sollen. Ich wollte weg von zu Hause. Ich wollte alles hinter mir lassen und neu anfangen. Nun war ich an meinem Ziel angekommen. Warum fühlte sich dann alles so elend an?
Hektisch bewegte sich die gähnende, hustende und schwätzende Menschenmenge um mich herum in Richtung Ausgang. Unzählige Koffer, Reisetaschen und Plastiksäcke bewegten sich mit. Mit meiner Reisetasche in der Hand machte auch ich mich auf den Weg. Am Ende des Gehsteigs sah ich den ersten Wegweiser.
"Sanitätskontrolle."
Dort musste ich hin. Dort sollte ich auch meinen Pass bekommen, der mir im Zug von einem Polizeibeamten abgenommen wurde.
"Warum nehmen sie uns die Pässe weg?", fragte ich eine Mitreisende. Den Beamten konnte ich nicht fragen. Ich sprach kein Wort Deutsch.
"Damit keiner davonläuft."
"Wovon?"
"Von der Sanitätskontrolle."
"Sanitätskontrolle?"
Ich hatte keine Ahnung was mich in der Schweiz erwartete. Meine Schwester hatte mir den Arbeitsvertrag organisiert und per Post zur Unterschrift gesendet. Das Visum hatte ich in Belgrad bei der Schweizerbotschaft erhalten. Ich kannte nur die Adresse des Hotels in dem ich arbeiten sollte. Von einer Sanitätskontrolle hatte niemand etwas gesagt.
"Lungen durchleuchten!", erklärte die Frau weiter. "Um zu sehen, ob jemand Tuberkulose hat."
"Ach so! Nur die Lungen?"
"Ja. Die Schweizer fürchten die Tuberkulose mehr als alles andere."
"Und wenn sie jemand hat?"
"Darf nicht rein."
"Muss man das jedes Mal bei der Einreise machen?"
"Solange du Saisonnier bist, ja."
"Wo findet die Kontrolle statt? Wie komme ich dorthin?"
"Folge einfach den Wegweisern. Oder den Anderen. Alle die hier aussteigen müssen dorthin."
Der Untersuch, nach Geschlechtern getrennt, wurde in einem Gebäude mit grossen Räumen durchgeführt, wahrscheinlich war es ein Schulhaus. Etwa 100 Frauen warteten bereits, als ich in den uns zugeteilten Raum kam. "Wie Rindviecher vor der Schlacht!", schoss mir durch den Kopf. Sie warteten ohne zu murren, oder sich zu beklagen. Da musste man durch. Es gab kein Entrinnen. Ich hatte keine Lust, mich mit den anderen zu unterhalten und suchte einen Platz am Fenster. So konnte ich wenigsten nach draussen sehen. Die Traurigkeit hing immer noch wie eine Klette an mir. Noch nie in meinem Leben hatte ich mich so bedeutungslos gefühlt. So ohnmächtig. Hier in dieser Menschenmasse zu warten war so erniedrigend! Ich war ein Niemand in einer Masse anderer Niemands.
Das geht vorbei, tröstete ich mich selbst. Du fängst ein neues Leben an. Bald wirst du dich wunderbar fühlen. Dass das Gefühl ein Niemand zu sein noch eine ganze Weile mein ständiger Begleiter in der Schweiz sein wird, konnte ich mir an jenem Tag nicht im Entferntesten vorstellen.
Die Zeit verging kriechend. Ich blätterte in der Zeitschrift, die ich in Belgrad vor der Abreise gekauft hatte. Ausser unzähliger Lebensgeschichten die mich nicht interessierten, gab es darin nichts Gescheites zu lesen. Ab und zu nickte ich ein. Die Welt schien still zu stehen. Nur wenn Namen aufgerufen wurden, kam Leben in die gelangweilte Menge. Langsam leerte sich der Raum. Irgendwann wurde auch mein Name gerufen, gemeinsam mit etwa zwanzig anderen Frauen.
An der Tür zum nächsten Raum schlug uns der Geruch unserer Vorgängerinnen entgegen. Der Geruch der verschwitzten Körper, billigen Deodorants und eines nach Caramel riechenden Parfüms, das bei älteren Frauen gerade in Mode war.
An einem Tisch sassen zwei Polizeibeamtinnen. Vor ihnen mehrere Kartonschachteln vollgefüllt mit Pässen. Sie wiederholten immer wieder etwas, das ich nicht verstand. Die Frauen um mich fingen an ihre Jacken, Blusen und anschliessend die Büstenhalter auszuziehen.
"Müssen wir uns ausziehen?", fragte ich entsetzt die Frau neben mir.
"Ja."
"Jetzt schon?"
"Ja. Damit es beim Röntgen schneller geht."
Während sie mit mir sprach, zog sie sich aus. Ihre Riesenbrüste standen plötzlich direkt vor meinen Augen. Weiss wie Milch, mit grossen dunklen Brustwarzenhöfen. Ich wusste nicht wo hinsehen. Noch nie hatte ich eine nackte Frau gesehen, ausser mich selbst natürlich. Nicht einmal meine Mutter. Meine Grossmutter hatte ich nicht ein einziges Mal ohne Kopftuch gesehen, geschwiege denn ohne Kleider. Nun zog auch ich mich aus. Ich versuchte es so zu tun, als ob es mir nichts ausmachte, obwohl ich vor Scham am liebsten in den Boden versunken wäre.
Das Warten zog sich auch hier hin. Der Raum heizte sich auf. Die Schweissdrüsen liefen auf Hochtouren. Ich staunte, wie selbstsicher die meisten Frauen waren. Sie verdeckten ihre Brüste nicht mit den Händen wie ich. Sie unterhielten sich lebhaft miteinander, während ihre Symbole der Weiblichkeit in allen Formen und Körbchen-Grössen, der Schwerkraft trotzend, oder von ihr angezogen, ohne Hemmungen zur Schau gestellt wurden. Je grösser die Brüste, umso angeberischer wurden sie präsentiert. Da konnte ich mit meiner Miniausführung nicht mithalten.
Der Untersuch selbst ging schnell voran, so fanden wir uns bald alle, von Schildern geleitet, auf den Perrons wieder. Niemand hatte die Tuberkulose. Die Pässe hatten wir gleich nach dem Untersuch erhalten. Mehrere Helfer erklärten uns, wer welchen Zug für die Weiterreise nehmen sollte. Ich musste bis nach Chur fahren und dann den Bus nach Parpan nehmen, sagte eine Serbokroatisch sprechende Frau zu mir, als ich sie danach fragte.
"Und wo ist der Bus-Bahnhof?"
"Gleich neben dem Bahnhof. Kannst nicht verfehlen."
Kannst nicht verfehlen! Als ich in Chur ausstieg, sah ich nirgendwo einen Bus-Bahnhof. Ich ging auf die Strasse und schaute mich um. Nur die Post gab es dort. Einige gelbe, mit "PTT" angeschrieben, busähnliche Wagen, standen vor dem Gebäude. Mich wunderte es, dass die Schweizer für ihre Post Wagen mit Fenstern benutzten. Nie im Leben wäre mir in den Sinn gekommen, dass die Post auch Menschen transportierte! Da es Mittagszeit war, stieg auch niemand in die Postautos ein, was für mich ein Hinweis in diese Richtung gewesen wäre, muss ich zur Rettung meiner Ehre noch sagen. Ich lief einige Male um den Bahnhof. Sah mir jedes Gebäude genau an. Doch nichts glich nur annähernd einem Bus-Bahnhof. Langsam machte ich mir Sorgen. Um 14 Uhr fuhr mein Bus. Bis dann müsste ich diesen verdammten Bahnhof gefunden haben! Es war bereits 13 Uhr. Die Vorstellung, dass ich 1500 km von zu Hause entfernt war und von niemanden Hilfe erwarten konnte, liess langsam Panik in mir aufsteigen. Was soll ich bloss tun?, flüsterte ich immer wieder vor mich hin. Was soll ich bloss tun?
Um halb zwei sass ich immer noch auf einer Bank vor dem Bahnhof Chur und wusste nicht weiter. Die paar deutschen Wörter, die ich vor meiner Abreise gelernt hatte, reichten weder um jemanden nach dem Bus-Bahnhof zu fragen, noch seine eventuelle Antwort zu verstehen. Meine einzige Chance war jemanden zu finden der meine Sprache sprach. Bestimmt waren auch andere mit dem gleichen Zug aus Buchs gekommen.
Die Menschen zogen an mir vorbei. Ich beobachtete sie. Hörte ihren Gesprächen zu. Doch weder meine Augen noch meine Ohren erkannten etwas Vertrautes. Nach einer Weile sah ich eine Gruppe Männer aus dem Bahnhof kommen. Das könnten Jugoslawen sein, dachte ich. Sie sahen einfach anders aus, als die Schweizer. Doch als sie näherkamen, hörte ich dass sie in einer mir unbekannten Sprache sprachen. Das kann nicht sein! Die Enttäuschung schnurrte mir die Kehle zu. Das kann nicht sein! Spontan entschloss ich mich, sie trotzdem anzusprechen. Vielleicht sprach jemand von ihnen meine Sprache. Ich stand auf und ging auf sie zu.
"Entschuldigung, spricht jemand von euch Serbokroatisch?", fragte ich.
"Wir alle sprechen Serbokroatisch!", antwortete ein älterer Mann.
"Gott sei Dank!" Ich schrie fast vor Glück. "Aber was redet ihr da für eine Sprache?", sagte ich während sich die Last, die mich kurz zuvor noch zu erdrücken drohte, in nichts auflöste.
"Albanisch", sagte der Mann. "Wir sind aus Kosovo."
Jugoslawien war ein Vielvölkerstaat. Die Brüderlichkeit und Einheit waren gross propagiert. Doch die reichten nicht bis nach Kosovo. Wir in Serbien hielten nicht viel von den Schiptaren, wie wir die Albaner bezeichneten. Sie wären ungebildet, primitiv und gefährlich, erzählte man uns. Sie praktizierten immer noch Blutrache. Doch die freundlichen Männer waren alles andere als gefährlich. Im Gegenteil. Sie waren nett, zuvorkommend und haben mir geholfen, das richtige Postauto zu nehmen. Auch die Fahrkarte haben sie für mich gekauft. Sie hatten mich gerettet. Ohne etwas dafür zu verlangen. Weil gute Menschen es so tun. Egal welcher Nation sie angehören, oder in welchem Land sie leben.

"Wir waren auf die Schweiz nicht vorbereitet", hat kürzlich eine Bekannte gesagt, als wir über unsere Anfänge in der Schweiz sprachen. Das ist genau die richtige Bezeichnung für meine ersten Schritte in der Schweiz. Ich war auf die Schweiz nicht vorbereitet.
Das erste Handicap war die Sprache. Ich verstand die Leute nicht und sie mich nicht. Ständig machte ich etwas falsch, weil ich nicht verstand was von mir erwartet wurde. Meine Chefin hatte dafür kein Verständnis. "Deutsch lernen", war ihr Standardspruch, wenn ich mal wieder was verbockt hatte und mich mit "Nix verstehen" zu rechtfertigen versuchte. Doch wie sollte ich Deutsch lernen, wenn ich nichts anderes als die Küche und mein Zimmer im Hotel Stätzerhorn kannte?
Das Zimmer teilte ich mit Zorica, einem Mädchen aus meiner Heimat. Sie war Mazedonierin. Wie die Albaner, die mir in Chur geholfen hatten, sprach auch sie eine Sprache, die ich nicht verstand. Doch mit Hilfe von Händen und dem Russisch das wir beide in der Schule gelernt hatten, konnten wir einigermassen kommunizieren. Nach langen Arbeitstagen sassen wir in unserem von Zorica hübsch eingerichteten Zimmer im Dachgeschoss des Hotels, sie stickte Tischtücher und Servietten für Ihre Mitgift, ich sah ihr zu und rauchte. Dazu erzählten wir uns gegenseitig unsere Lebensgeschichten. So gut wie wir es konnten. Sie kam in die Schweiz um etwas Geld für ihre Mitgift zu verdienen, da sie bereits einem Jungen aus ihrem Dorf versprochen war, aber sie noch mit der Heirat warten mussten. Warum sie warten mussten, erinnere ich mich nicht mehr.
Zorica war die erste, die meine felsenfeste Begeisterung für den Jugoslawischen Sozialismus ins Wanken brachte. Je besser ich sie kannte, umso weniger konnte ich verstehen wie das von mir so bewunderte System eine junge Frau hervorbringen konnte, die nichts anderes im Kopf hatte, als zu heiraten. Man kann im Nachhinein über den Sozialismus sagen was man will, aber die Frauen-Emanzipation war dort grossgeschrieben. Im Gegensatz zu der Schweiz die das Frauenstimmrecht erst 1975 eingeführt hatte, konnten Jugoslawische Frauen schon 1948 an die Urne gehen. Obwohl sie, um ehrlich zu sein, danach gar nicht verlangten, hat mir meine Grossmutter mal erzählt. Aber sie gingen. Alle. Es wurde von der Obrigkeit nicht gern gesehen, wenn man als Frau seiner Wahlpflicht nicht nachkam. Ja, sie wurden zu der Emanzipation gezwungen, aber manchmal heiligt der Zweck die Mittel. Schon die nächste Generation profitierte davon, dass Frauen überall mitreden durften.
Also wie war es denn möglich, dass Zorica nicht einmal die offizielle jugoslawische Landessprache sprach? Und die Emanzipation nicht einmal als Wort kannte? Es sollte noch eine ganze Weile vergehen, bis ich begreifen sollte, dass im Sozialismus der Spruch gelebt wurde: "Wie näher man am Feuer steht, umso wärmer ist es." Kosovo und Mazedonien waren weit, weit weg vom Belgrader Feuer - in jeder Beziehung...
Das zweite, das meinen Glauben an den Sozialismus zu erschüttern begann, war der Kapitalismus selbst. Zumindest der, den man in der Schweiz praktizierte. In der Schule lehrten sie uns, dass der Sozialismus die einzige Staatsform ist, die sich um die Menschen und nicht um das Geld kümmerte. "Im Kapitalismus arbeitet man den ganzen Tag, hat keine Sozialleistungen und keine Freizeit. Von bezahlten Ferien ganz zu schweigen. Die Löhne wären unter jedem Niveau. Politisch würden die Leute absichtlich dumm gehalten, damit sie sich nicht zu wehren wagten, beziehungsweise gar nicht merkten, dass sie ausgebeutet würden."
Von wegen! Ich staunte nicht schlecht, dass ich jede Woche einen freien Tag bekam und 1.66 Ferientage pro Monat zu gut hatte. Eine Krankenversicherung war auf meinem Lohnzettel auch ausgewiesen. Ich verdiente zwar nur die Hälfte dessen, was ein Schweizer in meiner Stellung verdient hätte, aber das Essen und das Wohnen hatten wir vom Arbeitgeber gratis. Abgesehen davon, muss man ehrlich sagen, konnte ich weder die Sprache, noch war ich für diese Art Arbeit ausgebildet. Da hinkte unsere Regierung wohl mit ihren Informationen hundert Jahre hinterher, dachte ich widerwillig. Dass dies kein Unwissen, sondern Propaganda war, dämmerte mir erst viel später.
Doch nicht nur die Sprache und die Erschütterung meiner ideologischen Grundsäulen machten mir zu schaffen. Dass ich in der Schweiz ein Niemand zu sein schien, nagte auch unerbittlich an meinem Selbstvertrauen. Meine Familie gehörte in Jugoslawien zum besseren Mittelstand. Unsere Vorfahren waren sogar adlig. Wenn ich in meinem Heimatort durch die Strasse ging, wusste man wer ich war und zu welcher Familie ich gehörte. Hier war ich ein Niemand. Eine Ausländerin. Über die man sich lustig machte, weil sie der einheimischen Sprache nicht mächtig war. Ich bildete mir das nicht ein. Ich erlebte immer wieder Situationen, die mir das bewusst machten. Ein Beispiel möchte ich hier erwähnen. Nicht weil es damals eine grosse Bedeutung hatte, sondern weil es mich bis heute, 44 Jahre später, verfolgt.
Meine Chefin war eine arrogante Dame in den Wechseljahren, die eine offensichtliche Aversion gegen mich hatte. Sie benahm sich stets korrekt, aber sie liess keine Gelegenheit aus, mich zu kritisieren oder zu belehren. Da wir zusammen in der Küche arbeiteten, war ich ständig unter ihrer Aufsicht. Ich erinnere mich nicht, dass ich je etwas getan hatte, ohne eine Kritik von ihr kassiert zu haben. Dazu war sie auch sehr launisch. Da ich inzwischen die Wechseljahre hinter mir habe, weiss ich auch warum. Doch damals fühlte ich mich durch ihre Laune regelrecht schikaniert. Wenn sie einen schlechten Tag hatte, war ihre Kritik scharf, manchmal sogar verletzend. Bei guten Tagen nur belehrend. Wie an jenem Tag als sie mir ein Tagesdessert anbot, das nach dem Mittagservice übriggeblieben war.
"Katica, wollen Sie?", fragte sie mich und hielt mir das Dessert hin. Obwohl ich es gerne genommen hätte, sagte ich nicht "Ja". Bei uns in Jugoslawien war es üblich, dass man zuerst so tut, als ob man es nicht wollte, in der Erwartung, dass der Anbieter seine Frage wiederholen würde. "Nicht, dass die Leute denken, dass du zu Hause zu wenig bekommst", erklärte mir mein Grossvater diesen eigenartigen Brauch.
"Nein.", sagte ich. "Fressen Sie."
Heute weiss ich, wie sich das damals in ihren Ohren angehört hatte. Dabei wollte sie einmal nett zu mir sein. Es ist mir immer noch peinlich, wenn ich daran denke. Ich wollte aber nur höflich sein, und auf das Dessert verzichten, damit sie es essen durfte. Ich wollte sie damit ehren. So wie es bei uns zu Hause üblich war, mit älteren Leuten zu reden. Da ich das falsche Wort dazu benutzt hatte, lag natürlich an meinem miserablen Deutsch. Dass man sich in der Schweiz für alles tausendfach bedanken musste und deshalb hier ein "Nein, Danke." angebracht gewesen wäre, wusste ich auch noch nicht.
Ohne die kleinste Regung sagte sie: "Schweine fressen, Menschen essen."
Peng! Ein weiterer Schuss auf mein Selbstvertrauen!
Beim Mittagessen im Personalraum erzählte ich Zorica mein peinliches Erlebnis. Eine junge Schweizerin die im Service arbeitete und bekannt für ihre Abneigung gegen Ausländer war, lachte als ich sagte «Schweine fressen, Menschen essen.» Selbstgefällig dichtete sie noch etwas dazu. Plötzlich schauten mich alle an.
"Was?", sprach ich sie an. "Ich nix verstehen."
"Ich nix verstehen!", äffte sie mich nach. "Alle Jugoslawen sind Schweine, habe ich gesagt", sagte sie.
Nun verstand ich es. Der ganze Frust der vergangenen Wochen bäumte sich in mir hoch. Wie kann diese Rotzgöre es wagen so was zu sagen? Was gibt ihr das Recht, über mich zu urteilen? Meine Familie hat eine gute Herkunft. Mein Grossvater ist ein sehr geachteter Mann in seinem Dorf. Ich habe Berufsmatura gemacht im Gegensatz zu ihr, die servierte, weil sie sonst nichts gelernt hatte. Die wagte es über mich und mein Land zu urteilen! Mein Herz schlug rasant, mein Körper zitterte vor Aufregung. Ich stand auf und ging langsam auf sie zu. Die Ohrfeige mit dem Handrücken traf sie wie ein Hammer. Sie sah mich ungläubig an und fasste sich an die Wange. Einen Augenblick erkannte ich blanke Angst in ihren Augen. Ein tiefes Gefühl der Genugtuung übermannte mich. Doch schon im nächsten Augenblick sprang sie auf und riss mich an den Haaren. Auch ich griff nach ihren. Ihr keuchender Atem streifte mein Ohr. Ein kalter Schauer ging meinen Rücken hinunter. Ich bereute bereits was geschehen war. Doch es blieb mir nichts anderes übrig als weiter zu kämpfen, die Krallen der kleinen Wildkatze steckten bereits in meinem Oberarm. Zum Glück griffen die Anwesenden ein und rissen uns auseinander. Gott sei Dank! Mein Frust hatte mich zu etwas hingerissen, was ich nicht mehr im Griff hatte. Was war in mich hingefahren? Wer hatte mich zum Retter der Jugoslawischen Ehre ernannt? Ich hatte nie zuvor einen Menschen geschlagen – später übrigens auch nicht. Das war das einzige Mal in meinem gesamten bisherigen Leben. Was stimmte mit mir nicht? Die Schweiz tat mir eindeutig nicht gut.
Nun hatte ich genug! Was meinten die Schweizer? Dass ich auf sie angewiesen war? Ich hatte es zu Hause viel schöner. Dort war ich ein Jemand. Hier ein Mensch ohne Persönlichkeit. Eine geduldete Fremde. Weil man billige Arbeitskräfte brauchte, damit die Reichen noch reicher werden. Ja! Ich hatte genug davon, nur geduldet zu sein. Ich entschloss mich, mein Visum nach Saisonende nicht mehr zu verlängern. Ich wollte definitiv nach Hause gehen.
Doch bis es so weit war, wollte ich noch Deutsch lernen. Um dieser Schnepfe aus dem Service und der Oberschnepfe aus der Küche meine Meinung sagen zu können, bevor ich dieses kalte Land für immer verlasse. 
(1) Mein Zimmer in Parpan GR 1975

Also gut – Deutsch lernen. Ich kaufte in Chur ein Lehrbuch Deutsch – Serbokroatisch. Stürzte mich auf die Grammatik, büffelte Wörter. Ich machte schnell Fortschritte. Theoretisch. In Wirklichkeit verstand ich immer noch nichts. Das Problem war, dass ich Hochdeutsch lernte aber rund um mich herum Schweizerdeutsch gesprochen wurde. Dazu kam, dass Deutsch für Slawische Völker eine ziemlich schwierige Sprache ist. Einerseits die Aussprache, anderseits die Fälle. Und die Artikel. Vor allem wenn sie zusammen mit Adjektiven auftreten. Auch ist das Geschlecht der Wörter nicht immer identisch mit den Wörtern in Serbokroatisch. Zum Beispiel das Wort Mädchen ist bei uns weiblich, nicht sächlich wie auf Deutsch. Das Bett und das Fenster sind männlich. Es gibt heute noch Wörter bei denen ich nachsehen muss, ob sie männlich oder sächlich sind, obwohl Deutsch für mich inzwischen wie eine Muttersprache ist. Denn wenn man den Artikel nicht kennt, hat man spätestens beim Akkusativ verloren. Deutsch war das Schwierigste, das ich je lernen musste. Die Regeln wären eigentlich einfach. Doch das Problem waren die Ausnahmen. Es gibt Regeln die man in zwei Zeilen erklären kann. Am Beipackzettel der Ausnahmen kann man sich jedoch die Zähne ausbeissen. Bis zu zwei A4 Seiten können die Ausnahmen füllen.
Irgendwann reichte mir das theoretische Büffeln nicht mehr. Ich hatte zwar einen grossen Wortschatz aber richtige Konversationen konnte ich immer noch nicht führen. Mir blieb nichts anders übrig, als den Kontakt mit den Schweizern zu suchen. Doch wie kommt man mit den Schweizern ins Gespräch, wenn man zu denen keinen Zugang hat?
"Vielleicht solltest du deine Zimmerstunde nicht immer im Zimmer verbringen", meinte Zorica, als ich mich darüber beklagte. (Falls jemand nicht weiss was Zimmerstunde ist: Das ist die Zeit nach dem Mittag- und vor dem Abend-Service. Die meisten Angestellten in den Hotels hatten in dieser Zeit eine, zwei Stunden frei.) Zorica ging oft während der Zimmerstunde spazieren. Ich blieb im Zimmer und schrieb Briefe an meinen Freund Bata oder an meine Grossmutter. Spazieren war nicht so mein Ding. Nicht zuletzt, weil ich immer Angst hatte von den Schweizern angesprochen zu werden. Ihre enttäuschten Blicke, wenn sie merken, dass ich eine Ausländerin bin, wollte ich mir nicht antun. Dass nicht alle Schweizer etwas gegen Ausländer hatten, wäre mir damals nicht in den Sinn gekommen. Meine Welt war ziemlich straff in schwarz und weiss, gut und schlecht eingeteilt.
"Komm doch mal mit mir spazieren", schlug Zorica vor.
Ich nahm ihr Angebot an. Schliesslich wollte ich Deutsch lernen. Und die Spaziergänge mit ihr hätten den Vorteil, dass ich so gleich als Ausländerin in Erscheinung treten würde. Sie arbeitete schon die zweite Saison in Parpan, viele Einheimische kannten sie bereits. So konnte ich sicher sein, dass jemand, der uns ansprach nichts gegen Ausländer hatte. Schon am ersten Tag stellte mir Zorica einen jungen Schweizer vor. Er lag im Liegestuhl im Garten des benachbarten Hotels Alpina und las ein Buch. Als er uns sah, stand er auf und kam auf uns zu. Keine ausgesprochene Schönheit, dachte ich. Aber sein Blick ist offen und sein Lächeln echt. Und die Figur lässt sich sehen. Schlank, fast drahtig war er.
"Das ist Hanspeter", sagte Zorica. "Er arbeitet als Koch in der Alpina." Dann sagte sie auf Deutsch: "Das meine Kollegin Katica."
"Du kannst zu mir Hampi sagen", sagte er und sah mich an. Arbeitest du auch im Stätzerhorn?"
"Ja."
"Im Service?"
"Nein."
"Sie arbeitet in Küche. Ihr Deutsch nicht so gut."
Ich staunte mit welcher Selbstsicherheit sich Zorica in ihrem gebrochenen Deutsch mit ihm unterhielt. So wollte ich auch sein. Von nun an gingen meine Zimmergenossin und ich gemeinsam spazieren. Und bei jedem schönen Tag wechselten wir einige Worte mit Hanspeter. Er war sehr höflich und gab sich viel Mühe langsam mit mir zu sprechen, damit ich ihn verstehe. Und wenn mir ein Wort nicht einfiel, versuchte er es zu erraten. Nach und nach verlor ich meine Hemmungen und fing an die Worte auszusprechen die ich bisher nur auf dem Papier kannte. Eines Tages lud er mich und Zorica nach der Arbeit in die Dorf-Bar ein. Sie wollte nicht mitkommen, da es sich ihrer Meinung nach nicht gehörte mit anderen Männern auszugehen, wenn man verlobt ist. Ich hatte damit kein Problem, obwohl Bata und ich ein Paar waren. Was war schon dabei mit jemandem etwas trinken zu gehen? Doch Zoricas Gespür war besser als meins. Bereits am ersten Abend funkte es zwischen Hanspeter und mir. Ich schob Bata zur Seite und liess mich auf das neue Abenteuer ein.
Von nun an ging es mit meinem Deutsch steil bergauf. Hanspeter war nicht nur freundlich, zuvorkommend und bescheiden, sondern auch genau der richtige „Deutschlehrer“ für mich. Er korrigierte mich, wenn ich was Wichtiges falsch sagte, aber er unterbrach mich nicht ständig um mich zu korrigieren. Manchmal liess er mich einfach reden und schaute mir begeistert zu. Das gab mir ein gutes Gefühl. Das hatte ich nie mit Bata gespürt. Unsere Beziehung war ein ständiger Kampf – auch er war ein Revoluzzer wie ich. Wenn ich mit ihm zusammen war, hatte ich immer Angst, seinen Ansprüchen nicht gerecht zu werden. Ich tat immer verrücktere Dinge, um mich aus dem Durchschnitt zu erheben. Um ihn zu beeindrucken. Bei Hanspeter war das nicht notwendig. Er bewunderte mich. Warum auch immer. Er gab mir stets das Gefühl etwas Besonders zu sein. Ich sah es in seinen Augen. Und das liebte ich an ihm.
Unsere Freundschaft dauerte zwei Monate. Dann war mein Visum zu Ende und ich durfte endlich nach Hause. Er brachte mich mit dem Auto nach Buchs. Bevor ich in den Zug stieg, weinten wir beide.
"Melde dich sobald du wieder in der Schweiz bist", sagte er zum Abschied.
"Ja, mache ich!", antwortete ich.
Ich hatte ihm nie gesagt, dass ich nicht mehr zurückzukommen werde. Wir hatten eine gute Zeit zusammen, und ich wollte sie nicht damit belasten. Aber meine Meinung über die Schweizer hatte sich auch durch diese Freundschaft nicht geändert. Die Schweiz war nicht meine Welt. Darüber war ich mir sicher. Er war ein Teil dieser Welt, und ich liebte ihn zu wenig, um mich seinetwegen auf sie einzulassen.
Mein Abteil war noch leer, als ich reinkam. Die anderen Mitreisenden waren noch nicht da. Diesmal gönnte ich mir einen reservierten Platz in einem Liegewagen. Ich sah durch das Fenster. Hanspeter stand immer noch da. Er schien traurig und verloren. Ich öffnete das Fenster und lehnte mich hinaus.
„Geh nur“, sagte ich. „Der Zug fährt noch lange nicht.“
„Ich bleibe“, sagte er und lächelte verlegen.
„Nein, bitte“, antwortete ich. „Geh!“
„Gut.“
Er winkte noch ein letztes Mal und ging. Ich habe ihn nie mehr gesehen. 
(1) Hotel Stätzerhorn, Parpan 1975

Mein reservierter Platz war am Fenster. Die meiste Zeit der Reise verbrachte ich damit, mir die vorbeifahrenden Ortschaften anzusehen. Unvergesslich blieb die Fahrt nachts durch Österreich. Wie schön die Strassen, Brücken und Läden beleuchtet waren! Wie viel Leben es noch da draussen gab. Auch zu späten Stunden. Meine Mitreisenden schliefen bereits. Wie kann man in einem Zug nur schlafen? Schon auf dem Weg in die Schweiz konnte ich die ganze Nacht kein Auge zumachen. Das ewige taka-taka der Stahlräder und die quietschenden Bremsen machten jeden Versuch sich zu entspannen zunichte.
Das Schild "Nicht hinauslehnen" starrte mich vom Fenster Rand an. Mein Herz zog sich zusammen. Es erinnerte mich an das Lied "Selma" von der jugoslawischen Rock-Gruppe "Bjelo Dugme" in dem es um ein solches Schild ging. Bata und ich hörten uns dieses Lied vor meiner Abreise ständig an. Es war an der Zeit, mich mit Bata zu beschäftigen. Bisher hatte ich die Gedanken an ihn völlig verdrängt. In den vier Monaten hatte er mir ein einziges Mal geschrieben. Ein paar unbedeutende Zeilen. Anfangs schrieb ich ihm regelmässig, aber als von ihm nichts zurückkam, hörte ich damit auf. Solange ich mit Hanspeter zusammen war, hatte ich auch kein Bedürfnis verspürt ihm zu schreiben. Doch mit jedem weiteren Kilometer wurden die Gedanken an Bata stärker. Ob er mich noch liebte? Ob ich ihn noch liebte? Ob er mich überhaupt je geliebt hatte? Wenn ich heute darüber nachdenke, bin ich mir nicht sicher, ob wir wirklich ein Paar gewesen waren. Ich glaube mein Wunschdenken hatte die Realität in einem falschen Licht erscheinen lassen. Er sah in uns zwei gute Freunde die viel Spass miteinander hatten, und die sich ab und zu küssten. Ich hingegen war in ihn verliebt seit er mich zum ersten Mal mit seinen blauen Augen angesehen hatte. Wir verbrachten viel Zeit zusammen. Manchmal gingen wir ins Jugendzentrum und tanzten zu Musik von Beatles, Rolling Stones, Status Quo, Deep Purple und Led Zeppelin. Manchmal aber sassen wir einfach in seinem Auto irgendwo in den Feldern und redeten. Stundenlang. Über unsere Träume und über unsere Vorstellungen des Glücks. Wir lachten sehr viel, Bata konnte sehr lustig sein. Als wir uns zum ersten Mal küssten, fing ich schon über die Namen unserer zukünftigen Kinder nachzudenken. Doch Bata ging nie weiter. Anfänglich schätzte ich es sehr, dass er nicht wie die anderen Jungs nur Sex im Kopf hatte. Aber mit der Zeit fragte ich mich was mit ihm nicht stimmte. Oder mit mir? Normalerweise wollte jeder Junge sofort mit mir in die Kiste steigen. Doch der Einzige mit dem ich es getan hätte, war nicht daran interessiert. Ich setzte alle meine Verführungskünste ein. Doch mehr als Küssen und leichtes Fummeln lag nicht drin. Irgendwann redete ich mir ein, dass unsere Beziehung dadurch etwas Besonderes war. Ich schlug sogar vor, dass wir erst miteinander schlafen, wenn wir verheiratet sind. Er stimmte sofort zu.
Und nun, wie sollte es jetzt weitergehen? Wieder bei den Eltern wohnen und um jeden Dinar betteln? Es war schon ein gutes Gefühl, eigenes Geld zu verdienen. Auch wenn es nur 650 Franken im Monat waren. Sie gehörten mir. Ich konnte damit machen was ich wollte. Vielleicht sollte ich doch wieder in die Schweiz reisen. Doch die Demütigungen, die ich als billige Arbeitskraft erfuhr, nagten noch zu sehr an mir. Ich wollte mir das nicht mehr antun. Dass es an einem anderen Ort besser sein könnte, bezweifelte ich.
"Doch! Es sind nicht alle Chefs so wie deine Frau Besserwisser.", hatte mir meine Freundin Milena gesagt, als sie mich vor einigen Wochen anrief. Sie war seit mehr als einem Jahr in der Schweiz. Anna hatte auch ihr eine Stelle organisiert. Auch ihr gefiel es sehr gut dort wo sie arbeitete.
"Ich arbeite in einem grossen Hotel", sagte sie. "Wir sind etwa hundert Angestellte. Für jeden Bereich gibt es einen Chef wie zum Beispiel einen Küchenchef, einen Chef de Service oder einen Personal-Chef. Aber die meisten von ihnen sind Ausländer. Nur der Hoteldirektor ist ein Schweizer. Aber den sehen wir kaum. Er redet nie mit einem."
"Ich habe genug von der Schweiz. Abgesehen davon möchte ich mit Bata zusammen sein."
"Und wenn er inzwischen eine andere hat?"
"Das wird er nicht!"
"Woher willst du das wissen?"
"Ich weiss es."
So sicher wie ich tat, war ich mir gar nicht. Ich hatte mich dasselbe auch schon gefragt.
"Katica", sagte Milena. "Hier ist eine Stelle im Office frei geworden. Ab Dezember. Ich habe schon gefragt. Sie würden dich nehmen. Vor allem weil du Deutsch sprichst. Du kannst den Vertrag unterschreiben, auch wenn du nicht sicher bist, dass du zurückkommst. So hast du einen Plan B, falls es mit Bata nicht mehr klappen sollte."
Milena kannte mich gut. Sie wusste, dass sie mich mit einem Plan B ködern konnte. Ich brauchte immer einen Plan B.
"Und wenn ich nicht mehr komme? Was passiert mit dem Vertrag?", wollte ich genauer wissen.
"Was wollen sie machen? Dich in Jugoslawien betreiben? Wegen 500 Franken Konventionalstrafe?"
Ich liess mich von Milena überreden. An meinem nächsten freien Tag fuhr ich zu ihr nach Vals um mich im Hotel Therme vorzustellen. Die Reise dauerte fast drei Stunden, obwohl es distanzmässig nur etwas mehr als 60 Kilometer waren. Zuerst musste ich von Parpan nach Chur das Postauto nehmen. In Chur nahm ich den Zug nach Ilanz. In Ilanz musste ich wieder das Postauto bis nach Vals nehmen. Das alles schaffte ich problemlos. Dank dem, dass ich Deutsch gelernt hatte. Vor knapp vier Monaten sass ich noch verzweifelt am Bahnhof Chur und wusste nicht weiter.
Die Personalchefin war eine Schweizerin. Verheiratet mit einem Spanier. Der auch im Hotel arbeitete, sagte mir Milena. Ich gefiel ihr auf den ersten Blick. Sie staunte wie gut ich nach so kurzer Zeit Deutsch sprach.
"Sie fangen im Office an", sagte sie. "Aber mit Ihren Sprachkenntnissen haben Sie gute Chancen bald in den Service zu wechseln."
"Was ist die Arbeit im Office?", fragte ich. Ich hatte Milena gar nicht gefragt, was meine Aufgabe dort wäre, weil ich nicht wirklich glaubte, jemals dort arbeiten zu müssen.
"Ich zeige es Ihnen gleich.", sagte sie.
Das Office war der Platz wo das Geschirr aus dem Speisesaal und dem Esszimmer des Personals gewaschen wurde. Stolz zeigte mir die Dame eine vollautomatische Waschstrasse. Vorne wurden die schmutzigen Teller, Gläser, Platten, Schüsseln und das Besteck eingefüllt, einige Meter weiter kam das getrocknete Geschirr raus.
"Die Maschine hat über 40 Tausend Franken gekostet", sagte sie fast ehrfürchtig. "Da lassen wir nicht jeden ran."
"Danke! Das ehrt mich", sagte ich.
Ich war wirklich beeindruckt. Wenn man bedenkt, dass ich im Stätzerhorn alles von Hand waschen musste, war das hier praktisch ein Bürojob. Auch der Raum selbst gefiel mir sehr. Er war sehr gross und alles war offen. Von dieser Stelle sah man überall hin. In die Küche, in den Speisesaal und in das Esszimmer der Angestellten. Und es herrschte eine angenehme Atmosphäre. Die Leute unterhielten sich und lachten während sie arbeiteten.
Mit einem Vertrag in der Tasche fuhr ich am Abend zufrieden nach Parpan zurück. Ich hatte einen Plan B! Einen guten Plan B.
Wenn man es so betrachtet, sinnierte ich weiter im Dunkel meines Abteils, während meine Mitreisenden den Schlaft der Gerechten schliefen, habe ich eine perfekte Ausgangslage. Wenn Bata mich noch liebt, bleibe ich in Jugoslawien. Wenn nicht, gehe ich wieder in die Schweiz. Im Vals würde es mir bestimmt gefallen.

Bata wartete nicht auf mich. Weder in Belgrad noch in meiner Stadt. Obwohl ich ihm geschrieben hatte, wann ich ankommen werde. Meine Eltern wunderten sich darüber.
"Wenn ich gewusst hätte, dass er nicht kommt, wäre ich gekommen, um dich abzuholen", sagte Mutter.
"Vielleicht ist ihm was dazwischen gekommen", verteidigte ich ihn halbherzig. "Ich fahre morgen zu Majka und Deda nach Boka. Dann sehe ich ihn sicher im 'Zwei-Uhr-Bus'.
Ich sah ihn noch bevor er mich sah. Seine Haare trug er immer noch schulterlang, so wie damals die Mode war, einen umwerfenden Bart hat er sich inzwischen wachsen lassen. Als er mich sah, weiteten sich seine blauen Augen. Einen Augenblick blieb er wie eingefroren stehen. Ich sah es ihm an, dass er sich freute. Doch er küsste mich nicht. Gab mir nicht einmal die Hand.
"Wann bist du gekommen?", fragte er beiläufig während er meine Fahrkarte kontrollierte.
"Gestern. Ich dachte, du kommst mich abholen."
"Ich musste arbeiten."
"Kein Problem", sagte ich.
"Siehst gut aus", flüsterte er und sah mir tief in die Augen, bevor er zum nächsten Fahrgast ging.
Die Schmetterlinge in meinem Bauch erwachten. Er war immer noch an mir interessiert! Dass er mich nicht geküsst hatte, störte mich nicht. Er war im Dienst. Das gehörte sich nicht. Ich beobachtete jede seiner Bewegungen, jedes Wort, das er zu jemandem sagte. Als er sich vorne neben dem Fahrer setzte, warf er einen Blick in den Rückspiegel. Unsere Augen begegneten sich. Mit einer Hand fuhr er durch die Haare. Ich liebte diese Bewegung! Und er wusste es. Das war ein Zeichen. Ein Zeichen, dass wir immer noch irgendwie verbunden waren.
"Gehst du zu den Grosseltern?", fragte er, als ich beim Ausstiegen an ihm vorbei ging.
"Ja."
"Ich hole dich um sieben ab.", flüsterte er.
Eine Antwort darauf zu geben war ich nicht in der Lage. Ich lächelte nur dämlich, wie verliebte Mädchen es eben tun.
Bata wusste wo meine Grosseltern wohnten. Er hatte mich dort oft abgeholt. Er war aber nie reingekommen, obwohl meine Grossmutter ihn gern kennengelernt hätte. Ich hatte ihr schon so oft vom ihm erzählt!
Sie begleitete mich auf die Strasse, als er mich um sieben abholte. Ich protestierte.
"Ich will nur ein Auge auf den Supermann werfen", sagte sie. "Ich sage nichts zu ihm."
Ich musste lachen. Woher hatte sie das Wort Supermann? Ja, die Welt blieb nicht stehen, während ich weg war.
Bata stieg nicht aus. Er wartete auf mich im Auto.
"Komm nicht zu spät!", hörte ich Majka rufen, als ich mich neben ihm ins Auto setzte. Ach wie süss sie war. Komm nicht zu spät! Was würde sie sagen, wenn sie wusste, dass ich in der Schweiz manchmal am morgen früh nach Hause kam? Nachdem ich die ganze Nacht mit Hanspeter verbrachte?
Bata fuhr auf eine Nebenstrasse ausserhalb des Dorfes. Etwas abseits hielt er an. Dann küssten wir uns. Lange. Zärtlich.
"Ich habe dich so vermisst", flüsterte er. "Ich lasse dich nie mehr wieder gehen!"
Oh, wie gut sich das anfühlte! Meine Zweifel an seiner Liebe waren wie weggewischt. Ich vergass wie schön es war, das eigene Geld zu verdienen. Ich vergass Hanspeter und das schöne Dorf Vals, das auf mich wartete. Ich fühlte wieder die unglaubliche Anziehung, die Bata auf mich ausübte. Bis spät in die Nacht erzählten wir uns, was in der Zeit, in der wir getrennt waren, geschah. Es war genau wie vor meiner Abreise. Er war so witzig! Wir lachten und lachten. Ab und zu sangen wir "Selma". Ich erinnerte mich nicht, wann ich zum letzten Mal so glücklich gewesen war. Und das Schöne daran war, das Glück fing erst an.
Doch schon am nächsten Tag, fing meine Begeisterung an zu bröckeln. Bata und ich konnten uns nicht verabreden, da er irgendwelchen Verpflichtungen nachgehen musste.
"Ich werde mich bei dir melden", sagte er beim Abschied.
Jeden Abend hoffte ich, dass er vorbeikommen würde, doch er kam und kam nicht. Schon vier Tage waren vergangen und ich hörte nichts von ihm. Majka versuchte mich zu trösten, wenn auch ihre Worte nicht das waren, das ich erwartet hatte.
"Er sieht sehr gut aus, aber er ist nicht der Mann der dich heiraten wird."
"Majka!", schrie ich verärgert. "Woher willst du das wissen?"
"Ich weiss es mein Kind", sagte Majka. "Wenn er im Sinn hätte dich zu heiraten, würde er sich bemühen, bei deiner Familie gut dazustehen. Aber er kommt nie rein, wenn er dich abholt. Das letzte Mal ist er auch nicht ausgestiegen, obwohl er mich gesehen hat."
"Ach, was verstehst du schon, Majka!", regte ich mich auf. "Die Zeiten haben sich geändert. Das ist nicht so wie früher."
"Das hat mit den Zeiten nichts zu tun. Er bemüht sich nicht, bei mir einen guten Eindruck zu hinterlassen, weil es ihm egal ist, was ich über ihn denke. Darum sage ich, dass er es mit dir nicht ernst meint."
Wütend lief ich davon. Doch ihre Worte blieben hängen. Und liessen sich nicht mehr abschütteln.
Erst am Wochenende, einen Tag bevor ich wieder nach Zrenjanin zurückkehren sollte, kam Bata vorbei. Er kam diesmal ins Haus. Das musste er wohl, weil wir nichts abgemacht hatten. Grossmutter bot ihm einen Kaffee an. Er lehnte es ab. Ich sah sie an. Sie zog ihr Kopftuch tief über die Stirn.
"Ich habe es dir gesagt. Kein Mann zum Heiraten", glaubte ich in ihren Augen zu erkennen. Doch sobald ich mich zu Bata ins Auto setzte, dachte ich nicht mehr an Majkas Worte, oder an die frustrierende Woche ohne ihn. Wir fuhren an die gleiche Stelle wie das letzte Mal.
"Wo warst du die ganze Woche?", fragte ich, als er den Motor abgestellt hatte.
Er sagte nichts. Küsste mich nur. Dann fuhr er mit der Hand durch meine langen Haare.
"Die sind gewachsen. Du siehst so gut aus! Ich bin nahe dran unsere Vereinbarung zum Teufel zu schicken."
Ich wusste, dass er damit unsere Kein-Sex-Vereinbarung meinte.
"Darauf warte ich schon lange.", antwortete ich und setzte meinen verführerischsten Blick auf.
Es gibt Augenblicke im Leben eines Menschen die wie Kreuzungen sind. Je nachdem welche Richtung man einschlägt, entwickelt sich ein komplett anderes Szenario. Das war ein solcher Augenblick. Wenn dieser Abend zu einem romantischen Höhepunkt unseres Wiedersehens geworden wäre, wäre mein Leben ganz anders verlaufen. Ich wäre zu Hause geblieben und hätte bald Bata geheiratet. Vielleicht wäre ich glücklich. Vielleicht aber auch nicht. Aber mein Leben hätte bestimmt eine ganz andere Richtung eingeschlagen.
"Nein!", sagte Bata und stiess mich theatralisch von sich weg. "Wir müssen standhaft bleiben."
"Vergiss die blöde Vereinbarung", flüsterte ich und zog ihn an mich.
"Nein." Er stiess mich nochmals von sich weg. Dabei lachte er spitzbübisch.
Ich wusste, dass es ein Spiel war. Dennoch ärgerte es mich langsam. Mit jeder Faser meines Körpers sehnte ich mich nach ihm. Ich wollte endlich wissen woran ich bin. Ich wollte wissen ob wir ein Liebespaar oder nur "Freunde mit besonderen Leistungen" waren. Doch er spielte mit mir alberne Spielchen.
"Wir werden bis Frühling warten müssen." Er war immer noch im Spassmodus.
"Bis Frühling? Warum?"
"Unser erstes Mal soll nicht in einem Auto stattfinden", sagte er.
Ich war enttäuscht. Masslos enttäuscht. Was soll das? Was stimmt mit ihm nicht? Warum wollte er mich nicht?
Genau in diesem Moment entschied ich mich, wieder in die Schweiz zu gehen. Ich wollte mich niemanden aufdrängen. Wenn er mich nicht will, soll er es sein lassen.
"Dann werden wir bis Herbst warten müssen", sagte ich gespielt beiläufig. "Ich habe einen Vertrag bis im September."
"Du gehst wieder zurück?" Er sah mich überrascht an.
"Ja."
"Du hast gesagt, dass du hier bleibst."
"Ich wusste nicht, dass sich alles so entwickeln würde."
"Wie meinst du das?"
"Echt jetzt?", platzte es aus mir heraus. "Wir haben uns vier Monate nicht gesehen und du lässt mich eine ganze Woche alleine!"
"Fängst an eine Klette zu werden?" Seine Stimme hörte sich leicht gereizt an.
"Offenbar hast du eine andere Vorstellung von einer Beziehung als ich."
"Was soll das bedeuten?"
"Ich weiss nicht einmal ob wir ein Paar sind.", sagte ich. "Sind wir es?"
"Natürlich sind wir es!", antwortete er.
"Warum lässt du mich dann eine ganze Woche alleine?"
"Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig."
"Natürlich nicht! Aber, dass du nach vier Monaten Trennung keine Lust hast mich öfter zu sehen, gibt mir schon zu denken."
"Ich hatte keine Zeit!"
"Du hast gewusst, dass ich nach Hause komme. Du hättest dir die Zeit nehmen können, wenn du es wolltest. Doch du wolltest das gar nicht."
"Ich dachte nicht, dass du wieder gehst."
"Eigentlich wollte ich gar nicht gehen. Aber dann habe ich mich anders entschieden. Ich bin es satt auf dich zu warten, ohne zu wissen ob du kommst."
Er antwortete darauf nichts. Wir rauchten schweigend. Mein Ärger war bald verflogen. Aber ich merkte, dass jetzt auch er sauer war. Der Abend war nicht mehr zu retten. Er fuhr mich nach Hause. Zum Abschied küssten wir uns nicht einmal.

Die restlichen Tage meines Urlaubs verbrachte ich mit Warten. Warten, dass Bata sich meldete. Ich vermisste ihn schrecklich. Bald würde ich für neun Monate weggehen. Neun Monate ohne ihn! Vorher musste ich unbedingt wissen, wie wir zu einander stehen. Ob wir noch ein Paar sind. Doch Bata kam und kam nicht vorbei. Damals hatten wir keine Handys und die Telefon-Nr. seiner Familie kannte ich nicht. Ich entschloss mich ihm ein Telegramm zu schicken.
"Komm so schnell wie kannst STOP ich muss mit dir reden STOP Katica", schrieb ich ihm.
Schon am selben Abend stand er vor unserer Haustür in Zrenjanin. Wir gingen in die Küche. Dort konnten wir ungestört reden.
"Was ist los?", fragte er. Kein Kuss. Kein verliebter Blick.
"Ich muss mit dir reden, bevor ich in die Schweiz fahre."
"Spinnst du? Weil du mit mir reden willst, sendest du mir ein Telegramm?" Seine schönen Augen wurden um eine Nuance dunkler.
"Was ist daran so schlimm?", zischte ich ihn an. "Ich muss mit dir reden. Da ich die Telefon-Nummer deiner Eltern nicht kenne, habe ich keine andere Möglichkeit gehabt."
"Meine Mutter hat fast einen Herzinfarkt bekommen, als der Briefträger das Telegramm brachte!"
Bata war stinksauer. Ich konnte es verstehen. Zu jener Zeit hatten nicht alle ein Telefon. Nachrichten die schnell übermittelt werden mussten, wie zum Beispiel der Tod eines nahen Verwandten, sendete man meistens per Telegramm.
"Ich fasse es nicht, dass du wegen so was ein Telegramm sendest!"
"Wegen so was? Für mich ist das wichtig!" Das Gespräch entwickelte sich nicht nach meinem Wunsch. Trotzdem gab ich nicht zu, dass die Idee mit dem Telegramm nicht so gut war. "Ich muss wissen, ob das zwischen uns noch was ist, bevor ich wieder in die Schweiz gehe!"
"Ich mag keine hysterischen Frauen", sagte er.
"Liebst du mich denn nicht mehr?" Ich hasste mich für diese wehleidige Frage.
Er sagte nichts. Sah mich nur finster an.
"Dann ist alles vorbei?", fragte ich den Tränen nahe.
"Daran hättest du denken sollen, bevor du das Telegramm gesendet hast", sagte er.
Ich bin ein sehr leidenschaftlicher Mensch. Wenn ich liebe, dann liebe ich mit allen Fasern meines Körpers. Für jemanden den ich liebe, würde ich alles tun. Doch ich müsste sicher sein, dass die Liebe erwidert wird. Ich fühlte, dass bei Bata dies nicht so war. Ich war für ihn ein Zeitvertreib. Mich würde er nie heiraten. Meine Majka hatte Recht. Ich stand auf und öffnete die Küchentür. Wortlos ging er an mir vorbei. Mein Herz blutete. Doch ich hielt ihn nicht zurück. Ich weinte auch nicht. Das liess mein Stolz nicht zu. Wer mich nicht liebt, den liebe ich auch nicht. Ich war auf ihn und seine Liebe nicht angewiesen!
Dass Bata mich nicht freiwillig tagelang alleine gelassen hatte, sondern dass seine Eltern über unsere Beziehung bestimmten, sollte ich jedoch erst viele Jahre später erfahren.

Ich weiss nicht, ob es jemanden in der Schweiz gibt, der Valser Wasser nicht kennt. Spätestens seit der Werbung "S’isch guat ds VALSERwasser". Doch nur wenige haben den wunderbaren Mikrokosmos, in dem sich das kleine Dorf Vals befindet, wirklich gespürt. Durch die hohen Berge vom Rest der Welt abgeschottet, mitten in der atemberaubenden Natur, zieht er einen schnell in seinen geheimnisvollen Bann. Und wenn man sich einmal auf das Gefühl eingelassen hat, wird man es nie mehr los.
Das Hotel Therme übertraf alle meinen Erwartungen. Dort war alles so anders als im Stätzerhorn! Der Betrieb war durch und durch organisiert. Die Abläufe perfekt aufeinander abgestimmt. Wir brauchten keine Vorgesetzten die uns sagten was zu tun war. Wenn ich mich mit dem Geschirr nicht beeilte, kam jemand aus dem Service und verlangte nach sauberen Tellern oder Besteck. Wenn das Servicepersonal nicht effizient arbeitete, fluchten die Köche oder reklamierten die Gäste. Wie lange wir Pause machten interessierte niemanden. Hauptsache die Arbeit war gemacht und alle Zahnräder der Therme-Maschinerie drehten sich in die richtige Richtung.
Die vorherrschenden Nationalitäten bei den Angestellten waren Spanier und Jugoslawen. Die Jugoslawen machten grösstenteils die niederen Arbeiten, wie Küche, Office, Reinigung und die Wäscherei. Ein Luxushotel produzierte täglich einen gewaltigen Berg aus schmutziger Bettwäsche, Tischtüchern und Stoffservietten. Dazu die Unmenge an Frottiertüchern aus dem Schwimmbad. Das alles musste abgeholt und nach dem Waschen, Bügeln und Zusammenlegen wieder zurückgebracht werden. Ein Riesenapparat, der genau so reibungslos wie alles andere funktionierte.
Die Spanier beherrschten die Bedienung der Gäste. Ob im Speisesaal, an der Bar oder in den "A la carte" Restaurants. Allerdings begriff ich das nicht. Denn die meisten von ihnen sprachen kaum Deutsch, im Gegensatz zu den Jugoslawen, die sich bemühten die Sprache zu lernen. Aber offenbar liebten die Gäste von einem höflichen, sauberen, stets makellos angezogenen und zum Dienen bereiten jungen Spanier oder einer Spanierin bedient zu werden. Mit ein wenig gutem Willen beiderseits klappte es dann auch mit dem Verstehen. Mir scheint, damals war die Beziehung zwischen den Gästen und dem Personal in den Luxushotels nicht so steif wie heute. Ich erinnere mich an eine lustige Anekdote aus dem Speisesaal bei der ich dabei war, und die später immer wieder erzählt wurde.
Es gab einmal einen neuen spanischen Kellner. Er bekam diese Stelle, weil sein Bruder schon dort gearbeitet hatte, aber er sprach kein einziges Wort Deutsch. Ein Gast bat ihn um etwas mehr Rüebli (für die deutsche Leserschaft: Karotten) und er ging deshalb in die Küche. Auf seinem Weg dorthin lief er an mir vorbei. Ich hörte wie er immer wieder das Wort "Rüebli" wiederholte, als ob er es sich einprägen wollte. Die Küchenbrigade bestand mehrheitlich aus jungen Männern aus der Schweiz, Deutschland und Österreich, die sich einen Spass daraus machten, Neuankömmlingen Streiche zu spielen. Allen voran der Küchenchef, ein schöner, blonder Mann, der mir von Anfang an gefiel aber leider schon vergeben war. Nun drückte ein Koch dem Kellner einen Teller in die Hand und er machte sich wieder auf den Weg in den Speisesaal. Als er bei mir vorbeilief sah ich, dass auf dem Teller Sellerie und keine Rüebli lagen. Ich blickte rasch zurück in die Küche und sah die Jungs lachen. Der Küchenchef deutete mir mit dem Finger auf den Lippen zu schweigen. Ich hielt den Spanier nicht auf. Er tat mir zwar Leid, aber dem attraktiven Küchenchef einen Gefallen zu tun bedeutete mir mehr.
Also der Kellner kam zurück zum Gast und legte die Sellerie mit einer eleganten Verbeugung auf den Tisch.
"Was ist das?", fragte der Gast.
"Rüebli.", antwortete er.
Der Gast sah ihn erstaunt an. In diesem Augenblick erschien der Küchenchef am Tisch mit dem Rüebli. Er stellte sich vor und entschuldigte sich für den Fehler. Der Gast lachte. Der Kellner verstand die Welt nicht.
So was lag damals drin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies heute in einem Luxushotel noch möglich wäre. Aber vielleicht lag es auch an der besonderen Atmosphäre die in Vals herrschte.
Die verschiedenen "Klassen" der Arbeiter spielten im Privatleben keine Rolle. Abends trafen wir uns meistens, sprachlich bunt gemischt, bei jemandem im Zimmer, hörten Musik, und versuchten uns so gut wie möglich zu verstehen. Was noch recht gut funktionierte, da die meisten ein wenig italienisch sprachen. Für die Spanier war es eine verwandte Sprache, und da Serbokroatisch dort niemand sprach, waren Jugoslawen gezwungen auch italienisch zu lernen. Die wenigen Schweizer, denen wir in der Freizeit begegneten, sprachen mit uns auch italienisch. Mein relativ gutes Deutsch nützte mir da nichts, also lernte auch ich italienisch. Das ging fast automatisch, denn rundherum sprachen alle diese Sprache, und sogar im Fernseher im Personalraum war "Swizzera Italiana" standardmässig eingestellt.
Milena und ich wohnten im Personaltrakt des Hotels, nur einige Schritte von unserem Arbeitsplatz entfernt. Sie arbeitete gleich gegenüber mir am Büfett. Ihre Aufgabe war die Ausgabe der Getränke, weil auch sie einigermassen Deutsch und Italienisch sprach. Wir teilten uns ein Zimmer. Es hat mir damals nichts ausgemacht, mit jemandem zusammen auf sechzehn Quadratmetern zu wohnen. Ich war gerne mit Milena zusammen. Wir kannten uns sehr lange. Sie lebte im gleichen Dorf wie meine Grosseltern. Milena kannte alle die im Therme arbeiteten. Ich musste mich nicht anstrengen Freunde zu finden. Ihre Freunde wurden automatisch auch meine Freunde.
Auch die Arbeit im Office machte ich sehr gerne. Meine Aufgabe war nicht nur, dafür zu sorgen, dass das Geschirr am Anfang der Waschstrasse eingefüllt und am Ende ausgeräumt wird, sondern auch für den Unterhalt zu sorgen. Ich nahm die Arbeit sehr genau und machte alles nach Vorschriften. Die Geschirr-Waschstrasse war damals eine Sensation. Immer wieder kamen irgendwelche Leute, um sie sich anzusehen. Da ich Deutsch sprach und die Maschine bald in- und auswendig kannte, konnte ich den Interessenten alles erklären und alle ihre Fragen beantworten. Und obwohl es nur eine einfache Arbeit war, machte ich sie gerne. Vor allem, weil ich nie das Gefühl hatte, minderwertig zu sein. Das war eine gute Entscheidung Deutsch zu lernen! Ich hatte meiner Ex-Chefin und meiner Erzfeindin aus dem Service in Parpan zwar am Schluss nicht die Meinung gesagt, was ursprünglich meine Motivation zum Lernen war, aber ich profitierte überall, weil ich Deutsch sprach.
Ich weiss nicht wie das heute ist, aber damals konnten Angestellte alle Annehmlichkeiten des Hotels benutzen wie die Gäste auch. Ich ging sehr gerne in das Thermalbad. Denen die das Hotel Therme kennen, möchte ich sagen, dass es damals nicht ein so mondänes Bad wie heute war. Mir gefiel es viel besser damals. Es war ein klassisches, grosses Schwimmbad mit Innen- und Aussenpool. Im Winter konnte man durch einen Wasserkanal nach draussen gelangen und dort im warmen Wasser baden, umgeben von Schnee soweit das Auge reichte. Ich verbrachte unzählige Zimmerstunden in diesem Bad. Es gefiel mir mit den Gästen am gleichen Ort zu sein. Das gab mir ein gutes Gefühl. Ich war nicht nur ein geduldeter Ausländer wie in Parpan.
Im Vals gab es einige Möglichkeiten auszugehen, obwohl das Dorf klein war. Eine schöne Bar im "Sporthotel Rovanada", das "Stübli" im Therme Komplex und mehrere Restaurants im Dorfkern wie zum Beispiel das Restaurant "Glenner". An den Wochenenden gab es im "Stübli" Livemusik zum Tanzen und und im Rovanada Diskomusik. Die Zimmerstunde verbrachten Milena und ich oft im Cafe Schnyder, gegenüber vom "Stübli". Dort gab es den besten Coupe Dänemark, den ich je gegessen hatte. Sie machten ihn mit der braunen, nicht mit der schwarzen Schokolade. Auch die heisse Schokolade die als Getränk serviert wurde, war einsame Klasse.
Das war eine schöne Zeit! Ich hatte eine gute Arbeit, nette Kollegen und viel Spass in den Abendstunden. An unseren freien Tagen fuhren Milena und ich nach Ilanz oder Chur. Unser Chef war so nett, uns gemeinsam frei zu geben. Zuerst gaben wir unser Geld grosszügig für Kleider aus, danach assen wir meistens zu Mittag in einem guten Restaurant. Unser Lieblingsessen war Zürich Geschnetzeltes. Für den Weg nach Hause kauften wir uns eine schöne Salsiz und frisches Brot in der Migros, die wir uns auf der Heimreise in der Rhätischen Bahn genehmigten.
Da konnten die Kommunisten noch lange über den dekadenten Westen wettern. Das Leben in Vals war weder dekadent, noch wurden wir ausgebeutet. Heute noch fühle ich mich zu diesem Ort hingezogen. In den vielen Jahren die inzwischen vorbei sind, habe ich nie aufgehört, Vals als ein kleines Teil von mir zu fühlen.
(1) Ich mit Freunden im Schwimmbad Therme Vals 1977

Die Namen der meisten Mitarbeiter, die ich damals in Vals kennengelernt hatte, habe ich inzwischen vergessen. Es sind mehr als vierzig Jahre seither vergangen. Doch an den Namen des Hotel-Direktors erinnere ich mich heute noch. Er hiess Sigrist. Seinen Vornamen kannte ich schon damals nicht. Herr Sigrist sah nicht wie ein Hotelier aus. In seinem hellgrauen Anzug, den er immer trug, erinnerte er eher an einen Buchhalter. Ihn hat man nie im Service gesehen. Oder an der Rezeption, um Gäste zu empfangen. Er sass immer in seinem Büro und schrieb etwas in dicke Bücher. Unter den Angestellten kursierten die wildesten Gerüchte über ihn. Das meist verbreitete war, dass er nicht freiwillig in Vals arbeitete. Das Hotel gehörte damals der Schweizerischen Bankgesellschaft - heute UBS. Man munkelte, dass Herr Sigrist ein Bankdirektor war, der sich etwas zu Schulden kommen liess und deshalb nach Vals strafversetzt wurde. Als Hoteldirektor. Damit er den verschuldeten Betrieb auf Vordermann bringt.
Eines Tages kam Herr Sigrist unerwartet in mein Office. Ganz alleine. Ohne irgendwelche Leute, denen die Waschstrasse gezeigt werden sollte. Die meisten Kollegen waren schon in der Zimmerstunde. Ich war immer die letzte in der Küche. Er fragte mich einige Details über die Maschine, die er eigentlich schon wissen sollte. Ich spürte, dass er nicht nur wegen der Maschine gekommen war.
"Sie sprechen gut Deutsch", kam er nach einer Weile zur Sache. "Wie lange sind Sie schon in der Schweiz?"
"Fünf Monate", antwortete ich.
"Was? Fünf Monate? Und Sie reden so gut Deutsch?"
"Ich will verstehen was Leute sagen", antwortete ich verlegen. Sein Kompliment schmeichelte mir ungemein.
"Das ist gut!", sagte er mehr zu sich selber als zu mir. "Das ist sogar sehr gut."
"Danke!", sagte ich, ohne zu wissen warum. Inzwischen hatte ich bemerkt, dass die Schweizer es sehr schätzten, wenn man sich ständig für alles Mögliche bedankte.
"Sie haben sicher gehört, dass wir am 24. Dezember das Weihnachtsfest für die Mitarbeiter feiern. Ich werde eine Ansprache halten. Aber die meisten verstehen sehr wenig bis nichts Deutsch. Für die Spanier habe ich schon einen Übersetzer gefunden. Würden Sie für die Jugoslawen übersetzen?
"Ich?" Ich war mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden hatte.
"Ja."
"Ich habe so was noch nie gemacht.", antwortete ich zögernd. Bei der Vorstellung vor mehr als hundert Leuten zu reden, lief mir kalt über den Rücken.
"Sie müssen nicht Wort für Wort übersetzen", sagte er. "Es reicht, wenn Sie nach meiner Rede den Leuten zusammengefasst übertragen was ich gesagt habe."
"Gibt es sonst niemand der das kann?", fragte ich in der Hoffnung mich irgendwie rausreden zu können, ohne ihn zu beleidigen.
"Von den Jugoslawen die ich kenne, sprechen Sie mit Abstand am besten Deutsch", antwortete er.
Wie unwohl es mir dabei war, ebenso reizte es mich dies zu tun. Ich, die im Juni noch kein Wort Deutsch sprach, sollte im Dezember als Übersetzerin auftreten! Wenn das nur die Schnepfe aus Parpan sehen könnte.
"Gut, ich mache es", sagte ich entschlossen.
"Sehr gut!" Er ging mit einem zufriedenen Lächeln auf seinem bleichen Gesicht. "Sehr gut!", hörte ich ihn noch einige Male vor sich murmeln.
In den Tagen bis zum Fest stürzte ich mich nochmals so richtig ins Deutschlernen. Ich überlegte mir welche Wörter er wahrscheinlich benutzen würde und lernte die besonders gut. Ich wollte mich auf keinen Fall blamieren.
Wie genau der Weihnachtsabend verlief, erinnere ich mich nicht mehr. Ich weiss nur, dass ich am Tisch neben ihm sass und mächtig stolz war. Ich, das Mädchen aus der Küche, sass vor dem ganzen Personal neben dem Hoteldirektor, weil er MEINE Hilfe benötigte.
Als ich mich am späteren Abend von den alten und neuen Bekannten verabschiedete, um in mein Zimmer zu gehen, hatte ich bereits einen Verehrer. Er hiess Miro und kam aus Bosnien. Ein sympathischer Mann im schwarzen Anzug mit einer schönen, bunten Krawatte. Er bestand darauf mich zu meinem Zimmer zu begleiten, damit ich mich im Hotel-Labyrinth nicht verlaufe, oder von jemandem belästigt werde. Doch als wir im Lift waren, drückte er plötzlich den Stop-Knopf und versuchte mich zu küssen. Seine Augen glitzerten dabei gutmütig. Er schien mir nicht gefährlich, eher ein wenig betrunken.
"Daraus wird nichts mein Freund", sagte ich und drückte wieder auf den Etage Knopf. Der Lift fuhr weiter.
"Man kann es ja versuchen", sage er schmunzelnd.
Warum ich mich daran heute noch so gut erinnere? Miro und ich wurden kein Paar aber er hatte später meine Schwester geheiratet, die auch nach Vals kam um dort zu arbeiten. Heute noch lachen wir herzhaft im Kreis der Familie über jenen Abend, als Miro mich vor Gefahren schützen wollte und dabei selbst zur grössten Gefahr wurde.
Für mein Vorwärtskommen in der Schweiz hatte jener Abend grosse Bedeutung. Einige Tage später kam Herr Sigrist wieder in mein Office.
"Guten Tag Katica", sagte er. "Wie geht es Ihnen?"
"Gut.", antwortete ich. Ein "Danke" kam mir im letzten Augenblick doch noch in den Sinn.
"Gefällt es Ihnen hier?", fragte er weiter.
"Ja. Danke. Ich bin gerne hier."
"Arbeiten Sie gerne im Office?"
"Ja. Danke."
"Es ist schade, dass jemand mit so guten Deutsch Kenntnissen nicht im Service arbeitet", sagte er.
Ich antwortete darauf nichts. Wollte mal abwarten was noch kommt.
"Wenn Sie möchten, kann ich organisieren, dass Sie im Speisesaal arbeiten."
"Wirklich?"
"Ja. Wirklich." Er schmunzelte.
Ich konnte mein Glück kaum fassen. Auch wenn ich gerne im Office arbeitete, Service war das höchste, das eine Ausländerin im Gastgewerbe erreichen konnte. Manch einer arbeitete Jahre lang in der Küche, bis er in den Service wechseln konnte. Ich hatte es schon im ersten Jahr geschafft!
"Das wäre schön!", sagte ich. Am liebsten hätte ich ihn umarmt.
"Es wäre aber erst ab Juni. Da gehen viele nach Hause. Sie haben den Vertrag bis September, das ist gut."
Herr Sigrist hielt sein Versprechen. Ab Juni durfte ich im Speisesaal arbeiten. Der Wechsel fiel mir nicht schwer, ich hatte genug Zeit mich darauf vorzubereiten. Ich liebte es einen schwarzen Rock, eine schwarze Bluse und eine weisse Spitzenschürze zu tragen. Ein Portemonnaie aus echtem Leder kaufte ich mir auch. Ab und zu kam Herr Sigrist zum Mittagessen in den Saal. Wenn ich Zeit hatte, rief er mich zu sich und wir unterhielten uns. Ich habe nie herausgefunden, warum er mich mochte. Es konnte nicht eine körperliche Anziehung gewesen sein, ich hätte seine Enkelin sein können. Abgesehen davon benahm er sich mir gegenüber stets korrekt. Nicht ein einziges Wort von ihm war je unpassend. Oder anzüglich. Vielleicht war ich die Tochter die er nie hatte? Vielleicht hatte er eine Tochter, aber ihre Beziehung war nicht gut? Vielleicht war seine Tochter nicht so geworden, wie er sich gewünscht hätte? Vielleicht hatte er eine Tochter die er liebte und die gestorben war? Vielleicht war sie so wie ich?
Was auch immer der Grund gewesen war, er hatte mich weitergebracht. Wenn er mich damals nicht protegiert hätte, wäre ich vielleicht nicht so geworden wie ich heute bin. Er gab mir das Gefühl, auch in der Schweiz jemand zu sein. Ein wertvoller Mensch, der nicht nur zur Kulisse des Hotels gehörte. Dank seiner Unterstützung hatte ich innert kürzester Zeit etwas erreicht, wofür andere Jahre benötigten. Ich war am Gipfel des Berges angekommen. Weiter nach oben ging es gar nicht. Dachte ich. Doch ich täuschte mich. Es ging noch höher. Natürlich dank Herr Sigrist.

"Ich möchte mit Ihnen reden", sagte Herr Sigrist eines Tages nach dem Abendservice.
"Ich muss noch meine Station fertig machen."
"Natürlich. Ich warte", antwortete er.
Der Vorteil, wenn man im Speisesaal arbeitete war, dass die Gäste nicht sitzen blieben. Gleich nach dem Essen gingen die meisten von ihnen in die Hotel-Bar, die sich gleich neben dem Saal befand. Ich wechselte rasch die Tischtücher und deckte die Tische, für die ich verantwortlich war, für das Frühstück.
Der Speisesaal von Therme war im französischen Stil eingerichtet. Die Tische waren mit schneeweissen Tischtüchern und grossen, perfekt gebügelten, weissen Servietten gedeckt. Dazu Silberbesteck und schöne grosse Gläser für den Wein. Auf den Beistelltischen glänzte das Servierbesteck und silberne Eiskübel für den Champagner oder Weisswein. Die Wände und der Sichtschutz zwischen den Tischen waren mit dunklem Kirschenholz eingefasst, was dem Raum eine besonders noble Note gab. Der dicke Teppich dämmte alle Geräusche. Man hörte nur leises Murmeln der Gäste, die sich im Kerzenlicht unterhielten. Dazwischen schwebten die guten Seelen aus dem Service und erfüllten alle möglichen Wünsche. Als ich diesen Raum zum ersten Mal beim Abendservice sah, wagte ich kaum zu atmen. Doch man gewöhnt sich an alles. Vor allem an das Gute. Ein paar Monate später, fühlte ich mich dort zu Hause.
"Alles fertig?", fragte Herr Sigrist, als ich mich zu ihm setzte.
"Ja."
"Sie machen sich gut im Service", sagte er. "Die Gäste mögen Sie."
"Ich hoffe es", sagte ich. "Ich bemühe mich."
"Haben Sie sich schon überlegt wie es weitergehen soll?"
"Weitergehen?"
"Bald ist September. Dann gehen Sie nach Hause."
"Ach so! Das meinen Sie."
"Werden Sie wieder kommen?"
"Ich denke schon."
"Sie haben der Personalchefin bisher noch nichts gesagt."
"Ich dachte, es hat noch Zeit."
"Eigentlich nicht."
"Nicht?"
"Nein. Die guten Jobs werden zuerst vergeben. Je früher Sie sagen, dass Sie wieder kommen, umso besser kann man sie einteilen."
"Ich möchte nichts anderes", sagte ich leicht beunruhigt. "Ich bin hier zufrieden."
"Sind Sie sicher? Sie haben hier sehr lange Arbeitszeiten."
Da hatte er Recht. Im Speisesaal arbeiteten wir von morgens früh bis abends spät. Mit ein paar Stunden Pause am Nachmittag. Aber das war überall so. Wir hielten das für normal.
"Ich habe mich daran gewöhnt."
"Was würden Sie sagen, wenn Sie am Abend um sechs fertig wären?"
Ich überlegte schnell wo man im Therme am Abend um sechs Feierabend hatte. Nirgendwo wo ich arbeiten könnte. Ausser an der Bar. Die Tagesschicht. Aber das war unmöglich. Ich wagte es nicht einmal daran zu denken! Dort arbeiteten nur ausgesuchte Leute. Meistens Spanierinnen.
"Ich weiss nicht wo im Therme es so was gibt", sagte ich.
"Wirklich?", wunderte er sich. "Sie laufen dort jeden Tag vorbei."
"Sie meinen die Bar?", nun wagte ich es doch auszusprechen.
"Ja! Als Barmädchen. In der Tagesschicht."
"Und was ist mit dem jetzigen Mädchen?"
"Sie und ihr Mann gehen weg. Die Stelle ist frei geworden. Haben Sie das nicht gewusst?"
"Nein. Ich kenne die beiden nicht so gut."
"Was sagen Sie? Wäre das was für Sie?"
Natürlich wäre das was für mich! Jeden Tag, wenn ich an der Bar vorbeilief, dachte ich wie schön das Barmädchen es hatte. An einem so schönen Ort ganz alleine zu arbeiten. Die Bar war sehr gross. Neben der Theke selbst gab es wuchtige Sessel und Salon-Tische aus Glas. Ganz besonders an dieser Bar war die Beleuchtung. Sie bestand aus unzähligen grossen Glaskugeln die an verschieden langen, dünnen Metallstangen über den Tischen hingen. Nachts sah es aus, als ob sie in der Luft schwebten. Doch nicht alle Tische mussten bedient werden. Die meisten Gäste, die Tagsüber dort sassen, warteten darauf sich an der Rezeption, die gleich daneben war, an- oder abzumelden. Wenn man das Hotel durch den Haupteingang betrat, lief man direkt auf die Bar zu. Links war die Rezeption, rechts der Speisesaal.
"Eigentlich schon.", beantwortete ich die Frage von Herr Sigrist.
"Aber?", ergänzte er meinen Satz. "Ich höre da ein ‚aber‘."
"Ich weiss nicht, ob ich das kann."
"Ein paar Tees für die Gäste der Schlankheitskur am Morgen und ein paar Kaffee oder Bier am Nachmittag."
"Nur das? Ist das nicht langweilig?"
"Ich denke nicht. Der Service ist dort nicht der Schwerpunkt. Das meiste findet an der Bar-Theke statt. Leute setzen sich dort, weil sie reden möchten. Ihre Aufgabe wäre ihnen zuzuhören. Und wenn es nötig ist, auch mit ihnen zu reden."
"Ich bin mir nicht sicher, ob ich das kann."
"Doch, Katica, Sie können das! Ich habe Sie oft im Speisesaal beobachtet. Sie reden gerne mit den Leuten. Und Sie reden in einer ungewöhnlichen Art. Nicht nur wegen Ihres Akzentes. Sie sind sehr natürlich und sehr direkt. Trotzdem sind Sie stets respektvoll."
"Finden Sie?"
"Ja. Aber Sie müssen sich schnell entscheiden. Die ‚Spanisch-Mafia‘ hat die Fühler schon ausgestreckt", ergänzte er schmunzelnd.
Ich lachte. Ich wusste warum er das sagte. Die Spanier organisierten den Nachschub der Arbeitskräfte selber. Es gab immer einen Bruder, eine Schwester oder einen Schwager der nur darauf wartete, dass irgendwo eine Stelle frei würde. Für die Personalchefin war das sehr hilfreich. Das mühsame Akquirieren der Arbeitskräfte blieb ihr erspart. Sie musste nur Verträge erarbeiten und das Visum beantragen.
"Dann würde ich das gerne machen.", sagte ich. "Danke, Herr Sigrist."
Er sah mich lächelnd an. Sagte aber nichts. Mir wurde plötzlich unangenehm. Hoffentlich bekomme ich eines Tages keine Rechnung für all das Glück, das ich dank ihm erfahren durfte. Das wäre schade. Denn ich mochte diesen alten Mann.

Im September fuhren Milena und ich gemeinsam nach Hause. Zuerst nahmen wir in der 1. Klasse des Bahnhof Büffet in Buchs ein gediegenes Abendessen. Zürich Geschnetzeltes! Was sonst? Ich freute mich auf die Reise. Ich war gerne mit Milena zusammen. Drei Monate sollten wir in Jugoslawien verbringen. So wollte das Gesetz. Die Saisonniers mussten drei Monate aus dem Land raus. Mich störte das nicht. Nach den anstrengenden neun Monaten machte ich gerne drei Monate Ferien. Und Milena war auch dabei. Wir nahmen uns vor, uns oft zu Hause zu sehen, bevor wir dann im Dezember gemeinsam wieder in die Schweiz zurückkehren. Vorher wollte ich noch Bata zurückgewinnen.
Eigenartig wie ich die letzten neun Monate in Vals verbringen konnte, ohne gross an Bata zu denken. Doch kaum sass ich im Zug nach Belgrad, erinnerte mich das "Nicht hinauslehnen" Schild wieder an ihn. Und ich fing an, über ihn nachzudenken. Was er wohl machte? Ob er eine Freundin hatte? Wir gingen im Streit auseinander. Ob sich das gelegt hatte? Ob wir wieder zu einander finden? Je näher mich der Zug an die Heimat brachte, umso mehr sehnte ich mich nach ihm. Doch diesmal war es für mich klar. Auch wenn es zwischen uns wieder klappen sollte, ich würde wegen ihm nicht mehr zu Hause bleiben. Ich war gerne in Vals. Und wollte unbedingt wieder dorthin.
Wie auch das letzte Mal, nahm ich den Bus nach Boka, um bei meinen Grosseltern einige Tage zu verbringen. Ich freute mich sehr darauf, vor allem weil auch Milena dort sein wird. So konnten wir etwas gemeinsam unternehmen, falls Bata nicht mehr an mir interessiert wäre. Ich achtete darauf, dass ich den Bus nehme, bei dem eine grosse Wahrscheinlichkeit bestand, ihn zu treffen. So war es auch. Und wie auch das letzte Mal funkelte es gewaltig zwischen uns. Am selben Abend holte er mich ab. Wir fuhren zu unserem Platz. Wir küssten uns. Es wurde nicht über das Telegramm gesprochen. Oder über unseren Streit.
Doch wie auch das letzte Mal bemerkte ich schon am nächsten Tag, dass Bata eine andere Vorstellung von einer Beziehung hatte als ich. Ihm reichte es, mich ab und zu zu sehen. Ich wollte ihn ständig um mich haben. Ich versuchte alle meine Tricks, um ihn an mich zu binden. Ohne Erfolg. So genoss ich die gemeinsamen Abende so gut ich konnte, und in der restlichen Zeit versuchte ich mich an diese Art Beziehung zu gewöhnen. Aber seit ich in der Schweiz einerseits von Hanspeter und anderseits von Herr Sigrist erfahren konnte, was es heisst, respektvoll behandelt zu werden, störten mich plötzlich die Allüren meines Balkan Machos. Denn die Momente in denen wir uns sehr nahe waren, konnten die unangenehme Zeit nicht mehr aufwiegen.
So wie ich bin, musste ich das klären. Ich wollte klar von ihm hören, was er mit mir vorhatte, und ob er sich vorstellen kann mich irgendwann zu heiraten.
Ich lud ihn zum Essen ein. Obwohl er ein Macho war, störte es ihn nicht, dass ich meistens bezahlte. Schliesslich lebte ich in der Schweiz und es war üblich, dass «die Ausländer» immer bezahlen. Das galt auch für Frauen.
"Ich muss bald in die Schweiz zurück", fing ich mit dem heiklen Thema an.
"Willst du wirklich wieder gehen?"
"Soll ich bleiben?", gab ich sofort zurück.
"Das musst du selber wissen", antwortete er.
"Bata, ich bleibe nur wenn du es ernst mit mir meinst."
Er antwortete darauf nichts.
"Siehst du?" Ich war plötzlich verärgert. "Du möchtest, dass ich bleibe, willst aber keine richtige Beziehung mit mir führen. Was willst du eigentlich?"
"Ich mag dich, und ich bin gerne mit dir zusammen", sagte er. "Aber meine Eltern werden nie zulassen, dass wir heiraten."
Peng! Diese Antwort hatte ich nie erwartet. Seine Eltern mochten mich nicht? Warum? Sie kannten mich nicht einmal!
"Warum nicht?", fragte ich, aus allen Wolken gefallen.
"Sie finden das nicht gut, dass du alleine in der Schweiz lebst. Sie sind sicher, dass du dort ein unmoralisches Leben führst."
"WAS?"
"Sie finden das sehr verwerflich."
"Und du? Sagst du nichts dazu?"
"Mein Vater lässt mit sich nicht diskutieren."
Das glaubte ich ihm. Sein Vater war ein höherer Polizeibeamter. In einer Diktatur diskutiert niemand mit einem Polizisten. Auch sein Sohn nicht.
"Und warum sind wir noch zusammen?", fragte ich.
"Ich mag dich. Und ich hoffe, dass sie mal ihre Meinung ändern."
Das war eine Liebeserklärung! So was kam bisher noch nie aus dem schönen Mund.
"Du kannst auch in die Schweiz kommen. Soll ich für dich eine Stelle suchen?"
"Nein!", antwortete er schnell.
"Warum nicht?"
"Ich würde nie mein Land verlassen!"
Zuerst dachte ich, dass er Spass macht. Doch es war sein voller Ernst.
Ich schüttelte den Kopf. Doch tief in meinem Innern verstand ich ihn. Auch ich hatte früher gedacht, dass man seine Seele nicht an die Kapitalisten verkaufen sollte. Inzwischen hatte ich eine ganz eigene Meinung über den Kapitalismus. Aber ich äusserte sie nicht. Er hätte mir sowieso nicht geglaubt – hätte ich früher auch nicht.
"Also dann lassen wir das Schicksal entscheiden was aus uns wird.", sagte ich. Ich staunte wie wenig mir die Vorstellung, ihn vielleicht nicht mehr zu treffen, ausmachte.
"Wie meinst du das?", fragte er.
"So wie ich das sehe, sind wir kein Liebespaar. Waren wir auch nie. Wir gehen nun definitiv getrennte Wege. Aber wir können trotzdem Freunde bleiben. Und etwas gemeinsam unternehmen, wenn ich wieder zurückkomme."
"Willst du das so?", fragte er.
"Willst du das so?", antwortete ich.
Keiner beantwortete die Frage. Und ich fuhr bald wieder mit Milena in die Schweiz. Mit allen Optionen die man nur haben konnte.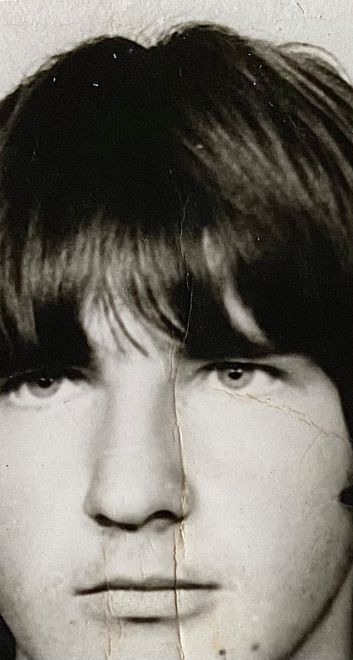
(1) Bata in den 70-ern

Im Hotel Therme konnte man damals, im Jahr 1976, eine 14-tägige Schlankheitskur machen. Eine 2000-Kalorie-Kur. Alle Mahlzeiten wurden im Speisesaal, genau nach dem Kalorien-Plan serviert. Ein Fitness Programm im Schwimmbad gehörte dazu. Nach dem Training wurden spezielle Tees und Säfte in der Bar serviert – in jenem Jahr von mir. Die Teilnehmer des Schlankheit-Programms waren vornehmlich Frauen um die vierzig. Die meisten von Ihnen hatten mehr als nur ein paar Kilos zu viel und waren dementsprechend alles andere als glücklich. Sie waren teilweise recht zickig und ich bedauerte bald, in die Bar gewechselt zu haben. Das sagte ich auch mal Herrn Sigrist, als er mich fragte, ob es mir gefällt.
"Das wird schon besser", tröstete er mich. "Hören Sie ihnen einfach zu."
"Die reden mit mir gar nicht!", beklagte ich mich.
"Gar keine?"
"Doch. Einige sind nett."
"Dann reden Sie mit denen. Lassen Sie sie spüren, dass Sie an ihrem Leid teilnehmen."
"Hm… Wie soll ich das machen?
"Im Speisesaal hat es auch funktioniert! Wie haben Sie es dort gemacht?"
"Dort sind Gäste gekommen um zu essen. Und haben schon deshalb gute Laune gehabt. Nach dem Training haben Sie Hunger, dürfen aber nichts ausser Knäckebrot essen."
"Ja, das kann sein. Versuchen Sie mal, sie auf ihr Problem anzusprechen. Ignorieren Sie es nicht."
"Ich habe gedacht, ihr Problem darf man nicht ansprechen."
"Das sehe ich nicht so. Sonst wären sie nicht hier."
"Hm…", ich zuckte mit den Schultern. "Ich weiss nicht wie."
"Zum Beispiel sagen Sie ‚Wie geht es Ihnen heute? Es muss bestimmt schrecklich sein, nicht essen zu dürfen, wenn man Hunger hat?‘ Wenn sie Ihre Frage ignorieren, wechseln Sie das Thema. Wenn sie anfangen darüber zu reden, hören Sie ihnen zu. Keine Ratschläge. Nur zuhören. Sie werden sehen, die meisten werden Ihnen dankbar sein."
Herr Sigrist hatte Recht. Einige Frauen warteten nur darauf, auf ihr Leiden angesprochen zu werden. Bald wusste ich genau, wie sich Hunger anfühlt und wie viele Varianten es davon gibt. Und wie schrecklich es ist, wenn man den ganzen Tag nur darauf wartet, dass es etwas zum Essen gibt. Nach und nach wurden die Gespräche persönlicher, und ich wusste bald genau welche Dame an der Verstopfung und welche an Durchfall litt. Sie mussten gar nichts bestellen, Kräuter-, Verveine-, oder Kamillen-Tee wurden stets vor die richtige Person hingestellt. Erstaunlich wie schnell die Hemmschwelle sinkt, wenn man sich verstanden und aufgehoben fühlt. Der Stuhlgang wurde zum Hauptthema der Teerunde, im Fünf-Sterne-Hotel Therme. Manchmal setzte ich mich auch dazu, wenn keine anderen Gäste anwesend waren. Ich freute mich mit ihnen über ihre Fortschritte und litt bei den Rückfällen. Ab und zu sah ich, wie Herr Sigrist aus seinem Büro hinter der Rezeption einen Blick zu uns warf.
Eines Tages bestellte er telefonisch zwei Kaffee. Ich soll den Kaffee zu ihm ins Büro bringen.
"Für wen ist der zweite Kaffee?", fragte ich als ich sah, dass er alleine war.
"Für Sie", antwortete er.
"Für mich?" Das hat es noch nie gegeben, dass er mich zum Kaffee einlädt.
"Aber…", versuchte ich zu protestieren. Mir war nicht wohl dabei.
"Ich habe gesehen, dass Sie keine Gäste haben", sagte er.
Ich setzte mich. Mein Herz schlug plötzlich heftig. Was will er von mir?
"Haben Sie einen Freund?"
Da haben wir es! Er will was von mir, dachte ich enttäuscht. Aber es schmeichelte mir auch, dass er mir eine so persönliche Frage gestellt hatte.
Ich sah ihn an. Sein Gesichtsausdruck war schwer zu erraten. Aber es schien als ob er sich über etwas amüsierte.
"Nein.", sagte ich. "Warum fragen Sie?"
"Das ist gut", sagte er. "Das macht die Sache einfacher."
Mit jedem weiteren Wort fühlte ich mich unwohler. Will er mich etwa fragen, ob ich mit ihm ausgehe oder so? Er sah nicht schlecht aus, aber er war um die sechzig! Und ich zwanzig.
"Die Leute reden über uns", liess er endlich die Katze aus dem Sack.
"Wie bitte?" Ich war mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden hatte.
"Die Leute denken, dass wir was miteinander haben", sagte er. Ich fühlte wie mein Gesicht feuerrot wurde.
"Wo… Wo… Woher wissen Sie das?", stotterte ich.
"Ich habe die letzte Nacht einen sonderbaren Anruf gehabt", antwortete er. "Ich hatte schon geschlafen, als das Telefon klingelte. Ein Mann, der gebrochen Deutsch sprach, fragte ob er Katica ans Telefon haben könnte."
"Was?"
"Ich sagte, dass Sie nicht bei mir sind aber er meinte, Sie hätten ihm gesagt, dass Sie die Nacht bei mir verbringen werden."
Langsam dämmerte es mir. Das passte wohl jemandem nicht, dass Herr Sigrist oft mit mir sprach und mich protegierte. Der Anrufer wollte, dass es aussieht als ob ich damit angegeben hatte. Riesenwut stieg in mir hoch.
"Das gibt’s ja nicht!", regte ich mich auf. "Es tut mir Leid Herr Sigrist. Ich habe sicher niemanden so was gesagt. Vor allem weil es gar nicht stimmt!"
Ich wagte es nicht ihn anzusehen. Meine Angst, dass unsere Freundschaft gerade zu Ende ging, wuchs und wuchs.
"Das glaube ich Ihnen", sagte er.
Seine Stimme hörte sich freundlich an. Ich wagte einen flüchtigen Blick in seine Augen. Sie lächelten. Er sah nicht verärgert aus. Eher amüsiert.
"Regen Sie sich nicht auf. Ich habe es Ihnen nur deshalb gesagt, damit Sie wissen, was man über uns denkt. Ich weiss nicht ob Ihnen das recht ist."
"Was die Idioten denken, interessiert mich nicht!"
"Dann ist es gut! Wir reden nicht mehr darüber.", sagte er und nahm einen grossen Schluck Kaffee.
"Sie sind mir nicht böse?", fragte ich.
"Ihnen böse? Warum sollte ich Ihnen böse sein?"
"Weil Sie wegen mir in der Nacht gestört wurden."
"Nein! Bestimmt nicht."
"Danke Ihnen!"
"Keine Ursache.", sagte er. "Sie sind ein hübsches Mädchen. Das wird wohl ein eifersüchtiger Verehrer gewesen sein."
Obwohl mir Herr Sigrist das Geschehene nicht übelnahm, ärgerte es mich enorm, dass mir jemand so was angetan hatte. Ich hatte es mit allen Kollegen gut und dachte, dass mich alle mögen. Dass es jemanden gab, der es nicht so gut mit mir meinte, beunruhigte mich.
(1) Ich, das Barmädchen - Hotel Therme, Vals 1975

Meine Schicht in der Bar endete normalerweise um 18 Uhr. Dann kam die Bardame. Ihre Schicht dauerte solange es Gäste gab. Wir mochten uns gut, und ich blieb meistens noch eine Weile um ihr zu helfen, weil in dieser Zeit viele Gäste einen Aperitif nahmen, bevor sie zum Abendessen gingen. Sie lehrte mich wie man Cocktails machte, Champagner öffnete und kleine Snacks zubereitete. Auch an Ihren Namen erinnere ich mich nicht, obwohl wir befreundet waren, und ich sie sehr bewunderte. Aber ich erinnere mich wie selbstbewusst sie war! Wie natürlich sie auf Menschen zuging. Ob das ein Gast, ein Kollege oder der Mann am Piano war. Sie nahm alle für sich ein. Eine besondere Schönheit war sie nicht, aber sie hatte eine Traumfigur und war stets geschmackvoll angezogen. Als Frau war sie mein absolutes Vorbild.
Eines Abends, ich half ihr wieder mal aus weil Hochbetrieb herrschte, wurde sie plötzlich kreideweiss.
"Mir ist so schlecht", flüsterte sie und verschwand durch den Hinterausgang an der Theke. Sie blieb eine ganze Weile weg. Ich unterdrückte mein Bedürfnis ihr nachzugehen und übernahm den Service.
Erst als die meisten Gäste in den Speisesaal wechselten, kam sie zurück.
"Entschuldige, dass ich dich alleine gelassen habe. Danke, dass du alles gemacht hast."
"Kein Problem", antwortete ich. "Aber was ist mit dir? Hast du was Schlechtes gegessen?"
"Ich bin schwanger", sagte sie.
"Was?" Sie war nicht verheiratet. Hatte nicht einmal einen Freund.
"Aber behalte es für dich, vorerst", sagte sie.
"Bist du glücklich darüber?", fragte ich.
"Nein, eigentlich nicht. Mir ist ständig schlecht."
"Aber das Kind? Möchtest du es?"
"Ich weiss es nicht."
Ich habe sie nie so niedergeschlagen gesehen.
"Ich sollte wieder übernehmen", sagte sie. Sie sah sehr müde aus.
"Nein. Bleib nur sitzen", sagte ich. "Mach du die Theke und ich werde die Tische bedienen."
"Wirklich?", sagte sie. "Du hast schon den ganzen Tag gearbeitet."
"Das macht mir nichts aus. Ich helfe dir gerne."
So vergingen einige Tage. Sie fühlte sich permanent schlecht und war immer deprimierter. Ich blieb immer länger, um ihr zu helfen. Bald war ich mir sicher, dass ich auch ohne sie die Bar führen könnte.
"Ich werde kündigen", sagte sie eines Abends zu mir.
"Nein! Das kannst du mir nicht antun!», schrie ich enttäuscht.
"Na ja, eine schwangere Bardame der ständig schlecht ist, ist nicht so gut für das Geschäft."
"Hat das jemand gesagt? Hast du es jemandem erzählt?", fragte ich.
"Nein. Aber so ist es. Und ich will weg hier. Ich möchte den Vater des Kindes nicht immer ansehen müssen."
"Seid ihr nicht mehr zusammen?"
"Wir waren nie zusammen", antwortete sie. "Er ist verheiratet."
"Oh!" Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Wie kann man sich nur mit einem verheirateten Mann einlassen?, dachte ich, hatte aber gleich deswegen ein schlechtes Gewissen.
"Möchtest du meinem Job übernehmen?", fragte sie plötzlich "Wenn ich weggehe."
"Meinst du das im Ernst?"
"Ja."
"Das geht doch nicht!"
"Warum nicht?"
"Das würde ich sehr gerne machen. Aber sie wollen sicher eine gelernte Bardame."
"Da bin ich mir nicht so sicher", sagte sie. "Du bist jung, unverbraucht und verdienst fast nichts. Das ist gut für einen Betrieb."
"Meinst du?"
"Ganz sicher! Wenn du möchtest, kann ich dich dem Chef als meine Nachfolgerin vorschlagen. Ich sage ihm, dass du die Arbeit schon kennst und so der Betrieb ohne Unterbruch weitergehen kann."
"Meinst du, ich habe eine Chance?"
"Ich denke schon. Sonst kannst immer noch deinen Freund um Hilfe bitten."
"Du meinst Herrn Sigrist?"
"Ja."
Ich bekam den Job ohne Hilfe von Herrn Sigrist. Die Empfehlung der Bardame hatte gereicht.
Ach, wie stolz ich war, als ich das erste Mal am Abend ohne die weisse Serviceschürze arbeiten durfte! Ich hatte sie zwar gerne an, aber sie abnehmen zu dürfen, war noch ein weiterer Schritt nach oben auf meiner Gastarbeiter-Karriereleiter. Denn die Arbeit in der Nachtschicht war viel anspruchsvoller. Neben der Bedienung der Gäste, durfte ich auch Kasse-Abrechnungen und Ware-Bestellungen machen. Ich erledigte alles grösstenteils selbständig. Nur ab und zu warf mein Chef einen Blick hinter die Theke. Er liess mich machen, und ich freute mich endlich etwas zu tun, was ich in meiner Berufslehre in Jugoslawien gelernt hatte. Ich war nicht mehr ein Niemand. Die Hotelgäste, meist Deutsche und Schweizer, sassen Abend für Abend bis spät in der Nacht an der Bar, wir unterhielten uns oder tranken gemeinsam ein Glas Champagner. Ich übte mich im unverbindlichem Flirten, liess mich aber nie mit einem Gast ein. Ich kam auch nicht gross in Versuchung. Die meisten Gäste waren mindestens doppelt so alt wie ich. Zu jener Zeit war ich sehr, sehr glücklich in meinem kleinen Paradies namens Vals. Doch wie das Leben so spielt, zum Garten Eden gehört auch die Schlange. Meine Schlange erschien in Form eines jungen Spaniers. Er hiess Andres.

Andres war einer dieser Spanier, die ohne ein Wort Deutsch zu kennen gleich im Service des Speisesaals vom Hotel Therme landeten. Weil sein Bruder bereits dort arbeitete und zu der Personalchefin ein gutes Verhältnis hatte. Er sah nicht wie ein Spanier aus. Zumindest nicht so wie ich mir einen Spanier vorgestellt hatte. Er war weder klein, noch hatte er dunkle Augen und pechschwarze Haare. Gross, mager und blond war er. Schlichtweg nicht mein Typ.
Warum ich an jenem 4. Januar 1977 trotzdem seine Einladung zum Tanzen angenommen hatte, als wir uns im Korridor des Personaltraktes begegneten, lag wohl an diesem trostlosen Tag. Die Festtage gingen vorbei, ohne dass eine einzige Karte von zu Hause gekommen war. Seit Tagen fühlte ich mich schrecklich einsam. Haben mich in den zwei Jahren schon alle vergessen? Wie länger ich von zu Hause weg war, um so mehr fehlte mir alles. Vor allem an den Feiertagen. Manchmal sehnte ich mich sogar nach der politischen Schule meines Stiefvaters. Die Einladung von Andres kam da genau richtig.
Die Musik in der Bar des Hotels "Rovanada" war laut und zum Weinen schön. Eine Schnulze löste die andere ab. Ich trank Rotwein, Andres Bier. Der erste Kuss ergab sich schon beim Tanzen. Am nächsten Morgen erwachten wir zusammen. Im Gegensatz zu den meisten Liebesbeziehungen die in den ersten Wochen am schönsten sind, benötigten Andres und ich eine lange Zeit um uns erst zu finden. Er war ein iberischer Macho und ich eine Balkanrevoluzzerin. Da er praktisch kein Wort Deutsch sprach, und ich kein Spanisch, war es fast unmöglich uns richtig zu unterhalten. Das einzige was uns verband war der Durst nach Leben und nach Vergnügen.
Im Sommer 1977 zog ich bei Milena aus. Andres und ich mieteten ein Appartement das zum Hotel Therme gehörte. Die Appartements konnten von den Angestellten zu besonders günstigen Preisen gemietet werden. Da das Wohnen ein Teil des Lohnes ausmachte, wurde uns das gutgeschrieben. Ich glaube mich zu erinnern, dass Andres und ich für unser Appartement nur 150 Franken im Monat zahlen mussten. Es bestand aus einem Schlaf-Wohnraum, einer Schrankküche und einem Bad. Das eigene Bad war ein besonderer Luxus.
Andres liebte Flamenco. Die Klänge dieser unglaublichen spanischen Musik zogen bald auch mich in ihren Bann. Wir sangen und tanzten mit unseren Freunden manchmal bis spät in die Nacht. So jung wie wir waren, machte es uns nichts aus, die ganze Nacht auf zu bleiben und am nächsten Morgen zur Arbeit zu gehen.
Inzwischen arbeitete auch meine Schwester in Vals. Sie verliebte sich ausgerechnet in Miro, meinen Lift-Verehrer vom Weihnachtsfest. Sabina, ihr erstes Kind wurde 1978 im Spital Ilanz geboren. Zu jener Zeit fühlte ich mich glücklicher, als ich je zu Hause bei meinen Eltern gewesen war. Ein eigenes Zuhause zu haben, eigenes Geld zu verdienen und meine Schwester in der Nähe, fühlte sich unglaublich gut an!
Die gute Zeit endete abrupt, als Andres nach einem Streit mit seinem Vorgesetzten fristlos entlassen wurde. Er musste bereits am nächsten Tag das Hotel verlassen. Das hört sich vielleicht harmlos an, für uns war es aber eine Katastrophe. Ein kleiner Weltuntergang. Denn als Saisonnier konnte er nicht gleich eine andere Stelle suchen. Die Arbeitsbewilligung wurde immer nur für den Arbeitgeber ausgestellt bei dem man gerade arbeitete. Also man musste das Ende der Saison abwarten bevor man eine neue Stelle antreten konnte. Doch um eine neue Arbeit zu bekommen, brauchte man Referenzen und Zeugnisse der bisherigen Arbeitgeber. Andres hatte die nicht. Hotel Therme war seine erste Anstellung in der Schweiz.
"Ich war im Reisebüro. Mein Flug nach Madrid geht morgen um vier Uhr", sagte Andres als ich am Abend nach Hause kam.
"Und dann?", fragte ich mit trockenem Hals.
"Ich komme nicht mehr zurück."
"Nie mehr?"
"Nie mehr. Ich habe genug von der Schweiz."
"Und ich?"
Er zuckte mit den Schultern und sah mich ratlos an.
Obwohl ich mir damals noch nicht vorstellen konnte, mein ganzes Leben mit Andres zu verbringen, verlor ich fast den Boden unter den Füssen, als es mir klar wurde, dass ich ihn nie mehr sehen werde. Wir hatten eine aufregende, temperamentvolle Zeit hinter uns, die alles andere als harmonisch war. Trotzdem fühlte sich der Gedanke ihn zu verlieren unerträglich an.
Die letzte gemeinsame Nacht war eine traurige Nacht. Der Morgen kam schneller, als es uns lieb war. Nun hiess es Abschied nehmen. Ich begleitete ihn nur bis zu der Haltestelle des Postautos. Der letzte Kuss. Die letzte Umarmung. Unsere Körper bebten. Der letzte Blick. Auch über sein Gesicht rollten Tränen. Doch es war zu spät. Wir hatten uns für ein Ende mit Schrecken, statt für ein Schrecken ohne Ende entschieden. Ein gemeinsames Leben war für uns nicht möglich. Wie hätten wir in Madrid leben sollen? Beide arbeitslos. Ich sprach nicht einmal Spanisch. Eine Fernbeziehung schien zu jener Zeit undenkbar. So hatten wir uns entschieden alle Brücken abzubrechen. Keine Briefe, kein Telefon, kein Wiedersehen.
In den folgenden Tagen versuchte ich das unvermeidliche zu akzeptieren. Mein Leben ohne ihn zu leben. Doch die Erkenntnis, dass er mich wirklich liebte, machte es mir nicht leicht. Denn ich war sicher, dass er mich liebte. Warum sonst hätte er geweint? Die Erinnerungen an die weniger schöne Zeit wurden nach und nach durch die schönen ersetzt. Alles was ich sah, erinnerte mich an ihn. Da ein Weg über den wir zusammen gingen, dort ein Tisch an dem wir sassen. Ein Lied zu dem wir tanzten. Die vielen Kämpfe die wir ausgetragen hatten, wirkten jetzt klein und unbedeutend. Oft weinte ich mich in den Schlaf. Er fehlte mir beim Einschlafen und beim Erwachen. Wenn ich nur einmal seine Stimme hörten könnte, dachte ich in meinen einsamen Nächten.
Doch kein Schmerz dauert ewig. Früher oder später heilt die Zeit alle Wunden. Die Lebensfreude siegt, vor allem wenn man jung ist. Schon bald hatte ich genug von den trostlosen Abenden, von der Einsamkeit und der Traurigkeit. Ich wollte wieder lachen. Und leben. Von nun an ging ich jeden Abend ins Stübli oder ins Rovanada. Ich musste mich mit niemanden speziell verabreden. Die Hotelangestellten waren überall anzutreffen.
Eines Abends im Stübli lernte ich einen jungen, gut aussehenden Mann aus dem Dorf kennen. Er studierte in St. Gallen und kam an den Wochenenden nach Hause. Auch an seinen Namen erinnere ich mich nicht mehr, aber ich erinnere mich, dass er unglaublich intelligent war. Ich unterhielt mich gerne mit ihm, zumal wir eine ähnliche politische Einstellung hatten. In seiner Gesellschaft fühlte ich mich wohl. Ein Paar waren wir aber nicht. Und während die Erinnerung an Andres von Tag zu Tag blasser wurde, fing ich an mich auf die Wochenenden zu freuen.
An einem trüben Morgen, ich war gerade aufgestanden und hatte mich mit einem türkischen Kaffee und einer Marlboro auf dem Sofa bequem gemacht, läutete in meinem Appartement das Telefon. Das war eine Seltenheit. Damals telefonierte man nicht so oft wie heute. Das Telefonieren war ziemlich teuer. Wer konnte das sein? Hoffentlich ist nichts zu Hause passiert, dachte ich und nahm beunruhigt den Hörer ab.
"Kati?" Die Stimme hörte sich fremd an, aber es gab nur einen Menschen der mich so nannte!
"Kati? Bist du es?"
"Andres?"
"Ja, ich bin’s!"
"Warum rufst du an? Das kostet viel Geld."
"Kati, ich kann nicht ohne dich sein. Ich komme zurück."
"Was? Sag’s nochmal!"
"Ich habe Arbeitsvertrag für dich und mich."
"Wo?"
"In Klosters."
"Ab wann?"
"Ab sofort."
"Das geht doch nicht", sagte ich "das weisst du."
"Vielleicht doch", sagte er. "Der Direktor mag dich. Frag ihn, ob du sofort gehen kannst."
"Ich weiss nicht, ob er mich so sehr mag."
Langsam merkte Andres, dass ich nicht so begeistert reagierte, wie er es erwartet hatte.
"Freust du dich nicht?", sagte er. Seine Stimme hörte sich vorwurfsvoll an.
"Doch! Doch!"
"Aber bist so, so..."
"Ich bin erst aufgestanden", unterbrach ich ihn. "Bin noch nicht richtig wach."
"Liebst du mich noch?", fragte er.
Das wäre der richtige Augenblick gewesen, ihm die Wahrheit zu sagen. Ich hätte mir so viel Leid ersparen können! Doch ich wollte ihn nicht verletzen. Und ein wenig Zeit gewinnen, um mir zu überlegen, wie ich zu dieser veränderten Situation stehe.
"Natürlich liebe ich dich!", rief ich entrüstet in den schwarzen Hörer. "Natürlich liebe ich dich."
"Dann ist alles gut."
"Wann kommst du?", fragte ich.
"In einer Viertelstunde", antwortete er.
"Was?" Ich war sicher, dass ich mich verhört hatte. Er lachte.
"Ich bin in Vals. Bei meinem Bruder. Darf ich gleich zu dir kommen?"
Vor einigen Wochen hätte ich alles für diese Worte gegeben. Jetzt wäre ich am liebsten aufgewacht. Wie aus einem schlechten Traum.
Ich benötigte einige Tage, um mich an Andres wieder zu gewöhnen. Er war mir in den zwei Monaten fremd geworden. Ich wusste gar nicht, worüber ich mich mit ihm unterhalten sollte. Um mit ihm schlafen zu können, musste ich vorher ein - zwei Gläser Wein trinken. Trotzdem bin ich bei ihm geblieben. Warum? Keine Ahnung. Aus Bequemlichkeit? Aus Mitleid? Oder war ich einfach zu feige, um ihm zu sagen, dass ich mir ein Leben mit ihm nicht mehr vorstellen konnte.
Das Gespräch mit Herrn Sigrist schob ich so lange wie möglich vor mich hin. Doch Andres drängte mich. Wir konnten die neuen Vorgesetzten nicht unendlich hinhalten. Ich fasste meinen ganzen Mut zusammen und ging in sein Büro.
Wie immer sass Herr Sigrist tief in seine Bücher versunken, als ich reinkam. Sein Gesicht strahlte, als er mich sah.
"Ah! Katica!"
"Darf ich stören?"
"Bitte, setzen Sie sich."
Er legte seinen Kugelschreiber auf den Tisch und sah mich interessiert an.
"Ich möchte Sie um etwas bitten."
"Ja?"
"Mein Freund ist zurückgekommen", sagte ich schnell, bevor mich der Mut verliess.
"Andres?"
"Ja." Er kannte Andres. Und er wusste auch Bescheid über den Streit, der zu Andres Entlassung führte.
"Herr Sigrist", ich räusperte mich. "Er möchte, dass ich mit ihm weggehe."
Er antwortete nichts. Sein Blick wanderte zum Fenster.
"Andres hat für uns Arbeit in Klosters gefunden. Ich wollte Sie fragen, ob ich vor Saisonende gehen darf."
Er sagte immer noch nichts. Sah weiterhin zum Fenster hinaus.
"Es tut mir Leid Herr Sigrist", sagte ich. "Es tut mir so Leid."
"Was tut Ihnen Leid?", fragte er plötzlich und sah mich fast feindselig an. Dieser Blick tat weh. Noch nie hatte er mich so angesehen.
"Dass ich Sie verlasse. Ich meine die Therme verlasse. Sie waren immer so gut zu mir. Ich verdanke Ihnen so viel."
"Haben Sie sich das gut überlegt?", fragte er.
"Ja", antwortete ich.
Eigentlich hatte ich es mir gar nicht überlegt, und gerne ging ich auch nicht. Ich wusste nicht einmal was ich genau in dem Hotel Garni in Klosters machen werde. Aber ich hatte mich da in etwas hineinmanövriert und kam nicht mehr raus.
"Ich liebe ihn", versuchte ich an die Gefühle von Herrn Sigrist zu appellieren.
"Ach die Liebe!" Er winkte ab. Seine Stimme hörte sich sarkastisch an.
Noch nie in meinem Leben hatte ich mich so schlecht gefühlt wie in jenem Augenblick. Ich wollte mit Andres weggehen, nur weil ich zu feige war um ihm zu sagen, dass ich lieber in Vals bleiben würde. So belog ich ihn, mich und meinen grossartigen Protegé, Herrn Sigrist.
"Andres ist kein Mann für Sie." Herr Sigrist unterbrach meine Gedanken. "Glauben Sie mir. Aber ich möchte Ihrem Glück nicht im Wege stehen. Sie dürfen gehen, sobald wir jemanden für die Bar gefunden haben. Ich werde es für Sie regeln."
Und schon wieder regelte er etwas für mich! Obwohl ich ihn um etwas bat, das er nicht für richtig hielt. Ich kam mir schrecklich undankbar vor. "Danke Herr Sigrist! Danke vielmals!", sagte ich den Tränen nahe.
"Danken Sie mir nicht. Dazu gibt es keinen Grund. Eigentlich sollten Sie mich verfluchen."
Ich sah ihn ungläubig an. Was meinte er wohl damit? Warum sollte ich ihn verfluchen?
"Ich verstehe nicht", sagte ich. "Wie meinen Sie das?"
"Sie verdienen etwas Besseres, als Andres, Sie wissen es nur nicht. Und ich habe die Macht zu verhindern, dass Sie mit ihm weggehen. Aber ich tue es nicht. Weil ich Ihnen nichts abschlagen kann."
Der Tag als ich Vals verliess, war einer der traurigsten Tage meines Lebens. Es regnete in Strömen als ich die Abschiedsrunde machte. Ich wäre so gerne geblieben! Als ich mich von Herrn Sigrist verabschiedete, weinte ich. Er war so ergriffen, dass er nichts sagen konnte. Nur die Hand gab er mir. Ich erinnere mich heute noch, wie warm und fest sie sich anfühlte.
Schade, dass ich ihn nie mehr gesehen hatte. Ich hätte ihm gerne gesagt, dass er Recht hatte. Mit seiner Meinung, dass Andres kein Mann für mich war. Dass ich ihn oft verfluchte, weil er mir damals nicht im Wege stehen wollte. Wenn er damals Nein gesagt hätte, wäre mein Leben vielleicht anders verlaufen. Doch wenn ich mit Andres nicht gegangen wäre, hätte ich später nie die grösste Liebe meines Lebens gefunden. So denke ich, dass der Abschied, wie traurig er auch war, mich weitergebracht hatte. Ein grosses Stück weiter, auf dem Weg zu dem, was ich heute bin.
(1) Andres und ich in Vals 1977

(2) Mein Zimmer in Vals 1976

Frau Keiser hatte eine Vorliebe für elegante Kleider in auffälligen Farben. Die Kleider waren aber auch das einzige Gute an ihr. Niemand konnte ihr etwas recht machen. Egal wie man sich bemühte, sie fand immer etwas, das sie kritisieren konnte. Meistens knöpfte sie sich gerade den vor, der ihr gerade über den Weg lief. Meine Arbeitskolleginnen und ich waren ständig auf der Hut, um sie rechtzeitig zu bemerken, damit wir ihr aus dem Weg gehen konnten.
Der Einzige der mit Frau Keiser kein Problem hatte, war der Koch Giuseppe. Schwerhörig wie er war, trug er einen Hörapparat. Sobald Frau Keiser in die Küche kam, schaltete er den Apparat aus. Und während sie ihm Vorwürfe über alles Mögliche machte, strahlte er sie mit seinen fröhlichen, dunklen Italiener-Augen an. Und wenn auch etwas von dem, was sie gesagt hatte zu ihm durchgedrungen wäre, hätte er es eh nicht verstanden. Wie viele anderen Italiener, sprach auch er nach vielen Jahren in der Schweiz kaum Deutsch. Giuseppe war ein sympathischer, älterer Herr. Ein besonders guter Koch war er aber nicht. Er machte abends oft nur eine grosse Büchse Ravioli auf, wovon jeder von uns, wenn’s gut kam, fünf Ravioli bekam. Wenigstens gab es noch Brot, aber auch nicht allzu viel, womit wir die Sauce aufsaugen konnten. "Keine Fleisch Mittag und Abend", sagte Giuseppe, wenn wir uns über die Ravioli beklagten. "Ich nicht viel Geld von Signora Keiser bekomme." Wenn ich heute über jene Zeit nachdenke, kommt mir als erstes der Hunger in den Sinn. Im Keisers Garni hatte ich ständig Hunger. Erst am Abend in meinem Zimmer konnte ich mich satt essen. Mit Brot und Bündner Salami.
Das Keisers Hotel Garni befand sich in Klosters, unweit vom Dorfzentrum an einer lebhaften Strasse. Wie die Bezeichnung Garni schon sagt, bot das Hotel den Gästen nur Zimmer mit Frühstück an. Zusätzlich wurde von der Familie Keiser in den Nachmittag- und Abend-Stunden im gleichen Haus eine Bar betrieben. Da der Frühstückservice logischerweise kein tagfüllender Job war, musste ich den Rest des Tages als Zimmermädchen arbeiten. Andres durfte in der Bar aushelfen. Was für eine schreckliche Ungerechtigkeit! Sein Deutsch war immer noch sehr dürftig und Bar-Erfahrung hatte er auch nicht, im Gegensatz zu mir. Und während ich die Bäder in den Gästezimmern putzte, die Betten machte, fremde Nachthemden zusammenlegte und die Zahngläser hochpolierte, flirtete Andres mit älteren Damen an der Bar. Mit Sehnsucht dachte ich an Vals und an den tollen Job, den ich für diese Misere aufgegeben hatte.
Dass Andres fast ein Drittel mehr als ich verdiente, überrascht wahrscheinlich niemanden. Er war ein Mann. In der Schweiz galten Männer damals als Familienernährer und verdienten deshalb einiges mehr als Frauen. Dazu kam, dass Frau Keiser eine unglaublich pingelige Person war. Noch nie zuvor war ich einer solchen Frau begegnet! Wie ein General bei der Truppeninspektion, wachte sie ständig über uns Faulpelze. Ihren Zeigefinger fürchteten wir wie den Teufel. Sie strich mit ihm so lange über das von uns gerade geputzte, bis sie etwas fand, worüber sie sich schrecklich aufregen konnte. Ihr Finger streifte sogar Stellen die nie jemand zu Gesicht bekam. Wie zum Beispiel unter die Matratzen oder über dem Tür- oder Fenster-Rahmen. Noch heute, wenn ich zu Hause mein Bad putze, kann ich keine Stelle ungereinigt auslassen. Der gefürchtete Finger von Frau Keiser wacht heute noch über mich.
Andres und ich wohnten in einem zweihundert Jahre alten Holzhaus in der Nähe des Hotels. Ich erinnere mich, dass seine Fassade mit Hörnern von Steinböcken und anderen Wildtieren verziert war. Ich hasste dieses Haus, von dem Augenblick an, als ich zum ersten Mal über seine Schwelle trat. Heute würde ich ein solches Haus lieben. Damals, nach meinem schönen, modernen Appartement im Vals, fand ich es schrecklich. Alles in diesem Haus war uralt und schmuddelig. Die Wände, die Einrichtung, die Möbel, die Vorhänge, die Teppiche. Wir hatten nur ein Zimmer für uns, das Bad teilten wir mit anderen Mietern. Auch im Zimmer selbst sah alles alt und deprimierend aus. Ich hatte immer das Gefühl all die zu riechen, die in vergangenen Generationen in dem selben Bett wie wir geschlafen haben.
Vor zweihundert Jahren war das Zimmer wahrscheinlich als sehr schön empfunden worden. Die Wände bestanden komplett aus Holz, der Boden und die Möbel auch. Es war ein sehr grosses Eckzimmer mit vielen kleinen Fenstern, die viel Licht in den Raum liessen. Doch das war nur wichtig, wenn man sich durch den Tag im Hause aufhielt. Andres und ich arbeiteten den ganzen Tag, abends wenn wir schlafen wollten, leuchteten die Strassenlaternen direkt auf unsere Gesichter. Es gab weder Nachtvorhänge, noch liessen sich Fensterläden schliessen. Andres störte das nicht. Er konnte überall schlafen. Ich hingegen wälzte mich bis spät in der Nacht in unserem antiken Hochbett und trauerte meinem geliebten Vals nach. Ich vermisste meine Spaziergänge in der Abgeschiedenheit, die lustigen Abende in der Rovanada-Bar, die Bäder von Therme und den Coupe Dänemark vom Cafe Schnyder. Ich vermisste meine freien Tage mit Milena in Ilanz oder Chur und die gemütlichen Abende mit meiner Schwester und Miro. Und ich vermisste Herrn Sigrist.
Bald befand ich mich in einem Zustand permanenter Unzufriedenheit. Mein Leben fühlte sich wie ein einziges Desaster an. Die Arbeit ödete mich an, Frau Keiser ödete mich an, Andres ödete mich an. Ich wachte morgens unglücklich auf und ging abends unglücklich ins Bett. Genau in dieser Zeit gerieten Frau Keiser und ich aneinander. Sie zitierte mich in ihr Büro.
"Ich bin jetzt am Bedienen", zischte ich sie an. "Ich komme, wenn ich fertig bin."
"Sie kommen sofort!", schrie sie mich an. Einige Gäste drehten sich nach uns um. Ihre dünnen, kalten Finger packten meinen Unterarm. Ich riss meinen Arm los und sah sie feindselig an. In mir kochte es. Langsam hatte ich die Nase voll. Wenn sie jetzt noch ein Wort sagt, laufe ich davon.
Doch sie sagte nichts und ging in ihr Büro.
"Haben Sie jetzt Zeit in mein Büro zu kommen?", fragte sie übertrieben höflich, als der Frühstückservice vorbei war.
"Ja.", antwortete ich kurz angebunden.
In ihrem Büro bat sie mich Platz zu nehmen.
"Das was heute passiert ist, darf nicht mehr vorkommen", sagte sie.
Während ich noch überlegte, was ich dazu sagen sollte, sprach sie weiter.
"Sie kommen aus einem armen kommunistischen Land", sagte sie. Ihre Stimme hörte sich wie die eines Pfarrers an. "Sie sollten froh sein, dass sie hier etwas zu essen bekommen. In Ihrem Land würden Sie hungern. Zeigen Sie mehr Dankbarkeit!"
Nun war das Fass voll! Das musste ich mir nicht gefallen lassen. Der sage ich jetzt die Meinung! Danach gehe ich packen und fahre nach Hause. Ich zweifelte nicht daran, dass sie mich entlassen würde, wenn ich ihr sagte, was ich sagen wollte.
"Ja ich komme aus einem armen, kommunistischen Land. Doch so viel Hunger wie hier in der reichen Schweiz, hatte ich in Jugoslawien nie."
Sie sah mich mit offenem Mund an. Als ob ihr Worte im Hals steckengeblieben wären.
"Was haben Sie gesagt?", fragte sie.
Ich wiederholte das gesagte.
"Kommen Sie mal in den Personalraum, wenn wir am Essen sind. Dann werden Sie verstehen was ich meine. Mit fünf Ravioli aus der Dose wird niemand satt."
Eine ganze Weile blieb sie stumm. Als ob sie das Gehörte zuerst verarbeiten müsste.
"Und das mehrmals in der Woche!", doppelte ich nach.
"Das wusste ich nicht", sagte sie. Ihre Worte schienen ehrlich gemeint. "Es tut mir Leid. Ich werde sofort mit Giuseppe reden."
Ich sah sie ungläubig an. Meinte sie das ernst? Oder war das Sarkasmus? Nie im Leben hätte ich mit einer solchen Antwort gerechnet. Eher mit einer Kündigung.
Doch Frau Keiser meinte es ernst. Und sie hielt ihr Wort. Von nun an gab es keine Ravioli mehr. Ab und zu kam sie unangemeldet in den Personalraum um zu sehen, was wir zu essen bekamen. Dass ich diese Schlacht gewonnen hatte, gab mir ein gutes Gefühl. Es war zwar nur eine kleine Schlacht, aber ich lernte daraus, dass man sich nicht alles gefallen lassen muss. Manchen Menschen muss die Wahrheit unverblümt gesagt werden. Damit sie ihre Augen öffnen. Und einen respektieren lernen.
Am Ende der Saison bat Frau Keiser mir und Andres einen Job für den nächsten Winter an. Sie war echt enttäuscht, als wir "nein" sagten.
(1) Andres und ich 1979

In Jugoslawien waren Militärgeheimnisse richtige Geheimnisse. Und die Militär-Stützpunkte befanden sich weit weg von jeglicher Zivilisation, gut versteckt vor Freund und Feind. Warum die Schweizer ausgerechnet einen Berg, der von Touristen nur so wimmelte, für eine Militärbasis ausgewählt hatten, konnte ich nicht verstehen. Dachten die wirklich, dass ein Schild "Fotografieren verboten" ausreichte, um die Radarantennen vom Rest der Welt geheim zu halten? Heute weiss ich, welcher Gedanke dahinter steckt: Dass die Schweiz Militärstützpunkte hat, ist nicht geheim. Was sich in ihnen verbirgt, schon.
Ich war in einer Gegend aufgewachsen in der bereits ein grosser Kürbis auf dem Feld als Gebirge bezeichnet werden konnte. Ein Hotel auf 2200 m Höhe, konnte ich mir gar nicht vorstellen. Kann man in einer solchen Höhe überhaupt atmen?, fragte ich mich, während die Vierer-Gondeln in Minutentakt die Talstation in Kriens verliessen. Andres und ich waren alleine in der Kabine. Unser Gepäck belegte den restlichen Platz. Auch Andres war kein Kind der Berge. Auch ihm war es mulmig in der Magengegend. In der Mittelstation Fräkmüntegg wechselten wir in eine grosse Kabine, die Platz für ca. 40 Personen bot. Sie sollte uns zu der Bergspitze bringen. Dort sollten wir bis zum Winter arbeiten und wohnen. Es war Ende Mai 1978. Die Wolken beherrschten den Himmel. Leichter Nieselregen vernebelte die Aussicht. Mit einem Ruck fuhr die Seilbahn los. Bereits nach einigen Metern verschluckte der Nebel die dicken Seile. Es fühlte sich an, als ob wir in der Luft schweben würden. Wir fahren in den Himmel, dachte ich und hielt Andres Hand fest.
Einige Spanier und Italiener, die offenbar im Hotel Pilatus Kulm arbeiteten, fuhren mit. Sie verbrachten ihren freien Tag in Luzern. Wir kamen sofort ins Gespräch. Nicht nur weil sie auch Ausländer waren. In der Abgeschiedenheit einer Seilbahn, die unter Windböen ächzt, kommt man sich automatisch näher. Sie lachten, als sie meine verkrampften Hände auf der Haltestange der Kabine bemerkten.
"Keine Angst", sagte eine nette Italienerin, die sich als Magi vorgestellt hatte. "Das ist normal. Die Bahn fährt nicht, wenn gefährlich ist."
"Woher wissen die, ob es gefährlich ist?", fragte ich.
"Sie wissen es", sagte Magi mit einer solchen unumstösslichen Überzeugung, dass ich ihr auf Anhieb glaubte. "Sie haben Computer", bekräftigte sie ihre Aussage.
Dann wird es stimmen, dachte ich ehrfürchtig. Ich hatte von Computern gehört und wusste, dass sie etwas ganz Besonderes waren. Aber wie die funktionierten und was man mit ihnen alles anstellen konnte, entzog sich meiner Vorstellungskraft. Als die Kabine in der Mitte der Strecke über einen grossen Mast fuhr, stockte mein Atem. Für einen kurzen Augenblick hatte ich das Gefühl, dass wir in die Tiefe stürzen.
Ich schrie. Alle lachten. Ausser Andres. Sein Gesicht war bleich wie ein Leintuch. Einige Wochen später lachten auch wir jedes Mal, wenn die Touristen an dieser Stelle schrien.
Abgesehen von der unheilvollen Seilbahn, übte der Pilatus auf mich vom ersten Augenblick an eine besondere Faszination aus. Wie Vals. Damals. Andres und ich bekamen ein schönes Zimmer in dem hundert Jahre alten Hotel Kulm. Es gab auch ein ganz modernes, rundes Hotel Bellevue. Dort gab es ein Selbst-Bedienungsrestaurant für die weniger betuchten Gäste und ein «A la Carte» Restaurant im französischen Stil, für die Gäste mit grösserem Budget.
Auf dem Pilatus waren die Spanier nicht in der Überzahl. Hier herrschten die Jugoslawen. Ihr Kopf war Smilja, eine einfache Frau aus Bosnien, die wie die "Spanisch Mafia" in Vals, für den Nachschub der Angestellten sorgte und sich um eine gute Integration der Neuankömmlinge bemühte. Was auch nicht schwer war, denn die meisten waren mit ihr verwandt oder verschwägert. Andres und ich waren Quereinsteiger. Wir meldeten uns auf ein Inserat, das in einer Hotelzeitung ausgeschrieben war. Besser gesagt, ich meldete uns an, denn Andres Deutsch reichte dafür nicht. Natürlich sorgte ich dafür, dass nur Service in meinem Stellenbeschrieb stand. Keine Zimmer, Küche oder sonst welche Zusatzaufgaben.
Ich war sehr gespannt auf Herrn und Frau Mohr die das Hotel, das eigentlich der Pilatus-Bahn gehörte, leiteten. Inzwischen wusste ich, dass man eine noch so gute Arbeit leisten kann, wenn der Chef einen nicht mag, hat man es nicht leicht. Wir meldeten uns an der Rezeption an. Die Empfangs-Sekretärin kündigte uns sofort bei den Mohrs an.
Frau Mohr war eine grosse, stattliche Frau in den Fünfzigern mit einem umwerfenden, französischen Akzent. Ihre Heimat war die Westschweiz, wo französisch gesprochen wurde. Mit ihrem geraden Rücken, den perfekt ondulierten Haaren und geschmackvollen Kleidern, hätte sie besser auf den Hof von Louis des Vierzehnten als auf den Berg gepasst. Ihr Mann schien einiges älter als sie. Sie hatten zwei Kinder. Beatrice, ein nettes, hübsches Mädchen, und François, der sich gerne bei den Angestellten aufhielt und uns ab und zu Kuchen aus der Küche im Namen seiner Mutter spendierte. Zu der Familie gehörte noch Frau Casanova, die Schwester von Herr Mohr, eine liebenswürdige alte Dame, die sich nur noch sehr langsam mit einem Gehstock bewegen konnte. Ihr legendärer Spruch "Ich hole das schnell!", wenn man sie um etwas bat, wurde stets mit liebevollem Schmunzeln wahrgenommen. Der Chef de Service war ein grosser, älterer Herr aus Wien, namens Steininger. Er trug stets einen schwarzen Anzug und trank gerne Abends, nach der Arbeit ein Glas Wein. Oder zwei. Er schaffte es locker, die Bestellung eines Vier-Gang-Menüs an einem Tisch mit vier Personen aufzunehmen, ohne ein einziges Wort aufzuschreiben.
Herr und Frau Mohr waren die ersten richtigen Patrons, die ich kennengelernt hatte. Sie nutzten Ihre Angestellten nicht aus und behandelten sie mit Respekt. Trotzdem blieben sie stets distanziert. Keiner hatte es je geschafft für sie mehr als ein Angestellter zu sein. Trotz ihrer Distanziertheit mochten die Angestellten Frau Mohr. Wenn sie einen kritisierte, tat sie das mit gewählten Worten. Sie war niemals verletzend! Manchmal konnte sie Kritik sogar humorvoll übermitteln. Zum Beispiel setzte sie sich mal zu mir an den Tisch, als sie mich zufällig beim Kaffee trinken im Restaurant sah.
"Ich muss Ihnen einen Witz erzählen", sagte sie.
Das war was Neues, dachte ich. Frau Mohr erzählt einen Witz!
Ich weiss nicht mehr genau wie der Witz ging, aber es ging um einen Arbeiter der immer ein blaues Auge hatte, ohne zu wissen warum, bis ihm jemand sagte, dass er den Kaffeelöffel aus der Tasse rausnehmen sollte bevor er trank. Ha, ha! Ich habe es begriffen und nie mehr den Kaffee getrunken ohne den Löffel aus der Tasse zu nehmen. Heute noch, wenn ich sehe, dass jemand so seinen Kaffee trinkt, kommt mir Frau Mohr in den Sinn.
Auf dem Pilatus lebte sich ähnlich wie in Vals. Nach der Arbeit trafen wir uns bei jemandem im Zimmer, die meisten Zimmer im Kulm waren von den Angestellten belegt. Die Hotel Gäste brachte man in den modernen Zimmern des runden Hotels Bellevue unter. Der Vorteil in einem Berghotel zu leben, war es, dass ab 18 Uhr keine Bahn mehr fuhr. Und Hotelgäste gab es selten. Damals war der Pilatus noch nicht so intensiv für den Tourismus genutzt wie heute.
An den schönen Sommerabenden spielten wir auf der Terrasse zwischen Kulm und Bellevue Handball. Wir spielten so lange es Bälle gab. Denn wenn ein Ball über die Mauer in Richtung Luzern flog, machte er erst zwei hundert Meter weiter unten Halt. Wir hatten etwa zehn Bälle. Wenn alle verbraucht wurden, war das Spiel zu Ende. Man kann sich vorstellen, wie unbeliebt sich derjenige machte, der den letzten Ball talwärts schoss. Am nächsten Tag ging jemand mit einem grossen Netz zu der Stelle wo die Bälle landeten und brachte sie wieder zurück.
Auf dem Pilatus lebten nicht nur die Angestellten und die Familie Mohr, sondern auch die Mitarbeiter der Schweizer Luftwaffe. Sie waren zuständig für die militärische Luftüberwachung und arbeiteten in Schichten. Eine Schicht dauerte von Montag bis Mittwoch, die andere von Mittwoch bis Freitag. Und was war mit Samstag und Sonntag?
"Am Wochenende darf die Schweiz nicht angegriffen werden", war der meist gebrauchte Spruch in diesem Zusammenhang – übrigens heute noch.
Doch das sind typische Sprüche von Leuten die sich wichtigmachen, ohne vom Thema etwas zu verstehen. Darum möchte ich hier kurz etwas klarstellen. Zur Rettung der Ehre von all den tollen Männern die damals dort arbeiteten, und mit denen ich teilweise bis heute befreundet bin.
Die Luftüberwachung bedeutet nicht, dass man nicht identifizierbare Objekte im schweizerischen Luftraum sofort abschiesst. Die Luftraumverletzungen werden protokolliert und bei Bedarf wird eine diplomatische Intervention eingeleitet. Ob man eine diplomatische Beschwerde am Samstag oder am Montag macht, spielt wirklich keine Rolle. Eine Nebenbemerkung: Sehr oft sind gerade die, die sich über die ungedeckten Wochenenden lustig machen, genau die, die sich an den grossen Kosten der Armee stören. Meine lieben Besserwisser, ein 24-Stunden Betrieb kostet was! Oder meint ihr, dass die Militärangestellten auf dem Pilatus Fronarbeit leisten?
Nun zurück zum Pilatus. Die Mitarbeiter der Luftwaffe waren Stammgäste in unserem Restaurant. Abends, nach dem Service, sassen wir oft zusammen, spielten Karten oder tanzten zu den Klängen aus der Juke-Box. Frau Keiser war vergessen, und das schreckliche Haus in Klosters auch. Die Patrons waren nett, die Arbeitskollegen und die Militärangestellten auch. So ein Berg verbindet. Auf eine seltsame Weise. Wie viele Stürme haben wir gemeinsam erlebt, wenn der Wind mit 150 Stundenkilometern um das alte Kulm pfiff! Wie oft waren wir tagelang die Einzigen auf dem Berg, weil die Bahn wegen des Sturms nicht fahren konnte! Wie oft hatten uns die notfallerprobten Militärs geholfen! Sie organisierten mitten in der Nacht eine Zahnradbahn, als eine Mitarbeiterin ins Krankenhaus musste, oder standen den Leuten bei, als ein Mitarbeiter durch einen Unfall starb. Auch sollte die Geschichte, der kleinen Anna, die mit zweitem Vornamen Pilatus heisst, zur Ehre von Frau Mohr nicht vergessen werden. Anna wurde dort oben, auf 2200 m über Meer geboren, in einer stürmischen Nacht, als weder die Zahnradbahn, noch ein Helikopter aufgeboten werden konnte. Mit Hilfe der telefonischen Anweisungen eines Arztes aus Luzern schaffte Frau Mohr die Geburtshilfe zu leisten. Ja, der Pilatus verband. Der Pilatus schweisste zusammen. Ein magischer Ort, der mich nie mehr losgelassen hat.
(1) Andres und ich auf dem Pilatus - Sommer 1978
Andres und ich, Pilatus 1978

(2) Pilatus Kulm 1980

(3) Ich auf dem Pilatus, 1980

"Jemand möchte dich sehen", sagte Lucic, ein alter Freund, mit dem ich viel Zeit verbrachte, wenn ich zu Hause in Jugoslawien war.
Es war Herbst 1979. Ich machte wieder mal meine Zwangsferien in der Heimat. Andres war in Madrid. Ab Dezember sollten wir wieder gemeinsam im Skigebiet Crap Sogn Gion in Laax arbeiten.
"Wer?", fragte ich.
"Ich darf es nicht sagen. Es sollte eine Überraschung sein."
Mit wenig Begeisterung sagte ich zu. Der einzige Mensch den ich gerne gesehen hätte, war Bata. Aber Lucic gehörte nicht zur Bata-Klicke. Sie wohnten nicht einmal in der gleichen Stadt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich kennen, war verschwindend klein.
Lucic und ich verabredeten uns wie immer in Restaurant "Lala". Wir setzten uns neben die Live-Musik, mit Blick zum Eingang. Jedes Mal wenn jemand reinkam, schaute ich genau hin. Werde ich ihn erkennen? Oder ist das jemand, den ich gar nicht kenne, und mich über Lucic kennenlernen möchte?
"Seit wann kennst du ihn?", fragte ich meinen Freund.
"Wen?"
"Tue nicht so!", sagte ich. "Den Mann, der mich sehen will!"
"Woher weisst du, dass es ein Mann ist?"
"Ich kenne keine Frauen, die sich mit mir gerne treffen würden."
Wir lachten. Ja, ich hatte nie weibliche Freunde.
Kurz darauf ging die Tür wieder mal auf. Ein Mann kam herein. Seine Haare sahen verwindet aus, sein Bart hätte schon längst einen Schnitt nötig.
"Hoffentlich ist es nicht der", sagte ich und sah Lucic drohend an.
"Wer?"
"Der Mann, der gerade zur Toilette geht."
"Keine Ahnung", antwortete er "habe ihn nicht richtig gesehen. Wieso meinst du, dass er es sein könnte?"
"Sein Gang kommt mir bekannt vor."
Er sagte nichts, sah mich aber so bedeutungsvoll an, dass ich mir sicher war, es handelte sich um den geheimnisvollen Freund, der mich sehen wollte.
Ich war enttäuscht. Insgeheim hatte ich gehofft, dass es Bata war. Kurz darauf kam dieser Mann tatsächlich zu unserem Tisch. Als erstes erkannte ich seine Augen. Diese unverwechselbaren, wunderschönen, blauen Augen. Es war Bata!
Er gab mir die Hand und setzte sich zu uns.
Mein Herz drohte aus der Brust zu springen. Ich wollte etwas Intelligentes sagen, doch nichts konnte diesem Augenblick gerecht werden.
"Ihr zwei kennt euch?", richtete ich nach einer Weile meine Frage an Bata.
"Ja", sagte er schmunzelnd. «Ich wohne jetzt auch in Zrenjanin.»
«Ja? Wo?»
«Im Bagljas.»
«Du nimmst mich hoch!», sagte ich. Bagljas war das gleiche Quartier in dem Lucic und ich wohnten.
«Nein!» Bata lachte. «Das ist wahr. So lernte ich Lucic kennen. Dass wir beide dich kennen, darauf kamen wir ganz zufällig.»
Ich sah in diese so geliebten Augen und konnte nicht glauben, dass er wirklich da war. Oh, Gott, wie ich diesen Blick vermisst hatte! Diese wunderschönen Lippen. Diese zarten Hände. In diesem Augenblick wurde es mir klar, dass ich Andres nie heiraten werde! Das was mich mit Bata verband, hatte ich nie mit ihm gespürt. Es wurde mir auch bewusst, dass ich in den sechs vergangenen Jahren nie aufgehört hatte Bata zu lieben. Andres und die anderen flüchtigen Bekanntschaften waren nur ein Trost-Pflaster auf meiner sich nach Bata verzehrenden Seele. Ein Ersatz. Wie eine Diabetiker-Schokolade, oder ein alkoholfreies Bier. Ich wollte ihn wieder haben! Koste es was es wolle!
Wir verbrachten einen wunderschönen Abend im "Lala". Es wurde viel gesungen und eine Menge Wein getrunken. Bata und ich sahen uns immer wieder an. Die Erinnerungen an unsere glücklichen Tage erwachten. Ich hoffte, dieser Abend würde nie enden. Doch irgendwann waren wir noch die einzigen Gäste. Es war Zeit zu gehen. Lucic und ich waren zu Fuss gekommen. Bata mit dem Auto, weil er direkt von der Arbeit kam. So konnten wir jetzt mit Bata nach Hause fahren. Zuerst lud er Lucic aus. Dann fuhren wir zu mir. Plötzlich bekam ich Angst. Was wenn er jetzt "Tschüss" sagt und nach Hause fährt? Das würde ich nicht ertragen können! Jetzt, wo ich endlich weiss, dass es für mich nur ihn gibt.
Kurz vor meinem Haus hielt er an.
"Bist du müde?", fragte er.
Mein "Nein!" kam noch bevor er den Satz beendet hatte.
Er wendete das Auto und fuhr aus der Stadt. In die unendliche Weite des Flachlandes. Irgendwo im Nirgendwo hielt er an. Millionen von Sternen sahen uns zu, als wir uns endlich küssten...
Die folgenden Tage waren der Himmel auf Erden. Ich lernte einen ganz neuen Bata kennen. Er liess mich nicht mehr tagelang warten. Er suchte meine Nähe so oft wie möglich. Wir gingen jeden Abend aus, und wir hatten eine Menge Spass. Wie damals als wir uns kennengelernt hatten. Wir schworen uns gegenseitig die Liebe, manchmal im Spass manchmal im Ernst. Wir sangen wieder "Selma". Und ich spürte zum ersten Mal in meinem Leben das wunderbare Gefühl, wenn ein einziger Mensch die ganze Welt bedeutet. Dass es einen Andres gab, vergass ich manchmal völlig.
Doch ihn gab es. Und wie näher die Zeit rückte, wieder in die Schweiz zu fahren, umso mehr fürchtete ich das Gespräch, das ich mit Bata führen musste. Ich zögerte es so lange wie möglich hinaus. Ich befürchtete, Bata würde mir nicht verzeihen, dass ich ihm von Andres nicht erzählt hatte. Wenn er gewusst hätte, dass ich mit einem anderen Mann zusammen lebte, hätte er sich vielleicht nicht auf uns eingelassen.
Erst zwei Tage vor meiner Rückreise wagte ich es ihm zu erzählen. Eine ganze Weile sagte er nichts. Dann fuhr er mit der Hand durch seine Haare und sagte: "Diesen Schlamassel musst du selber ausbaden. Das ist nicht meine Angelegenheit."
Dann küsste er mich. Ich wusste nicht was ich davon halten sollte. Dass er schreit oder sofort nach Hause fährt, hätte ich erwartet. Aber er tat so als ob das eine Kleinigkeit gewesen war.
"Du bist mir nicht böse?"
"Warum sollte ich?"
"Weil ich dir von ihm nicht erzählt habe."
"Du wirst deine Gründe gehabt haben"
"Ich bin mir nicht sicher, ob du das richtig verstanden hast", sagte ich. Plötzlich war mir nicht wohl bei der Sache.
"Doch ich habe es verstanden."
"Bist du nicht eifersüchtig?"
"Warum sollte ich?"
"Verarschst du mich?" Ich sah ihn ungläubig an.
"Nein! Es ist mein Ernst."
"Du bist wirklich nicht eifersüchtig?"
"Nein. Du bist hier. Und ich bin hier. Er ist in Madrid. Wer sollte da wohl eifersüchtig sein?"
"Hmm... Und wie geht’s jetzt weiter?", fragte ich.
"Ich gehe davon aus, dass du mit ihm nach deiner Rückkehr Schluss machen wirst."
"Ja! Das werde ich!" Ich konnte immer noch nicht glauben, dass er es einfach so hingenommen hatte.
"Und wenn du mit ihm Schluss gemacht hast, werde ich dich besuchen. Um sicher zu sein. Bei dir ist man nie sicher."
"Du kommst in die Schweiz?"
"Ja. Ich bin nicht Andres. Ich teile dich mit niemanden, du kleines Luder."
Zwei Tage später fuhr ich wieder zurück in die Schweiz. Er begleitete mich zum Bus.
Beim Abschied konnten wir uns kaum voneinander lösen. Der Abschiedskuss dauerte eine Ewigkeit. Als ob wir gespürt hätten, dass es der letzte war.
(1) Bata und ich 1980

Nach meiner Rückkehr in die Schweiz schien mir ein Leben mit Andres unmöglich. Er war voller Sehnsucht nach mir, doch ich ertrug seine Nähe kaum. Ich wusste, dass ich schnell handeln musste, aber er war so fürsorglich und gab sich so Mühe mich glücklich zu machen, dass ich es nicht übers Herz brachte mit ihm sofort Schluss zu machen. Wie das alles vor sich gehen sollte, hatte ich mir gar nicht überlegt. Als ich mit Bata zusammen war, schien alles so einfach. Jetzt holte mich die Wirklichkeit ein.
Dazu kam, dass mein neuer Arbeitgeber mir freudig mitgeteilt hatte, dass ich schon genug lang in der Schweiz bin, um eine B-Bewilligung erhalten zu können. Er werde sie für mich beantragen. Er fragte mich nicht, ob ich das wollte. Das musste er auch nicht. Die B-Bewilligung war das erklärte Ziel jedes Saisonniers! Mit einer B-Bewilligung war das Arbeits-Visum nicht mehr an den Arbeitgeber gebunden. Ich hätte also jederzeit meine Stelle wechseln können. Doch das Administrative wird nicht so schnell erledigt, sagte er mir. Ein bis zwei Monate wird es schon noch dauern. Auch wenn es sofort gewesen wäre, ich hätte meinem netten Arbeitgeber dann nicht gleich kündigen können. Das war ich ihm schuldig. Also ich musste bis im Sommer auf Crap Sogn Gion aushalten. Aber für den Sommer hatten Andres und ich auch schon den neuen Arbeitsvertrag für den Pilatus. Klar konnte ich den Vertrag stornieren, aber zuerst musste ich eine neue Stelle haben. Und wie finde ich eine neue Stelle, ohne dass Andres es merkt? Wie soll ich mich irgendwo vorstellen können? Ich ging in der Schweiz nirgendwohin ohne Andres. Wir hatten auch immer gemeinsam frei.
Mein Vorhaben, ihm alles über Bata zu erzählen und dann in ein anderes Zimmer umzuziehen, hielt nur solange, bis ich mit meinem Chef gesprochen hatte. Es gab kein einziges Zimmer in das ich umziehen konnte. Und mit ihm zusammen nach der Trennung in unserem zehn Quadratmeter Zimmer zu leben, war unvorstellbar. Immerhin lebten wir bereits vier Jahre zusammen.
"Viele Paare streiten sich", sagte mein Chef. "Man muss nicht gleich aufgeben."
Die Wahrheit konnte ich ihm natürlich nicht sagen. Viel zu sehr hatte ich Angst, dass er dann meine B-Bewilligung nicht beantragen würde.
So entschloss ich mich Bata zu schreiben. Und ihm die Situation zu erklären. Nach unserer gemeinsamen Zeit in Jugoslawien war ich mir seiner Liebe sicher. Er würde mich bestimmt verstehen. Ich bat ihn um ein wenig Geduld bis ich für den Sommer eine neue Stelle gefunden hatte. Von nun an achtete ich immer darauf, dass ich die Post vor Andres abhole. Doch Tage und Wochen vergingen, aber von Bata kam keine einzige Zeile. Vielleicht hatte er meinen Brief nicht bekommen, dachte ich, und schrieb ihm das gleiche nochmals. Auch auf diesen kam keine Antwort. Ich konnte das nicht verstehen. Ich war so sicher, dass wir uns endlich gefunden hatten. Doch tief in meinem Inneren spürte ich, dass Bata meine Beziehung zu Andres nicht wirklich so locker nahm, wie er es mir glaubhaft machen wollte. Dass ich nicht mit Andres sofort Schluss gemacht hatte, gefiel ihm bestimmt gar nicht. Er hatte gesagt, «Ich teile dich mit niemandem». Wie wichtig für mich die B-Bewilligung war, konnte er sich gar nicht vorstellen und hielt es für eine Ausrede, um nicht mit Andres sofort Schluss machen zu müssen.
Die Zeit bis zum Ende der Saison war eine einzige Tortur. Einerseits sehnte ich mich nach Bata, anderseits war ich von ihm masslos enttäuscht. Warum schrieb er mir nicht? Wenn er nicht akzeptieren konnte, dass ich immer noch mit Andres zusammen war, hätte ich wenigstens eine klare Antwort. Aber gar nichts zu schreiben! Ich wusste nicht, woran ich war. Nun blieb ich aus Trotz mit Andres zusammen. Obwohl ich spürte, dass unsere Liebe definitiv tot war. Die Zeit mit Bata hatte ihr den Todesstoss gegeben. Für eine Reanimation war es zu spät. Ich wollte ihn nicht mehr in meinem Leben haben - aber erst nach dem Saison Ende. Wozu mir jetzt Ärger einzufangen, wenn Bata eh nichts davon mitbekommt. Und wenn ich im Juni nach Hause fahre, werde ich Bata aufsuchen und ihm alles erklären. Falls er mich noch liebte, werde ich für ihn eine Stelle in der Schweiz suchen. Dann werden wir endlich für immer zusammen sein. Irgendwann werden mich seine Eltern akzeptieren. Ja es schien, dass alles noch gut werden könnte.
Andres merkte von all dem nicht viel. Wir waren inzwischen wie ein altes Ehepaar geworden. Unser Leben spielte sich zwischen der Arbeit und dem Vergnügen nach der Arbeit ab. Crap Sogn Gion war ein Bergrestaurant, aber er bot den Gästen und den Angestellten, viel für die Abende nach der Arbeit, oder nach dem Skifahren - eine schöne Bar, eine Kegelbahn und einen grossen Swimmingpool.
Im Juni flog ich nach Jugoslawien. Inzwischen verdiente ich viel besser und konnte mir eine Reise mit dem Flugzeug leisten. Andres und ich fuhren gemeinsam zum Flughafen. Er weinte als wir uns verabschiedeten. Ich tröstete ihn.
Noch während wir uns zum Abschied küssten, überlegte ich, wie ich Bata am schnellsten erreichen könnte. Zu Hause angekommen, rief ich gleich Lucic an. Ich konnte nie verstehen, warum Bata mir die Telefonnummer seiner Eltern nicht geben wollte. Er entschuldigte es damit, dass sein Vater ein höherer Polizeibeamte war. Seine Nummer fand man nicht im Telefonbuch. Doch das war ein Notfall. Ich wollte endlich wissen, woran ich mit ihm bin. Und zwar sofort.
"Kennst du die Telefonnummer von Batas Eltern?", fragte ich Lucic.
"Ja. Warum?"
"Ich brauche sie."
"Ich darf sie dir nicht geben."
"Du darfst es nicht? Wer hat das gesagt?"
"Bata."
Eine unheimliche Kühle durchflutete plötzlich meinen Körper.
"Bata?"
"Es tut mir Leid. Seine Eltern mögen dich nicht. Sein Vater hat ihm sogar verboten mit dir zu verkehren."
Nun wusste ich, warum Bata mich so oft alleine liess. Er hatte wahrscheinlich zuerst organisieren müssen, damit wir nie seinem Vater begegnen. Ich wusste, dass sie meinen Lebensstil in der Schweiz nicht billigten. Aber, dass sie ihm verboten hatten mich zu treffen, war für mich etwas zu viel des Balkans. Wie das wohl wird, wenn wir mal heiraten?, fragte ich mich. Für mich war dies jetzt klar. Bata wollte mich! Darum wollte er in die Schweiz kommen. Um dem Einfluss seines Vaters zu entfliehen.
"Kannst du ein Treffen organisieren?", fragte ich.
"Ich weiss nicht", zögerte er.
"Was ist?", langsam ärgerte ich mich. "Hat er dir das auch verboten?"
"Er ist mit jemandem zusammen", antwortete er. "Es tut mir so Leid, Katica."
"Mit jemanden zusammen? Es ist erst ein paar Monate, seit wir uns die Liebe geschworen haben!"
"Es ist eine aus seiner alten Heimat."
"Das hat bestimmt sein Vater organisiert!", regte ich mich auf. Batas Familie stammte aus einer Stadt in Südserbien. Eine ziemlich altertümliche Region.
"Kannst du ihm trotzdem sagen, dass ich da bin? Er kann selber entscheiden, ob er mich sehen will."
"Mache ich."
In den nächsten Tagen und Wochen schleppte ich Lucic überall mit. Wir besuchten alle Restaurants wo wir damals verkehrt hatten, in der Hoffnung ihn irgendwo zufällig zu treffen.
"Hast du ihm wirklich gesagt, dass ich hier bin?", fragte ich Lucic immer wieder.
"Ja!", antwortete er geduldig. "Er hat gesagt, dass er darüber nachdenken wird, ob er dich sehen will."
Bis zuletzt hatte ich gehofft, ihn zu sehen. Doch offenbar war ich ihm nicht mehr wichtig. Er hatte sich für die Neue entschieden. Vielleicht haben ihn seine Eltern dazu gezwungen, tröstete ich mich. Aber ein wirklicher Trost war das nicht. Vielleicht wusste er schon, als ich das letzte Mal da war, dass seine Eltern für ihn die Frau ausgesucht hatten. Vielleicht liess er sich deshalb endlich auf die Liebe mit mir ein. Wenn ich mit Andres sofort Schluss gemacht hätte, wäre er vielleicht zu mir gekommen und geblieben. Weg von dem Einfluss seiner Familie. Weg von der arrangierten Ehe.
Diesmal ging ich gerne in die Schweiz zurück. Das würde mir helfen Bata zu vergessen. Wenn ich nicht in seiner Nähe war, konnte ich gut ohne ihn leben. Ich freute mich auch aus einem anderen Grund. Ich entschloss mich mit Andres definitiv Schluss zu machen. Schon in Zürich. Am Flughafen. Ich konnte mir nicht mehr vorstellen, mit ihm zusammenzuleben. Ich liebte ihn nicht, und der Mitleidbonus war verbraucht. Danach werde ich zu meiner Schwester nach Männedorf fahren, und bis ich eine neue Stelle finde, bei ihr und Miro bleiben. Ich werde ein neues Leben anfangen. Ohne Andres. Ohne Bata. Seit ich von zuhause weg war, bestimmten diese beiden Männer über mein Glück und Unglück. Nun hatte ich genug. 
(1) Im Service auf Crap Sogn Gion

Manchmal spielt das Leben mit uns Spielchen die wir nicht verstehen. Wir sind enttäuscht. Fühlen uns betrogen. Ungerecht bestraft. Denn in diesem Moment wissen wir nicht, dass dieses Ereignis vom Schicksal gesteuert wurde. Weil wir zu einem Punkt gelangen sollten, welcher das Leben für uns vorgesehen hat. Wenn ich denke, wie oft ich Andres verlassen wollte, und immer kam etwas dazwischen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Schicksal wollte, dass ich in jenem Sommer 1981 auf den Pilatus kam. Obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte.
Andres wartete bereits auf mich, als ich am Flughafen Zürich landete. Mit flauem Gefühl im Magen kam ich auf ihn zu. Ich werde ihm sofort sagen, dass ich ihn verlasse. Bevor wieder etwas dazwischen kommt.
"Das ist Augustin", stellte mir Andres einen Mann vor, noch bevor ich etwas sagen konnte. Ich hatte diesen Mann schon bemerkt, wusste aber nicht, dass er zu ihm gehörte. Im Gegensatz zu Andres sah er genauso aus wie man sich einen richtigen Spanier vorstellt. Klein, dunkle Haare, dunkle Haut, dunkler Schnauz.
"Augustin?", fragte ich. "Dein Augustin?"
"Ja!"
Augustin war sein bester Freund. Seit sie Kinder waren. Ich wusste alles über ihn, Andres hat ständig über ihn gesprochen.
"Augustin kommt mit uns auf den Pilatus. Er bleibt einige Tage."
Oh, mein Gott!, war mein erster Gedanke. Will das denn nie enden? Werde ich mich nie von ihm trennen können?
"Ich habe auch von dir viel gehört", sagte Augustin. "Ich freue mich dich endlich kennenzulernen."
So konnte ich mit Andres nicht Schluss machen. Nicht jetzt! Das konnte ich ihm vor seinem besten Freund, seinem Idol, nicht antun.
"Ich von dir auch", antwortete ich.
"Bist du zum ersten Mal in der Schweiz?"
"Ja."
"Pilatus wird dir sicher gefallen." Mein Spanisch war inzwischen sehr gut, ich konnte mich problemlos mit Augustin unterhalten.
"Das glaube ich auch", sagte er. "Danke vielmals, dass ich bei euch schlafen darf."
Da wir erst am nächsten Tag arbeiten mussten, gingen wir meine Schwester besuchen. Ich hatte mich bereits aus Jugoslawien bei ihr angekündigt und gesagt, dass ich mich von Andres trennen werde. Sie und Miro konnten ihre Überraschung, dass er auch dabei war, kaum verbergen.
"Fragt nichts", sagte ich auf Serbokroatisch, während wir uns umarmten. "Ich erkläre es euch später."
Augustin blieb ein paar Tage bei uns, dann ging er noch weitere Bekannte besuchen. Als er gegangen war, hatte ich mich an Andres bereits wieder gewöhnt. Wir machten im gleichen Trott weiter. Wie in all den Jahren zuvor. Ich liebte ihn zu wenig, um mir ein Leben mit ihm vorstellen zu können, aber doch zu viel um ihm weh zu tun. Und da meine Liebe mit Bata nun definitiv in die Brüche ging, sprach nichts dagegen noch eine weitere Saison mit ihm zu bleiben. Irgendwann schaffe ich es doch, mit ihm Schluss zu machen, sagte ich mir, ohne daran wirklich zu glauben.
Unser Zusammenleben gestaltete sich viel einfacher als ich gedacht hätte. Wir sahen uns kaum. Er servierte im Bellevue und hatte abends meistens frei, ich bekam eine neue Aufgabe im Stübli, dem typisch schweizerischen Restaurant. Meine Arbeitszeit war von morgen früh, bist spät abends mit einer langen "Zimmerstunde". Den Job teilte ich mit einer sympathischen jungen Schweizerin namens Christa, die den schönsten Dialekt der Schweiz sprach – das Berndütsch.
Die Arbeit in Stübli konnte man nicht wirklich als Arbeit bezeichnen. Es war das Vergnügen pur! Vielleicht nicht gleich vom ersten Tag an, wir mussten uns zuerst einleben und unsere Gäste kennenlernen. Die Hauptgäste waren die Militärangestellten und Bauarbeiter, die einen grossen Umbau auf dem Pilatus machten. Die Pilatus-Bahn-Angestellten und das Hotelpersonal gehörten auch dazu. Wir mussten nicht selber kochen, nur servieren. Nur wenige Schritte trennten uns von der Hotelküche, in der wir das Essen bestellen konnten.
"Stübli" war das erste Restaurant in dem ich arbeitete, das vornehmlich von den Schweizern besucht wurde. Abgesehen vom Hotelpersonal und einigen Touristen, die sich dort zufällig verirrten. An die echten Schweizer musste ich mich erst mal gewöhnen. Die Schweizer, mit denen ich bisher Kontakt hatte, arbeiteten meistens im Hotelgewerbe und hatten einen unbelasteten Zugang zu den Ausländern. Die Gunst dieser Schweizer hier, vor allem die der Bauarbeiter, musste man sich zuerst verdienen. Doch wenn man jung und hübsch ist, und sich mit allen Kräften bemüht, den Naturburschen von der Baustelle zu gefallen, klappt es auch. Abgesehen davon, geizten wir mit dem Obstler im Kaffee Luz nicht, und der Bahnwein hatte stets einige Tropfen über den Messstrich. Bahnwein nannten wir einen günstigen, offenen Rotwein, der bei den Bahnangestellten beliebt war. Bald waren wir mit allen per Du, die Mahlzeiten wurden von lauter Schweizer Volksmusik aus der Juke-Box begleitet. Ich versuchte mich mit dem Jodeln, und an manch ruhigerem Tag baten Christa und ich unsere Gäste sogar zu einem Tanz. Tango, Walzer oder Foxtrott.
Unser neuer Patron, Herr Pfister, der das Hotel nach dem Tod von Herr Mohr übernommen hatte, störte unsere unkonventionelle Art mit den Gästen umzugehen nicht. Im Gegenteil. Der Laden war immer voll und die Gäste waren ausnahmslos zufrieden. Mit der Zeit wurden Christa und ich zu einer Attraktion, eine willkommene Abwechslung auf dem Pilatus, der für die meisten von uns auch eine vorübergehende Heimat war. Noch heute bin ich mit einigen von ihnen befreundet. Der Direktor, Herr Pfister, ist mein bester Freund. Ach wie wir manchmal lachen, wenn wir auch mal Herrn Saum, den ehemaliger Direktor der Pilatus Bahn, treffen! Er erzählt dann immer, wie er damals an der Talstation in Kriens eine Werbung für die Köstlichkeiten auf dem Pilatus Kulm sah. "Vorne Self-Service – von hinten bedient Sie Katia". Natürlich hat er das "von" angedichtet! Aber wir lachen immer darüber, und die nostalgischen Erinnerungen an jene wunderbaren Tage leben für uns alle wie ein Feuerwerk auf.
(1) Pilatus, Stübli 1981

(2) Ein Tänzchen mit Gast während dem Service

Richi gehörte nicht gerade zu meinen Lieblingsgästen, obwohl er ein sehr netter und höflicher Mensch war. Aber er kam meistens ins Stübli wenn wir mitten im Service waren und alle Hände voll zu tun hatten. Anstatt wie jeder normale Mann auf dem Pilatus ein Bier oder ein Glas Wein zu bestellen, bestellte er die kalte Schokolade. Und die musste man mixen, damit sich das Suchard-Pulver gut mit der Milch vermischen konnte. Danach musste man den Mixer sofort reinigen, damit die Schokolade nicht kleben bleibt. Also viel Aufwand - für 1.80 Franken.
Er gab nie Trinkgeld. Ausgerechnet er, der mir immer so viel Arbeit generierte. Doch so vorlaut wie ich war, sprach ich ihn mal darauf an.
"Du könntest auch mal Trinkgeld geben, Richi."
Er sah mich verwundert an. An eine so direkte Kommunikation war er wohl nicht gewöhnt.
"Deine Schokolade generiert sehr viel Arbeit. Du könntest wirklich mal aufrunden."
"Service compris", sagte er mit einem spöttischen Lächeln und nahm demonstrativ einen Schluck.
Was für ein Spiesser!, dachte ich. Der hat sicher genug Geld. Das macht er nur, um mich zu ärgern.
Als er das nächste Mal kalte Schokolade bestellte, servierte ich ihm die kalte Milch und das Schokolade-Pulver separat dazu.
"Kannst du das mixen?", fragte er ohne mit den Wimpern zu zucken.
"Sorry, der Mixer ist kaputt", log ich mit einem süssen Lächeln.
Er schmunzelte und öffnete das Säckchen mit dem Pulver.
Der Mixer blieb noch eine ganze Weile kaputt. Bis auch Richi anfing Trinkgeld zu geben.
Richi war ein sehr interessanter Mann. Er sprach wenig. Hörte aber gerne zu. Zu meiner Überraschung kam er plötzlich auch abends vorbei. Dann bestellte er Rotwein. Keine kalte Schokolade. Oft setzte er sich zu mir an den Tisch. Manchmal leistete er mir Gesellschaft beim Essen.
"Es ist unglaublich wie viel du in dich reinstopfen kannst, ohne dick zu werden!", sagte er mir eines Tages. Seine Augen strahlten Bewunderung aus.
"Ich kann essen so viel ich will", antwortete ich. "Ich werde nicht dick. In meiner Familie gab es seit mehreren Generationen keinen einzigen übergewichtigen Menschen."
"Der Mann, der dich mal ernähren muss, tut mir jetzt schon leid.", sagte er schmunzelnd.
Dass gerade er dieser Mann sein würde, konnte sich an jenem Tag keiner von uns im Entferntesten vorstellen. Er war verheiratet, und ich hatte Andres. Trotzdem verbrachten wir viel Zeit zusammen. Die kalte Schokolade war schon längst vergessen. Ich unterhielt mich gerne mit ihm. Er war sehr belesen. Ich las auch gerne. Wir mochten die gleiche Musik und tauschten regelmässig Musikkassetten aus. Und er hatte keine Vorurteile gegen Ausländer. Wir sprachen nie über Andres oder über seine Frau. Nur einmal hatte er gesagt: "Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich nie heiraten."
Nun wusste ich, dass er nicht glücklich verheiratet war. Komischerweise freute mich das sehr.
Es war Ende August 1981. Einige Militärs und Hotelangestellte wollten während der Zimmerstunde mit der Bahn nach Fräkmüntegg fahren. Einfach so. Ohne einen besonderen Grund. Etwas essen und ein Glas gemeinsam trinken. "Gehst du mit?", fragte mich Richi beim Mittagessen.
"Ich weiss nicht. Gehst du?", antwortete ich.
"Wenn du mitkommst."
"Dann komme ich mit."
Wir gingen nicht in das Restaurant direkt neben der Bahn. Da gab es immer zu viele Leute. Einige Hundert Meter von der Bahnstation entfernt gab es ein kleines Restaurant, mit einer grossen Terrasse. Es war ein wunderschöner Tag. Nur wenige Wolken zogen über den Pilatus, und die Sonne wärmte viel stärker als oben. Richi und ich setzten uns nebeneinander. Er lud mich zu einem Glas Wein und einer Bündner Platte ein. Mir fiel auf, wie schöne Zähne er hatte. Und schöne Hände. Seine Augen strahlten, wenn er mich ansah. Ich wünschte, dass dieser Nachmittag nie endete. Doch der Abend rückte näher, und wir mussten uns auf den Weg machen. Die anderen gingen voraus, wir schlenderten hinterher. Bei einer grossen Tanne hielt ich an.
"Das war ein wunderschöner Nachmittag", sagte ich. "Das sollten wir wiederholen."
"Ja.", sagt er und zog mich an sich. Unsere Lippen berührten sich ganz selbstverständlich. Ein Gefühl des unendlichen Glücks erfühlte mein ganzes Wesen. Noch nie hatte ich eine solche Nähe zu einem Menschen gespürt. Er war so sanft und so zärtlich und seine Augen so nah an meinen verrieten, dass er sich nach diesem Augenblick schon lange gesehnt hatte.
Plötzlich fing es an zu regnen. Kalter Wind zog über das kleine Tal. Wir lachten und rannten zu der Seilbahn. In der Bahn gingen wir auf Distanz. Es war selbstverständlich, dass wir das was geschah, für uns behalten werden. Ab und zu wechselten wir kurze, verliebte Blicke.
Den ganzen Abend verbrachten wir gemeinsam im Stübli. Es war ein unglaublicher Abend. Wir waren nie alleine, um etwas Intimes reden zu können. Trotzdem waren wir überglücklich. Wir brauchten nicht zu reden. Als er kurz vor Mitternacht die Rechnung verlangte, wurde mir plötzlich bewusst, dass dieses grossartige Gefühl bald vorbei sein würde. Spätestens, wenn ich mich zu Andres ins Bett legte. In diesem Augenblick entschied ich mich Andres definitiv zu verlassen. Und zwar sofort. Ins Zimmer zu gehen und sagen "Ich verlasse dich", würde nicht klappen, das wusste ich. Das wollte ich schon einige Male tun und schaffte es nicht. Doch ich wollte ihn dazu bringen, mit mir Schluss zu machen! Ich wusste auch wie ich das anstellen sollte. Manuel, ein Kollege von Andres sass auch im Stübli. Er war fast immer dort, Andres nur selten. Meine Gäste nannten ihn "Spion". Sie waren sicher, dass er im Auftrag von Andres auf mich aufpasste. Das wollte ich für mein Vorhaben nutzen. Ich brachte Richi die Rechnung und sagte:
"Du musst nichts bezahlen. Unter einer Bedingung." Plötzlich schauten mich alle am Stammtisch an.
"Und das wäre?", fragte Richi.
"Du musst mich küssen."
Alle schauten Richi gespannt an. Seine Kollegen fingen an zu lachen.
"Nur das?", fragte er.
"Nur das! Aber es muss ein richtiger Kuss sein, nicht nur auf die Wange."
"Warum nicht?", sagte er.
Ich beugte mich sofort über ihn und küsste ihn. Lange und zärtlich. Ich vergass, dass uns mindestens zehn Leute zuschauten. Ich vergass was zu diesem Kuss geführt hatte. Ich wollte es noch einmal spüren. Ob es so schön wie am Nachmittag würde. Und es war noch schöner. Für einen kurzen Augenblick sahen wir uns an, bevor alle zu Klatschen begannen. Danach zerriss ich die Rechnung. Als ich sie in den Abfalleimer werfen wollte, sah ich Manuel durch die Hintertür verschwinden.
Meine fiese Rechnung ging auf. Als ich ins Zimmer kam, hatte Andres bereits angefangen meine Koffer zu packen.
"Schau morgen, dass du ein eigenes Zimmer bekommst. Ich will dich nicht mehr in meinem Leben haben." Danach sprach er kein Wort mehr mit mir.
Das war gut so. Ich bemühte mich auch nicht, das Geschehene zu rechtfertigen, oder zu erklären. Ich dachte nur an Richi. Ich wollte ihn haben. Und das ging nur, wenn ich mit Andres Schluss machte. Es war mir egal, dass er verheiratet war. Ich wollte ihn nicht heiraten. Der Status "Geliebte" würde mir reichen. Und ich wusste, dass er mich auch haben wollte. Ich fühlte das. Ich hatte so was noch nie mit einem Mann erlebt. Ich spürte, dass er das Gleiche wie ich fühlte.
Am nächsten Tag bat ich Herrn Pfister um ein eigenes Zimmer. Ich zog gleich um. Bereits an diesem Abend wurden Richi und ich ein Liebespaar. Und sind es heute noch, 38 Jahre später. Mein Gefühl hatte mich nicht getäuscht. Ich hatte endlich den Mann meines Lebens gefunden. Danke Schicksal, dass du mich in jenem Sommer auf den Pilatus gezwungen hast.
(1) Frisch verliebt - Richi und ich Pilatus 1981

Eigentlich wollten Richi und ich nie zusammen wohnen. Wir wollten nie all die Dinge gemeinsam tun, die zu einer engen Beziehung gehörten, wie zum Beispiel Zähne putzen oder furzen. Ich hatte irgendwo gelesen, wenn jemand zum ersten Mal vor seinem Partner furzt, ist der Zauber bereits hin. Wir wollten nicht das Mystische, Aufregende, Knisternde zu Grunde richten, nur damit wir ständig zusammen sein konnten. Mir gefiel es, Richi in unserem Bistro zu treffen und mit ihm eine ganze Weile, überwältigt von der Wucht der Gefühle, einfach da zu sitzen und zu schweigen. Oder wenn er zu mir ins Restaurant kam, und beim Einkassieren seinen Oberschenkel an meinen presste. Diese flüchtigen Augenblicke des unendlichen Glückes wollte ich nicht durch das Zusammenleben zerstören. Nein. Ich wollte nicht mit ihm zusammen wohnen. Aber ihn öfter sehen schon. Mir reichte es nicht mehr, ihn nur zwei Tage in der Woche zu sehen. Ich entschloss mich, eine Stelle und eine Wohnung in Luzern zu suchen. So konnten wir uns auch an den Wochenenden sehen. Inzwischen wusste ich, dass seine Ehe nur noch eine Zweckgemeinschaft war. Damit der Sohn nicht ohne Vater aufwachsen musste. Seine Frau wusste von unserer Beziehung. Es machte ihr nichts aus.
Herr Pfister half mir eine Stelle zu finden. Er organisierte, dass ich in das Musikrestaurant Stadtkeller wechselte. Stadtkeller gehörte zu der gleichen Hotelkette wie Pilatus. Eine Wohnung zu finden, gestaltete sich viel schwieriger. Auf meine Anrufe bei den Vermietern erhielt ich stets dieselbe Antwort: "Wir nehmen keine Ausländer." Manchmal auch "Wir nehmen keine Jugoslawen". Doch die beste Antwort die ich je bekam war: "Wir sind ein anständiges Haus. Wir nehmen keine Jugoslawen." Heute lache ich darüber. Damals hatte es mich zutiefst verletzt. Diese Frau wusste von mir nichts. Weder woher ich kam, noch was für ein Mensch ich war. Sie beurteilte mich nur anhand meines Namens! Und das mit einer von Gott gegebenen Selbstverständlichkeit. Ich wollte aufgeben. Im Stadtkeller hatte ich eh schon ein Zimmer gehabt.
Nie hatte ich Richi so wütend gesehen wie an jenem Tag als ich ihm erzählte was die Vermieterin zu mir gesagt hatte. Er rief sie sofort an. Ich staunte wie anständig er ihr die Leviten über ihre Einstellung zu Ausländern gelesen hatte. Bei uns in Jugoslawien wären da schon einige kräftigere Ausdrücke gefallen und vielleicht im gleichen Zug noch eine Drohung ausgesprochen worden. Doch die Vermieterin blieb unberührt.
"Wenn Sie als Schweizer diese Wohnung mieten, habe ich kein Problem damit, dass Frau Lukinic mit Ihnen wohnt. Aber ich habe mit Jugoslawen als Mieter schlechte Erfahrungen gemacht. Ich will mit ihnen nichts mehr zu tun haben."
Nun mussten wir die Möglichkeit zusammen zu leben, doch in Betracht ziehen.
"Ich habe mit Anneliese gesprochen", sagte Richi eines Tages aus heiterem Himmel. Anneliese war seine Frau. "Sie hat nichts dagegen, wenn ich ausziehe."
"Wirklich? Und Beni?"
"Er ist noch klein. Jetzt ist es für ihn einfacher, dich zu akzeptieren, als später."
Das Wichtigste im Leben von Richi war sein Sohn Benjamin. Dass er ihn für mich aufgeben wollte, war so unglaublich, dass es mich in Panik versetzte. Bin ich diesen Opfers würdig? Liebe ich ihn genug, um seinem Sohn eine gute Stiefmutter zu sein?, fragte ich mich beunruhigt.
"Und ich schwöre dir", sagte Richi. "Ich werde nie vor dir furzen!"
"Auch nicht rülpsen?"
"Auch nicht rülpsen!"
"Und du kommst nicht ins Bad während ich mir die Zähne putze? Oder auf der Toilette sitze?"
"Oh, mein Gott! Nein! Nie im Leben!", antwortete er theatralisch.
Wir zählten noch eine ganze Reihe Dinge auf, die wir nicht in der Gegenwart des anderen tun werden und plötzlich dachte ich, dass es gar nicht so schlimm wäre, mit ihm zusammen zu wohnen. Im Gegenteil. Ich fing an, es mir zu wünschen. 
(1) Ich im Stadtkeller 1982

Am 26. August 1982 zogen Richi und ich zusammen. In eine Ein-Zimmer-Wohnung im Dachgeschoss über dem Hotel Engelburg in Luzern. Erstaunlicherweise war das wovon wir uns am meisten gefürchtet hatten, das kleinste Problem in unserem gemeinsamen Leben. Es machte mir absolut nichts aus, Richi in jedem Augenblick meines Lebens dabei zu haben. Es war mir egal ob er mich ungeschminkt oder mit zerzausten Haaren sah. Das atemberaubende Gefühl, das ich in seiner Nähe verspürte, liess nicht nach. Im Gegenteil. Es war die Kulmination eines wunderbaren Jahres, das wir hinter uns hatten. Nur das Bad benutzten wir nicht gemeinsam. Nicht weil es mir unangenehm war, sondern weil es so klein war, dass nur eine Person darin Platz hatte. Auch mit seinem Sohn verstand ich mich gut, obwohl ich manchmal schon Mühe hatte, diesen unglaublich tollen Mann, auf den ich so lange gewartet hatte, mit ihm zu teilen.
Trotzdem war ich alles andere als glücklich. Wir hatten keine gemeinsamen Freunde, und Richis Familie war nicht begeistert, dass er Annelies, die sie sehr mochten, für eine Serviererin aus Jugoslawien verlassen hatte. Wir hatten nie Besuch und wir gingen nie zu jemandem. Ich lebte bisher nur in den Hotels, und dort war immer etwas los. Wenn man sich einsam fühlte, klopfte man bei jemandem an, und schon war man nicht alleine. Luzern war eine wunderschöne Stadt, aber ich erstickte in ihr. Die Einsamkeit beherrschte mein Leben. An den Tagen, an denen Richi auf dem Pilatus war, fühlte ich mich so schrecklich, dass ich manchmal einen freien Tag nahm, um nach Zürich zu meiner Schwester zu fahren. Panikattacken und allerlei psychosomatische Beschwerden machten bald mein Leben zu Hölle. Ich fragte mich langsam, ob es Gottes Strafe war, weil ich eine Ehe zerstört hatte. Ich hatte keinen Appetit und trank keinen Tropfen Alkohol mehr. Das Leben machte keine Freude mehr. Nicht einmal Richis Liebe konnte dieses schreckliche Gefühl der Einsamkeit und Bedeutungslosigkeit ausgleichen. Mein Hausarzt meldete mich bei einem Psychiater an. Er war ein Kroate und konnte sich gut in die Seele seiner Landsmännin einfühlen.
"Sie sind nicht krank", sagte er zu mir nach einigen Sitzungen. "Sie brauchen nur eine Herausforderung."
"Herausforderung?", fragte ich.
"Ja. Sie sind jung, dynamisch, intelligent. Sie haben eine gute Ausbildung aber sie müssen Leute bedienen, weil Ihr Diplom in der Schweiz nicht anerkannt ist. Sie sollten sich überlegen eine Ausbildung zu absolvieren. Damit sie eine bessere Arbeit machen können."
Ich erzählte Richi von diesem Gespräch. Und, dass ich auch schon daran gedacht hatte, eine Handelsschule zu besuchen, mir aber nicht sicher war, ob ich sie schaffen würde.
"Du bist sowieso zu intelligent, um ein Leben lang Serviererin zu bleiben", sagte er. "Schau dich mal um, vielleicht kannst du eine Abendschule besuchen."
"Meinst du mein Deutsch reicht dafür?"
"Du kannst ja Deutsch."
"Ja, aber ich kann nicht gut schreiben."
"Das wirst du lernen, nehme ich an."
Schon die blosse Aussicht auf etwas Neues, liess mich mein Leben wieder lebenswert fühlen. Meine gesamte Freizeit verbrachte ich mit studieren der Unterlagen von verschiedenen Schulen, die ich mir zukommen liess. Die Freis Handelsschule machte das Rennen. Sie war nicht sehr teuer, und wenn ich ein Darlehen bekäme und am Wochenende arbeiten würde, konnte ich sogar die zweijährige Tagesschule besuchen. So bekäme ich ein anerkanntes Diplom, was bei der Stellensuche vorteilhaft wäre. Und von unserer Wohnung aus, war die Schule zu Fuss erreichbar.
Etwas Unangenehmes stand mir noch bevor. Der Gang zu der Fremdenpolizei. Denn eine B-Bewilligung erlaubte mir in der Schweiz zu sein, nur wenn ich arbeitete. Richi und ich hofften, eine Ausnahme beantragen zu können. In einem Jahr wäre ich sowieso schon so lange in der Schweiz, dass ich die C-Bewilligung beantragen konnte. C-Bewilligung bedeutete die Niederlassung. Ich würde in der Schweiz leben können, auch ohne zu arbeiten. Ich rief bei der Fremdenpolizei an und vereinbarte einen Termin. An einem Mittwochnachmittag. Damit Richi auch dabei sein konnte.

(1) Beni und ich 1982

(2) 1982 - eine Zeit der Umstellung

Am Empfang der Fremdenpolizei ging es wie in einem Bienenhaus zu und her. Mindestens zwanzig Menschen warteten darauf, ihr Anliegen bei jemanden deponieren zu können. Einige unterhielten sich, die anderen starrten ratlos in irgendwelche Formulare. Ein Mann am Schalter erklärte einer jungen Frau, dass sie das falsche Formular ausgefüllt hatte. Sie schien ihn nicht zu verstehen und winkte eine andere Frau her. Sie schien mehr zu verstehen und fungierte als Übersetzerin. Mit einem neuen Formular in der Hand verliessen sie schimpfend den Raum. Eine schwarze Frau, die einen Hut, geschmückt mit künstlichen Blumen und Früchten trug, redete pausenlos auf einen Mann ein. Er starrte vor sich hin, als ob er ihr gar nicht zuhören würde. Das hinderte die Frau aber nicht daran immer weiter auf ihn einzureden. Richi und ich sahen uns an. Wir zwei in zehn Jahren?, sagten unsere Blicke. Er fasste meine Hand und flüsterte "Versprich mir, dass du nie so wirst."
"Ich verspreche", antwortete ich und sah ihn verliebt an.
Ich hatte nicht vor, in der Reihe zu warten, schliesslich hatte ich einen Termin. Frech ging ich an den Wartenden vorbei. Komischerweise beklagte sich niemand. Bei der Fremdenpolizei wollte anscheinend niemand negativ auffallen. Nur der Mann am Schalter sah mich konsterniert an. Ich stellte mich vor und sagte, dass ich einen Termin habe.
"Nehmen Sie Platz ", hiess es, "Sie werden abgeholt."
Wir setzten uns auf zwei schlichte Holzstühle und warteten. Mein Blick wanderte wieder zu den Wartenden. Einige von ihnen sprachen serbokroatisch. Ich hörte ihnen eine Weile zu. Konnte aber nicht herausfinden worüber sie sich aufregten. Ich fragte mich ob es an dem Ort lag, dass alle so gereizt waren. Oder weil es hier für viele um zukunftsentscheidende Angelegenheiten ging. Wie bei mir. Ich hatte genug vom Servieren. Genug von geschwollenen Beinen und müden Armen. Genug von Spätschichten und betrunkenen Gästen. Ich wollte am Abend zu Hause sitzen und mit Richi einfach nur fernsehen.
"Herr Wunderlin? Frau Lukinic?" Der Beamte unterbrach meine Gedanken. Er schüttelte unsere Hände und führte uns in sein Büro. Eine gut isolierte Tür setzte dem sprachlichen Wirrwarr aus dem Vorraum abrupt ein Ende. Wir setzten uns. Er öffnete eine Dokumentenmappe die bereits auf dem Tisch lag. Ich sah mein Foto, die Kopie meines Ausländerausweises und meiner Bewilligung. Auch die Kopie eines Briefes, den ich mal an die Gemeinde Sarnen wegen einer verspäteten Bewilligung schrieb, lag dabei.
Die wissen alles über mich, dachte ich, während es in meinen Fingern zu kräuseln begann. Ich wusste, eine Panikattacke kündigte sich langsam an. Ich hatte nichts zu verbergen, trotzdem machte mir ein Amt, das mein Leben protokollierte, Angst. Wer weiss was alles dort steht. Vielleicht hat jemand etwas über mich geschrieben, das gar nicht wahr ist. Und jetzt bekomme ich deshalb keine Erlaubnis die Schule zu besuchen.
"Frau Lukinic, was führt Sie zu mir?"
Er lächelte. Seine Augen lächelten mit. Das gefiel mir so bei den Schweizern. Bei ihnen lächelten auch Beamte. In Jugoslawien hatte ich nie einen Menschen in öffentlicher Stellung lachen gesehen. Manchmal frage ich mich, ob die Beamten in Jugoslawien eine Zusatz Ausbildung in der Kunst des "Nicht-Lächelns" erhalten.
Das Kräuseln in meinen Händen wurde stärker. Ich versuche zurück zu lächeln. Normalerweise bereitete ich mich für ein Gespräch vor. Doch auf dieses konnte ich mich nicht vorbereiten. Ich wusste nicht, was sie mich fragen werden. Und was ich sagen oder nicht sagen sollte. Diese Unsicherheit lähmte mich. Mein Atem stockte. Einen Augenblick brachte ich kein Wort aus mir heraus. Der Mann bemerkte meine Unsicherheit. Er schien geübt im Umgang mit solchen Situationen.
"Sie arbeiten im Stadtkeller, nicht wahr?"
"Ja.", krächzte ich.
"Im Winter gehe ich gerne in den Stadtkeller. Ich habe dort schon Polo Hofer und die Apaches gesehen. Muss schön sein, in einer Musikbeiz zu arbeiten."
"So ist es", antwortete ich. Das Kräuseln in meinen Händen liess langsam nach. "Der Sommer ist stressig. Wegen den Touristen. Aber im Winter ist es gemütlich."
"Frau Lukinic, wie kann ich Ihnen helfen?", kam er wieder auf den Punkt.
Plötzlich hatte ich keine Angst mehr. Ich sah in seinen Augen, dass er mir wohlwollend gesinnt war.
"Ich möchte eine Ausbildung machen. Aber ich habe nur die B-Bewilligung. Ich wollte Sie um eine Ausnahmebewilligung bitten."
Er erkundigte sich nach Details. Auch nach Richis Rolle in meinem Leben. Ab und zu sah er in die Akte.
"Wir leben zusammen. Wir haben vor zu heiraten", sagte Richi, um meine Position zu bestärken.
"Es wäre für mich rüüdig wichtig, wenn ich die Ausbildung machen könnte", sagte ich, mit dem schönsten Lächeln, das ich aufbringen konnte.
"Sie sind schon eine richtige Luzernerin!" Die Augen des Beamten strahlten vor Freude.
Ich wusste, dass ihm das Wort rüüdig gefallen würde!, dachte ich glücklich.
Seit einigen Monaten bemühte ich mich Schweizerdeutsch zu reden. Bisher sprach ich auch mit Richi Hochdeutsch. Doch ein Bekannter hatte mir empfohlen Schweizerdeutsch zu lernen.
"Du willst doch nicht, dass man in dir eine Ausländerin erkennt, sobald du den Mund aufmachst, oder?", sagte er zu mir.
Nein. Das wollte ich nicht. Ich verstand das Schweizerdeutsch schon lange, aber ich getraute mich nicht zu reden. Mit der Hilfe von Richi ging es aber zügig voran. Ich hatte zwar noch viele deutsche Ausdrücke in meinem Vokabular, aber die Schweizer schätzten meine Bemühungen sehr, ihre Sprache zu sprechen. Das für Luzern typische Wort "rüüdig", was so etwas wie «sehr» bedeutet, brachte mir bei ihnen stets Pluspunkte.
"Sie werden im nächsten Jahr die Niederlassung erhalten", sagte er zu mir. Bis dann dürfen Sie die Schule besuchen. Herr Wunderlin bürgt für Sie, nehme ich an." Er sah Richi an.
"Selbstverständlich", gab Richi zurück.
Wir verabschiedeten uns. Der Beamte strahlte mich an. Ich war sicher, aus diesem Gespräch wird irgendwo am Rand eines Blattes in meiner Dokumentenmappe stehen. "Bemüht sich zu integrieren".
Was genau dazu geführt hatte, dass ich die Ausnahmebewilligung erhielt, weiss ich nicht. Meine makellose Akte? Mein Schweizer Freund, der bei der Armee arbeitete? Mein Schweizerdeutsch? Oder das Wort rüüdig? Vielleicht von allem ein wenig. Vielleicht war es aber nur der gesunde Menschenverstand. Oder die gelebte Menschlichkeit.

Manchmal traut man sich nicht, eine Herausforderung anzunehmen, weil man zu wenig darüber weiss. Etwas das man nicht kennt schüchtert einen ein. Einige Nächte bevor das Schuljahr in der Freis Handelsschule begann, konnte ich kaum noch schlafen. War mein Deutsch gut genug? Die Alltagssprache war kein Problem, doch werde ich auch all die Fachbegriffe in der Buchhaltung, Wirtschaft, Mathematik oder Sprachen verstehen können? Werden mich die anderen Schüler akzeptieren? Fragen über Fragen, auf die ich verzweifelt eine Antwort suchte. Ich tröstete mich damit, dass ich nichts zu verlieren hatte. Wenn es mit der Schule nicht klappen sollte, könnte ich wieder servieren. Doch dann ärgerte ich mich sofort über mich selbst. Wenn ich schon im Voraus sagte, dass es kein Problem wäre, wenn ich scheiterte, musste ich es gar nicht versuchen. Ich wollte nicht scheitern! Ich brauchte dieses Diplom! Ich wollte beweisen, dass ich nicht einfach eine dumme Ausländerin war, die froh sein sollte in der Schweiz leben zu dürfen, wie Frau Keiser es damals ausgedrückt hatte. Ich wollte auch Richi nicht enttäuschen. Er glaubte an mich. "Du bist intelligent! Du schaffst es!", feuerte er mich immer wieder an, wenn ich an mir zweifelte.
Am Tag X war ich viel zu früh in der Schule. Fast eine Stunde zu früh! Ich entschloss mich im benachbarten "Café Cecile" einen Kaffee zu trinken. Das Café war ziemlich voll. An einem Tisch, an dem zwei ältere Herren sassen, entdeckte ich noch einen freien Platz. Heute würde ich Männer um die vierzig nicht als "ältere Herren" bezeichnen. Aber wenn man selbst sechsundzwanzig ist, hat man eine eigene Sicht auf vieles. Das sind bestimmt Lehrer, dachte ich und fragte, ob ich mich zu ihnen setzen darf.
Sie hiessen Walter und Roland. Keine Lehrer, sondern Schüler. Wie ich. Ihre Ausbildung wurde von der Invalidenversicherung finanziert. Walter hatte etwas mit den Hüften, Roland einen lahmen Arm. Walter und Roland waren in der gleichen Klasse wie ich eingeteilt. Ich war froh, dass ich nicht die älteste in der Klasse sein würde. Wir betraten das Schulzimmer gemeinsam. Wahrscheinlich dachten die anderen Schüler auch, dass wir Lehrer sind. Sie alle waren unter zwanzig. Ich war die drittälteste in der Klasse. Und die einzige Ausländerin. Das machte mir ein wenig Sorgen. Werde ich mit den Schweizern mithalten können?
Wenn mir jemand damals gesagt hätte, dass ich die Beste in meiner Klasse sein werde, und die viertbeste in der ganzen Schule, hätte ich ihm nie im Leben geglaubt. Doch so war es. Zwei Jahre später war ich die stolze Besitzerin eines Handelsdiploms, mit der Note 5.22.
Doch die zwei Jahre waren alles andere als einfach. Ich hatte zwar immer noch meine exzellente Auffassungsgabe, die mir schon in Jugoslawien das Lernen leicht machte, aber ich war mit einer Welt konfrontiert, die ich überhaupt nicht kannte. Zum Beispiel in der Staatskunde. Stadträte, Kantonsräte, Regierungsräte, Nationalräte, Ständeräte, Bundesräte. Legislative, Exekutive. Linke, Rechte, Bürgerliche. Flügel, Fraktionen. Ausdrücke die ich nie zuvor gehört hatte. Ich lebte zwar schon acht Jahre in der Schweiz, aber richtig dazugehört hatte ich nie. Wer konnte sich das alles merken, wenn man es nur auswendig lernte? In Jugoslawien war die Staatskunde einfach. Wir hatten eine Partei und basta.
Und dann noch die Sprachen. Das Deutsch selbst erwies sich als mein kleinstes Problem. Ich stellte fest, dass wenn man in der Grammatik seiner Muttersprache gut ist, hilft das einem bei dem Erlernen einer anderen. Mein Problem waren Englisch und Französisch. Ich musste diese Sprache lernen mit dem Deutsch als Basis. Und mein Deutsch war noch lange nicht perfekt. Doch wenn man etwas will, schafft man es auch. Ich büffelte Wörter und Grammatik in jeder freien Minute. Es hing so vieles davon ab. Und wenn ich mal an mir zweifelte, orientierte ich mich immer an zwei leuchtenden Streifen am Horizont: Ein besseres Leben und Anerkennung.
Zu jener Zeit hatten Richi und ich unseren ersten Computer angeschafft. Einen Portablen. Nur 12.5 Kilo wog der Osborne, unser Stolz! Mit zwei 5 1/4 Zoll Laufwerken, eins für die Programme, eins für die Daten. Ganze 64 KB Arbeitsspeicher bot der Meister der modernen Technik des Jahres 1982! Auch einen Drucker schafften wir uns an. Dank Einverständnis meiner Schreibmaschinen-Lehrerin, durfte ich den Computer als Schreibmaschine benutzen. Als gelernter Elektroniker, der auf den Grosscomputern arbeitete, half mir Richi, das neue Medium kennenzulernen.
Wie stolz ich war, als ich meinen ersten Bürojob bei Caritas Schweiz bekam! Ich bekam ihn weil ich etwas von Computern verstand. Den ganzen Tag Spendenbeträge ab den Einzahlungsscheinen einzutippen, war zwar nicht der Traumjob, aber es war ein Anfang. Ein weiterer Schritt in Richtung Erfolg. Und plötzlich bemerkte ich, dass ich keine Panikattacken mehr hatte. Ja. Der Arzt hatte Recht. Ich war nicht krank. Ich brauchte nur geistige Nahrung.
(1) Freis Handelsschule - Pause im Cafe Cecile

Wir alle wissen was ein Computer ist und wie er funktioniert – mehr oder weniger. Unsere Welt ohne Computer wäre heute undenkbar. Wenn man ehrlich sein will ist es auch eine grossartige Sache, egal ob man die Arbeit am Computer liebt, oder sie nur als ein notwendiges Übel betrachtet. Ich liebte unseren ersten Computer! Unseren Osborne! Das Wunder in einem Nähmaschinen Koffer. Ich bin so stolz, dass ich von Anfang dabei war. Als die Computer unsere Welt zu erobern begannen. Im Jahr 1982 konnte man nicht einfach auf die Taste drücken oder mit dem Finger über den Bildschirm fahren, und die Welt öffnete sich. Nein. Wenn ich heute jungen Menschen erzähle, dass ich zuerst ein Programm eintippen musste, bevor ich von ihm etwas verlangen konnte, schauen sie mich ungläubig an. Eine grafische Oberfläche war noch Science Fiction. Ach wie stolz ich war, als ich zum ersten Mal eine Linie mit einem Befehl auf dem Bildschirm zaubern konnte. Und der Bildschirm war kleiner als der meines heutigen iPhones. Ein Zehner-Pack 5 ¼ Zoll Disketten kostete 150 Franken.
Richi und ich verbrachten unsere ganze Freizeit am Computer. Von seinem Wissen als Elektroniker profitierte ich auch. Mein Wissensdurst war unstillbar. Bald reichte ein Computer nicht, ein zweiter musste her. Ein Morrow. Natürlich das neuste Modell. Kostenpunkt fünftausend Franken - als Vergleich: ich verdiente damals brutto 2'000 Franken im Monat. Er hatte sogar eine Festplatte und einen richtigen Bildschirm – wie ein Fernseher. Man konnte so viel Neues damit machen! Es galt wieder alles auszuprobieren. Wir beide lernten das jeweilig aktuelle Betriebssystem wie CMS, Basic oder wie die alle schon hiessen. Bald hatten wir einen Dritten im Boot. Richis Sohn Benjamin. Er spielte gerne Computerspiele wie Invaders oder Tetris. So musste noch ein dritter Computer her, für Benjamin. Ein Comodore 64. Der Spielcomputer schlechthin!
"Eigentlich könntest du als Computer Supporterin arbeiten", sagte Richi eines Tages zu mir.
"Ich? Das kann ich doch nicht!"
"Doch das kannst du", er zeigte mir ein Inserat in der Zeitung.
Die Software Entwicklung Firma "HDP Autodata AG" suchte jemanden für den Telefonsupport und für die Schulungen ihrer eigenen Programme. Sie machten Programme für Auto-Garagen, Getränkehändler und Verkehrsvereine.
"Ich kann das doch nicht", sagte ich eingeschüchtert von all den geschwollenen Ausdrücken im Inserat. "Ich kenne die Programme gar nicht."
"Das ist es! Sie werden nicht erwarten, dass du es kannst. Es sind ihre eigenen Programme. Sie werden dich zuerst ausbilden müssen. Und mit dem Lernen hast du kein Problem."
"Ob sie eine Ausländerin nehmen?"
"Du bist keine Ausländerin", sagte Richi. "Du bist eine Schweizerin. Schon vergessen?"
Ich lachte. Vor ein paar Monaten hatten Richi und ich geheiratet. Damals wurde man mit der Heirat automatisch Schweizerin.
"Ja aber wenn sie mit mir reden, merken sie es. Abgesehen davon steht in meinen Zeugnissen mein lediger Name."
"Aber dort steht auch, was du alles schon gemacht hast", sagte Richi.
In meinem Caritas-Zeugnis standen lauter, wichtige Ausdrücke wie Input, Output oder Batchverarbeitung.
"Bewerbe dich. Glaube mir, du kannst das."
Es war so schön, wie Richi immer an mich glaubte! Dank ihm hatte ich Hürden geschafft, an die ich mich sonst nie gewagt hätte. So bewarb ich mich. Und ich bekam die Stelle! Warum auch immer. Vielleicht lag es wirklich daran, dass ich bereits mit den Computern gearbeitet hatte. Vielleicht lag es auch daran, dass ich keine grossen Lohnansprüche stellte. Was es auch immer war, dank diesem Job war ich endlich Jemand! Ich muss wahrscheinlich nicht erwähnen, dass ich auch diese Ausbildung locker geschafft hatte. Nun leistete ich unseren Kunden Unterstützung am Telefon, fuhr mit dem Chef durch die ganze Schweiz zu Verkaufsgesprächen und bildete unsere Kunden vor Ort aus. Da unsere Kunden Verkehrsvereine waren, durfte ich in den schönsten Hotels wohnen, wenn die Schulungen mehrere Tage dauerten. Gstaad, Schönried, Saanenmöser und Wengen, blieben für mich für immer in einer grossartigen Erinnerung.
Zu jener Zeit gab es noch keine Informatik Ausbildung. "Lerning by doing", hiess es. Man bewarb sich für einen Job, und wurde meistens vom Arbeitgeber ausgebildet. Ich liebte solche Schulungen! Nicht nur weil ich immer mehr über mein Lieblingsthema lernte, sondern auch weil ich in jedem Kurs die einzige Frau war! Bald konnte ich mir Stellen aussuchen. Alle drei Jahre wechselte ich den Arbeitgeber, um immer weiter zu kommen. Schindler Informatik, Raiffeisen Bank sowie die Stadt und Kanton Luzern waren meine grössten Stationen. Auch nach einem langen Arbeitstag verbrachte ich zu Hause mehrere Stunden am Computer. Ich kriegte nie genug. Mein Fachwissen stieg und stieg. Bald gab ich selber Computerkurse. In meinen ersten Textverarbeitungskursen mussten die Teilnehmer ihre Mäuse selber mitnehmen , wenn sie damit arbeiten wollten. Die waren viel zu teuer, um damit ein ganzes Schulzimmer einzurichten. Heute wird eine Computermaus als Verbrauchsmaterial eingestuft. Bereits für zwanzig Franken kann man eine Maus kaufen.
(1) Osborne - unser erster Computer, Jahrgang 1982, funktioniert heute, im Jahr 2020, immer noch

Inzwischen sind dreissig Jahren vergangen. Wir schreiben das Jahr 2020. Das Jahr, das wegen der Corona-Pandemie uns allen für immer in Erinnerung bleiben wird. Ich arbeite seit zwanzig Jahren als Informatikerin beim Kanton Luzern. Auch mit dreiundsechzig halte ich in der Welt der Informatik mit, mehr oder weniger. So wie ich mal die einzige Frau in allen Computerkursen war, bin ich jetzt die älteste. Vom Alter her könnte ich vielen meinen Kollegen Grossmutter sein. Im nächsten Frühling werde ich pensioniert. Dieser Zeit schaue ich mit gemischten Gefühlen entgegen. Ich freue mich darauf, weil der tägliche Stress, im Beruf mitzuhalten nachlassen wird. Anderseits werde ich dann beruflich definitiv zum alten Eisen gehören. Richi ist bereits seit zehn Jahren Rentner. So Gott und Corona es wollen, werden wir mit unserem Hund Lennon nächstes Jahr eine lange Reise mit dem Wohnmobil machen. Wir möchten die gesamte Küste Kroatiens kennenlernen, nicht nur Istrien, das wir seit Jahren immer wieder besuchen.
Benjamin, Richis Sohn, ist vierundvierzig Jahre alt. Er hat drei Söhne und eine Tochter. Gemeinsame Kinder haben Richi und ich nicht. Es hat nicht sein sollen. Aber in all den Jahren, haben sieben Katzen, drei Hunde und viele Meerschweinchen und Kaninchen unser Leben bereichert. Wir leben in einem grossen Haus in der Agglomeration Luzern, das wir nach unseren Vorstellungen bauen liessen.
Seit einigen Jahren habe ich das Reisen entdeckt. New York ist meine Lieblingsdestination. Mit der Transsibirischen Eisenbahn hatte ich Russland durchquert. Namibia, Südafrika, Island, England und Irland sind weitere Highlights meiner Reisen. Mein Trip nach Los Angeles wurde bereits nach drei Tagen wegen der Corona-Pandemie beendet. Das werde ich hoffentlich bald nachholen können.
Meine Mutter lebt in Serbien, Jugoslawien gibt es bekanntlich nicht mehr. Sie ist auch schon vierundachtzig Jahre alt. Mein Stiefvater wurde dreiundsiebzig Jahre alt. Bevor er starb, verkauften sie ihr Haus in Zrenjanin und zogen aufs Land.
Meine Grosseltern, Majka und Deda, wurden beide achtundachtzig Jahre alt. Paul, mein richtiger Vater starb mit vierundvierzig an gebrochenem Herzen. Er hat es nie überwunden, dass meine Mutter ihn verlassen hatte.
Meine Schwester Anna und ihr Mann Miro haben zwei Kinder, Oliver und Sabina. Sie sind auch schon über vierzig. Wir sehen uns nicht oft, weil sie nicht in der Nähe wohnen. Anna und Miro sind pensioniert und bereits mehrfache Grosseltern. Sabina steht mir sehr nahe. Als wäre sie mein eigenes Kind. Auch ihre Tochter Elena liebe ich sehr. Sie ist auch schon zwölf Jahre alt.
Bata habe ich nie mehr gesehen. Mein Freund Lucic, den ich nach zwanzig Jahren wieder mal in Serbien getroffen habe, hat mir erzählt, dass Bata verheiratet und bereits Grossvater ist. Ich bin von der Liebe zu ihm definitiv geheilt. Trotzdem würde ich ihn gerne mal sehen. Rein aus Neugier. Um zu sehen, wie er heute aussieht und wie sich sein Leben entwickelt hatte. Als ich ihn das letzte mal gesehen hatte, war er siebenundzwanzig Jahre alt. Jetzt ist er sechsundsechzig.
Mit Andres habe ich per Facebook Kontakt. Wir sind gute Freunde geworden. Er hat drei Söhne und ist auch schon Grossvater. Er schickt mir ab und zu Videos von seiner Enkelin per Messenger.
In meiner Freizeit schreibe ich Bücher. Auf Deutsch, natürlich. Bisher habe ich zwei Romane, eine Erzählung und mehrere Kurzgeschichten veröffentlicht. Ich schreibe gerne, doch oft fehlt mir die Zeit dafür, obwohl mir Richi Freiräume so gut wie möglich schafft.
Richi ist das Beste, das mir im Leben passiert ist. Ich habe in all den Jahren, die wir zusammen verbracht haben, keine einzige Sekunde bereut, dass ich mich für ein Leben mit ihm entschieden habe. Nicht zuletzt dank ihm bin ich heute da wo ich bin. Er hat mich stets unterstützt und an mich geglaubt. Er und seine Familie sind der Grund warum ich mich in der Schweiz zu Hause fühle. Er ist meine grösste Stütze. Mein Wegweiser. Mein Leuchtturm.
(1) Richi, ich und Lennon im Jahr 2020

(2) Richi und Lennon 2020

(3) Meine Mutter (83) im Jahr 2019

(4) Galileo und Lennon, die besten Freunde die es je gab 2020

(5) Unser Haus in Buchrain - 2020

"Eine gelungene Integration bedeutet, sich einer Gemeinschaft zugehörig zu fühlen. Sie setzt die Aufnahmebereitschaft der Mehrheitsgesellschaft voraus – wie auch die Bereitschaft der Zugewanderten, die Regeln des Aufnahmelands zu respektieren und sich um die eigene Integration zu bemühen."
Diese Zeilen habe ich irgendwann auf der Webseite des Bundes gelesen.
Mit meinen eigenen Worten gesagt: Wenn man in ein fremdes Land geht, ist man dort ein Gast. Ob ein willkommener oder unwillkommener spielt dabei keine Rolle. Ein Gast ist ein Gast. Ein guter Gast hält sich an die Regeln des Gastgebers. Er fordert nichts, nimmt das was ihm angeboten wird. Ein Guter Gastgeber bemüht sich, seinem Gast den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Sowohl der Gastgeber, als auch der Gast, nehmen Rücksicht auf die Herkunft, die Gewohnheiten und die Wertvorstellungen des anderen.
Leuchtet ein, nicht wahr? Warum ist dann der Weg der Integration, für die meisten von uns, mit unzähligen Stolpersteinen belegt? Was muss man tun, um die Steine aus dem Weg zu räumen?
Meiner Meinung nach, und die kommt aus eigener Erfahrung, braucht es nur zwei Dinge:
- Die Landesprache lernen
- Den mitgebrachten Rucksack ablegen
Das wichtigste ist, die Sprache so schnell wie möglich zu lernen. Wenn man zu lange damit wartet, findet man einen Weg zu leben auch ohne, dass man die anderen versteht, oder von ihnen verstanden wird. Wenn man die Sprache nicht kennt, ist man automatisch von der Gesellschaft ausgegrenzt.
Das zweitwichtigste ist, den mitgebrachten Rucksack abzulegen. Niemand von uns reist ohne Gepäck. Unsere Traditionen, unsere Erziehung und unsere Wertvorstellungen reisen mit. Doch in einem fremden Land gelten oft andere Traditionen, andere Wertvorstellungen. Darum müssen wir unseren Rucksack vorläufig ablegen, um uns auf das Neue einlassen zu können. Um es kennenzulernen. Und wer weiss, vielleicht gefällt uns das Neue besser, als das was in unserem Rucksack schlummerte. Und wenn nicht? Dann kann man den Rucksack wieder nehmen und zu unseren Wurzeln zurückkehren. Um eine Illusion ärmer und eine Erfahrung reicher.
(1) 1980 / 2020