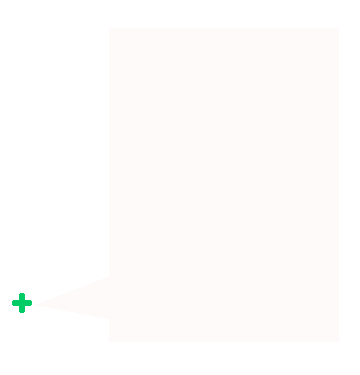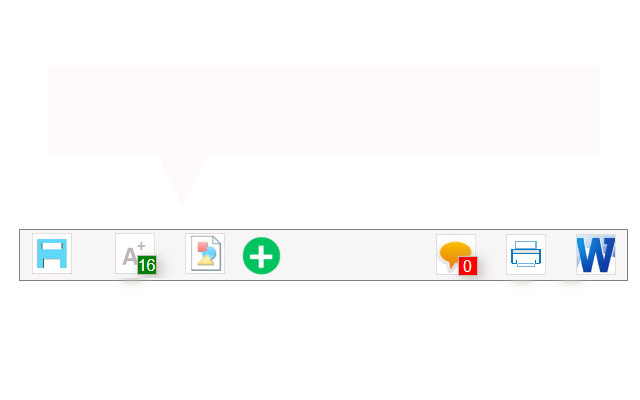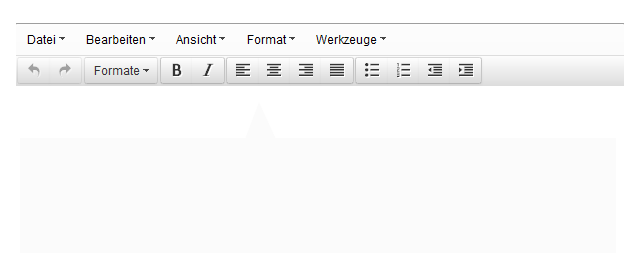Zurzeit sind 543 Biographien in Arbeit und davon 307 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 190

EIN KURIOSITÄTENKABINETT
AUTOBIOGRAFIE
von Hans Alex Meyer
1.1 www.meet-my-life.net/img/uploadAdminBig/3dfa05a5_p1011079.jpg" alt="" />
Die Familie des Arztes und Apothekers Johann Ludwig Meyer in Zürich. Dargestellt sind die Mutter des Doktors, seine Ehefrau und seine sechs Kinder: zwei Töchter und vier Söhne. Auf kupferplatte gemalt von Heinrich Werdmüller im Jahr 1796
Der Familienstamm der “Rosenmeyer“ gehörte dem Zürcher Patriziat an, also den regierungsfähigen Familien. Einige Portraits und Dokumente aus dem 17. und 18. Jahrhundert scheinen darauf hizuweisen, dass es unter den Vorfahren recht bekannte Leute gegeben habe. Die vor allem von der “Trinité“ (cf.Kap.3) behaupteten, unter unseren Vorfahren habe es zwei Bürgermeister der Stadt Zürich gegeben. Das ist Fantasie. Vielleicht waren die Kupferstecher Rudolf und Conrad auch “Roseπnmeyer“. (Das Familienwappen zeigt eine zweigeteilte rot-weisse Rose.) Die genealoischen Forschungen meines Neffen Emmanuel Meyer haben auch diese beliebten Familienmythen widerlegt. Historisch erwiesen aber als einer unserer Vorfahren im 18.Jahrhundert ist der Stadtarzt und Apotheker Johann Ludwig Meyer. Die Ähnlichkeit der Gesichtszüge meines Vaters mit den Porträts des Dr. Johann Ludwig ist unverkennbar.
1.2
Mein Urgrossvater, Johann Jakob Meyer-Stählin, lebte im sanktgallischen Rheintal. Es ist mir nicht bekannt, weshalb dieser Spross einer Zürcher Patrizierfamilie sich im Kanton Sankt Gallen niederliess. Als Grossvater schrieb er für die Enkel einen Bericht von seinem Erleben bei der Verteidigung von Mailand, als es im Jahr 1848 von den Österreichern unter dem Feldmarschall Radetzki belagert wurde. Nachdem er zusammen mit anderen Schweizer Kriegsfreiwilligen aus einer erbeuteten Kanone in die Richtung des österreichischen Armeelagers einen Schuss abgegeben hatte, wanderte er wieder in die Heimat zurück.
Es gibt ein kleines Ölbild des Wohnhauses seiner Familie in Mühleck. Auf der Rückseite ist das Jahr 1858 notiert. Zudem meldet diese, hier seien seine drei Nachkommen, Ludwig, Emmi und Guido geboren wurden.
An die Grosstante Emmi Sulzer-Meyer kann ich mich noch erinnern, wirkte als etwas exaltierte alte Dame mit einem schwarzen Halsbändchen, das die Hautfalten zusammen hielt. Vom Onkel Ludwig Meyer-Zschokke gibt es ein Foto, mit mir als Einjährigem auf seinem Schoss. Er hatte eine Tochter aus der bekannten Aarauer Familie Zschokke geheiratet und soll in Aarau die Gewerbeschule gegründet haben.
Der Jüngste, Guido, hatte Mathilde, die Schönste, sagte man, aus der Industriellenfamilie Weber von Menziken im Aargau geheiratet. Er war Reisender, Commis voyageur, wie man damals sagte, Vertreter einer Firma für Seife, vielleicht auch für Rauchwaren. Diese Mathilde hatte fünf Kinder geboren. Das zweitälteste war mein Vater, Alexander Rudolf.
1.3
Die Mutter meines Vaters, Mathilde Weber hatte die “Vornehmheit“, mit anderen Worten, den Reichtum, der Zürcher Familie der Rosen-Meyer, in die sie geheiratet hatte, masslos überschätzt. Deswegen machte sie ihrem Ehemann, ihren fünf Kindern, besonders dem Alex und sich selbst das Leben schwer. Mit ihrem Hochmut und fehlenden Sinn für die Wirklichkeit, liess sie sich vom erfolgreicheren Schwager Louis in Menziken-Reinach die Villa “Salve“ bauen, wo sie ihre Zeit mit der Lektüre von Courths-Mahler-Romanen verbrachte. Davon inspiriert, träumte sie von einem Leben in rauschenden Seidenkleidern und Equipagen. Ich weiss nicht auf welche Weise, hatten sich dabei nicht geringe Schulden angehäuft. Mit und trotz dem Dorfladen in Menziken, den sie von ihrer Familie geerbt hatte, geriet die Familie in Konkurs. An den Schulden hatte mein Vater noch sein halbes Leben lang zu zahlen, denn seine drei Schwestern waren lange Zeit arbeitslos oder in schlecht bezahlten unqualifizierten Stellen. Sie hatten alle drei Klavierspielen und Näherin lernen müssen, beides haben sie aber nie ausgeübt.
1.4
Der jüngere Bruder, Fritz, konnte angeblich finanziell auch nichts beitragen. Nach der Fantasie der Mutter hätte er Bankier werden sollen. Er wurde aber noch während der Lehrzeit entlassen, angeblich weil es zu Unregelmässigkeiten gekommen sei. Seither war er Hilfsarbeiter in den verschiedensten Firmen, wo er jeweils rasch zum Vorarbeiter aufstieg um sich dann gleich wieder eine neue Arbeitsstelle in einem anderen Beruf zu suchen.
1.5
Die Mutter Mathilde setzte alles daran, die Ehe von Alex mit Maria Sennhauser zu verhindern. Er war der Einzige der fünf Geschwister, der eine Berufslehre, nämlich die von der Mutter für ihn bestimmte Malerlehre, abgeschlossen hatte. Nach Lehrabschluss blieb er bei seinem Lehrmeister Hasler (oder Hassler) in Aarau noch eine Weile angestellt. Von allen vier Geschwistern, hatte zu jener Zeit nur er ein regelmässiges Einkommen. Es soll vorgekommen sein, dass ihm die Muter den Zahltag aus der Kitteltasche stahl und, wenn sie ertappt wurde, behauptete, das gehöre sowieso ihr. Sie habe in der Familie ausgestreut, Maria sei eine Schlampe, während sie der zukünftigen Schwiegertochter flüsterte, ihr Sohn Alex sei Alkoholiker.
Maria fühlte sich zeit ihres Lebens unter dem Druck, die Verleumdungen duech ihre Schwiegermutter als absolut untadelige Frau und Mutter Lügen zu strafen. Dabei hatte Maria für manche Verwandte des Vaters ein Refugium geschaffen wo sie tage- bis monatelang ohne Bezahlung leben konnten, für die Schwägerin Alice, als sie stellenlos war, und für Emmi, während ihrer schweren Krankheit. Auch der Schwager Fritz, der vorübergehend in Zürich als Fahrleitungsmonteur an der Trolleybuslinie nach Witikon arbeitete, wohnte ohne Entgelt während mehreren Wochen bei uns.
Auch eine von Vaters Cousinen, Klara Keller, wurde von Maria aufgenommen. Diese war 1936 nach Südafrika ausgewandert und kam ein Jahrzehnt später schwer depressiv in die Schweiz zurück. Aus den Gesprächen der Erwachsenen verstand ich, dass sie versucht habe, sich im Zürichsee zu ertränken, aber gerettet wurde. Aber trotz der Klara gebotenen Gastfreundschaft redete meine Mutter und auch ihre Schwägerinnen schlecht über die Unglückliche, als ob sie selber schuld wäre an ihrer Krankheit und verantwortlich für ihre Verzweiflungstat. Ich konnte schon als Vierzehnjähriger solche Harherzigkeit der Frauen gegenüber einer seelisch Kranken nicht verstehen. Ich wagte aber nicht, meine Meinung zu entgegnen. Meine Mutter und die Verwandten der Klara waren anscheinend noch geprägt vom gleichen Mangel an Einfühlung gegenüber seelisch Leidenden wie die unaufgeklärte Gesellschaft im Mittelalter.
1.6
Dank ihrer lebenslangen Bemühung war es meiner Mutter gelungen, die von der Schwiegermutter Mathilde ausgestreuten Verleumdungen auszuräumen, ausser bei der jüngsten Schwester von Alex, der Margrit, die, nachdem die besänftigende Wirkung des Bruders Alex nach seinem Tod erloschen war, noch eine böse Attacke gegen sie in Szene setzten wollte.
Zur Behandlung ihrer zunehmenden Erblindung in der Zürcher Universitätsaugenklinik lebte auch die Grossmutter Mathilde eine Zeitlang bei uns an der Kirchgasse 33. Man sprach vom Glaukom, dem Grünen Star und führte diese Augenkrankheit darauf zurück, dass sie nächtelang ihre Traumromane las. Das ist vielleicht einer der Gründe, weshalb meine Mutter und ihre drei Schwägerinnen das viele Lesen für augenschädigend hielten. Im Widerspruch dazu waren meine Eltern Mitglieder der "Büchergilde Gutenberg" und bezogen jeden Monat eines dieser preisgünstigen, literarisch wertvollen Bücher.
Obschon er unter seiner Mutter eine traurige Kindheit erlitten hatte, fühhlte sich der Vater verpflichtet, seine blinde Mutter häufig zu besuchen. Sie verbrachte den Rest ihrer Tage in Kilchberg, im Eleonorenheim für Blinde. Für diese Pflichtbesuche nahm er mich jeweils mit. So wurde ich häufig Zeuge davon, wie Mutter und Sohn lautstark miteinander stritten. Weil das Leben und die Menschen nicht ihren Illusionen entsprachen, war sie unglücklich und hartherzig geworden.
1.7
Kindheit, Jugend und Lehrjahre des.
Über seine Kinder-und Jugendzeit erzählt mein Vater im Gegensaz zur Mutter selten etwas, ausser über fogende zwei Erinnerungen: Für die männliche Jugend war
Die Teilnahne an den Übungen der paramilitärischen Kadetten noch während vielen Jahren später obligatorich. Für den Knaben Alex war das eine angenehme Abwechslung vom traurigen Stimmung in der Villa Salve. Mit Vergnügen erzählte er von einer kleinen Kanone mit welcher die künftigen Kanoniere richtig schiessen durften.
Um sich vor seiner Mutter zu schütze. verkroch er sich oft in den Estrich um zu lesen, denn dort gab es viele in Kisten verstaute Bücher.
Während seiner Malerlehre durfte er die Innenseite der Dachvorsprünge in der Aarauer Altstadt restaurieren. Sie waren früher mit barocken Girlanden bemalt worden. Wo sie ganz vergilbt waren, konnte er sie aus eigener Fantasie erneuern.
Bevor er sich in Zürich niederliess, arbeitete er noch in Zofingen und in Genf. In Genf kam er in Beziehung zu den Freimaurern, die ihn unter ihre Obhut nahmen. Davon erzählte er nur, dass einer der Freimaurer ihn einmal in einer Gartenwirtschaft vor einem Glas Bier sitzen sah. Mit erhobenem Zeigfinger machte ihm dieser ein Warnzeichen. Er hatte immer eine gewisse Hochachtung vor der Freimaurerei, aber, typisch für meinen Vater, konnte er sich nicht dazu entschliessen, einer Loge beizutreten. Ich habe von ihm wahrscheinlich meine Neigung zur Eigenbrödlerei geerbt.
Für seinen ersten Lohn kaufte er sich eine Monogaphie über Ferdinand Hodler. Hodler war damals zwar schon sehr berühmt, seine Wandmalerei im Landesmuseum aber gaben Anlass zu heftigen Anfeindungen durch patriotische Zürcher Bürger. Der Rückzug der Schweizer Lanzknechte aus der verlorenen Schlacht bei Marignano galt als Beleidigung für den schweizerischen Nationalstolz.
Vater Alex hatte immer eine gewisse Hochachtung vor der Freimaurerei, aber, typisch für ihn, konnte er sich nicht dazu entschliessen, einer Loge beizutreten. Ich habe von ihm wahrscheinlich meine Neigung zur Eigenbrödlerei geerbt.
1.8
Der Vater lernt das ”rote“ Zürich kennen und die Maria Sennhauser. In Zürich hatte der Vater einen Bekanntenkreis von Genossen, die sich im Volkshaus
zusammenfanden, alles Sozialdemokraten oder Kommunisten. Einige von ihnen beteiligten sich als Kämpfer im spanischen Bürgerkrieg. Er erzählte nie, wer dabei umgekommen war, aber dass einige der in die Schweiz Zurückgekehrten zu Gefängnisstrafen verurteilt worden waren, “wegen Schwächung der Schweizer Wehrkraft“. Das gab der kritischen Einstellung meines Vaters gegenüber dem Staat und der Regierung zusätzliches Gewicht. Die damals noch durchwegs bürgerliche Stadt- und Bundes-Regierung hatten sich um diese Zeit erst durch die Wahl der Sozialdemokraten Klöthi zum Stadtpräsidenten und Nobs in den Bundesrat für die Sozialdemokratie geöffnet. Die “Roten“ hatten lang als gefährliche Revoluzzer gegolten, so auch bei der Mutter Mathilde. Sie hatte ihren Sohn vor dem “roten Zürich“ gewarnt.
1.9
Die Weltanschauung des Vaters. Sein kritisches, oft ironisches und zynisches Denken und Reden und die künstlerisch-freie, nach ”inks“ orientierte Ansichten seiner Bekannten (Schriftsteller, Bildhauer, Musiker, Tänzer, Kunstmaler) prägte indirekt auch meine Einstellung zur Kunst und zur Gesellschaft, obschon Vater Alex nie versucht hatte, mich verbal zu beeinflussen. Als Junge hatte er eine gute Beziehung zum Pfarrer von Menziken, aber in Zürich verlor er unter dem Einfluss des Sozialismus das Interesse an der Kirche, ohne aktiver Atheist zu sein. Im höheren Alter fand er eine freundschaftliche Beziehung zum Pfarre Ruhoff an der Kirchgemeinde Balgrist in Zürich. Es ist bezeichnend für ihn, dass er durch die Persönlichkeit des Pfarrers und nicht durch die abstrakte Institution Kirche schliesslich seinen Weg zum christlichen Glauben fand.
1.10
Heirat. Meine Eltern heirateten im Oktober 1929 und wohnten dann in einem kleinen Miethaus am Münsterhof in Zürich, gegenüber der Fraumünsterkirche. Das Häuschen war so schmal, dass es in jedem Stockwerk nur für ein Zimmer Platz hatte.
Dann kam für das junge Ehepaar die erste gemeinsame Weihnacht. Maria dachte darüber nach, auf welche Weise sie feiern könnten. Ein Christbaum komme nicht in Frage, insistierte ihr Alex. In seiner Familie in Menziken hätten sich Vater und Mutter unter dem Christbaum jedes Jahr heftig gestritten. Am Weihnachtstag machten Maria und Alex einen langen Spaziergang auf den Üetliberg. Auf dem Rückweg blieb Alex einmal ein Weile unauffällig ein wenig zurück. Als die Beiden wieder bei sich zu Hause angekommen waren, zog er etwas unter seinem Mantel hervor: ein junges Tannenbäumchen, ihr erster Christbaum.
Seither gab es bei ihnen zu jeder Weihnacht einen Christbaum. Unter ihrem Christbaum ist nie gestritten worden.
1.11
Die Zeit der Wirtschaftskrise. Vom Münsterhof aus ist es kaum eine Viertelstunde zu Fuss an die steil zur Winkelwiese hinauf führende Trittligasse. Da war das Geschäft des Malermeisters Alder, der Arbeitsort des Vaters. Während der weltweiten Wirtschaftskrise, die von 1929 bis vor dem zweiten Weltkrieg dauerte, herrschte auch in der Schweiz schlimme Arbeitslosigkeit. Der Vater, der leitende Arbeiter in diesem Geschäft, war aber nie arbeitslos. Häufig und mit Stolz erzählte meine Mutter, dass Papi nie habe “stempeln“ müssen, das heisst Arbeitlosenunterstützung beziehen. Andere Werktätige seiner Generation wechselten den Beruf. Der Onkel Emil Mollet, der Ehemann der Tante Rösli, einer Schwester der Mutter, wurde vom Garagisten zum Wirt. Ein anderer Schwager, Fred Meier, Ehemann der Tante Berti, hatte als gelernter Holzschnitzer die Erwerbstätigkeit ganz aufgegeben. Seine tüchtige Frau ernährte ihren Ehemann und ihren Sohn Alex, als Leiterin verschiedener Konsum-Denner-Filialen.
1.12
Des stillen Dulders Grenze. Des Vaters seltene aber heftigen Jähzornanfälle, waren meistens Folge von Mutters Taktlosigkeiten, oder wenn mein Ungehorsam oder ein naïves, ungeschicktes Wort von mir seiner verletzten Seite zu nahe trat. Dann brach bei ihm alter, gestauter Zorn aus. Dann redete er laut, knallte die Türen zu aber er liess sich nie dazu hinreissen, die Mutter zu schlagen. Dann aber wurde ich zum Prügelknaben erkoren. Das machte mir Angst. Er schlug aber nur auf die Bettdecke unter die ich mich dann verkroch. Mir war schon im Kindesalter auf halbbewusste Weise klar, dass er dann an mir etwas abreagieren musste, was er als Kind weit schlimmer erlitten hatte, so dass ich es ihm viel weniger verübelte als der Mutter ihre oft verständnislos harten und ungerechten verbalen Schläge. Schlimmer noch war es, dass die Mutter nach solchen Szenen oft tage-, sogar wochenlang trotzig, verstockt und gehässig schwieg oder wegzulaufen drohte “um nie mehr zurück zu kommen“. Das hat sie tatsächlich einige Male inszeniert: Sie verbrachte dann ein paar Tage bei Ihrer Freundin Emmi in Schöftland, die das “Marili“ grenzenlos verehrte. Ich weiss nicht wie solche Flucht auf meinen Vater wirkte, ob er Angst um sie hatte oder erleichtert war. Sie kam nach solchen Eskapaden jeweils geradezu triumphierend zurück.
Das sind zwar traurige Erinnerungen. Genau besehen war es eigentlich nicht so schlimm für mich. Was mich manchmal bedrückte war, dass ich im Ehestreit der Eltern nicht mutiger zum Vater gestanden bin.
1.13
Mein Jähzorn-Erbe. Ich vermute, dass ich noch einen anderen, für meinen Vater typischen Charakterzug, geerbt habe, nämlich des Vaters Bedürfnis nach Harmonie, die Introversion, die Fähigkeit manche Belastung und Belästigung ohne Aufbegehren zu erdulden, aber nur bis zu einer gewissen Grenze. Wenn diese erreicht war, konnte es auch bei mir zu einem Ausbruch von Jähzorn kommen. Etwas ähnliches hatte ich an mir schon im Kindergarten erlebt. Ein mir gegenüber sitzender Bub hatte mich irgendwie belästigt. Da nahm ich meinen kleinen Schuh um ihn damit zu hauen. Hinter mir war aber ein Fenster. Mit dem Schuh in der Hand holte ich so weit und so übermässig heftig nach hinten aus, dass ich eine Fensterscheibe zertrümmerte. Der Vater, dessen Geschäft dem Kindergarten benachbart war, ersetzte dann die Glasscheibe ohne mich zu strafen oder auch nur zu schelten. Im Erwachsenenalter äusserte sich mein Jähzorn manchmal leider auch in Beziehungen zu Frauen. Wenn ich eine zeitlang Enttäuschungen oder Verletzungen stumm geduldet hatte, konnte mich eine unbedeutende momentane Enttäuschung in Jähzorn versetzen. Dann verlor ich plötzlich meinen Anstand und meine Impulskontrolle, und brüllte die Freundin zügellos heftig an. So zerbrachen manche Freundschaften unwiderruflich. Auf ähnliche Art ist auch die Scheidung von Verena zustande gekommen. Nur erstreckte sich damals mein stummes Hinnehmen von Frustration über Jahre und der hervorbrechende Zorn über Monate. Von heute aus gesehen ein ungerechtes und unbesonnenes egoistisches Verhalten,
Als ich in der Mittelschule war, hatte ich die Absicht, meine Eltern bei der Geschäftsadministration zu entlasten. Ich sah und hörte sie oft bis tief in der Nacht zu rechnen. Alles von Hand! Sie hatten sich nicht einmal eine Addirmaschine angeschafft. Das Steueramt verlangte plötzliich das Führen einer Geschäftsbuchhaltung. Das war meinen Eltern in ihrer Naivität vorher nie in den Sinn gekommen. Sie heuerten einen Buchhalter an, um es zu lernen. In der Schule hatte ich als Freifach doppelte Buchhaltung belegt und im Mathematikunterricht mit dem
Rechenschieber umzugehen gelernt. Was es aus Stolz oder Scham, dass sie meine Hilfe schroff ablehnten
Dagegen stellte mich der Vater ich in den Ferien manchmal Hilfsarbeiter an. So konnte ich etwas von seinem handwerklichen Geschick beobachten und lernen. Er konnte noch “gestosen” tapezieren, also die Tapetenbahnen aneinander stossend statt übereinander an die Wände kleben. Weil er die selten gewordene Kunst des Marmorierens und Maserierens noch beherrsche, bekam er anspruchsvolle Aufträge zum Beispiel alte Kirchenorgeln und antike Stilmöbel zu restaurieren Für meine Hilfsarbeit gab er mir sogar einen Stundenlohn, von einem Franken fünfzig Rappen. So hatte ich mir auch das Geld für die erste Ferienreise in die Provence verdient.
Ich kann mich an eine kurze Begebenheit erinnern, die zeigt, dass sein selbstloses Opfer für meine Ausbildung von der Umgebung wahrgenommen wurde. Es war nach der Maturfeier. Der Vater und ich standen noch vor dem Haus als der Hausbesitzer Buchmann dazu kam. Nach der Begrüssung, gratulierte er meinem Vater "zu diesem erfolgreichen Schritt". Das verwunderte mich, doch ich fand es angemessen. Es kam mir leider nicht in den Sinn, selber ihm zu danken für das Opfer, das er dafür gebracht hatte und für meine noch kommenden Ausbidungsjahre bringen würde
1.14
Das Malergeschäft. 1938 oder 1939, auf Initiative seiner Frau Maria, entschloss man sich, ein eigenes Geschäft für “Flach- und Dekorationsmalerei“ zu gründen. Nahe der Werkstatt seines bisherigen Arbeitgebers Alder, an der Neustadtgasse mietete er eine grosse einräumige Werkstatt. Damals war dieser Teil der Zürcher Altstadt das Quartier für viele Kleinhandwerker. Die teilweise recht breiten Gassen erlaubten bei schönem Wetter einen Teil der Arbeiten im Freien auszuführen, beispielsweise die alte Farbe von Fensterläden mit Hilfe einer Spachtel und der Benzinlampe abzukratzen.
Arbeiten mit dem Vater: Vom Ende der Mittelschulzeit an und während dem Studium nahm mich der Vater in meinen Ferien manchmal an seinen Arbeitsplatz als Handlanger mit. Dieser Lohn (total 50 Franken) reichten mit gerade für die geplante Ferienrise von zwei Wochen nach Südfrankreich.
Nach der Matur half ich dem Vater in einer Villa auf dem Zürichberg die frisch renovierten Jalousie-Fensterläden wieder anzubringen. Dazu brauchte ich meine ganze Kraft, weil man, um die schweren Läden einzuhängen, sich weit aus aus dem Fenster lehnen muss. Dadurch kam ich auch in das Zimmer der Vera, der Tochter des Hauses, Sie war Schülerin am Mädchengymnasium. Ich hätte sie gerne kennen gelernt, aber sie war nicht zu sehen. Ihre jüngeren Geschwister wussten, ich weiss nicht wie, dass ich soeben die Matur bestanden hatte. Sie tanzten im Garten herum und neckten mich: ”Jetzt hat er die Matur und ist noch so dumm!” Ihre Neckerei störte mich nicht sehr, lehrte mich aber, wie ein Handwerker und gar ein Lehrling in Kreisen der Villenbewohner auf dem Zürichberg eingeschätzt wird.
1.15
Der Erziehungstil des Vaters. Als ich noch im Kindergarten oder in den unteren Primarschulklassen war, setzte die Mutter den Vater als Miterzieher ein. Nachdem er abends jeweils wieder zu nach Hause gekokmmen war, musste ich ihm noch vor dem Nachtessen die Sünden des Tages beichten und der Arme war gefordert, eine Bestrafung zu erfinden, die sich dann aber meistens auf ein nicht sehr ernsthaftes Schelt- oder Scherzwort beschränkte. Vor dem Beichtzwang hatte ich mehr Angst als vor Vaters Verdikt.
1.16
Gute Erziehung beinhaltet auch Lob. Von Seiten der Mutter konnte ich dergleichen nicht erwarten, das hätte mich nach ihrer Ansicht nur noch mehr zum ”Aufschneider" gemacht, für den man mich gehalten hatte.
Doch einmal gab es ein Lob. Ich hatte zwar wie fast jede Woche am Samstagnachmittag die Stube vollständig geputzt, mit dem sechsfachen Prozedere nämlich Stahlspähnnen, Wischen, Flaumern, Wichsen, Blochen erst mit der Bürste und dann mit dem Lumpen und Abstauben: alle Möbel, die Standuhr, die Skulptur von Hans Gerber (nackter weiblicher Torso) und die Blätter der Clivia. Dann den grossen Stubenteppich in den Garten Tragen, an der Teppichklopfstange Aufhängen, Klopfen auf der einen Seite, Bürsten, Umkehren, Klopfen auf der Rückseite, Bürsten, wieder in die Stube Tragen und den runden Tisch wieder drauf plazieren. Dann galt dasselbe Ritual dem kleinen Eingangskorridor und der schon stark abgenutzten Holztreppe, die von unserem zweiten Stock ins Parterre führte. Die Treppenstufen waren an ihren Kanten schon stark abgerundet. Das hatte zur Folge, dass Mammi fast jeden Monat einmal ausschlipfte und alle Stufen hinunter glitt - ohne je sich einen Knochen zu brechen!). Nach einer solchen Samstagarbeit sass ich am Abend wieder an meinem geliebten Tisch und machte Schulaufgaben. Da kam der Papi ins Zimmer und sagte:, "D'Mueter hät gsäit, du heigisch guet gschaffet hüt" und Einzigartigkeit dieser Anerkennung im Auftrag der Mutter, die mich berührte und sie unvergesslich machte. Dabei war der belobnte Einsatz nach meiner Schätzung nicht grösser gewesen als üblich.
1.17
Vaters Strafkodex. Mit dem Basteln eines Hampelmannes hatte ich einen Wettbewerb gewonnenin und bekam als Preis ein sogenanntes Pfadimesser, einen Dolch, den ich am Hosengürtel befestigen konnte. Damit ausgerüstet zogen Hannes Ginsberg und ich an einem freien Nachmittag ins Wolfbachtobel. Dort, nahe schon am Zürichbergwald, gab es halbwüchsige Bäume, geeignet, meinen Dolch zum Fällen eines Bäumchens auszuprobieren. Wir wussten nicht, dass das Wolfbachtobel zum Bereich der städtischen Anlagen gehört und nicht zum Zürichbergwald. Zu unserem Pech sah ein Stadtgärtner unseren Frevel. Er brachte uns auf den Poizeiposten von Hottingen. Da wurden wir verhört und ich musste mein Corpus delicti abliefern. Man werde unsere Eltern benachrichtigen, die sollen uns bestrafen. Ich kam reumütig und geknickt nach Hause. Da waren meine Eltern schon informiert darüber, was geschehen war und was sie zu tun hätten. Und wie hat mein Vater diesen polizeilichen Auftrag umgesetzt? "Nicht dass ihr da gefrevelt habt, sollte man bestrafen," sagte er, "sondern dass ihr euch habt erwischen lassen." Dafür freilich gab es keine Sanktionen.
Es war in der dritten oder vierten Klasse des Gymnasiums. Ich war zu dieser Zeit verliebt in zwei Konfirmandinnen. Das war die Ursache für meine miserable Mathematiknote im Zeugnis. "Jede Verschlechterung der Noten gefährdet die Promotion", hiess es da. Der Vater, der das Zeugnis unterschreiben musste, kam zu mir während ich, wie meistens zuhause, am Schreibtisch sass, zeigte mir meine Zeugnisnoten und sagte nicht viel mehr als: "Was soll denn das ?" Das hatte genügt. Eine Klasse zu repetieren kam nicht in Frage. Für die fünfte Klasse nahm ich mir vor zu arbeiten, besonders für die Mathematik, auch im Hinblick auf das geplante Studium der Medizin. Und nach der Konfirmation verebbte der Liebessturm.
1.18
Gespräche zwischen Vater und Sohn. Die Gegenwart der Mutter verhinderte sie meistens. Es konnte sein, dass wir kaum einen ganzen Satz aneinander gerichtet hatten, da fuhr die Mutter schon mit ihrem Ich-Kommentar dazwischen, “Ich habe auch...", selbst wenn sie vorher in einem anderen Zimmer oder in der Küche war. Sie duldete nicht, dass Vater und Sohn einmal allein miteinander plaudern konnten. Wir waren beide unfähig uns dagegen zu wehren. Die Mutter erheischte sofortige und ungeteilte Aufmerksamkeit
Nach ihrer ihrer Afrikareis verbrachten meine Eltern zusammen mit meiner Familie ein Afrikareisen verbrachten meine Eltern und meine Familie einige Tage im Ferienhäuschen der Schwiegereltern Kuhn in Klosters. Auf einem der Spaziergänge in der Gegend, ergab es sich, dass mein Vater und ich eine kurze Zeit nebeneinader gingen, ungestört von den Gesprächen der Andern. Da sagte der Vater plötzlich zu mir: "Ich habe mein ige Tage im Ferienhäuschen der Schwiegereltern Kuhn in Klosters. Auf einem der Spaziergänge in der Gegend, ergab es sich, dass mein Vater und ich eine kurze Zeit nebeneinader gingen, ungestört von den Gesprächen der Andern. Da sagte der Vater plötzlich zu mir: "Ich habe mein
Während eines Urlaubes zwischen zwei ganzes Leben lang Lebensangst gehabt". Ich wusste nicht, was ich dazu hätte sagen können. Ich weiss nicht mehr ob ich ihm zu merken gab, dass es mich berührte. Ich hoffe, dass ich ihn mit diesem Bekenntnis nich ganz allein liess. Mit diesem Wissen konnte ich Vieles von seinem Verhalten verstehen. So auch, dass er sich gegen die Einmischungen seiner Frau nicht wehren konnte. Er war menschenscheu. Nie hat er sich für eine Ausstellung seiner eigenen Bilder entschliessen können, obschon ihn mit den beiden Galeristen der "Palette" Kolbrenner und Wiesner eine langjährige Freundschaft verband. Er war es, der die beiden Bilderrahmenmacher, auf die Idee gebracht hatte, neben dem Rahmengeschäft noch eine Gallerie zu eröffnen, die dann während Jahrzehnten für das Kunstleben in Zürich recht bedeutend wwürzigenGeruch von Terpentin. Das erinnert mich daran, dass der Vater malte. Das Lösungsmittel für die Ölfarben ist Terpentin. Das unten stehende Aquarell habe ich etwa um 1949 gemacht. Darauf ist zu erkennen, dass der Vater mit der linken Hand zeichnete unb malte, wie Leonar verschiedenen, zu Dutzenden in einer Vase eingestellten Blumen und Gräser konnte er so gut wie kaum ein Impressionist darstellen, niemals langweilig oder kitschig. Er malte oft das Naheliegende: das poetische kleine Bild mit zwei weissen Anemonen in der winzigen mit einem Vogel bemalten Keramikvase neben dem uralten Spielzeugpferdchen, das immer noch auf meinem Büchergestell seinen kleinen Wagen zieht. Das ist ein Frühwerk, eines seiner schönsten Bilder, das schon sein grosses malerisches Können zeigt. Er hat auch seine zwei Söhne porträtiert. Wo diese Werke hingekommen sind, weiss künstlerischen Nachlass unseres Vaters?
Er zeichnete viel, oft Karikaturen und Fantasiegestalten. Einige seiner Zeichnungen hatte die Mutter vor der Zerstörung gerettet. Sie ruhen jetzt in meiner Sammelmappe.
Es gab keinen Ausflug ohne Malblock und Aquarellfarben. Er zeigte mir, dass man beim Aquarellieren einer Landschaft immer mit dem Himmel beginnen soll und dass die schwarze Farbe nie benutzt werden darf. Seine Landschaftsaquarelle wurden dennoch immmer etwas düster: "Le paysage est un état d'âme".
1.19
Mein Vater war etwa siebzig Jahre alt, als er sein Malereigeschäft aufgab, seine letzte "Bude" kündigte. Im Keller unseres Wohnhauses an der Forchstrasse führte er noch leichte Aufträge aus. So vergoldete er die eisernen Grabkreuze für eine Familie. Von diesem Alter an begann er zu hinken. Obschon er nie über Schmerzen im einem Hüftgelenke klagte. Ich meldete ihn bei meinem Kollegen vom Neumünsterspital an, dem Internisten und Rheumatologen Dr.Heinz Brögli an Diagnose: Athrose des rechten Hüftgelenks. Die Gehschmerzen und der Röntgenbefund rechtfertigen die Indikation zur Operation. Schon einige Monate vorher war er zu mir in die Praxis gekommen zur Behandlung seiner leichten Herzinsuffizienz. Ich hätte die Behandlung gleich einem Kardiologen überlassen sollen, befürchtete aber, dass er damit nicht einverstanden gewesen wäre. Im Hinblick auf eine eventuelle Operation überwies ich ihn dann doch dem Kardiologen Dr.Kaufmann, dessen Praxis in deer Nähe der Wohnung lag. Noch vor dem Termin für die erste Konsultation erlitt er einen "ambulanten" Herzinfarkt, wie Dr.K. diagnostizierte, also ohne die sonst typischen heftigen Brustschmerzen und ohne dass er es für notwendig hielt, ihn zu hospitalisieren. Wir feierten am 15.Dezember 1978 Weihnachten mit der ganzen Familie. Der Vater machte noch Bemerkungen in seinem ironisierenden Ton, aus welchen ich im Nachhinein eine Vorahnung seines baldigen Sterbens zu vernehmen glaubte. Am 20. Dezember rief mich die Mutter am Morgen um sechs Uhr an: Sie glaube, dem Papi gehe es sehr schlecht. An Bett konnte ich nur noch die ärztliche Todesurkunde ausfüllen und aus dem Kirchengeasngbuch meiner Mutter und mir einige Sterbetexte vorlesen. Ich sagte alle noch bis zum 24. Dezember und länger eingeschriebenen Konsultationen ab und verbrachte drei Tage mit Weinen und damit, seinen Nachruf zu schreiben.

.

2.1
Ort der Handlung ist ein Weiler, der zur Gemeinde Lütisburg oder Batzenheid, in einem Seitental des Toggenburgs gehört, den meine Mutter in Erzählungen aus ihrer Kindheit “Underrindel" nannte. Ihre besondere Gabe war, spannende Erlebnisse aus ihrer Kindheit zu erzählen. Oft wünschte sie sich, gut schreiben zu können, um ihre Aberteuer und Leiden der Nachwelt zu erhalten. Ihr Leben war ausgefüllt abgesehen von den Pflichten als Hausfrau und Mutter und als Sekretärin im Malergeschäft von vielen Ideen und Wunschträume ihrer Fantasie. Zur Erfüllung gelangte kaum eines ihrer "Luftschlösser“.
2.2
Der Vater Sennhauser hatte als Erbe von seinem Vater den Beruf und sein Anwesen übernommen: Das Wohnhaus, einen Stall für die Milchkuh und den kleinen industriellen Betrieb zur Reinigung von Watte. Dazu gehörte eine Scheune zum Trocknen der Watte mit der Maschine, die durch ein Wasserrad betrieben wurde. Sennhausers hiessen im Dorf “s’Wattemachers“. Für dieses Erbe musste er seinen Geschwistern Zins bezahlen.
Nach dem ersten Weltkrieg ging der Marktbedarf an Polsterwatte zurück. Wattierte Kleider kamen aus der Mode. Mit dem Aufkommen der fabrikmässigen Watteherstellung ("Flawa" in Flawil) entstand übergrosse Konkurrenz. Bald einmal konnte er der finanziellen Verpflichtung gegenüber seinen Geschwistern nicht mehr nachkommen. Unter deren Druck kam es zum Konkurs. Das Haus mit allem was dazu gehörte wurde vergantet (versteigert). Seine zu jener Zeit schon erwachsenen Töchter und Söhne konnten sich selber ernähren. Der Vater verdiente seinen eigenen Unterhalt als Nachtwächter in der Giesserei Bühler in Uzwil. Die Töchter arbeiteten in der Fabrik, nur diedie Maria, als Kindermädchen und Magd (in Frankreich: femme de chambre, Kammerzofe), die Söhne als Hilfsarbeiter.
2.3
Mutige Taten, Volksmedizin und Aberglauben, Zu den berührendsten und traurigsten Abenteuern der Kindheit gehörte, dass sie zu einem geizigen Bauern und dessen Frau als billiges Mägdlein verdingt worden war. Sie musste für ein kleines Mädchen körperlich viel zu schwere Arbeit leisten und fand kaum genug Zeit für die Hausaufgaben der Schule. Unter der Bezeichnung “Verdingkinder“ hatte Jeremias Gotthelf schon bald hundert Jahre zuvor diesen Missbrauch von Kindern armer Familien beschrieben. An eine Wiedergutmachung für die Opfer dieser Verbrechen denkt man erst jetzt, mehr als hundert Jahre später. Mutig wie Maria schon als Kind war, entschloss sie sich eines Tages wegzulaufen. Das erst etwa acht Jahre alte Mädchen fand den mehrstündigen Weg nach Hause. Der Vater erkannte den Grund seiner Flucht. Ohne sie zu bestrafen behielt er sie nun zu Hause.
2.4
Der jüngere Bruder, Sepp, war dem Spital entflohen. Er litt an einer Sehnenscheideninfektion (Phlegmone) einer Hand. Der Spitalarzt wollte sie ihm amputieren, denn es drohte ihm der Tod an Sepsis (Blutvergiftung). Es gab ja noch keine Antibiotika. Die Amputation war gemäss der damaligen Schulmedizin das einzige Mittel, das Leben des Jungen zu retten. In der Nacht vor dem geplanten Eingriff jedoch flüchtete sich Sepp aus dem Spital, erschien zu Hause und weckte seine Schwester Marie. Sie pflegte ihn noch in der Nacht und darauf tagelang mit Bädern und Wickeln mit dem Absud von einer Pflanze, die der Vater “Akamonikraut“ nannte (wahrscheinlich Johanniskraut, Hypericum perforatum), das Wundermittel der väterlichen Hausapotheke. Als Anhänger des Kräuterpfarrers Küenzli kannte sich der Vater in der Kräuterheilkunde aus. Häufig kosultierten ihn deswegen die Dorfbewohner. Dafür nahm er nie Bezahlung an.
Die kranke Hand von Sepp wurde geheilt. Er lobte die Marie an jedem Familientreffen: Sie habe ihm die Hand und das Leben gerettet.
2.5
Ein Fuchs hatte im Hühnerstall ein Massaker angerichtet. Als das Mädchen Marie einmal allein zu Hause war, beobachtete sie vom Küchenfenster aus den Mörder, wie er der Hausmauer entlang zum Hühnerstall schlich. Sie hatte gerade in einer grossen Pfanne Wasser zum Sieden gebracht. Da schüttete sie das heisse Wasser auf den roten Pelz. Der Fuchs schreckte winselnd auf und rannte davon. Er war fortan an Wattemachers Hühnern nicht mehr interessiert.
2.5
Die folgende Geschichte illustriert die Geistesgegenwart der noch halbwüchsigen Maria. Ich weiss nicht, welche Umstände dazu führten, dass sie sich bei einer Nachbarin befand, die soeben geboren hatte und zusehen musste, dass das Neugeborene nicht lebensfähig war. Da holte Maria das in jeder Familie vorhandene Gefäss mit dem Weihwasser und taufte das Kind im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und gab ihm einen Namen. Sie hatte im kirchlichen Unterricht ja gelernt, dass jede Person berechtigt, ja verpflichtet , in einer solchen Situation die Nottaufe durchzuführen, damit das Kind nicht in den Limbus, die Vorhölle der ungetauften Kinder kam, sondern in den Himmel. Meine Mutter hat nicht erzählt, ob der Vater des Kindes und der Priester sich bei ihr bedankt hätten.
2.6
In der Stube meiner Familie stand die Bidermeier Schreibkommode, Versteck mancher kleiner Familien-Kostbarkeiten. Da war auch in einer abgegriffenen Brieftasche das Familiengeld und das Post-Quittungsbüchlein. In einem der kleinen Schublädchen lag der kugelrunde Achat mit einer verletzten Stelle in der sonst spiegelglänzend geschliffenen Oberfläche und einer durchgehenden Perforation, so dass man eine Schnur hindurchziehen konnte um ihn um den Hals zu tragen. Das war der Augenstein. Zur Behandlung aller möglichen Augenleiden musste man auf Verordnung des Vaters diesen Talisman an der Schnur um den Hals tragen solange bis der erwartete Zauber seine unfehlbare Wirkung getan hatte. Jedenfalls litt keines der zehn überlebenden Sennhauser-Kinder an bleibendem Augenschaden.
2.7
Die Mutter der Maria stammte aus Gams im Rheintal. Der junge Toggenburger Sennhauser galt bei den Gamser Buben als fremder Eindringling. Als er einmal seine Braut besuchen wollte, versperrte ihm eine ganze Reihe der Gamser Jungmannschaft den Weg. Auf diesen unfreundlichen Empfang war er vorbereitet. Er gab ihnen den mitgebrachten Fünfliber. Das reichte damals für einen reichlichen Umtrunk im Dorfwirtshaus. Sie luden ihn zum Mittrinken ein, aber er lehte ab und ging zu seiner Auserwählten.
Sie hat dreizehn Kinder geboren. Eines soll gleich nach der Geburt gestorben sein. Das zu jener Zeit jüngste Kind, Philipp, war im Alter von etwa drei Jahren an Diphtherie erkrankt. Als er nicht mehr atmen konnte, musste der Arzt einen Luftröhrenschnitt vornehmen. Alle Geschwister mussten die Stube verlassen. Nur die Maria schlich sich hinein und beobachtete die Operation von einem Versteck aus. Philipp aber musste trotz der Tracheotomie sterben.
Die Geburt der Mathilde war die Dreizehnte. Die Mutter starb einige Tage nach der Entbindung, wahrscheinlich am “Kindbettfieber“, einer Infektion mit Blutvergiftung (Sepsis). Das war neben der Lungenembolie die häufigste Ursache der damals noch entsetzlich hohen Müttersterblichkeit. Maria mochte gegen neun Jahre alt gewesen sein (1910) Sie bekamnun die Aufgabe, im Dorf den Tod der Mutter zu verkünden. So ging sie von Haustür zu Haustür und wunderte sich ein wenig, warum alle Leute so aussergewöhnlich lieb waren zu ihr, sie über den Kopf streichelten, “du armes Kind“ sagten und ihr ein Geldstück gaben. Sie kannte die schweren sozialen Folgen dieses Sterbens noch nicht. Es gab ja noch keine Hinterlassenenversicherung. Und es war auch keine nachbarliche oder verwandtschaftliche Unterstützung zu erwarten für den nun von Sorgen erdrückten Vater. Ein Leben ohne Mutter konnte sie sich noch nicht vorstellen. Ihr Dienst als kleiner Todesengel hatte ihr sogar zu gefallen. Doch in der Nacht hörte sie den Vater schluchzend in der Stube auf und ab gehen.
2.8
Der alltägliche Tod.
Zu jener Zeit begegnete das Kind dem Tod als etwas beinahe Alltäglichem. Manche Schulkameradinnen starben in ihrem Alter. Die Meisten von Ihnen stammten aus Familien deren Eltern und alle Kinder an den Stickmaschinen arbeiteten. Diese Maschinen waren von der Fabrik ausgeliehen und standen in den dunkeln, feuchten und kalten Kellern der Wohnhäuser. Diese Mütter hatten keine Zeit für einen Gemüsegarten, oder um richtig zu kochen. Die Kinder starben an der "galoppierenden Schwindsucht“. So nannte der Volksmund die kavernöse Lungentuberkulose.
Der weise Vater Sennahuser jedoch bemühte sich, mit seinen Kindern ein Stück Land zu bebauen und eine Kuh zu besorgen. So wurden die Kinder richtig ernährt, obschon die Mutter fehlte.
Maria hatte mit siebzehn Jahren noch keine Menstruation. Als eine Nachbarin das zu wissen bekam, behauptete sie, dass ein Mädchen sterben müsse, wenn es bis siebzehn die Tage noch nicht habe. Dieser ungehobelte, manchmal geradezu böse Umgangston war unter diesen einfachen Leuten üblich. Man warf sich ungeschminkte Wahrheiten (und Dummheiten) an den Kopf. Das war auch der Umgangston der Sennhauserschwestern unter sich.
2.9
Nach der Primarschule, den damals obligatorischen acht Klassen arbeiteten vier der fünf ihrer Brüder als Hilfsarbeiter und wurden schliesslich erfolgreiche Handwerker und Geschäftsleute und einigermassen wohlhabend. Vier der fünf Sennhausertöchter verdienten ihren Lohn bis zur Heirat als Fabrikarbeiterinnen. Meine Mutter jedoch wehrte sich gegen Fabrikarbeit und ging “in die Fremde“.
An den Vater meiner Mutter habe ich nur eine kurze, nebelhafte Erinnerung. Nicht vergessen habe ich die Fahrt zu seiner Beerdigung in der Toggenburger Bahn mit der Dampflokomotive. Im Kindergarten zeichnete ich dieses Ereignis in mehreren Szenen.
2.10
Maria in der Fremde. “Die Fremde“ wo Maria eine Stelle als Kindermädchen fand, war in Zofingen bei den zwei Buben der Familie Schlumpf, Die Familie Schlumpf waren Inhaber eines grossen Färbereiunternehmens. Die nach der Ansicht von Maria etwas dümmliche Mutter hatte ihre zwei Söhne schon recht verwöhnt. Marias Stolz aber war es, dass trotz ihres etwas strengeren Erziehungsstils die Beiden an ihrem Mareili mehr hingen als an ihrer eigenen Mutter.
Maria musste schon etwa vier Jahre an dieser Stelle verbracht haben, da war die Zeit der Pandemie der spanischen Grippe von 1918 und 1919. Maria erkrankte und kam bewusstlos ins Spital Zofingen. Währenddem sie langsame aus der Bewusstlosigkeit am Aufwachen war, hörte sie den Arzt und Pflegerinnen miteinander sprechen: “Das arme Kind, noch so jung, und muss schon sterben.“ Als sie wieder ganz zu sich gekommen war, machte sie den Helfern den Vorwurf: “Warum habt ihr mich nicht sterben lassen? Das wäre doch so schön gewesen!“ Es war nicht das erste Mal, dass sie gerne gestorben wäre.
2.11
Ich weiss nicht, weshalb sie die Stelle in Zofingen verlaiess und femme de chambre wurde, in Neuenburg, in Hermence und in Südfrankreich.
Schon als junges Mädchen soll sie mutig, tatkräftig gewesen sein, erlebte das Leben intensiv und farbig, begabt mit sprudelnder Fantasie, praktisch und lebensklug. Sie folgte nicht wie die anderen Schafe der Herde. Oft erzählte sie, dass sie in der Nähschule die Beste war, sodass die Lehrerin ihr gerne eine Ausbildung ermöglicht hätte. Zeit ihres Lebens hatte sie für sich etwas “Höheres im Kopf“ und beklagte es, dass die Armut ihr keine Berunflehre ermöglichte. Umso mehr lag ihr daran, wenigstes ihre Söhne etwas für die Vorstellung ihrer sozialen Umgebung “Höheres“ werden zu lassen. Conrad und ich verdanken diesem Ehrgeiz die Möglichkeit zu studieren. Sie setzte sich dieses Kränzlein in naïver Ehrlichkeit selbst auf den Kopf : “Ich habe euch studieren lassen“.
2.12
Maria kommt nach Zürich. Etwa um 1927 war Maria auch nach Zürich gekommen, zu den Schwestern Berti und Rös (Rosa). Da findet die Maria Sennhauser den Maler Alex Meyer und heiratet ihn im Oktober 1929. Zu dieser Zeit hatte Berti schon ihren Sohn Alex. Ihr Mann, Fred Meier, war ein strammer Kommunist, der sich daran hielt, nur ein Kind zu haben. Berti habe ihn geheiratet weil er ein “Solider“ sei. Das hiess: “Er raucht nicht, er trinkt nicht und er geht nicht mit anderen Frauen“. Und, weil er mit seinem Beruf als Holzbildhauer keine Arbeitsstelle mehr gefunden hatte (die Schnitzereien an den Stubenbüffets waren ausgestorben), arbeitete er nicht mehr, sondern ging “stempeln“, was damals wahrscheinlich während längerer Zeit möglich war als heute. Er besorgte den Haushalt und hütete den Sohn Alex, während seine Frau als Filialleiterin in einem Konsum Denner genug verdiente um die kleine anspruchslose Familie zu ernähren. Marias jüngere Schwester, Rosa, hatte einen Garagisten, den ruhigen introvertierten und treuen Emil Mollet geheiratet. Bald brauchte die Autobranche nur noch wenige Fachleute. Nicht zuletzt auf Initiative der rührigen Rös gründeten die Beiden ihre Existenz auf die Führung von Restaurants, angefangen mit einer “Beiz“ im damaligen Arbeiterquartier. Das war “die Brückenwage“ an der Badenerstrasse. Ihre Tochter Kitty wurde vom Grosi Mollet gehütet, die zusammen mit der taubstummen Tochter Berti und dem Sohn Emil Mollet mit Rosa im Nachbarhaus wohnten. In den Dreissigerjahren beeindruckten mich die nicht selten schwer betrunkenen Männer, die in der Umgebung quer über die Strassen torkelten. Zum sonntäglichen Mittagessen waren meine Eltern oft In der "Brückenwage", später im "Drahtschmidli" und im "Hotel Anker" zu Gast. Sporadische Erinnerung: Einmal war die Wirtsstube mit grossen Fasnachtsmalereinen des Vaters dekoriert. Jedesmal bekam ich von der Tante Rösli
ein Glas Himbeersirup mit einem Röhrli. Dazu durfte ich einen der salzigen Bierstenengel essen.
2.13
Die “Muttersprache“.
Alle fünf Sennhauser-Töchter waren starke Naturen, ihren Ehepartnern an Vitalität überlegen. Am wenigsten traf das noch zu bei meinen Eltern, wo der Kampf um die Überlegenheit nicht immer so eindeutig zu Gunsten der Ehefrau ausging, sondern häufig zu einem verbalen Ringen um die Macht wurde. Mutters Angriffe gegen den Vater kannten keine Rücksicht auf die Verletzlichkeit meines schon muttergeschädigten Vaters. Dieser ihr geistig überlegene stille Dulder, hatte schon bei seiner Mutter gelernt, zu schweigen, sich zurückzuziehen bis ihre Taktlosigkeiten seinen zurück gestauten Jähzorn entfesselten, von welchenich manchmal auch Einiges abbekam.
Erst im fortgeschrittenen Erwachsenenalter entdeckte ich nach und nach dass viele Ansichten, Werturteile über Menschen, nicht die Meinen waren, sondern von der Mutter kritiklos Übernommenes. Man müsste annehmen, dass ich durch die doch viel tiefer gehende Bildung und der weitere Horizont, die ich im Gymnasium und im Medizinstudium mitbekommen hatte mich immunisiert hätte gegen die kurzbeinigen Ideen der Mutter. Es zeigte sich aber, dass nicht nur die “Muttersprache“ die geistige Grundlage des heranwachsenden Kindes ist, sondern auch das was man die mütterliche Weltanschauung, die “maternale Lebensphilosophie“ nennen könnte. Sie wurde mir eingetrichtert mit der meinem Mami eigenen intensiven Emotionalität, zusammen mit dem Einsatz von Schuldgefühlen. “Ich habe mich für euch aufgeopfert, und das ist nun der Dank....“ (immer im Plural)
2.14
Alter und Abschied. Meine Mutter wurde 96 Jahre alt. Nach dem Tod meines Vaters lebte sie noch 18 Jahre, zunächst in der städtischen Wohnung an der Forchstrasse. Dann verlangte die städtische Liegenschaftsverwaltung, dass sie diese Wohnung für eine Familie freigibt. Wir fanden für sie eine schöne
Alterswohnung an der Letzistrasse, mit Aussicht ins Grüne. Hier fühlte sie sich noch einige Jahre wohl. Als sie noch viel jünger war stürzte sie schon häufig zu Boden, aber nur einmal brach sie sich damit einen Knochen: es gab die relativ harmlose Radiusfraktur. Ich arbeitete damals auf der Unfallstation des Kantonsspitals. So nahm ich sie gleich mit und reponierte die Fragmente und machte ihr die Gipsschiene. Einer ihrer Stürze an der Letzistrasse führte zur Beckenfraktur. Dafür wurde sie im Spital Bethanien (ohne zu operieren) behandelt, Wegen der zweiten sturzbedingten Beckenfraktur wies ich sie ins im Stadtspital Waid. Dort gab es Komplikationen: Pneumonie und Magenblutung. Beides wird noch behandelt. Dann aber war ihr geistiger und körperlicher Zustand so bedenklich geworden, dass sie nicht mehr in ihre Alterswohnung zurückkehren konnte. Ich musste sie ins Pflegeheim Witikon bringen in ein Zimmer mit noch drei anderen Patientinnen. Hier stürzte sie wieder, dieses Mal war die Folge eine Femurhalsfraktur, die trotz ihrem hohen Alter von 95 Jahren aus pflegerischen Gründen noch operiert werden musste. Nach dieser im Spital Neumünster auf dem Zollikerberg durchgeführten Operation wurde sie zunehmend verwirrt.
Sie döste nur noch vor sich hin. Wenn ich sie besuchte und begrüsste fragte sie manchmal noch: „bisch du de Hans?“.
Es war. als ob sie bereit wäre, Abschied zu nehmen. Manchmal murmelte sie noch etwas. Es tönt wie: „ich will jetzt sterben“. Ich versuche sie daraufhin anzusprechen: „Ja, dort ist ja schon der Pappi und wartet auf dich.“ (das war aus meiner damals noch agnotischen Religiosität ehrlich gemeint und keine seelsorgerliche Lüge). Plötzlich hell wach antwortete sie ohne zu zögern: „Der? Der hat noch nie auf mich gewartet!“
2.15
Am Ende.
Es gibt zwischen Menschen, die das Schicksal während Jahrzehnten aneinander gebunden hielt, eine Art stummes Sichverstehen. Es war nach diesem gehässigen Ausruf nun als ob sich zwischen uns etwas wie ein Nebel aufbaute, als ob mir etwas oder sie selbst sagen würde: “Du musst mich nun gehen lassen!“.
Da liegt sie nun, bleich und verwelkt und blickt mich erwartungsvoll und ängstlich an.
Ich beuge mich zu ihr hin und küsse sie auf die Stirn. Ich will etwas sagen, aber was? Vorwurf und Dankbarkeit lagen im Streit. Mit zaghafter Stimme kam dann doch:
“Du hast es gut gemacht. So gut wie es dir möglich war. Du hast dir sehr viel Mühe gegeben. Ja, du hast alles gut gemacht. Ich danke dir!“.
“Ich vergebe dir“ das auszusprechen vermochte ich nicht. Ich denke jetzt: Zu vergeben war ja wirklich nicht meine sondern Gottes Sache.
Sie scheint wie erleichtert zu sein. Oder ist es mein eigenes Aufatmen, das ich an ihr zu sehen meine? In meiner Vorstellung ist es als ob ein Etwas über ihr schwebte, gelöst von ihrer Körperlichkeit.
Die unruhigen und ängstlichen Augen haben sich jetzt beruhigt, diese schwarzen Augen, die dem Blick anderer Menschen immer ausgewichen sind, so dass ich seit meiner Kindheit dem Blick der Mutter nur ganz selten begegnet bin.
Das war der Abschied.
Zwei Tage später der Telefonanruf vom Spital Neumünster: Sie ist nun gegangen.
2.16
Als nach der Abdankung. in der Friedhofkapelle Enzenbühl die Urne in das Erdloch versenkt wurde, hätte ich heulen mögen. Ist das alles, was von diesem Leben übrig bleibt? Was ich ihr zuletzt noch zugeflüstert hatte, war ernst gemeint.

3.1
Alice, die Erstgeborene, kam nach Frankreich, anscheinend ohne lange Umwege in die Domäne einer Grafenfamilie, die im Schloss Compiègne gehaust haben soll. C. ist heute eines der bekanntesten historischen Denkmäler Frankreichs, zeitweise bewohnt von Louis XVI, Napoleon I und Napoleon III. Ich muss leider ein wenig daran zweifeln, ob es nach dem ersten Weltkrieg einer adligen Familie möglich war, dieses riesige Bauwerk mit mehr als 100 Salons, voll von Kunstwerken zu bewohnen und zu pflegen. Alice erzählte mit Begeisterung von den aristokratischen Kindern, die ihr anvertraut worden waren, von Claude, dem der Arzt zur Behandlung seiner Grippe (oder Tuberkulose?) Champagner verschrieben hatte und vom Mädchen, seinen Namen habe ich vergessen.
Ob es nun das Schloss Compiègne war oder ein bescheidener Landadelssitz: das Herz der Alice schlug und blieb ihr ganzes Leben lang bei diesen Baronen- oder Grafenkindern und den vornehmen Eltern, und für so viel Herz ist als Hintergrund nur ein Compiègne gut genug! Aus Frankreich zurück, war sie eine zeitlang Verkäuferin in einem Geschäft in Zürich, das wir heute Boutique nennen würden. Es hiess “Kunst und Spiegel“. Später arbeitete sie immer in Modegeschäften. Diese kleine, schwarzhaarige, dunkeläugige lebendigen Frau, glich einer Französin aus dem Midi mit dem glücklichen Charakter eines Tatarin de Tarascon, aber ohne seine Hochstapeleien. Und wie sie aus einem Landschlösschen ein Compiègne zaubern konnte, so sah sie in allen das Gute, das Edle und Schöne. Ein leidlich ansehnliches Mädchen war nach ihrer Beschreibung “bildschön mit einem prachtvollen Haar“. Als Verkäuferin in den Modegeschäften an der Bahnhofsstrasse, bei Gassmann, Modissa und schliesslich Wigert war sie in ihrem Element. Hier kam ihr ihre Ausbildung in “Couture“ zu statten. Hier war auch ihre ehrliche Achtung vor dem Vornehmen und Eleganten am richtigen Ort. Sie konnte auch in arroganten Kundinnen die gute Seite sehen und verhielt sich ihnen gegenüber ohne zu heucheln so, als wären sie echt vornehme Damen. Das machte sie bei der Kundschaft und bei der Geschäftsinhaberin, der Fräulein Wigert, beliebt.
Meine Mutter benutzte jeden Vorwand, zum Beispiel bei der Suche nach einem passenden Knopf beim „Keck“ an der Schipfe, mit ihrem Erstgeborenen, “Hansli“, für einen Spaziergang in die Stadt. Nach gelungenem Knopfkauf, war das Modegeschäft der Tante Alice das nächste Ziel. Als Fünf- bis Zwölfjähriger meinte ich, das sei nichts als ein Verwandtenbesuch für einen kurzen Schwatz bei der Schwägerin Alice. Mit zunehmendem Alter fiel mir auf, dass da nicht nur die Tante aus irgendeiner Kabine zur Begrüssung kam sondern drei, vier oder gar mehr ihrer Kolleginnen: “Lueg, Hansli, das isch d’Fräulein Karcher, das da d’Fräulein Büechi“ usw. Und ich musste allen diesen dezent schwarz Gekleideten die Hand geben. Da regnete es Komplimente über die Höflichkeit und die Hübschheit des Neffen, also die gute mütterliche Pflege und Erziehung. Irgendeine innere Zensur hat verhindert, dass mich diese Lobeshymnen dazu verführten sie für die Realität zu halten. Ich hasste es, den Netten und gut Erzogenen zu spielen und allen diesen schwarzen Vögeln das Händchen geben zu müssen. Aber ich war dazu dressiert, mitzuspielen. Meine Sympathie zur Tante Alice selber aber hat nicht darunter gelitten. Zum Abschluss von Mutters Tounée gab es jeweils im Café Usenbenz am Rennweg ein Vermicelle-Törtli.
Die treuesten Freunden der Alice gehörten die “Hansen“, Hans Walter, der Schriftsteller und Hans Gerber der Bildhauer und Collagist. Sie bewohnen ein wunderschönes Haus am Ufer des Genfersees, in Buchillon, in der Lacôte. Das “Tanti“, wie die Hansen sie nannten, war Dauermieterin des Gartenhäuschens unter dem gewaltigen Kastanienbaum in dessen Ästen nachts die Eichhörnchen und Siebenschläfer piepsten. Hier begann sie, kleine Aquarelle immer der gleichen Landschaft zu malen: Im Vordergrund der Genfersee; im Hintergrund das französische Ufer mit einigen Häusern von Thonon. Nach ihren Ferien im Gartenhäuschen zeigte sie uns jeweils ihre Werke, nicht ohne vorher zu bemerken, Hans Walter habe sie auch schön gefunden. Dieses Lob eines Könners tat ihr wohl und tat ihrem naiven Charme keinen Abbruch.
Nur von den Hansen vernahm ich einmal etwas von einer Liebesbeziehung, aber erst als diese schon zerbrochen war und Alice darob trauerte. In unserer Familie erzählte sie nie etwas von Liebschaften und ich habe sie nie mit einem Freund oder Partner gesehen.
Da meine Eltern konfessionslos waren, hatten sie mich nicht taufen lassen. Als ich aber angefangen hatte zur Kirche zu gehen und den Konfirmationsunterricht besuchte, verlangte es die Kirchenregel, dass ich, noch mit Siebzehn, getauft würde (zusammen mit Conrad). Die Tante Alice und Hans Walter (in absentia) übernahmen die Patenschaft (und die Unterstützung der Eltern in der “Zucht und Vermahnung zum Herrn“ wie es im Ritual der Landeskirche hiess). Von der Tantegotte bekam ich ein monatliches Sackgeld von fünf Franken, von Hans Walter zur Weihnacht und zum Geburtstag jeweils ein Buch aus seiner Bibliothek. Manche dieser Bücher haben mir wichtige kulturelle Aussichten eröffnet, die mir sonst verschlossen geblieben wären.
Das Medizinstudium, die Assistenzjahre und die Auslandaufenthalte schafften einen Abstand zurTante Alice wie auch zu den jüngeren Tanten, Emmi und Margrit.
Alice wohnte noch lange am Rennweg, dem Lindenhof gegenüber. Von ihrer Wohnung aus hatte sie den Blick auf dessen Baumbestand. Nachdem ihre Schwester Margrit nach dem Tod ihrer Patronin, Frau P. in den Ruhestand trat, zogen beide in eine Wohnung in Affoltern am Albis. Alice musste sich an das Wohnen auf dem Land gewöhnen. Abgesehen davon dass Alice jeden Morgen frisch gebrauten Kaffe trinken, Margrit dagegen den Resten vom Vortag aufwärmen wollte, kamen die beiden so gegensätzlichen Naturen erstaunlich gut miteinander aus. Alice litt schwer unter dem Verlust als ihre jüngere Schwester gestorben war. Ihre letzten etwa zwei Lebensjahre verbrachte Alice in traurigem Seelenzustand in einem Pflegeheim.
3.2
Emmi. Die Tante Emmi fand leider einen grausamen Tod. Zum 80. Geburtstag meiner Mutter hatten die Tanten unter Führung der Margrit ein “Fischessen“ in einem Restaurant am Ufer der Reuss organisiert. Fische essen zu gehen an einem Fluss oder See galt früher als besonders vornehm. Vielleicht glaubte man immer noch, die Delikatessen kämen täglich frisch aus dem nachbarlichen Gewässer auf den Teller. Wir waren alle schon im Restaurant. Nur Emmi liess auf sich warten. Da kam die Nachricht, sie sei im Bezirksspital. Auf dem Weg zum Restaurant war sie beim Überqueren der Dorfstrasse von einem Lastwagen angefahren worden. Es hatte geregnet, möglicherweise hatte sie unter ihrem offenen Regenschirm das Auto nicht gesehen.
Im Spital war sie schon vom Röntgen zurück: Halswirbelfraktur, Beine und Arme gelähmt. Sie war voll bewusst und erstaunlich gelassen.
Die Fische wurden ohne Emmi gegessen, trotz der gedrückten Stimmung.
Von Affoltern wurde sie ins Paraplegikerzentrum in Basel verlegt. Die Tetraplegie hatte sich nicht zurückgebildet. Kurz nach meinem Besuch in Basel kam der Bericht, ist sie gestorben.
So wie sie über diesen Unfall und über die schlechte Prognose nie gejammert und geklagt oder jemanden angeklagt hatte, so war sie während ihrem ganzen, von manchen Tragödien belasteten Leben geradezu stoisch gelassen. Sie hatte das schwerste Leben von den Dreien.
Alice erzählte, dass einmal ein Besucher in Menziken sich aufmerksam mit den Kindern beschäftigt hatte, ausser mit der damals Kleinsten. Da habe diese den Kleinfinger der linken Hand aufgehoben und gesagt: “S’Emmeli das bin I!“ Sie war eine der “Stillen im Lande“, eine, die nicht selten übersehen wurde. Als Erwachsene hatte sie ein langes und schmales Gesicht und die familientypische lange, gekrümmte Meyernase, die in der Art besser in ein Männergesicht gepasst hätte. Und sie war immer nicht nur schlank, sondern mager. Sie hatte eigenartige Essgewohnheiten und wehrte sich heftig, wenn man darauf nicht Rücksicht nahm, obschon sie sonst auf allen Lebensgebieten äusserst anspruchslos war. Sie litt wahrscheinlich an einer Anorexia mentalis.
Auch sie hatte musste eine Näherinnenlehre durchmachen, und auch sie hat diesen Beruf nie ausgeübt. An der ersten Arbeitsstelle, in der ich sie erlebte war die als Kinderhüterin, Gouvernante bei der berühmten Konditorei Himmel in Baden, wo es die besten Badener Chräbeli gab. Dort war ich einmal zu Besuch und lernte das Anneli Himmel, ihren Pflegling kennen, kann mich aber nur an ihre Puppe erinnern, die richtig aus dem Schoppen trinken und Pipi machen konnte.
Das Anneli war anscheinend ein kränkliches Kind weshalb es für eine Höhenkur nach Flims in ein Kindersanatorium geschickt worden war. Da wurde Flims von einem schweren Bergsturz betroffen, der das Hauptgebäude des Sanatoriums mit den Bettenzimmern zerstörte, als gerade viele Kinder zur Mittagsruhe in ihren Bettchen lagen. Viele wurden dabei durch die stürzenden Felsmassen verletzt oder getötet. Anneli war zusammen mit anderen Mädchen in einem Seitentrakt untergebracht. Was war mir ihm geschehen? Tante Emmi erzählte von diesem Wunder der Rettung so:
“Das Kind war am Schlafen, als der ungeheure Windstoss, der den herabstürzenden Steinmassen voranging die Wände des Raumes aufriss und was sich darin befand auf die umgebende Alpweide blies. Wie das Kind erwachte, fand es sich wohlbehalten in seinem Bettchen mitten auf der blühenden Matte.“
Schon bevor Emmi beim Anneli angestellt war, war sie Kinderhüterin in einem Pro Juventute-Sanatorium in Davos gewesen. Sie erzählte oft, dass die Kinder jeden Tag so und so viele Stunden Liegekur machen mussten. Das bedeutete, sich bewegungslos auf einem Liegestuhl in der Veranda der Höhenluft und dem Sonnenlicht auszusetzen. Ich bedauerte diese armen Kinder sehr. Denn während der damals noch üblichen für Kinder obligatorischen Mittagsbettruhe habe ich mich immer schwer gelangweilt.
Nachdem Emmi die Stelle bei Anneli Himmel verlassen hatte (war das Mädchen gestorben?), lebte Emmi bei uns an der Minervastrasse 9 in Zürich-Hottingen. Ich weiss nicht, ob sie damals irgendwo angestellt war.
Und während dieser Zeit wurde sie krank. Sie konnte nicht mehr gehen. Unser Familienarzt war Dr.Willi Dreifuss, der bekannte Kinderarzt, der in unserer Nähe, an der Hottingerstrasse, wohnte und praktizierte. Dr.Dreifuss vermutete Kinderlähmung und liess sie sofort hospitalisieren. Sie kam wegen der Ansteckungsgefahr in das so genannte Absonderungshaus, später ins Notspital in eine der Baracken, die während des Krieges aufgestellt worden waren.
Die Mutter kaufte Lysol, ein flüssiges Desinfektionsmittel und wusch damit alle Bettwäsche und putzte damit das ganze Zimmer. Der Verlauf dieser Lähmung sprach gegen die Verdachtsdiagnose. Emmi blieb lange bettlägerig, bekam kein anderes Medikament als Condurango-Wein, ein Mittel um den Appetit anzuregen. Nach einer gewissen Besserung wurde sie in die Orthopädische Klinik Balgrist verlegt, wahrscheinlich für Physiotherapie. Ich vermutete später, dass ihre Lähmungen auf eine Polyradikulitis Guillain-Barré zurück zu führen waren.
Sie bekam ein Rücken-Stützkorsett verschrieben, das aber die Patientin selber, wenigstens zu Teil, bezahlen musste. Die reiche Grosstante Berta Meyer von Knonau wurde, mit Erfolg, um eine finanzielle Beteiligung gebeten.
Das Nächste war wiederum eine Gouvernantenstelle bei der Bäcker-Konditorenfamilie Ammann-Nigg oder Nigg-Ammann, die in Zürich, im Niederdorf, ein lukratives Geschäft und Café führten, dessen Steuselkuchen berühmt war. Mutters Einkäufe in der Stadt fanden nun ihren Abschluss bei Streuselkuchen in der Konditorei Ammann. Für Emmi gab es einen vier- bis etwa sechsjährigen Bub und ein jüngeres Mädchen zu hüten währendem die energische Mutter der zwei Kinder das Geschäft führte.
Damals versuchte man vor den Kindern die traurigen Ereignisse in der Welt der Erwachsenen, selbst in der nächsten Umgebung, zu verbergen: “Sei nicht neugierig, das geht dich nichts an“, so wurde der kleine Frager abgespiesen, der sich dann seinen eigenen Vers machte zu dem was er vom Gerede der Grossen aufgeschnappt hatte. Zurückblickend bestand mein Vers darin, dass Emmi auch diese Stelle nach in paar Jahren verlor, weil beide Kinder starben. Der Bub wahrscheinlich an Leukämie und dass Emmi schwer darunter litt.
Sie wohnte dann wieder einige Zeit bei uns. In ihrer Verzweiflung begann sie sich für die Webung eines Herrn Müller zu öffnen. Der Bahningenieur von der BBC in Baden versuchte schon seit Jahren Emmi zu gewinnen. Als sie bei uns wohnte, hörten wir, wie sie auf seine Telefonanrufe jeweils antwortete: mehr als lakonisch. Damals neckte man die arme Emmi recht unfreundlich, mit ihrem “Tüpflimüller“. Er war ein zwanghafter Perfektionist und fanatischer Vegetarier. Schliesslich kam es dazu, dass sie sich von ihm heiraten liess. Aber nicht lange dauerte es, so war zu sehen, wie die Frau immer noch magerer, bleicher und verzweifelter aussah, bis schliesslich ruchbar wurde, dass die Ärmste in die Klauen eines Sadisten geraten war. Er war, im Freud’schen Jargon ausgedrückt, das Schulbeispiel eines analsadistischen obsessiven Neurotikers. Ob Emmi nach der Befreiung aus diesem Ehekerker wieder eine Arbeitsstelle fand oder von Erspartem lebte, weiss ich nicht.
Und dann endlich, sie zählte etwa fünfzig Jahre, fand sie für einige Jahre noch ihre Ruhe und ihr Glück. Ein Ingenieur, wiederum der BBC Baden und kurz vor oder nach der Pensionierung, hatte sich in sie verliebt. Wie es dazu kam blieb eines der vielen familiären “non-dits“. Im Herbst 1952 war die Hochzeit von Emmi mit Max Hürlimann. Ich erinnere deshalb daran, weil sie am gleichen Tag stattfand wie die Feier der Matur in der französischen Kirche an der Promenadengasse. Max Hürlimann war Wittwer. Seine erwachsene Tochter wohnte noch zeitweise mit ihm in Wettingen im Einfamilienhaus. Sie war aber häufig abwesend in Wien, zur Ausbildung als Sängerin. Ich habe nicht mitbekommen, ob sie damit Erfolg hatte. Über die verstorbene Gattin von Max gab es einige unschöne Gerüchte. Jedenfalls hatte auch er mit Emmi endlich für die letzten Jahre seines Lebens sein Glück gefunden. Er war ein biederer, gemütlicher Bürger. Seine einzige Macke war eine irrationale Angst vor den Kommunisten. Nach seinem Hinschied fand man im Schlafzimmer eine Pistole. Ob er damit die Kommunisten verscheuchen wollte? Danach liess sich auch Emmi in Affoltern nieder. Sie lebte in einer eigenen Wohnung in der Nähe ihrer Schwestern.
3.3
Margrit. die Jüngste der ”Trinité“ begann, wie ihre älteren Schwestern, ihr Berufslaufbahn als Kinderhüterin “Gouvernante“. Sie blieb aber in dieser Stellung bis zu ihrer Pensionierung, bei der Hoteliersfamilie P.. Sie betreute die Tochter Elisabeth, die Jüngste der drei Kinder von M. und H. P. Der Älteste, Paul, wurde Rechtsanwalt. Er war ein ruhiger, introvertierter Mensch, dessen Ehe und ganzes Leben in ruhigen Bahnen verlief. Er unterschied sich in fast Allem vom seinem jüngeren Bruder Urs dem Extravertierten. Urs brachte Dramatik in die Familie und setzte deren Tradition fort mit der Gründung einiger Restaurants und Hotels.
Margrit hatte blonde Haare (wie auch der Jüngste der Familie, Fritz). Sie unterschied sich auch durch ihren stämmigeren Körperbau von den grazilen Schwestern. Das passte gut zu ihrer Vorliebe für das ländliche Leben. Sie hätte Bäuerin werden können.
Für ihre Tätigkeit in der Stadt hatte sie ein eigenes Zimmer im Erstklasshotel P. an zentraler Lage in der Stadt.
Das Landgut der Familie P. jedoch war eigentlich die Domäne der Tante Margrit Sie kannte sich aus in der Landwirtschaft. Im Bauernhof zeigte mir die Tante den Stall mit den etwa dreissig Kühen und den armen Schlachtkälbern, die mit Milchmast zwangsernährt wurden. Beim Besuch bei den neugeborenen Ferkeln erklärte sie mir, dass man den männlichen Ferkeln bald nach der Geburt die Eckzähne herausbrechen müsse, damit sie als ausgewachsene Eber weniger gefährlich seien.
Einmal war von einem Knecht die Rede, der von einem wütenden Stier verletzt wurde. Fräulein Maja, wie Margrit genannt wurde, arbeitete auch mit dem Gärtner zusammen, so lernte sie vieles über den Anbau von Gemüse und Blumen. Sogar über die Bienenzucht wusste sie Bescheid.
Wenn die Tante in Zürich war, kam sie an den Mittwochnachmittagen oft zu uns an die Minervastrasse zu Besuch. An diesen Nachmittagen war ich schulfrei. Dann durfte ich manchmal mit der Tante und der Mutter Tee trinken und manchmal Gipfeli oder gar von der Patisserie essen, welche die Tante mitgebracht hatte. Ich lernte durch ihre Erzählungen manches über die Landwirtschaft, die Gärtnerei und über das Leben der reichen Leute kennen. Nur wenn die Frauen über die Tücken des weiblichen Unterleibs diskutierten, durfte und wollte ich nicht mithören. Medizin war eines der Lieblingsthemen der Margrit. Sie hatte dazu viel Gesprächsstoff von ihrer Freundin Margrit Gartmann, Arztgattin aus Märstetten im Thurgau.
3.4 Exkurs: die Freunde der Tante Margrit, die Arztfamilie Gartmann stammten aus dem Prättigau. Dr. Gartmann führte in Märstetten eine Landpraxis. Mit seinem Sohn Andrea verbrachte ich einmal einen Teil der Sommerferien im Prättigau (Jenaz), bei der Familie Luzi, der Mutter und Geschwister der Margrit Gartmann, um beim Heuen zu helfen. Ihre Schwester sass jeden Abend am Webstuhl um die Betttücher für ihre bevorstehende Heirat zu fabrizieren. Mit ihrem Bruder durften Andrea und ich mit dem Karabiner auf Spatzen schiessen.
Während des Medizinstudiums, etwa in den zweiten oder dritten Semesterferien, konnte ich einige Tage bei der Familie des Arztes Dr.Gartmann in Märstetten wohnen und im Kantonsspital Frauenfeld bei Dr.Isler eine Art Vorpraktikum absolvieren. Medizingeschichtlich war das spannend, denn Dr. Isler benutzte für seine Operationen noch die alte Äthernarkose mit der “Schimmelbuschmaske“.
3.5
Tante Margrit vertrat als Gouvernante der Elisabeth P. recht strikte pädagogische Prinzipien, passend für die künftige Erbin einer reichen und gesellschaftlich bedeutenden Familie. Diese Pädagogik beeindruckte meine Mutter sehr und so wurde sie zur Grundlage für meine Erziehung. Unerschöpfbar war der Fundus von Erziehungsgrundsätzen, die an Elisabeth P. angewandt und dann von meiner Mutter an mir praktiziert wurde.
Ein Beispiel: Da kam doch die Tante eines Mittwochs mit der erschütternden Nachricht, dass Elisabeth angefangen habe, liegend, also im Bett, zu lesen! Stracks wurde das auch mir verboten, obschon ich noch gar nicht auf diese Idee gekommen war. Allerdings wusste ich, dass mein Freund Fritz nachts unter der Betdecke mit einer Taschenlampe Bücher las.
Am Mittwochnachmittag gab es für mich häufig noch Schulaufgaben zu machen, zum Beispiel einen Text möglichst fehlerfrei abzuschreiben. Margrit sass dann gerne neben mir und verlangte absolute Fehlerlosigkeit, ohne zu “flicken“. Da musste ich manchmal bis zur Verzweiflung den ganzen Text wieder und wieder schreiben bis es mir endlich gelang. Die Übung hat mir sicher gut getan, weckte aber keine besondere Liebe zu dieser Tante.
3.6
Gab es im Leben der Margrit Beziehungen zu Männern?
Nein, eigentlich nicht. Es ist unwahrscheinlich, dass sie ernsthafte Beziehungen oder Affären zu verbergen hatte. Doch, da erinnere ich mich an einen Militärpiloten, der sogar einmal bei uns an der Kirchgasse zu Besuch war. Diese Beziehung hatte möglicherweise eine Zukunft. Dann aber verunfallte der Pilot. Margrit erzählte, er habe beim Andrehen des Flugzeugmotors am Propeller, wie es in den Dreissigerjahren noch nötig war, vom angelaufenen Propeller einen Schlag in den Rücken bekommen. Das habe ihn zum Invaliden gemacht. Es schien selbstverständlich zu sein, dass ein solcher als Ehemann für Margrit nicht mehr in Frage kam. Wenn mich die Erinnerung nicht täuscht, fiel mir auf, dass sie von diesem Unglück ohne Tränen und ohne erkennbare Zeichen von Erbarmen und Trauer berichtete.
Allen fünf Geschwistern war eine gewisse Gefühlsarmut oder sogar Kälte gemeinsam. Sie hatten als Kinder schon lernen müssen, vor der Mutter Mathilde ihre Emotionen zu unterdrücken. Gefühlsäusserungen ihres weichherzigen Ehemannes Gerold hatten bei seiner Gattin Mathilde nur bösartigen Spott ausgelöst.
Zum Thema Erotik lässt sich aus mancherlei aufgeschnappten Andeutungen folgende Geschichte rekonstruieren:
Der Vater der Elisabeth, der Hotelbesitzer P. soll ein Casanova gewesen zu sein und wie dieser, wenig wählerisch. Seine Frau sei besonders dadurch gekränkt gewesen, dass er sich mit beliebigen Hotelangestellten (Etagemädchen...) eingelassen habe. Auch der Margrit sei er nachgestrichen. Es blieb ungewiss aber unwahrscheinlich ob er mit ihr zum angestrebten Ziel gekommen ist. Für Margrit war es jedenfalls Grund genug, die Familie P. zu verlassen. Es kam zu einem Intermezzo bei der Familie Pfister, den Besitzern des Möbelgeschäftes, die in Üetikon am Zürichsee eine Villa bewohnten. Sie kam aber zur Famiie P. zurück und blieb bei ihnen bis zu ihrer Pensionierung. Aus der Gouvernante der Tochter war sie zusehends zur unentbehrlichen Organisatorin der Einladungen und Festen geworden und Begleiterin der alternden Frau P. und deren Enkel. Sie musste auf Kosten der Frau P. eine Kochschule absolvieren, um bei Einladungen die Küche des Landgutes überwachen zu können. Zu den Illustren Gästen gehörte sogar einmal der Aga Khan. Die Enkel des Ehepaares P. ,besonders die Kinder der Elisabet wurden während ihren letzten Jahren ihrer Berufstätigkeit zu einem neuen, eigentlichen Lebensinhalt. Elisabeth hatte ihren Ehemann aus einem florentinischen Adelsgeschlecht gefunden. Es hiess, er sei der verarmte Besitzer einer Fabrik. Um zu etwas Geld zu kommen, habe er seinen Adelstitel verkauft. Dennoch galt Elisabeth nun als Marchesa und ausserdem als die schönste Florentinerin ihrer Generation.
3.7
Unser Weihnachtsfest war die Hohe Tantenzeit. Mutter deutete mir manchmal an, mit welch schönen Geschenken für mich die Tanten erscheinen werden. Ich soll mir Mühe geben, für sie etwas Nettes zu basteln. Das hiess jahrelang, irgendwelche Schachteln oder Büchsen zu bemalen. Diese “Weihnachtsärbetli“ belasteten mich manchmal, weil in der Mittelschule vor dem Weihnachtszeugnis mehr an Prüfungsvorbereitungen gefordert waren als übers Jahr. Doch darin lag auch ein pädagogischer Gewinn: Ich lernte mit verschiedenen Materialien umgehen, z.B. Lackfarben, Leder (für Mammi musste ich von Margrit aus ein Portmonnaie zusammennähen), mit Linoleum- und Holzdruck. Auf die Reproduktionsverfahren kam ich allein aus praktischen Gründen. Ich konnte von einem einzigen Bild viele Abzüge herstellen und so auf einfache Weise mehrere Leute, nicht nur die Tanten, beschenken. Besonders gelungen war mir die Illustration des “Michael Kohlhaas“ von Kleist. Die zehn kleinen Holzdrucke machte ich in einer einzigen Nacht und klebte sie dann so im Buch ein, als ob sie zu dieser Auflage gehört hätten. Die Symbolik der Zinkätzungen des Illustrators Max Hunziker hatte mich inspiriert. Tante Margrit gab sich viel Mühe, sinnvolle und einfühlsame Weihnachtsgeschenke zu machen.
Die Tante Emmi hatte mich einmal nach Luzern eingeladen. In der Familie erzählte sie danach, welches Interesse ich an den dreieckigen Historienbildern in der Kappelbrücke gehabt hätte. Margrit fand zufällig antiquarisch ein ziemlich zerflettertes Buch mit lithografischen Abbildungen dieser Gemälde und glaubte mich damit zu erfreuen. Auf diese Weise lernte ich, mich für jedes Geschenk freundlich zu bedanken. („tamen est laudanda voluntas“). Tante Margrit war als Maiora domus bei P., für viele Familienangelegenheiten zuständig, vor allem aber für die Weihnachtsfestlichkeiten, die Dekorationen, den Christbaum, die Kerzenbeleuchtung, das Packen und arrangieren der Geschenke. Und so gab sie sich denn auch rührend Mühe für die Familie ihres älteren Bruders Alex. Allerdings mussten wir das Datum unseres Festes nach demjenigen der Hoteliers ausrichten.
3.8
Für Margrit war unsere Abstammung von der in der Stadt Zürich regimentfähigen Familie der “Rosen-Meyer“ von grosser Bedeutung. Zu meinem fünfzigsten Geburtstag schenkte sie mir als dem Stammesältesten ein Buch mit einigen Bildern und Daten aus der Familiengeschichte. Als Frontispiz hatte sie mit grosser Sorgfalt das Rosenwappen gemalt. Dazu einen gewichtigen Band Kopien der Fotografien von Vorfahren und Anverwandten soweit bis zu den Anfangszeiten der Fototechnik zurück, sorgfältig zwischen zwei antiquarische Buchdeckel montiert und die sorgfältig im einem flachen Kästchen geschützte Daguerrotypie.
3.9
1956/57: Zur Zeit des Medizinstudiums, hatte mich der Anatomieprofessor Gian Töndury angestellt um für die zweite Auflage seines Lehrbuches für topographische Anatomie zu zeichnen. Mit dem Lohn wollte ich die Reise nach Israel finanzieren. Die tausend Franken reichten nicht ganz. Da gab mir Tante Margrit ein Darlehen von fünfhundert Franken mit der halb zum Spass und doch eigentlich ernst gemeinten Auflage, ja nicht mit einer jüdischen Braut nach Hause zurück zu kommen.
3.10
Die Margrit war antisemitisch eingestellt. Als ich als kleiner Junge wieder einmal bei ihr in den Ferien war, beschrieb sie mir das Verhalten des “typischen“ Juden. “Wenn man ihn zur Wohnungstür hinausgeschickt hat, kommt er sicher zum Fenster wieder herein.“ Ich dachte natürlich nicht daran, dass unser sehr einfühlsamer und äusserst kompetenter Kinderarzt, Dr.Willy Dreifuss, ein Jude war. Ich war zu dieser Zeit sechs oder sieben Jahre alt. Zu dieser Zeit, am 9./10. November 1938, war die “Kristallnacht“ der Beginn der Verfolgung und systematischen Ermordung der Juden in Deutschland.
Die Tante hatte mit dieser Verleumdung einen antisemitischen Stachel in meine Seele gepflanzt, der sich einmal auf ganz üble Art gegenüber einem meiner Schulkameraden auswirkte (MEMO 6.11).
3.11
Mein Vater starb am 20.Dezember 1979, sehr betrauert von seinen drei Schwestern. Es schien, als ob mit ihm ein stummer Friedenstifter die Familie verlassen hätte. Denn wenig später explodierte eine zu seinen Lebzeiten durch seine blosse Gegenwart beruhigte, Jahrzehnte alte Feindschaft, zwischen der Tante Margrit und meiner Mutter.
Eines Tages rief mich Margrit an. Durchs Telefon kam wie aus dem blauen Himmel eine Schimpftirade gegen meine Mutter. Unter anderemdes Inhalts, dass diese Maria die Schwiegermutter, also Mathilde, schwer verleumdet habe. Sie gab mir auf unklare Weise zu verstehen, dass ich mich von meiner Mutter distanzieren soll oder sie zurechtweisen oder sonstwie mich deswegen auf irgendeine Art bemühen soll. Ich wusste nicht was ich anderes tun sollte als die Margrit mit diesem Ansinnen abzuweisen.
Eine so üble Intrige hätte ich der Margrit nie zugetraut, besonders da sie sich im Alter immer mehr als an Jesus Christus Gläubige erwies und im Arenenberg eine Diakonissin zur Freundin und christlichen Mentorin hatte. Aber jetzt ging mir ein Licht auf. Jetzt konnte ich mir auf einmal manches am Verhalten der Mutter erklären.
Zwischen meiner Mutter und der Schwägerin hatte es anscheinend von Anfang an eine Rivalität gegeben, sodass die beiden Frauen zu Feindinnen wurden.
Deswegen also musste sich Maria eine so ungeheure Mühe geben, eine perfekte Gattin, Hausfrau und vor allem Erzieherin zu sein. Besonderes Schwergewicht hatten die schulischen Leistungen und die Karriere ihrer Söhne. Dass ich die Kantonsschule besuchen konnte und Medizin studieren war gegenüber der alle Ärzte bewundernden Margrit ein Riesenerfolg für die Mutter, im Gegensatz zu den P.-Söhnen, die, so hiess es, nur dank Privatschulen die Matur bestanden hätten.
Ich begann auch zu verstehen, weshalb die Mutter sich die Erziehungsmethoden der Familie P. zum Vorbild genommen hatte.
So waren denn alle diese feierlichen Weihnachten, die gemütlichen Plauderstündchen beim Tee mit meiner Mutter alles nur Maske gewesen? Darum also wurde ich bei jeder Gelegenheit für irgendwelche Besorgungen in das vornehme Hotel P. geschickt, wo ich durch Wohlverhalten vor der Schwägerin Margrit und ihrer Patronin, den pädagogischen Erfolg meiner Mutter demonstrieren musste. Ich diente ihr also nur zu Prestigezwecken in diesem verborgenen aber harten Kampf. Zum Glück für Mutter war ich ein ziemlich hübsches und gelehriges Büblein.
Die telephonische Schelte der Margrit machte mich wütend gegen die Tante und auch gegen meine Mutter. Ich kam mir durch sie missbraucht vor. War ich denn nur dazu da, die Mutter gegenüber den Verandten zu rehabilitieren? Interessiert sie sich denn nur am Rand für mich?
Margrit hat uns, im Gegensat zu Alice nie mehr besucht. Ich sah sie bis zu ihrem Tod nicht mehr. Alice erzählte, Margrit sei depressiv geworden und dann in ihrer Wohnung in Affoltern a.A. ohne erkennbare Krankheitszeichen plötzlich gestorben.

www.meet-my-life.net/img/uploadAdminBig/6caf8872_p1011134.jpg" alt="" />
Ich bin de Joggelii (vier Jahre alt)
4.1
Die Geburt. Geboren wurde ich im Jahr 1932, am siebenundzwanzigsten Juli, laut Geburtsschein um zehn vor zwölf Uhr mittags, im Vorjahr der Machtübernahme Adolf Hitlers in Deutschland. Dreizehn Jahre später, nach der Niederlage der Deutschen gegen die Alliierten und der bedingungslosen Kapitulation am 7.Mai 1945 war ein grosser Teil von Werken und Zeugen der menschlichen Kultur für immer zerstört. Viele Millionen Menschen waren durch Kriegshandlungen, Krankheiten, Hunger und systematische Massenmorde umgebracht oder verkrüppelt .
Während diesen furchtbaren sechs Kriegsjahren blieb ich und meine Familie und unser ganzes Land verschont!
4.2
Schon als ich noch Primarschüler war, erzählte mir die Mutter an meinen Geburtstagen jeweis die Geschichte meiner Geburt:
“In der Allgemeinabteilung, der Universitäts-Frauenklinik Zürich, im so genannten Kreisssaal, lagen gleichzeitig mehrere Gebärende, nur mit Vorhängen voneinander abgetrennt. Ich hörte die Geburtsschreie der Nachbarinnen und beschloss, mich zu beherrschen: Ich werde mich auf keinen Fall so ordinär gehen lassen wie diese primitiven Italienerfrauen.“
Dieser mutige aber unsinnige Willensakt kam aus dem für meine Mutter typischen Überlegenheitsanspruch mit dem Erfolg, dass sie, wie ich vermute, einen Zervikalspasmus bekam, einen verkrampften Verschluss des Geburtsweges.
“Da kam ein Arzt an mein Bett und schimpfte mit mir: Ja er schrie mich richtig an, ich soll mich endlich gehen zu lassen.“
Es war offenbar höchste Zeit, dass sie mich endlich zur Welt kommen liess. Wegen der zu langen Austreibungszeit war das Produkt ihrer Anstrengung blau und atmete noch nicht oder nicht mehr. Nachdem ich vel später selber viele Geburten begleitet hatte, kann ich mir jetzt denken, weshalb ich blau und halb erstickt zur Welt gekommen bin.
Die damalige Reanimation blau-asphyktischer Babys bestand in Schlägen auf den Po, Schock durch Bespritzen mit kaltem Wasser und vielleicht noch mit einer Lobelin-Injektion, in der Absicht, das Atemzentrum zu stimulieren. Der Direktor der Frauenklinik, Professor Andres, ist vermutlich auch beigezogen worden. Später, noch während meinem Studium, zirkulierten für den Professor typische Erinnerungen.
4.3
Einige Anekdoten über Prof. Andres, Ordinarius für Gynäkologie und Geburtshilfe und Chefarzt am Frauenspital Zürich pflegte seine Vorlesungen mit mehr oder weniger absichtlichen sprachlichen Ausgleitern zu würzen, wie zum Beispiel:
“Das ist im höchsten Grase verwunderlich.“
“Der tutende Bluterus.“ (Der blutende Uterus)
Heftiger Applaus nach seinem glänzenden Vortrag: “Ich danke Ihnen für die Ovulation.“ (den Eisprung)
Eine mehr gebärende Frau (d.h. mit vielen Kindern): ist “eine mehr Begehrende.“
Und: “Le ventre d’une femme est une boîte de surprise.“
4.4
Wohnort Friesenberg. Die Mutter erzählte mir:
“Als ich mir dir nach der Klinikentlassung nach Hause kam, war ich voller Angst. Für dieses Kind soll ich nun ganz allein die Verantwortung tragen? Werde ich dieser Aufgabe gewachsen sein? Ich ging mit dir immer in dir städtische Mütterberatung. Die dortigen Pflegerinnenund auch die Ärztin fanden, das Kind gedeihe gut, und ich mache alles richtig.
Während deinem ersten Lebensjahr entwickeltest du dich gut. Aber dann hast du Keuchhusten bekommen und damit auch mich angesteckt.“
Die Mutter schien darüber nicht allzu sehr verängstigt gewesen zu sein. (So erübrigte sich gleich die nicht ganz harmlose Keuchhustenimpfung).
4.5
Meine Eltern liessen es sich nicht nehmen, abends manchmal auszugehen, ins Kino. ins Schauspielhaus oder in die Bodega Espanola an der Münstergasse, wo sich damals Künstler und Linke trafen. Dann habe mich, so wurde erzählt, eine Hausmitbewohnerin, die rothaarige Österreicherin namens Liesel mit Begeisterung gehütet. Die späteren Besuche bei der Liesel, als man schon im „Friesenberg“ wohnte, bereiteten ihr jeweils grosses Vergnügen. Ich kann mich noch vage an ihr lachendes Gesicht, ihre roten Haare und ihre Zärtlichkeiten erinnern, die ich zwar nicht immer liebte, wie ich überhaupt, soweit meine bewusste Erinnerung zurückreicht, die Zärtlichkeiten all der kleinkinderverrückten Frauen abzuwehren versuchte.
4.6
Kirchgasse 33. Von etwa 1934 bis 1938, dem Geburtsjahr meines Bruders Conrad, wohnte man wieder in der Zürcher Altstadt, im ersten, höchsten und ältesten Haus der Kirchgasse.
In diesem mittelalterlichen Wohnturm residierte im 14.Jahrhundert die Familie der Ritter von Manegg. Sie waren, statt Raubritter zu werden, aus ihrer Burg am Abhang des Üetliberges in die Stadt gezogen. Hier fanden Zusammenkünfte von Europas Minnesängern statt und hier entstand die Manessische Liederhandschrift von Johannes Hadlaub.
Die Dreizimmerwohnung im obersten Stockwerk ist der erste Wohnort, an den ich mich erinnere, an den weiten Rundblick auf einen grossen Brunnen mit Pferdefigur, bis nach Hotingen und deb Zürichberg. Der oberste Treppenabsatz war eine weite Flur, wo ich mit dem Dreiradvelo herumradeln konnte und führte zu den Eingangsüren unserer Wohnung und derjenigen der “Hansen“. Das waren die zwei jungen Künstler, Hans Walter, der Schriftsteller und Hans Gerber, der Bildhauer mit welchen wir und die Tante Alice bis zum Tod meines Vaters befreundet waren.
In der Wohnung einen Stock tiefer lebte das kinderlose Ehepaar Meier. Frau Meier arbeitete da und dort als Putzfrau. Ich war oft bei ihr zu Besuch. Der Rauchabzug aus den Zimmeröfen für Holz- und Kohle führte in einer Länge mehreren Metern durch dicke schwarze Blechrohre. Zum Reinigen montierte der Kaminfeger diese Ofenrohre ab. Da gab mir die liebe Frau Meier eine Bürste, legte mir eine Schürze um und liess mich Kaminfeger spielen. So bürstete ich mit Begeisterung einige Rohrstücke bis meine Mammi dazu kommt, mich entsetzt in unser Badezimmer trägt um die Spuren wegzuspülen. Die Begeisterung der Frau Meier und von mir teilt sie leider nicht. Auch der Herr Meier machte interessante Dinge: Er arbeitete als Gepäckträger im Hauptbahnhof. Manchmal transportierte er die Koffer mit seinem Dreiradvelo bis zur Wohnung der Reisenden. Auch spielte er die Handorgel. Manchmal rasierte er sich in ihrer Stube nach alter Manier: Der Stehspiegel auf dem Stubentisch, ein Becken warmes Wasser daneben, dazu der Rasierpinsel, die Rasierseife und dann das gefährliche Barbiermesser. Es war nicht so viel anders als bei meinem Vater aber altmodischer und darum interessanter. |
|
Der Hausbesitzer Winkler galt als das letzte Orginal der Zürcher Altstadt rechts der Limmart. Der reiche Mann, erzählte mein Vater, habe an manchen Sonntagen, wenn die Gottesdienstbesucher aus dem Grossmünster die Kirchgasse herauf kamen, im blauen Überkleid auf dem Trottoirstein vor seinem Haus rostige Nägel gerade gehämmert. .
|
4.8
Meinetwegen musste sich meine Mutter aber einmal schämen: In der SBB konnten bis vier Jahre alte Kinder gratis fahren.
I m Herbst 1936 reisten wir ins Tessin. Das waren meine ersten und einzigen Ferien mit beiden Eltern. In der Eisenbahn zeichnete ich mit dem Finger Männchen auf die beschlagene Fensterscheibe, die man eher einem Zehn-, als einem Vierjährigen zugetraut hätte. Der Kontrolleur bezweifelte den Schwindel der Eltern. liess er sich schliesslich überzeugen, da ich klein und schmächtig war. Während der ganzen Kindergarten- und Primarkschulzeit war ich klein und mager. Deshalb aber befürchtete meine Mammi von Seiten der Nachbarn und Verwandten für eine Rabenmutter gehalten zu werden. Ich war aber, trotz der guten mütterliche Küche, von Natur aus klein, blass und dünn und, wie es hiess "ein schlechter Esser“.
4.9
Kleinkinderängste. Zurück zu den Ferien im Tessin: Tante Rösli und die Mutter spielen hinter einem von hinten beleuchteten aufgehängten Leintuch ein Schattentheater, die Arztkonsultation, nämlich eine Operation, die darin bestand, dass der Operateur tief durch den Mund in die Patientin hineingreift und Küchenutensilien, von der Kelle bis zum Passevit herauszieht. Das aber muss mich dermassen entzetzt haben dass ich anfing zu schreien.
diesen Ferien im Tessin, ich war also vier Jahre alt, besuchten die Eltern mit mir an einem Sonntag in Locarno die Messe, welche vom Bischof zelebriert wurde. Zu hause zeichnete ich sein Porträt. Es ist in meiner Sammlung von Kinderzeichnungen noch erhalten.
Die Eltern waren manchmal bei den Hansen zu Hausfesten eingeladen, Parties würde man heute sagen. Als man eines Abends nebenan, bei den Hansen Fasnacht feierte, ging es laut und lustig zu. Da man aber Wand an Wand lebte, hielt mich ihr vergnügter Lärm lange wach. In der elterlichen Wohnung allein gelassen, geriet ich in Panik und klopfte an die gemeinsame Wand. Da kam die Mutter verkleidet als Kokotte des Fin-du-siècle, auf dem Kopf ein neckisches schwarzes Hütchen und ein modisches schwarzes Netzchen vor dem Gesicht, der Vater mit angeklebtem Schnauz, gefolgt von den Hansen und der Tante Alice. Die älteste Schwester meines Vaters und Freundin von Hans Walter und Hans Gerber wohnte zu jener Zeit bei uns in einem Zimmer mit separatem Eingang. In dieser Verkleidung erschien mir Mammi plötzlich fremd und unnahbar und erschreckte mich noch mehr als der nachbarliche Lärm. Ich meinte, sie sei eine Andere geworden, und hätte mich nun verlassen bis sie mich mit ihrer vertrauten Stimme tröstete.
4.10
Die Mutter erzählt
“Während einer anderen Party bei den beiden Nachbarn ging es wiedereinmal so fidel zu, dass es die Nachbarn gegenüber der Kirchgasse störte. Dort war nämlich das Konsulat des dritten bzw. tausendjährigen Reichs untergebracht, was unsere angeheiterten Sozialisten dazu verführte, durchs offene Fenster allerlei Witze hinüber zu rufen, wofür die dort hausenden Nazis kein Verständnis hatten, sondern der feuchtfröhlichen Gesellschaft die Polizei ins Haus schickten. Diese zeigten Verständnis und liessen sie ungebüsst.“
4.11
Spielen. Ich besass eine Kiste voll wunderbarer Bauklötzchen aus Lindenholz. Damit lies sich ein fast mannshoher Turm bauen. So hoch wurde er, dass ich auf den “Kubus“ stehen musste um die letzten, kürzesten Klötzchen aufzulegen. Der “Kubus“ war eine blau bemalte würfelförmige Holzkiste. Da hinein konnte ich mich verkriechen, sodass mich niemand sehen konnte. Noch fühle ich die Geborgenheit in dieser kubischen Höhle. Meine Freunde waren der Stoffesel, den ich trotz seinen Holzrädern mit ins Bett nahm, den Joggeli, eine ganz aus farbiger Baumwolle gestrickte schlacksig-weiche Puppe mit Zipfelkappe und der Teddybär. Der Teddybär war ein Bettgenosse aber auch mein Patient, denn er litt an einer Menge von Fremdkörpern in den Augen. Die Behandlung bestand darin, dass ich ihm einen Spitzer ans Auge legte. Der Bleistift, den ich damit bearbeitete, produzierte feine Holzsplitter: Das waren die zu entfernenden Fremdkörper.
Meine wichtigste Beschäftigung war Zeichnen und Malen. Der Vater brachte aus dem Geschäft alte Tapetenmusterbücher. Auf der Rücksite der Tapeten konnte ich zeichnen und malen. Er selber machte oft Zeichnungen für mich. Seine Zeichnungen waren für mich das Schönste was es gab und ich versuchte eifrig es ihm gleichzutun. Wenn die Datierungen meiner noch vorhandenen Kinderzeichnungen stimmen, muss ich ausserordentlich früh schon richtige Männchen gezeichnet haben unter Umgehung des in diesem Alter üblichen Kopffüssler-Stadiums.
Neben dem Modellierton beim Bildhauer Gerber gab es auch das weniger schwierige Modelliermedium Plastillin, Damit konnte ich unendlich viele verschiedene Tierchen und Männchen formen, mit dem Nachteil gegenüber dem Ton, dass die Kreaturen auf ihren weichen Beinen nie richtig stehen konnten.
4.12
Ein grossartiges Geschenk meiner Eltern war das Kasperlitheater. Es ist hie und da jetzt noch in Funktion für Familiengeburtstage. Der Vater liess vom Screiner eine aufklappbare hausartige Bühne machen und malte die Kulisse einer Stadtgasse. Die Köpfe formte er aus Papiermaché, wahre Charakterköpfe, deren jeder mich an jemanden aus der Verwandt- und Bekanntschaft erinnerte, die Hexe an die Grossmutter Mathilde Meyer-Weber, und ohne böses zu denken, sah ich im schmalen Kopf und der Hakennase des Teufels meinen Vater. Die Mutter nähte die Kleider.
Das einzige technische Spielzeug war eine Eisenbahn mit einer Dampflokomotive zum Aufziehen und einem Schienenkreis. Dieses Geschenk bekam ich, als ich etwa sechs Jahre alt war.
Beinahe vergessen hätte ich meine geliebten Bilderbücher, das höchste Glück vor dem abendlichen Lichtlöschen. Obwohl ich hie und da ein Neues geschenkt bekam, war die Auswahl beschränkt. Es störte mich aber nicht, immer wieder dieselben anzuschauen, „Joggeli sött go Birli schüttle“, „Strubelpeter“ und andere, die man heute als Klassiker in Antiquariaten teuer kaufen kann. Es gab Bilderbücher aus Karton und aus Stoff, also unzerreissbar, die mich etwas beschämten, denn ich zerriss keines der Papierbilderbücher. Erst viel später kamen die Kunstwerke von Herbert Leupin, von Hans Fischer (dessen Pitschi einigen unserer späteren Katzen den Namen gab) dann Alois Carigiets Schälleursli mit Nachfolgern. Die scheusslich-schönen Globibücher lernte ich durch meinen Primarschulfreund Kurt Zindel kennen, der sie alle vom ersten Band an (seit 1939) besass.
4.13
Darstellung oder Beschreibung von Gewaltszenen konnte ich aös Kleinkind nicht ertragen: Bei einer Kasperlitheater-Aufführung im Restaurant “Karl der Grosse“ trug der Kaspar statt dem gemütlichen Prügel eine Käpsli-Pistole, mit welcher er im Lauf des Dramas den Teufel erschoss. Ob dem Knall soll ich so laut geschrieen haben, dass die Mutter mit mir den Saal rasch verlassen musste.
Im Film Pinocchio von Walt Disney haben mich die perfiden Verführer Fuchs und Wolf zutiefst erschreckt, sosehr, dass ich später beim Lesen dieser schönen Geschichte die Seiten mit dem Auftritt der beiden Bösewichte überspringen musstess.
4.14
Im Kindergarten an der Trittligasse. Von der Winkelwiese bis hinunter zur Oberdorftrasse, zum Haus zum Sitkust (Papagei), der früheren Amtswohnung des Bürgermeisters Hans Waldmann, war Haus an Haus aneinander gebaut. In einem dieser Reihenhäuser war die
Werkstatt des Malers Alder, wo mein Vater bis 1938 arbeitete. Hinter allen diesen Häusern gibt es kleine romantische Gärten, so auch hinter den Räumen des Kindergartens. Als ich etwa vier Jahre alt war, führte mich die Mutter einige Werktagmorgen um neun Uhr von unserer Wohnung die Winkelwiese hinauf zum Kindergarten und holte mich dort um elf Uhr wieder ab. Eines Tages aber hörte ihr Abholdienst auf. Nachdem ich eine Weile enttäuscht gewartet hatte, ging ich kurz entschlossen allein nach Hause, läutete Sturm vor der schweren Haustür und forderte von der Mutter wütend, mich jetzt wenigsten draussen vor der Türe abzuholen. Der ein Jahr ältere Kollege Röbeli Haussmann hatte von diesem Sturm gehört. Am folgenden Tag begleitete er mich nach Hause.
Viele Jahre später hatte sich mit Robert eine Freundschaft entwickelt. Wir trafen uns oft im “Select“ am Limmatquai zum Kaffee (50 Rappen die Tasse) oder bei ihm zu Hause an der unteren Zäune und diskutierten über Kunst. Ich zeigte ihm mein erstes abstraktes Bild, ein Aquarell im Stil von Paul Klee und er schenkte mir den Abzug von seinem abstrakten Holzschnitt.
4.15
Unsere Kindergärtnerin hiess Frau Schneider. Sie war verwitwet und hatte schon etwas grau melierte Haare. Sie heiratete den “Schreinermann“ Herrn Hausammann. Ich nannte ich so, weil er manchmal zu Frau Schneider in die Kindergarten kam und mit uns bastelte (schreinerte). Er wurde später ein Kunde meines Vaters und war Experte bei meiner mündlichen Maturitätsprüfung in Französisch.
Um 1938 redeten die Erwachsenen über ein wichtiges weltpolitisches Ereignis: Die Verhandlungen des britischen Premierministers Chamberlain mit Hitler in München hatten den drohenden Krieg (vorläufig) verhindert. Ich erinnere mich noch daran, dass die Erwachsenen darüber redeten und froh zu sein schienen.
4.16
Spiele der Erwachsenen
Die Mutter liebte kleine Tricks und Amüsements. So erzählte sie, die Hansen amüsieren sich einmal damit, mir den Mund zu verkleben und brachten das Heftpflaster ohne meinen Schmerzensschrei nicht mehr weg. Das habe ich gkücklicherwiese vergessen. Aber Folgendes hat sich mir als beschämende Erinnerung eingeprägt.
Denn die Mutter verkleidet mich einmal in ein Mädchen und ich spiele die Mädchenrolle mit hoher Stimme und geziertem Getue, obschon ich mich über dieses Theater schämte. Sie sagte oft, dass sie lieber ein Mädchen als einen Buben gehabt hätte. Dann hätte sie ihm jeden Tag eine schöne Frisur machen können.
Ein anderer Trick Meiner Mutter. Sie erzählte: “Eines Tages las ich in der Zeitung ein Inserat, worin Hans Gerber ein weibliches Modell suchte. Darauf verkleidet sie sich in eine Noble, stellt sich dem Hans Gerber vor und spielt die vor lauter Befangenheit stumme Grand Dame, denn ihre Stimme hätte sie sogleich verraten. Es brauchte eine Stunde oder noch länger bis Hans G. den Witz und Betrug merkte.“
4.17
Minervastrasse 9. Nachdem mein Bruder Conrad zur Welt gekommen war ((8. August 1938), wurde die Wohnung an der Kirchgasse zu klein. Man bezog jetzt eine Wohnung mit drei Zimmern an der Minervastrasse neun in Hottingen, einem damals noch ruhigen Quartier, in der Nähe eines grossen Parks. Es war ein Häuschen aus der Biedermeierzeit mit drei Wohnungen, einem kleinen Garten mit Birnen- und Pfirsichbäumen. Das obere Stockwerk bewohnten die Hausbesitzer, Herr und Frau Buchmann mit ihrem Sohn Max. Mit Max dem zwei Jahre Älteren, habe ich oft gespielt, besonders in der geräumigen Winde mit dem Kasperlitheater. Im Parterre wohnte ein Ehepaar Haldi. Der Ehemann schien arbeitslos zu sein. Man sagte, er sei schizophren. Frau Haldi war Handweberin und hinderte mich mit ihrem rhythmischen Webstuhlklappern bis tief in die Nächte hinein am Einschlafen. Wir bewohnten die Wohnung im Mittelstock mit Ausnahme der zwei “Separatzimmer“, die durch eine eigene Türe mit dem Treppenhaus verbunden waren. Hier wohnte die Damenschneiderin Hedwig Maurer. Ich liebte sie, weil sie ein grossformatiges dickes Buch mir vielen der Bildergeschichten von Wilhelm Busch besass und mir manschmal daraus vorlas. Ihr Freund war der Kunstmaler Walter Müller. Mit seinen guten neoimpressionistischen Bildern wurde er in der Zürcher Kunstszene bekannt.
Nachdem Fräulein Murer in eine grössere Wohnung in der Nachbarschaft umgezogen war, hatten wir nun eine Fünfzimmerwohnung. Eines der neuen Zimmer führte zur geräumigen Terrasse, die von einer Weinrebe umwachsen war, die im Herbst recht schmackhafte “Chatzeseicherli“- Trauben hervorbrachte.
4.18
Musterhafte Erziehung. Die Graue Eminenz, deren autoritärem Einfluss meine Erzieherin unterworfen war, war die Tante Margrit. Sie war die jüngste Schwester meines Vaters, Gouvernante, also Erzieherin der Elisabeth, der Tochter der Hoteliersfamilie P. Elisabeth war deren jüngstes Kind neben den zwei Söhnen Paul und Urs. Von dorther kam, auf eine Art missverstanden, die Anleitung wie ein Kind “vornehmer“ und reicher Leute zu erziehen sei. Die Tante Margrit musste oder wollte in ihrer Eigenschaft als Gouvernante die Tochter Elisabeth nach den grossbürgerlichen Prinzipien doch mit dem kulturell etwas engem Horizont der Hoteliersfamilie erziehen. Dieser Stil hat leider auf einigen Gebieten den erzieherischen Ehrgeiz meiner Mutter entflammt. Auf diese Weise kam es dazu, dass ich für den Lebensstil eines Erstklasshotels, zu angepasstem Verhalten, untadeligem Anstand, und einer stockkapitalistischen Weltanschauung hätte sozialisiert werden sollen.
Ein Beispiel: Die Tante besuchte meine Mutter zu einer der häufig am Mittwochnachmittag stattfindenden Teevisite und brachta die aufregenden Neuigkeit, die Elisabeth habe angefangen, im Bett liegend zu lesen. (E. war etwa 4 Jahre älter als ich, damals etwa dreizehn.). Das habe man ihr mit Erfolg ausgetrieben. Sogleich wurde das auch mir verboten, obschon ich bisher noch gar nicht dazu in Versuchung gekommen war! Mein Freund Fritz Römer aber hatte damals schon lange über die Einschlafenszeit hinaus unter der Bettdecke mit der Taschenlampe Bücher gelesen.
4.19
Rembrandt Es gab Ereignisse. derentwegen meine Mutter sich für mich vor der Frau P. und der Tante Margrit meinte schämen zu müssen. Man qualifizierte mich als Aufschneider, weil niemand von der Erwachsenen sich einfühlen konnte noch begriff, was ein ziemlich gescheites Kind zu sagen hat, es aber noch etwas ungeschickt ausdrückt. Wie dumm köin nnen Erwachsene sein! Wir befinden uns in der Villa der Familie P. in ihrem Landgut F.. Da gab es ein sehr geräumiges Vestibül mit dem mächtigen Billardtisch, von wo aus einige Treppenstufen zu zwei engen Stübchen, zur riesigen Küche und zum Treppenaufgang für die zwei oberen Stockwerke führte. Gegenüber dem Eingangskorridor ging es geradeaus in den langen und hellen Salon, den so genannten Gartensaal, der sich in einer genau symmetrischen Allee ins Freie fortsetzte. In diesem Gartensaal gab es eine Art Galerie, wo ein lebensgrosses Porträt eines Mädchens, wahrscheinlich der Tochter Elisabeth, und mehr oder weniger ältere Porträts, Landschaften und Stilleben hingen. Die meisten waren entweder vor Alter oder mit absichtlicher Lackierung nachgedunkelt.
Die nun folgende Geschichte beruht vorwiegend auf was die Mutter und die Tante erzählt hatten, denn meine eigene Erinnerung ist lückenhaft:
“Du hast dich vor einem dieser dunklen Gemälde aufgestellt und gesagt: ‚Daheim haben wir auch solche Rembrandt’. Da musste ich mich vor der Tante Margrit und der Frau P. schämen, weil ich einen solchen Aufschneider als Sohn habe.“
Die Erwachsenen konnten sich nicht vorstellen, dass für einen Vier- oder Fünfjährigen Rembrandt nicht den Meister aus Holland bedeutete, sondern ganz allgemein dunkle alte Bilder. Die Episode erinnert mich an die Pumpernickel-Geschichte im „Grünen Heinrich“ von Gottfried Keller. Die schöpferische Phantasie eines Kindes wird als Charakterfehler missverstanden und bestraft.
Auch diese Anekdote diente im Kreis der Tanten zur Unterhaltung. So war ich der Erzieherin eine Quelle von Stoff, der, ein wenig ausgeschmückt, für ihre Pädagogik Lob erntete. Meine Altklugheit und Aufschneiderei musste bestraft werden und zwar so: Auf der Spitze des Weihnachtsbaums war statt dem golden glitzernden Stern nur ein Kerzchen aufgesteckt. Und von Hans Walter kam ein pädagogischer Brief. Er konnte den Zusammenhang natürlich nicht wissen, sonst hätte er weiser geschrieben.
4.20
Das Doktorbuch. Im F. ereignete sich auch die folgende Szene:
Als Sechs- oder Siebenjähriger galt ich auch als Aufschneider, weil ich mit meinen Kenntnissen zu prahlen schien, die ich mir aus dem “Doktorbuch“ angeeignet hatte, einem reich illustrierten medizinischen Ratgeber für Laien. Da hatte sich mir die Darstellung des geöffneten Brustkorbes mit den zwei Lungenflügeln eingeprägt. In einer Plauderei mit Elisabeth kam ich irgendwie darauf, zu behaupten, der Mensch habe zwei Lungen. Als aber Elisabeth, ihre Freundin Germaine und die Tante Margrit heftig widersprachen, es gebe nur eine Lunge, berief ich mich auf die Darstellung im “Doktorbuch“. Tante Margrit hinterbrachte das meiner Mutter, entsetzt über mein Besserwissertum den Grossen gegenüber und weil ich mit der Erwähnung des medizinischen Ratgebers der Tante und der Familie P. verraten hatte, dass ich Zugang zum “Doktorbuch“ habe mit seinen Abbildungen der Innereien des menschlichen Körpers, der Entwicklungsstadien des Foetus in der Gebärmutter und der nackten weiblichen und männlichen Körper. Dafür musste sich die Mutter meinetwegen gerade noch einmal schämen. Das *Doktorbuch“ war für mich eine Quelle interessanter Informationen. Es hat mich zu vielen Zeichnungen von Skeletten und Eingeweiden inspiriert und mich dazu angeregt, über die menschliche Anatomie nachzudenken, ohne dem Besserwissen der Erwachsenen nachzugeben.
4.21
Eltern waren so vernünftig, dass sie das Thema menschlicher Körper und Sexualität nie mit Verboten oder Geheimnistuerei umgaben. Als Folge davon interessierten mich die zweideutigen Geschichten und Witze zum Thema Sexualität der Schulkameraden überhaupt nicht. Ich fühlte mich ihnen überlegen mit meinen Kenntnissen und kommentierte die Zoten damit, dass ich das alles ganz normal und natürlich finde. Wenn ich etwas nicht verstand, konsultierte ich meine Mutter. Sie sagte später einmal, meine unschuldigen Fragen hätten sie manchmal schamrot werden liessen.
4.22
Das spontane Kind. Ursprünglich wagte ich kindlich, ohne Hemmung einen Polizisten auf der Strasse zu fragen, wann ich zur Schule gehen könne, weil die Erwachsenen sagten, ein Polizist werde kommen um es den Eltern mitzuteilen. Ich aber wollte es vorher wissen.
Ein wenig später getraute ich mich, in der Telefon- und Rediffusionzentrale an der Hottingerstrasse nach alten Radioapparaten zu fragen und erhielt wirklich einmal eines solchen. Nachdem meine Mutter die Biografie von Marie Curie
urie gelesen hatte und vom Radium erzählte, ging ich in eine Apotheke um nach dem Preis von einem Gramm Radium zu fragen. Mit dem Erwachsenwerden wurde dieser ungehemmte Zugang zu den Mitmenschen von der im Lauf meiner Kindheit anerzogenen Neurose verdrängt: Ich wurde gehemmt und verklemmt.
4.23
Sekundenschneller Gehorsam. Welche Bestrafung ich zu gewärtigen hatte, wenn ich dem mütterlichen Befehl nicht auf der Stelle und sofort Folge leistete, musste ich schon als Fünfjähriger erfahren. Ich wurde damals für einen ein wenig verzögerten Gehorsam mit einem Bündel der notwendigsten Kleidchen ins Treppenhaus bugsiert und die Wohnungstür hinter mir verschlossen. Das war noch im Manesseturm an der Kirchgasse 33. Das hat sich bei mir eingebrannt: Nich nur Ungehorsam sondern auch ein nicht sekundenrascher Gehorsam wurde mit totalen Verlust an Geborgenheit, also durch Entzug der existentiellen Lebensbasis bestraft.
Nach dem Umzug nach Hottingen war ich natürlich so oft wie möglich im Garten und manchmal bei unseren Nachbarn. Das Küchenfenster unserer Wohnung in ersten Stock öffnete sich auf den Garten und aus diesem Fenster geschah die mütterlichen Befehlsausgabe. Da gab es keine Ausrede für Zögern. Nur los, die Treppe hoch in die Wohnung gerannt. Ausserdem war die Auflage der Mutter: “Ich rufe nur einmal!“ Das fesselte mich an ununterbrochene Horchbereitschaft. Der mütterliche Auftrag konnte etwa sein, im Käseladen Hadorn am Zeltweg ein Mödeli Butter zu kaufen oder das Geschirr vom Mittagessen abzutrocknen. Deswegen war es mir nie möglich, mich ganz auf die Kinderspiele zu konzentrieren. Der plötzliche, nie voraussehbare Ausfall eines Mitspielers zerstörte gemeinsame Spiele wie zum Beispiel “Versteckis“. Da meine Spielkameraden, Max, der Sohn der Hausbesitzer und die Kinder der Nachbarn mit mir nicht mehr als zuverlässigem Mitspieler rechnen konnten, wurde ich in deren Meinung zum verhassten Eigenbrödler.
Soweit ich mich zurück erinnere, gab es eine undiskutable Uhrzeit für das Zubettgehen und Lichtlöschen, mindestens eine Stunde früher als die anderen Kinder des Quartiers, die im Sommer, wenn ich schon im Bett war, sie vor dem Haus noch spielen hörte. Dieses Regime galt mindestens bis ich im Gymnasium war, also bis ich etwa vierzehn war: Ein weitere Grund für die Ablehnung der Nachbarskinder.
4.24
Spätwirkung der Erziehung.
Und das ist das Ergebnis dieser Erziehung: Ich mache immer noch sehr ungern gemeinsame Spiele. Es begleitet mich während Jahrzehnten meines Leb ein “Komplex“ (nach C.G.Jung): Ich konnte mich gegen Schelte, Ansprüche, Beleidigungen, psychische und physische Angriffe nicht wehren, als ob jeder beliebige Mitmensch das Recht hätte, von mir alles Mögliche und Unmögliche zu fordern, mein Recht und meine Grenzen zu missachten und mich für alles Beliebige zu beschuldigen. Ich merkte oft nicht einmal, wenn mir ein Unrecht angetan worden war. mit einem Paket voll Minderwertigkeitsgefühlen wurde ich auf den Lebensweg in dieser Welt entlassen.
Ich war entsetzt, als mir Leute einer psychotherapeutischen Arbeitsgruppe kollegial und freundlich mitteilten, ich sei ausserordentlich leicht beeinflussbar. Ich verstand jetzt, dass ich mich mit dieser Ausrüstung jeder menschlichen Umgebung anpassen, und meine eigenen Ansichten hintanstellen musste. Die verständliche Folge davon (oder deren Ursache) ist meine Abscheu und Angst, Zeuge oder beteiligt zu sein bei Spannungen und Streit zwischen irgendwelchen Menschen.
Diese Prägungen wirkten sich bis weit in mein Erwachsenenalter aus. (cf.Kap. 8, Matur, Kp. 18, Eritrea)
Oft zerknirscht und beschämt es mich erst viel später: Warum hast du das Unrecht nicht bemerkt, das man dir angetan hat, oder dass du da und dort einen Erfolg für dich hättest verbuchen können?
Wie auch bei mir, zeigen sich an Menschen mit Minderwertigkeitsgefühlen, als Kompensationsversuch manchmal Züge der Selbstüberschätzung, Neigung zu “Bluffen“ , oder sogar bis zum unbewussten Hochstapeln.
4.25
Noch ein Blick zurück zum F. in M. Die seit frühester Kinheit dort verbrachten Ferien haben auch schöne Erinnerungen hinterlassen. Es gibt eine Photographie vom Schaukelpferdchen der P.-Kinder. Ich reite darauf und umarme zärtlich seinen Hals. Ich spüre noch die glatte kühle Oberfläche und das echte Rosshaar seiner Mähne.
Der sommerliche Garten mit den Himbeeren und Johannisbeeren, der Teich mit dem Feuersalamander, Amor, mein geliebter Spaniel, das Auto von Frau P. mit den winzigen Porzellan–Blumenväschen an den Innenwänden, die Geräusche und der Geruch der Küche, das Summen des Kühlschranks, die zwei freundlichen Dienstboten, Margrit und Marie. Manchmal aber ängsteten mich in der Nacht die rasselnde Hundekette und andere unbekannte Geräusche und hielten mich wach.
4.26
Zeichen von Mutterliebe. Als Kind konnte ich oft nicht einschlafen. Wenn ich dann nach der Mutter rief, brachte sie mir ein Trinkglas voll Zuckerwasser und zog mit sanften Händen die nach unten gestrampelte Flaumdecke über die Schultern.
Der Johannisbeerkuchen mit dem vom Backen leicht gebräuntem Eierschnee darauf wurde zur Tradition, weil ich einmal als Kind diesen Kuchen gerühmt hatte. Damit wurde jedes Jahr mein Geburtstag gefeiert.
Sonntag. Strahlend heisses Sommerwetter. Es duftet nach Bratwürsten. Kartoffeln werden gekocht für den Kartoffelsalat, der mit Gurken gemischt und warmer Bouillon übergossen eine der vielfältigen kulinarischen Spezialitäten war. Die Mutter hatte ihre Kochkünste in einem Grafenschloss in Frankreich erworben. Der Stumpenrauch des Vaters zeigt den geplanten Ausflug an und die gemütliche Stimmung. Der Tramwagen mit den Stehplätzen in der Mitte brachte uns in die Nähe zum Ausflugsziel, der Waid, der Forch, dem Üetliberg, oder zum Strandbad. Heute sieht man dieses eigenartige Tram-Vehikel noch für seltene Nostalgiefahrten durch die Stadt kreuzen.
Im Sommer im Strandbad Mythenquai. Der Geruch nach heissem Asphalt, nach See, Geräusche von kreischenden Mädchen, Plätschern der Wellen eines vorbeischwimmenden Dampfschiffs. Mit Kesselchen und Schäufelchen versuche ich eine Burg zu bauen. Die ersten Schwimmzüge: Die Mutter hält mich mit einem Arm unter meinem Bauch, die freie Hand unter meinem Kinn. Ein Vorturner ruft mit dem Megaphon die Leute zu Freiübungen auf der Wiese ein. Auf einem Podium zeigt er die Übungen vor. Er möchte witzig sein: Demnächst werde auch das Turnen rationiert. Man müsse es noch benützen. Soeben soll wieder ein Nahrungsmittel rationiert werden. Jedes Rationierungsgerücht löste damals Hamsterkäufe aus. Es war im Sommer 1943...
4.27
Verschwiegene Paranoia. Vom Kindergartenalter bis etwa zur 3.Klasse, also etwa im Alter von fünf Jahren an begleitete mich ein eigenartiger Bewusstseinszustand. Es schien mir, als sei ich ausserordentlich dumm, unendlich viel dümmer als alle anderen Menschen, sosehr, dass ich nicht merkte wie sie mir die Welt verfälschten und als Wirklichkeit vorspielten. Ich fühlte mich dann ausgeschlossen und einsam in einer fremden Umgebung, die mich in Bezug auf alles, was ich in der mich umgebenden Welt der Menschen, Gegenstände und Ereignisse erlebte in einem Zustand des grenzenlosen Unverständnisses hielt. Meine eigentlich guten Primarschulnoten und die Bewunderung der Erwachsenen für meine frühreife Begabung zum Zeichnen war alles nur gewollte, von allen Menschen verschwörerisch inszenierte Täuschung. Dieses Lebensgefühl verblasste zwar mit der Zeit, ging aber in ein noch bis ins Erwachsenenalter andauernde Grundgefühl des Anders-Seins als “normale“ Mitmenschen, anders als meine Klassenkameraden in der Mittelschule, ohne mich ihnen überlegen zu fühlen. Im Gegenteil, wie die in der Erinnerung an die Maturprüfungen beschriebene Fehleinschätzung meiner schulischen Leistungen. Es ist als ob mir das für die meisten Menschen selbstverständliche Grundvertrauen dem Leben gegenüber gefehlt hätte.
4.28
Erwa vierzig Jahr später Wirkung der Gestaltanalyse. Bis jetzt beschäftigte sich mein Text ausführlich mit dem, was mir erst im Laufe der Gestaltanalyse bei Elisabeth Leupold nach und nach bewusst geworden ist. Nachdem ich das Elternhaus verlassen, den Beruf ausgeübt, Familie gegründet, in Israel und Afrika gewesen war, musste ich feststellen, dass ich mich fast so selbstverständlich wie in der Kindheit noch oft mit der Mutter identifizierte. Mit den Jahren entdeckte ich und erschrak darüber, wie viele mütterliche Ansichten und Traditionen ich unkritisch von ihr übernommen hatte, und mich noch immer daran hielt, ohne mir dessen bewusst geworden zu sein.

6.1
1939 Die schweizerische Landesausstellung, Zu beiden Seiten des Zürichsees stehen die Bauten für die Ausstellungen, verbunden durch eine Schwebebahn vom rechten zum linken Seeufer. Das Zentrum des linken Seeufers war ein grosser freier Platz mit der berühmten Skulptur des Pferdehalters und den dafür neu entworfenen Aluminiumstühlen, die zum Klassiker geworden sind. Durchzogen war das Ausstellungsgelände von einem künstlichen Bach, der Besucher in besonderen kleinen Schffen zu den verschiedenen Ausstellungspavillions führte. Einmal besuchte mein Vater mit mir die Landi. Ich erinnere mich, dass wie zusammen die Vorstellung eines Roboters besuchten. Ein unförmiges eckiges wenig menschenähnliches Ungetüm, der ferngesteuert im Raum herumfuhr und aus den Augen elektrische Blitze sendete. Die Firma Brown-Boveri demonstrierte hinter einem riesigen Faraday-Käfig künstliche Blitze. Grosse Wandzeichnungen des Ilustrators Baumberger stellten die Schweizergeschichte dar. Die Ausstellung als Ganzes wollte eine bäuerliche und traditionelle Schweiz zeigen und zugleich ein industrielles, aus verschiedenen Kulturen bestehendes geeintes Volk. “Eines Volkes Sein und Schaffen“ hiess das Motto er Ausstellung. Es gab ein Landidörfli, die vertraute Darstellung eines traditionellen für typisch angesehenen schweizerischen Bergdorfes. Die traute Heimat war damals im Hinblick auf die nazionalsozialistische Kriegsdrohung ein wichtiges patriotisches Propagandmotiv. Ein zweites Mal durfte ich mit Max Buchmann die Landi besuchen. Ausser für den Eintritt hatten wir etwa einen Franken um uns etwas zu Essen zu kaufen. Wir kauften ein Paar Wienerli und ein Bürli für fünfzig Rappen. Ich weiss nicht mehr, was wir mit dem restlichen Geld machten
6.2
September 1939: Krieg. Der Vater hatte 1936 mir in einer Zeitung Bilder aus dem spanischen Bürgerkrieg mit ausgehungerten Kindern gezeigt mit der Erklärung: “Das ist wegen dem Krieg.“
Die Mutter sagte eines Tages zu mir, es sei jetzt Krieg und es gebe in den Läden keine Esswaren mehr zu kaufen. (Das war vernünftig, bis die Rationierung begann, um Hamsterkäufe zu verhindern). Ich weiss nicht mehr, ob wir genügend Vorräte hatten um die paar Tage der Sperre zu überbrücken. Das Wort “Krieg“ brachte mich zum Weinen, weil mir sogleich die Bilder aus dem spanischen Bürgerkrieg von verhungerten Kindern in den Sinn kamen.
Vom Kriegsgeschehen sind nur spärliche Berichte in unsere Familie gelangt. Ein Radio hatten wir erst um 1945 oder noch später, einen so genannten Rediffusions-Apparat. Er konnte über das Telefonnetz und damit störungsfrei die drei Schweizer Sender, Beromünster, Sottens und Monte Ceneri empfangen. Im obligatorischen “Amtsblatt der Stadt Zürich“ waren jeweils auf der letzten halben Seite Zusammenfassungen von Nachrichten aus dem In- und Ausland abgedruckt.
6.3
1940 Mobilmachung der Armee.
Fliegeralarm.
Als Kind erlebte ich in den Nächten ein wenig etwas von der Nähe und Bedrohlichkeit des Krieges, wenn Fliegeralarm gegeben wurde, dieses an- und abschwellende Heulen der Sirenen. Es war Sommer, das Fenster stand offen, das abendliche Zirpen der Schwalben war verstummt. Dann hörte ich das Brummen der herannahenden Bomber, die viermotorigen “fliegenden Festungen“ der Amerikaner. Sie waren dem Flakfeuer und den Jagdfliegern der Deutschen in die Schweiz ausgewichen, nachdem sie ihre Bombenlast über deutsche Nachbarstädte abgeworfen hatten. Von Rorschach aus habe man nachts am gegenüberliegenden Ufer des Bodensees Ludwigshafen brennen sehen. Die Schweizer Luftabwehr zwang aus Gründen der Neutralität alle ausländischen, so auch die die amerikanischen Maschinen (trotz der Schweizer Sympathie mit den Aliiereten) zur Landung in Dübendorf. Die überlebende Besatzung wurde bis zum Ende des Krieges interniert, d.h. auf Kosten des amerikanischen Staates in komfortablen Hotels untergebracht. Die Jugend bettelte sie dann um Kaugummi an, mit Zimt- oder “Peppermint“-Aroma.
6.4
Die Beobachtung mit dem Vater auf dem Zollikerberg. Später erzählte mir der Vater von einem Spaziergang auf dem Zollikerberg, dessen ich mich auch erinnerte: Zwei der “fliegenden Festungen“ überflogen die Hügelkette Pfannenstil im Tiefflug Richtung Dübendorf, gejagt von den Schweizer Flabschützen, deren Geknatter ganz in unserer Nähe zu hören war. Da traten aus einem der Flugzeuge ein, dann zwei, dann drei weisse Rauchwölklein auf. Wir meinten, die Maschine sei angeschossen worden und brenne. Aber sogleich zeigte es sich, dass es die Fallschirme waren, und dass sich die Besatzung aus dem wahrscheinlich angeschossenen Flugzeug retten musste. Die nun unbemannte Maschine flog weiter bis wir sie nicht mehr sehen konnten. Sie stürzte vermutlich, wie mancher steuerlose Bomber, schliessslich in den Zugersee ab. (Ein spezialisierter Unternehmer, der “Bomber-Schaffner“ hievte die Wracks später aus dem See.) Mein Vater bekannte später, dass er Angst hatte, wahrscheinlich mehr für die in der Luft hängenden Piloten als für uns. Bei den Luftalarmübungen im Schulhaus Wolfbach, wenn Schüler und Lehrer in den mit Balken abgestützten Luftschutzraum auf den Endalarm warteten, lernte ich, was es bedeuten könnte, wenn Bomben auch auf unser Haus fallen würden, wie in Schaffhausen und auf dem Milchbuck in Zürich. Die Häuser wurden untersucht auf bombensichere Keller und mit Werkzeugen zur Brandbekämpfung ausgerüstet. Der sehr tiefe Keller unseres alten Wohnhauses wurde mit einem gelben “L“ als luftschutztauglich markiert. Die Verdunkelung der Städte war eine der Luftschutzmassnahmen. Die Fenster waren nicht nur mit den Vorhängen und den Jalousien sondern auch mit schwarzen Tüchern verhängt. Bei unverhängtem Fenster durften in der Wohnung nur die blau getönten Glühbirnen angezündet werden.
6.6
Der kleine Babysitter. Wenn die Eltern ausgegangen waren lag ich bei Luftalarm steif vor Angst im Bett, bis das nun erwachte Brüderlein Conrad lautstark zu schreien anfing. Weder der Endalarm noch meine Beschwichtigungsversuche konnten ihn zum Schweigen bringen bis die Eltern nach Hause kamen. Ich dachte, er wolle frisch gewickelt werden. Dann packte ihn so ein, wie ich es der Mutter abgeguckt hatte. Die Eltern liessen es sich nämlich nicht nehmen, an manchen Abenden auszugehen, ins Kino, ins Theater oder sich mit Bekannten aus der Künstler- und der Bohême- Szene im Künstlergüetli oder in der Bodega, der spanischen Weinhalle im Niederdorf zu treffen. Damals stellte man nicht in Frage, ob ein sechs- bis acht Jahre altes Kind sich schon als Babysitter für seinen sechs- bis achtmonatiges Brüderlein eigne. Ich hatte den Gewinn, dass mir die Eltern dann von den Filmen und Theaterstücken erzählten. Das Schauspielhaus war zur Zeit der Naziherrschaft die einzige freie deutschsprachige Bühne. Hier wurden Schauspiele des Widerstandes uraufgeführt. Kai Munk: “Der Mond ging unter“ und “des Teufels General“ von Zuckmaier. (cf. Das Buch von Evelin Hasler: “Stürmische Jahre”
6.7
Ängste und Fantasmen.
Angsterlebnissebeschäftigten jahrelang meine Fantasien mit dem Ausbau von ausgedehnten unterirdischen Schutzräumen, Gängen, die in Höhlen führten. Ich stattete sie zu behaglichen Wohnräumen aus, worin man in Sicherheit war, vor Kriegshandlungen und Bomben geschützt. Da gab es Betten, eine Küche und natürlich unerschöpfliche Vorräte an Esswaren. Mit der Zeit entstand in meiner Vorstellung ein verzweigtes Netz von solchen unterirdischen Anlagen, ein wahrer Fuchsbau, mit all dem Komfort, wie ihn sich nur ein Zehnjähriger ausdenken konnte. Um Jahr 2012 auf der Reise in die Ukraine, sahen wir in Odessa die so genannten “Katakomben“. Das waren in Wirklichkeit unterirdische Behausungen, wo sich die Widerstandskämpfer samt ihren Familien monatelang aufhielten, um da und dort Einrichtungen und Verkehrswege der deutschen Besetzungstruppen zu sabotieren.
Gleichzeitig entstand in meiner Fantasie eine andere Rettungseinrichtung, an deren Durchführbarkeit ich nicht im Geringsten zweifelte. In Ergänzung des unterirdischen Höhlensystems sollte es dem Überleben in Meerestiefen dienen und war also mobil. Es bestand aus einem ausgehöhlten Walfisch, aus dessen Rumpf die Ruder wie bei einer Galeere auf das Wasser hinaus ragten. Welche Ruderer dann dieses Unterseeboot in Bewegung setzen sollten machte mir keine Sorgen. Aber es sollte wie ein bürgerliches Häuschen gemütlich ausgestattet sein und absolute Geborgenheit bieten
6.8 Nachbarskinder. Zu dieser Zeit wohnten wir an der Minervastrasse neun in Hottingen, in idealer Nähe zum Schauspielhaus, dem Kunsthaus, den Schulen und der Universität. Solange wir an der Kirchgasse wohnten, also in der Altstadt, die damals der Slum von Zürich war, hatte mir die Mutter den Umgang mit den “Strassenbuben“ verboten. Ausser dem Kindergarten-Kollegen Röbeli Haussmann, und, nur nur auf Distanz, das Bethli Winkler aus dem Nachbarhaus kannte ich niemanden unter den Kindern dieses Quartiers. Die ersten sechs Jahre meiner Kindheit lernte ich einsam zu sein.
Ich hatte deshalb keine Übung im Umgang mit mehr oder weniger Gleichaltrigen. Wie ich dann den Nachbarskindern an der Minervastrasse in meiner Naïvität von meinem Walfisch-Unterseeboot erzählte spottete man über mich. Von da an hiess ich “der Spinner“. Es gab noch andere Gründe, weshalb ich von den Nachbarskindern abgelehnt wurde: Ich galt als schlechter Spielkamerad. Das war eine Folge des mütterlichen Erziehungsstils (cf. Kap 3, Geboren und Erzogen.).
Als ich einmal an einem schulfreien Nachmittag allein im Garten war, kamen die zwei Mädchen, Zwillinge, aus dem an den Garten angrenzenden Haus und noch zwei oder drei mir nicht genauer bekannte Nachbarskinder und erzählten, im Schuppen eines der etwas weiter entfernten Häuser im Quartier sei eine Katze, die habe gerade herzige Junge bekommen. Die wollten sie mit zeigen. In diesem Schuppen gab es aber keine Katzen, dagegen begannen die Kinder mich im Raum herum zu stossen und mit den Fäusten zu schlagen. Sie sagten nicht weshalb, ich fragte auch nicht. Ich liess mich traktieren ohne zurückzuschlagen. Die Geschichte von der linken Wange in den Evangelien kannte ich aber noch nicht. Als Blut aus der Nase zu fliessen begann, rannten die Täter davon und ich schlich blutend nach Hause. Ich weiss nicht mehr, wie die Mutter das aufnahm. Einige Tage später kamen die Zwillinge und ihre Mutter. Sie brachten einige Süssigkeiten und die beiden Mädchen mussten sich bei mir entschuldigen. Und ich schämte mich. Wieder einmal habe ich mich nicht gewehrt!
6.9
Der Garten
Allerdings war unser kleiner Garten ein Magnet für die Nachbarjugend, besonders da der Besitzer namens Habis-Reutinger des gegenüberliegenden “roten Hauses“, eines vielstöckigen Backsteinbaues, für die Kinder den Zugang zu seinem kleinen Vorgarten verboten hatte. Unser Garten bestand aus dem “Wiesli“, das vom Hausbesitzer im Sommer einige Male gemäht wurde, eingefasst von einer Ligusterhecke, süss duftendem Phlox und einem rostigen Gartenhag, der mir manche Dreiangel in die Hosen riss. Statt das schwere eisernen Gartentor zu benutzen überkletterte ich ihn als Abkürzung zum Nachbarn namens Möller, einem Dänen, der hinter dem Haus eine geräumige Spenglereiwerkstatt betrieb. Dort lernte ich Blechstücke aneinander zu nieten und Lötwasser herzustellen. Mit seinem jüngeren Sohn Rolf bauten Conrad und ich im Sommer ein Zelt aus alten Textilien. Der älteste, Waldemar Möller war daran, sich ein Segelschiff, einen “Star“, zu bauen. Ich weiss nicht, ob es je fertig geworden ist. Im “Wiesli“ standen zwei Birnbäume und ein Pfirsichbaum. Im Spätsommer und Herbst brachte ich manchmal einen Pfirsich oder eine von den wunderbaren Butterbirnen mit in die Schule, und legte sie meinem geliebten S. unter ihr Schülerpult. Das war meine Liebeswerbung um den Schulschatz.
Der Hintergrund des kleinen Rasens war ein ländliches Bauwerk aus Holz auf Steinsockel. Links führte eine Türe zum “Schopf“, wo das Brennmaterial für den Winter lag und im oberen Stock waren die Wäscheleinen. Rechts führte die Türe zur Waschküche mit dem beheizbaren Wäschehafen, dem Trog und der hydraulisch betriebenen Wäschezentrifuge. An den Waschtagen musste ich am Morgen früh mit dem Einheizen beginnen, damit das Wasser für die “Kochwäsche“, wozu vor allem die Überkleider des Vaters gehörten, früh genug zum Sieden kam.
Der Vater brachte einmal von der Kundschaft, einer Anstalt für Grafik und Reproduktionen, ein grosses Bündel von verbrauchten Filmen. Ich füllte sie in den Ofen unter dem Waschkessel. Denn ich meinte damit gut anfeuern zu können. Kaum hatte ich das Zündholz in die Nähe der Filme gebracht, schossen Stichflammen aus der Ofentür, die ich vor Schreck nicht geschlossen hatte und aus allen Ritzen und Spalten des alten Ofens, begleitet von unheimlichem Brausen und Donnern. Ich glaubte, das Ganze werde mit einer Explosion enden, was nicht so abwegig war, denn alte Filme wie diese bestanden, was ich damals noch nicht wusste, aus einer hochexplosiven Zelluloseverbindung, in der Zusammensetzung ähnlich der Schiessbaumwolle oder der Nitrozellulose. Das war ein unvergessliches “chemisches Experiment“.
Es gab aber auch Explosionen, die Max und ich mit Absicht aus Spass und Interesse in Szene setzten.
6.10
Max Buchmann
Max, mein häufigster Kamerad, für Spiele und Lausbubenstreiche war der Sohn der Hausbesitzer, die das Stockwerk über uns bewohnten. Er war zwei Jahre älter als ich. Eine Eigentümlichkeit von ihm war, dass er sich wochenlang nur für eine einzige Sache interessierte und diese Sachen konnten verschiedener nicht sein. Eine Zeit lang war er vom Carabus fasziniert, dem Regenkäfer, deren es im Garten eine Menge gab. Mit seinen mächtigen Kiefern konnte dieser Raubkäfer von seinen Beutetieren, den Schnecken, kleine Fleischstücke abkneifen. Man musste ihn vorsichtig am Brustpanzer festhalten, sonst zwickte er heftig in den Finger und sonderte dabei einen stinkenden Saft aus. Es gibt noch einen gelungenen, naturnahen Linolschnitt von Max mit dem Porträt eines seiner Favoriten.
Oft sassen oder lagen Max und ich stundenlang am Boden im Atelier seines Vaters, der Schriftgrafiker war, und zeichneten. Während der Glühlampen-Epoche sammelte er Bilder und machte Zeichnungen von fast allen Varianten von elektrischen Glühbirnen mit der genauesten Angabe ihrer physikalischen Daten. Im Winter beschäftigten uns die Aufführungen im Kasperlitheater. Wir stellten das von meinem Papa bemalte Gehäuse im Estrich auf und verlangten für unsere Darbietungen Eintrittsgeld. Welche Dramen zur Aufführung kamen, weiss ich nicht mehr, nur noch, dass das momentane Lieblingsobjekt von Max, der Holzvergaser, der als Benzinersatz zum Betreiben der Autos im Gebrauch war, in Form der von uns gebastelten Kartonmodelle darin neben den schönen väterlichen Papiermaché-Figuren eine grosse Rolle spielte.
Eine Zeit lang gab es für Max auch ein weniger harmloses Faszinosum: Radioantennen. Seine Begeisterung für Antennen teilte ich eigentlich nicht mit ihm. Doch bei der Planung und Ausführung von Aktionen hielt ich doch als sein Mitarbeiter solidarisch zu ihm.
Das Dach eines Nachbarhauses zierte ein solches grosses vogelkäfigförmiges Kunstwerk aus Draht, das er liebend gern heruntergeholt hätte. Die dazu nötigen Vorkehrungen schienen uns aber doch allzu gewagt: Wie konnten wir auf das Dach dieses fünfstöckigen Gebäudes steigen? Da kam uns der Einfallsreichtum der Bewohner im Erdgeschoss unseres Hauses entgegen, von Herrn und Frau Haldi.
Herr Haldi war ernst und verschlossen. Er war fast immer zu Hause, obschon er noch nicht im Pensionsalter sein konnte. Meine Mutter sagte, er sei schizophren. Seine selbst gebastelte Radioantenne war in der Veranda ihrer Parterrewohnung aufgehängt, für uns im Klettern Geübte leicht erreichbar. Diese Radioantenne war ein kleines Kunstwerk und ein lohnendes Ziel für eine Zerstörungsaktion. Über einem regelmässig mit Nägeln bestückten, gleicharmigen Holzkreuz waren von innen nach aussen spriralig die farbig isolierten elektrischen Drähte gespannt. Dadurch gewann diese Antenne das Aussehen eines einfachen indischen Mandala. Und dieses Wunderwerk hing eines Tages nicht mehr in der Veranda. Die Täterschaft war rasch eruiert, ich war geständig und musste mich schamrot im Gesicht und stotternd bei Frau Haldi entschuldigen. Der Künstler selber wurde nicht involviert und für mich gab es keine schwereren Sanktionen. Bei einem genauen Verhör wäre wahrscheinlich Max als der Anstifter und ich als Ausführender etwa zu gleichen Teilen schuldig gesprochen worden. Wie sich die Eltern von Max Buchmann verhalten haben, weiss ich nicht mehr. Dieses Ereignis war vielleicht einer der Auslöser der etwas später aufkommenden Feindschaft zwischen meinen Eltern und der Frau Haldi gewesen.
Als während des Krieges in der Schweiz zu einer gewissen Zeit kein Autobenzin mehr erhältlich war. Dienten als Benzinersatz für die Autos neben den schon erwähnten Holzvergasern das aus einer Verbindung von Kohlenstoff mit Calcium bestehende, so genannte Carbid. Durch Zufügen von Wasser entstand das explosive Acetylengas. Ich weiss nicht mehr wie es möglich war, dass Jungen von zehn bis zwölf Jahren zu einigen Brocken von Calciumcarbid kamen. Ob wir sie in einer Benzintankstelle erbettelt oder geklaut hatten oder in einer Drogerie gekauft, wo Karbid für den Betrieb der Acetylen-Lampen vorrätig war, weiss ich nicht mehr.
Unser Experiment bestand darin, dass wir mit einem Nagel in den Blechdeckel einer leeren Blechbüchse ein kleines Loch schlugen, die Büchse mit Karbid und Wasser füllten und den Deckel drauf drückten. Dann musste einer von uns aus möglichst sicherer Distanz mit einem brennenden Hölzchen oder mit Hilfe einer Zündschnur Feuer an das Loch bringen. Mit einem lustigen Knall flog dann der Deckel etwa zwanzig Meter hoch in die Luft. Ich rieche in Erinnerung noch jetzt den scharfen Acetylengestank. Heute bin ich erstaunt, wie wenig einschränkende Sicherheitsvorschriften es damals gab, und dass uns diese gefährlichen Spiele nicht verboten wurden.
6.11
Max war Pfadfinder in der Abteilung, die sich Flamberg nannte. Er nahm mich an einem der an den Samstagnachmittagen statfindenden Übungen mit. Im Sagertobel wurde über den Bach eine Seilbrücke gespannt. Mit dem Ledergürtel am Seil aufgehängt überquerte man den Bach. Sonderbar fand ich, dass die gewöhnlichen Pfadis vor dem Gruppenleiter, dem Venner eine Art Achtungsstellung annahmen, indem sie die Schuhfersen aneinanderknallten. Das war mit zuwider. Die Mutter verstärkte meine Abneigung: die Uniform kostete Geld und sie wollte nicht auf meine Hilfe bei der samstäglichen Putz- und Haushaltarbeit verzichten.
6.12
Stumme Feindschaft.
Die nachbarliche Beziehung mit der Frau Haldi war zunächst ganz friedlich und für mich sogar lukrativ. Eine meiner Basteleien war die Herstellung von hexen- und drachenmässig aussehenden Fastnachtsmasken aus Halbkarton und Stoffresten. Frau H. fand Gefallen an diesen Masken und kaufte mir für ihren Privatkarneval einige ab. Das war mein erster Kunstverkauf.
Sonst aber litt ich unter dieser Mieterin. Sie war von Beruf Handweberin und machte jeden Tag bis weit über Mitternacht ihre Heimarbeit am Webstuhl. Das stundenlange Klick-klack hielt mich ebenso lange wach. Das quälte mich umso mehr, als meine Mutter grossen Wert darauf legte, mich noch im Alter von über zwölf Jahren abends um acht Uhr, lange vor den Nachbarskindern, zu Bett zu schicken.
Vielleicht war diese allnächtliche Störung der Grund dafür, dass man sich im Treppenhaus nicht mehr grüsste, obschon es so eng war, dass man ohne auf dem Treppenabsatz zu warten nicht aneinander vorbei kam. Selbstverständlich galt das Grussverbot auch für mich. Nun hatte diese Hausmitbewohnerin wie viele andere gute Leute in der Nachbarschaft Waisen und Kinder aus kriegsgeschädigten ausländischen Familien für einen Erholungsaufenthalt in der Schweiz aufgenommen. Buchmanns hatten als Gast einen kleinen deutschen Lausbuben namens Helmuth, Frau Haldi (nach der Trennung von ihrem Ehemann) ein Mädchen aus Italien, wahrscheinlich ein wenig älter wie ich. Im Winter begegnete ich ihr fast jeden Tag, wenn ich im “Schopf“ Holz zum Heizen holen musste und am Scheitstock Kleinholz zum Anfeuern schlug. Es hätte ja sein können, dass wir Jungen, wie Romeo und Julia hinter dem Rücken der verkrachten Eltern uns ein wenig verständigen und unsere Sprachmöglichkeiten ausprobieren. Nein! jeden Tag hielt uns dieses erdrückende Tabu der Alten gefangen, jeden Tag dieses peinliche Schweigen. Ich lernte nicht einmal ihren Namen kennen und wagte kaum sie anzusehen; sie schien nicht besonders hübsch gewesen zu sein, kein Wunder, wenn auch sie auf höheres Geheiss vor dem “Feind“ einen bösen Kopf machen musste. Diese kleinbürgerlichen engen peinlichen unlösbaren Verklemmungen! Sie gehörten damals zur Atmosphäre unserer Gesellschaft, zu dieser Nazi- und Kriegszeit, dieser kranken Stimmung des Ausgrenzens, dieser in braven Schweizer Familien einschleichende Kleinlichkeit.
6.13
Jüdische Menschen. Wie ist es zu erklären, dass ich als Elfjähriger in der Primarschule ganz plötzlich über meinen jüdischen Klassenkameraden herfgefallen bin und ihn geschlagen habe? Peter Wurmser hatte schon als Bub das “typisch jüdische“ Aussehen und Verhalten so wie ich es aus den Gesprächen der Erwachsenen aufgeschnappt hatte. Er hatte tiefschwarze leicht gekräuselte Haare, schwarze Augen, ein bleiches schmales Gesicht, eine für sein Alter schon leicht gebogene und spitze Nase und trug eine Brille (wie ich). Er war ein guter Schüler, immer freundlich und angepasst und ein wenig scheu, und im Gegensatz zu mir nie an Rivalitätsstreitigkeiten beteiligt. Vor diesem Unglücksfall hatte ich nie eine besondere Beziehung zu ihm gehabt, weder eine freundschaftliche noch eine ablehnende.
Also: es war Turnstunde, die ganze Klasse war auf dem Turnplatz hinter dem Schulhaus. Ich konnte aus irgendeinem Grund an dieser Turnstunde nicht teilnehmen. Entweder hatte ich wieder einmal einen Fuss verstaucht oder war noch rekonvaleszent von einer Grippe. Ich blieb deshalb im Schulzimmer zusammen mit Peter, der auch nicht am Turnen teilnahm. In der Erinnerung sehe ich Ihn in einer Schulzimmerecke, zusammengekauert, die Arme vor dem Gesicht meine Schläge abwehren. Welches Gefühl, welcher Anfall von Hass mich dazu antrieb weiss ich nicht mehr. Ich fühlte wahrscheinlich auch keine Aufregung, keine Befriedigung über irgendeine abreagierte Aggression. Es gab auch keine unmittelbaren Folgen. Peter hatte mich weder bei anderen Klassenkameraden noch bei der Lehrerin verklagt. Als mich einige Tage später Peter für den nächsten schulfreien Nachmittag zu sich nach Hause einlud, war ich nicht einmal besonders erstaunt. Erst später erkannte ich in dieser Einladung die liebenswürdige Weisheit seiner Mutter. Ich war nach diesem Besuch von jeder antijüdischen Neigung geheilt.
Die Familie Wurmser betrieb in Bülach ein Kleidergeschäft und wohnte in einer, für meine Begriffe, grossen vornehmen Villa auf einer Anhöhe, von wo aus an diesem sonnigen Sommertag sich das ganze Alpenpanorama eröffnete, so wie ich es noch nirgends gesehen hatte. Leo, der ältere Bruder von Peter war auch zu Hause. Die Mutter ermahnte uns, ihn in seinem Zimmer, wo er an seinen Hausaufgaben sass, nicht zu stören. Solche Rücksichtnahme und Achtung vor geistiger Arbeit, und sei sie erst auf Mittelschulniveau, machten mir unvergesslichen Eindruck. Peter und ich wurden mit Tee und Patisserie bewirtet. Vielleicht wanderten wir durch den nahen Wald und plauderten allerlei, aber kein Wort über meine Attacke. Ich fühlte mich wohl mit ihm zusammen, aber eine eigentliche Freundschaft entstand nicht. Den ein wenig älteren Bruder von Peter, Leo, hatte ich damals beim Vieruhrtee gesehen. Jahrzehnte später hörte ich einen Vortrag von ihm. Leo Wurmser war Professor für Psychiatrie an einer bedeutenden Universität in den USA geworden und ausgezeichneter Kenner von Sigmund Freud. Ich lernte sein voluminöses Buch "Die Maske der Scham" kennen, als ich mit Marianne Müller eine kleine Arbeit über dieses Thema schrieb. An seinem Buch war mir aufgefallen, dass er die Zitate aus Dostojewskij-Werken auf Russisch in kyrillischer Schrift geschrieben hatte, als ob alle seine Leser Dostojewkij in der Ursprache kennen würden.
Viele Jahre später besuchte ich Peter in Israel: Er hatte wie ich Medizin studierte und machte ein Praktikum im Regierungsspita in Afula, einer Nachbarstadt von Nazareth, zur gleichen Zeit wie ich im Missionsspital in Nazaret. Ich hatte mit ihm ein Gespräch über Religion und erinnere mich an was er über Gott dachte: Gott könne sich bei dieser Unmenge von Menschen unmöglich um jeden einzelnen kümmern. Nochmals viel später hatte ich vernommen, Hannes Ginsberg (ein Primarschulfreund) habe die Schwester von Peter Wurmser geheiratet.
Beim Abfassen der Erinnerungen an meine Kindheit erstaunt mich, wie viele Menschen jüdischer Herkunft ich während des Krieges kennen gelernt hatte. Meine eigene Erfahrung mit diesen Menschen widersprach dem, was ich aus den Gesprächen der Erwachsenen meiner Familie aufschnappte. Ausser von meinem Vater hörte ich fast nur üble Vorurteile, deren keines auf irgendeiner eigenen unguten Erfahrung beruhten, sondern nur aus dummen und vagen Gerüchten und vielleicht aus der vom Norden her durchgesickerten antijüdischen und allgemein verbreiteten Vorurteilen und Stimmungen in der Bevölkerung. Das Theaterstück „Andorra“ von Max Frisch illustriert sehr genau diese Gedankenlosigkeit und Dummheit.
In dem einen Jahr Sekundarschule gab es in der Klasse zwei jüdische Kameraden mit Namen Gutmann und Meyer oder Meier (!). Gutmann erzählte mir von einem Fest, an dem er eine schwarzen Anzug und Hut tragen musste. Das hatte mich sehr befremdet. Erst viele Jahre später lernte ich das Initiationsritual Bar Mizwa der zwei Söhne von Mirjam Bollag, einer Kollegin aus der Gestaltausbildung, kennen.
Es war mir als Kind nicht bewusst, dass auch der Vater meines Schulkameraden und zeitweisen Spielkameraden Hannes Ginsberg, ein überzeugter Christ jüdischen Ursprungs ist. Bei einer jüdischen Freundin der Mutter, Frau Ehrhart waren wir manchmal zu Besuch. Ihr Ehemann, Hans Ehrhart, war Kunstmaler und dekorierte die Schaufenster von Globus und von Jelmoli, die zur Weihnachtszeit sehr bewundert wurden. Ihre zwei Brüder namens Seidenberg führten später ein Buchantiquariat in der Altstadt. Einer unserer nächsten Nachbarn war der aus Jugoslawien stammende Sänger Rotmüller. Im Sommer hörte man ihn beim Üben seiner Opernarien. Sein Sohn Ilan war ein Spielkamerad von Conrad. Es hiess, nach dem Krieg sei er mit der ganzen Familie nach New York ausgewandert um an der Metropolitan Oper zu wirken.
Dr.med. Willy Dreifuss war unser Kinderarzt. Er hat uns gegen die Pocken geimpft, mir zur Stärkung jede Woche intravenös Calcium und Vitamin B injiziert. Seine Frau setzte mich dann jeweils einige Minuten vor die Ultraviolet-Lampe. Dazu band sie mir eine Sonnenbrille um. Unvergesslich blieb mir der Ozongeruch der Quecksilberdampflampe während des Krieges eine Ration Triebstoff zugeteilt.. Als Arzt bekam er auch Einmal durfte ich mit ihm in seinem Mercedes zu Krankenbesuchen fahren.
ass zur selben Zeit einige Kilometer nördlich von Zürich solche Leute systematisch ermordet wurden!
Erst um 1945 gab es Berichte von den Verfolgungen der Juden im dritten Reich und schliesslich vom Holokaust, Das ist und bleibt unfasslich!
6.14
Peter Hindemann
In der 6.Primarschulklsse, hatte ich eine tiefe Freundschaft mit dem Sohn eines Zahnarztes. Seine Familie wohnte in einer geräumigen Villa in Oberstrass, was fast soviel hiess wie “Zürichberg“, nämlich Reichtum. Peter war grösser als ich und schlank, spielte Tennis, trug eine vornehme Armbanduhr (damals für Buben im Primarschulalter eine Ausnahme und wirkte wie eine Zurschaustellung des Reichtums). Die Freundschaft mit Peter Hindemann war ernst und gefühlvoll. Wir waren beide verliebt, er in eine Edith und ich in die S., mein schon erwähnte Schulschatz. Peter summte meistens das traurige Lied der Lorelei von Heinrich Heine vor sich hin:
“Ich weiss nicht, was soll es bedeuten,
dass ich so traurig bin,
ein Märchen aus uralten Zeiten,
das geht mir nicht aus dem Sinn“.
Nach der Schule spazierten wir manchmal fast wie ein Liebespaar mit den Armen über den Schultern die Rämistrasse hinauf. Obschon der Inhalt unserer Sehnsüchte eindeutig Mädchen waren, herrschte zwischen uns eine beinahe erotische Stimmung. Nach Abschluss der Primarschulzeit mit der sechsten Klasse verloren wir uns aus den Augen. Von der damaligen Lehrerin, der Fräulein Baerwolff, habe ich erst viel später erfahren, Peter hätte einen unguten Charakter gehabt. Und noch später, er sei Gynäkologe geworden und praktiziere in Basel.
6.15
S., mein Schulschatz
Sie war eine Klasse jünger als ich. Es war eine Dreiklassenschule, sie sass deshalb im selben Klassenzimmer wie ich. S. war die Tochter eines Universitätsprofessors. Um die Osternzeit war ich einmal zu ihr nach Hause eingeladen. Als Geschenk brachte ich ihr ein von mir reich bemaltes Osterei. Da gab es noch einen jüngeren Knaben, einen Cousin vielleicht. S. flüsterte mir zu, der habe mit ihr so etwas wie Sex (dieses Wort wurde damals noch nicht gebraucht) machen wollen. Sie wollte wissen, ob sie davon schon ein Kind bekommen könnte. Das passte zu der etwas anzüglichen Stimmung in diesem Haus. Dazu kam auch ein jugendlich und sportlich wirkender Mann, vermutlich der Vater oder ein Onkel. Im Vergleich zu ihm wirkte die Mutter recht matronenhaft. Beim z’Vieri beschämte sie mich, weil sie meine Liebe zu ihrer Tochter zur Sprache brachte und mich auslachte, weil mir die Schamröte in den Kopf stieg.
Mit S. rauchte ich zum erstenmal. Wahrscheinlich hatte sie die Zigaretten ihrem Vater oder Verwandten geklaut. Wir gingen nach der Schule auf die Hohe Promenade und versteckten uns im Gebüsch hinter dem Denkmal des Sängervaters Nägeli. Genüsslich war für mich nicht der Rauch der Zigarette, sondern das mit meiner Geliebten geteilte Geheimnis. Die Möglichkeit, vom unserem Verborgensein für irgend welche erotische Annäherung zu profitieren, kam uns beiden nicht in den Sinn.
Während meiner Schulzeit am Gymnasium begegnete ich der S. fast jeden Tag, wenn sie vom Zürichberg herunter zu ihrer Schule, dem “Affenkasten“, kam und ich von Hottingen in die “Lümmelburg“ hochstieg. Wir gingen beide grusslos aneinander vorbei als kennten wir uns nicht. Sie zeigte immer ein verschlossenes ernstes Gesicht. Inzwischen publizierten Tageszeitungen, dem Professor sei gekündigt worden. Es kamen auch Gerüchte auf, er sei in irgend einen Skandal verwickelt worden,
Jahre vergingen. 1976 kurz nach Eröffnung meiner Praxis wurde ich zu S. gerufen weil sie einen sonderbaren Anfall (Bewusstlosigkeit? Psychose?) erlitten hatte. Ich erkannte sie sogleich, nicht nur wegen ihrem Namen und trotz ihrem sehr gealterten Gesicht. Sie wirkte, als ob sie unter dem Einfluss einer Droge stehen würde. Die etwa 19 jährige sehr hübsche Tochter war dabei. S. hatte jetzt allerdings einen portugiesisch klingenden Nachnamen. Gegenüber der Mutter erwähnte ich dummerweise den Skandal um den Professor. Sie klagte, man sei eben verleumdet worden. Noch ganz unerfahren mit psychiatrischen Notfällen dachte ich daran, S. zu hospitalisieren. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, hatte ich ihr irgendein Medikament verordnet. Wochen später bekam ich einen Anruf von ihr. Sie sei gegen ihren Willen in die psychiatrische Klinik Kilchberg geschickt worden; ich solle sie herausholen. Auch jetzt fehlte mir noch die in solchen Fällen nötige Erfahrung. Ich verweigerte ihr den Wunsch. Etwa zwei Wochen später rief mich ihre Mutter an um mir Vorwürfe zu machen wegen meiner Rechnung. Sie glaubte wohl, dass ich als “Freund der Familie“ für meine ärztliche Hilfe kein Honorar hätte verlangen dürfen. Mein Vorgehen war alldings noch ungeschickt, denn in Afrika konnte ich keine Erfahrungen erwerben im Umgang mit psychiatrischen Notfällen. Mein Verhalten in diesem Fall war nicht geschickt, aber nervenaufreibend und zeitaufwendig. Ich glaubte, das Recht auf ein Honorar zu haben, zumal es nach dem nicht besonders reichlichen Krankenkassetarif berechnet war. Doch obschon ich juristisch im Recht war, blieb mir ein Gefühl von moralischem und ärztlichem Versagen. Ich hätte ein psychiatrisches Konsilium verlangen müssen, oder sie schon gleich in eine Klinik einweisen sollen. Und ich hätte doch kein Honorar verlangen sollen. Ich hätte sie nach ihrem Hilfeschrei wenigstens in der Klinik besuchen sollen. Ihre ganze Erscheinung, krank und heruntergekommen, hatte mich sosehr erschreckt, dass meine Handlungsweise von der Angst und nicht von professioneller Ethik diktiert war, wie sie von einem Arzt zu erwarten gewesen wäre.
6.16
Kriegswirtschaft
Die Blockade der Verkaufs von Nahrungsmitteln wurde bald ersetzt durch die Ausgabe von Rationierungskarten, die man in eilig dazu eingerichteten Kriegswirtschaftsämtern jeden Monat abholen musste. Eine erstaunliche und bewundernswerte Organisation war in Kürze eingerichtet worden, die den Bedürfnissen jeder Familie je nach Alter der Kinder oder besonderer Notwendigkeit und den von den Importmöglichkeiten angepasst waren. Mein Vater bekam, weil er als zu den Schwerarbeitern gehörig zusätzliche Marken für kalorienreiche Nahrungsmitteln bekam. Als Schwerarbeiter galten inter anderen Berufstätige, die auf Leitern arbeiten mussten. Onkel Ludi, ein Bruder der Mutter, hatte sich mit Tuberkulose angesteckt und wurde deswegen auch besser versorgt.
Wenn ich mich recht erinnere war Brot nie rationiert, aber nur Schwarzbrot, das mindestens 24 Stunden alt war. durfte verkauft werden. Der tröstliche Slogan dazu hiess: „Altes Brot ist nicht hart, aber kein Brot, das ist hart“. Fleisch durfte nur zwei mal in der Woche auf den Tisch kommen.
6.17
Die LehrerInnen von der ersten bis zur sechsten Primarschuklasse
Erste Klasse: Herr Sigg
Zweite Klasse : Fräulein X, eine Aushilfe, während Herr Sigg krank war.
Dritte Klasse: Anna Walter
ierte bis sechste Klasse: Erika Baerwolff
Von der 4.Primarschulklasse an gab es obligatorischen Schwimmunterricht für die Buben auf der linken, für die Mädchen auf der rechten Seite der Badeanstalt Utoquai.
Der Unterricht wurde während des ganzen Sommerquartals durchgeführt, sobald das Seewasser die Wassertemperatur 17 Grad erreicht hatte. Als Abschluss gab uns der Schwimmlehrer nach einer kleinen Prüfung ein rundes Stücklein Stoff mit aufgesticktem “S“. Damit durfte man aus den Holzbassins in den See hinaus schwimmen. Aber schon im Jahr zuvor konnte ich der kontrollierenden Mami meine Künste im Schwimmen und Tauchen vorführen,
6.18
In der Ferienkolonie. Im zehnten oder elften Altersjahr hatte mich die Mutter für die Sommerferien in eine Ferienkolonie nach Spycher (wenn ich mich recht erinnere) bei Trogen im Appenzellerland angemeldet. Neben dem alten Wirtshaus, wo wir, etwa dreissig Buben, untergebracht waren, floss ein noch wilder Bach, der mein interessantestes Spielzeug war, denn an seinem Ufer fand ich blank gefegte Tierschädel, wahrscheinlich von Katzen, die jemand im wilden Wasser ersäuft hatte, aber auch von Vögeln. Vielleicht Pouletköpfe, die man hier entsorgt hatte.
Ich besuchte einmal die Bewohnerin des Bauernhauses in der Nachbarschaft mit ihrem neu geborenen Kind. Es hatte schon ein ganzes Rudel Kinder, denn als ich ihr Bébé bewundernd betrachtete, sagte sie : “Da isch scho wider sonen Schnoderi mee“. Ich war verwundert über diesen Mangel an Mutterliebe, dachte aber, dass für so arme Leute viele Kinder wahrscheinlich eine fast unerträgliche Last werden kann.
Eine alte Frau war unsere Köchin. Vielleicht hielt ich sie deswegen für abstossend hässlich, weil sie sehr schlecht kochte: in meiner Erinnerung gab es jeden Tag Brotsuppe mit Kümmel zu essen. Das Brot zum Frühstück war schimmlig und sauer und zog beim Auseinanderbrechen Fäden. Es war nur mit asketischer Selbstüberwindung essbar.
Manchmal machte man unter Führung der Kolonieleiter einen Ausflug. Beim Wandern mussten wir martialische Schweizerlieder singen
“Wir sind die jungen Schweizer,
Gar jung ist unser Blut.“
Niemand schien es zu stören, wieso die "jungen Schweizer" zudem auch noch "gar junges Blut" haben mussten. An ein besonders missliches Liedfragment erinnere ich mich: Man sang mit Begeisterung am Schluss jeder Strophe eines anderen Liedes:
“Haarus juhei!!“
Viele Jahre später habe ich erfahren, dass es der Kampfruf der Frontisten war, der Schweizer Nazionalsozialisten.
Nach der Rückfahrt wurden die Koloniekinder am Bahnhof von den Müttern abgeholt. Die Leiter gaben den Müttern Auskunft über das Verhalten ihrer Söhne. Von mir wurde gesagt, dass ich offenbar ein Interesse am Naturforschen habe.
6.19
Schöftland.
Als der Termin der Geburt von Conrad sich näherte, brachten mich die Eltern nach Schöftland, zur befreundeten Familie Wurm. Später verbrachte ich fast jedes Jahr eine oder zwei Wochen in Schöftland. Bald konnte ich ohne Begleitung reisen, mit der SBB von Zürich nach Aarau und am Bahnhofplatz umsteigen in die Suhretalbahn. Die Familie Wurm wohnte im Parterre dera Villa des Schuhfabrik Direktors. In Schöftland lernte ich das ländliche Dorfleben kennen und erlebte manche Premièren Beim Unkrautjäten im Gemüdegarten erwischte man hie und da eine Werre, einen hässlichen Schädling, die Maulwurfsgrille. Sie ernährt sich von Setzlingen, die sie an den Wurzeln in die Erde hinunter zieht .
Die Direktorsfamilie hatten einen leicht behinderten Sohn. Walti und ich konnten ihm zusehen, wie er eines seiner Kaninchen schlachtete. Mit einer Art kleiner Pistole tötete er es, zog ihm das Fell ab und entnahm aus dem aufgeschlitzten Körper die Innereien.
Im dem der Villa gegenüber liegenden Schopf fanden wir einmal einen Wurf von neugeborenen, noch nackten und rosaroten Mäusekindern. In einem sehr kalten Winter verirrte sich manchmal eine Spitzmaus in Wohnung. Damals begann ich mit Äthyläther zu experimentieren. Ich hatte eine Spitzmaus gefangen, setzte sie in ein grosses Konfitürenglas und legte einen flachen Deckeldrauf. Die arme Maus hüpfte beim Versuch sich zu befreien unermüdlich gegen den Deckel in die Höhe, aber jedesmal geb ich ihr an einem mit Äther getränkten Wattebausch zu schnuppern und beobachtete, wie sie langsam in Narkose fiel. Das Hüpfen hörte auf und sie bald lag sie regungslos da. Sie wirbelte noch kuz ihr Schwänzchen, dann war Ruhe. Vorher aber waren aus ihrem Pelz Hunderte von Läusen ausgezogen, die jetzt auch narkotisiert auf dem Gefässboden verstreut lagen. Etwa eine Viertelstunde später zeigte erneutes Wirbeln des Mäuseschwanzes das Wiedererwachen des Tierchens an. Ich weiss nicht mehr, ob auch die Läuse wieder erwachten und welchem weitern Schicksal wir die Versuchsmaus dann überliessen.
Ich weiss nicht, ob der Vater Willi Wurm als Deutscher mit den Machenschaften der Nationalsozialisten in Deutschland einverstanden war. Ich sah ihn einmal wie er sehr aufmerksam mit dem Ohr nahe am Radio eine Rede von Adolf Hitler anhörte. Aus dem Lautsprecher tönte eine schrille aufgeregt tönende Stimme, deren Wortlaut ich natürlich nicht verstand. Einmal erlebte ich den Besuch eines Angestellten des deutschen Konsulats. Auch dieser Herr hatte eine hektische Art zu reden. Enthusiastisch schilderte er die Angriffe der Stuka, die Sturzkampfflieger. Im Steilflug rasen sie erdwärts und beschiessen oder bombardieren aus der Nähe ein Bodenziel. Stolz erzählte er, wie dann auf dem Boden die Leute, "die Feinde", die Franzosen, Frauen und Kinder schreiend geflüchtet seien. Welche Heldentat der deutschen Wehrmacht! Die Begeisterung dieses Herrn für diese Scheusslichkeiten ekelte mich an.
Im Aarauerhof wurde einmal ein deutscher Propagandafilm gezeigt. Walters Mutter, Emmi, nahm uns mit. Es handelte sich um die Darstellung einer Seeschlacht. Marinesoldaten beschiessen ein Schlachtschiff des Gegners. Gewaltige Rauchwolken steigen aus dessen Rumpf. Die Sodaten schreien begeistert: Volltreffer! Zum Schluss wurde das Publikum um eine Gabe angebettelt. Ich weiss nicht, ob die Frau Wurm etwas spendete.
Wie schon als kleines Kind konnte mich auch im Primarschulalter und noch später alles was mit Schiessen und Geknalle verbunden war nur erschrecken. Dazu passt aber nicht, dass ich viel Zeit aufwendete, eine Armbrust zu basteln und, Karbidexplosionen zu experimentieren. Nicht zu meiner Furcht vor Geknalle war meine Teilnahme am Knabenschiessen. Das war für Zürcher Buben eine Art Initiationsritus. Kuzsichtige Brillenträger wie ich, haben wenig Chance, Lorbeeren zu gewinnen.

7.1
Zwischenstufe: Sekundarschule. Ich verdanke es zwar dem es dem Ehrgeiz der Mutter, dass ich die Mittelschule besuchen und mit der Matur abschliessen konnte. Dazu kam es aber über einen Umweg, denn die Primarlehrerin fand, ich sei noch zu klein und nicht reif und kräftig genug um den Eintritt ins Gymnasium zu schaffen und riet meiner Mutter, mich zunächst in die Sekundarschule zu schicken. Die Sekundarschule war in einem altmodischen mächtigen, neugotischen Backsteinbau am Hirschengraben untergebracht. Der überladene, halb gotisch-historisch halb jugenstilartige Bau soll zur Zeit der Planung für vorbildlich und kinderfreundlich gegolten haben, gefiel mir ebenso wenig wie der rückständige Stil des Unterrichts durch drei überalterte Lehrer, Bosshart für Mathematik, Naturwissenschaft und Französisch und Kübler für Deutsch und Geschichte. Musik gab ein ausgedörrter mürrischer und ebenso ruhestandbedürftiger Mensch. Religion gab ein Pfarrer, der sympathischste und jüngste neben den anderen, den greisen Pädagogen. Es war ser Pfarrer Frick, nicht der Grossmünster-Pfarrer gleichen Namens, der mich später taufte und konfirmierte. Bosshart kaute dauernd an einem Stumpen und teilte ebenso häufig Ohrfeigen aus wie sein Kollege Kübler.
Die Mutter unterstützte mich unterdessen beim Repetieren des Stoffes der sechsten Primarschulklasse, denn das war zum Bestehen der Aufnahmeprüfung ins Gymnasium verlangt.
7.2
In dieses Sekundarschul-Jahr fielen zwei Todesfälle, die mich zutiefst erschütterten.
Kurt Zindel war ein Klassenkamerad seit der dritten Primarschulklasse. Hier galt er als Musterschüler. Er wohnte mit seiner berufstätigen Mutter und deren Schwester im damals modernen Mehrfamilienhaus am Pfauen. Kurt war ihr einziges Kind. Das Thema meiner Freundschaft mit Kurt drehte um die komplizierte Einrichtung seiner elektrischen Eisenbahn, um die automatischen Weichen und die Geschwindigkeits-regulierung mit Hilfe des Transformers und auf das jeweils neueste Globibuch. Er besass alle Bände von der Ersterscheinung 1939 bis zum gegenwärtigen Jahr. Ausserdem konnte er dank seinem speziellen Gedächtnis die Abfahrtszeiten aller Züge vom Hauptbahnhof Zürich. Mit seinem freundlichen Naturell vermittelte er mir nie den Eindruck des verwöhnten Einzelkindes oder gar des Aufschneiders. Er liess mich ohne weiteres teilnehmen an seinem Spielen und lieh mir vertrauensvoll seine Globibücher aus. Kurt war auch in der ersten Klasse der Sekundarschule ein Klassenkamerad. Unsere Freundschaft schlief aber ein, weil er immer häufiger fehlte. Niemand erklärte uns, seinen Klassenkameraden, dass eine schwere Krankheit der Grund dafür war. Anders als in der Primarschule wirkte er jetzt blass und in sich gekehrt. Mir schien, dass die alten Sekundarlehrer wenig Rücksicht nahmen auf seine zunehmende Schwäche. Sie gleich grob mit ihm umgingen wie mit uns den Gesunden. Erst bei seiner Beerdigung merkte ich ihr ungerechtes Verhalten gegenüber diesem bleichen, stummen, zurückgezogenen Schüler. Obschon ich mich, als sein Schulfreund, auch nicht um ihn gekümmert hatte, sondern mich fraglos von ihm distanzierte. Über den Grund seiner häufigen Absenzen sprach niemand.
Nachdem Kurt lange und schliesslich endgültig dem Unterricht ferngeblieben war, verkündete der Lehrer Bosshart eines Tages, Kurt sei gestorben. An der Beerdigung musste die ganze Klasse zum Friedhof auf der Allmend Fluntern teilnehmen.
Die Beerdigung war schrecklich. Als der weisse Sarg in das Erdloch versenkt wurde, schrie die Mutter verzweifelt auf: „Kurtli...Kurtli! Dann wurden wir nach Hause entlassen. Nach der Beerdigung und während den folgenden Tagenn und Schulstunden scheiegen alle weiter: der Pfarrer, die Lehrer und auch meine Eltern. So war das Ende des Freundes Kurt Zindel.
7.3
Der Cousin Alex Meier starb wenige Wochen später.
Er wurde 18 Jahre alt. Er war der einzige Sohn der Tante Berti, einer älteren Schwester meiner Mutter und deren Ehemann. Alfred (Fred) Meier. Dieser war von Beruf Holzschnitzer gewesen. Als die mit geschnitzten Blumen und Schnörkeln verzierten Jugendstil-Möbel aus der Mode gekommen waren, wurde er schon früh als Arbeitsloser eine Zeitlang entschädigt, suchte oder fand (es war während der Krisenzeit der Dreissigerjahre) aber keinen anderen, sondern erkannte seine Berufung im heute wieder gesellschaftsfähig gewordenen Beruf als Hausmann. Die wie alle Sennhausertöchter äusserst tüchtige Berti lernte Verkäuferin in Filialen des Konsum Denner, wurde rasch Filialleiterin und mit zunehmender Häufigkeit zur Rettung abgewirtschafteter Filialen eingesetzt. Damit ernährte sie ihren Mann und den Sohn. Im Gegensatz zur Krankengeschichte von Kurt, hielt mich meine Mutter auf dem Laufenden. Die Krankheit, welche bei Alex zum Tod führte, begann mit Gelenkrheumatismus, einer Infektionskrankheit, die seit der Einführung des Penicillins in Europa fast ganz verschwunden ist. Sie war die Ursache vieler schwerwiegender Komplikationen, zum Beispiel der teilweisen Zerstörung der Herzklappen. Ich vermute, dass Alex an der schwersten der Komplikationen, der perakuten Streptokokkensepsis innert wenigen Stunden gestorben ist. Die Abdankung fand in dem mit altägyptischen Sphinxen dekorierten Krematorium im Sihlfeld in Zürich statt. Ich weiss nicht mehr, ob ein Pfarrer die Abdankung hielt. Der im Konsumgeschäft Denner als Ausläufer arbeitende Gesangstudent sang eine Arie aus dem Händeloratorium Jephtha. Diese Musik wirkte so tief und physisch fast unerträglich, so schmerzhaft wie ich Trauer seither nie mehr erlebt hatte. Beim Verlassen der kalten düsteren Abdankungshalle brach die Tante Berti heulend in Tränen aus.


Historischer Hintergrund. Der Stellvetreter Hitlers unterschreibt am 7. Mai 1945 die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht.
Churchill besucht Zürich. In der Aula der Universität hält er seine berühmte Rede “An die studierende Jugend Europas“. Sie wurde mit Lautsprechern ins Freie übertragen. So konnte ich sie hören. Soviel ich von seinem Englisch verstand, rief er die akademische Jugend auf, an der Einigung Europas zu arbeiten.
Mein Vater bringt die Nachricht vom Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki.
Der Kalte Krieg: USA-Bürger lassen sich atomsbombenichere Unterstände bauen.
Was ist das, “Atom“? Der Rektor Hardmeier, Physiklehrer und Rektor an unserem Gymnasium, hält für alle Schüler einen Vortrag über dieses Thema.
Die Marshall-Hilfe an Deutschland: das Wirtschaftswunder.
Ulbricht Präsident der DDR.
Dag Hamarskjöld wird Generalsekretär der UNO. Ich habe in seinem Buch ”Zeichen am Wege“ gelesen, Seine tiefsinnigen, nicht immer leicht verständlichen Gedanken, offenbaren einen von sublimer christlicher Ethik bewegten Menschen. Er ist beim Absturz des UNO-Fluzeugs zwischen dem Kongo und Katanga umgekommen, vermutlich war es ein geplantes Attentat.
8.2
Das Gymnasium der Knaben war im alten klassizistischen Kantonsschulgebäude untergebracht.
Heute befindet sich das Gymnasium im gegenüberliegenden Park im “Rämibüel“ einem modernen klotzigen Betonbau. In unserem alten Schulgebäude, das “Lümmelburg“ genannt wurde, sind jetzt verschiedene Lehranstalten untergebracht.
8.2.1
Fünf markante Lehrer:
Mathematik unterrichtete vor der Matur, nach zwei Vorgängern, der ruhige und geduldige Professor Hess. Im Gymnasium unterschied sich die Mathematik grundlegend von derjenigen der Sekundarschule.
Vereinfacht dargestellt: In der Sekundarschulgeometrie war ein Punkt das kleine Loch der Zirkelspitze im Papier beim Zeichnen eines Kreises, in der Mittelschule der abstrakte Nullpunkt der euklidischen Geometrie
Spannend fand ich, dass es in der Arithmetik ausser unserem üblichen Zehnersystem noch viele andere Systeme geben kann.
Als ich in Ruth verliebt und mit dem Wandbildern für das Gymifest beschäftigt war, erlitt ich einen massiven Absturz der Mathematiknoten. Ich hasste die algebraischen Gleichungen. Zudem hatte ich für die Mathematik-Hausaufgaben einfach keine Zeit (und keine Lust) mehr. Aufgeholt habe ich von der fünften Klasse an. Ich wurde wieder fleissiger, denn ich wollte Medizin studieren. Mit der analytischen Geometrie, der Goniometrie, der Differential- und der Integralrechnung fand ich die Mathematik wieder interessant.
8.3
Deutsch gabvvon der dritten Klasse an bis zur Matur Dr.Arthur Häny. Er war begeistert von Friedrich Hölderlin, Hugo von Hofmannsthal und Jeremias Gotthelf. Wir lasen und diskutierten aber auch Grorg Trakl und sogar Franz Kafka (“Die Verwandlung“), der damals erst bekannt zu werden begann. Neben dem Schreiben von Stunden- und Heimaufsätzen verlangte er häufig Vortragsübungen. Für meinen Vortrag über den “Tod in Venedig“ und “Tristan undIsolde“ von Thomas Mann brauchte ich zwei Unterrichtsstunden. Ich hatte dazu auch den “Doktor Faustus“ gelesen und einige andere seiner Novellen und das so intensiv, dass ich mich mit den für Thomas Mann typischen Protagonisten zu identifizieren begann, mit diesen ein wenig lebensschwachen, künstlerisch begabten Sprösslingen alter Familien und einer mediterranen Beimischung, also mit dunkeln Augen und Haaren. Mein Freund, Fritz Römer, war blond und hatte blaue Augen. Er war sportlich, grösser und stärker als ich. Er hatte schon eine intime Beziehung mit seinem Mädchen, als ich noch auf Distanz in Sonja und Esther, Kolleginnen vom Konfirmationsuntericht, verliebt war, ohne dass ich mich getraute, ihnen meine Liebe zu gestehen. Fritz wirkte auf mich wie der vitale Gegentypus zu mir, dem etwas degenerierten Künstlertypen der Erzählmgen von Thomas Mann. Beide Thomas-Mann-Vorträge hielt ich in des Autors etwas gekünstleten und langfädigen Schriftsprache. Nicht nur mit dem Inhalt, sondern auch mit der Sprache hatte ich mich total identifiziert. Ich merkte, dass Arthur Häny vom ersten, fast einstündigen Vortrag so beeindruckt war, dass er mir eine zweite Stunde gewährte. Damit nicht genug. Andere Lehrer machten in unserer Klasse lobende Bemerkungen dazu. Wahrscheinlich hat Häny im Lehrerzimmer davon erzählt. Es schien ungewöhnlich zu sein, dass ein junger Gymnasiast ausgehend von Thomas Mann selbständig auf den Unterschied zwischen naïver und sentimentaler Dichtung kam, den Aufsatz von Friedrich Schiller über diesesThema ausfindig machte, ihn las und verstand.
Ich hoffe, dass dieser Bericht nicht als Eigenlob verstanden wird. Zugegeben, ich war zunächst auf den Erfolg meiner aufwändigen Beschäftigung mit Thomas Mann ein wenig stolz. Meine Identifikation mit seinen morbiden Protagonisten aber löste eine Krise von Selbstzweifeln aus. Ich fing an, mich selber für ebenso lebensuntüchtig zu halten, was mein schon asthenisches Selbstwertgefühl noch mehr schwächte. Zum Glück hat mich das wirkliche Leben (und die Liebe) aus meiner Thomas-Mann-Krise schliesslich wieder zurückgeholt.
8.4
Der Biologielehrer Professor Konrad Escher. Um der einzigartigen Qualität seines Geographie (in der Unterstufe) und Biologie-Unterrichtes gerecht zu werden, brauchte ich zehn eng beschriebene A4-Seiten. Im ersten Schulzimmer, das im Sommer unter einem Glasdach drückend heiss war, lernten wir den Sonnenstand zu bestimmten Zeiten an verschiedenen geografischen Orten zu berechnen (worum es sich genau handelte weiss ich nicht mehr). Er brachte eine Reproduktion der frühesten Landkarte der Schweiz und der Gygerkarte des Kantons Zürich, die erste mit Hilfe der Triangulation geschaffenen und deshalb schon sehr genauen Karte. Er legte grossen Wert auf saubere und disziplinierte Führung der Hefte, besonders der vielen Zeichnungen, für welche er jeweils einen besonderen Raster an die Wandtafel zeichnete, den wir genau ins Heft kopieren mussten. Für unsorgfältige Heftseiten gab es folgende Sanktion: “Meyermännchen, mit dem Heft aufmarschieren! Ritschratsch Einheitstaxe“ und die hässliche Seite war herausgerissen mit der Auflage, diese bis zur nächsten Stunde fein säuberlich nochmals auszuführen und ihm zu zeigen. Er liebte es, uns vor den Unterrichtsstunden eine kurze Prüfung (zwei Minuten), ein “Ex“ schreiben zu lassen. Das ging so: “Ich zeige ein Tier“, damit brachte er irgendein Lebewesen aus einem der von ihm oft besuchten Teiche, beispielsweise einen Molch oder einen Süsswasserpolypen, den man beschreiben musste. Oder er stellte einige kurze Fragen. Schlechte Resultate gab er dem Betroffenen zurück mit den Worten: „“Note zwei sangen die Engel!“. Bei solchen didaktisch nötigen Korrekturen zeigte er sich nie verärgert wie gewisse andere Lehrer, sondern wirkte geradezu munter. Einmal stand in einer Vase eine wunderschöne Lilie im Schulzimmer. Den Unterricht begann er mit der Frage: “Warum ist diese Blüte da?“. Antwort der Schüler: “Wir werden wohl wieder ein Ex darüber schreiben müssen.“ Professor Escher, ganz ernsthaft: “Nein, sondern weil sie schön ist.“ Jede seiner Lektionen war in allen Einzelheiten auf einer Karteikarte, gezeichnet und notiert. Es schien, dass er eine Sammlung dieser Karten hatte um in allen Klassen des gleichen Stoff zu vermitteln. Er destilierte aus dem riesigen Stoff der Biologie viele für die Lebensäusserungen von Pflanzen und Tieren typische Erscheinungen. Zum Beispiel, wie die Spritzgurke ihre Samen so weit von sich weg spritzte, damit ihre Sprösslinge später ihre Mutter nicht um ihren Biotop konkurrenzierten, ähnlich wie das der Löwenzahn mit seinen fliegenden Samen erreicht. Wunderbar war die Exkursion in das Wehrenbachtobel. Mitte Mai gab es da eine Vielfalt von zum Teil seltenen Pflanzen, zum Beispiel zwei Fleischfressende, das Fettkraut und der Sonnentau. Um eine der heftig musizierenden Grillen sichtbar zu machen, steckt er einen Grashalm in ihr Loch. Das so gestörte schwarze Tierchen flieht dann aus seinem Versteck kann gefangen und betrachtet werden (und wieder freigelassen). In diesem Biotop, so nahe dem Stadtzentrum, wuchsen auch verschiedene Arten Orchideen der Gattung Orchis, dem “Knabenkraut“. Ich nahm eine Nachtfalterorchis nach Hause für mein Schlafzimmer. Sie verströmte in der Nacht einen paradiesischen, erotisierenden Duft. In der Oberstufe mussten wir als Semesterarbeit ein Herbarium anlegen mit mindestens vierzig wilden Pflanzen. ich hatte zu jener Zeit schon manche Pflanze gezeichnet so dass ich es wagte, die vierzig Pflanzen zu zeichnen statt zu pressen. Das gefiel dem Papa Escher sehr und er bemerkte, dass ich, hätte ich im sechszehnten Jahrhundert gelebt, ein so berühmter Botanikzeicher wie Leonhart Fuchs (1501 -1566) hätte werden können. Er besass einen Band dieses Künstlers, worin die in Holzschnitt gedruckten Pflanzen von begabten Kindern des Zürcher Waisenhauses koloriert worden waren. Eine Spezialität von “Papa“ Escher war sein “Cincera-Archiv“, worin er die Charakteristika jedes Schülers notierte mit der Ankündigung, dass er jedem Schüler zur Hochzeit einen Auszug aus dem individuellen Dossier senden würde. Das hat er für mich leider verpasst. Cincera kopierte mit seinem Spitzelsystem McCarthy, den USA-Senator, der jeden Mitbürger notierte, der auf irgend eine Art etwas mit Kommunismus zu tun hatte. Herr Cincera wollte wahrscheinlich in der Schweiz die Kommunisten-Paranoia der McCarthy-Ära einführen). Mit diesem Titel für sein Schüler-Dosser hat Professor Escher den Herrn Cincera sanft verspottet.
8.5
Italienisch, Freifach mit Dr. Stiefel. Er gab uns die Hausaufgabe, während einigen Tagen ein Tagebuch auf Italienisch zu schreiben. Ich war damals so sehr mit den Gedanken an Ruth erfüllt, dass ich sie zum Thema meines Tagebuchs machte. Ich merkte, dass sich die italienische Sprache für den Ausdruck von Liebesgefühlen besonders gut eignet.
Stiefel gab uns das Buch von Carlo Levi, “Cristo si è fermato a Eboli“ zu lesen, die eindrucksvoll erzählte Erfahrung eines vom Mussolini-Faschismus verbannten Arztes und Kunstmalers. Er begegnete im äusersten Süden Italiens einem Volk von armen Bauern, die vermutlich vor Jahrtausenden, schon vor der indoeuropäischen Invvasion, das Land besiedelt hatten. Er erlebte sie als quasi fossile Gesellschaft, die noch eine prähistorische magische Art zu leben und zu denken bewahrt hattte. Diees wunderbare Buch blieb mir unvergesslich. 1999, auf unserer Reise nach Apulien besuchten wir einen Schauplatz des Romans, Matera. Das Dorf liegt am abschüssigen Rand einer hohen Felswand, den Sassi. Dutzende von Höhlen durchlöchern diesen Fels, die früher von den ärmsten Familien bewohnt wurden. Zu Levis Zeiten war die Gegend von Malaria verseucht. Jetzt werden die Höhlenwohnungen an romantikbegeisterte Touristen vermietet. Jahrzehnte später lernte ich eine ähnliche Schilderung dieses magischen Stadiums unserer Vorfahren kennen und zwar aus dem Kanton Uri. Der Arzt Dr.Renner, der in Andermatt praktiziert hatte, beschrieb in seinem Buch “Der Ring über Uri“ die Lebens- und Denkungsart seiner Landleute, deren alltägliches Dasein früher von der gleichen urtümlichen magischen Tradition durchdrungen war.
8.6
Professor Herrmann Frei, genannt Ibicus gab Latein, nach Siegfried. Er wurde zu dieser Zeit gerade Siebzig. Unsere Klasse schenkte ihm zum Geburtstag einen Bildband mit den Radierungen von Rembrandte Im Gegensatz zu den nachfolgenden Lateinlehrer unserer Klasse verzichtete er darauf, uns allzusehr mit der lateinischen Grammatik zu drangsalieren. Vielmehr war ihm daran gelegen etwas von der Kultur und Lebensweise in der Antike mitzugeben. Ofr überstzte er uns (fliessend!) Texte aus der griechischen Literatur vor. Für die unvermeidlichen Extemporalien gabe er uns von ihm handgeschriebene Zettel mit lateinischen Texten zum übersetzen. Er gab selten Noten unter einer 4, fast immer eine 5, oder etwas seltener eine 6.
Nachdem Philosophie als Freifach nicht mehr belegt werden konnte, war er bereit, philosophisch interessierte Schüler für Privatissima zu sich nach Hause einzuladen. Ich erinnere mich noch an seine Erklärungen zu “The Conquest of Happyness“ von Bertrand Russel, ein dezidiert anti-bürgerlicher Mathematiker und Denker. Ibikus besuchte Jazzkonzerte in Willisau, als Jazz noch nicht für ernsthafte Kunst gehalten wurde. Er wollte wissen, was die Jugend interessiert.
Auch besuchte er manchmal am Biologieunterricht von Prof.Escher um dann in unserer nächsten Lateinstunde seine philosophischen Gedanken dazu mit uns zu teilen. Ein Beispiel: Er wunderte sich, dass es im Verborgenen von Gewässern eine solche Vielfalt und Fülle von eigenartigen Lebewesen gibt, deren Existenz und Sinn sich den Menschen entziehe. Er zeigte damit, was ich viel später während der Philosophieseminare lernte, dass der Anfang desPhilosophierens sei, dass man sich verwundern könne.
8.7
Die anderen Lehrer
Ausser den oben genannten erinnere ich mich noch an:
Bosshard (“Bobo“) Latein (nach Frei)
Gegenschatz Latein bis zur Matur (nach Bosshard)
Siegfried Latein (Unterstufe), Geschichte
Müller “Phimü“ Physik (nach Kramer)
Philipp Haerle Französisch (nach Chaton, nach ?)
Bertschinger Englisch (nach?)
Armin Schibler Musik
Viktor Aerni Zeichnen
Chemie Grob (nach Peyer)
Rebsamen Geografie (nach ?)
Pfändler Turnen, (dann ?)
? Doppelte Buchhaltung
Hugentobler? Stenographie
Jeder einzelne unserer Lehrer verdiente ausführlich
Ich bin sehr dankbar für diese Schule und ihre Lehrer. Sie haben mir, jeder auf seine Weise den Blick für die Weite der Welt geöffnet, das Bewusstsein für Zusammenhänge geweckt also mich zu Denken gelehrt.
8.8
Die Maturprüfungen
Im Zusammenhang mit den Maturitätsprüfungen erlebte ich drastisch die Spätwirkung dessen, was man mir in der Kinheit an Erziehung hat angedeien lassen. Obschon mir die meisten der für die Matur zählenden Notten bekannt waren, und ich annehmen musste, dass sie selbst bei mittelmässigen Prüfungsnoten weitaus genügt hätten, war ich überzeugt, dass ich die Matur nur knapp oder überhaupt nicht bestehen würde. Die Störung meines Selbstwertgefühls war dermassen tief in mir verwurzelt, dass ich allen diesen Bewertungen zum Trotz von meinem Versagen überzeugt war.
Nach der letzten Notenkonerenz kammen einzelne Lehrer auf mich zu um mich zu beglückwünschen. Auch jetzt noch verstand ich die Gratulationen ganz verkehrt: Das war, meinte ich, weil ich entgegen den Erwartungen die Matur doch noch bestanden hätte.
Die Abschlussfeier mit den Eltern und den Lahrern fand in der französischen Kirche statt. Der Rektor Hardmeier rief die nun “Maturi“ genannten Mittelschüler einen nach dem Andern auf in der Reihenfolge ihrer Prüfungsnoten. Als Ersten rief der Rektor Ruedi Hiestand an Rednerpult. Ruedi war in der ganzen Schule bekannt für sein phänomenales Gedächtnis. Nach der Matur studierte er Geschichte und spezialisierte sich auf Byzanz. Als Zweiter wurde ich aufgerufen. Das konnte ich nicht fassen. Langsam erhob ich mich von der Bank und musste schamvolles Gähnen unterdrücken. Der Rektor schenkte mir ein Buch mit der Wirmung: “Für gute Leistungen, Hardmeier,Rektor.“ Diese Geschichte tönt unwahrscheinlich, aber genau so habe ich sie erlebt. Ich habe sie nicht aufgeschrieben, um meinen Schulerfolg an die grosse Glocke zu hängen. Im Gegenteil, ich schäme mich meiner kathastrofal verkehrten Selbsteinschätzung. Das falsche Selbstbild verfolge mich mein ganzes Leben hindurch und führte zu einigen fatalen Fehlentscheidungen. Noch jetzt träume ich fast jeden Monat einmal, dess ich die Maturprüfungen oder das Staatsexamen nicht bestanden härre und deswegen die letzte Klassse oder da letzte Semester wiederholen müsse und für die Vorbereitung auf die Prüfung in Innerer Medizin mir allerdings die damals aktuellen Bücher fehlten.
Der Französischlehrer machte einmal eine (lernpsychologisch ungeschickte) Umfrage, wer der Klassenbste sei, Er nannte alle Hauptfächer, also die Sprachen, die Geschichte, die Naturwissenschaften
Konzert in der Kathedrale
und die Mathematik. Meine Klassenkameraden waren sich neidlos einig dass ich in all diesen Fächern der Beste sei. Das Endresultat war: Ich hatte das beste Zeugnis der Klasse und das Zweitbeste des ganzen Jahrgangs.


8.9
Kathedralen
Als nach dem Krieg die Grenzen ins Ausland wieder geöffnet wurden war die erste Auslandreise eine Schulexkursion nach Strassburg. Der Kathedrale: es war das erse al, dass ich eine richtig grosse hochgotische Kathedrale erlebte: Der Eindruck war überwältigend. Ich verstand Goethe den den durch und durch mit dem Stil der Klassik erfüllt war, dass vor diesem Riesenwerk mitelalterlicher Gotteanbetung, sein klassisches Altertum eine Zeit lang in den Hintergrundgeriet. 1950 ging es auf die nächste Frankreichfahrt mit Peter Burri, einem Freund aus der Nachbarschaft. Mit dem Velo ging es zuerst von Zürich nach Belford: mit dem Nachtzug nach Paris. Morgens um sechs Uhr durchquerten wir Paris. Auf der Champs Elisées gabe es noch fast keine Autos, aber von Pferden oder Eseln gezogene zweiräderige Wagen: wahrscheinlich Bauern, die ihre Produkte in die Halles, di Pariser Markthallen brachten. Von Paris aus radelten wir dem Lauf der Seine entlang, von einer Jugenheerberge zur nächsten bis in die Normandie, nach Etretat. Das vom
der Brandung aus den Falaises geformten Felsentor: das Motiv fü einigen Inpressionisten.
Die Rückfahrt nach Paris fühte über Chartras mit seiner Katehthedrale. Nicht himmelsstürmende Gotik sonder noch etwas von der Festigkeit der etwas wuchtigeren ronanischen Bauweise ie Rückfahrt nach Paris fühte über Chartras mit seiner Katehthedrale. Nicht himmelsstürmende Gotik sonder noch etwas von der Festigkeit der etwas wuchtigeren ronanischen Bauweise
8.10
A la echerche du tems perdu
Anfangs bezweifelte ich noch die Echtheit dieser tief- erotische Stimmung, welche dieses frühreife, ein wenig rundliche Mädchen mit den wunderbaren blonden Haaren in mir zu wckte. Ruth B. war ja mit ihren zwischen vierzehn und fünfzehn Jahren noch ein Kind! Ich war früher dann und wann ein wenig verliebt (wie S. In der Primarschule, Kap. ) Das aber war das erste Mal: Diese plötzliche und so intensive Liebeserfahrung war für mich so neu. dass sie mir neben der Lust manchmal Angst machten. Wenn ich allein war und nachts vor dem Einschlafen, drehte sich meine Liebesphantasie unablässig um die Sehnsucht, mit Ruthli zu schlafen.
Dazu müssten wir noch mindestens sechs Jahre warten! Eine unermesslich lange Zeit!
Ich hatte mir verboten, vor der Ehe Liebe zu machen. In ihrer und meiner damaligen Lebenssituation wäre eine Schwangerschaft katastrophal gewesen. Obschon ich nicht extrem prüde erzogen worden bin, hätte ein solcher ungeplanter Zwischenfall gegen die bürgerlichen Moralgrundsätze meiner Familie, besonders der Mutter und gegen mein eigenes christliches Ideal verstossen. Ausserdem war ich noch lange nicht imstande, für die Fortsetzung und die Folgen einer intimen Liebeseziehung
die Verantwortung zu übernehmen. Aber ich glaubte zu spühren, dass Ruth in ihrem jugendlichen Liebessturm sofort mitspielen würde. Ich konnte (oder wollte) jedoch nicht verhindern, mir die Sehnsucht nach dem Körper meiner Geliebten mit den sinnlichsten Einbildungen zu beleben. Ich stellte mir vor, wo und wie wir uns umarmen und wie die Empfängnis verhütet werden könnte. In Theorie wusste ich davon, sah mich aber unfähig und nicht in der Lage, solches in die Tat umzusetzen. Ich müsste der Ruth dann hoch und heilig die Heirat versprechen. Zu diesem Gelübte fühlte ich mich meiner Gefühle für sie und meiner Standfestigkeit doch nicht genügend sicher.
Aber wenn mein Arm auf ihrer Schulter lag, und ihre kühle weiche, zarte Wange so innig meine Hand streichelt, und ihre Küsse so leidenschaftlich... wenn ich sie so umfangen hielt, dass meine Hand nicht mehr wusste was sie tat...
Die Eltern B. wollten mich kennen lernen und liessen mich durch Ruth nach E. einladen. Wie ich am Bahnhof auf den Zug nach Erlenbach wartete und dabei innerlich zitterte vor Angst. Muss denn die Liebe mit soviel Angst bezahlt werden?
Das Das Haus der Familie B.ist eine stattliche historische Villa mit einem Zwiebelkuppelturm. Man kann sie für ein kleines Schloss halten. Da hingen noch alte Bilder, vielleicht die Ahnengalerie der vornehmen Besitzer. Die Möbel waren wertvolle Antiquitäten. Das Badezimmer hatte die Masse eines Salons. Es war ganz mit rosarotem Marmor ausgekleidet. Vermutlich hatte der Vater B. dieses Anwesen mitsamt der ganzen Einrichtung gekauft. Demnach musste er recht vermöglich sein, obschon er und seine Frau nicht recht in diese museale Umgebung passten. Die Mutter von Ruth schien mir nichts weniger zu sein als eine Schlossdame: Eine gemütliche Matrone. Sie demonstrierte mir ihre Bildungsungsbeflissenheit und redete davon, einen Englischkurs zu besuchen,”to brush up my English“.
Durchs Speisezimmer mit dem langen Tisch, der für den Nachmittagstee gedeckt war, gelangte man in eine verglaste Jugendstil-Veranda, so geräumig, dass der mächtige Billardtisch darin Platz gefunden hatte. Hier traf ich den Vater an,, der daran war, sich in dieser Kunst zu üben. Er war ein kleiner, vergnügt wirkender, etwas rundlicher Mann. Nachdem wir uns begrüsst hatten, forderte er mich zum Mitspielen auf. Auf dem grünen Feld stand ein Holzpilz. Man muss die Kugel mit der Queue so anstossen, dass sie den Pilz trifft und umwirft. Beim allerersten Anstoss, den ich in je meinem Leben gemacht hatte, schoss ich den Pilz ab, was den Herrn B. erstaunte und erfreute. Die Stimmung hätte nicht besser sein können. Es schien, als ob dieser Junge, der eben erst daran war, sich auf die Maturitätsprüfungen vorzubereiten, als Schwiegersohn in spe nicht unwillkommen wäre. Dieses Thema war natürlich nicht berührt worden. Es gab keine Inquisition über meine Familie, keine moralischen Ermahnungen. Ich weiss nicht mehr, ob die Rede auf mein geplantes Medizinstudium kam.
Der Vater hatte eben eine neue, seine dritte, Zahnarztpraxis eröffnet. Anscheinend liess er in diesen Praxen angestellte Assistenten für sich arbeiten. Eine gemütliche Art reich zu werden.
Ruth hatte noch zwei jüngere Geschwister, einen Bruder und eine Schwester (hiess sie Anneli?).
Anneli war im Kinderspital. Im Tagebuch hatte ich unter dem Datum vom 4. April 1951 den Besuch beschrieben:
“Zwischen Glaswänden liegt unter weissem Leinenzeug ein weisses Mädchen mit blauen Augen, dunkelblondem Haarschopf, dünnem Hälschen und langen, schmalen weissen Händen. Diagose: etwas wie Blutvergiftung ohne bekannte Ursache. Sie ist lebhaft; es geht ihr besser als Ruth angenommen hatte. Bald merkte ich, dass sie sehr intelligent war und reifer als die meisten Dreizehnjährigen.
Mir ihrer hinfälligen Schönheit, ihrer Reife und etwas wehmütige Lustigkeit empfand ich ihr gegenüber eine starke Anziehung. ohne dass diese meine Liebe zu Ruth überschattet hätte.Ich nenne Anneli mit einer gewissen Beschämung beim Vornahmen und duze es, wäthrend sie mit kaum merklicher Ironie sagt: Möchten sie sich setzen, Herr Meyer?“ So steht es im Tagebuch.
Ich vermute, dass sie an Leukämie erkrankt war und nicht mehr lange leben würde. Leider habe Ich nie erfahren, wie es ihr später ergangen ist.
Ich ging mit Ruth zu einigen Anlässen: Zum Konzert barocker Musik mit dem kürzlich zuvor gegründeten Zürcher Kammerorchester unter Edmont de Stoutz im Haus zur Schipf in Herrliberg und zur Komödie” Leonce und Lena“ von Georg Büchner im Neumarkttheater. Am” Zürifest“ hatte sich eine schlanke Rosmarie, eine Freundin von Ruth, zu uns gesellt, sodass ich nicht ohne Stolz mit zwei Mädchen an den Armen durch die Altstadt Zürichs spazierte von einem Tanzboden zum andern.
Frau Buchmann, unsere ”Hausmeistersfrau“ an der Minervastrasse, hatte mich zu einer Aufführung der Matthäuspassion von Bach in der Tonhalle eingeladen. In der Pause erschien Ruth parfümiert und mit damals modischen Keramik-Ohrenclips. Sie hatte sich vorher telefonisch angekündigt. Wenn später immer irgendwo dieses Parfum in der Umgebung war, sehnte ich mich plötzlich wieder nach Ruth mit ihrer rührenden Anhänglichkeit. Sie hatte, nur um mich zu sehen, für sich noch eine Karte für dieses Konzert gekauft. Ich war doppelt berührt von ihrem spontanen Rendez-vous und vom Schlusschor der Mathäuspassion: ”Wir legen Ihn mit Tränen nieder“ und. Die Erinnerung an diese Musik und an diesen Text bewegt mich immer noch. Ein anderes gemeinsames Musikerlebnis waren die sommerlichen Orgelkonzerte im Grossmünster. Da spielte der Münsterorganist Schlatter neben den alten barocken Komponisten auch Stücke von Fauré und Dupré. Dann und wann kamen so berühmte Meister des Orgelspiels wie Dupré persönlich aus Paris. Manchmal waren auch meine Eltern dabei.
So lernten sie Ruth kennen. Mein Vater nannte sie
”Ankebälleli“. Und die Mutter verstieg sich zu folgender Heldentat: Sie sah dass das Ruthli, wahrscheinlich in der Hoffnung, mich anzutreffen, einmal vor unsrem Haus stand. So wie auch ich oft mit dem Velo nach Erlenbach fuhr und um ihren Palast herumschlich. Der Geniestreich meines Mütterchens bestand nun darin, vors Haus, zur Ruth auf die Strasse hinunter zu steigen um sie wegzujagen, nicht nur um die nächste Strassenecke sondern sie musste sich zweihundert Meter weit bis zum Zeltweg entfernen! Ruth hat mir glücklicherweise nie davon erzählt. Ich weiss nicht was ich dann aus Wut angestellt hätte! Die Mutter hat es mir erst erzählt als sie schon über achtzig Jahre alt war.
Unter dem 25. April 1950 fand ich im Tagebuch die Kopie eines der vielen Briefe, die ich an Ruth geschrieben hatte. Wir hatten versucht, uns sechs Wochen nicht mehr anzurufen, zu schreiben oder zu sehen, um das allzu heftige Verlangen nach Nähe abzukühlen.
Noch vor Ablauf dieses Moratoriums hatte mir Ruth jedoch telefoniert. Daraufhin schrieb ich ihr diesen Brief:
“Meine liebe Ruth!
Du wunderst Dich vielleicht über diesen Brief, da ich Dich doch viel bequemer mit dem Telefon erreichen könnte.
Ich wundere mich sogar selbst darüber; so kann ich Dir also keinen vernünftigen Grund dafür angebe. „Le coeur a des raisons que la raison ne connaît point“.
Deine Telfhonanrufe haben mich etwas stutzig gemacht; hast Du nicht realisiert, wie lange sechs Wochen sein können, als Du mir die Abmachung vorschlugst?
Ich hatte mir fest vorgenommen, diese sechs Wochendes Schweigens einzuhalten; aber dazu hätte auch gehört, dass ich alle Gedanken, die sich mit Dir beschäftigten, verbannte.
Ich sehe jetzt ein, dass es sinnlos ist, unsere Trennung stur weiterzuführen....
Wenn ich unter einem blütenbeladenen duftenden Jasminzweig durchgehe, glaube ich Dich ganz nah zu fühlen.”
Ausschnitt aus dem Tagebucheintrag vom 13.Juni 1951:
“Letzten Samstag habe ich mit Ruth ‘Leonce und Lena’ von Georg Büchner gesehen, aufgeführt von einer Amateurgruppe im Theater am Neumarkt. Ich konnte nicht widerstehen, meiner Freundin möglichst nahe zu rücken. Dann, sobald das Licht zum Szenenbeginn erlosch, fühlte ich ein Köpfchen auf meinen Schultern und feine Haare, meine Wange streicheln.“
Erinnerungen an Ruth haben mich alten Knaben jetzt so bewegt, dass ich für diesen Abschnitt den etwas larmoyanten Titel von Marcel Proust passend fand.
Die leidenschaftlichen Gefühle für meine kleine Freundin haben mich damals so heftig aufgewühlt, wie ich das später nie mehr mit dieser Intensität erlebt habe. Das erste Mal, dass ich mit einer Freundin so innige Zärtlichkeit und Hingabe erlebte.
Mehrmals versuchten wir Beziehungspausen von bis sieben Wochen Dauer einzuschalten. Das sollte unsere Liebesflammen etwas dämpfen. Doch die gegenseitige Anziehungskraft überstieg bei weitem unsere Versuche mit weiser Zurückhaltung. Entweder sie oder ich schrieben oder telefonierten uns meistens schon nach ein paar Tagen.
Es gab damals nur eine Möglichkeit, eine Katastrophe zu vermeiden: Endgültige Trennung
Am Schluss ihres letzten, ihres Abschiedsbriefes, schrieb sie:
“ ....dass Du mich liebst und nicht vegisst“
Nein, liebe Ruth, ich habe dich nicht vergessen!
8.11
Skifahren in Bivio. Nicolas Zucker, Richard Braun, noch zwei andere Kollegen aus der Maturklasse (Reto Zobrist, Georg Weber?) und wir hatten oberhalb Bivio am Julierpass eine Hütte gemietet. Es gab eine Küche, eine Stube und ein Heulager aber kein Radio. Als wir mit Fellen an den Skiern von der Busstation im Dorf Bivio zu der Hütte hochstiegen, bemerkte Nicolas: ”Wenn wir wieder von da oben nach Hause fahren, hören wir vielleicht, dass inzwischen Josef Stalin gestorben ist.“ Das war im Jahr 1953. Und der Diktator war in dieser Zeit tatsächlich gestorben.
Weil das Wetter schlecht war, bestiegen wir den Piz Lunghin, mit den Fellen bis an den Fuss des Gipfels, dann mit allen Vieren kletternd bis zum Gipfel. Beim Versuch den Piz d’Err zu besteigen, mussten wir das oberste Stück aufgeben, denn der Wind war so heftig, dass er uns trotz den scharfen Skikanten von der Eisfläche in den Abgrund zu wehen drohte. Nachdem es dann etwa zwei Tage unablässig geschneit hatte, wurde es Richard und mir langweilig. Wir stiegen kurz entschlossen den frisch mit Tiefschnee bedeckten Abhang hinter unserer Hütte schräg nach oben, Ritschi vorn. Plötzlich ertönte ein dumpfes Donnern. Ritschi rief etwas wie “hau ab!“ Aber da bildete sich schon oberhalb von meinem Standort ein breiter Spalt in der Schneedecke, und der untere Teil, auf dem ich stand, begann zu rutschen. Erst nur langsam, dann immer rascher, schoben mich die Schneemassen talwärts. Zum Glück bildete der Abhang bald eine Terrasse. Nachdem ich einige Minuten lang nach unten gestossen worden war, blieb doch das Gesicht unbedeckt während der Schnee schon begonnen hatte, den Kopf nach unten zu drücken. In dieser Lage kam der sonderbare Schlitten zum Stehen, wobei Mund und Nase zum Atmen immer noch unbedeckt geblieben waren. Ich rief nach Ritschi. Da er mich nicht mehr gesehen hatte suchte er mich voller Angst und fand schliesslich meinen Kopf aus dem Schnee ragen und grub mich aus.
Es gab dann noch ein Abenteuer während diesen geschichtsträchtigen Skiferien. Wiederum waren es Richard Braun und ich, denen es langweilig wurde beim Warten auf Skiwetter. Meine Tante Margrit residierte zu dieser Zeit in einem grossenn, vornehmen Gebäude in historizistischem Baustil in der Nähe vom Silsersee als ”Ferienhaus“ der Familie P.. Die Tante wusste, dass ich in der Nähe am Skifahren war und lud mich ein, sie zu besuchen. Ritschi und ich fuhren eines Tages dem Julierpass entlang ins Engadin hinunter und quer durch die Ebene zur Tante Margrit. Sie empfing uns mit einem Glas Porto. Als ich erzählte, was wir im Sinn hatten, nämlich in St.Moritz tanzen zu gehen, schenkte sie uns zwanzig Franken. Damit setzte wir den Langlauf fort, über den gefrorenen See bis zur “Chesa Grischuna“ , von wo wir Musik hörten. Da gab es ein kleines Orchester mit singender Säge. Wir bestellten Café crème. Die zwei Tassen kosteten gerade schon die Hälfte unseres Budgets, so dass wir auf die Suche gingen nach einem billigeren Tanzlokal. Wir gelangten in ein einfacheres Etablissement mit Musik, wo vermutlich die Hotelangestellten ihre Freistunden verbrachten.
Waren es die klobigen Skischuhe, welche uns lauter Körbe einbrachte? Um Mitternacht machten wir uns auf den Heimweg. Nie habe ich den Eindruck des strahlenden, von den Myriaden Sternen übersähten Himmels vergessen, der sich über uns ausspannte, als wir von Bivio aufwärs stiegen. Um sechs Uhr morgens kamen wir in unserer Hütte an.
8.12
Das Kuriositätenkabinett
In meinem Schlafzimmer an der Minervastrasse stand ein kleiner zweitüriger Schrank aus dunklem Holz. Jedes Mal, wenn ich eine Türe öffnete, traf mich der strafende Blick der formalingetrübten Augen eines Katzenkopfes. Es war der Kopf vom geliebten Büsi der Familie Schneebeli, die im Parterre unter uns wohnten. Seit Monaten harrte dieses Präparat in einem Einmachglas der Untersuchung. Wie gelangte der Katzenkopf ins Kuriositätenkabinett?
Ich wurde eines Tages Zeuge davon, wie die Katze über den Bretterzaun in unseren Garten sprang, einen Schrei ausstiess und tot liegen blieb. Bald darauf standen die zwei kleinen Schneebeli-Mädchen weinend bei der soeben Verstorbenen. Ich bat ihre Eltern um Erlaubnis zur Obduktion. Ich wolle die Todesursache herausfinden. Zudem lockte es mich, mit dem neu erworbenen Sezierwerkzeug die inneren Organe freizulegen. Von Anatomie verstand ich noch nicht viel. In der Waschküche öffete ich Brust und Bauch des Tierchens und war erstaunt über den sauberen Glanz der die Bauchorgane überzog. Um das Gehirn zu untersuchen, hätte ich die Schädeldecke ablösen müssen, doch fehlte mir die dazu notwendige feine Säge. Der Kopf wurde deshalb abgetrennt, in Formalinlösung getaucht und für die spätere Untersuchung in mein Kuriositätenkabinett gestellt. Die vor der Waschküchentüre weinende Familie informierte ich über den Obduktionsbefund: Todesursache noch unklar, aber es werde weiter geforscht. Die Beisetzung der kopflosen Leiche fand im Garten statt.
Bald drängten sich, neben der Schularbeit neue interessante Projekte auf. Wenn das Kopfpräparat nicht nach weiteren Monaten entsorgt worden wäre, würde mich der Katzenblick immer noch anklagen. Das Ereignis offenbart einen für mich leider typischen Charakterzug: Die rasche Initiative und Begeisterung für ein Projekt wird sogleich durch neue Ideen auf die lange Bank verdrängt wo es endgütig liegenbleibt und vermodert.
Im Kuriositätenkabinett landeten noch andere Zeugen unerledigter Projekte. So die Pflanzenpresse im Hinblick auf ein künftiges Herbarium. Noch eine Tierleiche wartete vergeblich auf den Zugriff der Wissenchaft. Ich hatte einige Male versucht am Zürichsee zu fischen. Einmal fieng ich eine Schwale. Statt den ohnehin nicht sehr schmackhaften Fisch in Mutters Küche zu bringen, verschwand sie ebenfalls im Formalin. Dort blieb sie jahrelang.
Eine besondere Geschichte umrankt den etwas lädierten Totenschädel, der seine zweite und vorletzte Ruhestätte unter den gesammelten Kuriositäten gefunden hatte. Auf einer Fahrt mit der rhätischen Bahn machten wir, mein Bruder, ein Freund und ich einen Aufenthalt in Tiefenkastel. Es soll in der Nähe, einen abgelegenen Ort namens Mistail geben. Dieser Name erinnert an die Kirche des Klosters St.Johann “Müstair“ im Münstertal, wo sich Fresken aus der Zeit Karls des Grossen erhalten haben.
In einer Talsenke, einige hundert Meter unterhalb des DorfesTiefenkastel entdeckten wir das von wuchrndem Gebüsch und alten Bäumen verborgene Kirchlein San Peder mit den wie in Müstair drei karolingischen Absiden und einem riesigen Christphorus an der Eingangsfassade. Im Innern waren noch Reste einer Bemalung zu erkennen. Die Jahrzehnte spätere Renovation brchte interessante Wandmalereien zum Vorschein. Erst beim Verlassen der Kirche fiel mir ein zur Ruine verkommenes Häuschen auf, das der Kirche angebaute Beinhaus, vollgestopft mit Schädeln und aufeinander gebeigten verschieden langen Gebeinen. Auf einer schief hängenden Holztafel war noch ein Mahnspruch zu entziffern: “Was ihr seid, das waren wir, was wir sind das werdet ihr“. Dieses verwarloste Ossarium verführte mich zu einem Diebstahl. Ich steckte einen der am besten erhaltenen Schädel in den Rucksack, in der Absicht, daran im künftigen Anatomieunterricht die komplizierte Struktur der Schädelknochen zu studieren.
Eine Schachtel im Kabinett verströmte den Geruch von gedörrtem Fisch. Er ging aus von vertrockneten Seepferdchen, Seesternen und Muscheln. Wahrscheinlich hatte meine Mutter diese Preziosen von ihrer Arbeitsstelle in der Nähe von Sète am Strand des Mittelmeers mitgebracht. Sooft ich später selbst den warmen Strand eines Meeres absuchte, nie habe ich diese niedlichen, im warmen Meerwasser zappelnden Wesen in der Natur gesehen. Sind sie am Aussterben? Lebende Hippokampi sah ich zum ersten Mal in den Aquarien von Monaco.
Und dann gab es in meiner Schatzkammer auch das Anfangsstadium einer Mineraliensammlung: einige Stücke vom grünem Serpentin, die ich am Piz Lunghin gefunden hatte. Viel später kam ein kubisches Stück Salz vom Toten Meer dazu. Am Ufer der gesättigen Salzlösung des Meerwassers verfestigt es sich zum Mineral. Es nimmt aber selten seine eigentlich ideale kubische Kristallform an. Häufiger entstehen bizarre Säulen, in welchen bibelfeste Pilger die zur Salzsäule erstarrte Ehefrau des Lot zu erkenen glubten.
Israel: Auf der Fahrt von Berscheba nach Eilat heben sich in der Nähe rechts der Strasse einige Meter hohe Hügel grüner Steinbrocken vom gelben Sandboden der Wüste ab. Das sind Überbleibsel der Kupferbergwerke des Königs Salomo. Einige der schönen, giftig-grünen Stücke Kupfererz brachte ich mit nach Hause: Das war das Specimen Nr.3 meiner Mineraliensammlung in spe.
Im Garten meines Paten am Genfersees wimmelte es von Spinnen. Der frühere Besitzer des Anwesens war der Professor Delessert. Er interessierte sich für diese Achtbeiner. Da gab es auch viele Sechsbeiner, schöne Schmetterlinge und Heuschrecken mit blauen oder roten Flügeln, die sich nur im Moment des Sprungs entfalteten. Um die Tierchen ins Jenseits zu befördern und auf eine Unterlage zu stecken, benutzte ich die langen dünnen Insektennadeln und Äthyläther. Mit den so präparierten Insekten ergänzte ich die schon im Kuriositätenschrank ruhenden Käfer und Schmetterlinge. Jahzehnte später kamen Mitbringsel aus Afrika dazu: ein riesiges Nachtpfauenauge, ein ebeso mächtiger gelbgrüner Schwalbenschwanz, ein Nashornkäfer und ein eindrucksvoll grosser schwarzer Skorpion.
8.13
Fische und Stabheuschrecken. Auf dem Kabinett-Kasten gab es noch Platz. Da drauf kamen zwei Aquarien zu stehen, die ich mit meinem Freund Fritz gebastelt hatte. Es ist ein Glück, wenn junge Leute nicht viel Taschengeld bekommen. Solcher Mangel macht erfinderisch. Beim benachbarten Spengler bekamen wir streifenförmige Blechabfälle, die wir der Länge nach zu Winkel bogen. Wir fügten sie mit Nieten zum Gerüst des Wasserbehälters zusammen. Das Glas bezogen wir vom Brockenhaus. Bei meinem Vater hatte ich Glasschneiden gelernt.
Wenn die Glasscheiben eingesetzt sind, werden die Ecken mit einer Art Asphalt (Goudron) abgedichtet. Den Glasboden bedeckten wir mit sauberem Sand. Für die Sauerstoffversorgung setzten wir Wasserpflanzen, meistens Myriophyllum. Eines der Aquarien soll mit Kaltwasserfischen belebt werden, (Elritzen und die aus Amerika stammenden hübschen Sonnenbarsche), das Andere mit tropischen, also Warmwasserfischen.
Wie wärmten wir das Wasser für die Südamerikaner? In Zurich gab es in der Nahe der Hochschulen einen Spezialladen für wissenschaftliche Glaswaren. Dort bekommt man für wenig Geld Glasröhrchen. Zum Glück kochte meine Mutter mit Gas, sodass wir in einer Gasflamme das Glas weich erhitzen und zur U-Form biegen konnten. In jede der zwei Öffnungen kommt ein Korkzapfen. Durch jeden wird ein etwa 30 cm langer isolierter Draht getossen. An jedem der beiden Drahtenden wird einer der Kohlenstifte aus gebrauchten Taschenlampenbatterien angelötet. Beide Stifte tauchen in eine Kochsalzlösung. Und jetzt kommt das waghalsige Moment: Jedes der zwei aus den Korkzapfen ragenden isolierten Drahtstücke wird an je einen Pol eines normalen Netzsteckers angeschlossen. Es fliesst dann sogleich der Wechselstrom des Haushalts durch den aus den zwei Drähten und den zwei in die Kochsalzlösung tauchenden Kohlestiften bestehenden Apparat. Aber Aufgepasst, dass man beim Anschluss nicht einen Stromschlag bekommt! Vielleicht brennt auch die Haushaltsicherung durch. Beides ist uns nicht passiert. Wir erhöhten vorsichtig die Konzentration von Kochsalz und schoben die Kohlestifte sachte weiter in das Salzwasser. Man muss aufpassen, dass der Röhrcheninhalt nicht zum Sieden kommmt. Diese kleine Heizung wird ins Aquariumwasser gehängt und wenn die richtige Temperatur des Aquariumwassers (etwa dreissig Grad) erreicht ist, dürfen die Guppys und die farbig leuchtenden Neonfischchen aus dem engen Konfitürenglas in ihre neue Heimat ausschwärmen.
Beim Schreiben dieser Jugenderinnerung denke ich dankbar an die Toleranz und das Vertrauen meiner Eltern. Wie viele Eltern von Heute würden ihren Buben eine so gefährliche Bastelei gestatten? Welcher Kontrolleur des EWZ würde nicht gleich die Polizei rufen?
Alles ist uns wunderbar gelungen. Welcher Spass, wenn alle Fischlein an die Wasseroberfläche kommen, kaum nähere ich mich mit der Futterbüchse.
Aber mit der Zeit bildete sich um beide Aquarien eine Wasserpfütze. Die Ursache: der Wasserdruck spreizte die seitlichen Winkelbleche auseinander. Deshalb hatte es in der Goudrondichtung Risse gegeben. Wir hätten die obere Glaskante auch mit Winkelblechen verstärken müssen.
Die Wirkung von Wasserdruck auf eine senkrechte Fläche war acht Jahre später eine der Prüfungsaufgaben in Physik, dem ersten ”Prope“: Ich musste die Schwerlinie des Wasserdrucks auf eine Staumauer berechnen.
Neben dem Museum von biologischen Reliquien und den Fischchen gab es noch andere lebende Tiere: Goldhamster, die alle paar Wochen Nachwuchs warfen. Für unsere Kinder gab es später einmal Streifeneichhörnchen und immer wieder Katzen, die alle den Namen „Pitschi“ bekamen. Eine Haselmaus starb leider bald nach ihrer Gefangennahme. Tobias trauerte um den Verlust des putzigen Tierchens, das er liebevoll ”Mausi“ genannt hatte.
Auf einem meiner Streifzüge im Wald fand ich eine Insektenpuppe, vermutlich von einem Scmetterling, die an einem dürren Zweig hing. Sie hatte die Gestalt einer surrealistischen Skulptur. Sie wartete geduldig in einem der unentbehrlichen Konfitürengläser. Eines Tages bemerkte ich einen Riss im dünnen Panzer der Chrysalide. Nach und nach erschienen zusammengefaltete Schmetterlingflügel, deren feinen Adern sich zu strecken begannen, und der schlanke dunkle Körper mit dem winzigen Kopf und seinen Fühlern wurden sichtbar. Langsam tastete sich das Tierchen aus seiner Hülle. Nachdem sich die Flügel vollends entfaltet hatten, klammerte sich ein farbenprächtiges Tagpfauenauge mit seinen dünnen Beinchen zitternd am dürren Zweig fest. Während den Minuten dieser wundersamen Geburt empfand ich Ehrfurcht wie beim Anhören von zarter Musik.
Stabheuschrecken waren Bewohner eines weiteren, natürlich trockenen Aquariums. Der Biologielehrer überliess mir einige dieser niedlichen spindeldürren Insekten. Sie sind mit ihren 5 bis 6 cm langen hellbraunen Körpern von den Zweigen des Ligusters kaum zu unterschaden, bilden also ein perfektes Mimikri. Die Eigenart dieser dakbaren Tierchen ist ihre Parthenogenese: Sie legen dauernd etwa 3 mm grosse Eier. Wie lange es dauert, bis die Jungen schlüpfenl, konnte ich nicht herausfinden. Die niedlichen fadendünnen Kinder nähren sich sogleich, wie die “Eltern” vom den Ligusterbättern, die ich jeweils von der Ligusterhecke erntete.
Der Name “Stabheuschrecke” stimmt durchaus mit ihrer Körperform überein. Aber zum Erschrecken, also für weite und hohe Sprünge fehlen ihnen die kräftigen muskulösen Hinterbeine.

9.1
Wie ich zur Bibel kam. In der Oberstufe der Primarschule erzählte die Lehrerin die spannenden Geschichten aus dem alten und dem neuen Testament und sprach im Zusammenhang mit der Berufung des Samuel (1.Sam.3,1-21) über die christlichen Meditationen der “Guppenbewegung“ von Caux. Mein Schulfreund, Hannes Ginsberg und ich, waren fasziniert von der Möglichkeit durch innere Stille Gottes Stimme zu vernehmen.
Hannes lieh mir seine durch Schnorr von Karolsfeld illustrierte Bibel mit den für Kinder verständlichen Texten. In der Sekundarschule wurde uns eine gekürzte Ausgabe der Zürcher Bibel gegeben. Ich begann sogleich darin zu lesen.
1945 starb im Alter von neunzig Jahren die Urgrosstante Berta Meyer von Knonau ohne Nachkommen. Sie war eine entfernte Grosstante meines Vaters, so dass auch er eine gewisse Erbberechtigung hatte. Nachdem die zahlreichen Erben noch alle mehr oder weniger wertvollen Gegenstände, die sich in der Wohnung der Entschlafenen vorfanden, in Besitz genommen hatten, füllte ein Antiquar sein Dreirad-Lieferwägelchen mit den Resten, unter Anderem, was von der Bibliothek keinen der Erben interessiert hatte. Bevor er wegtuckerte durfte ich diesen Bücherhaufen noch einmal durchstöbern. Da fand ich eine grosse schwarze Zürcher Bibel in gotischer Schrift mit den Apokryphen. Das war einer der Auslöser für mein lebenslanges Bibelstudium.
9.2
Erschtterungen. Der Tod des Primarschulfreundes Kurt Zindel und im gleichen Jahr (1945) des Cousins Alex Meier erschütterte mich so sehr, dass ich auf viele Jahre hinaus am Sinn aller weltlichen Bemühungen, die das Leben forderte, zutiefst zweifelte. Wozu hatte Kurt noch die französische Verbenkonjugation lernen müssen, die ihm so viel Mühe machte und ihm die Schelte des Lehrers eintrug? Mir schienen die Erwachsenen ihrer Trauer und Erschütterung gänzlich hilflos ausgeliefert zu sein. Niemand, weder der Pfarrer, noch die Lehrer, noch die Eltern waren imstande uns, ihren Kindern und Schülern, eine Erklärung zu geben oder auch nur darüber zu sprechen. Alle schwiegen.
Das Schweigen der Erwachsenen enttäuschte mich. Mir wurde bewusst; Antworten auf die eigentlich allein wichtigen menschlichen Fragen sind von den Erwachsenen, unseren Lehrern, Erziehern und Vorbildern, nicht zu erwarten. Zutiefst in mir nagte der Zweifel an allen menschlichen Zielen, Pflichten und Sinngebungen, von denen die Erwachsenen uns überzeugen wollten. Das Einzige, was mir einen gewissen inneren Halt gab, war, was ich von Texten der Bibel und dann von einzelnen Theologen (Eduard Schweizer und Emil Brunner) und später von den Philosophen Kierkegaard und Pascal zu verstehen begann. Diese beiden Denker waren zutiefst im christlichen Glauben verwurzelt, aber voller Kritik und Zweifel gegenüber den traditionellen kirchlichen Autoritäten.
Eine Folge dieser Erfahrung war, dass ich mich von der Erwachsenenwelt entfremdete. Von meinen Eltern, besonders von der Mutter, meinem bisherigen “Überich“. Sie war meine unanfechtbare oberste moralische Instanz gewesen. In den Evangelien entdeckte ich eine unendlich feinere, viel tiefer gehende Ethik und Weisheit. Im Vergleich damit verblassten und enttäuschten mich die mütterlichen Prinzipien. Das Vertauen auf die Zuständigkeit der meisten Vorbilder und Autoritäten ging mir verloren.
Äusserlich allerdings erfüllte ich gehorsam, was die Eltern und die Lehrer an Anstand und Fleiss von mir erwarteten. Es kam deshalb nie zu sichtbaren Auseinandersetzungen mit den Erziehern und die Schulleistungen waren fast immer gut.
9.3
Taufe und Konfirmation. Meine konfessionslosen Eltern hatten mich nicht taufen lassen und mich nicht in die "Kinderlehre" der Kirche geschickt. Die Wirkung meiner unabhängigen Suche nach dem christlichen Ethos war, dass ich vom elterlichen Agnostizismus Abstand nahm und mich taufen und konfirmieren lassen wollte. Die Taufe fand kurz vor der Konfirmation bei uns zu Hause an der Minervastrasse durch den Grossmünsterpfarrer Frick statt. Die Eltern hatten nichts dagegen, dass mit mir auch gleich mein Bruder Conrad getauft wurde. Er war damals etwa elf Jahre alt. Für Conrad wurde die Tante Emmi Patin und Hans Gerber in Buchillon (in absentia) Pate. Meine Paten wurde Hans Walter (auch in Buchillon und abwesend) und die Tante Alice.
Ich ging zu den Sonntagspredigten im Grossmünster, hörte im Fraumünster die Predigten von Emil Brunner und in der Flunternkirche Eduard Schweizer. Das Buch von Brunner “Das Missverständnis der Kirche“ war für mich ein Markstein zum Verständnis gewisser kirchlicher Strukturen. Das begründete auch meine Zurückhaltung gegenüber dem institutionalisierten Christentum. Ich begann zu verstehen, warum es im Lauf der Geschichte zu vielen durch die Kirchen jeder Konfession betriebenen Missbräuche, Verbrechen und Kriege kam. Wie oft wurden Kirchen als Macht- und Verfolgungsapparate missbraucht statt zu bezeugen, was in den Evangelien deutlich geschrieben steht, nämlich die Armut, Demut und die Menschenliebe selbst gegenüber seinen Feinden so wie es Jesus Christus uns vorlebte. Das ist vielleicht einer der Gründe, weshalb sich viele human denkende Menschen, wie meine Eltern*) von der Kirche abgewendet haben (auch unter dem Einfluss des Sozialismus). Dennoch hat das Christentum, dieser "Schatz in irdenen (manchmal korrupten) Gefässen" nicht nur überlebt, sondern ist im Lauf der vergangenen zweitausend Jahre immer wieder durch einzelne Menschen und Bewegungen innerhalb oder ausserhalb der offiziellen Kirchen aufgeblüht und zur Wirkung gekommen (Beispiele: Franz von Assisi, Niklaus von Flüe, Jan Hus, Martin Luther, John Weseley).
*) Mein Vater sagte manchmal, dass ihn der christliche Sozialismus des Theologen Leonhard Ragaz überzeugt habe.
9.4
Erst nach der Konfirmation begann ich durch die Predigten von Brunner und Schweizer den eigentlichen Sinn des Glaubens an Jesus Christus zu verstehen. Emil Brunner sagte einmal in einer Predigt: "Es gibt zwei Arten von Menschen, diejenigen, die eine Hoffnung haben und und diejenigen, die keine Hoffnung haben." Von Emil Brunner habe ich auch zum erstenmal gehört, was das Sterben von Jesus am Kreuz bedutet: die Sühne (eigentlich eher “Heilung“) für den Zustand der Menschheit in Verlassenheit und Ferne von Gott, der sie erschaffen hat und liebt. Die "Sünde", von der Jesus die Menschen erlöst hat, ist ihre Gottesferne. Wie es zu diesem desolaten Zustand kam, erzählen in symbolischer Sprache die ersten Kapitel der Genesis, des ersten Mosesbuches. Für mich bleibt es ein schwer verständliches Geheimnis.
Um zu erklären, wie der Heilige Geist zu begreifen sei, brauchte Emil Brunner das Bild eines Radioempfängers. Wenn er auf Empfang eingestellt ist, kann er die "Sendungen" Gottes empfangen.
Wie die Apostelgeschichte berichtet, hat der spätere Apostel Paulus eine dramatische Bekehrung erlebt (das sogenannte “Damaskuserlebnis“). Bekehrung ist vom Menschen aus die Entscheidung, die Erlaubnis, die Freiheit, glauben zu dürfen, zu können. Doch ist sie auch und zuvor die Einwirkung "von oben" , von Gott, vom Vater "im Himmel". Im Evangelium des Johannes (3,3) steht der geheimnisvolle Satz: "Wer nicht von oben geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen". Im Vers 6 sagt Jesus weiter: "Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist". Der Glaubende wird, bildlich gesprochen, in ein neues Leben, hinein (wieder-) geboren.
Es geht um den Heiligen Geist Gottes, der, wie es in diesem Text weiter heisst, "weht wo er will, und du hörst sein Sausen, weisst aber nicht, woher er kommt und wohin er geht". Menschen, die solche Wiedergeburt aus dem Geist erfahren haben, wirken in den Augen der Mitmenschen in ihrem Verhalten und Denken manchmal ungewöhnlich, unvrtständlich, absurd, Ärger erregend. Es wurde und wird manchmal als ein gegen den “gesunden Menschenverstand“ stehenden “Skandal“ empfunden und bekämpft oder auch als unerhebliche Bagatelle übergangen und verdrängt.
9.5
Die Studentenbibelgruppe. Während des ganzen Jahres im Konfirmationsunterricht am Zürcher Grossmünster hörte ich von Pfarrer Frick keine Erklärung der zentralen Aussagen der Evangelien, sondern nur moralische Wegweisungen**). Den Inhalt der Evangelien liess er uns im Heidelberger Katechismus lesen, ohne uns zu erklären, was diese trockenen Glaubenssätze für das eigene Leben bedeuten.
**) u.a. Über die Verwerflichkeit der Onanie, was mich paradoxerweise erst auf die Idee brachte...
Als ich mit dem Medizinstudium begann, suchte ich in der Universität Zürich Anschluss an eine christliche Studentengruppe. Es gab die landeskirchliche Studentengemeinde und die Studentenbibelgruppe. Wegen meinem Vorbehalt dem Kirchlichen gegenüber wählte ich die Zusammenkünfte der Bibelgruppe, die sich “GBU“ (Groupe Biblique Universitaire) nannte nach dem Vorbild der Französisch sprechenden Hochschulen der Westschweiz. Später hiessen sie “VBG“, Vereinigte Bibelgruppen. Man kam in der Regel jede Woche an einem Abend bei einem der Gruppenleiter zu Hause oder im Studentenhaus zusammen. Man las während eines Semesters wenn möglich ein ganzes Buch der Bibel, jeweils ein Kapitel nach dem andern und versuchte den Inhalt, die Bedeutung und die Anwendung im persönlichen Leben zu verstehen Dier Leitung hatte jeweils jemand der älteren Studierenden mit eigener Erfahrung oder solchen, die an einer Ausbildungsfreizeit teilgenommen hatten.
Im Studentenhaus an der Attenhoferstrasse Zürich lernte ich den Leiter der VBG, Dr.phil. Hans Bürki, kennen. Er legte während eines Semesters an mehreren Abenden den Brief des Apostels Paulus an die Römer aus. Seine Vorträge waren gescheit, auf das Niveau von Hochschulstudenten abgestimmt, auf Grund seiner grossen Bibelkenntnis auf ein klares Ziel gerichtet. Er erklärte den Zuhörerern, was Glauben an Jesus Christus bedeutet. Ein Christ wird man durch die persönliche Entscheidung zum Glauben. In der biblischen Sprache: durch "Bekehrung" und "Wiedergeburt“. Die Predigten von Emil Brunner und Eduard Schweizer lehrten mich den Sinn der Evangelien intelektutuell zu verstehen. Es fehlte ihnen aber der Hinweis auf die Bedeutung der persönlichen Entscheidung für den Glauben an den Jesus wie es in den Evangelien von ihm geschrieben steht.
In seinen Vorträgen ging Hans Bürki davon aus, dass nicht nur den Agnostikern, und Atheisten sondern auch vielen Leuten, die dem Namen nach als Christen gelten, die persönliche Erfahrung des erlösenden Glaubens fehlt. Warum ist gerade der etwas schwierige Text des Römerbriefes dazu geeignet, dieses Thema zu erläutern? Weil er in konzentrierter Form die Grundlage des Christlichen Glaubens beschreibi: Nicht durch eigene Anstrengung sondern durch Glauben an den lebendigen Jesus Christus und dessen Erlösungstat kommt der Mensch in liebende Beziehung zu Gott. Darnach ist jeder Meinsch bewusst oder unbewusst auf der Suche. Denn jeder Mensch ist als von Gott Erschaffener darauf angelegt.
Von manchen bedeutend gewordenen Christen weiss man, dass ihnen der Römerbrief ein besonders deutlicher Wegweiser zum erlösenden Glauben war. Martin Luther und John Wesley (der Gründer der Methodistenkirche) gehören dazu. In unserer Zeit hat sich Karl Barth nicht ohne Grund intensiv mit dem Römerbrief befasst.
Hans Bürki war einer der vollzeitlichen Mitarbeiter der VBG, neben seiner Frau Dr.med. Ago Bürki-Filenz.
Seine Vorträge über den Römerbrief und Gespräche mit den älteren Mitstudenten Jeremias Kägi und August Meier, brachten mich zur Einsicht, dass mir trotz meinen ethischen Anstrengung zum Christsein das Entscheidende fehlte.
Ich hatte mich sehr bemüht, gut zu werden, als Christ zu leben. Ich litt darunter, dass ich mich dabei dauernd beobachten, beurteilen und verurteilen musste. Der Zwang zur Selbstbespiegelung wurde zur Qual, fast zum "Verrücktwerden". Diese Art von Ethik führte nicht zur Erlösung sondern zur Verzweiflung. Ich brauchte Hilfe. Nach einem seiner Vorträge bat ich Hans Bürki um eine Unterredung, die er mir an einem der nächsten Tage gewährte.
9.6
Die Entscheidung
Hier folgt ein persönlicher Bericht von einem Erlebnis, das mein weiteres Leben verändert hat. Ich gebe ihn ein wenig zaghaft zum Lesen. Vielleicht wirkt er auf manche Leute befremdend. Dann bitte ich herzlich, das Folgende, so wie ich s zu notieren versucht habe, stehen zu lassen und ALS VERSUCH EINER ART REPORTAGE anzusehen und zu akzeptieren, dass es sich nicht um Einbildung oder etwas aus dem Bereich der Psychopathologie handelt.
Ich sah mich also am 25.Mai 1954 im Büro von Hans Bürki in Zürich, während dem zweiten oder dritten Semester des Medizinstudiums. Ich erzählte ihm von meinem Willen Christ zu werden, von der Verzweiflung an meiner Ethik und meiner Not mit dem Glauben. Hans erklärte mir, was es mit dem dritten Kapitel des Römerbriefes auf sich hat. Keine noch so intensive, opferbereite ethische Bemühung kann einen Menschen mit Gott in eine persönliche, liebevolle und lebendige Beziehung bringen. Mit keinem noch so gewissenhaften eigenen Bemühen kann sich ein Mensch selber erlösen, "gerecht" machen, wie es im Text des Paulus heisst.
Nach etwa einer Stunde fragte mich Hans Bürki, ob ich beten wolle und Gott meine verfehlten “frommen“ Bemühungen bekennen.
Ich war davon ausgegangen, dass ganz andere so genannte Sünden mich von Gott trennten, unter anderem meine Schwierigkeit mit sexuellen Fantasien. Ich spürte, dass ich jetzt vor der Entscheidung stand, mich dem lebendigen Jesus, dem Christus, anzuvertrauen.
Was dann in den folgenden Minuten geschah, lässt sich mit Worten kaum verständlich beschreiben.
Ich begann zu verstehen, dass es diese eigenmächtigen Anstrengungen waren, die mir den Weg zur Erlösung und zur Wahrnehmung der Liebe Gottes versperrten. Das war meine "Sünde". Diesen Kampf und dieses Leiden hatte an meiner Stelle Jesus am Kreuz ausgestanden. Das ist es, was Er vollbracht hat!
Ich spührte deutlich die persönliche Gegenwart von Jesus, dem Christus Gottes. Da brach mein jahrelanger Kampf gegen mich selbst zusammen. Ich durfte “kapitulieren“. Und ich weinte.
Als ich wieder unter anderen Passanten auf der Strasse zur Tramstation ging, schien Helligkeit die ganze Umwelt zu erfüllen. Ohne Zweifel, ich war ein Anderer geworden. Zu Hause merkten meine Eltern, dass eine Veränderung an mir geschehen war. Ich weiss nicht mehr, ob ich ihnen mein Erlebnis erzählen konnte.
Hans Bürki schenkte mir danach eine kleines Bch mit dem Titel “Stille vor dem Herrn“, eine Anleitung zur Einübung in das erlöste Leben, durch biblische Texte und das tägliche Gebet. Der Gebrauch dieser Anleitung weckte und bestätigte mir jeden Morgen für den ganzen Tag das neue, helle, freudige Lebensgefühl.
Hans war bestrebt, mich sogleich als Mitarbeiter der VBG einzusetzen. Vielleicht hätte ich noch mehr Zeit gebraucht, um mich mit der überwältigenden Erfahrung zurecht zu finden. Ich meinte nun meinerseits, diese Erfahrung weiter geben zu müssen, noch bevor ich bis zuinnerst in meiner Gefühls- und Verstandeswelt ganz von der neuen Erfahrung durchdrungen war. Ich erkannte mit der Zeit, dass sich der innere Weg zum reifen Glauben nicht abkürzen lässt.
Ich kannte die Peinlichkeit, die entsteht, wenn Christen bei jeder Gelegenheit und Ungelegenheit meinen, noch ein sogenanntes “Zeugnis” für ihren Christenglauben anbringen zu müssen. Damit machen sie sich selbst und ihre Botschaft nur lächerlich und abstossend. Ein solcher Murks war mir zutiefst zuwider. Und doch meinte ich, mich dazu zwingen zu müssen, also wieder etwas aus eigener Willenskraft zu machen und dabei zu versagen. So wurde ich schon bald meiner gewonnenen Befreiung nicht mehr ganz froh. Es fehlte ein Seelsorger, der mich etwa so ermutigt hätte: “Der Heilige Geist wird schon dafür sorgen, dass deine Begegnungen und Gespräche mit Menschen spontan, interessant und hilfreich verlaufen, ohne dass du dich dauernd selbst zu beobachten und zu beurteilen brauchst“. Ich war jedoch immer noch zu stolz, solche Hlfe zu suchen. Deshalb war für mich unreifen Christen die Leitung der Studentenbibelgruppe eine Überforderung. Es war aber eine wichtige Erfahrung für mich, denn ich war ich in Gefahr, meinen Mitmenschen und vor allem meinen Studienkollegen gegenüber zum Eigenbrödler zu werden. Ich musste meine alte Menschenscheu ablegen.
Noch nach vielen Jahren konnte ich an die Auferstehung und die sogenannte Himmelfahrt von Jesus intellektuell nicht glauben. Ich erlebte, dass der erlösende Glaube nicht vom verstandesmässigen Füwahrhalten dieser Berichte abhängt. Mit der Zeit jedoch entstand in mir eine Art von neuem Intellekt, dem es möglich war, den Sinn dieser wundersamen Erscheinungen zu verstehen, ohne Zwang zum sacrificium intellectus
9.7
Das ideale Berufsziel nach dem Studium war die sogenannte “äussere Mission“, für mich als Medizinstudent die Laufbahn eines Missionsarztes. Ich wollte nicht so sehr missionieren als helfen. “Wo man mit einer Injektion Penicillin noch ein Leben retten kann“, das war meine Vorstellung.
Vorbereitet und bestätigt auf dem Weg, als Christ zu leben, hatten mich auch das Buch des norwegischen Bischofs Halesby. (“Wie ich Christ wurde“) und die Vorlesungen von Theophil Spoerri (Uniprofessor für französische Literatur) über die Pensées von Blaise Pascal. Besonders beeindruckt hattte mich das “Mémorial“, die Einleitung zu den Pensées, die Aufzeichnung seiner überwältigenden Begegnung mit Gott. Blaise Pascal beschreibt darin wie er IHN als gegenwärtige Person erlebte, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, “non des philosophes.“ Pascal, überwältigt von unsagbarer Liebe und Glück begann darauf ein neues Leben zu führen.
Wenn ich zurückblicke auf was sich vor fast sechzig Jahren ereignet hat, muss ich gestehen, dass viele Charakterfehler noch immer an mir haften. Trotz dem Gebot der Nächstenliebe war ich häufig lieblos und nachlässig gegnüber meinen Mitmenschen. Oft war ich richtig blind für sie. Das muss ich bedenken, wenn ich im folgenden Text einigen meiner gläubigen Bekannten und Freunde vorwerfe, sie hätten mich enttäuscht. Später hielt ich mich deswegen für berechtigt, im "Moratorium" allen christlichen Aktivitöten und Beziehungen eine zeitlang den Rücken zu kehren.
Ich wollte also Missionsarzt werden. Diese idee wurde zur Gewissheit während den zwei halbjährigen Praktika bei dem Schweizer Chirurgen Dr.Hans Bernath, der in Nazareth (Israel) in einem britischen Missionsspital für Palästinenser tätig war.
Dann aber, beim Versuch in einer evangelischen Mission in Afrika mit meiner Tätigkeit als Missionsarzt anufangen, kam es zu einem Zusammenbruch.
9.8
Die Enttäuschung.
Das Komitee der Schweizerischen Evangelischen Nillandmission bestand aus einigen Pfarrern ohne eigene Missionserfahrung und einem "Missionsinspektor", der zwar einige Jahre in Aegypten und im Nordsudan gearbeitet, aber eine sehr diffuse und veraltete Vorstellung von ärztlicher Mission hatte. Diese unerfahrenen Kirchenleute hatten für Eritrea (damals noch zu Äthiopien gehörig) ein sehr unklares Projekt entworfenen für den Aufbau einer ärztlichen Missionsstation. Sie hatten sich vorher offensichtlich nicht mit den Voraussetzungen für ein solches Projekt beschäftigt, sonst hätten sie gemerkt, dass Eritrea schon in den Sechzigerjahren ein politisches Pulverfass war, denkbar ungeeignet, um hier Land zu erwerben um ein Spital zu bauen.
Wir (meine Frau Verena, Tobias, 18 Monate alt und ich) trafen in Eritrea auf das Leiterehepaar, Erich und Gretli (!) Schaffner, die sich als enge und überfromme Fundamentalisten erwiesen, deren menschliches Verhalten in jeder Beziehung dem widersprach, was ich mir unter einem Christen vorgestellt hatte. Die beiden waren trotz jahrelanger Erfahrung im Missionsspital von Assuan in Ägypten organisatorisch, fachlich und menschlich sehr ungeschickt.
Ihr Verhalten verärgerte alle Beamten und Geschäftsleute, auf deren Wohkwollen wir angewiesen waren. Als Neulinge haben wir uns anfangs nur verwundert, bald aber konnten wir nicht mehr mithalten.
Gesundheitlich und psychisch havariert kehrten wir nach eineinhalb Jahren in die Schweiz zurück. Es war eigentlich eine Flucht.
9.9
Für die Fortsetzung meiner Ausbildung in Tropenmedizin liess ich mich dann für drei Jahre von der Pharmafirma Hoffmann-LaRoche zur Durchführung von Feldstudien in Moçambique anstellen (Wirkung und Nebenwirkungen von neuen Medikamenten gegen Malaria, Typhus, Bilharziose etc.)
Die letzte Station der Ausbildung in Tropenmedizin war das Kilimanjaro Christian Medical Center (KCMC) im Norden von Tansania, am Fuss des Kibo, des Kilimanjaro-Gipfels.
In die Zeit zwischen Moçambique und Tansania fiel das dreimonatige Sttudium der Tropenmedizin an der Universitöt Liverpool.
In dieserr Zwischenzeit trafen wir in der Schweiz auch wieder mit Freunden und Bekannten aus der Bibelgruppe zusammen. Manche hatten inzwischen ihre Theologie neu konzipiert. Die “Charismatische Bewegung" war entstanden. Man erwartete die unmittelbare Wirkung des Heiligen Geistes, in “Weisungen“, durch Träume, Inspirationen, Visionen und Wunder. Jede unerwartete Bagatelle, wie sie sich im täglichen Leben manchmal ereignet, wurde gleich, Gott lobpreisend, zum sichtbaren Wunder stilisiert. Es schien, als ob das Wrken des Heiligen Geistes wirklich neu erfahren worden wäre. Man begann “in Zungen zu reden“, wie es im Bericht vom Pfingstwunder in der Apostelgeschichte erzählt ist. Diese Bewegung erfasste manche landeskirchliche und freikirchliche Gemeinde. Einige ehemalige Mitarbeiter der Studentenbibelgruppen versammelten sich in einer Gruppe, unter Leitung von E.R. und R.L. um solche Geisteswirkungen zu erfahren. Um diese Bewegung kennen zu lernen, nahmen Verena und ich einige Male an solchen Zusammenkünften teil.
9.10
Wir waren schon seit einigen Tagen in Tansania, als ein warnender Traum mich in der Intuition bestätigt, dass das Getue um wundersame Wirkungen etwas Verlogenes an sich hatte.
“In einer gotischen Kathedrale geschieht von Zeit zu Zeit ein Wunder.
In dieser Kirche, an gut sichtbarer Stelle, stand eine aus Stein gemeisselte Figurengruppe. Die Dargestellten, nämlich Jesus, Maria und ein heiliger Kirchenvater begannen sich dann zu bewegen, als ob sie lebendig würden.
Das anwesende Kirchenvolk war jeweils zu Tränen gerührt und erschüttert über dieses sichtbare Eingreifen Gottes.
Ich wollte wissen wie das zustande kommt und inspizierte die Rückseite der Figuren. Da sass E.R., R.L. und vielleicht noch andere solche Begeisterte und bewegten mit Stäben von ihrem Versteck aus die mit Gelenken versehenen Köpfe, Arme und Beine der Steinskulpturen. Deus ex machina! Noch im Traum war ich empört über diesen Betrug.”
In Tansania arbeitete ich als Leitender Arzt (consultant) auf der Abteilung für innere Medizin im Kilimanjaro Christian Medical Center (KCMC). Dieses Spital stand eininge hundert Meter oberhalb der kleinen Stadt Moshi am Fuss des (damals noch!) eisbedeckten Vulkans Kibo, dem höchsten Berg in afrikanischen Kontinents.
In Moshi gab es die episkopale (anglikanische) Kirche, an deren Gottesdienste manche europäische Entwicklungshelfer teilnahmen. Als der einheimische Bischof diese Gemeinde einmal besuchte und einen Gottesdienst leitete, wurden unsere drei Kinder getauft.
Unser Vertrag mit der deutschen N.G.O. "Dienste in Übersee" war auf drei Jahre angelegt. Um für den Beginn des neuen Schuljahres für die Kinder rechtzeitig in der Schweiz zu sein, kehrten wir etwas von Ablauf dieser Zeit in die Heimat zurück.
9.11
Nach unserer Rückkehr aus Tansania konnten wir ein Haus auf dem Zürichberg mieten. Das war ein Glücksfall, denn es lag nur wenige Gehminuten vom meiner Praxis für innere und Tropenmedizin entfernt, die ich am 26. Juni 1976 eröffnet hatte.
Manche unserer Freunde hatten sich in Zürich der Baptistenkirche angeschlossen. Hier wirkte der Prediger Herr Röther, ein kluger und einfühlsamer Christ,
So gingen auch wir für den Gottesdienst in die Baptistenkirche, hörten seine guten Predigen und trafen einige alte Freunde. Unsere Kinder besuchten den Unterricht bei Herrn Röther und wurden auch von ihm konfirmiert.
9.12
Wieder eine Kehrtwendung. Verena und ich hatten an einer Selbsterfahrungs-Gruppe von Ehepaaren unter Leitung von Ago Bürki teilgenommen. Ago benutzte für einige therapeutische Interventionen Elemente aus der so genannten Gestalttherapie, die mich sehr überzeugten. Statt dem Vorschlag von Dr.Guggenbühl, meinem Analytiker, zu folgen, der mich gerne als Student am C.G.Jung-Institut gesehen hätte, beschloss ich einen Ausbildungsgang in Gestalttherapie zu belegen. Meine Arztpraxis hatte sich damals schon in die Richtung der Psychosomatik entwickelt. Dafür brauchte ich nun eine solide psychotherapeutische Ausbildung.
9.13
Ich besuchte das Auswahlseminar des Fritz-Perls-instituts für Gestalttherapie, das in einer Pension in der Nähe von Nürnberg stattfand. Unter den Teilnehmenden gab es zwei Frauen aus der Schweiz, Malina* und Dagmar. Mit ihnen kam es bald schon zu Nähe und Zärtlichkeit. Das war für mich eine neue, überraschende Erfahrung. Während den kommenden Jahren blieb ich mit ihnen befreundet.
Von da an machte ich in den vielen Gestaltseminarien eine ganz neue Erfahrung: dass ich anscheinend auf gewisse Frauen attraktiv wirkte. Diese für mich unerhörte Neuigkeit löste bei mir so etwas wie eine Sucht aus. Wenn immer an den folgenden Ausbildungveranstaltungen im Kreis der Teilnehmenden eine Frau, auf mich zu kam und Nähe zu mir suchte, konnte ich nicht widerstehen. Während diesen jeweils einige Tage dauernden Seminarien gab es keine soziale Kontrolle und es herrschte eine libertäre Atmosphäre. So konnten leicht intime Beziehungen entstehen. Meine Kontskte zu Frauen waren aber wegen den meist grossen Distanzen der Wohnorte kompliziert und jeses Mal gab es nach meist kurzer Dauer Trennungen. Dieses verrückte Leben benannte ich meinen "Venusberg" (in Anlehnung an die Geschichte des sagenhaften Ritters Tannhäuser).
Das Leben im Venusberg war mit zwei meiner bisherigen Lebenskonstanten nicht mehr vereinbar, mit meiner Ehe und meinem christlichen Glauben. Die Nähe und Zärtlichkeit mit neuen Frauen war süsse erotische Nahrung und Verführung. Danach war in mir heftiges Verlangen geweckt worden. Ich wollte aber kein Doppelleben fürhen. Die Ehe mit Verena geriet trotz unseren Versuchen mit Ehetherapien in eine Krise. Mit der Trennung von ihr verlor ich die tausend Gemeinsamkeiten, die mich mit Verena verbunden hatten, aus den Augen. Es kam zur Scheidung...
9.14
...und zum "Moratorium". Ich war dessen überdrüssig, was ich als Christ zu leben versucht und was ich mit sogenannten Christen erlebt hatte. Ich war allem voran von mir selber ernüchtert, aber auch von dem was ich in Eritrea, in der "Charismatischen Bewegung" und an einigen christlichen Freunden gesehen und an Enttäuschungen erlebt hatte. Ich brauchte eine Pause.
So sah mein “Moratorium“ aus: Ich werde nicht mehr beten, ich werde nicht mehr in der Bibel lesen, ich werde an keinem kirchlichen Gottesdienst mehr teilnehmen.
“Wenn Gott wieder etwas mit mir zu tun haben will, dann wird er sich schon wieder bei mir melden“. Diese Blasphemie, kann ich jetzt nur noch aus dem desolaten Zustand meines damaligen Innenlebens verstehen.
9.15
Christus holt mich zurück. Ich lebte schon einige Jahre mit Hélène zusammen in ihrem wunderschönen Haus in Bberstein. Da kam es dazu, ich weiss nicht mehr wie, dass ich eines Tages mit meinem Moratorium ein Ende machte, indem ich beschloss, still für mich jeden Abend das Unservater und für meine Nächsten zu beten.
Da ist Jesus Christus für mich wieder eine lebendige erlebte Gegenwart geworden, fast wie damals am 25.Mai 1954, nur weniger dramatisch.
Vom kirchlichen Christentum hielt ich noch einen gewissen Abstand. Ich gehe hie und da zur Predigt und zum Abendmahl in die Kirche und besuche die Bibellesegruppe unter Leitung des Pfarrers Beat Hänggi.
Kann ich mich darauf verlassen, dass der Vater mich nach diesem "Moratorium" und den Eskapaden im "Venusberg", den Verlorenen Sohn wieder liebevoll annimmt? Ist es Wirklichkeit, wenn ich die Nähe von Jesus, bewusst zu erfahren glaube und das verborgene innere Wissen, dass Er da ist?
Die Erinnerung an dieses alte Kirchenlied ist die Antwort auf meine Zweifel:
Mir ist Erbarmung widerfahren,
Erbarmung deren ich nicht wert.
Das zähl’ ich zu dem Wunderbaren,
Mein stolzes Herz hat’s nie begehrt

10.1
Die Bewerbung um ein Stipendium für dasMedizinstudium: Dafür wurden Referenzen einiger Mittelschullehrer benötigt. Als Ersten bat ich den Klassenlehrer und deshalb über die Leistungen aller Schüler seiner Klasse orientiert. Er schien hoch erfreut zu sein, weil er anscheinend nur Erfreuliches von mir berichten konnte. Erst an der Zeremonie der Diplomverteilung und der Rangliste nach der Matur merkte ich weshalb er so erfreut war, während er sich doch ständig über die miserablen Lateinkenntnisse unserer Klasse beklagte, Kein Wunder, nachdem wir vier Lateinlehrer hatten und jeder mit einer anderen Unterrichtsmethode. Als nächste Hürde musste ich einem Verwalter auseinandersetzen, weshalb ich Allgemein-Medizin und nicht Zahnmedizin studieren wolle. Er akzeptierte meine etwas philosophischen Argumente. Dann wurde mir auferlegt, jedes Semester einen Bericht zu verfassen. Dafür bekam ich dann pro Semester sechshundertfünfzig Franken. Das reichte gerade für die zu erwerbende Literatur, und die Semestergebühren mit dem AHV-Beitrag. Zum Glück konnte ich bei meinen Eltern wohnen und essen. Am Unangenehmsten war, dass ich mich dann bei jedem Dozenten wieder als Stipendiat vorstellen musste. Die sollten kontrollieren, ob ich zu den Vorlesungen erscheine!
10.2
Medizin ist: Philosophie, Kunst, Naturwissenschaft, Mitmenschlichkeit und Prestige. Das Interesse an der Medizin weckte unter Anderem der Schularzt der Mittelschule, Dr.Wespi (oder Wäspi), als er bei der Röntgendurchleuchtung unserer Klasse den Kopf des Klassenkameraden Zweifel auf dem Schirmbild aufleuchten liess. Diese eigenartig komplizierten Strukturen faszinierten mich wie auch die technischen Möglichkeiten ins Innere des menschlichen Körpers zu sehen.
Dazu kam eine Art von christlichem Bedürfnis den Mitmenschen zu helfen zu können.
Ich stellte mir vor, in einem Land der dritten Welt könne ich nur schon mit einer einfachen Injektion z.B. von Penicillin Leben. So sah ich den Zusammenhang von ärztlicher Hilfeleistung mit christlicher Mission.
Unter dem Einfluss der Tante Margrit (cf. Kap.4 “Trinité“) galt in unserer Familie der Arztberuf als der Vornehmste mit dem höchsten Gewinn an sozialem Prestige. Gleich nach dem Studium ermöglicht die Medizin bald ein gewisses (wenn auch kleines) Einkommen, während die philosophische Fakultät I, zu der einzelne Sprachlehrer am Gymnasium mich für geeignet hielten, zunächst noch zu einem brotlosen Beruf führte. Ausserdem lag mir das Lesen und Schreiben als Haupttätigkeiten nicht, als zu einseitig und zu theoretisch. Es ging mir darum auch handwerklich etwas tun zu können. Bei einem philologischen Studium würde mir ausserdem die Naturwissenschaft fehlen, die mich schon als Primarschüler fasziniert hatte. Mit Fritz Römer zusammen streiften wir in den Riedgebieten um Zürich herum um Fische, Insekten und Amphibien in ihren Biotopen zu beobachten und für unsere selbstgebauten Aquarien zu fangen und zu zeichnen.
Meine Eltern, besonders die Mutter, entwickelte eine erstaunliche Toleranz gegenüber Erfahrungen von der Art, wenn an einem Sonntagmorgen ein aus einem meiner Aquarien entwichener Feuersalamander unter ihrem Toilettentischchen spazieren ging. Nur die Blindschleiche fand bei ihr keine Gnade. Wir hatten auch keine Terrarien um sie unterzubringen. So liessen wir das elegante Tierchen in den Garten schleichen in der Hoffung, dass es dort zum Überleben genug Nahrung finde.
10.3
Die ersten zwei Semester, Das erste so genannte propädeutische Examen umfasst die Basiswissenschaften Physik, Chemie, Zoologie und Botanik.
Das von Professor Wanner am langweiligsten dozierte Fach war Botanik, noch ermüdender dasjenige der Gift- und Arzneimittelpflanzen, eine historische Erinnerung, als in früheren Zeiten die Pflanzenkunde die Grundlage der damaligen Therapiebemühungen war.
Chemie dozierte mit leiser und monotoner Stimme einer der zahlreichen Zürcher Nobelpreisträger nämlich Professor Karrer. Bei ihm lernte man gegen den Schlaf kämpfen. Seine Forschungen über die Gruppe der Carotinoide lagen schon Jahrzehnte zurück. Für die Medizin war der Zusammenhang zwischen dem Karottensaft und dem Vitamin A von grosser Bedeutung. Der Mangel dieses Vitamins führte zur Xerophthalmie, der “Austrocknung“ der Augen, eine Krankheit, die ohne Behandlung mit diesem Vitamin oder seiner Vorstufen (Rüeblisaft!) zur Erblindung führt. In Moçambique bin ich Patienten, besonders Kindern mit Xerophthalmie begegnet. Unter den Studierenden war aber bekannt, dass Professor Karrers beliebteste Prüfungsfrage die Synthese der Schwefelsäuren mit dem so genannten Bleikammerverfahren war.
10.4
Der beste Dozent war der Zoologe und Genetiker Professor Hadorn. Er vermittelte Voraussetzungen für das Verständnis und die Forschung in der gesamten Biologie und besonders auch in der Humanmedizin. Dazu gehört die vergleichende Anatomie: Missbildungen zum Beispiel die Hexadaktylie (die angeborene Sechsfingerigkeit) oder das angeborene Schwänzchen- beschrieben im Roman ”Hundert Jahre Einsamkeit“ von Garcia Màrques), die Bedeutung der Mathematik des Zufalls, für die genetische Forschung, das genetische Verständnis der Evolutionstheorie (Neodarwinismus) und die Auswirkung des Genotyps eines Lebewesens auf seinen Phänotyp, sein Erscheinungsbild..
Schon in der Kantonsschule hatte ich mit dem Maturfach Physik am meisten Mühe, doch die dazu gehörige Mathematik (Differential- und Integralrechnung) lernte ich da schon recht gut. Während dem Gang von zu Hause an die Uni gelang es mir, mit der Zeit, die vom Dozenten Professor Wäffler aufgegebenen Übungen auswendig, nur im Kopf, zu lösen. Das kam mir bei der Prüfung zu gut. Eine der Aufgaben an der mündlichen bestand in der Berechnung der Schwerelinie einer Staumauer. Der Prüfer war so begeistert von meiner Fertigkeit, dass er den etwas hilflosen Witz von der Entropie einer Champagnerflasche erzählte, die ich für diese Leistung zu gut hätte. Es blieb aber bei der Theorie; dafür gab es die Note Sechs.
10.5
An den Nachmittagen fanden die zu den Vorlesungen gehörenden praktischen Übungen statt. Ein Beispiel aus der Zoologie. Das Lieblingstier der Zoologen war die Fruchtfliegem Drosophila melanogaster, denn sie vermehrt sich rasch und zudem besitzt sie in ihrer Speicheldrüse Zellen, deren Chromosomen so gross waren, dass die Lage der Gene mit dem gewöhlichen Lichtmikroskop in der richtigen Reihenfolge abgelesen werden konnte. An Hand dieses Tierchens wurde zum ersten Mal das vollständige Genom eines Tieres bekannt, so wie Jahrzehnte später die vollständige Kenntnis der genetischen Ausstattung des Menschen gelungen war. Auf welche Weise der Abstand der Gene voneinander berechet werden kann lernten wir im Praktikum am Beispiel einer bei der Fruchtfliege durch Bestrahlung erzeugte Missbildung der Flügel. Das numerische Verhältnis der Nachkommen dieser Versuchstiere, die das mutierte Gen 2 mitbekamen zu den normal Gebliebenen (mit dem Gen 1) gibt einen Hinweis auf die das Cross-over-Phänomen zwischen den Genen. Je häufiger Crossovers zwischen zwei verschiedenen Genen stattgefunden hatten, umso grösser musste der Abstand zwischen G1 und G2 gewesen sein, Das also gibt einen Hinweis auf den relativen Genabstand, der im Massstab von Morgan-Einheiten angegeben wird. So ungefähr habe ich diese Art Forschung noch in Erinnerung und war davon fasziniert.
10.6
Ich wollte die Rekrutenschule möglichst rasch hinter mich bringen und meldete mich deshalb zum so genannten Frühprope an, das noch vor Semesterabschluss stattfand. Der Einrücktermin in die RS war so rücksichtslos früh, dass man die Vorlesungen zu den Prüfungsfächern nicht mehr bis zum Schluss besuchen konnte und hoffte, dass man nicht über die noch fehlenden Kenntnisse geprüft wird. Das traf für mich zu und ich hatte noch gute Prüfungsnoten mit zwei Fünfern und zwei Sechsern erreicht.
Nach der Rekrutenschule von vierzehn Wochen und den Semesterferien kehrte man wieder an die Uni zurück für die nächste Vorstufe, im Hinblick auf das zweite Propädeutische Examen, das die Fächer Biochemie, Anatomie mit Embryologie, Physiologie mit den dazugehörigen Praktika, das heisst Laborarbeit (Physiologie) und anatomische Präparation.
10.7
Drittes und viertes Semester und das zweite Propädeutische Examen. Der Name des Dozenten für Biochemie ist mir entfallen, nur an den Übernamen, nämlich “Säuli“ kann ich mich erinnern: er hatte leicht rüsselförmig vorstehende Lippen. Als Prüfungsvorbereitung arbeitenden Ueli Aeppli und ich sein ausgezeichnetes Lehrbuch durch. An der mündlichen Prüfung befragte er mich über die biologische und soziokulturelle Bedeutung von Kochsalz aus, worüber ich nicht viel zu sagen wusste.
Neben der Anatomievorlesung von Pr0f. GianTönduri musste man während zwei Semestern im Seziersaal arbeiten. Der Prosektor Dangel war ein von seinem Fach begeisterter Mann. Er war im Gesicht bleich und mager, so dass er dem Lieferanten seiner Objekte, nämlich dem leibhaften Tod ähnlich aussah. Sein Stolz war. dass er bei einer Leiche, durch minutiöseste Sektion die vollständige Freilegung des Seitenstrangs des Sympathicus ferig gebracht hatte. Das habe einen Besucher, einen weltberühmten Fachmann, zu Tränen gerührt, da man die beiden antagonistischen Systeme des vegetativen Nervensystems, den Sympathicus und den Parasympathicus bisher nur pharmakologisch darstellen konnte, als adrenergisch (Adrenalin) und cholinergisch (Acetylcholin).
10.8
Anatomisches Zeichnen Der Sohn von Prof.Hadorn, Beat studierte im selben Semester wie ich Medizin und war ein guter Zeichner. Er illustrierte ein Buch seines Veters und brachte mich auf den Gedanken, mich auch als Zeichner wissenschaftlicher Publikationen zu betätigen. Auf diese Weise kam ich zu den Aufträgen, für die Neuauflage des Buches von Prof. Gian Tönduri, (Topgrafische Anatomie) Zeichnungen nach anatomischen Präparaten seines Assistenten (Dr. Kubrik aus Ungarn) herzustellen.
Ein Mitarbeiter von Professor Tönduri dozierte Embrylogie. Er brachte einmal angebrütete Eier und demonstrierte das schon pulsierende winzige rote Herz des Hühnerembryos, das punctum saltans, (das unsere Vorfahren schon beobachtet und als den “springenden Punkt“ in die Umgangssprache aufgenommen hatten). Vom ganzen propädeutischen Unterricht hat mich diese Demonstration von beginnendem Leben am meisten beeindruckt.
10.9
Prof. O.A.M. Wyss vermittelte eigentlich nur Kommentare zur Physiologie und setzte das Grundwissen voraus. Dieses verschaffte man sich im Praktikum und den Lehrbüchern. Ich hatte mir das Buch eines brasilianischen Physiologen gekauft, weil es der Dozent so sehr empfohlen hatte. Weil es aber in Englisch war, profitierte ich nicht sehr viel davon. Dennoch bekam ich eine 6 an der praktischen Prüfung, weil ich die kolorimetrische Hämoglobin-Messung nach Sahli mit samt dem mathematischen Wahrscheinlichkeitstest ablieferte.
10.10
Christliche Philisophie. Während den ersten zwei Medizinsemestern belegte ich eine Vorlesung des Professors für französische Literatur, Theophil Spörri über die “Pensées“ von Blaise Pascal. Ich war schon lange auf der Suche nach dem christlichen Glauben und erhoffte mir nach den kirchlichen nun noch Erkenntnisse von einer nicht-kirchlichen Seite. Es war natürlich das sogenannte “Mémorial“ von Pascal, das mich grundlegend bewegte: Es braucht eine “spirituelle“ Erfahrung, die Einwirkung von Gott her.
Das bestätigte, was ich beim Besuch der Predigten von Professor Emil Brunner in der Fraumünsterkirche schon gelernt aber noch nicht erfahren hatte: Das Christentum ist keine Religion nach allgemeinem Verständnis, denn sie weist dem Menschen nicht den anstrengenden Aufstieg “von unten nach oben“ wie alle Religionen, auch die aus dem christlichen Glauben künstlich hergestellten Religiosität. Die Bewegung, die uns zu Gott führt kommt “von oben“, es ist seine Hand, die alle Hindernisse durchbricht und uns zu IHM nach oben hebt. So hat Pascal sein überwältigendes Erlebnis in seinem “Mémorial“ festgehalten. So hat es auch Martin Luther erlebt und aus der Lektüre des Römerbriefes bestätigt gefunden. (Manche andere grosse Denker haben an Hand des Römerbriefes diesen grundlegenden Unterschied zwischen der zur “Religion“ degenerierten Kirchlichkeit und dem eigentlichen christlichen Glauben erkannt, so auch Weseley, dem Gründervater des Methodismus und der Basler Theologieprofessor Karl Barth, Verfasser des Monumentalwerkes, die “Kirchliche Dogmatik“ und von Studien über den Römerbrief. (cf.Kap. 9,)
Aus diesem Suchen kam der Wunsch, mich einer Studentengruppe anzuschliessen, die sich nicht als kirchlich oder als christlich bezeichnet, sondern einfach gemeinsam die Bibel lesen will. So kam ich auf die Studentenbibelgruppe (SBG, GBU später VBG genannt). (cfg. Kap. 9,“Mein Versuch, Chtist zu sein“).
10.11
Das zweite Propädeutische Examen habe ich weniger glänzend bestanden wie das Erste. In der Anatomie musste ich an einer Leiche den Nervus fibularis präparieren, wie er sich um das Köpfchen des Fibularknochens schlingt. Das war keine Kunst und war ein Sechser wert. Wie es in der Physiologie zu einem Sechser kam habe ich oben schon erzählt. In der Biochemie war ich aufs Glatteis geraten als der “Säuli“ mich über das Kochsalz ausfragte.
Zur Feier meines neuen akademischen Titels nämlich “Candidat der Medizin,“ kurz „cand.med.“ (Vorher war ich erst „stud.med.“) luden mich ie Eltern zu einem Nachtessen im Restaurant Stadelhofen ein. Jetzt begannen die Klinikjahre, während welchen wir echte Kranke nicht nur zu sehen bekamen, sondern auch untersuchen und darüber referieren mussten.
10.12
Innere Medizin. Ein erster Eindruck dessen, was man als “Klinik“ bezeichnete, vermittelten die praktischen Kurse von PD Dr. Gloor-Meyer. Er demonstrierte an einem Patienten die Sondierung der Speiseröhre und gab Unterricht in grundlegenden so genannt physikalischen Untersuchungsmethoden, das Abklopfen des Brustkorbes zur Bestimmung der Herzgrösse und der Lungengrenzen und zur Auskultation der Herztöne. Später vermittelte Professor Siegenthaler die Bestimmung der Herztöne zur Diagnostik verschiedener krankhafter Veränderungen an der Anatomie der Herzklappen, der “Ventile“, welche die Blutströmung kontrollieren. Siegenthaler war mir sogleich unsympathisch: Er wirkte stur und perfektionistisch. Erst viel später merkte ich, dass ich damals schon etwas schwerhörig war und deshalb diese sehr leisen Geräusche im Vergleich zu meinen Mitstudenten schlecht erfassen konnte. Das war vielleicht auch ein Grund für meine Antipathie gegenüber dem Dozenten: Ich hatte eine Art schlechtes Gewissen weil ich meinte ich hätte zu wenig aufmerksam hingehört.
Die Pièce de Résistance des klinischen Unterrichts war die Vorführung von Kranken im grossen Hörsaal vor dem Ordinarius der Inneren Medizin, Professor Löffler und der Chirurgie vor Professor Brunner.
10.13
Professor Löffler. Zwei Studierende mussten vor jeder klinischen Vorlesung die Anamnese des zur Vorführung ausersehenen Patienten aufnehmen und ihn untersuchen. Die so erhobenen Befunde hatte man dann im Hörsaal zu referieren, womit man sich den oft kniffligen Fragen und Korrekturen des Dozenten aussetzte. Das nannte man “praktizieren“. Schliesslich, nachdem der Kranke in seinem Bett wieder hinausgeschoben worden war, besprach man die Diagnose und manchmal die Behandlung. Löffler legte keinen grossen Wert darauf die Therapien zu lehren, weil sie sich immer änderten, ausser für die neu aufgekommene Behandlung des Gelenkrheumatismus mit dem Nebennierenhormon Cortison und der Atherosklerose der Herzarterien mit Nitroglycerin und ähnlich wirkenden chemischen Substanzen. Löffflers Unterricht war durchsetzt mit Bildern von ausserhalb der Medizin, Geschichten und Aphorismen. Ich erinnere mich an sein Hippokrateszitat: „die Kunst ist lang, das Leben ist kurz“ und der Zeitpunkt (kairòs) für die richtige Entscheidung ist auf des Messers Schneide (oxys)“. Den Flüssigkeitsspiegel auf Thoraxröntgenbild oder bei der Durchleuchtung bei minimalen Brustfellentzündung verglich er mit der leicht geschwungenen Form der Hausdächer von Urnäsch. Als ich zum ersten Mal praktizieren musste, geriet ich an eine der schwierigsten Diagnosen, die “Multiple Sklerose”. Ich hätte vorher ein gutes Lehrbuch der inneren Medizin oder der Neurologie konsultieren sollen. So brachte ich wohl einige der Symptome dieser Krankheit zusammen, aber den grossen Neurologen, der die MS entdeckte und die drei pathognomonischen Symptome beschrieb, war der Charcot an der Salpetrière in Paris. Er formulierte die “Charcot’sche Trias”: Intentionstremor, temporäre Abblassung der Papille im Augenhintergrund und die skandierende Sprache. Löffler führte den berühmten Namen ein mit den an mich gerichteten Worten: „Wenn jetzt Charcot ihnen zugehört hätte, der wäre schon längst durchs Fenster abgesaust“. Es war die bewusste Didaktik Löfflers, seine Kandidaten der Medizin zu provozieren und zu stressen, in der Meinung, dass damit sich die Dinge dem Gedächtnis besser einprägen. Er hatte recht. Ich habe Charcot und die Leitsymptome der Multiplen Sklerose nie mehr vergessen.
Über die internmedizinischen Behandlungen dozierte sehr ausführlich Professor Moeschlin aus Solothurn.
10.14
Professor Brunner, war der Chefarzt der Chirurgischen Abteilung. Die Vorlesungen Brunners waren trockener. Er Vertrat eine straffe bürgerliche Ethik und erweckte damit das Vertrauen der Kranken und war für uns ein Vorbild. M.M., ein ehemaliger Primarschulkollege von mir, brachte einmal seine Freundin in Brunners Vorlesung. Der Pedell hatte es gemerkt und Brunner benachrichtigt. Dieser jagte den “Kavalier“, wie er ihn nannte, mit seiner “jungen Dame“ aus dem Hörsaal.
Manchmal ging es darum, den Tastbefund einer Geschwulst zu beschreiben. Auf die Frage wie gross sie sei, kam der praktizierende Student oft in Verlegenheit. Dann rief der Professor sein Faktotum, Herrn Pfaffhauser, der eine Schublade voll von kleinen und grossen Kugeln aus der Alltagswelt brachte, vom der Haselnuss zum Hühnerei bis zum getrockneten Kürbis.
Von Professor Brunners Verhalten beim Operieren zirkulierten manche Anekdoten. Wenn die Lampe das Operationsfeld nicht genügend ausleuchtete, wurde Brunner nervös und rief ungeduldig, fast weinerlich “Herr Pfaffhuuser, s`Liecht!“. Ein junger Kollege, der dem Professor bei einem schwierigen Eingriff assistieren durfte, hielt seinen Kopf etwas gar zu sehr über das Operationsfeld “Wa wönt si?“ fragt ihn Brunner. “Ich möcht öppis gsee“. “Wa wönt si gsie, wenn nid emol ich öppis gsiene!“.
In jedem Semester mussten zwei der Studierenden den so genannten 24Stunden-Dienst auf der Notfallstation absolvieren. Dazu stand ein Zimmer mit zwei Betten zur Verfügung, wo man ein wenig schlafen konnte, wenn keine Notfälle kamen. Am Anfang seiner Vorlesung kam Brunner jeweils mit dem Heft für die Anmeldungen. Einmal aber entsetze er sich: “Da haben sich für den nächsten Dienst ein Herr X und eine Fräulein Y eingeschrieben. Wie stellen sie sich das vor?“
10.15
Die besten und einprägsamsten Vorlesungen gab der Pädiater Prof. Fanconi. Seine Muttersprache war Italienisch, denn er stammte aus dem Puschlav. Er nahm Rhetorikunterricht beim Schauspieler Ernst Ginsberg, sodass er nicht nur grammatikalisch fehlerlos deutsch sprach, sondern mit ausdrucksvoller Rhetorik. Am Staatsexamen in Kinderheilkunde habe ich vor Aufregung leider versagt, denn ich verwechselte rechts mit links. Das etwa Fünfjährige litt an einer einseitigen Brustfellentzündung rechts. Das gab noch die Note Vier, obschon Fanconi einmal beteuert hatte: “Wer meine Vorlesungen besucht hat, bekommt nur Fünfer oder Sechser“.
10.16
Neben den rein klinischen Fächern, zu denen auch die klinische Visite auf den Spitalabteilungen gehörten, gab es fortlaufende theoretische Vorlesungen:
Professor Mooser, (Nachkomme von Jenischen aus Graubünden, deshalb mit zwei “O“ geschrieben) dozierte Hygiene. Das würzte er gerne mit anzüglichen Bemerkungen. Als eine Kollegin sich verspätet hatte und noch möglichst unhörbar in den Hörsaal schleichen wollte, rief Mooser: “Guete Morge, Fräulein, wo sind sie i de letschte Nacht gsy?“. Mooser wurde für seine Forschungen über die von Zecken übertragenen Ricketsiosen (Fleckfieber, Tic bite fever etc.) mit dem Marcel-Benoît-Preis geehrt. Seine neue Entdeckung wurde nach ihm „Ricketsia mooseri“ genannt.
10.17
PD Dr. Frei-Bolli unterrichtete Geburtshilfe an lebensnahen Modellen, einer Gebärenden aus Leder und einem mazerierten Fötus. Er war bekannt für seine markigen Sprüche. Als er einmal eine schon fortgeschrittene Steisslage zeigte, forderte er einen seiner Schüler auf, sich damit zu beschäftigen. Dieser studierte und zögerte lange während der Lehrer den Fötus immer weiter schubste. Schliesslich sagte er: “Handeln Sie endlich, sonst stirbt Ihnen das Kind und die Frau auch! Dann brauchen Sie nur noch den Vater tot zu schlagen, dann haben Sie eine ganze Familie umgebracht“.
Unvergesslich und hilfreich war seine Demonstration einer Querlage mit Arm-und Beinvorfall. Einer solchen Situation begegnete ich einmal in Chicumbane, (beschrieben im Kap. 20, Moçambique).
10,18
Prof.Manfred Bleuler ist der Sohn des berühmten Eugen Bleuler, dieser hat die früher als Dementia praecox genannte Geisteskrankheit erforscht und als Schizophrenie bezeichnet, weil die schon beim Jugendlichen beobachtbare Demenz für den Verlauf dieser Krankheit nicht typisch ist. Eugen Bleuler hat auch das wichtige Lehrbuch der Psychiatrie geschrieben, dessen folgenden Auflagen sein Sohn Manfred bearbeitet hat. Der Vater E.B. hat sich als einer der ersten Psychiater mit der Psychoanalyse von Sigmund Freud beschäftigt und damit der europäischen Psychiatrie eine neue Dimension gegeben: Die mitmenschliche Beziehung zwischen dem Therapeuten und dem Patienten (”Übertragung und Gegenübertragung”) verbesserte die Behandlung vieler seelisch ranker Menschen.
Manfred Bleuler gab eine ausgezeichnete, aber nicht leicht verständliche Vorlesung über medizinische Psychologie und die psychiatrische Klinik mit Vorstellung von Patienten. Dazu wurden jedes Mal zwei Studenten aufgerufen, die mit dem Patienten zu sprechen hatten. Bleuler lehrte uns, dass es in der Psychiatrie in erster Linie darum gehe, mit dem Kranken eine einfühlende Beziehung aufzunehmen.
Seit 1952 gab es zum ersten Mal ein Medikament, ein sogenantes Neuroleptikum, zur Behandlung von Psychosen, elso auch der Schizophrenie, das Chlorpromazin (Largactil). Bald entstanden viele neue Neuroleptika mit verschiedenem Wirkungspektrum und weniger oder kontrollierbaren Nebenwirkungen.
In einem kürzlich im ”Temps” erschienen Artikel des Psychiaters und Philosophen Boris Cyrulnik ist zu lesen, dass die Psychoanalyse erst nach 1968 von den Universitäten aufgenommen wurde und zur Psychotherapie“ vor 1970 nur die Lobotomie (chirurgisches Abtrennen einer Gehirnregion) und die Elektrokrampftherapie zur Verfügung standen. Dank E.Bleuler wurden in der Zürcher Psychiatrie die Errungenschaften der Psychoanalyse und ihren nachfolgenden Therapien über zwanzig Jahre früher eingeführt. Wir wurden belehrt, dass die folgenschweren körperlichen Behandlungen in der Psychiatrie nur noch sehr selten angewandt wurden. In meiner Praxis lernte ich einen älteren Patienten kennen, der viele Jahre zuvor wegen Schizophrenie lobotomiert worden war. Er bot den traurigen Eindruck eines Menschen, dessen Gefühlsleben und Denken verflacht und monoton geworden war.
10.19
Die wichtigsten Dozenten (Zusammenfassende Liste)
Löffler (Innere Medizin), Karthagener (Elektrokardiographie), Moeschlin (Pharmakotherapie), Brunner (Chirurgie), Mooser (Hygiene), Grumbach (Bakteriologie), Fanconi (Pädiatrie), Fischer (Pharmakologie), Schwarz (Gerichtsmedizin), Üehlinger* (Pathologie), v.Albertini/Rüttner**: (Histopathologie), Miescher (Dermatologie), Held (Gynäkologie und Geburtshilfe), Frey-Bolli ( Praktische Geburtshilfe), Willi (Neonatologie), Alder (Praktische Hämatologie), Lüthi (Neurologie), X (Physikalische Therapie und Balneologie), Bleuler (Psychiatrie).
(*Die zwei Töchter von Professor Üelinger* habe ich auf dem Schiff kennen gelernt, während dem Ausflug des internationalen Kongresses für Pathologie in Zürich. Da gab es Tanzmusik. Um die ernste mit Wissenschaft befrachtete Atmosphäre aufzulockern, forderte Vater Üehlinger die Jungen zum Tanzen auf. So kam ich zum Tanzen mit seinen zwei Töchtern. Ob es für meine Karriere nützlich gewesen wäre, um die Hand der Älteren anzuhalten?)
(**Prof.Rüttner wurde später mein Doktorvater: Der Titel der Dissertation: “Der diagnostische Wert der supraklavikulären Lympknotenbiopsie nach Daniels“ . Rüttner besuchte uns später in Moshi in Tansania zusammen mit dem Organisator der Entwicklungshilfe des Bundes. Wir diskutierten über geographische Pathologie. Dafür gibt es eindrückliche Beisiele, z.B. dass der nur in tropischen Malariagebieten vorkommende sehr bösartige ”Burkitt Tumor” vom gleichen Virus (Epstein-Barr) verursacht wurde wie die relativ harmlose Mononukleose der gemässigten Zonen.)
10.20
Das Staatsexamen. Zur Vorbereitung und für die Organisation der Prüfungstermine bildete man Gruppen von je vier Kandidaten. Es gelang mir, mich drei Fleissigen und Motivierten anzuschliessen, David Künzler, Emil Weisser und Max Burger. Max war schon intensiv mit seiner Dissertation beschäftigt.
Zur Prüfung in Hygiene bei Mooser begleitete mich Verena. Moser wollte sie zur Teilnahme in den Prüfungsraum einladen. Aber sie liess sich nicht darauf ein. Es war ja kaum ernst gemeint.
Ausser einem schlimmem Fauxpas in der Pädiatrie (in der Aufregung: rechts-links Verwechslung) hatte ich recht gute, wenn auch nicht glänzende Resultate. Das auf dem Diplom vermerkte Datum war der 29.Mai 1952.
Nach den Prüfungen kam man mit den Dozenten zusammen zu einem Diner im Restaurant zur Waag in der Zürcher Altstadt.
Dann haben uns die vier Elternpaare im vornehmen Restaurant Schloss Oberberg im Kanton Sankt Gallen eingeladen.
10.21
Zur Erholung von dem monatelangen Prüfungsstress hatte ich mir nur sehr wenige Tage Ferien zugestanden, bevor ich im Bürgerspital Solothurn als Assistent von Dr.Buff zu arbeiten begann. Im Anfang war ich noch bei der künftigen Schwiegerfamilie Kuhn an der Sankt Josefstrasse in Solothurn untergebracht, während Verena im Studentenhaus in Zürich wohnte.

11.1
Eine sonderbare Heiratsvermittlung
In der Rückschau verstehe ich nicht, weshalb ich mich durch die Voraussage der Madeleine Bernath an die noch unbekannte Verena Kuhn gleich schon für gebunden hielt. Es war eine sonderbare virtuelle Verlobung, ohne dass die zukünftige Braut etwas davon ahnen konnte,
Während dem medizinischen Praktikum in Nazaret (Israel) hatte mir Madeleine, die Frau des Schweizer Chirurgen, so rühmend von einer neuen Pensionärin im Studentenhaus in Zürich gesprochen, als ob es für mich keine andere Wahl gäbe. Die muss meine künftige Frau werden! Ich liess mich von Madeleine bestimmen, einer Person, die ich für eine vorbildliche Autorität hielt. Hans und Madeleine Bernath waren früher Leiter des Studentenhauses an der Attenhoferstrasse in Zürich.
Doch zur gleichen Zeit lernte ich in Nazareth die liebenswürdige Anne Eméry aus Neuchâtel kennen, Anne gab die mir deutliche Zeichen ihrer Zuneigung.Ich hielt jedoch stur an Madeleines Heiratsvermittlung fest und versuchte nicht einmal, Anne ein wenig besser kennen zu lernen.
11.2
Wie entstand mein Lebensplan von ärztlicher Mission in der dritten Welt? Unter den Mitarbeitern der Studentenbibelgruppe war viel von Mission die Rede. Von Mission im hergebrachten Sinn: in Entwicklungsländern wo viele Einheimische noch mit irgendeiner Form des Animismus lebten wie in Afrika, oder die einer der ausserchristlichen Religionen angehörten. Besonders August Meier, ein etwas äterer Studiuenkollege, sah sich schon in Indonesien. Er hatte mir Bücher über christliche Mission ausgeliehen. Obschon in solchen Büchern deutlich zum Ausdruck kam, welche Lasten, welchen Verzicht, welche Leiden und Enttäuschungen damit verbunden sein können, wagte ich es, um Verena zu werben auf dieselbe direkte Art, wie es August Meier der Margrit Leuenberger gegenüber gewagt hatte mit den Worten: "Kommst du mit mir in die Mission?“ Ich hatte beschlossen, diesem Beispiel zu folgen. Gusti kam aber nie nach Indonesien, sondern eröffnete eine Praxis für Allgemeinmedizin im Toggenburg
11.3
April 1958. Kaum aus Israel zurückgekehrt besuchte ich zwischen Ostern und Pfingsten das Studentenhaus an der Attenhoferstrasse. Geleitet wurde das Haus jetzt, nachdem Hans und Madeleine Bernath nach Israel ausgewandert waren, von Sam und Priska Jenny, einem Leiterpaar der Studentenbibelgruppen. Dieses Haus und seine Bewohner war für mich zu einer zweiten Familie geworden, obschon ich nie dort gewohnt hatte. In der Küche begegnete ich der Verena Kuhn, seit kurzem Studentin der Romanistik an der Universität Zürich. Das war nun zweifellos die von Madeleine Bernath gerühmte neue Pensionärin im Studentenhaus, die sie als meine Braut auersehen hatte. Ich hatte Verena vorher nicht mehr als dreimal gesehen, und nie ein Gespräch mit ihr geführt. Ich verliess mich ganz auf die Empfehlung der Madeleine.
Verena trug ein caramelfarbiges Kleid aus Manchesterstoff. Sie sagte gleich am Anfang unseres Gesprächs wie nebenbei : “Ich bin zwänzgi gsy“.
Über die Pfingstfeiertage fand in Moscia, dem Zentrum der VBG am Lago Maggiore, ein Treffen der Schweizer Bibelgruppen statt. Ich hatte mich anerboten, dort von meinen Erlebnissen im Vorderen Orient und im Missionsspital Nazareth zu erzählen. Gleich bei der ersten Begegnung mit Verena versuchte ich sie zur Teilnahme an dieser Tagung zu bewegen, mit Erfolg.
Ich hielt meinen Vortrag. Dazu hatte ich in einem Geschäft in Ascona einen Taperecorder gemietet um arabische Ùd-Musik und Gesänge aus dem Kibbuz vorzuspielen. Ich wollte den Apparat zu Fuss wieder nach Ascona bringen und bat Verena, mich zu begleiten. Warum nur befolgte sie so willig jeden meiner Vorschläge?
Wir wählten den Heimweg über die Maggiabrücke und dann dem steinigen Ufer dem Fluss entlang. Mitten in dieser Steinwüste fiel es mir ein, Verena den mit Mission gewürzten Heiratsantrag zu machen.
Sie sagte nicht ja und nicht nein.
Durch den Kastanienwald nach Moscia spazierten wir Pfot-in-Pfötchen, unterbrochen von der Einkehr in einem Grotte zu je einer halben Flasche Pepita!
Schon bald danach erklärte mir Verena ihre Bedingung. Sie lautete: Wir sollen uns während des ganzen folgenden Jahres nicht küssen, also bis zurVerlobung. Ich war schon so geblendet von der wunderbaren Vorstellung nun eine Braut zu haben, dass ich diese Klausel widerstandslos schluckte.
In Solothurn existierte eine Studentenverbindung, obschon es da neben dem Gymnasium keine Universität gab. Die Gymnasiasten kopierten, was sie für echt studentische Sitte hielten. Dazu gehörte der Kuss, den der Kavalier nach jedem Fest seiner Begleiterin zum Abschied zu verpassten hatte. Einige Mädchen von Verenas Klasse hatten sich gegen diese Sitte verschworen und den “Klub der Ungeküssten“ gegründet. Verena war natürlich ein Aktivmitglied. Das Kampflied der Ungeküssten war ein allen ernstes tradiertes studentisches Spottliedchen:
„Was die Mutter har gesagt sollst du immer glauben,
Lass von keinem Studio einen Kuss dir rauben.“
11.4
Prüdes Umfeld. Diese sonderbare Abwehr lässt sich vielleicht verstehen, wenn wir das soziale Umfeld ansehen, in dem Verena aufgewachsen ist
Verena erzählte: Auf ihrer Maturreise kamen einge der Schülerinnen ins Gespräch über Sexualität. Sie fanden heraus, dass keine Einzige dieser wohl 18 bis 20 Jahre alten Mädchen, die soeben die Reifeprüfung bestanden hatten, aufgeklärt war. Wie die Kinder entstehen und was das mit dem zu tun hat, was der Mann und die Frau miteinander machen: Keine Ahnung!
Im sozialen Umkreis in Solothurn und in ihrer Familie herrschte eine puritanische Atmosphäre. Unter der allgemeinen Abwehr köchelte jedoch eine unvollständig verdrängte Erotik , die sich manchmal durch halb-beabsichtigte Anspielungen verriet. In dieser Atmosphäre von Doppelmoral ist Verena aufgewachsen. Im Gegensatz zu ihren zwei Schwestern, Elisabeth und Susanne, die jede auf ihre Weise darunter gelitten und sich dagegen aufgelehnt hatte, war und blieb Verena folgsam und angepasst.
11.5.
Frühe Krisen mit Verena gab es schon bald auf Grund ihrer Unsicherheit, ihren Zweifeln und Ängsten. Durch das Kussverbot war jede Art von Nähe und Zärtlichkeit tabu. Kann man sich lieb haben, wenn es verboten ist, Liebesgefühle körperlich sichtbar zu machen? Trotz diesen Barrikaden liess ich selbst jedoch nie echte Zweifel an unserer Beziehung aufkommen. Ich krallte mich an der Unbedingtheit meines Heiratsantrages fest, ohne ihn je gründlich zu hinterfragen.
Wenn ich bei Kuhns zum Essen eingeladen war, wuschen Verena und ich jeweils das Geschirr. Dann kam ihre Mutter alle paar Minuten in die Küche. Um sich anzumelden, räusperte sie sich auffällig, als ob sie uns warnen müsste: Wir könnten ja am Schmusen sein! Solche mütterliche Rücksicht war schon deshalb absurd, weil Zärtlichkeit unter dem Verdikt der Kusslosigkeit und allgegenwärtiger Kontrolle uns ja überhaupt unmöglich war.
Verena schien sich vor der Ehe zu fürchten, nicht nur vor der körperlichen Nähe, sondern auch vor dem vermutlich frustrierenden Leben als Hausfrau, Gattin- und Muttersein, ein Leben, worüber sich ihre Mutter häufig beklagt hatte. Verlobt zu sein stellte sie sich dagegen als idealen Dauerzustand vor. Statt in einer eigenen Wohnung, würde sie lieber in einer Familienpension leben, frei von Hausfrauen- und Mutterpflichten.
11.6
1959 Die Verlobung
Als Einladungskarte zeichnete ich eine witzige Anzeige. Verena und ich reiten miteinander auf einem Kamel. Das schockierte trditionell-bürgerliche Verwandte.
Mutter Kuhn kochte ein Festmahl mit ”Kasseler Rahmbraten". Zu den Eingeladenen gehörten Leute, die wir später aus den Augen verloren haben: Alfred Brunner, ein Kollege von der chirurgischen Abteilung des Bürgerspitals Solothurn und ein Ehepaar aus Norddeutschland. Ich kann mich nur noch an den Namen der Frau mit dem sehr germanischen Namen “Gerlinde“ erinnern. In ihrem späteren Rundbrief war zu lesen, sie seien als Missionare nach Indonesien gereist. Dort bereuten sie nachträglich, dass sie auf dem Schiff den Jux der Äquatortaufe für Schiffspassagiere mitgemacht hatten. Der skrupelhafte christliche Ernst und die strenge Abgrenzung gegen “heidnische“ Rituale konnte ich nicht verstehen. Eine so peinliche Einengung und Angst vor allen nichtchristlichen Symbolen und Riten zeigten manche unserer gläubigen Bekannten.
Die Verlobung mit Verena gewann einen besonderen Akzent, weil ich mich nach den einjährigen Exerzitien in Kuss-Abstinenz geradezu verpflichtet fühlte, hic et nunc mit meiner Verlobten den ersten Kuss zu absolvieren, Das Unvergessliche ereignete sich im schönen Monat Mai auf der Schanz zu Solothurn.
Zum Verlobungsfest war auch die alte Tante Marie aus Grenchen zugegen. Sie spielte für den Mittelschulprofessor Gottfried Kuhn die Rolle eines Schreckgespenstes. Nicht selten war sie unangemeldet an der Sankt Josefstrasse erschienen, als ob sie kontrollieren wollte, wie man mit ihrer Investition zum Hausbau umgegangen war. Das war vermutlich der Grund dafür, dass der Vater Kuhn wegen der finanziellen Abhängigkeit von dieser reichen Verwandten so übervorsichtig mit Geld umging.
Tante Marie soll bei der Begrüssung am Verlobungstag, als sie meiner ansichtig wurde, ohne dass ich selbst es hören konnte, gesagt haben: “Das git schöni Chind“. Diesen Spruch habe ich wie manche andere Bemerkungen ähnlicher Art erst sehr viel später verstanden.
Die Mutter Kuhn verlangte, dass sich Verena vor der Hochzeit gynäkologisch untersuchen lässt. Dagegen habe ich mich aufgelehnt. Deswegen kam es nicht dazu. Ich verstand aber den Grund für diese mütterliche Ermahnung: Die Mutter der Hanna Kuhn, die “Mammia“ pflegte zu erzählen, ihre Ehe sei deshalb zerbrochen, weil die Hochzeitsnacht misslungen sei. Es wurde angedeutet, das Hymen sei anscheinend zu resistent gewesen.
11.7
23.Juli 1960: die Hochzeit.
Die Ziviltrauung im Standesamt Solothurn war recht lustig, weil der Standesbeamte das Ritual mit einer salbungsvollen und antiquierten Sprache vollzog. Er betonte noch allen Ernstes die strikte Aufgaben- und Machtteilung zwischen Mann und Frau.
Ich hatte für Verena einen silbernen Fingerring mit einem schönen Türkisstein herstellen lassen, den wir nach der Zeremonie im Bijouteriegeschäft abholen konnten. Eine Überraschung: Auf dem Weg durch die Altstadt kamen uns zwei Elefanten entgegen, ein Grosser mit seinem Jungen.
Für die kirchliche Trauung hatte ich den Zürcher Studentenpfarrer Frischknecht gebeten, nach Betlach zu kommen.
Ich habe an unsere Ehe geglaubt, sie für dauerhaft bis zum Tod gehalten. Das habe ich bei der Trauung in der Kirche Betlach im Kanton Solothurn, am 23 Juli 1960, mit Tränen in den Augen mit meinem Ja beschworen!
Für die Organisation des Hochzeitsfestes hatte die Mutter Kuhn den Feldherrenstab an sich genommen. Für das Bankett wurde das Restaurant Sternen in Kriegstetten bestimmt. Wir mussten unter dem Hochzeitsmarsch von Mendelssohn in den Saal schreiten um die mehrstöckige von einem kleinen Gipsehepaar gekrönte Torte anzuschneiden indem ich die messerbewehrte Hand von Verena halten musste.
Meine Mutter hatte uns mit einer Menge von Ratschlägen überhäuft: wie MAN es zu machen pflege, also müsse. Als Verena und ich am Hochzeitsfest um Mitternacht die Gesellschaft möglichst unbemerkt verlassen wollten, stand meine Mutter unter der Saaltüre, mit demonstrativ ausgestreckten Armen um uns den Ausgang zu versperren.
Ich fand das alles allzu bürgerlich. Ich war in ärgerlicher Stimmung, fühlte mich manipuliert, machtlos den alten Müttern ausgeliefert.
Die Mutter Kuhn verlangte den Schlüssel zu unserer Wohnung am Güggeliweg “um die Blumen zu pflegen “. Ich wollte aber keine schwiegermütterliche Kontrolle und verweigerte ihr diesen Wunsch. Dass sich auf diese Verweigerung hin ihre Augen mit Tränen füllten, vermochte mich nicht zu rühren.
Zwei oder drei Tage nach dem Hochzeitsfest, als wir bereit für unsere Hochzeitsreise im Bahnhof Solothurn auf den Zug warteten, kam der Vater Kuhn und überbrachte uns eine Tafel Schokolade. Ich konnte diese sonderbare Geste nur als Spionage im Auftrag seiner Frau verstehen: “Wie hat sie wohl die ominöse prima nox überstanden?“
Wahrscheinlich aus demselben Grund besuchte er uns einige Tage später in Ronco, wo wir eine kleine Ferienwohnung gemietet hatten. Plötzlich stand er vor der Türe der Casa Martello (unser Vermieter hiess Hammer) überbrachte uns ein gebratenes Huhn und wünschte bei uns zu übernachten. Herr Hammer stellte uns eine Matratzenliege in seinem Estrich zur Verfügung, wo es penetrant nach den Exkrementen seiner vielen Katzen duftete. Und dem Vater überliessen wir unser Ehebett zum nächtigen!
11.8
Verena, die Studentin. Wir sahen es als selbstverständlich an, dass Verena das angefangene Romanistikstudium weiterführen wird, aber um bald zu einer Berufsausbildung zu kommen, mit dem Ziel als Sekundarlehrerin für Sprachen abzuschliessen. Vater Kuhn hatte nichts einzuwenden, im Gegenteil war er sehr zufrieden, dass von jetzt an ich als ihr Ehemann für ihren Lebensunterhalt und ihre Studienkosten aufzukommen hatte. Mein Monatslohn war damals (1960) 650 Franken.
Nach mehrjährigem Aufenthalt ausser Europas, in Israel und Eritrea lebten wir von 1964 bis 1970 wieder in der Schweiz. Da dachte Verena daran, während dieser Zeit noch einmal ein Studium aufzunehmen. Sie hatte schon das Studium als Sekundarschullehrerin mit Erfolg abgeschlossen. Sie belegte bis zu unserer Ausreise nach Moçambique, einige Semester Archäologie und Geschichte der Antike.
Verena war immer eine fleissige und erfolgreiche Schülerin und Studentin. Sie hatte die Matur (mit Latein und Griechisch) als Zweitbeste ihres Jahrgangs und alle Prüfungen an der Universität im ersten Durchlauf bestanden.
Wie sie nach unserem letzten Afrikaaufenthalt (Tansania) im Jahr 1976 auf die Idee kam, als drittes Studium Psychologie zu studieren, weiss ich nicht mehr. Wenn sie von ihren Vorlesungen erzählte und den interessanten lebendigen jungen Mitstudierenden, musste ich sie ein wenig beneiden. Denn ich befand mich damals mitten in der Auseinandersetzung mit meiner langweilig gewordenen Tropenmedizin. Ich profitierte bald von ihren Kenntnissen in Psychologie. Einmal besuchte ich mit ihr eine Vorlesung des Professors von Uslar über die Beziehung zwischen Philosophie und Psychologie.
Verena schloss das Psychologiestudium mit dem Lezentiat ab.
Am liebsten hätte ich auch Psychologie studiert. Das führte zu meinem Entschluss: die berufsbegleitende Ausbildung in Gestalttherapie am Fritz-Perls-Institut aufzunehmen. Nach ihrem Lizenziat haben sich dann auch Verena und ihre jüngere Schwester, Susanne (Sue) Steiner, entschlossen, sich in Gestalttherapie ausbilden zu lassen. An der Zürcher Universität gehört zum Psychologiestudium keine Ausbildung in irgendeiner Form von Psychotherapie. Wer Psychotherapeut oder Psychoanalytker werden will, muss sich die Ausbildung in einem der verschiedenen privaten Institute beschaffen, deren jedes eine andere therapeutische Richtung vertritt.
Während all dieser Jahre bewies Verena, zu welch aussergewöhlichen Leistungen sie fähig ist. Sie meisterte drei Studien und zwei Lizenziate, bestand alle Prüfungen. Daneben betreute sie (und unterrichtete zeitweise) unsere drei Kinder!
11.8
Gemeinsame Abenteuer. Verena verbrachte mit mir (1960-61) meine halbjährige Aushilfe im Spital in Nazareth. (cf. Kap. 15) Später kamen die drei Geburten. Als ich in Zürich arbeitete, kam am 17.Februar 1962 unser erstes Kind, der Sohn Tobias zur Welt (cf. Kap.16, Zürich, Unispital). Die zweite Geburt geschah in der provisorischen Missionswohnung in Asmara, der Hauptstadt von Eritrea am 2.Mai 1964. Es war also eine Hausgeburt. Unsere Tochter Hanna Barbara kam da zur Welt. Ruth Trummer, die Schweizer Hebamme leitete mit meiner Hilfe die Geburt. Für den Fall von Komplikationen hatte ich aus der Schweiz für das von der Missionsgesellschaft geplante Spital (mit Grburtsabteilung) Nötige mitgebracht. Die Medikamente, die chirurgischen Instrumente, eine Geburtszange und einen Vakuumextraktor waren bereit, die Instrumente steril. Nur Weniges davon wurde bei dieser Entbindung gebraucht.
Unser drittes Kind, der zweite Sohn, Dominik, kam am 7.Februar 1969 kam im Spital Bethanien in Zürich zur Welt mit der Hilfe meines Studiumskollegen Dr.Martin Meyer. Wir wohnten damals in Oetwil am See.
11.9
Wie es zum Bruch kam. Trotz dem Beweis ihrer Bewährung in zum Teil sehr schwierigen Lebenslagen, ihrer Tapferkeit und bei all ihrer intellektueller Begabung erschien der Bruch unserer Beziehung mit der Zeit unabwendbar
Gerichtlich galt als Scheidungsursache “Ehezerrüttung“.
Was aber brachte uns denn eigentlich auseinander? Trotz unserer Versuche mit verschiedenen Paartherapien habe ich nicht herausgefunden, was aus der Sicht von Verena der Grund des Bruches war.
Was aus meiner Sicht unsere Beziehung am schwersten belastete, wurde mir erkennbar, als wir auf den Rat von Ago Bürki eine Paartherapeutin aus den USA konsultierten, Susan Haberfeld. Sie versuchte, zwischen Verena und mir die längst fällige Auseinandersetzung symbolisch, ohne Verletzungsgefahr, aber körperlich auszudrücken. Susan ging von der Annahme aus, dass sich zwischen uns seit Jahren Spannungen und ungelöste Konflikte aufgestaut, die wir nie ausgetragen, ja nicht einmal besprochen hatten. Susan gab jedem von uns eines der beiden weichen Pseudoschwerter (Batakas) und ermunterte uns, auf einer weichen Matte zu “fechten“. Verena stand kurz auf diese Unterlage, sprang aber sogleich wieder weg und zog sich zurück. Ich blieb allein auf der Matte stehen und hatte mich umsonst darauf gefreut, Verenas Angriffe zu spüren.
Seit den traumatischen Erfahungen von Eritrea (cf. Kp,18) waren Verena und ich jahrelang körperlich und psychisch krank. Ein Psychiater, den ich konsultierte, stellte beim mir Depression und Angstneurose fest. Wenn ich am Morgen von zu Hause ins Spital ging, hatte ich jedesmal Angst um Verena. Ich glaubte, sie auf jede Weise schonen zu müssen und ihr von meiner Angstbelastung nichts gesagt. Der Arzt, den wir für sie konsultierten, hielt für sie Psychoanalyse für dringend nötig. Aus verschiedenen Gründen haben wir das abgelehnt.
Man könnte sagen: Unsere emotionale und körperliche Beziehung war und blieb jahrzehntelang gestört. Und keine Beratung, keine ”Selbsterfahrung“, keine Therapie, keine Chance zeigte sich, diese Störung zu heilen.
Schliesslich bin ich dessen müde geworden, abgenützt und niedergeschlagen. Und ich bekam Anfälle von Jähzorn, die angestaute Wut, die mich zu jener Zeit manchmal überfiel.
Nach mehr als zweieinhalb Jahrzehnten permanenter ungelöster Konflikte und Frustration war ich ausgedörrt, bis ich mir zu erlauben begann, andere Frauen kennen zu lernen und zu erleben, was und wie eigentlich eine Frau für einen Mann sein könnte.
Ich wollte die Verbindung mit Verena lösen. und mir zu erlauben, eine zeitlang einmal mein eigenes Leben zu erproben.
11.10
In der Rückschau aber, mehr als dreissig Jahre später, sieht die Erinnerung an den Zerbruch meiner Ehe anders aus. Ich muss mir gestehen, dass ich immer noch, oder wieder erneut darunter leide. Aus dieser neuen Sicht sieht das Ehedrama anders aus:
Es hatte sich bei mir innerhalb der zwanzig Ehejahren ein Ressentiment geg.en Verena angestaut, Aus der Erinnerung wüsste ich dafür keinen überzeugenden Grund mehr. Dass ich dieses Zerstörerische so stark werden und mich dadurch schliesslich dazu drängen lies, mich von meiner Frau zu trennen, das verstehe ich jetzt nicht mehr und verurteile mich jetzt, nach so langer Zeit als leichtsinnig und dumm. Und erlebte es damals doch als Befreiung!
11.11
Tannhäuser im Venusberg
Die lllusion der Befreiung hiess: Scheidung, Befreiung und Erlaubnis, noch vor dem Greisenalter die Promiskuität des Jugendlichen nachzuholen. Das Mittelalter umschrieb die erotischen Eskapaden des gereiften Mannes mit einem Mythos: dem Venusberg. Dem Tannhäuser, dem Held dieser Wagneroper, gelang es, sich daraus zu befreien. Wie ich aus dem Venusberg errettet wurde, zeigt ein späteres Kapitel.
11.12
Vollzug der Trennung 1985 und Scheidung 1987. Ich bekam Briefe voller Vorwürfe: von Madeleine Bernath und von der Mutter, Hanna Kuhn, als ob ich der allein Schuldige und Verursacher des Zerwürfnisses sei. Einer meiner Bekannten, ein Pfarrer besuchte mich, um sich zu erkundigen, wie man die Ehe auflöst, denn er dachte auch daran, sich von seiner Frau zu trennen.
Franz Schumacher, ein Schulfreund aus dem Gymnasium, war mir bei der Scheidungsverhandlung beigestanden. Die finanzielle Forderung, die der Rechtsanwalt der Verena nahe gelegt hatte, war so hoch, dass ich bald einmal Sozialhilfe gebraucht hätte. Auch das Endresultat der Verhandlung war noch sehr hart. Man auferlegte mir, an Verena eine ansehnliche monatlichen Rente zu bezah bis zu meinem siebzigsten Lebensjahr.

12.1
Die Aushebung im achtzehnten Altersjahr fand in der Sportanlage Sihlhölzli in Zürich statt. Der Aushebungsoffizier teilte mich auf meine Auskunft, dass ich Medizin studieren werde, ohne weiter zu fragen zur Sanität ein. Von den sportlichen und ärztlichen Prüfungen kann ich mich nur dank einem Foto, an den Weitsprung, erinnern. Und dass es zur Verpflegung einen Schüblig mit Brot gegeben hat.
Noch bevor das zweite Semester zu Ende war und gleich nach dem ersten propädeutischen Examen musste ich nach Basel in die Rekrutenschule einrücken. Im Hof vor der gotischen Kirche des ehemaligen Klosters Klingenthal standen die Jungs bald in Einerreihe noch in bürgerlich individuellen Strassenkleidern jeder mit seinem Köfferchen. Aber nach zwei Stunden steckten alle schon in den ausgetragenen Uniformen vom letzen Weltkrieg mit Stehkragen und Häftliverschluss, der nur auf Befehl, wie wir bald lernten, geöffnet oder geschlossen werden durfte und mit der Policemütze auf dem Kopf, die ebenfalls nur auf langen Märschen in der sommerlichen Hitze auf Befehl des Vorgesetzten vorübergehend abgenommen werden durfte. Wir sahen alle wie Kriegsgefangene aus. Zur Unterscheidung trugen die Unteroffiziere eine Schirmmütze aus dem gleichen feldgrünen Uniformstoff. Dann wurde die so genannte Plankenordnung instruiert, wie Hosen und Kittel der Ausgangsuniform kunstvoll gefaltet aufeinander getürmt werden. Das Zahnglas hatte links dieser Planke zu stehen und die Zahnbürste am linken Glasrand angelehnt mit den Borsten in der Richtung nach links. Als es soweit war, glaubte ich, der Feldweibel mache einen Witz: Solche Pedanterie kann ja nicht ernst gemeint sein! Aber doch, ich gewöhnte mich an die militärische Gleichschaltung und versuchte während den nun folgende vierzehn Wochen möglichst viele Nischen von Selbständigkeit offen zu halten. Ich trug immer einen Block zum Zeichnen im Brotsack und ein kleines Neues Testament. Solang die Schule noch nicht in der “Verlegung“ war, also irgendwo auf dem Land oder im Wald kampierte oder während dem Schlussmanöver im Baselbiet herumzog, besuchte ich nach dem Hauptverlesen oft die Familie von Onkel Fritz (dem Bruder meines Vaters) und Tante Klärli* an der Nauenstrasse in Basel. Bei ihnen war ich dann zu einem zweiten Nachtessen eingeladen. Ich wollte einmal mit den zwei sehr hübschen Töchtern, der älteren Liselotte (sechs Jahre jünger als ich) und der kleinen Margrit ausgehen. Wir fanden einen Tanzboden im Freien. Gern hätte ich mit der Liselotte oder mit der Margrit ein wenig getanzt, aber beide gaben mir einen Korb. * Gestern war ich mit meinem Bruder Conrad in Basel zur Feier des hundertsten Geburtstags der Tante Klärli Meyer-Schott
12.2
Viel später, als wir an der Zürichbergstrasse wohnten, besuchte uns einmal Liselotte mit ihrer Familie, dem Ehemann, Arzt und Financier aus Florida (hiess er “Nagel“?) und ihren beiden Kindern, Marc und Monique(?). Er wollte mich für einen finanziellen “deal“ interessieren. Der Arztberuf sei für ihn das Hobby, Geld verdiene er mit seinen "Deals“. Es wunderte mich nicht, dass Liselotte sich nicht viel später von ihm hatte scheiden lassen. Sie zog dann mit einem neuen Partner nach Nashville um Pferde zu dressieren, mitten in der Provinz der Cowboys und der Country Music.
12.3
Noch während dem Studium musste ich noch den “Korporal abvermieten“. Einen Teil davon im Krankenzimmer der alten Kaserne in Zürich. Da lerne ich bei keinem älteren Kollegen, Blutbilder zu differenzieren, also die verschiedenen weissen Blutzellen zu unterscheiden und zu zählen und Penicillin am richtigen Ort intramuskulär zu injizieren, nämlich so, dass mit der Kanüle der wichtige Oberschenkelnerv nicht angestochen wird.
Für die zweite Hälfte schickte man mich nach Losone, an die Rekrutenschule der Grenadiere. Das war angenehm, denn ich konnte fast jeden Abend mit dem Velo nach Moscia hinüber fahren, und meine Freunde aus der Studentenbibelgruppe treffen. Zur Ausbildung der Grenadiere gehörten die Gefechtsübungen im Hinterland des Malcantone. Da stürmt eine Gruppe oder ein ganzer Zug voll bepackt mit Handgranaten oder Plastik (ein knetbarer Sprengstoff) eines der wilden Täler hinauf. Ich musste mit einer Bahre und der Sanitätstasche in Bereitschaft stehen, bis mir der Offizdier ein Sturmgewehr gab, mit der Aufforderung: “Hoppla, Sanitäter, gib den Burschen Feuerdeckung“!. Also soll ich über die Köpfe der bergauf stürmenden Rekruten schiessen. Das Sturmgewehr kannte ich noch nicht. Wenn man den Abzug betätigt, produziert es nicht nur einen Schuss wie die Karabiner am Knabenschiessen sondern eine Serie von Schüssen wie ein Maschinengewehr. Meine Knarre hüpfte gefährlich auf und ab. Da kam der Gruppenleiter gerannt und befahl mir, das Ding fest auf seine Stützen zu drücken.
Obschon ich mich für einen überzeugten Pazifisten hielt, begann mir das Kriegsspiel ein wenig Spass zu machen, noch mehr als man mich hinter eine Panzerabwehrkanone sitzen liess. Mit einer Art Steuerrad geschieht das Zielen. Kurz bevor die Panzerattrappe im die Schusslie kommt, abdrücken. Bis die Kugel beim Tank ist, hat der sich schon einen oder zwei Meter vorwärts bewegt. Der militärische Spass ist mir aber teuer zu stehen gekommen: ich verlor das Gehör für die hohen Töne, was sich auf dem Jahre später auf dem Audiogramm zeigt. Es gab den allein wirksamen Gehorschutz damals noch nicht. Als sehr behindernd erwies sich der Gehörsturz später für die Leitung von Therapiegruppen.
Die Gewohnheit, möglichst viel Zivilleben ins Militär mitzunehmen, habe ich während den kommenden Wiederholungskursen beibehalten. Im WK 1969 war das Bataillon 67 in Schöftland stationiert. Dort musste ich im Schössli mit ein paar Sanitätssoldaten eine Sanitätshilfestelle einrichten. Ein Logis fand ich beim Inhaber des Konfektionsladens, Herrn Lienert, den ich von meinen Ferien bei der Familie Wurm (Vater Willi, Mutter Emmi und dem 2 Jahre älteren Sohn Walter) kannte. Zur Vorbereitung auf meinen Hoffmann-LaRoche Forschungsauftrag in Moçambique hatte ich ein Sprachlehrbuch mitgenommen. Ich fand Zeit um die portugiesische Konjugation zu lernen. Zugleich war ich beauftragt worden, in allen Kompanien, die in der Region stationiert waren, einen physiologischen Leistungstest durchzuführen: Die Pulsfrequenz vor und nach einer genau definierten Körperanstrengung zu notieren. Mit der so entstandenen Liste berechnete ich noch die Streuung (die Zuverlässigkeit, mit dem x2_Test.) Das scheint dem Hauptmann gefallen zu haben, denn er beförderte mich am Schluss zum Wachtmeister
12.4
1982, also im fünfzigsten Altersjahr, hatee ich meine Dienstpflicht erfüllt und wurde zur Abgabe meiner Militärausrüstung aufgeboten. Anschliessend waren wir alten Männer zu einem gemeinsamen Nachtessen eingeladen. Dazu wurde armee-eigener Wein ausgeschenkt und eine ”Parade“ nach amerikanischem Vorbild vorgeführt, mit spärlich bekleideten Mädchen (Majoretten), die vom Nabel an aufwärts aber Uniform trugen.. Als Bühnendekoration dienten rechts und links alte Panzerabwehrkanonen. Ein Instruktionsoffizier hielt eine Ansprache. Er betonte die Schädlichkeit für die Schweizer Wehrbereitschaft die immer mehr aufkommende Neigung zur Selbstverwirklichung. Die Rede passte stilrein zur Geschmacklosigkeit des ganzen Theaters.

13.1 Bürgerspital Solothurn, chirurgische Abteilung.
Die Instrumentierschwester Hanni (cf.Kap. 26.5 ”Heimliche Liebe”) schien von einem Gerücht besonders beeindruckt zu sein, jedenfalls hörte ich sie mit ihrer nahe stehenden Kollegin im Operationssaal dergleichen Andeutungen machen, das Gerücht nämlich, ich sei auf dem Weg mich zur katholischen Kirche zu bekehren. Nie hätte ich gedacht, dass mein Besuch beim Spiritual Alois Müller des Solothurner Priesterseminars beobachtet wurde, noch dass sich irgend jemand dafür interessiert hätte. Ausserdem hatte ich nicht die Absicht mich von ihm in den Schoss der katholischen Kirche bekehren zu lassen. Er war eine Zeit lang zur Behandlung im Bürgerspital auf der internistischen Abteilung und so profitierte ich von der Möglichkeit bei einem Sachverständigen mehr über den Glauben der römischen Kirche zu erfahren. Dabei hatte ich unter Anderem gelernt, dass die Grundlage der katholischen Glaubenslehre nicht eigentlich die Bibel sei, sondern der "consensus fidelium“. Auf diese Weise spreche der Heilige Geist. Wer denn und wie erlöst werde, wollte ich wissen.
”Wer nie von der Erlösungsbotschaft der Kirche etwas gehört habe, ob ein solcher gerichtet wird?"
Die Antwort des Spirituals war:
"Wer die katholische Glaubenslehre gehört (und verstanden?) hat und nicht konvertiert, hat die Erlösung verscherzt.
”Das wäre dann mein Fall?"
"Wenn Sie verstanden haben, was Sie jetzt von mir gehört haben und die Konsequenzen daraus ziehen, nämlich die Konversion, sind Sie gerettet, andernfalls nicht.”
Es gab in den folgenden Jahren einige Stimmungen in welchen ich mir hätte vorstellen können katholisch zu werden. Jahre später, zur Zeit der Analyse bei Dr.Guggenbühl träumte ich davon:
Ich stand in einer Warteschlange von Menschen, die zum Priester kamen um die Eucharistie zu empfangen. Als ich an der Reihe war und vor dem Priester stand, der mir den Eindruck einer väterlichen und heiligen Persönlichkeit machte, verbeugte ich mich tief bewegt und weinte. Es war mir wie wenn ich in eine Art Heimat zurückkehrt wäre.
13.2
Nun zurück ins Jahr 1959. Gleich nach dem Staatsexamen konnte ich auf der chirurgischen Klinik des Bürgerspitals Solothurn als Assistenzarzt zu arbeiten beginnen. Schon vor dem Examen hatte ich mich dem Chearzt, Dr.Buff vorgestellt und mich auf mein Praktikum bei Hans Bernath in Nazareth bezogen. Hans B. war vor seiner Ausreise nach Israel Oberarzt bei Dr.Buff im Bürgerspital Solothurn, vorher im Kantonsspital Zürich unter Prof.Brunner. Deshalb kannte ihn Dr.Buff und vertraute seiner Empfehlung.
Während den ersten Wochen konnte ich bei den künftigen Schwiegereltern Kuhn in Solothurn wohnen, sogar im Zimmer von Verena. Mit der Zeit fand ich ein Zimmer noch näher beim Spital, bei der freundlichen, Frau Kaiser, der Witwe eines Steuerbeamten. Von ihm erzählte mir Frau Kaiser, nach der Pensionierung habe er zum Zeitvertreib auf der Rückseite von alten grünen Formularen für die Steuerzahlung mit der Schreibmaschine für jeden Tag der Woche das Menü geschrieben, das seine Ehefrau zu kochen habe. Die gute Schlummermutter stellte mir jeden Abend eine Tasse mit Milchkaffee und Gebäck ins Zimmer. Bis ich aus dem Spital jeweils nach Hause kam, war der Kaffee zwar immer schon kalt, denn die Arbeitstage dauerten meistens bis spät in die Nacht.
Jeden Werktag-Vormittag wurde operiert: ”um 7 Uhr Schnitt“. Der Patient musste um sieben Uhr narkotisiert und das Operationsfeld vorbereitet sein. Als Erstes das lange Ritual des Händewaschens, der Einkleidung mit dem sterilen weissen Mantel durch die schon ”sterile“ Instrumtierschwester, Desinfektion und rundum Abdecken des Operationsfeldes mit den weissen, später türkiesblauen Tüchern. Bis dann war sieben Uhr. Dann kam der Operateur und machte den Hautschnitt.
Es gab damals noch keinen Facharzt für Anästhesie. Der am Vorabend auf der Operationenliste notierte Assistenzarzt wird am nächsten Morgen dieses ganze Prozedere des Narkotisierens durchführen: Weil Curare aber nicht nur die Körpermuskulatur sondern auch die Atmung lähmt, war während der ganzen Wirkungszeit externe Beatmung erforderlich. Die Narkose wurde mit der intravenösen Injektion von Pentotal eingeleitet, dann ein kurzwirkendes Curarin, dann Intubation: ein Kautschukschlauch wird mit Hilfe eines leuchtenden Spatels zwischen die sich öffnenden Stimmritze in die Trachea eingeführt und mit einem kleinen Ballon rundherum gegen die Tracheawand abgedichtet. Dann wird das längerwirkende Curarepräparat in die Vene injiziert. Die Narkoseschwester übernimmt dann den Beatmungsbeutel, mit dem sie den Patienten während der ganzen Operation von Hand durch rhythmische Pressen und Loslassen des Beutels beatmet. Sie hat zudem regelmässig den Blutkreislauf zu kontrollieren und auf Anordnung des Operateurs oder des Assistenten die Narkosetiefe oder den Wirksamkeit der Muskelentspannung mit zusätzlichen Dosen von Hypnotika (Lachgas oder seltener Äthyläther) oder Curare zu steuern.
Im Bürgerspital Solothurn waren einige der im Operationssaal und auf den Abteilungen tätigen Schwestern Nonnen vom Orden der Ursulinerinnen. Die Ärzte waren von diesem Konvent angestellt. Beim Beginn der Anstellung mussten neu angestellte Ärzte sich der Priorin, der eigentlichen Arbeitgeberin des Spitalpersonals, der “Frau Mutter“ vorstellen.
13.3
Die Kollegen. Oberarzt war Bruno Vogt, ein gross gewachsener, ein wenig gebückt gehender schöner Mann, mit leiser, weicher Stimme, ein manuell und wissenschaftlich hochbegabter Arzt und Chirurg. Er lebte in Bern mit einer ehemaligen Assistenzärztin vom Bürgerspital Solothurn zusammen.
Der wahrscheinlich älteste Assistent war Bianchetti, ein grosser, dicker Tessiner. (Ich habe seinen Vornamen vergessen).
Ich erinnere mich an eine peinliche Szene. Bianchetti war schlecht gelaunt und zudem kam er beim Operieren in Schwierigkeiten. Er liess die unschuldig und zuverlässig ihren Atmungsbeutel quetschende Nonne seine Nervosität spüren..Sie war eine der Zuverlässigsten und Geduldigsten. Sie versuchte sich zu beruhigen indem sie laut Gebete der Kirche sprach. Ich weiss nicht mehr, ob der Operateur, davon beeindruckt, seine Tiraden unterdrückte.
Eines Abends hatte und ich meine Kollegen zu einem kleinen Nachtessen in unsere Wohnung eingeladen. Es war kurz nachdem Bianchettis Frau, eine Dänin, ihr erstesKind bekommen hatte. Ich beglückwünschte sie und fragte aus ahnungsloser Sympathie wie es ihr gegangen sei. Sie antwortete heftig: "Alle sagen es ist nicht slimm, aber es war sehr slimm“. Da Verena und ich (noch) keinen Wein tranken und sogar das Hochzeitsgeschenk von Weingläsern abgelehnt hatten, offerierten wir in unserer Unerfahrenheit als Gastgeber meinen Kollegen keinen Wein. (Ich hätte an das Wunder der Hochzeit von Kana denken müssen). Meine Kollegen waren so nett, nicht zu reklamieren, aber sie haben sich wahrscheinlich über uns gewundert. Es gab unter den Assistenzärzten noch einen zweiten italienisch Sprechenden, wie Kollege Bianchetti einen Tessiner, dessen Namen ich vergessen habe. Späte kamen noch drei Deutschschweizer dazu: Röthlisberger, Jud und Zürcher.
Alfred B. war der Sohn eines bekannten Spezialisten für orthopädische Chirurgie. Er folgte seinem Vater und wurde Chefarzt der Abteilung für orthopädische Chirurgie im Triemlispital Zürich. Ich hatte ihn zu unserer Verlobung als Begleiter von Sabeth eingeladen. Es war von ihr begeistert und lud sie zum Besuch der Biennale nach Venedig ein. Sie aber liess sich auf seine Avance nicht ein.
Unter den Angestellten und Assistenzärzten in diesem Spital herrschte im Verborgenen eine klebrig laszive Atmosphäre. Die Sekretärin der Internisten sass bei jeder Gelegenheit mit den Ärzten zusammen. Sie gab unmissverständliche Verführungszeichen und schien damit Erfolg zu haben. Zu dieser Zeit hatte sich die Frau eines Kollegen umgebracht. Über die Umstände und mögliche Ursache wurde nie gesprochen. Man ahnte, dass Untreue ihres Mannes Ursache dieser Verzweiflungstat gewesen sein könnte.
Ich war schon mit Verena verheiratet als sie einmal mit mir, als ich Nachtdienst hatte, im Zimmer des Pikettarztes im Spital übernachtete. Am anderen Morgen kam unsere nette Dienerin und Faktotum mit dem Fingerring von Verena und fragte die beim Morgenessen sitzenden Kollegen, wem dieser Damenring gehöre, den sie im Schlafzimmer der Chirurgie gefunden habe.
13.4
PD Dr. Hansulrich Buff, der Chefarzt. Er hatte sich habilitiert mit einer Arbeit über plastische Chirurgie, aber er dozierte an der Universität Zürich das weite Spektrum der allgemeinen Chirurgie, die damals noch unter der Leitung von Professor Brunner stand. Es gab ein von seinen Studenten verfasstes so genanntes Skript. Sie liessen es vom Professor begutachten. Er bemerkte dazu: “Ich habe gar nicht gewusst, dass meine Lektionen so gut sind“. Für das Repetitorium der Chirurgie hatte Dr.Buff immer dieses Skript zur Hand. So brauchte er sich nie vorzubereiten. Das entspricht seiner Arbeitsweise. Rasch, speditiv aber beim Operieren dennoch sorgfältig und minutiös. Bis in die USA war er für seine face liftings bekannt, weshalb sich nicht selten Amerikanerinnen von ihm “liften“ liessen. Ich war monatelang sein Privatassistent. Das bedeutete, das ich die Klientinnen vor und nach der Operation fotografieren musste und seine angefangenen Operationen zu vollenden hatte mit äusserst feinem Faden, zwanzig und mehr Nähten, nachdem er vorher nur die Hautschnitte gemacht und vier bis sechs Ecknähte angebracht hatte. Auf diese Weise konnte er in einer Viertelstunde erledigen, wofür ich dann für die knifflige Näharbeit mehr als eine halbe Stunde brauchte. Dafür hatten die Damen die lange Reise und ein stattliches Honorar aufgewendet.
Seine Persönlichkeit lässt sich als submanisch beschreiben. Damit machte er manchen Studenten und auch mir den Eindruck von Kompetenz und Entschlusskraft, besonders im Kontrast zum übergewissenhaften, manchmal langweiligen Professor Brunner. Ich lernte als Assistenzarzt auch die Schattenseite des Dr.Buff kennen.
Ein Junger Mann war nach einem Motorradunfall als Notfall aufgenommen worden. Er hatte ein Trümmerfraktur eines Oberschenkelknochens und war bewusstlos. Eine Operation kam wegen seinem Schockzustand noch nicht in Frage. Ich hatte Notfalldienst und musste deswegen die Nacht über im Spital bleiben mit der besonderen Aufgabe, diesen Schwerverletzten häufig zu kontrolliere, auf Blutdruck und Zeichen von Veränderungen im Schädel, also die Reaktion der Pupillen und die Tiefe der Bewusstlosigkeit. der Chef war bei sich zu Hause, Dr.Bruno Vogt, im Bern bei seiner Geliebten. Bei einer meiner häufigen Kontrollen fand ich dass die Pupillen des Jungen auf Licht nicht mehr reagierten. *Pupillenstarre“, ein Zeichen für schwere Schädigung des Gehirns. Ich rief Bruno Vogt an. Er raste von Bern ins Spital und alarmierte sogleich den Chef. Kaum angekommen begann der Chef mich anzubrüllen. Ich verschulde den desolaten Zustand des Verletzten, ich hätte den hätte ihn unzuverlässig überwacht. Ich könne gleich den nächsten Zug nehmen und abhauen! Vogt versuchte mich zu rechtfertigen. Er fand, dass ich mich In dieser Situation richtig verhalten hätte, den bedrohlichen Zustand richtig festgestellt und den Oberarzt gerufen. Bruno war auch unsicher und hatte deshalb den Chef herbeigerufen. Dieser diagnostizierte eine Fettembolie. Bei Trümmerfraktluren grosser Knochen gelangt fetthaltiges Knochenmark in den Blutkreislauf wodurch die feinen Haargefässe des Gehirns verstopft werden. Dadurch wird dem Gehirn zu wenig Sauerstoff und Glucose zugeführt, so dass es seine lebenswichtigen Funktionen einstellt.
Das sei, fand Bruno Vogt, die Assistententaufe gewesen, die jeder einmal über sich ergehen lasse müsse. Wenn der Assistent mit Gelassenheit reagiere und nicht meinte sich verteidigen zu müssen, sei er akzeptiert. Das schien bei mir der Fall zu sein, der er machte mich für lange Zeit Chefassistenten und wünschte, mich neben dem Kollegen Dr.Rötlisberger nach Zürich mitzunehmen. Nach meiner Heirat sagte der Chef einmal, sein Vorgänger “Clairmont“ habe jeden Assistenten der heiratete entlassen. Ich frage: Wollen sie mich jetzt auch entlassen? Buff: “Ich bin nicht Clairmont“.
13.5
Nach der Rückkehr aus Israel, von der zweiten, sechs Monate dauernden Vertretung, nahm ich die Arbeit als Assistent am Bürgerspita Solothurn wieder auf (cf.Kap.15, Nazareth II). Da wurde ich gleich mit der Neuigkeit überrascht, dass Dr.Buff an die Chirurgische Universitätsklinik Zürich berufen worden war.
Sein Nachfolger wurde Dr. Bächtold (Berch...?). Dieser hätte mich gerne in Sothurn behalten. Er war das Gegenteil von Buff, langsam und gewissenhaft. Die Opsschwestern stöhnten, weil nun die Operationen des Chefs doppelt so lange dauerten wie bisher. Wenn ich aber bei ihm geblieben war, hätte er mich wahrscheinlich nach seiner nicht viel später erfolgten Wahl als Chefarzt an die Uniklinik Bern mitgenommen, Eine Chance verpasst, Oberarzt zu werden! Für Verena allerdings wäre eine solche Beförderung unerträglich gewesn.Als Oberarzt ist man sehr häufig auf Pikett. Später hätte ich vom Neumünsterspital aus bei Prof. Koller Oberarzt in Basel werden können.Auch das hatte ich aus Rücksicht auf Verena abgelehnt.

14.1
In Zürich, an der Attenhoferstrasse, war das Studentenheim der VBG unter Leitung des Ehepaars Hans und Madeleine Bernath–Perret. Dr.Bernath war damals Oberarzt an der chirurgischen Abteilung des Zürcher Universitätsspitals. Er war mir hie und da aufgefallen als etwas untersetzter, kräftiger Mann mit einem grossen Kopf, aber, obschon ich zu den Veranstaltungen der GBU (Groupes Bibliques Universitaires, später: SBG =Studentenbibelgruppen und VBG = Vereinigte Bibelgruppen) oft in diesem Haus war, hatte ich ihn nicht persönlich kennen gelernt.
14.2
Hans Bernath. Eine Tages erzählte er in einer kleinen Versammlung von VBG-Leuten von einem Missionsspital, in Nazaret, im Staat Israel. Zur Zeit, als Palästina Protektorat unter Grossbritannien war, also nach 1917, hatte eine Gesellschaft namens Edinburgh Medical Mission Society dieses Spital gegründet zur ärztlichen Versorgung der arabischen Bevölkerung des Nordens von Palästina. Nachdem Dr.Bernath noch eine zeitlang als Oberarzt unter dem Chefarzt Dr.Buff im Bürgerspital Solothurn und in der chirurgischen Universitätsklinik Zürich gearbeitet hatte, werde er künftig in diesem Spital die Stelle als Chirurg einnehmen. Fast nebenbei meinte er: Für Euch Medizinstudenten wird es möglich sein, in diesem Spital eines der obligatorischen Praktika zu absolvieren.
14.3
Damals hatte ich mich schon um ein Dissertationsthema beworben und zwar bei Prof.Wyss, dem Physiologen. Er hatte mir zwei Themen vorgeschlagen: Die Physiologie der Nabelschnurarterien-Kontraktion nach der Geburt oder das Elektroenzephalogramm des Frosches. Ich hätte mich für das Erste entschieden als das Praxisnähere. Mein Vater war mit einer dadurch bedingten Verlängerung des Studiums um ein halbes Jahr einverstanden. Nun aber kam das Projekt "Praktikum in Nazareth“ dazwischen. Mit Hans Bernath, der nun schon in Israel tätig war, lief jetzt eine lebhafte Korrespondenz. Ich sei dort als Unterassistent willkommen. Aber Dr.Reich, der damalige Präsident der Medinalprüfungs- Kommission, lehnte die Anerkennung als offizielles Praktikum ab, trotz der Intervention Prof.Brunners.. Ich liess mich von diesem Hindernis aber nicht vom Nazareth-Projekt abhalten.
14.4
Um das Geld für die Reise zu verdienen arbeitete ich als Zeichner an der Neuauflage des Buches für Topographische Anatomie von Prof. Töndury. Leider erkrankte er zu dieser Zeit, sodass nicht alle der vorgesehen Tafeln zur Ausführung kamen. Immerhin gab er mir ein Honorar von tausend Franken. Die Tante Margrit streckte mir noch fünfhundert Franken vor mit der Ermahnung, ja kein “Judemeitli“ heimzubringen.
Hans Bernath bestellte einige Mitbringsel, unter Anderem einen Vakuumextraktor für die Geburtshilfe und eine Menge Operationshandschuhe. Ich hatte die Anwendung des Vakuumextraktors bei Dr.Stumpf, dem Gynäkologen des Bürgerspitals Solothurn gelernt.
14.5
Im April 1957 bestieg ich in Genua die Enotria, ein Pasagierschiff der Gesellschaft "Adriatica“.
Auf der Strecke nach Neapel lernte ich eine intelligente und sympathische junge Frau kennen, Fintje Marcus, aus Holland, die ein ähnliches Schicksal erlitten hatte wie Anne Frank, nur war sie gerettet worden. Sie lehrte mich einige Lieder in Ivrit. In Neapel, dem Zwischenhalt auf unserer Schiffsreise spazierten wir zusammen durch die Stadt. Sie entsetzte sich über die riesige neonbeleuchtete Statue der Madonna, die eine Kirchenfassade krönte. Ich wollte über den Libanon, Syrien und Jordanien nach Israel reisen, eine politisch etwas riskante Route, für die ich ein spezielles, von der UNO ausgestelltes Visum brauchte. In Piräus musste ich auf ein Schiff nach Beirut umsteigen. Ich nahm Abschied von Fintje, die auf der Enotria Richtung Haifa blieb. Wir tauschten unsere Israel-Adressen aus. Später besuchte ich sie einmal in ihrem Kibbuz in der Ebene Jesreel, nicht weit von Nazareth.
14.6
Athen. In Piräus gab es ein Altersheim für Armenier, welche vor dem Massaker in der Osttürkei nach Griechenland hatten fliehen können, das von einer Schweizer Armenienhilfe-Organisation geführt wurde. Es hiess deshalb „Helvetiko Girokomio“. Dort konnte ich übernachten bis zur Abfahrt des Libanon-Schiffes. Zwei Frauen aus dem Leiterteam (Frau Alder und...) zeigten mir Athen. Vor dem Postbüro in der Innenstadt sassen Berufs-Schreiber vor ihren mit Papier überdeckten Tischchen, die für Analfabeten Schriftstücke verfassten. In einer riesigen Markthalle wurde das Fleisch verkauft. Die Gasse der Handwerker und Schenken war erfüllt vom dissonanten Jaulen orientalischer Musik, die aus antiken Grammophonen mit riesigen Schallhörnern drang. Die Mechaniker- und Schreiner-Werkstätten, die Schneider-Ateliers und die Kaufläden waren nach der Strasse geöffnet, durch die sich ein konstanter Menschenfluss bewegte. Gearbeitet wurde im Freien. Zusammen mit den Kaufläden bot dieses Quartier den Anblick eines richtigen orientalischen Suq. Mit dem Sohn des Heimleiters und dessen Freund besuchten wir eine Schenke und tranken Rezina. Auf dem nackten Holz des Tisches standen Brocken von Fetakäse. Man klaubte von Hand kleinere Stücke davon ab und ass sie zum Wein.
Den Zwischenhalt in Alexandrien bis zur Weiterfahrt nach Beirut verbrachte ich mit Flanieren und Staunen über den Zauberer, der die wartenden Schiffspassagiere amüsierte, die vollständig maskierten Bettlerinnen, die mit ihren kleinen Kindern auf der Strasse am Boden sassen und die Männer, die im Pijama auf den Strassen umherspazierten.
14.7
Bei der Ankunft in Beirut spielte sich eine Szene ab, die sich auf ähnliche Art bei beiden noch folgenden Grenzübertritten wiederholte: Ich wurde als spionageverdächtig im Schiff festgehalten. Erst nachdem ich mich der Polizei, die zur Personenkontrolle aufs Schiff gekommen war, mit meinem Taufschein als Christ ausgewiesen hatte, durfte ich das Schiff verlassen. Soviel ich die Kontrolleure verstand, figurierte ich mit meinem jüdisch aussehenden Namen ”Meyer” auf einer Schwarzen Liste.
14.8
Madeleine Bernath kannte von Grandchamps, einer ökumenischen Kommunität (eine weibliche Abzweigung der Bruderschaft von Taizé), Schwester Beatrice und Schwester Ruth. Sie arbeiteten in Beirut in einer Poliklinik für Augenkrankheiten. Genau wie wir uns brieflich verabredet hatten, standen sie trotz der Verzögerung geduldig am Ausgang für die Schiffspassagiere und nahmen mich bei sich auf.
Hier durfte ich einige Tage wohnen
Die Schwestern zeigten mir die Stadt Beirut, brachten mich zu einer "Fraternität von "kleinen Schwestern“ von der Kommunität, die von Charles de Foucault gegründet worden war. Diese Frauen waren berufen, ihr Leben mit den Ärmsten zu teilen und für ihren Unterhalt "niedrigste“ Arbeit zu leisten, als Putzfrauen oder Arbeiterinnen. Sie lebten wie einige Zehntausend Randbewohner dieser Stadt im ”Bidonville“, im Slum, in einem buchstäblich aus Blechkanistern, Kistenholz und Kartonschachteln zusammen gebastelten Häuschen ohne Infrastruktur. Die Ausstrahlung der drei Frauen hat mich zutiefst beeindruckt. Nicht die Heiligkeit, Askese und hierarchische Unterordnung mancher kirchlichen Einrichtungen, sondern Frohgemut und Menschenliebe erhellten die Stimmung ihrer Hütte. Mit der jüngeren er zwei Grandchamps-Schwestern (Ruth) machte ich einen Ausflug nach Byblos (Griechisches Theater und Kinderselette in tönernden Amphoren) und Tyr. Diese Gegend gehörte zum alten Phönizien, einem Volk von Seefahrern, die mehrere bedeutsame Stadte als Handelsniederlassungen rund um das Mittelmeer gegründet hatten, wie Karthago und die später Emporio genannte Handelsstadt in Spanien. Von Tyr (Tyros) gab es eine Fahrt auf das Libanongebirge zu den letzten etwa siebzig Zedern. Im Winter kann man hier Ski fahren. Es gibt sogar einen Skilift.
Der die Augenpoliklinik in Beirut führende Arzt zeigte mir einige Fälle von Trachom, die so genannte ägyptische Augenkrankheit, und seine Behandlung. Dann wurde ich vom Pfarrer der protestantischen Gemeinde aufgenommen. Er erklärte mir die komplizierten Zusammenhänge der verschiedenen christlichen Kirchen im Libanon. Die Hälfte der Bevölkerung seien Christen, davon die meisten Maroniten, eine alte orientalische (die alt-syrische?) Kirche, die sich mit der lateinischen (katholischen) Kirche uniert hatte.
14.9
Die Fortsetzung der Reise verdanke ich dem Pfarrer Carl Vischer, den ich auch von der VBG kannte. Er war Lehrer in einem Internat, das auf halber Höhe des Libanongebirges liegt, der “Schneller-Schule.“ Er holte mich mir seinem VW-Käfer von Beirut ab. In dem Internat konnte ich übernachten. Ich begann die Gastfreundschaft dieser Leute schon für selbstverständlich zu halten.
Dann die VW-Fahrt über den Libanon in die Hochebene zwischen den beiden Gebirgszügen, des Libanon und des Antilibanon und zur Grenze nach Syrien. Dasselbe Prozedere spielte sich jetzt wieder bei den Grenzwachposten ab, obschon die Libanesen mir freundlicherweise in dem Pass notiert hatten, dass ich nicht identisch sei mit dem spionageverdächtigen xxMeyer. Jenseits des Libanon und kamen wir in die Biq’a, die ausgedörrte Hochebene, die beherrscht wird von gigantischen hellenistische Tempeln zur Verehrung olympischer Götter allen voran dem Göttervater und Blitze schleudernden Zeus. In dem trockenen Klima und spärlich besiedelten Land sind die kannelierten Säulenmonster von der Basis bis zu den korinthischen Kapitellen noch unversehrt. Dagegen sind die vielen für die ebenso viele Götterstatuen bestimmten manshohen gewölbten Mauernischen leer. Nachdem Carl mit seinem VW die karge Ebene durchquert hatte, gab es die nrue Steigung, den Antilibanon und kamen ins immer noch etwas kahle und gebirgige Landschaft, die mit grossen Wasserschöpfrädern, den Nuria, bewässert wurde.
14.10
In Damaskus erwartete uns die Familie Cavalcanti, wo Carl und ich gastfreundlich aufgenommen wurden. Da war der Vater, Lehrer in einer Mittelschule, eine temperamentvolle Ehefrau und Mutter von zwei schönen Mädchen. Die Ältere hiess Astrasia, war etwa achtzehn, die Jüngere, deren Name ich vergessen habe, schätzungsweise fünfzehn Jahre alt. Sie leiten ihren italienisch klingenden Familiennamen von Kreuzrittern ab, von welchen wahrscheinlich einige nach der Niederlage der Kreuzritter in Akkon (1291) in Palästina zurückgeblieben waren.
Frau Cavalcanti erzählte uns das Schicksal ihrer Familie. Wie Hunderte und Tausende mussten sie 1948 ihr ursprüngliches Heim als Flüchtlinge verlassen. Sie besassen ein Haus in Tiberias, Sie kamen aber nicht in ein Flüchtlingslager, sondern konnten sich in Damaskus eine neue Existenz aufbauen. Vom Krieg von 1948 hatte ich einige Kenntnis, doch mit vom Krieg unmittelbar Betroffene zu sprechen das hatte mich schon sehr beeindruckt. Obschon Frau C. beim Erzählen ihres Schicksals keinen Hass zeigte, war doch ihre Trauer um den Verlust, das Ressentiment gegen die Juden und die Ablehnung des jüdischen Staates einfühlbar, im Gegensatz zu ihrem Verwandten, dem Arzt und Major Haddad im Beith Jala, der die Shoa für eine gute Sache hielt.
Frau Cavalcanti. war eine ausgezeichnete Reiseführerin. Die erste oder eine der ersten Moscheen, war von der ältesten muslimischen Dynastie, den Umaijaden, erbaut worden. Sie hielten sich für die echten Nachfolger des Propheten. Dieses ehrwürdige Bethaus wurde in einem Teil des riesigen römischen Tempels errichtet. Aber da nicht die ganzen zwei seitlichen Säulenreihen des ursprünglichen, Tempels für den Hof und die Gebetshalle der Moschee gebraucht wurden, setzt sich die Reihe der mächtigen korinthischen Säulen in die Stadt fort, und bildet die ”gerade Strasse“, die in der Apostelgeschichte im Zusammenhang mit der Bekehrung des Saulus zu Paulus erwähnt wird.
Ich lernte von unserer Reiseführerin, dass die dekorativen Mosaike an der Fassade der Umaijadenmoschee von christlichen Künstlern aus Konstantinopel ausgeführt wurden. Natürlich nur mit abstrakten oder pflanzlichen Mustern, weil im Islam die Darstellung von Menschen, und, streng genommen, sogar von Tieren, verboten ist, damit die Gläubigen nicht in die Verehrung von Götzenbildern zurückfallen: Es hat also, entgegen der europäischen Schwarzweissmalerei in der Geschichte des Orients zeitweise ein friedlicher Kulturaustausch zwischen den verschiedenen religiösen Bereichen gegeben, der erst durch die Kreuzzüge zerstört worden ist.
Von Damaskus aus führte Carl die beiden Mädchen und mich nochmals in die Beq’a, zu den Tempeln von Baalbek.
Astrasia und ihre Schwester waren zu perfekter Höflichkeit erzogen worden, fast zu perfekt. Jedes Mal wenn Carl oder ich uns für eine beliebige Kleinigkeit bedankten, kam wie aus einem Automat: „You’re wellcome!“
Jahre später tauchte Astrasia plötzlich in Zürich auf und rief mich an. Ich weiss nicht mehr auf welche Weise schrieb oder sagte mir Frau Cavalcanti., dass sie von Carl enttäuscht sei. Vielleicht gab es für ihre Gastfreundschaft einen Grund: die Hoffnung, dass wir beiden Schweizer, der Pfarrer und der Arzt, sich für ihre Töchter interessieren sollten. Ob Astrasia von der Mutter deshalb nach Zürich geschickt worden war, um doch noch diese Möglichkeit auszukundschaften?
14.11
Die Erinnerung fliegt jetzt nach Jordanien, nach Amman und Jericho. Während der Fahrt in diesem Sammeltaxi, (den Frau Cavalcanti übrigens für mich bezahlte, da gab es keine Widerrede) brachte das Radio die akustische Begleitung zur Wüstenlandschaft, ein von kunstvoll getrommelten Rhythmen begleitetes Wimmern, unterbrochen von aggressiv tönenden Ansprachen. Ich meinte das seien Hetzreden gegen Israel aus Aegypten. Von Jericho bleibt mir ein ausgegrabener runder, kompakt gemauerter Turm in Erinnerung und die historische Datierung dieser ältesten städtischen Siedelung, ungefähr achttausend Jahre vor Christus, der Übergang der Steinzeit zum Chalkolithikum. Das war meine erste Begegnung mit den materiellen Überbleibseln unserer Urkultur, der "Wiege der Zivilisation Europas“.
14.12
Dies Reise vun Damaskus nach Jerusalem und das folgende Halbjahr in Israel hat sich mir als tiefes und gefühlstarkes Erleben eingeprägt. Die flimmernde Luft die wie einen Dunst über die Wüsten legt, die Menschen und ihre kräftige laute Sprache, und überall die eintönige Musik, die wie ein feines Gewebe alles einzuhüllen schien. Ein starkes Gefühl für das Fremde, Exotische, Orientalische und doch wie schon vertraut. Ich hatte mich mit dem Studium historischer Literatur und Texten der Bibel auf diese Landschaft und ihre Geschichte vorbereitet, und jetzt wurde das Buchwissen zu sichtbarer und fühlbarer Wirklichkeit und zu vertieftem und emotionalem Wissen.
14.13
In Jerusalem.
Vom Jordantal aus wurde in der Ferne gegen Westen ein Hügelzug sichtbar mir einem Turm: Das Augusta-Viktoria Spital auf dem Ölberg. Alt-Jerusalem gehörte damals zu Jordanien und war durch ein Niemandsland vom Staat Israel und Neu-Jerusalem getrennt. Umgeben von den uralten Mauern einer ursprünglichen Niederlassung des Johanniterordens waren der Sitz des deutschen Bischofs der evangelischen Kirche und eine Jugendherberge untergebracht und mit dem mittelalterlichen Kreuzgang der Kirche angebaut. Am Sonntag läutete ich die Glocke für den Gottesdienst, nach alter Weise mit einem Seil. Die Sekretärin des Bischofs, welche die Jugendherberge betreut, meldete, kaum war ich eingetroffen, dass über die Stadt Ausgangssperre verhängt worden sei.
Nachdem ich mich in verschiedenen Viertel der Altstadt wieder frei bewegen konnte, musste ich mich zunächst um das vorbestellte Visum der UNO kümmern, damit ich, der Abmachung mit Bernaths gemäss, am 26. Oktober durch das so genannte Mandelbaumtor das Niemandsland nach Israel über queren konnte.
Es blieben mir bis dann einige Tage, die ich dem Besichtigen des historischen, östlichen Teils von Jerusalem widmen konnte. Auf engsten Raum waren in den verschachtelten Quartieren die verschiedenen religiösen und ethnischen Bevölkerungsgruppen untergebracht, unterbrochen von einem weiten Platz mit dem Felsendom. Dieser ist umgeben vom mindestens einer Hektare grossen leeren alten Tempelplatz ein achteckiges würdig und harmonisch wirkendes Heiligtum. Die acht Seitenmauern sind vollständig mit farbigen Mosaiken überzogen. Ihre Farben schimmern in Ultrmarinblau, Türkis und grün. Das edle Achteck wird von einer ganz von Gold überzogenen Kuppel gekrönt (Die Kuppel war zu meiner Zeit noch dunkelgrau. Sie wurde erst einige Jahre später neu vergoldet). In der Mitte des hellen und stillen Innenraums liegt ein kantiger Felsblock mit einem weit klaffenden Loch. Durch dieses Loch soll nach dem Glauben einfacher Muslime, der Prophet Mohammed auf seinem Pferd reitend direkt in den Himmel gesprungen sein. Nach der jüdischen und christlichen Tradition war hier der Ort Morija, wo Abraham, dem Befehl von Jahve gehorchend, seinen Sohn Isa’ak hätte opfern sollen. Ein Engel verhinderte im letzten Augenblick dieses Menschenopfer. Im Süden begrenzt die grosse Al Aksa Moschee den Tempelplatz.
14.14
Ein Leprosarium
Südlich der alten Sadtmauer von Jerusalem gibt es das Tal von Siloah. Hier liegt ein Leprosarium, betreut von einer Schweizerin. Nachdem ich mich ihr als angehender Arzt vorgestellt hatte, führte sie mich zu einigen ihrer Patienten. Da sass ein alter Mann mit dem weissen Turban um den roten, kegelförmige Fez genannte Kopfbedeckung, also ein Scheich, ein Koran-Gelehrter. Er hatte keine Hände mehr, nur noch eiternde Unterarmstümpfe. Einem etwa fünfzehnjährigen Mädchen hob die Pflegerin einen grossen Verband vom linken Bein ab. Ein ausgedehntes Geschwür kam zum Vorschein. Leider verpasste ich die Gelegenheit, die Leiterin nach der Art der Behandlung zu erkundigen, ob sie Heilungen erlebt habe, ob es auch die so genannte akute Form der Lepra, die Leprareaktion, gebe, und ob sich auch ein Arzt um diese armen Menschen kümmere.
14.15
In der Nähe gibt es noch immer den Teich Siloah. Dorthin wies Jesus einen Blinden, sich mit dem Wasser die Augen auszuwaschen. Jesus hatte auf dessen Lider eine eigenartige Paste aus Sand und Speichel gestrichen. Als Jerusalem unter Hiskia, dem König von Juda, von den Assyrern bedrohnt wurde, liess er alle Wasserquellen in der Umgebung deer Stdt zuschütten. Aber vom Siloah-Teich aus liess er einen Kanal durch den Felsen graben, um Wasser in die Stadt zu leiten. Zusammen mit einem Reisegefährten, den ich in der Herberge kennen gelernt hatte, durchquerte ich diesen Kanal, der zur Zeit kein Wasser führte. In der Mitte befand sich eine Steintafel mit einer althebräischer Inschrift, die besagt, dass der Tunell von beiden Enden her aus dem Felsen gehauen worden und an dieser Stelle zusammen gekommen sei. Wie das ohne die heute möglichen Messungen möglich war, bleibt ein Rätsel.
14.16
Der westliche Abhang des Kidrontales wird eingenommen von der Stadtmauer und einem jetzt vermauerten Tor. Dahinter erhebt sich die Kuppel des Felsendoms. Die gegenüberliegende Seite des Tales Ist übersäht mit umgestürzten alten Grabsteinen. Im Talgrund steht in einer Felsnische ein zur steilen Pyramide geformter Monolith. Ich weiss nicht zu wessen Ehre dieses auffällige Monument erbaut oder aus dem Felsen gehauen worden war. In der Nähe liegt der von uralten Ölbäumen bewachsene Garten Gethsemane, wo Jesus von Judas verraten und von den Knechten des Sanhedrin verhaftet worden war. Das ist einer der vielen, aus den biblischen Berichten bekannten Orte, die in Jerusalem und seiner Umgebung zu sehen sind.
Besonders überraschten mich die noch erhaltenen antiken Gräber, aus dem Felsen, gemeisselte, so genannte Bankgräber. Sie erklären genau den Bericht der Grablegung von Jesus nach Matthäus, Kap. 27, 29 und 30. In diesen zwei Versen wird das Grab beschrieben, in welches Jesus nach seinem Tod gelegt wurde.. „Und Joseph (von Arimatäa) nahm den Leichnam, wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in ein neues Grab, das er für sich in den Felsen hatte hauen lassen, wälzte einen grossen Stein vor den Eingang des Grabes und entfernte sich.“ An den erhaltenen antiken Gräbern kann man erkennen, dass der "grosse Stein“ rund war, ähnlich einem Mühlestein, geformt und in einer quer verlaufenden Rille vor den Grabeingang gewälzt wurde. Er war, wie der Bericht weiter erzählt, zu schwer um von den Frauen weggerollt zu werden. Sie wollten den Toten am Tag darauf wie es die Sitte verlangte, noch mit aromatischen Kräutern und Salben versehen.
14.17
Bis um Grenzübertritt nach Israel blieb mir noch Zeit für den Ausflug nach Bethlehem. Frau Cavalcanti hatte mit einem Empfehlungsbrief an ihren Verwandten, den Arzt Dr.Haddad, der in Beit Jala, einer Nachbarortschaft von Beithlehem seine Praxis hatte und zugleich als Major der arabischen Legion regelmässig Sprechstunden in der nahen Kaserne durchführte. Er nahm mich bis zur Kaserne mit und parkierte das Auto beim Eingangstor und entschuldigte sich für die Dauer seiner Arztvisite. Währendem ich auf ihn wartete zog ich meinen Notizblock hervor um die letzten Eindrücke aufzuschreiben und zu skizzieren. Da stand aber schon einer der Ascaris vom Wachposten bei mir, nahm mir en Notizblock weg und führte mich zum Kommandanten in der Kaserne, der mich in gutem Englisch ausfragte. Inzwischen war ich es gewohnt, der Spionage verdächtigt zu werden. In aller Unschuld berichtete ich ihm, ich komme aus Syrien und sei ein Gast von Major Haddad. Der hohe Offizier behandelte mich höflich und schien meine Auskunft zu akzeptieren. Da kam auch schon mein Gastgeber und bestätigte meine Unschuld. Der Block mit den Notizen wurde aber konfisziert. Der Major fand mein Verhalten zu recht sehr ungeschickt. Während der Rückfahrt kamen wir natürlich auf Israel zu sprechen. Er konnte die Gründung des Staates Israel vor neun Jahren genau so wenig akzeptieren, wie alle seine Volksgenossen. Er ging in seinem Israelhass sogar noch weiter und sagte: "Schade dass Hitler nicht mehr dazu kam, alle Juden auszurotten.“ Das machte mir deutlich, wie unheimlich das im eigenen Leben erfahrene Unrecht unausrottbaren Hass und schliesslich Morde und Kriege erzeugen kann.
Jetzt überwog aber die orientalische Gastfreundschaft, Denn Doktor Haddad brachte mich noch zur Geburtskirche in Bethlehem. Auffällig an der nüchternen Fassade ist der aus sorgfältig behauenen keilförmigen Steinen gefügte ursprüngliche Eingang, ein hoher Halbrundbogen. Dieser aber hebt sich ab von der weniger kunstvollen Untermauerung, die ein kleineres bogenförmiges Tor offen lässt, das endlich bis auf einen knapp mannshohen rechteckigen Eingang zugemauert ist. Daran lässt sich das Ausmass der im Lauf der Jahrhunderte zunehmende sakrilegische Bedrohung ablesen, gegen die man den Eingang Heiligtums vermauern musste. Das Besondere Im Inneren ist weniger die in orthodoxen Kirchen übliche Dunkelheit, sondern das zweigeteilte ziemlich helles Kirchenschiff. Damit konnten mindestens zwei verschiedene Konfessionen ihre Rituale feiern. Wie der primitive Stall oder die Höhle etwa ausgesehen hat, in welcher gemäss den Evangelien Jesus geboren wurde, ist an dem mit kirchlichen Utensilien überlasteten Inneren nicht mehr zu erkennen. Am Abend kam ich mit einem Sammeltaxi wieder nach Jerusalem.
14.18
Über die Grenze nach Israel. Am 26.Oktober 1956 durchquerte ich das sogenannte Mandelbaumtor, das Niemandsland zwischen Jordanien und Israel. Im Grenzposten auf der jordanischen Seite empfing man mich mit orientalischer Höflichkeit, kontrollierte oberflächlich meinen Pass und das Visum der UNO und offerierte mir Kaffee. Ganz anders war der Empfang auf der israelischen Seite. Ruppige Wachen durchwühlten meinen Koffer. Sie wollten wissen, was ich mit dem mitgebrachten Vakuumextraktor und den Operations-handschuhen im Sinn habe. Zum Glück waren schon Hans und Madeleine Bernath da um die Leute zu beruhigen. Nicht zum Verkaufen waren die Sachen. Sie kämen den Patienten im Nazarethspital zugut. In Nazareth kamen wir erst in dunkler Nacht an. Am folgenden Morgen erwachte ich an einem heftigen Wortwechsel vor dem Nachbarhaus. Hatten die Leute so früh am Morgen schon Streit? Mit der Zeit merkte ich, dass dies die übliche freundliche morgendliche Bagrüssung war und wegen der Lautstärke und den vielen Knack-und Kehllauten des Arabischen für euroäische Ohren ungewöhnlich aggressiv tönte. Im Wohnhaus der Ärzte wohnte die Familie Bernath mit ihren drei Kindern,
14.19
Das Spital in Nazareth hiess offiziell EMMS (Edinburgh Medical Mission Society Hospital. Die Bevölkerung nennt es „Al Mustaschfa Inglis“, das englische Spital.
Worin bestand meine Beschäftigung in diesem Spital?
In den Bettenstationen hielt jeden Morgen jemand vom Pflegepersonal oder der Ärzte eine kurze Andacht. Hie und da wurde ich auch damit betreut. Nach dem Frühstück gab es den "Round“, die Arztvisite. bei den bettlägerigen Kranken liess sich der Arzt von der "Matron“, der Oberschwester oder von der Abteilungs-Schwester, den Verlauf und vom Patienten selbst das Befinden referieren. Der Arzt/die Ärztin änderte bei Bedarf die Behandlung, verordnete weitere Untersuchungen oder bewilligte die Entlassung. Ausser an den Operationstagen, wenn ich die Narkose durchführte oder dem Chirurgen assistierte, war ich anschliessend meistens im Ambulatorium beschäftigt, mit einer Nurse zum Übersetzen.
14.20
Mit der Zeit lernte ich einige Sätze Arabisch, so dass ich für die häufigsten Fragen und Antworten nicht immer auf die Dolmetscherin angewiesen war. Auf diese Art kam ich näher in Beziehung mit der Sprech- und Denkweise der Leute. Erst einige Jahre später wurde das EMMS-Spital dem staatlichen Gesundheitssystem angeschlossen. Seit seiner Gründung, also noch zur omanischen Zeit, diente es nur der arabischen Bevölkerung.
Im Ambulatorium konnte sich das Gespräch mit einem neuen Patienten etwa wie folgt abspielen: Auf die Frage, was dem Patienten fehle, kamen oft solche Antworten
“Ich habe Schmerzen
Seit wann hast du Schmerzen? (im Arabischen gibt es keine Höflichkeitsform).
Seit langer Zeit.
Wo tut es weh?
Überall“.
Wenn man den schmerzenden Ort genauer wissen wollte, deuteten die Kranken meistens auf den Bauch. Selbst wenn gerötete oder gar eiternde Augen von Anfang an den Ort des Leidens verrieten. Dareuf hingewiesen hörte ich oft: “Maalesch, das ist nicht schlimm“. Augenentzündungen sind so häufig, dass man deswegen den Arzt nicht für nötig hält. Die Menschen haben ein ausgeprägtes Bauch- aber kein Augenbewusstsein. Für die Behandlung mancher anderer Leiden hatten viele Leute schon einen Medizinmann besucht, der in der Regel über der schmerzenden Körperstelle eine "Miqwa“ anbringt, indem er in eine kleine künstliche Hautwunde die Bohne einer bestimmten Pflanze drückt, das grüne Blatt der Pflanzen darüber legt und mit irgendwelchen Fasern befestigt. Die dadurch provozierte Eiterung galt, wie schon in der Medizin des Altertums, als “pus bonum et laudabile“, als löbliche Eiterung. Eine Behandlung, die nicht schmerzt, gilt als unwirksam. Darmwürmer sind sehr häufig. Zur Diagnose der Art dieser Parasiten genügt die Frage: "Dud kabir au dud saghir? Grosser oder kleiner Wurm?” (Spuhlwurm oder Bandwurm?) So konnte ich erfahren, welche Medikamente der Patient schlucken musste. Manchmal kam er enttäuscht aus der Apotheke zurück, warf das Säcklein mit den Tabletten auf meinen Tisch und sagt: Nur Pillen? ”Lasimni ibri" Ich will eine Spritze! Aus demselben Grund lieben die meisten Leute Operationen. Viele kamen zu uns um ihren Leistenbruch oder ihre Hämorrhoiden operieren zu lassen.
14.21
Von besonderem Interesse fand ich die Geburtshilfe. Schon damit, dass die Gebärenden einen Teil ihrer vielschichtigen Kleider ausziehen mussten, hatten die Hebammen ein Problem, denn die Frauenkleider waren oft so zugenäht, dass es dazu die Schere brauchte. Für Frauen aus dem Volk der Drusen, Angehörige einer besonderen, wenig bekannten Religion, aus dem Grenzgebiet zwischen Israel, Libanon und Syrien schien die Entkleidung besonders traumatisch zu sein. Im Gegensatz zur Meinung mancher Europäer, dass Frauen aus weniger zivilisierten Völkern ihre Geburt leicht und klaglos erduldeten, gab es in der Gebärabteilung lautstarke und geradezu fantasievolle Äusserungen von Angst und Wehenschmerzen. "Ich sterbe! Erbarme dich, o Doktor, o Mohammed, o Messias!.......“ In der angelsächsischen Geburtshilfe war der Gebrauch der so genannten Beckenausgangszange sehr beliebt. Deshalb wurde der Vakuumextraktor, den ich mitgebracht hatte, am Anfang kritisch aufgenommen, bis man sah, dass damit der Kopf des Kindchens weniger verformt wurde als mit der Zange.
Wenn nach der glücklichen Geburt die Hebamme meldet, dass es ein Knabe sei, antwortet die Mutter meistens “Gott sei bedankt und gelobt!“. Ist es ein Mädchen, wird Gott weniger oder überhaupt nicht gelobt. Wie fast überall auf der Welt diese traurige Missachtung der Mädchen und Frauen.
14.22
Hakimi. „Die Weise“ wörtlich übersetzt. “Hakim“ bedeutete in der Umgangssprache Arzt, Hakimi Ärztin. Für diese wunderbare Frau passte der Doppelsinn: Sie war nicht nur Ärztin, sie war im ursprünglichen Wortsinn weise. Sie gross von Gestalt, waren ihre Haare weiss, obschon sie vermutlich kaum über vierzig war. Ihre Weisheit zeigte sich neben ihrer beträchtlichen medizinischen Kompetenz in ihrem liebevollem und einfühlsamen Umgang und mit allen ihren Mitmenschen, besonders natürlich mit Kranken. Im Gespräch und ihrer ganzen Haltung war nie etwas Richtendes, Verurteilendes oder Überhebliches zu spüren. Diese Frau war für mich das Vorbild des fähigen Mediziners als reifer Christ.
Sie zeigte mir an einem Patienten, der aus Versehen oder in suizidaler Absicht Kerosen getrunken hatte, wie man eine Magenspülung durchführt. Trotz der an sich nicht besonders feinen Prozedur waren ihre Bewegungen graziös und sanft unter beruhigendem Gespräch mit dem Patienten. Sie hatte vor einiger Zeit den Posten im Spital verlassen, um im Norden von Galiläa ein Ambulatorium zu führen, das bedeutet, dass sie allein volle Verantwortung zu übernehmen hatte. Das war ein entsagungsvoller Wechsel. Sie verzichtete damit auf den täglichen Austausch mit ihresgleichen.
Die Hakimi erstaunte mich auch durch ihre ökumenisch gesinnten, geistlich weiten Horizont. Das kam einmal zum Ausdruck, als man im Gespräch auf die Nonnen im benachbarten Karmeliterinnenkloster kam. Sie sei überzeugt, sagte sie, dass es die Gebete dieser Nonnen seien, welche unsere Arbeit im Spital nicht nur unterstützten sondern erst ermöglichten. Manche christliche Menschen, denen ich begegnet war, verurteilten andere christliche Glaubens- und Lebensformen. Hakimi lehrte mich, dass zu einem reifen Christenglauben auch Toleranz und Brüderlichkeit (hier: Schwesterlichkeit) gehört.
Diese beinahe Heilige pflegte aber auch durchaus weltliche Interessen. Seit Langem hatte sie sich ein Klavier gewünscht. Schliesslich hatte ihr Jemand in England ein Klavier geschenkt. Es wurde mit einem Frachtschiff nach Haifa befördert. Aber als es der Schiffskran beim Ausladen eben aus dem Laderaum hinweg gehoben hatte und es schwebend über dem Dock hing, riss eines der Tragseile. Das schwere Instrument stürzte auf den Steinboden und zerbarst in viele seiner Bestandteile. Wie die Hakimi das aufgenommen hat, weiss ich nicht. Gerüchtweise vernahm ich, sie sei wenig später doch zu einem Klavier gekommen. Überaus verwundert war ich, als ich vernahm, Hakimi lese Kriminalromane. Darf man das als Christ? Wie geht das zusammen mit ihrer sublimen Glaubenshaltung? So hat im ersten Augenblick mein innerer Pharisäer gefragt. Wo aber steht in den Evangelien geschrieben, ein Jünger Jesu dürfe keine Kriminalromane lesen wenn es zu jener Zeit ähnliche weltliche Vergnügen schon gegeben hätte? Vielleicht Weintrinken. Die Pharisäer hatten Jesus vorgeworfen, er sei ein Weinsäufer. Wegen dieser ihrer “desinvolture“ ist die Hakimi in meiner Achtung noch mehr gestiegen. Aber es brauchte noch die Bemerkung des Missionars Junot, um mich eines Besseren zu belehren, der mir im Hinblick auf einengende christliche Moral sagte: “plutôt trop large que trop étroit“. (cf. Kap. 20, Moçambique)
Ich bekam auf Kosten des Spitals Arabischunterricht bei Sit Matil. "Sit“ heisst jede über das übliche Heiratsalter hinaus ledig gebliebene würdige Dame. Sie fand, mich für meine Lernfähigkeit des Arabischen "enta schatr“, bist recht geschickt. Ich hatte allerdings schon während Monaten vor der Reise mit Hilfe eines veralteten deuschen und eines englischen Lehrbuches klassisches und modernes Arabisch zu lernen begonnen. Zudem gab mir Madeleine Bernath manche Stunde Unterricht.
14.23
Das Projekt eines christlichen Kibbuz, Mit Architekt Ben Dror ware Hans Bernath und ich einmal auf dem vorgesehenen Baugelände. Auf dem ausgetrockneten steinigen Boden verstreut lagen Steinkugeln. Der Architekt: “Das sind römische Katapultsteine. Wenn man in Israel beim Ausheben des Baugrundes für einen Hausbau auf archäologische Funde trifft, soll man sie verstecken, sonst kommen die staatlichen Archäologen, machen monatelelang Ausgrabungen und verzögern so den Bau.
14.24
Ein Pfarrer der Anglikanischen Kirche, Reverend David A. war auffallend häufig im Spital zu sehen, obwohl er weder in der Saint Margrits Church in Nazateth noch im Spital eine Funktion zu erfüllen hatte, bis bakannt gegebenen wurde, David werde demnächst die Hübscheste unserer englischen Sisters heiraten. Wir übten das Hochzeitslied “O taste and see how gracious the Lord is..”. Ich wurde von der Braut (wie hiess sie nur?) zum “Chief Usher“ ernannt, hatte aber keine Ahnung was man in dieser Rolle zu tun hatte. Im Nachhinein sagte man mir, dass ich in der Kirche die Gäste hätte empfangen und an ihre Plätze begleiten sollen. Stattdessen kam ich noch zu spät zur Trauung in die Kirche.
14.25
Nazareth: Die Bernaths besuchten den Gottesdienst am Sonntagmorgen nicht in der anglikannischen St.Margrits Kirche sondern in der kleine Gruppe von “Brüdern“ von “bekehrten“ Christen entsprechend den englischen “Plymouth Brethren“ oder “Darbisten“ mit dem eifrigen Evangelisten Jamil Hussen (Hussain), der mit faustdicken Drohungen der Strafe Gottes die Leute des Städtchens zu bekehren versuchte. Diese Form von Gottesdient brauchte (fast) keine Rituale. Meistens hielt Jamil Preigten und Gebete aus dem Stegreif. Diese, wie auch die Lieder, waren natürlich Arabisch. Ich nahm mit Hans und Madeleine an diesen Versammlungen der “Brethren“ teil.
Am Abend des Karsamstags besuchte ich den Ostergottesdienst in der (arabisch) griechich-orthodoxen Kirche. Hier gab es fast ausschliesslich vorgegebene liturgische Rituale und dauerte mehr als drei Stunden bis nach Mitternacht. Jeder und jede bekommt eine Kerze, die sie/er entzünder am Ur-Licht, das der Priester vom Altar vor die Gäubigen bringt. Damit geht man sotgfältig drei mal unm die Kirche. Wenn jemandes Lich erlischt, darf er/sie es an der Kerze des Nächsten wieder anzünden. Ein schönes Symbol für die christliche Gemeinde, die Ekklesia. Um Mitternacht stehen alle um ein symbolisch angedeutetes Grab vor der Kirche. Der Priester verkünder felierlich: “Christos anesti!“ „Al Messih qam!“. Christus ist auferstanden! Mit Jubel und Gesamg anwordet die Gemeinde im Chor.
14.26
Anne E.
Bernaths orientalische Gastfreundschaft brachte sehr häufig Besucher ins Haus, aus England, Holland, USA und der Schweiz, Alle wurden für beliebig viele Tage beherbergt. So traf auch eine junge Frau, eine Kunsthandwerkerin aus Neuenburg, bei uns ein. Sie war durch ihre Beziehung mit der Communauté von Grandchamps auf die Adresse des Schweizer Arztes in Nazareth gekommen. Ich hatte neben der Spitalarbeit genug Zeit um mit Anne über die Hügel von Galiläa zu wandern. Die bis da gelernte arabische Umgangssprache reichte, um mit Einheimischen ein paar Freundlichkeiten auszutauschen. Eine Fellachenfrau war gerade daran auf dem kuppelförmigen Backblech ihre papierdünnen Brotfladen zu backen. Sie gab uns davon. Sie schmeckten köstlich. Mitten in einer Wiese, wo Tausende Anemonen rot leuchteten, begegnete uns ein Junge mit einigen Kollegen. Er hielt uns eine eigenartige, wie ein Tigerfell gemusterte Schwertlilie entgegen. Er schenkte die Blume Anne. Ich gab ihm darauf eine kleine Münze, als “bakschisch“. Anne empfand das als Beleidigung, die Freundlichkeit des Jungen mit Geld zu belohnen. Ich dagegen fand sie ein wenig allzu romantisch. Die Armut der Leute zwingt sie manchmal dazu, Kinder betteln zu schicken oder auf irgendeine andere Art Geld zu verdienen. Das setzte mir einen sanften Dämpfer auf meine beginnende Verliebtheit. Auf diesem Spaziergang gab es kein Händchenhalten und schon gar nicht einen Kuss!
Als eines Abends Anne und ich miteinander in der Küche beschäftigt waren, steckte sie mir eine Probe vom Essen, das wir am zubereiten waren, liebevoll in den Mund. Ich war wohl seelische blind, diese deutliche Liebeserklärung nicht genügend wahrzunehmen. Oder hat mein Minderwertigkeitsgefühl wieder Sabotage geübt? ( "Eine so wunderbare Frau kann mich doch nicht lieben wollen...“ ) Ich war immer noch so verklemmt, dass ich trotz vielen gegenteiligen Erfahrungen, trotz manchen deutlichen Sympathie- und Liebeszeichen von jungen Frauen es nicht fassen, oft nicht einmal wahrnehmen konnte, dass ich als Mann anziehend sein könnte. (Ich lernte das erst während der Ausbildung in Gestalttherapie, dass ich in den Gruppen freundlich aufgenommen worden war: Da war ich schon nahezu fünfzig Jahre alt!)
Wieso erlaubte ich mir nicht, mich freundlich und liebevoll auf die im Jahr 1957 oder 58 in Nazareth anwesende Anne Eméry aus Neuenburg einzulassen? Als ob ich der Anne entsagen müsste, obschon wir uns auf unserer Wanderung über die Hügel von Galiläa so nahe gekommen waren, dass es für das Aufblühen von gegenseitiger Liebe kaum einen Schritt mehr gebraucht hätte.
Die Begegnung mit Anne hatte bei mir einen inneren Kampf ausgelöst. Es schien mir, als müsste ich darauf verzichten, mich mit Anne zu befreunden. Ich müsse sie “opfern“, weil ich mich schon an ”eine Verena”, gebunden meinte, deren Name ich damals noch nicht einmal kannte, die ich noch nicht gesehen hatte, die mir von Madeleine Empfohlene. Aus mangelnder Menschenkenntnis und akademischem Dünkel störte mich ein wenig an Anne, dass sie (wahrscheinlich) keine Mittelschulbildung hatte, als ob die bestandene Matur ein Zeichen für bessere Lebens- und Liebesfähigkeit wäre.
14.27
Israel Erfahren.
Hans und Madeleine machten mit mir hie und da eine Reise in interessante Gegenden, zum Beispiel mit ihrem VW- Käfer durch die Negev-Wüste nach Eilath am G0lf von Aqaba, am Roten Meer. Über Ber Sheba (Sieben Quellen), die südlichste Stadt von Israel, mitten in der Wüste. Wenige Kilometer südlich überraschten mich eine Reihe von mitten aus er Wüste aufsteigende Wasserfontänen; etwas näher werden die Häuser des Kibbuz Sede Boqer sichtbar. Die Abhänge der nun folgenden ockerbraunen Hügel sind terrassiert, Überbleibsel einer Stadt der Nabatäer, deren Ruinen noch auf dem flachen Rücken von einem der Hügel stehen. Erlaubte das Klima vor zweitausend Jahren auf den schmalen Äckern noch eine Landwirtschaft, die eine Stadt ernähren konnte? Einige Kilometer vor Eilath erheben sich giftgrüne Felsen und Schutthügel: Hier hatten die Israeliten schon zur Zeit des Königs Salomo aus dem Erz Kupfer gewonnen.
Eilath war im Jahr 1957 nicht viel mehr als ein Dorf von Bungalows und Baracken. Das Wunder dieses Ortes sind die unter dem Meeresspiegel liegenden Korallenbauten, gleich verschiedenfarbigne Sträucher, deren Überzug in leuchtenden Farben beim Annähern des Tauchers erlöschen. Hunderte von bunt gefleckten Fischen umgeben mich. Einige tragen papageienartige Schnäbel und nagen damit mit hörbarem Kratzen an den Korallen. Ein Schwarm von Tausenden kleinen Fischen zieht um den Korallenstock. Dieser bietet Unterschlupf für eine Muräne, die mit ihrem hässlichen Gesicht auf Beute lauert. In der Nähe wedeln die weissen Kiemen eines Röhrenwurmes im sanft bewegten Wasser. Aus einer anderen Höhle streckt eine elegante Makrele ihre grazilen Antennen.
14.28
Die Fahrt ans Tote Meer führt in der Nähe von abschreckend eingezäunten gigantischen Betonkonstruktionen vorbei, das “Weizmann Institut“, die Anlage für Nuklearforschung und wahrscheinlich die Produktionsstätte der israelischen Atombombe. Dem westlichen Ufer des Toten Meeres entlang liegen Blöcke aus kristallisiertem Meersalz zu beiden Seiten der Strasse. Einige der bizzaren hohen Salzsäulen werden der Gestalt der unglücklichen Frau von Lot zugeschrieben, die entgegen dem Verbot, auf die im Feuer lodernden Städte Sodom und Gomorra zurückgeblickt hatte.
Am Fuss der historischen Festung von Massada nahm ich ein Bad in der konzentrierten Salzlösung dieses Meerwassers. Es ist ein eigenartiges Gefühl, ohne Schwimmbewegungen wie ein Korkzapfen auf der Wasseroberfläche zu flottieren.
Wir übernachteten im Freien auf dem warmen, sandigen Boden der Wüste. Am Morgen um sechs Uhr begann der steile Aufstieg auf die flache Hügelkuppe, die von den Mauerruinen der Festung überdeckt ist. Von hier oben sind in der Ebene die Reste der acht, während der römischen Belagerung gebauten, und befestigten Militärlager zu sehen, mit welchen die von jüdischen Freiheitskämpfern besetzte und verteidigte Festung ausgehungert werden sollte. Die Geschichte meldet: Als die Besatzung, die Männer, Frauen und Kinder der römischen Belagerung nicht mehr standhalten konnten, statt sich zu ergeben, um von den Legionären umgebracht oder versklavt zu werden, massakrierten sich gegenseitig bis auf die letzte Seele. Man stelle sich vor: Nachdem den Spähern der Römer die Stille aufgefallen war, und sie sich der Ummauerung vorsichtig näherten, schliesslich mit Gewalt eindrangen, fanden sie nur noch die Leichen dieses Massenselbstmordes. Die Ruinen auf dem Hügel von Masada ist jetzt ein patriotisches Denkmal für Israels Heldentum.
14.29
Der See Genezareth. Die kirchliche Tradition weist manchen Orten im "Heiligen Land“ mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit einige der in den Evangelien erzählten Ereignisse zu. Am westlichen Ufer des Sees wird eine kleine Ortschaft Kefar Nahum genannt. Hier sollen nach dem Bericht der Evangelien Jesus die Fischer Simon Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes in der Ortschaft Kapernaum zur Nachfolge berufen haben. In der kleinen Kapelle erinnert ein schönes Mosaik mit der Darstellung von Fischen daran. Kafr oder Kefar ist noch jetzt die lokale Bezeichnung für Dorf. Weniger wahrscheinlich ist die Vermutung, Jesus habe hier seine Bergpredigt gehalten, denn in der Gegend gibt es ausser einigen niedrigen Bodenerhebungen keinen Berg. In einem Hof stehen noch einige mächtige Kornmühlen aus zwei übereinander liegenden Zylindern aus schwarzem Basalt. Über dem Nordufer des Sees liegen verstreut im hohen trockenen Gras verschieden geformte Trümmer, die Reste einer einst schwer befestigten Stadt, Hier muss Chorazin gestanden haben mit sechs Meter dicken Basaltmauern, Skulpturen und Reliefs von Kanaanäischen Göttern. Da ihre Bewohner auf Jesus nicht hören wollten, hatte er ihnen den Untergang prophezeit. Die gewaltigen Befestigungen hatten sie nicht beschützen können.
14.30
Im Kibbuz Ginegar.
Um das Leben in einem Kibbuz kennenzulernen durfte ich für zwei Wochen in einem in der Nähe von Nazareth gelegenen Kibbuz verbringen, indem ich am Vormittag in der Landwirtschaft mitarbeitete und am Nachmittag den Ulpan besuchte, wo die neu eingewanderten künftigen Israelis die Umgangssprche Ivrit zu lernen hatten. Die junge Lehrerin, Rifka, hatte Mühe die junge Bande zu zähmen. Trotz ihren heftigen Zwischenrufen: Schäkät Chaverim! wurde dauernd geschwatzt. Manchmal schimpfte sie auf Jiddisch, in dem lustig tönenden Gemisch von Hebräisch und dem Mittelhochdeusch der aschkenasischen Juden. Anlass zu intensiven Diskussionen gab das damals aktuellste Grossereignis: der Ausflug des Russen Gagarin in den Weltraum, Rifkas Kommentar: Gagarin hat im Himmel Gott nirgends angetroffen. Gott existiert also nicht.
Der neben mit in der Schulbank sitzende Chaver, ein Südafrikaner, merkte dass ich die hebräische Schrift weder lesen noch schreiben konnte. Da führte er mich ins Freie und lehrte mich in weniger als einer halben Stunde die hebräische Kursivschrift. Dann konnte ich wenigsten auf der Tabelle meinen Namen (Alek) und meinen täglich wechselnden Arbeitsplatz entziffern.
Einer der Mitgründer dieses Kibbuz lud mich einmal zum Tee in seinem Bungalow ein, wo ich auch seine Frau kennen lernte. Die Beiden Überlebenden der Shoa zeigten mit die in den Unterarm eintätowierte Häftlingsnummer. In ihrem kleinen Wohnzimmer nahm die Bibliothek eine ganze Längswand ein. Da standen neben Kant und Spinoza und Werken von anderern Philosophen zwei Bände mit Schopenhauerst "Die Welt als Wille und Vorstellung", die ich einmal zu lesen versucht, nichts davon verstanden und nach ein paar Seiten weggelegt hatte. Ich fragte ihn, ober den ganzen Schopenhauer gelesen habe. "Selbstverständlich!" war seine Antwort. Ich wagt nicht ihn noch weiter auszufragen, abeer es hätte mich nicht gewundert, wenn er früher Universitätsprofesser für Philosophie gewesen wäre.
Das Purim-Fest. Man verkleidet sich. Die Ulpanschüer singen, jedes in der Sprache seines Herkommens. Die hellblode Russin singt mit ihrer bezaubernden Sopranstimme ein trauriges Lied. Ich spiele den Wilhelm Tell und singe "Wilhelm bin ich der Telle mit starkem Muot und Bluot...“
Ich tanze mit einer Chaverah aus der Türkei. Ich hatte schon das Schiff für die Heimreise gebucht und erzählte ihr davon. Ich musste ihr das Datum und die Uhrzeit der Ankunft in Istanbul notieren, denn sie hatte im Sinn, mir ihre Freundin in Istanbul als Stadtführerin zu vermitteln. Das hat sie tatsächlich getan.
Unter den working guests in Kibbuz in Ginegar war auch der Arbeiterpriester Paul Gontier. Er las jeden Abend in seinem Zimmer die Messe nach dem orientalischen Ritus, die Messe des grichischen Kirchenvaters Chrisostomos. Drei Frauen, auch Kibbuzgäste und ich namen daran Teil. Es war jewils ein schönes, wahrhaft ökumenisches Abendgebet.
14.31
Die Rückreise. Nach der Rückkehr aus Israel war ich in Hochspannung. Ohne Verena zuerst kennen geleert zu haben, machte ich ihr schon wenige Tage nach der Rückkehr aus Israel einen Heiratsantrag. So wurde während dem ersten Aufenthalt in Nazareth, also 1958, mein kommendes Eheschicksal entschieden.
Die Schiffreise der wunderschönen türkischen Küste entlang. Besuch im Geburtsort des Apostels Paulus, Tarsus, der hellenistisch-römischen Ruinenstadt Perge und von Ismir (Smyrna) aus von Ephesos mit seinen grandiosen Ruinen aus seiner klassischen Blütezeit.
14.32
Im Hafen von Istanbul, stand auf dem Quai die junge sepharidische Jüdin, die Freundin jener Chavera, genau nach der Abmchung am Purimfest im Kibbuz. Das Erkennungszeichen: Sonnenbrille und Zeitung unter dem Arm. Eine hübsche Kunststudentin, die mir während vier Tagen, bis zur Abreise mit dem Zug in die Schweiz, Istanbul zeigte und mit mir einen Ausflug mit dem Schiff durch den Bosporus bis zum Schwarzen Meer unternahm. Wir fuhren vorbei an dem in türkischem Barock gebauten Palast Dolmabahdsche, an den Strandvillen, deren Stil mich an die Badeanstalten am Zürichsee erinnerten. Sie zeigte die beiden Ufer, das anatolische und das europäische (das byzantinische, von Rumi) überragenden gewaltigen Festungen “Anadoluhisare und Rumelihisare“ (sind die Namen richtig?), von wo aus 1453 Konstantinopel belagert und erobert wurde. Diese Jahreszahl, an die ich mich aus Geschichtsunterricht hätte erinnern müssen, hatte mir meine kultivierte Dragomanin in Erinnerung gerufen. Der Bosporus im April: überall das zarte Violett blühender Judasbäume. Fast wie Honneymoon! Ein Arzt in spe, aus Israel, also “sicher ein Israelit“, aus der reichen Schweiz, welche Hoffnungen musste ich in diesem Mädchen und seiner Familie geweckt – und enttäuscht haben! Es war aber nicht die Ermahnung der Tante Margrit, die mich daran hinderte, mich in diese Tochter Abrahams zu verlieben. Es gab Hindernisse eigener Art....
Die Heimreise mit dem Zug verzögerte sich. Ich hatte Problem mit dem Fahrplan in Belgrad.
Der Vater wartete in Moscia auf mich und war wegen meiner Verspätung voller Angst. Ich hatte nicht mehr telegrafiert
Zurück in Zürich nahm ich das Studium wieder auf und machte das Staatsexamen. Ich schloss mich einer Prüfungsgruppe von als fleissig bekannten Kommilitonen an

15.1
Im Hafen-Zollamt Haifa herrsche Lärm und Gedränge von den eben dem Schiff entstiegenen Passagieren. Da kamen mehrere Männer auf uns zu, um uns für die Zollabfertigung ihre Dienste als eine Art Anwälte anzubieten. Wir standen verloren in dem Gewusel, während die “Anwälte“ unseren Auftrag erwarteten. Da erschien Hans Bernath.
Er konnte den Zollbeamten davon überzeugen, dass mit den Chirurgie-Utensilien, die wir im Handgepäck mitgebracht me, nämlich im “Englischen Spital“ von Nazareth.
hatten, kein Handel getrieben würde, sondern den Bewohnern Israels zu gut kommt.
15.2
Die Familie Bernath. Da Dr.Runa Mackay im Urlaub war, durften Verena und ich ihre Wohnung benutzen und bei Hans und Madelaine Bernath essen. Am Tisch waren dann auch Bernaths eigene Kinder, Christine, Dorette, Marc André und zwei Waisenkinder, die sie später adoptieren konnten, Butrus und Bushra.
Die Familie Bernath lebte ausserordentlich bescheiden. Fleisch war sehr teuer, also selten. Eine Konservenbüchse mit Wienerli wurde am Sonntag geradezu feierlich geöffnet und die Wursthälften gerecht verteilt. Es reichte nicht für ein ganzes Würstchen pro Person. Die Küche machte meistens ein einheimisches Mädchen. Eines Tages gab es eine Suppe mit irgendwelchen Getreidekörnern oder Gries. Darin schwammen unverkennbar tausende von winzigen toten Würmchen. Alle blickten mit fragendem Gesicht auf Hans Bernath und erwarteten seinen Entscheid: Essen oder Wegschütten? "Essen“ war seine Parole. Und alle assen. Der Geschmack war nicht auffällig oder gar schlecht. Es brauchte nicht viel Überwindung, das Vorurteil gegen gekochte Würmchen zu loszuwerden.
15.3
Nun gab es aber schon eine Aushilfe für die abwesende Runa Mackay, eine Frau Dr. Roth, eine Israelin. Dr. John Taylor, der nicht glaubte, dass ich abkömmlich sei, hat sie ohne Hans Bernath zu informieren angestellt. So hatte ich auf medizinischem Gebiet nicht sehr viel zu tun, ausser im Notfalldienst im Ambulatorium, dem „outpatient service“ und zum Assistieren bei Operationen. Hans war während dieser Zeit auch noch kurz in der Schweiz. Deshalb konnte ich häufig kleinere chirugische Behandlungen durchführen, wie eingewachsene Zehennägel und Karbunkel-inzisionen. Curettagen bei inkomplettem Abort waren oft notwendig. Die Anästhesie war einfach und wirksam: Vor der Curettage wurde Morphin intravenös injiziert. Einmal wurde mir eine Frau gebracht mit der Diagnose Abortus incompletus, Blutspuren schienen es zu bestätigen. Die Angehörigen brachten noch einige Blutgerinnsel, zusammen mit etwas, was mir die Leute als abgestossenen Embryo vorzeigten. Es waren aber Innereien von einem Huhn oder einem Nagetier. Mit diesem Trick wollten sie mich von der Notwendigkeit der Operation überzeugen.
15,4
Das Schicksal der Mädchen
In der arabischstämmigen Bevölkerung der Region Galiläa wurden Mädchen sehr jung verheiratet. Manchmal wurden sie ganz einfach an den meistbietenden Mann verkauft. Nach dem israelischen Gesetz durfte erst ab dem sechzehnten Altersjahr geheiratet werden. Viele Felacheneltern kannten jedoch das Alter ihrer Kinder nicht, wollten aber ihre Töchter so jung wie möglich loswerden. Deshalb forderte das Zivilstandsamt bei jungen Mädchen eine ärztliche Altersbestimmung. Zu diesem Zweck wurden von einem Handgelenk Röntgenaufnahmen gemacht. Der Grad der Kalkeinlagerung in den Handwurzelknochen ermöglicht mit Hilfe einer Tabelle mit Vergleichsaufnahmen das Alter des Mädchens zu bestimmen.
Manchmal wurden solche unfreiwilligen Heiratskandidatinnen mit schweren Verbrennungen fast der ganzen Körperoberfläche ins Spital gebracht. Sie hatten sich mit Kerosen übergossen (das allgemein zum Kochen gebraucht wurde) und angezündet. Fast alle Mädchen starben. Die Ärmsten kannten keine andere Art, sich das Leben zu nehmen, um der Heirat mit einem alten, kranken oder sonst ungeliebten Mann zu entgehen. Bei weniger ausgedehnten Hautverbrennungen wurden die betroffenen Stellen mit Hauttransplantationen (nach Thiersch oder Reverdin) bedeckt. Ich lernte mit dem “Thierschmesser“ von gesunden Hautstellen hauchdünne Lappen zu schneiden und sie auf die Brandwunden zu verpflanzen. Das Resultat war kosmetisch meistens nicht wie man es gerne gehabt hätte. Aber man vermied auf diese Weise Infektionen und die Bildung von bewegungsbehindernden Kontrakturen der Hautnarben.
15.5
Das Wandbild im Speisesaal. Im Spital wurde ein neuer Speisesaal für das Personal eingebaut. Er war noch im Rohbauzustand, als die Idee aufkam, an der grossen Wand über einer Türe ein Wandbild anzubringen. Da ich mit ärztlicher Tätigkeit nicht ausgelastet war, hatte ich Zeit, ein Bild zu entwerfen. Es entstand eine biblische Szene mit Bezug auf das Essen, nämlich die Speisung der fünftausend Menschen, angedeutet durch den Jungen, der drei Fische und fünf Brote brachte, welche Jesus dann so vermehrte, dass es für die ganze Volksmenge reichte. Im Hintergrund waren Leute gezeichnet, die mit ihren Kranken zu Jesus kamen. Jesus ist als strahlende Sonne rechts oben symbolisch dargestellt. Im Hintergrund liegt der See Genezareth. Und ein Boot mit Fischern. Sie erlebten gerade den wunderbaren Fischzug.
Zunächst stellte ich mir ein Fresco vor und schrieb an Willi Fries um ihn um Rat zu bitten. W.Fries ist ein bekannter Ostschweizer Freskenmaler vorwiegend von biblischen Szenen.
Seine Ratschläge waren aber so kompliziert, dass ich darauf verzichten musste, ein buntfarbiges Wandbild zu malen. Stattdessen entschied ich mich für die Sgraffitotechnik, wie man sie als Dekoration an Engadiner Häusern sieht. Der Maurer brachte an der Wand zuerst einen dunklen Verputz an. Darauf kam eine weisse Schicht Kalk.
Mittlerweile hatte ich an der Zeichnung gearbeitet und war noch immer dran, sie zu verbessern, als Hans sie mir unter dem Bleistift hervor zog, um sie zu fotografieren. Er musste am folgenden Tag nach Europa reisen und er war der Einzige, der vom Entwurf ein Diapositiv herstellen und an die Wand projizieren konnte. Jetzt brauchte man nur den Konturen mit einem schwarzen Stift nachzufahren. So wurde das Bild vorgezeichnet. Jetzt schabte man den Strichen der Zeichnung entlang die weisse Schicht weg bis das darunterliegende Schwarze wieder an die Oberfläche kam. Das gab uns während der Abwesenheit von Hans, trotz der Mithilfe von mehreren Leuten länger als zwei Wochen zu tun, weil die weisse Schicht härter war als erwartet, denn der Maurer hatte statt Kalk weissen Zement verwendet.
Das Bild ist später zum Logo des Spitals geworden und verziert den Briefkopf der Korrespondenz.
15.6
Madeleine Bernath wartete gespannt darauf, dass Verena schwanger würde. Sie gab ihr einen dicken, grossformatigen Ratgeber für Säuglingspflege und beharrte darauf, sie in die Kunst des “aufsteigend heissen Bades“ einzuweihen, womit man früher fiebriger Kleinkinder behandelt hatte. Verena liess sich diesen Unterricht gefallen, doch ohne Begeisterung. Vielleicht war diese stumme Ablehnung der Grund dafür, dass Madeleine mit Verena deutlich weniger freundlich war als mit mir. Im Gegensatz zum ersten Aufenthalt in Nazareth, fiel mir auf, dass e Beziehung von Madeleine zu fast allen im oder um das Spital tätigen Frauen seht kühle, ja sogar gespannt war gespannt war, besonders zu Odette, der französischen Ehefrau von Dr. John Taylor, dem Medical Intendant, dem administrativen Chef, obschon die Muttersprache beider Frauen Französisch war. Taylors wohnten im Geschoss über den Bernaths, so dass jede Partie den Lebensstiel der anderen beobachten konnte. Madeleine ärgerte sich über den ihrer Ansicht nach unverantwortlichen Luxus, den sich Taylors leisteten, indem sie sich manchmal Esswaren aus England bestellten.
Die “Sisters“, die Pflegefachfrauen mit dem höheren Ausbildungsstand (im Gegensatz zu den ihnen untergeordneten ”Nurses“) waren nicht erfreut, als Madeleine in der Abteilung für Neugeborene und Säuglinge mitzuarbeiten begann. Damit hatte sie ja nur Gutes tun wollen.
Sonderbar, wie sich der Eindruck von einem Menschen ändern kann. Während meines ersten Aufenthaltes in Nazareth war mir Madeleine als ein engelhaftes Vorbild einer Frau erschienen. “Eine solche Frau möchte ich auch finden“ sagte ich einmal zu Hans. Ob ich durch die Heirat einen kritischeren Blick für Frauen bekommen hatte und auch die Zusammenhänge und Hintergründe deutlicher sehen konnte. Wahrscheinlich hatte mich auch die Kälte von Madeleine enttäuscht, mit der sie Verena begegnete. Jedenfalls hatte sich für mich Madeleins Nimbus als Traumfrau etwas verdunkelt.
15.7
Die Heimreise, Es war jetzt möglich, an christlichen Feiertagen von Israel nach Jordanien zu gehen. Als sich die Zeit für unsere Heimkehr näherte, benutzten wir diese Gelegenheit um nach Jordanien zu kommen und um das alte Jerusalem und einige Zeitzeugen aus der Antike und der biblischen Geschichte zu besuchen..
In Jordanien fanden wir Unterkunft bei Mrs Lambie, der Witwe eines bekannten Missionsarztes. In der Nähe von Bethlehem, im “Baraka-Tal“, hatte Dr.Lambie ein Spital für Tuberkulosekranke gegründet. Die Gedenktafel am Spitaleingang ehrt ihn als "a man of prayer“. Schon mehrere Male hat mich die Unbekümmertheit verwundert, mit der angloamerikanische Christen mit lobenden Inschriften an gute christliche Taten erinnern. Im EMMS-Spital in Nazareth hiess einer der Krankensäle nach dem Stifter “Abercombie ward“.
Dr.Lambie lebte nicht mehr. Mrs.Lambie führte eine kleine Pension. Ihr Lebensstil und ihre gehobene Sprache war die Wesensart mancher der bewusst gläubigen englischen Christen, wie ich sie schon in Nazareth (cf.“Hakimi” Kap.14), auf dieser Reise und später in London kennen gelernt hatte. Vor jeder Autofahrt wurde um ”journey mercies“ gebetet, vor dem explosiven politischen Hintergrund sehr passend.
Die byzantinisch-orthodoxe Geburtskirche in Bethlehem, soll nach der Tradition über der Höhle stehen, in welcher Jesus zur Welt kam. In der Umgebung von Bethlehem finden sich viele solche Höhlen. Sie sehen aus wie Spalten oder Risse in der sanft hügeligen Landschaft. Hier sollen noch immer Schafhirten leben, die nachts ihre Herde und sich selbst in diesen natürlichen Ställen unterbringen. Die Übereinstimmungen biblischer Texte mit der Landschaft und mit archäologischen Funden förderte schon auf der ersten Palästinareise mein Vertrauen in die historische, geografische und damit auch ihre geistliche Zuverlässigkeit.
15.8
Ostern in Jerusalem. Auf halber Höhe zwischen dem “Felsendom”, der Altstadt von Jerudalem und der Kuppe des Ölbergs liegt ein russisch-orthodoxes Kloster. Chorgesang in eigenartiger Tonart ertönte aus der Kirche. Neugierig, einen byzantinischen Ostergottesdiest zu sehen, traten wir möglichst leise ins Kirchenschiff. Viele Nonnen mit schmaler, zylindrischer schwarzer Kopfbedeckung füllten vor dem Altar knietend den Raum. Sie sangen abwechselnd mit dem vollbärtigen im bunten Ornat vor dem Altar stehenden Priester die Responsorien. Plötzlich verneigten sich alle, so dass sie mit Ihrer Stirn den Marmorboden berührten. Ebenso verneigten sich die wenigen auswärtigen Kirchenbesucher. Als Einzige stehen zu bleiben empfand ich als Sakrileg unter so vielen Frommen. Doch ich mochte mich nicht verbeugen vor etwas. das ich nicht kannte. Ich flüsterte meiner Frau zu: ”Komm, wir gehen“.
Seit dem frühen Mittelalter war das Grab Christi das vornahmste Ziel christlicher Pilger. Das Osterfest zieht immer noch viele Gläubige fast aller Kirchen der Christenheit an. Das im byzanthinischen Stil über einem ursprünglichen Grab errichtete Kirche ist im Innern in viele kleine Kapellen aufgeteilt. Manche, besonders die älteren kirdchlichen Denominationen, hatten sich für ihre besonderen Rituale eini paar Quadratmeter reserviert und mit ihren eigenen Symbolen dekoriert. Neben dem schönen, weiträumigen Tempelplatz und dem Felsendom der Muslime ist die Grabeskirche eher einem Trmitenhügel zu vergleichen als mit einem Ort der Anbetung.
In der Menschenmenge, die sich vor dem Eingangstor des Heiligtums staut, werden laut Gebete rezitiert und mit Tonbandgeräten aufgenommen. Von der Via dolorosa her kommen, theatralisch als römische Legionäre verkleidete dazu oder ein Kreuz tragende Menschen.
15.9
Ostern am ”Gordon-” und ”Garden”- Tomb
Die Altstadt von Jerusalem und in der näheren Umgebung gab es noch einige der Gräber, wie sie in den Evangelien beschrieben sind (z.B.Mk.15,36). In dieser Gegend gibt viele Felsen. Die Gräber wuren aus dem Stein gemeisselte Hählen, in denen beidseits eine Konsole belassen wurde. Daauf bettete man den Toten. Verschlossen wurde der Eingang durch einen mächtigen, wie zu einem Mühlrad geformten Stein, der auf einer in den Felsboden gegrabene Schiene hin und her gerollt werden konnte. Mk. 16,3: die drei Frauen, die nach der üblichen Brauch den Leichnam einbalsamieren wollten, konnten diesen mächtigen Verschlussstein nich wegwälzen.
Ich besichtigte solche (leere) offene aus dem Felsen gemeisselte Grabhöhlen mit dem zur Seite gerollten Verschlussstein. Jetzt konnte ich mir vorstellen, dass es die Kraft von Männern (oder Engeln) brauchte, um mit einen solchen “Mühlstein” den Grabeingang zu verschliessen oder zu öffnen, indem man ihn in seiner “Schiene” vom Grabeingang zur Seite rollte.
Ich hatte gelesen, dass Gordon, einer der Generäle von Allenby, dem Befrier Arabiens und Palästinas (1917) in einem Garten in Jerusalem ein solches Bankgrab gefunden hatte. Ob gerade dieses das Grab war, aus dem Jesus auferstanden ist, bleibt ein Rätsel. Es ist jedoch eine Illustration und eines der Zeugnisse für die biblische Auferstehungsberichte.
Manche englische, amerikanische und arabische Christen feierten vor diesem “Gordon’s- oder Garden-Tomb” Ostern auf ihre Weise. Da gab es auf Englisch eine lange Begrüssung und ein Gebet, eine ausfühliche Predigt und bekenntnishafte Zeugnise. Da war auch eine Schule von blinden Mädchen, die von einer Schweizerin betreut wurden. Sie sangen zur Hammondorgel-Begleitung geistliche Lieder auf Arabisch. Anschliessend trat noch eine amerikanisch sprechende junge Dame auf. Sie war mit einem kurzen rosaroten Jupe bekleidet und trug über ihrer üppigen Rita-Hayworth-Frisur ein ebenso rosafarbenes Federhütchen. Sie wurde als Filmschauspielerin aus Hollywood vorgestellt. Sie erzählte von ihrem gottfernen und leeren Lebensstil und von Jesus Christus, der sich iher erbarmt und ihr ein neues erfülltes Leben geschenkt habe. Es war eines der üblichen Muster einer Bekehrungsgeschichte in einer geradezu schmerzhaft unpassenden Umgebung. Und doch: welche Gelegenheiten und Umstände passen denn überhaupt jemals zu einem so intimen, tiefen, persönlichen Zeugnis? Ist nicht der Mut dieser Frau zu achten, dass sie von ihrer wahrhaftig mit Gott erlebten folgenreichen Richtungsänderung zu erzählen wagte, ob sie nun zu den gerade herrschenden Umständen passte oder nicht (cf.2.Tim.4,2).
15.10
Hebron
Um nach Hebron zu gelangen, nahmen wir das Sammeltaxi. An ihrem Standplatz in Jerusalem rufen die Fahrer lautstark ihr Fahrziel aus, zum Beispiel "Bet-Lächim“ (Betlehem) oder "Khälil“ . Khalil, Hebron, heisst Freund, weil Abraham, der Freund Gottes genannt wird, dort im Hain Mamre neben Sarah begraben worden war. An das Aussehen der Moschee erinnere ich mich nicht, aber an einen jung aussehenden Scheich in schwarzem Talar und langen weiten Ärmeln, eine schlanke Gestalt mit nach vorn gebeugtem Körper und traurigem Gesicht. Als die Zeitungen über das Massaker berichteten, das ein Israeli in dieser Moschee unter den Betenden angerichtet hatte, dachte ich wieder an den traurigen Scheich.
15.11
Im Norden von Jordanien
sahen wir Dscherasch, das alte Gerasa, ein gewaltiges Feld mit Ruinen einer bedeutenden Stadt aus der Zeit der römischen Okkupation, mit einem der seltenen antiken Theater, deren Szenenwand fast ganz erhalten ist. Von einem Triumphbogen ist nur die unterste Schicht, der tragende Bogen, erhalten geblieben. Er sieht bedrohlich fragil aus, ist aber dank der genialen Bogenkonstruktion mit keilförmig behauenen Steinen während den zweitausend Jahren nicht eingestürzt. Dort waren wir bei einem christlichen Ehepaar, Mitglieder der Baptistenkirche, untergebracht. Im ganzen Gebiet des alten Palästina sind fast alle christlichen Konfessionen vertreten.
Auf dem Weg von Judäa nach Galiäa liegt das biblische Samaria, nahe der Haupstadt Samarias, Nablus. Schon auf der ersten Reise nach Israel (1957), besuchte ich die Ruinen von Sichem zwischen den zwei bedeutsamen Bergen, dem Garizim und ihm gegenüber dem Berg Ebal. Zwischen den beiden Bergen befindet sich ein Sodbrunnen, der auf den alttestamentlichen Patriarchen Jakob zurückgeht. Er ist der Schauplatz der Begegnung einer samaritanischen Frau mit Jesus (Evang.Joh. Kp.4).
Josua, der die zwölf Stämme Israels aus der Wüste ins Land der Kanaaniter geführt hatte, liess sein Volk zwischen den beiden Bergen sich lagern. Er stellte ihnen den Garizim als den Berg der Treue zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs vor und den Ebal als Sinnbild der Heiden, der Kanaaniter, der Verehrer von Götzenbildern. Dann sollen sie sich entscheiden, welchem der zwei Berge sie die Treue halten wollten. Damit war ein Konflikt ausgelöst, der die Geschichte des Volkes Israel im “Gelobten Land“ Jahrhunderte lang beschäftigte und schliesslich zur Spaltung führte in ein Nordreich und dem Reich Juda und Ephraim im Süden, und schliesslich zur Auflösung des Nordreichs, in den benachbarten Völkerschaften.
In Samaria machten wir das Zentrum des uralten bis heute bestehenden Zweiges, der altisraelitischen Religion, der Samaritaner, ausfindig. Die Samaritaner wurden zur Zeit von Jesus von den „rechrgläubigen“ Juden als Ketzer verabscheut, während Jesus ihnen mit Toleranz begegnete, weil er die Menschen nach ihrer Mitmenschlichkeit (wie den guten Samariter im seinem Gleichnis) beurteilte und nicht nach ihrer Rechtgläubigkeit.
Wir wurden sogar von ihrem Hohepriester empfangen. Erst diese Begegnung belehrte mich, dass die jahrtausende alte Auseinandersetzung zwischen Nord und Süd in Palästina noch keineswegs erledigt war und sich in uralten Unterschieden äussern. Der Hohepriester zeigte uns ihren Pentateuch (ihre “Thora“) mit den vom jüdischen Alten Testament leicht verschiedenen Texten und in einer alten hebräischen Schrift abgefasst, vor der Erfindung der heutigen, für das Hebräische verwendeten Quadratschrift. Der englisch sprechende Hohepriesier in seinem Ornat lispelte. Es tönte etwas melancholisch: „Fe britif mufeum wanted to by it, but we not wanted to fell it“.
15.12
Für die Rückreise in die Schweiz hätten wir gerne mir dem Bus von Jerusalem nach Baghdad einen Abstecher nach Irak eingeplant, um etwas von den ausgegrabenen babylonischen und assyrischen Altertümern zu sehen. Leider merkte man im irakischen Konsulat, dass wir aus Israel gekommen waren und verweigerten uns das Visum. So blieben wir einige Tage in Amman als Gäste einer Missionarsfamilie namens Kennedy, bis wir mit dem Flugzeug (der KLM) nach Ankara abfliegen konnten.
In Ankara besuchten wir das Hethitermuseum mit dem Marmorsarkophag, der Alexander dem Grossen zugeschrieben wurde. Die Pflanzen und die spärlichen Bäume im Japanischen Park mussten unter einem heissen Sommer gelitten haben. Sie sahen verwelkt aus und staubig. Auf den Tischen standen Samoware und die Männer rauchten aus den Nargiles. Der Einfluss zweier Kulturen ist offensichtlich. Von Russland stammt der Samowar, aus dem Orient die Wassertabackpfeife.
Den Waggon dritter Klasse des Nachtzuges nach Istambul teilten wir mit Militär. Sie versuchten sich verbal mit uns zu verständigen, leider ohne Erfolg. Aber sie machten für Verena eine ganze Bankreihe frei, damit sie sich hinlegen und schlafen konnte. Ankunft in der Morgenfrühe in Üsküdar. In der Fähre nach Istambul gab es den stark gesüssten Tee in den hübschen Tulpengläsern. Jede solcher Einzelheiten war neu und bemerkenswert. So auch Migros-Autos, ambulante Verkaufsläden, wie sie in Zürich in den Dreissiger- und Vierzigerjahren die abgelegeneren Stadtquartiere besuchten. In einem solchen "Migros Türk“ kauften wir die rezente Wurst, die uns auf der Bahnreise in die Schweiz ernähren sollte. Im Vergleich zu 1958, meinem ersten Besuch der Türkei, standen jetzt mehr arbeitslose Männer in den Strassen herum.
15.13
Für die Fortsetzung unsere Rückreise mussten wir uns in Istanbul auf der bulgarischen Gesandtschaft noch ein Transitvisum besorgen. Auf der Bahnfahrt ernährten wir uns mit der Migroswurst und einem „Fanta“-ähnlichen Getränk, obschon in Belgrad ein ungarischer Speisewagen angehängt worden war. Wenn ich mich recht erinnere, dauerte dieser Reise etwa zwölf Stunden. Während der Bahnfahrt begann das Krankheitsymptom der Kolitis, die uns von da an noch jahrelang quälte und schwächte, denn sie löste immer wieder Episoden von Bauchschmerzen und Durchfall aus. Erst Jahre später, nach der Rückkehr aus Eritrea, diagnostizierte der Tropenspezialist Dr.med.Hans E.Meyer die inzwischen chronisch gewordene Amöbeninfektion. Die Behandlung (mit Furadantin, Tiberal und Humatin) war langwierig und verursachte unangenehme Nebenwirkungen. In Eritrea hatten wir zuvor zwar auf den Rat von Dr.JörgTrüb (Missionsarzt in Omdurman) jeden Tage eine Tablette Enterovioform oder Mexaform genommen. Erst viel später lernte ich, dass damit die körpereigene Abwehr noch vollends lahmgelegt worden war.
15.14
Wir übernahmen wieder unsere Wohnung in Solothurn, die wir an den Assistenzarzt Dr.Froidevaux untervermietet hatten, und ich nahm die Arbeit auf der chirurgischen Abteilung im Bürgerspital wieder auf. Kaum hatte ich mich wieder eingearbeitet, wurde bekannt, dass Dr.Buff zum Ordinarius und Chefarzt der chirurgischen Universitätsklinik B in Zürich, für Traumatologie und plastische Chirurgie, berufen worden war. Schon bald übernahm er diese Stelle. Dabei überredete er den Kollegen Rötlisberger und mich ihm nach Zürich zu folgen, sobald in der Uniklinik B Assistentenstellen für uns frei würden. Selbstverständlich zog er auch unseren hoch-begabten Oberarzt, Dr.Bruno Vogt mit nach Zürich. Leider schmeichelte mich diese ”Berufung“ nach Zürich, als Assistent an der Universitätsklinik. Doktor, nunmehr Professor Buff hatte uns noch versprochen, wir würden in seiner Universitätsklinik B auch in allgemeiner Chirurgie arbeiten können. Er werde nicht zulassen, dass der Herzspezialist in der Klinik A, Prof.Ake Senning, auch das Monopol der inneren Chirurgie beanspruche. So hätte ich die grösseren abdominalchirurgischen Eingriffe gelernt und nicht nur Traumatologie und Kosmetik. Aber nach lautstarken Streitigkeiten zwischen den zwei Chirurgieprofessoren, musste Prof. Buff den kürzeren Ziehen.
Was ich dann als Assistenzarzt in der Universitätsklinik für Chirurgie B an Spannungen vorfand überforderte mich, Hier wollte ich nicht länger als ein Jahr zubringen.
15.15
Verpasste Alternative.Während meinen letzten Wochen in Solothurn hatte ich noch Dr.Bächtold, den Nachfolger von Dr.Buff, kennen gelernt. Auch er begann um mich zu werben: Ich müsse unbedingt in Solothurn bleiben und stellte mir die Oberarztstelle in Aussicht. Er war im Charakter das Gegenteil von Buff: ein äusserst gewissenhafter, bedächtiger Chirurg. Er spielte nicht den ständig gestressten, aber genialen Arzt und hatte nicht das Zeug zum Frauenheld. Leider liess ich mich von ihm nicht überreden. Wenig später wurde Dr.Bächtold Chef der chirurgischen Universitätsklinik in Bern. Er hätte mir dort gewiss eine Assistentenstelle verschafft . Und ich wäre zu einer nicht besonders genialen aber boden-ständigen Ausbildung bei einem gewissenhaften Chirurgen gekommen in einem weniger hektischen und chaotischen Betrieb, wie er sich unter den Rivalitätskämpfen zwischen Buff und Senning in Zürich entwickelt hatte. Dr.Bächtolds Angebot abzulehnen war einer meiner schicksalhaften Fehlentscheide, die ich in meinem Leben auf Jahre, ja Jahrzehnte hinaus mit mancher psychischer Not und langdauernden Körperleiden bezahlen musste. .
Nach einem Jahr Trumatologie, plastischer Chirurgie mit Hektik und Chaos unter dem dauernd gereizten Chef hatte ich genug. Da kam gerade ”richtig“ Dr. Jörg Trüb mit dem Projekt Eritrea auf uns zu. Und verursachte die nächste unglückliche Weichenstellung!

Am 17.Februar 1962: TOBIAS kommt zur Welt
1961 - 1963
16.1
Das Abteilung Chirurgie B. Angebot von Prof.Buff ihm nach Zürich zu folgen, war verführerisch. Die bedächtige Art seines Nachfolgers, in der chirurgischen Abteilung des Bürgerspitals Solothurn, Dr.Bächtold, verblasste neben dem genialischen Schwung von Dr,Buff und seinem Oberarzt, Dr.Bruno Vogt. So fiel meine Entscheidung für Zürich.
Wir fanden in der Nachbarschaft des Unispitals Zürich eine Wohnung, an der Freiestrasse 17, im Erdgeschoss. Die Aufnahme durch die mist älteren Kollegen an dieser Klinik war am Anfang dadurch getrübt, dass ich mich nicht wie es üblich zu sein schien, gleich zum Beginn allen Kollegen vorgestellt hatte.
16.2
Der Betrieb in der neu zweigeteilten chirurgischen Klinik war zu Beginn mühsam und chaotisch. Bisher hatte es eine einzige chirurgische Universitätsklinik unter dem Chefarzt und Ordinarius Prof.Brunner gegeben. Nach dessen Pensionierung um 1961 waren daraus zwei Kliniken je für Innere (Thorax und Abomen) und für äussere Chirurgie (Unfall- und Wiederherstellungs-Chirurgie und Chirurgie der peripheren Gefässe) mit je einem Chef. Prof. Ake Senning wurde Vorsteher der Abteilung für innere Chirurgie. Im Gegensatz zu Senning war Prof.H.U. Buff noch keine international bekannte Kapazität. Er war bekannt als Spezialist für plastische und Wieder-herstellungschirurgie. Prof.Maurice Müller hatte in Bern eine neue Technik und das dafür notwendige Instrumentarium für die Behandlung von Knochenbrüchen erfunden und verkauft. Im Vergleich zu Müller war Buff ein konservativer Unfallchirurg und damit Müllers ausgemachter Gegner. Müller wurde mit seinen Erfindungen (und seiner enormen kommerziellen Begabung) so reich, dass er die Schande der durch die berner Polizei abgelehnten Einbürgerung von Paul Klee durch Stiftung des gewaltigen Klee-Museums wieder gutmachte.4
16.3
Es gab kein Organigramm zum Betrieb der verschiedenen Abteilungen der chirurgischen Universitätsklinik (Notfall-Aufnahmestation, der Poliklinik, der Patientenabteilung, Operationstrakt). Prof. Buff stellte sich vor, dass derselbe Arzt, der mit der Behandlung eines neuen Patienten begonnen hatte, weiterhin für diesen verantwortlich sein soll, also ihn in seine eigene Abteilung aufzunehmen hatte oder zur Nachkontrolle zu seinen Poliklinik-Zeiten bestellte. Dieses an sich wünschenswerte Verfahren liess sich in dem organisatorischen Chaos jedoch nur selten anwenden. Eine der Ursachen für diese Unordnung waren die oft lautstark coram publico ausgetragenen Händel zwischen den zwei Professoren: Ist die arterielle Embolie in eine Beinarterie infolge Vorhofflimmern oder die Lungenembolie aus der Thrombophlebitis einer Beinvene eine Sache des Thoraxchirurgen oder des Spezialisten für Chirurgie der Extremitäten?
16.4
Herzchirurgie. Durch einen Unfall kam es dazu, dass ich als Assistent der B-Klinik dem Herzchirurgen Senning bei einer Notfalloperation assistieren konnte: Ein Junge von etwa 18 Jahren hatte mit einem geladenen Flobertgewehr gespielt und dabei einen Schuss ausgelöst, der durch die Brustwand ins Herz gedrungen war. Er war bewusstlos, Blutdruck und Puls waren nicht mehr messbar. Bruno Vogt, unser Oberarzt, rief Senning in die Notfallstation. Unterdessen begann ich das Operationsfeld zu desinfizieren und abzudecken. Senning kam, öffnete mit einem tiefen queren Schnitt die Brusthöhle. Ausser einem See von Blut war nichts zu sehen. Senning ortete aber am Herz sogleich das Einschussloch, obschon es in dem Blutsee nicht sichtbar war, und verschloss es mit einem Finger. Den Ausschuss musste ich auf gleiche Weise verschliessen, so dass nun kein Blut mehr aus der schon fast leeren Herzkammer fliessen konnte. Unterdessen erhielt der Patient eine Bluttransfusion nach der andern und ein Priester war auch schon daran, ihm die letzte Ölung zu verabreichen.
- Was macht der da?
fragte Senning.
- Die letzte Ölung,
antwortete ich. Senning lachte.
- Öl heisst auf Schwedisch Bier. Der ist aber kein Optimist!
Der Blutverlust war nun provisorisch verhindert, das Herz pulsierte noch.
Jetzt konnte man die Schusslöcher ruhig zunähen. Die Kugel steckte in der dorsalen Brustwand man liess sie vorläufig dort stecken. Der Junge war gerettet.
Zu dieser Zeit experimentierten Senning und seine Assistenten mit dem implantierbaren Herzschrittmacher. Er ist der eigentliche Erfinder dieser inzwischen zu Routine gewordenen lebensverlängernden Methode. Eine andere Erfindung war die Technik, am offenen Herzen zu operieren, während dem eine Herz-Lungen-Maschine die ausgefallenen Funktionen, Atmung und Blutkreislauf übernimmt. Senning hatte selber einen solchen Apparat konstruiert. Auf diese Weise konnte man deformierte Herzklappen reparieren oder durch Prothesen ersetzen. Senning war der Erste, der in Europa (und Amerika?) begann, Herzrtransplantionen durchzuführen.
16.5
Prof.Buff konnte sein Versprechen nicht halten: Es gelang ihm nicht, einen Teil der allgemeinen Chirurgie innerer Organe besonders die abdominelle für die Klinik B zu beanspruchen. Damit hatte er uns verführt (Bruno Vogt als Oberarzt, Röthlisberger und mch als Assistenten) ihm nach Zürich zu folgen. Ich hatte nicht die Absicht, mich für traumatologische und plastische Chirurgie zu spezialisieren.
Der Chef machte mich zu seinem Privatassistenten sodass ich weniger zum Operieren kam. Die reichen Leute wollten auch für einfachere Eingriffe vom Chef persönlich operiert werden. So sollte er einmal eine Schienbeinfraktur mit dem so genannten Küntscher-Nagel behandeln, eine Operation, die er noch nie gemacht hatte, denn er verabscheute alles Maschinelle. Nur konnte man damals diesen Knochenbruch nicht mehr mit einem Gipsverband und sechs Wochen Bettruhe versorgen, während die Leute mit dem Marknagel schon nach ein paar Tagen wieder herumgehen konnten. Ich hatte diese Technik bei Vogt gelernt und musste nun dem Chef beibringen, wie man mit den flexiblen Bohrer umgeht um die Markhöhle auf das Kaliber des Nagels zu erweitern. Unter der Anweisung von Dr.Vogt lernte ich auch die Entfernung eines zerrissenen Meniskus im Kniegelenk. In der chirurgischen Poliklinik gab es Gelegenheit für manche ambulant durchführbare Eingriffe, wie Halux valgus.
16.6
Das wichtigste Ereignis in diesem Jahr 1962 war die Geburt unseres ersten Kindes, Tobias Markus, am 17. Februar. Fräulein Dr. Schenkel (alle unverheirateten Frauen wurden damals noch “Fräulein“ genannt) und leitete die Kontrollen. Fräulein Droktor wollte Verena für die Zeit der Schwangerschaft ein Stützkorsett Marke “Libelle Femina“ verschreiben. Das war wohl noch alte Schule, als das Korsett als unverzichtbares Dessous der weiblichen Mode galt. Verena verzichtete auf ein solches Gerüst. Im Spital der Pflegerinnenschule Zürich leitete Dr.Schenkel die Geburt. Die Geburt musste hormenell eingeleitet werden, als ob mein erster Sohn sich nicht beeilen wollte, das Licht der Welt zu erblicken.
Als wir aus dem Spital mit dem Kind nach Hause kamen, gab es ein Gewitter, im Februar! Meine Mutter kam um uns “zu helfen“. Die Hilfe bestand unter Anderem darin, erst einmal grosse Wäsche abzuhalten. Verena, die von der Dammnaht beim Gehen noch Schmerzen hatte, musste ihr die Funktion der Waschmaschine im Sousol demonstrieren, die Wäsche zusammensuchen und das Essen kochen. Für das Essen musste ich einkaufen und dann bald wieder zur Arbeit gehen.
Klein Tobias wog bei der Geburt nur 2,5 Kilo, war aber normal und gesund. Die Ernährung bot keine Probleme, zuerst mit Bruststillen, später mit den vielen Mustern von Säuglingsnahrung die wir von den Pharmafirmen bekommen hatten. Nachdem er den Schoppen mit Schololadegeschmack gekostet hatte, verweigerte er den faden weissen Paidolbrei. Er wusste also schon bald seinen Willen durchzusetzen. Wenn er in der Nacht statt zu schlafen mit kräftiger Stimme danach schrie herumgetragen und gefüttert zu werden, gab es Reklamationen von der Mieterin im ersten Stock, weniger wegen der Nachtruhestörung als wegen unserem nach ihrer Meinung allzu spartanischen Erziehungsstil.
16.7
Während diesem Jahr an der Uniklinik in Zürich bekamen wir Besuch von Dr. med.Jörg Trüb. Er war auf Heimaturlaub von Omdurman im Sudan, einer Nebenstadt von Khartum, wo die “Schweizerische Evangelische Mohammedanermission“ ein ärztliches Ambulatorium betrieb. Diese Missionsgemeinschaft hatte sich der Kooperation evangelischer Missionen (KEM) angeschlossen und deshalb Anspruch auf einen Beitrag aus dem Fonds der Aktion „Brot für Brüder“ für ein neues Projekt. Dabei wurde die Mission auf den Namen “Schweizerische Evangelische Nillandmission“ (SENM) umbenannt.
Dr.Jörg Trüb kam im Auftrag der Missionsleitung. Ob ich bereit wäre, in Eritrea als Arzt beim Aufbau einer ärztlichen Missionsstation mitzuwirken? Ein solches Angebot kam meinem Überdruss am Kantonsspital, meiner Abenteuerlust, und der Suche nach einer missionsärztlichen Aufgabe entgegen.
16.8
Nachdem Verena und ich zugesagt hatten, wurden wir dem Missionskomitee vorgestellt. Dieses Komitee bestand aus dem „Missionsinspektor“ Merklin, der vorher in Assuan tätig gewesen war, einigen älteren Pfarrern der Landeskirche und Schwester Rösli, welche die Männer während der Aufnahmeprozedur mit Kaffee und Gipfeli versorgte. Das Komitee gab für unsere Wahl „grünes Licht“ wie sie das ausdrückten.
Ich bestand darauf, dass wir uns vor der Ausreise ein Jahr (unbezahlte!) Zeit zur Vorbereitung bekamen. Unsere Freunde, Dr.Emanuel und Erika Pfähler und Dr.Anton und Susanne Wanner, unterstützten uns mit vierhundert Franken im Monat. Wir hatten geplant, gemeinsam eine ärztliche Mission aufzubauen. Verena und ich gingen als Vorhut voran. Nach dem Scheitern dieses Experiments, blieben die Pfählers und Wanners in der Schweiz. Wanners verbrachten später eine gewisse Zeit in einem Spital in Nordindien. Dr.Emmanuel Pfähler kam für ein Jahr nach Moçambique, um Dr.René Favre zu vertreten, der in der Schweiz auf Urlaub war.

1962-1963
17.1
Eine mit den VBG verbundene Familie von Schattdorf im Kanton Uri stellte uns ihr Ferienhaus auf einer nahen Alp zur Verfügung. Ob die Lektüre der Biografie Karls des Grossen die optimale Vorbereitung war auf den künftigen Einsatz als Missionsarzt? Ich hatte das Bedürfnis mich wieder einmal mit etwas zu beschäftigen, das möglichst wenig mit Medizin und Chirurgie zu tun hat.
In den darauf folgenden Sommermonaten wohnten wir in Moscia, am Ufer des Langensees, im Zentrum der Schweizer Sudentenbibelgruppen. Hans Bürki, der Sekretär "at large“ der IVF (Inter Varsity Fellowship) hatte ein "Bibelseminar“ eingerichtet, eine Art Sommeruniversität für mehr oder weniger christlich engagierte Akademiker. Neben Hans Bürki waren noch andere Dozenten eingeladen: Ein Theologe, der über den Pietismus dozierte (das war lehrreich) und ein Vertreter (Sekretär) der Studentenmission in Deutschland, Günther Dulong. Er war ein fanatischer Segler und ich wunderte mich, dass seine Frau das Alleingelassenwerden ohne Klage zu ertragen schien, was Verena nicht toleriert hätte. Ich weiss nicht mehr, was wir bei ihm gelernt haben.
Friso Melzer, der viele Jahre in Indien zugebracht und ein Buch über christliche Meditation geschrieben hatte, dozierte über dieses Thema. Das Ehepaar Melzer bewohnte das dem unseren benachbarte Zimmer. Als wir eines Abends ein langes Gespräch führten mit Roswitha Stössel (der Gotte und späteren Kindergärtnerin von Tobias), fühlte sich Herr Melzer gestört und rief: "Ich versteh ja sogar den Text!“
Da gab es auch einen Physiker und Mathematiker, den hochgebildeten Professor Philbert. Als Erscheinungstyp erinnerte er mich an Blaise Pascal oder Teilhard de Chardin. Er leitete aus einer mathematisch-physikalische Formel ab, dass in zehn Jahren ein Atomkrieg zwischen den Ost- und den Weststaaten ausbreche. Eine der Zuhörerinnen geriet deswegen in einen Panikzustand.
Schliesslich stieg an der Bushaltstelle Moscia ein Engländer aus, winterlich gekleidet in Mantel und Handschuhen. Dabei war zwischen 25 und 30 Grad warmes Sommerwetter. Er war Professor für Alte Geschichte am British Museum in London und berichtete über die archäologischen Belege und historischen Ereignisse zur Zeit der in der Bibel berichteten Ereignisse.
An den freien Nachmittagen pflegten Verena und ich Resten vom Mittagessen aus dem Kühlschrank zu stibitzen. So assen wir dann unser privates Picnic im Wald oberhalb von Moscia. Verena litt darunter, bei den Mahlzeiten von zwanzig und mehr schwatzenden Leuten umgeben zu sein. Während einer Mahlzeit im grossen Speisesaal wurde sie einmal plötzlich von Panik gepackt und verliess weinend den Raum. Es war ihre Art, anstatt in den für sie unerträglichen Situationen aufzubegehren, weinend weg zu laufen.
Leider wagte ich nicht, mit ihr über ihre Bedenken, Probleme und Ängste zu sprechen. Als für uns dann später die Lage in Eritrea unerträglich wurde, wirkte sich dieses Verhalten von Verena katastrophal aus. Ihr wortloses Dulden hatte sich in als seelischer Zusammenbruch entladen. Ich hätte ihre Verletzlichkeit schon damals wahrnehmen, zur Sprache bringen und unser Eritrea-Projekt neu überdenken sollen.
Hans Bürki hatte uns gewarnt, als wir im Herbst in die Bibelschule "Emmaüs“ in Vennes zogen um im Winterhalbjahr unsere geistliche Vorbereitung zu konsolidieren. Im meiner Vorstellung waren Christen einfach Christen, unabhängig vom Stil ihres Christseins- und Lehrens.
17.2
Die Bibelschule ”Emmaüs“ in Vennes bei Lausanne. Schon die über dem Empfangspult dieser Bibelschule auf die Wand gemalten Blümelein fielen mir auf. Aber es war nicht das erste und nicht das letzte Mal, dass ich meine ästhetischen Bedenken meinte übergehen zu müssen. Erst viel später merkte ich langsam, dass Ästhetik etwas mit Wahrhaftigkeit zu tun hat. Und christliche Existenz ohne Wahrhaftigkeit ist eben das, was gewisse sensible und wache Menschen abstösst, wie Bigotterie und Heuchelei. Es war diese Lebenshaltung als allein selig machende Christlichkeit behauptet, was das Zusammenleben und -Arbeiten mit dem Ehepaar Schaffner in Eritrea für uns unmöglich machen würde.
In Vennes wenigstens konnten wir als Hospitanten, "auditeurs“, auslesen, welche Vorlesungen und Veranstaltungen wir besuchen oder auslassen wollten. An den langen gemeinsamen Gebeten wollten wir nicht teilnehmen..
Wir bewohnten ein kleines Zimmer mit einem Nebengebäude. In einem oft sehr kalten Nebenaum war das Bettchen des acht Monate alten Tobias. Während den Vorlesungen und Bibelstudien, die wir gemeinsam besuchten, liessen wir Tobias tagsüber allein im Zimmer oder im Freien im Kinderwagen und kümmerten uns nicht darum wenn er weinte. Verenas Erziehungsstil folgte einem Autoren namens "Dreikurs“. In seinem Erziehungsbuch "Kinder fordern uns heraus“ vertritt er, diese spartanische Abstinenz sei günstig für die seelische Entwicklung des Kindes und schone die Eltern. Nur nicht verwöhnen!
Heute kann ich das nicht mehr verstehen.
Im Empfangsbüro wirkte Mademoiselle X, eine nette, kleine rundliche Dame, die ausser dem Sekretariat den Bibelstudenten Lektionen über französische Literatur gab. Das überraschte mich. Unter den VBG-Leuten in der deutschen Schweiz galt fast alles was mit Belletristik zu tun hatte als suspekt, so auch bildende Kunst. Nur Musik war anerkannt und auch gespielt und gesungen, natürlich die christlichen Lieder und Kanons und die Komponisten des Barock vor allem natürlich Bach. Die kulturelle Wüste und der christliche Kitsch scheinen in direktem Verhältnis zum Frömmigkeitsgrad der Gläubigen zu stehen. Einer der vielen Gründe, weshalb es einer besonderen Form der Selbstverleugnung bedarf, sich dadurch nicht abschrecken zu lassen auf der Suche nach echtem Glauben.
Jahrelang habe ich mich in dieser Wüste aufgehalten, fast nie mehr gezeichnet , gemalt oder schöne Literatur gelesen. Die grossen Schriftsteller und Dichter von der Klassik bis zur Moderne, kannte ich von der Mittelschule. Obschon ich Interesse daran, und das Bedürfnis danach hatte, liess ich da eine bedauerlich grosse Lücke entstehen. In Eritrea aber las ich den ganzen Matthias Claudius und Jakob Burckhardts Werk über die Renaissance in Italien.
17.3
Dr. de Benoît war der spiritus rector der Schule. Er war ehemaliger Arzt (ich weiss nicht ob und wo er praktiziert hatte und ob er als Missionsarzt tätig gewesen war. Ich hatte sein Buch, "Les douzes petits prophètes“ in Nazareth gelesen. Seine Lektionen waren fundiert und klar. Seine zwei unverheirateten Töchter wohnten mit ihm in ihrer geschmackvoll antik eingerichteten Ville. Sie beschäftigten sich mit dem Römerbrief und schienen finanziell unabhängig zu sein um beliebig viel Zeit für diese Studien zu haben. Die zwei Damen empfingen uns sehr liebenswürdig. Wir hatten die Ehre einer Einladung zum Souper in ihrer Villa. Von den an diesem Abend geführten Gesprächen erinnere ich mich nur noch an das dominierende Thema des Herrn Dr. de Benoît , nämlich die „rotule“, die Kniescheibe, welche ihm Arthroseschmerzen bereitete.
17.4
Der administrative Leiter er Bbelschule war René Pache, ein ehemaliger Jurist, ein aktiver Pykniker. Er war vor allem mit dem Expropriationsprozess beschäftigt. Für die neue Autobahn sollte vom Grundstück der Schule ein Stück abgegeben werden. Es war die erste Autobahnstrecke der Schweiz. Sie wurde im Hinblick auf die Landesausstellung in Lausanne geplant. René Pache hatte ein Buch geschrieben mit dem Titel: L’Au-Delà“, das Jenseits. Im Gegensatz zum Buch von Dr.de Benoît, hatte ich kein Interesse, dieses Buch zu lesen..
Monsieur Pache vertrat eine intolerante, ausgrenzende Theologie. „Les incrédules“ war eine viel zitierte Vokabel, wobei er die reformierte Landeskirche als „Eglise apostate“ verurteilte. Die Leute von der Bibelschule Emmaüs in Vennes wurden ihrerseits von der Leiterin der Bibelschule Beatenberg und deren Jünger verketzert. Das Kriterium war, dass die Einen als Prämilleniaristen, die anderen aber als Postmilleniaristen galten. Es ging um die Frage, ob das tausendjährige Reich vor oder nach der Wiederkunft Christi stattfinden werde.
Da wunderte ich mich und ich dachte an die Warnung von Hans Bürki.
Den Gipfel dieser Ausgrenzungsmanie erreichte ein amerikanischer oder englischer Monsieur namens Homer Payne*. Er glaubte aus der Bibel zu verstehen, dass Gott immer wieder unter einer grossen Zahl berufener Menschen eine Elite aussondere und zum Heil berufe. Wenn aus dieser wiederum eine grosse Zahl nach Paynes Ansicht untreue und ungläubige Kirchgänger geworden sei, würden aus diesen Vielen wiederum einige wenige, als einzige zu Erben des Reiches Gottes bestimmt. Es schien zu wissen, welche Christen schliesslich zu den Erwählten gehören würden. Alle anderen waren die Verlorenen, die Verdammten. Für diese gab es den Feuersee der Apokalypse. Schauderhaft! Vielleicht brauchte ich diesen Unterricht, um die Theologie des Ehepaars Schaffner, unserer künftigen Vorgesetzten in Eritrea durchschauen zu können: Sie stammten nämlich aus der Bibelschule Beatenberg und hielten sich wörtlich an die Verkündigung der Direktorin dieses Institutes, Frau Doktor Wasserzug.
Gegenüber diesen Spekulationen meinte ich, dass die selbstlose Liebe das Entscheidende des christlichen Glaubens und Lebens sei, der tägliche Versuch, dem Vorbild von Jesus nachzufolgen, unabhängig davon, ob man der reformierten, katholischen oder irgend einer anderen Kirche oder Gemeinde angehörte. Wenn ich das zu schreiben wage (am 7.August 2014), wird mir bewusst, wie weit ich alter Mann noch immer von dieser Art zu leben entfernt bin.
17.5
Dieser Winter, von 1962/63, war so kalt, dass der Zürichsee zugefror, so dass man darauf gehen und Schlittschuh laufen konnte. Die letzte „Seegfrörni“ war im Jahr 1919 gewesen. Wir kamen einmal aus Lausanne zu meinen Eltern nach Zürich zu Besuch und machten einen Eisspaziergang auf dem Zürichsee. In den dünn gesohlten Halbschuhen bekam ich unvergesslich kalte Füsse.

Geburt von HANNA BARBARA am 2,Mai 196
18.1
August 1963. Abreise von Venedig. Die Eltern von Verena und meine Eltern begleiteten uns zum Abschied nach Venedig. Es gab ein gemeinsames Abendessen im Restaurant „Tre Gobbi“. Am andern Morgen bestiegen wir das Schiff mit der traditionellen Rolle Papierstreifen, die uns noch symbolisch mit den Unseren verbinden sollten und zerrissen, wenn das Schiff auszulaufen begann.
Während das Schiff durch den Sueskanal fuhr, konnten die Passagiere mit einem Bus von Port Said aus Kairo besuchen. Auf der Fahrt beobachtete ich einen Steinbruch, in welchem junge Mädchen Steinbrocken in einem Korb auf dem Kopf tragen mussten. Welches Gewicht mochte das sein? Das war der erste Eindruck von der Art, wie man in arabischen und muslimischen Ländern mit Frauen umging. Man überlastet sie und beutet sie aus.
Im Hilton Hotel gab es einen Apéritiv oder Lunch. Im Kairo Museum konnte ich (damals noch!) problemlos mit meiner kleinen Kamera die berühmte Maske des Tutenchamun fotografieren. Dann war noch Zeit für einen Kamelritt zu den Pyramiden von Gina. Den Tobias auf dem Rücken kletterte ich durch den engen Gang in der Cheopspyramide bis zur leeren Grabkammer des Pharao. Im Innern dieses Monuments was es extrem heiss. Am Abend führte und der Bus nach Suez. Wir wurden in ein Restaurant geführt für das Abendessen. Ich weiss nicht mehr was zu essen gab. Es war der vielen Schiffspassagiere wegen eine richtige Massenabfertigung. Um Mitternacht kletterten wir mit Tobias und dem Kinderwagen an der Reling hoch wieder ins Schiff. In der Hitze des Roten Meeres bekam Verena einen diffusen Hausausschlag: Hitzeurtikaria. Auf dem Schiff fand ein Tanzabend statt, “get together dance“ wird diese Unterhaltung für gelangweilte Passagiere genannt. Was dabei beim Tanzen an Verrenkungen aufgeführt worden ist, fand ich sehr sonderbar. Erst viel später lernte ich den Rock-n-roll selber tanzen. Nach drei Jahren in chirurgischen Kliniken, nach einem Jahr Rückzug aus der Welt, Einsamkeit in einer Alphütte, im Bibelseminar im Tessin und in der Bibelschule in Vennes hatte ich den Kontakt mit dem Leben der modernen, zivilisierten und kultivierten Welt verloren.
So kamen Verena, unser Kind Tobias und ich nach langer Schiffsreise von Suez her in Massaua an, der Hafenstadt von Eritrea. Tobias hat seit jener Massenfütterung der Schiffspassagiere in Suez Dysenterie, eine gefährliche Sache bei einem Kleinkind von achtzehn Monaten.
18.2
Massaua, Die Hafenstadt von Eritrea liegt zwischen dem Roten Meer und der Wüste, die sich von Ägypten bis zum Horn von Afrika hinzieht und im Westen vom über zweitausend Meter über Meer erhobenen afrikanischen Hochplateau begrenzt wird. Massaua gilt als die heisseste Hafenstadt der Welt. Einsam und öde, lautlos und unbewegt brütete sie unter der blendenden Sonne.
Das Projekt. Wie war es nur möglich, dass ich mich mit dem achtzehn Monate alten Kind, und der noch nicht fünfundzwanzigjährigen Frau auf ein so unsicheres und gefährliches Abenteuer eingelassen hatte? Worin das Projekt eigentlich bestehe, und was in Eritrea eigentlich unsere Aufgabe sei, darüber hat man uns im Ungewissen gelassen und mir war es nicht in den Sinn gekommen nachzufragen. Man wusste noch nicht, ob der zufällig gefundene Standort, das Dorf Adi Quala, 200 km südlich von der Hauptstadt Asmara, für eine missionsärztliche Station überhaupt sinnvoll und geeignet sei. Aber darüber waren die Würfel schon gefallen denn schon vor unserer Ankunft hatte Erich Schaffner für die Mission ein vom offiziellen Eigentümer, der Regierung, in Adi Quala ein Grundstück gekauft für den Bau der künftigen Missionsstation. Doch die Bauern des Dorfes hatten das steinige Gelände als ihr Eigentum angesehen. Jahrelang hatten sie ihr Getreide, den Taff, darauf angebaut und wehrten sich jetzt gegen die Verletzung ihres Gewohnheitsrechts. Es gab kein Grundbuch, das die Eigentumsverhältnisse genau geregelt hätte, so dass es nicht möglich war, den Kaufvertrag der Missionsgesellschaft mit der Regierung durchzusetzen. Man hätte nicht darauf bestehen sollen, hier Wohnhäuser und ein Spital zu errichten, denn mit diesem Landkauf hatte man sich die Dorfeinwohner gleich am Anfang schon zu Feinden gemacht. Die erwachsenen Bewohner verhielten sich gegen uns zwar noch friedlich, die Kinder aber bewarfen uns mit Steinen. Aus diesem Grund hatte Erich sich angewöhnt, in einer Tasche immer einige Steine mitzutragen, um sie nach den Kindern zu werfen.
Schon bei unserem Vorstellungsgespräch vor dem Komitee der schweizerischen evangelischen Nillandmission hatte ich den Eindruck, dass sich diese gemütlichen Pfarrherren nicht viele Gedanken gemacht hatten über den Standort, das Ziel und die für eine solche Unternehmung notwendigen Mittel. Sie schienen keine Ahnung davon zu haben, dass die politische Lage in Eritrea alles andere als stabil war und nicht zu wissen, wo und wie eine solche Station aufgebaut und organisiert werden sollte. Oder vielleicht wussten sie es, wollten es uns aber vorenthalten.
Der die Situation, den Bedarf und die zur Verfügung stehenden und notwendigen Mittel hätte untersuchen und kennen müssen, war der Herr Missionsinspektor Merklin. Er hatte an verantwortlicher Stelle schon viele Jahre in Ägypten und im Sudan Erfahrungen und Kenntnisse gesammelt. Ich musste aus seinen sporadischen Andeutungen erraten, was eigentlich beabsichtigt war, denn weder Herr Merklin noch sein Gewährsmann, der Reverend Prince Albert Hamilton aus Assuan, formulierten jemals ein klares Projekt. Und ich war zu wenig frech sie zur Rede zu stellen.
Es ging ihm offenbar vor allem um den Aufbau einer Erholungsstation im klimatisch angenehmen Hochland für die Missionare, die im heissen Klima von Assuan und Omdurman im Sudan tätig waren. Einem “Greenhorn“ wie mich weckte diese Konzeptlosigkeit zusammen mit solchem Verdacht ein mulmiges Gefühl von Unsicherheit und durchlöcherte mein Vertrauen. Ich kann im Nachhinein noch weniger verstehen, wieso man dieses zukünftige Ferienparadies für ausgepumpte Missionare ausgerechnet auf dem politischen Pulverfass Eritrea gründen wollte.
Diese kleine Missions-Gesellschaft war auf Prestige angewiesen, weil sie kurz zuvor Mitglied der „KEM“ geworden war, der Kooperation evangelischer Missionen und von der Spendenorganisation „Brot für Brüder“ finanzielle Zuschüsse in Aussicht standen. Deshalb waren Herr Merklin und die Pfarrer vom Komitee so erfreut, einen Arzt gewonnen zu haben. Ich merkte erst später, dass man mich vor allem dazu verwenden wollte, dieser Missionsgesellschaft und ihrem Vorhaben den Anstrich von ernsthaftem Engagement und humanitärer Aktivität zu verleihen. Erst in zweiter Linie ging es darum, für die unterversorgte Landbevölkerung Hilfe zu bringen.
Ich würde nicht so weit gehen, dem Komitee und Herrn Merklin betrügerische Machenschaft vorzuwerfen auch nicht dass sie absichtlich gelogen hätten. Schuld am Misslingen war eher ihr Mangel an politischem und soziologischem Kenntnissen. Die Leute kümmerten sich zu wenig um die aktuelle Wirklichkeit, dachten zu wenig nach über Prioritäten und Strukturen. Den grössten Schaden stiftete die mangelnde Transparenz. Sie wurde vernachlässigt oder man hat vielleicht sogar bewusst wichtige Informationen vertuscht und vernebelt. Ich war zu naiv und unerfahren, um da nachzustochern. Beispielsweise hatte ich keine Ahnung wie viel Geld überhaupt zur Verfügung stand und fragt nicht danach, weshalb Erich Schaffner jedes Mal wenn er mir den kargen Lohn auszahlte, sich die Bemerkung erlaubte, ich verursache zu hohe Kosten und soll auf einen Teil des Lohnes verzichten.
18.3
Von Massaua nach Asmara. Zurück zum Tag unserer Ankunft. Ein grosser, hagerer Mann mit grauen Haaren kam mit bedächtigen Schritten auf uns zu, gab uns die Hand uns sagte „So, sind er aacho“. Das also war Erich Schaffner unser künftiger Chef
Nach dieser Begrüssung und Herrn Schaffners gelungenem Markten um die Zollgebühren ging es im VW-Picup von Massaua über unendliche Kurven auf das Hochplateau von 2400 m.ü.M.. Die Berge erwiesen sich nicht wie in der Schweiz als tektonisch aufgetürmte Gesteinsschichten, sondern waren wie gigantische Skulpturen aus dem Gestein vom Rand des zum Meer abstürzenden ostafrikanischen Hochplateaus durch die Witterung herausgeformt worden. So ging es stundenlang in engen Kurven und engen Tälern bergauf und an dicht von Opuntien (Feigenkakteen) überwachsenen Felsen und Bergabhängen vorbei. Beim genauen Hinsehen entdeckte man in diesen Tälern mit dörren Blättern oder Stroh gedeckte Hütten. Das waren die Dörfer dieses Volkes der Tigriner, deren Sprache wir demnächst zu lernen hatten. An einer europäisch aus Stein und Wellblech konstruierten Station konnte man etwas essen und trinken. Wir waren in grosser Sorge um Tobias, der ununterbrochen gelblichen flüssigen Stuhl entleerte, sodass die Windeln längst nicht mehr genügten um alles aufzufangen und Verena irgendwelche andere Tücher zu Hilfe nehmen musste. Ich weiss nicht mehr, ob und was und wie viel wir während diesem Zwischenhalt dem kranken Kind zu trinken geben konnten. Wir hatten keine Zeit dazu. Herrr Schaffner nahm darauf keine Rücksicht, er drängte nur auf rasche Weiterfahrt.
Ganz plötzlich flachte der gebirgige Horizont über uns ab. Bergspitzen, die uns vorher noch hoch überragten, waren jetzt ins Tal getaucht, so dass wir jetzt auf sie hinunter blickten. Wir nahmen die letzten Kurven über den Plateaurand und gelangten auf eine weit ausgedehnte öde Ebene, bewachsen von ein paar Agaven mit ihren baumhohen Blütenstämmen und einem lichten Eukalyptuswäldchen.
An der Endstation der Reise, in der eritreischen Hauptstadt Asmara, wurden wir in eine Wohnung in einem fünfstöckigen Mietshaus einquartiert, das provisorische Hauptquartier der Schweizerischen Evangelischen Nillandmission, das Haus Nummer eins an der schnurgeraden repräsentativen Palmenallee, der Avenue mit dem Namen des Kaisers von Äthiopien, Haile Selassie. Gretli und Erich Schaffner hatten die Mitwohnung schon mit Vorhängen und den wichtigsten Haushaltgeräten ausgerüstet. Erich ging sogleich in die Stadt um die üblichen eisernen Betten und das Bettzeug für uns zu kaufen. Dabei erlebten wir zum zweiten Mal den für Erich typischen Stil des Marktens. Er verärgerte damit jedes Mal die sonst freundlichen und geduldigen Verkäufer.
Im gleichen Ton verhandelte er mit Vertreten der Regierung und selbst mit dem Schweizer Konsul, mit Leuten also, auf deren Hilfe wir angewiesen waren. Stolz erzählte er nach dem Besuch in der Schweizer Botschaft in Adis Abeba, er habe den Leuten dort gesagt, dass man im diplomatischen Dienst ja kein sündenfreies Leben führen könne.
18.4
Tobias in Lebensgefahr. Inzwischen war der Zustand unseres Kindes lebensgefährlich geworden: Apathisch, mit eingefallene Augen lag er improvisierten Kettchen. Er atmete abnorm langsam und tief, nahe der Toxikose, dem Endzustand bei Säuglingsdyspepsie mit schwerem Verlust von Körperflüssigkeit. Ohne sehr rasche Behandlung führt dieser Zustand zum Tod. Wir löffelten ihm jetzt stundenlang dünnen gesüssten Tee ein. Zum Glück musste er nicht erbrechen sondern behielt die Flüssigkeit bei sich. Wir wollten ihm danach geraffelte Äpfel geben (die waren hier in Asmara sehr teuer. Karotten für die von Professor Fanconi erfundene lebensrettende Suppe gab es nicht.). Wir hatten aber kein Geld um Aepfel oder irgend etwas Ähnliches zu kaufen. Allzu ehrlich hatte ich den Rest vom Reisegeld, das wir in der Schweiz von der Mission bekommen hatten, dem Erich Schaffneer schon abgegeben, in der naiven Meinung, von jetzt an sei er als „Personalchef“ für unsere finanziell Versorgung zuständig. Ich bat ihn um Vorschuss auf den ersten Monatslohn. Seine Antwort: Das komme nicht in Frage. Wir sollen warten bis zum Ende des Monats. Es war aber erst Mitte August. Tobias erholte sich dennoch erstaunlich rasch, er blühte auf, auch ohne geraffelte Äpfel. Als ich darnach dem Erich Schaffner erzählte, dass Tobias beinahe gestorben wäre, sagte er (ich traute meinen Ohren nicht): “Das ist der Preis den Missionare eben zahlen müssen um im Weinberg des Herrn zu wirken“.
Ich ahnte, dass uns als Untergebene dieses Menschen nichts Gutes bevor- stand. Von seiner Frau, dem „Gretli“ Schaffner, die wir etwas später kennen lernten, bekamen wir bald den selben Eindruck. War ihr Verhalten ihnen angeboren oder die Auswirkung einer angelernten starren, grausamen Gottesvorstellung? Erich war von Beruf Feinmechaniker gewesen. Gretli, so liess sich seine kleine Ehefrau nennen, ist ehemalige Apothekerin. Ihr grauen Haare waren straff rückwärts gezogen und endeten in einem Chignon am Hinterkopf. Die Ausbildung zu Missionaren erhielt das Ehepaar Schaffner in der Bibelschule Beatenberg, wo die für ihre stramm fundamentalistische Theologie bekannte Frau Doktor Wasserzug das Regiment führte.
18.5
Die Sprache lernen: Tigrinya. Ein begabter Student, Gebrekristos Andemariam wurde unser Lehrer. Schon die sylabischen Schriftzeichen zu lernen, war eine rechte Arbeit, noch mehr die korrekte Aussprache. Schon das Arabische, als semitische Sprache braucht ja uns unbekannte Kehl- und Knacklaute. Im Tigrinya kommen noch einige dazu, was vermuten lässt, dass Tigrinya, mit seiner Ursprache, dem Ge’ez, eine noc ältere semitische Sprache ist, als das Arabische. Andere semitische Spravchen wie das Hebräische und Arabische werden von rechts nach links geschrieben, die beiden äthiopischen Sprachen, das Amharische und Tigrinya wie die europäischen Sprachen von links nach rechts. Die Buchstaben von Tigriny sind fast identisch mit dem Alfabeth des Amharischen, der Amtssprache von Äthiopen. Sie sind vom Ge’ez, der alten Kirchensprache übernommen worden, übernommen worden. Es gibt im Jemen alte in Stein gemeisselte Inschriften in einer alten Form der äthiopischen Schrift, die typischerweise nur aus Konsonanten bestand. Die Vokalzeichen sind, ungleich dem Arabischen, später mit den Kononsonanten zusammen gewachsen, so dass das amharische und tigrinische Alphabet aus 37 mal 7 Buchstaben (= 259 )besteht. Die im Alten Testament als Besucherin des weisen israelitischen Königs Salomo beschriebene Königin von Saba (=Jemen?) könnte sich einer ähnlichen ursemitischen Sprache und Schrift bedient haben.
**) Die arabische Zeitungsschrift verwendet für kurze Vokale auch keine Buchstaben,
18.6
Weihnachten 1963. Ferien in Derbe Seit bei Bishoftu in Aethiopien. Unser erster Flug mit den Ethiopian Airlines von Asmara nach Addis Abeba. Diese Stadt kam mir vor wie ein riesiges Konglomerat von locker angelegten Dörfern mit einstöckigen Häusern, verstreut in lehmigen Tälern, auf einer staubigen Ebene und auf den Hügeln. Dazwischen liegen Gärten und weideten Ziegen, Schafe und ein paar magere Kühe. Überall wachsen Eukalyptusbäume. Diese waren eingeführt und gepflanzt worden an Stelle der dornigen Gebüsche, welche das ganze etwa 2500 m ü.M. liegende Hochland bedecken. Aus Eukalyptusholz wird das tragende Gerüst der Häuser gebaut und dient als Heizmaterial. Auch wo viele Eukalyptusbäume nebeneinander stehen wirken sie nicht als Wald, sondern geben der Gegend das Aussehen eines lichten, etwas struppigen Haines. Andere Baumarten waren nur wenige zu sehen. Das Einzige was diesem riesigen Dorf den Anschein einer Stadt gibt, ist die gewaltige koptische Kirche, der Palast des Kaisers und noch einige Paläste für die Regierung, die Verwaltung und das Gericht alles mehr oder weniger in einem neobarockem Kolonialstil.
Wir fanden im Zentrum der Middle East General Mission Unterkunft. Das Anwesen bestand aus einigen schönen Häusern, die mit Tschiqa gebaut waren, einem Gemisch von Erde, Lehm, Stroh und Kuhmist, das über einem Holzgerüst und Flechtwerk aus Eukalyptusästen gepflastert und dann mit einem dunkelroten Anstrich versehen wird, sodass die Hauswände alemannischen Riegelhäusern gleichen. In diesem Missionshauptquartier war die Regel, vor den Mahlzeiten eine ganze lange Liste von Missionsanliegen zu beten eine Geduldsprobe für die Kinder... und für die Eltern.
Von Addis aus reisten wir weiter nach Bishoftu, in das Holiday Resort, eine Ferien- und Erholungsstation für Missionare, „Debre Zeit“ (Ölberg). Im amharischen Hochland gibt es viele biblische Ortsnamen. Debre Zeit ist schön gelegen an einem kreisrunden Kratersee. Dieser See ist unheimlich dunkel mit steil abschüssigen Ufern. Er muss sehr tief sein, ohne Ein- oder Ausfluss. Die hölzernen Bungalows der Station liegen zerstreut unter Eukalyptusbäumen. Dauernd gurren Tauben in unveränderlichem Rhythmus.
Kaum waren wir angekommen, wurde uns die letzte Neuigkeit erzählt: Ein Hirtenjunge, der wie jeden Tag die Viehherde eine lehmige Rampe hinunter zum See zur Tränke getrieben hatte, sei ausgeglitten, in den See gefallen und ertrunken. Man hatte seine Leiche noch nicht gefunden. Nach ihrer Sitte fasten die Einheimischen, also auch die Stationsangestellten, bis der Körper des Jungen gefunden werde. Bis dann soll man auch nicht im See schwimmen.
Es war gerade Heiliger Abend. Für die Feriengäste, die Missionare und die weissen Mitarbeiter fand dennoch ein festliches Dinner statt, zubereitet von den hungrigen Einheimischen. Corned Beef aus Büchsen war das Pièce de Résistance dieses Banketts.
In der Nacht darauf begann Tobias heftig seinem Kopf an das Brett der Kopfseite seines Bettchen zu klopfen. Was ist da mit ihm geschehen? Was will er damit sagen? Ich weiss nicht mehr, ob wir den Hilferuf verstanden hatten, das Bübchen gewiegelt und ruhig mit ihm geplaudert hatten. Ich hoffe es, doch leider bin ich nicht sicher.
18.7
In Adi Quala. Nachdem wir einige Zeit in der Stadt Asmara gewohnt hatten, wurde beschlossen, dass wir nach Adi Quala übersiedeln sollen, in der Hoffnung, dass die Verhandlungen über das Grundstück für die ärztliche Missionsstation dadurch günstig beeinflusst würden. Die Leute sollen sehen, welcher Segen es ist, einen Arzt im Dorf zu haben! Eine Art Gehöft von aneinander gebauten Einzimmerhäuschen, umgeben von einer mannshohen Mauer wurde gemietet und instand gestellt, mit einer Wasserleitung ins Badezimmer und die Küche und einer Toilette. Die Zimmerwände wurden neu gekalkt, ein gewaltiges eisernes Tor liess man schmieden. In der Mitte dieses Atriums legten wir einen kleinen Garten an. Alle diese Arbeiten machten wir mit der grossen Hilfe unseres Faktotums Ato Mesginna und einigen Handreichungen von Erich Schaffner ohne Zuzug eines Fachmannes. Statt sich über den vollendeten Umbau zu freuen, war Erich leider wieder einmal verärgert, weil die Kosten nach seiner Ansicht seine Vorstellungen überschritten hätten.
Das fliessende Wasser wurde nach einem vorbestimmten Zeitplan jedem Quartier oder Gehöft von einem Beamten, dem Idraulico zugeteilt. Je nachdem wie viel und wie lange er die entsprechende Rohrleitung geöffnet hatte, bekam der Empfänger mehr oder weniger Liter Wasser für den Tag. Erich verärgerte den Idraulico, denn er versuchte den Wasserpreis zu drücken. Resultat: der Idraulico rächte sich, indem er uns selten mehr als etwa 30 Liter täglich zumass. Das reichte nur sehr knapp für die Wäsche. Unsere beiden Kinder brauchten noch (Stoff-)Windeln. Wir halfen uns so gut es ging mit “Mineralwasser“ aus den Glasflaschen
18.8
Eine Schule
Gleichzeitig mit dem Aufbaueines Ambulatoriums stellten sich Hindernisse entgegen. So beschloss man eine Schule zu gründen, denn es gab in Adi Quala bisher keine Grundschule. Ein Gebäude wurde gemietet, die Wände gekalkt, einfache Schülerpulte und –Stühle entworfen und bestellt. Die Wandtafeln bastelten wir selber aus Pavatex und schwarzgrüner Spezialfarbe.
Lehrer wurden angestellt, junge Männer aus der Umgebung, die über die Grundschule hinaus einen höheren Schulabschluss hatten. Dann kam die Auswahl der Kinder für die erste Primarschulklasse. Altersangaben waren natürlich keine zu erhalten, so brauchten wir einen traditionellen Schuleignungstest: Wenn das Kind mit einem Arm über den Kopf hinweg das gegenseitige Ohr erlangen konnte, wurde es aufgenommen. Da kamen Väter und spornten ihre Kinder an, sich Mühe zu geben, den Arm hochzuziehen, um der Prüfung zu genügen.
Für die Einweihung wählte Gretli eigenmächtig als Datum einen der vielen Fastentage des koptischen Kirchenkalenders. “Damit ersparen wir uns die Verköstigung der Gäste“ war Gretli Schaffners Sparlogik. Trotzdem gab es eine offizielle Feier mit Ansprachen des Gemeindepräsidenten und des Provinzgouverneurs.
Nach der Eröffnung nahm uns Erich Schaffner einmal mehr ins Gebet. Er machte uns heftige Vorwürfe: Wir hätten für die Einrichtung dieser Schule viel zu viel Geld ausgegeben. Während der Planung und der Ausführung hatte er sich jedocch zum Finanzplan nie geäussert, sodass uns diese Schelte wie Blitze aus heiterem Himmel traf. Schaffners hatten auch kein Budget aufgestellt, was ihre Pflicht gewesen wäre. Um welchen Betrag wir die zur Verfügung stehenden Mittel überzogen hätten, sagte er uns nicht. Diesmal schmerzten uns diese Rüge noch mehr, denn wir hatten die Illusion mit der Gründung dieser Schule nun doch wenigsten einen winzigen Beitrag zur Entwicklung des Dorfes beigetragen zu haben.
So hatten wir eigentlich unseren humanitären und christlichen Auftrag verstanden.
18.9
Das Ambulatorium. Was eine umfangreiche missionsmedizinische Station hätte werden sollen, war vorläufig ein kleiner Raum für die Konsultationen, Untersuchungen und die ersten kleinen Operationen, daneben ein Schuppen, für den wuchtigen Dampfsterilisator, die Apotheke und das Instrumentarium.
Am Eröffnungstag gab es schon eine kleine Warteschlange von Patienten und deren Angehörigen. Da drängte sich mit einem Mal ein älterer, beleibter Herr nach vorn. Leibesfülle ist in diesem Land eine seltene Erscheinung und erregt eine gewisse Ehrfurcht. Deshalb überliess man den Herrn ohne zu murren den vordersten Platz in der Reihe. Er stellte sich vor als Dedschasmatsch Haile, dem Inhaber des höchsten Adelstitels im Dorf. Er beanspruchte für sich die Ehre, als Erster untersucht und behandelt zu werden, also das Dossier Nummer Eins zu bekommen. Er hatte, wie zu erwarten, einen zu hohen Blutdruck.
Unter den wenigen Patienten, die sich uns in den folgenden Tagen schon anzuvertrauen wagten, brachte ein Vater sein etwa neunjähriges Töchterlein. Es hatte ein golfballgrosses Lipom mitten auf der Stirne, keine bösartige aber schwer entstellende Geschwulst. Zur Entfernung brauchte ich eine leichte Narkose, damals noch mit der traditionellen Äthermaske. Alles ging gut. Zum Einschläfern brauchte es in kleines Fläschchen, also 50 ml Äther. Gretli machte mir nachher den Vorwurf, ein solches Fläschchen Äther koste neunzig Rappen. Das Kind für soviel Geld zu behandeln sei unverantwortlich. Mit meinen Behandlungsmethoden verschleudere ich das Geld der Mission! Zu ergänzen ist, dass unsere Patienten ihre Behandlungen bezahlen mussten. (Kurz nachdem unser Ambulatorium eingerichtet war entstand schräg gegenüber der Strasse eine staatliche Behandlungsstation, wo die Leute gratis behandelt wurden.)
Die Patienten der “Swiss Mission“ mussten auch, zusammen mit ihren Angehörigen, die biblische Geschichte vom verlorenen Schaf anhören, bevor sie zugelassen wurden. Erich Schaffner spielte diesen kurzen biblischen Text in der Landessprache Tigrinya ab von einer kleinen Grammophonplatte auf einem primitiven mechanischen Apparat mit Handaufzug. So wurde der von der Missionsleitung nie ausformulierte, doch stillschweigend von Schaffners vorausgesetzte Auftrag zur Verkündigung des Evangeliums erfüllt. Die Zuhörer, welche damit bekehrt werden sollten, waren allermeist Angehörige der äthiopischen Koptischen, also christlichen, wenn auch etwas altertümlichen Kirche. Einige von unseren Lehrern waren Mitglieder der evangelischen Kirchgemeinde, der eine grosse Kirche in Asmara gehört. Dann gab es auch einige Muslime aus dem Jemen, die meistens kleine Ladengeschäfte führten. Ich hatte nie richtig begriffen, wer denn da von uns noch missioniert werden soll. Sollen gemäss dem alten Namen “Mohamedanermission“ tatsächlich Muslime zum Christentum bekehrt werden? Mein Kleinglaube verbietet mir, das für sinnvoll zu halten, ganz sicher nicht mit einem Bibeltext ab Grammophon (und Wunder sind per definitionem sehr selten). Doch die gesundheitliche und soziale Misere lastet in diesem Land schwerer noch als in anderen afrikanischen Staaten. Schulen und ärztliche Hilfe und Bekämpfung der Hungersnöte waren, und sind noch jetzt, dringend nötig. Ohne energischen Einsatz gegen diese Nöte machen meines Erachtens Missionen ihr Christentum unglaubwürdig. Für die Christianisierung im Hochland von Eritrea und Äthiopien braucht es meines Erachtens keine Ausländer mehr.
18.10
Missionen. Es gab in Asmara einen schwedischen Pastor mit seiner Frau, die für die evangelische Kirche zuständig waren. Im Tiefland wirkte der Pfarrer Berglund, auch ein evangelischer Schwede, der sich um die eigenartigen noch animistischen Stämme dieser Gegend kümmerte. Er erzählte uns unglaubliche Geschichten von Besessenheit durch den Geist verstorbener Stammesgenossen. Er schien mehr anthropologisches als missionarisches Interesse zu haben.
In Asmara steht das “Headquarter“ des Red Sea Mission Teams, dessen “Leader“ es mit fanatischem Elan auf die muslimische Bevölkerung abgesehen hatte, die Völker an der Küste des Roten Meeres, die Somali, die Danakil und die Jemeniten. Zum Volk der Danakil, einem urtümlichen Nomadenvolk, das in der heissen, hundert und mehr Meter unter dem Meerespiegel liegenden Wüste lebt, hatte der “Leader“, Dr.Gurney, zwei Missionarinnen geschickt. Bald ging das Gerücht um, die eine von ihnen sei dort geschwängert worden. In Eritrea waren auch einige Missionare der “Middle East General Mission“ in verschiedenen abgelegenen Dörfern des Landes stationiert.
18.11
Die politische Situation. Die Leute der S.E.N.M. schienen davon nichts geahnt zu haben, obschon es damals schon deutliche Zeichen dafür gab, dass in Eritrea eine Untergrundorganisation tätig war, “Schifta“ genannt, welche die Sicherheit der Leute bedrohte.
Sie galten zunächst als gemeine Strassenräuber, welche vor allem die Strasse von Asmara in den Süden belagerten, die Strasse nach Adi Ugri und Adi Quala. Geschichten von Überfällen harmloser Zivilisten zirkulierten in Asmara. Die Schiftas interessierten sich jedoch mehr für das Kapern von Grossautomobilen als für einfachen Geldraub. Dann spezialisierten sie sich auf Waffenraub aus den im Land verstreuten Polizeistationen.
Man erzählte fast belustigt, dass einmal das Gerücht in Umlauf gebracht wurde, zu einem bekannt gemachten Datum eine bestimmte dieser Polizeistationen des Landes zu überfallen, um Waffen zu erbeuten. Das Polizeikommando zog deshalb Leute aus benachbarten Polizeistationen an den bedrohten Ort. Zur angegebenen Zeit passierte aber den Gewarnten nichts. Dafür wurden in benachbarten Stationen, wo es nach Abzug fast der ganzen Garnison nur noch ein par wenige Leute zur Bewachung gab, alle dort aufbewahrten Waffen ausgeräumt. Wozu Autobusse und Waffen dienten, wurde später klar. Es war die Vorbereitung zum Unabhängigkeitskrieg gegen Äthiopien, der Auftakt zu einem jahrelangen grausamen Befreiungskrieg, der mit der Unabhängigkeit von Eritrea endete, aber leider nicht mit dem Frieden mit Äthiopien und mit einer miserablen Vesorgungslage und einer autokratischen Diktatur.
18.12
Zur Geschichte. Äthiopien hatte nach dem 2.Weltkrieg über die frühere italienische Kolonie Eritrea das Protektorat übernommen und sich später als eigene Provinz einverleibt. Die Amharen im südlichen und die Tigriner im nördlichen Bergland sind die über die Stämme des Tieflandes dominierenden Völker. Die Menschen der zwei rivalisierenden Hochlandbewohner sind sich in vieler Hinsicht ähnlich. Die Menschen sind gross gewachsen, schlank, haben im Gegensatz zum Bantu-Afrikaner eine schmale Nase und eine café-au-lait Hautfarbe. Sie haben ihre eigene Rassentheorie: Sich selbst nennen sie “die Weissen*, die etwas dunkler Pigmentierten “die Roten“ und die ganz dunklen, angeblich Nachkommen von Sklaven, “die Schwarzen“. Beide Völker gehören einem besonderen Zweig der koptischen Kirche an und sind im Vergleich zu den Tieflandstämmen was man kultiviert nennen kann, denn sie haben eine eigene Schrift und eine bewusste eigene Geschichte. Das Königreich Axum in der heutigen Provinz “Tigré“ pflegte schon früh Handelsbeziehungen zu Griechenland, Arabien und Rom. Unter einem der Könige von Axum, Ezana, wurde im vierten Jahrhundert das Christentum Staatsreligion, noch vor dem römischen Kaiserreich.
Für den Ursprung des altäthiopischen Königtums, und seine Verbindung mit Israel zur Zeit des Königs der Israeliten, Salomo, gibt es die “Königssage“. Historisch ist die Verwandtschaft der äthiopisch-koptischen Kirche mit der alten hebräischen Religion wie auch die Anwesenheit des Stammes der Felascha in der Gegend von Gondar und im Dorf “Beth Israel“. Sie gehören einer alten Form der jüdischen Religion an. Sie wurden vor einigen Jahren von Israel als Juden anerkannt und bekamen Anrecht auf die israelische Staatsbürgerschaft und damit das Wohnrecht im Staat Israel. Eine grosse Zahl der Felaschas sind seither in Israel aufgenommen worden.
Hier also die Königssage:
According to Ethiopian traditional history the Queen of Sheba learned about the wisdom of King Solomon from a merchant called Tamrin, how he worshiped God and his skills building a great Temple in Jerusalem. The Queen of Sheba decided to visit and see for herself King Solomon's wisdom, how he worshiped God and his many skills. When the Queen of Sheba visited King Solomon in Jerusalem she gave him many gifts and she asked him many questions, which he was able to answer. Whilst she was with him, King Solomon made Queen Sheba promise not to take anything from his house. King Solomon went to bed one night on one side of the chamber and Queen Sheba went to bed at the other side of the chamber. Before King Solomon slept, he placed a bowl of water near Queen Sheba's chamber. As she was thirsty, Queen Sheba woke up at the middle of the night and found the water, which she drank. At this point Solomon heard noises, woke up and found her drinking the water. He accused her of having broken her oath not to take anything from his house. Nevertheless the beauty of Queen Sheba attracted King Solomon and the relationship between King Solomon and Queen Sheba was consummated, resulting in the birth of a son named Ibn-al-Malik (known as Menelik), the founder of Ethiopian Solomonic Dynasty.
18.13
Axum in der Provinz Tigré war vor etwa zweitausend Jahren die Hauptstadt eines grossen Reiches. Heute fühlt man sich im Zentrum dieser sonderbaren Siedlung wirklich um soviel Jahre zurückversetzt. Da stehen noch einige der aus Basalt gehauene, etwa 20 Meter hohen Stelen, einige sind oder wurden absichtlich umgestürzt und liegen als Fragmente im Gelände herum. Die reliefartige Verzierung dieser Stelen gibt genau die architektonische Struktur der Hochhäuser wieder, wie man sie jetzt noch in der Stadt Sana’a im Yemen sehen kann mit den Querschnitten der Rundbalken und den kleinen, in horizontalen Reihen angeordneten Fenstern.
Dann fällt dem Besucher das ununterbrochene eintönige Rezitieren jugendlicher Stimmen auf. Dann sieht man die Erklärung für diese Sprechchöre. Unter einem alten Baum sitzen am Erdboden oder auf Steinen etwa dreissig weiss gekleidete Knaben, die um einen ebenso weiss gekleideten Lehrer, einem “Deptera“, laut lesen. Sie lernen so gemeinsam einen religiösen Text auswendig, in der alten Kirchensprache Geez. Hie und da schlägt der Lehrer ohne sich von seinem Sitz zu erheben mit einem Stab einem Schüler auf den Kopf. Vielleicht wird so ein Schüler bestraft, wenn er zu langsam oder falsch spricht. Es ist eines der Priesterseminare von Axum, diesem religiösen Hauptort der äthiopischen Kopten. Im Zentrum steht die massive gedrungene Gestalt der Kirche der “Maria von Zion“. Frauen ist der Eintritt in dieses düstere Heiligtum verboten. (In der neuen, vom Kaiserpaar 1950 gestifteten Kirche “Maria von Zion“ haben auch Frauen Zutritt, vielleicht das Zeichen eines gewissen Fortschritts.) Vor dem Portal der alten Kirche steht ein regelmässig kubisch behauener Steinblock, der als Thron des Königs Ezana gilt. Etwas seitlich dem Eingang der Kirche steht ein von einem Eisengitter umzäuntes kleines Gebäude. Ein freundlicher Kirchendiener schliesst das Tor auf, sodass das Innere des Gebäudes sichtbar wird: Da stehen auf primitiven Holzgestellen viele goldschimmernde Kronen. Eine der Kronen nach der anderen nimmt er heraus ins Sonnenlicht, legt sie auf einen Brettertisch und erklärt uns welchem König oder Kaiser sie gehört hatte. Dabei lernte ich, dass es im alten Äthiopien viele kleinere Königreiche gab und weswegen der Kaiser sich „Negus Negast“, König der Könige titulieren liess. Sogar die Ehrfurcht gebietende Krone des Königs Ezana, tausendsechshundert Jahre alt, konnten wir hier unter freiem Himmel ansehen, bis zur Krone, die der gegenwärtige Kaiser Haile Selassie bei seiner Krönung getragen haben soll. Aus der Distanz erschienen diese heiligen Kopfbedeckungen wie aus ziemlich billigem vergoldetem Blech zu bestehen, mit Glas als Edelsteinen. Ob sie echt waren oder billige Repliken, sie scheinen an diesem heiligen Ort wie Reliquien verehrt zu werden
18.14
Das religiöse Leben und die Kirche in Äthiopien. In Adii Quala steht eine der vielen im ursprünglichen Stil gebaute Kirchen. Ich konnte sie einmal besuchen und fand den typischen Aufbau, der den Beschreibungen des salomonischen Tempels in Jesusalem ähnlich ist: Beim Eintreten befindet man sich im ersten Vorhof, der allen Besuchern offen steht, Allerdings müssen Frauen einen besonderen Eingang benützen. Sie gelangen so vor die Aussenwand des Vorhofs, die gegenüber dem Fraueneingang mit einer blauen Teufelsfratze bemalt ist. Damit wolle man den Frauen Ehrfurcht einflössen. Nach dem zweiten oder je nach der Grösse der Kirche, nach dem dritten Vorhof, der heilige Raum, der „Qedus. Im Zentrum der Kreises, im Innersten der Kirche, dem Allerheiligsten, dem Qedus Qedusan befindet sich ein Schrein, welcher der Bundeslade im jüdischen Tempel entspricht. Darin befinden sich (unbeschriebene) Repliken der Gesetzestafeln der Hebräer, die “Talbot“. Sie geben einem besonderen kirchlichen Feiertag den Namen. Es soll in keinem christlichen Land so viele kirchliche Feiertage, Fastentage und Priester geben wie in Äthiopien.
Ein besonders farbenprächtiges Kirchenfest ist “Masqal“, das Fest der Auffindung des wahren Kreuzes durch die heilige Helena, der Kaiserin von Byzanz. Im Hintergrund des Festgeländes ragen steil einige ockerfarbige, mehrere hundert Meter hohe Felskuppen aus der versteppten Hochebene. Auf freiem Feld flackert Feuer um ein hohes Holzbündel, welches das Kreuz symbolisieren soll. Auf farbenfrohen Schabracken traben die weiss gewandeten Reiter um das Feuer, ähnlich wie beim Sechseläuten in Zürich. Dasjenige Dorf, in dessen Richtung sich das angebrannte Holzbündel schliesslich neigt, dorthin wendet sich in diesem Jahr ein besonderer Segen Gottes. Um den bewegten Kreis der Reiter drängt sich das Volk der weissgekleideten Zuschauer. Die meisten tragen buntfarbige Sonnenschirme. Das alles gibt unter dem tiefblauen Himmel ein wunderschönes Bild. In Eritrea und in Äthiopien tragen Frauen und Männer Kleider aus dem gleichen weissen Baumwollstoff, dem “Abu Dschadid“, der “Vater der Neuigkeit“ genannt wird. Als Unterkleider aus demselben Stoff tragen die Männer Hosen, die Frauen Röcke und darüber eine Toga, die bei den Reichen an einer Seite mit einer bunt gewobenen Borde verziert ist. Zusammen mit ihrer eleganten Gangart gibt das den Leuten ein sehr würdevolles und geradezu antikes Aussehen.
16.15
Senate. Die Strasse nach Senafe führt von Adi Quala aus nach Südosten und senkt sich in engen Kurven ins Tiefland. In diesem Dorf lebte eine amerikanische Missionarsfamilie namens Mehafi. Herr M. war daran, die Bibel auf Somali zu übersetzen. Da Senafe an den Pfaden der nomadisierender Somalivölker liegt, gibt es reichlich Kontakt mir diesen Leuten. Man erkennt sie daran, dass die Frauen grosse halbmondförmige Ohrringe aus Gold tragen. Ihre Hautfarbe ist dunkler als die der Tigriner und Amharen.
Wir waren bei Mehafis zum Uebernachten eingeladen. Vater Mehafi führte den abendlichen Familiengottesdienst ein mit den Worten: „Let’s continue our worship with the song number...“. Die sonderbare Einleitung schien darauf hinzuweisen, dass man eigentlich den ganzen Tag über daran sei oder sein sollte „to worship“ oder dass das gewöhnliche Alltagsleben eigentlich ein Gottesdienst sei. (Hat nicht Paulus im K...-Brief die jungen Christen ermahnt: “Betet allezeit!..“ )
Das Dorf liegt zu Füssen eines kegelförmigen Berges, der aus einem einzigen zerklüfteten Felsen zu bestehen scheint, ein mythischer gespenstischer Ort, wo Einsiedler in derselben Höhle gehaust hatten, die jetzt ihre Grabesgruft ist. Beim Besteigen begegnet man etwa zwölf solchen Klüften, Höhlen oder tiefen Nischen; in manchen liegen noch die Gebeine des einstigen Gott suchenden und anbetenden Asketen. Manchmal stehen am Höhleneingang noch Reste einer kleinen Trockenmauer. Zu ihren Ehren hat man am felsigen Abhang eine kleine Kirche gebaut. Hier muss es einmal ausgesehen haben wie in der Thebaïs, der Felsenwüste in Aegypten, wo in den ersten christlichen Jahrhunderten die Anachoreten hausten.
Noch andere archäologische Spuren gibt es in der Gegend um Senafe.
Dr.Jürg Trüb, der Zürcher Arzt aus Omdurman (Sudan) kam einmal nach Eritrea zum Treffen der Leute der Schweizer Nillandmission, zu einer “Missionskonferenz“. Mit ihm besuchten wir nochmals Senafe. Diesmal bestiegen wir einen anderen Berg der Umgebung. Von dieser Bergkuppe aus konnte man in der Ebene quadratisch angeordnete Steinfundamente einer untergegangenen Stadt erkennen. Ich weiss nicht, aus welcher historischen Zeit diese Siedlung stammte. Vermutlich war zu jener Zeit die Ebene noch grün und fruchtbar, während sie jetzt grau-ockerfarbene Halbwüste ist. Auf der Rückfahrt begegneten wir der in meinem Buch (“L’empire du prêtre Jean“ von Jean Doresse) beschriebenen 6 m hohen Stele von Matara, aus vorchristlichen Zeiten mit einer antiken Inschrift.
18.16
Am 2.Mai 1964 kommt Hanna Barbara zur Welt. Wir haben in Eritrea eine Schule gegründet und ein Dispensarium. Und wir haben eine Tochter bekommen, Hanna-Barbara. Zur Nachbarschaft der Missionswohnung in Asmara gehörte eine Moschee. Fünfmal am Tag ruft der Muezzin das „Allah hu akbar“. An der Kaiser Haile Selassie I-Avenue, rief die römisch-katholische Kirche, ein paar hundert Meter weiter entfernt, näher beim Stadtzentrum, mehrmals am Tag zur Messe. Ihr Glockenspiel erinnert an das feierliche Geläute an den Sonntagen im Tessin. Mit dieser heiligen Begleitmusik ist Hanna Barbara am zweiten Mai 1964 zur Welt gekommen.
In Asmara gab es einen amerikanischen Militärstützpunkt, KANU genannt (wie Käniu ausgesprochen). Sie hüteten wahrscheinlich die in der Umgebung angelegten unterirdischen Raketenabschusssrampen. Ich fragte in ihrem Millitärspital, ob sie Verena aufnehmen würden, im Fall von Komplikationen bei der Entbindung. Nach dieser Zusicherung bereiteten wir uns für die Hausgeburt vor.
Das Instrumentarium für die Geburtshilfe, das ich für das künftige Missionsspital aus der Schweiz mitgebracht hatte, war sterilisiert und in Bereitschaft: Episiotomieschere, Nadeln, und Nadelhalter, Catgut und Lokalanästhetikum für die Naht des allfälligen Dammschnitts, Dolantin und Ocytocin zu Steuern des Geburtsverlaufs. Alle diese Dinge sind auch wirklich zur Anwendung gekommen. Die Geburtszange und den Vakuumextrator brauchten wir glücklicherweise nicht. Sogar eine private erfahrene Hebamme war da, Ruth Trummer aus Adelboden, Krankenschwester und Hebamme. Sie war ein paar Tage vor uns in Eritrea angekommen und wohnte nun mit uns eine zeitlang in Asmara, um wie wir, Tigrinya zu lernen. Später zog sie zu Schaffners nach Adi Quala. Ruth, meine Frau und ich bildeten das erste medizinische “Team“, das die Gründung der ärztlichen Missionsstation zur Aufgabe gehabt hätte.
Wie schon vor der Geburt von Tobias, hatte sich Verena mit den Übungen des ”accouchement sans douleur“ vorbereitet. Damit kann sich die Gebärende entspannen um vorzeitige Presswehen zu lindern. Was mich im Medizinstudium den Vorlesungen von Professor Held gelangweilt hatte, die mehrstündigen Fortsetzungsgeschichte einer einzigen normalen Geburt, konnte ich jetzt gut gebrauchen. Geburtshilfe kam mir vor wie das Landemanövers eines kleinen Flugzeugs auf einer unregelmässigen gebogenen Piste, also faszinierend.
Gelandet ist ein kleines Mädchen. Dass es sogleich schon atmete war an der Luftblase vor dem Näschen und Mäulchen zu erkennen. Es hat aber nur sehr zart geschrieen.
Im Wohnzimmer hatte inzwischen Mebrät, unser Hausmädchen, gewartet und ein paar Frauen, um, wie es Sitte ist, beim Gebären zu helfen. Sie waren erstaunt und enttäuscht, dass das Ereignis, das sie voller Spannung mit zu erleben hofften, sich stillschweigend hinter der Zimmertür abgespielt hatte. Und nicht wie bei ihnen von verschiedenen Arten von Geschrei begleitet, Geschrei der Angst und der Freude und der Litanei der pausenlosen Rezition von Koran- oder Bibelversen oder Beschwörungsformeln. Nun war das schon vorüber, ohne ihre brachiale oder “spirituelle“ Hilfe. Auch hatten sie das zu erwartende Schreien und Stöhnen der Mutter und das ungewöhnlich feine Stimmchen der Hanna-Barbara nicht gehört.
Die Schwester Ruth Trummer nabelt ab und beschäftigte sich mit dem Baby und ich machte die Näharbeit am Damm. Ruth hatte für Verena eine frugale Wöchnerinnendiät vorbereitet, für mich und sich selbst gab es ein kräftigendes Menue. Nach dem Essen versandte ich Telegramme an unsere Eltern. Zwei Tage später kam das Antworttelegramm von Vater Kuhn, in Latein (das kostet weniger Silben), mit dem Text: “avi te salutant“. “Die Vögel grüssen dich“-? Die Lateinerin Verena machte sich lustig über mich Banausen und korrigierte: Vögel heissen aves aber hier steht avi, die Grosseltern.
Einig Zeit später kamen Gretli und Erich von Adi Quala nach Asmara. Gretli frage beiläufig: „Braucht ihr noch etwas für den Säugling.“ Als wir verneinten, war sie sichtlich zufrieden.
Die Rückbesinnung auf die Geburtshilfe bei der Entbindung meiner Tochter Hanna Barbara wirkt heute als ein grosser Trost auf mich alten Mann, eine Tat die mich ein wenig stolz macht, sowenig sie auch etwas Aussordentliches ist. In Moçambique hatte ich später noch Hunderte von Entbindungen begleitet, manche bedeutend kompliziertere.
18.17
Geburtshilfe in der Nachbarschaft:.Wir wohnten schon in Adi Quala, als ich eines Tages zu einer Geburt in der nächsten Nachbarschaft gerufen wurde. Das Heim der Familie bestand ähnlich wie das unsere aus mehreren einräumigen Hütten in der Art eines kleinen Weilers. Nicht in die Wohnhütte wurden wir geführt, sondern in einen Lagerraum, der von einem mächtigen zylindrischen Getreidespeicher eingenommen war. Vor dieser Rundhütte aus Lehm sassen einige Frauen und viele Männer. Sie alle sangen, lamentierten und psalmodierten pausenlos Klagegesänge, Zaubersprüche oder Gebete. Im dunklen Inneren der Hütte konnte ich zunächst nur grosse Stoffhaufen in rhythmischer Bewegung sehen. Es waren die weiten mehrschichtigen Röcke von etwa sechs älteren Frauen die, ebenfalls psalmodierend, auf dem schwangeren Bauch herum drückten. Die Gebärende lag mit blassen Lippen und kaltem Schweiss auf der Stirn auf einem um etwa zwanzig Zentimeter erhöhten Schragen aus gestampfter Erde, der mit ein paar Strohhalmen mehr als spärlich gepolstert war. Man berichtete mir die Geburtswehen dauerten nun schon einen Tag und eine Nacht und vom Kind sei noch immer nichts zu sehen. Niemand verwehrte es mir, die junge Frau zu untersuchen (was mir bei moslemischen Familien nicht selten vorgekommen ist). Der Kopf sass auf dem Beckenboden fest, obschon die Grössenverhältnisse eigentlich für eine Spontangeburt gereicht hätten. Das unsinnige Gequetsche hatte den Uterus so geschädigt, dass er für die Austreibungswehen zu schwach war. Diagnose: Sekundäre Wehenschwäche. Verena holte den Vakuumextraktor aus unseren Hütten. Ich setzte die grösstmögliche Saugglocke an und langsam steigernd wurde diese nun leergepumpt. So entstand ein Vakuum zwischen der Scheitel des Kindes und der Metallglocke so dass sie darauf haftete. Durch sanftes Ziehen am Pumpenschlauch und Hin-und-Herbewegen kann man jetzt das Köpfchen langsam mit dem Hinterkopf voran über die Schwelle der Syamphyse kippen. Kurz vorher versuchte ich noch mit einem Dammschnitt den Ausgang aufzuweiten, vermutete aber, dass es nachher zuaätzlich noch einen grossen Riss zu nähen geben würde. Das Knäblein war nun entbunden und schrie wie es sich gehört. Ich durfte ihm den Namen geben: Ibrahim (Abraham) soll er heissen.
18.18
Verena und die Kinder durften mit dem Flugzeug heimkehren. Verena war seelisch am Ende der Belastbarkeit und Tobias litt an an einer Darminfektioon, verursacht durch Lamblien, einzellige Parasiten ähnlich den Amöben.
Bis das für die Heimreise gebuchte norwegische Frachtschiff in Massaua eintreffen und bis es schliesslich weiterfahren würde, hatte ich mehr als genug Zeit, mich mit Packen und mit der unumgänglichen Menge von bürokratischen Schikanen wie Ausreisevisa und Ausfuhrzoll für unser Gepäck zu beschäftigen.
Ich hatte auch noch Zeit für einen Ausflug ins westliche Tiefland, nach Keren, durch eine eigenartige von verzweigten Palmen bestandene einsame Landschaft.
Aus administrativen Gründen mussten Erich Schaffner und ich zwei Tage in Asmara verbringen. Schaffners hatten als Pied à terre in der Hauptstadt eine primitive Einzimmerwohnung gemietet. Ich musste also mit Erich im selben Zimmer übernachten. Vor dem Zubettgehen begann er mir in seiner monotonen und emotionslosen Stimme endlose Vorwürfe zu machen. Nachdem ich nochmals versucht hatte ihm den gefährlichen Gesundheitszustand von Verena zu erklären, war seine stereotype Antwort einmal mehr: “Das sind halt die Opfer, die man im Weinberg des Herrn bringen muss“. Nach seiner theologischen Ansicht muss man das Kind an einer Krankheit und die Frau am Selbstmord zugrunde gehen lassen, damit der Weinberg gut gedeihen kann. An welchen Moloch von Gott glaubt dieser Mensch!
Während er nicht aufhörte, seine Schelte über mich auszugiessen, begann ich plötzlich und unbeherrschbar am ganzen Körper zu zittern, zu schlottern, wie bei hohem Fieber, als hätte ich einen Anfall von Malaria. Obschon er das hätte wahrnehmen müssen, prasselte er mit seiner gefühllosen Stimme unbeeindruckt weiter. Wie war es möglich, dass jetzt diese Beschimpfung so tief in mich gedrungen war? Ich war dünnhäutig und selbstunsicher geworden. Massive Schuldgefühle packten mich und eine ungeheure Angst vor irgendeiner schicksalshaften, göttlichen Bestrafung. Verena könnte sich etwas antun oder es könnte ihr und den Kindern ein Unglück zustossen, das Flugzeug könnte abstürzen! Diese Angst dauerte während den folgenden Monaten an, bis ich endlich in Solothurn ankam und, wenigstens äusserlich, alles in Ordnung fand. Noch Jahre danach lebte ich unter dem Damoklesschwert, der Angst um Verena.
In Massaua waren unsere Habseligkeiten in das Frachtschiff verladen worden, dessen Abfahrt sich aber um Wochen verzögerte. Ich bewohnte während den letzten Tagen vor der Abreise schon meine Schiffskabine. Der Jahreswechsel von 1964 auf 65 wurde auf dem Schiff gefeiert. Mitternacht verkündeten die Sirenen der im Hafen liegenden Schiffe mit zwölf Stössen der Schiffssirenen.
Vorher noch hatte ich Aufnahme gefunden bei einer Familie des Red Sea Mission Teams. Sie hatten zwei Kinder im Vorschulalter. Bei ihnen wohnte auch ein junger Missionar, ehemaliger Bäcker-Konditor, den ich jeden Morgen laut beten hörte. Er verbrachte viel Zeit mit den zwei Kindern indem er sie Kinderreime lehrte und war begeistert von einem alten Dhau, einem der traditionellen hölzernen Boote, das er wieder flott bringen wollte, um die Küsten des Roten Meeres anzusteuern und dort zu missionieren. Er hatte schon ein altes Velorad als Steuerrad montiert und mit Veloketten mit dem Steuerruder verbunden. Ein antiker Motor war auch schon vorhanden,
Ich verbrachte die Wartezeit im Massaua mit Lernen der Elektrokardiographie. Noch nie und seither nie mehr habe ich mit so eiserner Disziplin gelernt, und dann noch ein so abstraktes und trockenes Fach. Die Angst und die Verzweiflung wurden damit ein wenig erträglicher.
18.19
Nach der Flucht. In der Schweiz musste ich vor dem versammelten Missionskomitee Rechenschaft ablegen. Ich vermied es über das Verhalten unserer Vorgesetzten zu sprechen. (Warum eigentlich?) Es war die ”Erkrankung“ von Verena, die als Argument für unser ”Versagen“ herhalten musste. Wie es in Wahrheit zum Versagen gekommen war, davon sprach ich nicht und niemand fragte danach. Einer der Pfarrerherren machte mir den Vorwurf, wir hätten "auf dem verlorenen Posten ausharren“ sollen. Heldentum war gefordert. Keiner der Herren erwähnte, dass wir in kurzer Zeit und unter widrigen Bedingungen immerhin eine Schule und das medizinische Ambulatorium gegründet hatten. Ich hätte protestieren sollen und ihnen vorwerfen, dass wir Sinnvolles geleistet hatten trotz ihrer miserablen Planung, und dass es ungerecht war, uns als verantwortungslose Geldverbraucher und Feiglinge anzuschuldigen. Aber da auch ich psychisch ausgebrannt war, kam mir solches nicht einmal in den Sinn.
Ich fand eine nicht sehr anstrengende Assistentenstelle in der Mehrzweckheilstätte Barmelweid. Verena litt noch jahrelang an Depression. Ich hatte noch jahrelang Angst um sie. Wir hatten beide Bauchbeschwerden, die sich später als Amöbeninfektion erwies, und Tobias hatte eine schwere Lamblieninfektion.
T

7. FEBRUAR: GEBURT VON DOMINIK
19.1
Januar 1965: Wieder in der Schweiz Das norwegische Frachtschiff blieb einige Tage in Suez, um eine Ladung Datteln zu löschen. In Palermo angekommen hiess es, das Schiff, werde für eine Unterhaltsarbeit während einer unbekannten Dauer in einem Dock bleiben. Da verlor ich die Geduld. Ich gelangte mit einer Fähre von Palermo nach Neapel, um von dort mit der Eisenbahn in die Schweiz zu kommen. Ausser meinem Koffer trug ich auf der ganzen Heimreise das Gestell für den Kinderwagen mit.
Nach dieser langen Reise kam ich endlich in Solothurn an.
Verena wohnte in den Zimmern im Untergeschoss des Elternhauses. Ich stieg die Treppe hinunter. Verena Kam mir entgegen. Sie trug ein wollenes Kleid mit grünem Muster, das sich ihrem schlanken Körper anschmiegte. Nach der langen Trennung und meine Ängste um sie, erschien sie mir unendlich schön und anziehend. Ohne Worte musste ich sie innig umarmen.
19.2
Von der Barmelweid nach Oetwil am See. Wie soll unser Leben jetzt weitergehen? Ich brauchte bald wieder eine Stelle als Assistenzarzt. Das frühere Lungensanatorium des Kantons Aargau, die Barmelweid, war jetzt “Mehrzweckheilstätte“. Der Chefarzt, Dr.Max Buser, kannte Hans Bernath. Damit war schon eine gewisse Gesinnungsaähnlichkeit gegeben. Ausserden pflegte Dr.Buser die psychosomatische Medizin mit dem Hintergrund der Daseinsanalyse und des Autogenen Trainings. Er ermutigte seine Assistenten, mit den Patienten therapeutische Gespräche zu führen. Das weckte mein Interesse an der Psychologie und gab mir Gelegenheit für erste Gehversuche in Psychotherapie. Ich wurde also Assistenzarzt in der Barmelweid, womit auch für die ganze Familie eine Wohnung zur Verfügung stand.
Von den zweieinhalb Jahre Barmelweid wurde mir ein Teil für den Erwerb des FMH-Titels für innere Medizin angerechnet. Obschon die Arbeit nicht streng war, gab es doch auch nächtliche Notfallinterventionen. Ein etwas älterer Kollege. Dr.F., der wegen seinem Herzinfarkt für seine Erholungszeit die weniger stressbelaste Stelle auf der Barmelweid angenommen hatte, verfügte über Erfahrung in Neuraltherapie. Dazu gehört die Kenntnis der Dermatome, der Repräsantion innerer Organe auf bestimmten Hautregionen, was durch die embryonale Entwicklung zu erklären ist. Dazu machte ich eine eigentümliche Erfahrung. Eine herzkranke Patientin erlitt jeden Abend ein Lungenödem. Bisher hatte man diesen bedrohlichen Zustand jeden Abend mit den damals üblichen Injektionen eines herzstimulierenden Medikamentes bekämpft. Anstatt sogleich diese nicht harmlose Droge zu injizieren, wagte ich es, der Frau im Bereich des Dermatoms des Herzens unter die Haut das in der Neuraltherapie verwendeten Lidocaïn einzuspritzen. Das Ergebnis war erstaunlich: in wenigen Minuten waren das typische Karcheln und die Atemnot behoben. Dr.Buser, dem ich das berichtete, war damit einverstanden, diese Frau weiterhin auf diese weniger toxische Art zu retten.
19.3
Aus dieser Zeit auf der Barmelweid sind noch zwei kleine Familiengeschichten zu erzählen.
Am Neujahrstag räumten wir unseren Weihnachtsbaum ab und warfen das Tännchen zum Brennholz des Spitals. Unser Tobias aber trauerte dem verschwundenen Christbaum und seinem Schmuck laut weinend nach. Wie konnten wir ihn trösten? Wir wussten nichts Besseres als nur halb gläubig um einen neuen Weihnachtsbaum zu beten. Und siehe da! unser Unglaube wurde erhört, denn auf dem nächsten Spaziergang im nahen Wald begegneten wir einer gefällten Rottanne, deren Spitze dem vermissten Weihnachtsbaum glich. Ich wagte den kleinen Diebstahl, sägte die Spitze ab und nahm sie nach Hause. Dort behängten wir sie erneut mit den Kugeln und besteckten sie mit Kerzen, so dass der neue wie der verschwundene Christbaum nochmals aufleuchtete.
Die zweite Geschichte: Wir lebten schon in Oetwil. Es war an Ostern. Wir machten mit allen drei Kindern einen Spaziergang im nahen Wald. Da sprang vor unseren Augen ein Hase über den Weg. Einig Schritte weiter, wo der Hase den Weg überquert hatte, lag ein farbiges Osterei! Wenn das nicht der Beweis dafür ist, dass der Osterhase die Eier bringt, vorausgesetzt, dass er sie vor lauter Eile nicht verloren hat.
Auf der Barmelweid konnte ich endlich an eine Doktorarbeit denken. Manchmal kamen aus Zürich Dr.Sprenger, der Chirurg und Dr.Zimmermann, der Anästhesist um Operationen an der Lunge durchzuführen. Zu diagnostischen Zwecken entnahm der Chirurg manchmal einige der über dem Schlüsselbein liegenden Lamphknoten, die dann vom Pathologen, meistens von Prof.Rüttner in Zürich, untersucht wurden. Mit Rüttner als “Doktorvater“ konnte ich dann mit zweihundert Fällen eine Statistik erstellen. Es entstand eine Dissertation mit dem Titel: "Der diagnostische Wert der supraclaviculären Lymphknotenbiosie nach Daniels".
19.4
Eine neue Arbeitsstelle: im Neumünsterspital. Nach den zweieinhalb Jahren in der Klinik Barmelweid bekam ich dank dem sehr wohlwollenden Zeugnis von Dr.Buser ohne Wartezeit eine Assistenzstelle auf der Abteilung für innere Medizin im Spital Neumünster. Da ich schon über eine gewisse Erfahrung in innerer Medizin mitbrachte, meinte man, ich würde an Stelle des austretenden Oberarztes Dr.Walter Zollinger die Oberarztstelle bekommen. Der Chef, Dr.Zollikofer, ernannte aber den dienstältesten Assistenten, Dr.Max Signer zum Oberarzt. Im Hinblick auf Verena war ich nicht besonders frustriert, denn als Oberarzt schlief man zwar bei sich zu Hause, war aber jede zweite Nacht auf Pikett, musste also je nach der Selbständigkeit des diensttuendenn Assistenzarztes in schwierigen Fällen telefonisch oder persönlich eingreifen. Aus dem gleichen Grund wagte ich nicht, ein sehr verlockendes Angebot anzunehmen: Professor Koller, Chef der Medizinischen Universitätsklinik Basel, suchte einen Oberarzt. Dr. Zollikofer hatte mich ihm empfohlen.
Der Oberarzt und ich führten in der Kardiologie Neuerungen ein: Den Kardioverter zur Behandlung des Herzkammerflimmerns und das intrakardiale Elektrokardiogramm.
Von der Barmelweid her hatte ich Erfahrung in der Behandlung des Pleurempyems. So erlaubte mir der Chirurg am Neumünsteerspital bei einem Patienten die Plauradrainage durchzuführen. Ich hatte zusammen mit Prof.Brunner, der im Gegensatz zum emeritierten Ordinarius für Chirurgie “Mikrobrunner“ ganannt wurde, über die Besonderheiten einiger Fälle von Pleuraempyem mit Streptococcus viridans eine kleine Arbeit verfasst und an einem Kongress vorgetragen.
19.5
An 7.Februar 1969 kam im Soital Bethanien in Zürich unser zweiter Sohn, Dominik, zur Welt.
Der Geburtshelfer war Dr.Martin Meyer, ein Kamerad von mir aus der Primarschule und dem Medizinstudium. Es war für Verena (und mich) die leichteste der Geburten von unseren drei Kindern. Verena hatte ein schönes Zimmer mit Aussicht über die Stadt. Dieses Mal gab es auch keine überaktive Hilfe der Grossmutter. Wie es damals noch üblich war unter ärztlichen Kollegen, machte Martin Meyer für seinen nächtlichen Einsatz keine Rechnung. Seine Mutter empfahl mir als Geschenk für ihn eine Flasche zwölfjährifen Balantine Whisky. (Was michein wenig verwunderte. Ob Hochprozentiges für Martin ein sinnvolles Geschenk ist?)
Zu dieser Zeit war er mit der Gynäkologin Frau Dr.med.Heilemann verheiratet, einer liebenswürdigen, mütterlichen Frau und erwartete sein erstes Kind. Ganz ernsthaft und naïv fragte er, ob er uns, falls es ein Sohn würde, ihn auch Dominik nennen dürfe.

20.1
Neuer Arbeitgeber: Hoffmann LaRoche. Wahrscheinlich hatte mich der immer hilfsbereite Tropenarzt Dr. Hans E. Meyer auf Dr,, später Prof. Michel Fernex gewiesen. Dr.F. bearbeitete bei Roche in Basel die Entwicklung von Medikamenten, die vor allem und auch für tropische Gebiete brauchbar und notwendig waren.
Dr. Hadi Wolfensberger war zu der Zeit noch Forschungsbeauftragter unter der Leitung von Dr.Fernex im Schweizer Missionsspital Chicumbane in Moçambique beschäftigt, unter Anderem mit der Wirkung des damals neuen Malariamittels Fansidar. Sein Vertrag war abgelaufen, ich sollte sein Nachfolger werden.
Vorher aber hatte ich an meiner Arbeitsstelle im Spital Neumünster einige Untersuchungen durchzuführen. Damit sollte ich vermutlich meine Fähigkeit für solche Forschung unter Beweis stellen. Um jene Zeit waren vier Patienten im Spital Neumünster, die sich in Marokko mit Paratyphus infiziert hatten. An ihnen konnte ich die Wirksamkeit und Sicherheit des neuen Cotrimoxazol (Bactrim) von Roche unter Beweis stellen.
Da gab es eine die neue galenische Form eines anderen Medikamentes gegen intestinale Infektionen. Der Wirkstoff befand sich in einer Matrix, welche dessen verlangsamte Auflösung, Resorption und damit verlängerte Wirkungsdauer bewirkte. Nun sollten einige Patienten dieses Medikament erhalten (nicht ohne dass es indiziert gewesen wäre) und die armen Pflegerinnen mussten aus dem Stuhl dieser Patienten die Pillenreste herausfischen. Das Labor Bei Roche in Basel konnte dann feststellen, wie viel vom Wirkstoff tatsächlich herausgelöst worden war. Für diese stinkende Extraarbeit bekamen die Abteilungsschwestern eine (zu) kleine Belohnung.
Meine Fähigkeit für solche Forschungsarbeit hatte die Roche-Leute anscheinend befriedigt. Dann wurde ich nach Basel zu einer Unterredung eingeladen.
20.2
Zwei Tage nachdem ich zum dritten Mal Vater geworden war, wurde ich zu einer Besprechung mit Dr.Fernex und seinem Mitarbeiter, Dr.Havas, nach Basel eingeladen. Wir besprachen das Administrative, die Reise, den Lohn, und die von Hadi Wolfensberger durchgeführten Untersuchungen. Auf meine Frage, was ich denn nun eigentlich zu tun hätte in Chicumbane, konnte mir Dr.Fernex keine genaue Auskunft geben. Während den zweieinhalb Jahren waren die meisten Fernex-Aufträge weiterhin verschwommen, sodass ich die meisten Forschungsprojekte selber entwickeln musste, in der Annahme dass Roche ein Interesse daran hatte, z.B. die Vergleich der traditionellen Behandlung des abdominalen Typhus mit Chloramphenicol, dem von Roche eben neu produzierten Cotrimoxazol (Bactrim). Im Übrigen, meinte Dr.Fernex, werde mich Hadi Wolfensberger einführen. Als ich schliesslich in Lourenço Marques von ihm die versprochenen Instruktionen erwartete, wusste auch er nicht, was ich untersuchen sollte. So führte ich denn seine Vergleichsstudie des Standardmittels Chloroquin zur Behandlung der tropischen Malaria mit dem neuen Medikament Fansidar weiter.
Die Sitzung mit Dr.F. und Dr.H. wurde in einem feinen Restaurant am Rheinufer fortgesetzt. Schon im Laufe des Morgens, im Zug von Zürich nach Basel hatte ich mich schlecht gefühlt. Schliesslich wurde mit so übel, dass ich das Essen nicht anrühren konnte. Schwitzend kämpfte gegen das drohende Erbrechen und den Kollapsl. Ich erklärte den beiden Kollegen, dass ich vor zwei Tagen zum dritten Mal Vater geworden sei und fand viel Verständnis dafür, dass Vater zu werden keine harmlose Sache sei.
20.3
Wir hatten des schöne Häuschen in Oetwil am See aufgegeben und als piet à terre, ein Bauernhaus mit niedrigem Zins in Auslikon gemietet. Dort konnten wir unsere Möbel belassen und da wohnten wir noch bis zur Ausreise nach Moçambique. Tobias ging in Hittnau zur Schule. Als frisch zugezogener “Fremder“ wurde er von den Schulkameraden gequält. Ich weiss nicht mehr, ob Verena deswegen bei der Lehrerin vorstellig geworden war.
Zu einer Familien- zusammenkunft hatte ich einmal meine Eltern und die drei Tanten (cf.“Trinité“) eingeladen um ihnen unser drittes Kind vorzustellen. Zugleich war es der Abschied vor der nächsten Afrikareise.
Da ging der neugeborene Dominik, der ja noch nie so viele Leute erlebt hatte, von Hand zu Hand von Tante zu Tante, von Küsschen zu Küsschen und natürlich besonders zu meiner Mutter. Am Abend war er in einem so sonderbar aufgeregten Zustand, dass ich ihm nicht anders zu helfen wusste, als mit einem kleinen Bruchstück von Valium.
20.4
Die Reise nach Moçambique. An die Einzelheiten unserer Reisevorbereitungen kann ich mich nicht mehr erinnern. Nur noch dass wir uns einige hermetisch verschliessbare Plastictonnen verschafften.
Südafrika und Moçambique wurden von den meisten afrikanischen Staaten als Feindesland angesehen. Südafrika wegen der Apartheid und Moçambique als portugiesische Provinz, wo zu dieser Zeit Krieg herrschte, denn die Frente Para a Libertaçâo de Moçambique (FRELIMO) war daran, das Land vom Norden her zu “befreien“. Unsere Flugstrecke führte uns von Zürich nach Nairobi, von da nach Entebbe in Uganda, dann nach Johannesburg. In J. ging es weiter mit der Moçambique-eigenen Fluglinie nach Lourenço Marques, (Nachdem die Portugiesen das Land verlassen hatten, wurde die Hauptstadt “Maputo“genannt.)
20.5
In Uganda konnten wir ein paar Tage verweilen. Eine uns aus der Studentenbibelgruppe Bekannte lebte in Kampala. Sie war mit einem englischen Missionar verheiratet. Erste Eindrücke vom tropischen Afrika empfingen wir am Viktoriasee, bei einem Picnic in einem kleinen Stück Urwald, wo Affen von Ast zu Ast hüpften von wunderschönen Tukanen mit riesigen farbigen Doppelschnäbeln geduldig beobachtet. Auf der Fahrt vom Flugplatz in Entebbe nach Kampale kamen wir an einigen Marktständen von Medizinmännern und Zauberern vorbei, die sich am Strassenrand niedergelassen hatten. Sie sind am weissen Anstrich aller ihrer Utensilien, Töpfen, Knochen, trockenen Tierkadavern, gefiederten Stäben, Fahnen und flatternden Bändern schon von weitem zu erkennen. Ich hätte einen solchen Medizinmann gerne besucht. Aber unsere gläubigen Freunde warnten uns vor dem diabolischen Geist, der sich von diesen Hexerichen auf uns übertragen könnte und steuerten rasch daran vorbei. Was könnte und dieser Hokuspokus schaden? Ich hatte ein rein ethnologisches Interesse und stand geneu so wenig in Gefahr wie unsere Freunde. Später bin ich bei frommen Chrissten diesem Aberglauben mehrmals wieder begegnet, in Verbindung mit einer ernsthaften Angst vor „dämonischen Mächten“, die nicht nur von so „besessenen Menschen“, sondern sogar von Gegenständen aus ihrer Umgebung ausgehend die christlich gläubige Seele schädigen könnten. Hier scheint noch eine untergründige heidnische Angst ihren Spuk zu treiben. Und ein Mangel an Verständnis der deutlichen Aussagen über die Freiheit des Christen in den Evangelien und in den Briefen des Paulus (z.B. die Diskussion über die Erlaubnis, Fleisch von Tieren zu essen, die einer Gottheit geopfert worden waren).
Ausflug an die Murchison Falls mit den Krokodilen.
In einem kleinen Flugzeug, (wenn ich mich recht erinnere war es eine “Havyland“), überflogen wir das grüne, fruchtbare Uganda. Kleine Siedlungen aus den einfachen Häuschen oder Hütten aus Bambusstäben, die Dächer mit Palmblättern bedeckt, drum herum unregelmässig angelegte Gemüse-gärten. Bananenen- und Papajabäume. Aus der Luft wirkt das Land wie ein Paradies. Jedesmal wenn wieder von einer Regierkungskrise in Uganda die Rede war und besonders als der schreckliche Idi Amin das Land ruinierte, dachte ich an diese Vogelschau aufs Paradies und das endliche erreichte Lebensziel des Candide bei Voltaire: “cultiver son Jardin“. Und immer wieder muss dieses einfache Glück zerstört werden von irgendwelchen machtsüchtigen Idioten.
Am Flugplatz Murchison begrüsste uns schon ein Elefant. Die Bootfahrt auf dem blauen Nil, den Wasserfällen entgegen: Wo sich das Boot dem Ufer näherte rannten auf hochgestelztsen Beinen Krokodile von verschiedener Farbtöung, hell ockerfarbig bis schwarz, ins Wasser. Obschon sie auf dem ockergelben Sand des festen Flussufers sehr rasch rennen konnten, vertrauten sie sich zur Flucht lieber dem Wasser an. Für den Blick von unten erscheinen die aus unschätzbarer Höhe stürzenden Kaskaden vom Wasserstaub wie im Nebel verschleiert. Ihr Aufprall hatte den Fluss zu einem See verbreitert und vertieft, Die von den in der Sonne silbern glänzenden Krokodilrücken bedeckten Sandbänke glichen dem Inhalt einer geöffneten Büchse Sardinen. Die vom Wassersturz benommenen Fische schwimmen den am Ufer dösenden Räubern in solcher Menge entgegen, dass es für sie geradezu ein Schlaraffenland sein muss. Ich sah zum ersten Mal vom Fluss aus, was man Galeriewald nennt, den Flussläufen folgender saftig und dicht grüner Urwald. Baumriesen lassen ihre Äste aufs Wasser überhängen, Beobachtungsposten für den weissen Fischadler. Von manchen Ästen hängen an Stielen lange walzenförmige Früchte über dem Fluss: vom "Wurstbaum“ ).
20.6
Die Familie kam schliesslich in Chicumbane an und sogleich gaben wir eine Aufführung mit dem Kasperlitheater-“Guignolles“.
Dr.Hadi Wolfensberger wunderte sich über den ungewöhnlich grossen Aufmarsch wichtiger Leute von der Missao Suiça bei unserer Ankunft in Lourenço Marques. Das Spital, in welchem ich meine Untersuchungen für Roche durchführen sollte, war aus der “Missao Suiça“ hervorgegangen. Der Pfarrer Zaccaria Manganhela, der Leiter der reformierten Kirche der Schweizer Mission, nahm uns zuerst im Empfang. Diese eindrucksvolle Gestalt wirkte wie einer der Apostel aus dem neuen Testament, gütig, weise und würdevoll. Wir sahen ihn nur noch ein oder zwei Mal. Später hiess es, er sei von der PIDE, der Policia Internacional de Difesa, verhaftet wurden und im Gefängnis gestorben. Über die Hintergründe hatte uns Hadi gleich nach unserer Ankunft ins Bild gesetzt. Wir mussten uns nämlich gleich im Büro der Pide melden, mit dem Hinweis, dass ich nur wissenschaftlicher Mitarbeiter de Roche sei und unabhängiger Gast der Missao Suiça.
Diese nämlich wurde verdächtigt, im Untergrund mit der im Norden des Landes Krieg führenden Befreiungsfront “FRELIMO“ zusammenzuarbeiten. Die Missionsstationen mit den Spitälern Kovu in LM und Chicumbane am Unterlauf des Limpopo waren deshalb unter besonderer Kontrolle der Pide. Beispielsweise mussten Zusammenkünfte von mehreren Personen (fünf oder zehn?) vorher angemeldet werden. Die Gottesdienste waren ausgenommen, Man nahm aber an, dass vielerorts Spitzel mit dabei sassen.
Hadi führte uns zum Nachtessen ins “Egipcio“ sein in Halbdunkel und süsse Hintergrundmusik gehülltes Stammlokal, wo er von eleganten halbbraunen Mädchen auf eine Art begrüsst wurde, die ihn gleich als Habitué auswies. In LM gab es einige Bordelle verschiedener Kategorie. Junge blonde Nachkommen der Buren aus dem puritanischen Nachbarland der Apartheid liessen sich hier von schwarzbraunen Mägdelein trösten.
Hier verbrachte Hadi seine freien Wochenenden. Als begabter Trompeter gründete er eine Jazzband, deren Konzert im Anzeiger von LM hoch belobt worden war. Seine andere Freizeitbeschäftigung war die Jagd, mit dem glatzköpfigen (Alopecia totalis) Ingenieur der Mission und Doutor Campos Magalhaes,. Dr. M.C. war de r Chearzt des Spitals für Dermatologie- und Lepra. Kurz vor unserer Ankunft hatten die drei ein Kudu erlegt, dessen Kopf mit den geschraubten Hörnern im Kühlschrank unseres künftigen Wohnhauses in Chicumbane lag. Hadi empfing uns im auf der Missionsstation mit einem Menue von Kudufleisch an einer Kokosnuss-Sosse (wunderbar!) und führte mich dann in die durchzuführenden Untersuchungen ein.
20.7
Erstaunt darüber, dass mir Dr.Fernex keine Instruktionen mitgegeben hatte, erklärte er seine bisherigen Arbeiten, die ich bis zu neuen Instruktionen von Dr.F. weiter führte.:
- Vergleich von parenteralem (intramuskuläre Injektion) Chloroquin mit Fansidar zur Behandlung der tropischen (Plasmodium falciparum) Malaria bei Kleinkindern . Dazu wird die Zahl der Plasmodien (falciparum) im Blut vor und nach der Behandlung gezählt.
- Bactrim bei Keuchhusten, Vergleich mit einem herkömmlichen Antibioticum (Chloramphenicol)
- Behandlung der Bilharziose bei Schulkindern mit einem neuen Mittel von Roche
- Malariaprophylaxe mit Fansidar-Tabletten bei Schulkindern.
Hadi erklärte mir die Behandlung der lebensbedrohlichen Austrocknung (Exsicccose) der dystenterischen Säuglinge mit Infusion der Flüssigkeit in die Bauchhöhle.
In ein paar Stunden erhielt ich so von Hadi Wolfensberger eine Einführung in die Praxis der tropischen Pädiatrie.
20.8
Die unentbehrlichen Hilfen.Vier ausgebildete Pflegefachfrauen aus der Schweiz, leiteteten zusammen mit einer einheimischen Oberschwester unter anderem die Poliklinik, die Bettenstationen und die Abteilung für Geburtshilfe. Sie führten die von mir verordneten Behandlungen durch, also die Injektion des Malariamittels, nachdem im Labor mit der Untersuchung eines Blutstropfens (Ausstrich und Färbung) auf Malaria die Diagnose bestätigt worden war. Der inheimische Cheflaborant, Paulo Mabunda und seine Gehilfinnen waren so selbständig und zuverlässig wie ich es mir nicht besser hätte wünschen können. Paulo Mabunda hatte eine kyphotische Rückgratverkrümmung infolge von Wirbeltuberkulose. Eines Tages rief er mich ins Labor, da eine seiner jungen Gehilfinnen ein im Mikroskop ungewöhnlich aussehendes Plasmodium bemerkt hatte: Es war das erste Mal, dass in Afrika die Spezies Plasmodium ovale gefunden wurde. Wir schickten die Präparate zum Malaria-Experten nach Liverpool, Professor Peters, der die Diagnose bestätigte und der Weltgesundheitsorganisation in Genf meldete. Diese Entdeckung verdanken wir der Aufmerksamkeit der jungen Laborgehilfin im Missionsspital Chicumbane.
Mademoiselle (!) Bernet und die Schweizer Hebamme (ihren Namen habe ich vergessen) waren beide schon viele Jahre in Moçambique tätig.
Bernet half mir jeweils bei den kleineren Eingriffen an den Nachmittagen, Leberbiopsien, die zur histologischen Untersuchung nach LM geschickt wurden, Kleinchirurgie und sehr häufig Lumbalpunktionen bei Kleinkindern aus dem pädiatrischen Ambulatorium mit Meningitisverdacht. Da floss nicht selten dicker Eiter statt der wasserklaren Rückenmarksflüssigkeit aus der Punktionsnadel. Dann injizierte ich jeweils gleich eine hohe Dosis Penicillin zusammen mit Streptomycin in den Subduralraum, unter diesen Bedingungen die einzige Chance, sogleich mit der dringenden Behandlung eineer bakteriellen und einer tuberkulösen Hirnhautentzündung zu beginnen, bevor wir die Resultate der bakteriologischen Untersuchung kannten.
Vor dem Beginn der Kinderpoliklinik stellte mir die Schweizer Krankenschwester aus Biel, Margrit Rüfli, die hospitalisierten Kinder vor. Wenn der Verlauf kompliziert war, musste ich das Kind selbst sehen, sonst genügte die Kontrolle der Aufzeichnungen auf der Fieberkurve und die mündlichen Angaben von Margrit.
Auf Shangan hiess der “Curandeiro”, der lokale Heiler “Xilandi” (Sch...). Margrit konnte sich mit den Leuten in Shangan verständigen.
„Hast du Medizin vom Xilandi bekommen ? und dem Kind gegeben?“
Die häufige Dysenterie von Kleinkindern wurde oft durch einen Xilandi mit einem toxischen Pflanzenextrakt zu behandeln versucht. Um das von diesen verwendete Pfanzengift zu bestimmen, kamen wir auf auf die Zwiebel einer Amaryllispfflanze namens Buphane disticha.
Margrit schien mir gewogen zu sein. Am Ende unserer Zusammenarbeit schenkte sie mir ein Buch über Epilepsie, ein Symptom, dem wir oft bei Kindern begegnet sind, die an der äusserst bedrohlichen zerebralen Form der tropischen Malaria litten. Ausser mit dem Malariamedikament Chloroquin oder Fansidar konnten die epileptiformen Krampfanfälle mit einer Injektion von Valium behoben werden.
20.9
Zum technischen Personal in Chicumbane gehörte unter anderen der Ingenieur Janet. Er war hatte einen ganz kahlen Kopf und stand dazu, „qu’il ne carbure que la bière“ und der Agronom Tissot, dessen hübsche rundliche Frau, eine Portugiesin unter Depressionen litt und dafür im Universitätsspital LM mit Elektroschock behandelt wurde (eine veraltete, allzu heroische Methode zur Behandlung der psychischen Depression).
Eine grosse Hilfe für die Diagnostik der vielen verschiedenen Infektionskrakheiten war die Laborantin Barbara Rüegg. Roche hatte uns die dafür benötigten Reagentien und Apparate zur Verfügung gestellt.
20.10
Kinder mit Virusinfektionen mussten isoliert untergebracht werden. Dazu reservierten wir zwei der zum Spital gehörenden Rundhütten. Masern und Keuchhusten war oft der Auslöser von Lungentuberkulose oder von Noma. Noma ist eine Superinfektion der Mundhöhlenwand mit anaeroben Bakterien. Grosse Teile des Gewebes werden schwarz, nekrotisch und werden abgestossen, sodass im befallenen Teil des Gesichtes scheussliche Löcher entstehen. Dadurch wird es schwierig, das Kinde zu ernähren, besonders wenn noch ein Teil des Unterkieferknochens mit betroffen ist und operativ entfernt werden muss. Eine Absonderlichkeit: Die gleichzeitige Kombination von Masern mit Varizellen beim selben Kind. Trotz der braunen Pigmentiertung der Haut sind die Hautveränderungen der beiden Infektionen mit einiger Übung leicht zu unterscheiden.
Und ein Weltereignis haben wir erlebt: zwei Frauen mit Blattern, Variola, und das nur einige Monate bevor die Weltgesundheitsorganisation die weltweite Ausrottung dieser epidemischen Seuche mitteilen konnte. Die ganze Belegschaft des Spitals und der Kirche, die noch nicht geimpft waren und die in weitem Umkreis wohnenden Leute wurden dann geimpft. Es ist kein einziger weiterer Fall bekannt geworden. Die beiden blatternkranken Frauen, eine Ältere und eine Junge haben beide die oft tödliche Krankheit überlebt.
Geschlechtskrankheiten waren sehr häufig. Verschiedene Stadien der Syphilis, die wir mit dem VDRL (Venereal Diseases Research Laboratory) genannten Test diagnostizierten. In der Schweiz kannte ich nur vom Hörensagen die Parot-Lähmung der Arme und Beine bei Kindern mit kongenitaler, d.h. vor oder während der Geburt erfolgten Infektion mit den Spirochäten. Ein sechsjähriges Mädchen hatte Teillähmungen an den Armen und Beinen war VDRL-positiv.
20.11
In Chicumbane konnte ich in Europa sehr selten gewordenen schwere Infektionskrankheiten beobachten: Ein vierjähriger Knabe mit Lyssa (Tollwut), nachdem er von einem Hund gebissen worden war, litt jetzt unter schrecklichem Erregungszustand und der Hydrophobie, dem Horror vor Wasser, so dass er nicht mehr trinken konnte. Ihm war nur noch mit starker medikamentöser Sedation zu helfen.
Nabeltetanus (Starrkrampf) bei Neugeborenen.
Die einheimischen Mütter oder “Hebammen” hatten die Gewohnheit, nach der Geburt Nabelwunde beim Neugeorenen mit Erde zu bestreichen. Dadurch können Sporen des Tetanuserregers, Clostridium tetanie. in den Körper des Kindes gebracht werden. Die Behandlung besteht in Antitoxinserum-Injektionen.
Endemische Pest im Slum von LM gab es einen endemischen Herd von Bubonenpest Der Bakteriologe, Prof.Rui Graça, hatte aus dem geschwollenen Lymphknoten eines jungen Mädchens aus dem Slum von Maputo das Pestbakterium isoliert. Er hielt mir die offene Petrischale mit den Yersinia (Pasteurella) pestis-Kulturen vor das Gesicht!
20.12
Geburtshilfe. Dr.René Favre: Der verantwortliche Missionsarzt der Missao Suiça lebte mit seiner Familie im Nachbarhaus. Jeden Morgen begab er sich mit dem grossen Missionsauto durch die 200 Meter lange Allee von Flamboyant-Akazien von zu Hause ins Spital. Durch Mangel an Bewegung und die Freude am Essen brachte er es zu seinem bemerkenswerten Embonpoint, wie übrigens auch seine Frau, Mutter der fünf Söhne. Warum fünf Söhne? Weil sich das Ehepaar sehnlich eine Tochter gewünscht hatten. Nach dem fünften Sohn hatten sie dann aber resigniert.
René benutzte meine Anwesenheit möglichst oft für Besorgungen in der Hauptstadt. Dann hatte ich Gelegenheit, zusätzlich auch seine Sparten zu übernehmen, also die Poliklinik und Bettenabteilung für Erwachsene und mich wieder mit Geburtshilfe zu beschäftigen. Während meiner Assistenzzeit in Nazareth hatte ich schon einige Erfahrung gesammelt im Umgang mit komplizierten Geburten.
Kurz nach unserer Ankunft hatte der Distriktsgouverneur die eben fertig gebaute Maternité feierlich eingeweiht.
Weitaus die meisten Geburten begleitete eine tüchtige, ruhige Schweizer Hebamme, sich die sich neben der Mademoiselle Bernet ein wenig im Hintergrund hielt. Zusammen mit ihren einheimischen Gehilfinnen bildete sie ein wirkungsvolles Team. Nur selten und bei wirklich sehr schwierigen Geburten brauchten sie die Hilfe des Arztes, der sich dann auf die Richtigkeit der Diagnose und der Indikation verlassen konnte. Dann war schon alles für den Arzt Notwendige vorbereitet: Für der Vakuumextraktion, für die Entwicklung bei Steisslagen, für die selten nötige Zange oder den Kaiserschnitt.
20.13
Bongane. In Missionen und Entwicklungsorganisationen gibt es Menschen, häufig sind es Frauen, von übermenschlicher Leistungsfähigkeit, die wahre Wunder an Opfer- und Hilfsbereitschaft vollbringen. Eine dieser ungewöhnlichen Frauen war „Bongane“, der Name von Mademoiselle Baumgartner in der lokalen Bantusprache Schangan. Ausgebildet als Kranken-schwester und Hebamme führte sie in etwa zwanzige Kilometer Entfernung vom Spital Chicumbane, tief im Buschland allein mit einheimischen Hilfen ein Spital mit einem Ambulatorium. Es bestand aus mehreren fest gebauten Bettenstationen und dem Poliklinik- und Geburtshilfetrakt, umgeben von einigen Rundhütten für die Familien und die weniger schwer Kranken. Aufgefallen war mir in der Mitte der ganzen Anlage eine mächtige Kokospalme, deren Stamm mit einem Palmblätterdach umfasst war. Ist das ein Regenschutz? „Nein, das schützt meine Leute davor von den fallenden Kokosnüssen erschlagen zu werden“.
René Favre war wieder einmal abwesend, ich war also auf Pikett. Um Mitternacht klopfte es an der Haustür und kratzte an den Fliegengittern unserer Fenster. Vor der Tür steht Bongane: „Ich han üch e grusige Fall pracht, Steisslag u Armvorfall. De Frou geits nöd guet. Sie lyt i dr Maternité. E ha grand no so e schwäri Sach bi üs, muess grad wider ga!“ Und schon knatterte der alte VW Picup wieder in den nächtlichen Busch.
Da lag die Frau, nicht ansprechbar, also bewusstlos. Vom Kind war ein Fuss und ein Arm zu sehen. Sein Körper lag quer. Ich dachte an den Geburtshilfelehrer Frey-Bolli und den Handgriff der Preussisch-Branderburgischen Ober-Hofwehemutter Christine Sigemundin, den er uns für solche Fälle gelehrt hatte: Ärmchen und Beinchen an je ein Band anschlaufen. Am Beinchen vorsichtig ziehen und das Ärmchen vorsichtig nach oben stossen, um eine Steisslage mit Beinvorfall herzustellen, wonach dann der Körper zusammen mit dem Ärmchen durch die engste Stelle des Beckens entwickelt werden müsste. Aber das Kindchen sass fest, die Uteruswand straff am seinem Körper. Also Kaiserschnitt. Vielleicht ist wenigstens die Frau zu retten. Der afrikanische Schnitt geht senkrecht durch die Mittellinie. Es eilt, der Blutdruck ist null. Und da liegt schon ein lebloses Wesen, zwischen der zerrissenen Gebärmutter und der Bauchwand. Plazenta vorsichtig abschälen. Dann die Entscheidung: Uterusamputation oder den Längsriss vernähen? Der Zustand der Mutter erlaubt nur das kürzeste Prozedere: Also die Naht. Die Mutter hat es überlebt, ihr Tod hätte wahrscheinlich eine Familienkatastrophe ausgelöst. In ihrer Aldeia (Dörfchen) hat sie noch kleine und halbwüchsige Kinder. Die Kleinen würden der Grossmutter zum Ernähren gegeben und in einigen Wochen mit Kwashiorkor, der lebensgefährlichen Fehlernährung, ins Ambulatorium der Bongane gebracht. Die glücklicherweise überlebende Mutter braucht(e) jetzt Unterricht zur Schwangerschaftsvermeidung. Ich hatte es verpasst, unter der Operation sogleich die Tubenligatur durch zu führen. Mein Fehler? Aber die Zeit drängte, denn die Patientin war im Schock. Lob gebührt dem Schweizer Anästhesisten, dem es gelang, sie aus dem Schockzustand zu retten.
20.14
Der Bericht von Claudine Roulet in ihrem Buch "Chronique Moçambicaine".
Ihr Mann, Dr.med.Jean-Daniel Roulet, hatte viele Jahre im Missionsspital “Kovu“ in Lourenço Marques gearbeitet und war manchmal zur Aushilfe nach Chicumbane gekommen. Er sprach Shangan und hielt einmal die Sonntagspredigt in der Kirche. Sie beschrieb in ihrem Buch das unbegreiflich sinnlose Verhalten der neuen Machthaber und ihrer Genossen im Namen eines missverstandenen Marxismus. Der ruhige, ausserordentlich fähige Arzt, mit dem Dr.Roulet in Kovu zusammenarbeitete, Dr.Gagnaux, war in dieser chaotischen Zeite erschossen worden.
Nach der "Nelkenrevolution“ in Portugal wurden die portugiesischen Besitzungen in Afrika in die "Unabhängigkeit“ entlassen. Die "Frelimo“ übernahm die Regierung in Moçambique. portugiesische Ärzte verliessen das Land. Einige der Missionsärzte blieben und versuchten im Chaos des Übergangs noch weiter zu helfen. Gruppen von “Medizintechnikern“ aus Kuba übernahmen die Spitäler. Im Spital der Bongane verkündeten sie, dass jetzt alles anders werde, es gebe jetzt “medicina revolucionar”, randalierten im Medikamentendepot und stahlen Instrumente. Bongane musste das Land verlassen. Nach ihrer Rückkehr in die Schweiz besuchte sie zu uns und erzähle von der Zerstörung ihres Lebenswerkes.
20.15
Besuche
Missionar Junot, der viele Jahre in Südafrika tätig war.:Als ich ihn fragte, welche Art Theologie für die Mission besser geeignt sei, eine large oder eher enge (fundamentalistische) . Seine Antwort war: "Mieux vaut trop large que trop étroit“.
In Pretoria war er Sereelsorger für zum Tod verurteilte Menschen gewesen. “J’en ai conduit douse jusqu’à la potence”.
M.Junot erzählte von seiner Annkunft in Mozambique. Er war für die Schweizer Missionsstation in Manjacaçe bestimmt:
Für die Reise seiner Familie und den Trnasport seines Gepäcks gab es Probleme, denn es war noch keine befahrbare Strasse gebaut worden und die Lokomotive für die Eisenbahnstrecke war in Revisiion. Kurzerhand organisiert er die Reise nach Manjacaze auf den Eisenbahnschienen ohne Lok, in einem von Einheimischen zu Fuss gestossenen Güterwagen,
Beim Anblick des Spitalkorridors, des voll mit wartenden Müttern mit ihren Bébés besetzten Wartereums für das Ambulatorium dar Kleinkinder sagt Herr Junot, mitTränen der Rührung in den Augen:
“Quel magnifique travail vous avez le privilège de faire!”
Andere Besuche: die Mutter Hanna Kuhn, Verenas Mutter und ihre Cousine Frau Frey, Roswitha Stössel, die Patin und Kindergärtnerin von Tobias , Elisabeth Bandi-Kuhn, Verenas ältere Schwester. Dr. (Prof) Michel Fernex.
20.16
Überraschungen am Strand
Die Lehrerinnen Verena und Erica Pfaehler unternahmen mit unseren Kindern/Schülern oft Ausflüge aufs Land, dem Limpopo-Fluss entlang oder an den nur zwanzig Autominuten entfernten Strand von Xai-Xai (Sch...-Sch...) am Indischen Ozean. Da lag viele Kilometer weit feiner gelber Sand. Etwa 200 Meter vom Ufer entfernt erstreckte sich ein aus spitzen Muscheln aufgebautes Riff. Wir glaubten deshalb, der Strand sei vor Haifischen geschützt. Das war eine Illusion, denn, nachdem wir uns mit den Kinder hier schon oft im angenehm warmen Wasser getummelt hatten, wurde bekannt, dass an dieser Stelle ein junger Mann durch einen Hai angegriffen und lebendberohlich verletzt wurde. Zum Glück gab es in der Nähe eine duch ein zweites Riff abgegrenzte Bucht. Innerhalb dieses vor Heifischen abgegrenzte Bassin von 1-1,5 m Tiefe konnten wir sicher schwimmen und tauchen..
Aber als ich darin einmal durch das Wasser watete, trat ich auf einen im Sand der Untiefe versteckten Zitterrochen. Der vesetzte mir ins linke Bein einen heftigen Stromschlag. Das Bein war nach dieser Überraschung für einige Meinuten gelähmt. In der zoologischen Beschreibung dieser besonderen Fische werden Stromstärken von 100 bis 200 Volt angegeben.
An einem der Strandnachmittages überraschte uns die Invasion einer vom Wind heran getriebene Flotte eigenartiger blauer Medusen (“Staatsquallen”). Sie werden von einem durchsichtigen kleinen Luftballon auf der Wasseroberfläche gehalten und ziehen mehrere teils kurze und teils bis meterlange Tentakeln nach. Tobias war am Schwimmen als er plötzlich aufschrie und aus dem Wasser rannte. Er war mit einer der langen blauen, im Wasser kaum sichtbaren Schlepptentakeln in Berührung gekommen und erlitt an den Berührungsstellen heftig brennende Hautrötungen. Das ist die Wirkung von Nesselzellen, die Abwehrwaffe von Polypen und Medusen. Ich betupfte die Rötungen mit einem hochprozentigen Alkohol. Ich hatte davon ein Fläschchen dabei. Mit dieser Bahandlung hörte die Stelle sogleich auf zu brennen und zu schmerzen. Die zoologische Bezeichnung dierer giftigen Tierchen ist sonderbarerweise “Portuguise-Man-o’War, Portugiesische Galeere = Physalia physalis”.
An dieser flachen Küste lag das verrostet Wrack eines Schiffes. Da Tobias Seefahrergeschichten gelesen hatte, kletterte er begeistert in der bedenklich schief im Sand steckende Ruine herum und versuchte, die Funktion der verschiedenen Räume zu erkennen

KILIMANJARO CHRISTIAN MEDICAL HOSPITAL MOSHI, (K.C.M.C) 1973 – 1976
21.1
Erster Kontakt mit dem K.C.M.C. Nach einem Zwischen- Urlaub in der Schweiz besuchten wir in Tansania das grosse neue Spital in Moshi, indem wir die Rückreise nach Moçambique kurz unterbrachen
Im Kilimanjaro Christian Medical Hospital wird die Abteilung für Innere Medizin von drei Ärzten (Consultants) geleitet. Der älteste, Dr. Frederick S. Wright, zeigte uns die Einrichtung und Funktionsweise dieser Abteilung.
1971 wurde das KCMC durch den Präsidenten von Tansania, Julius Nyerere, eingeweiht und gleich zum Regierungseigentum erklärt worden.
21.2
Pest
Dr. Wright. Sprach über ein aktuelles Ereignis, einem lokalen Ausbruch von silvatischer Pest, die 37 Bewohner eines kleinen Urwalddorfes in der Nähe von Moshi betroffen hatte. Ich konnte einen Blick in den streng isolierten Krankensaal werfen, in welchem die Überlebenden untergebracht waren. Diese gefäheliche Infektionskrankheit konnte rasch erfasst und eingedämmt werden.
Im Mittelalter hatte die Pest fast in jedem Jahrhundert einmal ganz Europa mit dem “SchwarzenTod“ überzogen. Damals betrug die Mortalität über 80%.
In dieser relativ kleinen lokalen Epidemie ist doch jeder Zweite der Erkrankten leider gestorben. Wenn die Behandlung nicht schon im ersten Stadium einsetzt, bevor der Bazillus ins Blut oder in die Lunge gedrungen ist. kommt die Behandlung (mit einem Breitspektrum- Antibiotikum) meistens zu spät.
So war es zu dieser auf einkleines Gebiet beschränkten Epidemie gekommen: Der Vater der dann erkrankten Familie ging im Urwald, der das Kilimanjaro Gebiet und die Abhänge des Kibo- umfasst, auf die Jagd auf kleine Säugetiere. Diese Tierpopulation ist ein Dauerreservoir des Pestbazillus, der Yersinia pestis. Der Erreger kann durch einen Vektor, dem Rattenfloh, von Tier zu Tier übertragen werden, auch auf den Menschen, wenn er sich der sich in das Endemidegebiet begibt. Auf Solche Weise infiziert, erkrankt er nach der Inkubationszeit von nur wenigen Tagen und steckt mit eingeschleppten Flöhen oder mit seinen Sekreten seine Mitmenschen an. Wenn seine Lungen befallen sind, überträgt er den Krankheitserreger durch Husten und Niessen.
In Moçambique gab es einen endemischen Herd von Bubonenpest Der Bakteriologe in Lourenzo Marquez Prof.Rui Graça, hatte aus dem geschwollenen Lymphknoten eines jungen Mädchens aus dem Slum von lou renç0 Marques das Pestbakterium isoliert. Er hielt mir die offene Petrischale mit den Yersinia (Pasteurella) pestis-Kulturen vor das Gesicht!
21.3
Vorbereitung auf Tansania Die Organisatoren von “Dienste in Übersee“ (“DÜ”) unterstützt bestimmte Entwicklungsprojekte indem sie dafür ausgewählte Fachleute vorbereitet und finanziert. Ich weiss nicht mehr wie ich auf diese parakirchliche Einrichtung gekommen bin.
In dazu bestimmten Kursen findet die Auswahl von medizinisch, organisatorisch oder pädagogisch ausgebildeten Leuten, statt, die sie für die besonderen Ansprüche in der dritten Welt vorbereitetet werden.
Medizinisches Personal vermittelten sie an Spitäler mit einigermassen funktionierender Infrastruktur, wo nicht nur Diagnosestellung und Behandlung von Kranken sondern auch Ausbildung von jungen Ärzten, Pflegepersonal etc. und von nicht akademischen Heilgehilfen (“Barfussärzten”) gefordert wurde. (cf. Kap. 21.4)
21.4
Das Tropeninstitut der Universität Liverpool führte einen sehr konzentrierten und berühmten dreimonatigen Kurs in Tropenmedizin. Diesen Kurs finanzierten mir die “Dienste in Übersee“.
In den drei Monaten lebte ich in einer Pension, dem recht primitiven "International Christian Friendship Club"
Da Studium in Liverpool
Ich galt noch als Mitarbeiter von Hofmann-La Roche, deren Vertreter für das UK mich überaus freundlich empfing. Verena und ich wurden von ihm in das beste Restaurant von Liverpool (”french cuisine”) eingeladen. In London gab es noch ein gemeinsames Essen mit dem Dozenten für Parsitologie, Prof. Nelson? mit Apéritiv im vornehmen, mit ledernen Polsterseseln stilvoll möbliertenLondoner Ärzteklub.
Einer der im Tropeninstitut unterrichtenden Dozenten, war Prof.Peters, der Malariaspezialist und Berater der WHO. Er hatte unsere Entdeckung des in Afrika bisher unbekannten Malariaerregers Plasmodium ovale in Moçambique bestätigt.
Dr.Fernex von LaRoche hoffte, dass ich in Tansania nochmals Medikamente testen könnte. Für den Fall einer Cholera-Epidemie hatte er schon eine Menge der zu prüfenden Medikamente ins K.C.M.C. senden lassen.
21.5
Mit Verena in Wales Im Verlauf des Kurses besuchte mich Verena. Wir mieteten ein Auto und machten eine Reise nach Wales. Da gab es das abschreckende Caernavon Caslte am Meer mit seinen von schreienden Dohlen umflatterten Türmen und die lustigen Dorfnamen von mindesten zwanzig Buchstaben, die gleich die Geschichte des Dorfgründers zu erzählen.
Wir besuchten auch das romantische Chester, nach dem römischen Castrum-Burg benannt, mit ”Lauben” wie in der Berner Altstadt.
21.6
Ich befreundete mich mit Marja Kekonnen, einer Kollegin aus Finnland. Sie wirkte so verschüchtert und zurückgezogen, dass ich meinte, ihr beim Verstehen und Lernen an der Tropenschule behilflich sein zu müssen. Ich merkte bald, dass sie jedoch eine sehr intelligente, emanzipierte Frau war, die meine Hilfe in keiner Weise brauchte. Sie erstaunte mich auch damit, dass sie ein Flugpilotinbrevet besass und auf dem Flugplatz Liverpool gelegentlich ihre obligatorischen Flugstunden absovierte. Wir machten ein wenig Sport miteinander und waren an einem Wochenende bei einer christlichen Familie eingeladen. Der Vater war Arzt, als Anästhesist in einem Spital angelstellt. Mit seiner Frau und den zwei Kindern besuchte er jeden Sonntag zweimal den Gottesdienst in der Baptistenkirche. Manchmal begleitete ich sie zum Gottesdienst am Sonntagmorgen. Einmal gelang es mir, die Familie zu bewegen, mit mir einen Spaziergang ans Meerufer zu machen. Hier gab es keinen Schnee aber Wind, der die Ginstersträucher zerzauste (es war im Februar). Da und dort blühten noch einige Rosen. Die zwei braven Kinder und die Mutterwaren nach diesem kleinen Familienausflug sichtlich erschöpft. Der Papa war dank seinem sportlichen Hobby, nämlich Golf, ein weniger besser trainiert.
21.7
An der Neurologischen Poliklinik Zürich
Als Ergänzung zur Tropenmeddizin brauchte ich noch eine Weiterbilung in Neurologie.
In der neurologischen Universitätsklinik Zürich wurde ich als Hospitant aufgenommen und der Obersrzt Dr.Schiller zu meinem Tutor ernanntt.
Bei dieser Gelegenheit konnte ich den Neurologen etwas aus meiner Kenntnis der Tropenmedizin beitragen: Ein Strassenarbeiter aus Portugal war von seinem Arbeitgebeber wegen Sensibilitätsstörungen der Extemitäten in die neurologische Poliklinik geschickt worden. Die Untersuchung des Patienten zeigte grossflächige Pignemtverschiegungen der Haut: Daran konnte ich das für Lepra (“Aussatz”) typische Bild erkennen, mit Befall von sensiblen Nerven. Meine Zeit an der neurologischen Poliklinik war leider, noch vor dem bakteriologischen Nachweis und der Therapieplanung abgelaufen.
21.8
Dr.med.Taylor aus England gehörte zu den Gründern der “Good Samaritan Foundation”, Diese leitete die Planung und Finanzierung des grossen Projekts. Für die Finanzierung kam meines Wissens unter anderen kirchlichen Werken die “Lutheran World Federatioon” auf. Er war dann der erste “Medical Superentendant” des KCMC. Dieser enorm aktive Kollege warr dazu auch noch für eine in Afrika tätige Mission von Augenärzten, tätig, die “Christoffel Blindemission”.
Ich beanspruchte auch einmal seinen Rat für die Abklärung einer neurologischen Erkrankung, denn Dr.Taylor verfügte über grosses Wissen in Neurologie.. Dass wir noch Suaheli zu lernen hätten war Für ihn selbstverständlich, “For you Swiss, this is just peanuts.” Verena hat es im Gegensatz zu mir geschafft.
21.9
Das Kilimanjaro Christian Medical Center Dieses grosse Spitals, sollte das Referenz- und Ausbildungszentrum für den Norden von Tansania werden, neben dem “Muhimbili”, dem staatlichen Universitätsspital in Dar Es-Salaam (das damals noch die Hauptstadt von Tansania war.) “Dar” sandte uns Medizinstudenten vor der Graduierung und Assistenten zu Weiterbildung, die nach einer gewissen Zeit und gemäss ihren Fähigkeit Oberärzte (Registrars) werden konnen. Für auswärtige praktzierende Ärzte und Ärztinnen wurden manchmal mehrtägige Weiterbildungskurse für angeboten. Die meisten intetrssierten Teilnehmer waren protestantische und katholische Missionsärzte.
Dazu gefügt wurde um 1974/75 die Ausbildung von sogenannten Barfussärzten nach dem Vorbild in China, also Leute, die befähigt werden , den Bauern und Hirten in den einsamen Gebieten dieses weiten Landes erste Hilfe zu leisten. Mit dem Funktelefon können periphere Spitäler Beratung abrufen, den Besuch von KCMC-Ärzten verlangen oder bei Bedarf den Transport von Kranken für spezielle Abklärungen und Behandlungen ins Referenzzentrum organisieren. Dazu dient das Flying Doctors Service (cf. 21.8)
Zu den Einrichtungen dieses grossen Spitals gehoren selbstverständlich auch Schulen zur Ausbildung von Pflege- und Hilfspersonal: von Pflegefachfrauen und Pflegern, von PhysiotherapeutInnen und medizinisch-technischen Assistenen/Assistentinnen, für das Labor und das Röntgen.
Einige Entwicklungshelfer nannten das “KCMC einen “weissen Elefanten”, eine überdimensionierte Einrichtung der Weissen, der reichen Industrieländer Den US-Amerikanern, den Kanadiern, den Australiern und Europäern wurde vorgeworfen, sie glaubten zu wissen, was für Afrika gut und nötig sei.
Nur das System der Barfussärzte hielt man für realistische und wirksame Hilfe bei dem noch "primitiven“ Entwicklungsstand der meisten Gegenden Afrikas.
21.10
Afrikanischer Sozialismus
Der charismatische Staatspräsident Julius Nyerere hatte an der Eröffnungsfeier des KCMC gleich verkündet, dass der Staat Tansania dieses Wunderwerk in seinen Besitz nehme und sämtliche Unterhaltskosten bezahle. Dieses Versprechen erwies sich bald als leere Rhetorik die sich folgendermassen auswirkt: Das KCMC hatte bis dahin alle Röntgenfilme bei europäischen Lieferfirmen, bezogen. Eines Tage jedoch stellten diese ihre Lieferungen ein. Warum? Weil der Staat Tansania seit dem Beginn des Röntgenbetriebes im KCMC dem europäischen Lieferanten noch nie eine Rechnung bezahlt hatte. Ein grosses überregionales Referenz- und Lehrspital von westlichem Niveau ohne die Möglichkeit zu Röntgendiagnostik! Wir hatten mit einer neuen Kollegin, einer voll ausgebildeten Radiologin kurz zuvor noch ein Carotisangiogramm durchgeführt bei Verdacht auf einen Hirntumor! Was soll die Ärmste künftig ohne Röntgenfilme anfangen?
21.11
Die Ärzte
Frederick S. Wright war als primus inter pares der älteste unter uns drei. Neben Fred bildeten noch Dr.John Williams aus Nordirland und ich diese flache Pyramidenspitze.
Die Patienten wurden in Abteilungen (“wards”) für innere Medizin (drei mal zwei, je für Männer und Frauen) untergebracht. Sie kamen entweder von peripheren oder eigenen Ambulatorien.
“Fred“ war unser “Senior Consultant”. In Edinburgh leitete er das Institut für Tropenmedizin. Nach seiner Pensionierung stellte er seine Erfahrung noch einmal Afrika zur Verfügung, wo er vorher noch während der britischen Kolonisationszeit in Kenia Medical Officer war und deshalb gut Suaheli sprach.
Die folgende Begebenheit beleuchtet die ärzliche und menschliche Haltung von Fred Wright:
Als wir drei Consultants einmal gemeinsam auf meiner Abteilung die Runde machten, stellte ich den zwei Kollegen einen Patienten vor, der an fortgeschrittenem Leberkrebst lit. Ich stellte die Frage, ob es indiziert wäre, ihn mit dem neuen von Roche zur Verfügung gestellten Chemotherapeutikum (Es hiess ”5-Fluoro-Uracil) zu behandeln. Es war besonders zur Therapie von abdominalen Formen von Krebs entwickelt worden. Die unvergesslich weise Antwort von Fred war: “Let him dy in peace!”
Bevor er nach Tansania kam, hatte Frederick Wright seine Frau verloren. Im KCMC traf er Gerda aus Dänemark, eine am KCMC tätige Physiotheapeutin. Dankbar pflegte Fred zu sagen “The Lord provided me with a new wife”. Gerda sprach so gut Suaheli, dass sie den Spitalangestellten Unterricht geben konnte. Verena besuchte mit Erfolg ihre Lektionen. Sie konnte nach der Rückkehr in die Schweiz mit der Frau eines einheimischen Pfarrers in Kisuahili korrespondieren. Ich brachte, die Zeit und Geduld nicht mehr auf, in Gerdas Kurs Suaheli zu lernen.
Dr.med.John Williams und seine Frau Lois hatten eben Joanna, ihr drittes Kind, bekommen. Verena und ich wurde sene Paten. Seine liebenswürdige Lois ist leider letztes Jahr. also 2015 an Krebs gestorben.
Unser Arbeitstag begann mit der “Chefvisilte“. Die Assistenz- und Oberärzte stellten die seit dem Vortag oder während der Nacht eingetretenen Kranken vor. Im Gegensatz zum schweizerischen Arbeitsstil des Spitalarztes, hatten meine jungen Kollegen noch nicht gelernt, bei jedem neu eintretenden Patienten ein so genannter Status zu erheben, das heisst die Anamnese und eine gründliche physikalische Untersuchung, “auscultation“ auf französisch, ist aber weit mehr war als nur das Abhören der Atem- und Herzgeräusche.
Die Auskultation und Interpretation der Herztöne und -Geräusche war das Spezialgebie von John, Fü mich aber die schwierigste Untersuchungsmethode. Vermutlich, weil ich schwerhörig zu werden begann.
21.12
Was war meine Aufgabe ? Ich hatte eine der drei Abteilungen der Abteilung für innere Midizin zu übernehmen. Dieser Rang wurde in der flachen britischen Hierarchie-Pyramide Consultant genannt und entsprach ungefähr einem Chefarzt und dessen Oberärzte hiessen Registrar.
Vom Gesundheitsminister wurde ich zum “Honorary Lecturer“ ernant, Ich durfte als Dozent wirksam sein, erhalte aber keinen Lohn (statt dessen bekomme ich “honour=Ehre!”)
21.13
Hierher gehört dier Erzählung einer typisch afrikanischen Episode.
Nicht selten mu ssten bewusstlose Menschen aufgenommenen werden, Menschen mit zerbralen Komplikationen schwerer Infektionskrankheiten, z.B. Meningitis, Hirnhaut entzündung. Da lagen diese Leute karchelnd auf dem Rücken im Bett, den Kopf durch ein Kopfkissen erhoben. Ich frage die Runde meiner Adlaten, ob sie wüssten, welches die richtige Lagerung bewusstloser Menschen sei. Nein, behaupteten einige. So zeigte ich es ihnen und erklärte. weshalb der Kopf tiefer liegen soll als die Brust, und zwar, wie auch der ganze Körper, auf die Seite gekippt, en Bein im Knie gebeugt. Als ich das nächste Mal wieder einen „afrikanisch“ gelagerten bewusstlosen Patienten antraf, rief ich alle im Raum Anwesenden herzu und forderte einen auf, den Menschen so hinzulegen, wie ich es ihnen kürzlich demonstriert hatte. Der aufgeforderte Kollege machte das perfekt. So ging es während den noch etwa zweieinhalb Jahren meines Aufenthalts im KCMC. Etwa 3 Jahre später besuchte uns auf seinem Rückweg aus Tansania nach den USA mein damaliger Kollege, der Amerikaner Dr.Dahm. Er berichtete uns von den Ereignissen im KCMC nachdem wir es verlassen hatten. Darunter die erfreuliche Nachricht, dass sich nun die korrekte Lagerung von Bewusstlosen eingebürgert habe unter der Bezeichnung „Meyer-Position“
Vonden Ärzten der anderen Spitalabteilungen kannte ich am besten die einzige Schweizer Ärztin von der Kinderabteilung, Dr.med. Noemi Brunner.
21.14
Die Abteilung fürPsychiatrie
Dr.Bondestam aus Finland erzählte uns wie man bis heute in Ländern wie Tansania Geisteskranke behandelte: nämlich wie in Europa zur Zeit des “christlichen” Mittelalters, währenddem es in islamischen Ländern schon recht comfortable, den Bedürfnissen der Kranken angepasste psychiatrische Kliniken gab. (Ich konnte in Syrien ein solches besuchen.) Die in mittelalterlichen GefängnIssen eingesperrten “verückten” Menschen wurden erst zur Zeit der französischen Revolution ven Ketten befreit durch Dr.Philippe Pinel von 1793 an. und anderen Pionieren. Beinahe zweihundert Jahre waren vergangen bis es Dr.Bondestam, dem “finnischen Pinel” gelang, die beauernswerten Geisteskranken aus den Gefängnissen zu befreien.
21.15
Krankenseelsorge
Wurde am KCMC auch unterrichtet mit mehr Ernszhaftigkeit als in Schweizer Spitälern. Dafür war ein in diesem kirchlichen Spezialgebiet ausgebildeter Pfarrer als Lehrer und Supervisor angestellt. Esist zu bedauern, dass es zwischen den Körperärzten und den Seelsorgern kaum je zu einem Gespräch kam. Man konnte leicht das Konsilium eines Kollegen aus anderen Abteilungen wie etwa einen Chirurgen oder den Psychiater anfordern. Aber die Seelsorger hielten sich so im Hintergrund, dass es uns nicht einfiel einen von ihnen um ein Kosilium zu bitten.
21.16
Die Abteilung für Sozialmedizin. Ein Arzt aus den USA verwirklichte ein effizientes Projekt: die “Under Ffives Clinics”. Ein Team von Kinderpflegepersonal und ein Arzt besuchte in regelmässigen Zeitabständen die Dörfer der Region. Nach Möglichkeit legte man für alle Kinder eines Dorfes vom Säugling bis zum Fünfjährigen ein Dossier an. Darin werden die Krankengeschichte, die Gewichts- und Wachstumskurve aufgezeichnet und die Impfungen aufgezeichnet. Man redete mit den Mütter über die Ernährung ung gab Ratschläge. Dabei geht es auch darum, die Entstehung der Eiweissmangel-Kranheit,”Kwashi Orkor” zu verhindern. Zugleich werden die Kinder gegen die häufigsten Viruskrankheiten (z.B.Masern) geimpft.
Man hoffft damit, die entsetzliche Kindersterblichkeit (bis 50% während den erstan fünf Lebensjahren) zu reduzieren.
Dieser wichteige Beitrag zur Verbesserung der Lebenssituation einer Bevölkerung, fiel leider, wie manche andere sinnvolle und notwendige Einrichtung, der Korruption zum Opfer.
Kaum hatte nach Ablauf seines Vertrags der in Community Health erfahrene Arzt aus Amerika , der diese wichtige Einrichtung in Gang gebracht hatte, das Land verlassen, wurden die Besuche der Dörfer aufgegeben. Der einheimische Vizedirektor der “Under Fives Clinics” hätte den Turnus der Dorfbesuche weiterführen solle. Es wurde aber bekannt, dass er nun der Landrover für seinen eigenen Bedarf brauchte, beispielsweise, um die Ernten seiner ausgedehnten Shambas einzbringen. Es ist beizufügen, dass dieser Herr eine hohe Stellung einnahm in der allein zugelassenen, sozialistischen Partei von Tansania, der TANU.
21.17
Die Chinesen
Das Gesundheitsministerium schickte eines der aus je fünf Ärzten aus China bestehene Equipe. Jeder einzelne von ihnen war in einem der wichtigsten Spezialgebieten der Medizin ausgebildet. Auf unserer Abteilung für innere Medizin bekamen wir sie nicht zu sehen. Unsere Kollegen von der chirurgischen Abteilung wussten etwas von der Tätigkeit des auf Akupunktur spezialisierten Chinesen zu berichten. Ein Hirte aus dem Volk der Masai kam als Notfall zur Chirurgie.In seiner Brust steckte tief im Fleisch ein Pfeil. Ob als Unfall oder Steitfolge blib mir unbekannt.
Der Akupunkteur machte mit seinen Nadeln eine genügend tiefe Anästhesie, die es erlaubte den tief sitzenden Pfeil für den Patienten schmerzlos heraus zu ziehen und die Wunde zu versorgen. Zum Beweis, dass der Patient zwar schmerlos war, aber nicht in narkotischem Schlaf lag, liess man ihn während der Operation etwas essen.
21.18
Krankheiten
Es gab Krankheitsbilder, die in der westlichen Welt noch nie oder vor mehr als hunder Jahren noch zu sehen waren.
Das erstaunliche Hirtenvolk der Masai bewohnte mit seinen Rinderherden die unendlich ausgedehnte Steppe. nordwestlich von Moshi..
Etsprechend ihrer Lebensweise ist es anderen Erkrankungen unterworfen, als die Bantu-stämmigen Bauern, die Chagga im Gebiet des Kilimanjaro. Ein Beispiel dafür ist der gefährliche Parasit Echinokokkus. Der E. Ist ein kleiner Bandwurm von Hunden und Füchsen. Gelangen seine Eier mit dem Kot in den Kärper eines Rindes-oder auch des Menschen, kann sich in seinem Körper daraus eine bis fussballgrosse Zyste bilden,
Eines Morgens beobachtete ich auf meiner Abtelung eine Masai-Frau. Sie hatte eine Öffnung im Brustkorb. Aus dieser Fistel schlüpfte eine etwas grapefruitgrosse , durch die Enge der Hautöffnung noch zusammengequetschte Echinokokkusblase. Gelassen beobachtete die Patientin was ihr da geschah.
In der Schweiz musste vor hundert Jahren die Bang-sche Krankheit der Kühe bekämpft werden. Wöhrend sie bei uns ausgestorben ist, grassiert diese Form von Brrucellose unter den Vieherden der Masai und infiziert manchmal auch die Menschen. Ein junger Mann war wegen Meningitis (Hirnhautentzündung) hospitalisiert worden. Zu unserer Überraschung stellte sich heraus, dass es eine Brucellen-Meningitis, eine äusserst ungewöhnliche Form der Bruchlose war. Eine andere, in unseren Breitengraden ausgestorbene landwirtschaftliche Infektion ist der Milzbrand, lateinisch “Anthrax”. Wir fanden bei einem Patienten, dass er an einer Hirnhautentzündung duch dieses Bakterium itt, an einer Anthrax-Meningitis befallen war .
Die beiden Fälle zeigen, dass man in tropischen Regionen nich nur eigentliche Tropenkrankheiten begegnet, wie Malaria, Schlfkranheit, Filariose oder Framöesie, die wr überigens ausser Malaria äusserst selten zu Gesicht bekamen. Es sind mehr die sozialen Lebenbedingungen alls das besondere Klima, welche die Pahologie einer Region beeinflussen.
21.19
The International School
Unsere Kinder besuchen diese nahe bei unserem Haus. Nach dem Portugiesischen in Moçambique lernten sie sehr rasch die Unterrichtssprache Englisch. Diese Schule war so gut, dass Tobias nach der Rückkehr in die Schweiz gleich ohne Aufnahmeprüfung ins Gymnasium aufgenommen wurde. Die “International School“ in Moshi war eine sehr gute, fast ideale Schule. Sie bot den Lehrgang vom Kindergarten bis zu einer Art Reifeprüfung oder Baccalaureat, womit der Zugang zu vielen Universitäten, z.B. auch Nairobi möglich war. Wir schätzten die Lehrer, die freie, moderne weltoffene Art des Unterrichts. Wir lernten die Lehrer gut kennen. Verena unterrichtete hier auch Französisch. Der Schulleiter aus Australien, David Nettlebeck und seine Frau wurden zu Freunden. Aber der Lehrplan folgte dem System von Kanada, geeignet für anglophone Schulsysteme, aber nicht für die Schweiz. Tobias näherte sich dem Alter in dem der Übergang ins Gymnasium fällig war.
21.20
Die Kirche
Die Kirche in Moshi mit dem Pfarrer aus England ist einem anglikanischen Bischof unterstellt. Unter dem britischen Spitalpersonal gab es die eher anglikanisch-kirchlich eingestellten und die dissidenten Christen. In der St.Margrits Kirche Moshi und bei ihrem Pfarrer fanden sich die aus historischen Gründen in England gespaltenen Wege zusammen.
Wir hatten unsere drei Kinder miteinander in dieser Kirche taufen lassen. Der Bischof hielt eine für die Kinder gut verständliche Predigt über das Wort “Trust” im Sinn von Glauben, Vertrauen, sich selbst Gott anzuvertrauen.
Westlich der Stadt Moshi, gegen die Meereküste gab es grosse Sisalplantagen. Die Sisalfasern famdem keine Käufer mehr und blockierten viele Quadratkilometer Ackerboden.
Ein Pfarrer aus Austalier, Brian Polkinhorn hatte das Land übernommen, um eine Musterfarm zu gründen, um eine neue, rentable Plantage anzulegen. Brian war ein einfallsreicher moderner “Missionar” für ein praktisches Christentum, das sich der aktuellen menschlichen und materiellen Notwendigkeiten annimmt. Hie und da leitete Brian als Pfarrer auch den Sonntagsgottesdienst in Moshi. In den zwei Predigten, die ich erlebte, ging es jedesmal um den unerträglichen materiellen Unterschied zwichen den Industieländern und Afrika. Er brachte einal einen frisch gebackenen Kuchen in die Kirche, als Symbol für die der Menschheit zur Verfügung stehenden Güter des ganzen Planeten. Wieviel davon konsumiert das reiche Drittel der Menschheit? Viel mehr als zwei Dritel!
Er schnitt den Kuchen in drei gleiche Stücke, gab der rechten Bankreihe die zwei, der anderen das eine Drittel mit der Einladung, man dürfe sich bedienen. Ob es denen zur Rechten in den Sinn kommt, denen zur Linken etwas von ihren zwei Dritteln hinüber zu reichen?
Das Thema einer anderen Predigt war “Genug ist genug”. Wie kommt es, dass die Menschen mehr Besitz zusammenraffen und mehr verbrauchen als sie zum Leben nötig haben, und das auf Kosten von Mitmenschen!
21.21
The Flying Doctors Service
EIne der ärztlichen Aufgaben am KCMC waren konsiliarische Besuche auswärtiger Spitäler, meistens pritestantischer oder, von Nonnen geführter katholischer Missionsspitäler. Oft wurden diese Flureisen auch für den Tranport von Schwerkranken oder unklaren Fällen zur Diagnostik und Behandlung ins KCMC benutzt.
Unser Cessna-Pilot war Hugh Prior. Die Flugstrecke führte nahe am eisbedeckten Gipfel des Kibo vorbei und weitete den Blick über die sanften blauen Hügel am Horizont und in die unendliche von den Masaihirten bewohnte Steppe. Vereinzelt, wie in respektvollem Abstand voneinander stehen da Baobab (Affenbrot-)-Bäume, und Schirmakazien. Auf den sonderbar fehlproportionierten plumpen Ästen der Affenbrotbäumen landen Geschwader von Aasgaiern, den Totengräbern der Steppe. Hugh liebete es von fliegerischen Heldentaten zu erzählen.
“Aber DAS könnt ihr Piloten nicht: auf Bäumen landen.”
“Oh doch, manche meiner Kollegen sind auf Bäumen gelandet”.
Hugh besuchte lieber die katholischen als die protestantischen Missionen. Jene sind überzeugte Teatotalers während die Nonnen ihren Besuchern gekühltes Bier offerieren.
Vom Flugzeug aus sind deutlich die Überreste eines verlassenen Dorfes zu erkennen: Abgebrannte Runhütten stehen in noch grünenden Gärten mit Maispflanzen, Papaya- und Banaenbäumen.
Das war die Auswirkung der so genannten UJAMAA- Bewegung. Der Distriktgouverneur muss des Staatspräsidenten Nyereres Idee des afrikanischen Sozialismus falsch verstanden haben. Im Übeereifer werden gewachsene Kulturen zerstört, als ob die öden Baracken für die zu gründende Gemeinschaftlichkeit färderlich wären. Auch das neue “UJAMAA-Dorf” sieht man vom Flugzeug aus :
Parallel zum Flugzeuglandestreifen und im rechten Winkel dazu sind lange Holzbaracken gebaut worden, mitten in der versteppten Ebene. Keine grüne Pflanze wächst in dieser Dürrre.Die Betroffenen beklagen sich darüber, dass diese künstlichen Barackenlager ohne Rücksicht auf die Wasserversorgung geplant wurden. Die umgesiedelten Bauern müssen jetzt auf Kosten des Staates ernährt werden, weil um die neue Siedlung keine Nutzpflanzen gedeihen.
21.22
Besucher
Mit Hanna Kuhn, Verenas Mutter, machten wir eine FahManchmalrt an den Naivashasee, der sich dem ostaftikanischen Riftvalley, dem Grabenbruch entlang zieht. der Panne im Tarangirepark. Die roten Elefanten.d
Mein Bruder Conrad mit Marie-Jacqueline machten ihre Hochzeitsreise zu uns bemerkte, sie sei ”une peitte nature”. Ursache Ihrer Panik war die Binahe-Kollision mit einem Elefantenvater und seiner Familie und als wir von einer Büffelherde umzingelt wurden.
Prof.Rüttner (mein Doktorvater) und der Vertreter der Eidgenössischen Kommission für Entwicklungshilfe.
Und schliesslich meine Eltern.
21.23
Ferien
Für einige Ferientage mit meinen Eltern mieteten wir ein Ferienhaus an der Küste von Kenya. Dieses “Ferienhaus” bestand aus zwei renivationsbedürftigen aber intakt aussehenden Häusern. Im verwilderten romantische Garten stand ein gewaltiger Baobab. Unsere Kinder spielten um einige alte Piroggen, Einbaum-Schiffe mit Aislegern, wie sie die Fischer benutzen und in und um zwei Hausruiinen. Mein Vater krempelte sich die Hosenbeine hoch und vegnügte sich mit Fussbädern im leichten Wellengang am Sandstrand. Ich warnte ihn zu spät, denn er litt am folgenden Tag an heftigem Sonnenbrand der Beine.
Ich hatte nicht vorausgesehen, dass in dieser Nacht die Oktober-Regenzeit begann und dass über dem Schlafzimmer meiner Eltern das Palmbätterdach ein Leck hatte. Die Eltern schliefen zwar gut, erwachten aber früh am Morgen im durchnässten Bett. Darauf zogen wir um in das komfortablere aber weniger romantische ”Oister Beach Hotel" bei Mombasa.
Mombasa, ist eine echt orientalisch wirkende Küstenstadt mit dem Dhau-Hafen. Diese altertümlichen, mit Schnitzereien verzierten Holzschiffe für den Handel mit Arabien, Pakistan und Indien erinnern an Sindbad, den Seefahrer aus der Geschichte von Tausend-und-Einer-Nacht.
Für eine spätere Ferienwoche konnten wir von einer Familie Archer das geräumige und komfortable Haus an der Kenyaküste mieten. Inbegriffen im Mietpreis war die Entlöhnung des Kochs, der uns jeden Tag ein Gericht mit Fischen zubereitete. Er kaufte sie frühmorgens am Strand bei den vom nächtlichen Fang zurück gekehrten Fischern.
Eines Tages wird der Koch akut krank mit Kopfschmerzen und Erbrechen, Zeichen der lebensbegrohlichen Hirnhautentzündung. Ich brachte ihn ins Spital nach Mombasa. Dort ist er am folgendenTag gestorben. Die egozentrisch naive Trauerdreaktion der Kinder: ”Schade um den guten Koch”.
Doch Sein Sohn übernahm lückenlos seinen Posten, nachdem und die Familie um einen Beitrag an die Begräbniskosten gebeten hatte.
21.24
Der Kilimanjaro
Nördlich der Stadt Moshi bildet ein etwa hundert Kilometer langer ovaler Kuchen das Findament für drei Vulkane.Der älteste, bis auf wenige Felsresten Abgtragene erhob sich kaum mehr vom Shira-Plateau. Im Osten steht der durch Verwitterung zerklüftete einstige Kegel des Mawensi. Zwischen überragt der Kilimanjaro Shira und Mawnsi. Sein Vulkankegel, der von Gletschern gekrönte Kibo, erhebt sich bis beinahe sechstausend Höhenmeter. Vom Wohnzimmer unseres Bungalows aus liess sich der nächtliche Schneefall am vergrösserten Weiss seiner Kuppe ablesen.
Wir schlossen uns einer Gruppe von Spitalangestellten an, die auf den Kibo steigen wollten. Mit unserem Landrover durchquerten wir den Urwald. Von der Waldgrenze aus ging es zu Fuss durch eine von Steppengras und baumhohen Erikapflanzen bewachsene “Alplandschaft”. Mit zunehmender Höhe werden die Erikabäume von über mannshohen grünen Säulen abgelöst, eine Lobelienart. Die keineren blütentragenden Pflanzen schützen sich gegen die Kälte mit einem feinen Pelz.
Auf etwa 3500 m.ü.M. verbringt man die Nacht in der aus Wellblech und Holz gezimmerten Hütte. Mittlerweile werden wir von fünf angeheurten Lastenträger begleitet. Sie bringen unser Gepäck und Bidons mit Wasser auf dem Kpf balancierend quer durch die jetzt pflanzenlose Wüste bis zur nächsten Hütte am Fuss des Kibo auf 5000 m Höhe.
Um ein Uhr des nächsten Morgens bricht man auf um den Vulkankegel des Kibo zu besteigen. Der Fussweg führt im Zickzack auf einer Geröllhalde zwischen bizzarren Eisskulpturen des Gletschers. Jetzt ist die empfohlenen Gangart: zwei Schritte bergauf, dann kurz stillstehen.
Um sechs Uhr ging hinter dem Mawenzi die Sonne auf- Ihre Strahlen schossen heftig zu beiden Seiten des zerklüfteten Nachbarn. Jetzt war intensiver Sonnenschutz gefordert, nicht nur mit Crème sondern mit der Schärpe über dem Gesicht und der Sonnenbrille. Der Tee in der Feldflasche war nun zum Eisklumpen gefroren. Im Steigen gabe es eine indische Art von salzigem Studentenfutter und vom Trockenfleisch unserer finnischen Kollegin zu essen.
Am “Gilmans Point” angekommen, wenige Meter unter der Höhe von 6000 überblickt man den weiten Kibo-Krater. Ich schätze den Durchmesser unsicher auf zwei bis drei Kilometer. Ich war aber meines Raumbewusstseins nicht mehr sicher und im Denken verlangsamt. Für die letzten Meter (?) Steigung hatte mir ein Träger die immer schwerer werdende Filmkamera getragen. Als ich Aufnahmen machen wollte, liess ich den Schutzdeckel des Filmkamera fallen. Es kostete alle Willenskraft ihn aus der Entfernung von nur zwei Metern aufzuheben. Der Blick in die Ebene war leider von Nebel verhängt- die Unendlchkeit der afrikanischen Landschaft hätte ein eindrucksvolles Filmsujet ergeben. Der Krater selbst ist eine ungefähr runde, unregelmässige Ebene. Einige scharfkantige Eisstelen stehen darin wie Plastiken in einer Ausstellung.
Dann bin ich stehend eingeschlafen. Wenn mich nicht ein Träger geweckt hätte, wäre ich als Eismumie am Kraterand geblieben.
Die Geröllhalte hinunter ging es rasch, das Gehirn schien die zunehmende Sauerstoffkonzentration der Luft zu geniesen und schuf eine angenehme Euphorie.
Dreissig Jahre später sind zwei meiner Kinder , Hanna und Dominik auf den Kibo gestiegen. Von dem interessanten Gletscher, der dem Vulkan die majestätische weisse Krone aufgesetzt hatte, war zu ihrer Enttäuschung nichts mehr zu sehen.
21.25
Autoabenteuer
Wir hatten von meinem Vorgänger für 10’000 $ den Ford Taunus gekauft. Er lieferte uns einige Pannen: mitten im Naivashapark blieb er stecken.
Wir hatten mit den Kindern mitten im Park mit dem Zelt kampiert. Es sei ein Achsenbruch in der “gear box” gewesen. Zum Glück kam ein Park Ranger mit seinem geländegängigen Auto und brachte uns zu nächsten Lounge (Touristenlager). Hier rief ich mit dem Radiotelefon dem KCMC an und bat den Spitalingenieur, uns am folgenden Tag abzuschleppen. Wir konnten hier übernachten, In der Nacht darau musste ich mich erbrechen: Das war die nicht bewusst gewordene Panik!
Ein Bestandtei des Ford nach dem Andern musste ersetzt werden,dafür konnten wir einen beim Garagisten stehenden ausrangierten Ford Taunus als Lieferant in Anspruch nehmen. Einmal ging es aber um ein Kugellager-für einen Fort unmöglich in Moshi zu finden. Doch, da gab es den indischen Eisenwarenhändler, der in seinen tausend Schachteln das grau gleiche Kugellager fand, aber russischer Herkunft!
Schliesslich verkauften wir den Ford weiter, ich weiss nicht mehr wem und gingen zu einem bekannten Engländer namens Horsley. Er arbeitete als Grosswildjäger für Miliardäre und hatte Landrovers zu verkaufen. Ein grosser blau Gespitzter hatte für den Transport der Leiche des wenige Jahre zuvor ermordeten Sultan von Zanzibar gedient. Wir enschieden uns für einen grossen Landrover im herkömmlichen Grün. “You’l never have any engine Doubles” Stimmte, doch es gibt noch manche andere spannende Pannen. Einmal bei der Fahrt durch den Tsavopark mit meiner Schwiegermutter und ein anderes Mal mit Marie-Jacques, nach der Hochzeit mit meinem Bruder, am die Momella Seen.
Ich hoffte, den Honeymoonern Conrad mit Marie-Jacques mit einer kleinen Reise in die wunderschöne Landschaft der Momella-Seen Freude zu machen. Die Seeufer sind rosarot gesäumt von den Tausenden Flamingos. Aufgescheucht scheinen siemit ihren langen Steckenbeinen noch auf der Wasserfläche zu rennen bevor sie in die Luft abheben. In der Nähe weidete ein Büffelherde. Einige der mächtigen schwarzen Körper suhlten sich in einer lehmigen Pfütze.
Plötzlich schien es mir, als ob ich mit gezogener Handbremse fahren würde. und es roch nach verbranntem Gummi. Zwischen den Brems -backen musste sich Sand eingeklemmt haben. Mit einem improvisierten Schöpfgefäss holte ich Wasser aus dem See und kühlte die heissen Felgen. Damit löste sich auch die Bremwirkung. Inzwischen war die schwarze Büffelherde bedrohlich nahegekommen. Ich war froh, dass wir mit normalem Tempo das Weite suchen konnten. Aber da stand ein neues Hindernis: ein hoher Elefant fächelte betrohlich mit den riesigen Ohren. Also sofort den Rückwärtsgang einlegen, um den gefährlich nahen Abstand zu vergrössern. Da erst sahen wir, dass der Bulle einer ganzen Elefantenfamilie das Überqueren der Strasse sicherte. Über Umwege gelangten wir sicher nach Hause. Jacqui war an Ende ihrer seelischen Belastbarkeit: “Je suis une petite nature”, nicht für afrikanische Abenteuer geschaffen.
21.26
Dar Es-Salaam: Die Gratifikation. Vor der Rückkehr in die Schweiz hatte ich Gelegenheit den Betrieb des Gesundheitsministeriums in der (damals noch) Hauptstadt Dar Es-salaam. Der Gesundheitsminister war ein Engländer, es war also anzunehmen, in seinem Ministerium einen einigermassen europäischen Standard der Organisation anzutreffen. Ich reiste zusammen mit Dr.Peter Hegenscheidt, einem der Gynäkologen vom KCMC, der wie ich seine Heimreise vorbereitete und ebenfalls die vertraglich zugesicherte Gratifikation persönlich abholen musste.
Unseren Lohn bekamen wir von der deutschen Organisation für Entwicklungszusammenarbeit DÜ (Dienste in Übersee). Wir galten aber als Staatsangestellte von Tansania. DÜ verlangte. Dass wir auf der Auszahlung der vertraglich zugesicherten Gratifikation bestanden, obschon der anstehende Betrag für unsere Verhältnisse so gering war, dass er die Reise- und Hotelkosten und den Lohn für die ausfallende Arbeitszeit kaum aufwog. Wir durften aber auf die Gratifikation nicht verzichten. Vielleicht sollte dieses Verbot als Erziehungsmassnahme dienen für die Bürokraten der Regierung. In diesem korrupten Regerungssystem würde das nicht abgeholte Geld früher oder später in die Taschen von Regierungsbeamten verschwinden. Dieser Verdacht bestätigte sich. Bis wir das Geld in der Händen hatten, gab es einen zermürbenden Hindernislauf durch eine Unzahl von Instanzen undefinierbarer Funktion durchzustehen. Nacheiner Woche, ausgefüllt mit täglichen Schikanen, wurde uns unser Geld ganz korrekt ausbezahlt.
.

22.1
Praxismiete. Im Dezember 1975 reiste ich von Tansania nach Zürich und wohnte einen Monat lang bei den Eltern an der Forchstrasse, um eine Praxisräumlichkeit zu suchen. Von den Angeboten auf mein Zeitungsinserat entschied ich mich für eine Parterrewohnung am Mittelbergsteig in Fluntern, also auf dem Zürichberg. Sie befand sich noch im Rohbau, gerade im richtIgen Zustand um die Praxiseinrichtung einzubauen. Die schon einige Zeit als Internistin und Tropenmedizinerin in Zürich praktizierende Dr.med.Claudia Sigg-Fahrner war mir mit Ratschlägen behilflich. Ihre Schwiegermutter, die Innenarchitektin, beauftragte ich mit dem Innenausbau. und der Gestaltung.
Nach der Weihnachtsfeier mit den Eltern flog ich für die letzten Wochen wieder nach Tansania.
22.2
Abschied von Afrika
Wir verliessen Tansania noch einige Wochen vor Ablauf der “Dienste in Übersee” vorgeschlagenen drei Jahren, weil die Kinder für den Beginn des neuen Schuljahres in der Schweiz sein sollten.
Ein Wohnungsprovisorium in der Schweiz.
Im März 1976 nahmen wir Abschied von Tansania und dem KCMC und bezogen diese provisorische Unterkunft.
Dr.med.Noëmi Brunner hatte uns in Mönchaltorf die zur Zeit leer stehende möblierte Wohnung von Bekannten vermittelt.
22.3
In die Zürcher Schulen aus der “International School” in Moshi.
Für Tobias redete ich mit dem Rektor des Gymnasiums Rämibühl. Rektor war gerade mein ehemaliger Lateinlehrer Prof.Ernst Bosshart, der “Bobo“. Er hatte im Archiv mein gutes Maturitätszeugnis gefunden, worauf er bereit war, Tobias ohne Eintrittsprüfung gleich in die speziell für ihn verlängerte Probezeit aufzunehmen. Er hatte aber schon vor Ablauf dieses Termins für die definitive Aufnahme genügende Noten.
Verena meldete Hanna Barbara beim Schulamt Zürich und Dominik im Mönchaltorf an.
Hanna kam in die sechste Primarklasse zu einer Fräulein Bächi. Unter dieser für Spezialfälle nicht sehr begabten Primarlehrerin fühlte sie sich nicht verstanden und litt.
Während den letzten drei Jahren hatten Hanna und Tobias die Freiheit und Toleranz der International School im Moshi genossen. Die helvetische Pädagogik passte nicht gut dazu. Ausserdem war während der Tansaniazeit die Unterrichtssprache Englisch.
Die tägliche lange Reise von Mönchaltorf zur Schule in der Stadt wareine rechte Belastung für Tobias und Hanna. Sie hatten sich aber nie darüber beklagt: Mit dem Bus nach Esslingen von dort mit Forchbahn bis in die Stadt, dann mit dem Tram bis zur Schule. Ich bewundere die Kinder, dass sie trotzdem den Anschluss in den Schweizer Schulen ohne Zeitverlust geschafft haben. Dafür hätte ihnen ein Lob gehört!
22.3
Dominik
hatte am Anfang mehr Glück. Er konnte gerade zum Schulanfang in der Dorfschule zu einer aufgeschlossenen jungen Lehrerin für die Einschulung. Allerdings war er schon in Tansania eingeschult worden. Im Moshi hatte er aber noch protestiert: „I don’t want to learn to write and to read!“ Da setzte ihn die Lehrerin in eine Ecke des Klassenzimmers, sodass er zwar mithören konnte, aber so als ob er nicht ganz zur Klasse gehörte. Wenig später jedoch, als die Schüler ein Gedicht dichten sollten, schrieb er: „ They fly on the moon. What do they find on the moon? Just a silly baboon“. Er hat es also doch gelernt. Leider war für ihn die Zeit bei der Dorflehrerin nur kurz. Denn als wir in Zürich in das Einfamilienhaus auf dem Zürichberg gezogen waren, kam er im Schulhaus “Heubeeribühl“ zu einer Primarlehrerin alter Schule, deren seelisches Gleichgewicht etwas gestört zu sein schien. Dem Gerücht nach wurde sie dann vorzeitig pensioniert. Dominik wurde also dreimal eingeschult. (Auch er schaffte dann später den Eintritt ins Gymnasium Rämibühl.) In der fünften Klasse kam er ins Flunternschulhaus zu einem Lehrer, der kurz vor der Pensionierung stand und wenig Verständnis hattte für Dominiks rebellische Fantasie. Er war sichtlich unglücklich. Wir liessen ihn abklären vom kinderpsychiatrischen Dienst an der Freiestrasse. Die Ärztin stellte auf Grund der Familiengeschichte eine sehr ernste Diagnose und wollte Dominik in die neu gegründete Klinik für Kinderpsychiatrie einweisen. Diese drastische Massnahme konnte ich nicht akzeptieren und rief Professor Heinz Herzka, dem Ordinarius für Kinderpsychiatrie an. Auch er hielt die vorgeschlagene Massnahme für übertrieben und empfahl uns, Dominik für die sechste Klasse in eine Privatschule zu schicken. So kam er im Sommer in ein Schlösschen auf dem Jolimont, wo ein “alternativer“ Pädagoge ein Institut mit freiem Lehrstil, etwa ähnlich dem englischen Sommerhill, eingerichtet hatte.
Auch Dominik wurde nach der Prüfung und Probezeit ins Gymnasium Rämibühl aufgenommen. Ich kümmerte mich leider zu wenig um die drei Gymnasiasten, in der Annahme, dass sie diese mittlerweile sechs Jahre problemlos durchstehen würden. Dominik musste eine Klasse wiederholen, aber ich bin nicht mehr so sicher.
22.4
Unser Wohnhaus an der Zürichbergstrasse
Ein Einfamilienhaus mit sieben Zimmern an der Zürichbergstrasse war zu mieten, für 2200 Franken. Der Besitzer, einehemaliger NZZ Redaktor, wohnte jetzt in Witikon, seine Sekretärin oder Freundin besorgte das Administrative. Das Haus lag nahe beim Zoo, umgeben von einem kleinen Garten, in einer leichten Senke des baumbewachsenen Terrains also etwas im Schatten. Von Mönchaltorf zogen wir also auf den Züriberg. Die Lage war ideal, keine zehn Gehminuten von der Praxis am Mittelbergsteig entfernt. Und nicht sehr weit von den Schulen der Kinder entfernt.
Hanna, sechs Jahre später: Um die Zeit ihrer Matur herrschte zwischen Verena und mir eine tiefgehende Krise, die schliesslich zu Trennung führte. Es schien, dass Hanna mit ihrem sonnigen Gemüt davon nicht berührt wurde.
Diese Annahme erwies sich als allzu optimistisch. Sie beruhte darauf, dass nie Zeichen von Frustration oder von so etwas wie Pubertätskrise erkennbar geworden waren. Einer meiner Fehler war, dass ich mich zu wenig um Hanna gekümmert hatte.

23.1
Finanzierung und Ausstattung Es brauchte nicht viele bauliche Änderungen, weil die, zwar als Wohnräume konzipierten Räume, sich noch im Rohbau-Zustand befanden Die Einrichtung der Praxis hatte ich mit der Innenarchitektin, Frau Sigg, schon von Tansania aus vorgesprochen. Viele Entscheidungen standen jetzt an. Die Auswahl der Firma, welche die Laboreinrichtung liefern soll und die Möblierung des Sprech- und Untersuchungszimmers. Sie bestellte den Empfangskorpus, die Auswahl der Wartezimmerstühle, die Einrichtung der ”Küche“ für die Instrumentensterilisation (ich wollte auch noch etwas Kleinchirurgie machen) und eine Kaffeemaschine. Ein anderer Raum wurde bestimmt für Therapie (z.B. „Novodyn“ eine Elektrotherapie zur Behandlung rheumatischer Schmerzen), den Elektrokardiographen und für das Büro.
Wenn ich daran zurückdenke, wie es zur Gründung meiner Praxis gekommen war und wie ich mich als frisch gebackener, frei praktizierender Arzt in einer Grossstadt fühle und zu verhalten hatte, erkenne ich erst die vielen Fehler und Unterlassungen, die ich aus Unkenntnis oder Trägheit begangen hatte. Die Erinnerung daran beschämt mich ein wenig. Nach den Jahren in der dritten Welt hatte ich wenig Ahnung, wie die Finanzierung dieses Unternehmens zu organisieren sei. Damit war ich auf Beratung angewiesen. Claudia Sigg, der ich manche kollegiale Hilfe zu verdanken hatte, verwies mich auf ihren Ehemann Hanspeter, Rechtsanwalt und Finanzberater. Wie man schwarze Konten eröffnet um Geld vor den Steuerbehörden zu verstecken, war sein erster Rat. Dabei hatte ich noch lange kein Vermögen zu verstecken! Ausserdem ekeln und beängstigen mich solche Winkelzüge.
Die Inenarchitektin, die ich mit dem Ausbau der Praxisräume beauftragt hatte, war die Mutter von Dr.iur.Hanspeter Sigg, also die Schwiegermutter der Kollegin Dr.med.Claudia Sigg. Damit war die Abhängigkeit von der Familie Sigg vollständig. Ohne Erfahrung in Buchhaltung waren die Unterlagen für die erste Steuererklärung ziemlich chaotisch geraten. Wahrscheinlich war der Zeitbedarf für die Herstellung der Steuererklärung recht aufwendig. Dennoch schien mir sein Honorar masslos übertrieben hoch. So ohne Erfahrung konnte ich dagegen nichts einwenden. Nach zwei Jahren, verlangte das Steueramt alle Unterlagen zu sehen. Später wechselte ich auf den Rat von Coni Schrafl zu Dölf Mülli, des das Vertrauen des Steueramtes genoss. Seine Arbeit kostete weniger als ein Drittel und seither wurden nie mehr Unterlagen angefordert.
23.2
Die Laboreinrichtung. Ein Photometer wurde angeschafft und eine Menge Reagenzien für die Biochemie, Hämatologie. Parasitologie und Urologie. Fast alle zur internistischen Diagnostik gehörenden Laboruntersuchungen konnte man in unserem Labor durchführen. Mit dem Photometer kann man biochemische Veränderungen im Blutserum nachweisen, z.B.Transaminasen. Erhöhte Serumkonzentrationen dieser Enzyme können Zeichen einer Lebererkrankung sein, z.B. Hepatitis, eine häufige Krankheit von Tropenrückkehrern und Flight Attendants. Mit der Zeit wurde die Laborarbeit immer aufwendiger, weil von den Ärzten, die ein biochemisches Labor führten, die Durchführung regelmässiger Vergleichskontrollen verlangt wurden.
Unser wichtigstes Laborinstrument war das Phasenkontrastmikroskop. Damit werden auch die an sich durchsichtigen Mikroben im ungefärbten Präparat erkennbar. Die meisten Tropenpatienten klagen über Bauchbeschwerden mit Durchfall. Die Ursache waren meistens Darmparasiten. Um sie nachzuweisen musste der Patient am Morgen die scheusslich bittere Glaubersalzlösung trinken. Im Lauf der folgenden Stunden mussten mindestens zehn Stuhlproben zum Mikroskopieren abgegeben werden. Da konnte man dann verschiedene Formen der krankmachenden Protozoen Entamoeba histolytica und Giardia lamblia sehen. Die sogenannte Magna-Form der Amöbe, die träge durchs Gesichtsfeld des Mikroskopes kriecht, ist der eigentliche Schädling, denn er gräbt buchstäblich Geschwüre in die Darmwand, dabei “frisst“ er rote Blutkörperchen und Darmzellen. Meistens war aber nur die Minutaform der Amöbe zu sehen oder die zu Zysten abgekapselte. Nur die Zysten können aus der Umwelt, z.B. im Trinkwasser und damit hergestellte Eiswürfel oder Glace. Wenn dieses mit Fäkalien verschmutzt ist, kommt es beim Konsumieren zur Infektion.
Dr.Claudia Sigg, Dr.Hadi Wolfensberger (mein Vorgänger in Moçambique, der in Zürich nun auch eine Tropenpraxis führte), Professor Eckert, Parasitologe am Tierspital, und ich vereinbarten eine Vergleichsstudie der Amöbendiagnostik. Deren Auswertung wurde aber schwierig, weil jeder von uns eine andere Vorstellung vom mikroskopischen Bild der pathogenen Amöben mitbrachte. Hadi stellte die Diagnose am häufigsten, Eckert am seltensten. Wer schliesslich recht behielt, liess sich nicht eruieren. Von dem bei Eckert angestellten Serologen erwarteten wir die Erarbeitung einer zuverlässigen Diagnostik. Aber bevor es soweit war, hatte ihn der Professor aus mir unbekanntem Grund entlassen. Bei dieser fortbestehenden Unsicherheit der Diagnose und der nicht ganz harmlosen Behandlung der Amöbiasis hatte ich immer ein etwas mulmiges Gefühl.
23.3
Die Praxisbevernissage
Inzwischen musste ich beim Kantonsarzt die Praxisbewilligung für meine zwei Spezialfächer einholen. Als ich ihm meinen Namen, unter dem diese Praxis registriert werden sollte als “Dr.med. Hans Alex Meyer-Kuhn“ angab, fragte er: „Und was, wenn sie sich scheiden lassen?“ Ich empfand diese Frage als anmassend und ausserhalb jeder Möglichkeit.
Zur Praxiseröffnung am 16.Juni 1976 gab es eine übliche Vernissage mit vielen Gästen. Der Nachbar Prof. Storck, pensionierter Ordinarius für Dermatologie, diskutierte mit mir über tropische Hautkrankheiten.
23.4
Gehilfinen
Die Wahl machte keine Probleme. Antoinette Sarkis hiess die erste Auserwählte. Sie stammt aus einer armenischen Familie. Soeben hatte sie die Berufsschule für Arztgehilfinnen abgeschlossen. Eine gewinnende hübsche und ausgeglichene junge Frau. Es ging nicht lange, so stellte ich eine zweite Hilfe an, die eifrige und intelligente F. H. Während den ersten Monaten war die Zusammenarbeit mit ihr optimal und sie ergänzte die Kollegin auf ideale Weise. Dann aber änderte sich ihr Verhalten. Sie wurde arrogant, überkritisch und fordernd. Ich verschrieb ihr einen Erholungsurlaub. Ihr Verhalten wurde aber immer bizzarrer und realitätsferner, Symptome einer beginnenden Psychose. Sie konnte schliesslich nicht mehr arbeiten. Es galt also, eine neue zweite Gehilfin zu finden. Jahre später begegnete ich F.H. zufällig. Sie war zur Behandlung in einer psychiatrischen Klinik gewesen. Jetzt war sie an der Ausbildung zur Krankenpflegerin im Spital Bethanien.
23.4
Dr.med.Conradin G.Schrafl. .Claudia Sigg machte mich eines Tages darauf aufmerksam, dass der Internist und Tropenspezialist. Conradin Schrafl, aus Südostasien in die Schweiz zurückgekehrt sei und eine Praxis zu gründen gedenke. Am Telefon bestätigte er diese Absicht. Noch sei er daran, bei einem Kollegen die Röntgendiagnostik zu lernen. Claudia hatte viel Wert auf die Einrichtung einer Röntgenanlage gelegt, vor allem um der damals noch üblichen Magen-Darm-Untersuchungen wegen. Bald aber wurden die Auflagen und Kontrollen für den Betrieb einer eigenen Röntgenalage für die Privatpraxis so aufwendig, dass sie sich nicht mehr lohnte. Ich bot ihm an, meine grossräumige Praxis mit ihm zu teilen und liess das für eine Doppelpraxis Nötige ändern. Coni verzichtete inzwischen auf eine zusätzliche Röntgeneinrichtung.Wir teilten die Räume so ein, dass jeder sein eigenes Sprech- und Untersuchungszimmer bekam. Die übrigen Räume standen in gleicher Weise Beiden zur Verfügung ebenso die Benutzung des Labors.
23.5
Parasitologie. Für die koprologische Parasitensuche gab Dr.Schrafl die traditionelle Glaubersalz-Provokation auf. Statt dessen gab er den Patienten drei Röhrchen mit einer Fixations-und Färbelösung (sogenannte MIF-Lösung) mit nach Hause. Diese schickte der Patient in unser Labor. Dann war bei der nächsten Konsultation das Resultat verfügbar.
Die Feststellung einer Infektion mit Lamblien ist zuverlässiger als die der Amöbiasis. Die munteren Einzeller verraten sich im Mikroskop, weil sie mit Hilfe ihrer Geisseln im Gesichtsfeld herumhüpfen. Sie schädigen ihren Wirt, indem sie sich zu Millionen an der Dünndarmwand ansaugen und dadurch die Nahrungsaufnahme behindern. Unter dem Mikroskop kann man neben den einzelligen Parasiten oft geradezu einen botanischen (Bakterien und Hefepilze) und zoologischen Garten beobachten (Amöben, Lamblien, Wurmeier, kleine Würmchen “Oxyuren“ ).
Von einer Praxisassistentin wird nach einer Einführung von etwa drei Wochen verlangt, dass sie alle diese Untersuchungen durchführen kann. Bei jedem auffälligen oder unklaren Befund, etwa wenn sie beim Mikroskopieren in der Stuhlprobe eine ihr unbekannte Mikrobe oder im Blutbild ein weisses Blutkörperchen nicht mit Sicherheit bestimmen konnte, musste sie unseren Rat holen.
Mit den von der Laborantin routinemässig hergestellten und gefärbten Blutausstrichen und “dicken Tropfen“ (eine Anreicherungsmethode für die Malariadiagnostik) beschäftige ich mich nach dem Feierabend oder über das Wochenende. Jedes Präparat durchsuchte ich zehn Minuten lang auf Malariaerreger, die in verschiedenen Formen der verschiedenen Spezies als Parasiten in den roten Blutkörperchen eingeschlossen zu finden waren.
Bevor Coni Schrafl mit mir die Praxis teilte, waren die zwei Gehilfinnen mehr als beschäftigt, besonders wenn dazu noch das Schreiben nach dem Diktaphon immer häufiger wurde. Ich konnte gut noch eine Praktikantin aus der Arztgehilfinnen-schule beschäftigen. So absolvierten hier auch zwei Töchter von Freunden: Karin, die ältere Tochter von Gerda und Hansruedi Koller und Barbara, eine Tochter von René und Berti Stucki ihr Praktikum. Vielleicht habe ich die jungen Frauen nicht genügend streng eingesetzt, denn es kam für eine kurze Zeit dazu, dass ich vier Angestellte beschäftigte.
23.6
Die Tropenmedizin. Was mich an der Tropenmedizin faszinierte, war die Verbindung der Physiologie und Pathologie des Menschen mit Biologie. Dazu kam noch die Anziehungskraft des Exotischen. Später unterstützten Berichte über Forscher und Missionsärzte, z.B. “Jungle Doctor“ von Dr.Paul White, diesen idealistischen Lebensentwurf.
Im Gymnasium hatte ich in der Schülerbibliothek das Buch "Mikrobenjäger“ von Paul de Kruif gefunden. Mit seinen meisterhaften Berichten hatte er bei mir ein Ideal geweckt: Der einsam heroische Forscher in seinem Zelt im Urwald. Das wurde für mich zum Idealbild des forschenden Arztes. Ein solcher ist noch besonders zu bewundern, wenn er im Sinn von Albert Schweitzer "unterentwickelten“ Volksstämmen Hilfe bringen und mit relativ einfachen Mitteln Leben retten kann: Mit einer Injektion Penicillin eine Lungenentzündung oder für ein paar Rappen eine Malariainfektion heilen können, das war mein idealisiertes und attraktives Berufsziel.
Was ich mir als idealer Lebensentwurf vorgestellt hatte, hat sich herausgestellt als ein Konglomerat aus meiner Selbstüberschätzung und den Vorstellungen von einer vergangenen längst nicht mehr altuellen Wirklickeit. Weisse Helfer wurden von manchen afrikanischen Staaten nicht mehr geschätzt. Es war keine leichte Sache, mich der Wirklichkeit des Arztseins in Afrika zu stellen, auf Lorbeerkränze und Faszination zu verzichten und schliesslich eine nicht besonders heroische und exotische Tätigkeit als praktizierender Arzt in Zürich aufzunehmen. Ausserdem betrübten und enttäuschten mich mich die traurigen politischen Berichte aus Eritrea und Moçambique Seit meiner Rückkehr in die Schweiz ist vieles von dem, was in Afrika aufgebaut worden war, nach kurzer Zeit wieder abgebaut oder sinnlos zerstört worden.
23.7
Ich hätte in Zürich gute Gelegenheit zur Fort- und Weiterbildung in innerer Medizin gehabt, Ich habe sie vernachlässigt, obschon ich dafür den FMH-Titel trug. Ich hätte, um mit der modernen europäischen Medizin wieder vertraut zu werden, bei meinem ehemaligen Chef, Dr.Zollikofer, an den internistischen Arztvisiten im Spital Neumünster teilnehmen können. Das ganz in der Nähe der Praxis gelegene Universitätsspital bot dauernd Fortbildungen in verschiedenen internistischen Gebieten an. Davon habe ich nur sehr selten Gebrauch gemacht. Noch jetzt quält mich die Nemesis mit dem Vorwurf, ich hätte die Innere vernachlässigt.
Hunderte von Träumen forderten mich auf, für die Prüfung endlich die Lehrbücher für Innere Medizin zu studieren. Aber wie sehr ich mich auch darum bemühte, immer werde ich daran verhindert. Entweder sind die Bücher nicht aufzutreiben oder komplizierte Familienverpflichtungen halten mich davon ab.
Mehre Patienten, darunter der Vater eines Schulfreundes, hätten mich als Hausarzt gewählt, wenn sie von meiner Kompetenz überzeugt gewesen wären. So beschränkte sich meine ärztliche Tätigkeit zusehends auf Parasitendiagnostik und Nachuntersuchung von Missionaren und Testen von Firmenangestellten auf Tropentauglichkeit. Zu denken gab mir ein Ingenieur der Contraves, einer Firma, die Raketen nach Dschedda in Saudiarabien lieferte. Für welchen Krieg würden sie eingesetzt?
23.8
1985 Übergang zur Psychotherapie. Die Patientin Frau St. machte mir Sorgen. Ich hatte noch nie einen so vom Unglück verfolgten n Menschen kennengelernt. Ihre Depression zeigte sich als abgründiger Negativismus. Während und nach dem Krieg verlor sie mit ihrer Familie als Sudentendeusche ihre Heimat. Ihr Ehemann hatte sie verlassen, um ihre Schwester zu heirten. Ich weiss nicht mehr, welche Beschwerden sie zu mir führten. Jedenfalls beschäftigten mich sowohl ihre körperlichen wie auch ihre seelischen Nöte. Dann entzog sie sich wieder meiner Diagnostik und Therapie. Erst nach einem Unterbruch von vielen Monaten konsultierte sie mich wieder: Man hatte bei ihr ein nicht mehr operables Colonkarzinom festgestellt. Sie wollte sich auch nicht mehr von einem Onkologen oder Gastroenterogen palliativ behandeln lassen, sondern wünschevon mir, dass ich ihr die Injektionen des Krebsmittels "Iscador" , ein Extrakt der Mistelpflanze injizierte. Diesen Wunsch erfüllte ich ihr. Für ihre zunehmenden Schmerzen brauchte sie später ein Morphinpräparat. Als sie ihre Wohnung nicht mehr verlassen konnte besuchte ich sie noch. Sie starb während ich mit der Familie in den Ferien war. Das war 1985.
In diesem Jahr wat meine Ausbildung so weit fortgeschritten, dass ich mich ganz der Pschotherapie widmen konnte. Neben den Therapie einzelner Peersonen, führte ich während sechs Jahren zusammen mit Dagmar Zimmer eine Therapiegruppe,

Ich werde Mitglied des Schweizer Vereins für Gestalttherapie (1980) Ausbildung in Gestalttherapie 1981 - 1993 mRedaktionsteam der Zeitschrift des Gestaltvereins Kibbuz in Jugoslawien 1984 Lehranalyse bei Dr.med.Elisabeth Leupold Basel 1982-1993
24.1
Die Balint-Gruppe. Um 1964, als Assistent auf der Barmelweid, hörte ich durch den Chefarzt, Dr.Buser, von den Balintgruppen. Auf dieseAnregung hin besuchte ich gleich nach der Praxiseröffnung 1976 in Zürich die Balintgruppe bei Prof.Knoepfel. Die Balint-Gruppen wurden begründet vom ungarischen Psychoanalytiker Michael Balint. Die geht zurück auf die Beobachtung des folgenden Phänomens: ein Teilnehmer schildert die Geschichte eines seiner Patienten. Dann äussern sich die anderen Teilnehmer, was sie dazu denken und empfinden. Das Unbewusste des Patienten bewirkt durch die Darstellung des Referenten eine Resonanz bei den Zuhörern.
Im gleichen Jahr begann ich mit einer Analyse beim Psychiater Dr.Adolf Guggenbühl, einem Vertreter der Richtung von C.G.Jung. Er war Leiter des Jung-Institutes in Küsnacht.
24.2
Innere Medizin Psychotherapie = Psychosomatik
Nach der Gründung der Praxis für Inneere und Tropenmedizin besuchte ich recht fleissig die Veranstaltungen der in dieser Zeit neu gegründeten Gesellschaft für Tropenmedizin. Mit der Zeit wurden meine Ausbildung in Gestalttherapie und die Weiterbildung in Psychiatrie immer wichtiger.
Ich wurde von der Fachgesellschaft für innereMedizin ersucht, die Minimalanforderung an Weiterbildung zu belegen. Diese aber hatte ich nicht erreicht, denn ich war mit der Weiterbildung in Tropenmedizin, mit der Analse bei Dr.Guggenbühl und dann dem anspruchsvollen Lehrgang in Gestalt-Psychotherapie mehr als ausgelastet. Ich musste deshalb auf den Titel "Spezialarzt FMH für Innere Medizin" verzichten. Später erwarb ich dank meiner langjährigen Ausbildung in Psychotherapie den Fähigkeitsausweis für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin. Das war notendig geworden, weil neue Tarifreglemente nur einem entsprechend ausgebildeten Arzt erlaubten, seine Behandlungen über die Krankenkasse abzurechnen.
24.3
Gefahren der Psychotherapie? Die meisten Aktivitäten, die etwas mit "Psyche“ zu tun hatten, wurden in kirchlichen und freikirchlichen Kreisen, so auch innerhalb der VBG, von manchen Leuten mit Skepsis angesehen. Auch ich hatte Bedenken. Es zirkulierten Gerüchte, wonach die Psychoanalyse oder Psychotherapie den christlichen Glauben und die Ehe bedrohe und zur Promiskuität verführe.
Da begegnete ich einem Buch von Dr. Guggenbühl mit dem Titel: "Die Ehe ist tot, es lebe die Ehe“. Das war der Grund für die Wahl dieses Analytikers. Ich hatte schon einiges gelesen von Jung und Malereien von ihm gesehen. Das Mythische und Bildhafte dieser Psychologie gefiehl mir. Ich hatte als Hinter -gedanken schon eine regelrechte Ausbildung in Psycho-therapie. Die Analyse bei Dr. G. gälte dann gleich als Anfang der Lehranalyse für die Ausbildung in Psychotherapie. Zudem hatte ich seit den Erlebnissen in Eritrea selber einige seelische Probleme, die sich nach meiner Beschäftigung mit dem Christenglauben und durch Seelsorge (bei Hans Bürki und Robert Rüegg) bisher nicht zu bewältigen waren.
24.4
Wozu Psychotherapie? Ich fühlte mich seit der Rückkehr aus Eritrea auch noch während der Zeit in Tansania dauernd bedrückt und müde. Verena und ich liessen uns beim Tropenspezialisten Dr.Hans E. Meyer parasitologisch untersuchen. Beide. Es zeigte sich, dass beide eine chronische Darminfektion mit Amöben (Entamoeba histolytica) hatten. Es brauchte zur Heilung mehrere Kuren mit den unangenehmen Amöbiziden. Ich hatte nachher noch viele Jahre lang eine Darmstörung. Tobias hatte chronische Durchfall wegen Infektion mit Lamblien (Lamblia giardia). Nach kurzer Behandlung mit Tiberal war er geheilt.
Meine depressive Grundstimmung wurde trotz diesen Medikamenten nicht besser.
Ich erinnere mich ungern an diese Zeit. Ich hätte doch im Jahr 1976, nach der Rückkehr in die Schweiz und Beginn der beruflich Senlbständigkeit allen Grund, mich an diesen Schritt mit Stolz und Freude zu erinnern. Statt dessen hattte sich grau und hässlich ein dumpfes Gefühl von Peinlichkeit und Schuld eingeschlichen. Es war eine jahrelange düstere Zeit, die schliesslich zur Trennung von Verena führte.
Was für einen Grund hatte ich denn, unzufrieden zu sein? Hatte ich nicht alles, was zu einem gelungenen Leben gehört? Eine Frau und gesunde Kinder, die (fast) keine Schulprobleme haben, ein Einfamilienhaus mit sieben Zimmern auf dem Zürichberg, einen interessanten und lukrativen Beruf? Einen Arbeitsplatz nur ein paar Gehminuten von zu Hause.
Von zu Hause an der Zürichbergstrasse führte der Weg in die Praxis dem langen Holzzaun des von Stockar’schen Anwesens entlang. Jeden Tag viermal die regelmässige Abfolge der Holzpfähle ansehen zu müssen, konnte ich fast nicht mehr aushalten. Wegen diesem phobische Zustand erschreckte mich allein schon das Klingeln des Telefons. Ich wagte kaum, den Hörer abzuheben und mit der anrufenden Person zu sprechen.
24.5
Psychotherapie nach C.G Jung
Dr.A Guggenbühl nannte das “free floating anxiety“. Er bestätigte meine etwas unklare Diagnose “Depression“, ein Zustand, den ich seit unserem Aufenthalt in Eritrea bisher nur bei Verena zu sehen glaubte. Von einem kompetenten Arzt eine Diagnose zu bekommen führte schon zu einer gewissen Entlastung: Ich bin nicht schuld an meinem Zustand. Das Übel war nun festgestellt und hatte den Namen einer Krankheit.
Dr.G. gehörte zu den Koryphäen der analytischen Psychlogie (einer Weiterentwicklung der Psychoanalyse von Sigmund Freud). Seine Analyse bestand vorwiegend in der Deutung meiner Träume. Seine Traumdeutungen aber lösten meine tieferen Probleme nicht. Ich las viel im “Grundwerk“, einer Sammlung der für die Ausbildung wichtigsten Werke von Jung. Ich zeichnete einige und beschrieb Hunderte meiner Träume. Aber in dieser Art von Analyse fehlte mir der Zusammenhang mit dem Körper, der "Sprache der Organe“. Die Teilnahme an der Balint-Gruppe bei Prof. K.Knoepfel hatte mir die Idee geweckt, Psychosomatik ins Zentrum meiner medizinischen Arbeit zu bringen. Die Psychoanalyse bei Dr.G. bestärkte diesen Entschluss, gab mir aber theoretisch und praktisch zu wenig Handhabe zum Verständnis und zur Behandlung von Patienten, die mich zunächst ja fast immer wegen Körperkrankheiten konsultierten. Ich brauchte Anleitung zum Erkennen allfälliger, dem somatischen Leiden zu Grunde liegender Psychopathologie und das Werkzeug, diese wirkungsvoll anzugehen.
Zu jener Zeit besuchten Verena und ich eine Selbsterfahrungsgruppe für Ehepaare. Die Ärztin Ago Bürki, die Frau des Leiters der VBG, Hans Bürki und als Kotherapeut Dieter Hanhart hatten dazu Ehepaare aus ihrem Bekanntenkreis eingeladen. Unter den Gruppenteilnehmern lernten wir René und Berti Stucki, das Paar Funkhouser und die Ärztin Marlies Dreifuss-Pauker mit ihrem Mann Alex kennen. Marlies kannte ich schon von ihrem Praktikum im Neumünsterspital. Später traf ich sie wieder in der Ausbildungsgruppe für Gestalttherapie (1981).
Von Ago Bürki, hörte ich zum ersten Mal etwas über die Gestalttherapie.
24.6
Ausbildung in Gestalttherapie. Diese Therapieform erlaubt einen unmittelbareren Zugang zu versteckten (verdrängten) Gefühlen und Trieben als die analytische Psychologie von Jung. So kam es, dass ich mich beim Fritz Perls Institut für Gestalttherapie zur Ausbildung anmeldete und nicht, wie Guggenbühl es gerne gesehen hätte, im C.G.Jung-Institut.
Ich las zwei Bücher von Fritz Perls, der mit seiner Frau Lore in den USA die Gestalttherapie eintwickelt hatten. Es sind Mitschriften von Therapiesitzungen, mit Ausbildungs-kandidaten. Neu und faszinierend war für mich das genaue Beobachten des körperlichen Ausdrucks von Emotionen. In wenigen Minuten (so schien es nach den Protokollen) wurde die „unerledigte Gestalt“ sichtbar, die vom Bewusstsein nicht zugelassenen Gefühle. Häufig kam es zu Tränen, die Fritz aber nicht lange unterstützte.
Das war nun die psychologische Behandlungsmethode, die ich brauchen konnte: Körperbezogen, direkt und kurz. In meiner eigenen Praxis musste ich allerdings lernen, dass bei schwer traumatisierten Patientinnen und Patienten eine Zehnminuten-sitzung nicht genügte. Es brauchte manchmal das ganze Spektrum von „Werkzeugen“, Imagination, Traumarbeit, Malen und Modellieren, Rollenspiele u.s.w. und das manchmal über Monate und Jahre. Doch jetzt hatte ich eine Tätigkeit als Arzt gefunden, die meiner Neigung und Begabung entspricht.
Um für die mehrjärige Ausbildung in Gestalttherapie zugelassen zu werden nahm ich am einwöchigen Auswahlseminar in der Nähe von Nürnberg teil. Zwei erfahrene Leiter waren beauftragt, die psychische Stabilität und die Motivation der Kandidaten einzuschätzen. Schon in diesem Auswahlseminar wurde bei mir eine längst verdrängte emotionale Spannung so sehr berührt und entlastet, dass ich einmal weinen musste. Das wurde von der Gruppe und den Leitern mitfühlend akzeptiert. Ich brauchte mich nicht zu schämen. Die Wirksamkeit der Gestalttherapie erfohr ich an mir selbst. In dieser Woche lernte ich die Psychiaterin Dagmar Zimmer kennen. Mit ihr entstand eine länger dauernde Freundschaft. Sie ermunterte mich, mit ihr zusammen eine Therapiegruppe zu gründen, noch bevor ich mich für genügend ausgebildet hielt. Die Zusammenarbeit mit Dagmar dauerte sechs Jahre. Mit der Zeit kam es zwischen Dagmar und mir zu Spannungen und ich bekam wegen der Verschlechterung meines Gehörs Mühe mit Gruppenteilnehmern einen Dialog zu führen. Dagmar führte die gemeinsam geführte Therapiegruppe noch eine Weile weiter zusammen mit einem Psychologen, der auch in Gestalttherapie ausgebildet war.
1984 Zum Lehrgang am FPI (Fritz Perls Institut) gehörte der vierwöchige sogenannte Kibbuz, Gruppen-therapeutische Intensivwochen auf der (damals noch jugoslawischen) Insel Dugi Otok. Die ersten zwei Wochen hatte Ruedi Signer und seine Partnerin Doris B. die Leitung, anschliessend eine ältere Ärztin, Hildegund Heinl(Orthopädin). Dabei kam es zur Beziehung mit zwdeutschen Fauen Hanne* aus Hamburg und Birgit* ei aus Wiesbaden (Venusberg!) *Namen geändert
24.7
Ein entgleistes Ausbildungsseminar . In einer Selbsterfahrungsgruppe kann sich im Kleinen abspielen, was sich im Grossen in der Gesellschaft ereignet: Vom mittelalterlichern Aberglauben bis zur faschistischen Pervesion im zwanzigsten Jahrhundert und fanatischen Bekämpfung von Andersdenkenden in der Gegenwart. Das ereignete sich in einem der Gestaltseminarien.
Wir waren in einem katholischen Hospiz in Einsiedeln untergebracht. Leiter der Gruppe war der Lehrtherapeut Richard Picker aus Österreich. Gleich in der ersten Sitzung machte uns Richard darauf aufmerksam, dass Einsiedeln als Wallfahrtsort eine besonders starke "spirituelle" Strahlkraft besitze. Wir sollen in der Klosterkirche um die "Engelskapelle" mit der schwarzen Madonna herumgehen und diese besondere Wirkung wahrzunehmen. Während den folgenden Sitzungen ging es weniger um Vermittlung von gestalttherapeutischer als um archetypische Erfahrung. Wir wurden von Picker bis in die Tiefe des kollektiven Unbewussten im Sinn von C.G.Jung angepeilt. Das hatte zur Folge, dass aus dieser Sellentiefe heraus tatsächlich atavistisches Verhalten aktiviert wurde, vergleichbar den Massenpsychosen in der Geschichte der menschlichen Gesellschaft.
Während einer der letzten Zusammenkünfte der Gruppe entstand folgende Konstellation:
In der Mitte des Raumes sass allein eine deutsche Kollegin am Boden. Nennen wir sie Helga*. Zur Rechten und zur Linken sass mit deutlichem Abstand von Helga je eine Hälfte der Gruppe am Boden. Ich sass dazwischen gegenüber von Helga. Picker war ausserhalb und schaute schweigend zu. Blond und jung und mit dem Ausdruck der Vezweiflung hätte sie, so wie sie war, das Gretchen im Faust darstellen können. Sie werde verfolgt von einem Kindervers, sagte sie, den sie nicht loswerden könne: "Morgens um sechs kommt die kleine Hex`". Sie glaube, sie sei selber eine Hexe geworden. Im Raum herrschte Hochspannung. Plötzlich blickte Helga anggsvoll in meine Richtung, aber ohne mich anzusehen und sagte aufgeregt: "Und du bist der Teufel!" Ich schwieg und wusste nicht, was tun. Endlich kam aus der Gruppenhälfte zur Linken eine schon erfahrene Gestalttherapie-Studentin, setzte sich neben Helga und legte ihr den Arm um die Schulter. So erlöste sie die "Hexe" von ihrem Wahn und mich von der Teufelsrolle. Eigentlich hätte Picker intervenieren sollen, um die Ausgrenzung von Helga zu verhindern.
Es war das eindrucksvolles Beispiel von Retraumatisierung statt Befreiung, aber eine lehrreiche Erfahrung., Ein Abbild im Kleinen von den den pathlogischen Massenphänomenen der Geschichte. Sie zeigt in nuce wie die Hexenverfolgungen in Mittelalter und Glaubenskriege bis heute zustande kommen: als Projektion von malignen Archetypen auf die anderen Mitmenschen.
24.8
Die Intervisiosgruppe. Die Diagnose und Behandlung von Menschen, deren aktuelles Leiden auf posttraumatische Zustände nach Vergewaltigung im jugendichen Alter hinweisen ("Inzest"), stellt den Therapeuten vor besondere Schwierigkeiten. Victory Spiegel und Eva Winitzki gewannen mich zur Teilnahme an einer diesem Themenkreis gewidmeten Intervisionsgruppe. Dazu kam die Ärztin Ilse Truninger, der Psychiater Gerold Roth und die Psychologin Erika Maag. Erika war damals noch in meiner Praxis als Psychotherapeutin tätig. Der errahrenste Therapeut war der Psychiater Dr.med.Christoph Hoffmann, der in Samaden praktizierte als einziger Psychiater im Engadin. Die Gruppe wurde kleiner durch den Tod von Ilse und den Ausschluss von Erika und löste sich auf, als Victory ausgetreten und Christoph nach St.Gallen umgezogen war.
24.9
Therapieerfahrungen: Inzest und Multiple Persönlichkeiten . Zu bedeutsamer Erfahrung kam ich durch eine junge Frau aus der Romandie (M.M.), die im Bethanienspital in Ausbildung zur Pflegefachfrau war. Ihr Leiden war die Folge schwerer sexueller Traumatisierung in ihrer Kindheit. Durch diese Patientin wurde ich zum ersten Mal aufmerksam auf die Folgen von inzestuöser Traumatisierung von Kindern. Seither erkannten nicht nur Psychiater, dass das bisher Undenkbare, nämlich sexueller Missbrauch schon von kleinen Kindern durch Angehörige oder Bekannte in der eigenen Familie leider sehr häufig ist. Solche Traumata führen meistens zu lebenslangen schweren seelischen Störungen. Damals wurde noch von gewissen Fachpsychiatern (u.a. von Frau Dr. Cécile Ernst) bestritten, dass es sich dabei um biografische Tatsachen handelt. Wie schon Sigmund Freud, glaubte man immer noch, sexuelle Fantasien und Ereignisse zwischen Kindern und Eltern kämen vom Kind aus und führten zu dem berühmten Ödipuskomplex. Wie vielen Tausenden von traumatisierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen hat diese von manchen Fachleuten inszenierte Verdrängung schweres Unrecht und Leiden zugefügt!
Von da an musste ich mich mit den seelischen Folgen nach sexuellen Verbrechen an Kindern beschäftigen. Es ist bei den meisten Menschen, die an solchen Störungen leiden nicht leicht, den Zugang zu den versteckten Trauma-Erinnerungen zu finden.
Dr.Christoph Hoffmann aus Samedan und ich besuchten einen Kongress in Amsterdam zum Thema „Multiple Personality Syndrome“, ein unheimlicher Zustand psychischer Spaltung, einer der Folgen von schwerer sexueller Misshandlung in der Kindheit. Die meisten Referenten, fast alles Frauen betonten die Häufigkeit dieser Krankheit, so häufig, dass es in den USA schon für die Behandlung der “Multiple Personality Synroms” gebe. Als eine der Vortragenden erzählte, es gebe PatientInnen mit bis zu zwölf abgespaltene Persönlichkeiten wurde ich skeptisch. Es schien mir, als ob diese Leute hier ins Esoterische abgleiten würden.
An diesem Kongress wurde gezeigt, wie solchen Menschen geholfen werden kann: In einer langdauernden ersten Phase durch geduldiges Zuhören, Stärkung Persönlichkeit und Aufbau einer vertrauenden Beziehung. Erst dann darf der Therapeut die Inzestvermutung zurückhaltend und vorsichtig vermitteln, selbst wenn sie schon bald am Anfang der Behandlung auf der Hand zu liegen scheint. Darin haben die Leute, mit dem "false memory syndrome“ recht: Bei zu forschen Vorgehen könnten die oft leicht beeinflussbaren PatientInnen auf eine falsche Fährte geraten. Ich hoffe und glaube, dass keine von mir behandelten Frauen und Männern infolge meiner therapeutischen Arbeit auf einen so unheilvollen Abweg geraten sind.
Eine wichtige Untestützung war mir das Buch von Ursula Wirtz mit dem Titel “Seelenmord“. Es war, soviel ich weiss, das erste deutschsprachige Buch über die sexuelle Vergewaltigung von Kindern durch erwachsene Personen und deren Folgen.
24.10
Die genannte M.M. war die erste meiner PatientInnen, welche sich an ihre von schwerer seelischer Verletzung belastete Kindheit erinnern konnte. Die schreckliche Erfahrung endlich jemandem anvertrauen zu können bringt die dringend nötige Entlastung. Doch während den ersten fünf Jahren (!)der Therapie sprach die Patientin ausser dem Notwendigsten nichts. Es fiel mir nicht leicht, jede Woche eine Stunde lang die Spannung auszuhalten, die von der Anwesenheit einer mutistischen Patientin ausging und nicht zu wissen, was ich tun oder sagen soll, um sie zum reden zu bringen.
Langsam erschienen spärliche Informationen über ihre Kindheit: Sie enstammt der christlich frommen Familie aus einem einsamen Gebiet des französischsprachigen Jura. Als Kind habe sie sich, oft im Gebüsch eines einsamen Bachtobels versteckt. Von ihrem achten Lebensjahr an bis zur Gegenwart kämpfte sie gegen die Versuchung, sich zu töten. Welche Erfahrungen haben bei dieser jungen Frau seit ihrer Kindheit Suizidalität verursacht? War das nicht das von Ursula Wirtz als "Seelenmord" Beschriebene ? Wie bringe ich meine Patientin dazi, darüber zu reden? Ich zeichnete ihr ein verschlossenes Tor und bat sie auf dieses Tor zu schreiben, was dahinter verborgen sein konnte. Was ist mit ihr in ihrer Kindheit hinter verschlossenen Türen geschehen? Sie beginnt nach und nach ihre Erinnerung zu erzählen: Die Mutter ist nicht wahrnehmbar. Das Kind ist allein mit dem Vater in der Stube. Dann geschieht Unaussprechliches. Das dennoch auszu-sprechen bringt ihr eine gewisse Erlaichterung. Aber sie kann nicht genau in Worte fassen, was der Vater dann mit ihr getan hatte. Die Suiziddrohung ist noch nicht behoben. Um sie für eine gewisse Zeit von ihrem Kampf gegen die Versuchung zum Sebstmord zu entlasten, schlage ich einen Aufenthalt in der Klinik Kilchberg vor, wo sie unter Kontrolle von aussen steht. Von dort kehrt sie erleichtert zurück, ist aber noch nicht in der Lage, die Ausbildung zur Pflegefachfrau wieder aufzunehmen. Sie stimmt einem Erholungsaufenthalt von einigen Wochen zu und ich melde sie in eine schön gelegenen Heimstätte im Tessin an. Von dort kam sie aber in der Seele verstört wieder zurück. Sie erzählte, dass einer der Leiter versucht habe, sie zu verführen. Die Erfahrung zeigt, dass in der Kindheit sexuell traumatisierte Menschen ihre Abwehrfähigkeit gegen Verführung und Vergewaltigung eingebüsst haben. Deshalb erleiden sie oft noch im Erwachsenenalter wiederholte Traumatisierung. Es ist als ob potentielle Täter merkten, welche Menschen sich zum Opfer eignen, mit wem sie leichtes Spiel haben würden. Schliesslich war sie von derVersuchung zum Selbstmord geheilt
Die Patientin konnte dreizehn Jahre nach dem Beginn die Therapie und auch ihre Ausbildung abschliessen und in einem Spital als Pflegefachfrau arbeiten. Etwas später berichtete sie mir von ihrer Heirat.
24.11
Leitsymptome und Behandlungen von Patenten nach sexueller Traumatisierung in der Kindheit
Bulimie und Anorexie:
Ruth.G. Der Vater ist Architekt. Die körperlich und psychisch asthenisch wirkende Mutter arbeitet nach der Scheidung als Büroangestellte.In einer der ersten Stunden erzählt Ruth einen bedeutsamen Traum: Der Balkon vor ihrer Wohnung ist voller Blumen Der Vater steigt von aussen auf den Balkon und reisst alle Blumen ab. Deutung: Symbolische Darstellung der "Defloration". Während der mehrere Jahre dauernden Psychotherapie ging es um Bearbeitung des Inzesttraumas. Das Resultat: Heilung von der Anorexie und Neuorientierung, Sie holte die Matur nach, studierte Psychologie und wurde Personalchefin in einem grossen Kozern.
Lena... konnte lange nicht über ihre schwere Bulimie sprechen. Es ist kaum zu Glauben, welche Mengen unausgewählter Nahrung sie in sich hineinstopfte. Sie blieb aber schlank, weill sie alles wirder erbrachen konnte. Störungen des Essverhaltens (bei Frauen und Mädchen zehn mal häufiger als bei jungen Männern) sind vermutlich nicht selten Folgen inzestuöser Traumatisierung. Während den ersten Monaten der Therapie konnte auch Lena nicht über sich reden. Es war der Vater, von Beruf Lehrer und überfromm christlich (!) der sie sexuell missbraucht hatte. Er lebte nicht mehr. Auf meine Einladung gab es eine Zusammenkunft von Lenas Familie: Es kamen die Mutter, die Schwester und die zwei Brüder.
Der ältere Bruder kann sich zar nicht daran erinnern, was Lene geschen war durch den Vater, aber er kann aus der Situation verstehen, wie das möglich war. Die Schwester erinnert sich daran, selber Übergriffe duch den Vater erlebt zu haben. Sie scheint aber weniger an den Folgen zu leiden. Der jüngere Bruder hingegen identifiziert sich mit dem Vater. Er hält sich fest an des Vaters starrer evangelikaler Frömmigkeit. Ein so frommer Mensch macht solche Sachen nicht. Er kann das nicht glauben. Die Offenheit der Mutter überraschte mich: "Jetzt verstehe ich manches", sagte sie.
Lena musste wegen ihrer Krankheit die angefangene Ausbildung zur Pflegefachfrau abbrechen. Sie fand nach einer von der Invalidenversicherung organisierten Ausbildung eine verantwortliche Stelle in einem Verlag. Nach der langjährigen Therapie war sie von der Bulimie geheilt. Nach den Erlebnissen mit dem Vater war für sie eine erotische Beziehung zu einem Mann undenkbar. Für ihr Bedürfnis nach Geborgenheit fand sie eine lesbische Partnerin.
Eine Frau mit Aids-Phobie (... B). In einer Einzelsitzung mit ihrem Ehemann wird deutich, dass er die Ängste seiner Frau für hysteriesche Inszenierung hält. Unfähig, sich in die Not seiner Frau einzufühlen, beauftragte er mich, als ob ich sein Garagist wäre, seine Frau wegen ihrer Verhaltensstörung gewissermassen zu reparieren. Von der Patientin erfahre ich, dass sie von diesem Ehemann seit Jahren keinerlei Zuneigung, Zärtlichkeit noch Intimität erhalten hatte. Sie konnte sich an keine Ursache ihr Angstzustände erinnern. Ich liess sie schliesslich mit geschlossenen Augen ein Stüch Modellierton bearbeiten. Als sie nach einer Weile die Augen öffnete sah sie zu ihrem Entsetzen einen grossen erigierten Penis. Das brachte die Erinnerung an schwere sexuelle Traumatisierung in ihr Bewusstsein zurück. Zur Bearbeitung des Traumaerinnerungen brauchte es dann noch viele anschliessende Therapie-sitzungen bis zur Überwindung ihrer Ängste. Ich konnte sie als geheilt entlassen. Ungelöst blieb ihr Leiden an der Kälte des Ehemannes.
Patientin E.L.: Sie hat seit ihrer Kindheit eine medizinisch ungeklärte, vermutlich psychogene Paraparese und Anorexie. Ihr Vater war ein schwer alkoholkranker Koch. Sie erinnert sich daran, dass der Vater sich mit ihr, dem drei- bis fünfjährigen Mädchen in einem Kellerabteil mit Betonwänden einschloss und sich mit Fremdkörpern an ihrem Genitale zu schaffen machte. Die Mutter verlangte, dass sie anstelle des Vaters mit ihr das Bett teilte. Von ihr aus sollte sie, wie es die ”fromme” Mutter getan hatte, zu dessen Rettung einen Alkoholiker heiraten, (obschon die Rettungsaktion der Mutter offensichtlich mislungen war). E. lebte lange selbständig. in einem geschützten Wohnheim. Später kam sie in ein Pflegeheim. Ihre Lähmung blieb unverändert ebenso die schwere Ernährungsstörung. Sie war etwa sechzig Jahre alt als sie starb.
Junger Norditaliener. Während der Therapie mit diesem jungen Mann zeigte sich, in welche besonderensituationen ich manchmal geraten bin. Der Vater nahm einmal an einer Therapiesitzung teil gemeinsam mit dem Patienten. Er hielt es für beleidigend und unzumutbar, ihn sexueller Übergriffe an seinem Sohn zu verdächtigen. Nachdem er mit seineer Familie das entberungsreiche Leben zur Kriegszeit habe durchstehen, sei es eine ungerechte Zumutung ihn als verantwortlich zu halten für die Probleme des Sohnes. Dieser leidet daran, dass er im öffentlichen Raum, überall wo Menschen stehen oder gehen, beim Anblick jeder Frau sexuell erregt wird. Er wird vom Wahn verfolgt, sie sogleich besitzen zu müssen. Er hatte sich einer Selbsthilfegruppe angeschlossen, die sich ähnlich den Anonymen Alkoholikern "Anonyme Sex-Süchtige" nennt.
Zwei kaum lösbare Schwierigkeiten können eine solche aufdeckende Inzesttherapie erschweren: Der Patient kann sich nicht genau daran erinnern wann, wo und auf welche Art der Übergriff stattfand und wenn sich der mutmassliche Täter nicht erinnern kann oder will. Der Therapeut kommt in Gefahr, vom Täter der Verleumdung verdächtigt zu werden. In solchen Fällen drängt sich auch die Fraage auf, ob die Erinnerung der objektiven Wirklichkeit entspricht oder falsch gespurt ist. Es ist gefährlich, wenn der Inzestsverdacht vom Therapeuten ausgesprochen wird. Es gilt abzuwarten, bis der Patient sich sponatan an das Trauma erinnert. Das ist ainer der Gründe, weshalb solche Psychotherapien oft sehr lange, Monate oder gar Jahre dauern.
24.12
Gestalt-Lehranalyse. So wie Sigmund Freud für die Ausbildung zu Psychoanalytiker eine Lehranalyse verlangt hatte, wird für künftige Gestalttherapeuten gefortert, dass der Lernnende sich selbst einer Analyse unterzieht. Es soll damit vermieden werden, dass der Behandelnde seine eigene unbewusste Problematik mit derjenigen seiner Klienten oder Patienten vermischt. Auf Empfehlung von Ruedi Signer meldete ich mich bei der Psychiaterin Dr.Elisabeth Leupold. Sie wohnte in Basel, so dass ich nun für mehrere Jahre zunächst zwei, später einnal in der Woche nach Basel reiste. In der Nacht vor der ersten Sitzung hatte ich einen auffälligen Traum, einen sogenannten Initialtraum:
"In Basel musste ich an einem der Automaten das Trambillet beziehen. Nachdem ich das Geld eingeworfen hatte, spukte der Automat eine nicht abbrechende Reihe von anainanderhängenden Billeten aus. Als ich Elisabeth diesen Traum erzählt hatte hörte ich sie ganz deutlich sagen: "Das ist die Frucht vieler Jahre".
Ich bat sie, mit zu erlären, was sie mit diesem Satz habe sagen wollen. Darauf war sie sehr erstaunt: Sie habe nichts gesagt. Dieser Satz war also eine Sprachhaluzination von mir, ein Hinweis auf die grosse künftige Bedeutung dieser jahrelangen Lehranalyse.
Wenn ich nun auf meinen Reisen nach Basel aus dem Zugfenster blickte spürte ich jedes Mal meinen Trübsinn. Es war die lange, viel zu lange Zeit, der mittlerweile schwer gestörten Ehe mit Verena. Ich konnte damals nicht wissen, weshalb und woran ich eigentliich so gelitten hatte. Ich erinnere mich, dass ich einmal zu Elisabeth gesagt hatte: "Ich finde die Freude nicht mehr". Alles was ich sah und hörte, selbst jede banale Sinneswahrnehmung löste eine Art von psychischem Schmerz aus. Ich war wieder in eine Depression geraten. Es war an einem Frühlingstag Ende März, nach etwa einem Jahr Psychotherapie da entdeckte ich plötzlich dass ich die bescheidenen kleinen Blumen in den Vorgärten dieses Quartiers wieder zu "spürten" begann Es ging ein bescheidenes Gefühl der Freude von Ihnen aus. So unscheinbar der Anlass, so überwältigend war das neue Wiedererleben aus meiner Kindheit und Jugendzeit.
Worin bestand denn die Therapie bei Elisabeth? Nicht in klassischer Gestalttherapie wie sie in den Büchern von Fritz Perls protokolliert ist. Eigentlich war sie noch näher bei der Analyse von C.G.Jung mit Gesprächen über Träume und über Beziehungserfahrungen, vor allem über die zunehmende Belastung durch meine Ehe . Einen grossen Platz nahm in unseren Gesprächen die Supervision ein. Sie gab mir Hinweise und Ratschläge im Umgang mit meinen Patienten. Es gab eine Zeit mit sieben Borderline-Patienten, deren Behandlung sehr anspruchsvoll und oft enttäuschend ist.
Nachdem ich wieder Zugang zu meinen Gefühlen gewonnen hatte, fand ich auch die Freiheit, den mir selbst auferlegten Ehezwang aufzugeben und andere Frauen kennen zu lernen.
Corinna kam einmal mit in eine Theapiesitzung, in anderes Mal B.. Jedesmal lenkte E. meine Aufmerksamkeit auf meine unbewusste Tendenz, mich in der Freundschaft mit einer Frau selbst zu verlieren und in der Folge wieder depressiv zu werden. Das war wahrscheinlich auch einer der Gründe gewesen, weshalb die Ehe mit Verena schliesslich zerbrochen ist.
Elisabeth Leupold beschäftigte sich intensiv mit esoterischem Gedabkengut. Sie veranlasste mich, von einem neutralen Institut mein Horoskop herstellen zu lassen, obschon ich diese "Wissenschaft" für Aberglauben hielt. Doch erstaunte mich, mit welcher Treffsicherheit diese professionellen Astrologen meine Eltern und meine Beziehung zu ihnen charakterisierten.
Ich muss gestehen, dass mich eine andere esoterische Vorstellung von E. lange Zeit fasziniert hatte, die Lehre von der Reinkarnation, wie sie ein hochgebildeter liebenswürdiger ungarischer Psychotherapeut namens Gostonyi vermittelte. Ich konsultierte ihn mehrmals. Mit Hilfe einer geführten Meditaion liess er mich in die Tiefe meines Unbewussten hinabsteigen. Dann tauchen Bilder auf, die symbolisch oder real Begebenheiten aus früheren "Inkarnationen" darstellen. Auf diese Weise erlebte ich mich in den unterschiedlichsten männlichen oder weiblichen Gestalten und historischen Epochen, vom Sklaven im alten Ägypten bis zum Zeitungsboy in einem Bahnhof im 19. oder frühen 20. Jahrhunderts. Eine der letzten "Erinnerungen" führte mich in die Zeit der Romantik. Ich liebte eine junge Frau aus grossbürgerlicher Familie, musste aber hinnehmen, dass sie starb bevor ich sie hatte heiraten können.
Gostonyi gab Vorträge, die als Tonbandkasetten erhältlich waren und schrieb Bücher. Manche der von ihm beschriebenen Erfahrungen erklärten scheinbar überzeugend das Schicksal einzelner Menschen oder Familien.
Das Wiedererwecken von Erinnerungen an frühere Existenzen kann interessant und faszinierend sein. Es birgt aber die Gefahrr nichts anderes zu bewirken als die Befriedigung narzisstischer Wünsche. Dem Ego schmeichelt die Vorstellung, früher einmal eine hochstehende Persönlichkeit gewesen zu sein. Ich bezweifle, dass eine so egozentrische Hypothese der psychischen Gesundheit und Vitalität zuträglich ist. Ich habe mit die Reinkarnationtheorie angesehen und sie schliesslich verworfen, um mich nach eingen Jahren auf das Paradigma des christlichen Glaubens einzustellen.
Von zwei während derr Therapie bei E. erlebten Ereignissen gilt es noch zu erzählen: Die Erfahrung von Hypnose und das Maskenseminar mit Bernward Weiss.
24.13
Hypnose. Während meinen Lehranalysejahren bei Elisabeth Leupold experimentierten wir auch noch mit einem anderen Zugang zum Unbewussten, dem ”Alpha-Training" (den Namen der Erfinderin dieser Methode habe ich vergessen). Ähnlich wie unter Leitung von Gostonyi geht es dabei um den imaginierten Abstieg aus der bewussten Oberwelt in die "unteren" Regionen der Psyche.
Dann kam die Vermutung auf, ich könnte als Ursache meiner "Neurose" auch gewisse Traumen in der Kindheit erlebt haben. Manche sind mir noch in Erinnerung (von Seiten der Mutter). Aber es konnte sein, dass es noch unerledigte Gestalten gab. die mit Hilfe von Hypnose ins Bewusstsein gehoben werden könnten. Elisabeth empfahl mir eine in dieser Therapieform erfahrene Psychiaterin in Basel. Ich lernte bei ihr die Technik der Hypnose und es schien, als ob eine verdrängte Kindheitserfahrungin in die Erinnerung auftauchte würde. Nachträglich aber war ich von der biografischen Wirklichkeit dieser Andeutungen nicht überzeugt.
Das Psychodrama nach dem Psychiater Moreno ist eindrucksvoll und für gewisse Menschen als Selbsterfahrung oder als Therapie sehr wirksam. Eine Ähnliche Form der Erfahrung bot der deutsche Psychologe Bernwart Weiss an. Jedes Jahr gab er einen vierzehn Tage dauernden Kurs, der in einem alten Kloster in Süddeutschland abgehalten wurde. In der ersten Woche fertigte jeder Telnehmer eine Maske an mit Hilfe von Ton, Gips und Papier. In einer Turnhalle übte man die Gelenkigkeit des Körpers und die Art, wie man sich als Pantomime auf der Bühne bewegt. In dieser ersten Woche las Bernward die Geschichte von Amor und Psyche aus dem Märchen "Der Goldene Esel" des römischen Dichters Apuleius vor. Davon ausgehend liessen sich in der zweiten Woche auf einer improvisierten Bühne ohne Sprache Geschichten darstellen.
Mit meiner Maske und in einem von einer Kollegin ausgeliehenen langenm weiten hellblauen Kleid stellte ich eine etwas deprimierte Pyche dar. Als ich mich im Umkleideraum so als traurige Frau im Spiegel daherkommen sah, erschrak ich: Das war doch "meine kranke Anima" wie Elisabeth mein "Alter Ego" einmal bezeichnet hatte! Sie war auf diese Diagnose gekommen wegen meinen verunglückten Beziehungen zu Frauen. Im Drama. das ich in dieser Rolle spielte, lag ich schlafend in einer Art Gefängnisturm. Ich erwachte mit einem lauten Schrei als sich mir ein Ungeheuer näherte. Es war Corinna. die sich eine Art Minotaurusmaske gemacht hatte. C. wurde nachher für etwa zwei Jahre meine Freundin. Sie war Kinderpsychologin, lebte in München und arbeitete an einem Film über Entwicklungspädagogik.
24.14
Der Praxiskollege Dr.med.Conradin G. Schrafl. Im Jahr 1985 verliess ich die somatische Medizin und beschränkte mich auf Psychotherapie mit Betonung auf Psychosomatik und Traumatologie.
Die Innere und die Tropenmedizin überliess ich meinem Praxispartner Coni Schrafl. Seit 1981 teilte ich die Praxis mit ihm. Umm 1990 hatte es einschneidende Umwälzungen für die Honorarabrechnungen gegeben. Um für die Krankenkassen abrechen zu können, wurden die Ärzte gezwungen, sich an ein rigides und kompliziertes, "TARMED" genanntes System zu halten. Dazu brauchten wir die Hilfe einer auswärtigen und teuren Firma. Dieser neue bürokratische Aufwand brachte den Kollegen Coni bald an die Grenzen seiner Geduld. 1997 gab er seine Praxis auf. Wir trennten uns und verliessen die Räume am Mittelbergsteig. Ich fand einen für meine Psychotherapien genügend grossen Raum bei der Psychologin Noëmi Holtz am Sonneggsteig.
Coni liess sich als Schiffsarzt auf Kreuzfahhrten anheuern. Dazu leistete er noch einen Beitrag an medizinische Hilfsprojekte in Borneo. In seiner Bescheidenheit hatte er mir das verschwiegen. Ich vernahm es erst bei der Abdankung. Coni war während einer Krezfahrt nach Grönland plötzlich gestorben, Von seiner Frau, Chan, hatte ich vernommen, dass Lungenembolie die Todesursache war.
(cf. Kp. 29. "Vom Mittelberg an die Sonnegg".

25.1
Wie hiessen sie, die den Venusberg bevölkerten?
Salome, Malina, Annemarie, Birgit, Corinna, Elsbeth, Doris, Maja, Karin, Mara*,
Der Blick zurück, welche Gefühle weckt er? Schuld? Reue? Trauer? Sehnsucht?Was suchte ich damals?Wahrschenlich narzistische Bestätigung. Und, ich gebe es zu: erotische Erfüllung.Schon von 1980 an war ich innerlich in einem desolaten Gefühlszustand. Ich war schon 48 Jahre alt, doch unfähig mein Chaos in Ordnung zu bringen.Nachdem ich mich 1985 von Verena getrennt hatte, irrte ich dreizehn Jahre lang verstört im Venusberg herum, suchte Liebe und eine Bleibe.Beides schenkte mir schliesslich Hélène, nachdem ich ihr 1998 begegnete war.
* Die Namen sind geändert
25.2
Im Auswahlseminar für die Ausbildung in Gestalttherapie entstand mit den zwei Schweizer Teilnehmerinnen Malina* und Dagmar eine jahrelange Freundschaft. Mit beiden war es zu Zärtlichkeiten gekommen, wie ich sie seit langem nicht mehr erlebt hatte. Doch viele Jahre später gingen beide Freundschaften in Brüche.
Fast jedesmal war die Initiative für eine Beziehung von der Frau ausgegangen. Wenn eine Frau mir zu verstehen gab, dass sie mich attraktiv finde, wirkte das auf mich überwältigend; auf alle Verführungen musste ich eingehen.
Der Verlauf aller folgenden Frauenfreundschaften folgte dem gleichen Muster. Alle begannen mit einem erotischen Strohfeuer und fastalle fanden nach einem explosiven Zerwürfnis ein abruptes Ende. Ich ging zu rasch vor und war zu wenig wählerisch, ging blindlings eine nach der anderen Beziehung ein und merke das Störende oder Fehlende zu spät. Dann ist es vielleicht der Rest meiner schon beschriebenen Neigung zu Jähzorn: nach längerem, manchmal kaum bewusstem Ertragen von Spannungen und Enttäuschungen, eine Freundschaft im Zorn plötzlich abzubrechen.
25.3
Für die Episoden mit Annemarie* und Birgit* fühlte ich mich Verena gegenüber schuldig. Es war noch zur Zeit meiner Ehe Einmal habe ich Verena bewusst angelogen. Ich glaubte ein Recht dazu zu haben. Wahrscheinlich hat sie meine Lüge gemerkt, aber nicht weiter nach der Wahrheit gestochert.,
Malina*. Um die Weihnachtszeit 1980 fand in einem abgelegenen Dorf in der Nähe von Nürnberg das Auswahlseminar für den Ausbildungskurs in Gestalttherapie statt. Ich wurde ohne weitere Auflage angenommenen. Es gab in dieser Gruppe zwei Frauen aus der Schweiz. Dagmar war Assistenzärztin am Institut für Sozialpsychiatrie.
Die Bekanntschaft mit ihr und mit Maina” setzte sich nach dem Auswahlseminar fort.
Malina* traf ich jeden Donnerstagmittag, zuerst in der ”Bodega“ und später im”Grünen Glas” zum Mittagessen. Malinas* Liebeserklärung lautete: ”Wenn ich Armin*, (ihr Partner und späterer Ehemann) verlieren würde, wärest du die nächste Wahl.“
Malina* ist eine sehr schöne, elegante Frau. Unsere Gespräche waren aber nie besonders anregend. Es ging meistens um Filme, die ich selber nicht gesehen hatte, und um ihren Beruf: psycho-motorische Therapie mit Kindern. Ich war recht stolz, mich mit einer charmanten, schönen, zwölf Jahre jüngeren attraktiven Frau in der Öffentlichkeit zu zeigen. Meinem Selbstwertgefühl tat es wohl. Während einer beruflichen Abwesenheit von ihres Ehemannes Armin Sch*. verbrachte Malina eine Nacht bei mir an der Büchnerstrasse. Doch es war kein “coup de foudre”.
Dann erkrankte Armin* sehr schwer. Ich weiss nicht, weshalb ich so hartherzig war und ihn nie besuchte. Ich hatte zwar versucht, meine Eifersucht zu überwinden, doch es war mir bewusst, dass ich, falls sie Armin verlieren würde für Maina nur die Rolle eines Lückenbüssers zu spielen hätte. Was geschieht, wenn ich solche Gefühle bekämpfe, nicht wahrhaben will? Es stellen sich Fehlleistungen ein, wie sie Sigmund Freud in seiner ”Psycopathologie des Alltagslebens” beschrieben hat. Ich vergass einige Male unser Rendez-vous, bis eines Tages Malina, kaum im ”Grünen Glas” angekommen, das Restaurant wieder verliess. Nach ein paar Schritten auf der Trottoir drehte sie sich nochmals zu mir um und sagte: Wenn du willst, kannst du mir ja einmal anläuten.
Ich habe nie angeläutet.
Zwei Wochen später las ich in der Zeitung, Armin* sei gestorben.
25.4
Annemarie* lernte ich in der ”Europäischen Akademie für Integrative Gestalttherapie“ in Hückeswagen in der Nähe von Köln kennen, eine hübsche, etwas mädchenhafte blonde Lehrerin aus Essen. Um einen Grund zu haben, mich mit ihr zu treffen, plante ich für ein paar Tage eine Kulturreise nach Belgien und damit ein Treffen mit Annemarie* zu vebinden. (Verena hatte kurz vorher auch allein eine solche Reise nach Belgien unternommen.)
In Köln hatte ich ein Auto gemietet und fuhr mit Annemarie ins Eifelgebirge. Dort verbrachten wir die Nacht in einem schön gelegenen Landhotel. Den stärksten bleibenden Eindruck erlebte ich als Annemarie nackt aus der Dusche kam: Welch anmutige, reizende Schönheit darf ich jetzt in die Arme nehmen! Doch wir beide standen unter spannungvoller Erwartung und Schuldgefühlen. Auch für sie war unsre Begegnung ein geheim gebliebener Seitensprung. Die ungeduldig erwartete Beglückung konnte sich unter dieser Voraussetzung nicht einstellen. Wir setzten zwar den schon vorher geführten Briefwechsel noch eine Weile fort, sie schickte mir noch einige Aktfotos von ihr (die ich verloren habe!). Noch lange nach der verunglückten Liebesnacht litt ich unter “chagrin d’amour“, war über mich selber wütend und hatte Verena gegenüber ein schlechtes Gewissen. Wenn ich mich mit Frauen einlassen wolte, wollte ich kein Doppelleben führen mit seinen unumgänglichen Heimlichkeiten und Lügen.
25.5
Doris*
Weder Doris noch ich sind jüdischer Abstammung oder Glaubens. Doch wir begegneten uns in der Synagoge der Liberalen Jüdischen Gemeinde in Zürich. Es war an der Bar-Mizwa-Feier eines der zwei Söhne von Myriam B.. Doris war als Freundin und Hüterin ihrer zwei Buben eingeladen. Ich kannte Myriam, da sie in unserer Vorbereitungsgruppe für die Abschlussprüfung in Gestalttherapie mitgewirkt hatte.
Für die Zeremonie in der Synagoge kam ich neben Doris zu sitzen. Während sich vor uns das religiöse Ritual abspielte, entstand im Geheimen zwischen uns wortlose erotische Anziehung.
Wir waren auch zum festlichen Abendessen eingeladen. Doris und ich richteten es so ein, dass wir am Tisch einander gegenüber sassen. Wir kamen mit einem uns beiden bekannter Gast ins Gespräch.( Der Vater von Eva W.), einer Kollegin aus der Gestalttherapie). Er redete uns an, als wären wir ein Liebespaar, obschon Doris* sichtbar eine Generation jünger ist. Einunddreissig Jahre ist der Altersunterschied.
Sie erzählte, sie sei in Sao Paulo in Brasilien aufgewachsen.
”Fala portiguês?” frage ich. “Sim, falo”. Jetzt plauderten wie einige Sätze in der Sprache, die mir seit den Jahren in Moçambique noch in Erinnerung war.
Da in Brasilien der Vater gestorben war, kehrte die Mutter mit ihrer Tochter Doris und den zwei Söhnen nach Europa zurück. Doris besuchte in der Schweiz das Gymnasium und brgann in Zürich Psychologie zu studieren. Alsls ich ihr begegnete, war sie seit einiger Zeit mit ihrem Studium ins Stocken geraten. Die Anforderungen des Studiums hatten bei ihr Erstarrung und Angst ausgelöst. Während unserer Freundschaft wurde sie von der Erstarrung und den Ängsten geheilt und sie schloss ihr Studium mit einer aufwenigen Lizentiatsarbeit ab. Sie hat in der Folge eine Stelle als Kinderpsychologin gefunden
Da wir in Gesellschaft als Paar auftraten, lösten wir bei Freunden und Bekanntenl oft verwunderte Fragen aus.
Wir folgten gemeinsam einem Grundkurs in systmischer Familientherapie in Bern. Auch für die zwei Kursleiter die Drs. Liechti und Zbinden war unsere Beziehung ein Rätsel. Oft fühlte ich mich selber fremd und deplaziert, wenn wir mit Freunden aus der Altersgruppe von Doris zusammen waren, ein Sechzigjähriger mit Dreissigjährigen!
Ich wurde aber von allen nicht nur akteptiert, sondern als Freund aufgenommen.
Zurück zur Bar- Mizwa-Feier.
Nach dem Abendessen, als sich die wäre es auch für mich an der Zeit gewesen, mich bei Myriam zu bedanken, mich von Doris zu trennen und nach Hause zu gehen. Statt dessen machte ich den Vorschlag, sie mit dem Auto zu ihr nach Hause zu bringen.
Vor ihrer Wohnung angekommen, sagte sie: “Möchtest du noch zu einem Tee herinkommen?” und dann: “Du kannst auch hier übernachten”.
Nachdem ich mich geduscht hatte, hörte ich sie sagen. “Ich habe Lust”. Da schlüpfte ich zu ihr ins Bett.
Das war unsere erste Liebesnacht. Ihr folgten während zwei Jahren noch Viele.
Liebe mit Doris* bewegte mich bis tief zuinnerst. Es ist schwer zu beschreiben, wie es kam, dass es mich einmal bis zum Weinen zu erschüttern vermochte. Eine alte Sehnsucht erfüllte sich.
Von Friedrich Nitzsche stammt dder Satz: ”Jede Lust will Ewigkeit, tiefe, tiefe Ewigkeit.”
Aber mit Doris* gab es keine Ewigkeit. Das wirkliche Leben lässt das nicht zu. Es ist zu hart. Auch von Doris musste ich Abschied nehmen.
* Namen geändert
Der Venusberg schickt mir die Rechnung: einen Herzinfarkt. Der psychosomatische Zusammenhang ist überdeutlich: solchen Eskapaden war das Herz eines Tages nicht mehr gewachsen.
Bei den rückenmuskel-stärkende Übungen auf dem Laufband verspürte ich zunehmend Schmerzen hinter dem Brustbein.
Ich bat Coni Scharfl um ein Elektrokardiogramm. An der Repolarisationsstörung der Herzvorderwand war nicht die Fehlschaltung durch seine Praxishilfe Ivonne, schuld, wie Coni zuerst meinte, sondern Zeichen eines nicht mehr akuten Septum-Vorderwandinfarktes. Er wies mich an den Kardiologen am Bethanienspital, der die Diagnose bestätigte und mich an Professor Hirzel wies. Am 27.Juni 1996 operierte mich Professor Hirzel im Hirslandenspital Zürich. Ihm gelang das Meisterstück, indem er mit der Sonde von der rechten Femoralarterie aus den verengten dritten Seitenast der Interventrikulären Arterie erweiterte und zwei Manschetten, ”Stents“ einführte. Ich konnte das Prozedre auf dem Bildschirm verfolgen. Ich sah auch, dass etliche andere Zweige der Kranzgefässe einengende Plaques aufwiesen: Bereit um den nächsten Infarkt zu produzieren?

26.1
Schule und Gruppen
Primarschule: Hannes Ginsberg, Peter Hindemann.
Seekundarschule: Kurt Zindel, Fritz Römer.
Gymnasium: Hansjörg Siegenthaler, Georg Weber.
Studium: Ueli Aeppli, Jeremias Kägi, August Meier.
Studentenbibelgruppe: Hansruedi Koller, Emmanuel Pfähler, Toni Wanner, Hans Bürki, Ago Bürki, Hans Bernath, Evi und Robert Constam, Heini Fricker, Ueli Jutzi, Sam und Priska Jenni, Peter Baumann, Robert Rüegg, Daniel Vischer, Thomas Wiesmann.
Psychotherapie, FPI: Dagmar Zimmer, Maly Schreier- Schaub, Christoph Hofmann, Gerold Roth, René Stucki, Myriam Spiegel.
Im Zusammenhang mir dem Hausbau Feldmeilen kam es zur Freundschaft mit den Achitekten Thomas Meyer, und mit dem späteren Psychiatrie-Kollegen Reto Heimgartner.
26.2
Verlorene und wiedergefundene Freunde Manche Freundschaften und Freundschaftsangebote sind zerbrochen, habe ich leider übersehen, abgelehnt oder vergessen. Oder sie haben wegen irgendeinem ungeklärten Missverständnis zu Distanz geführt .
Thomas Wiesmann war der Sohn des Kantonsbaumeisters, dessen Lebenswerk die Restauration des Zürcher Grossmünsters ist, Dieser war kurz nach der Vollendung gestorben und hinterliess die Tochter und ihren etwas jüngeren Bruder Thomas. Seine Frau war die als “schöne Jüdin“ bekannte Pianistin. Thomas war mein Banknachbar im ersten Jahr des Gymnasiums. Unsere Freundschaft bewirkte, dass er sich kurz nach mir zum christlichen Glauben entschied und das folgerichtige Leben eines Christen führte, viel geordneter und konsequenter als ich. Nach Abschluss seines Architekturstudiums reiste er nach Kansas und Kalifornien in die USA um drei Jahre im ”Fuller Theological Seminary“ zu studieren. 1961 kam er zurück, verheiratet mit Susan, einer Amerikanerin. Für die ersten Wochen, bis sie eine eigene Wohnung fanden, lebten sie mit uns in der Parterrewohnung an der Freiestrasse 17. Thomas arbeitete 25 Jahre in Zürich als Architekt, dann verbrachte er mit seiner Frau zwölf Jahre in Jerusalem. Er konnte sich in Israel niederlassen, weil er durch seine Mutter als Jude anerkannt ist. Thomas erkrankte vor teinem Jahr, Er ist am 29. Juli , am Tag nach seinem 83. Geburtstag, gestorben.
(Wann wird es für mich Zeit sein, mit meinen 84 Jahren?)
Von einigen Freunden aus der Zeit der Studentenbibelgruppe hatte ich Abstand genommen, weil mich sie Art ihres Christentums auf eine Art entwickelt hatte, die mich befremdete.
26.3
Während der Mittelschulzeit
Vielleicht hatte ich einen Teil der Konflikte, die ich in mir selber herumtrage, auf gewisse Freunde projiziert und mich von ihnen abgelehnt gefühlt. Unfair habe ich mich Georg Weber und seiner Frau Silvia gegenüber verhalten. Da war es meine intolerante Ablehnung der Lebens- und Sprechweise von Silvia, die mich von Georg entfremdet.
27.4
Küngolt Baumann war bis kurz vorher die Freundin von Georg Weber gewesen. Ich wusste aber noch nicht, dass diese Freundschaft abgeschlossen war. Küngolt hatte platinblonde Haare und wurde deshalb “Silberchüngel“ genannt. Es war an einem Fest im Waldhäuschen, das der Abteilung für Pfadfinderinnen gehörte. Ich war eingeladen durch Mädi Lutz, die mich schon an den Roverball im Hotel Belvoir in Rüschlikon eingeladen hatte. Mädi war eine etwas burschikose Pfadfinderin, Tochter der Dichterin Maria Lutz-Gantenbein. Sie war älter als ich und hätte, wie ich von Hans Gerber später hörte, mich gerne zum Freund oder Geliebten gehabt. In diesem Waldhaus fand ein Nachfest statt. Die Eingeladenen sollten sich verkleiden. Küngolt gab sich als verführerische Andalusierin. Ohne bewusste Absicht sie zu umwerben, begann ich, nachdem ich etwas Alkohol getrunken hatte, sie mit den mitgebrachten amuse-bouches zu füttern. Ich steckte ihr einen Bissen nach dem andern ins Mäulchen indem ich dabei ihr neckisches Gesichtsnetzchen aufheben musste. Als ein wenig später Mädi bemerkte, Küngolt hätte sich in mich verliebt, war ich sehr erstaunt. Ich hatte während meiner Mittelschul- und Studienzeit ein so miserables Selbstwertgefühl, dass es jenseits meines Vorstellungsvermögens war, ein Mädchen könnte sich in mich verliebt haben. Ausserdem wollte ich sie meinem Schulfreund Georg Weber nicht ausspannen.
Die Cousine Esther Während mein Freund Fritz Römer schon mit einem Mädchen aus seiner Nachbarschaft zu nächtigen pflegte, liebte ich heimlich meine Cousine Esther Burckhardt aus Basel. Fritz hatte auch schon eine Fotokamera und knipste die Esthi ab im Konfirmandinnenkleid und dem weissen Kränzchen im Haar. In Jener Zeit hörte ich zum ersten Mal die Appassionata von Beethoven und das erste Klavierkonzert von Tschaikowski. Diese Musik und der Duft der Phresien, welche Esthi meiner Mutter gebracht hatte, wecken bei mir immer noch diese verliebte Stimmung des Adoleszenten.
Einige Beziehungen lösten sich leider mit der Trennung von Verena auf: John und Lois Williams, aus Nordirland (Ulster), Arztkollege vom KCMC und Conrad, Ökonom in Tansania und Paula (aus Holland).
26.5
Ephemere und verborgene Gefühle
Die Operationsschwester Hanni auf der chirurgischen Abteilung des Bürgerspital Solothurn hatte keine Chance: ich war nämlich mit Verena schon verlobt und dann verheiratet. Dennoch erinnere ich mich manchmal mit einer gewissen Wehmut an Frauen, die mir gewogen waren, was ich Tölpel meistens nicht einmal merkte. Es war mir aufgefallen, dass die Hanni beim Instrumentieren ungewöhnlich häufig ihr Näschen am Rücken meines sterilen Operationsmantels reiben musste, weil es während dem Operieren nicht möglich war, sich die Nase zu putzen,
Anne Emery aus Neuchâtel, war bei Madeleine und Hans Bernath in Nazareth zu Gast war (cf.Kap. 14). Anne signalisierte deutlich ihre Zuneigung zu mir, aber ich war blockiert durch die von Madeleine inszenierte virtuelle Verlobung mit der mir ganz unbekannteN Verena Kuhn in Zürich
Margrit Rüefli, der Leiterin der Kinderabteilung im Missionsspital Chicumbane (Moçambique) (cf.Kap. 20). Auch von Margrit nahm ich deutliche Zeichen ihrer Zuneigung wahr. Und sie gefiel mir mit ihren tiefschwarzen Haaren und Augen. Sie konnte mir über alle die l schwer kranken Kinder mit grosser Fachkenntnis referieren, so dass ich nur wenige noch selber untersuchen musste. Sie hatte auch in kürzester Zeit Schangan, die lokale Sprache, gelernt, konnte also mit den Kranken und den Angehörigen sprechen ohne Hilfe einer Übersetzerin.

27.1
2004: Dr. Schrafl verlässt die Praxis am Mittelbergsteig. Sie wird geräumt. Coni Schrafl sitzt betrübt in einer Ecke der hinteren Zimmers, wo die Kaffeemaschine und die Kästen mit seinen Krankengeschichten stehen, während seine Frau, die unermüdliche Chan, am Aufräumen ist.
Ich selber habe nicht viel zu Zügeln. Die Stühle im Wartezimmer kommen in meine neue Praxis am Sonneggsteig, die Miller-Stühle nimmt Hanna, wie auch den riesigen demontierbaren Nussbaumschrank. Ich weist nicht mehr, wohin das Kanapee kam und der Schreibtisch. Ich war rasch fertig mit dem Aussortieren und Packen.
Warum wollte Coni Schrafl die Praxis aufgeben? Schon zu Beginn unserer Zusammenarbeit hatte er beschlossen, nicht weit über das fünfzigste Lebensjahr hinaus zu praktizieren. Der auslösende Faktor war die Einführung eines für die ganze Schweiz gültiges Arzttarifsystem, das ”Tarmed“. Coni und ich hatten beschlossen die Hilfe einer Abrechnungskasse zu benutzen, die ein einfaches elektronisches Übermittlungssystem der Arztleistungen anbietet, die Herstellung und den Versand der Rechnungen und das Inkassowesen übernimmt. Ich schätzte das als enorme Erleichterung. Coni war von Anfang an skeptisch. Mit der Zeit gab es Änderungen der Tarifstruktur. Laboruntersuchungen, das ist ein Grossteil des Einkommens von Internisten, werden schlechter bezahlt. Für die so genannt intellektuellen Leistungen, die Erhebung der Anamnese und die physikalische Untersuchung, beides die traditionellen Kernstücke der internmedizinischen Diagnostik, wurden zeitliche Begrenzungen definiert und der Honorartarif gesenkt.
Dieses System privilegiert den hoch spezialisierten, instrumentell und operativ tätigen Arzt. Es schien als ob der sogenannte Grundversorger oder ”Hausarzt“ systematisch benachteiligt würde, um so vielleicht mit der Zeit leicht kontrollier- und steuerbare ”Zentren“ herzustellen, die schliesslich verstaatlich werden...?!.
27.2
Warum ich Psychiater wurde.
In damals neuen Tarif-und Kontrollsystem wurde ärztlicher Tätigkeit komplizierter und unfreier. Das machte auch mich wütend, betraf mich aber weniger schwer, weil ich die Absicht hatte, mich altershalber in wenigen Jahren in den Ruhestand zu begeben. Ich konnte nach dem Tarmedsystem als Psychiater abrechnen, weil ich mehrjährige psychotherapeutische Ausbildung nachweisen konnte. Das Einkommen der Internisten wurde schwer eingeschränkt, indem die Tarife für das Patientengespräch und für die eigenhändigen, so genannt physikalischen Untersuchungen reduziert und in kleinere Zeiteinheiten zerhackten. Das hatte eine Entwertung des persönlichen Kontaktes zwischen Arzt und Patient zur Folge, also die nicht so leicht messbare, aber wichtigste und eigentliche menschliche Aufgabe des Arztes. Statistiken sollen gezeigt haben, dass der Grossteil der Patienten die Qualität ihres Arztes vor allem auf Grund seines menschlichen Umgangs einschätzen. Dieser Befund wird nicht berücksichtigt. Dem entspricht anthropologisch das Wieder-Aufkommen eines tot geglaubten Menschenbildes aus der Aufklärung: des ”homme machine“. Scheinbar unterstützt durch den Einfluss der Hirnbiologie auf die Erklärung der subjektiven Psyche. Das dazu passende Stickwort heisst: ”Der Mensch (die Psyche, die “Seele“) ist nichts anderes als...“ Es ist der Slogan des reduktionistischen Denkens. Unser ausgezeichneter Chemielehrer (er hiess Grob) machte den ironischen Spruch, als Spott gegen solche materialistische Anthropologie: „Der Mensch ist nichts anderes als eine chemische Reaktion in wässeriger Lösung“.
27.3
Der alternde Arzt. Vom siebzigsten Altersjahr an kann man im Kanton Zürich mit dem Gesundheitsausweis eines Kollegen die Praxisbewilligung noch zwei Mal um drei Jahre verlängern. Im Jahr 2004, im Alter von 72 Jahren konnte ich im besten Fall noch bis 76 praktizieren, also noch vier Jahre. Was mein Einkommen betrifft, konnte ich einige Auslagen sparen, wenn ich mich einer Gemeinschaftspraxis für Psychotherapie anschloss.
So hatte ich mich umgesehen nach einem Therapieraum, den ich vielleicht mit jemandem Teilen kann, um, falls ich mit der Zeit meine Arbeitszeit verringern wollte ohne den vollen Mietzins zahlen zu müssen.
Auf meine Suche meldete sich Noëmi Holtz, die ich vom Verein für Gestalttherapie kannte. Damals schon hatte ich den Eindruck, dass ich ihr willkommen war.
27.4
Ich hatte an einer Psychotherapie-Tagung ein Referat gehalten. Ich erzählte von dem kurz vorher besuchten Kongress über multiple Persönlichkeiten, insbesondere nach Inzesttraumen in der Kindheit. Zu Beginn lud ich das Publikum zu einem Experiment ein: Man soll die Augen schliessen und in der inneren Vorstellung um sich selbst herumgehen. Nach so und so vielen Runden die Augen öffnen und das Gefühl wahrnehmen: Schwindel, Angst, Realitätsverwirrung, Identitätsverwirrung etc.. Vorher hatte ich gewarnt. Wer schon einmal psychotische Zustände erlebt habe, sollte nicht mitmachen. Tatsächlich musste ich eine Teilnehmerin ausschliessen, weil sie schon zu Beginn der Übung Angst- und Verwirrungszustände bekommen hatte. Noëmi fragte mich darnach, ob ich mit ihr und noch anderen Therapeuten Supervision mache würde. Es gehe ihr vor allem um Schizophrenie. Mein Grund der Ablehnung: ich habe zu wenig Erfahrung mit dieser Krankheit, jedenfalls was die medikamentöse Behandlung betrifft.
27.5
Die Zusammenarbeit mit Noemi Holtz beruhte auf dem Prinzip der Delegation. Neue Patienten musste ich abklären, eine Diagnose und Therapie vorschlagen um sie nach ihrem Wunsch zur Durchführung der Gestalt - oder Gesprächstherapie an Noëmi zu delegieren. Ich blieb für Zwischenkontrollen, Supervision und medikamentöse Behandlung zuständig. Leute, die sich zur Behandlung bei meiner Mitarbeiterin angemeldet hatten, musste ich zuvor ebenfalls untersuchen und dann die delegierte Therapie begleiten. Früher konnte ich noch Psychotherapien an Erika Maag delegieren, obschon sie keine Universitätsausbildung in Psychologie absolviert hatte. Die Voraussetzungen dafür wurden jedoch jedes Jahr strenger und bürokratischer. Schliesslich musste auch ich nachweisen, dass ich als ärztlicher Psychotherapeut ”unbedenklich“ delegieren durfte, d.h.genügend psychiatrische Kompetenz besass. Inzwischen hatte ich zur Sicherheit einen diebezüglichen “Fähigkeitsausweis“ erworben, wozu ich mehr als genug Bedingungen erfüllt hatte.
27.6
Nachdem ich mich noch mit einer Menge von Formularen und Telefonaten beschäftigt hatte, lief die Zusammenarbeit mit Noëmi reibungslos. Seitdem Reto Heimgartner an meiner Stelle als delegierender Psychiater mit ihr zusammenarbeitete, war die Meldepflicht an die Krankenkassen und damit die fachliche und finanzielle Verantwortlichkeit noch wesentlich strenger geworden. Kursorische Zwischenberichte werden nicht mehr anerkannt. Bei nach Meinung der Krankenkassen langdauernden Therapien droht von diesen ein Rückforderungsverfahren. Noëmi war in den letzten etwa fünf Jahren häufig abwesend. Es fiel ihr immer schwerer, sich diesem neuen Regime mit der Machtausübung und Bedrohung durch die FMH und durch den Krankenkassenverband anzupassen. Für Reto steht vieles auf dem Spiel. Mit seinem korrektem Ungang mit den übermächtigen Instanzen lässt sich die drohende Reduktion der Psychiatrie auf pharmakologische Behandlungen und praktische Abschaffung des psychotherapeutischen Gesprächs vielleicht schadlos überstehen!
27.7
Mit solchen Perspektiven ist die idealistische Weltanschauung von Noëmi überfordert. Wenn man etwas über die materialistisch-mechanistische Grundeinstellung der gegenwärtigen biologischen Hirnforschung weiss, ist die Angst berechtigt, dass dies zu einem trostlosen Menschenbild und einer menschen-verachtenden Reduktion der ärztlichen Psychotherapie führen kann. Das Eis, auf dem die menschlich gesinnten Psychiater laufen, ist unter dieser Klimaänderung dünn und brüchig geworden. Aber wie sag’ichs meinem Kinde? Wenn das Kind die Vorstellung von der Heilen Welt nicht loslassen will oder kann? Das ist der Konflikt, den Reto mit seiner Mitarbeiterin austragen musste.
28.8
Wie hat sich der Umzug in einen neuen Behandlungsraum auf meine Art, meine Patienten zu behandeln ausgewirkt? Der neue Raum befand sich nicht weit vom Mittelbergsteig entfernt am Sonneggsteig in einer ebenerdig gelegenen Wohnung mit drei Zimmern und war nur etwa ein Drittel so gross wie der am Mittelbergsteig. Der Boden war nicht aus dem Naturstein Travertin sondern mit einem Spannteppich belegt. Deshalb konnte ich keine grossformatigen Zeichnungen machen lassen, wie zum Beispiel das Aufzeichnen der Körperkonturen. Diese Technik diente u.a. der Entwicklung einer besseren Wahrnehmung des eigenen Körpers und der Lokalisation von Beschwerden und Gefühlen. Auch die oft sehr wirkungsvolle Arbeit mit Modellierton musste ich aus Rücksicht auf den empfindlichen Spannteppich aufgeben. Das ersetzte ich durch häufigere Anwendung von Träumen und von projektiven Interventionen (z.B. auf den “leeren Stuhl“), Familienaufsstellung , Identifikationsübungen, körperbezogene Aktivierung unerledigter “Gestalten“ (zum Beispiel durch bewusstes Vertiefen der Atmung und Wahrnehmen der Wirkung auf Körperempfindungen und Auslösung von Emotionen).
Aber nicht nur der Therapie-Stil änderte sich. Es kamen auch Patienten mit anderen Krankheiten und Problemen. In den Jahren von 1980 bis etwa 1990 war ich mit schwereren psychischen Störungen konfrontiert, mit Borderline-Patienten, posttraumatischem Syndrom, z.B. Folgen von Vergewaltigung und Inzest während der Kindheit und Jugend und Anorexia mentalis (“Magersucht”). Mit der Zeit wurden Ratsuchende mit sozialen Problemen häufiger: Entscheidungsunfähigkeit in wichtigen Lebensphasen, Arbeitslosigkeit, Probleme mit der Familie, mit den Finanzen, meistens im Zusammenhang mit depressiven Zuständen.
27.9
Weniger Arbeitszeit. Einerseits war mir daran gelegen, noch einige Patienten behandeln zu können, aber zehn Psychotherapiesitzungen am Tag mochte ich nicht mehr bewältigen. Schon nach sechs intensiven Arbeitsstunden war ich am Abend zunehmend erschöpft. Auf der anderen Seite kam mir gelegen, hie und da mit neuen Leuten eine Behandlung einzuleiten, bevor sie bei Noëmi eine Behandlung beginnen wollten. Deshalb gab es bei mir für Patienten, die sich bei Noëmi angemeldet hatten, eine, zwei oder mehrere Sitzungen zur Diagnostik, zur Indikationsstellung, die Verlaufskontrolle und manchmal auch die für die Verschreibung von Medikamenten. Damit fiel mir auch zu, die immer häufiger verlangten Berichte an die Krankenkasse oder andere Versicherungen der Patienten zu verfassen.
27.10
Trauma- und Sozio-Therapie. Als ich noch praktizierte, erforderten die wenigen von den Krankenkassen verlangten Berichte noch keinen grossen Aufwand. Zusammen mit den meistens etwas kursorischen Berichten von Noëmi Holtz wurden sie akzeptiert. Aus meinen gelegentlichen Gesprächen mit ihren Patienten war ersichtlich, dass diese sich von ihr verstanden und hilfreich unterstützt wurden. Dazu folgendes Beispiel:
Es ging um eine von beiden Eltern schwer traumatisierte junge Frau aus Mazedonien. Die Ärmste geriet im Zusammenhang mit einer polizeilichen Drogenfahndung unschuldig während zwei Monaten in Untersuchungshaft. Noemi verschaffte sich Gehör bei den Vertrtern von Polizei und Justiz, so dass sie beinahe unbeschränktes Besuchsrecht bekam. Sie konnte sie ihr wirksame Krisenintervention und praktische Hilfeleistungen anbieten. Noëmi aktivierte die Sozialhilfe der Wohngemeinde und diese verhalf ihr, nach der Haftentlassung eine neue Wohnung und eine Arbeitsstelle zu finden. In so komplizierten Situationen gehört zur Psychotherapie auch engagierte Beschäftigung mit derm sozialen Umfeld des/r Patiente/in.
27.11
Reto Heimgartner war Assistentsarzt in einem psychiatrischen Ambulatorium. Er konnte sich aber jede Woche für einen Tag freimachen um in meiner Praxis schon einige psychiatrische Behandlungen zu übernehmen. Es war nun beschlossen, dass Reto Heimgartner, sobald er alle Bedingungen für den Erwerb des Titels für Psychiatrie und Psychotheraie erfüllt hatte, mein Praxisnachfolger wird.
Schliesslich konnten wir als Übergabedatum den 1.Januar 2008 festlegen. Das war demnach der Beginn meines “Ruhestandes“. Reto wünschte weiterhin Supervisionsitzungen von mir.
Mittlerweile wird die Dauer unserer Sitzungen immer länger und mit gemeinsamem Nachtessen beschlossen. So hat sich die kollegiale Beziehung zu einer vertrauensvollen Freundschaft entwickelt.
281
Gestalttherapie-Ausbildung im FPI (Fritz Perls Institut).
Gleichzeitig nahm ich teil an einer Gruppe für klientenzentrierte Gesprächstherapie. Und auch mit Verena an einer Gruppe für Ehepaare unter Leitung von Ago Bürki und Dieter Hanhart.
28 .2
Das Geburtstagsfest Vom fünfzigsten Lebensjahr an betritt man das Land der Alten. Jetzt wandere ich schon mehr als dreissig Jahe lang in diesem Land. Eine ganze Generation ist während dieser Zeitspanne vom Baby zum Erwachsenen gereift und hat vielleicht eine Familie gegründet. Hundertzwanzig Leute hatte ich eingeladen, aus den verschiedenen Beziehungskreisen und Wohnregionen, Verwandte, neue Bekannte aus dem Bereich der Ausbildungs-, Selbsterfahrungs- und Psychotherapiegruppen. Obschon die Bechburg bei Balsthal romantisch an schöner Aussichtslage am Jura-Südhang liegt und für die Mehrheit der 120 Eingeladenen bis dahin eine lange Wegstrecke zurückzulegen ist, war es doch gelungen hundert Menschen in die Bechburg zu locken.
28.3
Die Gäste
Elisabet Bandi-Kuhn* hatte mir die Aufführung von Liedern durch einen der Berner Ministrels, Jakob Stickelberger, zum Geschenk gemacht. Das war eine liebe Überraschung! Manche dieser Lieder stammtenvon Mani Matter, der damals schon nicht mehr lebte. Sabeth hatte, solang ich mit Verena zusammen war, nie vergessen, mir zum Geburtstag mit einer Karte, einem Brief oder einem kleinem Geschenk zu gratulieren. Ihr Freund hatte für das Fest die Rolle des Hoffotografen für sich ausgewählt und konnte sich so ein wenig im Hintergrund halten.Die jüngere Schwester, Susanne (Sue Steiner), ist beim Tanzen durch ihre expressionistisch ausladenden Bewegungen aufgefallen. Sie war damals ohne Partner. Coni Rohner (aus der Gesprächstherapie-Gruppe) liess sich von Otto F.Walter in die Karriere eines Schriftstellers einführen. Otto betonte mit Überzeugung, dass man Schriftsteller nur werde, wenn man nicht anders könne als schreiben, schreiben müsse. Hans Bürki sass lange bei Otto. Ich weiss nicht was sie diskutierten. Es war mir schon früher aufgefallen, welche Anziehung berühmte Leute auf Hans Bürki** ausübten. Ich hatte ihn früher ein wenig dafür beneidet und bewundert, für seine "désinvolture", dass er sie manchmal in kürzester Zeit als Freunde zu gewinnen wusste.
*Elisabeth (Sabet) ist dieses Jahr unerwartet an einem Hirnschlag gestorben.
Sirka Falk aus Finland hatte ich im Gestalt-Auswahlseminar kennen gelernt. Sie trug ihre blonden Haare zu mehreren neckische Zöpfchen geflochten und sie sprach Deutsch mit dem sympathischen Akzent der Finnen. Mit ihr entstand eine platonische Freundschaft. Ich hatte sie natürlich auch zum Bechburgfest eingeladen zusammen mit ihren Kollegen Paul ..., der wie Sirka am Studio Ilg für Zirkus und Akrobatik in Ausbildung war. Die Beiden führten im Freien, unter der weit ausladenden Linde der Schlosstherasse eine wunderbar lustige Pantomime auf. Es war nämlich an diesem fünfundzwanzigsten September noch sommerlich warm und hell.
Beim Abschied gratulierte mir Otto F. Walter bewundernd, dass ich so viele Freunde zusammengebracht hätte!
Sogar Gäste aus Holland waren da, Paula und Coenrad Verhagen. Wir hatten sie in Tansania kennengelernt. Im Vorjahr hatte Koenrad für uns zwei Paare eine wunderbare Reise nach Sri Lanka organisiert. In Sri Lanka wie auch in Ostafrika war er als forschender Ökonom mit ländlichen Entwicklungsprojekten beschäftigt.
Von meinen Verwandten waren die noch Lebenden der Altengeneration dabei. Mein Vater war vier Jahren zuvor gestorben, aber meine Mutter und zwei von den drei Meyer-Tanten (der "Trinité") waren noch frisch und lebendig. Tante Emmi fehlte. Sie war ein Jahr zuvor nach einem Verkehrsunfall gestorben (cf.Kap.3, “La Trinité).
Dominik, der dreizehnjährige jüngste Sohn, schützte sich vor den vielen Gästen: Er trug den ganzen Abend eine Baskenmütze und hohe Bergschuhe.
Auf die Idee, für mein Geburtstagsfest die, der Sage nach, vom Gespenst des mittelalterlichenTyrennen “Kueni” bewohnten Bechburg bei Balsthal zu mieten, brachte mich Dominique (“Müsu“) Walter, die Frau des Schriftstellers Otto F.Walter eine Freundin von Sue Steiner.
Für das Essen wurde eine Catering Gruppe angestellt. Zu Essen gab es Couscous, und um Mitternacht eine Bündner Gerstensuppe. Zum Probeessen kamen sie zu uns nach Hause an der Zürichbergstrasse. Sie brachten Haschisch mit, Ich versuchte es, indem ich ein ”piecely" auf den glühenden Tabak meiner Pfeire legte. Die Wirkung aber war, statt der zu erwartenden Euphorie, dass ich erbrechen musste.
Wo sind jetzt, über dreissig Jahre später, alle diese Bekannten, Verwandten und Freunde geblieben? Von Verena bin ich fünf Jahr später geschieden worden. Dadurch habe ich viele von unseren gemeinsamen Angehörigen und Freunde verloren.
28.4
1990-1991 Hausbau in Feldmeilen. Franz Schumacher, der Jurist und alter Kamerad aus der Kantonsschule, hatte von den Erben der Familie Mertens den Auftrag erhalten, das Grundstück ihrer ehemaligen Grossgärtnerei in Feldmeilen zu verkaufen. Er konnte es so einrichten, dass die bergwärts liegenden Parzellen zum Preis von etwa 1000 Franken pro m2, die weiter seewärz gelegenen mit weniger Seesicht zu etwa 700 verkauft werden konnten. Auf diesem, für Goldküstenverhältnisse recht preisgünstigen Terrain plante Franz eine Überbauung mit einer Reihe von Doppel-Einfamilienhäusern und suchte Freunde, die sich an einem gemeinsamen Bauprojekt beteiligen würden. Seine recht überzeugende Idee war, dass sich alle Beteiligten für die die Materialen und die Ausstattung der vier Doppelhäuser auf Gemeinsamkeit einigen und dadurch die Baukosten niedrig halten könnten. Meine Bank war bereit, mit zwei Hypotheken eine fast 100%ige Finanzierung zu gewähren. Für den Landkauf konnte ich eine Festhypothek von 5% bekommen. Die beiden Architekten Meyer und Schwarz wurden mit der Planung beauftragt. Thomas Meyer und seine Frau Silvia würden eines der angebauten Häuser selber bewohnen. Dann aber bekam dieser verlockende Plan bedenkliche Risse. Die Probleme begannen damit, dass die Nachbarn G. Einspruch erhoben mit der Begründung, hier sei ein Quartier für Landhäuser, ähnlich denjenigen, das sie selber bewohnten.
28.5
Am 31.12.2007: Abgabe der Praxis
Der Psychiater Reto Heimgartner wird mein Praxisnachfolger. Ich bleibe ihm als Supervisor. Reto versucht weiterhin mit Noëmi Holtz für delegierte Psychotherapien zusammen zu arbeiten. Noëmi zieht sich zunehmend zurück, zum Teil wegen ihrer unsicheren Gesundheit. Ausserdem möchte sie in Israel tätig werden, wo ihr Freund lebt. Der Versuch von Reto mit Noëmi zusammen zu arbeiten scheiterte an den gegensätzlichen Vorstellungen der beiden und an Noëmis abnehmenden Interesse.
Psychotherapie ade! Kleiner Mann, was nun? Die Familie pflegen, Malen, Zeichnen, Schreiben, Lesen, das Latein der Mittelschule auffrischen, einen Philosophiekurs besuchen, tägliche “Toilette intèrieure“ (Montaigne) mit Hilfe der "Losungen“, die für jedes Jahr von der Herrnhuter Brüdergemeine herausgegeben werden..
28.6
Philosophie
Prof. Daniel Hell war noch Direktor der Psychiatrischen Klinik, als er ein Seminar in Philosophie für Ärzte und medizinisches Personal gründete. Er gewann die den Emeritierten Prof.Holzhei , seine Frau, Alice Holtzhey ,den und Psychoanalxtiker Dr.med.Strassberg und den Philosophen Matthias Pfister.für den ein- bis zwei wöchentlichen Kurs für Philosophie.
Es gabforlaufende Erklärung eines bestimmten Werkes oder bestmmtee Themen mit ausgewählten Texten der philisophischen Literatur. Zum Beispiel gab Frau Dr.Holzhey gab ein Literaturseminar über Martin Heidegger, an dem ich auch teilnahm. Allerdings habe ich von ihrer Heidegger-Interpretation nicht viel verstanden. Mein immer schlechter werdendes Gehör verhinderte mich, trotz den neuen Hörgeräten daran, dem Dozenten und den Gesprächen genügend folgen zu können. Deshalb habe ich es schliesslich aufgegeben, an diesen Philosopiekursen teilzunehmen
**Hans Bürki lebt nicht mehr. Seine Frau, Ago konnte als Jüdin nach dem Krieg mit ihrer Mutter der freundlichen, würdevollen Frau Fillenz aus Ungarn in die Schweiz fliehen. In Ungarn hatte sie Medizin studiert, aber das für ärztliche Tätigkeit in der Schweiz notwendige Staatsexamen nicht absolviert. Sie gründete entsprechend den VBG besondere Bibelgruppen für "Krankenschwestern“, wie die Pflegfachfrauen damals noch hiessen. Dazu wirkte sie als psychologische und christliche Eheberaterin.

29.1
Die Begegnung
Aaarau eine besonders ansprechende Ausstellung gibt, sind nicht nur die Ausstellungssäle voller Besucher, sondern auch alle Tischchen in der Museumscafeteria besetzt. So war es am 14.Februar 1998 im Kunsthaus Zürich. Nur noch ein Stuhl war frei. Gegenüber sass eine interessant aussehende Dame und studierte konzentriert die Saalzettel der Ausstellung. Ich fragte sie, ob der Stuhl ihr gegenüber noch frei sei. Ja. Darf ich mich hier setzen? Selbstverständlich.
Man kam ins Gespräch über die gegenwärtige Ausstellung und über bildende Kunst im Allgemeinen. Sie sagt, im neuen Kusthaus Aarau gebe es zur Zeit auch eine interessante Ausstellung. Sie wohne in der Nähe von Aarau. Wir kamen überein, uns im Foyer des Kunsthauses Aarau nochmals zu treffen. Wir tauschten die Telefonnummern aus.
In meiner Vergesslichkeit wartete ich im Kunsthaus Zürich auf sie, statt in Aarau. Ich rief sie an. Des Sohn nahm den Höhrer ab. Die Mutter habe gesagt, sie gehe ins Kunsthaus. In welches? In das in Aarau. So fuhr ich rasend nach Aarau. Sie war noch dort. Sie nahm meine Verspätung gelassen hin. Wir gingen in ein Restaurant und assen Pizza. Mir war der Appetit schon vergangen, denn ich begann, mich in diese Dame namens Hélène zu verlieben. Wohin, nach diesem Essen? Hélènes Sohn ist mit seiner Diplomarbeit beschäftigt. Er studiere an der Hochschule für Gestaltung in Basel. Ihr ganzes Haus sei belegt mit Plänen und Modellen. Wir beschlossen, bei mir in Feldmeilen zu übernachten. Der Sohn Jérôme war erstaunt über die Eskapade
29.2
Hélène hat die Lebensgeschichte ihres Vaters Alfonse in einem ihrer Bücher unter dem Titel “Simon, l’Anniviard” erzählt. Er ist in seinem Heimatdorf St.Luc im Val d’Annniviers im Wallis als der Jüngste von zehn Kindern aufgewachsen. Die Mutter war erst dreissig Jahre alt, als ihr Ehemann durch einen Unfalll ums Leben kam. Es ist ihr gelungen ihre zehn Kinder allein zu ernähren und zu erziehen. Die AHV gab es damals noch nicht.
Damals lebten die Anniviarden noch als Halbnomaden. Die “Transhumance” bedeutete für die Dorfbewohner jedes Jahr viermal mit dem Vieh und dem ganzen Hausrat von einem Arbeitsort zum andern zu wandern, vom Weinberg im Rhonetal bic zur Alp.
Das erste Abenteuer nach der Handelsmatur in Sionder Hélène war die Ausbildung zur Hostess bei der Swissair. Als solche wurde sie für ein halbes Jahr in Rio de Janeiro stationiert. Von Rio aus lernte sie einen grosen Teil von Südamerika kennen.
Zurück in der Schweiz heiratete sie einem Assistenzarzt. Die Tochter Sabine wurde geboren.
Es folgten nach dieser so interessanten und hoffnungsvollen Jugendzeit eine Serie von Schicksaksschlägen. Nach zwei Jahren Ehe verlor sie ihren Mann an einem Autounfall. Und sie verlor zwei Kinder.
Ihr zweiter Ehemann, auch ein Arzt, war Elisé Gessaga. Mit ihm bekam sie ihren Sohn, Jérôme. Elisé war mit seiner Familie zur Weiterbildung in England, Deutschland und schliesslich in Lausanne mit dem Zeil Spezialist für Neuropathloge zu werden.
In Lausanne studierte Hélène Kunstgeschichte an der Universität. Dr.Gessaga wurde leitender Arzt der neu geründeten Abteilung für Neuropathologie am Kantonsspital Aarau.
Hélènes Sohn, Jérôme stdierte an der Hochschule für Gestaltung in Basel und wurde Innenarchitekt.
29.3
Schreiben
In den dunkeln Zeiten ihre Lebens erlebte sich Hélène als Stehaufmännchen; ihr Losungswort ist “résilience”: Wenn Schicksalsschläge einen umgeworfen hat, soll und kann man wieder aufstehen Sie stellte sich auf indem sie zu schreiben begann. Das erste Buch hat den Titel: “Le Ludion”, das Descartsche Teufelchen, das immer wieder aus der Tiefe auftaucht. Seither sind weitere sieben Bücher von ihr erschienen, Erzählungen und Romane. Am meisten Erfolg brachte die schon erwähnte historische Biografie ihres Vater, “Simon l’Anniviard”.
29.4
Malen
Die Kunsthistorikerin Hélène Gessaga- Zufferey wurde zur Kunstvermittlerin in der Sammlung von französischen Impressionisten in der Museum-Villa Langmatt in Baden und im Kunsthaus Zürich.
In ihrem Haus in Biberstein richteten wir ein Atelier ein. Hélène begann mit Akryl- und Ölfarben zu malen. Unter den ersten Werken gab es einige gelungene naturalistische Silleben. An der Hochschule für Gestaltung besuchte sie Malunterricht bei bekannten Künstlern. Mit der Zeit entstehen Bilder mit frei erfundenen bewegten Flächen, die sie mit grafischen Zeichen belebt.
29.5
Das Multitalent
Meine Lebensgefährtin war nicht nur charmant und vital sondern entpuppte sich als Multitalent. Wie ist es für einen Mann, mit einer solchen Frau zusammen zu leben?
Entsteht daraus eine explosive Mischung? Vielleicht ein Konkurrenzkampf. Auch ich male und das seit meiner Kindheit und nicht erst seit zwanzig Jahren. Und mit dieser Autobiografie habe ich auch zu schreiben begonnen. Aber nicht nur im Schreiben sondern auch in der Malerei ist sie mir jetzt um viele Nasenlängen voraus.
Am Anfang hatte mich die Wettbewerbssituation noch narzisstisch herausgefordert. Mit der Zeit empfinde ich sie als meine letzte Psychotherapie. Sie heilt mich nach und nach, so hoffe ich, von meine Egozentrik.
29.6
Konfliktstoff
im Zusammenleben mit Hélène bietet meine Zerstreutheit. Damit habe ich Kindheit meine Erzieher und mich selbst verärgert. Als junger Assistenzarzt im Spital hiess ich “der zerstreute Professor”, weil ich zwar recht viel wusste, aber ein Meister war im Vergessen. Die Pflegefachfrauen der Abteilung.haben mich dann freundlich erinnert. Mit dem Alter wird meine Gedächtnisleistung natürlich nicht besser. Es stört und ärgert die ökologisch sehr bewusst lebende Hélène, wenn ich beim Verlassen eines Zimmers immer wieder vergesse, das Licht auszulöschen oder in der Dusche das Rotlicht brennen lasse Mit dem Alter wird meine Gedächtnisleistung natürlich nicht besser. Es stört und ärgert die ökologisch sehr bewusst lebende Hélène, wenn ich beim Verlassen eines Zimmers immer wieder vergesse
Carl Gustav Jung hat zur “Erklärung” von Fehlleistungen einen giftigen kleinen Archetyp beschrieben, den er “Trickster” In seinem Buch führt Sigmund Freud Fehlleistungen auf die “Psychopathologie des Alltagslebens” nannte. Er meinte, das sei eine Auswirkung verdrängter libidinöser Wünsche. Solche Psychologismen erleichtern mich nicht vom Vorwürfen die ich mir selber mache “mea culpa”.
29.7
Die Alte Trotte
Bibersteinwar ein Weindorf und bemüht sich wieder eins zu werden. In dem dreihundert Jahre alten Gebäude mit seinen dicken Mauern soll die zum Schloss gehörende Weinkelter gestanden haben. Als die Familie Gessaga eine Unterkunft bei Aarau suchte, fanden sie die Ruine der Alten Trotte und liessen sie vorbildlich renovieren.
Die “Alte Trotte” gehörte zum Schloss Biberstein, wo nach der Eroberung des Aargaus im sechszehnten Jahrhundert durch die Berner, der Landvogt hauste. Die etwas erhöhte Lage dieses über 300 Jahre alten Gebäudes erlaubt einen Weitnblick gegen Süden auf die Aare hinunter, über den ganzen Aargau mit seiner dichten Bewaldung und bei klarem Wetter auf die Kette der Berner Alpen. Im Vorgarten mit dem mächtigen Nussbaum und einer Rotbuche setzen vom Frühling bis tief in den Herbst in abwechselnden Blüten ihre Farbakzente. Dem Vorgarten schliesst sich eine Wiese an, wo bis vor kurzem die Hirten vom Schloss ihre Walliserschafe weiden liessen.
Nachdem Hélène Elisé verloren hatte, wollte sie nicht allein in diesem grosseen Haus wohnen bleiben und dachte daran, in die Romandie, ihre Sprachheimat. zu ziehen. Nachdem wir uns begegnet waren, änderte sie ihren Plan und lus mich ein, zu ihr in die “Alte Trotte” zu ziehen, so dass ich voraoussichtlich meine letzten Lebensjahre in diesem schön renovierten und eingerichteten Haus und in dieser herrlichen Lage verbringen kann. Das verdanke ich der Grosszügigkeit von Hélène.
29.8
Reisen mit Hélèna
Seit 1998 haben Hélène und ich 45 Reisen unternommen, in die verschiedensten Kulturegionen der Welt, von Kuba bis China. Den Anfang machte der Plan, die Wiege der europäischen Kultur zu besuchen, die Mittelmeerländer.
Alle unsere Reisen hat Hélène vorbereitet. Bei ihrer Suche nach Unterkünften entdecke sie den Charm der “Bed-and.Breafast” –Einrichtungen. Sie sind, ausser man reist in einer Gruppe, preigünstigund persö,nlich, denn man wird in der Rgel voneiner Privatperso oder von einer Familie aufgenommen. Die die Ausstatlung ist meistens persönlich und originell. Und infast allen diese Etablissements schafft es die Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit der EigentümerIn dass man sich wie ein Freund oder Agehöriger und wie zu Hause fühlt.
Besonders interessant war diejenige in Lyon, welche in einer alten Seidenweberei im Zentrum der Stadt eingerichtet worden ist. Die diesem Gewerbe entsprechende Innenarchitektut wurde ohne grosse Änderungen belassen.
In St.Raffaël (Côte d’Azur) führte der Eingang durch einen subtropisch bepflanzten Garten zum einer alten Villa, in welcher jede Ecke mit verschiedensten Fundstücken vom Flohmarkt dekoriert ist, so dass das Ganze trotz kitschigen Vasen, Nippsachen und Bildern eine ästhetisch angenehme und humorvolle Wirkung entsteht. Hier begann der Tag mit einem lukullischen Frühstück und täglich frisch gebackenem, noch warmem Kuchen.
29.9
Liste der Reiseländer
Aegypten: (bis Abu Simbel) 2003, Libysche Wüste (Oasen)
China 2005
Deutschland. (3 mal, bei den Freunden, Micha und Hannelore Schneider), Baden-Baden 2010, Lindau/Mainau (nit Micha und Hannelore)i2012, Dresden 2013. Schifferstadt/Speyer (bei den Eltern von Jérômes Freundin Eva Maria Panzer), 2015.
Frankreich: Paris (4 mal), St. Paul de Vence/Drôme (2 mal) 2002, Burgund (Vézelay) 2004, Cassis (Côte d’Azur) 2006, Nancy, Lyon 2001, Menthon 2013, Metz 2013, Laveron/ Toulouse/ Conque/Montpellier (Langue d’Oc) 2014, Bordeaux 2014, , St.Raphaël (Côte d’Azur) 2015, Marseille 2015.
Griechenland: Mykonos 2009, Peloponnes 2016.
Iran / Turkmenistan / Usbekistan: 2001.
Italien: Apulien 1999, Amalfi-Küste 2008, Venedig (Biennale 2 mal),) /Ravenna (2007/ 2009), Südtirol 2010, Rom 2012, Turin 2015.
Kuba: 2012.
Libyen: 1999.
Marokko: 2000.
Österreich: Wien 1999.
Portugal: Lissabon/Porto 2013
Rajastan: 2002
Türkei: 2008 Kapadozien und die Ruinen der griechisch-römischen Städte an des Westküste Kleinsiens
|
|
|
|
|
|
.
.

Es ist wahrscheinlich, dass zeitgenössische Verwandte und Bekannte beim Lesen der hier erzählten Ereignisse andere Erinnerung haben, obschon ich mich bemüht habe, meine Erinnerungen möglichst wirklichkeitsgetreu wiederzugeben. Objektive Berichterstattung ist, wie man weiss, ein kaum je erreichbares Ideal.
Es war die allzugrosse Fülle all dieser amüsanten, absurden , und auch einigen traurigen Erinnerungen, die mich zum Schreiben verführt haben um so eine gewisse Ordnung in den chaotischen Fundus zu bringen.
Für manche der Erzählungnen habe ich die Berichte von mit nahestehenden Menschen eingeflochten. Eine besonders unerschöpfliche Quelle von ihr selbst erlebten Geschichten war meine Mutter. Sie erzählte so lebendig, dass ich sie als Kind beinahe selbst erlebte.
Dank gebührt zunächst dem Initiator dieser Memoiren-Aktion namens „meet-my-life“, Dr.Erich Bohli. Er ist mit enormer Geduld meinem alternden Neocortex* beigestanden. (*= Grosshirnrinde, die den Menschen in seiner Entwicklungsgeschichte zum “Homo sapiens” gemacht hat)
Ich danke meinen Freunden, die sich bereit erklärt haben, dann und wann ein Kapitel zu lesen und vielleicht einen Kommentar oder eine Kritik zu schreiben.
Un ich verdanke die Anregung zu schreiben meiner Lebensgefährtin Hélène Zufferey Gessaga, der Schriftstellerin und ihrem Sohn, Jérôme Gessaga. Er hat mich auf einen Zeitungsartikel hingewiesen, der auf das Projekt ”meet-my-life” aufmerksam machte.
Biberstein, im November 2017
Hans Alex Meyer

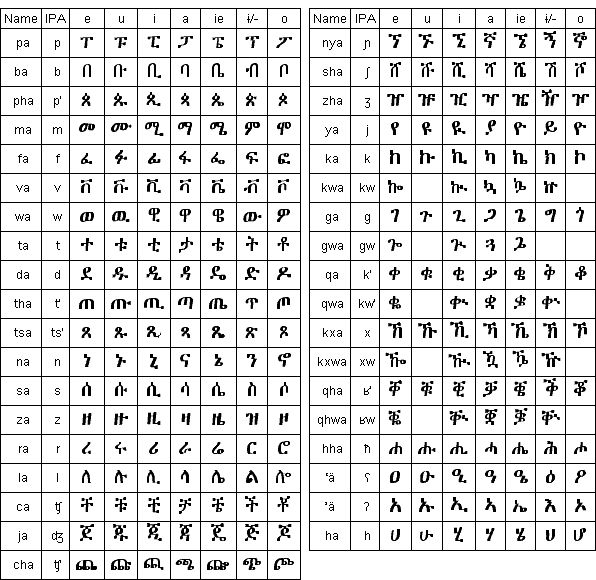
(1) Buchstaben der Tigrinya-Schrift: 270 Konsonanten mal 7 Vokale = 259 Silbenzeichen
DAS KURIOSITÄTRNKABINETT
INHALTSVERZEICHNIS
Kap. 1 Der Vater Alexander Rudolf Meyer
Kap. 2 Dei Mutter Maria Rosa Sennhauser
Kap. 3 La Tronité (meine drei Tanten- Schwestern des Vaters )
Kap. 4 Geburt und Erziehung
Kap. 5 Geburt des Bruders Conrad
Kap. 6 Primarschule, 1939 Krieg
Kap. 7 Sekundarschule, Begegnung mit dem Tod
Kap. 8 Mittelschule, die Freundin Ruth B. ,das Kuriositätenkabinett
Kap. 9 Mein Versuch, Christ zu sein
Kap. 10 Medizinstudium
Kap. 11 Szenen einer Ehe
Kap. 12 Militär
Kap. 13 Bürgerspital Solothurn
Kap. 14 Nazaret I (Israel)
Kap. 15 Nazareth II (Israel)
Kap. 16 Zürich Unispital, Geburt von Tobias
Kap. 17 Zwischen Zürich und Eritrea
Kap. 18 Eritrea, Geburt von Hanna Barbara, die Flucht
Kap. 19 Klinik Barmelweid, Spital Neumünster, Geburt von Dominik
Kap. 20 Moçambique
Kap. 21 Tansania
Kap. 22 Von Tansania zurück in die Schweiz
Kap. 23 Praxis für Innere und Tropenmedizin
Kap. 24 Vom Kärger zur Psyche
Kap. 25 Der Venusberg
Kap. 26 Freunde und heimliche Liebe
Kap. 27 Vom Mittelberg- an den Sonneggsteig
Kap. 28 Der Blick zurück
Kap. 29 Hélène....Biberstein
Kap. 30 Schlusswort
Kap. 31 Inhaltsverzeichnis