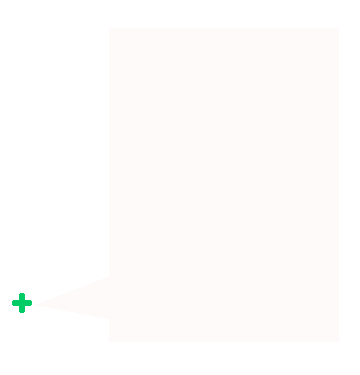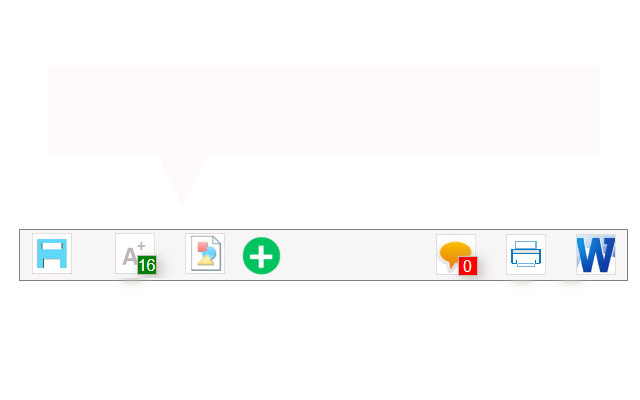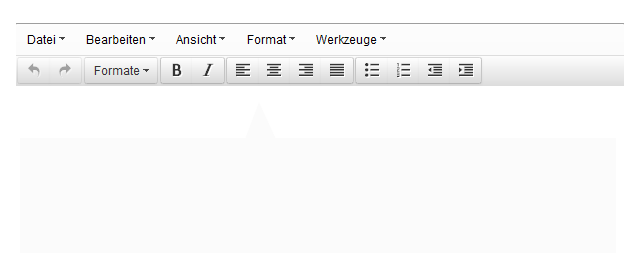Zurzeit sind 537 Biographien in Arbeit und davon 304 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 183


Dies dürfte die früheste Kindheits-Erinnerung sein: Meine Mutter "bädelet" mich in der grossen Blechbadewanne. Sie musste warmes Wasser aus der Küche hinein tragen. Im Badezimmer gab es nur einen Kaltwasserhahn. Sie musste sich tief hinunter bücken und legte mein Köpfchen in die Ellbogenkehle ihres Armes. Ich höre sie sagen: Bisch du en herzige Ruedeli.
Ja, ich war lange der herzige kleine Ruedeli. Geboren im Dezember 1947 als letztes von sechs Kindern.
Nach dem Nachtessen hielt sich die Familie in der Stube auf. Ich musste dann bald ins Bett. Am Kachelofen stand das Ofenbänkli. Wenn mich die Mutter auszog und ins Pyjama steckte, stand ich auf diesem Ofenbänkli. Meine Mutter hatte einen grossen Busen, und der Spalt zwischen den beiden Brüsten war im Ausschnitt zu erkennen. Ich steckte meine Hand in diesen Spalt. Ich erinnere mich, wie feucht-warm sich das anfühlte.
So sah ich als Kind meine Mutter: Eine Bauersfrau, ziemlich dick, immer irgendwo beschäftigt, wenn sie im Garten arbeitete mit hochrotem Kopf und ganz verschwitzt.
Und beim Vater erinnere ich mich an seinen Blick. Wie konnte der schauen! Ganz schrecklich war das, ich konnte damals und kann heute nicht sagen, was das Besondere an diesem Blick war, er war wie der Blick Gottes. Der wusste alles und konnte mit dem Blick strafen und vernichten. Immer wieder gab es diesen Blick, der durch Mark und Bein ging. Einmal sagte ich beim Essen: „Die Tiere essen und die Menschen fressen“. Ich fand das lustig, ich experimentierte mit der Sprache und experimentierte auch mit den Gesetzen, den Werten, die in unserer Familie herrschten. Aber da war er wieder, dieser Blick, der mich und das was ich gesagt hatte, völlig vernichtete.
Bis ins mittlere Erwachsenenalter träumte ich oftmals einen ähnlichen Traum: Ich musste vor einem bösen Stier flüchten. Aber, mein Gott, der Stier kam immer näher, senkte den Kopf, um mich auf die Hörner zu nehmen. Da sah ich einen hohen Gitterzaun. Im letzten Moment und mit letzter Kraft konnte ich an dieses Gitter "hechten" und empor klettern. Ich war dem Stier entronnen. Danach erwachte ich schweissgebadet. Immer und immer wieder träumte ich diesen Traum. Immer wieder das Gitter, das mich rettete. Und jedes Mal, wenn ich erwachte wusste ich, dass der Stier mein Vater war.
Einmal war wieder Chlausabend. Ich erinnere mich nur, dass mein Bruder Walter und ich anwesend waren, nebst den Eltern natürlich. Mich lobte der Chlaus und war nett mit mir. Walter tadelte er und sagte, er würde ihn mitnehmen. Er packte ihn und versuchte, ihn in den Sack zu stecken, Walter wehrte sich, hielt sich fest wo er konnte und versuchte sich los zu winden. Ich war total erschrocken, konnte aber die Sache nicht beurteilen, offenbar musste das wohl so sein, dass er ihn mitnahm in den Schwarzwald, denn Mutter und Vater schauten dem Treiben zu. Schliesslich gab der Samichlaus auf, liess von Walter ab. Er sagte, er würde noch mal ein Auge zudrücken und im nächsten Jahr wieder schauen. Aber eine Strafe gab es doch: Das Säckli für Walter gab er mir. Ich bekam 2 Säckli, Walter keines.
Ich lernte daraus: Die Eltern helfen dir nicht, wenn dich der Bölimann holen kommt!
Katja war ein liebes Tier, ein ungarischer Hirtenhund, Kuvasz heisst die Rasse. Sie strahlte eine Gelassenheit aus, irgendwie wusste ich, dass Katja mich verstand, sie war für mich sehr weise, sie strahlte die vollkommene Geborgenheit aus. Bei ihr, mit ihr fühlte ich mich wohl.
Katja war alt geworden. Sie schlief eigentlich nur noch. Und es sah so aus, als hätte sie auch Schmerzen. Der Tierarzt musste kommen, um sie erlösend einzuschläfern. Wenn man in unserem Haus zur Haustür eintrat, führte links eine Holztreppe hinauf zur Wohnung. So halb unter dieser Treppe hatte Katja ihr Lager. Und in der Haustür war im oberen Teil ein Fenster, durch das man hineinschauen konnte. Natürlich durfte ich bei der Todesspritze nicht dabei sein, schaute aber "heimlich" durch dieses Fenster hinein. Ich hörte einen Schrei von Katja. Dieser Schrei ging mir durch Mark und Bein. Katja lag bewegungslos da. Sie war tot. Ein seltsames beklemmendes Gefühl überkam mich.
Nach dem Nachtessen, als es bald darum ging ins Bett gehen zu müssen, da übermannte mich die Todesangst. Es wurde mir schwindlig und das Bewusstsein, dass ich eines Tages auch altersschwach und leidend sein würde und sterben musste, traf mich wie ein Blitzschlag. Ich fühlte mich sterben. Und ich glaubte, dass ich gerade jetzt am Sterben sei und man sofort den Arzt rufen sollte. Meine Mutter legte mich auf ihren Schoss und versuchte mir auszureden, dass ich am Sterben wäre. Und als sie keinen Arzt rief, ergab ich mich und beruhigte mich langsam wieder. Aber ich spürte auch, dass ich ein Stück naive kindliche Unbekümmertheit verloren hatte: Eines Tages würde auch ich sterben müssen. Dieser Gedanke war unvorstellbar für mich und lähmte von da an meine Lebensfreude und ich brauchte einen grossen Teil meiner Energie, um diesen Gedanken fern zu halten.
Ich habe jede Nacht ins Bett gemacht. Das war nichts besonderes, es war einfach so. Rückblickend frage ich mich, wie Mutter dies ohne mich dafür zu bestrafen so hin nehmen konnte. Ich nehme an, dass das Bettzeug nicht jeden Tag gewaschen wurde. Das Bett wurde aufgeschlagen und trocknete so. Das Pyjama war bis am Abend auch wieder trocken. Und mich selber hat sie mit einem nassen Waschlappen einfach abgerieben. Erst in der zweiten oder dritten Klasse „wurde ich ganz trocken“.
Tiere spielten eine grosse Rolle in meinem Leben, insbesondere die Wellensittiche und die Meersäuli. Beide Tierarten hatten etwas Gemeinsames: Ein sehr differenziertes Sozialleben. Die waren zärtlich miteinander, die spielten, sie stritten, manchmal so verbissen, dass Blut floss. Und es kam auch vor, dass ich streitende Meersäuli trennen wollte und dann einen Biss in den Finger abbekam. Bei den Meerschweinchen waren es die Männchen, die stritten um die Weibchen, bei den Wellensittichen waren es die Weibchen, die um eine Bruthöhle kämpften.
In der Nachbarschaft waren neue Leute eingezogen. Sie hatten eine Volière im Garten mit Wellensittichen. Wie ich diese Vögel zum ersten Mal sah, war ich ungeheuer fasziniert von ihnen. Diese schönen Farben, das lebhafte Getue und das immer um einander werben und Zärtlichkeiten austauschen. Solche Vögel wollte ich auch, aber ich musste natürlich zuerst fragen zu Hause. Es war zu erwarten: Der Vater sagte nein. Stubenvögel seien für Leute, die sonst keine Tiere haben können. An sich eine logische Begründung. Trotzdem konnte ich diese Absage nicht verstehen. Meine Tränen flossen ... und bewirkten, dass sich Vater doch erweichen liess und ich von der Nachbarin zwei Wellensittiche bekam, einen gelben und einen grünen, samt einem kleinen Käfig.
Ich fühlte mich sehr allein. Wohl fühlte ich mich bei meinen lieben Tieren. Viel bedeuteten mir auch die Kaninchen, die Katzen und später auch die Schafe, die uns Knaben gehörten. Das war meine Welt, da konnte ich mich zurückziehen und lebte das soziale Leben dieser Tiere mit. Ich identifizierte mich sehr mit den Tieren. Zu jedem hatte ich eine persönliche Beziehung, ich kannte jedes dieser Tiere in seiner Eigenart. Dies war meine heile Welt, eine Traumwelt, die mir half, doch einigermassen gut durch zu kommen im garstigen Sturm der Realität, wo ich mich nicht verstanden fühlte und wusste, dass ich anders war als die andern, dass man mich zwar nicht verachtete, teilweise aber nicht beachtete und mit Sicherheit belächelte.
Meine Kindheit war von Angst geprägt. Ich hatte Angst vor dem Vater, vor einem Bölimann, hatte Angst, etwas Falsches zu machen und dafür bestraft zu werden, ich hatte Todesangst, weil ich würde sterben müssen. Ich hatte aber auch Angst, Vater oder Mutter würden sterben. Oft empfand ich eine seltsame Stimmung in der Abenddämmerung. Etwas Bedrückendes, Beängstigendes schnürte mir die Brust zusammen, ohne dass ich genau sagen konnte, was es war. Einfach das Einnachten, das langsame Verschwinden von Licht, die Verwandlung alles Körperlichen in gespenstische Figuren bewirkten in mir eine unsägliche Beklemmung. Und niemandem konnte ich etwas sagen davon. Zu meinem Vater hatte ich keine emotionale Beziehung, der war für mich wie nicht ansprechbar. Meine Geschwister hatten die Ängste offenbar nicht, und sie hatten mich zu oft ausgelacht und mit Bemerkungen wie "ja, das ist wieder typisch für den kleinen Rüedel, diese Heulliese" abgestempelt und mundtot gemacht. Meine Mutter war mit all ihrer Arbeit, den vielen Kindern, mit Haus und Hof derart gefordert und wohl im Laufe ihrer Geschichte so unsensibel geworden, dass ihre Strategie es war, Probleme nicht im Gespräch zu bearbeiten, sondern mit "man denkt einfach nicht daran" oder „da muss man halt etwas auf die Zähne beissen" abzutun. Nein, die Mutter war für mich auch keine Vertrauensperson, um das, was mich belastete zu deponieren. Ich war allein. Ich war der kleine, zwar herzige Ruedeli, der sowieso noch für alles zu klein war, von dem man sagte "das gitt sicher nie en Puur" und "a dem isch es Meitli verlore gange".
Ja ich war und blieb der Kleine, der nicht war, wie er hätte sein sollen. Tausendmal sagte insbesondere die Mutter, dass ich halt hätte ein Mädchen sein sollen. Oh, sie habe sich so ein Mädchen gewünscht, dann wäre die Geschwisterreihe schön abwechslungsweise Bub – Mädchen – Bub – Mädchen – Bub – Mädchen gewesen. Und ich hatte ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun war es am Schluss eben Bub – Bub. Ja nun sei das halt so, aber ich sei eben doch eher ein Mädchen als ein Bub. Margritli hätte ich geheissen.
Ich war anders. Während meine Brüder auf dem Bauernhof mithalfen, konnte man mich dort nicht brauchen, ich blieb im Haus, musste wie die Mädchen im Haushalt helfen, durfte wie die Mädchen Klavier spielen und vertrieb meine Zeit mit "bäbele". Stundenlang konnte ich die Puppen ankleiden und wieder umkleiden, kämmte ihre Haare und machte ihnen andere Frisuren. Stundenlang verbrachte ich die Zeit mit "Stricklisle", was richtig Strick-Trick heisst. Mit "Fadespüeli“ und 4 Nägeln konnte ich schnell das nötige Werkzeug basteln und ich war sehr glücklich, als Mutter mir ganz speziell schön farbige Wolle kaufte für diesen gestrickten Wurm aus Wolle.
Auch in der Schule war ich ein eigenartiges Kind. Ich war – trotz Geschwistern – isoliert von fremden Kindern aufgewachsen, da der Bauernhof ziemlich abgelegen war. Den Kindergarten hatte man uns allen vorenthalten. Der Grund dafür war, so hörte ich erzählen, dass meine beiden ältesten Geschwister, als die Familie vom Bernbiet in die Ostschweiz zog, in den Kindergarten gehen sollten, dort aber wegen der berndeutschen Sprache oft ausgelacht und gehänselt worden waren. So wurden sie aus dem Kindergarten genommen und die nachfolgenden Kinder gar nicht erst hingeschickt.
Eines Tages erstand mein Vater auf einer Versteigerung ein Klavier. Es war vorgesehen, dass meine Schwestern Stunden nehmen würden. Und tatsächlich durften sie zu einer Bekannten meiner Mutter in die Klavierstunde. Ich hatte bisher schon Blockflöte gespielt und hatte auch am Klavierspielen Interesse. Und so durfte auch ich im Alter von 8 Jahren in die Klavierstunde. Es bestätigte es sich wieder: Am Ruedeli war ein Mädchen verloren gegangen. Ich durfte alles machen wie meine Schwestern.
Ich war überfordert, mich in einer Gruppe von "fremden" Kindern zu bewegen. Ich weinte sofort und fühlte mich verloren. Die "frechen" Buben in der Schule hänselten mich und lachten mich aus. Während die Buben sich beim Tschutten austobten oder mit Gespensterlis den Nervenkitzel übten, spielte ich mit den Mädchen Müetterlis oder eine Hochzeitsgesellschaft. Ich war eben anders. Ich war ein Meitlischmöcker. Und das musste ich auch oft hören. Es war nicht nur ein Mädchen an mir verloren gegangen, nein, ich war auch wirklich ein richtiger Meitlischmöcker.

Wenn ein Bauer pinkeln muss und er sich im Stall befindet, dann erledigen wohl alle Bauern dieses Bedürfnis gleich im Stall. Dort lassen ja die Kühe ihr Wasser in viel grösseren Mengen, und das Biseli eines Menschen kann da auch noch dazu kommen. Einmal musste der Vater mal, während auch wir Kinder im Stall waren. Der Vater wendete uns den Rücken zu. So konnte ich gar nichts sehen, und hätte doch so gerne mal gesehen, was er da für ein Zipfeli hat. Ich wollte um ihn herum gehen und schauen. Aber da war er wieder, dieser strenge „böse“ Blick, der mich lahm legte. Nein, da war nichts zu machen. Schade. Mein „Gwunder“ blieb. Dabei interessierte mich das doch sehr. Auch später habe ich nie „etwas“ gesehen beim Vater.
Soweit ich mich zurück erinnern kann, interessierte mich das Sexuelle. Interessant, dass der Hahn plötzlich einer Henne nachrannte, diese sich auf einmal flügelspreizend auf den Boden kauerte und der Hahn draufsprang und so seltsam rhythmische Bewegungen machte. Dabei musste sich hinten unter dem Schwanz von Hahn und Henne etwas tun. Nach einigen Sekunden stieg der Hahn von der Henne runter, plusterste sich auf und krähte stolz. Das war sehr interessant.
Oder wenn Katja "läufig" war und die Rüden aus der Nachbarschaft höchst erregt und geil um unser Haus strichen, wie in Trance nur die Hündin im Sinn hatten und nur nach ihr lechzend, da genügte es, dem Flöckli, dem Rex und wie sie alle hiessen, das Bein entgegen zu strecken und schon ritten sie auf und kopulierten mit dem Bein. Das trieben wir Brüder immer und immer wieder. Und ich war fasziniert von diesem Treiben.
Wenn eine Kuh zum Stier geführt wurde, wurden wir Buben weggeschickt. Das erhöhte natürlich nur den Gwunder. Vom „Wöschhüsli“ aus konnte man durch eine Fensterluke wunderbar zuschauen; leider war es etwas weit weg, aber ich war total fasziniert vom langen roten "Pfeil" des Stiers und der kräftigen Erregung, die ihn aufreiten liess unter Schnauben und Augenrollen. Geschlechtliches Treiben fesselte mich ausserordentlich.
Später wusste ich dann, dass das alles etwas mit Fortpflanzung zu tun hatte und unter den Schulkameraden wurde unter verstohlenem Lachen und Geheimnistuerei erzählt, dass eine Frau ein Kind bekomme, wenn der Mann sein "Schnäbi" in sie hinein stecke. Wow, das war ja spannend. Das wollte ich sehen. Zumindest eine Frau wollte ich mal sehen. Die Frauen hätten ja einen Schlitz. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Ich war sehr neugierig, die Geschlechtsöffnung einer Frau zu sehen, aber auch den Schwanz und die Behaarung eines erwachsenen Mannes.
In den Fünfzigerjahren kamen viele Süditaliener in die Schweiz zum Arbeiten. So kam Giuseppe zu uns, ein junger Italiener, mit dem es unkompliziert war, den Löli zu machen und lustig zu sein. Natürlich lehrte er uns auch die ersten Brocken der italienischen Sprache und balgte mit uns. Als Giuseppe sich schon gut eingelebt hatte bei uns, erzählten mir meine Brüder, dass er einen grossen Schwanz mit vielen Haaren habe. Was hatten da meine Brüder erlebt und gesehen, und ich nicht? Das musste sich ändern, diesen Schwanz, diese Haare wollte ich auch sehen. An einem Sommerabend ging Giuseppe baden. Unser Haus stand ja direkt am See. Die "Knechtebude", die war ja nicht in unserer Wohnung im ersten Stock, sondern im Haus im Parterre, hinter der Werkstatt. Man musste also durch die Werkstatt gehen. Dort in einem äusserst einfachen kalten Schlag waren drei Betten aus Eisengestellen mit je einem Nachttischchen, drei Stühle, ein kleiner Tisch und einen oder zwei Schränke. Für heute unvorstellbar einfache, bescheidene Verhältnisse. In dieser Bude wartete ich, bis Giuseppe vom Bad im See zurück kam um sich abzutrocknen und anzuziehen. Und da erhaschte ich, als er die nasse Badehose auszog, mit einem Blick seinen behaarten, für meine Verhältnisse ungeheuer grossen Schwanz. Wow, war das schön! Nun stand ich nicht mehr hinter meinen Brüdern zurück, nun hatte ich den auch gesehen. Aber ich kam mir vor wie ein Dieb. Ich hatte ja wie ein Dieb quasi im Versteckten auf Giuseppe gewartet und ihm mit einem Blick ein Stück Schwanz wie „gestohlen“. Ich fühlte mich verpflichtet, ihm auch einen Blick auf mein Schnäbeli zu geben. So holte ich das kleine Ding hervor und streckte es heraus. Giuseppe interessierte sich nicht dafür und lächelte, wohl über meine Naivität. Ich hatte ein schales Gefühl einerseits, anderseits war ich glücklich, endlich seinen Schwanz gesehen zu haben.
Ich erinnere mich, dass wir, meine Brüder und ich, als wir uns wieder einmal mit den Knechten in der Knechtenbude aufhielten, mit dem Schwanz von Giuseppe spielen durften. Er hatte die Hose geöffnet, lag auf dem Bett und wir durften den Schwanz anfassen und bestaunen. Giuseppe war nicht pädophil, auf jeden Fall bekam er nicht einmal einen Steifen.
Das „Wöschhüsli“ war ein altes Haus, das am Zerfallen war. Es lag auf einer kleinen Anhöhe etwa fünfzig Meter von unserem Wohnhaus entfernt. Dort drin machte die Mutter jeden Monat einmal einen ganzen Tag lang die Wäsche von der ganzen Familie und den Knechten und dem Dienstmädchen. Vollautomatische Waschmaschinen gab es damals noch nicht.
Im Wöschhüsli konnten wir Kinder uns auch gut zurück ziehen und im Versteckten spielen. Ich erinnere mich, dass mein Bruder Walter und ein Schulfreund von ihm, Konrad, dort „Hühnerlis“ spielten. Konrad war ein Jahr älter als Walter und sexuell auch schon reifer, er war vielleicht 13, Walter 12 und ich 10 Jahre alt. Er war der Hahn, ich ein Huhn. Und wie das so geht bei den Hühnern, das hatten wir ja oft beobachtet, rennt der Hahn plötzlich einer Henne nach und springt drauf. Und so holte Konrad Anlauf, während ich als Huhn auf den Knien den Hahn erwartete. Und da Konrad in der Entwicklung war, schon einen grösseren Schwanz hatte, der auch schön steif war, tat das halt doch recht weh am Arsch, auch wenn er natürlich nicht eindringen konnte.
Später bumste mich Konrad einmal richtig. Wir drei Brüder, Paul, Walter und ich, gingen an Sonntagen öfters zu Konrad und Hans, seinem Bruder, nach Hause. Dort war es immer spannend. Die Familie lebte in einem grossen Haus mit viel Garten und Tieren, Kaninchen und schönen farbigen Hühnern, auch Zwerghühnern und Enten. Und die Eltern von Konrad und Hans, die fand ich immer so gelassen und friedlich, die liessen ihre Buben einfach machen, es schien mir immer, es gebe da nicht so strenge Regeln, was man tun durfte und was nicht, wie bei uns. Und so schlichen Konrad und ich mal in sein Zimmer wo es dann zum Bums kam. Na ja, ob es so ganz richtig war, weiss ich nicht, auf jeden Fall tat es nicht weh.
Im Heustock gab es Höhlen. Wenn das Heu mit dem Gebläse eingeblasen wurde, war es locker, aber mit der Zeit senkte es sich etwas und so entstanden unter den Balken des Dachstuhls Höhlen. Es war spannend, aber auch unheimlich, durch diese Höhlen zu kriechen. Allein getraute ich mich nicht, aber mit den Brüdern zusammen ging ich mit. Manchmal entdeckten wir ein Katzennest, denn unsere Katzen brachten ihre Jungen ja, gut versteckt, meistens in der Scheune zur Welt. Das war dann ein Fest, wenn wir junge Kätzchen entdeckten!
Und einmal, als wir Brüder und die zwei Schulkameraden uns in diesen Höhlen befanden, wollte uns Hans seinen Schwanz zeigen. Hans packte aus und bekam einen Steifen. Er begann zu wichsen und spritzte ab. Wow! So gross, so interessant, so faszinierend, wie da ein Saft herunter tropfte! Von nun an faszinierte mich das Sexuelle noch mehr.
Ich hatte ein unsägliches Bedürfnis, von einem Mann liebkost zu werden. Im Alter von 12 – 13 Jahren, begann diese Sehnsucht eine ganz klare erotische Komponente zu bekommen und dies wurde mir zunehmend bewusst. Schon bis anhin empfand ich diese Sehnsucht, sie war auch schon erotisch gefärbt, aber ich konnte sie nicht klar der Erotik zuordnen, da ich bisher die Erotik nicht kannte. Früher empfand ich einfach so etwas wie ein Glücksgefühl, wenn ein Mann, ein netter Lehrer zum Beispiel, oder der Vater, was allerdings sehr selten vorkam, etwas Persönliches, Freundliches zu mir sagte oder mich einfach beachtete, zum Beispiel durch einen Blickkontakt. Nun kam die Erotik hinzu und ich bemerkte, dass das Aussehen eines Mannes meine Gefühle beeinflusste. Mich begann die Körper-, insbesondere die Schambehaarung, zu interessieren. Oder andere, gewisse Eigenschaften im Aussehen, die ich bis heute nicht definieren kann. Der gesamte Ausdruck, die Ausstrahlung eines Mannes spielte eine enorme Rolle. Und so konnte es geschehen, dass mich die Faszination über einen Mann, natürlich rein körperlich definiert, vollkommen lähmen konnte.
Ich funktionierte, manchmal eher schlecht als recht – aber ich litt unsäglich mit meinen Sehnsüchten in meiner bodenlosen Einsamkeit. Meine Tiere zu Hause trösteten mich etwas. Man nannte mich in der Familie "Ruedi, der Hühner- und Katzenvater". Und ich hatte meine Wellensittiche, die mich ablenkten.

Ich wollte Lehrer werden. Das hatte schon in der 5. Klasse fest gestanden. Später, rückblickend war ich mir dann nicht mehr sicher, ob ich das damals gewollt hatte, oder ob es sich um eine narzistische Besetzung handelte. Meine Grossmutter mütterlicherseits war ja Lehrerin, sie hatte 14 Kinder geboren, hatte einen "bösen" Mann, einen Landwirtschaftsbetrieb und während 49 Jahren die Unterschule in einem Dorf im Berner Oberland geführt. Dabei wurde sie als sanfte, liebe, gläubige Frau beschrieben – und dementsprechend verehrt. Meine Mutter empfand sich selber nicht als so intelligent; sie hatte ja auch nie Gelegenheit gehabt, eine höhere als die Primarschule zu besuchen. Sie hatte einen Bauern geheiratet und bedauerte es wahrscheinlich immer, dass sie die Sekundarschule nicht machen durfte. Ich hatte als kleines Kind sicher eine kreative Ader, spielte gerne "sanfte" Spiele mit zeichnen und singen und, als ich dann auch in der Schule vom Intellekt her gut durchkam, da sagte man mir bald, ich würde wohl mal ein guter Lehrer werden. Und ich, der das Gefühl hatte, nicht als vollwertig angenommen zu sein in der Familie, ahnte da eine Möglichkeit, Akzeptanz zu erheischen, wenn ich das, was die Eltern gerne sähen, auch erfüllen konnte. So übernahm ich den Wunsch meiner Eltern, wohl eher der Mutter, als meinen eigenen und entschied mich Lehrer zu werden. Und zog diese Entscheidung durch, auch entgegen mehrerer Signale, die im Laufe der Zeit darauf hin deuteten, dass dieser Beruf für mich gar nicht geeignet war.
In der Kanti, im Lehrerseminar, war das Spielen eines Musikinstrumentes Pflichtfach. Damals glaube ich, waren nur Klavier und Violine erlaubt. Ich durfte ja in die Klavierstunde gehen, seit ich acht Jahre alt war. Als ich dann im Seminar war, gehörte auch die Klavierstunde zum Unterricht. Ich erreichte ein beachtliches Niveau im Klavierspielen, überschätzte mich aber selber. Kameraden oder Personen, die selber kein Instrument spielten oder sich nicht für Musik interessierten, fanden, ich spiele fantastisch, wer etwas verstand, merkte, dass Klavier eigentlich nicht das Instrument war, das mir entsprach. Ich war ja keine selbstbewusste Persönlichkeit, ich war ja immer bedacht, ja nicht negativ aufzufallen, ja nicht anzuecken oder etwas Unerlaubtes zu tun. Ich hatte noch keine gefestigte Identität, war sehr unsicher, und dies auf Schritt und Tritt. Und diese Unsicherheit übertrug sich voll auf das Klavierspiel. Nie "stand" ich darüber, immer war es eine Glückssache, wie ich durch ein Stück durchkam, und nie brachte ich ein Stück fehlerfrei zu Stande. Trotzdem bedeutete mir das Klavierspielen viel. Ich denke, dass es mir trotzdem geholfen hat, alle meine Ängste, meine Sehnsüchte, meine Minderwertigkeit, meine Probleme ertragen zu können.
Als ich klein war, musste ich ja auch in die Sonntagsschule. Und da gab es ja die Sonntagsschulweihnacht. An der Hand der Mutter betrat ich die Kirche. Wie war ich gebannt von der Orgelmusik. Und wie ein kleines Samenkorn hatte sich damals der Wunsch in meine Seele eingenistet, oder eine Sehnsucht, oder die Vorstellung, es müsse wunderbar sein, selber eine solche „Maschine“ spielen zu können. Nun im Seminar bot sich die Gelegenheit, diesen Traum zu verwirklichen. Orgel war nämlich ein Freifach. Ich schrieb mich, sobald es möglich war, bei diesem Freifach ein und stellt bald fest, dass die Orgel mir doch mehr lag, als das Klavier. Das Orgelspiel erfordert eine andere Technik als das Klavierspiel. Mein Lehrer machte mir Mut und förderte mich.
Schon bald bekam ich eine Anfrage, an einer Beerdigung in der Kirche zu spielen. Ich traute mir das überhaupt noch nicht zu, aber es ehrte mich und darum sagte ich zu.
Das Orgelspiel an jener Beerdigung muss die reine Katastrophe gewesen sein. Ich war derart nervös, hatte schweisstriefende Finger, zitternde Hände und die Noten verschwammen mir vor den Augen. Ich war so unsicher, wann ich was spielen musste, obschon ich den "Ablauf" schriftlich vom Pfarrer erhalten hatte. Und machte wohl auch tausend Fehler.
Danach habe ich trotzdem immer wieder und immer öfter in Kirchen gespielt. An Beerdigungen, an Trauungen, immer öfter auch in Gottesdiensten. Dies brachte mir ein willkommenes Sackgeld ein und gab mir eine gewisse Befriedigung. Freilich, gegen die Nervosität hatte ich jahrelang zu kämpfen. Erst nach und nach reduzierte sie sich auf ein erträgliches und vielleicht gesundes Mass.
Natürlich musste ich im Lehrerseminar meine Sehnsucht nach Zärtlichkeit mit Männern verbergen, was mich unglaublich viel Energie kostete. Ich hatte grosse Angst, meine Sehnsucht durch mein Verhalten zu verraten. Es war ja nur eine Sehnsucht, ich war doch nicht schwul.
Ich erinnere mich an einige Episoden. So sassen ein paar Kameradinnen und Kameraden in einer Zwischenstunde im Restaurant. Es war kalt draussen und ich brauchte etwas Sättigendes und bestellte "zwei Warme". Natürlich meinte ich zwei "warme Ovomaltinen". Die ganze Gruppe lachte. Da wurde mir bewusst, dass das eine gefährliche Aussage war.
Ein andermal waren wir zu Besuch bei einer Kameradin, deren Eltern zu Hause ein Restaurant führten. Auf dem Dorfplatz vor dem Restaurant stand ein grosser Brunnen. Ich hielt den Wasserhahn in der Hand. Plötzlich erinnerte mich dieser an einen Penis, Form und Grösse dieses Hahns passten zu dieser Vorstellung. Schnell wandte ich mich ab aus Angst, meine Klasse hätte mich beobachten und "falsche" Schlüsse ziehen können.
Im Hinterkopf hatte ich auch immer noch die Aussage meiner Schwägerin, als wir einmal zu Hause im Garten standen und ein Mann auf einem Töffli vorbei fuhr. Meine Schwägerin sagte: "Schau, wie der mit seinem dicken Füdli auf dem Töffli sitzt. Der ist sicher homosexuell, denn die haben so ein dickes Füdli."
Ein Freud'scher Versprecher rutschte mir viel später einmal raus, als ich längst erwachsen und nach wie vor im Kampf gegen meine Gefühle war. Mit dem Madrigalchor, in dem ich mitsang, verbrachten wir ein Sing-Wochenende im Kloster Fischenthal. Ein netter Klosterbruder empfing und verabschiedete uns. Als ich ihm zum Abschied die Hand reichte, rutschte mir "Vielen Dank und auf Wiedersehen, Schwester ......" heraus.
Immer steckte die riesige Angst dahinter, ich könnte mich verraten.
Inzwischen hatte sich mein Sexualtrieb stark entwickelt und der war bei mir immer sehr stark. Ich onanierte ja seit ich 11 war immer öfter, in der Zwischenzeit hatte sich mein Geschlechtsapparat entwickelt und ein Ständer in der Hose war nicht immer so leicht zu verbergen. Und einen solchen bekam ich oft! Damals redete man ja noch nicht so offen über sexuelle Dinge – es war für mich unvorstellbar, dass die Klasse bemerken würde, ich hätte einen Ständer. Einmal, es war in der ersten Lektion am Nachmittag. Ich hatte einen, wie fast immer. In der Schulbank sitzend, war aber keine Gefahr, dass man das entdecken würde. Die Lektion begann, der Lehrer kam herein und begann die Stunde, indem er jemanden an die Tafel rief, um eine Aufgabe – es war in der Mathematik – zu lösen. Ich schickte ein Stossgebet zum Himmel: Herr, bitte mach, dass er nicht mich ruft. Es war nämlich im Sommer und ich trug eine leichte Sommerhose aus dünnem Stoff. Es ging nicht, den Steifen zu verbergen. Und der Lehrer rief mich an die Tafel! Mir wurde fast schwarz vor den Augen. Was tun? Ich musste gehorchen. Blitzschnell steckte ich die linke Hand – mit der Rechten musste ich ja an die Tafel schreiben – in die Hosentasche und so konnte ich den Ständer schräg an den Körper drücken, und die Hand zeichnete sich ab in der Hose, nicht der Schwanz. Aber das Pech war dann noch, dass – wohl vor lauter Verkrampfung – der Schwanz nicht zusammen fiel, sondern hartnäckig hart blieb. Erst als ich wieder am Platz sass, ging die Beule in der Hose zurück.


Ich konnte mir nicht vorstellen, schwul zu sein. Ich wusste nicht, was das war. Natürlich kannte ich die Ausdrücke wie "du schwule Sau" oder so, das hatte ich auch schon gehört, und irgendwie auch mitbekommen, dass es Burschen oder Männer gab, die "es mit einander trieben". Und ich wusste natürlich auch, dass ich solche Fantasien hatte und fast übermenschlich litt. Aber schwul, was war das eigentlich? Damals war Homosexualität noch ein Tabu-Thema. Auch in den Medien gab es das Thema nicht. In unserer Familie wurde nicht einmal das Thema Sexualität, verschwiegen denn Homosexualität angesprochen, in den Schulbüchern existierte es sowieso nicht. Also, es konnte gar nicht sein, dass ich da irgendwie abwegig war. Nein, ich wusste, meine Sehnsüchte würden vorüber gehen, wenn ich nur endlich die rechte Freundin hatte.
Ich hatte ja schon den Ruf eines "Meitlischmöckers" von klein an. Ich hörte auch meine Mutter immer wieder sagen, dass die Frau, die mich einmal bekäme, eine glückliche Frau sein werde, mit mir, der so gut im Haushalt helfen konnte... Also, es war klar, ich war nicht schwul und wollte nichts anderes als eine Freundin. Und später heiraten und vier Kinder haben. Ein eigenes Haus mit Garten. Und einen Hund. Ich wollte Lehrer sein und ein guter Vater, dem nichts mehr bedeuten würde als Frau und Kinder. Am Sonntag ausfahren in die Natur, an einen See, Blumen pflücken, Sonne geniessen, heile Welt, Glück, Seligkeit..... Heile Welt war meine Sehnsucht, Hölle die Realität, in der ich lebte. Um von der Hölle in die heile Welt zu gelangen, brauchte ich eine Frau. Eine Freundin erst mal. Und nebst der Sehnsucht, die ich empfand, wenn mir ein schöner Mann begegnete, war die Sehnsucht nach einer Freundin das zweite Leiden, das mir das Leben erschwerte. Warum fand ich keine? In den Sechzigerjahren begann so etwas wie eine Befreiungsrevolution. Pärchen begannen, sich Hand in Hand in der Öffentlichkeit zu zeigen, schon mit 16 oder 17, man sah mehr und mehr junge Leute sich auf der Strasse küssen, Zärtlichkeiten austauschen. Wie beneidete ich da die glücklichen Burschen mit ihren hübschen Mädchen. Wie gerne hätte ich mich auch mit einem Mädchen gezeigt, hätte es gerne geküsst und liebkost, und natürlich auch gerne Sex gehabt.
Und ich hatte es irgendwie geschafft – ich weiss nicht mehr wie – dies einem Freund im Seminar zu sagen, der immer wieder eine Freundin hatte, niemals lange Zeit die gleiche, aber sich doch mit einer zeigte. Einmal „ging“ er mit Nicoletta aus unserer Klasse. Und so kam es, dass wir abmachten, ich dürfe Nicoletta einmal küssen. Auch mit ihr hatte er das abgemacht. Es war an einer privaten Party, da schlichen Nicoletta und ich davon. Anfänglich hatte ich dröhnendes Herzklopfen, der Mut schien mich verlassen zu wollen. Aber das wäre doch zu viel Schande gewesen, ich hätte mir selbst ja nicht mehr in die Augen schauen können – da umarmte ich Nicoletta und sie liess sich küssen. Wow, ich hatte es geschafft, ich hatte eine Frau geküsst, nun begann ich ein echter Mann zu werden. Und, es war sehr schön, die Weichheit der Zunge zu spüren, die Sanftheit, die Wärme der Lippen .... Der Kuss dauerte vielleicht eine oder zwei Sekunden. Das war genug fürs erste. Ich schaute Nicoletta an und sagte "danke"! Sie hatte mich aus meiner Not befreit, dass ich mit 18 noch keine Frau geküsst hatte. Dass es mir gefallen hatte, war ja der beste Beweis, dass ich nicht schwul war.
Später einmal musste ich über mich staunen. Es war im Skilager. Eine junge Köchin sorgte für unsere Verpflegung. Sie hiess Diana, war unkompliziert und an den Lager-Abenden natürlich auch mit dabei. Der Zufall wollte es, dass ich ihr eines Abends allein in der Küche begegnete. Ich hatte wirklich nicht damit gerechnet, sie da zu treffen, aber unkompliziert und spontan ging ich auf sie zu und küsste sie auf den Mund. So etwas war mir noch nie geschehen, dass ich so spontan und freimütig eine Frau geküsst hatte. Diese Erfahrung tat mir gut. Diana liess sich küssen von mir. Also soviel minder als andere konnte ich ja wohl doch nicht sein.
Hanni kam aus dem Bündnerland. Sie hatte meinen Jahrgang. Für ein halbes Jahr in den Wintermonaten kam sie zu uns als Dienstmädchen. Ich fand Hanni nett, aber sie war für mich wie eine Schwester, zu der ich doch etwas Distanz hatte. Und ohne spezielle Ereignisse ging die Zeit vorbei, Hanni kehrte wieder ins Bündnerland zurück.
Als sie abgereist war durchzuckte es mich plötzlich: Wäre das nicht eine Chance gewesen, endlich eine Freundin zu finden? Mein Gott, ich Trottel! Eine solche Gelegenheit würde sich mir nicht so bald wieder bieten. Da servierte man mir was ich suchte auf dem Silbertablett und ich hatte es verschmäht! Ich hätte mir die Haare ausreissen können. Und – ich reagierte halt im Nachhinein, was ja auch ein wenig zu meinem Wesen gehört. Ich schrieb Hanni, machte ihr eine Liebeserklärung. Eigentlich hat mich Hanni erotisch nicht elektrisiert, ich fand sie nett, von ihrem Wesen her, aber nicht erotisch. Aber was nicht war, könnte ja noch werden. Und Hanni schrieb zurück, dass sie es gerne mit mir versuchen würde. Ich besuchte sie im Bündnerland und konnte sogar bei ihr zu Hause übernachten. Nein, nicht mit ihr, allein in einem Zimmer. Wir machten am Abend einen langen Spaziergang und schmusten. Mehr nicht. Und irgendwie fragte ich mich immer: Liebe ich diese Frau? Ich spürte einfach keine Erotik. Ich fand sie auch jetzt wieder nett, hatte aber kein Feuer in den Adern. Hanni selber machte einen etwas feurigeren Eindruck, der Funke sprang aber nicht auf mich über. Wir pflegten dann lange einen Briefwechsel, ich hatte ihr geschrieben, dass ich sie möge, aber irgendwie nicht lieben könne. Es war für mich sehr kompliziert, mit meinen Gefühlen klar zu kommen. Da hätte ich eine nette Freundin haben können, aber ich konnte nicht. War ich doch nicht normal oder was? Ich litt weiter.
Auch mit Leni kam ich nicht klar. Sie war die Schwester von einem Freund aus meiner Klasse. Und ich wusste, dass bei ihr kürzlich eine Liebschaft zu Ende gegangen war. Wir kamen zusammen, ich weiss nicht mehr wie. Leni war ein Jahr älter als ich und hatte schon mehrere Freunde gehabt. Sie hatte ein wenig den Ruf, immer wieder andere Freunde zu haben. Umso erstaunlicher war das für mich, dass sie bei mir „anbiss“. Wohl war es mir mit Leni nie, aber wir haben heiss geschmust. Das Gefühl, nun endlich auch eine Freundin zu haben, war ein gutes. Probleme gab es, als Lena an einem Sonntag etwas unternehmen wollte, und ich nicht mochte, weil ich „lieber zu Hause bleiben wollte“. Eigentlich ein klares Zeichen, dass es für mich nicht stimmte. Und Leni hat das Zeichen offenbar ganz richtig gedeutet. Von da an hatten wir Probleme und schliesslich gaben wir auf.
Den Kopf verlor ich fast ganz wegen Belinda Brungs aus Los Angeles. Sie war für ein Jahr als Austausch-Schülerin an der Kantonsschule. Das Lehrerseminar, das ich besuchte, war ja eine Abteilung der Kantonsschule. Belinda war dunkelhäutig. Sie besuchte in der Kanti eine Klasse über mir, aber ich sah sie oft. Mein Gott, wie gefiel mir diese Frau. Eine farbige Freundin, eine duneklhäutige Frau, das wäre fein! Da wäre ich etwas besonderes, andere hätten mich vielleicht beneidet. Und ich wäre stolz gewesen. Zum Stress wegen all den hübschen Lehrern, wo ich mich gegen meine heftige Sehnsucht nach Kontakt, nach körperlicher Nähe, wehren musste, kam jetzt der Stress, wie ich es wohl anstellen könnte, mit Belinda in Kontakt zu kommen. Einmal, es war Herbst, schlich ich um die Schulhaustüre herum, in der Hoffnung, ich würde Belinda begegnen. Ich wusste, dass sie an diesem Abend bis gegen 18 Uhr Schule hatte. Ich wartete lange, es dunkelte schon zu dieser Jahreszeit. Da öffnete sich die Türe und heraus kam – Belinda! Ich fühlte einen Stich in der Brust. Juhui, ich hatte sie gesehen. Nun nichts wie weg nach Hause. Aber konnte ich mir dann noch in die Augen schauen? Nun bot sich mir die Gelegenheit – die durfte ich nicht einfach weg werfen. Mit Herzrasen und allen Mut zusammennehmend ging ich auf sie zu, und fragte, ob ich sie zum Bahnhof begleiten dürfe. Sie wohnte bei einer Familie in einem kleinen Städtchen ausserhalb des Zentrums. Auf dem Weg zum Bahnhof gelang es mir dann doch, ganz normal zu sprechen, ich fragte sie, ob die Geschwister habe und ob es ihr gut gefalle hier in der Schweiz. Der erste Schritt war getan – nun gelang es vielleicht doch noch, Belinda zu gewinnen.
Von nun an sagte wir uns „hoi“, wenn wir uns begegneten. Und ich wusste nicht, wie ich nun weiter machen konnte, um Belinda näher zu kommen. Und dabei blieb es.
Manchmal ging ich mit meinem Bruder Walter und anderen Burschen, eher aus Walters Freundeskreis, in den Ausgang. Wir gingen in eine Beiz und soffen Bier. Ich war oftmals betrunken und habe dann halbe Nächte gekotzt. Manchmal gingen wir an ein „Chränzli“, ein Dorffest, wo Tanz war. Für mich war das immer eine Katastrophe. Ich sass da, hätte gerne getanzt, getraute mich aber nicht, ein Mädchen zum Tanze aufzufordern, wie man das damals gemäss Knigge noch machte. Ich sah manchmal eine, die ich gerne "angebaggert" hätte, aber ich getraute mich nicht. So vergingen viele Abende. Gut auch Werner und die anderen Burschen waren nicht so mutig, aber immerhin mutiger als ich, und kamen doch manchmal zum Tanzen. Während ich gerne hätte, aber nicht konnte.
Als kleiner Junge hatte ich mir immer sehr gewünscht, ein Baby zu sein. Ich beneidete jeden Säugling, ich fand, Säuglinge hätten ein glückliches Leben, würden von jedermann geliebt und machten immer Freude. Schade, dass ich kein Baby mehr war.
Als Schulbub wäre ich viel lieber ein Mädchen gewesen, ich litt darunter, ein Knabe und nicht ein Mädchen zu sein. Das Leben eines Mädchens hätte mir viel mehr entsprochen.
In der Pubertät war ich neidisch auf jede junge Frau, auf die Schwestern, auf meine Mitschülerinnen an der Kanti. Warum war ich ein Mann geworden und nicht eine Frau? Als Frau hätte ich mich beweisen können, hätte mich schön frisieren, anziehen und schminken können. Ein Frauenleben war das, was ich mir gewünscht hätte und oftmals war ich sehr traurig, dass es eben nicht so war. Als Frau wäre ich glücklich gewesen. Meinte ich.
Ich orientierte mich beim Heranwachsen an meiner älteren Schwester Erna. Sie war ja bereits erwachsen, im Berufsleben und ich fand das, was sie tat, richtig. Ich las ihre Frauenzeitschriften, dort mit Vorliebe die Frage- und Antwort-Rubriken. Natürlich wurden dort ausschliesslich Frauenthemen behandelt. Ich untersuchte ihr Handtäschli auf ihre Frauen-Utensilien, erprobte den Lippenstift, den Nagellack, den Gesichtspuder. Das alles natürlich heimlich und möglichst unbemerkt, aber es kam doch vor, dass sie mich dabei ertappte, oder es mir nachher ansah, wenn ich das Rot des Lippenstifts nicht ganz weggewischt hatte. Ich trug manchmal die Damenschuhe von Erna, stolzierte mit diesen sogar im Freien umher. Dabei kam es schon mal vor, dass mich jemand von der Familie sah. Aber es kam ja selten vor und so ahnte niemand, wie sehr ich mir wünschte, eine Frau zu sein oder zu werden. Und ich sehnte mich nach Zärtlichkeit mit einem Mann und Männern. Alles, was den Frauen vorbehalten zu sein schien. Ja, es wäre viel einfacher gewesen, ein Mädchen, eine Frau zu sein.
Weil mich alles von Erna beeindruckte, begann ich auch zu rauchen. Durch sie kam ich ohne weiteres auch mal an Zigaretten heran. Das war so im Alter von 16 Jahren. Natürlich musste ich das im Verborgenen tun, denn der Vater duldete das nicht. Er selber rauchte Stumpen. Ich erinnere mich noch an die Rösslistumpen die er rauchte und später dann die Rio6. Ich rieche noch den Geruch in der Stube, wenn Vater rauchte. Es gehörte damals einfach zu ihm. Aber Zigaretten rauchen, das kam in seinen Augen nicht in Frage. Hin und wieder bemerkte er doch, dass wir Jungen rauchten, oder geraucht hatten. Dann gab es Tadel. Was für mich hiess, dass ich das nächste Mal noch besser aufpassen würde, wenn ich rauchte. Mehr und mehr rauchte ich weniger versteckt, aber doch immer darauf bedacht, dass es der Vater nicht sah. Und rauchte natürlich immer öfter.

In jener Zeit war aber nicht nur bei mir, sondern wohl in der ganzen Familie Krise. Mein ältester Bruder hatte eine Frau geheiratet, die dem Vater nicht genehm war. Sie zogen weg für ein paar Monate ins Ausland. Nach der Rückkehr war geplant, dass er den Bauernhof übernehmen und später mit dem Bruder Walter den Hof als "Gebrüder" führen sollte. Aber Vater und Sohn kamen nicht zurecht miteinander. Das jung verheiratete Paar zog aus. Nach einiger Zeit holte der Vater die zwei wieder zurück, man wolle es doch nochmals miteinander versuchen. Es klappte wieder nicht, Im Streit trennten sich Alt und Jung wieder. In einem anderen Kanton fand mein Bruder eine Meisterknecht-Stelle. Meine Schwägerin erzählte mir später, der Vater habe sie dann nochmals zurückholen wollen, was sie aber abgelehnt hätten. Das kann ich gut verstehen.
Erna lebte ihr eigenes Leben, ging arbeiten und leistete sich Ferien und anderen Luxus und distanzierte sich klar vom strengen gotthelfschen Lebensstil, den der Vater gerne durchgesetzt hätte. Veronika, die jüngere Schwester ging es schlecht, sie hatte wohl auch Probleme mit dem Umfeld, in dem sie lebte. Vater musste sich einer Operation unterziehen: Krampfadern. Im Spital erlitt er eine Embolie und es ging ihm nicht gut. Die Mutter erzählte, dass er auch als 20-Jähriger bei der Blinddarm-Operation fast an einer Embolie gestorben wäre. Aber es war wie immer, wenn er nicht da war: Die Atmosphäre war entspannter, gelöster, freier. Nun durfte auch gelacht werden, auch die Mutter konnte lachen und auch mal einen Scherz machen. Ich hoffte, Vater würde sterben.
Er starb nicht. Die düsteren Jahre blieben. Er war in einer Depression. Eigentlich immer lag über unserer Familie ein depressiver Deckel. Immer öfter, wenn ich von der Schule – der Kanti – mit dem Velo heimkam, fühlte ich, wie so etwas wie ein Panzer über meinen Kopf kroch. Ja, mir war, als trüge ich einen Helm auf dem Kopf, der aber verschwand, sobald ich von zu Hause weg fuhr, und er "kroch" wieder über, wenn ich zu Hause ankam.
Diese Zeit war wahrscheinlich auch für Vater nicht leicht. Auf jeden Fall ging es ihm nicht gut. Er sprach zwar nie, war immer düster und schien bedrückt. In dieser Zeit der Versuche sich zurück zu ziehen vom Hof und ihn zu übergeben, war seine Bedrängnis besonders stark zu spüren. Er selber sprach nie davon, aber von der Mutter wusste ich, dass er am Liebsten zurück ins Emmental gezogen wäre, er hätte dort gerne ein Häuschen gebaut. Zurück zu den Wurzeln zog es ihn. Es wäre wahrscheinlich auch das eine Enttäuschung gewesen, denn er war seit etwa 25 Jahren in der Ostschweiz und das Emmental war auch nicht mehr dasselbe. Mutter war die, die klar sagte, sie gehe nicht mit. Und so ging auch er nicht. Es war offensichtlich, dass er in einer schweren Krise war. Plötzlich lag auf dem Kachelofen ein Gewehr. Wahrscheinlich zur Demonstration, dass er mit der Möglichkeit eines Suizids spielte oder gar eines grösseren Gewaltaktes, vielleicht gegen Frau und Söhne und Töchter gerichtet. Auf jeden Fall hatte meine Mutter Angst, weg zu gehen. Sie sagte einmal, als sie an ein Kirchenkonzert vom Kammerchor der Kantonsschule, wo ich mitsang, kam: "Hoffentlich macht der Vater in dieser Zeit nicht Dummes"!
Im Schreibtisch lag ein verschlossenes Briefcouvert mit der in der Handschrift meines Vaters geschriebenen Anschrift "Erst nach meinem Tode öffnen". Voller Sorge meinte die Mutter einmal, da stünden wohl nichts als Vorwürfe drin. Ob der Brief je einmal geöffnet wurde oder er sonstwie verschand, ich habe nie danach gefragt und weiss es nicht.
Ich ging einmal durch die Scheune und suchte etwas. Vielleicht eine Katze? Oder ein Werkzeug? Alles war still. Plötzlich sah ich meinen Vater auf einem hochgestellten Fass sitzen, einem Oelfass oder so. Und er sinnierte vor sich hin. Er sah schwermütig und traurig aus; lautlos machte ich mich von dannen. Aber er tat mir leid. Er war der, der das Klima in unserer Familie sehr negativ beeinflusste, er war der, der Dunkles ausstrahlte und einen schweren Schleier über Haus, Hof und Familie legte, er war der, der nicht reden konnte.... Er machte mir – ich kann nur von mir reden, aber wahrscheinlich den andern auch - das Leben sehr schwer. Aber irgendwie begriff ich jetzt, dass auch er litt, dass er gefangen war in seinen Grenzen. Es wurde mir klar bewusst, was ich ja schon lange ahnte: Er war kein Böser, er war ein Armer. Ich hasste ihn trotzdem.


Schon als Kind tat es mir immer schrecklich weh, wenn mich eine Biene stach. Je öfter ich gestochen wurde, umso mehr wurde ich geschwollen und es gab immer mehr körperliche Reaktionen. Es kam vor, dass, wenn mich eine Biene in den Fuss gestochen hatte, ich einen geschwollenen Kopf bekam. Schliesslich ging ich deswegen einmal zum Arzt. Er schickte mich in die Dermatologie nach Zürich, um genau abzuklären, ob ich allergisch sei. Und so reiste ich einmal, ich war sicher schon so 19 oder 20, nach Zürich. Nach dem Besuch des Ambulatoriums in der Dermatologie benutzte ich den angebrochenen Tag für einen Besuch im Zoo. Schon dort fiel mir ein grauhaariger Mann auf, der allein war und immer wieder zu mir her schaute. Könnte das ein Schwuler sein? Aber der sah ja ganz gewöhnlich und normal aus. Er sass dann auch im gleichen Tram, als ich wieder zurück fuhr. Natürlich schaute ich auch immer wieder zu ihm hin, da er etwas Geheimnisvolles ausstrahlte. Bei einer der Haltestelle, wo es ein Pissoir hatte, stieg er aus, steuerte auf das Pissoir zu, schaute auffordernd zurück und blieb unter dem Eingang sogar stehen. Ich spürte ein grosses Verlangen, ihm zu folgen, es interessierte mich ja sehr, ob etwas, und wenn ja, was da drin "laufen" könnte. Ich hatte Herzklopfen und konnte mich nicht überwinden, auszusteigen und dem Mann zu folgen. Die Angst war grösser. Es war die Angst, dass sich meine Homosexualität dann erst richtig entfalten könnte, wenn ich sie leben würde. Nein, das durfte ich nicht, ich musste sie unterdrücken. Dann würde sie sicher mit der Zeit verschwinden.
Es war in der Zeit des Seminars, im Sommer der Abschlussprüfungen. Arnold war ein Schulkamerad. Ich bewunderte seine Selbstsicherheit. Es freute mich, als er mich fragte, ob ich im Sommer mithelfen würde, ein Sonntagschullager zu leiten. Er sei Hauptleiter, habe bereits eine alte Kindergärtnerin und zwei junge Kantischülerinnen als Hilfsleiterinnen. Es wäre aber gut, wenn er noch eine Person mehr und am liebsten einen Burschen hätte. Ich stand vor dem Abschluss des Seminars, würde also bald Lehrer sein und da hatte es mir doch Freude zu machen, ein Lager zu leiten.
Und eine Nebenhoffnung spürte ich: Vielleicht war eine der beiden jungen Hilfsleiterinnen eine Freundin für mich?
Es wurde dann auch ein Ferienlager, das mein Leben tiefgründig beeinflusste. Eine der beiden Mitleiterinnen, Valentina, und ich kamen uns näher. An den Abenden, wenn die Kinder im Bett waren und einigermassen Ruhe eingekehrt war, jassten wir oft im Leiterteam oder wir spielten Schach zu zweit. Mit „Füessele“ unter dem Tisch begann unsere Beziehung. Der Körperkontakt breitete sich von den Füssen her aus und am Ende des Lagers schmusten wir innig.
Valentina war ein ganz tolles Mädchen. Sie kam aus sehr ähnlichen, bäuerlichen Verhältnissen wie ich und wir verstanden uns von vorn herein. Sie war eine junge Frau, die eine eigene Meinung hatte und diese auch vertrat. Das imponierte mir sehr. Sie gefiel mir und schon nach kurzer Zeit war für mich klar, dass das MEINE Frau sei. Ich hatte mich in Valentina verliebt und war total glücklich. Wenn ich im Bett lag und an sie dachte, wenn ich vor Glück gar nicht einschlafen konnte, da kam es aber doch vor, dass ich mich nach einem sexuellen Kontakt mit Arnold sehnte. Es wäre so einfach gewesen, wir schliefen ja im gleichen Zimmer. Natürlich hatte ich nicht den Mut, mich ihm zu offenbaren und von ihm aus kamen auch keine diesbezüglichen Signale.
Zwischen Valentina und mir entwickelte sich eine wundervolle Beziehung, die auch von unseren Familien getragen wurde.
Wenn Valentina und ich am Wochenende in den Ausgang gingen, konnte ich das Auto von meinem Bruder Werner benutzen und brachte Valentina nachher nach Hause. Dabei führte die Strasse über Land. Nun war es Herbst geworden, der Mais auf den Feldern stand hoch. Sie boten sich geradezu an, mit dem Auto von der Strasse weg, durch einen Feldweg zu fahren und neben einem Maisfeld zu parkieren. So konnte man sich mit dem Auto recht gut verstecken und schmusen. Aber nicht, dass wir schon sehr schnell Sex gehabt hätten! Klar, ich wäre bald, eigentlich von Anfang an, bereit gewesen. Ich wollte ja schon lange wissen, wie das geht und wie eine Frau zwischen den Beinen aussieht. Und ausserdem war da die Hoffnung, dass durch den Sex mit einer Frau meine Sehnsüchte nach Sex mit Männern endlich abklingen würden. Ich war überzeugt, dass diese nur so stark und heftig waren, weil ich den „richtigen“ Sex noch nicht kannte. Aber Valentina blieb relativ streng. Offenbar war sie noch nicht bereit dazu. Sie liess mich gewähren, sie zu liebkosen, sie zu knutschen; aber sobald sich meine Hand ihrer Schamgegend näherte, wehrte sie ab. Mich beeindruckte das sehr. Das war noch eine Frau mit Charakter!
Nach einem Jahr kam der Punkt, wo wir Geschlechtsverkehr hatten. Endlich hatte ich den Beweis, dass ich doch ein richtiger Mann war und nicht etwa ein gestörter, kranker Homo.

Ende 1969 war es geschafft. Ich war Lehrer! Aber bevor ich das sagen konnte, hatte ich noch eine mir unvorstellbare Hürde zu überwinden:
Das Oberseminar war für mich ein schreckliches Jahr. Wir hatten natürlich Übungsschule. Zu Viert wurde man quartalsweise einer Übungsklasse zugeteilt und immer 2 Seminaristen mussten an einem Vormittag eine Lektion halten in dieser Klasse, unter Aufsicht und Anleitung des betreffenden Lehrers. Und diese Übungslektionen waren eigentlicher Horror für mich. Stundenlang bereitete ich eine solche Lektion vor, mit Lektionsplan und dem nötigen Material, das ich dann zu brauchen gedachte, z. B. für die Moltonwand. Ich habe bis spät abends dann die Lektion durchgespielt in meinem Zimmer, bin spät zu Bett gegangen und fand keinen Schlaf. Was, wenn ich den Faden verlieren sollte? Was wenn ich plötzlich nicht mehr weiter wusste?, Was, wenn mir die Schüler eine Frage stellen, die ich nicht beantworten konnte? Ich habe mir jedes Szenario ausgemalt und war vor Angst vor dieser Lektion wie gelähmt. Wie vor einer Prüfungssituation. Ich fand meine Lektionen nie oder selten gut, wahrscheinlich beurteilte ich sie schlechter als sie wirklich waren. Aber ich habe gelitten, ganz enorm. Und wiederum konnte ich mit niemandem darüber sprechen. Zu den Eltern hatte ich kein Vertrauen, meine Geschwister waren nicht mehr zu Hause, ausser Walter. Wir hatten ja im Elternhaus nie gelernt, über Persönliches, über unsere Gefühle, Ängste und Nöte zu sprechen. Mit Lehrern und Klassenkameraden konnte ich auch nicht sprechen, ich hätte mich ja verraten, dass ich nicht Lehrer werden sollte. Ich hätte mich selber meiner Unzulänglichkeit entlarvt und das wagte ich nicht. Ich wollte nicht auffallen, ich wollte nicht abfallen. Und so litt ich still vor mich hin und zählte die Monate, bis das Oberseminar zu Ende war und ich endlich eine eigene Klasse führen konnte.
Nur einmal habe ich einen Hilferuf ausgeschickt, der unerhört verhallte. Nach einer gehaltenen Lektion mussten wir eine Nachpräparation schreiben, also die Lektion reflektieren, auswerten und uns mit der Kritik der Kameraden und des Übungslehrers auseinander setzen. Und da schrieb ich einmal, dass ich sehr Mühe hätte mit den Probelektionen und eben schreckliche Ängste davor und schlaflose Nächte etc. Danach sprach mich der Übungsschullehrer darauf an und fragte, ob meine Probleme etwas mit ihm zu tun hätten, mit seiner Klasse oder so. Und das musste ich verneinen, es hatte nichts mit ihm oder seiner Klasse zu tun. Und damit war es für ihn erledigt.
Ein sensibler Lehrer hätte an dieser Stelle vielleicht gemerkt, dass ich Hilfe gebraucht hätte. Doch wie hätte diese Hilfe aussehen können? Ich gestand mir ja selber nicht ein, dass ich Hilfe brauchte.
Im Sommer suchte ich eine Stelle als Lehrer. Das Oberseminar endete im Herbst. Es herrschte damals Lehrermangel und man konnte eigentlich aussuchen, wo man hin wollte. Mir war das recht, ich wollte ja schon lange von zu Hause fort, es war mir nicht daran gelegen, nahe beim Elternhaus zu sein.
Ein Kamerad von mir, mit dem ich mich all die Jahre gut verstanden hatte, hatte Verwandte in der Voralpenregion. Mein Kamerad, sagte zwar, dass diese Region für ihn nur in Frage komme, wenn er keine Stelle in unserer Stadt erhalte. Aber ich bewarb mich um eine Stelle in den Voralpen und bekam sie.
Aber noch galt es, die Abschlussprüfung im Oberseminar zu machen. Sie machte mir nicht so grosse Angst, weil ich immer gehört hatte, dass seit 20 Jahren nie mehr jemand durchgefallen wäre. Da würde wohl kaum ich jetzt gleich der Erste sein nach so langer Zeit.
In einem Punkt hatte ich aber Pech an der Prüfung. Es war am Tag der Prüfung des Faches Religion. Ich war um 10 Uhr an der Reihe. Ich schlief nicht gut, aber am Morgen dann doch tief. Ich erwachte und schaute auf die Uhr, es war wohl 9 Uhr, das reichte gut, vor halb 10 musste ich nicht aus dem Haus. Ich stand auf, ging in die Küche um zu frühstücken und prüfte auch dort die Zeit auf der Küchenuhr. Es war jetzt ein Viertel nach 9, also genau richtig. Ich ging rechtzeitig aus dem Haus und fuhr mit dem Auto von Walter weg. Der Weg führte an einem Schulhaus vorbei, an dessen Wand eine grosse Uhr war. Wie jeden Tag, um mich zu vergewissern, schaute ich auch an diesem Morgen darauf. Sie ging falsch, sie zeigte schon 10 nach 10. Das konnte nicht stimmen, zu Hause habe ich mich ja an zwei Uhren orientiert, die beide die gleiche Zeit zeigten, ich war früh genug weg gefahren. Da fiel mein Blick auf die Uhr im Auto: 10 nach 10. Nein, nein, das durfte nicht sein, ich war zu spät, meine Zeit für die Prüfung hatte schon angefangen. Was machte ich jetzt? Dass die Uhr zu Hause falsche Zeit zeigte, tönte als zu billige Ausrede, und dass gleich zwei Uhren zu Hause die gleiche, falsche Zeit anzeigten, das würde mir niemand glauben. Also, die Wahrheit zu sagen, das war in diesem Fall das Dümmste. Ich musste eine Ausrede erfinden. Und was fiel mir ein? Dass das Benzin im Auto ausgegangen sei, und ich das Auto bis zur nächsten Tankstelle – glücklicherweise sei es in der Nähe von einer Tankstelle stehen geblieben – schieben musste. Es muss auch wie eine faule Ausrede getönt haben. Ich konnte dann die Prüfung in Religion doch noch machen an diesem Vormittag, aber sie war sehr schwierig, ich wusste, dass ich da eine schlechte Note bekommen würde. Und hatte ein sehr ungutes Gefühl wegen dem zu spät kommen. Das hinterliess sicher einen schlechten Eindruck von einem angehenden Lehrer.
Nachdem alle Prüfungstage durch waren bekam ich einen Telefonanruf vom Rektor des Oberseminars. Er wollte mit mir reden. Das tönte nicht gut. Aber wahrscheinlich war es wegen dem zu spät Kommen. Sollte ich ihm die Wahrheit sagen? Oder vielleicht wollte er mir sagen, dass ich nicht so gut abgeschnitten hätte. Sicher nicht, ich sei durch gefallen. Seit 20 Jahren war ja keiner mehr durch gefallen. Er sagte sagte mir dann, dass ich eine sehr schlechte Prüfung gemacht hätte, auch die Diplomarbeit sei als ungenügend zu bewerten. Nein, nein, es sei noch nichts entschieden, er würde an der Prüfungs-Konferenz dann noch schauen, ob er noch etwas für mich tun könne.
Er konnte (wollte) nicht. Ich fiel durch. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, jetzt auszusteigen und eine andere Laufbahn einzuschlagen. Aber nein, ich wollte doch Lehrer werden, das war mein Beruf.
Es war hart. Der GAU, den ich überhaupt nicht befürchtet hatte, war eingetreten. Ja, das war eine Ohrfeige, die mir das Leben "versetzt" hatte. Aber es liess sich nicht ändern.
Es fiel mir sehr schwer, das Jahr des Oberseminars zu wiederholen. Ich musste nun noch ein Jahr zu Hause bleiben und die miese Stimmung aushalten.
Und es passierte mir noch ein Fehler; Ich blieb an meiner Stelle in den Voralpen hängen; die Gemeinde war an mir interessiert, offenbar war es einfacher, eine Jahres-Stellvertretung zu suchen als eine Anstellung.
Ein Jahr später als geplant konnte ich endlich sagen: Hurra, ich bin Lehrer!
Das war mein Leben: Schule, essen, schlafen, vorbereiten. Am freien Nachmittag, am Mittwoch, nahm ich zur Entspannung ein Bad und ging danach ins Bett, weil ich so müde und erschöpft war. Vor schlechtem Gewissen, da ich ja vorbereiten sollte, oder auch weil es sich doch nicht gehörte, am helllichten Tag ins Bett zu gehen, konnte ich aber nicht schlafen. Da ich doch etwas gedöst hatte, stand ich mit einem schwindligen Kopf wieder auf und bereitete vor, bis spät abends. Ich ging nie aus, weder Kino noch Konzert oder sonst was gönnte ich mir. Ich arbeitete nur. Dabei fühlte ich mich natürlich nicht wohl, fühlte mich überfordert und ausgelaugt, fühlte mich völlig allein, da ich keine Kontakte pflegte und es im Lehrerkollegium offenbar so üblich war, dass jeder für sich allein „wurstelte“.
Und trotzdem redete ich mir ein glücklich zu sein. Ich hatte mein Lebensziel erreicht. Und die Probleme beim Schule geben, die würden sich mit der Zeit sicher verlieren, da mit den Jahren ja auch die Routine und die „Erfahrung“ kommen mussten.
Kraft, dies alles durchzuhalten, gab mir meine Beziehung zu Valentina. Jedes Wochenende fuhr ich zu ihr und genoss das Leben mit ihr. Ich konnte es jeweils kaum erwarten, dass es Samstag wurde. Damals war am Samstag noch bis Mittag Schule. Wenn ich am Nachmittag bei ihr ankam, da war ich oftmals frustriert. Sie hatte zu Hause das Ämtli, die Stube zu putzen, und weil wir abends meistens ausgingen, musste sie sich selber natürlich auch „schön machen“. Nach amerikanischer Manier - Valentina war ja zwei Jahre zuvor in einem Austauschjahr in Amerika gewesen – putzte sie die Stube mit den Lockenwicklern im Haar. So wurde ich meistens empfangen. Dabei konnte ich es fast nicht erwarten, mit ihr ins Bett zu gehen und konnte nicht verstehen, dass dies nicht auch ihr grösstes Verlangen war. Ich wollte ja ein verständnisvoller, guter Mann werden und so machte ich jedoch immer gute Miene dazu. Ja, ich hatte auch Verständnis, dass Valentina zu Hause helfen musste. Ihre Eltern kannten ja auch nichts anderes als Arbeit. Aber es frustrierte mich.
Trotzdem fühlte ich mich glücklich. Mein Leben stimmte für mich. Obschon es verkrampft und Kräfte raubend war.
Wie ich neu in das Dorf kam, wo ich eine Lehrerstelle bekommen hatte, stellte ich mit Erleichterung fest, dass es keinen Kollegen gab, der mich erotisch faszinierte und in den Bann zog, wie ich es sonst kannte. Einer, Wilfried, sah zwar gut aus, aber er blendete mich nicht. Am Anfang. Es dauerte aber nicht lang, stellte sich die Faszination ein. Er galt als sehr beliebter, guter Lehrer und dadurch bewunderte ich ihn. Und je länger ich ihn kannte, umso mehr gefiel er mir und „erotisierte“ mich. Tatsächlich je länger je mehr. In der Pause war es üblich, dass die ganze Lehrerschaft draussen auf dem Pausenplatz beisammen stand. Da stand ich manchmal und himmelte Wilfried an. Immer zwischen den beiden Hoffnungen, er möge meine Sehnsucht nach körperlicher Nähe zu ihm erkennen und darauf eingehen, und er möge hoffentlich nichts bemerken. Ich wusste, er hatte eine Frau und zwei kleine Buben. Also war die Chance, dass er meine Hoffnung, er würde mal mit mir ins Bett steigen, erfüllen würde, quasi gleich null. So konnte ich diese Sehnsucht nur in der Fantasie ausleben.
Schlimm war für mich auch das Lehrerturnen. Meist spielten wir am Donnerstag am frühen Abend Volleyball. Wilfried trainierte uns, weil er auch in diesem Sport der Fachmann war. Ein Grund mehr, ihn zu bewundern. Und in der Garderobe zogen wir uns um und da wurde natürlich auch geduscht. Wilfried sah fantastisch aus. Ich war wie gebannt – und konnte ihn doch nicht allzu auffällig anschauen. Ich tat es verzweifelt mit seelischen Schmerzen heimlich und verstohlen.
Diese Faszination wurde je länger je stärker. Manchmal hielt ich es fast nicht aus, in seiner Nähe zu stehen und ihn nicht anfassen zu dürfen. Wie sehnte ich mich danach! Es zerriss mich fast. Ich liebte sein Lachen, ich liebte seine Stimme, es zog mich zu ihm hin und ich brauchte meine ganze Kraft, mich gegen diese Anziehung zu wehren.
Franz war der einzige Kollege im Lehrerteam, der auch noch ledig war. Wir waren oft zusammen. Meist über Mittag. Wir assen bei mir oder bei ihm, öfter bei mir, manchmal im Restaurant. Danach tranken wir Kaffee und hörten Musik. Franz war sehr intellektuell. Ich fühlte mich von seinen Gesprächsthemen überfordert und diese Mittagpausen waren oft keine Erholung, sondern anstrengend für mich. Trotzdem brauchte ich sie. Die Alternative wäre gewesen, auch über Mittag noch allein zu sein.
Einmal während eines Gesprächs über eine Kollegin sagte Franz, dass es Menschen gebe, die spürten, dass etwas in ihrem Leben nicht stimme, sie aber nichts dagegen unternehmen würden, sondern mit unguten Gefühlen unzufrieden weiterleben würden. Er meinte damit wohl jene Kollegin, aber für mich war es ein Fingerzeig. Da keimte in mir drin der Entschluss, etwas gegen meine homoerotischen Sehnsüchte zu unternehmen. Für mich war klar: In meiner Entwicklung musste etwas schief gelaufen sein. Ich gab die Schuld meinen Eltern, die mir nicht das Umfeld geboten hatten, das ich gebraucht hätte für eine gesunde Entwicklung. Meine Probleme mit dem Vater hatten wohl dazu geführt, dass ich einfach eine zu grosse Sehnsucht nach einem Mann, eigentlich nach dem Vater, hatte und darum in dieser emotional schwierigen Lage war. Aber Fehlentwicklungen konnten sicher behandelt werden. Ja, doch! Ich musste zum Psychiater. Ich war nicht körperlich krank, aber seelisch fehlentwickelt und darum brauchte ich eine Therapie. Was sollte ich tun, an wen konnte ich mich wenden? Am ehesten an den Chefarzt der Kantonalen Psychiatrischen Klinik. So meldete ich mich an für ein Gespräch.

Ich hatte immer ein sehr grosses Gerechtigkeitsgefühl. Ich fand, meine Freundin Valentina müsse wissen, mit wem sie sich da einlässt. Wenn sie alles wusste und mich trotzdem wollte – dann ok, aber ihr zu verschweigen, dass ich krank war und psychiatrische Hilfe brauchte, das konnte ich nicht verantworten.
Ich nahm mir vor, ihr am nächsten Wochenende, wenn ich zu ihr ginge, mit ihr zu reden und ihr von meiner Sehnsucht zu erzählen. Ich war auf alles gefasst: es konnte sein, dass sie mich verjagte, es konnte aber auch sein, dass sie mich trotzdem akzeptierte und mit mir zusammen bleiben wollte. Ich war ja schliesslich sonst ein Lieber und die Mutter hatte doch immer gesagt, dass die Frau, die mich einmal bekäme, eine glückliche Frau sein würde.
Es war nicht leicht, Valentina meine Sehnsucht nach „Mann“ einzugestehen. Ich hatte mich aber bereits entschieden, diese Sehnsüchte wegtherapieren zu lassen. Und das machte es mir etwas einfacher, da ich ja gewillt war, meine Fehlentwicklung zu korrigieren.
Valentina reagierte ganz gut auf mein Geständnis. Sie fand es sehr gut von mir, dass ich entschlossen war, eine Therapie zu machen. Auf jeden Fall wollte sie mich deswegen nicht verlassen. Wow, wie tat mir das gut! Offenbar hatte ich doch viele gute Qualitäten, dass Valentina diese meine Krankheit in Kauf nahm. Aber ich war ja nur vorübergehend krank. Der Psychiater würde mir schon beweisen, dass ich nicht homosexuell - schwul war damals noch ein sehr hässliches Schimpfwort - war. Und er würde mir helfen, diese Sehnsucht nach Mann zu überwinden.
Mit unheimlich grosser Überwindung, mit den schrecklichsten Horrorvorstellungen, was alles geschehen könnte, wenn ich psychiatrische Hilfe in Anspruch nahm und man das erführe, hatte ich mich also zu einem Gespräch bei Herrn Doktor angemeldet. Ich fuhr dann hin mit Herzklopfen und in grosser Angst, jemand könnte mein Auto vor dem Haus sehen und erkennen. Es war ganz schlimm. Aber ich zog es durch.
Herr Doktor hatte ein sympathisches Gesicht, er hatte weiche Züge im Gesicht. Ich schilderte ihm mein Problem und stellte ganz konkret die Frage, ob es denn bei Homosexuellen auch so sei, dass sie sich eine feste Partnerschaft wünschten wie zwischen Mann und Frau. Ja, natürlich sei da so, das sei genau das gleiche.
Da hatten wir es also: Das wollte ich nicht. Ich sehnte mich nicht nach einer „Ehe“ mit einem Mann, sondern nach Zärtlichkeit und Sex. Eine Ehe wollte ich mit Valentina, das war meine Vision, mein Ziel. Also war ich doch nicht homosexuell, sondern ganz normal. Nur dass bei mir eine grosse Sehnsucht nach Mann da war. Aber um diese zu beseitigen, kam ich jetzt ja hierher. Alles würde gut werden.
Nun begann eine lange Zeit der Auseinandersetzung mit mir selber. Auf Anraten des Psychiaters begann ich, auf meine Träume zu achten und träumte dementsprechend viel, oft von Wasser als trübe Kloake mit allerlei Gewürm und anderem Getier, mit Schlamm und Unrat drin – eine unergründliche Tiefe. Viel später begriff ich, dass dies mein Unbewusstes, meine Seele symbolisierte, ich es wenigstens so empfand, so unergründlich, so tief, so unheimlich. Undurchsichtige, Angst einflössende Tiefe – ein Abbild meines Unbewussten.
Es ging mir sehr schlecht. Die therapeutischen Gespräche, die Träume, die Überforderung in der Schule, das Abwehren meiner homosexuellen Bedürfnisse raubten unsäglich viel Kraft. Und ich konnte dies niemandem sagen. Ich war allein. Und hatte grosse Angst, dass Kollegen oder sonst jemand bemerken würde, dass ich grosse Probleme hatte. Nein, gegen aussen gab ich mich unbelastet, so als hätte ich das Leben im Griff.
Diese Auseinandersetzung mit mir selber wühlte mich auf – und ich beobachtete meine Gefühle und meine Sehnsüchte, ob sich da schon eine Besserung zeigen würde. Und durch das stete Beobachten spürte ich meine Gefühle gar nicht mehr. Ich war zeitweise sehr depressiv, ich war immer müde – konnte aber doch nicht gut schlafen. Ich arbeitete unheimlich viel für die Schule und blieb doch unzufrieden mit mir. Zum Glück konnte ich an den Wochenenden mit Valentina über meine Probleme sprechen. Ich erzählte ihr alles – auch am Telefon oder in Briefen - über die Gespräche beim Therapeuten, was wir dort besprachen und was ich darüber dachte. Es war eine Phase meines Lebens, wo ich völlig auf mich konzentriert war. Es muss für Valentina schlimm gewesen sein, ich war ja dadurch emotional auch nicht offen für sie.
Valentina kam einmal mit in die Psychotherapie. Ich wollte ihr unbedingt den netten Doktor zeigen, anderseits wollte ich, dass sie von ihm selber hörte, dass meine homosexuelle Neigung vorübergehen werde. Ich erinnere mich nur noch an eine Sequenz dieses Gesprächs: Sie sagte klar, dass sie mich trotzdem heiraten wolle, auch wenn ich im Moment noch nicht „gesund“ war. Da hatten wir es wieder: Ich war offenbar so liebenswert, dass eine Frau mich heiraten wollte.
Trotz Glücksgefühlen und der Illusion, die homosexuellen Sehnsüchte gingen jetzt vorbei, umklammerten mich die diesbezüglichen Probleme nach wie vor. Manchmal hielt ich es fast nicht aus, die Sehnsucht nach Sex mit Wilfried - oder einem anderen Mann - zerriss mich fast. Das würde sicher erst aufhören, wenn ich so etwas erlebt hatte. Auch der Psychiater riet mir, „es“ mal auszuprobieren. Und so konnte ich Valentina überzeugen, dass ich mal Sex mit einem Mann haben musste, um von diesen Sehnsüchten befreit zu werden.
Von irgendwoher wusste ich, dass sich Schwule auf Bahnhoftoiletten treffen. So fuhr ich eines Abends in die Stadt. Es war der Wochentag, an dem Valentina in der Frauenriege war und danach noch mit den Dorffrauen ins Restaurant ging. So hatte ich etwa 3 Stunden Zeit. Ich hatte schreckliche Angst, jemand aus meinem Dorf könnte das Auto sehen beim Bahnhof. So zerriss es mich fast: Jetzt musste es sein – und dann ganz schnell wegfahren wieder nach Hause. Ein älterer Mann lockte mich in eine Toilette. Wir packten aus und begannen gegenseitig zu onanieren. War das ein gutes Gefühl, endlich den steifen Schwanz eines Mannes in der Hand zu halten und zu spüren…..
So jetzt war es geschafft, ich hatte Sex gehabt mit einem Mann! Wow, ich hatte seinen Schwanz gesehen und fest gestellt, dass er etwa gleich gross war wie meiner. Ich konnte also bestehen, ich war wohl doch ein rechter Mann.
Ich war sehr aufgeregt, glücklich, dass ich „es“ geschafft hatte, aber auch mit einem schlechten Gewissen Valentina gegenüber. Ich war überzeugt, dass jetzt meine unerträgliche Sehnsucht nach Mann vorbei sein würde. Ich hatte es jetzt ja erlebt und wusste nicht recht, ob ich es genossen hatte oder nicht. Es war auch nicht wichtig. Ich kannte jetzt den Männersex und darum musste ich mich ja nicht mehr danach sehnen. Jetzt war mein Leiden vorbei, jetzt konnte das Glück beginnen.
In der nächsten Psychotherapiestunde erzählte ich alles meinem Therapeuten. Er hörte es sich an und fragte danach, ob ich es genossen hätte. Ich zögerte einen Moment. Ich spürte, ja, ich hatte es genossen, aber das durfte ich doch nicht sagen. Ich war jetzt ja geheilt und da passte es doch besser, wenn ich sagte, es hätte mir nichts bedeutet. Ich zögerte und sagte, ja es habe mir gut getan …. Da fiel mir der Therapeut ins Wort und sagte: „So, das muss jetzt aber aufhören!“. Dieser Satz erschreckte mich: Bestand doch die Gefahr, dass ich Homosexualität lernen konnte? Dass durch das „Versucherli“ das Verlangen nicht zurück ging, sondern stärker werden konnte? Nein, das wollte ich mir, Valentina und dem Psychiater schon beweisen, dass das nicht so sei.

Die Sehnsucht nach Mann kam in den folgenden Wochen sanft und leise zurück. Aber Valentina sagte ich nichts mehr davon. Ich war überzeugt, wenn ich nur mich anstrengte und weiterkämpfte, würde sie vorübergehen. Was sollte ich da Valentina weiterhin beunruhigen?
In der Zeit vor der Hochzeit hatte ich Herzbeschwerden, vermeintlich. Im linken Oberarm und in der linken Brustgegend verspürte ich ein Stechen, einen dumpfen Schmerz, einen Druck. Ich liess dies beim Arzt untersuchen und er fand nichts, Gott sei Dank. Mein Herz sei gesund. Vielleicht war es ein Signal, dass es nicht richtig war, zu heiraten.
Aber ich war glücklich. Nun würde sich alles zum Guten wenden. Ich war Lehrer und ich war verheiratet – also völlig normal. Meine Frau war auch Lehrerin. Das Leben würde gut und herrlich werden.
Nach zwei gemeinsamen Dorfschullehrerjahren machten wir uns Gedanken, wie wir unser Leben weiter gestalten sollten. In unserem Dorf bleiben, eventuell ein Haus bauen, eine Familie gründen und ich Dorflehrer bleiben? Oder wegziehen? Wenn ja, dann bald, es würde uns sonst immer schwerer fallen, wenn wir dann eine Familie wären. Oder noch ins Ausland gehen für eine gewisse Zeit? Aber was hat man da für Möglichkeiten, als Lehrer? An einer Schweizerschule eine Stelle finden, vielleicht? Ja, das wäre was.
Es folgte eine turbulente Zeit. Ich hatte eine Stelle an einer Schweizerschule in einem südlichen Land gefunden. Die Zeit der Vorbereitungen und des Umzugs waren sehr intensiv, so dass ich eigentlich wie keine Zeit hatte, mich mit meinen homosexuellen Bedürfnissen auseinander zu setzen, wie zwei Jahre vorher, als wir heirateten. Auch damals waren die bevorstehenden Veränderungen so im Vordergrund, dass ich nicht sehr litt unter der Sehnsucht nach Mann.

Aber es wurde mir sehr schnell klar, dass die Psychotherapie mich nicht geheilt hatte. Die Männer, Südländertypen, mit brauner Haut, Schnauz oder Bart, dunklen Augen und stark behaart, die faszinierten mich. Ich kam aus dem Staunen nicht heraus, konnte mich nicht satt sehen an diesen wunderschönen Männern, immer darauf bedacht, dass Valentina nichts davon merkte.
In die Wohnung neben uns, gleich Tür an Tür, zog kurz nach uns ein junges Paar ein, Antonio und Maria, Einheimische. Mit ihnen pflegten wir in Bälde einen ziemlich intensiven Kontakt und lernten so Land und Leute sehr gut kennen.
Antonio hatte einen Bruder, Rinaldo. Rinaldo war oft bei seinem Bruder Antonio zu Besuch und damit kamen auch wir in Kontakt mit ihm. Und ich „verliebte“ mit total in ihn. Mein Gott, sah dieser Mann toll aus. Ich war fasziniert, ich konnte mich nicht satt sehen an ihm. Und meine Sehnsucht, ihm körperlich nahe zu kommen, war fast nicht auszuhalten. Und ich hatte den Eindruck, dass er mich auch mochte.
Im zweiten und dritten Jahr an der Auslandschweizerschule konnte Valentina, ebenfalls Lehrerin, zwei Handarbeitsstunden von mir übernehmen und mich entlasten. Und so kam es, dass ich einen Nachmittag pro Woche frei hatte, während Valentina die zwei Stunden für mich übernahm.
Ich erinnere mich an einen solchen Nachmittag. Rinaldo war zu Besuch bei Antonio, dieser war wohl arbeiten und so kam Rinaldo nach der Siesta zu mir zu einem „digestivo“, einem Verdauungs-Schnäpschen. Und wie ich da so auf dem Kanapee sass mit ihm und wir small-talk hatten, hielt ich es fast nicht aus. Ich hatte einen Steifen bis zum Platzen, und war sehr bemüht, diesen zu verbergen, was nicht leicht war. Es war Sommer und ich nur mit Turnhosen bekleidet. Die Luft war so von Erotik geschwängert, dass ich mich fast nicht unter Kontrolle halten konnte. Ich ging raus und wechselte die Unter- mit der Badhose, weil die enger war und ich den Ständer besser verstecken konnte. Natürlich „geschah“ nichts zwischen Rinaldo und mir. Der Beweis, dass ich nicht schwul war.

Ein grosses Problem belastete und überschattete die 3 Jahre im Ausland sehr. Valentina wurde nicht schwanger. Als bereits ein paar Monate vergangen waren, und es immer noch nicht geklappt hatte, entschieden wir uns, mal zu einem Arzt zu geben. Bei Valentina fand man nichts konkretes. Der Arzt riet, dass auch ich mein Sperma untersuchen lassen sollte. So begab ich mich zu einem Institut klinischer Analysen. Dort musste ich mir einen runterholen und in ein Glasschälchen spritzen. Nach ein paar Tagen konnte ich das Resultat abholen. Es war ein langes, sehr detailliertes Schreiben; ich verstand natürlich nicht alles, schon in Deutsch sind ja Arztberichte für Laien schwer verständlich, in einer Fremdsprache erst recht. Aber am Schluss des Schreibens verstand ich und glaubte, nicht richtig zu sehen, ich hatte einen totalen Schock: Ich hatte unfruchtbares Sperma. Im Text hiess es allerdings, dass Spermien gefunden wurden, aber viel zu wenige und viel zu wenig agile, viele verkümmerte, deformierte und die paar guten, die es offenbar auch hatte, bewegten sich kaum oder viel zu wenig. Nein, das konnte ich nicht akzeptieren. Der Gedanke, kein zeugungsfähiges Sperma zu haben, kam für mich fast einem Todesurteil gleich. Alle meine 3 Brüder hatten Kinder – und ich, ich sollte steril sein? Also stimmte doch etwas nicht mit mir. Ich war kein richtiger Mann, wie man es mir doch immer gesagt hatte, oder es mich so hatte spüren lassen. Dann stimmte es also doch, dass ich eine halbe Frau war. Vielleicht deshalb meine Sehnsucht nach körperlicher Nähe zu einem Mann, nach Sex mit einem Mann? Nein, nein, nein!!! Ich vergrub mich tief unter die Decke und schrie, nein, das darf nicht wahr sein, nein! Wenn ich Valentina nicht gehabt hätte, vielleicht hätte ich mich umgebracht. Etwas Schlimmeres, als diesen Befund der Sperma-Analyse, hatte ich noch nie erlebt. Er traf mich mitten ins Herz und machte alle Arbeit, die ich an mir schon geleistet hatte, um endlich ein „normaler“ Mann zu werden, wieder zunichte.
Ich machte mehrere Therapien, konsultierte mehrere Ärzte, in den Sommerferien fuhren wir in die Schweiz und besuchten auch hier ein Fertilitätszentrum. Aber nichts von alledem brachte einen Erfolg. Mein Sperma war nicht zeugungsfähig.
Wieder im Ausland starteten wir noch einen Versuch bei einem neuen Arzt. Er sagte, er glaube nicht daran, dass die Spermiendichte im Sperma so wichtig sei. Letztlich genüge ein Spermium für eine Schwangerschaft. Er riet mir aber zu einer Hodenbiopsie.
Die Operation fand an einem Samstag statt. So konnte ich mich am Sonntag schonen und am Montag wieder zur Schule gehen.
Ich kann gar nicht beschrieben, wie ich es genoss, dass er die Biopsie selber durchführte. Er hantierte an meinem Sack, an meinen Hoden und ich konnte ihn dabei bewundern. Er war wunderschön! Der anwesenden Arzthelferin war es schlecht geworden, sie musste weggehen und so handlangte er selber und brachte die Operation gut zu Ende. Ach, ich war ihm so nahe. Fast, als hätte ich Sex gehabt mit ihm.
An Sonntag musste ich mich zwangsläufig schonen. Der Hodensack war geschwollen und jede Bewegung schmerzte sehr. Es war alles drum herum so empfindlich und ich musste aufpassen, dass ich mich nur sorgfältig bewegte. Auch am Montag noch. Aber wenn ich vorsichtig ging, langsam und behutsam, konnte ich doch zur Schule gehen. Ja, ich wollte nicht fehlen, es ging ja schliesslich niemanden etwas an, was ich da für Probleme hatte ….
In den mehr als 3 Jahren in Südeuropa hatte ich einmal einen Platten an einem Rad des Autos. Und das eine Mal war an diesem Montagmorgen, als ich mit geschwollenem Hodensack darauf achtete, mich möglichst wenig zu bewegen! Oh, du mein Gott. Ich konnte nicht weiterfahren, ein Rad hatte einen Platten! Ich hätte schreien mögen. Warum denn gerade jetzt? Ich konnte mich ja kaum bewegen. Und bei einem Radwechsel muss man sich bewegen, auf die Knie gehen. Oh, Gott, warum hast du mich verlassen! Es nützte nichts: Ich musste das Rad wechseln! Und tat es. Und litt unsägliche Schmerzen. Aber ich schaffte es, kam noch rechtzeitig zur Schule. Ich ging wie auf Eiern.
Als wir uns nach drei Jahren entschieden hatten, in die Schweiz zurückzukehren, als wir schon wussten, wo wir leben würden und bereits eine Wohnung hatten, fühlte ich mich, und ich denke auch Valentina, irgendwie entspannter, lockerer. Wir nahmen nicht mehr alles so ernst und zur Kinderlosigkeit hatte ich noch nicht ja gesagt, aber ich sah nun auch andere Optionen des Lebens. Und wir hatten uns ja für eine Adoption angemeldet.
Und dann geschah es: Die Periode blieb aus und wir machten einen Schwangerschaftstest. Er war positiv. Mich traf fast der Schlag. Sollte nun tatsächlich eingetroffen sein, worauf wir seit Jahren bangten? Und dies bei meiner Diagnose „steril“? War tatsächlich ein Wunder geschehen? Hatte nicht der hübsche Arzt immer Hoffnung ausgedrückt? Er glaube nicht an die Anzahl Spermien im Sperma, ein Spermium genüge? Hatte er mir damit den Druck genommen und mich – und auch Valentina – gelassener gemacht? Wie auch immer: Er war ein Schatz! Er hatte Recht gehabt, uns nicht aufzugeben. Ich liebte ihn!

Das Experiment „Dorflehrer“ wurde für mich zur eigentlichen Katastrophe. Ich schaffte es nicht, mich als Lehrer in der Schweiz wieder zurecht zu finden. Auch im Dorf, wo ich eine Lehrerstelle bekommen hatte, fühlte ich mich nie wohl. Ich grübelte unentwegt meinen Problemen nach und der Druck wurde immer grösser.
An einem Abend, als mich der Vater eines Schülers „zusammengeschissen“ hatte, weil ich die Möglichkeit geäussert hatte, den Schüler die 5. Klasse wiederholen zu lassen, brachte den Zusammenbruch. Ich musste zum Arzt, ich konnte nicht mehr. Er schrieb mich für ein paar Tage krank. Ich wusste nicht weiter, ich wusste nur eines: Lehrer bleiben kann ich nicht. Diesen Beruf überlebe ich nicht. In der Folge fällte ich die Entscheidung, den Lehrerberuf auf zu geben.
Als Kind in meiner nicht unproblematischen Familiensituation, wo ich mich nicht verstanden fühlte, boten mir meine Tiere, die Wellensittiche, die Meersäuli, die Kaninchen, Hühner und Katzen Trost und Ablenkung. Ich war ein Tierfreund. Als Lehrer fühlte ich mich sehr überfordert und unglücklich. Und so wurde es mir klar: Meine neue Arbeit sollte eine Arbeit mit Tieren sein.
Die Geburt unserer Tochter erfolgte während der Sportferien, am Mittwoch der ersten Woche. Das war gut so. So konnte ich mich wirklich ganz von der Schule distanzieren und nur für uns als Familie da sein. Ein Wunder war geschehen. Das Baby war das schönste Kind, das ich je gesehen hatte! Das Leben war toll, so schön, und die Schule, all jene Probleme waren ein paar Tage lang weit weg.

Nach den Frühlingsferien – damals hatten wir in der Deutschschweiz noch im Frühling den Schulanfang - bekam ich neue Fünftklässler. Die waren noch kleiner und etwas scheuer, zumindest am Anfang. Und so konnte ich etwas zuversichtlicher in die Zukunft blicken und hoffte, dass ich es wirklich aushalte, bis ich eine neue Arbeit gefunden hätte.
Ein paar Wochen später wurde in den Zeitungen über Probleme beim Tierschutzverein im Zusammenhang mit dem Tierheim berichtet. Im vergangenen Jahr war ein Tierheim eröffnet worden und der vom Tierschutzverein angestellte Tierpfleger und der Vorstand des Vereins, der direkte Arbeitgeber, hatten sich überworfen und dem Tierpfleger war gekündigt worden.
Diese Stelle wollte ich! Und ich bekam sie. Valentina war nicht begeistert, wir mussten wieder umziehen in eine Dienstwohnung an einer nicht sehr attraktiven Lage und ich würde nicht einmal die Hälfte des Lehrerlohnes bekommen.
Aber für mich war die Welt wieder in Ordnung, ich war glücklich und konnte nicht verstehen, dass Valentina es nicht auch zu hundert Prozent war. Wir hatten eine wunderbare Tochter, die sich prächtig entwickelte und wie durch ein Wunder zu uns gekommen war.
Im Herbst 1980, in zwischen hatten wir noch eine zweite Tochter bekommen, wieder wie durch ein Wunder, hatte ich mein zweites sexuelles Abenteuer mit einem Mann. Ich musste zu einer Tagung des Schweizerischen Tierschutzvereins nach Biel. Ich übernachtete in einem Hotel in Biel und hatte einen freien Abend. Ich „tigerte“ in Biel umher und es zog mich mit aller Kraft zum Bahnhof in die Toilette. Dann entdeckte ich ein weiteres öffentliches Pissoir und pendelte also zwischen diesen beiden Orten. Und wie das damals noch war, die Pissoirs waren voll von Männern, die da standen, als ob sie am Urinieren wären, aber in Wahrheit schauten sie lüstern nach Schwänzen und versuchten einen für einen sexuellen Kontakt zu gewinnen. Und so interessierte sich auch ein Mann für mich. Ich fragte ihn, ob er mit mir ins Hotel komme. Wie gerne hätte ich mich mit ihm auf dem Bett gewälzt und bei gemeinsamem Onanieren vergnügt. Nein, ins Hotel komme er nicht, aber ich möge ihm folgen, unauffällig in einem gewissen Abstand. Und ich folgte ihm. Er kannte sich in Biel aus und wusste in der Nähe ein weiteres Pissoir. Das war „untertag“, eine Treppe führte von der Strasse hinunter. Dort waren wir allein. Der Mann hatte einen schönen grossen Penis, der mich total faszinierte. Aber auch er war sehr geil und nach kurzem Onanieren spritzen wir ab und der „Spuk“ war zu Ende.
Wow, wieder hatte ich erlebt, dass ich einem Vergleich mit einem Mann Stand halten konnte. Ich war also normal und ein richtiger Mann. Ich hatte mittlerweile ja schon zwei steife Schwänze (ausser meinem) erlebt, es waren nicht alle gleich gross, aber meiner war sicher nicht kleiner als der Durchschnitt. Ach, ich war so glücklich, dass ich noch einmal Sex mit einem Mann erleben durfte. Nun hatte ich sicher genug, nun würde meine kranke Sehnsucht endlich verschwinden.
Von diesem Erlebnis sagte ich Valentina nichts. Meine homosexuellen Gefühle, die mich all die Jahre fast erdrückt hatten, waren jetzt ja sicher bald Vergangenheit. Da musste ich sie nicht noch einmal damit belasten.
Leider blieben meine Sehnsüchte nicht Vergangenheit. Sie waren auch Zukunft. Nach einer kurzen Pause waren sie wieder da. Aber ich glaubte immer noch nicht, dass ich schwul sei.
Ausserhalb der Schulferien hatte ich es manchmal gemütlich im Tierheim. Die wichtigste Arbeit, Tiere füttern und Boxen putzen, war dann schnell gemacht und – obwohl ich immer etwas zu tun hatte, konnte ich mir auch mal Zeit nehmen, im Büro die Zeitung zu lesen. Da las ich einmal vom Tod von Rock Hudson. Er war ein berühmter amerikanischer Schauspieler. Er sah sehr gut aus und war ein richtiger Frauenschwarm. Und er sei an AIDS gestorben. Von dieser Krankheit hatte ich schon mal etwas gehört. In San Franzisco sei eine unbekannte Krankheit aufgetaucht, eine Art Krebs, und diese Krankheit käme nur bei schwulen Männern vor, weil sie zuviel Sex mit wechselnden Partnern hätten. Eine Schwulenseuche also. So wurde sie anfänglich genannt. Und da las ich, dass dieser berühmte Schauspieler schwul gewesen sei. Ja, dachte ich, man darf eben nicht schwul leben, die sind doch selber schuld, die Schwulen, wenn sie dann diese Krankheit auflesen. Mir jedenfalls würde das nie passieren, ich hatte ja eine tolle Familie, meine Sexualität gehörte meiner Frau. Ich war zwar noch nicht so weit, dass ich das aus vollen Herzen sagen konnte, aber ich würde dies sicher erreichen, dass mich nur noch Sex mit Valentina interessierte.

Am Strassenrand sah ich immer wieder ein Plakat: „Neues Leben – schon gefunden?“ und irgendeine lächelnde Person schaute einen darauf an. Ich ärgerte mich sehr über dieses provokative Plakat. Was wollte diese Person wissen, ob ich ein neues Leben brauchte? Mein Leben war ok. Ich hatte eine tolle Familie, zwei herzige, liebe Kinder, eine Frau, die eine gute Mutter war, ich war ein guter Ehemann und Vater. Nur – ein schweres Problem blieb hartnäckig hängen: Meine Sehnsucht nach Nähe, nach Körperkontakt, nach Sex mit einem Mann. Aber musste ich deswegen mein Leben ändern und ein neues Leben beginnen? Diese sexuellen Sehnsüchte mussten und würden mit der Zeit verschwinden, und dann wäre mein Leben wirklich perfekt. Und da dieses Plakat – was sollte das? Das war nichts als eine absolute Frechheit.
Das Plakat ärgerte mich sehr – und doch, es liess mir keine Ruhe. Ich wusste – vielleicht hatte ich das bei näherem Hinschauen auf dem Plakat gelesen oder es hatte jemand gesagt, dass eine religiöse Absicht dahinter stand: Es wurde einem angeboten, an einer Gesprächsrunde über den christlichen Glauben teil zu nehmen und dadurch könnte man glücklich werden. Mein Ärger über die provokative Frage „Neues Leben – schon gefunden?“ verwandelte sich mehr und mehr in Neugier. Vielleicht war es wirklich ein einfacher leichter Weg, glücklich zu werden.
Valentina war mit dem Vorschlag einverstanden, dass wir uns zu einer solchen Gesprächsrunde anmelden sollten. Und wir gingen hin.
Nach dieser Reihe von Gesprächsabenden bekehrten Valentina und ich uns. Ich fühlte mich ganz verklärt, ich hatte wirklich ein neues Leben gefunden. Ich wäre bereit gewesen, einer Freikirche beizutreten und andere Menschen zu „retten“.
Einfacher wurde es in dem neuen Leben aber nicht. Am Anfang schien es mir zwar so, aber es gab neue Probleme. Ich bekam bestätigt, was ich ja längst selber immer glaubte: Mit mir stimmte etwas nicht. Homosexuelle Bedürfnisse durften nicht sein, das wollte Gott nicht. Aber nun würde mir Jesus helfen, ich musste mich nur tüchtig im Glauben üben und ihm immer näher kommen. Ja, ich hatte mein neues Leben gefunden, nun musste alles besser und ich durch und durch glücklich werden.
Nachdem der Schwiegervater ganz unerwartet starb, lebte die Schwiegermutter allein auf dem Bauernhof, wo natürlich schon längst nicht mehr „gebauert“ wurde. Wir hatten das Gefühl, sie stehe immer noch unter Schock. Es zeigte sich, dass sie nicht mehr gut allein leben konnte. Sie machte einen traurigen Eindruck und wurde immer verschlossener. Haushalt und Garten vernachlässigte sie mehr und mehr. Valentina ging jetzt jede Woche einmal hin um etwas zum Rechten zu schauen.
Langsam machte sich der Gedanke breit, dass es gut wäre, wenn eines von den Kindern zur Mutter in das grosse Haus ziehen könnte, um die Mutter etwas zu kontrollieren und zu unterstützen. Von den vier Geschwistern war Valentina die einzige, die kein eigenes Haus hatte. Alle hatten ihre Familien an einem andern Ort und wollten und konnten ihren Lebensmittelpunkt nicht wechseln. Und für Valentina war es auch nicht so einfach. Ich arbeitete im Tierheim und wir mussten in der Dienstwohnung wohnen. Und so keimte der Entschluss, dass ich mir eine neue Stelle suchen sollte/musste/wollte und wir dann in das Elternhaus von Valentina ziehen würden.
Plötzlich öffnete sich eine Türe in „unserer“ Stadt. Das Blaue Kreuz suchte für die Fürsorgestelle einen Fürsorger, der bisherige Amtsinhaber wurde pensioniert. Ich bewarb mich dafür und – bekam die Stelle. Siehst du? Ich war gläubig und Gott hatte mir einen neuen Weg eröffnet! Ich hatte ja keine Ausbildung für eine solche soziale Tätigkeit. Aber der Vorstand des kantonalen Blauen Kreuzes suchte keinen Profi, sondern einen Gläubigen, der in christlichem Sinne der Nächstenliebe arme Alkoholiker von ihrer Sucht „retten“ und zum Glauben bringen würde. Ja, es war der Wille Gottes, es war eine Berufung an diese Stelle. Es stimmte schon, du musst nur Jesus ins Leben nehmen und schon wirst du geleitet und begleitet. Ich war überzeugt, dass Gott mir die Fähigkeit und die Kraft geben würde, eine gute Arbeit zu leisten. Und immer noch hoffte ich, er würde auch mein grösstes persönliches Problem für mich lösen.
Ich war Laie, hatte keine Ahnung von Alkoholismus und was die Arbeit in diesem Bereich eigentlich war. Bisher hatte ich gehört, dass das Ziel der Arbeit darin bestand, arme süchtige Alkoholiker von ihrer Sucht zu retten und sie dem Glauben an Jesus Christus zuzuführen. Ich meinte ja, gerade erst erfahren zu haben, dass man sich nur bekehren müsse und alle Probleme seien gelöst. So sollte es auch mir gelingen, die armen Süchtigen zu retten. Das Blaue Kreuz war und ist keine Sekte, aber es wurde sehr stark von Personen aus der christlich-fundamentalistischen Ecke getragen.
Dieser herkömmlichen Arbeit eines Blaukreuz-Berufsarbeiters (so wurden die meist nicht ausgebildeten festangestellten Fürsorger genannt, im Gegensatz zu den Vereinsmitgliedern, die angeblich „umsonst arbeiteten“) stand die moderne Sozialarbeit konträr gegenüber. Anita, meine Kollegin, war seit 2 Jahren bereits in berufsbegleitender Ausbildung zur Sozialarbeiterin an einer Schule für Sozialarbeit und versuchte nach sozialarbeiterischen Normen zu arbeiten. Ich sage bewusst „versuchte“, denn wo es ging wurde sie vom Arbeitgeber (Vorstandsmitglieder des Kantonalen Blauen Kreuzes) gebremst, boykottiert und stand in dauerndem Konflikt mit diesem. Ich kam in dieses Dilemma, ohne dass ich überhaupt eine Ahnung hatte, was Sozialarbeit ist.
Anita war für mich eine sehr fordernde Kollegin, ich habe aber von ihr sehr viel gelernt. Durch ihre Direktheit, ihr kämpferisches Wesen hat sie mich zeitweise sehr überfordert. Ich war eher der Typ, der sich erst mal anpasste und wenig anzuecken versuchte, sie vertrat ihre Überzeugungen mit Vehemenz und beharrlich. Dies führte meistens zu unschönen Vorstandssitzungen, an denen wir „Berufsarbeiter“ auch teilnehmen mussten. Anita war in der Ausbildung zur Sozialarbeiterin und brachte Gedankenanstösse und Überzeugungen von ihren Schulwochen zurück, die in den Augen der Vorstandsmitglieder „vom Teufel“ waren. Ich begriff aber, dass ich mich von Anita leiten lassen musste und nicht vom Vorstand. Ich lernte von ihr, was Sozialarbeit eigentlich will und beinhaltet.
Ich kam gut aus mit Anita. Von meiner Haltung her war sie die Fachfrau und ich war der Lehrling und das war gut so. Wäre ich auch ein Alpha-Tier, hätte es wohl schwere Konflikte gegeben mit ihr und diese mit dem Vorstand waren schon genug, es lag gar nicht drin, auch mit der (einzigen) Kollegin noch Auseinandersetzungen zu bestreiten. Sie konfrontierte mich ja tagtäglich schon mit Haltungen, über die ich vorher gar nie nachgedacht hatte. Etwas vom ersten, woran ich mich erinnere, ist das Reizwort „Fräulein“. Es war immer so gewesen: Eine verheiratete Frau wurde mit „Frau“ angesprochen, eine ledige mit „Fräulein“. Bei Männern wurde dieser Unterschied nicht gemacht. „Herr“ für alle, ob verheiratet oder ledig. Anita fand – das war für mich ganz neu – das nicht richtig. Sie sagte, der Herr(gott) habe Männer und Frauen, Frauen und Männer geschaffen. Die Unterscheidung zwischen Frau und Fräulein sei Brunstgeheul des Mannes, damit dieser von vornherein wisse, an welche Frau er sich heranmachen könne. Logisch. Ja, einleuchtend, aber neu für mich. Oder dass Frauen für häusliche Arbeiten prädestiniert seien, das lehnte sie auch ab. Für mich war klar, dass es eine Rollenverteilung gab zwischen Frauen und Männern. Frauen arbeiteten eher im Haushalt – ich war da eine Ausnahme, ich war eben kein rechter Mann – die Arbeit der Männer war eher nach aussen gerichtet. Anita sagte, warum sollten nur Frauen einen Knopf annähen können? Männer hätten die gleichen Finger wie Frauen. Und so führte mich Anita zu ganz vielen neuen Einsichten und auch ich begann, vieles zu hinterfragen. Wer A sagt, muss nicht unbedingt B sagen.
Ich war jetzt gläubig und überzeugt, dass der Herr mir helfen würde, das zentrale Problem meines Lebens zu lösen. Er liess sich Zeit. Die homosexuellen Sehnsüchte raubten mir nach wie vor den grössten Teil der Energie. Ich wollte mich ja durch Gott behandeln lassen, warum half er mir nicht? Vielleicht war ich nicht gläubig genug? Ja, das würde es wohl sein. Ich brauchte keinen Psychiater, sondern einen Seelsorger, der mir half, im Glauben zu erstarken und endlich die Kraft zu erhalten, meine kranken Bedürfnisse abzulegen, der mich zu echtem Glauben führte und den Weg frei machte, dass Gott mich endlich befreien konnte.
In Blaukreuz-Kreisen hörte ich manchmal den Namen von Pfarrer Geiser. Er war früher in einem Dorf im Kanton Pfarrer und musste offenbar tiefgläubig sein und stand dem Blauen Kreuz nahe. Leider hatte er vor einiger Zeit den Kanton verlassen, weil er in eine andere Stadt berufen worden war. Aber vielleicht war er der richtige Mann, der mir helfen konnte?
Ich fragte Pfarrer Geiser an, ob er mich seelsorgerisch über eine gewisse Zeit betreuen könnte. Ich sagte ihm, ich sei neu als Fürsorger beim Blauen Kreuz tätig und bräuchte, gerade in der ersten Zeit, Unterstützung. Er wollte sich meine Anfrage überdenken. Nach kurzer Zeit, teilte er mir mit, dass er diese Aufgabe gerne übernehmen würde.
Ich war überzeugt, dass etwas mit mir geschehen sein musste, was ich nicht mehr wusste. Vielleicht war ich noch so klein, dass ich mich nicht mehr daran erinnern konnte. War ich vielleicht von einem Mann missbraucht worden? Nächtelang sinnierte ich darüber nach. Ich durchleuchtete in Gedanken meine Kindheit. Warum hatte ich als Kind immer solche Angst im Dunkeln? Warum hatte ich vor Jahren an einem Morgen einen so komischen Geschmack im Mund, als ich von einem Traum erwachte? War der Geschmack nicht der von einer nicht sauber gewaschenen Peniseichel? Oder warum hatte ich damals, als der Hund Katja starb, diesen Panik-Anfall? Hatte mich jemand missbraucht und mir mit dem Tod gedroht, wenn ich etwas davon erzählen würde? Vielleicht hatte Herr Stamm, unser Nachbar, mich einmal missbraucht, oder unser Melker Fredi, der jahrelang fast wie zu unserer Familie gehörte? Oder war es gar mein Vater? Immer und immer wieder forschte ich in meinem Unterbewussten. Eine Antwort fand ich nie.
Da sah ich plötzlich noch eine Möglichkeit, eventuell eine Antwort zu finden: Meine Eltern. Wenn ich missbraucht worden wäre, dann müssten sie das eigentlich wissen. Und so beschloss ich eines Tages, mich bei ihnen zu melden und um ein Gespräch zu bitten. An einem Sonntag fuhr ich hin. Vater und Mutter sassen in der Stube und waren gespannt, was ich wohl da mit ihnen zu besprechen hätte. Natürlich konnte ich nichts erzählen von meinen erotischen Sehnsüchten, aber ich sagte, dass es mir manchmal schlecht gehe, weil ich immer denken müsse, ich hätte in meiner Kleinkindheit etwas Schlimmes erlebt. Vater stand auf, holte seine Ordner und begann in seinen Bankunterlagen zu „nuschen“, Mutter sagte, nein, sie wisse nichts. Es sei gar nicht gut, sich so schwere Gedanken zu machen; es sei immer besser Schlimmes, das einem widerfahren sei, zu vergessen.
Nun wusste ich: Von meinen Eltern konnte ich nichts erwarten. Nein, ich selber musste weitergrübeln.
Die Seelsorge bei Pfarrer Geiser hatte nichts gebracht. Meine Bedürfnisse waren nicht verschwunden, der liebe Gott wollte mir nicht helfen. Ich erachtete mich zwar immer noch als „gläubig“, aber meine Frömmigkeit hatte im Blauen Kreuz einige Korrekturen erfahren. Die allzu fundamentale Einstellung der frommen Vorstandsmitglieder hatte mir zur Gewissheit verholfen, dass ich nicht auf diese Weise fromm sein wollte. Ich wollte einen Glauben, der Lebenskraft und -freude gibt, nicht sie mir nimmt. Nein, beten und hoffen, dass Gott meine Probleme löst, das war nicht der richtige Weg. Ich musste selbst Verantwortung übernehmen und hoffen, dass Gott mich leitet, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich musste wieder in eine Therapie. Ich war seelisch krank und ein Psychiater war ja da, psychische Krankheiten zu heilen. Wahrscheinlich hatte ich bisher immer zu wenig lang ausgeharrt. Ja, diesmal wollte ich mich nochmals in eine Therapie begeben und ausharren. So traf ich mit mir folgende Abmachung: Bei der nächsten psychiatrischen Praxiseröffnung, die ich in der Zeitung lesen würde, wollte ich mich melden und nicht aufgeben, bis ich geheilt war.
Die Situation beim Blauen Kreuz hatte sich dermassen zugespitzt, dass eine Zusammenarbeit zwischen dem Vorstand und uns zwei Berufsarbeitern nicht mehr möglich war. Da wurde uns gegenüber im Namen des Herrn gelogen und Druck ausgeübt, nein, meine Energie, die sowieso schon reduziert war wegen der krampfhaften Abwehr meiner Sehnsüchte, konnte ich nicht noch mit Auseinandersetzungen mit dem Vorstand verbrauchen. Ich entschloss mich die Stelle zu kündigen. Bald darauf fand ich - einen Monat nachdem Anita die Stelle verlassen hatte - eine neue Stelle bei der Pro Senectute.

Im Herbst 1988, kurz nach dem ich angefangen hatte bei Pro Senectute zu arbeiten, wurde tatsächlich in der Zeitung die Eröffnung einer psychiatrischen Praxis angekündigt. Was hatte ich mit mir abgemacht? Ich wollte mich melden. Ich war des Kampfes müde, ich musste jetzt erlöst werden von dieser unerträglichen Krankheit. Es war eine Ärztin, die die Praxis eröffnete, das war mir gerade recht. Vielleicht hatte ich Angst, ich könnte mich sonst in den Therapeuten verlieben. Und so ergriff ich das Telefon und erhielt einen Termin.
In der ersten Stunde der Therapie schilderte ich Frau Chalon meine Situation, die glückliche Familie, den guten Arbeitsplatz, aber auch das grosse Problem meiner homosexuellen Phantasien. Und ich käme zu ihr, damit sie mir helfe, diese zu eliminieren; es könne doch nicht sein, dass ich eine Familie hätte und daneben solche Sehnsüchte. Ich sei ja nicht schwul.
Und Frau Chalon anwortete: „Ok, wie wollen Sie das machen?“ Ich wisse das nicht, darum käme ich ja zu ihr, damit sie mir helfe.
Frau Chalon half nicht. Auf jeden Fall nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Sie liess mich erzählen, stellte hin und wieder eine Frage, gab eine Rückmeldung, mit der sie mich zum Nachdenken zwang. Das war alles. Sie liess mich zappeln! Mehr und mehr verzweifelte ich. Die Problematik meiner Sehnsüchte wurde immer penetranter – und auch sie wollte mir nicht helfen. Ich war am Ertrinken und erwartete, dass die mir einen Strohhalm reichte, wo ich mich dran halten konnte. Und doch – ich gab nicht auf. Ich hatte mir doch ganz fest vorgenommen, die Therapie nicht abzubrechen, bis ich geheilt war. Manchmal vergass ich zwar die Therapiestunde. Und das besprachen wir dann in der nächsten Stunde. Etwas zu vergessen kann ja bedeuten, dass es einem nicht wichtig ist, dass man sich dagegen wehrt; vergessen kann unbewusst gesteuert sein. Und so lernte ich mehr und mehr, mich und meine Gefühle zu hinterfragen und zu verstehen.

Mein vorheriger Arbeitgeber, der Vorstand des Kantonalverbandes des Blauen Kreuzes meines Kantons, war eigentlich gegen eine Ausbildung zum Sozialarbeiter. Aber angesichts dessen, dass der Ruf nach Professionalisierung in der Sozialarbeit, insbesondere durch den Geldgeber (unsere Beratungsstelle wurde ja durch den Kanton subventioniert) grösser wurde, konnte er sich fast nicht dagegen wehren und so bekam ich die Genehmigung, ebenfalls eine berufsbegleitende Schule für Sozialarbeit zu besuchen, allerdings erst, wenn Anita ihre Ausbildung abgeschlossen hätte.
Als wir Studierende zum ersten Mal zusammenkamen, fiel mir ein Mann sofort auf. Er war gepflegt und hatte einen Vollbart. Er war wohl etwas älter als ich. Wow, durchzuckte es mich, wenn ich mit diesem Mann das Zimmer teilen könnte! Man schlief nämlich in Zweierzimmern, denn diese Schule wurde ja als Internat geführt, in acht auf das ganze Jahr verteilte Schulwochen. Ich hoffte es so sehr! Und, fast unglaublich, es traf mich tatsächlich mit ihm zusammen. Ich war sehr aufgeregt, dass ich mit ihm das Zimmer teilen konnte und hoffte natürlich, ich könnte ihm mit der Zeit körperlich näher kommen. Er hiess Hanspeter, war verheiratet und hatte zwei junge erwachsene Kinder. Er war Sozialarbeiter in einem Kinderheim in einem Berggebiet, wo er auch lebte.
Während vier Jahren, in jeder Schulwoche, in jeder Nacht hoffte ich, dass er zu mir oder ich zu ihm ins Bett steigen würde. Manchmal schlief ich schlecht und hörte seinem Atem zu und wenn er sich bewegte, hoffte ich er stehe auf und käme zu mir. Manchmal stand er auf, weil er auf das WC musste. Ich wartete dann, bis er wieder hereinkam und ersehnte ihn bei mir. Vier Jahre lang geschah gar nichts in dieser Richtung. Und ich hatte natürlich nie den Mut gehabt, ihm etwas von meiner Sehnsucht zu sagen.
In der Ausbildung zum Sozialarbeiter liegt ein Schwerpunkt darin, sich selber differenziert wahrnehmen zu können, die eigenen Gefühle und Werte zu hinterfragen und zu verstehen. Ich lernte mehr und mehr, ehrlich mit mir selber zu werden.
In der Supervision, ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung, waren wir zu sechst. Wir sprachen über Schwierigkeiten an den verschiedenen Arbeitsplätzen, bei fast allen waren Probleme vorhanden. Wir sprachen auch darüber, was uns persönlich privat beschäftigte und uns Kraft gab, oder welche raubte.
Einmal blieben wir bei den persönlichen Problemen von einem Mitstudierenden hängen. Er war verheiratet und hatte drei Töchter. Die Ehe war am Auseinanderbrechen und er erzählte, wie sehr ihn das umtrieb und belastete, es flossen auch Tränen und wir alle spürten die Schwere dieser Situation.
Und in mir regte sich etwas. Ich litt ja auch unsäglich unter meinem Problem und spürte, dass da etwas raus musste. Und als das Thema der Ehekrise vom Kollegen beendet war, meldete ich mich, dass auch ich etwas zum Besprechen hätte. Obschon ich wahnsinnige Angst hatte vor den Folgen meiner Offenbarung, brach es aus mir heraus und ich erzählte von meinen Sehnsüchten und Phantasien und dass ich diese nicht brauchen könne, ich hätte ja Familie und Kinder …..
Es gilt immer in Gruppengesprächen, wo auch Persönliches seinen Platz hat: Was in der Gruppe gesprochen wird, bleibt in der Gruppe. Das heisst, es wird nicht weiter erzählt. Und doch hatte ich Angst davor, dass nun meine ganze Klasse wisse, was mit mir los sei. Mein Leben würde nun ein anderes sein. Ich würde sicher schräg angeschaut, vielleicht würde der Kontakt mit mir jetzt gemieden oder was auch immer. Aber ich konnte nicht anders, sondern erzählte von meinen Ängsten, die Familie zu verlieren, von meiner Verzweiflung und dass ich nicht wisse, wie es weitergehen sollte. Meine Tränen netzten ein Nastuch nach dem andern.
Und dann bekam ich Rückmeldungen von den Anwesenden. Ich erinnere mich an das, was Edith sagte: Ruedi, vielleicht bist du wirklich schwul, na und? Auch von den andern kamen ähnliche Statements. Nichts von Verachtung, nichts von Ablehnung, nichts von Distanz. Ich fühlte mich trotz allem angenommen.
Und doch ging ich mit gemischten Gefühlen in die nächste Schulwoche. Ein paar Kameraden und Kameradinnen wussten jetzt etwas ganz Intimes von mir. Vielleicht hatten sie es doch weiter erzählt, oder sah man mir sogar an, was ich für einer war? Ich stellte jedoch keinerlei Veränderung fest.


In dieser Zeit begann ich mich der Schwulenszene zu nähern. Woher ich gewisse Informationen hatte, weiss ich nicht mehr. Aber es gab in Zürich eine „Homosexuelle Arbeitsgruppe“ mit einem Beratungstelefon. Da rief ich einmal an. Ich hatte Herzklopfen, dass ich glaubte, die Brust müsste mir zerspringen. Zum Glück ertönte nur der Beantworter. Da hörte ich zum ersten Mal die Stimme eines offen schwulen Mannes. Ich konnte es fast nicht fassen, das war ein Mann, der zu seiner Homosexualität stand! Ich kannte ihn und seine Geschichte nicht, aber offenbar gab es Menschen, die schwul waren und ein schwules Leben führten. Nicht im Versteckten, nein, offen.
Nach und nach erfuhr ich immer mehr über schwules Leben. Ich hatte nicht gewusst, dass es Schwulensaunas gibt, wo auch Sex gemacht wird. Ich wusste nicht, dass Autobahnraststätten oder öffentliche Toiletten Treffpunkte für homosexuelle Kontakte sind (nur von den Bahnhof-Toiletten, das wusste ich), ich wusste nicht dass es Kontaktanzeiger gibt, wo man mittels Inseraten Kontakte finden kann, ich wusste, dass es Schwulenbars gab, aber nicht wo und wie man die finden konnte. Eine neue Welt eröffnete sich mir.
Noch immer glaubte ich, dass ich, wenn ich die schwule Welt kenne, einsehen würde, dass das nicht meine Welt war und mich dann definitiv und geheilt davon abwenden konnte.
Ich fuhr ja alle zwei Wochen nach Zürich in die Supervision. Da wollte ich einmal etwas früher hinfahren und vorher eine Sauna besuchen. Ich wusste mittlerweile, wo es eine solche gab. Brauchte das eine Überwindung! Was, wenn zufällig jemand von aus meinem Dorf mich in dieses Haus eintreten sähe? Oder wenn mich Schwule in dieser Sauna überfallen und vergewaltigen würden? Es gab ja AIDS und man musste vorsichtig sein. Ich schlich an die bestimmte Adresse, schaute die Klingel an, ging wieder weg, kam wieder, schaute mich um, ging wieder weg und trat schliesslich doch ein, mit einem Herz, das fast zu zerspringen drohte. Auch bevor ich die Klingel drückte, zögerte ich lange, wollte mich wieder davon machen, blieb doch.
Es war ja alles neu und unglaublich spannend. Ich legte mich, wie ich das bei anderen sah, ich eine Einzelkabine, liess den Vorhang aber offen. Und es ging nicht lange, da legte sich ein Mann zu mir. Ich konnte ihn nicht so richtig erkennen, es war ja alles verdunkelt und hatte nur schummriges Licht. Aber es genügte mir, endlich wieder einen männlichen Körper anzufassen und mit einem Mann zusammen zu onanieren.
Während der Schulwochen war ich ja jeweils eine Woche lang fort von zu Hause. Und eines Tages fasste ich den Entschluss, an einem Abend in die nächste Stadt zu fahren und ein Abenteuer auf der Bahnhoftoilette zu suchen. Auch diesmal brauchte es viel Überwindung. Ich könnte ja von einem Mitstudierenden, der zufällig auch in dieser Stadt hätte sein können, gesehen werden. Oder vielleicht musste er wirklich pinkeln und konnte mich dann da auf der Toilette stehen und warten sehen. Oder jemand aus meiner Stadt oder dem Dorf, wo ich wohnte, könnte auf Reisen sein und zufällig in diesem Bahnhof vorbei kommen, könnte sehen, wie ich in die Toilette ging und längere Zeit nicht mehr herauskam …. Ängste über Ängste. Trotzdem überwand ich mich.
Das Pissoir im Bahnhof war ganz eigenartig angeordnet. Es hatte eine brusthohe Mauer und auf beiden Seiten dieser Mauer waren Pinkelbecken. Wenn man da stand, konnte man dem Gegenüber ins Gesicht schauen. Da war es natürlich ein Leichtes, mit Augenzwinkern oder anderen Zeichen sich zu einigen und in einer WC-Kabine zu verschwinden. Ich war sehr scheu und liess mich anmachen statt selber jemanden anzumachen. Und es kam wieder zu gegenseitigem Onanieren. Es kam mir nicht so sehr drauf an mit wem, es genügte mir, dass der Mann sauber aussah, nicht stank und nicht abstossend hässlich war.
Auf dem Weg „Kontaktanzeiger“ kam ich nun auch hin und wieder zu einem sexuellen Kontakt. Ich fuhr mit dem Auto in der halben Schweiz umher um die betreffenden Männer zu besuchen. Und erlebte dabei viel Frust und Leerläufe. Einmal fuhr ich nach Romanshorn, einmal nach Arth-Goldau, Zürich, Winterthur, etc. Meistens kam es entweder zu gar keinem Körperkontakt oder es blieb unbefriedigend. Hin und wieder gab es auch schöne Momente.
Bei solchen „Ausflügen“ kam ich natürlich auch an Autobahnraststätten vorbei und lernte kennen, was sich dort abends, manchmal auch tagsüber, abspielte. Meistens gab es im Zaun, der eine solche Raststätte umgab, einen Durchgang raus, besonders, wenn sie von einem Wald umgeben war. In diesen Wäldchen war es oft wie in einem Ameisenhaufen. Da war ein Kommen und Gehen. Das Wäldchen lebte förmlich. Aber nicht jeder wixte mit jedem, es gab auch gruppenweises gegenseitiges Hantieren mit viel Gestöhne und Lustseufzern. Aber viele Männer hetzten ruhelos hin und her, immer auf der Suche nach einem noch Schöneren. Oder nach etwas, das es nicht gab.
An solchen Raststätten hatte ich doch hin und wieder schöne Begegnungen. Aber auch viele Enttäuschungen. Wenn ich zum Beispiel zwei Stunden lang gesucht und keinen gefunden hatte, der sich für mich interessierte, ging ich total gefrustet heim.
Solche Erlebnisse erzählte ich dann immer Valentina. Ich erwartete von ihr Verständnis, denn ich musste ja die Schwulenszene kennenlernen, um mich dann definitiv von schwulen Phantasien verabschieden zu können. Ob sie Verständnis hatte, weiss ich nicht, aber sie akzeptierte diese meine Aktivitäten. Wir waren beide überzeugt, dass dies nötig sei für meine Heilung.
Was ich viel, viel später feststellte: Die meisten Besucher dieser Raststätten waren nicht offen schwul. Manche hatten ein Kindersitzli im Auto oder es kam auch vor, dass es zu einem kurzen Gespräch kam, wo man von vielen erfuhr, dass sie verheiratet waren und die Frau ja nichts erfahren durfte.
Auch bei vielen Saunabesuchern war das so, dass Männer auf diese Weise versteckt ihre homosexuelle Neigung ein wenig auslebten.

Ich war in dieser Zeit immer verzweifelter. Ich wollte nicht schwul sein. Das durfte doch nicht sein, dass ich als Familienvater ein solches Leben führte. Gab es denn keinen auf der Welt, der mir helfen konnte? Ich fühlte mich bodenlos allein mit meinem Problem.
In dieser Verzweiflung hatte ich einen sonderbaren Traum.
Um ihn erzählen zu können, muss ich die Örtlichkeit, wo er sich abspielte, beschreiben: Beim Eintreten ins Haus, wo Pro Senectute ihre Geschäftsstelle hatte, befand man sich in einem grossen Gang. Geradeaus waren Treppe und Lift, links die Büros von Pro Senectute, wo auch ich mein Büro hatte, rechts ein Saal mit Küche, wo Pro Senectute einen Teil ihrer Kurse, Sprachkurse, Tanzen, Handarbeitsgruppen etc. durchführte. Und hinten, in der rechten Ecke, war das WC. Man musste zwei Stufen hinuntersteigen, dann war dort das Lavabo und daneben die Türe zum WC.
Im Traum stand ich oben an den beiden Stufen und hatte eine riesige Angst hinunter zu steigen. Ich schaute völlig entsetzt zur WC-Türe. Anita, meine ehemalige Kollegin vom Blauen Kreuz, stand hinter mir und machte mir Mut, die Tür zu öffnen. Sie redete mir gut zu und ermutigte mich so lange, bis ich Mut fasste und die Türe einen Spalt öffnete. Ich spähte hinein: Ich sah, dass es am Boden Stroh hatte, wie man ihn für Tiere in ihre Boxen einstreut. Es stand eine Futterkrippe da und ich sah - oh Schreck - ein wildes Tier mit dunklen struppigen Haaren, es hätte ein Ziegenbock sein können oder ein affenähnliche Tier, das wild umher hüpfte und ausbrechen wollte. Schnell konnte ich die Türe wieder schliessen. Und erwachte schweissgebadet.
Ich musste nicht lange über diesen Traum nachdenken, eine Interpretation war mir bald möglich, vielleicht auch mit Hilfe der Therapeutin. Hinter der Türe lag mein Innenleben, mein Unterbewusstes, meine Seele. Ich hatte Angst, genau da hineinzuschauen, denn ich wusste, dass sich da drin ein Ungetüm befand, das ausbrechen wollte, meine Homosexualität. Schnell schloss ich die Türe wieder zu. Ich war noch nicht bereit, das "wilde Tier" heraus zu lassen. Aber immerhin, ich hatte die Türe doch schon einen Spalt geöffnet und hinein geschaut.
Und Anita? Ich denke, dass Anita unbewusst mitgeholfen hat, dass ich angefangen habe, mich selber ernst zu nehmen und meine Gefühle und Sehnsüchte wahrzunehmen. Anita war eine gute Gesprächspartnerin, Sie konnte sehr gut zuhören und gab Denkanstösse und schnelle, direkte Rückmeldungen. Sie zwang einen damit, nachzudenken und Bilanz zu ziehen über die eigenen Werte und Anschauungen. So lernte ich mich besser wahr zu nehmen. Anita war ein wenig wie meine Begleiterin auf dem Weg zu mir selbst.
Mehr und mehr lehnte Valentina sich auf gegen meine neuen „Beschäftigungen“. Ich war dermassen mit mir und Männern beschäftigt, ich hatte so sehr Angst vor der Zukunft, spürte, dass das wilde Tier in mir ausbrechen wollte und spürte immer mehr, dass ich es nicht mehr lange würde einsperren können. Alles drehte sich bei mir nur um dieses Thema. Ich war zwar physisch anwesend, ging zur Arbeit, kam heim, das Leben lief „normal“, aber psychisch war ich nicht mehr präsent. In dieser Phase meiner Entwicklung war ich auch für die Kinder nicht mehr ansprechbar. Oberflächlich schon, aber oft wenn sie mir erzählten oder etwas fragten, war ich abwesend und mit meinen Gedanken anderswo. Um das zu überspielen, stellte ich vielleicht auch Fragen oder „interessierte“ mich dafür, wie es in der Schule gehe und was an diesem Tag gemacht hätten – aber ich war nicht in der Lage, Anteil zu nehmen und mich ernsthaft zu interessieren. Das war mir durchaus bewusst, aber ich konnte es nicht ändern. Meine Gedanken dachten an was sie wollten. Darunter litt ich und hatte Valentina und den Kindern gegenüber ein schlechtes Gewissen.
Der Geschäftsführer von Pro Senectute organisierte mal eine Retraite für die fünf Festangestellten, die auf der Geschäftsstelle arbeiteten. Eine Mitarbeiterin und ihr Mann besassen in den Bergen ein Ferienhaus. Sie stellte uns dieses für eine Retraite zur Verfügung. Sie selber war eine dieser fünf Teilnehmenden. Während der Sitzungen, die wir hatten und über die Zukunft der gesamten Organisation debattierten, war ich dabei und konnte mitdenken. Aber in den Pausen war ich wieder völlig absorbiert von meinen Sehnsüchten und Problemen. Und nach der schlaflosen Nacht, beim Frühstück, brach es aus mir heraus und ich erzählte meinem Chef und meinen Kolleginnen, was mich so bedrückte und fast in den Wahnsinn trieb. Das wilde Tier war am Ausbrechen.
Nun hatte ich mein Innerstes wieder ein bisschen mehr öffentlich gemacht.
Als ich von dieser Retraite nach Hause kam, sagte ich Valentina, ich hätte den anderen alles erzählt. Das kam nicht gut an. Ich merkte, wie bei ihr der "Laden runter ging". Viel später meinte sie dazu, dass sie damals realisiert hätte, dass es jetzt ernst galt und sich die ganze Problematik nicht einfach von selbst erledigen würde.
Ich hatte die Psychotherapie bei Frau Cholan nicht abgebrochen. Ich hatte durchgehalten, zwei Jahre lang ging ich regelmässig hin, obschon ich die ganze Zeit innerlich wütend war auf Frau Chalon, weil sie mir nicht half, sondern mich zappeln liess. Und doch, etwas hatte sich bewegt: Ich sehe noch klar vor mir, wie ich nach zwei Jahren wieder in eine Therapiesitzung kam und sagte, ich hätte das Gefühl, meine Zielsetzung sei falsch. Ich hätte den Eindruck, dass ich meine Homosexualität nicht abstreifen könne, offenbar gehöre sie zu mir. Ich müsste wohl das Ziel setzen, mit dieser Veranlagung leben zu lernen und sie so zu leben, dass meine Familie nicht darunter zu leiden hätte. Ich wollte Valentina und die Familie nicht aufgeben, nicht verlieren und darum müsse ich Valentina jetzt in die Entwicklung einbeziehen und miteinander müssten wir einen Weg suchen. Das hiesse Ehetherapie.
Im Nachhinein habe ich Frau Cholan begriffen, dass sie mich zappeln liess. Sie wusste, dass ich Zeit brauchte. Hätte sie mir in der ersten Sitzung gesagt, ich solle das vergessen, meine Sehnsüchte weg therapieren zu wollen, das gehe nicht, dann wäre ich nicht mehr zu ihr gegangen. Für diese Erkenntnis war ich damals noch nicht reif. Zu diesem Punkt zu gelangen, brauchte ich die lange Zeit des Leidens.


Valentina konnte sich das nicht recht vorstellen, wie wollte aber nicht so schnell aufgeben. Wir wollten uns miteinander in eine Ehetherapie begeben und fanden eine Psychologin, Frau Böttich. Ihr Mann war Pfarrer und sie hatte mit sechzig Psychologie studiert und eine Anstellung gefunden bei der Familienberatungsstelle der reformierten Kantonalkirche.
Bei Frau Böttich fanden wir uns gut aufgehoben. Es begann eine Zeit der harten Auseinandersetzungen. Frau Böttich nahm uns beider ernst und in dieser Akzeptanz konnten wir erstarken im Erkennen, was wir in unserem Innersten wollten.
Bei mir kam noch dazu, dass ich auch an der Schule für Sozialarbeit mehr und mehr lernte, mit mir ehrlich zu werden und aufzuhören, mich zu belügen. Ich spürte immer mehr, dass das wilde Tier, das mir Anita im Traum gezeigt hatte, ausbrechen wollte und ich es nicht mehr länger würde eingesperrt halten können. Ich konnte meine Bisexualität so halbwegs akzeptieren, aber der Ausbruch des Ungeheuers machte mir immer noch Angst. Was würde es draussen anrichten? Meine Verzweiflung war unermesslich. In dieser Verzweiflung ergriff ich einmal eine Handvoll Eier und schmetterte sie unter lautem Schreien in die Dusche. Und hatte nachher einen Weinkrampf. Das tat im Moment gut, aber das Problem war darum noch nicht gelöst.

In dieser Zeit versuchte ich mit Liederschreiben, etwas Erleichterung zu erhalten. Wohl ausgelöst durch Therapie und intensiver Auseinandersetzung mit mir selber, fielen mir Texte und interessanterweise auch immer die passenden Melodien fast wie von selber zu. Klar, musste ich dann noch ein wenig daran feilen und ausformulieren. So fielen mir innert zwei bis drei Monaten fünf, sechs Lieder zu. Ich hatte sie selber "vertont" (sprich mit Akkorden unterlegt), auf der Orgel gespielt und aufgenommen. Ich war so fasziniert von diesen Liedern, die meine momentane Situation widerspiegelten, dass ich sie immer wieder hören musste, immer und immer wieder, bis es Valentina zu viel wurde und sie sich beschwerte, dass ich für sie gar nicht mehr "vorhanden" sie. Ja, das spürte ich selber und auch die Kinder mussten das gespürt haben. Ich war blockiert. Gelähmt von der Angst vor der Zukunft.
2.3.1991 D Ballade vom Büebli
Es sich emol es Büebli gsi, dass hett gern wöle andersch si,
isch mit sich gar nöd zfride gsi, wills eso und ned andersch isch gsi.
Das Büebli isch ned glücklech gsi, will äs hett wöle andersch si,
drum isch es meischtens truurig gsi und hett sich tenkt debi:
Ich wett, i wär en grosse Maa, en schtarche Ma, en schöne Ma,
ich wett, ich wär en gschi-ide und au en luschtige Ma,
ich wett, ich wär en berüemte Ma, en mächtige Ma, en zfridne Ma,
ich wett i de Welt e Wichtigkeit und au en Name ha.
Und wos isch gsi en erwachsene Ma, hett er tenkt, er sei kein richtige Ma,
er sei jo gar kein grosse, kein schtarche, kein schöne Ma.
Er sei jo gar kein gschide Ma, kein luschtige Ma, kein berüemte Ma,
er sei jo gar kein mächtige Ma und hett kein Fride gha.
Verzwiflet isch er ume g'irrt, im Chopf isch er gsi ganz verwirrt,
hett Manne gsuecht wo so sind gsi, wien er hett wöle si.
Und gse hett er en grosse Ma, en schtarche Ma, en schöne Ma,
en gschide Ma, en luschtige Ma, en berüemte Ma und en mächtige Ma,
en zfridne Ma und au en Ma wo alls hett gha, won er ned hett gha.
So hett er gluegt vo Ma zu Ma, doch Fride hett er keine gha.
Ganz truurig isch er älter worde, am liebschte wär er mängmol gschtorbe,
nüt Schöös hett er uf de Welt me gse, es Lebe hett em tue so weh.
Do hett er sich imene Schpiegel gseh, hett gseh: So ein gits keine meh.
Hett gseh, dass er de einzig isch, wo isch grad so wien er isch.
Er isch zwar ned grad en grosse Ma,
ned grad en starche, ned grad en schöne Ma,
ned grad en bsunders gschide Ma und au kein luschtige Ma,
und gar ned en berüemte Ma, aber doch, er isch en rechte Ma.
Do entlech wird's em sunneklar, das Lebe, das isch wunderbar,
weme zue sich selber „jo" cha säge und sini Eigeheit tuet pflege.
Er isch jetz ganz en bsundere Ma, en Ma, wo sich selber gern cha ha.
Er gseht jetzt sini Wichtigkeit und sis Lebe isch voll Zfrideheit.
17.3.1991 De Lebesfunke
Ganz z'innerscht inne, verborge und versteckt liit es Sömli Lebeschraft.
Es hett gschlofe, sit Jahre, und niemert hetts gweckt, doch hett s sich bemerkbar gmacht.
Refrain:
Ich weiss ned, wan i will: Me hett mer geseit, wan i söll, doch isch das würkli das, wan i will?
Ha gmacht, ned wan i will, nume das, won i doch söll, und das isch ned das won i will.
Es hett agfange rumore ganz sacht, s het beiflusst s'Befinde am Tag und au Znacht.
Ich wott use, du muesch mit jetzt eifach gspüre! Und truckt hett s vo inne ganz fescht a Türe.
Ref.
So hett s i dere Seel s Glichgwicht gstört. Doch lang isch s gange, bis's öpper hett ghört.
Und wo me denn ghört hett, dass öpper chlopft, ja, denn hett me sich zerscht no d Ore zuegstopft.
Ref.
Gan z'innerscht inne, ganz tüüf i de Seel, hetts gstürmt und gwüetet und blitzt ganz hell.
D Welle vom Lebesmeer hend Schum obedra, und s Schiffli vom Lebe hett Seenot gha.
Ref.
Es git nur eis zum Rue übercho: Das Sömli, das mues me halt wachse lo,
es wott ghört si und gseh si, es wott sin Platz, und nieme ghöre de folgendi Satz: Ref.
De Mensch sött halt finde sin eigne Weg. Wener da cha, denn füelt er sich seelisch zwäg.
Me sött lebe, grad so wie me selber will, und nöd wie die andere säged, me söll.
Ref. Ich weiss jetzt, wan i will, säg mer selber, wan i söll, und denn isch da won i söll, da won i will.
Ich selber tue mer säge, wien i d Seel wott pflege, und denn wird s Lebe zum Sege.
21.4.1991 Mängmol
Mängmol füel ich mich gar ned guet, mängmol verlot mich alle Muet
Mängmol gspür ich ned, wer ich bi, mängmol wett ich au öpper si.
Mängmol do goht s mer würkli schlecht. Mängmol, do han i s gar ned recht.
Mängmol, do trüll ich mich im Kreis, mängmol, do wirft s mich us em Gleis.
Ich bi denn wienen Puding, wo vergheit, wienen Vogel, wo us de Luft abegheit,
wienen Chileturm, ohni Glogge dra, wie Wasser, wome ned trinke cha,
wienen Pullover, wo d Form verlüürt, wienes Chind, wo im Winter früürt,
Wienes Velo, ohni Luft, wienen Ma, wo vill z'vill suuft.
Meischtens möchte ich mich akzeptiere, meischtens wett ich das probiere.
Meischtens hoff ich, dass es mier glingt und meischtens mir besseri Ziite bringt,
Mängmol goht's mier denn scho chli besser, mängmol wird d Hoffnig wider grösser.
Mängmol freu ich mich a mim Muet woni säg: Ich find mich guet!
15.5.1991 Mich verjagts
Es verjagt, es verjagt, es verjagt en fascht,
Haltet sich selber nümmen us!
Irgend öppis, irgend öppis lauft ganz falsch!
Chunt us sich selber nümme drus!
Als Chind isch er wahnsinnig lieb gsi,
het nüt gmacht, wo me chönnt Astoss neh.
Trotzdem her er gwüsst, dan er nie cha si,
wie d Eitere in gern hetted gseh.
Won er i d Pubertät isch cho, hett er zwor scho opponiert,
aber nu ganz versteckt i sich inne, ja, dame dusse gar nüt siet.
Ufpasst hett er total, danem nüt Dumms passiert,
hett keis eiges Lebe gfüert,
hett gmacht, warne vo im erwartet hett,
isch gsi immer lieb und nett.
Sini Gfüel und Bedürfnis hett er unterdrückt,
hett nüt Ugrads sich erlaubt.
Was Wunder, dass s i dere Seel jetzt spuckt!
Die inner Rue er sich selber hett graubt.
Drum verjagts, drum verjagts, drum verjagts en fascht!
So cha nümme witer go!
Er wett entlech chönne use us sich selber,
rasch, und s Verdrängti uselo.
Und es bliibt sini Frog nochem Wie und Was.
Wer cha im en Antwort ge?
S'chunt em vor, als wär sis Huus us trübem Glas,
zerbrechlich, ohne use gseh!
28.5.1991 De Regeboge
lsch ächt de Regeboge für mich es Sinnbild gsi,
a dem Tag, trüeb und grau?
So klar und hell hend d Farbe glüchtet dri!
Ich ha gluegt und gstuunet au.
Grau und trüeb, so isch es gsi und d Farbe die hend glüüchtet dri!
Am Himmel stoot en schöne Regeboge,
d Gedanke hend sich mit im verwobe.
Mir, do isch es oft au grau und chalt zinnerscht inne i de Seel.
Und ich wett, bevor ich älter wird und alt, dass si au farbig isch und hell.
Grau und trüeb isch s Wetter gsi, und de Regeboge hett glüüchtet dri!
En Regeboge klar und hell wett ich ha i minere Seel!
Au d Form isch gsi schön gwölbt und rund,
hett sich gspannt wiit übers Land.
Und höch über em graue Himmelsgrund en Halbkreis drüber gspannt.
Höch in Himmel heft er gragt, und ich für mich, ich ha mi gfrogt,
ob de Regeboge für mich e Bedüütig hett, so farbig wien es Palett.
Sisch a mier, das Grau z übermoole mit Farbe mancherlei.
Und mit Schwung en Boge us de Tüüfi hole, wienes Tor zu mir selber, hei.
I minere Seel, do liit en Schatz und dem wird's eng, de bruucht me Platz!
De Regeboge isch für mich es Sinnbild gsi:
So farbig, so rund, so hell, so klar, so gross, so schön - so wett ich si.
14.6. 1991 Mis Brüederli
Chum, gib mir dini Hand, mis Brüederli,
Mir gönd jetzt über Land und reded echli.
Mir gönd de glichi Weg, ich kenn en scho,
und du, will du no chli bisch, muesch hinne no.
Chum gib mir dini Hand und heb di dra,
mir zwei, mir sind Brüeder und müend zäme ha!
Ich weiss doch, wies dir isch, bisch ganz elei,
i dinere Familie füelsch di ned dihei.
Und doch, chasch no ned furt, du bisch no z chli.
Es bliibt dir nu eis, muesch di schicke dri.
Los mier jetz guet zue: lch ha di gern!
Für mich bisch du min chline Schtem!
Du chliine Schtern, du lüüchtisch hell.
Di Lüüchte git warm und isch goldig geel.
Doch d'Lüüt um dich, die chönd's ned gsee,
weisch die sind für so n es schööns Lüüchte uf beidne Auge blind.
Heb Sorg zu dinm Lüüchte, jo da muesch!
Und lueg ganz fescht dass'ned verlüüre tuesch!
Min chline Brüeder, du bisch ganz guet!
Au wenns vo dine Lüiit dier niemer säge tuet!
lch wünsch dier ganz fescht und hoff, dass du da chasch:
Dass du de Glaube a dich nie falle lasch!
Min chline Brüeder, lauf din Weg graduus
und bau immer wiiter a dim bsundre Huus!
Weisch, ich has erlebt, wie schnell dass goht,
dass sich es Chind abetrucke loot,
und zum wider ufecho, do bruuchts vill Chraft!
lch, uf jede Fall, has no ned gschafft.
Mis Chind i mier, mis Brüederli,
ich hoffe, dass du mich verstoosch e chli.
Me seit doch d Chind, die lerned vo de Grosse.
Doch damol mueni die Regle umstosse.
Chum Brüederli und nimm mich a dini Hand!
lch bruuche dich zum wandere wiiter durs Land!
Obwohl du bisch de Chlii und ich de Gross,
muesch tröschte du mich i dim Schoss.
Im Frühling 1992 sass ich in der Frühlingswiese unter dem blühenden Mirabellenbaum. Da kam Valentina zu mir und sagte klar: „Entweder du hörst jetzt auf mit deinen Männergeschichten, oder wir müssen auseinander gehen. So kann ich nicht leben." Schlagartig wusste ich, dass wir uns trennen würden. Das wilde Tier vom Traum war ausgebrochen, ich konnte und wollte nicht mehr zurück. Aber trotzdem traf mich diese Entscheidung von Valentina mitten ins Herz. Mein Traum vom „zweigleisigen" Leben, die Familie erhalten und trotzdem sexuelle Männerkontakte pflegen, die zerbrach. Das war hart. Aber ein Doppelleben im Geheimen kam für mich überhaupt nicht in Frage.
.


Nach dem Ultimatum von Valentina hielt ich es fast nicht mehr aus mit ihr zusammen. Die Betten hatten wir im Schlafzimmer schon längst auseinander geschoben und etwas später konnten wir das Arbeitszimmer frei machen und ich bezog es.
Valentina meinte, ich müsste die Kinder informieren. Also rief ich die beiden Mädchen zu mir in mein Zimmer und beichtete ihnen, was mit mir in letzter Zeit geschehen war. Ich hätte mich schon als Kind von Männern angezogen gefühlt und diese Neigung sei geblieben und immer stärker geworden. Dass dies zu unserer Trennung führen könnte, das habe ich noch nicht gesagt. Vielleicht haben sie es geahnt?
Die Kinder taten mir leid. Ich wusste von der jüngeren Tochter, dass sie niemals geschiedene Eltern wollte und die grössere sprach nicht viel, da wusste ich nicht genau, was in ihr vorging, aber sicher wäre es für sie auch ein Problem. Und ich befürchtete - der Gedanke daran war ein Horror - dass sie in der Schule deswegen gehänselt würden. Nicht wegen der Trennung der Eltern, aber weil der Vater schwul war.
Valentina war sehr verletzt und trug diese Verletzung im Gesicht. Sie sprach nicht mehr viel mit mir und hatte einen bekümmerten, vorwurfsvollen Ausdruck. Sie klagte mich stumm an. Das hielt ich nicht aus. Trotzdem hatte ich noch nicht die Kraft, konkrete Schritte in Richtung Trennung zu unternehmen. Ich suchte Hilfe bei einem Freund und fuhr ich ein paarmal zu ihm in seine psychologische Praxis. Ich hatte Angst vor der finanziellen Situation, die auf uns zukommen würde. Valentina war zwar auch wieder in den Schuldienst eingestiegen. Der Psychologe öffnete mir die Augen, in dem er sagte: „.Aus Angst davor, das Geld würde nicht reichen, verharrst du in einem Leben, das du fast nicht mehr aushältst? Nur wegen dem Geld?" Ja, das stimmte, irgendwie würde es schon gehen, bei anderen, die noch weniger Geld hatten als wir, ging es ja auch. Also, ich würde ausziehen.
Von Tag zu Tag war es für Valentina und mich schwieriger zusammen zu leben. Sie war verletzt, weil ich fremd ging, ich war verletzt, weil sie nicht positiver mit der Situation umgehen konnte. Ich musste weg. Sicher war die Situation auch für die Kinder je länger je unerträglicher. Ich stellte mir aber nicht eine definitive Trennung vor, sondern ich würde eine kleine Wohnung mieten, wo ich zeitweise wohnen und „meine" Männer treffen konnte, zwischendurch mich aber immer wieder bei der Familie aufhalten würde. Für Valentina hoffte ich, dass sie bald einen Freund fände und sich dann immer wieder „familienfrei“ nehmen und sich mit ihm in meine Wohnung zurückziehen könnte. Wir wären eine Familie in zwei Wohnungen. Vielleicht käme es dann, nach einem Jahr oder so, sogar so weit, dass Valentina die Situation akzeptieren und wir in diesem neuen Arrangement so miteinander weiterleben könnten.
In dieser Zeit der grossen Krise, wo mein Ausziehen in der Luft lag, verunglückte Pitschi, unsere Katze. Das Fenster des Treppenhauses und das von Valentinas Schlafzimmer standen im rechten Winkel zu einander übers Eck. Vor beiden Fenstern stand je ein Blumenkistchen mit Hängegeranien. Die Geranien waren den Sommer über stark gewachsen und hingen schwer hinunter. Das Fenster zum Treppenhaus stand oft offen und die Katze liebte es, sich auf diese Blumenkistchen zu setzen oder gar zu legen. Und von einem Kistchen konnte sie gut auch auf das andere rüber springen. Nun an diesem Morgen, kurz bevor ich zur Arbeit fahren musste, hörte ich einen dumpfen Knall. Ich fand ein Blumenkistchen mit dem ganzen Busch der Hängegeranien am Boden - und darunter zuckte und bewegte sich etwas. Es war Pitschi, die in den letzten Zuckungen lag und starb. Offenbar war die Katze wie so oft übers Eck auf das Blumenkistchen gesprungen und dieses - das schwere Geraniengehänge - hatte wohl das Übergewicht bekommen, fiel hinunter und begrub die Katze unter sich. Ums Himmels Willen, welche Katastrophe! Auch das noch in dieser sowieso schon schwer belasteten trüben Stimmung bei uns!
Ich hörte, wie Valentina die Kinder weckte - sie mussten ja zur Schule - und ihnen die schlimme Nachricht überbrachte. Ich hörte beide laut weinen! Das war mir fast zuviel. Aber ich musste gehen und weinte auch auf dem ganzen Weg zur Arbeit.
Im Oktober 1992 zog ich aus. Ich hatte aus der Zeitung eine 1,5-Zimmerwohnung gefunden in der Nähe der Stadt. Erst einmal war ich glücklich. Ich hatte meine eigenen vier Wände, konnte schalten und walten, wie ich wollte. Und ich war so sehr auf die Zukunft ausgerichtet - ich könne da jetzt endlich uneingeschränkt schwul leben - dass ich den Schmerz, die Familie verlassen zu haben, gar nicht spürte. Meine Töchter hatten beim Zügeln geholfen und so fand ich, es mache ihnen nicht viel aus.
In meiner Herkunftsfamilie konnte niemand meinen Auszug verstehen. Klar, waren wir doch bisher als glückliche, harmonische Familie in Erscheinung getreten, und niemand in der Familie kannte ja die Hintergründe.

Brief der Mutter
Dienstag-Abend
Lieber Ruedi
Muss dir doch noch schreiben, dachte heute den ganzen Tag an Dich und Deine Fam. Und ich kann einfach nicht verstehen, was auch mit Dir und Valentina los ist. In was für einer Krise steckt Ihr auch. Was habt Ihr auch für Probleme, die Ihr zusammen nicht lösen könnt. Mir ist das ein Rätsel, warum das bei Euch auch so kam. Seit Ihr einander verleidet oder was ist auch los bei Euch?
In jeder Ehe gibt es Probleme, ich muss schon sagen auch bei Vater und mir war es oft nicht schön. Am liebsten wäre ich oft auch davon gelaufen. Vater war und ist noch heute von sturer Art und seine Frau und auch die Kinder galten ihm oft wenig. Dazu ein so verschwiegener, schweigsamer Mensch wo oft nichts redet und ich sitze da neben ihm und erdulde es. Oft wurde ich eben auch verruckt und war auch nicht so lieb mit ihm. Aber jetzt sind wir ja auf dem letzten Lebensweg und wir wissen nicht wie lange wir noch beisammen sein können, so wollen wir uns in dieser Zeit noch gut verstehen können und auf einander hören, was wir einander noch zu sagen haben. Wir sind eben auch ganz zwei verschiedene Arten von Menschen.
Dachte heute den ganzen Tag an Dich und an Euch und ich muss schon sagen es bedrückt mich doch sehr. Wir wollen hoffen und ich bete jeden Abend für Euch und bitte Gott, dass Ihr dann Euch doch wieder finden werdet. Valentina ist mir auch eine liebe Schwiegertochter. Und eben ich kann und kann es nicht verstehen, das es bei Euch nicht mehr geht zusammen. Was ist auch schuld und warum so muss ich mich immer wieder fragen. Dass man einander nach 20 Jahren Ehe nicht mehr verstehen kann oder will.
Also Ruedi Du musst entschuldigen dass ich dir so schreibe.
So hoffe ich das beste für Euch, und mein Wunsch ist, dass mit der Zeit alles wieder gut wird und Ihr einander wieder finden werdet. So behüt Dich Gott und sei herzl.-lieb gegrüsst von Deiner Mutter.
Brief an die Mutter
24.9.1992
Liebe Mutter
Vielen Dank für Deinen Brief. Ich habe erwartet, dass Du schreiben würdest. Ich verstehe Deine Fragen und das Nicht-verstehen-können unserer Situation. Wir haben ja darüber auch nicht viel erzählt.
Tatsache ist, dass wir, Valentina und ich, in letzter Zeit uns sehr verändert haben. Ausgelöst vielleicht durch meine Ausbildung, dann aber auch durch unser Alter, die sogenannte Midlife-crisis (die Krise des mittleren Alters) haben Entwicklungen eingesetzt, die auch positive Seiten haben. Wir haben gelernt, echt zu werden. Viel zu lange hat sich jedes von uns vor dem anderen versteckt, hat eine Rolle gespielt und eigene Gefühle und Ansichten aus Rücksicht auf die „harmonische" Ehe unterdrückt. Und gerade das wollen wir nicht mehr. Es ist ganz besonders für mich lebenswichtig, echt sein zu können, so zu sein, wie ich mich fühle und die Bedürfnisse zu leben, die in meinem Innersten schlummern. Ich habe gelernt, mich auch mit meinen Schattenseiten, mit meinen Eigenheiten anzunehmen. Ich habe gelernt auch meine Grenzen zu erkennen und mich nach ihnen zu richten.
Wenn Valentina und ich uns jetzt einmal trennen, dann nicht aus Hass. Wir werden weiterhin miteinander in Kontakt bleiben und uns auch weiterhin wieder als Familie zeigen. Wir wollen auch bewusst keine Scheidung. Aber es sind tatsächlich Probleme zwischen uns, von denen wir nicht offen reden möchten. Ich bitte Dich, das zu akzeptieren. Es sind unsere Probleme. Aber sie verunmöglichen im Moment ein Zusammenleben. So brauchen wir (vielleicht nur für eine gewisse Zeit) Distanz. Darum habe ich mir eine Wohnung gesucht. Im Moment gibt es keine andere Lösung. Was später kommt, lassen wir offen.
Es ist nicht Valentinas Schuld und sie bleibt weiterhin eine gute Schwiegertochter. Es ist auch nicht meine Schuld - sondern es ist das Schicksal unseres Lebenswegs, dass wir uns jetzt einmal in gegenseitigem Einverständnis trennen. Wir verstehen uns nicht mehr, aber wir haben keinen Streit. Wir ziehen einfach die Konsequenz von persönlichen Veränderungen von uns beiden.
Ich hoffe, dass du das doch ein wenig verstehen und auch akzeptieren kannst, dass wir nicht mehr darüber sagen wollen.
Der Schritt ist auch für uns nicht einfach, auch mit viel Schmerz verbunden. Aber wir freuen uns auch darüber und die Kinder auch, dass sie dann in der Stadt eine Absteige haben.
Es geht uns allen gut. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen um uns.
Herzliche Grüsse Ruedi
Die Situation liess der Mutter keine Ruhe. Als sie eines Tages am Telefon sagte, sie könne sich einfach nicht vorstellen, was da los sei mit uns, vielleicht habe sie sich in Valentina getäuscht, vielleicht sei „es" eben doch nicht die richtige Frau für mich, die genug Verständnis für mich habe, da wusste ich: Nein, das darf nicht sein, dass meine Mutter jetzt schlecht denkt von Valentina, sie kann wirklich nichts dafür, dass ich mich so sehr verändert und entwickelt habe, dass ein glückliches Familienleben nicht mehr möglich ist. Ich musste meine Mutter unbedingt aufklären. Aber wie sollte ich das anfangen? Ihr einfach so an den Kopf werfen, ich sei schwul, das schien mir zu hart. Ich wünschte, ich müsste es ihr nicht sagen, sondern sie würde es selber merken oder vermuten und mich danach fragen.
Da kam mir ein Buch zu Hilfe: „Schock und Alltag" von Walter Vogt. Ich weiss nicht mehr, woher ich von diesem Buch gehört hatte, aber ich wusste, dass Walter Vogt, ein Berner Schriftsteller, schwul war und auch eine Familie hatte. Und irgendwie die Balance zwischen den beiden Leben gefunden hatte. „Schock und Alltag" ist überhaupt nicht ein Buch über Homosexualität, sondern es sind eher philsophische Gedanken und Abhandlungen über unsere Erde und unsere Umwelt. Aber immer wieder sprach der Autor auch von seinen Träumen, in welchen homosexuelle Fantasien in Erscheinung traten. Mit etwas Feingefühl liess sich also erkennen, dass Walter Vogt selber davon betroffen war.
Es ist kein einfach zu lesendes Buch und ich dachte, wahrscheinlich sei es zu schwere Lektüre für meine Mutter. Trotzdem wollte ich das Buch von Walter Vogt der Mutter zum Geburtstag schenken. Vielleicht reichte es, dass sie nur darin schnupperte um auf Stellen zu stossen, worin die Problematik des Autors erkannt werden konnte und sie auf die Idee kam, es könnte auch meine, unsere, Problematik sein. Aber was würde dann geschehen? Meine Eltern gehörten zu einer Generation, die bei Lebensproblemen nicht zu einem Psychologen geht, sondern eher zum Pfarrer. Es schien mir wichtig, dass sich der Pfarrer darauf vorbereiten konnte, falls es tatsächlich eintreten sollte, dass ihn meine Eltern um Hilfe baten.
Pfarrer Hofer war der Pfarrer des Ortsteils, wo meine Eltern wohnten. Ich kannte ihn und war per Du mit ihm. Er und seine Frau sangen eine Zeitlang im gleichen Chor wie ich.
So besuchte ich ihn, schilderte ihm die Situation und sagte, ich könnte mir vorstellen, dass meine Eltern dann in ihrer Not sich bei ihm meldeten. Er nahm meine Schilderungen mit viel Verständnis auf und ich hatte ein gutes Gefühl, dass er dann, wenn nötig, meine Eltern gut betreuen würde.
Ich war Ende Oktober aus unserem gemeinsamen Haus ausgezogen, Mitte November hatte meine Mutter Geburtstag. Ich schenkte ihr das Buch von Walter Vogt. Ein paar Tage später rief sie mich an und sagte, ja, das Buch da, das ich ihr geschenkt hätte, sie könne das nicht lesen. Und darum habe sie es der Veronika, meiner Schwester, gegeben. Veronika habe gesagt, sie kenne den Schriftsteller Walter Vogt, der sei schwul gewesen. "Oh Ruedi'', habe sie gedacht, "hoffentlich ist das bei dir nicht so!" Worauf ich antwortete: .Wäre das denn so schlimm?" Nun wusste ich, dass Mutter zumindest schon vermutete, unsere Probleme gingen in diese Richtung. Zur definitven Gewissheit brauchte es aber noch einen Schritt.
Ich telefonierte meiner Mutter und lud sie ein, sie soll doch mal an einem Nachmittag zu mir kommen und wir suchten ein passendes Datum. Nein, am kommenden Samstag, da konnte ich nicht. Da ginge ich nach Basel. „Ja, was machst du denn in Basel? Hast etwa eine Freundin?" - „Nein, Mutter, ich habe keine Freundin in Basel, sondern einen Freund!". - „Ja, dann ist es also doch so, oh, Ruedi, das ist aber ganz ganz schlimm, was kann ich nur machen? Uh, dem Vater darf man das aber gar nicht sagen ..."
Brief der Mutter
Montag-Mittag
Lieber Ruedi
Es geht einfach nicht mehr anders ich muss Dir schrieben. Schon gestern Sonntag hatte ich so Längiziti nach Dir. Und dann die Vorwürfe die ich mir immer mache, wegen Dir, dass Du nun in einer solchen Situation drin bist. Du erbarmst mich unsäglich, Du bist nun ja so viel allein und Ihr, Valentina und Du und die Kinder, könnten es doch so schön haben. Zudem plage ich mich und mache mir Vorwürfe ich sei schuld, indem ich Dir viel zu wenige Liebe entgegen brachte als Du Kind warst. Letzten Freitag war ich bei Frau Dr. Herzig, und wir redeten mit einander über die Homosexualität. Sie sagte mir, das sei gar nicht gut für mich, wenn ich mich so plage, da könne man doch nichts machen, das habe es schön früher gegeben. Aber weisst deswegen bin ich eben gleichwohl halber krank, mag gar nicht schaffen und bin so müde, mag kaum laufen. Ich denke oft, was ist auch mit mir los. Aber weisst Ruedi Du bist halt gleichwohl so ein lieber und ich stehe zu Dir, sei es wie es wolle. Meine Gedanken darf ich eben niemandem verraten ich bin in dieser Beziehung so allein. Elvira sagte mir, wie Valentina so darunter leide, dass es nun eben auch allein ist. Aber was soll man machen, wenn man das auch wüsste. Mit Vater kann ich eben nicht viel reden, habe ihm aber gesagt, auf welchem Weg Du nun seist. Das sagte er, das sei gar nicht gut und das war alles. Bin so froh kommt bald Erna so habe ich auch jemanden. Denn ich habe so viel Längiziti nach meinen Lieben besonders nach Dir Ruedi. Wenn ich noch einmal jung wäre, wie vieles würde ich anders machen, habe auch meinen Kindern gegenüber so viel Fehler gemacht.
Und nun wegen unserer Baumann-Zusammenkunft das macht mir auch grosse Sorgen. Habe einmal mit Walter und Elvira darüber gesprochen, und sie sagten das könne man doch hier haben, indem man doch einen Party-Sevice machen könne. Metzgerei Zangger mache das auch. Walter sagt, bis dann sei die Ernte vorbei. Komme doch bald einmal zu uns. Erna sagt, zu selber Zeit sei sie ja auch da. Und Du kämst sicher auch cho helfen. Kann fast nicht mehr schreiben, so bin ich bekümmert und schlotterig. Sei nun vielmal herzl. gegrüsst von Deiner bekümmerten Mutter.
Jeden Abend bevor ich einschlafe befehle ich Dich dem himmlischen Vater an und denke es komme dann doch noch einmal anders.
Brief an die Mutter
10.6.1993
Liebe Mutter
Ich danke Dir für Deinen Brief, der mich beunruhigt. Eigentlich solltest Du glücklich sein, dass Dein Sohn jetzt endlich, nach so langen Jahren, den Mut gefunden hat, sich selber anzunehmen, zu sich selber zu stehen. Endlich kann ich meine Veranlagung akzeptieren. Das befreit!
Ja, ich bin glücklich, dass ich jetzt „ja" sagen kann zu mir. Ich habe mich selber gern, wie ich bin. Natürlich ist nicht alles nur Glück in meinem Leben. Aber in welchem Leben ist es das schon?
Ganz weit von Dir schieben solltest Du Deine Selbstvorwürfe. Liebe Mutter, Du hast doch getan, was Du konntest mit uns Kindern. Wir hatten es doch gut. Du bist ganz sicher nicht schuld, dass ich so bin. Ich habe Dir schon an jenem Samstag bei mir gesagt, und Du kannst es auch auf dem grünen Faltblatt lesen, welches ich Dir gestern geschickt habe: Homosexuell wird man nicht, homosexuell ist man, oder man ist es nicht. Niemand ist schuld daran.
Und wegen Valentina und den Kindern: Klar, mir tut unsere Situation auch leid wegen ihnen. Aber so was ist zu verkraften. Auch früher starben Mütter und Väter von Familien weg und die Hinterbliebenen mussten das verkraften. Und wir reden ja darüber. Dann ist es leichter!
Und noch etwas: Falls Du mit jemandem darüber reden möchtest: Hr. und Fr. Pfarrer Hofer wissen Bescheid. Sie wären doch auch für Gespräche bereit.
Liebe Mutter, Du bist verantwortlich dafür, ob Du an meiner Homosexualität zerbrechen willst. Du kannst Dich entscheiden, ob Du Dich zu Tode grämen willst. Du kannst Dich aber auch dafür entscheiden, die Sache leicht zu nehmen und Dich darüber zu freuen, dass ich endlich so sein kann, wie ich von Natur aus bin.
Ich wünsche Dir, dass Du die Kraft aufbringst, Deinen Kummer abzulegen und Deine Schuldgefühle. Sie nützen niemandem. Es ist gut, wie es ist! Herzliche Grüsse sendet Dir Ruedi

In dieser Phase bestand mein Leben hauptsächlich aus der unermüdlichen Suche nach sexuellen Abenteuern. Ich fuhr zwei- bis dreimal pro Woche nach Zürich (meine Männergruppe, Sauna- und/oder Barbesuch, sonstige Veranstaltungen) immer in der Hoffnung, jemanden zu finden für ein Abenteuer. Leider klappte es selten und oft ging ich deprimiert wieder heim.
An der Schule für Sozialarbeit hatten wir auch die Arbeit mit Gruppen behandelt und „gelernt", Gruppenarbeit zu machen. Könnte ich nicht eine Selbsthilfegruppe gründen und leiten? Ja, das war die Rettung, so könnte ich auch Freunde finden in der gleichen Situation und es wäre vielleicht leichter, die „glückliche" Familie zu erhalten und doch homosexuell aktiv zu sein. Ideal wäre es, eine oder zwei Familien kennen zu lernen und sich als Familien zu befreunden. Dann könnten wir Männer uns zwischendurch vergnügen und müssten den Frauen nichts verheimlichen.
Mit dieser Hoffnung gab ich ein Inserat in einem Kontaktanzeiger auf, wo ich Leute suchte, die interessiert waren an einer Selbsthilfegruppe für „bisexuelle Ehemänner". Auf mein Inserat bekam ich über dreissig Zuschriften. Ich konnte es fast nicht glauben. Dreissig! Dann war ich also doch nicht allein auf der Welt in dieser ausweglosen Situation. Ich nahm mit diesen Männern Kontakt auf. Einigen war es dann doch nicht ganz ernst, in einer Gruppe mit zu machen. Aber eine beachtliche Anzahl hatte echtes Interesse daran. Ich begann zu planen, fand in Zürich einen Gruppenraum, wo wir uns treffen konnten. Und so trafen sich anfangs November 1991 vierzehn Männer, um miteinander das weitere Vorgehen in dieser Gruppe zu besprechen.
Die Gruppe wurde ein voller Erfolg. Drei der Männer sprangen nach dem ersten Treffen noch ab, aber elf Teilnehmer „blieben". Wir trafen uns alle drei Wochen zu einem Gesprächsabend. Wir hatten abgemacht, dass wir vorerst die Gruppe nicht öffnen wollten, sondern in der gleichen Zusammensetzung, ohne neue Mitglieder, bleiben wollten. In der Gruppe war auch Alex, ausgebildeter Sozialarbeiter und studierter Psychologe. Er war bereit, die Gruppenleitung professionell zu übernehmen. In der Gruppe waren alles Männer, die in einer Beziehung mit einer Frau waren, einer lebte getrennt von seiner Frau, bei einem anderen wusste die Frau von dessen homosexueller Neigung, andere lebten diese Neigung versteckt aus.
In Zürich müsse es einen Badeort an der Limmat geben, wo vor allem Schwule sich treffen und nackt baden. Es gebe dort auch sexuelle Abenteuer. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, so etwas hatte ich noch nie gehört. Sicher hatte ich schon von Nudisten gehört und von Nudistencamps, aber in Zürich nackt baden? Das musste ich mit eigenen Augen sehen.
Und so erkundigte ich mich eines Sonntags bei Stani, den ich von den Bartmännertreffen her kannte. Er erklärte mir den Weg. An einem schönen Sonntag versuchte ich, die Örtlichkeit zu finden.
Anfänglich glaubte ich, am falschen Ort zu sein, weil ich keinen Menschen sah. Ich hatte mir das anders vorgestellt. Nun führte der Weg durch ein kleines Wäldchen und dahinter öffnete sich eine grosse Wiese. Am Rand dieser Wiese entlang ging ein kleiner Fusspfad, offenbar gingen da oft Menschen her. Und jetzt geschah das „Wunder": Da spazierten zwei ältere Herren splitternackt. Ich war wie elektrisiert. Es waren schöne Männer, schon grauhaarig, aber der Anblick des einen liess mich fast erstarren. Ich schlich den beiden Männern nach und da eröffnete sich mir das, was ich gesucht hatte: Nackte Männer!
Jedesmal, wenn ich zu diesem Badeplatz ging, waren diese beiden Männer auch anwesend. Sie hatten dieselben Badetücher und diese ganz dicht nebeneinander gelegt. Sie gingen immer miteinander ins Wasser, gingen miteinander spazieren und mir bald klar, dass es sich um ein ,,festes" Freundespaar handelte. Aber der eine der beiden, der faszinierte mich dermassen, dass ich ihm immer provokativ nachschauen musste. Und sehr oft schaute er verstohlen zurück.
Ich wollte unbedingt versuchen mit diesem Mann in Kontakt zu kommen und sagte zu Stani, dass mir auffalle, dass jene beiden Männer, ich zeigte ihm, wen ich meinte, immer auch da seien, wenn ich da sei. Und er wusste etwas mehr von denen, in welchem Quartier sie wohnten und wie sie hiessen. Und so war es für mich ein Leichtes, die Adresse heraus zu finden und ich schrieb ihnen einen Brief. Ich schrieb, dass sie mir aufgefallen seien beim Nacktbaden und ich sie sehr attraktiv fände und sie näher kennen lernen möchte.
Kurze Zeit später erhielt ich einen Anruf, einer der beiden Männer war dran. Er bedankte sich für den Brief, sie hätten sich beide sehr gefreut und sie möchten mich gerne mal einladen.
Nun hatte ich, was ich wollte: Ich war im Kontakt mit Herbert. Aber natürlich hatte ich sehr schnell begriffen, dass die zwei Männer ein ,,festes Ehepaar'' waren und es nicht einfach sein würde, Herbert ins Bett zu bringen. Nein, ich habe sogar erkannt, dass ich dies vergessen musste, denn ich wollte ja die Beziehung der beiden nicht gefährden. Aber immerhin, wir konnten uns ja platonisch befreunden, so konnte ich Herbert wenigstens hin und wieder anhimmeln. Und so entstand eine lockere Freundschaft. Mit der Zeit liess mein Interesse aber ein wenig nach, denn ich kannte ja immer mehr Männer und suchte einen für eine feste intime Beziehung. Vergessen konnte ich Herbert aber nie.
Ich hatte die Männergruppe, die ich gegründet hatte und die immer noch gut lief, wir trafen uns alle drei Wochen. Ich war in der schwulen Wandergruppe, die ungefähr einmal im Monat zu einer Wanderung irgendwo in der Schweiz einlud und Silvester/Neujahr immer zwei bis drei Tage in einem Klub- oder Lagerhaus verbrachte. Ich ging wöchentlich zu den Bartmännern. Immer wieder gab es Erwachsenenbildner oder Psychologen, die eigene Wochenenden mit Workshops anboten. Und dann war die Bolderntagung im Frühjahr und das Wochenende in der Paulusakademie und auf dem Leuenberg. Da fanden verschiedene Workshops statt. Und es wurde gesungen und getanzt. Und auch da erlebte ich eine ganz neue Welt und kam aus dem Staunen nicht heraus, wie viele Menschen da waren und wie viele ähnliche Situationen durchgemacht hatten wie ich. Und wie viele andere, aber auch schwierige Lagen gemeistert hatten. Zum Beispiel eine Frau, die vier Kinder hatte und einer Freikirche angehörte. Sie entdeckte ihr Lesbischsein auch in fortgeschrittenem Alter - oder sie liess es erst dann zu - und machte einen noch viel schwierigeren Weg durch als ich, musste sie sich doch auch dem Druck der Glaubensgemeinschaft entgegensetzen. Aber auch sie war ihren Weg gegangen.
Ich stand am Anfang eines neuen Lebens. Es war aber gar nicht im Sinne des Plakats von damals, über das ich mich anfänglich so sehr geärgert hatte. Mein Entwicklung hat mich nicht näher zur Kirche geführt, sondern ich hatte mich ihr mehr und mehr entfremdet. Schon lange habe ich mich über gewisse Pfarrer geärgert, wenn sie im Schlussgebet eines Gottesdienstes (als Organist hatte ich ja in vielen Gottesdiensten mitgewirkt) Gott baten: Und schenk uns endlich Frieden. Nein, das war nun doch wirklich nicht die Angelegenheit Gottes. Wir Menschen schaffen Krieg und Unfrieden, also können nur wir es machen, Frieden zu bekommen. Oder in Trauungen, wenn es hiess: Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. So ein Unsinn! Ich hatte ja meine Frau selber ausgesucht, Gott hat sich mir nicht auf einem Serviertablett vor die Türe gelegt. Ich ertrug es nicht mehr, wenn die Kirche Gott als gütigen Vater darstellt, der uns beschützt und uns hilft. "Für Spiis und Trank, für s täglich Brot, mier danked dir, oh Gott" hört man in Tischgebeten. Warum gibt er uns Speis und Trank und andere Völker lässt er darben? So kam ich Einsicht: Gott, wie ich ihn mir vorstelle, hat die Evolution unserer Erde, des ganzen Weltalls, des ganzen Kosmos, gesteuert und steuert sie noch immer. Aber was wir jetzt mit unserem Menschsein machen, darum kümmert er sich nicht. Er hat die Voraussetzungen gegeben, dass es uns gut gehen kann, wenn wir aber dieser Ressource nicht oder falsch nutzen, das ist nicht seine Verantwortung. Nein, Gott kümmert sich nicht um uns, auch nicht um jeden einzelnen von uns. Wir allein sind verantwortlich für das, was wir mit unserem Menschsein machen.
Und über das Leben nach dem Tod denke ich auch nicht wie die Kirche uns vorgaukelt. Dass wir unsere Lieben "im Himmel" wieder antreffen sollten, ist meiner Meinung nach Unsinn. Leben besteht aus Materiellem und aus Geistigem. Das Materielle ist in steter Wandlung, aus Tod entsteht neues Leben. Pflanzliche "Abfälle" vermodern, werden Erde und bilden den Grundstoff für neues Leben. Tierische Überreste zersetzen sich auch in ihre Grundstoffe und und diese werden für neues Leben "verwendet". Und so stelle ich mir auch die geistige Welt vor: Als einen grossen "See". Geht irgendwo Leben zu Ende, zerfällt es in Materielles und Geistiges. Das Geistige "regnet" als Tropfen in den See, nichts geht verloren. Die Moleküle vermischen sich im See. Und darum kann ein Tropfen der in den See fällt, niemals der gleiche Tropfen sein, den man dem See entnimmt. Und wenn neues Leben entsteht verbinden sich umgewandelte Materie mit Geistigem, das aber niemals mit einem früher verstorbenen Leben zu identisch sein kann.
Ich habe mich der Kirche vollends entfremdet und bin - als Konsequenz - ausgetreten.

In meiner ganzen Kind- und Schulzeit und auch als Erwachsener - immer hatte ich das Gefühl gehabt, mit mir stimme etwas nicht, ich sei krank, oder zumindest nicht normal. Ich sei kein rechter Mann und anders als die andern. Und nun, nachdem ich mein langes schwieriges Comingout hinter mir hatte und mich sogar nicht mehr als bisexuell sondern je länger je mehr als schwul erlebte, jetzt endlich fühlte ich mich „normal“. Ich war nicht wie jeder andere Mann - aber kein Mann ist ja gleich wie der andere, kein Mensch ist gleich wie der andere, jeder hat seine Eigenart. Ich war Mensch geworden. Ich war normal.


Es zeigte sich immer deutlicher, dass ein Wiederzusammenziehen mit Valentina nicht in Frage kam. Sie hatte inzwischen einen Freund, Jens, und ich war nicht in der Lage, auf sexuelle Kontakte mit Männern zu verzichten. Wir hatten uns, wie man so sagt, definitiv auseinander gelebt. So beschlossen wir gemeinsam, dass wir die Scheidung nun durchziehen wollten.
Ich hatte von einem Fritz eine Zuschrift auf mein Inserat im Kontaktanzeiger erhalten. Sie interessierte mich. Ich rief ihn an, er war gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. Ich wollte mit ihm ein Date abmachen. Er wohnte in Zürich und ganz spontan sagte er, wenn er sich beeile, reiche es ihm noch auf den Zug. Er wollte sofort vorbei kommen. Mir imponierte die Spontaneität. Ich holte ihn an Bahnhof ab. Ich hatte etwas zum Essen vorbereitet und er erzählte mir von sich und ich ihm von mir. Er arbeitete in Zürich und hatte hier auch eine Mietwohnung. Am Wochenende reiste er ins Tessin, wo er noch ein Haus besass, welches er viele Jahre mit einem Freund zusammen bewohnt hatte. Der Freund war erst vor ein paar Monaten gestorben. Er sei darum noch sehr traurig und könne fast nicht allein leben und hätte so gerne wieder einen festen Freund.
Wir hatten dann auch noch schönen Sex.
Am nächsten Wochenende besuchte ich ihn in Zürich. Seine Wohnung lag im Rotlichtmilieu in einem Haus mit vielen kleinen Wohnungen. Das Haus war schmutzig - und seine Wohnung auch. Sie war sehr kärglich eingerichtet, lieblos. Quer durch das Schlafzimmer war eine Wäscheleine gespannt, wo er seine Hemden und andere Kleider aufgehängt hatte. Es stand unsauberes Geschirr in der kleinen Kochnische, alles war ungepflegt und es war spürbar, dass da eine Person wohnte, die in einer grossen Krise war. Vielleicht konnte ich dem Mann helfen, aus dieser Krise heraus zu kommen? Irgendwie fand ich ihn doch interessant, aber ich spürte, eine feste Beziehung mit ihm würde sehr schwierig werden.
Heute weiss ich nicht mehr warum, aber irgendetwas an Fritz bewirkte, dass ich die Beziehung mit ihm fortsetzte, obschon ich von Anfang an gespürt hatte, dass auch das Innenleben von Fritz so chaotisch war wie sein Haus und die Umgebung. Es würde eine problematische Beziehung werden. Vielleicht war es das Geld, das mich zu bleiben bewog und mit ihm fast fünf Jahre zusammen zu leben? Fritz war Millionär und die erste Ziffer seines Vermögens auf der Steuererklärung war nicht eine Eins! Er war Alkoholiker, er trank ohne Weiteres zum Abendessen einen Liter Wein. Immer nur abends, danach schlief er offenbar gut. Fritz war sehr intelligent, aber er konnte seine Intelligenz, wie mir schien, nicht richtig anwenden. Er hatte einen guten Kern, aber die Schale erschien rau. Und er war stur. Er hatte fixe Ansichten, von denen er kein My abwich. Er war gehemmt, irgendwie auch menschenscheu, vor allem mied er fremde Leute. Mit Menschen, die er kannte und mochte, konnte er in Beziehung stehen, aber er war immer verkrampft und angstvoll, er schien immer wie bereit, sofort flüchten zu können. Ich hoffte insgeheim, ich könnte Fritz positiv beeinflussen und ihn zu gewissen Veränderungen führen. Er war ein lieber Kerl, es war schade, dass sein gutes Wesen unter all seinen Komplexen nicht richtig in Erscheinung treten konnte.

Einmal hatte ich einen Anruf von der Mutter. Sie teilte mir mit, dass Vater ein Schlägli gehabt habe, kein schweres, aber er sei im Bett und müsse sich jetzt langsam erholen. Er habe keine Lähmungen und könne auch sprechen. Seit meinem Weggang von der Familie ging ich nicht mehr oft ins Elternhaus. Als ich dann aber doch bald darauf wieder mal vorbei ging, war die Tür zum Schlafzimmer ein wenig offen und ich hörte, wie der Vater zur Mutter sagte: "Mach die Türe zu, ich will ihn nicht sehen." Die Mutter schalt ihn und sagte, er solle nicht so dumm tun, half ihm sich anziehen und dann kam er doch in die Stube und ich sagte ihm Grüezi. Es war dann nicht anders als sonst, gesprochen haben wir zwei eh fast nichts miteinander.
Später erfuhr ich dann, dass er sich in der Zeit der Krankheit doch sehr mit mir und meiner Situation auseinander gesetzt hatte. Elvira, meine Schwägerin, musste ja anfänglich bei der Pflege helfen. Und er habe dann oft von meiner Homosexualität gesprochen, viel geweint und gefragt, ob er wohl Schuld sei daran.
Für mich war klar: Er hatte die Krankheit gebraucht, um "mit mir fertig zu werden“. Aus der Krankheit, aus der Schwäche heraus konnte er darüber reden und sich damit befassen. Die Mutter wandte sich dann, wie ich das voraus gesehen habe, an den Pfarrer und sie hatten einige Gespräche mit ihm. Und Pfarrer Hofer hat offenbar gut reagiert und konnte der Situation die Dramatik nehmen.
Mein Vater erholte sich gut vom Schlägli und von da an fuhr ich jeden zweiten Samstag zu den Eltern, um die Wohnung zu saugen und sonst etwas „zum Rechten" zu schauen. Es war wieder alles beim Alten, ausser dass der Vater unbeholfener war als vorher. Mehr und mehr wurde er von der Mutter abhängig, sie begann - mehr als vorher - ihn zu „verwalten".
Mir ging noch etwas anderes durch den Kopf. Vater war ja immer ein düsterer, verschlossener Mann, der fast nicht gesprochen hatte. Er war immer ernst. Meine Schwester erzählte mir später, seine Mutter, also unsere Grossmutter, hätte immer gesagt, dass nur die dummen Leute lachen. Nur, das fiel mir schon als Kind auf, wenn wir Besuch hatten, da konnte er reden und lachen und war aufgeweckt und unbekümmert. Ich konnte mir vorstellen, dass er ähnliche Probleme wie ich gehabt hatte, aber zu der damaligen Zeit - und dann noch im Emmental - er überhaupt keine Möglichkeit hatte, in gleichgeschlechtlicher Richtung etwas zu erleben. Vielleicht war seine Reaktion auf mein Coming out darum so heftig und er dachte, er sei Schuld, weil er auch so war?

Im Sommer 1998 wechselte ich meine Arbeitsstelle. Nach schweren und nicht enden wollenden Problemen mit meinem bisherigen Chef hatte ich mich entschieden zu gehen. Ich war über fünfzig und der Stellenmarkt ausgetrocknet, auch im Sozialbereich. Aber ich hatte Glück. Ich hatte nur wenige Monate gesucht und eine gute Stelle bei der Stadt Zürich gefunden.
Ich pendelte zwischen meinem Wohnort und Zürich. Das ging gut, aber ich wusste, dass ich eines Tages in Zürich eine Wohnung suchen würde. Ich wollte mir Zeit lassen - ich hatte ja auch Zeit - denn mir war wichtig, dass meine Töchter die Möglichkeit hatten, bei mir abzusteigen.
Zufällig kaufte ich einmal den Tagi und schaute die Wohnungsinserate an. Plötzlich blieb ich an einem Inserat hängen. Da stand doch, dass in der Stadt Zürich in einem Haus mit acht Wohnungen, alle diese acht Wohnungen als Stockwerkeigentum günstig verkauft werden sollten. Bargeld hatte ich fast keines, aber wenn ich von den Eltern ein Darlehen bekäme, könnte ich eine verkraftbare Hypothek aufnehmen. Da machte es bei mir klick und ich begriff, dass man für eine günstige Eigentumswohnung nicht reich sein musste.
So bewarb ich mich für die Vierzimmerwohnung im vierten Stock und bekam sie, das Glück war perfekt. Für mich, für Fritz weniger. Er hoffte - und sagte das auch - dass sich die Mieterin weigere auszuziehen.
Sie kündigte dann nach ein paar Monaten und Fritz realisierte „den Ernst" der Lage erst jetzt so richtig. Ich wollte eine eigene Wohnung in Zürich beziehen, ohne ihn. Das hiess, unsere Wohngemeinschaft war daran, sich aufzulösen. Als meine Mieterin angerufen und mir mitgeteilt hatte, dass sie auszog, sackte er in sich zusammen und sah aus, wie ein geknickter Baum. Veränderung - das war für ihn etwas ganz schreckliches.
Ich hatte mich aus der einengenden und schwierigen Beziehung mit Fritz herausgeschält, mit der festen Überzeugung, dass ich keine enge Beziehung mehr wollte. Doch, ich wünschte mir eine Beziehung, aber sicher keine Wohngemeinschaft mehr. Und doch war ich immer am Suchen, und beim Suchen hatte ich immer die Frage im Hinterkopf, ob ich mir eine Partnerschaft mit dem Mann, den ich gerade im Visier hatte, vorstellen konnte.

Nach Vaters Tod, er war eineinhalb Jahre nach der Mutter gestorben, räumten wir die Wohnung der Eltern. Ich fand es schade, all diese Fotos unbesehen fort zu werfen und beschloss, sie durchzusehen. Dabei stiess ich auf einige Fotos, die mir bewiesen, dass Vater eine homoerotische Neigung gehabt haben musste. Nein, beweisen konnten die Fotos das nicht, aber mich in meiner Vermutung bestärken. Ich fand Fotos aus Vaters jungen Jahren. Offenbar machte er mit einer Gruppe anderer Burschen – sie könnten so 18 – 20 Jahre alt sein, einen Ausflug. Mein Vater war meistens sehr nahe bei einem anderen Burschen zu sehen, oft in direktem Körperkontakt, in dem der eine dem anderen die Hand auf die Schultern gelegt hatte, oder sonst in einem „lockeren“ Körperkontakt war. Und was mir auffiel, auf diesen Fotos hatte mein junger Vater leuchtende Augen, wie ich sie an ihm sonst nicht kannte. Ein Foto war da, wo die paar Burschen lagerten. Vater lag da am Boden nahe bei einem anderen Burschen und sie hielten sich die Hand und schauten sich glücklich an. Ein Foto, wie ich es auch in Schwulenmagazinen hätte finden können. Ich fand auch Fotos aus etwas späterer Zeit, da war er im Gespräch oder auf einem Spaziergang mit einem anderen Mann, es war meistens derselbe, da „himmelte“ Vater diesen Mann in einer ganz besonderen Weise an. Irgendwie strahlte er Glück aus, er hatte ein Leuchten in den Augen, eine Ausstrahlung, die ich sonst an ihm nicht kannte.
Ich fragte einmal Erna, meine Schwester, wer denn ihr Götti gewesen sei. Sie sagte, sie habe ihn nie gekannt. Man habe gesagt, es sei ein Freund von Vater gewesen, der sich dann aber von seiner Familie trennte und geschieden wurde. Man habe gemunkelt, er sei homosexuell gewesen. Ich denke, es war der Mann, der Bursche, den ich oft mit Vater auf Fotos gesehen habe.
Elvira, meine Schwägerin, sagte mir einmal, die Mutter hätte ihr erzählt, dass sie nach ihrer Hochzeit lange auf den ersten Geschlechtsverkehr habe warten müssen. Vater habe sich anfänglich vor ihr versteckt.
Nach all diesen Beobachtungen und Informationen war für mich klar, dass Vater eine homoerotische Neigung gehabt haben musste. Natürlich konnte er diese Neigung nicht leben, vielleicht war es für ihn wie für mich, wir spürten sie, aber es war etwas, das nicht sein konnte, nicht sein durfte. Nur, ich hatte das Privileg, später den Weg zur Akzeptanz zu machen und ein Coming out zu haben. Mein Vater hingegen wuchs in einer Zeit und in einem Umfeld auf, wo dies einfach nicht möglich war. Aber der Fact, dass er sein innerstes Ich nicht annehmen und leben konnte, machte ihn depressiv, düster, verschlossen, so wie ich ihn kannte.
Ich nehme an, dass er auch darum mit einer Krankheit auf meine Offenbarung, dass ich schwul bin, reagierte. Wahrscheinlich kam ihm meine Entwicklung einfach ganz, ganz nahe, vielleicht wurde ihm bewusst, dass ich nun lebte, was er gerne gelebt hätte und wogegen er sich mit aller Kraft gewehrt hatte. Und diese Erkenntnis, doch etwas verpasst zu haben, tat ihm wohl unendlich weh und nur in der Schwäche der Krankheit konnte er sich damit aus einander setzen.

Ein paar Monate lebte ich eine Beziehung mit Peter. Wir wohnten nicht zusammen, aber er war oft bei mir. Peter war dermassen negativ eingestellt zum Leben generell, er hasste die Menschen, er hatte ein derart negatives Bild von sich, er schimpfte über Gott und die Welt, war überhaupt nicht in der Lage, eigene Fehler zu erkennen an seinem Schicksal, für alles beschuldigte er die andern, dass mir doch nach neun Monaten klar wurde, dass unsere Beziehung keine Zukunft hatte.
Da bekam ich eine Todesanzeige. Gespannt öffnete ich das Couvert: Der Partner von Herbert! Sofort durchzuckte mich der Gedanke: Jetzt ist Herbert frei, das wird gefährlich für mich.
Nach den Erfahrungen mit Fritz, einem Radek aus Polen, den ich übers Internet kennen gelernt hatte und der mich jämmerlich verarschte, und Peter, die mir schmerzlich zeigten, wie schwierig feste Beziehungen sein können, konnte ich mir doch nicht vorstellen, als Single zu leben. Ich wollte einen festen Freund, aber nicht unbedingt in Wohngemeinschaft. Immer Kompromisse zu schliessen, das hatte ich satt. Ich wollte einen Freund mit eigener Wohnung in der Nähe; man könnte sich mal da und mal da treffen, viel Zeit miteinander haben und viele Gemeinsamkeiten miteinander leben. Ich war auch nicht bereit für sexuelle Treue.
Was sollte ich jetzt tun? Ja, klar, wieder suchen, per Internet, per Annoncen, per Aufsuchen von Treffpunkten.
Aber halt, vielleicht war das alles gar nicht nötig, da war ja Herbert, der war jetzt ja auch allein. Allerdings konnte ich mir nicht vorstellen, eine feste Partnerschaft mit ihm einzugehen, der Lebensstil, den er sich gewohnt war mit seinem verstorbenen Partner, der schien mir zu unterschiedlich zu meinem. Aber als Sexualpartner, das wäre toll. Herbert war immer noch ein attraktiver Mann, etwas an ihm faszinierte mich, ohne genau zu wissen, was es war. Aber wie sollte ich vorgehen?
Schon einmal hatte ich bei ihm guten Erfolg gehabt mit einem Brief. Also schrieb ich ihm, dass er mich immer noch fasziniert und dass ich ihn gerne im Bett näher kennen lernen möchte.
Nach ein paar Tagen rief er mich an. Er sei total überrascht gewesen von meinem Brief und er fragte sich, ob ich ihn da nicht verarschen wolle. Ja gut, wir könnten ja mal einen Spaziergang machen zusammen, um uns noch besser kennen zu lernen.
Nun war ich wiederum aufgewühlt; er hatte mir keine Absage erteilt. Vielleicht gelang es mir, ihn ins Bett zu bringen und daraus könnte ja dann eine gute Freundschaft entstehen.
Ziemlich schnell intensivierten sich unsere Begegnungen. Auch im Bett hatten wir uns mittlerweile kennen gelernt. Da ich nicht weit von da, wo er wohnte, arbeitete, ging ich öfters nach der Arbeit zu ihm und blieb dort über Nacht. An Wochenenden kam er dann manchmal zu mir und wir verbrachten das Wochenende bei mir. Es gab eine direkte Tramverbindung von ihm zu mir. Eigentlich ideale Gegebenheiten, wie ich sie mir gewünscht hatte. Aber irgendwie waren wir doch zu weit auseinander. Jeder musste „das Köfferli“ packen, wenn er zum andern ging; es wäre viel schöner gewesen, wenn wir auf Sichtdistanz zueinander gewohnt hätten. Jederzeit sich besuchen können, auch nur um sich zu umarmen und zu küssen, und dann wieder in die eigenen 4 Wände zu gehen, das wäre ideal gewesen. Ich fühlte mich in der Wohnung von Herbert nicht sehr wohl. Klar, es war ja das Nest, das er mit seinem Partner gebaut hatte. Und viele kleine Dinge im Alltag störten mich. Doch ich war glücklich, wieder jemanden zu haben, der mich faszinierte.


Die Skiferien mit meinen Töchtern und ihren Freunden, die ich mit Peter geplant hatte, fanden nun mit Herbert statt. Ich hatte meine Töchter selbstverständlich gefragt, ob sie einverstanden seien, wenn ich einen neuen Mann, den sie ja noch gar nicht kannten, mitbringe. Wir zwei älteren Männer verbrachten eine Woche in einem Ferienhaus im Goms, zusammen mit 4 jungen Menschen, die Ski fahren wollten. Es ging sehr gut. Die Jungen standen früher auf als wir, sie waren bereits aus dem Haus und wir konnten in Ruhe frühstücken und unsern Tag gestalten wie wir wollten. Wir wanderten und fuhren auch ins Skigebiet, aber nur zum Zuschauen. Zwei- oder dreimal wagten wir uns doch auf Langlaufskier und machten unsere ersten Versuche auf der Loipe. Abends waren wir alle dann wieder im Haus, jemand kochte, wir spielten und redeten viel. Meine Töchter wollten zum ersten Mal etwas genauer wissen, wie das ging mit meinem Comingout. Ich bewunderte Herbert, dass er das alles mitmachte. Er war sich doch gar nicht an so junge Leute gewöhnt, und er musste sich sicher auch gefragt haben, ob das für ihn stimme, einen Freund zu haben mit einer ganzen Familie im Rucksack. Ich bewunderte ihn, er nahm das alles so natürlich und unkompliziert. Er war einfach ein ganz toller Schatz!
Meine Schwester Veronika sagte mir, sie möchte eine Wohnung in meiner Stadt kaufen. Sie sprach in der Ich-Form, ich fragte nie, was mit Christian, ihrem Mann sei. Wollten sie sich trennen oder was? Aus reinem „Gwunder“, was der Wohnungsmarkt von Eigentumswohnungen so anbot, begann ich im Internet nach Wohnungen zu schauen. Und stiess auf Bauprojekte mit so tollen Wohnungen, die auch für Herbert und mich geeignet wären.
Plötzlich war das Feuer in mir entzündet. Ohne dass Herbert und ich das besprochen hatten, begann ich jetzt täglich nach einer Wohnung für uns zu suchen.
Ganz zufällig schaute ich einmal in der Mittagspause im Tagi die Wohnungsinserate für Eigentumswohnungen an und las folgendes: „5,5-Zimmerwohnung im 9. Stock in Liegenschaft mit Baujahr 1970, 60 Quadratmeter Terrasse, davon 18 m3 Wintergarten, Sauna in der Wohnung, separater Keller.“ Das tönte nicht schlecht.
Klar, der Preis war sehr hoch angegeben, aber wir konnten nicht widerstehen, die Wohnung anzuschauen.
Ich hätte lieber eine modernere Wohnung gehabt, aber eine Wohnung mit so viel Vorteilen, mit Sicht über die Stadt, mit einer so grossen Terrasse fast ohne Einsicht von Nachbarn, das war in einem Neubau sicher unbezahlbar. Und den Preis der Wohnung konnten wir ja halbieren, so würde es gehen. Schliesslich waren wir sehr begeistert von der Wohnung, dass wir nicht einmal versuchten, den Preis zu drücken. Jedes Zögern hätte die Gefahr beinhaltet, dass wir die Wohnung nicht bekommen könnten.
Und so kauften Herbert und ich zusammen diese Wohnung zu je 50 %. Ich war überzeugt, dass das richtig war. Ich war dermassen verliebt in Herbert, ich himmelte ihn an und war überzeugt, dass wir alles, was mich an ihm störte, bereinigen und Kompromisse schliessen konnten.
Es folgte für mich eine schwierige Zeit. Ich hatte grosse Mühe, so viel von dem in meinen Augen unnötigen Krimskrams von Herbert zu akzeptieren. Herbert war ein wunderbarer, ehrlicher, lieber Mensch. Aber er hatte grosse Mühe, Gewohnheiten zu hinterfragen und sich auf einen Menschen, der vieles anders sieht und andere Gewohnheiten hat, einzulassen. Wir hatten ein paarmal heftigen Streit, so heftig, dass ich sogar drohen musste, ich würde sofort wieder ausziehen, wenn er sich nicht bereit erklärte, auch auf mich einzugehen.
Am Anfang unseres Zusammenwohnens war ich oft sehr böse, hässig, zickig mit Herbert. So sehr, dass ich befürchtete, er könnte mich wieder verlassen. Das wollte ich eben doch nicht. Ich wollte, dass er Rücksicht nimmt auf mich. Meine Tochter fragte mich einmal, als sie bei uns zu Besuch war: „Bist du eigentlich auch mal lieb mit Herbert?“ Das gab mir sehr zu denken. Da wusste ich: Ich muss mich entscheiden: Entweder ich liebe ihn, oder ich verlasse unser gemeinsames Nest wieder, bevor es fertig gebaut ist. Ich entschied mich für die Liebe.
Aber ich fragte mich öfters, ob es klug war, so schnell mit Herbert eine Wohnung zu kaufen und zusammen zu ziehen. Lange habe ich meiner vorherigen Wohnung nach getrauert und manchmal hätte ich am Liebsten alles wieder rückgängig gemacht und weinte innerlich, weil ich wusste, dass das nicht möglich war.
Ab Januar 2004 war es in den Kantonen Genf und Zürich möglich, dass homosexuelle Paare ihre Partnerschaft eintragen lassen konnten. Das wollten wir auf jeden Fall tun. Es ging uns dabei vor allem darum, dass es im Todesfall des einen von uns nicht erbrechtliche Probleme wegen der Wohnung geben würde.
Ich wollte nicht, dass ein zukünftiges Erbe meiner Töchter sich durch das Eintragen der Partnerschaft allenfalls schmälern würde. Aber ich wollte auch nicht, dass Herbert im Falle meines Todes in finanzielle Bedrängnis komme. Und so konnten wir mit meinen Töchtern einen Vertrag abschliessen, der festlegte, dass sie einverstanden waren damit, dass Herbert in einer ersten Phase Vorerbe würde und erst, wenn auch er stürbe oder die Wohnung verkaufte, sie Anspruch hätten auf ihr Erbe.
So liessen wir unsere Partnerschaft registrieren, ohne grosse Umtriebe und Festivitäten.
Per 2007 trat in der ganzen Schweiz das Partnerschaftsgesetz in Kraft, wonach homosexuelle Paare ihre Partnerschaft eintragen lassen können und somit der Ehe in vielen Belangen gleichgestellt werden. Dies war bisher erst in den Kantonen Zürich und Genf möglich gewesen und wir hatten unsere Partnerschaft ja vor ein paar Jahren in Zürich eintragen lassen. Bisher eingetragene Paare mussten also nochmals „heiraten“, wenn sie das wollten, die bisherige „Heirat“ wurde nicht automatisch ins neue Recht übertragen.
Zur „Trauung“ auf dem Zivilstandsamt luden wir meine Töchter ein, sowie einige Bekannte von Herberts Wandergruppe der Pensionierten der Klinik, wo er ja jahrzehntelang gearbeitet hatte. Beim Verlassen des Stadthauses wurden wir von meiner Chefin und zwei Kolleginnen begrüsst und sie rollten einen roten Teppich (Papierrolle) aus und standen bereit mit Prosecco. Herrlich! So selbstverständlich wie bei einer „normalen“ Hochzeit.
Wir wollten unsere Partnerschaft mit Freunden und Verwandten feiern, aber es stand noch ein anderes Fest an: Ich wurde in diesem Jahr 60, und das sollte auch gefeiert werden. Also zwei Feste im gleichen Jahr mit in etwa den gleichen Eingeladenen, das ging nicht. So entschieden wir, dass wir in der Mitte, zwischen Heirat und Geburtstag beides zusammen feiern würden.
Zu unserem Fest hatten wir unsere Geschwister mit Partnerinnen und Partnern eingeladen, dazu viele Freunde und Bekannte. Es fand im September statt. Besammlung war bei uns zu Hause. Wir hatten ein Tram gemietet für eine Stadtrundfahrt während eineinhalb Stunden und danach feierten wir in einem Saal, den wir gemietet hatten. Durch einen Party-Service liessen wir uns verwöhnen und genossen das Zusammensein sehr. Es gab viele Produktionen und man konnte lachen. Herbert und ich gaben auch zwei Sketchs von Loriot zum Besten, „Das Frühstücksei“ und „Feierabend“, mit dem Kommentar, dass wir zeigen wollten, wie es bei uns zu Hause zu und her ginge. Es handelt sich bei diesen Sketchs um Szenen einer Ehe, wo die Kommunikation zwischen den Ehepartnern derart gestört ist, dass eine Verständigung gar nicht mehr möglich ist. Nachher sagte meine Tochter zu mir: „So ist es aber wirklich bei euch!“.

Ein paar Tage nach der Geburt von Niklaus, meinem Enkel, den Herbert auch als seinen Enkel bezeichnet, flogen wir nach Gran Canaria. Ich hatte zwar etwas Bedenken, denn Herbert hatte eineinhalb Jahre zuvor einen Herzinfarkt erlitten und war einige Monate rekonvaleszent. Ob ihm die weite Reise und die Klimaveränderung gut tun würde? Zum Glück ging alles gut.
Im Süden von Gran Canaria befinden sich die Dünen von Maspalomas. Diese Zone ist in der Schwulenszene sehr bekannt und beliebt, es ist ein Treffpunkt von Schwulen aus ganz Europa und sehr frequentiert von Voyeuren und Leuten, die schnellen Sex suchen. In den letzten Jahren finden sich dort auch mehr und mehr Heteros ein.
Normalerweise lagen wir dort in den Dünen im warmen Sand unter Büschen und schauten den Männern nach. Manchmal machte einer von uns einen Rundgang durch die Dünen, während der andere am Platz bleiben und hüten musste. Einmal, als Herbert von so einem Rundgang zurück kam, sagte er, er hätte einen jungen Mann getroffen, der mit ihm Sex wollte. Aber er, Herbert, wolle nicht und darum habe zu dem Burschen gesagt, er würde ihm seinen Freund „schicken“, der sei sicher bereit. Herbert schilderte mir den Platz, wo der junge Mann wartete und so machte ich mich auf den Weg – und fand ihn. Nach einigen Jahren der sexuellen Treue hatte ich nun wieder zum ersten Mal Sex mit einem fremden Mann.
Von da an wusste ich: Herbert akzeptiert, wenn ich Sex mit andern habe.
Ich bin überzeugt, dass der Mensch nicht für sexuelle Treue geschaffen ist. Dies ist ein gesellschaftlicher Zwang (auch von der Kirche her geschürt!), der viel Unheil anrichtet. Schade, dass Familien wegen einem Seitensprung auseinander brechen. Schade, dass wir nicht lockerer damit umgehen können. Ich habe einmal gelesen, dass jedes fünfte Kind ein „Kuckuckskind“ sei. Ich weiss nicht, ob das stimmt, aber doch scheint es viele solche Kinder zu geben. Ich finde das sehr schade und kann mir vorstellen, dass dies eine Partnerschaft schwer belasten kann, weil es heimlich und als Vertrauensbruch geschehen ist. Könnten wir Menschen mit Seitensprüngen lockerer und unverkrampfter umgehen, hätte das sicher die Folge, dass es weniger Kuckuckskinder gäbe.
Der deutsche Sexualwissenschaftler Martin Dannecker spricht mir ganz aus dem Herzen, wenn er in einem Interview (Tagesanzeiger, 4. November 2017) auf die Frage "Was können die Heterosexuellen von den Schwulen lernen?" antwortet: "Einen anderen Umgang mit dem Fremdgehen. Die Heterosexuellen sollen mit der Heuchelei aufhören und kapieren, dass man sehr glückliche Liebesbeziehungen haben kann, ohne treu sein zu müssen. Auch gut, wenn jemand treu ist. Aber dass Heterosexuelle auf einen Seitensprung fast immer mit einem Trennungsimpuls reagieren, ist für mich unverständlich. Schwule Paare handeln ihren Umgang mit dem Fremdgehen natürlich auch aus und stellen gewisse Bedingungen; es ist keineswegs so, dass da jetzt alle alles machen können. Aber sie bekommen die Quadratur des Kreise wesentlich besser hin: eine langjährige Beziehung und immer wieder sexuelle Leidenschaft."
Und auch die Tatsache der Prostitution…. Es sind nicht die Frauen, die sich aus sexuellem Bedürfnis heraus prostituieren. Und es sind ja nicht nur alleinstehende, einsame Männer, sondern oft verheiratete Familienväter, die Prostituierte aufsuchen.
Ich denke, dass Frauen eher zu sexueller Treue neigen, sie sind wahrscheinlich oft auch die, die eine gewisse Bremswirkung auf Männer bewirken können. Die Männer sind in Sachen sexueller Aktivitäten im Grunde genommen gleich, ob schwul oder hetero, die Paarkonstellationen machen den Unterschied.
Für mich und Herbert stimmt es, wenn ich sage, ich sei ihm treu. Er ist mein Lebenspartner, ich komme immer wieder zu ihm zurück und bleibe emotional sein Partner. Und umgekehrt.
Warum wird Treue meistens nur auf die Sexualität bezogen? Treue ist viel grösser.



7.11.2019
Liebe Mutter
Heute vor 19 Jahren bist du gestorben. Meine Schwester und ich waren die ganze Nacht an deinem Bett bei dir. Du warst manchmal ein wenig unruhig und hast dich am Griff über dem Pflegebett festgehalten, als hättest du noch etwas zu erledigen und könntest nicht gehen, bevor das erledigt war. Ja, klar, du machtest dir Sorgen wegen Vater, deinem Mann, den du jahrelang «verwaltet» hattest. Ich meine das Wort «verwaltet» nicht in böser Absicht, es war deine Art, für die ganze Familie Verantwortung zu übernehmen. Du fühltest dich verantwortlich für das Wohlergehen deiner Angehörigen, selbst wenn sie selber für sich Verantwortung übernehmen konnten. Besonders auch für Vater, als seine kognitiven Fähigkeiten nachliessen. Ich sagte dir am Sterbebett, dass du dir keine Sorgen um Vater machen müssest, für ihn werde gut gesorgt. Da fiel dein Hand entspannt auf die Bettdecke herunter und bald darauf tatest du deinen letzten Atemzug.
Heute verstehe ich es gut: Du warst in deiner Herkunftsfamilie das zweitälteste von zwölf Kindern, und das älteste von drei Mädchen. Klar, dass du schon von klein auf Kindermädchen sein und Verantwortung für deine kleineren Geschwister übernehmen musstest. In Anbetracht dessen, dass du einen "bösen" Vater hattest, der seine Kinder auch heftig körperlich züchtigen konnte, musstest du schon früh die Verantwortung gegenüber den Kleinen sehr ernst nehmen; wäre einem von ihnen mal etwas passiert, hättest du schwere Prügel bekommen. Ob das jemals eingetreten ist, weiss ich nicht.
Du hast nie viel von deiner Kindheit erzählt. Ich mag mich nur daran erinnern, dass du einmal gesagt hast, wenn du einen anderen Vater gehabt hättest, hättest du vielleicht eine schönere Kindheit gehabt. Wenn du etwas von deiner Ursprungsfamilie erzählt hast, ging es um deine Mutter, die gläubige Frau, die Lehrerin war und nebst den 12 Kindern 49 Jahre lang Schule gegeben hatte und den «bösen» Mann und seine sexuellen Bedürfnisse (das sprachst du natürlich nie so direkt aus, man konnte das aber erahnen in deinen Worten, die Mutter hätte schon lange genug Kinder gehabt) ertrug.
Als ich langsam erwachsen wurde, war ich oft nicht lieb und nett zu dir. Dein «Dich-für-alles-verantwortlich-fühlen» hat mich oft genervt. Dazu kam, dass du gerne geredet hast. Wenn ich halb verschlafen an meinem Frühstück sass, bevor ich mit dem Velo an die Kanti fahren musste, und du schon hellwach auf mich ein redetest, mich ausfragtest und mir Dinge erzähltest, die ich gar nicht hören wollte, da habe ich dir hinter deinem Rücken die Zunge herausgestreckt und innerlich «blöde Kuh, lass mich in Ruhe» genannt. Und erzählt habe ich dir nichts, höchstens mit ja oder nein geantwortet um dann nach dem letzten Bissen fluchtartig das Haus zu verlassen.
Du warst mit deinem ganzen Wesen eine Bauersfrau. Und auch das schätzte ich nicht. Ich war nicht glücklich darüber, dass wir eine Bauernfamilie waren. Ich habe mir lange gewünscht, in einer anderen Familie aufwachsen zu dürfen; erst viel später sah ich, wie viel mir das Aufwachsen mit Tieren und selber Tiere halten zu dürfen, gegeben hat. Aber du, du hast auch immer wieder gesagt, du hättest doch einen Metzger heiraten sollen. Ich sehe dich noch vor mir, wie du, wenn Hausmetzgete war, voller Elan und mit vor Eifer hochrotem Kopf Fleisch verarbeitet hast und das Brät für die Bratwürste gekostet hast, ob es mundete oder noch ein Gewürz oder eine Zutat fehlte. Für mich war der Tag der Hausmetzgete ganz schlimm, im ganzen Haus stank es fürchterlich nach ausgelassenem Fett und Metzgereidampf und alles, was man anfasste, schien fettig zu sein. Und da mitten drin du glückliche Mutter! Da ekelte ich mich vor dir.
Ein Schulkamerad sagte einmal in einem Gespräch, ich weiss nicht mehr worüber, er sei seiner Mutter dankbar und er liebe sie, denn sie habe ihn ja zu Welt gebracht. Das gab mir zu denken. Meine Empfindung den Eltern gegenüber war eine andere: Ich machte ihnen eher den Vorwurf, dass sie mich gezeugt hatten und dachte: «Ihr habt mich gewollt, oder zumindest gemacht, nun seid ihr auch verantwortlich dafür, dass es mir gut geht, aber mir geht es nicht gut mit euch.»
So war ich unendlich glücklich, als ich von zu Hause ausziehen konnte an meine erste Stelle als Lehrer.
Meine Tendenz war, mich von euch Eltern zu distanzieren. Valentina, meine Freundin, hatte ein inniges Verhältnis zu ihren Eltern. Sie lebte noch zu Hause und so verbrachte ich fast jedes Wochenende bei ihr. Und als ihr Vater später mal gesagt hatte, ich solle doch nicht mehr «pro forma» nach Hause gehen in der Nacht, schlief ich ab dann auch dort und wollte gar nicht mehr bei meinen Eltern vorbei gehen. Aber Valentina bestand darauf, dass wir ihnen doch hin und wieder einen Besuch abstatteten.
Liebe Mutter, nun bist du schon fast zwanzig Jahre tot. Und in diesen Jahren ist in mir die Einsicht gewachsen, dass ich mich dir gegenüber schuldig gemacht habe. Es tut mir sehr leid, dass ich dir nicht gesagt habe, was ich hätte sagen müssen: Du warst eine wundervolle Mutter.
Du hattest eine schwere Kindheit. Du hast einen Mann geheiratet, der sehr verschlossen war, eine depressive Grundstimmung hatte und nicht viel redete. Du wärst eine recht lebenslustige Frau gewesen, die gerne auch fröhlich gewesen wäre und von Herzen gelacht hätte, durftest aber deine Freude am Leben wegen deinem Mann nicht so richtig zeigen. Seine Devise war: Nur dumme Menschen lachen. Du hast gearbeitet, nichts als gearbeitet, warst Bauersfrau. Damals mussten die Frauen auch auf dem Feld helfen, wenn es nötig war. Du hattest einen Haushalt zu meistern von mindestens elf Personen (die Familie umfasste acht Personen, dazu kamen ein Melker, ein Karrer und ein Dienstmädchen), besorgtest einen grossen Garten, besorgtest die Hühner und warst uns Kindern eine liebe Mutter. Ich erinnere mich, dass du uns Kindern vor dem Zubettgehen oft noch vorgelesen hast aus so interessanten Büchern wie «Die sechs Kummerbuben» von Elisabeth Müller und ähnlichen. Das war so schön, so wunderbar.
Und deine Bedürfnisse, wo waren die? Das einzige, woran ich mich erinnere, ist der Bernerverein, dem du angehörtest. Einmal im Jahr war Bernerabend, da gingt ihr zusammen hin, Vater und du. Und hin und wieder gingst du in die Trachtengruppe, wo du andere Bauersfrauen trafst. Sonst hattest du nichts für dich. Du warst da für deine Familie und hast uns eine gute Kindheit beschert. Wir hatten alles, was wir brauchten. Und heute sehe ich, dass ich mir nichts besseres hätte wünschen können, als in einer Bauernfamilie aufzuwachsen mit einer bodenständigen Mutter, die ihr Leben mit Zuversicht und Zufriedenheit gemeistert hat.
Liebe Mutter, ich habe es versäumt, dir das zu sagen, als ich es dir noch direkt hätte sagen können: Ich bin glücklich, dich als Mutter gehabt zu haben. Ich danke dir dafür. Ich liebe dich.
Dein jüngster Sohn Ruedi

12.11.2019
Lieber Vater
Ich erinnere mich, dass ich als kleiner Dreikäsehoch mich auf deine Brust setzen durfte, als du dich nach dem Mittagessen auf das Sofa hingelegt hattest. So machtest du jeden Tag eine kleine Siesta, bevor du wieder an die Arbeit draussen musstest. Ich sass also da auf dir, eigentlich in einer ganz vertraulichen Situation, ganz nah bei dir. Ich weiss nicht mehr, ob du mich schelten wolltest, auf jeden Fall sagtest du, dass du mich zum Metzger bringen könntest, dann würde dieser mir die Hände abschneiden. Ja, ich wusste, du könntest das. Mir machte diese Aussage Angst, aber sie traumatisierte mich nicht, irgendwie spürte ich doch, dass du das nie tun würdest. Und doch hat sie sich auf meine Beziehung zu dir ausgewirkt.
Ich erlebte dich auch die überzähligen Welpen totschlagen. Da war ja unser mir vielbedeutender Hund Katja, mit der ihr dreimal Stammbaum-Hunde gezüchtet habt. Damals kriegten junge Hunde nur einen Stammbaum, wenn im Wurf nicht mehr als sechs Junge waren; Katja hatte aber mehr als sechs geworfen. Du schlugst den überzähligen den Kopf mit einem Stein ein und warfst sie in den See, an dem unser Haus stand. Ich hatte dir zugeschaut und verstand nicht recht, was da geschah. Aber was ich verstand war, dass du allmächtig warst.
Einmal strecktest du mir deine grell-gelben Hände entgegen; du hattest wahrscheinlich die Obstbäume gespritzt und von dem Spritzgift gelbe Hände bekommen. Aber mich erschreckte das sehr. Ja, du konntest sogar deine Hände verzaubern.
Du hattest einen sehr eindringlichen Blick, mit deinen Augen konntest du mich sofort zum Schweigen bringen. Du hast uns Kinder weniger mit Worten, aber mit deinem Blick erzogen. Dein Blick war Befehl. Und Tadel. Lob nie.
Du warst für mich fast wie ein Gott, gross und allmächtig. So handhabte es auch die Mutter bis zu einem gewissen Grad. Wenn sie mit uns Kindern nicht zurechtkam, hiess es: «Warte nur, bis der Vater da ist!», aber auch «Gut, dass der Vater das nicht gesehen hat!» Sie sagte aber nie: «Das werde ich dem Vater sagen.» Du warst der, der die Macht hatte, die Allmacht. Vor dir hatte ich Angst.
Ich denke, all dies wäre vielleicht nicht so schlimm gewesen, wenn du auch eine Gegenseite gehabt hättest, etwas Zärtliches, wenn du mich auch mal in den Arm genommen und geherzt hättest. Später, im Gespräch mit Geschwistern, erfuhr ich, dass du mich nächtelang umhergetragen hattest, als ich als Zweijähriger den Keuchhusten hatte und sehr litt. Da hätte ich fast weinen müssen, als ich davon hörte; die Vorstellung, dass ich dir sehr nahe war und du dich liebevoll um mich gekümmert hast, und ich erinnerte mich nicht daran! Das tat weh.
Ich erlebte auch, dass es nicht schön war, dir bei der Arbeit zu helfen. Das musste ich nicht oft, denn ich war ja bei der Mutter und musste wie die Schwestern im Haushalt helfen. Aber manchmal wollte ich doch in den Stall, oder auf das Feld wie meine Brüder. Aber du verstandest es nicht, mich anzuspornen. Von dir gab es nur Kritik. «So wischt man nicht, du musst den Besen so halten», oder ich rechte das Heu nicht sauber zusammen und so weiter. Je länger je mehr ging ich dir aus dem Weg.
Du bist mir ein Leben lang fremd geblieben. Du warst unergründlich, schweigsam und zurückgezogen, unnahbar und furchteinflössend. Du hast nie etwas von dir erzählt, hast auch nie etwas von mir wissen wollen, wie es mir geht, was ich denke, was mir gefällt. Es gab keine Nähe zu dir. Ich wusste aber auch nie, wie es dir geht, was dich beschäftigt und was du denkst. Interaktiven Austausch gab es nicht.
Später, als ich in die Pubertät kam und langsam erwachsen wurde, wusste ich natürlich, dass du nicht allmächtig bist, du wurdest mehr und mehr zum Störfaktor in unserer Familie. Oft kam es mir vor, als läge über unserem ein grauer Deckel, ich fühlte einen grauen Schleier sich richtig über mich legen, wenn ich mit dem Velo von der Schule nach Hause kam; und wenn ich wegfuhr, fiel auch dieser Schleier von mir weg.
Mit zunehmendem Alter wurdest du depressiver, so dass auch die Mutter unter dir litt. Wahrscheinlich um sie zu beeindrucken, legtest du einmal deinen Karabiner auf den Kachelofen und drohtest (wahrscheinlich nicht direkt, aber andeutungsweise) mit Suizid. Als du krank im Spital warst, da hoffte ich innig, du würdest sterben.
Vater, du warst ein Problem in unserer Familie. Es war offensichtlich, dass du nicht glücklich und zufrieden warst.
Dabei warst du kein Böser. Du hast uns fast nie geschlagen. Ich erinnere mich nur an eine Ohrfeige von dir, weil ich zu meinen Schwestern gesagt hatte, sie seien dumme Kühe und sie ihm das sagten. Aber wir durften als Kinder sehr viel unternehmen und mit Kameraden umhertollen, wir waren sehr frei und wir durften eigene Tiere halten und für sie Verantwortung übernehmen, zum Beispiel für die Schafe. Ich hatte meine Meersäuli und Kaninchen, später die Wellensittiche, mein ein und alles. Mein Bruder und ich durften zusammen im Schweinestall Nachtwache halten und «Hebamme spielen», wenn es Ferkel gab. Du trautest uns zu, dass wir das gut machten. Wir hatten eine schöne Kindheit. Wenn nur das Düstere von dir nicht gewesen wäre. Und ich hatte oft das Gefühl, du sähest mich gar nicht, ich sei für dich ein Nichts. Als würdest du mich gar nicht wahrnehmen.
Später, als ich selber eine Familie hatte, war der Umgang mit dir einfacher. Klar, ich wohnte ja nicht mehr zu Hause, aber nach wie vor gab es keine nahe Beziehung zwischen uns. Mit meiner Frau Valentina konntest du gut plaudern. Sie war auch eine Bauerntochter, die Eltern betrieben Rebbau. Und weil das ein ganz unbekannter Bereich war, hattest du viele Fragen dazu. Valentina hatte die Kindheit nicht mit dir verbracht und darum konnte sie dir ganz ungezwungen begegnen. Zu unseren Töchtern, deinen Enkelinnen, bliebst du eher ein distanzierter Grossvater.
Als du alt wurdest und gebrechlicher, deine Vergesslichkeit zunahm und du immer mehr abhängig wurdest von der Mutter, war es kein Problem mehr, dir zu begegnen, aber innig war unser Verhältnis nie. Erst auf dem Sterbebett, ich war mit meinen Töchtern anwesend, als du den letzten Atemzug tatest, spürte ich ein wenig Nähe: Ich fragte dich, ob ich dir die Füsse massieren dürfe und du antwortetest nicht klar und deutlich, aber das «Ja» konnte ich erahnen. Und ich tat es ein paar Minuten lang. So nahe war ich dir noch nie gewesen.
In den Jahren nach deinem Tod habe ich einige Erklärungen gefunden für dein düsteres Wesen: Ich bin überzeugt, dass du mit ähnlichen Problemen kämpftest wie ich. Ich hatte viele Fragen, und Antworten darauf gefunden.
Warum wandertet ihr während des Krieges aus dem konservativen Hügelgebiet des Bernbietes in die Ostschweiz aus, mit zwei kleinen Kindern und einen Monat vor der Geburt des dritten Kindes? Mir wurde gesagt, du und dein Bruder, die ihr beide gemeinsam einen Bauernhof hättet führen müssen, ihr wärt nicht miteinander ausgekommen. Einer habe gehen müssen. Das kann ja sein, aber warum dann so weit wegziehen? In den 1940er Jahren war ja ein solcher Umzug fast wie eine Auswanderung ins Ausland heute. Es hätte sicher in der ursprünglichen Region eine Lösung gegeben.
Dazu passt die Antwort meiner Schwester auf meine Frage, wer denn Ihr Götti gewesen sei. Sie sagte, sie habe ihn nicht gekannt, man habe ihr erzählt, dass er ein Freund vom Vater war, man habe gemunkelt, er sei homosexuell. Sie habe ihn nie bewusst gesehen. Dazu passt auch meine Beobachtung auf Fotos, die ich bei der Auflösung eurer Wohnung nach eurem Tod gemacht hatte: Da waren einige Fotos dabei, auf denen du und ein paar Kameraden als junge Burschen auf Wanderungen wart. Du hattest fast immer Körperkontakt mit einem anderen Jungen; er hatte dir den Arm über die Schulter gelegt, oder einer hielt den andern am Arm, oder beim Picknick auf einer Wiese lagst du dicht bei ihm und ihr hieltet euch bei der Hand.
Warum reagiertest du auf mein Outing so heftig, dass du krank wurdest? Und in deiner Schwäche der Krankheit zum Ausdruck bringen konntest, dass du dich schuldig fühltest und glaubtest, du wärst schuld an meiner Homosexualität?
Warum musste die Mutter nach der Hochzeit lange auf den ersten Geschlechtsverkehr warten? Sie hatte das ja einmal meiner Schwägerin erzählt.
Ja klar, auf all diese Fragen kann es mehrere Antworten geben, aber meine Antwort, die ich darauf habe, passt eben ganz in das Bild, das ich von deiner Lage habe: Du hattest ähnliche Sehnsüchte wie ich früher hatte. Und bist daran fast zerbrochen.
Damals, da hattest Jahrgang 1910, war ja Homosexualität noch fast ein Verbrechen, auf jeden Fall ein Tabu, erst recht in einem von Freikirchen geprägten Umfeld. Du hattest keine Möglichkeit, dich damit auseinanderzusetzen und sie auch nur ansatzweise zu leben. Es wäre bestimmt, wie bei mir, zur Scheidung gekommen. Und das in einer Bauernfamilie mit sechs Kindern! Undenkbar. Es gab nur einen Weg: Verdrängung bis zum Letzten. Und wer weiss, vielleicht hatte dein Umfeld eine vage Vermutung über dich geschöpft; da wurdest du unter Druck gesetzt, auszuwandern, so dass du und dein Freund euch nicht mehr begegnen konntet.
Oh, Vater, wie tut mir das leid. Was musst du gelitten haben. Kein Wunder konntest du nicht fröhlich sein, kein Wunder warst du depressiv und hast dich zurückgezogen. Ich habe mich ja bis zur sogenannten Lebensmitte ähnlich verhalten. Nur hatte ich das Glück, in einer anderen Zeit zu leben, wo die gesellschaftlichen Gegebenheiten mir ermöglichten, einen Weg aus der Not zu finden, auch dank einer zweiten Ausbildung (Sozialarbeit-Studium), die mir half, mich mit mir auseinanderzusetzen und mich selber besser wahrnehmen zu können und zu lernen, ehrlich zu mir selber zu werden.
Ich wünschte mir so sehr, du würdest jetzt noch leben in einer guten geistigen Verfassung. Ich würde mit dir über deine Sehnsüchte sprechen, würde dich in den Arm nehmen und dich trösten; auf jeden wären wir einander sehr nahe.
Lieber Vater, ich bin stolz auf dich, wie du das Leben gemeistert hast, du warst neben ein paar schwierigen Besonderheiten ein guter Vater. Wir Kinder durften eine reiche Kindheit erleben, hatten viel Freiheiten, wir mussten in Haus und Hof helfen, aber in einem erträglichen Mass. Du warst ein angesehener Landwirt, führtest einen stattlichen Hof und bildetest Lehrlinge aus. Und zu guter Letzt vererbtet ihr ansehnliche Ersparnisse an uns sechs Kinder.
Und ihr habt uns redliche Werte auf unseren Lebensweg mitgegeben: Ehrlichkeit, Rücksichtnahme auf andere und Bescheidenheit.
Schade, dass ich dir nie sagen konnte: Vater, ich habe dich gern.
Ich grüsse und umarme dich ganz innig dein jüngster Sohn Ruedi