Zurzeit sind 544 Biographien in Arbeit und davon 324 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 202



Mein Leben war nicht spektakulär, schon gar nicht ein Lehrstück für künftige Generationen. Es könnte aber sein, dass sich meine Kinder und vielleicht die Kindeskinder dafür interessieren, wie es "damals" war auf dieser Welt. Vielleicht greife auch ich selber eines Tages auf meine Notizen zurück, weil die Erinnerungen nach und nach schwinden. So geht es mir bereits jetzt beim Betrachten alter Fotoalben. Erlebnisse und Menschen, die schon vergessen waren, erwachen so manchmal zu neuem Leben.
Kein Autor möchte seine Leser langweilen, auch ich nicht. Ob und in welchem Masse dies gelingt, werden allfällige Leserinnen und Leser entscheiden. Immerhin haben sie jederzeit die Freiheit, die Lektüre abzubrechen.
Mein noch wichtigeres Anliegen wird erst gegen Ende meiner Aufzeichnungen angesprochen. Ich bange ernsthaft um die Zukunft des Klimas und damit um die Zukunft der Menschheit, insbesondere seit dem Rückzug der US-Regierung anno 2025 von den Pariser Abkommen von 2015. Während ich schreibe, ein halbes Jahr nach Antritt der zweiten Regierung unter Trump, ist ohnehin zu befürchten, dass wir am Ende einer auf Regeln basierenden Weltordnung angelangt sind. Es wäre tröstlich und hilfreich, wenn ich meine Leserschaft zumindest ein wenig mit meinen Befürchtungen anstecken und motivieren könnte.


Meine Eltern haben sich die Namen ihrer Kinder gründlich und gewissenhaft überlegt. Wohlklang und eine positive Bedeutung waren gefragt, und allzu geläufig sollten sie auch nicht sein. Der Erstgeborene war auf den Namen Thomas Christoph getauft, ich wurde Markus Andreas genannt, dann kamen Peter Michael, Franziska Elisabeth und Elisabeth Christine.
Mir gefallen alle Namen. Dass mein Vorname "Sohn des Mars" bedeutet, also Sohn des Kriegsgottes, ist mir erst spät bewusst geworden. Mit Andreas, auf Griechisch "der Tapfere" kann ich mich gut abfinden.All unsere Namen sind gewissermassen Klassiker, aber doch nicht alltäglich. Einen eigenen Sohn Markus zu nennen, war mir kein Bedürfnis, aber ausgeschlossen hätte ich es nicht.
Alle fünf Kinder hatten Übernamen. Einige entstanden dadurch, dass die Grösseren die Namen der rasch nachrückenden Kleinen nicht richtig aussprechen konnten. So wurde aus Franziska unsere "Ika", und so nennen wir sie noch heute. Ich wurde und werde von den Geschwistern "Märke" genannt. Allgemein bestand in unserem Umfeld in Lachen die Tendenz, alle Namen zu verballhornen und zumindest die männlichen auf "-e" enden zu lassen. Thöme, Märke, Fitsche... Der zuletzt genannte Übername von Peter war durch Fiete Appelschnut, eine Figur aus Puppenspielen am Deutschen Fernsehen, inspiriert.
Bei den "Wölfli", der Unterstufe der Pfadfinder, hatte ich den Übernamen "Sokrates". Das mag ehrenvoll erscheinen, aber es war mir eher peinlich. Vorgeschlagen hat ihn der schon damals betagte Leiter der Pfadfinder in Lachen, der Theologe Josef Vogel. Keiner meiner Altersgenossen wäre wohl auf diesen Namen gekommen.


Die Vorfahren beider Eltern waren einfache Bauern, väterlicherseits in Appenzell, mütterlicherseits, nicht weit davon entfernt, im Toggenburg. Die Grossväter hatten es zu Wohlstand gebracht, Grossvater Enzler in bescheidenem Mass als selbstständiger Textilkaufmann in zweiter oder dritter Generation, Grossvater Bösch als erfolgreicher Bauunternehmer.
Mein Vater wurde kurz nach meiner Geburt Chefarzt im Spital Lachen. Armut haben wir selber nicht erlebt. Die Verhältnisse der meisten Nachbarn im Quartier um den Bootshafen, waren aber bescheiden. Autos gab es noch wenige. Der Citroen Legère meines Vaters wurde daher von den Buben der Nachbarschaft bewundert, noch mehr der später folgende grüne Alfa Romeo, ein schnittiger Sportwagen mit Aluminium-Karrosserie der Marke Superleggera. Deren Werbespruch "la preferita dai gentleman driver" mag unserem auch auf äussere Erscheinung bedachten Vater die Wahl erleichtert haben.
Für die Anschaffung eines Fernsehers hatten die wenigsten Geld. Unser Vater besorgte 1956 ein Gerät der Firma Philips beim Händler Alois Oberli in Siebnen. Äusserer Anlass war die Invasion Ungarns durch Truppen des Warschauer Paktes. Damals hatten alle Angst vor einem grossen Krieg und wollten das Geschehen am Fernsehen verfolgen. Zu meinen frühesten Erinnerungen gehören daher Bilder von Panzern in den Strassen von Budapest.
Ein Bespiel für die ärmlichen Verhältnisse jener Zeit bietet das Geschäftsmodell eines benachbarten Zuckerbäckers namens Mächler. Bei ihm durfte man für 20 Rappen die Kinderstunde am Fernsehen verfolgen, und für 20 Rappen gab es eine kleine Papiertüte mit einer mickrigen Portion Eis, bei uns "Glace" genannt. Immerhin hatten alle Leute fliessendes Wasser und Toiletten innerhalb ihrer Häuser, bei Familie Beeler an der Hinteren Bahnhofstrasse in Form eines angebauten "Läubli", ein im ersten Stock am Mauerwerk hängender Holzschopf.
Die damalige Gesellschaft in Lachen, das zum Kanton Schwyz und damit zur "Innerschweiz" gehörte, war geprägt von katholischer Religiosität und Konservativismus. Sozialisten wurden gemieden und abschätzig kommentiert. Amerika war das grosse Vorbild, die Sowjetunion für viele das Böse schlechthin.
Vor der Schule war der tägliche Besuch der "Heiligen Messe" obligatorisch. In vielen Familien wurden regelmässig Tisch- und Abendgebete verrichtet. Unsere Eltern waren eher liberal, die Mutter gar reformiert, aber der Druck der Schule wirkte über uns Kinder auf die Eltern. So wurden zeitweise auch in unserer Familie Tischgebete verrichtet. Das Gutenachtgebet war ohnehin Routine, Einschlafen ohne gebetet zu haben ging gar nicht.
Zum 60. Geburtstag schenkten wir Papi, der sich sehr für seine Vorfahren interessierte, einen Stammbaum. Auf Anfrage erklärte sich der anerkannte Heraldiker Albert Grubenmann aus Appenzell bereit, zum Preis von 1000 Franken die Archive zu durchstöbern. Er lieferte uns den unten abgebildeten, akribisch von Hand geschriebenen Stammbaum.
Um die Lesbarkeit zu verbessern, habe ich die Ränder weggelassen. Auf den ganz unten aufgeführten Pelagius Enzler, genannt Play, soll der Spitzname "Bleierlis" zurückgehen. Einschränkend muss ich sagen, dass ich noch keinen Enzler getroffen habe, der sich nicht zu den Bleierlis zählt. Der Vater und Grossvater von Play hiessen beide Hans, geboren 1592 in Gonten bzw. 1567, ebenfalls in Gonten. Ihre Gattinnen hiessen Anna Auer und Barbara Füchsli. Beide Frauen, Mutter und Grossmutter von Play, sind gemäss Eintrag im Stammbaum 1629 an der Pest verstorben.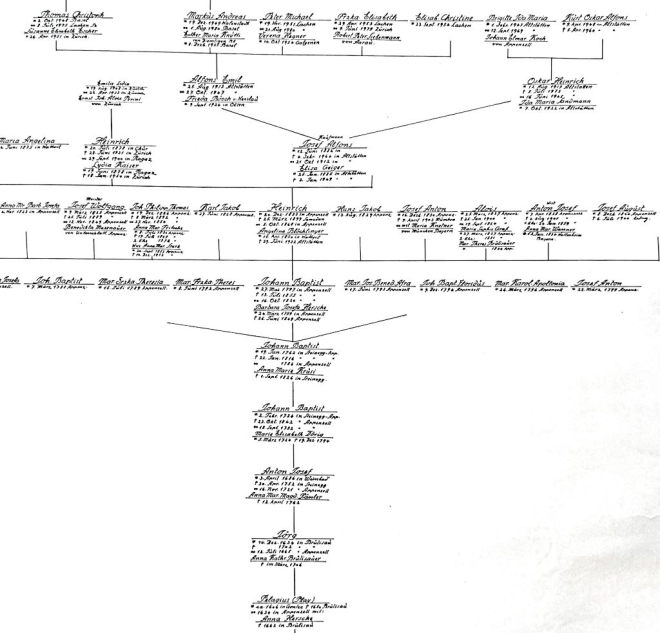
Die Familien meiner Grosseltern, meiner Geschwister sowie meine eigene habe ich mit Hilfe der Website „Myheritage“ gestaltet. Allerhand Firlefanz wie Herzchen oder Luftballons soll auf nahende Jubiläen hinweisen. Leider konnte ich diese nicht zum Verschwinden bringen, ebensowenig ein albernes Krönchen neben meinem Namen.
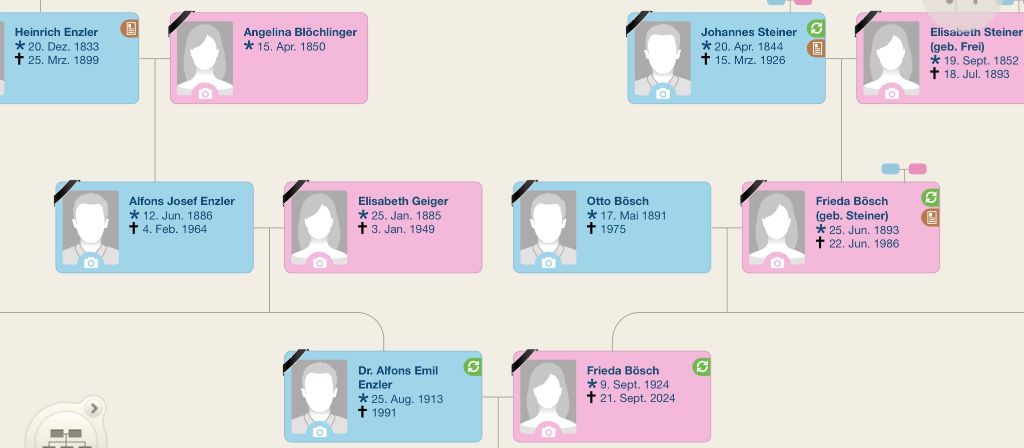
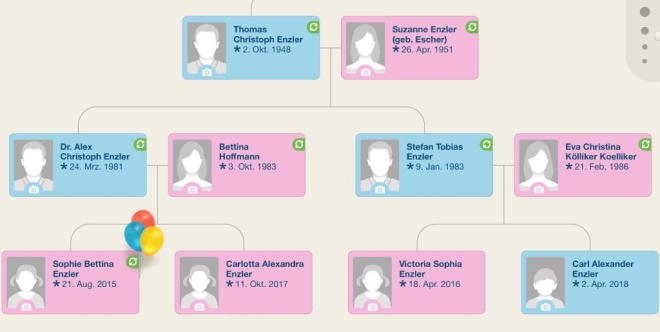
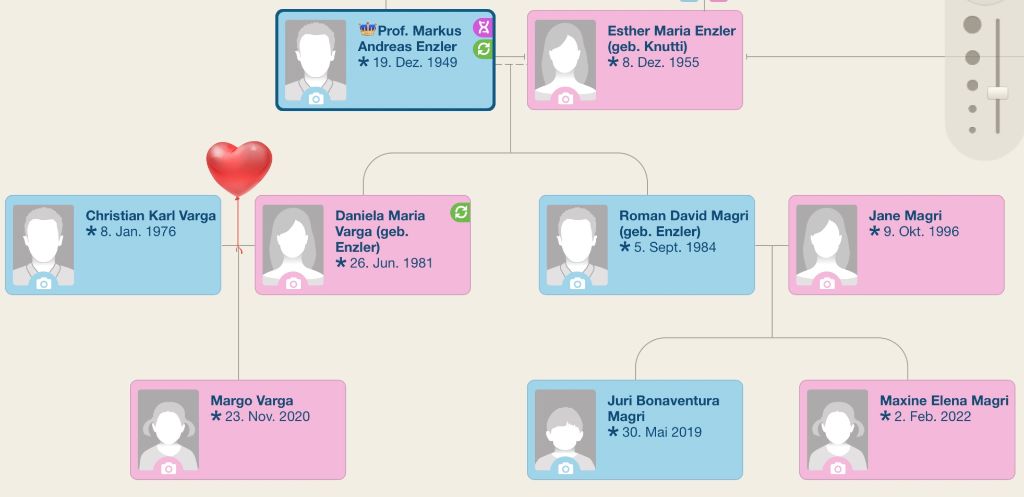
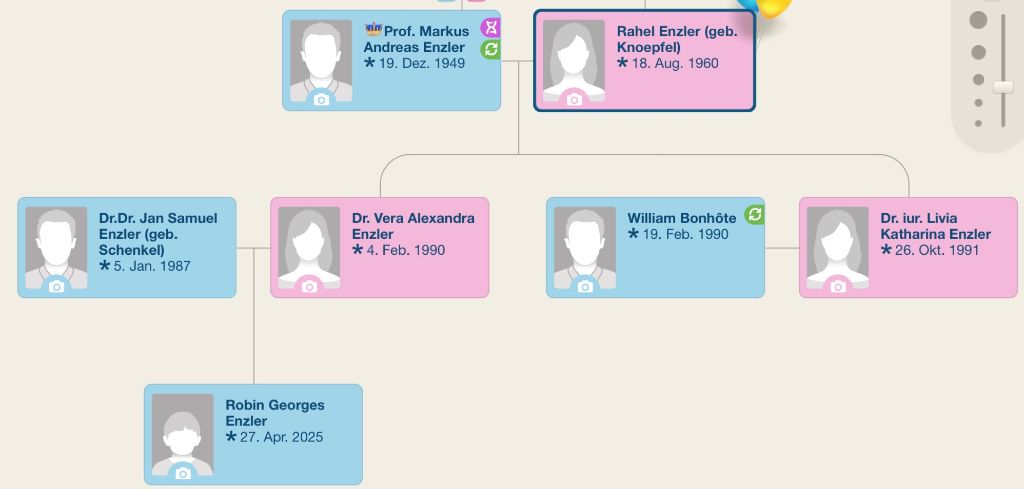
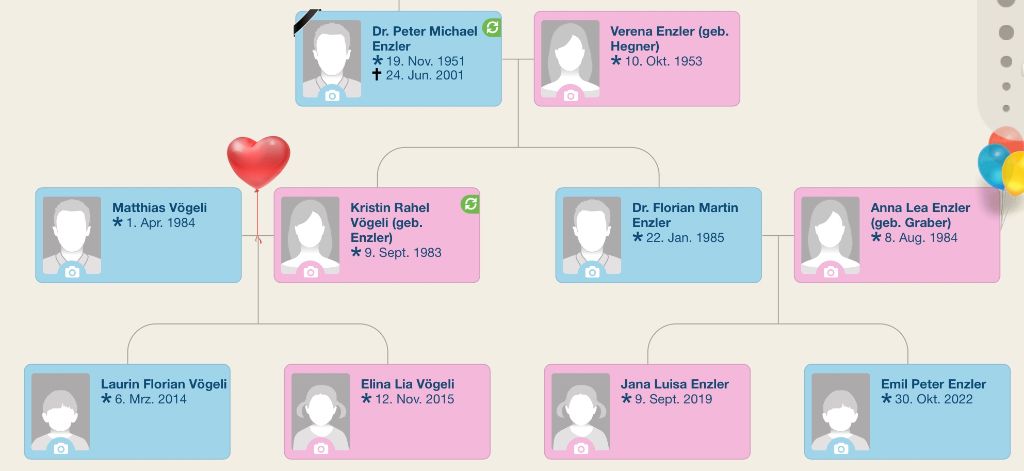
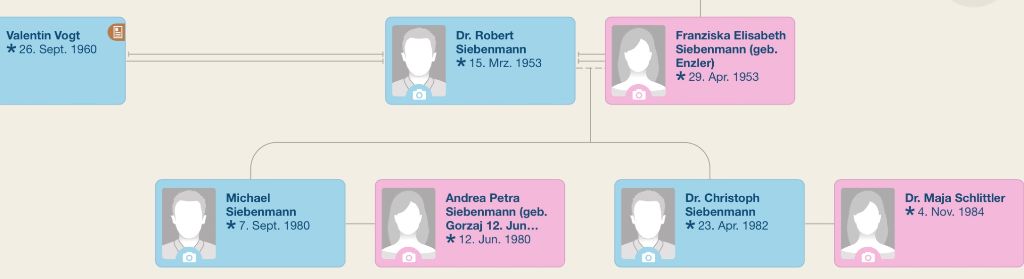
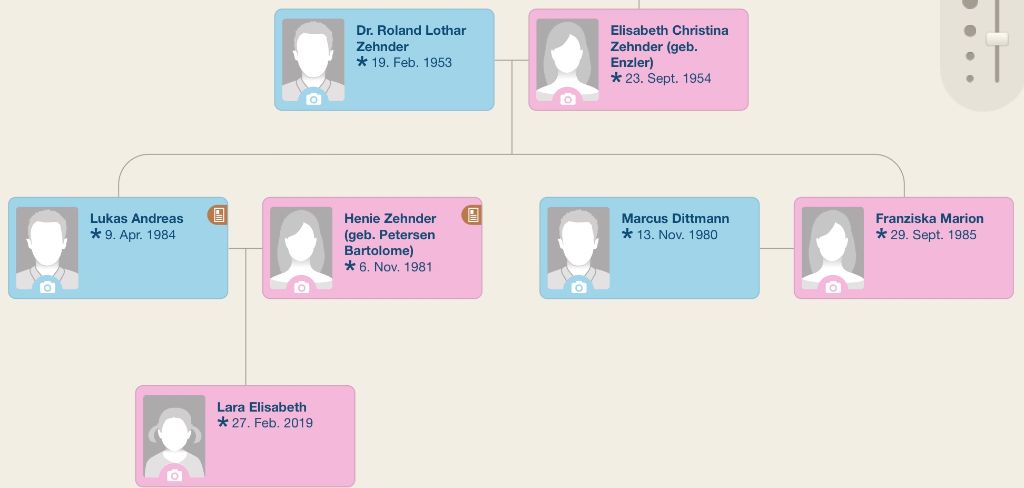

Der Witwer kam gerne nach Lachen zu Besuch, meistens mit der Haushälterin Anneli, die wir auch alle lieb hatten. Beide genossen die Küche von Mama Friedel. Mehrmals verbrachten wir Kinder Ferien in Altstätten, meistens zu zweit. Am häufigsten waren meine Schwestern dort, denn Grosspapi war geradezu vernarrt in sie, vor allem die strohblonde Franziska hatte es ihm angetan. Ich war allein oder mit einem der Brüder in Altstätten in den Ferien. Manchmal spielte Grosspapi Klavier und sang dazu, beispielsweise das Appenzeller Landsgemeindelied "Alles Leben strömt aus Dir...".
Regelmässig gingen wir mit Grosspapi wandern, am häufigsten auf den nahen Berg St. Anton. Nach Google Maps dauert der Aufstieg gute zwei Stunden, aber wir benötigten wahrscheinlich wesentlich mehr Zeit. Grosspapi musste manchmal mahnen und lockte mit einem kleinen Täfelchen Nestrovit. Das war eine vitaminhaltige, schokoladeartige Süssspeise von Nestlé. Ich liebte Nestrovit und beschleunigte meine Schritte im Hinblick auf die fragwürdige Delikatesse, auch wenn diese sehr sparsam abgegeben wurde: ein bis zwei kleine Täfelchen für über 600 Höhenmeter! Weitere Ausflüge führten etwa nach Heiden, von wo man einen schönen Ausblick über den Bodensee genoss. Über die wenige Kilometer entfernte Grenze nach Österreich gingen wir wohl nie, geschweige denn nach Deutschland.
"Grossvati" Otto Bösch, 1891 als Sohn eines Kleinbauern in Nesslau geboren, studierte in Burgdorf und Winterthur und wurde Bauingenieur. Über verwandtschaftliche Beziehungen trat er in die Baufirma Eberhard in Basel ein und übernahm sie später. Die Übergabe an seinen Sohn Hansruedi misslang, und so wurde Eberhard und Bösch an den Konkurrenten Musfeld verkauft. Das Geschäft muss einmal einen erheblichen Wert gehabt haben, aber zum Zeitpunkt des Verkaufs war die Baukonjunktur schlecht und die Firma etwas heruntergewirtschaftet. Man erhielt als Kaufpreis etwa den Wert der Liegenschaften.
Im Alter konzentrierte sich Otto auf sein lebenslängliches Hobby, die Wildtier-Jagd. Er hatte ein Jagdrevier beim im benachbarten Deutschland gelegenen Weil am Rhein und ein weiteres in den Bergen bei Gargellen in Österreich.
Gerne ging ich mit Grossvater auf Baustellen. Er präsentierte seine Enkel Freunden und Untergebenen mit einigem Stolz. Später als Mittelschüler durfte ich während der Ferien in seiner Firma arbeiten. Beispielsweise gab ich an Lastwagenfahrer Bestätigungen für abgeladenen Kies aus, oder ich bemalte Bretter für die Absperrung von Baustellen mit roter und weisser Farbe. Am liebsten sprayte ich "Eberhard & Bösch, Bauunternehmung" mittels einer Schablone in Schwarz auf die Bretter.
Manchmal durfte ich mit Grossvati nach Deutschland auf die Jagd. Meistens wurden die Tiere nur beobachtet, vielleicht wollte er mir die Tötung eines Tieres ersparen.
Als mein Bruder Thomas sich mit Suzanne verlobte auf dem Sitz "Morgensonne" in Feldbach, erlitt Grossvati einen Schüttelfrost. Das war wohl die erste Manifestation eines Tumorleidens, das ihm 1975 den Tod brachte. Ich war auf einer langen Reise mit "Encounter Overland". Als ich unangekündigt eines Morgens nach Lachen zurückkehrte, war niemand zu Hause. Unser Nachbar Hugo Meyer sagte mir, die Eltern seien zur Beerdigung von Grossvati nach Basel gereist. Ich könne sein Auto benützen, um die Abdankung vielleicht noch zu erreichen. Ich zog mich um und fuhr los. Als ich in die Kapelle auf dem Friedhof Hörnli in Riehen trat, ging ein Raunen durch die Gesellschaft.
In bester Erinnerung bleibt mir das profunde Wissen des Grossvaters. Er las viel, Fachliteratur, Belletristik, über Politik, und oft auch im 24-bändigen Meyers Lexikon. In der Familie hatte er den Ruf, schlicht alles zu wissen.
"Grossmutti" Bösch, 1893 in Wattwil geboren als Frieda Steiner, besuchte als Mädchen vermutlich die Sekundarschule und später ein Institut zum Studium der italienischen Sprache in Lugano. Das mag mit der Tätigkeit ihres Vaters als Weinhändler zu tun gehabt haben. Sie heiratete und hatte drei Kinder. Sie galt bei ihren Töchtern als etwas schlicht und bieder. Wenn ich in den Ferien in Basel weilte - manchmal allein, manchmal mit Thomas - ging sie gerne mit uns spazieren, am häufigsten durch die nahe gelegene "Wolfsschlucht" zum Bruderholz und zum Wasserturm. Manchmal lud sie uns in die Stadt ein. Nach dem Einkauf durfte man im Café Spielmann ein Getränk und eine Süssigkeit bestellen. Das Schönste dort war aber die Aussicht auf den Rhein und die darauf fahrenden Lastschiffe. Auch die Fähren faszinierten mich, die ohne Antrieb an einem quer über den Fluss gespannten Seil durch die Strömung angetrieben hin und her fuhren (Gierfähre nach Hendrick Heuck, 1657).
Als Kindergärtner oder junger Schüler durfte ich einmal mit Grossmutti in die Herbstferien nach Gargellen. Sie residierte wie schon in vergangenen Jahren im Hotel Madrisa, einem präsentablen Holzbau vom Ende des 19. Jahrhunderts. Die Jagd ihres Gatten lag in den Bergen, nicht weit entfernt, aber doch Stunden zu Fuss. Er tauchte nie im Hotel auf. Grossmutti wollte täglich Spaziergänge unternehmen. Ich hatte weniger Spass daran und ermüdete rasch. Ob die Müdigkeit nur vorgeschützt war, kann ich nicht sagen. Ich erhielt aber den Ruf, nicht besonders leistungsfähig zu sein. Später stellte mein Papa an meinem Herzen ein abnormales Rauschen fest. Wir konsultierten Fachleute wie Prof. Konrad Meyer in Männedorf oder Prof. Åke Senning am Universitätsspital Zürich. Eine klare Diagnose kam nicht heraus. Dank der Echokardiographie weiss ich heute, dass die Mitralklappe eine leichte Insuffizienz (Undichtigkeit) aufweist. Vielleicht war dies der Grund für das Geräusch.
Als Grossmutti alt und gebrechlich war, entschied die Familie, sie im Alters- und Pflegeheim Engelhof in Altendorf SZ unterzubringen. Dort starb sie auch. Sie wurde auf dem Friedhof Hörnli neben ihrem Gatten zur Ruhe gebettet.



Nur 10 Jahre davor, zu ihrem 90. Geburtstag, hat Mami ihre Familie zu einer Flusskreuzfahrt eingeladen. Mit von der Partie waren ihre noch lebenden vier Kinder mit Gattinnen und Gatten, Verena als Witwe von Peter sowie Gotte Gret.
Von Basel, wo Mami aufgewachsen war, ging es in einem sehr komfortablen Passagierschiff mit gutem kulinarischem Angebot den Rhein hinunter bis Koblenz, und von dort die Mosel hinauf bis Trier.
Mami erfreute sich damals, wie schon im ganzen Leben davor, einer vorzüglichen Gesundheit. Eigentlich hatte sie wenig dafür unternommen. Ihr Leben kannte zwar keine Exzesse, sie hat auch nie geraucht. Sport zu treiben, wäre ihr aber kaum in den Sinn gekommen. Ein paar bescheidene Fahrversuche auf Skiern sind das einzige, woran ich mich in diesem Zusammenhang erinnere. Im Tertianum nahm sie jahrelang an Turnstunden teil.
Geboren 1924 in Olten zog sie mit ihren Eltern Otto Bösch und Frieda, geborene Steiner, mit dem um zwei Jahre älteren Bruder Hans-Rudolf und der zwei Jahre jüngeren Schwester Margrit etwa 1927 nach Basel.
Vater Otto, Jahrgang 1891, war ein armer Bauernsohn von Nesslau im Toggenburg. Er war aber gescheit, fleissig und ehrgeizig, und hatte eine "gute Partie" geheiratet. Seine Braut hiess Frieda Steiner, war mit Jahrgang 1893 zwei Jahre jünger, und stammte aus einer traditionsreichen Weinhandlung im stattlichen Haus "Scheftenau" bei Wattwil.
Otto wurde Bauingenieur und nahm damals seine Tätigkeit bei der Baufirma Eberhard in Basel auf. Die verwitwete Inhaberin wurde "Tante Eberhard" genannt, den Grad der Verwandtschaft kenne ich aber nicht. Otto avancierte zum Chef und Teilhaber und später zum Alleininhaber. Den doppelten Firmennamen Eberhard & Bösch behielt er trotzdem bei.
Die Familie kaufte ein für die damalige Zeit typisches, neu erstelltes Reihenhaus an der Brunnmattstrasse 14 im Gundeldinger-Quartier in Basel für etwa 30'000 Franken. Meine Grosseltern waren fleissig, rechtschaffen, mässig religiös, aber konservativ und entschieden gegen soziale Experimente. Der zunehmende Wohlstand änderte nichts an der anerzogenen Bescheidenheit und Sparsamkeit. Die Rolle der Kinder war klar durch ihr Geschlecht definiert. Der Sohn würde einmal das Baugeschäft übernehmen, Friedel würde ihre Mutter Frieda im Haushalt unterstützen und Gret konnte sich im Geschäft nützlich machen. Ein Hochschulstudium lag für die Töchter ausserhalb des Vorstellbaren. Männer wollten ohnehin keine „studierten Weiber“, davon war mein Grossvater überzeugt, und seine Frau war wohl gleicher Meinung.
Unserem zukünftigen Mami war also die damals typische Frauenrolle zugedacht. Ein wenig Bildung, Kompetenz im Haushalt und schliesslich eine solide Heirat.
Friedel war kaum rebellisch, und trotzdem hatte sie eigene Pläne und meldete sich auf eigene Faust an für eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester.
Friedel war eine hübsche Frau und machte in ihrer weissen Uniform am Frauenspital gewiss eine gute Figur. Einige der jungen Ärzte interessierten sich für sie. Das Rennen machte aber unser nachmaliger Papi Alfons. Friedel war von seinem Aussehen und von seinem Charme lebenslang angetan, auch wenn sie manchmal gekränkt wurde, sei es durch mangelnde Empathie ihres Gatten ihr gegenüber oder durch Schwärmereien für andere Frauen, die fast eine Konstante waren im Leben unserer Eltern.
Das Ehepaar bezog seine erste Wohnung an der Kannenfeldstrasse in Basel. Dort kam Thomas zur Welt. Es folgte ein Umzug nach Walenstadt, wo die Familie eine Wohnung im vierten Stock bezog.
Schon 1950 zogen Enzlers weiter nach Lachen. Dort wurde die schöne und grosszügige Wohnung direkt am Lachner Hafen, wo heute das Hotel Marina steht, unser geliebtes Heim. Anno 1960 bauten die Eltern ein eigenes Einfamilienhaus an der Sonnenhofstrasse 24.
In den sechs Jahren von 1948 bis 1954 gebar Friedel ein Kind nach dem anderen. Später betonte sie, dass die Zahl von fünf Kindern schon zu Beginn ihrer Ehe angepeilt war. Die Kadenz der Geburten mag aber doch mit der damaligen Familienplanung zu tun haben. Ovulationhemmer waren noch nicht im Handel, und Rom lehnte ohnehin fast alle Methoden der Schwangerschaftsverhütung ab. Ausgenommen war die Methode nach Knaus-Ogino. Ich glaube mich zu erinnern, dass Mami nach deren Empfehlung täglich ihre Körpertemperatur mass und tabellarisch erfasste, um die fruchtbaren Tage zu erkennen. Die Methode war notorisch unzuverlässig und wurde deshalb von Freigeistern als "Vatikanisches Roulette" verhöhnt.
In jener Zeit verschaffte sich Mami einen Lernfahrausweis und absolvierte die nötigen Fahrstunden. Nach bestandener Prüfung fuhr sie einmal allein von Lachen zu einer Bank in Siebnen. Ob es dabei besondere Vorkommnisse gab, weiss ich nicht. Fakt ist, dass sich Mami danach jahrzehntelang nicht mehr ans Lenkrad setzte. Ihr Fahrausweis blieb aber gültig.
Anno 1960 bezog die Familie das Haus an der Sonnenhofstrasse 24 in Lachen. Einige Jahre später fand Mami, dass Autofahren doch ganz nützlich sein könnte. Sie belegte etwa 80 Stunden beim ortsansässigen Fahrlehrer Charly Kaiser, konnte sich aber nicht von ihm emanzipieren. Eines Tages beschwor ich sie, unter meiner Aufsicht eine Fahrt zu unternehmen. Wir gelangten aber nur bis zur 50 Meter entfernten Einmündung unserer Sonnenhofstrasse in die Neuheimstrasse an der Ecke unseres Gartens. Mami blieb mitten auf der Kreuzung stehen und stieg aus. Dabei hatte ich mich durchaus bemüht, sie einfühlsam zu unterstützen. Wiederum blieb es bei dieser einzigen Fahrt.
Mami blieb auch lange nach dem Tod von Papi im Haus an der Sonnenhofstrasse wohnen. Haus und Garten mitsamt Schwimmbad hielt sie in bester Ordnung und erledigte ihre Einkäufe zu Fuss. Sie hatte die Absicht, so lange wie möglich im Haus zu bleiben, obwohl sie es als viel zu gross empfand. Als sich allerdings 2004 die Möglichkeit ergab, in der neu erstellten Altersresidenz Huob in Pfäffikon eine sehr attraktive Wohnung zu mieten, in unmittelbarer Nachbarschaft zu ihrer Schwester Gret, zog sie nach Pfäffikon. Sie beide haben diesen Schritt nie bereut.
Nun frage ich mich, was für ein Mensch unser Mami war, und die Antwort fällt mir gar nicht leicht. Sicher war ihr wichtigstes Ziel, die Familie und den Gatten glücklich zu sehen. Auch Gäste mochte sie und kochte gerne für sie. Dabei musste sie mit der Spontaneität von Alfons zurechtkommen, der sie nicht selten mit Überraschungsgästen überfiel.
Uns Kindern gegenüber war sie einfühlsam und stand stets auf unserer Seite, wenn es Konflikte gab mit Kameraden oder sogar mit Lehrern. Sie erzählte uns beim Zubettgehen Märchen oder las vor, und sprach mit uns Nachtgebete.
Was ich an Mama vielleicht vermisste, waren Abwägen zwischen Standpunkten und verlässliches Urteilen. Sie war leicht beeinflussbar und konnte unerwartet ihre Meinung ändern. Ein "Fels in der Brandung" konnte sie für ihre Kinder - zumindest für mich - nicht sein. Dessen ungeachtet fühlte ich mich von Mami stets wohl behütet und war oft glücklich in ihrer Nähe.
Am 9. September 2024, feierten wir mit Mami ihren 100. Geburtstag in ihrem Pflegezimmer im Tertianum Huob in Pfäffikon. Anwesend waren meine beiden Schwester Ika und Lisa, deren Gatte Roland und meine Tochter Livia. Später kamen die langjährige Haushalthilfe Lisbeth und ihr Gatte Heiri Flüeler hinzu. Das Personal war sehr zuvorkommend. Direktor Peter erschien mit etwa einem Dutzend Mitarbeitern, und alle gemeinsam sangen "happy birthday".
Es war eine fröhliche Runde. Mami fand aber keinen Gefallen am Champagner und würgte den einen Schluck mit Mühe hinunter. Trotz ihrer Demenz überraschte sie uns mit ein paar ganz "träfen" Sprüchen. Ich erzählte, dass ihre anwesende Enkelin Livia in einer Woche eine Stelle beim EDA im Bundeshaus antrete, und fragte, ob sie wisse, wo das Bundeshaus stehe. Da fuhr sie mich an: "Jo klar, z' Bern, ich bi jo nöd depped".
Im Gespräch mit unseren Gästen kamen natürlich Erinnerungen zur Sprache, die meine allzu dürftige Beschreibung von Mami sinnvoll ergänzen. Franziska sprach neulich mit Mami darüber, dass sie sich am Abend, bevor Papi heimkam, jeweils frisiert und die Lippen geschminkt habe, nicht selten habe sie sich auch frisch angezogen. Ja, antwortete Mami, er sei ja ein toller Mann gewesen, und sie habe ihn eben geliebt.
Lisbeth, geborene Rust erzählte von ihrer ersten Lehrstelle im Haushalt der reichen Familie Straub in Zug. Der Lohn und die Behandlung seien in Ordnung gewesen, aber überall schien Geiz durch. Bei Gästen sei bekannt gewesen, dass man bei einer Einladung zum Essen nicht satt wurde. Zwei von drei Kindern der Familie Straub haben tragischerweise den Freitod gewählt, nähere Umstände entziehen sich aber meiner Kenntnis. Während ihrer Tätigkeit in Zug wurde Lisbeth von ihrer Schwägerin auf ein Inserat unserer Familie in der frommen Zeitschrift "Ancilla" hingewiesen. Lisbeth wagte einen Anruf und war von Mami sofort angetan. Sie verliess ihre Stelle unverzüglich und kam zu uns nach Lachen. Jetzt sagte sie, bei uns habe sie sich immer respektiert und sehr wohl gefühlt. Sie betrachtete ihre Anstellung nach eigenen Worten als ein grosses Glück. Gerührt war sie auch von der Rede von Papi bei ihrer Hochzeit mit Heiri, die von Respekt und Zuneigung zeugte.
Nach Mamis Tod schrieb uns Elisabeth:
"Mami war sehr mit sich im Reinen und bereit. Sie sagte vor ihrem Geburtstag, dass es schön sei von ihren Kindern und so vielen Menschen geliebt zu werden. Ich danke euch, ihr habt mir Familie und Heimat gegeben und mich zu dem Menschen gemacht der ich bin".
Dass Mami "ä Liebi" sei, haben mir befreundete Damen schon als Kind versichert, was ich stets nur bestätigen konnte. Die gleiche Eigenschaft wurde ihr auch von mehreren Kindern aus der Nachbarschaft zugebilligt, als wir sie ein halbes Jahr nach dem Leidmahl für Mami zum Essen auf die Johannisburg einluden.
In der Nacht auf den 21. September wollte uns das Personal des Tertianums mitteilen, dass Mami gestorben war, doch niemand war erreichbar. Am Morgen erreichte mich eine E-Mail des betreuenden Arztes Dr. Jürg Ebner, der Mami seit seiner Kindheit kannte. Er hatte um 02:05 Uhr den Tod festgestellt. Er kondolierte den Hinterbliebenen. Franziska und ich begaben uns ans Totenbett, Thomas war auf Kreuzfahrt in Neuengland und Lisa auf Reisen in Cornwall. Am 16. Oktober wurde die Urne im Beisein der Familie ins Grab des schon 33 Jahre früher verstorbenen Gatten Alfons auf dem Friedhof in Lachen gelegt. Pfarrer Thomas Kölliker gestaltete die Abdankungsfeier in der Kapelle im Ried neben dem Friedhof, wie schon ein knappes Jahr vorher für Gotte Gret in Riehen. Einmal mehr beeindruckte der Pfarrer, der mit meinem Bruder Thomas verschwägert ist, die Anwesenden mit seinem fundierten Wissen und seiner exzellenten Rhetorik. Nach der Feier ging die Familie ins Hotel Marina, sozusagen zurück zur Stätte meiner Jugend, zum Apéro und zum Abendessen.


Papa hat schon in der Jugend den Wunsch verspürt, Medizin zu studieren. Ganz ohne Einflussnahme kam ihm der Gedanke wohl nicht. Mein Grossvater väterlicherseits, Alfons Josef Enzler, Jahrgang 1886, war in zweiter oder dritter Generation Tuchhändler und hatte einen Kleiderladen in der Marktgasse von Altstätten unter den Arkaden, die dort "Schöpfen" genannt werden. Als mein Vater und sein jüngerer Bruder Oskar heranwuchsen, erwarb Grossvater Alfons ein Einfamilienhaus im Chalet-Stil an der Spitalstrasse in Altstätten. Damals fiel natürlich jedes vorbeifahrende Auto auf, ganz besonders aber das Cabriolet des Dr. Hildebrand. Dies war ein stattlicher Herr, der regelmässig mit hochgeschlagenem Mantelkragen und breitkrempigem Hut am Wohnhaus an der Spitalstrasse vorbei fuhr zu seiner Arbeit als chirurgischer Chefarzt am nahegelegenen Spital Altstätten. Grosspapi brachte seine Bewunderung deutlich zum Ausdruck und förderte Papis Wunsch, dem Dr. Hildebrand nachzueifern. Grosspapi war gerne bereit, ein Studium zu finanzieren. Andererseits wollte er sein Textilgeschäft in der eigenen Familie behalten. Aber dafür wurde der jüngere Sohn Oskar auserkoren. Papa Alfons war nämlich der bessere Schüler als sein Bruder, und so wurde rasch klar, dass er ein Gymnasium besuchen sollte und konnte. Nach einigen Abklärungen fiel die Wahl auf das Internat "Kollegium Maria Hilf" in Schwyz. Diese Institution war damals im Besitz der Bistümer von Chur, Basel und St. Gallen. Zu letzterem gehörte auch Altstätten.
Papi kam also ins Internat und wurde zu einem fleissigen und erfolgreichen Schüler. Später studierte er Medizin in Fribourg und Zürich. In Paris, Berlin und Wien wurden die damals beliebten "Auslandsemester" absolviert. Berlin stand bereits voll im Banne der Nationalsozialisten. Papi räumte ein, dass das stramme Regime auch ihn nicht unbeeindruckt gelassen habe.
Während des Studiums famulierte Papi mindestens einmal im Spital Altstätten. Grosspapi stolzierte mit geschwellter Brust durchs Städtchen. Sein Hochgefühl wurde allerdings zunehmend getrübt durch die Erkrankung seiner Frau Elisabeth, geborene Geiger, an Multipler Sklerose. Sie wurde von ihrem Gatten, meinem Grossvater, geduldig und engagiert gepflegt. Nach langen Jahren des Leidens und zunehmender Einschränkungen verstarb sie ein paar Monate vor meiner Geburt im Sommer 1949.
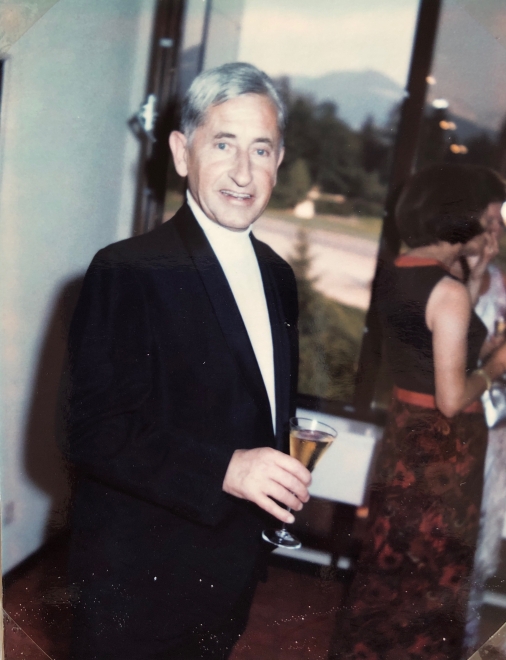


Am 19. Dezember erblickte der Schreibende das Licht der Welt. Darüber wurde bereits berichtet.
Die Ausschreibung der Chefarztstelle am Spital Lachen kam vielleicht früher als erhofft, aber Papa fand den Ort und das kleine Spital anziehend, hat sich beworben und die Stelle auch erhalten. Stellenantritt war Anfang 1951. So zog das junge Paar bereits nach zwei Jahren Walenstadt mit den Söhnen Thomas und Markus weiter nach Lachen.
Das Spital Lachen war ein stattlicher Bau mit tiefgezogenem Walmdach und Lukarnen von Anfang des 20. Jahrhunderts, umgeben von einem kleinen Park. Es verfügte über 40 oder 50 Betten, überwiegend in damals üblichen grösseren Krankensälen, zwei Operationssäle, ein Gipszimmer und eine Kapelle. Betrieben wurde es auf ärztlicher Seite von meinem Vater als Chefarzt, unterstützt von anfänglich nur zwei Assistenten. Der Aufgabenbereich des Chefarztes umfasste neben Chirurgie auch Gynäkologie und Geburtshilfe, auch Röntgenbilder mussten befundet und Probleme der Inneren Medizin behandelt werden. Für die zuletzt genannten Gebiete wurden auswärtige Fachkollegen bedarfsweise herangezogen, wahrscheinlich für ein paar Stunden pro Woche. Konsiliarius für Innere Medizin war lange Jahre der Chefarzt für Innere Medizin des Spitals Männedorf, Prof. Konrad Meier.
Die Krankenpflege oblag den Ordensschwestern des Klosters Ingenbohl. Dieser Orden umfasste damals noch tausende von ausgebildeten Krankenschwestern, die unter anderem auch im Kantonsspital Zug, im Spital Uznach oder im St. Claraspital Basel die pflegerische Hauptarbeit leisteten.
Eine der Ordensfrauen war Schwester Hugo (sic!), welche für die kaufmännische Leitung zuständig war. Sie muss ihre Arbeit gut gemacht haben, denn ihr wurde später die Verwaltung des viel bedeutenderen St. Claraspitals in Basel anvertraut.
Papi bekleidete seine Stelle während eines Vierteljahrhunderts, von 1950 bis 1975. In dieser langen Zeit erfolgten zwei Erweiterungsbauten, ein eher kleiner in den Fünfzigern, und ein stattlicher in den Sechziger Jahren, der die Zahl der Krankenbetten auf etwa 130 ansteigen liess. Bei der zweiten Erweiterung wurde die Abteilung für Innere Medizin verselbstständigt unter Dr. Armin Mäder, später auch die Gynäkologie unter Dr. Enrico Maroni.
Papa war stets bemüht, sich weiterzubilden. Noch in den frühen Sechziger Jahren vollendete er seine Ausbildung in Gynäkologie und Geburtshilfe mit einem längeren Aufenthalt an der Gynäkologischen Universitätsklinik in Frankfurt unter Prof. Otto Käser, einem Freund aus Basler Zeiten. Dadurch erhielt Papa neben seinem ersten Facharzttitel für Chirurgie seinen zweiten für Gynäkologie und Geburtshilfe.
In der Unfall-Chirurgie wurde Papa zu einem Pionier der Marknagelung. Gerhard Küntscher hatte in den Fünfzigern in Kiel eine Methode zur Behandlung gebrochener Röhrenknochen, v.a. am Unterschenkel und Oberschenkel entwickelt. Durch Aufbohren der Markhöhle vom oberen Ende her - beim Schienbein unter der Kniescheibe, beim Oberschenkelknochen an der Hüfte - werden Bohrer in die Markhöhle eingeführt und deren Durchmesser erweitert. Dann folgt die Einführung eines etwa fingerdicken hohlen Nagels, der die Bruchstücke auffädelt und stabilisiert. Im Idealfall ist eine sofortige Belastung möglich, und der Knochen verfestigt sich innerhalb von Wochen. Diese Marknagelung mit Aufbohren der Markhöhle wurde am Spital Lachen früher durchgeführt als in jedem anderen Schweizer Spital - anfänglich in Anwesenheit Gerhard Küntschers. Dieser, geniale, aber auch etwas kuriose Mensch wurde zum Freund der Familie und verbrachte einige Aufenthalte bei uns am See. Er liebte es, im See oder im Meer zu schwimmen, auch im tiefsten Winter.
Weitere innovative Operationsmethoden, die Papa Enzler früh einführte, waren die Hüftprothetik oder die transvaginale Hysterektomie, also die Entfernung der erkrankten Gebärmutter durch die Scheide.
Nach 25 Jahren Tätigkeit, erst 63-jährig, beendete Papa seine ärztliche Tätigkeit. Er erhielt viel Lob von Patienten und Behörden, hatte aber auch Kritiker wegen seines etwas aus der Mode gekommenen patriarchalischen Führungsstils. Immerhin blieben ihm viele ehemalige Assistenten Zeit seines Lebens in Freundschaft verbunden, beispielsweise Toni Ebner, der nach seiner Ausbildung in Lachen einige Jahre in Afrika ärztlich tätig war und danach eine Hausarztpraxis in Pfäffikon SZ betrieb, oder sein Nachfolger als Chefarzt Klaus Lüthold, jetzt Pensionär in Pfäffikon.

Aus der Mitgift von Mami erhielt Papi einen Flügel der Marke Blüthner. In den Sechziger Jahren wurde er durch einen Steinway & Sons mit 210 cm Länge ersetzt. Zeitlebens spielte Alfons Klavier, auch oder gerade dann, wenn ihn der Beruf besonders forderte. Er betrachtete die Musik als Ablenkung und Kraftquelle. Seine grosse Stärke war das Fantasieren und Improvisieren. Er konnte endlos Melodie an Melodie reihen, bereits komponierte, aber auch imaginierte. Dabei konnte er leicht von einer Tonart zur anderen übergehen. Gerne spielte er auch vor Publikum. Wenn die Eltern Gäste erwarteten, sass er am Flügel. Wenn es klingelte, ging Mami zur Türe und begrüsste die Gäste. Papi tat, als hätte er nichts bemerkt, bis die Gäste neben ihm standen. Dann zeigte er sich jeweils überrascht und erhob sich, um die Gäste zu begrüssen.
Einmal verpflichtete sich Papi, ein Benefizkonzert im Namen des von ihm mitbegründeten Rotary Clubs Zürich-Obersee zu geben. Dazu wählte er die Sonate Nr. 12 in As-Dur von Ludwig von Beethoven. Das war auch für ihn ein "harter Brocken", aber der Anlass wurde zu einem schönen Erfolg.
Abgesehen von der Musik war Papi an Literatur interessiert. In seinem Spektrum nahm die politische Literatur vielleicht die grösste Rolle ein. Zeitweise fand er aber grosse Freude an Klassikern.
Nur eine kurze Episode nahmen Papis Versuche als Kunstmaler ein. Die Bilder gerieten ziemlich Abstrakt, obwohl dies gar nicht beabsichtigt war. Phantasievoll erhielt ein Werk nachträglich den Titel "Franziska im Mohnfeld".

Unser Vater war ein oft charmanter, ja charismatischer und überwiegend extrovertierter Mann. Er konnte aber seinen Mitmenschen, auch den Familienmitgliedern gegenüber, durchaus sehr kritisch sein, manchmal auch hart und verletzend. Er stellte hohe Anforderungen an sich, aber auch an seine Kinder. "Sechs ist die beste Note" war eine oft geäusserte Ermahnung. Dass diese Skala nicht überall galt, für uns nur am Gymnasium in Schwyz und an den Universitäten Genf und Zürich, sei am Rande bemerkt. In der Primarschule in Lachen und am Jesuiteninternat in Feldkirch war die Eins die beste Note.
Ich hatte das Glück, meistens gute Schulnoten zu erzielen. Nicht zuletzt deshalb genoss ich einen gewissen Respekt. Manchmal empfanden meine Geschwister, dass Papi mich und die viertgeborene Schwester Franziska am liebsten hatte und manchmal privilegiert behandelte.
Mit Kleinkindern wusste unser Papa nicht viel anzufangen. Ich erinnere mich an eine mehrfach gehörte Äusserung: Wenn ihr älter seid, können wir auch miteinander reden. Vielleicht ist es diesem Umstand geschuldet, dass ich im Umgang mit Kleinkindern wohl auch nicht besonders geschickt bin. Immerhin war es zu meinen Zeiten als Vater kleiner Kinder eine Selbstverständlichkeit, etwa eine Sandburg zu bauen oder Windeln zu wechseln.
Papa war stolz auf seine Familie. Nicht zuletzt deshalb nahm er das eine oder andere Kind manchmal zur sonntäglichen Visite mit ins Spital. An Weihnachten ging die ganze Familie zur Weihnachtsfeier in die Spitalkapelle.
Als sich abzeichnete, dass ich Medizin studieren werde, nahm meine Nähe zum Spital weiter zu. Schon im zweiten oder dritten Studienjahr bekam ich in den sommerlichen Semesterferien eine Stelle zur Unterstützung des Sekretariats. Ich schrieb Arztberichte, welche leitende Ärzte diktiert hatten.
Beide Eltern hatten Sinn für schöne Kleider und pflegten sich bis ins Alter einwandfrei. Papi war eher eitler als Mami. Er liess sich gern fotografieren, unter anderem professionell im Studio Marianne in Rapperswil. Dabei gab es auch Bilder mit Hut von Borsalino und mit einer Zigarette der Marke Parisienne. Sie gehörte zum schweizerischen Burrus-Konzern und wurde eigentlich eher von Arbeitern geraucht als von Akademikern.

Die Besuche erfolgten meistens am Sonntag, meistens schien - so die Erinnerung - auch die Sonne, sonst wären die Besucher wohl gar nicht angereist. Dazu kam das festliche Geläut der ganz nah gelegenen barocken Pfarrkirche. Glanzvolle, harmonische Bilder sind zurückgeblieben.
Dramen kamen natürlich auch vor. Einmal verschluckte sich unsere Ika an einem zu grossen Bissen von Speck. Sie bekam schwere Atemnot und wurde bereits blau im Gesicht. Da krümmte Papi seinen rechten Zeigefinger, führte ihn tief in Ikas Rachen und förderte das Corpus Delicti unverzüglich zutage. Seine lange Erfahrung als Geburtshelfer mag ihm dabei geholfen haben.
Nicht selten kamen Würdenträger zu Besuch, Vertreter der Gemeinde, des Bezirks March oder Mitglieder der Spitalkommission. Ein besonders respektierter Gast war Benno Gut, damals Abt von Einsiedeln. Ein Schaudern überkommt mich und meine Geschwister bei der Erinnerung, wie wir damals reihum seinen Siegelring küssen "durften". Abt Benno wurde später zum Kardinal gekürt und in den Vatikan beordert.
Einmal jährlich pilgerten ganze Schulklassen von Lachen und den umliegenden Gemeinden in etwa 4 Stunden zu Fuss nach Einsiedeln und besuchten Gottesdienste in der prächtigen barocken Klosterkirche der Benediktinerabtei.
Die meisten Festivitäten in Lachen spielten sich an der Seepromenade ab, also direkt vor unserem Haus. Die Kirchmesse, "Chilbi" genannt, war ein besonderes Fest, oder die Gastspiele des Zirkus Knie oder kleinerer Zirkusse - direkt neben unserem Haus.

Innerhalb von 6 Jahren, von 1948 bis 1954, hat meine Mutter fünf Kinder geboren. Nach Mamis Aussagen hatten sich die Eltern schon früh auf fünf Kinder geeinigt. Aber womöglich hätten sie sich dafür gerne etwas mehr Zeit gelassen.
Die unregelmässigen Arbeits- und Essenszeiten unseres Vaters wurden problemlos vom Haushalt bewältigt. Ich erinnere mich, dass Papa nicht selten vom Spital anrief und kurzfristig einen Gast, meistens einen ärztlichen Kollegen, zum Essen anmeldete.Das Verhältnis zwischen uns Kindern war im Grossen und Ganzen harmonisch und unproblematisch. Die grossen Buben liebten die kleinen Schwestern und halfen wo nötig. Freilich gab es auch Eifersüchteleien, manchmal auch Wutausbrüche. Franziska bekam einen ganz roten Kopf, wenn sie wütend war, und dann ging man am besten in Deckung. Einmal stiess sie den Bruder Peter von der Seepromenade in Wasser. Er konnte noch nicht schwimmen. Die Haushälterin von Grosspapi, Anneli Niederer, sprang ins Wasser und rettete ihn, zusammen mit zwei Hobbyfischern, die gerade ihr Boot zurecht machten.
Auch handfeste Raufereien zwischen den Buben waren keine Seltenheit. Ich war dem älteren Bruder Thomas kräftemässig unterlegen, auch der jüngere wurde schliesslich grösser und stärker als ich. Das mag der Grund sein, dass ich bei Auseinandersetzungen schon früh eine versöhnliche Haltung eingenommen habe, zuerst in meiner Familie, später auch in der Politik. Diese wurden am Familientisch nicht selten kontrovers diskutiert. Der Lohn für meinen häuslichen Pazifismus war die Aussage meiner Schwestern, ich sei der umgänglichste, vielleicht sogar der Liebste unter uns Brüdern.


Gret ist 1926 in Olten geboren, ihre Eltern zogen aber schon ein Jahr später nach Basel. An der Brunnmattstrasse 14 verbrachte sie etwa 75 Jahre im Hause ihrer Eltern, sie wohnte dort weit über deren Tod hinaus. Anno 2004 zog sie nach Pfäffikon, wo sie neben ihrer Schwester, unserem Mami, eine schöne Attikawohnung in der Altersresidenz Tertianum mietete, bis zu ihrem Tod am 28. November 2023. Im Wesentlichen hat Gret also nur zwei Wohnsitze gekannt. Am 20. Dezember 2023 wurde ihre Urne im Friedhof Hörnli in Basel beigesetzt. Pfarrer Dr. Thomas Kölliker, Schwiegervater meines Neffen Stefan Enzler, gestaltete die Feier. Der begabte Redner zog die 26 Zuhörer in seinen Bann mit einer empathischen Schilderung von Grets Leben. Im Anschluss gingen wir zum Leidmahl in der Brasserie des Trois Rois an der Mittleren Rheinbrücke.
Mein Pate war Fritz Schwyter, ein praktischer Arzt in Siebnen, einer Nachbargemeinde von Lachen. Er war ein Studienfreund meines Vaters und überwies aus seiner Praxis in Siebnen Patienten ans Spital von Vater Alfons. Ich sah meinen "Götti" Fritz nur selten. Mit dem Fahrrad fuhr ich ein paarmal nach Siebnen und begleitete ihn in seinem VW Käfer auf Patientenbesuchen ins gebirgige Wägital.


Das Verhältnis von Friedel und Pia war unproblematisch, kollegial könnte man es nennen. Standesdünkel gab es keine. Alle zusammen unternahmen mit Kinderwagen Spaziergänge am See, bis zum Lachner Horn, oder später in die nahen Berge, etwa zum Bräggerhof oder sogar bis zum Stöcklichrüz.
In den vielen Jahren in unserem Haushalt lernte Pia den einen oder anderen Mann kennen. An einem Bewerber aus Ungarn fand mein Vater keinen Gefallen und machte kein Hehl daraus. Schliesslich kam der italienischstämmige Edi Maldini aus Dietikon. Er arbeitete unter anderem als Lastwagenfahrer. Einmal nahm er mich auf dem Beifahrersitz eines grossen Fiat-Lastwagens mit auf einem Transport in die Westschweiz. Einmal durfte ich in einem Kajak mitfahren. Pia und Edi haben geheiratet und ein oder zwei Kinder gehabt. Später haben sie sich scheiden lassen.
Pias Nachfolgerin Kristel Kürpick stammte ebenfalls aus Deutschland, aus der Gegend von Cuxhaven. Sie kam auch gut aus mit unserer Familie und blieb etliche Jahre. Gerne hätte sie einen Mann gehabt, aber in Lachen hat es nicht geklappt. Schliesslich lernte sie über ein Inserat einen nach Kanada ausgewanderten Deutschen kennen. Der brauchte vielleicht auch eine Frau für seinen Betrieb. Kristel ging auf gut Glück nach Kanada und heiratete. Was später aus ihr geworden ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Die nächste Kraft im Haushalt war wohl Renate Schneider, ebenfalls aus Deutschland. Sie hatte etwas Gediegenes an sich, blieb aber wohl weniger lang als ihre Vorgängerinnen. Sie heiratete einen in Lachen wohnhaften Deutschen und übernahm seinen Familiennamen Fässer.
Dann kamen Priska Gadient aus Flums, Gaby Berther aus Rueras im Vorderrheintal und Verena Hasler. Alle Mädchen erfüllten die Erwartungen, aber damals war ich schon im Internat und hatte daher keine nähere Beziehung zu ihnen. Erwähnenswert scheint mir der frühe Tod der zweifachen Mutter Verena Hasler an einem Krebsleiden.
Im Rückblick die wichtigste Rolle als Hausangestellte spielte Lisbeth Rust, eine Bauerntochter von Walchwil am Zugerberg. Sie hatte dunkle Haare und breite Backenknochen. Sie selber scherzte, dass diese Merkmale von einem slawischen oder mongolischen Vorfahren aus dem russischen Heer des Generals Suworow stammten. Dieses war im Jahre 1799 im Rahmen der napoleonischen Kriege durchs schwyzerische Muotatal gezogen. Seine Truppen sollen einige genetische Spuren hinterlassen haben.
Die Bedeutung von Lisbeth zeigte sich schon, als wir noch Studenten waren. Sie erwies sich als vielseitig interessiert und intelligent und erstaunte uns nicht selten durch Kenntnisse und praktische Fähigkeiten. Nachdem Mami anno 2004 vom langjährigen Familiensitz an der Sonnenhofstrasse in Lachen in die Altersresidenz Tertianum Huob in Pfäffikon gezogen war, kam Lisbeth weiterhin wöchentlich zu Besuch, brachte frische Blumen und erledigte Besorgungen. Den gleichen Service erhielt Gotte Gret bis zu ihrem Tod 2023. Sie hat Lisbeth sicher stets grosszügig entschädigt. Zusätzlich haben ihr beide Damen aus Dankbarkeit je einen sechsstelligen Betrag testamentarisch vermacht. Die Dankbarkeit und Zuneigung rührte auch daher, dass Lisbeth manche Beschwerden heilen konnte, manchmal sogar via Telefon.

Später wurde der Keller von einem Apotheker namens Mettler, Vorgänger der Apothekerfamilie Bruhin, übernommen und mit einer Art Villa überbaut. Die zum Garten offene U-förmige Symmetrie des Baus und zwei Türmchen zeigten das Streben nach Prestige. Der im Norden des Hauses gelegene Garten war umgeben von einer dichten Hecke als Sichtschutz.
Als ich einjährig war, bezog unsere Familie die von uns allen geliebte Wohnung. Zwischen Haus und Hafen lag nur eine wenig befahrene Strasse, die vor allem zum Flanieren genutzt wurde. Wohn- und Esszimmer waren grosszügig bemessen und nach Westen zum See hin ausgerichtet. Sie boten einen herrlichen Ausblick zum Hafen und zum Zürcher Obersee. Jenseits des Sees sah man die etwa 4 km entfernte Stadt Rapperswil mit Schloss und Kirche. Bei gutem Wetter konnte man über See und Bergen prachtvolle Sonnenuntergänge beobachten.
Östlich vom Wohn- und Esszimmer, dem See abgewandt, lag südseitig der Korridor mit der Haustür. Von hier führte eine lange Treppe der südlichen Hauswand entlang hinunter zur Seestrasse. Noch weiter östlich befanden sich ein Badezimmer und ein Kinderzimmer. Noch weiter vom See entfernt folgten das Elternzimmer, die Küche und unser Spielzimmer. Beide Schlafzimmer und das Spielzimmer hatten Fenster zu einem grossen Garten, der nördlich vom Gebäude lag.
Im Kinder-Schlafzimmer wurde es beim dritten oder vierten Kind zu eng. Für die beiden "grossen" Buben wurde nun vom Vermieter im oberen Stock ein weiteres Zimmer zur Verfügung gestellt, das einst seine Söhne bewohnt hatten. Sie waren aber beide verheiratet und ausgezogen. Dieses Zimmer lag direkt über unserem Esszimmer in einem quadratischen Turm und bot die gleiche wunderbare Aussicht wie das Wohn- und das Esszimmer. Allerdings war es völlig schmucklos. Thomas und ich hatten je ein Bett und vielleicht je einen Stuhl, an weitere Möbel oder an Bilder kann ich mich nicht erinnern.
Am liebsten hielt ich mich im Wohnzimmer auf. Es war am schönsten eingerichtet, hatte die tolle Aussicht, und ich fühlte mich wohl und frei darin. In unserem Spielzimmer waren wir dagegen oft eingesperrt. Wir haben uns oft gestritten und verprügelt. Da mein älterer Bruder Thomas mir kräftemässig überlegen war, waren die Kämpfe wenig ausgewogen und endeten in der Regel mit meiner Kapitulation.
Manche unserer Spielzeuge haben wir böswillig zerstört. So waren die einzigen Spielsachen, die uns dauerhaft blieben, grobe Bauklötze aus Holz.
Die nicht seltene Haft im Spielzimmer muss auch unserem Vermieter aufgefallen sein. Herr Fry befreite mich mehr als einmal durch das Fenster und liess mich in den Garten, der uns damals riesig vorkam und voller Rätsel war.
Regelmässig erklang Kirchengeläut von der knapp zweihundert Meter entfernten barocken, katholischen Pfarrkirche, Damals genoss ich den Pomp einer Messe, besonders an hohen Feiertagen, mit goldenen Messgewändern, Gesängen und Weihrauch. Danach, oft über den ganzen Tag und bis in die Nacht, spazierten Familien, Gruppen von Jugendlichen und Liebespaare dem See entlang. Es war wie im Kino. Nur durch ein Haus getrennt, in dem ein Fotograf namens Eugen Albrecht wohnte und arbeitete, lag das Hotel Ochsen mit einem etwas düsteren Restaurant. Davor befand sich eine Gartenwirtschaft im Schatten von Platanen. Sie war im Sommer oft gut besucht. Nicht selten spielte hier eine Ländlerkapelle unter Leitung des bekannten Volksmusikers Hugo Bigi.

Unsere Küche war eher klein. Sie bot Platz für einen elektrischen Herd mit drei oder vier Platten, zwei Schränke für Geschirr und Küchenbedarf sowie einen kleinen Tisch, an dem man eng zu viert sitzen konnte.
Hinter dem Kochherd befand sich eine Speisekammer mit Regalen, auf denen Vorräte lagerten. Hier befand sich auch der kleine Kühlschrank der Marke Sibir.
Über dem Herd gab es eine Ablage aus drei parallelen Eisenstangen zur Aufbewahrung von Pfannen. Jeweils im Herbst wurden aus eigenen oder gekauften Früchten verschiedene Konfitüren eingekocht.
Gerne erinnere ich mich an die Quitten aus dem eigenen Garten. Der einzige Quittenbaum war so schräg, dass man mit Hilfe eines Erwachsenen dem Stamm entlang aufrecht zur Baumkrone gehen konnte. Die steinhart geernteten Früchte musste man mehr als eine Stunde lang kochen. Danach wurden sie in ein Tuch aus Gaze gefüllt - ich glaube, man verwendete dazu Windeln. Die Ecken der Gaze wurden danach über dem Herd an einer Holzkelle festgebunden, die quer über den erwähnten Eisenstangen lag. Danach tropfte stundenlang gefilterter Saft mit Gelierzucker in die auf dem Herd stehende Pfanne. Das Resultat war das von uns heiss begehrte Quittengelee.

Gleich hinter dem Ochsenloch und hinter unserem Garten wohnte die alte Witwe Odermatt, die oft gelangweilt, aber gutmütig aus dem Fenster schaute und uns Kindern gelegentlich Süssigkeiten zuwarf. Daran reihte sich ein altes Mehrfamilienhaus mit der Familie Geiges im vierten Stock. Sie hatte drei Buben, die alle begabt waren. Über "Daniel Düsentrieb" werde ich im Zusammenhang mit dem Bau eines Modellflugzeugs berichten. Er studierte an der ETH und wurde Ingenieur. Dessen jüngerer Bruder hatte es auch dick hinter den Ohren. Er verfügte über technische und ökonomische Fähigkeiten. Damit engagierte er sich für das lybische Atombombenprojekt. Er wurde dabei straffällig und später gerichtlich verurteilt. Ein Haus weiter nördlich, im zweiten Stock, wohnte Familie Knobel, die im Parterre eine Papeterie betrieb. Vater Emil Knobel handelte auch mit Grafik, beispielsweise mit Stichen aus der Region, und machte sich einen Namen als Maler und Fotograf von Gebäuden und Landschaften. Seine Tochter Marianne war im Kindergarten meine erste Liebe. Es entstand aber keine Beziehung. Und doch lud ich sie später zum Maturaball nach Schwyz ein. Ich bin nicht sicher, ob wir uns je richtig geküsst haben, noch intimer wurden wir bestimmt nicht.
Im nächsten Haus weiter nördlich befand sich die Apotheke. Sie war von einem Dr. Mettler gegründet worden, der auch unser Wohnhaus am See auf den Fundamenten eines Bier- und Eiskellers gebaut hatte. Jetzt gehörte die Apotheke Dr. Josef Bruhin. Die Familie wohnte in den oberen Stockwerken. Der älteste Sohn Herbert wurde der nächste Apotheker nach Josef. Heute ist das Geschäft in den Händen von Thomas Bruhin, dem Sohn von Herbert. Josef Bruhins Tochter Hedwig war Lehrerin. Die Jüngste, Elisabeth, war kinderlieb und hütete uns ab und zu. Sie wurde später Ärztin und arbeitete unter anderem bei Papi am Bezirksspital Lachen.
Weiter nördlich folgte ein kleines Haus, in dem Familie Meier mit Tochter Esther wohnte. Man sagte, die Leute seien "Stündeler", gehörten wohl einer Freikirche an. Niemand wusste das genau, aber für uns Kinder war es Grund genug, die rechtschaffenen Leute zu ärgern, indem wir vor ihrem Fenster Faxen machten.
Unter Meiers Wohnung befand sich der Coiffeursolon von Georg Schweizer, der allen Kindern von Enzlers die Haare schnitt.
In einem weiteren alten Haus ohne Zentralheizung, etwa im dritten oder vierten Stock, wohnte Familie Solenthaler. Sie lebte sehr bescheiden und hatte eine behinderte Tochter namens Elisabeth, sowie den Sohn Toni. Von Toni durfte ich mein erstes Paar Ski übernehmen, die für mich viel zu lang waren.
Nordwärts folgte die Spenglerei Bühler, wo wir gelegentlich den Arbeiten zuschauen durften.
Bei den Familien Geiges und Solenthaler ging ich nach Lust uns Laune ein und aus, auch bei Albert und Ida Fry, den Besitzern unseres Hauses. Überall fühlte ich mich willkommen. Elisabeth Bruhin brachte uns manchal von der Strasse in die Wohnung ihrer Eltern oder in die Apotheke, wo es Interessantes zu sehen gab, beispielsweise Blutegel.
Bruhins besassen zwei fast baugleiche Badehäuschen an der Zürcherstrasse, jedes mit einem Garten von einigen Hundert Quadratmetern. Eines davon konnten meine Eltern später mieten. Es verfügte über eine gedeckte Terrasse von vielleicht 2 x 6 m, eine Art Wohnzimmer in der gleichen Breite, dahinter eine kleine Kochstelle mit Schränken sowie ein WC und wahrscheinlich eine Dusche. Der Mietzins betrug - unter Freunden - 1000 Franken im Jahr.


Gotte Gret hat mir einmal eine Puppe geschenkt, die selbstständig gehen konnte. Ihr Antrieb war ein kugelförmiges Gewicht, das mit einer feinen Schnur von vielleicht 50 cm Länge am Bauch der Puppe befestigt war. Man stellte die Puppe auf einen Tisch und liess die Kugel an der Schnur über die Tischkante baumeln. Unter ihrem sanften Zug bewegten sich die Beinchen abwechselnd um eine kurze Strecke, und die Puppe lief fast wie ein Mensch.
In den Ferien in Basel kam jemand auf die Idee, Wasser durch feine, transparente Schläuche von einem Gefäss in ein anderes herabfliessen zu lassen. Durch Anhebung des zuerst tiefer gestellten Gefässes konnte der Fluss umgekehrt werden. Wir fügten weitere Gefässe und Verbindungen hinzu und bildeten ein ganzes Netzwerk. Auch dieses Spiel konnte mich lange zufriedenstellen.
Mannschaftssport war weniger mein Ding. Fussball war mir wohl zu aggressiv. Am ehesten passte mir Völkerball. Bei diesem Spiel konnte ich wohl eher durch Ausweichen punkten als durch heroische Kämpfe um den Ball. Im Internat und im Militär wurde abends häufig gejasst. Dem konnte oder wollte ich mich zwar nicht entziehen, wurde aber dabei nie zu einer treibenden Kraft.
Meine Freizeit verbrachte ich mehrheitlich mit Klassenkameraden wie Andreas Betschart, Seppli Bochsler, Walti Bruhin, Sepp Kuster, und manchmal mit dem um ein Jahr älteren Bruder Thomas und seinen Freunden wie Röbi Spieser oder René Casagrande.
Am Hafen gab es immer etwas zu beobachten. Einige Frauen wuschen ihre Wäsche am See. Es gab aber kein Waschhaus, wie mancherorts in Italien. Die Wäscherinnen knieten auf einer steinernen Rampe, die zum Ein- und Auswassern von Booten diente, und mussten sich tief zum Wasser hinunter bücken. Manchmal legte gerade ein Fischer an und entlud seinen Fang. Das war ein Fest für die Möwen und für neugierige Buben. Regelmässig landeten auch Kursschiffe, was uns gleichermassen faszinierte. Der eine oder andere Bootsbesitzer reparierte etwas an seinem Boot. Interessant zu beobachten war der Betrieb Bootsverleih der Firma Kalchofner auf einem Floss im Hafen. Die Firma betrieb einen Kilometer weiter nördlich eine kleine Werft, wo auch unser Ruderboot mit einem 10 PS-Aussenborder und dem Namen "Gret" gebaut wurde.
Noch weiter nördlich befindet sich die Mündung der "Wägitaler Aa", eines etwa 10 m breiten Baches, der etwa einen Kilometer vom Dorfzentrum entfernt in den Zürichsee fliesst. Das Mündungsgebiet ist zum Teil bewaldet und ufernah von Schilf bewachsen. Man findet dort auch ein paar idyllische Sandstrände. Das Horn war ein beliebtes Versteck von jungen Liebespaaren. Eigene einschlägige Erfahrungen kann ich allerdings nicht vorweisen.
Gelegentlich bastelten wir im Freundeskreis, beispielsweise ein Floss mit vier grossen Heliomalt- Büchsen als Schwimmer. Das Vehikel war völlig instabil und damit unbrauchbar, weil die Fläche im Verhältnis zu den Schwimmern viel zu klein war.
Manchmal bauten wir Papierdrachen aus gekreuzten Schilfrohren und Seidenpapier und liessen sie im Wind steigen. Mehrmals kursierten Gerüchte, wonach man mit Utensilien aus dem Haushalt, worunter Pfeffer und Salz, Raketen herstellen könne, aber alle Versuche scheiterten.
Damals waren die Maikäfer noch gefürchtete Schädlinge. Mindestens einmal beteiligten wir uns an einer Aktion, bei der wir getötete Maikäfer gegen etwas Geld bei der Gemeinde abgeben konnten.
Einmal hatte Papi einen Bastelsatz der Firma Graupner für ein Modell des britischen Flugzeugs Mew Gull aus dem Jahre 1934 gekauft. Es zu bauen, hat uns im Alter von knapp zehn Jahren bei weitem überfordert. Auch Papi war keine grosse Hilfe. Da engagierte er einen schon älteren Buben aus der Nachbarschaft, Daniel Geiges, den wir wegen seines Wissens und Geschicks "Daniel Düsentrieb" nannten. Düsentrieb gelang der Bau des Flugzeugs und auch der Jungfernflug. Das Leben der Mew Gull war aber von kurzer Dauer und endete mit einer Bruchlandung.
In den Herbstferien der 5. Klasse wurde ich jäh aus dem Kreis meiner Mitschüler fortgerissen, wie an anderer Stelle berichtet.

Religiöse Themen spielten im Kindergarten eine grosse Rolle. Man sprach von der Notwendigkeit von Missionen und von "armen Negerchindli", deren Seelen und Körper gerettet werden mussten. Regelmässig wurde Geld gesammelt für Afrika, beispielsweise für die Mission in Lambarene mit dem Spital des legendären Albert Schweitzer. Im Schulzimmer stand ein "Kässeli" mit dem Kopf eines dunkelhäutigen Kindes, der zum Dank nickte, wenn man eine Münze einwarf.
Im Kindergarten wurde viel gespielt und gesungen. Edburga schlug dazu den Takt auf einem Tamburin. Wenn die Klasse einen Spaziergang unternahm, beispielsweise zur Kapelle im Ried, in deren Nähe jetzt unsere Eltern begraben sind, ging man in Zweierkolonnen, paarweise Hand in Hand.
Standort des Kindergartens war das Alte Schulhaus, direkt neben der Pfarrkirche. Von unserer Wohnung am Hafen war es weniger als 200 m entfernt. Das Zimmer war geräumig, aber etwa düster.
In der ersten Klasse wechselten wir das Zimmer, aber nicht das Schulhaus. Die Lehrerin hiess nun Elisabeth, ebenfalls eine Ordensschwester aus Menzingen.
In der zweiten bis vierten Klasse wurden wir im Neuen Schulhaus unterrichtet, einem nüchternen, aber zweckmässigen Bau aus der Zwischenkriegszeit. Ab jetzt waren wir nach Geschlechtern getrennt. Die seeseitige Hälfte des Schulhauses, vom Hafen her betrachtet links, war den Mädchenklassen vorbehalten, wir Buben waren rechts untergebracht. Die Mädchen wurden weiterhin von Ordensschwestern unterrichtet. Wir Buben hatten Männer als Lehrer, die meisten mit eigenen Familien. In der zweiten und dritten Klasse war Emil Stamm unser Lehrer. Er galt als kompetent und eher streng. Im vierten Jahr kamen wir in die Klasse von Josef Hegner mit dem Übernamen "Maudi". Er war der erste Lehrer, der einigermassen sportlich war. Den Sportunterricht genossen wir im Sommer manchmal in der Badeanstalt am See, einfach "Badi" genannt. Dabei waren wir immer wieder fasziniert von der Tatsache, dass Maudi an jedem Fuss nur vier Zehen hatte.
In der fünften Klasse ging's zurück ins Alte Schulhaus bei der Kirche. Der Klassenlehrer war nun Marcel Stählin. Er galt als milde und unterhaltsam. Manchmal las er vor, etwa aus dem Buch "Peter und die Sieben Meere". Dieses Buch war 1899 von einer britischen Autorin Mary Lee unter dem Pseudonym "Kapitän Maryat" geschrieben worden. Es hatte nostalgischen Charme, spiegelte aber auch koloniale Perspektiven und Werte sowie das damals kaum hinterfragte europäische Überlegenheitsnarrativ.

Ich bekam von der Lehrerin ein- oder zweimal Tatzen. An die Ursache erinnere ich mich nicht, und ich fand es auch nicht schlimm. Tatzen gab es auch gelegentlich bei Emil Stamm oder Sepp Hegner. Am Gymnasium in Feldkirch war nur der Generalpräfekt Schnetzer befugt, mit Tatzen zu strafen. Die "normalen" Präfekten bestraften uns gelegentlich damit, dass wir am Abend im Schlafsall knien mussten, mit den Armen nach beiden Seiten ausgestreckt. Das wurde jeweils schon bald zur Qual. Wir liessen die Arme zur Erholung jedes Mal sinken, sobald der im Gebet vertieft hin- und hergehende Präfekt sich von uns Sündern weg bewegte. Die Gründe für die Strafen waren meistens banal, beispielsweise Schwatzen im Schlafsaal nach dem Lichterlöschen.
Die Zeugnisse bedeuteten für mich wenig Stress. In der Primarschule gab es überwiegend Einer, manchmal eine Eins-bis-Zwei. Auch solch erfreuliche Zeugnisse wurden von Papa mit der Aussage kommentiert "Eins ist die beste Note!"
In Schwyz war Sechs die beste Note. Papis Spruch wurde angepasst, aber ungerührt bei jedem Zeugnis wiederholt.
Thomas wurde manchmal wegen seiner Noten gedemütigt, was ihm lange zu schaffen gemacht hat. Peter hat die erste oder zweite propädeutische Prüfung verpatzt und musste ein Semester wiederholen. Der Kommentar von Papi: "Trauer ist in dieses Haus eingekehrt". Es konnte schon weh tun.

Der Gebrauch des Fernsehers wurde, auch als wir noch jung waren, recht liberal gehandhabt. Allerdings sendete das Schweizer Fernsehen nur wenige Stunden am Abend, die deutsche ARD vielleicht 10 Stunden pro Tag. Am späten Nachmittag wurden noch jahrelang ausgedehnte Vermisstmeldungen aus dem mehr als zehn Jahre zurückliegenden Zweiten Weltkrieg ausgestrahlt. Davor und danach gab es beliebte Fernsehserien. Unsere Lieblinge waren Serien über Haustiere. "Lassie" war ein Schottischer Schäferhund, der dank Geschick und Intelligenz mit seinen menschlichen Freunden spektakuläre Taten, ja Wunder vollbrachte und Leben rettete. Die Stute Fury war der Protagonist einer weiteren beliebten Kinderserie. Später am Abend durften wir zusammen mit den Eltern "Vater ist der Beste" schauen, später folgte "Mutter ist die Allerbeste". Die Serien waren amüsant und stets auch ein wenig erzieherisch, sie zeigten uns eine heile Welt.
Mein erster Gang ins Kino erfolgte wohl 1960. Im Kino an der Tellstrasse von Lachen wurde "Exodus" nach dem Roman von Leon Uris gezeigt. Die folgenden Jahre verbrachte ich überwiegend an den Internatsschulen in Feldkirch und Schwyz. Da wurden regelmässig Filme gezeigt, die natürlich erzieherische Ziele verfolgten, teils aber auch der Belustigung dienten. Ich erinnere mich an italienische Spielfilme wie "Fahrraddiebe", ein Werk des Neorealismus von Vittorio des Sica, "La Strada" von Federico Fellini mit Giulietta Masina und Anthony Quinn oder "Das fliegende Klassenzimmer" nach Erich Kästner.
In den Sechziger Jahren brachte Papi ein Kassettengerät von Philips, als er vom Deutschen Chirurgenkongresses in München zurückkam. Eines seiner Motive bestand darin, dass er sein Klavierspiel aufzeichnen wollte.
Später lieferte unser Radio- und TV-Spezialist Oberli aus Siebnen eine Stereoanlage von Bang und Olufsen. Eine zunehmend umfangreiche Sammlung von Schallplatten wurde in einem innen leicht modifizierten barocken "Zürcher Wellenschrank" untergebracht. Nach dem wöchentlichen ärztlichen "Staff Meeting" am Universitätsspital Zürich ging Papi regelmässig zu den Musikalienhändlern Jecklin oder Hug und kaufte neue Platten. Am Samstag oder Sonntag hörten Papi und ich zusammen die neuen Aufnahmen. Papi fragte mich jeweils nach meiner Meinung, was mir schmeichelte und auch lehrreich war. Ich war schon als Student sehr musikaffin, weshalb ich auch beim Medizinstudium oft Schallplatten hörte. Das fand Papi schlecht, aber er war ja meistens abwesend. Ziemlich daneben fand er, dass ich im Sommer ein paarmal auf einer Luftmatratze im Schwimmbad unseres Gartens Medizinbücher studierte, manchmal sogar unter den Klängen klassischer Musik. Nach dem Staatexamen mit guten und sehr guten Noten verstummte die Kritik.

Fast alle Festivitäten spielten sich in Lachen an der Seepromenade ab, also direkt vor unserem Haus. Die Chilbi (Kirchweih), war ein besonderes Fest, oder die Gastspiele des Zirkus Knie oder kleinerer Zirkusse - direkt neben unserem Haus.
Bei schönem Wetter promenierten die Leute vor dem Ochsen und unserem Haus dem See entlang. An Festtagen wie Ostern, Pfingsten oder Chilbi (Kirchweih) waren die Spaziergänger besonders zahlreich und herausgeputzt.
Zu den wichtigen Anlässen innerhalb der Familie gehörten Samichlaus (6. Dezember) und Heiligabend. Unser Samichlaus wurde von Emil Bösch inszeniert, einem Freund meiner Eltern aus Pfäffikon und Ingenieur bei der dortigen metallverarbeitenden Firma Verwo. Wir konnten ihn aber nicht erkennen. Der Schmutzli (Knecht Ruprecht) war vielleicht seine Frau Bethli, aber da bin ich mir nicht sicher.
Wir hatten grossen Respekt vor dem Samichlaus. Er kam nicht als gütiger Bischof im roten Kleid daher, sondern eher polternd in einem schwarzen Mantel mit Kapuze. Als wir die Eltern darauf ansprachen, dass bei anderen Kindern der Samichlaus rot bekleidet kam, insistierten sie, dass unserer der richtige sei. Angeblich kam er aus dem Schwarzwald und hatte seinen Esel vor dem Haus angebunden. Unser Samichlaus war streng und wurde nicht selten zur Disziplinierung unserer Rasselbande eingesetzt, auch ohne seine Anwesenheit.
Am Abend des 6. Dezember warteten wir jeweils mit bangem Herzen auf dessen Ankunft. Sein Auftritt war dann auch ziemlich laut und einschüchternd. Jedes Kind musste ein Gedicht aufsagen. Dann verlas der Samichlaus jedem einzeln die Leviten, manchmal gab es auch Lob. Zuletzt erhielt jedes einen Sack mit Mandarinen, Erdnüssen und Schokolade, aber nicht selten bekam man auch die Rute zu spüren.
Einmal steckte der Samichlaus oder der Schmutzli Thomas, unseren Ältesten, buchstäblich in seinen Sack aus grobem Gewebe, um ihn in den Schwarzwald mitzunehmen. Wir wussten bereits, dass man dort viel arbeiten musste und nur Suppe aus Tannennadeln zu essen bekam. Tatsächlich verliess der Samichlaus unser Haus mit dem geschulterten Sack. Immerhin kam er bald wieder zurück und entliess Thomas aus seinem Gefängnis.
An Weihnachten war dagegen die Vorfreude meist ungetrübt. Das Wohnzimmer blieb für uns Kinder einige Stunden lang gesperrt, weil das Christkind dort beschäftigt war. Wenn wir unbefugt eintraten, riskierten wir, dass es die Geschenke wieder mitnahm.
Wenn alles bereit war, erklang ein feines Silberglöckchen. Wir sangen Lieder, am Flügel begleitete uns Papi und spielte noch weitere weihnachtliche Melodien. Zudem wurden Gedichte aufgesagt. Dann war endlich der Weg frei für die Bescherung.
Dabei kam viel Begeisterung auf, manchmal gab es auch Enttäuschungen. Nach dem bunten Treiben unter dem Tannenbaum schritt die ganze Gesellschaft zum festlichen Abendessen.
In angenehmer Erinnerung bleibt meine Erstkommunion. Ich trug zum ersten Mal im Leben einen Anzug. Er bestand aus einem schwarz-weissen Tweed. Die Hosen waren "Knickerbocker", im Volksmund "Chegelfänger" genannt. Das sind etwa wadenlange Hosen mit weiten Beinen, die unter den Knien mit einem Gummiband zusammengerafft waren.
Ich war stolz auf meine Kleidung und bewunderte zudem die gleichaltrigen Mädchen in ihren weissen Kleidern.
Alle Erstkommunikanten hielten während der Zeremonie andächtig brennende Kerzen in ihren Händen. Danach gab es ein schönes Essen zu Hause, an dem auch die Grosseltern aus Basel und Gotte Gret teilnahmen.
Aus Altstätten waren Grosspapi mit seiner Haushälterin Anneli sowie Onkel Oskar mit Gattin Idy angereist. Oskar war der jüngere Bruder von Papi, und Tante Idy war meine Patin oder Gotte. Von ihr erhielt ich meine erste Armbanduhr. Deren Marke hiess Roamer, während Thomas von seiner Gotte eine Tissot-Uhr geschenkt bekommen hatte. Thomas fand Tissot viel toller, ich insgeheim wohl auch, behauptete aber das Gegenteil.

Mein Cousin Kurt kam im Alter von etwa zehn Jahren traurig ums Leben. Er war mit seinem anderen Cousin Peter Stadler, mit dem Fahrrad von Altstätten ins nahe gelegene "Riet" unterwegs. Die beiden machten Pause auf einer Brücke und schauten den Fischen zu. Ein vorbeifahrendes Auto erfasste beide. Kurt starb auf der Unfallstelle, Peter erlitt einen Oberschenkelbruch und wurde wieder gesund.
Kurt hatte eine zwei Jahre ältere Schwester, Brigitte, Jahrgang 1947. Sie war ein liebes und schönes Mädchen. Kein Wunder dass sowohl mein Bruder Thomas als auch ich in sie verliebt waren. Es gab auch ein paar Eifersuchtsszenen, zeitlich im Zusammenhang mit der Trauerfeier für unseren gemeinsamen Grossvater Alfons Enzler in Altstätten anno 1964. Brigitte war bestimmt an erwachseneren Männern interessiert. Sie liess es uns aber nicht spüren und gab sich Mühe, ihren Charme gerecht an Thomas und mich zu verteilen.
Brigitte hat später einen Mann aus Altstätten geheiratet, Elmar Koch, und zwei Kinder geboren, Bettina Maja und Didier. Bettina Maja erhielt entgegen aller Gepflogenheit zwei männliche Taufpaten - Thomas und Markus Enzler! Später distanzierte sich sich von ihrem ersten Vornamen und nennt sich bis heute nur Maja mit dem Familiennamen Werlen vom Ehemann Roger.
Die Ehe ihrer Eltern Brigitte und Elmar war unglücklich und wurde früh geschieden. Brigitte übernahm das Kleidergeschäft ihrer Eltern und gab ihm einen neuen Namen "Linea B" und eine neue Ausrichtung. Sie war stolz auf einige prominente Kundinnen. Die junge Bundesrätin Ruth Metzler gehörte dazu.
Eine dauerhaft befriedigende Beziehung hatte Brigitte vermutlich nie. Sie fand zeitweise Trost beim Reiten. Sie litt aber an Depressionen und war deswegen öfter und über längere Zeit hospitalisiert. Schliesslich nutzte sie eine Entlassung, um sich am folgenden Tag das Leben zu nehmen. Sie fuhr im Auto in die Nähe einer Brücke, die bei Oberriet die Autobahn N 13 überquert, liess das Auto stehen und stürzte sich von der Brücke auf die Fahrbahn. Andere Personen kamen zum Glück mit dem Schrecken davon.
Erst anlässlich der Trauerfeier erfuhren wir vom traurigen Schicksal von Brigittes letzten Jahren und von der Tragik ihres Todes. Ihre Kinder Maja und Didier habe ich seither nicht mehr getroffen.
Seltener waren Besuche von Mamis Bruder Hans Rudolf Bösch und seiner Familie. Er war verheiratet mit Ilse, geborene Jahreiss, aus Kronach DE. Das Ehepaar hatte vier Kinder, Susanne, Michèle, und Jahre später die Zwillinge Martin und Peter. Hans Rudolf ist 1994 verstorben, Ilse 2014. Mit den Kindern hatten wir wenig Kontakt. Die Geschwister Enzler und die Geschwister Bösch haben gemeinsam zwei Grundstücke geerbt. Das eine befindet sich in Muttenz und hat einen erheblichen Wert. Es ist für 50 Jahre an die Firma Iveco verpachtet. Das Grundstück "Heimets" in Seelisberg misst etwa 38'000 Quadratmeter, hat eine schöne Aussichtslage, ist aber steil und im Winter wenig besonnt. Grossvati Bösch hat es vor 50 Jahren teuer erstanden in der Erwartung, dass es als Bauland eingezont wird. Dies traf aber nicht ein. Fünfzig Jahre lang wurde es vom benachbarten Bauern Sepp Odermatt kostenlos gepachtet und bearbeitet. Im Frühjahr 2025 haben wir es an den Landwirt Werner Würsch aus Emmetten verkauft. Ich habe mich um den Verkauf gekümmert, und er hat über ein Jahr gedauert. Im Kontrast dazu steht der erzielte Preis von 40'000 Franken, ein Bruchteil des Kaufpreises vor 50 Jahren. Im Kanton Kanton Uri gilt für landwirtschaftliche Grundstücke ein Höchstpreis von etwa 1.50 Franken pro Quadratmeter, der aber bei vielen Handänderungen unterschritten wurde.
Am 21. März 2025 trafen mein Bruder Thomas und ich die Zwillinge Martin und Peter, gemeinsam mit dem Mittelsmann Werner Eugster, zu einem teuren Mittagessen in der Brasserie des Trois Rois in Basel. Dabei ging es vor allem um die gemeinsamen Grundstücke. Die Zwillinge machten auf Thomas und mich einen guten Eindruck. Martin ist Pfleger und Hobbybauer im Simmental, verheiratet mit einer Pflegerin, beide sind tätig bei Spitex. Das Ehepaar ist kinderlos geblieben. Peter ist geschieden und hat drei Kinder. Er ist Team-Leader bei Indorsia Pharmaceuticals.
Die Zwillinge pflegen untereinander regelmässigen Kontakt. Mit ihren Schwestern verkehren sie weniger, die Schwestern hingegen stehen einander nahe. Zum Zeitpunkt unseres Treffens in Basel waren die Schwestern gerade zusammen in Italien. Susi ist kinderlos und alleinstehend. Michèle wurde früh geschieden und ist alleinerziehende Mutter von drei Kindern.

Vor dem Eintritt in den Kindergarten wurden meine Brüder und ich mit so genannten "Basler Schößli" ausgestattet. Das war eine Einheitskleidung, wie sie in Basel damals bei Buben und Mädchen üblich war, ein hinten geknöpftes Mäntelchen aus weiss und blau oder weiss und rot kariertem Baumwollstoff mit kurzen Ärmeln. Darunter trug man ein Leibchen und Strumpfhosen.
Diese "Basler Schößli" waren für uns Buben ein Albtraum. Wir fühlten uns wie Ausserirdische. Unsere Eltern, besonders unser Basler Mami, fanden die Kleidchen "einfach herzig". Widerstand blieb lange erfolglos, wahrscheinlich bis zur Einschulung.
Im Sommer trugen wir Buben meist weisse Baumwollsocken, die Grossmutti in Basel gestrickt hatte. Die Gummibänder am oberen Ende waren oft zu eng und drückten im Laufe des Tages Furchen in unsere Unterschenkel. Damit verbunden war oft quälender Juckreiz.
Schlimmer als die Kniestrümpfe juckten die Winterstrümpfe aus Schafwolle. Sie stammten ebenfalls aus Grossmuttis Basler Strickstube. Sie reichten bis fast zu den Hüften, und zu ihrer Befestigung mussten wir eine Art Mieder tragen, bei uns "Gschtältli" genannt. Zwei Träger verliefen über die Schultern, eine Stoffbahn ging um Brust und Bauch und wurde am Rücken mit Häkchen und Ösen verschlossen. Auf jeder Seite des "Gschtältli" und oben an jedem Strumpf war ein Knopf befestigt. Die Knöpfe von Mieder und Strumpf wurden durch Gummibänder mit mehreren Knopflöchern verbunden. Die Wahl der verwendeten Knopflöcher änderte mit dem Wachstum.
Rückblickend bleibt es für mich ein Rätsel, weshalb meine Brüder und ich trotz einem gewissen Wohlstand und Verbindungen zur Stadt altmodischer gekleidet waren als viele Schulkameraden. Freilich hätte dies Anlass geben können, uns zu hänseln. Das kam aber kaum vor, vielleicht wegen des Respekts, den unserer Familie genoss, und unserer Umgänglichkeit.
A propos "herzig"! Alle drei Enzler-Brüder hatten grosse und stark abstehende Ohren, unsere deutschen Haushalthilfen nannten sie "Segelohren". Wir litten alle darunter. Einmal beauftragte mein Vater einen Maler namens Wyrsch, mich zu porträtieren. Während seiner Arbeit war Wyrsch sehr beeindruckt und sagte, meine Ohren seien unglaublich, so etwas habe er noch nie gesehen. Das war natürlich kein Balsam für meine Seele.
Eines Tages fuhren alle drei mit den Eltern zum Deutschen Chirurgenkongress in München. Wir trafen uns mit Fritz Leisinger, dem Chirurgen von Richterswil, und seiner Familie. Fritz - für uns ein Herr Doktor - zeigte Verständnis für unseren Wunsch, die Segelohren operieren zu lassen, und wir schöpften Hoffnung, die aber enttäuscht wurde. Die Eltern blieben stur bei ihrem Urteil "herzig"!
Am Gymnasium in Feldkirch habe ich durch nächtliches Tragen von Mützen oder mit Heftpflaster versucht, die Ohren anzulegen. Ob es geholfen hat, weiss ich nicht, aber im Lauf der Jugend haben sich die Ohren fast normalisiert, die Peinlichkeit war vorbei.
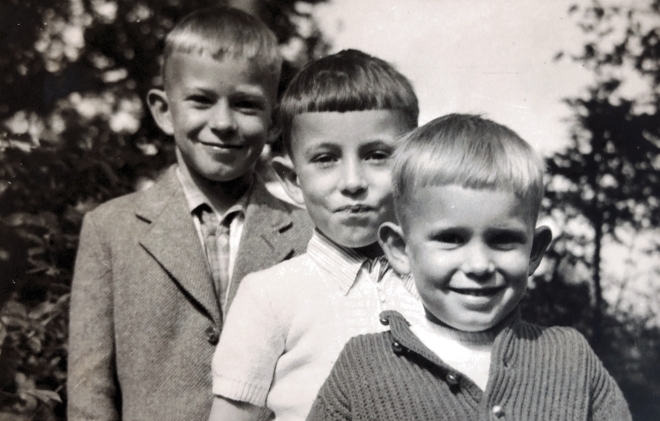

Mami war lebenslang stolz auf ihren Gatten und wohl lebenslang in ihn verliebt.
Mein Vater war in den frühen Jahren sicher auch verliebt. Später mag er schon mal ausgeschert sein, legte aber jederzeit Wert darauf, die Ehe fortzuführen und die Fassade zu wahren. Nicht selten kränkte er die Mutter, suchte aber nach Streitigkeiten wieder den Frieden. Wie bei vielen Ehen lag die Stärke nicht in Zärtlichkeit, sondern im Aushalten und Ausharren.
Rückblickend scheinen mir die persönlichen Beziehungen zwischen den Mitgliedern unserer Familie weniger intensiv als bei den meisten jungen Familien. Das lag vielleicht an der Dominanz und einer gewissen Unnahbarkeit von Papa. Hinzu kam seine starke berufliche Beanspruchung und demzufolge seltene Anwesenheit. Der frühe Weggang aller fünf Kinder in Internate dürfte weiter dazu beigetragen haben. Umso erfreulicher ist der enge Kontakt, den alle Geschwister mit Mami bis zu ihrem Tod gepflegt haben. Durchschnittlich kamen wohl etwa zwei Besuche pro Woche ins Tertianum. Zuletzt kam man am liebsten zu zweit, da Dialoge immer schwieriger wurden, insbesondere nach dem Tod von Gotte Gret.
Bei der Erziehung der Kinder war Papi der "Mann fürs Grobe". Mami hat uns nie körperlich bestraft. Sie drohte aber manchmal damit, es Papi zu sagen, wenn die Kinder allzu frech wurden. Das konnte damit enden, dass es Schläge gab. Sie wurden mit einem Teppichklopfer auf den Hintern verabreicht, manchmal mit einem Ledergürtel. Dabei hielt sich die Zahl der Schläge in Grenzen, nach meiner Erinnerung waren es etwa zehn. Thomas kam am häufigsten dran, aber auch nicht sehr oft, vielleicht zehn Mal insgesamt.
Ob die Mädchen je körperlich gezüchtigt wurden, kann ich nicht sagen.
Die Religion spielte in unserem Haushalt keine dominante Rolle. Papa war katholisch erzogen worden, und der Glaube war ihm keinesfalls gleichgültig. Er bedeutete für ihn eine lebenslange Suche nach Erkenntnis. Oft vertrat er unorthodoxe Ansichten. Er äusserte sie auch Klerikern gegenüber, etwa Abt Benno Gut von Einsiedeln, der späterer zum Kardinal wurde. Das konnte zu interessanten Diskussionen führen, die aber stets respektvoll geführt wurden. Besonders angezogen fühlte sich Papi von reformwilligen Kirchenvertretern, etwa vom in Tübingen lehrenden Hans Küng, ein Gegenpol zu seinem konservativen Kollegen Josef Ratzinger, dem nachmaligen Papst Benedikt XVI.
Politisch war man liberal und konservativ. Man glaubte an das Gute im Westen und das Böse im Osten, und fürchtete sich vor einem Krieg, der natürlich nur vom "Reich des Bösen" ausgehen konnte. So bezeichnete Ronald Reagan den Ostblock, und das war ganz im Sinne meiner Eltern.

Papa kaufte zunächst 1500, später weitere 1000 Quadratmeter zum Preis von etwa 30 Franken. Man wählte das Architekturbüro Müller. Max Müller zog damals traditionelle Architektur allen Modernismen vor und konnte meine Eltern dafür gewinnen. Die Bauzeit verlief fast ohne Probleme.
Im Herbst 1960 konnten wir das grosszügige Heim mit weitläufigem Garten, 10 Zimmern, mit breiten Balkonen und bald einmal einem Schwimmbad beziehen.
"Fast ohne Probleme" bedarf einer Erklärung: Wir Kinder interessierten uns für den Bau und dessen Fortschritt und gingen fast täglich zu Fuss vom See an die Sonnenhofstrasse. Eines Tages war ein grosses Tor für die beiden Garagenplätze montiert worden. Bruder Thomas und ich konnten der Versuchung nicht widerstehen, uns am oberen und unteren Ende des offenen Tores festzuhalten und zu schaukeln. Dabei riss eine grosse Feder des Öffnungsmechanismus und liess das Doppeltor niedersausen. Leider kam ich darunter zu liegen mit dem Gesicht auf den Boden gequetscht. Die Folge war eine Zertrümmerung meines Nasenbeins. Ich komme an anderer Stelle darauf zurück.


Zweimal durfte unsere Familie das Ferienhaus der Familie Leisinger in Davos benutzen. Fritz Leisinger war in Davos aufgewachsen und war jetzt Chefarzt am Spital Richterswil, in der gleichen Funktion wie Papi in Lachen. Beim ersten Mal handelte es sich um ein kleines, charmantes Holzhaus in Davos-Bünda. Zentralheizung gab es keine. Man feuerte den Herd in der Küche an, und über Luken gelangte ein wenig Wärme zu den Schlafzimmern. Leider konnte ich bei meinen späteren Besuchen in Davos das Haus nicht identifizieren. Vielleicht existiert es gar nicht mehr.
Das zweite Mal machten wir Ferien in einem von Leisinger neu erstandenen, grösseren Bauernhaus "In den Büelen" am Eingang zum Dischmatal. Papi verbrachte nur einen Teil der Zeit mit uns, weil seine Ferien stets einen Stellvertreter erforderten und zeitlich ziemlich beschränkt waren.
Leisingers hätten sich gefreut, uns als Nachbarn zu gewinnen. Zufällig stand bald ein Bauernhaus etwa 100 m weiter westlich zum Verkauf - für etwa 150000 Franken. Es war in schlechtem Zustand und Gülle schien vom Keller auf die Wiese zu fliessen. Der zweifellos aufwendige Umbau und die dezentrale Lage verunsicherten meine Eltern.
Als Alternative kam die Überbauung Solaria an der Dischmastrasse in Betracht. Papi wollte dem Erbauer Victor Müller eine der kleinen Einheiten abkaufen. Auf dem Grundbuchamt fragte der Beamte: "So, Herr Tokter, kaufend Sie au so nä Nuudlekischte?" Das verunsicherte Papa derart, dass er nicht unterschrieb und sich zurückzog.
Etwa 1964 wurde uns eine Wohnung im Hertihof angeboten, an der nordwestlichen Ecke der Kreuzung von Tal- und Hertistrasse. Sie hatte allerdings auch nur ein grosses Zimmer mit zwei Schrankbetten und einem Bettsofa. Dennoch kam es zum Kauf. Diese kleine Wohnung wurde einmal mit mindestens sieben Personen belegt, den drei Enzler-Buben, zusätzlich Carlo Gick, Felix Kordeuter, Roland Arman von meiner Schwyzer Gymnasialklasse und Markus Hofmann, der eine Klasse über uns ebenfalls das Gymnasium in Schwyz besuchte.
Die Wohnung war von vorneherein zu klein. Noch ein paar Jahre vergingen, dann kauften sie eine grössere Wohnung mit drei Zimmern. Sie befand sich an der Parkstrasse 2, in einem von der Zürcher Firma Uto erstellten achtstöckigen Bau im 1. Obergeschoss. Sie wurde zu einem Zentrum der Familie, vor allem der Kinder, zumal die Eltern nur selten gleichzeitig in Davos Ferien verbrachten. Später hatte Bruder Thomas mit Frau Suzanne und ihrer Mutter eine Wohnung in Klosters, Franziska mit ihrem damaligen Ehemann Robert eine Wohnung in Davos-Wolfgang, und wir kauften 2004 ein Domizil an der Skistrasse beim Bolgen. Die elterliche wurde noch bis etwa 2010 von Mami und Gotte Gret genutzt. Anfangs der Zwanziger Jahre wurde sie von unserer Schwester Elisabeth Zehnder übernommen. Kürzlich, im März 2025, hat Valentin, der Partner meiner Schwester Franziska, eine grosse Wohnung beim Hotel Alpengold (das "goldene Ei") in Davos gekauft. Davos bleibt also weiterhin im Zentrum der Familie und meines ganzen Freundeskreises. So hat von unserem Lions Club Herrliberg mindestens jedes vierte Mitglied eine Wohnung in Davos zur Verfügung.
Eines Tages, Ende der Siebziger Jahre, sah ich in der Neuen Zürcher Zeitung ein Inserat, in dem Wohnungen in traditionellem Stil im neu erstellten Hafen von Port Grimaud angeboten wurden. Ich versuchte Papi zu einem Kauf zu bewegen. Das gelang nicht, aber immerhin begann er sich für eine Liegenschaft am Meer zu interessieren. Von der befreundeten Familie Graf in Bäch hatte er Kenntnis von der Überbauung Edenmar in San Antonio de Calonge, unweit von Palamos an der Costa Brava. Nach ein paar weiteren Besichtigungen entschied er sich zum Kauf. Damals war es ganz normal, nur etwa die Hälfte des Kaufpreises zu deklarieren.
Edenmar hat meinen Eltern, aber auch meinen Geschwistern und mir grosse Freude bereitet. Zwar standen nur vier Schlafgelegenheiten zur Verfügung, zwei davon auf einem Schlafsofa. Die Lage der Wohnung war aber einmalig. Vor der grossen Terrasse lagen ein gepflegter Park, das offene Meer und die Bucht von Palamos. In wenigen Minuten gelangte man links vom Haus zum etwa drei Kilometer langen Strand, rechts gab es mehrere romantische Buchten. Papa benutzte die Wohnung bis kurz vor seinem Tod 1991, dann wurde sie nur noch selten besucht. Wir haben sie deshalb verkauft - leider zu einem Zeitpunkt, als die Preise tief waren.

Eigene Gedanken, ob ich die Sekundarschule in Lachen oder ein Gymnasium irgendwo in der Ferne besuchen solle, machte ich mir bis zur 5. Klasse keine. Die Entscheidung wurde an "höherer Stelle" gefällt - von Papi!
Papi hatte eines schönen Sonntags im Oktober 1960 den Sohn seiner Sekretärin, Balz Lohmeyer, dessen Firmpate er war, am Gymnasium Stella Matutina in Feldkirch besucht. Papi war von der Schule angetan, führte ein Gespräch mit dem Rektor und entschied, dass Thomas und ich dort gleich eintreten sollten. Die von Jesuiten seit einigen Jahrhunderten geführte Schule hatte vor dem Ersten Weltkrieg bedeutende Schüler, vor allem aus der Donaumonarchie, und Papi kannte ihren guten Ruf seit seiner Jugend in Altstätten.
Meine Basler Grosseltern oder Gotte Gret hatten mich tags zuvor von Lachen nach Basel geholt, damit ich bei ihnen meine Herbstferien verbringen konnte. Schon nach einer Nacht, am Sonntag, wurden die Ferien abgebrochen. Nach einem Telefonat aus Lachen brachten mich die Basler zurück nach Lachen, von dort transportierten Grosspapi und Anneli Thomas und mich weiter nach Feldkirch.
Für mich war es ein echter Schock, mitten aus den Ferien und aus meinem beschaulichen Leben als Primarschüler in Lachen so jäh herausgerissen zu werden. Ich wusste damals kaum, was ein Gymnasium war, noch dazu ein humanistisches mit Latein und Griechisch. Thomas hatte kurz zuvor die Verfilmung von Erich Kästners "Fliegendem Klassenzimmer" gesehen. Er wusste daher eher Bescheid und hegte die Hoffnung, dass es in unserem Internat ähnlich lustig zugeht wie im Film.
Bei unserer nächtlichen Ankunft schliefen die Kameraden bereits. Das Schuljahr hatte ja schon etwa sechs Wochen früher begonnen. Wir wurden daher im Krankenzimmer bei der "Pimse" einquartiert, so nannte man die gestrenge Krankenschwester. Am Montag wurden wir auf die "Abteilung" verlegt, mit Schlafsälen zu etwa 80 Buben und ebenso grossen Studiensälen. Ab sofort mussten wir uns nicht nur mit dem normalen Stundenplan beschäftigen mit neuen Fächern wie Latein und Französisch. Zusätzlich benötigten wir Nachhilfestunden, um den verpassten Stoff nachholen.
Die Bewegungsfreiheit der jungen Schüler war auf das eingezäunte Areal der „Stella“ beschränkt. Dazu gehörten immerhin einige Sportplätze und ein grosser Wald mit ein paar Felswänden.
In schauerlicher Erinnerung bleibt für mich das Essen. Einmal wöchentlich stand das ominöse "Haché" auf dem Speisezettel. Schon Stunden vorher und auch nachher roch das ganze Haus danach. Die Geruchsimmission muss übel gewesen sein, denn die Speise hiess im Schülermund schlicht "Fussi-Scheisse". Fussi - sein richtiger Namen war Fussenegger - war ein geistig behinderter Küchendiener.
Mein Bruder Thomas schien noch mehr unter der Diät zu leiden als ich. Tagelang ernährte er sich von Brotscheiben, auf die er eingeschmuggeltes Aromat streute.
Besuchssonntage gab es nur alle drei oder vier Wochen. An diesen Tagen wurde kompensatorisch verschlungen, was irgendwie in die kleinen Mägen hineinpasste. Abends mussten sich jeweils viele übergeben. Mir passierte es in meinen ersten zwei Jahren nach jedem Besuchstag.
Sehr positiv bleibt mir in Erinnerung, dass unser Horizont kaum durch Landesgrenzen eingeengt war. Schüler und Lehrer stammten etwa zu gleichen Teilen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hinzu kamen kleinere Gruppen, insbesondere aus dem seit dem Ersten Weltkrieg italienischen Südtirol. In diesem Umfeld konnte man Toleranz lernen, auch in religiösen Dingen. Trotzdem habe ich mich manchmal einsam gefühlt, nie ganz zuhause. Zwei Jahre nach Thomas und mir trat unser jüngerer Bruder Peter ebenfalls in die „Stella“ ein.
Für viele "Alt-Stellaner" war die Erfahrung des Internats weniger traumatisch als für Thomas und mich. Nicht wenige schwärmen noch heute von jener Zeit und sind aktiv bei den "Alt-Stellanern", einem Verein der Ehemaligen.

Bei Internaten, zumal katholischen, mag mancher an sexuelle Übergriffe durch Vorgesetzte denken. Immerhin lebte die grosse Mehrheit unserer Lehrer zölibatär. Aber nein, nichts dergleichen ist in meinem Umfeld vorgekommen, weder in Feldkirch noch später in Schwyz.
Einmal allerdings wurde ein etwas älterer Schüler fristlos von der Schule geschickt, weil er jüngeren einschlägige Avancen gemacht hat.
Mir bleibt rätselhaft, weshalb ich als Sohn eines Arztes und einer Kinderkrankenschwester damals bezüglich Sexualität noch völlig ahnungslos war. Ein paar Jahre zuvor war ich in einem Pfingstlager mit den "Wölfen", der Juniorenabteilung der Pfadfinder. Wir verbrachten zwei Tage in einem Pfadfinderheim am Pfannenstiel, unweit von unserem heutigen Wohnort. Jemand erzählte im Massenlager, was Männer und Frauen miteinander so anstellen konnten. Ruedi Keller, der in Lachen direkt neben uns wohnte, schrie darauf voller Wut: "Mini Eltere sind sicher nöd so Sauhünd!" - und das Thema war für mich erledigt.
Vage erinnere mich an frühere Gespräche mit Papi, der mit Thomas und mir von einer "Zeit der Reife" sprach. Man werde dann irgendwie anders und speziell, sagte er. Damit konnte er unser Interesse aber nicht wecken, und zum Kern der Sache kamen wir nie.
Ein Klassenkamerad aus Bozen, Heinrich Weiss, war vor mir bei Pater Frei, und ich wollte von ihm wissen, was er erfahren habe. Er nahm einen Bleistift und einen Spitzer, führte den Bleistift in die Öffnung des Spitzers und bewegte ihn vor und zurück. "Das ist schon alles" war sein Kommentar. Das war mir neu und regte mich zu Gedanken an, wie diese Situation allenfalls in Eigenregie imitiert werden konnte - und es gelang natürlich.
In den folgenden Jahren im Internat waren bei den Gesprächen Mädchen das beherrschende Thema. Ein paar ältere Kameraden brüsteten sich mit ihren Erfahrungen, die sie vielleicht wirklich schon gemacht oder einfach erfunden hatten. In Schwyz stellte sich ein Klassenkamerad namens Armin Hellmüller als besonders erfolgreicher Schürzenjäger dar. Der Arme verstarb bei einem Autounfall ein Jahr nach der Matura.
Vom "Kollegi" Schwyz sah man gut zum etwa 5 km entfernten Mädcheninternat Theresianum Ingenbohl, wo einige Töchter aus unserem Bekanntenkreis zur Schule gingen, auch meine beiden Schwestern. Die Vorstellung, dass dort ähnlich viele junge Menschen sich nach Zärtlichkeit und nach dem anderen Geschlecht sehnten, fand ich verstörend.
Ich empfand diese Situation als unnatürlich und ungesund. Ihr schreibe ich es zu, dass ich später verschiedenen herbeigesehnten und erfolgreich eingefädelten Begegnungen auswich, sobald es mit dem Spass ernst wurde - aus Angst, etwas falsch zu machen, zu versagen.
Zwei Beispiele:
Mit 14 besuchte ich gemeinsam mit meinem Bruder Thomas im Sommer einen Englischkurs in der Eurocentre Schule in Bournemouth. Im Winter davor hatte ich mit Erika W. vage ein Treffen in London vereinbart. Ihre Eltern hatten wie wir eine Wohnung an der Hertistrasse in Davos. Erika hatte zur gleichen Zeit wie ich einen Sprachaufenthalt in Folkstone geplant.
Erika war vielleicht etwas verknallt, und ich fand sie auch nett und zudem sehr zugänglich. Der Zweck des Treffens war höchstens andeutungsweise vereinbart worden: Eine erotische Erfahrung, die erste für mich, für sie wahrscheinlich auch. Ich fuhr im Zug nach London und traf Erika in der vereinbarten Hotelhalle. Dort schmusten wir ein wenig bis sie sagte, auf dem Zimmer wäre es doch schöner. Nun überkam mich eine Panik und ich erfand eine Ausrede, weshalb ich unbedingt nach Bournemouth zurückmüsse. So fuhren beide frustriert zurück zu ihren Sprachschulen.
In Schwyz besuchten wir in der Maturaklasse gelegentlich das Hotel Drei Königen und tranken dort meist ein Bier. Die hübschere Tochter des Hauses, Anni P. hatte etliche Verehrer unter den Studenten. Wahrscheinlich war der eine oder andere Bewerber auch erfolgreich.
Eines Tages schaffte ich es unter Aufbietung all meiner Kräfte Anni zu fragen, ob ich auf ihr Zimmer kommen dürfte. Sie bejahte und nannte mir die Zimmernummer und einen Zeitpunkt. Als der ersehnte Moment gekommen war, verabschiedete ich mich von den Kameraden in der Gaststube unter einem Vorwand, dann stieg ich Treppe um Treppe höher. Die Holzstufen knirschten, ich spürte jeden Herzschlag und die Beine drohten, ihren Dienst zu versagen. Die Angst, dass der gestrenge Wirt und Vater auftauchen und mich zur Rede stellen könnte, war nur teilweise schuld daran. Als ich oben angelangt war, setzten wir uns aufs Bett und begannen zu knutschen. Ich wusste schon bald nicht mehr weiter. Anni half mir, indem sie meine Hand mehrmals auf ihre Brust legte, die nur von einem dünnen, weichen Pullover verhüllt war. Ich erinnere mich nicht, ob sich meine grosse Erregung auch an einschlägiger Stelle auswirkte. Wahrscheinlich nicht, und das war wohl der Grund, weshalb ich "unverrichteter Dinge" meinen Rückzug antrat.
Nach der Matura ging ich für drei Monate nach Perugia zu einem Sprachkurs. Dort und im ersten Studienjahr in Genf lernte ich schon ein paar nette Mädchen kennen, aber zu Intimitäten kam es nicht. Emma B., eine ältere Kommilitonin in Genf, hatte mich bald durchschaut. Als sie mich fragte "es-tu encore puceau", verstand ich sie zunächst gar nicht. Erst mit einem Umweg über "La Pucelle d'Orléans", die Jungfrau von Orléans, wurde mir die Bedeutung ihrer Frage klar. Ich bejahte mit Bedauern. Emma bot gleich Hilfe an, um mich von meinem lästigen Makel zu befreien. Nervös schlich ich eines Nachmittags zu ihrer Wohnung. Ihre Frage "as-tu bu du courage" konnte ich nicht verneinen. Immerhin war es nur ein Bierchen.
Dank Emmas Expertise verlief alles nach Plan und zur Zufriedenheit beider. Wir haben uns noch mehrmals vertraulich getroffen. Verliebt war ich nicht, aber wir blieben Freunde über Jahrzehnte, unter Einbezug des Ehemanns. Dieser hatte nie kritischen Fragen gestellt. Mehrmals gingen wir zu dritt in die Ferien. Zu meinem Bedauern habe ich die beiden vor ein paar Jahren aus den Augen verloren.
Auch nach diesem eher späten Einstieg in die Welt der Erotik brauchte ich noch Jahre, um Gelassenheit im Umgang mit Frauen zu erlernen. Schade!

Das unerlaubte Verlassen des Areals der Stella Matutina war streng verboten. Die Übertretung des Verbots wurde mit Tatzen geahndet, Wiederholung konnte ein "consilium abeundi", die Wegweisung von der Schule zur Folge haben. Freilich blieb das Delikt meist unbemerkt.
Es gab durchaus legale Gründe, die Stadt Feldkirch zu besuchen. So hatte ich Klavierunterricht bei einer greisen Lehrerin, Frau Dr. Isbert hiess sie, und sie wohnte am Ardetzenberg. Der wöchentliche Gang dorthin bot mir die Möglichkeit, mit meinem wenigen Taschengeld etwas Schokolade zu kaufen, sogenannte "Riegel" für vielleicht zwei Schilling das Stück, nach dem damaligen Umtauschkurs von 1:7 etwa 14 Rappen.
Die Schokolade ass ich zum Teil, das Übrige verkaufte ich mit einer Marge an meine Kameraden.
Mit dem so gewonnen Geld leistete ich mir das eine oder andere Mal einen illegalen Ausgang. Ich überstieg abends in der Dunkelheit die Zäune, und zwei oder drei Mal gastierte der kleine Knirps zum Abendessen im eher gehobenen Hotel Hecht. Nicht schlecht staunten die Eltern bei einem Besuch im Restaurant, dass der Kellner mich bereits kannte.

Robert Kölliker war ein noch relativ junger Jesuit aus Basel. Er rauchte viel und schien mit seinem Schicksal nicht ganz im Reinen zu sein. Einmal veröffentlichte er ein Jugendbuch unter dem Titel "Bernd findet heim". Der Titelheld war vorübergehend dem bürgerlichen und katholischen Lebensstil entflohen und traf sich mit weniger seriösen Typen, machte auch mit Mädchen herum. Selbstverständlich verschlechterten sich die Schulleistungen. Durch eine glückliche Fügung, an die ich mich nicht konkret erinnere, fand Bernd zu guter Letzt wieder "heim" und auf den Weg der Tugend. Ob der arme Robert Kölliker seine eigene Geschichte erzählt hat, entzieht sich meiner Kenntnis.
Zu Beginn des Jahres 1961 wurden wir aus der Obhut Köllikers entlassen. Etwas Wehmut war schon dabei, denn wir hatten ihn als verständnisvollen und empathischen Lehrer erlebt. Einmal hat er mich etwas schockiert, indem er mein Niesen mit dem Scherz "Gscheitheit! - gsund bisch jo" quittiert hatte. Ich fürchtete danach, dass er mich für dumm hielt.
Fortan konnte ich aber in der Schule einigermassen mithalten. Ich muss aber recht verträumt gewesen sein. Einmal fragte ich den Latein-Lehrer Günter Abraham, während er gerade den lateinischen Ablativ - den 6. Fall - erklärte, was eigentlich das Wort "Amen" bedeute. Er merkte, dass ich nicht aufgepasst hatte, war erbost und gab mir keine Antwort.
In den drei Jahren in Feldkirch waren meine Versetzungen in die folgende Klasse nicht gefährdet. Meine Leistungen waren aber nicht berauschend. Schlechter erging es meinem Bruder Thomas in der Parallelklasse. Speziell mit dem Mathematiklehrer Helmut Hagel hatte er wie viele andere Schüler seine Mühe - und wohl auch umgekehrt. Nach Prüfungen verlas Hagel regelmässig vor der ganzen Klasse seine "Abschussliste", die etwa die Hälfte der Klasse umfasste, darunter zu oft auch meinen Bruder. Nach der zweiten Klasse wurde er nach Gesprächen zwischen Lehrerschaft und Eltern ins Institut Sonnenberg in Vilters SG versetzt. Es handelte sich um eine Sekundarschule mit Internat, gegründet 1950 von Josef und Hedwig Bonderer im Gebäude eines Sommerkurhauses der Jahrhundertwende. Auf diesen Schulaufenthalt folgte die Handelsschule im Kollegium Schwyz, wo Thomas und ich sowie auch der jüngere Bruder Peter wieder zusammentrafen. Schliesslich machten alle drei in Schwyz die Matura, Thomas in der Handelsschule, ich und Peter am Gymnasium Typ B, also mit Latein aber ohne Altgriechisch.
Nach Bestehen der dritten Gymnasialklasse diskutierten mein Vater und ich die Vor- und Nachteile eines Wechseln von Feldkirch nach Schwyz. Schwyz hatte ein siebenjähriges Gymnasium, das Eintrittsalter war aber zwei Jahre höher als in Feldkirch. Daher war ein Übertritt von der dritten Klasse wiederum zur dritten naheliegend. Für einen Wechsel sprach, dass Schwyz im Gegensatz zu Feldkirch eine eidgenössisch anerkannte Matura bieten konnte, die für ein allfälliges Medizinstudium unerlässlich war.
Die Aussicht, mich in einer neuen Schule neu einordnen zu können, lockte mich.

In Schwyz schmeckte mir die Kost besser als in Feldkirch, und das Regime war weniger streng. So konnte man jeweils am Donnerstag nachmittags etwa von ein bis vier Uhr in Gruppen kleine Wanderungen unternehmen und in Gasthäuser einkehren.
Unsere Ausflüge führten nach Brunnen, Schwyz, Steinen, zur Wirtschaft Burg an der Strasse nach Sattel oder auf den auf 840 m Höhe gelegenen, zu Fuss in eineinhalb Stunden erreichbaren Pass Haggenegg.
Im Restaurant Haggenegg machte ich meine erste Erfahrung mit Alkohol. Dem Beispiel der älteren Klassenkameraden folgend trank ich drei Flaschen Bier zu 58 cl. Beim Abstieg war ich recht wacklig auf den Beinen, aber passiert ist zum Glück nichts.
Nach fünf Jahren, anno 1968, konnte ich das Gymnasium mit der Matura Typ B abschliessen. Ich erzielte ich mit 5,4 die beste Durchschnittsnote unserer Klasse. In der Parallelklasse gab es allerdings einen noch jüngeren Schüler, Urs Marbet aus Basel, der mit 5,6 abschloss. Wir haben uns neulich wieder getroffen.
Wir feierten einen damals typischen Maturaball in Schwyz. Dazu lud ich die ehemalige Nachbarin vom See ein, Mariann Knobel. Sie war im Kindergarten meine "erste Liebe" gewesen, aber nach der Matura kam - mindestens bei mir - keine Leidenschaft auf.

Zum 30. Jubiläum organisierte ich ein Klassentreffen auf der Rigi mit Übernachtung auf Rigi-Kulm. Tags darauf stiegen wir fast 1500 m zu Fuss ab nach Vitznau. Am folgenden Tag litten die meisten unter schwerem Muskelkater. Für mich war es wohl der heftigste meines Lebens, schlimmer als nach meinen Marathonläufen.
Zum vierzigsten Jubiläum besuchten wir das Kloster Einsiedeln. Zum fünfzigsten schlug ich zunächst ein Treffen in Appenzell vor. Der Governor der Lions Clubs der Ostschweiz (District 102-E), Peter Molinari, schwärmte mir vor von seiner Klassenreise ins Baltikum. Das beeindruckte mich, und ich kam mir mit meiner Destination Appenzell ziemlich bieder vor. Nun startete ich eine Umfrage. Etwa die Hälfte votierte für Appenzell, die andere Hälfte für die Reise ins Baltikum. Das Dilemma war bald gelöst, indem wir beides machten: Appenzell zum 50. und das Baltikum zum 51. Jubiläum. Dabei konnte ich das Programm und die Reiseleitung von Molinari übernehmen.
Daiva Medveck empfing uns am Flughafen der litauischen Hauptstatt Vilnius. Per Bus fuhren wir in etwa 10 Tagen von Litauen über Lettland mit der Hauptstadt Riga nach Estland, zuletzt zur sehr malerischen Hauptstadt Tallinn. Unsere Gruppe war von der Reise sehr angetan. Carlo Gick schenkte mir als Dankeschön für die Organisation ein Album mit seinen gut gelungenen Fotos.
Seither sind die Treffen häufiger geworden, je zwei Tage in Basel und in Bellinzona, 2026 ist ein Stelldichein Altdorf vorgesehen.

Im Sommer 1970 absolvierte ich die Rekrutenschule für Sanitätstruppen in Tesserete. Ich fühlte mich der Aufgabe gut gewachsen und profitierte von den umfangreichen sportlichen Aktivitäten, darunter längere Märsche und Läufe. Der in manchen Truppen traditionelle Marsch von 100 Kilometern Länge blieb meiner Einheit allerdings erspart, 40 km waren wohl das Maximum. Trotzdem ging es mir wie vielen anderen auch. Am Ende der RS war ich gewiss leistungsfähiger als davor. Die RS war auch eine gesellige Zeit. So fühlte ich mich zunehmend wohl und fast zuhause im Tessin, insbesondere im Tesserete-Tal. Meine Liebe zum Tessin dürfte auch meiner einjährigen ärztlichen Tätigkeit im Ospedale Italiano di Lugano anno 1981 den Weg bereitet haben.
1972 habe ich die Unteroffiziersschule absolviert, wiederum bei den Sanitätstruppen in Tesserete. Etwa ein Jahr später, ich war als Unterassistent im Spital Herisau tätig, erlebte ich eine Phase rascher Ermüdbarkeit und verminderter Leistungsfähigkeit. Die Untersuchung an der Poliklinik des Universitätsspital Zürich führte zur Diagnose einer Sarkoidose, alias Morbus Boeck. Es handelt sich um eine Krankheit, die in den Lungen und im Lymphsystem Knötchen bildet. Diese winzigen Rebellen in meinem Körper befreiten mich für einige Jahre vom Dienst. Ihre unklare Ursache und eine gewisse Ähnlichkeiten mit der Tuberkulose suggerierten eine mögliche Ansteckungsgefahr.
Schon bald verschwanden die Befunde ohne Behandlung. Nach Ablauf von vier Jahren wurde ich erneut vor eine militärärztliche Untersuchungskommission in die Klinik Balgrist zitiert. Man liess mir die Wahl, ob ich zu den regluären Truppen zurückkehren oder zum Hilfsdienst übertreten wolle. Ich zog Letzteres vor, zumal ich mich für den Besuch einer Offiziersschule etwas alt und beruflich zu fortgeschritten fühlte.
Im Hilfsdienst absolvierte ich Weiterbildungskurse von jeweils wenigen Wochen und erreichte damit die so genannten Funktionsstufen 1 und dann 2. 1991 wurde der militärische Hilfsdienst aufgehoben und dessen Mitglieder wurden in die normalen Truppen integriert. So erhielt ich fast "gratis" den Grad eines Oberleutnants. Das war ein Ärgernis für meine Brüder, die bis zum Oberleutnant viel mehr Dienst leisten mussten.
In meinen weiteren Jahren absolvierte ich eher gemütliche Militärdienste, etwa in Stans, Burgdorf oder Sarnen. Ein Wiederholungskurs war so locker bzw. langweilig, dass ich etliche Velotouren im ganzen Kanton Obwalden machen konnte. Ein anderes Mal studierte ich das umfangreiche Standardwerk des Segelsports "Die Seemannschaft" so gründlich, dass ich kurz darauf die theoretische Prüfung für den "B-Schein" absolvieren konnte. Der Schein würde zur Führung von Segelbooten in küstennahen Gewässern berechtigen. Trotz guter Prüfung erhielt ich den Ausweis aber nie, weil ich die erforderlichen 1000 Meilen Praktikum innerhalb von drei Jahren nur zur Hälfte schaffte. Anno 2001 legte ich die Uniform für immer ab, ganz ohne Nostalgie.

Nach bestandener Fahrprüfung kaufte ich mir den damals alljährlich neu erscheinenden Auto-Katalog der Automobil-Revue. Er beschrieb alle Marken und Typen mit je einem Bild und einem standardisierten Steckbrief im Telegrammstil. Viel davon lernte ich ohne Absicht auswendig. Das billigste 1968 erhältliche Auto war ein Fiat 500 für 3800 Franken. Mein Traumauto war der Fiat 124 Spider, ein Cabriolet.
Unerwartet früh boten mir meine Genfer Freunde Emma und Edgar ihren Renault 4CV mit etwa 80000 gefahrenen km zum günstigen Preis von 850 Franken an. Da gab es für mich kein Zögern. Das bescheidene Wägelchen mit vier Sitzen und vier Türen, die vorderen nach vorne öffnend, wurde mein Stolz und meine Freude. Es von meiner Studentenbude im zweiten Stock an der Wotanstraße in Zürich zu betrachten, gab mir ein Gefühl großer Freiheit. Im Laufe einiger Jahre bin ich weitere 80000 km gefahren, und habe viele Reparaturen und Verbesserungen, teilweise nur vermeintliche, selber durchgeführt.
Zwei Beispiele: Zur Heizung diente „warme“ Luft, die vom Heckmotor durch die Türschwellen zum vorderen Fußraum und zur Windschutzscheibe geführt wurde. Die Schwellen waren aber durch Rostbefall bereits löchrig, und die Heizung dadurch fast wirkungslos. Das wurde vollends klar, als ich einmal mit meinem jüngeren Bruder von Davos nach Lachen gefahren bin. Die Heizung hat auch nach zurückgelegten 110 km nicht gereicht, um das Eis am Fußboden zu schmelzen!
Abhilfe erhoffte ich mir nun dadurch, dass ich das Kühlwasser des Motors im Heck mit Hilfe von Wasserschläuchen durch die Türschwellen in den kleinen Kofferraum am vorderen Ende des Autos leitete und durch einen dort installierten Radiator fliessen liess. Das Blech zwischen Kofferraum und Fussraum wurde mit zahlreichen Bohrungen perforiert. Ein Luftventilator sollte die erwärmte Luft in den Fussraum blasen.
Eigentlich war ich ziemlich stolz auf meine Idee und auf ihre Umsetzung, die sich als anspruchsvoller erwies, als anfänglich gedacht. Geholfen hat sie leider wenig, denn das Wasser kam nur noch lauwarm vorne an.
Mein Renault 4CV ließ sich manchmal nicht starten. Ein erfahrener Mechaniker, Hermi Schweizer bei der Renault-Garage in Altendorf, nahm einen Hammer und schlug damit auf den Anlasser. Und siehe da, das Gerät tat wieder seinen Dienst, das verklemmte Ritzel hatte sich gelöst. In der Folge habe ich den Trick mehrmals selber erfolgreich angewendet. Als auch diese Option nicht mehr half, erdachte ich meine eigene Therapie. Eine Besonderheit dieses Wägelchens war ja, dass die vorderen Türen nach vorne öffneten. So konnte ich vom Fahrersitz durch die geöffnete Tür den linken Fuß auf den Boden stellen und wie bei einem Tretroller das Auto rückwärts in Bewegung versetzen. Dabei hatte ich den Rückwärtsgang eingelegt, der rechte Fuß drückte die Kupplung. Sobald das Auto sich zügig rückwärts bewegte, nahm ich den rechten Fuß von der Kupplung und gab Gas. Gleichzeitig drückte ich mit linken Fuss die Kupplung. Mit etwas Glück lief jetzt der Motor.
Ziemlich peinlich wurde es einmal, als ich den Trick vor einer Schönen in Holland durchführen wollte. Leider hatte ich nicht beachtet, dass hinter meinem Renault ein Baum stand. Dieser hat einen bleibenden Eindruck am Heck meines Renault hinterlassen. Ich als trickreicher Fahrer konnte hingegen keinen nachhaltigen Eindruck erzielen.
Im Oktober des Jahres 1975 hatte ich meine erste Stelle am Forschungsinstitut für Osteosynthese-Fragen in Davos angetreten. Den Winter verbrachte ich mit Forschung an Tierknochen, aber auch mit Skifahren auf den umliegenden Bergen und mit Ski-Langlauf.
An einem Samstag im Frühjahr plante der Fotograf des Instituts, der Amerikaner Jeff Schlittgen, von Davos nach Urdorf bei Zürich zu fahren, um einen restaurierten Mercedes 190 SL zur Probe zu fahren. Die Einladung, Jeff zu begleiten, nahm ich gerne an.
Jeff war mit dem Auto zufrieden und unterschrieb einen Kaufvertrag. Inzwischen war ich auf ein knallrotes Cabriolet aufmerksam geworden, einen Mercedes 230 SL Jahrgang 1961mit Pagoden-Dach. Er stand ebenfalls auf dem Areal des Autohändlers Werner Häusermann zum Verkauf. Die Frage nach dem Preis konnte ich mir nicht verkneifen. Die Antwort erschien dann wie ein Zeichen vom Himmel: 13,800 Fr., zufällig genau der Betrag, den ich nach ein paar Monaten Arbeit auf meinem Sparkonto angespart hatte.
Freilich zögerte ich und stellte zusätzliche Fragen, zum Beispiel, ob der Motor revidiert sei. „Selbstverständlich“ lautete die Antwort des Verkäufers, allerdings müsste er die Belege zuerst auf dem Dachboden suchen. Ich zögerte weiter. Die Ermutigung von Jeff, "come on, it’s just money" beeindruckte mich allerdings. Wie grosszügig doch so ein Amerikaner denken konnte! Schliesslich willigte ich ein, und konnte zwei Wochen später meinen Mercedes abholen. Leider waren die Belege für die Revision des Motors nach wie vor nicht auffindbar.
Eine meiner ersten Fahrten führte über die Landesgrenze. In der Schweiz war schon damals auch auf Autobahnen die Höchstgeschwindigkeit auf 120 km/h begrenzt, während in Deutschland kein grundsätzliches Limit bestand.
Also testete ich kurz nach der Grenze die Fähigkeiten meines neuen Gefährts. Gut 180 km/h habe ich wohl hingekriegt, aber dann begann der Motor zu ruckeln, und die Fahrt wurde langsamer. Zum Glück konnte ich noch einen Parkplatz erreichen, bevor gar nichts mehr ging. Bei der Betätigung des Anlassers drehte der Motor nicht mehr, er war offensichtlich blockiert.
die Rückführung des Pannenfahrzeugs in die Schweiz war ziemlich abenteuerlich. Mithilfe eines Freundes und des Lancia Fulvia von Gotte Gret schleppten wir den 230 SL in der Nacht über einen unbemannten Grenzübergang. Am folgenden Tag wurde er von dort vom Händler Häusermann abgeholt und in die Garage nach Urdorf überführt.
Ein befreundeter Anwalt forderte den Kaufpreis zurück. Belege für die behauptete Revision des Motors konnte Häusermann nach wie vor keine vorlegen. Schliesslich einigten wir uns darauf, dass ich meinen eingetauschten Fiat 128 zurückerhielt. Ich hatte somit 3000 Fr. verloren, was mich natürlich ärgerte. Mein damaliger Chef in Davos, Prof. Stephan Perren, tröstete mich aber und sagte, dass er froh sei über den Ausgang. "Warum denn?", wollte ich wissen. Er meinte, dass der Mercedes bei meinem späteren Stellenantritt auf der Chirurgie des Kantonsspitals Basel nur Neid erregt hätte und für mich zur Hypothek geworden wäre. Werner Häusermann traf ich unerwartet wieder beim Skifahren in einer Lodge namens Galena in Kanada. Er offerierte eine Flasche Wein, und die Sache war für uns beide erledigt.
Jahrzehntelang habe ich meine Vorliebe für Cabriolets bewahrt, vom klitzekleinen Fiat 850 Spider über VW Golf, Peugeot 205 cti, Mercedes CLK, BMW 3er bis zum Audi A3. Dann war Schluss mit offen fahren, gleich aus zwei Gründen. Einerseits verursachte mir der Fahrtwind zunehmend Bindehautentzündungen, andererseits wuchs mein Wunsch, umweltfreundlicher mit einem Elektroauto unterwegs zu sein. Zuerst war es ein VW ID.3, dann ein Renault Mégane.
Daneben hatten wir meist auch ein familienfreundliches Fahrzeug wie VW Passat, VW Sharan, Mercedes GLK. Letzterer tut 2025 immer noch brav seinen Dienst, nach 12 Jahren und 250'000 km im Einsatz. Neulich musste das Fahrzeug zur Kontrolle, und der Experte stellte Rost an der Hinterachse fest. Der Ersatz kostete etwa 6'000 Franken. Die Kosten wurde aus Kulanz vollumfänglich von Mercedes übernommen. Das hat mich uns beeindruckt.

In der Rekrutenschule wurde regelmässig Sport getrieben. Dadurch kam ich zu einer gewissen Kondition, die aber bald darauf wieder verloren ging. Anno 1985 verbrachte ich ein paar Monate an der Universität von Loma Linda in Kalifornien. Mein Mentor, der Gefässchirurg Louis Smith, nahm mich in sein Haus auf und animierte mich dazu, jeden Tag mit ihm joggen zu gehen. Das tat ich, hatte aber anfänglich alle Mühe, dem etwa dreissig Jahre älteren Mann zu folgen. Das änderte sich im Lauf meines Aufenthaltes und ich merkte: Ausdauer kann auch Spass machen.
Nach dem Einzug in unser Haus in Herrliberg im Sommer 1996 lud mich Mariann Decurtins - damals Präsidentin des Singkreises Herrliberg - in ihre Laufgruppe ein. Etwa zwanzig Jahre lang trafen wir uns jeweils am Sonntag morgens um neun Uhr beim Rütihof, um eine Runde von etwa 11 km zu laufen. Mit von der Partie waren Arthur Decurtins, Dorothee Furler-Ulrich, Kurt April, manchmal Norbert Albin, Karin und Beat Messerer und weitere Personen aus dem Freundeskreis. Ein paarmal absolvierte ich offizielle Halbmarathon-Läufe um den Greifensee, jeweils in gut zwei Stunden, dann auch in Davos. 2004 meldete ich mich erstmals zum Zürich Marathon an und benötigte dafür gute 4 Stunden. Es folgten der 30-km-Landwasserlauf und zwei Marathonläufe in Davos. Zum letzten Mal ging ich 2014 mit 65 Jahren an den Start und absolvierte den Davoser Bergmarathon. Er begann in Bergün zunächst mit einer langen Schleife in den Hügeln südlich der Ortschaft. Bei grosser Hitze folgte ein endlos scheinender Aufstieg durch das Val Tuors bis zur Keschhütte, weiter ging's zum Sertig-Pass und hinunter ins Sertigtal. Von da verlief der Weg über die letzten 10 km leicht abschüssig nach Davos. Für die Strecke von 42 km mit 1800 m Aufstieg und 1500 m Abstieg benötigte ich gute 7 Stunden. Das war zwar keine Glanzleistung, aber noch klar unter dem offiziellen Limit, und das von Migros ins Internet gestellte Video zeigte, wie ich im "normalen" Laufschritt durchs Ziel ging. Am Abend traf ich Arthur und Mariann sowie Franziska zum Hühnerschmaus im Hotel Montana, danach gingen wir noch zur Grischa Bar. Bei der Heimkehr in unsere Davoser Wohnung wollte ich meine Fähigkeit testen, zu Fuss zum dritten Stockwerk zu gelangen. Es ging ganz passabel.
Bei späteren Läufen schmerzte manchmal das rechte Knie, das ja bereits eine Meniskus- und eine Kreuzbandläsion sowie eine Kreuzbandrekonstruktion hinter sich hatte. Also gab ich das Laufen auf, Radfahren blieb stets problemlos für die Gelenke, aber spätestens ab 70 Jahren schätzte ich die Unterstützung durch einen Elektromotor.
Als neugeborenes Kind fiel ich, wie berichtet, vor allem durch eine sehr heisere Stimme auf. Trotzdem konnte ich mir als Kind ein paar Franken verdienen, wenn ich bei Gästen ein Liedchen aus dem Kindergarten sang. Ich tat es meist ganz verschämt, verkroch mich beispielsweise unter den Tisch. Wenn ich gar keine Lust hatte, liess ich mich nicht einmal durch eine Erhöhung meines Honorars - etwa von einem Franken auf zwei - überzeugen. Ich erinnere mich an den berührenden Text der ersten und letzten Strophe, die mittlere fehlt.
Ade, ade liebs Müeterli,
Auch in der Primarschule war ich noch chronisch heiser und wurde deshalb vom Singen weitgehend dispensiert. Im Internat in Feldkirch sang ich im Chor, ich glaube sogar im Sopran. Dann kam der Stimmbruch und meine kurze Laufbahn als Sänger bekam einen längeren Pause.
Als junger Arzt trat ich als Bass in den "Gemischten Chor Basel" ein und bekam zunehmend Freude am Singen. Ich nahm eine Zeitlang Singstunden bei einer älteren Dame, Frau Stark. Nach meinem Wegzug gab es wieder einen längeren Unterbruch. Erst in Urdorf trat ich wieder einem Chor bei. Endgültig "erwischt" hat mich das Singen anno 1996 in Herrliberg. Am Tage unseres Einzugs ins neue Haus, es war ein Montag Ende August, gingen neue Bekannte mit Notenblättern an unserem Haus vorbei, Elisabeth und Felix Escher. Sie waren unterwegs zur Probe des Singkreises Herrliberg und ermutigten mich, mitzugehen. Man begann gerade mit einem neuen Werk. Im Chor traf ich die bereits erwähnte, liebenswürdige und tatkräftige Präsidentin Mariann, den charismatischen Dirigenten Andri Calonder sowie etliche weitere Frauen und Männer, die mir gleich sympathisch waren. So kam es, dass ich nun schon fast seit dreissig Jahren Mitglied dieses Singkreises bin. Viele Sänger sind noch die gleichen wie damals. Andri hat nach 20 Jahren die Leitung abgegeben und wurde abgelöst vom nicht minder charismatischen Dieter Hool. Mit ihm hat unser Laienchor sozusagen neue Höhen erklommen.
Einen Höhepunkt für Dirigent und Sänger stellte unser Auftritt im KKL anno 2001 dar. Ich spielte die Hauptrolle im Organisationskomitee des Jahreskongresses der European Society for Vascular Surgery und konnte die Eröffnungszeremonie gestalten. Ich begrüsste die etwa tausend Teilnehmer, sprach über die Geschichte von Luzern und seine heutige Bedeutung, und bat gleich anschliessend "meinen" Singkreis auf die Bühne. Wir brachten die "Carmina Burana" von Carl Orff zur Aufführung, was das Publikum mit viel Applaus und Komplimenten verdankte.
Weitere Höhepunkte unseres Chores waren Auftritte auf der ägäischen Insel Syros, im spanischen Murcia sowie in Riga, der Hauptstadt Lettlands. Dabei kamen auch unsere touristischen Interessen jeweils nicht zu kurz.
Anno 2026 begeht der Singkreis sein 40-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass wollen wir das Requiem von Giuseppe Verdi aufführen.
Seit 2023 singe ich durch Vermittlung unserer Mitsängerin Hanne Leggemann, zusätzlich im Zürcher Konzertchor. Bisher zwei Weihnachtskonzerte haben wir in der Kirche Fraumünster aufgeführt. Unsere eindrücklichsten Auftritte galten aber den Jahreszeiten von Josef Haydn in der Tonhalle Zürich und dem Requiem von Franz von Suppè im KKL, dem Kunst- und Kulturzentrum in Luzern. Ein paar solistische Auftritte waren mir auch vergönnt. Bei der Hochzeit meiner Nichte Kristin mit Matthias Vögeli im Sommer 2014 sang ich in der reformierten Kirche von Stäfa zwei oder drei Titel, darunter das Ave Maria von von Bach-Gounod. Weitere sang ich bei der Hochzeit von Katharina Grimm und von unserer Tochter Vera. Nach dem Ableben von Antoinette (Toni) Schweri sang ich auf Einladung ihres Sohnes René anlässlich der Trauerfeier auf dem Friedhof Witikon.
Papi war ein begabter Hobbypianist, der stundenlang improvisieren konnte. Er hätte es gern gesehen, wenn alle fünf Klavier gespielt hätten. So erhielten fünf Kinder Klavierstunden während durchschnittlich etwa sechs Jahren. Das macht zusammen 30 Jahre Unterricht mit einem erschütternden Resultat: Keiner von allen hat als Erwachsener noch Klavier gespielt. Der einzige, bescheidene Erfolg war wohl mein Engagement als Sänger.

Nach ein paar Jahren war ich wiederum in Amerika und konnte mir eine Festplatte mit 40 Megabyte Speicherkapazität einbauen lassen, einen sogenannten Hyperdrive. Das bedeutete damals eine Investition von nochmals etwa fünftausend Franken. Weil die Festplatte einen Laser enthielt, wurde das Gerät von den US-Behörden als "dual use" eingestuft, also auch militärisch einsetzbar. Deshalb musste ich damals für die Ausfuhr eine Genehmigung einholen.
Trotz jahrelanger Treue zu Apple Produkten schwenkte ich 1996 bei der Eröffnung einer eigenen Praxis zu Microsoft um. Der Grund war, dass Praxissoftware nur zu einem kleinen Teil auf Apple lief.

Woher kam nur meine Tendenz, Gegensteuer zu geben? Die römische Weisheit "et altera pars audiatur" - auch die andere Seite soll angehört werden - war damals und ist immer noch eine der wesentlichen Erkenntnisse meines Lebens. Es war mir auch ein Bedürfnis, sie an meine Kinder weiterzugeben.
Leider erinnere ich mich nicht, wer oder was mich ursprünglich in diesem Sinne beeinflusst hat. Zur Relativierung der Einteilung der Welt in Gut und Böse erwähne ich ein interessantes Erlebnis anlässlich meines Sprachaufenthaltes 1968 in Perugia. Damals waren die Truppen des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei einmarschiert, um den "Prager Frühling" zu beenden. Die Studentenschaft in Perugia demonstrierte dagegen, der Corso Vanucci war voller protestierender Menschen - und ich war begeistert dabei. Wir malten Protest-Parolen auf Transparente. Wer stellte uns dafür Räume und Material zur Verfügung? Der Sitz der Kommunistischen Partei Umbriens!

Eine ganz andere Situation war es, wenn ich als Mittelschüler und auch noch als Student attraktiven Mädchen begegnete. Manchmal bekam ich kein Wort über die Lippen. Ich erinnere mich an eine Fahrt in der Zweiergondel von der Schatzalp zum Strelapass mit einer hübschen Französin. Ich war etwa im gleichen Alter, vielleicht 14, und konnte bereits etwas Französisch. Trotzdem habe ich es nicht geschafft, nur ein Wort zu sagen, geschweige denn, ein Gespräch anzufangen.

Kurzfristig liebäugelte ich auch mit einem Studium der Physik, die ich als Schulfach sehr mochte. Schliesslich entschied ich mich doch für das Medizinstudium, und ich habe es nie bereut. Insbesondere in späteren Jahren, als ich meinen Beruf selbstständig ausüben konnte, schätzte ich die oft sehr erfreulichen Kontakte zu meinen Patienten in Kombination mit den handwerklichen Herausforderungen. Rückblickend kann kann ich diese Tätigkeit durchaus als Berufung betrachten.


Die Vorlesungen auf Französisch waren anfänglich eine rechte Herausforderung, auch die Abfassung von schriftlichen Arbeiten und Prüfungen. Immerhin gelang dies bis zum Ende des ersten Studienjahres recht gut, und die damals "Erstes Propädeutikum" genannten Examina in Chemie, Biologie und Anatomie verliefen problemlos.
In Genf lernte ich ein knappes Dutzend Mitstudenten aus der Deutschschweiz kennen. Sie waren mein wichtigstes soziales Umfeld.
Ich wohnte in einem kleinen Haus im Servette-Quartier, an der Avenue Luserna 7 (heute De-Luserna). Fräulein Karoline Schnurr, eine ältere Deutsche, führte dort eine kleine Pension. Fräulein Schnurr - so wollte sie angesprochen werden - beherbergte ausser mir noch etwa vier weitere Personen. Sie bekochte uns jeden Abend.
Ihre Pension konnte kurzfristig auch Bekannten Unterschlupf bieten, beispielsweise Barbara Müller, die ich von Lachen kannte, sowie Béatrice Egli oder Marius Zehnder, beide aus meinem Semester.
Lustig fand ich die Erzählung unserer Schlummermutter, sie sei als Kind wegen ihres aus der Mode gekommenen Vornamens Karolina gehänselt worden. Inzwischen hatte eine monegassische Prinzessin den selben Namen, und damit war er plötzlich beliebt.
Die meisten Mitstudenten aus der Deutschschweiz hatten nur ein Jahr Aufenthalt in der Rhonestadt geplant. Die Kontakte mit Einheimischen blieben spärlich, wir hatten den Eindruck, die Genfer blieben lieber unter sich. So war es auch für mich naheliegend, die weiteren Semester in Zürich zu belegen.
In Zürich fand ich ein Zimmer an der Wotanstrasse 6, unweit vom Klusplatz. Das Haus gehörte einem Architekten namens Hans Becker, der ein Zimmer im Hochparterre als Büro benutzte. Die übrigen Zimmer waren vermietet, im ersten Stock an das Ehepaar Rauber. Hanne Rauber studierte Ethnologie und war auf Tibet fokussiert. Darüber verfasste sie eine Dissertation, die ich allerdings nie gesehen habe. Im zweiten Stock hatte ich ein Zimmer mit Lukarne nach Norden, Blick auf die Wotanstrasse, und einem Lavabo. Daneben gab es Platz für einen Tisch und grossen Schrank am Fussende des ca. 140 cm breiten Bettes. An die Rückseite des Schranks hatte ich ein Poster der unbekleidet aber sittsam posierenden Jane Fonda aufgehängt. Zum Duschen musste ich drei Stockwerke hinabsteigen, bis in den Keller. Im Winter konnte es dort eiskalt werden. Das hat die Duschdisziplin vor allem im Winter nicht gerade gefördert. Die Attraktivität des Zimmers war nicht hoch, trotzdem habe ich es bis zum Abschluss des Studiums behalten. Das lag am akzeptablen Preis von 180 F pro Monat, aber auch an den Mitbewohnern im zweiten Stock, die zu Freunden wurden.
Auf der gegenüberliegenden Seite des Korridors wohnte Costa Becker, Sohn des Hauseigentümers und ewiger Medizinstudent, der sämtliche Examina erst mit der maximal zulässigen Zahl von Anläufen schaffte. Nach dem Studium wanderte er nach Arizona aus, heiratete eine Indigene, hatte mit ihr einige Kinder und baute eigenhändig ein grosses Haus. Etwa mit 65 ist er bei einem Motorradunfall zu Tode gekommen. Weitere temporäre Mitbewohner waren Ursula Diriwächter, unser liebes "Diri", die später Zahnärztin und Gattin des Allgemeinpraktikers Donat Blum wurde, sowie Dieter Käser, später Psychiater und mit Iris Thür verheiratet.
Mein Aufenthalt an der Universität Zürich wurde 1974 durch das Wahlstudienjahr unterbrochen. Ich famulierte zwei Monate auf der Gynäkologie des Ospedale San Giovanni in Bellinzona. Das förderte meine Kenntnisse der italienischen Sprache und meine Liebe zum Tessin. Der Chefarzt Dr. Athos Gallino hatte in den Fünfziger Jahren zusammen mit meinem Vater an der Frauenklinik in Basel gearbeitet und war mit ihm befreundet, auch die Gattinen kannten und mochten sich.
Ein weiteres Praktikum absolvierte ich auf der Anästhesiologie am Kantonsspital St. Gallen unter Dr. Kern. Er förderte seine Unterassistenten in vorbildlicher Weise.
Etwa vier Monate arbeitete ich auf der Inneren Medizin des Claraspitals in Basel und gastierte erneut bei Gotte Gret und den Grosseltern. Ähnlich lang war ich auf der Chirurgie im Spital Herisau tätig. Während dieser Periode erkrankte ein niedergelassener Arzt in Herisau, Dr. Stoll. Mein Chefarzt Prof. Rolf Lanz bat mich, die Praxis vorübergehend zu führen in der Erwartung, dass Stoll bald zurückkehren könne. Die Hoffnung hat sich nicht erfüllt, Stoll ist bald darauf verstorben, und seine Praxis wurde aufgelöst.
Meine erste praktische Tätigkeit war eine erhebliche Herausforderung. Nicht nur einmal musste ich mich auf den Ratschlag der erfahrenen Praxisassistentinnen verlassen.
Später und schon etwas erfahrener habe ich noch zwei weitere Praxisvertretungen übernommen, einmal bei einem alten Dr. Schönenberger in Klingnau und dann bei Dr. Milan Matijasevic in Niederhasli. Er war früher Chirurg und Stellvertreter meines Vaters in Lachen gewesen, weshalb ich ihn bereits kannte. Später hatte er in die Praxis gewechselt, weil die wachsende Gemeinde Niederhasli schnell wuchs und intensiv nach einem Arzt suchte. Seine Praxis wurde meines Wissens von der Gemeinde finanziert. Ich hatte das Vergnügen, sein schönes Haus zu bewohnen, während er mit seiner Gattin in Kroatien die Ferien verbrachte.
Das Studium verlief gradlinig und problemlos. Als unangenehm empfand ich die Autopsien in der Anatomie und später in der Pathologie. Mein Abschlussexamen erfolgte im Frühling 1975 mit 25 Jahren und 5.6 als Notendurchschnitt.

Die erwähnten 5000 Franken waren keine üppige Apanage und reichten nicht, wenn man sich dann und wann etwas Besonderes gönnen wollte, z.B. einmal die schöne Cousine (!) Brigitte zum Nachtessen in die Bodega einladen oder eine Woche Ferien machen in den Bergen oder am Mittelmeer. Immerhin hatten wir die beiden Ferienwohnungen der Eltern in Davos und in San Antonio de Calonge an der Costa Brava zur freien Verfügung. Aber das bescheidene Auto - Renault 4 CV 1961, erstanden für 850 Franken von den Genfer Freunden Edgar und Emma Brügger mit ca. 80000 km auf dem Zähler - brauchte auch etwas Benzin und Unterhalt.
Zur Aufbesserung meines Budgets arbeitete ich oft während der Semesterferien oder vor Weihnachten. Meine Tätigkeiten umfassten den Verlad von Fiat-Autos auf Lastwagen bei der Logistikfirma Cotra (in Dübendorf?), Lieferdienste per Auto für den Spielwarenhändler Pastorini am Weinplatz in Zürich, Nachtwachen und Famulaturen in Spitälern, Hilfsskilehrer in Davos. Einmal hatte ich eine kleine Nebenrolle in einem Film "The Swiss Connection" mit Elke Sommer, die ich aber nur kurz zu Gesicht bekam bei einem Arbeitslunch im Hotel Storchen.
Gegen Ende des Studiums fungierte ich während dreier Wochen als Arzt in einem Ferienlager von SSR, dem Schweizerischen Studentenreisedienst, in Akçay an der ägäischen Küste der Türkei. Das war im Jahre 1974. Fünfzig Jahre später sah ich die Gegend nochmals auf einer Kulturreise mit der Reisehochschule Zürich. Zu meiner Überraschung erfuhr ich, dass RHZ die Nachfolgeorganisation des SSR ist!
Das soziale Leben als Student in Zürich umfasste fast tägliche Inspektionen vom Rondell und des Lichthofes im Hauptgebäude der Universität, gelegentlich kombiniert mit einer Tasse Kaffee. Ich und viele andere wollten dort Mädchen sehen. Zu Kontakten führte dies kaum, ich war einfach zu verklemmt.
Nach den Vorlesungen gönnte man sich ein Bier in der Arbeiterbeiz "Oberhöfli" an der Ecke Plattenstrasse/Zürichbergstrasse.
Der Fitness zuliebe, aber auch aus sozialen Gründen nahm ich manchmal an Fitnessprogrammen der Universität in einer Ballonhalle zwischen dem Schwesternhochhaus des Unispitals und dem Uni-Hauptgebäude teil.

Carmen folgte mir nach Zürich und wurde von Freunden und auch von meinen Geschwistern gut aufgenommen. Papi meldete Bedenken an, weil sie in einem Kinderheim in Venetien aufgewachsen war und keine Familie vorzuweisen hatte. Ich weiss nicht, in welchem Mass er mich beeinflusst hat, aber plötzlich wurde mir die Nähe meiner Freundin mit ihren auf lange Frist angelegten Erwartungen unangenehm, und ich wollte die Bindung lösen.
Carmen hatte ein Zimmer im Schwesternhaus des Kantonsspitals und drohte mit Suizid. Sie war längere Zeit in psychiatrischer Behandlung. Sie machte ein paar Versuche, mich wiederzugewinnen. Sie tat mir furchtbar leid, aber ich liess mich nicht umstimmen.
Auch ich habe natürlich ein paar Abfuhren erlitten, aber längere Perioden des Leidens blieben mir glücklicherweise erspart. Einmal bin ich einer Holden nach Ibiza nachgeflogen, einmal wegen einer anderen mit meinem Renault 4CV die Nacht hindurch nach Perugia gefahren. Zweimal Fehlanzeige. Heute erinnere ich mich nicht einmal mehr an ihre Namen.

Mindestens einmal kam es zu einem Familiendrama. Ich arbeitete in den Sommerferien des Medizinstudiums im Spital Lachen als Unterassistent. Ich durfte Papa bei Operationen assistieren als so genannte "zweite Hand". Die "erste Hand" war Papas Stellvertreter, Dr. Wladimir Sorokin, ein Arzt mit kroatischen und - weiter zurück - russischen Wurzeln. Papa war unzufrieden mit der Operationsschwester und machte ihr ständig Vorwürfe, und das in einer Weise, die ich nicht verstehen konnte. Meine Gefühle schwankten zwischen Scham, Wut und Trotz. In der Garderobe, in Anwesenheit von Sorokin, machte ich ihm deswegen ziemlich unflätige Vorwürfe, nannte ihn einen ungehobelten "Rüpel". Seine sofortige Reaktion war mein Hinauswurf aus Spital und Vaterhaus. Ich suchte darauf Zuflucht bei Tante Gret in Basel. Ich durchlief eine breite Skala von Gefühlen, darunter Wut, aber Scham und Schuldgefühle. Gret erwies sich einmal mehr als gute Beraterin. Nach etwa einem Monat kam meine Mutter zu Besuch nach Basel, vermutlich im Auftrag von Papa. Sie versuchte, die Vater-Sohn-Beziehung zu kitten, was denn auch gelang. Weitere zwei Wochen später umarmten wir uns, und die Sache war erledigt. Ob der eine oder andere Worte der Entschuldigung über die Lippen brachte, vermag ich nicht mehr zu sagen.
Ich fand bemerkenswert, dass Papi gleich nach dem Vorfall den Spitalpräsidenten anrief, seinen Freund Georges Leimbacher, und ihn informierte. Damit wollte er wohl unkontrollierbaren Gerüchten zuvorkommen.

Nach der Mittelschule verbesserte ich meine Sprachkompetenz durch ein Jahr Medizinstudium in Genf, ein Jahr als Assistenzarzt in Lugano, drei Monate Fellowship in Loma Linda und später ein knappes Jahr Tätigkeit als Oberarzt in Liverpool.
Ein "Zwischenjahr", also ein Jahr zum Reisen zwischen Mittel- und Hochschule, war zu meiner Zeit kein Thema. Freilich wollten auch wir Ferien machen, feiern und ausspannen, aber das durfte nicht auf Kosten des beruflichen Fortkommens gehen. In die Ausbildung und den Beruf wurde auch die militärische Karriere integriert, möglichst ohne Zeitverlust. Die meisten Studenten waren daher bemüht, alle militärischen Ausbildungen in den Semesterferien zu absolvieren.
Einige Studenten verlegten die obligatorische Rekrutenschule um ein Jahr vor, um diese Pendenz vor dem Studium zu absolvieren. So ging auch ich mit 18 Jahren, im Sommer 1968 in die RS. Im nächsten Sommer folgte die Unteroffiziersschule. Auch eine Dissertation wurde von vielen Studenten ins Studium hineingepackt. Ich nahm diese Aufgabe gemächlicher, in dem ich sie an meiner bezahlten Stelle im Forschungszentrum in Davos angehen konnte.
Im fortgeschrittenen Alter von gegen 60 Jahren verspürte ich eine Sinnkrise und überlegte mir eine berufliche Veränderung. Davon kam ich zum Glück ab. Ich setzte mir neue Ziele ausserhalb der beruflichen Tätigkeit, unter anderem die Teilnahme an einem Marathonlauf. Den ersten lief ich 2004 in Zürich. Darüber habe ich bereits berichtet. Als weitere Massnahme gegen Trübsal erwog ich das Erlernen einer weiteren Sprache. Nach Deutsch, Latein, Französich, Englisch, Italienisch und Spanisch würde es (ohne Berücksichtigung eines Jahres Altgriechisch in Feldkirch) meine siebte. In die engere Wahl kamen Russisch, Arabisch oder Mandarin. Weil ich dachte, Russisch könnte mir in der neuen Praxis am ehesten von Nutzen sein, entschied ich mich für diese Sprache und ich habe die Wahl nie bereut.
Erstmals 2008 belegte ich einen Sprachkurs auf der Krim, die damals noch zur Ukraine gehörte. Valentina Mushinskaya betrieb seit einigen Jahren eine Schule im Dorf Samota etwas westlich von Jalta, etwa zwanzig Minuten zu Fuss von der Schwarzmeerküste entfernt. Bei ihrer Nichte Olena Zvagnina erhielt ich täglich mehrere Privatstunden. In der Freizeit machten wir Ausflüge mit Olenas Ehemann Sergej, der einen klapprigen Lada besass. Wir besuchten Städte wie Jalta, Feodossija oder Paläste aus der Zarenzeit, etwa den ganz in der Nähe gelegenen prächtigen Livadia-Palast. Dort hatten sich am 4. November 1945 Churchill und Roosevelt mit Stalin getroffen, um eine neue Weltordnung zu vereinbaren.
Die Region gefiel mir sehr, Landschaften und Städte waren beeindruckend, die Küche von Valentina sehr lecker. Auch ihr Geschirr gefiel mir, und ich konnte mir nicht vorstellen, dass es aus sowjetischer Produktion stammte. Ein Blick auf einen Tellerboden verblüffte mich aber doch, denn da stand "Hotel Sonne, Küsnacht". Eine ähnliche Aufschrift fand ich auch an meinem Bett. Valentina beeilte sich, mir die Harmlosigkeit des Sachverhalts aufzuzeigen. Eine Frau Guggenbühl aus Küsnacht gehörte zu ihren ersten Sprachschülerinnen. Die Familie hatte fast dreihundert Jahre den schönen Gasthof Sonne betrieben und dann an Urs Schwarzenbach, den Eigentümer des Hotels Dolder in Zürich verkauft. Frau Guggenbühl wusste von den enormen Schwierigkeiten nach dem Zerfall der Sowjetunion und bot Valentina an, sich alles auch Küsnacht zu holen, was sie gebrauchen und irgendwie auf die Krim transportieren konnte. So gelangten Möbel und Geschirr von den Gestaden des Zürichsees an die Schwarzmeerküste!
Im Jahre 2010 belegte ich universitäre Sprachkurse in St. Petersburg. Rahel und Livia sowie Thomas und Franziska mit ihren Familien reisten mir nach, und zusammen fuhren wir per Schiff über die Newa, den Ladogasee und den Onegasee zur Wolga und über den Fluss Moskwa nach Moskau. Wir genossen die schönen Landschaften und Städte sowie die oft zitierten "Weissen Nächte" Ende Juli bei sommerlichen Temperaturen.
Nach der Einnahme der Krim durch Russland verlegte Olena ihre Sprachkurse nach Odessa. Dort genoss ich weitere zweimal zwei Wochen Unterricht. Die Stadt und ihre Umgebung erkundete ich ausgiebig, zum Teil mit Hilfe meines bewährten Reiseführers Sergej. Auch dieses Region wuchs mir ans Herz.
In den Westen der Ukraine reiste ich gegen zehn mal mit Freunden vom Singkreis Herrliberg, um in der ehemals habsburgischen Stadt Uzhgorod nahe der ungarischen Grenze mit dem Kammerchor Cantus zu singen. Ihr Gründer und Leiter Emil Sokach führte jährlich "Masterkurse" für ausländische Sänger durch. Krisztina, Emils ältere Tochter, hatte im ungarischen Debrezen Ökonomie studiert und emigrierte 2014 in die Schweiz. Sie nahm eine Stelle an bei Falu, der Firma unseres Freundes Guy Petignat. "Vorübergehend" wohnte sie bei uns in Herrliberg, in Wirklichkeit wurden es fünf Jahre. Krisztina wurde so zur ukrainischen "Schwester" unserer Mädchen und zur vertrauten Freundin der ganzen Familie.
Über die Jahre hatte ich zwei Länder, Russland und die Ukraine, teilweise kennen und auch lieben gelernt. Viele Freundschaften verbinden mich mit Menschen beidseits der Grenzen. Es erschüttert mich daher sehr, dass nach dem russischen Angriff diese Völker allen Gemeinsamkeiten zum Trotz zu unerbittlichen Feinden geworden sind.
Abgesehen von meinen Sprachaufenthalten erhielt ich etwa zehn Jahre lang Privatstunden bei Elena Stutz, einer Russin, die in Altendorf verheiratet ist und wöchentlich zu einer Doppelstunde in meine Praxis kam. Eine andere Schülerin von Elena, die bereits betagte, aber überragend sprachkundige Yvonne Lang, hatte Russischkenntnisse auf einem ähnlichen Niveau wie ich. Jeweils gleichzeitig absolvierten wir mehrere Examina auf Russisch, zuletzt auf dem Level Telc B2. Die Prüfungen fanden unter strenger Kontrolle in einer Handelsschule in Rapperswil statt. Im Anschluss an die Prüfungen gingen Yvonne und ich zu dritt mit Elena im ausgezeichneten Restaurant Quellenhof zum festlichen Abendessen.
Neben der beruflichen und militärischen Ausbildung verfolgte ich ein paar technische Projekte. Die erste innovative Idee kam mir, als Spikes für Autoreifen erfunden und auch verwendet, aber wegen der Schäden an den Strassen alsbald wieder verboten wurden. Ein Reifen mit einziehbaren Krallen wäre die Lösung, dachte ich. Ich wollte dies mit einem zweiten pneumatischen System erreichen, mit dem sich die Krallen ausfahren und wieder einziehen liessen. Auf dem Patentamt in Bern erfuhr ich, dass bereits ähnliche Patente existierten.
Etwas mehr Glück hatte ich mit einem chirurgischen Instrument. Ich entwarf ein Tunnelliergerät für die Gefässchirurgie. Dabei handelt es sich um einen gebogenen Stab mit Griff und stumpfer Spitze, mit dem ein Blutleiter in den menschlichen Körper hineingezogen werden kann. Typischerweise wird bei Bypassoperationen ein solcher Blutleiter, sei es eine Prothese oder eine körpereigene Vene - zwischen Leiste und Kniekehle mitten durchs Bein verlegt. Zuerst stösst man das Tunnelliergerät durchs Gewebe und zieht dann den daran befestigten Blutleiter in seine Position.
Mein Gerät wies kleine Verbesserungen auf und wurde bald vom Instrumentenbauer Martin in Tuttlingen hergestellt und vom Gefässprothesen-Produzenten Impra vertrieben. Ich erhielt über viele Jahre einen kleinen Obulus, durchschnittlich vielleicht 1000 Franken pro Jahr. Besonders freute ich mich, als ich im Operationssaal in Liverpool als Erfinder begrüsst wurde. Die leitende Operationsschwester meinte, es sei eine Ehre, den Erfinder des mit "Enzeller" angeschriebenen Instrumentes im Hause zu haben.
Eines schönen Winters hatte die Firma Blizzard ein Skimodell mit einer härteren und einer weicheren Kante im Angebot. Durch das Austauschen von links und rechts konnte man sich auf härtere oder weichere Pisten einstellen. Mir kam darauf eine andere Lösung dieses Problems in den Sinn: Ein Ski mit verstellbarer Härte. Ich dachte mir eine Lösung aus, machte Skizzen und kontaktierte die Firma Kästle im vorarlbergischen Hohenems. Man zeigte Interesse, aber die Umsetzung verzögerte sich. Bald ging die Firma ohnehin in Konkurs. Ziemlich genau zehn Jahre später wurde mir bei einem Skitest ein Modell von Völkl vorgestellt, dessen Härte mittels eines Drehknopfes vor der Bindung verstellt werden konnte. Ich war überzeugt, dass jemand von Kästle mit meinen Skizzen zu Völkl gegangen war. Ein befreundeter Anwalt schrieb einen Brief an Völkl, aber ohne Erfolg. Meine Idee war erstens nicht patentiert und lag zweitens bereits zehn Jahre zurück. Dass der Ski auch unter der Ägide des versierten Fabrikanten Völkl nicht zum Erfolg wurde, empfand ich als Erleichterung.
Von grösserer Bedeutung hätte ein System werden können, mit dem ich endoskopisch Gefässprothesen an Körperarterien, etwa die Aorta, anschliessen wollte. Ich führte ein paar Experimente durch und investierte auch Geld für Material und patentrechtliche Angelegenheiten. Als allerdings eine internationale Patentanmeldung zur Debatte stand, zog ich die Reissleine. Die Kosten waren zu hoch im Verhältnis zur Aussicht auf Erfolg.
Nach meinem Wechsel in die private Medizin schien die Gründung einer eigenen Firma vorteilhaft. Im Hirslanden nannte ich meinen Betrieb "Venenzentrum am See". Diese Bezeichnung wurde am neuen Standort in Feldmeilen weitergeführt. Inzwischen war es im Kanton Zürich auch möglich, Arztpraxen als Aktiengesellschaft zu betreiben. So mutierten wir zur AG. Gemeinsam mit Thomas Proebstle gründete ich eine weitere Firma zum Vertrieb von Thermoablations-Kathetern, die ProVena AG. Nach wenigen Jahren wurde aber der Hersteller ClosureFast an Johnson & Johnson verkauft. Diese grosse Firma war in der Schweiz breit repräsentiert und wollte den Vertrieb selber übernehmen. Die ProVena AG wurde daher nicht weiter beliefert, erhielt aber immerhin eine Entschädigung von 100'000 Franken.

Der erste Lohn betrug, wenn ich mich recht erinnere, 3600 Franken. Da ich die familieneigene Wohnung kostenlos bewohnen konnte, war meine finanzielle Lage recht komfortabel.
Etwa eineinhalb Jahre arbeitete ich in Davos.
Mein erstes Projekt betraf Grundlagenforschung. Es ging um die Frage, wie stark eine Stahlplatte, wie sie bei der Osteosynthese verwendet wird, auf einem Knochen haftet. Zu Ihrer Beantwortung entwickelte ich ein Gerät mit einem Kippmechanismus. Der fixe Knochen mit der mobil darauf liegenden Platte wurde geneigt, bis die Platte abglitt. Der Tangens des Gleitwinkels entspricht definitionsgemäss dem "Reibungskoeffizienten". Der Koeffizient wurde unter verschiedenen Bedingungen bestimmt, z.B. mit variablem Anpressdruck oder mit aufgerauten Platten. Die Unterschiede waren gering, der Koeffizient betrug etwa 0.37. Aus dieser Arbeit entstand 1977 meine Dissertation mit dem Titel "Die Reibung zwischen Metallimplantat und Knochen".

Der Flug nach Birmingham war Horror, und Perren sagte mir viele Jahre später, dass er nie einen schlimmeren erlebt habe.
Der Start in Bad Ragaz verlief normal. Über dem Bodensee wurden die Wolken dichter. Wir flogen tief mit Sicht auf den Rhein. Alle Windungen des Flusses mussten wir nachfliegen, um die Orientierung zu behalten. Nördlich von Basel wurden die Wolken dichter. In Kehl überspannt eine Starkstromleitung den Rhein in grosser Höhe, wahrscheinlich 80 m über dem Wasser. Perren flog bewusst unten durch, weil er darüber vielleicht die Orientierung verloren hätte. Noch aufregender wurde es weiter nördlich. Plötzlich fielen alle Instrumente aus, wir hatten keinen Strom an Bord. Perren behielt seine sprichwörtliche Ruhe. Er studierte im Handbuch, wie er das Fahrwerk ohne Elektromotor ausfahren konnte, und fand eine Kurbel. Nach diversen Versuchen, den Strom wieder einzuschalten, entschied sich Stephan für ein "Reset". Er stoppte dafür den Motor. Nach dem Einschalten des Hauptschalters sprang der Motor durch die Wirkung des Luftdrucks auf den Propeller gleich an, und das Stromnetz arbeitete wieder, alle Instrumente taten ihren Dienst.
Im Norden Deutschlands und über dem Ärmelkanal klarte das Wetter auf, und wir hatten eine angenehme Landung in Birmingham. Auch der Rückflug verlief erfreulich.
Eine weitere Reise nach England führte mich nach London. An einem Kongress für Biomechanik, in der Queen Elizabeth Hall rechts der Themse und mitten in der City, durfte ich meine Arbeit über die Reibung zwischen Osteosyntheseplatte und Knochen vortragen. Ich hatte grossen Respekt vor dem internationalen Publikum und hatte mich akribisch vorbereitet. Obwohl die Materie im wahrsten Sinne des Wortes "knochentrocken" war, erhielt ich von den Vorsitzenden Komplimente für die Klarheit meines Vortrags und kräftigen Applaus vom Publikum.
Im Zusammenhang mit meiner Forschungsarbeit über Elektromagnetismus bei Knochenheilung wurde ich ans Institut von Andrew Basset an der Columbia University in New York beordert. Einige Tage verbrachte ich an der Universität. Dann nutzte ich die Gelegenheit, die Ostküste näher kennen zu lernen. Mit Linienbussen von Greyhound reiste ich nach Süden, besuchte Philadelphia, Washington und einige Orte in Florida, u.a. Disney World. Disney hat mir gefallen, später auch Disneyland in Kalifornien und noch mehr der Europapark in Rust unweit von Basel. Dort spricht mich besonders die Inszenierung eines friedfertigen Internationalismus an. Ich besuchte den Park mehrmals mit den Kindern. Nun freue ich mich auf weitere Besuche mit Enkelinnen und Enkeln.
Aus Kalifornien schickte ich damals eine Ansichtskarte an meine Eltern mit der Adresse "Enzler, 8853, Switzerland". Als Nachricht schrieb ich "I am testing the abilities of the Swiss post service". Die Karte kam unverzüglich zuhause an. So lief es manchmal im vordigitalen Zeitalter.
Perren erhielt zahlreiche Einladungen für Vorträge weltweit. Es wurde ihm zu viel. Daher liess er sich manchmal vertreten von Dr. med. dent. Berton Rahn, der am Institut die zahnärztliche Forschung leitete. Aber auch Berton konnte oder mochte nicht so oft reisen. So kam es, dass Perren mich fragte, ob ich Lust hätte... Ja, die hatte ich!
Meine Aufgabe bestand jeweils darin, über Forschungsergebnisse aus Davos zu berichten. Alles drehte sich um die Knochenheilung unter den Bedingungen der operativen Versorgung.
In den folgenden Monaten und Jahren hielt ich Vorträge in Chicago und gönnte mir danach eine touristische Verlängerung nach Montreal, Toronto und zu den Niagara Falls.
Ein andermal ging die Reise nach Sidney. Etwa 24 Stunden dauerte der Flug in drei Etappen. Und obwohl mir ein Sitz in der Business Class offeriert war, hatte ich wohl meine erste Thrombose. Ich nahm das aber zu wenig ernst, liess mich auch nicht behandeln. Die Symptome gingen bald zurück. Inzwischen, nach mehreren weiteren Thrombosen, zuletzt im Zusammenhang mit der Covid-Pneumonie von 2020, weiss ich, dass bei mir eine Thrombophilie vorliegt, also eine gesteigerte Gerinnungsneigung des Blutes aufgrund von zwei oder drei gestörten Gerinnungsfaktoren.
Irgendwann fragte mich Prof. Hans Willenegger, einer der Gründer der AO, ob ich an einem seiner AO-Kurs in Merida, Venezuela, zwei Vorträge halten könnte. Es ging um die Biomechanik der Knochenheilung und um die Behandlung von Schenkelhals-Frakturen. Zur Begründung seiner Frage sagte er, ich spreche doch Spanisch. Weit gefehlt! Ich gestand Willenegger, dass ich an einem dünnen Band von Langenscheidt mit dem Titel "Spanisch in 30 Tagen" arbeite. Er meinte, ich sollte es mir trotzdem überlegen.
Klar reizte mich die Aufgabe. Es war Dezember, und der Kongress in Venezuela sollte im Juni oder Juli stattfinden. Ich machte mir selbst gedanklich zur Bedingung, dass ich die Vorträge von zweimal etwa 30 Minuten Dauer "wenn schon" auf Spanisch halten würde - und auswendig. Nach ein paar Tagen sagte ich zu. Jetzt begann eine unheimlich anstrengende Zeit voller nächtlicher Arbeit neben dem Beruf und mit den grössten Selbstzweifeln. Schliesslich wurde klar, dass ich den zweiten Vortrag über Schenkelhalsfrakturen, wovon ich nur bescheidene theoretische Kenntnisse hatte - alleine nicht schaffte. Da kam mir Gustav Siebenmann zu Hilfe. Er war Hispanist an der Handelshochschule St. Gallen und damals der Schwiegervater meiner Schwester. Er lieferte mir einen Text auf Tonband, den ich annähernd auswendig lernte.
Auf dem Kongress in Merida erhielt ich Lob für meinen ersten Vortrag über die Knochenheilung. Der zweite Vortrag sei auch nicht schlecht, aber "weniger meiner" gewesen, sagte ein Teilnehmer treffend.
Eine weitere Vortragsreise führte nach Johannesburg in Südafrika. Ich war Teil von einem grösseren Team, das von Peter Matter, dem Chefchirurgen aus Davos, angeführt wurde. Peter Holzach, sein Stellvertreter und spätere Nachfolger, war auch Referent, ebenso Alex Staubli, später Chef der Orthopädie in Luzern, und Willy Rittmann von Rorschach.
Neben unseren Verpflichtungen am AO-Kurs besuchten wir in der Umgebung von Johannesburg eine Goldmine. Ein lokaler Arzt lud uns zu einem Besuch im Baragwanath Hospital in Soweto ein. Es handelte sich um das grösste Hospital der südlichen Hemisphäre. Der Besuch war für mich sehr lehrreich. Wir erfuhren, dass täglich bis zu zehn Patienten mit Messerstichen ins Herz dort eingeliefert wurden. Um möglichst viele Leben zu retten, wurden die Herzen im Notfallraum freigelegt, um Zeit zu sparen ohne Desinfektion. Die einleuchtende Begründung lautete, dass nur ein Überlebender eine Infektion riskiere, und dass diese in der Regel gut beherrschbar sei.
Bemerkenswert an unserem Besuch in Soweto fand ich auch, dass der einladende Arzt uns in seinem Rolls Royce ins überaus arme, ausschliesslich von Schwarzen bevölkerte Soweto fuhr.
Im Anschluss an Johannesburg reisten wir weiter und verbrachten gemeinsam einige Tage im Krüger-Park. Die Gruppe war harmonisch und die gemeinsamen Erlebnisse brachten uns einander näher. Das war wohl auch der Grund, weshalb mich Willy-Werner nach Rorschach und später nach St. Gallen engagierte.
Anno 1985 durfte ich als Vertreter des Forschungsinstituts nach Indien reisen, um in Delhi und in Mumbay, im vornehmen Taj Mahal Hotel, Vorträge zu halten. Das Hotel erlangte 2008 traurige Berühmtheit durch terroristische Angriffe, die es teilweise zerstörten.
Eine weitere Vortragsreise führte mich 1987 mit dem bekannten Tübinger Professor Sigfried Weller nach Semerang in Indonesien. Darüber berichte im Zusammenhang mit meiner Heirat mit Rahel.
Somit habe ich durch meine Arbeit in Davos schon in jungen Jahren die Gelegenheit erhalten, Länder auf allen Kontinenten zu besuchen: Südafrika, die USA, Venezuela, Indien, Indonesien, Australien und verschiedene Destinationen in Europa.

Durch Vermittlung von Perren lud mich Allgöwer zu einem Vorstellungsgespräch am Kantonsspital Basel ein. Alle wichtigen Leute - damals lauter Männer - waren anwesend, ausser Allgöwer als Departementsvorsteher die Professoren Morscher (Orthopädie), Weibel (Gefässchirurgie), Pfeiffer (Handchirurgie) und einige Leitende Ärzte, darunter Peter Tondelli (später Chefarzt im St. Claraspital), Udo Steenblock (später Chefarzt in Bad Säckingen), Pietro Regazzoni und weitere. Ich erhielt die begehrte Stelle und freute mich auf den Antritt zum Jahresanfang 1977.
Die erste Einteilung im grossen Team der Chirurgie war ein Schock: Die Intensivstation! Als erste Aufgabe wurde ich mit dem Abschluss einer langwierigen Krankengeschichte beauftragt. Die Patientin hatte monatelang auf der Intensivstation gelegen und war schon vor Tagen verstorben. Mein Vorgänger hätte die Arbeit längst erledigen müssen, hat es dann aber vorgezogen, unverrichteter Dinge die Abteilung zu wechseln. Ich fand die Aufgabe furchtbar schwierig, zumal ich noch keine Ahnung hatte von Intensivmedizin und der ganzen Terminologie. Tagelang muss ich daran gearbeitet haben. Erst später kam mir der Gedanke, dass ich mir die Aufgabe auch hätte leichter machen können.

Die Ausbildung zum Facharzt für Chirurgie dauerte 6 Jahre. Meistens rotierte man alle 6 Monate von einer Stelle zur anderen. Nach den ersten Rotationen auf der Intensivstation und auf der Notfallstation erfolgten weitere auf der Poliklinik und im Kantonsspital Bruderholz unter dem Titel "Gefässchirurgie". Diese Bezeichnung war reichlich vermessen, denn unsere Beschäftigung mit diesem sich rasch entwickelnden Fach beschränkte sich damals weitgehend auf die Behandlung von Krampfadern.
Anschliessend arbeitete ich ein Semester im Kinderspital, damals idyllisch am Südufer des Rheins gelegen. 1981 folgte das zum Curriculum gehörende "B-Jahr", also ein Jahr chirurgischer Tätigkeit in einem kleineren Spital. Ich hatte mir die Chirurgie am Ospedale Italiano di Lugano gewünscht und die Stelle auch erhalten.
Nach dem B-Jahr ging es zurück an die Alma Mater in Basel, wieder mit halbjährlichen Rotationen. Ich kam auf eine von zwei chirurgischen Stationen unter Leitung von Peter Tondelli, danach erneut ins Bruderholz, dann auf die Halbprivatstation am Kantonsspital.
Am Ende des Curriculums konnte man den Spezialarzt-Titel für "Chirurgie FMH" beantragen. Voraussetzung war ein genügender Katalog von selber durchgeführten Operationen. Bei mir war er knapp, wie bei den meisten Kollegen. Mein grösster Mangel betraf die geforderten zehn Operationen an der Schilddrüse. Ich hatte zunächst gar keine vorzuweisen. Angesichts dieser Notlage liess mich Chef Allgöwer drei seiner privaten Patienten operieren und assistierte mir dabei. Die weiterhin fehlenden sechs oder sieben Schilddrüsen-Operationen konnte ich mit Varizen und Shunt-Operationen wettmachen. Als "Shunt" bezeichnet man eine operative Verbindung zwischen einer Arterie und einer Vene, meist am Arm. Diese Verbindung lässt die Vene anschwellen, und nach einigen Wochen oder Monaten kann sie für die regelmässigen Venen-Punktionen bei der Hämodialyse verwendet werden. Mit dem nun aufgebesserten Operationskatalog erhielt ich Mitte 1984 den Titel "Spezialarzt für Chirurgie FMH".
Nun hoffte ich auf eine Oberarzt-Stelle. Als Thomas Rüedi und Adrian Leutenegger als Chefärzte ans Kantonsspital Chur gewählt wurden, boten sie mir die Möglichkeit, dort als Oberarzt einzusteigen. Mein Gespräch mit Allgöwer brachte mich davon ab. Er meinte, dass ich mich selbst degradieren würde. Er überschätzte dabei offenbar meine Chancen bei seinem Nachfolger Felix Harder. Dieser machte mir schon bald darauf klar, dass mir andere Kandidaten bei der Beförderung zeitlich vorgezogen würden, insbesondere mein Freund Christoph Ackermann, oder Michael Heberer. Also musste ich auch weitere Stellen ausserhalb der Universität in Betracht ziehen.

Auf Rat von Roland Rüegger bewarb ich mich - zunächst erfolglos - bei Prof. Hannes Schwarz im Limmattal-Spital. Dann kam ein Angebot von Prof. Willy-Werner Rittmann aus Rorschach, den ich von der gemeinsamen Reise nach Südafrika kannte. "WW" lockte mich mit der Aussage, dass er Chancen habe, in St. Gallen Chefarzt zu werden. Ich könnte dann mitziehen und mich auf die Gefässchirurgie spezialisieren, mit der Aussicht auf eine leitende Stelle. WW bot mir an, dass ich meine Kenntnisse bei seinem Freund Louis Smith am Loma Linda Hospital im südlichen Kalifornien verbessern könnte. Das schien mir attraktiv, und Alternativen sah ich kaum, also nahm ich sein Angebot gerne an.
Ursprünglich zogen wir einen Aufenthalt in Loma Linda mit der ganzen Familie in Betracht, obwohl das auch finanziell eine Herausforderung geworden wäre. Nach einer unharmonischen Silvesterfeier mit der ganzen Familie Knutti auf dem Jakobshorn in Davos beschlossen wir, dass ich zunächst alleine nach Loma Linda reise.
Die Universität von Loma Linda und die dazugehörigen Krankenhäuser waren im Besitz der freikirchlichen Glaubensgemeinschaft der Adventisten. Sie genossen einen ausgezeichneten Ruf. Mein Chef und Mentor hiess Louis Smith. Er war ein religiöser Mann und führte das Leben eines Gerechten. Seine Frau Marguerite, meist Mag genannt, und die einzige Tochter Patty taten es ihm gleich. Patty war damals schon verheiratet mit Richard Catalano, einem ebenfalls in Loma Linda tätigen Traumatologen. Die beiden wohnten in der Nähe von Louis und Mag und hatten zwei Kinder im Vorschulalter, Andy und Lisa.
Smiths bewohnten ein schönes Einfamilienhaus mit Garten und Swimmingpool in Redlands, einer wohlhabenden Gemeinde unweit von Loma Linda. Bei meiner Ankunft stellte man mir in Aussicht, ich könne ein paar Tage bei Familie Smith wohnen, bis ich eine passende Unterkunft gefunden hätte. Das Zerwürfnis mit Esther beschäftigte aber auch die Smiths, und so luden sie mich ein, die ganzen drei Monate in ihrem Haus zu verbringen.
Ich verbrachte die ersten drei Monate des Jahres 1985 in Loma Linda. Zehn Jahre zuvor hatte ich in Bern auch ein US-amerikanisches Staatsexamen abgelegt namens „ECFMG“ (Educational Commission for Foreign Medical Graduates). Daher hatte ich gehofft, selber ärztlich tätig werden zu dürfen. Dies traf dann aber in Kalifornien absolut nicht zu. Ich verbrachte aber praktisch Tag und Nacht in der unmittelbaren Umgebung von Louis Smith, angefangen beim täglichen Jogging morgens um sechs. Ich konnte ihm jede Menge Fragen stellen, die er stets geduldig und kenntnisreich beantwortete. In der freien Zeit las ich die über zweitausend Seiten des gefässchirurgischen Standardwerks "Vascular Surgery" von Robert Rutherford. Bei meiner Rückkehr in die Schweiz fühlte ich mich mindestens theoretisch gut gewappnet für die neue Aufgabe.
Im April 1985 trat ich meine Stelle als Oberarzt im Spital Rorschach an. Die Tätigkeit umfasste vor allem die allgemeine Chirurgie. Gefässchirurgische Eingriffe waren eher selten und umfassten die Anlage von arterio-venösen Fisteln für die Hämodialyse nach Nierenversagen sowie arterielle Bypassoperationen bei Arteriosklerose an den Beinen.

Der Umzug in die Ostschweiz war zeitlich mit dem Scheitern meiner ersten Ehe mit Esther verbunden. Sie wäre vielleicht gerne mit nach Loma Linda gekommen, aber angesichts vorangegangener Streitigkeiten und angesichts der finanziellen Lage war ich dagegen.
Wir hatten bereits eine geräumige Wohnung mit fünfeinhalb Zimmern in der Gemeinde Rorschacherberg gemietet. Inzwischen betrachteten wir beide die Ehe als gescheitert. Die Wohnung war für mich allein zu gross und zu teuer. Ich konnte sie also nicht beziehen, musste aber gemäss Vertrag drei Monate Miete entrichten. Ich fand eine kleine, aber neue und gefällige Wohnung in Horn, etwa 5 km westlich von Rorschach. Zur Arbeit fuhr ich nun meistens mit dem Velo.
Die Arbeit in Rorschach war harmonisch und lehrreich. Ich fühlte mich umgeben von empathischen Menschen. Zum guten Teamgeist trugen WWs Charisma und Optimismus bei, aber auch die Internisten, der Chefarzt Pius Bischof und seine Stellvertreterin Christa Meyenberger. Anfang 1986 lernte ich im Spital Rorschach meine spätere Frau Rahel kennen, was dem Leben zusätzlichen Reiz verlieh. Darüber berichte ich später.
Wie erwartet, trat in dieser Zeit der viszeralchirurgische Chefarzt am Kantonsspital St. Gallen, Prof. Rudolf Amgwerd, altershalber zurück und seine Stelle wurde ausgeschrieben. Rittmann bewarb sich, gewählt wurde aber Hans Säuberli. Er hatte seine berufliche Laufbahn eindeutig auf die Viszeralchirurgie ausgerichtet und war Chefarzt am (kleineren) Kantonsspital Zug. Rittmann wurde dagegen schon seit seinen Basler Zeiten nachgesagt, er hätte gerade bei viszeralchirurgischen Eingriffen mehr Komplikationen als andere. Dies wurde auch damit erklärt, dass er sich in seiner Karriere überwiegend mit Knochenbrüchen befasst hatte.
Überraschend machte der gewählte Säuberli einen Rückzieher. Ob WW dabei eine Rolle gespielt hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich erfuhr vom Rückzug in der Sauna des Hotels Waldau in Rorschach vom Urologen Gian Tomamichel. Gleich nach der Begegnung rief ich WW an und berichtete ihm über die neue Entwicklung. Dies schien mir wichtig, weil WW am selben Abend zu einem AO-Kurs nach Davos aufbrach, wo er u.a. auf den orthopädischen Chefarzt des KS St. Gallen, Bernhard (Hardy) Weber traf. Weber war auch Chef der Wahlkommission für die Stelle in St. Gallen und somit der "Königsmacher" . Ich wollte WW davor bewahren, Hardy mit Vorwürfen zu begegnen. Das hat er beherzigt und war mir dankbar für den Tipp.
Im zweiten Anlauf wurde WW zum Chefarzt der Viszeralchirurgie am Kantonsspital St. Gallen gewählt. Mir stellte er die Stelle eines Leitenden Arztes für Gefässchirurgie in Aussicht, verständlicherweise ohne zeitliche Angabe. Diese Position war besetzt von Danko Sege, der schon lange kompetent und loyal unter Rudolf Amgwerd gearbeitet hatte. Auch WW gegenüber erwies sich Sege als sehr loyal. Er gestattete sich höchstens ab und zu ein Augenrollen.
Die Wahl von WW wurde von vielen Seiten skeptisch betrachtet und kommentiert. Etwa die bisherigen Oberärzte opponierten im Hintergrund, manchmal auch offen. Ich selber hatte auch meine Zweifel, ob WW der richtige Mann war für diesen Posten. In dieser Zeit spazierte ich einmal mit meinem Vater im Gebiet des Lachner Flugplatzes. Als ehemaliger chirurgischer Chefarzt in Lachen war er durch seine Bekanntschaft mit dem abtretenden Amgwerd und seine Freundschaft mit dem ehemaligen Gesundheitsdirektor des Kantons St. Gallen, Gottfried Hobi, gut vernetzt und an den Ereignissen sehr interessiert. Er fragte mich, wie ich die Wahl von WW einschätze. Unter dem Siegel der Verschwiegenheit antwortete ich sinngemäss, dass ich WW dankbar sei für seine Förderung, und dass ich mich auf die neue Aufgabe in St. Gallen freue. Allerdings sei ich nicht überzeugt, dass er für die neue Aufgabe der richtige Mann sei. Schon auf seinem Posten in Rorschach hatte er sich beim einen oder anderen viszeralchirurgischen Eingriff übernommen.
In den ersten Tagen nach dem Stellenantritt gewann WW ein paar Etappensiege mit guten Auftritten und Voten, denen eigentlich niemand guten Gewissens widersprechen konnte. Ich war erleichtert und zuversichtlicher. Doch schon bald traten operative Komplikationen in den Vordergrund, besonders nach Operationen an der Speiseröhre, die WW so gerne zu seinem Steckenpferd gemacht hätte. Für die ersten Eingriffe dieser Art reiste jeweils der international renommierte Jörg Rüdiger Siewert vom Universitätskrankenhaus "Rechts der Isar" in München an. Anschliessend an die gemeinsamen Eingriffe brillierte WW mit Gastfreundschaft, Liebenswürdigkeit und launigen Reden. Im Laufe einiger Monate operierte WW zunehmend selbstständig - und steigerte dabei die Komplikationsrate. Dessen ungeachtet hatte WW einen unbändigen Drang, für seine Chirurgie bei Speiseröhrenkrebs zu werben. Dazu dienten auch Fortbildungen für Hausärzte.
Gleichzeitig sammelten einige Gegner belastendes Material. Besonders aktiv waren ein Oberarzt-Kollege und Personal auf der Intensivstation.
Leider kann ich mich nicht mehr an den zeitlichen Ablauf der Ereignisse erinnern. Irgendwann, vielleicht Anfang 1989, wurden behördliche Ermittlungen gegen WW aufgenommen. Zudem wurde eine ärztliche Untersuchungskommission bestimmt, und mein "alter Bekannter" Prof. Hannes Schwarz vom Limmattal-Spital, zu ihrem Präsidenten. Schwarz erinnerte sich an meine Bewerbung etwa vier Jahre zuvor. Statt mir hatte er damals Roland Rüegger die Stelle gegeben. Rüegger kannte ich von unserer gemeinsamen Zeit als Assistenten in Basel. Zufällig war Rüegger gerade zum chirurgischen Chefarzt des Kantonalen Spitals Uznach gewählt worden. Da lag es nahe, dass mir Schwarz jetzt dessen frei werdende Stelle als Oberarzt am Spital Limmattal anbot. Ich nahm sie gerne an, zumal es in St. Gallen zunehmend eng wurde - primär natürlich für WW. Meine Kündigung in St. Gallen kommentierte Prof. Michael Härtel, der Chef der Radiologie mit den Worten: "Ja, ja, Herr Enzler, die Ratten....". Die zweite Hälfte des Sprichworts - "verlassen das Schiff" - brauchte er gar nicht auszusprechen. Wir lächelten uns gegenseitig bedeutungsvoll zu.
Für WW war mein Abgang natürlich ein Treuebruch. Er wird gedacht haben, Schwarz hätte mich angeworben, um gegen WW auszusagen. Dieser Gedanke kam mir, als wir ein oder zwei Jahre später bei einer Feier zu Ehren Allgöwers an der Uni Zürich zusammentrafen. Ich wollte WW und seine Frau Ursi freundlich begrüssen, aber beide wandten sich zu meiner Überraschung von mir ab.
In Wirklichkeit war alles ganz anders. Schwarz hatte mir die Stelle angeboten, weil mir schon Jahre davor in Aussicht gestellt hatte, bei einer nächsten Gelegenheit auf mich zurückzukommen. Zudem sagte er, dass er mich nicht als Zeugen einvernehmen wolle, um meine Loyalität WW gegenüber nicht auf die Probe zu stellen. Ich hatte WW tatsächlich einiges zu verdanken. Die Position von Schwarz empfand ich damals wie heute als "nobel".
WW wurde veranlasst, seine Stelle in St. Gallen aufzugeben. Ob er noch die Chance bekam, von sich aus zu kündigen, weiss ich nicht. Bald schon bekam er aber eine neue, annähernd gleichwertige Stelle am Kantonsspital Liestal. Dem vorausgegangen war der altersbedingte Rücktritt von Prof. Mario Rossetti. Rittmann wurde bei seinem Stellenwechsel unterstützt von seinen künftigen Mitbewerbern am Departement Chirurgie am Kantonsspital Basel. So konnte er seine Funktion bis zum Pensionsalter ausüben. Noch in St. Gallen gab es allerdings ein dramatisches medizinisches Zwischenspiel. Beim Tanzen an einem Personalfest brach WW zusammen und war bewusstlos. Man diagnostizierte einen Herzinfarkt mit Perforation der Herzwand. Es gelang, ihn ans Universitätsspital Zürich zu transportieren, wo er von Prof. Marko Turina erfolgreich operiert wurde.
Gerne hätte ich meine Erinnerungen an die turbulente Zeit in St. Gallen überprüft und ergänzt durch Konsultation von Einträgen im Internet. Alles, was ich zu Thema fand, war ein Eintrag unter "Digitaler Lesesaal des Staatsarchivs St. Gallen". Er beinhaltet die Titel, die Namen und die Lebensspanne von WW (1938 - 2013). Dann: "Ergebnis der Abklärungen und weiteres Vorgehen". Und weiter: "Schutzfrist 100 Jahre" - bis 14.11.2089. Weitere sachdienliche Informationen fand ich keine.


Neben mir gab es am Limmattal drei weitere chirurgische Oberärzte, Heinz Hasler, Rolf Ruckert und Thomas Kehl. Wir waren alle gleichgestellt und hatten kaum Auseinandersetzungen.
Hannes Schwarz war ein zurückhaltender Mann, als Standespolitiker wie auch als Chirurg sehr vorsichtig. Wir schätzten ihn hoch, fanden ihn aber manchmal zu zögerlich. Wir hatten zudem den Verdacht, dass er etwas unter dem Regiment seiner Gattin Regula litt. Er war sehr formal und begrüsste jeden seiner Ärzte beim Morgenrapport mit Handschlag und mit der Anrede "Herr Doktor" oder "Frau Doktor". Ein besonderes Kennzeichen war, dass er seinen Stellvertretern in hohem Mass vertraute. Manchmal hätte man ihn in schwierigen Situationen, zum Beispiel bei nächtlichen Notfalloperationen, gerne zur Seite gehabt. Er ermutigte uns aber in solchen Fällen jeweils, nach unserem eigenen Gutdünken zu handeln. Im weiteren Verlauf verhielt er sich dann aber stets loyal und kritisierte selten.
Ein weiteres Merkmal seiner Amtsführung war seine Grosszügigkeit. Jeder Oberarzt erhielt pro Jahr etwa 40'000 Franken aus einem Fond, der von Privathonoraren gespeist wurde. Finanziell war ich jetzt also besser gestellt denn je zuvor.
Schwarz war stets der Meinung, dass ich mich habilitieren sollte. Dazu hatte mir bereits Rittmann in Rorschach und St. Gallen geraten, aber seine Bemühungen bei Felix Harder an der Uni Basel trugen keine Früchte. Schwarz war mit seinen Avancen an der Uni Zürich erfolgreicher. Er überreichte meine Arbeit "Der in situ-Bypass" dem Vorsteher des chirurgischen Departementes, Prof. Felix Largiadèr.
Unter "in situ"-Bypass versteht man eine damals wiederentdeckte und weiterentwickelte Technik zur Umgehung verstopfter Arterien mit einer körpereigenen Vene, meistens der "Vena saphena magna" (VSM). Diese Vene verläuft vom Innenknöchel entlang der Innenseite des Beines bis zur Leiste.
Ich beginne die Erklärung mit der geläufigen Bypass-Technik. Dabei wird die Vene (VSM) zunächst operativ aus dem Körper entfernt und - wegen ihrer Klappen, die ja nur eine Flussrichtung in Richtung zum Herzen zulassen - von oben nach unten gekehrt. Dann wird die Vene mithilfe eines Tunnelliergerätes wieder in den Körper hinein verlegt und an zwei Stellen - proximal und distal der Obstruktion - an Arterien angeschlossen. Danach kann Blut durch die Vene nach distal, also in die Peripherie fliessen.
Ganz anders bei der "in situ"-Technik. Hier wird die Vene (VSM) in ihrem Bett belassen, eben "in situ". Sie wird also nicht umgedreht. Sie wird aber ebenfalls proximal und distal der verstopften Arterien mit je einer offenen Arterie verbunden. Jetzt verhindern aber noch die Venenklappen, die ja nur den Fluss nach proximal zulassen, den Blutfluss nach distal. Die Schliessfunktion der Klappen muss daher zerstört werden. Dies gelingt mithilfe feiner Klinken, die an einem Draht durch die Lichtung der Vene gezogen werden und die Klappensegel aufschlitzen. Danach kann Blut über die Vene in die Peripherie fliessen.
Largiadèr reagierte positiv auf meine Anfrage und schlug vor, dass ich zu einem späteren Zeitpunkt nach Zürich wechseln und mich mit meiner "schönen Publikation" habilitieren solle. Die Arbeit war 1990 mit dem Schweizer Angiologie-Preis prämiert worden. Kollege Heinz Hasler hatte mich auf die Ausschreibung des Preises aufmerksam gemacht.

Felix schien geneigt, mich mittelfristig zum Nachfolger von Brunner und somit Leiter der Gefässchirurgie aufzubauen.
Meine Habilitation hätte somit eine Formalität sein können. Meine Tätigkeit als Oberarzt am USZ dauerte zunächst knapp drei Jahre. Dabei hatte ich regelmässig Dienst zu leisten als Oberarzt des Departementes, hatte also auch traumatologische und viszeralchirurgische Notfälle zu betreuen, gegebenenfalls mit Unterstützung aus den entsprechenden Abteilungen. Diese Tätigkeit verlief unspektakulär, ohne grosse Triumphe, aber auch ohne nennenswerte Komplikationen. Deshalb fragte ich den Departementsvorsteher Largiadèr, ob er einen Auslandaufenthalt zu meiner Weiterbildung in Gefässchirurgie unterstützen würde. Ein Aufenthalt an einer renommierten ausländischen Klinik, oft in den USA, war wie ein Ritterschlag und leitete in aller Regel einen Karriereschritt ein. Largiadèr bejahte ohne zu zögern. Nun fragte ich, ob ich nach meiner Rückkehr eine leitende Stelle erwarten könne. Ja, antwortete Largiadèr, nach dem altersbedingten Rücktritt von Urs Brunner in ein bis zwei Jahren. Auch meine nächste Frage nach der Berechtigung zum Bezug von Privathonoraren wurde ohne Umschweife bejaht. Nun wollte ich noch wissen, ob denn auch Professor Turina damit einverstanden wäre. Da streckte der kleine Mann auf seinem Stuhl seinen Rücken und sagte bedeutungsvoll: "Herr Enzler, das ist immer noch eine departementale Entscheidung"! Damit meinte er, seine eigene, und er sollte sich irren. Zwar freute ich mich, das zu hören, aber ich traute der Sache nicht. Zu sehr fürchtete ich Ablehnung und die Ränkespiele des mächtigen Turina. Von mehreren Seiten hatte ich gehört, dass er jeden blockiert, der seinem Imperium zu nahe kommt. Und zu seinem herzchirurgischen Reich zählte er - entgegen dem inzwischen international etablierten Standard - fraglos die Gefässchirurgie.
Zu meiner Absicherung sprach ich vor meinem Auslandaufenthalt mit dem Direktor der in Zürich führenden Privatklinik Hirslanden, Felix Ammann. Er reagierte sehr positiv und sagte mir seine Unterstützung zu, falls ich in seine Privatklinik wechseln wollte.
Für eine so wichtige Fortbildung im Ausland war es wichtig, eine gute Adresse auszuwählen. Ich hatte Peter Harris aus Liverpool bei Vorträgen in Barcelona und in Lausanne sprechen gehört und war von seinen didaktischen Fähigkeiten, aber auch von seinem Charme sehr angetan. Er leitete einen sehr aktiven und innovativen gefässchirurgischen Betrieb. Peter war einer von drei Consultants der gefässchirurgischen Abteilung am "Royal Liverpool Hospital". Also fragte ich ihn, ob ich mich beim ihm bewerben könnte. Ich erklärte ihm dabei offen, dass meine Ausbildung Defizite aufweise, die ich in Zürich nicht wettmachen könne. Sie betrafen vor allem die Chirurgie der Bauchschlagader (Aorta), insbesondere die Operation von Aneurysmen (Ausweitungen), und der Halsschlagader (Carotis), deren fortgeschrittene Einengungen (Stenosen) manchmal operativ behoben wurden zur Vermeidung von Hirnschlägen. Die Aorta und die Carotis gehörten am USZ zum Hoheitsgebiet der Herzchirurgie. Dies war nicht nur für mich persönlich ein Ärgernis, sondern im übrigen Europa und in den USA unüblich und zerstörte die Chancen von potenziellen Kandidaten aus der Schweiz für gefässchirurgische Stellen im Inland und erst recht im Ausland.
Peter Harris antwortete sehr freundlich und wir vereinbarten meinen Stellenantritt im Februar 1995.

Wir wollten alle gerne weiter im Haus in Urdorf wohnen, auch als ich meine Stelle am USZ angetreten hatte. Oft fuhr ich auch jetzt mit dem Velo zur Arbeit und brauchte dafür eine gute halbe Stunde. Der Weg führte von Urdorf durch Schlieren zum südwestlichen Ufer der Limmat. Ungeachtet des Fahrverbots fuhr ich dem Fluss entlang bis Zürich, dort über den Lettensteig mitten durch die damals international berüchtigte Drogenszene, dann über die Stampfenbach-, Hochfarb- und Leonhardstrasse zum USZ. Zeitweise konnte ich am USZ auch einen Parkplatz beanspruchen, wenn ich wegen der Witterung oder wegen Zeitmangels mit unserem Zweitwagen nach Zürich fuhr, einem Peugeot 205 Cabrio.
Vor dem Stellenantritt in Liverpool wurde der Peugeot durch einen Fiat Punto Cabrio ersetzt. In ihm fuhr ich nach Calais und mit der Fähre nach Dover. Ob ich unterwegs übernachtet habe, weiss ich nicht mehr. Via die Autobahn M6 gelangte ich in weiteren fünf oder sechs Stunden nach Liverpool. Dort belegte ich ein bescheidenes Zimmer in einem Hochhaus, das primär von Nurses, also von Pflegefachleuten, bewohnt war. Im grossen Hauptgebäude des Royal Liverpool Hospital musste ich mich erst mal durchfragen, bis ich die Abteilung des "Mister Harris" auf dem 7. Stock endlich fand. Ich war erstaunt über deren Kleinheit. Neben dem Chef gab es zwei Chirurgen, deren Ausbildungsstand etwa meinem entsprach, John Brennan und Tony da Silva. Zusätzlich arbeiteten dort zwei oder drei "Interns". Sie betreuten die Patienten und deren Dossiers auf den Abteilungen ohne das Ziel einer gefässchirurgischen Ausbildung. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir Shamim Rose, ein hübsche Inderin, die mit einem englischen Arzt verheiratet war und bereits zwei Kinder hatte. Zu meiner Überraschung kontaktierte sie mich Ende 2022. Sie kam nach Zürich, und wir verbrachten einen Abend zusammen. Gemäss ihrem Wunsch assen wir Fondue - in der Cave Valaisanne.
Bevor ich in Liverpool eine ärztliche Tätigkeit aufnehmen konnte, musste ich eine staatliche Bewilligung einholen. Das konnte nicht vor Ort geschehen, sondern bei einer nationalen Behörde in Croyden, südlich von London. In einem Tag schaffte ich knapp die Hin- und Rückfahrt im Zug und das Einholen der Bewilligung.
Danach ging es für mich zügig voran. Regelmässig assistierte ich Peter Harris, seltener auch den beiden anderen Consultants. Schon bald liess man mich selbstständig Bypassoperationen durchführen, dann auch Operationen von Aortenaneurysmen. Bemerkenswerterweise wurde man bei diesem Eingriff jeweils von nur einer Person ohne chirurgische Ausbildung unterstützt, oft von der australischen Libby, von der indischstämmigen Shamim oder gelegentlich von Tony, der aus Brasilien stammte. Entscheidend war dabei der Einsatz eines sehr effizienten, ausgeklügelten Systems von Retraktoren mit dem Markennamen "Omnitract". Haken verschiedener Tiefe und Breite wurden an einem zuvor fixierten Rahmen befestigt.
Ich empfand den Omnitract als grossen Vorteil gegenüber der Zürcher Gepflogenheit, drei oder vier Assistenten an den Operationstisch zu verknurren.
Operationen an der Halsschlagader (Carotis-Endarteriektomien) waren selbst in Liverpool nicht häufig. Dafür fuhren Peter und ich jeweils zum auswärtigen, neurochirurgischen Walton Hospital. Meistens standen an einem Tag zwei Eingriffe auf dem Programm, von denen Peter jeweils den ersten durchführte. Schon bald fing er an, mir bei jedem zweiten Eingriff zu assistieren.
Ausser der operativen Tätigkeit hatten wir an mindestens zwei Nachmittagen pro Woche eine gut frequentierte Sprechstunde zu bewältigen. Das war für mich zunächst eine grosse sprachliche Herausforderung. Die meisten Patienten waren ungebildet und redeten in ihrem schwer verständlichen Dialekt, "Scouse" genannt. Die Sprechstunde brachte auch eine ausführliche Korrespondenz mit den zuweisenden Ärzten und anderen involvierten Spezialisten mit sich. Das war anfänglich recht schwierig, aber alles gelang, nicht zuletzt dank der tüchtigen Sekretärin Susan Needham, die meine Diktate zurechtbog.
Nach einem knappen Jahr war ich fast ein "Liverpudlian" geworden, und ein Oberarzt-Kollege verpasste mir einmal den Titel eines "Honorary Scouser". Mir war noch wichtiger, dass ich einen respektablen Operationskatalog zusammengebracht hatte. Andere Schweizer waren davon beeindruckt und strebten ebenfalls Stellen in Liverpool an, etwa Matthias Widmer, später Leitender Arzt am Universitätsspital Bern, und Bettina Marty, die später eine Chefarztstelle in Fribourg erhielt.
Etwa im Mai 1995 kam auch meine Familie nach Liverpool. Ich hatte intensiv nach einer attraktiven Wohnung gesucht und sie in Birkenhead gefunden, auf der gegenüberliegenden Seite des River Mersey. An der "Priory Wharf" gab es eine neuere Siedlung, die direkt am Wasser gelegen war. Sie bot einen spektakulären Ausblick auf Liverpool und auf vorbeiziehende Tanker, die ihre Fracht weiter flussaufwärts in Ellesmere Port löschten. Für mich war es eine grosse Freude, meine stinkige Studentenbude zugunsten unserer schönen Wohnung zu verlassen und wieder gemeinsam mit meinen drei Mädchen zu leben.
Unser soziales Leben war recht abwechslungsreich. Vera und Livia waren 5 und 4 Jahre alt und besuchten eine Nursery, einen Vorkindergarten. Wir waren ziemlich regelmässig im schönen Haus von Peter und Carol Harris im Norden von Liverpool eingeladen und luden sie zu Gegenbesuchen an die Priory Wharf ein. Beide waren uns zugetan, und das war glücklicherweise gegenseitig. So kam das Ehepaar im Dezember 1999 zur Feier meines 50. Geburtstags auf die Schatzalp in Davos. Und einige Jahre später besuchten wir sie in ihrem Anwesen in St. Tropez.
Gelegentlich erhielten wir Besuch aus der Schweiz. Peter Harris beriet mich jeweils im Hinblick auf gemeinsame Ausflüge. Als Mami und Gotte Gret uns besuchten, empfahl er den Lake District. Zu sechst reisten wir im kleinen Fiat Punto dorthin. Wir wohnten im romantischen Dorf Grasmere am gleichnamigen See und nächtigten in einem hübschen Hotel, das den Namen von William Wordsworth trug. Wordsworth hatte die Schönheit des Lake District in vielen Gedichten besungen. Auch uns hat der Lake District sehr gefallen. Es handelt sich um eine karge, wilde Gegend, die stellenweise fast hochalpin anmutet. Die lieblichen Seen sind aber von einer reichen Flora umgeben, Rhododendren und zahllose andere Pflanzen gedeihen hier prächtig.
Als Viola, die Schwester von Rahel, mit ihrem Sohn Philippe anreiste, war North Wales unser Ziel. Per Auto fuhren wir nach Llangollen (sprich: Chlanggochlen). Dort bestiegen wir ein für Grossbritannien seit etwa 1750 typisches Transportmittel, ein Narrowboat. Wie der Name andeutet, sind diese Boote nur etwa 2.2 m breit, aber unseres war etwa 18 m lang. Die Kanäle waren nur wenig breiter, und entgegenkommende Schiffe konnte man nur an dafür vorgesehenen Stellen kreuzen. Unsere Reise dauerte etwa vier Tage und führte durch liebliche Weiden, durch Tunnels und über spektakuläre Brücken. Am eindrücklichsten fanden wir den schiffbaren Pontscysyllte Aqueduct, der uns in über 30 m Höhe über den River Dee führte. Man schlief, kochte und ass bequem auf unserem Schiff. Als Nachteil empfand ich, dass ich als Steuermann stets nahe beim Heck stehen musste, mehr als 10 m entfernt von der Familie, die den Aufenthalt im Bug vorzog.
Andere Reiseziele, etwa mit den Eltern von Rahel, waren die nahe gelegene, hübsche Stadt Chester römischen Ursprungs. Auch York, ebenfalls eine ehemalige Römerstadt, war ein lohnendes Reiseziel.
Nördlich von Liverpool gefiel uns ein langer Sandstrand namens Freshfield. Er brauchte keinen Vergleich zu scheuen mit der Bretagne oder mit Sylt. Für den abendlichen Ausgang an warmen Sommerabenden liebten wir ein gemütliches Restaurant in West Kirby, im Mündungsgebiet des (oben erwähnten) River Dee.
Im Sommer verbrachten wir zwei Wochen in Irland mit Freunden aus Urdorf, Claudio und Beatrice Amann, mit ihren und unseren Kindern.
Im Herbst 1995, vermutlich im September, kontaktierte mich Rolf Schlumpf, Oberarzt am Departement Chirurgie am USZ, und fragte nach meinen An- und Abwesenheiten. Er benötigte meine Angaben für die Erstellung des Plans für den Oberarztdienst. Mich traf fast der Schlag, denn ich sollte ja als leitender Arzt zurückkehren ohne Verpflichtungen beim Oberarztdienst. Ich telefonierte gleich darauf mit dem Departementsvorsteher. Largiadèr informierte mich, dass Turina mich zunächst auf seiner herzchirurgischen Abteilung als Oberarzt einstellen und besser kennenlernen möchte. Das sei doch auch eine Chance. Mir schien dagegen völlig klar, dass das nichts Gutes bedeuten konnte.

Der Chef Marko Turina hatte einen Stellvertreter, Ludwig von Segesser, nachmaliger Chef der Herzchirurgie in Lausanne. Dieser schrieb täglich das Operationsprogramm auf die schwarze Tafel bei den Operationssälen. Die meisten Ärzte standen nahe dabei in der Hoffnung auf interessante Zuteilungen. Mein Name wurde systematisch "vergessen", was bestimmt vom Chef ausging. Wenn ich Segesser darauf ansprach, schrieb er mich beim einen oder anderen Eingriff als 2. Assistenz hinzu. Ich stand da mit meinen nunmehr zehn Jahren Erfahrung als Oberarzt, und war auf das Niveau eines Unterassistenten herabgestuft, fehl am Platz, nutzlos.
Schon bald folgte eine weitere Demütigung. Turina als Fachvertreter für Herz und Gefässe in der Medizinischen Fakultät hatte meine Habilitation mit der Arbeit über den "in situ-Bypass" abgelehnt. Dass diese mit dem Angiologie-Preis 1994 ausgezeichnet worden war, liess ihn offensichtlich kalt. Bei einem Gespräch sagte Turina, die Publikation sei zu wenig originell, und riet mir, sie zurückzuziehen. Ich könnte ja allenfalls später eine neue Arbeit schreiben. Ich ahnte die Falle und fragte, wie denn das zu einem guten Ende führen könnte, also zu einer Arbeit, die ihm genehm wäre. Turina antworte sibyllinisch: "mit meiner Unterstützung". Mir war klar, dass er mir eine solche niemals gewähren würde. Er sprach zudem einen bedeutenden Satz, der seine Motive erklärte, und mir gewissermassen die Sinnlosigkeit meines Kampfes vor Augen führte: Die Gefässchirurgie müsse Teil der Herzchirurgie bleiben, weil nicht alle ausgebildeten Herzchirurgen mit kardialen Operationen ihr Auskommen finden konnten. Für diese Kollegen sei die Möglichkeit, auf die Gefässchirurgie auszuweichen, von grosser Wichtigkeit.
Sollte ich mein Gesuch um die Habilitation nun wirklich zurückziehen und damit dem Rat des Mannes folgen, der es so offensichtlich nicht gut mit mir meinte? Otmar Trentz, Chef der Traumatologie und gleichzeitig der andere starke Mann im Departement, riet mir auf Anfrage dazu, zumal eine andere Chance auf Erfolg ohnehin nicht bestand.
Das alles betrübte und bedrückte mich, machte mich auch wütend. Ich schlief schlecht und geriet in die Nähe einer Depression. Die Versenkung hatte aber wenigstens den einen positiven Effekt, dass ich viel Zeit hatte. Ich beschloss, sie zu nutzen für eine neue Arbeit, wenn möglich mit dem Segen von Turina. Gespräche über das weitere Vorgehen fanden jedoch nicht statt. Wenn ich Turina auf der Visite nach einem Termin fragte, verwies er mich an seine Sekretärin. Sie wiederum schlug mir jeweils vor, ich solle doch Turina auf der Visite direkt ansprechen. Ein abgekartetes Spiel.
Im Laufe einiger Wochen kam mir eine etwas listige Idee. In schrieb per E-Mail an Turina und schilderte ihm den Plan einer Arbeit über "Qualitätssicherung" in der peripheren Gefässchirurgie. Das Thema war damals in aller Munde und nahm an Kongressen grossen Raum ein.
Aufgrund einer Analyse von über 1000 arteriellen Rekonstruktionen bei Patienten am USZ mit Durchblutungsstörungen an den Beinen wollte ich ein Konzept und Instrumentarium für systematische Nachkontrollen entwickeln. Ziel und Zweck war es, (nach solchen Operationen stets drohende) erneute Verschlüsse mittels Ultraschalluntersuchung bereits vor ihrem Eintritt zu erkennen. Dies war möglich, weil den Verschlüssen meist Verengungen vorausgingen, die zu einer lokalen Beschleunigung der Blutströmung führte. Diese konnte im Ultraschall meistens erkannt und quantifiziert werden. Durch geeignete Interventionen, meistens Angioplastien (Ballondilatation), konnten Verengungen behoben und die drohenden Verschlüsse nicht selten vermieden werden. Damit liessen sich die Langzeitergebnisse erheblich verbessern.
Nach der Projektbeschreibung bat ich Turina um eine Stellungnahme. Largiadèr und Trentz erhielten Kopien. Eine Stellungnahme von Turina erhielt ich nicht. Trotzdem fuhr ich fort und erstattete Turina regelmässig Bericht über den Fortschritt meiner Arbeit, immer mit Kopie an Largiadèr und Trentz. Nach einem knappen Jahr meldete ich, die Arbeit sei fertig. Turina hatte nie klar Stellung genommen und war jetzt wohl überrumpelt. Er hätte bestimmt das eine oder andere einwenden und auch verbessern können. Nach seinem monatelangen beharrlichen Schweigen wollte er sich vielleicht jetzt auch nicht mehr vor seinen Kollegen exponieren.
Nun reichte ich meine neue Arbeit und ein erneutes Gesuch um die Habilitation ein. Ihr etwas sperriger Titel lautete: Qualitätssicherung in der peripheren Gefässchirurgie. Konzept und Instrumentarium abgeleitet aus einer Untersuchung von über 1000 peripheren arteriellen Rekonstruktionen mit 10 Jahren Beobachtungszeit am Universitätsspital Zürich. Auch diese Schrift wurde prämiert, diesmal mit dem Preis der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie 1994. Dies mag ein wenig geholfen haben, dass Turina jetzt grünes Licht gab, womöglich auch unter dem Druck anderer Fakultätsmitglieder. Die Habilitation wurde 1996 erteilt.
Fünf Jahre später wurde ich gemäss Tradition eingeladen, mich um eine Titularprofessur zu bewerben. Ich tat dies und rechnete eher mit Ablehnung, zumal ich inzwischen in der Klinik Hirslanden tätig war, sozusagen bei einer Konkurrentin des Universitätsspitals. Die Titularprofessur wurde mir aber im Jahre 2002 zuerkannt. Vielleicht hatte geholfen, dass ich inzwischen Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Gefässchirurgie war (2001 - 2003) und Mitherausgeber der Fachzeitschrift VASA (2002 - 2010). Später wurde ich auch Präsident der Union der Schweizerischen Gesellschaften für Gefässkrankheiten (2004 - 2007) sowie ein Vorstandsmitglied und "Treasurer" der European Society for Vascular Surgery (2007 - 2012). Publizistisch blieb ich weiterhin aktiv und brachte es auf über 100 bei PubMed verzeichnete Titel. PubMed ist die Publikationsliste des US-amerikanischen National Institutes of Health. Bei der Mehrheit der Artikel war ich Erstautor, aber einige davon sind zum Teil repetitiv, und Spektakuläres findet sich darin kaum.

Ich war nach Liverpool gegangen und im Hirslanden angetreten mit dem Ziel, Gefässchirurgie im international üblichen Sinne des Wortes zu betreiben und auf diesem Gebiet auch eine gewisse Rolle zu spielen. Das beinhaltete die Rekonstruktionen peripherer Arterien (meist Bypässe an den unteren Extremitäten) die Versorgung von Aneurysmen (meist der Aorta), Carotisstenosen (Verengungen der Halsschlagader), arterio-venöse Shunts für die Hämodialyse und natürlich Venen, meist durch Behandlung von Krampfadern.
Bei der Behandlung von Aortenaneurysmen gab es damals eine neue Methode mit Endografts. Über Kathetersysteme und ohne Bauchschnitt wurden Gefässprothesen ins Innere von Aortenaneurysmen implantiert. Sie nahmen den arteriellen Druck von der erweiterten und geschwächten Wand der Aneurysmen und konnten so deren oft tödliche Ruptur vermeiden.
Ich war überzeugt von den Endografts und hatte das Glück, in Liverpool und auf Kongressen einige ihrer Entwickler und Pioniere persönlich kennen zu lernen, darunter Claude Mialhe aus Draguignan in der Provence sowie Ulrich Blum aus Freiburg im Breisgau. Auch Peter Harris wurde bald ein Protagonist der Endoprothesen. Alle drei waren bereit, mich bei der Einführung der neuen Techniken an der Klinik Hirslanden zu unterstützen, und reisten mehrmals nach Zürich. Als wesentliche technische Hilfe sollte für den Operationssaal ein neuer, grösserer Bildverstärker angeschafft werden, ein mobiles Röntgengerät von Philips mit einer Bildgrösse von 30 cm. Direktor Felix Ammann war zur Investition der erforderlichen etwa 100'000 Franken bereit. Da kam aber kräftige Opposition von Seiten des Herzzentrums. Die Kardiologen hatten bereits ähnliche, etwas kleinere Bildverstärker in ihrem Herzkatheter-Labor. Das Labor unterstand aber dem Herzzentrum, und ich erhielt nur beschränkten Zugang. Zudem begann schon bald auch der Kardiologe Maurus Huber damit, Endoprothesen in Aortenaneurysmen einzusetzen.
Das Herzzentrum verfügte nach vielen Jahren Tätigkeit über ein ausgedehntes Netz von zuweisenden Ärzten. Die Folge war, dass mein Projekt nicht nach Wunsch zum Laufen kam.
Die Chirurgie an der Halsschlagader (Arteria Carotis) war auch am Hirslanden schon fest in der Hand der Herzchirurgen, namentlich meines damaligen Schwagers Robert Siebenmann. Alle Herzchirurgen im Haus vertraten die gleichen Gebietsansprüche wie ihr ehemaliger Chef und Lehrer Marko Turina. Auch in der Carotis-Chirurgie blieb für mich die Acquisition von Patienten schwierig.
In den ersten 10 Jahren am Hirslanden hatte ich Tausende von Venen operiert, dazu 328 Arterien, 82 Shuntoperationen (Anlage arterio-venöser Fisteln für Punktionen zur Hämodialyse), 96 Aorten und 29 Carotiden. Mein Ziel einer umfassenden Gefässchirurgie hatte ich damit in zehn Jahren nicht erreicht. Mir war auch stets bewusst, dass die arteriellen Eingriffe von Natur aus komplikationsträchtiger und ganz einfach "stressiger" waren als die Varizen.
Auch bei der Behandlung der Varikose gab es zu jener Zeit neue Entwicklungen. Thomas Proebstle, ein Dermatologe mit Physikstudium aus Heidelberg, war ein Pionier der Thermoablation. Thermoablation diente dazu, Venen mit schadhaften Klappen durch Anwendung von Hitze zu verschliessen. Deren bisher operative Entfernung durch "Stripping" wurde durch eine minimal-invasive Methode ersetzt. Zweck beider Behandlungsmethoden ist die Behebung von Reflux, also des falsch nach distal (fusswärts) gerichteten Blutflusses in Venen. Dieser kann nämlich Beschwerden und Schwellungen zur Folge haben, manchmal sogar Geschwüre an den Beinen ("offenes Bein").
Ich besuchte Proebstle erstmals im April 2004, einen Tag nach meinem ersten Marathonlauf, den ich in Zürich absolviert hatte. Die damals verfügbaren Methoden VNUS Closure und der Dornier-Laser überzeugten mich aber nicht sehr, ich setzte sie nur bei wenigen Dutzend Patienten ein. Im Jahr 2008 allerdings, mit dem Markteintritt der wesentlich verbesserten Methode ClosureFast, drehte der Wind. Darauf führte ich zusammen mit Proebste an der Klinik Hirslanden die Thermoablation im grösseren Stile ein.
Die Stagnation bei meinen arteriellen Eingriffen und der Zuwachs bei den venösen liessen mich an einen Rückzug aus der arteriellen Chirurgie denken. Ich setzte den Plan in die Tat um, indem ich meine Versicherung für arterielle Eingriffe sistierte. Dies brachte zwar bei der Prämie meiner Haftpflichtversicherung nur eine unbedeutende Reduktion von etwa 6000 auf etwa 5000 Franken jährlich. Ich wollte und konnte aber mit diesem Schritt meiner Praxis eine klare, neue Ausrichtung geben.

Mein "alter" Kollege und Berater Stefan Dommann hatte seine dermatologische Praxis vor ein paar Jahren von Meilen in die denkmalgeschützte "Fabrik am See" in Feldmeilen verlegt. Im Frühjahr 2010 rief er mich an wegen einer interessanten Neuigkeit: Die Firma Swarovski zog weg von der Fabrik am See in einen prächtigen Neubau in Männedorf, und ihre vielen Räumlichkeiten wurden frei.
Mit dem Praxisbauer Jürg und der Kollegin Hilde konnte ich alle freien Räume besichtigen. Wir hatten die Wahl zwischen etwa drei Optionen. Die Sache war rasch entschieden. Wir mieteten die obersten beiden Geschosse oberhalb des Eingangs A, ganz nahe beim Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen.
In der zweiten Hälfte des Jahres 2010 begann der Umbau unter der Leitung von Jürg Sturzenegger. Ich investierte gegen eine halbe Million Franken. Man konnte sich schon fragen, ob ein so gewichtiger Schritt im Alter von 62 Jahren sinnvoll sei. Nun, es war ein unternehmerischer Entscheid mit Chancen und Risiken. Aus heutiger Sicht, 15 Jahre später, war es ein guter Schachzug. Ich konnte sowohl meine Lebensqualität als auch meine Einkünfte verbessern.
Unsere Erfahrungen und auch einige Vergleichsstudien sprachen für die Überlegenheit der Thermoablation gegenüber der üblichen Stripping-Operation. Die Krankenkassen liessen sich allerdings etliche Jahre Zeit mit der Zulassung, obwohl die Thermoablation dazu beitrug, die Patienten vom stationären in den ambulanten Bereich zu verschieben, was einiges Sparpotenzial mit sich bringen konnte. Erst 2016 wurde die Thermoablation kassenpflichtig. Zu jener Zeit war auch bereits ein neuer Laser von Elves Biolitec lanciert worden, der unser Behandlungsspektrum sinnvoll erweiterte.
Die neue Praxis in Kombination mit der Thermoablation wurde zu einer Erfolgsgeschichte. Nach Einführung der Kassenpflicht bei Thermoablationen anno 2016 konnten wir damit beginnen, eine Warteliste mit über zweihundert Patienten abzuarbeiten. Die Umsätze schnellten in die Höhe und erreichten 2018 mit 2.8 Mio einen Höhepunkt. Zwei Jahre später, mit der Covid-Pandemie, brachen sie deutlich ein.

Alex Wick war in der Lage, praktisch über Nacht eine korrigierte Version zu drucken, und die Eröffnung verlief harmonisch und erfolgreich.
Am längsten betreute Madeleine Geiser mein Sekretariat. Sie war beim Personal und bei den Patienten sehr beliebt. Mir und auch meiner Familie wurde sie zu einer vertrauten Freundin. Durch Heirat mit ihrem langjährigen Partner Eric erhielt sie den Namen Madeleine Bolt. Nach etwa sieben Jahren wollte sie weitere berufliche Erfahrungen machen und arbeitete vorübergehend im Herzzentrum, später auf der Urologie im Hirslanden. Einige Jahre nach ihrer Scheidung von Eric Bolt heiratete Madeleine den Bankfachmann Reto Kirchhofer. Er ist in Davos aufgewachsen und besitzt dort eine Wohnung. So sehen wir uns ab und zu in Davos und manchmal in Zürich.
Eine weitere tüchtige Mitarbeiterin war Carmen Kolonic, auch sie eine ehemalige Dentalassistentin. Sie führte etwa fünf Jahre lang erfolgreich das Sekretariat im neuen Venenzentrum am See. In dieser Zeit benötigten wir zwei bis drei MPA, die unter der Leitung von Carmen arbeiteten. Während ihrer Zeit im Venenzentrum heiratete sie und übernahm den Namen Rexhaj. Carmen wechselte zum Chirurgen Otmar Schöb am Hirslanden. Auf sie folgte Corina Moser, mit der ich ebenfalls positive Erinnerungen verknüpfe.
Nach Corina gab es häufigere Wechsel als früher, was zum Teil mit Inkompatibilitäten unter den MPA zusammenhing. Bei zwei MPA wurden Burnouts diagnostiziert. Eine MPA gelangte mit der Rechnungsstellung in einen schweren Rückstand von mehr als einer halben Million Franken, verriet mir aber nichts davon. Es folgten ziemlich turbulente Zeiten mit mehreren Entlassungen und Kündigungen von Angestellten. Bei meinem Abgang waren die Schwierigkeiten endlich überwunden. Mithilfe der kosovo-stämmigen, in Netstal aufgewachsenen MPA Ljumturje Adili wurde die Praxis wieder auf Kurs gebracht. Hilfreich war dabei auch meine Nachfolgerin Lisa Högger, die bestens mit "Lumi" auskam und auch mit mir.

Durch Vermittlung eines Industrievertreters kam Maurizio Camurati zu uns, vormals Oberarzt am Spital Bülach. Wir vertrugen uns jahrelang prächtig. Als die Praxis rasch wuchs, wollte ich eine weitere ärztliche Kraft einstellen. Maria Studer war eine gute Wahl, und sie stellte auch keine grosse Bedrohung für Maurizios Ambitionen dar. Mit ihren zwei Kindern absolvierte sie nur ein beschränktes Arbeitspensum, und wegen ihres Ehemannes, eines erfolgreichen Chirurgen am Inselspital, wohnte sie in Bern. Dennoch kam es zu Feindseligkeiten gegenüber Maria. Maurizio warf mir vor, dass ich ihm die Nachfolge versprochen hatte, und er sah nun diese bedroht.
In Wädenswil hatte ich mit Zustimmung von Maurizio und Maria eine weitere Aussenstation eröffnet in der Praxis des allgemeinchirurgisch tätigen Kollegen Beat Wenger. Eines Tages hatten sich Mauri und Beat hinter meinem Rücken abgesprochen und Mauri übernahm die Praxis. Allzu böse konnte ich nicht sein, zumal ich mit Wenger keinen Vertrag hatte, nur mündliche Absprachen.
Mauri verliess also unser Venenzentrum und nahm gleich unsere leitende MPA mit. Sie war an sich kein grosser Verlust, denn unter ihrer Ägide hatten sich offene Rechnungen im Umfang mehr als einer halben Million angehäuft, leider gab es aber deutliche Hinweise, dass auch Patientendaten über den See nach Wädenswil gelangt waren.
Die Lücke, die Mauri hinterliess, wurde von PD Dr. Christian Schmidt geschlossen, vormals Oberarzt am Spital Uster. Seine Frau Sabine übernahm später den Part von Maria Studer.
Zusammen starteten wir eine weitere Venen-Sprechstunde und später auch Thermoablationen in der Praxis "Medizin am Schauspielhaus" von Andrea Rosemann und weiteren Kollegen. Nach einem Jahr zog ich mich zurück, Christian führte die Tätigkeit fort. Und schon bald hatten sich die Ehepaare Schmidt und Rosemann auf die Übernahme der "Medizin am Schauspielhaus" geeinigt.
Nun hatte ich zum zweiten oder dritten Mal eine potenzielle Nachfolgelösung verpasst. Dazu mögen überhöhte Preisvorstellungen und auch mein sonstiges Verhalten beigetragen haben.
Im Mai 2019 konnte ich Dr. Lisa Högger, chirurgische Oberärztin am KS Baden, als Stellvertreterin gewinnen. Wir kamen gut miteinander aus. Die Praxis an sie zu übergeben, wurde dennoch von beiden Seiten nicht ernsthaft in Betracht gezogen, zumal die Familienplanung einen wichtigen Stellenwert in ihrem Leben einnahm.
Nun begann ich, mit verschiedenen Investoren und Praxisgruppen zu verhandeln, u.a. mit den Pallas Kliniken. Unsere Verhandlungen schienen dem Ziel schon nahe zu sein, als Pallas mich am neuen Standort im traditionsreichen Kaufhaus Jelmoli als Leiter engagieren wollte, aber das Interesse am Kauf des Standortes Feldmeilen nachliess. Das konnte nicht in meinem Interesse liegen.
Einmal mehr kam ein Tipp vom Dermatologen in der Fabrik am See, meinem "alten" Kollegen und Berater Stefan Dommann. Er war in Verhandlung mit der deutschen Corius-Gruppe, die schon etwa 20 dermatologische Praxen in Deutschland besass und etwa fünf in der Schweiz. Ein Treffen mit dem charismatischen Nathanael Meier von Corius im Dezember 2019 machte mich zuversichtlich, dass alles rasch zu einem guten Ende kommen würde. Wenige Wochen später wurde aber die Covid-Pandemie zu einer ernsten Bedrohung für Individuen und auch für manche Firma. Im März wurde von der Landesregierung ein Lock-Down verfügt. Etwa gleichzeitig erkrankte ich an Covid und wurde in der Hirslanden-Klinik hospitalisiert. Das war einer raschen Abwicklung unserer Verhandlungen keineswegs förderlich. Unsere Umsätze brachen ein, auch die der meisten anderen Betriebe von Corius. Der auf dem EBIT-DA basierende Kaufpreis der Praxis sank. Hinzu kam, dass meine Aktien des Venenzentrums monatelang nirgends auffindbar waren. Wir waren überzeugt, dass sie bei unserem Anwalt seien, aber er verneinte kategorisch. Meine Frau musste auf der Suche danach sozusagen das Haus auf den Kopf stellen, leider ohne Erfolg. Nach einigen Wochen stellte sich heraus, dass die Aktien doch beim Anwalt waren. Was für eine Erleichterung! Als Entschädigung hat er mir freundlicherweise 6000 Franken überwiesen.
Allen Rückschlägen zum Trotz kam der Verkauf an Corius per 1. Juli 2020 zustande. Der Kaufpreis betrug eine Million. Das war deutlich weniger, als ursprüglich erhofft, aber mehr als genug, um meine Investitionen vor 2010 zu kompensieren.
Der Vertrag verpflichtete mich, noch mindestens bis Mitte 2022 in der Praxis zu arbeiten. Am 1. Januar 2022 würde Lisa die Leitung übernehmen.
Mein Pensum hätte ich an sich gerne reduziert. Lisa wurde aber im Herbst 2020 schwanger und musste frühzeitig ihre Arbeit einstellen. Am 15. Juli 2021 gebar Lisa eine gesunde Tochter, Ella-Sophie. Darauf folgte Mutterschaftsurlaub. Also blieb ich lange Zeit voll beschäftigt.
Anfang 2022 ging die Praxisleitung reibungslos an Lisa Högger über und Mitte 2022 schied ich aus. Alles geschah sehr einvernehmlich und friedlich, abgesehen von den Intrigen einer Christina A., die im Namen und im vermeintlichen Interesse von Corius in unserer und auch in anderen Praxen Ärzte und Mitarbeiter nervte. Zwei Jahre nach meinem Rücktritt hörte ich von ihrer Entlassung, und mochte ihr keine Träne nachweinen.

Auch die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen sowie mit den Mitarbeitern war konsensorientiert und stark überwiegend angenehm.
Bei meinem Antritt als Assistent in Basel hatte ich wie die meisten Kollegen eine vage Vorstellung von einer akademischen Karriere. Später schwebte mir eine Stelle als Chefarzt vor. Mehrmals habe ich mich darum beworben, namentlich an den kantonalen Spitälern in Schaffhausen, Solothurn und Thun. Es hat aber nicht geklappt. Warum nicht, ist schwer zu beurteilen. In Schaffhausen war ich an zweiter Stelle, noch vor einem langjährigen Kollegen und Freund, der vorher und nachher seine Fähigkeiten als Arzt und ärztlicher Leiter mannigfach bewiesen hat. In Solothurn war ich auch Zweiter, wenn ich mich richtig erinnere.
Hätte ich die notwendigen Führungsqualitäten gehabt? Ich hatte nie Gelegenheit, das zu erkunden, geschweige denn, zu beweisen. Es ist durchaus möglich, dass ich zu sehr konsensorientiert war, zu "weich" vielleicht.
War ich ein guter Chirurg? Kein schlechter, denke ich, aber herausragend vermutlich auch nicht. Erst mit dem chirurgischen Steckenpferd meiner letzten fünfzehn Berufsjahre, den neuen Methoden zur Behandlung der Varikose, erlebte ich das wohltuende Gefühl, eine Technik besser zu beherrschen als die weitaus meisten Kollegen. Für diese Einschätzung spricht die Tatsache, dass im Laufe der Jahre gegen hundert Kolleginnen und Kollegen zu uns ins Venenzentrum kamen, um von mir zu lernen. Ich berichtete sehr offen über unsere Erfahrungen und gab alle meine Erkenntnisse und "Tricks" freizügig preis. Mir wäre nie eingefallen, dafür eine finanzielle Entschädigung zu verlangen. Allerdings wurden die Katheter für die Thermoablation bei Demonstrationen vor Kollegen jeweils kostenlos vom Hersteller zur Verfügung gestellt.
Besonders gefreut haben mich Auszubildende aus dem Ausland oder zwei Ärztinnen aus der Schweiz, deren Gatten bekannte Gefässchirurgen waren. Buchstäblich am letzten Tag meiner beruflichen Tätigkeit, ich glaube es war am Donnerstag, 30. Juni 2022, kam ein bekannter plastischer Chirurg aus der Region und wollte unbedingt von mir behandelt werden. Ich konnte noch ein Zeitfenster für die Untersuchung finden. Nach dem Feierabend konnte ich dann noch beide Beine behandeln - auch dank der Flexibilität und Unterstützung einer Praxisassistentin.
Mein Basler Chef für nur kurze Zeit, Felix Harder, hatte mich auf die Karriere des Wattwiler Chirurgen und Chefarztes Reinhard Fischer hingewiesen, der sein berufliches Glück sozusagen in der Chirurgie der Varizen gefunden hatte. Er wollte mir damit eine Möglichkeit für mein weiteres Wirken aufzeigen. Ich war nicht erfreut, sondern gekränkt, zumal er mir gleichzeitig eröffnete, dass ich nicht als nächster zum Oberarzt am Kantonsspital Basel befördert würde.
Freilich ist mir auch schon der Gedanke gekommen, dass mein hartnäckiger Widersacher Turina nicht nur politische Motive gehabt haben könnte, mich zu verhindern, sondern vielleicht auch an meiner Eignung zweifelte. Was aber gegen diese Hypothese spricht, ist die Tatsache, dass er mich nie operieren gesehen hat, und somit mein Geschick und Potenzial daher kaum richtig beurteilen konnte.
Es entbehrt nicht der Ironie, dass ich schliesslich auf dem Gebiet der Varizen gelandet bin, auf welches mich Harder schon 1985 hingewiesen hatte.
Wie auch immer, es war gut, wie es war. Das habe ich immer wieder gedacht, wenn befreundete und andere Chefärzte an ihren Lasten, auch den administrativen, fast zugrunde gingen, öffentlich gerügt und manchmal entlassen wurden, oder von sich aus den Dienst im öffentlichen Gesundheitswesen quittiert haben. Viele fanden schliesslich doch noch in der Privatmedizin Zuflucht, obwohl sie sich früher nicht selten herablassend darüber geäussert hatten.
Ich blicke nun zufrieden auf meine Berufstätigkeit zurück. Sie hat mir Freude bereitet, eine gute Reputation geschaffen, und sie war auch wirtschaftlich erfolgreich. Dazu hat wesentlich meine Erfolgssträhne mit der Thermoablation beigetragen. Meine Hinwendung zu dieser Methode wurde von Kollegen vielleicht belächelt oder sogar höhnisch kommentiert. Mir verlieh sie aber wie nie zuvor das gute Gefühl, ein Pionier zu sein, der jedem Konkurrenten trotzen konnte, und auf das richtige Pferd gesetzt zu haben.
Meine Laufbahn könnte man mit der eines Bergsteigers vergleichen, der von Gipfeln träumt und Erstbesteigungen plant, sich aber schliesslich in einer Alphütte gemütlich einrichtet.


Während meiner Anstellung im AO-Forschungsinstitut in Davos konnte ich die Dreizimmer-Wohnung meiner Eltern im Uto-Ring benutzen.
Dann suchte ich eine Wohnung in Basel. Dank den Beziehungen von Gotte Gret zu Hanspeter Musfeld erhielt ich ein Schmuckstück, eine Dreizimmerwohnung am Pfeffergässli 13 in der Altstadt. Besonderheiten waren die begehrte Lage in der Altstadt, fünf Gehminuten vom Kantonsspital entfernt, eine dekorative Wand im Wohnzimmer aus gebrochenem Granit sowie eine gegen 20 Quadratmeter grosse Terrasse, von der man auf einen privaten Innenhof mit Springbrunnen blickte. Diesen Hof konnte ich nutzen, dort habe ich mindestens einmal ein grösseres Fest organisiert mit klappbaren Tischen und Bänken und gegen 40 Gästen aus der Nachbarschaft und vom nahegelegenen Kantonsspital.
Es folgte ein Jahr Aufenthalt in Lugano zusammen mit Esther. Wir fanden eine Mietwohnung mit riesiger Terrasse an der Via Belvedere in Viganello mit Blick auf die Stadt, die dahinter liegenden Hügel und den See. Der Blick auf den Monte San Salvatore erfreute uns stets aufs Neue. In Lugano wurde Tochter Daniela geboren.
Manchmal fuhren oder flanierten wir den Ufern des Sees entlang, oft mit dem Hintergedanken, dass wir vielleicht einmal für länger im Tessin wohnen oder ein Feriendomizil erwerben könnten. Meine bevorzugte Gegend war die Strecke zwischen Morcote und Agno. Neulich waren Rahel und ich im neu erstandenen Haus am See in Morcote bei Misa und Eva Gütling zu Besuch. Das hat uns sehr gut gefallen.

Durch ein Inserat wurden wir auf ein neues, einseitig angebautes Einfamilienhaus an der Finkenstrasse 27 in Oberwil im Kanton Basel-Land aufmerksam. Es bot eine weite, freie Sicht nach Norden ins Elsass, ein stilvolles Cheminée mit einem grossen Eichenbalken davor und einer antiken Platte aus Gusseisen auf der Rückseite, eine Küchenabdeckung aus Lavastein, eine Schublade mit ausklappbarem elektrischem Fleischschneider. Vom benachbarten Weiherhof hörte man die Rufe von Pfauen und das Quaken von Fröschen.
Der Kaufpreis betrug 520'000 Franken. Schwiegervater Edmund stellte eine finanzielle Unterstützung von 30000 Franken in Aussicht, Vater Alfons nochmals den gleichen Betrag.
Schon bald wurde ich zum ersten Mal Miteigentümer einer Immobilie.
Das Leben in der Finkenstrasse war unterhaltsam, manchmal auch etwas turbulent. Die meisten Familien hatten Kinder in einem ähnlichen Alter. Man unternahm vieles gemeinsam, wir vor allem mit Claudia und Kos Reurts.
Wir wohnten drei Jahre in Oberwil, danach ging die Ehe auseinander. Das Haus wurde verkauft, wobei wir den Einstandspreis nur knapp realisieren konnten, zumal die Konjunktur vorübergehend abgeflaut war.
Anschliessend lebte ich zwei Jahre als Einzelgänger in einer netten Wohnung ohne Besonderheiten in Horn nahe Rorschach. Als ich mit Rahel zusammenzog und meinen Arbeitsplatz nach St. Gallen verlegte, konnten wir eine schöne Wohnung an der Rehetobelstrasse 81 kaufen. Sie hatte fünfeinhalb Zimmer mit Garten und einen hübschen Ausblick auf die Stadt sowie auf einen kleinen Zipfel des Bodensees.

Nach weiteren zwei Jahren trat ich meine Stelle als Oberarzt am Spital Limmattal an. Wir konnten ein schönes, grosses Haus mit Schwimmbad an der Üetlibergstrasse 21 in Urdorf mieten. Der Vermieter hatte das Haus für etwa 4500 Franken pro Monat inseriert, aber das war für uns klar zu viel. Nach monatelangem Leerstand erhielten wir den Zuschlag für 3500 Franken. Die Besitzer hatten für sich in unmittelbarer Nähe ein noch feudaleres Haus erstellt. Als Nachbarn hatten wir stets freundschaftlichen Kontakt.
Am Universitätsspital Zürich wurde mir eine leitende Stelle in Aussicht gestellt, mit Honorarberechtigung und "allem, was dazugehört", wie mir der Vorsteher des Departements Chirurgie sagte. Ich schaute mich daher nach einem Haus um. An einem regnerischen Novembertag stand ich erstmals auf der Parzelle Im Büeler 3 in Herrliberg. Es war Liebe auf den ersten Blick. Die Kosten von zunächst etwa 2.5 Mio Franken konnte ich allerdings nicht stemmen. Mit der gütigen Unterstützung von Mami und Gotte Gret (100 bzw. 200 Tausend) gelang dann aber der Kauf. Die Schulden bei den beiden Damen waren nach etwa drei Jahren abbezahlt. Wir zogen 1996 ein und wohnen bis heute im gleichen Haus. Die Panorama-Aussicht überwältigt uns und unsere Besucher immer wieder von neuem.
Ein Gestaltungsplan schränkte damals die Freiheit beim Bauen stark ein, erhöhte aber die Ausnutzungsziffer. Der Gestaltungsplan führte auch dazu, dass das Quartier den Charakter und den Status als Einfamilienhauszone praktisch unverändert behalten hat.Gegen 2020 waren kleinere Reparaturen fällig. Hinzu kam, dass ein Nachbar bei der Gemeinde eine grosszügigere Auslegung des Gestaltungsplans erstritten hatte. Nun beschlossen auch wir, den oberen Stock umzubauen. Aus dem Obergeschoss mit stark geneigtem Dach und nur etwa 40 cm hohem "Kniestock" sowie je drei schmalen Lukarnen nach Süden und Norden wurde ein vollwertiges Obergeschoss. Die Giebelhöhe blieb unverändert, der Dachwinkel beträgt jetzt 23 statt früher 34 Grad, und aus dem "Kniestock" und den mickrigen Lukarnen sind vollwertige Räume von minimal 220 und maximal 390 cm Höhe entstanden. Zum Vergleich: Das Erdgeschoss ist 250 cm hoch.
Alle Schlafzimmer bieten eine ausgezeichnete Fernsicht, im Elternzimmer ist sie grandios.
Der Umbau im oberen Stock hat mehr als halbe Million gekostet, mit der Renovation im Erdgeschoss und der Anschaffung neuer Möbel wohl gegen eine Million. Unter Einbezug der ehemaligen Erstellungskosten, des Schwimmbads und Verbesserungen im Garten belaufen sich die kumulierten Investitionskosten auf mindestens 3.6 Mio Franken.

Der Umbau wurde von zwei dramatischen Situationen begleitet. Kaum war im März 2020 das alte Dach vom Haus entfernt worden, wurde vom Bundesrat wegen der Covid-Pandemie ein Lockdown verfügt. Anfänglich sah es ganz danach aus, dass auch die Baubranche ihre Arbeit einstellen müsste. Ein Baustopp ohne Dach hätte uns bereits genügt, um "kalte Füsse" zu bekommen. Es kam aber noch schlimmer. Ich wurde wegen meiner eigenen Covid-Erkrankung im Hirslanden hospitalisiert und bekam, obwohl ich nie intubiert werden musste, zeitweise Todesängste. Erschwerend kam hinzu, dass es mit dem Verkauf meiner Praxis plötzlich nicht weiterging, weil die Aktien der Provena AG nicht auffindbar waren.
Nach einer Woche konnte ich vom Spital entlassen werden und mein Zustand besserte sich rasch - abgesehen von der Lungenembolie drei Monate nach der Infektion. Nach einigen Wochen des Bangens wurden die Aktien bei meinem befreundeten Anwalt gefunden, und der Verkauf der Praxis ging endlich über die Bühne.Retrospektiv mögen diese Wirren banal erscheinen, aber damals kumulierte alles zu einem bedrohlichen Ausmass.
Ein kleineres Drama war auch der Einsturz unseres Vordaches unter einer schweren Schneelast im Januar oder Februar 2021. Die darunter geparkte Vespa wurde leicht beschädigt, sonst passierte nichts Schlimmes. Es hätte auch anders kommen können, wenn sich Personen unter dem Vordach befunden hätten.
Unser Haus macht uns nach wie vor grosse Freude. Für mich ist auch das Schwimmbad wertvoll, in dem ich im Sommerhalbjahr fast täglich gegen eine halbe und manchmal eine ganze Stunde schwimme. Gerne möchte ich dieses Privileg noch lange behalten, aber natürlich mache ich mir auch Gedanken über das Wohnen im höheren Alter, wenn ich vielleicht nicht mehr die eine Treppe hinauf und hinuntersteigen oder zum Bus gelangen kann. Rahel ist 11 Jahre jünger, also möchte sie vielleicht noch im Haus wohnen, wenn es für mich schwierig werden sollte. Kommt Zeit, kommt Rat.

Im Jahre 2014 lernten wir bei einer Flussfahrt auf dem Mekong Peter Basci kennen. Er berichtete über sein "Wönigli", das er am Lago Maggiore gekauft habe, direkt am Ufer in Laveno. Ich wurde hellhörig und stellte einige Fragen. In der gleichen Nacht holte ich weitere Informationen aus dem Internet und bestellte Unterlagen nach Herrliberg. Nach unserer Heimkehr lagen Prospekte und Angebote in unserem Briefkasten. Rahel hatte bereits früher gesagt, dass sie keine Wohnung in Italien wolle. Immerhin wurden wir uns bald einig, welches der vielen Angebote ihr am wenigsten missfiel. Aber der Grundriss der Wohnung Nr. 31 in der Überbauung Zucchi wies einige Schwächen auf. Ganz unverbindlich erkundigte ich mich, ob Änderungen möglich seien, und die Antwort war positiv. Also fingen wir an, Skizzen von verbesserten Grundrissen zu zeichnen und der Immobilien-Firma Pohl in Bozen zu schicken. Die Änderungen wurden dann jeweils innert Tagen ins Reine gebracht. Nach zwei Monaten, fand ich, müssten wir endlich Laveno und die Wohnung besichtigen. Aus Kalkül lud ich meine Schwester Franziska ein, mit uns zu fahren. Das Fazit war bald klar. Ich wollte die Wohnung, Rahel wollte sie nicht, und Franziska sagte: Ich würde sie sofort nehmen, aber ich kann gut reden, da es mich nichts kostet. Rahel wurde schliesslich milder und lenkte ein. In der Folge engagierte sie sich stark und mit gutem Erfolg bei der Finalisierung der Pläne und bei der Möblierung. Inzwischen fühlen wir uns beide in der Wohnung wohl und "zu Hause", auch im Städtchen Laveno und seiner Umgebung. Wir haben auch Freundschaften geknüpft mit anderen Bewohnern unserer Überbauung und von ausserhalb.



Unser direkter Nachbar während der Kindheit in Lachen, Rudolf Keller, sagte dezidiert, "wenn du verkaufst, spinnst du!". Auf meinen Einwand, ich allein hätte zu wenig Mittel für das Projekt, stellte er mir seinen Schwiegervater vor, den Architekten Otto Senn und dessen Sohn und Nachfolger Andy. Otto zeichnete buchstäblich über Nacht ein Projekt, das mich viel eher überzeugte als das vorhergehende, kostenpflichtige Projekt eines Architekten aus Küsnacht. Wir wurden gleichberechtigte Partner und erstellten 22 Wohnungen in zwei Blöcken, die miteinander verbunden sind. Eine spätere Aufteilung ist bereits vertraglich geregelt. Die Zusammenarbeit verlief stets störungsfrei und die Einnahmen sind erfreulich. Allerdings hat mir der Immobilien-Profi Otto schon öfter versichert, dass es keineswegs bei allen Projekte derart gut laufe.

Als ich Ende der Siebziger Jahre bereits als Assistenzarzt in Basel arbeitete, besuchte ich die Schweizer Mustermesse, damals die grösste Messe im Lande, in die auch die Uhren- und Schmuckmesse integriert war. Wahrscheinlich hat mich Lisa begleitet, aber das weiss ich nicht mehr genau. Jedenfalls besuchten wir an der Uhrenmesse den Stand der Firma Xantia, deren Gründer und Inhaber mein nachmaliger erster Schwiegervater Edmund Knutti war. Dort sah ich - zum ersten Mal seit Jahren - seine Tochter Esther. Ich fand sie jetzt auf Anhieb anziehend und interessant. Bald waren wir ein Paar. Esther hatte eine Altstadtwohnung am Ring in Biel, gab diese aber auf und zog zu mir ins Pfeffergässli 13 in Basel.
Unser Verhältnis war nie perfekt, Meinungsverschiedenheiten wurden immer häufiger. Beide fragten sich, ob wir genügend zueinander passen. Anscheinend wollte aber weder Esther noch ich "Spielverderber" sein, man wollte auch etwas wagen.
Als ich Fränzi, eine gemeinsame Freundin nach gemeinsam verbrachten Ferien in Spanien auf unsere Differenzen ansprach sagte sie sinngemäss, das sei doch immer so, da müsse man durch.
Am 2. August 1980 heirateten wir auf dem Standesamt in Basel. Trauzeugen waren Hans Gut und Julia Christ. Gefeiert wurde am Bielersee. Die Trauung fand in dem hübschen Kirchlein von Ligerz statt mit prächtigem Blick auf die St. Petersinsel und den Bieler See. Dann gab es einen Apéritif im Weinbaumuseum in Ligerz. Schliesslich verschob sich die Gesellschaft in Privatautos zum bestens renommierten "Le Vieux Manoir" in Murten. Das Hotel und dessen grosser Garten am See waren idyllisch. Gastronomisch wurden wir auf hohem Niveau verwöhnt. Die Väter hielten schöne Reden, Geschwister und Freunde nahmen uns mit amüsanten Produktionen auf die Schippe. Wir hatten grosses Wetterglück und blieben bis weit nach Mitternacht im Freien. Das war auch nötig, denn im Innern hätte unsere Gesellschaft von gegen hundert Personen gar nicht Platz gefunden.
Die Hochzeitsreise führte nach Mexico. Dort trafen wir jüdische Geschäftsfreunde von Edmund Knutti, die uns grosszügig beherbergten und uns die Stadt zeigten. Weiter ging die Reise in einem Mietwagen mit Umwegen über Taxco nach Acapulco. In dieser damals mondänen, sehr amerikanisch anmutenden, heute dem Vernehmen nach heruntergekommenen Feriendestination am Pazifik ist wohl unsere Tochter Daniela "konzipiert" worden. Sie kam am 26. Juni 1981 zur Welt. Die Geburt fand im Ospedale Italiano di Lugano statt, wo ich das ganze Jahr 1981 als Assistenzarzt auf der chirurgischen Abteilung arbeitete. Ein sogenanntes "B-Jahr" in einem kleineren Spital war ja unverzichtbarer Bestandteil der Facharztausbildung.
Unsere kleine Familie wohnte damals in Viganello, einem Teil von Lugano. Wir hatten für ein Jahr eine Terrassenwohnung am Hang des Monte Brè gemietet. Sie war grosszügig und hatte eine uneingeschränkte Aussicht auf die Stadt und den See. In Lugano erlebten Esther und ich die wohl beste Zeit unserer Ehe.

Ziemlich regelmässig trafen wir uns mit unseren Freunden aus Basel, Christoph und Coni Ackermann. Meine Idee, das sogenannte B-Jahr der chirurgischen Ausbildung im Südkanton zu absolvieren, überzeugte Christoph, und so suchte er eine analoge Stelle. Er fand sie im Ospedale San Giovanni in Bellinzona.
Für gemeinsame Abendessen war das Ristorante Ombretta, direkt nach der Grenze zwischen Gandria und Cressogno am Lago di Lugano gelegen, eine unserer bevorzugten Adressen. Wir assen fast immer das gleiche Menu, das uns jedesmal als eine Besonderheit des Tages angekündigt wurde: "Oggi abbiamo specialmente per voi tagliatelle alla diavola, poi un filetto di manzo alla senape". "Siamo tutti d‘accordo" lautete unsere übliche Antwort.
Daniela verbrachte viel Zeit an der frischen Luft auf der teilweise gedeckten Terrasse. In der Gemeinde Origlio, 15 Autominuten weiter nördlich, wohnte in einem historischen, typischen Tessiner Haus ein mit Esther befreundetes Paar mit einem etwa gleichaltrigen Sohn. Die Mütter trafen sich öfter und die Kinder fanden ihre ersten Spielkameraden.
Der Einzug nach Oberwil erfolgte Anfang 1982. Wir pflegten recht rege Kontakte mit verschiedenen Nachbarn und luden auch regelmässig Ärzte und Pflegepersonal vom Kantonsspital zu uns ein.
Unsere eheliche Beziehung erodierte damals mehr und mehr. Dazu trugen auch Aussenbeziehungen bei - auf beiden Seiten. Trotzdem war Esther anno 1984 zum zweiten Mal schwanger. Roman wurde am 5. September 1984 am Frauenspital Basel geboren. Leider habe ich ihn nur wenige Monate "zuhause" erleben können, weil die Ehe Anfang 1985 zerbrach. Bei der Hochzeit von Roman mit der reizenden Jane Magri im Sommer 2023 in der Bieler Taubenlochschlucht habe ich mich vor allen Gästen bei meinem Sohn dafür entschuldigt, dass ich ihm in seiner Jugend nicht mehr zur Seite stehen konnte. Gleichzeitig habe ich Romans langjährigem Stiefvater Bernhard Hotz, der Esther geheiratet hat, gedankt, dass er die Vaterrolle ausgezeichnet erfüllt hat.



Nach der Rückkehr aus Amsterdam, am Abend des ersten Arbeitstages, ging ich auf Oberarzt-Visite am Spital Rorschach, begleitet von Assistenzart Kuno Schawalder, der ein Freund geworden war. Endpunkt der Visite war die kleine Intensivstation des Spitals. Dort empfing uns eine neu eingestellte "Krankenschwester" - heute wäre "Pflegefachfrau" die korrekte Berufsbezeichnung - mit dem Namen Rahel Knoepfel. Sie war eine einnehmende Erscheinung mit toller Figur, klassisch schönem Gesicht und strahlend grünen Augen, dunklen, fast schwarzen Haaren und einem fröhlichen Charme. Sie gefiel mir auf Anhieb. Auch Kuno war von Rahel angetan.
Nach Abschluss der Visite und Verabschiedung von Kuno ging ich nochmals zurück auf die Intensivstation und fragte Schwester Rahel unverblümt, ob sie mit mir zum Abendessen komme. Sie war nicht abgeneigt und überlegte einen geeigneten Zeitpunkt. "Warum nicht heute" lautete mein Vorschlag. Sie willigte ein. Wir verabredeten uns im Restaurant des Hotels Bad Horn, einem beliebten Ausflugsziel am Bodensee mit eigener Landestelle, etwa 5 km westlich von Rorschach.
Wir unterhielten uns gut. Wahrscheinlich habe ich an diesem Abend viel mehr gesprochen als Rahel. Ich erzählte von meinen Reisen und von meiner Idee, einen Ski mit verstellbarer Härte mit der Firma Kästle im vorarlbergischen Hohenems zu entwickeln.
Rahel und ich verabschiedeten uns nach dem schönen Abend per Händedruck.
Der Abend mit Rahel hatte mir gefallen, aber ich bekam Gewissensbisse wegen Kuno, der ebenfalls Interesse an Rahel zeigte. Ich war frisch von Esther geschieden, also ein Mann mit Vergangenheit. War es da richtig, dem möglichen Glück zweier junger Leute im Wege zu stehen? Angesichts solcher Gedanken ermunterte ich Kuno nach ein paar Tagen, auch einen Vorstoss zu wagen. Auch er hatte Erfolg. Mir kamen indessen neue Zweifel. War ich dabei, leichtsinnig ein grosses Glück zu verspielen? Noch ein paar Tage vergingen, dann sagte ich zu Kuno, ich sei "zurück im Rennen".
Bald schon waren Rahel und ich ein verliebtes Paar. Schon im April verliess sie aber Rorschach planmässig, um während des Sommers in Mallorca als Reiseleiterin für die Firma Esco zu arbeiten. Esco war ein Reiseanbieter, der zum Hotelplan und damit zum Migros-Konzern gehörte.
In dem halben Jahr von Rahels Tätigkeit auf Mallorca flog ich fünf Mal nach Palma. Einmal fuhr ich mit meiner damals fünfjährigen Tochter Daniela im Golf Cabrio nach Süden. In Sète nahmen wir die Fähre nach Palma. Jeder Besuch war ein neues Abenteuer. Von Rahels Arbeitsplatz in Cala d'Or ganz im Osten fuhren wir im Auto fast an jede Ecke und zu vielen attraktiven Orten auf der ganzen Insel.
Nach Abschluss der Touristensaison kehrte Rahel in die Schweiz zurück und arbeitete zunächst im Esco-Büro in St. Gallen. Nach einigen Monaten kam sie zurück zum angestammten Beruf als Krankenschwester und fand eine Anstellung auf der Abteilung für Hämodialyse am Kantonsspital St. Gallen. Als Hämodialyse bezeichnet man die "Blutwäsche", wie sie bei Menschen mit ungenügender Nierenfunktion etwa dreimal wöchentlich durchgeführt wird.
Rahel zog zu mir in die kleine, gemütliche Wohnung bei der spitztürmigen Kirche in Horn. Später kaufte ich die Eigentumswohnung an der Rehetobelstrasse in St. Gallen. Dies machte umso mehr Sinn, als ich nach der Berufung meines chirurgischen Chefs Willy-Werner Rittmann ans Kantonsspital St. Gallen dort eine neue Stelle als Oberarzt angenommen hatte.

Einige Wochen vor meiner Abreise fragte ich Rahel, ob sie mich nach Indonesien begleiten wolle. Sie sagte zu. Also flogen wir etwa Mitte August nach Jakarta. Dort mieteten wir ein Auto. Am 18. August kamen wir im etwa 500 km weiter östlich gelegenen Yogyakarta an. Wir feierten am 18. August Rahels Geburtstag in einem japanischen Restaurant. Dort machte ich ihr einen Heiratsantrag. Sie willigte ein und sinnierte über einen möglichen Zeitpunkt. "Nächste Woche in Bali", sagte ich, worauf sie etwas überrascht entgegnete, das sei gar nicht möglich, dazu bräuchte sie doch Papiere. Darauf griff ich in meine Westentasche und zog ihre Geburtsurkunde hervor. Rahel war sehr erstaunt und konnte sich nicht erklären, wie ich an dieses Dokument gelangt war.
Meine Leserinnen würden wohl einen oder mehrere Verbündete innerhalb von Rahels Familie vermuten. Dies trifft aber nicht zu. Einige Wochen zuvor hatte ich mit der Einwohnerkontrolle der Gemeinde Stein im Kanton Appenzell-Ausserrhoden telefoniert. Rahel war Bürgerin von Stein AR. Zum Glück war eine Frau am Apparat, bei einem Mann wäre mein Plan wohl gescheitert. Ich enthüllte der Dame meinen romantischen Plan: Ich wolle Rahel mit einem Antrag überraschen und in Bali heiraten. Nach der erst kurz zurückliegenden Scheidung meiner ersten Ehe schien mir eine stille Hochzeit eine gute Option.
Die nette Dame am Telefon erklärte mir erwartungsgemäss, dass die Zustellung einer Kopie der Geburtsurkunde an einen Unbekannten nicht möglich sei. Sie liess aber auch Sympathien für meinen Plan durchblicken. Ich versuchte darauf, sie von meiner Seriosität zu überzeugen und sagte, dass ich als Oberarzt am Kantonsspital St. Gallen arbeite. Weiter bat ich sie, mich zur Überprüfung via Zentrale zurückzurufen.
Als bald darauf das Telefon in meinem Büro klingelte, wurde ich optimistisch. Und tatsächlich schickte sie das begehrte Papier per Post. Diese aus meiner Sicht löbliche Tat war natürlich illegal und hätte die Frau ihre Stelle kosten können.

In der kurzen Zeit vor der Abreise galt es, die nächsten Angehörigen zu informieren. Dazu gaben wir Postkarten mit einem Foto des neuvermählten Paares in Auftrag mit der Aufschrift "Just married". Dass die Karten erst nach uns in der Schweiz eintreffen würden, war einkalkuliert.
Bei unserer Ankunft in Zürich wurden wir von Rahels Eltern Jörg und Irma Knoepfel aus Rheineck am Flughafen abgeholt. Ich rief meine Eltern in Lachen an. Sie schlugen vor, dass wir alle nach Lachen kommen sollten, damit sie die Eltern von Rahel auch kennen lernen konnten. Unseren neuen Zivilstand gab ich noch nicht preis. In Lachen war auch Gotte Gret zu Gast.
Gesagt - getan. In meinem Elternhaus begrüssten sich alle sehr höflich und prosteten sich schon bald zu. Da ergriff ich das Wort und sagte, ich hätte eine Mitteilung zu machen. Gotte Gret warf ein, wir hätten uns wohl verlobt. "Noch schlimmer", sagte ich, "wir haben geheiratet". Nach ein paar Sekunden erstaunten Schweigens schlug mein Vater, der Älteste in der Runde vor, dass sich alle duzen sollten. Nun wurde gratuliert, geherzt, umarmt, geküsst. Es war ein schöner Nachmittag.
Trotz der erwähnten Gründe für eine "stille Hochzeit" hatten wir das Bedürfnis, die beiden grossen Familien miteinander bekannt zu machen. Deshalb luden wir etwa 40 Angehörige und einige Freunde im Herbst zu einer Wanderung im Appenzellerland ein. Schlusspunkt war das (inzwischen nach 105 Jahren Betrieb geschlossene) Hotel Waldau, wo wir ein festliches Abendessen genossen.



Am Abend vor der Geburt schauten wir uns in Zürich unser zukünftiges Auto an, einen VW Passat, und gingen dann zu einem Fondue zu meinen Eltern nach Lachen. Am späteren Abend setzten die Wehen ein, und Vera kam am Morgen des 4. Februar 1990, einem strahlend schönen Sonntag, im Spital Limmattal zur Welt. Mit unserem vom Malermeister Wernli gemieteten, grosszügigen Haus konnten wir unserem Töchterlein ein schönes Heim bieten.
Eineinhalb Jahre später, am 26. Oktober 1991, wurde unsere Livia geboren, ebenfalls im Spital Limmattal. Gotte Gret war seit einigen Tagen bei Rahel, um sie zu unterstützen. Ich war damals im Militärdienst in Sarnen. Frühmorgens am Samstag, 26. Oktober, sollte ich vom Dienst entlassen werden. Eine Bewilligung zur vorzeitigen Heimkehr im Falle der Geburt hatte ich schon tags zuvor eingeholt. Als am Freitag abends bei Rahel die Wehen einsetzten, versuchte Gret, mich "vorschriftsgemäss" über das Kompaniebüro zu erreichen. Dieses war aber regelwidrig nicht mehr besetzt. Also rief sie im Hotel Metzgern an, wo ich mit anderen Offizieren einquartiert war. Es war fast Mitternacht, und nur ein Kellner war noch am Aufräumen im Restaurant. Er nahm den Anruf entgegen, hatte aber keine Ahnung, wo ich schlief. Daher ging er von Zimmer zu Zimmer und rief meinen Namen, bis er mich gefunden hatte. Mein Gepäck stand schon bereit, und ich konnte im eigenen Auto losfahren. Ich traf noch rechtzeitig vor der Geburt im Limmattalspital ein.

Hinten: Daniela, Roman, Markus, Jörg, Gret, Sara, Michael S., Rolf.
Vorne: Kuno H., Irma, Friedel, Ika mit Livia, Röbi, Vera, Christoph, Armin H.
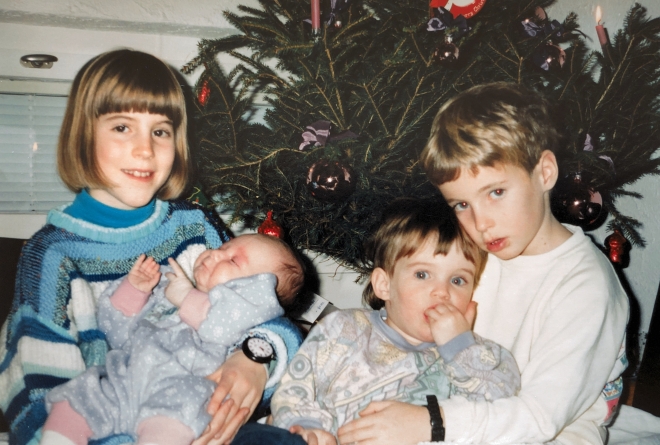


Roman hat das zweisprachige Gymnasium in Biel abgeschlossen. Dann hat er Studiengänge in Soziologie und in Islamwissenschaften absolviert. Teil davon ist ein profundes Studium der arabischen Sprache.
Im Jahre 2010, kurz vor dem Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien, arbeitete er ein Jahr lang als Praktikant auf der Schweizer Botschaft in Damaskus. An der Uni Bern studierte er auch beim Islamwissenschaftler Reinhard Schulze, der durch seine Kommentare in den Medien landesweit bekannt ist. Roman war zeitweise journalistisch tätig und hat etwa in der WOZ über Konflikte im Nahen Osten berichtet. Er besitzt eine grosse Empathie für alle Menschen unter Einschluss von Randgruppen. So hat er sich immer wieder für deren Belange eingesetzt. Aktuell arbeitet Roman für den Verein "Surprise", der die bekannte Strassenzeitung herausgibt. Daneben betätigt er sich in der Sanierung von Liegenschaften, auch im eigenen Mehrfamilienhaus im Zentrum von Biel. Seit 2024 züchtet er zudem auf einem selbst erworbenen Grundstück in Le Landeron Feigenbäume.
Vera erledigte schon in der Primarschule ihre Aufgaben zuverlässig. Nach guten Erfahrungen befreundeter Familien mit der Freien Evangelischen Schule in Zürich meldeten wir Vera dort zur Sekundarschule an. Sie gewann dort ein gutes Selbstvertrauen und absolvierte danach eine Immersionsklasse des Gymnasiums Küsnacht. "Immersion" bedeutet, dass etwa die Hälfte der Fächer in englischer Sprache erteilt und geprüft wurde.
Auch die Prüfung für den Numerus clausus und das Studium der Zahnmedizin hat Vera gut gemeistert. Nach dem Studium der Zahnmedizin hat sie sich nochmals aufgerafft und sich in Zürich zur Kieferorthopädin weitergebildet. Parallel dazu hat sie doktoriert. Dazwischen hat sie als Zahnärztin gearbeitet, u.a. an der Zahnklinik für Kinder und Jugendliche in der Stadt Uster und im Zahnarztzentrum am Hauptbahnhof in Bern. Heute arbeitet Vera als Kieferorthopädin in der Praxis Perfectsmile in Grenchen.
Livia erhielt nach dem ersten Jahr im Kindergarten die Option, in die erste Klasse zu wechseln. Die Meinungen der Lehrer, Eltern und Verwandten gingen stark auseinander. Schliesslich nahm sie die Herausforderung an und war fortan die Jüngste ihrer Klasse.
Zunächst wollte Livia Sprachen studieren, Französisch und Russisch, und machte ihren Bachelor. Danach suchte sie eine Neuorientierung. Mit der Logopädie wurde sie nicht glücklich, aber dafür nachher mit der Juristerei. Sie schloss mit dem Master ab und dissertierte mit einer Arbeit über "frozen conflicts" im postsowjetischen Raum unter dem Völkerrechtler Oliver Diggelmann. Nun hat sie womöglich ihre Traumstelle gefunden. Sie arbeitet zu 80 % im Eidgenössischen Departement des Äusseren als Juristin und befasst sich mit Staatsverträgen.

An der Mittelschule hatte sie ihren ersten Freund Niki kennen gelernt. Er war bei uns in Herrliberg gern gesehen und begleitete unsere Familie auch gelegentlich nach Davos. Später, beim Studium der Zahnmedizin, lernte Vera Jan Schenkel kennen. Er hatte bereits ein Auge auf Vera geworfen, und als er sie ansprach, wurden die beiden bald ein Paar. Sobald Jan das Studium abgeschlossen hatte und finanziell unabhängig wurde, mietete er eine Wohnung an der Erlachstrasse in Zürich. Ein Jahr später schloss auch Vera ihr Studium ab und zog bei ihm ein. Später wohnten die beiden in nach Kerzers im Freiburgischen. Damals arbeitete Jan am Inselspital und Vera in der kieferorthopädischen Praxis von Dr. Sascha Ryf in Biel.
Als sich Vera am Zahnärztlichen Institut der Universität Zürich zur Kieferorthopädin weiterbildete, zogen die beiden in die Gemeinde Egg im Zürcher Oberland. Das Paar heiratete im Sommer 2021 auf dem Zivilstandsamt Seeland in. Jan übernahm in bemerkenswerter Weise den Namen Enzler von seiner Braut. Anschliessend dinierte die kleine Gesellschaft auf der St. Petersinsel. Am 18. Semptember folgten eine Zeremonie in der Kirche und ein Fest am Lago Maggiore. Die etwa einhundert Freunde und Verwandten trafen sich am Vorabend zum Kennenlernen im Köpi Club am Lungolago von Laveno. Am Samstag fuhr die Gesellschaft auf einem Boot zur Zeremonie in der Kirche von Feriolo. Hündchen Brandy durfte die Ringe von der Kirchentür zum Altar bringen. Darauf folgte ein Aperitif. Dann ging es weiter per Boot zum Hotel Verbano auf der Isola dei Pescatori. Dort erlebten wir einen wunderbaren Abend. Auch der Himmel war gnädig und trug am Nachmittag und frühen Abend mit warmen Sonnenstrahlen zu dem unvergesslichen Anlass bei. Zum Ausklang des Abends verschob sich die Gesellschaft auf zwei aneinander vertäute Partyschiffe. Jetzt kamen gewaltige Regengüsse. Das störte indes nur uns Alte, die um ein Uhr in Laveno an Land gingen. Um drei Uhr war der Spuk vorbei, und die Jungen gelangten trockenen Fusses zu ihren Hotels und Wohnungen.
Im Herbst 2022 konnten Vera und Jan mit etwas elterlicher Unterstützung ihr Traumhaus kaufen. Es steht in einem liebevoll angelegten Garten, angrenzend an die Landwirtschaftszone in Dotzigen bei Büren. Jetzt arbeitete Jan in seiner plastisch-chirurgischen Praxis an der Bahnhofstrasse in Biel, 13 km vom Wohnort entfernt. Er hatte sie von Daniel Knutti übernommen, dem Bruder meiner ersten Frau Esther. Vera arbeitet bei Perfectsmile in Grenchen, 11 km von Dotzigen. Am 27. April kam ihr erstes Söhnchen Robin Georges in der Hirslanden-Klinik Linde in Biel zur Welt.


Unser erster Enkel entstammt der Beziehung von Roman mit Jane Magri. Juri Bonaventura wurde am 30. Mai 2019 geboren, ebenfalls in Biel, aber in einer Hausgeburt an der Logengasse 36A. Am 2. Februar 2022 wurde Jane von ihrem zweiten Kind entbunden, wiederum zuhause. Das Mädchen erhielt den Namen Maxine Elena.
Nach alledem wurde am 1. Juli 2023 geheiratet. Kurz davor eröffnete mir Roman, dass er den Namen Magri von seiner Frau annehmen werde. Das war eine Art ausgleichende Gerechtigkeit, nachdem ich durch die Übernahme meines Familiennamens durch Jan bereits unverhofft einen Stammhalter hatte.
Die Hochzeitsfeier fand in der Auberge des Gorges in Frinvillier statt, am oberen Ende der Bieler Taubenlochschlucht. Das war wieder ein sehr gelungenes Fest bei wunderbarem Sommerwetter.
Am 1. September 2025 kam die Nachricht von Roman wie ein Blitz aus heiterem Himmel: Jane wollte sich von ihm trennen und war auf der Suche nach einer eigenen Wohnung. Ihre Worte anlässlich der Hochzeit vor zwei Jahren hatten mich sehr bewegt. Ich dachte, die beiden seien ein perfektes Paar und ihre Liebe währe ewig.

Meine älteste Tochter Daniela hatte irgendwann in ihrer Berufstätigkeit Christian Varga kennen gelernt, der (wie sie zeitweise auch) für Entwicklungsprojekte tätig war. Beide fanden einander sympathisch, aber beide waren in festen Beziehungen. Jahre später begegneten sie sich erneut. Jetzt waren beide "single", und die Sympathie war noch da. Bald wurden sie ein Paar, auch ein wenig auf der Basis, dass beide keine Kinder haben wollten. Bei unseren gemeinsamen Ferien Ende 2019 auf Curaçao gab es vielleicht ein paar Meinungsverschiedenheiten, manchmal wurde aber auch geheimnisvoll getuschelt. Worüber, wussten wir nicht. Doch bald darauf war Daniela schwanger. Sie hatte es nicht leicht, denn sie bekam einen ausgeprägten Schwangerschafts-Diabetes, der mit hohen Insulindosen behandelt werden musste. Am 23. November kam Töchterchen Margo zur Welt. Wie schon alle ihre Cousins und Cousinen war sie ein gesundes und sehr herziges Baby. Glücklicherweise bildete sich der Diabetes bei Daniela vollständig und ohne Folgen zurück.
Die junge Familie wohnte einige Jahre an begehrter Lage in der "Matte" von Bern, an der Schifflaube 28. Im Herbst 2025 bezogen sie eine eigene Wohnung an der Lerberstrasse 18 in Bern. Dieser Ort liegt erhöht nordöstlich der Aareschleife in Bern und bietet einen herrlichen Blick auf den Fluss und die Stadt.

Livia war ein paar Jahre mit dem Studenten und begeisterten Sportler, dann Psychologen Gianandrea Pallich befreundet. Dann wollte sie wieder eigene Wege gehen. Schon Jahre zuvor hatte Livia William kennen gelernt. Beide arbeiteten am Stand der Automarke Volvo am "Salon de l'Automobile". Hundertzwanzig Jahre lang war diese Automesse eine wichtige Institution, aber inzwischen wurde sie aufgegeben wegen der immer stärkeren Konkurrenz von München und Paris. Livia und William trafen sich erneut bei gemeinsamen Freunden und wurden ein Paar. Mehrmals haben sie Rahel und mich begleitet auf Reisen, unter anderem nach Laveno oder nach Dalmatien, wo wir mit der Firma Inselhüpfen per Schiff und Velo unterwegs waren. Bei den Ferien mit der ganzen Familie im Februar 2025 in Thailand gaben die beiden ihre Verlobung bekannt. Im August 2025 verbrachten wir wieder gemeinsame Ferien, diesmal in Helsingborg im Süden von Schweden. Williams Vater Christian, von der Mutter Dominique seit langem geschieden, wohnt dort in einem kleinen Haus auf einem Grundstück, das er von der Familie seiner Mutter geerbt hat. Dominique und die Geschwister von William, Céline und Eric, waren auch dabei.
Wir haben gemeinsam sehr schöne Tage verbracht. Ein Höhepunkt war eine Spaziergang durch Ländereien der Grafen Wachtmeister mit einem Schloss aus der Renaissance und einem grösseren im eklektizistischen Baustil des 19. Jahrhundert. Hier war die Grossmutter von William aufgewachsen, die Gräfin Ebba Wachtmeister. Die Familie stammt von Deutschrittern im Baltikum ab, wurde aber schon 1578 in den schwedischan Adel aufgenommen. Als Erstgeborene hätte Ebba den ganzen Besitz geerbt, aber die Liebe zum Juristen Dominque Bonhôte aus Neuchâchtel hat sie in der Schweiz festgehalten und auf ihr Erbe verzichten lassen. Schlossherr ist ein Cousin von Christian.
Auch sehr schön war eine Velotour auf der Insel Ven, wo der Astronom Tycho Brahe während Jahrzehnten Himmelsbeobachtungen akribische aufgeschrieben hat. Rahel und ich verbrachten danach fünf unvergessliche Sommertage in Stockholm.

Meine erste Ehe mit Esther war nie das reine Glück. Wir waren uns auch schon bald nicht mehr treu. Die Frage nach Ursache und Wirkung ist so müssig wie die Frage bezüglich Huhn oder Ei. Nach dem Scheitern der Ehe hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil uns ein harmonisches Eheleben nicht gelungen war, und die Kinder ohne Vater aufwachsen würden.
Bei der Beziehung mit Rahel wollte ich alles richtig machen. Ich erinnere mich an eine nächtliche Fahrt über die tief verschneite Autobahn von Basel nach Rheinfelden am Anfang unserer Beziehung. Ich war sehr verliebt und sagte zu ihr, dass bei einem zukünftigen Streit die Schuld allein bei mir liegen könne. Sie antwortete "spiegelbildlich". Nein, sie könne sich das nicht vorstellen, sie müsste schuld sein. Ich war glücklich und gelobte mir, ohne es auszusprechen, bei unserer Beziehung grösste Sorgfalt walten zu lassen.
Nach ein paar Jahren hatte die Routine aber auch unsere Beziehung eingeholt. Jede Seite tendierte dazu, bei Meinungsverschiedenheiten bei sich selber das Recht und beim Gegenüber das Unrecht zu sehen. Ein paarmal wurden wir wohl auch lauter als angebracht. Wir beide befürchteten, dass die Pensionierung und das damit verbundene engere Zusammensein unser Verhältnis weiter komplizieren könnte. Eine Verschlechterung trat aber nicht ein, im Gegenteil. Wir wurden beide gelassener und teilen mehr harmonische Erlebnisse als vor zehn oder zwanzig Jahren.
Meine berufliche Tätigkeit hat mich meistens stark beansprucht. Das war ein Grund, weshalb die Arbeit im und ums Haus sowie die Erziehung unserer Töchter weitgehend von Rahel erledigt wurden. Für ihre Qualität als Mutter spricht die erfreuliche Entwicklung unserer Töchter durch alle bisherigen Lebensphasen. Nach der Pensionierung hatte ich plötzlich viel verfügbare Zeit. Meine häuslichen Aktivitäten haben aber nicht im gleichen Ausmass zugenommen.
Ich koche gelegentlich, pflege das Schwimmbad und ein wenig den Garten sowie die Fahrräder, decke den Tisch und räume ab. Gelegentlich gehe ich einkaufen, am liebsten mit der App "Bring!", einem elektronischen Einkaufszettel von der Migros, wo wir beide unsere Bestellungen eintragen können.
Rahel ist eine gute Köchin und eine sorgfältige Haushälterin. Ich bin mir wirklich für nichts "zu schade", aber Rahel hat im Haushalt "das Sagen". Mein gelegentlich schlechtes Gewissen pariert sie mit der Feststellung, dass ich viele Jahre lang mehr als sie gearbeitet habe und ja auch gut zehn Jahre älter sei. Sie findet die aktuelle Rollenverteilung daher unproblematisch, umso mehr, als sie beim Haushalten oft Hörbücher abspielt, und die Arbeit daher gar nicht als langweilig oder lästig empfindet.
Mein Verhältnis zu allen Kindern und auch unter ihnen ist geprägt von Respekt und Zuneigung. Allerdings könnte mein Verhältnis zu ihnen noch enger sein. Rahel hat häufiger Kontakt und auch intensiver. Bei längeren Gesprächen, auch im "Mädels-Chat" zwischen Rahel, Vera und Livia gibt es wohl lange Unterhaltungen über Hunde, Pferde, Ställe und die Reiterei.
Bin ich eifersüchtig? Ich bin ambivalent, auch gar nicht überzeugt, dass ich bei dieser Art von Austausch voll integriert sein möchte.
Nach einer verbreiteten Meinung tauschen sich Kinder mit der Mutter enger und länger aus als mit dem Vater. Töchter sowieso. Das tröstet mich. Wenn die Kinder Unterstützung brauchen, wissen sie, dass sie sich an mich wenden können. Auch wenn jemand Geld brauchte, etwa für eine Hochzeit oder einen Hauskauf, habe ich den erforderlichen Betrag überwiesen. Um Gerechtigkeit bemüht, habe ich die gleiche Summe jeweils auch an die anderen drei Kinder ausbezahlt. Insgesamt beläuft sich der Transfer auf etwa eine Million. Das fiel mir nicht schwer, zumal in den Jahren 2023 und 2024 sowohl Gotte Gret als auch Mami verstorben sind. Beide haben ansehnliche Guthaben hinterlassen, die wesentlich dem Erbe ihres Vaters Otto Bösch zu verdanken sind.

Zusätzlich gingen wir mit Freunden zum Windsurfen nach Domaso am Comersee oder nach Torbole und Riva am Gardasee. Die Mädchen lernten früh schwimmen und im Winter skifahren. Regelmässig bekamen wir Besuch von unseren Eltern und Geschwistern. Oft reisten sie mit ihren eigenen Kindern an, mit bis zu acht Cousinen und Cousins von meiner Seite und fünf weiteren von Rahel. Die Kontakte mit Daniela und Roman waren nicht sehr häufig, aber stets liebevoll.
So erlebten wir alle vorwiegend glückliche Zeiten. Vom ersten Todesfall in der engeren Familie, dem meines Vaters 1991, haben die Kinder nicht viel mitbekommen. Mehr bewegt haben sie der frühe Tod meines jüngeren Bruders Peter im Jahre 2001 und dann der Hinschied von Grossvater Jörg anno 2016.
Eine besondere Zeit für unser Familienleben war das halbe Jahr, das wir 1995 in Liverpool verbrachten. Die Kinder fühlten sich sehr wohl im Haus an der Priory Wharf, Birkenhead, direkt am River Mersey. An Werktagen besuchten sie Kindertagesstätten, ihre getrennten "Nurseries". Rahel arbeitete zeitweise unentgeltlich im Gefässlabor. Wir erinnern uns an eine lustige Episode, wo einer ihrer Patienten erstaunt feststellte, dass auch sie aus der Schweiz sei. Er hätte heute bereits einen Schweizer Arzt kennen gelernt, der Arnold Schwarzenegger gleiche. "I mean the head, not the body". Mindestens dem zweiten Teil des Satzes konnte sie nicht widersprechen.
Nach der Rückkehr in die Schweiz sagten die Kinder eines Tages, dass sie nach England zurückkehren wollten. Warum wohl? "Weil dort immer die Sonne scheint", lautete die Antwort. Tatsächlich hatten wir in Liverpool ein unglaublich sonniges und warmes Jahr erlebt, 1995 wurde auch als "year of drought" bezeichnet.
Nun wohnten wir kurzfristig im Haus meiner Mutter in Lachen. Sie hatte sich in ihre Wohnung nach Davos zurückgezogen, um uns das Feld zu überlassen. Während dieser Zeit besuchten wir gerne die Baustelle unseres neuen Hauses in Herrliberg. Ende August 1996 konnten wir einziehen. Herrliberg war seither der geographische Mittelpunkt unserer Familie.
Eine gemeinsame Passion von Rahel und mir war und ist das Reisen. Im Laufe der Jahre waren wir zusammen in den USA, in Brasilien, Bolivien, Thailand, Indonesien, Marokko oder Ägypten, oft in Italien, Frankreich, Jugoslawien und Griechenland. Weitere Reisen führten nach Russland, in die Türkei, nach Myanmar, Laos, Vietnam, Japan, Indien, Norwegen, Holland. Hinzu kamen zwei oder drei Kreuzfahrten in der Karibik. Spektakulär war eine Reise im Kleinflugzeug von Hohenems in Vorarlberg nach Kapstadt mit Dr. med. Georg Schlatter als Pilot und 9 Passagieren. Dazu gehörten John und Ise Gut und meine Schwester Franziska. Wir landeten an etwa 18 Destinationen und erlebten mehrere Safaris vom Feinsten.
Besonders angetan haben es uns Flusskreuzfahrten auf dem Nil, der Wolga, dem Rhein und der Mosel, dem Irrawaddy oder dem Mekong. Mehrmals waren wir mit gemieteten Booten in Dalmatien und in den Kykladen unterwegs, meist mit Guy Petignat als Skipper. Auf Bootsferien in den Norfolk Broads und in der Mecklenburgischen Seenplatte begleiteten uns Corina Gieré und ihrer Tochter Annina. In Mecklenburg war auch unsere junge Hündin Anik dabei. Sie musste jeweils mit einigem Aufwand über eine improvisierte Brücke vom Boot an Land und zurück transportiert werden.
Corina führte uns zweimal nach Griechenland, einmal zum Peloponnes und einmal nach Kreta. Wir erkundeten Landschaften und Kulturstätten per Mietauto und zu Fuss. Besonders eindrücklich waren eine ausgedehnte Wanderung durch die Schlucht von Samaria auf Kreta, die Besichtigung von Monemvassia oder eine Aufführung von Aristophanes' "Die Vögel" im antiken Theater von Epidauros.
Auch eine grössere Reise nach Thailand bleibt in guter Erinnerung. Zusammen mit Edith und Marius Breitenmoser mit Sohn Manuel sowie Elsbeth und René Schweri mit ihren Kindern Renzo, Silvana und Danilo fuhren wir im Kleinbus durch den Norden des Landes, über Chiang Mai bis zum Goldenen Dreieck. Die Führerin, die sich selber "Blüemli" nannte, unterhielt uns regelmässig mit ihren interessanten Ausführungen und lockeren Sprüchen. Im Anschluss verbrachten wir eine Woche am Strand in Phuket.
Ein probates Mittel, alle vier Kinder zusammenzubringen, waren Tauchferien. Mehrmals verbrachten wir gemeinsam Zeit über und unter dem Wasser in Ägypten, zuerst in Sharm-el-Sheik, später in El-Quseir. Alle Familienmitglieder und die Partner waren schliesslich im Besitz eines Tauchscheins.
Es folgte eine grandiose Kreuzfahrt auf dem Nil von Luxor nach Assuan und zurück, inklusive Ausflug nach Abu Simbel. Anschliessend verbrachten wir eine Woche Tauchferien in Soma Bay, wo wir die Familien Steinmann und Geilinger trafen.
Zu meinem 70. Geburtstag lud ich die ganze Familie über Weihnachten nach Curaçao ein. In dem sehr charmanten Hotel "Lion's Dive" fühlten wir uns überaus wohl. Die Unterwasserwelt war nicht so reich wie in Ägypten, trotzdem haben wir auch die dortigen Tauchausflüge sehr genossen.
Nach meinem 75. Geburtstag, im Februar 2025, flogen wir mit den vier Kindern, ihren PartnerInnen und den drei Enkelkindern Juri, Margo und Maxine zu zwei Wochen Strandferien ein. Im Club Robinson auf Khao Lak in Thailand hatte jedes Paar einen eigenen Bungalow mit Swimming Pool und direktem Zugang zu Strand und Meer. Mit von der Partie war auch Robin der Sohn von Vera, der allerdings erst zwei Monate später zur Welt kam. Diese Familie war so angetan, dass sie einen weiteren Aufenthalt im kommenden Jahr in Betracht zieht.
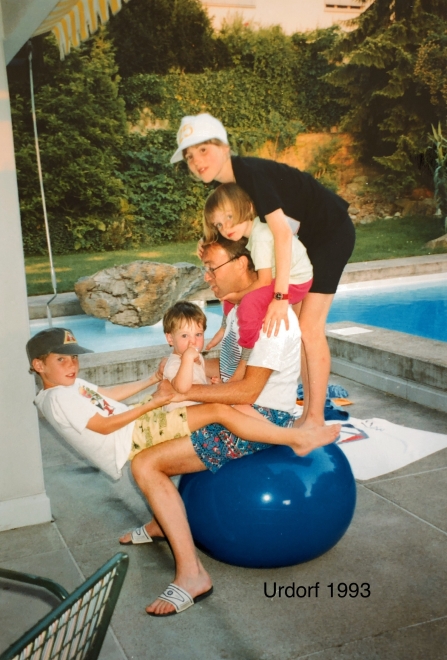

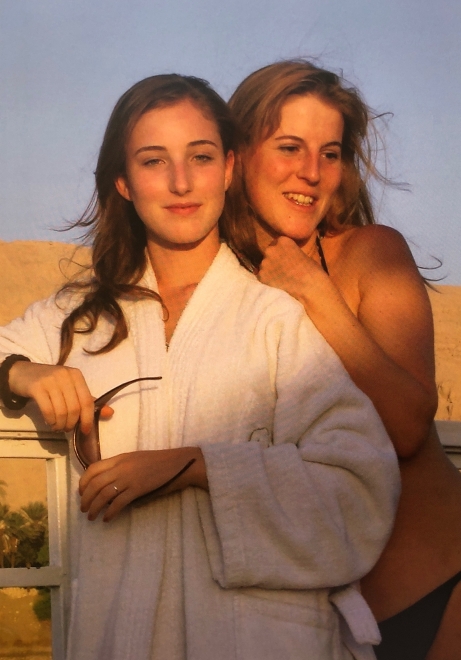



Eine kleine, reizende Hündin war besonders anhänglich, und wir freundeten uns gleich mit ihr an. Schliesslich entschieden wir, sie mit nach Hause zu nehmen. Wir gaben ihr den Namen "Kossa", in Erinnerung an ihre Herkunft aus Kos.
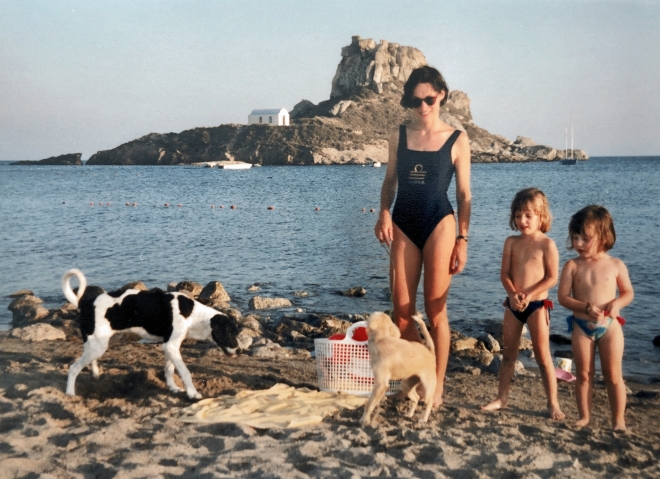
Zunächst benötigte Kossa einen Impfausweis. Ein Tierarzt war bald zur Stelle und verpasste Kossa die nötigen Impfungen. Die Eintragungen im Ausweis datierte er ein wenig vor, damit beim Import in die Schweiz die Fristen dem Anschein nach eingehalten wurden.
Bei der Ankunft in Zürich schlief Kossa noch tief. Wir gingen durch den Zoll, ohne etwas zu deklarieren. Kaum hatten wir den Zollbereich verlassen, sprang Kossa aus der Tasche und pinkelte auf den Boden der Ankunftshalle. Als wir in Urdorf eintrafen, holten wir bei unseren Nachbarn etwas Hundefutter. Auch Leimgrüeblers freuten sich über unseren neuen Mitbewohner. Am nächsten Morgen riefen sie uns aber entsetzt an, weil bei ihnen im ganzen Haus Flöhe herumsprangen.
Nach einer Floh- und einer Wurmkur schien unser Hündchen gesund und lebte etwa zehn Jahre glücklich mit unserer Familie. Nach dem Umzug nach Herrliberg war sie im Dorf für ihre Selbstständigkeit bekannt. Sie ging täglich auf eigene Faust auf Tournee und sammelte bei verschiedenen Häusern ihre Häppchen ein, unter anderem im Restaurant Frohe Aussicht, das später zum Privathaus des Bau- und Immobilienunternehmers Christian Spleiss geworden ist. Trotz ihrer kulinarischen Exkurse blieb Kossa stets schlank.
Mit gut zehn Jahren starb sie an Brustkrebs.
In Emmetten brachte eine hübsche Hündin der Rasse Golden Retriever einen Wurf Welpen zur Welt. Durch Vermittlung von Rahels Schwester Viola übernahmen wir ein weibliches Hündchen mit dem Namen Anik. Kossa und Anik kamen sehr gut miteinander zurecht.
Nach Kossas Tod campierten Rahel und Viola mit den Kindern auf einem Grundstück in Seelisberg, das damals der Familie meiner Mutter gehörte und 2025 nach einigen Anstrengungen meinerseits an Bauer Werner Würsch verkauft wurde. Auf dem Hof, der vom Bauern Odermatt betrieben wurde, gab es einen frischen Wurf von Kätzchen. Auf Wunsch der Kinder durften sie zwei kleine Kater mit nach Hause nehmen. Sie gaben ihnen die Namen Timi und Gliko. Ich erinnere mich an ein Foto, auf dem die Hüdin Anik auf dem Rücken liegt und in jedem "Arm" ein Kätzchen hält. Gliko ging eines Tages verloren, Timi begleitete uns siebzehn Jahre lang.
Rahel und die Kinder liebten Anik noch mehr als Kossa. Sie wurde aber nur 7 Jahre alt, bevor sie ebenfalls an Brustkrebs zugrunde ging. Auf Anik folgte Miro, ein Rüde der gleichen Rasse aus dem Entlebuch. Er wurde uns zum treuesten aller Begleiter, bis er mit 14 Jahren wegen verschiedener Leiden eingeschläfert werden musste. Der Verlust traf vor allem Rahel schwer.
Schliesslich gab es noch ein paar Pferde in unserer Familie. Die treibende Kraft war zunächst Vera, die schon als kleines Kind in Pferde vernarrt war. Sie brachte auch Rahel zum Reiten. Schliesslich kauften wir eine Stute mit dem Namen "La Vie Pure", die aber nach wenigen Jahren von ihren Leiden erlöst werden musste. Sie hatte wohl eine Diskushernie am Hals, die zu Gangunsicherheiten führte und beim Reiten zur Gefahr wurde. Das nächste Pferd hiess Forsythia. Sie war ein wunderbares Pferd, wurde aber nach etwa zehn Jahren zunehmend durch Zitterattacken geplagt, zuletzt noch zusätzlich durch eine Vereiterung der Kieferhöhlen. Sie musste ebenfalls euthanasiert werden. Noch vorher kauften sich die Damen den Wallach Rubino. Er bekam schon in jungen Jahren Meniskusbeschwerden. Er wurde deswegen operiert und therapiert, musste aber schliesslich auch euthanasiert werden. Aktuell besitzt Vera eine Stute namens Saliana, deren Gesundheit bisher keine Probleme macht. Sie wohnt im Stall Ey der Familie Schmalz in Büren an der Aare.



Wir lernten früh schwimmen. Hilfreich war ein Angebot von Grossvater Bösch von 5 Franken für jeden, der in Lachen die Hafeneinfahrt schwimmend überqueren konnte. Sie war etwa zehn Meter breit.
Später gingen wir gerne in die "Badi", die Badeanstalt der Gemeinde, oder in unser Badehäuschen, zunächst mit den Eltern oder der Hausangestellten, später auch mit Geschwistern oder mit Freunden.
Im Winter gefror der Hafen manchmal. Dann war Schlittschuhfahren angesagt. Selbst bei dünnem Eis wagten wir uns hinaus. Manchmal gab das dünne Eis beim Überqueren wellenförmig nach, was den Läufer als Held erscheinen liess. Ein besonders kecker Läufer brach einmal durch das dünne Eis, an ernste Folgen kann ich mich aber nicht erinnern.
Als junger Student träumte ich von einem Segelboot. Zusammen mit Matthias Oechslin aus der unmittelbaren Nachbarschaft, und mit der hübschen Kindergärtnerin Lilian Schmid aus dem Nachbardorf Siebnen fuhren wir in meinem ersten Auto, dem kleinen Renault 4 CV, zu einem Segelkurs nach de Kaag in den Niederlanden. Irgendwo am Rhein übernachteten wir zu dritt im Zelt. Gerne wäre ich Lilian näher gekommen, aber ich wagte rein gar nichts
Bald darauf kauften Matthias und ich zusammen eine gebrauchte Rennjolle des Typs 505 von Martin Fehlmann im Höhgaden. Wir bekamen einen Trockenplatz nahe beim Aahorn ("Horä"). Dort war über viele Jahre mit Abfällen aus ganz Lachen ein Damm aufgeschüttet worden.
Bei gutem Wind ging ich mit Matthias oder Franziska oder anderen Bekannten gerne auf den See. Gerne stieg ich bei guten Winden ins Trapez, hisste manchmal auch den Spinnaker, manchmal alles auf einmal und ganz alleine. Dafür hatte ich für das Ruder einen besonders langen Ausleger gebastelt. Ein- oder zweimal kenterte das Boot, aber ich konnte es auch alleine wieder aufrichten.
Nach dem Studium fehlte uns die Zeit, und das Boot wurde verkauft.
Von Basel aus entdeckte ich das Windsurfen. Mit Basler Freunden verbrachten wir Wochenenden am Sempacher-, Thuner- oder Urnersee. Manchmal fuhren wir über Pfingsten oder für eine ganze Woche nach Domaso am Comersee oder nach Torbole am Gardasee. Dort waren die Windverhälnisse die besten. Regelmässig blies morgens der "Vento" von Norden und ziemlich verlässlich von ein Uhr an die "Ora" von Süden. Wir alle waren vom Windsurfen begeistert. Am Abend kamen wir oft erschöpft zum Campingplatz zurück und brauchten alle Kraft, um uns noch zum Abendessen aufzuraffen.

Später nahm ich an Segeltörns teil, zweimal mit den Ehepaaren Hans und Ise Gut sowie Ueli und Fränzi Stüssi. Sie führten uns von Venedig nach Dalmatien und von den British Virgin Islands in die umliegenden Gewässer der Karibik. Eigentlich wollte ich den Segelschein für Küstengewässer erlangen. Die B-Schein-Prüfung bereitete ich auf eigene Faust vor und bestand. Die nötigen 1000 Meilen konnte ich aber nicht innerhalb der gegebenen Frist von drei Jahren absolvieren.
Weitere 10 Jahre später segelten Rahel und ich mit unseren St. Galler Freunden erneut in der Karibik.
In den letzten Jahren ging ich verschiedentlich auf Törns mit Guy Petignat und weiteren Freunden in verschiedenen Gegenden der Ägäis.


Viel Freude bereitet hat mir stets auch harmonisches Zusammensein mit der Familie, mit Eltern und Geschwistern, mit den eigenen Kindern und ihren Angetrauten, schliesslich auch mit den Enkeln.
Lebenslängliche Freundschaften habe ich einige gepflegt und pflege sie weiter. Ich bin zudem vernetzt über die Gesellschaft zu Constaffel, den Lions Club Herrliberg, den Singkreis Herrliberg und den Zürcher Konzertchor.
Eine Freundesgruppe geht auf das Medizinstudium zurück. Nach dem frühen Tod von Walter Grubenmann und dem Rücktritt von Dieter Grob besteht unser selbsternannter "Grufti"-Club noch aus Dieter Käser mit Iris, Thomas Weber mit Brigitte, Ursula (Diri) mit Donat Blum sowie Fredy Loretz mit Lilotte. Einmal im Jahr treffen wir uns reihum in einem Zuhause zu einem gemütlichen Abendessen. Die Wohnorte sind Wernetshausen am Bachtel, Zollikerberg, Wädenswil, Rifferswil und natürlich Herrliberg. Bei dieser Gelegenheit lassen wir jeweils unsere Erinnerungen an die Studentenzeit hochleben, u.a. an gemeinsame Erlebnisse in unserer WG an der Wotanstrasse, wo neben mir auch Diri und Dieter zeitweilig gewohnt haben.
Ein weiterer Freundeskreis trifft sich mindestens einmal jährlich zwischen Weihnachten und Neujahr im Veltlinerstübli in Monstein bei Davos zu einem Abendessen. Alle beteiligten Freundschaften gehen auf meiner Basler Zeit zurück: Coni und Christoph Ackermann, Eva und Misa Gütling, Claudia und Peter Vogelbach und neuerdings Annette Bailleux und Raetus Casty. Raetus hat den grössten Teil seines Lebens als Möbelhändler in Davos verbracht und hat jetzt mit Annette auch einen Wohnsitz in Erlenbach. Ackermanns wohnen in Oberwil BL und besitzen das Haus in Herrliberg, das sich westlich unmittelbar neben uns befindet. Neuerdings wohnen darin ihre Tochter Bettina und ihr Gatte Claudio Decurtins sowie deren Kinder Leo und Alma. So kommt es, dass im Nachbarhaus gleich zwei Freundespaare ein- und ausgehen, eben Coni und Christoph Ackermann sowie Mariann und Arthur Decurtins. Alle drei Paare haben Wohnsitze in Davos, das dortige Haus der Familie Decurtins ist sogar zu ihrem primären Wohnsitz geworden.
Vor einem Jahr hat sich ein neues Grüppchen formiert. Mariann und Arthur Decurtins haben ihren langjährigen Freund Robert Lombardini mit Gattin Mara in ihre eindrückliche Stadtwohnung im Hochhaus Löwenbräu in Zürich eingeladen. Mit von der Partie waren auch meine Schwester Franziska mit Valentin Vogt sowie Rahel und ich. Bald folgte eine Gegeneinladung ins grosszügige Haus von Valentin in Hombrechtikon, dann eine weitere vom Ehepaar Lombardini in ihr schönes Haus in Hünenberg. Im Herbst luden wir die Gruppe zu uns nach Herrliberg ein.
Die wichtigsten Freunde der letzten Jahre waren "Die Herren", so der Name unserer WhatsApp Gruppe. Dazu gehören Peter Schweizer, Bruno Langfritz und Guy Petignat. Wir haben viele Jahre zusammen im Singkreis Herrliberg gesungen, musizierten auch mehrmals zusammen mit dem Kammerchor Cantus in der Schweiz und in der Ukraine, oft in Kombination mit Besuchen weiterer Städte und Landschaften. Wir gingen öfter zusammen auf halb- bis ganztägige Touren mit unseren E-Bikes. Zudem treffen wir uns etwa einmal im Monat zum Abendessen. Wir kochen selber "reihum", manchmal laden wir zusätzlich unsere Damen ein.
Mit Fahrrädern mit der Unterstützung von Elektromotoren haben auch Rahel und ich ein neues gemeinsames Hobby gefunden. Wir erkundeten bereits einige Gegenden der Schweiz, das Baskenland, das Piemont, die dalmatinische Küste, die Kykladen. In diesen Tagen haben wir für Rahel ein neues Fahrrad von Centurion gekauft, "fully suspended", und wir hoffen, dass wir dieses "Steckenpferd" noch lange reiten können.

Wenn die Zufriedenheit wesentlich vom Beruf kommt, und die Berufstätigkeit eines Tages wegfällt, droht Gefahr. Einige Patienten und Freunde haben mich gefragt, ob ich mich nicht vor der Pensionierung fürchte. Eine ärztliche Freundin aus Einsiedeln berichtete mir von tiefen Depressionen ihres Vaters, der als Zahnarzt gearbeitet hatte. Solche Erkrankungen sind leider nicht selten.

Papi Alfons war am Gymnasium Mitglied der Suitia und an der Universität bei der Akademischen Verbindung der "Welfen". Bis ins Alter pflegte er freundschaftliche Beziehungen, die auf die Welfen zurückgingen. Erwähnen möchte ich Paul Hofmann, Anwalt in Rapperswil und CVP-Ständerat der Kantons St. Gallen, weiter Gottfried Hobi, ebenfalls Jurist und später Gesundheitsdirektor des Kantons St. Gallen oder Hubert Mäder, Chirurg und langjähriger Chefarzt am Kantonsspital Zug.
Alle drei und zum Teil ihre Gattinnen wurden zu Paten und Patinnen meiner Geschwister.
Trotz dieser eindeutig positiven Erfahrungen riet Papi tendenziell von einer Mitgliedschaft ab. Warum eigentlich? Hatte er zu viele Trinkgelage erlebt, vor denen er uns verschonen wollte? Seine Bestrebungen waren erfolgreich, denn keiner von uns drei Brüdern trat einer Studentenvereinigung bei.
Papi war auch Rotarier und Mitbegründer des Rotary Club Zürich Obersee, der jeweils im Hotel Bächau tagte. Mir scheint, dass er von diesem Kreis viel Zuneigung und Unterstützung erfahren hat. Er hat wohl auch viel zum Clubleben beigetragen mit seinem Charme, seiner Eloquenz und seinem Klavierspiel.
Ich konnte als Vierzehnjähriger von Rotary in Form eines Jugendaustausches profitieren und verbrachte drei Wochen in Bushey Heath bei der Familie Halliwell nördlich von London. Von dort führte uns Miles' Vater im Auto nach Stratford-upon-Avon, Warwick Castle und weiteren Sehenswürdigkeiten.
Es war naheliegend, dass auch meine Brüder Thomas und Peter später Rotarier wurden. Ich wäre ebenfalls dazu bereit gewesen, wurde aber nie angefragt.
Im Jahre 2004 wurde ich von Ted Metzger in den Lions Club Herrliberg eingeladen. Ich sagte gerne zu, wies aber darauf hin, dass ich wegen meines Engagements beim Singkreis Herrliberg nicht immer kommen könnte, denn beide Gruppen trafen sich jeweils am Montag Abend, Lions aber nur zweimal pro Monat. Die Lions akzeptierten das, Ted und Hans Haag wurden meine Paten.
Kurz nach dem Eintritt in den Club übernahm ich das Ressort "Activities", und konnte ein paar Einsätze gestalten. Beispielsweise bauten wir an Wanderwegen und Picknickplätzen in Isenthal im Kanton Uri und in Gletsch im Wallis. 2011-12 war ich Clubpräsident, 2012 wurde ich Delegierter des District 102 E für LEMC - Lions European Music Competition. Von 2015 bis 2022 war ich dann LEMC-Delegierter des Multidisrict 102, der die Schweiz und Liechtenstein umfasst.
Während meiner zehnjährigen Tätigkeit für LEMC nahm ich an einigen Europaforen teil, in deren Rahmen jeweils auch die Musik-Wettbewerbe stattfanden. Ich gewann bei diesen Treffen Freunde unter den Lions aus der Schweiz und vielen anderen Ländern, und auch unter den teilnehmenden Musikern und Juroren.
Meine "Première" war das Europaforum in Brüssel anno 2012. In diesem Jahr war der Wettbewerb dem Violoncello gewidmet. Ich konnte Chiara Enderle aus Zürich rekrutieren, und sie gewann den 2. Preis. Weitere Destinationen waren Istanbul, Augsburg und Sofia. In Sofia 2016 gewann "unser" Violinist Anthony Fournier aus dem Wallis den 1. Preis.
In besonderer Erinnerung bleibt mir der Wettbewerb in Montreux mit der Trompete als Instrument. Als lokaler Oganisator hatte ich viel Arbeit zu erledigen. Gut geführt und unterstützt wurde ich von Pastor Ingo Brookmann aus Leer in Friesland. Er leitete LEMC schon seit einigen Jahren und war somit mein Vorgesetzter, der zum Freund wurde. Zusammen mit seiner reformierten Kirchgemeinde Leer besuchten Rahel und ich 2017 eine von Ingo geführte, hochinteressante Reise durchs "Heilige Land".
Für meine Organisation namentlich in Montreux erhielt ich viel Anerkennung. Die bisher letzte Teilnahme an einem Europaforum war 2022 in Zagreb. Endlich kam bei LEMC wieder die menschliche Stimme als Instrument zum Zug, wie ich es schon seit Jahren angestrebt hatte.
Als Musik-Delegierter war ich Mitglied des Governor-Rats und konnte Vorschläge einbringen. Ich zitiere aus der Lion Zeitschrift vom 6. Dezember 2017: "Die Idee kam von Markus Enzler, Delegierter Musikwettbewerb des MD 102. Wie wäre es, fragte er im Frühjahr 2016 an seiner ersten Sitzung im Governorrat, wenn die Lions anlässlich des Centennials der Öffentlichkeit ein Modell des Bundeshauses schenken würden? Es wäre ein Geschenk, das weit über das Jubiläumsjahr hinaus Bestand hätte und auf sympathische Weise öffentlichkeits- und medienwirksam wäre. Die Begeisterung über den Vorschlag hielt sich in Grenzen. Nur einer fing sofort Feuer: Peter Molinari, damals amtierender District-Governor des Bezirks Ost. Gemeinsam machten sich die beiden dazu auf, das Projekt zu konkretisieren." Das über 100'000 Franken teure Modell aus Bronze wurde von der Kunstgiesserei St. Gallen hergestellt und im Namen der Lions als haptisches Modell den Blinden und Sehbehinderten und der ganzen Bevölkerung geschenkt. Es steht auf dem "Känzeli" im Südwesten der Bundeshausterrasse. Von dort geniesst man auch eine hervorragende Aussicht auf die Berner Alpen, etwa auf die Gipfel von Eiger, Mönch und Jungfrau.

Mein Bruder Thomas ist seit Langem mit Suzanne, geborene Escher verheiratet. Ihr Vater Hans Konrad Escher war "Constaffelherr", der Vorsteher der hochgeachteten Gesellschaft zu Constaffel mit Sitz im Haus zum Rüden in Zürich. Als Schwiegersohn des Constaffelherrn wurde Thomas früh in die Gesellschaft aufgenommen. Als ich Mitte der Neunziger Jahre auch in Zürich Fuss gefasst hatte, lud mich mein Bruder als Gast ein. Schliesslich wurde auch ich Mitglied. Ich gehe oft und gern zu den Anlässen, unter anderem am Sechseläuten mit Umzug, kulinarischen Freuden und rhetorischen Höhepunkten. Dafür sorgen illustre Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, u.a. die Rektoren der Universität und der ETH, aber auch unsere Constaffelherren.


Als Student bekam ich von Papi etwa 500 Franken im Monat, aber leider nicht durch regelmässige Überweisungen. Meine Geschwister und ich mussten jeweils nachfragen. Wir empfanden die Bittgänge als demütigend.
Das war einer der Gründe, nach zusätzlichem Einkommen zu suchen. Mit verschiedenen Nebenbeschäftigungen, über die ich an anderer Stelle berichte, konnte ich mein Budget etwa verdoppeln.
Als Arzt erhielt ich in Basel mehr Lohn als Kollegen in anderen Kantonen, ich glaube, es waren schon zu Beginn über 4000 Franken monatlich. Damit konnte ich mir die schicke Wohnung am Pfeffergässlein 13 leisten, ab und zu in den Ausgang, manchmal in die Ferien. Als Oberarzt nahmen die Einkünfte weiter zu, aber nun hatte ich ja eine Familie zu ernähren.
Im Grunde behielt ich meine Sparsamkeit über die meiste Zeit meines Lebens bei.
In der Privatpraxis stiegen die Einnahmen bald auf das Doppelte dessen, was ich als Oberarzt verdient hatte, später noch weiter. Inzwischen hatte ich aber das Haus in Herrliberg gekauft, finanziert mit der grösstmöglichen Hypothek und mit Darlehen von Mami und Gret im Umfang von 300'000 Franken. In etwa zwei Jahren konnte ich den Damen ihre Einsätze zurückzahlen. Nun floss das nicht benötigte Geld in die Altersvorsorge.
Mit 55 Jahren kaufte ich weitere Liegenschaften, nämlich die Ferienwohnung in Davos, mit Möblierung für eine knappe Million. Fast gleichzeitig zog Mami vom Haus in Lachen ins Tertianum. Darauf realisierten der Architekt Otto Senn und ich gemeinsam das Projekt „Sonnenhof“. Meine Geschwister wurden mit je 450'000 Franken entschädigt.
Als ich mit 62 Jahren das Venenzentrum am See gründete, musste ich wieder eine halbe Million investieren. Schon damals hatte ich aber die Absicht, etwa weitere zehn Jahre zu arbeiten, wenn es meine Gesundheit erlaubte. Diese zehn Jahre wurden die wirtschaftlich erfolgreichsten meiner Karriere. Mit 65 liess ich mir die Guthaben aus der 2. Säule der Altersvorsorge auszahlen. Nun leisteten wir uns noch eine zweite Ferienwohnung, diesmal im lombardischen Laveno am Lago Maggiore. Die Investition war ähnlich wie in Davos. Eine Hypothek war aber nicht nötig.
Heute kann ich beruhigt feststellen, dass auch nach dem Ende der Berufstätigkeit die Einnahmen gut Schritt halten mit den Ausgaben.

Bei einem anderen Ferienaufenthalt in Altstätten durfte ich ein Velo benutzen, das wohl Anneli gehörte. Ich fuhr ins nahe Städtli und sah Tramschienen. Fein, dachte ich, die werden mich leiten. Und so fuhr ich bewusst mitten in eine Schiene hinein. Klar dauerte es kaum eine Sekunde, bis ich auf dem Boden lag. Dass der Kreiseleffekt, den die Schiene durch meine Schuld blockiert hatte, fürs Radfahren unverzichtbar ist, verstand ich erst später im Physikunterricht.
Das grösste gesundheitliche Problem meiner Jugend war ein Unfall im Jahre 1961. Meine Eltern bauten unser zukünftiges Einfamilienhaus in Lachen, und der Bau war schon weit fortgeschritten.
Wir Kinder interessierten uns für den Fortschritt der Arbeiten und gingen regelmässig die Baustelle besichtigen. Eines Tages war das Tor für die beiden Garagenplätze frisch montiert. Bruder Thomas und ich konnten der Versuchung nicht widerstehen, uns am oberen und unteren Ende des offenen Tores festzuhalten und zu schaukeln. Dabei riss eine grosse Feder des Öffnungsmechanismus. So entfiel die Kraft, die das Tor in der offenen Position hielt, und liess es herunter sausen. Leider geriet ich darunter und wurde mit dem Gesicht auf den Boden gequetscht. Die Folge war eine Zertrümmerung meines Nasenbeins. Ich erinnere mich gut an den ungewohnten Geruch von Blut in meiner Nase. Wie ich damals ins nahe Spital Lachen gelangte, weiss ich nicht, vielleicht im Auto des herbeigerufenen Vaters. Der im Spital akkreditierte Ohren-Nasen-Hals-Spezialist Otto Schnyder aus Rapperswil wurde zugezogen. Er tamponierte die Nasengänge mit Gazestreifen, einerseits zur Blutstillung, andererseits zur Anhebung des plattgedrückten Nasenbeins. Dieser Vorgang war sehr schmerzhaft und kam mir endlos lange vor. Sehr unangenehm war dann auch die Notwendigkeit, durch den Mund zu atmen. Nach ein paar Tagen wurden die Gazestreifen entfernt und durch neue ersetzt, wiederum unter heftigen Schmerzen. So ging es weiter, bis das Nasenbein einigermassen konsolidiert war. Das Resultat war aber unbefriedigend, sowohl vom ästhetischen als auch vom funktionellen Gesichtspunkt. Mami jammerte, dass mein ehemals "griechisches Profil" das schönste der Familie gewesen sei, und das war natürlich im Eimer. Die Nasenatmung kam auch nicht mehr recht in Gang. Ich war immer darauf angewiesen, den Mund leicht geöffnet zu haben und durch den Mund zu atmen.
Nach etwa drei Jahren wurde nach verschiedenen Konsultationen beschlossen, dass die Nase repariert werden sollte. Ich kam zu einer Koryphäe unter den Nasenchirurgen, zu Rodolphe Meyer in Lausanne. Der Eingriff wurde in der Clinique Bois-Cerf vorgenommen. Ich musste etwa eine Woche im Spital bleiben. Dort wurde ich von einer ganz reizenden Krankenschwester betreut. Vor ihr war es mir besonders peinlich, dass ich einen Gipsverband im Gesicht trug, der dem Schnabel von Globi glich.
Am Wochenende besuchte mich Gotte Gret aus Basel und führte mich in die Stadt. Ich konnte kaum fassen, dass sie sich mit grosser Gelassenheit an der Seite eines solchen Ungeheuers in die Öffentlichkeit wagte. Ich dankte es ihr später in einem Schulaufsatz unter dem Titel: "Ein Mensch, der mich stark beeindruckt hat". Mein Selbstbewusstsein war damals an einem Tiefpunkt.
2010 wollte ich wieder einmal in die geliebten Veloferien nach Mallorca. Hanspeter Elmer von der Pharmafirma Drossapharm organisierte sie jährlich. Kurz vor dem Abflug brach auf Island der Vulkan Eyjafjallajökull aus und schleuderte riesige Mengen von Asche in die Atmosphäre. Der Flugverkehr in halb Europa war wochenlang lahmgelegt. Daher wurde die Reise abgesagt. Stattdessen wollte ich Reitstunden nehmen bei Ueli Küpfer, bei dem auch unser Pferd Forsythia in Pension war.
Ich war kein totaler Anfänger. Im Alter von zehn oder elf Jahren hatten Thomas und ich eine strenge Ausbildung in der Reitschule des Zirkus Knie in Rapperswil genossen. Mit 14 Jahren war ich in einem Sprachaufenthalt bei Familie de Vaugelas auf dem Château du Beauché in Vendoeuvre, Departement Indre. Die Familie besass etwa sieben Quadratkilometer Land und etwa sieben Pferde. Dort konnten wir lange Ritte unternehmen. Aber alles war lange her.
Nun vereinbarte ich meine erste Reitstunde mit Ueli. Es lief ganz gut, aber zum Schluss wurde mir heiss und ich fragte Ueli, ob ich auf dem Pferd sitzend meinen Pullover ausziehen könne. Er bejahte. Weder er noch ich dachten an den Reithelm. Der behinderte das Manöver und erzeugte ungewohnte Geräusche. Das Pferd scheute, während ich mit vom Pullover verdeckten Augen an meinem Helm manipulierte. Ich fiel zu Boden, und ja, es tat sehr weh. Wie unter Reitern üblich, ging die Lektion weiter. Zuhause angekommen, nahm ich ein warmes Bad und schluckte Ponstan. Am nächsten Tag war - als Ersatz für Mallorca - eine Velotour mit Hanspeter und Janine Elmer angesagt, mit dabei Jürg Ebner und andere Mallorca-Veteranen. Wir starteten bei Elmers auf dem Hirzel, fuhren über Einsiedeln und die Ibergeregg nach Schwyz und weiter nach Zug. Dort war ich am Ende meiner Kräfte und fuhr mit dem öffentlichen Verkehr zurück nach Hirzel.
Wochen später, als mich immer noch Schmerzen plagten, suchte ich den Chiropraktiker meines Vertrauens auf, Berhard Anklin in Zürich. Er machte ein Röntgenbild und stellte einen Bruch des. 2. Lendenwirbelkörpers fest. Eine weitere Therapie schien nicht mehr nötig, aber es dauerte noch etliche Wochen, bevor meine Schmerzen verschwanden.
Diese Geschichte trug mir das Etikett eines zähen Burschen ein. Mein Ruf wurde weiter gefördert durch eine Schulterluxation im Dezember 2014, die sich ebenfalls mit Elmers und einigen Ärzten am Jakobshorn in Davos ereignete. Vor die Wahl gestellt, ob ich lieber im Helikopter oder auf einem Schlitten zum Spital transportiert werde, fürchtete ich das Warten auf den Helikopter und die Schläge auf dem Schlitten gleichermassen. Ich entschied, auf den Skiern von der Jatzhütte zum Fuxägufer zu fahren, was auch gelang. Dort erhielt ich einen Grappa oder zwei, worauf mir ein - leider kurz darauf verstorbener - Kollege die Schulter reponierte. Ich war so begeistert, dass ich ihm um den Hals fiel. Dabei luxierte die Schulter erneut, und und musste wiederum reponiert werden. Dennoch ging ich nicht ins Spital und hoffte auf spontane Heilung. Ich wurde auch beschwerdefrei, aber ein Jahr später luxierte die Schulter erneut, diesmal bei einem ganz banalen Sturz auf dem Chörbschhorn über Davos-Frauenkirch. Diesmal wurde ich per Helikopter ins Spital Davos transportiert. Einige Wochen später operierte Dr. Jan Leuzinger in der Klinik im Park meine linke Schulter. Endoskopisch nach dem Latarjet-Verfahren sägte er den Rabenschnabelfortsatz des Schulterknochens ab und montierte diesen mit einer Schraube an den Rand der Gelenkspfanne. Dadurch wird die Luxation weitgehend verunmöglicht. Bei mir hat es glücklicherweise bis dato gehalten.
Das Schulterproblem führte dazu, dass ich meine bereits gebuchte Teilnahme beim Helikopterskifahren in Kamtschatka um Ostern 2015 absagen musste. Zwei Geschwister von Rahel, Immo und Viola sowie ihr Partner Dominik, gingen trotzdem, und sie wurden nicht enttäuscht. Ich nutzte die Gelegenheit, mit der Gruppe bis nach Moskau zu reisen und dort drei meiner Patienten zu besuchen. Besonders beeindruckt hat mich das Anwesen von Igor und Ira Yushkevich. Igor ist ein Textilunternehmer mit hunderten von Läden der Marke Tvoe. Ira war früher Fernsehsprecherin, jetzt betreute sie ihre beiden Kinder. Ihr beeindruckendes, geschmackvoll gestaltetes Heim im Bauhausstil liegt in einer bewachten Überbauung im Norden Moskaus mit Anstoss an einen künstlichen See. Ich wurde von Ira mit einem vorzüglichen Mahl verwöhnt. Zum Kaffee gab es Schokolade von Läderach aus der Moskauer Filiale.
Zwei Jahre nach dem verpassten Skiabenteuer brachen Immo, Viola und Dominik erneut nach Kamchatka auf, und ich meldete mich wiederum an. Auch diesmal musste ich absagen. Im Herbst 2016 war eine Diskushernie aufgetreten, "intraforaminal L5/S1 links". Die Folge waren eine Lähmung der Fussheber und eine Gefühlsstörung seitlich am linken Fuss. Auf eine Operation wurde sozusagen mit Bedauern verzichtet, da ich wegen einer Lungenembolie unter Antikoagulation stand. Rückblickend bin ich froh darüber, denn die Symptome bildeten sich im Laufe eines Jahres fast gänzlich zurück.
Bei einer dritten Kamchatka-Reise meiner Verwandtschaft sagte ich von Vorneherein ab, die ferne Halbinsel stand für mich offensichtlich unter keinem guten Stern.

Am vierten Tag wurde die Computertomographie wiederholt. Sie zeigte eine Verschlechterung der Lungenbefunde. Gleichentags kam meine jüngste Tochter Livia in die Nähe der Klinik. Besuche waren ja untersagt. Sie rief mich an und schlug vor, dass ich auf den Balkon hinaustrete. Tatsächlich erblickte ich sie winkend in der Ferne. Angesichts der Verschlechterung der Befunde überkam mich der düstere Gedanke, dass ich sie vielleicht nie wiedersehen würde.
Meine Stimmung wurde durch weitere Faktoren getrübt. An unserem Haus in Herrliberg war das Dach entfernt worden im Hinblick auf einen Ausbau des Obergeschosses. In diesen Tagen wurde aber im Rahmen des Lockdowns ein Baustopp erwogen - eine sehr unerfreuliche Perspektive, wenn das Dach bereits weg ist. Glücklicherweise konnte dann doch weitergebaut werden.
Die Covid-Erkrankung ist dann doch einigermassen glimpflich verlaufen. Am 3. April 2020 konnte ich aus der Klinik entlassen werden. Drei Monate später erlitt ich allerdings eine Lungenembolie, die wahrscheinlich eine Folge von Covid war. Wir verbrachten ein Wochenende mit unserem Freund Peter Schweizer in Laveno. Die Rückkehr in die Schweiz per Eisenbahn war am 30. Juni 2020 geplant. Am 29. bekam ich zunehmend Atemnot. Zuerst wollte ich die Rückkehr im Zug, bzw. teilweise im Taxi lediglich zeitlich vorverlegen. Dann wurde die Atemnot schlimmer, und wir kontaktierten die Schweizerische Rettungsflugwacht. Nun wurde mir zu einer Repatriierung geraten. Etwa um 23 Uhr landete ein Helikopter auf einer freien Wiese am See, wo jeweils die Jahrmärkte abgehalten werden. Man flog mich ins Ospedale Civico di Lugano, wo die Diagnose gestellt und ich mit Blutverdünner behandelt wurde. Drei oder vier Tage später holte mich mein Freund Guy Petignat in seinem Tesla von Lugano nach Herrliberg. Im Anschluss wurde eine Thrombophilie, eine verstärkte Neigung zu Thrombosen diagnostiziert. Seither nehme ich regelmässig Blutverdünner ein, 10 mg Xarelto pro Tag.

Etwa zehn Jahre davor hatte ich die typischen Symptome einer vergrösserten Prostata mit plötzlichem, manchmal "imperativem" Harndrang. Eine typische transurethrale Prostataresektion verschaffte Linderung. Bei diesem Eingriff wird die vergrösserte Vorsteherdrüse durch die Harnröhre Schnipsel um Schnipsel herausgeschnitten und verkleinert mit dem Ziel, die verengte Harnröhre zu erweitern und den vorher beeinträchtigten Harnfluss zu normalisieren.
In der Folge des Eingriffs wurde, wie üblich, PSA regelmässig kontrolliert. Im Jahr 2022 erfolgte ein erneuter Anstieg, der Anlass gab, vom Drüsengewebe Nadelbiopsien zu entnehmen. Dreizehn Biopsien wurden entnommen, und alle enthielten Krebszellen. Nun beschloss man eine minimal-invasive Entfernung der Prostata mit dem Da Vinci Gerät.
Der Eingriff erfolgte am 12. Januar 2023 durch Dr. Jean-Luc Fehr, einen sehr erfahrenen Operateur. Leider stellte er schon intraoperativ fest, dass der Krebs die Grenzen des Organs überschritten hatte, und entfernte daher zusätzliches Gewebe. Die histologische Untersuchung zeigte allerdings, dass die Schnittränder immer noch nicht „im Gesunden" lagen. Daraus muss man auf zurückgebliebene Krebszellen schliessen. Aus diesem Grund wurde mir eine Radio-Therapie empfohlen, eine Bestrahlung im Bereich der ehemaligen Prostata und ihrer nächsten Umgebung. Sie umfasste etwa 35 Sitzungen in den Monaten April und Mai 2023. Während und nach der Behandlung ging es mir recht gut, Nebenwirkungen hatte ich kaum. Einschränkend könnte ich den negativen Einfluss der erweiterten Operation und der Bestrahlung auf die Sexualfunktion erwähnen. In meinem Alter fällt dies freilich weniger ins Gewicht als bei jüngeren Leidensgenossen.
Das weitere Schicksal und auch das medizinische Vorgehen hängen weitgehend vom Verlauf der PSA-Werte ab. Nach aktuellem Stand der Medizin besteht bei einem Anstieg von PSA auf 0.5 Einheiten eine Chance von etwa 50 %, mit einer Positronen-Emissionstomographie eine Metastase zu finden, die dann meist gezielt bestrahlt werden kann. Abwarten und Hoffen lautet die Parole. Im Januar 2025 betrug der Messwert 0.44. Nach der bisherigen Erfahrung rechnete ich mit einer Verdoppelung innerhalb von drei Monaten. Stattdessen war aber der folgende Messwert etwas tiefer. Weitere Messungen sind halbjährlich geplant, und bei einem Anstieg über 0.8 wäre eine weitere PET-Untersuchung angezeigt. Sollten sich eine oder mehrere Metastasen zeigen, würden sie bestrahlt. Mit diesen und weiteren therapeutischen Optionen ist es eher unwahrscheinlich, dass die Prostata dereinst zu meiner Todesursache wird.

Mein jüngerer Bruder Peter ist leider anno 2001 mit knapp 50 Jahren viel zu früh verstorben. Todesursache war ein Krebsleiden der Speiseröhre.
Schon Jahre zuvor hatte Peter immer wieder unter Magenbrennen und saurem Aufstossen gelitten und deswegen auch Spezialisten konsultiert. Mindestens einmal wurde wegen einer Stimmbandlähmung eine Röntgendarstellung der Speiseröhre durchgeführt, ein so genannter "Breischluck". Dabei muss der Proband unter Röntgenkontrolle einen strahlendichten Brei schlucken. So gelangt die Lichtung der Speiseröhre zur Darstellung.Im Herbst 2000 konnte Peter plötzlich nicht mehr schlucken. Die Gastroskopie zeigte einen grossen Tumor am Übergang von der Speiseröhre zum Magen. Bald folgte eine operative Entfernung der Speiseröhre durch Prof. Peter Tondelli am St. Claraspital in Basel. Der Eingriff verlief gut. Leider lagen aber bereits zahlreiche Metastasen in Lymphknoten vor. Deshalb wurden weitere adjuvante Behandlungen durchgeführt wie Chemotherapie und Bestrahlungen. Peter behielt lange einen gewissen Optimismus, aber als im Mai 2001 ein Darmverschluss auftrat, blieb kaum noch Hoffnung.
Nach Monaten des Leidens verstarb er - nach seinem Wunsch in seinem geliebten Haus in Lostorf in der Obhut seiner getreuen Verena - am 24. Juni 2001.
Peters Witwe Verena unterzog sich im Frühling 2024 einer gynäkologischen Routineuntersuchung. Im Ultraschall sah man einen Tumor im rechten Eierstock. Dieser sollte operativ entfernt werden. Beim Eingriff zeigte sich aber eine massive Aussaat von Tumorzellen im ganzen Bauchraum (peritoneale Metastasen), und der Eingriff musste abgebrochen werden. Histologisch lag ein undifferenziertes, kleinzelliges Karzinom vor. Nun folgten 6 Zyklen Chemotherapie, ergänzt durch Immuntherapie. Verena ertrug alles mit bewundernswerter Gelassenheit, hatte aber zunächst wenig Hoffnung auf Heilung. Die Behandlung hatte jedoch einen geradezu sensationellen Erfolg. Ein Jahr nach Beginn der Krankheit sah es danach aus, dass sie definitiv besiegt sein könnte. Leider ist bald darauf ein Rezidiv aufgetreten. Verena stellte sich nach dieser Diagnose erneut der Chemotherapie und unternahm in der 3-wöchigen Therapiepause zusammen mit Lisa und Roland eine Reise in die Normandie und die Bretagne. Das selbe bewährte Grüppchen unternahm im August eine weitere Reise, diesmal ins Baltikum.
Franziska bekam im Herbst 2024 Rückenschmerzen, die sie zunehmend vom geliebten Golfen abhielten. Im Frühling 2025 wurden verschiedene Untersuchungen vorgenommen, die zur Diagnose eines Multiplen Myeloms führten. Die Schmerzen im Rücken und inzwischen auch im rechten Oberschenkel waren durch Metastasen in der Wirbelsäule und im Femur verursacht. Zudem hatte eine Ummantelung des rechten Sehnervs durch Tumorzellen zu einem weitgehenden Verlust der Sehkraft am rechten Auge geführt.
Der Oberschenkel und die Umgebung des Sehnervs wurden durch Bestrahlungen angegangen. Gegen die anderen Manifestationen der Krankheit erhielt Franziska vier Zyklen Chemotherapie und zusätzlich eine Immuntherapie. Am 26. August erhielt sie eine schwere chemotherapeutische "Keule", welche die verbliebenen
Tumorzellen ausschalten sollte. Dadurch wird die Immunabwehr des Körpers kurzfristig
ausgeschaltet. Franziska wurde deshalb isoliert. Schon am folgenden Tag wurden
Stammzellen in die Blutbahn infundiert, die Wochen zuvor durch Aderlass entzogen wurden. Damit kann die Immunabwehr während der Wochen der Isolation wieder hergestellt werden, denn die Stammzellen siedeln sich im Knochenmark an und beginnen sich zu vermehren.
Vorübergehend verschwanden die weissen Blutkörperchen vollständig aus dem Blutbild, wie beabsichtigt. Aber bereits nach einer Woche traten neue auf und ihre Zahl stieg rasch an, ein ebenso gutes Zeichen. Zur Erholung ging die sehr erschöpfte Franziska für zwei Wochen in die bewährte Reha Klinik Schloss Mammern.
Während ihrer schweren Krankheit hat Valentin unsere Ika mit grosser Empathie umsorgt. Auch wir sind ihm dafür sehr dankbar.


Mami hat sich theoretisch kaum mit der Religion auseinandergesetzt. Sie als reformiert Getaufte hat sich aber redlich
bemüht, den Erwartungen unserer katholischen Umwelt in Lachen gerecht zu werden, ohne sich selbst zu verbiegen.
Als Kind fühlte ich mich der Kirche eng verbunden. Die biblischen Geschichten haben mich fasziniert. Der Beichtunterricht gab uns etwas Einblick in Sünden und Laster, die es auf der Welt gab. Besonders irritierte, faszinierte und animierte das Sechste Gebot. Sinngemäss stand dazu im "Beichtspiegel": Ich habe unkeusch gedacht, geredet, gehandelt, allein oder mit anderen undsoweiter.
Wenn man schon einmal wusste, dass man unkeusch handeln konnte, musste man es auch ausprobieren, in meinem Fall fast ausschliesslich alleine. Das hat aber das Gewissen belastet und musste regelmässig gebeichtet werden. Es bleiben Erinnerungen an den modrigen Geruch des hölzernen Beichtstuhls mit dem muffigen Vorhang, vermischt mit Weihrauch, hinter dem Gitter ein Schatten, der mir zwei Ave Maria und ein Vaterunser als Wiedergutmachung meiner sündigen Neugier aufbrummte. Ich hatte dabei echte Schuldgefühle, war manchmal zu Tränen gerührt und gelobte jedes Mal Besserung.
Am Gymnasium beschlichen mich langsam Zweifel an einzelnen Glaubensinhalten. Die Zweifel nahmen bezüglich Breite und Tiefe laufend zu und am Ende blieb fast nichts übrig. Spätestens als Medizinstudent erschien mir die Gesamtheit der Glaubensinhalte als Ausbund an Unvereinbarkeiten und Widersprüchen, als Zumutung an den Intellekt. Ich wundere mich bis heute, dass dieses Konstrukt zweitausend Jahre überlebt hat und die meiste Zeit das Leben so vieler Menschen und die Geschicke der Welt entscheidend geprägt hatte.
Die Existenz einer höheren Macht abzulehnen, liegt mir indes fern. Ich fühlte mich damals und fühle mich noch heute als Agnostiker. Ich bin also der Ansicht, dass die Existenz oder Nichtexistenz einer höheren Instanz ungeklärt ist und auch nicht geklärt werden kann.

Ich hoffe sogar auf eine zukünftige positive Rolle der Religionen. Hans Küngs Traum von einem allen Religionen gemeinsamen Weltethos hat sich bisher leider nicht erfüllt. Sein Imperativ "Kein Frieden unter den Nationen ohne Frieden unter den Religionen" scheint aber derzeit dringlicher denn je. Die Ausstellung "Weltreligionen - Weltfrieden" anno 2023 in Tübingen soll ein Besucher wie folgt kommentiert haben: "Hier liegt der Schlüssel - wenn ihn nur jemand umdrehte."
Alle grossen Religionen müssten endlich mit einer Stimme jegliche Gewalt gegen Menschen und gegen die Natur verurteilen. Zusammen hätten sie vielleicht noch die Macht und die Kraft, dem ausufernden Materialismus und Militarismus auf der Erde Einhalt zu gebieten.
Das dringendste Thema für die Zukunft der Menschheit scheint mir die nahende Klimakatastrophe. Die Beschlüsse des Pariser Klimagipfels von 2015 hätte sie vielleicht noch abwenden können. Seit dem Rückzug der USA unter dem Trump-Regime von diesem Abkommen haben sich die Aussichten weiter verdüstert. Aus meiner Sicht bleibt eigentlich nur noch die Hoffnung auf eine Art "Deus ex machina". Der neugewählten Papst Leo XIV könnte vielleicht eine führende Rolle spielen, wenn es gelänge, im Sinne von Hans Küng sich mit den einflussreichsten Religionsführern auf ein gemeinsames Vorgehen zu einigen.

Wenn ich eines Tages nicht mehr autofahren kann oder darf, rückt der öffentliche Verkehr weiter in den Vordergrund. Zum Bus gelangt man von unserem Haus in wenigen Minuten, steil abwärts allerdings. Die Steigung beträgt 18 %. Auf dem Heimweg kann man oberhalb des Hauses aussteigen und etwa gleich weit und gleich steil bergab zum Haus gelangen. Da werde ich wohl irgendwann an meine Grenzen kommen.
Auf dem Areal der ehemaligen Chemischen Fabrik Uetikon werden Miet- und Eigentumswohnungen erstellt, die etwa 2028 fertiggestellt sein sollten. Das Projekt interessiert mich, und ich habe mich bereits bei den Erstellern gemeldet. Aus heutiger Sicht wäre der Zeitpunkt der Fertigstellung vielleicht noch etwas früh für einen Umzug, besonders für Rahel. Kommt Zeit, kommt Rat.
Ein Leben in einer gepflegten Altersresidenz kann ich mir gut vorstellen. Als wir vor 20 Jahren die beiden Attikawohnungen von Mami und Gotte Gret im Tertianum in Pfäffikon bezogen, sagte ich zum Personal halb im Scherz, halb im Ernst: Wenn eine der Damen die Wohnung nicht mehr braucht, werde ich sie gerne übernehmen. Nun sind beide hoch betagt gestorben, aber ich hatte trotz meiner 75 Jahre noch keine Lust, den damaligen Worten Taten folgen zu lassen.
In der Theorie bin ich entschieden für das Recht auf ein selbstbestimmtes Ende des Lebens. Die praktische Umsetzung könnte aber schwierig werden. Es droht ja die Gefahr, dass ich, wenn ich zum Sterben bereit bin, gar nicht mehr bestimmen kann.
Vielleicht wäre es sinnvoll, rechtzeitig mit Exit Kontakt aufzunehmen, aber ich fühle mich dazu noch zu wenig motiviert.
Innerhalb der Familie sind wir uns ziemlich einig darüber, dass lebensverlängernde Massnahmen im fortgeschrittenen Alter äusserst restriktiv gehandhabt werden sollten.
Was dereinst mit meinem toten Körper geschieht, ist mir nicht sehr wichtig. Ich tendiere zu einer Urnenbeisetzung im Friedhof von Herrliberg. Diese Gemeinde ist mehr als jede andere zum Mittelpunkt meines Lebens geworden. Ein schlichter Gedenkstein wird genügen, gerne versehen mit einem QR-Code als Link zu diesen Aufzeichnungen. Als Agnostiker meine ich allerdings auch, dass der Totenkult vor allem für die Überlebenden passen muss.
Rahel und ich stimmen diesbezüglich überein. Sie sieht aber Probleme im Hinblick auf das Engagement eines Pfarrers bei meinem Ableben, zumal ich aus der Kirche ausgetreten bin. Ich bin aber zuversichtlich, dass man einen passenden Zeremonienmeister und einen passenden Rahmen finden wird. Freilich sollte man dann nicht knausrig sein.
Rahel und ich haben 2012 beim Amtsnotariat Rapperswil einen Ehevertrag abgeschlossen. Er sieht vor, dass Rahel aus den hinterlassenen Liegenschaften wählen kann, was sie wünscht. Meine vier Kinder sind alle gleichgestellt.

Eine Ausnahme macht der Laufsport. Wenige Jahre nach der Teilnahme am Davoser Alpin-Marathon von 2014 begann das rechte Knie leichte Beschwerden zu verursachen. Dort hatte ich ja vor Jahrzehnten eine Kreuzbandläsion und danach eine operative Rekonstruktion. Seitdem ich den Laufsport aufgegeben habe, tut das Gelenk brav seinen Dienst.
Gehen ist kein Problem, auch bergauf nicht. Ich hatte damals die Idee, regelmässig von Laveno aus den Sasso del Ferro zu besteigen. Schliesslich wurden es nur ein oder zwei Mal pro Jahr. Immerhin habe ich am 11. Mai 2024 meine kürzeste Aufstiegszeit zum Poggio Sant' Elsa erzielt, knapp 99 Minuten für 720 m Höhenmeter. Am 12. Juli 2025 stieg ich mit William, dem Verlobten von Livia und seiner Schwester Céline, erstmals die steile Route unter der Seilbahn bis zur Bergstation. Wir kamen zügig zum Ziel, und ich war mit meiner Leistung sehr zufrieden. Mir wurde aber auch klar, dass der Weg für Leute meines Alters zu unsicher ist. Also werde ich in Zukunft wieder auf den gut ausgebauten Weg über Monteggia und Casere auf den Sasso wandern.
Zu meinem aktuellen Sportprogramm gehört Schwimmen. In diesem Sommer bin ich täglich bis zu 120 m Längen in unserem Pool geschwommen, etwa 800 m. Ich beschränke mich auf Brustschwimmen, und mein Stil entspricht dem einer Grossmutter. Deshalb benötige für die Strecke etwa 40 Minuten.
Langlaufen war ich im vergangenen Winter etwa fünf Mal. Wie schon im Vorjahr lief ich auch bis zum Kurhaus Sertig. Die Fahrt zurück machte mir aber Angst, obwohl die Verhältnisse nicht schlecht waren. Zufällig hatten mich mein Neffe Christoph und seiner Partnerin Maja vom Auto aus erkannt. Sie waren gerade von einer Skitour zum Sertig Dörfli zurückgekehrt. Ihr Angebot, mit Ihnen im Auto zurück nach Davos zu fahren, nahm ich gerne an. In den letzten Jahren war ich mehrmals vornüber gestürzt, und habe mir dabei Rippen gebrochen. Das Problem hat sich akzentuiert mit dem Übergang vom Skaten zum klassischen Langlauf mit Fellstreifen, die manchmal brutal bremsen, wenn man ein Areal mit weicherem Schnee überfährt.
Alpin skifahren waren wir im letzten Winter vielleicht zehn Mal. Das geht noch recht gut, aber ich bin vorsichtiger und langsamer geworden. Während ich früher tendenziell schneller fuhr als Rahel, ist es jetzt umgekehrt. Dies hängt zeitlich etwa mit meinem Sturz am 5. Januar 2020 zusammen. In Begleitung von Rahel und Carlo Bianchi fiel ich vornüber und zog mir Frakturen des rechten Schlüsselbeins und einiger Rippen zu. Gut möglich, dass die Rippenverletzungen die Covid-Infektion zwei Monate später begünstigt haben.
Beim Radfahren hatte ich glücklicherweise seit Jahrzehnten kaum Stürze, jedenfalls keine mit Folgen. Ich fühle mich auf dem Velo recht sicher und hoffe auf einige weitere Jahre.

Wäre alles anders geworden, wenn ich freizügiger erzogen worden wäre und gelebt hätte? Hätte mir und meinen Nächsten das Ausleben der "Freien Liebe", wie sie sich zu Beginn meines Studiums ab 1968 verbreitete, mehr genützt oder geschadet? Hätte sie meine Bindungsfähigkeit gefördert oder gemindert? Wäre mein Leben glücklicher verlaufen oder weniger glücklich?
Ich weiss es nicht, und die Frage mag jetzt müssig erscheinen.
Gerne denke ich in diesem Zusammenhang an einen klugen Text von Mani Matter über "Hemmige". Aus dem Lied greife ich drei Strophen heraus:
Si wäre vilicht gern im Grund gno fräch
und dänke, das syg ires grosse Päch
und s'laschtet uf ne win e schwäre Stei
dass sie Hemmige hei
.....
Was unterscheidet d'Mönsche vom Schimpans?
s'isch nid die glatti Hut, dr fählend Schwanz
nid dass mir schlächter böim ufchöme, nei,
dass mir Hemmige hei!
.....
Und we me gesht, was hütt dr Mönschheit droht,
so geseht me würklech schwarz, nid nume rot
und was me noch cha hoffe isch alei,
dass sie Hemmige hei!

Meine Reisen in andere Kontinente liessen nie den Zauber verblassen, den meine weitere Heimat Europa auf mich ausübt. Seine Landschaften und Kulturen, über Jahrtausende gewachsen, bleiben für mich unübertroffen.
Reisen in ferne Länder werden auch unter dem Aspekt des Klimawandels immer problematischer. Ich tendiere deshalb dazu, in Zukunft in Europa zu reisen, wo möglich vorzugsweise mit der Eisenbahn.
Eine ferne Sehnsucht bleibt: Das Reich der Mitte. Zwar habe ich anno 1999 ein paar Tage an einem Kongress in Shanghai verbracht und mich in der Gegend etwas umgesehen. Jetzt habe ich aber grosse Lust, China eingehender kennen zu lernen. Dieses Land wurde hundert Jahre lang vom "Kollektiven Westen" tief gedemütigt, etwa durch Opiumkriege (1839-1860) und die Boxer-Repression (1900). Nun hat es die Kindersterblichkeit von 60 auf 6 pro Tausend gesenkt und 800 Millionen Menschen (Weltbank, 2021) aus grosser Armut herausgeführt - in nur drei Jahrzehnten! Diese Leistung scheint mir einmalig in der Menschheitsgeschichte. Sie wird aber im Westen oft ignoriert, durch kritische Berichte relativiert oder einfach schlechtgeredet. Bin ich naiv? Freilich weiss ich um einige Schattenseiten, etwa in "Bildungscamps" eingesperrte Uiguren. Aber ich will mit eigenen Augen sehen, was ich beurteile. Für Mai 2026 planen Rahel und ich eine "umfassende" Reise nach China mit dem Veranstalter Studiosus. In einem Jahr werde ich hoffentlich viel mehr wissen über dieses überaus wichtige Land, seine Menschen und ihre Geschichte.

Im Vorwort habe ich kurz erklärt, weshalb ich meine Erinnerungen aufzeichne. Beim Schreiben wurde mir zunehmend bewusst, wie mein Leben und das der meisten Menschen eine ständige Suche ist. Beim Schreiben ist es die Suche nach dem passenden Wort, im Leben sucht man laufend nach richtigen Entscheidungen, nach Freundschaft, Partnerschaft, nach beruflicher Befriedigung und nach unzähligen weiteren Dingen.
"Wir haben die Wahrheit gesucht. Wir haben sie nicht gefunden. Morgen suchen wir weiter" soll Sokrates sinngemäss gesagt haben. Ein prominenter Freund, Erwin Koller, hat diesen Satz als Schlusswort vieler seiner Fernsehsendungen im Format "Sternstunde Philosophie" ausgesprochen.
Mit solchen Gedanken habe ich einen provisorischen Titel für meine Aufzeichnungen gewählt: Weg als Ziel - Notizen eines Suchenden. Ich war nie richtig zufrieden damit, zu beliebig kam er mir vor. Einmal erwähnte ein früher Leser meiner Notizen, dass ich ihm ziemlich "unaufgeregt" vorkomme, und dass diese Eigenart sich vielleicht wie ein roter Faden durch mein Leben ziehe. Der Gedanke gefiel mir, und ich mutierte die Überschrift in "Unaufgeregt - Zwischenbilanz nach 75 Jahren", freilich mit einem Augenzwinkern.
Bei meiner neuesten Lektüre, "Das Buch der Freude" von Dalai Lama und Desmond Tutu, hat mir eine Zielsetzung des Erzbischofs und Friedens-nobelpreisträgers besonders gefallen: "Eins sein mit der Welt, ein Vorrat an Freude, eine Oase des Friedens, ein Teich der Gelassenheit…". Schön wär's!
Meet-my-life.net war beim Entschluss zur Aufzeichnung meiner Erinnerungen und beim Prozess sehr hilfreich. Die erste Hilfe bestand in einem umfangreichen Fragenkatalog, ähnlich wie bei einem Interview. Zwar habe ich nur einen kleinen Teil der Fragen direkt beantwortet, aber sie durchzusehen half sehr dabei, ferne Erinnerungen wieder wach zu rufen und eine Auswahl zu treffen. Bei technischen Fragen konnte ich mich jederzeit an real existierende Menschen wenden, insbesondere an Dr. oec. Publ. Erich Bohli. Zuverlässig, prompt und präzise wurden meine Fragen stets beantwortet. Herzlichen Dank!
Finanzielle Unterstützung von meet-my-life.net durch Firmen wie Coop oder Swisscom, aber auch Persönlichkeiten wie beispielsweise Emil Steinberger ermöglicht es, die Kosten für Schreibende sehr tief zu halten.
Der Schreibprozess führte gefühlsmässig zu einer beträchtlichen Vermehrung meiner Freundschaften. Im Kapitel 8.13 stand in einer frühen Version sinngemäss, dass ich nicht viele langjährige Freundschaften gepflegt habe. Rahel fand diese Aussage unzutreffend und begründete ihre Meinung. Danach habe ich das Kapitel etwas ausgebaut. Beim Weiterschreiben wurde mir zunehmend bewusst, dass ich Unsinn erzählt hatte, und ich realisierte mehr und mehr, dass viele Menschen mir über die Jahre ihre Freundschaft geschenkt haben und weiterhin schenken.
Im Dezember 2024 war es mir vergönnt, meinen 75. Geburtstag mit der ganzen Familie sowie Freundinnen und Freunden zu feiern, insgesamt mit über 120 Menschen, die mir lieb und wichtig waren. In der Vogtei Herrliberg genossen wir ein ausgezeichnetes Abendessen, zudem wurde ein exquisites Musikprogramm geboten. Die junge Sopranistin Chelsea Zurflüh sang Lieder aus Opern, Operetten und Jazz. Chelsea hatte zuvor in kurzer Zeit etliche prominente Gesangswettbewerbe gewonnen, so 2024 den Internationalen Haydn-Wettbewerb in Rohrau oder den 78. Concours de Genève. Sie wurde am Klavier begleitet von ihrem Gatten Fernando Loura. Die beiden hatten ein halbes Jahr vorher geheiratet.
An meiner Feier, am 22. Dezember, beging Chelsea ihren 29. Geburtstag. Es war mir eine Ehre und eine grosse Freude, den Abend zu moderieren und mit dem jungen Musikerpaar zu gestalten.
Das Wiedersehen mit Freunden aus allen Lebensphasen liess Erinnerungen aufleben und spornte mich zusätzlich zum Schreiben an. Zudem zeigte sich, dass man auch in meinem Alter noch Freunde gewinnen kann. Am 5. September 2025 fuhr ich im Zug nach Köln zu Chelseas Debüt als Opernsängerin als Pamina in der Zauberflöte an der Oper von Köln. Gemeinsam mit einem Lehrerpaar aus Büren an der Aare, das Chelsea in Pieterlen unterrichtet hatte, gingen wir gemeinsam zu einem späten Abendessen. Wir blieben bis ein Uhr, als das Lokal schliessen musste. Fränzi und Martin Breitinger hatte ich nie zuvor gesehen, aber wir alle empfanden viel Sympathie füreinander und den Wunsch, uns wiederzusehen. Am folgenden Morgen machte ich gemeinsam mit Chelsea eine Stadtbesichtigung der besonderen Art, die "Faszination Köln Fahrradtour". Zehn Wochen später sang Chelsea die Pamina am Royal Opera House in London, noch vor ihrem 30. Geburtstag. Was für eine unglaubliche Karriere!
Eine weitere Motivation zum Schreiben ist meine Dankbarkeit. Es war und ist ein grosses Privileg, in dieser Weltgegend fast sorglos mit lieben und engagierten Eltern und Geschwistern aufzuwachsen und eine ausgezeichnete Ausbildung zu geniessen. Das Berufsleben hat mir neben gelegentlichen Enttäuschungen vor allem Freude, Befriedigung und Wohlstand beschert. Jetzt, im fortschreitenden Alter, bieten mein Gesundheitszustand, eine intakte Ehe mit Rahel, unsere Familie, unser Freundeskreis und die vier Kinder mit ihrem Anhang gute Voraussetzungen für weitere Jahre, auf die ich mich freuen kann. Dazu tragen natürlich unsere vier Enkel bei: Juri (2019), Margo (2020), Maxine (2022) und Robin (2025). Wer weiss, vielleicht kommen weitere hinzu.
Mein herzlichster Dank geht an euch alle!







