Zurzeit sind 549 Biographien in Arbeit und davon 329 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 208



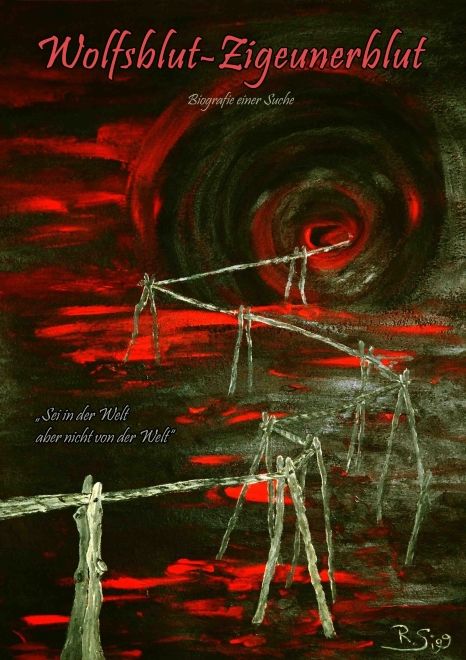
In ihrem Buch gibt uns die Autorin Einblick in den inneren Werdegang einer Frau, ihre aussergewöhnlichen spirituellen Erfahrungen und ihren Weg.
In mitreissender Fähigkeit und Farbigkeit in der Wortwahl wird in vier Teilen die Entwicklungsgeschichte von Lilia geschildert.
Wir erfahren von der Einsamkeit und der frühen Ernsthaftigkeit des Kindes und begleiten danach Lilia in ihrem Suchen und ihrer Zerrissenheit bei Entscheidungen über verschiedenste Ausbildungen und in Beziehungen zu Menschen und Tieren.
Ihr tiefes Erkennen der Vorgänge in der Natur ist wahrnehmbar, dass alles immer ein Einschlafen und Aufwachen ist, immer wiederkehrend, und dabei ihr eigenes Erwachen: „Warum hat mir das nie jemand gesagt?“
Lilia lernt immer mehr ihre Individualität zu leben und wird dabei unabhängiger und stärker. Sie erkämpft sich einen Platz im fast normalen Anderssein.
Und doch begegnen wir immer wie schemenhaft der wilden, inneren Wölfin...
Eine faszinierende Lebensgeschichte, ein aussergewöhnliches Buch.
Rut Sigg lebt in der Schweiz, im Oberaargau, in einem renovierten Bauernhaus im Grünen mit ihrem zweiten Mann, mit Katzen, Hunden und grossem Garten.
Sie besuchte das Lehrerseminar. Anschliessend studierte sie Gesang und trat als Konzertsängerin auf. Das Yoga erarbeitete sie sich bei einem indischen Meister. Von ihm erhielt sie auch die Erlaubnis, es zu unterrichten. Ihre weiterführende Suche nach dem Woher und Wohin brachte sie in Kontakt mit spirituellen Lehrern in Europa, Asien und Übersee. Sie lernte das Drehen der Derwische, das Sitzen im Zen. Daraus entstand das erste Buch „Über die Brücke des Atems“.
Von ihres Vaters Seite stammt Rut Sigg von Fahrenden ab. Ihre Mutter kam aus einer erfolgreichen Kaufmannsdynastie. Integration als Stolperstein blieb deshalb ein Hauptthema in Rut Siggs Leben. Vor allem auch nach dem Selbstmord ihres Mannes. Das Buch „Wolfsblut - Zigeunerblut“, das als „Mutmacher“ auf Wunsch des Verehrten Abtes Phratep Kittimoli, des Wat Srinagarindrawararam, des Buddhistischen Zentrums in Gretzenbach, Solothurn, Schweiz, entstanden ist, vermittelt einen Einblick in diese Problematik und zeigt, welche Kraft Tragik und Schmerz entspringen kann.
1. Kind sein, wie geht das?
Das Ruhebett weich und nachgiebig, von Omas Atem geschaukelt, auf und ab und auf und ab. Wie in eine Muschel kuschelte sich Lilia in Omas Arm. Weißgraue Locken auf gobelinbestickten Kissen lagen neben dunkelblonden Zöpfen mit Maschen wie Propellern. Über ihnen ragte die Wand voller Bücher empor, dazwischen das Radio mit stoffbezogener Front. Wabernder Duft von Kölnisch Wasser. Geruch von körperwarmer Seide. Von schlafendem Getier. Urgeruch, bergend, gewichtig wie Erdreich umwogte Lilia. Aus dem Radio erklang Mozart. In Lilias Brust vibrierten Saiten, geflutet von Klang, geflutet von Glanz, sprengend den Körper, der zu eng war, um sie zu fassen: Glück, Jubel, Tränen, lautlos.
Lilia war neun und in den vom Gesetz verordneten Ferien bei Mutter und Großeltern. Spiralend glitt sie in einen Trichter aus Gold. Kummer und Scham wichen bezwingender Kraft. Da war kein Kind sondern stählerner Wille, ein Drachenherz.
Daneben die königliche Erscheinung Omas, ausladend, nicht allzu groß, dafür durchdrungen von Autorität. Ihr Blick sprach - und verurteilte prompt, was ihm missfiel. Er war überall. Kontrollierte. Befahl. Beherrschte. Wer ihm auswich, verlor. Lilia hielt dem Blick stand. Oma und Lilia bildeten ein Paar. Sie wussten, wie sie einander zu nehmen hatten. Dafür gab es klar abgesteckte Rituale. Hatte Lilia einen Wunsch, spielten sie ein Ritual nach dem anderen durch, und die Erfüllung folgte über kurz oder lang.
Oma war talentiert, in mancherlei Hinsicht. Vor allem malte sie überdurchschnittlich gut und hatte entsprechende Träume. Doch dann heiratete sie, wie in ihren Kreisen üblich, einen vielversprechenden Mann, Oberst im Generalstab. Fotos zeigten ihn auf dem Pferderücken mit dekoriertem Hut und Säbel. Er entstammte einer Fabrikantenfamilie der Metallverarbeitungsbranche. Ihm schwante Großes - nicht wie Oma im Musischen - sondern unternehmerisch. Er gründete ein Geschäft an bester Lage. Und da bald auch ein Sohn geboren wurde, bekam Oma Arbeit zuhauf. Nebst Haushalt und Kind arbeitete sie Vollzeit im Laden, auch als ihr Mann für die Heimat an der Grenze Wache hielt.
Das Geschäft gedieh und damit die Ansprüche der Kunden. Immer extravaganteres Porzellan, edleres Besteck bestückte die Auslagen. Der Kundenstamm wuchs. Und als im Zentrum der Stadt, wegen Insolvenz, eine Immobilie zu kaufen war, schlugen Oma und Opa zu. Sie investierten alles, was sie hatten. Der Kundenstamm blieb ihnen treu und vermehrte sich laufend. Die Exklusivität des Angebotenen sprach sich herum. Auch gab es im Geschäft einen Service, der sich speziell um ausgefallene Kundenideen kümmerte. Und so wurden Gerätschaften in Auftrag gegeben, die im Handel noch gar nicht existierten. Ein Einsatz, der sich als Goldgrube erwies.
Oma und Opa ging es gut, auch wenn sie nicht als harmonisches Paar durchgingen. Beide waren Alphatiere, beide unerschütterlich in ihren Ansichten. Opa gab selten nach, auch im Alter nicht, als seine Ansprüche es immer öfter an gesundem Menschenverstand fehlen ließen. Er machte seine Umgebung leiden und verstand nicht warum. Man ging ihm aus dem Weg, delegierte seine Pflege an geschulte Hände. Und das machte ihn noch verschlossener, noch grollender. Er starb im Schlaf, auf dem Gesicht die Züge des Obersten. Befehlsgewaltig noch im Tod. Es kam nicht wirklich Trauer auf. Sie wurde von der Familie zwar absolviert. Doch war von da an von Opa nur noch wenig die Rede. Einzig seine Tüchtigkeit als Geschäftsmann blieb sprichwörtlich.
Die Bezeichnungen „Opa“ und „Oma“ kannte Lilia nicht. Doch da die ganze Familie die Großeltern so nannte, nahm Lilia an, sie hießen so. Erst viel später fand sie ihre richtigen Namen heraus.
Oma war, was man zu ihrer Zeit „Une Grande Dame“ nannte. Sie beschäftigte eine Couturière der „Haute Volée“, derer von ganz oben. Oma glich in der Art ihrer Ausstrahlung, durch ihre ungekünstelte Würde, einer Adligen der Renaissance. In Gesellschaften war sie natürlicher Mittelpunkt. Man holte ungebeten einen Sessel für sie herbei, wenn sie erschien. Und Damen und Herren, die sich mit ihr unterhalten wollten, knieten schon mal auf den Boden, um sie auf Augenhöhe zu sprechen.
Ihre Couturière kreierte Wunderwerke für Oma, duftige, bodenlange Seidenkleider, die sie auch im Alltag trug. In dezenter Musterung mit üppigen, weißen Spitzen- und Rüschenjabots im offenen Ausschnitt und weiten, wehenden Ärmeln. Opa, stolzes Mitglied einer Zunft, lieferte den Schmuck zur ausgefallenen Garderobe, und Oma verstand ihn auf ihrem Busen elegant zu präsentieren.
Firmenjubiläen, runde Geburtstage und ihre goldene Hochzeit feierten Oma und Opa standesgemäß: Die goldene Hochzeit in der Kirche mit Musikern des Stadttheaters, mit erneuertem Eheversprechen und rosenstreuenden Enkelinnen als Vortrab, zu denen auch Lilia gehörte. Oma genoss das. Sie blühte auf in Gesellschaft, war geistreich, sprachgewandt und belesen. Und sie sprühte vor Humor, wenn er nicht auf ihrem Rücken ausgetragen wurde. In Wagenkolonnen von Rolls Royce und Bentley mit ihren Gästen zu Hochburgen der Gastronomie zu fahren und sie zu verwöhnen, machte sie glücklich. Sie zeigte selbstverständlich und mit Begeisterung, was sie und Opa geschafft hatten.
Und doch gab es auch dunkle Seiten in Oma. Etwas verhalten Grausames bewohnte sie. Die unterdrückten Träume, die verpassten Gelegenheiten eines selbstbestimmten Lebens vergaß sie nicht, und sie manifestierten sich zuweilen in massiver Bosheit, etwa gegen Angestellte und sogar gegen ihre mittlerweile zwei Söhne und eine Tochter. Oma hatte Haare auf den Zähnen. Lilia wusste darum. Und bei aller Liebe, die Lilia zu ihr hegte, da sie in ihr jemanden gefunden hatte, der ihr die Stange hielt, ohne gleich zu strafen, wenn sie rebellierte, verfiel sie ihr nicht. Lilia nahm sich in Acht. Oma war ihre bewunderte Gegnerin, die sie auszunehmen verstand, wenn ihr danach war, die sie jedoch zu sehr respektierte, um diesen Umstand auszunutzen. Sie kannten einander. Sie spürten einander. Und sie hielten einander auf Distanz. Lilia hätte Oma nie erzählt, was sie im Innersten bewegte, was sie quälte, und ihr Leben zur Hölle machte. In eigenen Worten hätte sie ihr das nie anvertraut. In dieser Hinsicht wusste sie Oma auf der Seite des Feindes. Omas Liebe hörte dort auf, wo es um das Ansehen und das Wohl des eigenen Clans ging.
Inzwischen bewohnten Opa und Oma eine stattliche Bürgervilla mit Garten am Sonnenberg. Im Parterre lagen zwei Salons, einer hell und weitläufig, den Oma zu ihrem Schreibzimmer erkor, und einer kleiner und eher düster, der die Bibliothek enthielt, und in dem Opa seine Habanos rauchen durfte. Das Herzstück des Parterres war das Esszimmer, zu dem auch ein Erker gehörte, in den Oma zwei von ihren Fauteuils hatte stellen lassen nebst ihrem Handarbeitstisch. Wenn Oma nicht gerade Briefe schrieb, in großzügiger, schwungvoller Schrift auf Büttenpapier mit Monogramm, häkelte, strickte sie oder stickte Gobelins. Die gesamten antiken Sessel im Salon waren mit ihren Arbeiten bespannt. Ebenso diejenigen in Opas und Omas Schlafzimmer und in allen anderen Räumen des Hauses. Und eine große Reproduktion des Abendmahls von Leonardo derselben Machart schmückte eine Wand des Esszimmers.
Oma arbeitete schnell, fast verbissen. Unter ihren Händen entstanden Dutzende von spitzenumsäumten Tischtüchern aus schwerer, handgewebter Leinwand, Servietten, Bettüberwürfe, Kissen und Schemel. Vor allem als sie älter wurde und weniger gut zu Fuß war, beschäftigten sich ihre Hände ohne Unterlass, so als müssten sie etwas nachholen, sich selbst etwas beweisen, bevor es zu spät sei, als gelte es gegen etwas anzugehen, dem sich Oma um keinen Preis stellen wollte.
Wenn sie über Handarbeiten saß, Opas Dackel als Wärmekissen auf den Füssen, mit dem er in jüngeren Jahren auch auf die Jagd gegangen war, schien sie glücklich. Dann wichen die Sorgen über ihren einen Sohn, der immer noch zuhause wohnte sowie über ihre Tochter, die wieder zuhause wohnte. Der andere Sohn, der wie sein Vater ebenfalls die Karriereleiter des Militärs erklomm, wurde mittlerweile von Opa ins Geschäft eingeführt und übernahm es später auf eigene Rechnung.
Im oberen Stockwerk des Hauses befand sich das herrschaftliche Schlafzimmer von Oma und Opa. Es hatte einen Kamin, vor dem als Funkenschutz ein Paravent in Hinterglasmalerei stand, die Darstellung eines Teichs, an dessen Ufer Spatzen und Meisen Körner pickten. Wie auf Vielem, das Omas Händen entstammte, herrschten darauf Brauntöne vor.
Lilia liebte diesen Paravent. Doch ihr wurde nur selten erlaubt, das Schlafzimmer der Großeltern, das denselben geräumigen Erker hatte wie das Esszimmer, zu betreten. Wurde es ihr gestattet, ließ sie flink ihren Blick in jeden Winkel gleiten und erspähte dabei auch eine, wie ihr schien, furchterregende Apparatur, die über einer Stuhllehne hing. Was das sei, getraute sie sich nicht zu fragen. Erst viel später erfuhr sie, dass Opa damit seinen Leistenbruch in Schach hielt. Offiziell war es auch dem Dackel verboten, sich ins Zimmer zu schleichen. Pfiffig und zielstrebig, gelang es ihm jedoch immer mal wieder, es sich auf Omas seidener Steppdecke wohlsein zu lassen. Er war eigensinnig und selbständig und gehorchte nur Opa, denn Opa konnte pfeifen, dass Lilia das Blut in den Adern gefror. Und das wirkte auf den Dackel besser als ein Peitschenhieb. Im Nu stand er bei Fuß, setzte sich auf die Hinterbeine und machte Männchen, mit keckem Blick und schräg gestelltem Kopf.
Auch Omas Tochter, Lilias Mutter, bewohnte das erste Stockwerk und ebenso Omas erstgeborener Sohn. Das Badezimmer mit den Waschbecken und einer Badewanne auf Löwenfüssen befand sich auf dieser Etage. Sowie ein winziges Zimmer für Dienstboten, neben der Toilette gelegen, und das Gästezimmer, in dem Lilia hauste, wenn sie gezwungenermaßen bei der Mutter und den Großeltern weilte.
Den stärksten Anziehungspunkt stellte für Lilia das Untergeschoss dar, und zwar der Wintergarten, der ursprünglich dafür gedacht war, Orangenbäumchen und andere heikle Pflanzen zu beherbergen. Die Dienstbotendusche befand sich dort. Die Waschküche. Die Vorratskammer. Opas Weinkeller sowie eine Garage. Im Wintergarten mit seinen Einbauschränken gefiel es Lilia am besten. Sie waren von oben bis unten gefüllt. Öffnete man die Türen, entdeckte man nichts als Päckchen.
Lilia drehte sich behutsam auf den Rücken, die rechte Seite erhitzt von Omas Schlaf. Sie brauchte Platz. Ihre Brust war übervoll. Mozarts Presto raste darin als hechelnder, stichelnder Schmerz. Lilia breitete den Körper bis zum Bersten aus. Atmete tief. Atmete unerschöpflich. Die Melodie drängte sie ans Ende ihrer selbst, saugte sie ein. Der Körper bäumte sich auf. Wand sich. Stürzte ab und lag doch mäuschenstill. Weh oder Ekstase? Sie wusste es nicht. Der Satz verklang, das Blut schäumte in Lilias Adern, die Ohren donnerten, der Herzschlag dröhnte. Davon erzählen durfte Lilia nicht, denn sie würde damit nur Schelte ernten. Mit ihrem Inneren war sie allein. In Mozart wurde sie herzklein, unsichtbar, flog weg von Schmach und Leid. Ein blendender Punkt. Schrei und Abgrund, der sie barg und heilte.
Im Flur erklang der Gong. Die Köchin rief zum Essen. Vor den Fenstern gähnte Nacht.
Oma erhob sich seufzend. Die Hände an den Flanken, richtete sie sich mühsam auf. Lilia dagegen war hellwach. Mozart verlieh ihr ungeahnte Kraft. Sanierte sie. Gebar sie neu. Sie hakte sich bei Oma ein und führte sie zum Tisch. Der Mutter schenkte sie keinen Blick, tat, als sei sie gar nicht da und motzte auch nicht, als die Köchin gesüßte Eierspeise, die Lilia hasste, ins Zimmer trug. Sie war satt von Musik. Das Essen konnte ihr gestohlen bleiben.
Lilia hatte in der Schule rasch und enthusiastisch lesen gelernt. Sie las viel, besaß auch schon eine bebilderte Biographie von Mozart. Kinderbücher mochte sie weniger, die ödeten sie an. Lilia merkte früh, dass sie Handfestes brauchte, um nicht unterzugehen. Sie musste wissen, wie Erwachsene dachten, und warum so wenig Verlass auf sie war. Der Geschichte Mozarts entnahm sie, dass andere Kinder genauso litten wie sie, auch wenn sie noch so begabt waren. Sogar in der Schule war von ausgenutzten, im Stich gelassenen, vereinsamten Kindern die Rede - vor allem im Religionsunterricht bei einer kindlich-mütterlichen Nonne. Dort stand während der Stunde ein Kästchen mit einem knienden Bübchen auf dem Pult. Und wenn Lilia das Zwanzigrappenstück, das sie auf sanften Druck der Nonne von zuhause erbettelte, in den Schlitz des Kästchens warf, nickte das Bübchen zum Dank. Das Kästchen fand Lilia faszinierend abstoßend. Das Nicken des Bübchens machte sie wütend. Denn wenn sie zu hören bekam, solche Bübchen, die auf der anderen Seite der Erde wohnten, wären froh, sie hätten überhaupt etwas zu essen, besäßen Eltern und ein Dach über dem Kopf wie sie und, würden deswegen nie herummaulen, hätte sie dem Bübchen den Kopf abschlagen können. Was gab es schon zu kaufen für einen Zwanziger. So eine Heuchelei.
Sowenig wie Mozart kannte Lilia ein intaktes Familienleben. Die Erzählungen von Mitschülerinnen über gemeinsame Sonntagsausflüge weckten in ihr vor allem Trauer. Nachvollziehen konnte sie sie nicht, denn in ihrem eigenen Leben gab es nur selten Entsprechendes. Umso mehr sehnte sie sich nach Mozarts Musik. Ihre Reinheit empfand sie wie Medizin. Bar jeder Bosheit, jeder Rachsucht strömte. Stürmte sie dahin. Spülte Erniedrigung und Benutztwerden weg. Mozart zu hören, machte Lilia makellos. Es war wie Beten, todesverachtend mutig. Mozart horchend dachte Lilia nicht ans Sterbenwollen. In Mozart gab es weder Falschheit noch Verrat. In Mozart war Leben gut. War Kindsein fröhlich. Und das Aufwachen am Morgen erstrebenswert.
Sternstunde Mozart: Leider schlug sie für Lilia selten. Das Radio war für sie tabu. Nur mithören durfte sie. Schlug sie jedoch, war ihr, als schnüre ihr Herz Siebenmeilenstiefel und reiße alle Himmel zu sich herab. Seit wann Lilias Liebe zu Mozart datierte, war ihr unbekannt. Ihr schien, sie sei stets dagewesen. Mangels Hörgelegenheiten hatte sie sich einfach nicht gezeigt.
Lilia besaß auch ein Bild von Mozart, eine Schwarzweiß Kopie eines Originalgemäldes auf Samtkarton. Und wohin sie ging, das Bild musste mit, sogar in die Schule, versteckt in einem Buch. Nachts stellte sie es auf das Kästchen neben ihrem Bett und küsste es, bevor sie einschlief und ebenso, bevor sie aufstand und es in die Tasche steckte. Sie konnte sich nicht sattsehen daran. Doch war unklar, was sie an Mozart am meisten vergötterte: Seine Musik. Sein Aussehen. Seinen Lebenslauf. Die Tragik, die sie dahinter wahrnahm - oder schlicht das, was Mozart in ihr selbst auslöste: die Hingabe, die seine Musik in ihr bewirkte, das was in ihrem Körper, in ihrem Nervensystem dabei abging, das Bespieltwerden, als sei sie selbst die Geige oder Flöte - diese Möglichkeit purer Selbstaufgabe, die einen Jubel in ihr auslöste weit jenseits von dem, was ihr Leben bis über die Schmerzgrenze hinaus belastete. Lilia hätte es nicht zu sagen vermocht. Sie dachte auch nicht darüber nach. Sie lebte es und fand das ganz natürlich. Es war für sie so selbstverständlich wie Zähneputzen, wie ihre Gespräche mit dem Herrgott, vor dem sie ebensowenig ehrfurchtsvoll kuschte, sondern ihn genauso als Hilfsmittel benutzte. Lilia schlug sich mit ihm. Sie forderte ihn heraus. Erpresste ihn mit einer Leidenschaft, derer sie sich ohne Scham bediente - bis sie dieselbe Kraft, dieselbe Macht in sich keimen sah wie beim Hören von Mozart. „Du musst helfen, hörst du, du musst einfach, es geht nicht anders“; beschwor sie den Herrgott während Stunden, in Nächten, in denen sie, steif vor Angst, auf dem Fell vor ihrer Kommode kniete, ungeachtet der Kälte, die Eisblumen an ihr Fenster zeichnete, und lautlos ums schiere Überleben schrie. Sich immer wieder daran erinnernd, dass ja nicht ihr Wille, sondern der seine maßgebend sei. Um dann weiterzuzetern: „Wenn du nicht hilfst, kann ich nur noch aus dem Fenster springen.“
Ob es schließlich der Herrgott war, der sich erweichen ließ. Ob ihre Inbrunst. Oder die bezwingende Wunschkraft, war für Lilia sekundär. Hauptsache es wirkte. Zwar glaubte sie an den Herrgott, doch glaubte sie vor allem an ihr eigenes Tun. Umsonst erhielt man nichts. Der Preis zählte. Den Preis zu kennen, war ausschlaggebend und der hieß: „Alles oder nichts“. Eine Erfahrung, die Lilia laufend machte. Nur wenn sie parierte, klein beigab und sich scheinbar unterzog, bestand die Chance, dass sie erreichte, was sie brauchte. Das galt im Äußeren. Also hatte es auch im Inneren so zu sein. Des Herrgotts Wille war die Richtschnur - doch Druck zu machen. Knallhart zu fordern. Und sogar zu drohen, schien sicherer.
Nach dem Abendessen lud die Mutter Lilia ein, mit ihr in den Keller zu gehen und zu sehen, was sie sich an Spielsachen wünsche. Die Tore der Wandschränke taten sich auf wie eine Verheißung. An der einen Türe hing mit Reißnageln gesichert eine Liste, darauf beschrieben der Inhalt der Päckchen: „Mutters Puppe mit Kleidchen“, stand da, oder: „Lieb Bruders Feuerwehrauto“, „Papas Baukasten“, oder „Klein Onkels Pferdchen mit Wagen“. Es fanden sich aufziehbare Piepmatze, Autos, ein Affe, der die Trommel schlug, sowie Plüschtiere und vieles mehr. Und zuunterst, ebenfalls verpackt, ein Puppenwagen auf hohen Rädern und einem Stossbügel aus Porzellan. Den, sowie einen Baukasten, den die Mutter für sie nach oben tragen musste, da er viel zu schwer war, den aufziehbaren Affen und ein paar Plüschtiere, zwei Puppen, eine mit Porzellankopf und Augen, die auf und zu klappten und eine aus Gummi, der man das Fläschchen geben konnte, wünschte sich Lilia meistens. Dass sie die Sachen nur leihweise erhielt, war ihr bewusst. Doch bettelte Lilia jedes Mal, das eine oder andere Stück zum Vater mitnehmen zu dürfen, wenn die Ferien um waren, und Lilia heimreisen konnte. Sie versprach, es pflichtgemäß beim nächsten Besuch wieder abzuliefern, ein Argument, das nie verfing. Die Mutter ließ nicht mit sich reden. Das gegenseitige Unverständnis, die Fremdheit und Hilflosigkeit von Mutter und Kind waren unüberbrückbar. Abgründe von Verletztheit. Groll. Und Hass klaffte dazwischen. Das Kind stand für die Mutter zu sehr für Erniedrigung. War zu sehr Abbild des Vaters. Verkörperung von Willkür und Gottlosigkeit. Die Mutter ihrerseits zu sehr Verkörperung von Gewalt. Falschheit. Und Teufelei für das Kind.
Sobald Lilia eines der Spielzeuge überdrüssig wurde, trat es den Rückweg in den Keller an und wurde weggepackt. Auch mit den Dingen wirklich spielen konnte Lilia nicht, denn erstens gehörten sie ihr nicht, und zweitens gab es niemanden, mit dem sie sich an ihnen hätte erfreuen können. So saß sie oft da, die Puppe mit Porzellankopf im Arm, den altmodischen Wagen zur Seite, bettete die Puppe hinein, nahm sie wieder heraus, zog sie um, bürstete ihr Haar und langweilte sich. Ihr fehlte das Eigene: Plastilin etwa, mit dem sich etwas kreieren ließe, ein Fahrrad, ein Schaukelpferd oder Rollschuhe zum sich Austoben. Stieß sie den Puppenwagen durch den Garten, lauerte ihr die Mutter an jeder Ecke auf und fotografierte sie. Dutzende von Malen. Für Lilia ein Horror. Sie zog Grimassen, drehte sich weg, obwohl die Mutter bettelte, sie solle doch lieb sein und sie anlächeln, da sie sie sowieso nur für kurze Zeit haben dürfe. Was für Lilia wie „besitzen dürfe“ klang. Sie fühlte sich wie ein Ding, das man aufs Regal stellt zum Begaffen und Begrapschen, nicht wie etwas von Leben Erfülltes.
Mit Lilia spielen konnte die Mutter nicht. Sie wusste nicht wie. Und ebenso wenig anzufangen wusste Lilia mit der Mutter. So unheimlich, so feindselig standen sie einander gegenüber, aus Trotz, aus Leid, aus Ratlosigkeit: Lilia das Kind - die Mutter die Erwachsene, der es an Übung mit dem Kind gebrach. Liebe, die ins Leere zielte. Sehnsucht, die nicht erwidert wurde. Wie auch? Sie waren Verfemte, durch Negativpropaganda voreinander schlecht gemacht. Versöhnung, Verständnis waren viel zu entfernt, weit jenseits alles Sichtbaren. Lilia erschien die Mutter fett, plump und abstoßend. Ihr Hass auf die Frau, die offensichtlich Macht über sie besaß, fällte dieses Urteil. In Wirklichkeit wirkte die Mutter kindlich, gehemmt und sperrig. Mit weichem Fleisch. Fast knochenlos. Leicht schlurfend, da sie oft Pantoffeln trug wie ein Dienstmädchen, mit Kopftuch und Ärmelschürze, wenn sie ihr Zimmer mit dem Wedel abstaubte. Mit Händen weiß und bläulich, mager wie Krallen. Mit dünnem, blondem Haar, das sie nachts auf winzige Wickel drehte und mit einem Netz zusammenhielt. Und hellen, wässrigen, oft rotgeränderten Augen. Ihr Gang hatte etwas zum Tanzen ungeeignet Rollendes. Kuhhaft Milchwarmes tränte aus ihrem Gehabe. Es weckte in Lilia Zorn und Aggression, und sie schämte sich für die Mutter.
Diese trug von Oma entworfene und gestrickte Pullover mit breitem, anliegendem Bund bis zur Taille. Dort setzten gleich die Ärmel an: schräg nach außen, bis zu den Handgelenken reichende Fledermausärmel. Oma verwendete währschafte Wolle. Das ergab schwere Pullover. Sie bevorzugte Pastellfarben. Und obwohl die Arme nie mit den Achselhöhlen in Berührung kamen, nähte die Mutter Schweißblätter hinein. Auch für diese Pullover schämte sich Lilia, obschon sie an der Mutter gut aussahen und sie sie mit Chic trug. Es waren gewagte, extravagante Stücke. Dazu passten Plisséeröcke und Mutters rahmengenähte Treter. Großkarierte Mäntel und Hüte mit Feder oder Band, deren Rand auf einer Seite aufstand. Goldene Armbänder und Ringe mit grünen oder blauen Gemmen vollendeten ihr damenhaftes Aussehen. Die Mutter hatte Charme. Und mit etwas mehr Selbstbewusstsein und Schwung hätte sie als arrivierte Schriftstellerin oder Malerin durchgehen können. Ihr Witz war leise. Ihr Lachen wiehernd oder perlend, je nach Situation. Die Scheu und Unberührtheit eines Teenagers umgab sie in Gesellschaft. Doch konnte sie wütend, böse und sogar brutal sein im Umgang mit Lilia.
Die Mutter ordnete sich Oma bedingungslos unter. Stigmatisiert durch das Fiasko ihrer Ehe, wurde sie wieder Tochter, und Oma kam das nicht nur ungelegen. Denn die Tochter leistete ihr Gesellschaft, las ihr aus der Zeitung vor, begleitete sie bei Einkäufen, legte ihre Tabletten zurecht, suchte Verlorenes, glättete die Wogen, wenn bei Tisch Streit zwischen Oma und dem ledigen Bruder ausbrach. Kurz: sie war in vielerlei Hinsicht nützlich. Oma bediente sich ihrer Dienste kommentarlos, und der Mutter blieb keine Wahl. Obwohl alle Schuld am Scheitern ihrer Ehe auf Lilias Vater projiziert wurde, hatte die Tochter Schande über die ultrakatholische Familie gebracht. Mindestens zu Anfang ihrer Rückkehr brauchte es Erklärungen gegenüber Angehörigen und Freunden, die Omas Stolz und Selbstverständnis ankratzten. Sie verzieh das der Tochter nicht.
Zur Sühne verleugnete die Tochter sämtliche eigenen Bedürfnisse, leistete sich nur eine Marotte und zwar die, dass sie überallhin kleine Notizbüchlein mit sich schleppte, und sei es im Café, in einem Geschäft oder zu Besuch bei Freunden, Verse hineinkritzelte. Plötzlich wurde ihr Blick starr, ihr Gesicht verträumt und verzückt, und trotz Omas „Sch-sch-sch“, ließ sie sich nicht wecken. „Die Frau spinnt“, war sich Lilia sicher. Das kleine Mädchen, das mit Buben begeistert auf Bäume kraxelte, ließ sich in dieser wenig geerdeten Frau mit ihrem Alltag auf Sparflamme kaum noch erkennen.
Seit ihrer Schulzeit war die Mutter dahingehend erzogen worden, später einen vermögenden Mann zu heiraten, und damit das Ansehen der Familie zu mehren und zu untermauern. Sie wurde für Studienaufenthalte nach Italien geschickt sowie in die französische Schweiz. Sprachen lernte sie leicht, eine Berufsausbildung stand nicht zur Diskussion. Die Hauptsache waren angenehme Umgangsformen, ein vollendeter Auftritt in Gesellschaft sowie gepflegte Erscheinung und Konversation. An Kochkursen oder Kursen für Haushaltsführung lag Oma nichts. Dass der Zukünftige Hausangestellte beschäftigen würde, fand sie selbstverständlich.
Doch die Tochter machte einen Strich durch diese Rechnung. Sie verliebte sich in Italien in einen heißblütigen, stürmischen Mann, der nicht ihren Kreisen angehörte. Wie es ihr, trotz der Umsicht der Nonnen des Instituts, das Oma für sie ausgesucht hatte gelang, vom geplanten Weg abzukommen, blieb ihr Geheimnis. Tatsache war, dass sie von dem Mann um keinen Preis der Welt mehr lassen wollte, obwohl ihr strikter Glaube ihr verbot, seinem Drängen ohne Gottes Segen nachzugeben. Und so suchte der hitzige Römer sich ein willigeres Herz. Es bahnte sich bald eine Schwangerschaft an. Die betroffenen Familien zeterten und drohten mit Vergeltung, so dass dem Mann nichts anderes übrig blieb, als den Unfall zu legalisieren - was für Lilias Mutter ein Desaster bedeutete, von dem sie sich nur schwer erholte.
Als fast schon „spätes Mädchen“ begegnete sie Jahre danach auf einem Studentenball Lilias Vater. Wieviel Liebe bei dieser Verbindung im Spiel war, wusste nur sie selbst. Im Übrigen kümmerte das niemanden, sie hatte zu gehorchen, denn obwohl der junge Mann aus sehr bescheidenen Verhältnissen stammte, mauserte er sich bereits zum angesehenen Forscher in der Chemiebranche. Geld besaß er keines. Möbel und Aussteuer mussten Oma und Opa berappen. Dafür war er ansehnlich, ehrgeizig und zielstrebig, also genau das, was vor allem Opa außerordentlich behagte. Trotz des Krieges richteten Oma und Opa dem Paar eine prächtige Hochzeit aus. Das hochgeschlossene, spitzenbesetzte Brautkleid stammte von Omas Couturière. Die Kutsche, von weißen Pferden gezogen, wurde mit Lilien geschmückt. Und auch diesmal rollten die Gäste in Wagen von Bentley und Rolls Royce zum Bankett. Dass die Tochter endlich unter der Haube war, bedeutete für die Eltern eine Erlösung, die sie sich gern etwas kosten ließen. Gereichte doch die Entfaltung von etwas Wohlstand auch ihrem Geschäft zum Vorteil.
Fotos zeigten die Tochter zerbrechlich. Scheu. Verträumt. Und ängstlich. Lilias Vater dagegen kühl, sichtlich bemüht um gute Figur und imponierendes Auftreten. Nach der großen Liebe sah es nicht aus. Und in der Hochzeitsnacht zerbrach sie denn auch vollends. Die Mutter war nicht aufgeklärt. Von Blümchen und Bienchen hatte sie gehört, von der Aufgabe der Frau, gottesfürchtig der Kirche und dem Mann zu dienen ebenso. An so viel Nähe jedoch, wie ihr Gatte sie nun von ihr verlangte, hatte sie sich noch nie auch nur im Entferntesten herangewagt. Ihr Entsetzen war denn auch nicht gespielt. Ihre Angst nicht gekünstelt. Sie verweigerte sich nicht, um erobert zu werden. Sie saß schlicht in der Falle und schrie um ihr Leben. Es blieb dem Gatten nichts anderes übrig als zuzupacken, um die Ehe zu vollziehen. Seine Frau würde sich schon an ihre Pflichten gewöhnen, dachte er.
Doch sie gewöhnte sich nicht daran. Zu heftig war der Sturz aus ihrem Mädchenhimmel in die nackte Tatsache. Bald stellte sich zudem heraus, dass sie mit Lilia schwanger ging. Die Geburt geriet zur Katastrophe: all das Blut. Der Schweiß. Die Qual. Der Schmutz. Sie hielt das Kind zurück, so lange es irgend ging. Es zerriss sie beinahe. Und dann wollte es nicht atmen, wurde blau und schlaff, überlebte dennoch und trug auch keinen sichtbaren Schaden davon. Doch die Mutter schwor bei Gott, Ähnliches sollte ihrem Töchterchen nie widerfahren. Nie sollte es Gewalt, nie solche Erniedrigung erleiden.
Um Lilia kümmerte sich bald eine Säuglingsschwester, denn nun zeigte es sich, wie hoffnungslos überfordert die Mutter mit Kind, Küche und Haushalt war. Mehrmals am Tag rief sie in Panik Oma an, konnte weder das Putzen noch das Kochen bewältigen, noch ihren Hausfrauentag gestalten. Die Telefonrechnungen stiegen ins Astronomische, und das Gehalt des jungen Forschers erschöpfte sich vor Monatsende. Auch deshalb, weil seine Frau die Lebensmittelpreise nicht kannte und wahllos einkaufte, was ihr schmeckte. Streit war vorprogrammiert, und auch die nächtlichen Quälereien gaben der Beziehung den Rest. Nach einem halben Jahr brannte die Mutter mit Kind und Gepäck durch, heim zu Oma und Opa.
Das Kind behalten durfte die Mutter nicht. Lilias Vater setzte sämtliche Hebel in Bewegung, um sein Töchterchen „diesem Pack und Gesindel“, wie er seine Schwiegerfamilie nannte, zu entreißen - obwohl er sich ursprünglich einen Buben gewünscht hatte, einen solch gescheiten wie er selbst, der seine Forschungsarbeit verstehen und in seine Fußstapfen treten würde. Doch der verhassten Gegenpartei durfte nicht einmal ein Mädchen überlassen werden. Also holte er es zurück. Darauf bewaffneten sich beide Parteien mit Anwälten, mit den tüchtigsten, den effizientesten und teuersten - ging es doch ums Heimzahlen. Falls je Liebe zwischen den beiden Seiten gekeimt hatte, wich sie bebendem Zorn.
Lilia weilte während den ersten beiden Lebensjahren meistens bei Verwandten, da der Vater noch keine Ersatzmutter für sie gefunden hatte. Sie galt als glückliches Kind. Mit kugelrundem Kopf und breitem Lächeln brabbelte sie zufrieden vor sich hin und schrie selten.
Da die Schwester von Lilias Vater ledig war, warf er ein Auge auf sie. Nach Schulende hatte sie auf eine Berufsausbildung verzichtet und eine Stelle in einer Fabrik angetreten, um zusammen mit ihrer Schwester, die ebenfalls in der Fabrik arbeitete, des Bruders Studium zu berappen. Nicht freiwillig. Ihr Vater hatte Druck gemacht. Und als jetzt Lilias Vater seine ledige Schwester darum bat, zu ihm zu ziehen und sich der Aufzucht seines Mädchens anzunehmen, machte der Pfarrer Druck. Sie sei verpflichtet, sich für das Geschöpfchen zu opfern, und auf eigenes Glück zu verzichten, beschwor der Pfarrer sie. Und so wurde die Tante Lilias Pflegemutter. Ob willig oder gezwungenermaßen, das kümmerte niemanden.
Nicht nur auf Scheidung von seiner Frau plädierte Lilias Vater. Sondern er ging aufs Ganze und verlangte die Annullierung der Ehe. Er wolle wieder heiraten, seinem Töchterchen eine neue Mutter bescheren, gab er zu Protokoll. Auch er gehörte dem Katholizismus an, was bedeutete, dass eine Scheidung bei erneuter Eheschließung den Segen der Kirche verhindert hätte. Obwohl Lilias Vater es nicht so genau nahm mit dem Glauben und Gottesdienste so gut wie nie besuchte.
Finanziell mittlerweile ordentlich gestellt, ging er das Wagnis eines Rechtsstreits ein, merkte jedoch rasch, dass die Gegenseite über Mittel verfügte, von denen er nur träumen konnte. Eine Schlammschlacht ohnegleichen bahnte sich an. Gutachten der übelsten Sorte untermauerten das Versagen seiner Frau. Zuletzt sah es so aus, als sei sie Lilias Vater als geistig zurückgebliebene Katze im Sack verkauft worden. Natürlich hatte er sie vor der Hochzeit nur selten allein sehen dürfen, doch gehörte das zum Sittenkodex besserer Familien dazu. Denn die Braut sollte unbefleckt in die Ehe treten.
Die Annullierung zog sich über Jahre hin. Und am Ende entschied der Vatikan tatsächlich zu Gunsten von Lilias Vater. Später fragte sich Lilia oft, warum ihr Vater sie um jeden Preis haben wollte. Und ebenso seltsam erschien ihr, dass die Mutter sie, koste es, was es wolle, für sich beanspruchte. Denn mit Lilia suchte weder die eine noch die andere Partei je das Gespräch. Auch dann nicht, als sie verstand, was ihretwegen ablief. Sie war von Anfang an nur Objekt, um das ein erbitterter Machtkampf loderte, als existiere sie gar nicht als Mensch.
So sehr zerzauste der Rechtsstreit die Finanzen von Lilias Vater, dass er ihn zwang, vom komfortablen Haus, das er mit seiner Frau bewohnt hatte, in ein Genossenschaftshäuschen umzuziehen, ein schäbiges, hölzernes Haus mit Balkon, winzigem Garten, ohne Warmwasser, ohne Kühlschrank, ohne Heizung, nur mit einem Brikettofen in der engen, muffigen Stube. Der Herr Doktor strandete umgeben von Asozialen, Flüchtlingsfamilien und Hilfsarbeitern, die mehr schlecht als recht über die Runden kamen mit ihrem Zahltag, der in einigen Fällen bis zu dreizehn Mäuler stopfen musste.
Der Vater arbeitete tagsüber und genoss in seiner Firma mehr und mehr Ansehen. Lilia jedoch bekam zu spüren, dass sie hauste, wo sie nicht hingehörte und günstigen Wohnraum beanspruchte, der ihr nicht zustand. Der Vater hatte Lilia, die bei ihrem Erscheinen noch zu klein gewesen war um selbst darauf zu kommen erzählt, die Frau in seinem Haus sei nicht ihre Mutter, sondern nur die Tante. Doch das war Lilia egal. Hauptsache, sie war da, denn sie liebte sie sehr und nannte sie „Mama-Tante“, weil ihr der Vater verbot, „Mama“ zu ihr zu sagen. Als nach und nach durchsickerte, wo Lilias Vater arbeitete, und wieviel er demzufolge verdiente, bekam Lilia Feindseligkeit und Ausgrenzung im Quartier zu spüren. Der Rechtsstreit, der ein Vermögen kostete blieb geheim. Auch die Familienverhältnisse kannte lange Zeit niemand. Erst allmählich kam die Wahrheit ans Licht.
Des Vaters Familie stammte von Jenischen ab, von Fahrenden also. Das war ein weiteres, pikantes Detail, dessentwegen sich die Nachbarn das Maul zerrissen. Der Vater schämte sich seiner Herkunft nicht. Er rühmte sich eines seiner Professoren der, von Studenten angegriffen, stolz erklärte: “Ja, meine Vorfahren waren Fahrende, und dennoch stehe ich heute hier vor Ihnen und unterrichte Sie, meine Herren“. Der Vater liebte diese Geschichte. Sie stärkte ihm den Rücken. Vaters Ahnen waren an dem Ort, an dem ihr Wohnwagen während einer bestimmten Nacht gestanden hatte, zwangseingebürgert worden. Per Gesetz. Man hoffte, das Gelichter, das die Dörfer unsicher machte, und anständige Leute durch unbotmäßiges Verhalten vor den Kopf stieß, so besser unter Kontrolle zu kriegen. Die meisten Kinder wurden in Pflege gegeben. Das sollte gewisse ungebührliche Charakterzüge ausmerzen und anständige, Steuern zahlende Bürger aus ihnen machen.
Was die Erfordernisse des Alltags betraf, war der Vater ein Träumer. Nur in seiner Arbeit blühte er auf, legte sich mit Leidenschaft, Fantasie und Kühnheit ins Zeug, gab sich unangenehm und aufsässig, wenn er Hindernissen begegnete. Erstaunliche Wildheit überkam ihn. Er kämpfte verbissen. Und der Erfolg gab ihm jedes Mal Recht. Patent um Patent beschwor er mit erhobener Hand auf dem amerikanischen Konsulat. Das beflügelte seinen Ehrgeiz.
Ein paar Mal nahm er Lilia mit, zeigte ihr sein Labor, stellte ihr seine Mitarbeiter vor. Eine bisher unbekannte Seite am Vater offenbarte sich Lilia. Sie stand vor einem Menschen, der geachtet, und dessen Fähigkeiten anerkannt wurden. Der nicht einfach griesgrämig, verbittert und depressiv auf dem Bett hockte und sich heimlich betrank, Lilia übersah, ihren Versuchen ihn aufzuheitern mit Bissigkeit begegnete, sie aus dem Zimmer scheuchte und zusehends vereinsamte. Lilia hatte des Vaters Wildheit und Zähigkeit geerbt. Auch seine Depressivität. Sowie den verzweifelten Mut, den jeder Widrigkeit trotzenden Optimismus. Sie hielt es aus, inmitten sich bis aufs Blut bekämpfender Erwachsener, ohne stabile Verhältnisse zu wachsen und sich zu entwickeln. Auch wenn ihr Herz sich verkrampfte vor innerem Weh. Sie sich oft in den Schlaf weinte. Und niemanden hatte, mit dem sie reden konnte, und auch gar nicht gewusst hätte, worüber sie reden sollte, da sie nichts anderes kannte als ihr Elend.
Dieses nahm seinen Anfang an einem Samstag, kurz nach Lilias drittem Geburtstag. Die Tante lärmte mit Pfannen und Tellern in der Küche herum. Der Vater tigerte durchs Zimmer, fluchte und schlug Türen zu. Und Lilia versteckte sich hinter dem durchgesessenen Sofa, drückte verängstigt eine Stoffpuppe gegen ihr Herz. Niemand sagte ihr, was los sei. Niemand bereitete sie auf das, was kommen sollte vor. Sie stolperte zu Mama-Tante in die Küche. Doch diese stieß sie von sich, als sei sie selbst das zukünftige Opfer und nicht Lilia, die diese Rolle noch gar nicht kannte. Untröstlich und ungetröstet duckte sich Lilia wimmernd hinter den Ofen.
Gegen vier Uhr klingelte es. Der Vater trampelte in den Flur hinaus um aufzuschließen. Das Haus hörte auf zu atmen. Kein Laut ließ sich hören. Nach einigen Augenblicken betrat der Vater die Stube, gefolgt von einer Frau, die Lilia fremd war. Dass sie keine gewöhnliche Besucherin sei, witterte Lilia. Wie ein getretener Hund verkroch sie sich hinter Vaters Beinen, der die Frau bat, auf einem Stuhl am Esstisch Platz zu nehmen. Er selbst saß auf dem Sofa. Mama-Tante hielt sich in der Küche still. Niemand sprach. Lilia zitterte. Der Vater packte sie am Arm und stieß sie, Widerstand nicht duldend, der Frau in die ausgestreckten Hände. Lilia, steif vor Schreck, schob die Hände zurück. „Na komm schon, sei lieb zu der Frau“, rügte der Vater. Der Boden unter Lilias Füssen wich. Und niemand half. Was machte man mit ihr? Lilia schrie nicht. Weinte nicht. Sie atmete nur schwer. Von Angst wie gelähmt. Die Frau, die sich langsam fing, sagte leise Worte, die Lilia nicht verstand, besänftigende Worte. Und wieder schubste der Vater ihr Lilia zu. Und Lilia funktionierte. Ließ sich ziehen. Sachte umarmen, kalt wie Eis. Willenlos. Für die Erwachsenen die gleiche Tortur. Szenen nie gelernt. Nie geprobt. Zerrissenes Leben. Nicht mehr gut zu machen.
Der Vater, Mama-Tante und Lilia veränderten sich von da an, kaum spürbar und doch stetig, so als ziehe Nebel auf, der sie allmählich verschlang.
Der Vater, oft übellaunig, griff Mama-Tante an. Oben an der Treppe stehend, spottete er über ihren Gesang. Zugegeben, er war nicht gekonnt, kam einfach von Herzen. Mama-Tante liebte Volkslieder und gehörte einer Trachtengruppe an. Hin und wieder lud sie Freundinnen ein und sang mit ihnen. Bei einigen klang das gut. Sie jodelten sogar. Noch bevor die Frauen erschienen, entfloh der Vater, Gift und Galle speiend, drohend, er werde Mama-Tante kündigen. Für Lilia ein Schrecken ohnegleichen. Ohne Mama-Tante wäre sie verloren. Mama-Tante war Mutter und Zufluchtsort. Ihr vertraute sie blind. Auf sie war Verlass. Auch wenn alle anderen Stricke rissen.
Leid tat sich Lilia nicht. Sie fragte sich nur: „Was tun zum Überleben?“ Woher die Kraft, woher das Wissen nehmen? Instinktiv griff Lilia zum Gebet, beschwor die Gottesmutter, die als Frau am ehesten Rat wusste. Und auch die Heiligen spannte sie ein. Gebete breit abzustützen war das Gebot der Stunde. Lilia ging nun in die erste Klasse: Nicht allzu gern. Denn wer wusste schon, was inzwischen zu Hause geschah. Und sie war nicht vor Ort, war ohne Kontrolle. Lilia träumte sich durch die Stunden. Schaute aus dem Fenster. Leere im Innern. Zu groß war die Sorge. Zu erdrückend die Angst, um dem Unterricht zu folgen.
Das Rechnen blieb eine Plage für Lilia. Das kränkte den Vater über die Massen. Wer nicht rechnen konnte, war kein richtiger Mensch. Er versuchte es mit Drill. Lilia kauerte auf dem Teppich vor seinem Bett. Der Vater rechnete vor. Immer wieder. Lilia hob flehend den Blick, in blanker Furcht. Der Vater machte Druck. Lilia schrumpfte. Sie konnte so nicht. Doch der Vater konnte nicht anders. Schimpfend jagte er Lilia weg. O wäre sie ein Bub! Kein solch verhuschtes Ding. Und immer diese Tränen! Er hielt das nicht aus.
Lilia verkroch sich heulend unter die Decke. Mama-Tante brachte Wasser mit Tropfen zum Trinken. Lilia wurde still im warmen Bau. Roch sich, eingerollt wie ein Tier. Trost im Horchen nach innen suchend. Außen tat alles weh.
Alle drei Monate holte die Fremde Lilia nun ab, um mit ihr in den Zoo zu gehen. Da Lilia sie nicht mochte, setzte das schon am Vorabend heftige Szenen ab. Lilia schrie zum Steinerweichen. Mama-Tante trotzte. Der Vater tobte. „Immer diese Weiber mit ihrem Gezeter! Könnt ihr nicht nüchtern überlegen? Was ist schon dabei. Stell dich doch nicht so an, Lilia. Geh einfach mit und nimm das Geschenk, das sie dir gibt.“ In der Tat brachte die Fremde Lilia immer ein Geschenk: mal eine Puppe, mal einen Teddy, mal Handschuhe, Schal und Kappe - eher billige Geschenke, die nicht lange hielten. Entsprechend Lilias Wohnsituation vielleicht. Der Zoobesuch fand bei jedem Wetter statt, auch wenn sie praktisch als Einzige den Gehegen und Käfigen entlang streunten. Die Fremde gab sich Mühe, Lilia aufzumuntern. Sie solle von sich erzählen, bettelte sie, von der Schule, wie es ihr gehe, was sie möge. Lilia blieb meistens stumm. Erzählte sie dennoch, rief das bei der Fremden solche Euphorie hervor, dass sie Lilia in die Arme riss und zu küssen versuchte, wovor es Lilia grauste. Sie wehrte sich verzweifelt, stieß die Fremde zurück, schlug sie, wenn die sie nicht freiwillig losließ - zwei Wesen. Zwei Welten. Wie Tag und Nacht. Und keine Brücke dazwischen.
Und immer noch redete der Vater nicht mit Lilia, ließ sie im Dunkeln über ihre und seine Situation, wartete ab. Hilflos. Wütend: auf sich selbst - auf Lilia - auf die Welt. In welches Schlamassel war er ohne Schuld geraten. Er hatte es doch gut gemeint. Auch mit Lilia. Sogar mit seiner Frau. Ein Verbrecher war er jedenfalls nicht.
Mittags aßen Lilia und die Frau, die so gar nicht zu ihr zu passen schien, im Restaurant des Zoos, und Lilia konnte sich ihre Leibspeise aussuchen: Ravioli oder Spaghetti mit Tomatensauce. Beim Dessert: bei Kompott oder Eis - aber nur an warmen Tagen - durfte Lilia ihr Geschenk betrachten. Und auch wenn es ihr nicht besonders gefiel, bedankte sie sich ordentlich. Der Vater hatte ihr eingebläut: „Mach ja nicht, dass ich mich für dich schämen muss.“
Nach der Geschenkübergabe hielt Lilia nichts mehr im Zoo. „Ich will heim“, quengelte sie, obwohl sich die Fremde Mühe gab, Lilia für die Affen, die sie noch nicht besucht hatten, oder für die Bären und die Giraffen zu begeistern. Lilias Lieblingstiere sparte sie für den Nachmittag auf, um Lilia zurückzuhalten. Sie litt wie Lilia litt. Doch das kümmerte Lilia nicht, denn die Fremde war in ihren Augen böse, da sie Lilia zwang, mit ihr mitzugehen. Lilia hatte von des Vaters Verhalten Mama-Tante gegenüber gelernt. Zwar traktierte sie die Fremde nicht mit Schimpfwörtern, wie er die Tante. Lilia vergällte ihr nur den Tag. Mies fühlen sollte sie sich. So wie Lilia sich mies fühlte. Sich nicht an ihr freuen, sondern spüren, dass Lilia sie nicht wollte. Sie nicht riechen. Und schon gar nicht umarmen konnte. Absichtlich verletzte sie die Frau. Absichtlich trat sie sie. Nicht etwa aus Versehen.
Und dann eröffnete der Vater Lilia, sie verbringe von nun an die Frühlings-, die Herbst- und die Weihnachtsferien bei der Fremden. Er malte ihr aus, wie schön es dort sei, dass die Frau Geld habe und Lilia verwöhne. Doch Lilia weinte schon, hörte gar nicht hin. Bei der Erwähnung, sie müsse zur Fremden nach Hause, stürzte das im Verborgenen mehr und mehr gewachsene Elend über ihr zusammen wie ein himmelhoher Turm, der sie unter sich begrub. Sie hustete. Würgte. Rang nach Luft. Mama-Tante rannte um die Tropfen. Der Vater ohrfeigte Lilia, um sie zu Verstand zu bringen. Es half alles nichts. Nun war es aus. Die Hölle tat sich vor Lilia auf. Hass auf das Leben. Hass auf die Fremde. Hass auf den Vater. Ströme von Verzweiflung und Verrat. Chancenlos abgeschoben. Nie geliebt. Nur feilgeboten: ihr Drachenherz ertrank in Blut.
Natürlich blieb Lilia keine Wahl. Das Gesetz hatte entschieden. Die Annullation der Ehe war nach sieben Jahren Fakt. Und den Preis dafür bezahlte Lilia.
In der Bahnhofshalle hielt der Vater Lilia an der Hand. Es zog. Lilia trug ihren Mantel mit dem kuscheligen Pelzkragen, in den sie wie zum Schutz das Gesicht barg. Draußen regnete es.
Neben dem Vater auf dem Boden stand Lilias Koffer. Zwei Kleider, Wäsche, ihren abgewetzten Lieblingsteddy, ohne den sie nicht einschlafen konnte, Seife und Zahnbürste: Mehr enthielt er nicht. Sie warteten seit einer Viertelstunde. Die Fremde sah Lilia nicht herankommen, da sie zu Boden starrte, stumm, in ihren Schuhen steckend, als habe sie keine Füße, als hänge sie im Nichts. Sei nur Schrei. Im Tonlosen erstickt. Die Fremde hielt an, griff nach Lilias Koffer, nach Lilias freier Hand, riss daran. Lilia ließ den Vater los, stolperte von ihm weg. Er schaute sich nicht um, entfernte sich mit hastigem Schritt. Kein Laut fiel.
Im Zug saß Lilia bleich auf ihrem Platz, wie ein Stück Eis. Die Fremde versuchte ein Gespräch, erzählte von Oma und Opa, vom Hund. Beim Wort „Hund“ hob Lilia den Kopf. Ein Hund! Der Wunschtraum ihres Lebens. Nie hatte sie einen haben dürfen. Immer hieß es: „Dann pflegst du ihn zwei Wochen lang, und hinterher müssen wir uns um ihn kümmern.“ Doch so war Lilia nicht. Auf einen Hund wäre Verlass gewesen. Auf Lilia wäre Verlass gewesen. Nichts hätte sie trennen können. Er hätte bei ihr im Bett geschlafen. Ein Hund war Gesprächsstoff, der Lilia weckte. Sie erzählte ihren Traum und fieberte dem Kommenden entgegen.
Der Dackel empfing sie, ekstatisch um sie herumtanzend. Die Fremde sagte, sie habe ihm von Lilia erzählt, und er erkenne sie. Lilia war selig. Den Hund auf dem Schoss, saß sie auf den Gartenplatten, bis Oma in der Tür erschien und fragte, warum sie nicht ins Haus kämen, Kuchen und Tee stünden bereit.
Es wurde Abend, und die Frau ließ für Lilia ein Bad einlaufen. Zuhause badete Lilia im Keller, in der Waschküche, einmal die Woche, am Samstag. Schon am Nachmittag feuerte Mama-Tante den Wäschehafen ein, und von dort lief das Wasser in die Wanne, die sich hinter einer Backsteinwand befand. Lilia badete zuerst, wenn das Wasser noch beinahe kochte. Sie streckte eine Zehe hinein und zog sie erschreckt wieder zurück. Mama-Tante rief aus dem Flur, sie solle sich beeilen, der Vater wolle auch ins Wasser und sie dann zuletzt. Lilia wirbelte das Wasser mit der hölzernen Kelle, die zum Herauswuchten der Wäsche aus dem Hafen diente durcheinander, bis sie dessen Hitze ertrug, kletterte steif in die Wanne, damit das Wasser nicht an ihren Beinen hochschlabberte und seifte sich ab, sich an Mama-Tantes Mahnung erinnernd, dabei nur ja nicht Pipi zu machen. Lange blieb Lilia nicht in der Wanne.
Als sie ihr entstieg, war ihre Haut krebsrot und dampfte wie eine gekochte Kartoffel. Bevor sie zu zittern begann, schlug sich Lilia das bereitliegende Badetuch um Schultern und Bauch, eilte mit klatschenden Pantoffeln durch den finsteren Kohlenkeller - immer in Furcht vor Gespenstern, die nach ihr grapschen könnten - die hölzerne Treppe hoch, durch den eisigen Flur und in die Stube, wo Mama-Tante sie trockenrubbelte. Im Bett schwitzte Lilia genüsslich nach. Folgte sinnend den Tropfen, die über ihre Stirn und den Rücken rannen, stolz darauf, Gespenstern und anderen Bösewichten entronnen zu sein und wickelte sich ins schützende Nachthemd wie in einen Kokon.
Im Badezimmer von Oma und Opa kam das Wasser aus einem Boiler und war vergleichsweise kühl. Die Fremde, die Lilia „Du“ nannte, kontrollierte seine Temperatur mit einem Thermometer in Form eines hölzernen Bootes. Das Wasser dürfe nicht mehr als fünfunddreissig Grad heiß sein, das sei für Kinder genug, dozierte sie. Lilia fröstelte in dieser Lauheit, doch mehr Wärme wurde ihr nicht erlaubt. Sie musste sich von Kopf bis Fuß von der Frau einseifen lassen, sich auf den Bauch legen, die Hand der Frau unter ihrem Kinn und schwimmen. Wobei putzige gelbe Entchen und kleine Fische neben ihr herschaukelten.
Schwimmen konnte Lilia seitdem sie sieben Jahre alt war. Der Vater hatte es sie gelehrt, während Ferien, die sie an einem See, zusammen mit Freunden des Vaters verbrachten. Lilia hatte sich geziert, gezappelt und zuletzt in Panik um sich geschlagen, obwohl sie sich an den Flanken des Vaters, der unter ihr schwamm, festhalten durfte. Gurgelnd, spuckend und keuchend, klammerte sie sich wie ein Polyp an ihn. Nach einigen Versuchen, während denen der Zorn des Vaters eskalierte, hob er sie mit einem Ruck hoch und warf sie ohne Vorwarnung ins Wasser. „Da schwimm oder ersauf“, schimpfte er, und Lilia erschrak dermaßen, dass sie wild zu paddeln begann und plötzlich richtig schwamm, zum Stolz des Vaters, der die Geschichte jedem der wollte - oder auch nicht - erzählte, wobei sich auch Lilias Brust vor Begeisterung blähte.
Mit der Frau zu schwimmen, genierte sich Lilia. Sie schämte sich, nackt vor ihr auf dem Bauch liegen zu müssen. Zu viel Nähe. Zu viel Intimität wurde Lilia in zu kurzer Zeit abgerungen. Sie war weit davon entfernt, der Frau zu vertrauen. Lilia war daran gewöhnt, allein zu baden, ihren Körper für sich zu haben. Weder der Vater noch Mama-Tante hätten sie je so angefasst wie die Fremde, die sich benahm, als gehöre Lilia ihr. Jede Faser in Lilia sträubte sich gegen den Zugriff der Frau. Die ließ sich nicht beirren, zog Lilia aus der Wanne, als tue sie das seit Jahr und Tag, setzte sie sich auf die Knie und trocknete jeden Fleck an ihrem Körper. Spähte sie aus, als suche sie schadhafte Stellen an ihr, Stellen von Räude oder Schorf etwa. Und zog ihr zuletzt ein blaues Nachthemd mit farbigen Punkten über den Kopf, dabei trällernd und Lilia neckend, kitzelnd und herzend wie einen Säugling. Entweder nahm die Frau Lilias verängstigte Abwehr nicht wahr oder negierte sie absichtlich. Lilia kam sich vor wie ein Straßenköter, den man mit aufgezwungener Fürsorge innert kürzester Zeit domestizieren will.
Die Kleider, in denen Lilia angereist war sowie ihren Koffer samt Inhalt, hatte die Frau bereits an sich genommen und in einen Schrank geschlossen. Auch den alten Teddy, Lilias kostbarsten Besitz - mit dem Hinweis, ihre Sachen seien nicht sauber. Und auch Lilia rieche schlecht. Offensichtlich vernachlässige der Vater sie. Sie bekomme ihr Zeug erst wieder, bevor sie abreise. Es waren Worte, die Lilia zuerst nicht erreichten, Worte, wie sie sie nie zuvor gehört hatte. Nie hätte Mama-Tante etwas dergleichen zu ihr gesagt, sowenig wie der Vater, auch wenn er wütend auf sie gewesen wäre. Lilia stand da, ohne sich zu rühren. Stand neben der Frau wie nicht bei sich. In ihrem Körper taten die Worte unheimlich weh, obwohl sie ihre Bedeutung nicht verstand. Sie verdrückte eine Träne, wie um Platz zu machen in sich drin. Den Schmerz in Fluss zu bringen. Zu weinen getraute sie sich nicht. Der Vater hatte ihr eingeschärft, tapfer zu sein, weil er sonst die Konsequenzen tragen müsse. Sei sie nicht brav, kriege er vom Anwalt der Frau einen schlimmen Brief. Und das wollte Lilia auf keinen Fall, denn es würde den Krieg zuhause nur anheizen. Wenn sie nur wüsste, welche Rolle die Frau in ihrem Leben spielte. Warum musste sie zu ihr? Und warum durfte sie so mit Lilia umspringen?
Wie in Trance ließ sich Lilia ins Zimmer führen. Die Frau setzte sich auf den Rand ihres Bettes und versuchte, Lilia an sich zu ziehen, denn sie wolle mit ihr beten. Mit beiden Händen umschloss sie Lilias Hände und forderte sie auf, das Vaterunser aufzusagen. Lilia blieb stumm. Finstere Leere im Kopf. Verschüchtert suchte sie sich der Frau zu entwinden. Die ließ sie nicht los. Lilia befreite sich mit Gewalt. Trat die Frau. Boxte sie in den Bauch - und erschrak ob dessen Weichheit. Es graute ihr vor diesem Fleisch, das sie in sich hineinzuzwingen versuchte. Gerangel. Keuchen. Lilia schwitzte vor Anstrengung. Doch die Frau gewann. „Für deine Bosheit wird dich der Herrgott bestrafen“, schalt sie Lilia, die in der Falle saß - in bebender Angst vor der Frau. In bebender Angst vor dem Vater. Den Folgen.
Lilia schlotterte. Die Frau ließ von ihr ab, aufs Äußerste verstimmt und gleichzeitig zutiefst gekränkt, weil ihre Liebe zum Kind, das man ihr vor bald einem Jahrzehnt heimtückisch gestohlen hatte, so bitter missachtet wurde. Wie hatte sie sich auf Lilias Besuch gefreut. Wie viel Kampf und Geld hatte es sie gekostet, dem Gericht die Erlaubnis dafür abzuringen. Und nun verweigerte ihr das undankbare Geschöpf den erkämpften Sieg. „Du bist ein ganz, ganz böses Mädchen“, stammelte sie, Worte, die wie Ohrfeigen auf Lilia hinunterprasselten.
Lilia lag lange wach, nachdem die Frau aus dem Zimmer gelaufen war, flehte zur Muttergottes um Vergebung für ihr sündiges Verhalten, ohne zu erfassen, worin es bestand. Der Schlaf wollte nicht kommen, obwohl sie sich kaum rühren konnte vor Erschöpfung. Ihren Tränen ließ sie freien Lauf. Das Heimweh schüttelte sie durch und durch. Hätte der Vater sie weggeschickt, hätte er gewusst, wie übel man ihr mitspielte? Hätte er das getan? Lilia getraute sich nicht, sich die Antwort auf diese Frage auszudenken.
Am Morgen betrat die Frau ohne anzuklopfen Lilias Zimmer. Lilia, sofort hellwach, kroch blitzschnell in den entferntesten Winkel des Bettes, hoffend, dort könne sie die Frau nicht erreichen. Doch sie täuschte sich. Wieder fiel die Frau über sie her, zurückhaltender zwar, doch immer noch auf eine Art, die Lilia kränkte.
Mama-Tante umarmte Lilia auch, aber liebevoll, nicht so, als habe sie ein Recht auf sie. Mama-Tantes Umarmungen waren herzlich, ohne Lilia zu vergewaltigen. Mama-Tantes Nähe ließ Lilia freiwillig zu, weil sie sie liebte. Weil sie einander liebten. Es bedeutete Glück, einander zu umarmen, wenn man einander liebte. Lilia hätte am liebsten losgeheult. In ihrer Lage zu sein, ohne zu wissen warum, war kaum auszuhalten. Doch sie riss sich zusammen. Unten wartete der Hund. Wartete Oma. Das würde ihr helfen, die verbleibenden Tage zu überstehen. Ein Schimmer Hoffnung durchzuckte Lilias Gemüt.
Im Schrank in Lilias Zimmer hingen Kleider, die die Mutter für sie gekauft hatte, keine selbstgenähten oder selbstgestrickten, wie sie Lilia zuhause trug. Alle, von der Unterwäsche über Blusen, Röcke, bis zu Schuhen, Strümpfen, Überschürzen und Mänteln waren neu und richtig teuer, so teuer, wie sie Lilia nie besessen hatte. Die sollte sie anziehen, bestimmte die Frau. Lilia kamen die Kleider so fremd vor wie die Frau, die sie für sie ausgesucht hatte. Schweigend kleidete sie sich damit an. Mit nach Hause nehmen dürfe sie die Kleider allerdings nicht, erklärte die Frau. Sie blieben bei ihr zurück, bis Lilia wiederkomme. „Dann sind sie vielleicht schon zu klein“, stellte Lilia nüchtern fest. „Das macht nichts: Dann holen wir einfach neue“, entschied die Frau. Wieder verstand Lilia nichts.
Während des Frühstücks, zu dem Hörnchen und weiße Brötchen gereicht wurden, gehörte Lilias ganze Aufmerksamkeit dem Hund. Zu ihrem Entzücken machte er Männchen neben ihrem Stuhl, und Oma erlaubte ihr, ihm von ihrem Brötchen ein Stückchen abzugeben. Griff Oma selbst nach Brötchen, nach der Kaffeetasse, oder nach sonst etwas, war die Frau sofort zur Stelle, um Omas weiten, seidenen Ärmel zu retten. Er hätte sonst bekleckert werden oder sich an etwas festhaken können. Bei Tisch waren solche Handreichungen die Hauptaufgabe der Frau. Oma präsidierte den Tisch, und die Frau saß ihr zur Rechten, gegenüber Lilias ledigem Onkel, mit dem Lilia umgehend Freundschaft schloss. In seinem braunen Anzug, mit den buschigen Brauen über den tiefliegenden Augen und dem wuscheligen Haar, erschien er Lilia wie Rübezahl. Nicht weil sie ihn hässlich fand, sondern weil er sich in ihren Augen irgendwie verdreht und verknotet anfühlte. Sie mochte ihn auf Anhieb. Er foppte sie und machte Späße, und Lilia vergaß die Frau an ihrer Seite, wurde Kind, war froh darüber, dass der Onkel nichts von ihr forderte. Daran gewöhnt, in Extremen zu leben, entwickelte Lilia Übung darin, Gefühle und Gedanken im Handumdrehen zu wechseln. Sie musste schnell sein. In ihrer Situation konnte sie sich Trägheit nicht erlauben. Punktgenau musste sie reagieren, auf Schmerz, auf Freude, sofort. Sie durfte sich davon nicht überrollen lassen. Das machte Lilia wendig. Springlebendig. Wenn auch stets aufs Äußerste gespannt. Wachsam wie ein Tier. Gefahr sofort witternd. Schlug ihr Drachenherz auch wild, unterkriegen ließ es sich nicht. Kraft machte es frei. Rettete es aus jedem noch so tiefen Weh. Herzklein der Punkt, dem die Kraft entspross. Doch äußerst präsent.
Der Tag verging. Der Abend kam. Lilia legte sich eine Strategie zurecht. Um das Kopfende ihres Bettes stand eine spanische Wand aus Holzrahmen und Stoffbahnen. Lilia zog die Wand nach vorn, sodass der eine Flügel vor das Bett zu stehen kam. Mit einer Schnur, die sie Oma abgeluchst hatte, befestigte sie den Bettüberwurf am Holzrahmen und am Nagel eines Bildes, das an der Wand über dem Bett hing. Dann kroch sie mit dem Oberkörper unter dem Überwurf hindurch, zog die Decke bis unters Kinn und lag versteckt, wie hinter zugezogenen Vorhängen. Die Frau trat ein. Stand starr. Dann hob das Donnerwetter an. Sie riss den Überwurf herunter. Schmiss ihn zur Seite. Packte Lilia und schüttelte sie, wie der Wind eine Vogelscheuche. Atemlos vor Wut warf sie sie aufs Bett und schlug die Türe hinter sich zu. Stille. Später betrat der Onkel Lilias Zimmer. Lilia gab vor zu schlafen. Der Onkel setzte sich ohne ein Wort auf die Bettkante. Nach einer Weile strich er sachte über Lilias Haar, küsste sie leicht und verschwand.
Lilias Angst vor der Frau war zu enorm, als dass sie weiterhin gewagt hätte, sich gegen ihre Zugriffe zu wehren. Auch die Frau wurde vorsichtiger. Kalter Krieg brach an. Die Parteien lagen auf der Lauer. Oma verkniff sich eine Stellungnahme. Doch Lilia spürte ihren Vorwurf, der sich wie ein gehässiges Vieh zwischen sie und Oma schob, bereit zum Sprung bei geringster Gelegenheit. Die Sinne gespitzt, bewegte sich Lilia wie auf rohen Eiern durch den Tag - der sie wie schlieriger, giftiger Nebel enger und enger einzukapseln drohte. Gegen Abend schlich sie sich zu Oma, die, ohne den Blick zu heben, verbissen an einer Leintuchspitze häkelte, den schnarchenden Dackel auf dem Schemel zu ihren Füssen. Lilia schob den Dackel beiseite. Er plumpste vom Schemel, rollte sich zusammen und schnarchte weiter. Statt seiner hockte sich Lilia auf den Schemel, streichelte Omas Füße und legte den Kopf auf ihr Knie. Oma ließ die Häkelarbeit sinken und strich über Lilias zerzausten Pony. Lilia sprang auf, schlang die Arme um Omas Hals, barg ihre heiße Stirn in ihrem Kleid und schluchzte. Oma hielt still, bis sich Lilia beruhigte, schob sie zur Seite und hielt ihr eine ihrer stets griffbereiten Pralinen an die Lippen. Sie schauten einander an, Omas Augen voller Liebe, Lilias Augen tränenverschmiert und voller Zweifel. Unlösbares trennte sie, und verband sie zugleich. Sie gehörten zusammen, und doch schien die Kluft zwischen ihnen unüberbrückbar.
An einem der nächsten Nachmittage fuhren Lilia, Oma und die Frau zu Verwandten, bei denen Lilia zum ersten Mal ihren Kusinen begegnete, eine davon in ihrem Alter. In einem Zimmer im Obergeschoss, das sich über die halbe Grundfläche des Hauses erstreckte und kaum möbliert war, spielten die Kinder miteinander Ball. Lilia ließ ihrem Temperament freien Lauf. Die Mädchen johlten und polterten, bis die Mutter der Kusine den Kopf zur Türe hereinstreckte und vorsichtig fragte, ob es ihnen gut gehe und sie Spaß hätten. „O ja, sehr“, rief Lilia, so laut, dass die Frau im unteren Stockwerk es hören musste, ob sie wollte oder nicht.
Lilias Ferien gingen zu Ende - nach zwei Wochen bitterstem Heimweh und einem mühsamen sich Eingewöhnen. Bevor die Frau mit Lilia zum Bahnhof fuhr, zog sie Lilia an sich und sagte: „Und von jetzt an wirst du mich „Mama“ nennen. Ich will das so. Hast du verstanden?“ Eine Erklärung folgte nicht. Da war es wieder, das alles durchdringende Entsetzen, das Lilia den Atem raubte. Sie befreite sich aus der Umarmung der Frau, an die sie aus unbekanntem Grund ein unentwirrbares, Lilia bis aufs Blut strangulierendes Netz fesselte. Nach herzlichem Abschied von Oma und Opa und versteckten Tränen vom Dackel, saß Lilia voller Trotz bocksteif im Taxi, bereit sie zu beißen, sollte die Frau sie auch nur streifen.
Am Bahnhof wartete der Vater auf Lilia. Die Frau stellte, wieder ohne ihn anzuschauen, Lilias Koffer neben seine Füße und ging steifbeinig über den Bahnsteig davon, angestrengt darauf bedacht, weder zu straucheln noch sich umzudrehen. Lilia wusste, dass es ihr das Herz zerriss, sie wieder abgeben zu müssen – und das ohne Gruß und ohne Händedruck. Lilia sah es deutlich, dass es der Frau das Herz zerriss. Doch Mitleid oder sonst eine Regung von Sympathie konnte sie nicht aufbringen. Dafür fühlte sie sich zu tief verwundet.
Im Tram erzählte Lilia kleinlaut, was die Frau von ihr verlangt habe. „Aber ich kann sie doch nicht „Mama“ nennen. Mama-Tante ist doch meine Mama“, stöhnte Lilia. „Nein“, antwortete der Vater, „das ist sie nicht. Das habe ich dir gesagt. Ich habe dir sogar mehr als einmal gesagt, sie sei nur deine Tante.“ „Aber wie kann das sein“, schluchzte es in Lilia, doch sie getraute sich nicht, zu fragen. Zu sehr fürchtete sie des Vaters Zorn. Der erkannte, dass es eine Stellungnahme brauchte. Nicht wissend, was erwidern, donnerte er los: „Dann nenne sie halt „Mama“. Das kostet dich doch nichts. Und wenn es sie freut…. Gib dir halt einen Ruck. Du bist doch ein großes Mädchen.“ Lilias Freude über das Nachhausekommen war dahin. Der Glaube. Die Hoffnung. Und die Zuversicht, ein Zuhause überhaupt zu haben, zerbrachen jäh. Und von da an zerbrach auch jegliches Einvernehmen zwischen dem Vater und Mama-Tante.
Mama-Tante bewohnte das Giebelzimmer im zweiten Stock des Hauses, ein geräumiges Zimmer, in dem sogar ein kleiner Ofen stand. Es lag gleich neben dem Estrich, der das Holz für den Winter verwahrte. Seitdem Krieg herrschte zwischen dem Vater und Mama-Tante, stand der Tisch, den Mama-Tante von ihrer früh verstorbenen Mutter geerbt hatte, in ihrem Schlafzimmer. Vorher schmückte er die Stube. Das Jugendstilklavier, das, meistens verstimmt, ebenfalls die Stube wohnlicher gestaltet hatte, verkaufte Mama-Tante. Zudem trug sie den orientalischen Teppich aus der Stube zu sich hinauf. Als Ersatz dienten nun der angeschlagene Küchentisch und ein schäbiger Teppich aus zweiter Hand, mit zum Teil ausgefransten Kanten.
Von da an verging kaum ein Tag, an dem der Vater und Mama-Tante nicht aneinander gerieten. Mama-Tante sang demonstrativ zur Hausarbeit. Der Vater verspottete sie demonstrativ. Doch nicht mehr nur vom Treppenabsatz aus, sondern indem er drohte, sie zum Teufel zu jagen. Gelegentlich rutschte ihm die Hand aus. Dann hieben der Vater und Mama-Tante aufeinander ein, als gehe es ums Töten. Blanker Hass trieb sie an. Ein Machtkampf wie zwischen scharfgemachten Kampfhähnen. Der heiße Inhalt der Kaffeetasse flog Mama-Tante ins Gesicht. Sie antwortete darauf, indem sie dem Vater die Schüssel mit Kartoffeln nachwarf. Ob dem Ringen und Umsichschlagen vergaßen sie ihre Umgebung. Vergaßen Lilia, die sich, nach anfänglicher Erstarrung, zwischen ihre Beine gedrängt hatte und sie zu trennen versuchte - dabei getreten wurde und ebenfalls Hiebe einfing - bis sie losbrüllte, was das Zeug hielt und den Vater und Mama-Tante damit zur Vernunft brachte, so dass sie voneinander abließen - nicht ohne dass der Vater Mama-Tante eine weitere Ohrfeige verpasste. Der Vater machte auf dem Absatz kehrt, und Mama-Tante drückte Lilia gegen ihren Bauch. Schniefend. Ausgerissene Haare auf den Schultern. Mit rotem Gesicht und Kaffeeflecken auf dem Kleid.
Lilia weinte hemmungslos. Sie war im Sommer neun geworden. „Geh, lauf zum Pfarrer. Wir brauchen dringend Hilfe, irgendjemand muss doch was tun können“, stöhnte Mama-Tante. Und Lilia rannte los wie auf Knopfdruck, blind vor Tränen - rannte, als verfolge sie der Leibhaftige. Bevor sie am Pfarrhaus läutete, wischte sie sich am Taschentuch mit den Glückskäferchen, das ihr der Vater nach ihrer Heimkehr von der Mutter als Trost geschenkt hatte, das Gesicht trocken, schaute sich scheu um, ob jemand sie dabei beobachte und getraute sich erst dann, die Klingel zu bedienen. Zeugen ihrer Schmach konnte sie nicht gebrauchen. Sie schämte sich auch so schon tief genug.
Der Pfarrer, ein liebenswürdiger, ruhiger Mann, mit breitem Gesicht und blühenden Wangen, behäbigem Umfang, Wohlwollen ausstrahlend, um die Vierzig herum, ließ sie eintreten und im Besprechungszimmer Platz nehmen. Sie hörte ihn die Haushälterin um einen Tee für Lilia bitten. Lilia wurde gewahr, wo sie sich befand. Ihre Tränen waren versiegt, und sie konnte wieder normal denken. Im Zimmer war es angenehm warm, die Einrichtung so unauffällig wie der Pfarrer selbst. Und Lilia erinnerte sich daran, was sie hergetrieben hatte, erinnerte sich an jede Einzelheit, an das Klatschen der Schläge, das Scheppern zerberstenden Geschirrs, das Stampfen und Raufen. Und verglich es mit der Durchschnittlichkeit, in der sie gelandet war, fragte sich, ob das wirklich der richtige Ort sei, um ihr Anliegen vorzubringen. Da jedoch eine Erklärung von ihrer Seite gefordert schien, stotterte sie, als der Pfarrer sich neben sie setzte: „Mama-Tante hat gesagt, sie müssten uns helfen, der Vater schlage sie sonst tot.“
Während des Rennens war sie sich ihrer Mission sicher gewesen. Nun zweifelte sie an der Kompetenz des Ortes. Zwar kannte der Pfarrer ihre zerrütteten Verhältnisse. Nur: war er wirklich die richtige Person um ihnen zu helfen? Er war sanft, gütig und verständnisvoll, und die Kinder liebten ihn. Doch besaß er genügend Kraft? Er war ja nur ein Pfarrer, nicht einmal verheiratet und ohne Kinder. Was konnte so einer schon ausrichten?
Der Pfarrer schaute Lilia sorgenvoll an, betrachtete nachdenklich ihr zerzaustes Haar, den abgerissenen Träger ihrer Schürze, deren Latz herunterhing und die rot angelaufene Schramme auf ihrem Handrücken. Lilia druckste herum. Erzählte Bruchstücke. Hielt inne. Seufzte. Dachte nach. Die Stirne gekraust. Die Augen bittend auf den Pfarrer gerichtet. Sie wusste, der Vater würde des Pfarrers mögliche Intervention keinesfalls billigen, ihn schnurstracks aus dem Haus werfen und mit der Polizei drohen. Im Zorn war nicht mit ihm zu spaßen. Im Zorn vergaß er sich selbst.
Innehaltend. Überlegend. Sich wiederholend. Kleinlaut, sich wegwünschend, hockte Lilia auf dem Stuhl. Was tat sie hier? Und was geschah zuhause? Vielleicht lebte Mama-Tante schon nicht mehr: Ein Gedanke, der Panikfeuer durch ihre Adern jagte. Sie hätte Mama-Tante nicht alleinlassen dürfen. Sie allein traf die Schuld, wenn Mama-Tante etwas zustieß - eine Last an Verantwortung, die sie fast ohnmächtig werden ließ. Und ihr gleichzeitig klarmachte, wie hilf- und machtlos sie war. Rannte sie doch gegen die herrschenden Umstände an wie gegen turmhohe Riesen, an deren fettem Übermaß sie nur scheitern konnte.
Hoffnungslos schluchzend fiel Lilia in sich zusammen. Der Pfarrer trat hinter sie, streichelte ihre nasse Wange und tröstete: „Du musst jetzt ganz, ganz stark und tapfer sein und fest zum Herrgott beten, dann hilft er euch gewiss.“ Entsetzt schaute Lilia zum Pfarrer auf. Welch salbungsvolles Geschwätz! Welche Feigheit!. Sie war doch kein Säugling. Mit ihr konnte man doch erwachsen reden. Solch ein Herrgott konnte ihr gestohlen bleiben!
Lilia ließ Tee und Pfarrer stehen und rannte weg, fort, nur fort von dem verlogenen Ort. Zwar betete Lilia auch weiterhin. Doch dem Pfarrer ging sie aus dem Weg. Ihre Enttäuschung über seine Unbeholfenheit saß zu tief. Den Glauben an die Allmacht der Kirche verlor Lilia. Auch diejenige an Gottes Barmherzigkeit. Ihre Gebete richteten sich zwar immer noch an Gott: nun jedoch an einen Kämpfergott. Einen Gott der Starken, die forderten und nicht vor ihm zu Kreuze krochen.
Jeden Freitag schob eine schwarzgekleidete Frau ihren Gemüsekarren durch die Straße, in der Lilia wohnte. Sie war alt, humpelte, den Rücken krumm, auf gichtigen Beinen. In elsässischem Singsang pries sie ihre Waren an, aus leuchtenden Augen über faltigen Wangen, mit fast zahnlosem Mund und kehligem Lachen. Die gute Hexe aus dem Märchenbuch: Kindern, Tieren und Menschen wohlgesinnt. Hausfrauen mit Einkaufstaschen strömten herbei und inspizierten ihren Karren. Einen flachen Handwagen auf Eisenkufen, der viel zu schwer war, um ihn durch Stunden um Stunden über endlose Straßen zu schieben. Im Herbst brachte die Elsässerin Bottiche voller Hagebuttenmost, die die Mütter mit Zucker zu Konfitüre verkochten. Im Winter eingelagertes Wurzelgemüse, aus dem Mama-Tante Eintopf sott. Die Elsässerin bot auch Fleisch dazu an. Und Flaschen mit Sirup. Säcke voller Nüsse, die zu Butterbrot schmeckten. Dazu runzlige Äpfel für Kuchen und Kompott. Verschiedene Tees und dicke, goldgelbe, im Holzofen gebackene Zöpfe.
Ihr Angebot wechselte gemäß den Jahreszeiten, doch die Frau selbst blieb sich stets gleich. Sie bekam Kaffee angeboten oder Schnaps zum Aufwärmen. Dankbare Frauen steckten ihr einen Extrabatzen zu, doch sie nahm nie etwas. Von ansteckender Fröhlichkeit, robust und voller Würde stapfte sie klaglos von Haus zu Haus, in Hitze und Regen. Nur bei Schnee kam sie nicht. Dann fehlte etwas im Quartier. Das Frösteln hinter den tristen Mauern nahm zu. Die Sehnsucht nach Zärtlichkeit wuchs. Es war, als sei mit der Frau, die Tag um Tag durch die Straßen wanderte, ohne ein Dach über dem Kopf, auch den Bewohnern des Quartiers Geborgenheit abhanden gekommen. Manche der Bewohner darbten. Die Frau zu sehen, ihre Liebenswürdigkeit zu erfahren, ihre demütige Unbeschwertheit, machte ihnen Mut. Nimmermüde ging die Frau einher, ein Glöckchen an der Deichsel. Ohne Handschuhe. Woher nahm sie die Kraft? Die Frauen schüttelten den Kopf, senkten die Stimme wie in Ehrfurcht, wenn sie von ihr sprachen. Bewunderten, hatten sie lieb.
Es war nicht zu übersehen, dass die Elsässerin Menschenkenntnis besaß. Der Gang durch die Stadt, der Lärm, die Trams, Autos und Fahrräder. Das kräfteraubende Manövrieren des sperrigen Karrens, immer auf der Straße, da er auf kein Trottoir passte, hatte sie Weisheit gelehrt. Sie beobachtete. Lächelte. Schwieg. Was immer man zu ihr sagte, auch wenn man sie schalt, sie verwünschte: das Lächeln strahlte mühelos durch ihre faltenreiche Haut. Sie war einfach da und flößte Achtung ein. War ein Phänomen, das niemand verstand.
Solange der Vater noch Haushaltungsgeld herausrückte, aßen Lilia, Mama-Tante und er am Samstag oder Sonntag Produkte vom Karren der Elsässerin. Je mehr sein Zorn auf Mama-Tante wuchs, desto weniger Geld rückte er heraus. Dann musste Lilia ihn anbetteln. „Frag doch deine Tante. Die verdient ja genug an mir. Soll sie doch für euch bezahlen“, grollte der Vater als Antwort. Oder an sehr üblen Tagen: „Wofür soll ich Geld geben, ich esse ja längst nicht mehr mit euch.“ Das stimmte. Denn neuerdings verkroch sich der Vater lieber im Zimmer, mit kalter Wurst und Schnaps. Und an Wochenenden und anderen Feiertagen blieb er meistens ganz weg. Er sagte niemandem Bescheid, wohin er fahre. Zufälligen Bemerkungen entnahm Lilia, er sei bei Frauen. Und versuchte Lilia, ihn zurückzuhalten, drohte er gewohnheitsmäßig damit, Mama-Tante aus dem Haus zu werfen und wieder zu heiraten. Und zwar eine Frau, die ihm gefalle, auch wenn sie nicht Lilias Idealbild entspreche. Dann allerdings rastete Lilia aus.
Lilia verabscheute die Frauen ihres Vaters, die die Mutterrolle an ihr ausprobieren wollten. Sie hasste sie, bevor sie sie gesehen hatte. Manchmal musste sie, als Testperson, um dem Vater aufzuzeigen, ob eine von ihnen als Mutter tauge, auf Ausflüge mit. Dann schmollte und trotzte Lilia wie ein bockiger Esel, obwohl einige der Frauen gar nicht so übel waren, nett mit Lilia umgingen, freundlich, und dem Vater tunlichst nicht zu nahe rückten, um Lilias Angst, ihn zu verlieren, nicht aufzustören. Die eine oder andere hätte sicher eine ansprechende Mutter abgegeben. Der Vater bat die Jeweilige dann, hinter vorgehaltener Hand, um Geduld, was Lilias überempfindlicher Wachsamkeit selten entging. Er nannte Lilia ein gebranntes Kind und vertröstete die Frau auf später. Doch Lilia als wirklich gebranntes Kind, hatte die Nase voll von jeglicher Art von Frauen und zeigte es ihnen auch. Wortlos. Verbissen. Sämtliche Stacheln gesträubt, ließ sie sich weder umarmen, noch küssen, noch beschenken. Nur Mama-Tante war ihr recht. Und die wollte sie behalten. Und das um jeden Preis, auch wenn der Vater noch so sehr drohte. Sie würde um Mama-Tante kämpfen wie ein Stier.
Lilias Angst, ihren Vater an eine andere Frau zu verlieren, war enorm. Sie liebte den Vater abgöttisch und litt furchtbar darunter, dass sie ihm in mancher Hinsicht nicht genügte. Hätte sie wenigstens ordentlich rechnen können, und wäre sie weniger exaltiert, kindisch verängstigt und kratzbürstig gewesen, wie er das nannte, hätte er Lilia vielleicht ebenso lieben können wie sie ihn.
Trotz der Mühe, die sich Lilia gab, gelang es ihr nicht, diese Mängel wettzumachen. Wie auch? Der Vater sprach ja nicht mit ihr, setzte sich nicht mit ihren Anliegen, Schwierigkeiten und deren Folgen auseinander. Zumindest erschien es Lilia so. Sie fühlte sich entsetzlich allein und zutiefst schuldig. Auch böse, weil der Vater ihr das immer wieder vorwarf, jedoch nie anfügte, wie er sie denn gerne hätte, damit er sie lieben könnte. Was sie tun sollte, um in seinen Augen akzeptabler zu wirken. Sie versuchte, ihm zu gefallen, ihm zu zeigen, wie wert er ihr war. Versuchte, sich seine Anteilnahme an ihrem Geschick, an ihrer Geschichte, seine Zuneigung dadurch zu erkaufen, dass sie bewusst Dinge so sagte, wie er sie mochte. Auch wenn sie anderer Überzeugung war. Sich unterwarf. Kuschte wie ein Hund. Dass Lilia gegen die Bestimmungen der Gerichte rebellierte - sowie auch gegen des Vaters Wut und dessen Verhalten Mama-Tante gegenüber, hielt sie für normal.
Das Gefühl, nirgendwo hinzugehören, nirgendwo wirklich hineinzupassen, begleitete Lilia seit früher Kindheit. Sie war wie ein ausgesetztes Wolfsjunges, das überall fehl am Platz ist, es niemandem recht machen kann, dessen Unzähmbarkeit überall aneckt. Ihretwegen litten andere. Weil es Lilia gab. Weil sie nicht darum herumkamen, für sie zu sorgen - da sie existierte. Dass sie existierte, kam Lilia wie ein Fehler der Schöpfung vor. Zeitlebens. Und auch das Gefühl, sich selbst verleugnen zu müssen, um halbwegs akzeptiert zu werden. Und doppelt so hart zu arbeiten als andere, für ein bisschen Zuneigung, verfolgte sie jahrzehntelang und relativierte sich erst, als sie alt wurde.
Das „Ghetto“: So hieß die Genossenschaftssiedlung, in der der Vater zur Miete wohnte - das „Ghetto“ bestand aus vier Reihen von je zehn aneinandergebauten Häuschen, die eine übermannshohe Mauer zu einem Quadrat zusammenschloss. Alle Häuschen, aus Holz und bräunlichem Stein erbaut, glichen einander. Der einen Reihe gegenüber befand sich die Rückseite der nächsten, wie Reihen von Gänsen, die sich den Hintern zudrehten. Und so ähnlich verlief auch das Leben darin. Die Leute aus der einen Straße pflegten losen Kontakt mit denen aus ihrer Straße, und kaum mit denen aus der nächsten. Obwohl nahe zusammengepfercht, blieben die Parteien für sich. Quartierfeste gab es nicht. Der Name „Ghetto“, den Spötter außerhalb des Quartiers erfunden hatten, passte. Es zeigte sich trist, wirkte unwirtlich, verwahrlost. Freiwillig, so hieß es, wohne keiner dort.
In der Schule wurde Lilia deswegen gehänselt. Und obwohl sie es einmal ums andere abstritt, dort zuhause zu sein, schrien Mitschülerinnen: „Ätsch, ich hab dich doch gesehen!“
Lilia schämte sich für ihr Zuhause. Nebst ihrer Herkunft lieferte es zusätzlichen Stoff für Aggression. Vor allem Cesira, ein dickes, lautes Mädchen, das zweimal sitzen geblieben war, schon Brüste hatte, und sich enorm was darauf einbildete, hatte es auf Lilia abgesehen. „Halt’s Maul, dreckige Zigeunerin“, geiferte sie, „mein Vater hat mir gesagt, was für ein Pack ihr seid.“ „Ja, gib’s ihr“, schrien die Kameradinnen auf dem Pausenplatz. Auf dieses Zeichen hin stürzte sich Cesira auf Lilia. Und obwohl diese versuchte, sich mit vor dem Gesicht verschränkten Armen zu schützen, traktierte Cesira sie aufs Übelste. Gegen Cesiras Bärenkräfte kam Lilia nicht an. Manchmal gelang es ihr, Cesira in die Hand, mit der sie ihre Zöpfe gepackt hielt, zu beißen. Darauf folgte ein noch größerer Wutanfall ihrer Erzfeindin. Doch meistens rettete Lilia nur das Schrillen der Pausenglocke aus Cesiras Klauen. Zwar bekamen die Lehrerinnen mit, was sich zutrug, doch Lilia zu helfen, kam keiner in den Sinn. Cesiras Vater galt als rabiater Schläger, der deswegen auch schon gesessen hatte. Sich mit so einem anzulegen, schien riskant.
An Lilias Armen bluteten die Male von Cesiras schmutzigen Nägeln. Ihre sonst um den Kopf gewickelten Zöpfe hingen zerzaust über den Rücken, die Maschen zerrissen. Der Arzt bekam nach jeder Schlägerei Arbeit, denn Lilias Schrammen heilten schlecht, eiterten und hinterließen Narben. Der Vater schwieg dazu, meinte höchstens, Lilia solle weniger feige sein und sich halt wehren.
Lilia wurde auch oft höhnisch gefragt, was sie denn zum Mittagessen bekommen habe. Sie selbst hätten Hähnchen gehabt, Braten, oder sonst eine Leckerei, die auf Lilias Teller nur selten lag. Mama-Tante arbeitete nun zwar halbtags als Verkäuferin, dafür strich der Vater ihr den Lohn. Und wenn es deshalb an Geld mangelte, aßen Mama-Tante und Lilia Würstchen mit Brot oder Ravioli aus der Büchse, die Mama-Tante mit Käse überbuk. Und diese bräunliche Kruste mochte Lilia sehr, genoss sie wie ein Festessen.
Es war, als trage Lilia sämtliche Makel der Welt sichtbar auf ihrer Haut. Sie konnte tun, was sie wollte, es gereichte ihr meistens zum Nachteil. Lilia fühlte sich wie verhext. Dafür durfte sie ihren Geburtstag feiern, mit Bratwürsten, Kartoffelsalat und einer rosaroten Torte, geschmückt mit bunten Marzipantierchen. Dazu durfte sie Nachbarkinder einladen. Die blieben aber meist nur solange, bis die Teller leergegessen waren. Rasch stoben sie wieder auseinander, die Buben mit Fußbällen, die Mädchen, vor Bewunderung johlend, und sich die Bäuche haltend, der Buben Kraft bewundernd, Schürzenzipfel im Mund, oder in der Nase bohrend. Wollte Lilia mitspielen, musste sie fragen, ob sie das dürfe. Dann wurde darüber beraten und ihr das Ergebnis mitgeteilt. Oft hieß es: „Nein“, oder die Kinder verdufteten, „Lilia, wo bist du“ höhnend. Schlich sich Lilia beschämt nach Hause, tröstete Mama-Tante sie mit ein paar Nüssen, einem Apfel und nahm sie in die Arme. Es kam vor, dass sie beide eng umschlungen auf dem Sofa lagen und leise zusammen schnieften. Lilias Lage war aussichtslos, an allen Fronten. Auch Mama-Tantes Lage war aussichtslos. Und letztlich auch diejenige des Vaters, den nur seine Arbeit rettete.
Zur Arbeit fuhr der Vater auf einem schwarzen Militärvelo. Hinter die Lenkstange geschraubt befand sich ein halbrunder, blecherner Sitz für Lilia. Und hin und wieder lud er Lilia in den Tiergarten zu den Rehen, den Igeln und den Wildschweinen auf ein Eis, oder ein Faustbrot mit Käse und Schinken ein. Das ging so lange gut bis Lilia zu groß wurde, und er beim Treten nicht mehr über ihren Kopf hinwegsehen konnte. Von da an fuhr sie in einem Drahtkorb auf dem Gepäckträger mit. Und als kleines Kind trug sie der Vater auf seinen Schultern, wenn sie anfing vor Müdigkeit über ihre Füße zu stolpern und wie ein Sack Kartoffeln an seiner Hand hing.
Es gab diese Glückssplitter in Lilias Leben, diese kleinen Freuden: das Süßholz, die Rolle Bärendreck oder den sauren, grünen Ziehstengel vom Kiosk am Sonntag, nach ihrer Heimkehr von der Kirche, die sie mit Mama-Tante besuchte. Es gab auch Sonntagsspaziergänge mit integriertem Abendessen, das aus garniertem Wurstsalat bestand und hochtupierter Sahne auf Meringueschalen zum Dessert, manchmal sogar mit einer darunter versteckten Kugel Eis. Lilia aß mit Heißhunger und Genuss. Und sie aß viel, besonders wenn der Vater guter Laune war und sie spürte, dass sie für einmal zu keinem Tadel Anlass gab. Sie wurde pummelig.
Der Vater war mit Lilia zwei Kleidchen kaufen gegangen, eines in Türkis und eines in Rosa und Grau, beide mit Puffärmeln und weiten Röcken, das türkisfarbene mit einer breiten, gebundenen Schleife im Rücken, was Lilias Pausbackigkeit noch unterstrich. Doch die Kleidchen waren hübsch und duftig. Und für einmal gefiel Lilia selbst Mama-Tante, wenn sie eines davon für den Spaziergang mit dem Vater anzog. Manchmal erzählte Lilia dem Vater sogar eine Geschichte, die sie in der Schule gelesen hatten, währenddem sie Hand in Hand dem Fluss entlangspazierten, oder etwas Persönliches über sich, etwas, das ihr besonders nahe gegangen war. Sie tat das behutsam und scheu, denn der Vater war so empfindlich, besonders wenn er getrunken hatte - sodass die Stimmung im Nu kippte. Der Vater sich angeschuldigt vorkam. Und Lilia zu einem Nichts zusammenschrumpfte, weil sie sich so weit vorgedrängt hatte, dass er ihretwegen litt.
Und es gab die Ferientage mit dem Vater, dem Onkel, der Tante und ihren beiden Töchtern, bei denen Lilia ihre ersten Lebensjahre verbracht hatte - in einem bodenständigen, heimeligen Familienhotel in den Bergen. Die Söhne des Besitzers gehörten zur Skirennfahrerelite des Landes, heimsten Preise ein, auf Skiern aus Holz, in Überfallhosen und Wadenbinden, auf dem Kopf gestrickte Bommelkappen und Zwilchhandschuhe an den Händen. Und es gab das verbotene Hüpfen der drei Mädchen auf den Matratzen der Hotelbetten, als sie zur Mittagsruhe auf ihr Zimmer geschickt wurden, und Lilia vor lauter Übermut in Schieflage geriet und kopfüber auf den Heizungskörper knallte.
Die Wunde blutete. Lilia wurde übel. Und von der Hand, die Lilia auf die Wunde drückte, als sie heulend nach dem Vater suchte, lief es rot und klebrig auf ihren Arm. Die Erwachsenen, die bei Kaffee und Grappa die Ruhe im Garten genossen, reagierten entsetzt. Der Vater schlang ein Frottiertuch um Lilias Kopf, das er mit einer Sicherheitsnadel befestigte. Und er fuhr mit ihr in der Pferdekutsche zum Arzt ins nächste Dorf, da der Autobus um diese Zeit pausierte. Während des Nähens hielt der Vater Lilias Hand. Jeder Stich ließ Lilia zusammenzucken und presste ihr eine Träne aus den Augenwinkeln. Sie biss die Zähne zusammen, und der Vater lobte ihre Tapferkeit. Er kaufte ihr ein mit Enzian und Edelweiß besticktes Sennenkäppchen, zum Schutz der Wunde vor der brütenden Sommersonne, und einen Riegel Schokolade mit Haselnüssen, Lilias Lieblingsleckerei. Zärtlich, wie seit langem nicht, umsorgte der Vater Lilia, bekräftigte seine Freude darüber, dass ihr nichts Schlimmeres passiert sei, hätte sie doch tot sein können. Seine Hand, die auf dem Rückweg in der ihren ruhte zitterte, als er das erwähnte - leise und wie beiläufig, um ja den Teufel nicht an die Wand zu malen.
Ein bisschen war Lilia nun Mittelpunkt der Gesellschaft im Hotel. Sie erhielt ein Extradessert nach dem Abendessen und von der Frau des Besitzers eine Schachtel mit drei Taschentüchern, auf denen Kätzchen, drollige Hunde und possierliche Küken abgebildet waren. Gescholten wurden die Cousinen: wegen Anstiftung zum Ungehorsam. Lilia erhielt nur Mitleid, was ihr in der Seele wohltat. Zwei, drei Tage dauerte die Sorge um ihre Gesundheit. Kopfschmerzen wiesen auf eine Gehirnerschütterung hin. Dann ebbten die Aufmerksamkeiten ab. Der Vater wurde wieder der Vater, die Kluft zwischen ihm und Lilia so tief wie zuvor. Lilias Gehemmtheit kehrte zurück und damit das Gefühl des Verlassenseins.
Was Mama-Tante für Lilia zu ihrer einzig richtigen Mutter machte, wusste Lilia nicht. Es ergab sich einfach. Mama-Tante war weder geistreich, noch gebildet, noch belesen. War weder schön noch hässlich: Nur arm und gewöhnlich. Und doch bestand diese tiefe, innere Verbindung zwischen ihnen. Seit dem Krieg zwischen Mama-Tante und dem Vater, litt Mama-Tante an massiven Migräneanfällen, kotzte sich die Seele aus dem Leib, bog sich unter unmenschlichen Kopfschmerzen, die sie zum Schreien zwangen. Tränenbäche rannen über ihre Wangen, und Schlieren von Rotz verunstalteten ihr Gesicht. Sie verlor jede Haltung, litt wie ein Tier. Als breche der angestaute, innere Schmerz sich Bahn. Wie herunterdonnerndes Geröll, Schutt und Schlamm.
Lilia erschreckten diese Ausbrüche, auch weil sie nichts dagegen tun konnte, hilflos vor dem Sofa stand, auf dem sich Mama-Tante hin- und her wälzte. Aufgelöst und außer sich. Das Kleid verrutscht. Die Beine bloß. Der Busen offen: ein Bild des Jammers. Oft half nur der Besuch des Arztes. Ihr Zustand tat Lilia entsetzlich weh. Sie kauerte sich weinend neben Mama-Tante auf den Boden und hielt ihre Hand, falls Mama-Tante sie ihr überließ. Von Ekel keine Spur. Ganz anders als bei der Mutter, deren bloße Berührung sie anwiderte. Berühren durfte Lilia Mama-Tante im Zustand der Migräne nur selten. Sie vertrug nicht die geringste Einmischung, nicht den geringsten Kontakt. Wie gefangen in ihrer Verstörtheit lag sie da. Auch der Arzt fragte nichts. Stach kurz die Nadel in ihren Arm. Winkte Lilia zu. Und verzog sich wieder.
Mama-Tantes Migräneanfälle stürzten wie Naturkatastrophen über sie beide herein. Sobald die Spritze wirkte, fiel Mama-Tante in totenähnlichen Schlaf. Lag da wie weggeworfen. Ein lebloses Stück Fleisch. Wie nicht von dieser Welt. Einerseits fasziniert, andererseits schockiert beobachtete Lilia diese Verwandlung, schaute genau hin, prägte sie sich ein, als wolle sie sie malen. Auch jetzt berührte sie Mama-Tante nicht. Das verrutschte Kleid, die nackten Beine: Sie ließ alles, wie es war und wartete. Kam Mama-Tante zu sich, erschreckt über ihr Aussehen, tröstete Lilia sie, nahm sie in die Arme, holte ein nasses Tuch zum Waschen des Gesichts und brachte, sobald Mama-Tante, sich an einem Stuhl festhaltend aufstand, Kissen und Decken auf dem Sofa in Ordnung.
Lilia war es ein Rätsel warum sie die Mutter nicht mochte und Mama-Tante über alles, warum sie Menschen überhaupt mochte und andere nicht. Als der Vater sie fragte: „Was hast du eigentlich gegen die Mutter? Dir kann es doch egal sein, wie sie ist. Sie gibt dir schöne Kleider, sie geht mit dir in den Zoo, ins Kino. Sie hat ein tolles Haus. Eigentlich könntest du das genießen. Dass du dafür bei ihr wohnen musst, ist doch ein Klacks“, wusste Lilia keine Antwort. Sie wurde verwöhnt: das war richtig. Sie wurde beschenkt, auch wenn sie die Geschenke nur geliehen bekam: auch das war richtig. Sie durfte mit der Mutter und Oma sogar in teuren Hotels wohnen: das war oberrichtig. Doch löschte all das nicht den tiefsitzenden Abscheu vor der Mutter in ihrem Herzen. Als habe sie dieses Gefühl schon mit auf die Welt gebracht, lag es verknotet in ihrem Inneren.
Lilia wohnte tatsächlich gelegentlich mit Oma und der Mutter im Hotel. Sie hatte Oma extra darum gebeten, mit dem Hintergedanken, der Mutter dadurch während einigen Tagen weniger ausgeliefert zu sein, täuschte sich jedoch. Zwar war sie Gast im Grand-Hotel sowieso, im Parkhotel am See. oder an anderen teuren Adressen, doch musste sie sich dafür ein Zimmer mit der Mutter teilen. Das war eine bittere Pille. Denn nur schon den Geruch der Mutter mochte Lilia nicht. Als Kompensation – so verstand es Lilia - bekam sie Abendkleidchen, die zum Diner getragen wurden. Die, vom Kellner in weißen Handschuhen vor sie hingestellte Schale mit der Suppe, ruhte auf silbernem Platzteller. Der Kellner beugte sich ihren seltenen, gehemmt geflüsterten Wünschen mit vollendetem Charme, fragte sie bei jedem Essen, ob es ihr schmecke, oder ob sie es lieber gegen etwas anderes eintauschen möchte. Er nannte Lilia „Mademoiselle“ und legte ein zusätzliches Kissen für sie auf den Stuhl, damit ihr beim Essen die Tischkante nicht in die Quere kam.
An einem Abend gaben die Wiener Sängerknaben im Ballsaal ein Konzert. An einem anderen wurde ein Film über Robben und Pinguine gezeigt, beides Lilias Lieblingstiere. Tags darauf bekam sie von Oma eine Babyrobbe aus echtem Fell geschenkt, die sie kaum mehr aus der Hand legte. Sie war wie für Lilia gemacht. Ihre Finger passten genau darum herum, und sie roch richtig nach Tier. Nach Wasser. Und urtümlicher Wildheit. Und an den Nachmittagen ging Lilia mit der Mutter im See schwimmen. Sie gebärdete sich dabei selbst wild wie eine Robbe, sprang vom Brett, den Schrei des Entsetzens der Mutter missachtend, schwamm so weit hinaus, dass die Mutter ihren Kopf mit der geblümten Badehaube aus der Ferne kaum noch ausmachen konnte. Und das alles zur Strafe der Mutter, trug diese doch eine Badehose aus dem letzten Jahrhundert, mit Stößen fast bis zu den Knien, aus dunkelblauer Wolle, die nichts unterstützte. Nichts zusammenhielt. Beschönigte. Oder verbarg.
Lilia konnte sich vor Scham und Entrüstung kaum fassen, auch wenn sie sich verbalen Protest verbot. Ihre Wut kannte keine Grenzen, eine Wut, die Lilia noch gar nicht so lange an sich wahrnahm, die als Gegenpol zu ihrem ständigen, inneren Weh entstanden sein musste, wie zum Schutz des Gleichgewichts. Eine Wut, die kochte, beinahe überkochte, und die zu bändigen Lilia alle Kraft kostete. Sie zu unterdrücken wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Die Wut machte Lilia böse. Gebar Gefühle von Gewalt. Gar Lust, dreinzuschlagen. Totzuschlagen. Und sie machte ihr nicht einmal Angst. Sie schien normal und legal, ihren Umständen angemessen, vorausgesetzt sie hielt sie unter Kontrolle. Und Lilia hielt die Wut unter Kontrolle. Sie war wie ihr Ding mit Gott, war Kraft, geboren aus Not. War Macht, schweigende Macht. Ein Kokon aus Macht, der Unterdrückung und dem Mangel zum Trotz.
Den vierundzwanzigsten Dezember durfte Lilia zu Hause verbringen. Erst am fünfundzwanzigsten wurde sie zur Mutter spediert. Doch an wirklich fröhliche Heilige Abende erinnerte sich Lilia nicht. Dafür an Geschenke, die der Vater zuhause für sie bastelte. An das drei Stockwerke hohe Puppenhaus etwa. Eine Treppe führte mitten hindurch, bis hinauf zur Dachterrasse. Die Fenster der Stube hatten Sprossen und konnten dank Scharnieren auf- und zugestoßen werden. Die Stube war möbliert. Aus dunkelrotem Holz stilecht gefertigte Stühle standen darin - sowie ein Tisch mit geschwungenen Beinen, ein winziges Klavier und ein mit grünem Samt überzogenes Sofa. Sogar ein Weihnachtsbäumchen mit Kugeln und Kerzchen schmückte sie. An den Fenstern hingen Vorhänge mit Volants. Und den Boden bedeckte ein gemusterter Teppich. Die Möbelchen kamen von Mama-Tante, waren, wie der feingearbeitete Esstisch, der ursprünglich die Mitte ihrer Wohnstube eingenommen hatte, bevor Mama-Tante ihn in ihr Zimmer verfrachtete, Erbstücke von Lilias Großmutter, die lange vor Lilias Geburt gestorben war. Die Puppenküche füllten Möbel aus Plastik sowie eine pompöse Standuhr. Im zweiten Stock befand sich ein voll ausgestattetes Bad, wie Lilia es vom Haus der Mutter her kannte sowie das Elternschlafzimmer. Im dritten Stock lagen die Kinderzimmer. Und auf der Dachterrasse schaukelten Püppchen in gehäkelten Hängematten unter farbigen Schirmchen, die auf- und zugespannt werden konnten.
Allein vermochte Lilia die Puppenstube, die normalerweise unter einem Tuch in Vaters Zimmer stand, nicht die Treppe hinunter in die Stube zu tragen, oder an Sommertagen in den Garten hinaus.
Im Jahr darauf überraschte der Vater Lilia mit einem Kaufladen, auf dessen Theke eine Kasse mit drehbarer Kurbel klingelte. Im Angebot lagen Knäuel aus farbiger Wolle, Stricknadeln. Schächtelchen mit Gäbelchen, Messerchen und Löffelchen. Brote aus Salzteig. Standen Päckchen mit Kaffee und Tee. Gläser mit echten Bonbons, mit Mehl, Gries und Zucker. Produkt reihte sich an Produkt auf geräumigen Regalen, im Halbrund angeordnet. Und natürlich fehlten weder Papiergeld noch Münzen. Taschen. Beutel. Und Tüten aus Zeitungspapier. Auch den Kaufladen konnte Lilia alleine nicht hochheben.
Und wieder im Jahr darauf fand Lilia einen Bauernhof unter der Weihnachtsföhre. Unter dem aufklappbaren Dach des Bauernhofs stapelten sich Heu und Stroh. Brennholz. Schaufeln aus dünnem Blech und winzige Besen . Darunter lag die Wohnung der Bauersleute. Daneben befand sich der Stall mit Kühen. Schafen. Eseln. Pferden und Ziegen. In einem Anbau hausten die Schweine, und ums Haus herum standen verschiebbare Bäume und Zäune.
Und zu Lilias Geburtstag gesellte sich noch ein Gehege für Hühner. Gänse. Enten und Fische dazu. In einem Gefäß, das der Vater aus dem Labor mitgebracht hatte, wuchs echtes Gras. Es war neben einem ovalen Wasserbecken in den Boden eingelassen. Die Fische und die Enten schaukelten auf dem Teich. Die Hühner und Gänse tummelten sich im Gras, oder pickten Körner aus hölzernen Zubern.
Den Wert dieser Arbeiten wirklich schätzen, konnte Lilia nicht. Die gestörte Beziehung zwischen Mama-Tante und dem Vater schmälerte ihn. Doch sie freute sich darüber und spürte die Liebe des Vaters, dessen Hände die Wunderdinge hervorgebracht hatten - auch wenn in Lilia die Gewissheit, sie sei die Quelle der sie umtosenden Leiden, immer stärker drückte.
Mangels Freundinnen spielte Lilia meistens allein. Und allein gaben Spielsachen nicht viel her. Zu selten konnte Lilia sie herzeigen, als einen Wert, der auf sie abfärbte. Geteilte Freude wünschte sich Lilia. Und blieb mit diesem Wunsch allein. Sie war nicht wie anderer Leute Kind. Wälzte Sorgen unkindlicher Natur. Dachte Gedanken, die ihrem Alter fernlagen. Oder hätten fernliegen sollen. Verhielt sich tierhaft ängstlich. Nicht draufgängerisch, wie die Clique um die Nachbarsbuben und -mädchen. Sie passte nicht zum Kindsein. Passte nicht in eine Familie. Nicht in ein Leben gewohnheitsmäßiger Abläufe. Und scheuchte sie der Vater am fünfundzwanzigsten Dezember von ihren Schätzen weg, nahm das Drama der Vertreibung seinen unausweichlichen Verlauf. Schon allein diese Unausweichlichkeit machte Lilia für Kameradinnen verdächtig. Dazu kam, dass sie beim Vater wohnte und nicht bei der Mutter, wie es zu jener Zeit nach Scheidungen üblich war.
Oma, Opa, die Mutter, Tante, Onkel und die Kusinen warteten jedes Jahr mit dem Feiern auf Lilia. Erschien sie endlich, stand die mächtige Blautanne schon, über und über mit kostbarem Schmuck und Engelshaar behängt, im Salon der Großeltern, eine Arbeit, die Opa für sich beanspruchte. Die Frauen durften die Geschenke darunter arrangieren, die Mutter die Krippe. Lilia musste Blockflöte, und als sie grösser wurde, Klavier spielen, Weihnachtslieder begleiten. Man erwartete von ihr den Beweis, dass etwas aus ihr wurde, was nicht selbstverständlich war, unter den Umständen, unter denen sie aufwuchs. Deren Schäbigkeit wurde Lilia immer wieder vorgeworfen, bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Sich Akzeptanz durch Effizienz zu erarbeiten, war deshalb für Lilia Pflicht. Unterliefen ihrem Spiel unter diesem Druck Fehler, war das nicht anders zu erwarten. Auch Lilias Begeisterung über die teuren Geschenke ließ zu wünschen übrig, denn mit nach Hause nehmen durfte Lilia sie ja nicht.

2. Was tun zum Überleben?
Lilia stellte oft fest, dass sie in zwei Leben gleichzeitig existierte: Im einen, in dem sich die sichtbaren, äußerlichen Geschichten abspielten, die sie wie Blöcke aus Granit an den Füssen hinter sich herschleifte. Geschichten, die die Luft zum Atmen dick und fett gerinnen ließen und das sich Unsichtbarmachen, um nicht unter die Räder von Missfallen oder Aggression zu geraten, zum Spießrutenlauf. Sie kam sich vor wie ausgesetzt. Auf spitze Pflöcke gespießt. Beute von allem und jedem. Nie herrschte Ruhe. Stets musste sie auf dem Posten sein. Gespannt wie eine Sehne. Pfeilen ausweichend, die um ihren Kopf zischten – und in einem anderen Leben, das nur in ihr drin stattfand.
Als Opfer fühlte sich Lilia deswegen nicht. Sie lebte einfach nicht wie andere Kinder. Und eigentlich wollte sie das auch nicht. Nicht wirklich. Denn die meisten Kinder empfand sie als langweilig, als hohl. Die meisten Erwachsenen ebenso: wie leere Zündholzschachteln. Sie wagten nichts - dachten nichts - rieben sich an nichts - schlingerten durchs Leben wie Boote ohne Steuermann - dümpelten vor sich hin - krachten aneinander, ohne Konsequenz. Wozu?
Lilia entdeckte in sich einen Ort ganz anders beschaffen, als die winzige Ecke an äußerer Welt, die sie kannte. Einen Ort nur für sich allein - wo sie auf Fragen stieß, auf Bilder. Landschaften - auf Wesen, die sie zum Nachdenken, zum Spüren verführten. Sie entdeckte Tiefe. Abgründige. Schwarz wie Tinte. Glatt und spiegelnd wie Lack. So als könne sie sich darin erkennen, beugte sie sich vor - über diesen Krater, dessen Wände von Schlieren von Blut starrten - einem Meer von Tränen, in Monsterwellen gestaut.
Früher, als Lilia bei Onkel und Tante in der Wohnung gegenüber der Dorfkirche manche Monate verbrachte, zogen die Beerdigungsprozessionen unter ihren Fenstern vorüber. Dann überquoll dieser Trichter manchmal. Dumpf schepperte der Trauermarsch. Aus dem Sarg, auf dem mit silbernen Troddeln behängten, von Pferden gezogen Wagen, reichten Hände hinauf zum Vorhang, hinter dem sich Lilia fasziniert und elektrisiert versteckte. Sehnige Knochenkrallen, die sie magnetisch anzogen. An ihr zerrten. Rissen. Sodass sie alle Kraft brauchte, um standzuhalten. Der Tod und Lilia: Entsetzen pur. Schaurig, ekstatisch. Die Sinne schärfend wie Dolche. Bilder von Gemetzel. Von Zerfleischung, beseligend irr.
Die Kusinen spotteten über Lilias Angst. Auch ihre Eltern hielten Lilia für zu schreckhaft und überdreht. Doch für Lilia war das, was sie Angst schimpften, wie Mozarthören, wie sich mit Gott herumschlagen: Quelle von Kraft. Zugang zu Orten, ihr geschenkt, zu denen andere den Schlüssel nicht kannten. Offensichtlich nicht, sonst erschienen sie ihr nicht wie aus Pappe geschnitten. Flach und ohne Fleisch. Blutleer und wie nicht existent.
Die Erlebnisse mit dem Tod erfuhr Lilia als Gewinn. Sie hätte sie um keinen Preis missen mögen. Sie waren heilig wie Kirchen. Wie Schrunden im Bodenlosen, wo Teufel hausten, doch auch Drachen - sowie Gott und die Heiligen, die Mutter Maria. Waren Orte wollüstigen Aufgehobenseins.
Von Oma erhielt Lilia zum Weihnachtsfest in diesem Jahr ein Tischgrammophon und drei kleine Schallplatten. Als Lilia raushatte, wie es funktionierte, hörte sie nicht mehr auf, die Platten zu spielen: „Die Kleine Nachtmusik“, ein Adagio aus einem Flötenkonzert von Mozart und das „Ave Maria“ von Schubert. An allen dreien konnte sie sich nicht satthören. Vor allem die „Nachtmusik“ tat es ihr an. Das Hüpfen, Springen, das Perlen der Töne entführte sie auf Wogen unbeschreiblichen Genusses, auf eine Schaukel, die hoch hinauf in die Wolken schoss, sich überschlug, schneller und schneller, und Glückseligkeit widerspiegelte, wie nur Lilia sie zu kennen glaubte. Welche Leichtigkeit. Trotz Mozarts hartem Leben. Trotz eines Vaters, der den Jungen knechtete und ans Klavier zwang, so wie der Vater es mit Lilia anstellte. Mit Ohrfeigen, wenn sie nicht gutwillig übte - da sie viel lieber Harfe gespielt hätte, was der Vater rundweg abschlug, als zu exzentrisch, zu verrückt.
Mit welcher Leichtfüßigkeit trippelte, schlängelte sich die Nachtmusik dahin. Lilia tanzte verzückt, den Rock geschürzt wie ein Abendkleid, einen Arm über dem Kopf, auf Zehenspitzen, tonlos lachend, unbändig. Hätte sie doch Mozarts Spritzigkeit, vielleicht wäre das Leben leichter. Wäre der Vater gerechter. Und Mama-Tante weniger oft krank. Und vielleicht könnte sie dann sogar die Mutter lieben.
Am Hass auf die Mutter trug Lilia schwer. Er machte ihre Tage anstrengend, auch physisch. Die Mutter auf Distanz zu halten, kostete Energie, brauchte Tricks. Und ein Gleichgewicht zwischen Ablehnung und Akzeptanz zu finden ebenso. Sie hasste die Mutter ja nicht andauernd. Es gab Momente, in denen sie zusammen schäkerten. Momente, in denen Lilia die Mutter an der Hand zog und sie ermunterte mit ihr zu rennen - zusammen mit dem Dackel, der über alle Berge stürmte, bevor sich die Mutter anstoßen ließ, rascher, weniger schwerfällig hinter ihm herzuwandern. Eine Gangart, die sie sich mit Oma angewöhnt hatte, weil die nicht leicht trug an ihrem Gewicht. Der Dackel war das Rennen gewöhnt. Mit Opa zu Pferd, früher bei der Jagd, wurde es ihm zur zweiten Natur. Und er rannte kläffend Hänge hoch und runter, Mutters Pfiffe großzügig überhörend. Lilia staunte über Mutters Pfeifen, und wie gut sie das konnte. Es passte so gar nicht zum Bild, das Lilia von ihr hatte.
Und kehrten sie von ihren Spaziergängen heim, Lilia in den steifen, hohen Schuhen, die sie auf Geheiß der Mutter trug, knackten und brieten schon Marroni im Backofen bei Köchin Maria in der Küche. Wunderdinge für Lilia. Wie süß sie dufteten. Und Oma wartete mit dem Tee auf sie. Der Dackel, selbständig heimgekehrt, hatte vor der geschlossenen Haustüre Einlass gefordert und lag nun wohlig grunzend auf Omas Füssen, leckte sich das Maul im Vorgenuss der Praline, die an der Tischkante für ihn bereitlag. Ein Familienidyll nach Lilias Sinn. Wäre die Mutter. Wären die Umstände nicht so unglücklich gewesen: Lilia hätte zufriedener nicht sein können.
Lilia konnte sich tatsächlich so gut wie an kein glückliches Weihnachtsfest erinnern, auch Jahrzehnte später nicht. Für sie bedeuteten Festtage harte Arbeit. Sie sah es als ihre Aufgabe, sich schief und krumm zu legen, um Ausgleich zu schaffen, ein Mindestmaß an Harmonie zu kreieren. Zuhause trottete sie zwischen dem Vater, Mama-Tante - und später dem Großvater, nachdem er zu ihnen gezogen war - hin und her, um die drei Menschen, die sie über alles liebte um den Baum zu versammeln. Auch wenn der Baum nach nichts aussah, nur ein paar Kugeln an ihm baumelten, wenige Kerzen auf den Ästen der Föhre steckten, die sperriger nicht hätten sein können. Und der restliche Schmuck von Mama-Tante und Lilia aus Goldpapier gebastelt war, um Geld zu sparen, weil dem Vater an Weihnachten zuhause nichts lag.
Lilia begriff nicht, warum der Vater so handelte. Eine Art Teufel schien ihn zu reiten, die Gier absichtlich weh zu tun, Verachtung zu demonstrieren. Wie einen Zwang überkam sie ihn. Bat Lilia eine Woche vor Weihnachten, er möchte doch für einmal eine Tanne mitbringen, wurde er bissig, stieß sie von sich, als trete sie ihm zu nahe, knurrte, eine Föhre sei mehr als gut genug. Wozu was Teures kaufen. Weihnachten sei was für Senile und Säuglinge. Der Vater sprach mit einer Gehässigkeit über das Fest, die in Lilia die immer gleiche Verzweiflung weckte. Sie schluchzte hektisch, verschluckte sich, rang nach Luft. Das ohnehin dünne Eis schmolz unter ihren Füssen. Da war sie wieder: Die Ausweglosigkeit. Das in die Enge Getriebenwerden, wie ein Schwein im Schlachthaus - schmaler und schmaler wurden die Durchgänge. Bis sie sich zu Ritzen verengten. Geschrei einsetzte. Würgendes Umsichschlagen. Der Stromstoß allem ein Ende setzte. Blut herumspritzte. Gestank einem den Atem verschlug. Sie hatte es gesehen im Schlachthof.
Und Lilia bemühte sich doch so. Warum nützte alles nichts? Sie kniete vor dem Vater, bettelte, er solle mit ihnen feiern. Wenigstens für ein paar Minuten mit ihnen zusammensitzen, ohne ausfallend zu werden. Sie umfasste des Vaters Knie: „Ich will auch lieb sein dafür“, stammelte sie hilflos, nicht wissend, wo ein und aus. Flehend um ein bisschen Menschlichkeit. Ein bisschen Nachgiebigkeit. Weniger Feindschaft. Weil sie doch alle aufeinander angewiesen seien. Was könnte sie sonst tun? Wo könnte sie hin? Sie hätte doch keinen Platz, schon gar nicht bei der Mutter.
Wieder stieß der Vater Lilia zur Seite, stieg über sie hinweg. Fast trat er sie. Er gehe nun, maulte er. Er sei an einen Ort eingeladen, wo man ihn schätze und komme erst Ende der Woche zurück. Ob er ihr wenigstens Geld gebe für etwas zu essen, flennte Lilia. „Für wen? Für die Alten? Nein! Für dich gebe ich dir Geld, nur für dich.“ Und Lilia: „Ich kann doch nicht allein kochen, allein essen, und Mama-Tante und der Großvater kriegen nichts. Das ist doch nicht gerecht.“ Ob sein Leben denn gerecht sei, kreischte der Vater. Ob dieses Haus. Diese hysterische Hexe dort unten. Und der ungewaschene Greis etwa gerecht seien. Ob er das verdient habe. Mit all seinem Wissen? Zuhause sei er doch ein Nichts, purer Dreck.
Nun weinte der Vater. Er zog Lilia an sich und strich ihr über die tränenverschmierten Wangen. Hoffnung, scheu flackernde Sehnsucht entflammte in Lilia. Am Ende würde doch alles gut, und der Abend gerettet. Dann stand der Vater auf, legte Geld auf die Kommode, küsste Lilia und machte sich bereit, zu gehen. „Es ist Weihnachten. Und ich kriege nichts“, flehte Lilia, „nicht einmal ein Geschenk?“ „Was willst du denn. Sag schnell. Ich habe wenig Zeit.“ „Das Buch „Die Welt in der wir leben“, hätte ich schon lange gern“, seufzte Lilia entmutigt. Es lag in vielen Läden auf, galt als Sensation, weil es Bilder von Planeten zeigte, die Oberfläche des Mondes, dessen Gestalt durch neuartige Teleskope sichtbar geworden war. „Gut. Du sollst es haben. Aber dann ist Schluss.“ Lilia nickte.
Zügig lief der Vater die Treppe hinunter und aus dem Haus. Eine Stunde später legte er Lilia das Buch uneingepackt in die Arme. Es wog viel, vom Format her und weil es sich Lilia hart erkämpft hatte. Es freute sie auch. Die Bilder elektrisierten sie. Doch dann legte sie das Buch zur Seite. Der Preis dafür erdrückte sie, schien ihr zu hoch. Sie fühlte sich erschöpft, ausgepumpt und leer. Wie zusammengepfercht in einer verstopften Kloake. Als gebe es für sie keinen anderen Ort zum Verkriechen. Kein Heim, in dem sie legitim zu Hause sei. Nur Kälte. Entsetzen und die wuchernde Angst, aus allem, woran sie hing, hinausgeworfen und verjagt zu werden.
Es wurde ein stiller Abend. Mama-Tante baute resigniert Puppenteller, Puppentassen, Pfannen mit Deckeln, Schüsseln und Krüge: Geschirr für eine Großfamilie sowie einen blechernen Herd zum Kochen unter dem Baum auf. Der Großvater schenkte Lilia eine hölzerne Handpuppe, ein Krokodil, das die Zähne fletschte, und in dem eine Salami steckte. Lilia stand auf Salziges. Mit Süßem war sie nicht zu verführen. Mama-Tante und Lilia spielten zweistimmig ein paar Weihnachtslieder auf ihren Blockflöten. Dann war es Zeit fürs Bett. Lilia weinte sich in den Schlaf. „O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit“, klang es gedämpft aus dem Radio, das Mama-Tante während des Aufräumens laufen ließ. Der Rauch der Toscani, die der Großvater rauchte, wand sich durch die Ritzen von Lilias Zimmertür. Die Sichel des Mondes entsandte einen milchweißen, fluoreszierenden Strahl zu Lilias Kopfkissen: eine Rutschbahn, wie Mama-Tante das nannte, auf der Engel zu Kindern glitten, unhörbar und fast unsichtbar, um sie vor bösen Träumen zu bewahren. Doch manchmal schien es Lilia, sie erhasche einen Blick auf sie, nur gerade einen Herzschlag lang.
Eine von Lilias Schwächen bestand darin, dass sie gerne Prinzessin spielte. Zuhause ging das nicht. Die Kameradinnen aus der Nachbarschaft fanden solche Spiele blöd. Und die Buben spielten lieber „Onkel Doktor“ mit den Mädchen, ein Spiel, das Lilia scheute wie die Pest, und bei dem sie nie mitmachte. War Lilia dran, um sich auszuziehen, erfand sie Ausreden. Sie habe Mama-Tante rufen hören, meinte sie, oder: der Großvater sei krank. Das stempelte sie zur Spielverderberin. Sie sei zu eingebildet und verklemmt, höhnten vor allem die Mädchen. Lilia stellte fest, dass unter den Mädchen weniger Solidarität herrschte als unter den Buben. Die Mädchen verspotteten und schwärzten einander rascher an, waren deutlich hinterhältiger und feiger als die Buben. Dafür waren die Buben grober im Umgang miteinander und brutal, wenn es darum ging, anderen das Fahrrad zu manipulieren oder eins über den Schädel zu hauen. Die Mädchen beließen es beim Beißen und Haareausreißen.
Beim Doktorspiel bauten die Buben mit ausgedienten Leintüchern eine Hütte, in die sie die Mädchen, eines nach dem anderen einluden. Obwohl der Gedanke, mitzuspielen, in Lilias Bauch ein Ziehen und Surren verursachte, das sie interessant fand, fürchtete sie sich davor. Und das nicht nur, weil sie katholisch war, ihre Kameraden dagegen reformiert. Es erinnerte sie an die beschämenden Erfahrungen mit der Mutter, die immer noch darauf bestand, Lilia beim Baden einzuseifen und sie unter Wasser zu streicheln. Auch wenn sie gewisse Grenzen nicht überschritt.
Was sich in der Leintuchhütte abspielte, erfuhr Lilia deshalb nie. Da sie nicht mitmachte, durfte sie auch nicht hineinschauen. Sie hörte nur das Kichern und Glucksen der Mädchen - und manchmal einen piepsigen Schrei.
Um dennoch auf ihre Rechnung zu kommen, versuchte Lilia, die Mutter während ihren Ferien für das Prinzessinnenspiel zu begeistern. Die ließ sich ein paarmal erweichen, die Schleppe, das bestickte weiße Tischtuch, das sich Lilia um den Hals geknotet und über die Schultern drapiert hatte, hinter ihr herzutragen, und ihr die Krone vom vorjährigen Dreikönigskuchen aufs Haar zu setzen. Nur machte die Mutter das Spiel nicht lange mit, da sie Lilias Absicht durchschaute. Denn Prinzessin zu mimen, beinhaltete für Lilia, vor Übergriffen geschützt zu sein. Märchen erzählte Lilia niemand. In den wenigen, die sie in der Schule gehört oder selbst gelesen hatte, wurden Prinzessinnen zwar ebenso misshandelt wie andere Menschen auch. Zum Beispiel mit Ratten und Schlangen in finstere Verließe gesteckt und dem Hungertod preisgegeben. Doch fand sich immer ein Prinz oder ein Knecht von edlem Gemüt, der die Prinzessin, unter Überwindung grässlicher Gefahren befreite, und sie im Triumph zu ihren Eltern zurückbrachte. Dann wurde gefeiert, dass sich die Tische unter den Köstlichkeiten bogen, und auch die Armen satt wurden. Der König gab die Prinzessin ihrem Erretter zur Frau, und sie lebten glücklich und in Reichtum auf immerdar.
Die Bedeutung, die Könige und Prinzessinnen für Lilia erhielten, basierte auf ihrer Annahme, dass Menschen unter besonderen Umständen, selbst nach grenzenlosen Schmerzen, irgendwann den Status erreichten, der ihnen Ehre und Ruhm zugestand. Und, was den Ausschlag gab: ihnen Immunität garantierte. Eine Prinzessin umwehte eine Aura von Unberührbarkeit. Niemand durfte einer Prinzessin nahetreten, sie herumschubsen. Schlagen. Oder anschreien. Und schon gar nicht ohne Erlaubnis umarmen und küssen. Prinzessinnen gehörten sich selbst. Niemand hatte ein Recht auf sie.
Spielte Lilia Prinzessin, erlebte sie für Augenblicke die Sensation, auserwählt zu sein. Ihr Körper schwebte über dem Boden, streckte sich, bewegte sich fein und zierlich. Auf leichten Füssen stolzierte sie einher - die Mutter wegen der Länge der Schleppe zwei Meter hinter sich. Lilias Prinzessinnenwürde verbot der Mutter, die Schleppe fallen zu lassen und sich Lilia zu schnappen. Für wenige Augenblicke wusste sich Lilia geschützt. Und da sie in Sachen Gefühle wendig geworden war wie ein Schlänglein, gewohnt, blitzschnell zu reagieren, erholte sich ihr Gemüt in diesen Augenblicken seliger Loslösung herzklein: im Unberührten tief innen. Allem Schmerz entrückt.
Immer noch gab es niemandem, mit dem sich Lilia austauschen konnte. Sie war darauf angewiesen, Zusammenhänge, ihre Lage betreffend, selbst zu erschnüffeln. Die Nase im Wind wie ein Hase, schnuppernd, sich duckend, unhörbar hoppelnd, Gefahren, Vorteile, Schlupfwinkel ernäselnd. Sie lernte zu schauen. Mit Sperberblick. Ohne zu zwinkern. Minutenlang nicht aufzufallen. Tief im Körper atmend auszuharren. Wie festgezurrt.
Oma und die Mutter sprachen Italienisch, wenn Lilia nicht wissen durfte, wovon sie redeten. Durch regloses Zuhören fand Lilia den Weg, Gesagtes zu interpretieren. Die Erwachsenen merkten nichts davon. Sie wähnten sich sicher. Sogar wenn sie erörterten, ob es nicht doch noch eine Möglichkeit gäbe, Lilia für immer bei sich zu behalten. Kam solches zur Sprache, kostete es Lilias ganze Anstrengung, nicht auf sie loszustürmen, die Mutter an den schütteren Haaren zu reißen, und auf sie einzuhämmern. Es gab Momente in denen die Mutter Lilia auf Deutsch über ihre Anstrengungen informierte. Dann schrie Lilia: „Um keinen Preis bleibe ich hier. Dann bringe ich mich lieber um.“ Als Folge verbannte die Mutter Lilia in ihr Zimmer, schloss die Jalousien, verbarrikadierte das Fenster, drehte den Schlüssel im Schloss und überließ Lilia für den Rest des Tages sich selbst - bis sie zur Vernunft gekommen sei und sich daran erinnere, wie man mit seiner Mutter rede.
Nur der Onkel besaß die Gabe zu vermitteln, wenn die Stricke zu Reißen drohten. Nur er verstand, wie ernst es Lilia mit ihrer Drohung meinte. Die Mutter erging sich in Selbstmitleid, fühlte sich tödlich beleidigt. Was für ein böses Kind sie doch zur Welt gebracht habe, greinte sie, ein vom Herrgott und allen guten Geistern verlassenes. Von ihr habe Lilia das nicht. Da stecke der Vater dahinter. Ihn werde gerechte Strafe ereilen. Diesen Verworfenen. Diesen Teufel. Daran glaubte die Mutter felsenfest. Sich selbst sah sie als lilienrein. Allein dass sie ein Kind zur Welt gebracht habe, mache sie Marien gleich. Nicht umsonst gab sie ihrem Kind den Namen „Lilia“, hoffend, er färbe auf sein Verhalten ab. Mache es zu einem gottesfürchtigen. Makellosen Wesen.
Wörter, Sätze, eine Sprache um sich mitzuteilen, kannte Lilia immer noch nicht. Es gab auch niemanden, dem sie sich und ihre Sicht der Dinge hätte mitteilen wollen. Dem Vater sicher nicht. Beim leisesten Versuch, sich zu erklären, befahl er Schweigen. So überspannt wie sie rede, müsse man sich ihretwegen ernsthafte Gedanken machen. Sie solle nur ja niemandem sowas erzählen. Das sei Unsinn, Geschwätz einer Verrückten. Das komme von der Mutter. Mit der habe er auch kein vernünftiges Wort reden können. Lilia solle sich unterstehen, solchen Schmarren zu verbreiten. Sonst kriege sie es mit ihm zu tun, belehrte der Vater sie erbost.
Sich als Nullnummer. Als überflüssig. Und nicht zurechnungsfähig zu sehen, wurde zu Lilias zweiter Haut. Nur in sich besaß sie Raum. Und immer mehr nur dort zu leben, machte sie sich auf: im Sprachlosen, Uferlosen. Wo Beschränkung kein Thema war. Wo keine Wächter an Türen Posten bezogen und sie zuschlugen, sobald Lilia zum Fliegen ansetzte. In Träume abhob. Welten eroberte. Ekstase erfuhr, die in ihr die Gewissheit erschuf, dass Rettung auch für sie möglich sei. Dass es einen Weg gebe, zu entkommen. Nur zu finden brauche sie ihn. Und selbst wenn alle Möglichkeiten erschöpft seien, könne sie immer noch aus dem Fenster springen: Gott hätte ein Einsehen mit ihr.
Lilias Träume handelten nicht von Feen, Zwergen, Hexen oder Engeln, die sich zu ihrer Errettung vom Himmel schwangen, in Schwaden von Licht und sphärische Klänge gehüllt. Lilias Träume konzentrierten sich auf das Jetzt. Auf ihr tägliches Erleben, die Erfahrungen mit ihrem Umfeld. Immer wieder ließ Lilia sie vor ihrem inneren Auge vorüberziehen. Um sie sich haargenau einzuprägen, sie in ihr Bewusstsein einzubrennen. Damit sie sie verstünde. Damit sie zu erlebtem Alltag würden, der ihr gehöre, dem sie nicht nur ausgeliefert sei. Denn vor allem die Vielfalt der Erlebnisse machte Lilia zu schaffen, machte luzides Erfassen fast unmöglich. Und doch bestimmte gerade diese Vielfalt darüber, ob sie sie überrollte und erdrückte. Oder stärkte und befreite.
Diese Lektion brachte Lilia niemand bei. Sie war ihre Idee, geboren aus überlebenswichtiger Notwendigkeit. Vielleicht damit sie nicht wirklich verrückt würde. Denn dass sie verrückt sei, bekam sie hie und da zu hören. Vor allem von Kameradinnen, denen sie in schwachen Momenten von den Fünfsternehotels erzählte, dem roten Plüsch, den extravaganten Möbeln, den Dancings, in die sie Oma am Nachmittag für ein Stündchen begleiten durfte, um den Tanzenden zuzuschauen. Die Mutter saß dann so vertieft in ihr Notizbuch, dass Lilia ihre Anwesenheit vergaß.
Eines Nachmittags gewahrte Lilia ein unauffällig auffälliges Paar, einen älteren Herrn und eine jüngere Frau in weitschwingendem, seidenem Rock, dem Parfumschwaden entströmten, die Lilia tief in sich einsog. Die sie umgarnten wie Polypenarme, geschmeidig und betäubend zugleich. Die zierliche Dame schmiegte sich eng an den, um einen Kopf größeren Herrn, einen Bartträger mit Siegelring. Er nestelte mit bebenden Fingern an den Knöpfen ihrer Bluse, ihre Brüste ertastend, den Blick hinuntersenkend ins Abgründige, lüstern und staunend zugleich. Nichts davon entging Lilias Sperberblick, auch nicht der Kuss auf die Hand der Dame, der einem Biss nicht unähnlich sah. Ebenso wenig wie der brennende Blick, hypnotisierend vor Begierde, als der Tanz zu Ende war.
Lilias Nerven brannten vor Konzentration. Was geschah? Was spielte sich ab? Sie spürte das Flattern, das Wispern. Das Raunen des Bluts. Rasch und heftig, ungestüm in ihren Adern. Fragezeichen über Fragezeichen und keine Chance, sich zu erkundigen. Das hätte ihre Wahrnehmung verraten, und Oma in Entsetzen versetzt. Sie hätte gemauert, Lilia nie mehr zum Vieruhrtee ins Dancing geladen. Was Lilia sah, musste geheim bleiben, wie eine Verschwörung mit sich selbst. Sie war doch ein Kind, und hoffentlich ein anständiges. Und Kinder sahen solche Dinge nicht. Solch delikate Vorgänge. Dem Erleben Erwachsener vorbehalten.
Ihre Konzentrationsfähigkeit bescherte Lilia eine enorme Palette an Erfahrungen, gemessen an Erfahrungen Gleichaltriger aus ihrer Umgebung. Und das machte sie ihnen gegenüber suspekt. Gab sie auch nur Splitter davon preis, stand sie als Lügnerin da. „Das glaube ich dir nicht. Das hast du alles nur erfunden. Du lügst doch faustdick“, hieß es. Klugheit gebot Lilia, ihre Beobachtungen für sich zu behalten. Diese Erlebnisse auf den zahllosen Ebenen ihrer Existenz, von der Welt der Reichen bis zur häuslichen Armseligkeit beim Vater zwar ins Buch ihres Herzens einzugravieren, in jeden Nerv ihres Systems, nicht aber nach außen gelangen zu lassen. Nach außen, wo sie nur belacht, verhunzt, niedergemacht wurden. Lilia mutierte zum altklugen, mit vielen Wassern gewaschenen Mädchen, das oft Misstrauen erweckte, weil niemand wusste, woran man mit ihm war -- ob es flunkerte oder aus echtem Wissen heraus sprach.
Andererseits war Lilia immer noch unaufgeklärt - als Letzte ihrer Klasse. Sie war nun elf. Die Bevölkerung des Stadtgebiets in dem sie wohnte, bestand aus Fabrikarbeitern oder Angestellten der Stadt, des Gaswerks, der Bahn. Aus Männern also, die sich nach getaner Arbeit am Stammtisch trafen, Witze rissen, mehr oder minder zotige, über Politiker, Großkotze und Frauen schwadronierten. Und diese Haltung auch nach Hause trugen zu den heranwachsenden Söhnen. Dort bekamen sie die Mütter mit, die kleinen Buben und die Mädchen. Und die wiederum gaben sie in der Schule zum Besten. In Lilias Klasse waren es vor allem Cesira und ihre Freundin Yolanda, die väterliche Verhaltensweisen nachäfften und auch zum Besten gaben. Angefeuert von ihren Kameradinnen führten sie nach Ablauf der Pause, kurz bevor die Lehrerin ins Zimmer trat, in eine Ecke gedrückt, wie ein Liebespaar, szenisch vor, wie Vater und Mutter, oder ihre Brüder und deren Freundinnen, sich abknutschten. Sich wollüstig aneinander zwängten. Ihre Hände die entsprechenden Körperstellen begrapschten und kneteten. Mit Stöhnen, unterdrückten Schreien und sexuellen Handgreiflichkeiten. Grob, lieblos und abstoßend - fratzenhafte Gesichter, nass von Schweiß, von Mitschülerinnen im Halbkreis umstanden - für den Fall, dass die Lehrerin sie überraschte. Eine für Lilia unzumutbare Inszenierung. Ekelhaft. Ohne dass sie sich hätte wegdrehen können. Auch weil ihr Körper auf rätselhafte Weise in Aufruhr geriet beim Zuschauen. „Bébé“ nannten die Mädchen Lilia, die Unwissende, die Blöde, die kicherte über Witze, deren Sinn sie nicht verstand. Und „Tomate“, weil sie errötete, wenn von Schwänzen und Mösen die Rede war. Ausdrücke, die in ihrem Wortschatz fehlten.
Lilia brauchte Monate um dem Vater zu beichten, sie schäme sich ihrer Unwissenheit und werde deswegen gehänselt und verprügelt. Der Vater nahm ihre Beichte gelassen, ohne sich etwas daraus zu machen. Seine Tochter war eben eine Exzentrikerin, eine Tragödin im besten Sinne des Wortes. Doch er handelte. Am Wochenende nahm er Lilia mit in den Zoo, richtete ihre Aufmerksamkeit auf die entsprechenden Körperöffnungen vor allem der großen Tiere, an denen sie gut sichtbar waren: der Giraffen, Elefanten und Zebras. Er erzählte vom Heranwachsen der Sprösslinge im Leib der Mütter und dem Hinausschlüpfen ins Licht der Welt durch eben diese Öffnungen. Lilia reagierte begeistert. Ihre Wissenslücke war gestopft. Am Montag prahlte sie damit vor den Kameradinnen. Der Vater habe ihr alles sehr schön - und gar nicht so böse und grob erklärt, wie in ihren gemeinen Witzen. Als die Mädchen nachhakten und sich erkundigten ob sie denn auch wisse, wie Kinder gemacht würden, schrumpfte Lilias Stolz in nichts zusammen. Das zu fragen hatte sie vergessen. Sie errötete und kämpfte mit den Tränen. Unter Spott und Hohn der Mitschülerinnen verzog sie sich in ihre Bank und meldete sich während der Deutschstunde, in der sie sonst glänzte, kein einziges Mal zu Wort.
Es kam der Tag, an dem Lilia zum ersten Mal mit der Mutter und Oma das Stadttheater besuchen durfte. Man gab „Das Land des Lächelns“ von Lehàr.
Zuerst ging es darum, Lilia entsprechend auszustaffieren, denn noch immer sperrte die Mutter alles, was Lilia von zuhause mitbrachte, weg und bekleidete sie mit Selbstgekauftem. Oma übernahm die Regie. Lilia sollte ihr Ehre machen. Sie würden Geschäftsfreunde treffen, die Lilia, die Enkelin, noch nicht kannten. Lilia wurden Verhaltensregeln eingeschärft. Sie solle sich still und diskret verhalten und nur antworten, wenn sie gefragt werde. Und das kurz und bündig, jedoch höflich und mit einem Lächeln. Oma wählte in einem der angesagten Läden der Innenstadt ein türkisblaues Samtkleid mit Puffärmeln und weißem Spitzenkragen aus. Dazu ein Jäckchen aus silbergrauer Angorawolle, weiße Strumpfhosen und mit einem Lochmuster verzierte schwarze Lackschuhe. Vornehm, wohlgeboren und bestens erzogen sah Lilia darin aus. Sie gefiel sich, auch wenn sie sich in den teuren Kleidern fremd vorkam und fürchtete, sie zu beschädigen, oder zu verdrecken. Bevor das Taxi die Mutter, Oma und Lilia abholte, hängte ihr die Mutter als Leihgabe ein kleines, mit Türkisen besetztes Kreuz an goldenem Kettchen um den Hals. Aus der Asche war die höhere Tochter aus besserem Hause erstanden. Alles an Lilia zitterte. Ihre Nerven bebten. Die Anspannung färbte ihre Wangen rot wie Äpfelchen. Das ganze Mädchen glühte wie eine Rose. Es hielt sich mäuschenstill, sonst wäre es in Stücke zersprungen.
Und dann erschienen die Musiker. Atemberaubendes Melodieren. Tirilieren. Musizieren hob an. Jeder übte für sich allein. Es klang wie Vogelgezwitscher am frühen Morgen, wenn die Schleier der Dämmerung wichen, ehe die Sonne sich über den Horizont erhob. In Lilia hüpften die Nerven aus Reih und Glied. Nie zuvor hatte sie Ähnliches gehört.
Etwas später erschien der Dirigent, und derbes Klatschen zerbrach den Bann, aber nur kurz. Die Ouvertüre gewann an Fahrt. Der Vorhang hob sich. Und Lilias Augen, Lilias Gemüt und Wesen erschütterte eine Geschichte, eine Musik, erschuf in ihnen eine Welt, die sie sich in kühnsten Träumen nicht hätte vorstellen können. Dankbar dafür, dass niemand sie stupfte, ansprach oder den Arm um sie legte, saß sie da wie eine Statue. Die Sinne geschärft wie Klingen. Töne. Trauben zartester Gespinste von Musik. Unendlich weit entrückt aus Alltag und Leid war Lilia. Erfuhr Liebe. Sehnsucht. Verzicht. Erlebte Trauer, die zerriss. Trennung gleich der Verdammnis. Und fiel aus allen Wolken ob des brutalen Getrampels, der Bravos am Ende der Darbietung.
Stumm folgte sie der Mutter, die sie mit sich aus dem Theater zog und brauchte Stunden, um wieder Boden unter die Füße zu kriegen. Die Mutter kaufte ihr Platten mit den gängigsten Arien aus der Operette, die Lilia sich anhörte, ohne aus dem Staunen hinauszufinden, wieder und wieder. Bis die Mutter fand, es sei nun genug, und das Grammophon konfiszierte. Doch das kränkte Lilia nicht. In ihr drin war alles gespeichert: Gesang. Glück. Verzweiflung: die Lebensmuster, die sie kannte. Die ihr vertraut waren wie die eigene Haut. Die sie Tag für Tag erlebte auf der Achterbahn von Schmerz und Wahn ihres Daseins - einsam und geschunden. Ein Kiesel, achtlos zur Seite gekickt, zäh umkämpft. Doch an dem sich die Zähne ausbiss, wer ihn zu zertrümmern suchte. Lilia empfand sich als um Jahre gealtert. Geheimnisse, nur lose verdeckt, erschlossen sich ihr, sie wusste nicht wie - ein Schatz, gestählt im Drachenfeuer des Herzens - von außen uneinsehbar, wie nicht vorhanden.
An einem Samstag im Mai zog der Großvater zu Mama-Tante, dem Vater und Lilia ins Haus. Bis dahin hatte er bei seiner zweiten Tochter, deren Mann und den beiden Mädchen, an dem Ort gelebt, an dem die Begräbnisprozessionen vor dem Haus vorüberzogen, die in Lilia Panikattacken auslösten.
Tante und Onkel bewohnten eine helle, geräumige Wohnung mit Heizung, Kühlschrank, Boiler und Badezimmer. Des Großvaters Zimmer war, nebst der Stube, das größte und schönste. Voller Sonne, wenn sie schien. Voller Mädchenlachen nach Schulschluss und an den Wochenenden. Die Kinder mochten den Großvater, mochten seine zierliche, schmächtige Gestalt, das schrundige, feine Gesicht, den melancholischen Blick. Der Großvater war seit vielen Jahren Witwer. Während der Zeit der Stickereikrise war sein Geschäft bankrottgegangen. Nun reiste er noch mit einem Köfferchen voller Stoffmuster zu früheren Kunden, in der Hoffnung auf Bestellungen, auf einen Zuschussbatzen zu seiner schmalen Rente. Bei seiner Tochter fühlte er sich zuhause, wohl und geborgen.
Am Ende des langen Flurs stand sein dunkelroter, samtener Ohrensessel: eine Geburtstagsgabe der Gemeinde. Ruhte er dort, was oft der Fall war, turnten die Mädchen an ihm und am Sessel herum. Stiegen am Großvater hoch, über ihn hinweg, kletterten auf die Rückenlehne, rutschten daran hinunter und dem Großvater auf die Schultern. Er beklagte sich nie. Oft schimmerten Tränen des Glücks in seinen Augen, trotz der unsanften Behandlung vonseiten seiner Enkelinnen, Lilia mit eingeschlossen, wenn sie zu Besuch weilte. Zwar gab es manchmal Streit zwischen der Tante, der Schwester von Lilias Mama-Tante, und dem Großvater, wegen seiner Dickköpfigkeit, seiner Bosheit, dem gnadenlosen Egoismus, wie die Tante schimpfte. Die ja auch, wie Mama-Tante, auf eine Ausbildung zugunsten des Studiums ihres Bruders, Lilias Vater, hatte verzichten müssen. Doch Lilia liebte das Großväterchen, wie sie ihn taufte über alles, was immer auch für Schuld an ihm kleben mochte. Ihre Augen fanden alles perfekt an ihm. Lilia hängte Kirschen über seine Ohren. Zog ihn an der Nase. Döste an seiner Brust. Glucksend und schäkernd. Er bescherte ihr Augenblicke von Zugehörigkeit, in denen sie sich geliebt fühlte. Und das erdete sie.
Dann erhielt sein Schwiegersohn, von Beruf Ledergerber, das Angebot, in England eine leitende Stellung in einer Gerberei zu übernehmen. Und nach reiflicher Überlegung kamen Großvaters Tochter und sein Schwiegersohn überein, sie müssten das Angebot annehmen, eine ähnliche Chance kriegten sie nie wieder. Nur: wohin mit dem Großvater? Mitnehmen konnten sie ihn nicht. Er sprach kein Wort Englisch und hätte sich in dem fremden Land verloren gefühlt. Ein Altersheim ließ die Familienehre nicht zu. Also wurde Lilias Vater daran erinnert, der Zeitpunkt sei gekommen, sich seinem Vater gegenüber erkenntlich zu zeigen: er sei ihm definitiv etwas schuldig.
Der Vater erschrak zu Tode. Die Vorstellung, seinen Vater bei sich aufzunehmen, den er schon darum nicht liebte, weil er zur Familie gehörte, mit der er wegen seiner Schwester, Lilias Mama-Tante, nur Scherereien erlebte, war unzumutbar. Er erfand tausend Gründe, warum er nicht für seinen Vater sorgen könne. Auch die finanzielle Seite führte der Vater an, bezahle er doch immer noch Unterhalt für seine Frau, und das nicht zu knapp. Doch ließ sich eine andere Lösung nicht finden. Es gab ja noch die Kammer unter dem Dach, in der Mama-Tante das Dörrobst lagerte, die Körbe mit den selbstgebackenen Fasnachtsküchlein, die Gläser mit eingemachten Früchten und Konfitüren.
Also kriegte diese Kammer, die praktischerweise gleich neben dem Zimmer von Mama-Tante lag, neue Vorhänge, wurde ausgefegt und für den Großvater hergerichtet. Sie war gerade so breit, dass das schwere Bettgestell des Großvaters, mit dem geschnitzten Kopfteil, unter der abgeschrägten Decke Platz fand, sodass er durchs Fenster auf die Schrebergärten und auf die blutrot bemalten, hölzernen Gebäude des Kindergartens schauen konnte. Das Kreuz wurde über dem Nachttisch angebracht. Auch sein, wie ein Katzenfell graugetigertes Sofa fand Platz. Sowie seine Kommode und ein schmaler indischer Läufer - als Schutz gegen kalte Füße, da das Zimmer nicht geheizt werden konnte.
Ein heizbares Zimmer gab es zwar im unteren Stockwerk. Darin standen das Klavier, auf dem Lilia übte, und ihr ehemaliges Kinderbett, in dem ihre jüngere Kusine, die erst vier Jahre alt war übernachtete, wenn die Mädchen zu Besuch kamen. Das geschah auch nun, denn ihre Eltern fuhren allein nach England. Die Möbel und ihre übrigen Habseligkeiten folgten ihnen auf Lastwagen. Onkel und Tante wollten zuerst ihr Haus einrichten. Sich am neuen Wohnort umsehen. Schulen und Läden ausfindig machen. Und der Onkel sich an seinem Arbeitsplatz eingewöhnen.
Der Abschied von Tochter und Schwiegersohn fiel dem Großvater unendlich schwer. Er weinte stundenlang. Auch über den Verlust seines alten Zimmers, des Komforts der Wohnung, von dem er am neuen Ort nur träumen konnte. Er wurde nun der vierte in der Reihe der Badenden in der Wanne im Keller an den Samstagabenden. Dass er seine Enkelinnen noch ein paar Wochen um sich haben würde, tröstete ihn nicht. Seine Freunde aus dem Dorf, die Kollegen aus der Kneipe, die Vertreterreisen in die näheren Dörfer, Gespräche am Familientisch: all das war dahin. Er fiel übler, als nur vom Regen in die Traufe. Das Beziehungsklima im Haus war in keiner Weise mit dem zu vergleichen, an das er gewöhnt war. Der Großvater begriff, dass der Umzug zu seinem Sohn eine Notlösung darstellte, und dass er weder willkommen war, noch von Lilias Vater und Mama-Tante gemocht wurde. Auf sich selbst gestellt, nahm er seine Reisen, die nun Stunden dauerten, wieder auf. Immer noch besaß er ein Generalabonnement. Die Tage verbrachte er im Zug. Hie und da gesellte sich jemand zum Plaudern zu ihm. Er las Zeitung, oder saß einfach da, deprimiert, sein Los betrauernd und sich fragend, fragend, fragend: ein Häufchen Elend ohne Richtung und Ziel.
Wenige Monate später holten der Onkel und die Tante aus England ihre beiden Mädchen nach. Der Großvater blieb als Wrack zurück. Er hörte tagelang nicht auf zu schluchzen, aß nicht, trank nicht, wollte nur noch sterben. Lilia versuchte, den Großvater zu trösten so gut es ging. Doch da sie für sich selbst keinen Trost fand, blieb der Erfolg aus. Sie allein konnte weder den Onkel noch die Tante ersetzen, noch die Kusinen. Sie war so unglücklich wie der Großvater. Genauso verzweifelt. Genauso hoffnungslos. Zusammen weinten sie auf dem Sofa in seiner Kammer. Lilia brachte dem Großvater Tee und Essen, da er sich weigerte in die Stube hinunterzusteigen. Auch wenn dort der Ofen brannte, und er seine eiskalten Hände hätte wärmen können. Den Tee trank Lilia. Das Essen brachte sie Mama-Tante zurück.
Der Vater reagierte mit Wut auf seines Vaters Dickschädel und setzte sich ab. Mama-Tante heulte vor sich hin. Der Zeiger der Uhr rückte nicht von der Stelle. Die Tage schlichen wie Monate einher. Keine Besserung zeigte sich. Sie waren vier Menschen, vier Kontinente, weit voneinander entfernt, außer Hör-, Sicht- und Spürweite. Kein Zueinanderfinden gelang. Weder der Vater noch Mama-Tante noch Lilia fühlten sich als Familienmitglieder. Geschweige denn der Großvater. Jeder war Gefangener seines Elends. Woher sollte Kraft kommen, um sich des Großvaters anzunehmen, ihm ein Daheim zu bieten. Sein Leid zu lindern. Und sich um ihn zu kümmern? Der Großvater verwahrloste, seelisch und körperlich. Auch wenn Mama-Tante sich Mühe gab, ihm einigermaßen gerecht zu werden. Da es an Geld fehlte, zerlumpten seine Kleider. Der Tag rückte heran, an dem Mama-Tante Großvaters Hosen und Jacken nicht mehr flicken konnte. Lilia musste sich zum Vater bemühen und um neue Kleider für den Großvater betteln. Und der Vater ließ sich erweichen und ging mit dem Großvater das Notwendigste einkaufen.
Dem Vater gehörte mittlerweile ein Auto, ein Opel, das erste und einzige Auto im Quartier. Die Leute zerrissen sich das Maul darüber. spotteten über den Herrn Doktor, dessen Vater in Lumpen gehe. Für Lilia Qual über Qual. Sie hätte dem Großvater so gerne geholfen. Nur wie? Für den Vater schämte sie sich. Er war hart und kalt geworden. Ihn kümmerte nicht mehr, was zuhause lief. Er war es müde, Zahlvater zu sein. Er war es müde, um Lilia zu kämpfen, immer und immer wieder. Denn Lilias Mutter gab keine Ruhe, versuchte jeden Trick, um ihrer Tochter habhaft zu werden. Und Lilia machte ihm so wenig Freude. Ihr Verständnis von Zahlen war katastrophal. Nie würde sie lernen zu rechnen, wie es sich gehörte. Nur Geschichten hatte sie im Kopf, wirres Zeug, mit dem er nichts anzufangen wusste. Sein Leben war eine einzige Tortur. Das Auto tröstete ihn, konnte er damit doch Reißaus nehmen, wenn er zuhause das Nörgeln der Tante und das Flennen seiner Tochter nicht mehr aushielt, und zuschauen musste, wie der Großvater sich hängen ließ, nicht den geringsten Funken von Eigenständigkeit mehr aufbrachte.
Der Besitz des Autos bedeutete für den Vater mehr als nur Trost. Im Geschäft verbesserte es sein Prestige. Sein Chef hatte ihm nahegelegt, es sei an der Zeit, das Fahrrad an den sprichwörtlichen Nagel zu hängen. Des Vaters Karriere fordere diese Maßnahme.
Hin und wieder nahm der Vater Lilia mit auf eine Fahrt. Den Großvater ebenfalls, wenn Lilia lieb genug darum bettelte. Nur Mama-Tante nicht. Es kam auch vor, dass Lilia ein Mädchen aus ihrer Straße zum Mitfahren einladen durfte. Gerne wurde es nicht gesehen, doch die Leute gaben um Lilias willen nach. Damit sie nicht so alleine sei mit den Erwachsenen. Meistens fuhr man über Land, und die Kinder kriegten in einem Gasthaus heiße Ovomaltine und ein Stück Kuchen. Der Großvater ein Bier, und wenn es hoch kam, Würstchen mit Kartoffelsalat. Lilias, sich aller Mühseligkeit zum Trotz, immer wieder bahnbrechendem Optimismus war es zu verdanken, dass im Auto gelegentlich gesungen wurde, der Vater einen Witz zum Besten gab, oder der Großvater aus seinem Leben in der Stickereibranche erzählte: aus Zeiten, als Stickereien in Heimarbeit hergestellt wurden. In feuchten Kellern mit schimmligen Wänden. Und die Heimarbeiter an Rheuma und anderen Krankheiten, hervorgerufen durch Armut und Entbehrung litten. Weil ihnen nichts anderes übrig blieb, als sich für ein paar Batzen zwölf Stunden am Tag in bitterer Kälte abzumühen.
Die Monate zogen dahin. Der Großvater wurde zu schwach zum Reisen. Ein Schlaganfall fesselte ihn ans Bett. Und Lilia wachte mitten in einer Nacht auf, weil aus dem Zimmer des Großvaters ein Keuchen und Röcheln erklang, das sie nie im Leben gehört hatte. Sie schrie nach Mama-Tante, und es dauerte lange Augenblicke bis sie die Treppe hinunterkam. „Du musst jetzt tapfer sein, Lilia“, sagte sie, „der Großvater ist schwer krank. Der Pfarrer wird bald kommen und ihm die Letzte Ölung geben.“ Was das bedeutete, wusste Lilia. Mama-Tante kramte silberne Kerzenständer, von deren Existenz Lilia nichts gewusst hatte, aus einem Tuch, das in einem Winkel ihres Schranks lag. Dann erklang ein Glöcklein vor dem Haus, und kurz darauf geleitete Mama-Tante den Pfarrer und einen Ministranten die Stiegen zur Kammer des Großvaters hinauf. Da ihr eigenes Zimmer genau darunter lag, vernahm Lilia jedes Wort, das im Obergeschoss gesprochen wurde. Gebete wurden rezitiert, das Glöcklein erneut angeschlagen. Da hielt es Lilia nicht mehr im Bett. Trotz der Eiseskälte kniete sie sich auf das Schaffell vor ihrer Kommode, auf der sie aus winzigen, zinnernen Messgeräten einen Altar gebaut hatte und begann mit dem Pfarrer um die Wette zu beten, so inständig, dass sie Umwelt und Kälte darob vergaß.
Der Pfarrer war längst wieder gegangen, ebenso wie der Arzt, der gerufen worden war. Nur Lilia kam nicht zur Ruhe. In schierer Todesangst rechtete sie mit Gott um das Leben des Großvaters, fordernd wie stets, wenn sie keinen Ausweg sah. Wimmernd wie ein Tier in der Falle. Besinnungslos vor Angst. Als krieche der Tod in jede Zelle ihres eigenen Körpers. Wie Schleim. An ihr fressend, wie bösartiges Gewürm. Sie merkte nicht, dass im Haus längst wieder Ruhe eingekehrt, das Keuchen und Röcheln verstummt waren, und Mama-Tante zu Bett ging. Wogen von Entsetzen, von gleißendem Gebet, ohnmächtigem Gestammel schüttelten sie. Bis sie irgendwann zu Boden glitt, einschlief und erst wieder zu sich kam, als sie, steif vor Kälte, erwachte. Lilia verkroch sich wie ein geprügelter Hund ins Bett. Als Mama-Tante sie am Morgen weckte und sagte: „Es geht dem Großvater besser, du darfst ihm eine Tasse Kaffee hinaufbringen“, erinnerte sich Lilia an die Ereignisse der Nacht. Ihren Beitrag dazu behielt sie für sich. Doch das Gefühl, gute Arbeit geleistet zu haben, bestärkte sie in der Annahme, mit Gott lasse sich geschäften - wenn man sich nur konsequent genug dafür einsetze.
Lilia liebte den Heiland über alles. Ohne ihre Anhänglichkeit an ihn hätte sie nicht überlebt. Nur nicht den Heiland, den die Kirche anbot. Der erschien ihr zu gering. Zu mager. Zu körper- und machtlos. Der Kirchenheiland konnte ihr nicht die Stange halten. Dafür brauchte Lilia einen potenteren Gegenspieler. Sie wusste nichts anzufangen mit einem Heiland, der buchstabengetreuen Gehorsam forderte, und dem Gläubigen keine Chance ließ, sich eigene Meinungen zu bilden und, falls nötig, an der Grenze der Gottlosigkeit entlangschrammende Hilfe zu erflehen. Lilias Heiland taugte nicht für Angepasste, die zu Kreuze krochen, weil ihnen der Mumm zur Gegenwehr fehlte. Über den Heiland dachte Lilia auch nicht nach. Ihre wortlose Sprache kannte kein gegenständliches Gegenüber. Was ihr begegnete, was sie sah und erlebte, geschah nur in ihrem Innern. Lief in einer Art von Raum in ihrer Brust ab. Als befinde sich dort eine Bühne. Und sie schaue den darauf Agierenden zu. Leide gleichzeitig mit. Stehe selbst im Geschehen - und bleibe doch unbeteiligt. Alles, durch das Lilia hindurchging, fand in diesem Raum statt: der größte Schmerz, die lichtvollste Ekstase. Es gab nur diesen einen Raum, um sie wahrzunehmen.
Lilia fragte sich auch nicht, warum nichts von dem, was sie in seltenen Momenten auszudrücken versuchte, auf Verständnis stieß, sondern nur auf bösen Widerstand. Warum sie kein liebes Wort dafür erntete, nur Vorwürfe, Flüche, Ohrfeigen. Oder, wenn es besonders schlimm kam, der Vater einen Fuß auf die Treppe stellte, sie übers Knie legte, und ihr den Hintern mit ihrem Kinderbesen verdrosch. Lilia bewohnte den Raum in ihrer Brust wie eine Kapsel. Der Außenwelt begegnete sie je länger desto mehr mit Misstrauen und Ablehnung. Meistens fühlte sie sich im falschen Film. Das Bewusstsein, dass ohne ihr Dasein Leben für andere Menschen leichter ginge, setzte sich wie eine Krake in ihrem Gemüt fest. Eine lebensverneinende Krake. Die sie zu zermahlen trachtete - bis nichts mehr von ihr übrig wäre und sie, wie der Vater sagte, zu einem normalen, fröhlichen Kind würde.
Deshalb schickte der Vater Lilia zur Spieltherapie, wo ein Fräulein Halbeisen sie in einem Raum, angefüllt mit Regalen voller Spielsachen empfing. Lilia solle auswählen, wozu sie Lust habe und so lange damit spielen, wie es ihr gefalle. Lilia fand die Spielsachen toll, die Teddys in allen Größen süß, das Fräulein nett, nur konnte sie nichts damit anfangen. Zum Spielen hatte Lilia kaum Zeit gehabt, zumindest keine innere Zeit. Auch nicht, wenn Lilia mit dem Vater auf einer Bergwiese saß, Silberdisteln bewunderte, der Vater mit ihr ein Wasserrad für den Bergbach baute, und sie beim Sennen kuhwarme, schäumende Milch tranken. Denn es gab in Lilias Leben kein Ausruhen. Der unweigerliche Absturz in den Alltag erhielt nur Aufschub, die Anspannung blieb.
Während Lilias Kindheit herrschte der Heiland als oberste Instanz im Raum ihrer Brust. Teilweise aus Angst, es sonst mit ihm zu verderben, teilweise aus Mangel an Alternative. In der Primarschule erhielt Lilia, wie alle katholischen Kinder, religiöse Unterweisung zur Vorbereitung auf die erste Kommunion. Jede zweite Woche trafen sich die Kinder bei Nonnen in einem Kloster in der Stadt. Ein Pfarrer unterrichtete sie in Bibelkunde, und sie hörten Geschichten über Heilige, lernten den Begriff „ein heiligmassiges Leben“ kennen, ohne sich etwas darunter vorstellen zu können, zumindest was Lilia betraf. Manchmal durften sie sich Schmalspurfilme anschauen, mit Charly Chaplin oder Mickey Mouse. Und zur Vesperzeit wurden riesige, mit Käse und Wurst gefüllte Brote verteilt sowie Tee ausgeschenkt.
Und am Karfreitag zeigte der Pfarrer eine Tonbildschau über den Kreuzweg Jesu. Dazu lasen Nonnen die entsprechenden Texte vor. Die Dias stammten aus Rom und zeigten Bilder von berühmten Meistern. Vielen der Mädchen trieben sie Tränen in die Augen. Einige der Buben versuchten, Emotionen mit blöden Sprüchen zu überspielen. Doch je länger die Darbietung anhielt - die insgesamt drei Stunden dauerte - desto stiller wurde es im überhitzten, nach Schweiß, Socken, fettigen Haaren und erregten Buben und Mädchen riechenden Saal. Als alle Peinigungs- und Kreuzigungsdias abgespult waren, ging das Licht an.
Hastig verschwanden zerknüllte Taschentücher in Schürzen- und Hosentaschen. Die Kinder waren erledigt, gebodigt ob der Flut an zur Schau gestellter Gewalttätigkeit, auf die niemand gefasst gewesen war. Kleinlaut drückten sie sich durch die Tür auf den Flur, stolperten die ausgeleierten Stiegen hinunter ins Freie. Die kühle Luft, der hereinbrechende Abend, der vorüberbrandende Verkehr beruhigte die Gemüter so weit, dass Wörter. Sätze. Schreie. Gekicher. Geknuffe und Geschubse ins Gedächtnis zurückkehrten, und Kommentaren freien Lauf ließen. Viele sahen arg mitgenommen aus. Andere nur müde, erdrückt vom Überangebot an Religion. Die meisten fanden, es sei ein lohnenswerter Nachmittag gewesen - vor allem auch wegen des zusätzlichen Kuchens, trotz der Fastenzeit. Die Mägen zumindest waren überfüllt. Ob auch die Herzen, oder nur die überstrapazierten Nerven, musste jedes Kind für sich entscheiden. In Lilia hinterließ der Nachmittag bleibende Spuren. Vor allem Erstaunen darüber, dass alles Gezeigte - Schauerszenen sowie Verklärtes, Hässliches und Herzergreifendes - sich im Raum in ihrer Brust niedergeschlagen hatte. Der Heiland und die Bösen: Sie hausten am selben Ort in ihr.
Am Morgen der ersten Kommunion wachte Lilia voller Enthusiasmus auf. Zusammen mit Mama-Tante hatte sie im Laden ein duftiges, knöchellanges Organzakleid, schneeweiß, mit Sankt-Galler-Stickerei auf der Brust, den Ärmeln und am Saum ausgesucht. Ihre Zöpfe band Mama-Tante wie Schaukeln zu ihren Ohren hinauf und schmückte sie mit Maschen. Lilia trug nigelnagelneue Sandalen und gestrickte Garnsocken. Der Vater fotografierte sie, und die Aufnahmen zeigten ein strahlendes, fröhliches Mädchen, mit leuchtenden Augen und einem Lächeln im Gesicht, das Grübchen in ihre Backen zauberte. Sie sah, dass der Vater sich an ihrem Anblick freute und stolz auf seine Tochter war. Er legte ihr ein goldenes Kreuz um den Hals, zog sie an sich, küsste sie und wünschte ihr alles Glück der Welt zum großen Tag.
Lilia war selig, auch weil sie sich auf die Vereinigung mit dem Heiland freute. Sie fieberte darauf zu, in Erwartung von etwas Mächtigem, das ihr Leben für immer verändern würde, in jeder nur denkbaren Hinsicht. Der in ihr wohnende Heiland würde aus ihr einen verwandelten Menschen machen in einem verwandelten, glücklichen Leben. Alle Sorgen hätten ein Ende.
Am Abend zuvor war Lilia zu ihrer ersten Beichte gegangen, Scheu, Angst und zitternde Erwartung im Herzen. Rein und weiß wie Schnee gehe sie daraus hervor, wurde ihr gesagt. Lilia gab sich Mühe, die gelernten Sprüche und Bekenntnisse einwandfrei an den Pfarrer zu bringen. Es gelang. Und als sie die Tür des Beichtstuhls aufmachte und geläutert in die Welt trat, erschien ihr diese transparent und funkelnd, wie getaucht in vibrierendes Licht, das durch Kirchenfenster gleitet. Und plötzlich war ihr, sie werde aufgehoben. Der Boden wich für Sekundenbruchteile unter ihren Füssen, und sie wurde getragen wie auf Flügeln. Furcht und Ekstase durchloderten sie. Ihr Herz hämmerte.
Die Beichte blieb das unvergesslichste Ereignis ihrer Erstkommunion. Denn während des Hochamts am Tag darauf schnitten die neuen Sandalen wie Messer in ihre Fersen. Sie konnte kaum gehen. Und als sie auf den Altarstufen kniete, und der Heiland auf ihre Zunge gelegt wurde, konnte sie kaum schlucken vor Schmerz. Nichts Zusätzliches geschah. Kein Licht schien auf. Kein Glückgefühl zeigte sich. Nichts Heilandsmässiges fand sich in ihr, so ausgiebig sie auch suchte. Lilia war enttäuscht, auch wenn sie die Enttäuschung für sich behielt und nicht einmal das Beichterlebnis preisgab. Der Vater schenkte ihr zum Mittagessen - für das er extra anständiges Geschirr hatte besorgen müssen, wie Mama-Tante meinte, da einige Gäste eingeladen waren - eine holzgeschnitzte Madonna mit Kind, eine zierliche, ihr Kind liebevoll anlächelnde. Wenigstens dafür habe er sich nicht lumpen lassen, stellte Mama-Tante grummelnd fest. Lilia war begeistert und inzwischen wieder voller Hoffnung, dass doch noch alles gut würde - und sehr stolz auf des Vaters großzügiges Geschenk.

- Emigranten-Bohème
Seit einiger Zeit besaßen Oma und Opa ein Haus in der Südschweiz, über der Stadt und dem See gelegen, umstanden von Bergen, die am Morgen wie Schemen aus gleißendem Dunst ins Sonnenlicht traten und abends blau und violett in die Schatten der Nacht zurückglitten. Das Haus, eine Villa in lombardischem Stil mit Turm und Loggia, stand in einem weitläufigen Park, mit einer Pergola voller Reben als Auffahrt, mit Palmen, Feigen- und Bananenbäumen und prächtigen Blütenstauden in allen Farben. Zum See hin stützte eine zehn Meter hohe Mauer das Grundstück. Darunter lag die, zu Anfang noch ungepflasterte Straße. Es war ein Paradies, auch für Lilia, die trotz Anwesenheit der Mutter in ihren Ferien dort auflebte. Und ebenso, weil Oma, unten in der Stadt und in ähnlichen Anwesen am Berghang Leute kannte, wie sie Lilia niemals zuvor getroffen hatte. Wenn Oma ausfuhr, bestellte sie ein Auto mit Chauffeur, immer dasselbe mit dem immer gleichen Fahrer in Uniform. Es handle sich dabei nicht um ein Taxi, betonte Oma, sondern um ein Auto eines privaten Unternehmens, das Wert darauf lege, zu besonderer Kundschaft besondere Sorge zu tragen. In manchen Dingen war Oma ein Snob.
Der Chauffeur fuhr Oma auch gelegentlich zur Villa Bonifazio, die Deutschen gehörte. Sie besaßen Silberminen in Brasilien. Lilia erfuhr es von der Mutter. Laut wurde darüber nicht gesprochen. Die Leute waren erstaunlich, auf eine für Lilia aufregende Art exzentrisch und verrückt. Offensichtlich schwammen sie im Geld. Innenarchitekten verwandelten immer wieder Räume oder Flure durch wechselnde seidene Baldachine in exotisch anmutende Preziosen. Eine Art Tanzsaal bekam eine im Renaissancestil geschnitzte Decke mit hängenden Zapfen, Rosetten und Lilien in verschiedenen Farben. Auf einem Podest im weitläufigen Salon, mit Blick auf See und Berge durch hohe, abgerundete Flügeltüren, thronten samtene Sofas, in denen man so tief versank, als seien es Bäuche butterweicher Tierkörper. Links und rechts davon standen Stehlampen aus chinesischen Vasen mit seidenen Schirmen, die zwei Buddhastatuen flankierten, lebensgroße Buddhas aus schwarzem Marmor, die magische Anziehungskraft auf Lilia ausübten. Überirdische Stille umwaberte sie, als seien sie allein auf weiter Flur, als könne sie nichts, aber auch gar nichts aus ihrer Versenkung aufstören. Sie waren mit sich und in sich vollkommen. Und dadurch verliehen sie dem Raum eine Präsenz, die Lilia an Ort und Stelle festnagelte, als sie ihn zum ersten Mal betrat. Sie war hin und weg von den Buddhas, vergaß sogar zu grüßen, obwohl die Hausherrin an Ausgefallenheit den Buddhas in nichts nachstand - deren Gelassenheit allerdings nicht auf sie abzufärben schien. „Schrill“ hätte Lilia die Erscheinung der Frau genannt, hätte sie das Wort damals schon gekannt. Sie trug Seide, und der Ausschnitt ihres Kleides ließ tief blicken. Darin, und darüber hinaus bis zum Bauchnabel, hingen Ketten über Ketten, an denen Buddhahändchen baumelten, in Gold, in Edelstein, in Holz geschnitzt. An ihren Fingern blitzten Diamanten, und im Haar steckten Spangen, kunstvoll ziseliert. Was hätte billig, überdreht und geschmacklos wirken können an der Dame des Hauses, fand sich zu einem Gesamtkunstwerk zusammen, das verblüffte, jedoch überzeugte.
Oma und die Signora passten vorzüglich zueinander, Oma in ihrer diskreten Eleganz, die Signora als verspielter Schmetterling. Und Oma und die Signora verstanden sich auch ausgezeichnet. Ohne in irgendeiner Weise Haltung vermissen zu lassen, plauderten, lachten, gurrten sie miteinander, Tee trinkend, Pralinen und Konfekt naschend, an Likörchen nippend. Und Lilia stellte fest, dass auch sie sich in dieser besonderen Umgebung so wohl fühlte, als habe sie nie anderes gekannt. Ihr Ernst verflog. Sie blieb zwar scheu. Aber innen drin öffneten sich Flügel weit und leicht, breiteten sich aus, und Lilia segelte in Licht und Behendigkeit, die sie so nicht kannte. Die in starren Ansichten, Vorbehalten und Geboten festgenagelte Wohlanständigkeit, die der Vater und die Mutter ihr predigten, war wie weggeblasen. Man durfte also leben. Man durfte sich entfalten. Der Fantasie, unbändiger Lust und Freude Tür und Tor öffnen. Und alles ohne dafür gerügt, bestraft, geschlagen oder eingesperrt zu werden. Was für eine Entdeckung für Lilia!
Für ganz in Ordnung hielt Oma die Familie der Signora wohl doch nicht. Hinter vorgehaltener Hand tuschelte sie zuhause mit der Mutter. Wörter wie Sklavenhaltung, im Zusammenhang mit Silberminen fielen. Etwas schien nicht so sauber zu sein, wie es den Anschein machen sollte. Die Vornehmheit der Familie verleitete zu Zweifeln. Doch Oma hielt das nicht davon ab, die Gastfreundschaft der Signora auszukosten. Und eine Seite ihres Charakters auszuleben, der es sonst an Nahrung gebrach.
Hin und wieder fuhren Oma, die Mutter und Lilia auch zu einem, in einem lauschigen Wald versteckten Anwesen am See, zu einem Gebäude, das Lilia Rätsel über Rätsel aufgab. Es war in fernöstlichem Stil gehalten.
In Nischen an den Mauern brannten diskret funkelnde Laternen. Teppiche hingen an den Wänden, von der Decke bis zum Boden. Im Dämmerlicht erkannte Lilia Tänzer und Tänzerinnen in Tempeln oder Schlössern darauf. Pferde mit Menschenköpfen. Delphine auf denen Göttinnen ritten, zumindest kam es Lilia so vor. Wagen mit feuerspeienden Rädern rasten über Himmel. Und schaurige Gnome mit Flügeln und Fratzengesichtern bewachten Tore, die von Gold nur so strotzten. Und all das war in diffuses, Umrisse nur erahnenlassendes Licht getaucht. Ein subtiles, gekonntes Spiel: Helles, das sich Schatten anheimgab - Schatten, die Helles umschmeichelten. Eine Märchenwelt aus „Tausend und eine Nacht“. Abgehoben. Wollüstig. In höchstem Masse kunstvoll und erlesen.
Oma kannte den Besitzer. Bei jedem Besuch erzählte er von Zimmern, die er neu habe einrichten lassen, von Kunstkäufen aus fernen Ländern, von Dingen, von deren Existenz Lilia bestenfalls aus Büchern vage wusste. Die Mutter und Lilia blieben im Parterre, wenn der Hausherr Oma durch die Räume führte. Lilia kriegte Limonade. Der Mutter wurde von einem Diener in wehendem Gewand Tee und Konfekt serviert. Das Wort „Puff“ kannte Lilia schon, und zwar durch den Vater, wenn er Mama-Tante eine Hure schimpfte, die in einen Puff gehöre. Doch seine Bedeutung verstand sie nicht. Auch schien das Wort auf dieses Haus nicht zu passen. Selbst wenn es etwas seltsam Anrüchiges ausstrahlte. Möglich, dass der Hausherr es mit seiner Dienerschaft allein bewohnte. Dass vielleicht an seiner unglaublichen Sammlung exquisiter Kunst ein Makel haftete. Das Haus war leer, wenn Lilia es mit Oma und der Mutter besuchte. Kein Geräusch ließ sich hören. Und an das Gesicht des Besitzers erinnerte sich Lilia stets nur verschwommen.
Es war ein prächtiges Gesicht. Ein bärtiges mit gelockter Haarpracht, wachen, lauernd blickenden Augen. Und gleichzeitig von ungeahnter Sanftheit des Ausdrucks. Zu einem Menschen gehörend, der nur in sich selbst. Mit sich selbst lebte. Und von seiner Umwelt nichts zu erwarten schien. Der Mann war schlank und wendig wie ein Rohr. Bewegte er sich, raschelte sein wadenlanger, seidener Kaftan. Er trug meistens Weiß, das im Licht der getönten Lampen einen goldenen Schimmer annahm, so wie seine Haut. Lilia fragte sich, ob er das Haus, diesen Palast umgeben von einem überaus gepflegten Park, je verlasse. Einesteils glich er dem sprichwörtlichen Lebemann. Andererseits kam er Lilia vor wie ein Mönch. In sich versunken. Allein in einer Welt, die zwar von Schätzen strotzte. Doch ohne die er genausogut hätte leben können.
Lilia getraute sich nicht, Oma nach dem Woher des Mannes zu fragen. Oma erwähnte ihn und die Besuche in seinem Haus mit keinem Wort. Und obwohl Lilia nie hinter das Geheimnis des verwunschenen Ortes kam, lernte sie dort manches über Menschen, besonders über Oma kennen. Züge kamen an ihr zum Vorschein, die das Tageslicht zwar nicht scheuten, doch auch nicht suchten. Die Vielschichtigkeit des Menschseins offenbarte sich Lilia in neuem Licht: Untergründiges das Vordergründiges überschattete, zeigte sich. Oma als Meisterin des Versteckspiels. Oma als Zauberin, sogar als Hexe. Oma, die ein Leben für sich entdeckt hatte, das in Lilia etwas wachkitzelte, das sie erst entfernt ahnte. Und das zu manifestieren sie sich nicht zutraute. Noch lange, lange nicht.
Ein weiteres Lieblingsanwesen von Oma gehörte einem Maler, einem Emigranten, so wie es auch der Besitzer der Liegenschaft am See war, der mit russischem Akzent sprach, der Maler dagegen mit ungarischem. Lilia erwählte sein Haus zu ihrem Lieblingshaus. Wieder in lombardischem Stil gehalten, bestand es aus drei Stockwerken. Im obersten befand sich des Malers Atelier, ein Raum, der sich über die ganze Fläche des Hauses erstreckte, einschließlich des Turmzimmers, dessen Wände herausgebrochen waren. Breite, dem Nachmittag zugewandte Fenster erlaubten ausgeglichene Beleuchtung. Von hoher, hagerer Gestalt gehörte dem Maler eine Stimme, die Lilia beim ersten Hören den Atem verschlug. Er kam mit seiner Frau zu Besuch, beugte sich tief hinunter zu Omas Hand, hauchte einen Kuss darüber hinweg, und schnurrte. Gurrte. Tremolierte tief im Bauch, wie aus den Eingeweiden eines Cellos heraus: „Was für eine Freude, Sie zu sehen, Gnädigste.“ Als versierter Tänzer bewegte er sich pantergleich auf den Sessel zu, den Oma ihm anbot, ließ sich darauf nieder mit einer Grandezza, als gehöre ihm die ganze Welt. Beugte sich leicht vor, um ja kein Wort zu verlieren von dem, was Oma sagte.
Oma begrüßte inzwischen die Gattin des Malers, eine kleingewachsene, pummelige Person, die ihrem Gatten nur knapp bis zur Brust reichte. Sie trug einen türkisfarbenen, kunstvoll um den Kopf gewundenen Turban und fast an jedem Finger einen pompösen Ring. Dazu ein wollenes Kostüm, kombiniert mit einem gemusterten Seidentuch, das üppig wie ein Vorhang über ihre Schultern drapiert lag. An der Leine führte sie einen Hund, von dem Lilia nur wusste, wo Kopf und Schwanz sich befanden, weil er Oma anbellte. Sein Körper war über und über mit langen, grauen Zapfenlocken behängt, unter denen auch seine Augen verschwanden.
Ganz anders als ihr Mann gurrte, noch schnurrte seine Frau. In krächzend rauhem Tonfall beantwortete sie Omas Gruß mit unterdrücktem Vorwurf und leicht angriffiger Stimme. Von Lilia nahm der Maler erst Notiz, als Oma sie ihm vorstellte. Die Mutter hielt sich wie immer im Hintergrund, darauf bedacht, Oma vor Ausrutschern zu bewahren, als Anstandswauwau der Extraklasse, leicht indigniert, wenn Oma zu sehr in Fahrt geriet, doch machtlos. Denn in Anwesenheit ihrer Freunde scherte sich Oma keinen Deut um ihre Tochter, gab sich wie es ihr gefiel. In Feierlaune erhob sie sich ohne Mühe über die, von ihrer Familie vorgelebte und untermauerte Etikette. Als Dame von Welt genoss sie ungeniert, was das Leben ihr an Speziellem und Andersartigem bot, mochte sie zuhause auch noch so kirchentreu und konservativ erscheinen: hier war sie Mensch, hier wollte sie es sein.
Geld hatte der Maler nie. Steuern bezahlte er keine, obwohl jedes Jahr in Nobelkurorten Ausstellungen seiner Bilder stattfanden. Er verdiente gut. Nur war er nicht bereit, seine Gewinne mit einem Staat zu teilen, der ihm den roten Pass zu lange nicht gegönnt habe, wie er fand. Also gab er opulente Gelage für seine Kunden und legte den Rest seiner Einnahmen in Kunstwerken an. So brachte er jeweils einen gotischen Flügelaltar mit nach Hause, oder einen mit silbernen Pfauen bestickten, chinesischen Paravent. Jedes Zimmer seines Hauses war in anderem Stil möbliert. Es gab ein marokkanisches Zimmer, eines im Stil von Louis dem Vierzehnten, ein barockes, natürlich ein chinesisches und ein japanisches, das mit einer Samurairüstung samt Helm und Schwert überraschte. Eine Putzfrau bezahlen konnte und wollte der Maler nicht. Seine Frau musste das Haus und seine Schätze in Ordnung halten, weswegen sie sich einmal übers andere bei Oma und der Mutter beschwerte, ihren Mann einen Halunken, einen Tunichtgut und Tagedieb nannte: schnatternd und keifend, obwohl sie innig an ihrem Mann hing. Eine Scheidung stand außer Frage, auch wenn ihr Mann sie ständig betrog. Früher war sie Tempeltänzerin gewesen: am russischen Hof, in Persien, wo auch immer. Sie zeigte Lilia Fotos aus jenen Tagen. Eine Schönheit war sie gewesen und sehr beliebt, umschwärmt, weil unantastbar. Mondgesichtige, zarte Jünglinge von makellosem Wuchs assistierten bei ihren Tänzen. Schweinekram nannte sie, was Männer mit Frauen trieben und warnte Lilia davor, sich je darauf einzulassen. Sie erhielt fürstliche Geschenke von ihren Bewunderern: Einen zarten Wandbehang etwa, auf den mit Seiden- und Silberfäden eine Landschaft von überirdischer Anmut gestickt war: Bäume. Hütten. Ein Fischer mit einem Kahn - in einer Manier, die keinem Antiquar seine Herkunft verriet. Jedoch unzweifelhaft ein kostbares Stück. Den Teppich schenkte sie später Lilias Onkel mütterlicherseits. Und von ihm erbte ihn schließlich Lilia - sowie die eine Hälfte einer gewichtigen, chinesischen Mandarinkette, deren Alter ebenfalls im Dunkeln blieb. Kleine, feixende und weinende Gesichter, aus dunkelrotem Holz geschnitzt, Edelsteine und bunt bemalte Glasperlen schmückten sie. Der andere Teil der Kette blieb in der Familie der Mutter, auch der elfenbeinerne Totenkopf, der die Mitte der Kette innegehabt hatte.
Jahre danach erzählte die ehemalige Tänzerin Lilia von der Hochzeitsnacht mit ihrem Mann. Wie er sie genommen. Wie sie sich gegraust habe, geekelt. Wie sie danach schimpfend ins Bad gelaufen sei um sich zu waschen. Und ihn von da an nie mehr an sich rangelassen habe. Selbst wenn er sie deswegen nach Strich und Faden hintergehe: Mit schwerreichen Inderinnen, Deutschen, Perserinnen ohne Moral, mit jedem Rock, dessen er habhaft werden könne. Sie schrieben ihm sogar nach Hause, diese Flittchen. Rosarote oder violette, parfümierte Briefchen, die sie anwiderten. Sie ziehe Handschuhe an, um sie auf seinen Nachttisch zu legen. Innerlich lachte Lilia über diese Ergüsse, amüsierte sich köstlich beim Zuhören. Doch gleichzeitig bedauerte sie die Frau.
Manchmal verabredete sich Oma mit dem Ehepaar in einem der besonders von Emigranten beliebten Kaffees in der Altstadt. Dann erhielt Lilia heiße Schokolade mit Sahne. Serviererinnen trugen auf Etagèren exquisite Törtchen zum Tisch, die sogar Lilia mochte. Und der Maler, der Noldi hieß, zauberte für sie, zog sich Geldstücke aus der Nase oder den Ohren, ließ Lilias Armbanduhr verschwinden und fand sie unter ihrem Teller wieder. Nur einen Papagei auf den Bügel einer der Wandleuchten zaubern wollte er nicht. Dafür müsse sie sich gedulden. Wenn sie grösser sei, werde er ihrem Wunsch liebend gerne nachkommen.
Lilia ertappte sich dabei dass sie, als sie um die elf, zwölf Jahre alt war, anfing, an dem Maler auf eine Weise zu hängen, die ihr zu schaffen machte. Kam er nun zu Besuch, putzte sie sich heraus. Der Vater hatte ihr ein Deux-piéces mit geradem, wadenlangem Rock, entsprechend der damaligen Mode bewilligt, und Schuhe mit kleinen Absätzen und einem Loch an der großen Zehe, die sie höllisch drückten, die sie jedoch tapfer trug, wenn die Gelegenheit es erforderte. Und für einmal schien dieser Aufzug auch den Ansprüchen der Mutter zu genügen. Unter der Jacke trug Lilia eine dünne, gelbgemusterte Bluse und ein Sträußchen aus handgearbeiteten Strohblümchen am Revers. Wie eine kleine Dame sah Lilia in diesem Aufzug aus und fühlte sich auch so.
Lange bevor der Maler bei Oma erschien, fing Lilia innerlich an zu zittern. Ein Ziehen im Herzen, im ganzen Körper plagte sie. Sie versteckte sich, in der Hoffnung, der Maler werde nach ihr suchen, was ihm natürlich nie einfiel. Und schellte die Hausglocke, wäre sie ihm am liebsten in die Arme gerannt, so sehr sehnte sie sich nach ihm. In Lilia ging es drunter und drüber. Sie hatte keine Ahnung, was mit ihr geschah. Sie wusste nur, dass sie nichts dringender wollte, als dass der Maler sie in die Arme nähme, wie auf einem Bild von Chagall, das sie gesehen hatte, und mit ihr weit, weit hinauf in einen glühend roten Himmel flöge. Und dann wären sie für immer eins und zusammen.
Da der Maler Lilia nicht mehr beachtete, als er es mit irgendeinem Kind getan hätte, weinte sie nach seinem Weggang stundenlang und ließ sich auch von der Mutter, die sich ratlos über sie beugte, kaum trösten. Lilia war in allen Zellen verliebt, ohne zu wissen worum es sich dabei handelte.
Als Lilia den Maler viele Jahre später wieder traf, erschienen ihr seine prägnanten Gesichtszüge, die einst wie von Künstlerhand gemeißelt ausgesehen hatten, als grob. Fast fratzenhaft. Und sein Gebiss, von der Zeit verfärbt, wie dasjenige eines Pferds. Nur seine Stimme versprühte noch den gleichen Charme. Er starb ganz gewöhnlich an Altersschwäche. Ohne jede Magie. In Lilia rührte sich nichts, als sie die Nachricht erhielt.
In der Altstadt am Seeufer gab es zudem ein Antiquitätengeschäft, dessen Besitzer Oma ebenfalls kannte. Sie besuchte das Geschäft regelmäßig mit der Mutter und Lilia. Vermögenden wurde dort jeder Wunsch erfüllt, selbst wenn es sich um die Beschaffung von Kunstwerken handelte, nach denen am Ende der Welt gesucht werden musste. Irgendwann standen sie in voluminösen Kisten im Laden bereit, um abgeholt zu werden. Welche Wege sie auf ihrer Reise zurückgelegt hatten, ging niemanden etwas an. Der Besitzer des Ladens, ein guter Kunde von Omas und Opas eigenem Geschäft, erklärte Oma während eines ihrer vielen Gespräche, er erkenne jedes, absolut jedes noch so kleine Schmuckstück oder Kunstwerk, das je durch seine Hände gegangen sei, falls er es wiedersehe.
Lange danach, als Oma und der Maler längst tot waren, wollte Lilia, die des Händlers Beteuerung beeindruckt hatte, herausfinden, ob sie der Wahrheit entspreche. Von Oma hatte sie einen Anhänger aus Bernstein mit einem Amethysten in der Mitte, der an seidener Kordel hing, geerbt, ein Schmuckstück, das durch seine raffinierte Bescheidenheit bestach. Zu diesem Zweck stöberte Lilia an einem Dienstag, an dem sie zu Besuch in der Stadt weilte, in dem Laden herum - aus dem inzwischen alle Buddhas und übrigen Kostbarkeiten verschwunden waren, und der nun alltägliche „Antiquitäten“ feilhielt, den Touristenströmen, die die Stadt durcheilten, Rechnung tragend.
Nach einigen Momenten trat der, zu einem schmächtigen, ausgezehrten Männchen zusammengeschrumpfte Besitzer aus seinem Büro, um sie nach ihren Wünschen zu fragen. Immer noch war er sorgfältig gekleidet und gekämmt. Doch der enthusiastische Glanz in seinen Augen war erloschen. Und sichtbare Schwermut beugte seinen Rücken. Er begrüßte Lilia, schaute ihr in die Augen. Schaute auf ihre Brust. Und ein Leuchten flog über seine Züge, als er sagte: „O, dieser Anhänger wurde in meinem Laden gekauft. Ich erkenne ihn!“ Lilia war baff. Der Händler fragte Lilia, wo sie ihn herhabe, und Lilia erzählte von ihrer Großmutter, dem Maler, den Minenbesitzern und anderen ehemaligen Kunden des Geschäfts, die sie als Kind getroffen hatte - die einen mittlerweile tot, andere als Gäste in Seniorenresidenzen weilend. Es wurde ein freundschaftliches Gespräch über vergangene Zeiten. Nur noch eine der Villen, in denen Oma ein- und ausgegangen war, stand. Die übrigen waren von den Erben verkauft, abgerissen und durch moderne Bungalows ersetzt worden, die ohne Hilfe von Personal bewohnt werden konnten. Lilia war es gerade noch vergönnt gewesen, Splitter dieser schillernden Nachkriegs-Emigranten-Bohème mitzuerleben - an die sie noch Jahrzehnte später hauchfeines Porzellan, gezeichnet mit dem Stempel der ungarischen Krone, und handgeschmiedetes Reinsilberbesteck aus russischem Fürstenhaus erinnerte, das sie an Festtagen auf Omas Lieblingstischtuch, geschmückt mit üppigen Klöppelspitzen stellte. Stolz. Jedoch auch in leiser Wehmut über den Wandel der Zeit. Verbunden mit dem Wissen, dass sie all das irgendwann leichten und dankbaren Herzens verkaufen werde.
Im schmalen, ungepflegten Rasenstück, das einige mehr schlecht als recht blühende Strauchrosen sowie Winterastern säumten, und in dem auch das Schildkrötengehege seinen Platz gefunden hatte, stand ein Pfirsichbaum, den Lilia und Mama-Tante vor Jahren aus einem Kern gezogen hatten. Sein Stamm war gedrungen. Die Äste breiteten sich über den halben Rasen aus wie ein Schirm. Der Baum trug jedes Jahr so viele Früchte, dass seine Zweige mit Pfählen gestützt werden mussten. Da der Baum ebenfalls keine Pflege erhielt, nie geschnitten wurde, war er in der Mitte auseinandergebrochen, und Lilias Vater hatte ihn mit Stoffbändern zusammengebunden. Die Wunde heilte, doch bildeten sich grobe Wülste schorfiger Borke darumherum. Dessen ungeachtet produzierte der Baum unverdrossen Pfirsiche, massige. Mit orangem Fleisch, süß wie Konfitüre.
Als Mama-Tante wegen einer Unterleibsoperation im Spital lag, packte Lilia eine Basttasche mit Pfirsichen voll und schnallte sie auf den Gepäckträger ihres Kinderfahrrads, um Mama-Tante damit zu überraschen. Das Essen sei nicht gerade großartig, hatte Mama-Tante verlauten lassen. Und Lilia hoffte, es mit ihrem Mitbringsel ein bisschen aufzupeppen.
Mama-Tante belegte mit drei anderen Frauen ein Vierbettzimmer. Um ihre Verlegenheit und Scheu zu überspielen, drückte Lilia die Tasche voll gespielten Übermuts auf die Bettkante neben Mama-Tantes Arm. Einige der vollreifen Früchte zerplatzten und hinterließen einen braunen Fleck auf dem Leintuch. Mama-Tante schalt Lilia wohlwollend und schob die Decke darüber. Sie freute sich über die Früchte. Die, die noch essbar waren, legte sie auf das Tablett mit dem Teeglas. Die restlichen gab sie Lilia zum Entsorgen wieder mit.
Obwohl es Lilia und Mama-Tante aus Verlegenheit nicht gelang, ein Gespräch am Laufen zu halten, genossen sie das Wiedersehen. Der Weg ins Spital war weit. Lilia konnte ihn nicht oft zurücklegen. Sie versicherte Mama-Tante, wie sehr sie sich auf ihre Heimkehr freue und beteuerte, sie habe eine Überraschung für sie im Sinn. Mama-Tante solle sich willkommen fühlen, obgleich der Vater Lilia damit gedroht hatte, Mama-Tante nicht mehr ins Haus zu lassen. Nach ihrer Genesung solle sie sich nach einer Wohnung umschauen, und während der Zeit der Suche bei einer ihrer Freundinnen unterkommen, hatte er bestimmt. Er wolle ihr auf keinen Fall wieder begegnen. So wüst die Angst vor dieser Drohung in Lilia wucherte, so entschlossen arbeitete sie an einem Willkommensplakat für Mama-Tante.
Aus Papierstreifen, die sie verschiedenfarbig bemalte, in kleine Stücke schnitt, zu Ringen zusammenklebte, schmiedete Lilia eine Kette, in deren Mitte das Schild mit dem Willkommensgruß hängen sollte. Sie war fast fertiggestellt. Mama-Tante würde am frühen Nachmittag mit dem Taxi eintreffen. Der Vater hatte es empört abgelehnt, sie mit seinem Auto abzuholen. Lilia arbeitete emsig. Die Kette, die die Breite des Treppenabsatzes, der einer Art Vorraum glich, einnahm, hing schon und hielt, zu Lilias Freude, dem Zug stand. Sie war an die drei Meter lang. Das Schild lachte vor Farbe, den Rüschen aus Papier, die Lilia darumherum geklebt und mit Goldflitter überzuckert hatte. Lilia triumphierte innerlich.
Dann wandte sich Lilia der Dekoration des Bettes in Mama-Tantes Zimmer zu. In ihrer Wäschekommode wusste sie ein dunkelblaues Tuch, das sie beide schon oft für Dekorationszwecke benutzt hatten. Das nagelte sie an die Holzwand über dem Bett, klebte aus Goldfolie geschnittene Sterne darauf, baute mit Schachteln ein Podest auf die Bettdecke, schmückte alles mit Blumen, die sie auf der Wiese hinter dem Quartier pflückte und platzierte zuoberst eine geschnitzte, liebliche Schutzengelfigur, ihr spezielles Willkommensgeschenk, für deren Kauf sie ihr Taschengeld gespart hatte.
Als Lilia Mama-Tantes Zimmer verließ, auf Zehenspitzen, um ja keinen Streit zu provozieren, denn sie hörte den Vater die Treppe hochsteigen, fiel ihr vor Schreck und Anspannung die Schere aus der Schürzentasche, als sie sich bückte, um die restlichen Papierschnitzel zusammenzuräumen. „Was machst du dort oben“, rief der Vater. Lilias Herz stand still. Dann galoppierte es los. Der Vater übersprang drei Stufen auf einmal, alarmiert von Lilias Geheimnistuerei. Als er die Bescherung sah, brüllte er los: „Was fällt dir ein, mir in den Rücken zu fallen. Du weißt genau, dass ich die Tante nicht mehr im Haus haben will. Und du veranstaltest ein solches Theater ihretwegen. Du bist schon genau wie sie: hinterhältig und verlogen. Nimm diesen Dreck sofort runter, oder ich verdresche dir den Arsch. Die Tante kommt mir, ein für allemal, nicht mehr ins Haus!“ Damit machte er rechtsumkehrt und wandte sich zum Gehen, schnaubend vor Wut und Entrüstung.
Lilia, zu Eis erstarrt, brachte keinen Ton zustande. Plötzlich, gewahr werdend, dass zu handeln keinen Aufschub duldete, streckte sie sich, baute sich auf dem Treppenabsatz auf und artikulierte klar und deutlich: „Dann mach ich mich kaputt, jawoll, ich mach mich kaputt, ich schwör’s.“ Es bestand kein Zweifel, dass Lilia ihre Drohung wahr machen würde, soviel verstand der Vater, auch wenn er vor Zorn schäumte. Er rannte die Treppe hinunter in sein Zimmer, wummerte die Türe hinter sich ins Schloss, sodass das Haus erzitterte, und fluchte zum Gotterbarmen, tobte und wütete in seinem Zimmer, Lilia hätte nicht sagen können, für wie lange.
Sie stand immer noch wie angewurzelt da, den Körper steif und hart wie Stahl. Zum ersten Mal hatte sie gesiegt. Zum ersten Mal hatte der Vater auf sie hören müssen. Sie hatte es gewagt, ihm Angst und Schrecken einzujagen. Es war nicht Triumph, den Lilia spürte, nicht die Tatsache, dass der Vater unterlegen war und sich deswegen jämmerlich fühlte. Es war die Tatsache, dass sie sich hatte Gehör verschaffen können, dass jemand gezwungen worden war, ihr Beachtung zu schenken, sie als Mensch, als Persönlichkeit wahrzunehmen. Das zählte. Nach ein paar Minuten, als die Anspannung Lilias Körper verließ, und Erschöpfung sich breitmachte, brach sie auf der obersten Treppenstufe zusammen und weinte herzzerreißend. Sie wusste genau, dass sie nur Aufschub ertrotzt hatte. Sie war sich des Schwertes, das über ihrem Kopf baumelte bewusst. Früher oder später würde der Vater die erstbeste Gelegenheit beim Schopf packen und Mama-Tante rausschmeißen. Spätestens dann. Wenn er. Wie vielfach angedroht. Wieder heiratete.
Als Lilia nach dem dunkelblauen Tuch in der Kommode stöberte, war ihr ein voluminöses, in orange Pappe gebundenes Buch in die Hände gefallen. Es sich anzusehen, hatte sie bei den Willkommensvorbereitungen für Mama-Tante keine Zeit gehabt.
An einem Nachmittag, an dem Mama-Tante Freundinnen besuchte, machte sie sich darüber her. Das Buch war schwer und sehr dick. Die Seiten waren dünn und klein beschrieben. Zeichnungen illustrierten sie. Anfangs verstand Lilia kein Wort beim Überfliegen des Inhalts. Dann beschäftigte sie sich eingehender mit den Zeichnungen. Sie stellten nackte Körper dar, Männer und Frauen, die Lilia an den langen Haaren erkannte, und die in scheinbar unmöglichen Stellungen aneinander klebten. Weshalb, gab Lilia Rätsel auf. Doch ihr eigener Körper reagierte prompt. Ihr wurde heiß und kalt. Das Blut schoss in ihre Wangen. Es begann in ihrem Bauch und zwischen den Beinen zu rumoren. Abscheu und Faszination bemächtigten sich des Körpers. Sie verstand den Text zwar nicht, konnte sich keinen Reim darauf machen. Nur einzelne Wörter blieben in ihrem Kopf wie festgezurrt. Und diese riefen immer stärker eine Revolution in ihren Gliedern hervor, die sie begeisterte und gleichzeitig erschreckte, denn sie spürte, dass sie Unsäglichem begegnete und Verbotenes trieb. Und dass sie Mama-Tante betrog. Schuldgefühle mischten sich in die Erregung. Die Magie überwog.
Lilia erinnerte sich an einen Telefonanruf, während dem ein Mann sie dazu ermuntert hatte, untenherum ihren Körper zu berühren. Sie hatte es nicht getan, denn Mama-Tante unterbrach den Anruf und warnte Lilia vor solchen Männern. Nun traute sich Lilia die Berührung zu und war verblüfft und empört, ertastete sie doch warme, kuschelige Weichheit und gleichzeitig eine Art Salbe, etwas Schmieriges, Feuchtes, das sich nach Tier, nach Schlund, nach etwas anfühlte, das Lilia bisher entgangen war. Unbehagen breitete sich in ihr aus. Geriet sie auf schlüpfriges Terrain, auf abschüssiges Gelände? War es das, was man Unkeuschheit nannte, das, vor dem der Pfarrer warnte? Lilias Körper schien aufzublühen. Aufzubrechen, wie Erdkrumen im Frühling, wenn Tulpen und Narzissen sich mit geballter Kraft daraus hervordrängen, junge Hunde sich hemmungslos im Schlamm balgen, wohlig und ganz ohne Scham. Lilia konnte nicht aufhören, nach sich zu tasten. Sich zu streicheln. Zu reiben. Ihre Hand wurde wie geführt, so als wisse sie von alleine, worum es gehe.
An einem gewissen Punkt explodierte Lilias Körper von unten her bis obenauf. Er tat furchtbar - und doch überhaupt nicht weh. Er jubilierte. Stürmte dahin. Wurde weggetragen wie Wolken. Ohne Ziel. Und dann war es zu Ende. Der Körper sackte zusammen. Das Klopfen und das Schlagen dauerten noch an. Bis auch das verebbte, und Lilia ratlos. Irritiert. Und beschämt zurückblieb.
Hastig versteckte Lilia das Buch. Sie roch an ihren Fingern, die sich klebrig anfühlten, wie Schlamm, Schlick, Moder und noch etwas, für das sie keine Worte fand. Lilia stand auf, schaute sich im Zimmer um, in dem sie Schändliches an Mama-Tante begangen hatte. In dem Furchtbares. Wildes. Doch unfassbar Begehrenswertes in ihr geschehen war.
Lilia sah den mannshohen Spiegel neben dem Ofen, stellte sich davor, so nah, dass ihr Gesicht die Scheibe berührte, und schaute sich an. Sogleich erblindete das Glas unter ihrem Atem. Lilia nahm den Mund davon weg, atmete behutsam, äugte weiterhin in den Spiegel, in ihre Augen. Was, wie sie feststellte, gleichzeitig nicht ging. Das eine Auge schob sich sogleich über das andere. Und nur eines blieb übrig, in der Mitte der Stirn. Lilia rief dieses eine sanft beim Namen, „Lilia, Lilia“, ohne Unterbruch, ein Dutzend Mal oder mehr. Antwort kam nicht. Lilia hielt inne. Da sperrte ein Trichter sein Maul auf in ihrem einen Auge. Gefräßig, erbarmungslos, sich schneller und schneller drehend. Blindwütig. Mit ungeheurer Macht. Lilia verschlingend. Sich einverleibend. Verdauend. Lilia schreckte auf. Kurz vor der Ohnmacht riss sie sich los. Zitternd. Schutz suchend. Zuflucht. Doch sie sah nichts, als sich selbst.
Die Arme eng um den Leib geschlungen, rollte sich Lilia auf dem Schaffell vor dem Spiegel auf den Bauch. Stille brütete über dem Haus. Lilia erinnerte sich des Vaters, gewahrte in sich die Angst, die von seinem Ausbruch an Gewalt noch übrig war, schrumpfte in sich zusammen. War wieder Kind.
Erlebtes verflüchtigte sich schon. Die Schuld blieb. Die Ungewissheit. Die Fragen, für deren Beantwortung sie keinen Partner kannte. Und beichten würde sie das Erlebte sowieso nicht können. Zu grausam erschien ihr die Gefahr gewohnter Repression, eingeübt und in ihrem Wesen festgesaugt wie Blutegel, die zu ihrem Leben dazugehörten wie Essen und Trinken. Wie das Schrecknis des Körpers. Wie Lust, die das Tageslicht scheute. Wie das sich, unverzeihlich, in wollüstig Verbotenes vorwagen.
Die Regelblutung ereilte Lilia als letzte der Klasse und schlug sie zu Boden vor Entsetzen und Schmerz. Nach Stunden von Kampf, während denen keines der gängigen Medikamente anschlug, glitt Lilia in Ohnmacht und fiel erschöpft in tiefen Schlaf. Von Mama-Tante war sie schon vor einiger Zeit auf das unweigerlich zu Erwartende vorbereitet worden. Binden lagen für sie bereit. Doch sich vorstellen - und das Grässliche dann auch wahrhaben, konnte Lilia nicht. Sie weigerte sich mit äußerster Kraft dagegen „Frau zu werden“, wie Mama-Tante das nannte. Und dass das sich Ausbluten nötig sei, um einmal Kinder zu kriegen, überstieg Lilias Fassungsvermögen. Wer sagte, dass sie Kinder überhaupt wollte - da das Kindsein aus Missbrauch in physischer und emotionaler Hinsicht bestand?
Das hastig Überflogene aus Mama-Tantes Buch, brachte Lilia nicht in Zusammenhang mit dem, was ihr Körper ihr antat. Der blutende Abgrund, der in ihr wie ein Tier seinen brünstigen Rachen aufriss: geifernd, heulend und ihre Eingeweide verschlingend, sie in einen dampfenden Krater zerrend - weckte schauriges Ahnen. Drei Tage lang blieb Lilia ans Bett gefesselt, bevor sie auf wackligen Beinen aufstehen konnte und der Gedanke an Brot, Milch und Käse zum Frühstück sie nicht mehr anwiderte. Am vierten ging sie wieder zur Schule, zerbrechlich wie ein rohes Ei.
Lilias Kameradinnen war sofort klar, was sich ereignet hatte. „Na, ist das Bébé erwachsen geworden? Hast du‘s endlich doch geschafft“, höhnten die einen. Und: „Das gibt sich, wenn du es erst einmal gewöhnt bist“, beschwichtigten andere. Doch es gewohnt sein wollte Lilia nicht. Sie fühlte sich besudelt. Stinkend. Wie ein offenes Geschwür. Und hoffte sehnlichst, es sei alles ein Irrtum. Der Körper werde wieder normal, das Schwärende werde vergehen - und nie mehr wiederkehren.
Allerdings kehrte es wieder. Und es wurde nicht besser als beim ersten Mal. Von Mal zu Mal lag Lilia zwei bis drei Tage im Bett. Das Ziehen, das ihren Körper in Stücke riss, ihr Nervensystem in den Grundfesten aufstörte, ließ nicht nach. Lilia nahm sich einen Stapel Bücher ins Bett und legte sich bäuchlings darüber, bis die Medikamente nach Stunden endlich Erschöpfung und Schlaf brachten. Es schien, Lilia blute sämtliches Grauen ihres Lebens aus sich hinaus. Sie hätte gar nicht zur Schule gehen können. Das Blut wäre hemmungslos an ihren Beinen hinuntergelaufen.
Lilia durchlitt unbändige Ängste, die ihr niemand nahm. Mama-Tante stand hilflos da, und der Vater ließ sich so wenig als möglich blicken. Weiberzeug: das mied er. An Verständnis und Trost gebrach es ihm selbst ohnehin. Also verduftete er und wartete das Ende ab. Nur gab es kein Ende. Das Bluten erjagte Lilia zudem unregelmäßig, zeitweise alle drei Wochen. Die Lehrerin wurde beim Vater vorstellig, weil Lilia zu oft der Klasse fernbleibe, beim Turnen fehle, unaufmerksam, weinerlich und schwermütig sei. Lilia musste zum Arzt, zum Psychologen - und schwieg. Schwieg überall. Was hätte sie auch sagen sollen. Sie wurde als verstockt taxiert. Und als nicht therapierbar heimgeschickt. Es wurde beschlossen, der Sache ihren Lauf zu lassen. Lilia Zeit zu geben. So viel Zeit verstreichen zu lassen, bis die Dinge von selbst ins Lot fielen.
Mit dem dunkelblauen Tuch aus Mama-Tantes Kommode verband sich noch ein Ereignis, ein freudiges, auf das Lilia stolz war. Lilias Begeisterung richtete sich auf das Theater. Sie hätte gerne auch in der Schule Theater gespielt, nur stand kein solches Fach auf dem Lehrplan. Also ergriff Lilia selbst die Initiative.
Mama-Tante konnte Lilia für ihren Plan, ein kleines Weihnachtsspiel aufzuführen, sofort begeistern. Bei der Lehrerin dauerte es etwas länger. Die Proben und Vorbereitungen dürften den Unterricht nicht stören, noch unterbrechen, meinte sie zögernd.
Mama-Tante entdeckte in einem Kinderbuch ein kurzes Stück, das von Tannenbäumchen handelte. Das dunkelblaue Tuch diente, wieder mit goldenen Sternen besteckt, als Hintergrund der Szenerie. Lilia und zwei ihrer Mitschülerinnen wurden von Mama-Tante mit grünen Stoffresten und Zweigen in den Haaren und an Armen und Beinen in Tannenbäumchen verwandelt. Ein viertes Mädchen spielte, auf einer Leiter hinter dem blauen Tuch versteckt, einen Engel. Beim entsprechenden Stichwort sollte der Engel die Leiter erklimmen, mit ausgebreiteten Flügeln über das Tuch schauen und anmutig Kunstschnee über die Tännchen streuen. Das Stück begann mit den Versen:
„Ihr Tännchen, schnell, erwacht, erwacht,
Es schlug soeben Mitternacht.
Um diese Stunde, wie ihr wisst,
Die Sprache uns gegeben ist.“
Darauf erzählten die Tännchen den Zuhörern, zu denen auch Familienmitglieder gehörten, wie alle Kreaturen in der Heiligen Nacht miteinander reden könnten: über Kinder. Tiere. Über die Weihnachtsstuben, in die sie durch Vorhangspalten hineinäugten. Über Lichterglanz auf Tannenzweigen und Geschenkpakete darunter. Einige von Lilias Mitschülerinnen grinsten unverhohlen, auch aus Scham, um nicht zu zeigen, wie berührt sie von der Ernsthaftigkeit des Dargestellten waren. Denn die Ernsthaftigkeit kam an. Und auch die Mühe, die sich Lilia gemacht hatte, ein einigermaßen passables Hochdeutsch in ihre Mitspielerinnen hineinzupauken.
Ein kleines Malheur passierte dennoch: als der Engel, zu vertieft ins Zuhören, vergaß, den Kunstschnee auszustreuen, der so zauberhaft auf dem weißen Tuch unter den Füssen der Tännchen im Schein der Kerzen geglitzert hätte. Lilias Zischeln schreckte den Engel auf, und der Schnee fiel. Nur ging dabei ein Lachen durch die Reihen. Kein boshaftes. Ein zustimmendes - das geschmeidig überleitete zu begeistertem Applaus. Lilias Augen strahlten, und ihre Wangen glühten. Niemand missgönnte ihr den Triumph. Noch Wochen danach träumte Lilia den Traum der Tannenbäumchen - auch am Heiligen Abend - ohne den Vater, der sich wieder irgendwohin hatte einladen lassen.
Der Großvater verelendete sichtlich. Trauer umwand ihn wie eine Zwangsjacke. Daraus befreien konnte er sich nicht. Wie auch? Niemand half ihm dabei. Niemand wusste, was dagegen zu tun wäre. Alle waren zu sehr mit sich selbst und der eigenen Verwahrlosung beschäftigt, vor allem der inneren. Nur Lilia kämpfte verbissen dagegen an. Ihr Drachenstolz verbot ihr, sich feige in scheinbar Unabänderliches zu schicken. Wach bleiben, hieß die Devise, Hinsehen. Schauen, schauen, schauen. Sich nichts entgehen lassen. Sogar noch den verborgensten Fallstrick ertappen. Sich weder von links noch von rechts übertölpeln lassen, weder von den Erwachsenen noch von eigener Schwäche. Es gab ja etwas zu verlieren. Das Leben war noch so neu.
Nur den Großvater erwartete nichts mehr. Sein Leben zerlief. Und er ließ es zu. Jeden Tag ein bisschen mehr, blutete es sich aus ihm hinaus, tropfenweise, unhörbar, wie ein Wasserhahn, den man im Keller vergessen hat zuzudrehen. Es geschah so unauffällig, dass das Erschrecken groß, und die Verblüffung echt waren, als den Großvater ein Schlaganfall niederstreckte - als plötzlich das Spitalauto vor dem Haus hielt und ihn abtransportierte, vom Vater angeordnet.
Zurück blieb ein massives Loch. Die Anwesenheit des Großvaters war zur Gewohnheit geworden. Nun gab es niemanden mehr, an dem ungestraft und widerspruchslos, Gehässigkeit, Einsamkeit sowie die anderen Gefühle abreagiert werden konnten, die unbewusst Alltage zur Hölle machten. In dieser Hinsicht war der Großvater nützlich gewesen. Denn aller Gestörtheit der Beziehungen zum Trotz, hatte sein duldendes Erleiden des Misslichen, das ihm widerfuhr, dem Haus und seinen Bewohnern auch etwas gebracht. Trotz Verfall, Vernachlässigung und Verachtung seiner Person, hatte der Großvater wie ein ruhender Pol gewirkt. Er war einfach dagewesen. Anspruchslos wie ein alter Hund. Der nicht einmal motzt, wenn er getreten wird – übersehen, und seine bescheidenen Ansprüche vergessen werden.
Kehrte der Großvater nach erfolglosen Reisen nach Haus zurück, war es oft spät. Ein Stückchen kaltes Fleisch, ein Kanten Brot, eine Tasse Kaffee war alles, was er noch bekam. Und das in vorwurfsvoller Haltung gegenüber seiner Unzulänglichkeit. Warum konnte er nicht rechtzeitig heimkommen, wie anständige Leute? In seinem Alter? Man wusste ja nie.
Lilia setzte sich manchmal noch kurz zum Großvater an den Tisch, wenn er schweigend sein karges Mahl in sich hineinstopfte. Er zeigte Hunger, den das bisschen Essen garantiert nicht stillen konnte. Lilia litt beim Zuschauen. Sie hätte ihm gerne mehr gegönnt, doch Mama-Tante erklärte, das bräuchte es nicht. Und der Großvater bestätigte, er sei wirklich satt.
Lilia fühlte sich mies, als habe sie den Großvater durch ihre eigene Gefräßigkeit bestohlen. Sie hätte leicht von ihrem Essen etwas zurückbehalten können. Es hätte für beide reichlich gehabt. Ein beißendes Weh setzte sich beim Empfinden des Hungers des Großvaters in Lilia fest. Es schmerzte fürchterlich, legte ihre Hilflosigkeit offen wie ein aufgebrochenes Geschwür. Es stank zum Himmel und sie hatte nicht einmal die Macht, es zu heilen. Nie würde es aus ihr verschwinden, was immer sie auch täte. Immer würde klar sein, dass sie versagt, nicht geholfen hatte.
Großvaters Not schlug eine tiefe Bresche in Lilias Inneres, einen Abgrund, der für ihre eigene Qual stand. Für dieses Etwas, das im Menschen jede Handlungsfreiheit untergräbt. Lähmt. Vergiftet. Sie, Atemzug um Atemzug, in sich verschlingt, schlimmer als jedes Biest es könnte. Einmal flehte Lilia zum Vater um mehr Rücksicht, mehr Unterstützung, mehr Anteilnahme am Elend des Großvaters: Ohne Gehör zu finden. Ihr Flehen wurde nur als Sentimentalität und kindisches Unwissen taxiert.
Als der Großvater aus dem Spital zurückkehrte, nahm das Drama seinen Lauf. Großvaters Reisen hatten ein Ende. An Flucht durfte er nicht einmal mehr denken. Mama-Tante arbeitete den ganzen Tag. Lilia besuchte die Schule. Und der Großvater saß allein zuhause, gebannt in den Käfig seiner zunehmenden Demenz. Die ständige Unterernährung brachte seine Verdauung zum Erliegen. Durchfall folgte. Oft waren die rohen, nur weiß übertünchten Wände um die Klosettschüssel kotverspritzt. Der Vater rebellierte. Mama-Tante schrubbte wütend mit der Bürste daran herum. Es stank zum Himmel. Herzzerreißendes trug sich zu. Überflüssige Hunde wurden erlöst. Und überflüssige Menschen? Auf welchen Misthaufen schmiss man die?!
Es ächzte in Lilia. Wand sich in ihr. Brachte sie fast um. Über Messers Schneide stolperte ihr Verstand. Es gab keine Rettung. Leben war erbarmungslos. Man entkam ihm nicht.
Wenig später erwischte der zweite Schlaganfall den Großvater. Schrittweise ging er zugrunde. Diesmal endete er in der geschlossenen Abteilung der psychiatrischen Klinik der Stadt, wo Abgeschobene strandeten. Hinter dicken Mauern. Ohne Garten um sich zu sonnen. Ohne die geringste Blume, um sich daran zu wärmen. Nicht einmal Bilder hingen an den Wänden. Im Zwölfbettzimmer lagen zwölf Erlöschende. Den Wänden entlang hockten tagsüber Dösende. Zwischendurch Suppe löffelnd, die nicht sättigte. Dem Verhungern näher und näher rückten sie: wie Verdammte.
Einmal durfte Lilia den Großvater mit Mama-Tante besuchen. Durch viele, immer gleich wieder hinter ihnen abgeschlossene, verglaste Türen wurden sie geschleust. Von Trakt zu Trakt. Bis sie zuhinterst den Trakt der Endzeitigen erreichten, die nur noch warteten. Von denen man nur noch erwartete, dass sie rasch aufhörten zu warten. Abgeräumt würden. Je früher desto besser. Damit sie endlich verschwänden und Ruhe gäben.
Der Großvater allerdings war noch nicht so weit. Er verstand noch, in welcher Falle er steckte. Mama-Tante hatte Weihnachtsplätzchen für ihn gebracht. Er klaubte danach wie nach Ankern. Steckte sie unzerbrochen in den Mund, drei auf einmal, kaute ausgehungert. Flennte, man habe ihm nicht einmal „Frohe Weihnachten“ gewünscht. Niemand schaue nach ihm. Den ganzen Tag lasse man ihn allein. Nur zum Scheissen seien plötzlich welche da, die mit Argusaugen durch die Glastür der Toilette sperberten. Und wehe, es gehe was daneben.
Der Großvater heulte Rotz und Wasser. Lilia war nur verstört. Mama-Tante versuchte unbeholfen zu trösten, im Wissen, dass alles umsonst war. Hilfe nirgendwo in Sicht. Eine Stunde später wieder dasselbe Prozedere: Türen. Schlösser. Trakt auf Trakt. Dann endlich Tageslicht. Aufatmen. Freiheit. Sonne. Luft. Lilia weinte fassungslos vor sich hin, im Angesicht der Nutzlosigkeit, der Chancenlosigkeit - den bodenlosen Abgrund, „Leben“ genannt, im Blick.
Als der Großvater verendete, befand sich Lilia auf dem Heimweg von der Schule. Der Vater, inzwischen wieder verheiratet, hatte für sich und die Neue ein Häuschen außerhalb der Stadt gekauft. Mama-Tante wohnte in einer düsteren, geräumigen Altbauwohnung jenseits der Stadt, in direkter Nachbarschaft zu guten, alten Freunden und ging Tag für Tag ihrer Arbeit nach.
Lilia setzte sich auf die Treppe zum Haus, daran gewöhnt zu warten, wenn der Vater und die Stiefmutter einkaufen gegangen waren. Einen Hausschlüssel besaß sie nicht. Sie hätte ja unbemerkt Freundinnen einladen, oder Mama-Tante das Haus zeigen können. Und das durfte auf keinen Fall geschehen. Nur schon Mama-Tante zu begegnen war Lilia verboten.
Lilia träumte schwermütig vor sich hin. Das Warten zog sich in die Länge. Erst nach fast einer Stunde sah sie das Auto sich nähern und langsam in die Garage abtauchen. Den Kopf gesenkt, kam der Vater als erster die Stufen herauf. „Was machst du denn für ein Gesicht“, versuchte Lilia zu scherzen. Ungemütliches, wann immer es sich machen ließ zu überspielen, hatte sie gelernt. Doch diesmal verfing ihr Bemühen nicht. „Der Großvater ist tot“, hauchte der Vater, verschwand raschen Schrittes, wie auf der Flucht, im Hauseingang und schluchzend im Schlafzimmer. „Ja, jetzt kann er heulen. Jetzt braucht er nicht mehr zu helfen“, dachte Lilia, Gedanken, die, wie von einem Automaten mechanisch angewählt, in ihr auftauchten, Dutzende Male von Mama-Tante gehört, wenn Verzweiflung den Vater übermannte.
Lilia selbst fühlte nichts, außer dass ein Schalter in ihr umgekippt wurde, und die Pein um den Großvater auslöschte. Zu sehr hatte sie um ihn gelitten. Tränen waren keine mehr da. Nur der Vater heulte wie ein Wolf. Lilia hatte ihn noch nie so erlebt. Kühle lag in dieser Feststellung. Einmal kam er die Treppe in Lilias Zimmer hinauf und umarmte sie, im Versuch, sich an ihr aufzurichten. Mitleid. Trost heischend. Doch Lilia konnte nichts für ihn tun. Hätte er sich früher erweichen lassen, wäre vielleicht alles anders gekommen. Nun war es zu spät. Nun musste er selbst mit dem Angerichteten klarkommen.
Für die Beerdigung reichte ein Armensarg. Das schmale Rosenbouquet darauf verbarg die Schande nicht. Der Vater, aufrecht, bleich, die Züge wie aus Metall geschnitten, ging am Arm der Stiefmutter. Lilia, die wusste, dass sie inmitten der wenigen Trauergäste in Sicherheit war, gesellte sich zu Mama-Tante, und hängte sich bei ihr ein. Der Weg zum Grab war lang. Zumindest lang genug, um einander das Nötigste zu erzählen. Auch Lilias Kampf um Mama-Tante war ausgestanden. Sie hatte sich auch in diese Trennung geschickt. Eine gewisse Härte und Unnahbarkeit breitete sich allmählich in Lilia aus. Vereisung: nicht arg, doch spürbar. Am Grab rannen letzte Tränen von Mama-Tante und dem Vater. Dann ging es mit den Gästen ins Bahnhofsbuffet zu Rösti mit Bratwurst. Der Notwendigkeit war Genüge getan.
Seit Jahren hatte der Vater nach einer neuen Frau gesucht, nach einer, die auch mit Lilia zurechtkäme. Als er mit Lilia in der Südschweiz in einem nach alter Sitte geführten Hotel, in dem noch die Tradition der Table d’Hôte aufrecht erhalten wurde, in den Ferien weilte, begegnete er Louise. Sie war Holländerin, Kindergärtnerin und mit einer Freundin angereist. Und sie war um einiges jünger als der Vater, schlank, ein bisschen grösser als er, eher grobknochig, fröhlich und laut. Mit blondem, lockigem Haar, milchweißer Haut, die die Sonne nicht bräunte, sommersprossig. Sprach mit Akzent und trug fast knöchellange, blau und weiß karierte Baumwollkleider mit schwingenden Röcken, verziert mit Volants.
Louise war ausnehmend hübsch, mit gewinnendem Lächeln, sehr in den Vater verliebt, und sie vermied es zu versuchen, Lilias Gunst zu erkaufen, was sie von allen bisherigen Kandidatinnen wohltuend unterschied. Und Louise konnte exzellent mit Kindern umgehen, mit ihnen spielen, rennen, raufen. Sodass Lilia beUngemütliches, wann immer es sich machen ließ zu überspielen, hatte sie gelernt. Doch diesmal verfing ihr Bemühen nicht. „Der Großvater ist tot“, hauchte der Vater, verschwand raschen Schrittes, wie auf der Flucht, im Hauseingang und schluchzend im Schlafzimmer. „Ja, jetzt kann er heulen. Jetzt braucht er nicht mehr zu helfen“, dachte Lilia, Gedanken, die, wie von einem Automaten mechanisch angewählt, in ihr auftauchten, Dutzende Male von Mama-Tante gehört, wenn Verzweiflung den Vater übermannte.
Lilia selbst fühlte nichts, außer dass ein Schalter in ihr umgekippt wurde, und die Pein um den Großvater auslöschte. Zu sehr hatte sie um ihn gelitten. Tränen waren keine mehr da. Nur der Vater heulte wie ein Wolf. Lilia hatte ihn noch nie so erlebt. Kühle lag in dieser Feststellung. Einmal kam er die Treppe in Lilias Zimmer hinauf und umarmte sie, im Versuch, sich an ihr aufzurichten. Mitleid. Trost heischend. Doch Lilia konnte nichts für ihn tun. Hätte er sich früher erweichen lassen, wäre vielleicht alles anders gekommen. Nun war es zu spät. Nun musste er selbst mit dem Angerichteten klarkommen.
Für die Beerdigung reichte ein Armensarg. Das schmale Rosenbouquet darauf verbarg die Schande nicht. Der Vater, aufrecht, bleich, die Züge wie aus Metall geschnitten, ging am Arm der Stiefmutter. Lilia, die wusste, dass sie inmitten der wenigen Trauergäste in Sicherheit war, gesellte sich zu Mama-Tante, und hängte sich bei ihr ein. Der Weg zum Grab war lang. Zumindest lang genug, um einander das Nötigste zu erzählen. Auch Lilias Kampf um Mama-Tante war ausgestanden. Sie hatte sich auch in diese Trennung geschickt. Eine gewisse Härte und Unnahbarkeit breitete sich allmählich in Lilia aus. Vereisung: nicht arg, doch spürbar. Am Grab rannen letzte Tränen von Mama-Tante und dem Vater. Dann ging es mit den Gästen ins Bahnhofsbuffet zu Rösti mit Bratwurst. Der Notwendigkeit war Genüge getan.
Seit Jahren hatte der Vater nach einer neuen Frau gesucht, nach einer, die auch mit Lilia zurechtkäme. Als er mit Lilia in der Südschweiz in einem nach alter Sitte geführten Hotel, in dem noch die Tradition der Table d’Hôte aufrecht erhalten wurde, in den Ferien weilte, begegnete er Louise. Sie war Holländerin, Kindergärtnerin und mit einer Freundin angereist. Und sie war um einiges jünger als der Vater, schlank, ein bisschen grösser als er, eher grobknochig, fröhlich und laut. Mit blondem, lockigem Haar, milchweißer Haut, die die Sonne nicht bräunte, sommersprossig. Sprach mit Akzent und trug fast knöchellange, blau und weiß karierte Baumwollkleider mit schwingenden Röcken, verziert mit Volants.
Louise war ausnehmend hübsch, mit gewinnendem Lächeln, sehr in den Vater verliebt, und sie vermied es zu versuchen, Lilias Gunst zu erkaufen, was sie von allen bisherigen Kandidatinnen wohltuend unterschied. Und Louise konnte exzellent mit Kindern umgehen, mit ihnen spielen, rennen, raufen. Sodass Lilia begann, sie, nach ein paar Tagen argwöhnischen Begutachtens, ausgiebig zu mögen. Denn Louise entpuppte sich auch als ausgezeichnete Märchenerzählerin, und das bedeutete für Lilia nie gekanntes Glück. Zusammen erfanden Louise und Lilia die absurdesten Geschichten. Lilias ausgeprägte Fantasie tobte sich aus. In welche Abenteuer Lilia Louise auch entführte, Louise ging mit. Zudem zog Lilia den Namen „Louise“ allen anderen Mädchennamen vor. Stets hieß eine ihrer Puppen so. Alles passte zusammen.
An einem Abend - ein Gewitter war im Anzug - bettelte, flehte Lilia den Vater an - der Freunde in einem Grotto treffen wollte - er möchte, um alles in der Welt, bei ihr bleiben. Sie ging auf die Knie, händeringend und voller Panik. Denn Lilia fürchtete sich vor Gewittern, verlor fast den Verstand deswegen. Doch der Vater blieb hart - Lilia allein.
Lilia fand sogar den Schlaf - als ein entsetzlicher Donner sie aufstörte. Schlag auf Schlag wechselten sich Blitze mit dem Wummern, Poltern und Dröhnen des Donners ab. Das Hotel bebte. Die Lichter am Ort erloschen. Der Sturm sprengte die Glastür zum Balkon von Lilias Zimmer mit Getöse auf. Schwaden von Wasser wehten herein. Die Vorhänge klatschten gegen die Wände, wie verrückt gewordene Gespenster. Lilia schrie. Schrie um ihr Leben, Mal um Mal. Niemand hörte sie. Das Unwetter tobte, wie losgelassene Teufelsbrut.
Lange Zeit danach - Lilia kauerte unterm Bett, verstopfte sich die Ohren mit den Fingern, schrie immer noch, erschöpft, ohne Hoffnung. Unversehens ging die Tür auf und Louise, die Gewitter ebenso fürchtete und deshalb nicht mit dem Vater ausgegangen war, fischte Lilia unterm Bett hervor. Lilia, verschwitzt von Kopf bis Fuß, spürte, dass sie roch. Dennoch barg sie das Gesicht am Hals von Louise, die sie huckepack in den Speisesaal trug, wo alle im Hotel verbliebenen Gäste bei Kerzenlicht flüsternd beisammensaßen. Sie teilten Lilias Furcht, denn an ein solches Gewitter konnten sich selbst die Hotelbesitzer nicht erinnern.
Später trug Louise Lilia zu sich ins Bett, wo Lilia wie ein Hund an Louise geschmiegt einschlief.
Erst gegen Morgen kam der Vater ins Hotel zurück, angesäuselt, frohgemut, nach einem prächtigen Abend. Das Gewitter war spurlos an ihm vorübergegangen. Im Grotto unter der Erde hatten Stille und Frieden geherrscht. Umso erboster war er, als er zuerst nach Lilia fahnden musste. Was ihr einfalle, andere mit ihren Wahnvorstellungen zu behelligen, schimpfte er. Louise versuchte, Lilias Verhalten zu rechtfertigen. Das half wenig, denn dem Vater entging der Ernst der Lage. Gewöhnt an Lilias Extravaganz, wie er erklärte, glaubte er Louise kein Wort. Erst als der Morgen dämmerte, und die Verwüstungen offenbar wurden, begriff er, was geschehen war.
Um Lilia zu versöhnen, und weil er selbst das Schauspiel nicht verpassen wollte, fuhr er am Nachmittag mit ihr zum Eingang einer Schlucht. In sie hineinzugelangen, wie normalerweise, ging nicht, denn der Zugang dazu war versperrt. Überall standen Polizisten herum, regelten den Verkehr, wiesen Passanten an, zügig voranzuschreiten. Der Vater und Lilia schlossen sich der Kolonne an und erspähten, was schon beim Frühstück sensationslüsternes Tischgespräch gewesen war: Eine der massivsten Brücken der Region war vom Wildbach, zu dem das Flüsschen, über das sie führte, angeschwollen war, aus ihrer Verankerung gerissen worden. Eine Brücke aus Eisen. Eine Brücke der Bundesbahn. Zerknittert lag sie quer über dem Fels. In viele Teile zersplittert. Schaurig anzusehen. Schwer vorstellbar, welch mörderische Gewalt sie so zugerichtet hatte. Sogar dem Vater graute ob des Anblicks. Als es erneut zu gießen begann, nahmen er und Lilia Reißaus. Nun erst dämmerte dem Vater der Grund für Lilias Verhalten.
Louise heiratete der Vater dann doch nicht. Sie war ihm zu groß, zu derb gebaut. Zu fremdländisch. Darob zerbrach Louises Herz. Und auch deswegen, weil Louise Lilia lieb gewonnen hatte. Wenige Monate später brachte sich Louise um. Lilia und Louise waren sich nah gewesen wie Seelenschwestern. Vielleicht zu nah. Und das erschreckte den Vater. Andenken an Louise besaß Lilia nicht. Gegenstände spielten in ihren Abenteuern keine Rolle. Schere, Faden, Stifte, ein knorriges Stück Schwemmholz oder bizarre Steine genügten ihnen zur Unterhaltung. Wichtiger waren ihnen Stimme. Gesten und der Einsatz des Körpers. Sowie Freude und überschäumende Fantasie. Alles andere hätte sie nur behindert.
Der Vater wurde von der Tochterfirma in Holland öfters zu Forschungszwecken eingeladen: zu Tagungen und Vorträgen. In dieser prominenten Rolle lernte er immer wieder Frauen kennen, und sie verschmähten ihn nicht. Weiteren Frauen begegnete er, wenn er mit Lilia ans Mittelmeer in die Ferien fuhr, oder an die Nordsee. Ein Mann mit Doktortitel, Superjob und mutterlosem Kind: das zog. Zu Lilias Erstaunen fiel seine Wahl stets auf hausbackene, gängiger Tradition verhaftete Frauen, die Lilias Geschmack in keiner Weise entsprachen. Sie konnten nicht fliegen. Es gebrach ihnen an Lebensgier. Lilia vermisste an ihnen das Quantum Verrücktheit, das ihrem Leben Würze gab. Zudem wollten sie Lilia kaufen und hielten sie für zu blöd, um das zu merken. Sie machten ihr Geschenke, spielten fade Spiele mit ihr. Nur um beim Vater zu punkten. Und natürlich durchschaute Lilia ihre Machenschaften. Sie waren austauschbar, ohne das Magische, das Lilia begeisterte.
Erst während Ferien in der Toscana fing der Vater Feuer. Die Handarbeitslehrerin eines Gymnasiums verdrehte ihm den Kopf. Anita machte den Vater dadurch kirre, dass sie von Bewunderern schwärmte, die nur darauf warteten, sie zu kriegen.
Anita reiste in Begleitung einer Freundin, einer stillen, ältlichen Person, die in Anitas Schatten stand. Sie ließ Anita den Vortritt und kümmerte sich um Lilia, wenn der Vater mit Anita allein sein wollte. Lilia liebte die stille Frau. Sie würde zum Vater passen, meinte sie. Doch davon wollte der Vater nichts wissen. Er hing an Anitas Angel fest. Und sobald das Lilia innewurde, fing sie an, Anita zu hassen, reflexartig, obwohl Anita nicht versuchte, sie zu bestechen.
Ein halbes Jahr später heirateten die beiden. Die Hochzeit fand ohne Lilia stand. Sie maulte, als der Vater sie darüber aufklärte, gab ihm jedoch Recht, da sie sich gut genug kannte, um zu wissen, dass sie sich nicht beherrschen könnte. Auf irgendeine Weise würde sie ausfällig. Und dass der Vater dieses Risiko umging, verstand sie.
Der Vater blieb zwei Wochen weg. Während dieser Zeit packte Mama-Tante ihren „Kitsch und Krempel“, so der Vater, und zog am Tag vor seiner Rückkehr aus. Er fürchtete, seiner Schwester als Frischvermählter unter die Augen zu treten. Und er floh vor Lilias Abschiedsschmerz. Als Lilia am Morgen erwachte, war das Haus leer. Sie hatte verloren. Das Lieb und Teure. Das Unentbehrliche. Unersetzliche: es war zu Ende. Alles war zu Ende. Lilia fühlte sich alt. Verbraucht. Ohne Vorstellung davon, wie Leben weitergehen sollte. Ob Leben überhaupt noch eine Chance hatte.
Etwas außerhalb der Stadt, in einer Gegend, in der die Bewohner als wohlhabend galten, stand das bescheidene Haus, das der Vater gekauft hatte. Die Möbel steuerte Anita bei: ein Elternschlafzimmer in dunklem Holz, das Esszimmer in französischem Stil, die Vitrine noch ohne Inhalt, ebenso wie das Buffet, da das neue Geschirr noch nicht geliefert worden war.
Die Gestaltung des Salons lag Anita besonders am Herzen. Er sollte ihren Sinn für Repräsentation widerspiegeln und beim Besucher den Eindruck von Eleganz und Wohlhabenheit erwecken. Sie suchte einen angesagten Schreiner auf und gab ihm den Auftrag, Sofa, Fauteuils und Tischchen im Stil des „Chippendale“ zu fabrizieren. Anita schwärmte für das, was sie „britisches Understatement“ nannte. Es dauerte Wochen, bis die Möbel eintrafen. Und als sie endlich im Salon standen, wirkten sie in dem schmalen, länglichen Raum verloren und passten zu Lilias schwarzem Klavier wie die Faust aufs Auge. Auch Anita schien enttäuscht, obwohl sie einmal ums andere betonte, wie perfekt die Möbel aussähen. Es klang, als glaube sie es selbst nicht. Warm und behaglich fühlte sich der Salon nicht an, wirkte eher unterkühlt. Anita und der Vater hielten sich jeden Abend darin auf, der Vater Zeitung lesend, Anita Babyjäckchen und winzige Söckchen strickend, da sie hoffte, bald schwanger zu werden.
Lilia schickte sich in die Rolle der Stieftochter. In der Schule lief es nicht schlechter als zuvor. Vom Zwang zum Klavierspiel durfte sie in die Freiheit des Orgelspiels wechseln, denn Orgeln standen nur in Kirchen. Lilia verstand diesen Wechsel als Kompensation, als ein Entgegenkommen des Vaters, damit ihr auch ein Stück seines Glückskuchens zuteilwerde - da auch das Üben sich dadurch außer Haus verlagerte. Trotz guten Willens scheiterte Lilia an ihrem Bemühen, sich Anita anzunähern. Dass sie einander nur bedingt kannten, und einander je weniger mochten, desto besser sie einander kennenlernten, verhärtete die Fronten. Einmal mehr verlangte eine Fremde von Lilia, sie solle sie „Mutter“ nennen. Und einmal mehr brach es Lilia das Herz, festzustellen, dass auf Erwachsene kein Verlass war. Lilia sehnte sich nach heilem Raum zum Ausruhen, zum Sein, ohne ständigen Druck. Und sie konnte Anita unmöglich „Mutter“ nennen. Das ging einfach nicht. Schließlich erfand sie als Kompromiss den Namen „Ana“.
Ana gab sich streng. Aus ihrer Sicht war Lilia der Preis, den sie für den Vater bezahlte, und das ließ sie Lilia spüren. Lilia genügte ihr in keiner Weise. Nichts an ihr war, wie es sollte. Das musste sich ändern, und zwar rasch. Lilia spie innerlich aus vor Entrüstung über diese Zumutung, entschloss sich, sämtliche Manipulationen Anas zu sabotieren. Lilia war dreizehneinhalb Jahre alt und keinesfalls mehr bereit, sich herumschubsen zu lassen wie ein ausrangiertes Möbelstück. Wieder quälte sich Lilia durch die Tage. Einmal mehr ertrank ihr Drachenherz in Tränen. Und das fast jeden Abend, wenn Lilia ohne Essen zu Bett geschickt wurde, weil Krieg herrschte. Wenigstens war sie dann mit sich allein und konnte tun und denken, was sie wollte. Der alte Vorwurf des Ungenügens holte Lilia ein.
Als Kind hatte Lilia ums schiere Überleben gekämpft, ohne nach Gründen zu suchen. Nun, auf die Vierzehn zugehend, begann ein neues Kapitel im Buch ihres Lebens. Die Fronten verhärteten sich. Das Telefon schloss Anita weg. Einen Hausschlüssel erhielt Lilia nicht. Und der Umgang mit Mama-Tante wurde ihr strikte verboten. Lilia besuchte sie dennoch hie und da im Geschäft. Ersann Schlupflöcher. Setzte auf die Hilfe früherer Bekannter. Doch keine List verfing. Die Eltern wurden jede ihrer Verfehlungen inne. Und Strafe folgte auf dem Fuß. Lilias Wut schäumte.
Schillers „Maria Stuart“ stand auf dem Plan des Stadttheaters. Und Lilia, die nun die Realschule besuchte, durfte sich das Stück mit ihrer Klasse ansehen. Alle Mädchen hatten sich herausgeputzt. Die Lehrerin erschien in dunkelblauem Samt. Nur Lilia trug eines ihrer beiden Werktagskleider. Sie wurde angestaunt, als komme sie vom Mond. Doch Gifteleien bleiben aus. Auch nun war sie in der Klasse nicht sonderlich beliebt. Auch nun musste sie fragen ob sie dürfe, wenn sie sich in der Pause zu den anderen auf die Mauer setzen wollte. Auch nun hieß es manchmal „nein. Doch manchmal ertönte auch ein „Ja“. Und sie hatte sogar eine Freundin.
Die Eltern waren wegen Vaters Gesundheit für drei Wochen in die Berge gefahren, und Lilia wohnte in einem Heim in der Nähe der Schule. Es war ein Heim für Männer und Frauen, die sich keine Wohnung leisten konnten, die zwar eine Arbeitsstelle hatten, jedoch in der Welt allein dastanden. Menschen die die Klatschpresse lasen und untereinander kaum Kontakt hielten, Lilia befremdet musterten und Distanz wahrten. Zum Essen saß man an langen Tischen. Senf, Konfitüre oder Ovomaltine, die selbst gekauft werden mussten, weil sie das Budget des Heimes sprengten, ließen die Besitzer auf dem Tisch zurück. Jeder Bewohner hatte seinen angestammten Platz. Als Lilia sich zum ersten Frühstück auf den erstbesten Stuhl setzte, zu Brot und Butter, die ihr gereicht wurden, nach einem Konfitürenglas griff und sich bediente, wurde sie hart angefahren. Das sei ihr Platz und ihre Konfitüre, und Lilia solle sich zum Teufel scheren, wetterte eine ältliche, dürre Person mit fettigem Zopf und Borsten auf einer Warze am Kinn. Erschreckt floh Lilia vom Tisch und ging ohne Frühstück zur Schule.
Vor dem Mittagessen erkundigte sie sich bei der Oberin des Hauses, wo sie einen freien Platz finde. Wenn sie beim Essen verstohlen in die Runde äugte, kam sie sich vor wie im Kino. Der Vater hatte sie nicht eingeweiht, sie kommentarlos mit ihren Schulbüchern bei der Oberin abgeliefert. Das war auch der Grund, warum Lilia ohne Sonntagsrock ins Theater ging. Ein Anruf bei Ana, ob sie ihn zuhause holen dürfe – der Schlüssel war bei ihrer Stiefgrossmutter hinterlegt – löste ein Donnerwetter aus. Sie solle aufs Theater verzichten, wenn ihr ihre Kleider nicht passten, schimpfte Ana. Für ein Mädchen in Lilias Alter eine schlimme Antwort. Auch um saubere Wäsche musste Lilia Ana anbetteln. Häftlingen, Asozialen und Obdachlosen rationierte man Wäsche. Scham über dieses Eindringen in ihr Privatestes peinigte Lilia. Ihre Unterhosen wusch sie von da an heimlich selbst aus. Zu reden gaben auch ihre häufigen Regelbeschwerden, die Schmerzen, das Erbrechen. Ana durchforstete Lilias Schrank, überwachte sie bis ins Bad und empörte sich sogar über Lilias Bindenverschleiss.
Verstohlen schlich Lilia im Theater an den Kameradinnen vorbei zu ihrem Platz und schnallte die Riemchen an ihren zu knappen Schuhen auf, damit sie weniger drückten. Dann hob sich der Vorhang, und das Drama entfaltete sich. Und auch in Lilias Körper entfaltete sich Zelle um Zelle.
Lilia tauchte ab in die Welt hoher Kunst. Der Klang der Sprache schlug sie in Bann. Ihre Augen verzehrten, was sie sah. Jede Regung der Darsteller echote in ihr, riss sie mit sich fort, durch Kampf, Terror und Anschuldigungen bis zum Augenblick, in dem Maria an ihres heimlichen Geliebten Busen sank. Einen Herzschlag lang. Einen Aufschrei reinster Verzweiflung lang, bevor sie, gefasst, und gleichzeitig gebrochen, zur Enthauptung schritt.
An diesem Punkt, diesem Hieb des Schicksals, diesem Riss, standen für Lilia die Zeit, das Stück und die Gedanken still. Dass Liebe über den Tod triumphierte, an einem bestimmten Ort im Herzen, war für Lilia eine Offenbarung. Von da an fühlte sich Lilia nicht mehr nur verlassen. Schillers Gesamtausgabe stand in Vaters Bücherregal. Und Lilia durfte darin lesen. Sie suchte sich Stellen heraus, die sie besonders fesselten, leise, verhaltene, herzzerreißende, in denen sich Größe zeigte, in denen Gewalt unterlag, angesichts der Macht der Liebe. Lilia las überall, unter dem Pult in der Schule, im Bus, auf der Straße, mit einem Auge auf Passanten um ihnen rechtzeitig auszuweichen, in der Nacht im Bett. Und ihr wurde klar, was sie später werden wollte: Schauspielerin, Tragödin.
Das Familienleben gestaltete sich in mancherlei Hinsicht mühsam, auch weil Ana Hoffnungen hegte, zu Hausbällen eingeladen zu werden, zu Filmabenden. Schmalspurfilme waren groß in Mode. Statussymbole waren Ana wichtig. Ein repräsentativeres Auto musste angeschafft werden. Eine Kamera. Ein Projektor. Ana rang um Oberhand. Und Lilia tat alles, um sich ihrer Fuchtel zu entringen. Sonntagnachmittage oder Samstagabende glichen sich wie ein Ei dem anderen. Ähnliche Häuser. Ähnliche Einrichtungen. Zelebriertes Bürgertum. Für Lilia ein Alptraum. Anständigkeit um der Anständigkeit willen. Fassaden hinter die nicht geschaut werden durfte. Ein uneheliches Kind hätte für die Tochter den Ausschluss aus Familie und Gesellschaft bedeutet. Eine nicht standesgemäße Heirat ebenso. Söhne und Töchter wurden entsprechend den Erwartungen der Eltern gedrillt. So gehörte sich das.
Der Vater kränkelte. Woran, durfte Lilia nicht wissen. Eine Frage von Macht für Ana.
Zur Mutter fuhr Lilia nun aus eigenem Antrieb. Teils aus Gewohnheit, teils aus Langeweile. Am liebsten weilte Lilia im Haus der Großeltern in der Südschweiz. Da Opa inzwischen verstorben war, sollte die Villa verkauft werden. Ohne Mann im Haus fühlte sich Oma in dem weitläufigen Anwesen verloren. Immer weniger gut zu Fuß, brauchte sie Lilias Mutter als Stütze. Je mehr Omas Kräfte nachließen, desto stärker wurde die Mutter. Sie überwachte den Haushalt und Omas Gesundheit peinlich genau. Das stolze Gewicht von Oma setzte bei der Mutter Bärenkräfte voraus. Hilfe von Fremden anzunehmen, weigerte sich Oma. Die Mutter mutierte zum umsichtigen Wachhund. Ohne sie wäre Oma zugrunde gegangen. Ihren Launen. Ihrer Gehässigkeit. Der wachsenden Bosheit, hätten Außenstehende nicht standgehalten. Der Mutter über die Jahre erprobte Geduld, Gelassenheit und Nachsicht zahlten sich nun aus. Die Mutter sorgte für Oma bis zu deren letztem Atemzug.
Als Lilia den Ehering, den ihr einst Lilias Vater an den Finger gesteckt hatte, nach des Vaters Wiederverheiratung immer noch an der Mutter Hand blinken sah, konnte sie es sich nicht verkneifen, nach dem Grund zu fragen. „Vor Gott bin immer noch ich deines Vaters Frau und niemand anders. Er hat einen Meineid geleistet, lebt in wilder Ehe. Und das wird ihm Gott nicht verzeihen.“ Und die Mutter meinte es ernst. Lilia bohrte nach: „Der Vater trägt nun aber einen anderen Ring. Du bist allein mit dem deinen. Dein Glaube zielt in Leere. Der Vater will dich vergessen, ein Leben haben ohne dich.“ Lilia genoss es, in Mutters Wunde zu stochern. Das säuberte zwar nicht die eigene. Doch geschah es der Mutter recht, dass ihr heimgezahlt wurde, was sie an Lilia verbrochen hatte.
Es dauerte Jahre, bis Lilia fähig wurde, die Mutter, ebenso wie sich selbst, als Opfer zu sehen, als Opfer von Umständen, treibend auf einer Bahn, die sie beide nicht freigab – weil Wissen fehlte. Mut. Entschlossenheit, die Trägheit zu überwinden, die sie an die Vergangenheit kettete
4. Aufbruch
Es gärte im Land. Frauen meldeten sich zu Wort. Sie wollten Einfluss nehmen, mitreden, die Geschicke des Landes nicht mehr nur den Männern überlassen. Ihre Stärke unter Beweis stellen.
Diesem Bestreben entsprang die Idee einer Art von Gymnasium nur für Mädchen, unter der Direktion einer Frau. Weibliche Belange sollten bei der Wahl der Fächer Gewicht bekommen. Frauen sollten sich profilieren, auch auf Chefetagen. Der Blätterwald rauschte. Tradition und Moderne gerieten sich in die Haare. Die Moderne machte Boden gut. Und ihr gelang die Realisation des unerhörten Projekts. Auch Ana und der Vater ließen sich überzeugen. Und Lilia wurde Schülerin dieser Mädchenoberschule, der Skeptiker ein kurzes Leben prophezeiten.
Die Eltern atmeten hörbar aus. Dass Lilia durch das neue Angebot auch mit dem, was sie „linksintellektuelles Gedankengut“ nannten, in Berührung kam, erfreute sie weniger. Die Lektüre von Brecht etwa verbot der Vater Lilia. Ebenso Sartre, die Beauvoir, Kierkegaard, Wilder und den Spinner Hesse. Was Lilia nicht daran hinderte, sich den Inhalt dieser Bücher begeistert reinzuziehen. Da ihr Taschengeld ihr nicht erlaubte, selbst welche zu kaufen, lieh sie sich Bücher aus: Hauptsache Literatur. Hauptsache Wissen. Dadurch drehte sich Lilias Eindruck der Welt innert kürzester Zeit um hundertachtzig Grad. Aus eigenem Antrieb. Ohne Zutun der Eltern. Lilias Wissbegier war unzähmbar. Die Nase in Büchern, ließ Lilia ihre Einsamkeit vergessen. Zwar wohnte sie beim Vater und Ana, doch ein Zuhause besaß sie nicht. Das Leben drängte. Wünsche, Hoffnungen türmten sich in ihr: Irgendwann würde sie den Absprung schaffen!
Was Lilia auch unternahm, sie unterlegte es mit der todesverachtenden Leidenschaft ihrer Ahnen. Andere Jenische kannte Lilia nicht. Hörte Lilia von irgendwoher Zigeunermusik, setzte das ihr Blut in Brand. Unbändiger Drang zu tanzen packte sie. Wild und bodenlos. Bis zur Auslöschung. Lilia hielt ihre Überschwänglichkeit, wie der Vater sie schimpfte, für normal. Sie kannte nichts anderes, nahm sich genauso wahr, verstand nicht, was daran übel sein sollte. Sie rettete sie aus ihrem Käfigalltag. Im Offenen, Uferlosen erfuhr sich Lilia als stark. Als gesund. Und unbändig lebendig. Für Lilia bedeutete das Wegfliegenkönnen Freiheit. Für Außenstehende offenbar Bedrohung.
Es war eine Zeit, in der sich Lilia einmal übers andere unsterblich verliebte. An der neuen Schule fand sie eine neue Freundin, mit der sie sich nahezu symbiotisch verband. Den leeren Platz in sich füllte sie mit Esther bis in den hintersten Winkel. Was sie sonst niemandem erzählte, bürdete sie Esther auf. Esther diente als Katalysator. Lilias Heimatlosigkeit fand in ihrer Freundschaft einen Ort, um am Erlebten nicht zu ersticken, sich zu spüren und zu erden. Esther war wie Lilia Einzelgängerin, wollte Geschichte studieren, nach Amerika auswandern. Konkretes, das für Lilia noch gar nicht zählte. Esther gehörte einer anderen Gesellschaftsschicht an als Lilias Eltern. Deshalb durfte Lilia Esther nicht mit nach Hause bringen. Also vereinbarten sie eine Zeit am Abend, zu der sie mit aller Kraft aneinander denken und einander Grüß schicken wollten. Lilias Wunschkraft war enorm. Sie vertiefte sich in Dinge, die sie mochte mit gleicher Intensität wie in Dinge, die sie verachtete. Schlüpfte in ihre Haut. Dagegen wehren konnte und wollte sich Lilia nicht. Ihr Verständnis von Leben basierte darauf, eins mit den Erscheinungen zu sein. Das verlieh Lilia Überlebenskraft. Und es verlieh ihr gleichzeitig die Fähigkeit, unter Erfahrenes Striche zu ziehen. Vergangene Freuden und Leiden blieben vergangen, auch wenn sie die Zeit der Loslösung unbeschreibliche Schmerzen kostete und Geduld. Sie grub sich hindurch bis Licht erschien, bis Lilia sich geheilt erhob und weiterging. Da Lilia tief in ihre Himmel und Höllen hinunterstieg, und Abgründe so weit auslotete, wie sie nur konnte, wurden sie gelebte Wirklichkeit. Ausgedehnt. Steinig. Und gefahrvoll, verliefen diese Wege. Das Ausloten als Arbeit zum Verstehen und Bewältigen bedeutete Wissen, das Lilia gehörte. Bedeutete Freude und Ekstase. Die Frage nach Sinn, die immer Erwartung, Gewinn und Verlust beinhaltet, reichte Lilia nicht. Nur Erfahrung zählte. Auf die Intensität des Wagnisses kam es an. Von ihr hing die Ausschließlichkeit von Erfahrung ab. Eine Gratwanderung. Ein Balancieren auf Messers Schneide. Für Lilia Normalität. Halbbatziges fürchtete sie. Es kam die Zeit, da Lilia anstelle von Gott Luzifer, den Träger des Lichts, um Hilfe anflehte. Denn Wissen gebar sich aus Leiden. Aus Verweigerung. Dem Bekenntnis zum Abgrund. Der Weg bestand aus dem nächsten Schritt. Dem nächsten Sicheinlassen. Ein Wegtauchen hätte Selbstmord bedeutet.
Es gab zwei renommierte Tanzschulen in der Stadt. Die eine besuchten Jugendliche der Reichen. Die andere vorwiegend solche des gehobenen Mittelstands. Die erste befand sich in einem von Lilias Schule weit entfernten und wenig geachteten Stadtteil. Die zweite im Herzen der Stadt. Kinder der Reichen behandelten die, die mit der minderen Tanzschule vorlieb nehmen mussten, herablassend. Doch Lilia machte das nichts aus. Sie besuchte mit drei Kameradinnen die näher gelegene. Auf Anas Maschine hatte sie sich zwei faltenreiche, wadenlange Röcke aus leuchtendem, fließendem Stoff genäht, die sittsam an ihr hinunterhingen, wenn sie stand und abenteuerlich mitschwangen, wenn sie ging, sich zum Rad entfalteten, wenn sie sich drehte. Dazu trug Lilia rote Wildlederballerinas, die sie sich mit Bügeln für Ana, mit Autowaschen und mit Kinderbetreuung bei Nachbarn verdient hatte.
Der dunkelgetäferte Saal, mit glänzendem Parkett und goldgerahmten Spiegeln an der Wand, war brechend voll, als Lilia zum ersten Tanzabend erschien - mit hämmerndem Puls, sich in eine Ecke drückend, verängstigt und gehemmt, da sicher keiner der Jungen sie zum Tanzen auffordern würde. Die anderen Mädchen, viel hübscher als sie, in richtigen Tanzkleidern, würden ihr den Rang ablaufen. Lilia wünschte sich weg – und doch auch wieder nicht. Lilia schämte sich – und doch auch wieder nicht. Lilia fühlte sich zutiefst elend. Und doch auch wieder nicht. Gesenkten Blicks saß sie auf ihrem Platz. Die Stuhlreihen standen gegen die Wand gerückt, je eine der anderen gegenüber. Außer einem prachtvollen antiken Schrank und einer Anrichte mit nobel geschwungenen Beinen, waren die Stühle das einzige Mobiliar im Raum, stilvolle Stühle mit zierlicher Malerei in Gold.
Der Meister erschien mit seiner Frau, hieß die Anwesenden willkommen, forderte die Jungen auf, sich ein Mädchen auszusuchen und drehte die Musikanlage an. Lilias Kopf sank noch tiefer. Innert Sekunden erblickte sie blankgeputzte Schuhspitzen vor ihren Füssen. Und als sie aufschaute, stand ein ganz normaler Junge mit sauberem Hemd und Krawatte vor ihr und streckte die Hand nach ihr aus. Lilia lief dunkelrot an. Zumindest glaubte sie das.
Der Tanzmeister instruierte die Verbeugung für die Herren und den Knicks für die Damen. Die Paare verteilten sich im Raum. Und es wurde demonstriert, wie sie einander zu halten hatten. Lilia schrak zusammen, als ihre Hand sich in die feuchte, zitternde ihres Partners legte, und seine andere sich auf ihren Rücken. So nah an sich dran hatte sie noch keinen Jungen gespürt, fast zu nah, sodass es schutzlos machte, ihr keinen Platz zur Wahrung ihrer selbst ließ, Geheimnisse offenlegte, ihr Gesicht bis in jede Pore entblößte. Lilia war nun sechzehn Jahre alt. Doch der Tanzmeister, sich der Situation, dank jahrelanger Erfahrung, bewusst, ließ niemandem Zeit für Scheu oder gar Flucht. Ein schneidiger Walzer erklang, riss die Paare von selbst in die Drehung. Und ehe sie es sich versahen, standen sie einander keuchend und lachend gegenüber, Hand in Hand, vertraut, gelöst, wie verwandelt.
Nun erst lernten sie die entsprechenden Schritte, die Wendungen, den Schwung aus der Hüfte. Und flott und flotter trug sie derselbe Walzer ein zweites Mal übers Parkett. Pause.
Die Mädchen kehrten zu ihren Stühlen zurück, die Jungen ebenfalls. Eifriges Plappern, verschämtes Kichern, ein Wogen von zuckenden Rücken, verkrampften Schultern, unterdrückten Seufzern hinter vorgehaltener Hand. Doch schon wimmerten wieder Geigen, verbeugte sich der nächste Tänzer vor Lilia, entschwebte sie in seinem Arm auf Flügeln der Ekstase. Ein Stolpern hie und da. Zerquetschte Zehen. Lilias Rock wogte. Es war ein Gefühl: Es erdrückte sie fast!
Wie nicht von dieser Welt, glitt Lilia die Treppe hinunter zur Straße. Laternen brannten. Ein lauer Frühlingsabend kühlte die brennenden Wangen. Wieselflink schlüpfte Lilia zwischen den Flanierenden hindurch, um Ecken herum, und erwischte mit gewagtem Sprung die anfahrende Bahn. Ana hatte ihr verboten, sich begleiten zu lassen. Die Räder knirschten in den Geleisen. Hitziges Bimmeln scheuchte Säumige von der Straße. Kinoreklamen flammten aggressiv, übermannshoch. Vorführungen waren zu Ende, neue begannen. Lilia war froh über ihren langen Heimweg, den steilen Anstieg zu Fuß um zum Haus zu gelangen. Sie wusste, sie würde erwartet und ausgefragt, und sie brauchte die Zeit, um sich zu finden.
Erst nach der dritten Tanzstunde wagte es Lilia, sich in der Runde der Herren umzusehen. Sowenig wie Lilia waren sich ihre Kolleginnen einig, welchen der Tänzer sie hübscher und anziehender fanden, weniger verklemmt. Nach der fünften Stunde jedoch hatte Lilia ihre Wahl getroffen. Und sie wurde erwidert.
Erik gehörte zu den Stillen. Er lief, wie Lilia, immer gleich weg nach dem Kurs. Er war groß. Lilia reichte ihm nur bis zum Kinn. Er ging sehr geradeauf, strahlte Selbstbewusstsein aus. Auch Reserviertheit. Nach Meinungen ihrer Mitschülerinnen war Erik definitiv der bestaussehende Mann der Runde. Innerlich brannte Lilia längst für Erik, ohne es sich anmerken zu lassen. Ihm entgegen zu sehen, wenn er kam, um sie aufzufordern, getraute sie sich nicht. Erik lachte nie. Kam zielstrebig auf Lilia zu, das glatte, füllige Haar nach hinten gekämmt, die graublauen Augen auf Lilia gerichtet. Er sprach leise, wie abwesend, als trage er ein Gewicht mit sich herum, roch wunderbar diskret, ging mit Gesten sparsam um, tanzte mit seinem ganzen Wesen, hielt Lilia sicher im Arm, als habe er nie anderes getan. Es war ein Fest, sich an ihn zu verlieren und ihm zu folgen, leicht, behände und gekonnt.
An die Stelle der Helden aus Lilias Büchern rückte Erik. Gegen Ende des Kurses tanzte Lilia nur noch mit ihm. Auch andere Paare hatten sich gefunden. Ihre Kameradinnen fanden es ungerecht, dass ausgerechnet Lilia sich Erik geschnappt hatte, Lilia, das Mauerblümchen. Doch Lilia kümmerte das nicht. Ihr Blut sang Erik.
Lilia hatte Erik zaghaft gegenüber Ana erwähnt. Ana besprach sich mit dem Vater. Und Lilia erhielt die Erlaubnis, am nächsten Abend mit Erik etwas trinken zu gehen, falls sich die Gelegenheit ergebe. Und tatsächlich bat Erik Lilia darum, als müsse es so sein.
In Lilia bebte – zitterte - flirrte jeder Nerv, tat weh, sehnte sich. Sie gingen schweigend nebeneinanderher. Erik schlug ein Lokal vor, in dem berühmte Formationen Blues und Jazz vortrugen, in dem sich Intellektuelle, Künstler und Existenzialisten trafen. Einen Ort, in den Lilias Vater nie einen Fuß gesetzt hätte. An diesem Abend blieb es still im Lokal. Lilia nippte an einem Saft. Erik trank Wasser. Sein sinnender Blick ruhte auf Lilia. Seine Hand lag auf der ihren, entfachte nie gekanntes Feuer in Lilia. Erik erzählte, seine Mutter werde bald sterben. Dennoch habe sie ihn zum Tanzen geschickt.
Lilia hörte zu, alle Sinne gespannt. Nie zuvor hatte sie mit einem Jungen zusammengesessen. Nie zuvor hatte einer so zu ihr gesprochen, sie auf diese Weise ernst genommen. Erik referierte über Religion, über den Glauben, der ihm helfe, ohne den er verzweifeln würde. Viel Raum dehnte sich zwischen Erik und Lilia aus. Sie fühlten sich wohl und vertraut miteinander, zwanglos, ohne an Zeit zu denken. Als die von Ana gewährte Stunde vorüber war, blieb kein Bedauern übrig. Und der Raum zwischen ihnen war intakt.
Erik begleitete Lilia zur Straßenbahn und zog sie leicht an seine Brust, so als bestehe Lilia aus Flaum. Nichts sonst geschah. Das Glück beschied Lilia diese makellose Erfahrung, die ihr Gemüt ohne Scheu oder Bedenken aufschloss. Im Kurs tauchte Erik nicht wieder auf.
Ana und der Vater hatten sich nach ihm erkundigt. Eriks Vater war Hauswart. Die Mutter putzte fürs Feriengeld. Und Erik lernte Laborant. Lilias Eltern setzten sich mit der Familie in Verbindung und bedrohten Eriks Vater. Er arbeitete in derselben Firma wie Lilias Vater und bangte um seine Stelle.
Lilias Herz brach. Sie weinte, als gelte es zu sterben. Da sie Eriks Adresse kannte und wusste, wo er in die Lehre ging, wo er die Straßenbahn wechselte, passte sie ihm ab. Sie hoffte so sehr, Erik zu sehen, erblickte ihn auch tatsächlich. Er ging wenige Schritte von ihr entfernt über die Straße, schaute sie auch an, unbewegt und ernst, und bestieg die nächste Bahn. Auch um Erik zu schützen, verzog Lilia ebenfalls keine Miene. Denn Ana hatte überall Spione: Kameradinnen aus Lilias Klasse, die sich nichts dabei dachten, ein Auge auf Lilia zu haben.
Auch zum Abschlussball erschien Erik nicht. Es wurde ein rauschendes Fest, mit Showtanzeinlagen. „Silvery Moon“, das Lieblingsstück damaliger Tanzschüler, wurde mehrere Male gespielt, von der Bigband in weißen Satinkostümen mit silbernen Kragen. Ein Junge mit Lockenkopf und schweißigen Händen umschwärmte Lilia. Bis um zehn Uhr durfte Lilia bleiben. Dann huschte sie unbemerkt zur Tür hinaus. Der Taxifahrer erkundigte sich, ob niemand sie begleite. Lilia schüttelte den Kopf. Kein weiteres Wort fiel.
Erik blieb der einzige Freund Lilias während ihrer Schulzeit. Verliebt war Lilia immer wieder, vor allem in Lehrer. Die Jungen ihres Jahrgangs erschienen ihr fad, zu keinem richtigen Gespräch zu gebrauchen. Denn zu mehr hätte Lilia niemals ja gesagt. Dafür fühlte sie sich zu fragil.
Erstaunlicherweise stand Lilia in ganz anderem Ruf. Ihre Zurückhaltung in Fragen von Freundschaft deuteten ihre Kameradinnen als Erfahrenheit. Sie sei mit allen Wassern gewaschen, hieß es. Wisse vollumfänglich Bescheid. Sie beneideten Lilia, fürchteten sie insgeheim. Versicherte Lilia das Gegenteil, glaubten sie ihr nicht. Sie wirke zu gewandt, auch in ihren Aufsätzen zu erwachsen, meinten sie.
In Wirklichkeit war Lilia mehr Kind als die meisten ihrer Mitschülerinnen. Als in einem der seltenen Gespräche mit Ana das Verhalten des Mannes während des Beischlafs zur Sprache kam, schreckte Lilia schon nur bei der Nennung des Wortes zusammen, hob angewidert die Hände und beteuerte, sie würde nie dergleichen zulassen. Die physische Vereinigung mit einem Mann schien an Grässlichkeit und an Hässlichkeit alles Vorstellbare zu überbieten. Sie war doch kein Tier. Suhlte sich doch nicht im Dreck. Lilias Grausen war echt.
Ihr erstes Konzert besuchte Lilia mit dem Vater. Noch zu Mama-Tantes Zeit. Die Karten dafür hatte der Vater von seinem Chef gekriegt, der verhindert war. Erstklassige Karten, auf dem Balkon, schräg über der Bühne. Eine weltberühmte Sängerin bot einen Schubertabend dar.
Schon nur ihre Erscheinung schockte Lilia. Ein weit ausgeschnittenes Kleid aus taubengrauer Spitze umspielte eng ihren Körper. Darübergelegt eine Schleppe, von der Taille an sie umstehend wie der Federschmuck eines Pfaus. Ihr Haarturm schmückten glitzernde Spangen. Es verschlug Lilia die Sprache.
Sie selbst saß in einem dunkelgrauen, schmucklosen Etwas mit Stehkragen, das sie mit dem Vater zusammen gekauft hatte – wegen des plissierten Rocks - auf ihrem Platz. Bei seinem Anblick schlug Mama-Tante die Hände über dem Kopf zusammen und schimpfte, sie sehe wie eine alte Schachtel darin aus. Wie eine geprügelte Klosterschülerin. Doch Lilia gefiel das strenge, klösterliche Kleid. Zur Versöhnung steckte Mama-Tante eine rote Seidenrose an ihren Kragen – damit Lilia weniger bleich und krank darin aussehe.
Lilia konnte die Musik kaum fassen. Selbst wenn sie tief atmete dabei. An gewissen Stellen stürzte ihr Herz mit innerem Schrei kopfüber in Abgründe. Um dann wieder in unbeschreibliche Süße hochgerissen zu werden.
Lilia war das einzige Kind im Konzertsaal. Und sie kam mit der Fülle des Klangs und dem Schmerz, den er in ihr auslöste nicht klar. Sie brauchte lange um das Gehörte zu verdauen. Dafür durfte sie von da an sämtliche Konzerte für Kinder des Symphonieorchesters in ihrer Stadt besuchen, richtige Konzerte, die Werke ganz unterschiedlicher Stilrichtungen beinhalteten. Lilia liebte jedes. In alles, was mit Musik zu tun hatte, floss ihr Herz ungehemmt – so wie in alles, was sich um Bücher drehte, um Bilder berühmter Maler.
Vor allem die Kunst der Renaissance begeisterte sie. Die Männer mit schulterlangem Lockenhaar. Mit Augen, abgründig wie Seen, an denen sie sich nicht sattsehen konnte. Augen und Hände faszinierten Lilia grundsätzlich. Hände wie gedrechselt, wie gemeißelt. Mit Adern, die hervorsprangen. Mit Ringen. Spitzen, die die Handgelenke umschmeichelten. Ihrem Zimmer hatte Lilia längst seine puritanische Strenge genommen. Reproduktionen schmückten die Wände, Plakate von Musikern und Schauspielern. Sie spannte sie übers Eck, stellte die vom Vater geschenkte, bemalte Truhe darunter als Frisiertisch, rückte das Bett ans Fenster, sodass sie auf Wiesen, Bäume und den Mond schauen konnte. Regale bastelte sie sich aus Brettern und Backsteinen, aus was immer sich dafür anbot. Hauptsache nicht spießig - und entgegen Anas konservativem Geschmack. Lilia kitzelte es, Ana herauszufordern. Immer noch eins draufzuhauen. Es war ihre einzige Möglichkeit, sich emotional zu sanieren.
Dem Vater ging es je länger desto schlechter. Manchmal lag er tagelang nur im Bett. Dann durfte ihn Lilia nur von der Türe aus grüßen. Ana duldete Lilia nicht an ihres Vaters Seite. Das Schlafzimmer war für sie tabu. Ana war nicht glücklich. Auch der Vater war es nicht. Immer noch strickte Ana Babyjäckchen, Mützchen oder winzige Söckchen. Sie hoffte so sehr auf ein Kind. Und Lilia verstand das. Anas prekäre Stellung in der Familie war offensichtlich. Ein Kind hätte Anas Anwesenheitsanspruch gestärkt.
Lilia war nun öfters allein zu Hause, bewacht von der Stiefgroßmutter, einer verrunzelten, vergrämten Frau, die mit Lilia im Befehlston verkehrte, und deren Gebiss beim Kauen hörbar klapperte. Denn immer öfter weilte Ana mit Lilias Vater in einem Sanatorium in den Bergen. So hatte sie sich die Ehe nicht vorgestellt. Es kam sie hart an, Krankenwärterin zu spielen, ihren Mann, der sich einesteils schuldig, andernteils deprimiert fühlte aufzuheitern. Er hatte nichts zu tun, als sich ruhig zu verhalten und Medizin zu schlucken, von der ihm übel wurde. Er hustete, spie, übergab sich, an manchen Tagen einmal ums andere. Manchmal reichte es für einen Spaziergang. Die Gegend war prächtig. Gewaltig. Mit Sicht auf ewigen Schnee. Mit Alpwiesen. Silberdisteln. Enzianen: Eine Idylle. Im Ort gab es ein Casino, ein Kino, Konzerte, Tanztees – für Gesunde – für den Vater nur ausnahmsweise. Er wurde dünner und dünner, seine Wangen fielen ein, färbten sich grau. Und kein Kind war in Sicht. Er hatte versagt und benahm sich danach. Teils sehnte er sich nach Ana, weinte, bettelte um ihre Anwesenheit. Teils schickte er sie weg – damit sie lebe, sich amüsiere, sich was gönne.
All das wusste Lilia nur durch exaktes Hinhören und Hinschauen, denn Ana schottete den Vater ab, wo sie nur konnte. Ihn in den Bergen zu besuchen, erhielt Lilia keine Erlaubnis. Nicht einmal nach seiner ersten Lungenoperation. Das Telefon blieb weggeschlossen. Und Lilia kannte auch des Vaters Adresse nicht. Schrieb sie ihm, überbrachte Ana den Brief. Ganz sicher las sie ihn vorher. Also konnte Lilia dem Vater nicht ihr Herz ausschütten. Ana befahl Lilia, nichts über sich selbst zu schreiben, sondern sich nur auf die Gesundheit ihres Vaters zu beziehen. Für Lilia bedeutete das, lügen zu müssen.
Klinikaufenthalte zogen sich mehr und mehr in die Länge. Der Vater kehrte nur noch selten nach Hause zurück. Waren Lilia und er kurz ungestört, gestand der Vater, er habe sich getäuscht, alles falsch angepackt. Er hätte Ana nicht heiraten, Lilia nicht dermaßen sich selbst überlassen sollen. Er weinte nun oft. Schien verloren. Haltlos. Vereinsamt. Und dass Lilia ihm nicht helfen konnte, nagte an ihr. Auch sie weinte wieder oft: um den Vater, um vertane Zeit. Verpasste Chancen. Noch dachte sie nicht, der Vater sei dem Sterben nahe. Doch der Raum um sie beide verengte sich, das spürte sie. Der ohnehin gravierende Druck nahm noch zu. Nun ging es auch darum, Lilia zu versorgen. Ana schlug vor, sie in ein Internat zu schicken. Ein harter Schlag für Lilia – doch auch der einzige Weg, Ana zu entkommen. Denn Ana verhärtete sich mehr und mehr, auch gegenüber dem Vater. Und als es um die Suche nach einem Internat für Lilia ging, knauserte sie nicht einmal, obwohl sie sonst zu Geiz neigte. An einem See in der welschen Schweiz fand sie den geeigneten Platz. Dort würde Lilia die Sprache lernen. Französische Literatur studieren. Tennis spielen. Schwimmen und segeln können. In einer stattlichen Villa wohnen, mit Park und eigenem Badeplatz. Deshalb fiel Lilia der verfrühte Abgang von ihrer Schule nicht schwer.
Der Vater und Ana fuhren Lilia ins Internat. Da sie als erste eintraf, durfte sie sich ihr Bett im Viererzimmer aussuchen. Sie wählte dasjenige am Fenster, neben der Glastüre, die auf einen steinernen Balkon mit durchbrochener Balustrade hinausführte. Nur die Bewohner dieses Zimmers durften ihn benützen. Das gefiel Lilia. Weniger Gefallen fand sie an einer ältliche, rosagekleideten Dame mit gichtigen Händen – eine der Lehrerinnen – die ihr beim Einräumen der Wäsche half und genau darauf achtete, worüber Lilia verfügte, eigenhändig entschied, was die Eltern wieder mitnehmen sollten. Dass diese Fremde in ihrer Wäsche wühlte, ertrug Lilia schlecht. Es machte sie hilflos. Unmündig. Stempelte sie zu einem Nichts.
Den ersten Nachmittag, bevor ihre Mitschülerinnen anreisten, verbrachte Lilia mit Monsieur, dem Direktor des Instituts, im Segelboot auf dem See, voller Furcht zu Beginn, bis ihre Finger das Anklammern ließen, und ihr das Ruder anvertraut wurde. Denn das Boot war sehr groß, fasste neun Personen, und es allein zu handhaben bedeutete Schwerstarbeit.
Aus dem ganzen Land, und sogar aus dem Ausland, trafen Mädchen in Lilias Alter ein. Nach einer Aufnahmeprüfung, wurden sie den verschiedenen Klassen zugeteilt. Lilia gehörte fortan zu den am meisten fortgeschrittenen. Sie erhielt eine in die Jahre gekommene, kleine, wendige Lehrerin, die Lilia an einen Pinscher erinnerte. Ihre wachen, hellblauen Augen irrlichterten hin und her, beobachteten ohne Unterlass. Die Frau wirkte klug, schlau und gewitzt, auch ziemlich bissig. Ihr weißgraues Haar krauste sich, akkurat frisiert, über den Schläfen. Sie trug einen hellblauen Bolero aus Angorawolle zur schneeweißen Bluse und einen fast bodenlangen, grauen Rock sowie schwarze Schuhe mit dicken Absätzen. Alles an ihr wirkte kühl und unbestechlich. Sanft war sie nicht. Sie wusste, was sie von ihren Schülerinnen wollte und würde es durchsetzen.
Im Internat musste ausschließlich Französisch gesprochen werden, auch von Mädchen, die noch keinen richtigen Satz zusammenkriegten. Da Lilia, vorwiegend aus Faulheit, immer wieder ins Deutsche zurückfiel, wurde sie vor die Wahl gestellt, sich entweder an die Regel zu halten oder heimzufahren. Von da an schleppte Lilia tagaus tagein den Larousse mit sich herum. Das Wörternachschlagen erschien ihr als Maloche, ebenso das Formen von Sätzen und das Reden. Der Sinn der Übung bestand darin, anstatt zu schwatzen, sich dem Lernen zu widmen. Eine harte Lektion für Sechzehnjährige, sogar für die Schweigerin Lilia. Allerhöchstens während den zwei Stunden freien Ausgangs an Samstagnachmittagen fiel hie und da ein deutsches Wort, und wirklich nur dann, wenn man sicher sein konnte, dass kein Spitzel in der Nähe lauerte, der einen verpfiff.
Lilia tat es gut mit ihren drei Zimmergenossinnen zusammenzuwohnen. Sie blühte auf, auch wenn sie sich hie und da stritten, dass die Fetzen flogen. Fortgeschrittene wie Lilia, erhielten die Aufgabe, Anfängern bei ihren Studien zu helfen, obwohl ihr eigenes Pensum an die zwölf Stunden Einsatz am Tag verlangte. Jeden Tag wurde in Lilias Klasse ein Diktat geschrieben und gleich korrigiert. Brauchte es drei Durchgänge, weil immer noch Fehler drinsteckten, folgte ein Nachsitzen. Vier aus Lilias Klasse, Lilia miteingeschlossen, sollten am Ende des Jahres ein Diplom in französischer Literatur erwerben. So hatte es ihre Lehrerin, Mademoiselle Zellweger, beschlossen. Davon ließ sie sich nicht abbringen. Kein Trick zog. Mademoiselle war immun gegen jede Art von Schummelei. Und Lilia gefiel diese Unbestechlichkeit. Sie wurde ernst genommen. Jemand machte sich die Mühe, sie zu fordern. Lilia hob den Handschuh auf: der Hexe wollte sie es zeigen. Und sie begann die Hexe zu lieben. Die gehörte der Religionsgruppe der Gesundbeter an, wie sich bald herausstellte. Litt ein Mädchen an Schnupfen, oder schlief es während der Stunde ein, stellte Mademoiselle die Betreffende schonungslos vor der Klasse bloß. Sie fand bei jeder in der Klasse den wunden Punkt. Weder Tränen noch Rechtfertigungen zogen. Die Ergebnisse gaben ihr Recht. Dank zähen Durchbeißens erkämpfte sich Lilia die Achtung Mademoiselles. Sie erhielt die Erlaubnis für Sonderlektüre, durfte „Les Misérables“ von Victor Hugo lesen und bezahlte für das Privileg mit Panikattacken. Die Vorgänge um Notre Dame, die Verstümmelten, die ausgebufften Huren, der Abschaum. Darüber der Glöckner, bucklig, verfemt. Ein Bastard, geifernd und rachsüchtig: Lilia sah es, als befinde sie sich mittendrin. Roch es. Fühlte es. Das Gewucher, das Schwärende. Den bestialischen Gestank, die zerborstenen Gemäuer – den umflorten Mond, das Gekreische und Geröchel. Die Glockenschläge wie Schiedsgerichte. Erbarmungslos. Der Mensch als Klöppel. Verblutend. Verdammt. - Lilia stürmte die Treppe hoch unter die Decke, spät nachts, nach der Lektüre, aus Angst vor Verfolgung. Das Buch musste im Pult, unter Heften versteckt übernachten.
Mademoiselle beobachtete, was in Lilia vorging, nahm sie noch härter ins Gebet, schraubte sie buchstäblich an sich fest. Und Lilia ging mit. Auch wenn sie die Hexe manchmal bis aufs Blut hasste. Doch die Hexe wollte nichts anderes, als Lilia aus ihrem Schneckenloch pulen, sie in die Sonne schicken, wollte, dass Lilia sich spürte. Ihre Kraft. Ihr Feuer. Nicht um daran zu verbrennen, sondern um sich daran zu stärken. Eine Hetzjagd, die Lilia zu Höchstleistungen anspornte. Lilia sprach mittlerweile akzentfrei Französisch, ging in Aufsätzen mit ausgesuchten Redewendungen um, als habe sie nie andere gebraucht. Kein Schlupfloch gestattete Mademoiselle. Das Hämmern von Mademoiselles Absätzen hallte durch das ganze Haus, wenn sie ihren Kontrollgang antrat. - Noch hätte Lilia die Lektüre, an der sie, außer Programm, arbeitete gegen das Heft mit der vorgeschriebenen Übersetzung tauschen können. Doch sie saß wie gelähmt an ihrem Tisch, saß wie das Kaninchen vor der Schlange. Schon stand Mademoiselle in der Tür: „Nicht wahr, du liest“, bemerkte sie eisig. Der Verrat brach Lilia fast das Herz.
Da Lilia während den Ferien nicht nach Hause konnte und allein im Internat zurückblieb, erhielt sie von Mademoiselle Aufgaben für jeden Tag. Und sie durfte mit Monsieur segeln gehen. Nun schrie sie vor Glück, wenn das Großsegel das Wasser streifte. Steif am Wind. Wellen das Deck überspülten. Ihre Haare flatterten, und das Ruder erzitterte unter ihrer Hand. Ihr Körper sich spannte, und sie mitflog. Leben trank. Rausch trank, als habe nichts je ein Ende.
An Samstagabenden besuchten die Internatsschülerinnen das kleine, schäbige Kino am Ort, marschierten in Reih und Glied hin und wieder zurück, nachdem sie sich einen Film reingezogen hatten, vom uralten Schinken bis hin zu Kostbarkeiten mit Gérard Philippe, Jean Gabin und Michèle Morgan. Hauptsache Kino, Hauptsache Momente der Entspannung vom pausenlosen Büffeln.
Im Sommer lockte das Freiluftkonzert im ehemaligen Kloster auf der Insel, die Lilia jeden Morgen begrüßte, wenn sie die Vorhänge ihres Zimmers zurückschob. Und prompt verliebte sich Lilia in einen der Cellisten des Orchesters, das Mozart spielte, zum Umfallen süß. Die Nacht roch nach betörenden Essenzen.
Lilia brauchte das Verliebtsein wie die Luft zum Atmen. Es machte sie lebendig, spornte ihre Leistungen an, riss sie aus ihrem Weltschmerz, aus der abgründigen Trauer, die sie immer wieder einholte. Einer ihrer teuersten Dichter wurde denn auch Alfred de Musset: der duldende Sänger des Schmerzes. Der am Kreuz des Lebens Verschmachtende.
Die Prüfungen begannen unter der Aufsicht eines der Professoren der Universität. Einem unbeugsamen, begnadeten Grammatiker in schwarzem Radmantel, mit aufgestelltem Kragen, der einem Gemälde von Toulouse-Lautrec entsprungen schien. Die Mädchen der Klasse von Mademoiselle, die sich für das Diplom qualifiziert hatten, brüteten, weit voneinander entfernt, im gestuften Hörsaal über den kniffligen Ausgefallenheiten der französischen Sprache. Der Professor tigerte vor dem Katheder hin- und her. Zu schummeln war unmöglich. „L‘Adieu à L’Enfance“ – Abschied von einer Kindheit, die Lilia nie gehabt hatte - hieß das Thema des darauffolgenden Aufsatzes: - gähnende Leere im Kopf von Lilia - gähnende Leere auf dem vor ihr liegenden Blatt – dann die Eingebung, das Pferd vom Schwanz her aufzuzäumen. Auf blütenübersäten Pfaden schritt Lilia einher. Wind strich durch ihr Haar. Sachte raunend glitten Blätter über marmorne Schultern träumender Statuen, verdorrten, noch ehe der Sommer nah. Starben vor ihrer Reife. Zerstoben, wie nie geboren. Melancholie. Trauer, ohne Aufruhr. Leben zerfloss: So war es immer gewesen. Über vier Seiten streute Lilia diese Elegie, wehmütigen Herzens, fürchtend versagt zu haben. Sie endete mit Kinderlachen, das vom Tor des Parks her erklang, Hoffnung verkündend, Zuversicht und Ausblick – und Lilia erhielt die Bestnote für ihren Erguss. Auch in den anderen Fächern. Und sie erschien als Zeitungsnotiz.
Von Mademoiselle bekam Lilia sämtliche Bände der Bücher geschenkt, die sie außer Programm hatte lesen dürfen. Von der Direktion des Internats wurde ihr eine Stelle als Lehrerin angeboten. Lilia lehnte ab. Zu eng gefasst erschien ihr der Rahmen, in dem sie hätte unterrichten müssen. Sie versprach, Mademoiselle, ihr zu schreiben – und tat es nie.
Zuhause wieder Deutsch sprechen zu müssen, erschien Lilia als der Gipfel der Hässlichkeit. Die Eltern glaubten in Lilia noch das gleiche, schwierig zu handhabende Kind zu sehen, das sie ein Jahr zuvor im Internat abgeliefert hatten. Lilia dachte mit inniger Zärtlichkeit an Mademoiselle zurück, die ihr Wertschätzung entgegen gebracht, und dadurch zu ihrer Entfaltung beigetragen hatte.
Einen Ausweg aus ihrem häuslichen Dilemma fand Lilia, indem sie begann Nachhilfestunden zu geben. Und gleichzeitig kümmerte sich Ana um eine Au-Pair-Stelle in England. Denn dass sie und Lilia nicht länger unter einem Dach wohnen wollten, war offensichtlich. Dennoch begleitete Ana Lilia auf ihrem ersten Flug nach London. Und sie verbrachten drei ereignisreiche Tage zusammen, besuchten alle Lieblingsorte von Ana, ein Konzert, ein Ballett, Museen, Schlösser, überluden die gemeinsamen Tage mit Ereignissen. Ana, unbelastet von Sorgen um ihren Mann und zu Gast in ihrer Traumstadt, genoss jeden Augenblick. Am Morgen des vierten Tags brachte sie Lilia zum Bahnhof, von wo aus Lilia zu ihrer Au-Pair-Stelle fahren sollte, und flog heim. Lilia war auf sich selbst gestellt. Eine Aussicht, die ihr gefiel.
Eine stramme, elegant gekleidete, selbstbewusste Dame holte Lilia am Zielbahnhof ab. Das Erkennungszeichen waren Lilias rote Wangen. Alle Schweizer sähen so gesund aus, wegen der fetten, würzigen Alpenmilch: rote Wangen, Milch, Käse, Heidi - schienen für Engländerinnen Synonyme zu sein. Die Dame - Lilia sollte sie „Mylady“ nennen - wohnte in einem weitläufigen Landhaus im viktorianischen Stil. Efeu rankte sich an seinen Mauern hoch. Lilia erhielt ein Schlafzimmer mit Boudoir sowie ein saalähnliches Badezimmer. Zum Haus gehörten ein Park und ein Rasentennisplatz.
Die Verhandlungen, Lilias Anstellung betreffend, hatte Ana geführt. Sie versprach der Dame, Lilia sei eine routinierte Köchin und Kinderbetreuerin. Mylady gedachte ihren Sommerurlaub mit Tochter, Schwiegersohn, deren Baby sowie zwei Nichten und deren Freunden in ihrem Ferienhaus am Meer zuzubringen und brauchte Lilia, damit sie dort den Haushalt schmeiße. Dass sie in Lilia eine Niete gezogen hatte, merkte sie in den ersten Tagen. Und als Lilia noch wegen Bauchkrämpfen ausfiel, legte ihr Mylady nahe, sich so rasch als möglich eine andere Stelle zu suchen.
Mylady malte, stellte aus, spielte Klavier bei Hauskonzerten, studierte Englisch mit Lilia, nahm sie mit zu Garden Parties. Doch wirklich gemocht hatten sich die beiden von Anbeginn nicht. Ihre Art sich zu geben, das Überakzentuierte, Manierierte, das Einstudierte, Flirtende dieser Sorte Mensch verunsicherte Lilia. Rosa gepuderte Gesichter. Perlen, die unauffällig auffällig durch Finger glitten. Blitzende Ringe, absichtslos absichtlich zur Schau gestellt: ein Puppentheater. Unwirklich. Gehemmt und gleichzeitig Heiterkeit erregend. Frauen, die nie hatten arbeiten müssen. Die über alle Zeit der Welt verfügten, um sich und ihren Stand zu feiern.
Beim Tee getraute sich Lilia fast nicht, die delikaten Tässchen mit den beiden erlaubten Fingern zu halten, die anderen drei graziös gestreckt – nur etwas, beileibe nicht zu viel. Mehr als einmal verschüttete sie einen Schluck, fühlte sich unförmig und deplatziert. Missgeschicke, die diskret übersehen wurden. Sofort eilte von irgendwoher Hilfe herbei, wie ein Schatten, ersetzte Tässchen und Tellerchen, goss frisch ein. Ein perfekt inszeniertes Spiel. Jede Unmittelbarkeit entbehrend.
Die Gebäude, in die Lilia mitging, waren sehr alt, mehrere hundert Jahre. Lilia bekam hohe, weite Tanzsäle zu sehen, in dunklem Holz, mit Wandgemälden und prunkvoll geschnitzten Galerien rundum - für die Bejahrten, die der Jugend lieber zuschauten als mittanzten. Von oben herunter abschätzten, wer mit wem - wie oft. Und wer zu wem – oder besser: nicht passen könnte. Wie zu Shakespeares Zeiten. Die Herren schienen unkomplizierter, derber, schwärmten von Fasanen- und Fuchsjagden. Das Zeitaufwendige des Umgangs miteinander: Nichts lief direkt. Alles geschah nach Regeln. Rituale waren zu erfüllen. Nie würde Lilia zu dieser Art von Gesellschaft Zugang finden, nie den Drill, den es dafür bräuchte, aufholen können. Ihr bürgerlicher Geruch verriete sie immer.
An ihrer zweiten Au-Pair-Stelle wurde Lilia mit Herzlichkeit empfangen. In einem bescheidenen Vorstadthäuschen mit kleinem Gärtchen, wohnte ein junges Ehepaar mit einem Bübchen und „Mister Bates“, einem Hush Puppy, von dem erwartet wurde, dass er Preise gewinne und es auch tat. „Mister Bates‘ “ Erscheinungsbild war untadelig. Rannte er mit seinen kurzen, krummen Beinen durchs Haus, bebten die hölzernen Wände. Lilia liebte den Hund bedingungslos, bedingungsloser als den kleinen Jungen, den sie hüten, und mit dem sie spielen sollte. Dass Lilia nie richtig spielen gelernt hatte, erwies sich nun als Nachteil. Doch da sie anstellig, fleißig, aufmerksam und freundlich war, blieb sie willkommen.
Der Herr des Hauses, ein schmächtiger, unscheinbarer Anwalt, arbeitete in der City von London. Er stand am Anfang einer Karriere, die sich die jungen Leute erfolgreich wünschten. Wurde er zu Projekten hinzugezogen, die mit dem Königshaus zu tun hatten, vibrierte das Häuschen vor Aufregung. Dann tat Eile not. Die Karriereleiter hoch ging es im Spießrutenlauf, mit Herzklopfen und viel Angst. Der Schnellere war der Geschwindere. Trödler wurden gnadenlos überrundet. Mit Ellbogen, spitz wie Dolche. Es ging um alles oder nichts. Manch einer, der auf sich warten ließ, hatte das Nachsehen. Massen standen am Start. Wenige gewannen. Arny, der Hausherr wollte gewinnen. Er arbeitete bis zum Umfallen, um an den richtigen Stellen zu gefallen. Das Ehepaar ging nur aus, wenn es dem Vorwärtskommen diente. Ständiger Druck hing über dem Häuschen. Panik ging um, wenn Dinge nicht nach Plan liefen. Es war wie im Krieg: Ein Kampf um Sekunden. Zauderer bestrafte das Leben. Dann reichte es noch für eine Kanzlei auf dem Land, und das Prestige war dahin.
Mit Lilia gingen die jungen Eheleute leicht und lässig um. Am wenigsten einfach fand Lilia die Arbeit mit Nigel. Er war ein pummeliges Kind, trug eine Brille, weil er schielte, erstaunt dümmlich in die Welt guckte, linkisch auf den Beinchen stand und rasch losheulte, wenn ihm Wünsche nicht erfüllt wurden. Dann half „Mister Bates“ Lilia aus der Patsche. Er schubste und leckte Nigel, bis sie zusammen über den Boden kugelten.
Einen Tag in der Woche hatte Lilia frei. Fast jeden verbrachte sie in London, in Theatern, der Oper, dem Ballett, in Museen. Manchmal sah Lilia zwei Vorstellungen an einem Tag, eine Matinée und eine Abendvorstellung. Dazwischen besuchte sie Schlösser und Parkanlagen. Und sie las alles von Shakespeare, was in Arnys Bibliothek stand, einen Durst stillend, der unstillbarer wurde, je mehr sie trank. Alles, was ihr zuhause verboten gewesen war, holte sie nach. Lieber verzichtete sie aufs Essen, als auf eine Vorstellung. Wie zuvor das Französische, wurde nun das Englische zu Lilias Lieblingssprache. Sie entdeckte neue Autoren, auch Anton Tschechov, der zu einem ihrer bevorzugten Dichter wurde: Seine Wehmut, die Schwerblütigkeit seiner Figuren, denen Hoffnung über Hoffnung abhandenkam, sie versumpfen ließ im Suff, aus Nachlässigkeit, mangelndem Willen, vor allem aus Unwissenheit. Sie ertrinken ließ in Herzweh. Und die doch nicht der Würde entbehrten, einen Rest an Menschlichkeit behielten, die unausweichliche Bürde ihrer Klasse schulterten, selbst wenn sie zuletzt daran zerbrachen. Durch Tschechov erhielten Verlust und Niederlage für Lilia ein anderes Gesicht. Seine Figuren waren nie wirklich schmutzig, schmierig oder verabscheuenswürdig. Auch ihre Niedertracht trug den Stempel von Tschechovs Liebe. Gleichgültigkeit zeigte sich nie.
Die Monate von Lilias Aufenthalt in England verflogen im Nu. Als Lilia das realisierte, brach sie in Tränen aus. Auch ihre Gasteltern waren baff. Lilia gehörte mittlerweile zur Familie. Doch bleiben konnte sie nicht. Sie hatte mit ihren Eltern vereinbart, dass sie sich während des Rests des Jahres in einem Privatgymnasium auf ihre Aufnahmeprüfung ins Lehrerinnenseminar vorbereiten würde. Denn Lilias Wunsch, Schauspielerin zu werden, hatte bei ihren Eltern nur Wut, heftige Anschuldigungen und Vorwürfe gezeitigt. Die Eltern sprachen von Schande, von Tingel-Tangel und Hurerei. Sie hätten sich doch nicht all die Mühe mit ihrer Schulung und Erziehung gegeben, damit sie sie auf den Müll werfe. Anas Idee: „Wenn du dich unbedingt präsentieren musst, werde Lehrerin“, hatte Lilia schließlich akzeptiert.
Lilia, deren Flugzeug am Nachmittag landete, freute sich darauf, ihren Vater und Ana wiederzusehen. Doch niemand holte sie ab. Sie wartete eine Stunde, bestieg dann den Bus, die Straßenbahn, den Zug - und erreichte das Elternhaus um sieben Uhr abends. Sie läutete. Niemand öffnete. Lilia setzte sich mit ihrem Koffer auf eine Treppenstufe. Gegen neun Uhr trat eine Nachbarin vors Haus, sah Lilia, rief sie herein und fragte sie aus. „Deine Eltern sind verreist“, bekam Lilia zu hören.
Lilia war müde und dem Weinen nahe. Die Nachbarin machte Tee und schmierte ein Brot für Lilia. Lilia rief die Großmutter an und erfuhr, ihre Eltern würden erst tags darauf heimkommen. Sie könne mit dem Taxi zu ihr fahren und bei ihr übernachten. Lilia lag die ganze Nacht wach. Nach dem Frühstück erhielt sie Geld von der Großmutter und die Adresse eines Hotels in der Zentralschweiz. Dort erwarteten sie die Eltern. Der Vater erschien Lilia krank und blass. Ana hielt sich mit der Begrüßung nicht lange auf. „Wie siehst du nur aus, Mädchen“, rief sie. „Schau dich an. Hatten die dort keine Spiegel. So kannst du nicht unter die Leute. Wir gehen als erstes zum Coiffeur. Der soll dich herrichten.“
Zweieinhalb Stunden später verließ eine ziemlich verdatterte Lilia den Laden, die Haare kurz geschnitten und zu runden Locken gedreht. Eine Wolke von Haarspray umwehte sie, süßlich nach Pisse riechend. Der Vater flüsterte Lilia zu: „Das geht vorüber. Lach!“ Er machte den Vorschlag, sie sollten zusammen zu Nacht essen, und Lilias Heimkehr feiern. Doch Lilia hatte anderes im Sinn. Der Aushang am Theater kündigte „Die Zauberflöte“ an. Und Lilia, immer noch wütend, weil sie versetzt worden war, tat kund, sie gehe ins Theater. Das komme überhaupt nicht in Frage. Nun sei sie wieder zuhause, und es würden andere Saiten aufgezogen. Und wenn ihr das nicht passe, könne sie gut auch ohne Nachtessen zu Bett gehen, bemerkte Ana eiskalt.
Letzteres befolgte Lilia freiwillig. Sie lag und heulte sich das Heimweh nach England von der Seele. Durch die Jalousien verfolgten ihre Augen die wie Spieße in ihr Zimmer hereinbrechenden Scheinwerfer der Autos. Wie Fächer über sie geworfen – ausgelöscht – über sie geworfen, wieder und wieder. Lilias Tränen versiegten. Sie drehte das Radio an. Takte der „Zauberflöte“ durchströmten ihr Nervensystem. Eine Aufführung aus Wien: leichtfüßig, gewichtig, drohend. Wie Wellen, die anrollten, sich zurückzogen, anrollten. Garben aus Klang, ständig neu gebündelt, in zahllosen Schattierungen. Lilia lauschte. „Covent Garden“ tauchte auf vor ihrem inneren Blick. Der Abend der „Bohème“. Stehplatz. Eine Lücke in den Sitzen blieb offen. Lilia schlüpfte hinein, fürstlich platziert, hingerafft von der Magie des Orts, der Sänger, des Dramas. Applaus ohne Ende. Dutzende Rosen den Sängern vor die Füße geworfen.
Gegen Morgen schlief Lilia ein - erschrak, als sie sich im Spiegel sah, den Wusch an Haaren, wild durcheinander. Sie versuchte sie mit der Bürste zu glätten, gerade genug, dass Ana fand, es sei schade um die teure Frisur. Nach dem Frühstück die Heimkehr: Lilia im Innersten zerstückelt.
Lilia besuchte, wie vereinbart, den Unterricht eines Privatgymnasiums ihrer Heimatstadt, zur Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung ins Lehrerinnenseminar. Im etwas verwahrlost wirkenden, düsteren Altstadtbau roch es wie in ihrer früheren Primarschule, nach Bohnerwachs, Schweiß, abgestandener Luft und vor sich hinmoderndem Papier. Die Fenster gingen auf eine stark befahrene Straße hinaus, die zu einem der alten Stadttore führte. Trambahnen bimmelten, Autos hupten. Hie und da war sogar Pferdegetrappel zu hören.
Lilia liebte die Stunden im maroden Gebäude. Ihre Klasse bestand aus wenigen Schülern, Jungen und Mädchen. Immer mal wieder blieb jemand weg, und neue kamen dazu.
Nach den sechs Monaten, die Lilia in dieser Schule verbrachte, behielt Lilia nur die Erinnerung an ihren Deutschlehrer. Er faszinierte sie vom ersten Augenblick an. Klein gewachsen, hager, die Kleider am Leib schlotternd, wirkte er auf Lilia wie ein Powerdrink. Er schien ungemein belesen. Und wie Lilia liebte er den Konjunktiv der Vergangenheit. Das Jonglieren mit Wörtern, mit Zitaten, Begriffen aus Geschichte und Literatur bereitete ihm unsägliches Vergnügen. Er galt als genial. Bei anderen als Blender, als verkappter Kommunist, Betrüger und Hallodri. Seiner Feinde rühmte er sich, spielte mit der Gefahr, wie mit einer verwilderten Katze. Es hieß, er würde hin und wieder überfallen und verprügelt. Immer noch besuchte er Vorlesungen an der Universität, in Philosophie, Geschichte, Germanistik, in vielen verschiedenen Disziplinen. Je nachdem welcher Professor gerade Tagesgespräch war, welche Vorlesungen hergebrachte Denkweisen umstülpten, welche den Klang neuer Ansätze in sich bargen. Alle aus der Intellektuellenszene kannten ihn. Und er kannte alle, wurde gehasst, geschmäht ob seiner Dreistigkeit und Unverfrorenheit. Frauen zog er magisch an. Bewegte sich in Künstlerkreisen wie ein Irrlicht. Eben noch dagewesen, war er schon wieder über alle Berge. Grüßte nicht. Verabschiedete sich nicht. Tauchte auf. Und tauchte weg. Ohne Gewissensbisse. Ohne sich im Geringsten um die Meinung anderer zu kümmern. Er gehörte nur sich selbst und ließ keinen Zweifel daran übrig. Er empfand sich als genau richtig, als optimal, als ein mustergültiges Exemplar menschlicher Vollkommenheit.
Leo, so hieß der Lehrer, konnte an keiner öffentlichen Schule als Unterrichtender lange bestehen. Sein Sarkasmus kostete ihn immer wieder Sympathien. Dennoch galt er als ausgezeichneter Pädagoge. Und natürlich verliebte sich Lilia restlos in Leo. Sein Weltbürgertum bewunderte sie. Sein ausuferndes Wissen bezauberte sie. Und auch dass er sich für sie zu interessieren schien, vor allem für eine gewisse Kühnheit ihres Denkens, wie er sagte. Er mochte Menschen, die für sich einstanden, die sich ihrer Gedankengänge nicht schämten. Einen inneren Weg zu verteidigen hatten - und es auch taten.
Ana und der Vater allerdings begrüßten Lilias Schwärmerei für Leo in keiner Weise. Für sie galt er als rundum suspekt. Und ihre Erkundigungen über ihn, untermauerten diese Ansicht. Doch den Umgang mit ihm verbieten, konnten sie Lilia nicht. Auch war ihr in ihrem Alter nicht mehr einfach vorzuschreiben, sie habe nach der Schule sofort nach Hause zu fahren. Einen gewissen Freiraum mussten die Eltern Lilia nun zugestehen.
Und so kam es vor, dass sie hin und wieder eine Stunde oder zwei in Leos Wohnung verbrachte, der ersten Junggesellenwohnung, die Lilia kennenlernte. Leo liebte antike Uhren. Die größte, massivste und schwerste, aus geschwärztem Eisen, hing genau über dem Kopfende seines Bettes, das auch als Sofa diente. Fiele sie hinunter, erschlüge sie ihn auf der Stelle, eine Vorstellung, die Leo genüsslich auskostete. Es schien, er fürchte weder Tod noch Teufel. Seine Handschriftensammlung flößte Lilia tiefen Respekt ein. Sein Zigarettenverbrauch ebenso. Und dass er Tag und Nacht rauchigen, parfümierten Tee trank überdies. Als Teetisch diente ihm ein alter, mit skurrilen Motiven bemalter Schlitten. Da er nicht für sich selbst kochte, stand die Spüle voll mit braunverfärbten Tassen. Und in der Badewanne stapelten sich Hosen, Hemden und Jacken. Lilia fragte sich wo, wann und wie er sich wasche. Doch roch er immer gut, nach Kräutern, nach Fernöstlichem, das Lilia nicht kannte. Und seine Kleider waren sauber, auch wenn hie und da ein Knopf an ihnen fehlte. An den Füssen trug er Stiefeletten, und sein dünnes, blondes Haar bedeckte eine Baskenmütze, wenn es regnete. Mit Schirm und Überzieher gab er sich nicht ab.
Zwei weitere Lehrer blieben Lilia vage im Sinn: Ein Zwillingspaar aus Ostdeutschland. Beide hünenhaft, breitschultrig, schwergewichtig ohne dick zu sein, mit seltsamem Akzent sprechend. Ob sie die beiden mochte, war Lilia nicht klar. Sie waren Exoten, fielen auf durch ihre Erscheinung und auch durch ihr Zusammengehörigkeitsgefühl. Eine Beobachtung, die Lilia, die keine intakten Beziehungen zwischen Menschen kannte frappierte.
Lilia gehörte nicht zu den Mädchen, die von anderen nach Hause eingeladen wurden. Sie hatte immer höchstens eine oder gar keine Freundin, da sie niemanden zu sich nach Hause mitbringen durfte, so als ob ihre Eltern nicht daran interessiert wären, dass sich Lilia integrierte, irgendwo dazugehörte. Da ihr Vater kränker und kränker wurde, fehlten ihm die Zeit und der Raum, sich um solche Banalitäten zu kümmern. Er dachte, Lilia finde sich schon irgendwie zurecht. An ihrer Zähigkeit hatte er sich oft genug die Zähne ausgebissen. Und Ana schien es egal zu sein, was aus Lilia wurde. Sie würden nicht zusammenbleiben, falls dem Vater etwas zustoßen sollte, das war ihnen beiden klar. Und bis dahin wäre Lilia fast oder ganz volljährig, und sie hätte sich nichts vorzuwerfen, wenn sie sich nicht mehr um sie kümmerte.
Die Lehrer-Zwillinge hielten zueinander wie Pech und Schwefel. Heike war bei den Schülern beliebter als Heiko, der einer Art von Riesenbaby glich, sich in seinem Körper nicht sonderlich daheim fühlte und sein linkisches Gehabe durch anzügliche, peinliche Witzchen wettzumachen suchte. Einmal setzte er sich auf den Stuhl neben Lilia, um ihr beim Schreiben eines Französischaufsatzes über die Schulter zu gucken. Dabei entdeckte Lilia, dass an seinem linken Oberschenkel die Hosennaht ein paar Zentimeter klaffte und den Blick auf weißliches, behaartes Fleisch freigab, was einen solchen Stich in Lilias Herz hinterließ, und einen solchen Widerwillen in ihrem Gemüt hervorrief, dass sie fortan seine Stunden so oft als möglich schwänzte. Sie fühlte sich, als habe er sie unsittlich berührt.
In dieser Hinsicht war Lilia äußerst heikel. Küssen lassen hatte sie sich schon einmal, und zwar von einem ganz und gar harmlosen Gymnasiasten, dem Sohn eines Freundes ihres Vaters. Er durfte sie nach einer Einladung bei seiner Familie auf seinem Roller nach Hause chauffieren. Lilia war noch nie Roller gefahren. Dass sie den Jungen von hinten um die Taille fassen sollte, um nicht hinunterzufallen, kostete sie Überwindung. Sie genoss die Fahrt. Und da er so unbedarft, so durch und durch angepasst wirkte, und auch überhaupt als Typ für Lilia keinerlei Gefahr bedeutete, durfte er sie zum Abschied küssen. Nur kurz. Nur auf geschlossene Lippen. So ekelte sich Lilia nicht vor seiner Berührung, auch weil sie wusste, sie würden einander nicht wiedersehen. Denn er gedachte, im darauffolgenden Jahr sein Jura-Studium zu beginnen und wäre dann sowieso für sie gestorben. Lilias Selbstwertgefühl war zu schwach, als dass sie sich als Freundin eines Jungen aus besseren Kreisen gesehen hätte. Menschen aus intakten Familien, mit Eltern die einander und die Kinder liebten, glichen für Lilia einem Mythos jenseits ihrer Reichweite. Sie fürchtete sich vor solchen Leuten. Ihre Kenntnisse geordneter, zärtlicher Verhältnisse waren gleich Null. Sie fühlte sich inmitten solcher Menschen als Fremdkörper. Dinge, wie eine gemeinsame Familiensprache und unproblematisches gegenseitiges Verständnis, waren Begriffe jenseits von dem, was ihr Leben ausmachte. Lilia glich einem Paria. Und sie erfuhr sich deshalb in Zwischenmenschlichem auch nicht als zuständig. Sie war Zuschauerin und würde es ein Leben lang bleiben. Doch entwickelte sich gerade diese Qualität in ihrem späteren Leben zu eine ihrer Stärken. Das Leiden ersparte sie ihr zwar nicht, im Gegenteil. Das in und mit sich Alleinsein machte das Leiden für Lilia ausschließlicher, endgültiger. Dafür vermittelte es ihr die Kraft der Durchdringung. Wenn andere Trost und Hilfe in Familien und Freundschaften fanden, und Leiden dadurch seinen Stachel verlor, es linderte, verdünnte - wie Sirup, in den man Wasser gießt - kriegte Lilia die volle Ladung, die ganze Breitseite ab, ungebremst, in voller Bitterkeit. Das lehrte sie, Leben ungeschönt zu sehen.
Je älter Lilia wurde, desto weniger Angst verursachte ihr das Hinschauen. Es wurde selbstverständlich, wurde zum Lebenszweck, zum Lebenselixier. Lilia lernte zu schauen ohne zu zwinkern, lernte, über so lange Zeit die Augen offen und fokussiert zu halten, bis sie erspäht und durchdrungen hatte, was sie wissen musste, oder wollte. Für bescheiden hielt sich Lilia nicht. Und sie gab sich auch keine Mühe, bescheiden zu wirken oder aufzutreten. Eine Art von Sendungsbewusstsein trieb sie an. Sie war sich sicher, sie würde Herausragendes schaffen, irgendwie und irgendwann. Und das nicht einfach in alltäglichen Belangen. sondern in Speziellem.
Doch vorderhand genoss Lilia das Ballett. Entdeckt hatte sie es durch Leos Nichte, an der er sehr hing und die er umsorgte wie seine eigene Tochter, da er fand, ihre Mutter kümmere sich, als Alleinerziehende, nicht genug um sie. Isolde war ein exzentrisches Mädchen, leicht unterbelichtet, fand Lilia, dafür umso begeisterungsfähiger. Zur Zeit ihrer Bekanntschaft, beschäftigte sie das klassische Ballett. Sogar auf der Straße stolzierte Isolde mit ausgedrehten Füssen einher, wie die Startänzer des Theaters, das einen ausgezeichneten Ruf hatte. Die ausgedrehten Füße Isoldes imitierte Lilia nicht. Lilia fand vieles an Isolde peinlich, hielt sie für oberflächlich und hysterisch, für eine Göre, die jeden Jungen anflirtete, ohne selbst über Format und Beständigkeit zu verfügen. Nur voller Flausen darüber steckte, was es sonst Großartiges anstellen könne, falls es mit dem Tanzen nicht klappe.
Isolde war genau das Gegenteil von Lilia, die sich als eine Art von Pfeil erlebte, der schnurgerade die Luft durchschnitt. Doch als Türöffnerin zu Leo, leistete Isolde gute Dienste. Sie besuchte die gleiche Schule wie Lilia, nur ohne Ambitionen, lediglich weil ihr Onkel dort unterrichtete und über weitreichende Kontakte verfügte, die Isolde auch Zugang zu Mitgliedern des Balletts verschafften. Sie durfte Proben besuchen, was Leo hoffen ließ, sie packe die Gelegenheit beim Schopf und stürze sich in die Ausbildung. Doch geschah nichts dergleichen. Isolde heiratete ohne Schulabschluss einen reichen Luftikus nach ihrem Geschmack. Das enthob sie jeder Anstrengung. Sie durfte weiterhin Kind spielen und ihren Gelüsten frönen, ohne Folgen befürchten zu müssen.
Im Geheimen erstand Lilia ebenfalls Spitzentanzschuhe. Sie hatte Gewicht verloren und brauchte sich nicht zu schämen. Im Geschäft gab sie sich als versiert, auch wenn sie daran zweifelte, die Verkäuferin nehme ihr die Ballettstunden ab. Allein das Anprobieren der Schuhe, glich einer Tortur, geschweige denn das Daraufstehen, und das Gehen mit durchgestreckten Beinen. An ein mit winzigen Schrittchen Dahingleiten, wie die Schwanenprinzessin, war nicht zu denken. Das würde beinhartes Training erfordern. Obwohl die Elevinnen aus Paris und London, deren Ausbildung und Karrieren Lilia in einschlägigen Zeitschriften verfolgte, wirkten, als flögen sie. Lilia hängte schließlich die Ballettschuhe als Andenken an einen Nagel neben ihrer Zimmertüre.
Weniger war das Feuer in Lilias Innerem nicht geworden. Immer noch loderte es. Immer noch trieb es sie durch die Tage. Den Druck von zuhause linderte, dass Lilia viele Stunden des Tages außerhalb verbrachte. An die, von Ana immer noch an sie gerichteten Vorwürfe, gewöhnte sie sich. Bald würde sie sie nicht mehr zu hören bekommen. Ein paar Wochen noch, dann hätte sie die Prüfung ins Seminar geschafft. Davon zeigte sich Lilia überzeugt. Andere Gefühle durfte sie nicht aufkommen lassen. Die Vorstellung, den Absprung nicht zu schaffen, und weiterhin zu Hause wohnen zu müssen, verbot sie sich. Es hätte das Ende ihres Lebens bedeutet.
Lilia glaubte unbeirrt an ihre Chance. Dass sie über keinen Rückhalt verfügte, so wie andere junge Menschen, denen Eltern, Freunde und Lehrer halfen, sich im Leben zurechtzufinden, erschien ihr nicht immer nur als Mangel. Denn Rechenschaft schuldig zu sein, vor anderen zu kuschen, sich anzubiedern, ging Lilia gegen den Strich. Es rief eine Empfindung in ihr wach, die physische Übelkeit erzeugte, sich auf ihrer Haut wie schlieriger Schmutz anfühlte. Es aus eigener Kraft schaffen wollte sie, auch wenn sie kein Geld hatte, und es niemanden kümmerte, ob sie etwas zustande brächte. Sie würde ihren Weg finden, schon nur aus der Notwendigkeit heraus, zu überleben. Daran glaubte Lilia felsenfest. Noch immer gab es den Herrgott und die Mutter Maria. Und die würden sie nicht vor die Hunde gehen lassen. Selbst wenn der Gedanke, zu unterliegen, beißende Panik in ihr auslöste. Nach außen mochte sie sich eine Aura von Souveränität, zumindest von Überlegenheit und Unverwüstlichkeit zugelegt haben. Doch innen drin litt sie dieselben Höllenqualen wie seit je, gab es keinen Boden unter ihren Füssen. Sie vermisste Gesprächspartner, Ratgeber, Menschen, die ihr zeigten, wie Leben ging. Sich anderen gegenüber öffnen konnte Lilia immer noch nicht. An Sprache fehlte es ihr nach wie vor. Sie spürte, dass sie Anliegen hatte, die sie nicht zu fassen kriegte, weil sie sich selbst nicht zu fassen kriegte. Das machte sie verwundbar. Unsicher. Bar der Balance. Wie sie ihre überbordenden Kräfte bündeln sollte, blieb ihr verborgen. Nur hoffen konnte sie. Und darauf verlegte sie ihre ganze Inbrunst.
Lilia hatte ein verfeinertes Gespür dafür bekommen, wo sie willkommen war und wo nicht. Sie empfand Ablehnung wie eine Wand, die sich ihr entgegenstemmte, sie nicht hindurch ließ, so als renne sie gegen Watte an. Würde sie sich hindurchkämpfen, und Zugang erzwingen, würde sie nur noch mehr im Abseits, im Raumlosen landen als bisher. Das hatte zur Folge, dass auch das Lieben für Lilia aus der Distanz stattfand. Waren ihre Angebeteten nicht zugänglich, hinderte sie das nicht daran, sich ihnen so nahe zu fühlen, als stünden sie neben ihr. Durch Entbehrung war ihr Innenleben derart reich geworden, dass sie über zahllose Schattierungen von Wahrnehmung, von Zuneigung und Liebesfähigkeit verfügte. Und da ihr die Worte, diese auszudrücken fehlten, erlebte sie Gefühle als Gewichtungen. Als Färbungen. Klänge. Als hauchfein und durchlässig wie Gespinste - oder überwältigend. Brausend. Und alles Bisherige niedermetzelnd.
Die Ausgrenzung weckte eine Unmenge an Sensoren in Lilia. Sie hörte Zellen ächzen, gewahrte Leben und Atmen auf eine Weise, die gar nicht kommunizierbar war. Die Stummheit lehrte sie die Sprache von Existenz. Das Entstehen und Entschwinden des Augenblicks. Die Bodenlosigkeit. Die Unmöglichkeit von Anhaftung sowie die Fruchtlosigkeit von Befriedigung, da sie stets mit leeren Händen zurückblieb. Selbst wenn sie sich einzubilden versuchte, gewonnen, Schätze gesammelt zu haben. Lilia ahnte, dass dem nie so war. So sehr sie sich auch Mühe gebe, sie würde sich immer allein wiederfinden.
Lilia wunderte sich manchmal, dass andere Menschen das nicht so sahen. Nicht erkannten, dass zwei Dinge, oder Wesen, nicht gleichzeitig am selben Ort existieren konnten. Dass das schon rein physikalisch nicht ging, geschweige denn in der Wirklichkeit des Alltags. Und dass deshalb auch nie zwei Wesen zur gleichen Zeit dasselbe fühlten oder erlebten. Selbst in der größten Ekstase hatten keine zwei zusammen Platz. Selbst die unglaublichste, fantastischste Liebeserklärung zielte letztendlich ins Leere, mochte sie den Beschenkten auch im Moment beglücken, ihn glauben, irrwitzig hoffen und jubeln machen: Der Augenblick danach würde unweigerlich die Herrlichkeit in Nichts zerbröseln, ihn ausgehöhlt und einsam zurücklassen. Das Gesetz der Natur, des Lebens, wollte es so. Alles andere war Augenwischerei.
Doch keimten diese Erkenntnisse erst ansatzweise in Lilia auf. Ihr Leben richtete sich unbewusst danach. Sie vermochte es nicht zu steuern. Schnurgerade führte es sie diesen Weg entlang. Und sie gehorchte ihm fraglos. Er wurde ihr wichtiger und wichtiger. Sogar unausweichlich wichtig, erschien ihr als der einzig gangbare. Obwohl sie keinen Grund für diese Annahme anzugeben gewusst hätte. Sie folgte einfach ihrer Bestimmung.
Immer öfter weilte der Vater nun krankheitshalber in den Bergen. Und Ana teilte sein Schattendasein, mietete sich am Ort eine Ferienwohnung, in der ihr Mann sie an Tagen, an denen er sich dazu imstande fühlte besuchte. Auch Lilia durfte ein Wochenende dort verbringen. In der Küche standen hohe Barhocker an einer Theke, die zum Anrichten des Essens diente. Plötzlich entwickelte sich bei Ana aus dem Nichts heftiger Zorn, den eine Bemerkung von Lilia zusätzlich entflammte. Mit voller Wucht und hasserfülltem Blick schlug Ana mechanisch zu und traf Lilias rechte Wange. Lilia ließ sich widerstandslos, samt Hocker, zu Boden fallen, wie ein nasser Sack, gleichzeitig erschöpft und tieftraurig. Es würde die letzte Ohrfeige sein, die sie von Ana erhielte. Einer weiteren würde sie sich auf keinen Fall unterziehen. Sie war es so müde, zum Erbrechen müde, immer nur abgekanzelt, runtergemacht und für ihre Sicht der Welt zurechtgewiesen zu werden. Sie hatte es satt. Zum Speien satt!
Nach diesem Vorfall durfte Lilia ihren Vater während mehreren Monaten nicht mehr sehen. Einmal noch - es schien, sein Leben nehme eine Wendung, er genese, atme wieder auf - besuchte der Vater Lilia überraschend an ihrem Seminarort. Sie gingen spazieren, etwas schüchtern zuerst, nebeneinander her wie Fremde, darauf bedacht, einander tunlichst nicht zu berühren, waren sie es doch nicht gewöhnt, miteinander allein zu sein. Es brauchte Zeit, bis ein Gespräch zustande kam. Doch dann gelang es ihnen, sich behutsam zu öffnen. Der Vater hörte Lilia zu, und Lilia hörte dem Vater zu, und beide waren baff, bass erstaunt darüber, wie viel, und was sie einander alles zu sagen hatten. Unabhängig von ihren individuellen Lebenseinstellungen, standen sie einander als Erwachsene, als Gleichwertige gegenüber. Sogar als Freunde, die einander gerade erst entdeckt hatten, Schätze im anderen findend und zutage fördernd, deren Existenz ihnen, aus Mangel an Gelegenheit und Muße verborgen geblieben waren. Es war das einzige, wirkliche Gespräch zwischen ihr und dem Vater, an das sich Lilia erinnerte. Seinen Inhalt vergaß sie. Doch dass sie einmal, nur dieses eine Mal von ihrem Vater ernst genommen und bedingungslos akzeptiert worden war, dieses Geschenk behielt sie. Es war eine der großen Gaben, die das Leben für sie bereithielt, und es erfüllte sie mit stets gleichbleibender Dankbarkeit.
Im Übrigen wurde es Zeit, dass Lilia von zuhause wegkam, denn mit Ana gab es keine Möglichkeit der Verständigung mehr. Der Vater weilte wieder in den Bergen. Ein schwerer Rückfall hatte eine erneute Operation zur Folge gehabt. Ana und der Vater waren zutiefst enttäuscht und entmutigt, auch darüber, dass ihre Ehe nicht in Fahrt kam, dass keiner ihrer Pläne sich erfüllte, nur Prüfung auf Prüfung folgte, und Freude, Hoffnung und Zuversicht sich immer mehr in Fremdwörter verwandelten. Ana wurde darob verhalten bösartig, richtete versteckte Vorwürfe an Lilias Vater, hielt den Gedanken an Lilia kaum noch aus, und schob Lilia unmissverständlich und eiskalt die Schuld an seiner Krankheit und an seinem möglichen Tod in die Schuhe. Nur ihrer Verrücktheit und ihren hirnverbrannten Ansichten sei es zu verdanken, dass es dem Vater so schlecht gehe. Lilia sei schuld an seinem Zustand, denn ihr unaufhörlicher Widerstand habe ihn aufgerieben, schimpfte sie.
Zu ihrem Glück konnte Lilia diese Vorwürfe stehen lassen, wo sie waren. Erstaunlicherweise prallten sie von ihr ab wie Wassertropfen. Das Maß schien voll, eine Trennung unvermeidlich. Und als Lilia die Prüfung ins Lehrerinnenseminar so gut bestand, dass ihr eine mündliche Nachkontrolle erspart blieb, packte sie ihre Habseligkeiten beinahe leichten Herzens. Ana fuhr sie zum Seminarort, der nun während Jahren zu ihrem neuen Wohnort werden sollte. Und die beiden verabschiedeten sich mit tiefem Ausatmen voneinander. Sogar mit Lachen und Winken. Doch ohne ihre Erleichterung zu verheimlichen. Lilia zog einen dicken Strich unter ihr Zusammenleben mit Ana. Ganz würde sie Ana zwar noch nicht los sein. Dafür war Lilia nun wenigstens weit genug vom Schuss entfernt, um sich befreit zu fühlen. Die Spannweite ihrer Flügel vervielfachte sich. Und das gönnte sie sich.
Im von katholischen Schwestern geleiteten Mädchenheim für auswärtige Schülerinnen der Kantonsschule und des Lehrerinnenseminars, in dem ihre Eltern Lilia angemeldet hatten, erhielt sie, wie durch ein Wunder, das letzte, verfügbare Einzelzimmer. Es war klein wie eine Schuhschachtel. Ein Bett, das zentimetergenau die Breite des Zimmers füllte, ein Schrank, der exakt Platz bot für ihre Habseligkeiten sowie ein Lavabo und ein Tisch machten seine Möblierung aus. Der Tisch stand unter dem Fenster neben der Glastüre, die auf eine halbrunde Terrasse hinausging, die mehr als Schmuck des Hauses gedacht war, denn als Balkon. Zwei hölzerne Stühle fanden knapp darauf Platz, so dass sich Lilia auf den einen setzen und die Füße auf den anderen stellen, oder die Beine zum Sonnenbaden übers Geländer baumeln lassen konnte. Lilia fühlte sich in ihrem Schuhkarton glücklich wie im Paradies. Die Eingangstüre zum Zimmer verhängte sie mit einem buntgemusterten, afrikanischen Tuch, das mit seiner Farbigkeit den Raum nahezu sprengte. Das Lilia jedoch besonders liebte, weil es sie, als Abschiedsgeschenk von ihrer Schulfreundin, vor Heimweh schützen sollte. Den Tisch dagegen bugsierte sie kurzerhand auf den Flur hinaus. Bald darauf, angelockt durch das Rumpeln und Schieben während der Aktion, klopfte eine der Nonnen an die Türe und äußerte zögerlich Befürchtungen wegen des Tisches. Wie Lilia denn ihre Hausaufgaben zu machen gedenke, fragte die Nonne besorgt. Auf einem A4-grossen Brett hatte Lilia einige zerbrechliche Dinge transportiert, die sie am neuen Wohnort nicht missen wollte. Sie hatte sie mit Klebeband darauf fixiert, so dass sie während des Umzugs nicht zu Boden fielen. Und dieses Brettchen zeigte Lilia der Nonne nun, darauf hinweisend, sie sei es gewohnt, auf den Knien zu schreiben. Sie habe das im Internat gelernt, wo sie frühmorgens, um ihre Zimmerkolleginnen nicht zu stören, unter der Bettdecke bei Taschenlampenlicht auf genau solch einem Brettchen geschrieben habe, beim Büffeln von Grammatik. Die Nonne ließ sich halbwegs von Lilias schalkhaft hervorgelachter Erklärung überzeugen. Doch machte die Geschichte mit dem Tisch umgehend die Runde. Ungläubige Gesichter musterten Lilia beim Nachtessen. Getuschel war zu hören, als sie ihren leeren Teller zur Anrichte zurücktrug. Ihren Stempel hatte Lilia weg. Doch das kratzte sie nicht. Hauptsache freier Raum war gewonnen.
Und dorthin, auf den Boden, der Wand entlang und auf den Fenstersims darüber, platzierte Lilia nun ihre wenigen mitgebrachten Lieblingsbücher: Die gesammelten Werke von Shakespeare auf Englisch an prominentester Stelle. Daneben Tschechov, zusammen mit einigen Franzosen. „Dichtung und Wahrheit“ von Goethe. Weniges von Kafka, Böll, Benn und Brecht. Damit war der Raum ausgeschöpft. Auch rund um ihr Bett gab es einen Sims für Bücher und Krimskrams. Ihre wenigen Nippes fanden dort Platz, der Wecker. Die silberne Schachtel mit dem Nagelpflegezeug. Ein Kerzenständer. Eine Rolle Räucherstäbchen. Zwei fast durchsichtige, bemalte Tässchen aus ihrem bevorzugten Chinaladen. Sowie eine Büchse mit Tee und ein Tauchsieder in gläsernem Behälter - den sie allerdings nur auf dem Steinboden des Flurs vor dem Zimmer benützen dürfe. Und das auch nur ausnahmsweise, weil sie Vertrauen in ihre Vorsicht habe, erklärte die Nonne.
Unter den Sims über der Bettdecke klebte Lilia einige, aus einem englischen Journal ausgeschnittene Bilder, die Laurence Olivier in berühmten Rollen zeigten, von „Hamlet“, bis zu John Osborne’s „Entertainer“. Auf einem der Bilder prangte als Hintergrundkulisse eine grob skizzierte, nackte Frauengestalt. Die Nonne betrachtete sie nachdenklich und legte Lilia ans Herz, dieses Bild besser nicht aufzuhängen. Es sei nicht weiter schlimm, meinte sie mit linkischem Hüsteln. Doch könnten die anderen Mädchen vielleicht daran Anstoß nehmen. Und Lilia gerate deswegen in ungünstiges Licht. Und das wollten sie doch beide nicht, oder? „Natürlich nicht“, versicherte Lilia, löste die Klebestreifen von der Wand, wobei das Bild zerriss, und steckte es zwischen die Seiten des Taschenbuchs, das sie gerade las.
Die Nonne war jung, mit gewinnendem Blick. Einem Herzen offen wie ein blühender Garten. Und perlendem, Glück verheißendem Lachen. Dazu gesellte sich eine schelmische, mädchenhafte Stimme - der eine scharfe Intelligenz gegenüberstand. Es war offensichtlich, dass die Nonne Lilia mochte.
Die meisten Mädchen im Heim stammten vom Land. Aus Dörfern, in denen bereits ihr Vater oder ihre Mutter als Lehrer tätig waren. Sie unterschieden sich schon im Alter von Lilia. Denn im Gegensatz zu Lilia, die zwei Jahre mit dem Erlernen des Französischen und des Englischen verbracht hatte, waren sie direkte Schulabgänger. Auch in der Auswahl ihrer Bücher und in ihrem Erscheinungsbild fiel Lilia auf. Lilia trug als einzige eine Kleopatra-Frisur mit exakt geschnittenem Pony, einen diskreten bräunlichen Lidstrich und einen Hauch von Lippenstift. Nur einen Hauch. Da ein Zuviel zu ihrem ohnehin markanten Gesicht nicht gepasst hätte.
Lilia zählte nun neunzehn Jahre. In der Schule kam sie gut mit. In den Sprachfächern, wie zu erwarten, sogar sehr gut. Was Lilia hin und wieder zum Bummeln verleitete. Das heimliche Lesen von Büchern unter dem Pult reizte sie besonders.
In Algebra und Geometrie dagegen hatte Lilia wenig zu vermelden. Sie hasste die beiden Fächer immer noch mit derselben Intensität, wie das Rechnen in der Primarschule - aus lauter Hilflosigkeit, weil der Umgang mit Zahlen für sie keinen Sinn machte. Lilia verstand ihre Sprache nicht. Winkel, Tangenten, Logarithmen blieben ihr gegenüber stumm, gafften sie an, als sei sie ein Gespenst.
Lilias Mathematiklehrer bemühte sich nicht sonderlich um seine Klasse. Für helle Köpfe machte sein Gekritzel an der Wandtafel Sinn, und mit ihnen bestritt er die Unterrichtsstunden. Die anderen überließ er sich selbst, das heißt, er forderte die Guten auf, sich um die Unbegabten zu kümmern und ihnen auf die Sprünge zu helfen. Bei einigen klappte das. Doch Lilia fand selten jemanden, der Zeit hatte, sich ihrem Dilemma anzunehmen. So pendelte sie zwischen knapp genügenden und ungenügenden Zensuren hin und her. Nur dank den Sprach- und den musischen Fächern konnte sie sich im Rahmen des guten Durchschnitts an der Schule halten. Auf Chemie und Physik wurde weniger Gewicht gelegt. Und darin nicht zu glänzen, sondern gerade so mitzurutschen, galt als minder bedenklich.
Zu jener Zeit begannen die Schuljahre im Frühling, was bedeutete, dass die Theater- und die Konzertsaison an ihrem Seminarort noch nicht zu Ende war, als Lilia dort eintraf. Sie verpflichtete sich zur Mitwirkung im „Cäcilienverein“, dem Frauenchor der Stadt, da es für die Aufführung der „Vier Jahreszeiten“ an guten Sopranen fehlte. Und Lilia besaß einen guten Sopran, mit beträchtlichem Stimmumfang. Außerdem spielte sie ja Orgel und erhielt von der Stadt die Erlaubnis, auf einer der Orgeln in der mittelalterlichen Stadtkirche zu üben, durch deren bunte Fenster Schwaden irisierenden Lichts ihre Hände wie tanzende und hüpfende Wiesel über die Tasten gleiten ließen.
Notgedrungen reiste Lilia an den Wochenenden nicht nach Hause, denn ihr Elternhaus stand nun meistens leer. Dafür jobbte sie an Mittwochnachmittagen mit einer Kollegin in einer Teppichfirma, faltete und packte im Akkord Prospekte ein und verdiente sich damit das Geld für den Besuch der Theatervorstellungen im Saalbau sowie der Konzerte in den Kirchen der Stadt. Alle wichtigen Tourneetheater machten Halt am Ort. Kleist, Lessing, Goethe, Schiller wurden gegeben, jedoch auch Wilder und vor allem Hauptmann und Ibsen. Und Lilia lernte Tennessee Williams kennen, dessen Sicht auf das Leben ihr Herz in Stücke riss. Es war eine Zeit, in der das Theater Blüte über Blüte hervorbrachte. Das Fernsehen spielte noch keine Rolle. Computer, Handys und CDs gab es nicht. Um sich zu unterhalten und zu bilden, besuchten die Leute Schauspiele, Konzerte und Ausstellungen. Man fand sich zusammen, diskutierte, ergötzte sich. Mehr oder weniger Interessante und Interessierte trafen an den gängigen Orten immer wieder aufeinander. Mit der Zeit erkannte man den einen oder anderen, nickte ihm zu, grüßte. Die einen erschienen in Abendgarderobe, andere im Kleinen Schwarzen. Gesehen, und möglichst anerkennend wahrgenommen zu werden, zählte noch. Auszugehen gehörte zu den Besonderheiten des Alltags. Man hielt auf sich und erschien zu entsprechendem Anlass entsprechend gekleidet. Exzentriker spielten eine Rolle. Gewagte Tenues erregten Aufsehen. Schmuckstücke wurden ausgeführt wie Rassehunde. Und wer einen Pelz vorzuweisen hatte, tat das ohne Scham.
In solchen Kreisen mitzuhalten, vermochte Lilia nicht, doch etwas einfallen ließ sie sich immer, und sei es nur, dass sie eine silberne Kette mit Anhänger so um den weiten Ausschnitt ihres Sonntagskleides feststeckte, als sei es ein kostbares Stück, drapiert um das Dekolleté einer Dame der Renaissance. Lilia lebte und liebte Drama und genoss es, ihren Hang zu Ausgefallenem auszuleben. Nun erst recht, da die schwersten Fesseln von ihr abgefallen waren. Und irgendein billiger Fummel, mit dem sich etwas Zünftiges zusammenstecken, zum Turban winden, oder, hinter sich herwehend, über die Schulter werfen ließ, fand sich immer. In Sachen Fantasie brauchte Lilia Konkurrenz nicht zu fürchten. Ihre Barschaft reichte zwar nur für Stehplätze, jedoch hatte sie rasch heraus, wie sie es anstellen musste, knapp nach dem Lichterlöschen zu einem leergebliebenen Sessel zu flitzen, als habe sie dafür bezahlt. Ihr Sperberblick leistete ihr dabei exzellente Dienste. Kolleginnen mochten das Nachsehen haben. Lilia stand sich nie die Beine in den Bauch. Sie kriegte immer einen Platz an bevorzugter Stelle.

5. Phaidon!
Gegen Ende Januar des gleichen Jahres entdeckte Lilia in einer Tageszeitung den Theaterzettel der Großstadt - die nur eine Zugstunde von ihrem Schulort entfernt lag - und darauf angekündigt eine Vorstellung des „Phaidon“ von Platon: Zu einem Theaterstück umgearbeitet von Mitgliedern des Goetheanums in Dornach, das Lilia seit ihrer Kindheit ein Begriff war. Der Vater hielt zwar die, die dort ein- und ausgingen, für Spinner und Fanatiker, die dem Herrgott die Zeit stahlen. Und Ana pflichtete ihm bei. Doch Lilia hatte schon während ihrer Schulzeit zu Hause heimlich den Kontakt zum anthroposophischen Gedankengut gesucht und auch Bekanntschaft geschlossen mit Menschen, die diesem beipflichteten. Sie musste also unbedingt, koste es, was es wolle, die Aufführung sehen.
Seitdem sie die Ankündigung gelesen hatte, fühlte sich Lilia, als stehe sie an einem Wendepunkt. Ein unglaublicher Drang, zu erfahren um was es sich dabei handle, trieb sie an. Da ihr das notwendige Kleingeld fehlte, tat Lilia, was sie immer noch tat, wenn die Not ein gewisses Maß überstieg: Sie setzte sich in die Kapelle ihres Wohnheims und betete, was das Zeug hielt. Irgendein Weg musste sich finden, denn die Eltern anzubetteln, hätte keinen Zweck. Sie würden keinen Rappen für etwas, das sie Schmarren nannten, locker machen.
Auf für Lilia unerklärliche Weise, kriegte die junge Nonne mit, dass Kummer Lilia plagte. Als sie ihr das nächste Mal im Flur begegnete, fragte sie sie vorsichtig aus: wie es ihr gehe. Ob sie es gut habe im Heim. Ob sie glücklich sei. Zuerst hielt sich Lilia zurück, dachte, Nonnen seien kaum Ansprechpersonen für solch weltliche Dinge wie die, die sie plagten. Schließlich beugte sie sich dem sanften, schwesterlichen Druck. Dass Lilia fürs Theater brannte, wusste die Nonne. Auch hatte sie mitbekommen, dass Lilia sich für spirituelle Belange interessierte, auch entsprechende Bücher las. Sie nahm zudem wahr, dass Lilia gänzlich unberührt war, sich für Spezielles aufbewahrte, sich sehr schützte, auf ein Ziel hinlebte, das ihr wichtiger schien als alles andere auf der Welt. Im Erspüren von Menschlichem war die Nonne Meisterin. Gerade weil sie so überaus verschwiegen war, beobachtete, realisierte, und erst dann Schlüsse zog. Sie reagierte nicht sofort, als Lilia ihr von „Phaidon“ erzählte. Doch am darauffolgenden Tag steckte sie Lilia im Vorübergehen eine Zwanzigfrankennote in die Tasche. Sie wisse, dass Lilia ein anständiges Mädchen bleiben werde, flüsterte sie. Sie spüre das und möchte sie auf ihrem Weg - und sei es auch nur mit einem bisschen Geld - unterstützen, um ihr zu zeigen, dass sie an sie glaube. Lilia war sprachlos: Eine Nonne und Geld wegschenken. Es stamme aus der Haushaltskasse des Heims, sagte die Nonne. Es sei bei Lilia in guten Händen, und werde von ihr richtig verwendet.
Nun stand Lilias Wunscherfüllung nichts mehr im Weg. Die Karten für die einmalige Aufführung des Goetheanums waren nicht so teuer wie die Karten für die normalen Vorstellungen. Das Geld reichte für einen guten Platz. Lilia fieberte auf den Abend hin, als gelte es ihr Leben. Warum, hätte sie nicht zu sagen gewusst. Es lag etwas in der Luft, das Großes, Weltbewegendes verhieß.- Und dann hob sich der Vorhang.
Das Stück bestand aus nur einem Akt. Sokrates saß inmitten seiner Schüler - wie Jesus beim Abendmahl, schoss es Lilia durch den Kopf. Der Schierlingsbecher stand auf einem Tischchen, etwas von ihm weggerückt. Und als sie Phaidon sagen hörte: „Mir ist ganz wundersam zumute“, weil Sokrates, um seinen Jüngern die Tragik seines Geschicks auszureden, von den Vorgängen in der Natur anhob zu erzählen - wie eines aus dem anderen entstehe. Wie alles miteinander zusammenhänge. Wie nichts ohne das andere sein könne - und dann zum Schluss kam: „Aus dem Leben also, was entsteht?“ Und ein Schüler daraus folgerte: „Das Tote.“ „Und aus dem Toten demzufolge?“ „Notwendig, muss ich eingestehen, das Lebende“, war es um Lilia geschehen. Ein dunkler, massiger Vorhang zerriss in ihrem Geist: „Warum hat mir das nie jemand gesagt?! Es wäre so wichtig gewesen, das zu wissen. So unendlich wichtig, - lebenswichtig!“ Gedanken, die brausend in Lilias Bewusstsein stürzten. Und als dann folgte, dass alles immer einem Einschlafen und einem Aufwachen gleiche. Und auch der Mensch ein Vergängliches sei, das einmal diesen, dann jenen Namen trage. Weil Leben nichts anderes als ein Wiederkehrendes, ein sich Wiedererinnerndes sei. Denn wenn es Tod gäbe als etwas Endgültiges: mit der Zeit nichts anderes als Totes mehr existierte, und Leben zum Erliegen käme. Dass dem aber offensichtlich nicht so sei. Die Seele im Gegenteil mit jedem Wiederscheinen in einem Körper dazulerne. Und demzufolge unsterblich sei. Und als Sokrates zuletzt den Becher leerte, auf seinen Sitz zurücksank, und unfassbarer Friede sich über die Szenerie breitete, schwamm Lilias Herz in nie gekanntem Glück. Erschien sie sich, wie um eine Lebensspanne gealtert. Im wahrsten Sinne erwachsen geworden.
Durch Sokrates erhielt Lilia die Erlaubnis, ohne Scham und Scheu dort weiterzudenken, sich dorthin weiterzubewegen, wohin sich zu wenden, sie stets gewarnt worden war. Was als verrück. Entartet. Verrucht. Als jeder Realität abhold erklärt worden war. Und einem anständigen Menschen grundsätzlich verboten gehöre.
Stille verharrte, als der Vorhang sich senkte - gleich einem tiefen Ausatmen. Niemand klatschte. Lärm hätte physischen Schmerz bedeutet, die Intensität der Stimmung getötet. Erst langsam breitete sich verhaltener Applaus aus. Einmal ging der Vorhang noch hoch. Die Schauspieler saßen ebenso da wie zuvor, denn sie standen nicht im Mittelpunkt. Um das Gesagte ging es einzig. Und das blieb im Raum, wie eine in schwindelerregende Höhen ragende, mächtige Kathedrale.
In der Garderobe wurde mehr geflüstert als gesprochen. Man hatte an etwas Bewegendem teilgenommen, das verstummen ließ. Nur das Rascheln von Seide. Von Armen die in Ärmel glitten. Von Handtaschen, die auf- und zugeklappt wurden. Und das Toktok hoher Absätze waren zu hören.
Der Asphalt roch warm und klebrig nach Regen. Das Nieseln verwandelte Scheinwerfer in flirrende Bahnen aus sprudelndem Licht, wesenhaft das Dunkel durchhuschend, als wohne ihnen Leben inne. Lilias Herz hämmerte. In ihren Zellen sang und orgelte es. Sie ging, als schwebten ihre Füße. In den Gassen roch es nach Nacht. Nach Schlaf und schwerem Traum. In jenen der Touristenmeile aus jeder Kneipe anders: Aus der einen nach Bier - Blasmusikfetzen plärrten hinter angelaufenen Scheiben - aus anderen nach Curry. Nach fetten Würsten. Fritten. Nach brutzelnden, triefenden Hähnchen. Oder nach Kuchen, die aussahen wie rosaroter, hellblauer und lindengrüner, übereinandergestapelter Gips.
Lilia nahm es wahr, als laufe ein Film vor ihren Augen ab - in jeder ihrer Zellen. Vibrierend. Rieselnd. Modulierend wie Gischt, die auf Felsen versprüht - und doch aus weiter Ferne, als gehe nichts sie etwas an. Als finde es irgendwo weit weg von ihr statt. Sie spürte gleißende Klarheit in sich, die fast schmerzte. Jeden Winkel ausleuchtete. Schattenlos. Wie jedes Mal, wenn Wahrnehmung sie streifte, die seit altersloser Zeit verborgen in ihr geschlummert hatte, sich willentlichem Zugang versagte.
„Warum hat mir das niemand gesagt“, ging es ihr immer wieder durch den Kopf. Warum war sie für solche, und ähnliche Gedankengänge stets bestraft, gezwungen worden, sie zu unterdrücken, gar zu verleugnen? Welcher Makel, oder welche Gefahr haftete ihnen an, dass sie geheim gehalten, tot geschwiegen werden mussten? Lilia verstand es nicht. Zu wissen hätte ihr helfen können, das Gewaltsame und Menschenverachtende ihrer Tage und Jahre anders anzugehen. Es vielleicht sogar zu verändern. Aus anderem Blickwinkel zu sehen.
Doch nun war es da, öffentlich dargestellt, in zugängliche Worte gefasst: Allgemeingut. Wenigstens für die, die es wollten. Es schon vor ihr gehört hatten. Oder in denen es, wie bei Lilia, aus Bodenlosem unversehens hochgespült worden war: Als ein Erinnern, ein Wiedererkennen.
Über Lilia war ein Füllhorn von überreichem Segen ausgeschüttet worden: Genauso fühlte es sich an. Und das versuchte sie tags darauf auch in der Klasse in Worte zu fassen, als ihre Kameradinnen sie überfielen, um voller Neugier und zugleich Scheu, Genaueres aus ihr heraus zu kriegen. Denn obwohl Lilia sie dazu aufgefordert hatte, getraute sich keine von ihnen, mit ihr mitzugehen, und sich dem gedanklichen und emotionalen Wagnis, das damit verknüpft sein mochte, auszusetzen. Auch aus Angst, damit die Eltern zu verärgern. Eine Angst, die Lilia ferner als fern lag. Um Freiheit des Denkens hatte sie, seitdem sie sich selbst wahrnahm, gekämpft.
Das Einzige, worüber Lilia sich nun den Kopf zerbrach war, wie sie mit diesem Schauspieler, dem Schauspieler des Sokrates, Verbindung aufnehmen könnte. Sie musste einen Weg finden, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Unbedingt. Das Aufgetane durfte nicht wieder zugeschüttet werden, unter dem Druck des Alltags ins Unbewusste zurücktauchen. „Du solltest ihm halt schreiben“, eröffnete ihr eine der Mitschülerinnen - eine von denen, die so etwas selbst nie wagen würden, eine der zaghaften, die es bloß kitzelte, andere die Kohlen aus dem Feuer fischen zu lassen. Und ihr Vorschlag traf ins Schwarze. Natürlich musste Lilia an Sokrates schreiben. Wenn keine das konnte: sie konnte es. Und das wussten ihre Kolleginnen. Lilia war dafür bekannt, dass sie sich dorthin vorwagte, wovon andere sich lieber fernhielten.
Nur: was sollte sie schreiben? Wie ging man so etwas an, um ernst genommen, und nicht einfach ignoriert zu werden?
Auf ihrem Bett sitzend, das Brett mit einem leeren, schneeweißen Blatt vor sich auf den Knien, dachte Lilia nach. Ohne Erfolg. Ausgedachtes produzierte nur schwärmerisches Gelaber.
Plötzlich fiel Lilia die Abschlussprüfung im Internat ein, der Aufsatz zum Thema „L‘Adieu à L’Enfance“. Und sie ließ, wie damals, die Feder selbständig übers Papier gleiten, erzählte, wie unstillbare Sehnsucht sie ins Theater getrieben. Wie die Worte von Sokrates ihr Herz um- und umgegraben hätten. Sprach vom Wiedererkennen, das sie so deutlich gespürt habe und davon, dass sie, bitte, bitte, mehr darüber erfahren, Sokrates treffen, mit ihm darüber reden möchte. Denn obwohl sie dem Programmheft den Namen des Darstellers entnahm, scheute sie davor zurück, sich so privat an ihn zu wenden. Die Sache zählte. Um die ging es. Nicht darum, einen Schauspieler zum Gesprächspartner zu haben.
Es dauerte denn auch keine Woche, da lag eine Antwort auf ihrem Teller am Tisch im Mädchenheim. Lilias Herzschlag setzte einen Atemzug lang aus. Dann blickte sie sich verstohlen um, steckte rasch den Umschlag in die Tasche, doch vergebens: er war längst erspäht worden. Ihre halbe Klasse gierte nach dem Inhalt. Lilia setzte sich an den Tisch, nahm die Gabel zur Hand, kaute mechanisch, ohne zu merken, was sie aß und verließ nach dem letzten Bissen, halb rennend, den Esssaal.
Kaum in ihrem Zimmer, zündete Lilia eine Kerze an, setzte Räucherstäbchen in Brand, öffnete mit zittrigen Fingern das Couvert und entnahm ihm einen, auf dünnes Papier mit verblasstem Farbband geschriebenen Brief. Er enthielt die Einladung zur Vorstellung einer Komödie von Kleist, in der der Schauspieler die Hauptrolle spiele. Sowie zu einer Übernachtung in seinem Haus, mit anschließendem Gespräch - und, falls gewünscht: einer Schnupperstunde in Stimmbildung, nach Art von Rudolf Steiner, am darauffolgenden Morgen.
Ihre Hände zitterten immer noch, als Lilia den Brief zusammenfaltete und behutsam in den Umschlag zurückschob. Nie zuvor hatte sie einen solchen Brief zu Gesicht gekriegt. Nie war Ähnliches an ihre Adresse gesandt worden. Lilia wusste nicht, wie ihr geschah. Nicht einmal, wo ihr der Kopf stand. Ganz zu schweigen davon, was sie denken, fühlen oder tun sollte. Sie war in etwas hineingestürzt, das nach schierer Zauberei aussah. Und wirklich sie, sie allein war damit gemeint: Lilia konnte es nicht fassen. Offenbar war sie doch nicht einfach verrückt. Und es gab Menschen, die verstanden, was sie bewegte.
Mit weit aufgerissenen Augen saß Lilia da und starrte ins Leere. Keinen Moment lang zweifelte sie daran, dass sie das Angebot annehmen würde. Nicht die leiseste Bangigkeit, nicht das leiseste Zögern nahm sie in sich wahr. Was immer sie erwartete, sie war bereit dazu, sich hundertprozentig darauf einzulassen.
Und dieser letzte Gedanke katapultierte sie übergangslos in die Wirklichkeit zurück. Fieberhaft fing Lilia an zu rechnen. Das Geld für die Reise, für Geschenke, Blumen: wie konnte sie es aufbringen? Dann die Frage des Datums: wie den Eltern erklären, dass sie an jenem Tag unterwegs wäre, ohne dass sie ihr auf die Schliche kämen - da sie Lilia immer noch gelegentlich ausspionieren ließen?
Mit dem Datum hatte sie Glück. Es fiel auf die Zeit der Fasnacht in ihrer Heimatstadt, die sie sowieso einigen ihrer Mitschülerinnen hatte zeigen wollen. Sie würden alle zusammen mit dem letzten Nachtzug hinfahren, um zeitig zum Auftakt dort zu sein. Im Laufe des Nachmittags würde sich Lilia auf den Weg zu Sokrates machen, und mit ihren Kolleginnen, die in einer Jugendherberge übernachten konnten, tags darauf wieder im Mädchenheim erscheinen. Gegen ihren Besuch der Fasnacht hätten die Eltern nichts einzuwenden. - Der Rest war einzig und allein ihre Sache.
In ihre Heimatstadt sehnte sich Lilia nicht zurück, denn die pulsierte sowieso unablässig in ihrem Blut. Doch die Fasnacht der Stadt zog sie geradezu magnetisch an. Das Mysterium des Totentanzes - das Jahrhunderterdbeben, das die Stadt unter sich begrub - die Pest, die in ihr wütete: die schemenhaften Gestalten in schwarzen Mänteln mit Schnabelmasken voller Knoblauch und magischer Kräuter gegen Ansteckung, die zu nachtschlafender Stunde hastig Tote in stinkenden Laken auf Karren verfrachteten und ratternd damit die Gassen durcheilten, zum Schindanger vor dem Tor - diese Grenzstadt voller pulsierender Internationalität, untermalt vom Klang düsterer Schicksalshaftigkeit - das Münster mit den feixenden, wasserspeienden Ungeheuern, der Kreuzgang, der nach Moder roch und in dem das Schlurfen psalmodierender Mönche noch immer die Stille zu prägen schien - die erste Universität des Landes im schmalbrüstigen, gotischen Gebäude aus goldgelbem Kalkstein, in dem Erasmus von Rotterdam und manch anderer der hellsten Köpfe lehrte und forschte: – all das liebte Lilia aus tiefstem Herzen. All das brachte ihr Nervensystem in Wallung und ihre Fantasie zum Blühen. Und erst der Fasnachtsbeginn - wenn mitten in der Nacht die Lichter ausgingen! Die prächtigen, übermannshohen Laternen, von Pfundskerlen getragen, funkelnd durch die Gassen torkelten. Trommeln und Piccolos die alten Reisläufermärsche intonierten: ein Zauber, der Lilia hypnotisierte. Das Gehen im Schritt des Trommelns. Das betäubende Hämmern im Brustkorb. Diese mitreißende Kraft, die Stunde um Stunde schmerzende Beine vergessen machte, die Wahrnehmung von Hunger, Durst und Kälte einfach wegblies.
Dann das Dämmern des Tags über den Brücken. Das allmähliche Verglimmen der Laternen. Die dampfende Mehlsuppe, verschwenderisch bestreut mit duftendem Käse. Füße voller Ameisen, die langsam auftauten. Hände, die sich wieder an Bewegung erinnerten. In den Alltag zurückflutendes Bewusstsein. Darauf das Eintauchen ins Grelle verstopfter Straßen, bei Sonne, Regen oder Schnee. Bizarre Larven. Scheppernde Kakophonie, die Menge anheizend, sie verführend wie Rattenfänger. Zügig die Gassen sprengend, hinauf zum Münster, dem Herzstück der Stadt, um das sich Leben bündelte, zu aller Zeit. - - Und dieses eine Mal, zu gleichen Teilen: die Wahrnehmung des gespenstischen Mummenschanzes zusammen mit der Wahrnehmung des Abenteuers Sokrates. Es passte zusammen wie der Dotter zum Ei. Es passte haargenau: Grenzgängerisches auf beiden Seiten. Und auch, dass all das in Lilia Platz fand, sie nicht zersprengte: Es waren solche Momente. Schnittstellen zwischen Extremen. Für die Lilia existierte, durch die sie Lebendigkeit in Riesenschlucken sog.
Gegen vier Uhr am Nachmittag verabschiedete sich Lilia von ihren Kolleginnen, zog sich in der Toilette eines Restaurants um und wanderte, die Menschen, die Schreie, die Püffe nicht mehr wahrnehmend, zur Trambahnstation. Nun war sie allein. Nun ließ sie alles Bisherige hinter sich. Nun begann nie Dagewesenes. Dafür mobilisierte sie all ihre Energie. Alle Wachheit. Die Luzidität des Blicks - so wie es ihr entsprach. Während der halbstündigen Fahrt straffte und entspannte sie sich zugleich, wie sie es in den Yogastunden gelernt hatte, die sie seit einigen Wochen besuchte. Von allem Ablenkenden räumte sie sich leer. Und als sie die Straße zum Goetheanum erklomm, und es allmählich in Sicht kam, war ihr, als strebe sie nach Hause, als kehre sie endlich heim. Die orange flimmernden Fenster blinzelten ihr zu, zogen sie höher und höher.
Im Foyer spähte ein bejahrter, freundlicher Herr nach ihr aus, überreichte ihr die Eintrittskarte, führte sie zum Eingang des Saals und bat sie, sich nach Ende der Vorstellung beim Künstlereingang einzufinden. Der Saal, ein uterusähnlicher Raum, dem breite Verstrebungen aus Beton Schwere sowie rhythmische Gliederung vermittelten, war Lilia aus Führungen durch das Gebäude vertraut.
Der Vorhang wich zur Seite, und die Vorstellung begann. Den Sokrates erkannte Lilia nicht wieder. Er trug eine speckig schimmernde Glatze, auf der eine blutunterlaufene, riesige Beule prangte, schlottrige, geflickte Gewänder. Wirkte, als rieche er nicht eben gut, als wasche er sich nicht allzu oft. Er war zum Totlachen. Lilia merkte plötzlich, dass sie der allgemeinen Heiterkeit verfiel. Das schäbige, gemeine, gerissene, hinterhältige und boshafte Lavieren dieses urmenschlichen Unmenschen war zum Umfallen komisch. Es war so gekonnt gespielt, dass trotz aller Niedertracht Sympathie entstand - weil ja keine Krähe einer anderen ein Auge aushackt. Während dieses Abends lernte Lilia zu lachen, aus ganzem Herzen und ohne Hintergedanken, einfach zu lachen, so dass ihr nach Ende der Vorstellung die Bauchmuskeln wehtaten, es sich um Lippen und Kiefer herum wie Muskelkater anfühlte, und sie erstaunt feststellte, dass sie in ihrem bisherigen Leben kaum je gelacht hatte.
Nach der Vorstellung traf sie am Bühnenausgang auf einen imposanten, weißhaarigen Herrn mit dem gütigen und weisen Blick des Sokrates. Nun erkannte sie ihn. Er war es. Untrüglich.
In Lilias Herz fand ein tiefes Ausatmen statt - nicht aus Stolz darüber, dass sie diesen Schauspieler kennenlernen durfte. Sondern aus dem gleichen Gefühl des Heimkommens, das sie zuvor den Berg hinaufgezogen hatte, näher und näher zu den orangen Lichtaugen der Fenster. Lilia fühlte Scheu: Und das war in Ordnung. Sie fühlte leise Bange, in den Augen Sokrates‘ nicht zu genügen: Und auch das war in Ordnung. Was sie gar nicht fühlte, war Misstrauen, nicht einmal einen Hauch davon. Selbst wenn unter Leuten aus Vaters Kreisen manche zweideutige Geschichte über die Anhänger des seltsamen Baus auf dem Hügel kursierte.
Sokrates und Lilia gingen behutsam nebeneinander her, auf einem schmalen Feldweg, entlang einer Reihe typischer Häuser mit den, in die Schräge modellierten Fensterrahmen, den abgerundeten Dächern, die sie wie behaglich hingeduckte Tiere aussehen ließen. Sie weckten in Lilia Gefühle von Geborgenheit und Zugehörigkeit. Ob sie die Häuser mochte oder nicht, fragte sie sich nicht. Sie kannte ihren Anblick seit ihrer Kindheit.
Zwar hatte der Vater nie ein gutes Haar an deren Bewohnern gelassen. Doch als sich Ende des Krieges herumsprach, es gebe im anthroposophischen Speisehaus üppig beladene Früchtekuchen zu essen, für deren Bezahlung es keine Lebensmittelmarken brauche, spazierte er öfter mit Lilia an der Hand aufs Schloss über dem Goetheanum und hinunter durch den Wald - wo in winzigem Holzhäuschen ein lebensgroßer Kapuzinermönch, mit kantig geschnitztem Gesicht, in einer mottenzernagten Kutte auf einem Stühlchen saß, der dankbar nickte, wenn Lilia ihm einen Batzen in die Bettelschale warf. Lilia fürchtete sich vor dem Mönch. Sie mochte den muffig riechenden Kerl so wenig wie später das Bübchen auf der Schachtel der Nonne. Doch der Vater meinte, es sei wichtig, bei ihm vorbeizugehen und ihm etwas zu geben, noch dazu, wenn dafür Lebensmittelmarken gespart würden.
Sokrates, den Lilia später nach seinem Vornamen „Papa Moritz“ nannte, schwieg. Und Lilia fühlte sich glücklich dispensiert davon, seine Kunst zu loben. Sie hätte auch nicht gewusst, in welchen Worten. Ihn, wie ein Backfisch, anzuschwärmen, hätte überhaupt nicht gepasst. Sie gingen im gleichen Schritt, einem sanften, gemeinsamen Hin- und Herschwingen wie im Tanz. Das rückte sie einander näher, als es Worte vermocht hätten. Als sie das Wohnhaus erreichten, stand seine Frau schon in der Tür. Sie umarmte Lilia, nahm ihr Mantel, Kappe und Tasche ab, als kenne sie sie seit Jahren und führte sie in die kleine Küche, auf deren Tisch eine Mahlzeit bereitstand. Nach einer Vorstellung brauche ihr Mann das, sagte sie, denn vor einer Vorstellung möge er nichts essen.
Erst nun kam ein Gespräch zustande. Und es war Emilie, Papa Moritz‘ Frau, die es in Gang brachte, ungezwungen und leichthin, sodass Lilia alle Hemmungen verlor und frisch drauflos erzählte. Auf die gleiche Art, in der sie ihren Brief geschrieben hatte. Nun gab sie auch preis, dass sie in ihrem Leben nie so gelacht habe wie eben gerade. Dass sie nie diese Leichtigkeit und ansteckende Fröhlichkeit gespürt habe, wie umgeben von diesem speziellen Publikum, das sich weit weniger verkorkst und elitär gebe, als das Theaterpublikum, an das sie gewöhnt sei.
Es wurde spät. Und obwohl Lilia im Zug nur kurz geschlafen hatte, war sie kein bisschen müde. Übernachten durfte sie im Gästezimmer, das ebenerdig auf einen kleinen Hof hinausging und in dem drei Betten standen, da es zu den Festspielzeiten an ausländische Gäste vermietet wurde. Was Papa Moritz und seiner Frau erst erlaubte, sich das Haus zu leisten. Es kuschelte sich in den Hang. Die Eingangstür befand sich im ersten Stockwerk. Auch dieses Haus wies die weichen, wie von Töpferhänden geformten Fenster und Türen auf, allerdings in bescheidenerem Maß, als die kostspieligen Villen reicherer Besitzer. Denn so zu bauen, war teuer.
Lilia schlief wenig. Zu viele Eindrücke häuften sich in ihrem Gemüt. Sie zu sortieren, einzuordnen und genauso abzuspeichern, dass sie sie beliebig abrufen konnte, würde Zeit brauchen. Ihrer Gewohnheit gemäß fing sie gleich damit an. Nur was in ihr präsent blieb, konnte als gelebt und erfahren gelten. Nur was präsent blieb, machte ihr Leben reich. Lilia war nicht die Träumerin, die sich mit Diffusem, Schattenhaftem zufriedengab. Klar und fest umrissen musste dastehen, was sie erfuhr. Wie hätte sie sich sonst darauf abstützen, daraus lernen können? Sie fotografierte in ihrem Innern die Ereignisse in scharf umrissenen Bildern, ausgeleuchtet wie Kulissen. Farben, Gerüche, Gewichtungen, Wärmegrade: alles musste stimmen, auch Bewegungen, Stimmlagen und Emotionen. Mühe kostete das Lilia nicht. Es geschah wie von selbst, wirkte als Sicherheitsventil, vermittelte die Gewissheit, dass sie keinen Fantasien nachjagte, keine Schemen und Gespenster in sich heranzüchtete. Es war eine Form von Selbstdisziplin, der sich Lilia natürlich unterzog. Die selbstverständlich zu ihr gehörte, und sie in ihrem Alleinsein davor schützte, den Boden unter den Füssen zu verlieren. So wie andere ihr Herz Freunden ausschütteten, Fotoalben anlegten, Tagebücher schrieben, archivierte Lilia ihr Leben laufend in sich selbst.
Der nächste Morgen brachte eine gelöste und vergnügliche Stunde in Sprech- und Stimmbildung. Das rollende „R“ konnte Lilias Zunge nicht produzieren. Um es zu üben, gab ihr Papa Moritz Sätze auf wie: „Große, runde Reifröcke rasten unter Regenschirmen.“ Oder: „Grenzenlose, graue Meerriesen rollen riesig heran.“ Lilia bog sich vor Lachen - wie am Abend zuvor. Und Papa Moritz freute sich an ihrem Ergötzen. Er fand, sie sei ein ganz erlesenes Wesen, wie er noch keines getroffen habe. Deshalb habe er auch auf ihren unbeschwerten Brief geantwortet. Denn er beantworte wenige, da ihm die Zeit dafür fehle. Nebst der Schauspielerei unterrichte er, führe Regie, arrangiere Texte zu Eurythmie, damit das Geld reiche. Hier auf dem Hügel arbeite mit, wer sich für die Sache interessiere. Reich werde dabei niemand, Außer, er sei es von Haus aus.
Obwohl gewöhnlich vegetarisch gegessen wurde, trug Emilie zum Mittagessen ein kross gebratenes Hühnchen auf: zur Feier von Lilias Besuch, und auch weil sie sich der Anthroposophie gegenüber nicht sektiererisch verpflichtet fühlte. Was Papa Moritz Lilia über sein Leben und sein Wirken auf dem Hügel erzählte, klang bodenständig und nach gesundem Menschenverstand. Ihres Mannes Arbeit bestehe wirklich darin, gesunden Menschenverstand zu vertreten, erzählte Emilie Lilia während des Abwaschs. Ihr Mann sei deshalb bei Kollegen und Kolleginnen nicht grundsätzlich beliebt. Doch äußerst geschätzt, aufgrund seiner menschlichen und künstlerischen Fähigkeiten. Man könne ihn auf der Bühne nicht entbehren. Er habe vom konventionellen Theater aus Überzeugung auf den Hügel gewechselt. Momentan sei er der beste Schauspieler für große, klassische Rollen. Und deshalb nehme er sich auch gewisse Freiheiten heraus, da seine Loyalität offensichtlich sei.
Lilia hörte mit Ohren zu, die fast bis zur Decke reichten. Nie zuvor hatte jemand so mit ihr gesprochen: So offen, so unverbrämt, als gebe es nicht das Geringste zu befürchten. Lilia wurde vollstes Vertrauen gewährt und nichts, was sie selbst sagte, hinterfragt, auseinanderdividiert und gegen sie verwendet. Niemand zog ihre Kompetenz in Frage, obwohl sie nur Schülerin war, ohne Leistungsausweis und ohne besondere Qualifikation. Ihr Wert stand nicht zur Diskussion. Und auch an ihrer Ehrlichkeit wurde nicht gezweifelt.
Im Laufe des Nachmittags machte sich Lilia auf den Heimweg, im Gepäck ein Stück unermesslich frischen Lebens. Sie wusste, ihre Kameradinnen würden sie nach Strich und Faden durchleuchten, da es ihnen selbst am Mut fehlte, sich Ähnlichem auszusetzen. Dafür, dass sie es dennoch kennenlernten, gab es Lilia, die scheinbar vor nichts zurückschreckte. Die Courage besaß, Wagnisse einzugehen, deren Preis sie nicht kannte. Mochte sein, es steckte in Lilia ein gewisses Quantum an Vermessenheit. Einige nannten es Selbstüberschätzung. Doch für Lilia ging es dabei nur um die Notwendigkeit, auf ihrem Weg zu überleben.
Der Drang nach einem Weg, von dem sie ahnte, er sei in ihr vorgezeichnet - dieser Zwang, nicht locker zu lassen - alles zu versuchen um herauszufinden, worum es sich dabei handle - nahm ihr die Furcht davor, Grenzen niederzuringen. In den Augen des Vaters auch Grenzen des guten Geschmacks, zumindest was die Anthroposophie betraf. Oder Grenzen des Anstands, die es einem verboten, andere mit seinen Anliegen zu behelligen. Dabei war Lilia sicher, dass sie es gegenüber Papa Moritz an Anstand nicht fehlen ließ. Das Gutbürgerliche ihrer Herkunft dürfte solche Schranken vielleicht nicht überspringen. Doch stand ihr Zigeunerblut dem bestimmt nicht im Weg. Und Lilia wusste, dass, könnte sie mit ihrem Vater unter vier Augen reden, er andere, freiere Meinungen verträte. Vor Ana fürchtete er sich, weil er auf ihre Hilfe angewiesen war. Doch war er keiner, der anderen nach dem Maul schwatzte - und gewiss kein Feigling. Er hätte sich sonst in seiner Arbeit nicht so weit vorgewagt. Sich nicht so hineingekniet, dass sie gesundheitsgefährdend wurde. Er kannte die Substanzen, mit denen er forschte. Er war sich der Risiken, die er einging bewusst. Verschloss die Augen nicht davor.
Wie verabredet, traf Lilia am Bahnhof auf ihre Kolleginnen. Es sah aus wie Bestimmung. Nichts lief schief. Alles entspann sich nach Plan. Wie geschenkt. So, als seien Fäden gezogen worden, damit Lilia ihr Abenteuer bis zum letzten Tropfen austrinken und schattenlos genießen könne.
Natürlich wurde Lilia mit Fragen überrannt. Doch schon nach kurzer Zeit zeigte sich bei den Mädchen Müdigkeit. Die mit Eindrücken und Erlebnissen randvollen Tage, zeitigten Wirkung. Eine nach der anderen barg den Kopf im aufgehängten Mantel und schlief, zu Lilias Erleichterung ein. Nicht dass sie den Mitschülerinnen etwas vorenthalten wollte. Es war nur nicht die richtige Zeit zum Erzählen. Zu ungewohnt, zu ausgefallen erschien ihr das Kleid noch, in das sie, über kurz oder lang, die Absicht hegte, hineinzupassen. Auch um an Schlaf zu denken, fehlte ihr die Muße. Noch war der Berg des Erfahrenen nicht abgetragen. Noch pflasterten seine Teile keinen Weg, auf dem sie weitergehen konnte.
Lilia war mit Einladungen überhäuft worden, gewiss - mit dem Angebot von Ausbildung zum Nulltarif - mit jeder Option, zu lernen, sich zu bilden - die Arbeit von Papa Moritz und ihre Hintergründe von Grund auf kennenzulernen, und im Theater Fuß zu fassen. Und das, ohne bedrängt zu werden. Sie blieb frei, ja oder nein zu sagen. Es bestand keinerlei Verbindlichkeit. Alles passte so unglaublich zusammen, dass tatsächlich höhere Gewalt im Spiel zu sein schien. Zwanglos, unkompliziert wie händewaschen, simpel wie frühstücken, war eine der Türen nach der anderen vor ihr aufgesprungen. Es bestand nicht der geringste Grund zu Zweifeln. Auf alle Fragen gab es Antworten. Lilia würde bei Emilie und Papa Moritz wohnen, sobald sie die Schule abgeschlossen hätte. Sie würden sie annehmen als das Kind, das sie nie hatten, aus dem selbstverständlichen Gefühl heraus, dass sie einander seit undenklicher Zeit kannten, einander in nichts fremd waren. So als habe das Leben nur darauf gewartet, dass Lilia groß würde und sich auf den Weg zum Hügel mache.
Auch während den folgenden Tagen drückte sich Lilia ums Erzählen herum. Es galt, auf Prüfungen hinzuarbeiten, Mathematik zu büffeln, sodass innert kurzer Zeit das Erlebnis Dornach in die Vergangenheit glitt, zwar immer noch im Raum stand, doch verblasste: wie etwas, das es so nicht gab, das einem so nicht geschenkt wurde. Fast märchenhafte Züge nahm es an. Und es brauchte einen Brief von Ana, die Lilias Eskapade innegeworden war, um Lilia zu erden. Der Brief klang laut und böse, beinhaltete erneut den Vorwurf, den Vater in den Tod zu treiben, klagte Lilia der Lüge und des Betrugs an. Hintergangen habe sie die Eltern. Undankbar sei sie, rücksichtslos, verhaltensgestört. Sie habe keinerlei Ehre im Leib. Eine Schande sei sie für die Familie.
Lilia bestritt keinen der geäußerten Vorwürfe. Tief innen wütend machte sie nur, dass die Stiefmutter sich getraute, so mit ihr umzuspringen. Dass Lilia irgendwem irgendetwas mit ihrer Suche nach Gangbarem antun könnte: Dieser Vorwurf schürte den Zorn in ihr am meisten, weckte sogar Mordgelüste. Doch anstatt Lilia von ihrem Bestreben abzubringen, zementierte Anas Verhalten es zusätzlich, schliff Lilias Zähne zum Durchbeißen noch schärfer.
Die Bekanntschaft mit Papa Moritz und die Einladung ins Goetheanum brachten Lilia nicht nur Bestätigung und Freude, sondern sie versetzten sie auch in arge Bedrängnis. Weiterhin besuchte sie so viele konventionelle Theateraufführungen, wie sie nur konnte. Allerdings nicht mehr nur, um sich daran zu begeistern. Sie fing an, die einen gegen die anderen abzuwägen, suchte nach Vor- und Nachteilen der verschiedenen Arten, Theater zu spielen und teilte ihre Beobachtungen auch Papa Moritz mit. Und in regelmäßigen Abständen antwortete Papa Moritz. Er hielt sich dabei, wie Sokrates, in gebührendem Abstand, ergriff keine Partei, schrieb liebevoll, mit inniger Anteilnahme - und äußerte sich mit feinem Humor zu Lilias explosionsgeladenen Ausführungen, stets auf Harmonie und Ausgleich bedacht. Es waren Briefe voller Güte, die auf Lilias zerrissenes Innenleben wie Heilsalbe wirkten. Einem Menschen wie ihm, war Lilia nie zuvor begegnet, einem Weisen, der durch Krieg, harte Entscheidungen und innere Konsequenz auf einen Pfad der Ruhe und des Gleichgewichts eingebogen war.
Obwohl Lilia Zeiten des Kampfes durchlebte, die sie arg durchschüttelten, ließ sich Papa Moritz zu keiner persönlichen Stellungnahme hinreißen. Hin und wieder legte er seinen Briefen anthroposophische Texte bei, deren Lektüre Lilia in Erstaunen versetzte. Ihre Vernetztheit, auch mit Glaubensrichtungen aus dem asiatischen Raum, beeindruckte sie. Die Buddhas im Haus von Omas Freunden kamen ihr in den Sinn, eine Erinnerung, die tief verankert in ihr ruhte, und ihr jedes Mal, wenn sie daran dachte, rätselhafte Kraft verlieh, als stießen ihre Füße auf Grund, in einem Augenblick von Genesung, in dem Zeit stillstand.
Wieder einmal war sie von Papa Moritz zu einer Festspielaufführung ins Goetheanum eingeladen worden, zu einer Darbietung im großen Saal, dessen farbige Fenster das Licht in allen Schattierungen des Regenbogens brachen. Und obwohl die Aufführung Stunden dauerte, das Mitgehen mit der Getragenheit des Gesprochenen Lilia ermüdete, war sie schweigsam und im Innersten angerührt an Papa Moritz‘ Seite durch die Nacht heimgeschlendert.
Daneben erkundigte sie sich im Konservatorium der benachbarten Großstadt, ob es für sie möglich wäre, noch während ihrer Schulzeit Schauspielunterricht zu erhalten. Lilia wurde aufgetragen, drei Rollen einzustudieren, und sich zu einer Eignungsprüfung anzumelden.
Massiven Ängsten zum Trotz, mit eiserner Entschlossenheit, ihr Leben auf die eine Karte „Theater“ zu setzen, wählte Lilia eine Szene aus einem Stück von Lorca aus, dazu das Gebet Gretchens aus dem „Faust“ sowie eine Sequenz aus dem „Traumspiel“ von Strindberg. Ihre Deutschlehrerin weihte sie in ihr Vorhaben ein. Und sie versprach, Lilia zu unterstützen. Dass Lilia ihre Zukunft nicht in der Ausübung des Lehrerberufs sah, war ihr klar. Zwar erteilte Lilia gute Probelektionen und verstand es, Kinder zu begeistern: Doch sich tagaus tagein der Bildung von Kindern zu widmen, überforderte Lilia. Ihre Beziehung zu Kindern war zu vage, da sie selbst das Kindsein fast nur aus negativer Sicht kannte.
Immer noch traute sich Lilia wenig zu. Sie kurvte während den Wochen der Vorbereitung auf das Vorsprechen durch sämtliche Höllen, kniete Abende lang auf dem eiskalten Steinboden der Kapelle im Mädchenheim und bestürmte die Muttergottes um Hilfe. Ohne das Theater könne sie nicht leben, greinte Lilia. Bis tief in die Nacht hinein flehte und bettelte sie - besorgt beäugt von der Nonne, die Lilia so zugetan war, dass sie ebenfalls für das Gelingen ihres Zieles betete.
Und dann war es soweit. Versehen mit den Wünschen ihrer Deutschlehrerin und den Segnungen der Nonne, machte sich Lilia auf den Weg, in ihrem besten, in verschiedenen Brauntönen und in Weiß gestreiften Sommerkleid, das ihre mittlerweile fraulichen Rundungen ausebnete, und ihren eher gedrungenen Körper in die Länge zog. Ihr Portemonnaie und die Bücher mit den einstudierten Szenen legte sie in einen offenen Korb, die Titel nach oben, zur Stärkung des Selbstbewusstseins. Und den Korb bettete sie sich in die Armbeuge, so wie sie es bei Mitgliedern des Frauenchors während ihrer letzten Opernaufführung gesehen hatte. Ein bisschen Show, ein gewisser Stil musste sein: sollte das Unternehmen gelingen.
Es wurde der heißeste Tag in Lilias Leben, von der Temperatur und von seinem Inhalt her. Lilia war in ein Haus hoch über der Stadt gerufen worden, von einer Schauspielerin, deren Kunst sie mehrmals auf der Bühne und im Konzertsaal bewundert hatte. Die bejahrte, füllige Künstlerin mit den prägnanten Zügen, typisch für Tragödinnen von Format, führte Lilia in einen Raum, dessen Wände aus Regalen voller Bücher bestanden. Er wirkte kühl. Jalousien tauchten ihn in grünlichen Dämmer, was Lilia an ein Aquarium gemahnte.
Lilia legte ihre Bücher auf ein Tischchen neben den Fauteuil der Schauspielerin, die ihr die benötigten Stichwörter gab. Sonst wurde nichts gesprochen. Zuerst trug Lilia Gretchens Gebet vor, geriet gleich nach den ersten Worten, die ihr vor Angst im Hals stecken bleiben wollten, in Fahrt. Ihre Scheu verflog. Lilia spielte um ihr Leben, blieb ihr doch keine Wahl, als zu gewinnen. Nach der dritten Darbietung legte sich Stille über den Raum, flaumige, leichte - und gleichzeitig drückende Stille, wie kurz vor einem Gewitter.
Lilias Knie wankten. Panik schnürte ihre Kehle zu. Schweiß rann über ihr Gesicht und an den Armen hinunter. Dann erklangen die Worte: „Du darfst nicht - du musst zum Theater gehen!“ In Lilia brach ein Aufruhr aus, den in Schranken zu halten, sie die größte Mühe kostete. Am liebsten würfe sie sich der Mimin zu Füssen. Doch das Bewusstsein von Haltung überwog. Die Rolle hatte Vorrang, nicht das persönliche Befinden, das begriff Lilia schlagartig. Darauf folgte die Kritik, die in Hinweisen, ihren minimen Akzent betreffend bestand, und in der Folgerung gipfelte, die Rolle des Gretchens sei nichts für sie. Mit geschlossenen Augen höre sich ihre Darstellung überzeugend an, doch öffne man sie, sei klar, dass Lilia, als erwachsene, vollerblühte Frau, die sie sei, nicht in die Rolle passe. Sie müsse sich den massiven Rollen widmen, den Pfundsweibern, die notfalls über Leichen gingen, und ihr Leben opferten um ihrer Ehre, ihrer Überzeugung willen - Sätze, die wie himmlische Musik in Lilias Ohren orgelten. Sie zerbarst fast vor Glückseligkeit. Ihren Enthusiasmus konnte ihr Körper kaum bergen. „Ja, ja, ja“, schrie es in ihr drin. Sie war bereit dazu, alles zu geben: sie war so bereit dazu! Nichts würde sie von ihrem Traum mehr trennen können - einem Traum, der urplötzlich keiner mehr war, der sich, wie durch ein Wunder, in Wirklichkeit verwandelt hatte.
Lilia hielt sich mit aller Kraft zurück. Ihr war, ein Sechsergespann arabischer Hengste zerre an ihr. Das offerierte Glas Saft schüttete sie sich unkontrolliert in die Kehle. So sehr dürstete es sie nach Leben, nach einer Aufgabe, nach echter Herausforderung. Jede Faser in ihr gierte danach.
Dabei ging es nun in erster Linie darum, die Eltern von ihrem eigenmächtigen Tun und dem Ergebnis zu unterrichten. Sie solle auf jeden Fall ihre Ausbildung beenden, eine Matura und ein Diplom in Händen, seien unabdingbar, erklärte die Schauspielerin. Sie begebe sich auf einen steinigen Pfad. Talent allein genüge nicht. Durchhaltewille sei gefragt, eiserner Durchhaltewille. Doch daran fehle es Lilia ja nicht, wie sie sehe. Und auch eine Portion Glück gehöre dazu.
Lilia ihrerseits erzählte von den Schwierigkeiten mit den Eltern, davon dass sie nie die Erlaubnis für den Besuch der Schauspielschule geben, keinen Rappen für ihre Ausbildung herausrücken würden. „Macht nichts“, entgegnete die Künstlerin, „du bist fürs Theater geboren. Ich werde das Geld für dich vorschießen, und du kannst es mir später zurückgeben. Denn du machst Karriere, das ist gewiss. Für dich lege ich die Hand ins Feuer. Jetzt geh. Und trage die frohe Botschaft nach Hause.“ Letzteres sagte sie mit mitfühlendem Schulterzucken, einem verschwörerischen Lachen und den besten Wünschen für halbwegs ergiebigen Erfolg.
Geblendet hob Lilia die Hand vor die Augen, als sie sich, kurz darauf, im gleißenden Sonnenlicht wiederfand. Sie rannte los, lief ihren Beinen in Windeseile hinterher, die nur eines wollten: hinaus, hinaus in die Welt, ins pralle Leben, weg von der qualvollen Enge ihres bisherigen Daseins - - und stieß prompt mit der borkigen Rinde einer Eiche zusammen, die ihren Arm blutig kratzte, ihren Lauf jedoch nicht bremste. Das besorgte erst ein, mit quietschenden Reifen knapp neben ihr stoppendes Auto, dessen Lenker sie brutal in den Augenblick zurückriss, als er schrie: „Hast du den Verstand verloren, blödes Gör: Ich hätte dich glatt überfahren können!“
Das wirkte. So unbedarft dürfe sie nicht mehr in der Welt herumrennen, dämmerte es Lilia, denn nun habe sie etwas zu verlieren. Was für ein Gedanke: alles Bisherige in den Schatten stellend. Etwas zu verlieren zu haben, wofür es sich lohnte - zu sich selbst Sorge zu tragen - gegenüber sich selbst gut zu sein: Das war so neu und ungewohnt, dass Lilia wie angewurzelt stehen blieb. Mit einem Schlag machte alles Sinn, schien ihr Dasein etwas wert zu sein. Plötzlich glaubten Menschen an sie, an Fähigkeiten, die sie auszeichneten. Das war so unfassbar, dass es Lilia Tränen in die Augen trieb. Sie schloss sie und dankte mit jedem Nerv, mit jeder Zelle ihres Körpers für das Geschenk, da sein zu dürfen, ein ganz bestimmter Mensch sein zu dürfen, dem vertraut wurde, und dem man etwas zumutete. Sie würde Zeit brauchen, um das in vollem Umfang zu begreifen.
Lilia ging langsam die Straße entlang, lenkte ihre Schritte versonnen in Richtung der Wohnung ihres Onkels, des Bruders der Mutter: denn sonst kannte sie niemanden in der Stadt. Mit jemandem musste sie ihr Glück teilen, selbst wenn sie daran zweifelte, dass sich der Onkel mit ihr freuen werde. Er war ein ältlicher Kauz geworden, hatte sich mit seiner Familie überworfen, hauste hypochondrisch und gehässig in einer Dreizimmerwohnung. Nur gerade von so vielen Möbeln umgeben, als unbedingt notwendig. Ohne Bilder an den Wänden. Ein Miesepeter, der sich selbst und denen, die mit ihm in Verbindung traten, Vergnügen, Lust und Leichtigkeit des Seins missgönnte. Und der die Welt als Jammertal sah. Als einen Ort der Busse. Der Strafe. Und der Sühne.
Der Onkel zeigte sich denn auch nicht begeistert von ihrem Besuch. Er hasste unangekündigte Heimsuchungen. Als er Lilia vor der Türe stehen sah, warf er sie reflexartig wieder zu. Lilia drückte nochmals auf die Klingel, da sie auch vom Onkel repressives Verhalten nicht mehr willens war hinzunehmen. Und dieses Mal ließ er sie eintreten.
Sofort rückte Lilia mit ihrer Botschaft heraus, in der Hoffnung, den Onkel auf andere Gedanken zu bringen, ihn zu beruhigen und seinen Missmut zu bändigen. Doch der Onkel hörte sie nur mit halbem Ohr. Er wetterte gegen die Mutter, die Kusinen, die miese Verwandtschaft, die versucht habe, ihn um sein Erbe zu betrügen, verbot Lilia rundheraus, sich je wieder mit diesen Gaunern einzulassen. Und als Lilia ihm zu verstehen gab, sie lasse sich nichts mehr vorschreiben, treffe, wen sie wolle und hege weder gegen die Mutter noch gegen die Kusinen oder die übrige Verwandtschaft Groll, da sie nun ihren Weg gefunden, ihre Bestimmung, das Ziel, um das sie gerungen habe: denn nun sei es gewiss, dass sie Schauspieltalent besitze. Sie sei für würdig befunden worden in die Fußstapfen bedeutender Mimen zu treten. Und der Onkel könne ihr den Buckel hinunterrutschen, wenn er sich nicht zu benehmen wisse.
Da rannte der Onkel zur Türe, verriegelte sie und steckte den Schlüssel in die Hosentasche. Bleich vor Wut, fauchte er, Lilia müsse schwören, die Familie, die ihn so schäbig behandelt habe, in Zukunft zu meiden. Doch Lilia dachte nicht daran, nicht nun, da sie es allmählich schaffte, mit der Mutter und den Verwandten eine Beziehung gegenseitigen Zutrauens aufzubauen. Lilia stand mit flammendem Blick, wie eine Furie, vor dem Onkel, nicht gewillt, klein beizugeben. Er solle sofort die Türe öffnen, auf der Stelle, sie verbringe keine Minute länger in seiner Wohnung, drohte Lilia. Und endlich hörte der Onkel sie. Verdutzt schloss er die Tür auf, warf sich in der Küche kaltes Wasser ins Gesicht und entschuldigte sich für seinen Wutausbruch. Über Lilias bestandene Aufnahmeprüfung zeigte er sich mehr als erstaunt. Dass seine Nichte zu so etwas fähig sei, überrasche ihn. Auch zweifle er an der Einwilligung ihrer Eltern, ihren Plan zu unterstützen. Auf seine Hilfe könne sie nicht hoffen, falls sie in Schwierigkeiten gerate. Er habe selbst nichts und müsse mit dem Bisschen, das ihm die elende Verwandtschaft zugestanden habe, haushälterisch umgehen. Dabei wusste Lilia, dass der Onkel zeit seines Lebens nichts anderes getan hatte, als an der Börse zu spekulieren, den Geldmarkt kannte wie kaum ein anderer, und dass er auf einem erklecklichen Haufen soliden Goldes hockte. Wenigstens bot der Onkel Lilia an, eine seiner Spezialitäten für sie zuzubereiten, da sie sicher Hunger habe nach der großen Anstrengung. Und eine halbe Stunde später stand ein Tablett mit gebuttertem Pumpernickel, belegt mit geräuchertem Lachs und gedünstetem, noch warmem Blumenkohl auf dem Tisch. Friede kehrte ein. Und ein angeregtes Gespräch über Lilias, hoffentlich glanzvolle Zukunft, wurde möglich. Entgegen seiner Gewohnheit unterließ es der Onkel sogar, sie mit seinen altmodischen, nervtötenden Ratschlägen einzudecken.
Im Juli werde Lilia zwanzig Jahre alt, und Ana hatte ihr zur Feier ihrer Volljährigkeit ein kleines Geburtstagsfest versprochen. Auch der Vater, dem es nach der positiv verlaufenen Operation besser ging, wolle dafür nach Hause kommen. Darüber freute sich Lilia, umso mehr als sie ihn nicht mit leeren Händen wiedersähe. Sie hatte nun auch etwas zu verschenken, etwas, das aus ihrer Sicht kostbarer nicht sein konnte: Ihre bestandene Eignungsprüfung für die Schauspielschule, diese Carte Blanche, die es ihr erlaube, vorerst wochenendweise mit ihrer Ausbildung zur Schauspielerin zu beginnen.
Lilia zitterte beim Gedanken an Anas Reaktion auf ihr Geschenk. Doch gleichzeitig flammte, herzklein, in ihrem Innersten die Hoffnung auf, es könne für einmal etwas an ihr geschätzt werden, die trostlose Abfolge immer gleich übelgesinnter Abfuhren ein Ende haben. Lilia klammerte sich an ein winziges Erlebnis diesbezüglich, an einen Abend in der Stube, während einer Autorenlesung am Radio: sie handelte von einem Affen, einem übermütigen Schimpansen, und von einem Forscher, der unter der Palme saß, an deren Stamm der Knirps sich klammerte, feixte und versuchte, dem Forscher auf den Kopf zu pissen. Als ihm das nicht gelang, packte er eine Kokosnuss, schleuderte sie nach dem Mann, wild keckernd, den Kopf nach hinten geworfen, drohend mit der Faust seine Brust zerballernd. Darauf griff er mit kühnem Sprung, leicht wie eine Feder, nach einem der Äste und ließ sich daran baumeln wie ein Sack, das Maul offen, die Zähne gebleckt, in fassungsloser Verblüffung über diesen Blödmann, diesen Idioten und Volltrottel, der zu ihm hochblickte, als könne er ihm was: ihm, dem Halbstarken im vollen Saft seiner strotzenden Jugend, dessen geblähter Stolz förmlich zu riechen war.
Innert Sekunden mimte Lilia die Szene, den Affen erspürend, als stecke sie selbst in seinem Fell: - als sie auf den überraschten Ausdruck im Gesicht des Vaters stieß. Lilia erwachte wie aus kurzem Traum, als er erstaunt ausrief: „Du solltest Schauspielerin werden. Mein Gott, von wem hast du das bloß, das ist ja phänomenal.“ Wie aufloderndes Stroh hatte die Bemerkung des Vaters Lilias Herz entbrannt, sogleich gefolgt von der Enttäuschung, er meine es ja doch nicht ernst. Denn als sie nachfragte: „Denkst du das wirklich? Meinst du das so“, war auch des Vaters Faszination verflogen. „Natürlich nicht“, lachte er, wie von einem Alptraum erlöst und fügte rügend hinzu: „Was denkst du denn, wofür wir das ganze Geld in deine Ausbildung investiert haben.“
Dennoch wagte Lilia einen Antwortbrief auf die Einladung von Ana, stammelnd, nach Worten ringend, um ein klitzekleines bisschen guten Willens buhlend, ein Minimum an Akzeptanz, ohne dass, wie gewohnt, ein Scherbenhaufen zurückbleibe. Sie versuchte zu bezirzen, zu schäkern, den Wert ihres winzigen Geschenks zu schmälern, bis nur ein Häufchen simpler Buchstaben davon übrigblieb, die niemandem wehtaten. Weder auftrumpfen noch übervorteilen wollte sie. Die zurückhaltendsten, klangärmsten Wörter klaubte Lilia aus ihrem Gedächtnis, Schläge fürchtend, um Gnade bettelnd wie ein Hund, der aus Übermut versehentlich des Meisters Schuhe zerfetzt. Leider half es nichts. Ana schickte einen Brief voller Vorwürfe, Schuldzuweisungen und Hass zurück. Was der Vater dachte, blieb im Dunkeln. Lilias Feier zum zwanzigsten Geburtstag wurde abgesagt. Sie erhielt auch keine Karte, keinen Gruß. - Und Lilia verschmerzte es, darin geübt, den lindernden Schwamm übers gebeutelte Herz zu ziehen.
Lilia lernte durch ihre Freundin einen Medizinstudenten kennen, der Karten für „Die Physiker“ von Dürrenmatt ergatterte, die im Theater in der Großstadt Furore machten, und die zu sehen, Leute von weit her anreisten. Und als er von Lilias missglücktem Geburtstag hörte, schenkte er ihr eine der Karten. Er war ohne Freundin, denn seine Familie und sein Studium nahmen ihn zu sehr in Anspruch. Einer seiner Brüder war geistig behindert. Mit ihm verbrachte er so viel Zeit wie möglich, um ihn zu fördern und zu schulen. Und diese tiefempfundene Fürsorge beindruckte Lilia sehr, denn sie wusste, dass sie zu Ähnlichem nicht fähig wäre. Sie ließ sich gerne von Rolf einladen, auch weil sie sich ein bisschen in ihn verguckt hatte, wohl wissend, dass auf ihrem zukünftigen Weg ein Mann an ihrer Seite sie nur behindern würde. Es wurde ein freundschaftlicher Abend, Balsam für Lilias geschundenes Gemüt. Die Vorstellung entschädigte sie für jedes noch so feine, entgangene Geschenk.
Es schien eine besonnene, langsame, geduldige Aufführung zu sein, ganz ohne Hektik - und gleichzeitig von solch atemberaubendem Tempo, dass Lilia die Spucke wegblieb. Sie vergaß einmal übers andere auszuatmen, saß auf der Kante ihres Sessels wie angeschweißt, wie ein Pilz, der sich im Wachsen reckt und reckt. Lilia wurde übergroß, mit einem Raum so weit innen drin, dass Wände nicht zu existieren schienen. Die Giehse, dieser „alleinige Mensch“, wie sie sich selbst nannte… – nein: sie war nicht wie Lilia. Vermessen wäre solch ein Vergleich. Aber etwas, ein herzkleines Etwas in Lilia, erkannte das viel größere, umfassendere Etwas in der Giehse, dem sich dasjenige in Lilia verwandt fühlte. Das machtvolle Alleinsein dieser Frau, das ihr die unbändige Präsenz, die pralle Kraft verlieh:…. eine kaum erkennbare Geste, flüchtig in die Luft entlassen wie Flaum - ein angedeutetes Lächeln, süß, herzzerreissend, überschwemmend - ein Vorwärtsschieben des Fußes - ein Schritt: Die geringste Geste füllte die Bühne bis zur Rampe. Talent pur. Fleischgewordenes Phänomen. An dem nichts zu viel, nichts zu wenig war. Vollkommen, die Giehse, vom Stimmigsten, das Lilia je gesehen hatte. Sie lebte die Rolle. Nichts blieb zu wünschen. Und sie spielte ihre berühmten Kollegen nicht an die Wand. Sie blieb in ihrem Raum, ganz sie selbst, ohne Allüren. Eine grauenvoll perfide, durch und durch niederträchtige, kaltherzig Berechnende mimend. Und doch ein Mensch, der in Lilia weder Ekstase noch Hass schürte, sondern nur ein atemvolles: „Ja“.
In Lilias Klasse war bekannt, dass Lilia das Privileg, „Die Physiker“ zu sehen, zuteil geworden war. Das Stück gehörte zur Pflichtlektüre. Außer ihrer Lehrerin hatte es jedoch niemand gesehen. Also sollte Lilia über die Aufführung berichten, zumal sie selbst den Weg der Giehse beschreiten würde. Nur fand Lilia keine Worte dafür. Alle schienen ihr zu laut, zu groß, zu krass und überschminkt: wie Münder vollbusiger Operndiven. Sie wusste nichts zu sagen. Lilia erfasste einzig, dass sie ein Jahrhundertgeschenk erhalten hatte, umfassender als jede Party. Und dass ein Knoten in ihr aufgesprungen war - auch in ihrer Stimme. Dem Klang. Dem Volumen. Dem Umfang.
Lilia geriet immer mehr ins Dilemma. Die Frage, was sie wirklich wolle, wie ihre Zukunft aussehen solle, wurde ständig drängender. Sollte sie das konventionelle Theater wählen? Oder sollte sie sich zum Theater auf dem Hügel bekennen? Der Haken an der Wahl, wie sie entdeckte, lag beim „Bekennen“. Anthroposophische Darstellungskunst verlangte den ganzen Menschen. Nicht dass das beim konventionellen Theater anders gewesen wäre. Doch blieb dort die Frage nach dem Bekenntnis, nach dem spirituellen Hintergrund eines Menschen außen vor. Dieser Unterschied gab Lilia zu denken. Wollte sie ihr gesamtes Leben einsetzen? Oder nur ihre Persönlichkeit? Auch Papa Moritz wusste darauf keine Antwort. Er war so lange an konventionellen Theatern gewesen, bis er das Egozentrische daran nicht mehr ertragen konnte. Er war somit im Besitz der Erfahrung, die den Sinneswandel in ihm produzierte. Lilia dagegen kannte den Theaterbetrieb erst partiell.
Bis dahin war Lilia ein Alleinmensch gewesen. Alles Wichtige, Lebensnotwendige, auch in gesellschaftlicher Hinsicht, hatte sie sich allein ausgesucht, es allein in die Wege geleitet und unternommen. Auch deshalb, weil in Gesellschaft anderer alles stets kompliziert wurde, Fäden zog, langweilte. Das ausufernde Diskutieren in der Gruppe, das Abwägen, das Warten: Es passte so gar nicht zu Lilias Lebenstempo. Lieber lief sie alleine los, dann konnte sie sicher sein, dass die Dinge ebenfalls losliefen, und zwar in ihrer Gangart, in ihrer Raschheit des Denkens und Entscheidens.
Der Theaterbetrieb allerdings verlangte anderes. Da grassierte Wiederholung. Da brauchten Proben einen langen Atem, dem alle Beteiligten folgen konnten, auch die Gemächlichsten, und das liefe auf dem Hügel sowie in den Städten auf ein- und dasselbe hinaus.
Da die Eltern Lilias Taschengeld gestrichen hatten, schenkte ihr Papa Moritz das Geld für die Zugfahrt. Dadurch konnte sich Lilia während der Festspielzeit auch Teile von „Faust II“ ansehen, atemgeladene, machtvolle Aufführungen. Sie beanspruchten Lilias Fassungsvermögen bis auf den Grund. Sehr tief ausholend, sehr langsam flossen sie dahin. Rezitierend in gedehntem Sprechgesang, saßen himmlische Heerscharen auf Stufen über Stufen auf der Bühne, was die Illusion erzeugte, das Geschehen stoße in sämtliche Himmel vor. Vom Text verstand Lilia nichts. Das Wehen, Weben und Wogen der sich abwechselnden Chöre der Bewohner der Transzendenz, zog sie so sehr in Bann, dass zum Denken kein Raum blieb. Sie schwamm auf Nebelschwaden, deren Ursprung und Ziel im Verborgenen lagen, Ebenen sprengten, von deren Existenz Lilia nichts wusste. Obwohl die Ahnung sie streifte, die Intensität gerade ihres Betens liege Goethes Welt vielleicht näher, als die, alle Grenzen niederringende Spannkraft seiner Dichtkunst es vermuten lasse.
Da Lilia keine Möglichkeit sah, die konventionelle Schauspielausbildung am Konservatorium zu beginnen, weil die Eltern gedroht hatten, sie sonst von der Schule weisen zu lassen, durfte sie zu einem weiteren Vorsprechen antreten, das wiederum sehr ermutigend verlief. Lilia wandte sich nach der Rückkehr ins Heim der Rolle der „Maria Magdalena“ von Hebbel zu, einem Text nach ihrem Geschmack, von höchster Tragik und gnadenlosem Ausgang, ein Drama, wie sie es brauchte, um eine Entscheidung herbeizuführen - so hoffte sie.
Als sie an einem Nachmittag, in ihrem Zimmer stehend, den Rand des Brunnens visualisierte, in den zu stürzen sie sich gedachte, blind vor Entsetzen ob des Schicksals, das sie sich aufgebürdet, der Schande, der sie sich anheim gegeben hatte - aus innerem Zweispalt - auch aus Liebe und verwegener Hoffnung - jedoch bar der Aussicht auf Erfolg - zerrieben zwischen Fronten, deren Eigendynamik sie in den Abgrund drängte: - - sah Lilia die Szene vor sich, als spiegle sich darin ihr eigenes Leben. Sie erblickte die bemoosten Steinquader des Brunnens, als seien sie real, fühlte die heranwachsende Schande in ihrem Bauch, die sie mit Messern qualvoller Selbstgeisselung traktierte, spürte den Sog, die Lust, die Ekstase nahender Selbstzerstörung, erhob die Stimme, ergoss ihr ganzes Wesen in den Monolog - und erstarrte jäh: „Was geht dich dieses elende Weibsbild an“, sagte klar eine deutlich artikulierende Stimme in Lilia. „Was geht dich diese haarsträubende Geschichte an? Die hat doch mit dir nicht das Geringste zu tun.“ Der Schock! Aus der Rolle zu fallen gehörte zum Schlimmsten, was einem Schauspieler widerfahren konnte. Den Text zu vergessen, war ein Klacks im Vergleich dazu. Die Identifikation mit der darzustellenden Figur einzubüßen, dagegen tödlich.
Lilia blieb seltsam nüchtern bei dieser Erfahrung. Das Missgeschick war ihrem Beobachtungstrieb zuzuschreiben, der Fluch und Segen gleichzeitig bedeutete. Doch gehörte er zu ihrer Natur. Dem Faden des Lebens zu folgen, instinkthaft, wolfsgleich, war ihre Aufgabe. Nichts sonst.
Durch Zufall oder Fügung lernte Lilia einen Sänger kennen, der auch unterrichtete und nicht weit von ihr entfernt wohnte. Sie erzählte ihm, sie stehe an einem Kreuzweg und warte auf einen Wink. Und wie jedes Mal wenn Lilia erzählte, tat sie das unter Einsatz ihres ganzen Körpers, ließ die Stimme der Darstellung entsprechend tanzen, lachen, weinen, aus schierem Glück an einer Darstellungsweise, die dem Zuhörer leibhaftiges Mitgehen ermöglichen sollte. Sie zog auch den Sänger damit in Bann. Er bat sie, ihm vorzusingen. Und, bewegt von der Art ihrer Phrasierung, ermunterte er sie, sich in Gesang ausbilden zu lassen. Das allerdings war eine Option, in die sich Lilias Ehrgeiz, von sich aus, nie zu versteigen gewagt hätte.
Um diese Zeit herum begegnete Lilia einem gleichaltrigen jungen Mann, der Pierre-Louis hieß. Das Schicksalshafte dieser Begegnung nahm sie nicht wahr, da sie hauptsächlich an seinem, um etwa zwanzig Jahre älteren Mitarbeiter interessiert war. Einem nicht gerade gepflegten, etwas dicklichen Familienvater, der mit ausländischem Akzent sprach, und der für jedes risikolose Geplänkel zu haben schien. Das intellektuelle und emotionale Gefälle zwischen den beiden Männern war offensichtlich. Beide machten Lilia schöne Augen, warben um ihre Gunst. Doch Lilia blieb distanziert, auch wenn der Ältere etwas an sich hatte, das sie erheblich anzog: Eine nicht zu übersehende Skrupellosigkeit gegenüber den Gefühlen anderer - sowie wie die Schnoddrigkeit eines Menschen, der um eine gewisse Attraktivität weiß, die unter die Gürtellinie zielt. Man konnte ihn einen geilen Bock nennen. Pierre-Louis tat das sogar. Lilia wusste genau, worauf der Mann abzielte, und es gelüstete sie, es auszuprobieren. Zum Glück war der Weg von ihrer Unberührtheit zu seiner Schamlosigkeit zu weit, und wurzelten Lilias Prinzipien zu tief. Sie spielte mit dem Gedanken wie die Katze mit der Maus, ließ sich auch probehalber von ihm küssen, mit einem, patzigen, schmatzenden Kuss, wie vom Sabbermaul einer Kuh – wonach Lilias Lust auf Pierre-Louis‘ Mitarbeiter jäh erstarb.
Von da an setzte Pierre-Louis alles daran, Lilia für sich zu gewinnen. Er war genauso scheu, genauso unsicher und gehemmt wie sie. Doch er wusste, was er wollte. Und Lilia war allein, ohne Freund, ohne Familie, ohne verbindliche Beziehung.
Lilia lebte nun bei einer „Schlummermutter“, was bedeutete, dass sie sich in einem privaten Zimmer bei einer alleinstehenden Dame hatte einmieten dürfen. Und, kaum eingezogen, das spartanisch und bieder eingerichtete Zimmer in eine romantische Bude à la Lilia verwandelte, zum Entsetzen ihrer Wirtin. Wieder verbannte Lilia den Tisch aus dem Zimmer, schrieb, strickte, nähte auf den Knien, auf dem marokkanischen Lederhocker kauernd, den der Vater ihr als Kind zum Geburtstag geschenkt hatte. Denn seit längerer Zeit strickte und nähte sich Lilia ihre Kleider aus günstigen Restposten an Wolle und Stoffen nach eigenen Entwürfen. Das Handarbeiten fiel ihr leicht. Ihre Nähte sahen aus wie maschinengemacht. Geriet etwas nicht auf Anhieb, änderte sie es, bis es passte, einen gewissen Schliff aufwies. Das Spezielle. Den extravaganten Kick. Den Lilia suchte.
Bei ihrer Wirtin wohnte sie mit zwei Klassenkameradinnen, jede in einem separaten Zimmer. Doch da Lilia ihre Eigenheiten voll auslebte, auch was das Anhören von Musik betraf, das zahllose Wiederholen gewisser Stellen aus Symphonien, die sie vergötterte, oder die Anfangstakte von Tschaikowskys „Klavierkonzert“, wurde die Luft zwischen Lilia und der Schlummermutter ziemlich geladen. Bis Lilia erkannte, eine Änderung ihrer Wohnsituation sei angebracht. Also zog sie den hölzernen Leiterwagen mit ihren wenigen Habseligkeiten ein paar Häuser weiter, zu einem Landhaus, in dem sich auch ihr Lieblingslehrer eingemietet hatte: ein Welscher, einer aus der französischen Schweiz, der jede Woche zu seiner Mutter reiste, die buchstäblich auf ihm kniete, ihm kein einziges, ungestörtes Wochenende gönnte - sehr zum Leidwesen Lilias, die bis über die Ohren in den Lehrer verknallt war. Was ihre Wirtin dahingehend ausnützte, zu versuchen, Lilia mit ihm zu verkuppeln. Wand an Wand standen ihre Betten. Lilia konnte den Mann sogar atmen hören, wenn sie die Ohren spitzte.
Musik und Theater lagen seit Lilias Bekanntschaft mit Pierre-Louis auf Eis. Zwar besuchte Lilia weiterhin jede nur denkbare Vorstellung, auch diejenigen im Theater auf dem Hügel. Doch Papa Moritz ging es nicht gut. Und eines Tages erhielt Lilia von Emilie die Nachricht, er liege im Krankenhaus, sein Herz sei sehr schwach, und er möchte Lilia gerne sehen, falls sie das einrichten könne.
Im Innersten aufgestört von der Nachricht, saß Lilia am folgenden Wochenende an seinem Bett. Papa Moritz hielt ihre Hände, die süß dufteten, nach dem Zitronenbad, in das er zur Beruhigung seines Herzens getaucht worden war. Das ganze Zimmer roch nach Toscana. Der Ernst der Lage entging Lilia, denn ein Leben ohne Papa Moritz konnte sie sich nicht vorstellen. Leise sprachen sie über Lilias mögliche Zukunft auf dem Hügel, über ihr gemeinsames Leben, Seite an Seite, und über vieles mehr - nur nicht über einen eventuellen Tod ihres über alles geliebten Lehrers. Und doch war es das letzte Mal, dass Lilia ihn sah, ihn so nahe wie nie zuvor bei sich spürte. Sie legte ihren Kopf auf seine Hände, wie um sich, ihn, und ihr Gemeinsames zu ankern. Furcht sah Lilia in Papa Moritz‘ Augen keine. Das Wort Furcht kam ihr gar nicht in den Sinn. Sie waren beisammen und würden es noch viele Jahre lang bleiben. Das Antlitz ihres Lehrers strahlte so viel Licht aus, so viel Seligkeit, und Glück. Seine Augen glänzten wie von innen heraus erleuchtet, liebevoll und voller Fürsorge. Zwei Wochen später schlief Papa Moritz für immer ein, ging durch „Das Große Tor“, in die andere Welt.
Als Lilia von Emilie die Nachricht erhielt, schrie sie wie am Spieß. Der Verlust traf sie ins Mark, ungeschützt. Sie hörte nicht mehr auf zu schluchzen. Das „Nie, nie mehr“ der Situation trieb sie an den Rand des Wahnsinns. Eineinhalb Jahre lang hatte sie ein Zuhause gehabt, und nun war auch das wieder weg. Die Ungerechtigkeit und Gnadenlosigkeit des Umstands ließen sie verzweifeln. Doch war das noch nicht genug der Qual: Denn drei Wochen später verschied auch Lilias Vater.
Auf Anraten des Arztes, hatte Ana Lilia nochmals zu einem Besuch des Vaters eingeladen. Er saß im Bett, vor sich hinbrabbelnd wie ein glückliches Kind, als Lilia sein Zimmer betrat - die Hände in einem leeren, roten Plastikbecken, in dem er vermeintliche Substanzen um und um schaufelte. Ein leuchtendes Violett sollte daraus entstehen, wie ihr der Vater strahlend mitteilte. Lilia schaute ihm in die Augen, und diesmal erkannte sie die Zeichen. Obwohl Ana ihr versicherte, es gehe dem Vater von Tag zu Tag besser, er habe sogar ein paar Löffel Suppe gegessen, sah Lilia, dass das nicht stimmte. Seine Augen verrieten das Gegenteil. Doch Lilia schwieg. Sie nahm vom Vater Abschied. Er zog sie in die Arme und erkannte sie sogar. „Adieu, mein Äffchen“ – so hatte er sie manchmal als Kind genannt - schmunzelte er und gab ihr einen Kuss. Darauf versank er, selbstvergessen, wieder im Mischen und Schaufeln. Zurück im Hotel weinte Lilia die ganze Nacht. Ihr Drachenherz zerbrach. Kein Stein blieb auf dem anderen. Die Liebsten wurden ihr genommen. Und was blieb für sie? Und noch einmal drei Wochen später erhielt Lilia die Nachricht, dass nun auch Oma gestorben sei. Doch Tränen hatte Lilia keine mehr.
Um zu ihrem Erbe zu kommen, überredete Ana einen Arzt des Spitals, einen Wisch zu unterschreiben, ein eilig in der Mitte entzwei gerissenes Papier, auf dem stand, der Vater bestimme Ana zur Alleinerbin. Das undefinierbare Gekritzel am Ende, bezeichne die Signatur des Vaters. Der Name des Arztes, der als Zeuge dabei gewesen sei, stehe rechts davon. Geld bedeutete Lilia nichts. Und von Ana erhalten, die ihr von der Abmachung zwischen dem Vater und sich erzählte, wollte sie ohnehin keines.
Doch der Onkel, dem sie die Geschichte, kurz danach, als schlechten Witz mitteilte, schlug Alarm. Er beauftragte seinen Anwalt, sich der Sache anzunehmen. Dann bestürmte und zwang er Lilia dazu, den Anwalt mit ihm zusammen aufzusuchen. Erst dort, als sie mit dem freundlichen, älteren Herrn in seiner Kanzlei unter vier Augen sprach, erfasste Lilia den Ernst der Lage. Der Fetzen, mit dem die Stiefmutter das Erbe des Vaters hatte erschleichen wollen, wurde ihr vorgelegt. Sie staunte ob Anas Kühnheit, allerdings immer noch ohne die Zusammenhänge zu verstehen. Erst als der Anwalt ihr erklärte, dass wenn sie sich nicht um ihr Erbe kümmere, sie bis zum Schulende von der Gnade Anas abhängig sei, und sich hinterher, ohne einen Rappen in der Tasche, eine Existenz aufbauen müsse, begriff sie, unterschrieb die Vollmacht für den Anwalt und brachte damit die Sache ins Rollen.
Hinterher lud der Onkel Lilia zum Essen in ein bekanntes Lokal ein, und sie erhielt, zur Feier ihrer Selbständigkeit, das erste Glas Wein. Den Geschmack fand sie interessant, nicht besonders angenehm, nur spannend, und das tiefrote Funkeln der fast öligen Flüssigkeit bewundernswert. Doch als kurz darauf ihre Glieder schwerer und schwerer wurden, und sie vor Müdigkeit fast unter den Tisch sank, verwandelte sich ihr Wundern in Bestürzung. Wie sie so auf den Zug und nach Hause kommen solle, fragte sie den Onkel mit glasigen Augen und schwerer Zunge. „Kein Problem“, entgegnete der. „Warte nur ab, bis wir wieder draußen in der Kälte stehen, dann vergeht das Geflimmer von selbst. Doch vorher trinken wir noch einen Kaffee.“ Gesagt, getan. Damit wurde Lilia doppelt zur Erwachsenen getauft. Auch den Kaffee fand sie interessant, allerdings nicht besser als den Wein, und sie versprach sich, in nächster Zukunft beides zu lassen, zumindest so lange bis sie es vielleicht zu mögen gelernt habe.
Ihre Erbschaft betreffend, entschied das Gericht, mit Lilias Einwilligung, die Stiefmutter solle das Haus behalten, und Lilia erhalte das Bargeld. Ana spie Gift und Galle, als sie den Bescheid erhielt. Doch die Sache war rechtens, wie der Onkel sagte. Dass sie wieder arbeiten musste, um Hypothek und Lebensunterhalt bestreiten zu können, verzieh Ana Lilia nie. Ana empfand es als die größte Demütigung und Gemeinheit, die ihr je angetan worden seien. Dafür kriegte Lilia Luft und Raum, um ihr Studium in Ruhe und ohne Sorgen abzuschließen.
Sehr umfangreich fiel das Erbe nicht aus. Ein Großteil seiner Barschaft war für des Vaters jahrelange Krankheit draufgegangen. Aus dem gleichen Grund fiel auch die Witwenrente für Ana bescheiden aus. Doch Lilia war vorerst in Sicherheit. Und darüber freute sie sich. Sie suchte nach einer besseren Lösung für ihre Unterbringung. Auch in dieser Hinsicht wollte sie ihre eigene Meisterin sein. Und Pierre-Louis brachte sie auf die Idee, sich eine kleine Wohnung zu nehmen. Überraschenderweise war gerade eine zu mieten, eine winzige Zweizimmerwohnung in der Altstadt, als Teil der Stadtmauer, mit Fenstern, die nach vorne und nach hinten hinausgingen, und unter denen an Festtagen sämtliche Umzüge vorüberdefilierten. Das erschien Lilia wie ein Sechser im Lotto. Voller Begeisterung bestellte sie Vorhänge, kaufte ihr erstes, eigenes Bett, das Pierre-Louis zusammenbaute, einen billigen Schrank und einige Stühle. Den Tisch wollte sie, mit Pierre-Louis‘ Hilfe, selbst basteln. Die Tischplatte sollte aus, von ihr bemalten Keramikteilen, in der Art eines Mosaiks, zusammengestückelt werden. Pierre-Louis schreinerte den Tisch. Er stand auch, etwas wackelig zwar, doch alle Beine waren gleich lang. Und das Mosaik würde ihm, durch sein Gewicht, die notwendige Stabilität verleihen.
Schon seit längerem besaß Lilia ein Spinett: ihr ganzer Stolz und unübersehbare Zierde der neuen Bleibe. Lilia, die zu jener Zeit begeistert Brecht las, kam während des Einrichtens „Die Kleinbürgerhochzeit“ in den Sinn. Sie teilte ihre Beobachtung scherzend Pierre-Louis mit, der den Witz leider nicht verstand, mit Lilias Gedankensprüngen und Wortspielen oft nicht zurechtkam. Lilia ließ die Sache auf sich beruhen. Sie waren beide jung, befanden sich am Start zu einer selbständigen Existenz, obwohl Pierre-Louis schon als Angestellter in Lohn und Brot stand. Das Leben schien es gut mit ihnen zu meinen. Der Rest würde sich finden.
Dass Pierre-Louis immer häufiger bei ihr übernachten wollte anstatt in der Wohnung, die er mit seiner Schwester gemietet hatte, störte Lilia zwar, behagte ihr ganz und gar nicht. Doch zu intervenieren getraute sich Lilia nicht. Außer Pierre-Louis gab es niemanden, der sich um sie sorgte. Er hatte sich um Mietvertrag und Kaution gekümmert. Ohne seine Hilfe hätte Lilia die Wohnung nicht bekommen. Die Vermieter erkundigten sich genau nach Lilias Verhältnissen und fragten unumwunden, ob Pierre-Louis und sie in naher Zukunft zu heiraten gedächten, denn in wilder Ehe zu leben, komme für sie unter seinem Dach nicht in Frage.
Lilia fühlte sich brüskiert. Mit Pierre-Louis geschlafen hatte sie noch nie, gedachte auch nicht, es zu tun. Selbst während der Woche, die sie zusammen in Frankreich verbrachten, war es nie zu direktem Hautkontakt gekommen. Und schon gar nicht zu mehr. Dass Pierre-Louis sich auf sie legte, sich angekleidet an ihr rieb, war das Äußerste, das sie ertrug. Sie mochte es auch, wenn dabei etwas sich in ihrem Bauch zu regen begann, und sie Gefühle verspürte, die Wohltuendes versprachen. Doch sobald sie diesen Punkt erreichte, stoppte sie Pierre-Louis. Sie mochte ihn. Sie hatte ihn gern. Sie schätzte ihn. Er gefiel ihr. Er war weder dick, noch plump, noch hässlich, noch gutaussehend. Er war einfach Pierre-Louis. Und ob sie ihn dafür liebe, fragte sie sich nicht. Es kam ihr nicht in den Sinn. Er war da, weil sie ihn brauchte. Ob er derjenige war, auf den sie gewartet hatte? Sie hatte keine Ahnung. Und im Moment führte es viel zu weit, sich darüber Gedanken zu machen. Über Beziehung wusste Lilia nichts. Über gemeinsames Zusammenleben als Paar, wusste sie nichts. Nichts über die Liebe zwischen Mann und Frau. Und noch weniger über das Ding „Ehe“ genannt. Sie hatte ja erst angefangen, ohne Furcht zu atmen, sich Wünsche auszudenken, an deren Berechtigung zu glauben und daran, dass es für sie, so wie für andere auch, einen Platz auf der Welt gebe.
Lilia spürte, wie Pierre-Louis sich in ihrem Leben sachte breit machte. Er wolle ein eigenes Bett, wenn sie ihn schon nicht in ihrem dulde. Er wolle Platz für Kleider und Wäsche in ihrem Schrank, da er ja auch für ihren Hund sorge, ihn zur Arbeit mitnehme, mit ihm laufen gehe, wenn Lilia in der Schule sei.
Tatsächlich hatte sich Lilia mit dem ersten Geld, das der Anwalt ihr geschickt hatte, einen Hund gekauft, den sie wirklich nur deshalb halten konnte, weil Pierre-Louis sich anerbot, für ihn zu sorgen. Es war ein roter Spaniel, eine Dame, ein Herzenswunsch Lilias. Sein Körbchen stand im winzigen Bad, hatte wenig Platz, so wie Pierre-Louis und Lilia auch. Lilia liebte den Spaniel über alles, mehr noch als Pierre-Louis, verzog ihn in jeder nur denkbaren Hinsicht, ohne zu wissen, was ein Hund an Pflege, an Beschäftigung brauchte. Ihn von der Leine zu lassen, getraute sie sich selten, wenn sie allein mit ihm unterwegs war. Ihre Furcht, ihm könne etwas zustoßen, er könne weglaufen, oder im Kanal ertrinken, war zu groß. Sie litt Ängste um den Hund, die sie um Pierre-Louis nicht litt. Sie machte sich Sorgen um ihn, die sie sich um Pierre-Louis nicht machte. Und gab sich keine Rechenschaft darüber. Sie blieb der Alleinmensch, der sie immer gewesen war - selbst wenn Pierre-Louis sich näher und näher an sie herandrängte. Es wuchsen dabei nur ihre Bedenken. Die heimliche, unheimliche Bedrohung, übernommen zu werden, per Handstreich sozusagen, erstarkte. Obwohl sie wusste, Pierre-Louis sei nicht so. Er habe Ehre im Leib und würde nichts tun, das ihr schaden könne. Doch insgeheim traute sie ihm nicht, wie keinem Mann, wie überhaupt niemandem. Traute sie doch nicht einmal sich selbst.
Lilia begriff nicht, was in ihr vorging. Sie stellte sich keine Fragen. Wie stets beobachtete sie nur: Sich, Pierre-Louis, ihre Umstände, Pläne, die sie immer noch zu verfolgen gedachte, Träume, die sie hegte: Alles ohne darüber zu sprechen. Auch mit Pierre-Louis sprach sie nicht über sich, weder über ihre Gefühle, noch über ihre Gedanken. Sie glaubte dass, wenn er sie so liebe, wie er sagte, er ihre Gedanken und Gefühle spüren, und ihre geheimsten Hoffnungen erraten und erfüllen werde. Im Übrigen war ihre Angst davor, er könne beleidigt sein, wenn er entdecke, dass sie nicht so dachte wie er, und deswegen ausfällig werden, oder sie sogar im Stich lassen, viel zu groß.
Pierre-Louis war ein ganz normaler Mann, der einen Beruf erlernt hatte, sein Geld damit verdiente und einigen Hobbies frönte, die vorzugsweise mit dem Militär zu tun hatten. Eine seiner Leidenschaften bestand darin, im Sandkasten mit winzigen Soldaten strategische Situationen herzustellen, sie zu fotografieren, mit ranghöheren Offizieren an Manöverübungen zu diskutieren, und sich in dem bisschen Ruhm zu sonnen, den er damit erntete. Lilia verstand diese Seite an Pierre-Louis nicht, stand hilflos daneben, wenn er ihr die neuesten Fotos erklärte. In ihrem Herzen erklang kein Echo. Sie versuchte, nicht zu kritisieren, ihn nicht in Frage zu stellen, nicht gering zu achten. Pierre-Louis schätzte es, Befehlen zu gehorchen. Er lebte auf, wenn er zu Wiederholungskursen in die Kaserne aufgeboten wurde. Unter Militärkollegen fühlte er sich wohl. Er hätte gerne zum Stab gehört. Und er sprach davon, sich um eine Stelle als Instruktor zu bewerben - was bedeutete, dass er wochen- und monatelang von zu Hause weg wäre. Für Lilia ein Graus. Für wen hätte sie dann da sein. Wen umsorgen können?
Die Abschlussprüfungen am Lehrerinnenseminar standen bevor, und Pierre-Louis büffelte mit Lilia stundenlang Algebra und Geometrie, Fächer, für die Lilia immer noch jedes Sensorium fehlte. Dank Pierre-Louis‘ unermüdlicher Geduld und seinem pädagogischen Geschick, schaffte sie in der mündlichen Prüfung überraschend eine Fünfkommafünf. In der schriftlichen allerdings, saß sie hilflos vor der komplizierten trigonometrischen Aufgabe, die sie lösen sollte. Winkel und Tangenten gerieten durcheinander. Lilias Blätter sahen aus, als habe eine Schlacht darauf stattgefunden. Als die Zeit um war, gab sie sie ab. Sie wusste, sie hatte versagt. Die mündliche und die schriftliche Note, die in einer Eins bestand, ergaben ein „ungenügend“, was Lilia nicht weiter tragisch fand, es als den notwendigen Klecks im Zeugnis stillschweigend hinnahm. Dank den Noten in den übrigen Fächern bestand sie die Prüfungen gut, und verfügte damit über ein Diplom - und gleichzeitig über eine Matura.
Dass Lilias Vater verstorben war, bekam Lilias Klassenlehrer erst dann mit, als er das von ihr eigenhändig unterzeichnete Zeugnis kontrollierte. Er fragte zuerst auf dem Rektorat nach, was das zu bedeuten habe und wandte sich erst dann an Lilia. Der Tod des Vaters lag Monate zurück.
Er war an einem dreiundzwanzigsten Dezember gestorben, also während den Schulferien. Praktisch niemand an Lilias Schule hatte davon erfahren.
Da der Vater im Waldfriedhof an seinem Sterbeort begraben werden wollte, reiste Lilia am vierundzwanzigsten dorthin. Und Ana quartierte sie in einem Schwesternheim ein. Eine, der sie betreuenden Schwestern, stellte ein geschmücktes Weihnachtsbäumchen in ihr Zimmer. Lilia nahm es nicht wahr. Sie weinte haltlos vor sich hin. Es heulte mit ihr wie mit einem Wolf. Stundenlang. Die ganze Nacht.
Am Morgen betrat Ana ihr Zimmer. Sie denke, Lilia solle ihren Vater noch einmal sehen, sagte sie nüchtern. Lasse Lilia diese Gelegenheit verstreichen, könne es sein, dass sie Ana später vorwerfe, sie nicht eindringlich genug auf die Möglichkeit hingewiesen zu haben. Lilia zuckte zurück wie unter einem, Hieb. Nein, nein: sie habe noch nie einen Toten gesehen, nein, das komme nicht in Frage, ihre Angst davor sei viel zu groß. Und überhaupt wolle sie den Vater lieber so in Erinnerung behalten, wie er im Spital gewesen sei, als er sie in den Arm genommen und „Äffchen“ genannt habe, wehrte sich Lilia. Doch Ana ließ nicht locker. Und natürlich war ihr Lilia später sehr, sehr dankbar dafür.
Es lag viel Schnee. Unter der Kirche, in den Felsen gehauen, gab es einen kleinen Abstellraum. Dorthin hatte man den Sarg des Vaters gebracht und ihn auf Stützen gestellt. Lilia zitterte am ganzen Leib, als Ana die schrundige, knarrende Holztüre aufstieß. Sie musste Lilia förmlich hinter sich her in den Raum hineinziehen. Ein Fenster ließ das eisige Verließ nicht allzu düster erscheinen. Der Sarg aus hellem Holz sah nicht wirklich bedrohlich aus.
Ana löste die fein ziselierten Schrauben des Deckels. Um ihn hochzuheben, brauchte sie Lilias Hilfe, doch Lilia zögerte. Die Angst klebte ihre Füße am Boden fest. „Komm schon“, bat Ana, „er wird dir nichts tun.“ Lilia hob mit Ana zusammen den Deckel an. Sachte fiel ein behutsamer Strahl Tageslicht auf des Vaters Gesicht. Lilia stand da wie erstarrt. Überrumpelt. Sah nur Stille. Allgewaltige, herzkleine Stille - einem Punkt, einem Zentrum, einer sprudelnden Quelle entfließende, klingende Stille. So tief, dass Worte keine Bedeutung hatten. Von so tief innen, wo Worte gar nicht existierten. Und wie liebevoll des Vaters Züge! Ganz frei. Ganz rein. Schattenlos. Lilias Herz quoll über vor Dankbarkeit. Tränen überfluteten ihr Gesicht - lautlos. Sie wollte ihre Weihnachtsgeschenke in den Sarg legen: einen messingenen Kerzenleuchter, für den sie einen Nachmittag lang im Atelier eines Antiquars geputzt hatte, und andere Kleinigkeiten. Ana fand, das sei schade, sie solle die Geschenke lieber ihr geben, sie lebe ja noch und könne sie gebrauchen. Und Lilia gehorchte. Nur ja die Stille nicht stören. Nur ja den Frieden nicht aufs Spiel setzen. Der Augenblick war unersetzlich. In ihrem Herzen würde er verharren bis zu ihrem Tod.
Noch zwei Tage hintereinander konnten Ana und Lilia den Vater besuchen. Dann wurde er auf dem Waldfriedhof beigesetzt.
Von den Feierlichkeiten bekam Lilia nichts mit. Verwandte reisten an, die sie seit Jahren nicht gesehen hatte und kaum noch erkannte. Es betraf sie nicht. Sie blieb mit ihrem Weh und mit dem unfassbaren Geschenk von Stille allein inmitten der Leute. Auch vom Leichenschmaus kriegte sie nichts mit. Es fand alles statt. Doch Lilia weilte weit, weit weg. Im herzkleinen Ort, an dem es nur sie allein gab – fern und gleichzeitig nah. Blutnah. In farbloser, körperloser Stille.
Tags darauf reiste Lilia ab, fuhr mit dem Zug zur Mutter. Wo hätte sie sonst hin sollen? Omas Villa war verkauft, und die Mutter bewohnte mit einer invaliden Italienerin, die schon Oma gedient hatte, drei Wohnungen im ersten, neu erbauten Hochhaus der Stadt, im sechsten Stockwerk, an der Seepromenade. Zwei der Wohnungen bestanden aus je drei Zimmern mit gläsernen Balkonen, eine aus nur einem. In ihm wohnte Lilia für gewöhnlich, wenn sie die Mutter besuchte. Die Italienerin hauste unter dem Dach in zwei abgeschrägten Mansarden, mit winzigem Bad und ebensolcher Küche. Im Sommer heizten sich die Kammern auf, im Winter waren sie eiskalt, trotz Strahlern. Es war die einzige Sorte Wohnung, die sich die Italienerin auch noch nach der Mutter Tod von ihrer Rente würde leisten können.
Während dieses Besuchs durfte Lilia, ausnahmsweise, die eine der weitläufigeren Wohnungen für sich in Anspruch nehmen. Alle Gobelins von Oma standen darin. Doch dafür hatte Lilia keine Augen. Kaum ließ die Mutter sie allein, ging sie zu Bett und heulte sich einmal mehr den maßlosen Verlust - die maßlosen Verluste, die sie so kurz hintereinander erlitten hatte - vom Herzen. Lilia war sich sicher, die Mutter könne ihr Schluchzen hören und rechnete es ihr hoch an, dass sie sie dennoch sich selbst überließ. Gerade Trost gespendet zu bekommen, hätte sie nun überhaupt nicht ertragen. Denn Trost gab es keinen für ihr Elend, nur wie immer, das sich Hindurchkämpfen - bis irgendwann Licht in Sicht wäre.
Lilia, die frisch diplomierte Unterstufenlehrerin und frisch verheiratete junge Frau, sah sich mit Tagen konfrontiert, die sie aus eigenem Antrieb füllen und erfüllen musste. Alle in ihrer Klasse traten Lehrstellen an. Sie als Einzige hatte entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen. Doch welchen, wusste sie plötzlich nicht mehr. Ihre Ehe mit Pierre-Louis kam auf Druck der Vermieter zustande sowie auf Druck von Seiten Pierre-Louis‘, der ihr unumwunden erklärte, er bringe sich um, falls sie ihn verschmähe. Pierre-Louis meinte das todernst. In seiner Familie meinten es alle, außer seiner Mutter, todernst, wenn sie von Selbstmord sprachen. Das begriff Lilia. Sie mochte Pierre-Louis, wollte ihn nicht verlieren. Den Gedanken, verheiratet zu sein, fürchtete sie nicht. Auch nicht den Gedanken an Treue. Was Lilia Angst machte, war die Tatsache gegenseitigen Ausgeliefertseins. Sie wusste, dass ein Mann ein Recht auf seine Frau, beziehungsweise auf ihren Körper hatte. Die Ehe musste vollzogen werden. In der Nacht vor der Hochzeit schlief sie denn auch mit Pierre-Louis, in ihrem schmalen Bett, in ihrer ärmlichen Wohnung - - das selbstgenähte, knöchellange Hochzeitskleid aus genoppter, eierschalenfarbener Seide, auf das sie sehr stolz war, wie zum Schutz, über die Stuhllehne drapiert. Mit einem selbstgeflochtenen Kranz aus Seidenblumen im Nacken über dem Knoten ihres Mozartzopfs, sah sie elegant und richtig bräutlich aus.
Lilia hätte auch gern in einer Kirche geheiratet. Doch da kein Familienmitglied zur Hochzeit kommen wollte - die Mutter lehnte entrüstet ab, Ana antwortete erst gar nicht auf ihre Einladung, und sonst gab es niemanden, den sie bitten konnte - äußerten die Pfarrer, der in Frage kommenden Kirchen, Bedenken. Wer würde Lilia zum Altar führen? Und überhaupt: So ganz ohne Familie - sie wüssten nicht – nein, sie möchten lieber die Finger von der Sache lassen. Ohne Segen der Eltern? Und so jung? Was sollte das werden? Das könne doch nicht gut dgehen. Der eine Pfarrer, ein behäbiger Elsässer mit Doppelkinn und himmelblauen Schweinsäuglein, Geistlicher einer heruntergekommenen, romanischen Kirche jenseits der Grenze, die Lilia sehr liebte, erklärte in seinem breiten Dialekt, er würde ihnen dringend raten, es sich nochmals zu überlegen. Sie sollten die Angelegenheit mit ihren Angehörigen besprechen, sie um Zustimmung bitten, da sie sonst garantiert in einem Jahr wieder geschieden seien.
Das gab Lilia den Rest. Sie und Pierre-Louis, der ohnehin nicht kirchlich orientiert war, entschieden, nur aufs Amt zu gehen, und sich den Segen eines Pfarrers zu schenken. Gleichzeitig beschlossen sie, aus der Kirche auszutreten. Denn auch mit dem Eheunterricht, zu dem sie einer der Priester eingeladen hatte, kamen sie nicht klar. Sie gingen nur einmal hin. Damit war die Möglichkeit für eine kirchliche Trauung vertan. Kein Unterricht - keine Trauung.
Auch das Thema des notwendigen Vollzugs der Ehe, das der Geistliche ansprach, machte Lilia zu schaffen. Der Rebell regte sich in ihr, war sie doch um nichts in der Welt dazu bereit, sich einfach preiszugeben Ihr Körper gehörte ihr allein, war immer und überallhin mit ihr mitgegangen, hatte sie durch dick und dünn begleitet: Und nun sollte das ein Ende haben, bloß weil sie einen Ring am Finger trug? Es ging Lilia nicht in den Kopf.
Dennoch nahm Lilia das Heiraten ernst, mit vielen guten Vorsätzen, in bester Absicht. Sie wollte eine treue und willige Frau für ihren Mann sein: Ein perfekter Kumpel, eine optimale Freundin und Gefährtin. Nur über ihren Körper: Darüber wollte sie selbst bestimmen, so wie sie es ein Leben lang getan hatte. Und das hatte sich nie als falsch erwiesen.
Dass Lilia in Pierre-Louis nicht verliebt war, nicht wirklich, nicht so, dass sie am liebsten Tag und Nacht mit ihm geknutscht hätte, ging ihr nicht auf. Sie dachte sich die Ehe als Aufgabe, so wie alles in ihrem Leben eine Aufgabe war, die es zu bewältigen galt. Das erste Mal Sex mit Pierre-Louis ließ sich denn auch ziemlich kümmerlich an, ähnlich einer Geometrieübung. Lilia gab sich zwar Mühe, doch sie verlor sich in keinem Augenblick an Pierre-Louis, vergaß sich nicht einen Lidschlag lang, zog die Sache durch, so gut es ging, trotz Schmerzen, obwohl sie das Ergebnis alles andere als erstrebenswert dünkte. Denn Nähe zuzulassen, hatte Lilia nicht gelernt. Jegliches Rudelgefühl ging ihr ab. Für sie als Alleinmensch war das kein Thema. Der Raum um sie herum war heilig. Nur für Lilia war darin Platz. Sie kannte nichts anderes. Und nichts anderes machte Sinn.
Lilia benötigte Zeit, viel Zeit, um sich in ihrem neuen Stand zurechtzufinden, und Pierre-Louis gewährte sie ihr. Er schien sie wirklich zu lieben, auch dann wenn er ihren Gedankengängen, die sie selten preisgab, nicht folgen konnte. Er akzeptierte Lilia, so wie sie war, akzeptierte auch, dass Lilia Dinge wusste, von denen er keine Ahnung hatte. Von deren Vorhandensein sogar nicht einmal Lilia eine Ahnung hatte. Dinge, die ihr nicht bewusst waren, sondern ihrem Wesen innewohnten, ohne dass sie sie dachte. Urdinge, die ihre ganz persönliche Wahrheit ausmachten, und an denen zu rütteln nicht in Frage kam. Wozu auch, waren sie doch bis ins Mark ausgeleuchtete, gültige Werke.
Lilia lebte als verheiratete Frau so, wie sie stets gelebt hatte: Für sich allein. Mit sich allein. In sich allein. Mit Pierre-Louis tat sie sich zusammen um gemeinsamer Anliegen, gemeinsamer Interessen willen, nicht um sich als Mensch in Pacht zu geben.
Lilia verstand nicht, warum sie, bloß weil sie verheiratet war, keine eigenen Zukunftspläne mehr schmieden sollte. Sie und Pierre-Louis könnten eine Studentenehe führen, argumentierte sie. Nur zusammen Kinder zu haben, und als einzigen Lebensinhalt ihr Gedeihen zu verfolgen, sperrte Lilia in einen Käfig, in dem sie jämmerlich zugrunde ginge. Pierre-Louis genügte diese Art von Leben. Sie sprachen nicht darüber, doch Lilia spürte es und fürchtete ein solches „Kleinbürgerszenario“, wie sie es nannte, wie die Pest. Nie könnte sie sich damit zufrieden geben. Deshalb setzte Lilia alles daran, Pierre-Louis davon zu überzeugen, auch er solle größere Ziele anvisieren. Ein Abendstudium zum Beispiel, sagte sie, würde seine Berufschancen, sein Ansehen und sicher auch sein persönliches Wohlbefinden entscheidend verbessern.
In diese Zeit grundlegender Auseinandersetzung Lilias mit ihrer Zukunft, fiel die letzte Überweisung von Vaters Erbe durch Lilias Anwalt. Nun war es aufgebraucht, und Lilia musste sich Entscheidendes überlegen. Sie war Schülerin des Sängers geworden, der sie auf ihr Talent aufmerksam gemacht hatte. Sie besorgte ihren winzigen Haushalt, ihren Hund, übte Lieder und Arien und studierte Harmonielehre bei einem Komponisten, der am Anfang einer beachtlichen Karriere stand und sich mit Privatstunden über Wasser hielt. Pierre-Louis kam zum Mittagessen nach Hause. Ansonsten füllte Arbeit seine Tage aus. Sein Gehalt reichte knapp für ihr Auskommen. Lilia teilte es peinlich genau so ein, dass Rechnungen bezahlt wurden ohne angemahnt zu werden.
Wenn Studierende ihres Gesangslehrers nach Verona reisten, Opernaufführungen besuchten, in den höchsten Tönen davon schwärmten, saß Lilia zuhause und grämte sich. Insgeheim war sie davon ausgegangen, zu heiraten gehe mit finanzieller Sicherheit Hand in Hand: Offenbar ein Erbe der Gedankenwelt von Oma und der Mutter. Zwar besaß Pierre-Louis ein Auto, einen klapprigen DKW, dessen Lackschicht verblasst und unansehnlich geworden war. Doch als er Lilia voller Stolz zum ersten Mal zu einer Mitfahrt einlud, erstarrte sie bei seinem Anblick und begriff schlagartig, was es hieß, aus bescheidenen Verhältnissen zu stammen, jung verheiratet zu sein, am Anfang einer Karriere zu stehen, ohne finanzielle Sicherheit im Rücken. Sie ließ sich die Überrumpelung nicht anmerken. Die Einschätzung ihrer Situation stülpte sich ruckartig um. Es galt, die Orientierung zu behalten und sich erst recht darum zu bemühen, der drohenden Enge zu entfliehen. Sie setzte ihre ganze Überredungskunst ein, Pierre-Louis von der Notwendigkeit beruflicher Verbesserung zu überzeugen - bis er schließlich „Ja“ sagte, um des Friedens willen, weniger aus persönlicher Überzeugung, wie Lilia fühlte. Hauptsache, er tat es. Und notgedrungen suchte sich auch Lilia eine Arbeitsstelle. Das erwies sich als einfach, denn dank ihres Diploms fand sie sofort Beschäftigung, und obwohl der angebotene Lohn bescheiden wirkte, erklärte sich Lilia damit einverstanden. Dass sie darüber diskutieren sollte, wusste sie nicht. Ihr Arbeitstag betrug neun Stunden, begann um sieben Uhr in der Früh und dauerte bis sechs Uhr abends. Zwei Wochen Ferien pro Jahr standen ihr zu. Über Mittag blieb Zeit zum Kochen, Zeit zum Essen, Zeit für den Hund. Nach Arbeitsende wiederum. Und hinterher ging sie zum Gesangsunterricht, fünfmal die Woche. Für Pierre-Louis sah der Tag in etwa gleich aus. Nur dass er abends in die Großstadt fuhr, um dort, während vier Jahren sein Architekturstudium zu absolvieren.
Die treibende Kraft hinter allem war Lilia. Von ihrem Einsatz hing der Erfolg ab. Sie hoffte inständig, der Herausforderung gewachsen zu sein. Die Diskrepanz zwischen Pierre-Louis‘ und ihren eigenen Ambitionen bereitete ihr Sorgen. Lilia fühlte sich, als erwache sie aus einem Dämmerzustand, aus entrücktem Traum. Fragen, worauf es im Leben tatsächlich ankomme, machten ihr zu schaffen. Klar war nur, dass: Sollte ihre Beziehung blühen, sie beide ihren Teil dazu beitragen mussten. Es schien Lilia unmöglich zu glauben, ihr Leben gipfle in der Ehe mit Pierre-Louis. Für Lilia war die Ehe ein Trittbrett , ein Sprungbrett. Lilia hoffte, Pierre-Louis sehe das genauso.
Lilia war entschlossen, aus ihrer Beziehung zu ihm das Beste zu machen. Auch weil Pierre-Louis eine Seite an sich hatte, die sie tief rührte: Etwas Fragiles, Feingliedriges, durch das sie sich ihm innig verbunden fühlte. Seine Schwester hatte schon zweimal versucht, sich das Leben zu nehmen. Und für Pierre-Louis stand fest, dass es auch bei ihm irgendwann soweit sein werde. In seinen Augen fand sich oft ein Ausdruck abgründigen Altseins, wie bei einem Ahnvater. So, als wisse Pierre-Louis um Zustände von Vergänglichkeit und Tod, die anderen verschlossen blieben. Er sprach nicht darüber, doch Lilia fühlte es, und es weckte Beschützerinstinkte in ihr. Vielleicht konnte sie ihm vergelten, was er für sie tat, indem sie auf ihn aufpasste, ihn behütete, auch wenn Pierre-Louis sagte, er sei nicht bedürftig, brauche keine Hilfe und werde auch keine annehmen. Dass Lilia ihm finanziell unter die Arme griff, von ihrem Erbe einen Möbelvertrag, den er sich als Teenager hatte aufschwatzen lassen, ablöste, empfand er als Demütigung. Er vergoss Tränen darüber. Auch hatte sich Lilia einen Verlobungsring mit Brillanten gewünscht, wie in Kreisen ihrer Verwandtschaft üblich. Sie waren zum Goldschmied gegangen. Der errechnete den Preis, und Pierre-Louis gab den Ring in Auftrag. Erst hinterher begriff Lilia, dass er den Ring nicht bezahlen konnte und deswegen heimlich einen Kredit beantragte. Ohne Aufhebens bezahlte Lilia den Ring aus eigener Tasche, und steckte ihn sich beim Goldschmied gleich selbst an den Finger. Hinterher ging ihr auf, wie sehr sie Pierre-Louis damit verletzte. Sie schämte sich fürchterlich, flehte um Vergebung. Doch Pierre-Louis verlor kein Wort darüber.
Damit der Weg zu seinem Studienort einfacher zu bewältigen wäre, besprachen Pierre-Louis und Lilia auch den Kauf eines neuen Autos, vereinbarten Ratenzahlungen. Doch da Lilia diese Abstotterei schon nach wenigen Monaten anödete, beriet sie sich mit der Lieferfirma, die ausrechnete, wieviel sie sparen würden, wenn sie den Restbetrag auf einmal hinterlegten. Und Lilia veranlasste auch diese Ablösung - dieses Mal allerdings nach eingehendem Gespräch mit Pierre-Louis. Lilia bat Pierre-Louis in ihren Vorschlag einzuwilligen, malte ihm aus, um wie viel angenehmer das wäre, und um wie viel freier sie sich fühlen würden ohne die finanzielle Belastung. Auch dieses Mal spürte sie, dass sie Pierre-Louis Leid zufügte. Er kam sich minderwertig vor, dabei meinte es Lilia doch nur gut. Warum sollten sie sich unnötigen Ballast aufbürden, wenn es anders ging, hatten sie es doch noch schwer genug als Studentenehepaar: Zu viel Arbeit, zu kurze Nächte, zu wenig Zeit füreinander - obwohl diese Punkte Lilia auch als Vorteil erschienen. So konnten sie langsam in ihre Beziehung hineinwachsen, besser mit dem aufgebürdeten Stress klarkommen.
Denn Lilia stellte plötzlich fest, dass sie nicht mehr einschlafen konnte, Stunde um Stunde neben Pierre-Louis wach lag, dessen Atemzüge sie voller Neid zählte, im Rhythmus mit der Kirchturmuhr, deren Schläge jede Viertelstunde wie Hammerhiebe auf sie hinunterprasselten. Ihre Arbeit bei der Unfallversicherung, wo sie nichts als Protokolle in die Maschine tippte, litt nicht unter ihrer Schlaflosigkeit, ebenwenig wie ihre Gesangsausbildung. Energie hatte Lilia mehr denn je. Eisernen Willen sowieso. Und Stehvermögen noch dazu.
Lilia und Pierre-Louis wohnten nun in der Hauptgasse der Stadt, zuoberst in einem Haus aus dem Barock, in einer Altbauwohnung mit über drei Meter hohen Zimmern und einem Dachgarten - in einem Juwel also, um das sie beneidet wurden - auch wenn sie Wände selbst neu anstreichen müssten, falls ihnen daran liege, wie der Besitzer sagte. Auch der Hund kriegte mehr Auslauf. Lilia pflanzte einen Blumengarten auf dem Dach, mit einer Laube aus Winden, die in allen Farben blühten und Schutz vor der Sonne boten. Wieder defilierten sämtliche Umzüge unter ihren Fenstern durch die Gasse, in denen die Blasmusik echote wie in den Bergen, und Lilia und Pierre-Louis auf der Fensterbrüstung sitzend frühstückten, hoch über Fahnen und Zuschauermassen mit den Beinen baumelnd. Es gab sie: Diese Augenblicke geteilter Freude zwischen ihnen. Augenblicke stillen Einvernehmens. Von Gefühlen satt. Und gegenseitigem Spüren. Voller Hoffnung. Leichtigkeit. Und Zuversicht. Wie Lilia, hatte auch Pierre-Louis keinen Freundeskreis. Und wie Lilia früher, hasste auch er seine Mutter, obwohl er nie klar ausdrückte, weshalb.
Pierre-Louis‘ Mutter wirkte sehr dominant. Ihre und seines Vaters Familie waren reich gewesen, bevor die Weltwirtschaftskrise sie über Nacht verarmen ließ. Pierre-Louis‘ Vater hatte eine piekfeine Erziehung in einem ausgesuchten Lyzeum in den Bergen genossen. Seine Eltern waren im schnittigen Cabriolet vorgefahren. Und Ferien am Lido von Venedig und in Nizza gehörten zum guten Ton. Pierre-Louis‘ Vater war an den Umständen des Bankrotts seiner Familie zerbrochen, war zum Alkoholiker geworden. Quälte sich durch Tage voller Groll, in einem unterbezahlten, miesen Job. Schämte sich täglich über die jämmerliche Hütte, die alles war, was er seiner Familie bieten konnte: Ein winziges, verbrauchtes Häuschen mit schäbigem Gärtchen, in dem seine Frau, in allem immer das Gute hervorhebend, das Regiment innehatte. Sie quartierte sogar Flüchtlinge ein. Legte in jedem verfügbaren Quadratmeter Matratzen aus, bis hinaus in den schmalen, stickigen Flur. Kochte Essen bis spät in die Nacht. Bot immer wieder gestrandeten Menschen Asyl, bis sie auf eigenen Füssen stehen konnten. Sie war eine Energiemaschine, die sich nicht unterkriegen ließ: laut, jovial, sich mit jedem verbrüdernd, der Hilfe brauchte - sodass ihr Mann daneben mehr und mehr verblasste, sich in sich selbst zurückzog, zum Gespenst wurde, das sich ins Koma soff - und das seine Frau ins Bad trug und wieder ins Bett, ohne sich zu beklagen. Nur manchmal weinte sie verzweifelt vor sich hin, Enttäuschung, Kummer und Elend aus sich hinausrinnen lassend wie einen Bach. Bis Mut und Kraft wieder überhandnahmen, und sie den Karren aus dem Dreck und weiterziehen konnte. Und natürlich trampelte sie mit ihrer überbordenden Energie Schwächere oder Stillere in Grund und Boden. Auch Pierre-Louis. Und das konnte er ihr nicht verzeihen. Soviel sich Lilia auch bemühte, ihn umzustimmen: Zu seiner Mutter fand er den Weg zurück nicht. Ebenso wenig wie zum Vater, den er mehrheitlich verachtete, und der nach vielen Jahren durch passiven Selbstmord an übermäßigem Alkoholgenuss zugrunde ging. Dass der Vater, als Pierre-Louis noch ein Kind gewesen war, seine Ordonanzpistole auf die Mutter gerichtet und gedroht hatte, sie zu erschießen, wenn sie ihn nicht in Ruhe trinken lasse, konnte er ihm nicht nachsehen.
Und es geschah, was nie hätte geschehen dürfen: Lilia wurde schwanger. Ihr Entsetzen darüber manifestierte sich mit elementarer Gewalt. Alle ihre Pläne schwammen wie Fetzen verbrannten Papiers bachab. Lilia heulte sich die Augen wund. Pierre-Louis stand ratlos daneben. Was war denn so schlimm daran, ein Kind zu kriegen, fragte er sich. Das hätte die gemeinsame Basis ihres Lebens zusammenkitten, und Lilia dennoch singen und Theater spielen lassen. Es war normal, in ihrem Alter ein Kind zu gebären. Es könnte ihnen Freude bringen und eine lohnenswerte Aufgabe.
Spätestens nun begriff Lilia, dass Pierre-Louis und sie in völlig verschiedenen Welten unterwegs waren, und auch dass Pierre-Louis mit ihrem Bestreben, sich eine künstlerische Karriere aufzubauen, nichts anzufangen wusste. Zwar ging er mit zu Aufführungen, die sie vorschlug, zu Konzerten, die ihr wichtig erschienen. Doch mit ihm später darüber reden, diskutieren, Gesehenes und Gehörtes vertiefen, konnte sie nicht. Der Draht dazu fehlte ihnen. Das Verständnis für Lilias Sichtweise ging Pierre-Louis ab. Theater war für ihn Theater - Musik einfach Musik - schön und gut. Doch das wirkliche Leben erfüllte sich darin, eine Familie zu gründen, einen Hafen, einen Anker im Tatsächlichen. Plötzlich klaffte ein Riss durch ihr Leben.
Nachdem sie sich ausgeheult hatte, saß Lilia nur noch stumm und blass auf ihrem Bett und starrte die gegenüberliegende Wand an. Die Welt um sie herum versank. Sie aß nicht mehr, trank nicht mehr. Die Toilette suchte sie auf wie ein Geist, ohne wahrzunehmen, was sie tat. Das Einkaufen und den Hund Spazierenführen verrichtete sie auf dieselbe Weise, einzig fixiert auf ihr alle Hoffnung erstickendes Elend.
Pierre-Louis meldete sie beim Hausarzt an und begleitete sie dorthin. Doch dem Hausarzt waren die Hände gebunden, von Gesetzes wegen und aus persönlichen Gründen. Leben zu töten kam für ihn nicht in Frage. Und Lilia war gesund. Ein Kind hätte ihr gut getan. Nur wollte Lilia keines. Die Angst davor, es könnte ein ebenso desaströses Leben vor sich haben wie sie selbst, machte sie fast wahnsinnig. In ihren Augen bedeutete das Kindsein die entsetzlichste Qual, die ein Mensch erdulden konnte. Sich dafür hergeben konnte sie unmöglich.
Der Arzt verschrieb Lilia eine gewisse Sorte Pillen, die sie eine Woche lang jeden Tag nehmen solle. Die Chance bestehe, dass sich der Fötus wieder verabschiede. Lilia nahm die Pillen drei Tage lang, ohne dass etwas geschah. Nur ihre Verzweiflung wuchs ins Unermessliche. Sie wolle nur noch sterben, hauchte sie tonlos. Ohne definitiven Ausweg wolle sie nur noch sterben. Nichts sonst komme in Frage. Der Rest der Pillen blieb in der Schachtel. Lilias Fatalismus verhinderte die Aussicht auf Erfolg.
Pierre-Louis, der es mit der Angst zu tun bekam, rief alle Ärzte der Stadt an, doch keiner wollte helfen. Er fragte bei Kollegen nach, bei Freunden aus dem Militär - und erhielt endlich eine Adresse und eine Telefonnummer in Mailand. Lilia rief dort an. Eine Frau meldete sich mit harter Stimme und kurz angebunden: sonntags um neun Uhr sollten sie vorbeikommen und vierhundert Franken mitbringen. Das war genau die Summe, die Lilia und Pierre-Louis in der Eile zusammenkratzen konnten.
In tiefdunkler Nacht fuhren sie los. Doch noch vor dem Morgengrauen ereilte sie eine Reifenpanne. Ersatzreifen hatten sie keine. Lilias Puls raste. War nun wieder alles umsonst? Gab es kein Erbarmen, keine Gnade? Nicht einmal mehr Beten ging. Sie rannten zum nächsten Dorfbahnhof. Von dort aus rief Pierre-Louis einen Freund an, der ihm einen Gefallen schulde. Er überredete ihn, sie zur nächsten Stadt zu fahren, wo sie einen Schnellzug erwischen könnten, da Lilias Mutter im Sterben liege. Nach geraumer Zeit erschien der Freund tatsächlich und lud sie auf. Die Fahrkarten schmälerten zwar den mit der Hebamme vereinbarten Betrag, doch sie mussten das Risiko eingehen. Sie erreichten Mailand früh genug. Das Taxi verkleinerte ihr Budget noch einmal. Dreihundertundfünfzig Franken blieben übrig.
Der Wagen hielt vor einem stattlichen Bürgerhaus. Im Entrée brannten stilvolle Leuchten. Kein Mensch war zu sehen. Totenstille herrschte. Sie befanden sich in einem großzügigen Turm, der durch eine gläserne Kuppel erleuchtet wurde. Der Wand entlang wand sich eine frisch gebohnerte Treppe, schimmernd wie ein Lindwurm. Man hätte sich über die Brüstung in die Tiefe stürzen können. Lilia und Pierre-Louis erklommen sie. Im zweiten Stock öffnete sich eine geschnitzte Eichentüre einen Spalt weit, durch den eine Frau mittleren Alters nach ihnen Ausschau hielt, den Finger am Mund. Sie bedeutete ihnen, einzutreten. Ein weiträumiges Wartezimmer mit mindestens zwei Dutzend Stühlen nahm sie auf - Platz für die ganze, eine Schwangere begleitende Familie, wie in südlichen Ländern üblich. Wohlstand schien zu herrschen. Die Hebamme tastete Lilias Brüste ab, ihren Bauch: „Wie bei einer Viehschau“, dachte Lilia. Doch das war egal. Alles war nun egal. Hauptsache sie wurde ihr Kind los. „Das ist knapp“, meinte die Hebamme. „Du bist fast im dritten Monat.“ „Nein, erst Ende des zweiten“, entgegnete Lilia angstvoll. „Nun, so komm. Ich versuche es.“ Sie führte Lilia in den angrenzenden Praxisraum und befahl ihr, sich auf eine bereitstehende Liege zu wuchten, die Füße aufgestützt. „Und jetzt das Geld“, wandte sie sich an Pierre-Louis. Er klaubte den verbleibenden Rest hervor, eine Entschuldigung stammelnd, die Lilia übersetzte, mit flehendem Blick. Die Hebamme schmollte, rümpfte die Nase, willigte schließlich ein, den Eingriff vorzunehmen. Sie tat es ohne Narkose. Lilia stieß im entscheidenden Moment einen heiseren Schrei aus. Die Hebamme stürzte sich auf sie, verschloss ihr mit der Hand den Mund, horchte angstvoll ins Leere, doch nichts rührte sich im Haus. Pierre-Louis hielt Lilias Kopf. Die Qual war kurz, dafür heftig. Lilia durfte sich wieder anziehen, inklusive Binde, da sie innert Kürze zu bluten anfangen werde, wie die Hebamme mahnte. Das Geld wurde weggeschlossen, und die Hebamme schubste die hinkende Lilia und Pierre-Louis durch den Türspalt auf die Treppe zurück, schloss lautlos hinter ihnen ab.
Das Geheimzuhaltende. Unaussprechbare war geschafft. Das demütigende Bitten. Die Abhängigkeit von der Gnade einer völlig Fremden. Das Verbrecherische. Vom Gewissen nicht Kontrollierbare war überstanden. Später, später war Zeit, das Geschehene zu sichten und sich damit auseinanderzusetzen.
In der Kühle des Morgens, inmitten des menschenleeren Quartiers umarmten sich Lilia und Pierre-Louis, glücklich über das gemeinsam bestandene Abenteuer. Nun hatten sie es nicht mehr eilig. Die Rückfahrkarten steckten in Lilias Tasche. Alles andere konnten sie geruhsam angehen. Lilia fühlte sich wie der Hölle. Der Verdammnis. Wie grausamstem Schicksal entronnen. Zwar meldeten sich nun Schmerzen. Sie ertrug sie leise stöhnend. In ihr war heilloses Durcheinander gläserner Klarheit gewichen. Nun konnte sie sich ans Ordnen machen. Am Montag ginge sie wieder zur Arbeit, auch wieder in die Gesangsstunde. Noch einmal - oder wieder einmal - war sie davongekommen. Sie fragte Pierre-Louis nicht, was ihm die Aussicht auf ein Kind bedeutete. Ihre gemeinsame Zukunft war gerettet. Und sie konnte nur hoffen, dass Pierre-Louis dafür Verständnis aufbrachte. Von da an schluckte Lilia die Pille. Dass sie davon Fettpölsterchen ansetzte, verschmerzte sie. Auf das Abzählen der Tage war scheinbar kein Verlass.
Rund drei Jahre vor diesen Ereignissen saß Lilia in der ersten Reihe des Theaters in der Großstadt. Das Stück, das an diesem Abend gegeben wurde, handelte von zwei Männern, einem bodenständigen und einem intellektuellen, die sich in einem Bunker verschanzt hielten, nur durch ein Periskop mit der Außenwelt verbunden, da die Erde einer Kaugummikatastrophe zum Opfer gefallen war und sich ihren Augen nur noch als missfarbene, jedes Leben erstickende Schliererei darbot. Die beiden, einander auf Gedeih und Verderb ausgelieferten, in sturem Glauben an ein mögliches Ende der Verheerung festsitzenden, ernährten sich von Dosenfutter, den immer gleichen Erbsen sowie von Keksen, die sie kistenweise eingekauft hatten, ohne daran zu denken, dass sie ihrer in absehbarer Zeit überdrüssig würden. Meter um Meter standen die Regale voll davon. Der Intellektuelle, ein süffisanter, überheblicher Kotzbrocken, sanierte sich mit Yoga-Übungen, mit salbungsvollem Gerede und Gehabe, das mehr und mehr in Zynismus umschlug. Innert Kürze drehte sich der Alltag nur noch um Gier, ums Überleben oder Verrecken. Sie würfelten um jeden Löffel Gemüse, um jeden Keks, wobei der Gewitzte den Bauchmenschen einmal ums andere beschiss. Die Handlung drehte sich um Unterdrückung, Krieg bis aufs Blut, um Brutalität, den Wahnwitz eines aussichtslosen Überlebenskampfes - der seinen Höhepunkt erreichte, als der Büchsenöffner verlorenging.
Ein schauriges Stück, dessen Aktualität das Herz gefrieren ließ, kreischend komisch. Ulk und Posse gepaart mit tödlichem Hass, der gesamten Palette menschlicher Regungen unter dem Aspekt völliger Sinnlosigkeit: Ein Fressen für Schauspieler.
Am einen der beiden Typen konnte sich Lilia nicht sattsehen. Seine Stimme hypnotisierte sie. Lilia wurde fast verrückt vor Lust, sie zu genießen. Die Stimme stellte sogar die von Noldi, dem Maler aus ihrer Kinderzeit, in den Schatten. Und plötzlich, wie vom Blitz getroffen, wusste Lilia, dass: „Wenn dieser Mann mich je rufen sollte, würde ich auf nackten Füssen vom Ende der Welt zu ihm laufen.“ Kaum gedacht, schüttelte Lilia den Gedanken von sich ab, wohl wissend, dass sie nie im Leben die Chance dafür kriegen werde, denn: wer war sie schon im Vergleich zu ihm.
Lilia heiratete Pierre-Louis einige Monate danach - im vollen Wissen, dass schon nur der altersmäßige Unterschied zwischen ihr und dem Schauspieler viel zu groß sei, und sie selbst noch viel zu sehr Kind, zu unerwachsen und unerfahren, um einem Mann seines Formats auch nur das Wasser zu reichen. So manches hatte sie noch zu lernen. Es gebrach ihr so sehr an Souveränität. Denn obwohl Lilia sich als Alleinmenschen erfuhr, sehnte sie sich nach einer starken Schulter. Nur, wie hätte sie die bei einem Mann finden sollen, der ständig von Theater zu Theater pendelte?
Dennoch blieb die Melodik seiner Stimme unauslöschlich in Lilias Herzen. Sie kultivierte sie im Stillen. Immer wieder ertönte sie auch am Radio. Immer wieder bei Matinées: Fontane, Mann, Goethe, Rilke, Benn, oder Lasker-Schüler deklamierend. Eine Stimme, die sich in Lilias Leben Bahn zu brechen verstand, einen Weg furchte in ihrem Inneren, zu dem sie den Zugang leichter und leichter fand. Bis er sich zum festen Bestandteil ihres Lebens formte. Etwas in Lilia bereitete sich auf Entscheidendes vor. Sie wusste das. Es geschah mit ihrem Einverständnis. Sie wollte es so. Sie ging das Risiko ein. Sie ging so weit, dass sie als Nachsatz zu ihrem Versprechen, die Worte hinzufügte: „Und wenn es mich das Leben kosten sollte.“
Daneben nahm der Alltag mit Pierre-Louis seinen Lauf. Lilias Gesang machte Fortschritte. Ein erstes Vorsingen brachte das erste Engagement: Den Vortrag einer Arie in einem Barockkonzert. Das lange schwarze Kleid für Lilias Premiere schneiderte eine junge, ehrgeizige Studentin der Kunstgewerbeschule der Großstadt, deren Adresse Lilia von der Freundin ihres Gesangslehrers erhalten hatte. Die angehende Couturière wohnte in einem schmucken Rebhäuschen außerhalb der Stadt, zusammen mit ihrem Mann und ihrem kleinen Jungen. Zum Maßnehmen und Anprobieren brauchte Lilia das Auto. Pierre-Louis verfügte mittlerweile über einen Geschäftswagen. Der Entwurf zum Kleid war schlicht. Der etwas gewichtige, von der Schneiderin vorgeschlagene, schimmernd schwarze Stoff fiel gerade am Körper entlang bis zu den Fersen. Die Ärmel wurden zu den Handgelenken hin weit und mit eierschalenfarbenem Satin gefüttert, der aufblitzte, wenn Lilia sich bewegte, die Arme mit der Partitur zum Singen erhob. Unter dem Brustansatz öffnete sich am Kleid eine Falte, die bis zum Boden reichte, gegen die Füße hin breiter wurde, sodass das Kleid beim Gehen an Umfang zunahm und sich der Bewegung des Körpers anschmiegte. Stoffüberzogene Kugelknöpfe liefen bis unters Kinn. Einen Kragen bekam das Kleid nicht. Das Innere des Halsausschnitts polsterte wieder eierschalenfarbener Satin, dessen weiche Farbe sich offenbarte, wenn Lilia den Kopf drehte, da sie die Knöpfe nur bis knapp über dem Dekolleté schloss. Es war ein Bild von einem Kleid. Nonnenhaft und pfiffig. Klösterlich streng und von raffinierter Eleganz. Und, da die Schneiderin noch nicht ausgelernt hatte, für Lilia erschwinglich.

6. Das erste Konzert
Die Konzertproben liefen rund. Lilia fühlte sich gut, obwohl ein Phänomen, das sie so nicht kannte, ihr die Hölle heiß machte: das Lampenfieber. Eine Woche vor dem Konzert überzog ein roter Bläschenausschlag Lilias Rücken, die Schultern, die Arme und den Bauch. Lilia verging fast vor Angst. Pierre-Louis musste sie dreimal am Tag mit einer milchweißen Flüssigkeit gegen den Juckreiz bepinseln, der mehligen Staub an den Kleidern hinterließ. Dennoch freute sich Lilia auf das Konzert - auch wegen Pierre-Louis. Ein Kind hatte sie ihm nicht schenken können. So hoffte sie, ihn mit ihrer Musik ein bisschen zu entschädigen. Es ihm sozusagen als kleines Entgelt für ihr Versagen zu offerieren, damit er erkenne, dass doch noch etwas aus ihr werde.
Denn nach wie vor peinigten Versagensängste Lilia bis aufs Blut. Immer noch konnte sie nicht wirklich als vollwertiger Mensch für sich einstehen. Immer noch fühlte sie sich minderwertig. Jämmerlich klein. Und mies wie ein verdreckter Bastard, den man aus der Küche scheucht. Zwar ließ sie sich nichts davon anmerken. Sie kämpfte einen verzweifelten Kampf gegen die Angst. Und ihr Lehrer, der darum wusste, stand eisern hinter ihr, stärkte ihr den Rücken, wo es nur ging. Versicherte, sie könne das. Sie sei gut. Und es laufe alles bestens.
Am Tag ihres Auftritts wollte Lilia um vier Uhr nachmittags für sich und Pierre-Louis ein leichtes Abendessen kochen. Sie marinierte etwas Fleisch und schälte Kartoffeln. Den Salat breitete sie zum Abtropfen auf dem Küchentisch aus. Als sie kurz die Toilette aufsuchte und in ihre winzige Küche zurückkehrte, traute sie ihren Augen nicht: Das Fleisch war weg. Sie rief Pierre-Louis. Der wusste von nichts. Erst als Lilia ihre Spanieldame sich genüsslich die Schnauze lecken sah, begriff sie. Ihr Lachen über das Missgeschick entspannte sie. Viel Angst kollerte von ihren Schultern. Anstatt Schnitzel aßen Lilia und Pierre-Louis Würstchen. Groß essen mochten sie beide nicht, denn auch Pierre-Louis litt unter Lampenfieber. Für Lilias Zukunft war das Gelingen des Konzerts entscheidend, von immenser Bedeutung. Es war ihr erster, öffentlicher Auftritt. Nichts Ähnliches war ihr je passiert. Also musste es gelingen.
Pierre-Louis und Lilia fuhren los. In der Sakristei der Kirche zog sich Lilia um. Die langen Haare trug sie mit Hilfe eines zusätzlichen Haarteils zu einem Chignon hochgesteckt, über den nun luftige Locken baumelten. Lilia sah aus wie eine richtige Sängerin. Und sie war eine richtige Sängerin, die bezahlt wurde für das, was sie tat. Das sagte sie sich immer wieder, wenn sich das Lampenfieber anschlich wie ein bösartiges Vieh. Und sie sich nur noch wünschte, ohnmächtig zu werden, damit rasch alles vorüber sei, und zwar für immer. Doch Lilia gelang keine Ohnmacht, und der Zeitpunkt ihres Auftritts rückte unweigerlich heran. Und plötzlich stand er vor ihr. Auf einen Wink des Dirigenten erhob sie sich wie in Trance, trat vor, realisierte, dass sie stand, spürte das feine Schaben ihres Kleides auf den Fußrücken, erinnerte sich daran, wie sehr ihr ihre Aufmachung gefiel, streckte den Rücken – denn nun gab es kein Entrinnen mehr, nur noch das „Vogel friss“, denn zum Sterben war es zu spät.
Das Orchester setzte ein. Geigen zirpten. Flöten stöhnten. Das Fagott schluchzte begütigend. Und die perlenden Läufe und Triller des Cembalos bereiteten den Einstieg in Lilias Arie vor. In der zweiten Reihe, gut sichtbar, saß ihr Gesangslehrer. Er ließ sie nicht aus dem Blick, gab Zeichen zum Atmen, trug sie durch die ersten, wiegenden Takte, während denen sich Lilia kaum spürte, als bestehe ihr Körper aus Luft. Dann plötzlich schien es, als öffneten sich Schwingen an ihren Schultern, als hebe sie ab. Lilias Brustkorb weitete sich, ihr Atem schwoll kraftvoll, und ein Glücksgefühl ungeahnter Art trug sie durch die Musik - die alsbald verklang, kein pompöses Auftrumpfen darstellte, sondern behutsam Jesu Liebe und Erbarmen besang.
Lilia zitterte am ganzen Leib, als sie geendet hatte. Die Partitur rutschte ihr fast aus den Händen. Sie senkte die Arme. Tränen standen hinter ihren Lidern. Sie biss die Zähne zusammen, um sich keine Blöße zu geben. Mein Gott: Was war geschehen? Wohin war sie getragen, entführt worden? Glücklich lächelnd und auch stolz, hob ihr Lehrer die Daumen zum Zeichen des Siegs. Später trat er zu ihr und umarmte sie stürmisch.
Während des hinterher von Chor und Orchester offerierten Mahls, den Blumen für Lilia, dem Lob des Dirigenten, der ihr eine erfolgreiche Zukunft prophezeite, konnte Lilia immer noch nicht fassen, was mit ihr geschehen, dass sie nicht in Ohnmacht gefallen, nicht gestorben war. Und dass sie weder sich, noch Pierre-Louis, noch ihren Lehrer blamiert hatte. Lilia wurde gebührend gefeiert. Ein neuer Abschnitt ihres Lebens begann, und sie dankte einmal übers andere still in sich selbst für dieses Wunder. Dankte jedem, der ihr die Hand schüttelte. Dankte dem Leben für ihr Leben, der Hilfe für die Hilfe.
Plötzlich wurde ihr alles zu viel. Und als sie allein mit Pierre-Louis im Auto saß, sackte sie erschöpft in sich zusammen. Am liebsten hätte sie geheult, einfach so. Und auch weil wieder Alltag heranrückte. Der Bann bereits zerbröselte. Die Ekstase erlosch. Nichts wirklich übrig blieb, als ein paar durstige Blumen. Als ein willkommener Zustupf für die Studienkasse. Und die Aussicht auf den folgenden Tag im Büro. Dort traf sie ihre Kollegin, die das Konzert besucht, doch aus Scheu sich auf der hintersten Bank versteckt gehalten hatte. Sie reichte ihr gehemmt die Hand und beichtete stammelnd, sie habe während Lilias Singen geweint, so sehr habe es sie gepackt. Für Lilia jedoch lag das Konzert schon wieder in weiter Ferne. Sie stand wie eh und je am Anfang und mit leeren Händen da. An ihr lag es, den Karren am Laufen zu halten. Das Vergeßenwerden würde sie im Nu einholen. Nichts gab es im Leben, das keinen Schatten warf. Nichts Glänzendes, dem nicht Stumpfes innewohnte.
Gern ging Lilia nicht zur Arbeit. Jeden Tag denselben engen Lift zu besteigen. Denselben muffigen Flur entlangzugehen. Die Türen abzuzählen. Die richtige aufzustoßen. Mit freundlichem Gesicht. Wissend, dass ihre beiden Kollegen genauso wenig begeistert waren von ihrem Job: das zermürbte sie. Der eine ihrer Kollegen war klein, dünn, schäbig, eine graue Maus, lieber gehorchend als entscheidend. Der andere stämmig, jovial, laut, über Frauen als Experte herziehend, ein Anpacker.
Lilia hatte sich Büroarbeit ausgesucht, weil sie dadurch mit dem kleinstmöglichen Aufwand das Geld für ihr Studium verdiente. Das Zehnfingersystem beherrschte sie nicht wirklich. Im Internat, wo es zum Ausbildungsprogramm gehört hätte, drückte sie sich darum herum. Im Übrigen verachtete Lilia Büroarbeit viel zu sehr, als dass sie sich gutwillig dafür hergegeben hätte. Am Schwierigsten dünkte Lilia, dass sie während ihren Arbeitstagen kaum Bewegung kriegte, Stunde um Stunde festgezurrt auf ihrem Stuhl saß. Und höchstens der Gang zur Toilette Abwechslung brachte. Das Büro glich, mit seinen Gittern vor den Fenstern, einem Gefängnis. In den Fluren roch es säuerlich. Staute sich die Luft von Jahrzehnten. Hämmerten die Schritte im immer gleichen Takt auf den Fliesen. Unterschied sich das Schlurfen in nichts vom Vortag. Das Grüßen ohne einander anzuschauen. Die Banalität. Das Verletzende, plattgewalzt von der Unabwendbarkeit.
An Sonntagabenden lastete der Montagmorgen besonders schwer auf Lilias Schultern. Vor allem, wenn Pierre-Louis das Wochenende durcharbeitete, wegen bevorstehender Prüfungen, oder des Baus eines Modells, und sie ihm im Büro Gesellschaft leistete, strickend, lesend, am gleichen Strick ziehend, weil sie Mann und Frau waren. Und Lilia es als selbstverständliche Pflicht ansah, ihren Mann zu unterstützen, wo immer es ging. Wählte Pierre-Louis das Alleinsein, saß Lilia zuhause. Übte Gesang. Hörte Musik. Putzte. Wusch Wäsche in der Badewanne mit den Löwenfüssen, da das Geld für eine Waschmaschine nicht reichte. Und wartete angstvoll auf den Montag. Im Wissen darum, dass sich davor noch die lange Nacht ohne Schlaf hinwälzte. Es war kein Leben. Und doch war es ihr Leben. War es das Leben, zu dem sie sich bereit erklärt hatten, mit dem Ziel, es dereinst hinter sich zu lassen: Wenn Erfolge sich einstellten. Auf dieses Ziel hin fieberte Lilia. Ob Pierre-Louis das gleiche ersehnte, wusste sie nicht. Sie wusste je länger desto weniger, was er fühlte, dachte, in Frage stellte oder bloß übermüdet hinnahm: Da er Lilias Hoffnungen in ihn nicht sterben lassen wollte. Ihren Glauben an eine Zukunft, die der Rede wert wäre.
Im schmalen Schlauch des Büros, in dem Lilia kaum zwischen ihren Kollegen hindurchgehen konnte, ohne sie zu berühren. An ihrem kleinen, zerkratzten Pult. Der klapprigen Schreibmaschine. Der mickrigen Topfpflanze, die selten genügend Wasser bekam, weil der Stämmige darauf beharrte, sie dürfe so wenig verwöhnt werden wie eine Frau, weil sie einem sonst die Haare vom Kopf fresse und das Geld zum Fenster hinauswerfe. In diesem Schlauch fieberte sich Lilia durch die Tage, da sie sonst umgekommen wäre vor Angst, die erträumte Zukunft zu verfehlen, und Pierre Louis zugrunde zu richten mit ihren Erwartungen. Doch das Schwierigste an ihrer Arbeit bestand für Lilia darin, dass ihre Tätigkeit als Schreibkraft sie viel zu wenig forderte. Einerseits sparte das Energie, die sie abends fürs Singen benötigte. Andererseits gebot es dem Wandern ihrer Gedanken keinen Einhalt. Sie schwärmten in jede nur mögliche Richtung. Und vor allem in die, die den Grundmustern ihres Lebens zugrunde lagen. Selten hegte Lilia freudige Gedanken, Gedanken von Leichtigkeit und frohgemuter Zuversicht. Meistens drehten sie sich um Prekäres. Bodenloses, das keinen Halt gab. Und seinen Schatten über alles breitete, das Lilia lieb und teuer war.
Von Pierre-Louis‘ Klasse am Technikum, der ursprünglich zwölf Studenten angehörten, blieben Ende des zweiten Jahres gerade mal sechs Lernende übrig. Die Anforderungen waren für manche zu hoch, der Durchhaltewille zu wenig ausgeprägt. Die Sechs schlossen sich zu einer Gruppe zusammen, die eisern zusammenhielt. Zwei davon waren bereits verheiratet, einer der sich mit dem Bau von Ziegen- und Hühnerställen, Schuppen und Garagen über Wasser hielt und Pierre-Louis, der bereits namhafte Projekte der öffentlichen Hand betreute - unter Einsatz aller seiner Kräfte und immer mit Bedenken im Nacken, den Anforderungen nicht zu genügen - genau wie Lilia.
Um sich gegenseitig Kraft zu geben und das Zusammengehörigkeitsgefühl für die zwei noch vor ihnen liegenden Jahre zu intensivieren, trafen sich die Sechs hie und da außerhalb der Schule. Der eine, ein Fils à Papa, der in der Firma seines Vaters arbeitete und sich ungeniert frei nehmen konnte, wenn ihm danach war, wohnte mit Eltern und Dienstboten in einer feudalen Villa mit parkähnlichem Garten außerhalb der Großstadt. Zur Party bei ihm zog Lilia das duftige, türkisfarbene Kleid an, das die Stiefmutter ihr für den Abschlussball der Tanzschule genäht hatte. Die Frau des Garagenbauers trug Schlaghosen und eine Rüschenbluse, die kecke, stupsnasige Freundin des Gastgebers ein tief ausgeschnittenes, hautenges Seidenkleid und hochhackige Schuhe, die Herren schmale, lässig geschlungene Lederkravatten oder ein locker gebundenes, seidenes Tuch im Ausschnitt. Alle gaben sich Mühe, entsprechend dem Anlass aufzutreten. Rudi, der Gastgeber, legte Elvis- und Beatles-Platten auf. Sie saßen auf Barhockern im Partyraum der Villa. Rudi schenkte Gin-Tonic und anderes hartes Zeug aus, das Lilia nicht kannte und Pierre-Louis nur beschränkt. Schon nach wenigen Schlucken begann es in Lilias Magengegend unangenehm zu ziehen. Es entwickelte sich ein Schmerz, der sie veranlasste, sich auf dem unbequemen Hocker vor- und zurückzuwiegen. Ihr war fürchterlich zumute, auch weil sie merkte, wie fremd sie sich in dieser Gesellschaft und an diesem Ort vorkam. Auch Pierre-Louis schien sich nicht sonderlich wohl zu fühlen. Die geschniegelte Umgebung, die Demonstration von Reichtum drückte auch auf die Stimmung der anderen Kollegen. Sie sehnten sich weg, obwohl Rudi, ein wohlerzogener, weichherziger Bursche, der rasch feuchte Augen bekam, wenn ihm eine Geschichte zu nahe rückte, sie mit Lachsbrötchen und anderen ungewohnten Leckereien bei der Stange hielt.
Schließlich rannte einer der Gäste in den Garten, die anderen hinterher. Er entdeckte eine Boule-Bahn, die beleuchtet werden konnte. Rudi schaffte Kugeln herbei und sie spielten, aller Hemmungen ledig, bis gegen Mitternacht
André, der andere verheiratete Kollege von Pierre-Louis, wohnte vergleichsweise bescheiden. Sein Sohn, noch ein Säugling, schlief an einer Wand, die von Schimmel befallen war. Auch die Außenmauern des Hauses überzogen Flecken des Pilzes. Die Einrichtung war spärlich, Geld ebenso. Wie bei Pierre-Louis und Lilia hielten vor allem der Enthusiasmus und die Hoffnung auf eine glänzendere Zukunft die Beziehung zwischen André und seiner Frau aufrecht. André briet Würste, als sich die Gruppe bei ihm traf, und seine Frau bereitete Salate zu. Die Freundin von Rudi steuerte einen Kuchen bei. Die Atmosphäre gestaltete sich locker, da keinerlei Ansprüche vorgetäuscht, noch zu erfüllen waren.
Und dann kamen Pierre-Louis und Lilia an die Reihe. Und natürlich wollte es Lilia gut machen. Die Angst davor es nicht optimal hinzukriegen, trieb sie um. Sie plante eine Vorspeise, einen Hauptgang und ein Dessert, und natürlich alles selbstgemacht. Und es gelang auch, obwohl in ihrer engen Wohnung kaum Platz war für die Gäste. Die meisten Möbel stammten aus dem Brockenhaus, waren von Lilia farbig bemalt worden. An allen Wänden des Wohnzimmers liefen Büchergestelle, vollbepackt mit Bänden über Bänden entlang.
Das dritte, sehr große Zimmer des Stockwerks, das sie erst Monate später zu ihrer Wohnung hinzumieten konnten, diente damals noch als Gästezimmer des Hausherrn, in dem sein Sohn, der sich verzweifelt bemühte, sich als Schauspieler und Regisseur an kleinen Bühnen durchs Leben zu schlagen sowie seine Tochter, die als Anwältin arbeitete, nächtigten, wenn sie ihre Eltern besuchten. Das Zimmer kam ihnen vor wie ein Ballsaal, mit ausgetretenem, uraltem Holzboden aus breiten Bohlen und einem Kachelofen, der sich immer noch heizen ließ.
Die Gäste in den beiden eher schmalen Zimmern, die Lilia und Pierre-Louis vorerst bewohnten unterzubringen, erwies sich als Kunststück. Ein Sofa hatten sie nicht, bloß eine harte, niedrige, von Pierre-Louis zusammengezimmerte Bank, auf die Lilia Kissen legte. Das Wetter kam ihnen zu Hilfe. Die Sonne schien, und auf der Dachterrasse blühte die von Lilia gestaltete Pergola in den schönsten Farben. Nach dem Essen spazierten sie gemeinsam zum Fluss hinunter, wo Pierre-Louis und Lilia allen noch ein Eis spendierten. Die Einladung war gelungen, und Lilia fiel ein Stein vom Herzen.
Die Studentenehe erwies sich je länger desto mehr als harter Prüfstein. Bleierne Müdigkeit wuchs. Gehässigkeit schoss ins Kraut. Pierre-Louis und Lilia schwiegen einander tagelang an, auch aus taktischen Gründen, um einander nicht zusätzlich zu verletzen. Lilias Geburtstage, zum Beispiel, blieben zeit ihres Lebens Leidenstage für Lilia. Sie war zu uneins mit ihrem Amlebensein, als dass sie sie als Feiertage begehen konnte. Um Freundschaften zu pflegen, fehlte ihr und Pierre-Louis ohnehin die Zeit. Auch hatten sie nicht gelernt, im Kreis von Mitmenschen aufzublühen. Sie schrumpften eher und verdrückten sich sobald als möglich. Lebenstüchtigkeit ging ihnen ab, gesundes Selbstbewusstsein, rechneten sie doch beide nur zögerlich, und sozusagen auf Zusehen hin mit sich selbst.
Am Vorabend ihres Geburtstages, im vierten Jahr von Pierre-Louis‘ Ausbildung, ertappte Lilia Pierre-Louis dabei, wie er spät nachts durch die Wohnung geisterte und an verschiedenen Orten rosarote Zettel anbrachte, auf denen von ihm entworfene Comicfiguren, die er blendend hinkriegte auf etwas hinwiesen. „Was machst du um diese Zeit noch“, herrschte Lilia ihn an, „du musst doch morgen früh raus.“ „Es sollte eine Geburtstagsüberraschung werden“, erwiderte Pierre-Louis kleinlaut und brach seine Tätigkeit jäh ab.
Lilia stand da wie vom Donner gerührt. Feuer im Herzen. Unsägliches Weh - im schlagartigen Erkennen dessen, was sie angerichtet hatte. Sie fiel Pierre-Louis um den Hals. Bettelte. Flehte um Vergebung für ihre Unachtsamkeit. Ihr hochmütiges, zutiefst verletzendes Vorpreschen. Als habe sie nichts gelernt aus dem Verhalten ihrer Eltern, ihrer Kindheit. Als habe sie weniger als nichts begriffen von den übernommenen Mustern. Den eingefahrenen Geleisen. Aus denen sich hinauszuwuchten schier unmöglich schien. Die ihr Leben durchzogen wie Adern aus Gift. Wie Flüche. Nie erlahmend im Untergrund ihres Wesens. In nachtschwarzen Gewölben. Im Knechtenden, das jegliche Freiheit verbot.
Es war nicht das erste und nichts das letzte Mal, dass Lilia solches Fehlverhalten an den Tag legte, Lieblosigkeit, die sie selbst mindestens so stark verletzte wie ihr Gegenüber. Und das sie nicht mehr vergessen konnte. Das noch Jahrzehnte später in ihr schrie wie am Tag der Tat. Nichts, das sich zutrug, konnte ungeschehen gemacht werden. Verbrechen türmte sich auf Verbrechen. Leben zerbrach darunter. Vertrauen schmolz. Beziehung zerbarst in tausend Stücke. Lilia quälte sich mit ihren Selbstzweifeln. Sie machte nichts als Fehler, so als könne sie nicht anders. Kleine Freuden, kurze Erfolge bezahlte sie viel zu teuer.
Immer öfter kam Lilia nun der Gedanke, sie hätte Pierre-Louis nicht heiraten dürfen. Hatte seine Drohung, Selbstmord zu begehen, sie dazu bewegt – oder nur die Tatsache, dass sie so schrecklich allein war? Lilia wusste nicht ein noch aus, wenn solche Gedanken von ihr Besitz ergriffen. Und sie taten das je länger desto häufiger. Vor allem an gewissen schulfreien Abenden, an denen Pierre-Louis nicht nach Hause kam, sondern mit dem Auto umherirrte, und Lilia ihn zusammen mit der Schwiegermutter suchen ging. Ihn an einem Waldrand fand, oder gestrandet an einer Kreuzung, und die Schwiegermutter Lilia die Schuld gab am Leiden ihres Sohnes. Da sie nur ihrem eigenen Ehrgeiz fröne, anstatt ihrem Sohn ein ordentliches Zuhause zu bieten. Vorwürfe, die Lilias Schuldgefühle ins Unermessliche türmten. War sie wirklich so viel selbstsüchtiger als andere? Pierre-Louis gierte doch nach Erfolg, das wusste sie. Er begehrte Geld, je mehr desto besser. Auch wenn er sich bescheiden gab. Er war es nicht. Etwas in ihm schätzte Reichtum. Es plagte ihn, dass er sich mit so wenig zufrieden geben musste. Deshalb auch hatte Lilia ihn angestachelt, sich anzustrengen. Pierre-Louis ging gern bei reichen Auftraggebern ein und aus. Er liebte es, bedient und hofiert zu werden. Obwohl er es gegenüber seiner Familie zu verbergen suchte. Als Lilia nochmals eine gewisse Summe erbte, diesmal von Mama-Tante, die nach jahrelangen Herzkreislaufbeschwerden und Schwindelanfällen endlich sterben durfte, hatte Pierre-Louis nicht das Geringste dagegen, dass sie ein Rustico in der Südschweiz erstanden, um es zusammen zu restaurieren. Auch wenn ihm die Arbeit daran bald zu viel wurde, und er sich fühle wie ein Kuli, vor einen Wagen gespannt, den er gar nicht ziehen wolle, wie er sagte. Er hätte lieber etwas Fertiges, mit allem Drum und Dran und möglichst viel Komfort. Zu dumm, dass Lilias Erbe dafür nicht reichte.
In der Südschweiz kauften Lilia und Pierre-Louis zuerst einen Stall ohne Aussicht auf Berge und See. Dafür mit einem Stück Wiese oberhalb des Gebäudes, das atemberaubende Rundsicht gestattete. Es war die Zeit, in der es als schick galt, ein Rustico sein eigen zu nennen. Die alten Besitzer verscherbelten sie zu Hunderten, um ihrer beschwerlichen, hungergeprägten Vergangenheit adieu zu sagen. Den Stall kauften sich Lilia und Pierre-Louis fast unbesehen, hastig, Hauptsache es war ein Rustico. Erst im Nachhinein, als sie zu rechnen anfingen, und Pierre-Louis das Gebäude ausmaß, die Schäden und Mängel auflistete, erkannten sie, dass sie eine Sanierung und Restaurierung nicht bezahlen konnten. Glücklicherweise meldete sich auf ihre Verkaufsanzeige ein ebenso Gieriger wie sie selbst, der ihnen das Objekt mit nicht allzu großem Verlust wieder abnahm.
Darauf traten seine ursprünglichen Eigentümer mit einem neuen Verkaufsangebot an Lilia und Pierre-Louis heran, boten ihnen ihr früheres Elternhaus an, ein zweistöckiges Rustico mit Seesicht, Kellergewölbe und zwei Balkonen. Diesmal kauften sie das Häuschen blind. Und es entpuppte sich als Gewinn. Zwar befand es sich in bedauernswertem Zustand: Das Dach musste erneuert werden. Es gab kein fließendes Wasser, keine Elektrizität. Doch Lilia und Pierre-Louis schafften es, nach und nach ein Bijou aus dem Objekt zu zaubern. Vor allem Lilia, die, seitdem Pierre-Louis sein Studium beendet und mit Diplom abgeschlossen hatte, nur noch unregelmäßig arbeitete und immer wieder Zeit in der Südschweiz verbrachte. Die aus groben Flussquadern aufeinandergeschichteten Mauern vom alten Putz befreite, mit Meißel und Hammer. Den Schutt wegschleppte. Die Fugen zwischen den Steinen neu verputzte. Sodass die Wände sich in ihrer ursprünglichen Schönheit präsentierten. Eine Arbeit, die Kraft kostete, und mit der sich Lilia starke Rückenschmerzen einhandelte, wenn sie mit gefüllten Pflasterkübeln die Leiter erklomm.
Als die Wände in den beiden Zimmern des turmartigen Gebäudes, das nur vier mal fünf Meter Grundfläche aufwies, saniert waren, machte sie sich hinter die Restauration der Decke im Eingangsraum, der ursprünglich als Küche und Wohnzimmer gedient hatte, und in dem die Eltern mit ihren fünf Kindern und den Großeltern gewohnt hatten, wie, konnte sich Lilia beim besten Willen nicht vorstellen. Geschlafen hatten die Erwachsenen am offenen Kamin in Holzstühlen, deren Rückwand und Seitenlehnen vom Boden bis über den Kopf reichten. Und die Lilia und Pierre-Louis im Originalzustand mit dem Haus gekauft hatten. Als die Kinder ausgeflogen, die Großeltern gestorben, und nur noch die Eltern übriggeblieben waren, behielten diese die alten Gewohnheiten bei. In einem der Stühle starb denn auch der Vater, still und ohne Aufhebens. Lediglich sein letztes, tiefes Ausatmen weckte die Mutter. Und sie konnte den Vater gerade noch von vorn mit den Armen stützen, sonst wäre es ins offene Feuer gefallen.
Neben ihrem Sitz gab es in der Hauswand ein winziges Fensterchen, den Fernseher, sozusagen, weil es den Pfad, der vor dem Häuschen vorüber führte, so ins Visier nahm, dass nichts, was in diesem Teil des Schmugglerdörfchens geschah, den Bewohnern verborgen blieb.
Zu den Schmugglern gehörte auch der Pfarrer. Das Leben aller im Dorf hing von diesen Einkünften ab. Kinder, die ins benachbarte Ausland als Schornsteinfeger verkauft wurden, Väter, die sich in fremde Kriegsdienste begaben, obwohl das Reislaufen per Gesetz verboten war, oder die ebenfalls im Ausland Arbeit suchten, brachten niemals genügend Geld heim, um die Familien durchzufüttern - die den Winter über von wurmstichigen Kastanien lebten, vom bisschen Mais, das karge, zwischen Felsen an Steilhänge geklebte Felder hergaben, von gedörrten Trauben und vom Grappa, den die Dörfler selbst brauten, auch wenn sie über keine Lizenz verfügten. Manche hielten sich ein paar Hühner, ein Schwein in einem jämmerlichen Verschlag, wenn es hochkam eine Ziege oder zwei. Es war ein hartes, elendes Überleben in diesen Rustici.
Als Lilia sich hinter die Restauration der Decke im Eingangsraum machte, stellte sie fest, dass unter den glasharten, mehrmals übereinander gepinselten, weißen Kalkschichten rötlich und schwarz glänzendes Kastanienholz zum Vorschein kam. Die Arbeit erwies sich als Schinderei. Auf der Leiter stehend, das Gesicht mit Tüchern verhängt, eine Brille über den Augen, den Rücken nach hinten durchgebogen, hieb sie mit Stechbeutel und Hammer hoch über ihrem Kopf Stückchen um Stückchen vom Verputz ab. Denn an ein Abschmirgeln des Holzes war nicht zu denken. Das Holz erwies sich als hart wie Granit. Der Verputz ebenso. Die Schmirgelmaschine rauchte und stank innert Sekunden vor Überanstrengung. Einen Quadratmeter schaffte Lilia pro Tag und lasierte das freigelegte Stück Decke zur Belohnung sofort - bevor sie zum nahen Grenzbach wanderte, um sich abzukühlen, den Ruß aus der Nase zu schnäuzen, und sich gründlich zu waschen. Während der Arbeit lief das Radio in voller Lautstärke. Lilia wählte meistens Symphonien von Mahler aus, wegen ihrer massiven Dramatik und der gewagten Dissonanzen, die sie anstachelten und auf Touren brachten. Anders hätte sie die Schufterei nicht durchgestanden. Und weshalb verrichtete sie sie überhaupt?
Immer noch klang und sang die Stimme des bewussten Schauspielers in ihrem Blut, eigentlich ununterbrochen, vor allem, wenn sie mit sich allein war. Und das war sie oft, gerade in ihrem Rustico. Und die Hoffnung, er möge eines Tages nach ihr rufen - auch wenn sich das noch so verrückt ausnahm - schwieg nicht. Denn in einem Hotelzimmer. In einem Bett, in dem Tausende von Geschichten jeder Art ausgetragen worden waren - ihn dort zu treffen. An einem solch unpersönlichen Ort. An dem ihnen nichts vertraut war. An dem alles sie störte. Provisorisch bliebe, Fremd und desolat - an einem solchen Ort könnten sie nie und nimmer zueinander finden. Lilia würde nicht zu ihm durchkommen. In den geheimen Punkt im Herzkleinen. Ureigenen.
Lilia arbeitete viele Tage an der Decke und an den sie tragenden Balken. Doch dann, eines jubelnden Morgens, präsentierte sie ihrer erstaunten, ungläubigen Nachbarin ein Stück schimmernder Pracht - manchmal nachtschwarz, im Feuer des Kamins tizianrot leuchtend - wie es keine zweite im Dörfchen gab. Die ganze Familie der Nachbarin schaute nach und nach vorbei und wunderte sich darüber, was Fremde aus ihren elenden Hütten zu zaubern vermochten.
Pierre-Louis baute einen Boiler ein. Eine Dusche entstand. Die Toilette erhielt Wände und eine Türe. Im Laufe der Jahre mauserte sich der Gewölbekeller zu einem wohnlichen Gästezimmer, ebenfalls mit fließendem Wasser und Toilette. Und zu guter Letzt wurde der Hauswand entlang, die bei starkem Regen feuchte Flecken zurückbehielt, eine professionelle Drainageleitung gezogen. Dazu brauchte es einen Graben so tief, dass man sich beim Hinunterstürzen alle Knochen gebrochen hätte. An die Hauswand über den See hängte der Schreiner des Örtchens zwei neue Balkone aus Kastanienholz. Und irgendwie schafften Lilia und Pierre Louis es, dank einer angemessenen Hypothek und ihren beständigen Einkünften, das Ganze zu finanzieren. Lilia trug Bücher ins Haus, Teppiche, hübsche kleine Dinge, die dem Herzen gut taten und funktionierte das Häuschen immer mehr zu einer Bleibe um, die sie das ganze Jahr über hätten bewohnen können. Sogar einen zusätzlichen Ofen schleppte Pierre-Louis mit der Hilfe eines Freundes von Lilia an.
Battista hieß Lilias Freund. Er war uralt, doch rüstig geblieben. Man munkelte, er habe als junger Mann in der Fremdenlegion gedient. Mit Lilia sprach er Französisch. Seine hellblauen Augen leuchteten von tief innen, im Einverständnis mit sich selbst. Er war im wahrsten Sinne des Wortes weise, unbelastet von Rachegedanken irgendwelcher Art, seine Vergangenheit oder Gegenwart betreffend. Geheiratet hatte er nie. Er lebte ein paar Rustici von Lilia entfernt, einen Katzensprung, und lehrte sie, den perfekten Risotto zu kochen, Fenster und Türen anzuschlagen, so dass sie im Lot blieben und nicht gleich wieder zuklappten, wenn man sie öffnete. Und Lilia fand heraus, wie sie mit Hilfe von alten Lappen, Kunstharz und Farbe die zerfressenen Fensterrahmen so instand stellen konnte, dass sie wieder intakt erschienen.
Lilia lernte unglaublich viel von Battista, auch was ihr eigenes Leben und Erleben betraf. Sie lernte, Milde in sich aufsteigen zu lassen. Milde gegenüber ihrer Mutter. Gegenüber dem Vater. Der Stiefmutter. Ihrer verflixten persönlichen Geschichte und gegenüber sich selbst. Battistas Stimme klang schelmisch, kichernd, perlend. Er kam ihr vor wie ein kauziger Waldschrat. Doch gleichzeitig vornehm, von feiner Lebensart. Selbst wenn er manchmal einen deftigen Witz zum Besten gab, und Lilia verstehen ließ, er hätte nichts gegen ein bisschen von einer gewissen Zweisamkeit. Er forcierte nichts. Einmal bat er Lilia, sie küssen zu dürfen und tat es leichthin, mit seinem fast zahnlosen, etwas eingefallenen Mund. Battista mochte was auch immer erlebt und durchlitten haben, es hatte ihn nicht gewöhnlich, nicht banal und schäbig gemacht. Er war ein Herr geblieben, trotz seiner nicht immer gepflegten Erscheinung. Und er roch stets gut.
Das Dörfchen mit dem Rustico hing hoch oben. Über dem See. Am steilen Hang. Wie eine Traube. In nächster Nähe zur Grenze nach Süden. Tag und Nacht spazierten Grenzwächter die alten Schmugglerpfade hoch und wieder hinunter, im immer gleichen Trott. Der Schein ihrer Taschenlampen huschte über die Mauern durchs Fenster zu Lilia hinein. Sie gingen mühelos, als könnten sie gar nicht anders, als auf abschüssigen, rutschigen Felsbrocken herumzuklettern wie Bergziegen. Den Feldstecher in der Hand. Das Gewehr über der Schulter - denn der Schmuggel hörte nicht auf, verzog sich bloß in den Untergrund. Anstatt um Zigaretten ging es nun um Medikamente.
Lilia war sich nicht sicher, ob Pierre-Louis sich an ihrem Rustico ebenso freute wie sie selbst. Sie machte es sich darin wohnlich, heimelig, wie in einem Zigeunerwagen, nach Art einer Frau, die einen Ort gefunden hat, an dem sie sein und sich entfalten kann. Pierre-Louis, der Rastlose dagegen, hielt es nicht aus, so wie Lilia es liebte, den Tragekorb zu schultern, die Säge zu behändigen, den Hund zu rufen und im Wald über dem Örtchen dürres Holz zu sammeln fürs abendliche Kaminfeuer. Oder die Reben zu schneiden, die im Sommer die Balkone vor übergroßer Hitze schützten und geradewegs in die Teller hineinwuchsen, als Nachspeise, wenn sie am Klapptisch zu Mittag aßen. Es sei denn, die gefräßigen Siebenschläfer, die des Nachts im Gebälk Jäger und Gejagte spielten, seien ihnen zuvorgekommen.
Weilte Lilia im Rustico, bewohnte sie es leidenschaftlich gern. Ihr Drang wegzugehen, schmolz gegen Null. Manchmal, wenn ein Salatsieb fehlte. Nicht genügend Gabeln oder Messer in den Schubladen zu finden waren. Wenn die Taschenlampe den Geist aufgab. Das Hundefutter ausging. Oder sie sich nach einem Schaufensterbummel sehnte, schnappte sie sich den, von Mama-Tante geerbten Einkaufswagen. Nahm den Hund an die Leine. Lief die heiße, steile Straße zum See hinunter ins nächste Dorf zur Schiffsanlegestelle, kaufte sich eine Rückfahrkarte und setzte sich in einen Winkel des Boots. Wo sie ungestört den Wellen lauschte. Den Hund auf der Bank neben sich, sein seidiges Fell kraulend, in Gedanken versunken. Doch achtsam beobachtend, wie mehr und mehr Leute das Schiff bestiegen, je näher die Touristenzentren rückten: alte, junge, Säuglinge, quengelnde, lachende oder gehässig vor sich hinstierende: Feriengäste, darauf bedacht, so viel als möglich zu unternehmen, es sich so wohl zu machen, als es ging, um ja keinen Tag des raren Urlaubs ungenutzt verstreichen zu lassen. Eine Art von Menschen, die Lilia seit ihrer Kindheit vertraut war. Seit den Tagen, die sie mit Oma und Opa in der alten Villa verbrachte. Und nun bei ihrer Mutter in den noblen Wohnungen am See. Auch Pierre-Louis gehörte zu dieser Sorte von Menschen. Nicht weil er am Herdentrieb litt. Sondern einfach, weil Urlaube so schnell vorübergingen. Und er seine Batterien am besten aufladen konnte, wenn er sich Eindrücke gönnte, alte Kirchen besuchte, in den Grotti Salami und Schafskäse genoss, begossen von einem Boccalino Nostrano - auf der Piazza Kuchen aß und Eis schleckte: Wenn er Ferien so gestalten konnte, wie man sich Ferien vorstellte. Ihm ging es nicht ums Wohnen. Ihm ging es ums Erleben. Und deshalb genoss es Lilia, wenn sie allein in ihrem Rustico hauste, und sich die Zeit so einteilte, oder sie so verstreichen ließ, wie sie es mochte: ohne besondere Vorkommnisse.
Seitdem Pierre-Louis sein Studium abgeschlossen hatte, trat der Unterschied der Interessen zwischen Lilia und ihm noch deutlicher zutage. Nicht nur dass Pierre-Louis rauchte wie ein Schlot, „Gauloises bleues“ ohne Filter, ein Statussymbol seiner Zunft - und Lilia nicht. Es zeigte sich auch immer stärker, dass ihrer beider Ansichten über das Leben, das Lohnenswerte daran, das Gegenteil davon, auseinander drifteten. Sie waren zwei grundverschiedene Menschen: Pierre-Louis, der Militarist, der Patriot, der Sesshafte, der sich an bodenständigen, bleibenden Werten orientierte - und Lilia, deren Fantasie am liebsten Purzelbäume schlug, der das Gefühl von Heimat fremd war, die Wurzellose, die nicht an Beständigkeit und Dauer glaubte, auch wenn sie sich danach sehnte, und für die Familie und Alltag Wörter darstellten, die sie nachgerade in die Flucht schlugen.
Auch die Begriffe, mit denen sie Dinge und Ereignisse benannten, stimmten nicht überein. Sie gebrauchten nicht dieselben Wörter, weder für Liebe noch für Sex, weder für Gemeinsamkeit noch für Einsamkeit, weder für Gewinn noch für Verlust - und schon gar nicht für Glück. Zu Glück gehörten für Lilia auch Wagnis, Risiko und Einsatzbereitschaft ohne Hintergedanken. Für Pierre-Louis nicht. Für ihn beinhaltete Glück Mühelosigkeit, Geschenk, etwas, das nichts kostete. Für Lilia dagegen hatte Glück einen Preis, der auch Leiden nicht ausschloss. Und deshalb mangelte es den beiden immer öfter an Gesprächsstoff. Und der Eindruck: „er“ oder „sie versteht mich ja doch nicht“, nahm überhand. Sie schwiegen einander an, nun, da sie Zeit hatten, einander ohne Stress näher kennenzulernen, einander auf Augenhöhe zu begegnen und eine gemeinsame Zukunft zu formulieren, die für beide passte.
Es passte nichts.
Pierre-Louis wurde gleich nach seiner Diplomierung zum Wehrdienst einberufen, setzte sich Ziele, wollte sich als Berufsmilitär weiterbilden. Lilia rannte weiterhin dem Ausbildungsstress hinterher. Für sie war nichts zu Ende gegangen. Immer noch lief sie mit Volldampf voraus. Alle Nerven gespannt, zog sie immer noch einen Karren, der sich längst in Luft aufgelöst hatte, ohne sich stoppen zu können. Da Pierre-Louis nicht mehr mitmachte, fiel sie in ein Loch, lag wieder nächtelang wach. Sich fragend, was werden solle. Suchte nach Sinn, nach Inhalten für ihre Ehe, ihr weiteres Zusammengehen. Und fand nichts. Sie ging ins Büro, arbeitete die Tage durch - so wie Pierre-Louis die Tage durcharbeitete. Besuchte Gesangsstunden, übte - mittlerweile bei neuen Lehrern, von denen sie sich frische Ideen, größere Herausforderung erhoffte. Dadurch lernte sie auch das Opernleben kennen, die Macken und Launen der Stars. Erlebte, womit Pierre-Louis nichts anzufangen wusste, was für ihn ein Buch mit sieben Siegeln darstellte, über das er den Kopf schüttelte, verständnislos. Was waren Korrepetitoren? Wozu dienten die? Was Rollenspiele? All das ehrgeizige sich beweisen Wollen – Müssen - weil sonst keine Aussicht auf Erfolg bestand? Nein. Pierre-Louis konnte mit dem, was Lilias Leben umfasste, nicht das Geringste anfangen.
Und so war es nicht verwunderlich, dass Lilia eines Tages entdeckte, Pierre-Louis habe eine Freundin, mit der er zwar nicht schlafe, doch mit der er gut und ausgiebig reden könne. Die lieb sei. Mit wenig zufrieden. Eine ganz normale Frau. Ohne Überspanntheit. Ohne nennenswerte Fantasie. Einfach ein Mensch zum Gernhaben.
Israels „Sechstagekrieg“ machte einen gewaltigen Eindruck auf Pierre-Louis. Der Kampf Israels ums Überleben - die Geschichte der Hagana - die Persönlichkeit Moshe Dajans - die Kibbuzbewegung beschäftigten ihn sehr. Er legte sich eine entsprechende Bibliothek zu und äußerte den Wunsch, nach Israel auszuwandern. Zumindest spielte er mit dem Gedanken und versuchte, ihn auch Lilia einzuimpfen. Und Lilia schwenkte auf seine Linie ein. Für Abenteuer war sie zu haben. Und klassische Musik spielte in Israel eine bedeutende Rolle. An Lehrern und Möglichkeiten fehlte es dort nicht.
Um die praktische Seite eines solchen Unternehmens besorgt, kümmerte sich Lilia vorerst darum, wo sie modernes Hebräisch lernen könne und wurde in der Israelitischen Kultusgemeinde fündig. Fremd war ihr das Judentum nicht. Sie las leidenschaftlich gerne jiddische Geschichten, jiddische Witze, interessierte sich für die Juden in Russland, in Litauen und Deutschland - so, wie sie für jede der großen Weltreligionen offen war. Jede davon kennenlernen wollte, um herauszufinden, ob ihr innerster Kern der gleiche sei. Sich unterscheide. Oder ob sich alle im selben Punkt träfen.
Lilias Herz klopfte beträchtlich, als sie sich zur ersten Hebräischlektion in dem Gebäude einfand, das, wie ihr schien, anders roch als jedes, das sie bisher betreten hatte. Eine breite, geschwungene Treppe führte in den ersten Stock. Im Schulzimmer traf sie auf acht weitere Interessierte. Alles Juden. Die meisten jung, weil sie nach ihrer Ausbildung in die Heimat ihrer Ahnen auszuwandern gedachten, Piloten werden wollten, Kämpfer, oder Kibbuzim und Rabbiner. Der Hebräischlehrer, ein litauischer Jude, in Russland aufgewachsen, pogromgeprüft. Dreizehn Sprachen beherrschend. Klein gewachsen, nahezu kahl, viel, viel älter als Lilia. Eingebürgerter Flüchtling, mit glühend schwarzen Kohlenaugen, hypnotisierendem Blick. Gebrochen Dialekt sprechend, mit russischem Akzent: Eine Persönlichkeit, die Lilia sofort ins Auge stach, sie packte und nicht mehr losließ. In Lilias Augen ein Mann zum Träumen. Gefährlich, da im Innersten verletzt. Und rachedurstig. Sich ständig bedroht fühlend. Kein angepasster Bürger. Ganz bestimmt nicht.
Einfach war es nicht, Hebräisch zu lernen, sich die Schrift anzugewöhnen, sie von rechts nach links zu schreiben, und das Buch verkehrtherum aufzuklappen. Doch da Lilia Herausforderung suchte, kniete sie sich mit Feuereifer ins Lernen.
Was sie jedoch auch suchte, war Abrashkas, ihres Lehrers Blick - ohne sich im Klaren darüber zu sein, was sie damit bezweckte. Es zwang sie einfach, ihn anzuschauen, in seine todtraurigen, tief melancholischen Augen zu blicken. Einmal ums andere das Dahinter zu ergründen. Den Kummer darin, den unermesslichen mitzukriegen, der seinem schwierigen Naturell zugrunde lag. Denn dass Abrashka schwierig war, auch grausam, das blieb ihr nicht verborgen. Sein Spott biss, wenn einer der weniger Begabten Schnitzer beging. Er stellte andere leichthin bloß. Ihre Verlegenheit belustigte ihn.
Meistens saß er am Pult vor der Klasse, die Lilia zugewandte Hand vor dem Auge, mit gespreizten Fingern. Später erzählte ihr Abrashka, das sei die beste Art und Weise gewesen sie, ohne dass andere es merkten, anzuschauen: Im Schielen durch das Gitter seiner Finger. Lilia sei ihm sofort aufgefallen. Er hätte sie gleich am ersten Abend küssen mögen. Dann wären sie miteinander gegangen, Lilia wäre schwanger geworden und sie hätten geheiratet.
Doch Abrashka war bereits verheiratet. Und den goldenen Käfig, in den sie seine Eifersucht gesteckt hätte, konnte sich Lilia lebhaft vorstellen. Nein, und nochmals nein: Abrashka erfahren, kosten, von ganz nah - das ja. Doch mehr: niemals. Die Raschheit und Unerbittlichkeit seines Denkens hätte Lilia in die Flucht geschlagen, hätte sie sie nicht gleichzeitig herausgefordert.
Immer noch war Lilia unerfahren in Sachen Beziehung und Sex, und Pierre-Louis weise genug, das nicht auszunutzen. Als sie ihm nach rund zwei Jahren eines Abends gestand, sie werde die Hebräischstunden fallen lassen, entgegnete er, er werde das nicht erlauben. Früher oder später werfe sie ihm vor, er habe ihr die Gelegenheit vermasselt, diese eine, spezielle Erfahrung zu machen, und das könne er nicht hinnehmen. Sie solle sich aufraffen und zwar sogleich, obwohl der Abend noch jung sei. Pierre-Louis‘ offenbar hellseherischen Fähigkeiten erstaunten Lilia nicht. Sie war daran gewöhnt. Er überraschte sie oft mit Unvorhersehbarem, das prompt eintraf. Also begab sich Lilia auf die Reise. Mit Herzklopfen, denn auch sie ahnte oder sah manchmal Ereignisse voraus.
Als sie das Gemeindehaus betrat, brannte noch kein Licht. Sie näherte sich langsam der Treppe. Als klebten ihre Füße am Boden fest und sie müsse sie mühsam hinter sich herschleppen, zog sie sich am Geländer hoch, wie eine Ertrinkende, halb ohnmächtig. Aus einem der Korbstühle im dämmrigen Vorraum löste sich eine Gestalt, trat auf sie zu. Arme umschlangen sie. Es flüsterte an ihrem Ohr: „Ich wusste, du würdest kommen.“ Lilias Körper schwand in einen Kuss hinein, wie sie ihn noch niemals gekostet hatte. Wie lange sie beieinander, ineinander standen, konnte sie nicht sagen. Irgendwann ging das Licht an. Es wurde geschwatzt und gelacht. Und die beiden trennten sich. Lilia, schwankend, sank in einen der Sessel, rang nach Atem, versuchte sich mühsam zu fassen, kriegte sich kaum in den Griff. Dachte, alle sähen sofort, was mit ihr los sei. Doch niemand ließ sich etwas anmerken. Nur einer der älteren Schüler prüfte leicht schmunzelnd ihr Gesicht. Sie waren Freunde, kannten einander gut.
Nach dem Unterricht wartete Abrashka hinter dem Gebäude auf Lilia. Und wieder küssten sie einander. Lilia wusste nicht, dass man das so ausgiebig, so ausdauernd und mit solchem Genuss tun konnte.
Abrashka und Lilia trafen einander von nun an jede Woche vor oder nach dem Unterricht. Manchmal lud Abrashka Lilia zum Essen in gute Lokale ein. Er aß wie ein Schwein, schmatzte, sprach mit vollem Mund, Soße versprühend, kanzelte Kellner ab, rügte, das Fleisch sei nicht zart genug, nicht im eigenen Saft gebraten. Ihm etwas recht zu machen, schien schwierig. Doch da der Altersunterschied zwischen ihnen so groß war, dass sie keiner als Paar identifizierte, war sein Verhalten Lilia egal. Ihn darauf hinzuweisen, nützte ohnehin nichts. Persönlich verstand er keinen Spaß. Er hätte einen Streit vom Zaun gerissen. Und das wollte Lilia nicht riskieren. Sie wäre ihm nicht gewachsen.
Dann lud Abrashka Lilia eines Abends nach der Klasse ein, mit zu ihm nach Hause zu kommen. Er beteuerte einmal übers andere, wie sehr er sie liebe. Und in gewissem Sinne tat er das auch. So wie Lilia ihn in gewissem Sinne liebte, ihm verfallen war, sozusagen als Experiment, im Wissen, dass diese Verbindung keinesfalls von Dauer sein durfte.
Lilia traf auf eine lieblos eingerichtete, sehr konventionelle Wohnung. Es schien, es lebe niemand darin, so herzlos fühlte sie sich an. Lilia und Abrashka schliefen miteinander. Er legte sich auf sie, nahm sie, traurig, wie in einem eingespielten Ritual. Lilia hatte den Eindruck, sie sei benutzt worden. Es funkte nicht zwischen ihnen. Die Magie der heimlichen Küsse war dahin. Nach dem Akt fuhr sie zum Bahnhof, betrübt, erschöpft und immens leer.
Wochen später besuchte Abrashka Lilia bei ihr zu Hause, an einem sonnenlosen Nachmittag. Er brachte sein Manuskript einer Kinderbibel mit, das er ihr zum Lektorieren dalassen wollte. Doch sie trafen einander nicht mehr. Beide waren enttäuscht, Abrashka mehr als Lilia. Sie erfuhr nie, was er sich von ihr erhofft hatte. Als er sich wusch, klaute Lilia das Manuskript aus seinem Köfferchen. Doch das fehlende Gewicht verriet sie. Abrashka wurde böse, schnauzte sie an, hielt ihr Unfähigkeit vor, drohte, sich von ihr zu trennen. Doch waren sie überhaupt zusammen? Lilia, deprimiert, sagte sich innerlich von ihm los, obwohl sie wusste, dass sie äußerlich viel schmerzhafte Zeit dafür würde aufbringen müssen. Auch Abrashka schien sich nicht einfach von Lilia lösen zu können.
Wenn Abrashka nicht unterrichtete, arbeitete er am Gericht als Übersetzer, da er auch des Arabischen kundig war. Und als nach einem Attentat auf eine israelische Maschine Verhandlungen und Prozesse folgten, die Abrashka protokollierte, bat er Lilia um Mithilfe, denn Deutsch zu schreiben war ihm nicht sonderlich geläufig. Lilia kaufte sich eine „Hermes-Baby“ und redigierte seine Texte, die abgestürzten Passagiere betreffend: ihre Berufe - woher sie kamen - ihre Destinationen und Habseligkeiten. Anhand von Pässen, Flugscheinen, Medikamenten in Jackentaschen, wurde ihre Identität erforscht und Angehörige gesucht. Es war eine aufreibende, leidvolle Arbeit. Doch Abrashka bezahlte Lilia dafür. Und sie lernte viel, auch über Trauerbewältigung. Und das half ihr, zu Abrashka auf Distanz zu gehen.
Vor einer Hebräischklasse fand Abrahska eines Abends Lilia in angeregtem Gespräch mit ihrem Bekannten in der Eingangshalle des Gemeindehauses. Sie lachten und scherzten. Abrashka rannte - schnaubend, wie ein angeschossener Stier an ihnen vorüber, sie keines Blickes würdigend, und verduftete nach der Klasse, noch bevor Lilia ihre Bücher und Hefte zusammengepackt hatte. Beklommen wartete sie in ihrem Stammkaffee auf ihn, wartete eine Stunde und mehr. Abrashka erschien nicht. Der letzte Zug brachte Lilia nach Hause. Aufgewühlt schrieb sie an Abrashka, flehte nach dem Grund seines Wegbleibens. Keine Antwort. Nach der nächsten Klasse stellte sie ihn. Abrashka schrie wutentbrannt, sie habe ja nun einen anderen, und vielleicht könne der noch besser küssen als er, sie solle sich aus dem Staub machen: mit einer wie ihr wolle er nichts zu tun haben.
Lilia war wie vor den Kopf geschlagen. Sie versuchte, die Geschichte in eine humorvolle Richtung zu lenken, Abrashka zu beruhigen, sein Geschrei verstummen zu lassen, doch er schimpfte erbittert drauflos, in demütigender, mieser Weise, drehte sich auf dem Absatz um und ließ Lilia stehen. Das tat furchtbar weh. Lilias Tränen rannen, als sie die Bahnhofstrasse hinunterflüchtete. Und sie flüchtete wirklich. So konnte es nicht weitergehen. Sie musste Schluss machen, die Beziehung beenden, bevor sie selbst daran zerbrach.
Es war der Güte, der Liebenswürdigkeit und Einfühlsamkeit Pierre-Louis‘ zu verdanken, dass ihr das innerhalb von drei Tagen gelang, Tagen, während denen sie mit Fieber, Kopfschmerzen und Reißen in Gliedern und Nerven im Bett lag, unfähig aufzustehen. Unfähig zu essen oder zu trinken. Pierre-Louis pflegte sie schweigend, im Verstehen, wie wichtig die gemachte Erfahrung für Lilia war. Er machte ihr keine Vorwürfe, fühlte sich weder betrogen noch verraten, auch dann nicht, als Lilia, um sich zu schützen und zu erholen, sich längere Zeit von ihm fernhielt.
Hie und da erblickte Lilia Abrashka von weitem, da sie öfter in der Gegend des Gemeindehauses zu tun hatte. Einmal lief er auch hinter ihr her, flehte sie an, zu ihm zurückzukehren, da er entsetzlich allein und einsam sei. Doch Lilia wies ihn ab, ließ sich auch nicht berühren, obwohl sie ihm gerne um den Hals gefallen wäre. Sie hatte zu sehr gelitten. Nun war sie geheilt. Dass Abrashkas Frau in der Zwischenzeit Selbstmord begangen, ätzende Putzmittel getrunken und jämmerlich daran zugrunde gegangen war, während Tagen in Spitalpflege, konnte sie nicht umstimmen. Sie klappte das Buch Abrashka für immer zu und trauerte ihm nicht nach. Auch die Hebräischstunden erübrigten sich, da Pierre-Louis‘ Schwärmerei für Israel ebenfalls abebbte.
Ans Goetheanum kehrte Lilia wieder und wieder zurück. Es bedeutete für sie immer noch Heim, wenn auch längst nicht mehr so innig wie zu Lebzeiten von Papa Moritz. Selbst der Kontakt zu seiner Frau Emilie war eingeschlafen, da sie beide, Lilia und Emilie, ohne die Anwesenheit von Papa Moritz, einander nicht wirklich etwas zu sagen hatten. Emilie war keine Theaterfrau. Ihr ging es auf dem Hügel um anderes. Sie hatte sich lange Jahre der Eurythmie gewidmet, war mit den Lehren Steiners groß geworden, schon als Kind durch die Schule und durch ihr Elternhaus. Und dorthin kehrte sie nun öfters zurück, um ihre mittlerweile sehr alten und kranken Eltern zu pflegen. Emilie war fröhlich, doch gleichzeitig still und in sich gekehrt. Nun verstärkte sich dieser Charakterzug. Sie blieb viel mit sich allein, in Erinnerung an ihren Mann, dem sie allerdings nicht leidenschaftlich nachtrauerte, nicht auf Art der meisten Menschen: mit Tränenergüssen und Zuständen von Verzweiflung. Das passte nicht zu ihrem Leben. Zu ihrem inneren Wissen. Ihrer selbstverständlichen Weisheit. Und dem Mitgefühl Lebendigem gegenüber. Sie war erfüllt vom Wissen um den Fortbestand von Existenz. Dem unablässigen Wandel. Das Mysterium der Wiederkehr hatte sie verinnerlicht.
Wenige Wochen nach dem Hinübergehen von Papa Moritz, lud sie Lilia noch einmal zu sich ein, kochte für sie, zeigte ihr eine Fotografie von Papa Moritz im Sarg, gebettet auf ein Meer von Blumen. Er war zuhause aufgebahrt worden, und viele derer, die ihn verehrt, bewundert und geliebt hatten, trafen sich dort, um von ihm Abschied zu nehmen - auch sie ruhig, gelassen, ohne Pathos und Drama. Danach wurde er kremiert. Und die kleine, achteckige Urne aus Metall, mit farbigen Mustern aus Email verziert, erhielt einen Platz im winzigen, fensterlosen Urnenraum zuoberst im Goetheanum, auf halber Höhe der monumentalen Plastik aus übereinander geklebten und zurechtgeschnitzten Holzplatten von Rudolf Steiner, die den Namen trug: „Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman“. Es war ein starker. Würdiger. Ehrfurcht gebietender Ruheort. Nur Mitglieder des Hauses, deren Angehörige sich verdient machten, kehrten dort ein. Der Meister selbst, einige berühmte Dichter, Musiker und Wissenschaftler teilten sich diesen Raum, in dem Erwachsene kaum aufrecht stehen konnten. Dämmerlicht aus verborgenen Leuchten erfüllte ihn. Nichts Unheimliches haftete ihm an. Lilia hatte eine gelbe Rose für ihren geliebten Lehrer mitgebracht. Seine Urne in die Hand zu nehmen, getraute sie sich nicht. Sie streichelte sie nur sachte, ertastete die Kühle des Metalls, freute sich an den farbigen Ornamenten, bestaunte benachbarte: eine massive aus behauenem Rosenquarz auf einer Stehle etwa, in der ein Dichter ruhte, dessen Schriften sie gut kannte, und deren Komik, der untergründige Humor, die Leichtigkeit des skurrilen Kombinierens von Unkombinierbarem sie oft zum Lachen gebracht hatte. Lilia fühlte sich federnd, geborgen. Trauer stellte sich nicht ein. Ihr war so wohl wie stets in dem Gebäude, auch inmitten derer, die weitergegangen waren. Hier war ihr Heim, das einzige, das sie bisher gehabt hatte, das ihr aus tiefsten Tiefen Nahrung spendete, auf unspektakuläre Art, seit undenkbarer Zeit. Nie musste sie sich an diesem Ort eingewöhnen. Sie fand ihn einfach wieder.
Lilia knickte die Rose um die Urne herum, so dass die Blüte auf ihr drauflag. Darauf verließen sie den Raum. Emilie löschte das Licht, schloss ab und steckte den Schlüssel ein. Sie stiegen schweigend die vielen Treppen hinunter, die in die Abendsonne hinausführten. Zu sagen gab es nichts. Zu bedauern gab es nichts. Alles war in Ordnung so wie es war. Lilia schwang mit in der Ruhe Emiliens, die sie durch die Stunden trug, bis sie sich auf Nimmerwiedersehen voneinander trennten. Lilia in unermesslicher Dankbarkeit.
Doch Lilias Verweilen im Goetheanum hörte mit diesem Vorfall nicht auf. Immer noch lief das Bemühen, sie dem Hause zu erhalten. Im Andenken an Papa Moritz erhielt sie den ersten Regisseur als Lehrer, mit der Aussicht auf kostenlose Ausbildung. Auch er kam vom konventionellen Theater. Doch war er jung und mit einer reichen Frau verheiratet, deren Vater dem Paar zur Hochzeit ein palastähnliches Gebäude geschenkt hatte, mit breiter Treppe mittendrin, auf die von oben Licht durch eine Kuppel aus zartestem Alabaster fiel. Das Haus mit seinen durchmodellierten Räumen, schmückten fantastische Gemälde mit wogenden, wabernden Gestalten und Gesichtern, deren Augen den Betrachter nicht losließen, eine Welt aufzeigend, wie sie Lilia nicht kannte. Dagegen nahm sich das Studierzimmer des Regisseurs wie eine düstere, bedrohlich wirkende Klause aus, so als habe für ihn die Notwendigkeit bestanden, das Übermaß mit Strenge und Askese in Schach zu halten.
Zu Beginn ihres ersten Treffens sprachen Lilia und ihr neuer Lehrer über Papa Moritz, über die Art, wie er mit ihr gearbeitet habe. Und Lilia ließ dem Strömen ihres Herzens freien Lauf, schilderte die Führung, die Unterstützung, die Liebe, die sie durch ihn erfahren habe.
Darauf ging es zur Sache. Der Regisseur drückte ihr aus einer, viele Bände umfassenden Gesamtausgabe Goethes, den Text einer frühen Fassung von „Faust II“, die in keine der gängigen Ausgaben Eingang fand, in die Hand. Es war ein schwieriger, schwerblütiger Text, der sich um Helena, um felsige Buchten im Ägäischen Meer, um was auch immer drehte, mit dem Lilia wenig bis nichts anzufangen wusste. Von dem ihr Lehrer jedoch behauptete, es sei genau der richtige Text für sie, als Einstieg in das, was sie von ihm zu erwarten habe. Seine Augen sprühten dunkles Feuer. Er sprach die Verse vor, deklamierte, gestikulierte wie in Trance. Lilia gab sich Mühe, die in sie gesetzten Erwartungen zu erfüllen. Und ihre Gesangsausbildung kam ihr dabei zu Hilfe. Ihre Stimme schwang nicht so machtvoll, so ausgreifend durch den Äther wie die des Regisseurs, dessen Gestalt dabei in Flammen aufzugehen drohte. Doch schienen ihre Bemühungen zu genügen.
Nach der Unterrichtsstunde wurde sie eingeladen, einer Eurythmieprobe beizuwohnen. In einem, in den nackten Fels gehauenen, indirekt erleuchteten Saal leitete ein elfengleicher junger Mann die Schritte und Bewegungen seiner Schüler an, einen mit den Armen hoch über dem Kopf balancierenden Stab in Händen. Überschlank, durchsichtig, schwebend, glitt er pfeilschnell mit winzigen Schrittchen auf spitzen Zehen über den Boden, ohne ihn sichtbar zu berühren. Ihm folgte eine über zwanzig Personen starke Truppe, elastisch wie Rohre im Wind, substanzlos, aufgelöst in ein Mysterium, das Lilia nur vom Hörensagen kannte. Augenblicklich verglich sie ihre, im Vergleich dazu schwergewichtige Bodenhaftung mit dem ätherischen Weben und Schweben um sich herum. Doch bevor sie sich über den Unterschied grämen konnte, kam die Probe zum Ende, und Lilia wurde zu Tee und Gebäck gebeten. Sie befand sich in den Eingeweiden, im Allerheiligsten, der Öffentlichkeit Unzugänglichen. Es schauderte sie. Und gleichzeitig fühlte sie sich privilegiert. Sie geriet in Dimensionen, in die sie noch niemals vorgedrungen war. Türen öffneten sich, die Wunder offenbarten - jedoch auch knallharte Forderungen an sie stellten.
Mit leichtem und gleichzeitig schwerem Herzen machte sich Lilia am Abend auf den Heimweg, den gewichtigen Band „Faust II“ in der Tasche. Den Text übte sie im Geheimen, wenn Pierre-Louis aus dem Haus war. Einerseits genoss sie den schrankenlosen Gebrauch der Stimme, den Modulationsüberschwang, den die Steinersche Technik ihr scheinbar gestattete. Andererseits schämte sie sich dieses Aufwands. Er erschien ihr zu groß. Zu ehrgeizig. Der eher leisen Qualität des Textes nicht angemessen.
Dann fing ihr Lehrer, bezugnehmend auf die Vorgänge im Text an, auf für Lilia unangenehme Weise aufdringlich zu werden. Sie konnte nicht ausmachen, ob mit Absicht und Hintergedanken, oder nur bedingt durch die Dramatik seines Berufs. Auf jeden Fall fühlte sich Lilia je länger desto unbehaglicher in seiner Gegenwart, in der faustisch düsteren Zelle seines Studierzimmers, die einem Kerker glich. Und dann entschloss sich Lilia Hals über Kopf zur Flucht, nach einem Nachmittag, an dem sie noch zum Besuch einer internen Bilderausstellung und eines Goldschmiedeateliers eingeladen worden war. Sie kam sich undankbar vor. Doch ihr Bedürfnis, das Erlebnis mit Papa Moritz ungetrübt zu erhalten, gebot ihr diesen Schritt - den sie nie bereute, sowenig wie irgendetwas, unter das Lilia bewusst einen Schlussstrich zog.
Mit achtzehn Jahren, noch als Schülerin, besuchte Lilia ihren ersten Yogakurs. Die Übungen fielen ihr leicht. In der kleinen Klasse von sieben Teilnehmern war sie mit Abstand die Jüngste.
Nach einem Jahr kündigte der Lehrer an, der Meister habe eine Meditationsklausur ausgeschrieben, wer sich dafür interessiere, solle sich melden. Da der Kurs während den Sommerferien stattfand, trug Lilia auf der Stelle ihren Namen in die Liste ein, obwohl sie nicht wusste, woher sie das Geld dafür nehmen sollte. Genauso wenig wie Schauspielstunden, würden ihre Eltern eine Meditationsklausur bezahlen. Sie hoffte auf zusätzliche Arbeitsmöglichkeiten im Teppichgeschäft, in dem sie mittwochs Prospekte einpackte. Hauptsache, sie fällte den Entscheid. Der Rest würde sich finden.
Doch der Rest brauchte sich nicht zu finden, denn der Yogalehrer teilte ihr kühl mit, sie könne die Meditationswoche nicht besuchen. Sie sei viel zu jung dafür. Schüler hätten keinen Zutritt. Und sie würde sowieso nicht verstehen, worum es sich dabei handle: da ihr das notwendige Basiswissen fehle.
Lilia war baff. Als sie fragte, wer denn der Meister, der Kopf der Schule sei, wurde ihr auch diese Auskunft verweigert. Doch eine Schule zu besuchen, von der sie nicht einmal wissen durfte, wer ihr Leiter war, kam für Lilia nicht in Frage. Für sie gingen Yoga und Heimlichtuerei nicht zusammen. Lilia stieg umgehend aus dem Kurs aus. Und ihr schien, dem Lehrer sei das recht. Ihre ständigen Fragen und ihr ausgeprägtes Interesse für die Belange des Yoga und von Meditation - sowie der inneren Haltung, die dahinter stecke - nervten ihn. Oft war er um Auskünfte verlegen, und das machte ihn wütend. Lilia spürte es deutlich. Zwar übte sie weiterhin. Doch es büßte seinen Reiz ein. Sie konnte die erlittene Abfuhr nicht verstehen, sowenig wie das dahinterstehende Duckmäusertum. Es erinnerte sie zu sehr an das Verhalten ihrer Eltern.
Nun, Jahre später, erhielt sie erneut die Gelegenheit, Yogakurse zu besuchen. Als Musikstudentin bekam sie Ermäßigung auf den Preis, sodass sie sich den Unterricht leisten konnte. Lilia hoffte, auch Pierre-Louis‘ Interesse für Yoga zu wecken. Doch sie hoffte vergebens.
Während der ersten Yogastunde, die sie mit Gesangskollegen besuchte, musste sie sich das Lachen verkneifen. Der unerhört hübsche, weißgekleidete Inder, der auf einem Schemel neben einem geschnitzten Tischchen aus Rosenholz saß und zu Beginn und am Ende der Stunde ein Glöckchen erklingen ließ, hörte nicht auf, beseligt zu lächeln. Er sprach mit deutlichem Akzent, langsam, bedächtig, als verfüge er über alle Zeit der Welt. Er erschien Lilia unwirklich, wie eine Gestalt aus einem Märchenbuch. Der Nutzen der instruierten Atemübungen blieb ihr verborgen. Die langsam auszuführenden Asanas strapazierten ihre Geduld. Sie hatte Yoga anders kennengelernt, weniger gestelzt, nicht so abgehoben, zähflüssig und aufs Äußerste beherrscht.
Nach der Stunde frotzelte sie über das Erlebte, kicherte wie ein Backfisch. Dennoch ging sie wieder hin - und erlebte die zweite Lektion wie eine Offenbarung, saugte sie in sich hinein wie lange Vermisstes. Ihr Körper gehorchte den Übungen, der Atem durchfloss ihn mühelos, gab sich ihm willig hin, entließ ihn unverkrampft, ohne Eile, als habe Lilia nie anderes getan. Am Ende des Unterrichts fühlte er sich doppelt so weit und doppelt so behände an wie zuvor.
In der Eingangshalle des Yogazentrums lagen Bücher auf, die der Lehrer geschrieben hatte, gemeinsam mit einer älteren Kollegin, die seine Yogapartnerin war und einmal die Woche einen Abend lang über die Theorie hinter dem Yoga sprach, über Meditation, sogenannte „Innere Arbeit“, über das, was sie „Den Weg“ nannte. Lilia packte die Gelegenheit beim Schopf, besuchte den nächsten dieser Abende - und traf auf eine Frau unbestimmten Alters, die mit einer Selbstverständlichkeit auftrat, die Lilia sprachlos machte. Nicht den geringsten Zweifel schien die Frau zu kennen, deren Deutsch ungarisch klang, so wie dasjenige vieler Flüchtlinge, die damals ins Land strömten. Und sie wusste, wovon sie sprach. Jedes Wort saß wie in Stein gemeißelt. Ihre Erscheinung erinnerte Lilia an eine Königin des alten Ägyptens. Sie war so präsent wie Lilia noch niemanden erlebt hatte. Und sie forderte ihr zahlreich erschienenes Auditorium in einem Maß heraus, das kein Hinterfragen des Gesagten duldete. Die umfassende eigene Erfahrung dessen, was sie unterrichtete, erfüllte jede Pore ihres Seins.
Auf einen Auftritt mit jiddischen, russischen und chassidischen Liedern, deren Texte noch Abrashka für Lilia auf Band gesprochen und erklärt hatte, folgte ein Engagement für eine Messe von Haydn, und schlossen sich weitere Aufträge zu Feiertagen, Hochämtern, Hochzeiten und privaten Feiern an. Es schien sich für Lilia eine Karriere anzubahnen - hätten sich ihr nicht die vielen Fragen in den Weg gestellt, die sie bis aufs Blut piesackten, sodass keiner der errungenen Erfolge sie wirklich befriedigte, geschweige denn mit bleibendem Glück verwöhnte. Zwar erfüllte sie die in sie gesetzten Erwartungen. Doch genügte das als Essenz eines Lebens? Erreichte es den innersten Ort, das Herzkleine? Speiste es die verborgene Quelle? Oder blieb es Äußerlichkeit – in Abhängigkeit gebannte Oberflächlichkeit, so wie jede Art von Interpretation?
Die gemeinsamen Sommerferien verbrachten Pierre-Louis und Lilia stets in Frankreich, der Heimat von Pierre-Louis‘ Ahnen. Am Abend des letzten Arbeitstages fuhren sie bis weit in die Nacht hinein. Hauptsache sie gelangten so rasch als möglich über die Grenze, dorthin, wo Französisch gesprochen und französische Lebensart gepflegt wurden. Pierre-Louis sehnte sich ebenso danach wie Lilia. Jenseits der Grenze fühlten sie sich wie verwandelt. Die Landschaft präsentierte sich in saftigerem Glanz. Verheißungsvollere Gerüche waberten. Trauterer Singsang hallte durch die Gassen. In den Bistros diskutierten die Leute mit ausholenden Gesten und lachenden Mündern die Geschehnisse des Tages. Hießen die schüchternen Studenten willkommen. Verwickelten sie in ihre Geschichten. Und auch wenn Pierre-Louis sich zurückhielt, da er die Sprache, die er noch als Junge fließend gekonnt, fast vergessen hatte, gehörte er zum Kreis dazu. Rasch wurde bekannt, woher Lilia und Pierre-Louis kamen. Wohin sie wollten. Was sie im Alltag trieben. Und warum sie gerade diese Reiseroute gewählt hatten. Sie wurden überschüttet mit Ratschlägen und Hinweisen auf besondere Orte. Bijous verborgener, im Reiseführer nicht aufgeführter Schlösschen. Kapellen. Gässchen und Eckchen, die das Herz kitzeln und glucksende Glückseligkeit durch die Adern treiben.
Ihr Reisegeld teilten Pierre-Louis und Lilia in separate Couverts auf, gleich viel für jeden Tag. Verpflegten sie sich während des einen Tages mit Baguettes, Käse und Tomaten, durften sie sich am Abend ein besseres Hotel leisten. War ihr Hunger am Mittag besonders groß, weil sie früh aufgestanden und schon durch mehrere Kirchen oder Schlösser gezogen waren, aßen sie in einem Routier - in einer der Gaststätten, die Lastwagenchauffeure aufsuchten. Diesen Häusern haftete ein ausgezeichneter Ruf an. Das Essen wurde in prall gefüllten Schüsseln serviert, ein Vorteil für Pierre-Louis, der kaum Grenzen kannte, wenn es ums Futtern ging. Er verputzte mühelos Vorspeisen, Suppen, Hauptgänge, Desserts und den traditionellen Käseteller, ohne zuzunehmen.
Pierre-Louis fuhr auch die ganzen Strecken selbst, obwohl Lilia einen Führerschein besaß. Tatenlos neben Lilia zu sitzen, machte ihn nervös, zumal er sich nicht verkneifen konnte, laufend ihren Fahrstil zu korrigieren, dabei die Hände verwerfend, stöhnend, sich selbst bemitleidend. Pierre-Louis war als Mitfahrer eine Null. Um Geld zu sparen, hatte Lilia versucht, bei ihm Fahrstunden zu absolvieren, was in lautstarken Auseinandersetzungen gipfelte.
Einmal fuhr sie auf einer abgelegenen Waldstrecke bergauf, als der Motor plötzlich den Geist aufgab. Es ging weder vorwärts noch zurück. Pierre-Louis geriet in Wut, schimpfte, tobte, stieß Lilia grob vom Sitz und zur Türe hinaus. „Das Auto hat kein Benzin mehr“, rechtfertigte sich Lilia kleinlaut. Doch Pierre-Louis war nicht zu bremsen. „Was, kein Benzin mehr!“ Schäumend schmiss er sich selbst hinters Steuer, drehte den Schlüssel: das Auto tat keinen Wank. Zornig, wie ein junger Stier, trat er gegen einen der Kotflügel, entlud seine Wut gegen das Fahrzeug. Lilia, zur Salzsäule erstarrt, stand daneben, ohne zu begreifen, was ablief. Inzwischen hatte Pierre-Louis den Tankdeckel abgeschraubt und leerte Benzin nach. Sein Zorn schien so rasch verraucht, wie er sich entzündet hatte. Er setzte sich ans Steuer, schaltete den Motor ein, ein Schnurren antwortete ihm, und das Auto fuhr. Lilia stieg zu. Kein Wort fiel. Auch keines der Entschuldigung.
Während eines eisigkalten Winters verbrachten Pierre-Louis und Lilia die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr in ihrem Rustico, um den Weiler zu erleben, wenn er nur von Einheimischen bewohnt war, und die wenigen Ferienhäuser mit verrammelten Fenstern im Tiefschlaf lagen. Dem Nachbardorf, in dem es eine Post und einen Lebensmittelladen gab, war ein neuer Pfarrer zugeteilt worden, ein Rumäne aus einer Missionsstation in Afrika. Im Dorf munkelte man, man habe ihn wegen Frauengeschichten ins Exil versetzt. Er wirkte wie ein zerzauster Rabe, verstört und verloren im düsteren, schwierig zu beheizenden Pfarrhaus. Wenigstens kannte er die Sprache der Dorfbewohner, denn er suchte vehement Kontakt, sprach auch Lilia an, als sie auf der Post Briefmarken kaufte. Er war der perfekte Erzähler, und da er merkte, dass Lilia das gefiel, lud er sie zum Kaffee ins Pfarrhaus ein und klopfte von da an immer mal wieder an ihre Türe, bewunderte ihre Arbeit am Haus. Fragte, ob sie verheiratet sei. Wo ihr Mann sich aufhalte. Warum er sie nicht begleitet habe - fragte fast zu viel, zu aufdringlich. Er wurde Lilia lästig. Öfter und öfter überhörte Lilia von da an das Pochen des löwenköpfigen Klopfers. Doch hatte sie dem Pfarrer während einer ihrer Begegnungen versprochen, sie singe an Weihnachten zur Mitternachtsmesse in der Kirche. Und dieses Versprechen wollte sie halten.
Lilia reiste zwei Tage früher an als Pierre-Louis, mit Zug und Taxi, damit sie in der Kirche proben konnte. Sie musste ohne Begleitung singen, denn das, unter dicker Staubschicht auf der Empore begrabene, von Würmern zerfressene Harmonium gab seit Jahren keinen Pieps mehr von sich. Als Anstandswauwau hatte Lilia ihre Nonna, eine weißhaarige, behäbige Deutschschweizerin, die seit Jahren im Dorf lebte, mitgenommen, was der Pfarrer, zur heimlichen Belustigung der Frauen, mit Befremden zur Kenntnis nahm.
Während dem sie sich einsang, wanderte Lilia im Chor von einer Ecke zur anderen, um herauszufinden, von wo aus ihr Gesang die Kirche am besten fülle, ohne zu arg zu hallen. Sie sang ausgesucht langsam, damit die Töne sich nicht überschlugen. Ihre Begleiter nickten anerkennend. Die Kirche habe noch nie solche Klänge vernommen, stimmten sie überein.
Des Pfarrers Einladung zum Kaffee nach der Probe schlug Lilia aus und stapfte stattdessen mit der Nonna in ihr Haus zurück, wo der Kamin schon auf Nachschub an Holz wartete. Die Küche fühlte sich wohlig temperiert an. Lilia liebte den Geruch verbrannten Holzes, das Flackern der Kerzen in den Vasen auf dem Kaminsims, die Schemen an die Wände zauberten, als habe Lilia haufenweise Gäste. Sie ging früh zu Bett, zog Leintuch und Wolldecke bis über die Ohren. Es brauchte drei volle Tage, um das Haus im Winter warm zu bekommen. Noch verbrannte die Kälte der Granitquader ihre Nasenspitze, als sie sich gegen die Wand drehte. Erst auf dem Rücken liegend, schlief Lilia ein und erwachte spät. Eine bleiche Sonne kitzelte mit ihrem Strahl ihre immer noch eiskalte Nasenspitze, so dass sie niesen musste.
Schon um elf Uhr am Heiligen Abend, begann sich die ungeheizte Kirche mit Menschen der umliegenden Orte zu füllen. Bald war auch der letzte Platz besetzt, denn es sprach sich herum, dass für einmal Musik die Messe kröne.
Kurz vor Mitternacht fuhren Lilia und Pierre-Louis vor, Schneeketten an den Rädern, die dennoch leicht schlitterten, als Pierre-Louis versuchte, das Auto zu stoppen. Lilia schlich von der Seite durch die Sakristei in die Kirche. Sie scheute die bohrenden, taxierenden Blicke der Leute, die sie zum Teil kannte, zum Teil noch nie gesehen hatte. Obwohl sie und ihr Mann ein Rustico besaßen, obwohl wohlwollend anerkannt wurde, was sie daraus gemacht hatten - vor allem, dass sie es so restaurierten, dass es seinen Charakter behielt - war Lilia die Fremde, die Auswärtige, die sich, aus Sicht der Einheimischen, das Erbe ihrer Vorfahren unter den Nagel gerissen hatte, selbst wenn sie froh darüber gewesen waren, es loszuwerden. Ein Stückchen Schmerz blieb daran haften, vor allem am Umstand, dass sie es fast um jeden Preis hergegeben hätten, um für sich etwas Moderneres zu bauen. Hassliebe war im Spiel, auch Missgunst. Lilia und ihr Mann wurden willkommen geheißen. Wurden gemocht. Doch ein Zwiespalt blieb. Sie gehörten nicht wirklich dazu. Und bei aller Freundschaft, ließ man sie das in entscheidenden Momenten spüren. Und nun sang Lilia während der heiligsten Messe des Jahres! Das gab zu denken. Das musste verdaut werden, selbst wenn Neugierde überwog. Die Zuhörer würden den minimsten Missklang sofort wahrnehmen und ihn anderntags im Laden kommentieren. Lilia musste auf der Hut sein. Auch wenn sie fror. Vor Kälte und Aufregung zitterte. Bevor die Kirche sich, durch die zahllosen Kerzen und die Menge an Anwesenden, erwärmte.
Lilia stimmte das erste Weihnachtslied an, eines, das in vielen Sprachen und Ländern gesungen wird, ein Jubellied, und es gelang. Lilia fühlte sich leicht und froh. Die Töne trugen sie durch die Nacht der Nächte - obwohl der erste Ton sie erschreckte, wie verstopft klang, wie durch Watte gesungen, da die Körper der Zuhörer jedes Echo auslöschten. Gegen Ende der dritten Strophe - Lilia wagte, alle drei zu singen, in der Hoffnung, das Jubilieren der Melodie reiße selbst die letzten Zweifler mit - erlaubte sie sich einen Schlenker in höchste Höhen als Abschluss, zu ihrem eigenen Glück sowie zur Gewinnung der Herzen der Anwesenden. Und er tat seine Wirkung. Ein Raunen ging durch die Reihen.
Zum ersten Mal in dieser Nacht getraute sich Lilia, die Menge der Messebesucher anzuschauen. Sie stand etwas seitlich im Chor, unter der Kanzel, und brauchte dafür nur den Kopf ein bisschen nach rechts zu drehen. Die Nonna in der ersten Reihe nickte ihr anerkennend zu. Und Lilia fiel ein Stein vom Herzen, wenngleich sie sich nicht wirklich Sorgen gemacht hatte. Sogar ihr Lampenfieber hielt sich in Grenzen.
Dennoch beunruhigte Lilia das Zwiespältige ihrer Situation. Sie wusste nie wirklich, woran sie war - als Fremde in dieser gewachsenen Dorfgemeinschaft. Die meisten der Jungen wanderten aus. Die Einwohnerschaft war auf ein Minimum zusammengeschrumpft. Durch die Erzählungen ihrer Großeltern, und diejenigen von Battista, wusste Lilia Bescheid über das harte, elende Vegetieren in den Dörfern und Tälern der Region. Der Haken bestand darin, dass sie es selbst nicht miterlebt hatte. Die Schwärze der Nächte, der Gewänder. Von denen meistens nicht einmal eines zum Wechseln vorhanden war. Die Schwärze abgründiger Angst vor Naturgewalten. Vor Dämonen, an diesem Rand der Zivilisation. Der Zwang zum Glauben aus schierer Not. Die Schwärze verhaltener Flüche, unterschwelliger Gewalt. Sogar von Totschlag, wenn Hilfe umsonst schien. Wenn alles Gold, die Buntheit der Altäre, der Heiligenbilder nicht genügen wollte. Hoffnung ertrank. Seuchen die Familien heimsuchten. Kinder, zur Unterstützung des Alters gedacht, dahinserbelten, von Würmern zerfressen und verhungernd: Lilia kannte die Geschichten nur vom Hörensagen. Denn sie stammte aus der heilen Welt des Nordens. Der Welt prosperierender Städte. Hatte Ausbildung genossen. Konnte reisen. Sich Wissen aneignen. Soviel sie wollte. Besaß Geld. Erholte sich nicht erst mühsam von Schwärze, Hunger und Furcht. Sie war keine der Ihren. Sie kam aus dem Licht. Als Gewinnerin. Eignete sich leichthin an, was anderen wie tonnenschwere Gewichte anhing.
Lilia kannte diesen Zweispalt in- und auswendig – so gut wie die Einheimischen, auf ihre Art, und ohne dass diese etwas davon ahnten. Sie genoss nur vermeintlich Überlegenheit und scheinbare Macht. Eine Idee, von der Lilia spürte, dass sie immer zwischen den Einheimischen und ihr wuchern würde. Aller Freundschaft zum Trotz. Und auch all der Anerkennung zum Trotz, die ihr nach der Mitternachtsmesse zuteilwurde und momentweise das Trennende zwischen ihnen bodigte: Durch Umarmungen, die von Herzen kamen, ungefiltert und neidlos. Durch Blumen, die von der Dekoration abgezweigt und ihr in die Arme gedrückt wurden. Durch Lachen und Zurufe, die, wie in südlichen Regionen üblich, der Besinnlichkeit des Augenblicks nichts anhaben konnten.
Im Sommer darauf sang Lilia ein weiteres Mal für die Region, die ihr ein zweites Zuhause beschert hatte - zwei Dörfer weiter weg, in einer sechseckigen, auf einer Felsenkanzel hoch über dem See gelegenen Kirche mit wuchtiger Kuppel - während des Festgottesdienstes zu Ehren des Kirchenheiligen, den auch Touristen besuchten. Sie wählte ein „Jubilate“ und ein „Ave Maria“, intonierte sie leise und so zurückhaltend wie möglich, denn der enorme Widerhall ließ sich nicht einmal durch die zahlreich erschienen Gläubigen dämmen. Lilia vermied Vibrato, blieb schlicht, geradlinig, einzig dem Raum verpflichtet - der es ihr dankte.
Schon nach der Mitternachtsmesse hatte der Pfarrer angeboten, Lilia und Pierre-Louis, als Dank für die überraschende Darbietung, zum Essen einzuladen, was nicht leicht zu bewerkstelligen war, da sämtliche Hotels auf ihrer Seite des Sees im Winterschlaf lagen. Auf sein Bitten ließ sich einer der Hoteliers dazu überreden, für sie zu kochen. Der Pfarrer, Lilia und Pierre-Louis fuhren zu ihm, setzten sich, als einzige Gäste, in den unterkühlten Speisesaal und genoßen ein Festmahl. Die Unterhaltung verlief gestelzt. Pierre-Louis‘ Anwesenheit war in des Pfarrers Augen überflüssig. Pierre-Louis amüsierte sich darüber, zwinkerte Lilia verstohlen zu - die sich Mühe gab, nicht loszuprusten, angesichts der skurrilen Situation, in der sie sich befanden. Ausführlich beantwortete Lilia des Pfarrers Fragen, das Singen, ihre Ausbildung und Karriere betreffend. Der Pfarrer hielt Lilia für etwas Besonderes, wie er ihr versicherte. Hielt ihr Leben, ihren Weg für beneidenswert. Machte keinen Hehl aus seiner Bewunderung - von der er sie liebend gern direkt überzeugt hätte, handgreiflich, versteht sich, auf weichen Kissen. Lilia ihrerseits versuchte, seine plumpen, zweideutigen Anbiederungen mit Scherzen zu überspielen und ignorierte jeden weiteren seiner Versuche, zu ihr ins Haus zu schlüpfen, obwohl er noch einige Male an ihrer Türe um Einlass bettelte. Später erfuhr sie, er sei wiederum versetzt worden. Einen neuen Pfarrer erhielt die Gemeinde nicht. Die Kirche blieb verwaist. Nur noch zu besonderen Festlichkeiten reiste ein Geistlicher aus einem der Touristenzentren an.
Pierre-Louis besuchte weiterhin seine Freundin, stundenweise, ohne dass es ins Gewicht fiel. Im Winter grub er frühmorgens ihr Auto aus dem Schnee. Half ihr mit der Steuererklärung. War für sie da, wenn sie Hilfe brauchte. So wie sie für ihn da war, wenn er Hilfe brauchte. Pierre-Louis versicherte Lilia, es gebe keinen Anlass zu Eifersucht. Martha sei ein Mensch, mit dem er einfach reden könne, ohne Angst zensuriert und hinterfragt zu werden. Sie nehme, was er sage so, wie er es sage, höre zu und berichte im Gegenzug über ihre eigenen Ängste und Sorgen - ein bisschen wie eine Schwester. Er habe sie lieb, und sie sei ihm wichtig.
Vollends zerstreuten diese Beteuerungen Lilias Beunruhigung nicht, hörte sie doch deutlich den Vorwurf heraus, mit ihr könne Pierre-Louis nicht reden. Sie gebe keine adäquate Gesprächspartnerin ab, keine, die vorurteilsfrei zuhöre, die spüre, dass auch er jemanden zum Reden brauche. Denn er sei nicht der beharrliche Schweiger, als den sie ihn sehe. Er könne sehr gut erzählen, wenn man ihm dafür Raum lasse.
Damit unterstellte Pierre-Louis Lilia auch, sie lasse ihm keinen Platz. Was hieß, sie verweigere ihm die Luft zum Atmen und beanspruche allen Raum nur für sich allein. Er verkümmere neben ihr. Ersticke. Sie untergrabe seine Lebenskraft, seine Kreativität. Lasse ihn zum seelischen Krüppel verkommen.
An Assoziationen zu Pierre-Louis‘ Bemerkung mangelte es Lilia nicht. In Lilia schellten sämtliche Alarmglocken ob dieser Feststellungen. Sie bettelte, beschwor Pierre-Louis, wie schon Dutzende von Malen, seitdem sie ihn kannte, sich auch ihr gegenüber zu öffnen. Versuchte ihm darzulegen, wie sehr sie selbst Kommunikation vermisse. Wie sehr sie unter dem zentnerschweren Schweigen leide, das sich zwischen ihnen auftürme und zunehme, je mehr sie versuche, zu Pierre-Louis hindurchzudringen. Dabei wusste Lilia nicht wirklich, was Kommunikation für sie bedeute. Horchte sie in sich hinein, spürte sie, dass sie etwas mit dem, was sie „das Herzkleine“ nannte, zu tun habe. Mit den innersten Belangen des Menschseins. Mit Stillem. Verschwiegenem. Mit etwas, das mit Worten vielleicht nicht einmal mitteilbar war. Das hinter einer Wand, die sich nicht beiseiteschieben ließ, festgemauert verharrte. Und an der auch ihre Beziehung zu Pierre Louis scheitern werde, eines vielleicht nicht allzu fernen Tages.
Sich das einzugestehen, getraute sich Lilia fast nicht. Es rührte an ein Tabu. An Unaussprechliches. Es raubte ihr den Boden unter den Füssen. Das Bisschen an Boden, das sie sich in hartem Kampf erobert zu haben glaubte. Gegen wen, gegen was? Noch ein Tabu, an das sich anzunähern Lilia nicht gelang. Einer Zone zugehörig, die Dasein untergrub. Normalität unmöglich erscheinen ließ.
Schon während ihrer Seminarzeit, als Lilia in der Zweizimmerwohnung hauste, und Pierre-Louis täglich bei ihr vorbeischaute - auch um den Hund abzuholen - bestand Lilia darauf, das Schlafzimmer für sich allein zu haben. Auf Pierre-Louis‘ Drängen erlaubte sie ihm, sich mit aufeinandergeschichteten Ziegelsteinen und Brettern im Wohnzimmer ein Bett zu bauen. Obwohl alles in ihr sich dagegen sträubte. Was sie ihm jedoch nicht sagte. Der Gedanke, mit einem Mann, oder konkret, mit Pierre-Louis zusammenzuwohnen, raubte ihr die Luft. Lilia besaß zeitlebens ein Zimmer für sich allein. Dieses Privileg aufzugeben bedeutete, einen Teil ihrer selbst aufzugeben. Den verletzlichsten Teil ihrer selbst. Den, der sich nicht wehren konnte. Angriffen hilflos ausgeliefert war. Und der nun, seitdem Pierre-Louis sich bei ihr eingenistet hatte, in ständiger Bedrohung schwebte. In diesem Zuviel an Nähe, die machte, dass sich Lilia preisgegeben fühlte. So als habe ein fremdes Tier ihr Nest besetzt. Ihr Revier für sich beansprucht. Und sie irre vor dem geraubten Bau hin und her. Ausgeschlossen und übergangen - war sie doch nicht wirklich gefragt worden, ob sie mit Pierre-Louis zusammenleben wolle, nicht eindeutig, nicht mit Worten. Er machte einfach geltend dass, wenn er sich schon um ihren Hund kümmere, und ihr Nachhilfestunden in Mathematik erteile, er nicht spät nachts noch nach Hause fahren wolle. Das leuchtete Lilia notgedrungen ein. Ohne dass sie sich getraute, diese Not zu äußern. Denn sie brauchte Pierre-Louis‘ Anwesenheit. Schon wegen der Drohung ihrer Vermieter, sie kriegten die Wohnung nur, wenn sie innert nützlicher Frist heirateten. Auch für diese Belange kannte Lilia niemanden, mit dem sie sich hätte beraten können. Nicht einmal ihr Gesangslehrer, der Lilia ebenfalls bedrängte, jedoch vorwiegend in erotischer Hinsicht, taugte dafür.
In Lilias Schrank hingen nun mehrere lange Roben, zum Teil selbst geschneiderte, zum Teil gekaufte, die Lilia für ihre Gesangsauftritte brauchte, während denen sie sich als vollerblühte Frau präsentierte, und die, ihrem Rang als Solistin zustehende Distanz genüsslich auskostete. An einem Abend nach einem Konzert sagte der Sohn einer befreundeten Altistin zu Lilia, sie sei wie ein saftiger Apfel: beiße man ihn an, breche man sich einen Zahn an ihm aus. Ein Ausspruch, der Lilia gefiel, weil er Stärke, Selbstbewusstsein und Sicherheit suggerierte, die Lilia nicht besaß. Die ihr jedoch ein Image verpassten, das sie als Sängerin brauchte - sowie als Ehefrau, nur mochte sie darüber nicht nachdenken – ginge es dabei doch um die Angst des Kindes, dem es an Beweisen fehlte, die seine Unschuld bezeugten.
Bei aller Intuition, der feinen Begabung Pierre-Louis‘, sich in Unterschwelliges, in Verborgenes einzufühlen, blieb er der junge Mann, der sich ein Ziel setzt und es verfolgt. Nicht rücksichtslos, sondern beharrlich, darauf vertrauend, das entspreche der Normalität. Und dagegen ließ sich nichts ins Feld führen, selbst wenn diese Haltung Lilia in die Flucht trieb, ohne dass sie sich zu sagen getraute, was ihr daran Angst machte. Vielleicht lag es an der Subtilität von Sprache. Daran, dass ein falsch oder unpräzise hingeworfenes Wort das Herz im Handumdrehen bluten machte und aller Hoffnung beraubte.
Mit unüberhörbarer Regelmäßigkeit ließ Pierre-Louis ab einem gewissen Datum Hinweise auf Selbstmord fallen. Zuerst unauffällig, doch für Lilias geübte Ohren deutlich genug. Dann häufiger und präziser, im Sinne von: sie müsse sich auf die Möglichkeit vorbereiten: sie könne den Gedanken daran ertragen. Er wisse das. Er kenne sie dafür gut genug. Und setze es voraus. Und es war nicht einmal die Möglichkeit des Eintreffens dieser Ankündigung, die Lilia erschreckte. Denn diese hatte sie selbst jahrelang ausgiebig genug ins Auge gefasst: Einzelheiten der Ausführung bewusst visualisiert, wenn sie weder aus noch ein wusste. In Schrecken versetzte Lilia der Zweispalt, in den sie ihre Gefühle stürzten: die unterschwellige Sehnsucht nach Selbstbestimmung, im Gegensatz zur Furcht vor erneutem Alleinsein, dem sich selbst Überlassensein, ohne dass es jemanden kümmerte. Davor fürchtete sie sich am meisten. Liefen ihre Lebensadern so parallel, dass sie zum bestimmten Zeitpunkt gemeinsam bereit sein würden: Pierre-Louis um Abschied vom Leben zu nehmen, und Lilia, um damit umzugehen? Pierre-Louis betonte, er sei weder krank, noch bedürfe er eines Arztes oder sonstiger Hilfe. Im für ihn passenden Moment zu verschwinden, sei wohl überlegt. Stelle keinen Akt von Torschlusspanik dar. Zeige nicht einmal Anzeichen von Lebensverweigerung. Sondern entspreche seinem persönlichen Willen - gehöre so zu seinem Leben, wie Lilia zu seinem Leben gehöre. Es sei die Fortsetzung von etwas, das seit seiner Geburt in ihm schlummere. Und das Lilia genauso zu akzeptieren habe, wie er ihren Wunsch zu singen, oder sonst etwas zu tun, zu dem sie Neigung verspüre. Er lasse ihr die Freiheit, fügte Pierre-Louis hinzu, und fordere sie auf, ihm auch die seine zuzugestehen. Und zwar nicht bloß, sie ihm zu gestatten. Das machte Pierre-Louis klar. Er erbete sich nichts. Er nehme sich, was ihm gehöre.
Die Verweigerung jeglichen Mitspracherechts war es, die Lilia wütend machte. Und dass sich Pierre-Louis desselben Prinzips bediente wie sie.
Bis zu einem gewissen Grad war Übereinstimmung zwischen Menschen möglich. Ab dann spielte die, keine Kritik duldende, persönliche Freiheit, die nur sich selbst gehörte. Das wusste Pierre-Louis so gut wie Lilia. Weder sie noch er bedurften der Unterstützung. Bei aller Härte und Schonungslosigkeit dieses Sachverhalts, fühlte sich Lilia durch Pierre-Louis‘ Klarheit gestärkt. Es dünkte sie, ihre Ehe strebe auf eine Art von Höhepunkt zu: auf eine Form von Verwirklichung, die sie sich zwar nicht gewünscht habe, die jedoch zu nichts im Widerspruch stehe, das für sie Leben bedeute. Die Totalität der Wahrnehmung von Möglichkeit sei in ihrem Sinn. Sie dürfe sich nicht beklagen und müsse es auch nicht, brauche um Pierre-Louis keine Ängste auszustehen. Als gleichwertige Partner folgten sie dem Faden, der für sie Freiheit bedeute. Keine Fragen stellten sich. In der Bedingungslosigkeit des Jasagens, in der Schuld und Unschuld sich die Waage hielten, die Extreme in sich zusammenfielen, erfülle sich der Sinn ihres Zusammenseins.
Doch noch war die Zeit nicht reif. Es sollten noch gut zwei Jahre vergehen, bis Pierre-Louis‘ und Lilias gemeinsamer Weg durchtrennt wurde.
Die Besitzer des Hauses, in dem sie wohnten, waren alt und gebrechlich. Im Stockwerk, zwei Etagen unter ihrer Wohnung befand sich die Buchbinderei, mit der der Herr des Hauses einst seinen Lebensunterhalt bestritten hatte, als angesehener Bürger der Stadt mit ausgedehntem Freundes- und Kundenkreis.
Die Buchbinderei war an einen auswärtigen Nachfolger vermietet, einen stillen, in sich gekehrten, alleinstehenden Mann mittleren Alters, der zusammen mit seiner Mutter in einem Bauernhaus auf dem Land wohnte. Lilia traf ihn gelegentlich, wenn sie ihren Hund spazieren führte oder einkaufen ging, meistens dann, wenn er aus dem umfangreichen Vorrat an Pappen, Papieren, Leimen oder Sonstigem, das im Flur vor der Werkstatt auf Regalen bereitlag, das Benötigte heraussuchte. Sie grüßten einander und gingen ihrer Wege. Es dauerte seine Zeit bis sich ein zaghaftes Gespräch zwischen ihnen anbahnte. Lilia, die Bücher über alles liebte, da ihnen aus ihrer Sicht etwas Heiliges anhafte, interessierte die Arbeit des Buchbindens. Und besonders der Goldschnitt an Büchern rief eine Regung sinnlicher Befriedigung in ihr hervor. Mit dem Finger darüber zu streichen, fühlte sich seidig an, lebendig und atmend wie flauschiges Fell. Es machte den Inhalt der Seiten zu etwas Kostbarem, das das Herz anging und tief unter die Haut drang. Lilia durfte zuschauen und mit weichem Lappen den Goldschnitt polieren, sodass er von innen her zu glänzen begann, wie von heimlicher Glut geschürt. Ein Zauber wohnte dem Vorgang inne, der Lilia entzückte.
Und den Buchbinder wiederum entzückte Lilias Reaktion. Er fing sachte Feuer. Begegnete er ihr, fing die Dürre seiner Erscheinung, das papieren Graue, unter dem Staub der Werkstatt Erstickte an zu fiebern. Zumindest änderte es seine Temperatur, rutschte vom Unterkühlten in Richtung Frühling und zu Sommerlichem hin, sodass Lilia sich gezwungen sah, dem Buchbinder aus dem Weg zu gehen, sorgfältig, denn ihr war die Fragilität dessen, was in seinem Innern, in seinen Augen und auf seinen Wangen zu blühen anfing, nicht entgangen. Sie durfte keine Hoffnungen in ihm wecken. Die Einladung zu einer Antiquitätenmesse schlug sie mit dem Hinweis aus, sie weile dann in ihrem Rustico, weil ihr Schreiner einen Schrank im oberen Stockwerk einpassen wolle.
Lilia erkannte die Not des Mannes, und sie rührte sie. Sie erkannte die Einsamkeit: das auf windigen Höhen, schutz- und heimatlose Ausgesetztsein, ohne Aussicht auf Geborgenheit. Zuviel des Näherrückens hatte sich schon zwischen ihnen aufgebaut, und Lilia fühlte sich deswegen schuldig.
Dazu kam, dass Lilia eine ganz andere Zeit näher rücken sah als die, die sie mit dem Buchbinder zusammen hätte durchlaufen können: Die Zeit von Bernd, den sie nun mit Vornamen in sich drin zu nennen wagte, im Herzkleinen, dessen Tür nach außen immer noch verriegelt war. Sein Name stand erneut auf dem Theaterzettel der Großstadt, unübersehbar, in kapitalen Lettern, die Lilias Blut in Wallung versetzten, mit einer Leidenschaft, die kein Mann je zuvor in ihr geweckt hatte. Der alte Schwur, der wie ein Menetekel ihr Innerstes durchloderte, legte alles Bisherige in Asche. Diese Zeit war die ihre. Für diese Zeit hatte sie sich aufgespart. Auch wenn es sich wie Wahnsinn anfühlte. Doch: wie die Distanz zu Bernd überbrücken? Wie sich bemerkbar machen? Und was anbieten, das genügte? Sie war so arm im Vergleich zu ihm. Und viel zu jung, in jeder nur denkbaren Hinsicht.
Die Frau des Vermieters war durch Krankheit und Alter so geschwächt, dass sie Pflege brauchte, die Lilia allerdings nicht leisten konnte. Doch übernahm sie es, die Frau hin und wieder zu baden. Sie mochten einander. Und die Dame verfügte über ein sattes Selbstverständnis - als langjährige Geschäftsfrau, die die zur Buchbinderei gehörende Papeterie geführt hatte - sodass sich das schüchterne Atemanhalten, der zögerliche Moment vor der Entblößung ihres Körpers wie von selbst löste. Lilia half so wenig als nötig. Berührte ihre Nacktheit so wenig als möglich. Reichte Seife. Netzte an. Massierte die Kopfhaut. Und wusch das krause Haar so sachte es ging. Lilia hatte zu wenig Erfahrung mit Körpern anderer Menschen. Verstand zu gut, wie schwierig es für die Frau sein musste, solch Einschneidendes anzunehmen, das hilflos machte, Scham hervorrief - auch von Lilias Seite - sowie die Angst vor Überforderung, vor offener oder geheimer Aggression, aus Gründen plötzlichen Unwohlseins, oder unverhoffter Desorientierung. Man wusste nie, was in vom Alter gezeichneten Gehirnen vor sich ging. Und Lilia wollte alles richtig machen, auch zur Entlastung des Mannes, der nicht mehr die Kraft hatte, seine Frau mehr, als nur vom Stuhl hochzuheben. Schlurfen konnte sie noch allein, doch das Ankleiden schaffte sie nicht mehr. Sie war hübsch, feingliedrig, die Haut seidenweich, sehr hell, kein bisschen runzlig. Und sie war sich dessen bewusst.
Doch das Dranbleiben fiel Lilia nicht leicht. Wiederholungen waren nicht ihr Ding. Es kam der Tag, an dem sie sich verweigerte, nicht helfen konnte, weil es einfach nicht ging, sich alles in ihr dagegen sträubte. Der Hausherr versuchte es selbst. Seine Frau entglitt ihm und fiel ohnmächtig zu Boden. In Panik rief der Mann um Hilfe. Zum Glück war Pierre-Louis gerade nach Hause gekommen. Sie trugen die Frau ins Bett und riefen den Arzt: Es war nichts passiert.
Lilia konnte sich ihr Versäumnis lange nicht verzeihen. Dass sie so schamlos ihr Eigenes vor das offensichtliche Bedürfnis anderer stellte, plagte sie physisch, als nage ein Wurm an ihr. Von da an nahm sie ihre selbstauferlegte Pflicht sehr ernst - bis zu dem Tag, an dem die Frau in Spitalpflege gegeben werden musste, wo sie, nur halb bei Sinnen, mehrere Wochen blieb. Bevor sie, ohne Benachrichtigung ihres Mannes, in ein Pflegeheim verfrachtet wurde, und Lilia sie mit ihm zusammen stundenlang suchte. Denn nirgendwoher kam taugliche Information. Niemand wusste Genaues. Erst beim Eindunkeln fanden sie die Frau, warm und wohlig gebettet vor sich hindösend, ohne die Besucher zu erkennen, in einem Heim außerhalb der Stadt. Der Mann weinte herzerweichend. Lilia konnte nichts tun, als mit ihm nach Hause zu fahren und ihn für den kommenden Tag zum Mittagessen einzuladen. Was von da an zur Institution wurde. Bis seine Tochter ihn zu sich in die französische Schweiz beorderte, obwohl er sich mit Händen und Füssen dagegen wehrte.
Hin und wieder durfte ihr Vermieter für ein paar Tage nach Hause zurückkehren und mit Pierre-Louis und Lilia zusammen Mittagessen. Er lebte jedes Mal auf, fühlte sich wie neu geboren, erzählte Geschichten aus früheren Zeiten: Als das erste Auto durch die Gassen der Altstadt tuckerte, hustete, furzte, spuckte, als explodiere es demnächst. Es gehörte einem Metzger, der es mit einem Freund zusammengebastelt hatte. Zu seinem und zum Gaudi der Kinder, die johlend hinter ihm herrannten, der Hunde, die es wütend anbellten, die Räder zu zerbeißen versuchten und der Katzen, die fauchend zur Seite stoben. Kinder, Hunde und Katzen gab es zuhauf in der Stadt. Die Zimmer der schmalbrüstigen Häuser waren überfüllt. Das Wasser holten die Frauen aus dem Stadtbach, der ungeschützt durch die Gassen rann. Es lärmte und roch aus Fenstern und Türen. Lehrer ohrfeigten die Kinder. Väter verdroschen sie. Und doch war es eine heile Welt, in der jeder seinen, ihm bestimmten Platz kannte. Bessergestellte, wie Lilias Vermieter, genossen Autorität.
Wie in allen größeren Orten, schlossen sich die Berufsleute zu Zünften zusammen. In der Pelzgasse boten die Kürschner ihre Erzeugnisse feil. In die Farbgasse ging, wer einen Maler suchte. Es schien eine sehr geordnete Gesellschaft zu sein, zu der Zeit, als Lilias Vermieter selbst Kind war, eine geregelte, von harter Arbeit geprägte Gemeinschaft. Nicht alle hatten zu essen. Nicht alle eine geheizte Stube. Die Meister, zu denen auch Lilias Vermieter gehörte, trafen sich zum Abendschoppen im „Goldenen Löwen“, die Handwerker in den Schenken unten am Fluss, die Frauen unter den Torbögen, oder im Waschhaus.
Lilias Vermieter sehnte sich in jene Zeit zurück, nun, da er alles verloren hatte, was Leben für ihn lebenswert machte. Mit seiner Tochter, einer spitzzüngigen, geschiedenen, ältlichen Jungfer, die nichts freute, verstand er sich nicht eben gut. Sie zwang ihren Vater zu sich, um dem Vorwurf zu entgehen, sie entziehe sich der Verantwortung. Tagsüber saß sie im Büro, ihr Vater allein in der Wohnung. Oder er lief durch die unbekannten Straßen, den Dackel an der Leine, mit dem einzig er reden konnte, denn des Französischen war er nur beschränkt mächtig. In den Bistros war es ihm zu laut. Und er fand sie auch nicht heimelig genug. Ein Bier war rasch getrunken, die Zeitung rasch durchgeblättert, vom Einsamen unter Einsamen auf der Parkbank am See. Die Nachmittage zogen sich schwerfällig hin bis zur Rückkehr seiner Tochter, die ihm den Abend versüßte, indem sie die Eintönigkeit der Arbeit, die Trostlosigkeit als Alleinstehende beklagte. Den Sohn sah er selten. Der rieb sich auf an bescheidenen Bühnen, die begabteren als Sprungbrett dienten, den Kopf sprühend vor Plänen, die allen Bemühungen zum Trotz kaum je Gestalt annahmen.
Eine großartige Köchin war Lilia nicht. Sie hatte keine Gelegenheit, das Kochen zu erlernen. Sie fand, in ihren Zukünftsplänen habe Hausarbeit sowieso keinen Platz. Und die Stiefmutter fühlte sich nicht dazu berufen, Lilia in Hausarbeit anzuleiten. Als Lilias Vater noch arbeitete, aß er in der Kantine der Firma. Und Ana dachte, für sich und Lilia lohne es sich nicht, groß zu kochen. Es gab, was sich anbot. Die Stiefmutter richtete die Teller selbst an, schaute peinlich genau darauf, dass auf keinem Teller mehr lag als auf ihrem eigenen. Denn sie litt an einer eigenartigen Form von Geiz. Da sie sich im Zusammenleben mit Lilia und ihrem Vater nicht aufgehoben, nicht erfüllt und sicher fühlte, versuchte sie, alle und alles unter Kontrolle zu behalten, über alle und alles zu bestimmen, und zu bestrafen, was sich nicht fügte. Tadel ging ihr leicht von den Lippen, Lob so gut wie nie. Und auch von Belohnung hielt sie nichts. Anstatt sich mehr einzubringen, sabotierte sie tiefere Beziehungen zwischen sich, dem Vater und Lilia, gönnte Lilia den Vater nicht, gönnte dem Vater Lilia nicht, gönnte sich Lilia nicht und umgekehrt. Sie verbitterte zusehends, rächte sich hinterrücks. Was Lilia noch weniger dazu anspornte, sich um Hausarbeit zu kümmern.
Das Putzen, das Waschen, das Kochen und das Bügeln musste sich Lilia während ihrer Ehe mit Pierre-Louis nach und nach selbst aneignen. Und es blieb zeitlebens ein notwendiges Übel für sie, ging ihr nie leicht von der Hand. Sie empfand es als eine Art von Prüfung, mit dem entsprechenden Stress behaftet. Als etwas wie eine heimtückische Krankheit, der sich nicht entziehen konnte, wer nicht wirklich reüssierte im Leben - keine nennenswerte Karriere zustande brachte, aus welchem Grund auch immer. Sich Letzteres einzugestehen, fehlten Lilia noch der Mut und die Übersicht. Sie glaubte felsenfest daran, berufen zu sein für etwas, das sich irgendwann abzeichnen würde. Anderes durfte nicht geschehen. Anderes würde Leben für sie untragbar machen. Älter als vierzig Jahre wollte sie ohnehin nicht werden. Viel Zeit blieb ihr also nicht. Denn sie war bereits fünfunddreißig.
Sich damit auseinanderzusetzen, fehlte ihr die Muße. Denn ihr Wunsch nach Bernd nahm ein Ausmaß an, als liege ihr ganzes Leben und Überleben in seiner Hand. Alles womit sie zu tun hatte, was sie innerlich beschäftigte. Die Dinge des Alltags. Wasser. Die Luft zum Atmen. Die Hitze im Herzen. Die Erde, auf die sie trat - trug mittlerweile den Namen „Bernd“. Tage und Nächte prägte sein Name. Dieser Name, der dem goldunterlegten, smaragdenen Glühen der Abendsonne über Jurahöhen glich. Dem ein Zauber innewohnte. Ekstatisches, das jede Zelle aufrüttelte. Und Qual. Lust. Trauer und Tod enthielt. Weite schuf, die schwindeln ließ. Tiefe, die keine Angst erzeugte. Nur Einverständnis. Ein Ja, Grüften und Schlünden entsprungen. Präsenz bis zum Zerspringen erzwang.
Lilia besuchte die angekündigte Vorstellung, das Auftragsstück eines jungen Autors. Der Inhalt dünkte sie lau. Scheinbar sollten die Stars des Ensembles mangelnden Glanz wettmachen. Und am Tag nach der Aufführung setzte sich Lilia hin und schickte Bernd eine kühle, sachliche Kritik, die ihrem Zustand entsprach. Dem Zustand luzider Klarheit, der für Lilia alle Grenzerfahrungen prägte. Sie erlaubte sich nicht den Hauch einer Anbiederung. Schenkte sich nicht her. Hielt sich völlig zurück. Gab sich unpersönlich und sah sich auch so. Erschuf Distanz. Leeren Raum: Gerade weil sie um die Schicksalshaftigkeit Bernds in ihrem Leben wusste. Der Schwur, für die Begegnung mit ihm sogar ihr Leben aufs Spiel zu setzen, erfüllte ihr Wesen bis zum Rand. Eile tat nicht not. Schritt für Schritt wollte sie den Weg zu ihm gehen. Nichts anderes als diesen Weg sah sie in sich. An Schuld dachte sie nicht. Es würde eine Begegnung außerhalb von Zeit und Raum sein. Was beinhaltete, dass sie einander nicht behalten durften, nur „als Sternstaub ineinander explodieren“, wie Bernd es später nannte. Besorgnisse und Ängste. Gefühle von Unzulänglichkeit schwanden aus Lilias Wesen. Sie fühlte sich wie neu geboren. Lebte auf. Mit solidem Boden unter den Füssen und einer Gewissheit im Herzen, die banalen Alltag nicht berührte.
Und Bernd schrieb zurück, zeigte sich erstaunt über die Genauigkeit ihrer Beobachtung, die Professionalität ihrer Kritik, fragte, ob sie vom Fach sei. Mit ihrer Antwort ließ sich Lilia Zeit. Um mit der Situation Schritt zu halten. In sie hineinzuwachsen. Kraft und Stärke zu gewinnen. Wie auf vor langer Zeit vorbreiteten, schimmernden Geleisen schien die Geschichte sich zu entwickeln. Auf sie zuzurollen. Plötzlich fühlte Lilia Geduld in sich wachsen. Konnten sich normalerweise Wünsche für sie nicht rasch genug erfüllen, ließ sie nun die Zeit sich so langsam entfalten, als es irgend ging. Ein Gefühl von Verantwortung erfüllte sie. Bernd war verheiratet. Sie selbst war verheiratet. Es brauchte äußerste Behutsamkeit, damit keine, oder doch so wenige Verletzungen als möglich entstanden. Und das bei allen direkt oder indirekt Beteiligten. Das Stürmende, Drängende in ihr schien Bedachtsamerem zu weichen. An der Ausschließlichkeit ihres Wünschens änderte sich nichts. Sie wollte ihr nur den größtmöglichen Raum verschaffen. Eine Weite der Ausdehnung, die ihr Sein in einem Maß einschloss, das nicht den geringsten Schatten mehr zuließ. Selbst wenn dabei alle Brücken hinter ihr einstürzten: Sie würde das daraus entstehende Leiden aushalten.
Wie bei Papa Moritz ließ Lilia in ihrem nächsten Brief die Feder frei übers Papier laufen, zurückhaltend zwar, doch nicht zurückkrebsend. Sie erzählte einiges von sich. Gewöhnliches. Gab sich alltäglich. Uninteressant. Hütete sich davor, Erwartungen zu wecken. Nicht sie rief nach Bernd. Er sollte nach ihr rufen. Und deshalb durfte sie keinerlei Spielchen treiben, musste sie authentisch, gläsern wirken. Lilia wollte Die Große Liebe erfahren, die Verwandlung in sich barg. Und sie war bereit, den dafür geforderten Preis zu bezahlen. Bernd war der Richtige. Denn er konnte fliegen. Deklamierte die Konsequenzen in seinen Texten auf eine Weise, die zu erkennen gab, dass er ahnte, wovon er sprach. Es vielleicht sogar erfahren hatte. Denn dass er ein Frauen Liebender und ein von Frauen Geliebter war, verstand sich von selbst. Darüber machte sich Lilia keine Illusionen.
Im Übrigen war Lilia einfach nur verliebt in Bernd und sehnte sich nach ihm, nach seiner Berührung, seinem Körper, seiner Stimme und seinen Zärtlichkeiten mit nie gekannter Intensität. Bernd war der Mann.
Leben wurde sehr, sehr langsam in Lilia, sogar ihr Herzschlag. Wenigstens kam ihr das so vor: als sterbe sie allem Bisherigen ab. Lege ihre Haut, ihr bisheriges Dasein zur Seite, wie ein ausgedientes Kleid. Bernd schrieb, er möchte sie kennenlernen, er müsse sie kennenlernen, unbedingt. Er schickte ihr Einladungen. Trat hier auf. Las dort. Doch Lilia reiste ihm nicht nach. Sie hätte es nicht ertragen, ihn in irgendeinem Hotelzimmer zu treffen. An einem fremden Ort wäre nichts daraus entstanden, nichts für ihn, und nichts für sie. Sie brauchten einen Ort außerhalb des Üblichen: - - in ihrem Rustico, das sie nur deshalb mit so viel Sorgfalt vorbereitet hatte. Erst noch hatte sie gezögert, diese Möglichkeit zu erwägen. Das Rustico gehörte ja nicht nur ihr. Nun wurde sie auch für diesen Schritt bereit. Einzigartiges bedingte einen einzigartigen Preis. Es mochte sein, ein Leben reichte nicht aus, ihn zu bezahlen.
Wieder besuchte Lilia eine Vorstellung mit Bernd. Und diesmal gab sie am Bühneneingang einen kleinen, selbstgebundenen Rosenstrauß für ihn ab. Während der Vorstellung - sie saß in der dritten Reihe - suchte sie seinen Blick, indem sie innerlich seinen Namen rief, immer wieder, bis es wirkte. Plötzlich klinkte Blick in Blick. Eine ganze Passage lang. Lilias Herz schlug langsam und hart wie ein Gong.
Nach der Vorstellung schlenderte sie in der Nähe des Bühneneingangs herum, als warte sie auf jemanden. Bernd verließ das Theater, Bücher unter dem Arm, die Hand auf der Brust, die das Sträußchen hielt. Er schaute sich um, suchend. Lilia stellte sich, als kenne sie ihn nicht, sah belanglos an ihm vorbei. Bernd ging an ihr vorüber. Ein Hauch von Bühnenparfum streifte sie. Er bog um die Ecke und war weg.
In Lilias Innerem toste ein Wildbach. Äußerlich wirkte sie gefasst. Alltäglich. Unauffällig. Sie schlenderte zum Bahnhof, bestieg den Zug, sich wundernd über das Ausmaß an Leidenschaft, das in ihr abging. Darüber dass es überhaupt Platz in ihr fand. Wunderte sich, woher sie diesen Raum nahm. War Leben so, wenn es Grenzen verneinte, Gefahren als nichtig erachtete? Um Lilia herum wirbelte es wie ein Karussell, ratatatata: Schmerzhaft laut klang das Rattern der Räder auf den Schienen. Tropfen schlingerten schräg über die Scheibe. Lichter schlierten vorüber. Die Nacht, augenlos, erstickte Zeit. Existenz erlosch. Lilia, hellwach, fragte sich, wer denn eigentlich fuhr. Ob überhaupt einer oder etwas fuhr. Lärm vermischte sich mit Dunkelheit zum Augenblick ohne davor und danach.
Zum Neujahr schickte Bernd Lilia ein Bild von sich in der Rolle des „Marquis von Posa“, eines Malteserritters aus Schillers „Don Carlos“, in Rüstung und Helm, den Degen umgeschnallt. Er wünschte ihr alles Gute, bat, er möge ihr nicht zu nahe treten mit seinem Geschenk. In Abständen reisten von da an Briefe hin und her. Der Spur nach wusste Lilia, wo Bernd auftrat, schickte Zeilen an solche Adressen, auch ins Ausland, wie Federn in den Wind, ohne Eile, ohne Sorge, sie könnten ihr Ziel verfehlen. Irgendwann erhielt Bernd sie, mit verschiedenen Adressen vollgeschmiert. Sie kamen immer an. Der Film lief aus sich selbst heraus. Es gab nichts mehr zu tun, als ihm zu folgen.
Ostern rückte heran, und Lilia band für Bernds nächsten Auftritt einen Frühlingsstrauß aus Tulpen, Narzissen und Anemonen. Es wurde ein gewichtiger Strauß, dessen Stiele sie nicht mit einer Hand umfassen konnte. Sie legte ihn sich in den Arm, in der Absicht, ihn auf die Bühne zu schmuggeln, wissend, dass Bernd die Angewohnheit hatte, eine Stunde vor Auftritt im Theater zu sein - doch in der Annahme, er weile noch in der Garderobe. Sie schlich sich durch den Hintereingang ins Haus, verhielt den Schritt, bevor sie auf die Bühne trat, wo sie den Strauß auf den Tisch legen wollte, von dem aus Bernd Gedichte vortragen würde. Als sie aus der Kulisse trat, trat Bernd aus der Kulisse gegenüber. Lilia blieb wie festgeschraubt stehen, stammelte: „O, das hab‘ ich nicht gewollt.“ „Aber ich“, entgegnete Bernd leise, nahm ihr den Strauß aus dem Arm, bückte sich zu ihr hinunter und küsste sie behutsam auf die Wange. Lilia machte kehrt und rannte davon.
Ihre Wange glühte und ebenso der Rest von ihr. Sie fühlte sich ertappt, wie ein Backfisch, der seinem Idol auflauert. „So hätte es nicht kommen dürfen“, seufzte der eine Teil von ihr, „aber es hat doch genau gestimmt“, der andere. Nun wusste Bernd, wer sie war. Sie hatte eine Karte für die zweite Reihe, würde ihm gegenüber sitzen. Und so geschah es. Und Bernd las immer wieder Verse direkt in ihre Augen hinein. Denken konnte Lilia längst nicht mehr. Nur da sein. Mit jeder Faser. Wie eine an beiden Enden entzündete Fackel. Freiwillig. Und nicht wie ein gefangenes Huhn. Nicht ausgeliefert. Sondern sich hinschenkend, mit allen zur Verfügung stehenden Sinnen.
Den letzten Vorhang wartete Lilia nicht ab. Sie schlich während zweien zur nächsten Seitentür hinaus ins Freie. Wie verweht. Flog die Straße hinunter und quer darüber hinweg, zwischen Autos hindurch: nicht weg von der Liebe - sondern auf der Liebe. Den Bahnhof ereilte sie in der Hälfte der Zeit und kaufte sich einen Kaffee. Nicht um klar zu werden von Bernd - doch um klar zu werden für Pierre-Louis, der sie zuhause erwartete, ihren Zustand schweigend erahnend. Dass sie weg von ihm strebte, spürte er. Dass es sie zog, allein zu sein, ebenso. Es war nie zur Sprache gekommen. Lilias Verhalten lehrte es ihn. Die zunehmende Eigenständigkeit ihres Denkens, die ihn nicht mehr selbstverständlich miteinschloss. Die Trennung, die sich anbahnte.
Auch Pierre-Louis‘ Pläne konkretisierten sich. Nach seinem letzten Militärdienst bewarb er sich als Ausbildner für Rekruten. Nun wartete er auf Antwort. Lilias und sein Weg schlugen immer deutlicher Richtungen ein, die unvereinbarer nicht sein konnten. In ihrem Denken und Wünschen wurden sie einander fremder und fremder. Obwohl das innere Band sie so stark zusammenhielt, dass in Lilia der Gedanke heranreifte, nur des einen Tod könne sie wirklich voneinander scheiden. Ein Gedanke, den sie, kaum gedacht, sogleich verdrängte, als denke sie Verbotenes. Der Gedanke war aufgetaucht wie eingeflüstert. Und er entsprach nicht ihrem Wunsch. Auch nicht geheimer Hoffnung. Sie war weit davon entfernt, Pierre-Louis los sein zu wollen. Doch wieso zeigte sich der Gedanke dann? Eine Frage, die in Lilias Herz einen seltsamen Tanz aufführte. Warum die Dinge nicht nehmen, wie sie sich zu zeigen wünschten? Oberflächlich leichthin genießen, was sich anbot. Den Zuckerguss vom Kuchen lecken. Anstatt die Erde um- und umzupflügen. Im Untergründigen zu wühlen wie ein Maulwurf. Oder wie eines der abstrusen Tiergebilde, die in schwärzesten Schlünden entlegener Meere entdeckt wurden?
Im Übrigen durchlief Lilia ihren gewohnten Alltag, als sei nichts geschehen. Immer noch arbeitete sie zeitweise in einem Büro. Immer noch stand das Singen an erster Stelle. Der Anschein blieb gewahrt. Sie fuhr jeden Tag mit dem Zug in die Großstadt, absolvierte den Unterricht im Theater, arbeitete mit dem Korrepetitor an Opernarien. Ihre neuen Lehrer stempelten sie zum Koloratursopran. Also übte sie Stücke von Mozart, Belcanto-Arien und Musik des Spätbarocks - gelegentlich unterbrochen von Auftritten unterschiedlicher Art. Der Vorteil, mit Solisten des Theaters zu arbeiten, bestand darin, dass sie sich gratis so viele Vorstellungen ansehen konnte, wie sie wollte, von der Solistenloge aus, mit Aussicht schräg in die Kulissen. Was einen Blick auf die Sänger bot, kurz bevor sie auftraten, aus den Eingeweiden des Theaters ins Rampenlicht tauchten.
Lilia nähte und strickte auch immer noch für sich. Suchte immer noch den besonderen Hingucker, den ihr selten gut gefüllter Geldbeutel sich leisten konnte. Sie bevorzugte das Extravagante aus Freude am Kombinieren. Oft trug sie die Haare nun in Sängerinnenmanier, hochgesteckt, verziert mit glitzernder Spange. Sie galt als gut angezogen und gutaussehend. Doch wirklich wohl fühlte sich Lilia auch in der Opernwelt nicht. Es glich einem Wandern zwischen den Welten, wie ihr ganzes bisheriges Leben, nur ohne Zugehörigkeit zu vermitteln. Freundschaften hörten dort auf, wo der Konkurrenzkampf begann. Das Leben von Darstellern beinhaltete viele Stunden des Wartens: auf Probenbeginne, auf Korrepetitoren, auf Kostümbildner, auf die Maske. Sänger und Sängerinnen, die für Gastspiele geholt wurden und im Hotel wohnten, verbrachten Wartezeiten meistens in der Kantine, in einem theaternahen Kaffee oder Restaurant. Man kam, klopfte einander auf Rücken oder Schulter, man ging und tat dasselbe. Es war ein Leben bestehend aus Ritualen, die Zusammengehörigkeit vortäuschen sollten, ohne die Leere zwischen dem einen und dem nächsten Applaus wirksam zu überbrücken - dem Konsum von Kaffee und Alkohol Vorschub leisteten, und manche Liaison zur Folge hatten, die einzig aufgrund von Langeweile und Ödnis zustande kam.
Lilias Geschichte mit Bernd entwickelte sich äußerst behutsam, wenigstens von Lilias Seite. Bernd begriff, dass sie ihm nicht nachreisen würde. Demzufolge verlagerte sich seine Hoffnung auf Vorstellungen, die in ihrer Nähe stattfanden. Er klagte, er spähe nach jedem Auftritt nach ihr aus und werde jedes Mal enttäuscht. Er sagte mittlerweile du zu ihr und greinte, er wisse, dass er von ihr nur träumen dürfe, da sie, wie auch er, gebunden sei. Manchmal schrieb er stürmisch, manchmal traurig, resigniert oder romantisch verspielt. Insgesamt meist ungelenk, bedauerte, dass ihm eine eigene Sprache fehle, er nur diejenige der Dichter beherrsche, die er lese.
Dennoch ließ sich Lilia nicht drängen. Sie besuchte selten eine Vorstellung. Und wenn, lief sie gleich nach dem letzten Vorhang weg. Nicht weil sie die Absicht hatte, mit Bernd zu spielen, sondern weil sie auf den Augenblick wartete, der ihnen beiden reif, wie einer der vor Saft strotzenden Pfirsiche aus Lilias Kinderzeit, in den Schoss fiele, ohne Hindernisse und Pannen zu beinhalten.

7. Festspielzeit, auch für Lilia!
Es wurde Sommer: Festspielzeit. Bernd war von Engagements umlagert, Lilia weilte in ihrem Rustico, Pierre-Louis bei der Arbeit. Nun schlug die Stunde null.
Lilia lud Bernd zu sich ein. Denn nun war die Zeit gekommen, auf die sie Jahr um Jahr hingearbeitet hatte. Gelang es ihnen nicht, sich nun zu treffen, würde die Intensität ihrer Sehnsucht sich verflüchtigen. Wie prickelnder Wein, der entkorkt stehen blieb. Die Euphorie der Festspielatmosphäre galt es zu nutzen. Sie würde Anstrengung beflügeln, den Weg der Liebe freischaufeln. Lilia war es todernst damit, auch wenn sie sich hie und da fragte, in welch hirnverbrannten Film sie sich verlaufen habe. Ihr Entschluss stand fest. Sie wollte „es“ wissen, aller Eventualitäten zum Trotz.
In einer Nacht von Samstag auf Sonntag des Monats August sollte es geschehen. Bernd würde nach der Probe losfahren und gegen Abend bei ihr sein. Doch die Frühnachrichten am Radio unterbrach die Meldung, ein Bergsturz habe Straße und Bahnlinie verschüttet, Zugreisende müssten auf Busse umsteigen, und Autofahrer einen Umweg über andere Pässe machen. Also würde Bernd nicht kommen. Und er hätte auch keine Gelegenheit, die Nachricht zu vernehmen, denn er weilte bei der Probe und würde niemanden in sein Vorhaben eingeweiht haben.
Dennoch bereitete Lilia alles für seinen Empfang vor. Was hätte sie sonst tun sollen? Außer Bernd bevölkerte nichts und niemand mehr ihre Tage. Sie schmückte das Rustico mit Blumen, setzte die Minestrone an, hängte den Kessel übers Feuer in den Kamin und stellte Teller und Gläser bereit. Wirklich geschockt über den Misserfolg ihrer Pläne war Lilia nicht. Sie verbrachte zwar eine schlaflose Nacht, während der sie so überwach auf ihrem Bett saß, dass sie nicht einmal Schmerz verspürte. Wirklich geschockt jedoch zeigte sich Bernd. Er machte sich auf den Weg, einen Rosenstrauß auf dem Beifahrersitz. Mehr als eine Stunde stand er im Stau. Der Ferienverkehr war enorm. Dann tauchten die Umleitungstafeln auf, die die Kolonnen schrittweise in Richtung eines anderen Übergangs dirigierten. Auf der Passhöhe zeigte die Uhr auf Mitternacht. Der Verkehr stand still. Es ging weder vorwärts noch zurück. Bernd. Verzweifelt. Wütend. Zerriss unter Tränen die Straßenkarte und zertrampelte die Rosen. Die einzige Gelegenheit, Lilia zu treffen, war vertan. Er kehrte um, erreichte um Vier in der Früh sein Hotel. Um neun begann die nächste Probe. Zu erschöpft um zu schlafen, schrieb er einen herzzerreißenden Brief, den er noch vor dem Frühstück per Express an Lilia sandte. Und den Lilia gegen sechs Uhr am Abend erhielt.
Der Postbote, ein rundlicher, asthmatischer Mann mit Grübchen in den Wangen, der bei seiner Mutter in einem Haus wohnte, dessen Mauern von spinnwebenartigen Rissen durchzogen waren, seitdem die Eisenbahn daran vorüberfuhr, brachte ihn Lilia. Er schwärmte für Lilia. Sein Mund verzog sich bis zu den Ohren, sobald er sie sah. Er gewöhnte sich daran, zu jeder Tageszeit Expressbriefe zu ihrem Haus zu tragen. Denn obwohl Lilia ein Telefon besaß, wollte sie nicht von Bernd angerufen werden. Die Post befand sich im nächsten Dorf. Der Bote musste die Straße hochradeln und zu Fuß das Dorf durchqueren, an dessen Ende Lilia wohnte. Was ihn nicht zu stören schien. Denn nie blieb ein an sie gerichteter Brief über Nacht bei ihm liegen. Er hätte auch nichts dagegen gehabt, Lilias Briefe direkt ins Haus zu tragen und ein bisschen mit ihr darin zu verweilen.
Lilia hatte den Tag so zugebracht wie jeden anderen davor, war mit dem Hund im Wald Holz sammeln gegangen, hatte einen Fensterrahmen repariert, die Asche aus dem Kamin gekehrt, im Nachbardorf eingekauft. Nach innen als loderndes Feuer, nach außen kühl und reserviert, wie nicht vorhanden. Gegen Abend, als sie sicher sein konnte, dass der kleine Strand, wo sie zu baden pflegte, menschenleer sein würde, war sie mit Hund und Tasche über die abschüssigen Ziegenpfade zum See hinuntergerannt wie gejagt, den Boden kaum berührend. Weit hinaus war sie geschwommen, hinein ins Gold der untergehenden Sonne. Der See wurde schwarz. Die Bäume am Ufer schrumpften. Lilia schwamm sich die Seele aus dem Leib, bis ein schlieriges, zähes Etwas sich in ihren Beinen verfing - und sie entsetzt umkehrte, von einer Angst getrieben, als sei der Leibhaftige hinter ihr her. Am Ufer stürzte sie in den Sand, nach Atem ringend, denn nun überfiel sie der Schmerz mit voller Wucht, riss ihr das „Nie mehr, nie mehr werde ich dich in die Arme schließen können“ aus Bernds Brief das Herz in Stücke. Sie raffte Handtuch und Kleider zusammen und hetzte ins Dorf zurück. Aus den Häuschen roch es nach Kaminfeuer und Mahlzeiten. Lilia tastete sich den aus Steinquadern errichteten groben Hauswänden entlang, hie und da unterstützt vom mageren Flackern einer Lampe hinter halb geschlossenen Vorhängen.
Der Kessel mit der Minestrone hing noch im Kamin. Sie trug ihn vors Haus und leerte ihn aus. Katzen, Siebenschläfer, Dachse und Marder mochten sich daran gütlich tun.
Selbst gegessen hatte Lilia seit Tagen kaum einen Bissen. Im Kühlschrank lagen ein hart gekochtes Ei und ein Stück Brot, an denen sie knabberte, wenn ihr zu flau wurde. Zehn Kilos hatte sie verloren während den vergangenen drei Wochen, seit dem Tag, an dem Bernd und sie das Datum seines Besuchs festlegten. Und sie fehlten ihr nicht. Sie setzte sich im Dunkeln an den Kamin, den Hund auf den Knien: Mali, wieder einen Spaniel, ihren zweiten mittlerweile. Drückte ihr Gesicht in sein Fell. Nun begannen ihre Tränen zu fließen, doch nicht für lange. So klein beigeben wollte sie nicht. Auf keinen Fall durften sie einfach die Flinte ins Korn werfen. Lilia machte Licht, setzte sich an den Tisch, konsultierte Kalender und Fahrplan und vertagte kurzerhand Bernds Besuch um eine Woche. Bis dahin würden wenigstens die Geleise geräumt sein. Lilia war entschlossen, dem Schicksal zu trotzen. Und sie klang so überzeugend, dass Bernds Mut zurückkehrte. Der folgende Samstag war tatsächlich vorstellungsfrei. Wenn er nicht nach Hause führe, müsste es klappen.
Lilia saß nun oft im Dunkeln am Kamin, die Füße nah an der Glut, denn die Nächte wurden kühler. Ein Hauch von Herbst kündigte sich an. Durch das Fenster streifte sie der Duft satter Trauben, machte sie trunken, weckte ihre Gier nach prallem Lebendigsein. Nach Höhenflügen jenseits sturer Hindernisse. Jenseits des Kriechens auf schlammigem Grund, wie ein gestrandetes Insekt. Wie mühsam Leben doch war! Wie erschöpfend der Kampf um ein bisschen Würze in Tagen, die nicht reifen wollten, wie schlieriger Nebel Hoffnung verhüllten.
Bevor die Sehnsucht ihre Atmung zu verkleben drohte, holte sich Lilia Block und Stift, schloss die Augen und senkte den Blick in sich hinein wie in einen Krater: in rabenschwarze Dunkelheit. Atmete an gegen die drohende Depression. So lange, bis sich schemenhaft Raum in ihr abzeichnete, sich ein Korridor auftat, der behutsam nach unten führte. Und sie sich von hinten in ihm entlanggehen sah, die Füße klanglos tappend durch den Dämmer des Schlunds. Gedanken und Gefühle erloschen. Nur Wort um Wort ereilte sie, mühelos, wie von selbst. Lilia pflückte die Worte wie Beeren, tastete nach Block und Stift und schrieb sie nieder. Pflückte weiter, schrieb auf. Ein letztes Züngeln aus der Glut erlaubte ihr einen Blick aufs Papier, auf die drübergestreuten Sätze. Lilia wendete es um, notierte, bis irgendwann der letzte Satz geschehen war. Der letzte Punkt gesetzt. Und Lilia vernahm, der Vorgang sei zu Ende.
Sie ließ sich Zeit, bevor sie die Augen öffnete, die Lampe anzündete und das Entstandene las. Es war ein Gedicht, aus der Not vor dem Ertrinken gerettet. Woher es kam, fragte Lilia nicht. Dankbar für den Anker, erstaunt über das Geschenk, schickte sie es an Bernd. Denn nur ihm gehörte es zu. Und Bernd jubelte, als er es las. Es löschte jeden Zweifel und alle Ängste, erneut zu scheitern, in ihm aus.
Endlich war wieder Samstag. Der Tag prangte und duftete. Der See funkelte wie ein Diamant. Lilia stand auf dem Balkon, trank sich voll, genoss den Anblick. Nicht die Spur einer Besorgnis haftete ihr mehr an. Sie rief Mali und nahm den letzten Gang unter die Füße. Langsam, Schritt um Schritt auskostend, stieg sie bergan. Bis hinauf zu einer über dem Dorf stehenden Bank, setzte sich hin, Mali im Arm. Augenblick um Augenblick zerrann, leicht wie Sand. Nichts gab es mehr zu tun. Lilia atmete aus. Und mit der ganzen Inbrunst ihrer Liebe zu Bernd wiederholte sie innerlich den Schwur, dass, was immer auch geschähe; wie hoch immer auch der Preis dafür wäre, sie würde den Weg zu ihm gehen, bewusst und ohne zu zögern. Das fühlte sich unglaublich einfach an und nicht im Geringsten pathetisch. Es führte schlicht kein Weg an Bernd vorbei: nur einer durch ihn hindurch.
Als die Sonne sich gegen den Bergkamm neigte, spazierte Lilia zurück. Ein Taxi wendete auf dem Parkplatz vor dem Dorf. Der Fahrer, den sie kannte, winkte ihr zum Gruß. Lilia erklomm das kurze, steile Stück zum ersten Rustico und tauchte in die kühle, schattige Gasse zu ihrem Haus ein. Die unebenen Steine sandten Wärme durch die dünnen Sohlen ihrer Sandaletten. Kein Mensch war zu sehen. Ab und zu drang Geschirrgeklapper durch ein geöffnetes Fenster. Die Sonne schleuderte die letzten Strahlen über die Dächer. Aus dem Brennkeller duftete es nach frischem Grappa.
Lilia ging langsam. Ihr blieb noch fast eine Stunde. Um sechs Uhr wollte Bernd eintreffen. Als sie vor ihrem Häuschen um die Ecke bog, und nach rechts die Sicht auf den See wieder frei wurde, erblickte sie einen Mann, der nach Hausnummern Ausschau hielt. Lilia, unfähig zu denken, stand bockstill. Sie hörte leise ihren Namen. Der Mann trat auf sie zu. „Ich bin ja noch nicht gewaschen“, durchfuhr es Lilia. Bernd zog sie in die Arme, küsste sie, und Lilia glitt sanft in unnennbare, schimmernde Weiten. Mann und Welt, Sehnsucht und Schmerz waren ausgelöscht. Und es erklang voller Liebe in ihrem Herzen der Satz: „Nicht den Mann hast du gesucht, sondern etwas, das weit, weit jenseits von ihm liegt.“ Lilia hörte es ohne Erstaunen.
Wie aus einer Ohnmacht erwachte sie in den Armen von Bernd, der sie vom Boden hochgehoben hatte und immer noch küsste, als wolle er nie wieder damit aufhören. Sie löste sich von ihm und wurde schlagartig inne, welches Leidenspotenzial erfüllte Wünsche in sich bargen. Doch nur für einen Augenblick, denn Bernd legte einen buschigen Strauß Rosen in ihren Arm und flüsterte: „Sie brauchen Wasser, bitte.“ Kaum im Haus - die Rosen mussten sich gedulden - zerschmolzen die beiden erneut in einem Kuss - wie Wasser in Wasser rinnt. Die Zeit stand still, als sollte sie nie mehr zu fließen beginnen.
Es war Nacht, als sie sich voneinander lösten. Die Blumen erhielten eine Vase. Lilia entfachte das Feuer unter dem Suppentopf. Bernd entkorkte den Wein. Alles äußerst behutsam, um ja nicht zu stören. Die Magie nicht zu zertrümmern, deren Zerbrechlichkeit sie beide aus Erfahrung kannten, Bernd aus seinem Umgang mit der Musik von Dichtung, Lilia durch ihren Gesang. Leise und leicht bewegten sie sich aneinander vorbei, wie Tänzer. Einer Choreographie gehorchend, die von Scheu herrührte, doch auch vom Bedürfnis, so lange als irgend möglich die Zeit am Fortschreiten zu hindern. Sie schauten einander an, zuerst verhalten, dann mutiger. Wie groß Bernd war! Wie klein im Vergleich dazu Lilia. „Viel zu groß und viel zu klein füreinander“, dachte Lilia. Sie aßen und tranken still. Dann wollte Lilia kurz duschen. „Allein“, bat sie. Um durchzuatmen. Um noch einmal alle ihre Sinne auf den einen Punkt, genannt „Bernd“ zu bündeln, und hinterher den Mann in sich zuzulassen, durch sich hindurchzulassen, ohne Gedanken an irgendein danach.
Es wurde die Erfüllung ihrer Wünsche, auch wenn sie sich von außen dabei zuschaute und wahrnahm, was nicht passte. Als Bernd seine Finger zwischen die ihren schob, fuhr ein schneidender Schmerz durch ihre Gelenke. Und sie würde voller blauer Flecken sein, wenn er sie wieder verließe. Sie flüsterte es ihm schelmisch zu, als sie mit ihren Lippen seine buschigen Brauen nachzeichnete, seine Locken durch ihre Finger gleiten ließ und seinen Körper bestaunte, den er vom Adam aus der Sixtinischen Kapelle entliehen zu haben schien. Und irgendwann nannte sie ihn zum ersten Mal bei seinem Namen. Und er hörte ihn. Er war leibhaftig da. Ihretwegen. Nach sechzehn Jahren. Seitdem sie ihn das erste Mal gesehen hatte: es war kein Traum.
Später wünschte sich Bernd einen Spaziergang durch die Gegend, ein Glas Wein in einem Grotto, damit es sich anfühle, als hätten sie Zeit, als sei die Nacht noch viele Stunden lang. Im Schein einer Taschenlampe zogen sie los, bergauf und bergab, auf Pfaden, die nur Dorfbewohner kannten. Bernd hielt Lilia eng an sich gedrückt. Es bestand die Gefahr von Schlangen oder anderem Getier, auf das zu treten wenig ratsam wäre. Sie sahen nur das Rund von dünnem Licht zu ihren Füssen, in das hinein sich manchmal Schuhspitzen schoben. Kastanien, Feigenbäume und süß duftende Blütenstauden bargen sie wie ein Tunnel. Gelegentlich warf der volle Mond einen Armvoll Strahlen durch ein Loch im Blätterdach.
Als die Schlucht sich weitete, öffnete sich eine Anhöhe vor ihnen, der Vorhof einer Kirche, deren Kuppel in fahlem Weiß erstrahlte, wie von innen erleuchtet. Eine Mauer darum herum verhinderte den Sturz in die Tiefe. Lilia setzte sich darauf, ließ die Füße baumeln. Bernd stand hinter ihr und legte die Arme um sie, schwere Arme, unter deren Gewicht Lilia ihr Herz in lauten Schlägen hämmern hörte - in dieser Zeit dazwischen, die den Atem verlangsamte und Wahrnehmung silbern machte, durchsichtig wie Eis, und leer - schaurig und beseligend zugleich. Im Herzkleinen waren sie eins in eins, und würden doch immer zwei bleiben. Getrennt in ihrer eigenen Welt. Die nie wirklich kommunizierbar wäre. In keiner Sprache. Keinem Wort.
Im Grotto saßen sie beim Wein und erzählten einander das Nötigste. Auf dem Rückweg stolperte Lilia und wäre beinahe hingefallen. Bernd, in Panik, riss sie in seine Arme. Wie vertraut sie einander waren und kannten einander doch kaum. Die Nacht dehnte sich, ihnen zuliebe, in jede nur mögliche Richtung.
Gegen Morgen nickte Bernd kurz ein. Lilia verschwand in seinen Armen, fest umschlungen. Nie zuvor hatte sie jemandem erlaubt, sich so nah in ihre Nächte zu drängen. Ihre Wange lag auf seiner Schulter. Sein Kopf ihr zugewandt. Sein Atem badete ihre Stirn. Weit und offen ruhte sein Gesicht im Kissen. Jung sah es aus, unberührt. Wie eine Landschaft im Morgentau. Lilia zeichnete behutsam mit ihrem Finger seine markante Nase nach, die Lippen. Wie seltsam, dass eine Generation an Jahren zwischen ihnen lag. Als sie ihn sachte küsste, wachte er auf. „Bernd, es ist Zeit“, flüsterte sie. Sein Gesicht zerbrach in tausend Stücke. „Nein, nicht“, stöhnte er und klammerte sich an sie wie ein Fallender.
Noch einmal stürzten sie ineinander. Tauschten schluchzend Schwüre aus, die nie zu halten sein würden. Versicherten einander unverbrüchlicher Liebe. Wohl wissend, dass die Zeit sie zerpflücken werde. Das Dorf schlief noch, als sie denselben Weg, den sie in der Nacht gegangen waren, unter die Füße nahmen. Es war kalt. Die Berge standen gläsern und schroff im fahlen Licht der sich langsam erhebenden Sonne. Unwirklich. Gespenstisch für die beiden Überwachen. Die wie vom Tageslicht ertappte Diebe hangabwärts hetzten. „Komm ein Stück mit“, bat Bernd Lilia und kaufte ihr und Mali eine Fahrkarte. Sie kauerten sich aneinander. Bernd legte seine Wange auf Lilias Kopf und seufzte: „Wie soll er heißen, wenn es ein Junge wird?“ „Es wird kein Junge, Bernd, und auch kein Mädchen.“ „Einen Jungen habe ich mir zeitlebens gewünscht“, entgegnete Bernd. Sein Geruch hüllte Lilia ein wie ein Mantel. Wie gern hätte sie seinen Wunsch erfüllt, wären sie einander zu einer anderen Zeit und unter anderen Umständen begegnet.
Bis zur Ankunft des Schnellzugs blieb ihnen etwas mehr als eine Stunde. Sie frühstückten, doch Lilia brachte kaum einen Bissen hinunter. Um Bernd zu bewegen, einzusteigen, musste der Schaffner zweimal pfeifen. „Avanti, Signore“, rief er ihm zu. Bernd riss sich von Lilia los. Sprang auf den schon anfahrenden Zug. Winkte mit beiden Armen - bis eine Schleife den Wagen Lilias Blicken entzog.
Lilia stand da, als sei alles Leben aus ihr gewichen. Irgendwann löste sie sich aus ihrer Starre und fing an zu rennen. Auf einer Anhöhe, von der aus sie den Bahnhof sehen konnte, warf sie sich ins Gras, den Hund in den Armen und weinte, weinte, bis ihre Tränen alle waren. Dann lief sie keuchend den Weg zurück. Rammte die Türe hinter sich ins Schloss und verriegelte sie. Als könne sie dadurch das Fortschreiten des Lebens unterbinden.
Bernd hatte versprochen, Lilia jeden Tag zu schreiben. Und das hielt er auch ein. Und natürlich schrieb Lilia jeden Tag zurück. Während der Festspielzeit funktionierte das problemlos. Erst als wieder Auslandsengagements folgten, und die Distanzen zwischen ihnen sich vergrößerten, blieben sie tageweise ohne Nachricht voneinander. Für Lilia ein Graus. Stunden voller Leiden. Die sie marterten, als brate sie in siedendem Öl. Das Gleiche traf auf Bernd zu. Er zermürbte sich in Sorge um Lilia. War ihr etwas zugestoßen? Liebte sie ihn nicht mehr? Hatte sie nur mit ihm gespielt? Lilia überraschten diese Qualen nicht. Sie entsprachen ihren Erfahrungen von Leben, den Schilderungen der Dichter. Und doch brauchte sie alle, ihr zur Verfügung stehende Kraft, um mit ihnen klarzukommen. Dass sie allein war, empfand sie als Segen. So musste sie niemandem gegenüber Rechenschaft ablegen.
Tagsüber arbeitete sie am Haus, putzte, räumte um, nähte Vorhänge. Vor dem Eindunkeln lief sie zum See hinunter und nach dem Schwimmen in Rekordgeschwindigkeit den Berg wieder hoch. Herz und Nerven glühten. Nachts lag sie wach oder saß am Kamin. Nach Worten. Nach Versen fahndend. Um den Faden nicht zu verlieren. Auf der Höhe des Erlebens zu bleiben. Mit der nächsten Post ging das Entdeckte an Bernd, versetzte ihn in Erstaunen, so wie Lilia, die selbst nicht wusste, wie ihr geschah. Die Gedichte lösten tiefe Dankbarkeit in ihr aus. Sie wirkten als Medizin gegen das Verbranntwerden. Und Bernd spendeten sie Freude und Zuversicht. Die Gewissheit, dass Lilia ihn liebte. Und sie gaben ihrer Beziehung eine zusätzliche Dimension: Sie erfüllten Bernd mit Bewunderung. Mit Achtung. Er fühlte sich geehrt, dass er diese, bisher unentdeckte Gabe in Lilia zum Blühen bringen durfte. Lilias Gedichte forderten den Kritiker in ihm heraus, den Interpreten. Doch es schmerzte ihn, dass er sie nicht herumzeigen durfte.
Bernd lud Lilia zu den Festwochen ein. Sie sollte ihn auf der Bühne sehen. Und er wollte sie von der Bühne aus sehen, nun, da sie zueinander gehörten. Doch Lilia gehörte auch zu Pierre-Louis. Und Pierre-Louis wohnte seit kurzem ebenfalls in ihrem Rustico. Und wusste um Bernd. Nur nicht, dass Bernd bei Lilia übernachtet hatte. Das musste Lilia Pierre-Louis gestehen, als sie ihn darum bat, sie für zwei Tage ziehen zu lassen. Es traf ihn hart, wenn auch nicht unvorbereitet. Er war ein zu guter Beobachter, um nicht zu wissen, was in Lilia vorging. Doch er wusste auch, sie würde zu ihm zurückkommen. Die Geschichte mit Bernd entbehrte der Zukunft. So wie früher die Geschichte mit Abrashka. Lilia sammelte Erfahrungen, die sie brauchte, um daran zu reifen. Sie war eine Reisende - im Gegensatz zu ihm, dem Sesshaften. Und Reisende durfte man nicht aufhalten. Also willigte Pierre-Louis ein. Er würde dafür drei Tage in Venedig zubringen und Mali mitnehmen. Und dem stimmte Lilia zu.
In der Nacht vor Lilias Abreise ergoss sich ein Gewitter um das andere über die Südschweiz. Verursachte Schlammlawinen. Bäche traten über die Ufer. Züge konnten nicht fahren. Straßen waren gesperrt. Am Abend zuvor hatte Lilia für Bernd einen prunkvollen Strauß von hellblauen, rosaroten und dunkelvioletten Hortensien, durchsetzt mit Lorbeerzweigen zusammengestellt. Um Mittag würde Pierre-Louis sie zum Bahnhof bringen. Vorausgesetzt, die Geleise blieben vom Unwetter verschont. Lilia erstarrte beim Gedanken, nicht fahren zu können.
Der Regen ließ nach. Den Strauß umwand sie mit dickem Packpapier. Ihre Tasche drückte sie gegen die Brust, als sie im Laufschritt vom Auto zum Schalter rannte, schon nach wenigen Schritten nass bis über die Knie. Sie winkte Pierre-Louis zum Abschied und fühlte einen Stich im Herzen, als er den Motor startete. Tränen umwölkten ihren Blick. Dann bestieg sie den Zug, als wechsle sie von einer Rolle in eine andere und bleibe sich dennoch gleich. Ihre Gefühlslage wendete sich schlagartig. Ekstase vibrierte in ihren Adern. Lilia wunderte sich über das Ausmaß an Empfindungen, die ihr zur Verfügung standen - weit gefächert wie das Klangspektrum einer Orgel, zumindest eines beträchtlichen Teils davon. Zog sie aus dieser Fülle die Kraft weiter und weiter zu gehen, ohne Angst vor der Konsequenz?
Auch in der Festspielstadt nieselte es. Es war kalt, und übelriechender Nebel hing in den Straßen. Lilia sollte Bernd um sechs Uhr treffen, zwei Stunden vor der Vorstellung, so dass ihnen Zeit bliebe, sich ineinander wiederzufinden. Sie hatte noch eine gute halbe Stunde bis dahin. Lilia setzte sich in ein Kaffee, zog das, zu Fetzen zerfallene, immer noch feuchte Packpapier vom Strauß und stellte ihn auf einen Stuhl neben sich. Seine Ungewöhnlichkeit zog die Blicke auf sich. Doch Lilia ließ sich auf keinen Gesprächsversuch ein.
Sie nippte an ihrem Tee. Ihre Finger glitten über das Glas. Dem Henkel entlang. Und Lilia schaute ihnen versonnen dabei zu. Als seien sie Teil eines Films und gehörten gar nicht ihr. „Wessen Hand ist das“, fragte sie sich, „meine kann es nicht sein, denn sonst könnte ich sie nicht von außen anschauen.“ Unvermittelt sah sie sich in ihrem Körper wie in einem Gehäuse sitzen. Und auch das gehörte nicht ihr. Ein Ding saß auf einem Stuhl, dessen Bewegungen sie beobachtete wie die Bewegungen von etwas Fremdem. Lilia staunte sich an. Etwas in ihr sah dieses leere Gehäuse. Das ihren Namen trug. Und für das sie verantwortlich zu sein schien. Obwohl sie es nicht wirklich kannte. Und wenige Minuten entfernt von ihr wartete ein Mann namens Bernd auf sie, und bewohnte dieselbe Sorte Gehäuse. Und wem begegnete sie, wenn sie auf ihn traf?
Lilias Augen folgten weiterhin dem, das Glas erkundenden Finger. Im ausgetrunkenen Teil spiegelte sich die Cafeteria. Zeichnete Menschen und Dinge als vorüberhuschende, substanzlose Schatten in einen leeren Raum. Als sich ein älterer Mann neben ihr geräuschvoll räusperte, schreckte Lilia auf und schaute auf die Uhr. Es war Siebzehnuhrfünfundvierzig. Ihr Herz schlug Alarm. Und ihre Wahrnehmung veränderte sich abrupt. Sie fand sich übergangslos in ihrem Körper wieder - in diesem mysteriösen Etwas, in dem es vibrierte und sprudelte, als sei es anfüllt mit Champagner. Hastig legte sie das Geld für den Tee neben ihr Glas. Schnappte sich Strauß und Tasche und lief wieselflink über die Straße und unter das Dach der hölzernen Brücke, an deren Ende Bernd sie erwarten wollte. Je näher sie dem Treffpunkt kam, desto langsamer wurde ihr Schritt. Sie versteckte sich hinter einem der Pfeiler. Unter einem der Giebelbilder. Auf dem ein Gerippe auf einer Schindermähre Söldner auf einem Schlachtfeld mit blinkender Sense niedermähte. Auf dem Vorplatz vor dem Theater schritt Bernd, der Mann ihrer Träume. unruhig auf und ab. Gedankenverloren schaute Lilia ihm zu.
Als vom nahen Kirchturm her sechs Schläge erklangen, flog sie, wie aufgehoben und vom Wind in seine Arme geweht, auf Bernd zu. „Schau mir in die Augen“, flüsterte Bernd, „siehst du darin, wie sehr ich dich liebe?“ Lilia hob den Kopf. Konfrontierte sich mit seinem weit aufgerissenen, brennenden Blick. Dem Flehen. Dem rückhaltlosen Begehren darin und dachte: „Und wo ist die Liebe: wie sähe die aus?“ Der Gedanke streifte Lilia nur, störte nichts in ihr auf und verstummte von selbst, als sie in Bernds Kuss versank. Bis ein Polizist sie sanft zur Seite schob, weil ein Auto dort, wo sie standen, parkieren wolle. Bernd nahm Lilias Strauß an sich und drückte ihn ans Herz. „Sträuße, die so lange halten und so spektakulär sind, kriege ich nur von dir“, sagte er zärtlich. Er legte den Arm um Lilia und führte sie ins Hotelzimmer - ein mit bemalten antiken Bauernmöbeln bestückter Raum, das breite Bett bereit zur leidenschaftlichen Begrüßung.
Später, für den Abend zurechtgemacht, folgte sie Bernd hinter die Bühne und hinauf in seine Garderobe - wo er gleich damit anfing, sein frisch gebügeltes Kostüm von der Stange zu nehmen, es zurecht zu legen und sich zu schminken. Diese Wandlung vom Geliebten zum professionellen Darsteller vollzog sich in Sekundenschnelle, was Lilia, die dieselbe Wandlungsfähigkeit besaß, nicht erstaunte. „Meine Frau wird hier sein, auf dem Platz neben deinem“, bemerkte er sachlich. „Deine Karte ist auf meinen Namen reserviert. Du kannst sie an der Kasse abholen.“ Mit einem letzten Aufwallen verabschiedete er sich von Lilia. Und als Lilia sich an der Tür nochmals nach ihm umdrehte, war er schon so vertieft in das Ziehen eines Lidstrichs, so unansprechbar konzentriert, als existiere sie nicht.
Lilia besorgte sich die Karte, setzte sich in einen Sessel im Foyer, zog ein Buch aus der Tasche und vertiefte sich in die Lektüre. Ohne Buch ging Lilia nie aus dem Haus. Ihr Lesehunger war so unstillbar wie je. Doch diesmal las sie nur Buchstaben, die keinen Sinn ergaben, da sie sich nicht zu Wörtern und Sätzen fügten.
Als sie das Buch schloss, um die Zeit bis zum Vorstellungsbeginn mit Warten zu verbringen, fiel ein von Bernd an sie gerichteter Brief aus den Seiten, den sie am Morgen vor ihrer Abreise erhalten, und in dem Bernd ihr eine gute Reise gewünscht und sie angefleht hatte, ja zu kommen, da er sonst vergehe: so sehr verzehre er sich nach ihr, dass er sogar fürchte, seine Arbeit leide darunter. Lilia blühte auf, wenn sie solche Sätze las. Dass sie dieser Aussagen für würdig befunden wurde, erschien ihr als phänomenal - selbst wenn gewisse Wendungen überbeansprucht und verbraucht klangen, und weit hinter dem sich Ereignenden herhinkten. Kurz vor Vorstellungsbeginn setzte sich Lilia an ihren Platz neben Bernds Frau, einer aparten, attraktiven Dame mit blondem, schulterlangem Haar und den spitz zulaufenden Füssen einer Ballerina. Sie trug silberne Sandalen mit Absätzen, war um einiges älter als Lilia, erregte Aufsehen und wurde von allen Seiten begrüßt.
Lilia, die wieder zu lesen versuchte, hielt ihr Buch in beiden Händen, damit Bernds Briefe, von denen sie mehrere zwischen die Seiten gesteckt hatte, nicht zu Boden rutschten. Bernds Schrift war so markant wie seine übrige Erscheinung und wäre sofort erkannt worden. Gespielt wurde ein nordischer Klassiker. Schwerblütig. Tragisch. Ein Kammerspiel und Paradestück für Schauspieler. Es mutete Lilia seltsam an, dass der Liebhaber auf der Bühne derselbe sein sollte, in dessen Umarmung sie eben noch gelegen hatte. Bernd spielte mit der gleichen Unmittelbarkeit, mit der er geflüstert hatte: „Schau mir in die Augen. Siehst du darin, wie sehr ich dich liebe?“ Es schien Lilia, als nehme das Drama den Verlauf ihrer eigenen Geschichte vorweg.
Nach dem letzten Vorhang sehnte sich Lilia nach ihrem Zimmer. Wie um Schutz zu suchen, ließ sie ein Bad einlaufen. Sie fröstelte. Fühlte sich ausgelaugt. Als habe sie sich übernommen. In der Wärme des Wassers, das sie umhüllte wie duftendes Fell, entspannten sich ihre Nerven. Sie war lediglich im Theater gewesen, dachte sie. Das Gesehene betraf sie nicht. Was geschehen musste, würde geschehen. Noch hatten sie Zeit.
Lilia war nahe am Einschlafen, als Bernd an die Tür klopfte, zu ihr ins Bad stürzte und vor der Wanne auf die Knie. Er hob sie aus dem Wasser und trug sie zum Bett. Lilia wartete mit geschlossenen Augen, bis er sich entkleidet hatte. Ihr war als schwebe sie. Nichts, gar nichts konnte sich nun mehr zwischen sie schieben. „Mein Glück“, raunte Bernd an ihrem Ohr.
Später in der Nacht suchten sie das Restaurant des Hotels auf, um etwas zu essen. Bernd war hungrig nach drei Akten sich unwiderruflich zuspitzender Tragödie. Der Wein, von dem Lilia, da sie fast nichts aß, nur wenig kostete, löste die Anspannung. Die Scheu. Die sich bei Lilia immer wieder Bernd gegenüber einstellte. Auch wenn sie, wie eben gerade, nur kurze Zeit voneinander getrennt gewesen waren. Noch war an der Beziehung zwischen ihr und Bernd nichts für sie selbstverständlich. Verspürte sie das ausgeprägte Bedürfnis, die Zeit mit ihm so viel als irgend möglich zu verlangsamen. Sie sollte nicht verlodern, ohne wenigstens eine Zeitlang kraftvoll und beständig gebrannt zu haben. Die Ereignisse durften Lilia nicht durch die Finger rieseln. Sie würde sie sonst nicht im Herzkleinen ausformen können, als die Kostbarkeit, die sie für sie darstellten. Das Einmalige, das ihr Leben nie würde wiederholen wollen, noch können.
Nun lag eine weitere gemeinsame Nacht vor ihnen. Sie verbrachten sie in Bernds Zimmer, schräg gegenüber demjenigen von Lilia. Einem normalen Zimmer mit Doppelbett. Ohne besonderen Schmuck.
Einmal. Als sie einander ausatmend in den Armen lagen. Bedauerte Bernd, nicht mehr so jung zu sein wie Lilia. Er erzählte aus seinen Anfängen am Theater, als er die Rollen der tragischen oder komischen Liebhaber gespielt habe. „Damals hätten wir einander begegnen sollen. Vor Sonnenaufgang wurde ich nie müde. Ich hätte dich stundenlang beglücken können. Es tut mir so leid, dass mir nun engere Grenzen gesetzt sind.“ Lilia erschrak ob dieses vehement geäußerten Bekenntnisses. Offenbar fand Bernd, er leiste nicht genug. Er vergelte Lilia das, was sie ihm schenke, nur mangelhaft. Und Lilia konnte seine Bedenken nicht zerstreuen. Denn in seiner Welt schien es, ein optimaler Schauspieler müsse auch ein optimaler Liebhaber sein. Zu dem selbstverständlich optimales Stehvermögen gehöre. Also Sex vom Eindunkeln bis zum Morgengrauen. Eine Vorstellung, die in Lilia altbekannte Ängste wachrief. Das Grauen vor Vereinnahmung und der Langeweile gegenüber dem Ewiggleichem - denn auch verschiedene Stellungen beim Sex erzeugten nicht mehr Würze - geschweige denn mehr Liebe, fand sie. Es legte sich wie ein Hauch ein feines Netz von Betrübnis über ihr Zusammensein. Lilia konnte noch so oft wiederholen, wie froh sie darüber sei, dass sie sich einander leise und behutsam hingeben könnten. Ohne wie Wilde übereinander herzufallen. Sie konnte Bernds Wehmut nicht zerstreuen. Dass sie fürchtete, Bernds Kraft hätte sie erdrückt. Sogar fast zermalmt, wäre sie ihm früher begegnet, verschwieg sie. Wieviel Offenheit vertrug die Liebe? Wieviel Offenheit vertrug das Zusammensein zweier Liebender? Sie wusste es nicht. Worte zerbrachen so leicht den Bann stillschweigenden Einverständnisses.
Während dieser Nacht lernten Lilia und Bernd wieder ein bisschen Alltag voneinander kennen. Und Lilia bemühte sich darum, gerade nur so viel davon zuzulassen, dass der Zauber zwischen ihnen nicht durch die Gier nach Befriedigung Schaden erlitt. Es glich dem Tanz auf hohem Seil. Doch es würde verhindern, dass sie einander verletzten. Dass vor allem Lilia verletzt würde. Wurzelte Bernds Leben doch in einer sicher gefügten Karriere. Wogegen Lilias Existenz noch in gar nichts wirklich Fuß gefasst hatte. Wovon sollte sie zehren, wenn sie einander wieder ziehenlassen mussten?
Deshalb setzte Lilia alles daran, dass ihre Begegnung für sie nicht in Beliebigkeit ausartete. Dass keine Affäre daraus wurde. Und Bernd nahm das deutlich wahr. Obwohl Lilia es nur andeutungsweise anklingen ließ. Er fragte erstaunt: „Woher weißt du das alles? Du bist doch noch so jung.“ „Du musst nur hinschauen, genau hinschauen auf das, was läuft. Dann zeigen sich die Dinge wie von selbst“, flüsterte Lilia, „in vielen, vielen Schattierungen. Und du musst nur die richtige wählen, um den Verlauf einer Geschichte entsprechend zu lenken.“ Bernd schwieg. Sie erscheine ihm wie ein Wesen aus einem Raum zwischen den Zeiten. Jemandem wie ihr sei er noch nie begegnet. Sie wecke in ihm Gefühle und öffne Kammern, die er bis dahin nicht wahrgenommen habe. Er fühle sich auf eine Weise von ihr durchschaut und verstanden, die ihm fast Angst mache. Sie berühre Stellen in ihm, zu denen sonst nur die Dichter Zugang hätten, raunte Bernd zwischen zwei Küssen. Sein Körper war weich und fließend geworden. Und als er sie mit äußerster Sorgfalt, langsam und staunend in sich schloss, hauchte er in ihr Ohr: „Melusine, meine Melusine, wem habe ich dich, wem habe ich dieses Wunder zu verdanken?“
Nach dem Frühstück und vor dem Beginn seiner Probe, war es diesmal Bernd, der Lilia zum Bahnhof brachte. Sie hatte sich für die Reise zu ihm eine elegante Reisetasche aus grauem, faserigem Stoff mit Lederbeschlägen gekauft, die Bernd mit abgespreiztem Finger trug, und die an ihm neckisch aussah wie eine Damenhandtasche. Und wieder ging es wie ein Riss durch sie hindurch, als sie sich auf dem Trittbrett voneinander lösten, bevor die Türen mit derbem Krachen zuschlugen. Während dem der Zug sie in Richtung Süden davontrug, schrieb Lilia seitenlang an Bernd. Und am darauffolgenden Tag erhielt sie Seitenlanges von Bernd. Er erzählte, er habe die morgendliche Probe erlebt wie in Trance, habe sich unfassbar leicht und sicher gefühlt. Es sei gewesen, als liege sie immer noch in seinen Armen. Nicht ein einziges Mal habe ihn der Regisseur unterbrochen oder korrigiert. Ihm am Bühnenausgang nur schmunzelnd zugenickt, mit den Worten: „Du musst eine wunderbare Nacht verbracht haben.“
Bernd und Lilia hatten vereinbart, dass sie sich vor Ende der Festwochen noch einmal treffen würden. Diesmal brachte Bernd Lilia in einem Hotel direkt über dem Wasser in einem Doppelzimmer unter, das er auch selbst bewohnte und schon öfter bewohnt hatte, wie er Lilia erzählte. Es war weitläufig, enthielt antike Möbel und eine Vitrine voller porzellanener Kostbarkeiten. Zwei Flügeltüren öffneten sich auf einen Balkon mit barockem, schmiedeeisernem Geländer, unter dem sich der Fluss, unter der orangen Pracht der sinkenden Sonne, träge, wie flüssiges Blei dahinwand. Der Tag war brütend und stickig gewesen. Nun umwehte eine feine Brise die beiden, sich in den Armen Liegenden, bis Bernd Lilia bedeutete, er müsse sich sputen. Die Badewanne nahm sie zusammen auf. Und schon eilte Bernd zum Theater, währenddessen Lilia sich langsam ankleidete und schmückte. Sie fühlte sich rundum glücklich, und wollte das durch ihre Aufmachung auch kundtun. Zu diesem Zweck streifte sie ein violett-, rot- und schwarzgemustertes Kleid aus fließendem Stoff über den Kopf, das ihre Brüste und die schlanke Taille umschmeichelte und bis auf die Füße fiel. Dazu passten schwarze Ballerinas, lange Ohrgehänge in Form eines Pfauenrads, geschmückt mit Steinen in denselben Farben wie das Kleid und ein dreieckiger, locker gehäkelter Schal aus glänzendem Garn mit Fransen, über den Lilias bis fast zur Taille reichendes, glattes Haar sich wie Seide ergoss. Lilia betrachtete sich im Spiegel, der in geschnitztem, goldenem Rahmen neben dem Frisiertisch auf dem Boden stand und gefiel sich sehr. Sie drehte eine Pirouette, und das Kleid drehte sich mit ihr. Sie weigerte sich, an ein Morgen zu denken, lief aus dem Hotel, durch Gassen zu einer Brücke, an deren Geländer sie sich lehnte, auf das Wasser hinunterstaunend. In Stücken und Gedichten, vorwiegend aus der Zeit der Romantiker, ersäuften sich Liebende wie sie, wenn der Rausch erschöpft war, und verknöcherter Alltag sie ihrem Wahn entriss. In Lilia lächelte jede Zelle beim Gedanken daran: Egal was geschah: umbringen würde sie sich deswegen nicht.
Unversehens wurde Lilia angesprochen. Ein junger Herr stand neben ihr und entschuldigte sich dafür, dass er sie aus ihren Gedanken aufschrecke. Er habe sich getraut sie anzusprechen, weil sie so glücklich aussehe, und er eine überzählige Karte fürs Symphoniekonzert habe, die er ihr schenken möchte. Oder genauer: Er möchte sie einladen, das Konzert mit ihm zusammen anzuhören. Lilias Lachen ließ ihre Ohrringe wild vor- und zurückschaukeln. „Ich bin doch schon verabredet“, sagte sie mit einem Ausatmen, das sie fast zerplatzen ließ vor Glück. Der Herr bedauerte das sehr und schaute ihr versonnen nach, als Lilia leichtfüßig davontanzte. Trunken von der Aussicht auf den Abend. Die Nacht. Die Arme des Geliebten. Das Aufschäumen des Bluts in ihren Adern. Und das sich Ergießen im anderen, bis es einen selbst nicht mehr gab.
Diesmal holte Lilia Bernd nach der Vorstellung in seiner Garderobe ab, zu der ein direkter Zugang aus dem Zuschauerraum des Theaters führte. Ihre Aufmachung begeisterte ihn, und er fand, es umwehe sie wirklich etwas von einer Zigeunerin - nebst dem Melusinenhaften - was in Lilia helles Gelächter erzeugte, als sie versuchte, die beiden Frauentypen miteinander zu vereinbaren. Sie gingen Hand in Hand durch die Stadt. Zeigten sich zum ersten Mal in der Öffentlichkeit. Was Bernd zur Feststellung bewog: Er stehe zu ihr und möchte ihr das auch zeigen. Mitten auf der Brücke zog er sie in die Arme und küsste sie ausgiebig. Lilia erschreckte Bernds plötzliche Manifestation offenkundigen Besitzanspruchs. Sie versuchte sich loszumachen. Das grelle Licht der Straßenbeleuchtung flößte ihr Angst ein. So als stünden sie zur Schau gestellt im Ring: allen Blicken preisgegeben. Für sie ging alles viel zu schnell.
Lilia, im Innersten getroffen, im Schutzlosen berührt, sann auf Flucht. Es klirrte in ihren Ohren, als falle ihr Herz in Scherben. Sie klammerte sich ans selbe Brückengeländer, über das sie sich, nur Stunden zuvor, gelehnt hatte, schmetterlingsleicht, trunken vor Glück. Tränen rollten über ihre Wangen. Bernd, der nicht wusste, wie ihm geschah, und was er verbrochen habe, legte die Arme um sie und sagte bestimmt: „Wenn du mich liebst, dann wolle mich, dann nimm mich auch.“ Doch dass er so weit vorausdachte - in ein Erdreich Pflöcke einzuschlagen versuchte, das dafür noch gar nicht bereit war, lähmte Lilia, sodass sie kaum gehen konnte. Bleich und kraftlos wie ein Schatten schlich sie mit hängendem Kopf neben ihm her.
Im Hotelzimmer angekommen, taumelte sie auf den Balkon und starrte in die missfarbene Brühe des Flusses, der nun aussah wie eine sich windende und alles verschlingende Riesenkrake. Die Zeit stand still, weil es kein lebbares Morgen mehr gab.
Wie lange Lilia so dastand, wusste sie nicht. Das Denken und die Gefühle waren ihr abhandengekommen. Einzig ein ohnmächtiger, schneidender Schmerz hielt sie am Existierten. Da schlangen sich von hinten nackte Arme um Lilia, und Bernd zog sie sachte vom Geländer weg, ihren Körper an sich bergend wie mit einem Mantel. „Komm zu mir, Liebes“, raunte seine Stimme in ihr Ohr- diese Stimme, die augenblicklich Schmerz, Taubheit und Schwäche aus ihr hinauswischte, und sie in ihrer beider Geschichte zurückholte. Langsam zog Bernd Lilia aus. Im Dämmer der beleuchteten Ufer schimmerte sein nackter Körper wie Marmor. Er hielt Lilia mit gestreckten Armen von sich weg. Und sie betrachteten einander wie zum ersten Mal.
Lilia ließ sich auf den Teppich gleiten, und Bernd tat es ihr gleich. Dann zog er sie auf seinen Schoss. Drückte sie in sich, als wolle er sie nie wieder loslassen. Irgendwann stemmte er sich zuerst aufs eine Knie, dann aufs andere und stand langsam auf. Lilia hing an ihm. Gestützt von seiner stählernen Kraft, wie ein Affe an einem Baum. Bei diesem Gedanken gurgelte ein Lachen aus Lilias Kehle, verzweifelt, beseligend und irr. Schlangenhaft wand sich Bernd noch tiefer in sie hinein. Sie wollte schreien, ohne zu wissen weshalb. Bis sich der Schmerz in leuchtende Ekstase verwandelte. Ihre Sinne schwanden unter Pochen und Stoßen. Lilia barg den Kopf an seinem Hals. Und heiseres Schluchzen drängte aus ihr. Bernd trug sie zum Bett, ohne sie zu verlieren. „Du machst meine geheimsten Sehnsüchte wahr“, stöhnte er. „Nie hätte ich gedacht, dass ich das einmal erleben dürfte. Du weißt nicht, was du mir gibst.“ Es wurde eine lange Nacht. Doch anstatt zerschlagen, fühlte sich Lilia am nächsten Morgen kräftig und sicher. Sie fuhren gemeinsam mit dem Zug in die Großstadt, Bernd zur Probe einer nächsten Produktion, Lilia zur Gesangsstunde und zu ihrem Korrepetitor. Und es war, als sei in Lilia ein Tor machtvoll aufgetreten worden. Die Koloraturen perlten wie von selbst aus ihrer Brust. Ihr Körper strotzte vor Kraft. Und sie war stolz auf sich. Auch wegen der Hürde, die sie mit Bernds Hilfe hatte überwinden können.
Eine weitere gemeinsame Nacht lag vor ihnen. Bernd fragte sie, ob sie die Festspielaufführung noch ein drittes Mal sehen wolle, und Lilia hatte nichts dagegen. Ein Schatten von Ungeduld trübte kurz die Situation, weil Bernd sich nun noch um eine dritte Karte für Lilia bemühen musste. Doch warf dieser Umstand Lilia nicht aus dem Gleichgewicht.
Zurück in ihrem Rustico versuchten Pierre-Louis und Lilia ihren Alltag, so gut es sich machen ließ weiterzuführen. Lilia ging sachte auf Distanz, versuchte Raum zu schaffen zwischen sich und Pierre-Louis. Eine Art neutraler Zone. In der sie einander begegnen konnten, ohne einander zu verletzen oder zu kränken. Was nicht einfach war, denn Pierre-Louis machte nicht mit. Aus ihrer veränderten Perspektive sah Pierre-Louis für Lilia nun sehr anders aus. Nicht nur physisch. Sondern auch in dem, wie er sich gab. Sich bewegte. Dachte und sprach. Er stand nicht schlechter da als zuvor. Nur verwandelt. Wie ein Fremder, den Lilia von Grund auf neu würde kennenlernen müssen. Falls sie es denn wollte.
Drohender denn je ragte auch Pierre-Louis‘ Vorsatz, Selbstmord zu begehen zwischen ihnen auf. Pierre-Louis bewegte sich hart und nüchtern darauf zu, verweigerte jedes diesbezügliche Gespräch. Lilias schüchterne Einwände prallten an ihm ab wie an Granit. Er beharrte auf seinem Recht. Wie ein Soldat an der Grenze im Angesicht des Feindes, bereit anzugreifen beim geringsten Vorkommnis. Und der Feind schien Lilia zu sein. Zumindest einer, der ihn umzingelnden Feinde, von denen ein anderer Pierre-Louis selbst war. Er wirkte so isoliert, als habe er bereits alle Brücken hinter sich verbrannt. Lilias noch nicht wirklich artikulierter Sehnsucht allein weiterzuleben, setzte er eisige Kälte entgegen. Und das bewusst. So wie eine Katzenmutter ihr Junges von sich scheucht, wenn die Zeit der Abnabelung gekommen ist. Und es beißt und haut, wenn es sich ängstlich an sie drängt, weil es das Ausgesetztsein fürchtet. Miteinander reden konnten Pierre-Louis und Lilia nicht mehr. Lilia versuchte, ihm klar zu machen, dass es nicht an ihm liege, wenn sie von ihm wegstrebe.
Lilia empfand tatsächlich das, was mit ihr geschah wie ein von Pierre-Louis Wegstreben. Ein Weiterleben wie bisher schien für sie undenkbar. Obwohl sie immer noch nicht sah, in welche Richtung es sie zu gehen drängte. Immer noch hing das Leben zentnerschwer an ihr. Erschien Freiheit als Utopie. Wenn sie ihr bisheriges mit demjenigen Leben verglich, durch das sie sich während den vergangenen Monaten gequält hatte, bemerkte sie auf den ersten Blick keinen Unterschied, ihre Persönlichkeit betreffend. Bei genauerem Hinsehen jedoch nahm sie wahr, wieviel mehr Raum sie nun um sich herum brauchte. So als sei sie in die Länge und in die Breite gewachsen. Sie fühlte sich rundum in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt, schien überall anzustoßen, wie ein Wolf im Käfig. Und das hatte nichts mit Pierre-Louis zu tun. Er trug keine Schuld daran. Etwas war einfach aus ihrem Leben weggenommen worden, und etwas anderes hinzugekommen. Eine Form von Druck war verschwunden, dafür eine andere gewachsen. Und zwar das Bewusstsein für Verantwortung. Ihre Unschuld hatte sie verloren.
Dennoch gediehen in ihr weiterhin Gedichte voller Sehnsucht nach Bernd, mit denen sie sich dem Schmerz über die unvermeidbare, allmähliche Loslösung stellte. Gleichzeitig begriff sie die Notwendigkeit, Bodenständiges zustande zu bringen, wie es andere Menschen auch taten, die Familien aufbauten, sich in einem Beruf etablierten, ihren Tagesablauf auf einen Nenner brachten und bürgerlicher Ordnung gehorchten. Obwohl Lilia allein die Vorstellung davon die Kehle zuschnürte.
Die Theatersaison war in vollem Gang, Bernd ständig auf Tournee. Er litt genauso unter der Trennung von ihr, wie Lilia von ihm, arbeitete Tag und Nacht um sie zu vergessen. Obwohl es ihm so wenig gelang wie Lilia. Briefe reisten hin und her, deren Inhalt sich in Beteuerungen und Wehklagen erschöpfte. Und die Bresche zwischen ihnen weiter und weiter auseinanderklaffen ließ. Denn Worte allein stopften sie nicht. Und gelang ihnen doch hie und da ein Treffen. Und wurde ihnen eine Nacht geschenkt, stürzte sie der unweigerliche Abschied nur in noch tiefere Verzweiflung. Lilia hatte diese Entwicklung kommen sehen. Bernd nicht. Er hoffte auf eine gemeinsame Zukunft. Andeutungen in Briefen ließen Lilia erzittern. Sie versuchte, sie zu ignorieren. Denn Bernd bewegte sich damit auf für Lilia verbotenem Terrain. Zum einen stand der große Altersunterschied zwischen ihnen, den Lilia nicht wegen der Anzahl an Jahren fürchtete, sondern weil er sie gezwungen hätte, eine Generation an möglichen Erfahrungen zu überspringen, um auf Bernds Niveau zu gelangen - zum anderen ihre Gebundenheit.
Es wurde Sommer. Lilia besuchte immer noch die Kurse ihres indischen Yogameisters, studierte immer noch Gesang, inzwischen bei einem Bassbariton, dessen Gestaltung des „Beckmesser“ in Wagners „Meistersinger“ ihm viel Lob eintrug. Er war sehr liebenswürdig. Und gleichzeitig mit Komplexen behaftet wie ein Igel mit Flöhen. Seine Ehe war ein Desaster, denn seine Frau, eine äußerst impulsive Italienerin, glaubte an Erscheinungen spiritistischer Natur, litt unter dem Erfolg ihres Ehemannes, fand, sie verkomme in seinem Schatten, und weinte sich während leidenschaftlichen Ausbrüchen die Augen aus. Oft herrschte Krisenstimmung in der Wohnung, und Lilias Unterricht litt darunter, wenn der Arzt herbeigerufen werden musste, um die Frau zu beruhigen. Das ödete Lilia zwar an, doch schätzte sie es, im Sänger einen Freund gefunden zu haben, mit dem sie ihre Sorgen teilen konnte. Er wusste über Bernd und über Pierre-Louis Bescheid. Bernd kannte und bewunderte er. Und dass Lilia mit ihm in Verbindung stand, flößte ihm Respekt ein. Vor Pierre-Louis, dem er ebenfalls schon begegnet war, verspürte er Angst. Denn auch seine Frau drohte ihm gelegentlich mit Selbstmord, falls er sie zu verlassen gedenke, was ihm nicht im Traum einfiel, denn er liebte sie. Im Übrigen fand er, Lilia sollte ins Mezzosopranfach wechseln und dramatischere Rollen singen. Lilia arbeitete mit ihm an der Partie der Agathe, da Teile davon auf dem Programm ihres nächsten Konzerts standen. Das Lampenfieber plagte Lilia immer noch extrem. Und ihr schien, die periodisch auftretende Diskussion über ihre Stimmlage spiegle sich perfekt im dünnen Eis, über das ihr Leben sie führe. Ohne sie sich tatsächlich einzugestehen, streifte sie hie und da die Ahnung, auch das Singen erübrige sich allmählich. Auch es werde den bevorstehenden Selbstmord Pierre-Louis‘ nicht überstehen.
An einem Freitagabend nach ihrem fünfunddreißigsten Geburtstag eröffnete Pierre-Louis Lilia, seine Zeit laufe aus, und er habe ihr einen Vorschlag zu unterbreiten. Es sei ihm bewusst, sagte er, dass er ihr viel Leid zumute. Und er dürfe ihr das zumuten, da sie die Kraft habe, es zu ertragen. Als Unterstützung habe er sich ausgedacht, sie sollten für eine Woche in die Südschweiz fahren, und er werde sie jeden Tag zum Sommercamp ihres Yogameisters fahren, wo sie üben und die Meditationsseminare besuchen könne. Während dem er seine Tage nach seinem Gutdünken allein verbringe.
Lilia schnappte nach Luft, als Pierre-Louis geendet hatte. Er schaute ihr ungerührt in die Augen. Ob sie seinen Vorschlag annehme oder ablehne, mache für ihn keinen Unterschied. Er wolle ihr damit entgegenkommen, die Härte des Bevorstehenden abfedern, meinte er. Lilia war sprachlos, obwohl Pierre-Louis‘ Vorschlag wie angegossen zum Ablauf ihres Lebens passte. Einen Augenblick lang fühlte Lilia, heiß wie Lava, Wut in sich aufsteigen. Sie hätte Pierre-Louis ins Gesicht schreien mögen, ob er noch bei Sinnen, oder schon übergeschnappt sei. Und was er sich einbilde, so mit ihr zu verfahren. Doch was hätte das gebracht? Tränen strömten über ihr Gesicht, als sie in den Vorschlag einwilligte. Ihr Leben brach auseinander wie ein Kartenhaus. Und sie schaute ihm dabei zu, ohne etwas dagegen tun zu können.
Pierre-Louis zog sich immer mehr in rätselhafte Geheimnistuerei zurück, in die ihm Lilia nicht folgen konnte, und es auch nicht durfte, denn Pierre-Louis hielt sie geflissentlich von sich fern. Selbst schüchterne Umarmungen ließ er nicht mehr zu. Oft blieb das Essen stehen, das Lilia ihm auftischte. Sie wusste kaum noch, was ihm anbieten. Und die Wand, die er allmählich zwischen ihnen aufrichtete, wurde so undurchdringlich, dass Lilia vermutete, Pierre-Louis wolle sie mit Gewalt ans Alleinsein gewöhnen. Tage tiefster Niedergeschlagenheit folgten auf Tage krampfhafter Zuversicht. Während denen Lilia um Verstehen rang. Einerseits hatte sie das Gefühl, mit einem Schwerkranken zusammen zu wohnen. Andererseits tauchte immer wieder Zorn in ihr auf. Zerstörerischer Zorn. Der in der Überlegung gipfelte: Es sei eine Unverschämtheit wie Pierre-Louis mit ihr umspringe. Dann mahnte sie die innere Stimme zu Zurückhaltung, rief ihr Bernd ins Gedächtnis, und das, was sie selbst Pierre-Louis aufgebürdet habe. Im Grunde waren sie quitt, außer dass Pierre-Louis es wagte zum Äußersten zu greifen. Obwohl er ihr versicherte, sein Selbstmord sei ihm in die Wiege gelegt worden. Und er übe damit keinerlei Rache an ihr. Lilia deutete Bernd gegenüber ihre Situation an, doch wusste er keinen Rat, beteuerte nur, er werde sie nicht im Stich lassen, was immer auch geschehe.
Wie einem Nebel entronnenn fing die Verschiedenheit von ihrer und Bernds Persönlichkeit an, sich vor Lilias innerem Auge abzuzeichnen: Bernds ausschließliche Ausrichtung auf die Texte seiner Dichter, und Lilias dringliche Suche nach dem Verstehen von Werden und Vergehen - zwei unvereinbare, klar vorgezeichnete Wege. Bernd bezog seine Weisheit aus den Versen und der Prosa der Dichter. Lilia forschte nach der ihren in der direkten Konfrontation mit dem Drama ihrer Existenz. Bernds Weisheit stammte aus zweiter Hand. Diejenige von Lilia aus persönlichem Erleiden. Bernd wurde von seiner Familie, dem ausgedehnten Freundeskreis und einem begeisterten Publikum durchs Leben getragen. Währenddessen Lilia auf sich selbst gestellt war. In Schützengräben war Bernd jahrelang Zeuge unnennbarer Gräueltaten gewesen - die er nicht zuletzt mit Hilfe der Dichtkunst überstanden hatte, mit Hilfe eines Trostes also, den er sich mit Lilia teilte. Bernd war angeschossen worden, das Projektil steckte noch in seinem Körper. Lilias Verwundungen dagegen waren unsichtbar. Bernd verweigerte jeden Dialog über sich selbst. Seine Erfahrungen lagen verdrängt unter der reinigenden Oberfläche seiner Kunst. Konflikten ging er aus dem Weg. Während einer ihrer Begegnungen meinte er zerknirscht: „Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber eigentlich kann ich mit Frauen nichts anderes anfangen, als mit ihnen zu schlafen. Du solltest für mich ein Buch über dein Leben schreiben, das würde mich brennend interessieren“, und Lilia verstand, was er damit meinte.
Bleich und gebeugt kam Pierre Louis von seinem letzten Militärdienst heim. Und erst Tage später nannte er Lilia den Grund dafür. Sein Gesuch, Instruktor bei der Truppe zu werden, wurde mit der Begründung abgelehnt, er sei erstens zu alt dafür, und zweitens Brillenträger. Schlotternd wie ein Gerippe hing Pierre-Louis in seinem Körper, die erloschenen Augen auf Lilia gerichtet. Vom Kirchturm schallte die Totenglocke. Stille hing wie Blei dazwischen, giftige Stille, die jedes Hoffen auf ein ertragbares Morgen erdrosselte. Eine Amsel sang. Das Gemampfe sich schließender Bustüren erklang, das Röhren eines Motorrads. Versatzstücke scheinbar sich entrollender Zeit, wie das Scheppern gläserner Murmeln auf Blech: zum Schreien banal.
Eisiger Schweiß brach aus Lilias Haut. Ihre Kehle zerriss heiseres Schluchzen. Aussichtslosigkeit rammte sich wie tödlicher Stahl in ihr Herz. Wie Hohn schrillte der Gedanke an Trost. Lilia verzog sich in eine lichtlose Ecke. Mit angezogenen Knien ertrank sie in Erstarrung. Pierre-Louis verschwand und kehrte erst lange nach Mitternacht zurück. Am nächsten Morgen teilte er Lilia mit, er habe in der Südschweiz zwei Hotelzimmer gebucht, die sie in einer Woche beziehen könnten.
Lilias und Pierre-Louis‘ Fahrt in den Süden trug den Stempel von Endgültigkeit. Kein Gespräch kam zustande, obwohl sich Lilia Mühe gab, den Abgrund an Vereisung zwischen ihnen mit Hinweisen auf ihnen Vertrautes zuzuschütten. Pierre-Louis ließ keinerlei Annäherung zu. Er schien zu fürchten, irgendein schlagendes Argument von Lilias Seite bringe seinen Entschluss ins Wanken.
Schon halb fataler Resignation verfallen, klammerte sich Lilia an die Tatsache, dass Pierre-Louis noch im Diesseits wandle, noch für sie erreichbar sei, Dinge noch zu ordnen wären. Die Aussicht auf Pierre-Louis‘ Tod machte ihr weniger Angst, als die dadurch entstehende Unordnung, die Umstellung auf Ungewisses.
Im Hotel bezogen sie ihre Zimmer. Lilia handelte und verhielt sich, als könne das hauchdünne Eis unter ihren Füssen jederzeit bersten. Sie wusste weder was tun, noch was sagen. Sie hoffte auf Anweisungen und Verhaltensregeln, die sie durch diese „Zeit dazwischen“ führen konnten, diese Zeit zerrinnenden Lebens, in der Atem zum Ersticken knapp wurde. Doch nichts geschah. Pierre-Louis zog sein Ding durch und erwartete von ihr, dass sie ihr Ding durchziehe. Die Trennung schien schon vollzogen. Entfremdung stand zwischen Ihnen wie eine undurchdringliche, von Pierre-Louis vorsätzlich errichtete Wand. Lilia blieb nur, den von ihm vorgegebenen Weg weiterzugehen. Einen Weg aus stählerner Kraft, von dem sie nicht hinunterstürzen könnte, selbst wenn sie es wollte. Pierre-Louis hielt das Heft unerbittlich in der Hand. Nur sein Wille zählte noch. Er förderte in Lilia widerspruchslosen Respekt zutage.
Am zweiten Tag im Yogazentrum sah sich Lilia zu des Yogameisters Füssen kauern und ihm den Sachverhalt berichten. Er trug ihr auf, einen Brief an seine Partnerin zu schreiben, und darin um ein Interview zu bitten. Lilia schrieb ihre Geschichte auf, und Pierre-Louis anerbot sich, den Brief für sie zu überbringen, warum, getraute sich Lilia nicht zu fragen.
Am Abend darauf wurde Lilia in ihres Meisters Haus geladen. Sie bereitete sich umsichtig darauf vor, wählte ein knöchellanges, ärmelloses Sommerkleid mit Spitzenbesatz, dazu goldene Sandaletten und Ohrringe, die fast bis auf ihre Schultern baumelten. Ihr Haar trug sie offen, durch einen Seidenschal, dessen Enden der Abendwind über ihre Schultern drapierte, gebändigt. Sie wusste, dass sie gut aussah, wollte es so, denn sie war keine zerknirschte, händeringende Sklavin. Es ging um ihr Weiterleben, nicht ums Kapitulieren.
Wie verabredet, schüttelte sie die Glocke neben der Haustüre und wartete. Schritt näherten sich. Die Tür ging auf und ihre Lehrerin, die so viel Unsichtbares für Lilia verstehbar gemacht hatte, stand vor ihr. Schweigend. Lilia musternd, von oben bis unten, mit feinem Lächeln in jeder Falte ihres großflächigen Gesichts mit den spitz zulaufenden Hexenohren. „Du stammst nicht aus diesem Volk, sondern aus dem meinen. Und du kannst dich so hart bemühen, wie du willst, du wirst hier nie dazugehören“, vernahm Lilia.
Sie wurde ins Haus gebeten: In den Raum, ausgestattet mit Gemälden, Skulpturen und dem mächtigen schwarzen Flügel der ehemaligen Konzertpianistin und bildenden Künstlerin. Dort standen sie einander gegenüber. Auge in Auge. Der Blick, in den Lilia hineingezogen wurde, war so zwingend, dass sie sich weder bewegen, noch hinfallen konnte. Er hielt sie aufrecht. Wie auf einen Dolch gespießt. Ohne Ausdruck. Gefühl. Oder Hintergedanken. Und er durchspülte Lilia mit einer Kraft, die sie nie zuvor erfahren hatte: Der Blick der Zigeunerin: Sie hatte davon gehört. Und zeit ihres Lebens darauf gehofft, ihm zu begegnen. Wolfsaugen, die die Zeit aufhoben. Und, ohne das Geringste zu fordern heilten.
„Und wo liegt nun das Problem“, fragte die Lehrerin Lilia sanft. „Es gibt keines“, antwortete Lilia. „Nein, es gibt keines: Deines Mannes Leben neigt sich zum Ende. Und du fängst ein neues an. Er kann das nicht mehr, dafür hat er sich schon zu weit entfernt.“
Ihre Lehrerin führte Lilia durchs Haus, zeigte ihr die Zimmer, den Garten, erzählte aus ihrem Leben. Entgegen Lilias Annahme, herrschte überall eine Atmosphäre edler Bohème, künstlerisch überhöht, die Lilia aus der Seele sprach. Zum Abschluss tranken sie zusammen Saft auf der Terrasse. Seidige Wellen läppelten am Ufer. Von Paddeln stoben silberne Tropfen. Die Reifen an Lilias Handgelenk klingelten zärtlich, wenn sie ihr Glas anhob. Mondlicht glättete die Nacht. Ein letzter Vogel zirpte sich in den Schlaf. Entferntes Geschrei von Zikaden instrumentierte Trauer und Weh. Es roch nach Tau. Nach Verwesung. Und süßem Keimen. Nichts war zu wenig. Nichts zu viel.
Die Heimfahrt gestaltete sich für Lilia und Pierre-Louis so schweigsam wie die Anreise, so als gebe es nichts mehr zu kommunizieren. Ihre Wege schienen klar vorgezeichnet. Ein Zurück zu Gemeinsamem war ausgeschlossen. Obwohl Lilias Herz in ihrer Brust schwer wog wie ein Stein, gab es keinen Laut von sich. Die Zeit bildete einen Tunnel, den hinter sich zu bringen, es noch galt. Ob sich an dessen Ende Befreiung zeigte, war bedeutungslos. Grau und metallisch schmeckend, sog der Alltag Lilia und Pierre-Louis in seinen gefühllosen Trott.
Bernd schrieb Lilia, wie unerhört dankbar er ihr für das Unbekannte sei, das sie in ihm bewege und ans Licht fördere: für die Liebe. Die Einfühlsamkeit. Die Behutsamkeit. Und das kaum hörbare, sachte Aufeinanderzugehen, das er durch sie kennengelernt habe. Und das nun auch seiner Frau und seiner Familie zugutekomme. Es versetzte Lilia einen Stich ins Herz, wenn sie daran dachte, dass andere Früchte ernteten, deren Samen sie gesät hatte. Sie tat sich leid.
Doch Bernd lud sie ein, eine ganze Woche mit ihm zu verbringen. Oder wenigstens die Nächte davon, denn tagsüber arbeite er an der Inszenierung einer Oper. In Lilia erblühten Bilder, die ihr vorgaukelten, wie herrlich es wäre, Tag für Tag dem Fortschreiten der Arbeit ihres Geliebten zuzuschauen, versteckt in einer Loge oder hoch oben in einem der Ränge. Obwohl sie aus ihrem wenigen an Erfahrung wusste, wie langwierig, nervenaufreibend und auch öde das Ausarbeiten winziger Szenen, Auftritte und Abgänge sich oft gestaltete. Wie viele Wiederholungen es brauchte. Wie viele Diskussionen. Auch war die Aussicht auf den Besuch der Stadt des Ruhrpotts keineswegs prickelnd. Sowenig wie Abend für Abend am Theaterausgang auf einen müden, verschwitzten, gestressten Mann zu warten. Nie wissend, in welcher Laune er zu ihr stoßen würde. Dennoch: nein zu sagen wäre unmöglich. Eine ähnliche Gelegenheit würde sich nie mehr finden. Also unterrichtete sie Pierre-Louis in kurzen Worten von ihren Plänen. Er hörte kaum hin, wie ihr schien.
Einige Tage vor ihrer Abreise rief sie Bernd an, um mit ihm das Nötige zu besprechen. Er zögerte. Stotterte. Verhaspelte sich in den Worten, als er ihr mitteilte: „Du kannst nicht kommen, Lilia, ich würde das niemals aushalten. Du wärst den ganzen Tag allein, und ich im Theater. Wie sollte das gehen. Ich würde nur an dich denken, könnte überhaupt nicht arbeiten.“ „Die Idee kam doch von dir, Bernd“, bettelte Lilia und versuchte verzweifelt, das Ende des Taus noch zu erhaschen, das schon ihren Händen entglitt. Das Ende des Stückchens Glück, das sich ihr bereits entzog, aus ihrem Herzen verdampfte und sich in nichts als gähnende Leere auflöste. „Nein, Lilia, ich kann nicht, bitte, bitte versteh‘, es wäre unser beider Untergang“. Lilia verstand – und pflichtete tonlos bei, als sie den Hörer auflegte.
Sie stand neben dem Apparat, unfähig einer Empfindung. Dann ergriff der Schmerz sie wie ein Orkan. Sie ballerte einmal ums andere die Stirne gegen die Wand, wie um sich zu ankern, den Verstand nicht zu verlieren. Plötzlich hielt sie inne: Von Weh keine Spur. Nur Raum herrschte in ihr, soweit das Auge reichte, Raum, in den weder je ein Gedanke noch ein Gefühl sich verirren würde. Atem trug Lilia durch diesen Raum, weit, weit hinauf und behutsam zu sich selbst zurück. Einen Augenblick lang dachte Lilia daran, mit Wut auf den Raub ihres Leids zu antworten. Was sich jedoch als kindisch erwies. Also ließ sie es bleiben. Setzte sich hin. Stützte den Kopf in die Hände. Und ließ Tränen sie ins Tatsächliche geleiten: das darin bestand, den Hund auszuführen und einkaufen zu gehen. Auch arbeitete sie an einer Zusammenfassung ihrer Lebensgeschichte für Bernd. Seinem Wunsch entsprechend. Daran würde sie weiterspinnen, den Abend wenigstens auf diese Weise mit ihm zusammen auslaufen lassen.
Hin und wieder fuhr Lilia auch in die Südschweiz um ihre Mutter zu besuchen. Es waren stille, ereignislose Tage, die sie zusammen verbrachten. Die Mutter ermüdete rasch. Ein scheues Lächeln spielte um ihren Mund. Ein Lächeln wie um Vergebung bittend, wenn sie seltenerweise mit ihren dünn gewordenen, spinnenbeinigen Fingern über einen Pullover oder den Stoff eines Rocks strich, den Lilia selbst geschneidert hatte. Handwerklich begabt war die Mutter überhaupt nicht. Sie konnte höchstens einen Knopf annähen. Und sogar dafür brauchte sie viel Zeit, schon nur um Nadel, Faden und das entsprechende Kleidungsstück zurechtzulegen. Omas Handarbeitskünste hatte sie rückhaltlos bewundert, neben ihr gesessen, ihr beim Häkeln, Sticken oder Nähen staunend zugeschaut. Die Zeitung vorlesend oder Paketschnüre entwirrend, und zum neuerlichen Gebrauch aufrollend. Eine Beschäftigung, der sie sich mit Leidenschaft widmete. Womit sie sonst ihre Tage zubrachte, war Lilia nicht klar. Sie las fast nichts, außer Erbauungsliteratur. Das Gebetbuch. Oder ihre eigenen, liebenswürdigen, aggressionsfreien Gedichte. Was sie aufregte, oder aus der Fassung brachte, vermied sie, auch in musikalischer Hinsicht. Nicht einmal für Gespräche über Philosophie war sie zu haben. Außer dem katholischen Christentum betrachtete sie alle Religionen als Götzendienst. Erklärungen akzeptierte sie nicht. Verweigerte das Anhören jeglicher Argumente. Ihr Aktionsradius schien sich auf das Abstauben ihres mit Möbeln und Schachteln vollgestellten Schlafzimmers zu beschränken. Dafür verwendete sie einen Wedel aus Pfauenfedern. Pullover, Jacken und Wäsche versorgte sie auf dieselbe Weise wie früher die Spielzeuge im Wintergarten ihres Elternhauses: zuerst in Seiden-, dann in Packpapier und mit Bindfäden verschnürt im voluminösen Schrank ihrer Elternschlafzimmereinrichtung, von der sie sich nie getrennt hatte. Und immer noch trug sie auch den, ihr von Lilias Vater an den Finger gesteckten Ehering. Die Küche und die restliche Hausarbeit besorgte ihre invalide, italienische Hausangestellte.
Die Mutter lebte ein enttäuschtes, nach außen kaum vorhandenes Leben. Früherer Groll und der Hass auf ihren Mann legten sich und wichen gottergebener Resignation. Sie ging früh zu Bett. Drehte ihre Haare auf die Wickel. Band sie mit dem Haarnetz zusammen. Rieb sich die Hände ein. Zog Handschuhe darüber. Öffnete das Missale und betete, auf dem Rücken liegend, bis das Büchlein ihren Händen entglitt, und sie getröstet einschlief.
Lilia versuchte nun öfter, sich vorzustellen und nachzuempfinden, wie sich die Mutter gefühlt habe, als man ihr Lilia als halbjähriges Töchterlein aus den Armen riss, um sie dem Vater zurückzugeben. Zu jener Zeit war die Mutter jung und, obwohl gehemmt und verklemmt, von explosionsartigem Temperament gewesen. Sicher weinte sie, schrie ihren Schmerz aus sich hinaus, über Monate, Jahre. Während dem sie, stets neue Hoffnung schöpfend, die Anwälte auf Trab hielt, im Kampf um ihr Kind. Bis sie endlich, als Lilias Volljährigkeit heranrückte, diesen Kampf, innerlich zerstört und verbittert aufgab.
Wenn Lilia sich im Spiegel betrachtete, aufmerksam ihre Züge musterte, die ersten scheuen Fältchen willkommen hieß, als Garanten dafür, dass sie lebte, erkannte sie von Mal zu Mal deutlicher das Gesicht der Mutter darin. Gleichen wollte Lilia der Mutter nie. Doch auch in Lilia schliffen die gemachten Erfahrungen das Herzzerreissende weg. Es gab Momente, in denen sich die beiden Frauen, einander gegenübersitzend zulächelten, und sich leise Gefühle füreinander regten. Es kam sogar vor, dass Lilia die Mutter scheu umarmte, auf die Wange küsste, und die flaumige, dünne Seidenhaut - die sich so ganz anders anfühlte als ihre eigene, robuste - verzeihende Zärtlichkeit in ihr wachrief.
Obwohl sie noch bei Kräften war, erschien die Persönlichkeit der Mutter wie verweht. Zu einem Hauch geschrumpft. Hingegeben dem inständigen Hoffen auf die Barmherzigkeit und Sühne Gottes. Ging sie seltenerweise aus, kleidete sie sich entsprechend ihrem Stand. Darauf legte sie Wert. Sie trug nun vorwiegend Schwarz. Zuhause jedoch die alten, von Oma handgestrickten Pullover und dazu die Faltenröcke, die Lilia seit ihrer Kindheit kannte. Meistens legte sie sich auch die Kette mit den erd- und honigfarbenen Achaten um den Hals. Und auch ihr Parfum wechselte sie nicht. Sie verhielt sich lautlos und unaufgeregt, als habe sie es sich zur Gewohnheit gemacht, ihre Gefühle so tief in sich zu verstauen, dass sie niemandem auffielen. Nicht einmal ihr selbst. Versuchte Lilia, die Mutter zu irgendeiner Stellungnahme zu bewegen, oder Überschwang zuzulassen, blockte die Mutter sofort ab und drehte sich weg. Was sie am Leben hielt, war Lilia nicht klar. Die Pflicht dem Glauben gegenüber? Pure Gewohnheit? Lilia wusste es nicht. Zu fragen wäre sinnlos. Die Mutter verwiese sie eisig in ihre Schranken. Sie schien ihren Stolz darin zu sehen, wie eine Königin schlicht ihrem Amt zu dienen. Ungeachtet eigener Bedürfnisse. Die für sie nur noch darin bestanden, den Regeln ihres Standes perfekt zu entsprechen.
Einmal noch versuchte Lilia Pierre-Louis zu verführen, mit ihr zu schlafen, doch es erschien ihr im Nachhinein, als habe sie ihn vergewaltigt. Von da an ließ sie jeden Versuch von Annäherung bleiben. Ihre Gefühle pendelten zwischen Wut, Resignation, sich aufbäumender Zuversicht und abgrundtiefer Schwermut. Was sie am Weiterleben hielt, wusste sie längst nicht mehr. Weil Pierre-Louis sich oft darüber beschwerte, dass ihre Betten nicht - wie die anständiger Ehepaare - im selben Zimmer nebeneinanderstünden, räumte Lilia die Wohnung um und gab den Betten den besten Platz darin. Sie versprach sich keinen Gewinn davon. Es ging eher darum, letzte Dinge in Ordnung zu bringen, Pierre-Louis zuliebe. Denn auch er brachte letzte Dinge in Ordnung. Beschäftigte sich mit Papieren. Mit Ordnern. Warf alte Kleider und Fotos weg. Beschriftete Schachteln neu. Lilia schaute nicht hin, ließ ihn wortlos gewähren. Sie ging singen. Führte Mali spazieren. Erledigte ihre Arbeit im Büro. Putzte und kochte. Versuchte, ein Leben aufrecht zu erhalten, in dem sie einherging wie in einem Traum - als Schattenwesen. Selbst das Blut in ihren Adern schien seinen Fluss zu drosseln. Sie passte sich dem versickernden Dasein ihres Gatten an, ohne darüber nachzudenken. Instinktiv. Und auch, weil für nichts anderes mehr Platz war. Ließ das Absterben ihre Gemeinsamkeit überziehen wie Schimmel Verrottendes bepelzt. Da Lilia auf keinen Freundeskreis Rücksicht nehmen musste, verpuppte sie sich in ihre Einsamkeit, die das einzige, noch Atmende in ihrem Alltag darstellte.
Langsam gedieh die Zusammenfassung von Lilias Geschichte, als Geschenk für Bernd gedacht. Obwohl Lilia, die immer noch nicht daran gewöhnt war, die Gefühle über sich selbst in Begriffe zu biegen, die dreiunddreißig Seiten, auf die das Werk am Ende anwuchs, nur stockend zustande brachte. Sie schrieb in der dritten Form, nannte sich „das Kind“. Sie wusste, dass es dabei um ihr Eigenstes ging. Doch kriegte sie es nicht zu fassen. Es klebte zu fest an ihr. Umschloss sie zu dicht. Die Distanz, es von außen anzuschauen, um es abzubilden, fehlte ihr. Und es fehlten ihr vor allem immer noch die Worte, um es darzustellen. Lilia bekam den Eindruck, es sei alles wie ein Film an ihr vorübergelaufen. Das pulsierend Verbindende zwischen dem Text und ihr war nicht da. Zum ersten Mal in ihrem Leben wollte jemand wirklich wissen, wer, was und wie sie sei, und Lilia saß in einem lichtlosen Verließ im Nirgendwo. Konnte weder schreien. Noch sich sonstwie artikulieren. Sah sich abgeschnitten von Begriffen: Im Abstrakten gefangen, wie lebendig begraben.
Eines Abends, kurz vor Mitternacht - Lilia war mit dem Hund zum letzten Mal an diesem Tag um fünf Uhr draußen gewesen - knurrte Pierre-Louis, der ungläubig verfolgte, wie Lilia sich fürs Zubettgehen bereit machte: „Und der Hund: willst du nicht wenigstens noch mit ihm rausgehen, sonst hält er die Nacht nicht durch“. Lilia, betäubt ob des, wie sie dachte, unberechtigten Vorwurfs. Und wütend über die Einmischung, giftete zurück - sich daran erinnernd, dass Pierre-Louis seit Wochen ihren Hund kaum noch beachtete: „Wir sind immer miteinander zurechtgekommen. Auch ohne dich.“ Kaum rausgerutscht, erstarrte sie ob ihrer Worte. Sie klangen wie ein Schlüssel, der knarrend in einem rostigen Schloss umgedreht wird: Im Schloss eines Gefängnisses. Dessen Insasse das Tageslicht nie mehr sehen würde. Einem, dem Verhungern und Verdursten Preisgegebenen. Wie ein Feuermal, flackernd und anklagend, blieben die Worte in Lilia haften: jahrelang.
Wochen später, an einem sprühenden Herbsttag voller gleißender Sonne, betrat Pierre-Louis die Wohnung nur kurz. Ignorierte das Mittagessen auf dem Tisch. Grapschte nach etwas. Machte rechtsumkehrt und wollte gleich wieder wegrennen. Lilia lief ihm nach, eisigen Schrecken im Herzen, packte ihn am Jackenzipfel und bettelte: „Bitte, bitte, Pierre-Louis, lass uns einander doch wenigstens „Adieu“ sagen.“ Pierre-Louis hielt inne. Schaute ihr blicklos in die Augen. Drückte einen Kuss auf ihre Wange. Scheuchte den Hund zur Seite und lief die Treppe hinunter. Immer eine Stufe überspringend. Wie auf der Flucht. Lilia kehrte zum Tisch zurück. Machte sich lustlos ans Essen. Zerfledderte es auf dem Teller, als scharrten Vögel darin herum. Räumte es schließlich in die Küche und warf es weg. Sie leinte Mali an und lief dieselben Stufen ebenso gehetzt hinunter, die eben noch Pierre-Louis im Laufschritt hinter sich gebracht hatte. Wie oft noch? Ihr Inneres war mittlerweile so ausgedörrt von Sorge und Erschöpfung, dass der kurze Satz nicht einmal mehr ein Echo hervorrief.
Am Flussufer begegnete sie, wie gewohnt, einer alten, schwergewichtigen Frau, die ihren größten Schatz, einen ebenfalls gichtigen, überfütterten Dackel, der gerade aufs Trottoir schiss, reumütig rügte und sich bei Lilia umständlich für ihren Liebling entschuldigte. Zuerst wollte Lilia dieser stereotypen Begegnung ausweichen. Dann ließ sie es, weil es eh nicht mehr darauf ankam. Es erschien Lilia tatsächlich, als spiele es keine Rolle mehr, was sie mit dem Funken Leben, der ihr noch blieb anstelle.
Der Spaniel und Lilia blieben lange weg an diesem prallen, saphirblauen Nachmittag. Als sie gegen sechs Uhr nach Hause zurückkehrten, schrillte das Telefon. Es zerriss die Stille wie Lärm aus einer anderen Welt. Lilia nahm den Hörer ab und sagte ihren Namen. Gähnende Leere in sich. Als stehe die Zeit still. Eine Männerstimme antwortete, ein Polizist der Kantonspolizei: Er habe ihr etwas Wichtiges zu sagen. „Ja, ich höre“, antwortete Lilia. „Nein, nicht am Telefon“. Lilia möchte bitte auf den Posten kommen. Immer noch wie in luftleerem Raum, rannte Lilia durch die Gassen. Mali neben sich wie einen Anker. Sie betrat das Gebäude. Auf dem Tisch in der Mitte eines kahlen, nach Männern, gebohnertem Parkett und gewichsten Stiefeln riechenden Raumes, lagen ein Bund Schlüssel, ein Geldbeutel und ein weißes Couvert. Lilia wusste, was das bedeutete, doch regte sich nichts in ihr.
Blockiert starrte sie auf die Auslage und kam erst zu sich, als ein Polizist neben sie trat und leise sagte: „Ihr Mann hat diesen Abschiedsbrief hinterlassen.“ Er reichte ihr den Brief, ohne sie aus den Augen zu verlieren. „Ich will allein sein“, hörte sich Lilia murmeln. „Nein, wir dürfen sie jetzt nicht alleinlassen. Das ist Vorschrift“, rechtfertigte sich der Polizist - der viel zu nahe neben Lilia stand, die sich in die Enge getrieben fühlte, wie ein angeschossenes Tier. Er fragte Lilia, ob sie niemanden habe, der ihr beistehen könne. „Nein“, sagte Lilia mechanisch, „ich bin allein.“ Dann kam ihr in den Sinn, die Schwiegermutter müsste angerufen werden. „O, das haben wir schon getan. Sie wird innert Kürze hier sein.“
Lilia nahm den Umschlag, zog den Brief daraus hervor und las: „Liebe Lilia, es ist nicht deine Schuld….“. Weiter kam sie nicht. Eine Flut von Tränen überströmte ihr Gesicht. Keuchendes Schluchzen entrang sich ihrer Kehle, als brächen verriegelte Schleusen. Sie ließ sich auf eine Bank fallen und übergab sich ihrer Verzweiflung. Schaute sich dabei zu und schüttelte innerlich den Kopf über das Betragen, das so gar nichts mit ihr zu tun zu haben schien. Erst als die Schwiegermutter auf sie zutrat, und sie in die Arme schloss, stürzte sie in ihren Schmerz hinein und wurde Kind. Ein Kind, über das rückhaltloses Elend hereingebrochen ist. Man ließ sie weinen. Später unterschrieb sie eine Quittung. Behändigte Schlüsselbund und Geldbeutel. Drückte sie gegen die Brust – die Hundeleine hatte sie nie losgelassen – und wartete, stumpf vor sich hinstierend, auf die Schwiegermutter, die dem Polizisten versprach, sie würde die Nacht bei Lilia verbringen. Sie schlief neben ihr, in Lilias Bett. Lilia kroch in dasjenige ihres Mannes.
Pierre-Louis hatte sich in seinem blutroten, schicken Peugeot auf einem sonnenüberfluteten Parkplatz über der Stadt die Militärpistole in den Mund gesteckt und abgedrückt. Lilia und er liebten den Ort und waren dort hie und da mit dem Hund laufen gegangen.
Am folgenden Morgen erwachte Lilia halbtot vor Kaputtheit. Ihr Körper fühlte sich an wie ein Sack voller Felsbrocken. Nur langsam dämmerte ihr, was geschehen war. Dass ihr bevorstand, was sie einerseits, aus schierer Überforderung sehnlichst herbeigewünscht, andererseits gefürchtet hatte, wie die Pest: Sie war Witwe geworden. Mit fünfunddreißig Jahren. Im besten Alter. Feststellungen, mit denen sie nichts anzufangen wusste. Die im Raum verpufften wie Dampf. Der einzige Gedanke, der sich fassen ließ, hieß: „Ausruhen. Ich muss endlich einfach ausruhen.“
Die Schwiegermutter war schon auf. Es duftete nach Mandarin-Tee und frischem Brot. Und obwohl sich Lilia sterbenskrank fühlte, trieb sie die Schwiegermutter zur Eile an. Sie mussten aufs Amt, den Todesfall melden, im Spital Pierre-Louis‘ Sachen abholen: Die Tüte mit dem Hemd voller Blut, der Hose, dem Gürtel, den Schuhen. Und dem Ehering: einem Erbstück von Lilias Großmutter, auf dem ein großer Diamant mit altem Schliff prangte, den Lilia Pierre-Louis als Dank für ihren glitzernden Verlobungsring geschenkt hatte. Sie fand ihn in einem der Schuhe, in ein Stück Küchenpapier gewickelt.
Es musste ein Sarg bestellt werden. Lilia wurde von der Schalterbeamtin gefragt, ob sie ihren Mann noch einmal sehen wolle. Doch sie winkte ab, meinte entschuldigend, sie wolle ihn so in Erinnerung behalten, wie sie ihn gekannt habe. Was die Schwiegermutter sehr bedauerte, die entgegnete, sie habe bis dahin von jedem ihrer Toten persönlich Abschied genommen. Doch war Lilia einfach zu müde, noch ein weiteres Mal in die Geschichte einzutauchen. Nach den vielen Monaten des Bangens, solle endlich Zeit zum Atmen sein, rechtfertigte sie sich. Was die Schwiegermutter schmollend akzeptierte.
Den Peugeot hatte die Polizei konfisziert. Pierre-Louis‘ Bruder würde ihn nach der Reinigung und dem Flicken des Lochs in der Decke, durch das die Kugel ins Freie gesaust war verkaufen. Lilia war froh, damit nichts mehr zu tun zu haben. Sie verfügte ja noch über den Geschäftswagen, um mit der Schwiegermutter ins Blumengeschäft zu fahren. Zur Redaktion der Zeitung. Und zum Bahnhof, um ihren Onkel abzuholen, der sich im Laufe des Tages als erster gemeldet hatte. Lilia fragte sich, woher er die Nachricht habe, und die Schwiegermutter sagte, sie habe ihn angerufen. Im Übrigen blieb das Telefon den ganzen Tag über still. Pierre-Louis‘ Chef brachte Blumen vorbei und kondolierte im Namen der Belegschaft. Er fragte zögernd nach dem Grund des Selbstmords. Er könne sich die Ursache nicht erklären. Sie bilde für sie alle ein Rätsel. Lilia, die in eine Art puppenhafte Erstarrung verfallen war, ließ die Schwiegermutter reden, die sich, scheinbar geeicht durch die jahrzehntelange Auseinandersetzung mit der selbstmordgeschwängerten Situation ihrer Familienmitglieder, gefasst und nüchtern gab. Gründe gab es viele. Und doch keine, die wirklich passten.
Der Onkel, der die Schwiegermutter nicht kannte, gab sich reserviert. Er lud sie und Lilia zum Essen in ein Gartenrestaurant in der Stadt ein, wo er der Schwiegermutter mehr oder weniger behutsam auf den Zahn fühlte, klar machte, dass er ihren Einsatz zwar schätze, sie jedoch unmissverständlich den Unterschied des Standes zwischen sich und ihr fühlen ließ. Sie war ihm nicht böse deswegen. Es gab eben solche und andere Leute: solche mit Größe und andere, die sich ihrer Größe stets neu rühmen mussten. Wenigstens verhielt er sich kooperativ. Der Onkel ermahnte Lilia zu Haltung. Überlegenheit. Und kühler Distanz. Und Lilia tat, was sie konnte. Sie hätte sich so gerne ein bisschen bemitleiden und hätscheln lassen, sich so sehr gewünscht, für einmal die Fahne nicht hochhalten zu müssen, allem Schlachtengetümmel zum Trotz. Doch würde dafür erst Zeit sein, wenn sie allein wäre. Ganz allein. Und sich dessen auch bewusst.
Es blieben nur wenige Tage bis zur Beerdigung. Die Mutter meldete sich dafür ab. Nur der Onkel würde dabei sein.
Lilia war mit Mali zur Schwiegermutter gezogen, schlief neben ihrem Bett auf einer Matratze am Boden. Die Enge machte ihr nichts aus. Sie versuchte, als Gegenleistung im Häuschen etwas Ordnung zu schaffen, die Flusenmäuse unter dem Bett zusammen zu saugen. Und die Zeitschriften, die überall zu Dutzenden gestapelt lagen, auf einem Regal zu bündeln. Die Schwiegermutter ließ Lilia erbittert gewähren. Sie hasste es, wenn ihre Haushaltführung angezweifelt wurde. Ihr genügte sie. Für Lilia gestaltete sich die Putzerei zur Therapie. Deshalb ließ die Schwiegermutter sie gewähren. Sie fuhr auch mit Lilia in die Stadt, um für sie, die nichts Schwarzes besaß, ein passendes Kleid auszusuchen. Lilia wählte einen anthrazitfarbenen, gestrickten Zweiteiler, bestehend aus einem weiten, plissierten Jupe und einem modern und pfiffig geschnittenen Oberteil, dessen Taille eine gleichfarbige Kordel zusammenhielt. Das Kleid war teuer und speziell. Lilia konnte es sich deshalb leisten, weil ihr tags zuvor ein Vertreter, bei dem Pierre-Louis nur gerade drei Monate zuvor eine Lebensversicherung für sie abgeschlossen hatte, das daraus fällige Geld mit einem Blumenstrauß und dem herzlichsten Beileid vorbeigebracht hatte. Lilia stellte erstaunt fest, dass ihre Jugendlichkeit Kondolierende zu einer seltsamen Form von Vertraulichkeit anregte. So als müsste sie in den Arm genommen und wie ein Kind getröstet werden. Auf Fragen nach dem Warum antwortete sie deshalb kurz: „Es ist geschehen. Ich weiß warum. Und das genügt.“
Zu ihrer Überraschung meldete auch der reformierte Pfarrer seinen Besuch an. Über die Art der Beerdigung hatte Lilia sich noch keine Gedanken gemacht. Sie und Pierre-Louis gehörten ja keiner Kirche mehr an. Die Unterredung mit dem Pfarrer leitete die Schwiegermutter in die Wege. Denn, aller Umstände zum Trotz, sollte ihr Sohn ein anständiges, christliches Begräbnis bekommen. Dafür legte sie sich ins Zeug. Benachrichtigte sogar die beiden Vereine, denen Pierre-Louis angehört hatte. Lilia war äußerst dankbar für diese Unterstützung. Auf bürgerliche Gepflogenheiten legte sie keinen Wert. Kannte sich darin nicht aus. Der Gedanke, öffentlich als trauende Witwe zur Beerdigung erscheinen zu müssen, bereitete ihr mehr als Unbehagen. Dem Pfarrer, einem verheirateten Mann mit vier Kindern, nur wenige Jahre älter als Lilia, machte sie unmissverständlich klar, dass sie es keinesfalls dulde, sollte er den Gästen einen salbungsvollen Sermon präsentieren, um die unumstößliche Tatsache des Selbstmords zu kaschieren. Sie wünschte sich als Thema ein Zitat aus dem „Hohelied“. Des Pfarrers Einwand, das komme sonst nur für Hochzeiten in Frage, wischte sie mit entschiedener Handbewegung unter den Tisch. „Mein Mann ist seinen Weg bewusst und bis zum Ende selbstbestimmt gegangen. Er war nicht Opfer. Seine Tat entsprach seinem ureigenen Willen. Das verdient Respekt. Liebevollen Respekt.“ Stotternd und gebodigt von Lilias Unerschütterlichkeit, ließ sich der Pfarrer überzeugen. Lilia betonte, dass wenn sie auch nur die geringste Beschönigung und verbrämende Sentimentalität von ihm höre, sie sofort aufstehen und das Krematorium verlassen würde. Das wirkte.
Der Pfarrer lieferte eine Predigt ab, die den Anwesenden solchen Eindruck machte, dass völlig unbekannte Personen am Ende des Gottesdienstes Lilia die Hand schüttelten und meinten, das sei die erste würdevolle und zutreffende Ansprache gewesen, die sie unter solchen Umständen gehört hätten. Sie gratulierten Lilia. Der Pfarrer habe ihnen gesagt, sie selbst habe die Idee des Zitats aus dem „Hohelied“ und den Kommentar dazu geliefert.
Während der Zeremonie musste Lilia ihre ganze Kraft aufbieten, um nicht loszuheulen. Vor allem als die Fahnenträger der Vereine den Chor der Abdankungshalle betraten und die Urne begrüßten, die unter einem Kranz von gelben Rosen und weißen Freesien fast verschwand. Ein Lebenslauf wurde nicht verlesen. Pierre-Louis‘ Bruder, ein Cousin und ein weiterer Angehöriger der Familie, den Lilia nicht kannte, sagten ein paar Worte. Jemand las ein Gedicht vor. Eine junge Frau sprach ein Gebet. Lilia bemühte sich um nichts, als darum, Gefasstheit, Ruhe und Würde zu bewahren: Aus Hochachtung und Liebe für ihren Mann. Es sollte kein Schatten auf sein Andenken fallen.
Erst noch war sie, Stunden vor der Beerdigung, am Flussufer entlanggerannt, den Hund neben sich, als einziges Wesen, das nun noch zu ihr gehörte. Sobald Verzweiflung sie überrollen wollte, stand sie still, so tief atmend als es irgend ging, bis sie den Blick ihrer Lehrerin wieder in sich sah. Diese unbeweglichen Augen ohne Hintergrund. Ohne Emotionen. Ohne Stellungnahme. Die sie vor dem Hinfallen bewahrten. Ihr Kraft gaben. Ihr Herz mit Liebe fluteten. Ohne zu zwinkern standhielten. Wie die Augen besagten Wolfs: Der zwischen Bäumen am Waldrand verharrt. Zu Stamm und Borke wird. Für Ungeübte unsichtbar. Schauend. Wahrnehmend. Und plötzlich wegtauchend. Wie nie gewesen. Ohne das geringste Geräusch.
Diese Augen trugen Lilia durch ihr Laufen. Durch das Aufbäumen akuter Verzweiflung. Durch brausende Angst – auch vor den Leuten, vor denen sie geradestehen musste, sei es als Schuldige oder als Erleidende, je nach deren Standpunkt.
Als Lilia voller brodelnder Energie und doch abgekämpft heimkam, duschte sie, puderte ihre Augen, erneuerte den Lidstrich. Sie zog das Kleid an und schlüpfte in die Pumps mit den goldenen Schnallen. Außer dem glitzernden Ehering und dem brillantenbesetzten Ring ihrer Großmutter trug sie keinen Schmuck. Die Haare band sie zum Mozartzopf zusammen. Betrachtete sich im Spiegel, um sicher zu gehen, dass ihr Aussehen Pierre-Louis keine Schande bereite.
Zusammen mit dem Onkel und der Schwiegermutter machte sie sich zu Fuß auf den Weg zum Friedhof, einen Bund orangefarbener Rosen in der Hand. Einen Beutel brauchte sie nicht. Der Jupe besaß verborgene Taschen. Zum anschließenden Imbiss mit Braten, Salaten und Kuchen erschienen überraschend viele Leute. Lilia lernte Verwandte ihrer Schwiegermutter kennen, deren Namen sie gleich wieder vergaß. Obwohl sie sich bemühte, eine zuvorkommende, liebenswürdige Gastgeberin zu sein, verharrte ein Teil ihrer selbst in erstarrter Konzentration. Es war, als sei der Knall des Schusses, den sich ihr Mann gesetzt hatte, zu einer Art von Dauerknall geworden. Der Schock hallte nach. Lilia fühlte sich wie hypnotisiert davon. Er machte sie innen totenstill, obwohl sie sich äußerlich mit Menschen sprechen und sogar lachen sah. Eine Stille, die anhielt. Sich immer wieder zeigte, und mit den Jahren zum Dauerzustand wurde. Lilias Leben schien auf eine bisher unbekannte Ebene versetzt worden zu sein. Die Augen des Wolfs, deren unverrückbarer Blick sie immer wieder aufsuchte, trugen ihren Teil dazu bei.
Einige Tage nach Pierre-Louis Beerdigung verspürten Lilia und ihre Schwiegermutter das Bedürfnis, einander wieder los zu sein, auf freundschaftliche Art und gleichzeitig mit Ungeduld. Lilia packte ihre Habseligkeiten und verabschiedete sich. Auch weil sie sich nicht länger dem unausgesprochenen Vorwurf, sie sei schuld an Pierre-Louis‘ Tod - der manchmal wie ein schwärender Schatten von der Schwiegermutter auf sie überschwappte - aussetzen wollte.
Auf der obersten Treppenstufe bei sich zuhause angekommen setzte sich Lilia hin, Mia im Arm. Plötzlich fühlte es sich unmöglich an, die Türe zur leeren Wohnung aufzustoßen und sich gewöhnlichem Alltag zu überlassen. Mia spürte Lilias Angespanntheit und begann leise zu fiepen. Lilia zog sie näher zu sich heran. Gemeinsam fingen sie an zu heulen, in langgezogenen Tönen, wie Wesen, die sich in argen Schmerzen wiegen. Später schlug das Heulen um in hilfloses Wimmern, als seien sie ausgesetzt worden, oder verloren gegangen, als bestünden keinerlei Aussichten, dass sie je gefunden würden und Hilfe erhielten. Auch glich es einem Ausbluten. Ließ es die unbändige Erschöpfung der vergangenen Monate aus Lilias Adern rinnen.
Mia entglitt Lilias Arm und bettete sich auf den roten, ausgelatschten Klinker, Pfoten und Kopf auf Lilias Schenkel. Lilias Arme hingen über ihre Knie wie nasse Tücher. Aus ihren Fingerspitzen flossen Weh, Sehnsucht und Einsamkeit. Rannen behutsam zu Boden und versickerten. Mit jedem Ausatmen wurde ihr Körper leichter. Schmiegte sie sich tiefer in dieses muskuläre Futteral, in das er nahtlos hineinpasste. Zeit schien aufgehoben, als gebe es überhaupt nichts mehr zu tun. Außer dem geduldigen Warten darauf, dass bald auch ihr Dasein ende. Sie schien in der Tat am natürlichen Schlusspunkt eines prall gefüllten Lebens angekommen zu sein, in dem es auf unspektakuläre Weise keinen Platz mehr für Zusätzliches gab.
Als es in Mia und Lilia still geworden war, schloss Lilia die Wohnungstüre auf und stellte sich dem Dahinter, an dem sich, zu ihrer großen Verwunderung, nicht das Geringste verändert hatte seit ihrem Weggang. Sie hörte den Bus durch die Gasse dröhnen wie zuvor. Die Kirchturmuhr verkündete klangvoll die Zeit. Als sie das Fenster aufmachte, drang Kindergeschrei zu ihr hinauf. Die Geschäfte waren geöffnet. An den Herbst gemahnende Dekorationen schmückten die Auslagen. Lilia konnte es kaum fassen, dass draußen das Leben sich unaufhörlich abspulte, als sei nichts passiert. Während dem in ihrem Inneren eine Zäsur gähnte, ein Raum bar von Zeit, und ihr eigenes Leben bockstill stand. Lilia setzte Wasser auf und braute sich einen Tee. Malvenduft stieg ihr in die Nase. Sie trank in winzigen Schlucken. Das heiße, aromatische Getränk wärmte ihre Kehle, schwemmte das Stickige der vergangenen Tage weg, rann belebend die Speiseröhre hinunter und breitete sich in ihrer Körpermitte aus. Der Nebel begann sich zu lichten. Tag erreichte Lilia. Freude über das wieder Zuhausesein stieg in Wangen, Stirn und Augen und erinnerte sie daran, dass sie als erstes aufräumen wollte.
Auf einem Regal standen, mit angeklebten Zetteln voller Anweisungen, immer noch die von Pierre-Louis vorsorglich bereitgestellten Ordner, Versicherungen betreffend, die zu kündigen waren und vieles mehr. Lilia sah sie einzeln durch, machte sich Notizen. Sie musste nur noch für sich allein sorgen, nur noch mit sich allein zurechtkommen. Sie würde sich an diese Tatsache gewöhnen. Sie brauchte nichts dafür zu tun. Nur zuzuschauen, wie sie sich ergab. Mali wich Lilia nicht von der Seite. Lilia war mehr als nur dankbar für diese beharrliche Anwesenheit. Sie liebte Tiere, seitdem sie denken konnte, nicht nur Hunde.
Als Kind durfte sie weiße Mäuse halten und Schildkröten. Die Mäuse wohnten in einer zweigeteilten Kiste. Auf der einen Seite standen ihre Futtertröglein. Die andere war vollgestopft mit Holzwolle. Darin bauten die Mäuse wahre Labyrinthe an Gängen und Kammern, in denen sie ihre Jungen großzogen, winzige, rosarote Fleischbällchen, die heillos zu quieken anfingen, wenn Lilia die Holzwolle anhob, um sie zu zählen.
Die Kiste bedeckte ein feinmaschiges Gitter, das mit drehbaren Haken über die Ränder gezurrt wurde. Die Kiste selbst stand auf den Gartenplatten vor der Küche. Und hin und wieder kam es vor, dass eine von Nachbars Katzen das Gitter aufriss und sich ein paar Mäuler voll duftendes Frischfleisch gönnte. Der Verdacht streifte Lilia, der Vater helfe solchen Raubzügen nach, wenn er fand, die Mäusepopulation vermehre sich zu rasant.
Gewöhnliche, graue Mäuse ersäufte der Vater kurzerhand im Gully vor dem Haus. Die weißen Mäuse jedoch duldete er, als Ersatz für den Hund, den er Lilia nicht zugestand. Für den Vater stellten die Mäuse das kleinere Übel dar – ebenso wie Lilias Schildkröten. Auch an ihnen hatte Lilia den Narren gefressen, fütterte ihnen mit Puppenlöffelchen Brotbröckchen, eingeweicht in Milch, knackige Salatblätter, Erdbeeren, mit denen sie sich gierig vollstopften, Tomaten, Pfirsiche, Gurken, alles, was sie mochten. Denn Schildkröten etwas aufzuzwingen, erwies sich als unmöglich. Über das, was ihnen nicht behagte, trampelten sie kurzerhand hinweg, zermanschten es, schmierten sich den Panzer damit voll.
Ihr Gehege stand auf dem beschränkten Viereck an wucherndem Gras in der Mitte des schäbigen Vorgärtchens. Die Schildkröten mähten es laufend ab und schlierten später grünlich schillernde Kotwürste hinter sich her. Dadurch ersparten sie es dem Vater, den Rasenmäher mit den abgenutzten Klingen öfter als notwendig schnaubend über das unebene Gelände zu bugsieren. Eine Arbeit, vor der sich auch Mama-Tante so oft es ging drückte.
Natürlich hatten Lilias Schildkröten Namen, auf die sie auch hörten, wenn Lilia sie rief. Unerwartet hurtig beinelten sie herbei, die Hälse gestreckt, die Mäuler auf und zu klappend. War Lilia nicht vorsichtig genug beim Darreichen einer Erdbeere oder eines Stückchens Apfel, bekamen ihre Finger die messerscharfen Kanten ihres Beißapparates zu spüren. Die Tiere wurden mit der Zeit ziemlich frech und eigensinnig, büxten gelegentlich aus und taten sich an Nachbars Gemüsebeeten gütlich. Eine davon blieb einen ganzen Winter lang verschollen. Lilia fand sich mit ihrem Verschwinden ab, dachte, sie sei geklaut worden, oder erfroren. Dann sah sie sie an einem der ersten warmen Frühlingsnachmittage auf sich zuhoppeln, das Maul wie üblich aufgerissen, Futter bettelnd, als sei nichts geschehen.
Auch Katzen gab es im Quartier. Doch vor diesen Tieren fürchtete sich Lilia. Sie lief vor ihnen davon, kaum tauchten sie auf. Hochgehoben, oder auch nur gestreichelt, hätte sie keine. Ihre Krallen erinnerten Lilia zu sehr an die von Cesira, mit denen sie periodisch Lilias Arme zerkratzt hatte.
Um ihren Tagen eine Struktur zu geben – und auch um ihren Lebensunterhalt zu verdienen - suchte Lilia eine neue Stelle in einem Büro. Sie stenographierte, tippte Briefe, Matrizen, kopierte, betreute die Dokumentenordner, verrichtete all die Arbeiten, die sie über die Jahre hinweg an verschiedenen Arbeitsstellen erlernt hatte. Ihre Mutter hatte nach Pierre-Louis‘ Beerdigung in ziemlich missmutigem Ton am Telefon gemeint: „Du brauchst jetzt wahrscheinlich Geld, nehme ich an.“ Worauf Lilia gereizt erwiderte: „Nein, brauche ich nicht. Ich bringe mich schon durch“, eine Antwort, die gedehntes Erstaunen in Mutters Stimme hervorrief. Deutlich milder gestimmt entgegnete sie: „Sag es einfach, wenn du etwas willst. Ich bin natürlich für dich da.“ Soweit kommen lassen wollte es Lilia nicht. Dafür war sie zu stolz. Das Geld von der Lebensversicherung brachte sie auf die Bank. Nur die einmalige Auszahlung der Witwenrente behielt sie für Gesangsstunden, Versicherungsprämien und andere Eventualitäten im Haus.
Der Aufforderung Bernds folgend, setzte sich Lilia erneut mit der Zusammenfassung ihrer Lebensgeschichte auseinander. Die Nachmittage und die langen Abende gehörten ja nun ihr allein. Einen Fernseher besaß sie nicht und dachte auch nicht daran, sich einen anzuschaffen. Fernzusehen glich in Lilias Augen einer Bankrotterklärung. Nicht mehr ungestört mit sich selbst auszukommen, empfand Lilia als persönliches Versagen, als einen Rückschritt in emotionales und kulturelles Rudelverhalten. Sie wollte ihr intellektuelles Potential nicht durch Fastfood-Denken verwässern.
Das Manuskript für Bernd begann mit einer Szene zwischen dem Vater und Lilia, die damals zwei Jahre alt war. Die Kurzfassung enthielt nur den Hinweis, der Vater habe manchmal vor dem Zubettgehen, oder an den Wochenenden, mit ihr gespielt. Das habe sie sehr glücklich gemacht. Nun brütete sie über diesem Nichts an Inhalt. Versuchte daraus eine durch Liebe, Einfühlsamkeit und Fröhlichkeit geprägte, sicht-, hör-, riech- und rundum erfahrbare Szene zu gestalten. Ein Kammerspiel der Intimität. Durchpulst vom Herzschlag ungetrübter Zweisamkeit.
Mit geschlossenen Augen verharrte Lilia bewegungslos vor dem blanken Blatt Papier. Die Nähe zu sich selbst, zum ureigensten Erleben erschien ihr wie Fledderei. Scham stieg in ihr auf, brannte auf ihren Wangen. Es kostete sie Überwindung, zum Ereignis auf Distanz zu gehen, sodass es darstellbar wurde, sich aus ihrem Gemüt herauslösen ließ, wie der Dotter aus einem hartgekochten Ei. Es sah aus, als müsste sie sich zuerst selbst zerstören, sich wie eine Nuss knacken, um den Kern der Erfahrung freizulegen.
Unerwartet zeigte sich ein winziges Detail: ein gestrickter Babyschuh, der vom kindlichen Puppenfuß gerutscht war und nur noch an seinem Häkelband von einer winzigen Zehe hing, als der Vater Lilia in die Luft warf, wieder auffing, an seine Brust drückte und wie ein flauschiges Stück Fell knuddelte, rubbelte, schüttelte und wiegte. Lilia ließ das Bild sich selbst aufschreiben und staunte, als es sich rein und frei von Gefühlelei auf dem Blatt präsentierte, farbenfroh, geruchs- und gefühlsintensiv. Abgetippt ergab es eine ganze Seite – nur eine Seite! Und daraus sollte ein pralles, vor Lebendigkeit strotzendes Buch werden? Lilias Mut sank, als sie sich ausmalte, wieviel Kraft sie ein solcher Vorgang kosten würde. Schon nur die eine Seite hatte sie müde und ausgelaugt zurückgelassen - wenn auch auf ungeahnte Art zufrieden, erfüllt und stolz.
Tags darauf versuchte sie, der ersten eine zweite Seite hinzuzufügen, einen weiteren Eindruck in Worte zu fassen und für sich sichtbar zu machen. Lilia begab sich in die Szene hinein, die sie in Latzhosen zeigte. An einem Kindergeschirr hängend, das kreuzweise über ihre Brust lief. Es gab ein Foto dieses Erlebnisses. Lilia war mit Mama-Tante und dem Vater im Tierpark gewesen. Den Hintergrund bildete ein Rudel grasender Rehe. Der Vater ging auf Distanz, rief Lilia zu sich. Mama-Tante ließ das Leitseil los, und die dreijährige Lilia stolperte, mit Grübchen in den Wangen, die Arme nach dem Vater ausgestreckt, wie ein noch nicht ganz flügger Spatz jauchzend auf ihn zu: ein Moment häuslichen Glücks, prall, saftig und süß wie ein frisch vom Baum gepflückter Apfel.
Das Schreiben fiel Lilia diesmal merklich leichter, auch wenn ihr der Gedanke, das ein Buch lang durchzuhalten erneut den Schweiß auf die Stirne trieb und schwarze Angst ins Herz. Vier, fünf Episoden gelangen Lilia so erstaunlich einfach, obwohl die Idee, sie seien Abbilder ihres Erlebten sie befremdete. Entsprachen sie wirklich der Realität? Oder war nur Fantasie am Werk?
Noch einmal setzte sich Lilia blankem Papier aus. Diesmal ging es um eine junge, weiße Gans, die der Vater eines Abends nach der Arbeit mitbrachte und Lilia zur Pflege anvertraute. Lilia war gerade in den Kindergarten eingeschult worden. Die Gans erhielt Gras, Salat, Getreide und in Wasser eingeweichtes Brot als Nahrung und manchmal Gemüse- und Früchteabfälle. Sie war nicht wählerisch.
Kam Lilia nach Hause, rannte ihr „Seppi“ - so taufte Lilia die Gans, ohne sich darum zu kümmern, ob es sich bei ihr um eine Gans oder eher um einen Ganter handelte - laut schnatternd entgegen, mit vorgestrecktem Hals, in einem Tempo, das Lilia fürchten ließ, die Gans laufe geradewegs durch sie hindurch. Doch dem war nicht so. Seppi verletzte Lilia nie, warf sie nie um. Haarscharf vor ihren Füssen stoppte die Gans, grub ihren Kopf in Lilias Schürze, in ihre Achselhöhle, barg ihn an Lilias Hals, zärtlich und behutsam. Und sie schubsten einander, schnäbelten, Seppi mit leisem, weichem Kollern in der Kehle, den Kopf durch Lilias Hände stoßend und ziehend, als bestehe er aus Flaum. So leicht und fein fühlte er sich an.
Lilia und Seppi wuchsen untrennbar zusammen. Lilia und Seppi - Seppi und Lilia: sie waren wie Zwillinge, nie böse aufeinander oder ungeduldig. Bis zum Tag, an dem Mama-Tante Seppi, der mittlerweile rund und stark geworden war, in einen Korb mit Deckel verfrachtete und Lilia bekanntgab, Seppi müsse zum Tierarzt gebracht werden. Zusammen schleppten sie den gewichtigen Korb die Straße hinunter und um einige Ecken herum. Mama-Tante läutete an der Hintertür eines Hauses, dem Lilia nie besondere Aufmerksamkeit gewidmet hatte. Ein Mann in weißer Schürze nahm den Korb in Empfang, tat kund, sie könnten Seppi in zwei Tagen wieder abholen. Und Mama-Tante und Lilia kehrten nach Hause zurück.
Voller Ungeduld und heimlichem Unbehagen bestürmte Lilia Mama-Tante schon am darauffolgenden Tag, sie könne nicht länger auf Seppi warten. Doch schenkte ihr Mama-Tante kein Gehör. Der Sonntag fiel auf einen wichtigen Feiertag. Mama-Tante trug einen fülligen, mit Orangen und Äpfeln vollgestopften Braten auf, dazu Kartoffeln und frische, gesprenkelte Stangenbohnen. Wieder bettelte Lilia, Seppi solle endlich heimkehren. Doch nur betretenes Schweigen antwortete ihr. Wie ein Schuss durchschlug Lilia die unfassbare Wahrheit. Sie schrie auf vor Schmerz und rannte nach draußen. Mama-Tante folgte ihr. Lilia stieß sie von sich. Welch ein Verrat! Lilia konnte es in ihrem kleinen Kopf nicht fassen, dass die Großen so gemein sein konnten. Während vielen Tagen schob sie das Heimkehren nach der Schule auf die lange Bank, hing herum, drückte sich an Zäunen und Hauswänden entlang, bekam es nicht in den Griff, zu verzeihen. Verweigerte sich dem Lauf der Welt. Dem Denken Erwachsener, die Kinder als vernachlässigbare Größe betrachteten, die man nach Lust und Laune belügen und betrügen konnte.
Die verschiedenen Episoden zusammengenommen brachten es auf mehr als ein Dutzend Seiten, fühlten sich tatsächlich an wie der Anfang eines Buchs. Lilia heftete sie mit einem blauen Band zusammen und steckte sie in einen orangen Umschlag, auf den sie in verschnörkelten Lettern den Namen „Bernd“ malte.
Denn Bernd wollte sie besuchen. Nach wochenlangem Unterbruch. Bedingt durch Pierre-Louis‘ Ableben. Er plante, spät nachts nach einer Vorstellung loszufahren und gegen Mitternacht bei Lilia einzutreffen.
Allem was geschehen war zum Trotz, fieberte Lilia Bernds Besuch entgegen. So lange hatte sie ihn nicht in den Armen gehalten, sogar gedacht, es wäre nie mehr möglich. Dann fand sie Bernds Brief im Kasten, der ihr seine Sehnsucht mitteilte, sogar in Verse, in holprige, liebenswürdige Verse gepackt. Und auch in ihr entbrannte die Liebe erneut, die sich, nur oberflächlich zugeweht, in halbschattigen Verzicht zurückgezogen hatte. Sie war ja allein und niemandem mehr Rechenschaft schuldig - überhaupt nicht schuldig, nicht im Sinne einer verwerflichen Tat, die sie begangen hatte. Und Bernd war noch nie zu ihr nach Hause gekommen. Es würde das erste Mal sein, dass er sie in ihrer Wohnung besuchte, in ihrer Witwenklause, die nebst Hunderten von Büchern, immer noch mit denselben, selbstangepinselten Brockenhausmöbeln bestückt war - wie zur Zeit ihrer Ehe mit Pierre-Louis. Lilia mochte ihre Art zu wohnen, die farbigen Teppiche an den hohen Wänden, die bunten Kissen auf der, zum Sofa umfunktionierten Couch, die sich auch Mali als bevorzugten Liegeplatz ausgewählt hatte. Mit ihrem schwarzgrauen Fell passte sie vorzüglich zum prallen Rot, dem Violett und Gelb - wie für ein Werbefoto hindrapiert.
Um elf Uhr, nach dem mutmaßlichen Ende von Bernds Vorstellung - einem langfädigen, schwerblütigen Klassiker - stieg Lilia die vier Stockwerke zum Hauseingang hinunter. Sie bewohnte das Haus allein, seitdem sein Besitzer für immer zu seiner Tochter in die Westschweiz übersiedelt war. An Lilias Arm baumelte ein Korb, in dem Rechaudkerzen in gläsernen Untersätzen steckten, Zündhölzer und ein paar dunkelrote, kleinblühende Rosen. Sie entriegelte die Eingangstür mit dem langstieligen Schlüssel, rückte einige Teelichter auf dem mit unebenen Granitplatten gepflasterten Flur zu einem Herz zusammen, zündete sie an. Drapierte die Rosen drumherum. Stieg bedachtsam die Stufen hoch. Verteilte gleichmäßig Teelichter darauf. Bewegte sich wie in Trance. So als begehe sie eine sakrale Handlung. Mit den wenigen Lichtern, die übrigblieben, bezeichnete sie den Eingang zu ihrer Wohnung. Den Tisch des Esszimmers. Den Weg bis zu sich ins Wohnzimmer, wo sie in einem durchgesessenen, antiken Lehnstuhl warten würde. Ihr Manuskript legte sie, ebenfalls von Kerzen angeleuchtet, gut sichtbar auf den Tisch im ersten Zimmer.
Kribbelnd lebendig wie schäumender Wein fühlte sich das Warten an. Mali schlief tief, als habe sie sich zurückgenommen, um ja nicht im Weg zu sein. Als es gegen Mitternacht ging. Die Turmuhr schlug dreimal. Stand Lilia kurz auf und äugte durch einen Spalt im Vorhang auf die Straße. Bernd bog eben um die Ecke, musterte die Häuserfront und schickte sich an, die Straße zu überqueren. Lilia sandte Wellen über Wellen aus ihrem Herzen die Stufen hinunter, um Bernd zu sich hochzuziehen. Nach einigen Augenblicken hörte sie das Knarzen der Stufen. Lilias Herz raste wie ehedem. So lautlos als es ging, trat Bernd zu ihr. Legte den Finger auf den Mund. Hob Lilia aus dem Sessel. Und trug sie zum Bett. Trug sie flaumleicht wie jedes Mal. Als habe sie überhaupt kein Gewicht. Er setzte sie hin. Und miteinander entkleideten sie einander. Langsam. Wie inszeniert. Und ohne einen Laut. Es hätte des Fingers an Bernds Lippen nicht bedurft: Lilia hatte ohnehin im Sinn, ihn stumm zu empfangen. Und stumm zu verabschieden.
Dann lagen sie beisammen. Und alles fügte sie wie selbstverständlich ineinander. Die Stille vermittelte den Bewegungen. Den Küssen. Den Zärtlichkeiten einen Hauch von Ewigkeit. Als drücke es ihnen einen Stempel von Unverwüstlichkeit auf. Dankbarkeit wallte in Lilia auf beim Gedanken, dass sie einander solches zu schenken fähig waren. Diesen ungierigen Vollzug eines Rituals. Das dank des Schweigens einem Gebet glich. Das nichts verlangte. Nur segnete.
Eine Stunde später verabschiedete sich Bernd mit einem letzten Kuss. Lilias Kopf mit heißen Händen umfassend. Und seinen Blick in den ihren bohrend wie zum letzten Mal. Lilia reichte ihm den Umschlag. Bernd stieg die Treppe hinunter. Die Kerzen ließ Lilia brennen. Sie würde die Reste am Morgen nach dem Spaziergang mit Mali einsammeln.
Zwei Tage später fand Lilia einen Brief von Bernd im Kasten. Er schrieb kein Wort, Lilias Erzählungen betreffend. Als sie ihn um einen Kommentar bat – um eine Bestätigung irgendwelcher Art, die ihr Kraft und Mut zum Weitermachen vermittelten – meinte er, er schweige absichtlich, denn ihr Geschriebenes spreche ihn so sehr an, dass er keineswegs intervenieren, den Fluss ihrer Erzählweise durch nichts stören wolle. Nun sei sie auf dem richtigen Weg. Sie solle ihn weitergehen und sich nicht davon abbringen lassen. Eine Auskunft, die in Lilia einen Moment lang sämtliche Glocken zum Schwingen und Klingen brachte, bevor sich Mutlosigkeit breit machte. Lähmende. Breiige Überforderung. Wozu sollte sie sich weiterhin anstrengen? Wer, außer Bernd, interessierte sich für ihre Geschichte? Sie war ein Niemand. Gehörte weniger denn je irgendwohin: Alte Gefühle, die Lilia in- und auswendig kannte, und die ihr längst zum Hals hinaushingen, liefen Amok in ihr. Sie fraßen sich wie Würmer durch die labile Schicht an fadenscheinigem Selbstbewusstsein, das sie sich errungen zu haben glaubte. Kurzfristig optimalen Einsatz zu zeigen, darin war sie gut, sehr gut sogar. Doch langfristig die täglich anfallenden Widrigkeiten mit Kraft und Engagement durchzutragen, das lag ihr nicht. Obwohl: ihre Geschichte mit Bernd trug sie seit fast zwei Jahrzehnte mit sich herum. Versorgte sie unablässig mit nie erlahmender Energie. Nahezu mit Besessenheit. Ohne sie aus dem Blick zu verlieren. Sie verwässern zu lassen. Oder sich zu erlauben, dass sie in Sentimentalität und modrige Schäbigkeit abrutschte. Also konnte sie durchboxen, was ihr am Herzen lag, wenn sie es wollte, vorausgesetzt es machte Sinn und generierte Bereicherung. Machte ein Buch über sich selbst zu schreiben Sinn? Lohnte es den Aufwand? Nur um es letztendlich in ihrer Schublade verschwinden zu sehen?
Diesen Fragen auf den Grund zu gehen, kam Lilia über Nacht die Zeit abhanden. Denn Bernd überstieg eine Grenze, die zu übersteigen sich selbst Lilia, die Überschwängliche, nicht die Einwilligung gegeben hätte: er fragte sie in seinem nächsten Brief, ob sie ihn heirate, wenn er sich freimache.
Lilia zerriss es das Herz, als sie den Satz las. Es spaltete sie mitten entzwei, als habe der Blitz in sie eingeschlagen. Sie wand sich vor Entsetzen. Dass ihre Begegnung nicht dauern würde, wusste sie. Nun da sie zu zerbrechen begann, raubte ihr der Schmerz den Verstand. Sie verfügte über nichts, um einer in Alltag und Normalität abgerutschten Verbindung mit Bernd Rückhalt zu geben. Immer noch nannte er sie seine Melusine. Und sie verstand, was er damit meinte. In gewisser Weise hatte er Recht: Sie war die Wasserfee mit Schlangenleib, der der Ritter versprechen musste, ihren Anblick an gewissen Tagen zu meiden. Nur unter dieser Bedingung könne sie ihm Reichtum schenken. Ihn verzaubern. Und beglücken. Wolle er sie sich dagegen zu eigen machen, zerbreche die Magie: Er würde ihre wahre Erscheinung erkennen. Dem gegenüberstehen, was ihr zu einem tüchtigen Alltag fehle: feste Füße, die in der Erde wurzelten. Sesshaftigkeit, um seinem pausenlosen Herumreisen ein Heim zu bieten. Einen Herd, an dem er ausruhen, Kraft tanken könne - bei einer Frau, die selbst Karriere mache. Die einen soliden Freundeskreis besäße. Einen ausgedehnten Bekanntenkreis, der sie während den Phasen des Alleinseins unterstütze. Dinge von denen Lilia nur träumen konnte. Und von denen sie im Grunde genommen gar nicht träumen wollte, weil sie ihrer Lebensart zuwider liefen. Denn angehören – gehören, wollte Lilia niemandem. Zudem fehlten ihr Zeit und Muße, jemanden mit sich mitzutragen. Sich mit jemandem zu teilen. Und was, wenn aus einer solchen Verbindung ein Kind hervorginge. Ein Junge. Den sich Bernd so sehr wünschte. Und er sie mit ihm fallen ließe. Über Wochen. Auch Monate hinweg? Sie würde sich gefangen fühlen. An bleiernen Ketten hängend. Und die Energie, die Bernd an ihr so sehr schätzte. Die ihm zu fliegen erlaubte. Würde jäh erlahmen. Das durfte nicht sein. Nicht nur sie würde daran zugrunde gehen. Sondern auch er. Und daraus würde Schuld geboren, wirkliche Schuld.
Lilia antwortete Bernd nicht gleich. Sie erbat sich Zeit. Erbat sich Raum. Um zu Atem zu kommen. Pierre-Louis war noch keine zwei Monate tot. Das Bewusstsein für ihr Witwentum hatte noch nicht richtig in ihr Wurzeln geschlagen. Sie durfte sich von keinen zusätzlichen Anforderungen und Ereignissen überrollen lassen. Ihr Weiterleben hing davon ab, dass sie sich still verhielt. Sich ihrem Alleinsein stellte. Und zuerst einmal ausatmete – ausatmete. Sie war so müde. War des Lebens so müde. Der Geballtheit der Vorkommnisse überdrüssig. Zum Sterben überdrüssig.
Doch Bernd erneut zu sehen willigte Lilia ein. Noch so gerne. Noch gehörte es zum Vollkommensten, das sie sich vorstellen konnte. Sie reiste ihm zu einer Lesung nach. Sie besuchten zusammen eine Gemäldeausstellung und übernachteten in einem Hotel. Gaben sich alle erdenkliche Mühe, ihr Zusammensein zu kitten. Den Haarriss, der es schon spaltete zu übersehen. Ineinander noch einmal mit der ganzen Ausschließlichkeit ihrer Liebe aufzugehen. Das Verblühen abzuwenden. Obwohl sie beide spürten, wieviel Abschied schon in ihrem Gemeinsamen steckte. Wie subtil es begann, auseinanderzudriften.
Bernd erhielt anlässlich seines Auftritts einen Arm voller Blumen, den er, willentlich oder unbewusst, gegen die Brust drückte, als er sich mit gierigem Kuss von Lilia trennte, die, schon räumlich durch die Blütenpracht von ihm getrennt, sich bemühte ihn zu erwidern.
Und dann begegnete Lilia Igor. An einem eiskalten Morgen im Wald am Fluss. Sie trug geschnürte, pelzgefütterte, ihre Waden bedeckende Stiefel, oberhalb derer die, nur von dünnen, fleischfarbenen Strümpfen bedeckten Knie bläulich angelaufen waren, einen kurzen, gemusterten Wollrock, eine Fuchsfelljacke und über Stirn und Ohren ein buntes Tuch. Igor bemerkte sie erst, als er mit seinen drei irischen Wolfshunden um ein paar Bäume herum in ihre Richtung schwenkte. Lilia schreckte zurück. Welch geballte Ladung an Präsenz kam da auf sie zu! Sie blieb wie angewurzelt stehen. Das Einzige, das sie hervorbrachte war: „Beißen sie?“ „O, nein. Sie sind sehr friedlich“, entgegnete der Mann und lachte.
Lilia kam sich einfältig und görenhaft vor in ihrer zimperlichen Ängstlichkeit. Mali ging auf die Hunde zu. Sie beschnüffelten einander. Weiter geschah nichts. Mali, mit ihrer in sich gefestigten und gönnerhaften Selbstverständlichkeit, brachte so rasch nichts aus der Ruhe. Typisch Spaniel, ließ sie sich weder wirklich erziehen noch sonstwie verbiegen. Sie bellte selten. Und wenn, klang es einfach nach Protest, weil irgendetwas ihr zu nahe getreten war und ihre Intimsphäre verletzte. Feindselig gab sie sich nicht. Auch nun benahm sie sich überlegen damenhaft, trabte schwänzelnd weiter, die drei sie überragenden, linkischen Zudringlinge links liegen lassend. Lilia konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. „Ist halt ein Spaniel“, meinte der Mann grinsend, grüßte, wünschte einen schönen Tag und ging seines Wegs.
Lilia vergaß ihn sofort. Aus dem Augenwinkel hatte sie flüchtig wahrgenommen, was für ein ausdrucksvolles Gesicht ihr gerade begegnet war. Fülliges Haar umkräuselte Stirn und Schläfen und fügte sich im Nacken zu einem kurzen, währschaften Zopf. Zöpfe an Männern mochte Lilia. Doch war in ihr kein Platz für diesen speziellen. Immer noch geisterte der Gedanke in ihrem Hinterkopf herum, sie werde bald sterben. Vergehen und im Nichts verschwinden. So wie es den Anschein habe, liege auch ihre Beziehung zu Bernd im Sterben. Werde innert Kürze vergehen. Und im Nichts verschwinden. Wie die Luft, die sie atmete, der es ebenso an beständiger Substanz gebrach.
Lilia lebte ein in sich verschachteltes, abgeschiedenes, von fast jedem sozialen Engagement abgekapseltes Leben. Ein Auto besaß sie nicht mehr. Der Firmenwagen wurde zurückgenommen. Pierre-Louis‘ Auto verkauft. Sich ein neues zu gönnen, kam Lilia nicht in den Sinn. Wozu auch? Außer zur Schwiegermutter, die sie zu Fuß in einer knappen Stunde erreichte, besuchte sie niemanden. Ihr war nicht wirklich bewusst, wie sie die Tage zubrachte. Sie vereinbarte, die Gesangsstunden noch so lange zu besuchen, bis der Tag anbreche, an dem sie glasklar wahrnehme, dass sie sie für immer loslassen könne, ohne es zu bereuen. Ihr letztes Engagement sagte sie ab, obwohl sie den Dirigenten, der sie sehr mochte, damit vor den Kopf stieß. Lilia war an einem Punkt angelangt, an dem alles in ihr nach Befreiung schrie. Nach Erlösung von Lasten, die sie sich einst freiwillig, enthusiastisch und voller Ehrgeiz aufgehalst hatte.
Es dauerte nur elf Wochen, bis der Morgen heranrückte, an dem Lilia aufstand und es innerlich zu ihr sagte: „Heute ist der Tag.“ Sie atmete tief durch, bestieg den Zug, reiste in die Großstadt, leicht und frei, erschien zur Gesangsstunde und verkündete: „Heute ist der Tag gekommen. Heute höre ich definitiv mit dem Singen auf.“ Und trotz Bedauern ihres Lehrers, stieß sie auf Verständnis. Drei Tage später ereilte sie, wie ein Bergsturz, eine Erkältung. Sie hustete, schniefte, nieste wie schon lange nicht mehr. Und sie genoss es. Ihr Leben machte reinen Tisch. Sie schnürte die Opern-, Lieder- und Konzertpartituren zu Bündeln zusammen und trug sie ins Brockenhaus. Die Berge an Schallplatten, aus dem Barock bis hin zu Wagner und Schönberg, verschenkte sie en bloc. Es befanden sich richtige Trouvaillen darunter, etwa der ganze „Cid“ von Corneille mit Gérard Philippe, „Hamlet“ mit Laurence Olivier und Ähnliches. Lilia räumte ihre Vergangenheit ohne Bedauern auf. Und zog einen dicken Strich darunter.
Nur unter Bernd einen Strich zu ziehen, gelang ihr noch nicht. Sie wollte es auch nicht. Diese Geschichte war noch nicht ausgestanden. Und sie würde es noch lange nicht sein. Runde sieben Jahre benötigte Lilia, um sie endgültig zu Ende zu bringen, in Liebe und Dankbarkeit. Sodass sie auch Bernds Schachtel, vollgestopft mit Briefen, Fotografien, Karten und Gedichten ohne Bedauern, und ohne dass es ihr das Herz brach in den Kamin stellen und mit einem Zündholz in Flammen aufgehen lassen konnte.
Bis dahin durchlebte Lilia manchen Tag wie im Fieber. Vor Sehnsucht. Begehren. Einem Reißen und Zerren in Herz und Gliedern, das sie schier durchdrehen ließ. Genaugenommen lief jeder Tag so ab: in vollendeter Qual. Sie hielt sich nur bei Verstand, indem sie Gedichte schrieb. War sie mit Mali unterwegs, trug sie Papier und Stift bei sich. Und sobald Lilia das Gefühl überkam, nicht weiterzukönnen, setzte sie sich auf einen Stein am Wasser, oder einen abgesägten Stamm am Wegrand, und ließ ihr Entsetzen in Worte Fließen. Es entstanden subtile, pastellene Verse. Alle an Bernd gerichtet. Sie schickte sie ihm auch zu. Gerade weil auch er sich unendlich schwer tat mit der Trennung von ihr. Lilia sagte ihm, eine Heirat komme für sie nicht in Frage. Er schrie, als er es vernahm. Beklagte, er könne kaum noch arbeiten. Leide genauso wie sie. Doch es gab keine andere Lösung. Sie mussten, jeder für sich allein, ihre Geschichte zu Ende bringen. Sie hatten es von Anfang an gewusst. Vielleicht hätten sie noch eine Weile durchhalten können. Bis irgendwann dennoch ein Schlussstrich hätte gezogen werden müssen. Es gab Erfahrungen, die im Tatsächlichen nicht von Dauer sein durften. Auch wenn sie im Unsichtbaren weiterlebten. Weiterblühten. Bis sie, diamantengleich, aus sich selbst heraus zu strahlen anfingen. Und zum Licht wurden auf dem Rest des Wegs. Glück und Weh fanden am selben Ort im Herzen statt. Dieselben Nerven brachten sie zum Schwingen. Beide brannten sie den Menschen aus. Um schließlich Raum und Weite. Einverständnis und Reichtum zu schaffen. Sie wussten es. Sie wollten es. Der Flug zur Sonne trug den Absturz in sich. Dass daraus kein Zerschellen wurde, lag in ihrer Hand. Und Lilia war eisern entschlossen, dieses Juwel, das ihr das Leben gönnte, auf keinen Fall verkommen zu lassen. Sie schrieb noch gelegentlich halbherzig an Szenen des Buchs für Bernd. Doch machte die Arbeit nicht mehr wirklich Sinn. Sie schickte ihm auch in Abständen Briefe. Oder überreichte sie ihm am Ende von Lesungen, zusammen mit Blumen. Wenn sich Gelegenheit dazu bot, küsste er sie mit der gleichen Inbrunst wie ehedem.
Einmal, fünf Jahre nach ihrer Trennung, die nie wirklich eine war, Besuchte Lilia eine Vorstellung mit Bernd in der Hauptrolle, ein leises, äußerst feinnerviges, zart besaitetes Stück, wie der Flügel eines Schmetterlings. Ein Stück, dem ein Briefwechsel zugrunde lag. Und von dem Bernd Lilia hinterher schrieb, seine Interpretation enthalte all die Hingabe. Das Beseelte. Verhaltene. Das Lilia ihm zu erfahren möglich gemacht habe. Es war kein Stück, das zog. Nur gerade eine Handvoll Zuschauer füllten die Reihen am sommerlichen Nachmittag, an dem Lilia es zusammen mit einer Kollegin besuchte. Bernd spielte nur für Lilia. Es war nicht zu übersehen. Immer wieder tauchte sein Blick in den ihren. Er bewegte sich sorgsam und still. Darauf bedacht, den Zauber der Sätze, die leichthin glitten wie Seifenblasen, ja nicht zu stören. Lilia hing an ihm und um ihn wie die Luft, die sie atmeten. Wieder gebar sich das Wunder ihres Vereintseins. Doch Lilia fürchtete, der Schmerz der Ablösung könnte sie in seinen Augen alt und hässlich aussehen lassen. Also ließ sie sich von ihrer Freundin, die nichts von ihr und Bernd wusste, nach der Vorstellung dazu überreden, vor ihrer Heimfahrt noch etwas essen zu gehen.
Zwei Wochen später erreichte Lilia ein Brief von Bernd, in dem er klagte, er habe mehr als eine Stunde am Bühneneingang auf sie gewartet, ohne zu begreifen, warum sie nicht erscheine. Schließlich sei er wie gelähmt nach Hause gefahren. Die letzten Tage seien eine einzige Tortur gewesen. Er spüre sich noch immer fast nicht. Wie sie ihm das nur habe antun können.
Den drei Wolfshunden in Begleitung ihres Besitzers begegnete Lilia nun öfter, ohne es besonders zu vermerken. Die Tatsache streifte ihre Wahrnehmung, fand jedoch keinen Weg in ihr Bewusstsein. Bei den meisten Begegnungen wurden ein paar Worte gewechselt, belanglose Sätze, die nichts hergaben und nichts wegnahmen, zu nichts einluden und nichts offenlegten.
Gerade zu dieser Zeit, trotz tiefsten, grimmigsten Winterwetters, zog es Lilia besonders ans Wasser. Automatisch wählte sie den gleichen Weg, auf dem sie vor der Beerdigung ihres Mannes entlanggerannt war, atemlos, heulend, eisernen Willens nicht schlapp zu machen. Den Wolfsaugen folgend, als werde sie von ihnen auf einer Bahn entlanggezogen, die sie vor dem Entgleisen schütze. Die Strecke betrug etwas mehr als eine Stunde. Sie führte auf einem Fußweg, auf dem zwei Personen knapp nebeneinandergehen konnten dem Fluss entlang, durch tunnelartige Waldstücke und über sandige Buchten. Es war ein Weg, den Lilia instinktiv suchte. Dessen Begehung nie zur Gewohnheit wurde. Der Fluss mit seinen Uferpartien aus groben Kieseln, angeschwemmtem Holz, von Enten und Schwänen bewohnt, wurde, je nach Witterung, in Schattierungen leuchtenden Grüns getaucht, in blauviolett flimmerndes Silber oder mit Gold besternt, wenn sich die Sonne dem Horizont zuneigte. Zum Schwimmen eignete sich der Fluss wenig. Strudel, die immer mal wieder einen Vater, der ein Kind oder seinen Hund vor dem Ertrinken retten wollte, in sich hineinzogen und gurgelnd verschlangen, mäanderten bizarr über seine Oberfläche. Ein tückisches Gewässer war es, das Mali fesselte. Sie war unermüdlich im Apportieren von Stecken, die Lilia an seichten Stellen für sie ins Wasser schmiss. Bis Mali zitterte und bebte, einerseits aus Kälte, andererseits aus Gier, nicht genug davon zu kriegen. Dann setzten sich Lilia und Mali auf die von Sonnenwärme beheizten Steine, und Lilia rubbelte Mali, bis das Zittern aufhörte, und Mali sich erneut ins Wasser stürzte. Mali und Lilia: sie hingen aneinander wie Kletten. Beide hatten sie niemanden außer einander. Beide waren sie gefühlsbetont, hatten nah ans Wasser gebaut, mochten es warm und kuschelig. Daneben waren beide ein bisschen widerspenstig und hart im Nehmen. Eifersüchtig darauf bedacht, nichts und niemandem Platz zwischen sich zu gönnen. Sie genügten einander vollständig.
Tiere spielten in Lilias Leben die erste Klarinette. Tiere, so fühlte sie, brauchten mehr Schutz als Menschen. Menschen waren Tieren schon nur durch ihren Eigensinn. Durch Härte. Gefühllosigkeit und Egoismus überlegen. An Tieren klebte Lilia mit ihrem Blut. Fühlte sich ihnen auf eine Weise zugehörig, die sie gegenüber Menschen nur selten empfand. Menschen fürchtete, bewunderte oder floh sie. Gegenüber Tieren wusste sie sich nicht im Nachteil. Fell mit ihren Händen durcheinander zu wuscheln, unterschied sich himmelweit vom Streicheln über feuchte oder papierene, struppige oder Make-up-beschmierte Menschenhaut. Die sich stets etwas klebrig anfühlte, nicht so streichelfreudig, zart und weich. Fell aktivierte die Nerven in Lilias Händen. Sang in ihnen. Kribbelte. Liebkoste die Hände in sinnlicher, erotischer Weise, die das Herz kitzelte. Nicht sexuell. Sondern im Ertasten von ihresgleichen. Du-haft.
Per Zufall entdeckte Lilia in einem Warenhaus eine im Preis stark reduzierte Wolldecke aus grauem künstlichem Fell, die sie sich nachts direkt über den Körper zog und in der sie, links und rechts, ihre Hände vergrub, wie in warmem, wohligem Erdreich. Sich dabei geborgen, beheimatet fühlend und embryonal zufrieden. Tiere bewegten sich in einer Aura, die Lilia physisch spürte. Und wenn Mali sie mit ihren dunklen, tiefgründigen Augen ansah, ihr Blick sich verschleierte wie der Blick eines Welpen, der voll vertraut, der sich ganz hingibt dem Blick des Verwandten, wusste Lilia manchmal kaum, wo das Tiersein aufhörte und etwas begann, für dessen Existenz sie keinen Namen kannte. Es grenzte an Magie, an etwas sehr Geheimnisvolles, dem auch Leiden eignete und das, wie Lilia selbst, todgeweiht war.
Die Tage rannen Lilia durch die Finger wie Sand, schwerelos, auch leidenslos. Morgens ging sie zur Arbeit, am Nachmittag mit dem Hund nach draußen, so weit wie ihr immer noch müder Körper gehen mochte. Sie erlebte sich wie in luftiger Höhe. Stille war nach dem Sturm eingekehrt. Sie war aller Pflichten enthoben. Ein Bewusstsein, das sich allmählich in jede ihrer Zellen senkte Ohne Rebellion. Sie war nun wirklich allein. Finanziell kam sie gerade so über die Runden. Mehr brauchte sie nicht. Für eine etwaige Zukunft fehlte es ihr an Plänen. Sie konnte sich kaum noch an ihren früheren Ehrgeiz. Den Enthusiasmus. Die Leidenschaft erinnern. Der Schmerz um Bernd hatte sich zum Dauerzustand gewandelt. Er durchfloss ihre Tage wie flüssiges, heißes Blei. Ein Umstand, in den sie sich widerstandslos fügte. Sie hätte ihn vermisst, wäre er plötzlich verstummt. Und sie wäre vielleicht zu Eis erstarrt, ohne das permanente Brennen. Es gab ihren Tagen Präsenz und Sinn.
Um Pierre-Louis zu trauern gelang Lilia nicht. Es wäre ihr wie Verrat vorgekommen. Sie betete auch nicht für ihn, fand, er habe das nicht nötig. Für Lilia hatte seine und ihre Geschichte ein schlüssiges, klares, sogar sauberes Ende genommen. Es gab nichts daran herumzudeuteln, nichts zu hinterfragen. Schuld lag keine vor. Die Schuldfrage wäre nur dann aktuell geworden, hätte Lilia sich um ihre Mitarbeit an der Geschichte gedrückt. Da sie sie bis zum Ende durchtrug, blieb nichts zu verzeihen. Und keine Vergebung musste eingefordert werden. Das Leben gehörte den Lebenden. Ob sie sich selbst auch dazu zählte, entging Lilias Wahrnehmung. Sie befand sich in einer Art freiem Fall. In einer Zwischenwelt. Gehörte weder zur Seite der Tätigen, noch zur Seite der Untätigen. Dankbar dafür, dass sie niemandem etwas schuldete, nur mit sich allein klarkommen durfte, ließ sie die Tage laufen wie es ihnen beliebte.
Manchmal begegnete sie auf ihren Märschen einem Mann, der in allen Einzelheiten Leo, ihrem Lehrer aus dem Privatgymnasium glich. Sie war verblüfft, als sie ihn zum ersten Mal sah, vergaß sogar zu grüßen. Er führte einen struppigen, schmutzigbraunen Dackel an der Leine, der aufs Wort gehorchte.
Nachdem sie ein paarmal Seite an Seite gelaufen waren, getraute sich Lilia, den Mann zu fragen, ob er Leo kenne. Er antwortete mit: „Ja.“ Eine Erklärung folgte nicht. Später erwähnte er, es komme öfter vor, dass Leute ihn verwechselten. Lilia hätte gern mehr über ihn erfahren, fürchtete jedoch, brüskiert oder abgehängt zu werden. Neugierig erscheinen wollte sie auf keinen Fall, Auseinandersetzungen unbedingt vermeiden. Sie erfuhr nur seinen Nachnamen. Der Einfachheit halber hielt Lilia ihn für den Zwillingsbruder von Leo. Wie Leo philosophierte er gerne, obwohl ihm das Militante fehlte. Er stieg für nichts auf Barrikaden. Verhielt sich reserviert und distanziert. Seine Sicht der Welt hatte nichts von der Buntheit und der Besessenheit Leos. Er war ein angenehmer Wanderkamerad, weder aufregend noch langweilig, vor allem nicht anstrengend. Und das genügte Lilia. Zuweilen versuchte er, den einen oder anderen ihrer Gedankengänge etwas zurechtzurücken und ließ es bleiben, als er dabei auf Lilias beharrlichen Widerstand stieß. Er wohnte Lilia gegenüber, ein Stockwerk unter dem ihren, und winkte ihr hin und wieder zu, wenn er sich fürs Spazierengehen zurechtmachte. Das freute Lilia. Meistens schloss sie sich ihm an. Nicht immer. Obwohl es sie wurmte, wenn sie ihn darauf allein losziehen sah. Doch vor erneuter Abhängigkeit graute ihr noch mehr als vor Einsamkeit.
Es wurde Weihnachten. Und Lilia beschloss, das Fest allein zu verbringen. Dem Widerstand der Schwiegermutter zum Trotz, die meinte, Lilia solle sich das nicht antun. Ein Argument, das Lilia nicht verstand. Sie empfand verheißungsvolle Freude, wenn sie an diese Tage nur mit sich allein dachte. Der Gedanke, mit der Familie der Schwiegermutter zu feiern, flößte ihr dagegen Schrecken ein. Nicht weil sie die Leute nicht mochte. Sondern wegen der Anstrengung, die sie erbringen müsste, um sich mitzuteilen, vorwurfsvolle oder mitleidige Blicke durchzustehen, zu essen und zu trinken, Geschenke zu verteilen und zu empfangen: All der Rituale wegen, die gemeinsames Feiern zwangsläufig mit sich brachte.
Lilia kaufte sich ein winziges Bäumchen, das sie auf den alten Schlitten stellte, den sie auf einem Flohmarkt, in Erinnerung an Leo erstanden hatte. Auch wenn er dem exklusiven Modell Leos in keiner Weise das Wasser reichte. Über und über schmückte Lilia das Bäumchen, bis es aussah wie eine Preziose aus Omas und Opas Zeiten. Bis es glitzerte und flimmerte. Daneben stellte sie die Krippe mit den „Santons“ und dem originalgetreuen „Mas“, den Pierre-Louis, entsprechend den Vorbildern, die sie in der Provence bestaunten, gebaut hatte. Den Schlitten schob sie vor die Couch, zu den hohen Fenstern, die auf die Hauptgasse hinausgingen, und über die sich Lichterketten spannten, jede mit einem umfangreichen Stern behangen. Dann löschte Lilia das Licht und entzündete einige Kerzen auf ihrem blutrot bemalten Teetisch. Mali im Arm, legte sie sich auf die Couch. Der Glanz der Weihnachtsbeleuchtung von draußen verwandelte die Stube. Lilia lag in traumgleicher Weichheit. So verhalten. Fast ausgelöscht. Als stehe Leben still. Obwohl Tränen über ihr Gesicht rannen, empfand sie Glück darüber, einfach nur für sich zu sein. Nichts wollte sie fühlen, als einzig sich selbst. Ihren Atem. Den Herzschlag. Das Liegen. Den Geruch ihrer Haut. Den Geruch von Fell. Das Wohlsein. Malis Wärme an ihrer Brust. Das Auslaufen der Zeit.
Mit ihrer Mutter pflegte Lilia nur dann Kontakt, wenn Lilia selbst sie anrief. Die Mutter ergriff nie die Initiative. Es ging ihr auch nicht besonders gut. Vom Onkel erfuhr Lilia, es sei bei ihr Krebs diagnostiziert worden, und sie bekomme starke Medikamente. Sei jedoch auf und gehe jeden Tag mit ihrer hinkenden Haushälterin ein paar Schritte nach draußen, die Seepromenade entlang. Beim Hören dieser Nachricht merkte Lilia, wie weit entfernt die Nachricht für sie klang, als habe sie weder etwas mit ihrer Mutter noch mit ihr selbst zu tun.
Am zweiten Weihnachtstag, als allmählich Einsamkeit in ihre Etage hochkroch, wie ein Wurm, der sich über die Festtage mühsam zu ihr hinaufgearbeitet hatte, setzte Lilia sich mit der Mutter in Verbindung. Deren Stimme klang erschöpft, melancholisch, und Lilia, sensibilisiert durch eigenes Leid, fühlte liebkosende, ihr Herz durchflutende Zärtlichkeit zu dieser ihr nahezu unbekannten Frau am anderen Ende der Leitung. Widerstand und Abscheu waren wie weggeblasen. Sie konnte mit der Mutter sprechen ohne Missbilligung. Ohne Notwendigkeit, die Antworten der Mutter als Angriffe auf ihre Person zu empfinden. Über ihre Krankheit fragte Lilia die Mutter nicht aus. Sie wusste, sie erhielte keine Auskunft. Immer noch trauten sie einander nicht über den Weg. Immer noch bestand zwischen ihnen die Angst, vom anderen bloßgestellt, hintergangen oder angefeindet zu werden. Wie zwei Katzen schlichen sie um den heißen Brei. Darauf bedacht, einander tunlichst nicht in die Quere zu kommen. Es blieb bei Nettigkeiten, bei Andeutungen. Lilia getraute sich nicht, der Mutter zu sagen, sie rufe sie an, weil sie sich einsam fühle. Und auch die Mutter umging Formulierungen, die auf irgendein Manko auf ihrer Seite hinwiesen. Beide spürten sie die Sehnsucht des anderen nach Annäherung. Vielleicht sogar nach einer tröstenden Hand. Einem aufmunternden Wort. Einem persönlichen, nur ihnen beiden zugehörigen Satz, der Öffnung herbeiführen könnte. Und tatsächlich: Kurz bevor sie sich voneinander verabschiedeten, führte die Mutter überraschend an, sie denke daran, ihre Wohnungen zu verkaufen, sich eine komfortable Altersresidenz zu suchen und für den Rest ihrer Tage in ihren Heimatkanton zurückzukehren. Was Lilia dazu veranlasste, spontan zu versichern, sie komme sie besuchen, sie überlasse sie ganz sicher nicht sich selbst, sondern nehme sich ihrer an, so gut, als es in ihren Möglichkeiten liege. Lilia war freudig überrascht, dass die Mutter ihr diesen einen Schritt entgegenkam, aus eigenem Ansporn. Und dass sie selbst es schaffte, auf ihn einzugehen. Das Bedürfnis, die emotionalen Altlasten aus ihrer Vergangenheit anzupacken und aufzulösen, zeigte sich bei Lilia nun besonders stark.
Vielleicht trug ihre Müdigkeit dazu bei und die Lethargie ihres Zustandes in unbestimmten Zwischenbereichen, die sie nicht dingfest machen konnte. Vielleicht hatte es auch mit ihrem Alter zu tun. Lilia war nun zweiundvierzig Jahre alt. Oder es spielte der Tod Pierre-Louis‘ mit hinein, der ihr den Zugang zu einer Haltung des Einlenkens, des Vergebens und Vergessens öffnete, den sie vorher nicht sehen konnte. Wie auch immer: Lilia fühlte sich zutiefst zufrieden. Im Senkel. In etwas Reinem angekommen, als sie den Hörer auflegte, Mali hochhob, an sich drückte, und vor lauter Erfülltheit ein kurzes, heftiges Schluchzen aus ihr hervorbrach. Das sich anfühlte, als sei sie einem heilenden, süß und gleichzeitig herb duftenden Bad entstiegen. Sie wusste, es würde ihr nicht immer leicht fallen, das gegebene Versprechen einzuhalten, falls ihre Mutter wirklich heimkehrte. Und Lilia war sich auch klar darüber, dass, wollte sie ihre Altlasten tatsächlich erlösen, ihr nichts anderes übrig bliebe, als sich die Zeit zu nehmen, einfühlsam, zurückhaltend und offen auf ihre Mutter zuzugehen. Das Versprechen war gegeben und angenommen worden. Die Mutter würde seine Ernsthaftigkeit am sich hoffentlich entfaltenden Resultat messen.
Lilia hatte es stets abgelehnt, sich zu gegebener Zeit um den Hausrat der Mutter zu kümmern. Die umfangreichen, antiken Möbel, das viele Silber, Geschirr und Kristall, die Schubladen voller bestickter Leinwand, die Teppiche und Bilder stellten für Lilia zeitlebens Monstrositäten dar, sperrige, staubige Hässlichkeiten, die sie niemals in ihrer Wohnung dulden würde. Nun, da die Mutter erwähnte, sie werde die Sachen verkaufen müssen, falls Lilia sie nicht haben wolle, drehte sich Lilias Sicht auf die Dinge um hundertachtzig Grad. Sie verstand nicht, wie es geschah. Plötzlich packte sie die Gier mit voller Wucht. Zum ersten Mal richtete sie eine Bitte an ihre Mutter. Und die Mutter willigte freudig ein. Sie vereinbarten dass, sobald der Umzug der Mutter vollzogen sei, Lilia aus ihren Wohnungen all das zu sich holen könne, wonach es sie gelüste. Und nun, da die Mutter die Gewissheit hatte, ihre Sachen würden nicht in alle Winde zerstreut, fand der Onkel innert wenigen Monaten den von der Mutter gewünschten, komfortablen Ort in ihrem Heimatkanton, an dem sie bis zu ihrem Hinscheiden bleiben konnte. Eine Ambulanz des Kantonsspitals fuhr die Mutter heim. Und sie erholte sich unter der sorgenden Obhut der Ärzte, die ihr sofort alle Medikamente wegnahmen und durch keine neuen ersetzten, wie durch ein Wunder erstaunlich rasch. Mit rosigem Gesicht saß sie im Lehnstuhl in ihrem Einzelzimmer, mit Sicht auf die Berge, und lachte Lilia mit einer Herzlichkeit an, die Lilia nur selten an ihr wahrgenommen hatte. Sie ließ sich sogar dazu überreden, sich von Lilia zu Tee und Kuchen einladen zu lassen. Obwohl sie hinterher darauf bestand, die Rechnung selbst zu begleichen. Das erstaunte Lilia nicht. So kannte sie ihre Mutter: Nur ja sich nichts schenken lassen, das einem irgendwann vorgehalten wurde. Die Mutter hatte wieder Biss.
Aus den paar Dingen, die Lilia ursprünglich gedachte, aus den Wohnungen ihrer Mutter mitzunehmen, wurde ein großer Möbeltransporter voll. Zum Glück bestand die Firma darauf, die Gläser, die Antiquitäten und das kostbare Porzellan, aus Sicherheitsgründen, selbst einzupacken. Lilia hätte das nicht geschafft. Nicht weil sie handwerklich nicht geschickt genug war, sondern aus Gründen der Zeit. Die Wohnungen mussten rasch geräumt werden, da sie nach der Renovation sogleich von neuen Besitzern bezogen würden.
Als der Möbeltransporter vor Lilias Haus hielt, und eines der sperrigen Stücke nach dem anderen die vier Stockwerke hochgewuchtet wurde, verschoben sich an den Fenstern gegenüber und links und rechts davon schon mal die Vorhänge, und fielen verstohlene Blicke auf das seltsame Vorgehen. Seitdem der Besitzer das Haus nicht mehr bewohnte, und nur noch Lilia darin hauste – nebst dem Buchbinder, der sich bloß tagsüber darin aufhielt – harrten viele auf dessen Verkauf.
Lilias altes Brockenhauszeug verließ, eines nach dem anderen, die Räume, wurde ersetzt durch Goldgerahmtes, Barockes und klirrend Hauchdünnes. Es fand alles den ihm gebührenden Platz und sah, nach Abschluss des Umrichtens, nach überraschend Wenigem aus. Die hohen Räume ließen manches sogar bescheiden aussehen. Die Bezahlung des Transports übernahm die Mutter. Lilia gefiel sich in ihrer neuen Umgebung, die so neu ja nicht war. Die gobelinbezogenen Fauteuils, das Buffet, an dem sich die Transporteure fast übernommen hatten und die Tische mit den Schnörkelbeinen gaben Lilia das Gefühl, plötzlich älter und gesetzter zu sein. Sie kannte die Dinge seit langem. Dass sie nun die alleinige Verantwortung dafür hatte, rief auch ein mulmiges Gefühl in ihr hervor. Ihr Verständnis für Konvention und Tradition wurzelte, wenn überhaupt, nur äußerst oberflächlich. Eigentlich gingen sie die Sachen überhaupt nichts an. Zur Not würde sie sie verkaufen können. Darin sah sie, wie zum Schutz, ihren größten Nutzen.
Wie versprochen besuchte Lilia die Mutter regelmäßig, jeden Samstagnachmittag. Da Lilia inzwischen wieder eine Ganztagsstelle innehatte, bedeutete das eine große Herausforderung. Den Hund nahm sie zur Mutter mit. Denn allein die Hinfahrt zu ihrem neuen Zuhause betrug zweieinhalb Stunden. Für die Reise benötigte Lilia demnach fünf Stunden. Etwa drei Stunden verbrachte sie mit der Mutter, machte kleine Spaziergänge mit ihr und – was das Wichtigste war – ließ sich von der Mutter zum Essen einladen. Darauf bestand die Mutter. Ohne gemeinsames Essen, das ausschließlich die Mutter bezahlte, ging es nicht. Und es musste umfangreich gegessen werden, möglichst mit Vorspeise, Hauptgang, Dessert, Kaffee – und Pralinen auf dem Zimmer der Mutter nach dem Essen. Das Ritual mit den Pralinen war der Mutter immer noch heilig. Und sie konnte es nur schwer verkraften, dass Lilia Pralinen nicht mochte, sie als zu aufdringlich süß und in ihrer Zusammensetzung zu üppig empfand. Immer wieder bettelte die Mutter, Lilia möchte doch wenigstens eine der Köstlichkeiten probieren, ihr zuliebe. Essen hätte sie Lilia aufgetischt, bis Lilia daran erstickt wäre. Doch Geld – und sei es nur für eine Briefmarke – hätte sie ihr um keinen Preis gegeben. „Du kannst erben, wenn ich tot bin“, beschied sie Lilia. Lilias pekuniäre Verhältnisse sprach sie nicht mehr an, seitdem ihr Lilia entgegnet hatte, sie komme allein zurecht. Sie wollte auch nichts über Lilias Privatleben, über ihre Interessen und Liebhabereien erfahren. Sie weigerte sich kategorisch, sich über Lilias Persönliches zu unterrichten. In ihren Augen hatte Lilia die Kirche verraten und betrieb Götzendienst: da sie sich für sämtliche Religionen der Welt interessiere. Und dass ihr Mann Selbstmord begangen hatte, bedeutete eine solche Ungeheuerlichkeit, dass nicht einmal hinter vorgehaltener Hand darüber geflüstert werden durfte. Seit ihrem Kranksein, dem Umzug zurück in ihren Heimatkanton und der Aussicht, am neuen Ort bleiben zu können, bis sie sterbe, hatte die Mutter sich in ihrem Glauben wie eingemauert. Der Heiland gewährte Erlösung, Sühne für das, was ihr angetan worden war und ewige Seligkeit. Wer anderes glaubte, auch nur berücksichtigte, oder als gleichwertig erachtete, war auf irgendeine Weise verdammt. Ob gleich höllenpflichtig, darauf antwortete die Mutter nicht, bedauerte jedoch Lilias Abtrünnigkeit und betete für sie.
Einfach durchzuziehen waren diese Besuche für Lilia wirklich nicht. Doch sie wollte Wort halten, auch wenn dadurch für sie selbst kaum noch Zeit blieb. Das Putzen, Waschen, Bügeln und Aufräumen fand sonntags statt. Das Einkaufen um sechs Uhr nach der Arbeit, kurz bevor die Läden schlossen. Lilia lernte, ihr Leben auf eine Art zu takten, die sie Nerven kostete, doch sie auch stolz machte. Sie tat etwas für die Mutter und belohnte sich damit selbst.
Ohne Medikamente erlangte die Mutter überraschend Kraft und stabile Gesundheit. Und das freute Lilia. Sassen sie nach Essen und Spaziergang zusammen in ihrem Zimmer, versuchte Lilia auf jede nur denkbare Art ein Gespräch zwischen ihnen in Gang zu bringen, obwohl die Auswahl der Themen ihr erdrückend beschränkt erschien. Lilia liebte und suchte Kontroverses. Denkweisen, die bis an Grenzen der Existenz reichten, faszinierten sie, selbst wenn sie sie nicht in Worte fassen konnte. Ihren Geist ließ Lilia schweifen, wohin er wollte. Die Gesamtheit des Lebens interessierte sie. Deshalb empfand sie die willentliche Beschränkung der Mutter auf nur für sie Gültiges, als schiere Zumutung. Doch da bei diesen Besuchen die Mutter im Mittelpunkt stand, und Lilia ihr diese Aufmerksamkeit schenken wollte, schickte sie sich darein. Es kam ihr zugute, dass sie daran gewöhnt war, nicht gehört zu werden, und auch nicht Gegenstand von Interesse zu sein, was ihre Gefühlslagen und Belange betraf. Sie hatte gelernt, sich selbst auszulöschen, anderen das Feld zu überlassen, solchen, die sich in Worte fassen konnten.
Stieg Lilia nach diesen Ausflügen abends die vielen Treppen zu ihrer Wohnung hinauf, fühlte sie sich ausgebrannt und erledigt. Auch Mali schien erschöpft. Sie legten sich meistens sogleich ins Bett. Lilia lauschte auf die feinen Atemzüge Malis, deren Korb am Kopfende ihrer Couch stand. Lilia schlief noch immer schlecht. Sie nahm nun deutlicher wahr, wie viel es sie kostete, auf andere einzugehen und sich gesellschaftlich einzubringen. Ihre Lebensumstände hatten es sie nicht gelehrt. Es gab diese Wand zwischen ihr und ihrer Umwelt, die zu durchdringen ihr Gesang und ihre Liebe zu Bernd geschafft hatten, doch nicht sie selbst mit ihrem persönlichen Wesen. Am Morgen danach fühlte sie sich wie gerädert. Es kostete Lilia Mühe, aus dem Bett zu steigen und sich Mali und ihrem Haushalt zu widmen. Auf ihrem Gang dem Fluss entlang begegnete sie nach wie vor dem Mann mit den drei Wolfshunden. Sie bemerkte es, ohne sich etwas dabei zu denken. In ihr Bewusstsein drang es nicht vor. Dafür war die Distanz zwischen ihnen zu unüberwindlich.
Mit der Zeit fiel Lilia auf, dass sie dem Mann des Öfteren begegnete, öfter als ihr lieb war, genaugenommen jeden Tag. Ihr fiel auch auf, dass er manchmal Corgies oder einmal sogar zwei Dackel mit sich führte, die Mali wütend anbellten, obwohl, oder gerade weil Mali sie überhaupt nicht beachtete. Es blieb bei knappen Grüßen zwischen Lilia und dem Hundeliebhaber. Wie ein Tier, das Gefahr wittert, blieb Lilia auf Distanz, zur Flucht bereit beim geringsten Verdacht, er versuche sich anzubiedern. In ihrem Raum war noch für niemanden, außer für sie selbst Platz. Wie die Mutter, verteidigte Lilia diesen Raum. Sie gehörte so sehr nur sich selbst, dass sie nicht einmal ihr Leiden mit jemandem teilen mochte, ein Leiden, das zu stummer, farbloser Präsenz kristallisiert war. In ihren Augen fehlte es ihrem Leben an nichts.
Eines Tages begegnete sie dem Mann in Begleitung eines anderen. „Igor, willst du die Hunde nicht anleinen, schau, da kommt jemand mit einem Spaniel“, hörte Lilia den Begleiter sagen. „O, nein, ich kenne den Spaniel: Er ist harmlos.“ Mit kaum hörbarem Gruß drückte sich Lilia, hinter einen Baum ausweichend, an den Männern vorüber Sie fühlte sich wie ausgezogen, obwohl die Männer sie nicht weiter beachteten.
Nun, da sie seinen Namen wusste, versuchte sie Igor - entgegen ihrem eigentlichen Wunsch - noch geflissentlicher aus dem Weg zu gehen. Denn, wie sie entsetzt bemerkte, gewöhnte sie sich an die Begegnungen mit ihm. Sie schienen in ihrem Alltag ein Zeichen zu setzen, einen Anker auszuwerfen, an dem sie ihren Tag aufhängen konnte. Durch Igor bekam der Tag einen Herzschlag, an dem ihr etwas lag, den sie nicht mehr missen wollte. Ein Gedanke, der in Lilia Panik erzeugte. Sie beobachtete, wie sie die Begegnungen mit Igor herbeisehnte. Fehlte Igor an einem Tag, empfand sie es fast als Beleidigung.
Lilia sah sich gefangen. Sie gab sich vermehrt Mühe mit ihrer Erscheinung, schaute zweimal in den Spiegel, bevor sie sich mit Mali auf den Weg machte. Es begann ihr wichtig zu sein, dass sie gut aussah – nicht wegen Igor, log sie sich vor. Sie begann, Igor zu mustern. Bisher hatte sie ihm nur flüchtig in die Augen geschaut. Nun holte sie es nach und stellte fest, dass Igor graue Augen hatte mit einem Stich ins Grünliche. Sie waren nicht sehr groß und wirkten eher länglich als rund. Igors Wangenknochen standen etwas vor. Die Haut darunter hing leicht durch. Sein massiges Kinn ließ ihn als willensstark erkennen. Der Blick, der überraschend schutzlos wirkte, besänftigte das eher Unzugängliche des Gesichtsausdrucks. Die offene Stirn, wenngleich halb verdeckt durch das füllige Haar, das in der Mitte gescheitelt, vorhanghaft links und rechts über die Ohren fiel, zeigte ihn als strikten Geradeausdenker, der nicht allzu viel von Kompromissen hielt.
Was sie sah, gefiel Lilia. Igor war keine alltägliche Erscheinung, und mit ihm auszukommen bestimmt nicht leicht. Sie erschrak, als sie diesen Gedanken in sich wahrnahm. Doch so sehr sich Lilia auch gegen ein erneutes ins Leben Eintauchen wehrte: sie war auf geradem Weg dazu. Es geschah ohne Aufhebens, von allein. Der Faden war gesponnen, sie musste ihm nur folgen.
Lilia ging es manchen Monat lang unschlüssig, sogar widerwillig an. Kurzen, beiläufigen Gesprächen entnahm Lilia, dass Igor auf einem von dem ihren völlig verschiedenen Dampfer durch die Tage fuhr. Es schien, ihrer beider Ansichten und Meinungen fänden unmöglich einen gemeinsamen Nenner. Zudem sah sich Lilia als zu alt und immer noch zu müde an, um mit ihrem Leben nochmals von vorne zu beginnen. Der Gedanke an die endlosen Gespräche, die notwendig wären, um einander zu verstehen, sich auf den anderen einzustellen, empfand sie als erdrückend. Lilia versuchte, gegenüber Igor im Unpersönlichen zu verweilen, auf stabilem Eis zu laufen. Denn die Furcht, darin einzubrechen verstärkte sich, je mehr Nähe Igor suchte, je offensichtlicher er Interesse für sie bekundete.

8. Was für ein bunter Mann.
Im Übrigen kam ihr Igor als sehr bunt vor. Sich selbst sah Lilia als extravagant, als in mancher Hinsicht ziemlich schillernd. Doch Igor schien das noch zu toppen. Er scherte sich nicht um Konventionen, kombinierte Passendes und Unpassendes nach Lust und Laune. Zu schwarzer Kleidung trug er verschiedenfarbige Socken, die Hosenbeine entsprechend hochgestülpt, sodass das Violett und Gelbe, das Grün und Orange an seinen Füssen knallten wie Fanfarenstöße. Die Socken zogen Blicke magisch an. Den Rest des Mannes nahm man erst in zweiter Linie wahr. Igor genoss es, mit Schockern zu jonglieren. Die Meinung anderer focht ihn wenig an. Diesbezügliche Diskussionen blockte er ab. Er schien in jeder Hinsicht sich selbst der Nächste zu sein. Und bezeugte das durch eine straffe, souveräne Körperhaltung. Sie überragte Lilias Kleinheit nicht nur was ihre Länge betraf. Die Unbeugsamkeit von Igors Meinungen, wenn es um Recht oder Unrecht ging, ließ Lilias unbeholfene Vermittlungsversuche hilflos aussehen. Igor wusste unzweifelhaft Bescheid. Und Lilia glaubte seiner Überzeugungskraft am Anfang ihrer Bekanntschaft auch, beneidete seine offensichtliche Rundumsicht. Igor schnitt sich durchs Leben wie ein Messer. Igor, dem Überflieger, fiel alles leicht. Wie Sonne und Mond verhielten sie sich zueinander. Weit voneinander entfernt, hielten sie das Ende einer Saite in Händen, die, würde sie bis zum Zerreißen gespannt, misstönendes Kreischen von sich gäbe - und nur in seltenen Augenblicken lockeren Einverständnisses Gesang von zauberhafter Magie.
Vorerst allerdings waren das nur nebelhafte Wahrnehmungen, die Igors imposante Erscheinung in Lilia hervorrief. Fast ein Jahr zuvor war sie ihm zum ersten Mal begegnet. Nun ging es wieder auf Weihnachten zu, das zweite Weihnachten, das sie allein verbringen würde. Und auch wenn Igors Auftauchen in ihrem Alltag Unruhe, Besorgnis und Versuche ängstlichen sich Absicherns hervorgerufen hatten, fühlte sie sich nicht als erobert.
Nichts desto trotz mochte es Lilia von Tag zu Tag mehr, Igor anzuschauen. Er stellte ein solides Gesamtpaket dar, das in allen Einzelheiten stimmte. Auch dass er an einem bissig kalten Dezembermittag in einem knöchellangen, schwarzen Ledermantel erschien, der speckig glänzte und in Lilia Übelkeit hervorrief, da er sie an gewisse Gangsterfilme erinnerte, schlug sie nicht in die Flucht. Igor nahm Einzug in Lilias Leben und ließ sich nicht mehr abschütteln.
Als Lilia vor den Festtagen für eine Woche zu einem Astrologiekurs zu fahren beabsichtigte, schmollte Igor, als habe sie ihn beleidigt. Lilia war perplex. Ein Beziehungsdrama war das Letzte, das sie sich wünschte. Sie zog kurz entschlossen einen Ring ihrer Oma vom Finger und drückte ihn Igor, mangels eines passenderen Gegenstandes, in die Hand, mit der Bitte, er möge ihn hüten, bis sie wieder zurück sei. Sie verabschiedete sich brüsk und lief in Richtung Stadt davon, die überrumpelte Mali hinter sich herziehend wie ein widerspenstiges Kind. Erst als sie sich außer Sichtweite wusste, drehte sie sich nach Igor um. Er folgte ihr nicht.
Lilia fühlte sich mies und ausgelaugt. In ihrer Wohnung angekommen, konzentrierte sie sich aufs Packen. Mali würde sie mitnehmen. Der Mutter hatte sie Bescheid gesagt. Langsam beruhigte sich Lilias Gemüt. Sie spürte wieder Raum zum Atmen. In ihrem Leben war immer noch sie die Herrin.
Für die Astrologie interessierte sich Lilia seit längerem. Da sie nicht mehr in die Großstadt fuhr, seitdem sie das Singen an den Nagel gehängt hatte, und dadurch auch die Stunden bei ihrem Yogameister wegfielen, fahndete sie nach einem neuen Inhalt für ihr Leben. Nach wie vor beschäftigte sie die Frage nach dem Woher und Wohin, dem Wozu und Warum von Leben brennend. Dadurch stieß sie auf die Astrologie. Sie wies auf Schwachstellen im Leben eines Menschen hin, zeigte Ursachen und Wirkungen auf. Lilia ließ ihr Horoskop aufzeichnen und fand eine Frau, die es für sie deutete. Lilia war begeistert davon, mit jemandem die Trümmer ihrer Existenz zusammenzuklauben. Sie lechzte danach. Gerade weil sie, aus Mangel an Wörtern, die Brennpunkte selbst nicht ansprechen konnte. Dass es Menschen gab, die das anhand einer bloßen Zeichnung schafften, bewunderte sie. Die Sternbilder und ihre rätselhaften Bedeutungen riefen Respekt in ihr hervor. Dass es für ihre Deutung Kreativität und Intuition brauchte, kam ihr gelegen. Denn für Jenseitiges war Lilia zu haben.
Die Astrologin, deren Kurs sie besuchte, hieß Aglaja und sprach mit dem gleichen Akzent wie die Mitarbeiterin ihres Yogameisters, die Frau mit dem Wolfsblick und den spitz zulaufenden Hexenohren. Die Beschäftigung mit der Astrologie fühlte sich deshalb für Lilia an wie ein Nachhause kommen. Das Auswendiglernen von Sternbildern, Konstellationen, von Oppositionen und deren Auswirkungen behagte Lilia weniger. Dafür war sie zu faul, interessierte sich weit mehr für jene Bereiche, für die eine spezielle Art von innerem Gespür gefragt war, über das Lilia verfügte, einem Gespür für Muster und Zusammenhänge auf Ebenen, die als feinstofflich gelten. Dort fühlte sich Lilia zuständig.
Der Kurs entpuppte sich als Jungbrunnen für Lilia. Er fand in einem kleinen Hotel in den Bergen statt, in dem zu jener Jahreszeit, außer ihrer Gruppe von zehn Teilnehmern, keine Gäste logierten. Die bescheiden aber freundlich eingerichteten Zimmer gingen auf einen Balkon hinaus, von dem aus der Blick senkrecht in die Tiefe auf einen See stürzte, der je nach Tageslicht tiefschwarz, violett, rosa oder bleiern glimmte. Eine gespenstische Szenerie, in einem engen, von schroffen Felsen umstandenen, an einen Krater erinnernden Abgrund. Die Sicht passte vorzüglich zum Stoff. Zum sich hineinwühlen ins Schwärende, Fiebrige des Unterbewussten, mühsam dem Verdrängen anheimgegebenen. Manches kam ans Licht, das bei Einzelnen auch Tränen auslöste.
Für Lilia schienen sich ungeahnte Möglichkeiten, eine glanzvolle Zukunft betreffend anzubahnen, was in ihr die Fackel der Hoffnung neu auflodern ließ. Doch wurde auch bemerkt, die vorwiegend dunkeln Seiten in ihrem Horoskop deuteten darauf hin, der ersehnte Erfolg zeichne sich möglicherweise nicht in der Öffentlichkeit ab, sondern im Entgegengesetzten, dem Untergründigen. Dem konnte Lilia zustimmen. Zu ihrem Leidwesen. Denn der Prinzessinnentraum in ihr war noch nicht gestorben. Sie hoffte stets, irgendein geheimer, noch verborgener Pfad führe sie aus dem Dunkel ins Licht, lasse sie auferstehen wie Phönix aus der Asche.
Die meisten Teilnehmer des Kurses waren Frauen. Doch auch drei Männer in Lilias Alter getrauten sich, sich mit der heiklen Materie auseinanderzusetzen. Diese Mischung aus beiden Geschlechtern bot täglich Gelegenheit zu Heiterkeit, dem spielerischen Umgang von Anziehung und Abstoßung. Kleine Flirtereien, Scherze, Gelächter relativierten die Gewichtigkeit der Materie. Abends wurde getanzt. Geschichten machten bei einem Glas Wein die Runde, auch gespenstische, von der Wirtin beschwörend geflüsterte, die zeitlebens am Abhang über dem See gewohnt hatte. Im Winter vom Rest der Zivilisation abgeschnitten. Zugeschneit. Ohne medizinische Versorgung, Von schwindenden Vorräten zehrend. Der Platz galt als Kraftort. Und demzufolge auch als ein Ort, an dem Verheimlichtes, Unausgesprochenes sich zeigen konnte – ebenso wie Heilung, tiefes Atemholen. Er war für die Art von Arbeit, der sich die Gruppe widmete, klug ausgewählt.
Das Heimkommen nach dem Kurs empfand Lilia als kühl und enttäuschend. Igor machte ihr eine Szene, lautstark und aggressiv. Den Souveränen, den Überflieger, den die Meinung anderer nicht kümmerte, quälte Eifersucht. Den geliehenen Ring zurückzuverlangen, getraute sich Lilia nicht. Igors Ausbruch ließ sie verstummen. Sie wusste ihm nichts entgegenzusetzen. Ihr Kopf war hohl wie eine leergegessene Büchse. Kein Argument zu ihrer Rechtfertigung ließ sich darin blicken. Das gerüffelte Kind nahm von ihr Besitz. Sie fühlte sich im Unrecht. Schuldig. Ohne zu wissen, worin ihre Schuld bestand. Auf den bekannten Nullpunkt zurückkatapultiert, ließ Lilia die Flügel hängen. Trostlosigkeit im Herzen, in dem eben noch eine Illusion von Chance, von Neuanfang sich gezeigt hatte. Igor zog ab. Lilia war es egal. Insgeheim hoffte sie, er verschwinde für immer: Der tolle Kerl. Der Bilderbuchmann.
Es zeigten sich nun öfter Schmerzen in Lilias Kreuz, die manchmal so stark wurden, dass sie sich kaum mehr bewegen konnte. Am Morgen aufzustehen und sich gerade aufzurichten, kostete sie Überwindung. Lilia fing an, für sich alleine Yoga zu üben. Das half vorübergehend. Doch die Leere in ihrem Inneren. Die Ödnis, die einer Wüste ohne Horizont glich, ließ sich nicht länger verheimlichen. Sie hatte aufgehört Neues dazuzulernen, sich in eine Richtung zu orientieren. Ihre Tage zerrannen ohne Höhen und Tiefen, ohne Farbe und Geschmack. Igor betrachtete sie nicht als Bestandteil ihres Lebens, eher als gelegentliche Erschütterung ihres Selbstverständnisses, wenn er, wie durch Zufall, vor ihrem Haus auftauchte, oder ihr mit Wolfshunden, Corgies oder Dackeln am Fluss über den Weg lief. Lilias Freizeit war zu schmal bemessen, als dass sie sich ernsthaft mit ihm befassen konnte. Igor wünschte sich das. Und Lilia bemerkte es. Doch Raum gab sie ihm nicht. Auch aus Angst. Er war zu stark. Zu rasch. Zu heftig. Zu fordernd. Lilias Alltag dagegen zu sehr hinuntergeschraubt auf Notwendiges.
Ihre Begegnungen glichen für Lilia Explosionen. Feuer und Wasser hatten keinen gemeinsamen Nenner. Lilia fühlte sich oft wie verbrannt. Viele kleine Übergriffe vonseiten Igors – nicht physische, nicht psychische – versengten ihre erst knapp zurückgewonnene Standfestigkeit. So als stehe sie an einem Bahnhof, vorerst einfach um zu überlegen, welchen Zug sie besteigen solle – und in den erstbesten brutal hineingeschubst werde.
Da segelte aus dem Nirgendwo, wie eine Feder, eine Einladung auf ihren Küchentisch: ein Seminar ankündigend, organisiert von einer Gruppe, die sich um einen spirituellen Lehrer gebildet hatte. Sie studierte die Mystik des Islam, den Sufismus. Ohne zu überlegen meldete sich Lilia an. Zwei Wochen Ferien standen ihr noch zu. Es war Sommer. Der Zeitpunkt schien perfekt, um zu entkommen. Lilia hatte keine Ahnung von dem, was sie erwartete. Vielleicht geriete sie vom Regen in die Traufe. Mit noch mehr Überforderung als Igor sie darstellte. Vielleicht geriete sie in die Fänge einer Sekte. Lilias Kopf schwieg. Hauptsache, sie lernte wieder. Türen gingen auf. Erfahrung bevölkerte das Ausgestorbene ihres Inneren.
Es fanden sich an die dreißig Leute im Seminarhaus zusammen. Wenige kannten den Lehrer persönlich. Lilia war auf alles und auf nichts gefasst. Sie hatte keine Meinung über das, was kommen sollte. Als sie den Lehrer das erste Mal sah, trug er Knickerbockers, dicke, gestrickte Strümpfe mit Zopfmuster, hohe Schuhe, eine grüne Lodenjacke, kombiniert mit kariertem Hemd und einer Kappe, auf deren Spitze ein farbenfrohes Windrad im sanften Sommerwind rotierte. „Aha“, dachte Lilia sachlich, „das ist nun also mein Lehrer.“ Damit war der Fall für sie erledigt. Sie brauchte einen Lehrer: Er war erschienen - weitere Gedanken erübrigten sich.
Lilia fiel tatsächlich vom Regen in die Traufe. Allerdings auf einer Ebene, auf der sie sich zutiefst angesprochen fühlte. Aufstehen um halb sechs. Körpertraining. Frühstück. Abwaschen. Putzen bis neun. Danach Unterweisung. Einführung in den Zikr, das Gebet. In die Literatur: Jalaluddin Rumi, Ibn Arabi, Suren aus dem Koran. Faszinierendes. Gedankengut, das Lilias Herz im Sturm eroberte. Lilia fühlte keine Berührungsängste, wenn es um Wissen auf spirituellen Ebenen ging. Die wenigsten der Teilnehmer kannten sich im Islam aus.
Um das zu erläutern, das Lilia sich während den Jahren mit ihrem Yogameister und seiner Mitarbeiterin angeeignet hatte, brauchte Lilia lediglich einen neuen Wortschatz. Denn dass es sich um das Selbe handelte, begriff sie auf Anhieb. Im Inneren blieb sich Leben immer gleich: In allen seinen Erscheinungsformen. Ob sie zum Gruß die Hände faltete, oder die eine Hand auf Herz legte, war einerlei. Auch ob sie auf die Knie fiel und den Kopf zur Erde neigte, sich tief verbeugte, oder das Kreuz schlug: Leben wandelte sich nicht. Lilia lernte den Bruderkuss, das Sitzen auf niedrigem Kissen, mit nach hinten gebogenen Beinen, das rhythmische Neigen des Körpers, das Wenden nach links und nach rechts des Kopfes zum Skandieren des „Allah, Allah, Allah“ auf vollem Atem, so dass es klang wie ein stampfendes Keuchen aus tiefstem Herzen. Und sie lernte zu ihrer Freude, dass „Allah“ nicht „Gott“ bedeute, einen Gott, der nur den einen und nicht anderen gehörte, sondern „Nichtheit“. Lilia fühlte sich angekommen.
Leicht machte ihr das der Lehrer allerdings nicht: ein veritabler Scheich mit persischem Namen. Lilias Ego geriet arg in die Mangel. Gehorsam wurde gefordert, da der vorhandene Platz gering bemessen war, und schon allein deshalb nicht jeder tun und lassen konnte, was er wollte. Die Zeitangaben mussten peinlich genau eingehalten werden. Nur der Lehrer erlaubte sich Freiheiten. Das Ende der Abendklassen, zum Beispiel, war nie voraussehbar. Es zog sich je nach Schläfrigkeit. Nach Überdruss. Nach unterschwelliger Gehässigkeit der Teilnehmer so lange hin - manchmal wurde es drei Uhr morgens - bis auch der letzte begriff, dass er keinem Kuschelkurs folgte, sondern Disziplin und Selbsterziehung gefordert waren.
Manchmal griff der Lehrer zur Gitarre und hob an zu singen. Mit einer Stimme, die klang wie murmelndes Silber. Zu Beginn, als die Lieder noch neu waren, hörten die Anwesenden mit offenen Ohren zu. Die Melodien umschmeichelten die Gemüter. Vermittelten Wohlgefühl. Heilung der gestressten Nerven. Nach Tagen allerdings, als die Lieder bekannt waren – der Lehrer sang stets dieselben vier bis fünf – fingen sie an lästig zu werden. Zogen sich die Strophen bis zum Bersten des Nervenkostüms ins Endlose. Hass machte sich fühlbar. Widerstand. Es tobte innerlich. Offener Krieg brach aus in den Gemütern. Der erstrebte Zeitpunkt für den Lehrer, um ein markerschütterndes „Stopp“ in die Runde zu schmeißen, das den Herzschlag zum Stocken brachte und übergangslos die Gehirne zum Schweigen. „Was seid ihr nur für Idioten. Schaut euch doch an. Die kleinste Anstrengung bringt euer Selbstverständnis zum Straucheln“, schalt der Lehrer mit Trauermine - die augenblicklich sämtliche, mühsam verdrängten Schuldgefühle der Anwesenden zutage förderte. Er spielte virtuos auf ihrer Klaviatur. Manche fühlten sich betrogen. Andere – wie Lilia – die geeicht war für Psychospiele, erkannte mit widerwilliger Dankbarkeit, was abging. Die Wut auf den Vater, der Abscheu vor der Mutter und der Stiefmutter wurden gnadenlos hervorgebuddelt. Lilia erkannte sich in all ihrer verleugneten Hässlichkeit im Spiegel, den der Lehrer ihr vorhielt.
Sie pochte anderntags an seine Bürotür. Und obwohl sie vor Herzklopfen kaum sprechen konnte, bekannte sie: „Ich möchte alles lernen, was du weißt: um jeden Preis.“ Der Pakt war geschlossen. Der Lehrer nahm sie in den Arm, drückte sie leicht. Alle Schwere fiel von ihr ab. Und sie glitt federleicht durch die Tür in den Garten hinaus. Wo sie sich unter einen Baum setzte, den rauen, borkigen Stamm im Rücken, die Hände voller feuchter Blätter, die taunasse Erde unter sich, die auf ihrem Hosenboden einen dunklen Ring hinterließ. Ihre Gedanken zusammenraffend, durchlief sie noch einmal die eben durchlebten Momente. Sich fragend, ob sie eventueller Selbstquälerei anheimgefallen. Wie real das Erfahrene sei. Wie echt der eingeschlagene Weg. Und ob sie tatsächlich bereit sei, ihn zu gehen.
Ein Teil in ihr riet zur Flucht. Der andere stimmte klar und deutlich dagegen. Was sie durcheilte, war weder neu noch speziell. Es zog sich wie ein roter Faden durch ihr Leben. Sie würde sich an diesem Faden bis zu ihrem Tod entlanghangeln.
Von da an motzte nichts mehr in Lilias Innerem gegen die Methoden ihres Lehrers. Sie durchlief das Seminar als aktive Zuschauerin. Und als am Ende der beiden Wochen der Lehrer anbot, die Willigen in den Sufiweg zu initiieren, meldete sich Lilia an. Obwohl Zweifel und Ängste sie am Abend davor noch einmal beutelten. Und sie die ganze Nacht wach lag. Der Teil in ihr, der noch glaubte, Flucht schütze vor Entscheidung, errang kurz die Oberhand. Doch als die Sonne aufging und einen neuen, heißen Tag ankündigte, kuschte er und gab nach.
Weiße Kleider besaß Lilia nicht. Sie fuhr ins Dorf und besorgte sich, was der biedere Laden anbot. Ein weißes Kopftuch lieh ihr eine Kollegin. Notwendig war weiße Kleidung nicht. Doch Lilia war es wichtig, sich zur Zeremonie ganz einzubringen. Zu ihrer Überraschung ließen sich fast alle Kursteilnehmer initiieren. Die meisten standen vor einem neuen Lebensabschnitt, waren um die Vierzig, wie Lilia. In langen Reihen saßen sie - wie Hühner - auf niedrigen Bänken den Wänden entlang, Frauen und Männer. Einer nach dem anderen wurde zum Lehrer gerufen, der das schwarze Gewand des Scheichs trug sowie den hohen Hut, der den Stein zu seinem Grab symbolisierte. Ihm zur Hand ging ein Türke, der Ali hieß und lachen konnte, dass sich die Balken bogen.
Der Lehrer nahm Lilias Hände und suchte ihren Blick. Seine blauen Augen schwammen in Tränen. Sie leuchteten wie Wasser, von Strahlen der Sonne durchdrungen, fast türkisblau. Augen, die nichts festhielten. Ohne Hintergrund aus der Leere ins Geschehen blickten. In unfassbarer Nähe zum Angeschauten. Und doch ohne sich in irgendeiner Weise daran zu klammern. Derart freigelassen, öffnete sich Lilias Wesen in eine Hingabe hinein, die sie nie zuvor erlebt hatte. Alles um sie herum schwand dahin. Sie erhielt nichts. Kein Amulett. Keine Kerze. Keine Blume. Nur diesen Blick. „Sei in dieser Welt aber nicht von ihr“, ging es ihr hinterher durch den Kopf, als wieder Gedanken in ihr auftauchten. Ein Satz, den sie bisher nicht verstanden hatte.
Der Tag verging still. Niemand sprach gerne. Es war etwas geschehen. Doch die Wenigsten wussten, was. Die Knie schmerzten wie am Tag zuvor, als ein langer Zikr, eine Rezitation der Namen Gottes, die zum Ereignis passten, der Initiation folgte. Die Hitze drückte auf den engen Raum wie jeden Tag. Und alle schienen froh, als Ali endlich die Fenster aufriss, Durchzug das Zuviel an Emotionen mit sich forttrug, und der Lehrer aus voller Kehle einen Gassenhauer aus den Zwanzigern anstimmte. Das Tischdecken stand an. Letzte Gartenarbeiten waren zu verrichten. Und hinterher das Kofferpacken. Man würde sich wöchentlich in der Großstadt treffen, immer donnerstags den Abend zusammen verbringen, mit Gebeten, Unterweisungen und Fragen, die gestellt werden konnten. Lilia war im Islam angekommen und das dünkte sie keineswegs speziell.
Und Igor rückte stetig näher. Einerseits fühlte sich Lilia geschmeichelt, andererseits bedrängt. An einem Sonntagnachmittag sah sie ihn mit einer Frau an der Seite hoch zu Ross. Den Rücken gereckt wie ein preußischer Offizier. Die Zügel locker in einer Hand.
Lilia hatte seine langfingrigen Hände nicht ohne Überraschung bemerkt, als er sie zum ersten Mal mit Handschlag begrüßte. Igor erkannte Lilia nicht. Zur Sicherheit versteckte sie sich hinter einer Eiche. Igors Haar hing aufgefächert um seine Schultern, von einer Spange zusammengefasst. Offenbar liebte er kunstvoll geschnitzte Spangen aus Holz, Bambus oder Horn, wie Lilia leicht irritiert feststellte, denn er schien mehrere davon zu besitzen. „Ein kitschiger Mann“, dachte Lilia. Einer, der überhaupt nicht zu ihr passte. In ihrem Witwen-Weltbild nichts zu suchen hatte. Er war zu auffallend, gab sich zu extravagant. Man drehte sich nach ihm um. Schaute zweimal hin. Ein Mann, den eine Frau allein nie würde hüten können. Schon gar nicht eine wie Lilia, die weniger denn je bereit war, sich an einen Mann zu verlieren. Er hatte sie nicht nötig. Und sie ihn noch weniger. Und doch trug er den Ring ihrer Großmutter am kleinen Finger. Lilia passte er gerade mal an den Daumen.
Lilia in Bezug zu Igor: Das war wie ein Puzzle, von dem erst ein Stück Rand gelegt worden war. Der Rest lag an einem Haufen in der Schachtel, die Teile so kompliziert ineinander verhakt, dass es unmöglich schien, sie zu ordnen. Wie um alles in der Welt sollte daraus ein Bild entstehen!
Während eines nächsten Seminars mit ihrem Sufimeister, das in einem alpinen Kurort stattfand, in einer Jugendherberge hoch über dem Dorf, lernte Lilia das „Drehen der Derwische“, eine der Hauptdisziplinen der Sufis kennen. Am Hang vor dem Gebäude stand ein Zelt, das den fünfunddreißig Teilnehmern großzügig Platz bot. Und den brauchten sie. Den Grund erfuhren sie am eigenen Leib, als der Tanz der Derwische unterrichtet wurde. Zuerst ging es nur darum, auf einem Bein zu stehen, sich die Hände überkreuz auf die Schultern zu legen und den Kopf nach rechts. Um ihn aus dem Weg zu kriegen, damit die Körperachse frei und das Denken in den Hintergrund gedrängt würde.
Lilia hatte das Drehen schon einmal gesehen. Eine Gruppe von zwanzig Männern aus der Türkei in langen, wie Räder weitschwingenden, weißen Röcken hatte in einer Mehrzweckhalle eine Vorführung davon gegeben, die sie tief berührt, gefesselt und begeistert hatte. Ohne dass ein Wort darüber verloren wurde, verstummten die Zuschauer, als die Derwische, in schwarze Mäntel gehüllt, mit hohen braunen Hüten auf dem Kopf, behutsam trippelnd die Tanzfläche betraten, um die herum die Gäste einen Kreis bildeten,. Ein Wusch von Durchzug schien den Raum von allem Störenden zu reinigen, wie ein Besen, der alle Erdenschwere hinwegfegte. Die Derwische warfen die Mäntel ab, wodurch das Weiße der Röcke, die darunter zum Vorschein kamen noch blendender wirkte. Und als das Drehen in vollem Gang war, sämtliche Derwische im Takt um die eigene Achse wirbelten, bekam Lilia den Eindruck, das Gebäude, samt seinem Inhalt, bohre sich tiefer und tiefer in den Grund, als zögen es Anker in eine Konzentration hinein, die mit Händen greifbar schien. Am Ende der Darbietung wurde geklatscht, doch die Derwische, sich in die Schwärze ihrer Mäntel zurückziehend, schwebten im Gänsemarsch davon, ohne Reaktion auf den Lärm - so als geschehe das Klatschen jenseits ihrer Wahrnehmung. Sie verharrten in sich selbst, im Gebet, unberührt von der Außenwelt und schritten geläutert von dannen.
Unter den Zuschauern, die sich zum Teil wie hypnotisiert an der Kaffeebar mit Essen und Getränken bedienten, brandete verlegenes Geschwätz auf, währendem andere wie eingemauert vor sich hinmampften, als nähmen sie nicht wahr, was um sie herum geschähe Es gab türkische Häppchen, die wunderbar schmeckten, salzige und süße, die von Honig troffen und die - wie bei Lilia - wieder Boden unter die Füße schoben. Sodass ein sich der Dunkelheit draußen und bissiger Kälte Zuwenden möglich wurde. Das Klappern von Absätzen auf dem Pflaster trat ins Bewusstsein. Das Starten von Motoren. Von Scheinwerferlichtern, die einem um die Ohren flogen.
Das Drehen wirkte unglaublich einfach, so als geschehe es von allein. Doch die Unkundigen im Zelt fanden zu Beginn ihres Trainings, es sei selbst mit bestem Willen nicht zu schaffen. Schon nur das Stehen auf einem Bein bereitete nach kurzer Zeit Höllenqualen. Durch das Abspreizen des Kopfes verlor der Körper das Gleichgewicht. Bald fingen Beine an zu schlottern. Jemand fiel neben Lilia um. Unwillen machte sich bemerkbar. Immer mehr Teilnehmer ließen den rechten Fuß, der angewinkelt am linken Unterschenkel verharren sollte, fallen, sodass das Training für einige Zeit unterbrochen werden musste.
Tags darauf dieselbe Tortur. Doch es gab Vereinzelte, die nun nicht mehr nur litten. Sie durften einen Schritt weitergehen, sich langsam - immer noch mit den Händen auf den Schultern - drehen. Der linke Fuß blieb dabei mit dem Boden verhaftet. Der rechte vollführte, zusammen mit einer Art sanften Schubses aus der Hüfte eine vollständige Drehung des Körpers. Dafür brauchte es Socken, die auf dem Holzboden rutschten. Und die Drehung musste dreihundertsechzig Grad umfassen, damit der rechte Fuß immer genau nach vorne zeigte, sobald er den Boden berührte. Denn dort lag das blutrote Fell, auf dem der Scheich später, während der Dreh-Zeremonie, stehen, einem Derwisch nach dem anderen mit dem Blick seinen Platz in der Runde zuweisen und dessen Hut küssen würde.
Am wichtigsten war es, die eigene Mitte nicht zu verlieren. Sonst bestand die Gefahr, dass einem Übelkeit übermannte, der Körper vornüberstürzte und wie ein Geschoss durch das Zelt sauste, bevor er gegen die nächstbeste Wand donnerte. Verhindert werden konnte dieses Missgeschick nur, wenn ein Übender beim leisesten Anflug von Übelkeit auf die Knie fiel, die Stirne auf den Boden drückte und tief atmend darauf wartete, dass die Auswirkungen fehlgeleiteter Zentrifugalkraft sich legten.
Mit Übelkeit hatte Lilia selten zu kämpfen. Durch den Raum flog sie nur einmal, was ein paar blaue Flecken zur Folge hatte. Doch merkte sie, dass, sobald sie zu drehen anfing, sich die Ambivalenz ihres Daseins darin spiegelte: die Hass-Liebe zu ihrem Leben - das Sowohl-als-auch - das Bewusstsein dafür, dass alles immer auch ganz anders sein könnte.
Lilia brauchte zwei Jahre, bis sie sich dem Drehen – dem eigentlichen Gedrehtwerden – richtig hingeben konnte. Doch dann liebte sie es. Und auch wenn ihre Haltung nicht perfekt wurde, erlebte sie das bedingungslose Verankertsein in ihrer Mitte. Erfuhr sie das Wirbeln von Existenz um sich herum. Den Kopf nach rechts geneigt. Die Arme ausgebreitet wie Flügel. Die eine Hand zum Himmel gerichtet, als empfange sie eine Frucht. Die andere gegen den Boden weisend, als gebe sie die Frucht der Erde zurück. Den Blick durch Daumen und Zeigefinger gerichtet, mit fast geschlossenen Augen. Getragen von der Macht des Atems. Festgezurrt. Bis zum Bersten aufgespannt zwischen Himmel und Hölle, wie eine sirrende Saite. Betäubendes Tosen von Existenz im Ohr. Gleissende Stille im Herzen.
Gelegentlich ließ sich der Scheich, ihr Lehrer, dazu überreden, selbst zu drehen. Und bei ihm geschah es einfach. „Es“ drehte ihn. Nicht er drehte sich. Und Lilia ging auf: „Wer eigentlich dreht sich da? Ist da überhaupt jemand?“
In ihr Rustico fuhr Lilia nur noch selten. Zu lebendig barg es die Erinnerung an Bernd in sich. Die Steinquader am Kopfende des Bettes, die seinen Rücken gestützt hatten. Die kastenförmigen Stühle am Feuer, in die er kaum hineinpasste. Der geschnitzte Briefkasten neben der Eingangstür, in den der Bote die Umschläge nur gefaltet hineinschieben konnte. Der raschelnde Bund vergilbter Rosen am Nagel. Das vergessene Eau de Toilette, an dem zu riechen Lilia vermied, da Sehnsucht sonst wie ein Messer ihr Nervensystem durchtrennte. Die schweren Sommernächte voller Geruch nach Erdreich, nach vor Hitze duftenden Steinen. Die samtenen Flechten darauf, die sich wie Felle toter Mäuse anfühlten, im Abkühlen begriffen. Und manches mehr, das Lilia herbeizerrte - und gleichzeitig von sich wegjagte: Es war viel zu viel. Zu viel an Versprochenem. Zu viel an Zerbrochenem. An Verzicht, bedingtem und freiwilligem, da Leben einfach weiterlief und sich nicht darum kümmerte, wer ihm folgte.
Der Taxifahrer, der Lilia, nun da sie kein Auto mehr besaß, vom Bahnhof zum Dorf fuhr, hatte Wind von ihrer Geschichte bekommen und sondierte, ob es nicht angebracht wäre, er käme abends vorbei um ihr Gesellschaft zu leisten und sie ein wenig aufzumuntern. In Lilia schrie es um Hilfe ob dieses Angebots. Sie reiste fluchtartig wieder ab, zu Fuß, den Koffer hinter sich herziehend. Eine Anstrengung, die den angestauten Schmerz wenigstens halbwegs betäubte. Zuhause die Abwesenheit. Tage, an denen Lilia, litt wie ein aufgespießtes Insekt. Und Igor. Existenz, die keinen Aufschub gönnte, nie pausierte, lief und lief, wie Wasser: Entweder man schwamm mit oder ersoff. Bernd wollte Lilia in ihrem Rustico besuchen. Er kündigte es in wenigen, immer noch lodernden Sätzen an. Doch auch das: es war zu viel. Viel zu viel. Lilia ertrug es nicht. Wie hätte sie, nach all dem, was inzwischen geschehen war, was Zeit zwischen sie geschaufelt hatte, die Ursprünglichkeit ihrer ersten Begegnung wieder herbeizaubern sollen. Sie waren aufeinander zugesaust. Ineinander explodiert. Und weitergeflogen, in ihrem persönlichen Tempo. Um Bernd Glanz und Gloria vorzuspielen, und angeschimmeltes Glück zu suggerieren, erschien ihr Bernd zu schade.
Während den folgenden Tagen wählte Lilia bewusst einen Hunderundgang, auf dem sie Igor nicht begegnen würde. Sie wusste, sie entkam der Auseinandersetzung mit ihm nicht. Sie lag auf ihrem Weg, es führte nichts daran vorbei. Doch wenn ihr schon die Umstände keinen Urlaub gönnten, wollte sie sich selbst wenigstens die Zeit zum Ausatmen schenken. Pierre-Louis stand ihr nicht im Weg. Den Weg mit ihm war sie zu Ende gegangen. Nur Bernd: An ihn kettete es sie noch. Er lebte, war erreichbar, wartete. Und Lilia lebte, war erreichbar, wartete. Das musste sich zuerst geben: wie ein ins Netz gegangenes Tier aufhört, sich zu wehren. Und davon war sie noch zu weit entfernt.
Als sie eine Woche später erneut auf Igor traf, überschüttete er sie mit halb ernsten, halb gespielten Vorwürfen. Er verstand, dass sie ihn bewusst mied. Er sprach von Sorgen, von gehegten Bedenken. Sie setzten sich auf eine Bank, schwiegen. Lilia wusste keine Antwort, wahrte Abstand. Innerlich am Weglaufen, gab sie sich äußerlich kühl, besonnen, versuchte es mit einem Scherz - der zwischen sie und Igor fiel wie ein Klotz.
Igor drehte behutsam ihren Kopf in seine Richtung. Die Berührung elektrisierte Lilia. Igor erkannte das Elend in ihren Augen. Lilia schreckte zurück wie ein Krebs. Nach langen Minuten – seine Dackel spielten mit Lilias Spaniel, balgten sich im Ufersand – meinte Igor beiläufig, er möchte Lilia zu irgendetwas einladen, er überlasse ihr die Wahl. Er sagte „du“ zu ihr. Offenbar hatte er ihren Namen erfragt. Und Lilia antwortete, sie überlege es sich. Darauf verabschiedeten sie sich, ohne einander die Hand zu geben. Kühle überfiel Lilia. Die Sonne war im Sinken begriffen. Die Hündin schüttelte sich. Sand und Staub stoben flirrend aus ihrem Fell. Wind kam auf.
Einen Wunsch hegte Lilia schon: Sie war noch nie in einer Disco gewesen. Vielleicht war sie mittlerweile zu alt dafür. Doch den Vorschlag konnte sie Igor immerhin unterbreiten. Sie schuldeten einander nichts. Mochte sein, er sagte nein. Na und? Tanzanlässe waren rar in Lilias Leben. Da sie keine Freunde hatte, lud auch niemand sie dazu ein. Lilia tanzte gern. Sie tat es für sich allein. In ihrer Stube. Abends. Bei Kerzenlicht.
Als sie Schauspiel studierte und während ihrer Zeit als Sängerin, besuchte Lilia Fechtkurse und Seminare für Modern Dance. Lilia war wendig wie ein Aal. Sie bewegte sich leicht. Und weich. Auch mit geschlossenen Augen durch Tanzsequenzen geführt zu werden, machte ihr nichts aus – oder wenn es galt, über Partner hinwegzurollen, von ihnen über den Boden geschleift zu werden. In dieser Art von Nähe blühte Lilia auf. Ihre Wangen glühten vor Begeisterung. Auf der Ebene des Tanzes ging es nicht um Zudringlichkeit. Um Begierde. Sondern um Befreiung. Die Hingabe an tänzerische Abläufe bedeutete Austausch. Geben und Nehmen. Nicht Behalten wollen. Klar, schwitzte man dabei. Doch war es nicht die Sorte Schweiß, die Männerhände glitschig werden ließ. Man roch auch mit der Zeit und freute sich auf die Dusche nach der Anstrengung. Tänzerkörper verloren sich in Selbstaufgabe, ohne deswegen in Schlüpfrigkeit zu gleiten.
Lilia traute Igor zu, Grenzen zu respektieren. Sie hielt ihn für einfühlsam genug, Plumpheit zu vermeiden. Ohne Zweifel war er sehr versiert, was Frauen betraf. Ausgehungert erschien er ihr nicht. Sein Selbstwertgefühl wirkte intakt, sogar mehr als das. Sonst hätte er Lilias Scheu vor zu plötzlicher Annäherung weder wahrgenommen noch beachtet. Lilia musste vor ihm nicht auf der Hut sein. Er würde ihrer auf Dauer vielleicht überdrüssig. Doch ausnützen würde er ihre Lage nicht.
Bei ihrem nächsten Zusammentreffen fragte Igor Lilia nach ihrem Wunsch. Und Lilia erzählte ihm scherzend, sie würde gerne eine Disco besuchen. Igor schien überrascht. Bevor Lilia sich zurücknehmen und ihr Vorpreschen bereuen konnte, willigte er belustigt ein. Die aufkeimende Angst behielt Lilia für sich. Ebenso die Zweifel, die sie erst gegen Morgen, kurz bevor der Wecker klingelte, einschlafen ließen. In Gedanken durchforstete sie wieder und wieder ihre Garderobe. Bis sie sich für einen weiten, wadenlangen, mit Spitzen und Rüschen verzierten, mehrfarbigen Rock entschied, der mit kurzem Mieder unter der Brust geschnürt wurde. Dazu wählte sie eine rosafarbene, selbstgenähte Bluse mit weiten Ärmeln „à la Gitane“, die mit einer Kordel am Halsausschnitt geschlossen, oder offen getragen wurde. Was ihr, wie sie wusste, zusammen mit ihrem langen Haar einen verhaltenen Touch von Wildheit, von Hasch-mich-und-ich-beiß-dich verlieh. Lilia liebte das Spiel um Anziehung und Abstoßung. Nur ging es für sie dabei um mehr: Um die herzkleine Annäherung an den Punkt zwischen Ekstase und Verderben. Es ging ihr nicht darum, auf Igor Eindruck zu machen - sondern darum, sich selbst zu feiern.
Sie verabredete sich mit Igor für Samstagabend. Für einmal ließe sie ihre Mutter im Stich – ein Gedanke, der seltsame Wehmut in Lilia weckte. Sie dachte mit Unruhe und schmerzhafter Trauer an ihren Ausflug mit Igor, so als mache sie sich damit schuldig. Erst der Samstagmorgen ließ so etwas wie erregte Freude in ihr aufkeimen. Nebst massenhaften Bedenken. Es fehlte ihr an Übung, mit einem Mann zusammen zu sein, einen ganzen Abend mit ihm zu verbringen. Worüber sollten sie reden? Sie wussten so gut wie nichts voneinander. Und Lilia hatte nichts vorzuweisen – immer noch nicht. Wogegen Igor sicher und solide im Sattel zu sitzen schien. Nicht nur, wenn er ausritt.
Ihre Minderwertigkeit sprang Lilia an wie ein bissiges Vieh, zerrte und riss an ihr, als kriege es nie genug. Sie würde auch Igor enttäuschen – so wie sie alle Menschen enttäuschte, die ihr mehr als nur auf konventionelle Art nähertraten. Sie halte nicht, was sie zu versprechen vorgebe, hieß es, seit sie denken konnte. Lilia machte sich diese Ansicht zu eigen. Sie sog sie auf wie ein Schwamm. Vielleicht hatte sie sich ja auch deswegen von Bernd getrennt, aus Angst, er könnte selbst draufkommen. Mochte sein, sie war ein Feigling, rannte vor dem Leben davon.
Es wurde Abend und Lilia machte sich bereit. Machte sich bereit für sich selbst. Gab sich Mühe, fast vergessene Handgriffe aufzufrischen. Der Lidstrich gelang nicht auf Anhieb. Dafür saß der Hauch von Lippenstift perfekt. Und auch die übrige Aufmachung konnte sich sehen lassen. Lilia gefiel sich ausgesprochen. Wie eine Witwe sah sie jedenfalls nicht aus. Spurlos an ihr vorübergegangen, war das Erlebte nicht. Andeutungen überstandenen Wehs spielten um ihre Mundwinkel.
Ihre kleinen Füße steckte Lilia in schwarze Pumps mit zierlichen Absätzen. Ketten verschiedenfarbiger Steine wanden sich um ihren Hals, und Gehänge aus Pfauenfedern baumelten von ihren Ohren. Verschiedene Ringe an Zeige- und Mittelfingern vervollständigten Lilias Aufmachung. Sehr viele Monate waren vergangen, seitdem sie sich das letzte Mal in ähnlicher Tracht im Spiegel gegenübergetreten war. Ihre Erscheinung befremdete sie. Lilia war gespannt auf Igors Reaktion. Sie würde sofort merken, falls sie ihm missfiele. Jede noch so kleine Anspannung nähme sie augenblicklich wahr.
Die von Igor ausgesuchte Disco befand sich in einer Kleinstadt, eine halbe Stunde von Lilias Wohnort entfernt. Igor fuhr einen Mustang. Er trug ein blütenweißes Rüschenhemd und enge, schwarze Hosen, die Haare zum Zopf geflochten. Lilia hatte keine Vorstellung von dem, was sie erwartete. Sie saß neben Igor. Machte sich so schmal als möglich. Fühlte sich fremd. Fehl am Platz. Rätselte an der Bedeutung ihres Zusammenseins herum, wie an etwas Unstatthaftem. Zu sagen wusste sie nichts. Igor gab sich gelassen, lächelte sie hin und wieder an. Die Zeit rückte kaum vom Fleck. In der Parkgarage bat Igor Lilia, sitzenzubleiben. Er ging ums Auto herum und öffnete ihr die Tür, hielt sie so lange auf, bis Lilia ihren Rock zusammengerafft hatte und ausgestiegen war. Die dargebotene Hand übersah Lilia. Darauf bedacht, nicht zu stolpern, versuchte sie mit Igor Schritt zu halten.
Lärm, knallige Musik, Zigarettendunst und schummriges, rötliches Licht empfingen sie und sogen sie in einen Rachen überhitzter, betäubender Dumpfheit hinein. An der Decke drehte sich eine, in allen Farben blitzende Kugel träge und lasziv, wie eine verschlafene Katze. Igor fasste Lilias Hand und zog sie aufs Parkett. Er hielt sie auf Armeslänge von sich, zählte die Takte, bis er den Einsatz fand, riss Lilia zu sich heran, wirbelte sie im Kreis, scheuchte sie von sich weg: Rock‘n’Roll ging ab. Igor tanzte wie ein Teufel: Körpereinsatz pur. Und endlich erinnerte sich auch Lilia an ihr Können, das jahrelang brachgelegen hatte, da Pierre-Louis nie mit ihr tanzen gegangen war. Oder sie nicht mit ihm. So genau wusste sie das nicht mehr.
Die wenigen Männer, die sie kannte, bevorzugten schleichende Tanzstile, die die Paare aneinanderklebten. Die Beine ineinander verschlungen. Wange an Wange geschmiegt. Ein Abtauchen in den Geruch des anderen: Bauch an Bauch. Lilia hasste es, wenn das Geschlecht des Partners sich wie ein sich windendes Tier langsam an ihrem Körper aufrichtete, und leises Stöhnen den Lippen des Mannes entfuhr. Mit Igor geschah nichts dergleichen. Er tanzte um des Tanzens willen, mit urtümlicher Kraft, setzte die Schritte gekonnt, sodass Lilia nie ins Straucheln geriet. Dazwischen ließ er sie los, drehte sich um sich selbst, wand sich wie ein Korkenzieher, genauso als habe er zeit seines Lebens nichts anderes getan als zu tanzen, sich im Takt der Musik herumzuschwingen, auf die Knie zu fallen, und wieder emporzuschnellen.
Irgendwann stand Lilia still und schaute ihm nur noch zu. Andere folgten ihrem Beispiel. Ein Kreis bildete sich um Igor, der alles um sich herum vergessen zu haben schien und nur noch hüpfte, wippte, mit den Armen schlenkerte, als wolle er sie von sich werfen. - Schallender Applaus. Igor erwachte aus seiner Trance. Lachte aus vollem Hals. Schlang die Arme um Lilia und riss sie hoch. Das Gesicht in ihrem Haar, schnaufte er wie ein Stier. Die Arme wie Zangen. Sodass Lilia kaum noch Luft bekam. Dann ließ er sie los und staunte sie an. „Wow, das tat gut“, grinste er. „Das habe ich vermisst. Danke, dass du mich daran erinnert hast.“
Bei Cola und Chips erzählte Igor, er habe als Bub Ballettstunden genommen und als talentiert gegolten. Doch er sei zu schnell gewachsen, zu groß geworden. Und mit Schuhgröße fünfundvierzig als Balletttänzer nicht mehr in Frage gekommen. Das habe ihm fast das Herz gebrochen.
Der Abend war noch jung, und Lilia und Igor tanzten drauflos wie aus lähmendem Schlaf erwacht. Ihre Gesichter leuchteten. Sie schwitzten. Sie hatten einander entdeckt und gefunden. Eingerostete Schlösser mit verbogenen Schlüsseln geöffnet. Muskelkater würde Lilia einholen. Sie würde sich elend fühlen, als habe sie sich verraten. Ohne zu wissen warum. Und Igor? Wer war Igor? Lilia hatte nicht die leiseste Ahnung.
Lilia erwachte wie gerädert. Jeder Knochen in ihrem Körper schrie. Sie schleppte sich ins Bad, warf sich kaltes Wasser über Gesicht und Schultern. Das klärte ihre verklebten Augen, sodass sie wieder richtig sehen konnte. Heißer Tee weckte ihre Lebensgeister, obwohl das Gefühl vorherrschte, sie sei während der Nach windelweich geprügelt worden. Zudem krallten sich wie stachlige, eklige Biester Gewissensbisse in ihrem Gemüt fest, so als habe sie einen massiven Fehler begangen. Lilia kannte diese Biester. Sie hoben periodisch ihre fratzenhaften Gesichter, wie um sie daran zu erinnern, sie habe kein Recht darauf, sich zu freuen.
Auch an diesem Tag wählte Lilia eine Spazierroute, auf der sie Igor nicht über den Weg laufen würde. Sie war wütend auf ihn, weil er diesen Zwiespalt in ihr wiedererweckt hatte, der sie lähmte wie nichts sonst, sie in seinen Schlund zog, zu Busse und Sühne ermahnte, obwohl sie nicht wusste wofür. Sie bemühte sich, ihre Hündin zu knuddeln wie immer, sie mit Stöckchenwerfen übers Feld zu jagen, ihrer Stimme nicht anmerken zu lassen, dass sie den Tränen nahe war. Doch Tiere lassen sich nicht täuschen. Mali spielte mit, nur ließen ihre Sprünge die übliche Leichtigkeit vermissen. Sie kehrte rascher zu Lilia zurück, ermüdete früher, trottete bald mit hängendem Kopf neben ihr her. Lilia setzte sich auf eine Bank am Waldrand mit Aussicht über die Stadt. Kein Mensch war zu sehen. Kirchenglocken klangen blechern an ihr Ohr, das Keckern eines Vogels im Geäst, entferntes Hupen. Wattiger Nebel dämpfte Farben, umflorte Häuser und Türme, Feen und Kobolden genehm. Das unterschwellige Rauschen des Stroms violetter Trauer im Herzen - den Urgrund ihres Lebens - saß Lilia da, Mali im Arm, schlug Wurzeln, ließ sich ins Erdreich ziehen. Schwere, Trauer und Schuld ertranken darin, bis Mittagsgeläut sie aufscheuchte.
Den Nachmittag verdöste Lilia, vergaß sogar, dass sie vorhatte, ihre Mutter anzurufen, als Entgelt für den ausgefallenen Besuch. Igor blieb sie tagelang fern, als sehe sie keinen Weg in einen Alltag zurück, zu dem auch andere Zugang hatten. Die Protokolle im Büro tippte sie in sich gekehrt. Man schätzte ihr Schweigen, das sie selbst der Stellungnahme und des Austausches enthob.
Die Arbeit im Büro liebte Lilia weniger denn je. Sie verrichtete sie, weil sie auf Entlohnung angewiesen war: Widerwilliges Überleben. Weder die Schwiegermutter noch ihre eigene Mutter hingen davon ab, dass Lilia sich um sie kümmerte. Auch niemand sonst. Ihre Stelle könnte irgendjemand ausfüllen, besser als Lilia, die Feiern und Firmenausflügen fernblieb.
Nun erst, als die Monate vergingen, wurde Lilia das Ausmaß ihres Nichtintegriertseins bewusst. Woche für Woche gestaltete sich gleich. Schrillte per Zufall das Telefon, erschrak sie. Ihre Wohnung enthielt nichts als Stille. Sie besaß immer noch keinen Fernseher. Auch Platten hörte sie sich keine mehr an. Meistens las sie, Bücher über Sufismus, über den Islam, Schamanismus, Astrologie – kaum mehr Klassiker. Die hörte sie nur noch, wenn Bernd sie am Radio vortrug. Dann nahm Lilia das Radio mit in den Zug, an Samstagen, wenn sie zu ihrer Mutter fuhr, und sog, das Ohr ans Gehäuse gepresst, im Vorraum bei der Toilette sitzend, seine Stimme in sich hinein, wie eine Verhungernde die Nahrung. Ihr Blutdruck schlug Purzelbäume. Der Herzschlag donnerte gegen ihre Rippen. Der Schmerz ließ nicht nach: es war zum Verzweifeln.
Zu wissen, dass Bernd sprach und nicht zuzuhören, brächte Lilia nicht fertig.
Das Lesen hatte sich Lilia auch im Büro angewöhnt. Es kam fast jeden Tag vor, dass sie eine Weile nichts zu tun hatte. Um diese Momente zu überbrücken, und um sich emotional zu sanieren, griff sie zum Buch, das sie unter Ordnern und Akten versteckt hielt. Fiel ihr Name, reagierte sie blitzschnell. Ihre Leseeskapaden nahm niemand wahr.
Eine vorbildliche Bürokraft war Lilia nicht. Guter Durchschnitt, das musste genügen für den bescheidenen Lohn, den sie erhielt, da sie immer noch nicht verstand, dass es an ihr lag das zu ändern. Erst später, als sie in einem KMU arbeitete, zusammen mit einem homosexuellen und ausgesucht höflichen und liebenswürdigen jungen Mann, taute Lilia etwas auf. Plötzlich konnte sie schwatzen und lachen. Zur Pause teilten sie sich Brötchen, Kuchen oder auch mal Schokolade. Sie lud ihn und seinen Freund zu Gulaschsuppe und Dessert zu sich nach Hause ein, deckte den Tisch mit Omas erlesenstem Spitzentuch, dem feinsten Geschirr und kristallenen Gläsern, in die der Wein gotische Fenster zauberte. Mit den Schwulen zusammen zu sein erfrischte Lilia wie ein parfümiertes Bad. Sie waren äußerst pflegeleicht. Und wie Lilia während ihren Gesprächen erfuhr, auch dankbar dafür, dass Lilia sie wie normale Menschen behandelte. Es geschehe immer wieder, erzählten sie, dass sie eine Wohnung nicht bekämen, angepöbelt würden oder anonyme Briefe erhielten. Lilias Freundschaft genossen sie, und Lilia fühlte sich beschenkt.
Ihrem Chef gefiel das harmlose Geplänkel allerdings weniger. Und als Lilia einmal das Wort „Laib“ in einem Text mit dem Wort „Leib“ verwechselte, wurde er so wütend, dass er Lilia anschrie und ihr nahelegte, die Stelle zu kündigen. Von da an gelang es Lilia nicht mehr, im Büroalltag Fuß zu fassen.
Am nächsten Ort, an dem sie sich bewarb, gefiel sie zwar auf Anhieb. Ihr neuer Chef meinte, sie passe genau in seinen Betrieb, doch Lilia konnte sich je länger desto weniger in die Arbeit fügen. Sie fühlte sich unterfordert und langweilte sich. Die leere Zeit in der es nichts zu tun gab, dehnte sich in dieser Firma noch mehr in die Länge. Es wurde viel geschwatzt, auch von Lilias Seite. Der Betrieb lief nicht wie gewünscht. Ihr Chef ging Lilia auf die Nerven. Sie fand ihn hinterwäldlerisch, plump, ungebildet. Ihr Engagement litt darunter. Das Aus war absehbar und folgte kurz darauf: fünf Jahre nachdem sie Igor zum ersten Mal begegnet war.
Eine Woche nach ihrem Discoabend rief Igor Lilia an. Seine Stimme klang, als habe er sich das, was er sagen wolle genau zurechtgelegt. Forsch und barsch, wie heruntergebetet, sprudelten die Wörter aus ihm hervor. Er gab Lilia zu bedenken, er trage immer noch ihren Ring und das jeden Tag - und bewusst, und er wünschte sich, ihre Beziehung würde diesen Namen auch verdienen. Er verstehe nicht, warum sie immer wieder davonlaufe. Warum sie ihm zwar den Ring aber nicht sich selbst gebe. Lilia schwieg betroffen. Seine Entschlossenheit fühlte sich an wie eine Ohrfeige. Natürlich war es verrückt gewesen, ihm den Ring zu lassen. Er sollte ihn ja nur hüten. Zur Besänftigung von Lilias schlechtem Gewissens, weil sie ihn mit ihrer Teilnahme am Seminar eifersüchtig gemacht hatte. Ein Pflaster hätte er darstellen sollen, mehr nicht. Nur getraute Lilia sich hinterher nicht, den Ring zurückzuverlangen. Ihre Ängstlichkeit ermutigte Igor, schürte in ihm die Annahme, sie wolle mit ihm in Verbindung sein.
Wollte Lilia das? Ein Teil in ihr sagte „ja“, ein anderer Teil „nein, auf keinen Fall“, schüttelte sich die Idee aus dem Fell wie ein Hund sich Flöhe. Der Gedanke an die Anstrengung, die durch eine neue Verbindung an Lilia herangetragen würde, Seiten im anderen zu entdecken, die sie nicht mochte, sich an andere dranzuhängen, die sie mochte: Die Mühe, die das kostete: - lieber blieb sie allein. Und dann? Was wäre in zwei Jahren, in dreien oder in zehn? Der Blick in diese Perspektivenlosigkeit jagte Lilia noch mehr Furcht ein, als einzuwilligen, mit Igor zu Abend zu essen. Auch wenn Lilia deswegen innerlich zitterte, da der Onkel, dem sie mitgeteilt hatte, sie habe wieder jemanden kennengelernt, sie deswegen anschrie und ihr vorwarf, sie sei wohl nicht bei Trost, sich so kurz nach dem Unglück mit dem einen Mann auf einen neuen einzulassen. Lilia entschied, Igor nun erst recht eine Chance zu geben.
Daneben setzte sich Lilia hin und wieder hinter die Texte, die sich Bernd von ihr wünschte. Eine Arbeit, die die Nabelschnur zwischen ihnen am Pulsieren hielt. Vorläufig. Bis sie vollends gekappt würde. Das Schreiben fühlte sich für Lilia an wie ein Behaustsein. Ein Ort des Schutzes. Des Dialogs. Es kostete sie Mühe, sich hinter die Schreibmaschine zu klemmen. Widerstände waren zu überwinden. Auch Ekel vor dem Schürfen in sich selbst. Einmal überwunden, machten sich die Tasten selbständig, und der Text flog leicht wie ein Vogel aufs Papier, überraschte Lilia jedes Mal mit seiner Vielfalt, die nicht sie herstellte, sondern die ihr aus den Händen gesogen wurde. Als entwickelten sich die Sätze aus sich selbst heraus. Die Faszination, die Geschriebenes auf Bernd ausübte, wurde Lilia bewusst. Und sie verstand, warum er nicht daran interessiert war, eine persönliche Sprache für sich zu entwickeln. Sprache gehörte niemandem. Sie konnte gepflückt werden wie ein Apfel vom Baum. Wie eine Rose aus der Hecke.
Je länger sich Lilia mit ihren Lebensepisoden beschäftigte, desto eindrücklicher nahm sie die Willkürlichkeit von Sprache wahr, die in jedem Stein. Jedem Splitter Holz. Jedem Blatt. In einer Schlange. Einem Affen. Einer Straße. In Häusern und Menschen existierte. In allem und jedem. Dem Sichtbaren und auch dem Verborgenen. Nie aufhörte zu raunen. Zu zicken. Zu flöten oder zu jubilieren. Ausdruck von Lebendigkeit schlechthin war. Weder wahr noch unwahr.
An diesem Abend hörte Lilia den Regen, der gegen das Fenster tröpfelte subtiler denn je. Es geschah in Kadenzen, mal schneller, mal langsamer, fordernder oder verhaltener. Als Brummeln oder Klatschen. Nie gleich. Tausende Wörter diktierten die Tropfen dem Glas, an dem sie hinunterglitten wie auf Schlitten, leicht und schnittig. Verwehend als Nebel im Nachtwind, der die Läden zum Erzittern und Holpern brachte. Worauf die Wände mit unterschwelligem Schnurren antworteten, wie eine Katze im Halbschlaf. Leben barst vor Wörtern – ihrer Farbigkeit. Ihrer Gewichtigkeit. Ihrer Klangfülle. Dem Geschmack. Dem Anfühlen. Dem Umschmeicheln oder sich Verweigern. Beliebig konnten sie eingesetzt, weggelassen, verschwiegen, hinausgeschrien werden - im Sterben verhauchen. Waren Augenblicksgäste ohne Bestand. Kaum gesetzt, schon wieder in Frage gestellt.
Lilia erlebte ein Berauschtsein, eine Freudigkeit wie seit langem nicht mehr. Es war Illusion zu glauben, Texte enthielten Wahrheit – oder müssten Wahrheit enthalten. Ihnen vorausgegangen waren so viele Jahre an Vergangenem. Die Mühlen der Erinnerung. Das Verwässert- und Aufgepeitschtwerden. Das Ersaufen in Gewissensbissen jeder Sorte, das sie schal machte, seicht, ihnen Kraft, Macht und Witz raubte. Das Gehirn, das sie um und um drehte und mit Bedeutung überhäufte, bis zum Erbrechen. Dabei brauchten sie nur die Erlaubnis, ins Blickfeld zu springen. Aufzublitzen. Sich einzuschleichen. Sich einzubluten in das längst Vorhandene. Das sich noch nicht einmal danach sehnte, erkannt zu werden, sondern es aus sich heraus war.
Lilia entdeckte einen Kanal an Lebendigkeit in sich, in den sie sich hineingleiten lassen durfte. Der sie führte. Hätschelte. Und schaukelte wie Arme eines Liebenden. Ließ sie das zu, lag nichts dazwischen, gab es keine zwei, waren die Wörter nicht außerhalb von Lilia, sondern sie mitten in ihnen, und die Wörter an sie angewachsen wie ihre Haut.
An guten Tagen feierten sich die Wörter in Lilia. An anderen lagen sie in Hinterhalten wie Feinde, ließen sich weder blicken noch überrumpeln. Oder sie sprangen sie an wie Biester, die nach ihrem Fleisch gierten, sie unter sich begruben und aussaugten. Dann herrschte Ohnmacht und Lilia ertrank in den Wörtern, die sie bedrängten. Schuld zuwiesen. Leben zum Kotzen fanden. Totsein als Wonne. Solche Tage überwogen. Umso mehr erschienen die anderen Lilia wie pures Glück.
Igor entführte Lilia an einem Abend buchstäblich. Als sein Auto anhielt, befanden sie sich in ländlicher Gegend,
vor einem Gutshof. Und als sie ausstiegen, tauchten Pferdeköpfe auf. Wiehernde, die ihre Hälse an den Kanten der Tore rieben, die sie in ihre Ställe bannten. Ein verblüffender Anblick, der Lilia zum Lachen brachte, und die Widerstände gegen das Eindringen Igors in ihr Leben, die beißende Abneigung gegen sein Selbstverständnis ertränkten. Lilia fürchtete Pferde, ihre Größe, die Bockigkeit, das Sperrige ihrer Bewegungen. Dass sie nicht zu ihr hinauskonnten, gab ihr den Mut, ihre Nasen zu streicheln: Warmes, Samtenes, Feuchtes, das ihre Hände mit Schlieren überzog. Elf Boxen waren bewohnt, die übrigen scheinbar leer. Ihre Besitzer seien mit ihren Bewohnern unterwegs, erläuterte Igor.
Er zog Lilia zum Stalltor, aus dem ihr unzählige Düfte entgegenwaberten: Nach spelzigem, knisterndem Heu. Nach Wärme aneinandergedrängter Leiber. Nach ranzigem Fett. Schwartigem Leder und vielem mehr. Der weitläufige Stall versetzte Lilia in Verwirrung. Sie ging unwillkürlich auf Abstand zu Igor, der die Pferde mit Belohnungswürfeln fütterte und auf sie einsprach – schnäbelnd - schnurrend, in einer Melodie tiefster Zugehörigkeit und Vertrautheit. - Die Frage: „Wer ist Igor“, drehte sich in Lilias Gehirn wie ein Refrain.
Sie ließ sich wortlos herumführen: Durch den Stall ins Hauptgebäude. Durch eine moderne Küche in einen großzügigen Speisesaal mit langer Tafel, die für mehrere Personen gedeckt war. Lilia stand unschlüssig herum. Igor sprach in der Küche mit einem Mann, der sich andauernd räusperte. Er stellte ihn später Lilia als seinen Vater vor.
Lilia fühlte sich in einem Film, von dem sie weder Titel noch Inhalt kannte. Sie schwieg, da es nichts zu sagen gab. Igor benahm sich als Eigentümer. Die Zeit hing in der Schwebe, wie eine kurz vor dem Sturz in die Tiefe angehaltene Achterbahn. Allmählich trudelten ein Pferdepfleger ein, ein alternder Jockey der hinkte, ein Verwalter, der Gärtner, der Stallbursche, die Haushälterin, die Schüsseln und Flaschen hereintrug und eine weißhaarige Dame, auf die die Anwesenden wie auf etwas Unberührbares reagierten. Aus Lilias Unterbewusstsein tauchte das Bild ihrer Oma auf – ein Anhaltspunkt, der das bange Staunen in Lilia löste. Sie ließ sich ihren Platz zuweisen, setzte sich ohne Umschweife, nahm den gefüllten Teller entgegen, das Glas Wein, Wasser, einen Salat. Bald regten sich Gespräche. Igor stupste seinen Ellbogen in Lilias Seite und scherzte: „Verblüffung gelungen?“ Sie lachten einander an wie alte Freunde. Nur wusste Lilia immer noch nicht, in welcher Beziehung sie zueinander standen.
Als sie von einem der Essenden zum anderen schaute, erinnerte sie sich daran, wie ihre Mutter am Tisch zu sitzen pflegte, wie sie auf den von Oma gefüllten Teller wartete, ihn ein bisschen von sich wegschob, die Hände übereinanderlegte um das Tischgebet zu sprechen, müde Hände, magere, mit dunklen Schatten zwischen den Knochen, wo das Fleisch fehlte: Wie zusammengefaltete Flügel von Fledermäusen. Lilia durchflutete Zärtlichkeit, die in ihrem Inneren Tränen weckte. Obwohl sie sich in der Runde wohlfühlte, wäre sie lieber bei der Mutter am Tisch im Café der Altersresidenz, wo sie die Mutter jedes Mal nötigte zu essen - mehr und noch mehr, bis Lilia fast platzte. Hätte sie zwei Menus hintereinander bestellt, Lilia hätte der Mutter keine größere Freude machen können. Dass Lilia verhältnismäßig wenig konsumierte, betrauerte die Mutter. Sie müsse doch bei Kräften bleiben, wenn sie so hart arbeite und so wenig schlafe. Versuchte Lilia der Mutter zu erläutern, sie arbeite nicht härter als irgendwer sonst, in ihrem Alter erwarte man das von ihr, sah sie ihrer Mutter an - deren Augen sich im Ungewissen verloren - dass die Mutter nicht zuhörte. Sie wollte ihre Meinung keiner Rechtfertigung aussetzen, keine Erklärungen verarbeiten. Ihre Ansicht bedurfte keines Kommentars. In Erz gegossen stand sie unverrückbar im Raum, verweigerte sich jeglicher Diskussion. Es folgte eine nicht minder verhärtete Stille, die eine Scharte zwischen die Mutter und Lilia zog, scharf wie eine Rasierklinge. Lilia benötigte stets mehrere diskrete Atemzüge, um ein neues Kapitel Konversation anzuschneiden, ohne gleich das nächste Tabu zu streifen.
Die Unerbittlichkeit der Mutter verletzte Lilia jedes einzige Mal, auch wenn sie sich vorgängig dagegen wappnete: Die Eiseskälte dahinter schnürte ihr die Kehle zu. Danach den Fluss von Zuneigung und Zärtlichkeit wieder in Gang zu bringen, kostete sie Überwindung. Gelang es ihr, machte sie das doppelt glücklich, über die Mutter sowie über sich selbst. Es freute Lilia, als sie sah, dass die Sturheit der Mutter ihr auch zu mehr Kraft, mehr Bodenhaftung verhalf. Sie war nicht mehr nur die, in zu großen Filzpantoffeln und einer langärmligen Überschürze von Zimmer zu Zimmer schlurfende, jeder noch so geringen Forderung von Oma aufs Wort gehorchende, demütig gebeugte Dienstmagd. Sie war Erbin, selbständig und wohlhabend genug, um an respektabler Adresse zu wohnen. Und sie zeigte es, ließ sich Einkäufe ins Haus bringen, beorderte Anwalt und Vermögensverwalter zu sich. Und Besucher mussten sich telefonisch bei ihr anmelden, um vorgelassen zu werden. Omas Vermächtnis manifestierte sich in der Mutter: es war nicht zu übersehen. Und auch nicht zu überhören Die metallische Härte der Stimme, die Hartnäckigkeit, wenn sie einen Auftrag so – und auf keinen Fall andersherum – erledigt haben wollte, entlockte Lilia manches heimliche Lächeln.
Weitläufig war das Zimmer ihrer Mutter nicht. Und auch die Aussicht gab nicht allzu viel her. Dafür die Betreuung umso mehr. Den einen der beiden Direktoren des Hauses bezirzten ihr trockener Witz und ihr spröder Charme. Er erfüllte ihr jeden Wunsch, selbst wenn dabei ein Stück seiner Freizeit draufging. Das größte Geschenk für Lilias Mutter bestand jedoch darin, dass sie jede Sorge, bezüglich Krankheit und den Prozess des Sterbens, fallen lassen durfte. Sie würde in ihrem eigenen Bett liegen bleiben, bis zu ihrem letzten Atemzug. Das nahm ungeahnten Druck von ihr weg – sowie auch von Lilia.
Das Abendessen bei Igors Familie zog sich in die Länge. Es wurde über Pferde gesprochen. Eine der Stuten, Amina, lag matt im Stroh. Ein Pferdeflüsterer wurde erwartet. Die Miene von Igors Vater verdüsterte sich, als ein Junge meldete, der Besuch verzögere sich um einen Tag. Die lokalen Rennen standen bevor. Amina würde sich zum ersten Mal mit anderen Neueinsteigern messen. Igor eilte aus dem Zimmer, um selbst mit dem Therapeuten zu verhandeln. Er überredete ihn, nachts vorbeizukommen und bei ihnen im Haus zu übernachten.
Nach dem Essen verschwanden Igor und sein Vater im Stall. Der Jockey, der Lilia beobachtete, gesellte sich zu ihr, sich für die widrigen Umstände entschuldigend. Er sprach nahezu akzentfreies Deutsch. „Ich heiße Stepan“, stellte er sich vor und verbeugte sich linkisch. Alles an ihm schien verzogen, von den Schultern bis zu den Zehen, auch das Gesicht. Nur der Blick aus den dunkelbraunen Augen traf Lilia bolzengerade. Und so unmittelbar, dass sie ihm unwillkürlich auswich. Obwohl Stepans Züge verzerrt wirkten, als habe ein Kind mit Knetmasse Clown gespielt, frappierte Lilia ihre Schönheit. Das pechschwarze Haar umspielte eine hohe Stirn, auf der alle Furchen von links oben nach rechts unten liefen. Auch Stepans Mundwinkel hingen von links nach rechts. Nur die Augen standen, wo sie sollten, überschattet von dichten Brauen. Sie saßen in ihren Höhlen wie in Nestern. Die Wangen flappten wie Segel. Es war ein Gesicht, an dem sich Lilia nicht sattsehen konnte. Immer wieder zwang es sie, es anzuschauen.
Lilia gesellte sich zu Stepan ans Fenster. Die Schwärze der Nacht starrte sie an. Schmal schimmerte die Sichel des Mondes durch die Zweige der Linde in der Mitte des Vorplatzes, um deren Stamm sich eine hölzerne Bank wand wie ein Kragen. Scheinwerfer glotzten zum Haus empor wie Augen verschreckter Gespenster, fahlen Glanz über die Wiesen scheuchend und wieder wegtauchend. Stepan und Lilia waren allein. Friede herrschte, sanft untermalt durch luftiges Plätschern des Brunnens im Hof. Stepan zog einen Stuhl herbei und setzte sich so hin, dass die eine Gesäßhälfte über die Sitzfläche hinausragte. Das dazugehörende Bein streckte er halb aus, den Fuß nach außen gekippt. Erst nun bemerkte Lilia, dass er einen Buckel hatte.
Stepan lächelte vor sich hin. Sein Gesicht leuchtete wie angestrahlt. Er richtete den Blick auf Lilia, die Augen erfüllt von Glück. Scheinbar ohne Grund fing er an, leise vor sich hinzulachen, glucksend wie das Sprudeln von Quellen, die manchmal unerwartet mitten aus einer Wiese springen. Er zog eine Schwarzweißfotografie aus der Tasche, darauf ein Junge auf einem Dreirad, der in die Linse winkte: „Mein Enkel“, sagte Stepan sanft. Dann schwiegen sie zusammen, satt und in sich und ihre Gefühle eingebettet. Nichts geschah. Nichts störte. Lilia fielen die Augen zu. Sie betrachtete die Sichel des Mondes, die sich rot hinter ihren geschlossenen Lidern spiegelte. Kein Schmerz war da. Kein Zweifel tauchte auf. Die Abwehr schwieg.
Als Stepan leicht über Lilias Arm strich, erschrak sie nicht. Ihr Wesen war nach allen Seiten offen, wie ein von Säulen gebildeter Tempel. Von der Seite, an der Stepan saß, strömte flauschweiche Wärme zu Lilia hinüber, vager Geruch von schwitzenden Pferden. Von speicheldurchtränktem Holz. Aufgeweichtem Sägemehl und Kraftfutter. Nebst einem Hauch von Rasierwasser, das nach Harz und Kräutern duftete. Ein Gemisch pulsierender Lebendigkeit, das Lilia mit allen Sinnen in sich einsog wie lange Vermisstes. Stepan roch zum Verrücktwerden gut. Sie fühlte sich ihm ebenbürtig wie einem Tier ihrer Gattung. Sie empfand nicht die geringsten Hemmungen. Er war ein Mann, doch als Mann keine Bedrohung. Und das nicht, weil er sichtbar invalid war.
Die Minuten vergingen. Eine halbe Stunde zerrann. Eine ganze. Sie saßen nebeneinander. Schulter an Schulter. Ohne ein Wort. Bis eine Türe schlug, Stimmen hallten und eilige Schritte sich näherten. Igor und sein Vater betraten das Esszimmer. Eine Woge aufgeregter Gereiztheit traf die Sitzenden, hart wie ein Brecher. Sie schreckten auf, verhaspelten sich in Wörtern, wie Ertappte, fragten nach dem Wie und Warum, und ob Hoffnung auf Genesung bestehe, als müssten sie etwas gutmachen, sich schuldig fühlen, weil sie sich mühelos aus der herrschenden Problematik ausgeklinkt hatten.
Igor starrte stirnrunzelnd zu Stepan hinüber, griff nach Lilias Hand und meinte: „Ich bringe dich besser nach Hause. Es könnte eine lange Nacht für mich werden, und ich bin ungenießbar, wenn eines unserer Pferde krank ist.“ Widerspruchslos ließ sich Lilia wegführen, reichte Igors Vater im Vorübergehen die Hand, bedankte sich, schickte einen kurzen Blick zu Stepan, der geistesabwesend sitzengeblieben war, und verschwand zusammen mit Igor. Der Raum zwangloser Vertrautheit, in dem sie mit Stepan verweilt hatte, war erloschen, als habe ein Windstoß silbernes Licht in nichts zerblasen. Es wurde kühl. Lilia fror. Ein Zittern vibrierte durch ihre Nerven. Die unterschiedlichen Regungen, denen sie in solch kurzer Zeit ausgeliefert gewesen war, hatten Lilia erschöpft. Sie riss die Augen auf, um sie am Zuklappen zu hindern. Igor ließ sie bei laufendem Motor aussteigen und fuhr sogleich zurück. Ein kurzer Gang zur Versäuberung Malis – und Lilia fiel ins Bett wie ein Stück Holz.
Am Sonntagmorgen nieselte es. Lilia erwachte früh, als es noch beinahe dunkel war. Sie entließ Mali auf die Terrasse. Die Blüten der Winden, die auch in diesem Sommer die kleine Laube überwucherten, in deren Schutz ihr Gartentisch und zwei Klappstühle standen, waren noch geschlossen. Zusammengefaltet wie Regenschirme. Ihre Unterseite schimmerte weißlich. Nur an den Kanten zeigten sie ihre eigentliche Farbigkeit: das Rosa, das Violett und die vielen Tönungen dazwischen. Lilia setzte Teewasser auf und schmierte sich ein Brot. Mali trottete in die Küche. Die weichwarme Hundeschnauze auf ihrem Knie, sinnierte Lilia vor sich hin, kraulte selbstvergessen Malis Kopf, zog sachte die kühlen, samtenen Hängeohren der Hündin durch ihre Finger. Mali hielt still, als sei sie mit Lilias Bein verwachsen. Die Minuten verliefen tropfend wie Honig. Das Rieseln auf den Fensterscheiben war der einzig hörbare Laut, hörbar als Bewegung, die mal in schrägen, mal in geraden Bahnen über das Glas kroch. Vom Kirchturm erklang das Morgengeläute. Langsam schlich Helligkeit über den Horizont. Der Regen hörte auf. Lilia saß auf Augenhöhe mit den Dächern der Altstadt, die sich steil wie Grate dem Dämmern entgegenreckten. Kaum ein Fenster war erleuchtet. In den Schluchten zwischen den Häusern, eng wie Schlote, hing schroffes Dunkel. Bis auf gelegentliches Knacken, eiliges Trippeln und nagendes Schaben schwiegen Mauern und Gebälk. Schlaf stemmte sich gegen das Erwachen.
Lilia drehte das Radio an. Kaum hörbar erklang Orgelmusik. Lilia lauschte, all ihre Sinne auf die Musik gerichtet, die dadurch an Volumen gewann. Die Vibrationen übertrugen sich auf ihren Körper. Je mehr sie sich vertieften, desto lauter widerhallten die Töne darin. Wie sachte Erleben doch war, wie herzklein. Der erste Bus schnaubte durch die Gasse. Er rüttelte das Haus aus der Stille, in der es eben noch vor sich hingedöst hatte. Mali seufzte, zog den Kopf von Lilias Knie und legte sich brummelnd auf ihre Füße. Sofort strömte Wärme Lilias Beine hoch. Die Ahnung eines Sonnenstrahls stahl sich durch die Wolken. Der Himmel riss auf. Es war Tag. Und Lilia entschloss sich, mit dem Bus aufs Land zu fahren und so lange mit Mali zu laufen, bis sie beide genug davon hatten. Um diese Zeit würden noch kaum Fußgänger unterwegs sein, was Lilia davor bewahrte reden zu müssen.
Es gab vieles, das in Lilia angeschaut, umgewendet und verarbeitet werden musste. Wie einen alten Traktor musste sie sich auf Vordermann bringen, um mit den anderen des Fuhrparks wieder konkurrieren zu können. Sie schlürfte eine weitere Tasse Tee und dachte an Bernd, der immer noch auf der ersten Seite ihres Bewusstseins stand. Für einmal war die Vergegenwärtigung nicht nur mit Schmerz behaftet. Dankbarkeit drängte sich mehr und mehr in den Vordergrund. Dankbarkeit dafür, dass Bernd in ihrem Leben hatte stattfinden dürfen.
In diesem Moment klingelte das Telefon. Lilia überhörte es zuerst. Als das Lärmen zu ihr durchdrang, stand sie auf. Igor meldete sich. Er müsse ihr unbedingt sagen, Amina, die Stute, sei über dem Berg. Der Pferdeflüsterer sei in der Nacht noch aufgekreuzt, habe Amina behandelt, in ihrer Boxe geschlafen und die Therapie am Morgen gleich fortgesetzt. Jetzt stehe die Stute wieder und mache erste Schritte. Igor schluchzte kurz auf vor Erleichterung. Dann fragte er Lilia, ob sie zusammen laufen gehen und unterwegs irgendwo frühstücken könnten. Und Lilia sagte ja.
Unterwegs fing es wieder an zu regnen. Sie wurden nass bis auf die Knochen - während des Frühstücks in einem von Lilias Lieblingslokalen wieder trocken - um hinterher erneut begossen zu werden. Igor hatte seine Dackel dabei, die mit Mali durch die Pfützen tobten.
Als Igor sich vor ihrem Haus von Lilia verabschieden wollte, lud sie ihn ein, sich bei ihr abzutrocknen und einen Tee zu trinken. Plötzlich hatte sie Lust auf ihn, war ihre Angst vor ihm wie weggeblasen. Igor sagte lachend zu. Sie rannten zusammen die Treppen hoch, die Hunde voraus, die sie zuerst trocken rubbelten. Dann standen sie voreinander, die Hände voller nasser Tücher. Lilia machte einen Schritt auf Igor zu. Die Tücher glitten zu Boden. Sie trampelten darauf herum, als sie einander in die Arme fielen. Lilias Füße verhedderten sich darin.
Langsam zogen sie einander aus. Die klammen Klamotten. Die kotigen Schuhe und Socken. Igors Hände legten sich um Lilias Brüste. Sie passten genau hinein. Lilia zuckte unter der hitzigen Berührung zusammen. Angst lauerte im Hinterhalt, bereit zuzuschnappen. Lilia verweigerte sich dem Denken. Sie wollte Igor. Ohne zu vergleichen. Ohne sich zu fragen. Igor zog sie zum Bett, setzte sich darauf. Die Hände auf Lilias Flanken. Sein Mund glitt an ihrem Körper hinunter. Ein Feuersturm erfasste Lilia, als sich seine Lippen zwischen ihre Schenkel drängten. Bereitschaft spannte ihren Körper wie einen Bogen. Sie öffnete sich seinem Wollen. Hungrig. Ungestüm. Glitt auf den Teppich. Zog ihn mit sich. Ergab sich gierig seinen Küssen - vergaß sich - vergaß alles.
Später erlosch der Rausch. Sie lagen ineinander verknäuelt. Ein Haufen Mensch. Spürten das Pochen. Dröhnen. Und Rasen ineinander. Bis auch das abebbte, Klarheit zurückkehrte. Und Lilia sich mit dem Unabänderlichen konfrontiert sah. Beide waren sie keine Anfänger. Beide wollten sie einander nicht verletzt zurücklassen. Sie wussten um Stil, um das, was sich gehörte. Also verabschiedeten sie sich vorsichtig voneinander. Vermieden Versprechen. Beließen es bei einem scheuen: „Ciao“.
Lilia lieh Igor einen trockenen Pullover und saubere Socken von dem Wenigen, das sie von Pierre-Louis behalten hatte. Igor zog sich an, pfiff seinen Dackeln, die sich in Malis Korb räkelten. Und die drei polterten die Treppe hinunter. Mechanisch, wie in Trance, räumte Lilia die nassen Sachen in die Maschine. Immer noch ohne einen Gedanken, setzte sie Teewasser auf, übergoss damit das Kraut, das mit einem Schwall an Düften darauf antwortete. Lilia stand zugleich neben sich und völlig in sich. Wie eine, die sich ein Stück anschaut, das sie selbst geschrieben hat. Weder Frau noch Mann, besah sie sich das Geschehene regungslos. Es hatte so kommen müssen, war weder gut noch nicht gut, war einfach natürliche Konsequenz. Die Teile des Puzzles passten nahtlos. Zu bereuen gab es nichts. Ebenso wenig zu rechtfertigen. Oder zu betrauern. Die Geschichte spulte sich von der Rolle, wie ein Bindfaden, kommentarlos. Man musste ihr nur folgen. Lilia liebte Igor nicht. Er liebte Lilia nicht. Mit etwas Geschick würden sie erkennen, was zu tun war. Oder auch nicht. Der Ausgang des Stücks blieb offen.
Irgendwann kehrte die Sonne zurück. Lilia verdöste den Tag. Las wie eine Schlafwandlerin. Ass wie eine Schlafwandlerin. Ging mit Mali Gassi wie eine Schlafwandlerin. War weder froh noch traurig. Fühlte nichts, außer Müdigkeit. Bevor der Gedanke an Bernd, ein Anflug von Bedauern, oder Selbstvorwürfe überhand nehmen konnten, schlief sie ein und erwachte erst, als das Rattern des Weckers nicht aufhören wollte.
Von nun an trafen Igor und Lilia einander täglich, wenn sie mit den Hunden unterwegs waren. Igor kam aus der entgegengesetzten Richtung. Mit Absicht. Und sie gingen den längeren Teil des Weges Seite an Seite zurück. War der Tunnel zwischen Ästen, Stämmen und Gestrüpp zu schmal, liefen sie hintereinanderher, wie zwei die zusammengehören. Igor legte es darauf an, Lilia zu zähmen, ihren Widerstand zu schmelzen. Und Lilia ließ es zu. Manchmal halbherzig. Manchmal froh darüber, dass es wieder einen Menschen in ihrem Leben gab, dem sie etwas bedeutete. Wenn sie auch nicht wusste, was.
Lilia nahm ihren Durst nach Zuwendung wahr. Er schien bodenlos. Und das machte ihr Angst. Denn sie hatte geglaubt, solchen Regungen entwachsen zu sein: Kleinkinderkram, der sie allzu lange gefangen gehalten hatte. Sie dachte, sich von der Tyrannei der Gefühle gelöst, und darin schon ziemliche Fortschritte gemacht zu haben. Dass sie nun wieder in der Falle saß – in der Männerfalle, wie es ihr Onkel verachtungsvoll nannte – konnte sie nur schwer akzeptieren. Fakt war, dass sie Igor verführt, dass sie selbst den ersten Schritt auf ihn zu gemacht hatte und dass das Folgen nach sich zog. Sie konnte ihn nicht mehr einfach wegschicken. Das unangenehme Wort „Verantwortung“ stand dagegen.
Lilia freute sich nun auch jedesmal darauf, Igor zu begegnen. Nur seine gelegentlichen Wutausbrüche machten ihr zu schaffen. Sie lähmten sie auf die gleiche Art wie diejenigen ihres Vaters, früher, als sie klein gewesen war. Der hinterlassene Stempel schien frisch wie beim ersten Mal, und zog Lilia den Boden unter den Füssen weg. Sie stand dann da, wie von einer Viper gebissen. Konnte sich nicht rühren. Nicht sprechen. Wusste nicht, wohin mit sich.
Lilia und Igor horchten einander sorgfältig aus. Und stellten fest, dass ihre Ansichten über das Leben einander nicht entsprachen. In keiner Weise. Lilia erwähnte beiläufig, sie gehöre einer Sufi-Schule an. Igor verstand nicht, wovon sie redete. Religion bedeute ihm nichts. Lilia zwar auch nicht. Doch wie ihm erklären, es sei das Dahinter, das sie fessle.
Sprach Igor von seiner Leidenschaft für Pferde, von den beiden Reiterhöfen, die er mit seinem Vater und dem Bruder bewirtschafte, von seiner Liebe zu den Tieren, die ein Gespür fast wie Menschen hätten, blieb Lilia stumm.
„Sie verstehen, was du ihnen sagst. Du siehst es in ihren Augen. Und ihr ganzer Körper antwortet darauf. Sie zeigen dir genau, was sie sich von dir wünschen. Und entsprichst du ihnen nicht, können sie ganz schön beleidigt sein. Sie stellen sich dann an, als seist du Luft, zeigen dir die kalte Schulter. Vor allem die Stuten. Und du musst dich anstrengen, um ihre Gunst zurückzugewinnen. Sie sind wie Frauen: launisch und zickig, sofern sie dich lieben. Doch treu wie Gold. Hängenlassen würden sie dich nie.“
Igor wurde bildschön, wenn er von seinen Pferden sprach. Und unüberwindbar stark, als liehen sie ihm ihre Kraft. Er wuchs und dehnte sich aus vor Energie. Und seine Augen sprühten. „Ein Teufelskerl“, dachte Lilia und fragte sich, wie lange sie ihn zu interessieren vermöge, bevor er eine andere anlache. Er sei zweimal verheiratet gewesen, ließ er Lilia wissen. Jemanden wie sie habe er allerdings noch nie getroffen - - was vielleicht auf ein bisschen Dauerhaftigkeit schließen ließ. Sie spielten miteinander, weil sie einander so fremd waren. Suchten nach einem gemeinsamen Nenner.
Lilia erzählte Igor von ihrer Mutter und er hakte behutsam nach, erkundigte sich, ob es ihr diene, wenn er sie am kommenden Samstag zu ihr fahre. Sie verliere so weniger Zeit. Und falls es ihr nicht unangenehm sei, dürfe er dabei ihre Mutter kennenlernen.
Unangenehm war das Lilia nicht. Sie freute sich über das Angebot. Es enthob sie der Mühe, um Gesprächsstoff mit der Mutter zu ringen. Igor brillierte in Gesellschaft. Er blühte auf, bestritt Konversation, als sei es das Einfachste der Welt. Lilia würde sich zurücklehnen, beobachten, genießen und sich erholen. Ihre Beziehung zur Mutter machte zwar Fortschritte. Sie lernten beide dazu. Und sie lernten vor allem, einander nicht mehr grundsätzlich zu misstrauen. Der Schuldberg zwischen ihnen schmolz - von Lilias Seite schneller als von der ihrer Mutter. Sie erwähnte den Verrat von Lilias Vater nicht mehr so oft, wie sie das früher getan hatte. Die Tatsache stand nach wie vor zwischen ihnen. Und auch wenn Teile davon abbröckelten, blieb die Schuldfrage unangetastet und übertrug sich nahtlos auf Lilia, die Frucht des angerichteten Unheils.
Es verstand sich von selbst, dass der Ausflug zur Mutter in Igors Begleitung zum Erfolg gedieh. Ein Blick – und Igor hatte sich das Herz der Mutter geschnappt. In ihrer Familie hätte sie einen Mann mit einer Renaissance-Mähne kaum geduldet. Aber so - weil Igor sie ja nichts anging - ließ sie sich im Sturm erobern. Sie und Igor schwatzten. Lachten. Schäkerten zusammen wie Teenager. Die Wangen der Mutter gewannen an Farbe, ihre Augen an Glanz. Igor breitete einen unerschöpflichen Vorrat an Nachrichten vor ihr aus. Es stellte sich heraus, dass die Mutter ein geheimes Faible für Pferde hatte, dass sie insgeheim für schwere Motorräder schwärmte – wie auch Igor eines besaß - und die hartgesottenen Typen mit den Fransenjacken und den abenteuerlichen Helmen auf dem Kopf bewunderte, die an ihrer Residenz mit dumpfem Röhren der Motoren vorüberbrausten, das, wie die Mutter schüchtern gestand, Schmetterlinge in ihren Bauch zaubere. Lilia war baff. Insgeheim hatte sie vermutet, es müsse eine verborgene Saite im Leben ihrer Mutter geben, die zum Klingen gebracht werden könne von jemandem, der mit keiner Schuld ihr gegenüber behaftet wäre.
Nach einem üppigen Essen – Igor hatte sogar die von Lilia mitgebrachte Pralinenschachtel mit der Mutter zusammen leergegessen, was sie ihm hoch anrechnete – begleitete sie Lilia und Igor vors Haus um sie zu verabschieden und – so vermutete Lilia – um sich zu vergewissern, dass Igor eine ansehnliche Partie abgeben könnte. Keine mangelhafte wie seinerzeit Pierre-Louis, der Habenichts. Und tatsächlich: kaum sah sie ihn seinen dunkelvioletten Jaguar ansteuern, brach die Mutter in begeistertes Entzücken aus. Das war, was sie sich für ihre Tochter wünschte. Das war ein ordentlicher Mann, ein Mann von Stand, dem man auf Augenhöhe begegnen konnte. Igors Punktestand erreichte die Bestmarke. Seine Glorie färbte auf Lilia ab. Die Mutter war sichtlich gerührt und erleichtert, als sie Lilia zum Abschied auf die Wange küsste. Sie solle ja gut auf Igor aufpassen, raunte sie ihr ins Ohr.
Igor begann, sich in Lilias Leben mehr und mehr auszubreiten, was, wie Lilia verstand, einer gewissen Norm entsprach. Mochte man einander, rückte man näher zusammen. Er wollte auch immer öfter in ihrer Wohnung übernachten, mit Lilia schlafen. Ihre gemeinsame Geschichte entwickelte sich, zu Lilias Schrecken, sozusagen normal. Die Angst peinigte sie, ihre Höhle werde geentert, wie früher von Pierre-Louis. Der Wolf in ihr sann auf Flucht. Doch zeigte sich auch dieses Mal kein Ausweg. Schnurgerade bahnten sich die Ereignisse ihren Weg. Für ein Nein gab es keinen Platz. Und fragen, wie damit umzugehen sei, konnte Lilia auch niemanden. Sie verglich Igor nicht mit Bernd. Träumte sich in Igors Armen nicht in Bernds Arme. Sie war gesättigt von Liebe, brauchte keine Wiederholung und wollte sich nicht mehr zu denselben Höhen emporschwingen wie mit Bernd. Igor war ein anderer Mensch, und obwohl sie ihn mochte und sich emotional auch mehr und mehr auf ihn einließ, entbehrten ihre Gefühle einer gewissen Leidenschaft. Sie freute sich an seiner Anwesenheit. Sie mochte seinen Geruch, seine Art sich zu bewegen, seine Stimme. Es bahnte sich Freundschaft zwischen ihnen an. Aber Liebe? Lilia zweifelte.
Eine Zeitlang dachte sie daran, ihr Hab und Gut zu veräußern, sich einen Kleinbus zuzulegen und auf Weltreise zu gehen, weit weg, an Orte, die ihr keine Entscheidungen abverlangten. Dann wieder meinte sie, wenn sie beide ihre Wohnungen behielten, hätte ihre Beziehung möglicherweise eine Zukunft. Was Lilia am meisten quälte, war Igors Annahme, sie lege genausoviel Wert wie er darauf, so oft als möglich mit ihm zu schlafen. Das Gegenteil konnte er sich nicht vorstellen.
Unterschwellig rumorte es zwischen Lilia und Igor. Manchmal kam es zur Eruption. Streit entbrannte. Türen schlugen zu. Igor schimpfte und drohte. Lilia heulte und bettelte. Unmerklich verbreiterte sich die Kluft zwischen ihnen. Lilia fühlte sich missverstanden, verachtet: Das alte Lied auf einer Schallplatte, die einen Kratzer abbekommen hat. Nichts in Lilias Leben hatte sich verändert, erneuert. Das Gerüst an Gefühlen und Gedanken, das ihr Leben aufrecht hielt, blieb dasselbe. Zusätzliche mochten dazugekommen sein. Doch im Kern änderte es nichts. Eine Entdeckung, die Lilia nur langsam erfasste, da sie ihr als zu monströs erschien.
Dafür entwickelte sich eine andere Beziehung mit Leichtigkeit und Spontaneität: diejenige zwischen Lilia und Stepan. Lilia empfand Stepan nicht als Herausforderung. Es gab keine Türen, die ihres und sein Revier voneinander trennten. Lilia sah Stepan, als spiegle sie sich in ihm. Wie auf einem Negativ, stellte er die dunkleren, konkreten Umrisse von Leben dar, währenddem Lilia für die Zwischentöne stand: das Ungewisse, nicht unmittelbar Fassbare. Zusammen ergaben sie ein Bild; Stepan als ruhender Pol, tief wie ein See und klar wie ein Sommertag - Lilia das auf dem Wasser spielende, nicht greifbare Flimmern des Lichts. Lilia kannte niemanden, der so geradeaus lebte wie Stepan. Zwischenmenschliches schien für ihn weder Mühen noch Fallen zu beinhalten.
Um Lilia die Furcht vor Pferden zu nehmen, anerbot sich Stepan, ihr das Reiten beizubringen. Und was für Lilia wie ein Witz klang, meinte er ernst, so ernst und so selbstverständlich, dass Lilia nicht anders konnte, als sich darauf einzulassen. Igor weihte Lilia vorerst nicht ein, für den Fall, dass sie sich als Reiterin blamierte.
Sie traf sich mit Stepan am nahen Waldrand. Er führte Alexa, die zahmste Stute des Stalls am Zügel. Er selbst ritt einen Hengst. Auch im Sattel saß er schief. Doch Körperbeherrschung, Leichtigkeit und seine physische Kleinheit machten das körperliche Defizit wett: er ritt wie ein König. Zum Aufsteigen diente Lilia ein Baumstrunk. Es kostete sie dennoch Kraft. Ihr Herz schlug Alarm. Kaum oben, ließ Stepan die Stute an der langen Leine traben, behutsam zwar, doch so dass es Lilia durch und durch schüttelte wie eine Vogelscheuche. Sie klammerte sich am Sattel fest, die Zähne klappernd, die Augen angstvoll aufgerissen, wenn es auf der einen Seite der Runde leicht bergab ging. Stepan schwieg. Beobachtete. Schmunzelte.
Als Lilia sich entspannte, ihre Bewegungen dem Rhythmus des Pferdes anpasste und sie sich bewusst wurde, in welcher Lage sie sich befand, und was von ihr erwartet wurde, grinste Stepan breit. „Aha“, grunzte er, „du kommst allmählich in die Gänge.“ Lilia lachte befreit. Es fühlte sich unheimlich gut an, sich den Bewegungen des Tiers zu überlassen. Ein Schnalzen von Stepan versetzte seinen Hengst und Lilias Stute in Galopp. Lilia schrie: „Halt, halt, halt“ und krallte die Finger in die Mähne des Pferds. Ein langgezogener, beruhigender Laut Stepans stoppte die Pferde.
Stepan glitt zu Boden, humpelte zu Lilia hinüber, legte eine Hand auf ihren Schenkel. Lilia zitterte. Völlig erschöpft jammerte sie: „Was, wenn ich hinuntergefallen wäre?“ „Du wärst nicht hinuntergefallen“, grinste Stepan. „Ich wollte dich nur lehren, dass du auf dem Pferderücken nicht träumen darfst. Pferde sind Fluchttiere. Sobald du die Kontrolle über deine Gefühle verlierst, verlierst du die Kontrolle über dein Pferd. Ekstase hin oder her: wachbleiben musst du, vorausschauend reiten. Du vertraust zwar der Gutwilligkeit des Pferds. Doch vor allem muss das Pferd deiner Führung vertrauen. Ihr müsst ein Team sein. Es braucht den Einsatz von euch beiden.“ Stepan half Lilia vom Pferd. Als ihre Füße den Boden berührten, sank sie in die Knie, als sei sie seekrank. Stepan lachte sich krumm, nahm die Zügel an sich und schwang sich selbst auf Alexas Rücken. In den Bügeln stehend preschte er mit schiefem Becken hoch aufgerichtet über die Wiese. Erdbrocken flogen durch die Luft. „Hoi, hoi, hoi“, jauchzte Stepan. Reiter und Tier genossen einander, als seien sie zu einem Wesen zusammengewachsen. Wären Funken gestoben und hätten Stepans flatternde Mähne entflammt, es hätte Lilia nicht erstaunt. Beim Absteigen verzog Stepan das Gesicht und seufzte verstohlen. Dann brach erneut Gelächter aus ihm hervor. Wie ein übermütiger Bub fiel er Lilia um den Hals und schmetterte: „Du kommst schon noch auf den Geschmack: dafür sorge ich!“
Schon am Abend stellte Lilia fest, dass ihr sämtliche Knochen wehtaten, als sei sie von einer Klippe gestürzt. Sie kroch ins Bett. Das Entsetzen über die Bodenlosigkeit des Schmerzes, der sie schon seit langem peinigte, sich seit einiger Zeit fast täglich meldete und sich zur Hintergrundmusik ihres Lebens formte, machte sie noch steifer. Sie versuchte, normal zu atmen, obschon ihr das Atmen so anstrengend erschien, als verrichte sie Männerarbeit. Jeder Atemzug verlangte Entscheidung, fühlte sich an wie ein Ringen. Mali schnarchte neben ihr. Dennoch hockte das Alleinsein wie ein heimtückisches Biest auf Lilias Brust, das nur darauf lauerte, sie verrecken zu sehen. Solchen Augenblicken des Herausgehobenseins aus der Zeit, des Zerstiebens in zahllose Einzelteile wie eine Maschine, die geschreddert wird, begegnete Lilia öfter. Entweder riefen die Schmerzen die Augenblicke hervor, oder die Augenblicke die Schmerzen. Lilia wusste es nicht. Sie stocherte im Dunkeln, rang nach Klarheit, nach Verstehen und sah sich doch nur mit Hilflosigkeit konfrontiert. Es würde Stunden dauern, vielleicht die ganze Nacht, ehe das Biest einnickte und, von ihrer Brust hinuntergleitend, sich von ihr abwandte. Woher es kam, wer es ihr schickte, blieb Lilia ein Rätsel.
Lilia rief im Büro an und meldete sich krank. Abwechslung neutralisierte den Alptraum zwar. Doch dafür hätte sie einen Schritt von sich weg, über sich hinaus erkennen müssen. Und das war an diesem Morgen nicht der Fall. Wie ausgesetzt vor der geschlossenen Kirchentür, starrte sie dem werdenden Tag ins verzerrte Gesicht. Ohnmächtig zu handeln. Ohnmächtig, sich in den Griff zu kriegen. Erst gegen Mittag legte sich die Qual. Lilia fühlte sich verdreckt, als sei sie in Jauche gefallen. Sie duschte. Mali brauchte Auslauf. Lilia rannte mit ihr den Fluss entlang, keuchend und gehetzt – bis die Augen sie packten, wie vor Pierre-Louis‘ Beerdigung, die Hexenaugen des Wolfstiers, dessen Blick nicht wankte, sie stoppte und aufrichtete.
Zurück in ihrer Wohnung setzte sich Lilia zum Schreiben hin, nun, da sie wieder klar sah. Darüber was sie beschreiben wollte, machte sie sich keine Gedanken. Sie betrachtete das leere Blatt das, eingespannt in die neue, elektrische Kugelkopfmaschine, im schmalen Kegel der Schreibtischlampe blinkte. Lilia wurde sich des Privilegs bewusst, schreiben zu können, wonach ihr der Sinn stand. Sie war die Meisterin ihres Texts: von A bis Z. Was immer sie erzählte - vorerst einmal nur sich selbst – irgendwo, irgendwann hatte es sich zugetragen, auf irgendeiner Ebene, in irgendeiner Form. Reines, Unangetastetes gab es nicht. Maßlos viele Spuren Hindurchgegangener führten aus allen Richtungen in alle Richtungen darüber hinweg. Ihr schien, Leben beginne stets neu, mit jedem Morgen, jedem Augenblick, und gleichzeitig, als bewege es sich keinen Deut. Lilia fragte sich: „Kommen die Gedanken auf mich zu, oder gehe ich ihnen entgegen?“
Lilia legte die Finger auf die Tasten und erlaubte ihnen, Sätze niederzuschreiben ohne Kontrolle. Sie las sie nicht durch, korrigierte sie nicht. Sie ließ sie geschehen. Das Zimmer bevölkerte sich mit Gestalten, mit Augen schwarz und ohne zu zwinkern. Wie Wächter. Wartende auf einen Zug. Feines Wehen. Angenehm warm. Duftend nach gemähtem Gras. Nein: behutsamer. Nicht so irdisch versifft. Duft des Erinnerns. Inneren Wissens um schon einmal Gewesenes. Die Blicke folgten Lilias Blick. Unentwegt. Ein Erschauern wie Hauch durch Blätter im Frühling. Alle sie Betrachtenden kannten Lilia. Ohne dass sie selbst einander wahrzunehmen schienen. Oder waren sie alle nur eine? Spiegel über Spiegel ihrer selbst? Ein Kabinett von Spiegeln? In das sich Lilia verirrte?
Da! Eines der Wesen hob die Hand. Nebelhaft schob es sich durch die Reihen der anderen. Schwebend, ohne Widerstand. Vor Lilia hielt es still. Undurchsichtig der Blick. Ohne Gefühl. Kein Lächeln. Keine Trauer. Keine Regung irgendwelcher Art. Es drang zu Lilia durch. Erbarmungslos. Und alles drumherum erlosch. Lilia war allein mit ihm. Sorgsam diffundierte das Wesen in Lilia hinein. Schmerzlos. Herzklein. Es blies in Glut. Und entfachte Feuer in Lilias Brust. Der Ausdruck von Lilias Augen wechselte zu goldenem Grün. Ein Lächeln kräuselte Lilias Lippen. Kroch in ihren Körper, ihre Glieder. Sie legte die Hände darauf. Und ihr war, sie streichle Fell, dichtes, kühles Fell.
Kaum hatte Lilia die Maschine abgestellt und das Blatt herausgezogen, gellte hässlich das Telefon. Igor erkundigte sich nach ihrem Wohlergehen. Misstrauen und unterdrückten Groll in der Stimme, die sich umsonst zu beherrschen und zu beruhigen suchte. Lilia schob den Hörer vom Ohr weg, ging in Deckung. Unversehens griff Igor an. „Warum hast du mir nicht gesagt, dass Stepan dir Reitunterricht gibt? Warum hast du nicht mich gefragt? Ist Stepan dir wichtiger als ich?“ Hieb um Hieb peitschten Fragen und Anschuldigungen auf Lilia ein, ließen sie schrumpfen wie einen Ballon, aus dem die Luft entweicht. Ein Teil in ihr wehrte sich gegen die Zumutung, angebrüllt zu werden. Ein anderer fühlte sich zutiefst schuldig. Ein dritter gäbe Igor wütend gerne einen Tritt in den Hintern und ein paar gesalzene Ohrfeigen. Und ein vierter verkröche sich am liebsten in ein Mauseloch. - Welchem sollte sie folgen?
Ehe Lilia noch zu einem Ergebnis kam, hängte Igor auf. Das Telefon antwortete mit ödem Gedröhn, als verhöhne es Lilias Willenlosigkeit. In Lilia kochte der Zorn – zu spät. Sie schmiss ein paar Bücher gegen die Wand, was nichts bewirkte, ihr Versagen nur noch unterstrich und sackte auf ihrem Stuhl zusammen, die Stirn auf der Platte, die Arme kraftlos an sich hinunterhängend. Schüchternes Lecken an ihrer Hand ließ sie sich aufrichten. Lilia rutschte zu Mali auf den Teppich. Mali, die Pfoten auf Lilias Schultern, knuffte sie, bis Lilia hintüberkippte. Mali fläzte sich auf Lilias Bauch, die kurz nach Luft rang. Mali japste, knurrte, fiepte wie ein Welpe. Lilia brach in Gelächter aus. Sie rollten zusammen über den Teppich, bis Malis Ausgelassenheit den Höhepunkt erreichte, an dem sie in Grobheit überzuschwappen drohte. Lilia gebot Malis Wildheit Einhalt. Und nach einigen zusätzlichen Hopsern gehorchte Mali, kuschte, die Augen immer noch irrlichternd vor Schalk. Momente, die in Lilia Glück entfachten wie Raketen, die zischend den Nachthimmel durchstechen, bevor sie explodieren. Igors Ausbruch zerstob wie widerwärtiger Gestank.

9. Das Drehen der Derwische
Viele Donnerstagabende waren ins Land gegangen, seitdem Lilia von ihrem Lehrer in die Welt des Sufismus initiiert worden war. Sie hatte sich den täglichen Zikr, das muslimische Gebet, zur Gewohnheit gemacht, ebenso wie die verschiedenen anderen mentalen und physischen Übungen, die ihr aufgegeben worden waren. Es kostete sie nichts, den Anweisungen ihres Lehrers zu folgen. Sie tat es von sich aus. Denn kontrolliert wurde sie nicht.
Woche für Woche erhielten die Mitglieder der Gruppe zudem ein diesbezügliches Thema, zu dem sie sich schriftlich äußern sollten. Die Blätter wurden vom Lehrer durchgesehen. Und hin und wieder bat er jemanden, seine Stellungnahme in der Gruppe vorzutragen. Lilia war oft dran mit dem Vorlesen. Es kam auch vor, dass der Lehrer sie am Ende des Abends beiseite nahm, sie auf Details in ihrer Arbeit hinwies, anregte, sie möge sie noch einmal überdenken, tiefer hineintauchen, klarer herausarbeiten, was sie sagen wolle. Er meinte, sie sei prädestiniert dafür, sich vor Publikum zu äußern, Menschen anzuleiten. Sie müsse sich nur getrauen, zu dem was sie zu sagen habe zu stehen. Ihre Sichtweise sei richtig, präzise, und sie könne Wichtiges auf den Punkt bringen. Hinweise, die Balsam in Lilias Gemüt träufelten, es wie Sprudel zum Schäumen brachten.
Der Herbst färbte die Landschaft. Der Erde entströmten striemige Nebelfetzen, umhüllten liebkosend Stämme, Sträucher und Gräser. Der Fluss dünstete kristallene Kühle aus: weißlich schimmernde Abende, durchglüht von Gold, von Rot und dunklem Violett. Sonnenstrahlen stahlen sich zwischen Ästen hindurch, projizierten vibrierende Inseln ins Moos. Es roch nach Moder, nach Pilzen. Morsche Nadeln, sterbendes Geäst knarzten unter jedem Tritt. Erleuchtete Fenster schürten die Sehnsucht nach Rückzug, nach Wärme. Geruch trocknender Schuhe und Kappen. Ein Zögern hing in der Luft: Nur nicht zu lange unterwegs sein. Die Nacht schnappte mit jedem Tag früher zu, verschlang Licht, Farben und Konturen im Handumdrehen. Hurtig die Schritte. Drängend der Wunsch. Ein Aufatmen, wenn die Türe hinter einem ins Schloss fiel.
Lilia meldete sich zum „Semazen-Training“ an, dem die traditionelle Zeremonie des Drehens der Derwische kurz vor den christlichen Festtagen folgen würde. Auf Anregung des Lehrers sollte ein Großanlass daraus werden.
Ein Saal wurde angemietet. Lilia übernahm es, die Dekorationen zu liefern – und bereute bald, sich so weit vorgewagt zu haben. Ihr Vorschlag, die Säulen des Saals mit Tannenzweigen und roten Bändern zu schmücken stieß auf wenig Gegenliebe. Sie solle sich überlegen, welcher Tradition die Zeremonie entstamme, meinte der Lehrer freundlich, und sich Entsprechendes einfallen lassen. Sie besprach sich mit den ihr zugewiesenen Helfern und blieb zuletzt allein mit der Ausführung ihrer Idee, da sie nicht in der Großstadt wohnte.
Büchern entnahm sie zu Ornamenten gefügte „Namen Gottes“, die sie der Länge nach aneinanderreihte, wie Bänder. Ein Vorschlag, der Begeisterung auslöste, und Lilia mit der Tatsache konfrontierte, dass Arbeit und ziemliche Kosten auf sie zukommen würden. Der Saal war groß. Ein professionelles Kamerateam sollte ein vertriebstaugliches Video der Veranstaltung herstellen. Also brauchte es potente Versatzstücke, die den Raum, das abgesteckte Rechteck, in dem die Semazen drehten, wie Arme umschlössen und machtvoll zusammenhielten. Lilia engagierte einen Schreiner, der die Tafeln lieferte. Darauf wurden die, in leuchtendem Rot gedruckten Fahnen mit den Namen Gottes geklebt. Und Lilia verarbeitete massenhaft Alufolie, lindengrünes und rotes Klebeband, um in stundenlanger Arbeit den glitzernden, in traditionellen Farben gehaltenen Rahmen darum herum zu gestalten. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Igor lieh Lilia einen Lieferwagen, um die schweren, fast einen Meter breiten und drei Meter langen Tafeln samt Leiter und Werkzeug zu transportieren. Sich die Show selbst anzusehen, scheute er sich.
Um drei Uhr morgens fuhr Lilia los. Die Straßen waren autoleer. In Lilias Blut sirrte Erwartung. Sie summte vor sich hin: - als sie plötzlich einen Stopp riss. Wie ein Pfeil schoss es rot unter ihr übers Pflaster. Lilia stieg zitternd aus. Nichts war zu sehen. Der Fuchs hatte es zwischen den Vorder- und den Hinterrädern hindurchgeschafft. Lilia goss sich, Dank murmelnd, Tee ein aus der Thermosflasche, spülte sich die Kehle frei. Wach und klar startete sie zur Weiterfahrt. Kein weiterer Zwischenfall folgte. Die Tafeln kamen heil an. Ein üppiges türkisches Frühstück empfing sie. Um sechs Uhr begann der Aufbau der Tribünen für die Zuschauer, die aus Deutschland, England, den Staaten und dem Vorderen Orient eintreffen würden. Mit ihren Helfern hievte Lilia die Tafeln an Drähten an den Innenseiten der Säulen hoch. Kraftvoll und professionell umspannten sie den Raum. Lilias Mühe hatte sich gelohnt.
Das Studium des „Sufismus“, die Sichtweise des Islams in ihr Leben einzuschleusen, fand Lilia anstrengend. Der Faktor Zeit machte es anstrengend. Alles ging sehr schnell. Druck auszuüben schien von Bedeutung zu sein. Der Scheich beherrschte die Arbeit mit Energie, mit Spannung und Entspannung perfekt. Wie ein Dirigent baute er Extreme auf. Schuf Dissonanzen. Peitschte die Tempi voran wie ausgelassene Pferde. Mit nichts als sich selbst, mit dem, was er sagte, wie er es sagte, wann er was betonte, anderes in der Schwebe ließ. Er war ein Manipulator, ein Kanalisierer erster Güte. Fasziniert schaute Lilia seinem Taktieren zu. Dem plötzlichen Innehalten, auf eine flaumige Ebene Wechseln, die irgendjemandem in der Runde unversehens den Boden unter den Füssen wegriss, sodass Widerstände in ihm zusammenbrachen. Angestautes sich zeigte, nie berücksichtigtes Leiden. Dann fing der Lehrer ihn auf und leitete ihn durch eine Art von Geburtsprozess hindurch, mit einer Hingabe, die sprachlos machte. Der Lehrer verfügte über tausende von Registern, die er nach Bedarf ziehen konnte. Sein Blick blieb stets scharf wie der eines Adlers. Auch wenn er, tränenschimmernd, jemanden in seinem neuen Leben willkommen hieß. Es liefen Prozesse ab, die die Betreffenden erschöpften. Ihre Gesichter jäh veränderten. Krankheiten heilten und anstelle von Hass und Angst Hoffnung säten. Die Menschen blieben sich gleich. Einzig ihr Erfahrungsradius veränderte sich. Sie sahen Leben in frischem Licht. Verloren die Scham über ihr Sosein. Über ihre scheinbaren Fehler und Mängel.
Auch Lilia durchlief solche Prozesse. Was sie dabei am meisten erstaunte war, dass der Scheich den Finger stets auf den richtigen Punkt legte, Sätze verwendete, die ihr Vater und die Mutter exakt gleich gegen sie ins Feld geführt hatten. Er kannte das umfassende Vokabular menschlichen Leidens in erschütternder Weise. Selbst dasjenige, das auf Flüchtlinge, Gefolterte oder tödlich Erkrankte passte. Er kannte Leben in Schattierungen, die in sich zuzulassen Lilia aus eigener Kraft sich gescheut hätte. Erziehung fand statt, Erziehung, die sie nicht demütigte, keine Schuldgefühle schürte, und gegen die sie sich nicht kratzbürstig zur Wehr setzten musste. Obwohl physische Nähe dabei im Spiel war, trat der Lehrer ihr nicht nahe. Er blieb in sich selbst. Eine Haltung, die Lilia bei Papa Moritz beobachtet hatte, bei ihrem Yogameister und seiner Mitarbeiterin – und sogar bei Mademoiselle Zellweger, die Lilia gerade deswegen im Institut zu Höchstleistungen angespornt hatte.
Lilia entspannte sich wie eine Katze, deren gesträubtes Fell eine lindernde Hand glattstreicht. Dass der Lehrer nichts von ihr erwartete, sich ihr nicht aufdrängte, sondern ihre Privatsphäre unangetastet ließ, weckte in Lilia Leichtigkeit, als sei sie einem Jungbrunnen entstiegen. Lilia stand alles frei: das Rezitieren des Zikr, das Drehen, das Verfassen von Beiträgen. Das machte das Dranbleiben einfach. Sie übte aus eigenem Ansporn. Sie übte mit oder ohne Kopftuch, das sie sich lose, wie einen Schleier über das Haar warf und dabei feststellte, dass sie sich darunter geborgener fühlte, mehr bei sich. Der Lehrer ermunterte die Gruppe, mit den Aufgaben zu experimentieren, in gemeinsamen Gesprächen Erfahrungen zu teilen. Lilia war weit davon entfernt, sich deswegen als Muslima zu sehen.
Ein Türke war der Scheich nicht. Auch nicht Muslim, der fünfmal am Tag betete. Er entstammte einer Adelsfamilie aus dem Westen, konnte weder Arabisch, noch Persisch, noch Türkisch. Nur die für sein Amt notwendigen Gebete und Rezitationen beherrschte er. Fremdsprachen waren nicht sein Ding. Das Selbstverständnis seiner Herkunft machte sie überflüssig: Anzupassen hatten sich die anderen: die aus der Welt des Bürgerlichen, die nicht, wie er, auf dem millionenschweren Polster einer Brauereidynastie geboren worden waren. Er durchlief die Vergewaltigungen und Demütigungen der Eliteschulen, ging zur Universität, sprang ab, schummelte sich durch diverse Anstellungen, bis er sich die Hörner genug abgestoßen hatte, um Verantwortung zu übernehmen. Er sollte lernen, den Familienbetrieb zu leiten, was er auch gutwillig versuchte, jedoch ohne Erfolg. Er besaß weder die Beständigkeit, noch den Fleiß, noch den Willen, sich althergebrachten Regeln und Sitten anzupassen. Das Verlogene, Falsche dahinter brachte ihn schier um den Verstand. Die Zeiten während denen er sich plan- und willenlos durch Partys, Yachtausflüge, Jagdgesellschaften, Liebeleien und Casinos hatte treiben lassen, waren vorüber, das wusste er. Nur, die einzuschlagende Richtung sah er nicht. Er dachte nach und kam zum Schluss, dass er nicht unterstützen könne, was, wie er sagte, einst auf dem Rücken von Sklaven erwirtschaftet worden sei.
Er haute ab und wurde enterbt. Ihm blieben ein bisschen Erspartes, eine Trommel und seine Gitarre. Die Vorrechte seiner Herkunft wurden ihm aberkannt. Er landete in einer Kellerwohnung aus zwei Gelassen, von deren Wänden der Putz bröckelte: Zog um sein Bett, um die Kakerlaken fernzuhalten einen Ring von DDT. Schmollte. Siechte dahin und tat sich über die Massen leid. Stundenlang trommelte er sich seinen Schmerz, Enttäuschung und Wut aus dem Leib. Bis es irgendwann genügte
Ein paar wenige aus seinem Freundeskreis waren ihm treu geblieben und folgten ihm . Denn „Woodstock“ stand an. Wer konnte, reiste hin. Auch Lilias Lehrer. Wieder zurück, zog er eine Band auf, mit der er in Kneipen und In-Lokalen zu Geburtstagen und Familienfesten aufspielte. Auftritte, die ihm erlaubten, sich hie und da satt zu essen. Die Wehmut ersäufte er in Alkohol. Er führte ein wüstes, himmeltrauriges, rast- und zielloses Leben. Irgendwann wurde die Band von irgendwem entdeckt. Es folgten gezielte Auftritte in Cabarets, zusammen mit Rollschuhartisten, Schlangenbeschwörern, Feuerkünstlern, Affenbändigern. Er lernte Prostituierte kennen, Drogendealer. Das Bewusstsein seiner Herkunft rettete ihn vor allzu unvernünftigen Abstürzen. Und er lernte, dankbar zu sein für das Kaleidoskop an Lebenssituationen jeglicher Art, das vor seinen Augen ablief und ihn zwar vereinnahmte, jedoch nicht so sehr dass er darob den klaren Blick verlor.
Seine physische Schönheit, das rötliche Kraushaar, das im Scheinwerferlicht wie ein Heiligenschein seine Schläfen umflorte und die schmelzende Weichheit seiner Stimme brachten der Band Erfolge ein. Über Nacht wurde sie zum gefragten Act. Eine steile Karriere erfasste sie, schwemmte sie nach Amerika, von Konzert zu Konzert. Die Plattenindustrie schnappte nach ihr. Preise ereilten sie. Drei Jahre später war sie ausgeblutet, ausgelutscht, erschöpft – zerfiel - und Lilias Lehrer sah sich erneut dem Nichts gegenüber. Die Gagen waren verprasst.
Er verlegte sich auf den Handel mit antiken Manuskripten, vermittelte an Leute seines Standes kostbare Bücher zu unerschwinglichen Preisen – falls er Lust dazu hatte - oder trieb sich in Gassen und Buchhandlungen herum, stöbernd, forschend, sich nach einer Zukunft sehnend, die Sinn machte. Dabei traf er auf seinen zukünftigen Lehrer, einen Türken, ebenfalls nobler Herkunft, einen Patriarchen von massigem Körperbau mit Adlernase und durchdringendem Blick. Sie wechselten ein paar Worte. Der Türke lud ihn zu einer Zusammenkunft ein. Und Lilias Lehrer ging hin. Zu verlieren hatte er nichts. Als Folge davon unterzog er sich einer erbarmungslosen Umbildung in jeder Hinsicht.
Medial veranlagt, wie er war, und gleichzeitig ausgestattet mit ausgezeichneten Führungsqualitäten, ermöglichte ihm die Arbeit mit seinem Lehrer, sich selbst und sein Leben - sowie die Natur von Leben überhaupt - auf Ebenen zu erfahren, die sein Wesen erdeten. Sein Verantwortungsbewusstsein festigten. Und ihn dazu befähigten, in sich und in anderen das Bewusstsein für Transzendenz zu schüren und zu fördern.
Nach Jahren der Zusammenarbeit mit seinem Lehrer erhielt er von ihm den Auftrag, das „Drehen der Derwische“ in den Westen zu bringen. Er wurde in die Staaten und nach Kanada beordert, wo er mittellos, nur mit einem Koffer in der Hand und ohne jemanden zu kennen begann, Zentren aufzubauen. Die Unmittelbarkeit seiner Ausstrahlung. Sein gewinnendes Wesen. Sein Gesang. Seine Mission öffnete ihm eine Türe nach der anderen. Er hungerte, quälte sich durch Perioden bitterster Einsamkeit und Verzweiflung, wuchs daran. Menschen jeglicher Herkunft schlossen sich ihm an, zogen begeistert Projekt um Projekt mit ihm auf. Er hatte etwas von einem Rattenfänger, mit dem Unterschied, dass er sich durch erschütternde Lauterkeit auszeichnete. Er war naiv. Von tiefer Gläubigkeit beseelt. Jungenhaft. Verspielt. Doch biss auf Granit, wer ihn von einem seiner Vorhaben abbringen wollte. Er zog sie gnadenlos durch. Spornte die Leute zu Höchstleistungen an. Überforderte sie hemmungslos. Kaum einer, der ihm folgte, fand, es habe sich für ihn nicht gelohnt, er habe nicht Wertvolles gewonnen: An Einsicht, an Kraft, an Liebesfähigkeit. Manche nannten ihn einen Besessenen, hassten seine Unerschütterlichkeit, seine Verbissenheit. Doch Wenige wandten sich von ihm ab. Was er ihnen anbot hatte zu sehr Hand und Fuß. Und dass er sich selbst nie schonte, machte ihn in einem Maß vertrauenerweckend, das kaum jemanden kalt ließ. Als Lilia ihn kennenlernte, brannte das Feuer noch ebenso in ihm, war seine Kraft ungebrochen, auch wenn er um Jahrzehnte älter geworden war.
Lilias Beziehung zu Igor vertiefte sich. Sie tat nichts dafür und nichts dagegen. Sie schaute zu, interessiert, neugierig und auch betroffen. Stellte fest, dass Igor ihr je länger desto weniger gleichgültig wurde. Und das beunruhigte sie. Sie stellte Sorge in sich fest. Vor allem sorgte sie sich um sich selbst. Igor glaubte sie sein Engagement ihr gegenüber nur bedingt. Er meinte, er stehe an einem Wendepunkt in seinem Leben. Verschiedenes stimme nicht mehr. Er leide oft an Depressionen, fühle, dass etwas fehle, etwas Grundlegendes, das er nicht zu fassen kriege. Lilia erzählte ihm bruchstückhaft von der Arbeit mit dem Scheich. Igor hörte zu, hakte nach, zeigte sich verwirrt darüber, dass sie sich ausgerechnet dem Islam zugewandt habe, betonte erneut, er habe mit Religion nichts am Hut. Lilia versuchte ihm zu erklären, sie habe sich gar nichts zugewandt. Sie verfolge einfach ihren Weg und benutze dafür die Werkzeuge, die sich ihr anböten. Doch genau damit traf sie einen wunden Punkt in Igor. Warum das Leben ihr als Werkzeug nicht genüge, fragte Igor irritiert. Er überlege sich doch auch vieles. Dafür brauche er keinen Fremden, der ihn anleite. Lilia versuchte aufzuzeigen, es gebe verschiedene Ebenen sich für etwas zu verpflichten.
Das Eis war dünn, auf dem sich diese Gespräche bewegten. Es konnte einbrechen. Für Lilia war das weniger ein Problem als für Igor. Lilia war daran gewöhnt Risiken einzugehen. Igor nicht. Bei ihm stellte sich rasch die Frage nach Bevormundung, nach Einmischung in Intimstes. Für Lilia war Religionszugehörigkeit ein Instrument, ein Wegweiser, der rot, grün oder sogar schwarz sein konnte: Für Igor dagegen galt einzig persönliche Souveränität. Jede Form von Abhängigkeit war ihm zuwider. Er konnte nicht glauben, dass Lilia sich frei fühle in ihrer Arbeit mit dem fremdländischen Scheich. Doch ließ er Lilia gewähren, legte ihr keine Steine in den Weg. Ein paarmal ging er zu Festlichkeiten mit. Den Lehrer fand er sympathisch, war erstaunt über die Normalität, die Ungezwungenheit in der Gruppe, die überraschend an Mitgliedern zunahm. Die Bücher des Scheichs fanden faszinierte Leser. Igor konnte damit nichts anfangen. Und Lilia war das recht. Dass Igor sich nicht zum Mitmachen entschied, kam ihr gelegen.
Igor gab sich dafür Mühe, einen Grundstock an Erinnerungsmustern für sich und Lilia aufzubauen: Wie eine Art von Kitt um sie aneinanderzukleben, leicht und doch dauerhaft. Er schlug Lilia vor, sie könnten den Dachstock der Scheune, die ans Haupthaus des Reitzentrums grenze, in eine gemeinsame Wohnung verwandeln, eine zweistöckige, mit separaten Zimmern für Lilia. Lilia horchte auf. Ihr Herz schlug hoch beim Gedanken, Neues zu gestalten. Sie verbrachte mit Igor sonnenschwere Tage in der Südschweiz, auf dem See, in einem angemieteten Motorboot - und schweigend am Kaminfeuer in ihrem Rustico. Wenn sie durchs Städtchen gegenüber zogen, die Darbietungen der Jazzformationen aus aller Welt genossen, mittanzten. Oder Igor, an eine Hauswand gelehnt, Lilia vor seinem Bauch, die Arme um ihre Taille geschlungen, sie vor Anrempelungen der Menschenmassen schützte, die an ihnen vorüberbrandeten, klatschend, johlend, in nicht endenden Fluten von Leibern, Gerüchen und Sprachen. Dann fühlte sich Lilia angekommen. Sie standen da wie ein Fels in der Brandung, still, mit sich allein, unverwundbar. Für Lilia ein Erlebnis, das sie nie vergaß. Nicht zuletzt deswegen willigte sie in Igors Vorschlag ein, mit ihm zusammenzuziehen.
Lilia spürte, wie die Arbeit mit dem Scheich sich in ihr niederschlug. Gedankengänge, die sie früher nicht gedacht hätte, erschienen ihr plötzlich als normal. Ihr Weltbild dehnte sich aus. Eine Reise in die Türkei wurde geplant. Fünfunddreißig Teilnehmer fanden sich am Flughafen ein. Es sollte eine Pilgerreise werden, mit Besuchen bei verschiedenen Scheichs sowie bei der Witwe des Lehrers von Lilias Scheich. An wichtigen Grabstätten sollte gebetet werden. Und auch ein bisschen Freizeit war vorgesehen.
Lilia hatte noch nie ein muslimisches Land besucht. Als am ersten Tag ein Muezzin nach dem anderen von den Minaretten der Stadt herunter das Morgengebet intonierte, fiel Lilia vor Schreck fast aus dem Bett. Ein Stimmengrollen, als spielten Dutzende von Orgeln, echote über den Dächern. Dabei war es noch fast dunkel.
Nach dem Frühstück, Stunden später, entrollte sich ein straffer Zeitplan. In einem Teppichgeschäft hieß sie Scheich sowieso willkommen und bewirtete sie mit Lammfleischfladen und zuckersüßem Pfefferminztee. Man saß mit untergeschlagenen Beinen auf Teppichen, um große Tücher herum, auf denen das Essen serviert wurde. Dann ging es durch die Straße der Goldschmiede, in der jedes noch so kleine Schaufenster, vollgestopft mit Schmuck, rotgolden auftrumpfte wie erleuchtet - - zur ersten Moschee, zur zweiten, zum Grabmal eines berühmten Sufi-Heiligen aus früheren Jahrhunderten, zum Essen auf dem Land, mit in kleinen Öfen frisch zubereiteten Fladenbroten, gefüllt mit Gemüsen. Weiter mit dem Bus durch wirbelnden Staub über holprige Wege zu einem nächsten Grab, in eine nächste Moschee und einem abschließenden Besuch in einer Tekke, einem Sufi-Zentrum - bevor alle halbtot in ihre Betten fielen. Dass die Duschvorhänge still vor sich hinschimmelten, nur kaltes Wasser zur Verfügung stand und die Bettvorleger mottenzerfressen waren, nahm kaum mehr jemand wahr.
Alle Orte, die während den folgenden zehn Tagen abgehakt wurden, stellten Stationen auf dem Werdegang von Lilias Scheich dar. Nur drei der Teilnehmer hatten muslimische Wurzeln. Die übrigen überschwemmte eine Flut von Farben, tierischen, menschlichen und anderen atemberaubenden Düften, von kehligem Stimmengewirr, Staub ohne Ende. Von brennenden Sonnentagen in ehrfurchtgebietenden Steinwüsten antiker Stätten: Von halbfertigen Sarkophagen früherer Zivilisationen aus der Werkstatt eines Steinmetzen, der, aus welchem Grund auch immer, an ihrer Fertigstellung gehindert worden war. Eine Reise, die in Lilia die Beobachtung keimen ließ, auch Ruinenstätten seien einfach Steinhaufen, von Menschen angehäuft, von Menschen zerschlagen, weiterverwendet, Jahrhunderte um Jahrhunderte, Steine bar der Bedeutung, geheiligt nur durch auf sie projizierte Vorstellungen ihrer Entdecker.
Der Besuch der Witwe des Scheichs von Lilias Lehrer bildete den Höhepunkt der Reise. Die Gäste trafen auf eine stattliche Frau, die, müde geworden von Alter und Beschwernis auf einem verschnörkelten, mit farbigen Tüchern bedeckten Sofa saß. Von Kissen gestützt. Die geschwollenen Füße auf einem Schemel. Die langfingrigen, elfenbeinernen Hände im Schoss gefaltet. Ein blaues Kopftuch über dem Scheitel, das ihr weißes Haar metallisch glänzen ließ. Wie eine Madonna. Mit weiten, geduldigen, in Mitgefühl zerfließenden Augen, die den, der in sie hineinschaute, dünnhäutig machten. Sein Innerstes nach außen kehrte. Und Scham und Schmerz aus seinem Herzen wischten.
Lilia und ihre Mitreisenden waren in Gruppen eingeteilt worden. Nicht alle hätten auf einmal im Besuchszimmer Platz gefunden. Immer nur ein paar wenige wurden hineingeführt, knieten steif auf dem Boden. Zu sprechen wagte niemand. Was sollte zu einem Menschen, der sich im Lichten zwischen Leben und Sterben befand, auch gesagt werden. Die Bedürftigen waren die Besucher, nicht die Witwe. Geballtes strahlte aus ihr, mit einer Macht, als befinde man sich im Zentrum eines Kraftorts.
Auch Lilias Mutter wurde müder und müder. Lilia besuchte sie regelmäßig. Sie waren miteinander zur Ruhe gekommen. Vielleicht nicht zum Frieden, dafür zum Einverständnis des Zusammengehörens ohne Vorwurf. Das Zimmer von Lilias Mutter hatte keinen Balkon, auf dem ein Bäumchen hätte stehen können. Deshalb kreierte Lilia Jahr für Jahr ein weihnächtliches Gesteck für ihre Mutter, das sich an einem Kleiderhaken an ihrem Schrank aufhängen ließ. Es blieb das einzige, an Weihnachten Erinnernde, das die Mutter in ihrem Zimmer duldete. Beim Neujahrsbesuch entfernte es Lilia und entsorgte es im Abfalleimer vor dem Haus.
Die Mutter bewunderte Lilias Geschicklichkeit, ihren Einfallsreichtum, so wie man den Fleiß eines Nachbarkindes bewundert. Lilia störte das nicht. Sie war froh darüber und dankbar dafür, dass sie wenigstens noch diese Rolle im Leben ihrer Mutter spielen durfte. Mehr und mehr verkapselte sich die Mutter in sich selbst. Gespräche mit ihr zerbröselten. Nichts interessierte sie mehr, weder das Weltgeschehen, noch Motorräder, noch noble Karossen. Sie welkte dahin. Nur wenn Igor Lilia begleitete, kitzelte Schalk ihre Züge, erlaubte sich ihr Blick bescheidenen Glanz. Für Igor schwärmte sie wie ein Backfisch, heimlich und verschwiegen. Einzig der Gedanke, zum Pflegefall zu werden, weckte Ängstlichkeit in ihr, die gleiche Scheu vor Nähe, die auch Lilia umtrieb: Die Tatsache des Ausgeliefertseins. Des Behändigtwerdens aus Not, wegen des Unvermögens sich selbst zu helfen: dieses angstvolle Zittern verband sie beide und der tiefsitzende, lautlose Schmerz, den es anrührte.
Die Monate, die ihnen noch blieben, schmiegten sich samten zwischen sie. Sie entglitten einander mühelos. Auch durch die Mithilfe Igors, dem sich die Mutter, Lilias wegen, zu Dank verpflichtet fühlte. Noch am letzten Tag ihres Lebens aß sie im Speisesaal. Nur ihren täglichen Spaziergang an der frischen Luft ließ sie aus. Nach der Abendmahlzeit fand sie sich unwohl. Rastlos. Gehetzt. Nur kurz. Dann legte sie sich hin. Schloss die Augen. Und verschied.
Lilia und Igor erhielten die Nachricht sofort. Am nächsten Morgen fuhren sie zu ihr. Die Mutter lag angekleidet auf dem Bett, die Hände von einem Rosenkranz zusammengehalten. Winzig sah sie aus. Der Körper wie entleert. Elend – Wut – Rachsucht - wie weggewischt: entflohene Gespenster. Lilia weinte vor Freude darüber, dass sie einander noch hatten spüren dürfen, behutsam. Einander noch hatten in den Arm nehmen dürfen. Als die Feindschaft sich verflüchtigte. Liebe glimmte. Und Lilia den Namen „Müeti“ anstelle des „Du“ setzte. Darüber, dass alles noch hatte werden dürfen - und nun leuchtete.
Amtliches war zu erledigen. Lilia erhielt den Pflichtteil, der ihr ermöglichte, im Alter nicht zu verhungern. Und Lilia sah sich dabei, wie jedes Mal, mit der Angst vor Behördenkram konfrontiert. Sie konnte sich so viel Mühe geben, wie sie wollte: Die Lähmung packte sie im Nacken. Wie ein Affe, der ihr die Gurgel zudrückte. Sie verhielt sich gehemmt, stolperte über Schwellen, verhaspelte sich in Wörtern, versuchte geistreich und wohlerzogen zu wirken und benahm sich doch, als könne sie knapp bis drei zählen. Lilia war nie straffällig geworden. Es lag nichts gegen sie vor. Ihr Leumund war tadellos. Dennoch schlug sie einen Bogen um jedes amtlich aussehende Gebäude. Sie fand, es rieche nach Verwahrlosung, Schande und Exil. Die Furcht, im Gefängnis zu laden, trieb ihr den Schweiß aus den Poren: das Erbe ihrer Ahnen. Verwandte der Mutter feindeten Lilia während der Beerdigung wegen ihres Erbteils an, meinten gehässig: „Eigentlich steht dir überhaupt nichts zu. Du gehörst ja nicht zu uns.“ Das Gesicht rot vor Scham, bohrte Lilia die Nägel in ihre Handflächen und schwieg. Bis eine ihrer Cousinen sie durch die Bemerkung erlöste: „Natürlich gehört sie zu uns. Es ist immerhin ihre Mutter, unsere Tante, die wir gerade beerdigt haben.“
Igors Vorhaben, den Giebelbereich der Scheune in eine Wohnung für sich und Lilia umzubauen, nahm Gestalt an. Sein Vater war zufrieden mit dieser Entscheidung. Er begrüßte es, dass Igor von ihm wegrückte, in ein separates Gebäude. Da sie die beiden Höfe gemeinsam bewirtschafteten, und Igor oft unterwegs war, zu Auktionen oder Rennen, war das bis dahin kein Thema gewesen. Das Haupthaus war weitläufig genug. Igor hatte drei Zimmer für sich allein. Wenn er wollte, konnte er den Bewohnern aus dem Weg gehen. Sich unsichtbar machen. Er führte ein eigenständiges Leben. Sein Vater kümmerte sich nicht um seinen Lebenswandel. Igor hatte Freundinnen, ging nach Laust und Laune aus. Er konnte es sich leisten.
Dass Igor sogar einen Sohn hatte, wusste nicht einmal sein Vater. Geschweige denn Lilia. Igor war reserviert oder umgänglich, je nach Laune. Festnageln ließ er sich nicht. Man konnte seiner nie ganz sicher sein. So wie seine über alles geliebten Pferde war auch Igor ein Flüchtender. Lilia vermied es, ihn zu fragen, woher seine Familie stamme. Lilia horchte auch Stepan nicht aus. Vielleicht war er vom Pferd gefallen. Vielleicht unter einen Traktor geraten: Sie fragte nicht. Sowie auch Igor und Stepan sich nicht nach ihrer Vergangenheit erkundigten.
Lilia hatte Glück. Von einer Agentur erhielt sie einen Übersetzerjob. In wenigen Wochen würde sie frei über ihre Zeit verfügen und zuhause arbeiten können. Sie beschloss, ihre Wohnung in der Stadt zu behalten, und sich bei Igor nur einzumieten. Alle Brücken hinter sich abbauen wollte sie nicht. Dafür fühlte sie sich zu alt. Obwohl sie froh darüber war, Igor, der auch in Finanz- und Behördenfragen beschlagen war, an der Hand zu haben. Er meinte verschmitzt, er habe es ihrer Mutter sozusagen versprochen, sie nicht im Stich zu lassen. Eine Aussage, die in Lilia gemischte Gefühle auslöste.
Es gab Tage, an denen Lilia von morgens bis abends auf Flucht sann. Es gab Tage, an denen sie Igors distanzierte Fürsorglichkeit genoss. Und es gab Tage, an denen sie sich von heimlichen Machenschaften umgarnt fühlte, wie von gierigen Schatten. Lud Igor sie zu einem Rennen ein oder zum Essen und warb er um sie mit seinem ungelenken Charme, ließ sie sich ohne Widerstreit um den Finger wickeln. - Sie waren wie zwei Spinnen in benachbarten Netzen, belauerten, beäugten einander. Wiegte sich das eine Netz im Wind, zog es das andere nach. Im selben Netz konnten sie nicht wohnen. Doch sich zu trennen, ginge ebenfalls nicht. Dafür hatten sie schon zu intensiv voneinander gekostet. Sie liebten einander vielleicht nicht in gängiger Weise. Sie brauchten einander vielleicht nur. Doch Hauptsache, sie konnten einander riechen, und ihre Finger passten ineinander. Beide wurden sie leicht sauer. Beide hingen sie gelegentlich emotional durch. Und beide waren sie selbständig genug, um nicht auf Gedeih und Verderb voneinander abhängig zu sein. Vorteile die Lilia gefielen. Manchmal griff sich Lilia an den Kopf und fragte sich, ob sie verrückt geworden sei, sich auf Igor einzulassen. Dann stockte ihr Atem. Ihre Füße baumelten über dem Nichts. Und ihr Herz drohte stillzustehen.
Reiten lernte Lilia weiterhin nur mit Stepan. Er wurde für sie zu mehr als einem Lehrer. Schien vom selben Baum gefallen. Mit demselben Fell bekleidet. Von ähnlichem Duft. Dem gleichen Rudel entstammend wie Lilia. Minenspiel und Blicke genügten ihnen zur Verständigung. Stepan knurrte oder grunzte, um Lilia auf Fehler aufmerksam zu machen, ging mit ihr um wie mit seinen Pferden, direkt und ohne Umschweife, mit liebevoller Derbheit und heiterer Zartheit. Ungekünstelt. Ohne Launen. In seiner Nähe entspannte sich Lilia wie von selbst. Sie waren wie zwei Hände, die sich ineinander verschränken.
Nach der Reitstunde bat Stepan Lilia meistens zum Tee, zu russischem Tee aus einem Samowar, den er aus der Tasse schluckweise in die Untertasse goss, und über ein Stück Zucker in seinen Mund laufen ließ. Stepans Wohnung lag über dem Schafstall und den Boxen, in denen die Hunde schliefen. Die Wohnung bestand aus zwei Zimmern, Küche und Bad. Alle Räume waren bis in den Giebel des Gebäudes hochgezogen. Das alte, unregelmäßige Gebälk pockennarbig, von Schrunden und Kerben zerfurcht. Die Wohnung duftete nach Zirbelholz: Weich, harzig, herb, die Nerven liebkosend und gleichzeitig belebend. Das Wohnzimmer dominierte ein mächtiger, von Stepan selbst gebauter Kamin, dessen Hut alte Biberschwanzziegel schmückten. Davor lag das Fell eines hünenhaften Grizzlybären, nebst einem Stapel Zeitungen, in fremden Lettern geschrieben. Anstatt Stühlen gab es massige Polster, in die man tief einsank. Gerahmte Fotos über einer schmalen Couch zeigten Portraits von Familienmitgliedern. An kühlen Abend entfachte Stepan ein Feuer im Kamin, tischte auf einem glänzend gehobelten Brett Brot, Käse, Wurst und eingemachtes Gemüse auf, Nüsse und Most von den Apfelbäumen des Hofs oder einen Schluck Wein. Er setzte das Brett auf das Fell, baute die Polster zu einem Kreis zusammen, und er und Lilia fläzten sich in das Rund, gestützt und geborgen, aneinandergeschmiegt, wunschlos mit sich allein und doch gemeinsam. Beim ersten Mal hatte Lilia noch geniert geschäkert: „Kitschig wie im Kino.“ Worauf Stepan trocken entgegnete: „Na und, säßest du lieber im Regen?“
Lilia war darauf betont auf Abstand gegangen, auf Stachellänge sozusagen. Doch bald war ihr Widerstand zerbröselt. Stepan lag in den Polstern, schlürfte Wein, knabberte Gemüse und krosses Brot, knackte Nüsse, die Augen geschlossen, das schiefe Gesicht wie beschienen von einem Lächeln, das nicht lockte, nichts suchte, nichts wollte. Lilia breitete sich neben ihm aus, legte den Kopf auf seine Schulter, horchte seinem Herzschlag, der tropfend zerrann, zeitlos und ohne Anspruch. Irgendwann fielen die Scheite funkensprühend ineinander. Stepan legte den Arm um Lilia. Sie dösten vor sich hin. Ein Lamm blökte. Einer der Dackel kläffte. Die Stille zwischen ihnen war so dicht, dass es klang wie der Weckruf eines Hahns.
Lilia fuhr die Landstraße entlang. Der Mond gleißte als Gesicht, das sie fragend musterte. In Lilia purzelten die Gefühle drunter und drüber. Einige kicherten, andere höhnten. Die hintersten maulten: „Schuldig, schuldig.“ In Lilia brannte sachte das Feuer aus Stepans Kamin.
Mit der ihr von Stepan zugewiesenen Stute Alexa zu galoppieren, getraute sich Lilia nicht. Das Traben jedoch ging ordentlich. Sie musste es sanft angehen, sonst schrien tags darauf ihre Knochen und Nerven Alarm. Stepan berührte Lilia an einem Punkt, der unerkannt in ihr geschlummert hatte. Es fiel Licht in Winkel und Schrunden, deren Vorhandensein Lilia aufrüttelte. Stepan schien einer Gattung anzugehören, die in Märchenbüchern vorkam. Manchmal hatte Lilia das Gefühl, sie träume ihn nur, er existiere nicht wirklich. Bis er ein weiteres Mal auf sie zuhumpelte, kollerndes Gelächter in jeder Zelle, ihr aufs Pferd half, sich selbst auf seinen Hengst schwang, als sei er heil von Kopf bis Fuß, seine Ekstase in den Himmel schrie und davonstob, schief und krumm in den Bügeln stehend: Ein diabolischer Clown, Teufel und Gott zugleich. Er trug seine unsäglichen weißen oder farbenfrohen Jockeyanzüge stolz und selbstbewusst. Mangel oder Selbstzweifel schien er nicht zu kennen. Das Herzkleinleuchtende seiner Augen brannte die Trauer aus Lilias Gemüt. Ihr Körper glitt in katzenhafte Leichtigkeit. Und obwohl die Angst vor ihrem Pferd noch nicht ganz gewichen war, gab sie sich dem Rollen seiner Muskeln hin, als habe sie nie anderes getan.
Stepan besaß, worum Lilia immer noch rang: Stepan war weise. Unbekümmert weise und unbekümmert lebendig, trotz seiner Gebrechen. Und er stand Lilia so nah, dass er auch dann nicht von ihrer Seite wich, wenn er mit Igor wegfuhr, und sie einander tagelang nicht sahen. Den Balsam seines Daseins ließ Stepan in Lilia zurück. Und er verbrauchte sich nicht.
Lilia und Stepan ritten schweigend dahin. Zweige zerbarsten unter den Hufen der Pferde, Blätter wischten über ihre Gesichter. Der Geruch von Schnee hing in der Luft. Leises Beißen von Wind strich über ihre Stirnen. Als der Weg sich verbreiterte, trabten sie nebeneinander. Stepan reichte Lilia die Hand. Sie war heiß wie sein Tee und schickte pulsierende Wärme in Lilias Gemüt. Ein Käuzchen rief. Ein Rabe antwortete krächzend. Der sich zum Abend neigende Tag belebte sich. Drei frühe Rehe lugten hinter einer Tanne hervor und querten den Weg ohne Eile. Die Reiter wandten sich heimwärts. Erste Lichter blinkten im Tal. Lilia fror. Stepan, der es bemerkte, gab seinem Hengst die Sporen. Und Alexa folgte ihm kurzerhand. Überraschender Galopp brachte die beiden in die Nähe des Hofs. Lilia klammerte sich schreckgelähmt an Alexas Sattel. Stepan grinste. Die Augenbrauen hochgezogen. Die Zähne gebleckt: nur die rote Pappnase fehlte zum gelungenen Bild.
War sie bei Stepan, ließ Lilia den Tag absichtslos durch ihre Finger gleiten und wunderte sich darüber, wie lang ihn das machte. Mit Igor zusammen wetteiferte sie über Weltanschauliches. Schmiedete Pläne. Stritt sich über Sex und darüber, wieviel der Mensch davon brauche. Und mit Igor zusammen genoss Lilia vor allem das Tanzen. Die flapsige Behändigkeit seiner Beine, und der Swing in seinen Hüften machten es zum Ereignis. Mit Igor spulten sich die Stunden in Windeseile ab. Entwanden sich der Kontrolle. Wurden Igor und Lilia zu Konkurrenten. Mussten sich Geben und Nehmen die Waage halten. Wurden Einsatz und Anstrengung verlangt. Galten sie als Liebespaar. Sie waren gleich alt, hatten ähnliche Grundschulen besucht und unterschieden sich doch in ihren Tätigkeiten und Interessen wie der Tag von der Nacht. Lilia gab sich Mühe, Igors Ansprüchen zu genügen. Sie wusste, sie würde es auf Dauer nicht schaffen. Würde es nicht aushalten, unfallfrei auf den Schienen eines gängigen, gemeinsamen Alltags einherzugleiten, würde früher oder später ihren Beziehungszug zum Entgleisen bringen. Das Zuviel an Nähe würde sie erdrücken. Auch wenn die Angst vor lebenslangem Alleinsein sie dazu zwänge, so lange durchzuhalten, als es irgend ginge.
Unterdessen nahm der Ausbau von Igors Wohnung Gestalt an. Lilia erhielt eine großzügige Einzimmerwohnung mit Schwedenofen und Balkon. Sie machte sich Gedanken darüber, ihr Haus im Süden zu verkaufen. Igor und Lilia hatten es ein paarmal als Feriendomizil benutzt. Nun stand es die meiste Zeit leer. Lilia hängte ein Schild mit dem Vermerk „Da Vendere“ an die Eingangstüre. Gefühle von Bedauern unterdrückte sie. Mehr als zwei Jahrzehnte lang hatte ihr das Haus gehört. Es hatte Pierre-Louis und Bernd erlebt. Und zuletzt Igor. Es hatte ihr viele Stunden heilsamer und unheilsamer Einsamkeit beschert. Seine Aussicht auf den See und die Berge lag tief eingebrannt in ihrem Inneren. Sie würde sie nie verlieren. Sowenig wie den Geruch von Kastanienholzfeuer und berstenden Marroni. Sie konnte das Haus hergeben, ohne es zu vermissen. Es war zu Ende gelebt.
Als sich kurze Wochen danach ein Interessent meldete, stimmte sie dem Verkauf sofort zu. Igor half ihr mit den Formalitäten. Ein weiteres Stück Gelebtes lag hinter Lilia, sauber geschichtet wie gemähtes Gras. Nach dem Verkauf ging sie mit Igor essen und spülte mit einer Flasche Barolo nach, einem melancholischen, eleganten Wein voller Noblesse, der dem zu Herzen gehenden und doch freudigen Anlass bestens entsprach. Lilia bemerkte an einem leichten Flattern ihres Nervenkostüms, dass sie im Begriff war, sich in Igor zu verlieben. Furcht zitterte ihren Rücken hoch. Doch sie gab ihr keinen Raum. Was nützte es, sich nun noch zu sorgen? Die Würfel rollten. Und sie rollten munter und heiter klappernd übers schimmernde Parkett.
Auch in der Arbeit mit Lilias Sufi-Scheich kündigten sich Veränderungen an. Sie vernahm, dass sich bereits mehrere Leute am Schreiben einer Biographie des Scheichs versucht hatten, doch jedes Mal gescheitert waren. Des Scheichs aufwändigen und ausgefallenen Lebenswandel zwischen die Seiten eines Buches zu bannen, hatte sich als nicht zu bewältigende Herausforderung erwiesen.
Lilia ließ ein paar Tage verstreichen, während denen sie sich zu vergegenwärtigen suchte, mit welchen Schwierigkeiten sie eventuell würde zu kämpfen haben, falls sie sich ebenfalls der Aufgabe stellte. Viel Zeit blieb ihr nicht: Das Risikohafte daran durfte nicht verwässert werden. Kurz entschlossen, musste sie es anpacken. Sonst verpuffte seine Sprengkraft, und sie würde genauso scheitern wie ihre Vorgänger. Sie bat den Scheich um einen Termin und fragte ihn um die Erlaubnis, die Biographie verfassen zu dürfen. Der Scheich lachte schallend und hieb sich auf die Schenkel. „Wenn du wüsstest, wie viele das schon versucht haben“, rief er. „Ich weiß“, entgegnete Lilia, die aufkommende Bangigkeit entschlossen hinunterschluckend: „Ich möchte es dennoch probieren.“ „O.k. – du wirst nach England, Schottland, nach Amerika und nach Kanada fliegen müssen um zu recherchieren.“ Lilia erblasste innerlich. England und Schottland gingen ja noch. Doch Amerika und Kanada? Sie war das Reisen nicht mehr gewohnt. Und Amerika verachtete sie zutiefst. Von Kanada ganz zu schweigen: das lag irgendwo jenseits ihrer Fantasie. Zurückzukrebsen stand allerdings nicht zur Diskussion. Sich einer möglichen Gefahr zu entwinden schon gar nicht. Also schaute sie ihrem Lehrer in die Augen und antwortete: „Einverstanden.“ Sie vereinbarten ein paar erste Interviewtermine. Und Lilia fuhr heim, teils berstend vor Unternehmungslust, teils schlotternd vor Entsetzen. Sie würde jede Menge Städte und Menschen besuchen, sich als versierte Interviewerin ausgeben müssen und darauf vertrauen, dass die Kraft dazu sich mit der Inangriffnahme der Arbeit zeigte.
Ein paar Wochen lang verschwieg Lilia Igor, wofür sie sich verpflichtet hatte. Die Gespräche mit ihrem Lehrer gestalteten sich äußerst spannend. Er ging wohlwollend auf ihre Fragen ein. Auch auf heiklere. Nahm auch kein Blatt vor den Mund, wenn er über seine Herkunft, seine Familie, seine Kindheit sprach. Vor Lilia entfaltete sich eine illustre, wenn auch, bedingt durch ihren eigenen Englandaufenthalt, nicht gänzlich unbekannte Welt. Es berührte sie sehr, zu hören, wie ihr Lehrer sich darin zurechtgefunden und sukzessive die Kraft in sich gesammelt hatte, sich ihrer schließlich zu entledigen. Auch er war immer wieder Menschen begegnet, die ihm ermöglicht hatten, einen Blick hinter Offensichtliches zu werfen: Durch seine Nanny etwa, die ebenfalls einer Zigeunerfamilie entstammte. Oder einen Forstaufseher, der von ihm, dem angehenden Jäger verlangte, ein Kaninchen mit bloßen Händen zu töten, um in ihm Respekt gegenüber den Kreaturen zu wecken. Dafür platzierte er ihn auf der windabgewandten Seite eines Baus. Der Knabe wartete bis ein Kaninchen den Kopf daraus hervorstreckte, packte zu und brach ihm das Genick, bevor das Kaninchen realisierte, wie ihm geschah. Das feuchtwarme, erschlaffte Tier in Händen nahm der Bub die nachfolgende Stille als ein atemloses Standhalten wahr. Ein Schweben jenseits des Herzschlags. Er war sechs Jahre alt.
In der Primarschule dann begann jeder Schultag mit ein paar Übungen im Freien, einem gemeinsamen Gebet und einer Atemklasse, während der die Kinder das Kanalisieren von Energie lernten. Unterweisungen, mit denen er zeit seines Lebens weiterarbeitete. Die ihm zur Meisterschaft im Drehen der Derwische verhalfen. Und die Basis seines Lehrens schlechthin bildeten.
Innert Kürze füllte Lilia ein Heft mit Notizen über schicksalshafte Fügungen und skurrile Begegnungen aus dem Leben ihres Lehrers. Baustein schob sich auf Baustein. Ihre Kugelkopfmaschine bekam haufenweise Futter. Und Lilia steckte mitten im Schreiben, bevor sie überhaupt realisierte, dass sie ein Buch zu verfassen im Begriff war.
Und plötzlich stand das Reisen an. Und Lilia stellte mit Schrecken fest, dass an ein Zurück nicht mehr zu denken war. Sie musste Igor informieren, Telefonanrufe mit wildfremden Menschen führen, ihren Pass verlängern lassen, Geld wechseln, packen, so wenig als möglich und doch genug für eisige Wintertage, denn in Schottland und in Teilen Englands läge Schnee. Begeistert über ihr Ausscheren zeigte sich Igor nicht. Um ihn nicht unnötig zu behelligen, nahm Lilia ein Angebot von Freunden aus der Sufi-Gruppe an. Sie würde nach der Donnerstagabendzusammenkunft bei ihnen übernachten. Und am darauffolgenden Morgen direkt zum Flughafen fahren. Ihre Mission trug Lilia einerseits Sympathien ein, andererseits Neid. Das Übliche. Ein bisschen ragte sie nun obenaus. Man tuschelte über die Beachtung und die Zeit, die der Lehrer ihr schenkte, der es sich im Gegenzug nicht nehmen ließ, Lilia gelegentlich vor der Klasse zurechtzuweisen, oder als Beispiel hinzustellen, zur Wahrung des Gleichgewichts, und auch um Lilias Entschlossenheit zu erproben.
Dass nicht er Lilia zum Flughafen fahren durfte, nahm Igor Lilia übel. Er schmollte. Sie bekam ihn vor ihrer Abreise nicht mehr zu Gesicht.
In Schottland wurde Lilia in dem Zentrum empfangen, das der Scheich ihres Lehrers als letztes aufgebaut hatte, in einem alten verwinkelten Landedelhaus mit Werkstätten, riesigem Holzherd in der Küche und einem Park, der sich über sanft geschwungene Hügel erstreckte, bis hin zu einem, nun halb zugefrorenen See. Auf der zunächst gelegenen Anhöhe befand sich unter einem marmornen, von vier Säulen getragenen Rund, das Grab des Scheichs. Seinem Wunsch entsprechend lag er auf der Seite, das Gesicht dem Haus zugewandt. Zu den Interviews mit Lilia versammelten sich die Bewohner in den beiden, mit anheimelnd verbrauchten Jugendstilmöbeln eingerichteten Räumen des Scheichs, seinem Wohn- und seinem Sterbezimmer.
Nachts fror Lilia erbärmlich in ihrem schmalen altertümlichen Bett. Durchzug hinderte sie am Einschlafen. Das Herrschaftshaus ächzte und stöhnte. Wie Fahnen wehten Schneeschauer vor den Vorfenstern vorüber, gespenstisch in Szene gesetzt durch die zum Grabmal emporstrebenden Laternen. Während sporadischen Schlafsequenzen erschien ihr der Scheich. Seine Hand streckte sich nach ihr aus. Den Kopf leicht angehoben, die eine Hälfte des Gesichts überschattet von seiner scharfkantigen Nase, die andere im Schein des irisierenden Blaus seines Auges, sagte er zu Lilia einen Satz, ein paar Worte nur, die sich wie Male in Lilias Herz brannten, und die sie viele Monate lang wie eine Verheißung durch die Tage trugen. Die Vision war so real, dass Lilia davon überzeugt war, den Scheich wirklich getroffen zu haben.
Am Morgen wurde sie nach einem eventuellen Traum gefragt. Sie erzählte das Vorgefallene, und keiner von den Bewohnern des Hauses war erstaunt darüber. Solche Dinge geschähen andauernd, meinten sie. Habe jemand eine Frage, die ihn umtreibe, steige er zum Grabmal empor. Ja, es reiche sogar, die Frage einfach mit sich herumzutragen. Beantwortet werde sie immer – und zwar genau auf die Art, die Lilia beschrieben habe: So als sei der Scheich noch am Leben.
Und Fragen hatte Lilia zuhauf. Vorab diejenige, was um alles in der Welt sie zu dieser Reise getrieben habe. Was sie hier tue. Wozu das gut sein solle: – einen ganzen Rucksack voller Fragen. Der Rucksack, den sie tatsächlich mit sich schleppte - nebst zwei Gleichschwertaschen mit Kleidung, Toilettenartikeln und dem unvermeidlichen Tonbandgerät - steckte voller Schokolade und Sackmesser, die ihr als Gastgeschenke dienten. Ihren Gastgebern begegnete Lilia zurückhaltend und schüchtern. Bestimmt waren sie durch ihre jahrelange Arbeit mit Lehrern und Meistern wenn nicht ganz, so doch halb erleuchtet, dachte sie. Einige von ihnen senkten ihren Blick nachsichtig in den ihren, bemühten sich liebevoll um sie, wie um ein verletztes Tier, oder eine harmlos Verrückte, was es Lilia hinwiederum leicht machte, an Informationen zu kommen, die sie möglicherweise mit dezidierterem Auftreten nicht erhalten hätte. Die schiere Flut davon ließ sie erschauern, wenn sie sich ins Bewusstsein rief, dass sie sie in einem brauchbaren Text würde unterbringen müssen.
Es war eine völlig neue Sorte von Menschen, die Lilia während ihres Unterwegsseins traf. Leute von Adel waren darunter, Professoren, Hippies, Künstler, Musiker, ein Anwalt, Habenichtse und Reiche. Und alle hatten sie mit dem Mythos von Woodstock zu tun, den Mythen um Stonehenge, Glastonbury, dem Thor, den Druiden, Gurdjieff, den Sufis und so weiter: mit diesem offensichtlich weltumspannenden Band, das unsichtbar und unzerreißbar Menschen miteinander verknüpfte, die zu einer Erfahrung von Freiheit durchzudringen suchten die nicht alltäglich war, nicht käuflich und auch nicht risikofrei. Lilia war sich dessen, was sie tagtäglich erlebte zwar bewusst. Doch da sie allein unterwegs war, allein die jeweiligen Plätze und Häuser ausfindig machen musste, in denen sie erwartet wurde, ängstigte die Aussicht, Teil dieses Umfassenden zu sein, Lilia auch. Der bescheidene hölzerne Krönungssessel der englischen Monarchen in Westminster, die Hunderte kostbarer, dickverstaubter Buddhas in einem Privathaus in Chelsea, Schmuck von Ururahnen in Vitrinen in Salons, führten ihr vor Augen, wie wenig von der Welt sie tatsächlich wusste, vom Hinter- und Untergründigen der Geschichte.
In Schottland besuchte sie zum ersten Mal ein tibetisches Kloster, dasjenige, in dem ihr eigener Scheich die Initiation in Meditation erhalten hatte. Sie saß im bescheidenen Gemach, vom Abt fürsorglich alleingelassen, in dem ihr Lehrer Stunden, Tage und Wochen auf einem Kissen im Lotossitz, von Schmerzen und Verzweiflung umgetrieben verbracht hatte, hadernd mit sich und seinem Geschick, um Erlösung ringend. Eindrücke. Gerüche. Geräusche stürmten auf Lilia ein. Ein Wirrwarr von Gesichtern. Hautfarben. Sprachen. Von Lachen und tiefem Ernst. Sie erntete Respekt für ihre Bemühungen. Bedenken ob des Ausmaßes, der schillernden Vielfältigkeit der Aufgabe. Und immer auch Hochachtung: Als der Abgesandten einer spirituellen Schule eines ihnen bekannten Lehrers, dessen uneingeschränktes Vertrauen sie genoss.
Zurück von ihrer Reise, öffnete ihr Lehrer für Lilia einen über und über mit Etiketten nobler Hotels beklebten Schrankkoffer, der voller Korrespondenzen und Fotographien steckte, seine jahrzehntelange Arbeit mit Menschen betreffend - und stellte den Inhalt zu Lilias Verfügung.
Der Ausbau von Igors weiträumiger Wohnung ging zügig voran. Lilias Einzimmerappartement erschien ihr fast zu groß. Es nahm sich enorm verpflichtend aus, dachte sie für sich. Und hoch wie ein Kirchengewölbe. Wie bei Stepan. Zudem erhielt Lilias Zimmer einen Zwischenboden, eine Galerie, zu dem eine hölzerne Wendeltreppe emporführte. Es war fast zu viel des um Lilia Werbens. Es rückte ihr auf den Pelz. Doch sie schwieg, spendete linkisch Beifall, bedankte sich für den Aufwand - ihre eigene Wohnung im Sinn, die ständige Möglichkeit zur Flucht. Der Mietzins, den Igor zusammen mit seinem Vater aushandelte, kam ihr lächerlich bescheiden vor. Igors Vater schien Lilia gewogen. Er möge ihre untergründige Wildheit, das Ungezähmte, das er in ihr entdecke. Ihrer habhaft zu werden scheine nicht leicht. Sie rinne einem zwischen den Fingern hindurch wie Wasser. Sie könne einen glauben machen, man sei ihrer sicher. Und kaum strecke man die Hand nach ihr aus, greife man ins Leere. Und erwische man sie doch, entwinde sie sich wie eine Katze, fauchend und kratzend, obwohl sie einen nicht verletze. Er sagte das bei einem Glas perlenden Sekts, das er Lilia tänzelnd reichte, gurrend, mit tiefer Stimme, die Lilia an ihre erste Liebe erinnerte, den Maler aus der Südschweiz.
Muster wiederholten sich. Lebensgerüste blieben sich stets gleich. Igor und sein Vater sahen sich ähnlich wie Brüder. Nur dass des Vaters Haar mondweiß schimmerte. Er hatte dieselben hohen Backenknochen und die leicht durchhängenden Wangen, denselben geschmeidigen Reiterkörper. Igor erzählte Lilia, sein Vater könne galoppierend auf Pferderücken stehen, und er spiele die Balalaika wie ein Teufel. Doch es dauerte lange bis Lilia in den Genuss dieser Musik kam. Als sie darum bat, prallte sie gegen eine Wand. Plötzliche Stille krachte in den Raum. Igor wurde bleich. Sein Vater biss die Zähne zusammen und ließ sie stehen, als habe sie unerlaubt eine hermetisch abgeriegelte Grenze überschritten.
Viel, viel später, an einem prallen Sommerabend - Lilia wohnte nun meistens auf dem Hof - erschien der Vater unversehens am Feuer, über dem seine Mitarbeiter mit Igor und Lilia Würste brieten, das Instrument in ein Tuch gewickelt unter dem Arm, und fing an zu spielen, langsam, schwerblütig, nach den Tönen fingernd wie einer, der lange Vergessenes zusammensucht. Es klang wie leises Weinen, Schluchzen, wie ein behutsam, langsam ans Licht drängender Schmerz. Dann schlug die Melodie um und stürmte urtümlich, grob und ungebärdig davon, wie eine Herde Fohlen, drängend und trampelnd. Igor stierte mit gesenktem Kopf vor sich hin. Auch Stepan schaute nicht auf. Die Musik schlug um sich, stach zu, stritt, kämpfte – bis sie jäh abbrach. Die letzten Töne fielen wie Kiesel ins Gras. Und der Vater wie ein Stein auf die aus rohen Balken gezimmerte Bank. Igor nahm dem Vater sanft das Instrument aus den Händen, wickelte es ins Tuch und legte es hinter sich auf den Boden. Lange fiel kein Wort, einzig gelegentliches leises Schlürfen und Schlucken waren zu hören und das Zischen, wenn ein Tropfen Fett in die Glut fiel, oder Scheite knackend zerbarsten.
Lilia hatte angeregt, ihre Wohnung sollte einen separaten Eingang erhalten. Und Igor war auf diesen Wunsch eingegangen. Die Möbel kaufte sich Lilia neu, nahm keine von Zuhause mit. Einzig ein paar Kleidungsstücke, Schuhe und den Stoß Bücher, in dem sie gerade las. Auch einen zweiten Hundekorb für Mali besorgte sie. Im Übrigen stellte Lilia fest, dass sie sich, weilte sie bei Igor, anders anzog, anders frisierte als sonst. Sie kaufte Kleidungsstücke, die sie in der Stadt nicht trüge: Bestickte Blusen, schwingende Röcke mit Blumenmustern. Sie standen ihr, machten einen anderen Menschen aus ihr. Sie rutschte unter dem Eindruck, den Igor und sein Vater, Stepan und der Haushalt um diese Menschen herum auf sie ausübten in eine Rolle hinein, wie um eine Brücke von ihrem bisherigen zu diesem unbekannten, geheimnisumwobenen Dasein zu bauen, das sie auf dem Hof lebte. Nie wieder spielte Igors Vater die Balalaika. Nie wurde die Vergangenheit der Familie erwähnt. Das Gras, das über diese Wunde gewachsen war, wurde nie wieder aufgerissen. Wenigstens nicht in Anwesenheit Lilias, die sich auch nicht sonderlich Gedanken darüber machte. Auch sie selbst sprach nicht über ihr früheres Leben. Ihr Witwentum war bekannt: Das genügte. In Igor hatte sie sich zwar verliebt, doch war es eine Verliebtheit, die mehr mit Verwunderung zu tun hatte, als mit Selbstvergessenheit. Sie zog mit ihm an einem gemeinsamen Strick, jedoch ohne ihre eigene Welt aufzugeben. Eine gewisse Scheu vor Igor hinderte Lilia daran. Sie war sich seiner nicht sicher. Die gemeinsame Basis fehlte. Die gemeinsamen Interessen.
Auf Anraten ihres Scheichs begann Lilia, Kurse in Körper- und Atemschulung anzubieten. Ein paar Mal nahm Igor daran teil. Sie sprachen ihn nicht sonderlich an. Er wolle ihr ihre Welt lassen, meinte er, sie lasse ihm die seine auch. Und tatsächlich hielt sich Lilia aus allem raus, was Familie, Pferde und Rennen betraf. Eine kleine Insel baute sie sich darin nur mit Stepan auf. Er unterrichtete sie nebst dem Reiten im Umgang mit Schafen, überließ ihr das Tränken von Lämmern, die nicht aus eigenem Antrieb saugen konnten.
In ihrem grünen Overall hockte sich Lilia hin, die Flasche in der Hand und freute sich an der Saugkraft des Lamms, dessen Gier den Nuckel beinahe verschlang. Meistens kletterte währenddessen ein zweites auf ihren Rücken und kaute an ihren Haaren. Bis Lilia die Idee mit den zwei Flaschen hatte. Den Rücken an der Wand, ein schmatzendes Lamm in jedem Arm, kauerte sie im Stroh. Die knochigen Körperchen. Die knuddeligen Fellchen. Die runden Köpfchen mit den trotzigen Stirnen. Und die stampfenden Hufe auf ihren Schenkeln. Geruch warmen Fells, von Vergorenem, knisterndem Stroh und Amoniak. Und dass Lilia selbst Lamm war für die Lämmer, wenn sie im Übermut ihre Köpfe gegen ihre Nasenwurzel rammten. Und Lilia diesen eigenartigen Schmerz spürte, der kitzelnd die Nase hochfuhr, kurz bevor das Nießen begann: Glück pur. Die Lämmchen blökten, kaum hörten sie Lilia nahen, ein Laut, der tief in ihr Gemüt drang. Das Leiden hungriger Kreatur. Dieser schutzlose Laut, der schmerzte und gleichzeitig beseligte, im Herzkleinen explodierte wie Leuchtfeuer. Lämmer tränken – sich selbst tränken – Mängel stillen – Schmerz sich zeigen lassen und heilend darüber streichen, bis er sich ergab - wie satte Lämmer, die noch etwas auf ihr herumstaksten, bevor sie in schiefen Sprüngen zur Mutter auf die Weide hopsten.
In der Stadt hatte sich Lilia einen Kursraum gemietet, und zu ihrer Überraschung kam ihr Angebot an. Vollends verblüffte sie, dass sie Menschen ansehen konnte, wo im Körper ihre Schmerzen saßen. Lilia beobachtete wie sie, sobald jemand den Raum betrat, mit ihrem eigenen Körper unwillkürlich seine Haltung korrigierte. Hingen jemandes Schultern nach rechts, schob Lilia die ihren nach links. Kippte jemandes Kopf wie der eines Vogels nach vorn, nahm Lilia ihren eigenen zurück. Mit der Zeit wurde dieses Mitgehen zu einer Sprache ohne Worte, die beim Übenden über das Unterbewusstsein wirkte. Lilia baute ihre Yogaerfahrung und ihr Wissen um den Atem in die Kurse ein. Das half ihr im Umgang mit ihren eigenen Schmerzen. Lilia zog die Kursteilnehmer am Seil ihres eigenen Lernens mit, so wie ein Schlepper Boote hinter sich herzieht. Kamen neue Interessenten dazu, fing sie wieder bei Grundlegendem an, machte es zu einer Wiederholung für die Fortgeschrittenen und schloss die vermeintliche Lücke, indem sie die Neueren übergangslos den Älteren gleichsetzte, was bei den Neuen die Idee erzeugte, sie seien gar keine Anfänger und folgten seit langem ihren Unterweisungen. Lilia stellte fest, dass sie die Art und Weise des Lehrens ihres Scheichs übernommen hatte, ohne es zu merken. Sie vermittelte keinen erlernten Stoff, sondern einen gegangenen Weg. Hin und wieder wurde sie gefragt: „Wie kommt es, dass ich bei dir Übungen schaffe, die ich eigentlich gar nicht kann?“
Auf dem Hof lebten auch Katzen, denen Lilia geflissentlich aus dem Weg ging. Bis sie eines Nachts fürchterliches Geschrei im Schopf hinter dem Schafstall hörte. Es zeterte. Polterte. Fauchte. Und keifte. Eine der Katzen hatte vor kurzem Junge geboren, in einer der Bananenschachteln, die Lilia zum Transport ihrer Dinge benutzte. Die Katze zeigte ihr die Jungen sogar. Schnurrend strich die Katze um Lilias Beine, ging zurück zur Schachtel, stieg hinein, strich erneut um Lilias Beine, mehrere Male, bis Lilia sich zögernd der Schachtel näherte. Die Katze setzte sich auf den Deckel. Lilia beugte sich zu ihr hinunter. Die Katze strich um ihre Hand. Sorgsam und ängstlich langte Lilia in die Kiste. Die Katze saß still und schaute Lilia zu, währendem Lilias Hand in Knäueln flauschigen Flaums versank. Es piepste aus der Schachtel. Die Katze stieg hinein. Lilias Hand - die heißen, feuchten Bäuschchen, von denen ein Duft nach Kraut und Süßholz, warmem Blut und Milch ausströmte - fingerte an den Tierchen herum, unschlüssig darüber, was sie mögen oder was zu viel sein könnte.
Deshalb schlug es in Lilia Alarm, als kurz darauf in der Nacht, der Marder sich mit der Katze um die Jungen stritt. Dass es dabei um Mord ging, war klar. Doch was tun? Nichts rührte sich in Igors Wohnung. Am nächsten Tag die Bescherung. Die Kartons lagen verstreut herum. Kotspuren, Blutspuren überall. Und als Lilia die Schachteln beiseite räumte, kamen Katzenköpfchen an leergefressenen Fellbäuchlein zum Vorschein, eines, zwei, drei – vier. Fünf Junge waren es insgesamt gewesen.
Lilia setzte sich auf eine Treppenstufe und fing an zu schluchzen. Da strich Weiches um ihren Rücken, das auch greinte, langgezogen lamentierte. Nun hatte Lilia keine Mühe mehr, die Katze auf ihren Schoss zu heben. Lilia legte den Kopf auf den Rücken der Katze, und zusammen stießen sie Laute hilflosen Klagens aus, deren Klänge und Länge sich immer mehr anglichen. Irgendwann tauchte Igor auf und erkundigte sich nach dem Geschehenen.
Darauf blieb die Katze zwei Tage lang verschwunden. Bis einer der Stallburschen Lilia zurief, es liege ein winziges Kätzchen im Stroh bei den Schafen. Lilia rannte los, nahm das Kätzchen, das gerademal ihre Hand füllte, und rief nach seiner Mutter. Zusammen rannten sie zu Lilias Wohnung, die eine der Schachteln holte, sie mit Tüchern auspolsterte und das maunzende Kätzchen hineinlegte. Die Alte sprang hinterher. Vor die Kiste stellte Lilia eine Schale mit Katzenstreu, etwas abseits Wasser und Futter.
Tage später sah sie, wie der kleine Kater sich anstrengte, aus dem Karton zu steigen. Mehrere Male fiel er zurück. Als er es endlich schaffte, ließ er sich in die Streu fallen und machte sein Geschäft. Von dem Moment an wurden Lilia und Ilko, wie sie den Kleinen nannte, unzertrennlich. Lilia bekam Schweißausbrüche, als Ilko durchs Fenster auf den Balkon, und später durch die Türe in den Garten hinauswollte. Erst als Lilia sah, wie fürsorglich die Mutter mit dem Kleinen umging, und ihm auch gelegentlich eine scheuerte, wenn er zu unverschämt an ihr herumriss, schwand ihre Angst, es könnte ihm etwas zustoßen.
Ilko und Mieze, so hieß die Mutter, brachten das Entsetzen vor dem Gekratzt- und Gebissenwerden in Lilia zum Verstummen. Schon der spätere Tod von Mieze, die eines Tages einfach verschwand und unter einem Baum im Gemüsegarten tot aufgefunden wurde, störte Lilia auf. Das Band zwischen ihr und Ilko jedoch wurde so stark, dass sie nicht einschlafen konnte, wenn sie ihn nicht zuhause wusste. Sie musste sich zwingen, ihn gehenzulassen, als er anfing bei Vollmond ums Haus herum zu miauen und Tage später verdreckt und ausgehungert zurückkam, als sei nichts gewesen. Sie schleppte ihn durch Verletzungen nach Raufereien mit Mardern. Er bekam die Rinderflechte und sie musste ihn in Desinfektionsmittel baden. Er lag bei ihr auf dem Bett, auf ihrem Pult, wenn sie schrieb, auf ihren Knien, wenn sie strickte oder nähte. Er wurde zu Lilias Schatten. Und als die Jahre vergingen, und in Lilia die Angst wuchs, er könne bald sterben, empfand sie es fast als Erlösung, als Igor eines Abends an ihre Türe klopfte, in einem Korb den toten Kater. Er sei gerade verschieden, sagte er. Er habe sich noch vor Lilias Türe geschleppt und sei dort liegengeblieben. Sie begruben ihn miteinander. Ein großes Weh beschwerte Lilias Gemüt, gepaart mit Dankbarkeit dafür, dass das Unvermeidliche nun geschehen war und sie aufhören konnte sich zu ängstigen.
Langsam gewöhnte sich Lilia an das Zusammenleben mit Igor und seiner Familie. Keines der Mitglieder forderte etwas von ihr oder schien etwas von ihr zu erwarten. Manchmal aßen sie und Igor mit der Familie im Haupthaus. Manchmal kochten sie für sich in Igors Wohnung. Es fühlte sich für Lilia an wie das Hin und Her auf einem Bahnhof. Man traf sich oder traf sich nicht. An einigen Tagen saßen vier Leute um den Tisch herum, an anderen sieben, acht oder zehn. Noch mehr, an Tagen der „Offenen Tür“, wenn ein Pferd zum Verkauf stand, nach Renntagen oder Auktionen.
Igors alte Großmutter, die die Tafel dominierte, wenn sie hin und wieder erschien, zog die Fäden. Lud sie zum Tischgespräch ein, wurde geredet. Schwieg sie, füllte Stille den Raum. Traf Lilia sie im Garten, blieb Lilia auf Abstand, außer die Dame winkte sie herbei, um sie auszuhorchen. Ihre altmodische Gönnerhaftigkeit amüsierte Lilia. Ihren melodischen Akzent mochte sie. Doch ihr Herz würde Lilia nicht gewinnen. Und das stachelte Lilia an, ihre an Oma erlernten Taktiken an der Dame auszuprobieren. Lilia machte sich nicht klein. Sie gab sich nur nicht preis. Jede Information über sich, ließ sie sich aus der Nase ziehen. Als sei sie es nicht wert, erfahren zu werden. In Anwesenheit von Igors Großmutter, fühlte sich Lilia wie auf einer Bühne. Sie inszenierten sich. Spähten sich aus. Vermieden wunde Punkte. Kamen einander nur gerade so nahe, dass keine der anderen Sphäre touchierte. Sie spielten Katz und Maus auf Augenhöhe. Lilia würde nie wissen, was die Dame über sie dachte. Und da sie ihr nichts schuldig war, kümmerte das Lilia auch nicht.
Die Großmutter hielt sich sehr gerade, trotz einer gewissen Gebrechlichkeit. Sie ging meistens in Grau. Schmuck und gelegentlich ein farbiges Tuch über den Schultern unterstrich die Distinguiertheit ihrer Kleidung. Die Röcke aus weicher Wolle reichten bis zu ihren Knöcheln und kaschierten geschickt die geschwollenen Füße in den zu engen Pumps, die nur beim Treppensteigen kurz hervorblitzten. Sie verbot sich jede Äußerung von Schwäche. Schmerzen zeigten sich höchstens am verstohlenen Zucken ihrer Mundwinkel. Man musste sie gut kennen, um zu bemerken, dass sie hinter ihrer stoisch aufrechterhaltenen Fassade litt. War sie einmal jung gewesen? Hatte sie einmal geliebt? Und beim Kinderkriegen geschrien? Die Maske ihres immer noch ebenmäßigen Gesichts, ließ nichts durchblicken. Ihre grauen Augen wirkten, als schwämmen sie in Tränen. Nur sie offenbarten, dass sich hinter der Gestyltheit ein duldender, verletzlicher Mensch versteckte.
Manchmal stritten sich Igor und sein Vater, dass die Fetzen flogen. Scheinbar über Nichtigkeiten. Und zwar in ihrer Muttersprache. Wenn ihr hitziges Temperament überschäumte: das spie. Zeterte. Kreischte. Und fauchte, als gehe es ums Töten. Gerade dass Lilia nichts davon verstand, ließ es in ihren Ohren besonders gefährlich klingen. Wie Platzhirsche rammten sie sich gegenseitig, krachten aufeinander, manchmal Fäuste schwingend - bis sie plötzlich in Gelächter ausbrachen, einander umarmten und umzuwerfen versuchten, wie rammlige Böcke. Ein Verhalten, an das sich zu gewöhnen, Lilia Zeit und Nerven kostete. Ihr überstrapaziertes Streitkostüm schien ein Nochmehr an Auseinandersetzung nicht zu verkraften. Beim bloßen Zuhören wurde ihr schlecht, und schlug ihr Blutdruck Purzelbäume. Auch schämte sie sich für die beiden – für ihren Mangel an Erziehung, wie Lilia dachte. Sie brauchte eine Pause, bis sie sich Igor danach wieder nähern konnte. Saß sie am Abend, nach einem Tag voller Arbeit, auf ihrem Balkon, oder am Ofen mit einem Buch und klopfte Igor bei ihr, meldete sich eine Art von Platzangst in ihrem Nervensystem. Denn meistens ging es um Sex. Sie waren beide noch längst nicht zu alt dafür. Nur dass Lilias Appetit darauf befriedigt war, der von Igor jedoch nicht. Lilias Wünschen. Träumen. Und Fliegen war durch Bernd für immer gestillt worden.
Als Lilia ein Wochenende mit der Gruppe und ihrem Scheich in einem Kloster in den Bergen verbrachte, fand Igor die Schachtel mit Bernds Briefen, mit Kopien ihrer Antworten, ihren Gedichten, und las sie. Bei Gelegenheit, als Lilia wieder einmal keine Lust auf ihn hatte, machte er ihr diesbezüglich eine Szene, dass die Balken krachten, und Lilias Mut ins Bodenlose sank. Sie fühlte sich schäbig, nutzlos und nichtswürdig. Als keine richtige Frau. Dabei verstand sie nur nicht, was diese ständigen Wiederholungen des Ewiggleichen wert sein sollten. Sex ohne Liebe begriff sie nicht. Und ginge es dabei um Liebe, gäbe es nicht diesen Druck. Das große Tabu: Verweigerung zwischen Partnern riskierte das Liebesaus. Gleichstellung: Ein wertloser Wisch. Eine Maus, die Stückchen um Stückchen vom Konstrukt von Liebe abbiss, bis - mangels Willigkeit - die Liebe aufgegessen war.
Fühlte sich Lilia von Igor bedrängt - auch von seiner Familie, deren geschäftlichen und menschlichen Problemen - fuhr sie zu sich nach Hause und verpuppte sich mit Mali. Glättete ihre Person, wie ein zerknülltes Stück Papier. Kehrte zu ihrem Rhythmus zurück, oder tat ein paar Stunden lang einfach nichts. In der Hoffnung, Igor rufe nicht an, ruhte sie sich aus. Seiner Anhänglichkeit entronnen wie einem Netz. In ihrer Wohnung, mit dem nun leicht muffigen Geruch, der in Schränken und auf Teppichen und Kissen wie feiner Dunst hing, sammelte sie ihren Körper, Zelle um Zelle, ihre Gedanken, Gefühle und Gewohnheiten zusammen, als seien sie ihr in der Zwischenzeit abhandengekommen. Einen oder zwei Tage lang hielt sich Lilia damit über Wasser. Immer im Bemühen, nicht an Igor, an Stepan, die Familie, die Katzen, Schafe und Hunde zu denken, sondern in ihrem kleinen Einerlei Zufriedenheit und Ruhe zu finden. Dann fing das Sehren an, behutsam wie leises Bluten. Stepans Humpeln und Igors Lachen schoben sich wie Kulissen vor Zufriedenheit und Ruhe. Das Melodiöse, Zischende ihrer Muttersprache. Die Wärme von Stepans Armen, wenn sie vom Pferd glitt. Die aalhafte Wendigkeit von Igors Bewegungen. Der Schmiss, der ihr zu einer Leichtigkeit des Tanzens verhalf, die sie ohne ihn nicht aufgebracht hätte. Sein unverschämtes Selbstverständnis: Lilia vermisste sie in jedem Winkel ihres Wesens. Als sei sie auf Entzug.
Die Tage fern vom Hof dehnten sich endlos. Sie fürchtete das Klingeln des Telefons, das ihr Alleinsein zerschnitt wie mit Messern. Und erhoffte es doch mit jeder Faser ihres Körpers. Igors Stimme klang nüchtern, sachlich, kühl, wenn er anrief. Ebenso wie die von Lilia, die sich jede Emotionalität versagte, nur gerade das Nötigste zur Antwort gab, anfügte, sie habe gerade keine Zeit zum Plaudern. Beide logen sie willentlich, um ihr Intimstes nicht zu verlieren. Das Stückchen Persönliches unter den Füssen, das vor Enttäuschung schützte, Eigenständigkeit vortäuschte, die sich längst in Abhängigkeit verwandelt hatte, unmerklich. Mindestens zehn Tage lang zwang sich Lilia durchzuhalten. bevor sie sich eingestand, es sei sinnlos, sich einzureden, sie komme allein zurecht und brauche Igors - und die Gesellschaft seiner Familie nicht. Ein Geständnis, das sich für Lilia anfühlte wie ein Besiegtwerden. Ein Unterliegen. Oft erlebte sich Lilia im Vergleich zu Igor als uralt. Als verrunzelte, ergraute Schachtel, die sich knapp auf den Beinen hielt. Nicht in physischer Hinsicht. Es lag an der Verschiedenartigkeit ihrer Sicht auf Leben, auf Arbeit und Vergnügen.
Lilia stellte fest, dass gerade das Vergnügen in ihrem Alltag kaum eine Rolle spielte. Sie war ständig am Gehen. Das Lernen, Erfahren, das Durchdringen des sie Umgebenden waren ihre Themen. Einfach da zu sein, in einem Tagesablauf ohne Gewicht, ohne Anstrengung, fiel ihr schwer. Je älter sie wurde, desto deutlicher vernahm sie die Stimme ihrer Herkunft. Das Erbe der Fahrenden. Das auf Achse sein. Die Angst vor Einmischung. Vor allem vor Einmischung durch Behörden oder Institutionen. Davor empfand sie geradezu panische Angst. Der Stempel des Eingefangen- und Versorgtwerdens, das ihren Vorfahren erst wenige Generationen früher widerfahren war, leuchtete tiefrot. Sie konnte sich so gut zureden, wie sie wollte, das Mal ließ sich weder überdecken noch wegwischen. Es wurde nur stärker. Zwar half es ihr, zu begreifen, worin ihr Fluchtverhalten wirklich wurzelte. Doch ein Gegenmittel zeigte es nicht auf. Einmal Zigeuner immer Zigeuner? Sie selbst hatte nichts dagegen einzuwenden. Einzig den Preis dafür fand sie hoch.
Im Mai, wenn Fahrende auf dem Weg nach Südfrankreich Igors Vater um einen kurzfristigen Standplatz auf der Wiese gegen den Wald hin baten, riss es Lilia in sich herum, als sei sie von eisernen Ketten gefesselt. Wenn sie schon nicht mitkonnte, musste sie zumindest ihre Wohnung neu erfinden, die Möbel umstellen, alle, sodass sich ein frisches Bild ergab.
Schon Pierre-Louis hatte jedes Jahr unter diesem Zwang zu leiden gehabt. Er male die Wände rund um die Möbel farbig an, sodass der Spuk ein Ende habe, hatte er gedroht. Und natürlich wusste Lilia, dass sie zwar das Erbe in sich trug, sich inmitten lauter Fahrender jedoch so wenig aufgehoben gefühlt hätte, wie unter Sesshaften. Es war dieses Halbhalbe, das sie nirgendwo rasten ließ. Auch nicht in den Armen eines Mannes. Und Igor spürte das. Spürte, dass er Lilias nicht habhaft wurde. Dass sie ihm ständig entwischte, wie Quecksilber, sogar wenn sie in der Stille langsam ihre Yogaübungen ausführte, oder las, die Füße hochgelagert, eine Kerze neben sich, den Kater auf dem Schoss, wie für die Ewigkeit hingegossen. Sie war es nicht. Kaum näherte er sich ihr, raschelten ihre Stacheln in Abwehr, bis sie sah, dass es nicht ums Nachstellen ging, ums Zupacken. Dann gelang es ihr auch hin und wieder, einfach anspruchslos mit ihm zusammen zu sein – so wie mit Stepan, bei dem sie sicher sein konnte, dass er nichts von ihr wollte.
An der Biographie ihres Scheichs arbeitete Lilia vor allem in den Nächten, wenn alles ringsum schlief, die Energie im Überfluss zur Verfügung stand, wenn Licht und Schatten die Dreidimensionalität der Straßen und Gebäude drastisch hervorhoben. Fantastische Einblicke sich ergaben, als lägen Innereien bloß. Bizarre Verwinkelungen. Verschachtelungen. Lilia liebte diese Nacktheit, die Gedanken und Gefühlen Flügel verlieh, dämonenhaft schwarze oder in Licht getauchte, sirrende. Dann schrieb es sich leicht. Auch weil sie einen vorgegebenen Stoff bearbeitete und nicht nur auf Persönlichem herumkaute. Ihr Lehrer hatte erwähnt, nun stehe Amerika an. Lilia müsse wieder reisen.
In ihrer Gruppe, die mittlerweile mehrere hundert Teilnehmer umfasste, wurde Geld gesammelt. Und genau die Summe kam zusammen, die die fast zwanzig Flüge kosteten, die Lilia zu den, von ihrem Lehrer vorgeschlagenen Stationen führen sollten: quer durch die Staaten und bis hinauf nach Kanada. Lilia schwindelte, wenn sie daran dachte. Doch fehlte ihr die Zeit dafür. Geschenke mussten gekauft werden, praktische Kleider und Schuhe, ein Koffer für die Mitbringsel und einer für die Kleider. Lilia wollte so leicht wie möglich reisen. Ihr standen nur vier Wochen zur Verfügung. Und angemeldet war sie bei Dutzenden von ehemaligen Schülern, Freunden und Lehrern ihres Scheichs. Das hörte sich so jenseitig an, dass sie darob in stupende Gelassenheit verfiel und den Tag null einfach auf sich zukommen ließ. Hauptsache das Tonbandgerät, massenhaft Batterien und Bandkassetten steckten in ihrem Gepäck, dazu der Packen mit den nummerierten und in der richtigen Reihenfolge aneinandergehefteten Tickets.
Igor fuhr sie zum Flughafen. Sie umarmten einander. Igor blieb mit Mali an der Leine zurück. Und Lilia verschwand - in einem Zustand zwischen den Gefühlen, so als rolle sie nicht nur über Transportbänder. Ihr Körper schwebte. Es war wie Beten. Ein Zustand von Nichtexistenz, der sowohl Besorgnis, als auch Ekstase von ihr fernhielt.
Das Flugzeug landete um elf Uhr dreizehn in schwarzer Nacht auf einem kleinen Flugplatz an der Ostküste der Staaten. Lilia musste sich eine Stunde gedulden, ehe sie abgeholt wurde. Sie war darauf vorbereitet. Sie checkte aus und setzte sich auf eine Bank nahe der Eingangspforte. Die Halle leerte sich. Das Einchecken. Die Reise. Das Ankommen in der Dunkelheit: es spulte sich in Lilia ab wie ein Film. Sie spürte, wie und wo sie saß, hörte das Blut in ihren Adern, fühlte Erwartung, die auf nichts wartete. Ein Uni-Professor würde sie abholen. Er war auf dem Weg zu ihr, fuhr durch dieselbe Nacht die um Lilia herumhing wie ein Mantel.
Ohne Gefühl saß sie auf ihrem Platz und schaute der Nacht ins Gesicht. Vielleicht war es verrückt als Frau mutterseelenallein, kurz vor Mitternacht hier zu sitzen, und auf einen Mann zu warten, den sie nicht im Geringsten kannte. Doch es fühlte sich fabelhaft an. Eine Geschichte mit Potenzial.
Bevor sie anfing zu frösteln oder Hunger zu verspüren, fuhren die gläsernen Eingangstore seufzend auseinander, ein Schatten bog um die Ecke und eine sonore Stimme grüßte: „Du musst Lilia sein, deine strahlenden Augen verraten es mir.“ Zu anderen Zeiten und unter anderen Umständen hätte Lilia diese Begrüßung als plump taxiert. Zur herrschenden Geisterstunde passte sie. Der Mann hieß Andy, schien daran gewöhnt, zu nachtschlafender Zeit unterwegs zu sein und nahm selbstverständlich an, es mache Lilia nichts aus, vor der Heimfahrt in der nächsten Mall shoppen zu gehen. Um Mitternacht einkaufen? Lilia schaltete blitzschnell: Das also war Amerika.
Die Mall war riesig, eine hochgewölbte Halle, deren Anfang und Ende sich unter der nächtlichen Sparbeleuchtung nicht absehen ließen. Und sie war menschenleer. Andy schnappte sich einen Wagen, schritt zielgerichtet den vollbeladenen Gestellen entlang, fischte heraus, was er brauchte – unter anderem ein Käsesandwich für Lilia zum Sofortverzehr sowie eine Flasche Cola – lief zu einer der Kassen, an der ein Schwarzer saß, der lustlos in einen Minifernseher stierte, wechselte ein paar aufmunternde Worte mit dem Einsamen, bezahlte. Das Bild des Mannes an der Kasse der Mall ging Lilia im Kopf herum, als sie das Sandwich kaute und hin und wieder mit einem Schluck aus der Flasche nachspülte. Die Nacht war stockdunkel. Sie fuhren über Land.
Lilia bestaunte ihre Ankunft in der „Neuen Welt“ und fand, sie passe ausgezeichnet zu ihrer Mission. Andy war verheiratet, hatte einen Jungen, ein Problemkind. Seine Frau würde Lilia nicht zu Gesicht kriegen. Sie hielt nichts von Andys Scheich und nichts von Lilias diesbezüglichem Besuch. Lilia, schon schlafbereit in ihrem Bett sitzend, hieß Andy eintreten, als er an die Tür klopfte. Sie müsse so bald wieder weg, und er habe ihr so viel zu erzählen, meinte er, begann auch gleich und hörte nicht auf damit bevor der Morgen graute. Lilias Bandgerät wurde mit der ersten einer ausgedehnten Reihe fabelhafter, von Fotografien untermauerter Geschichten gefüttert.
Nach zwei Stunden Schlaf folgte ein „Sightseeing“. Lilia erhielt auf einem Schlachtfeld eine Lektion in Geschichte, musste sich immer wieder daran erinnern, dass sie sich in Amerika befinde, auf einem fernen Kontinent, obwohl das Gras unter ihren Füssen nicht anders raschelte als bei ihr zuhause, die Sonne genauso wärmte, und nur das Essen sich für ihren Magen gewöhnungsbedürftig anfühlte.
Am gleichen Nachmittag noch flog Lilia nach Kanada. Über Vancouver ging die Sonne unter, als sie landete. Strahlen rotgoldenen, nebeldurchwirkten Lichts überschwemmten die Bucht. Die Schlünde der Straßen, trunken von Nacht. Bänder irisierender Scheinwerfer auf den Highways. Tausende strahlender Fenster wie Augen an den Fassaden der Wolkenkratzer. Vor den Schaltern Schlangen von Menschen: weißen, roten, gelben. Warum sie nach Kanada einreisen wolle, wurde Lilia gefragt. Wege durch den Terminal, die nicht enden wollten, riesige Hallen. Totempfähle. Skulpturen von Bären und Lachsen. Kanus, in denen bronzene Indianer kniend ruderten. Endlich das Gepäck.
Eine Freundin ihres Scheichs erwartete sie. Dann die Rampe zum Ausgang. Lilia lief sie zugig, als eine der Letzten hinunter. Noch standen Leute da, die Reisende erwarteten. Niemand sprach Lilia an. Sie wartete kurz, ging die Rampe wieder hinauf und nochmals hinunter. Und da rief eine Frau mit starken Hüften und breitem Lachen ihr zu: „Du musst Lilia sein“, lief ihr entgegen und zerdrückte sie fast an ihrem breiten, weichen Busen. Sie habe am Hafen, mit Sicht auf das Meer, ein Hotelzimmer gebucht. Sie würden erst am nächsten Morgen zu ihr nach Hause auf die Insel schippern, erzählte sie. Großstadtfeeling. Nachtessen mit Rundsicht auf die Stadt im Turmrestaurant. Bummeln. Quatschen. Menschen zuhauf. Gelächter. Blinkende Reklameschilder. Asphalt unter den Schuhen. Und die Idee, nichts von alledem sei ihr fremd in Lilia. Wohlgefühl des Aufgehobenseins. Wie eine Prüfung, eine schwierige Aufgabenstellung fühlte sich bisher nichts auf ihrer Reise an.
Indianische Freunde von Jane begrüßten Lilia bei ihrer Ankunft auf der Insel, überreichten ihr eine traditionelle Originalmalerei einer Willkommensgottheit. Der alte Indianer mit dem verschmitzten, wissenden Lächeln aus wasserblauen Augen, ein Freund von Jane, der auf einem Holzgerüst über einem Feuer aus duftenden Scheiten frisch gefangenen Lachs räucherte und Lilia ein Einmachglas voll davon schenkte. Die Tänze des Stamms mit dem zungenbrecherischen Namen, den Lilia nicht aussprechen konnte. Eine Schule von elf Orcas beim Eindunkeln im Meeresarm unterhalb des Hauses. Das Glitzern der Kreuzfahrtschiffe: wie Christbäume. Lilia stand am Fenster und schaute. Schaute nur. Saugte auf wie ein Schwamm.
Anderntags zurück aufs Festland. Die eintägige Fahrt in eine Gegend wie Wüste. Gelber Sand. Flimmernde Hitze. Ein säulengeschmücktes Gebäude über einem See. Zu Besuch bei einem der Lehrer ihres Scheichs. Einem abchasischen Prinzen. Klein, zierlich. Mit Augen, die Menschen lasen wie Bücher. Unnachgiebige Kraft. Kein Richter: einer, der vorausging. Ein Tisch voller Freunde: Künstler, Musiker, Derwische. Lilia zu seiner Rechten. Jane zu seiner Linken. Videos urtümlicher abchasischer Tänze. Reiterspiele. Kampfspiele. Der Prinz, der ebenfalls seine Vergangenheit zurückgelassen hatte, war einen entbehrungsreichen, schonungslosen Weg gegangen, um auf sein Amt des Lehrens vorbereitet zu werden. Leute, Leute, die Lilia Grüße an ihren eigenen Lehrer mitgaben, Geschenke zur Erinnerung.
Das Adieusagen zu Jane und John, ihrem Ehemann, nach vier prallgefüllten Tagen, fiel schwer. Auch John konnte Lilia kaum gehen lassen. Es blieb nur wenig Zeit vor ihrem Abflug. Und doch wollte John, der Holzfachmann, Jäger und Fischer, Lilia noch ein Stück echten Urwalds zeigen, jahrhundertealte Baumriesen, einer neben dem anderen, wie Säulen, in dräuendem Halbdunkel kaum voneinander zu unterscheiden. Die von Wurzeln zerfurchten Wege voller Bärenhaufen. John wusste, wie Bären zu begegnen war. Sie rochen sie, doch zeigten sie sich nicht. Dafür stand wie eine Erscheinung plötzlich ein silbergraues, von flüchtigem Strahl matt erhelltes, bräunlich geflecktes Etwas auf schlanken Beinen zwischen zwei Stämmen, die grün-golden-fluoreszierenden Augen starr auf die unerwarteten Besucher gerichtet: Ein Wolf! Lilias Puls raste. Nicht vor Angst. Sondern vor freudigem Erkennen. Ekstase bannte sie auf die Stelle, keine fünfzehn Meter von dem Tier entfernt. Auge in Auge verharrte sie mit ihrem Totemtier - bis es lautlos verschwand, fast ohne sich bewegt zu haben, als würde es vom Wald verschluckt. Totenstille herrschte.
Das sich Loslösen fiel schwer. Und das Abschiednehmen ebenso. Jane, John und Lilia waren mehr als Freunde, sie waren Geschwister geworden. Tränen flossen.
Von Ort zu Ort reiste Lilia, wusste mittlerweile auswendig wie ein Flughafen funktionierte. Sie traf Christen, Juden, Buddhisten, zwei Sikhs, einen Hindu und Muslime, Sufis – alles Schüler, Weggefährten oder ehemalige Lehrer ihres Scheichs. In Hollywood wohnte sie bei Filmleuten, die in den Studios beschäftigt waren. Tage zuvor hatte ein Erdbeben erhebliche Schäden an Gebäuden und Straßen angerichtet. Auch im Haus ihrer Gastgeber waren die Fußböden noch übersät von Mauersplittern, war der Kamin gespalten, und einige Türen gingen nicht mehr zu. Geputzt werden durfte erst, nachdem Versicherungsexperten die Schäden aufgelistet hätten.
Als Lilia im Bett lag, erschien ihr Gastgeber mit dem Telefon in der Hand und meldete, ihr Lehrer sei am Apparat. Es war halb drei Uhr in der Nacht. Lilia, die nicht hatte einschlafen können, atmete auf. „Ich sehe, dass du nicht richtig empfangen worden bist, dort, wo du jetzt wohnst. Ich habe bereits veranlasst, dass du am Morgen abgeholt wirst. Tony, einer meiner engsten Freunde, wird kommen. Du wirst früher aus Hollywood abreisen als geplant, hast also drei freie Tage vor dir. Wie willst du sie gestalten“, fragte der Scheich. „Ich will zu deinem verrückten Lehrer in Nevada fahren, von dem du so viel erzählt hast.“ „Ich habe dir davon abgeraten. Man weiß nie, wie man dort empfangen wird. Du könntest massiv enttäuscht werden“. „Das ist mir egal. Ich will auf jeden Fall dorthin“. Zögernd teilte der Scheich Lilia die Telefonnummer mit. Lilia jubelte. Ihre Gastgeber waren bestürzt und betrübt, als Lilia ihnen ihre frühzeitige Abreise mitteilte. Tony brachte sie in einem gefälligen Hotel mit Swimmingpool in Los Angeles unter. Und Lilia schwamm und genoss die eine Nacht ohne Verpflichtung.
Wieder folgten Interviews und Besuche, auch in einer Wohnung, in der Schwaden von Cannabisdunst in den Zimmern hing. Im Übrigen stellte Lilia fest dass, wo immer sie sich aufhielt, sie sich nicht anders fühlte als bei sich zuhause, nur viel intensiver beschäftigt. Die Menschen, mit denen sie sprach, egal welcher Tradition oder Religion sie angehörten, brachten dieselben Argumente vor, äußerten dieselben Bedenken, teilten dieselben Schwierigkeiten wie Lilias Landsleute in ihrer Arbeit mit ihrem Scheich - dieser Arbeit, die der Befreiung aus dem Egogefängnis diente, oder zumindest der Annäherung an diese Möglichkeit. Daneben waren sie einfach nur Menschen, ungeachtet ihrer Hautfarbe. Was Lilia verblüffte, war das Gefühl von Normalität, das sie erlebte. Von Glamour keine Spur, nicht einmal in Hollywood, wo sie zum Essen in ein Promirestaurant geführt wurde. Von dort aus hatte Lilia auch in Nevada angerufen und war freudig begrüßt und eingeladen worden.
In der Zwischenzeit führte ihre Reise sie kreuz und quer durch die Staaten: über San Francisco bis hinunter zur Grenze Mexicos, in die Wüstenregion von Santa Fe, Las Vegas, nach Atlanta, Denver, New York… – ohne einem eigentlichen Plan zu folgen. Für das Datum von Lilias Besuch ausschlaggebend war die Verfügbarkeit ihrer Gastgeber.
Ihre Ankunft in Nevada warf alles über den Haufen, was Lilia je in ihrem Leben kennengelernt hatte. Der Hausherr präsentierte sich ihr mit geschminktem Antlitz. Das Zentrum, das aus mehreren weit auseinanderliegenden Gebäuden und Gärten bestand, zählte Trickfilmzeichner und Regisseure, namhafte Psychologen, Sterbeforscher, Schauspieler, Künstler und Wissenschaftler jeder Richtung, Normalsterbliche, Arbeitslose und viele mehr zu seinen Mitgliedern. Der Hausherr galt als Genie, spielte zig-Instrumente, stellte in namhaften Galerien aus, benutzte Techniken aus jedweder Tradition, wenn sie sich als nützlich erwiesen. Auch Methoden aus der Gehirnforschung. Schuf Computerprogramme, in denen Avatare über das Unterbewusstsein auf Menschen einwirkten. Beim ersten Kontakt mit diesen Techniken revoltierte Lilias Nervensystem. Erst Jahre später, als Lilia mit Zen-Meditation in Berührung kam, verstand sie deren Wirkungsweise. Die Verbindungen der Schule reichten, dank medialer Vernetzung, bis nach Russland und China.
Den Lehrer selbst zu beschreiben gelang Lilia nur schwer. Er war mittelgroß, athletisch, mit rundem Kopf und Glatze. Trug kurzärmlige schwarze T-Shirts und farbenbekleckste Trainingshosen. Hatte Energie wie eine Herde Bisons und ein dementsprechendes Temperament. War in etwa gleich alt wie Lilia. Wohnte in einem kleinen, schäbigen Zimmer mit Fernseher - und besaß nichts. Kriegte er Leinwände, behielt er die, die er gerade brauchte, schenkte die anderen weg. Bekam er Geld, floss es ins Zentrum, das von den zahllosen Mitgliedern getragen wurde. Er selbst wollte nichts. Außer seiner Arbeit, die zum Ziel hatte, den Menschen zu helfen, sich zu einem ausgeglicheneren, harmonischeren Wesen zu entwickeln. Auch seine künstlerischen und technischen Fähigkeiten stellte er in diesen Dienst. Er entwarf Geschirr, das am „Rodeo Drive“ in Beverly Hills auslag. Seine Theater- und Puppenspieldarbietungen spielten im Bereich von Science Fiction. Er bediente jede nur denkbare Ebene menschlicher Erfahrungsmöglichkeit. Und das rüttelte Lilia auf. Das Ausmaß an Horizont, das selbstverständlich vor ihr ausgebreitet wurde, ermöglichte es Lilia, auch ihren Scheich in neuem Licht zu sehen. Von der Tragweite seines effektiven Wissens konnte ihr Scheich seiner Gruppe von Anfängern nicht einmal einen Bruchteil vermitteln. Lilia begann zu ahnen, was sie mit dieser Reise geschenkt bekommen hatte.
Lilias Aufarbeiten der mehr als drei Dutzend Tonbänder, der Notizen, die Gastgeber für sie zusammengestellt hatten, dem Packen an Fotographien und anderen Dokumenten, der ihr zugesteckt worden war, nahm gut drei Jahre in Anspruch. Lilia gehörte mittlerweile ein Computer. Trotz Schwierigkeiten. Ermüdungserscheinungen. Und gelegentlichem Überdruss, wuchs das Manuskript. Am Ende füllte es zwei große Ordner. Gedruckt wurde das Buch nicht. Das Tun verkörperte das Werk. Als ihr Scheich das Opus gelesen und für gut befunden hatte, erhielt Lilia den Auftrag: „Und nun schreibst du, aufgrund dieser Arbeit, ein Buch über deinen eigenen Weg.“
Jahre später schaffte sich Lilia einen weiteren Computer an. Der Fachmann, der ihre Dateien auf die neue Maschine übertrug, unterschlug, aus Unachtsamkeit oder aus welchem Grund auch immer, die Hälfte davon. Auch diejenigen der Biographie. Sie blieben verloren. Und es machte Lilia nichts aus. Sie nahm es zur Kenntnis – und erinnerte sich an die Geschichte von Milarepa, dem tibetischen Meister. Nachdem er, um seine Familie zu rächen, fünfunddreißig seiner Verwandten gemeuchelt hatte, war er mit sich so sehr am Ende, dass er einen Meister aufsuchte. Der gab ihm den Auftrag, allein und nur mit eigener Hände Arbeit einen Turm zu errichten, von dessen Zinne man weit übers Land blicken könne. Milarepa schuftete drei Jahre lang, bei jedem Wetter, Tag und Nacht, wie in Trance. Als der Turm fertig war, stieg der Meister mit Milarepa hinauf, schaute sich um und sagte: „Und nun baust du den Turm zurück, Stein um Stein, sodass nichts mehr davon übrig bleibt.“ Milarepa tat, wie ihm geheißen. Und darauf nahm ihn der Meister als Schüler an.
Während Lilias Abwesenheit in den Staaten, brach zwischen Igor und seinem Vater ein heftiger Streit aus. Es ging um die Geschäftsübergabe und darum, wer die Betriebe später weiterführen solle. Die Männer gerieten in Rage. Igor brüllte wutschnaubend: „Ich habe doch einen Sohn! Wenn du kein solcher Tyrann wärst, hätte ich dir das längst gesagt.“ Igors Vater erstarrte. Er öffnete die geballten Fäuste – und auf seinem Gesicht blühte überraschend ein Lächeln auf. Er fiel über Igor her. Heulte. Grölte. Konnte sich kaum fassen vor Begeisterung und Erleichterung. Er schüttelte Igor wie einen Sack. „Warum hast du mir nichts davon gesagt, du elender Schuft.“ Igor ließ ihn gewähren.
„Und wie heißt das Prachtsstück?“ „Alain“, erwiderte Igor. „Und wo hast du ihn versteckt?“ „Nirgendwo. Er lebt bei seiner Mutter. Ich sehe ihn selten.“ „Das müssen wir sofort ändern. Du rufst die Frau an. Und ich will euch alle drei heute zum Abendessen auf dem Hof sehen.“
Igor zog es vor, seinem Vater nicht zu widersprechen. Er trollte sich und versuchte, dem Befehl nachzukommen. Die Verbindung kam nicht zustande. Erst vier Tage später bekam der Vater seinen Enkel zu Gesicht. Der Elfjährige gefiel ihm auf Anhieb. Über Blutsverwandtschaft ging nichts.
Und so kam es, dass Lilia, als sie von ihrer Reise zurückkehrte, auf eine fremde Frau in Igors Wohnung stieß - und einen Rotschopf von elf Jahren, den Igor ihr als seinen Sohn vorstellte. Es war ein schwerer Schlag für Lilia, obwohl sie versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Ihr war, als werde ihr das Herz aus dem Leib geschossen.
Lilia schlich sich mit Mali davon. Erschöpfung. Die Tausend Eindrücke der Reise, katapultierten sie aus ihrer Euphorie in die Hölle. Igor versuchte, sie anzurufen, doch Lilia antwortete nicht. Er versuchte, mit seinem Schlüssel in ihre Wohnung zu gelangen. Doch Lilia ließ den ihren innen stecken. Igor rief nach ihr. Bettelte. Wollte alles erklären: Lilia reagierte auf nichts. Es fühlte sich an, als liege ihr Leben in Trümmern. War das der Preis, den Erfahrungen kosteten?
In den folgenden Wochen und Monaten folgte ihr der Begriff „ein-Mann-wie-Igor“ wie ein Schatten. Sie hätte es wissen müssen: „Ein Mann wie Igor“ scherte sich nicht um Treue. „Einem Mann wie Igor“ hängten sich ungefragt zehn ihrer Sorte an jede Hand. Wie war sie nur so kurzsichtig gewesen? Nur weil sie toll miteinander tanzten? Nur weil er so prächtig aussah? Gut roch? Und ihr einfach gefiel?
Lilia schlug sich wund an diesem „ein-Mann-wie-Igor“. Sie heulte sich ihr Leben von der Seele – bis sie nicht mehr wusste, ging es nun um Igor oder um ihr verflixtes Dasein, das wie Leim an ihr klebte.

Es wurde Winter, den sie mit sich allein verbrachte, mit ihren Übersetzungsarbeiten und den Gruppen in Körpertherapie, die rund liefen, und aus denen sich Freundschaften entwickelten. Die Wochenenden waren am schlimmsten zum Überstehen. Zum Glück hatte sie Mali, ihre alt gewordene Spanieldame, mit der sie lange Wanderungen unternahm, die sie beide müde und ruhig machten. Auch hatte sich Lilia einen Fernseher zugelegt. Obwohl sie das immer noch als Niederlage betrachtete. Der Fernseher als Tröster und Überbrücker? Und wenn schon. Zu ihrer Überraschung wurde er weitaus mehr als nur ein Lückenbüßer. Es fesselte Lilia, Handlungsstränge zu verfolgen, und Verhaltensmuster zu beobachten. Und dass sie nicht mehr aus dem Haus gehen musste, um sich Filme anzuschauen, freute sie.
Einmal erspähte sie Igor von ferne, seinen Jungen an der Seite. Lilia entwischte in eine Seitengasse. Igor schrieb Lilia Briefe, in denen er darlegte, die Mutter von Alain lebe nicht bei ihm und ziehe das auch nicht in Betracht. Sie gehe voll auf in ihrem Job als Filialleiterin. Und er habe sich auch keinen Ersatz für Lilia zugelegt. Sie sei im Irrtum mit ihrer Ansicht, seine mangelhafte Treue betreffend.
Es nützte nichts. Lilia ertrug es nicht, ihn zu sehen oder ihm zu schreiben. Es war zu früh. Eine Tür war zugeschlagen worden, und eine andere noch nicht aufgegangen. Erst einmal brauchte sie Zeit. Viel Zeit.
Dass Igors Schläfen ergrauten, machte ihn noch attraktiver. Ebenso dass er ein wenig zunahm, seine Wangen voller wurden, und der Blick sanfter. Er schrieb, er möchte mit Lilia alt werden, ihrer unterschiedlichen Auffassungen zum Trotz. Und ihre leere Wohnung gähne ihn an. Lilia ließ schweigend die Zinszahlungen weiterlaufen.
Manchmal kam ihr Stepan im Wald auf seinem Hengst entgegen, Alexa am Zügel. Sie ritten zusammen und – vorausgesetzt Igor weilte auswärts – verbrachten den Abend miteinander in seiner Wohnung, wärmten einander, Seite an Seite. Assen. Tranken. Ruhten aus. Stepan war ausgezeichnet im Raumgeben. Und manchmal ließ Lilia einen Gruß an Igor zurück.
Die Monate vergingen. An einem Morgen, beim Frühstück, streifte Lilia der Gedanke, es könnte nun Zeit für Bernd sein, zu sterben. Es fühlte sich so an. Und tatsächlich entdeckte sie drei Tage später einen Nachruf auf ihn in der Zeitung. Auch Lilias Scheich hatte sich, wegen Alter und Krankheit, in sein Heimatland zurückgezogen. Und Lilia sah sich nach einer Gelegenheit um, sich ihren lange gehegten Wunsch, Zen-Meditation zu studieren, zu erfüllen, entdeckte ein entsprechendes Kloster ganz in ihrer Nähe. Denn das Viele, in ihr Gewachsene, brauchte Platz - mehr Platz - um sich zu entfalten.
Eines Tages, gegen Mittag, ging Lilia in Gedanken versunken, nach einer ihrer Gruppenstunden, eine Quartierstrasse entlang. Hinter sich hörte sie Motorenschnauben. Ein Fahrer versuchte, sie auf sich aufmerksam zu machen. Lilia drehte sich um. Der Fahrer war Igor. Sein Fahrzeug eines der in Mode gekommenen, hochrädrigen Monstermobile. Es fuhr langsam auf Lilia zu.
Die Eingebung traf Lilia wie ein Blitz: Sie ließ sich sackschwer zu Boden fallen. Bremsen kreischten. Langsam glitt das Fahrzeug über Lilia hinweg. Es roch nach Benzin, Öl und Staub.
Als es über Lilia wieder tagte, setzte sie sich auf. Das Auto stand taub und stumpf da, wie ein verschrecktes Ungeheuer. Igors entsetzten Blick - die Wut in seinem geliebten Gesicht - die fürchterliche Angst: Lilia nahm sie wahr, wie projiziert auf eine Wand.
Sie erhob sich - auf ihrer Handtasche die bizarre Zeichnung einer Radspur. Es schepperte, als sie die Tasche umhängte…..
Lilias Augen begegneten gründlich Flimmerndem. Sie streckte die Hand aus nach der flauschigen Wärme des Tiers.
Wie Nebel zerging der Wolf. Doch als Lilia ihre Finger öffnete, fand sich darin ein Büschel glänzenden, robusten Fells.....
Jahre vergingen.....
(Fortsetzung siehe meet-my-life: Rut Sigg, "Über die Brücke des Atems".

=====================
(c) 2021 Rut Sigg - alle Rechte vorbehalten







