Zurzeit sind 544 Biographien in Arbeit und davon 324 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 202




für Hans Peter, Felice, Elena und Livia. Für meine Geschwister, Nichten und Neffen.

Die kommenden Geschichten reihen sich aneinander wie die Ringe eines Wurms. Ein Satz setzt den nächsten fort. Es ist ein Wurmfortsatz.
Der Wurmfortsatz sei ein unnützes Anhängsel und für uns Menschen nicht mehr notwendig. In meiner Kindheit war die Entfernung des Blinddarms eine der häufigsten Operationen. Sobald ein Kind im Spital war, fragte man sich, ob es wegen des Blinddarms oder des Schneidens der Mandeln abwesend war. Bei mir ist alles noch drin.
Es fragt sich, ob der folgende Wurm genau so unnütz ist wie der Wurmfortsatz.
Es gibt Dinge, die sind “nützlich und schön”, und andere sind “unnütz und unschön”. Zudem gibt es die “nützlichen und dennoch unschönen” Dinge. Auf keinen Fall zu vergessen ist die Kategorie “nutzlos und schön”. Diese Dinge hält man tausendmal in den Händen, dreht und wendet sie und kann sich kaum entscheiden, ob sie für den Abfall oder die Schatztruhe bestimmt sind.
Um es auf den Punkt zu bringen: Meine Geschichte aufzuschreiben wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Es ist ja bereits so viel geschrieben. Für mich war es aber unheimlich schön mich in meine Geschichte zu vertiefen und diese auch weiter zu erzählen.

Nicht jede Geschichte steht in direktem Zusammenhang mit der nächsten. Sie sind nicht chronologisch geordnet. Zusammen ergeben sie ein Patchwork aus Geschichten. Sie handeln von Erlebnissen in Sins, meiner Kindheit und meiner Ursprungsfamilie. Darunter gemengt sind Reflexionen und Beschreibungen zu meiner Krebserkrankung. Denn es war diese spezielle Zeit, die mir ermöglichte, mich dem Schreiben zu widmen.
Als Kind schämte ich mich sehr für meinen zweiten Namen. Er wurde wegen meiner Tante Emmi gewählt und war so altmodisch.
Meine Abneigung dem Zweitnamen gegenüber hat sich ins Gegenteil verwandelt. Heute bin ich sehr stolz auf ihn. Deshalb lasse ich mir diese einmalige Gelegenheit nicht entgehen und räume dem schönen Namen hier einen Ehrenplatz ein. Die Autorin des Buches heisst Emma. (Anmerkung für die Wiedergabe meiner Geschichte in meet-my-life: Den Namen "EMMA" gab ich mir in der Buchausgabe von Edition Unik. Denn im Rahmen des Schreibprojekts von Edition Unik schrieb ich meine Geschichte erstmals auf. Leider wird dieses gute Schreibprojekt nicht weiter bestehen und auf Ende 2025 total aufgelöst.)

Ende des 19. anfangs 20. Jahrhunderts war eine Zeit des Pioniergeistes und der Ingenieurskunst. Die grossen Bergbahnen aufs Jungfraujoch oder über den Berninapass wurden gebaut. Die ersten Autos gehörten zum Strassenbild und man tüftelte an Flugobjekten. Davon fühlte sich mein Vater angezogen. Als junger Mann zwischen den zwei Weltkriegen lebte er seinen Erfinderdrang aus, indem er in einem Segelflugklub Segelflieger und Doppeldeckerflugzeuge aus Holz konstruierte. Mut, Holz, ein paar Flugkenntnisse und der Wunsch zu fliegen genügten. Das Flugzeug bot Platz für eine Person. In meiner Erinnerung erfolgte der einmalige Flugversuch vom Dach eines Schopfes. Da sei wohl meine Fantasie mit mir durchgebrannt, meinte mein ältester Bruder Hans. Denn er wusste mehr über die Flugabenteuer.
Die Rolle des Vaters im Segelfliegerklub war das Erbauen und Konstruieren der Flugobjekte. Selbst sei er nie geflogen. Nach seiner Erzählung starteten sie die Segelflieger, die das Baujahr von ungefähr 1943 hatten, auf der Rigi mit der Gummiseiltechnik. Das Flugzeug wurde hinten mit einem Pflock befestigt. Gummiseile wurden ans Flugzeug montiert und einige Männer spannten diese Gummizüge weit nach vorne. Wenn sich der mutige Mann im Cockpit des Einplätzers installiert hatte, wurde das Seil vom Pflock gelöst und der Segelflieger wurde in die Luft gespickt. Offenbar ging es immer gut aus. Von einem Unfall oder dergleichen haben wir nie etwas gehört. Die Faszination für Oldtimerflugzeuge ist 70 Jahre später wieder neu erwacht. Mit derselben Abflugtechnik spicken sie auf der Rigi Segelflieger mit Baujahr aus den 40er Jahren wieder in die Luft.
Die Flugfaszination blieb bei unserem Vater ein Leben lang erhalten. So mussten wir etwa 25 Jahre später nach Verwandtschaftsbesuchen im Luzernerland jeweils einen Stopp in Beromünster einschalten. Auf dem kleinen Flugplatz beobachteten wir das Starten und Landen der kleinen Flugzeuge. Dabei schaute sich der Vater um, ob irgendwo neue Flugzeugmodelle zu entdecken waren. Mein Bruder Hans erinnerte sich, wie er mit dem Vater viele Stunden auf dem kleinen Flugfeld in Birrfeld bei Brugg verbracht hatte.
Der Vater kaufte die Schreinerei seines Schwiegervaters in Ättenschwil. Diese wurde nach einigen Jahren zu klein. Vaters Innovationsgeist kam von neuem zum Vorschein, als er in Sins eine grössere Schreinerei bauen liess. Rund 100 Jahre und über drei Generationen dauerte der Familienbetrieb, der zuerst unter dem Namen Bucher und später unter Mühlebach bekannt war. Im Jahre 2021 wurde das Haus mit allem Drum und Dran abgerissen und machte einer neuen Siedlung Platz.
Mein Vater war ein humorvoller, kreativer und fleissiger, kleingewachsener Mann. Der Humor blieb viele Jahre verborgen und erschien in den letzten Lebensjahren von Neuem, als sein Leben wieder sehr viel entspannter wurde. Immer verfügbar war aber sein kreatives Denken. Davon habe ich viel von ihm geerbt. Er hatte viele Ideen, wie er Geheimfächer für Schwarzgeld in seine Buffets einbauen konnte. Darin bewahrten die späteren Besitzer der Buffets einen Teil ihres erarbeiteten Geldes auf und versteckten es so vor den Steuern. Man erzählt sich, dass die Besitzer manchmal ihr Geld vergassen und die Nachkommen nichtsahnend die Möbelstücke weggaben.
Von meinem Vater habe ich auch das Schreinern gelernt. Wir mussten als Kind nicht nur unheimlich viel in der Werkstatt arbeiten, wir durften die Werkstatt auch nutzen. So bastelte ich viel mit Holz und lernte den Umgang mit Holzbearbeitungsmaschinen. Besonders viel habe ich in der Schreinerei in den 2½ Jahren gemacht, als mein Vater Witwer war, und ich einmal pro Monat nach Hause ging. Ich brachte jedes Mal ein Holzprojekt mit. Mein Vater und ich verbrachten den Samstag in der Werkstatt. Er beobachtete mich vom Holzschemel aus, wie ich mein Bett, mein Spinnrad oder meinen kleinen Webstuhl herstellte. Von dieser Position aus gab er mir professionelle Anleitungen und vermittelte mir das Handwerk. So genoss ich quasi gratis eine kleine Schreinerlehre. Elterliche Anerkennung war etwas sehr Rares in unserer Kindheit. Umso stolzer und glücklicher machte mich das väterliche Lob, als er zu mir sagte, dass ich die Schreinerlehre glatt im 2. Lehrjahr beginnen könnte.

Auf den eher unfreiwillig gemachten Wanderungen versuchte ich unseren Mädchen meine wenigen botanischen Kenntnisse zu vermitteln. Die Begeisterung für die Namen der Blumen und Bäume war genau so klein wie fürs Wandern. Aber zwei Bäume mussten sie einfach kennen: die Buche und den Nussbaum. Denn aus diesem Holz sind sie gemacht. Schliesslich hiessen beide Grossmütter mit ihren Mädchennamen wie Bäume. Hans Peters Mutter hiess Nussbaum und meine Mutter hiess Buche(r). Mein Vater liebte Bäume und vor allem das Holz, woraus sie bestanden. Sein absoluter Favorit war der Nussbaum. Oh, wie hätte ihm Frau Nussbaum - zumindest wegen ihres Namens - sehr gefallen. Denn am liebsten stellte mein Vater Möbel aus Nussbaum her.
Solche Bäume suchte er sich gerne im ungefällten Zustand aus. So geschah es, dass er bei Sonntagspaziergängen oft an der Tür eines Bauern klingelte und sein Interesse an diesem oder jenem Baum unmittelbar bei der richtigen Person platzierte. Leutescheu war mein Vater nicht. Besonders lange mussten wir gelangweilt daneben stehen, wenn er auf jemanden stiess, mit dem er sich ausgiebig über Holz und Holzverarbeitung unterhalten konnte.
Mein Vater bildete sich bis zum Schreinermeister weiter. In den frühen 30er und 40er Jahren war er Geselle und auf Wanderschaft. Die meisten Distanzen wurden zu dieser Zeit mit dem dem Velo zurückgelegt. Er verkehrte wöchentlich zwischen den Orten Bremgarten, Ättenschwil und Oberkirch. Ättenschwil lag ziemlich genau in der Mitte zwischen seiner Arbeitsstelle in Bremgarten und seinem bäuerlichen Elternhaus in Oberkirch. Im Jahr 1930 war er beim Schreiner Jakob Bucher in Äettenschwil angestellt. So machte er 14 Jahre später sehr gerne bei Familie Bucher einen Pausenstopp. Besonders die elf Jahre jüngere Marie hatte es ihm angetan. Für ihn war langsam die Zeit für eine Familiengründung gekommen, und deshalb warb er sehr aktiv um die Schreinerstochter. Dazu wählte er Ansichtskarten mit Kindersujets. Auf der ersten Karte schrieb er sie mit “wertes Fräulein Bucher” an. Schon bald wurde vorsichtig “liebes Fräulein Marie” geschrieben, bis der Mut über ihn kam und er seine Zukünftige mit “allerliebste Marie” ansprach. Etwa 25 von diesen liebevoll handgeschriebenen Karten schickte er von Mai 1943 bis August 1944 nach Ättenschwil. Über so viele schöne Worte und grossartige Liebesbekundungen könnte man glatt neidisch werden.
Meine Mutter trug das ihrige dazu bei. Sie klebte die Ansichtskarten mit den Kinderbildern in ein goldbraunes Album. Auf jeder Seite schrieb sie in Gedichtform den jeweiligen Stand der Beziehung. Sie offenbarte darin den ersten Kuss und den Moment des Heiratsantrags. Auf der nächsten Karte war postwendend ein Kinderpärchen abgebildet, das Händchen haltend auf einer blumigen Wiese stand. Am Rand der Karte schrieb mein Vater noch eine Bemerkung darauf: “So Zwei wie Wir Zwei”. Die Hochzeit fand kurz vor Ende des zweiten Weltkrieges im April 1945 statt.
Vier Jahrzehnte vergingen. Das Album schlummerte still und beinahe vergessen vor sich hin. Die Blätter vergilbten und wurden brüchig. Wer hat schon eine Vorstellung über das frühere Leben der eigenen Eltern. Bei uns war das nicht anders, bis zu dem Moment, wo dieses Buch auftauchte und uns die überraschende Liebesgeschichte unserer Herkunft erzählte.
Das Album wurde nach dem Tod meiner Mutter in ihrem Kleiderschrank entdeckt. Mit Stolz in den Augen gab uns der Vater die Erlaubnis diesen grossartigen Fund zu lesen. Seither bewahre ich es mit grosser Achtsamkeit auf. Denn ich wurde zur glücklichen Erbin dieses sehr persönlichen und berührenden Zeitdokumentes.

Jeder wusste schon lange vor meiner Geburt, dass ich kein Knabe sein würde. Bei uns kamen die Knaben jeweils im Schaltjahr und streuten sich schön regelmässig zwischen die Mädchen. Viermal hat sich diese Regel bestätigt. Das erste Mal 1948 und das letzte Mal 1960. Mein Geburtsjahr gehörte nicht dazu. Dafür waren die Schweizer Seen in diesem Februar gefroren.
Meine Mutter gönnte sich das erste mal eine Spitalgeburt im St. Annaspital in Zug. Vom Spitalfenster aus konnte sie direkt die Schlittschuhläufer und Spaziergänger auf dem Zugersee beobachten.
Eine ganze Woche blieb sie stationär. Nach 10 Hausgeburten war es für sie eine völlig neue Erfahrung nach der Geburt so gut umsorgt zu werden. Beim Gebären war unsere Mutter nie gross auf medizinische Hilfe angewiesen. Die Unterstützung einer erfahrenen Hebamme genügte. Von meiner Mutter lernte ich, dass schwanger sein und gebären keine grossen Sachen seien. Sie bekannte mir später einmal, dass die Probleme und die Anstrengungen erst später kämen. In dieser einen Woche Geburtsferien im Spital musste sie sich um nichts kümmern. Für einmal war nicht sie für alles zuständig sondern konnte sich für einmal aufgehoben und umsorgt wissen.
Dieser Spitalaufenthalt mit Geburt und Pflege kostete insgesamt Fr. 564.95.- Die Krankenkasse vergütete davon 153.- und der Rest von Fr. 411.95 musste selbst bezahlt werden. Die Spitalrechnung lag in einer Schachtel mit unzähligen anderen Rechnungen fein säuberlich aufbewahrt.
Auf der mit Schreibmaschine getippten Spitalrechnung kann man die Details der Rechnung sehen. Z.B. kostete die Hebamme und der Geburtssaal Fr. 70.- und der Verbrauch der Geburtswäsche Fr. 30.-. Dank der gewissenhaften Buchhaltungsführung meiner Mutter konnte ich sämtliche Ereignisse meiner Kindheit später rekonstruieren. Wie heisst es doch so schön: „follow the money“.
So fand ich unter anderem die Arztrechnung meiner Naht an der Stirn. Mit sechs Jahren hatte ich einen Zusammenstoss mit einem Auto. Ich rannte damals gedankenlos über die Strasse zu unserem Nachbarn. Dieses Ereignis hatte ich komplett aus meiner Erinnerung gelöscht. Erst als ich wegen der Chemotherapie keine Haare mehr hatte, wurde ich wieder daran erinnert. Denn die Naht wurde überraschenderweise wieder sichtbar.
Auch an den Zahnarzt wurde ich durch die Quittungen erinnert. Die Zähne wurden beim Dorfzahnarzt geflickt. Mit Angstschweiss und verheulten Augen lag ich auf dem Zahnarztstuhl und wurde mit Lachgas eingeduselt. Beim nach Hause laufen beteuerte mir die Mutter jedes Mal, dass es doch überhaupt nicht schlimm gewesen wäre und dass sich das Geheul doch keineswegs gelohnt habe. Trotz dieser Worte konnte sie das Heulen beim nächsten Besuch nicht verhindern. Dafür hatten sich die Zahnbehandlungen wirklich gelohnt. Viele der Amalganfüllungen waren selbst nach über 40 Jahren noch immer gut. Diese waren im Verhältnis schon recht teuer und kosteten Fr. 45.- pro Stück.
Jede Rechnung von uns Kindern belastete das Haushaltsbudget aufs gröbste. Aber die Gesundheit war meiner Mutter sehr wichtig, denn wir blieben nicht unverschont von Krankheiten. Anne hatte Asthma. Sie musste während ihrer Kindheit einige Male auf die Rigi zur Kur. Dort kam sie in Kontakt mit französisch sprechenden Kindern, und sie lernte noch vor dem Kindergarten ihre ersten Französischwörter. Ganz beflissen wendete sie ihr neues Wissen zu Hause an. Die beiden Sätze “sanöwapa” oder “saonöfäpa” gefielen ihr besonders gut.
Meine Schwestern Agnes und Theres schielten durch die Gegend und mussten regelmässig in die Sehschule, und der Seppi hatte die Zuckerkrankheit. Die Betreuung von Seppi nahm die Mutter besonders in Beschlag. Somit wusste Käthy, dass sie keinesfalls auch noch etwas haben dürfe.
Meine Augen waren gut, dafür kosteten die Zähne. Meine Zahnstellung war nicht vorteilhaft, und sie wurden mit Erfolg korrigiert. Ich war sehr glücklich darüber, denn in der Schule wurde ich wegen meinen vorstehenden Schaufeln oft genug gefragt: „wotsch es Nüssli?“ Diese Rechnungen lagen ebenfalls in der Kiste. Sie beliefen sich auf Fr. 3‘360.- Im Vergleich dazu kostete die Zahnstellungskorrektur meiner Töchter 30 Jahre später mehr als 12’000.- pro Tochter. Zum Glück hatten wir für sie rechtzeitig eine Zahnversicherung abgeschlossen.
Die Gesundheit, und insbesondere der Erhalt der Gesundheit, nahm nach der Kirche den zweitwichtigsten Platz in der Werteskala der Mutter ein. Damit wir gesund und kräftig blieben, wurde uns täglich ein Löffel Biomalt verabreicht. Diese Büchse mit dem honigähnlichen Inhalt kannte zu dieser Zeit wohl jedes Kind in der Schweiz. Dann gab es die Nestrovittäfeli. Sie sahen aus wie Schokoladetäfeli. Diese enthielten 11 Vitamine und 4 Mineralstoffe. Da Schokolade etwas sehr Rares war, kam diese Gesundheitsschokolade gerade recht. Widerlicher hingegen war der Lebertran, er roch abscheulich und lag dickflüssig auf einem Löffel. Heikel tun oder zimperlich sein hatte bei uns keine Chance. Alle öffneten brav den Mund.
Ich bin natürlich froh, dass ich als Mädchen geboren wurde. Die Mutter verriet mir, dass der Vater unbedingt noch einen Gottfriedli haben wollte. Dieser Name eines Onkels war in unserer Familie noch nicht vertreten. Gegen diesen Namen setzte sich meine Mutter vehement zur Wehr und schlug „Martin“ als Alternative vor. Aber, da mein Jahrgang sowieso kein Schaltjahr war, erübrigte es sich den Kopf und den Hausfrieden wegen des Namens zu zerbrechen. In einem waren sie sich jedoch sehr einig. Ich musste auf den Namen einer Heiligen getauft werden. Rita von Cascia wurde ausgewählt. Sie ist die Schutzpatronin für die Metzger und wird in aussichtslosen Fällen angerufen. Rita ist die Kurzform des Namens Margarita und bedeutet die „Perle“. Ich war nie wirklich begeistert von meinem Namen, bis ich auf Reisen feststellte, wie praktisch er war. Die ganze Welt verstand ihn. Ich musste nie buchstabieren oder Erklärungen abgeben. Sogar in Indien war es ein beliebter Mädchenname und bedeutete dort die „Wahrhaftige“.
Wir wären eigentlich sieben Schwestern gewesen. Die zweitgeborene Katharina starb im zweiten Altersjahr an einer Lungenentzündung. Antibiotika war gerade erst erfunden worden. Meine Eltern hatten offenbar damals noch keinen Zugang zu diesem Wunderheilmittel. Das frühverstorbene Schwesterlein war während meiner Kindheit noch sehr präsent. Nicht, dass man viel davon gesprochen hätte. Dies zeigte sich vielmehr durch die Besuche an ihrem Kindergrabstein. Der Kinderfriedhof war ein magisch anziehender Ort. Ich kannte nicht nur den Grabstein meiner kleinen grossen Schwester bestens. Auch die Namen und das Alter von vielen andern Kindern wusste ich auswendig. Gerade das Halbwissen über deren Schicksale löste ein unheimlich schönes Gefühl von Neugierde, Wehmut, Angst und „Tschuddern“ aus. Nirgends sonst war ich der Geisterwelt so nahe und auch der beängstigenden Tatsache, dass der Tod auch vor Kindern nicht zurückschreckt.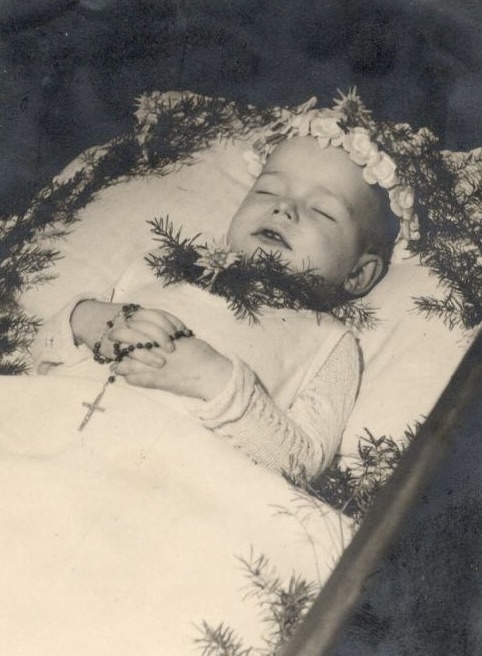
Die zweitgeborene Schwester Katharineli

Die Todesanzeige
Meine Schwester wäre 16 Jahre alt gewesen, als ich geboren wurde. Ein kleines Album mit schwarzweissen Fotos ermöglichte es mir ein Bild von Katharineli zu machen. Auf dem ersten Bild sah man das 1 3/4 Jahre alte Kind im Sarg liegen. Ein weiss gekleidetes hübsches und friedliches Kind. In den gefalteten Händen hielt es einen Rosenkranz.
Meine Mutter litt ein Leben lang unter dem Gefühl nicht alles zur Rettung der zweitgeborenen Tochter getan zu haben.
Meine älteste Schwester Maria musste ebenfalls den Tod eines eigenen Kindes erleben. Lea, die zweite Tochter, starb mit knapp 30 Jahren während einer Skitour durch eine Lawine.
Auch Hans Peter und seine Familie wurden von einem solchen Schicksal nicht verschont. Bei ihnen starb der kleine Kurtli mit 4 Jahren bei einem Autounfall.
Es wäre gelogen zu sagen, dass sich meine Eltern so viele Kinder gewünscht hätten. Die Religiosität mit der Botschaft, dass die Kinder ein Segen Gottes seien, war im Kopf und im Freiamt stark verankert. Vier Kinder hätten meiner Mutter gereicht. Die nächsten sechs nahm sie als Geschenk hin und schickte sich in ihr Schicksal.
Es kostete sie viel Kraft und das totale Zurückstellen eigener Bedürfnisse. Sie gab, was sie konnte. Ich hätte mir mehr elterliche Fürsorge gewünscht, aber spürte, dass es soviel gab, wie in dieser Situation überhaupt möglich war.
Zwischen uns zehn Geschwistern liegt altersmässig fast eine Generation. Wir haben trotz des Altersunterschieds vieles gemeinsam. Wir sind doch alle aus demselben Holz geschnitzt. Das Arbeitsame, das wir in der Kindheit lernten, konnte niemand im späteren Leben abschütteln. Die meisten sind sportlich und lieben Bergtouren. Bodenständig, ideenreich und engagiert sind alle. Luxus, tolle Autos oder ein Leben auf der Teppichetage bedeutet niemandem etwas.
Wir erlebten, wie sich unsere Eltern abrackerten, um alle Kinder zu ernähren und jedem eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Deshalb strebte niemand von unserer Generation eine kinderreiche Familie an. Auch die Kirche hatte inzwischen nichts mehr dazu zu sagen. Es kamen insgesamt 17 Nachkommen von uns zehn Geschwistern.

Meine Mutter war eine blitzgescheite Frau und ein Organisationstalent. Sie managte den ganzen Betrieb. Wenn ich die Mutter suchte, war sie meistens im Büro. Dort schrieb sie Offerten und Rechnungen oder machte die Buchhaltung. Gar nicht gerne hatte sie die Unterbrechungen durch das Läuten an der Ladentür. Aber das war ein Teil des Geschäftes. Sie musste mit potentiellen Kunden die Ausstellung im oberen Stock durchschreiten. Denn das Möbelhaus Mühlebach bestand aus der Schreinerei und einer Möbelhandlung. Über der Werkstatt war der zweistöckige Ausstellungsraum von jeweils 100m2 Verkaufsfläche. Dort lagerten die Möbel, die zum Weiterverkauf bestimmt waren. Natürlich konnte lange nicht alles weiterverkauft werden. Dadurch kam ich in meiner Jugendzeit zu einer kompletten neuen Zimmereinrichtung. Sie bestand aus einer Kombination von Bett, Nachttisch, Schrank und Pult, alles im selben Stil hergestellt. Es war mein grosser Stolz. Damit war ich topmodern, und ich verpasste keine Gelegenheit meine Freundinnen in mein Zimmer einzuladen.
Falls meine Mutter nicht im Büro war, hatte man grosse Chancen sie an der Nähmaschine am grossen Esszimmertisch zu finden. Sie fertigte auf Wunsch Vorhänge nach Mass an. Bei uns konnte man die komplette Wohnungseinrichtung für bald heiratende Paare finden. Dies war unser Zielpublikum. Denn zu dieser Zeit kaufte man sich nur einmal im Leben Möbel. Mein Vater hätte sich nicht in seinen schlimmsten Alpträumen vorstellen können, dass IKEA und Billigmöbelhäuser einmal die Möbelbranche überrollen würden.
Meine Mutter bedauerte ein Leben lang, dass sie keinen Beruf erlernen konnte. Sie wäre gerne Lehrerin geworden. Die ältere Schwester Anna entkam ihrem damaligen Frauenschicksal, indem sie ins Kloster ging. Dort konnte sie sich zur Krankenschwester ausbilden lassen. Das Kloster bot ihr zudem die Möglichkeit über 40 Jahre lang in Tansania zu arbeiten. Sie bekam einen Ordensnamen und hiess von nun an Luitberta. Die jüngere Schwester Ottilia konnte eine Ausbildung als Kinderkrankenschwester machen. Unsere Mutter beneidete sie deswegen ein Leben lang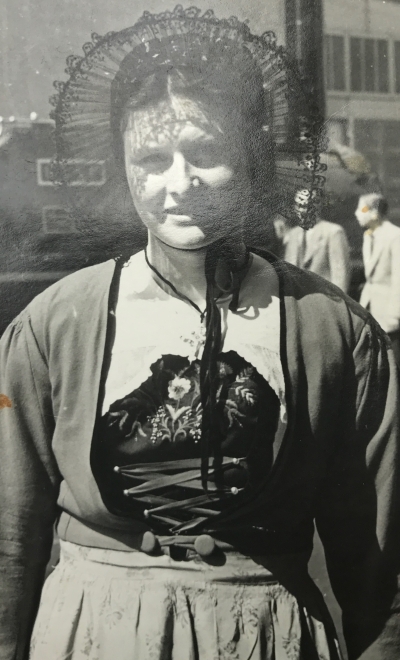
Das Stimmrecht für Frauen wurde in der Schweiz erst 1972 eingeführt. Da war Mutti bereits 52 Jahre alt. Von diesem Moment an schritt sie mit Stolz und hocherhobenen Hauptes ins Gemeindehaus und gab ihre Stimme für jede Vorlage und für alle Wahlen in der Urne ab.
Das Thema “3. Welt” war sehr präsent bei uns. Die Mutter engagierte sich über Jahrzehnte in der 3. Weltgruppe in Sins und traf dort regelmässig ihre engsten Freundinnen. Dazu gehörte Frau Dr. Huber und Frau Dr. Sommaruga, die Mutter der späteren Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Die Ehefrauen der Doktoren wurden zu dieser Zeit mit grosser Selbstverständlichkeit mit dem Titel des Ehemannes angesprochen.
Simonetta Sommaruga ging in die selben Schulklasse wie mein Bruder August und war zufälligerweise auch in der selben Ausbildungsklasse am Konservatorium wie meine Schwägerin Andrea, der Ehefrau von August.
Mutti pflegte auch sehr guten Kontakt zu den jungen Frauen des Dorfes. Als sie schon über 60 Jahre alt war, ging in nächster Nähe ein Café auf. Jeweils am Donnerstagabend fand dort ein Frauenabend statt. Meine Mutter fühlte sich angesprochen und gesellte sich unter die rund zwanzig Jahre jüngeren Frauen. Sie erzählte mir mit Begeisterung von diesen Bekanntschaften und den lebhaften Gesprächen.
Als wir Kinder ausser Haus waren, konnte sie sich erneut ihren Interessen widmen. Während der Vater im Fernsehstuhl in der Stube einnickte, las sie im Esszimmer nebenan ein Buch nach dem andern. Sie besuchte Glaubenskurse und setzte sich intensiv mit der neueren Auslegung der Kirche auseinander. Sie fand es gar nicht stimmig, dass die Frauen in der katholischen Kirche keinen wirklich würdigen Platz hatten. Der Theologe und Philosophe Hans Küng war ihr grosses Vorbild. Sie war von Grund aus eine "Freidenkerin" und gab uns dieses Denken in den Genen mit.
Es ist mir ein Rätsel, wie unsere Mutter sowohl die randvollen Tagespflichten, das soziale Engagement als auch die Kontaktpflege zu so vielen Menschen unter einen Hut bringen konnte. Ihr Hut muss wirklich riesig gewesen sein.

Ich kam mit einer rosaroten Brille auf die Welt. Die schlimmen Dinge sah ich oft nicht auf den ersten Blick. Das zeigte sich auf dem Flug nach Lodja. Ich war gerade 20 Jahre alt, und es war meine erste Flugreise. In Lodja besuchten Theres und ich unsern Bruder August im damaligen Zaire - heute "demokratische Republik Kongo". Wir waren die einzigen Passagiere in einem viermotorigen Frachtflugzeug. Das Flugzeug musste viel Material ins Landesinnere bringen und wurde in Kinshasa gechartert. Zuhinterst im Frachtraum hatte es zwei schlottrige Sitze, die sogar mit Sicherheitsgurten versehen waren. Vor uns türmte sich das Frachtgut, das unter Netzen festgebunden war. Kurz nach dem Abflug in Kinshasa beobachteten wir, wie sich ein Propeller auf unserer Fensterseite immer langsamer drehte bis er stillstand. Ich liess mich nicht aus der Ruhe bringen und sagte ganz unbeschwert zu Theres: „Wahrscheinlich haben wir die Flughöhe“. Erst als die Piloten mehrmals das Gepäck kontrollierten und einer von ihnen zu uns blickte und den Daumen hochhielt, realisierte ich den Ernst der Lage. Das Flugzeug ist schlussendlich gut in Lodja gelandet.
August holte uns am Flughafen mit einem Lastwagen ab. Unsere Reise ging auf Schotterstrassen weiter zu seinem Einsatzort. August wusste schon recht gut, wie Afrika funktionierte. Wir sassen neben ihm in der Führerkabine, als ein Polizist mit Polizeihut und Uniform am Strassenrand stand und uns winkend aufforderte anzuhalten. August fuhr unbekümmert an ihm vorbei. Dazu sagte er ganz unaufgeregt: “Der rennt uns nicht nach”. Falls er angehalten hätte, wäre sein Schweizer Lastwagenfahrausweis mit Sicherheit als ungültig erklärt worden.
Einmal war die rosarote Brille nicht in griffnähe, und ich hatte richtig bodentiefe Angst. Das war ungefähr 10 Jahre später auf unserer Veloreise durch Südindien.
Hans Peter und ich fuhren über die Berge von Tamil Nadu und Kerala. Es ging über weite Strecken durch wunderschöne Teeplantagen. Unser Ziel war der Peryar-Nationalpark. Da soll man auf einem Hochsitz übernachten und die Tiere erleben können. Zwei Nächte verbrachten wir auf dem Hochsitz. Die Nacht im Urwald zu erleben war einfach fantastisch. Eine Elefantenherde graste direkt unter uns. Sehen konnten wir so gut wie nichts aber die Fressgeräusche waren aufregend genug.
Der folgende Tag war der Tag an dem ich so richtig vor Angst schlotterte. Die Parkwächter beteuerten uns mit ihren lockeren kopfschüttelnden Bewegungen mehrmals “no problem”. So fuhren wir mit Sack und Pack los. Schon bald stoppte ein Touristenbus. Der Chauffeur guckte aus dem Fenster und warnte uns vor einer Elefantenherde. Wir standen mitten im Urwald und wussten nicht, was wir mit dieser Warnung tun sollten. Einfach stehen bleiben war keine Lösung. So radelten wir weiter. Plötzlich wackelten ganz dicht neben uns sämtliche Baumkronen und die bekannten Fressgeräusche waren zu hören. Meine Knie schlotterten, das Herz fiel in die Hosen und vor lauter Nichtwissen was zu tun wäre, stieg ich vom Velo. Das war wohl das Dümmste. Hans Peter schrie hinter mir so laut er konnte: “fahr weiter, fahr, fahr”. Ein Elefant trat hinter uns aus dem Wald, drehte sich und verschwand wieder im Wald. Die Gefahr war vorüber.
Im nächsten Park begegneten wir einem australischen Tierfotografen. Seine Bilder machte er für “National Geographic”. Er erzählte von einigen Abenteuern, die er auf seinen Fototouren erlebt hatte. Nach dem Gespräch mit ihm wussten wir nun, wie wir beim nächsten Mal einem Elefanten entkommen konnten. Man soll niemals geradeaus rennen. Besser ist es Haken zu schlagen und abzuwarten, bis der Elefant jeweils die Richtung wechselt. Nach einigen Haken ist man dem Elefanten erfolgreich davongerannt. Wir hatten niemals mehr die Gelegenheit diese Fluchtmethode auf ihre Tauglichkeit zu prüfen.
Der Pessimist sagt, es sei gefährlich mit einer rosaroten Brille durch die Welt zu gehen. Unrecht hat er nicht. Trotzdem bin ich sicher, dass meine rosarote Brille schon einige Male das Unheil nicht aufkommen liess, da ich es gar nicht erwartete.

Meine Eltern hatten Jahrgang 1908 und 1919. Ich war die Jüngste der Familie mit Jahrgang 1963. Schon das allein ist komisch. Die Eltern meiner Klassenkameraden waren mindestens 20 Jahre jünger als meine Eltern. So wuchs ich sozusagen mit meinen Grosseltern-Eltern auf. Es kamen zu dieser Zeit nur noch ganz wenige Kinder aus Grossfamilien und uralte Eltern zu haben war auch selten. Deshalb war mir eine Freundin mit demselben Hintergrund sehr wichtig. Bereits am ersten Kindergartentag setzte sich Luzia neben mich und sagte: „Du hast ebenfalls alte Eltern und so viele Geschwister zu Hause, du bist meine Freundin“. Ich kannte sie vorher nicht und war komplett überrascht, was sie alles von mir wusste. Der gemeinsame familiäre Hintergrund verband uns und machte uns stark. Die Freundschaft hielt während der ganzen Primarschulzeit an.
In unserem riesigen Haus wohnten neben der Familie noch sehr viele weitere Personen. Über drei Stockwerke waren die Betten verteilt. Alle lebten von einer Küche und benutzten dasselbe Badezimmer. Toiletten gab es glücklicherweise recht viele. Geduscht hat damals niemand. Wir badeten einmal wöchentlich samstags. Dabei benutzten mehrere Kinder dasselbe Badewasser. Um heisses Badewasser zu haben musste in der Küche der Herd ordentlich mit Holz eingefeuert werden. Damit wurde das Wasser im Boiler heiss. Gleichzeitig standen immer grosse Pfannen mit Wasser auf dem Herd. Das heisse Wasser wurde dann zusätzlich in die Badewanne geleert.
Mit uns wohnten Schreinerlehrlinge und Arbeiter, die in den Mansarden einquartiert waren. Die Haushalthilfen bekamen auch ein Zimmer. Der Grossvater und eine Tante verstarben lange vor meiner Geburt. So wurden diese Schlafplätze sehr schnell wieder durch dazugekommene Kinder besetzt. Die Grossmutter lebte bei uns bis ich zehn Jahre alt war, und verstarb mit 93 Jahren.
Ich selbst erlebte keine Hausmädchen mehr. Als ich Kind war, waren meine älteren Schwestern genug alt um Haushaltarbeiten übernehmen zu können und zu den jüngeren Geschwistern zu schauen. Sie brachten die kleineren Geschwister ins Bett und wachten über sie, bis diese eingeschlafen waren. Eine sehr unbeliebte Aufgabe. Viel lieber wären sie draussen mit gleichaltrigen Mädchen gewesen. Meine Schwestern machten das Beste daraus. Sie fanden eine Methode, wie sie die Aufgabe machen konnten und gleichzeitig auch etwas Vergnügen daran hatten. Sie legten sich bäuchlings aufs Holzgestell unter dem Stubenwagen. Während sie in einem Buch lasen, schoben sie den Wagen mit den Füssen hin und her bis das Kind im Wagen eingeschlafen war.
Essen kochen und Einnehmen war ein sich täglich wiederholendes riesiges Unternehmen und musste gut organisiert sein. Wir hatten einen grossen Esszimmertisch, der ungefähr für 10 Personen Platz bot, die andern assen in der Küche. Bei uns war das Tischgebet vor und nach dem Essen ein festgelegtes Ritual. Wie viele tausend Mal hatte ich das „gegrüsst seist du Maria” gebetet? Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich es bis heute nicht auswendig kann. Das grosse Handicap war dieses zungenbrecherische Wort im ersten Teil des Gebetes: „Gebenedeit seist du unter den Frauen“ lautete es. Darüber stolperte ich jedes Mal und stammelte vor mich hin, bis das restliche Gebet zu Ende war. Vor kurzem schaute ich im Internet, was dieses ominöse Wort eigentlich hiess und fragte mich, warum man die Kinder so plagen musste. Man hätte doch einfach „gesegnet“ sagen können.
Solche Kinderwortfallen gab es noch viele. Ein Freund erzählte mir kürzlich, dass er nie wusste was “saben” wohl heisse. Er musste immer beten: “lieber Gott von dem wir alle saben” - Ja klar verstand er später: “von dem wir alles haben”.
Ich war nicht nur ein fröhliches, unternehmungslustiges und tatkräftiges Kind. Ich war manchmal auch sehr traurig und habe viel geweint. Was mich traurig machte, blieb mir nicht wirklich in Erinnerung. Es gab viele Gründe. Ich glaube, ich fühlte mich oft allein gelassen und überfordert mit der Situation schon früh vieles allein anpacken zu müssen. Es fehlte unseren Eltern schlichtweg die Zeit sich um alles zu kümmern. So entstand meine frühe Selbständigkeit aus situationsbedingter Notwendigkeit.
In der Schule zeigte sich die Mischung der verschiedenen sozialen Herkünfte ganz klar und deutlich. Es gab die ursprünglichen Dörfler. Dazu gehörten die Kinder der Bauernfamilien, die Kinder der Handwerker, der Metzger, der Bäcker, der Wirte und der Gemeindearbeiter. Wir fühlten uns untereinander dem gleichen Stand zugehörig und solidarisch.
Bei den Neuen im Dorf arbeiteten die Väter entweder in den zwei grossen Betrieben Lonza und Airex oder fuhren täglich mit dem Auto nach Zug zur Arbeit. Welche Arbeit sie verrichteten, war nicht klar ersichtlich. Im Gegensatz dazu kannten wir die Arbeit unserer Väter bestens. Denn sowohl die Kinder der Bauern wie auch die der Handwerker mussten sowieso im Betrieb mitarbeiten.
An den neuen Familien haftete der faszinierende Duft des Modernen und Schicken. Sie lebten in neugebauten Einfamilienhäusern. Etwa so stellte ich mir ein elegantes Leben vor. Der Vater ging täglich zur Arbeit und die Mutter war zu Hause und hatte das Privileg ausschliesslich den Haushalt und die Kindern versorgen zu müssen. Sie konnte den Tag auf den neuen Spielplätzen oder in der Badi verbringen. So ein Leben konnte sich unsere Mutter schlichtweg nicht vorstellen. Die Rollenaufteilung der damals modernen Frau als Haushälterin und Kinderbetreuerin hielt sich nicht sehr lange. Ab zirka 1990 begann sie langsam wieder zu zerfallen. Nur zirka 20 Jahre überdauerte dieses Bild der Schweizer Familie. Meine älteste Schwester und ihre Generation waren zu dieser Zeit junge Mütter.
Die Eltern oder vor allem die Mütter der modernen Familien hatten Zeit sich für die Allgemeinheit zu engagieren und Neues entstehen zu lassen. In Sins gründeten sie den Verein „Kreativ 77“. Davon profitierten wir alle. Denn sie organisierten besonders viel für die Kinder.
Zum Beispiel gab es ab 1977 die Kinderfastnacht mit Guggenmusik, Fasnachtswagen und Umzug. Im Saal des Restaurants Einhorn wurden Mütschli und Wienerli verteilt und anschliessend wurde wild getanzt.
Die Fasnacht war nicht die einzige neue Errungenschaft. Sie stampften auch einen Robinsonspielplatz aus dem Boden. Hier durften die Kinder mit alten Holzlatten, Säge, Nägeln und Hammer tolle Bauten kreieren. Ich persönlich brauchte dieses Areal nicht. Ich hatte ja meinen eigenen “Robinsonspielplatz” zu Hause und erst noch ganz unbeaufsichtigt.
Es bestand so etwas wie ein unausgesprochener Kluft zwischen den alten und den neuen Dorfbewohnern. Dramatisch oder bösartig war dies jedoch nicht. Dank der Freundschaft, die ich mit vielen Kindern der modernen Familien pflegte, durfte ich auch vom Kindereinsatz der Mütter profitieren. Sie nahmen mich mit in die Badi oder zum Skifahren.
In der Schule waren diese Unterschiede natürlich auch zu erkennen. Es gab die Kinder, die farbig gestrickte Wollpullover mit gestrickten Strumpfhosen trugen, und Kinder, die mit modernen Tricotkleidern und den geschmeidig an den Beinen anliegenden elastischen Strumpfhosen daherkamen.
Solche Dinge lösten einen gewissen Schulstress aus. Gestresst war ich jedoch nie wegen den schulischen Inhalten. Denn diese kapierte ich schnell und problemlos. Stress bedeutete zum Beispiel das Skilager ab der 5.Klasse. Obwohl ich im Sport immer zuvorderst war, wurde ich im Skilager in die schlechteste Fahrgruppe eingeteilt und musste mit alten Brettern mit Schnallenbindung die ersten Skiversuche machen.
Ich beneidete die Kinder der Einfamilienhäuser. Ich hätte gerne meine Grossfamilie mit einer Dreikindfamilie getauscht. Im Sommer wären wir nach Rimini gefahren und im Winter in die Skiferien.
Sport bedeutete mir viel. Allabendlich ging ich auf den Schulhausplatz. Da trafen sich immer die gleichen Kinder und wir spielten Abend für Abend Fussball. Alle, die rennen konnten, durften mitspielen. Auf der Schulhauswiese wurde kein Unterschied zwischen Mädchen und Knaben gemacht. Nur der Fussballclub nahm leider keine Mädchen ins Training auf. Wir Mädchen liessen uns deswegen nicht abhalten und bildeten eine ehrgeizige Frauenmannschaft. Bei sämtlichen Grümpelturnieren in Sins und Umgebung machten wir mit. Die erste Runde überstand unser Team in der Regel problemlos und nicht selten reichte es bis ins Final. „Tschutte“ war über viele Jahre meine grosse Leidenschaft.
unsere Frauenmannschaft: Gertrud, Esther, Margrit, Luzia, Brigitte, Rita, Luzia

Meine Grossmutter war für mich die graue Eminenz der Familie. Sie hatte Jahrgang 1880. Auf ihre Mithilfe war man einfach angewiesen. Sie kochte fast immer für die gesamte Sippschaft. Ebenfalls hatte sie auch eine dominante Rolle bei der Kindererziehung. Es war unmöglich sich ihrer Gegenwart und ihrem Einfluss zu entziehen.
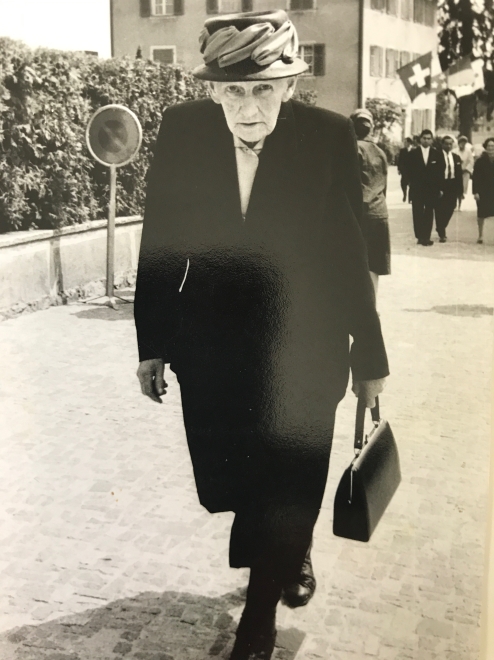
Die Grossmutter bewohnte zwei Zimmer. Neben dem Schlafzimmer hatte sie eine eigene Stube. Wenn das Tagwerk vollbracht war, zog sie sich in ihr Refugium zurück. Das war auch gut so. Denn unsere Mutter war alles andere als glücklich über die Nähe ihrer eigenen Mutter. Der Generationenkonflikt war spürbar. Besonders machten unserer Mutter die sehr engen moralischen Vorstellungen der Grossmutter zu schaffen. Der streng religiöse Erziehungsstil wurde eins zu eins bei den Grosskindern angewendet. Das entsprach ganz und gar nicht dem eher freien Geist der Mutter. Obwohl die katholische Kirche auch meiner Mutter viel bedeutete, ging es ihr doch häufig zu weit. Sie musste mit der Präsenz ihrer Mutter leben und diese Abhängigkeit aushalten und akzeptieren.
Die Grossmutter überwachte uns überall. Sie sass in der Kirche jeweils ein paar Bänke weiter hinten. Wenn wir uns da nicht gut benahmen, gab es zu Hause Schelte. Während des Gottesdienstes schwatzen oder unruhig auf den Kirchenbänken herumrutschten ging gar nicht. So vermieden wir, wenn immer möglich, zur selben Zeit wie die Grossmutter in der Kirche zu sein. Da sie aber ihr halbes Leben in der Kirche verbrachte, war dies gar nicht so einfach.
Seit dem Tod des Grossvaters im Jahr 1957 wollte sie niemals mehr allein in ihrem Zimmer schlafen. Es musste immer jemand neben ihr in Grossvaters Bett schlafen. Die Grosskinder, das heisst lediglich die Mädchen, wurden für diese Aufgabe ausgewählt. Zuerst waren meine drei älteren Schwestern Anne, Agnes und Käthy an der Reihe. Nach ein paar Jahren wechselte die Crew und meine Schwester Theres und ich mussten uns diese Aufgabe teilen. Alle zwei Woche war ich an der Reihe. Für die andere Woche hatten wir ein Zimmer mit nur einem Bett, das wir natürlich beide je eine Woche benutzen konnten.
Der Duft ihres Schlafzimmers sitzt mir noch tief in der Nase. Diese Grossmutterschlafwoche hätte ich gerne weggezaubert. Es wäre damals niemandem in den Sinn gekommen die Kinder um ihre Zustimmung zu fragen. “Ist es dir recht bei der Grossmutter zu schlafen?” Es wäre uns auch nicht in den Sinn gekommen uns dagegen zu wehren. Wir machten es einfach.
Einer der bedeutenden Tage für die katholischen Kinder war der Weisse Sonntag. An diesem Tag durften die 8jährigen Kinder das erste Mal die Heilige Kommunion empfangen. Eine Woche lang musste man sich darauf vorbereiten und Rituale und Abläufe einüben.
An diesem besonderen Tag trugen die Erstkommuniönler bodenlange weisse Kleider, die von der Gemeinde zur Verfügung gestellt wurden. Die Mädchen trugen zudem ein schmuckes weisses Blumenkränzli in den Haaren. Mit der Taufkerze in der Hand war der grosse Einzug in die Kirche. In andächtigen Schritten liefen wir in zwei Reihen den Weg ab. Diese Prozession war der Grossmutter sehr wichtig und sie instruierte mich am Vorabend, dass ich auf keinen Fall herumgrinsen dürfe. Dies muss wohl der Grund gewesen sein, dass ich auf allen Fotos des Weissen Sonntags ein ernstes Gesicht machte. Es schien, wie wenn es der traurigste Tag des Lebens gewesen wäre.
Eine Besonderheit der katholischen Kirchen sind die Kirchenbänke, die eine Vorrichtung zum Knien haben. An der Rückseite der Vorderbank ist jeweils ein Kniebrett montiert. Während der Gottesdienste und Gebetsstunden gab es festgelegte Rituale, bei denen sich alle Kirchen- besucher niederknieten. Knien tat man aber auch beim besonders andächtigen Beten oder nach der Beichte. Bequem war diese Stellung ganz und gar nicht.
 erste heilige Kommunion in der katholischen Kirche
erste heilige Kommunion in der katholischen Kirche
Meine Grossmutter besass zu Hause eine solche Kirchenbank mit Kniebrett. Sie sah genau so aus wie die Bänke in der Kirche. Sie war lediglich viel schmäler und bot nur für eine Person Platz.
Dieser Betstuhl eignete sich prima für Spiele mit Freundinnen. Besonders der Moment der Kommunionsausteilung war beliebt. Wir knieten auf dem Kniebrett, falteten die Hände und streckten die Zunge heraus um die Kommunion zu empfangen. Das Kind, das den Pfarrer spielte, legte etwas Essbares als Hostie auf die Zunge und murmelte dazu unverständliche Worte.
Auch meine Mutter unterstützte dieses Spiel. Sie kaufte zu meiner grossen Überraschung Pommes Chips, die wunderbar als Hostienersatz dienen konnten. Dies war Motivation genug um immer wieder diese Episode zu spielen.

Päng machte es und da war er, unangemeldet, gnadenlos und unerwünscht. Der Krebs in der Brust versteckte sich vor mir. Es bestand keine Chance, dass ich etwas von aussen hätte spüren können. Sogar als ich genau wusste, wo er sich eingenistet hatte, konnte ich anfänglich nichts ertasten. Selbst meine Tochter, die etwas Übung im Abtasten von menschlichem Gewebe hat, hätte keinen Verdacht geschöpft. Später erhielt ich vom onkologischen Gynäkologen eine Anleitung, wie ich den etwas über 2 cm grossen Krebsknollen mit meinen Händen finden konnte. Regel Nummer eins: nicht im Sitzen oder Stehen die Brust abtasten. Es muss im Liegen sein. Dann musste man noch ordentlich das Brustgewebe wie eine Senftube nach oben bzw. von der Seite in die Mitte schieben. Auf diese Art und Weise konnte ich ihn doch endlich erspüren und wusste, die Mammografie hatte tatsächlich mich gemeint.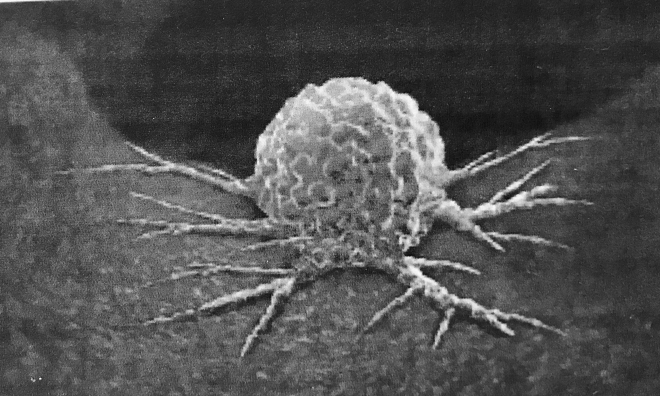
Wie wäre es wohl gekommen, wenn ich nicht rein zufällig beschlossen hätte mich um einen neuen Hausarzt zu kümmern. Meine langjährige Hausärztin wurde vor zirka 10 Jahren pensioniert. Seither war ich medizinisch gesehen obdachlos. Das änderte sich in diesem verhängnisvollen Frühling. Eine neue Hausarztpraxis ging vor kurzem in unserem Städtchen auf. Ich wollte endlich meinen erhöhten Cholesterinspiegel regelmässig kontrollieren lassen.
Aber wie es bei einem Erstgespräch sein kann, wollte der pflichtbewusste Arzt noch ein paar Dinge mehr wissen. Er fragte mich, wann ich die letzte Mammografie gemacht hätte. Etwas beschämt musste ich zugeben, dass sämtliche Couverts vom Präventionsprogramm “Donna” direkt im Altpapier gelandet seien. Auf dieses Bekenntnis schaute er mich mit seinen schönen dunklen Augen eindringlich an und beteuerte, dass jetzt der richtige Moment dazu wäre. Und so begann das Unheil. Obwohl die Entdeckung in Tat und Wahrheit ein Glück war. Denn es war genug früh, bevor sich Metastasen im Körper ausbreiten konnten. Danach wurde das restliche Jahr komplett durch diese Diagnose bestimmt.
Zuerst mal ging ich unbekümmert in die Mammografie. Das Telefon zwei Tage später beunruhigte mich noch in keiner Weise. Schliesslich kommt es oft vor, dass ein “Schatten” gesichtet wird. Den vorgeschlagenen Termin am folgenden Dienstag schlug ich wegen eines abgemachten Vorhabens in den Wind. Inzwischen weiss jeder, dass ich mit einer rosaroten Brille geboren wurde. Dafür bin ich eigentlich sehr dankbar, denn es erspart mir grosse Vorausängste und Voraussorgen. Bis zum Ultraschall und sogar bis zur Eröffnung des
Laborergebnisses der Biopsie konnten mich keine wilden Gedanken in den Nächten stören. Beim Ultraschall realisierte ich jedoch erstmals, dass es sich nicht um etwas Harmloses handeln konnte. Das intensive Abtasten der Lymphknotengegend und die Blicke waren zu verräterisch. Es wurde jedoch kein klares Wort darüber geäussert. Dies war die Aufgabe des Hausarztes beim zweiter Besuch. Dort hätte ich viel lieber über den Cholesterinspiegel gesprochen als über den Laborbefund der Biopsie.
Uns Menschen fehlt so etwas wie ein Konzept, wie wir mit einem plötzlich eintreffenden schlechten Ereignis umgehen können. Solche Situationen lassen sich nicht antizipieren. Es zeigt sich erst im Moment des Eintreffens. Menschen reagieren sehr individuell. Meine
Reaktion war eher pragmatisch. Ich führte mir kurz die über zehntausend Frauen vor Augen, die dies bereits überstanden hatten. Brustkrebs ist der besterforschte Krebs und die medi-zinischen Behandlungen sind sehr weit entwickelt. So beschloss ich die vorgeschlagene Behandlungsprozedur gradlinig durchzustehen. Ich schlief weiterhin gut und machte psychisch und mental während des ganzen halben Jahres Chemotherapie keine Berg- und Talfahrten.
Wo im Körper wohnt wohl das Vertrauen und die Zuversicht? Gibt es ein physisches Plätzchen dafür? Meine Zuversicht in einen guten Ausgang der Krankheit war gross. Dieses Vertrauen ruht im tiefsten Innern. Es ist unmöglich, sich dieses Gefühl willentlich zuzuführen. Dies teilte ich meinem Bruder Giuseppe mit. Auch er musste in diesem Jahr mit zwei amputierten Beinen eine komplette Lebensumstellung hinnehmen. Auf meine Äusserung, ich sei sicher, dass dies schon gut kommen werde, schaute er mich mit zweifellosem Blick an und bemerkte ohne Firlefanz: “Weisst du, das ist bei uns so”. Bestimmt meinte er damit, dass wir in unserer Familie mit Urvertrauen und Zuversicht gut ausgestattet wurden.
Seit einigen Jahren wird viel von Resilienz gesprochen. Gerade das Fehlen der Resilienz wurde zum gesellschaftlichen Thema. Widerstandsfähigkeit zu erlernen ist in unserer komfortablen Zeit definitiv schwieriger geworden.
Ich wuchs in keiner Komfortzone auf. Uns Kindern wurde viel zugetraut. Man vertraute darauf, dass wir zu diesem oder jenem fähig seien, und mutete uns viel Selbständigkeit zu. Ich bekam in meiner Kindheit die Gelegenheit selber zu mir zu schauen. Mit Bestimmtheit ist dies eine der Voraussetzungen zur Bildung einer Widerstandsfähigkeit.

Das Grundstück war zirka 2000m2 gross. Auf zirka 1000m2 standen das Haus, die Schreinerei und der Schopf. Es gab überall unzählige Ecken, Nischen und Verstecke. Ein unglaublicher Spielplatz für viele Abenteuer. Wir tummelten uns auf dem ganzen Areal. Es bestand eigentlich keine Chance zu wissen, wo die Kinder waren und was sie taten. Niemand hätte Zeit gehabt uns zu suchen geschweige denn zu überwachen. Es war auch besser so. Denn wir scheuten nichts. Mein 2½ Jahre älterer Bruder August war abenteuerlustig und für alles zu haben.
Astrid Lindgren beschrieb meinen Bruder im Buch „Immer der Michel“ ganz zutreffend. Schliesslich hatte er auch eine kleine Schwester, die im Buch Lina hiess und die mit Begeisterung und Unbekümmertheit alles mitmachte.
Mit August unternahm ich richtig gefährliche Abenteuer. Als ich zirka 10 Jahre alt und August 2 ½ Jahre älter war, kletterten wir durchs Dachfenster auf das Dach des 12 Meter hohen Hauses. Klettern war sowieso unsere Leidenschaft und die Höhe konnte uns nichts anhaben. Kein Wunder wurde August später Zimmermann. Wir liefen locker über die Ziegel und fühlten uns absolut sicher. Auf die Spitze trieben wir es, als wir bis an den Rand des Daches liefen und uns hinsetzten. 
unser Haus: zuvorderst das Wohnhaus. Rechts hinten die Schreinerei
Vorne die Schaufenster des Ladens
Wir konnten die Höhenluft nicht lange geniessen. Der Ausflug nahm ein abruptes und beschämendes Ende. Die Nachbarin hatte uns entdeckt und telefonierte umgehend der Mutter. Diese kam in Windeseile hinauf, schaute aus dem Dachfenster und befahl uns mit ruhiger Stimme sofort zurückzukommen. Das böse Ende kam auf dem sicheren Estrichboden. Die erste und einzige Ohrfeige der Mutter musste ich hier einstecken. Gleichzeitig prasselte ein Schimpftirade auf uns nieder.
Ein weiterer Abenteuerplatz war der Holzschopf, der verschiedene schräge und verwinkelte Dächer hatte. Auch da gingen wir gerne aufs Dach. Nur war es da nicht halb so gefährlich. Im Winter liebten wir das Schneerutschen mit Plastiksäcken auf den für das Gesäss gerade richtig rund geformten Ziegeln.

Es passierte eigentlich nie etwas wirklich Ernsthaftes. Alle von uns hatten ab und zu Schrammen und Beulen.
Eine bleibende Erinnerung an den Sägewagen holte sich Theres an einem schönen Sonntag. Sie lebt seither mit einem krummen Fingernagel. Der Sägewagen war ein tolles Eisenbähnli, das auf Schienen zirka 10 Meter hin und her fahren konnte. Wir legten uns bäuchlings auf den Wagen und fuhren immer wieder die kurze Strecke ab. Da kam plötzlich der Mittelfinger zwischen die Schiene und das Wagenrad. Das Nagelbett des Fingers wurde dabei abgedrückt.
August holte sich einmal einen doppelten Unterarmbruch. Er unterschätzte die Höhe des Hausvordaches komplett. Denn er meinte, er könne einfach auf die kleine Wiese darunter springen und zeigte mir, wie das geht. Bei den meisten Dummheiten war ich mit grosser Begeisterung dabei. Nur diesen tollkühnen Sprung wagte ich nicht.
Als Jugendlicher unternahm August weitere Abenteuer mit Freunden. Da wollte er die kleine Schwester nicht mehr dabei haben.
Neben unserem Grundstück bot auch die nähere Umgebung viele Möglichkeiten für spannende Unternehmungen.
Der Bach hinter dem Haus und die nahe Reuss blieben über lange Zeit Anziehungspunkte. Es gab keine Jahreszeit in der ich nicht unfreiwillig in einem dieser Gewässer gelandet bin. Wenn dies vorgefallen war, musste ich mich möglichst ungesehen ins Haus schleichen. Niemand durfte sehen, dass ich tropfnass war. Denn besonders die Reuss galt als sehr gefährlich. Wenn ich hätte gestehen müssen, wo ich gewesen war, hätte es bestimmt ein Zetermordio gegeben.

Familienausflüge gab es eigentlich kaum. Wir fuhren allenfalls auf den elterlichen Bauernhof meines Vaters ins Mooshüsli nach Oberkirch. Im Opel Kadett Kastenwagen hatten mindestens 6 Kinder Platz. Der Vater war am Steuer, die Mutter daneben und mindestens 4 Kinder auf dem Rücksitz. Zwei weitere Kinder platzierten sich rückwärts im Kastenwagen des Autos. Da wir meistens zur Kirschenzeit gingen, mussten sie sich zwischen die Kirschenkisten quetschen, die beim Heimweg gefüllt waren.
Die meisten Sonntage blieben wir zu Hause mit immer ähnlichem Tagesablauf. Zuerst war der Sonntagmorgen- Gottesdienst, dann das Mittagessen mit Poulet und am Nachmittag ein Spaziergang in der Umgebung oder an die Reuss.

sonntäglicher Spaziergang in der näheren Umgebung.
Ich sitze rechts der Mutter
Trotzdem waren die Sonntage keinesfalls langweilig. Sehr aufregend und spannend waren die Nachmittage, wenn die älteren Nachbarsbuben kamen. Dann spielte eine ganze Kindermeute bei uns neben dem Haus Schlagball.
An regnerischen Sonntagen stand eine grosse, frisch geputzte Werkstatt zur Verfügung. In diesem Indoorspielplatz standen hölzerne Bockleitern für Hüttenkonstruktionen und kleine Rollwägelchen zum Spielen bereit.


In viel deutlicher Erinnerung blieb mir der Unfall meines Bruders Alois. Es war an einem Montagmorgen im März 1979. An diesem Tag begannen die Abschlussprüfungen der Bezirksschule Sins. Bereit für den ersten Prüfungstag stand ich an diesem Morgen auf. Mein gutes Gefühl, dass ich diese Prüfung prima meistern würde, änderte sich schlagartig. Im Treppenhaus traf mich der Schreck und die schnelle Gewissheit, dass etwas Schlimmes passiert sein müsse. Die Steinplatten waren voller Blut. In der Küche weinte die Mutter. Der Vater fuhr unterdessen mit dem verletzten Bruder und einem abgeschnittenen Finger ins Kantonsspital Aarau.
Dort wurde einer von zwei abgeschnittenen Fingern wieder angenäht. Nach der Reha-bilitationsphase nahm er seine Schreinerarbeit wieder auf. Der wieder angenähte Finger hatte keinen klaren Platz in der linken Hand. Er war weder Zeige- noch Mittelfinger und wurde nie wieder wirklich beweglich. Funktionell gesehen war er kaum mehr brauchbar. Auch bei Alois hatte man nicht den Eindruck, dass er bei der Verrichtung seiner Arbeit eingeschränkt gewesen wäre.
Mit diesem Erlebnis musste ich an den Prüfungstag antraben und einen Aufsatz schreiben. Keines der vorgesetzten Aufsatzthemen konnte mich für eine vernünftige Geschichte inspirieren. Eines der Themen taugte meines Erachtens jedoch gut genug um umgedeutet zu werden. So schrieb ich den Titel: „Eine Maschine, die mich fasziniert“ in „Ein Werkzeug, das mich fasziniert“, um. Ich war glücklich eine taugliche Lösung gefunden zu haben. Nach meiner Ansicht gelang es mir recht gut über „die menschliche Hand als das ausgeklügeltste Werkzeug“ zu schreiben. Mit dieser Reflexion über die Hand hätte ich eigentlich schon mal die besten Voraussetzungen für eine zukünftige Ergotherapeutin geschaffen. In der Einführung und im Schlusswort wurde das Erlebnis vom Unfall am Morgen beschrieben und die Umwandlung des Themas begründet. Die Note, die ich für diese gedankliche Auseinandersetzung erhielt, war enttäuschend. Als sonst gute Aufsatzschreiberin erreichte ich ein knappes genügend. Die Testbewerter waren wohl überfordert mit meiner eigenwilligen Interpretation des Themas. Wie sollten sie bloss meine Arbeit in die vom Kanton vorgegebenen Bewertungskriterien einordnen.
In meiner späteren Arbeit als Ergotherapeutin erlebte ich viele Handverletzungen. Es ist erstaunlich, welche Mobilität man heute auch nach schlimmen Unfällen dank ausgeklügelten Operationstechniken und einer ergotherapeutisch unterstützten Handrehabilitation wieder hinkriegt. Davon konnten mein Vater und mein Bruder leider nicht profitieren.

Die einzige, die aus meiner Sicht nie Kind war in der Familie, war Maria. Auf allen Fotos stand sie gross und stramm neben einer riesigen Kinderschar.

Wenn sie in den Ausgang ging, machte sie sich schön. Sie toupierte ihre Haare und kleidete sich in ein Gesamtkonzept mit grünem Kleid, grünen Schuhen und grüner Handtasche. Dazu schmückte ein Goldketteli gut abgestimmt sowohl die Schuhe, die Handtasche und auch das grüne Kleid. Der Lippenstift durfte niemals fehlen. Etwa so auszusehen war ein erstrebenswertes Ziel für mich. Als Vorbereitung schlüpfte ich schon mal in die grünen Schuhe mit den hohen Absätzen und übte darin zu laufen.

An meine Schwester Maria habe ich keine Erinnerung ohne ihren Mann Ludwig. Bevor sie verheiratet waren, kam er an den Sonntagen mit einem kleinen Auto und holte seine zukünftige Frau ab. Sie verbrachten diese Nachmittage aber nicht in trauter Zweisamkeit. Die “vier Kleinen”, das waren Alois, Theres, August und ich, durften mitgehen.
Man führe sich mal diese lustige Szene vor Augen. Da fährt ein Paar, beide knapp über zwanzig Jahre alt, mit einem kleinen Auto an den Zugersee. Aus dem Auto steigen vier Kinder im Alter von 12, 9, 7 und 5 Jahren. Sie packen Picknickdecke, Cervelat und Badehosen aus und vertummeln munter den Sonntagnachmittag zusammen. Erstaunlicherweise waren diese Unternehmungen für meine Schwester und ihren zukünftiger Mann weder eine Plage noch eine Zumutung. Sie hatten soviel Spass, dass verschiedene weitere Ausflüge folgten.

Einige Jahre später war Maria schwanger und der Geburtstermin war gegen Ende Februar. Ich fragte sie, ob sie das Kind nicht an meinem Geburtstag gebären könne. Sie raubte mir jedoch jegliche Illusion. In der Tat kam Rebekka nur zwei Tage nach meinem Geburtstag zur Welt. Nun war ich mit acht Jahren Tante geworden. Bald kam Lea und etwas später Simeon. Maria entlastete unsere Mutter oft indem wir Kleineren bei ihr in Kägiswil Ferien machen durften.
Später in Sarnen hüteten Theres und ich ihre Kinder und ermöglichten Maria und Ludwig kinderfreie Wochenenden.

Wir waren keine braven Kinder. Mutti sagte sogar oft dass August und ich die schlimmsten Kinder gewesen seien. Wahrscheinlich hatte sie alles Frühere bereits vergessen.
Jedenfalls hatten wir unser eingefleischtes Mittagessen-Streitritual mit den Füssen unter dem Tisch. Wir hatten festgelegte Essensplätze. August und ich sassen immer direkt vis à vis voneinander. Das war natürlich der grösste erzieherische Fehler. Aber im Denken unserer Eltern musste die Sitzordnung einfach so sein. August sass auf der Bank links vom Vater. Ich sass auf dem Stuhl rechts von der Mutter. Mutter und Vater sassen immer vis à vis voneinander. In dieser Ausgangsstellung wussten August und ich sofort bei Beginn des Essens, was wir mit unseren Füssen unter dem Tisch zu tun hatten. Wir waren in ständigem Fusskontakt und kämpften um die Mittelstange des Tisches.
Dies bewirkte wahrscheinlich, dass ich immer so langsam beim Essen war. Alle andern waren schon längstens fertig und ich löffelte immer noch die Suppe aus dem gelben Plastikteller. Als Jüngste hatte ich nämlich diesen Teller bis ich sicher weit über 10 Jahre alt war. August ass noch sehr lange aus dem grauen Plastikteller.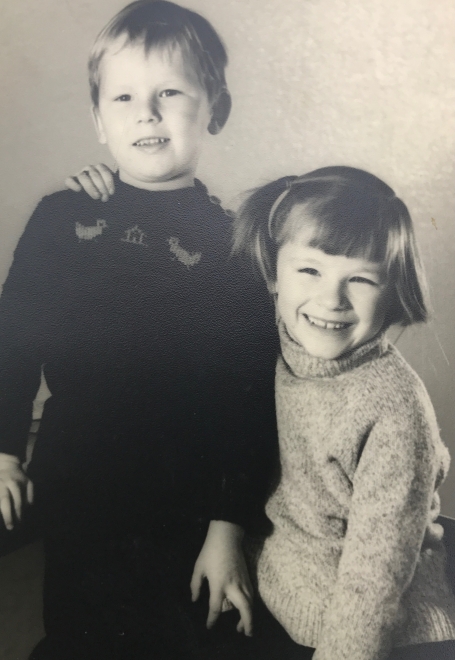
 oben: August und Theres, unten: August mit mir
oben: August und Theres, unten: August mit mir

Ich habe wohl in meiner Kindheit so viele Stunden in der Kirche verbracht, wie die meisten Menschen ihr ganzes Leben lang nicht aufholen können.
Ein sehr obligatorischer Kirchbesuch war die wöchentliche Messe am Wochenende. Diese fand in der Regel am Sonntagmorgen um 9.30 statt. In der Kirche hatte es für sämtliche Kirchgänger eine vorgeschriebene Sitzordnung. Bei den Kindern ging es nach den Schulklassen: Die Erstklässler waren in der 1. Kirchenbank, die Zweitklässler in der zweiten etc. Die Mädchen im linken Kirchenschiff, die Knaben im rechten Kirchenschiff. Dahinter waren die Frauen wiederum auf der linken Seite und die Männer rechts hinter den Knaben. Ging ein Ehepaar gemeinsam zur Kirche, waren sie zusammen auf der rechten Seite.
Ging eine Frau allein, war sie selbstverständlich auf der linken Seite.
Spannend wurde es, wenn es im Dorf neue Paare gab. Immer wenn ein Paar zusammen kam - es konnte auch unverheiratet sein – bekannte sich das Paar öffentlich zur Beziehung, indem es zusammen in die Kirche ging und sich zusammen auf die rechte Männerseite setzte.
Ich war jahrelang mit den gleichen Schulfreundinnen in der Kirche. Auch da gab es manches Bekenntnis untereinander. Immer, wenn im kirchlichen Ablauf vom Pfarrer gesagt wurde: „Erhebet eure Herzen“, sprachen die Kirchenbesucher im Chor: „Wir haben sie beim Herrn“. In diesem Moment flüsterten wir uns zu und fragten uns gegenseitig: “Bei welchem Herrn hast du dein Herz?”. Das war immer ein Anlass zum Kichern.
Der kleine Bruder der Freundin brachte uns auch zuverlässig zum Lachen. Er ging noch nicht zur Schule und durfte deshalb neben seiner Schwester im Kirchenbank sitzen. Mit ihm wurde es besonders lustig, wenn er statt “Bitt für uns” immer lautstark “pippluns” in die Kirche schrie.
Später durften wir am Samstagabend in den Vorabendgottesdienst gehen. Wie die meisten in meinem Alter gingen wir überhaupt nicht gerne in die Kirche. So hatten wir auch unsere Tricks um dies zu umgehen. Als ich zirka 14 Jahre alt war, stand ich mit einer Freundin zusammen rechtzeitig vor der Kirchentür. Wichtig war dabei, dass wir von der Dorfbevölkerung gesehen wurden. Als dann alle in der Kirche verschwunden waren gingen wir für ¾ Stunden spazieren. Pünktlich bei Kirchenende standen wir wieder vor dem Kirchenportal.
Weitere Kirchenanlässe fanden unter der Woche statt. Vor allem der Mai war kirchlich gesehen sehr überbelastet. Am Montag, am Mittwoch und am Freitag fand die Maiandacht statt. In dieser halben Stunde wurde ausschliesslich Rosenkranz gebetet. Dafür hielt man die Gebetskette in der Hand. Bei jedem Gebetsdurchgang konnte man eine Perle weiter vorrücken und hatte so eine Übersicht, wie lange es noch geht.
Dann gab es den monatliche Herzjesufreitag. Dieser fand am Morgen früh um 6.00 statt.
Im Dezember gab sehr viele weitere Frühandachten. Zum Glück mussten wir nicht all zu oft in diese gehen.
Da wir ja arme Sünder waren, mussten wir samstags auch immer wieder zur Beichte. Im abgedunkelten Beichtstuhl gestanden wir dem Pfarrer unsere Sünden. Obwohl ich nicht die Bravste war, kamen mir in diesem Moment keine Sünden in den Sinn. Deshalb hatte ich mir etwas zurechtgelegt. Ich sagte dem Pfarrer jedes Mal, dass ich der Mutter die Zunge herausgestreckt habe. Ich erinnere mich nicht mehr, ob ich dies wirklich getan habe oder nicht. Aber damit war ich gerettet. Darauf flüsterte der Pfarrer unverständliche Worte, gab mir die Absolution und den Auftrag im Gebetsstuhl noch einige “Gegrüsst seist du Maria” zu beten.
Das einzige, was mir bei all diesen kirchlichen Ereignissen recht gut gefiel, waren die Bet- und Bittgänge. Diese fanden immer im Mai statt.
Die gesamte Dorfbevölkerung lief über die Felder und betete, dass die Ernte gut ausfallen solle. Natürlich war bei dieser Prozession die Reihenfolge und der Platz, wo jeder stehen und laufen musste, streng festgelegt. In der Mitte lief der Pfarrer eine Monstranz tragend unter einem Baldachin. Während des Laufens wurde gebetet, gesungen und ab und zu auch einfach still gelaufen. Die Gebete und die Gesänge waren sicher verzerrt. Denn die Kolonne war sicher über 100 Meter lang und das zusammen sprechen oder singen war schlichtweg unmöglich.
Es fanden drei Bittgänge statt. Der weiteste Marsch war am Sonntagnachmittag nach Beinwil. Ich mochte diese Bittgänge wahrscheinlich auch wegen dem Fünflieber. Nach der Ankunft gab es eine Messe in der dortigen Kirche und danach die langersehnte heisse Ovomaltine mit einem Nussgipfel dazu.
Am Montagmorgen früh lief man nach Auw und am Dienstag nach Abtwil.

In meiner Kindheit hatten Hochzeiten eine grössere Faszination. Da eilte ich an den Samstagnachmittagen sogar freiwillig Richtung Kirche. Jeweils um 14.00 wurde geheiratet. Meistens war das Paar oder mindestens die Braut aus dem Dorf und man kannte sie. Etwa eine Stunde später musste man mit einem kleinen Plastiksäcklein ausgerüstet bereitstehen. Der grösste Moment, den man mit Herzklopfen abwartete war der Augenblick, in dem die Braut aus der Kirche trat. Sie und ihr frisch Angetrauter verliessen die Kirche als erstes. Dahinter waren die Mädchen, die den Schleier, im besten Fall einen sehr üppigen und langen, hielten. Dann kamen die Verwandten und die weiteren Personen in eher ungeordneter Abfolge. Meistens wurde das Brautpaar von irgendwelchen Vereinen oder Freunden empfangen. Diese schwangen die Fahnen oder hatten ein Tor aus Blumen und Zweigen vorbereitet. Wir Dorfkinder warteten dahinter und waren startbereit für das Auflesen der “Feuersteine”. Diese Bonbons waren in farbiges Papier eingepackt und hatten eine absolut nicht mundgerechte würfelige Form. Nur an Hochzeiten kamen die Feuersteine zum Einsatz. Schliesslich konnte man auf der Innenseite des Papiers immer einen sinnreichen und zur neuen Lebensphase passenden Spruch lesen. Die Bonbons bestanden aus purem farbigem Zucker und schmeckten nicht einmal wirklich gut. Trotzdem ging es darum möglichst viele davon zu erwischen und als Beute nach Hause zu tragen.
Der Hochzeitsmonat war natürlich der Mai. Da wiederholte sich das Schauspiel jeden Samstag.
Meine Eltern heirateten im April 1945. Auf dem Hochzeitsfoto trug mein Vater einen Hut und stand auf einem Randstein. Der weisse Brautschleier der Mutter war geschickt über die Füsse des Vaters drapiert. So konnte niemand die geschickte Tarnung mit dem Randstein entdecken. Der Vater war nämlich einen ganzen Kopf kleiner als die Mutter. Nach der Hochzeitszeremonie leisteten sich meine Eltern eine bescheidene dreitägige Reise im Gebiet des Vierwaldstättersees. Genaue Details sind uns leider keine bekannt. Das Rotzloch und der Bürgerstock waren aber die wichtigsten Orte, die vom Vater am meisten genannt wurden.
Der zweite Weltkrieg wurde im Juni darauf beendet. Obwohl die Schweiz nicht arg vom Krieg betroffen war, war die Nachkriegszeit auch hier gut zu spüren. Viele Dinge waren Mangelware. Man ging höchst sorgsam mit allem um, verwendete es mehrfach und flickte es, bis es wirklich nicht mehr ging. Es musste in diesen Jahren auch in der Schweiz unheimlich viel gearbeitet werden, damit man einigermassen über die Runden kam. In diesen Nachkriegsjahren begann das Ehe- und Familienleben meiner Eltern.

Im November 1969 heiratete meine älteste Schwester. Ich war damals gerade 6 Jahre alt. Meine Schwester Theres und ich trugen ein rotes hübsches Röckli aus rotem Manchesterstoff. Für einmal waren wir beide, die zwei wichtigsten Personen nach dem Brautpaar und durften direkt hinter ihnen aus der Kirche schreiten. Leider hatte meine Schwester Maria keinen langen Brautschleier. So trugen wir lediglich Blumen hinterher. In dieser Position kamen wir uns unheimlich wichtig vor.

An das Fest im Restaurant mit der Musik und dem sehr langen gedeckten Tisch kann ich mich bestens erinnern. Es war berauschend schön.
Die Spiele und die gebotene Unterhaltung waren auch für mich perfekt.
Bei einem Spiel wurde ein immens grosses und zehnfach eingepacktes Paket weitergegeben. Jeweils eine Person, die die Bedingungen erfüllte, die auf dem Paket standen, durfte die nächste Schicht des Paketes enthüllen. Man suchte also unter den Gästen den Menschen mit der längsten Nase oder der grössten Schuhgrösse. Am Schluss durfte die jüngste Festteilnehmerin eine Schicht auspacken und das Geschenk der Braut übergeben. Das machte ich natürlich sehr gerne und übergab ddas Geschenk meiner Schwester und Gotte.
Am meisten beeindruckte mich aber, dass meine frischvermählte Schwester bereits am nächsten Tag auf die kanarischen Inseln auf die Hochzeitsreise flog.
Hans Peter und ich heirateten im Jahr 1997 und feierten dies im Sommer darauf mit einem grossartigen Fest. Wir kannten uns damals schon zehn Jahre und hatten bereits die 3jährige Tochter Felice.
Das Fest fand an einemder schönsten und wärmsten Augusttage statt. Mein gut sichtbarer schwangerer Bauch mit den Zwillingen war schön in goldigem Stoff eingepackt.
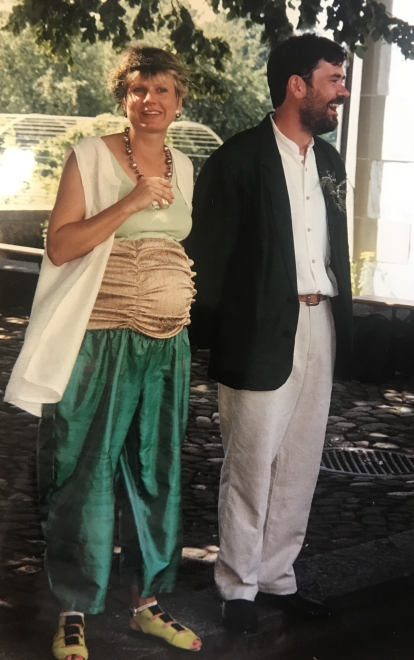

Das Wort Hochzeitsreise, das in meiner Kindheit so glamourös und vielsagend daher kam, hatte für uns keine Bedeutung mehr.
Diese Romantik rund um die Hochzeit wurde in unserer Zeit und unseren Kreisen nicht gelebt und war eher verpönt. Es wäre auch dahin geschwatzt, wenn ich eine unserer früheren Reisen als Hochzeitsreise bezeichnen würde.
Wiederum 25 Jahre später bekam das Heiraten und das Fest drumherum eine neue exklusive Bedeutung. Seit einigen Jahren geht es darum für diesen einmaligen besonderen Tag eine besondere Inszenierung aufzubauen. Alles muss für die Fotos und Filme stimmen. Eines vom wichtigsten dabei ist die richtige “Location” zu finden. Das Fest wird oft nicht selbst geplant. Dazu gibt es spezielle Hochzeitsfirmen, die dieses Event gern und teuer organisieren können. Für den richtigen Ort nimmt man selbstverständlich auch Reisen mit der gesamten Gesellschaft ins Ausland in Kauf.
Da hingegen war unsere Hochzeit doch ziemlich "selbst gebastelt".


Bete und arbeite. Das war bei uns wortwörtlich so. Alle arbeiteten sehr viel. Auch wir Kinder wurden überall eingespannt. Es war einfach normal. Niemand musste erklären, dass es alle brauchte, damit das Gefüge funktionieren konnte. Wir arbeiteten in der Schreinerei, im Haushalt und einfach überall und immer. In der Schreinerei stand ich sehr oft hinter der Hobelmaschine und nahm das Holz ab, das der Vater vorne hineinschob. Stück für Stück legte ich auf ein Wägeli. Die Leisten kamen meistens noch ein zweites oder sogar drittes Mal durch die Hobelmaschine.
Zu dieser Zeit sparte man an Massivholz und arbeitete mit Furnieren. Diese milimeterdünnen Holzscheiben mussten zusammengeleimt werden. Die Kinderarbeit war jeweils die Kleberesten mit heissem Wasser und Spatel abzuschaben und die Furniere zu reinigen.
Am Samstag musste die ganze Werkstatt gründlich geputzt werden. An verschiedenen Stellen in der Werkstatt waren Löcher für ein Absaugsystem montiert. Das war sehr praktisch. Wir starteten den Ventilator und wischten mit dem Besen alle Späne und Holzstaub in Richtung der Löcher. Dort wurden sie wie von einem Staubsauger eingesaugt und gelangten durch Röhren in den Extrakeller. Einsaugen war super. Es ging ohne grossen Aufwand und machte sogar Spass. Nur, war der Keller einmal voll, musste dieser von Hand entleert werden. Da musste Holzkiste für Holzkiste mit Span aus dem Untergrund wieder hinauf gehoben werden. Die Holzspäne wurden von einem Lastwagen abgeholt und zu verbrennbaren Holzpriketts verarbeitet. Nach dieser staubigen Arbeit war die Nase jeweils voll von Schmutz und die Taschentücher waren schwarz geschnäuzt.
Der Haushalt wurde von der Grossmutter, den Haushalthilfen, die jeweils ein Jahr bei uns waren, und den Mädchen erledigt. Es mussten grosse Mengen an Nahrungsmitteln herbeigeschafft und gekocht werden. Später konnte ich mir nicht mehr vorstellen, wie die Nahrungsmittel angeschleppt wurden. Ich erinnere mich nur an die täglich zwei Kilo Brote und an die viele Milch. Denn eine gewisse Zeit war es meine Aufgabe jeden Tag 10 Liter Milch nach Hause zu tragen. In jeder Hand hielt ich einen Kessel mit jeweils 5 Liter Milch drin. Eine meiner Schwestern leerte einmal so einen Milchkessel unterwegs versehentlich aus. Dies war ein riesiges Drama, das wir uns eigentlich nicht leisten konnten.
Damit die Essenskocherei ein bisschen einfacher ging, hatten wir jeden Wochentag das ungefähr gleiche festgelegte Menu. Am Montag gab es Reis mit irgend etwas, am Dienstag gab es Adrio, am Mittwoch stand Gehacktes mit Hörnli auf dem Tisch, am Donnerstag gab es Voressen mit Kartoffelstock, am Freitag entweder Fisch oder Käsekuchen. Am Freitagabend ging der Metzger mit dem grossen Korb von Haus zu Haus. Uns brachte er jeweils ein Stück Siedfleisch. Dieses wurde am Samstag zu Mittag gekocht. Natürlich immer mit der Fleischsuppe voraus.
Das Festessen am Sonntag war ein ganzes Poulet und, wenn wir viel Glück hatten, gab es sogar Pommes Chips dazu.
Fleisch gehörte zur täglichen Nahrung. Nur am Freitag wurde darauf verzichtet. Gemüse und Salat assen wir nicht so viel. Bei den Gemüsen waren es vor allem Bohnen, Sellerie und Rüebli. Die Mutter kochte dem Vater oft Apfelschnitze, damit auch er etwas Gesundes zu sich nahm. Salat war eher selten.

Seit kurzem hängt das Bild von Carl Spitzweg “der arme Poet” an der blauen Wand über unserem Bett. Hans Peter war überhaupt nicht begeistert, als ich das Kunstwerk nach Hause brachte, und die Platzierung an diesem Ort missfiel ihm erst recht. Doch die Ablehnung war schnell beiseite geräumt. Denn ein Dichter, der über dem Bett hängt, ist überaus praktisch. Er streut Nacht für Nacht seine poetischen Gedanken über einen. Etwa so anstrengungslos stellte ich mir mein Buchprojekt vor, in das ich mich kurz darauf mit grossem Elan stürzte. Alle Zutaten existierten bereits. Ich brauchte weder neue Buchstaben noch Wörter zu erfinden. Meine Aufgabe war es bloss sie in einer sinnvolle Reihe hintereinander zu fügen.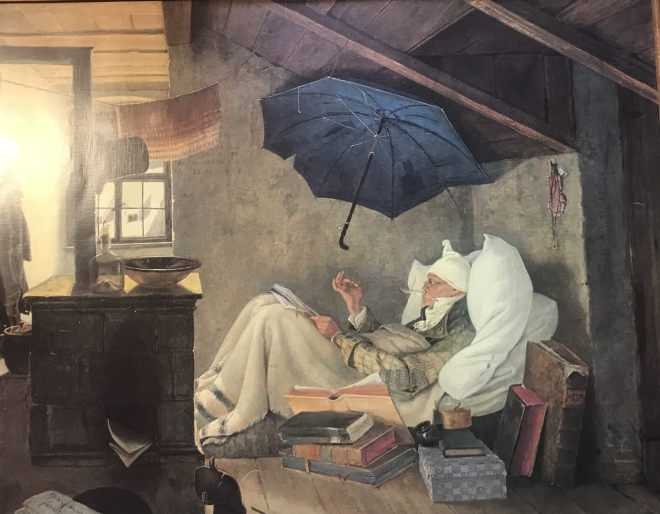
Das Bild vom armen Poet erhielt ich von meinem bayrischen Schwager Hans. Von ihm und seiner Familie handelt die folgende Geschichte. Was jetzt kommt, wird mir kaum jemand glauben.
Hans kommt aus einer Grossfamilie und hat neun Geschwister. Sie wuchsen in einer Schreinerei im bayrischen Aschheim auf. Sein Vater hatte Wagner gelernt. Die Wagenräder wurden aber schon bald nicht mehr von Hand hergestellt, und deshalb führte er den Betrieb als Schreinerei weiter. Die Eltern von Hans hatten die Jahrgänge 1912 und 1923. Der Altersabstand zwischen den Eltern betrug also 11 Jahre, genau wie unsere Eltern. Der älteste Sohn hatte denselben Jahrgang wie unsere älteste Schwester und die jüngste hatte meinen Jahrgang. Es waren sechs Mädchen und vier Knaben. Und zu guter Letzt hatten sie noch dieselben Namen. So kommt es, dass bei der Familie Sturm auch eine Maria, eine Anne, eine Theres, eine Käthy ein Josef und ein Hans aufwuchsen. Meine Schwester Käthy heiratete in diese bayrische Familie hinein und nahm den Hans. Ihre beiden Söhne Korbinian und Severin waren also wirklich stark herausgefordert die Übersicht über ihre grosse Verwandtschaft zu behalten. Auf der Deutschen wie auch auf der Schweizer Seite standen sich zwei gleiche Familienkonstellationen gegenüber - je neun Onkel und Tanten rechts und neun Onkel und Tanten links.
Als ich meinem Schwager Hans beim Besuch in Landshut von meiner Begeisterung für Spitzweg erzählte, holte er sogleich das Bild des armen Poeten aus seinem Fundus. Er brauche es nicht mehr und ich dürfe es gerne in die Schweiz mitnehmen. Ich nahm es freudig entgegen, hängte es am selben Tag über dem Bett auf, überzeugte meinen Mann von dessen Wirkung und war bereit für den Wörtersegen im Schlaf.

Vor vielen Jahren gab ich einmal einige BHs für eine Brustkrebsmanifestation ab. Bis ich selbst davon betroffen war, hatte ich mich keine Sekunde mit dem Thema Brustkrebs auseinandergesetzt, und mein Wissen war dementsprechend gering. Nur schwach erinnere ich mich an diesen Aktionstag. Jeder BH sollte an eine brustkrebsbetroffene Frau in der Schweiz erinnern. Die BH’s wurden an langen Wäscheleinen aufgehängt und schmückten den Bundesplatz. Man wollte aufzeigen, wie verbreitet diese Krebsart war.
Meine Ahnungslosigkeit ging soweit, dass ich meinte, der Krebs sei nur etwas sehr Lokales - eben nur in der Brust. Dieser könne entfernt werden, im schlimmsten Fall mit einer ganzen Brustamputation und voilà. Die Selbsterfahrung lehrte mich auf unliebsame Weise etwas anderes. Auch ein Brustkrebs betrifft den ganzen Körper. Auch ein Brustkrebs hat die Kapazität sich im ganzen Organismus auszubreiten und seine Untaten anzurichten und im schlimmsten Fall sogar zum Tod zu führen.
Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs. Sehr viele verschiedene Faktoren, die durch eine Biopsie im Labor aufgeschlüsselt werden, bestimmen die erforderlichen Behandlungen.
Kaum wusste man von meinem Krebs in der Brust, begann die gigantische Behandlung ihn zu bekämpfen. Die Chemotherapie musste so schnell wie möglich begonnen werden. Glücklicherweise waren bei mir noch keine Metastasen gefunden worden und das sollte auch so bleiben, deshalb ging man gleich mit starkem Geschütz dahinter. Der Onkologe wollte bereits am andern Tag nach dem Gespräch mit der ersten Dosis beginnen. Der erste Cocktail war eine rote Flüssigkeit. Tröpfchenweise floss er in mich hinein. Mit dem Epirubicin im Körper verfärbt sich sogar der Urin. Alle zwei Wochen verbrachte ich 3 - 4 Stunden im Behandlungsraum einer onkologischen Praxis auf einer Liege. Der zweite Cocktail, der mir im Abstand von drei Wochen verabreicht wurde, bestand aus einem Eibenpräparat. Aus der giftigen Eibe wird der Wirkstoff Docetaxel gewonnen. Diese Substanz bremst die schnell wachsenden Krebszellen.
Die Chemotherapie ist schon ein starkes Ding. Sie setzte mich zeitweise komplett ausser Gefecht. Die ersten 3 Tage nach der jeweiligen Infusion waren sehr gut ertragbar. Wahrscheinlich machte mich das verabreichte Cortison während den ersten drei Tagen lebendig und unternehmungslustig. Übelkeit oder Erbrechen hatte ich nie. Das konnte zum Glück medikamentös verhindert werden. Etwa am 4. Tag nach der Infusion überfiel mich die grosse Müdigkeit mit einer Wucht, wie wenn ich von einem Lastwagen überrollt worden wäre. Eine körperliche Schwere, die sich kaum beschreiben lässt und die ich davor noch nie erlebt hatte, legt mich lahm. Dann rappelte ich mich wieder langsam auf. Die restlichen Tage bis zur nächsten Medikation waren recht gut und ich konnte fast vergessen, was vorgefallen war. Doch genau im Moment, als sich das Leben wieder einigermassen gut anfühlte, kam der nächste Schuss. Wieder lag ich kaputt auf dem Sofa und durchlebte den nächsten Chemozyklus.
Das Leben wurde in diesem halben Jahr langsamer. Kein Vergleich zum früheren Leben, das ich in einem Vollgastempo durchlebte. Vorbei war es mit meiner fast unerschöpflichen Energie und Ausdauer. Nun wurde ich abrupt auf Null hinunter gebremst.
Neben der Müdigkeit gab es noch andere Nebenwirkungen. Es war nicht schlimm keine Kopfhaare mehr zu haben. Mit der Perücke hatte ich mich prima arrangiert. Komischer war, dass die gesamte Körperbehaarung wegfiel. Noch nie im Leben hatte ich so schöne haarlose Beine. Leider hatte ich in diesem Sommer keine Gelegenheit diese perfekten Unterschenkel der Öffentlichkeit zu zeigen. Die Augenbrauen und Wimpern waren ebenfalls dünn geworden aber noch da. Ich bemühte mich die letzten Wimpern mit Wimperntusche zu erwischen. Es galt dabei das richtige Mass zu halten. Bei zu wenig sah man nichts. Bei zu viel wurde es zu einem Geschmier.
Weit mehr beeinträchtigte mich die diffuse Geschmacksempfindung, die sich beim Essen einstellte. Die Schleimhäute im Mund wurden stark angegriffen und die Geschmacksnerven abgestumpft. Alles schmeckte fad und geschmacklos. Freunde, die mit Pralinen oder Schokolade daherkamen, durften sie gleich selber aufessen. Es war schlichtweg kein Genuss mehr.
Damit meine Muskeln nicht ganz verloren gingen, versuchte ich trotz Geschmackseinbussen normal zu essen. Protein in Pulverform und Sportlerdrinks ergänzten meine Ernährung.
Die Haut wurde sehr empfindlich. Ab und zu hatte ich rote, fast offene Stellen, die sorgsam gepflegt werden mussten.
Das Thema mit den sehr veränderten Ausscheidungen lasse ich mal beiseite.
Nur ganz am Rande betroffen war ich von Sensibilitätsstörungen in den Händen und Füssen. Diese verschwanden bald wieder. Da hatte ich grosses Glück, denn Neurophatien sind eine häufige und schlimme Nebenwirkung der Chemotherapie.
Da die weissen Blutkörperchen mit der Verarbeitung der Chemo genug beschäftigt waren, war das Immunsystem sehr geschwächt. Bakterielle Infekte hätten sehr schnell aufgelesen werden können. Ich überstand die ganze Chemotherapie ohne Infektionen. Ich war aber auch sehr vorsichtig und habe nichts anbrennen lassen. Was man früher von mir nicht so kannte.
Ausser während den zwei schlimmsten Tagen ging ich täglich Velofahren. Die Anforderung von flach zu langsam wieder bergwärts fahren steigerte ich im Laufe dieser drei Wochen. Sport machen war mein einziger aktiver Beitrag zur Bekämpfung des Krebses. Dank dem bin ich ganz bestimmt so gut über die Runden gekommen.
Nach einem halben Jahr Chemotherapie ging es an die zehnte und letzte Infusion. Das Gefühl endlich fertig zu sein war überwältigend. Da war auch bei mir fertig mit Pragmatismus und die Emotionen gewannen Oberhand. Mir flossen die Tränen in Sturzbächen. Mit diesem Tag war ich am Ende des Tunnels angelangt. Ein grosser Meilenstein war erreicht.
Es folgte bald darauf eine kleine Operation und ein Monat Bestrahlung.
Einen Rückschlag im Krebsbekämpfungsprozess erlebte ich nach der Operation. Im herausgeschnittenen Gewebe wurden noch lebende Krebszellen gefunden. Die ÄrztInnen des Tumorboardes beschlossen eine Änderung der weiteren Behandlung vorzunehmen. Weitere 14 Infusionen im Abstand von 3 Wochen standen bevor. Kadcyla hiess das Medikament. Es war eine Chemotherapie, die nicht zu vergleichen mit der Ersten war. Es soll in noch lebende Krebszellen eindringen und diese zum Zerplatzen bringen. Das Risiko eines Rezidives soll sich dadurch um weitere Prozente reduzieren. Leider gab es noch keine Messgeräte, die nachprüfen könnten, ob alle Krebszellen getilgt worden waren.
Während des ersten halben Jahres durchforschte ich kein einziges Mal das Internet. Ich wollte auf keinen Fall von ungefiltertem Wissen überflutet werden und mich verunsichern lassen. Erst nach einem halben Jahr begann ich mich übers Internet zu erkundigen. Ich las Fachartikel und schaute spannende Referate über YouTube. Die gefundenen Informationen waren viel besser als ich erwartet hätte. Es half mir meinen individuellen Brustkrebs und die erlebte Behandlung besser zu verstehen und einzuordnen.
Falls es wieder einmal einen Büstenhaltertag auf dem Bundesplatz geben sollte, wäre ich diesmal in der ersten Reihe dabei. Eine politische Botschaft hätte ich nicht, denn es wird ja bereits alles zur Bekämpfung des Krebses getan. Die Forschung ist wohl bei keinem andern Krebs so weit wie bei Brustkrebs. Die Hauptbotschaft ist vielmehr das Bewusstmachen der grosse Zahl von betroffenen Frauen. Jährlich werden in der Schweiz über 6000 Brustkrebsdiagnosen gestellt. Das heisst, täglich erfahren 17 Frauen, dass sie einen Krebs in der Brust haben.

Als die Grossmutter starb, wurde ein grosses Zimmer frei. Meine grossen Schwestern hatten eine sehr gute Idee zur Nutzung dieses Raumes. Wir brauchten eine „Popstube“. Meine Schwester Anne schwang die Farbpinsel und malte die Wände rot an und versetzte ein Muster mit schwarzen Schlieren darauf. Ein Plattenspieler und eine Kaffeemaschine waren die zwei wichtigsten Utensilien in dieser Stube. Die Plattensammlung war sehr klein. So lief tagaus, tagein die Beatlesplatte „let it be“ oder „money“ von Pink Floyd.
Unser Haus war ganz generell offen für Menschen. Quasi jeder war willkommen. Wir brachten immer viele Schulkameraden mit nach Hause. Offenbar gefiel es ihnen in unserer Popstube. Das Schulhaus war ja auch nur 5 Laufminuten entfernt. In der Oberstufe hatten wir immer wieder Leerstunden, diese konnten wir gut bei uns verbringen. Manchmal überbrückten Klassenkameradinnen die Zeit in der Popstube, auch ohne meine Anwesenheit.
Obwohl sehr viele junge Leute bei uns ein- und ausgingen, war es der Mutter nicht zu viel. Sie sagte oft, dass es ihr lieber sei, die Kinder seien hier im Haus als sonst irgendwo.
Einmal brachte ich meine Wohnkollegin Margreth aus Biel mit nach Sins. Sie setzte sich an den Esstisch. Als der Vater keine Reaktion zeigte und sie nicht begrüsste, sagte ich ihm: „Schau, das ist Margreth“. Er schaute kurz vom Teller auf und erwiderte: „Aha, ich habe gedacht es sei eines von uns“.
Ebenso war es mit einem Freund meines Bruders August. Hardi gehörte über ein paar Jahre zur Familie. Er war täglich bei uns. Wenn er am Abend nicht am Nachtessenstisch war, fragte man sich schon, wo er verbleibe. Er verbrachte viele Stunden bei uns und half oft und gerne dem Vater bei irgendwelchen Arbeiten. Er kam zu Besuch, auch wenn August gar nicht zu Hause war.

Früher wurden die Verstorbenen in ihrem Wohnhaus aufgebahrt. Die Bestatter wuschen sie zu Hause und richteten sie schön her und legten sie in den Sarg. So konnten alle Leute vorbeikommen und die Toten nochmals sehen und sich von ihnen verabschieden.
Meine Mutter besuchte alle Toten, die sie kannte. Sie nahm mich mit und wir zogen los. Sie hielt mich an der Hand und wir liefen im Stechschritt durchs Dorf zu irgendwelchen Leuten. Sie hatte ja nie viel Zeit, deshalb lief sie so schnell und ich musste mit kleinen Schritten mit-hüpfen. Dieser schnelle Schritt blieb an mir haften und meine Töchter könnten ein Liedchen davon singen, wie sie mir hinterher haben rennen müssen.
Zum schnellen Schritt meiner Mutter ist noch zu sagen, dass sie ein paar Jahre später nicht mehr schnell laufen konnte. Ihr Herzfehler, nämlich ein Loch zwischen den beiden Vorhofkammern, machte sich bemerkbar und Mutter wurde bei jedem Schritt sofort kurzatmig. 1976, mit 56 Jahren, wurde ihr Herz operiert. Danach fühlte sie sich nochmals wie neu geboren.
Jedenfalls gingen wir die Toten besichtigen. Tote anschauen war absolut kein Tabu und ich habe als kleines Mädchen schon sehr viele Tote gesehen. Dieser Anblick machte mir überhaupt nichts aus.
Später wurden die Toten nicht mehr zu Hause aufgebahrt. Ich selbst behielt diesen Brauch bei und gehe noch immer in die Aufbewahrungshalle um Bekannte ein letztes Mal zu sehen.
In Sins waren drei Holzsärge auf dem Estrich gelagert. Der Grossvater Jakob war Schreiner und Sargmacher. Er schaute voraus und stellte Särge für seine Angehörigen her. Nach seinem Tod blieben noch drei Särge im Estrich. Sie hatten etwas Makaberes und Faszinierendes zugleich. Zum Spiel legten wir uns in die Särge. Ich hielt es nur ein paar Sekunden aus. Das reichte um meinen Mut zu beweisen. Denn gruslig und angsteinflössend blieben die Särge auch nach mehreren Versuchen. Die Särge fanden bald ihre endgültige Bestimmung. Einer war für die Grossmutter im Jahr 1973, der zweite war für die Mutter im Januar 1987 und der letzte für den Vater im Oktober 1989.

Dieses Wort kenne ich, seit ich denken kann. Mein Bruder Seppi, der sich später Giuseppe nannte, war Diabetiker seit seinem 6. Altersjahr. Mein Vater hatte auch seine eigene Erklärung für dieses Krankheitsunglück. Er führte es auf zu viel Zuckerkonsum zurück. Vor Weihnachten kamen viele Pakete von Lieferanten und Geschäftspartnern. In den Geschenkpaketen waren oft grosse Salamis und Pralinen, und jedes Jahr war ein riesiger Sack mit Bonbons dabei. Die Eltern versteckten die Zückerli im Büro in einer Schublade. Dies nützte so gut wie gar nichts, denn alle wussten, wo die Bonbons zu finden waren.
Mein Vater war überzeugt, dass mein Bruder zu viel von diesen Süssigkeiten gegessen hatte, und deshalb die Zuckerkrankheit bekam. Als der sechsjährige Seppli grosse Mengen Wasser trank und sein Durst einfach nicht gestillt werden konnte, musste er untersucht werden. Die Bauchspeicheldrüse arbeitete nicht mehr und der Zucker konnte nicht mehr verarbeitet werden. Von da an brauchte Seppi jeden Tag eine Spritze mit Insulin. Damals waren es riesige Glasspritzen. Die Mutter musste ihn ins Bein stechen, was der kleine Seppli gar nicht wollte. So dauerte es Abend für Abend eine unendlich lange Zeit, bis die Prozedur vorüber war. Als ich geboren wurde, war Seppi bereits 10 Jahre alt und konnte sich die Spritze selbst setzen. Trotzdem erinnerte ich mich gut daran, wie unsere Mutter täglich mit den Spritzen hantierte und diese auskochte und in der Küche zum trocknen hinlegte.
Das Essen wurde komplizierter bei Seppi. Das Schlimmste für ihn war nicht der Verzicht auf Süsses. Das Allerschlimmste war für ihn, dass er nicht mehr so viel Kartoffelstock essen durfte, wie er gerne wollte.
Die Familienstimmung war geprägt durch Seppis Wohlbefinden oder Unwohlbefinden. Ging es ihm gut, ging es allen gut. Hatte er aber einen Wutanfall, dann zitterten die Wände und das Geschirr zerbrach. Später erkannte ich den Zusammenhang mit den Emotionen und dem zu tiefen oder zu hohen Zuckerspiegel. Wenn der Zuckerspiegel nicht stimmt, kann es einen Menschen ausser Rand und Band versetzen. Zum Glück wurde die Technik der medizinischen Versorgung immer besser und ausgeklügelter. Heute funktioniert es mit einem Insulindepot unter der Haut. Mit wenig Manipulation durch die Haut und der App auf dem Handy kann nun die Zufuhr gesteuert werden.
Die Begleitung von Seppi war zeitintensiv für die Mutter. Obwohl er als Erwachsener alles selbst verrichtete, war die Mutter immer um ihn besorgt. Noch am Sterbebett machte sie sich Gedanken, wie es mit ihm weitergehen würde. Sie legte uns Geschwistern nahe, dass wir weiterhin zu ihm schauen sollen.
Das taten wir auch. Denn bei allen Krankheitsgeschichten, die Giuseppe während seines 70-jährigen Lebens durchleben musste, konnte er immer auf die Unterstützung seiner Brüder und Schwestern zählen.

Im Jahr 2022 musste er beide Füsse auf der Höhe der Unterschenkel amputieren lassen. Die Wundheilung der Zehen und Füsse war so schlecht, dass er beinahe an einer Blutvergiftung gestorben wäre. Deshalb musste der linke Fuss im Januar notfallmässig weg. Ein paar Monate später entschied er selbst ebenfalls den zweiten Fuss amputieren zu lassen. Denn es bestanden dieselben Probleme mit der Wundheilung wie am linken Fuss.
In der Rehabilitation lernte er mit den Prothesen umzugehen und damit zu laufen. Er trainierte vorbildlich und über eine gewisse Strecke lernte er sehr gut mit den künstlichen Beinen zu laufen. Für längere Strecken wurde es aber zu anstrengend. Ein einfacher Rollstuhl mit Elektroantrieb schuf Abhilfe und die Bewegungsfreiheit war damit kaum mehr eingeschränkt. Er wurde dadurch sogar mobiler als vor den Amputationen. Der Rollstuhl ermöglichte längere Spaziergänge in der Umgebung und ebenfalls die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel.


Wenn im Jahr 1975 kurz vor 12.00 Uhr mittags zwei kleine Fiats hintereinander an unserem Haus vorbei ins Dorf fuhren, dann gingen die eineiigen Zwillinge Werner und Hans zu ihrer Mutter Mittag essen. Sie kochte wahrscheinlich gerade Hörnli mit Ghackets und Apfelmus, was hier alle mochten.
Die Salvisberger Zwillinge weckten bei mir Verwunderung, Interesse und auch ein bisschen Angst aus. Sie hatten auch einen Kosenamen. Sie nannten sich selbst gegenseitig “Guguseli”. Die beiden Männer hatten es schwer in der Schule gehabt und hatten nie lesen und schreiben gelernt. Sie sprachen kaum und wenn überhaupt nur in einer Sprache, die nur sie beide verstanden. Jeder sass selbst am Steuer seines kleinen Fiats, obwohl sie nie unterschiedliche Wege gingen.
Die Salvisbergzwillinge kannte jeder im Dorf. Aber niemand konnte sie unterscheiden. Dies war von grossem Vorteil z.B. für die Autoprüfung. Man sagte, dass nur einer von beiden, dafür zweimal, hingegangen sei.
Jeweils so gegen 12.50 Uhr fuhren die beiden in umgekehrter Richtung wieder vorbei. Darauf konnte man sich von Montag bis Freitag verlassen. Es gehörte zu meinen Gewohnheiten zur richtigen Zeit aus dem Fenster zu schauen und das Vorbeifahren der Fiats abzuwarten. Dann war die Welt in Ordnung.
Die Brüder verbrachten ihre Tage mit dem Förster im Wald. Sie konnten einfache Handlangerarbeiten erledigen. Durch diesen Job und das Leben im Dorf wurde ihnen ein selbständiges Leben ermöglicht und sie mussten ihr Leben nicht in einer Institution verbringen. Als viele Jahre später der erste der beiden starb, musste der andere Zwilling erst lernen allein zu leben. Dies gelang ihm recht gut und er lebte noch über zehn Jahre weiter in Sins. Foto eines Dorfanlasses. Unsere Mutter mit dem Baby auf dem Arm
Foto eines Dorfanlasses. Unsere Mutter mit dem Baby auf dem Arm
In einem 2000 Seelen Dorf, wie dasjenige, in dem ich aufgewachsen bin, kannte jeder jeden. Oft blieben die Familien im Dorf. Wenn das älteste Kind einer Familie das Elternhaus übernahm, suchten sich die jüngeren Geschwister etwas Eigenes in der Umgebung. Unsere Familie war eher eine Ausnahme. Von meinen neun Geschwistern blieben lediglich zwei Brüder im Dorf.
Meine Mutter hatte ein grosses Herz und einen besonderen Zugang zu den speziellen Menschen im Dorf. Davon gab es ausser den Zwillingen noch mehr. Da war zum Beispiel die „Käppelimarie“. Mit ihren zu Stoppeln geschnittenen kurzen Haaren fiel sie auf. Zudem hatte die Käppelimarie goldene Ohrringe, die ein riesiges Loch ins Ohrläppchen rissen. Sie fuhr mit einem Zweitakttöffli und einem grossen Anhänger durchs Dorf. Mit der Sense mähte sie die kleinen Wiesen, die sonst niemand mähte. Das Heu lud sie auf ihren Anhänger und brachte es ihren Schafen.
Wir hatten unter dem Haus am Bach auch eine Wiese. Da mähte sie das Gras. Wenn sie fertig war, sass sie lange bei meiner Mutter in der Stube beim Käffelen. Oftmals hatte sie noch eine Sorge, die sie hier loswerden konnte. Zudem hatte sie meistens noch ein Anliegen auf Lager. Es gab immer irgendwelche Arbeiten, die sie nicht selbst erledigen konnte. Da war sie bei Frau Mühlebach am richtigen Ort. Denn die Mutter schickte sofort ein Kind in Käppelimaries Haus, um dort die gewünschten Arbeiten zu erledigen.
Auch Frau Hürlimann kam sehr gerne mit ihren Sorgen und Wünschen zur Mutter. Sie wohnte in einem alten abbruchreifen Haus direkt neben den Bahngeleisen. Das Haus war schmuddelig und dunkel und mindestens 5 zottige Hunde wohnten mit ihr darin. Jedes Mal, wenn ich in dieses Haus trat, musste ich vorher noch zünftig einatmen und danach möglichst lange die Luft anhalten. Ich wurde immer besser im Anlegen von Luftreserven. Denn ich musste recht oft zu ihr. Wahrscheinlich konnte ich deshalb in der Badi ohne Probleme eine ganze Länge von 25Metern unter Wasser schwimmen. Bei Frau Hürlimann musste ich z.B. die Glühlampen an der Decke wechseln oder Vorfenster ein- und aushängen.
Meine Mutter war mit ihrer grossen Hilfsbereitschaft und den vielen Kindern ein sicherer und zuverlässiger Wert für diese alleinstehenden Frauen.

Die Lehrer und Lehrerinnen der Schulen von Sins kannten unsere Familie. Innerhalb von 17 Jahren gingen alle zehn Mühlebachkinder im Schulhaus ein und aus. Die Kinder, die später als Käthy geboren wurden, hatten es etwas schwerer in der Schule. Sie war unsere absolut gescheiteste Schwester. An ihr wurde alles gemessen. Die Lehrer sagten mir 9 Jahre später noch, dass das Käthy dies oder jenes längstens gekonnt und gewusst hatte. Als jüngere Schwester von Käthy hatte man eigentlich keine Chance. Man stand immer in ihrem Schatten.
Für mich war Käthy das „Kätteterli - Spielgfätterli“. So nannten wir sie immer. Denn sie spielte viel und oft mit ihren jüngeren Geschwistern. Als sie dann eine junge Lehrerin war, durfte ich mithelfen die Prüfungshefte ihrer Schüler zu korrigieren. Da ich den Schulstoff schon gehabt hatte, konnte ich Vorkorrekturen mit feinem Bleistift hineinschreiben. Käthy war nicht sehr lange Lehrerin. Sie stürzte sich schon bald ins Chemiestudium und zog zum Hans nach München.
Käthy brachte noch etwas anderes sehr spannendes und sehr exotisches in die Familie. Sie verschaffte uns nämlich besondere Haustiere. Sie bot sich an die Reptilien eines Seminarkollegen zu hüten. So kamen wir in den Genuss von zwei junge Schlangen. Es waren Königsboas aus der Gruppe der Würgeschlangen. Sie waren mit ihrer Länge von 80 cm noch komplett harmlos. Wir konnten mit den Schlangen „spielen“, indem wir sie um unseren Arm gleiten liessen.
Damit noch nicht genug. Es kamen noch Leguane und Warane dazu. Die ganze Familie engagierte sich rund um diesen Reptilienzoo. Einer der Brüder baute die Terrarien. Die Tiere brauchten auch Futter. Die Schlangen verschlangen lebende Mäuse. Das war die Gelegenheit für den kreativen August. Er erfand eine Mausefalle, die die Mäuse lebend einfing. Die Echsen ernährten sich von Insekten. Für sie ging ich täglich auf die Wiese nebenan um massenhaft Heuschrecken zu fangen. Die Tiere waren zirka 2 Jahre bei uns und hausten in ihren Terrarien im Schlafzimmer von Käthy.
Meine beiden Lehrerinnenschwestern liessen mich stark an ihrem schulischen Alltag teilhaben. Denn mindestens so gerne wie Schulhefte korrigieren ging ich mit meiner Schwester Agnes in die Turnhalle. Als ich etwa 10 Jahre alt war, war sie bereits eine ausgebildete Handarbeits- und Turnlehrerin. Mit ihr und oftmals noch mit einer Freundin gingen wir an Samstagen in die Turnhalle. Mit ihren Schlüsseln standen die Tore offen. Sie wollte den Sportunterricht vorbereiten und ich bot ihr eine Win- win- Situation. Agnes hatte mit mir ein Versuchskaninchen und ich hatte die tolle Gelegenheit mich in der grossen Turnhalle zu tummeln.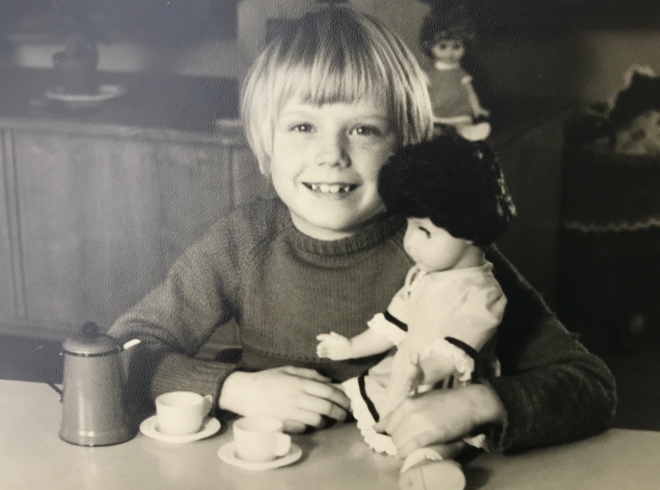

In meinem Jahrgang waren sehr viele Kinder in Sins. Deshalb wurden wir für den Kindergarten in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe durfte montags, mittwochs und freitags gehen. Die zweite Gruppe ging an den Tagen dazwischen. Die Kindergärtnerin war eine Klosterfrau. Wir sprachen sie mit Schwester Hildegard an.
In der ersten Klasse waren wir 44 Kinder. Davon hatten zwei Klassenkameraden eine Behinderung. Nach dem ersten Schuljahr gingen beide in eine Sonderschule. Fräulein Kressebuch, die Lehrerin, war kurz vor ihrer Pensionierung. Sie kam sehr gut zurecht mit dieser Kinderschar.
Bevor wir Kinder am Morgen das Haus verliessen, mussten wir den Weg übers Esszimmer machen und uns in die Reihe vor das Weihwassergeschirr stellen. Die Mutter tauchte ihren Daumen ins gesegnete Wasser und machte ein kleines nasses Kreuz auf die Stirn, den Mund und die Brust. Das Nass auf der Stirn und auf dem Mund hatte ich überhaupt nicht gern.
Ein solcher Morgenablauf war damals üblich in katholischen Familien. Später realisierte ich, dass dieses Ritual, unabhängig von Glauben und Religion, eine sehr schöne Geste darstellt. Man gab dem Kind einen Segen mit auf den Weg. Darin schenkte man dem Kind das Zutrauen den Tag selbst meistern zu können und die Hoffnung, dass es am Abend wieder gesund nach Hause kam.
Es war nicht der absolute Wunsch unserer Mutter so viele Kinder zu haben. Ihr war sehr bewusst, dass kinderreiche Familien in späteren Jahren, als es kaum mehr Grossfamilien gab, nicht unbedingt ein beneidenswertes Image hatten. An Kindern von Grossfamilien haftete ein Vorurteil von schmutzig und vielleicht auch etwas dumm. Dem wollte die Mutter ein starkes Gegensteuer geben. Es war ihr ausgesprochen wichtig, dass wir in der Schule fleissig und gescheit waren. Dies gelang allen ganz gut. Zudem mussten wir immer sauber gekleidet aus dem Haus gehen. Bei der morgendlichen Weihwasserabgabe konnte sie den Gesichts-, Hände- und Kleidercheck machen. Im Notfall konnte mit dem Weihwasser noch etwas weggeputzt oder die Kleider noch zurecht gerückt werden.
Ich wusste schon in der Schulzeit in Sins, dass ich Bobath-Therapeutin werden wollte. Niemand wusste, was dies war. Ich selbst hatte, um ganz ehrlich zu sein, auch keine Ahnung.
Auf diese Idee kam ich in einem Familienlager, das meine Schwester Maria mit drei andern Frauen und ihren Kindern durchführte. Maria nahm mich mit, denn ich spielte gerne mit Kindern. Es waren mindestens zehn Kinder mit dabei. Bei einer Mutter beobachtete ich, wie sie auf spezielle Art mit ihrem zweijährigen behinderten Knaben spielte. Sie erzählte mir, dass sie von einer Bobath-Therapeutin angeleitet wurde. Diese instruiere sie, wie sie ihr Kind fördern könne.
Ich habe noch nie „Bobath-Therapeutin gehört, trotzdem war meine Berufsentscheidung in diesem Moment unverrückbar gefallen.
Meine Recherchen ergaben, dass man Physio- oder Ergotherapeutin sein müsse. Danach könne man sich zur Bobaththerapeutin weiterbilden. Als Bewegungsmensch war für mich klar, dass ich Physiotherapeutin werden wollte. Meine Mutter meinte aber dringend ich solle im Bezug zu meinem Berufswunsch etwas offener sein und schickte mich in die Berufsberatung. Dort wurde mir empfohlen eher Ergotherapeutin als Physiotherapeutin zu lernen. Für diesen Hinweis war ich im Nachhinein sehr dankbar. Ergotherapie passte definitiv besser zu mir. Mit diesem Beruf konnte ich meine Affinität zum Handwerk, mein Interesse an Medizin und die therapeutische Arbeit mit Menschen ideal kombinieren. Wenige Jahre nach der Grundausbildung wechselte ich das Fachgebiet. Ich verliess die neurologische Erwachsenenrehabilitation und spezialisierte mich im Fachbereich der Pädiatrie. Jetzt war der Moment für die Ausbildung zur Bobaththerapeutin gekommen, und somit war ich bei meinem ursprünglichen Berufsziel angelangt. Später wurde dieses therapeutische Konzept zu “Neuro Development Treatment” kurz “NDT” umbenannt.

Wer war die Hippiefrau der Familie? Dies muss man wohl nicht zweimal fragen. Das war natürlich meine Schwester Anne. Etwa anfangs der Siebzigerjahre eroberte sie in bunten Kleidern und mit 5 Freunden in einem VW- Bus die Welt. Es waren drei langhaarige Männer und drei Frauen. Neben meiner Schwester Anne war auch unsere Cousine Vreni mit dabei. Sie fuhren gegen Osten los. Ich glaube, sie wollten nach Indien - wie alle zu dieser Zeit, aber sie kamen nur bis Afghanistan.
Das praktische Herrichten des Busses und die letzten Reisevorbereitungen wurden bei uns erledigt. Der Start der grossen Reise begann vor unserem Haus. Es war ein besonderer Moment, als alle sechs einstiegen und langsam losfuhren. Die Reisenden winkten aus den Autofenstern und wir winkten genau so heftig und intensiv zurück.

Meine Mutter stand Ängste und schlaflose Nächte aus, wegen diesem Abenteuer. Die sechs Freunde waren gerade etwas über 20 Jahre alt und wagten durch unbekannte und auch sehr konfliktreiche Länder zu reisen. Es blieb unseren Eltern nichts anderes übrig als sie ziehen zu lassen und zu hoffen, dass sie heil wieder zurückkamen.
Erst aus der erwachsenen Sicht realisierte ich die Bedeutung dieser Reise für unsere Familie. Die Werte der Hippiezeit entsprachen ganz und gar nicht den religiös geprägten Werten unserer Eltern in dieser Zeit. Trotzdem wurde meine Schwester Anne nie verurteilt oder bestraft. Beim Nachfragen bei meinen älteren Geschwistern erfuhr ich, dass niemals bös über Anne gesprochen wurde. Es war nicht die "abverheite" Tochter. Mein ältester Bruder Hans sagte dazu: "die Eltern hatten einfach ein Urvertrauen und glaubten, dass alles gut gehen wird." Heute habe ich eine grosse Achtung vor dieser offenen und wohlwollenden Haltung meiner Eltern. Insbesondere die Mutter war die Werte vermittelnde Person. Den ihre Meinung und Haltung bestimmten den Alltag bei uns sehr stark.
Ich war sehr neugierig auf alles, was die Abenteuerlustigen erlebten und freute mich auf ihre Heimkehr. Mit grösster Spannung erwartete ich das Auspacken der Reisesouvenirs und hoffte natürlich, dass auch etwas für mich darunter war.
Ein VW-Bus war damals der Inbegriff der Freiheit und das begehrte Reisemittel. Mein Bruder Hans hatte auch einen ausgebauten Bus. Er fuhr mit Freunden zum Nordkap. Meistens stand aber sein Bus neben dem Haus. Damit war ich schon zufrieden. Denn mit Freundinnen darin zu übernachten war schon ein grosses Vergnügen und recht abenteuerlich.

Anne hatte die Begabung unsere Eltern immer wieder in Schockmomente zu versetzen. Sie war etwas über 25 Jahre alt. Als ausgebildete Krankenschwester ging sie mit „Terre des hommes“ voller Idealismus und Abenteuerlust nach Bangladesh. Es waren die Jahre 1975 – 1977. Schon bald erhielten wir in Sins einen Brief, der ein unvergessliches Foto enthielt.
Auf dem Bild kauerte ein kleines Mädchen 2-3 Jahre alt. Es war sehr abgemagert. Anne schrieb unseren Eltern, dass sie dieses Mädchen adoptieren wolle. Meine Eltern waren, trotz des grossen 3.Weltherzens der Mutter, schlichtweg entsetzt und konnten sich auf keine Art und Weise auf ein mögliches Grosskind aus dem Osten freuen.
„Terre des hommes“ erlaubte diese Adoption nicht. So blieb Anne nichts anderes übrig als ihren Auftrag zu befolgen und das Mädchen in die Schweiz zu bringen. Das Mädchen wurde von einer Genfer Familie adoptiert. Sie hiess in Bengalisch „Kurene“ die Adoptiveltern gaben ihr in der Schweiz den Namen Cindy.
In weiser Voraussicht hatte Josianne, Annes Kollegin, dem Mädchen noch einen Brief mit in die „Wiege“ gegeben. Als erwachsene Frau kam dieser Brief in die Hände von Cindy. Nun erst war es ihr möglich etwas über ihre Herkunft zu erfahren. Cindy machte sich auf die Suche nach den zwei Frauen, die sie in Bangladesh betreut und später in die Schweiz gebracht hatten. Das Internet machte es möglich, dass sich Cindy, Anne und Josianne zirka 30 Jahre später wieder finden konnten. Ein herzberührendes Wiedersehen zwischen Anne und der erwachsenen Kurene-Cindy fand statt. Wie durch ein Wunder gewann Anne ihre erste “Tochter” als erwachsene Frau zurück.



Der Holländer Tom gehört seit unendlich langer Zeit zur Familie. Er ist der Ehemann meiner Schwester Anne. Die Gewohnheiten von Tom aus Holland brachten das Verständnis darüber, wie man etwas zu machen hatte, völlig ins Wanken. Gerade beim Essen gab es sehr viele Unterschiede. Da fielen mir doch beinahe die Augen aus dem Kopf, als ich beobachtete, was er mit unserer Butter tat. Er kratzte sie mit dem Messer waagrecht auf der Oberseite weg. Wie konnte man die Butter nur so verunstalten. Wir waren uns gewohnt am Buttermödeli jeweils ein Stück senkrecht abzuschneiden. Sein Vorgehen entsetzte uns alle. Dann legte er ein Stück Käse auf das Butterbrot und dann ein zweites Butterbrot obendrauf. Wir staunten Klötze. Sandwich isst man höchstens unterwegs, aber nicht zu Hause. Später in Holland verstand ich, warum die Holländer immer Sandwich assen. Die Brote wurden hier mit der Maschine in so feine Scheiben geschnitten, dass eine Scheibe längstens auseinander gefallen wäre, hätte sie nicht zur Stabilität eine zweite Scheibe oben drauf gekriegt.
Zum Znacht assen wir sehr oft geschwellte Kartoffeln. Dies auch deshalb, damit die Mutter für die Zmorgerösti die Kartoffeln schon bereit hatte. Geschwellte Kartoffeln essen verstand Tom wiederum gar nicht. Er musste sich wohl unter Barbaren gefühlt haben, denn in Holland waren geschwellte Kartoffeln explizit für die Schweine gedacht.
Tom hatte lange schwarze Haare und einen Bart. Ohne viel dazu zu tun, hatte er das ideale Aussehen für einen Weihnachtsmann und diese Rolle füllte er perfekt aus. An Weihnachten kniete er vor den Christbaum und legte zehn bis zwanzig schön eingepackte Geschenke darunter.
Tom brachte zudem riesige Mengen von „Drobies“ mit in die Schweiz. Die Holländer lieben Lakritze. Bärendreck bestand aus dem Zuckersirup, der aus den Wurzeln von Süssholz gewonnen wurde. Bei uns waren die «Drobies» eher etwas gewöhnungsbedürftig. Aber Tom ermüdete über viele Jahre nicht uns an diese holländische Spezialität zu gewöhnen. Irgendwann gab er es schlussendlich auf, als er merkte, dass die vorjährigen Portionen noch unberührt im Haus zu finden waren.
Viel begehrter hingegen waren all die verschiedenen Packungen der holländischen Schokoladenstreuseln. Auch diese brachte er jedes Jahr in grossen Mengen mit. Davon konnten wir nie genug kriegen. Der Schoggistreuselimport aus Holland durfte auch die kommenden Jahre niemals abbrechen. Denn die Streusel waren bei der nächsten Generation ebenso beliebt.

“Was hast du zu Weihnachten gekriegt?” wollte man immer am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien von den Klassenkameraden wissen. Ausser an das Pyjama, das zuverlässig jedes Jahr von meinem Götti eintraf, und an eine Puppe von meiner Gotte erinnere ich mich an keine speziell an mich gerichteten Geschenke. Die Eltern schenkten uns Spielzeuge, an denen hoffentlich alle Freude hatten. Super war die Rennautobahn. Jeweils zwei Rennfahrer standen im Duell gegeneinander. Mit einem Geschwindigkeitsknopf in der Hand steuerte man die Rennautos möglichst geschickt um die Runden.
Ein weiteres Gemeinschaftsgeschenk war ein Metallbausatz. Damit wurden mit Kreativität und Konstruktionsgeschick Kräne, Autos, Brücken und vieles mehr gebaut. Viel Unterhaltung bot auch ein Eishockeykasten. Statt Fussballern wurden Hockeyspieler in Schlitzen übers ganze Eisfeld geführt.
Der Vater machte ausschliesslich Geschenke für die Mutter. Sie bekam regelmässig ein neues Küchengerät. So fand eine moderne Pouletschere Einzug in unseren Haushalt. Später war es ein Kisagbläser oder ein Mixer.
An meinem Geburtstag bekam ich etwas Geld um in der Papeterie ein neues Globibuch oder ein Malbuch auszulesen.
Mein grosser Traum war aber etwas Grösseres. Ich wünschte mir sehnlichst ein paar Skis.
Im Keller lagerten verschiedene alte Modelle mit braunen klobigen Skischuhen und einem wirklich alten Bindungssystem. Eine Schnalle musste vorne hinuntergedrückt werden, damit der Skischuh auf dem Ski fixiert werden konnte. Trotz zweier grosser Vorteile waren diese Skies auch in den Siebzigerjahren ziemlich aus der Mode geraten. Es war nämlich möglich mit Fellen den Berg hoch zulaufen oder im Telemarkstil runterzufahren.
Ich wünschte mir natürlich Skis, die mit den neuen Fersenautomaten ausgestattet waren. Diesen Wunsch hatte ich öfters bei der Mutter platziert. Einmal an Weihnachten entdeckte ich unter den Geschenken ein längliches grosses Paket. Das versetzte mich sofort in die kühnsten Fantasien. Es stand hinter dem Christbaum an die Wand gelehnt. Während des obligaten Weihnachtsliedersingens versuchte ich per Augenmass abzuschätzen, ob die Länge des Pakets in etwa stimmen könnte. Ich war mir mittlerweile sicher, dass in diesem Paket Skis für mich drin sein müssten. Doch ich wurde enttäuscht. Die Mutter durfte das Geschenk auspacken und hervor kam ein neues Bügelbrett.
Meine Schwester Anne, die bereits Geld verdiente, half mir aus der Patsche. Sie kaufte sich neue Skis und ich durfte diese mitbenutzen. Das war die grosse Rettung. Damit konnte ich ohne mich zu schämen an einem Skikurs teilnehmen und ins Skilager gehen. Weitere Skitage erlebte ich dank Bruder Hans, der mich zusammen mit seiner zukünftigen Frau Marlies in verschiedene Skigebiete mitnahm.
Zwei Geschenke fanden den Weg ohne mein Zutun zu mir. Als ich etwa sechs Jahre alt war, gewannen meine Geschwister ein Trotinett an einer Tombola.
Auch der kinderlose Briefträger im Dorf hatte Glück mit Losen. Er gewann einen Puppenkinderwagen. Da er diesen nicht brauchen konnte, konnten die Mühlebachmädchen profitieren.
Mein Kinderherz hatte aber noch weitere Wünsche. Diesmal waren es Rollschuhe. Das war gerade der neuste Hit, als ich etwa 13 Jahre alt war.
Unter den damaligen Rollschuhen stelle man sich Metallteile mit 4 Rollen vor. Diese wurden mit Lederriemen an die normalen Schuhe gebunden. Solche Rollschuhe wären der Inbegriff meines Glücks, glaubte ich. Im Schaufenster des dörflichen Eisenwarenladens hatte ich solche gesehen. Sie kosteten Fr. 40.20. Diesen Wunsch trug ich meiner Mutter vor und bettelte innig darum. “Das kommt gar nicht in Frage” war die erste vernichtende Antwort. Sie begründete es damit, dass sie den andern Kindern nie so etwas habe kaufen können.
Die Zeiten änderten sich und es ging unserer Familie aus finanzieller Sicht deutlich besser. Die meisten der Geschwister waren inzwischen selbständig geworden und unser Leben wurde angenehm entspannter. Nachdem die Mutter nochmals darüber geschlafen hatte, änderte sie ihre Meinung und ich durfte die Rollschuhe kaufen gehen.
Solche Entscheidungen verursachten der Mutter arges Kopfzerbrechen. Wie man es auch wendet und dreht, eine Zerrissenheit blieb unvermeidlich. Darf man den jüngeren Kindern Dinge ermöglichen, wovon die älteren Geschwister nie zu träumen gewagt hätten? Oder musste sie ihren Gerechtigkeitssinn neu überdenken? Die Mutter entschied weise und hatte die Einsicht, dass alles zu seiner Zeit seine Richtigkeit und seine Berechtigung habe.
Mit meinen neuen Rollschuhen erlebte ich die grössten Glücksmomente. Sie waren mein grosser Stolz und damit gehörte ich auf dem Schulhausplatz wirklich dazu.

In unserer Nachbarschaft wohnte ein älteres kinderloses Ehepaar. Aus irgend einem Grund war ich öfters in ihrer Stube. Bei Brunners verbrachte ich viele Nachmittage und genoss die ungeteilte Aufmerksamkeit und ganz besonders die heisse Schokolade. Auf dem Tisch lagen ein lustiges Malbuch und neue schöne Farbstifte bereit. Es gab sogar Bilderbücher in diesem kinderlosen Haushalt und zwar mehr, als wir zu Hause hatten. Bei uns gab es nämlich nur zwei Kinderbücher. Eines von Hofmann mit dem Suppenkasper und eines mit missionarischen Geschichten mit vielen Abbildungen von schwarzen Afrikanerkindern.
Die Besuche bei Brunners nahmen ein schnelles und abruptes Ende. Frau Brunner fragte mich einmal ganz arglos, ob ich nicht bei ihnen bleiben wolle. Als Begründung fügte sie noch hinzu, dass mein Mutter doch noch so viele Kinder habe. Das war zu viel und ging mir definitiv zu weit. Ich verzichtete von nun an auf die gemütlichen Stunden, die heisse Schokolade und die liebevolle Zuwendung und ging nicht mehr hin.

Viele Jahre später erhielt ich ein ähnliches Angebot von meiner Schwiegermutter. Es berührte sie sehr von mir zu hören, dass ich kurz vor meinem 24. Geburtstag meine Mutter verloren hatte und auch der Vater bald darauf gestorben sei. So bot sie mir kurzerhand an, dass sie nun mein “Muetti” sein könne. Ich wehrte dieses gutgemeinte Angebot vehement ab. Obwohl meine Schwiegermutter ohne Zweifel eine ganz tolle Frau gewesen ist, aber eine Mutter zu ersetzen geht einfach nicht.
Meine Schwiegermutter kannte ich über 30 Jahre. Das sind mehr Jahre als ich meine Mutter gekannt habe. Ich schätzte sie in jeder Hinsicht und war glücklich, dass unsere Kinder eine so aufmerksame und liebevolle Grossmutter hatten. Wir führten viele wertvolle Gespräche über unsere Leben, die Familien und auch über die vielen Bücher, die wir beide gelesen hatten. Sie starb 2016 im Alter von 86 Jahren.

Kaum hatte ich das Diplom in Ergotherapie im Sack überrumpelte uns eine schlechte Nachricht: Die ersten Krebssymptome bei Mutti zeigten sich. Nur wurde der Krebs lange nicht als solcher erkannt. Ein halbes Jahr nach den ersten Symptomen - ich kam gerade von der Südostasienreise mit Brigitte zurück - teilte mir Mutti mit, dass sie Krebs habe. Der Körper war schon voller Metastasen. Der Krebsherd wurde nie gefunden. Man sprach von diffusem Lymphknotenkrebs. Der Krankheitsprozess schritt sehr schnell voran.
Mutti war kurz vor ihrem 67. Geburtstag und wusste, dass sie nicht mehr lange leben würde. Es war ihr daher sehr wichtig, noch einmal die gesamte Familie ein paar Tage zusammen zu haben. Maria organisierte das erste Familienweihnachtstreffen in der Sommerau oberhalb Sarnen. Wir waren drei Tage im Ferienheim und wussten alle, dass es das letzte Zusammensein mit Mutti sein würde.
Nach den Tagen in der Sommerau war sie nur ein paar Tage zu Hause. Den nächsten Bestrahlungstermin in Aarau hatte sie an Silvester. Ihr Krankheitszustand war innert Kürze so schlecht geworden, dass sie im Spital entschieden, sie stationär aufzunehmen.
Am andern Tag - es war der 1. Januar 1987 - ging ich zu ihr ins Spital. Zum Znacht versuchte sie ein Birchermüesli zu essen. Sie verschluckte sich mehrmals. Das gefiel mir gar nicht und ich entschied die Nacht neben ihr zu bleiben. Den Lehnstuhl rückte ich neben das Bett und verbrachte die Abend- und Nachtstunden mit kurzen Nickerchen und dazwischen kleinen Gesprächen mit der Mutter. In diesem Moment dachte ich noch nicht ans Sterben. Gegen die frühen Morgenstunden änderte sich mein Gefühl. Ich spürte den Tod im Zimmer und bekam panische Angst. Mit dem ersten Zug fuhr ich nach Sins. Beim Verabschieden fragte sie mich noch als letztes, ob ich Geld für den Zug hätte.
Kaum zu Hause angekommen kam die Nachricht, dass die Mutter in Bewusstlosigkeit gefallen sei. Nun war allen klar, um was es ging. Der Vater und alle, die in Sins waren, stiegen ins Auto. Knappe zwei Stunden nach dem Verlassen des Spitals war ich wieder drin. In Windeseile reisten alle andern Geschwister und die Tante Ottilia nach Aarau.
Der Vater brachte ein paar bedeutungsvolle Gegenstände mit. Diese drapierte er auf dem Tischli im Spitalzimmer. Diese Sachen sollten der Mutter nach dem letzten Atemzug auf die Brust gelegt werden. Mit dieser liebevollen Geste brachte der Vater seine Hingabe und Fürsorge für sie bis zum letzten Moment zum Ausdruck.
Es folgte ein unendlich langer, intensiver Samstagnachmittag. Alle durften einen Moment allein mit der Mutter im Zimmer verbringen. Sie hatte die Möglichkeit, allen ihre wichtigsten Anliegen mitzuteilen. Jedes von uns konnte sich persönlich von ihr verabschieden. Diese Einzelbesuche mussten gut organisiert sein, denn die Mutter brauchte auch immer wieder Ruhezeiten dazwischen. Wenn sie in Schlaf fiel, war es jedes Mal ungewiss, ob sie nochmals erwachen würde. Es gab Momente, in denen wir alle gleichzeitig um ihr Spitalbett versammelt waren. In diesen Momenten sangen wir „Donna nobis“ in Endlosschlaufe.
Bevor einige nach Hause gingen, wurde noch die Totenwache in der Nacht abgesprochen. Es sollte immer jemand da sein, jedoch nicht zu viele Personen gleichzeitig. Mutti starb gegen 4 Uhr früh. Anne, Giuseppe und Käthy waren beim letzten Atemzug dabei.

Im späteren Gespräch stellte sich heraus, dass genau die Geschwister anwesend waren, die dabei sein wollten. Ich wollte nicht dabei sein. Denn vor diesem Moment fürchtete ich mich.
Ich hatte damals kein Gefühl dafür, dass sie mit 67 Jahren eigentlich noch viel zu früh starb. Es war einfach so. Unsere Mutter hatte ihr Leben lang enorm viel geleistet und gearbeitet. In meiner Erinnerung war sie von der Arbeit gezeichnet und erschöpft. Die Krankheit brach aus, als ich als Letzte die Ausbildung abgeschlossen hatte. Nun waren alle Kinder selbständig und sie konnte loslassen. Ich hätte es mir anders gewünscht. Trotzdem war für mich klar, dass es richtig und gut so war.
Die eigene Mutter so nahe in diesem intimen Moment des Sterbens zu erleben war eine unglaublich eindrückliche und nachhaltige Erfahrung. Ich war dankbar für ihre grosse Offenheit, die sie uns bis zum letzten Moment gezeigt hat. Wir erlebten die Todesangst, die Spannung, die durch den ganzen Körper zieht. Sie krallte sich mit ihrer Hand in meine Hand so, dass ihre Fingernägel in meinem Handfleisch tiefe Spuren hinterliessen. Bis sie plötzlich in Frieden mit sich war und ganz entspannt im Bett lag. Ihre letzten Worte waren zwischen den Welten. Sie sagte: “Ich muss gehen, das Himmelstor steht offen”, “Meine Mutter ruft mich” oder “Ich sehe Licht”. Sie musste den Schritt in die andere Welt nicht allein gehen. Sie wurde von ihren Vorfahren abgeholt. Wir durften den Moment erleben, in dem sie zwischen Leben und Tod hin und her pendelte.
Das Begräbnis fand ein paar Tage später in Sins statt. Die Kirche war rappelvoll. Es war eine berührende und sehr würdige Beerdigung. Wir gestalteten diese Abschiedsfeier als Familie mit vielen individuellen Beiträgen. Der Kirchenchor, in dem unsere Mutter über viele Jahre mitsang, half uns musikalisch durch diesen schwierigen Moment. Zusätzlich sang eine Solistin das Lied “Ich weiss, dass mein Erlöser lebet” aus Messias von G.F. Händel.
Draussen am Grab spielte die Dorfmusik.

Das erste Mal kam ich in Zusammenhang mit meiner Mutter in Kontakt mit Bestrahlung. 1986 wurden die Metastasen ihres diffusen Krebses zweimal wöchentlich in Aarau bestrahlt. Ihr Krebs war aber bereits sehr weit fortgeschritten.
Bestrahlung als Krebsbehandlung wird seit 1912 angewendet. In diesem Jahr gelang Otto von Franqué die Heilung eines Eierstockkrebses mit Röntgenbestrahlung. In den vergangenen 100 Jahren hat sich die Bestrahlungstechnik enorm entwickelt. Die Geräte sind höchst differenziert und unheimlich präzis.
Bei mir war der Apparat “Truebeam” im Einsatz. Diese Maschine war im Keller der onkologischen Radiologie hinter speziell dicken Mauern, damit keine Strahlung in die Umgebung gelangen konnte.
Ich wurde auf die Liege dieses Apparates gebettet. Das Einrichten musste mit grosser Präzision geschehen. Strahlungserfahrene Bekannte warnten mich vor “Kriegsbemalung”, die sie mir versehen würden. Es kam ganz anders. “Truebeam” - die neuste Generation von Bestrahlungsgeräten - konnte mehr. Bei diesem Apparat erfolgte der Abgleich für die richtige Position mit übereinanderliegenden Fotos.
Bevor die erste Strahlungsdosis abgegeben wurde, verschwanden die betreuenden Fachpersonen im Steuerungsraum. Dort überwachten sie alles über mehrere Monitoren.
Die Bestrahlung selbst dauerte jeweils nur wenige Sekunden. Wenn es losging, bewegten sich die Arme des Roboters langsam auf mich zu und um mich herum. Alles drehte und bewegte sich, bis die millimetergenaue Einstellung eingerichtet war. Während dieses Vorgangs durfte ich mich kein bisschen bewegen. Die grosse Krake umarmte mich. Dann hörte ich ein sanftes Kommando aus dem Off: “Bitte einatmen”. Ich musste den Brustraum mit Luft füllen, die Luft anhalten und reglos ausharren. Der Abstand zwischen Strahlungsgebiet und Herz wird dadurch um ganze 2 cm vergrössert und hilft, dass das Herz möglichst nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Nach zirka 20 Sekunden erlöste mich die Stimme und ich durfte wieder normal atmen. Zum Glück hatte ich das lange Luftanhalten bereits in jungen Jahren aus anderen Gründen gut trainiert. Die Krake bewegte ihre Arme und alles begann nochmals von vorne. Etwa 4 mal ging das so. Dann löschte das rote Licht im Raum, mein Liegewagen rückte vor und fertig für heute. Weiter ging es mit derselben Prozedur während 28 Tagen hintereinander. Nur an den Wochenenden wurde ein Bestrahlungsunterbruch gemacht.
Hoffentlich hatte die Krake weitere potenziell gefährliche Krebszellen erfolgreich abtöten können.

Die Berge Rigi und Pilatus konnte man von Sins aus gut sehen. Sie hatten eine magische Anziehungskraft auf mich. Ich wäre gerne hochgelaufen. Ich hatte aber damals keine Gelegenheit in den Berge zu gehen. So wanderte ich Sonntag für Sonntag mit Luzia oder Brigitte der Reuss entlang. Im Sack war ein Fünflieber der Mutter für eine Ovomaltine in der Beiz. Einmal ging es Richtung Oberrüte das andere Mal Richtung Mühlau.
Einige meiner Klassekameraden mussten manchmal an den Wochenenden wandern gehen. Am Montag in der Schule ging es dann los mit Jammern über offene Füsse und über stundenlanges “Tschalpen”. Ich musste sogar ihre Blasen an den Füssen begutachten, die sie mir mit einer Mischung aus Wehklagen und Stolz zeigten.
Ich wäre so gerne auch in die Berge gegangen, aber für Wanderungen fehlte meinen Eltern die Zeit und die Energie. Der Glücklichste unserer Familie war deshalb Giuseppe. Sein Götti war Onkel Oswald. Er war Jäger und kannte sich in den Nidwaldner Bergen sehr gut aus. Giuseppe und andere ältere Geschwister durften manchmal mit diesem Onkel in die Berge gehen.
Zu den Bergen kam ich später auf eigene Faust. Als ich meine Freundin Rita in der Weiterbildungsschule in Zug kennenlernte, hatte ich die richtige Person gefunden.
Wir eroberten zusammen die Welt. Mit Rucksack, Schlafsack und Mätteli ging es los über Berge und durch Täler. Ahnungslos, selbstsicher und etwas tollkühn wanderten wir von Graubünden ins Wallis. Für die Übernachtung reichte in der Regel ein Holzschuppen oder ein weicher Moosboden. Die Nächte waren manchmal sehr kalt. Aber am nächsten Tag war alles wieder vergessen.
Mit Rita und ihren Freunden wurde ich in die Welt der Skitouren und des Kletterns eingeführt. Ich hatte meine Leidenschaft gefunden.



Den ersten Ultraschall in meiner zweiten Schwangerschaft machte ich in der 20. Schwangerschaftswoche. Einmal mehr zeigte sich der grosse Vorteil meiner rosaroten Brille. Sie half mir sorglos die Monate der Schwangerschaft zu geniessen.
Die Ärztin setzte den Sensor auf den Bauch und Schwups erschienen auf dem Bildschirm zwei Kugeln. Ich sagte sofort: “Das sind ja zwei Babies”. Die Ärztin bestätigte dies und antwortete ohne zu zögern: „Jetzt muss ich noch schauen, ob es ein drittes Baby hat“. Das war dann nicht der Fall, was uns natürlich erleichterte. So wurde uns neben dem geplanten zweiten Kind ein drittes Kind geschenkt.
Bei Zwillingen wird im Ultraschall sofort nach der Trennhaut zwischen den zwei Embryonen gesucht. Es war keine zu finden, was auf eine späte Teilung des befruchteten Eies hinwies. Deshalb folgte ein zweistündiger Termin beim Chefarzt des Frauenspitals Bern.
Das Einzige was ich damals wusste, war, dass es eineiige Zwillingsmädchen in einer Eihaut waren.
Die Selbstforschung über den eigenen Zustand per Internet wäre seit kurzem möglich gewesen. Ich machte es nicht. Das war gut so und half mit Sicherheit, dass ich mich nicht unnötig verunsichern liess.
Beim nächsten Termin untersuchte der Arzt Zwilling A und Zwilling B per Ultraschall auf Herz und Nieren. Die Assistentin auf dem Stuhl musste alles protokollieren oder auf ihrer Checkliste abhaken. Ich hörte: „rechte Herzklappe - gut, Vorkammer - gut, Lungenflügel rechts - gut, Leber - gut“ etc. etc. Dieser Vorgang wiederholte sich ein zweites Mal.
Nach dem grossen Check wendete sich der Arzt mir zu und sagte: „Es ist alles in Ordnung. Es sind zwei gesunde Babies“. Da ich ja überhaupt nichts anderes erwartet hatte, fragte ich etwas erstaunt, was denn nicht gut sein könnte. Daraufhin kam eine Erklärung, die bei mir natürlich nicht gerade Freude auslöste. Die späte Teilung des befruchteten Eies gebe unter Umständen auch Siamesische Zwillinge. Dass dies nicht der Fall war, konnte man auf den ersten Blick sehen. Es wäre jedoch möglich gewesen, dass nicht jedes Kind alle Organe gehabt hätte oder dass diese nur teilweise ausgebildet gewesen wären.
Nach dieser Aufklärung wischte ich mir zuerst mal den Schweiss von der Stirn und schickte ein Dankesgebet zum Himmel. Es ist halt doch nicht so selbstverständlich, dass immer alles gut geht. Gerade ich hätte dies bestens wissen müssen, denn ich arbeitete seit einigen Jahren in einer Sonderschule mit Kindern mit körperlichen Behinderungen.

Eineiige Zwillinge entstehen aus Laune der Natur. Ich selbst hatte meine eigene Theorie dazu. Im Winter als ich schwanger wurde, hatte ich mich mit einer Tuba ausgerüstet und übte für die Fasnacht. Die tiefen Töne der Tuba gingen direkt in den Bauchraum und liessen ihn vibrieren. Durch diese Erschütterungen sprang ganz einfach das befruchtete Ei in zwei Teile. Wer das nicht glauben will, der spiele mal Tuba neben einem Teller, auf dem Sand liegt. Durch die Schwingungen der Töne tanzt der Sand.
Die Mädchen mussten dann in der 36. Schwangerschaftswoche etwas früher als geplant mit Kaiserschnitt geholt werden. Zwilling B, das war Elena, wuchs nicht mehr und hatte ausserhalb des Leibes bessere Chancen sich zu entwickeln.
Wenn mir eine Frau erzählte, dass ihr Baby bei der Geburt 4 Kilo gewogen habe, dann entgegnete ich jeweils, dass ich für dieses Gewicht zwei Kinder gekriegt hätte. Elena wog 1720 und Livia 2280 und sie gediehen beide prima.
Felice gefiel es sehr auf einen Schlag gleich zwei kleine Schwestern und Spielkameradinnen zu bekommen. Zum einen wurde sie sofort Mutter von zwei gleichen Zwillingspuppen, die sie eingebettet in Kissen und Decken in einem Köfferchen überallhin mitnahm. Zum andern hatte sie eine spannende Operation für ihre ersten ärztlichen Einsätze gefunden. Alle möglichen Frauen aus der Verwandtschaft und der Nachbarschaft mussten hinhalten um die Zwillingspuppen zu gebären. Sie zog ihre Arztschürze an, legte das hölzerne Stethoskop um den Hals und holte mit gekonntem Schnitt und geschickter Hand die Puppen unter den Pullovern der Gebärenden hervor.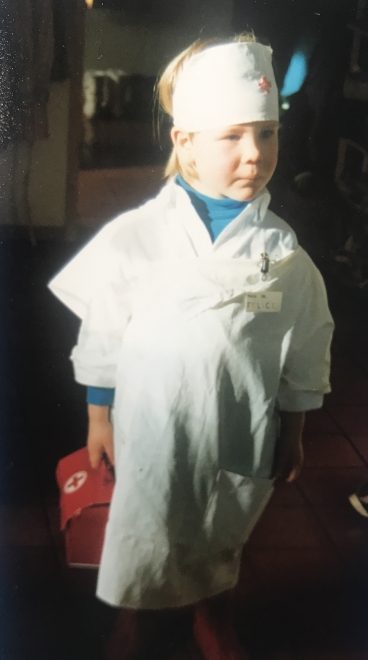
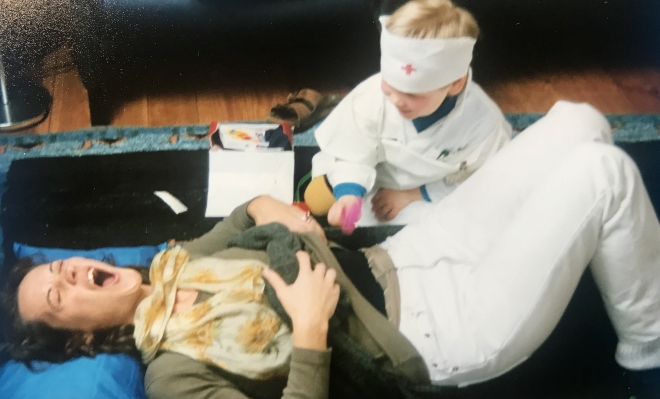

Niemand hätte gedacht, dass unsere Mutter vor dem Vater stirbt. Schliesslich war sie elf Jahre jünger als er. Als die Mutter tot war, sprach der Vater relativ locker vom „Sterben“. Er sagte z.B.: „An der nächsten Weihnacht bin ich dann nicht mehr da“ oder Ähnliches. Als der Tod näher kam und er dies spürte, war es für ihn trotzdem sehr schwer. Im September 1989 hatte er einen Herzinfarkt und war einige Tage im Spital. Er erholte sich so gut, dass er danach noch an einer Pilgerfahrt nach Lourdes teilnehmen konnte.
An einem Wochenende im Oktober darauf, bevor er starb, war ich in Sins. Am Sonntag machten wir wiederum einen Ausflug auf dem Vierwaldstättersee. Wir machten eine Schiffsrundfahrt und nahmen ein gemütliches Mittagessen ein. Da ist ein Grossvater mit seinem Grosskind unterwegs, dachten wohl die Leute um uns herum. Vater liebte die Fahrten auf dem Vierwaldstättersee. Er kannte jeden Winkel dieser Gegend und über alles, was er sah, hatte er eine Geschichte zu erzählen. Aber diesmal war er unruhig und es war ihm unwohl auf dem Herzen. Er hatte seine Medikamente dabei und las immer wieder die Beipackzettel. Er grübelte über eine mögliche Herzoperation nach, denn er sagte zu mir: „Ich habe gehört, dass sie nun auch an älteren Menschen eine Herzoperation vornehmen würden“.
An diesem Abend war es ihm sehr unwohl. So blieb ich ungeplanter Weise noch bis Montag in Sins.
Dieser sonntägliche Schiffsausflug zwei Tage vor seinem Tod war die letzte schöne gemeinsame Aktivität und ich bin dankbar, dass ich dies noch erleben durfte.
Am Dienstagmorgen spürte er, dass etwas definitiv nicht stimmte. Er telefonierte meinen Schwestern Maria und Agnes um sie zu bitten mit ihm ins Spital zu fahren. Beide konnten nicht von einer Sekunde auf die andere alles stehen und liegen lassen und vertrösteten ihn auf einen Moment später. Warum fragte der Vater nicht als erstes Alois, der mit ihm im Haus lebte? Sicher ahnte er sein baldiges Ende und wollte eine der Töchter bei sich haben. Alois brachte ihn schliesslich ins Spital nach Muri. In Sins stieg Vater noch selbst ins Auto. Im Spital angekommen, war er zu schwach um zu gehen. Er musste in einem Rollstuhl direkt auf die Intensivstation gefahren werden.
Als sich sein Zustand nach zirka einer Stunde stabilisierte, ging Alois nach Hause und informierte alle Geschwister. Alois erreichte mich im Spital Biel, wo ich zu dieser Zeit arbeitete. Kurz vor Mittag hatte ich eine ruhige Minute und ich telefonierte ins Spital Muri und fragte nach dem Vater. Ich wurde mehrmals an eine andere Person weitergeleitet. Mehrmals wurde ich gefragt, wer ich denn sei. In diesem Moment wusste ich mit Sicherheit, dass er bereits gestorben war. Die Todesnachricht wurde mir kurz darauf von einem Arzt bestätigt.
Vater starb ohne Beisein eines Familienangehörigen auf der Intensivstation im Spital Muri.
Die Beerdigung fand einige Tage später in Sins statt. Am Morgen der Beerdigung gebar meine Schwester Theres ihren Sohn Luca.
Während 2 1/2 Jahren war er Witwer. Wir waren alle komplett überrascht, wie gut Vater die plötzliche Lebensumstellung und die damit verbundenen Anforderungen selbst managte. Davor war die Alltagsorganisation voll und ganz bei der Mutter. Auch die Kontaktpflege mit den Kindern war ihr Gebiet. Wir lernten unsern Vater nochmals neu kennen. Denn plötzlich nahm er sein Leben vollkommen allein in die Hand und wurde sehr initiativ. Er liess es sich nicht nehmen alle seine Kinder im In- und Ausland zu besuchen. Ich war zutiefst erfreut und gerührt, als er eines Sonntags mit dem Zug bei mir in Biel auftauchte und mich am La Niccaweg besuchte.
Etwa so wie unser Vater sein Leben beendete, so wünschte ich es mir auch für mein Lebensende. Er war bis zum Schluss in jeder Hinsicht selbständig.
Unser Vater war ein initiativer Mensch mit viel Tatkraft. Er erreichte in seinem Leben viele sich selbst gesetzte Ziele. Er war es sich gewohnt voraus zu denken und die nötigen Schritte einzuleiten.
So war es nicht erstaunlich, dass er über seinen Tod hinaus dachte und für jeden von uns sowohl sein Foto, wie auch das der Mutter hinterliess. Er stellte nämlich zwanzig genau gleiche Bilderrahmen her. Nach seinem Tod fanden wir die eingerahmten Fotos vor. Sie standen für jeden von uns bereit. Wir sollten unsere Eltern auch nach ihrem Tod nicht vergessen und ihre Bilder in unsere Ahnengalerie aufnehmen.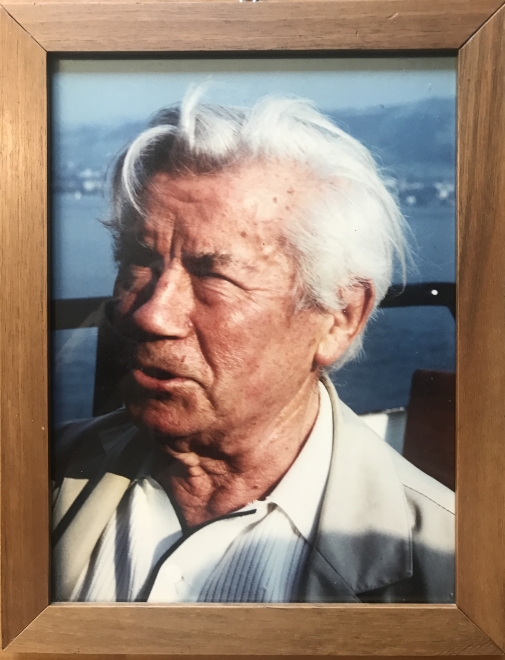


Mein Götti Gregor, der bereits 50 Jahre alt war, als er mein Götti wurde, war für mich eine besondere Person. In meiner Kindheit war er bei vielen wichtigen Anlässen dabei. Er nahm interessiert an meinem Leben teil. Das war ich mir von erwachsenen Personen nicht sehr gewohnt. Meistens dachte er an meinen Geburtstag und kam in Sins vorbei oder schickte zumindest eine Karte. Er war der Cousin unserer Mutter. Mein Grossvater Jakob Bucher war der Bruder seines Vaters. Götti Gregor mit Jahrgang 1913 absolvierte seine Schreinerlehre in Aettenschwil bei seinem Onkel Jakob, der ja mein Grossvater war.
Gregor blieb nicht Schreiner. Später besuchte er das Lehrerseminar und wurde Lehrer. Er unterrichtete mit Vorliebe die Werkfächer an der Oberstufe. Auch die Musik hatte es ihm angetan. Er schuf eine Verbindung zwischen Handwerk und Musik und baute sich seine eigene Geige. In seiner Wohngemeinde Rothenburg war er über viele Jahre Organist und Chorleiter.

Der Kontakt blieb auch, als ich erwachsen war und eine eigene Familie hatte. So war er bei meiner Diplomfeier in Biel dabei. Später machte er hübsche Geburtsgeschenke für unsere Kindern. Immer wieder telefonierte er nach Bern und wollte wissen, wie die Kinder aufwuchsen und wie es uns als Familie ging. Erst beim Schreiben dieser Zeilen realisierte ich, dass er vielleicht seine Göttipflichten deshalb sehr ernst nahm, weil ich zu dieser Zeit längst keine Eltern mehr hatte.
Beim letzten Besuch bei ihm zu Hause waren unsere Kinder zirka neun und sechs Jahre alt. Er war schon sehr alt und war fast ganz erblindet. Besonders die Kinder waren überrascht und staunten, wie gut er sich trotz Erblindung zurechtfand. Den Aprikosenkuchen, den er uns servierte, hatte er selbst gemacht. Vor unseren Augen drapierte er den Rahm aus der Dose geschickt darüber. Er offenbarte uns, dass er nun mit seiner Blindheit fast besser sehe als früher. Damit meinte er, dass seine Wahrnehmung von Geräuschen und auch die taktile Wahrnehmung so geschult wurden, dass er fast alles kompensieren konnte. Er hatte eine Einrichtung am Computer mit der er die Zeitung in Grossformat lesen konnte.


Danach besuchte ich ihn noch einige Male im Altersheim. Ich brachte alte Familienfotoalben mit und er konnte mir viele familiäre Zusammenhänge erklären.
Mein Götti blieb bis zum Tod ein sehr weltoffener, interessierter Mensch. Die Gespräche waren bis zum Schluss differenziert, vielseitig und anregend. Er konnte nicht mehr lesen, hielt sich aber über das Radio und mit Hörbüchern auf dem aktuellen Stand.
Kurz nach meinem letzten Besuch bei ihm bekam ich von seiner Tochter einen Anruf. Die Tochter solle sich in seinem Namen bei mir entschuldigen. Er meinte, er habe beim letzten Gespräch nicht mehr alles genau mitgekriegt und nicht mehr gut auf mich eingehen können. Davon hatte ich nichts gemerkt. Sein Standard war sehr hoch und es war ihm wichtig sich bis zum Schluss nicht gehenzulassen. Er starb ein paar Monate darauf mit 98 Jahren.

Meine Sofastunden, die ich wegen der Chemotherapie durchlebte, ermöglichten mir das zu tun, was viele Menschen erst nach der Pensionierung tun. Ich vertiefte mich in die zwei Bananenschachteln mit Briefen und Erinnerungsdokumenten aus der Familie. Dazu kam die genaue Begutachtung des goldenen Albums. Vaters Schrift auf den Karten war nicht einfach zu lesen. Während Stunden entschlüsselte ich in detektivischer Arbeit und oft mit einer Lupe die Worte und Buchstaben auf den Karten.
Die Wiederentdeckung des goldenen Albums war mein Zaubermoment. Jedes Mal beim Öffnen des Buches entwich der Buchgeist wie der Flaschengeist von Aladin und in seinem Dunst kamen Erinnerungen hoch.
Nach jeder Betrachtung des Albums atmete ich tief durch und legte es mit grosser Wertschätzung und Dankbarkeit wieder in die Schatztruhe zurück.
Inzwischen weiss man vom Wurmfortsatz, dass er sehr wohl eine wichtige Funktion in unserem Körper hat. In ihm werden die körpereigenen und individuellen Darmbakterien als Reserve gespeichert. Angenommen, ich erleide eine schwere und lange Durchfallerkrankung. Dann braucht mein komplett entkräfteter und ausgelaugter Darm eine Wiederaufbauhilfe. Dieser Startschuss kommt vom vernachlässigten Wurmfortsatz. Dank den Bakterien aus dem Reservelager kommt der Darm wieder in Schwung.
Mit grosser Hingabe und in vielen versunkenen Stunden entstanden diese Geschichten. Sie dürfen nun still durch die Zeit schlummern wie die Bakterien im Blinddarm. Vielleicht öffnen sie nach vielen Jahren ein Fenster in die Vergangenheit. Vielleicht lüften sie Jahre später den Nachfahren der Mühlebachfamilie ein paar Geheimnisse ihrer Herkunft.


Die Vertiefung in meine Familiengeschichten brachten viele Gespräche mit meinen Geschwistern. Sie erzählten mir weitere Erlebnisse aus ihrer Sicht. Einiges davon habe ich in meine Geschichten einfliessen lassen. Im Gespräch mit meinen Geschwistern Schwager und Schwägerinnen erlebte ich viele Aha - Momente und erfuhr Dinge, die noch vor meiner Zeit geschahen.
Hans Peter erfuhr nach 35 gemeinsamen Jahren noch überraschende und neue Dinge aus meinem Leben.
Angefangen mit Schreiben habe ich jedoch aus dem Bedürfnis meinen Töchtern etwas von meiner speziellen Kindheit zu erzählen. Einer Kindheit die nicht mehr so ganz in die Zeit passen wollte. So schrieb ich die Erinnerungen für Felice, Elena und Livia auf. Sie kannten meine Eltern nicht und konnten das Leben im grossen Haus in Sins nie miterleben. Sie waren nur für wenige kurze Momente da und sahen es kurz vor dem Abriss nochmals.
Herzlichen Dank für die schönen und anregenden Gespräche mit meinen Geschwistern und ihren Ehemännern und Ehefrauen: Maria und Ludwig, Hans und Marlies, Anne und Tom, Giuseppe, Agnes und Ruedi, Käthy und Hans, Alois, Theres und Piero, August und Andrea. Alle angeheirateten Personen sind seit 35 - 55 Jahre ein Teil der Familie. Sie konnten ihre Eindrücke aus einer Aussensicht schildern.
Das Leben setzt sich fort. Die Neffen und Nichten tun ihr bestes. Rebekka mit David und Rafael, Lea († 2002), Simeon, Simona und Mauricio mit Hera und Jerun, Vincent und Charly mit Luca, Marcel, Nadja und Jean-Sebastien mit Eléonore, Elias und Eloic, Esther, Korbinian und Elisabeth mit Luise und Tabea, Severin, Yanik, Luca, Vera und Lorin und unsere Töchter: Felice, Elena und Livia.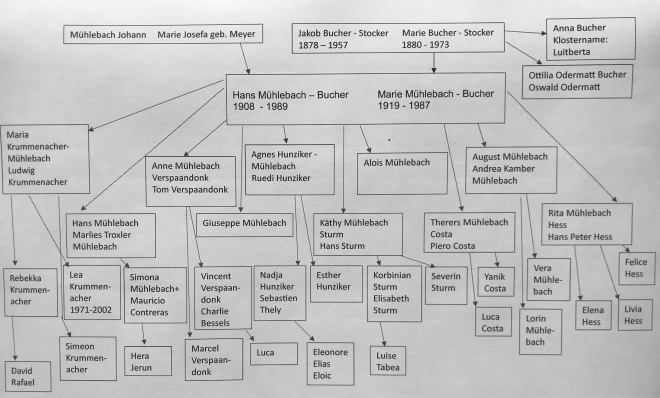

Hans im Glück
neu geschrieben im Jahr 2020 für das Abschlussfest in der Schreinerei.
Es war einmal ein Schreinergeselle. Der arbeitete fleissig und ohne Unterlass bei einem Schreinermeister. Nach 7 Jahren ging er zum Meister und sagte zu ihm: „Ich habe nun 7 Jahre bei dir gedient. Nun möchte ich zurück in mein Land, dorthin wo ich hingehöre.
Der Meister sagte: „Du hast gut und fleissig gearbeitet. Du sollst nun deinen Lohn erhalten“. Er gab ihm ein sehr grosses Stück Gold. Der Klumpen war mindestens so gross wie der Kopf des Schreinergesellen.
Hans schulterte das Stück Gold und fuhr mit dem Velo frisch und fröhlich über die Hügel und Felder. Zielsicher hielt er vor dem Haus von Jakob in Aettenschwil an und sagte zu ihm. „Hier gehöre ich hin. Ich gebe dir dieses Stück Gold und werde für dich in deiner Schreinerei wei- terarbeiten und hierbleiben.“ Hans machte einen guten Tauschhandel, denn er bekam nicht nur die Schreinerei, sondern auch noch eine fleissige Frau dazu.
Sie blieben nicht lange zu zweit. Schon bald gesellte sich ein Kind nach dem andern dazu. Das Haus platzte aus allen Nähten und Hans beschloss das Haus zu verlassen und ein neues und grösseres Haus im nahe gelegenen Dorf zu bauen.
Das neue Haus war aber sehr teuer und Hans musste sehr viel und vor allem sehr gekonnt arbeiten. Eine geschickte Handlungsweise bestand darin, dass er jedes Holzstück bis aufs letzte zu nutzen wusste und aus jedem noch so kleinen Stück Holz ein Möbel zimmern konnte. Mit dieser besonderen Begabung konnte er sehr viel teures Holz sparen. Trotzdem tauschte er den Erlös der Möbelstücke sehr schnell wieder in Holz um. Am liebsten hatte er Nussbaum. Die Hölzer, die er bei so mancher guten Gelegenheit erwarb, wurden im Schopf fein säuberlich verstaut und warteten dort viele Jahre lang, bis sie von Würmern durchlöchert wurden.
Der Kindersegen nahm kein Ende. Aber was könnte des Schreinermeisters grösseres Glück sein als viele kleine Hänschen und Mariechens um sich zu haben. Sie waren alle gut geraten, gescheit und vor allem sehr fleissig. Dass sie auch noch gefrässig waren, brachte Hans immer wieder in Schwierigkeiten. Am besten denkt man in dieser Situation langfristig und legt einen guten Vorrat an. Der Vorrat enthielt nicht nur Birnen und Most, sondern auch viele halbfertige Bauernmöbelstücke und sehr viel Furnier.
Der Vater und die Mutter waren so glücklich mit ihrer Kinderschar, dass sie dieses Glück auch gerne teilten und öfters die fleissigen Hände von Hans und Mariechen ausliehen. So ging Hänschen zu Frau Hürlimann, um dort die Vorfenster ein- und auszuhängen. Oder Mariechen ging nach Reussegg um dort bei Huwilers bei der Bohnenernte zu helfen. Auch der Käppelimarie musste man unter die Arme greifen und ihre grossen Grasladungen nach Hause schleppen.
An einem Sonntag, als die Mutter, die Grossmutter und die vielen Kinder in der Kirche waren, kam ein Wandersmann mit einem voll beladenen Leiterwagen daher. Hans fragte: „Wo kommst du her und was hast du auf deinem Wagen?“ „Ich komme aus dem grossen Spessartwald und hier auf dem Wagen habe ich schönes Eichenfurnier.“
Eine solche Gelegenheit gibt es kein zweites Mal, dachte sich Hans und bot dem Reisenden sofort einen Tausch- handel an. Die Mutter hatte nämlich vorsorglich den Hühnerbraten vor dem Kirchgang in den Ofen getan. Hans bot dem deutschen Gesellen den ganzen duftenden Braten zum Tausche an. Da der Geselle sehr hungrig war, willigte er sofort ein. Während dieser genüsslich den ganzen Braten aufass räumte Hans das schöne Spessarteichenfurnier in den bereits vollen Furnierkeller. Als die hungernden Mäuler nach Hause kamen, war alles erledigt und der Tisch war gedeckt.
Es standen 10 Porzellanteller auf dem Tisch, zwei waren für die Eltern und 8 für die ältesten 8 Kinder. Der gelbe und der graue Plastikteller waren aber für die jüngsten zwei Kinder und daraus assen sie bis weit ins Schulalter hinein. Diese Teller genügten doch noch lange, denn neues Porzellangeschirr wäre wirklich eine Verschwendung gewesen.
An diesem Sonntag gab es wiederum eine Schüssel Hörnli mit Apfelmus. Das stärkte die Kinder für den Spaziergang an der Reuss oder das nachmittägliche Schlagballspiel neben dem Haus.
Klein Hänschen und Mariechen gingen gerne in die Schule. Sie trugen farbige Wollpullover, die die Gross- mutter aus wiederverwerteter Wolle gestrickt hatte. Die Hosenbeine der Stoffhosen waren oft ein bisschen Hochwasser. Denn die Knochen von Hänschen und Mariechen wuchsen schneller in die Länge als der Bauch rund wurde.
So lebten sie tagaus und tagein, bis das Haus allmählich wieder leerer wurde und neun von zehn Mariechen und Hänschen eigene Wege gingen. Nur ein Hänschen schlief weiterhin im grossen Haus und setzte die Arbeit fort. Er baute viele Möbel und reparierte überall, wo es etwas zu reparieren gab. Es gab kaum ein Haus im Dorf, über dessen Schwelle er noch nie gegangen wäre.
Und immer, wenn es eine gute Gelegenheit gab, kaufte er ein schönes Stück Furnier ein.
Dort unten im dunklen Furnierkeller ruhen die dünnen Holzlatten seit sehr vielen Jahren. Jeweils in den klaren Mondnächten, wenn es leise flüstert und kräschelt, tauschen sie Geschichten aus. Sie erzählen einander, woher sie kommen und welche Umstände sie in diesen Keller gebracht haben. Sie erzählen sich, was oben in der Schreinerei alles so geschieht und wie sie Knaben und Mädchen hinter der Hobelmaschine gesehen haben oder wie am Samstag die Schreinerei gewischt wurde. Viele Furniere haben am eigenen Leib erlebt wie sie durch die Hände der Kinder gewaschen und geschabt wurden. Oftmals rätseln sie, wofür sie wohl einmal eingesetzt werden. Sie warten geduldig auf ihre Bestimmung.
Und eines kann ich mit Gewissheit sagen: In den dünnen Fasern dieser Hölzer liegt die Essenz des gesamten Lebens dieses Hauses. Hier liegt der Schatz von „Hans im Glück“.













