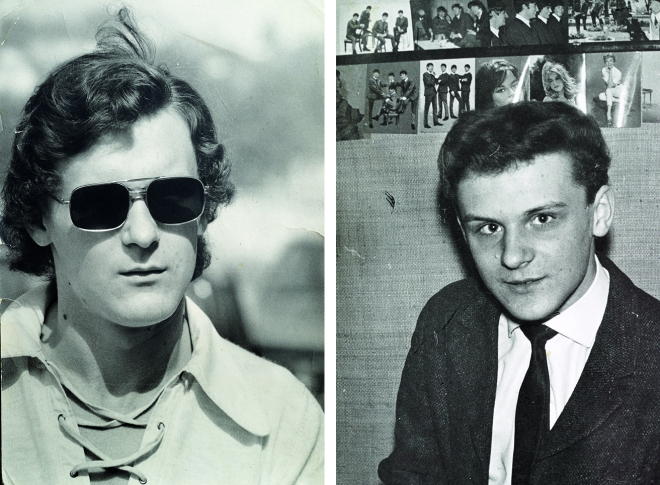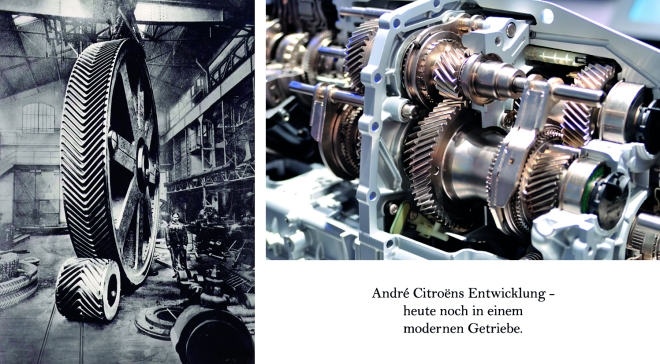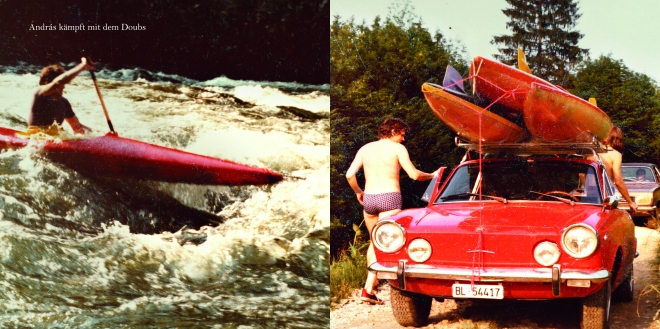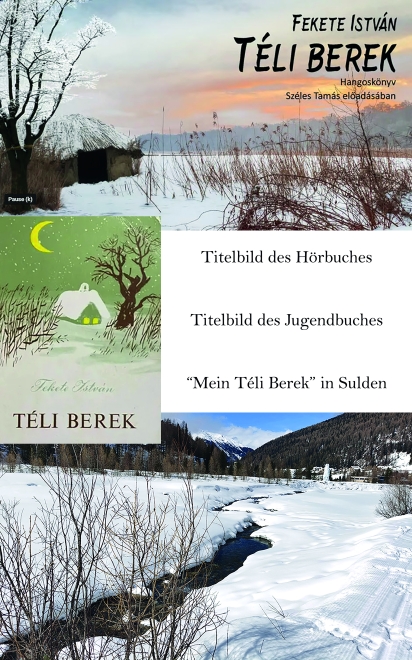4.
Mutters Lebenslektion Nr. 1
9.
Mutters Lebenslektion Nr. 2
13.
Kleiner, grosser Geschäftsmann
14.
Das Einparteiensystem
18.
Mutter kommt nicht heim
19.
Sechs Monate ohne Mutter
21.
Der Hochspannungsstudent
22.
Meine Einheitswährung
27.
Die vierköpfige Familie
28.
Die strenge, aber spannende Schule
29.
Das organisierte Rauchen
30.
Praktikum Sommer 1964
33.
Praktikum Sommer 1965
36.
Herbst – meine schönste Jahreszeit
44.
Die fünfköpfige Familie
45.
Wisa Gloria – oder steht die Physik Kopf?
47.
Der einfache Schweizer und der Graf
48.
Grausame Erziehungsmethoden
53.
Warten auf die Braut – dann die kurze Ehe
54.
PAX-Lebensversicherungsgesellschaft
56.
Ski fährt die ganze Nation …
59.
Autos – meine Leidenschaft
63.
Romont – Château-d‘Oex
64.
If You Don’t Know Me By Now …
66.
Schweizerischer (Basler-) Bankverein
68.
Informatiker trifft Informatikerin
76.
Find a girl, settle down …
77.
Schweizer – Land – Leute
79.
Anhang 1 - Die ungarische Geschichte
80.
Anhang 2 - Die bahnbrechende Konstruktion des Kálmán Kandó
81.1.
FALU VÉGÉN KURTA KOCSMA…
Vorwort
Seite 0 wird geladen
Vorwort
Ich widme dieses Buch in erster Linie meinen Eltern. Sie haben mich bis zum Teenageralter erzogen, dann entwurzelt, aber anschliessend alles darangesetzt, dass diese junge Pflanze in die richtige Erde kommt, wieder Wurzeln fasst und gedeiht.
Dann danke ich aber auch meinen kleinen Schwestern und allen meinen lieben Verwandten, die auf ihre Art immer meine Stütze waren.
Meine Widmung geht ausserdem an alle, die mich hier in der Schweiz annahmen, egal wie. An allen von ihnen bin ich gewachsen, alle haben mich geprägt, egal ob sie mich mit offenen Armen empfingen, verschmähten, auslachten, unterstützten oder ignorierten.
An dieser Stelle gilt mein Dank und Anerkennung meiner lieben Frau, die bereits seit über 40 Jahren an meiner Seite im Guten und im Schlechten mitschreitet und nach Möglichkeit dafür sorgt, dass es eher auf der guten Seite bleibt.
Ein besonderes Augenzwinkern gilt zwei meiner Neffen. Sie schrieben während ihrer Ausbildung je eine Arbeit über Migration und Integration. So einen Fall haben wir doch vor der Haustüre, dachten sie und kamen zu mir. Ich sass mit jedem von ihnen mindestens einen Nachmittag lang über ihrer Aufgabe, habe ihnen einige Rosinchen meiner Geschichte erzählt und sie staunten, wie spannend solche Episoden sein können und wie vielfältig die Hintergründe waren. Einer der beiden meinte dann: Das müsste man einmal niederschreiben!
Nun, sein Wunsch wurde mir Befehl …
Zu grossem Dank verpflichtet bin ich auch meinen «Assistentinnen», die zum Entstehen dieses Werkes tatkräftig beigetragen haben:
Meine Frau Trudy las als erste die Texte, behob die gröbsten Fehler und hinterfragte einige Formulierungen. Sie übernahm auch die Versionenverwaltung der Episoden sowie das Erstellen des Layouts. Sie war stets Gesprächspartner in allen offenen Fragen und Entscheidungen.
Meine jüngere Schwester Georgina, die Geschichte und Germanistik studiert hatte, übernahm danach das eigentliche, professionelle Redigieren. Mit ihr konnte ich zudem familiäre Belange diskutieren und sie stellte auch die alten Familienbilder zur Verfügung.
Dem «Sechs-Augen»-Prinzip gerecht zu werden, las Trudys Tenniskollegin Therese, ebenfalls Lehrerin, das Ganze durch und meldete, was noch hängen geblieben war.
Um aus dem vorgeschliffenen Diamanten einen Brillianten zu formen, übernahm Marie-Luise Stettler das verlagsinterne Lektorat.
Meinen Leitsatz übernahm ich von niemand Geringerem als vom grossen Herrn der deutschen Sprache, Konrad Duden (1829-1911), der lehrte: «Schreibe so, wie du redest!
Über die Hintergründe und Geschehnisse, die hier geschildert werden, habe ich im Nachhinein bewusst nicht weiter recherchiert. Diese sollen hier so weitergereicht werden, wie das ein Kind, dann ein junger Mann empfunden, erlebt und vernommen hatte, wie die Leute in Ungarn um ihn herum mit gesenkter Stimme diskutierten, denn die Wände hatten Ohren.
Liebe Leserschaft, kommt mit mir auf meine Reise!
Sommer 1965
Seite 1
Seite 1 wird geladen
1.
Sommer 1965
Gemächlich setzte sich der überlange Zug am Budapester Ostbahnhof in Fahrt. Errichtet 1884, galt dieser Bahnhof als einer der modernsten in Zentraleuropa, verfügte er doch bereits von Anfang an über eine elektrische Beleuchtung und verband die ungarische Metropole mit den meisten westlich gelegenen Städten Europas.
Unser Zug hatte die Bezeichnung «Wiener Walzer» und fuhr via Wien Richtung Schweiz. Wir sassen in diesem Nachtzug, meine Mutter, mein Pflegevater, meine kleine Schwester und ich. In Hegyeshalom, der letzten Station vor der Grenze zu Österreich, kamen die Zollbeamten, um die Papiere und das Gepäck zu kontrollieren. Dann setzte sich der Zug in Bewegung, doch nach kurzer Strecke blieb er erneut auf freiem Feld stehen. Das war nun die geografische Grenze zwischen Ungarn und Österreich, zwischen Ostblock und dem Westen. Es stiegen uniformierte Grenzwächter ein, während sich Grenzsoldaten mit dem Maschinengewehr im Anschlag entlang des Zuges aufstellten. Es erfolgte eine besondere Kontrolle mit Listen, die mit unseren Papieren verglichen wurden und nochmaligem scharfen Blick auf unser Gepäck. Scheinbar waren wir nicht verdächtig, so zogen sie ins nächste Abteil. Meine Mutter war sichtlich erleichtert, es war dermassen augenfällig, dass ich staunen musste: An jeder Grenze gibt es doch Grenzkontrollen und wir hatten ja nichts zu verbergen.
Als der Zug in Wien hielt, gingen Mihály, so hiess mein Pflegevater, und ich an Land, denn wir wussten, wir hatten hier einen längeren Aufenthalt. Als Erstes peilten wir eine Trafik an, wie in Österreich die Tabakläden heissen. Mihály kaufte seine Zigarillos und ich eine Schachtel Marlboro. Als Nächstes gingen wir in das Bahnhofbuffet und zündeten dort nach dem ersten Schluck kühlen Biers unsere neu erstandenen Tabakerzeugnisse an. Dabei unterhielten wir uns angeregt. Zwischen uns entwickelte sich schon seit einiger Zeit eine Art Männerfreundschaft.
Zurück in unserem Abteil fanden wir meine Mutter, wie sie meine Schwester schlafen legte. Der Zug setzte sich in Bewegung und die Aussenbezirke Wiens zogen an uns vorbei. Dann wurde es aussen nichts als dunkel und wir lehnten uns zurück. Plötzlich fragte mich meine Mutter: «Was hieltest du davon, nach unserem Urlaub in der Schweiz zu bleiben?»
Mir stockte der Atem. So ein absurder Gedanke! Ich fühlte mich in Ungarn wohl, das Land bot für Jugendliche alles, was ihr Herz begehrte. Kultur war nahezu gratis zu haben, von guten Büchern über Theaterbesuche bis hin zu den klassischen Schallplatten. Moderne westliche Musik war zwar fast nicht bezahlbar, aber immerhin erhältlich. In den Discos und Openairs wurden Beatles, Stones und Konsorten nachgeahmt. Sport und Eintritte ins Schwimmbad oder im Winter auf die Schlittschuhbahn: für uns alles erschwinglich!
Ebenso hatte ich die Aufnahmeprüfung in meine begehrteste Ausbildungsstätte geschafft, konnte dort nicht nur die für mich interessantesten Fächer studieren, nein, darüber hinaus hatte ich die ersten innigen Freundschaften schliessen und die ersten Freundinnen kennenlernen können. In Ungarn konnte ich mit ihnen über alles diskutieren und meine Aufsätze schreiben. Ich wusste seit einem früheren Schweiz-Urlaub, wie das ist, in einem Land zu sein, wo man die Sprache nicht beherrscht.
Also nein!
In Basel erwartete uns mein Onkel Pityu, der Schwager meiner Mutter. Er brachte uns nach Grellingen, wo sie wohnten und wo wir unseren Urlaub verbringen sollten. Ich kannte das schon, war ein Jahr vorher hier, es war herrlich.
Einige Tage später zog mich meine Mutter zur Seite und verkündete, dass es nicht mehr eine Frage, sondern ein Fakt sei: Wir bleiben in der Schweiz. Sie hätten bei den zuständigen Behörden einen Asylantrag eingereicht.
Ich war sprachlos und schaute sie an. Sie hatte einen für mich bekannten, ernsten Gesichtsausdruck, den ich nur selten sah. Ich wusste nun: Es ist so, es gibt keine Diskussion mehr. Mit diesem Gesichtsausdruck sagte sie: «Mein geliebter Sohn, ich habe meine Gründe. Diese wirst du eines Tages begreifen.»
Aber zuerst musste sie die Behörden überzeugen. Während 1956, als beim grössten Aufstand eines Ostblockstaates gegen das sowjetische Regime die Grenzen offen waren, bekam jeder ungarische Flüchtling automatisch politisches Asyl. Neun Jahre später, als wir kamen, mussten wir belegen, dass wir nicht Wirtschaftsflüchtlinge waren. Dies gelang meiner Mutter und ihrem Mann. So konnte Mihály anfangs des Jahres 1966 beginnen, für sich eine Arbeitsstelle sowie eine Wohnung für die Familie zu suchen.
Meine Vorfahren
Seite 2
Seite 2 wird geladen
2.
Meine Vorfahren
Ungarn war schon immer ein Schmelztiegel verschiedener Nationen. Bereits im Früh-Mittelalter fielen die Tataren ein und dezimierten die ursprüngliche Landbevölkerung. Danach rief König Béla IV. die Bauern in Europa auf, in Ungarn ein Stück Land zu nehmen und zu bebauen. Nach der türkischen Invasion im 16. und 17. Jahrhundert war die Situation dann nicht mehr so dramatisch, aber gute Fachkräfte waren aus der ganzen Welt immer noch sehr willkommen. Die ganze ungarische Geschichte, zusammengefasst in «Nussschalengrösse», können interessierte Leser in Anhang 1 nachlesen. Hier gehe ich kurz auf die für mich bereits bekannte Familiengeschichte ein.
Mein Urgrossvater mütterlicherseits war ein waschechter Ungar, hiess Kaszás, was so viel wie Sensemann bedeutet. Aber wenn man diesen Namen hörte, dachte niemand an den Tod, vielmehr an den guten, Ernte einbringenden Landwirt. Meine Urgrossmutter hingegen war aus Berlin. Die Familie Kaszás stammte aus einer Kleinstadt im Westen Ungarns und da war auch eine Burg, ein Sitz der Dynastie Wittelsbach im ehemaligen Wasserschloss Nádasdy. Bei dessen Bewohnern war meine Urgrossmutter als Gesellschafterin angestellt und hatte die Hauptaufgabe, den Sprösslingen der Herrschaften die deutsche Sprache beizubringen. Sie tat dies auch, bis sie von meinem Urgrossvater weggeheiratet wurde.

Urgrossmutter als Gesellschafterin ... ... und als Herrin des Hauses
Diese Kleinstadt Sárvár liegt auf der Strassenverbindung von Wien zum Balaton, also Plattensee. Die Kaszás hatten ihr Haus an zentraler Lage mitten an der Verkehrsachse. Das Gebäude hatte auch eine Ladenlokalität, in welcher mein Urgrossvater ein Konfektionsgeschäft betrieb. Er liess von den Näherinnen in der Umgebung in Heimarbeit Kleider nach dem Mass seiner Kunden nähen und verkaufte diese.
Wie damals in katholischen Kreisen üblich, hatte meine Urgrossmutter 18 Schwangerschaften, woraus dann 9 Kinder auch das Erwachsenenalter erreichten. Dass dieses Verhältnis dazumal als einigermassen normal empfunden wurde, zeigt mir folgende Begebenheit: Das Kind vor meiner Grossmutter war ein Mädchen und wurde Ludovika getauft. Es starb sehr früh. Das nächste Kind, meine Grossmutter, wurde ebenfalls Ludovika getauft.
Mein Grossvater stammte aus Graz und hiess ursprünglich Fasching. Er war in Sárvár Gemeindeschreiber. Als Staatsbeamter musste er einen ungarischen Namen annehmen, so wurde er Fertöszegi, in Anlehnung an den nahe gelegenen Fertö Tó, also Neusiedlersee. Meine Grosseltern bekamen zwei Kinder, meine Mutter, ebenfalls Ludovika getauft, und ihre Zwillingsschwester Georgina. Die Kinder waren leider fast zu klein auf die Welt gekommen, um zu überleben. Damals, 1929, gab es das benötigte Aufbaupräparat lediglich von einem grossen Nahrungskonzern aus der Schweiz. Dieses war jedoch nahezu unbezahlbar, doch mein Grossvater konnte es sich dank seiner guten Stellung leisten, diese spezielle Aufbaunahrung für die Zwillinge zu besorgen. Das heisst, dass meine Mutter und ihre Schwester überlebten, aufwuchsen und meine Mutter mich auf die Welt bringen konnte, ist diesem besonderen Umstand zu verdanken. So entwickelten sich die Mädchen zu prächtigen Frauen, zwei blonde Engel, die allen Leuten freundlich begegneten und halfen, wo sie nur konnten. Sie waren auch oft auf dem Friedhof anzutreffen, wo sie versuchten, vernachlässigte Gräber in Ordnung zu bringen. Die Auswirkung dieser Art von Nächstenliebe begegnete mir später immer wieder, als ich meine Heimatstadt besuchte und alle Leute, die mich erkannten, als Erstes die gleiche Frage stellten: «Wie geht es den Zwillingen?»
Die Zwillinge gingen in Budapest in ein, auch als Internat geführtes Gymnasium, fuhren jedoch in den Ferien jeweils nach hause. Dies in einem speziellen Schnellzug genannt "ÁRPÁD", ein früher Vorgänger der späteren TEE-Züge.

Hier meine Frau Trudy mit meiner Cousine Ria in einem solchen Zugwagen in Budapest, im Bahnhistorischen Museum.
Die Zwillinge reiften zu Beginn des zweiten Weltkriegs zu Prinzessinnen aller Ballveranstaltungen heran. Später gesellten sich dort stationierte Offizier dazu, die himmlisch tanzen konnten. Einer von ihnen sollte dann mein Vater werden.
Doch zuerst schlug der Krieg zu und er, ein Artillerieoffizier, geriet in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Aus Sibirien mit einigen abgefrorenen Zehen zurückgekehrt, heiratete er meine Mutter. Im zivilen Leben wurde er Zolloffizier und leitete die Station Kelebia an der serbischen Grenze.
Ich kam 1949 in Sárvár zur Welt, denn meine Mutter ging dazu selbstverständlich «nach Hause».
Hurra, da bin ich!
Seite 3
Seite 3 wird geladen
3.
Hurra, da bin ich!
Meine Mutter kam mit dem kleinen András von der alten Heimat endlich zu ihrem Ehemann in ihr neues Zuhause. Mein Vater hiess Géza Széplaky, aber das war nicht immer so. Er besass ursprünglich einen anderen Namen, da seine Familie aus dem Felvidék stammte, also aus jenem nördlichen Teil Ungarns, der nach dem Ersten Weltkrieg der Slowakei zugesprochen wurde. Auch er musste als Offizier der ungarischen Armee anstelle von Stefányi einen waschechten ungarischen Namen annehmen.
Südlich von Budapest liegt eine kleine schmucke Gemeinde namens Széplak. Der Name bedeutet so etwas wie Schönheim. Mit dem «i» hintendran heisst man Schönheimer. Da mein Vater wegen irgendeiner Heldentat ausgezeichnet wurde, durfte er dieses «i» auf «y» wechseln, was dann bewirkte, dass er künftig nicht mehr Schönheimer, sondern von Schönheim hiess.
In einem solchermassen adeligen Hause einquartiert, fühlte sich der kleine András in Kelebia pudelwohl. Diese ländliche Gemeinde mit etwa 2‘000 Einwohnern an der Südgrenze Ungarns bot seinem Zolloffizier ein schönes Zuhause mit grossem Garten und ein Gärtner wurde auch zur Verfügung gestellt – also ein wunderschönes Plätzchen zum Toben und zum Spielen. Doch allmählich wurde der Junge grösser und damit der Garten immer kleiner. Das erste Dreirad musste her und damit konnte man nach Herzenslust umhersausen, sodass es auf die Strasse ging, zumindest aufs Trottoir. Dieses hatte aber so seine Tücken.
Schon vor meiner Geburt distanzierte sich die jugoslawische Führung unter Tito vom Ostblock und wurde auch nicht Mitglied des Warschauer Paktes. Das Land orientierte sich immer mehr am Westen. Ein Umstand, der Spannungen zwischen den Altkommunisten und den neuen Titoisten auslöste. Es gab Grabenkämpfe, sogar offene Kämpfe, Flucht und Verfolgung. Hierbei scherten sich die Kontrahenten nicht um die Grenze zu Ungarn, sie schossen um sich, dabei auch über die Grenzlinie, also in unsere Strasse. Da kann man sich leicht vorstellen, dass meine Mutter meinem Vater gegenüber ganz energisch auftrat: «In dieser Umgebung kann man kein Kind erziehen. Entweder lässt du dich versetzen oder ich gehe mit dem Kind nach Hause!»

Mutter ... und Sohn
Mein Vater war kein Mann grosser Worte oder Diskussionen. Er dachte nach und stellte sein Gesuch um Versetzung. Er bekam eine neue Stelle in der Zentrale, so kam die Familie nach Budapest.
Diese wunderbare, einst blühende Metropole, wo die erste feste Brücke über die schiffbare Donau gebaut wurde, die Kettenbrücke, heute noch das Prospektbild Nummer 1 aller Donaufahrten, wo bereits 1896 die erste Metrolinie auf dem Kontinent eröffnet wurde, wo Gustave Eiffel den Westbahnhof baute, diese Stadt als Perle an der Donau lag nach den Bombardierungen im Krieg ziemlich zerschlagen da und es herrschte Wohnungsnot. Die herrlichen, mehrheitlich im Jugendstil erbauten, mehrstöckigen Häuserreihen der Innenstadt wiesen Löcher auf oder aber waren arg beschädigt. Die neue, von den Sowjets eingesetzte sozialistisch kommunistische Regierung hatte bereits sämtliche Wohnungen und Häuser verstaatlicht und hielt deren Verteilung in der Hand. Mein Vater als Staatsangestellter bekam für sich und seine Familie ein Zimmer zugewiesen.
Unser Wohnraum war eines der drei grossen Zimmer einer ehemaligen Herrschaftswohnung in einem riesigen Jugendstilblock mit vier Stockwerken und Raumhöhen von mindestens 4 Metern. Drei Zimmer, drei Parteien. Eine alleinerziehende Mutter, eine blinde, alte Frau und wir.
Das riesige Entrée diente allen auch als Esszimmer mit einem grossen Esstisch in der Mitte. Die erste Türe führte in das gemeinsame Badezimmer, hinter der zweiten befand sich das Zimmer der alleinerziehenden Mutter. Dann kam die Türe zur Küche, natürlich ebenfalls für alle. Die nächste Türe führte in das Zimmer der alten Frau und durch dieses Zimmer mussten wir gehen, um in unsere vier Wände zu gelangen. Die alte blinde Dame lag mehrheitlich in ihrem Bett, wurde von so etwas wie der Spitex versorgt und störte sich überhaupt nicht daran, dass wir durch ihr Zimmer ein- und ausgingen, vermutlich war sie auch etwas taub.
In der damaligen Situation war diese Art zu wohnen gänzlich in Ordnung. Die Räume waren grosszügig und man sah um sich herum vorwiegend nur Engeres, Schlimmeres. Ich ging in eine Art Kindergarten mit Tagesbetreuung, denn der Staat verlangte von jedem Mann und jeder Frau, dass sie arbeiteten, den Sozialismus aufbauten, den Weg in einen heilbringenden Kommunismus ebneten. Die Parole war: «Wer nicht arbeitet, soll nichts zu essen haben.» Es war gang und gäbe, dass die Strassenpatrouille den Arbeitsnachweis verlangte. So viel Arbeit gab es natürlich nicht, doch die Betriebe waren verpflichtet, die Leute anzustellen. Die Idee dahinter war, dass der Staat die Erziehung der nächsten Generation in die Hände bekam, in Tages-Säuglingsheimen, Tages-Kindergärten, Tages-Schulen usw.
Da wurde ich natürlich verpflegt und lernte auch Butterbrot auf sozialistische Art zu bestreichen: Man streicht Butter auf die Brotscheibe und schabt anschliessend wieder alle Butter weg. Übrig bleibt das, was in den Löchern der Brotscheibe hängen geblieben ist. Ausserhalb der Unterrichts- und Essenszeiten wurden die Hausaufgaben gemacht oder es wurde gespielt.
Zu Hause gab es andere Spielzeuge. Wir hatten in unserem Zimmer einen langen, schmalen, längsgestreiften Läufer liegen gehabt, das war damals schon meine Autobahn. Dann entdeckte ich eines Tages in einem Schaufenster den echten Willys Jeep, mattgrün mit dem weissen Stern und grossen weissen Zahlen darauf. Er war aus Blech, so etwa in Massstab 1:20. Das gab schlaflose Nächte. Meine Eltern merkten das und ich bekam das Ding auf Weihnachten.
Heute frage ich mich: Wie war es möglich, ein amerikanisches Militärfahrzeug im stalinistisch regierten Ungarn öffentlich zu verkaufen? Mit meinem heutigen Verständnis komme ich darauf, dass es auf die ungarische Mentalität zurückzuführen ist. Selbst wenn man sich unterjochen muss, heisst es nicht, dass man auch zu parieren hat. Man kann den Hals aus der Schlinge ziehen, etwas trotzen, sticheln, einen amerikanischen Jeep als Modell verkaufen.
Mutters Lebenslektion Nr. 1
Seite 4
Seite 4 wird geladen
4.
Mutters Lebenslektion Nr. 1
Kleiner Mann wuchs heran und die Wünsche wurden immer grösser. Meine neueste Entdeckung war ein Krankenwagen, den ich mir auf die nächsten Weihnachten wünschte. Ich bekam ihn auch, ganz gross, aus Holz gefertigt, aber so, dass man alle Türen öffnen konnte. Hinter den hinteren Flügeltüren lag eine Bahre mit einem Kranken oder Verunfallten darauf. Diese konnte ich herausziehen und im Krankenhaus abliefern. Dann sofort den Nächsten retten.
Meine Freude war unbeschreiblich, meine Autobahn voll im Betrieb, bis mich eines Tages meine Mutter heranwinkte.
«Mein Junge, wir müssen etwas machen.»
«Hurra, was denn?»
«Den kleinen Jungen nebenan gesund machen, er ist schwer krank.»
«Jaaaaa, wie denn?»
«Weisst du, seine Mutter kann ihm keine so schönen Geschenke machen, wie du sie bekommst. Aber es gäbe welche, die würden ihn vor Freude gesund machen.»
Mir dämmerte etwas, ich bekam so ein Gefühl von Angst und fragte:
«Was meinst du damit?»
«Ich meine, wir müssen dem kranken Jungen deinen Krankenwagen überlassen, damit er vor lauter Freude gesund wird.»
In mir brach eine Welt zusammen. Aber die Ernsthaftigkeit meiner Mutter war für mich so neu, so unwidersprechlich, dass ich wusste, es gibt keine Diskussion, sie hat gesprochen.
Am nächsten Tag brachte ich den Krankenwagen mit Tränen in den Augen hinüber zu dem bettlägerigen Jungen. Seine Augen strahlten, er brachte kein Wort heraus, er umarmte das Ding und schlief ein.
Meine Mutter rief mich erneut und sagte: «Ich danke dir mein Sohn, du bist ein ganz grosser Held.»
Ich war aufgewühlt, im Bett wusste ich nicht, soll ich heulen oder lachen. Wochen später war der kleine Junge gesund und meine Mutter nahm mich an der Hand und wir gingen gemeinsam rüber. Der muntere, kleine Junge fragte: «Wollen wir nicht gemeinsam spielen?»
Wieso nicht, der Läufer im Entrée war eh länger als derjenige in unserem Zimmer.
Vater verschwindet
Seite 5
Seite 5 wird geladen
5.
Vater verschwindet
Jetzt folgt ein schwieriges Kapitel: nicht, weil ich nun etwa von einem Kindheitstrauma berichten müsste, nein, im Gegenteil, weil ich gar nicht weiss, was ich darüber schreiben soll. Ich kann nicht wissen, was dieses Ereignis in meiner Mutter bewirkte, sie hat es mich nie spüren lassen. Und was es in mir auslöste, weiss ich auch nicht mehr. Ich war etwa sechs Jahre alt und kann mich nicht erinnern, dass ich bis dahin von meinem Vater viel mitbekommen hätte. Er war nebst seinem Beruf mit seiner Musik beschäftigt, war ein begnadeter Klavierspieler und komponierte selbst Klavierstücke, die zum Teil sogar öffentlich vorgeführt wurden und auf Schallplatte gepresst käuflich erwerbbar waren.
Seien wir mal ehrlich: Ich war vorwiegend mutterbezogen und das Verschwinden meines Vaters hinterliess bei mir keine grosse Lücke.
Schon als kleiner Junge erkannte ich dabei etwas, konnte es jedoch überhaupt nicht verstehen: Meine Mutter war eine schöne Frau. Sie war nicht sehr gross, aber wohl proportioniert mit einem ansprechenden Gesicht, umrahmt von blonden Locken. Sie achtete immer auf ein gutes Auftreten, war stets adrett gekleidet.
Bei gewissen Anlässen sah ich die neue Frau meines Vaters. Sie war eine schlampige Erscheinung, klein, rundlich und in ihrem vollen Gesicht war ihre dicke Brille wie in Fettpölsterchen eingewachsen. Irgendwie hingen ihre Kleider an ihr schief und schienen gar nicht zueinander zu passen.
Ich war nicht der Einzige, der die Welt meines Vaters nicht verstand. Seine Entscheidung, sich von meiner Mutter zugunsten dieser Frau zu trennen, spaltete seine gesamte Umgebung. Er hatte vier Brüder, von denen standen zwei zu ihm und zwei zu uns. Bei Letzteren war er zwar auch willkommen, jedoch nur alleine, ohne seine Lenke, so hiess seine neue Frau. Mit den zwei anderen Brüdern pflegten wir keinen Umgang mehr, weil Lenke es nicht duldete, dass sie mit meiner Mutter oder mit mir Kontakt hatten.
Er bekam Probleme am Arbeitsplatz, weil auch seine Vorgesetzten sich auf die Seite meiner Mutter stellten, sehr zu ihrem Vorteil, wie es sich später herausstellen sollte. Auf eine Art hatte ihn seine Frau eingesperrt, er sollte zu mir keine Kontakte mehr unterhalten. Was ich allerdings erkennen musste, ist: Als mein Vater gesundheitliche Probleme bekam, pflegte sie ihn hingebungsvoll, und das bis zum Ende seines Lebens. Es wurde dann auch eine lange Zeit, denn er ist 92 Jahre alt geworden.
Meine Mutter hatte nie über meinen Vater geschimpft und verlangte dies auch von niemandem. Nur ein einziges Mal sagte sie zu mir: «Mein lieber Sohn, du kannst froh sein, hast du von deinem Vater nur das Aussehen und nicht den Charakter geerbt.»
Bei den Grosseltern
Seite 6
Seite 6 wird geladen
6.
Bei den Grosseltern
Meine Mutter musste nach der Scheidung natürlich weiter arbeiten, sogar Zusatzarbeiten annehmen, damit wir über die Runden kamen. So gelangte ich vorübergehend in die Obhut meiner Grosseltern.
Wurde das eine abenteuerliche Geschichte!
Mein Grossvater war vor dem Krieg ein Staatsdiener in guter Position und als solcher im neuen Regime ein unerwünschtes Element. Er wurde verbannt an das Ende der Welt, musste die Administration einer Kolchose übernehmen und bekam eine Bleibe zusammen mit Grossmutter in einem gottverlassenen Weiler ohne Strom. Da war ich untergebracht und lernte das Landleben kennen. Unsere Verbindung zur restlichen Welt bestand in Form eines batteriebetriebenen Radios, ein hölzernes Monster mit den danebenstehenden, in Bitumen eingegossenen Batterieblöcken. Aus diesen ragten Schrauben heraus, die kupferne Rändelmuttern aufwiesen. Zwischen diesen wurden dann die Drähte eingeklemmt, die aus dem Radio kamen.
Diese Batterieblöcke mit ihren glänzenden Schrauben hatten mich schon immer fasziniert und wenn sie leer waren, bekam ich sie zum Spielen. Es ging so weit gut, bis mich das Innenleben einer dieser Batterien zu interessieren begann. Ich klaute in der Küche ein spitzes Messer und schickte mich an, das Ding zu sezieren. Es kam ein äusserst faszinierender Inhalt zum Vorschein: Alu-Wicklungen, ein aus Kohle bestehender Stab, doch darum herum eine gelartige Masse, die dann meine gesamten Klamotten ruinierte …
Meine Grossmutter steckte mich für lange Zeit ins Bad und die Kleider konnte man vergessen.
Für mich war das eine herrliche, unendlich weite Welt, in welcher ich mich nahezu ohne Schranken austoben konnte. Ich habe die Tiere kennengelernt, das waren allesamt freundliche, weiche, warme Wesen. Meine Grossmutter zog Hühner auf. Sie kaufte sie als winzige «Güggeli» und wenn sie alt genug waren, hat sie diese an Eierproduzenten weitergegeben.
Dabei konnte ich auch etwas Eindrückliches erfahren: Eines dieser kleinen, flauschigen, gelben, lebendigen Kügelchen bekam ich zum Liebkosen. Ich konnte es streicheln und wir spielten miteinander. Ich fütterte es, gab ihm Wasser, es war mein Spielgefährte. Das kleine Ding blieb immer in meiner Nähe, gehörte nicht zur schnatternden Menge. Aber ich merkte auch, es wuchs nicht wie die anderen, blieb kümmerlich und war ohne mich nicht lebensfähig. Ich musste einsehen, so viel menschliche Nähe tat dem Tier nicht gut. Mein «Güggeli» wurde auch nicht alt. Es war mein erster richtiger Verlust.
Führte dieses Erlebnis dazu, dass ich Zirkus nie gern mochte? Damals überwiegten Attraktionen mit Tieren und gerade diese faszinierten mich keinesfalls, sie waren mir eher zuwider. Obwohl ich die Akrobatik der Menschen bewunderte, hielten mich Tiernummern davon ab, Zirkusvorstellungen gerne zu besuchen.
Ich kam in die Schule und diese war vier Kilometer weit weg – ein langer Weg für so einen kleinen Jungen, selbst wenn es lustig war, in Gesellschaft einiger anderer Kameradinnen und Kameraden dorthin zu schlendern oder hüpfen. Dann kam eines Tages meine Mutter vorbei und brachte mir ein Fahrrad mit. So wie ich mich fühlte, war «überglücklich» untertrieben. Es war auch ein besonderes Rad: Der Rahmen bestand aus zwei Rohren, oben zusammengeschweisst, hinten auseinandergehend, um das Hinterrad aufzunehmen.
Ich war der King unter den wenigen Fahrzeugbesitzern … In meiner Gunst standen dann Mitschülerinnen oder Mitschüler, die auf dem Gepäckträger über dem Hinterrad mitfahren durften.
Im Winter mussten wir Schüler Holzscheite mit in die Schule nehmen, damit der Stubenofen im Klassenzimmer angefeuert werden konnte. Der Ofen strahlte eine Wärme aus, die mich bis heute begleitet, besser gesagt die Erinnerung daran, die Sehnsucht danach.
Später dann in der Schweiz, in den späten 60er Jahren, fuhr ich einmal im Winter mit der Rhätischen Bahn, Teilstrecke VZ, Visp-Zermatt von Brig in Richtung Zermatt. Der Wagen war ein theoretisch bereits ausgemustertes Exemplar mit offenen Plattformen. An einem Ende stand bei der Türe zum Eingang eine einfach gezimmerte Toilette, am anderen hingegen ein Stubenofen mit Feuer darin. Als der Billeteur kam, schien seine vornehmliche Aufgabe nicht einmal die Billettkontrolle zu sein, sondern mit den zwei mitgebrachten Holzscheiten das Feuer im Stubenofen am munteren Leben zu erhalten. Ich reckte mich in meinem holzbeplankten Sitz und fühlte mich als Passagier der ersten Klasse.
Heute, mit meiner Frau entwarfen und bauten wir bereits zwei Häuser nach eigenen Vorstellungen und in beiden steht ein Kachelofen mit Holzfeuerung, welcher im Winter nahezu täglich in Betrieb ist.
Was ich in jener Zeit als Kind auf dem Lande nicht wissen konnte, war, dass meine Mutter mich auf Biegen und Brechen zurückhaben wollte und was sie wirklich im Sinn hatte, das erreichte sie jeweils auch. So hatte sie auch für meinen Grossvater eine Stelle in Budapest als Buchhalter in einer Grosskäserei organisiert. Unterdessen hatte sie auch eine etwas grössere Wohnung ergattern können, so zogen meine Grosseltern und ich nach Budapest zurück und lebten als Grossfamilie zusammen. Meine Mutter und mein Grossvater gingen ihrer Arbeit nach und Grossmutter übernahm meine Erziehung.
Die eiserne Lady
Seite 7
Seite 7 wird geladen
7.
Die eiserne Lady
Ich weiss nicht mehr durch welche Umstände auch immer, aber eine kurze Zeit konnten meine Grosseltern mich nicht betreuen. So kam ich in die Obhut meiner Grosstante, der Schwester meiner Grossmutter. Sie hiess Rózsa, wir alle sagten ihr Rózsa néni, also Tante Rosa. Sie wohnte in Sárvár, etwas ausserhalb vom Zentrum und lebte mit ihrem Mann in einem schönen, recht grossen Haus, umgeben von einem, für meine Verhältnisse, riesigen, gepflegten Garten. Meine Grosstante war gross, stattlich, sozusagen eine Erscheinung. Ihr Mann eher schmächtig, fast unscheinbar, aber eine bedeutende Figur in der Stadtverwaltung.
Die Voraussetzungen waren also ideal, dort untergebracht zu werden. Sie waren kinderlos, somit stand ein unbenutztes Kinderzimmer alleine für mich zur Verfügung. Der Schulweg war auch kurz, zumindest im Vergleich zu dem bisher 4-kilometrigen. Ich fühlte mich sehr wohl untergebracht, genoss das grosse Haus und den riesigen Garten. Das Fenster meines Zimmers lag Richtung Osten. Mich weckte kein Wecker, sondern die Sonnenstrahlen des erwachenden Tages. Es war also feudal, es wäre auch so geblieben, wenn ich dort nicht die eiskalte Herzlosigkeit meiner Grosstante hätte kennenlernen müssen.
Zwei Episoden wurden in meinem kindlichen Herzen eingebrannt, die ich nicht mehr vergessen kann.
Irgendetwas hatte ich angestellt, das war ja so weit nicht aussergewöhnlich. Daraufhin hatte ich von Rózsa néni zwei Tage Hausarrest aufgebrummt bekommen, das war auch in Ordnung. Doch ausgerechnet in dieser Zeit fand meine Grossmutter die Gelegenheit nach Sárvár zu fahren, um mich zu besuchen. So kam sie auch diesmal, wollte mich zum Glacé-Essen mitnehmen, doch ihre Schwester verkündete, das ginge jetzt nicht, der Junge stehe unter Hausarrest. Meine Grossmutter flehte sie an, sie hätte eine mehrstündige Bahnreise auf sich genommen, um den Jungen zu sehen, da müsste man doch eine Ausnahme machen können. Ich bot an, anstelle meines zweitägigen Hausarrestes anschliessend einen viertägigen auf mich zu nehmen, wenn sie mich nur laufen liesse. Es war nichts zu machen.
Ich stand auf der Terrasse mit Tränen in den Augen, meine Grossmutter im Garten, ebenfalls heulend. Es nützte nichts, ihre Schwester hatte kein Herz, sondern Prinzipien.
Ein anders Mal klappte der Besuch meiner Grossmutter. Rózsa néni arbeitete in der Filiale einer Grosswäscherei, wo sie die zu reinigenden Sachen entgegennahm und diese nach der Reinigung wieder aushändigte. Diese lag im Zentrum von Sárvár, ich ging oft nach der Schule dorthin. Auch kam meine Grossmutter in den Laden, als sie mich einmal besuchte. Sie brachte mir in einem Topf ein Pflänzchen mit und erklärte mir, wie ich daraus eine grosse Pflanze machen könne. Wir liessen das Töpfchen im Lokal bei ihrer Schwester stehen und gingen Glacé essen. Als ich dann meine Grossmutter zum Bahnhof begleitete, kam ein Gewitter mit Windböen auf. Wir verabschiedeten uns und ich ging zur Wäscherei zurück.
Unterdessen schloss Rózsa néni den Laden und meine Pflanze liess sie weder im Geschäft stehen, noch nahm sie diese mit. Stattdessen stellte sie das Töpfchen auf die Treppe, die zum Eingang führte. Der Wind setzte meiner Pflanze zu und sie hing geknickt über ihren halben Stiel. Bei diesem Anblick brach in mir eine Welt zusammen. Damals habe ich es nur gefühlt, heute weiss ich es ganz genau: Die zarte, dem Wind ausgesetzte, gebrochene Pflanze verkörperte in meiner Seele die Liebe meiner Grossmutter zu mir, welche nicht hätte dem zerstörerischen Wind ausgesetzt werden dürfen.
Meine Mutter und meine Grosseltern erkannten nun: Sie mussten mich aus diesen paradiesischen Verhältnissen, aber lieblosen Atmosphäre befreien und mich wieder zurückholen in meine gewohnte, liebevolle Umgebung. Ich bin ihnen für diese Entscheidung bis heute unendlich dankbar.
Wieder in Budapest
Seite 8
Seite 8 wird geladen
8.
Wieder in Budapest
So war ich wieder in dieser Millionenstadt gelandet, fern von meiner Weite, von meinen Tieren. Doch das pulsierende Leben faszinierte mich auch, ich lernte alle Automarken kennen und konnte alle, die vorbeifuhren, aufsagen. Ich musste nicht mehr in die Tagesschule, meine Grossmutter hatte meine Erziehung in die Hand genommen, zumindest tagsüber.
Und da war auch meine Tante Georgina, die Zwillingsschwester meiner Mutter. Sie behandelte mich wie ihr Kind. Sie kam öfters zu Fuss von der Arbeit zurück, damit sie statt der Fahrkarte für mich ein Stück Schokolade mitbringen konnte. Ich vergesse es nie mehr, die Schokoladen-Stücke hiessen «Boci csoki», waren grün eingepackt und eine freundliche Kuh lächelte einem entgegen. Ich konnte es nicht wirklich wissen, doch etwas erspüren, was es hiess, diese Schokoladenstücke zu bekommen.
Meine Tante kannte keine Grenzen. Die Winter waren damals sehr kalt und sie hatte lange gespart, bis sie mir einen so richtig wärmenden Lammfellmantel kaufen konnte. Langsam dämmerte mir, wie viel Entsagungen Erwachsene um mich herum auf sich nahmen, um mich zu verwöhnen.
Meine Grossmutter war eine sehr gute Erzieherin. Sie war jugendlich, achtete auf ihre Figur, Frisur und ihr Erscheinungsbild. Sie war ja erst 44 Jahre jung, als ich auf die Welt kam. Woran ich mich heute noch erinnern kann: Als wir an den Donau-Strand gingen, hatte keiner geglaubt, sie sei meine Grossmutter, alle waren überzeugt, sie wäre meine Mutter.
Klar brachte das Leben in einer Grossstadt daneben «Störfaktoren» mit sich. Als Beispiel musste ich jedes Mal, wenn wir öffentliche Verkehrsmittel benutzten, meine weissen Zwirnhandschuhe anziehen – wenn auch widerwillig. Dass diese dann am Ende des Tages fast schwarz waren, bot meiner Grossmutter die Bestätigung für deren Notwendigkeit.
Sie war gebildet und belesen, sie weckte in mir das Interesse für Kultur und konnte alle meine Fragen beantworten. Doch nicht nur das, sie war auch im praktischen Leben voll dabei. Ein Beispiel aus tausend ihrer Empfehlungen, das heute noch aktuell ist: «Du sollst deine Schuhe nicht zweimal hintereinander tragen. Diese gehören nach dem Tragen ausgestopft, einen Tag in Ruhe gelassen und erst danach kannst du diese wieder gebrauchen.»
Und siehe da, meine Schuhe sind bereits uralt, doch immer noch wie neu und mein Dilemma ist, ich würde gerne neue kaufen …
Grossmutter hatte Kaffeekultur. Diese ging so weit, dass sie nur grüne Kaffeebohnen kaufte, denn die bereits gerösteten könnten an Aroma verlieren. Sie röstete jeweils eine Portion zu braunen, herrlich riechenden Bohnen. Nebenan durfte ich Weizenkörner rösten, um dann meinen Kaffee zu brühen. Diese Prozesse dauerten eine Weile und wir mussten die Pfännchen auf dem Gasherd ständig rütteln, damit die Bohnen oder die Körner nicht anbrannten. Dann wurden diese gemahlen und zum herrlich duftenden Kaffee «zelebriert».
Grossmutter war eine Hygienefanatikerin, eine Verehrerin von Dr. Semmelweis. Dieser in Budapest geborene Arzt bewahrte unzählige junge Frauen vor dem gefürchteten Kindbettfieber, alleine mit seiner Lehre von Hygiene. Schon seit dem 18. Jahrhundert war es den Ärzten erlaubt, Tote zu sezieren, um den Krankheiten auf den Grund zu kommen. Nur nach dem Sezieren gingen sie zu den Gebärenden und verbreiteten damit die Infektionen. Semmelweis befahl ihnen, die Hände zu waschen, vielmehr zu desinfizieren. So hörten die zahlreichen tragischen Sterbefälle gebärender Mütter weitgehend auf.
Das Verlangen nach Sauberkeit hinderte meine Grossmutter daran, auch Ordnung zu machen, sie war ja entweder am Reinigen oder am Lesen. Ich vermisste etwas Ordnung in unserer Wohnung und war oft neidisch, wenn ich Schulkameraden in ihren ordentlich aufgeräumten Wohnräumen besuchte.
Meine Erziehung war tadellos, doch musste ich das Schicksal aller Kinder teilen, die von ihren Grosseltern erzogen wurden – nämlich zu vorsichtig, eher etwas ängstlich. Eltern sind dabei viel lockerer, erlauben einiges mehr, das Kind kann viel mehr wagen. Auch ich durfte zu wenig auf den «Tschuttiplatz», denn Grossmutter hatte nicht genug Zeit, um mich immer über eine verkehrsreiche Strasse zu begleiten.
Abends wiederum war meine Mutter zuständig, um meine Schulaufgaben und auch meine schulischen Leistungen zu kontrollieren.
Mutters Lebenslektion Nr. 2
Seite 9
Seite 9 wird geladen
9.
Mutters Lebenslektion Nr. 2
In Ungarn waren bereits in den frühen 50er Jahren allerlei westliche Erzeugnisse erhältlich. Einzig, man musste über das nötige Kleingeld verfügen und dieses war in den meisten Fällen eine ganze Menge. Auch landesspezifische Erzeugnisse wie gute Exportgüter hatten einen überdurchschnittlichen Preis. Beispielsweise die PICK-Salami aus Szeged, diese, mit Edelschimmel zart überzogene, Monate an der Luft getrocknete Salami war oft Mangelware und wenn erhältlich, sehr teuer. Ich hatte diese Salami besonders gerne gemocht, mag sie heute noch und meine Grossmutter kaufte mir zuliebe manchmal 50 Gramm davon.
Dank der zentralistischen Planwirtschaft waren immer wieder Artikel des täglichen Bedarfs nicht erhältlich, aber grosso modo hatten wir allzeit genug zu Essen. Meine Grossmutter führte unseren Haushalt und wir hatten dabei nichts zu beanstanden.
Eines Tages nahm sie mich mit, als sie bei einer ihrer Freundinnen zu Besuch war. Die Dame war auch Grossmutter eines kleinen Jungen, der an diesem Nachmittag nicht in ihrer Obhut stand. So konnte ich ungehindert mit den Spielsachen des Kleinen spielen und dabei stiess ich auf eine Schachtel Lego-Klötze. Die Dame, die wir besuchten, hatte Verwandte in einem der skandinavischen Länder und bekam für das Enkelkind von dort allerlei geschenkt. Dazumal war Lego noch bei seiner ursprünglichen Idee geblieben, mit unterschiedlichen Bauklötzen die Kinder irgendetwas bauen zu lassen. Vorgefertigte Figuren, die man nach einem bestimmten Bauplan zusammensetzen muss, gab es damals noch nicht. Eine Grundplatte, Klötze in verschiedenen Grössen und Farben und es hiess: Mach‘ mal!
Ich vertiefte mich in den Zusammenbau eines Hauses, eine zweite kleinere Grundplatte diente als Dachfläche. Dann nahm ich es auseinander und das nächste Projekt war ein Auto. Noch nicht ganz fertig, verkündete meine Grossmutter, es sei höchste Zeit, nach Hause zu gehen. Sie müsse schliesslich was als Nachtessen auf den Tisch zaubern.
«Nur noch schnell fertigmachen, bitte» – aber Grossmutter meinte, jetzt sei wirklich Schluss. Ihre Freundin merkte meine bodenlose Enttäuschung und sagte: «Du kannst das Spiel mitnehmen. Mein Enkelkind hat keine richtige Freude daran, spielt nur selten damit, es wird das Spiel nicht vermissen.»
Ich war richtig sprachlos. Meine Grossmutter sagte auch, das können wir nicht annehmen, kostet doch so ein Spiel in diesem Umfang etwa einen mittleren Monatslohn. Aber ihre Freundin meinte:
«Papperlapapp, ich habe so eine Freude zu sehen, wie dein András Spass an diesem Spiel hat, – lass mir die Freude und nehmt es mit!»
So packten wir unsere Sachen zusammen, einschliesslich dieses wertvollen Geschenkes. Ich konnte mein unerwartetes Glück kaum fassen, konnte nicht ruhig gehen, hüpfte an der Hand meiner Grossmutter zu unserer Busstation, schwebte sozusagen im siebten Himmel.
Während der Heimfahrt, berauscht von so vielen Glücksgefühlen, schmiedeten wir einen teuflischen Plan.
Als Mutter von der Arbeit heimkam, war ich gerade daran, mein Autoprojekt erneut zu verwirklichen. Wir begrüssten uns wie immer, doch dann blieb sie stehen und schaute meine Grossmutter fragend an.
Daraufhin sagte diese: «Weisst du, das hat sich der Junge so sehr gewünscht, ich konnte einfach nicht widerstehen …»
Und genau das war der Moment, als wir dachten, die Bombe platzt, dass Mutter toben und in etwa sagen würde: «Du weisst doch ganz genau, dass wir uns das nicht leisten können. Der Junge bekommt alles, was er sich wünscht, aber nur im Rahmen unserer Möglichkeiten.» Oder so ähnlich.
Aber nein. Meine Mutter blieb gelassen und sagte zu ihrer Mutter: «Du bekommst das Haushaltsgeld und verwaltest es nach deinem Gutdünken. Das Einzige, was wir von dir verlangen, ist, dass wir am Monatsende immer noch etwas Anständiges zu essen bekommen. Wie du das machst, liegt allein in deiner Verantwortung.»
Sie sprach diese Worte ganz ruhig, dann ging sie sich nach der Arbeit frisch machen und anschliessend setzten wir uns alle an den Tisch.
Es war für mich beeindruckend, wie früh ich schon erfahren durfte, was Verantwortung bedeutet.
1955
Seite 10
Seite 10 wird geladen
10.
1955
Nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges herrschten vorwiegend die Besatzungsmächte über Europa. In den westlichen Teilen waren das die Alliierten, also Frankreich, Grossbritannien und die USA, in der östlichen Hälfte das sowjetische Regime. Die NATO wurde gegründet und als Gegenstück der Warschauer Pakt.
Während Amerika mit dem Marshallplan Europa als wichtigen Wirtschaftspartner aufbaute, wussten die Sowjets nichts anderes, als die von ihnen befreiten Länder zu schröpfen mit der Begründung, Kriegsentschädigung zu kassieren. Dabei wurden ostdeutsche Fabriken «abgeschraubt» und in der Sowjetunion wieder aufgebaut.
Beispiel Autoindustrie: Der sowjetische Moskwitsch war anfänglich ein waschechter Opel Olympia, bis man dann die Karosserie, nicht aber die Technik modernisierte. Der grössere Opel Kapitän wurde in der UdSSR als Pobjeda hergestellt und in Polen als Warszawa. DKW wurde in Ostdeutschland als Wartburg weitergebaut usw. Wollte man die Luft von Berlin aus dem Olympiajahr 1936 schnuppern, so musste man lediglich in einer der Ostblock-Metropolen die U-Bahn besteigen. Dort fuhren nach dem Krieg die in der UdSSR hergestellten U-Bahn-Kompositionen, so wie man diese damals in Berlin entworfen und gebaut hatte.
Nach einem Abkommen aller Siegermächte gab es Westdeutschland, Ostdeutschland, Westberlin und Ostberlin. Nach dem gleichen Muster gab es auch Westösterreich und Ostösterreich, Westwien und Ostwien.
Doch zehn Jahre nach Beendigung des Krieges formierte sich Westeuropa wieder zur Selbstständigkeit im Rahmen der Möglichkeiten. Am 5. Mai 1955 entliessen die Westmächte Westdeutschland in die Autonomie. An diesem Tag endete dort das Besatzungsregime und die Bundesrepublik Deutschland erhielt ihre staatliche Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Die beiden deutschen Staaten wurden als eigenständige Nationen anerkannt, wobei die BRD der NATO und die DDR dem Warschauer Pakt beitraten. Somit war die Ost-West Trennung besiegelt.
In diesem Jahr, am 8. Dezember 1955, beschloss der Europarat sein Emblem: eine blaue Flagge mit zwölf goldenen Sternen.
Auf der anderen Seite behielt die Sowjetunion ihre Oberhoheit über die von ihr von den Nazis befreiten Gebiete. Ostdeutschland blieb also Bruderstaat der Sowjetunion, welche versuchte Westberlin mittels einer Blockade zu zwingen, wieder zu Ostdeutschland zu gehören. Dies wurde durch eine anderthalbjährige Intervention der Westmächte verhindert, Stichwort Rosinenbomber und Ausbruch des Kalten Krieges. In der Zeit von Juni 1948 bis gegen Ende 1949 wurde Westberlin im Rahmen der «Operation Luftbrücke» ausschliesslich durch die Alliierten aus der Luft versorgt mit Lebensmitteln, Medikamenten, Roh- und Baustoffen, allem. Der Übername «Rosinenbomber» entstand dadurch, dass die Besatzungen der aus vorwiegend DC-3, DC-4 und Dakota Flugzeugen bestehenden Flotte in der Anflugschneise Süssigkeiten für die Kinder abwarfen.
Ähnliches hätte Österreich auch geblüht, wenn die Sowjetunion nicht auf Geld angewiesen gewesen wäre. Doch die enorme Aufrüstung in den USA, dann die prestigeträchtige Weltraumforschung überforderten die sowjetischen Finanzen. Sie verkauften also ihren ostösterreichischen Anteil an die Westmächte. Es sickerte durch, dass sie dafür an die UdSSR die damals unglaublich hohe Summe von 150 Millionen Dollar bezahlten. Aktuell hört man in Bezug auf Staatsgeschäfte nichts als Milliarden. Aber damals bedeuteten Millionen Dollars mehr als heute Milliarden.
Was dabei für Ungarn entscheidend war: Die Grenze zum Westen rückte direkt an Ungarn heran. Man roch also die Freiheit vor der Haustüre.
Die USA unterhielten im Westteil Europas einen Radiosender namens «Radio Freies Europa». Dieser sendete sein Programm in alle von den Sowjets besetzten Gebiete auf weite Distanz empfangbaren Kurzwellenfrequenzen in den jeweiligen Landessprachen aus. Der Sender bediente alle Schichten, die politisch Interessierten ebenso wie die Jugend, die westliche Musik hören wollte.
Das Anhören dieses Senders war strengstens verboten. Dennoch entstanden Gerüchte, nicht zuletzt basierend auf Nachrichten dieses Senders, dass uns freiheitsliebenden Ungarn die Amerikaner oder, anders gesagt, die Westmächte helfen würden, sobald wir einen Aufstand gegen das sowjetische Regime auslösen würden.
Eine der Hörerinnen dieses Senders war meine Urgrossmutter. Sie ging auf ihr 90. Lebensjahr zu und meinte, so eine alte Frau würde nicht einmal die Stasi behelligen. Sie hörte also die Sendungen und hielt wöchentlich Kaffeekränzchen ab mit Leuten, die zwar interessiert waren, aber sich nicht trauten den Sender einzuschalten.
Entscheidend für das Schicksal unserer Familie sollte dann ihre Aussage werden: «Wenn es ein Land auf Erden gibt, für das es sich lohnt, Ungarn zu verlassen, so ist es die Schweiz.»
1956
Seite 11
Seite 11 wird geladen
11.
1956
Als ich an diesem denkwürdigen 23. Oktober 1956 in der Tagesschule meine Hausaufgaben machte, fiel mir auf, dass plötzlich alle so aufgeregt waren und zu den Fenstern strömten. So ging ich auch zum Fenster, ergatterte mir einen Platz und schaute hinaus auf die Strasse. Was ich sah, war auf eine unbeschreibliche Art furchterregend, ohne dass ich den Sinn hätte begreifen können. Es zogen Lastwagen vorbei voller Leute auf den Ladeflächen, die laut sangen und Parolen im Chor von sich gaben. Auf jedem dieser Lastwagen wurden ungarische Fahnen mitgeführt, doch diese waren so anders.
Nach Einführung des sowjetisch diktierten Regimes wurde die über 1‘000 Jahre gehisste ungarische Fahne mit den Farben Rot, Weiss, Grün, ähnlich wie in allen Bruderstaaten, verändert. In der Mitte ihrer Flaggen musste das sozialistische Symbol aufgenommen werden: Hammer und Sichel, umrahmt von einem Ährenkranz, oben zusammengefügt von einem alles überstrahlenden roten Stern, unten zusammengehalten von einem Band in den jeweiligen Landesfarben.
Doch nun prangte in den Fahnen nicht das Symbol, sondern ein Loch, herausgeschnitten oder herausgebrannt. Die Fahne mit dem Loch in der Mitte wurde Symbolbild des Aufstandes, der an diesem Nachmittag ausbrach.
Die Leute strömten zum Parlament, versammelten sich auf dem grossen Platz davor und stellten ihre Forderungen. Das war einzigartig in diesem totalitären Regime und entsprechend nervös reagierte der Staat. Der Platz wurde schnell umzingelt von Soldaten der ungarischen Armee, aber auch von solchen der sowjetischen Besatzungsmacht. Doch die Schüsse kamen weder von den ungarischen noch von den sowjetischen Soldaten. Ob diese keinen Befehl erhielten oder den Befehl verweigerten, ist mir nicht bekannt. Tatsache ist, die Schüsse wurden ausschliesslich von bewaffneten Einheiten des Staatssicherheitssystems abgefeuert und alleine an diesem Nachmittag, auf diesem Platz forderten sie etwa einhundert Menschenleben.
An einem anderen Ort in Budapest, wo die Menschen sich ebenfalls versammelten, geschah dasselbe: Etwa einhundert Zivilisten starben auch dort im Gewehrfeuer des eigenen Staatssicherheitssystems.
Diese Einheit bekam ursprünglich eine Zentrale in der Budapester Innenstadt, in der Prachtallee Andrássy út, in einem im 19. Jahrhundert in Neobarock errichteten grossen Gebäude. Dieses wurde daraufhin gemäss ihren Bedürfnissen ausgebaut, vor allem unterkellert, wo dann die Folterzellen ihren Platz fanden.
Natürlich war diese Zentrale Ziel Nummer eins der Aufständischen. Nach deren Stürmung wurden die eingesperrten politischen Insassen freigelassen. Dann aber wurde der Volkszorn in seiner Gnadenlosigkeit zelebriert: Die Stasi-Funktionäre hingen entlang dieser Allee an den Bäumen, zum Teil mit aufgeschlitzten Bäuchen.
Die Sowjets unter Führung von Nikita Chruschtschow fielen nicht sogleich in Ungarn ein. Im Gegenteil, die dort stationierten Einheiten wurden abgezogen. Chruschtschow sprach mit den Westmächten, mit der NATO-Spitze und machte unmissverständlich klar, dass er an seinen territorialen Ansprüchen festhalten will, und koste es einen dritten Weltkrieg. Es gab nämlich ausser in Ungarn sowohl in Polen als auch bei den als Freunde gewonnenen arabischen Ländern Unruhen gegen das sowjetische Regime.
In dieser Zeit wurde in Ungarn eine demokratische Regierung gebildet, die Grenze zu Österreich geöffnet. Etwa 120‘000 Leute nutzten die Gelegenheit und verliessen das Land, darunter auch meine Tante Georgina mit ihrem soeben geheirateten Mann.
Die Westmächte und NATO gaben nach. Unter Vermeidung eines dritten Weltkrieges erteilten sie Chruschtschow freie Hand. Darauf kamen die sowjetischen Panzer nach Ungarn und ein blutiger Freiheitskampf begann.
Ich als kleiner Junge merkte nichts Wesentliches davon, nur dass ich nicht zur Schule konnte. Am Anfang war ich noch einige Male an Mutters Arbeitsstätte, der Philatelie und dort wurden die kleinen roten Flaggen mit der goldenen Sichel und dem Hammer, die an jedem Schalter standen, entfernt. Ich ergatterte eine der kleinen, entblössten Fahnenstangen mit der kupfernen Spitze, die mir so gefiel. Die nahm ich als Spielzeug heim.
Statt Schule hatte man sich zu Hause mit irgendetwas beschäftigt. Manchmal kam der Nachbarsjunge vorbei und wir spielten Karten. Dabei lutschte ich an der kupfernen Spitze der Fahnenstange. So geschah das Unglück: Eine Karte von mir fiel zu Boden, und damit mein Spielgefährte diese nicht erkennen konnte, bückte ich mich augenblicklich, um diese aufzuheben. Das Dumme war nur, dass ich die Fahnenstange immer noch im Mund hatte und bei dieser heftigen Bewegung bohrte sich diese mir mit ihrer kupfernen Spitze in den Gaumen.
In diesem Moment scherte sich meine Mutter um keine Ausgangssperre, auch nicht darum, dass auf den Strassen gelegentlich geschossen wurde. Sie nahm mich auf die Arme und rannte mit mir in das nächste Spital. Das war für mich die Gelegenheit, einen Eindruck von den Geschehnissen zu bekommen. Die Bilder brannten sich in mein kindliches Gehirn ein: ein totes Pferd auf der Seite liegend, ein ausgebrannter russischer Panzer, der noch aus der Luke rauchte.
Obwohl diese Bilder in meinem Kopf immer noch gegenwärtig sind, mag ich mich nicht daran erinnern, ob sie mir damals Angst einflössten. Sicher ist, ich konnte als siebenjähriger Junge die Situation gar nicht erfassen, geschweige einordnen. Woran ich mich aber jetzt noch erinnern kann, war ein bedrohliches Gefühl, als ich die Szenen mit den Lastwagen und den laut singenden Menschen darauf auf der Strasse erblickte.
Auch in der Wohnung, wo ich von allem abgeschirmt war, vernahm ich die Gewehrschüsse, aber meine Fantasie reichte noch nicht aus, mir vorzustellen, wie es wirkt, wenn ein angeschossener Mensch zusammenbricht. Ich hatte auch vernommen, dass es lebensgefährlich werden kann, vor der Bäckerei für Brot anzustehen. Aber warum? Das hatte man mir nicht erklärt.
Dann kam das Sirenengeheul. Meine Mutter packte etwas an Essbarem zusammen, nahm mich an die Hand und wir gingen in den Keller. Wir sassen auf den Briketthaufen und in den Gängen standen die Nachbarn und diskutierten. Was mir auffiel, waren Kerben in den Latten, welche die Abteile abgrenzten. Ich fragte meine Mutter und sie erklärte mir: «Gar nicht so lange her, nur etwa zwölf Jahre, du warst noch nicht auf der Welt, wurde im Zweiten Weltkrieg auch Budapest bombardiert. Das heisst Bomben von Flugzeugen wurden abgeworfen, die unten explodierten und Gebäude zerstörten. Manchmal mussten Menschen Tage, Wochen hier unten verbringen, damit sie nicht in den Trümmern sterben. Sie haben jeden Tag eine Kerbe in eine Latte geschnitzt.»
Ich spürte, es musste sehr schlimm gewesen sein, obwohl wir jeweils nur einige Stunden dort unten verbringen mussten. Während des Aufstandes wurde nicht bombardiert, aber Alarm ausgelöst, wenn Panzer vorbeizogen. Wenn deren Besatzung etwas Verdächtiges zu vernehmen glaubte, wurde sofort geschossen, manchmal nicht nur aus dem Maschinengewehr, sondern aus der Kanone und das konnte ein Gebäude zum Einstürzen bringen.
Gegen Ende Jahr wurde es ruhig und ich konnte wieder zur Schule gehen. Dann zogen wir in die von meiner Tante und meinem Onkel verlassene Wohnung in der Innenstadt.
Meine Tante geht
Seite 12
Seite 12 wird geladen
12.
Meine Tante geht
In diesem denkwürdigen Jahr 1956 heiratete im September die Zwillingsschwester meiner Mutter. Ihr Mann war ein vom Systemwechsel gezeichneter Mensch. Seine Eltern waren zwar keine Grossgrundbesitzer, doch auch keine Knechte, sondern Landwirte, die ihrerseits Knechte beschäftigten. Das war schon einmal genügend, um als imperialistischer Ausbeuter und als Klassenfeind abgestempelt zu werden. Noch schlimmer wurde die Tatsache gewertet, dass seine übrigen Verwandten dem abgelösten Regime als hochrangige Beamte gedient hatten, wie auch ein Oberrichter oder ein Parlamentarier.
Mein künftiger Onkel wollte sich ausbilden lassen, wollte am Technikum Chemie studieren und Chemiker werden. Das wurde ihm auch gewährt, doch zuerst musste er sich von seiner Vergangenheit lösen. Das hiess, er war verbrummt dazu, etwa anderthalb Jahre als Zwangsarbeiter in einem Steinbruch zu arbeiten, natürlich ohne Lohn. Die Belohnung war, dass er sich von der Schuld der Vorfahren freilösen konnte und auch das gewünschte Technikum besuchen durfte. Ist es verwunderlich, dass von da an sein grösstes Schimpfwort «Kommunist» hiess?
Sie heirateten im Oktober 1956. Mein Onkel Pityu hatte mich überaus gern gehabt, wenn er mich auch gerne als Mamatitti hingestellt hatte. Allerdings, als meine Mutter meinte:
«András nehme ich zur Hochzeit nicht mit, da er keine entsprechenden Kleider hat», meinte er kurzerhand, «dann heiraten wir nicht.»
So stehe ich auf dem Hochzeitsfoto in kurzen Hosen da, jedoch bei passenden spätsommerlichen Sonnenstrahlen im Oktober.
Kurz darauf brach der Aufstand aus und die Grenze nach Westen wurde geöffnet. Mein Onkel nahm seine frisch Angetraute an der Hand und flüchtete mit ihr schnurstracks nach Österreich. Sie landeten in einem Auffanglager. Dort lernten sie weitere junge Paare kennen und in diesem Kreise verkündete meine Tante das, was sie von meiner Urgrossmutter mitgenommen hatte: «Wenn es ein Land gibt, das es wert ist, Ungarn zu verlassen, dann ist es die Schweiz.»
Dies leuchtete den neu gewonnenen Freunden auch ein.
Sie allesamt warteten. Es kamen Busse aus Deutschland, Frankreich, Italien, USA, kurzum aus nahezu allen westlichen Ländern, um Flüchtlinge abzuholen. Doch sie blieben geduldig. Das Lager war bereits nahezu leer, als der Bus aus der Schweiz eintraf.
Diese jungen Paare trafen also in der Eidgenossenschaft ein. Ein Teil von ihnen war medizinisch ausgebildet, diese wurden in Zürich und Umgebung aufgenommen. Der Rest, eher mit einer chemischen Ausbildung, etablierte sich naturgemäss in Basel und Umgebung. Mein Onkel als Chemielaborant fand seine Stelle in der Papierfabrik Ziegler in Grellingen im Birstal.
Diese geografische Teilung hatte der bereits tief verwurzelten Freundschaft keinen Abbruch getan. Die etwa vierzehn Paare trafen sich weiterhin regelmässig, zum Teil zu berauschenden Partys.
Kleiner, grosser Geschäftsmann
Seite 13
Seite 13 wird geladen
13.
Kleiner, grosser Geschäftsmann
Ich brauchte immer Geld. Ich habe es bereits ganz früh erkannt: Das Schönste am Geld ist es auszugeben … Aber zuerst einmal musste man es haben. Dazu ergriff ich immer wieder Gelegenheiten, um an Geld zu kommen, neben der Schule in der Freizeit …
Es fing schon ganz früh in der Primarschule an. Wie gesagt, Kultur wurde vom Staat gefördert, also kosteten auch Schulsachen lediglich einen symbolischen Betrag, ein Schulheft einen halben Forint. Doch wenn ein Schulkollege sein Heft daheim vergass und ein Blatt brauchte, so trennte ich ihm aus der Mitte meines Heftes ein Blatt heraus und verkaufte es ihm für einen oder zwei Forint. Ich war auch bedacht, das ergatterte Geld gezielt auszugeben, nicht sofort zu verschleudern. So merkte meine Mutter mit der Zeit, dass meine Schulhefte ungewöhnlich dünn waren und auch, dass ich Geld besass. Sie stellte mich zur Rede.
«Woher hast du das Geld?»
«Ich habe Blätter aus meinem Schulheft verkauft!»
«Für wie viel?»
Ich nannte die Beträge und sie erklärte mir daraufhin Begriffe wie «Erpresser», «Hehler» und dergleichen. Sie trug mir auf, das eingenommene Geld bereitzuhalten und eine Liste der Jungs zusammenzustellen, die zu meiner Kundschaft gehörten. Als ich fertig war, kam sie mit in die Schule. Sie unterhielt sich kurz mit der Lehrerin und ich musste mit meiner Liste und dem Geld bei den betroffenen Schulkameraden vorbeigehen und die Münzen wieder aushändigen.
Na gut, solche Geschäfte habe ich nicht mehr getätigt. Aber zwei und zwei wollte ich immer zusammenrechnen.
Als meine Grosseltern bereits in der Schweiz waren, wollten sie mir ein schönes Geschenk machen und fragten, welche starke Dampflokomotive sie mir für meine Modelleisenbahn schenken sollten.
Ich hatte schon Ideen, doch dachte ich weiter: In Ungarn war gerade ausgesprochen Mode, bei Regenwetter in einer Pelerine herumzulaufen, statt unter dem Regenschirm. Ich wusste, so eine Pelerine kostete in der Schweiz CHF 22.–. Diese waren in Ungarn heiss begehrt und ich konnte so ein Exemplar mindestens für HUF 600.– verkaufen. Das war die Ausgangslage, dann die weitere Rechnung: Eine ansehnliche Dampflokomotive für die Modelleisenbahnanlage kostete in der Schweiz etwa CHF 100.–, während in Ungarn ca. HUF 1‘000.–.
Also rechnete ich: Wenn sie mir an Stelle der Lokomotive 5 dieser Pelerinen schicken würden, könnte ich diese für HUF 3‘000.– verkaufen und bekäme dafür drei tolle Lokomotiven.
So haben wir es also gemacht. Ich hatte die Pelerinen wie geplant verkauft, nur das Geld nicht für Lokomotiven verwendet, denn unser Haushalt brauchte dringend Geld. Es hiess: «Du bekommst es später wieder.» Dazu kam es nicht, aber irgendwie störte es mich gar nicht, ich spürte die Notwendigkeit.
Später bekam ich von meiner Mutter zu Weihnachten mehr als eine tolle Lokomotive, darunter ein Prachtexemplar: Die grün lackierte bayrische Schnellzuglok mit dem ganzen passenden Personenzug dahinter, ebenfalls in grün gehalten.
In der Schweiz, als ich nebst dem Gymi mit Nebenarbeiten meine ersten Autos erstand und damit in der Weltgeschichte umherfuhr, aber auch die Familie überallhin umherkutschierte, war nie ein Thema, wer das Benzin oder die Versicherung bezahlt, es war einfach Familienangelegenheit.
Über meine unzähligen spannenden «Geschäftsbeziehungen» erzähle ich mehr in der Chronologie.
Das Einparteiensystem
Seite 14
Seite 14 wird geladen
14.
Das Einparteiensystem
Gemäss dem Kongress der Siegermächte über Nazi-Deutschland in Jalta bekam die Sowjetunion uneingeschränkte Macht über die Gebiete und Länder, die sie befreit hatte. Dazu gehörten Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn und Teile Deutschlands und Österreichs. Diesen Anspruch nutzten die Sowjets unter anderem dazu, in diesen Ländern das Einparteiensystem mit Gewalt einzuführen. Die ausschliesslich erlaubte Partei war fortan die Kommunistische Partei. Interessanterweise stimmten von da an jeweils 98 % aller Bürger dieser Länder nur noch für Abgeordnete dieser einzigen Partei – freiwillig natürlich.
Die Partei war allmächtig und allgegenwärtig. In jedem Betrieb wurden Parteisekretäre eingesetzt, die dafür sorgten, dass die Richtlinien der Partei eingehalten wurden. Nach aussen übernahmen sie die Funktion des Personalchefs der Personalabteilung. Nach innen waren sie jedoch an jeder wichtigen Sitzung dabei und bei Produktionsbetrieben hatten sie Sorge getragen, dass die Richtlinien der Planwirtschaft eingehalten wurden. Bei Dienstleistungsbetrieben wie Banken und Versicherungen schauten sie, dass nur die richtigen, linientreuen Leute befördert wurden.
In Ungarn war niemand gezwungen, Parteimitglied zu werden. Doch wollte man nur einen noch so kleinen Schritt im Beruf weiterkommen, musste man beitreten. Entsprechend waren sogar Leute der Opposition Parteimitglieder, denn dies bedeutete gar nichts, ausser dass man nicht blockiert war.
Selbst in den Schulen mussten einige Lehrerinnen und Lehrer ihre Ausbildung als Parteisekretär absolvieren, sonst konnten sie nicht Klassenlehrerin oder -lehrer werden.
Diese Funktionäre waren überaus gefürchtete Personen. Man wusste, wenn diese etwas vernehmen würden, was man tat oder äusserte, was nicht linientreu war, so erging sofort die Meldung an die Zentrale und in einem solchen Fall musste man sich richtig warm anziehen … Man sprach immer wieder davon: Die Wände hätten Ohren. Dementsprechend sprach man manchmal ganz leise miteinander.
Die Ungarn neigen dazu, ihren Schmerz, ihre Sorgen, aber auch ihre Freude auf irgendeine Art kundzutun, sei es in Form eines Liedes, eines Gedichts oder einer satirischen Darstellung. Von denen gab es genug und der Staat duldete diese zumindest nach dem Aufstand von 1956, als die liberale Kádár-Regierung an die Macht kam. Ihre Auffassung war: Die Gemüter sollen sich mit Satire entladen, statt auf die Strassen zu gehen, wobei man unschön eingreifen müsste.
Wie waren diese satirischen Szenen? Ich mag mich an deren zwei erinnern. Im Ungarischen steht der Begriff «Kormány» sowohl für Lenkung als auch für Regierung. Da kurvte der kleine, rothaarige, aber ungarnweit beliebte Kabarettist Kabos mit einem Fahrrad in einer furchtbaren Zickzack-Linie auf die Bühne, warf den Drahtesel in die Ecke und verkündete: «Diese Lenkung (also Regierung) ist nicht zu gebrauchen!»
«Paradicsom» heisst im Ungarischen Tomate oder aber auch Paradies. Die Regierung sprach immer über das zu erreichende kommunistische Eldorado. Da kam der Kabarettist auf die Bühne, biss in eine Tomate, warf diese in die Ecke und meinte, «Diese Tomate (also Paradies) ist nicht zu geniessen!»
Ähnlich wie die Satire auf der Bühne dienten die politischen Witze am Stammtisch als Blitzableiter. Den meines Erachtens herzigsten unter den unzähligen möchte ich euch nicht vorenthalten:
In der Primarschule hat die Lehrerin vor, den Kindern bereits höherstehende Begriffe näherzubringen. So fragt sie: Wer von euch weiss, was «Katastrophe» bedeutet? Hansi meldet sich und verkündet: Bei uns am Hof sterben die Hühner, das ist eine Katastrophe. Die Lehrerin meint, sie müsse ihn berichtigen und sagt: Dass bei euch die Hühner sterben, ist schlimm, aber noch keine Katastrophe. Eine Katastrophe ist, dass Genosse Stalin gestorben ist. Hansi nickt mit dem Kopf und die Lehrerin ist überzeugt, er hat es begriffen. Eine Woche später kommt die staatliche Schulaufsicht vorbei und nimmt am Unterricht teil. Die Lehrerin will glänzen und wiederholt ihre Frage betreffend Katastrophe. Sie ruft Hansi auf und dieser verkündet: Es ist eine Katastrophe, dass Genosse Stalin gestorben ist. Aber das ist nicht schlimm. Schlimm ist, dass bei uns am Hof die Hühner sterben.
Es ist wie gesagt die ungarische Mentalität, dass man seinen Frust durch Humor ablädt. In den Sechzigern spürte ich auch eine überbordende Lebensfreude. Die Restaurants waren voll, die Biergärten ebenso. Man genoss das Leben, man gab das Verdiente locker aus, denn es reichte eh nicht für andere Ziele wie ein Auto oder ein Häuschen, geschweige denn für eine Weltreise.
Die Leute nahmen ihre Auflagen gelassen entgegen und kamen denen nach Möglichkeit nach. Doch da war auch noch was …
Zwei Kollegen treffen sich und der eine staucht den anderen zusammen, wieso dieser an der letzten Parteiversammlung nicht teilgenommen hätte. Daraufhin erwidert der Angesprochene: Wenn ich gewusst hätte, dass dies die letzte Parteiversammlung ist, wäre ich garantiert gekommen.
Das war Sozialismus. Und die Partei verkündete den Slogan: Wir sind auf dem Weg zum (Allheil bringenden) Kommunismus.
Aber seien wir doch ehrlich. Was heutzutage Berichte über andere sozialistische Länder bringen, allen voran der DDR, schockiert uns und man muss zugeben, Ungarn war wirklich die «lustigste Baracke» im sozialistischen Lager. Für ausgewählte DDR-Bürger galt es als Reise in den Westen Urlaub am Balaton, also am Plattensee zu verbringen.
Ein weiterer Begriff aus dieser Zeit ist «Salamitaktik». Ungarische Salami verkauft sich weltweit ganz gut, aber das ist nicht der Grund. Salamitaktik steht für: Immer wieder kleine Scheiben für sich zu gewinnen. Ein Beispiel:
Die Markthallen waren in Ungarn bereits in den Sechzigerjahren zum Bersten voll, anders als in anderen sozialistischen Ländern. Die Bauern waren in allen diesen Ländern zwangsenteignet worden und mussten in Kolchosen unter Planwirtschaft arbeiten – Argwohn war naturgemäss vorprogrammiert. In Ungarn konnten sie ein kleines Stück für Eigenbedarf behalten. Die Regierung erkannte: Auf diesen kleinen Landstücken gedieh mehr als auf den unter Planwirtschaft bewirtschafteten Ländereien. Dabei reden wir nicht über Massenproduktion wie Getreide oder Kartoffeln, sondern über Gemüse, Obst oder hausgemachte Wurst.
Entscheidend war, dass dieses Stück Land für Eigenbedarf von Jahr zu Jahr vergrössert wurde, also mit Salamitaktik den Bedarf der Bevölkerung immer mehr erfüllte – und damit wurde die allgemeine Zufriedenheit gefördert.

Budapest vásárcsarnok d.h. Zentralmarkthalle
Tomatenernte
Seite 15
Seite 15 wird geladen
15.
Tomatenernte
In der Schule kam es alleweil wieder vor, dass wir zur Fronarbeit abberufen wurden. Es war immer ein freudiges Ereignis: Anstelle des doofen Unterrichts hinaus in die Natur und etwas Nützliches tun.
Diesmal war Tomatenernte angesagt. Die Klassenlehrerin gab uns die Einzelheiten zuhanden der Eltern mit: «Tagesverpflegung mitgeben, dafür können die Kinder so viele Tomaten mit nach Hause nehmen, wie sie nur wollen oder können. Achtung: genügend zum Trinken mitgeben!»
So versammelten wir uns an besagtem Morgen in der Schule, jeder einen Rucksack dabei und wurden aufs Feld geführt. Da ging die Ernte los, wir sammelten die schönen reifen Tomaten in grossen Kisten, welche dann die Erwachsenen zum Abtransport stapelten.
Gegen Mittag, nach Verzehr des Mitgebrachten ging es weiter und es hiess: «Ihr könnt nun eure Rucksäcke mit Tomaten füllen.» Viele meiner Mitschüler füllten ihre Rucksäcke mit grünen Tomaten auf, aber ich war viel gescheiter und wählte die schönsten, reifsten Exemplare aus.
Am Ende des Erntetages wurden wir bis zum Stadtrand zurückgeführt. Dann galt es auf Tram und Bus umzusteigen, um nach Hause zu kommen. Unterdessen herrschte der nachmittägliche Berufsverkehr und die öffentlichen Verkehrsmittel waren entsprechend voll. Dies bedeutete Gedränge …
Mit der Zeit merkte ich im Bus, dass mein Rücken nass wurde. Mein Rucksack schrumpfte und die Sauce rann meinen Buckel hinunter. Zu Hause angekommen war ich total durchnässt, mein Ranzen beinhaltete nur noch Tomatensaft und ich wurde schnurstracks in die Badewanne gesteckt.
Meine Mutter kam und sagte: «Das hätte ich dir sagen sollen …»
Später fielen mir immer wieder die grünen Tomaten auf, die an den Fenstersimsen an der Sonne nachreiften, und ich musste dann schmunzeln über mich, den Gescheiteren.
Körpergeflüster
Seite 16
Seite 16 wird geladen
16.
Körpergeflüster
Eines Tages ging es meiner Mutter nicht so gut. Und es wurde immer schlimmer, bis sie eines Morgens nicht mehr im Stande war, aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Wir bestellten den Hausarzt und er kam auch ziemlich rasch.
Damals war es üblich, dass die Hausärzte zu ihren Patienten gingen. Etwa die Hälfte ihrer Praxiszeit verbrachten sie mit Hausbesuchen. Das war weltweit so und diese Ärzte wurden dann auch die ersten guten Abnehmer für Autos. Doch zuerst fuhren sie mit ihren pferdegezogenen Kutschen übers Land. Dies rief in den weiten USA Henry Ford bereits 1908 auf den Plan, das erste «Volksauto» zu konstruieren und zu bauen. Bis anhin waren diese Gefährte für die Luxusschicht als sehr kostspielige Spielzeuge oder aber als Wettbewerbsfahrzeuge vorgesehen, um der Welt zu beweisen, dass diese neue Erfindung stabil und beständig etliche Runden unter Volllast absolvieren konnte. Dagegen benötigten die von Henry Ford vorgesehenen hohen Stückzahlen eine neue Produktionstechnologie, so erfand er kurzerhand die Fliessbandfertigung. Mit deren Hilfe wurden diese einfachen Autos erschwinglich gefertigt und gingen als der sagenhafte T-FORD, im Volksmund «Tin Lizzie» genannt, in die Geschichte ein. Sehr viele Hausärzte tauschten ihre Pferdekutschen gegen einen T-FORD, so bekam dieser auch den Übernamen «Doctors Coupé». Etwa vierzig Jahre lang gehörten diese Modelle zu den meistgebauten Exemplaren. Erst als der ebenfalls sagenhafte VW-Käfer in Brasilien weitergebaut wurde, kam dieses Modell mit ca. 28 Millionen Einheiten auf den ersten Platz der Rangliste. Auch in Europa entstanden einfach gebaute, erschwingliche Modelle, etwa von OPEL und Renault, die das Prädikat «Doktorwagen» erlangten.
Also der Hausarzt kam und diagnostizierte bei meiner Mutter eine Magen-/Darm-Störung und verordnete eine ganz strenge Diät, etwa Schleimsuppe und so … Meine Grossmutter, die den Haushalt führte, befolgte die Anweisungen und setzte ihre Tochter auf die verordnete Diät. Doch es wurde mit ihr nicht besser, im Gegenteil, sie wurde immer schwächer und bereits sowas wie Toilettengänge wurden zur Tortur. Nach ein paar Tagen verkündete sie, sie müsse jetzt etwas Währschaftes haben, ein Fleischgericht, denn sie war eine ausgesprochene Fleischliebhaberin. Meine Grussmutter war schockiert und meinte, das könne sie nicht machen.
Aber meine Mutter bestand in aller Entschiedenheit darauf, sie sagte, sonst gehe sie ein und wir könnten sie dann zu Grabe tragen. Daraufhin ging meine Grossmutter in die Küche, schaute, was sie zusammentragen konnte und kochte etwas Kräftiges mit Fleisch. Sie brachte ihrer Tochter vorerst eine kleine Portion. Diese stürzte sich darauf und kurze Zeit später reichte sie den Teller ihrer Mutter mit der Aufforderung, nun eine rechte Portion darauf zu servieren. Ihre Mutter schüttelte den Kopf, aber gehorchte. Nachdem sie einen Teller voll des feinen Gerichts verschlungen hatte, sank meine Mutter in ihre Kissen. Sie strahlte zufrieden und wurde zusehends munterer. In der Folge ging es ihr nicht besser, aber auch nicht schlechter. Jedoch wurde sie wieder kräftiger. Als der Hausarzt das nächste Mal zur Visite kam, beichtete ihm meine Mutter, was geschehen war. Der Arzt machte grosse Augen, verstand die Welt nicht mehr, aber tat das einzig Richtige: Er wies meine Mutter für eine umfassende Untersuchung ins Spital ein. Dort wurde dann die Ursache allen Übels gefunden: Eine nasse Lungenentzündung, wobei ihre Lunge bereits zur Hälfte im Wasser stand. Daraufhin bekam sie die passende Therapie und einige Zeit später kam sie in alter Frische nach Hause und war wieder meine «alte Mutter».
Heute noch versuche ich bewusst auf meinen Körper zu lauschen. Früher hatte ich hie und da Kopfschmerzen. Da fragte ich meinen blöden Kopf, was ihm fehlen würde. Und dieser antwortete mir etwa: Du sollst einen Kaffee trinken. Ein anderes Mal konnte ich an einen Espresso gar nicht denken, da musste ich etwas essen. Später wurde ich aufgeklärt: Kopfweh bekommt man, weil sich die Venen verengen oder aber ausdehnen. Beim Ersten muss man Kaffee trinken, beim Zweiten etwas essen, damit das Blut wieder in den Magen dirigiert wird.
Dann wiederum, wenn bei mir der Bauch dumm tut, frage ich ihn und er sagt mir, was ihm fehlt: Einige Scheiben Knäckebrot oder aber eine Wurst vom Grill. Dann gibt er sich zufrieden …
Kinderpsychologie
Seite 17
Seite 17 wird geladen
17.
Kinderpsychologie
Am Ende der Primarschulzeit gab es ein grosses Fest. Mein Jahrgang beschloss, die Zeit mit einem Maskenball abzuschliessen. JA, super, – ich wünschte, als Cowboy aufzutreten. Irgendwie trieben meine Mutter und Grosseltern die entsprechende Kleidung auf: breite Cowboy-Hosen, ein kariertes Hemd, das rote Dreieck-Halstuch hatte ich von der Pfadfinderbewegung ohnehin. Es fehlte nur noch der Colt.
Grossvater bastelte für mich einen stattlichen Gurt mit Halfter dran. Mutter schnitt aus einem starken Karton einen Colt aus und überzog ihn mit Silberpapier. So hatte ich meinen Silber-Colt, mit dem ich die Veranstaltung unsicher machte. Ich war mächtig stolz auf den jungen Cowboy, der sämtliche Schurken beseitigte und alle Bedürftigen beschützte.

András der Cowboy
Diese Veranstaltung kam mir in den Sinn, als bei meiner Schwester der Haussegen schief hing. Grund war, dass der Sohn Marco als Kind eine Spielzeugpistole wollte. Die Eltern lehnten ein solches Spielzeug kategorisch ab, was der Junge natürlich nicht begriff. Der Kind-Eltern Krieg brach aus, wobei die Eltern unbeugsam blieben. Doch unsere Mutter half beim Kinderhüten entscheidend mit und sie nahm sich dabei auch ihre Freiheiten. So kaufte sie Marco eine Spielzeugpistole, womit der Junge dann abwechselnd Sheriff, Indianer, Mafioso oder Gendarm spielte, zwei oder drei Wochen lang. Dann wanderte die Spielzeugpistole allmählich in die Kiste der nicht mehr gebrauchten Spielzeuge und war kein Thema mehr.
Kinder haben ihren Charakter, den man nicht versuchen sollte zu brechen. Rahel, die Tochter meiner jüngeren Schwester, wuchs in einer «naturbelassenen» Umgebung auf, bereits vor drei Jahrzehnten ökologisch denkend, ungeschminkt, natürlich in die Welt schauend. Aber was hat sich das Kind, als es vier Jahre alt war, zu Weihnachten gewünscht? Einen Schminkkoffer. Den bekam sie auch und ist bis heute eine ausgesprochene Ästhetikerin, die sich gerne mit schönen Dingen umgibt. Das hat sie einzig in ihren Genen mitgebracht.
Bei meinen Schwestern liessen mich die Eltern gerne gewähren. Mihály, der ausgesprochene Zahlenmensch, konnte nicht begreifen, wieso meine Schwester Kati irgendeine Formel nicht auf Anhieb begriff. Als ich das merkte, sagte ich: «Lass mich mal!»
Ich hatte eine einfache Rolle: Für meine Schwestern war ich halbwegs Kumpel, dann aber auch Erziehungsperson. Ich konnte ihnen in ihrer Sprache etwas erklären, das sie oft auch begriffen.
Ich hatte bei allem die Geduld, die Kinder benötigen.
Oft ging ich einkaufen, der Coop lag nicht weit von uns in Bottmingen, allerdings musste man die Strasse zweimal überqueren, einmal an einer Fussgängerampel und noch einmal in einer Seitenstrasse auf dem Fussgängerstreifen. Kati wollte oft mitkommen und ich nahm sie auch mit, wenn ich genügend Zeit hatte, ihr auch beizubringen, wie man Strassen überquert. Wenn sie sich streckte, erreichte sie auch den Knopf, um die Ampel für die Fussgänger zu schalten.
Eines Tages stellte sie den Wunsch an unsere Mutter, alleine Brot zu holen. Mutter schaute mich daraufhin fragend an. Ich meinte, wir sollten gemeinsam noch einen letzten Probelauf machen, den die Kleine auch bestand. So gab ich meine Empfehlung, sie alleine Brot holen zu lassen. Sie ging und bis sie zurück war, schwitzte ich Blut.
Kinder merken alles, wenn auch rein intuitiv. So kam von den Schulbehörden, als Kati sechs Jahre alt wurde, die Anfrage an die Eltern, ob sie das Kind mit sieben Jahren einschulen wollen, wie hier üblich oder schon mit sechs Jahren, wie es ein Testlauf vorsehen würde. Die Eltern diskutierten auch darüber, denn für sie wäre es mit sechs Jahren so, wie sie dies von Ungarn her gewohnt waren. Das Kind früher für das Leben vorbereiten oder ein Jahr länger Kind sein lassen? Mitten in dieser Diskussion kam Kati dazwischen und meinte: «Wieso fragt ihr euch, András kommt bald heim und er sagts euch dann.»
Wir haben auch einiges an Blödsinn veranstaltet, in einem gewissen Rahmen gehört das zur Kindererziehung. Einmal legte ich mich in der Mittagspause auf das Sofa. Eine der beiden kam als Kopfkissen. Darauf hiess es immer wieder: «Kispárna ne mocorogjon», was immer fröhliches Kindergelächter auslöste. Das hiess etwa: «Kleines Kissen nicht unruhig werden.» Von da an musste ich mich eine Zeit lang täglich hinlegen und Kati oder Georgina abwechselnd als kleines Kissen unter den Kopf nehmen.
Aber nun zurück zu den Geschehnissen in Chronologie.
Mutter kommt nicht heim
Seite 18
Seite 18 wird geladen
18.
Mutter kommt nicht heim
Dann kam Mutter eines Tages nicht nach Hause. Das war zuerst einmal nicht aussergewöhnlich, sie nahm gerne dringende Zusatzarbeiten an, um unsere Finanzen aufzubessern. Aus dem Radio erfuhren wir dann, dass sie vorläufig gar nicht mehr nach Hause kommen würde.
Sie arbeitete in der Zentralfiliale der Philatelie in Budapest. Ich war einige Male dort, als sie mich mitnahm, weil sonst niemand auf mich aufpasste. Ich kannte einige ihrer Kolleginnen und Kollegen, auch Mihály, den Chefbuchhalter, mit dem sie öfters zu tun hatte. Er war ein sympathischer Typ, mit einem markanten Gesicht und stets freundlich.
Manchmal nahm Mutter auch Arbeiten mit nach Hause, dann durfte ich helfen, Briefmarken nach verschiedenen Kriterien zu sortieren, Jahrgang, Land, oder was eben gefragt war.
An jenem frühlingshaften Mittwochmorgen, ich glaube 1959 fuhren an der Filiale zwei Busse der Staatsanwaltschaft mit vergitterten Fenstern vor. Es sprangen mehrere Polizisten aus den Bussen und umstellten das Gebäude. Einige Beamte gingen hinein und befahlen alles niederzulegen, nur die allerpersönlichsten Sachen zusammenzupacken, Maximum eine Handtasche voll und in die Busse einzusteigen. Die ganze Belegschaft, rund 70 Angestellte, wurde abgeführt und in Untersuchungshaft gesteckt. Niemand von ihnen wusste, warum.
Auch wir zu Hause erfuhren nichts, nur die Tatsache, dass diese Inhaftierung erfolgt war. Ich schaute meine Grossmutter an und fragte mich: «Was machen denn Kinder, die nicht in der Obhut ihrer Grosseltern sind?»
Vorerst war auch kein Besuch bei den Inhaftierten erlaubt. Einige Zeit später wurde der Grund dieser Untersuchungshaft bekannt. Die Staatsanwaltschaft vermutete illegale Geschäfte mit geschützten Briefmarken, Korruption und unerlaubte Geschenke an die Direktionsmitglieder. Daraufhin wurden sämtliche Mitarbeiter eingesperrt, damit diese in Ruhe und voneinander unabhängig vernommen werden konnten. Das war Grund genug, den Kindern ihre Eltern zu entziehen.
Meine Mutter und ihre Kolleginnen und Kollegen waren nicht die Einzigen, die dieses Schicksal teilen mussten. Immerhin wurden die Inhaftierten kategorisiert zusammengetan und meine Mutter musste ihre Zelle auch nicht mit einer Mörderin oder sonstigen Verbrecherin teilen, sondern hatte eine Zellengenossin Incike, eine Direktorin der Budapester Tiefkühlfabrik. Durch sie erfuhren wir damals schon, dass keine Marktfrau Gemüse mit so hohem Vitamingehalt anbieten könne, wie es tiefgekühltes oder konserviertes Gemüse aufweise. Wie kommt denn das?
Der Vitamingehalt sinkt nach der Ernte rapide schnell ab. Die Tiefkühl- oder Konservenfabriken haben Verträge mit den Bauern beziehungsweise den Landwirtschaftsbetrieben. Diese melden, wenn eine Sorte erntereif ist, daraufhin wird die Produktion auf dieses Produkt eingestellt. Die Ernte erfolgt mit sofortiger Ablieferung und anschliessender Verarbeitung. Das Gemüse landet also innert weniger Stunden im Tiefkühlbeutel oder der Konservendose. Diesen Zeitraum kann die beste Marktfrau nicht erreichen, geschweige denn unterbieten. Die einzige noch bessere Variante wäre, die Rübe gleich vor dem Verzehr aus der Erde zu ziehen, im heimischen Garten oder auf dem Balkon ...
Kurzum, die zwei Frauen sind Freundinnen geworden. Man hatte ihnen dazu auch sechs Monate Zeit gegeben, auf engstem Raum.
Sechs Monate ohne Mutter
Seite 19
Seite 19 wird geladen
19.
Sechs Monate ohne Mutter
Meine Mutter war, je nach Situation, sehr lieb zu mir oder aber überaus streng. Beides musste ich sechs lange Monate vermissen. Meine Grosseltern taten alles, mir das Leben trotzdem möglichst angenehm zu gestalten. Doch manchmal in der Nacht musste ich bitterlich weinen. Diese Trennung war nicht zu vergleichen mit jenen, in welchen ich woanders leben musste, auf dem Weiler oder bei der herzlosen Tante. Das war geplant, das musste sein. Doch jetzt war sie mir jäh entrissen worden auf ungewisse Zeit. Und wir wussten nicht, warum und wie lange noch?
Uns gegenüber wohnte ein Mann ganz alleine. Er stellte meiner Mutter nach, doch sie wollte nichts von einer Beziehung wissen, zumindest nicht mit ihm. Nun ergriff der Arme die Gelegenheit und kümmerte sich um mich und nahm mich an Veranstaltungen mit wie Puppentheater oder auch in den Vergnügungspark mit allerlei Attraktionen. Er kam mit auf die Achterbahn und nahm meine Hand, als ich Angst in der Geisterbahn hatte.
Angesichts solcher Zuneigung eines fremden Mannes wurde mein Grossvater ganz wütend, ging an der Arbeitsstätte meines Vaters vorbei und las ihm vor seinen Kollegen die Leviten: «Dass du dich überhaupt nicht um deinen Sohn kümmerst, bügeln wir aus. Normalerweise hat er immerhin seine Mutter. Aber nun ist die Mutter weg, das weisst du ganz genau, und jetzt wäre es deine verdammte Pflicht, dich um den Jungen zu kümmern, zumindest bis seine Mutter wieder da ist!»
Daraufhin kam mein Vater einmal – ein einziges Mal – vorbei und nahm mich mit in den Zirkus. Das wars dann.
Irgendwie ging selbst diese Zeit vorüber und Mutter, wie auch alle anderen wurden nach sechs Monaten aus der Untersuchungshaft entlassen. Die Filiale wurde mit neuer Direktion wiedereröffnet, jedoch mit den meisten alten Angestellten. Beamte in höheren Positionen wurden entweder verurteilt und dauerhaft eingebuchtet oder aber fürstlich rehabilitiert.
Mihály wurde Finanzchef eines grösseren Unternehmens mit etwa 4‘000 Mitarbeitern. Sie haben Musikwiedergabegeräte hergestellt, wie Tonbandmaschinen, Plattenspieler und dergleichen.
Incike, die Zellengenossin meiner Mutter, wurde in das Ministerium befördert als Beraterin und Botschafterin der ungarischen Agrarwirtschaft, reiste also von da an in der ganzen Welt umher und vertrat an diversen Kongressen die diesbezüglichen Landesinteressen.
Und ich konnte wieder ruhig schlafen, Mutter war daheim.

Panem et circenses
Seite 20
Seite 20 wird geladen
20.
Panem et circenses
Ich habe das rein terroristisch stalinistische System nicht erlebt, vielmehr als zu kleiner Junge nicht wahrgenommen. Was ich hinterher mitbekam, war, dass Nikita Sergejewitsch Chruschtschow im Februar 1956 am Parteitag der KPdSU in einer fünfstündigen Rede mit dem Stalinismus und dessen Schreckensregime abgerechnet hatte. Eine Folge davon war auch der grösste Aufstand im Ostblock in Budapest im Oktober 1956 gegen das immer noch stalinistische Regime. Dieser wurde zwar von sowjetischen Panzereinheiten blutig niedergeschlagen, aber ein grosser Gewinn wurde erzielt: Der Stalinismus wurde auch in Ungarn verbannt. Es kam unter János Kádár eine nach Möglichkeit recht liberale Regierung an die Macht. Die Planwirtschaft war immer noch vorherrschend mit Vollbeschäftigung unter dem Motto «wenig Arbeit für alle bei geringem Lohn». Dieser reichte für das Leben, doch die Ungarn wollten mehr. Sie wollten mehr als nur leben, sie wollten fröhlich sein, sie wollten den Alltag geniessen. Die Regierung steuerte das Ihre bei: Bücher, Theater, Opernhausbesuche waren leicht erschwinglich. Doch die Leute wollten noch etwas mehr: Die Restaurants waren stets voll, die Zigeunerbands spielten überall laut ihre Musik und die Fiaker kutschierten die Verliebten in den Gassen von Obuda von Biergarten zu Biergarten. Die Lieder hiessen «Az asztal tarka barka, rajta jó kadarka …» dann «Éjjel az omnibusz tetején, emlékszel kicsikém, de csuda volt – A lovacskák bandukoltak Budán át, és égö ajkad eloltotta a lámpát …». Also: Die Ungarn lebten. Doch das hatte seinen Preis.
Die Morgenschichten fingen früh an, in der Industrie um 6:00 und in den Verwaltungen um 7:00 Uhr. Entsprechend früh war man auch frei am Nachmittag, und dann fing für die meisten eine zweite, privat organisierte Schicht an. Beliebt war, einander im Freundeskreis zu helfen, ein Ferienhaus zu bauen oder die Wohnung aufzufrischen. Kleine, privat geführte Firmen kamen auf und auch in diesen wurde nachmittags fieberhaft gearbeitet. Ein Beispiel: Die Wohnungen wurden alle verstaatlicht und entsprechend unter einer staatlichen Verwaltung geführt. Tropfte der Wasserhahn, konnte man dies der Verwaltung melden, und wenn man Glück hatte, kam ein halbes Jahr später ein Spengler vorbei, um den Schaden zu beheben. Alternativ konnte man den Spengler um die Ecke rufen, er kostete Geld, aber der Schaden war innert nützlicher Frist behoben.
Wenn man ausgelassen leben wollte, und das strebten die meisten an, musste man irgendeiner lukrativen Zweitbeschäftigung nachgehen. Was ich dabei mitbekam war, dass bei Familien, die es sich leisten konnten, irgendein Familienmitglied anstelle von Tagesheimen das Kind oder die Kinder erzog. Wenn ich also bei meinen Schulkameraden vorbeiging, sah ich die Mutter oder Grossmutter fast immer bei einer Heimarbeit.
Beliebt waren Tätigkeiten wie etwa Laufmaschen in Nylonstrümpfen wieder hochzuziehen, also diese zu reparieren. Dazu brauchte man kleine Maschinchen, die aussahen wie Miniatur-Nähmaschinen. Die Arbeit war lukrativ, denn die Nylonstrümpfe waren teuer. Diese gehörten auch zu meinen «Handelswaren», die mir meine Tante oder meine Grosseltern aus der Schweiz zukommen liessen.
Eine andere Mutter füllte fertiggebrauchte Kugelschreiber wieder auf. Dazu drückte sie an der Spitze die Kugel hinaus, füllte die Röhre mit der Spezialtinte auf und drückte die Kugel wieder hinein. Ergebnis: Bei jedem Ansetzen kleckste der Kugelschreiber, aber man konnte wieder damit schreiben.
Meine Cousine in meinem Geburtsort Sárvár füllte Einwegfeuerzeuge mit Gas wieder auf. Diese waren leer, lange bevor der Feuerstein verbraucht war. Es lohnte sich also, zuerst am Boden ein Ventil einzubauen und danach das Feuerzeug vier bis fünfmal wieder mit Gas aufzufüllen.
Meine Grossmutter suchte eher künstlerische Beschäftigungen. Sie bemalte Fertigkrawatten. Das waren Dinge, die fertig gebunden mit einem Gummiband um den Hals getragen wurden. Dazu bekam sie vom Hersteller mittelgraue Plastikröhren. Diese bemalte sie von Hand kunstvoll mit Streifen in allen Farben, – das Design war ihrer Fantasie überlassen. Anschliessend gingen diese Dinger zum Hersteller zurück, der die Krawatten mit den Gummibändern fertigstellte.
Was ihr aber erkennbar einiges mehr an Spass bereitete, war, Puppenköpfe zu bemalen. Irgendeine Firma stellte handgefertigte Puppen her und schickte meiner Grossmutter die Rohlinge der Puppenköpfe in Form von rosarotem Plastikguss zu. Sie hauchte diesen Rohlingen mit sichtlicher Freude Leben ein, indem sie die Augen, die Wimpern und die Augenbrauen ausmalte. An der Iris konnte sie sich verweilen, es war für sie ganz besonders wichtig, dass die Augen lebten. Diese waren dunkel und sie malte ganz feine, helle Striche hinein.
Dann kam der Mund, und grosse Beachtung schenkte sie den Pausbacken: nicht zu rot, aber doch etwas lebendig, vor Gesundheit strahlend.
Allerdings erlebte ich nicht nur solches Treiben in schönen, hellen, ordentlichen Wohnungen. In der Schule wurde ich auch dazu verbrummt, schwächeren Schülern Nachhilfestunden zu erteilen. Diese stammten des Öfteren aus ganz ärmlichen Verhältnissen, wohnten oft in ehemaligen Geschäftsräumen im Sous-sol, alles in einem Raum. Beim Eintreten roch ich den Menüplan der vergangenen Woche, denn Lüften verursachte höhere Heizkosten. Da holte ich meine ersten anatomischen Kenntnisse, denn die grössere Schwester wusch sich und machte sich im Hintergrund für den Ausgang bereit, während wir an unseren Aufgaben büffelten, da wie gesagt, die ganze Wohnung aus einem einzigen Raum bestand.
Auch baute ich meine «Handelsbeziehungen» immer weiter aus, vorwiegend mit Sachen, die ich aus der Schweiz bekam. Dazu gehörte beispielsweise die «pille», wie schon erwähnt, eine hauchdünn gefertigte Regenpelerine aus Kunststoff.
Das sozialistische Regime hatte nicht nur viel auf Kultur gesetzt, nein, es hatte auch die Moral überwacht. Anzügliche Zeitschriften gab es keine und schon gar keine im Stile vom BRAVO. Damit entdeckte ich eine echte Marktlücke. Irgendwoher bekam ich eine Rolle schwarzweisser Negative mit nackten Frauen darauf. Ich ging damit ins Labor in Mihálys Firma und fertigte Abzüge an. Diese gingen weg wie frische Weggli.
So konnte ich mit meinen Freunden auf den besten Hotelterrassen der Stadt Wodka-Cola schlürfen und das ungarische Dolce Vita geniessen.
Dann der «Ifipark», also Jugendpark: Im Budapester Burgquartier gab es ein recht grosses Festivalgelände. Da traten Rockbands auf, die im Stile der Beatles, Stones und Konsorten aufspielten. Es gab darunter auch ganz bekannte – ich treffe heute noch in der Schweiz Leute an, die sagen: «Eine Platte von OMEGA habe ich auch daheim.» Das Gelände hat man neulich aufgefrischt, es heisst heute «Bazar» und ist ein touristischer Anziehungspunkt. Aber damals traf sich dort die Jugend von Budapest und genoss ihre Freiheit.
JA, auch ich genoss meine Jugend in vollen Zügen, ohne die «Nebengeräusche» zu spüren oder wahrzunehmen, mit welchen die erwachsene Gesellschaft fertig werden musste.
Der Hochspannungsstudent
Seite 21
Seite 21 wird geladen
21.
Der Hochspannungsstudent
Meine Grossmutter väterlicherseits wohnte etwas ausserhalb von Budapest. Es führte eine Vorortsbahn dorthin und ich war einige Male bei ihr zu Gast. Sie hatte ein recht ansehnliches Haus mit einer einladenden Veranda und einem grossen Garten, wo man sich austoben konnte. Dort anzutreffen war öfters auch ein bereits älterer Cousin von mir, Imi wurde er genannt, denn sein Name war Imre, wie der seines Vaters, einer der beiden Brüder, die nach der Scheidung meiner Eltern eher auf der Seite meines Vaters standen. Das hielt Imi damals nicht davon ab, gute Freundschaft mit mir zu halten, denn uns verband das gemeinsame Interesse an der Technik.
Irgendwie verfügte Imi über eine verlassene Ladenlokalität in der Nähe von Grossmutters Haus, in einem schönen Eckgebäude, wo er seine Modelleisenbahn aufstellen konnte. Diese brauchte viel Platz, denn es war eine Spur 0-Anlage, wie damals üblich, mit den Wagen und Lokomotiven aus Blech. Die Stirnseiten der Loks verfügten über eingelassene Fassungen, wo man kleine Glühbirnen, die man damals in den Taschenlampen verwendete, einschrauben konnte. Diese standen dann vor und beleuchteten mehr die Stirnseite der Lokomotive als das Trassee.
Wir waren oft in diesem Raum anzutreffen, spielten den Eisenbahner. Mein Liebling war eine grüne elektrische Lokomotive mit Stangenantrieb, wie man es von den Dampflokomotiven kennt. Sie war eine der ersten Elektroloks mit einer solchen Konstruktion und dies bereits in den Zwanzigerjahren. Sie hiess Kandó, benannt nach seinem Konstrukteur Kálmán Kandó. Ein bereits ausgemustertes Schauexemplar stand in einem der Bahnhöfe auf der Strecke zur Grossmutter. Imi erzählte mir viel über diese bahnbrechende Konstruktion. Ob ich all seine Erläuterungen verstand, ist zu bezweifeln. Doch bekam ich diese in meiner Eisenbahnerzeitschrift kürzlich bestätigt.
Dies können Technik-Interessierte im Anhang 2 nachlesen.

Die damals moderne Elektrolokomotive des Kálmán Kando
Imi hatte recht: Kandós Konstruktion war tatsächlich bahnbrechend und die heutige Antriebssteuerung basiert auf seinen Entdeckungen, wenn auch heute elektronisch unterstützt.
Doch uns verband auch noch etwas Weiteres.
Imi nahm mich immer wieder mit, um an seinen Experimenten als Student für Hochspannungselektrik teilzunehmen. Das Labor war unweit von dem Haus entfernt, wo wir wohnten. So konnte er auf dem Weg dorthin bei uns kurz läuten und mich mitnehmen, sofern ich Zeit hatte, das heisst, wenn die Hausaufgaben bereits gemacht waren. Das war dann für mich immer sehr aufregend.
Imi und noch einige Studenten hatten einen Schlüssel zu diesem Labor. Wir betraten den grossen Raum, der dreigeteilt war. Im ersten Teil standen die riesigen Transformatoren, die Imi zuerst aktivieren musste. Diese fingen dann langsam an zu summen, das Geräusch wurde immer lauter und Imi erklärte mir die Funktion der Zeiger in den grossen runden Instrumenten, die immer weiter nach oben kletterten. Im zweiten, verglasten Raum konnten wir Platz nehmen und die Unterlagen ausbreiten, die Imi dabei hatte. Im dritten Raum standen direkt vor uns spezielle Geräte, die für die Experimente vorgesehen waren, unter anderem auch kleinere oder grössere glänzende Metallkugeln auf beweglichen Stangen.
«Wir beginnen mit dem ersten Experiment, du kannst vorerst nicht mitkommen», sagte Imi, und legte einen übergrossen roten Schalter um. Daraufhin konnte er die Türe zum Experimentierraum öffnen und eintreten. Er nahm eine kleine Stange aus dem Sack, die er schon im Voraus vorbereitet hatte, und mit Hilfe dieser Masseinheit stellte er zwei Kugeln auf die zu seinem Experiment benötigte Distanz ein. Dann kam er zurück, legte den roten Schalter wieder um und verkündete:
«Wir starten jetzt!»
Er stellte Regler an seinem Schaltpult ein und wir legten die bereitgestellten Brillen an.
«Jetzt müssen wir uns auf die Kugeln, die ich eingestellt habe, konzentrieren», sagte er und betätigte einen ebenfalls roten Knopf. Ein Blitz sprang von der einen Kugel zur anderen, es donnerte und wir legten die Brillen ab.
«Das war jetzt ein Lichtbogen», sagte Imi und fügte hinzu: «Den müssen wir nun genau beschreiben.» Dann stellte er mir seine Fragen, wie ich Form, Farbe und weitere Eigenschaften des Lichtbogens wahrgenommen hatte. Wir redeten darüber und ich fühlte mich wie ein Assistent eines Wissenschaftlers und war entsprechend stolz.
Dieses Spiel wiederholte sich mit unterschiedlichen Einstellungen sowohl am Schaltpult als auch an der Distanz der Kugeln. Am Schluss packte Imi seine Notizen zusammen und wir gingen nach Hause.
Meine Einheitswährung
Seite 22
Seite 22 wird geladen
22.
Meine Einheitswährung
Das ungarische Geld, genannt Forint, war nach Einführung des sowjetisch diktierten sozialistischen Regimes nicht sonderlich schön gestaltet – wahrscheinlich im Hinblick darauf, dass es eh vom Rubel abgelöst würde. Wie die Noten genau aussahen, weiss ich nicht mehr. In meinem Alter war man mit den Münzen zufrieden. Diese waren mit einer Ausnahme allesamt aus Aluminium geprägt, hatten kaum Gewicht und wurden sofort matt. Wir spielten viel mit ihnen, zum Beispiel vor der Hauswand. Jeder Spieler musste eine Münze werfen, sodass diese möglichst nahe an der Wand landete. Derjenige Spieler, dessen Münze am nächsten zur Wand lag, konnte alle Münzen einsacken. Dieses Spiel konnten wir an jedem Trottoir spielen. Hatten wir mehr Platz und eine grössere geteerte Fläche, so konnten wir den Schwierigkeitsgrad erhöhen, indem wir in beliebiger Entfernung einen Kreidestrich zogen, den wir dann mit den Münzen anpeilen mussten.
Die ganz grosse Ausnahme in der Gestaltung der Münzen bildete die 2-Forint Münze «Kétforintos». Diese war aus einer bronzeähnlichen Legierung geprägt, hatte ein schönes Gewicht, blieb lange glänzend, stellte also etwas dar und war sehr wertvoll, denn dafür bekam man den Eintritt ins Schwimmbad oder auf die Schlittschuhbahn. An den Verpflegungsständen erstand man dafür eine «Lángos», einen Fladen aus Hefeteig mit Kartoffeln vermischt, frittiert, worauf man allerlei schmieren konnte, zum Beispiel Knoblauchöl, Sauerrahm mit geriebenem Käse und dergleichen. Oder man bekam einen Kolben gekochten Zuckermais mit Salz oder Zucker nach Belieben. Dann gab es für diese Münze auch weitere Spezialitäten.
Budapest wurde im 19. Jahrhundert als Grossstadt modernisiert, das heisst ein neuer Strassenplan wurde entworfen und angelegt. Dies bedeutete Enteignungen und Abriss alter Häuser, was aber, so hiess es, von den Eigentümern gerne in Kauf genommen wurde, da man stolz auf seine Stadt sein wollte und dazu auch noch fürstlich entschädigt wurde. Der Entwurf des englischen Städtebauingenieurs Adam Clarc sah zwei Ringe vor, den kleinen und den grossen, jeweils zwischen zwei Brücken. Deren gab es damals bereits acht über die Donau in Budapest. Ausgehend vom Zentrum führten breite Ausfallstrassen nach West, Ost und Süd. Die Kreuzungen der Ringe mit diesen Radialstrassen waren entsprechend riesig und diejenigen in der Innenstadt wiesen später für die Fussgänger grosse Unterführungen auf. Diese wurden zu Vorboten der fliegenden Verpflegung, aber auch andere Läden fanden hier einen Platz wie Buch- oder Modegeschäfte und dergleichen.
Diese Unterführungen waren beliebte Treffpunkte für Jung und Alt, da konnte man ungeachtet des Wetters aufeinander warten. Für mich war aber etwas anderes, ganz Spezielles der Anziehungspunkt: Hier wurden auch die ersten Softeismaschinen aufgestellt. Eine schöne, grosse Portion Softeis kostete einen «Kétforintos» und schmeckte himmlisch, ob Sommer oder Winter.
Doch im Winter gesellten sich andere Buden dazu wie «Kürtöskalács»-Stände. Wie entstand dieses köstliche Süssgebäck? Die früher üblichen Stubenöfen wiesen nach Möglichkeit längere waagerechte Kaminstücke auf, die ihrerseits die Restwärme an den Raum abgaben. So konnte die Hausfrau ihren Hefeteig streifenweise um das heisse Ofenrohr wickeln, Zucker und Zimt darüber streuen und zuschauen, wie ihre Kreation mit dem karamellisierten Zucker darauf goldbraun wurde. Dann konnte sie die übrigen Familienmitglieder rufen und diese mit einem abgebrochenen Stück beglücken. In den Buden damals drehten sich längliche Metall- oder Holzzylinder aus Ahorn mit dem darum gewickelten Teig vor einer Infrarotheizung. Natürlich war das nicht mehr so romantisch wie ursprünglich, aber für einen «Kétforintos» bekam man ein schönes Stück süsses, herrlich duftendes Heissgebäck.
Woher kamen für mich diese Glückseligkeit bringenden Münzen? Einerseits gab es Taschengeld. Dann konnte man sich zu Hause oder in der Nachbarschaft nützlich machen, natürlich gegen Entgelt … Aber es gab auch eine besondere Quelle.
Meine Mutter pflegte an den Sonntagen nicht nur etwas Feines zu kochen, sondern auch irgendeine einsame Tante oder einen einsamen Onkel dazu einzuladen. Der Besuch drückte mir gewöhnlich nach dem Mittagessen den «Kétforintos» in die Hand und so konnte ich umgehend in die Badi oder auf die Schlittschuhbahn verschwinden und mich so vor dem nachmittäglichen Tratsch retten.
Es gab also lauter Herrlichkeiten für diese schöne, glänzende Münze!
Aber auch mit einer eher unangenehmen, jedoch lehrreichen Erinnerung verbindet mich der «Kétforintos»:
Sollte an einem Sonntagmittag eine besonders liebe Tante empfangen werden, dann war es Brauch, dass meine Mutter mir so eine Münze in die Hand drückte mit dem Auftrag, die Tante an der Bushaltestelle abzuholen und unterwegs für sie einen Blumenstrauss zu besorgen. So auch an diesem Sonntag, als ich Incike abholen sollte. Unterwegs zum Blumenladen fiel mir am Kiosk auf, dass die neue Autozeitschrift erschienen war. Sehnsüchtig sah ich die Titelseite an und schlenderte zum Blumenladen weiter. Dort wiederum fiel mir auf, dass ein Bouquet aus Strohblumen nur die Hälfte kostete von einem solchen aus Schnittblumen. Und die Strohblumen glänzten blau und bordeauxrot in der Sonne, wie schön. Und mit der Differenz konnte ich auch die Autozeitschrift kaufen. Als Incike ankam und ich ihr meinen Strauss reichte, stutzte sie etwas, dann lächelte sie und bedankte sich.
Zu Hause angekommen sah meine Mutter die Strohblumen, dann die Zeitschrift in meiner Hand. Sie runzelte kurz die Stirn, geleitete dann ihren Besuch zum Mittagstisch und kam zu mir zurück. Mit ganz ernsthafter Miene sagte sie zu mir: «So etwas machst du nicht wieder. Hast du es wirklich verstanden?» Ihre so gestellte Frage schmerzte mehr als ein Peitschenhieb. Ich versuchte nicht zu heulen und entgegnete mit leiser Stimme: «Ja.»
Als Incike ging, zwinkerte sie mir zu und fragte ganz laut: «Wo ist mein schöner Strauss? Ich liebe dieses Blau und das kräftige Rot.» Solchermassen ermuntert habe ich dann meine Mutter zur Rede gestellt.
«Du hast mir beigebracht, dass man teilen muss. Wieso darf nicht auch Incike mit mir teilen?» Ein kurzes Lächeln huschte meiner Mutter über das Gesicht, dann wurde sie wieder ernst. Nicht sehr, doch genügend – ich kannte bereits die Abstufungen ihrer Ernsthaftigkeit.
«So einfach ist es nicht, mein kleiner Philosoph. Klar, sollte man, wenn es angebracht ist, mit anderen teilen. Aber hier geht es um etwas ganz anderes. Du hast von mir einen Auftrag erhalten, den hast du zwar auch erledigt, aber überhaupt nicht wunschgemäss. Weisst du, Strohblumen reicht man eher, wenn man sich trennen will. Also bitte, von jetzt an führst du das aus, was man dir aufträgt.»
Dann wurde ihr Gesicht ganz entspannt und liebevoll lächelnd sagte sie: «Ich weiss, mein lieber Sohn, du wirst es so tun», und drückte mir einen dicken Kuss auf die Wange.
Die drei Grazien
Seite 23
Seite 23 wird geladen
23.
Die drei Grazien
In der damaligen Zeit waren Freundschaften von grosser Bedeutung. Es ging in erster Linie nicht darum, sich miteinander zu vergnügen. Nein, der hauptsächliche Grund war, einander Halt zu geben, vertraute Geheimnisse auszutauschen. Natürlich gab es dann auch die vergnügliche Seite, das Abschalten vom täglichen Trott.
So hatte auch meine Mutter zwei sehr innige Freundinnen. Die eine war «Szöszi», also das «Blondchen». Dieser Begriff hatte damals nichts zu tun mit den abschätzigen Blondinen Witzchen, eher war er der Inbegriff für die herzige blonde Frau. So war Szöszi auch, stets gut gelaunt, immer etwas über der Sache stehend und eher besonnen. Sie war, genauso wie meine Mutter, alleinerziehende Mutter eines Lausebengels. Sándor war etwa gleich alt wie ich und wir hatten auch einiges miteinander angestellt.
Die dritte im Bunde war Mártika, eine hübsche Brünette. Eine bezaubernde Frau, jedenfalls verkörperte sie für uns die spätere Traumfrau. An ihr stimmte für uns alles: das Aussehen, das Gemüt, ihr Humor, ihre Freundlichkeit. Sie hatte nur einen entscheidenden Fehler: ihren Verlobten. Dieser war ein schwammiger Glatzkopf, ein hochintelligenter Richter am obersten Gericht und beherrschte acht Fremdsprachen in Wort und Schrift. Darunter war auch Russisch, sehr zu unserem Leidwesen. Damals war diese verhasste Sprache in Ungarn in allen Schulen ab dem fünften Schuljahr Pflichtfremdsprache Nummer Eins. Wie es sich gehörte, waren Sándor und ich sehr schlecht in diesem Fach, so kamen meine Mutter und Szöszi auf die Idee, uns beim Glatzkopf in Nachhilfeunterricht zu stecken, was ihn für uns auch nicht sympathischer machte. Nicht nur, dass er in unseren Augen gar nicht zu unserer Traumfrau passte, nein, er brachte es unter anderem auch fertig, uns an den Haaren zu ziehen, wenn wir seine Russischaufgaben nicht oder nicht richtig gelöst hatten.
Dann geschah die Fügung des Himmels!
Mártika fuhr mit der Vorortsbahn in einen Aussenbezirk von Budapest. Die Züge waren damals noch weit davon entfernt, mit Klimaanlagen ausgestattet zu sein und nicht alle Passagiere ertrugen den Durchzug offener Fenster während der Fahrt. An diesem heissen Nachmittag war es entsprechend stickig im Wagen. Mártika sass am Rande zum Mittelgang und spürte langsam, wie es ihr schlecht und allmählich schwarz vor den Augen wurde. Neben ihr stand ein Mann, gross gewachsen, athletisch und bemerkte Mártikas Schwäche. Er riss das Fenster auf, stützte die Frau und stieg mit ihr an der nächsten Haltestelle aus. Wie der Himmel es wollte, befand sich dort ein gemütlicher Biergarten mit angenehm wehendem Lüftchen unter den Ästen einer uralten Platane. Sie unterhielten sich gut, er stellte sich vor als «Aladár», Freunde würden ihm «Ali» sagen. Sie tauschten ihre Telefonnummern aus und gingen schliesslich ihre Wege.
Einige Tage später rief Ali an, erkundigte sich nach Mártikas Wohlbefinden und lud sie diesmal in der Stadt zum Kaffee ein. Sie folgte der Einladung, worauf weitere folgten, so lernten auch wir Ali kennen. Er war überaus sympathisch mit einer stets freundlichen Ausstrahlung und obendrein war er Ingenieur. Also DER Traummann für unsere Mártika!
Das Märchen hatte einen Haken: Mártika war unentschlossen, besser gesagt im Clinch. Von Ali war sie natürlich angetan, doch dem Anderen hat sie sich bereits versprochen. Wir hatten zwar Verständnis, dennoch hofften wir innigst, dass sie das Richtige tun würde… Dafür gingen wir in die Kirche und warfen beträchtliche Summen in den Opferstock, ich glaube mindestens den Betrag, wofür man ein Softeis bekam.
Der Himmel half uns und hatte Mártika das Richtige vorgegeben: Sie entschied sich für Ali! Wir waren erleichtert: «Unsere Traumfrau bekommt unseren Traummann!»

Ali, Martika und Tochter Ildiko
Die Ehe führte in eine harmonische Zeit mit einer Tochter, Ildiko. Als ich später mit Trudy nach Budapest fuhr, waren wir stets Gäste bei Mártika und Ali, sie verstanden sich mit Trudy genauso glänzend wie mit mir.
Dann starb Mártika zu früh, allerdings war Ildiko bereits verheiratet und hatte zwei Kinder.
Bei Ali gingen wir weiterhin gerne vorbei und luden ihn zum Nachtessen ein. Mit der Zeit wurde auch Ali alt, mochte nicht mehr zum Nachtessen kommen, so gingen wir mit ihm Mittagessen. Bis dann eines Tages von Ildiko die Todesanzeige von Ali kam. Diese traf uns im Herzen, ich konnte gar nicht schlafen und schilderte in einem Brief Ildiko unsere Kindheitserlebnisse. Postwendend schrieb sie zurück und bedankte sich: Sie hätte diese Geschichte nicht gekannt, doch diese hätte ihr Freudentränen in die Augen getrieben.
Auch mit Szöszi hatten wir uns bei unseren Ungarnbesuchen immer wieder getroffen. Einmal begleitete Trudy ihre Eltern zum Wellness Urlaub nach Budapest. Ihre Eltern residierten in einem Hotel auf der Margarethen-Insel und sie wohnte bei Szöszi. Die zwei Frauen erlebten lustige zwei Wochen miteinander. Tagsüber begleitete Trudy ihre Eltern und zeigte ihnen die Sehenswürdigkeiten Budapests, dann aber war sie mit Szöszi einkaufen und anschliessend standen sie in der Küche, wo Trudy in die letzten Geheimnisse der ungarischen Küche eingeweiht wurde.
Bei Szöszi konnte man sich so richtig daheim fühlen. Einmal verbrachten Trudy und ich gemeinsam einige Tage bei ihr. Ich ging mit ihr in die Markthalle, und da übernahmen mich Kindheitserinnerungen: An einem Stand lachten mich wunderschöne, schneeweisse Champignon Köpfe an. Diese erinnerten mich daran, dass ich als Kind nie gezwungen wurde, Dinge zu essen, die ich nicht mochte. Dank dessen habe ich diese Gerichte immer wieder freiwillig probiert, bis dann eines Tages dieses oder jenes von ihnen zu schmecken begann.
So war es auch mit den Pilzen. Meine Grossmutter nahm manchmal diese herrlich frisch aussehende Champignon Köpfe, panierte und brätelte sie, bis diese zu herrlich duftenden, goldbraunen Stücken wurden. Jedes Mal gelüsteten sie mich, probierte sie oft, doch nach dem Reinbeissen ging das Runterschlucken schon nicht mehr. Aber nun in der Markthalle war ihr Ruf unüberhörbar: «Probiere es doch nochmals mit uns»! Ich bat Szöszi diesmal panierte Champignon Köpfe zu machen und sie strahlte: «Das habe ich tatsächlich schon lange nicht mehr gemacht!»
Wir gingen mit den Champignon Köpfen heim und Trudy freute sich auch über die Idee. Allmählich füllte sich die Küche mit dem herrlichen Duft und als die goldbraun gebratenen Champignon Köpfe auf den weissen Tellern lagen, sahen sie zum Reinbeissen aus. Ich nahm vorsichtig den kleinsten Kopf und biss voller Erwartung rein. Der erste Biss schmeckte fein, doch schon beim Kauen wurde es schwieriger, geschweige denn beim Runterschlucken, doch es gelang mir: Heldenhaft würgte ich den kleinen Champignon Kopf runter, aber dann war Schluss. Ich sah ein: Ich muss Pilzgerichte endgültig abschreiben, obwohl ich den Geschmack gerne hätte.
Wenn Trudy ihr hervorragendes Filet Gulasch Stroganoff macht, kauft sie eine schöne Schachtel Minichampignons, hackt diese ganz fein und das Gericht bekommt sein Pilz-Aroma und ich muss nicht auf Pilze beissen.
Sonntagmittage
Seite 24
Seite 24 wird geladen
24.
Sonntagmittage
Wie gesagt, die sonntäglichen Mittagessen waren fast jedes Mal ein kleines Fest. Der Tag fing schon ganz gut an: Ich konnte den Wecker abstellen, dieser musste mich an diesem Tag nicht zum Schulalltag aufschrecken. Nein, mich weckten dann die Sonnenstrahlen, nicht etwa die allerersten, sondern die ersten, die ich wahrnahm. Recken und strecken und ab ins Badezimmer. Nein, nicht etwa schnell duschen, sondern Badewasser einlassen und eintauchen ins warme Nass. Oft nahm ich sogar etwas zum Lesen mit, so flogen die Stunden vorbei.
Erneut wurde ich aufgeschreckt von den verführerischen Düften des Mittagessens. Da hiess es schnell abtrocknen, sich anziehen und meinen sonntäglichen Aufgaben nachgehen, wie zum Beispiel den festlichen Tisch zu decken. Meine Grossmutter hatte mir ja beigebracht, wohin Messer und Gabel gelegt werden, ich wusste sogar, wo die Weingläser hingehören.
Nebst vielen anderen Leckereien wurden sehr oft panierte Sachen kredenzt. Wienerschnitzel darf ich ja nicht sagen, denn im Nachkriegs-Ungarn war es gesetzlich verboten, Kalbfleisch zu verkaufen. Das hatte uns auch nicht gefehlt, denn wir waren damit einverstanden, das Tier zuerst einmal gross werden zu lassen, statt im Kindesalter an die Schlachtbank zu führen. Ausserdem hat ein zartes Stück Schweinefleisch viel mehr Geschmack, als das milchig schmeckende Kalbfleisch.
Es wurden also Berge von panierten Schnitzeln nach Wiener Art gebraten oder solche nach Pariser Art. Das heisst, bei Letzteren wurde ein Milch-Eier-Mehl Teig vorbereitet, die Schnitzel in Mehl gewendet und anschliessend durch den Teig gezogen. Egal ob Wiener oder Pariser, die Schnitzel schmeckten herrlich und waren auch an folgenden Tagen kalt zu geniessen.
Weitere sehr beliebte Leckereien waren die panierten Pouletstückchen. Auch diese waren in der Folgewoche in kaltem Zustand mehr als willkommen.
Apropos Folgewoche: Einer ungarischen Hausfrau war es damals bei einer Einladung nicht wohl, wenn nicht eine gehörige Portion vom Essen übrigblieb. So wusste sie, dass sie genügend gekocht hatte und nicht als knauserig verrufen werden konnte. Ausserdem hatten wir die panierten Sachen aller Art auch kalt sehr gerne gehabt.
Es wurde also gekocht und gebacken. Mutter hatte oft irgendwelche Einladungen gehabt, wobei ich auch auf meine Kosten kam. Nicht nur wegen des feinen Essens und der grossen Torten – es winkte oft der begehrte «Kétforintos».
Wie bereits berichtet, war meine Mutter sehr pflichtbewusst und mir gegenüber eher streng. Doch von ihr habe ich auch eine Art Lockerheit gelernt, die Kunst nicht immer nach Vorgabe oder Gewohnheit handeln zu wollen, sondern sich der gegebenen Situation hinzugeben.
Es gab nicht an jedem Sonntag Besuch, aber auch ohne Besuch hatte Mutter normalerweise etwas Feines gekocht. Doch manchmal, auf dem Sofa liegend, hatte sie sich gestreckt und gereckt und gefragt, ob es mir recht wäre, heute einen faulen Sonntag zu machen. Freudig sprang ich auf, denn ich wusste, was diese Frage bedeutete: Ich sollte ein Paar «Szafaládé» kaufen, also so etwas wie Chlöpfer oder Cervelats, nur etwas grösser. Geplant war es nicht, die Idee kam spontan, also hatten wir die Wurst nicht daheim. Ich zog mich freudig an und rannte los.
Bereits in den frühen Sechzigern gab es in Budapest Selbstbedienungsläden, die in der Woche 7 mal 24 Stunden offen hatten, also auch an einem Sonntag. So einen hatten wir in der Nähe, das heisst eine Viertelstunde im Laufschritt. Da besorgte ich die besagten Würste, legte sie ins Wasser, liess sie eine Weile sieden und servierte sie dann meiner Mutter und mir mit Brot und Senf.
Ich weiss nicht warum, aber diese faulen Sonntage kann ich nicht vergessen, diese empfand ich herrlich und genoss ihre Ungezwungenheit über alles. Heute noch bedeutet für mich ein «Waldfest», also Chlöpfer mit Brot, ein Festessen.
Ein Chlöpfer oder Cervelat gekocht oder vom Grill – nur eine Abwechslung. Was ich dann später in der Schweiz kennenlernen konnte, waren echte kulinarische Steigerungen: Arbeiterkotelett, bestehend aus halbiertem Chlöpfer gebraten mit einem Spiegelei drauf. Oder Arbeiter-Cordonbleu, also zwischen den Chlöpfer-Hälften Käse und das Ganze eingepackt in Bratspeck, das Gebilde fixiert mit einem Zahnstocher und knusprig gebraten, bis der Käse im Inneren schmilzt.
Es gibt nichts Schöneres als Vielfalt, und sei es zwischen Waldfest und Rindssteak!
Denkwürdiger Sonntag
Seite 25
Seite 25 wird geladen
25.
Denkwürdiger Sonntag
Wie schon erwähnt, war für meine Mutter ein fast allsonntägliches Ritual, etwas Kulinarisches zu kochen und dann auch jemanden einzuladen, sei es eine Freundin, einen Verwandten, Onkel oder Tante. Ich genoss diese Sonntage, half oft in der Küche und deckte den Tisch.
Kurz bevor der Gast kam, bekam ich manchmal eine ganz wichtige Aufgabe.
In diesen alten Wohnungen aus der Jahrhundertwende dienten die Keller nicht etwa als Weinkeller, nein, diese wurden mit Briketts aus Kohle gefüllt. In den meisten Wohnungen, wie auch in unserer stand an zentralem Ort ein Kachelofen, der im Winter mit diesen Eierbriketts gefüttert wurde. Auch in den Wohnungen konnte man Wein unmöglich lagern, entweder wegen des heissen Sommers oder wegen der Heizung.
So drückte mir Mutter ein Geldstück und die handgeschliffene Bleikristallkaraffe in die Hand, mit dem Auftrag, Wein zu besorgen. In der Stadt gab es in fast jeder Strasse eine kleine Weinschenke, meist im Sous-sol, ein paar Treppen runter, schön im Kühlen. In der Theke waren immer drei Kübel eingelassen, zwei für Weisswein, einer für Rotwein. Die Ungarn waren mehrheitlich Weissweintrinker, im Sommer wurden vor allem die weissen Gespritzten bevorzugt in verschiedenen Verdünnungsformen, ob man Feierabend hatte oder während der Arbeit sich einen genehmigte. Zu essen gab es Kleinigkeiten, einen «Pogácsa», ein Hefegebäck mit Grieben darin oder eine Brotscheibe mit Schweineschmalz bestrichen, darauf rotes Paprikapulver, Salz und je nach Wunsch ein, zwei Zwiebelringe. Dem sagte man dann «Borkorcsolya», also Weinschlitten.
Ich ging also los, hüpfte die Treppenstufen hinunter, immer mehr Stufen miteinander, bis ich eines Tages die nächste angepeilte Stufe nicht traf. Ich flog mitsamt der Karaffe hinunter, die in Tausend Stücke zerbrach. Am Ende sass ich auf einer Treppenstufe, unter mir die kostbare Karaffe in Scherben zerstreut. Ich konnte mich noch nicht ganz sammeln, da kam meine Mutter, aufgeschreckt durch den fürchterlichen Lärm und setzte sich neben mich auf die Treppenstufe. Ich war auf die grösste Schelte gefasst, doch sie strich mir liebevoll über die Haare und sagte mit sanfter Stimme: «Siehst du nur, du könntest mitten in diesen Scherben liegen und bluten. Dann wären wir alle unglücklich. Das ist doch ein Grund, dass du mir jetzt versprichst, nicht mehr so ungestüm die Treppe hinunter zu stürmen. Versprochen?»
Es blieb mir nichts anderes übrig als zu nicken und das Gefühl zu haben, sie hätte wieder einmal recht.
Doch dies blieb nicht mein eindrücklichstes Erlebnis von diesen Sonntagen. Es gab einen anderen Sonntagnachmittag, den ich nie mehr vergessen kann.
Onkel Sándor, von uns Sanyi genannt, war mir schon immer sehr sympathisch, aber erst seit diesem denkwürdigen Sonntagnachmittag wusste ich auch, warum. Er war ein Bruder meiner Grossmutter, ein aufgestellter Typ, an unserem Geburtsort nannte man ihn den Johnny Weissmüller von Sárvár. Er sah aus wie der Tarzan-Darsteller in den Filmen, stets braungebrannt und er vollbrachte auch «Heldentaten».
In dieser Kleinstadt gibt es einen Fluss mit einer Bogenbrücke darüber. Diese war aus Beton errichtet, der hohe Bogen hatte schon eine Breite von etwa einem halben Meter. Er erklomm diesen Bogen im Winter in einer knappen Badehose, liess seine Muskeln spielen und stürzte sich kopfvoran in den Fluss zwischen die Eisschollen. Die Zuschauer klatschten und als er wieder an das Ufer kam, wurde er entsprechend gefeiert. Natürlich heiratete er das schönste Mädchen des Ortes, eine langbeinige, rothaarige Schönheit. Sie hatten dann zwei Kinder, doch die Ehe ging schief. Die Frau verschwand irgendwohin und mein Onkel wurde alleinerziehender Vater, dies in einer sehr schwierigen Zeit. Von seinem Vater her war er in der Textilbranche tätig, nach der Scheidung als Vertreter für Textilien. Er fuhr mit seinem Motorrad im ganzen Land umher, Sommer und Winter und musste die Kinder manchmal tagelang alleine lassen.
Er war an diesem Sonntagmittag bei uns eingeladen. Nach dem Essen beschlossen wir, in die Innenstadt zu gehen, um irgendetwas anzuschauen. Als wir uns bereit machten, verkündete meine Mutter, sie sei plötzlich so müde, sie würde lieber zu Hause bleiben. So zogen wir also ohne sie los und weil unser Ziel weiter weg lag, gingen wir zur Bushaltestelle. Kaum fuhr der Bus an, sagte Sanyi etwas würde ihm nicht gefallen. Die Art, wie sich meine Mutter von uns verabschiedete, würde ihn irritieren, er hätte so ein schlechtes Gefühl dabei. Bei der nächsten Haltestelle stiegen wir aus und nahmen den Bus zurück nach Hause.
Was uns dort erwartete, war schockierend. Mutter lag leblos auf dem Sofa, neben ihr zwei Medikamentenschachteln ohne eine einzige Pille darin. Einer von uns stürmte zu der nächsten Telefonzelle und alarmierte die Rettung. Sie kam auch mit Blaulicht und Sirene. Als Erstes flössten sie meiner Mutter etwas ein, wovon sie erbrechen musste, aber wie ein Vulkanausbruch. Dann wurde sie ins Spital mitgenommen.
Ich befand mich wieder in diesem Loch das nun tiefer und schwärzer war als damals, als sie verhaftet wurde. Die Frage war nun ungleich dramatischer, sie hiess nicht «Wann kommt Mutter endlich heim?» Nein, diesmal war sie kaum zu ertragen: «Kommt Mutter heim?» Zum Glück dauerte diese Ungewissheit nur eine lange Nacht. Am nächsten Tag konnten wir sie besuchen.
Da lag sie etwas blass, doch lebendig und als Erstes entschuldigte sie sich bei uns allen, bei mir, bei ihren Eltern. Sie hätte im Moment einfach nicht ein und aus gewusst. Doch nun täte es ihr unendlich leid und sie würde es nie wieder tun.
Über das «Warum» habe ich mir keine Gedanken gemacht, denn ich spürte, wusste, dass ich nicht den Grund geliefert hatte. Es ist auch nie zur Sprache gekommen, zumindest nicht in meiner Gegenwart.
Ich kann es nicht beschreiben, wie erleichtert ich war, und nun wusste ich, warum ich Onkel Sanyi schon immer so geschätzt hatte und nun auch über alles liebte. Das spätere Leben gab mir auch die Gelegenheit, aus meiner Dankbarkeit ihm gegenüber zumindest etwas zurückzugeben.

Onkel Sanyi, Tante Györgyi
Mutterliebe und …
Seite 26
Seite 26 wird geladen
26.
Mutterliebe und …
Später sinnierte ich etliche Male darüber nach, was Mutterliebe bedeutet. Die ungarische Literatur ist reich an Schilderungen dieses und anderer Phänomene, die unsere Seelen berühren.
Der berühmteste Dichter Ungarns, Sándor Petöfi, beschreibt in etlichen seiner Gedichte seine mehrschichtige Liebe: die zu seinem Vaterland, insbesondere zu dem schwierigen Gebiet, wo er auf die Welt kam und aufwuchs, dann zu seiner Frau und ganz innig zu seiner Mutter.
Er sah die ungarische Seele.
Ein Beispiel ist «Falu végén kurta kocsma», also am Dorfrand die kleine Beiz am Ufer des Szamos, ein Seitenfluss der Theiss. Die Beiz könnte ihr Spiegelbild im Fluss sehen, wenn nicht die Nacht hereinbrechen würde. Aber drinnen geht es fröhlich und laut zu, junge Burschen sind am Festen: «Frau Wirtin, Sie goldene Blume, bringen Sie ihren besten Wein, alt soll er sein wie mein Grossvater und feurig wie meine Liebste.» Dann tritt eine Magd herein und verkündet: «Die Herrschaften schicken mich mit dem Befehl, aufzuhören zu lärmen, so könne man nicht schlafen.» Doch die Jungs erwidern: «Zum Teufel mit deinen Herrschaften und du sollst in die Hölle verschwinden!», und geben der Zigeunerband das Zeichen, das nächste Lied anzustimmen und sei es für ihr letztes Hemd. Später klopft es erneut an der Türe, ein junges Mädchen tritt ein und sagt: «Gott segne euch! Ich flehe euch an, etwas leiser zu festen, meine Mutter ist sehr krank und sollte Ruhe haben.» Es gibt keine Antwort, die Jungs nicken nur, schlürfen ihre Becher aus und gehen heim.
Das ist ungarische Mentalität auf den Punkt gebracht.
Kurt W. Zimmermann, der 2011 als «Journalist des Jahres» ausgezeichnete Zürcher Journalist und Buchautor mit Zweitdomizil unter anderem in Budapest fasst dies so zusammen: «Ungarn hat etwas Archaisches. In der Luft liegt nicht der moderne Zeitgeist der schrankenlosen Toleranz, sondern der Geist von Eigenwilligkeit, Trotz und nationalem Stolz».
Ich spürte das bereits als Kind, selbst meiner Mutter gegenüber. Nebst grosser Liebe und Achtung war immer eine Portion Trotz dabei. Als Beispiel: Wenn ich erkannte, dass ich in Mathe oder Geschichte zu schlechte Noten hatte, fing ich an zu büffeln. Dies geschah immer in der Hoffnung, dass Mutter den Sachverhalt nicht merkte und mir etwa befehlen würde, mehr zu lernen. Der Befehl musste von innen kommen und ja nicht von aussen – egal von wem.
Petöfis Heimat ist die Puszta, damals ein Ödland im Osten Ungarns, steppenartig mit Treibsand und einem unberechenbaren Fluss, der Theiss, schwierig landwirtschaftlich zu bebauen und wenn es in den Karpaten im Winter viel Schnee gab und der Frühling schnell und warm daherkam, konnte der Fluss alles in seiner Umgebung vernichten.
Und dennoch heisst es in einer seiner «Liebeserklärungen» an dieses Gebiet, wo er sich heimisch fühlte mit Blick nach Osten: «Mit nekem ti zordon Kárpátoknak vadregényes tálya, bár csodállak, ámde nem szeretlek, képzetem hegy, völgyeidet nem járja.» Es ist sehr schwer, diese literarisch hochstehende Aussage zu übersetzen, also sinngemäss: «Karpaten, was soll ich mit deinen wilden, aufregenden Spitzen anfangen? Ich bewundere dich, doch mein Geist wandert weder in deinen Bergen, noch in deinen Tälern.»
Petöfis Liebe zu seiner Frau währte nicht lange, denn er fiel ganz jung mit 23 Jahren in den Freiheitskämpfen gegen die Österreicher. Er musste es gespürt haben, denn er schrieb: «Wenn ich nicht mehr bin, so solltest du trauern und den Trauerschleier anlegen, doch nicht zu lange. Bald solltest du diesen ablegen und um meinen Grabkranz wickeln. Ich komme dann einmal, hole diesen, nehme ihn mit nach unten und presse ihn für ewige Zeiten an mein Herz.» Dazu kam es nicht, er hatte kein Grab, keinen Grabkranz, er war einfach verschollen in einem der Freiheitskämpfe gegen die Habsburger.
In mehreren seiner Gedichte bekundet er seine Liebe zu seiner Mutter. Mir am meisten Eindruck gemacht hat das Gedicht: «Füstbe ment terv», also der Plan, der sich in Rauch auflöste. Da beschreibt er, wie er in einem Ochsengespann nach langer Zeit wieder nach Hause unterwegs ist. Die Zeit scheint still zu stehen, obwohl das Gefährt sich stetig bewegt. Die ganze Zeit überlegt er, wie er seiner Mutter begegnen sollte, welche Worte würdig seien, die Mutter nach so langer Zeit wieder zu begrüssen. Dann heisst es etwa: «Dann trat ich in die gute Stube ein, meine Mutter flog mir entgegen, ich umarmte sie und hing wortlos an ihr, wie Frucht am Baum.»
János Arany beschreibt eindrücklich das Familienleben des 18. Jahrhunderts auf dem Lande, wo meistens drei Generationen miteinander leben. Grundtenor ist: Die Hausfrau, die Mutter ist Herrin des Hauses. Der Mutter wird in gegenseitiger Liebe Respekt gezollt.
Der Dichter Endre Ady lebte in der Zeit der industriellen Revolution. Er hatte es sich zur Lebensaufgabe gemacht, in seiner Dichtung auf die Missstände der Arbeiterschicht aufmerksam zu machen, dies sehr oft anhand der Arbeit seiner Mutter. Sie war Büglerin, damals einer der härtesten Berufe, als die schweren eisernen Bügeleisen mit glühender Kohle befüllt werden mussten und die Tagesarbeit zwölf bis sechzehn Stunden dauerte. Für die Schwere dieser Arbeit spricht der Umstand, dass während des Ersten Weltkriegs die Büglerinnen doppelt so viele Essensmarken bekamen wie die restliche Bevölkerung.
József Attila lebte in der Zeit nach Ady Endre, im zwanzigsten Jahrhundert und prägte meine Arbeitsweise. In einem seiner Verse heisst es: «Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes», was etwa heisst: «Genau und stetig, wie die Sterne den Himmel durchschreiten, nur so lohnt sich arbeiten.» In meinem Beruf gab es oft hektische Zeiten. Doch wenn es hiess, es sei nun wirklich superdringend, dann fing ich an, langsam und bedächtig zu arbeiten, damit mir ja kein Fehler unterlaufe, denn deren Korrektur hätte viel mehr Zeit beansprucht, als die Arbeit mit Bedacht erforderte. Eben: Genau und stetig, wie die Sterne den Himmel durchschreiten und den gegenüberliegenden Horizont ohne Verzug erreichen.
Dann die Emanzipation: Das ist in Ungarn keine neue Erfindung, dazu haben die Frauen den Grundstein spätestens während der Osmanen-Kriege im 16. Jahrhundert gelegt. Die Osmanen kamen mit einer ungeheuerlichen Überzahl an Kämpfern und stürmten eine Burg nach der anderen. Die Verteidiger hatten eine begrenzte Anzahl Kämpfer, diese mussten auch einmal ausruhen und dann nahmen die Frauen die Verteidigung in die Hände. Damals meist mit heissem Pech, das sie über die Angreifer gossen. Dann war eine Zeitlang Ruhe, gerade genug, um die nächste Ladung Teer aufzukochen.
Allen voran Katica Dobó, die Frau des Burgherren zu Eger. Ihre Heldentaten sind beschrieben im Roman «Egri csillagok», also die «Sterne von Eger», den ich mindestens dreimal gelesen habe. Sie wurde auch zur Fahnenträgerin der Emanzipation ungarischer Frauen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte Vollbeschäftigung mit Arbeitslosigkeit innerhalb der Werkstore. Der Vorteil der Mütter dabei war, dass sie sich unbekümmert ausbilden lassen und zur Arbeit gehen konnten, natürlich nicht in der Giesserei, aber als Buchhalterin, Managerin oder Strassenbahnführerin. Busfahrerinnen gab es nicht, da damals weder Lenkung, noch Pedalerie servounterstützt waren. Es gab mehr Juristinnen als Juristen, mehr Ärztinnen als Ärzte.
Die verstaatlichten Betriebe waren verpflichtet, die Leute einzustellen und unter ihnen die Arbeit zu verteilen. Das war dann meist weniger als eine normale Tagesarbeit. So kam es auch, dass Mütter uneingeschränkt freibekamen, wenn sie sich um ihre Kinder kümmern mussten, wie zum Beispiel an den ersten Schultagen. Da wurde jedes Kind tagelang von seiner Mutter zur Schule begleitet, ich auch. Und ich war mächtig stolz auf meine junge, schöne Mutter. Das waren natürlich andere Schüler auch, so gab es Raufereien darüber, wessen Mutter nun wirklich die Schönste sei …
Die Gedicht-Originaltexte befinden sich in Anhang 3.
Die vierköpfige Familie
Seite 27
Seite 27 wird geladen
27.
Die vierköpfige Familie
In Ungarn bekam jede Mutter nach der Geburt sechs Monate frei bei vollem Lohn. Wollte sie nach dieser Zeit immer noch zu Hause bleiben, so wurde ihr Arbeitsverhältnis weitere zweieinhalb Jahre aufrechterhalten, allerdings ohne Lohn. Als meine Schwester zur Welt kam, blieb meine Mutter also sechs Monate daheim und als diese Zeit ablief, musste sie aus finanziellen Gründen weiter arbeiten gehen. Das war dann genau die Zeit, als meine grossen Schulferien begannen.
Als Agrarland gab es in Ungarn in den Schulen im Sommer rund drei Monate Sommerurlaub. Die Kinder mussten bei der Ernte oder im Haushalt helfen, weil die Eltern so beschäftigt waren. Dafür gab es keine sonstigen Ferien ausser den Überbrückungen bei grösseren Festtagen wie Weihnachten und Ostern. In den grossen Städten wäre dies nicht mehr notwendig gewesen, doch diese traditionell entstandene Regelung galt immer noch einheitlich für das ganze Land.
Ich bot mich also an, meine Schwester in den Schulferien zu versorgen, bis eine Lösung gefunden wurde. Ich war ein grosser Junge im 15. Lebensjahr und hatte die harte Aufnahmeprüfung an meiner Traum-Ausbildungsstätte geschafft. 1‘200 Mädchen und Jungs hatten es versucht, 260 kamen rein. Alles war anders, als in den bisherigen Schulen, erstens die Kleiderordnung. Wir Jungs mussten Stoffhosen, ein weisses Hemd, Krawatte und einen Kittel tragen. Ich wurde entsprechend eingekleidet. Interessanterweise mussten die Mädchen eine schlichte, blaue Schürze tragen.
Aber noch war es nicht so weit, zuerst kamen die Sommerferien. Ich wärmte die von Mutter vorbereiteten Schoppen auf und wickelte die Kleine, sobald das nötig wurde. Ich schob sie in ihrem Kinderwagen durch die Strassen. Wir wohnten zwischen dem riesigen Stadtpark und der City, so hatte ich die Auswahl zwischen dem beschaulichen grünen Park und dem pulsierenden Leben der Innenstadt. Auf diesen Spaziergängen kam mir eine Idee: Ich kleidete mich, wie es für die künftige Schule vorgesehen war und lieh mir Mutters Ehering aus erster Ehe aus. Solchermassen geschmückt ging ich mit meiner Schwester im Kinderwagen spazieren und genoss die Blicke, die einem so jungen «Vater» geschenkt wurden. So gesehen fehlten mir die Schulferien im eigentlichen Sinne gar nicht.

Kati läuft... bis zur Schlittschuhbahn
Der Sommer ging rasch vorbei und ich konnte die langersehnte technische Mittelschule für Verkehrsmaschinen antreten. Meine Klasse startete mit 42 Schülern, 6 davon waren Mädchen. Das war für mich ein Novum, war ich doch bisher in eine Schule gegangen, die getrennt war für Mädchen und Jungs: Diese war ein riesiges Gebäude, welches die ganze Breite eines Blocks zwischen zwei Strassen einnahm. Über den beiden Eingängen prangten Skulpturen. Über dem einen Eingang zwei Knaben und über dem anderen zwei Mädchen. So wusste man auf Anhieb, wo man hingehörte.
Nicht so in der neuen Schule. Diese lag etwas ausserhalb der Innenstadt, schon fast ländlich, denn sie brauchte viel Platz für Nebengebäude, wie Werkstätten und auch für grosse Sportplätze.
Welche Lösung für meine kleine Schwester nach meinen Sommerferien gefunden wurde, weiss ich nicht mehr so genau. Ich weiss nur, dass ich mich weiterhin sehr viel um sie kümmerte. Wenn sie schon nicht mein Spielkamerad wurde, dann doch so etwas wie mein Baby.
Im zweiten Weltkrieg waren die Kämpfe in Budapest Endkämpfe, die deutsche Wehrmacht war nur noch auf dem Rückzug. Das bedeutete auch, dass auf diesem Wege für sie jede Minute wichtig war. So sprengte die Wehrmacht alle acht in Budapest vorhandenen Brücken in die Luft beziehungsweise in die Donau. Damit gewannen sie etwa 24 Stunden, so lange dauerte es nämlich, bis die Sowjetarmee ihre Pontonbrücken aufgebaut hatte und ihren Vormarsch fortsetzen konnte. Sieben dieser Brücken hat man wieder rekonstruiert, zum Teil mit aus der Donau herausgehobenen Teilen, zum anderen Teil aus nachgebauten Elementen.
Doch bei der letzten dieser Brücken war eine Rekonstruktion nicht mehr möglich. Die ursprünglich 1903 errichtete Elisabethenbrücke war damals schon eine ganz moderne Hängebrücke ohne jeglichen Pfeiler über der etwa 300 m breiten Donau. Durch diese kühne Konstruktion wurde sie dermassen zerstört, dass ein Wiederaufbau nicht mehr möglich war. Zwischen den zwei Brückenbogen am Ufer lag alles in der Donau. Daraufhin wurde sie neu konstruiert als einzige ganz moderne Hängebrücke, getragen von einem Paket von 64 Kabeln zwischen den ebenfalls neuen Toren an den Ufern. Diese 64 dicken Kabel sind zu einem Achteck zusammengefasst, mit Schellen zusammengehalten, an denen auch die beachtlich dicken vertikalen Kabel hängen, die dann die Brückenkonstruktion jeweils über die ganze Länge der Brücke halten. Als Gegensatz zu allen übrigen historischen Brücken wurde die neue Elisabethenbrücke ganz in Weiss gestrichen. Sie wirkt heute noch zierlich und gilt als eines der immer noch modern anmutenden Wahrzeichen Budapests. Sie wurde 1963 fertiggestellt und nach den Belastungsproben in den ersten beiden Tagen der Bevölkerung übergeben, während dieser Tage noch ganz ohne Autoverkehr. Ich nutzte die Gelegenheit und schob meine Schwester Kati in ihrem Kinderwagen über die neu erstellte Brücke. Wir zwei waren also unter den ersten Benutzern dieser stolzen, neuen Brücke über die Donau.

Kati tüchtig...
Nicht nur ich war stolz auf meine Schwester, das war natürlich auch ihr Vater. Als begeisterter Fotograf hatte er auch Hunderte, wenn nicht Tausende Bilder von ihr und von der ganzen Familie geschossen. Er hatte ja auch eine gute Kamera, einen ostdeutschen Nachbau einer legendären Leica. Und die Bilder kosteten uns nur den Preis des Filmes, denn seine Firma unterhielt für ihre Mitarbeiter ein Fotolabor, wo alles vorhanden war, von den benötigten Chemikalien bis hin zum Fotopapier sowie die gesamte Einrichtung, allerdings nur für Schwarzweiss-Abzüge, doch diese waren zu jener Zeit üblich.
Selbst beim Film wusste Mihály, was er am besten besorgen musste. Er nahm immer die ostdeutschen OrWo Filme, das war die Abkürzung von Original Wolfen, wo diese in den ehemaligen Agfa-Werken hergestellt wurden. Diese waren seit ihrer Gründung 1909 weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von Reproduktionsträgern, also von Filmen, Tonbändern und Schallplatten. Im zweiten Weltkrieg übernahmen zuerst die amerikanischen Besatzungsmächte das Werk und sicherten sich alle Schriften der Fertigungstechnik. Basierend auf diesen Entwicklungen und Verfahren entstand in den USA die Eastman Kodak Company, die daraufhin ihre ersten Kodak Farbfilme produzierte und anbot. Dann erfolgte die Übergabe an die sowjetischen Besatzungsmächte. Auch diese begannen ihre Filmproduktion mit den mitgenommenen Produktionsanlagen in der Ukraine.
Es war unterschiedlich, was die Besatzungsmächte unter Kriegsentschädigung verstanden. Während die Sowjets ganze Produktionsbetriebe abmontierten, in der Sowjetunion oder in einem Bruderstaat aufbauten und damit weiter produzierten, nahmen die Alliierten, allen voran die USA, eher die hochstehenden Technologien mit. Wernher von Braun lässt grüssen …
Die Herstellung qualitativ hochstehender Filme war eine sehr sensible, chemische Angelegenheit und basierte auf ganz seltenen Materialien. So entstand dann auch ein geheim gehaltener Rohstoffaustausch zwischen den Leverkusenern Agfa- und den OrWo Werken in Wolfen.
Als wir im Rahmen einer Deutschlandreise unter dem Motto «Technik und Kulturgeschichte» das Werk in Wolfen besuchten, musste ich an all die Stunden zurückdenken, die ich damals mit Mihály im werkseigenen Fotolabor verbracht hatte. Ich war natürlich immer gerne im Labor dabei, wo wir die Filme entwickelten, dann das Fotopapier belichteten, ebenfalls entwickelten und fixierten. Einmal habe ich mich aber ertappen lassen: Ich konnte manchmal daheim meine kleine Modelleisenbahnanlage aufbauen und wollte diese auch fotografieren. Doch Mihály meinte, es ginge nicht, wir hätten kein Stativ und das Licht würde bei weitem nicht ausreichen, ein Bild zu machen. Ich wollte es dennoch ausprobieren, aber Mihály blieb standhaft. Dann gingen meine Eltern irgendwohin auswärts, Theater, Oper, irgendwas. Ich nahm den Fotoapparat, befestigte an der Schraube, die das fehlende Stativ festhalten sollte, eine Schnur, lange genug, damit ich auf deren anderes Ende treten konnte und zog die Kamera nach oben. Solchermassen gespannt hoffte ich, dass die Schnur die Funktion des Stativs übernimmt, hielt den Atem an und drückte ganz vorsichtig ab.
Das nächste Mal im Labor kam auch dieses Bild dran. Als Film bereits entwickelt, wurde es auf Fotopapier belichtet und in die entsprechenden Bäder getaucht. Im Entwicklerbad kam dann das Bild im schwachen roten Licht der Dunkelkammer allmählich zum Vorschein. Zuerst die Eisenbahnanlage. Hurra, diese war überraschend scharf zu erkennen. Aber nicht nur das: Neben dem Bahnhof kam ganz klar ein Aschenbecher zum Vorschein, so klar, dass man darin eine rauchende Zigarette erkennen konnte. FAZIT: Fototechnisch eins zu null für mich, doch beim Rauchen hatte ich mich selbst überführt. Die Überraschung für mich war jedoch auch perfekt: Meine Eltern wussten bereits, dass ich rauchte …
Später, in der Schweiz erstand Mihály eine KONICA. Er erklärte mir auch, warum. Damals waren die Fotoapparate halbautomatisch und verfolgten zweierlei Philosophien: Die einen hatten die Blende bestimmt und die Belichtung überliessen sie dem Fotografen. Die anderen hingegen wählten die Belichtungszeit und liessen die Blende offen.
Dazu muss man Folgendes erklären: Blende und Belichtungszeit bestimmen eigentlich alles in der Aufnahme. Kleine Blende, grosse Tiefenschärfe, grosse Blende kurze Tiefenschärfe. Nur, hier hat der Fotograf lediglich eingeschränkt Entscheidungsfreiheit, denn es muss eine gewisse Menge Licht auf den Film einfallen. Das bedeutet, am sonnenüberfluteten Strand gelingt nahezu jede Aufnahme. Doch in einer düsteren Kirche muss man eine längere Belichtungszeit wählen, damit überhaupt ein Bild entsteht. Dabei darf allerdings der Apparat nicht im Geringsten wackeln. Dann die Portraits: Diese sollten die Person hervorheben, also der Hintergrund sollte bewusst unscharf bleiben. Dies erreicht man mit einer grossen Blende, es braucht also keine sehr langen Belichtungszeiten.
Nun, KONICA baute in den Sechzigern als einzige Firma ihre Fotoapparate mit wahlweise einstellbarer Halbautomatik: Blendenvorwahl oder Vorwahl der Belichtungszeit. Diese Möglichkeit hatte Mihály begeistert und dann auch mich. Er empfahl mir auch ein Buch über Fotografieren vom Starfotograf Alexander Borell mit dem Titel «KONICA Mon Amour». Das Buch ist eine Liebeserklärung an die Fotografie. Es ist nicht nur eine Anleitung dazu, gute Bilder zu schiessen. Das Buch erklärt, warum echtes Fotografieren die Seele des Fotografen oder der Fotografin widerspiegelt – oder zumindest die «Handschrift».
Als ich meine ersten «Batzeli» in der Schweiz verdient hatte, kaufte ich zwei Sachen, erfüllte mir damit zwei Träume. Erstens kaufte ich mir ein Tonbandgerät, zweitens eine einfache Fotolabor-Ausrüstung für Mihály. Ersteres wurde ein Erfolg, doch das Zweite erwies sich als Ergebnis meiner jugendlichen Naivität.
Mein Tonbandgerät hatte ich sehr viel genutzt. Schallplatten kaufte ich aus zwei Gründen keine: Erstens waren diese recht teuer, zweitens mag ich es nicht, eine LP lang dem gleichen Interpreten oder der gleichen Interpretin zuzuhören und seien es meine Lieblinge. So stellte ich auf dem Tonband meinen Musik-Mix zusammen und war damit zufrieden.
Hingegen kam die Laboreinrichtung nie zum Einsatz. Ganz klar: Wir hatten ja keinen Raum, der als abdunkelbares Labor hätte dienen können und auch die Schwarzweiss-Fotografie hatte mittlerweile für den Hausgebrauch ausgedient. Mihály machte nach wie vor seine unzähligen Aufnahmen von der Familie, doch die Filme landeten in einem Fotolabor und wurden für wenig Geld farbig entwickelt und auf Fotopapier gebracht.
Eine KONICA war mir trotz grösster Begeisterung vorerst verwehrt geblieben, denn deren Kaufpreis entsprach damals etwa der Hälfte meines Monatslohnes. Dann kam aber der grosse Aufschwung in der IT-Branche und jeder Informatiker konnte locker für einen höheren Lohn den Arbeitgeber wechseln. Dies versuchten die Arbeitgeber natürlich abzuwehren, so bekamen ich und meine Kollegen rechtzeitig vor Ferienbeginn einfach so einen halben Monatslohn zusätzlich ausbezahlt. Ich ging damit sofort zum Fotoladen und erstand meine KONICA, erst noch mit einem speziell lichtstarken 1.2 Objektiv.
Die Begeisterung führte dazu, dass bei mir von da an nach jedem Urlaub, nach jedem speziellen Anlass ein Album entstand, allerspätestens drei Wochen danach. Man nahm seine bevorzugten Filmrollen immer mit, denn diese waren unter den drei führenden Herstellern unterschiedlich: Kodak Filme boten einen warmgelben Farbstich, Agfa war eher blau angehaucht und Fuji Film eindeutig mit Grünstich. Diese Unterschiede nahm man nur bei direktem Vergleich wahr, aber dann ganz eindeutig. Auf eine Reise nahm ich nicht genügend Kodak-Filme mit und konnte am Urlaubsort nur Agfa nachkaufen. Im Fotoalbum sieht man, bei welcher Aufnahme mir der Kodak Film ausgegangen war …
Meine KONICA ist natürlich seit einiger Zeit in Pension und fristet ihr ruhiges Dasein an prominenter Stelle in unserer Vitrine. Immer wieder schaut sie mich mit ihrem grossen, lichtstarken Objektiv an und ich blinzle dankbar zurück.

Dann kam die Ära des digitalen Fotografierens und seither sind die Fotoalben nur noch Folder im Computer …
Die strenge, aber spannende Schule
Seite 28
Seite 28 wird geladen
28.
Die strenge, aber spannende Schule
Ein Technikum war die Parallele zum Gymnasium nach der acht Jahre dauernden obligatorischen Grundschule. Wesentliche Unterschiede waren, dass es über viel mehr, vorwiegend technische Fächer verfügte als das Gymi und ungleich strenger geführt wurde. Dafür war man nach dem Abschluss, also nach dem Abitur, ein in jedem Betrieb gern gesehener Techniker oder aber an der Technischen Hochschule ein willkommener Student. Der Preis war, dass die Lehrer vor allem in den technisch orientierten Fächern in der Notengebung äusserst streng vorgingen. Die Begründung war, dass man auch mit einer oder zwei schwachen Noten durch die Matura kam. Trotzdem: Die Konstruktionen, die man im Berufsleben erstellte, mussten halten und funktionieren.
Dafür gab es die spannendsten Fächer. Meine Favoriten waren Technologie, also Fertigungstechnik, dann Darstellende Geometrie und Maschinenzeichnen, aber auch Physik und Chemie.
Der Technologielehrer war ein goldiger Mensch, wir mochten ihn alle sehr. Er werkelte auch viel mit uns. Zum Beispiel bauten wir Modelleisenbahnen mit ihm, aber weit entfernt von gekauften Schienen. Nee, wir haben bei ihm die Drahtzugmaschine kennengelernt, Schienen fabriziert, diese an selbst gebauten Schwellen befestigt und in ein echtes Schotterbett gelegt. Das ging natürlich ganz, ganz langsam voran, aber vor uns hatten bereits etliche Schüler mit Begeisterung an der Anlage gebaut, so konnten wir bereits mit mitgebrachtem Rollmaterial Züge fahren lassen.
Darstellende Geometrie war auch faszinierend: Figuren konstruieren, aber dreidimensional, die Elemente des Kegelschnitts erklären als Basis die gesamte Geometrie, angefangen vom Punkt, über die Gerade, den Kreis, die Ellipse bis hin zum Tangens und Kotangens.
Maschinenzeichnen war zwar zweidimensional, verband aber drei Ansichten eines Objekts organisch miteinander. Auch das war faszinierend. Weniger spannend war die technisch vorgegebene Schrift. Eigentlich machte man dies damals mit der Schablone. Doch wir mussten die Schrift so lange üben, bis unser strenger Lehrer die eigene Schrift nicht von derjenigen mit der Schablone erstellten unterscheiden konnte.
Physik und Chemie waren auch sehr interessant, doch wir Jungs büffelten diese Fächer nicht nur deshalb fleissig, sondern auch, weil die Lehrerin nicht nur flott, aber darüber hinaus ausgesprochen hübsch war. Keiner von uns hatte es sich erlaubt, vor ihr Blösse zu zeigen.

Einzig mit der Klassenlehrerin hatten wir Pech. Sie unterrichtete Russisch, was bei den meisten von uns eher verpönt war. Ein Gentleman-Agreement zwischen Staat und der Schülerschaft sah auch vor, dass kein Schüler wegen Russisch eine ungenügende Note bekam. Unsere Klassenlehrerin wusste dies und war darüber nicht gerade erbaut, was sie uns manchmal auch spüren liess. Wir mussten lediglich einige wenige Anforderungen erfüllen: Fliessend lesen können und einigermassen fehlerfrei Diktate schreiben. Dann musste Woche für Woche eine andere Schülerin oder Schüler am Anfang der Russischstunde die Klasse anmelden können, also Klassenbestand und wie viele davon gerade fehlten und warum, natürlich auf Russisch. Doch auch die Russischstunden gingen vorbei …
Den Höhepunkt der Woche bildete die samstägliche, achtstündige praktische Arbeit in der hauseigenen Werkstatt. Im ersten Jahr arbeiteten wir ausschliesslich mit manuellem Werkzeug und als Erstes stellten wir einen Hammer her.
Das tönt zwar recht trivial, aber beim Ausführen kommt man auf die Welt. Aus einer Eisenstange wird zuerst ein gutes Stück abgesägt. Daraus wird der Hammerkopf geformt, klassisch mit abgeschrägtem hinterem Teil. Der Winkel muss stimmen, dazu ist die richtige Führung der Feile entscheidend. Dann werden die Kanten gebrochen, aber ganz genau nach vorgegebenem Mass. Die Schlagfläche muss eine genaue Wölbung aufweisen, diese verlangt nach einer gekonnten Feilenführung. Eine besondere Herausforderung bildet dann das ovale Loch, um den hölzernen Stiel aufzunehmen.
Bohren mit der Maschine durften wir bereits, doch das Loch musste dann oval werden. Es war also nicht ohne …
Endlich, endlich, im zweiten Jahr kamen wir zu richtigen Maschinen. Diese entfachten dann das Höchste der Gefühle: Hobelmaschine, Fräsmaschine, Drehbank manuell geführt oder programmierbar. Mein erklärter Favorit war die Drehbank, am liebsten manuell bedient. Da formte sich aus einem Eisenstück etwas Wunderbares, eine Achse, ein Zahnrad oder ein Gewinde. Wie auf einem Hochseedampfer herrschte in der Werkstatt eiserne Ordnung: In der letzten Stunde wurde nur noch aufgeräumt, gereinigt, geölt und geschmiert. Selbst heute kann ich meine eigene Werkstatt nicht verlassen, ohne vorher aufzuräumen.
Dann die Schulkameradinnen. Endlich entdeckten wir Jungs das andere Geschlecht. So doof waren die Mädchen eigentlich gar nicht, wie wir bisher dachten. Und sie hatten sonst noch Qualitäten, es war nämlich ganz verlockend und aufregend mit ihnen in der Konditorei Kaffee zu trinken und über alles zu plaudern. In Ungarn waren in den Kinos allerlei westliche Filme zu sehen, vorwiegend französische und italienische, aber auch sehr viele Filme aus sowjetischer Produktion, hauptsächlich um die Heldentaten der Roten Armee zu verherrlichen. Damit bei diesen Filmen die Kinosäle nicht leer blieben, wurden die Schüler aus allen Schulen dorthin ausgeführt, natürlich nicht freiwillig, wir auch. Doch hatten wir dann mehr Interesse an den Schulkameradinnen als an der Handlung. Und dies ging manchmal über das Kaffeetrinken hinaus.
Nicht nur der Schulunterricht, auch die Schuldisziplin wurde sehr streng gehandhabt. Hatte man etwas halbwegs Ernsthaftes verbrochen, so bekam man eine schriftliche Verwarnung. Bei der zweiten Verwarnung im Schuljahr flog man von der Schule.
So war es nicht verwunderlich, dass von den etwa 42 Schülerinnen oder Schülern, welche pro Klasse begannen, im Schnitt nur 18 bis 20 die Matura schafften.
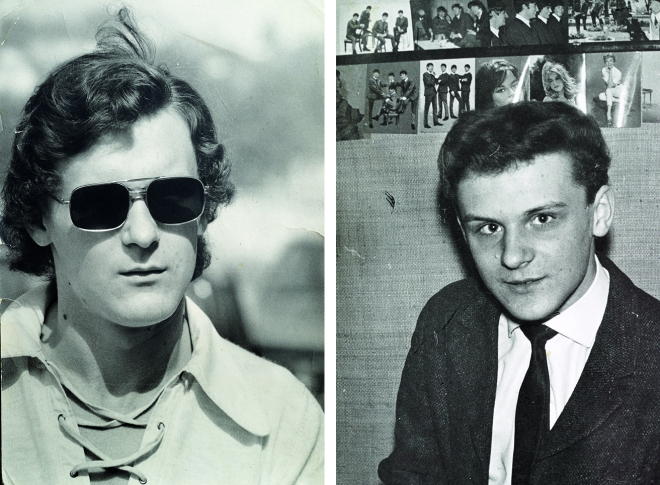
So ändert sich die Zeit... András 1964, András 1965
Das organisierte Rauchen
Seite 29
Seite 29 wird geladen
29.
Das organisierte Rauchen
Ein Disziplinarvergehen am Technikum war auch das Rauchen. Natürlich versuchten vorwiegend Jungs aus den höheren Semestern an versteckten Orten zu rauchen, wo dann Lehrer unvermittelt auftauchten und solchermassen renitente Schüler massregelten.
In den frühen Sechzigern kaufte Ungarn zwanzig Stück der legendären NOHAB Diesel ein, das waren die sechsachsigen dieselelektrischen Lokomotiven aus Schweden. Ich war ein Bewunderer dieser stolzen Maschinen. Sie wurden auch vor leichten Güterzügen eingesetzt, aber vorwiegend vor Personenzügen auf der Paradestrecke um den Balaton.

NOHAB Dieselelektrische Lokomotive aus Schweden.
Der Unterschied zu den normalerweise verkehrenden leichten vierachsigen Diesellokomotiven aus sowjetischer Herkunft, Ludmilla genannt, dann zu den schweren sechsachsigen Varianten namens Sergej, war, dass man, während ein NOHAB Diesel den Bahnhof verliess, nur die ausströmende heisse Luft über den Auspuff zittern sah, während sich bei den russischen Kollegen eine schwarze Wolke über den Lokomotiven bildete. Sergej wurde mitunter auch Taigatrommel genannt, dies wegen des enormen Lärms, den die Lokomotive entwickelte.
Eines Tages ging ich in der Schule nichts ahnend auf die Toilette und pinkelte friedlich vor mich hin. Dann wurde ich darauf aufmerksam, dass sich zwei meiner Schulkollegen fröhlich rauchend über diese neue Lokomotive aus Skandinavien unterhielten und den grössten Blödsinn von sich gaben, etwa über Getriebe und ähnlichen Unsinn. Haarsträubend, denn so eine schwere Lokomotive kann doch niemals über ein Getriebe, geschweige denn über eine Kupplung angetrieben werden. Das Prinzip einer dieselelektrischen Lokomotive besteht darin, dass ein relativ langsam, mit konstanter Drehzahl drehendes Dieselaggregat einen Stromgenerator antreibt, der wiederum den Strom für die Fahrmotoren liefert. Fährt die Lokomotive unter Last, so erhöht sich der Strombedarf, das Drehen des Stromgenerators wird schwerer, so wird dem Dieselmotor automatisch mehr Treibstoff zugeführt und damit bleibt dessen Drehzahl erhalten.
Ich versuchte dies den beiden klar zu machen, als ein Lehrer hereinplatzte. Aha, es wurde geraucht, also entsprechend wurden wir von der Direktion vorgeladen. Vergebens bezeugten meine beiden älteren Kameraden, dass ich nicht mitgeraucht hätte, doch die Direktion meinte, die zwei versuchten wenigsten einen zu decken. Fazit: Wir bekamen alle drei die gefürchtete schriftliche Verwarnung.
Ich kochte vor Wut, so viel Ungerechtigkeit konnte ich nicht ertragen. Die nächste Nacht drehte ich mich im Bett hundertmal hin und her, konnte nicht schlafen und heckte meinen Plan für eine durchschlagende Rache aus.
Das Dumme daran war, dass ich dadurch auch anfing zu rauchen. Die Rache bestand darin, dass ich unter meinen Kollegen das vor den Lehrern sichere, organisierte Rauchen einführte.
Von meiner Tante aus der Schweiz bekamen wir periodisch Pakete, wobei sie die Obergrenze von 20 kg immer schön ausnutzte. Das Schlimmste war, wenn das Paket an einem Freitag ankam und wir mit dem Anschneiden der Stange Salami bis um Mitternacht warten mussten, denn Mutter schaute darauf, dass an einem Freitag kein Fleisch gegessen wurde. Bei diesen Paketen wurde an jedes Familienmitglied speziell gedacht. Ich erinnere mich an die ovalen Schachteln mit den frischen Datteln. Mihály hatte aufgehört Zigaretten zu rauchen, er genehmigte sich hie und da ein Zigarillo oder an ganz besonderen Anlässen eine schöne Zigarre. Diese bekam er auch von meiner Tante, jedes Stück fein säuberlich in einer Aluhülle mit Drehverschluss versorgt.
Diese Aluhüllen nahm ich dann und verteilte sie unter meinen rauchenden Kollegen. Die Hüllen dienten zweierlei Zwecken: Erstens als mobiler Aschenbecher, zweitens jederzeit als sichere Aufbewahrung von angerauchten oder fertiggerauchten Zigaretten. So konnten wir im obersten Stock auf einer Art Empore, von wo aus wir die Treppe beobachten konnten, paffen wie wir wollten. Wenn ein Lehrer auftauchte, verschwanden die Zigaretten in den Aluhüllen, Deckel drauf und ab in die Hosentasche. Der Sauerstoffmangel hatte sie dann rasch ausgelöscht. Klar hatten die Lehrer den dicken Rauch in diesen Räumen bemerkt und auch, dass der Rauch sich nicht abgestanden, sondern noch frisch und warm anfühlte. Aber sie konnten beim besten Willen keine Asche, keine Zigarettenkippen finden, auch nicht nach der Aufforderung, einen Schritt zur Seite zu tun. Sie konnten uns nichts nachweisen, so hatten wir sie zur Weissglut gebracht. So lange sie noch anwesend waren, schmunzelten wir nur, dann aber lachten wir über sie, nur ich konnte denken: Ihr habt mich ja auch mal …
Praktikum Sommer 1964
Seite 30
Seite 30 wird geladen
30.
Praktikum Sommer 1964
Im Technikum waren nicht nur die samstäglichen praktischen Arbeiten angesagt. Es wurde auch verlangt, dass in den fast drei Monaten dauernden Sommerferien ein voller Monat in einem Betrieb, das demselben Ministerium wie die Schule angehörte, gearbeitet wurde.
Meine Mutter war froh, dass der Betrieb, in welchem Mihály eine leitende Position innehatte, den Anforderungen entsprach. So organisierte sie für mich durch ihn einen bequemen, sauberen Job. Ich hätte also in einem Büro aushelfen sollen. Als ich dies vernahm, verkündete ich lauthals: «Nicht mit mir! Ich verbringe nicht einen Monat im Sommer in einem Büro, auf keinen Fall!» Da fragte Mihály: «Was willst du denn?» Ich besprach das mit ihm. Daraufhin organisierte er mir die Sommerstelle in der Werkstatt für firmeneigene Fahrzeuge. Das tönte schon viel besser, die Firma hatte nebst PWs auch etliche Lastwagen, die zu betreuen waren.
Die schöne Bürostelle gab ich der Schulkollegin Ilona weiter, die dafür sehr dankbar war.
Die Werkstatt war für meine Begriffe riesig, mit Hebebühnen und mehreren Gruben, um die Fahrzeuge zu warten und zu reparieren. Für mich war es ganz aufregend, an richtigen Autos, PWs oder LKWs Hand anzulegen, mitzubekommen, wie sie funktionierten, die Finger zu verbrennen beim Ablassen vom heissen Motorenöl, zu lernen, Drehmomentschlüssel einzustellen und zu verwenden und vieles mehr.
Eines Tages, wieder in einer Grube arbeitend, fiel mir etwas auf. Zuerst bemerkte ich es gar nicht richtig, doch dann realisierte ich es: Die Beine, die ich von einer vorbeigehenden Person aus dieser Perspektive wahrnehmen konnte, steckten nicht in den üblichen Arbeitskleidern, sondern in Strümpfen – ein ungewohnter Anblick in der Werkstatt! Doch dann vernahm ich eine mir bereits vertraute Stimme: «Wo ist András?» Ich eilte zur Treppe, die aus der Grube führte und an der Oberfläche erblickte ich Ilona, meine Schulkollegin mit einem grossen Sack in der Hand. «Ich habe Glacé mitgebracht!» verkündete sie und dann: «Aber für euch alle!» Es gab ein riesiges Hurra, alle liessen die Werkzeuge fallen. Wir standen alle im Kreis und schlemmten unsere Leckerbissen. Von da an war sie ein gern gesehener Gast in unserer Werkstatt, ob mit oder ohne Glacé. Einmal, als sie kam, rannte der Werkstattleiter davon und erschien bald wieder mit einem grossen Sack Glacé.
Manchmal holte sie mich nach Arbeitsschluss ab und wir schlenderten auf dem Werksgelände umher, da sie eine Stunde später als ich ausstempeln musste. Das muss ich der Leserschaft auch erklären:
In Ungarn ticken die Uhren gleich wie in der Schweiz, in der Zeitzone «Mittel Europäische Zeit», MEZ oder UTC 1. Die Sonne hingegen, weil Ungarn auf dem gleichen Breitengrad über 1‘000 km weiter östlich liegt als die Schweiz, geht etwa eine Stunde früher auf. Zwischen Genf und Debrecen beträgt diese Differenz genau eine Stunde. So kommt es, dass auch «das Leben» in Ungarn früher erwacht. In Werksbetrieben wurde von 6:00 bis 14:00 Uhr gearbeitet, in Büros und Verwaltungsbetrieben von 7:00 bis 15:00 Uhr.
Ich ging also um 14:00 Uhr rasch duschen, mich umziehen und Tag für Tag immer freudiger vor das Werkstatttor. Hatte ich Ilona dann erblickt, nahm mein Herz einen immer grösseren Satz. Als wir die Werkstore verliessen, nahmen wir den gleichen Weg bis in die Innenstadt, wo dann die Entscheidung fällig war: Musste sie gleich nach Hause oder konnten wir noch etwas unternehmen? Der Stadtpark mit etlichen Attraktionen war in der Nähe: Széchényi Strandbad, Zoo, Lunapark, Verkehrsmuseum und vieles mehr. Ausserdem war der Park wunderschön angelegt mit Rasenflächen zum Verweilen, exotischen Pflanzen und Bäumen, die sich auf einer Tafel erklärten. Ein künstlicher See bot Tummelplatz für Modellbootsbauer, auf einem anderen konnte man selber Paddelboot fahren. Etliche Bänke im Schatten der Bäume luden ein, eine Pause zu machen.
Kam sie jedoch nicht, so schlenderte ich alleine zur Vorortbahn, die mich Richtung Innenstadt brachte. Die Endstation war ganz nahe beim grossen Ostbahnhof, da konnte ich mich ins Betrachten der Lokomotiven und Wagen vertiefen. An diesem Bahnhof kamen auch internationale Züge an – ein Leckerbissen für einen Freund von allem, was Räder hat.
Das grosse Erlebnis
Seite 31
Seite 31 wird geladen
31.
Das grosse Erlebnis
In diesem Sommer erwartete mich noch etwas anderes, Atemberaubendes:
Meine Eltern und Kati waren im Frühjahr 1964 mit einem regulären Besucherpass zu Besuch bei Mutters Zwillingsschwester in der Schweiz. Im gleichen Haushalt lebten auch ihre Eltern. Ich blieb zu Hause, nicht nur wegen der Schule, sondern auch als eine Art Pfand. Es war üblich, Teile einer Familie reisen zu lassen, sofern ein Familienmitglied zurückblieb, von welchem man vermutete, dass man es nicht allein lassen wollte. Ich war in dieser Zeit bei den Redlers untergebracht, also bei Mutters Cousine Anikó. Unterdessen war Károly nach erfolgreich erledigtem Auftrag in der Puszta als Sachverständiger ins Ministerium befördert worden. Sie wohnten also in Budapest, wieder an exklusiver Lage am Rande eines kleineren Stadtparks mit einem Seelein. Ihre relativ grosszügige Wohnung bot mir Platz für diese drei Wochen, zumal ihre Tochter bereits geheiratet hatte und ausgezogen war.
Nach dem ersten Sommerpraktikum 1964 wartete das grosse Abenteuer auf mich. Nachdem die Eltern mit meiner Schwester Kati planmässig zurückgereist sind, bekam ich den Reisepass in die Schweiz. Am Ostbahnhof in unserer Nähe setzten mich meine Eltern in den Zug und die Reise begann. Der Wienerwalzer fuhr in die Nacht hinein, um am nächsten Tag in Basel anzukommen.
An der ungarisch-österreichischen Grenze war unser Abteil noch einigermassen voll. Es waren österreichische und deutsche Geschäftsleute, die man eh nicht scharf kontrollierte. Ich besass wenig Gepäck und meine Papiere waren in Ordnung, also die Grenzkontrollen verliefen ohne Verzögerungen. In Wien, Innsbruck und auch Salzburg leerte sich mein Abteil, die Leute stiegen aus oder um. An der Grenze zur Schweiz sass ich bereits alleine im Abteil. Der Schweizer Zöllner kam, sah meine Papiere an und fragte nur: «Schnaps dabei?» Ich schüttelte den Kopf.
Dazu muss ich etwas vorausschicken. Schnaps brauchte ich nicht mitzunehmen, denn mein Onkel und mein Grossvater führten den ungarischen Spezialitätenladen in Basel, sie verkauften also selber Schnaps aus Ungarn. ABER: In einer ungarisch geführten Küche kennt man keine aromatisierten Essigsorten, weder Apfel- noch Wein- noch andere Essigderivate. In der ungarischen Küche wird reine Essigessenz verwendet. Diese ist geschmacklos, also reine Essigsäure. So kann diese ganz konzentriert gekauft werden, also 20%-ig, das entspricht etwa der vierfachen Stärke verglichen mit den üblichen Essigsorten, musste also zum Gebrauch mindestens 1:4 verdünnt werden. Warum auch immer, diese Art Essig war in der Schweiz nicht zu beschaffen. So gab mir meine Mutter zwei Literflaschen reine Essigsäure mit, damit ihre Schwester Salat und sonstige Gerichte auf ungarische Art herrichten konnte.
Der Zöllner stöberte in meinem Gepäck und in den Kleidungsstücken, schön eingebettet fand er die zwei Flaschen glasklarer Flüssigkeit. Sein Gesichtsausdruck sagte aus: «Habe ich ja gedacht!» Die Etikette konnte er nicht entziffern, so schraubte er den Deckel ab, setzte seine Nase an die Flasche und zog den Duft hoch. Es kam, wie es kommen musste: Plötzlich bekam er fast keine Luft, sein Gesicht lief tiefrot an und seine Augen tränten. Wortlos drückte er mir die Flasche und den Deckel in die Hand und verliess das Abteil so schnell er konnte.
In Basel angekommen wurde ich von Pityu abgeholt. Bei ihnen zu Hause erwarteten mich mit Freudentränen in den Augen meine Tante und meine Grosseltern. Klar waren wir alle sehr gerührt, hatten sich doch alle von ihnen damals in Budapest auf irgendeine Art an meiner Erziehung beteiligt, und das in ausgesprochen schwierigen Zeiten. Meine Tante, die einige Male statt Fahrkarten zu lösen von der Arbeit kilometerlang heimgelaufen ist, damit sie mir ein Stück Schokolade kaufen konnte. Meine Grossmutter, die 50 g Schinken kaufte, weil ich Schinken überaus gern hatte und mir einredete, dass sie nur den Rand gerne hat mit der Fettschicht daran. Nur um zwei Beispiele zu nennen.
Dann genoss ich als Stadtkind in Grellingen die herrlich grüne Landschaft mit den sanften Hügeln, den weidenden Kühen – es war für mich eine völlig unbekannte Umgebung, somit Ferienstimmung pur.
Mein Onkel, meine Tante, wie auch mein Grossvater gingen ihrer Arbeit nach. Meine Grossmutter war also am Betreuen der beiden Enkelinnen. Ich war mehr als zufrieden in dieser Umgebung, atmete die bisher unbekannte Landluft ein. Doch manchmal, wenn meine Tante freinahm und auf ihre Kinder aufpassen konnte, nahm mich meine Grossmutter mit nach Basel. Wir gingen dann in ihr bevorzugtes Café «Pellmont» an der Freien Strasse, denn ihre Devise war: «Lieber weniger oft, dafür aber ganz fein.» Anschliessend schlenderten wir Basels Einkaufsstrasse hinunter.
Damals war es in den Ländern des Warschauer Paktes für Normalbürger verboten, westliche Devisen zu besitzen. Mit einem Reisepass hingegen bekam man das Recht, eine gewisse Menge davon zu kaufen. In meinem Falle waren es nach Bezahlen von Visum und Fahrkarte noch CHF 30.–, mit denen ich in die Schweiz reiste. Ich entdeckte auch zwei Sachen, die ich unbedingt kaufen musste:
Einerseits das Modell einer französischen Lokomotive für meine Modelleisenbahn. Eine futuristisch anmutende Elektrolokomotive mit an beiden Enden rund um den Führerstand laufenden Panoramafenstern. Das Modell kostete damals CHF 14.–, dies bezeugt das Preisschild an der Originalschachtel, die ich heute noch hüte.
Dann fiel mir ein herziges Schürzlein auf, gerade passend für meine Schwester Kati. Das habe ich auch gekauft und somit war mein Geldvorrat so ziemlich verbraucht.
Meine Grosseltern wollten aber auch, dass ich wenigstens etwas von der wunderschönen Schweiz erleben kann. Mein Grossvater, der den ungarischen Spezialitätenladen führte, hatte bereits einige Freunde. Einer dieser guten Bekannten besass einen stationären Wohnwagen an einem grösseren Campingplatz am Hallwilersee. Der Freund bot an, uns ein Wochenende lang dort zu beherbergen. Sie holten uns in Basel mit ihrem Renault Dauphine ab. Später sollte ich eine ganz besondere Bekanntschaft mit diesem kleinen, sympathischen französischen Automobil schliessen. Das Auto war schon flink, doch mit fünf Personen und Gepäck an Bord bekundete das 850 cm³ Motörchen schon etwas Mühe. Entsprechend wurden wir etliche Male überholt, worauf unser Fahrer mit erbosten Sprüchen reagierte.
Der Campingplatz war recht gross, so gross sogar, dass an beiden Enden je ein Openair stattfinden konnte, das eine mit Unterhaltungsmusik für die mittleren und älteren Semester, das andere mit Rock und Twist für die Jüngeren. Ein Stück Wiese diente als Tanzfläche für die Jugend, doch getanzt wurde überall, selbst auf den Bänken. Die Bewegungen waren nicht schwer nachzumachen und zum Tanz auffordern musste man auch niemanden, es tanzten ja bereits alle und überhaupt nicht in Pärchenformation. Natürlich wurde ich mitgerissen.
Dann fiel mir auf einmal auf, dass eines der Mädchen immer wieder mir gegenüber tanzte. Die Band wechselte und dadurch entstand eine Pause. Das Publikum ging an seine Plätze zurück oder formierte Gruppen, lauthals diskutierend, lachend. Bevor ich mir überlegen konnte, was ich nun machen sollte, nahm das Mädchen meine Hand, zog mich vom Platz und wir gingen spazieren. Sie merkte bald, dass eine Konversation nicht zustande kommen konnte, so gingen wir Hand in Hand weiter, bis sie mich ganz unvermittelt auf die Seite zog und küsste. Lang und innig, wie die Grossen. Dann gingen wir zu der Musik zurück.
Es war für mich eine enorm aufregende Erfahrung. Nicht unbedingt der erste Kuss mit einem Mädchen, aber auf diese Art dann schon. Viel mehr aufgewühlt hatte mich die Erkenntnis, dass man jemanden auf diese Weise küssen kann, nur weil es im Moment Spass macht.
Pfarrers Goggomobil
Seite 32
Seite 32 wird geladen
32.
Pfarrers Goggomobil
In diesem Sommer nahmen mich meine Tante und Pityu nach dem sonntäglichen Mittagessen mit nach Kleinlützel, in dieses idyllische Dorf unweit von Grellingen an der französischen Grenze. Grund war der Pfarrer, den sie gut kannten, weil er auch aus Ungarn stammte. Wir plauderten und er interessierte sich für meine Geschichten aus Ungarn, über das Leben in Budapest und auch über meine bisherige Ausbildung. Als ich mit wachsender Begeisterung vom Technikum erzählte, stand er auf, holte einen kleinen Schlüsselbund und meinte lächelnd: «Wir wollen dich nicht mehr langweilen, mein Junge. Ich bekam gerade meinen Dienstwagen, steht am Kirchplatz in der Box 5. Du kannst es gerne unter die Lupe nehmen und auf dem Kirchplatz auch ausprobieren.»
Ich bedankte mich, ging schnurstracks zur Box 5 und öffnete das Tor. Da lachte mich ein Goggomobil an, ein schmuckes Wägelchen aus dem Hause Hans Glas GmbH, ein ehemaliger Motorradhersteller. Damals wollten immer mehr Töff-Fahrer eher auf vier Rädern und mit Heizung durch den Winter fahren und so sahen sich Motorradhersteller genötigt, Kleinwagen herzustellen. Ich schob das Auto aus der Box und betrachtete es eingehend, denn zu Hause sah man nur Autos aus planwirtschaftlicher Herstellung.
Dann fiel mir etwas ein … Ich war mal bei einem meiner Schulkameraden zu Hause, als er einen Schlüsselbund abhängte und wir zu einem leeren Grundstück gingen, an dessen Rand eine Reihe Autoboxen standen. Er machte ein Garagentor auf und schob einen Wartburg hinaus – ein schönes Auto, zweifarbig, mittelblau und crème mit tollen Rundungen. Wartburg war eine Burg in Eisenach, wo das Automobilwerk Eisenach die gleichnamigen Autos produzierte, basierend auf den Genen der DKW F9 der Auto Union, eine in Ungarn sehr beliebte Marke, schnell, leichtfüssig, relativ einfach zu bedienen mit leichtgängiger Lenkung und Pedalerie.
Im Technikum lernten wir den Aufbau eines Autos kennen und konnten Sachen ausprobieren anhand von 1:1-Schnittmodellen. So war es nicht verwunderlich, dass Pali plötzlich hinter dem Steuer Platz nahm und mir andeutete, auch einzusteigen. Er drehte einige Runden auf dem grossen, leerstehenden Grundstück, hielt an und meinte, das könne ich auch ausprobieren, wenn ich wollte. Natürlich wollte ich, so tauschten wir die Plätze. Das erste Mal anfahren ging etwas holprig, doch das Auto rollte. Zweiter Gang und ich fuhr auch einige Kreise auf dem Grundstück. Dann versorgten wir das Auto.
Der Gedanke, dass ich einmal ein richtiges Auto bewegen durfte und konnte, liess mich nicht los. So sass ich im Goggomobil hinter dem Lenkrad und probierte im Stehen die Gänge durchzuschalten. Und den Zündschlüssel hatte ich auch …
Also gut, in Gottes Namen. Ich drehte am Schlüssel und das Motörchen erwachte. Erster Gang und die erste Runde am Kirchpatz. Je besser das ging, umso enger erschien mir der Kirchplatz. Es kam, wie es kommen musste – plötzlich war ich auf der Strasse vor der Kirche. Das war die Durchgangstrasse nach Frankreich, aber das wusste ich nicht. So fuhr ich fröhlich weiter, es gab nahezu keinen Verkehr. Und dann wurde es mir plötzlich unheimlich. Die Strassenmarkierung war unbekannterweise gelb aufgemalt und die Strassenschilder sahen auch ungewohnt anders aus. Bei der nächsten Gelegenheit wendete ich und fuhr zurück. Erst auf dem Rückweg realisierte ich die Grenzstation, wo ich meine Tante, meinen Onkel und den Herrn Pfarrer erblickte. Ich wurde durchgewunken, hielt an und gab dem Herrn Pfarrer die Schlüssel zurück.
Auf dem Heimweg schilderten sie mir, wie unzimperlich die französische Polizei mit so dubiosen Typen umzugehen pflegte: Fünfzehnjähriger ohne Französisch- oder Deutschkenntnisse, der keinen Pass vorweisen konnte, geschweige denn einen Führerschein …
Jahre später erlebte ich Ähnliches mit der Basler Polizei mit dem Unterschied, dass alle meine Papiere in Ordnung waren, nur eben hatte ich sie bei der Kontrolle nicht bei mir …
Praktikum Sommer 1965
Seite 33
Seite 33 wird geladen
33.
Praktikum Sommer 1965
Nachdem ich bereits zwei Jahre Technikum absolviert hatte und den Vorschlag zum Weitermachen erhielt, war das nächste Sommerpraktikum fällig. Diesmal hatte ich es rechtzeitig vorbereitet und bekam mit Mihálys Hilfe die Stelle beim grossen Autobushersteller IKARUS nördlich von Budapest.
In der, für die Warschauer-Pakt Staaten seitens der Sowjetregierung diktierten Planwirtschaft wurde auch der Fahrzeugbau zentral gesteuert. Abgesehen von kleineren Manufakturen wurde die Massenherstellung aufgeteilt: Die UdSSR lieferte Flugzeuge und Lokomotiven, einschliesslich U-Bahn Züge. Die Tschechoslowakei war zuständig für Strassenbahnzüge. An der Personenwagenproduktion waren UdSSR, DDR, Tschechoslowakei, Polen und Rumänien beteiligt. Autobusse stellte Ungarn her. Diese sah man dann nicht nur in den Ländern des Warschauer-Pakts, sondern sogar in China und der Mongolei, zum Teil auch in der westlichen Hemisphäre. In Insiderkreisen legendär wurde der Ikarus 55, einer der ersten Autobusse mit Heckantrieb und selbsttragendem Aufbau. Charakteristisch war die Heckansicht mit dem wie ein Rucksack angehängten Antrieb. Diese Modelle als Linien- oder Fernbus sieht man heute noch an nostalgischen Treffen. Einige Busbetriebe in Deutschland bieten mit so einem Fahrzeug Fahrten an Grossanlässe an.
Meine Aufregung war also riesengross, als ich das erste Mal durch das sonst so streng bewachte Werkstor schreiten durfte. Ich wusste bereits um die historische Bedeutung dieser im vorherigen Jahrhundert, genau gesagt im Jahre 1895, gegründeten Manufaktur, die dann ab 1912 Reisebusse herstellte. Was ich damals nicht wissen konnte: In den 1980er-Jahren wuchs Ikarus zum weltgrössten Autobushersteller mit jährlich 15‘000 hergestellten Einheiten von Linien- und Reisebussen sowie elektrisch angetriebenen Oberleitungsbussen heran. Westliche Länder wurden auch mit Ikarus-Bussen beliefert, allerdings mit den ebenfalls in Ungarn hergestellten MAN Motoren.
Mir wurde meine Arbeit gezeigt: In der riesigen Endmontagehalle sollte ich gleich zum Arbeitsbeginn die an diesem Tag benötigten Seitenscheiben aus dem Lager holen, mitsamt den dazugehörenden Gummidichtungen. Hierzu bekam ich einen Plattformwagen, den ich wie einen Leiterwagen hinter mir herzog. Die Berechnung wurde mir überlassen: Staple ich die Fenster hoch, habe ich schwer zu ziehen. Staple ich niedriger, muss ich öfters fahren. Ich hatte beides ausprobiert, bis ich das richtige Mass für mich fand. Bei dieser Arbeit ersetzte ich einen Betriebsangehörigen, der wegen seiner langjährigen, ausgezeichneten Arbeit als Dank und Auszeichnung einen Monat Sonderurlaub erhalten hatte, davon zwei Wochen mit Familie in einem der werkseigenen Hotels auf Kosten des Betriebes. Das wusste ich, weil die Mitarbeiter mit Auszeichnung in einem grossen Schaukasten am Werkseingang mit Foto gezeigt wurden.
Auch in diesem Betrieb fing die Produktion um 6:00 Uhr morgens an. Diese stoppte dann um 10:00 Uhr für eine halbstündige Pause, damit sich die Leute erholen und verpflegen konnten. Nach ein paar Tagen Arbeit war ich gewöhnlich zu diesem Zeitpunkt mit meiner Tagesarbeit fertig, aber nicht, weil ich so überaus flink gewesen wäre. Es lag ganz einfach am Arbeitsvolumen.
Die meisten, das heisst nahezu alle Betriebe waren verstaatlicht. Verschont blieben nur ganz kleine oder solche mit hoher ausländischer Beteiligung. Alle staatlichen Betriebe waren verpflichtet Leute einzustellen, ob genügend Beschäftigung vorhanden war oder nicht. In den meisten war naturgemäss nicht genügend Arbeit für alle Beschäftigten vorhanden, also musste das Arbeitsvolumen auf mehrere Mitarbeiter aufgeteilt werden. Bei den immer wieder vorkommenden polizeilichen Kontrollen musste nicht nur ein Identitätsnachweis vorgewiesen werden, sondern auch ein Beschäftigungsnachweis. Ohne diese Ausweise wurde man zwecks Abklärung geradewegs abgeführt. Nicht alle, doch sehr viele Beschäftigte mussten lernen, die Tagesarbeit auf den ganzen Tag aufzuteilen. Diesbezüglich war ich noch ungeübt, so musste ich schauen, was ich nach der Pause machen sollte. Das wiederum fiel mir gar nicht schwer. Die Produktion von bereits modernisierten Autobussen bot mir tausende spannende Schauplätze. Ich will hier nicht im Detail darauf eingehen, nur auf eine besondere Begegnung:
Bei meinen Streifzügen stiess ich auf das werkseigene Versuchsgelände – ein grosses Gelände mit den unterschiedlichsten Strassenbegebenheiten: Von mit Schlaglöchern übersäter Strasse über unruhigen Kopfsteinpflasterbelag bis hin zu der Hochgeschwindigkeitspiste mit überhöhten Kurven gab es alles. Am Rande standen Prototypen zur Erprobung, kleine, mittlere und grosse Busse. Ich hatte diese gerade unter die Lupe genommen, als jemand erschien.
«Hey, Junge, interessieren dich die Sachen hier?», fragte er. Ich nickte nur und er fuhr weiter: «Wollen wir eines ausprobieren?» Er merkte, ich war zu sehr überwältigt, um eine Antwort zu geben. So ging er in sein Kabäuschen neben der Piste, hängte einen Schlüssel ab und winkte mir, mitzukommen. Wir bestiegen einen mittelgrossen Bus und das Abenteuer startete. Zuerst wurden wir auf schlechten Strassen durchgeschüttelt, dann ging es aber auf eine rasante Runde über die Steilwandkurven. Es war für mich wie Achterbahnfahren im Vergnügungspark, nur noch spannender.
Am Ende der Fahrt fragte er mich, ob es Spass gemacht hätte. Anhand meiner Sprachlosigkeit merkte er, wie sehr ich beeindruckt war.
Am nächsten Tag nach der grossen Pause ging ich geradewegs auf das Versuchsgelände. Ich musste nicht lange warten und mein Versuchspilot erschien. «Heute müssen wir einen Grossen ausprobieren, der bekam neue Stossdämpfer und diese muss ich nun beurteilen», sagte er und holte den Schlüssel. Es war wirklich ein ganz grosser Gelenkbus und er wies mich an, hinten Platz zu nehmen. Nach ein, zwei atemberaubenden Runden fragte er mich, wie ich die Federung dort hinten empfand. «Weisst du», meinte er, «ich muss wissen, wie du die Schwingungen empfunden hast, zu abrupt, angenehm oder zu weich». Ich versuchte ihm das Erlebte möglichst klar zu schildern und er machte seine Notizen.
Nach ein paar Tagen fragte er mich, ob ich nun selbst etwas ausprobieren möchte. Völlig überrascht von der Frage, war es lediglich meine Körpersprache, die ihm die Antwort gab. Schmunzelnd hängte er den Schlüssel zu einem sogenannten Mikrobus mit ungefähr zwanzig Plätzen ab. Ich setzte mich hinters Steuer, und nachdem wir den Sitz eingestellt hatten, meinte er: «Jetzt geht es los – auskuppeln, ersten Gang einlegen, gleichzeitig etwas mehr Gas geben und die Kupplung langsam mit Gefühl loslassen.»
Ich wusste bereits: Mit einem Goggomobil ging es ganz gut, aber siehe da, auch das für mich riesige Fahrzeug setzte sich in Bewegung.
«Jetzt etwas mehr Gas geben, Kupplung drücken, zweiten Gang einlegen, Kupplung diesmal rasch kommen lassen, kontinuierlich Gas geben.»
Es funktionierte. Ich war schlicht überwältigt. Ich realisierte, dass ich Auto fahre und das mit nur sechzehn Jahren. Dann kam der dritte Gang, damit fuhren wir bereits einige zusammenhängende Runden. Es folgte das Herunterschalten, schon viel schwieriger … möglichst ruckfrei anhalten – auch eine Challenge. Doch mein Lehrer war zufrieden und am nächsten Tag wiederholten wir die Übung in einer grösseren Runde. Da sagte er: «Das kannst du bereits ganz gut. Ich hänge den Schlüssel zu diesem Kleinbus im offenen Bereich auf, du kannst ihn jederzeit holen. Ich bin nächste Woche auswärts beschäftigt und du kannst nach Belieben üben.»
Zuerst konnte ich meinen Ohren nicht trauen, doch sein ernster Gesichtsausdruck holte mich in die Realität zurück. Ich bedankte mich und wünschte ihm eine gute Zeit.
Am nächsten Tag hatte ich gar keine Pause gemacht, stattdessen eilte ich zu «meinem» Kleinbus. Schlüssel abgehängt, eingesteckt, Motor gestartet und losgefahren. Puls etwa bei 120, wenn das reicht. Aber es ging sehr gut und ich probierte immer unterschiedlichere Pisten aus.
So verging meine Praktikumszeit im Fluge und ich erlebte sie tausendmal aufregender als an irgendeinem Strand liegend.
Was ich damals nicht ahnen konnte, war, wie nützlich diese Übung später einmal sein sollte. Auf unserer Weltreise hatten wir in Australien ein Motorhome gemietet, aus Gründen der Bequemlichkeit einen Vierplätzer. An einem Sonntag mit dem legendären GHAN in Adelaide angekommen, übernahmen wir unser Wüstenschiff für fünf Wochen, nur eben nicht das Bestellte. Es stellte sich heraus, dass durch ein Versehen unser Vierplätzer bereits weg war, so mussten wir uns mit einem Sechsplätzer «zufriedengeben». Es war ein 7,5 Meter langes Ungetüm auf Lastwagenbasis mit Doppelbereifung hinten, Halbgängen und Motorbremse. Trockengewicht 4,5 Tonnen und mit einer Höhe, dass wir einige schöne Plätze in den Campings umtauschen mussten, da die untersten Äste der schattenspendenden Bäume zu tief für unser Riesenmöbel hingen. Aber das Ding war herrlich zu fahren, bei den PWs vermisse ich heute noch die angenehme Motorbremse.
Der verlorene Sohn
Seite 34
Seite 34 wird geladen
34.
Der verlorene Sohn
Meine Mutter und ihre Zwillingsschwester hatten eine ein bisschen ältere Cousine, die auch so etwas wie ihre Freundin war. Sie hatten viel miteinander erlebt und egal, wohin es die Einzelnen von ihnen verschlug, sie blieben einander treu.

Meine Mutter und ihre Cousine Anikó.
Die Cousine hiess Anikó und heiratete einen bemerkenswerten Mann, einen Bauingenieur. Er war nicht nur tüchtig, nein, er war auch ein exzellenter Fachmann und obendrein noch strebsam. Er war alles andere als Kommunist, doch trat er der Kommunistischen Partei bei, denn ohne die Parteimitgliedschaft kam man keinen Schritt voran. Er wollte aber weiterkommen, er wollte etwas erreichen, etwas erschaffen. So kam es auch: Er wurde beauftragt, in der ungarischen Puszta die lebensmittelverarbeitende Industrie aufzubauen.
Die ungarische Puszta erstreckt sich im östlichen Teil des Landes, also östlich der Donau – eine Art Steppe. Sie wird von einem sehr zahmen Fluss, der Theiss, durchquert, an deren Ufern die Leute friedlich fischten. Sie nannten sie liebevoll «Szöke Tisza» also «Blonde Theiss», weil deren Sandboden ihr Wasser gelblich färbte. Aber dieser Fluss kann, besser gesagt konnte, ungeahnt böse werden. Wenn in den Karpaten, wo er herkommt, der Winter sehr schneereich war und der Frühling rasch einsetzte, wurde aus diesem lieblichen Fluss eine Bestie. Tosend übertrat er alle seine Ufer, verwüstete angrenzende Ländereien und zerstörte 1879 Szeged, die drittgrösste Stadt Ungarns mit ca. 150‘000 Einwohnern zu 95 %. Der ungarische Dichter Sándor Petöfi umschrieb so eine Überschwemmung mit den Worten: «Mint egy örült, ki letépte láncát, vágtatott a rónán át …» oder etwa «Wie ein Wahnsinniger, der sich seiner Ketten entledigt hatte, fegte der Fluss durch die Landschaft.» Daraufhin wurde der Fluss begradigt, von dem über 1‘400 km langen, sehr kurvenreichen Flusslauf blieben nicht mehr ganz 1‘000 km übrig. Die Ufer wurden verstärkt, in den angrenzenden Ortschaften Dämme gebaut, dazwischen gezielte Überschwemmungsgebiete errichtet.
Die Puszta links und rechts der Theiss war ursprünglich wenig bebaubar, wies grossflächig Treibsand auf, der dann mit reihenweise gesetzten Akazienbäumen gebändigt wurde. Diese sind sehr genügsam, vertragen lange, heisse Perioden ohne Bewässerung. Im Frühling blühen sie mit herzigen weissen Blüten, die einen berauschenden Duft verbreiten. So wurde auch dieses Gebiet Ungarns Ackerland, auf welchem sonnenliebende Gemüsearten kultiviert werden konnten. Diese wurden dann für die Zeiten nach der Saison industriell verarbeitet, das bedeutete, es mussten Konserven- und Tiefkühlfabriken errichtet werden. Genau diese Aufgabe bekam Károly, Cousine Anikós Ehemann.
Sie wohnten in Szolnok, der Hauptstadt des grössten Komitats der Puszta, in einer für ungarische Verhältnisse luxuriösen Wohnung am Rande des Stadtparks. In einem Jahr konnte ich einen Teil der Sommerferien dort verbringen und lernte ihre beiden Kinder kennen. Der Sohn hiess natürlich auch Károly wie der Vater, und wir nannten ihn Karesz. Er war etwa vier Jahre älter als ich und seine Schwester, nochmals vier Jahre älter, hiess Hugi. Es waren tolle Ferien, raus aus der Grossstadt, in der Nähe des Spiel- und Sportplatzes ohne Grossmutter, die ständig Angst hatte, wenn ich eine Strasse überqueren wollte. Hier war ich auch das erste Mal im Kino, es waren Freilichtvorstellungen. Ganz genau erinnern mag ich mich heute noch an eine italienische Produktion mit Gina Lollobrigida. Es war eine Trilogie und die einzelnen Teile hiessen «Brot», «Liebe», «Fantasie».
Karesz war ein überaus aufgeweckter Junge, von dem ich eine Portion Frechheit lernen konnte. Doch mit ihm wurde es dann ganz dramatisch.
1956, als der Aufstand ausbrach und die Grenzen für einige Zeit offen waren, war er gerade zwölf Jahre alt. Irgendwie ging er alleine los und landete in Österreich in einem der Auffanglager. Wie auch immer, er hatte dort erklärt, dass er Verwandte in Kanada hätte, das hatte er bei Gesprächen der Eltern und Verwandten aufgeschnappt. Tatsächlich wurde er eingeschifft, landete in Kanada und mit Hilfe des Internationalen Roten Kreuzes wurde er bei seinen Verwandten abgeliefert.
Diese waren kinderlose Industrielle und nahmen den Knaben mit Freude und offenen Armen auf. Sie fanden in ihm nicht nur einen aufgeweckten, tollen Jungen, sondern auch die Hoffnung auf den bisher fehlenden Nachfolger.
Doch Mutterliebe artet manchmal in Affenliebe aus. Anikó war blind und sah die Zukunft ihres Sohnes nicht, sie konnte einfach nicht verarbeiten, ihren Sohn zu verlieren. Leider verdiente ihr Mann in seiner leitenden Position so gut, dass sie es sich leisten konnte, monatlich mit ihrem Sohn lange zu telefonieren. Das nutzte sie auch erfolgreich aus, um ihren «Jungen heimzuweinen».
Karesz kam dann sechszehnjährig tatsächlich nach Ungarn zurück. Er hatte auch seine Lieblingsspielzeuge mitgebracht, darunter Indianerklamotten inklusive Plastikwaffen. Eines Tages kamen auf dem Spielplatz zwei Männer vorbei und nahmen ihn samt Spielzeug mit – unerlaubter Waffenbesitz. Während des Verhörs wurde ihm nahegelegt, seinen Kameraden über Kanada zu erzählen und anschliessend über deren Reaktionen zu berichten. Karesz sagte: «Das mache ich nicht!» Selbst nach einigen Drohungen blieb er bei seiner ablehnenden Haltung. Er wurde daraufhin heimgebracht.
Ein anderes Mal wurde er auch mit irgendeinem Vorwand mitgenommen. Das Spiel wiederholte sich mit der Drohung: «Du kommst bei uns noch dran.»
Das geschah dann, als er zum Militär einberufen wurde. Sie hatten ihn dort regelrecht fertiggemacht. Wir mussten ihn mehrere Male im Militärspital besuchen. Er hatte drei Selbstmordversuche überlebt, allerdings mit mehreren Operationen, darunter einen halbierten Magen, nachdem er rostige Nägel geschluckt hatte.
Ob seine Mutter dabei begriffen hat, was sie mit ihrer egoistischen Affenliebe angerichtet hatte, können wir nicht wissen.
Später verstand ich, dass Karesz‘ Schicksal meine Mutter darin bekräftigt hatte, das Land zu verlassen. Wir hatten ja seit 1956 Verwandte in der Schweiz, auch mir hätte es blühen können, dabei auf ähnliche Art benutzt zu werden. Auch bei mir vermutete meine Mutter ein diesbezügliches «Nein», und deshalb setzte sie alles daran, die Familie ausser Landes zu bringen, bevor ich ins Militär einberufen würde, selbst wenn es nicht ihr einziges Motiv dazu war.
Mihály, ihr Mann, hatte bereits eine Position erreicht, die in der damaligen Zeit brenzlig werden konnte. Nun warum? Ab einem gewissen Verantwortungsbereich war es jederzeit möglich, dass man in Ungnade fiel, und dann war die Zukunft ungewiss. Von Verhaftungen bis hin zum spurlosen Verschwinden vernahm man alles. Auch bei seinem Vorgänger wusste man nicht, was mit ihm geschehen war. Es ist also nicht verwunderlich, dass meine Mutter diesbezüglich ebenfalls kalte Füsse bekam und ihre Bereitschaft immer grösser wurde, Ungarn zu verlassen.
Mutters Hürdenlaufen
Seite 35
Seite 35 wird geladen
35.
Mutters Hürdenlaufen
Die Reisepässe, die wir für den Besuch in der Schweiz hatten, waren zwar zwei Jahre gültig, aber nur für eine einmalige Ausreise. Allerdings konnte man diese im Verlauf dieser zwei Jahre nochmals für eine erneute Ausreise aktivieren. Genau das war der geniale Plan unserer Mutter. 1964 im Frühling bekamen Mutter, Mihály und Kati die Pässe. Als sie heimkamen, bekam ich den Pass. Unsere Mutter dachte, nachdem alle wieder heimgekehrt waren, würden die Behörden nicht mehr ganz so misstrauisch sein und den Stempel geben. Ausserdem waren unsere Namen unterschiedlich und die Gesuche hatten wir zu verschiedenen Zeiten eingereicht. Doch davor galt es für sie noch einige Hürden zu überwinden.
So ein Gesuch musste für jede Person der zuständige Parteisekretär empfehlen, ausser bei meiner kleinen Schwester, da mussten einfach beide Elternteile unterschreiben. Meine Mutter und Mihály hatten an ihren Arbeitsstellen einen so guten Leumund, dass der jeweilige Parteisekretär ihre Gesuche ohne Diskussionen unterschrieb. Das wäre alles soweit gut gegangen, aber in meinem Fall stiess meine Mutter auf mehrfachen Widerstand:
Da ich noch minderjährig war, musste mein leiblicher Vater mitunterschreiben. Er verweigerte jedoch die Unterschrift, weiss Gott warum. Das wird ihm wohl seine Frau befohlen haben. Gutes Zureden seitens meiner Mutter half nichts, so ging sie zu seinem Vorgesetzten. Die Leute in der Behörde, in der er arbeitete, hatten ja seit seiner Scheidung von meiner Mutter wenig Verständnis für seine neue Ehe gezeigt und seine Vorgesetzten schauten auch stets, dass er seine Alimente pünktlich zahlte. So hoffte meine Mutter auch in diesem Falle auf Unterstützung.
Ihre Hoffnung war berechtigt. Der Vorgesetzte meines Vaters empfing meine Mutter, liess sie Platz nehmen und fragte: «Was hast du diesmal auf dem Herzen?»
Meine Mutter schilderte ihm die aktuelle Situation: «Du weisst ja, als Géza uns verliess, musste ich arbeiten gehen und unser Junge wurde von seinen Grosseltern erzogen. Meine Schwester ging 1956 frisch verheiratet in die Schweiz und dort haben sie zwei Kinder. Auch sie muss aus finanziellen Gründen arbeiten gehen, so siedelten unsere Eltern mit einem legalen Ausreisepass zu ihr, um die Kinder dort zu betreuen. Wir konnten sie letztes Jahr besuchen, mein jetziger Mann, unsere Tochter und ich. Anschliessend im Sommer konnte András zu den Grosseltern. Sie alle wohnen dort in einem gottverlassenen Dorf, alle gehen einer Arbeit nach, ausser meiner Mutter, die auf die Kinder aufpasst. Es war also keine Lustreise für meinen Sohn, dort konnte er lediglich kennenlernen, wie Kühe grasen und wiederkäuen. Aber seine Grosseltern waren überglücklich, den Jungen wiederzusehen. Und diesen Sommer möchten sie das auch, aber Géza weigert sich, das Gesuch zu unterschreiben.»
«Mit welcher Begründung?»
«Keine Begründung, einfach so. Wahrscheinlich hat ihm seine Frau verboten zu unterschreiben.»
Der Vorgesetzte nahm den Telefonhörer und zitierte meinen Vater in sein Büro. Er befahl ihm kurzerhand zu unterzeichnen. Da hatte mein Vater keinen Mumm mehr zu widersprechen und unterschrieb.
Die nächste Hürde zu knacken erwies sich als schwieriger. Die für mich zuständige Parteisekretärin war meine Klassenlehrerin. Sie unterrichtete Russisch und hatte einen Groll auf Schüler, die sich weigerten, Russisch zu lernen, denen sie aber trotzdem eine genügende Note erteilen musste, da sie die Minimalanforderungen erfüllten.
Ausserdem war ihr Mann in der ungarischen Rüstungsindustrie tätig und beide wussten, dass sie in diesem Regime nie einen Reisepass in ein westliches Land bekommen würden. So fragte sie sich und auch meine Mutter, wo es vorgeschrieben sei, dass ein 16-jähriger Bursche alle Jahre in die Schweiz reisen dürfe. Sie liess nicht mit sich reden. So ging meine Mutter zur Schuldirektorin und schilderte ihr die Situation, ähnlich wie beim Vorgesetzten meines Vaters, nur etwas ausführlicher, denn diese kannte unsere Geschichte nicht so gut wie jener. Die Schuldirektorin zeigte grosses Verständnis und unterschrieb das Gesuch eigenhändig. Meine Mutter bedankte sich mit Tränen in den Augen und zum Abschied umarmten sich die zwei Frauen.
Die nächsten Hürden, die sie zu überwinden hatte, hatte ich ihr gestellt.
Langsam wurde es Zeit für die grosse gemeinsame Reise mit Packen anzufangen. Als ich merkte, dass meine Mutter die Modelleisenbahnen zusammenpackte, fing ich an zu rebellieren: «Das ist doch nicht dein Ernst, für die Sommerferien meine Modelleisenbahnen mitzunehmen!»
«Doch mein Junge», erwiderte sie und erklärte auch, warum: «Siehst du, wenn du deine Modellbahnen aufstellen willst, müssen wir alle Möbel umstellen, es wird alles eng und bald musst du wieder zusammenpacken. Bei deiner Tante kannst du auf dem Estrichboden deine Bahnen aufstellen und ganze vier Wochen ungestört jederzeit laufen lassen.»
Ich überlegte – es war tatsächlich so. Auf den Estrichboden führte eine von der Decke herunterziehbare Treppe hinauf. Die Treppenstufen waren schön breite Bretter, ich konnte also, so stellte ich mir vor, darauf stehend bequem die Szene auf Augenhöhe betrachten. Donnerwetter, sie hatte mich wieder einmal überzeugt.
Als sie dann aber meinen Wintermantel einpackte, wurde ich echt widerspenstig: «Wintermantel im Sommerurlaub…?»
Aber auch diesmal lieferte sie eine plausible Erklärung: «Weisst du, nun gehen wir alle gemeinsam. Und diesmal hat dein Onkel versprochen, uns in die Berge mitzunehmen. Und dort, wo der ewige Schnee liegt, ist auch ewig kalt. Du wirst um deinen Wintermantel froh sein.»
«Aha…»
Dann kam der grosse Tag. Mit ziemlich viel Gepäck fuhren wir im TAXI zum Ostbahnhof, wo unser Zug Richtung Schweiz losfuhr.
Was anschliessend geschah, habt ihr bereits im ersten Kapitel dieses Buches lesen können …
In Grellingen bei meiner Tante und meinen Grosseltern erwartete mich also nicht der langersehnte Urlaub, sondern die leere, für mich vollkommen ungewisse Zukunft. Meine Eltern reichten den Antrag für Asyl ein, in dieser Zeit ein nicht mehr so einfaches Unterfangen für Flüchtlinge aus Ungarn. Das Land galt bereits als recht liberal regiert, vielleicht am liberalsten im ganzen Ostblock. Es mussten also individuelle Motive geltend gemacht werden. Dazu wurden sie während drei Monaten immer wieder vorgeladen und bis aufs kleinste Detail befragt über:
- ihre Verhaftung unschuldigerweise,
- die Sache mit Karesz und seiner Tortur im Militärdienst,
- Mihálys Position in der Firma und das Verschwinden seines Vorgängers,
- schliesslich die Familienzusammenführung nach all den Vorkommnissen,
die wir in den schwierigen Zeiten miteinander erleben mussten.
Was sie sonst noch ins Feld führten, weiss ich nicht mehr, jedenfalls nach minuziöser Überprüfung dieser Angaben erhielten wir, Mutter, Mihály, Kati und ich politisches Asyl in der Schweiz.
Das bedeutete uneingeschränkte Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung schweizweit mit dem Ausweis B, der jedoch alle zwei Jahre neu bei der Fremdenpolizei abgestempelt werden musste. Dies war eigentlich nur eine Formsache, doch musste man beim persönlichen Einreichen des Ausweises im Warteraum Platz nehmen, bis einige Sachen geklärt oder registriert waren.
Später, nachdem ich für die Sutter-Bäckerei Brot ausfuhr und auch zur Fastnachtszeit die Innenstadt-Filialen noch vor dem Morgenstreich beliefern musste, blieb ich natürlich als Zuschauer bei diesem Riesenspektakel. Ich hatte den besten Platz in der vordersten Reihe in der Freien Strasse. Bei meiner nächsten Vorstellung im Spiegelhof in Basel, wo auch die Fremdenpolizei für Baselstadt und Baselland beheimatet war, schritt ich beim Aufruf meines Namens zum besagten Schalter und reichte dem Beamten meinen Ausweis zwecks Abstemplung. Er nahm ihn entgegen, schlug ihn auf, worauf ihm ein schöner Haufen Räppli auf sein Pult rieselte. Er lachte laut und ich erinnere mich ganz genau: So schnell wie diesmal hatte ich den Stempel vorher noch nie bekommen …
Aber zurück zu diesem verhängnisvollen Sommer 1965 in Grellingen. Das Asylverfahren dauerte gute drei Monate. Danach ging für Mihály die Suche nach einer Arbeit sowie nach einer bezahlbaren Wohnung los. Arbeit fand er beim Schweizerischen Bankverein in Basel, die günstige Dreizimmerwohnung in Bottmingen.
So fing das neue Leben für unsere damals noch vierköpfige Familie am Anfang des Jahres 1966 an.
Herbst – meine schönste Jahreszeit
Seite 36
Seite 36 wird geladen
36.
Herbst – meine schönste Jahreszeit
Wenn einige den Winter nicht schön finden, sind sie selbst schuld. Diese kennen nur den Pflotsch in den Städten, das Frieren an den Bushaltestellen. Andere schnallen Skier, Snowboards oder je nachdem Schneeschuhe an, geniessen die weisse Wunderwelt in den Bergen, die kristallklare Luft, die Sonnenstrahlen und erholen sich prächtig. Dann die langen, dunklen Winterabende, da kann man so viel Schönes zu Hause anstellen. Man hat ja im Sommer so manches zur Seite geschoben …
Anders ist es im Frühling, den haben alle gern. Die Natur erwacht, die kargen Äste der Bäume werden zu einer zartgrünen Krone. Es riecht überall nach frischem Grün und die Felder werden allmählich farbig. Beim Spazieren im Wald oder in einer Baumallee begeistern die zartgrünen Blätter, die immerzu grösser werden – das muss man gerne haben.
Der Sommer ist dann DIE Jahreszeit aller – die Zeit, Urlaub zu machen, dem Alltag zu entfliehen, sich zu erholen. An Wochenenden und bei Einladungen werden die Grills angezündet und die Würste schmecken wie Steaks. Velos und Cabriolets werden geputzt und genutzt, die Schwimmbäder sind übervoll. Alles klar.
Doch der Herbst – wer mag den rühmen? Diese kalte, windige Jahreszeit, in welcher sich die Natur zurückzieht, die wild tanzenden Blätter der Bäume sich zuerst in eine Farbenpracht verwandeln, doch bald darauf herunterfallen, um die Strassen glitschig zu machen oder aber im bissigen Wind dahinfliegen.
Trotz alledem habe ich eine sonderbar herrliche Beziehung zum Herbst. Dieser mag noch so widerlich sein, ich liebe ihn. Aber warum?
Im Sommer 1965 traf mich in der Schweiz die Wirklichkeit. Ich hatte fast alles verloren, was mir lieb war. Meine Heimat, meine Schule, meine Freunde und Freundinnen, meine Stadt, in der ich aufgewachsen bin, meine Sprache, die ich so gerne benutzt hatte. Ja, ich fiel in eine Art Apathie. In der herrlichen Umgebung vom abgelegenen Neutal in Grellingen konnte ich die Möglichkeiten, die es bot, nicht wirklich geniessen. Ich hatte mich in meinen Kokon zurückgezogen und mein einziges Vergnügen war, Briefe an meine Freunde und Freundinnen zu verfassen und die erhaltenen etliche Male zu lesen. Meine Mutter fragte mich immer wieder: «Was fehlt dir mein Lieber, was kann ich für dich tun?» Eine Antwort konnte ich nicht formulieren.
Ein bisschen Türöffner war Miklós, der war etwa vier Jahre älter als ich, arbeitete wie mein Onkel beim Ziegler und war einquartiert bei einer Familie im Haus uns gegenüber. Er war der erste fremde Mensch in der Schweiz, den ich kennenlernte. Er hatte Ungarn 1956 als etwa zwölfjähriger Junge verlassen und landete in der Schweiz in einer Klosterschule. Dort wurde er zum Kunstschmied ausgebildet. Damit fand er eine Anstellung in der Papierfabrik Ziegler. Die ungarische Sprache hatte er bereits fast verlernt. Autoliebhaber war er ebenso wie ich auch, was uns zuerst einmal zueinander brachte. So hatte er mir beigebracht, was eine Nockenwelle ist und ich konnte ihm sagen, das sei eine «bütyköstengely». Das waren also meine ersten Schritte, um die deutsche Sprache zu erlernen und für ihn, die ungarische Sprache wieder zu erlangen.
Dann kam mein Grossvater etwa Mitte Oktober und verkündete, das Weihnachtsgeschäft breche heran und da bräuchte er unbedingt Hilfe. In dieser Zeit wurden tonnenweise Waren verkauft, wie Wein, Salami, Wurstwaren und auch Christbaumschmuck aus Schokolade, genannt «Szaloncukor». Dieser hing haufenweise an jedem ungarischen Weihnachtsbaum.
Alle diese gelieferten Waren mussten im Geschäft versorgt werden und dazu brauchte mein Grossvater Hilfe. Er nahm mich also morgens im Zug mit nach Basel und beschäftigte mich, machte mich mit seinen Freunden bekannt. Diese waren mitunter ganz lustige Gesellen und erzählten von ihren Erfahrungen in der Schweiz. Im Lagerraum hinter dem Verkaufsladen gab es genügend Platz für einen Tisch, auf welchen dann irgendeiner eine Flasche Wein stellte, mein Grossvater brachte die Gläser und die kleine Party ging los.
Das alleine war es nicht. Im Zug, in welchem wir jeweils nach Hause fuhren, sass oft ein Mädchen – Entschuldigung, eine junge Frau, die mich immer wieder ganz freundlich anlachte. Sie war besonders hübsch, ihr Wahrzeichen waren stets feuerrot geschminkte Lippen. Sie war auch immer elegant gekleidet, verhalten modern, aber sehr farbenfroh. Ich nahm eines Tages allen Mut zusammen und, bevor der Zug in Grellingen ankam, reihte ich mich vor ihr in die Schlange der Aussteigenden.
Die damaligen «Schüttelbecher» dieser Regionalzüge waren noch recht unbequem: Die Perrons tief, die Wagen hoch und Letztere hatten so etwas wie einen Dreitritt unter der Türe, dennoch war der Ausstieg fast ein akrobatischer Akt.
Ich stieg vor der jungen Frau aus, drehte mich jedoch sogleich um und reichte ihr die Hand, um beim Aussteigen behilflich zu sein. Sie nahm meine Hand, ich spürte, dass sie diese tatsächlich als eine Art Stütze nutzte und stellte mit Erstaunen fest, dass sie meine Hand selbst dann nicht losliess, als sie bereits festen Boden unter ihren Füssen hatte. Die Dorfjugend kicherte, doch das interessierte weder sie noch mich. So war ich also «genötigt», sie auf dem Heimweg zumindest ein Stück zu begleiten. Sie merkte bald, dass eine Konversation mit mir nur ganz beschränkt möglich war, trotzdem fragte sie mich nach meinem Namen. Ich sagte: «András», und anschliessend erkundigte sie sich, woher ich käme. Aus Ungarn, und sie erwiderte: «wie interessant.» Sie fragte, wo ich wohne. Ich deutete auf den Hügel gegenüber, wo Ziegler seine Siedlung aufgebaut hatte und mein Onkel lebte. Dann verabschiedete sie sich und ich lief, besser gesagt, schwebte in Gedanken versunken zurück zum Bahnhof und anschliessend hinauf zum Neutal.
Das war der Moment, als mir klar wurde: Der Schlüssel zum Glücklichwerden ist die Sprache. Es war nicht nur das, ich hatte nun auch eine echte Motivation, diese so schnell als möglich zu erlernen.
Ein anderes Mal, als ich Georgette nach der Zugfahrt auf ihrem Heimweg begleitete, fragte sie mich, bei wem ich wohnen würde. «Hajdu», sagte ich, so hiess mein Onkel.
An einem Sonntagnachmittag läutete das Telefon. Mein Onkel nahm den Hörer, daraufhin strahlte er und plauderte fröhlich. Es war Georgette, die anrief. Mein Onkel war ganz stolz, war doch die junge Frau bekannt als eines der schönsten Geschöpfe des Dorfes. Sie erzählte ihm, dass sie in Basel an der Freien Strasse, der erstrangigen Einkaufsstrasse bei «Maison Lehmann» als Modeberaterin arbeite und dass sie mich nach Arbeitsschluss jeweils ab 18:30 Uhr dort gerne erwarten würde.
Nachdem die beiden alles geklärt hatten, gab mein Onkel das Gespräch freudestrahlend weiter. Ich konnte das alles gar nicht so richtig fassen.
Bei meinem Grossvater musste ich wirklich anpacken. Es wurden jeweils vormittags Waren angeliefert, die versorgt werden mussten. Aber an den Nachmittagen gab es manchmal Flauten. Da stand ich vor der Ladentüre und genoss die tiefherbstliche Stimmung. Der Laden war an einem der schönsten Orte Basels angesiedelt, an der Dufourstrasse, gegenüber dem Kunstmuseum. Ich schaute in die neblige Luft, sah die Scheinwerferkegel der vorbeifahrenden Autos, wie diese beim Nieselregen die Regentropfen zum Leuchten brachten. Inmitten dieser Stimmung spürte ich, wie die Lebensgeister allmählich in mich zurückfanden. Diese trüb-nasse Empfindung ist bei mir verkoppelt mit Wiederbeleben. In dieser für jeden normalen Menschen als grausig empfundenen Stimmung freute ich mich auf den Zeitpunkt, da ich Georgette abholen konnte, und auf die Zeit, wo ich mich mit ihr und allen anderen nach Herzenslust in hiesiger Sprache unterhalten konnte.
Diese besondere Gemütslage verkörperte meine Zukunft, mein Wiedererwachen.
In mir koppeln sich der Herbst und das Wiedererwachen wie im Falle des Experiments mit dem Pawlowschen Hund. Pawlow erkannte, dass beim Organismus und auch beim Geist Ereignisse sich verkoppeln. Diese Theorie bewies er mit seinem Hund: Eine Zeit lang läutete er beim Fressenverabreichen mit einer Glocke. Nach einer gewissen Zeit reichte es, mit der Glocke zu läuten, um beim Hund Speichelfluss auszulösen.
Nun, bei mir mag der Herbst noch so düster sein, in mir löst er das Gefühl des Erwachens aus. In dieser nasskalten Zeit fühlte ich, dass ich mich von meiner Apathie löste, dass ich in die wirkliche Welt zurückkehrte, und zwar in der Schweiz, dass ich die Kraft hatte, alles daran zu setzen, auch hier zu Hause zu sein und die Sprache zu erlernen, so schnell als möglich, und dies nicht nur wegen Georgette!
Das Weihnachtsgeschäft ging vorbei, Mihály bekam, wie schon erwähnt, eine Stelle beim Schweizerischen Bankverein und fand eine günstige Dreizimmerwohnung in Bottmingen. Caritas richtete uns die Wohnung mit gebrauchten Möbeln ein. Ich fing an, mich um meine Zukunft zu kümmern. Wie sollte es mit meiner Ausbildung weitergehen? Einfach war das nicht: Das Schweizer Schulsystem war spätestens ab der Mittelstufe ganz anders organisiert als in Ungarn.
Dennoch traf ich mich noch einige Male mit Georgette. Sie musste auch nicht immer direkt nach Hause gehen. Oft gingen wir dann ins «Tis», wie man diese Institution in Basel nannte. Das war die Abkürzung von «Atlantis», so hiess und heisst dieses Lokal heute noch, mittlerweile schweizweit bekannt als Basels «Hard Rock Café». Hier traten damals und treten heute noch bekannte und weniger bekannte Musikkünstler auf, es ist auch eine Art Talentschmiede. Die Musik ist jeweils so laut, dass man sich nicht unterhalten muss, eigentlich gar nicht kann.
Anschliessend gingen wir zum Bahnhof, wobei uns bis zum letzten Zug manchmal etwas Zeit übrigblieb. Auf dem Weg lag ein hübscher Park, ein grösserer Teil davon wurde später mit dem wachsenden Verkehr dem Heuwaage-Viadukt geopfert. Aber damals war er noch schön bewachsen und überall standen Sitzbänke. Dann setzten wir uns und liebkosten einander in der Dunkelheit der alten Bäume. An einem Abend, kurz bevor wir zum Zug mussten, merkte Georgette, dass einer ihrer Ohrringe fehlte. Eine fieberhafte Suche ging los, die unterbrochen wurde durch die Notwendigkeit, auf den letzten Zug zu eilen. Dabei wurde sie so richtig hässig. Es war für mich eine Erkenntnis, wie eine schnurrende Katze unvermittelt zur brüllenden Löwin werden konnte.
Die «56er Ungarn»
Seite 37
Seite 37 wird geladen
37.
Die «56er Ungarn»
Nach unserem ersten Einleben in der Schweiz konnten wir auch mit den seit dem 56er Aufstand hier lebenden Ungarn Kontakte knüpfen. Es war nicht schwer, war doch der ungarische Laden, den mein Grossvater führte, ein beliebter Treffpunkt aller ihrer Gesellschaftsschichten. So konnten wir auch den grossen Kreis der Bekannten meiner Tante kennenlernen. Das Bild, das sich uns präsentierte, war nicht nur farbig, sondern auch sehr vielschichtig, um nicht zu sagen kontrovers.
Im Grunde hatten die Schweizer Glück mit den ca. 12‘000 Neuankömmlingen, die sie auf einmal aufgenommen hatten. Umgekehrt natürlich auch. Wir konnten vernehmen, mit welch grosser Gastfreundschaft diese empfangen wurden, wie weit die erste Unterstützung reichte. Ein glücklicher Umstand war, dass die ungarischen Behörden ihre politischen Gefangenen nicht mit den Verbrechern mischten, so konnten die Gefängnisse ganz gezielt geöffnet werden und blieben für Kriminelle geschlossen.
Die Schweizer Hilfsorganisationen waren sehr geduldig und zurückhaltend, die Flüchtlinge in den Sammellagern abzuholen. So gelangten fast nur Leute in die Schweiz, die nicht einfach in den Westen wollten, sondern gezielt in die Schweiz. Diese Flüchtlinge waren vorwiegend gut ausgebildet, beherrschten mehr oder weniger die deutsche Sprache und waren sofort gewillt, einer Arbeit nachzugehen oder ein kleines Unternehmen zu gründen.
Selbst bei der Eröffnung des ungarischen Ladens in Basel zeigten die Behörden sehr viel Kulanz und taxierten diesen als Genossenschaft, so blieb der Laden steuerbefreit. Am Anfang florierte das Geschäft, denn der Bedarf an ungarischen Spezialitäten war sehr gross. Dieser ebbte dann mit der Zeit allmählich ab. Doch die gute Anfangszeit reichte, um die ganze Einrichtung abzustottern und nachher die Miete an dieser exzellenten Adresse an der Dufourstrasse zu bezahlen. Zunehmend wurde es finanziell immer enger. Der Betreiber war Chemiker in einem Pharmaunternehmen und musste einen Angestellten bezahlen. Die Verschuldung kam unweigerlich und mein Onkel übernahm den Laden darauf basierend, dass mein Grossvater als Miteigentümer das Geschäft aktiv betreiben würde. Der Preis war lediglich, die Schulden zu übernehmen.
So stand schliesslich mein Grossvater hinter dem Verkaufspult und sein Fleiss und Charisma brachten den Erfolg. Die Leute kehrten zurück und zu ihnen gesellten sich viele spanische Gastarbeiter, die entdeckt hatten, dass die ungarische Hauswurst genauso scharf war, wie ihre Chorizo. Mein Grossvater begrüsste sie mit «Buenos Dias!», lernte bald, wieviel «medio kilo» ist und verabschiedete sich mit fröhlichem «adios Amigos!»
Mein Onkel erweiterte das Sortiment und so entstanden Weihnachtsknüller wie «Szaloncukor» und «Beigli».
«Szaloncukor» sind spezielle Bonbons, mit denen jeder anständige ungarische Christbaum geschmückt wurde. Sie sehen aus wie Knallbonbons, sind in allen Farben eingepackt und schmecken Jung und Alt vom Baum geraubt am besten. Von diesen wurden anfangs November Hunderte von Kilos angeliefert und erfolgreich verkauft.
«Beigli» wiederum sind Hefeteigstrudel mit Nuss- oder Mohnfüllung. Die Herstellung dieser übernahm unsere Mutter. Im November und Dezember sah unsere Küche aus wie eine Bäckerei und ich mahlte zentnerweise Nüsse, was einfach war, sowie Mohn. Mohn mahlen ist eine echte Herausforderung. Dieser wird in einer ganz kleinen Mühle eher gequetscht als gemahlen und das wird in dieser Menge mit der Zeit ein echter Kraftakt. Endlich fand ich eine Bäckerei, die auch Erzeugnisse mit Mohnfüllung anbot und über eine professionelle Mohnmühle verfügte. In diese schleppte ich meinen Mohn in Fünfkilo-Säcken und holte ihn dann für ein paar Franken gemahlen wieder ab.
Unser Onkel Sanyi stellte in rauen Mengen Hauswurst her, was auch sehr gut ankam, ob Ungar, Spanier oder auch Schweizer. Dazu kommen wir später noch.
Es wurden zwei Tiefkühltruhen angeschafft und das Geschäft mit ungarischen Maispoularden und Junggänsen ging los. Einige Sorten ungarischer Weine verkauften sich sehr gut, was die Herren Direktoren im benachbarten Bankverein entdeckten und davon in der Vorweihnachtszeit kistenweise verschenkten.
Mein Onkel ging an den Weihnachtsmarkt nach Genf und daraus entstand mit der Zeit eine Filiale in der Rhonestadt.
Ich wurde von meinem Grossvater immer wieder mit unterschiedlichen Aufgaben betraut, so sammelte ich meine Erfahrungen mit den «56er Ungarn». Manche von ihnen kamen in den Laden, redeten ganz komisch, um zu signalisieren, dass sie fast nur noch Deutsch reden und suchten die ungarischen Begriffe. Aber wehe, sie mussten meinem Grossvater helfen, jemandem etwas Komplizierteres auf Deutsch zu erklären. Da kam es heraus: Sie hatten Deutsch noch nicht gelernt, aber Ungarisch bereits verlernt …
Manche redeten ausschliesslich Schriftdeutsch. Diese fanden, Schwyzerdütsch sei eine Bauernsprache, das würden sie nicht reden. Sie seien schliesslich Diplomierte …
Man rühmte die ungarische Sprache und behauptete, dass gewisse Ausdrücke im Deutschen gar nicht vorhanden seien. Anfänglich schien dies auch zu stimmen, doch allmählich vertieften sich meine Deutschkenntnisse und ich merkte, es gibt für jeden Ausdruck ein Äquivalent, nur nicht als 1:1 Wortübersetzung. Gerade Feinheiten werden einfach anders formuliert, bewirken jedoch das gleiche Empfinden. Man muss sie nur kennen.
Dann gab es die ganz Integrierten, diese sprachen locker sowohl Schwyzerdütsch, Schriftdeutsch sowie Ungarisch und hatten es nicht nötig, von den Schweizern als «sajtos» zu reden, was so etwas wie «Käser» bedeutet. So einer war ein einigermassen erfolgreicher Transportunternehmer mit einer Reihe von Kleinlastwagen. Seine Fahrzeuge waren nicht zu übersehen. Man sah sofort, dass er aus dem VII. Bezirk stammte, ein mittelständischer Distrikt in Budapest. Die Auflösung: Ich weiss nicht mehr, wie viele Mannschaften die ungarische Fussballliga hatte, aber sechs davon kamen aus Budapest: ein Fussball-Club der Armeeangehörigen, einer der Polizisten, ein weiterer der Eisenbearbeiter, dann einer, der von der Partei unterstützt wurde, noch ein Club aus dem Judenbezirk und schliesslich einer von den Mittelständischen, der «Fradi» mit der Abkürzung von «Ferencvárosi Torna Club». Und Letzterer hatte die Farben grün und weiss, die Fahnen und Leibchen waren grün-weiss gestreift. Nun also, die Lastwagen dieses frischgebackenen Eidgenossen waren grün-weiss gestreift lackiert.
Kurzum, man musste seine ursprüngliche Identität nicht verleugnen, um sich vollständig zu integrieren.
Ich lernte auch den Rektor des Mädchengymnasiums in Basel kennen. Herr Dr. Hargitay bedauerte sehr, dass ich kein Röckchen und die Haare nicht als Zöpfe trug, denn als Junge konnte er mich in seiner Schule nicht aufnehmen. Er hätte mit mir eine Ausnahme gemacht, um die Matura in einem staatlichen Gymnasium zu machen. Damals mussten die Schülerinnen und Schüler jünger als 22 Jahre alt sein, um die staatliche Reifeprüfung zu absolvieren und dies hätte ich nicht mehr geschafft, bis ich in Deutsch, Französisch und Englisch soweit gewesen wäre.
Herr Poldes war einer der Direktoren der Basler Versicherungsgesellschaft PAX und zuständig für Mathematik. Er sprach fliessend Schwyzerdütsch und Schriftdeutsch, pflegte aber auch fleissig seine Muttersprache und war einige Male mit seiner Gattin bei uns, um mit unseren Eltern ungarische Verse aufzusagen und zu geniessen. Ursprünglich hiess er Poldesz, liess aber das Z in seinem Namen weg, um die Leute mit diesem Doppelbuchstaben SZ nicht zu verwirren.
Er sollte später meinen beruflichen Werdegang entscheidend beeinflussen.
Udo Jürgens und …
Seite 38
Seite 38 wird geladen
38.
Udo Jürgens und …
Die Lieder dieses Komponisten, Klavierspielers und Sängers klingen sehr beschwingt, fast wie Sommerhits, die nach einer Saison verschwinden. Doch lauscht man seinen Texten, muss man erkennen, dass diese überaus gesellschaftskritisch sind. Das «Ehrenwerte Haus», aber auch «Ich war noch niemals in New York» stimmen einen nachdenklich. Schnippisch, zynisch ist auch das Lied «Aber bitte mit Sahne …»
Das herausragende in dieser Reihe ist «Griechischer Wein». Dies klingt so, als ob man sich in den Ferien wähnt, sieht nur weisse Strände, tiefblaues Meer mit sanften Wellen, gutes Essen und geniesst dazu den griechischen Wein. Doch weit gefehlt. Das Lied ist für mich eines der traurigsten in Udo Jürgens‘ Schaffen.
In diesem äusserst beschwingt tönenden Lied schlendert er in den Vorstadtstrassen einer deutschen Stadt und kehrt in ein Lokal ein, aus dem noch Licht hinausstrahlt. Da sitzen Männer mit dunklen Haaren und braunen Augen. Sie laden ihn ein, mit ihnen griechischen Wein zu trinken «schenk nochmal ein» und erzählen ihm ihr Leid. Von Frauen, die fern in der Heimat leben, Kindern, die ihren Vater noch nie sahen. Sie aber sitzen hier, arbeiten tagsüber, um das kleine Glück zu Hause zu erschaffen. Der Refrain tut richtig weh:
Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde,
Komm schenk dir ein
Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran,
Dass ich immer träume von daheim, du musst verzeih‘n.
Griechischer Wein und die alt vertrauten Lieder,
Schenk nochmal ein
Denn ich fühl die Sehnsucht wieder, in dieser Stadt
Werd‘ ich immer nur ein Fremder sein und allein.
Genau das wollten unsere Eltern uns ersparen. Sie setzten alles daran, hier keine Fremden zu sein. Klar war unsere Ausgangslage eine andere: Wir kamen nicht, um etwas Geld zu verdienen und damit später zu Hause etwas aufbauen zu können. Unsere Zukunft war ungewiss, tendierte eher in die Richtung, dass wir in unserer neu gewählten Heimat für immer bleiben müssten.
Was hiess das? Es bedeutete nichts anderes, als sich hier einzuleben, zu assimilieren und Wurzeln zu schlagen. Andererseits bedeutete dies keinesfalls, die ursprüngliche Nationalität zu verleugnen. Keine und keiner von uns wechselte oder änderte den Namen, um nicht aufzufallen, obwohl ich anfänglich etliche Schwierigkeiten mit meinem Namen hatte. Viele meinten, das könne man gar nicht aussprechen, bis ich diese aufklärte und ihnen empfahl, das Z hinter dem S zu ignorieren, das sei ein Doppelbuchstabe, sozusagen das scharfe S. Dann hellten sich die Gesichter auf und es hiess freudig: «Sooo einfach ist das …!» Allmählich änderte sich die Gesellschaft in der Schweiz, sie gewöhnte sich immer mehr an das Fremdländische im eigenen Land und ich musste immer seltener erklären, wie man meinen Namen ausspricht.
Ich stand jederzeit dazu, ursprünglich ein Ungar zu sein. Auf eine interessante Art spornte mich dies stets an. Ich spürte und wusste, dass auch bei bestem Integrationsgrad das, was ich tue, doppelt verbucht wird: «Das tat er, so ist der Széplaky», und dann, wenn auch unbewusst «So ist ein Ungar». Und daraus werden Schlüsse gezogen, wie eine Nation zu beurteilen ist.
Immanuel Kant lehrte: «Handle so, dass deine Maxime stets zur Aufstellung einer allgemeinen Gesetzgebung dienen kann.» Ich denke, so weit ging ich nicht, hatte jedoch meinen für mich persönlich abgeleiteten Leitsatz vor Augen: «Handle so, dass dein Tun kein schlechtes Licht auf die Nation wirft, aus welcher du kommst.»
Das bedeutete keineswegs, manchmal nicht anzuecken. Nein, auch das gehört zur ungarischen Mentalität.
Das Verhalten unserer Eltern förderte die Integration und half, uns in der Schweiz zu etablieren. Als Erstes widersetzten sie sich dem Wunsch der Zwillingsschwester meiner Mutter, in ihrer Gesellschaft aktiv mitzumachen, darin einzutauchen. Sie und mein Onkel hätten uns dort gerne gesehen. Aber unsere Eltern hatten erkannt, diese bildeten ihre eigene kulturelle Enklave in der Schweiz, in die sie nicht hineingehören wollten, vielmehr bauten sie ihre eigene Gesellschaft auf. Zuerst war es die Freundschaft mit den Suters, der benachbarten Familie in Bottmingen. Das Verbindungsglied waren auch meine Schwestern und Suters Töchter. Diese waren etwa gleich alt und allesamt in den Augen ihrer Eltern unterernährt. Sie assen auch nicht sehr gut, doch ein simpler Trick funktionierte: Die Kinder wurden abwechslungsweise bei ihnen oder bei uns zum Mittagessen einberufen, und siehe da, drüben schmeckte alles, selbst was man daheim verschmähte.

Bei Suters.
Meine Eltern lernten damals Deutsch im Gymnasium, so mussten sie diese Sprache in der Schweiz nur noch auffrischen. Dennoch war ich der Erste, der einigermassen sattelfest wurde und auch die meisten Amtsgeschäfte erledigte, beispielsweise das mit den Schulferien meiner Schwestern.
Unsere Mutter fand, die Mädchen seien zu schmächtig, zu dünn. Sie ging mit ihnen zum Kinderarzt, doch dieser versuchte sie zu beruhigen mit der Argumentation, seine eigenen Kinder seien nicht anders und er fände das ganz in Ordnung. Aber unsere Mutter gab nicht nach, doch der Kinderarzt blieb auch standhaft und verweigerte jegliche medikamentöse Behandlung.
Was er hingegen verordnete, war frische Bergluft. Dazu waren die Skiferien gut, doch diese waren im Kanton Baselland im Gegensatz zu anderen Kantonen auf eine Woche beschränkt. So gab der Kinderarzt ein Rezept für zweiwöchige Skiferien.
Mit dieser ärztlichen Empfehlung ging ich dann zur Erziehungsdirektion nach Liestal. Ich wurde an den Erziehungsdirektor verwiesen, der mich dann auch empfing. Er war ein Nationalrat, ein überaus sympathischer, junger Politiker. Er hörte mich an und zeigte Verständnis: Sie seien seit langem daran, die Winterferien den meisten übrigen Kantonen anzugleichen, also auf zwei Wochen auszudehnen. Nichtsdestoweniger musste ich noch einige Male bei ihm mit diesem Ersuchen vorsprechen.
Was sich in dieser Zeit geändert hatte, war, dass unsere Gespräche länger wurden. Er interessierte sich sehr dafür, wie wir uns bereits eingelebt hatten und ob wir uns hier inzwischen heimisch fühlten. Ich unterhielt mich gerne mit ihm, teilte ihm gerne meine Empfindungen mit, auch meine unterschwelligen, beispielsweise meine Empfindung einer gewissen Lieblosigkeit der Schweizer, dass Kinder ihre Eltern nicht mit einer Umarmung, sondern mit einem Händedruck begrüssten.
Dann hatte ich das Gefühl, das alles ändere sich allmählich. Das war die Zeit, als Schweizer vermehrt zu reisen begannen. Dieses Volk, das seit 250 Jahren kein Leid erleben musste, lernte allmählich andere Kulturen, andere Schicksale kennen. Die Leute fingen an, miteinander anders umzugehen, lockerer, herzlicher. Ich erlebte diesbezüglich einen echten Generationenwechsel.
Was ich damals nicht ahnen konnte: Jahre später sollte ich mit «meinem» Erziehungsdirektor zu tun bekommen und dies in einer sehr entscheidenden Angelegenheit.
Wie weiter?
Seite 39
Seite 39 wird geladen
39.
Wie weiter?
Wir mussten uns zuerst mit dem schweizerischen Schulsystem vertraut machen. Technikum ist hierzulande erst nach einer abgeschlossenen Lehre oder nach der Matura möglich. So landete ich bei einer Firma in Reinach, die in Aussicht stellte, mir eine verkürzte Lehre als Maschinenzeichner zu ermöglichen, da ich ja im Technikum in Budapest dieses Fach bereits abgeschlossen hatte. Da kam eines Tages jemand vorbei, der sein Geschäft im gleichen Gebäude hatte und ungarisch sprach. Csitkovics hiess der Mann und er deckte auf, dass mich die Firma auf eine Art ausnützte. Mit der Begründung der mangelnden Deutschkenntnisse steckten sie mich in das allererste Lehrjahr, doch am Zeichenbrett arbeitete ich wie jeder andere Kollege.
Csitkovics überzeugte meine Eltern von seiner Lösung für mich und organisierte mir einen Platz in einem Privatgymnasium in Basel, wobei Caritas meine Schulgebühren übernahm – zumindest den Anfangstarif. Hingegen bei jeder Erhöhung mussten ich oder meine Eltern zusätzlich in die Tasche greifen.
So ging ich ins Gymi und nebenbei arbeitete ich im Ingenieurbüro von Csitkovics. Das war eine überaus aufregende Zeit. Mittlerweile verlegte er sein Büro von Reinach nach Birsfelden in das Haus, wo er gemeinsam mit seiner Partnerin wohnte. Meine grossen Einsätze kamen in den Schulferien, wenn er mit ihr in den Urlaub fuhr und ich den Laden führte, manchmal bis zu sechs Wochen lang. Ich erledigte die Administration, aber auch die technischen Zeichnungen, die benötigt wurden – damals noch auf dem Zeichenbrett mit Pauspapier und verschieden dicken Tuschtinten-Füllfedern. Diese Zeichnungen wurden nicht ausgeliefert, sondern Kopien davon in mehreren Exemplaren, die von Lithografen erstellt wurden. Unsere Lithografie-Werkstatt war in der Innenstadt, dorthin musste ich meine Zeichnungen bringen und Tage später die grossen Kopien abholen. Dazu standen mir in der Garage drei Autos zur Verfügung: Ein Jaguar E-Type, der war mir zu heiss, dann ein Deux Chevaux, den fand ich wiederum zu lahm. Die Partnerin von Csitkovics besass einen Renault Florid – dieses wunderschöne Cabriolet wurde zu meinem Favoriten. Es waren nicht die Fahrleistungen, die mich begeisterten. Das Auto basierte auf dem zahmen Renault Dauphin mit einem 850 cm³ Motörchen, allerdings dank dem Doppelvergaser etwas kraftvoller und spritziger. Aber das Auto war wunderschön gezeichnet, gestreckt, dynamisch und damit hob es von den damals üblichen Formen meilenweit ab. Und es war ein Cabriolet!
Ich hatte schon den Lehrfahrausweis und ich wusste, ich kann bereits Auto fahren. Also fuhr ich einen ganzen Sommer lang mit diesem aufregenden Auto umher und erlebte dabei einige adrenalin-spendende Momente.
Die Autobahn zwischen Basel und Zürich war damals noch nicht erstellt, so fuhr der gesamte Verkehr zwischen diesen Städten durch Birsfelden. Musste ich meine Zeichnungen zum Lithografen bringen und später dann die Kopien abholen, reihte ich mich also in den Verkehr ein und genoss die Sonnenstrahlen. Auf einer Fahrt in die Stadt wälzte sich die Kolonne durch die Hauptstrasse von Birsfelden. Ich erblickte einen Autofahrer in einer Seitenstrasse mit einem Bootsanhänger im Schlepptau und dachte, er hätte keine Chance, sich hier in den Verkehr einzufädeln, also hielt ich an und winkte ihn herein. Ein Polizist trat an mein Auto. Ich dachte, ich sei nun verloren. Doch es kam ganz anders: Er begrüsste mich und meinte, wir hätten einen viel besser fliessenden Verkehr, wenn alle Teilnehmer so höflich zueinander wären. Statt meine Papiere zu kontrollieren, nickte er anerkennend und ging weiter den Verkehr regeln.
Eines Tages wusch ich das Auto. Nicht etwa, weil es so dreckig gewesen wäre, nein, eher aus meiner Überzeugung heraus, dass man ein Auto erst beim Waschen so richtig kennenlernen kann, nämlich jede Wölbung, jede Sicke, einfach jedes Detail, das die Gesamterscheinung des Fahrzeuges ausmacht. Weil ich dabei entdeckte, dass das vordere Wechselschild voller Insekten war, klickte ich es heraus, schrubbte es frei und legte anschliessend das Schild an die Sonne zum Trocknen. Nach getaner Autowäsche wieder im Büro entdeckte ich, dass ich heute Lithos abholen sollte. Also nichts wie weg in die Innenstadt! Als ich die Rollen bekam und mit diesen zum Auto ging, merkte ich in meiner Lage etwas Erschreckendes: Ich hatte die vorderen Nummernschilder nicht wieder angebracht. Was nun? Sollte ich es wagen, ohne Nummer und ohne Führerschein durch die Stadt? Oder lieber mit dem Tram zurück nach Birsfelden, die Nummer holen und dann heimfahren? Wie sagte mein Grossvater immer wieder: «Wer wagt gewinnt.» Schliesslich hatten mich meine Grosseltern erzogen, also setzte ich mich hinters Lenkrad und fuhr zurück ins Büro. Mein alter Herr hatte wieder einmal recht gehabt.
Ich nutzte das Auto in dieser Zeit manchmal auch nach der Arbeit für die Freizeit, was die Eltern natürlich nicht wissen durften. So fuhr ich heim nach Bottmingen und stellte das Cabriolet auf dem grossen Parkplatz der Birsigtalbahnstation ab, natürlich offen, denn es war schönster Hochsommer. Zu Hause beim Nachtessen zog ganz überraschend ein heftiges Gewitter über unser Dorf. Es begann kräftig zu regnen, ich sprang auf und rannte zum Auto, um das Dach zu schliessen. Auf dem Rückweg überlegte ich, wie ich mein Verhalten erklären sollte, doch mir kam nichts Glaubhaftes in den Sinn. So kam es heraus, dass ich ohne Führerschein Auto fuhr. Die Reaktionen meiner Eltern waren eher verhalten, sie kannten mich ja genügend und staunten über einige Dinge, die ich anstellte, bereits nicht mehr.
Dann kam meine Autofahrprüfung. Ich fuhr den Florid in den Hof der MFK in Binningen, wo dann die Prüfung losgehen sollte und ging mir noch einen Espresso genehmigen. Zur Prüfzeit kam der etwas ältere Experte und fragte, wer das Auto hierhergebracht hätte. Ich sagte ihm, das sei ein Kollege gewesen, dem das Auto gehört, doch er hätte keine Zeit mehr gehabt, auf meine Prüfung zu warten. Die Skepsis war seinem Gesicht abzulesen. Dann ging es los. Er hielt seine grauen Haare mit beiden Händen gegen den Fahrtwind fest. Wir fuhren über fünf Viertelstunden umher, machten die verrücktesten Manöver, die meines Erachtens alle gut gingen, doch am Ende meinte er, es würde noch nicht ausreichen, ich müsste noch weiter üben. Ich verstand die Welt nicht, aber der Experte hatte gesprochen.
Etwas später trat ich die Prüfung mit Onkels altem Opel an und diese war innert einer Viertelstunde mit Erfolg bestanden. Da sollte einer die Welt verstehen …
In dieser Zeit zog Csitkovics einen ganz grossen Fisch an Land. Eine riesige deutsche metallverarbeitende Firma belieferte auch die Raumfahrtindustrie und hierzu brauchte sie ganz spezielle Fachkräfte: röntgensichere Schweisser, die mit dem Spiegel hinter dem Rücken schweissen konnten und zwar alle erdenklichen Materialien wie auch Chromstahl oder Duraluminium. Csitkovics bekam die Besten der Besten, denn er konnte mit seiner Schweizer Firma hohe Auslandsspesen verrechnen und einen schönen Teil davon an die Leute weitergeben. Diese Möglichkeit nutzte er und gemeinsam bauten wir das Geschäft gross auf.

Csitkovics Dienst-Chevrolet
Ich rechnete jeden Monat bis zu 120 Löhne aus. Das war nicht ohne … Das deutsche Lohnsystem sieht vor, sämtliche Staatsabgaben mit dem Lohn abzurechnen, also Steuern, Krankenkasse usw. Es war auch noch nicht die Zeit von Online-Banking, so steckten wir alle zwei Wochen die Lohnsumme in einen Aktenkoffer und flogen damit nach Düsseldorf – es war eine aufregende Zeitspanne. Ich hatte dafür ein Semester im Gymi ausgesetzt und innerhalb dreier Monate mein erstes neues Auto verdient und erworben. Das war ein wunderschöner, hellblau métallisé lackierter Vauxhall Viva, mit dem damals als sportlich geltenden 72 PS-Motor und einem ordentlichen Fahrwerk.
Dann die Fliegerei: Bei den ersten Flügen nach Düsseldorf kam Csitkovics mit und ich wunderte mich; er schlief, sobald er im Sitz versunken war, augenblicklich ein. Ich fragte mich: Wie kann man bei einer so aufregenden Sache wie Fliegerei einfach schlafen? Nun, bei ihm war es wohl nicht der erste Flug.
Dann die Baronin
Eines Tages kam im ungarischen Laden eine bereits in die Jahre gekommene Lady vorbei. Sie war schon eine eindrückliche Erscheinung und hatte genug Goldschmuck an sich, um glaubhaft zu machen, dass sie eine ungarische Baronin sei, auf der Suche nach ihrem Vermögen, das sie von einem Verwandten, einem Bischof, geerbt hätte, der dann in der Schweiz verstorben sei. Sie suche jetzt einen «Privatsekretär», der ihr bei ihren diesbezüglichen Recherchen behilflich sein könnte. Ich wurde ihr empfohlen.
Darüber später noch mehr.
Und die Samstage
Wie es dazu kam, weiss ich nicht mehr. Jedenfalls verbrachte ich meine Samstage in einem kleineren Fernsehladen beim Spalentor. Ich erledigte das Rechnungswesen der Woche, schrieb die Mahnungen und verbuchte den Umsatz. War der Inhaber ein Schweizer oder eher ein Ungar? Jedenfalls hiess er Hefty und seine Grosseltern wanderten in der Wirtschaftskrise von der Schweiz nach Ungarn aus, wo sie ihr Glück fanden, desgleichen auch seine Eltern. Doch dann kam der Zweite Weltkrieg und stellte alles auf den Kopf. So flüchtete der Sohn aus der dritten Generation 1956 wieder in die Schweiz zurück.
Es war eine interessante Beziehung. Wir waren bis zum Schluss «per Sie» zueinander, doch schüttete er sein Herz mir gegenüber so aus, wie zu keinem seiner «per du»-Kollegen. Oft lud er mich nach Ladenschluss zum Nachtessen in ein feines Lokal ein und wir diskutierten auch über ganz persönliche Sachen.
Allmählich zeichnete sich der Weg ab …
Onkels Opel P2
Seite 40
Seite 40 wird geladen
40.
Onkels Opel P2
Das Auto war für mich etwas Spezielles. Es fing damit an, dass ich mit diesem Fahrzeug mein Ziel, den Führerschein noch vor dem 19. Lebensjahr zu machen, erreichen konnte.
Pityu war bezüglich seines Fahrzeugs sehr locker. Sobald er in Basel war, konnte ich es immer haben, unter dem Motto: «Wenn du es bewegst, muss ich mich nicht um den Parkplatz kümmern.» Und ich bewegte das Auto überaus gerne. Als ich jeweils den Schlüssel abholte, war es für mich ein besonderer Moment, mit einem Fahrzeugschlüssel zu einem Auto zu schlendern, das ich dann nach Gutdünken bewegen konnte. Heute ist es nicht anders. Heute habe ich eine recht schöne Oldtimer-Sammlung und wenn ich mir für meine nächste Fahrt eines der Modelle aussuche und den Schlüssel dazu hole, habe ich das gleiche erhabene Gefühl.
Damals bedeutete für mich das Bewegen von Onkels Auto meistens Arbeit. Ich erledigte für den ungarischen Laden Auslieferungen, dennoch stolzierte ich freudig, den Autoschlüssel um den Finger drehend, zum abgenutzten Opel Rekord P2.
Eines Tages, besser gesagt abends, wurde es brenzlig. Es war der 23. Dezember 1967 und es ging um die letzten dringenden Auslieferungen vor den Weihnachtsfeiern. Ich nahm das Auto entgegen und suchte die erste Adresse. Die war irgendwo unten am Rhein. Es setzte starker Regen ein und ich musste meine Querstrasse mit der Adresse suchen. Ich fuhr entsprechend langsam, dann leuchteten hinter mir zwei Scheinwerfer auf. «Du kannst den Verkehr mit deiner Sucherei nicht aufhalten», dachte ich und gab Gas. Was ich nicht merkte war, dass auf dieser Strecke damals schon Tempo 30 galt. Dann erblickte ich das Blaulicht des nachfolgenden Fahrzeuges und hielt am Strassenrand an. Das Auto mit dem Blaulicht schwenkte vor mich hin. Es war ein weisser FORD Zodiac mit schwarzen Türen, auf denen das Wappen der Basler Polizei prangte. Es kamen zwei Polizisten zu mir und fragten nach meinen Papieren. Mit Schrecken musste ich feststellen, dass ich sie alle in meiner Jackentasche hatte und die Jacke hing immer noch im ungarischen Laden. Autopapiere? Diese waren natürlich bei meinem Onkel, ebenfalls im ungarischen Laden. Selbst den Autoschlüssel hatte ich nicht. Es war eine Spezialität von OPEL, der kleine Kranz um das Zündschloss. Dieser diente für die sogenannte «Garage-Stellung», das heisst, in dieser Position konnte man den Schlüssel abziehen und dann konnten die Leute in der Garage den Motor ohne Schlüssel starten. Für meinen Onkel war das auch für den Alltag bequem …
«Zeigen Sie den Kofferrauminhalt.» Ich machte den Kofferraum auf und nebst den Salamistangen und den Weinkisten lagen dort Onkels Einkäufe für das Weihnachtsfest: ein Anzug, Seidenschal, Lackschuhe. Und ich, ohne Papiere, ohne Autoschlüssel, mit dürftigen Deutschkenntnissen, mit einem Auto mit Berner Kennzeichen, denn damals gehörte das Birstal noch zum Kanton Bern.
Langsam dämmerte es mir, und als ich hinten im Zodiac sass, wusste ich, jetzt bist du schlecht dran. Doch die Meldung der Polizisten, sie hätten eben einen ausländischen Fahrzeugdieb gefasst, hat mich endgültig auf den Plan gerufen. Ich mobilisierte alle meine dürftigen Deutschkenntnisse und versuchte ihnen klar zu machen, dass es keinen Sinn ergebe, mich auf den Clara-Posten zu bringen, sondern in den ungarischen Laden. Da wären alle meine Papiere, der Fahrzeugeigentümer, die Wagenpapiere und alle Erklärungen über den Kofferrauminhalt und die Umstände. Ein Kollege von ihnen hatte das Auto unterdessen zum Clara-Posten gebracht.
Es gelang mir, sie zu überzeugen und der dienstältere Polizist gab seinem jüngeren Fahrer den Befehl, an die Dufourstrasse zu fahren. Auf der dem Laden gegenüberliegenden Seite, auf dem Parkplatz vor dem Kunstmuseum, hielt der Polizeiwagen. Der ältere Polizist stieg aus, machte die hintere Türe auf und sagte: «Mach keinen Scheiss, mein Junge, wir gehen jetzt in den Laden.» Dann zückte er seine Pistole, liess mich aussteigen und lief hinter mir her über die Strasse, die Waffe auf mich gerichtet. Wir traten in den immer noch hell erleuchteten Laden ein, der Polizist mit gezückter Pistole hinter mir her.
Meine Mutter, meine Tante, aber auch mein Onkel erstarrten vor Schreck. Der Polizist fragte nach den Papieren, mein Onkel reichte ihm meine Jacke mit meinen Ausweisen und er suchte nach seinen Fahrzeugpapieren. In dieser Zeit traf auch der jüngere Polizist ein und nahm die Papiere entgegen. Diese waren dann schon in Ordnung und die Pistole wanderte wieder in den Halfter. Mein Onkel drückte den beiden Polizisten je eine Flasche ungarischen Wein in die Hand und entschuldigte sich für die ungünstigen Umstände, die entstanden waren.
Anschliessend wurde ich zum Clara-Posten gefahren, wo noch der Opel vom Onkel stand. Da erklärte mir der Polizist, der das Auto dorthin gefahren hatte, mein Onkel könne von Glück reden, dass sein Auto im Kanton Bern eingelöst sei, in Basel würde man die Schilder wegen den vielen vorhandenen Mängeln sofort abschrauben.
Doch «meine» Polizisten erklärten, sie würden mich zu der Adresse führen, die ich so verzweifelt gesucht hatte. Dort verabschiedeten sie sich ganz freundlich und ich konnte die Ware ausliefern.
Aber auch «Lustfahrten» waren manchmal angesagt, vorwiegend samstags, wenn Pityu im Laden mithalf. Ich musste ins Gymi und nahm das Auto aus parkierungstechnischen Gründen mit. Nachmittags fuhr ich mit einer Schulkollegin in das Geschäft und erkundigte mich, ob Auslieferungen anstünden. Falls nein, konnten wir beide etwas «Wildes» unternehmen, irgendwo hinfahren, die Gegend geniessen, einen Espresso schlürfen.
Vor so einer Ausfahrt kam eines Tages meine Schulfreundin auf die Idee, eine Rolle selbstklebende Rallyestreifen mit schwarzweissen Karos zu kaufen. Mit diesen zierten wir den alten Opel an den Flanken, aber auch längs der Motorhaube, Dach und Kofferraumdeckel. Es sah ganz peppig aus auf der silbergrauen Karosserie und ich war gespannt auf die Reaktion meines Onkels. Er schüttelte lächelnd etwas den Kopf und entfernte die Streifen erst einige Wochen später, als sich die Enden in der Waschstrasse zu lösen begannen.
Ganz anders war es beim Geschenk seiner Mutter, als sie zu Besuch kam. Sie brachte freudestrahlend einen Wackeldackel für die Hutablage mit. In der Zeit, als sie da war, musste der Dackel mit seinem gefederten Kopf die nachfolgenden Autofahrer grüssen. Als Valéria heimging, brachte Pityu sie auf den Bahnhof und bereits auf seiner Rückfahrt sass der Wackeldackel nicht mehr auf der Hutablage.
¿Mutterkomplex?
Seite 41
Seite 41 wird geladen
41.
¿Mutterkomplex?
Einmal auf diesen «Lustfahrten» mit Onkels Opel kamen meine Schulkollegin und ich auf die Idee, auf der Gempenstrecke Gummi zu hinterlassen, dort oben die Aussicht auf die Hügellandschaft zu geniessen und anschliessend einen Espresso zu schlürfen.
Auf dem Gempen stand und steht immer noch ein Aussichtsturm mit 115 Stufen, die auf die fünf Aussichtsplattformen führen. Am Einstieg ist ein Drehkreuz, das man damals mit einem Fünfzigerli füttern musste, um den Weg freizukriegen. Da sparten wir natürlich das zweite wertvolle Stück und gingen zusammen, eng umschlungen durch diese Barriere. Das war dann der Auftakt. Ganz oben erwartete uns eine überwältigende Aussicht auf die Hügellandschaft von Solothurn und Baselland, bei sehr guter Sicht sogar hinaus bis zum Elsass und den Vogesen, Basel und den Schwarzwald. Berauscht von so einem Anblick musste man sich erneut ganz fest umarmen …
Natürlich war es ganz schön, Susanne, diese hübsche, blonde, üppig gebaute junge Frau zu umarmen, zu spüren, wie sie sich an mich schmiegte – doch ohne diesen ominösen, alles bedeutenden Herzschlag. Aber wieso? Sie war der ähnliche Typ wie meine Mutter, die ich ja als die schönste Frau auf Erden anschaute. Es war schon immer so, seit ich Mädchen kannte.
Im Technikum hatte ich eine Freundin, ähnlich wie Susanne. Die meiste Zeit verbrachte ich mit ihr, wir gingen ins Theater, in die Oper und anschliessend konnten wir die halbe Nacht in verrauchten Kaffeehäusern darüber diskutieren, was wir gerade erleben durften. Doch diesen ominösen Herzschlag spürte ich erst dann, als mir Klara entgegenkam – eine schlanke Brünette mit einem stolzen Gang, etwas Unnahbares ausstrahlend. Einmal sassen wir in einem dieser befohlenen russischen Filme nebeneinander. Beim Diskutieren trafen sich unsere Hände und sie zog die ihre nicht zurück. Ich war wie elektrisiert, legte meinen Arm um ihre Schulter und später gaben wir einander einen Kuss und ich wähnte mich im siebten Himmel.
Dann später in der Schweiz: Bei der verschworenen Gruppe, die gemeinsam flüchtete, wurde die zweite Generation allmählich erwachsen oder zumindest halbwegs. Diese hatte zu einer Party gerufen und ich wurde ebenfalls eingeladen. Ich ging hin und es wurde ein wirklich lustiger Anlass. Eva, die Gastgeberin, Tochter eines Stararchitekten in Arlesheim, kümmerte sich eingehend um mich, und ich war wieder einmal im Clinch. Sie war eine hübsche, vollschlanke blonde junge Frau, sehr schön zum Anschauen, doch wieder hatte dieser ominöse Herzschlag, den man in der Kehle spürt, bei mir gefehlt. Entsprechend knöpfte mich mein Onkel vor und meinte: «Wie kannst du einem so hübschen Mädchen aus einem so guten Hause einen Korb geben?»
Ich konnte und wollte ihm das nicht erklären. Diese Frage stellte ich mir jedoch einige Jahre später selbst, als ich den Automobilsalon in Genf besuchte. Damals fand er noch in der Innenstadt im alten Messezentrum statt. Im Park davor gab es gleichzeitig auch eine Chilbi, wo man sich vorzüglich an einem Wurststand verpflegen konnte.
Im Salon schlenderte ich nicht nur an den ausgestellten Autos vorbei, nein, ich besuchte auch die Stände mit den Modellautos.
Gerade vertieft in eine der Vitrinen, merkte ich plötzlich, dass mir eine Frau um den Hals fällt. Es war Eva. Sie berichtete, wie sie zur ewigen Studentin geworden ist, dass es sie nach Genf verschlagen hätte, um sich im Französisch zu vertiefen und sie eben an ihrer dritten Abschlussarbeit werkelte und dass sie allerlei Gelegenheitsjobs annehmen würde, wie auch an dieser Ausstellung. Auch ich berichtete über meinen Werdegang als IT- Mitarbeiter. Dann plauderten wir noch etwas, bis sie einen Kunden bedienen musste. Ich ging weiter in der Ausstellung und überlegte, wie wäre es geworden, wenn …
Ein flüchtiger Kuss von Susanne holte mich in die Wirklichkeit zurück.
«Warst du in Ungarn?», fragte sie, doch ich schüttelte den Kopf.
Dann, unten im Restaurant rührte ich gedankenversunken in meinem Espresso, obwohl ich keinen Zucker und keinen Rahm hineintat. Die Frage liess mich nicht los: «Wieso spricht mich nur ein Frauentyp an, der vollkommen anders ist als meine Mutter, die ich aber schon als Kind als die schönste Frau auf Erden empfand? Ist das eine Art Mutterkomplex?»
Natürlich schaute ich Filme mit Gina Lollobrigida und Sophia Loren begeistert an, doch meine schauspielerischen Lieblinge wurden Audrey Hepburn oder Geraldine Chaplin. Klar war ich begeistert von Catherine Deneuve. Fasziniert war ich aber von Juliette Binoche (Anhang 4).
«Bist du wieder in deiner Vergangenheit?», fragte Susanne erneut, doch wieder musste ich den Kopf schütteln und sagte: «Nee, eher in der Zukunft.»
Tantes VW Käfer
Seite 42
Seite 42 wird geladen
42.
Tantes VW Käfer
Meine Tante Georgina machte löblicherweise den Führerschein schon ganz früh, sie wollte unabhängig sein. Und als sie dank meiner Grosseltern wieder zur Arbeit gehen konnte, kaufte sie sich einen VW Käfer. Das Exemplar wäre heute sehr gefragt, wahrscheinlich war es eines mit den begehrten «Brezel» Heckscheiben. Das denke ich, denn das Auto hatte eine 6 Volt Bordanlage, typisch für die ganz frühen Modelle.
Meine liebe Tante verkündete, sie könne ganz vorzüglich Auto fahren, nur nicht nachts, was mit den 6 Volt-Birnen in den Scheinwerfern ihres Käfers nicht verwunderlich war. Dann wollte sie auch nicht in Tunnels fahren und nicht in der Stadt, wenn sie komisch parkieren müsste, also seitwärts oder etwa rückwärts. Aber sonst ginge alles sehr flott.
Auch dieses Auto musste ich gelegentlich fahren: Auslieferungen, Parkplatz für das Auto suchen usw. Ich bewegte den Käfer äusserst gerne, denn ich merkte allmählich, dass ich ein automobilistischer Sonderling bin. Das heisst, je schwieriger das Fahrzeug zu lenken war, umso mehr Freude hatte ich daran. Es machte enorm Spass mit Zwischenkuppeln oder Zwischengas zu schalten, dann gingen die Gänge blitzschnell wie in Butter rauf oder runter. Das Gefährt hatte eine unpräzise, aber sehr leichtgängige Lenkung. Kunststück, unbeladen lastete nahezu kein Gewicht auf der vorderen gelenkten Achse. Dann waren meine jungen Augen zudem scharf genug, um von den schwachen 6V-Birnen immer noch etwas von der nächtlichen Strasse zu erahnen. Zugegeben, bei dem heutigen dichten, hektischen Verkehr möchte ich das Auto nicht mehr bewegen …
Es hatte ein Faltdach, also ein Dach aus Stoff, das man öffnen und nach hinten schieben konnte. Das tat ich auch meistens, denn ich war schon immer ein Liebhaber von Sonne und Wind beim Autofahren. Was ich jedoch nicht wusste, war, dass das Schloss vorne beim Arretieren des Stoffdaches nicht einwandfrei einrastete.
Vor einer dieser berauschenden Partys, welche die geflüchteten Pärchen miteinander feierten und wovon gerade eine bei meinem Onkel stattfinden sollte, fuhr meine Tante nach Basel und holte sich ein neues Cocktail-Kleid. Dann ging sie zum namhaftesten Coiffeur der Stadt, zum Lütolf, und liess sich eine entsprechende Frisur machen.
Auf der Heimfahrt fand sie, sie hätte noch genügend Zeit, eine neue Errungenschaft von Basel kennenzulernen: die soeben eingerichtete automatische Auto-Waschanlage bei der St. Jakobs Halle, die auf ihrem Heimweg lag. So fuhr sie mit ihrem VW Käfer in die Waschanlage hinein und die erste rotierende Bürste öffnete ihr Faltdach, rollte es nach hinten und sie wurde schamponiert, gewachst und getrocknet, wie ihr VW Käfer.
Meine Tante suchte Hilfe bei ihrer Schwester und so stand sie vor unserer Tür mit herunterhängenden, nassen Haaren, durchnässtem Kleid und gab auch sonst eine klägliche Figur ab.
Dann ging sie ins Bad. Unsere Mutter versuchte die Kleider ihrer Schwester in Ordnung zu bringen, während meine Schwester Kati sich um deren Frisur kümmerte. Ich nahm eine Kabelrolle, steckte einen Föhn ein und versuchte, den Käfer-Sitz einigermassen trocken zu bekommen.
Am Schluss sah Georgina ganz passabel aus und wir entliessen sie an ihre Party.
Allerdings zu Hause angekommen fragte die Nachbarin:
«Aber Frau Hajdu, ich dachte Sie wollten auch noch zu ihrem Coiffeur …»
Minerva
Seite 43
Seite 43 wird geladen
43.
Minerva
So hiess das Privatgymnasium in Basel, in das ich eintrat. Es war eine spezielle Welt, eine mehr als farbige, vielfältige. Alle Schülerinnen und Schüler hatten eine besondere Veranlassung, in diese Schule zu gehen, solche wie ich, die aus alters- oder anderen Gründen nicht ein reguläres Gymnasium besuchen konnten.
Andere Schülerinnen und Schüler hatten die ordentliche Schule nicht geschafft, warum auch immer, doch ihre vorwiegend schwerreichen Eltern wollten es nicht wahrhaben, dass ihre Sprösslinge ohne höhere Ausbildung bleiben sollten. Einer von ihnen wurde ein guter Kumpel von mir, er war der Sohn von Dr. Prof. Weiss, Dozent an der Basler Uni und Leiter der zuständigen Kommission für die eidgenössische Matur. Damit der Junge von Therwil bequem nach Basel kam, bekam er einen schmucken MG 1100er. Das Modell kannte man besser als Austin 1100, doch seine Version hatte eine markantere, MG-spezifische Kühlermaske. Sein Vater fuhr standesgemäss einen Opel Senator, die Repräsentationslimousine der Rüsselsheimer Marke. Eines Tages musste der Opel für längere Zeit in die Werkstatt und der Vater meines Kumpels beschlagnahmte für diese Zeit den MG seines Sohnes. Der Opel kam aus der Werkstatt zurück, doch der Vater gab seinem Jungen den MG nicht mehr zurück – er bekam so eine Freude an diesem wendigen, spritzigen, schmucken Fahrzeug. So musste mein Schulkamerad von da an mit der Staatskarosse des Vaters ins Gymi. Damals fuhr ich einen fast schrottreifen Vauxhall Victor und wir schockten die Basler Bevölkerung, indem wir einander leicht ramponierten, anschliessend einander anlachten, statt die Polizei zu rufen.
Eine andere einschneidende Begebenheit, eine Art Prüfung, wurde Vera für mich. Ein Mädchen, das leider überhaupt nicht meinen Vorstellungen von einer möglichen Freundin entsprach. Dabei hatte es die junge Frau auf mich abgesehen. Sie verwickelte mich nach dem Unterricht in Gespräche, setzte sich auf die Schreibfläche der Schulbank mit den Füssen auf der Sitzfläche, wo ich sass, hatte knappe Röckchen an und presste die Beine nicht immer konsequent zusammen. Doch das war noch nicht «Köder» genug. Was mich an meine Grenze brachte war, dass sie meinen ausgesprochenen Traumwagen fuhr: einen Mercedes-Benz 230 SL, die legendäre «Pagode», die mich masslos begeisterte. Die Versuchung war entsprechend riesig. Doch ich blieb standhaft, wofür ich heute noch stolz auf mich bin.
Die Begeisterung für das Modell hielt an, weshalb ich viele Jahre später für meine Frau Trudy so eine «Pagode» restaurieren und diese als ihr «Chefmechaniker» immer wieder bewegen konnte …
Wir hatten unterschiedliche Lehrerinnen und Lehrer gehabt. Mit den meisten kam ich sehr gut aus, doch es gab einen, der hatte es auf mich abgesehen. Das war ein junger Dozent für darstellende Geometrie – eines meiner Lieblingsfächer im Technikum in Budapest. Dieser Lehrer hatte mich bei jedem Deutschfehler, den ich machte, ausgelacht und sonst noch unschöne Bemerkungen über solche Fremdlinge wie mich gemacht. Dann kam die Schlussstunde des Semesters. Da hatte er eine Doppelstunde einberufen für eine abschliessende, umfassende Konstruktion. Mit dieser begann er an der grossen Tafel mit Lineal, Winkelmass und Kreide. Im Verlauf merkte ich, dass er gar nicht so sattelfest war und steuerte bewusst Elemente bei, die nicht richtig waren. Kurz vor Schluss meldete ich mich und erklärte, warum die ganze Konstruktion falsch sei. Mit einem hochroten Kopf musste er das Ergebnis akzeptieren. Nun ja, es heisst Rache sei süss. Manchmal ist sie geometrisch.
Meine Lehrerinnen für Deutsch und Englisch hingegen waren ganz sympathisch. Die Deutschlehrerin empfahl mir eine Lektüre: «Jerry Cotton». Dieses wöchentlich erscheinende Heft sei von unterschiedlichen deutschen Autoren in einer einfachen, aber guten Sprache verfasst, der Stoff sei leicht verständlich und spannend zu lesen. Ich probierte es aus und der Mann war mir auf Anhieb sympathisch: Er war selbst in brenzligen Situationen den Schurken überlegen, hielt diese im Schach mit seiner Magnum 44, trank Bourbon und fuhr einen Jaguar E-Type. Jede Woche rannte ich zum Kiosk, um das neue Heft zu holen.
Dann die Englischlehrerin: Sie hatte es mir nicht verübelt, dass ich bei ihr alles andere als ein Musterschüler war. In den Fremdsprachen mussten wir für die Maturitätsprüfung jeweils drei Werke angeben, die wir analysieren sollten. Sie gab drei Bücher vor und das eine hiess «How to be an Alien» und war verfasst von Georges Mikes. Das ist doch ein ungarischer Schriftsteller, geboren 1912 in Siklós, sagte ich meiner Lehrerin und fragte sie, wie es dazu käme, dessen Werk als Lektion für eine Maturprüfung zu verwenden. Sie hatte es mir dann ganz genau erklärt: «Einheimische lernen ihre Sprache im Elternhaus, dann auf der Strasse und meinen, sie beherrschten diese. Das kann auch stimmen, doch bei einem ausländischen Zuzügler, der in einem fremden Land literarisch tätig sein will, sieht es ganz anders aus. Dieser geht der Sprache auf den Grund, lernt sie ganz bewusst und interessiert sich für alle Nuancen und Facetten der Sprache, wie auch Georges Mikes, der in Grossbritannien einige Bücher mit Erfolg veröffentlichen konnte.»
Es ergaben sich tolle Freundschaften. So lernten wir vier Jungs einen ganzen Sommer lang zusammen auf die Vormatur. Diese Vorprüfung umfasste alle Fächer, die in einem regulären Gymi Erfahrungsnoten ergeben, von einem Privatgymnasium jedoch nicht akzeptiert werden.
Ich war kein sonderlich guter Schüler, deshalb hatte mich die Minerva gar nicht für diese Prüfungen angemeldet. Ich ging also als «wilder Kandidat» und kam mit 25 von möglichen 30 Punkten zurück. Ich meldete mich für den nachfolgenden Unterricht für die Hauptmatur an und weder das Schulsekretariat noch der Schuldirektor verstanden, wie das kommen konnte. Sie konnten nicht wissen, dass wir, drei meiner Schulkollegen und ich, in den letzten Sommerferien vor den Prüfungen fünf Wochen lang Tag und Nacht gebüffelt hatten. Jeder hatte sein Lieblingsfach und konnte die anderen unterstützen. Das war eine «Sonderschule» der besonderen Art, die uns Spass machte und uns mit Bravour durch die Prüfungen brachte.
Bis zur Hauptmatur ging es noch ein Jahr. In den vorangehenden Sommerferien hatte ich mich dann mit einem Schulkameraden darauf vorbereitet. Meine Knacknüsse waren die beiden Fremdsprachen Französisch und Englisch.
Die fünfköpfige Familie
Seite 44
Seite 44 wird geladen
44.
Die fünfköpfige Familie
Die Zwillinge, meine Mutter und meine Tante, hatten bereits je zwei Kinder und sie fanden, das sei OK so, mehr brauche es nicht – auch schon aus finanziellen- und Platzgründen. Doch eines Tages, als meine Mutter ihre Schwester zu Besuch hatte, verkündete sie ihr, dass sie schwanger sei. Diese schlug die Hände zusammen: «Du alte Henne, hast du denn nicht genug von Verhütung gehört?»
Mutter meinte, es sei halt nun mal so passiert und sie würde jetzt selbstverständlich auch nichts dagegen unternehmen.
«Na klar», meinte ihre Schwester, schüttelte jedoch den Kopf und hörte nicht auf mit ihrer Schwester zu schimpfen.
Kati, etwa dreijährig kriegte das alles nicht mit, ich aber schmunzelte nur und freute mich über den Zuwachs der Familie. Unterdessen verdiente Mihály bereits recht ordentlich, so wurden die Eltern bei der Hausverwaltung vorstellig und fragten für eine Vierzimmer-Wohnung nach. Das dritte Kind war noch nicht auf der Welt, als wir tatsächlich im gleichen Block, allerdings in einem anderen Eingang und ein Stockwerk tiefer in eine grössere Wohnung ziehen konnten. Fieberhaft wurde das Kinderzimmer für den Neuankömmling hergerichtet: Fenster und Türen neu gemalt, Wände neu tapeziert, Spannteppich herausgerissen und der darunterliegende Parkettboden aufgefrischt.
Mit all diesen Vorbereitungen noch nicht fertig, kam später die Schwester unserer Mutter vorbei. Irgendwie geknickt und mit ganz leiser Stimme verkündete sie, vielmehr beichtete sie, dass auch sie schwanger sei. Einen Vorwurf machte ihr niemand, sie erhielt eher die Empfehlung: «Freue dich doch!»
So bekamen wir unsere Georgina und Hajdus ihren Isti. Ihr Kleiner wurde nach zwei Mädchen gemäss alter Tradition Stephan getauft, wie sein Vater.

Georgina und Kati
Die neue Vierzimmer-Wohnung war viel schöner als die alte mit drei Zimmern. Diese grössere Wohnung hatte auch nach drei Seiten Fenster und nach vorne und hinten je einen Balkon. Was mir jedoch noch einige Male passierte, war, dass ich beim Heimkommen in Gedanken versunken in unsere alte Wohnung reinplatzte. Ich schaltete, weil alles anders aussah, rief eine Entschuldigung und ging in unsere neue Wohnung.
Ich hatte also bereits zwei Schwesterlein. Wir haben einiges an Blödsinn getrieben, aber sie verstanden es auch, wenn es ernsthafte Worte gab. Die Eltern waren den Umständen geschuldet nicht mehr die Jüngsten und waren manchmal froh, wenn ich mal das eine oder andere Erziehungsproblem mit meiner jugendlichen Gelassenheit und Geduld übernahm. Das funktionierte ganz gut und unser Verhältnis untereinander ist auch nach vielen Jahren ungebrochen nichts als herzhaft und lebendig.

Georgina und Kati wachsen auf.
In dem Haus mit der neuen Wohnung fanden wir auch genug gute, offene Nachbarn vor. Gegenüber wohnten die Suters mit zwei etwa gleichaltrigen Mädchen wie meine Schwestern – also die beste Voraussetzung, die Türen links und rechts offenzulassen.
Zudem war eine italienische Familie in der Nachbarschaft, damals noch zwei Generationen umfassend – ganz freundliche Leute. Das Problem war nur, dass die Alten kein Deutsch sprachen. Aber ihre Gesten waren verständlich.
Der Sohn arbeitete in einer Garage in Basel und kaufte immer neuere, grossvolumige Autos mit vielen Kilometern auf dem Tacho. Das waren die besten Käufe, denn Langstreckenkilometer belasten die Mechanik am wenigsten, nicht so, wie wenn das Auto dazu dient, den BLICK am nächsten Kiosk zu holen. Bei jeder Gelegenheit sausten sie nach Süditalien, es reichte ein freier Freitag oder Montag, um am verlängerten Wochenende die Strecke unter die Räder zu nehmen.
Das war die Zeit, als ich noch meinte, von Oliven müsse man sterben – diese waren für mich so exotisch, so fremd. Ich sah, dass die Nachbarn aus Italien immer Oliven heimbrachten. Diese standen in kleinen Fässern im Keller. Der Alte holte gelegentlich einige davon herauf. An diesem denkwürdigen Tag auch …
Ich ging in den Keller und der Alte kam mir entgegen. Er trug einen Teller voll Oliven, grüne, braune, schwarze mit unterschiedlichen Gewürzen, Ölen und Kräutern darum. Das Ganze war ein Gedicht und ich sagte es auch bewundernd dem alten Italiener. Daraufhin streckte er mir mit strahlendem Gesicht den Teller entgegen und bot mir an, die Oliven zu probieren. In diesem Moment wusste ich, nun bin ich verloren. Ich konnte das freundliche Angebot unmöglich zurückweisen, folglich musste ich eine dieser ausgewachsenen Oliven nehmen und dann sterben. Aber siehe da: Die Olive schmeckte und von Sterben war keine Rede … Seither habe ich die Dinger überaus gerne.
Eines Tages verkündete Georgina, sie wolle unbedingt eine Katze. Die bekam sie auch, vermeintlich einen Kater, also Florian getauft. Dann stellte sich heraus, dass die von Kopf bis Fuss tiefschwarze Katze ein Weiblein war, so wurde sie ganz einfach auf Flörli umgetauft. Sie war ein handzahmer Stubentiger, bis heraus kam: Meine Schwester hat eine Allergie auf Katzenhaare. Was nun? Einfach sich vom geliebten Tier zu trennen, ging gar nicht. In dieser Zeit bauten Trudy und ich auf dem Land unser Haus und die Lösung war naheliegend: Wir übernahmen das Kätzchen, so blieb es in der Familie. Auch Stubentiger haben ihre angeborenen Instinkte. Als wir sie nach der Angewöhnungszeit bei uns in Zeiningen das erste Mal hinaus liessen, brachte sie bereits eine Maus heim und verzehrte diese voller Stolz vor unseren Augen …
Wisa Gloria – oder steht die Physik Kopf?
Seite 45
Seite 45 wird geladen
45.
Wisa Gloria – oder steht die Physik Kopf?
Früher hatten Kinderwagen Räder mit ganz grossem Durchmesser, manchmal waren die vorderen sogar noch grösser als die hinteren. Mit so einem schob ich meine Schwester Kati durch die Strassen, Parks und über die Donaubaubrücken quer durch Budapest. Die Erklärung für die grossen Räder war, dass die Eltern und sonstigen Betreuer sich nicht zu tief zum Kind bücken mussten. Aber auch, und das war in der Stadt viel wichtiger, weil CO2 schwerer ist als Luft, sammelt sich also in Bodennähe an. Obwohl CO2 im Grunde nicht giftig ist, sollten die Kinder dieses in dieser Konzentration nicht einatmen. Wir trinken es aber im Sprudelwasser. Heute schützen wir uns vor allem in der Welt, was schädlich sein könnte, die Kinderwagen haben jedoch ganz winzige Räder, aus diesem Grunde sogar oft doppelt installiert.
Nein, CO2 scheint heute der Physik ein Schnippchen zu schlagen und bildet über uns eine Glocke, die unser Klima beeinflussen soll.
Aber als meine zweite Schwester in der Schweiz zur Welt kam, galten immer noch die alten physikalischen Gesetze und die Kinderwagen waren nach wie vor hoch gebaut mit grossen Rädern. Als für unsere kleine Georgina die Kinderwagenbeschaffung aktuell geworden war, gingen Mihály und ich einen kaufen. Ich brauchte nicht lange zu suchen, steuerte schnurstracks auf einen Wisa Gloria zu. Es war ein prächtig schönes Exemplar mit königsblauem Bezug und verchromten Spannbügeln für das Verdeck. Es hatte auch eine angenehme Federung pro Achse mit doppelelliptischen Federn, wie es früher die Kutschen hatten. Was mich weniger interessierte, war, dass es das teuerste Stück im ganzen Laden war. Mihály gefiel das Prachtexemplar auch, zog tief am Zahn und liess dafür einen beträchtlichen Teil seines Monatslohnes liegen.

Kati mit Georgina
Was ich noch im Technikum gelernt hatte, war nicht nur, dass CO2 schwerer ist als Luft, sondern auch, dass die Sonne ihre wechselnden Intensitätsperioden hätte, womit Klimaschwankungen erklärt werden könnten:
Es ist ein interkontinental ausgetragener Streit darüber ausgebrochen, wer die riesigen Ölreserven unter der Arktis und Antarktis erschliessen dürfe – wenn überhaupt, denn diese Gebiete sollen geschützt werden. Tatsache ist, dass diese Ölreserven aus den Meeren entstanden sind, die hier einmal gewesen sind. Ihre abgestorbenen Lebewesen haben das sogenannte Plankton gebildet, aus dem durch weitere Einflüsse Erdöl gebildet wurde. Erst danach ist die Eiszeit gekommen, welche die Arktis und Antarktis hervorbringen konnte.
Schon Heraklit von Ephesos erkannte: «Nichts ist so beständig wie der Wandel.»
Schliesslich kam der Mensch, und er belastet, wie jedes Lebewesen unseren Planeten. Als die industrielle Revolution in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ausbrach, rauchten die Kamine der Fabriken, sodass man in diesen Gebieten kaum atmen konnte. Eines der Zentren in Europa war das Ruhrgebiet, wo man je nach Wetterlage die gegenüberliegende Strassenseite nicht mehr sah und die Leute zu früh starben. Der immer wichtiger werdende Güterverkehr wurde mit Hilfe von Dampflokomotiven abgewickelt, deren Kohlefeuerung schwarzen Rauch ausstiess, voller CO2 und Feinstaub, und dies nicht nur in den Industriegebieten, sondern quer durchs Land. Für die Bevölkerung war das ungesund, doch das Klima reagierte jahrhundertelang nicht. Heute fahren die Züge elektrisch, aus den Industrieanlagen verschwanden die Dampfmaschinen und bei den Feuerungsanlagen sind Rauchwaschanlagen in Betrieb.
Dann die Autos, Sündenböcke Nummer 1: Diese verkehren seit über 130 Jahren auf der ganzen Erde, zuerst in geringer Anzahl, dann aber begann rasch ihre Massenverbreitung. Die rauchten und stanken um die Wette. Die nach dem Zweiten Weltkrieg in der Schweiz sehr beliebten Amerikaner gaben sich nicht mit einem Verbrauch unter 20 bis 40 Litern auf 100 km zufrieden. Zudem mussten ihre Katalysatoren ausgebaut werden, da es in der Schweiz noch kein unverbleites Benzin gab. Das Klima sah tatenlos zu, jahrzehntelang. Heute verbrauchen die Autos einen Bruchteil vom damaligen Treibstoff, verfügen über geregelte Katalysatoren und Partikelfilter.
Das Klima reagiert erst jetzt. Und wir wollen es nun innerhalb dreier Jahrzehnte beeinflussen …
Hoffentlich kommt es nicht soweit, wie in der folgenden kosmischen Geschichte: Zwei Planeten treffen sich im Weltall. Dem einen geht es gar nicht gut, das sieht man selbst aus galaktischer Entfernung.
Da fragt ihn sein Kollege: «Was fehlt dir denn?»
Der andere antwortet ganz geknickt: «Ich habe den Homo sapiens.»
Da erwidert sein Kollege ganz gelassen: «Das ist nicht so schlimm. Den habe ich auch mal gehabt.»
Tram fahren
Seite 46
Seite 46 wird geladen
46.
Tram fahren
Trudy hat eine Salatschleuder. Das ist eine geniale Sache, ein Behälter mit einem drehbaren Korb darin. Sie bereitet Salatblätter mundgerecht vor, wäscht sie und legt diese in den Korb und es heisst: «Du kannst Tram fahren.» Dann lege ich den Deckel darauf, drehe am Knopf und die gewaschenen Salatstücke werden durch die Schleuderbewegung vom überschüssigen Wasser befreit. Dabei entsteht ein Geräusch, das mich an das Tramfahren in meiner Kindheit erinnert.
Damals in Budapest fuhren noch vorwiegend alte zweiachsige Strassenbahnwagen in der Stadt umher. Diese hatten einen ganz einfachen Antrieb mit gerade verzahnten Zahnrädern, damit sie hin und her fahren konnten. Nur an der Promenadenstrecke entlang der Donau am Pester Ufer fuhr die Linie 2 mit den modernen, vierachsigen, schnellen «Stuckas» und machte ihre Ehrenrunde um das Parlamentsgebäude. Dann wurde die Produktion der öffentlichen Verkehrsmittel unter den Mitgliedern des Ostblocks aufgeteilt und die alten Zweiachser wurden allmählich durch die tschechischen Vierachser abgelöst.
Aber als Kind fuhr ich noch vorwiegend mit den alten Zweiachsern und diese «sangen» in den höchsten Tönen – wie die Salatschleuder von Trudy. Nun aber warum?
Hurra, jetzt darf ich abschweifen!
Früher gab es ein alltägliches Bild auf den Strassen: die schwarz gekleideten Zimmermannsjungen mit dem grossen Hut und den Schlaghosen. Man weiss ja, es war Zimmermannstradition, das Land zu bereisen, Erfahrungen zu sammeln, bevor man irgendwo sesshaft wurde. Noch viel früher, so um die Jahrhundertwende nach dem 19. Jahrhundert gingen auch sehr viele andere junge Handwerker auf die Wanderschaft, um ihr Wissen zu erweitern. So auch André, der Sohn des belgischen Juweliers Levie Citroën. Nach seinem Studium an der École polytechnique, stiess er auf seiner Wanderschaft in Polen auf eine mechanische Werkstätte, wo eine ungewohnt leise laufende Drehbank ihre Dienste versah. Er liess sich in dieser Werkstatt anstellen und kam der Sache auf den Grund: Der Antrieb der leise laufenden Drehbank hatte schrägverzahnte, genauer gesagt doppelwinklige Zahnräder, deren Zähne aneinander gleiten. Bei gerade verzahnten Zahnrädern hingegen schlagen die Zähne aufeinander. Er ging mit dieser Erkenntnis und dem frisch erworbenen Patent nach Hause und probierte bereits 1905 ein Getriebe mit schrägverzahnten Zahnrädern zu bauen. Es wurde ein voller Erfolg – die ganze Welt wollte für allerlei Antriebe und Maschinen ein dermassen leise laufendes Getriebe haben. Das Geschäft lief so gut, dass André sich im Jahre 1919 an den damals aufstrebenden Automobilbau heranwagte. Er führte dabei auch die Fliessbandverarbeitung in Europa ein. Man sieht heute noch etliche Fahrzeuge, die mit ihrem Doppelwinkel als Markenzeichen die Entdeckung André Citroëns symbolisieren.
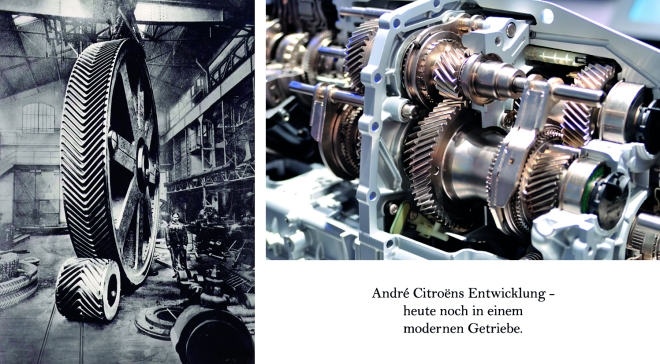
Diese Theorie bestätigen auch unsere modernsten Personenwagen. Sie laufen leise, denn alle Vorwärtsgänge sind schräg verzahnt und laufen dadurch fast geräuschlos. Aber der Rückwärtsgang, vor allem, wenn man beim Rückwärtsfahren mutig Gas gibt, singt in den höchsten Tönen. Auch dafür gibt es eine Erklärung: Wenn alles in einer Richtung geht, kann man die schrägverzahnten Zahnräder einsetzen. Sollte jedoch die Richtung gewechselt werden, also Rückwärtsgang, geht das nicht mehr, denn dann würden die zwei Zahnräder, die für den Wechsel der Drehrichtung verantwortlich sind, ihre Verzahnung in einem X zueinander präsentieren und das geht nicht gut. Also in diesem Falle kommen nur gerade verzahnte Zahnräder in Frage und diese geben ihre bekannten Geräusche von sich.
Dass junge Handwerker aller Sparten gerne fremde Erfahrungen sammelten, bewies auch ein angehender Konditor aus Genf. Er kam nach Budapest, wo er sein Herz verlor und eine renommierte Cafeteria in der Budapester City übernahm. Er baute dieses K & K-Lieferantenhaus weiter aus. Wie damals für neu auftretende Konditoren üblich, lancierte er eine Eigenkreation, die Gerbeaud Schnitte.
Auf ausgewallte Hefeteig-Platten wird Aprikosenkonfitüre gestrichen und mit gemahlenen Baumnüssen bestreut. Drei solche Platten kommen aufeinander, wobei die dritte Platte nicht mehr bestrichen wird. Anschliessend werden sie gebacken. Nach der Abkühlung wird das Gebäck mit Schokoladenglasur überzogen. Vorzugsweise wird das Ganze zwei, drei Tage gelagert, damit sich die Geschmäcker miteinander verbinden können. Danach werden längliche Stücke geschnitten. Wenn Trudy unseren Gästen die Gerbeaud Schnitten auftischt, scherzen wir, ob diese nun eine Schweizer Spezialität aus Ungarn oder aber eine ungarische Spezialität aus der Schweiz geniessen möchten. Jedenfalls haben die süssen Versuchungen bisher ausnahmslos alle begeistert.
Heute ist das Kaffeehaus Gerbeaud eine der besten (und teuersten …) Adressen in Budapest für Kaffee und Kuchen.
Dann ist da der Zürcher Abraham Ganz, der sein Metallgiesserei-Unternehmen dank ungarischer Investoren aufbauen konnte – mehr darüber in der folgenden Episode.
Der einfache Schweizer und der Graf
Seite 47
Seite 47 wird geladen
47.
Der einfache Schweizer und der Graf
Die Grafen Ungarns nahmen im Laufe der Geschichte unterschiedliche Rollen ein. Es gab die Verarmten, die ihre Schulden genauso wie ihren Titel würdevoll trugen. Dann waren da aber die ganz Reichen, die entscheiden mussten, wozu sie ihre Reichtümer verwendeten. Viele von ihnen bauten Schlösser, die einander in ihrer Grösse und ihrem Prunk übertrafen. Am berühmtesten ist Schloss Eszterházy in Fertöd, ganz im Westen Ungarns. Der Prinz Eszterházy baute sein erstes Schloss in Kismárton, heute Eisenstadt im Burgenland, das damals zu Ungarn gehörte. Doch dann strebte er nach noch mehr und entwarf Ungarns grösstes Schloss in Fertöd, das heute in Reiseführern das «Hungarian Versailles» genannt wird. Dieser im 18. Jahrhundert erbaute Rokoko-Palast diente mit seinen grossen, prachtvollen Ball- und Konzertsälen über Jahrzehnte auch als Residenz von Joseph Haydn und seinem Orchester.
Mein Favorit ist das Barockschloss Festetics in der Stadt Keszthely am östlichen Ende des Balaton. Das in hellgrau gehaltene Gebäude mit den dunkelgrauen Dächern fasziniert mich mit seiner klaren Gliederung. Graf Festetics baute im 18. Jahrhundert nicht nur sein Schloss in Keszthely, sondern auch eine Schule, eine Apotheke, ein Spital und die Hochschule für Agrarwissenschaften.
Damit sind wir beim Thema, das ich ansprechen möchte. Die meisten Schlösser dienten auch als würdige Kulisse für Staatsempfänge der Könige und für kulturelle Anlässe. Doch es gab einen anderen Grafen, der seine Rolle gänzlich woanders sah.
Graf István Széchenyi war Staatsreformer und Unternehmer. Er widmete sich ab 1825 ganz dem wirtschaftlichen Fortschritt Ungarns. Seiner Initiative und auch seinem finanziellen Einsatz ist eines der wichtigsten Wahrzeichen in Budapest zu verdanken, die «Széchenyi Lánchíd», die Kettenbrücke im Herzen Budapests, die auf jedem Prospektbild für Donaufahrten an prominenter Stelle abgebildet ist. Angeblich ist sie die erste fixe Brücke auf der schiffbaren Donau, erbaut in den Jahren 1839 bis 1849, also lange bevor die legendäre K & K-Monarchie mit dem österreichischen Kaiserreich zustande kam.
Die Brücke war jedoch bei weitem nicht sein einziger «Husarenstreich». Seinem Bestreben ist auch die erste Eisenbahnlinie Ungarns zu verdanken, die 1846 in Betrieb genommene Linie Budapest-Vác, das heisst ein Jahr vor der «Spanisch Brötli Bahn», der ersten Eisenbahnlinie der Schweiz. Doch bei diesem Erfolg war Széchenyi nicht der einzige Akteur.
Ein junger Schweizer Ingenieur aus Zürich, Abraham Ganz machte eine wortwörtlich bahnbrechende Entwicklung. Er revolutionierte die Giesstechnik für Eisenbahnräder. Diese konnten nun schneller, einfacher und günstiger gegossen werden und waren erst noch sicherer gegen die damals häufig auftretenden Radbrüche. Hierzu brauchte er Investoren, die er jedoch in der Schweiz nicht fand. Er suchte in ganz Europa weiter, doch die Idee einer Eisenbahn war noch etwas fremd in den Köpfen der Investoren. Fündig geworden ist er dann in Ungarn. Dort gründete er seine Giesserei, die später zu Ungarns grösstem Metallindustriezweig aufstieg, heute noch genannt «GANZ-Mávag».
Széchenyi und Ganz spannten zusammen und konnten eine der ersten Eisenbahnlinien Europas in Betrieb nehmen. Ganz sollte vom König für seine Leistungen zum Baron ernannt werden, doch er lehnte die Ehrung dankend ab: «Ich bin ein einfacher Schweizer.»
Grausame Erziehungsmethoden
Seite 48
Seite 48 wird geladen
48.
Grausame Erziehungsmethoden
Wenn ich bei der Erziehung meiner Schwestern gefragt war, versuchte ich stets nach meinem Vorsatz zu handeln: «Die Erziehung muss liebevoll, aber konsequent sein.» Natürlich kam in unserem Alter auch das Spielerische dazu, zum Beispiel bei den Tischmanieren.
Salat auf ungarische Art schwimmt in einer Flüssigkeit aus Wasser, etwas Essig, Salz und Zwiebelringen. Ich nahm manchmal ein Salatblatt auf die Gabel, tropfte es ab, aber dann schwang ich es so, dass meine Schwestern vom Salatwasser etwas angespritzt bekamen. Anschliessend verkündete ich: «Seht ihr, genau DAS darf man am Tisch nicht machen.»
Sie haben es auch nie getan, doch gelegentlich fragten sie: «Dürfen wir das machen, was man nicht machen darf?»
Die Eltern oder ich antworteten dann: «Ja, aber nur ein bisschen und nur einmal.»
Freudig kichernd versuchten sie das Salatblatt so zu schwingen, dass die Tropfen nicht ins Auge gingen. Irgendwie war es daraufhin ein Leichtes, ihnen ganz ernsthaft beizubringen, wie man den Tisch deckt und später auch, wie man sich bei einem Festessen benimmt.
Was heisst «konsequent» in der Erziehung? Ich bat die Eltern, dreimal zu überlegen, bevor sie NEIN sagten. Weil es dann auch bei diesem NEIN bleiben sollte. Sonst weiss das arme Kind nicht, soll es betteln, zwängeln oder sonst was versuchen, um das NEIN umzustossen oder aber wissen, es ist so. Aber dann soll es auch einen Grund für das NEIN geben, und man kann froh sein, wenn man diesen dem Kind auch erklären kann.
Es konnte aber manchmal auch dazu kommen, dass meine Erziehungsmethoden grausame Formen annehmen mussten. Wie zum Beispiel bei meiner kleineren Schwester Georgina.
Als sie Teenie wurde, begann sie mit ihren Freundinnen «Afternoon Tee» zu zelebrieren. Sie bekam dazu das kostbare Herend-Teeservice mit dem Rothschild Muster, kochte für den Tee Wasser auf und unsere Mutter zauberte sogar kleinere Häppchen dazu. Als die Young Ladys dann gingen, bat Mutter ihre Tochter Georgina, den Tisch abzuräumen.
«Ja, ich mache das, muss aber vorher noch schnell etwas erledigen.»
Aufforderung und Antwort erfolgten einige Male in gleicher Form, dann musste Georgina ins Bett. Abends räumte Mutter den Salontisch ab und ärgerte sich über ihre Tochter.
Nachdem sich dieses Spiel zwei, drei Mal wiederholt hatte, sagte ich unserer Mutter, sie solle nicht abräumen.
«Das kann man doch nicht machen», meinte sie, aber ich verkündete: «Das KANN man machen, das MUSST du so machen!»
Und so kam es: Als Georgina das nächste Mal ihre Freundinnen empfing und das Teegeschirr suchte, meinte Mutter nur: «Es ist in der Stube.»
Meine Schwester fragte: «Ach, schon?»
Mutter antwortete: «Nein, noch.»
Die Girls gingen hinein und tatsächlich standen auf dem Salontisch der Teekrug und alle Tassen, allerdings mit dem auf den Tassenböden eingetrockneten Tee vom letzten Mal.
Georgina bekam einen roten Kopf und fing an abzuräumen. Ihre Freundinnen halfen und unter Mutters Anleitung bekamen sie das Teegeschirr sauber. Das Teewasser wurde gekocht und sogar Häppchen kamen zum Vorschein.
Künftig strömten die Young Ladys nach ihrer Tee-Time nicht mehr zum Ausgang, nein, sie kamen mit ihren Tassen in die Küche und es wurde gemeinschaftlich abgewaschen. Und unsere Mutter musste sich nach diesen Anlässen nicht mehr ärgern.
Die Matura
Seite 49
Seite 49 wird geladen
49.
Die Matura
Da ich eine Privatschule für die Maturvorbereitungen besuchte, musste ich die eidgenössische Matura ablegen, ohne Erfahrungsnoten, wie diese von staatlichen Gymnasien anerkannt werden. Also bestand die Maturitätsprüfung in zwei Etappen aus zwölf Fächern, zuerst einmal die sogenannten Nebenfächer. Zurückdenkend und zusammenfassend muss ich festhalten, dass die Experten allesamt freundliche und wohlgesinnte Gelehrte waren, die einem eher halfen als Stolpersteine stellten.
Einen nicht zu unterschätzenden Bammel hatte ich zum Beispiel vor der Geschichtsprüfung, da mich damals dieses Fach eher weniger interessierte. Die mündliche Prüfung bestand aus drei Teilen: Welt- und Schweizergeschichte sowie ein selbst gewähltes Spezialgebiet, das bei mir selbstverständlich die ungarische Geschichte war. So trat ich vor die Experten und der Zuständige begrüsste mich freundlich und verkündete, dass er die Schweizer- und ungarische Geschichte zusammen in einer Frage abhandeln möchte: «Ich nenne dir eine Jahreszahl und möchte wissen, was du bei beiden Ländern dazu zu sagen hast, ist das für dich in Ordnung?»
«Oh, ja!», sagte ich, woraufhin er die Jahreszahl nannte: 1848.
Ich war unbeschreiblich erleichtert. Ich wusste bereits von der ungarischen Geschichte her, dass dieses Jahr ein enorm wichtiges Kapitel im gesamteuropäischen Wandlungsprozess nach Ausbruch der industriellen Revolution war. Dann erfuhr ich im Gymi, und das hat mich fasziniert, wie besonnen die Schweizer auf diesen Umbruch reagierten. Statt sich die Köpfe einzuschlagen, schufen sie die Geburtsstunde der «Modernen Schweiz». Ich bekam wahrscheinlich rote Backen und erklärte ihm in einer Begeisterung, dass die Schweiz in diesem Jahr vom Staatenbund zum heutigen Bundestaat übergangen ist. Das heisst, die bis anhin selbstständigen Staaten, heute Kantone, sich zu einem Staat Schweiz zusammenschlossen, dass die Schweiz damals eine gemeinsame Verfassung und ein gemeinsames Parlament schuf. Gewisse Auswirkungen spüren wir heute noch: Wir zahlen dreierlei Steuern: Erstens Gemeindesteuer an die Wohngemeinde, dann Staatssteuern an den Kanton und zuletzt Bundessteuern an den Bund. Ich erinnere mich, dass unser Geschichtslehrer sagte, die Schweiz hätte eigentlich keine Hauptstadt. Bern sei der «Sitz des Parlaments». Ob das jetzt seine persönliche Einschätzung war oder eine geschichtliche Tatsache, kann ich nicht wissen. Die Schweiz ist auch in anderen Sachen einzigartig, wie bei der Nationalflagge. Alle Nationen haben rechteckige Flaggen, meistens im Länge-Breite Verhältnis von 2:3. Nur die Schweiz und der Vatikanstadt haben offiziell rechteckige Flaggen im Länge-Breite Verhältnis von 1:1.
Dann in Ungarn: Der beliebteste und von allen gern gefeierte Nationalfeiertag ist der 13. März. Da legt man rot-weiss-grüne Kokarden an und geht auf die Strassen, um zu feiern. JA, am 13. März 1848 brach der Aufstand gegen die Habsburger aus. Wir erinnern uns: Die Osmanen fielen im 16. Jahrhundert in Ungarn ein, um den Occident zu erobern. Ungarn kämpfte gegen diese Übermacht und konnte 150 Jahre lang deren Weitermarsch verhindern. Als die Türken aber 1683 Wien belagerten, erwachten die Österreicher und schlugen zurück. In diesem Zuge befreiten sie auch das bereits geschwächte Ungarn von den Türken und von da an betrachteten sie das Land als ihr Territorium. Gegen diese Unterjochung standen die Ungarn 1848 auf, zuerst erfolglos, dann aber erfolgte 1867 der Durchbruch im sogenannten «Ausgleich». Dies bedeutete, dass Ungarn wieder ein selbstständiges Königreich wurde, also sein eigenes Parlament wieder erhielt. Die Österreicher bedingten sich aus, dass der österreichische Kaiser gleichzeitig der ungarische König wurde. «Franz Josef grüsste mit der K & K-Monarchie», in die Geschichte eingegangen auch als «Donau-Monarchie».
Mein Experte war begeistert und liess zu, dass ich voller Begeisterung über die zehn Minuten hinaus die Antwort gab. Dann aber kam doch noch eine Frage zur Weltgeschichte, die ich einigermassen beantworten konnte, so kam ich auch in diesem Fach auf die Note 5.
Auch das Hauptfach Deutsch musste gut gegangen sein, da ich hier ebenfalls einen 5er schaffte. Es wurden drei Themen vorgegeben, wobei man zu einem dieser Inhalte einen Aufsatz schreiben musste. Ein Thema sagte mir zu, so fing die Füllfeder an, über die Blätter zu sausen. Nach zwei Stunden musste ich darauf achten, dass ich zum Abschluss kam. Damals war ich in Deutsch noch gar nicht so sattelfest, also vermute ich, dass etliche meiner Fehler als Flüchtigkeitsfehler taxiert und damit ignoriert wurden.
Ebenfalls in den übrigen Fächern hatte ich scheinbar Glück, denn meine Noten waren durchwegs sehr gut – die Abschiffer kamen dann in Französisch und Englisch.
Nachdem die Maturzeugnisse verteilt wurden, zitierte mich Professor Wyss, der Leiter der Maturitätskommission, zu sich und fragte: «Wie erklärt sich dieses Ergebnis? So etwas habe ich noch nie erlebt – durchwegs gute bis sehr gute Noten, dann ungenügend in Französisch und Englisch.»
Ich erklärte ihm, dass ich vor wenigen Jahren ohne Deutschkenntnisse, die ich erst erarbeiten musste, in die Schweiz gekommen sei. Auf der Basis dieser Fremdsprache, die ich noch nicht beherrschte, zwei weitere Fremdsprachen zu erlernen, hätten mich überfordert.
«So ist das!», sagte er und fragte «Was wolltest du mit der Matur anfangen?»
Ganz spontan und entschlossen erwiderte ich: «An der ETH Maschinenbau studieren.»
Nach kurzer Überlegung meinte er: «Na, dann sehe ich für dich kein Problem! Da kommst du auch mit einer Aufnahmeprüfung hin und die beinhaltet nur eine Fremdsprache. Im Englischen hast du gute Ansätze, und die anderen Fächer schaffst du locker. Ich empfehle dir einen Sprachaufenthalt in England und wünsche dir alles Gute!»
Ich bedankte mich und ging gedankenversunken auf die Strasse, setzte mich dann auf eine Parkbank und liess die Gedanken im Kopf kreisen. Diese jagten sich zwischen meiner Erfolglosigkeit an der Matura und den Zukunftsperspektiven, die mir Professor Wyss gerade mitgegeben hatte.
Es ging nicht lange und ich war fest entschlossen, eine Stelle zu suchen, wo ich das nötige Geld für einen Sprachaufenthalt in England verdienen könnte. Freudig sprang ich auf und wusste, was ich nun für meine Zukunft zu tun hatte.
Arbeiten für London
Seite 50
Seite 50 wird geladen
50.
Arbeiten für London
Ich beherzigte die Empfehlungen des Herrn Professor Wyss. Aber ein Sprachaufenthalt in England kostete einiges und meine Devise war damals schon: Etwas mehr schuften, aber das Gewünschte nicht aufgeben. So schaute ich, dass ich in London in eine Schule kam.
Dazu brauchte ich also Geld, deshalb ging ich ein halbes Jahr in der Sutter-Bäckerei zur Arbeit als einer der sechs Chauffeure, welche die 16 Filialen der Firma belieferten. Als Benjamin bekam ich natürlich die ungünstigste Tour: Sechs Innenstadtfilialen mit allerlei Gebäck versorgen, also wenig fahren, dafür häufig Be- und Entladen.
Die Grossbäckerei wurde bereits von den beiden Söhnen des alten Herrn Sutter geführt, dennoch kam dieser täglich zur Arbeit.
Eines Tages konnte er nicht auf seinen Parkplatz fahren, denn wir versperrten ihm den Weg mit unseren Fahrzeugen. Er gab den Autoschlüssel dem dienstältesten Chauffeur, um sein wunderschönes Lancia Flavia Coupé, ganz ähnlich dem Ferrari 250 GT, zu versorgen, sobald es genügend Platz geben würde. Das war bald einmal der Fall und unser Dienstältester stieg in den schönen Lancia. Aber es passierte gar nichts. Unverrichteter Dinge reichte er den Schlüssel seinem Kollegen, der auch keinen Erfolg hatte, und so ging das Spiel bis zu mir. Mit skeptischen Blicken reichten sie mir den Schlüssel. Ich stieg ein, atmete tief den feinen Ledergeruch ein und steckte den Schlüssel in das Zündschloss. Dann drehte ich daran; zuerst kam Strom in die Grundverbraucher wie Positionslicht usw. Dann wurde der Strom für die Zündung frei gelegt und anschliessend, in der nächsten Stufe sollte der Anlasser betätigt werden. Aber nein, vor dieser letzten Stufe merkte ich, dass der Schlüssel nicht etwa klemmte, sondern am Anschlag war. Also mal schauen. Rennwagen und besondere italienische Spezis hatten oft einen separaten Knopf, um den Anlasser zu betätigen. Ich schaute mich am reich bestückten Armaturenbrett um und entdeckte tatsächlich einen unscheinbaren roten Knopf. Ich drückte darauf und der Sechszylinder erklang in seinen schönsten Tönen. So konnte ICH das schöne Lancia Coupé auf seinen Parkplatz manövrieren. Siegesbewusst stieg ich aus und genoss die verwunderten Blicke. Ich reichte den Schlüssel dem verblüfften ältesten Chauffeur, damit er diesen dem alten Herrn Sutter wieder abgeben konnte.
In dieser Zeit erlebte ich allerlei. Unsere Flotte für sechs Fahrer bestand aus acht Renault Estafette, denn wegen ihrer Anfälligkeit waren mindestens zwei davon in Service oder Reparatur. Auch ich meldete, dass die Gänge beim Ausladen heraussprangen, also das Auto nicht mehr hielten und auch die Handbremse keine grosse Wirkung hätte. Ja, das Auto komme nächstens in den Service, dann werde das behoben, hiess es. Aber dann, vor der Filiale an der Eisengasse, erlebte ich den schlimmsten Moment dieser Zeit. Ich befand mich im Laderaum, als ich merkte, dass das Auto rollte. Dummerweise hatte ich die Räder nicht nach rechts eingeschlagen, so rollte das Fahrzeug führerlos quer über die Gasse und knallte in die Fassade der gegenüberliegenden Bijouterie. Zum grossen Glück standen gerade keine Leute vor den Schaufenstern und auch der Aufprall war nur mässig, denn die angezogene Handbremse liess das Fahrzeug nicht ganz frei rollen. Dennoch war die Erfahrung, im Laderaum machtlos dazustehen ein überaus eindrückliches und unvergessliches Erlebnis.
Es gab auch Lustiges. Wir arbeiteten nur jeden zweiten Nachmittag, um lediglich die leeren Kisten sowie das Eingetrocknete zurückzubringen. Auch das Schloss der seitlichen Schiebetüren war nicht mehr in Ordnung und vertrug meine Fahrweise überhaupt nicht. So kam es, dass ich im Hof ankam und mich einer der Sutter Junioren mit einem breiten Lächeln empfing und verkündete: «Jetzt kannst du die Runde nochmals machen». Nun ja, die Schiebetüre ging bei jedem Losfahren auf und in der nächsten Kurve sauste eine Reihe Harassen hinaus auf das Trottoir. Und dieses Spiel wiederholte sich so oft, bis alle Kisten in der Stadt verstreut lagen. Entsprechend kamen die telefonischen Meldungen in der Sutter-Bäckerei an.
Aber nicht nur bei diesem Anlass erfuhr ich, wie die Leute gerne den selbsternannten Polizisten spielen …
Ich merkte, dass manchmal, meistens gegen 9:00 Uhr, ein heilloses Gedränge im Hof stattfand. Alle Chauffeure waren da und wollten ihre Autos beladen. Daraufhin hatte ich sie umorganisiert. Diejenigen mit ihren längeren Fahrten hatten vier Touren und ich mit meiner Innenstadt sogar sechs. Also schaute ich, dass ich frühmorgens meine drei Fahrten in Ruhe absolvieren konnte. Dann waren die anderen an der Reihe und ich machte eine Stunde Pause. So ging ich zu meiner Grossmutter am Spalentorweg. Sie empfing mich oft mit ihren traumhaften Crèmeschnitten. Dann legte ich mich aufs Ohr und schlief eine Runde. Das war auch nötig, hatten wir doch morgens um sechs Uhr antreten müssen. Nach einer halben Stunde weckte sie mich mit einem herrlich duftenden Espresso und so konnte die Arbeit weiter gehen. Eines Tages empfing mich nach der Pause einer der jungen Herren Sutter und fragte mit einem verschmitzten Lächeln im Mundwinkel: «Wie geht es der Freundin?» Zuerst war ich verdutzt – Freundin …? Dann sagte er: «Die am Spalentorweg.» Da fiel bei mir das Zwanzigerli: Einige, denen es aufgefallen war, dass ein Sutter-Auto jeden Morgen eine Stunde vor dem Haus stand, wo meine Grossmutter wohnte, riefen bei der Firma an mit der Frage, ob sie das wüssten und ob das rechtens sei? Ich erklärte dem jungen Herrn Sutter, was Sache sei, aber er winkte nur ab: «Du hast den Ablauf tipp-topp organisiert, und wenn du dabei Pause machst, ist das deine Sache, Hauptsache die Lieferungen erfolgen zeitgerecht.» Das war auch stets der Fall.
Das Betriebsklima war angenehm, ich merkte, dass alle gerne ihre Arbeit verrichteten. Manchmal schnappte ich mir ein Brötchen direkt aus dem Ofen und verschlang es trotz gut gemeinter Ermahnungen noch backheiss. Entgegen aller Bedenken hatte ich nie irgendwelche Beschwerden vom heissen Gebäck bekommen. An den Nachmittagen gab es Crèmeschnitten und sonstige herrliche Süssigkeiten.
In diese Zeit fiel auch die Basler Fasnacht. Da musste ich bereits morgens um 2:00 Uhr die Innenstadtfilialen mit Zwiebel- und Käsewähen beliefern. So blieb ich also in der Stadt und hatte den besten Platz an der Freien Strasse, um morgens um 4:00 Uhr dem Morgenstreich beizuwohnen.
So ging das halbe Jahr vorbei und ich hatte endlich das Geld für einen dreimonatigen Sprachaufenthalt in London zusammen.
London
Seite 51
Seite 51 wird geladen
51.
London
Ich gebe zu: In dieser Metropole habe ich mein Herz verloren. Ich hatte auch unbeschreibliches Glück mit der Familie, bei welcher ich von der Organisation untergebracht worden war. Die meisten meiner Mitschüler erzählten über ihre Landladys und Landlords, dass diese arme Rentner seien, auf jeden Pence angewiesen und mit allem sparen müssten, mit dem Essen, der Heizung, dem Warmwasser, das nur zu gewissen Zeiten zur Verfügung stand. Nicht so bei mir.
Meine Gastgeber waren eher wohlhabende Leute, ehemals Globetrotter: er Engländer, sie Kanadierin und kennengelernt hatten sie sich in Australien. Er war Direktionsmitglied in einer Versicherungsgesellschaft und sie hatten trotz etwas fortgeschrittenem Alter einen nur fünfjährigen Sohn. Ich war nicht der einzige Student bei ihnen, da waren noch zwei junge Französinnen, das Haus war ja gross genug im Einfamilienhaus-Quartier, genannt Hammersmith. Die Untergrundbahn Circle Line führte dorthin, dann eine Buslinie, die ich selten nahm, denn zu Fuss war man meist schneller.
Ich verkündete Rosaly, so hiess meine Landlady, dass ich zum Nachtessen nicht daheim sein möchte, denn ich wollte London erkundschaften. OK, sagte sie, und jede Woche gab sie mir den Anteil zurück, den sie von der Organisation der Schule für das Nachtessen erhielt. Aber jedes Mal beim Frühstück lud sie mich ein, beim Nachtessen ihr Gast zu sein. Ich blieb meistens in der Stadt, aber einmal war ich am Nachmittag zu Hause und machte meine Hausaufgaben. Da kam ein besonders feiner Duft herauf in mein Zimmer und ich konnte nicht widerstehen, ich blieb zum Nachtessen und fragte, was ich da Feines esse. Es war ein Lammbraten, was ich im Grunde nicht esse. Aber diesmal schmeckte es hervorragend …
Normalerweise waren für mich die Erkundungstouren in London berauschend. Es musste nicht einmal die Westminster Abbey sein, es gab auch sehr viele weitere aufregende Entdeckungen. Wie «The Monument to the Great Fire of London» an der Fish Street im Zentrum der Londoner City. Es erinnert an den grossen Stadtbrand von 1666. Die 62 Meter hohe dorische Säule, die von einer Aussichtsplattform und einer vergoldeten Urne gekrönt wird, wurde zwischen 1671 und 1677 im Zuge der Wiederaufbaumassnahmen nach dem verheerenden Brand errichtet. Nicht nur die Aussicht auf die Londoner City hatte mich fasziniert, auch den englischen Humor konnte ich kennenlernen: Beim Eingang hing eine Tafel mit der Aufschrift «No Lift, but only 311 Steps», natürlich in Form einer engen Wendeltreppe …
Im Sockelgebäude des Turmes erinnern Inschriften an die Katastrophe. Damals wurde vier Fünftel der London City völlig zerstört, darunter auch die St. Paul‘s Cathedral, die ich bereits Tage vorher so fasziniert bewundert hatte.
Es ist hier kein Platz, alle meine Eindrücke dieser zwei Monate zu schildern. Nur das, was mir unvergesslich in Erinnerung geblieben ist.
Wenn meine Gastgeber ihrerseits Gäste empfingen, baten sie mich eindrücklich, daheim beim Nachtessen dabei zu sein. Das tat ich auch und berichtete vor stets interessiertem Publikum über die Schweiz, aber ebenfalls über Ungarn. Das waren oft äusserst spannende Begegnungen, denn die Leute interessierten sich für die ungarische Geschichte, vorwiegend für die neueste Zeit unter dem sowjetischen Regime. Sie hörten öfters wie gebannt zu und stellten auch ganz interessante Fragen, die ich nach bestem Wissen und Gewissen sowie gemäss meiner Englischkenntnisse zu beantworten versuchte.
Ganz schön empfand ich die Frühstücke. Da das Leben im damaligen London erst nach 9:00 Uhr begann, sassen wir alle um halb acht am Frühstückstisch: Landlady, Landlord, der kleine David, die beiden Französinnen und ich. Wir bekamen das obligate «Ham and Eggs», dann gab es nach Belieben frisch getoastetes Brot und Bitterorange-Marmelade. Wir plauderten und unsere Gastgeber interessierten sich stets, was wir Neues dazu gelernt oder erfahren hätten.
Einmal, bei diesen schönen Morgenanlässen fragten meine Studienkolleginnen, ob ich den Führerschein hätte? Ja, sagte ich und daraufhin strahlten ihre Gesichter, während sie eine kleine Annonce aus der Zeitung zeigten: FORD Escort für nur £ 1.50 pro Tag ohne Meilenbeschränkung. Damit könnten wir ja die Westküste erkundschaften … Rosaly griff sofort zum Telefon, doch ihr Gesicht verfinsterte sich: Alle diese Autos seien bereits für Monate reserviert. Doch sie sah sich auf den Plan gerufen und telefonierte eifrig weiter, damit wir unser Vorhaben durchführen könnten. Das Gesamtergebnis war vernichtend: Alle günstigen Mietautos waren bereits reserviert. Da gab es nur den sündhaft teuren Godfrey Davis, zwar auch nur für £ 1.50 pro Tag, aber zusätzlich einige Pennys pro Meile, und das waren sehr viele bis zur Westküste und zurück. Zu teuer für uns, doch bat ich unsere Landlady nachzufragen, ob sie auch Vauxhall Viva im Angebot hätten – und das hatten sie.
So stand ich am nächsten Tag vor der Filiale der Autovermietung Godfrey Davis. Zwei Livrierte machten mir die doppelflügelige Eingangstüre auf. Drinnen standen mehrere Schalter für die Kundschaft bereit, einer von ihnen war noch nicht besetzt. Ich ging dorthin, fragte nach einem Vauxhall Viva. Die junge, sympathische Schalterbeamtin meinte, das sei kein Problem und nahm meine Personalien auf. Am darauffolgenden Samstagnachmittag konnte ich das Auto abholen. Das war genau das Modell, das ich daheim hatte und bereits in- und auswendig kannte.
Zwei Strassenecken weiter hielt ich an und schraubte die Antriebswelle des Tachometers unter dem Armaturenbrett weg. Somit wurden auch keine gefahrenen Meilen gezählt, zumindest nicht auf dem Tachometer. Am Sonntagmorgen hatten wir uns, die französischen Studentinnen und ich, beim Frühstück beeilt und waren bereits recht früh unterwegs. Es war ein berauschendes Erlebnis, nicht nur die Strassen durch alle richtig englischen Dörfer auf dem Weg, auch die wildromantische Gegend an der Westküste dieser riesigen Insel war hinreissend. Mit diesen Eindrücken fuhren wir heim.
Auch das Linksfahren war für mich kein Problem, ich denke, weil das Lenkrad an diesem Auto für Linksverkehr auf der richtigen Seite war. Einzig die Gangschaltung mit der linken Hand war etwas gewöhnungsbedürftig.
Spät abends lieferte ich meine Girls ab und fuhr wieder in die Stadt, die niemals schlief. Ich schraubte die Tachowelle zurück, tankte das Auto voll, kontrollierte den Ölstand und kurvte im nächtlichen London etwa zehn Meilen umher. Anschliessend hatte ich noch gerademal zwei Stunden Schlaf bis zum Frühstück. Es war herrlich zu erleben, wie die zwei jungen Mademoiselles von unserer Fahrt schwärmten. Es gab für den Rest der Woche beim Frühstück kein anderes Gesprächsthema …
An diesem Morgen gab ich das Auto in der Hoffnung ab, dass die Vermietungsfirma nichts von unserem Schwindel merke. Das schien auch der Fall zu sein, so bezahlte ich die Grundgebühr und die wenigen Miles, die ich mit angeschlossenem Tachometer gefahren war.
Dann ging ich erleichtert zur Schule und der Londoner Alltag nahm seinen Lauf. In der Stadt begnügte ich mich damals mit meinen Pancakes anstelle eines Nachtessens. Diese hiessen Silverdollar und waren an jeder Ecke mit unterschiedlichen Zutaten erhältlich, fleischig, süss, was man gerade wollte. Anstelle eines ausgiebigen Nachtessens ging ich lieber ins Kino. Da gab es auch Filme, die ich nicht ganz verstand. Heute noch grüble ich nach, welcher Sinn hinter «Clockwork Orange» von Stanley Kubrick steckt. Einige Szenen sind mir heute noch gegenwärtig, ohne deren Sinn verstanden zu haben.
Kaum zwei Wochen nach unserer Ausfahrt verkündeten die Girls bei einem gemütlichen Frühstück, dass sie auch die Südküste erkunden möchten und dass ich so eine gute Gelegenheit hätte, günstig dorthin zu kommen … Ich wäre schon gerne dabei gewesen, doch mir war etwas Bammel beim Gedanken: Hat der Vermieter bei unserem Schwindel mit den Meilen wirklich nichts bemerkt? Schlussendlich hatte ich ein Herz gefasst …
Die zwei Livrierten machten die Flügeltüren auf, «meine» Schalterbeamtin war auch diesmal frei, strahlte und fragte: «Same car, same conditions, Sir?» Ich bejahte und das Spiel fing von vorne an: Tachowelle abhängen, mit den Girls an die Südküste fahren, volltanken, die Tachowelle anschliessen und das Auto mit einigen wenigen Meilen abgeben.
Ich hatte trotz Spätherbst mit dem Wetter Glück, fürchtete sogar den legendären Londoner Smog nicht erleben zu dürfen. Doch gegen Schluss kam er mit umso mehr Vehemenz. Der Verkehr war erlegen und die Fussgänger tasteten sich die Wände entlang. Irgendwie kam ich zum Heimfliegen zum Flughafen London Heathrow, doch dort hiess es, vorläufig sei kein Abflug möglich. So verbrachte ich die Nacht am Flughafen und schlief, so gut es ging, am Boden. Am nächsten Morgen erwachte ich mit einem Bärenhunger, hatte jedoch kein englisches Geld mehr, nur einen Schweizer Fünfliber. Münzen wurden gewöhnlich nicht umgetauscht, aber ein Betreiber einer Wechselstube interessierte sich für meinen Fünfliber, wechselte den in englische Währung, so konnte ich meinen Hunger etwas stillen.
Dann ging die Warterei los, bis verkündet wurde, dass die Fliegerei in Bournemouth Airport weitergehen könne, da dort der Nebel schwächer sei. So stiegen wir in die bereitstehenden Busse ein und fuhren nach Bournemouth. Tatsächlich hoben wir dort mit 24 Stunden Verspätung ab.
Unser Ziel war Basel, doch der Kapitän verkündete, Basel hätte zu viel Nebel, wir würden in Zürich landen. Buh-Rufe von der Hälfte der Passagiere, Jubel von der anderen Hälfte. Dann die erneute Durchsage: Wir würden doch in Basel landen. So kamen die Buh-Rufe nun aus der anderen Ecke, wie auch der Jubel.
Wir landeten in Basel-Mülhausen. Ohne einen Rappen in der Tasche steuerte ich einen Taxifahrer an. Ich verkündete ihm, ich hätte kein Geld, doch meine Eltern würden schon bezahlen. Er meinte OK, und so fuhren wir los nach Bottmingen. Meine Mutter stand schon auf der Terrasse und als sie uns anfahren sah, kam sie sofort mit dem Geldbeutel herunter, bezahlte das TAXI und nahm mich in ihre Arme.
So war ich wieder daheim, den Kopf übervoll mit Erlebnissen.
Ich konnte nicht ahnen, dass ich später in dieser Stadt sogar sporadisch arbeiten sollte. Vom Bankverein aus mussten wir international verteilte Systeme testen, ob diese auch in der jeweiligen Umgebung funktionierten. Das dauerte dann jeweils eine Woche, doch blieb ich einige Tage länger. Trudy, meine spätere Frau, kam nach und ich konnte ihr einiges zeigen, was mich in London faszinierte. Wir sahen auch «Cats» auf der Bühne und sonstige englische Originale in diversen Kleintheatern.
Seither war ich nicht mehr in London. Vielleicht fürchte ich zu sehr, diese 70er- und 80er-Jahre Romantik heute zu vermissen: die alten Doppeldecker mit den offenen Plattformen, auf die man jederzeit rauf und runterspringen konnte, die Plüschsitze der alten Circle Line U-Bahnwagen, die kleinen Läden in Hammersmith wo ich gewohnt hatte, die rund um die Uhr offen waren. Bei einer Stadterkundung stieg ich versehentlich eine oder zwei U-Bahnstationen vor meiner Destination aus. So musste ich zu Fuss ein Quartier durchqueren, das es in sich hatte. Statt Verkehr lagen ausgeschlachtete oder ausgebrannte Autos auf den Strassen, welche den vorwiegend farbigen Kindern als Spielzeug dienten. Männer und Frauen diskutierten mit lauter Stimme zwischen riesigen Abfallhaufen. Sind diese Ghettos unterdessen verschwunden oder aber noch schlimmer geworden?
Das arme Kind …
Seite 52
Seite 52 wird geladen
52.
Das arme Kind …
Incike, die damalige Zellengenossin meiner Mutter, landete also im Ministerium für Landwirtschaft, und dessen Produkte vertrat diese an verschiedenen Kongressen in ganz Europa. Unterdessen lebten wir in der Schweiz, und wenn Incike es sich einrichten konnte, machte sie eine Zwischenlandung in Zürich mit längerem Aufenthalt. Dann holte ich sie in Kloten ab, wenn es gut ging zum sonntäglichen Mittagessen. Die Gespräche mit ihr waren für meine Mutter immer ein Highlight.
Incike verkündete freudestrahlend, dass ihre Nichte demnächst die Matura machen würde und sie hätte gar keine Bedenken, dass das Kind diese nicht bestehen würde. Anschliessend hätte sie einen grösseren Kongressaufenthalt in Rom, den sie verlängern würde, um der Lieblingsnichte als Maturgeschenk die «Ewige Stadt» zu zeigen. Darauf würde sie sich so sehr freuen und wäre jetzt schon daran, alles vorzubereiten. Der einzige Haken sei, das arme Kind müsse etwa eine Woche in einem Hotelzimmer ausharren, bis sie mit dem Kongress fertig sei und sich der Nichte widmen könne.
Da meinte meine Mutter, sie solle kein Problem daraus machen: «Du nimmst das Kind mit nach Kloten. Ihr kommt zu uns, das Mädchen bleibt bei uns und du fliegst weiter nach Rom. Sobald du dort frei geworden bist, setzen wir sie ins Flugzeug nach Rom und ihr könnt das Maturgeschenk realisieren.»
Incike nahm das Angebot dankend entgegen, umarmte meine Mutter und meinte: «Ich habe schon immer gespürt, du bist die beste Freundin, die ich je hatte!»
Dann brachte ich sie wieder zum Flughafen.
Der nächste Sommer kam und ich musste Incike und ihre Nichte in Kloten abholen: Incike, die rundliche, freundliche blonde Tante und die Nichte, eine schlanke, zierliche junge Frau mit braunen Haaren, etwas keck in die Welt schauend.

Beim sonntäglichen Festmahl ging es locker und fröhlich zu, doch nach dem Dessert merkte ich allmählich, dass sich «das Kind» über die Gespräche ihrer Tante mit der Gastgeberin zusehends langweilte. Auch ich war an diesen Diskussionen nur mässig interessiert, so überlegte ich beim Espresso, was ich machen sollte.
Mein soeben erstandenes, als allererster Neuwagen gekauftes Auto stand unten am Parkplatz, der schmucke Vauxhall Viva. Dieser war bereits eingefahren und betriebswarm nach der Fahrt nach Kloten und zurück. Da könnte man doch die erste forcierte Fahrt unternehmen im Basler «Niemandsland». Das war die besondere Strasse zum Flughafen Basel-Mulhouse. Eine schweizerische Strasse auf französischem Gebiet, die damals weder die Schweizer noch die Franzosen kontrollierten. Sie war rechts und links hoch eingezäunt, schnurgerade und mit Sicherheit ohne Fussgänger. Das hiess, man konnte diese Strasse bedenkenlos als Versuchsstrecke benutzen.
So fragte ich die Nichte, ob sie Lust hätte, mit mir das neue Auto auszuprobieren und sich am Flughafen Basel umzuschauen und etwas zu trinken. Sie war sofort dabei und wir fuhren los, zuerst durch die Strassen der Stadt, doch dann folgte die freie Strecke zum Flughafen.
Damals hatten Flughäfen etwas Besonderes an sich. In ihnen wehte die Luft der weiten Welt, sie hatten Erstklassrestaurants, Terrassen, um die abfliegenden und ankommenden Flugzeuge zu bewundern. Es gab damals noch keine Sicherheitskorridore und keinen Massentourismus. Überall spürte man einen Hauch von Exklusivität.
Da sassen wir auf der Terrasse, genossen die Sonnenstrahlen, aber auch den Duft von Kerosin, bis ich beim Blick auf die Uhr erschrak: Wir mussten augenblicklich zurück, damit ich Incike zu ihrem Anschlussflug nach Rom bringen konnte.
Auch bei der Fahrt nach Kloten wollte die Nichte mitkommen. So fuhren wir zu dritt los. Wir verabschiedeten uns in der Abflughalle und ich blieb mit Jutka zurück. Ich meinte, vor der Heimfahrt könnten wir uns noch einen Espresso genehmigen und sie willigte ein. So sassen wir in der Terrassenbar, diesmal in Zürich-Kloten. Sie nippte an ihrer Cola und ich am Espresso. Draussen kamen und gingen die farbigen Lichter an den Flügelenden, entweder erloschen sie oder entschwanden am Horizont.
JA, damals boten die Flughäfen eine besondere Atmosphäre. Vielleicht von den Eindrücken überwältigt, sassen wir auf der Rückfahrt wortlos nebeneinander.
Am nächsten Tag war ich in der Schule und auch sonst beschäftigt, doch nach dem Nachtessen fragte ich Jutka, ob sie Lust hätte, in die Stadt mitzukommen. Klar hatte sie das, und so fuhren wir nach Basel. Ich konnte ihr allerlei Aufregendes zeigen: Café Tropic, Club 59, Atlantis und überhaupt die «Kinostrasse» Steinenvorstadt. Da war viel Betrieb, auch abends, da musste man seine Partnerin an die Hand nehmen, um sie nicht zu verlieren.
Das Café Tropic war etwas ganz Besonderes. Der Betreiber war ein Safarigänger und Jäger, so hingen im ganzen Café Trophäen an den Wänden, von Tigerhäuten bis hin zu ausgestopften Krokodilen und auch die Tische waren sehr speziell: wannenartig hergestellt, mit Glas abgedeckt und in der Wanne lagen allerlei exotische Tiere. Alles Gefährliche, was in Afrikas Wildnis umherkroch, von Taranteln bis hin zu Vipern, war da zu bewundern. Dann, das war für mich besonders wichtig: Damals in Basel war es das einzige Lokal, das Espresso anbot. Die Schweizer waren damals fast ausschliesslich Kaffee Crème-Trinker.
Der Club 59 war damals eines der wenigen Lokale, welches nach Mitternacht offen hatte. Hinter der «Kinostrasse» floss die Birsig durch die Innenstadt, überdacht als Sackgasse mit Parkplätzen. So stand am Ende dieser eine Drehbühne, angetrieben von der Birsig, worauf die Autos umdrehen konnten. Das Hinauffahren war einfach, die Einfahrt stand immer in Fahrtrichtung. Doch beim Hinunterfahren musste man auf Draht sein: In einem bestimmten Moment runter, nur so blieb die Anlage in Fahrtrichtung stehen. Hatte man dies verpasst, musste man eine weitere Runde drehen. Und dies unter den kritischen Blicken der bereits wartenden Autofahrer …
So etwa auf der Höhe dieser Drehbühne befand sich der Eingang zum Club 59. Es führte eine Treppe hinunter in eine spezielle «Casablanca»-Atmosphäre. Die Tische standen eng beieinander, das Lokal war völlig verraucht und irgendwo in der Mitte, auf einem kleinen Podium stand ein schwarzer Flügel. Auf diesem klimperte ein Barpianist fast pausenlos eingängige Melodien. Man kam sich vor wie Humphrey Bogart und nach ein, zwei Wodka Cola sah das Gegenüber aus wie Ingrid Bergmann.
Selbst morgens um zwei konnte man Spaghetti bestellen, die beliebteste Hausspezialität war Knoblauchspaghetti.
In dieser Zeit kam das von Lynn Anderson interpretierte Lied «I Beg Your Pardon» ganz gross in die Charts. Der Refrain hiess «I beg your pardon, I never promised you a rose garden.» Ich nahm das Lied auf Tonbandkassette auf, nahm diese mit ins Auto und positionierte das Band auf den Startpunkt dieses Liedes. Eines Abends auf dem Heimweg, einige Minuten vor Bottmingen, schob ich die Kassette ein und fragte Jutka, ob sie den Text verstehen würde. «Of course», meinte sie. Daraufhin steuerte ich den Wagen kurz vor Bottmingen hinauf auf den Bruderholzhügel. Da gab es nämlich einen «Rose Garden», ein öffentlich zugänglicher Rosengarten einer Grossgärtnerei zwischen Binningen und Bottmingen. Im Mondschein konnte man in den Gassen des Gartens schlendern und sogar die Blüten wahrnehmen. Siehst du, sagte ich, es geht auch ohne Versprechen …
Die kurze Zeit ging schnell vorbei, vollgepackt an Erlebnissen und Eindrücken. Es kam die Fahrt nach Kloten, der Moment des Abschieds, der nicht leichtfiel.
Aus Rom kam dann jeden Tag eine Postkarte, die eine schöner als die andere, doch meine Aufmerksamkeit galt eher dem Geschriebenen. Dieses besagte, dass Basel auf eine wundersame Art aufregender sei als Rom …
Warten auf die Braut – dann die kurze Ehe
Seite 53
Seite 53 wird geladen
53.
Warten auf die Braut – dann die kurze Ehe
Es folgte ein reger Briefwechsel. Mag sein, dass ich auch deshalb das Büffeln der französischen und englischen Wörter vernachlässigte. Die Briefe waren jeweils sehr dick, die Füllfeder sauste über die Blätter, bei Jutka genauso wie bei mir.
Dann kam die Matura mit den ausgezeichneten Noten, ausser in Franz und Englisch. Die Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung zur ETH, der Aufenthalt in London, ausserdem Poldes, der mit seiner Frau bei unseren Eltern ungarische Literaturabende verbrachte. Einmal machte unsere Mutter die Bemerkung, der Junge sei an den Vorbereitungen zur ETH-Aufnahmeprüfung, doch sie hätte das Gefühl, so ganz sicher sei er sich nicht was er wirklich wolle.
«Er ist sich nicht sicher was er künftig soll? Dann WEISS ICH, was es ist!», rief Poldes aus und bat meine Eltern, dass ich zu Hause sei, wenn sie das nächste Mal kämen. So geschah, dass ich eines Abends ihm gegenüber am Esstisch sass, während die anderen in der guten Stube Verse aufsagten oder vorlasen. Er erzählte über das Phänomen EDV, Elektronische Daten Verarbeitung. DAS sei die Zukunft, in der Mechanik hätte man bereits alles erfunden, da gäbe es nur noch Verfeinerungen.
«Die künftigen Datenströme werden mit manueller Verarbeitung nicht mehr zu bewältigen sein. Da braucht es die maschinelle Verarbeitung, und dies wird in der Zukunft viel mehr als eine Rechenmaschine sein. Es werden Computer sein, diese müssen jedoch programmiert werden – DAS ist die Zukunft!»
Seine Begeisterung hatte mich erfasst, so liess ich mich in der PAX anstellen. Er meinte, er wolle nicht auf Fachidioten bauen, also sollte ich vorerst einmal das Versicherungswesen kennenlernen. Ich kam zuerst für ein Jahr in eine Fachabteilung, wo ich nach jeder Lohnerhöhung die Pensionskassenbeiträge von KMU-Betrieben berechnete. Sie mussten mit mir zufrieden gewesen sein, denn der Abteilungsleiter, Dr. Batz versuchte mich mit allen Mitteln in seiner Abteilung zu behalten.
So kam ich in meinen jungen Jahren zu meinem begehrten Sportcabriolet, zum FIAT 124 Spider. In der PAX gab es eine Institution, welche für die Aussendienstmitarbeiter Autos finanzierte. Es war eine Art hausinterner Vorgänger des heute üblichen Leasings und hiess «VW-Konto», denn es waren alles VW-Modelle, da wir den Importeur betreuten. Den berechtigten Mitarbeitern wurde das Auto zur Verfügung gestellt. Sie mussten pro Monat so viele einhunderttausendstel des Kaufpreises zurückerstatten, wie sie Kilometer gefahren waren. So war das Auto beim Erreichen von 100‘000 km bereits abbezahlt. Das war bei Aussendienstlern relativ schnell der Fall.

FIAT 124 Spider 1800
Da wir auch die grosse FIAT-Vertretung in Basel betreuten, konnte Dr. Batz für mich den FIAT Spider organisieren, obwohl ich Innendienstler war. Sein nächster Köder war, mir den Posten des Stellvertreters vom Leiter der neu zu gründenden Krankenkassenabteilung zu offerieren – natürlich mit den besten Chancen für den Aufstieg. So blieb ich zweieinhalb Jahre in der Fachabteilung, doch dann verkündete ich unwiderruflich, dass ich nun in die versprochene EDV-Abteilung wolle.
Damals gab es noch keinerlei EDV-Ausbildung in irgendeiner Schule. Die Leute gingen in Kurse des Anbieters der jeweiligen Maschine, so war ich einige Male in Frankfurt im Ausbildungszentrum von Honeywell Bull. Da lernte ich eine andere Computer-Sprache kennen: Der Harddisk wurde zur Festplatte, die Files mutierten zu Dateien, der Record zum Satz usw.
In dieser Zeit gab es sonst noch etwas Einschneidendes für mich. In der Gymizeit lernte ich «Hochdeutsch» und meine Schulkollegen sprachen gerne so mit mir, denn die Maturprüfungen wurden auch in Schriftdeutsch abgehalten und es war eine gute Übung für sie. Es ergaben sich dabei auch lustige Situationen. Christian, einer meiner Schulfreunde und eingefleischter Fasnächtler, nahm mich zu seinem Larvenmacher mit. Dort sprach er dann mit dem Meister aller Larven Schriftdeutsch, worauf dieser die Welt nicht mehr verstand – bis Christian dies merkte und ihm lachend die Sache erklärte.
Bei meiner ersten regulären Anstellung hingegen erklärte ich meinen Kollegen, sie alle sollen mit mir so reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen sei – ich würde das schon verstehen oder nachfragen und selbst versuchen so zu reden.
Als ich in die EDV-Abteilung kam, war es schon ganz normal, dass sie in ihren verschiedenen Schweizer Dialekten, ihrem Deutsch oder Elsässisch mit mir redeten. Das alles färbte ab …

Auto und Braut
So verging die Zeit und etwa zwei Jahre später konnte Jutka wieder in die Schweiz reisen. Sie war Nichtraucherin und ich schwor, mit Rauchen aufzuhören, sobald sie wieder da sei. Sie war da, ich hörte auf zu rauchen, doch der Rückfall kam. Der erste Anlauf misslang.
Ich verkündete, ich würde heiraten. Meine Mutter war ausser sich: «Wieso müsst ihr so überstürzt heiraten?»
Sie redete mir ins Gewissen und versuchte mir klarzumachen, dass es gar keinen Sinn ergeben würde, sich nach so kurzer Zeit zu binden. Sie verstand nicht, dass es für mich keine kurze Zeit war, dass wir mit unseren Briefen uns auch ganz tief in der Seele austauschen konnten.
Dann die Mutter von Jutka: Wir wussten, sobald klar wird, dass ihre Tochter nicht mehr heimkommt, bekommt die ganze Familie als Strafe eine Ausreisesperre. So wollte ich die Hochzeit in der Zeit abhalten, als ihre Mutter noch reisen konnte. Ich dachte, es würde auch meiner Mutter das Herz brechen, an meiner Hochzeit nicht dabei sein zu dürfen.

Hochzeit mit Hajdus, Jutkas Mutter und Incike
Ich verdiente CHF 1‘200.– im Monat, damals kein schlechter Lohn, so kostete z.B. ein Liter Benzin so zwischen 30 und 40 Rappen. Jutka, da sie bereits vier Semester Medizin studiert hatte, bekam in der chemischen Industrie CHF 1‘400.–. Darauf konnte man wirklich schon etwas aufbauen.
So kam es also zur Hochzeit. Wir hielten sie in bescheidenem Rahmen ab, im Kreise der Familie. Jutkas Mutter konnte tatsächlich zur Hochzeit kommen und sie spürte, meine Mutter würde ungeachtet ihrer Ablehnung der Eheschliessung gegenüber, Jutka wie ihre weitere Tochter behandeln, nachdem ihre Mutter wieder nach Ungarn zurückkehren musste.
Unserer elterlichen Wohnung gegenüber wurde ein ganz moderner Block aus vorgefertigten Elementen errichtet. In der Bauphase sahen wir Panel am Kranhaken vorbeischweben, mit der ganzen Kücheneinrichtung daran. Als wir heirateten, war das Gebäude erst vier Jahre alt und wir bekamen eine frei gewordene Wohnung und einen Autoeinstellhallenplatz.
Es passte alles zusammen, mussten wir doch in Bottmingen bleiben im Hinblick auf die Einbürgerung, die ich unbedingt anstrebte. Wir nahmen also die Wohnung im obersten Stockwerk und die Vermieterin, die wir bereits als unsere Krankenkassenagentin kannten, kam bei der Wohnungsübergabe mit. Es traf sie fast der Schlag: Die Wohnung war total verdreckt. Die vierköpfige Familie mit ihren zwei Kindern hatte wohl vier Jahre lang nicht wirklich geputzt. Eine Putzmannschaft, bestehend aus Vermieterin, meiner Mutter, Jutka und mir nahmen sich der Sache an und wir schrubbten ein Wochenende lang. Die Wohnung war wunderschön, zwei Fronten mit Fenstern fast bis zum Boden, darunter ganz schmale Heizkörper, Konverter genannt. Diese waren nicht mehr zu retten und wurden ausgewechselt. Aber die offene Küche strahlte und bot Platz für einen runden, roten Esstisch mit roten Stühlen und rotem Geschirr mit weissen Tupfen. Die Küchenfenster bekamen rot-weiss karierte Vorhänge, also Romantik pur.

Die Siebziger mit Schlaghosen, Wohnwand, Tonbandmaschine...
So waren auch die ersten Ehejahre. Jutka arbeitete in der Basler Chemie, orientierte sich aber immer mehr an sportlichen Tätigkeiten, denn sie war von Haus aus eine eingefleischte Sportlerin. Sie spielte Spitzen-Basketball und daheim, in Szeged an der Theiss, war sie in der Ruder-Regatta Rennen gefahren.
Jutkas sportorientiertes Herz kam immer wieder zum Vorschein. Als sie das erste Mal auf die Bettmeralp mitkam und die Skifahrer sah, verkündete sie ganz bestimmt, dass sie das auch ausprobieren wolle. Wie dies herauskam, vernehmen wir in der Episode «Ski fahren».
Dann kam das Kajakfahren dazu. Am besten tat man dies in der Gruppe, auf wilden Gewässern. Tönte ja gut und ein guter, langjähriger Bekannter, ein Nachbarsjunge organisierte für uns und ein paar andere Enthusiasten einen Workshop im Kajakbau. Jeder Teilnehmer mietete je eine Negativform eines halben Kajaks, also Unter- und Oberhälfte. Die delikate Aufgabe bestand darin, in die Halbschalen Fiberglas einzulegen und diese mit so wenig Polyestermasse wie möglich zu durchtränken. Je weniger von dieser Masse verwendet wurde, umso schwerer und länger musste man einarbeiten, aber umso leichter und elastischer war dann der Bootskörper.
Eine Woche jeden Abend waren wir am Kajak bauen. Aber das Ergebnis liess sich sehen: Gekaufte Einerkajaks wogen je nach Qualität zwischen 18 und 20 kg. Unsere kamen auf 14 bis 15 kg.
Die ersten «Gehversuche» unternahmen wir auf dem Doubs, oberhalb St. Ursanne. Dann wurden die Simme, Kleine Emme und sonstige wilde Gewässer in der Schweiz unter den Kiel genommen. Ich hielt wacker mit und hatte meinen Spass daran. Es war eine aufregende, wenn auch nicht ungefährliche Sportart. Doch wenn man die grundlegenden Verhaltensregeln befolgte, waren die Gefahren in Grenzen zu halten.
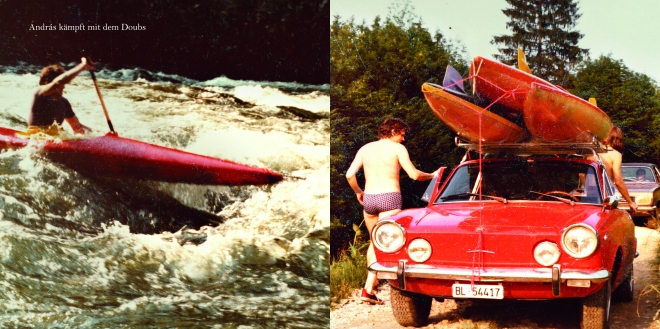
Dann entschied Jutka, das Sportlehrerdiplom anzustreben. Sie ging mit der Gruppe nach Österreich auf viel wildere Gewässer und auch zum Skifahren. Das wurden ihre Spezialdisziplinen. Ich konnte nicht mithalten, schon wegen der Arbeit nicht.
So merkten wir allmählich, dass wir uns auseinanderlebten. Wir besprachen das und reichten die Scheidung ein. Wir nahmen dafür einen Anwalt, Dr. Hartmann, den ich aus meiner Mitarbeit bei Csitkovics kannte, als gemeinsamen Vertreter, um uns über die juristischen Hürden zu lotsen.
Er beriet uns auch, wie wir unsere Guthaben aufteilen sollten, die Autos – wir hatten da bereits einen Zweitwagen – die Möbel usw.
Wir blieben Freunde, sehr zur Freude von Jutkas Mutter, die wusste, ihre Tochter würde nie alleine gelassen werden, zumal unsere Mutter sie weiterhin wie ihre Tochter behandelte.
Jahre später traf ich dann meine zweite Frau Trudy, die Persönlichkeit genug war, diese Freundschaft zu akzeptieren und miteinander zu pflegen, auch mit meiner Ex-Schwiegermutter, die sie dafür gerne in ihr Herz schloss. Wir besuchten sie einige Male in Szeged, wo sie ein Einfamilienhaus mit einem schönen ausladenden Garten besass. Als wir dann für Clubkollegen in kleineren Gruppen Ungarn-Rundreisen organisierten, half sie in ihrer Gegend die originellsten Landbeizen mit der besten Fischersuppe, die dort traditionell aufgetischt wurde, aufzusuchen. Diese Fischersuppe war nicht einfach eine Fischsuppe, nein, diese war benannt nach den Fischern an der Theiss, welche jene bereits am Ufer aus frisch gefischten Fischen in ihren «Bogrács», einem über dem Feuer am Dreibein hängenden Gefäss, zubereiteten.
Jutka lud uns immer wieder ein oder kam bei uns vorbei, vor allem wenn ihre Mutter wieder einmal in der Schweiz zu Besuch war. Sie meldete sich aber auch, wenn sie ein Problem hatte, das sie mit niemand anderem besprechen wollte. Dabei betonte sie immer wieder, dass die einzige Person, in die sie immer uneingeschränktes Vertrauen hatte, die ihre immerwährende Stütze war, unsere Mutter gewesen sei. Als sie starb, fühlte sich Jutka vorerst alleine gelassen. Doch seither seien wir ihre Stütze.
PAX-Lebensversicherungsgesellschaft
Seite 54
Seite 54 wird geladen
54.
PAX-Lebensversicherungsgesellschaft
Mein erstes Projekt in der neuen Abteilung war für mich sehr faszinierend und auch nützlich. Ich hatte die Aufgabe, alle peripheren Geräte der Anlage zu bewegen. Aber wozu? Ganz einfach: Es kamen immer wieder Agenturleiter oder andere Interessenten sowie auch Kunden vorbei und ihnen wollte man die moderne EDV-Anlage vorführen, mit allem, was sich daran bewegte.
Ich schrieb also ein Programm, das Lochkarten einlas, ebensolche wieder fröhlich ratternd punchte und ausspuckte, die schrankhohen Bandmaschinen laufen liess, bei denen hinter den Glasscheiben sich die Bänder hin und her bewegten, die riesigen Discs ratterten, ihre Lese- und Schreibköpfe von Spur zu Spur sprangen und die Drucker mit ihren 24-Nadeln laut hämmernd nette Texte auf gestreiftes Endlospapier schrieben.
Es war eine aufregende Zeit für mich. Ich lernte die ganze EDV-Mannschaft kennen, Fräulein Gurtner, die ein absoluter Crack war, was die neusten Technologien betraf, Werner Tanner, den hilfsbereiten Kollegen, der mit seinem Autobianchi A 112 Rennen fuhr sowie die ganze Belegschaft um den Computer herum, wie die netten hübschen Locherinnen, die unsere von Hand geschriebenen Programme mit ihren riesigen «Schreibmaschinen» auf die für den Computer lesbaren Lochkarten verewigten.
Die Firma war ehrlich bemüht, die Mitarbeiter zu belohnen, gar zu verwöhnen. Alltäglich war, dass wir in der firmeneigenen Kantine im obersten Stockwerk das Mittagessen serviert bekamen. Mit dem Service wurden Studentinnen und Studenten beauftragt, die auf Silbertablett das Essen brachten. Irgendwann fiel jemandem auf, dass wir das Nachbestellte in einem Gefäss sammelten und mitnahmen. Der Fall wurde untersucht und es kam heraus: Wir brachten das Essen einem armen Kollegen, der nicht einmal das Geld für die Kantine hatte. Er war ein abgestürzter Alkoholiker, den die Firma gnädigerweise weiterbeschäftigt hatte. Daraufhin beschloss die Geschäftsleitung, den Mann umsonst in der Kantine zu verpflegen und auch sonst zu schauen, wie man ihm helfen könnte.
Es gab die unterschiedlichsten Anlässe, wozu die Belegschaft eingeladen wurde, so auch ein Skiwochenende mit Skirennen in den Flumserbergen. Gewonnen hatte das Rennen der Sohn des Bündner Agenturleiters, Zweiter wurde unser «fliegender Werner» und man sehe und staune, Dritter wurde ich. Ich wurde bejubelt, mehr als der Sieger! Na klar, der Bündner ist prädestiniert, Werni mit seiner FIS-Lizenz ebenso, dass aber der Junior aus Ungarn den nächsten Rang holte, wurde hoch anerkannt.
Am Abend gab es Musik und Tanz. Der Bündner Agenturleiter hatte nicht nur einen Sohn, sondern auch eine bildhübsche Tochter. Diese wollte den ganzen Abend mit mir tanzen, obwohl ich gar nicht so ein Hirsch im Schwingen des Tanzbeins war. Solchermassen «geschafft» ging ich hinauf, um in unserem Zimmer das Hemd zu wechseln. Da kam mir eine der Locherinnen entgegen, fiel mir um den Hals, bedankte sich für den schönen Abend, obwohl ich mich wenig um sie gekümmert hatte und küsste mich leidenschaftlich.
Ganz verwirrt ging ich hinunter den letzten «Schlumi» zu nehmen und dies war der erste Moment, als ich mich fragte, ob meine Mutter mit ihren Bedenken betreffend meiner überstürzten Ehe nicht doch recht hatte.
Bei der Arbeit wurde ich einem echten Projekt zugeteilt. Mein Begleiter dabei war André, ein herzensguter Mensch, mit dem ich mich auf Anhieb blendend verstand. Wir gingen miteinander in die Kantine, und wenn uns das Essen nicht zusagte, halt eben in das Migros Restaurant im Kirschgarten, wo die grösste und schönste MMM-Filiale der Stadt eingerichtet war.

In diesem «echten» Projekt wurde es klar – alle waren sich einig – mein ursprünglicher Promotor, Herr Poldes habe mich in allem benachteiligt. Wir fragten uns, warum? Eine mögliche Antwort war, dass er im Bestreben, einen Landsmann nicht zu bevorteilen, auf die andere Seite des Pferdes gefallen war.
Dann hatte die PAX das Vorhaben, auf eine moderne, vernetzte Umgebung zu wechseln, um weitere drei Jahre verschoben. Das ging mir zu lange, denn ich hoffte etwas Moderneres kennenzulernen.
Es folgte meine Scheidung, der Militärdienst und nach alledem war ich bereit, alles in meinem Leben zu wechseln, auch den Arbeitgeber.
Die Schweizermacher
Seite 55
Seite 55 wird geladen
55.
Die Schweizermacher
Wer hat den Film nicht gesehen – mit Emil Steinberger, Walo Lüönd und einer Handlung, welche die schweizerische Einbürgerungspraxis zwar humoristisch, aber gnadenlos aufs Korn nimmt. Was ich bestätigen kann: Unsere Einbürgerung 1975 verlief haargenau so, wie im Film dargestellt.
Damals musste man zur Einbürgerung bereits 12 Jahre in der Schweiz gelebt haben, wobei es unter Umständen Erleichterungen gab. In meinem Falle zählten die Jahre als Jugendlicher doppelt. So konnte ich mein Gesuch bereits 1974 einreichen. Doch ich war vorsichtig, wollte nicht ins Militär und erkundigte mich bei der Gemeindeverwaltung. Sie meinten, ab 26 sei man nicht mehr dienstpflichtig, aber empfahlen, dies beim Sektionschef zu verifizieren, was ich auch tat. So reichte ich mein Gesuch ein und die Maschinerie begann zu laufen.
Eigentlich ging dieses dreistufige Verfahren in unserem Falle – die Ehefrau wurde automatisch miteingebürgert – recht schnell voran.
Erste Stufe: Bund. Was die damalige Fremdenpolizei alles über uns sammelte und überprüfte, konnte ich nicht wissen, was wir aber wussten: Nun müssen wir unsere Wohnung stets aufgeräumt und sauber halten, denn eines Tages bekommen wir überraschend Besuch.
Es kamen dann eines Abends zwar weder Emil Steinberger noch Walo Lüönd bei uns vorbei, aber zwei freundliche Bundesbeamte. Sie schauten vollkommen unauffällig in alle Ecken unserer Wohnung, stellten ein paar Fragen und gingen nach einer freundlichen Verabschiedung weiter.
Dann bekamen wir den schriftlichen Bescheid, dass die Bundesbehörde für die weitere Stufe, die kantonale Überprüfung grünes Licht gegeben hätte.
Auf dieser Stufe geschah das Lustige. Ich wurde nach Liestal zur Prüfung eingeladen: Deutschkenntnisse, Kenntnisse über das Staatsgefüge usw. Ich ging also zu einem bestimmten Termin nach Liestal, Gebäude X, Stockwerk Y, Zimmer Z. Ich klopfte an und trat ein. Da erwartete mich breit grinsend ein sympathischer junger Nationalrat: «mein» Erziehungsdirektor.
Er stand auf, kam auf mich zu, reichte die Hand und meinte: «Wir kennen uns schon so lange. Ich brauche Sie mit Deutschkenntnissen und Schweizergeschichte nicht mehr zu plagen.»
Ja, wir kannten uns aus der Zeit, als ich für meine Schwestern um die zweiwöchigen Winterurlaube ersuchen musste. Dann wusste er auch, dass ich an der Matura in Deutsch sowie in Schweizergeschichte glänzend abgeschnitten hatte. Er meinte also, es würde ihn noch interessieren, wie ich in Justiz und Politik bewandert sei. Auch das ging locker über die Bühne und daraufhin kam seine Empfehlung: «Ich möchte Sie auffordern nach ihrer Einbürgerung, der wohl nichts im Wege steht, politisch aktiv zu werden. Wir brauchen in der Politik Verjüngung, neue Ideen und Impulse von Leuten, die bewusst zu uns gehören wollen.»
Ich hatte mich nicht festnageln lassen, aber bedankt für seine Einschätzung. Ich wusste jedoch, ich bin nicht der geborene Politiker. Vielmehr bin ich der eingefleischte Techniker, und Politik zu betreiben in einer echten Demokratie, wo bis zu fünf Parteien am Ruder sind, müsste enorm schwierig sein. Egal was du vertrittst, es sind vier andere dagegen … Meistern kann man das schon, aber dafür bin ich zu wenig diplomatisch veranlagt.
So kam es zur dritten Hürde: Die Gemeinde.
Ich kannte seit unserer Eheschliessung den Gemeindeschreiber Herrn Cereghetti und er meinte, das sei nur noch eine reine Formalität. Aber wie gestaltete sich diese Formalität?
Wir wurden an die entscheidende Gemeindeversammlung eingeladen. Für uns waren Plätze in der vordersten Reihe reserviert. Wir, Jutka als meine Ehefrau und ich, dann ein weiteres Pärchen, der ebenfalls aus Ungarn stammende Dorfarzt und seine Angetraute. Als das Geschäft mit den Einbürgerungen an der Reihe war, wurden wir vorgestellt, danach mussten wir den Saal verlassen, also an allen Anwesenden vorbei nach draussen schreiten, damit sie uns auch optisch begutachten konnten.
Und dort mussten wir schmunzeln: Im Flur waren Lautsprechen installiert und die waren nicht abgestellt. So bekamen wir die ganze Debatte über uns zu hören. Es wurde von keinem in Frage gestellt, ob wir allesamt eingebürgert werden sollten. Die Debatte drehte sich um die Frage: Wieso muss dieses junge Paar, also wir, gleich viel Gebühren bezahlen wie der Herr Doktor, der vermutlich das Mehrfache dessen verdient wie das junge Paar. Na ja, die Frage wurde nicht gelöst, Bestimmungen sind eben nicht immer individuell zu handhaben.
So kam dann eines Tages, an einem schönen frühlingshaften Dienstagmorgen unser Heimatschein per Post an: ein A4-Pergament mit schöner Schrift und allerlei wichtigen Stempeln darauf. Hurra: Bürger und Bürgerin von Bottmingen, Baselland!
Bereits am darauffolgenden Donnerstag kam das Aufgebot, mich zum Militärdienst zu stellen. Ich schmunzelte nur, war ich doch gerade über 26 Jahre alt. An besagtem Tag ging ich unbeschwert nach Liestal in die Kaserne, um das Programm über mich ergehen zu lassen. Es gab auch einen Film über das Schweizer Militär mit ihren Funktionen. Anschliessend konnte man einen Fragebogen ausfüllen und drei Einteilungswünsche ankreuzen. Ich kreuzte die Gattungen Motorfahrer, Funker und Radarsoldat an. Am Schluss des Programmes mussten wir einen Aufsatz schreiben, wie wir diesen Vormittag erlebt hätten.
Nach dem Mittagessen kam die sportliche Prüfung, die ich locker lächelnd absolvierte. Beim Stellen bekam ich auch vom Sportoffizier den Stempel «TAUGLICH». Wäre ich schon, dachte ich mit einem Lächeln auf den Lippen.
Dann stand ich vor Oberst Bernasconi, dem Einteilungsoffizier. Er sagte, er könne auf meine Wünsche eingehen und mich in einer Stabskompanie als Funker mit eigenem Fahrzeug einteilen. Ich bedankte mich locker, fragte aber, ob er mein Geburtsdatum angeschaut hätte.
«Das habe ich mein Junge. In der Schweiz ist man bis zum 28. Lebensjahr einteilungspflichtig.»
«Nicht bis 26?», fragte ich und er belehrte mich:
«Ab 26 können wir niemanden mehr zwingen, weiterzumachen. Aber RS-pflichtig ist man bis 28.»
Das war der Moment, als ich erfuhr, was es heisst, weiche Knie zu bekommen. Ich musste mich einen Moment wirklich an seinem Pult festhalten.

Andras der Funker
Ski fährt die ganze Nation …
Seite 56
Seite 56 wird geladen
56.
Ski fährt die ganze Nation …
Ursprünglich dachte ich keine Sekunde daran. Wir waren zwar die ganze Familie und manchmal Cousinen und Nachbarsfamilie im Winter jeweils zwei Wochen auf der Bettmeralp, wo ich die Wunder des Winters genoss, aber der Anblick der Skifahrer zog mich nicht im Geringsten auf die Pisten. Ausgedehnte Spaziergänge, manchmal rüber zur Riederalp, Bücher lesen, Briefe schreiben, das waren meine Vergnügen nebst der grössten Freude, den uneingeschränkten Winter zu geniessen. Bettmeralp war autofrei, nur die Pferdeschlitten der Hotels zogen fast weihnächtlich bimmelnd an uns vorbei. Manchmal standen sie einfach wartend da, und wir konnten die Pferde streicheln und ihnen die, aus den Cafeterias stets mitgenommenen Zuckerwürfel verabreichen.

Bettmeralp in Wallis
Dann geschah es. Frisch verheiratet kam meine Frau Jutka mit uns, sah die Skifahrer und sagte mir: «DAS muss ich auch probieren! Entweder kommst du mit, oder du kannst mir von unten zuschauen.»
Natürlich ging ich mit, obwohl ich bis anhin nie erwogen hatte, Ski zu fahren. Wir gingen in das Skischulbüro und meldeten uns für den Erwachsenen-Anfängerkurs an. Dieser war im Wallis etwas ganz Spezielles: Ein Miniskikurs mit wachsenden Skiern im Verlauf des Kurses.
Am Einteilungstag bekamen wir Skier, die kaum länger waren als die Skischuhe. Mit diesen wurden die ersten Rutschübungen absolviert, damit die beiden Skilehrer uns aufteilen konnten in eine stärkere und eine schwächere Gruppe. Jutka kam entschieden in die bessere Gruppe, was mir niemals passiert wäre. Da sie uns bei der Einteilung beieinander lassen wollten, absolvierte ich bereits den ersten Nachmittag mit Päuli, dem jungen, strengen Skilehrer in der besseren Gruppe.
Am nächsten Tag waren die Skier bereits 90 cm lang und wir probierten die ersten Schwünge, die fast schon aussahen wie Skifahren. Am dritten Tag behielten wir diese und wechselten am vierten Tag auf 130 cm lange Latten. Am Schluss wiederholten wir alles Erlernte auf 160 cm langen Skiern, die sich fast wie echt fuhren. Da in der darauffolgenden Woche in Basel Fasnacht war, konnten wir bis Mittwoch bleiben und so fragten wir nach, ob wir diese Skier bis am Mittwoch behalten könnten. Ja, doch, und am Schluss dieser Skiferien gingen wir mit dem Gefühl heim, wir könnten Skifahren.
Jedenfalls mussten wir nicht über Stemmbögen gehen und auch das Fahren mit zusammengepressten Skischuhen wurde uns nicht beigebracht. Wir fuhren wie die Einheimischen mit natürlicher Haltung, also Beine hüftbreit auf dem Boden.
Zu Hause kauften wir eigene Skier, wobei zumindest ich sehr schlecht beraten wurde. In der nächsten Saison war die Herrlichkeit wie verflogen. Die Skier bockten und ich verstand die Welt nicht mehr, bis ich mit meiner Cousine die Skier wechselte. Am Ende der nächsten Abfahrt verkündete sie: «Auf diesen Brettern kann keiner Skifahren!», und stieg schleunigst aus. Ich wiederum war auf ihren Skiern glücklich, ich konnte doch Skifahren.
Wieder daheim ging ich in ein kleines Sportgeschäft in Birsfelden und verkündete: «Ich möchte gute, geschmeidige Skier haben, habe aber sehr wenig Geld, um nochmals Skier zu kaufen.» Der Inhaber überlegte kurz und meinte: «Ich hätte etwas sehr Gutes für dich, wenn dich ein veraltetes Design nicht stört», und holte ein Paar ELAN hervor mit den schrecklichen blauen und roten Längsstreifen drauf. «Diese waren mal die weltbesten Allrounder, die bekommst du von mir für CHF 200.–.» Natürlich nahm ich die Skier mit Handkuss, denn wirklich gute Latten kosteten damals schon um die CHF 600.–. Er montierte die Bindungen um und ich war für die nächsten paar Jahre der glücklichste Skifahrer.

Georgina im Ski-Kindergarten ... und Kati in der Skischule
Unterdessen hatte Jutka umgesattelt und studierte bereits an der Sporthochschule. Mit ihren Kolleginnen und Kollegen gingen wir einige Male auf den Hasliberg zum Skifahren und wohnten bei einer Bauernfamilie weit abseits der Pisten mitten im Wald. Tönt super romantisch, aber der Weg zum Bauernhaus hatte es in sich. Er ging durch Wälder, Bäche und einem speziellen Hindernis: einer tiefen Senke. Am Rande angekommen, stand die schwierige Entscheidung an: Lasse ich die Skier von ganz oben laufen, komme ich auf der anderen Seite fast bis hinauf, aber die Gefahr besteht, dass es mich unten umso mehr zusammenstaucht. Je weiter ich runterstieg, desto sicherer war die Ankunft, aber auch das Hinaufstampfen umso länger. OK, das Mittelmass wurde für die tägliche Heimfahrt gefunden, nicht aber für den Ankunftstag. Da trug ein jeder von uns einen Rucksack voll Lebensmittel auf dem Buckel und Konserven können sehr, sehr schwer sein … Da musste man nochmals die ganze Kybernetik durch den Kopf und durch die Beine gehen lassen.
Hingegen bei der Bauernfamilie war der Aufenthalt unbeschreiblich romantisch und heimelig. Die Küche war so gross, dass an zwei Ecken je ein grosser Esstisch stand, einer für die Familie, einer für die Gäste. Der riesige Holzherd war für uns alle da. Es stand auch immer ein mächtiger Topf drauf mit Kaffee Lutz für alle. Wir lernten, den echten Kaffee Lutz zu kochen: Es wird Wasser aufgekocht, etwas Kaffee gemahlen und in das kochende Wasser geschüttet. Dann kommt eine kleine Kanne eiskaltes Wasser dazu, um abzuschrecken und das Kaffeepulver auf den Boden sinken zu lassen. Zu guter Letzt ein gehöriger Gutsch selbstgebrannter Schnaps und fertig ist das seelenerfreuende Getränk. Dann konnte jeder mit seinem Chacheli jederzeit vorbeigehen und eine Kelle voll herzhaften Kaffee Lutz schöpfen.
Mit der eigenen Familie jedoch gingen wir immer noch auf die Bettmeralp. Mihály bekam vom Bankverein jährlich seine vergünstigten REKA-Reisechecks und weil einige seiner Kollegen diese Vergünstigung verschmähten, konnte er einige Kontingente einsammeln. Zu den Checks gab es auch ein Büchlein, das er so lange studierte, bis er das Günstigste am schönsten Ort fand. Und das war Bettmeralp, ein Skigebiet auf fast 2‘000 m Höhe. Dort pickte er ein älteres Chalet heraus, am Waldrand, stilecht «Tannenduft» genannt. Es gehörte einem Gewerbeschullehrer aus Brig, wie sich herausstellte, einer überaus herzlichen, netten Familie. Es fing jedoch mit einer Streiterei an:
Unsere Mutter hatte jeweils vor unserer Abreise das ganze Chalet auf Hochglanz gebracht. Dies fiel der Vermieterin bei der Wohnungsabnahme natürlich auf und sie wollte daraufhin partout keine Reinigungspauschale entgegennehmen. Aber unsere Mutter blieb standhaft und bestand darauf: «abgemacht ist abgemacht». Das Ergebnis dieser Reiberei war, dass das Cheminee, als wir das nächste Mal kamen, frisch gereinigt da stand mit genug Holz nebendran, um die nächsten zwei Wochen jeden Abend einzufeuern. Im mittleren Wochenende unseres Aufenthaltes, als sie andere Wohnungen zum Wechsel vorbereiteten, kamen sie auch bei uns vorbei und es gab gute Gespräche bei einem Glas Wein.

Im Chalet "Tannenduft" am Waldrand ... Es kann nicht schnell genug in die Skiferien gehen
Hier schnappte ich meine erste Lebensweisheit im germanischen Sprachraum auf: Auf der dicken Pfette quer über unserem Esstisch stand eingeschnitzt: «Spare, Lerne, Leiste was, so Hast du, Kannst du, Giltst du was.»
Bettmeralp entstand entlang einer langen Strasse von der Seilbahn bis nach hinten zum Aletsch-Skilift, wo auch das altehrwürdige Hotel «ALETSCH» mit seinem guten öffentlichen Restaurant stand. Hierher lud Mihály immer vor der Abreise die ganze Familie zum Abschiedsessen ein.
Fast alle Chalets und Hotels standen auf der Bergseite der Strasse, talseitig waren die eher öffentlichen Gebäude wie Kirche, Kapelle, Skischule. Es war eine herrliche Zeit, wir mussten an den Skiliften nicht lange anstehen. Das ganze Dorf verfügte über ein einziges öffentliches Telefon und dieses hing offen an der Wand der Post, nur ein Dächlein darüber. Es standen immer Leute an, denn wahrscheinlich hatte es in den wenigsten Chalets Telefonanschlüsse.
Zu dieser Zeit leitete Mihály die gesamte Wertschriften-Abteilung für die Region Nordwestschweiz. Die Abteilung hatte quartalsweise Abschlüsse abzuliefern und wir waren jeweils zur Zeit des ersten Quartalsberichtes des Jahres auf der Bettmeralp, so musste sein Stellvertreter den Abschluss fertigstellen. Doch Mihály interessierte sich für die Ergebnisse und wir stampften einige Male zum öffentlichen Telefon, warteten, bis wir drankamen und dann ging es los. Mihály hörte zu, dann wurde er laut, denn die Verbindung war schlecht: «Nein, nein, dann müssen wir 50 Millionen Roche rüberschieben!» Dann etwa: «Na gut, wir nehmen dort 20 Millionen Brown Boveri weg», und so weiter. Wen wundert’s, dass die Leute einander anschauten und sich ihre Gedanken machten.
Doch allmählich änderten sich die Zeiten. Die grosse Masse schien Bettmeralp entdeckt zu haben und es schossen auch auf der Talseite der Strasse grössere Chalets mit vier bis sechs Wohnungen wie Pilze aus dem Boden. Als das Anstehen mühsam wurde, modernisierten sie die Anlagen. Ergebnis: Die Leute tummelten sich alle auf den Pisten. Es wurde auch eine hochmoderne Seilbahn mit 100 Plätzen gebaut – die Kabine sah aus wie ein schwebender Tramwagen. Die alte Seilbahn blieb bestehen, denn diese bediente Betten, das Dorf zwischen Tal- und Bergstation.
Mihálys Gesundheitszustand verschlechterte sich, er mochte die über 1‘500 m Höhenunterschied nicht mehr mit der neuen Bahn in einem Zug bewältigen. So fuhren wir beide mit der alten Seilbahn nach Betten, machten einen ausgiebigen Spaziergang und setzten dann unsere Fahrt fort.
Wallis und Walliser
Seite 57
Seite 57 wird geladen
57.
Wallis und Walliser
In den ersten Wintern auf der Bettmeralp hat es mich ganz und gar nicht gestört, dass ich manchmal meine beschauliche Winterwelt verlassen musste. Was waren die Gründe?
Unsere Mutter bekam einmal Zahnschmerzen. Das kann ja passieren, doch diesmal hatte sie ihre passenden Medikamente nicht dabei. Also bot ich an, diese in Brig zu besorgen. Recht früh schwebte ich mit der Seilbahn zur Talstation, ging zu unserem Auto und musste feststellen, wie tief dieses in der Zwischenzeit eingeschneit worden war. Nicht nur das Auto, auch die Zufahrt vom Parkplatz zur Strasse. Daraufhin beschloss ich soooo viel Schnee nicht etwa wegzuschaufeln, denn die Rhätische Bahn brachte einen in wenigen Minuten nach Brig. So kaufte ich meine Rückfahrkarte – damals gab es dieses Phänomen noch – und fuhr mit «meiner» roten Meterspur-Bahn nach Brig.
Die Stadt war faszinierend. Ich weiss nicht, wie das möglich ist, aber am Ende einer jeden Strasse steht ein Berg! Man erblickt eine bizarre Felsenformation, egal in welcher Strasse, in welcher Gasse der Betrachter vom Zentrum weg hinaus blickt. Um diese Erfahrung reicher ging ich zur Apotheke, kaufte die entsprechenden Schmerzmittel und machte mich auf den Rückweg. Am Bahnhof stand schon die RhB Komposition, also stieg ich ein. Dass der Zug mit grünen Wagen bestückt war, fiel mir nicht besonders auf. Diese waren für damalige Verhältnisse bereits altertümlich aber selbst die Holzbeplankung der Sitzbänke störte mich ganz und gar nicht.
Der Zug setzte sich in Bewegung. Ich schaute wie immer aus dem Fenster hinaus, doch die vorbeiziehende Landschaft kam mir schon etwas fremder vor, als auf der Hinfahrt. Dann kam der Kondukteur. Er brachte zwei stattliche Holzscheite mit, die er in dem Stubenofen, der am Ende des Wagens seine Wärme spendete, auflegte. Anschliessend erfolgte die Billettkontrolle.
Ich händigte ihm meine Rückfahrkare aus, woraufhin er nach reiflicher Überlegung den Kopf schüttelte und meinte:
«Die passt also gar nicht. Wohin willst du?»
«Nach Betten», sagte ich.
«Aha», meinte er und verkündete: «Wir fahren aber Richtung Zermatt.»
Mir dämmerte langsam, dass ich den falschen Zug bestiegen hatte und schaute ihn entsprechend unschlüssig an. Mein Billeteur holte sein dickes Kursbuch hervor, blätterte darin und sagte:
«Bleibe ruhig sitzen. Ich hole dich dann.»
Zwei, oder drei Stationen später kam mein Kondukteur und winkte, ich soll ihm folgen. So stiegen wir aus. Am Perron gegenüber stand der Zug in umgekehrter Richtung. Mein Betreuer erklärte seinem Kollegen auf Walliserdeutsch was Sache sei, so vermutete ich jedenfalls, woraufhin dieser mich mitnahm. Sein Zug fuhr los und ich konnte die tief verschneite Landschaft, die ich eben erblickte, nochmals geniessen. In Brig angekommen holte mich mein neuer Zugbegleiter ab und zeigte mir den Zug, der mich dann wunschgemäss nach Betten Talstation brachte.
Natürlich bedankte ich mich mit den schönsten Worten, die ich fand. Heute weiss ich, wieviel Bussgeld ich in einer ähnlichen Situation aktuell zahlen müsste. Doch damals war die Welt noch anders in Ordnung.
Ganz zu schweigen beim nächsten Vorfall.
Mutter brauchte ein Medikament, das sie täglich einnehmen musste. Doch oh Schreck und Graus, sie hatte dieses daheim vergessen. Das Medikament war rezeptpflichtig, also riefen wir ihren Hausarzt an.
«Kein Problem!» meinte er. «Ich rufe die Apotheke in Brig an, erkläre die Sache und sende das Rezept nach. Ihr könnt das Mittel morgen abholen.»
Mit dieser Aufforderung machte ich mich am folgenden Tag auf den Weg. Diesmal war der Winter nicht so schneereich, sowohl mein neues Auto, als auch die Wegfahrt waren schneefrei, so beschloss ich mit meinem schönen Vauxhall Viva nach Brig zur Apotheke zu fahren. Dort angekommen galt es die Sachlage zu schildern, was mir gelang und auch das Gespräch mit dem Hausarzt meiner Mutter zeigte Früchte, so wurde mir verkündet, das besagte Medikament sei bestellt und würde am Nachmittag gegen 16:00 Uhr geliefert.
Nun, was tun bis dahin? Ich setzte mich in mein Auto und fuhr los Richtung Simplon Pass, lag ja vor der Haustüre. Es war eine wunderschöne Fahrt, auch ohne Probleme denn ich setzte stets grossen Wert darauf, die besten Winterreifen zu haben. Dann, als es richtig zu steigen begann, stand die Tafel: Gesperrt, Fahrverbot. Aber die Barriere stand offen. Was nun? Also wenn die Barriere offen steht, dann kann man doch fahren, oder?
Ich fuhr also hinauf und anfänglich ging es ganz gut. Dann wurde es immer enger, die Schneewände kamen rechts und links immer näher. Nach einem Abzweiger nach links war dann offensichtlich: Die Strasse war nur einspurig geräumt. Ich fuhr weiter, mittlerweile sah ich zwischen den Schneemauern nur noch das blaue Band des Himmels. Es wurde mir langsam schon etwas unheimlich, bis ich endlich in Simplon Dorf ankam. Da war es dann freundlicher, ich konnte auf einem schönen grossen Platz parkieren und in einem Restaurant einen Kaffee bestellen.
Als ich eintrat und grüsste schauten mich alle an, als ob ich vom Mond käme. Ich bestellte meinen Espresso, den die Serviertochter auch brachte. Hingegen als ich winkte zu bezahlen, kam der Wirt an meinen Tisch und setzte sich. Er schaute mich an und fragte:
«Wo kommst du her?»
Ich antwortete: «Aus Brig, warum?»
«Weil die Strasse gesperrt ist!»
«Ja» erwiderte ich, «aber die Barriere stand offen, so meinte ich: ich könne fahren!»
Er schüttelte nur den Kopf und fragte: «Was hättest du gemacht, wenn eine Dringlichkeitsfahrt entgegengekommen wäre, zum Beispiel Ambulanz?»
Sprachlos schaute ich ihn an. Er ging dann ans Telefon, sprach mit irgendwelchen Leuten, kam zu mir zurück und verkündete: «Jetzt kannst du runterfahren.»
Ganz, ganz kleinlaut verliess ich das Restaurant und wusste, ich muss dem Wirt nicht versprechen so einen Blödsinn nicht nochmals zu tun!
Die Skitour
Seite 58
Seite 58 wird geladen
58.
Die Skitour
Man kann es ruhigen Gewissens behaupten: Die Skilehrer auf der Bettmeralp waren allesamt Enthusiasten. Um ein Beispiel zu nennen: Einer von ihnen war Linienpilot bei der SWISSAIR, nahm jedoch jeden Winter drei Monate unbezahlten Urlaub, um sich in seiner heimatlichen Umgebung auf der Bettmeralp, ungeachtet der finanziellen Einbusse, als Skilehrer auszutoben. Ein anderer war Trainer der Jugend-Nationalmannschaft, er brachte es fertig, mir den damals üblichen Rennschwung, den Umsteigeschwung beizubringen, was daraufhin zu meiner Lieblingsfahrweise wurde. Teilweise kamen wir im Skikurs zu «Privatunterricht», da nach der viertelstündigen Pause die Skilehrer aufstanden und eisern verkündeten, es gehe jetzt weiter. Wir standen bereits, doch die Mehrheit der Kursteilnehmer meinte, sie kämen nach. So kamen meine Schwestern und ich, manchmal auch noch eine Cousine zu unseren Privatstunden. Einer unserer Skilehrer war Bergführer und schlug uns etwas Unglaubliches vor: Eine Skitour auf den Aletschgletscher.
Der Gedanke liess uns nicht ruhig schlafen, doch am nächsten Tag verkündeten wir, dass wir natürlich mitkämen.
Einige Tage später versammelte sich eine kleine Gruppe, vorwiegend junge Leute, morgens um 6:00 Uhr beim Skilift Aletsch, der für diesen Anlass extra gestartet wurde und von welchem wir zum Skilift «Chüebode» stampften. Auch dieser wurde in der Frühe eigens für uns in Betrieb gesetzt. Mit dem Lift gelangten wir zum Fusse des Eggishorn, wo wir unsere Felle an den Skiern montierten und mit deren Hilfe hinauf stampften. Noch bevor uns die Kräfte endgültig verliessen, eröffnete sich vor uns ein unbeschreibliches Panorama!
Unter uns der Aletschgletscher vom Jungfraujoch herkommend, die Kurve am Konkordia Platz bis hinunter ins Tal. Überwältigt standen wir da, bis unser Führer meinte, nun müssten wir weiter, sonst liesse sich der Tagesplan nicht bewältigen. Also Felle runter von den Skiern, im Rucksack verstauen und runterkurven zum Gletscher. Dort wurden wir angeseilt, obwohl ich sicher war, unser Reiseführer wusste ganz genau, wo er uns über die breiteste «Brücke» zwischen den Gletscherspalten führen konnte. Aber sicher ist sicher.
Auf dem Gletscher angekommen wurde «biwakiert». Nicht gerade im Sinne von Reinhold Messner, aber wir bekamen silbrige Tücher, auf welchen wir das Mitgebrachte ausbreiten und verzehren konnten. Mittagessen auf dem Aletschgletscher – welch ein aufregendes Vergnügen!

Erklimmen des Aletschgletschers ... über die Gletscherspalten
Nach einer ausgiebigen Pause hiess es wieder aufbrechen, Skier anschnallen und auf der autobahnähnlichen «Piste» runterfahren bis auf die Höhe der Riederalp. Dort wieder anseilen, den Gletscher verlassen, die Felle wieder montieren und so stampften wir hinauf auf die Riederalp. Von da an ging es ein sanftes Gefälle hinunter auf die Bettmeralp. Da gab es eine rührende und auch laute Verabschiedung sowohl von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern als auch von unserem Tourenführer.
Nach zwölf unvergesslichen Stunden waren wir wieder daheim im warmen Chalet, wo das Feuer im Kamin züngelte und Mutter uns mit dem herrlich duftenden Nachtessen erwartete. So schön empfand ich Müdigkeit noch nie.
Autos – meine Leidenschaft
Seite 59
Seite 59 wird geladen
59.
Autos – meine Leidenschaft
Im Privatgymnasium MINERVA in Basel, das ich besuchte, kamen viele Jungs und Mädels bereits mit dem eigenen Auto, waren wir doch alle über das normale Gymnasiastenalter hinaus. Klar hätte ich auch gerne eines, zumal ich bereits seit einiger Zeit stolzer Besitzer des Führerscheines war.
Mein erstes wurde dann ein kleiner Renault Dauphin mit einem 850 cm³ Heckmotörchen. Ein Schulkollege erzählte, seine Grosseltern hätten einen Neuwagen gekauft und die Garage hätte für ihren Dauphin CHF 400.– geboten, doch daraufhin meinten sie, das schmucke Auto gäben sie für dieses Geld schon hin, aber nicht für die Garage, sondern an jemanden, der das Angebot mehr schätzen könne und kein Geschäft daraus machen würde. Und dieser Auserwählte wurde dann ich.
Da stand also mein erstes Auto, etwa mausgrau, zehnjährig mit 88‘000 km. Ich putzte es zwei Tage lang. Zuerst innen, schamponierte die Sitze und desinfizierte Lenkrad und Schaltknüppel. Am Folgetag reinigte und polierte ich das Auto aussen. Und siehe da, es bekam eine für die damalige Zeit übliche erbsligrüne Farbe. Offenbar hatte ich zehn Jahre Laternengarage-Stadtpatina wegpoliert.
Am dritten Tag zeigte ich überall stolz meine Errungenschaft und am vierten Tag unternahm ich mit meinen beiden Schulfreunden eine Ausfahrt zum Rheinfall in Neuhausen. Auf dem Rückweg geschah dann das Unglück. Zwischen Leibstadt und Schwaderloch gab es eine damals noch recht scharfe Kurve im Wald, wo mir ein Traktor entgegenkam. Ein ebenfalls entgegenkommender Opel Kadett-Fahrer war der Meinung, einen Traktor könne man auch in einer Kurve überholen. Er tat es auch, so kam es in der Folge zum Frontalzusammenstoss. Mein Beifahrer Christian bekam einen Schock und lief einfach planlos um die Autos herum. Walti, der hinten sass, brach sich einige Mittelhandknochen. Er als leidenschaftlicher Klavierspieler war besorgt darüber, ob er jemals wieder so gut Klavier spielen könne … Doch in diesem Moment kümmerte er sich ohne diese Gedanken um mich, denn ich war vorne eingeklemmt, hatte ich doch das linke Vorderrad so etwa unter meinem Fahrersitz. Trotz gebrochenen Knochen bog er mit blossen Händen Bleche auseinander, damit man mich rausholen konnte, denn es gab bereits einen Kabelbrand unter dem Armaturenbrett. Dies war ein normalerweise unmöglicher Kraftakt, den er fertigbrachte, um mich zu befreien. Helfer kamen dann mit Wolldecken, so lag ich am Boden, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Renault Dauphin nach dem Frontalzusammenstoss
Am nächsten Tag brachte Pityu meine Mutter und Mihály im Spital in Leuggern vorbei, wo ich mit meinem komplizierten Beinbruch lag. Meine Mutter war froh, dass sie zuerst mich sah und erst nachher das Wrack, umgekehrt hätte sie nicht geglaubt, dass sie mich noch lebend wiedersehen würde.
Es wurde dann ganz lustig in diesem Provinzspital in einem Achterzimmer inmitten lauter Unfallopfer. Also nicht krank, einfach mal aus dem Verkehr gezogen … Es gab etliche fröhliche Feste mit jüngeren Schwestern, die den Abend bei uns verbrachten. Mein Beinbruch konnte dort mit konventionellen Methoden nicht geheilt werden, so wurde ich anschliessend im Basler Bürgerspital zweimal mit vollem Erfolg operiert.
Danach kaufte die Familie einen gebrauchten Mittelklassewagen, einen Vauxhall Victor, mit dem ich sie etwa drei Jahre lang umherkutschierte. Das Auto liess uns nie im Stich, aber für mich wurde es trotzdem ein Lehrstück. Oft merkte ich, es müsste etwas repariert werden. Entweder war es für mich klar, was fehlte oder ich ging in Oberwil in eine Garage, holte ihre Diagnose und die entsprechenden Ersatzteile ab und los ging die Reparatur. Allerdings musste noch eine Hürde überwunden werden: die Zoll-Schrauben des alten Engländers. Aber ebenfalls in Oberwil gab es eine kleine Velo- und Töff-Werkstatt, wo ich für einen Fünfliber Zoll-Schlüssel mieten konnte …

Vauxhall Victor
Dann tauchte das grosse Geschäft im Ingenieurbüro auf, wo ich aushalf. Wir hatten es ganz gross aufgebaut und in diesen drei Monaten verdiente ich das Geld für meinen ersten Neuwagen. Er war ein schmucker Vauxhall Viva in mittelblau métallisé mit der sportlicheren Motorisierung und Fahrwerk – ein tolles Auto, mit dem ich sehr viel Spass hatte und sehr viele Kilometer gefahren bin. Das war auch die Zeit, als man statt Franz-Stunde mit gleichgesinnten Schulkollegen irgendwo hinfuhr, um einen Espresso zu schlürfen …

Vauxhall Viva von 1970 - zuerst steht er hübsch da - dann in Aktion...
Vier Jahre später kam dann die Möglichkeit, via PAX, meinem Arbeitgeber zu meinem ersten echten Traumauto zu kommen: Ein roter FIAT 124 Spider Cabriolet. Seit nunmehr fünfzig Jahren ist dies mein «Lieblingsspielzeug» und ein absolut treuer Begleiter auf unzähligen Ferienfahrten vom Schwarzen Meer bis hin zur Algarve. Die ersten zehn Jahre diente es nicht nur als Alltagsauto und für den Arbeitsweg, sondern selbst für die Skiferien. Für den Winter hatte es Winterreifen, Hardtop und Skiträger.
Erst dann kam der erste Zweitwagen, ein schnittiger FIAT 850 Coupé – auch feuerrot mit Doppelscheinwerfern – ebenso ein Spassmobil, das gute Dienste leistete.
Mein erster Mercedes-Benz hatte eine Vorgeschichte.
Bence, ein liebgewordener Freund, war sogar ein Vorkriegskind. Sein Vater besass ein Unternehmen und fuhr einen Mercedes-Benz 170 V. In diesem Fahrzeug krabbelte der Junge zwischen Fahrersitz und Rücksitzbank, dann sass er später neben seinem Vater, bis dessen Betrieb verstaatlicht und das Auto enteignet wurde.
Noch in Ungarn heiratete er eine Klavierkünstlerin. Sie hatten ein Kind und schafften es irgendwie in die Schweiz. In Bence lebte der Traum vom Mercedes weiter, bis ihm zwei «grosse Heckflossen» über den Weg liefen, die für sehr wenig Geld zu haben waren, war doch der eine total verrostet und der andere mechanisch im Eimer. Er kaufte beide Autos, richtete irgendwo eine Werkstatt ein und machte aus diesen zwei Wracks einen prächtigen Mercedes-Benz. Als stolzer Besitzer wurde er entsprechend bewundert und die Geschichte zog seine Kreise. Bald einmal hiess es: «Kannst du nicht auch für mich …?» Und er konnte.
Er und seine Frau waren sehr ehrgeizig. Sie jettete von Vorstellung zu Vorstellung, mit der Zeit in ganz Europa, er arbeitete als Agronom in der Chemie und verbrachte seine Abende in seiner Werkstatt. Ein weiterer Traum von ihm war, sein eigener Schafzüchter zu werden. So kaufte er ein altes, verlassenes Bauernhaus im Jura, unweit von Delémont in Glovelier und begann mit dessen Restaurierung.
Seine Frau war ständig auf Tournee, er tagsüber am Arbeitsplatz, abends in der Werkstatt und an den Wochenenden und in sämtlichen Ferien in Glovelier am Wiederaufbau des Hauses. Der Junge wurde in ein Internat in Deutschland gesteckt. Klar driftete die Ehe auseinander, so konnte Bence auch bedenkenlos seine Träume ausleben.
Eines Tages hatte er einen «/8» im Angebot, einen Mercedes-Benz 250 E, Farbe noch frei wählbar. Da wurde ich schwach, bestellte bei ihm das Auto in silbergrau métallisé.
Das Auto erwies sich für die damals recht stolze Summe von CHF 5‘000.– als Glückskauf. In dieser Zeit war ich in der Rekrutenschule und konnte aus verschiedenen Gründen in der 17-wöchigen Ausbildung 23-mal nach Hause fahren und natürlich auch zurück nach Romont.
Damals gingen wir nicht mehr nach Bettmeralp zum Skifahren, aber die Eltern kauften eine Ferienwohnung im Diemtigtal im Berner Oberland. Fünf Jahre lang holte ich in der Saison meine Schwestern an jedem Wochenende und in allen Ferien ab, und wir fuhren zum Wiriehorn hinauf zum Skifahren. Die neu aufgebaute Siedlung lag am Rande der Skipiste, so konnten wir vor dem Haus die Skier anschnallen und zur Talstation runterfahren und abends bei der letzten Abfahrt von der Piste abschwingen und vor unserem Chalet die Skier abschnallen …
In diesen fünf Jahren musste ich ein einziges Mal Schneeketten montieren, allerdings sassen meine Schwestern auf der letzten Steigung einige Male als Ballast im Kofferraum. Aber immerhin, von wegen Hinterradantrieb ungeeignet auf Schnee …
Daraufhin kam die ganz grosse Versuchung …
Im Militärdienst bekam ich eine fundierte Ausbildung im Geländefahren, wurde ich doch als Funker in einer Stabskompanie eingesetzt und musste öfters mit dem Funk-Pinzgauer eine Anhöhe erklimmen, um zwischen den beiden Tälern links und rechts eine Verbindung herzustellen. So war also der 4x4-Bazillus gesetzt …
In dieser Zeit entwickelte Daimler-Benz im Auftrag von Schah Reza Pahlavi den besten Geländewagen der Welt. Der damalige Herrscher von Persien meinte als Grossaktionär der Firma, es gäbe einige gute Geländewagen im Angebot, aber er wolle DEN BESTEN und das solle Daimler-Benz für seine Armee entwerfen. Sie tat es in Kooperation mit der österreichischen Steyr-Puch, die bereits viel Erfahrung in Sachen Vierradantrieb besass. Diese Firma lieferte auch die legendären Pinzgauer für die meisten westeuropäischen Armeen.
So bauten Steyr-Puch und Daimler-Benz ein gemeinsames Werk in Graz um das legendäre G-Modell zu bauen. Als alles so weit war, sahen die ganzseitigen Inserate ebenfalls sehr verlockend aus:
In der oberen Hälfte ein Pinzgauer, in der unteren ein G-Modell. Und die Unterschriften lauteten: «Zuerst der Dienst … dann das Vergnügen …».
Das passte haargenau für mich – so kratzte ich die benötigten CHF 30‘000.– zusammen und ging zur Mercedes-Vertretung nach Lörrach in Deutschland. Nun, warum dorthin? Weil bereits das Grundmodell in der Schweiz CHF 35‘000.–kostete, da es Komponenten enthielt, die ein echter Geländefahrer nicht brauchen konnte: Servolenkung, da spürt man im Gelände nicht jedes Steinchen unter den Rädern. Plüsch-Teppiche in der Kabine, wo man doch mit den dreckigen Stiefeln einsteigt … und so weiter.
Das Ganze hatte einen Haken: Damals durften deutsche Niederlassungen für Mercedes-Benz Fahrzeuge keine Neuwagen an Schweizer Käufer verkaufen. Doch der Verkäufer meinte: «Ich kann das Auto als Vorführwagen nach ihren Wünschen bestellen, den ich dann drei Monate behalten muss. Danach kann ich ihnen das Fahrzeug als Gebrauchtwagen verkaufen.»
«Abgemacht!», meinte ich. Nach der Auslieferung konnte ich MEIN Auto im Schaufenster der Garage drei lange Monate lang bewundern. Stolz schleppte ich auch Freunde und Freundinnen nach Lörrach zum besagten Schaufenster und zeigte ihnen MEIN Auto!
Nach der Übernahme und Verzollung in der Schweiz ging die Wintersaison 1980/81 los. Von da an war natürlich das Ankommen in unserer Ferienwohnung im Diemtigtal gar kein Problem mehr – es sei denn, ich kam auf die Idee, einen Abstecher in eine Kiesgrube zu machen, um zu zeigen, was das Auto alles konnte …

230 G 1980 Unterwegs nach Südfrankreich im Montblanc Massiv
Mangels Erfahrung machte ich dabei auch manch entscheidende Fehler. Einmal fiel mir in einer dieser Kiesgruben eine hübsche, grosse Pfütze auf. Hurra, da könnte man mit so einem Wunderauto herrliche Fontänen produzieren, so fuhren wir hinunter. Ich schickte Trudy raus, um die tollen Fontänen zu fotografieren und setzte zur grossen Durchquerung an. Zuerst ging es gut, doch dann wurde aus der Vorwärts- allmählich eine Abwärtsbewegung und das Auto steckte im Schlamm fest. Ein Aussteigen war nicht möglich, denn die Türöffnungen standen bereits unter Wasser. Zum Glück stand Trudy bereits draussen, so konnte ich sie bitten, Hilfe zu holen. Diese organisierte sie auch in Form eines Bauern mit seinem Traktor. Er kam mit hohen Stiefeln und befestigte eine lange Kette an unserem Anhängerhaken und fuhr los. Doch damals waren die Traktoren noch nicht so mächtige Monster wie heutzutage und die Räder seines Traktors drehten durch, ohne dass wir uns bewegt hätten. Nach einigen erfolglosen Versuchen wollte er bereits aufgeben, als ich rief «Es hat sich etwas bewegt!» Daraufhin unternahm er noch einen Versuch und dieser war endlich von Erfolg gekrönt.
Das Modell war offensichtlich für die Wüste konzipiert und entsprechend wurde der Rostbehandlung keine grosse Beachtung geschenkt. So kamen die ersten Reparaturen und nach über 40 Jahren Erfahrung muss ich feststellen, dass ich das Auto trotz Pflege bereits etwa dreimal gekauft habe…
Als wir Südtirol als unsere Winterdestination entdeckten, die wir pro Saison etwa dreimal aufsuchten, merkten wir, dass unser G-Modell zu langsam, zu laut und zu durstig für diese Distanzen sei.
Am Genfer Automobilsalon entdeckte ich ein Auto, das schlussendlich zu unserem «Vernunftsauto» wurde und bereits seit etwa zwei Jahrzehnten seinen «Winterdienst» klaglos absolviert. Am Skoda-Stand glänzte der modernisierte, mit VW- und AUDI-Technik ausgestattete Octavia Combi 2 Liter Turbodiesel mit Vierradantrieb für verhältnismässig wenig Geld. Ich zeigte Trudy das Auto bei der Basler Vertretung, wobei wir zuerst an allen VW-, Audi- und Seat-Modellen in die hinterste Ecke pilgern mussten. Ihr gefiel das Auto auch. Wir schlugen zu und ich dachte, ich wäre unter den Wenigen, die das Auto entdeckten.
Doch weit gefehlt … von da an schienen die Octavia Kombi wie Pilze aus dem Boden zu schiessen. Jeder Handwerker, der bei seiner Kundschaft als vernünftig erscheinen wollte, kreuzte mit so einem Kombi auf.
Ein weiterer Neuwagen kam bereits 1991 dazu. Trudy hatte sich als Wirtschaftsinformatikerin selbstständig gemacht und erhielt abwechselnd in Basel, Bern und Zürich Aufträge. Es musste also ein sicheres, bequemes, flinkes, doch eher überschaubares Auto her. Wir landeten beim damaligen «Baby Benz», dem Modell 190 E mit dem komfortablen 6-Zylinder 2,6-Liter Motor. Ein Kollege, ein OPEL-Fahrer, meinte, er sei nicht so doof, etwa CHF 10‘000.- mehr für ein Auto zu bezahlen, nur um den Stern vor der Nase zu haben. Was besagter Kollege unterdessen für Erfahrungen sammeln konnte, können wir nicht wissen. Unser MERCEDES präsentiert sich immer noch in alter Frische und fährt uns trotz seiner über 500‘000 km Laufleistung munter an unsere Ziele und dies ohne jegliche gröberen Reparaturen.
Es folgten dann alles Modelle, die im Kapitel «Die Oldtimerei» beschrieben werden.
Die Oldtimerei
Seite 60
Seite 60 wird geladen
60.
Die Oldtimerei
Eigentlich waren wir mit unseren Fahrzeugen top ausgerüstet: Cabriolet für den Sommer, Geländefahrzeug für den Winter und, um Lasten zu befördern. Aber es reizte die Oldtimerei, also Fahrzeuge, die man nicht braucht, die einen aber faszinieren und einem nur Probleme bereiten. Aber wenn sie laufen, können sie unheimlich viel Spass und Freude vermitteln.
Das erste Exemplar war ein Mercedes-Benz 220 S aus dem Jahr 1956, der «Grosse Ponton» mit Sechszylindermotor und grossem Faltdach fast über das ganze Dach. Besser gesagt wäre, denn das Auto kam bei uns nie in Verkehr. Ich war ein echtes «Greenhorn», kaufte das Auto in der festen Überzeugung, es selbst bereitzustellen und ging auf das Angebot des Verkäufers nicht ein, für relativ wenig Geld das Fahrzeug vorzuführen und wieder in Verkehr zu setzen.
Es war also nicht vorgeführt, hatte einige Roststellen, sonst aber war das Auto in einem tadellosen Zustand. Die gesamte Mechanik funktionierte, ohne auch nur einen Tropfen Öl zu verlieren. Wir fuhren zwar des Öfteren mit dem Prachtexemplar umher, Trudy voraus mit einem vermeintlich abgerissenen Abschleppseil und hintendran ich mit dem Oldie, welcher ein Stückchen Abschleppseil am vorderen Abschlepphaken hängen hatte. Tja, soeben gerissen …

Mercedes Benz 220 S Jahrgang 1955
Dieses Projekt fiel unseren Diplomarbeiten und dem anschliessenden Bau unseres ersten Hauses in Zeiningen zum Opfer. Wir trennten uns vom guten Stück. An einem Sonntagvormittag kurvte ein wunderschön hergerichteter, dunkelblauer 220 S mit grauem Interieur und Faltdach auf unseren Vorplatz in Zeiningen. Unser Käufer hatte die Restaurierung hinter sich und seine erste Fahrt führte ihn zu uns.
Ebenfalls an einem Sonntagvormittag blätterte ich die Automobil Revue durch und bei den Annoncen sprang mir ein Jahrgang ins Auge: Januar 1949, genauso wie meiner. Das war ein 170 S-D. Das Fahrzeug basiert auf dem Vorkriegs 170 V, wurde jedoch etwas modernisiert, hatte aber noch die Vorkriegsform mit freistehenden Kotflügeln und grossen, runden Laternen als Scheinwerfer. Der Preis war mit CHF 12‘000.–umwerfend, gleichzeitig unverständlich – so wenig Geld für so ein aufregendes Modell. Trudy und ich gingen das Auto anschauen und uns wurde alles klar.
Der Besitzer hatte eine mechanische Werkstatt, das Auto war entsprechend technisch und mechanisch tipp topp in Ordnung, hatte auch einen frischen MFK-Stempel, also sofort einlösbar. Aber die Karosserie war in einem Zustand, der in der Schweiz mindestens CHF 30‘000.– verschlungen hätte, um diese in Ordnung zu bringen. Somit war der Preis erklärbar, doch erörterte ich dem Verkäufer, dass wir Maximum CHF 10‘000.– für dieses Hobby frei hätten. Nach kurzem Zögern willigte er ein.
Frischfröhlich kurvten wir mit dem neu erstandenen alten Fahrzeug umher, doch ich wusste, für viele Fragen brauchte ich kundige Antworten. So traten wir in den «Mercedes Benz Veteranen Club Schweiz» ein. Dann vernahm ich von meinem Onkel Pityu, dass es dort, wo er herstammte und seine Mutter immer noch lebte, zwei Freunde gab, einen Spengler und einen Lackierer, die gut und für unsere Verhältnisse sehr günstig arbeiteten. Ich nahm drei Wochen frei, in der Meinung, dass man in zwei Wochen die Karosserieschäden in Ordnung bringen und die Neulackierung auch noch anbringen könne.
Wir fuhren mit dem Autoreisezug nach Graz, anschliessend via Sárvár zu den Meistern. Das war das Wochenende des Formel-1 Rennens in Budapest. An der Grenze sahen wir die feuerroten, auf Hochglanz polierten Transporter der Ferraris. Unterwegs gab es eine ungewöhnlich grosse Polizeipräsenz, entsprechend wurden wir ganze vier Mal angehalten. Allerdings, anstelle der Papiere interessierten sich die Beamten eher für das Alter des Autos, dessen Motorisierung und warum wir ihr schönes Land besuchen würden. Anschliessend wünschten sie uns gute Fahrt und einen angenehmen Aufenthalt.
Trudy flog heim in der Meinung, dass sie nach zwei Wochen zurückkomme und wir eine ausgedehnte Heimreise entlang romantischer Landstrassen unter die Räder nähmen. Sie kam auch wie abgemacht, allerdings um zu helfen, das Auto zusammenzubauen. Es gab an der Karosserie etliche M8-Schrauben, die besser in feine Frauenfinger passten. Anschliessend blieben uns zwei Tage für die Heimfahrt …

170 S-D Jahrgang 1949
In der Folge kam eine «Delegation» vom Club vorbei, der Präsident und einige Stamm-Mitglieder, um zu begutachten, was wir in Ungarn für etwa CHF 2‘000.- erreicht hatten. Sie waren höchst erstaunt, so ein Ergebnis für weniger als ein Zehntel des hiesigen Preises. Das Auto präsentierte sich wirklich prächtig mit seiner zweifarbigen schwarz-baroloroten Lackierung. Die «Fachleute» faszinierte der messerscharfe, mit den Fingern nicht spürbare Übergang zwischen den beiden Farben der Karrosserie. Was mir damals keiner von ihnen sagte, war, dass dieses Exemplar ein sagenhaft fantasievoll zusammengesetztes Ergebnis vieler Umbauten war. Erstens: 1949 gab es das Modell nur als Benziner. Also, es wurde erst später auf Dieselantrieb umgebaut. Auch die Karosserie entsprach nicht der ursprünglichen Erscheinung, sondern der etwas modernisierten Variante nach dem ersten Mopf, also Modellpflege. Diese zusammengesetzte Erscheinung erweiterte ich dadurch, dass ich den Kofferraumdeckel mit den früheren, aussen angebrachten grossen verchromten Scharnieren ersetzte. Also ein echter Verschnitt, nichts für Puristen, jedoch wunderschön zum Anschauen, aber auch zum Fahren.
Nach dieser Restaurierung kamen bald einmal die ersten Anfragen von Clubkollegen und in der Folge wurden in Ungarn etliche Oldtimer restauriert oder aber Gebrauchsautos vor dem Schredder gerettet. Ich musste alle diese Arbeiten koordinieren, unzählige Telefonate und Mails erledigen und mit den Kollegen etliche Male nach Ungarn fahren. So blieben auch meine Ungarischkenntnisse einigermassen intakt.
Dann kam das «unanständige Angebot» – unanständig darum, weil man trotz aller Vernunft nicht widerstehen konnte. Die Anbieter wussten von meiner Leidenschaft für Cabriolets und dass für mich das höchste der Gefühle ein Vorkriegscabriolet sein würde. So boten sie mir folgendes Geschäft an: Sie hätten ein altes Cabriolet und eine ebenso alte Cabriolet-Limousine auf 170 V Basis. Ich bekäme das Cabriolet, wenn ich beide Fahrzeuge in Ungarn auf meine Kosten restaurieren würde, das Cabriolet für mich und die Cabriolet-Limousine für die Anbieter.
Unterdessen stiegen die Preise auch in Ungarn und die Autos waren in einem undenkbar schlechten Zustand. So kam mich das schöne Cabriolet sehr teuer zu stehen. Der Vorteil für mich ist, dass ich nun weiss, auf welche Art alles restauriert und revidiert worden ist, was man bei einem gekauften Exemplar nie wissen kann. Ich weiss auch, dass alle Teile an diesem Auto original sind, wie man in Oldtimerkreisen sagt: Matching Numbers.
Für uns noch wertvoller wurde das Auto dadurch, dass wir die Nachfahren vom Vorbesitzer ausfindig machen konnten. Von ihnen erhielten wir sogar Familienfotos vom Vater und vom Auto und damit die Bestätigung, dass wir das Auto tatsächlich in Originalfarben Schwarz und Crème hatten lackieren lassen.
Das Auto macht enorm viel Spass, alle am Strassenrand winken fröhlich lächelnd zu und das Schönste ist, wenn ich junge Leute aus Dankbarkeit zur Hochzeit fahren kann. Meine Therapeutinnen, die mich hingebungsvoll zurechtgeknetet hatten oder die Tochter meines Zahnarztes, dann die Sekretärin, die mir Besucherplätze zuschanzte, wenn unsere eigene Garage zu eng wurde.
Das mit dieser Sekretärin war am lustigsten. Lucia heiratete still und leise im engsten Kreise ihrer Familien. Doch durch ihre Kollegin vernahm ich davon und wir heckten einen Plan aus:
Sie wollten vom Standesamt zu Fuss ins nahe gelegene Restaurant hinüber, wo die «Hochzeitsgesellschaft» bereits wartete. Doch ich wartete auf sie vor dem Standesamt in Binningen mit dem Oldtimer und «entführte» die beiden zum Wasserschloss Bottmingen, wo ich einige Fotos mit ihnen und dem Oldtimer machte. Lucia hatte hie und da Tränen der Freude in den Augen, und diese Freude hatte sie verdient.
Unterdessen ist unser neustes Auto, der Skoda, auch schon bald 20 Jahre alt. Also nur noch Alteisen in der Garage …
Schreibstil
Seite 61
Seite 61 wird geladen
61.
Schreibstil
Ich war schon als Kind dem Literarischen ergeben. Schuld daran war vor allem meine Grossmutter. Nachdem ich die ersten Kinderbücher verschlungen hatte, führte sie mich schon sehr bald in die Welt der Jugendbücher und machte mir diese schmackhaft. Sie war vor allem der internationalen Literatur zugeneigt und legte mir Bücher vor, wie beispielsweise «Oliver Twist» oder «David Copperfield» von Charles Dickens.
Die Eindrücke dieses Schrifttums leben immer noch in mir. Es kann mir einmal schlecht gehen, doch als Schreinerlehrling im Sarg übernachten musste ich noch nie, also was solls? Und David Copperfield wuchs ohne Vater auf, mit liebevoller Erziehung von Mutter und Haushälterin. Wie war es bei mir mit Mutter und Grossmutter?
Mitreissen konnten mich auch geschichtliche Bücher wie «Die Sterne von Eger» oder aber «In Ravenna wurde Rom begraben». Ersteres schildert den osmanischen Einfall und wie Ungarn diesen 150 Jahre lang von Europa fernhalten konnte. Dabei wird im Speziellen die Erstürmung der Festung von Eger beschrieben und wie Frauen genauso kämpfen können wie Männer, wenn es nötig ist.
Dann in Ravenna endete die Antike mit dem Ende des Römischen Reiches und das Mittelalter begann.
Immer mehr wählte ich meine Lektüren selbst aus. 1962 erschien das Buch «Rozsdatemetö» von Endre Fejes. Der Titel meint übersetzt «Schrottplatz», aber wenn man versucht den Begriff, wie ihn der Autor meint zu erfühlen, muss man den Buchtitel wortwörtlich übersetzen und dann entsteht so etwas wie «Rost Friedhof». Diese Wortwahl ist vielsagend, denn die Geschichte beginnt mit einem Vorfall auf dem Schrottplatz, einem handgreiflichen Streit, in dessen Verlauf jemand unglücklich stürzt und an seiner Kopfverletzung stirbt. Danach folgen in der Rückblende 50 Jahre Familiengeschichte, vom Ersten Weltkrieg bis hin zum tragischen Ende der Familie im Sozialismus.
Wie bereits erwähnt, empfahl mir später in der Schweiz meine Deutschlehrerin Jerry Cotton zu lesen. Das war eine ausgezeichnete Idee, aber danach war meine erste eigene Entdeckung Erich Kästner. Damals schon, der deutschen Sprache bereits etwas mächtig, faszinierte mich der Schreibstil Kästners. Bei seinen Büchern fing ich an, Sätze mehrmals zu lesen um die Ausdrucksweise, den Schreibstil zu verinnerlichen. Seine trockenen, doch so humorvollen Sätze faszinierten mich. Als in «Drei Männer im Schnee» sich Geheimrat Schlüter über seine Behandlung im Hotel beklagt, erwidert sein «Pendant», den man für den Millionär gehalten hat, das sei auch eine schwachsinnige Idee gewesen, sich als armer Mann verkleidet in einem Luxushotel aufzuhalten. Daraufhin fragt der echte Millionär seinen Butler Johann: «Hat unser junger Freund recht?» Johann antwortet: «Ich fürchte ja, wenn auch der Begriff ‹schwachsinnig› etwas hochgegriffen ist.»
Diese Wortwahl, diese Art das vernichtende Urteil so geschickt in Worte zu fassen, hat mich zutiefst beeindruckt – und dies ist lediglich ein Beispiel aus unzähligen.
Arthur Hailey entdeckte ich, weil einige seiner Werke verfilmt wurden. Damals, als Jugendlicher noch bei den Eltern in Bottmingen, fand ich manchmal Zeit, im Fernseher Filme anzuschauen. Da sah ich «Airport», später das «Hotel» und wurde auf diesen Autor aufmerksam. Dann las ich das Buch «Wheels» und dabei kam der Wunsch auf, «Airport», und das «Hotel» auch zu lesen. Es wurde mir klar, wie viel mehr ein Buch bieten kann als eine Verfilmung. Wie viele Nuancen, wie viele Details das Geschriebene beinhalten kann.
Und auch das: Bei der Verfilmung führt jemand Regie, sucht die entsprechenden Schauspieler aus und lässt diese gemäss seiner Inszenierung auftreten. Nicht so beim Lesen eines Buches. Da ist der Leser sein eigener Regisseur, kann sich seine Figuren selbst vorstellen, frei nach der Schilderung des Autors.
Kein Film, und mag dieser über vier Stunden gehen, vermag so viele Details wiederzugeben, wie diese im Buch beschrieben sind. Die Figuren im Sinne des Autors zu formen ist die vornehme Aufgabe des Regisseurs. Doch diese Funktion kann der Leser für sich selbst viel besser in seiner eigenen Empfindung wahrnehmen.
Arthur Haileys Werke werden unter Belletristik gehandelt. Ich gehe jedoch einen Schritt weiter und bezeichne diese auch als Sachbücher. Nun warum? Alles was er schreibt ist untermalt von Farbe und Spannung. Seine Figuren bewegen sich zwischen Liebe und Hass, Freundschaft und Feindschaft, Hilfsbereitschaft und Zwist. Es ist alles spannend zu lesen. ABER: Was er über die jeweilige Sache geschrieben hat, ist akribisch recherchiert worden.
In «Airport» wird detailliert beschrieben, welche Anstrengungen es benötigt, die tief verschneiten Landebahnen für die, in Not anfliegenden Flugzeuge brauchbar zu präparieren. Was es an psychologischem Geschick braucht, einen verzweifelten, arbeitslosen Familienvater, der eine Lebensversicherung zugunsten seiner Familie abschliesst, davon abzuhalten, die an Bord mitgeführte Bombe zu zünden.
In «Wheels» werden die Nöte des Fliessbandverantwortlichen genauso geschildert wie die Anliegen des Designers, die Probleme des Zulieferers und die Diskrepanz zwischen Entwickler und Direktion. Dann noch ein faszinierendes Beispiel über kleine, jedoch wichtige Entwicklungsstufen eines Automobils:
Im Buch werden keine Markennamen genannt, doch der einigermassen autointeressierte Leser kann ausmachen, es wird die Entwicklung des FORD Mustang geschildert. JA, FORD erkennt, dass die Babyboomer, die durch die abertausenden frontheimkehrenden Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, nicht die behäbigen, chrombehangenen Autos kaufen wollen, sondern etwas schickes, schnelles, sportliches! Für die Mehrheit amerikanischer Entwickler ein Neuland, doch sie haben das geschafft!
Bei der Enderprobung dieser Neuentwicklung taucht jedoch ein Problem auf: Bei dem, als Höchstgeschwindigkeit angegebenen Tempo treten im ganzen Fahrzeug Vibrationen auf. Die Entwickler finden auch die Lösung in Form einer Strebe zwischen den Aufhängungen der Vorderräder. Kostenpunkt für Ankauf, Oberflächenbehandlung und Einbau: $ 9.50. Die gesamte Direktion tritt zusammen, um das Problem zu behandeln. Die einen meinen, bei den amerikanischen Geschwindigkeitslimiten sei das kein Thema. Doch die anderen entgegnen: Wenn nur ein Autojournalist mit dem Mustang auf die Rennstrecke geht und das Problem entdeckt, kann man die Prospekte einstampfen und das tolle Verkaufsargument Geschwindigkeit vergessen. Es wird lange debattiert. Wie bitte? Wegen $ 9.50? Aber nein: Die Zielsetzung ist, über eine Million FORD Mustang zu verkaufen. Das macht zehn Millionen Dollar für die Strebe. Da lohnt es sich für die Direktion einen Tag lang zu diskutieren.
Schlussendlich wurden bis 2018 zehn Millionen Mustang verkauft …
Irgendetwas führte mich später zu Max Frisch. Zuerst einmal «Homo Faber». Auf Anhieb verstand ich die verworrene Geschichte gar nicht, sie war für mich zu verwirrend. Doch ebenfalls bei Max Frisch faszinierte mich der Schreibstil und ich las das Buch ein zweites, ein drittes Mal bis ich alles begriffen hatte. In der Zeit nach meiner Scheidung lernte ich eine bemerkenswerte junge Frau kennen, mit welcher ich sehr viel über Literatur diskutieren konnte, auch über meine neuste Entdeckung von Max Frisch. Lisa war, wie ich, von diesem Autor angetan, so konnten wir uns mit dem Gelesenen auseinandersetzen.
Einmal, in der Weihnachtszeit, lud ich meinen Berufspaten André, seine Frau Dorli und Lisa zum Nachtessen ein. Mihály bereitete für uns eine Metzgerplatte vor, brachte diese bei mir vorbei, und ich brauchte diese nur noch in den Ofen zu schieben. Es wurde ein toller Abend, doch hinterher musste ich mich schämen. Erst Tage später entdeckte ich Lisas Geschenk unter dem Weihnachtsbaum: Das Buch «Stiller» von Max Frisch. Natürlich verschlang ich auch dieses in Windeseile und natürlich hinterliess auch dieses Werk seine Spuren in meiner neu erworbenen Sprache.
Nicht unerwähnt bleiben darf in diesem Zusammenhang der Motorjournalist Fritz B. Busch. Seinen Schreibstil lernte ich in der Zeit kennen, als ich jede Ausgabe der deutschen Zeitschrift «Auto Motor Sport» las. Seine sachlichen, jedoch überaus humorvollen Schilderungen begeisterten mich. Uns verband nebst dem technischen Interesse noch eine andere Leidenschaft: das Cabriolet fahren. Nicht so, wie man es heute kennt, mit den Seitenscheiben, Windschott und Nackenheizung. Nein, das Cabriolet fahren lernte Fritz bei seinem Vater kennen, einem Motorsport begeisterten Menschen, der einen Opel 4/16 PS besass. Damals war Cabriolet fahren weit weg vom schicken Vorfahren vor der Opera, nein, es war eher die Angelegenheit armer Leute oder Enthusiasten. Das muss ich jetzt erklären:
Bis in die 1950er Jahre hatten die Personenwagen Chassis, zu Deutsch Rahmen, wie es heute nur noch Lastwagen besitzen. In diesem Chassis war alles was man zum Autofahren benötigt untergebracht: Motor, Getriebe, Hinterachse, Vorderachse mit Lenkung. Es kam normalerweise die Karosserie auf diesen Rahmen, doch man konnte diesen auch ohne bestellen und dann wurde eine individuelle Karosserie darauf gesetzt. In dieser Zeit kostete das Auto umso weniger, je einfacher dessen Karosserie war, also diejenigen ohne Dach waren die günstigsten.
Dann kamen die selbsttragenden Karosserien. Dabei wurde die Karosserie mit Hohlräumen so weit verstärkt, dass die Teile wie Motor, Getriebe, Hinterachse und Vorderachse mit Lenkung in dieser untergebracht werden konnten. Den tragenden Teil bildeten die A- B- und C- Säulen, in denen die Türen eingehängt waren, und welche mit der Dachkonstruktion verbunden die Steifigkeit der selbsttragenden Karosserie ergaben. Diese Bauweise machte die Autos günstiger und leichter.
Fehlt nun die Dachkonstruktion, muss man die Bodengruppe entsprechend verstärken, die auftretenden Resonanzen beseitigen, was in der Herstellung viel Aufwand verursacht. So wurden aus den günstigsten Autos die exklusivsten, teuersten.
Zurück zu Fritz B. Busch. Speziell in Erinnerung geblieben ist mir seine Ode auf das Cabriolet fahren:
Unter dem Titel «Und über uns die Sterne» beschreibt er eine Cabrioletfahrt in einer lauen Sommernacht, als er mit seiner Frau unterwegs ist. Die Scheinwerfer auf die Strasse gerichtet, den Blick hin und wieder gen Sternenhimmel. Und als er kräftig Gas gibt und seine Frau die Arme hebt, um ihre blonden Locken gegen den Fahrtwind zu bändigen, strafft sich ihre weisse Bluse und Fritz ist immer noch fasziniert von diesem Anblick. Sexistisch? JA, aber wer diese Art Sexismus ablehnt, ist ein Heuchler. Fritz B. Busch war immerhin 53 Jahre mit derselben Frau verheiratet.
Seine Oldtimersammlung wurde mit den vielen Leihgaben seiner Freunde zu einem bekannten Museum, das seit seinem Tode von seiner Tochter geführt wird.
«Ich denke, und das Auto handelt so, als wäre das Auto meine Beine. Diesen Satz müssen Sie notfalls noch mal lesen. Verzeihen Sie mir diesen Stil, aber ich habe nur ihn», schrieb er in seiner üblich ironischen, unterhaltsamen Art in der Jaguar E-Type-Reportage, die zuerst in «Auto Motor Sport» erschien.
Nun ja, ich habe auch nur den Schreibstil, der anfänglich durch diese Autoren geprägt wurde.
Onkel Sanyi
Seite 62
Seite 62 wird geladen
62.
Onkel Sanyi
Irgendwie schaffte es auch Onkel Sanyi sich in der Schweiz niederzulassen. Wie ich dann vernehmen konnte, kamen auch seine Kinder, also sein Sohn und seine Tochter. Allerdings kümmerten sie sich überhaupt nicht um ihren Vater, egal was er benötigt hätte. Aber mein Grossvater beschäftigte ihn gerne im ungarischen Laden. Tagsüber arbeitete er in der Stückfärberei in Basel. Als Textilfachmann blieb er seinem Metier treu und schob in der «Stücki» die mit Textilien beladenen Wagen von der Bleicherei zur Färberei oder sonst wohin.
Nach der Tagesarbeit stellte er für den ungarischen Laden Wurst-Spezialitäten her. Er konnte diese besonders günstig herstellen, da er eine spezielle Technik anwendete.
Am riesigen Schlachthof in Basel, wo täglich hunderte Rinder und Säue geschlachtet und zerstückelt wurden, hatten die Metzger keine Zeit, die Fleischstücke exakt vom Knochen zu trennen. Vielmehr schnitten sie das wertvolle Fleisch mit einer schwungvollen Bewegung vom Knochen, wobei einiges an schönem Fleisch am Knochen hängen blieb.
Sanyi kaufte diese Knochen für fast nichts ab und hatte dann Zeit, alles Fleisch in minutiöser Kleinarbeit von den Knochen zu trennen. Mit dem Ergebnis konnte er die feinsten Würste herstellen. Er hatte auch eine Räucherkammer mit mehreren Räucherschränken, wo die rassigen Würste zum Schluss bis zum Verzehr reiften.
Als die Ungarn sich zusehends in der Schweiz einlebten und immer mehr Älpler Makronen, Rösti, Raclette, Fondue und sonstige hiesige Spezialitäten entdeckten, ging der Umsatz im ungarischen Laden zurück. Doch mit den in Basel und Umgebung lebenden Spaniern konnte der ungarische Laden über die nächsten Jahre hinweggerettet werden.
Aber auch dies nahm einmal sein Ende. Sanyi war bereits pensioniert und seine wenigen Jahre in der «Stücki» brachten ihm nur eine kleine AHV-Rente ein. Ich nahm das in die Hand und stellte den Antrag für Ergänzungsleitungen. Diese wurden ihm auch mit den damals üblichen Auflagen genehmigt: Ich musste in seinem Namen jedes Quartal bescheinigen, dass er immer noch in seiner bescheidenen Einzimmer-Wohnung hauste und dass er die Miete regelmässig bezahlte.
Was die AHV-Behörden weniger interessierte war, dass Sanyi auch in Basel den Tarzan verkörperte. Im Frühling war er der Erste, der am Rheinufer die noch zarten Sonnenstrahlen einfing. So war er zum Sommeranfang bereits gebräunt. Schliesslich wurde auch der «Unzerstörbare» krank: Behandlungen, Therapien, Operationen. Nach alledem landete er zur Rehabilitation auf der Chrischona, über Bettingen bei Basel. Ich besuchte ihn einige Male nach seinem Mittagessen, so genossen wir zusammen Dessert und Kaffee.
Einmal, an einem schönen sonnigen Tag, war es auf der Terrasse des Rehabilitationszentrums auch so. Er sagte, er freue sich so sehr, dass ich ihn besuche. Wir nahmen unsere Desserts, tranken unsere Kaffees und Sanyi legte sich in seinen Liegestuhl und genoss die Sonnenstrahlen. So schlief er ein, und ich ging wieder ins Büro.
Noch am selben Tag riefen sie von der Chrischona an und verkündeten, dass Sanyi an diesem Nachmittag endgültig eingeschlafen sei.
Sanyi, du alter Kumpel! Du hast meine Mutter für mich zurückgeholt, dafür konnte ich dich auf deinem letzten irdischen Weg begleiten.
Romont – Château-d‘Oex
Seite 63
Seite 63 wird geladen
63.
Romont – Château-d‘Oex
Oberst Bernasconi hatte meine Wünsche tatsächlich erfüllt. So wurde ich im freiburgischen Romont zur Rekrutenschule einberufen und zum Funker ausgebildet – nicht für die Infanterie mit dem Funkgerät auf dem Buckel, sondern als Motfahrer mit eigenem Fahrzeug.
Es war eine aussergewöhnliche Rekrutenschule, eine besondere Truppe: alles überalterte Soldaten, ewige Studenten, schwarzhäutige Eidgenossen und ich mit 26 Jahren eingebürgerter Flüchtling – und dann unser «Löfti», also unser Zugführer im Range eines Leutnants. Er war der Jüngste unter uns und hatte die Situation nicht wirklich souverän im Griff, nur ein Beispiel:
Wir fassten unsere Willys-Jeeps offen, ganz ohne Blachen und dies für die Winter-RS. Bei manchen Übungen oder Verschiebungen mussten wir zuerst den Schnee von den Sitzen räumen, bevor wir einsteigen konnten. Bei einer morgendlichen Abfahrt bekam ich den Motor in meinem ausgeleierten Willys nicht zum Laufen. Ich holte den jungen Leutnant, er stieg ein, machte irgendwas, ohne es mir zu erklären, brachte damit den Motor zum Laufen und schritt selbstgefällig die Gruppe ab und fragte: «Muss ich sonst noch jemandem helfen?»
Der Feldweibel weckte uns jeweils, indem er morgens um 6:00 Uhr sein riesiges Kofferradio vorbeibrachte und die wildeste Rockmusik auf maximaler Lautstärke laufen liess.
Ich lernte auch, was freiwilliges Blutspenden bedeutete. Eines Tages hiess es: «In der Stadt gibt es freiwilliges Blutspenden. Wer geht, kann in der Stadt im Ausgang bleiben. Wer nicht geht, muss hier Graben graben …»
Das Blutspenden war gar nicht schlimm, und damals gab es anschliessend zum feinen Sandwich oder zur Suppe auch noch ein Glas Rotwein. Daraufhin wurde ich sowie meine spätere Frau Trudy, regelmässige Blutspender. Wir spendeten solange, bis die Voruntersuchungen ergaben, dass mein Hämoglobinspiegel für mich zwar genügend sei, jedoch nicht zum Blutspenden ausreichen würde.
Was ich lernte, war das militärische Funken nach strengen Regeln. Hinter jeder Regelung fragte ich nach dem Sinn, fand ihn auch und machte so keine Fehler. In der Folge schloss ich die RS mit dem Funkerabzeichen ab. Für einige grössere Übungen gaben sie mir ein, zwei Kameraden mit, um gemeinsam selbstständige Aufgaben zu erledigen.
Das ging immer sehr gut und gegen Ende der Rekrutenschule wurde ich vor die «Obrigkeit» zitiert. Sie baten mich weiterzumachen. Doch ich wusste, zwingen konnten sie mich nicht mehr. So fragte ich: «Wie stellt ihr euch das vor? Ich habe wegen meiner Hautausschläge Marschdispens und muss auch keinen Kämpfer mit den unzähligen Taschen tragen, welche die Luft abschnüren. Es ist doch in der ZS auch zwingend, einen 100 km-Marsch zu absolvieren.»
Sie nickten und meinten, wenn sie es wollten, wäre alles möglich. Hauptsache, ich könne mit Leuten umgehen.
Ich blieb standhaft. Mit Kollegen zusammenarbeiten hatte mich schon immer gereizt, aber dann eher am Arbeitsplatz als im Militärdienst.
Während der 17-wöchigen RS war ich 23-mal daheim. Einerseits wurde ich kein einziges Mal zur Wochenendwache aufgeboten, andererseits musste ich wegen den Scheidungsverhandlungen auch unter der Woche freibekommen. Ergänzend auch etwas Lustiges: Das Ingenieurbüro, wo ich aushalf, musste schlussendlich Konkurs anmelden. Es wurde untersucht, ob eventuell betrügerischer Konkurs vorliege. Ich bekam in dieser Sache eine Vorladung von der Staatsanwaltschaft als Auskunftsperson. Diese fand an einem Mittwochvormittag in Basel statt. So erhielt ich vom Dienstagabend bis Donnerstagmittag frei. Ich erschien zum Termin in Uniform und mein Zuständiger meinte, wenn er gewusst hätte, dass ich im Militärdienst sei, hätten sie mit dem Termin gewartet. Ich beruhigte ihn und versicherte, es sei für mich eine willkommene Abwechslung in der RS freizubekommen und dabei die «Zivilisation» zu geniessen. Nach Beantwortung einiger Fragen fragte der jüngere Beamte, ob ich gerne nochmals eine «Abwechslung» hätte. «Oh ja», versicherte ich ihm und meinte, so Mittwochvormittage wären ideal. Zwei Wochen später bekam ich die entsprechende Vorladung.
Die RS ging also unbeschadet vorbei, und ich wurde zum ersten Wiederholungskurs aufgeboten. Einrücken in Burgdorf, um den Funker-Pinzgauer zu fassen, dann weiter zum Stützpunkt einer Stabskompanie einer Panzereinheit in Château-d‘Oex, mit dem 5-Tonnen Gefährt, vollgestopft mit Funkgeräten. So absolvierte ich als Erstes eine Fahrschule, einerseits, um den militärischen Zusatzführerschein über 3,5 Tonnen zu erhalten, andererseits umfasste das Programm eine fundierte Ausbildung im Fahren im Gelände. Na bitte, zum Cabriolet-Bazillus nun auch noch der Bazillus im Geländefahren …
Bei den Manöverübungen waren die Aufgaben recht interessant, meistens mit zwei zugeteilten Kameraden hinauf auf den höchsten «Höger», um eine Relaisstation zwischen den Tälern links und rechts einzurichten. Dabei lernten wir die Bauern im Welschland kennen: Die einen jagten uns zum Teufel, während die anderen uns mit Kaffee Lutz, belegten Brötli und Getränken aus dem Keller willkommen hiessen. Zweitere erzählten oft von ihren Söhnen, und wie froh sie seien, wenn diese berichteten, wie gut sie während ihrer WK-Übungen in der Deutschschweiz aufgenommen worden seien …
An unserem ständigen Stützpunkt in Château-d‘Oex schliefen wir in der Vieh-Verkaufshalle. In der Luft schwebte noch der Duft der Kühe. Ich konnte vorzüglich schlafen, obwohl es eine pulsierende Umgebung war, nämlich mit 120 Soldaten aus sechs verschiedenen Zügen. Eine Stabskompanie brauchte vom Schützenpanzer- bis hin zum Motorradfahrer alles. Die Ausgangszeiten waren also unterschiedlich sowie auch der Ankunftsradau danach …
Die WKs fanden immer im November/Dezember und dann anschliessend im Januar statt. So packte ich meine Sachen im Dezember gar nicht aus, um dann nach dem nächsten WK fast zwei Jahre Ruhe vom Militär zu haben.
Dabei lernte ich die damaligen FHD-Soldatinnen kennen und auch hassen. Wir mussten jeweils einen Tag früher nach Burgdorf zurückfahren, um zuerst ihre Sani-Pinze zu putzen und für den nächsten Dienst zu konservieren. Die Ladys konnten nach Herzenslust im grössten Dreck umherfahren, die Jungs putzten ihre Pinzgauer dann schon. An sich ist das keine leide Aufgabe, aber im Dezember und im Januar … Kaum waren in der Nacht unsere Finger aufgetaut, mussten wir am nächsten Tag an unsere eigenen Fahrzeuge gehen.
Später, als das AMP-Burgdorf bereits zum Militär-Fahrzeugmuseum umfunktioniert war, bekam ich eine kleine Entschädigung. An einem schönen Sonntag gab es dort einen Tag der offenen Tür. Ich fuhr natürlich hin und musste feststellen, welch grosses Interesse herrschte. Etwas ausserhalb Burgdorfs, bereits Kilometer vor dem Ziel, standen entlang der Strasse die parkierten Autos der Besucher. Unbeirrt fuhr ich weiter und fand das von einem Soldaten überwachte Eingangstor natürlich verschlossen vor. Während ich umherschaute, wo ich wenden könnte, kam ein Fahrzeug heraus und der Überwachungssoldat deutete mir an, hineinfahren zu können. Auf dem Platz, wo ich früher jeweils im Winter Pinzgauer hatte putzen müssen, konnte ich nun mittendrin parkieren.
Eines Tages, bei den Vorbereitungen zum nächsten Dezember-WK fand ich mein Dienstbüchlein nicht, ohne welches kein Einrücken vorstellbar war. Ich stellte die Wohnung auf den Kopf, aber es kam beim besten Willen kein Dienstbüchlein zum Vorschein. Ganz verzweifelt setzte ich mich in einen Fauteuil, zündete eine Zigarette an und begann zu überlegen, wo das Ding sein könnte. Nach einigen Zügen kam mir die erlösende Idee: Ich rannte in die Einstellhalle und fand im Handschuhfach meines Autos tatsächlich das Dienstbüchlein noch mit dem Sold darin, den ich vor fast zwei Jahren erhalten hatte …
If You Don’t Know Me By Now …
Seite 64
Seite 64 wird geladen
64.
If You Don’t Know Me By Now …
Gerade geschieden, stellte sich für mich die Frage: Trübsal blasen oder anfangen das Leben zu geniessen. Ich entschied mich für das Zweite.
Damals in der PAX wurde noch vieles «per pedes» erledigt, das hiess Kopien gemacht, Akten herumgetragen, EDV-Listen sowie auch die gesamte sonstige Korrespondenz ins Büro gebracht. Gerade in dieser Zeit nach meiner Scheidung wurden diese Akten in meiner Abteilung von einer jungen Frau zu uns ins Büro gebracht. Sie machte auf dem zweiten Bildungsweg eine sogenannte «Bürolehre» und musste gerade diesen Dienst absolvieren. Sie war jung, stets gut gelaunt, freundlich und obendrein auch noch verlässlich.
In der Tat war sie eine rothaarige Schönheit mit Sommersprossen im Gesicht, das von ihren gewellten Locken umrandet war, kurzum: ein schöner Anblick und ein Sonnenschein im Büroleben.
Als in der Kantine eines Tages etwas «Ungeniessbares» angesagt war und mein Bürokollege in den Ferien weilte, fragte ich sie, ob sie mitkäme, mit mir in der schönen grossen MIGROS-Filiale am Kirschgarten etwas anderes zu essen. Maya willigte ein und wir gingen in das etwas südländisch eingerichtete Selbstbedienungsrestaurant. Es erinnerte mich an das Pendant in Südfrankreich, im gigantischen Einkaufszentrum «CAP 2000» bei Nizza.
Wir unterhielten uns prächtig und sie trat ihren Dienst etwas verspätet an …
Von da an war es normal, Sachen zusammen zu unternehmen.
Das war die Zeit, als mich die ungarische Baronin auf der Suche nach ihrem Erbe als Privatsekretär engagiert hatte. Ich musste an Verhandlungen im Rahmen von festlichen Essen teilnehmen. Als die Baronin von meiner Freundin erfuhr, wünschte sie, diese bei den Verhandlungen als Begleiterin ihres Privatsekretärs dabei zu haben. Maya war auch sofort dafür zu haben. Sie war die Ältere der beiden Töchter einer alleinerziehenden Mutter und sie wohnten in einer sozial unterstützten Wohnung in Münchenstein. Sie war der Baronin auf Anhieb sympathisch, doch diese bemängelte ihre dürftige Kleidung, so nahm sie «die Kleine» mit und kaufte ihr im besten Hause zwei, drei passende Garderoben. «Die Kleine» entwickelte sich auch zu einer richtigen Gesellschafterin, fing an vermehrt Zeitungen zu lesen, um über alles diskutieren zu können.
Meine erste «Amtshandlung» für die Baronin bestand darin, für ihre Recherchen CHF 10‘000.- Startkapital bei zugesagten 10 % Zins aufzutreiben. Dafür übergab sie mir als Pfand eine kleine Schatulle voller Goldschmuck. Am nächsten Tag erzählte ich dies meinem Bürokollegen André, der ohnehin eine Spielernatur war. Er hatte Rennpferde laufen in Deutschland, kaufte junge Exemplare und verkaufte diese dann je nach Erfolg mit Gewinn weiter. Er liess den Goldschmuck schätzen und das Ergebnis war: mindestens CHF 20‘000.–Wert. So konnte ich meiner Baronin bereits am zweiten Tag meiner Tätigkeit den gewünschten Betrag übergeben, was damals einem bescheidenen Jahreseinkommen entsprach.
Die Baronin kaufte für Dienstfahrten ein Oldsmobile Toronado Formula 400, ein schnittiges Coupé, ein Muscle Car mit 7,4-Liter Achtzylinder, mit dem ich unter anderem Leute vom Flughafen Zürich abholen musste, mitunter aber auch meine Freundin in Münchenstein. Dann standen etliche Nachbarn an den Fenstern und schauten zu, wie Maya, chic gekleidet, bei mir einstieg und ich beim Losfahren zwei dicke schwarze Striche am Boden hinterliess.
Es ging weiter, ich gönnte Maya dieses Vergnügen, und ich selbst genoss die Zerstreuung nach meiner gescheiterten Ehe. Sie war ein Sonnenschein, aber nicht mein Traum für eine Frau der Zukunft. Aber was solls, wir waren noch jung und ich konnte noch gar nicht daran denken, mich wieder zu binden.
Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, ging ich bei ihr einmal ohne zu überlegen etwas zu weit: Die Höhenburg Rötteln stammt aus dem 13. Jahrhundert und ist heute eine Burgruine bei Lörrach, unweit von Basel. Die Burgreste versucht man mit allen Mitteln zu erhalten, darüber hinaus ist man bestrebt, ihnen neues Leben einzuhauchen. Es werden Sommernachtsfeste veranstaltet sowie Theateraufführungen abgehalten.
Einmal gab es dort eine Programmansage, die mich reizte. Ich fragte Maya ob sie mitkäme, was sie auch sofort bejahte. Dann fragte ich sie unbedarft, ob sie ihre Mutter und ihre Schwester mitnehmen wolle, ich würde diese auch gerne einladen. Da war sie auch sofort dafür, so fuhren wir an einem schönen Sommernachmittag zu viert nach Rötteln.
Es wurde ein unbeschreiblich schöner Abend. Vor der Vorstellung gab es genügend Häppchen und Apéro in einer berauschenden Umgebung. Auch die Aufführung war zu geniessen und anschliessend gab es vor der Heimfahrt einen «Schlumi» in der lauen Sommernacht.
Auf der Fahrt zurück herrschte naturgemäss kein grosser Verkehr mehr, ich konnte entspannt fahren. Auf dem Rücksitz Mayas Mutter und Schwester, sie neben mir. Auf einmal rückte sie näher, legte ihren Arm um meine Schultern, schaute mich an und sagte fast ohne Laute, die Lippen kaum bewegt, eher mit den Augen: «András, ich liebe dich!»
Das kam so spontan, so echt – ich erschrak. Ich wollte doch mit dieser kleinen netten Geste, ihre Mutter und ihre Schwester einzuladen keine so tiefgreifenden Gefühle erwecken. Zumal ich das Gefühl hatte, Maya hätte mich nicht ganz richtig verstanden, nicht ganz richtig gespürt. Das bestätigte sich dann auch.
Einmal, als sie bei mir übernachtete, fanden wir keinen Schlaf. Stattdessen plauderten wir, wie man so schön sagt, unablässig über Gott und die Welt. So gegen drei Uhr morgens sagte ich: «Weisst du wie viele Naturwunder die Schweiz bietet?»
«Na klar», meinte sie, «aber an was genau denkst du gerade?»
«An den Sonnenaufgang am Vierwaldstättersee.»
«Oh ja», rief sie, schlüpfte aus dem Bett und aus dem Badezimmer hörte ich sie sagen: «Das schauen wir an, jetzt gleich!»
So fuhren wir nach Küssnacht am Rigi. Da kannte ich ein Plätzchen mit einer Bank am Seeufer, zählte doch Luzern und Umgebung zu meinen Hauptdestinationen, um die Cabriolet-Saison nach dem Winter zu eröffnen. Da sassen wir, eng umschlungen, denn der Morgen war doch etwas kühler als erwartet.
Die harmlosen, grauen Schleier am Himmel wurden allmählich heller bis ganz weiss. Mit der Zeit nahmen sie eine zart rötliche Farbe an, die immer stärker in Purpurrot überging. Dann erschien der kleine rote Punkt über dem Horizont, wurde rasch zur leuchtenden Halbkugel und bald konnte man nur noch aus dem Augenwinkel reinschauen, so hell war sie. Als die Sonne so hoch stand, dass sie teilweise von den Wolken bedeckt wurde, verabschiedeten wir uns von ihr. Maya musste ihren Frühdienst antreten, damit die eintrudelnden Kolleginnen und Kollegen ihre am Vortag bestellten Akten bereits auf ihren Pulten vorfanden. Ich hingegen würde mir im Bahnhofbuffet noch ein Gipfeli und einen Espresso genehmigen können.
Aber das eben erlebte Schauspiel hinterliess eindeutig das Gefühl: Man muss nicht in die Karibik fliegen, um dieses Naturwunder des Sonnenaufganges zu erleben. Entsprechend verzaubert starteten wir zur Heimfahrt. Kurz vor Basel kam mir ein dummer Scherz in den Sinn. Ich fragte sie: «An welcher Tramhaltestelle kann ich dich absetzen?»
Ich war gespannt auf ihre Reaktion. Wird sie wie eine schnurrende Katze sagen: «Ich weiss, du machst nur Spass und fährst mich zum Geschäft!»
Oder aber wird sie mir wie eine Furie an den Kopf werfen: «Ich verbringe die ganze Nacht mit dir, da erwarte ich auch, dass du mich bis zum Geschäft fährst!»
Beides hätte ich akzeptiert, vielmehr erwartet oder eine Kombination, dass sie zuerst aufbrause, dann aber sagen würde: «Ich weiss schon, dass du mich bis ins Geschäft bringst.» Aber es kam nichts dergleichen.
Sie überlegte kurz und nannte eine Tramhaltestelle auf dem Weg.
Ich war fassungslos. Hatte sie wirklich angenommen, dass ich sie nach diesen Erlebnissen tatsächlich nicht einmal bis zu ihrer Arbeitsstelle fahren würde?
Der Song, der später durch «Simply Red» zum Welthit wurde, war bereits geschrieben:
If you don’t know me by now,
You will me never, never, never know …
Wortlos fuhr ich bis zur PAX und liess sie aussteigen.
Aufbruchstimmung
Seite 65
Seite 65 wird geladen
65.
Aufbruchstimmung
Das Scheitern meiner Ehe löste in mir unbewusst einen Drang zum Aufbruch aus. Davon blieb mein erster regulärer Arbeitgeber, die PAX, auch nicht verschont. Ich schaute mich in der Szene um. Damals hatte der Bankverein das weltweit modernste EDV-System aufgebaut und das reizte mich. Ich reichte meine Bewerbung ein und Mihály, als angesehener und auch mehrfach beförderter Mitarbeiter, hatte seine Empfehlung für mich abgegeben. Nach der Rekrutenschule wurde ich also Mitarbeiter beim Bankverein.
Zudem musste ich auch aus finanziellen Gründen meine Wohnung in Bottmingen aufgeben. Die Vermieterin hatte volles Verständnis, sie hatte uns ja gekannt. Ich ging mit der Kündigung bei ihr persönlich vorbei und wir besprachen die Situation bei Kaffee und Kuchen. Sie erzählte mir Dinge, die ich bisher gar nicht zu Ohren bekommen hatte.
Beispielsweise hatten Mitbewohner reklamiert, dass der Széplaky Stunden mit der Pflege seines Autos in der gemeinsamen Einstellhalle verbringen würde und dabei allgemein verrechneten Strom verbrauche. Da meinte die Vermieterin erwidern zu müssen: «Spielen eure Kinder im Winter oder bei schlechtem Wetter nicht stundenlang im Treppenhaus und verbrauchen dabei allgemein verrechneten Strom?»
Daraufhin gab es Ruhe.
Meine Mutter haderte mit der Situation und dem Umstand, dass ich von Bottmingen wegziehen wollte, also von unserer neuen Heimat und auch aus ihrer Nähe. Das waren ihre Gefühle, doch rationell hatte sie volles Verständnis und sie war Diejenige, die für mich eine günstige Wohnung in Birsfelden fand. Ich hatte finanzielle Verpflichtungen, musste der PAX die Restsumme für den FIAT 124 Spider bar auszahlen, sowie Jutka für die Differenz dessen, was ich behielt und was sie mitnahm, entschädigen. Letzteres war nicht schlimm, denn sie meinte, ich könne das in monatlichen Raten zahlen und sie dadurch kontinuierlich in ihrem Studium unterstützen.
Aber, um mich bei der PAX «freizukaufen», musste ich bei meinem Bürokollegen ein Darlehen aufnehmen. Um dieses so schnell als möglich zurückzahlen zu können, begann ich an sieben Tagen der Woche zu arbeiten: Montag bis Freitag am Arbeitsplatz, samstags im Fernsehladen und sonntags Zeitungen austragen. Aber auch das war lustig und vergnüglich.
An den Sonntagen war ich gewöhnlich zum Mittagessen bei den Eltern zu Hause. Nach dem Dessert, Kaffee und fröhlichem Geplauder stellte sich die schwierige Frage, welche meiner Schwestern im zweisitzigen Cabriolet zur nachmittäglichen Zeitungstour mitkommen durfte. Manchmal waren die anstehenden Hausaufgaben entscheidend, manchmal die Reihenfolge, wer zuletzt dabei gewesen war.
Die Wohnung in Birsfelden, die meine Mutter für mich gefunden hatte, war im wahrsten Sinne des Wortes eine Bruchbude. Sie befand sich in einem Haus, das man zugunsten eines Neubaus seit langem abreissen wollte, aber der Bau sich aus irgendwelchen Gründen verzögert hatte. So vermieteten sie die Bleibe doch noch vorübergehend. Die Miete war in meinem Sinne niedrig. Ich bezahlte pro Monat CHF 250.– für diese ordentliche Dreizimmer-Wohnung, allerdings ohne Zentralheizung. In den Räumen standen Stubenöfen – wie romantisch – die Warmwasserversorgung war jedoch zentral.
So schleppte ich im Winter sackweise Cheminéeholz und auch etwas Briketts in die Wohnung und heizte damit, sofern ich überhaupt zu Hause war. Wenn ich wusste, dass ich am nächsten Tag zu Hause sein werde, setzte ich ein dicht in Zeitungspapier eingewickeltes Brikett aufs Feuer und machte die Luftzufuhr ziemlich zu. So hatte ich am nächsten Tag immer noch Glut, um mit einer neuen Ladung Holz ein schönes Feuer zu entfachen.
Auch die Rekrutenschule kam mir gelegen. Ich war dabei weg vom täglichen, gewohnten Leben. Obwohl … vergnüglich war die Winter-Rekrutenschule in Romont gar nicht. Immerhin musste ich dafür meine Wohnung nicht den ganzen Winter heizen …
Schweizerischer (Basler-) Bankverein
Seite 66
Seite 66 wird geladen
66.
Schweizerischer (Basler-) Bankverein
Herr Unger, der Personalchef des Schweizerischen Bankvereins, bluffte bereits zu Beginn unserer Besprechung mit einem Stapel Akten, um zu signalisieren, er hätte genug Bewerbungen, also Lohnverhandlungen seien nur in beschränktem Masse möglich. Aber das war auch nicht meine Absicht – ich wollte einfach in allem ein neues Leben beginnen.
Dann kam ich in die engere Wahl und damit ins Gespräch mit der Fachabteilung. Dabei waren der Gruppenleiter und sein Stellvertreter. Wir sprachen über einige Dinge, nicht nur auf die Arbeit bezogen. Wie ich später erfuhr, bekam ich meine Stelle dank meiner Armbanduhr.
Ich trug eine MOVADO, also die Uhr ohne Zahlen, ohne Striche auf dem schwarzen Zifferblatt, sondern lediglich zwei Zeiger und ein silberner Punkt, die Sonne bei 12 Uhr. Die Uhr ist ausgestellt in den Museen der «Modern Art» in Paris, New York usw. Der Stellvertreter sagte zum Gruppenleiter: «Wer solch eine Uhr trägt, wird wohl ein etwas besonderer Mensch sein. Genau solche brauchen wir!»
So wurde ich Mitarbeiter der einzig baslerischen Grossbank der Schweiz – damals zumindest. Warum sie mich anstellten, wurde mir erst später klar. In der PAX arbeitete ich an einem Immobilienverwaltungsprojekt mit und Herr Unger hatte die Vision, die Immobilien, die Bankverein besass, hausintern zu verwalten. Er nahm mich an die Verhandlungen mit den Sitzdirektoren, die für die Immobilien zuständig waren, immer mit. Dabei lernte ich die halbe Schweiz kennen, hauptsächlich die feinsten Restaurants.
Herr Unger bestellte oft Rindsfilet. Diese kamen unter der Heizhaube und wurden vor den Augen der Gäste serviert. Dabei wurden die Enden abgeschnitten, zur Seite gelegt und nur die Mittelstücke serviert. Dann sagte ich zum Kellner: «Ich hätte gerne das Endstück.» So bekam ich dieses zusätzlich und kam auf den Geschmack von Rindsfilet, halb oder ganz durchgebraten.
Aus dem tollkühnen Immobilienverwaltungsprojekt wurde leider nichts, so wurde ich mit den Projekten des Personaldatensystems beauftragt. Dies war eine Weile spannend, doch dann suchte ich etwas Neues.
So kam ich in die Technik, genau gesagt ins Datenbanken-Verwaltungssystem. Es war eine tolle Zeit, aber ich wollte endlich einmal auch bei einer Bankapplikation mitwirken. Man vertröstete mich immerfort, deshalb beabsichtigte ich kurzerhand zu kündigen und teilte dies meinem Sektionsleiter mit. Dies vernahm auch der Leiter der Sektion, die für Kreditgeschäfte zuständig war. Werni Bruderer bat mich zu sich in sein Büro und schilderte mir die Situation. Das Kreditprojekt, die Ablösung der Bearbeitung vom Papier auf den Computer, wurde kurz vor seiner Einführung vom Controlling abgeschmettert. Begründung: ungenügendes Reporting. Die Projektmitarbeiter waren so enttäuscht, dass alle fünf kündigten und übrig blieb nur der Projektleiter. Nun musste Werni eine neue Truppe zusammenstellen und erst noch im grösseren Stil als bisher geplant. Dabei hatte er drei Einheiten vorgesehen, die Online-, die Batch- und die Reportinggruppe. Dabei würde er mich gerne mit dem Reporting beauftragen und mir Projektmitarbeiter zur Seite stellen.
Werni war ein überaus sympathischer Typ, und was er vorschlug, tönte sehr verheissungsvoll: Bankapplikation, Verantwortung für ein Gebiet, das scheinbar immer mehr an Bedeutung zunahm, aber auch für Mitarbeiter. Wie hätte ich nein sagen können?
Ich bekam zwei Mitarbeiter und die Möglichkeit, an den Projektsitzungen meine Forderungen an die applikatorischen Abläufe zu stellen, damit ein relevantes Reporting auf die Beine gestellt werden konnte.
Das wichtigste Element, die Nationalbankstatistik, entwarf Herr Stöckli, ein Direktionsmitglied der Generaldirektion, mit welchem ich eng zusammenarbeiten durfte. Es fiel mir nicht schwer, denn Herr Stöckli war ein überaus angenehmer Mensch. Natürlich klappte nicht alles auf Anhieb, was damals genau das Aufregende an unserer Arbeit war: Wir konnten alles auf der grünen Wiese aufbauen. Dies traf auch die Sitzdirektoren, die bisher Daten falsch erfassen liessen, aber zuhanden der Statistik dann richtig deuteten. Nun, das kann der Computer nicht, der interpretiert alles gleich. Ein Beispiel waren die Begriffe Domizil und Risikodomizil. Ein Deutscher besass in Davos eine Ferienwohnung. Was ist nun Domizil und was Risikodomizil? Bei den Richtigstellungen gab es bei einigen regionalen Sitzen etliche Überstunden, befohlen von Direktor Stöckli. Damit er mich nicht mit jeder seiner Fragen belästigen musste, lernte er die Programmiersprache zumindest lesen und interpretieren.
Nach erfolgreicher Einführung des Kreditprojektes nahm auch der Projektleiter seinen Hut und ich wurde mit zwölf Mitarbeitern als Gesamtleiter für die Konsolidierungsphase ernannt. Dabei merkte ich, dass man sich beim Administrieren von so vielen Leuten zwangsläufig von der eigentlichen Arbeit entfernte. Es war eine aufregende Aufgabe, doch hinterher äusserte ich den Wunsch, wieder Projektarbeit in kleineren Einheiten zu verrichten.
Wie hält man es in derselben Firma 33 Jahre bis zur Pensionierung aus? Die Antwort ist einfach. Man nimmt an so vielen unterschiedlichen Projekten teil, man hat dabei mit unterschiedlichen Auftraggebern zu tun, muss unterschiedliche Abläufe kennenlernen, sodass es einem abwechslungsreicher vorkommt als bei manchem Firmenwechsel.
Damit verbunden ist allerdings auch, dass man mit dem einen Projekt eher unglücklich ist und sich öfters über die Umstände ärgern muss. Anschliessend kommt das nächste Projekt mit angenehmen Auftraggebern aus dem Betrieb, mit tollen Mitarbeitern, mit denen man gerne zusammenarbeitet und womöglich auch ein spannendes Gebiet, das man bearbeiten muss. Das sind dann meistens die Projekte, die mit Erfolg zu Ende geführt werden.
Gegen Ende meiner Laufbahn kam die Bankenkrise. Es gab die zwangsweise erlassenen frühzeitigen Pensionierungen. Ich wurde verschont und gehörte zu den Wenigen, die regulär pensioniert wurden. Allerdings kam in meinem letzten Dienstjahr die Finanzkrise, was auch zur Folge hatte, dass mein Einstellhallenplatz gekündigt wurde. Ich erkundigte mich beim Vermieter, was mich der Platz kosten würde und es kam heraus: Eine Jahresmiete entsprach dem damaligen Preis eines Erste-Klasse-GA, das ich dann auch bevorzugte.
Es war herrlich: Ich hatte etliche Überstunden zum Abbauen und wenn das Wetter einladend war, nahm ich frei und fuhr kurzerhand ins Tessin, nach Luzern und machte eine Runde am Vierwaldstättersee oder nach Genf auf der wunderschönen Jurastrecke.
Mein letztes Projekt war ein Glücksfall mit dem angenehmsten Betriebspartner, den ich jemals erleben konnte. Es fing jedoch gar nicht gut an …
Das Projekt wurde getrieben von unserem Controlling, einer überaus hochnäsig gewordenen Einheit. Dazu muss ich etwas aus unserem Metier erörtern: Als ich zum Bankverein kam, war die IT klar nach zwei Haupteinheiten gegliedert – der Analyse und der Programmierung. Diese Einheiten waren sogar im dritten und im zweiten Stock unseres Gebäudes örtlich getrennt. Doch unsere junge Führung erkannte, dass es so zu viele Reibungsverluste gab und rief die Parole aus: Wir brauchen keine Analytiker und keine Programmierer, wir brauchen Analytikerprogrammierer, also Fachkräfte, die beide Themenkreise abdecken können. Nur so gibt es keine Missverständnisse zwischen denen, welche die Arbeit vorbereiten und denen, welche diese ausführen. Was bedeutete dieses Vorhaben? Ganz einfach, dass jeder Mitarbeiter zur Selbstständigkeit erzogen wurde. Es war ein voller Erfolg und in der Folge kannte ich nichts anderes.
Doch bei meinem letzten Projekt trat das Controlling als Alleswisser auf, die hatten alles vorgekaut, wir in der IT durften nur ausführen. Rebellieren nutzte nichts, das Controlling war Auftraggeber und bezahlte in der internen Abrechnung für das Projekt.
Dann kam die Einführung des Projektes in der Produktion. Der wichtigste Benutzer, der mit seiner Gruppe die statistischen Wünsche der Geschäftsleitung erfüllen musste, gab ein vernichtendes Urteil ab: «Die Ausführung der Datensammlung ist in der vorliegenden Form völlig unbrauchbar!»
Aber wie weiter? Der Benutzer bot an, die betriebliche Projektleitung zu übernehmen und das Projekt neu aufzurollen, aber nur mit mir, ohne Controlling. So fing eine erfolgreiche und überaus angenehme Zusammenarbeit an. Wir gestalteten das Vorhaben gemeinsam in gegenseitigem Vertrauen und auch einer Art freundlicher Achtung. Keiner fällte eine Entscheidung, ohne diese mit dem Partner zu besprechen. So kam das Projekt zum Fliegen.
Mein Partner Fulvio war noch jung, aber dank seiner kompetenten und freundlichen Arbeitsweise bei seinen Mitarbeitern, bei seinen Abnehmern und natürlich auch bei mir sehr beliebt. Er sorgte auch dafür, dass nach meiner Pensionierung mein Wunschkandidat das Projekt übernehmen konnte. Ich ging also mit dem besten Gefühl in den Ruhestand.
Etwa drei Jahre später rief mich mein Nachfolger an und gab mir bekannt, wann und wo Fulvios Beerdigung stattfinden würde. Ja, er bekam eine aggressive Form von Blutkrebs, selbst eine Knochenmarktransplantation half nichts. In dieser Nacht konnte ich keine Sekunde schlafen.
Er hinterliess eine junge Frau und zwei halbwüchsige Kinder. Bei seiner Beerdigung las der Pfarrer an der Abdankung gefühlsmässig unbeteiligt seine kurze Lebensgeschichte vor. Als dieser fertig war, stand ich spontan auf, ging zum Rednerpult und erzählte aus vollem Herzen, was Fulvio denen, die mit ihm hatten zusammenarbeiten können, bedeutet hatte.
Auf freier Wildbahn
Seite 67
Seite 67 wird geladen
67.
Auf freier Wildbahn
Wie gesagt, nach meiner gescheiterten Ehe tröstete ich mich mit der neu erlangten Freiheit und machte flüchtige Bekanntschaften. Dann kam Rita, eine Bündnerin aus Disentis. Dort hatte sie einen Coiffeur-Salon, doch es kam zum Unglück. Ihre ältere Schwester besass bereits ein Auto und die beiden fuhren über den Oberalp, wobei die Fahrerin eine Kurve nicht erwischte und frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug knallte. Der Unfall war nicht sehr schlimm, doch die damals noch nicht angegurtete Beifahrerin Rita flog in die Windschutzscheibe und ihr Gesicht erlitt etliche Schnittwunden. Ihr behandelnder Arzt empfahl ihr eine Schönheitschirurgie in Basel, um die Narben vollends verschwinden zu lassen. So gab Rita ihren Coiffeur-Salon in Disentis auf und liess sich in Basel nieder.

Rita aus Disentis
Als ich sie kennenlernte, war in ihrem Gesicht kaum etwas von den Unfallspuren zu sehen. Dennoch standen ihr noch zwei, drei Eingriffe bevor mit Narbenschleifen und Behandeln. Sie war vielleicht nicht berauschend hübsch, aber eine interessante Frau und hatte eine «Bombenfigur». Ausserdem war sie eine Nymphomanin, was einem Mann in meinem damaligen Alter lustig vorkam, zumindest eine Zeit lang.
Ich lernte ihre Familie kennen. Ihr Vater war Redaktor des Lokalblattes und von ihm erfuhr ich, warum die Bündner-Sprache dem Untergang geweiht sei: Es gäbe mehrere Versionen, wovon drei vorherrschend seien. Die hochalemannischen Dialekte des Churer Rheintals, zweitens die höchstalemannischen Walserdialekte, die sich klar vom Churer Rheintalischen unterschieden und drittens die südbairische (tirolische) Mundart in Samnaun. Das Problem dabei sei, dass die Bündner sich nicht auf einen dieser Dialekte einigen könnten und dadurch auf keine einheitliche Unterstützung oder Anerkennung zählen dürften.
Es ist ja wirklich faszinierend: Die Schweizer Banknoten sind nicht nur mit Zahlen, sondern auch mit Worten umschrieben, und dies in den vier Landessprachen. Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Dabei sind die Noten in ihrer Grössenordnung aufwärts alternierend in den beiden hauptsächlich gesprochenen rätoromanischen Dialekten angeschrieben. Also abwechselnd im «Rheintalischen» und im «Walser».
Rita hatte mich beeindruckt: Sie war glücklich in meiner Bude in Birsfelden, mit der Stubenofenheizung, mit der zwar grossen, aber sehr bescheiden eingerichteten Küche. In meiner Begeisterung für meine Bündnerin rief ich die Verlobung aus. Die Verlobungsfeier fand in Disentis in einem feinen Lokal statt, wobei die Eltern von uns beiden dabei waren und einander endlich kennenlernen konnten.
Dann kam das:
Unsere Portierfrau Daisy, die alles über alle wusste, ging in die Ferien. Ihre Ablösung war eine sehr junge Studentin, ein Wuschelkopf.
Es fiel mir auf, wie sie mich mit ganz offenen Augen anstrahlte und ich lud sie zum Mittagessen ein. Sie willigte sofort ein und ich verstand die Welt nicht mehr. Ich alter Knochen, bereits gegen 30 Jahre alt, komme bei einem so jungen, überaus hübschen Wesen so gut an … Sie warf mich mit dieser Beziehung, die sich parallel mit derer zu Rita entwickelte, vollkommen aus der gewohnten Bahn. Ich war machtlos: Sie war aus Rorschach und ihren leicht nasalen ostschweizer Dialekt fand ich nicht nur angenehm, nein, sogar sehr sexy. Ihre offene, natürliche Art faszinierte mich, auch ihre Begeisterungsfähigkeit für vieles, was ich mit ihr unternehmen wollte. Es war eine sehr «zarte» Beziehung, aber umso aufregender.
Immerhin wurde mir klar: Ich war noch nicht so weit, wieder eine feste Beziehung einzugehen. Dies erörterte ich Rita und löste unsere Verlobung auf. Sie verstand es nicht und es gab unschöne Szenen. Sie wurde richtig hysterisch. In meinem Leben kam es ein einziges Mal vor, dass ich eine Frau schlagen musste. Doch Rita beruhigte sich erst nach einer Ohrfeige und nun konnte ich mit ihr reden.
Sie sah es ein. Aber sie bestand darauf, dass ich meine Versprechen einlösen würde: Ihr das Autofahren beizubringen und in Südfrankreich gemeinsam zu zelten. Das taten wir auch und dabei versuchte sie, mich mit allen ihren Mitteln zurückzugewinnen. Nach einiger Zeit mietete sie ebenfalls in Birsfelden, unweit meiner Bleibe, eine Wohnung. Es hiess dann einige Male: «Komm doch rüber, ich brauche dich.»
Danach gingen wir in die nahe gelegene Pizzeria und am nächsten Morgen konnte ich meine frisch gewaschene Unterwäsche anziehen.
Es ist eine Schande, aber ich weiss beim besten Willen nicht mehr, wie mein Wuschelkopf hiess. Nach einiger Zeit ging sie nach Amerika, um die grosse weite Welt kennenzulernen. Wir wechselten viele Briefe, doch einmal schrieb sie, dass sie einen anderen Studenten kennengelernt hätte, den sie lieben würde.
OK, vorbei.
In dieser Zeit verhalf ich Rita zu einem gut erhaltenen, günstigen Renault R8, mit dem ich ihr Fahrstunden erteilte.
Dann kam Wuschelkopf zurück und bat mich um Hilfe: Sie hätte den Führerschein, aber nun müsste sie Autofahren lernen. Wie das …?
Sie erklärte: Irgendwo in einer etwas abgelegenen Gegend, wo sie waren, hielten auch Polizisten ein Fest ab, wobei diesen mit der Zeit das Bier ausging. Da die Polizisten alle bereits etwas beschwipst waren, trauten sie sich nicht zu, in die Stadt runterzufahren, um Bier zu holen. Da boten ihnen die Studenten an, die teilweise bereits den Führerschein hatten, dies für sie zu besorgen. Später eingeladen auf dem Polizeirevier, wollte deren Chef nicht nur ihre Auslagen begleichen, sondern darüber hinaus auch ihre spontane Bereitschaft honorieren. Aber womit? Einer der Studenten kam auf die Idee, sie hätten schon gerne den Führerschein … Kein Problem, und der Polizeichef stellte ihnen allen das begehrte Papier aus.
Mit dem Renault R8 fuhr ich mit Rita morgens zu ihrer Arbeitsstelle, sie am Steuer. Dort angekommen übernahm ich das Auto und düste damit zum Bankverein. Über Mittag kam «mein» Wuschelkopf vorbei und wir absolvierten eine Fahrstunde. Nicht sehr viele, denn sie war besonders gelehrig, hatte richtig Gefühl sowohl für die Fahrtechnik als auch für den Verkehr. So ging es weiter, bis ich sie ruhigen Gewissens in die Selbstständigkeit entlassen konnte. Später machte auch Rita ihren Führerschein.
Eines Tages verkündete Rita, dass sie mich nach wie vor sehr gerne bei sich hätte, aber ich solle bitte nicht raufkommen, wenn im Hof ein Auto mit Winterthurer Kennzeichen stehen würde. Das sei nämlich das Auto ihres neuen Partners.
Der nächste Schritt war, dass sie nach Winterthur zog und ich war gänzlich befreit – und auch erleichtert.
Informatiker trifft Informatikerin
Seite 68
Seite 68 wird geladen
68.
Informatiker trifft Informatikerin
Wie bereits erwähnt, gab es zu unserer wilden Zeit noch keine staatliche oder sonst anerkannte Informatiker-Ausbildung. Da unterstützte der Schweizerische (Basler-) Bankverein die Bemühungen des kaufmännischen Vereins, eine solche Ausbildung zu offerieren und dies erst noch mit eidgenössischem Diplom. Unsere Erbauer des damals weltweit modernsten EDV-Systems engagierten sich als Referenten und erwarteten von Mitarbeitern, die weiterkommen wollten, diese Schulung zu absolvieren.
Eine berufsbegleitende Abendschule war alles andere als einfach, bedeutete fast jeden Abend von 17:00 bis 20:00 Uhr Schulunterricht unter der Woche, sowie oft auch an Samstagvormittagen.
Trotzdem meldete ich mich mit meinen weiteren etwa zwölf Kollegen an einen der ersten Kurse an. In dieser damals noch vorwiegend männerdominierten Gesellschaft waren erstaunlicherweise auf der um die vierzig Anmeldungen umfassenden Liste auch vier Frauennamen verzeichnet.
Männer können ja unterschiedlich sein, aber Frauen …
Der eine Frauenname fiel mir auf, kannte ich doch die Dame von der PAX her. Sie hier? Sie wusste doch bereits alles – wie sie meinte. So kam sie auch nie zum Unterricht und entsprechend schiffte sie bei der ersten Zwischenprüfung sang- und klanglos ab.
Eine zweite junge Frau besuchte nur den Mathe-Unterricht, sie hatte lediglich etwas mit Mathematik vor.
Dann das Püppchen, wie wir sie nannten. Sie war eine stets aufreizend gekleidete junge Dame, die mit Vorliebe bei einem Mann sass, der es bereits zu etwas gebracht hatte. Eine Ahnung hatte sie nicht, an die erste Zwischenprüfung hatte sie sich gar nicht erst angemeldet. Wir waren uns sicher: Sie war einzig auf Männerfang aus. Ob ihre Bemühungen von Erfolg gekrönt wurden, entzieht sich unserer Kenntnis.
Dann war eine junge Frau da, etwas zurückhaltend, immer schlicht gekleidet, meistens mit blauem Rock und weisser Bluse, was ihr aber sehr gut stand. Sie fiel damit auf, dass sie ihre Aufgaben stets richtig löste und interessante Fragen stellte. Bei einer kniffligen Aufgabe zum Programmieren war sie als Erste soweit. Ihre Lösung sah gut aus, und einige von uns wurden beauftragt, die Lösung zu testen. Ergebnis: Alles OK. Da meldete sie sich und verkündete, sie hätte das Programm bei sich auch getestet und eine Unterfunktion entdeckt, die noch nicht ganz richtig funktioniere.
Bei einer samstäglichen Prüfungssimulation gingen wir alle gemeinsam in dieselbe Cafeteria. Sie sass neben mir und fragte nach meinem Tätigkeitsgebiet. Es war schwierig zu erklären, ich war zuständig für unsere sehr restriktiv gehandhabte Metadatenbank. So etwas war damals noch nirgendwo verbreitet, geschweige denn bekannt.
Es wurde Winter. Nach dem Unterricht eilte ich an allen vorbei zurück ins Büro, um noch Dringendes zu erledigen. Da sauste ich auch an ihr vorbei, aber aus dem Augenwinkel erkannte ich, dass sie Mühe hatte, ihren Wintermantel anzuziehen. Bereits auf der Strasse hatte ich mich gefragt: «Ist das deine Erziehung? An jemandem vorbeizugehen, der Mühe bekundet, den Ärmel des Mantels zu finden. Schäme dich!»
Ein weiteres Mal verliessen wir die Schule zu dritt: Mein Bürokollege Urs, die junge Frau namens Trudy und ich. Natürlich war ich auf dem Weg, weitere Überstunden zu machen. Trotzdem regte ich an, gemeinsam noch kurz einen Kaffee zu trinken. Urs meinte, er müsse heim, seine Familie würde ihn wegen der Schulung ohnehin zu oft vermissen. Doch Trudy willigte ein.
Wir gingen in die «Filiale», eine Cafeteria namens «Jokey», wo man auch Kleinigkeiten essen konnte. Dort trafen sich oft die in der Stadt etwas verstreut domizilierten Informatiker. Da kamen Entwickler, Organisatoren und Operateure der Rechenzentren zusammen und konnten in einer ungezwungenen Atmosphäre ihre Beziehungen pflegen. An diesem Abend kamen dort Trudy und ich sehr gut ins Gespräch und der Kaffee gab Durst. Da bestellte ich ein Halbeli Roten. «Aber nur einen Schluck, ich bin mit dem Auto da», meinte sie, was mir dann egal war, ich hatte die Überstunden bereits aufgegeben. Die Flasche wurde leer und das gab mir die Idee, in die Stadt runterzuziehen, da wäre das «Bistro», erst noch mit viel mehr Ambiente als hier im «Jokey».
Im «Bistro» wurde das Gespräch vertieft, ein weiteres Halbeli leer, wonach Trudy aber verkündete, jetzt sei ultimativ Zeit nach Hause zu gehen. Das taten wir auch – ich konnte das Tram der Linie 3 nehmen, sie hingegen musste mit ihrem Citroën GS heimfahren. Am nächsten Abend erzählte sie mir, wie froh sie gewesen sei, daheim heil angekommen zu sein …
Unsere Bekanntschaft vertiefte sich und wurde allmählich zur Liebschaft. An einem Sonntagnachmittag läutete meine Glocke in meiner Bruchbude in Birsfelden. Vor der Türe stand Trudy mit einem Riesenbouquet von Lupinen. Sie hätte in Stuttgart, wo sie früher gearbeitet hatte, zu tun gehabt und wusste, dass zu dieser Jahreszeit am Strassenrand die Lupinen wunderbar blühten, so hätte sie welche gepflückt. Mit dieser Erklärung übergab sie mir das Bouquet. Ich war zwar sprachlos, doch lud ich sie geistesgegenwärtig zu einem Drink ein. Der Nachmittag verging im Flug und wir machten uns auf, gemeinsam Pizza zu essen.
Trudy lebte in einer schönen grossen Wohnung in Reinach. Ihre Mitbewohnerin heiratete, zog aus und Trudy meinte, so eine grosse Wohnung würde sie alleine nicht brauchen. Ich wohnte immer noch in Birsfelden in meiner provisorischen Unterkunft. Wir beschlossen zusammenzuziehen, jedoch weder in ihre Luxuswohnung noch in meine Absteige. Ich meldete uns für eine bankvereineigene Wohnung an, doch es gab bereits eine ellenlange Warteliste. Aber man sehe und staune, wenige Wochen später bekam ich den Anruf, wir hätten eine Wohnung. Wie denn das?
Die Antwort hiess: Alle wollten in einen Neubau oder zumindest in eine neuere Wohnung einziehen. Was uns angeboten wurde, war eine Wohnung in einem etwas älteren, ehemals als Genossenschaftshaus erbauten Gebäude. Es war jedoch eine schöne 3½ Zimmer Wohnung mit ganz neu eingebautem Badezimmer und neuer Küche, fünf Minuten zu Fuss zum Büro, in einer traumhaften Umgebung, im sogenannten «Dalbeloch». Was hiess das: Unsere neue Wohnung befand sich ausserhalb der alten Stadtmauern unterhalb des St. Alban-Tors, daher der Name. Unsere Strasse führte geradewegs zum Rheinufer, einen Steinwurf von der alten historischen Papiermühle entfernt. Auf dem Heimweg liefen wir an alten Patrizierhäusern vorbei, die versteckt in verschlungenen Gärten standen. Auf den Messingschildern standen die Namen der Basler Urbevölkerung. Weiter ging es entlang des Baches, der auch die Räder der Papiermühle antrieb. Es gab einen alten Marktplatz, wo einige Male mittelalterliche Märkte abgehalten wurden, mit eigens geprägten Dalbe-Talern und mittelalterlichen Handwerkern, die ihre Handwerkskünste vorführten und das Erzeugte anboten.
Wir genossen diese Wohnung, nicht nur, weil sie entsprechend günstig war, sondern auch wegen ihrer besonders reizvollen Umgebung, egal zu welcher Jahreszeit. Mich als Hobbyfotografen reizten die herrlichen Bilder, die ich in dieser Wunderwelt schiessen konnte. Ich beschloss, ein Fotoalbum unter dem Motto «Dalbeloch in vier Jahreszeiten» zu erstellen. Es war naheliegend, machte ich doch von allen Ferien und Reisen mit meiner KONIKA Bilder, und jedes Mal entstand umgehend ein Fotoalbum. Und damit komme ich auch zu meinen beiden «Schandtaten».

Unterwegs zum Standesamt mit meiner Schwester Kati und ihrem Mann Gianni
Bei unserer späteren Hochzeit entstand ebenfalls eine grosse Anzahl schöner Bilder – aber (noch) kein Fotoalbum. Eine Entschuldigung gibt es nicht, nur eine Erklärung: Wir erstellten ein provisorisches Album, damit die anwesenden Leute ihre Fotobestellungen tätigen konnten. Und bei diesem Provisorium blieb es (vorläufig!) auch. Das mit feinem cremefarbenem Leder bezogene Album ist heute noch leer.
Auch vom Dalbeloch entstanden die schönsten Aufnahmen in allen vier Jahreszeiten, die vergrösserte ich bereits nach Bedarf, um die entsprechenden Ausschnitte erstellen zu können. Trudy schenkte mir ein herrliches Album: Das lederbezogene Deckblatt ziert ein Reliefdruck mit einem mittelalterlichen Motiv. Auch dieses Album ist noch leer.
Erklärung: keine. Doch eine Parallele: Ich habe, wie bereits geschildert, eine Modelleisenbahnanlage. Und ich bin mittlerweile auch Bierliebhaber. Einmal waren wir im Verkehrshaus in Luzern zu Besuch, wo ich eine Vitrine mit einer wunderschönen Modellkomposition vom schönsten Schloss der Schweiz entdeckte, der FELDSCHLÖSSCHEN Brauerei: Alle fünf Hauptgebäude, ein Schornstein und das Restaurant mit Biergarten im Massstab meiner Anlage. Trudy konnte mich kaum von dieser Vitrine wegzerren, schenkte mir jedoch später das Modell zum Zusammenbauen – eine Riesenschachtel mit unzähligen Einzelteilen. Ich nahm die Schachtel in den folgenden 30 (!) Jahren etliche Male hervor, bewunderte die wunderschön mehrfarbig wiedergegebenen Teile und stellte die Schachtel tief seufzend wieder zurück. Dann kam das Unglück, das mir zu meinem Glück verhalf …
Mit je einer kleinen Bierharasse links und rechts in der Hand eilte ich unsere Treppe hinauf, bis ich einen Tritt verfehlte und rücklings hinunter sauste. Ergebnis: Rippenbruch nahe der Wirbelsäule. In der Folge konnte ich eine Woche kaum etwas anderes machen als sitzen. Also sass ich am Esstisch, Trudy brachte mir die grosse Schachtel, Schere, Japanmesser, Nagelfeile, Klebstoff und ich setzte endlich das FELDSCHLÖSSCHEN zusammen. Heute bin ich glücklich: Der Gebäudekomplex ist eine der grössten Zierden meiner Modelleisenbahnanlage.
Kehren wir zurück nach Basel. Wir richteten unsere Wohnung nach den damaligen Bedürfnissen ein, das heisst einer der schönen, hellen Räume wurde zum Arbeitszimmer. Ich konnte damals im Bankverein nicht gebrauchte Büroeinrichtungen für wenig Geld kaufen, zum Teil waren diese noch nie benutzt worden. So fingen wir an, uns zusammen auf das Diplom vorzubereiten.
Nochmals Ski fahren
Seite 69
Seite 69 wird geladen
69.
Nochmals Ski fahren
Meine zweite Frau Trudy war die erste, der ich weder das Autofahren noch das Skifahren beibringen musste. Sie hatte das Skifahren zwar nicht mehr dermassen intensiv kultiviert wie ich, war deshalb etwas aus der Übung gekommen. So kam es, dass ich im Diemtigtal, wie sie sagt, eine Saison lang «auf ihr herumgehackt» hätte. Ich wollte sie auf der Kante fahren sehen, ich wollte in den Kurven den Unterbelag ihrer Skier sehen. Ich wollte sie rassiger gekleidet sehen – wir hatten den Ehrgeiz so auszusehen wie die Einheimischen, so sportlich und nicht so touristisch. Ein Skiwechsel mit meiner Schwester Kati, die am besten von uns fuhr, ergab: «Deine Skier sind unfahrbar!»
So ging Trudy schleunigst zu «unserem» Godi im Skigebiet, der uns bereits seit einiger Zeit mit Material versorgte. Er zeigte ihr einen «Authier» – damals gab es diese Schweizer Marke noch. Danach ging das Fahren schon viel besser … Sie war begeistert, die Skier waren nicht nur wunderschön, bordeauxrot mit einer goldenen Sonne, sondern sehr geschmeidig und präzise zu führen. Als diese dann vom Gebrauch an jedem Wochenende Schwächen zu zeigen begannen, schenkte ich Trudy auf Weihnachten ein Paar neue «Authier» des Typs «Venom». Mit diesen war sie auch mehr als zufrieden. Warum nur müssen solche kleinen, feinen Marken verschwinden?
Nach dem Verkauf der Wohnung im Diemtigtal suchten wir Skigebiete in der Schweiz und in Österreich, welche uns zusagen würden. Doch überall fanden wir nach unseren Begriffen überfüllte Skipisten vor. Zugegeben, wir wollten zügig umhersausen und dazu brauchte man eben genügend Platz …

Trudy auf Crans Montana
Dann fiel uns ein Artikel in der Basler Zeitung auf. In diesem wurden die Skigebiete Südtirols wegen der Kulinarik ihrer Hotels und der Freundlichkeit der Einheimischen gerühmt. Dann stand der für uns entscheidende Satz: Südtirol ist, «wo jeder zweite Bügel leer losgeht». Das hiess, die Gebiete waren nicht übervoll.
Unser erster Versuch in Kurzras überzeugte uns nicht, so suchten wir weiter und wurden in Sulden, im Ortlergebiet definitiv fündig: ein schneesicherer Ort auf 1‘900 m, wo die Pisten bis auf 3‘250 m reichten, im unteren Bereich romantische Waldabfahrten, weiter oben dann Pisten auf dem Gletscher. Auch die Erwartungen betreffend Freundlichkeit der Gastgeber bestätigten sich weitestgehend, mit dem Resultat, dass wir seit dreissig Jahren dorthin fahren, und das mittlerweile vier Wochen pro Saison.
Auch meine Schwester Kati kam einmal mit ihrem Sohn mit. Seither ist die ganze Familie immer wieder auf Sulden anzutreffen, auch im Sommer.
Vor etwa fünfundzwanzig Jahren wurde es dann ganz toll. Das Carving kam auf und auch die Meldungen in den Medien über die neuartigen Verletzungen mit verdrehten Knien und verrenkten Schultern häuften sich. Es hiess, das neuartige Gerät, der geschnittene Ski entwickle eine Eigendynamik, die beherrscht werden müsse. Dies leuchtete ein, wir sahen jedoch, dass der hauseigene Skilehrer in einem Stil fuhr und unterrichtete, den sie uns bereits auf der Bettmeralp nicht mehr lehrten. Was nun?
Robert, die «rechte Hand» unseres Hoteliers war zuständig für den Weinkeller und stand auch an der Rezeption. Wir wussten, er war professioneller Snowboard-Fahrer, unterrichtete Snowboard-Lehrer und drehte Filme zu diesem Thema. Wir gingen also zu ihm und erörterten ihm unser Anliegen. Betreffend Skilehrer lachte er nur: «Ja, ich weiss, ihr wollt keine Rückschritte, sondern Fortschritte machen!»
Dann wurde er ernst und meinte, momentan gäbe es im Skigebiet einen, der das am besten machen könnte, und das sei der Toni. Sein Freund Toni war zwar Skilehrer, aber auch Pächter zweier Skihütten mit Restaurants. Die eine betreute er, die andere seine Frau. So war er ziemlich schwer zu schnappen, doch nach einigen Anläufen schafften wir es doch noch.
Aufgrund von Roberts Empfehlung nahm er uns als Schüler und gab uns bereits in dieser ersten Saison vier Stunden. Zuerst wollte er wissen, was wir konnten, wie wir auf unseren «sanften» Carving-Skiern stünden. In der vierten Stunde bei der Schlussabfahrt bekamen wir das Gefühl, alle anderen Skifahrer auf der Piste seien unsere Slalomstangen.
In der nächsten Saison ging es dann richtig los. Er liess uns Fun-Carver mieten, die Stöcke daheimlassen und zeigte uns, wie man das Gerät richtig in die Kurve lenkt. Das waren die Grundelemente. Nachher kam es faustdick.
Er katapultierte uns in Sphären, die wir nie geahnt hätten. Wenn es die Verhältnisse erlaubten, fuhr er mit uns abseits der Pisten ganz berauschende oder wilde Abfahrten und trug uns auf, diese auch ohne ihn zu fahren. Wenn man mit der grossen Gondelbahn in das Gletschergebiet hinauffährt, sieht man eine sehr steile Schneise namens Hochleiten. Manche Leute reden darüber unter dem Motto «hier fahren manchmal Verrückte hinunter.» OK, das sind vorwiegend die Einheimischen, aber Toni fuhr mit uns dort auch hinunter, dann, um den Spass zu erhöhen, auch ohne Stöcke. Er brachte uns viele Schwungarten bei, hatte jedoch stets auch darauf geachtet, dass wir das «Schulische» auch können sollten, denn das sei die Basis, und es könne jederzeit sein, dass man jemanden hinunter lotsen müsse.
Dieser Hochleiten bescherte uns auch ein spezielles Erlebnis. In einem Winter lag sehr viel Schnee, dadurch wurde diese Schneise recht breit und einladend. Viele Einheimische fuhren dort hinunter, es wurde also zu einer richtig schönen Piste. In unserem Hotel kannten wir bereits recht viele Leute und erzählten in der sogenannten «Hamburger Gruppe», dass der Hochleiten nun ganz gut zu fahren sei und fragten die eher jungen Leute, wer mit uns käme. Keiner wollte. Jeder hatte Angst um seine Knochen. Am Schluss kam Rüdiger mit seinen 65 Jahren auf uns zu, ob wir ihn mitnehmen würden? Wir kannten ihn sehr gut, denn wir hatten an den Abenden etliche Gespräche mit ihm geführt, da er dies an Stelle vom «UNO» spielen mit den anderen bevorzugte.
Wir überlegten kurz, aber wir hatten bereits gesehen, dass er besonnen fuhr, konsequent auf den Kanten stehen konnte und sagten ihm zu. Am nächsten Tag, bei herrlichem Sonnenschein fuhren wir gemeinsam mit der Bahn hinauf. Weiter unten verliessen wir die Piste. Der Übergang war etwas mühsam, ein schmaler Weg zwischen Felsen. Dann lag vor uns die Abfahrt.
Ich fuhr los, hinter mir Rüdiger und den Abschluss machte Trudy. Schön schulisch, bis etwa zur Mitte, da hielten wir kurz an. Rüdiger war gut drauf, so fuhren wir weiter. Von da an wurde die «Piste» breiter und es standen auch keine Felsen mehr im Weg. Unten angekommen, noch vor der Mittelstation der Gondelbahn, wurden wir belohnt: So einen glücklichen Menschen mit so einem strahlenden Lachen wie bei Rüdiger haben wir vielleicht noch nie gesehen.
Toni war ein Teufelskerl. Es wurde in Sulden eine Piste gebaut, die so steil ist, dass die Schneekatze nicht mehr ohne Anseilen hinauf und hinunter kommt. An einem Januarmorgen, als wir Stunde bei ihm hatten, war die Piste immer noch wegen Vereisung gesperrt. Doch die Zuständigen überlegten, ob sie diese wieder freigeben könnten. Da bot Toni an, die Piste zu prüfen, fuhr mit uns hinunter und nutzte die Gelegenheit, uns beizubringen, wie man über eine teilweise vereiste Piste sicher hinunterfahren kann.
So erlebten wir die Sonnenseite. Doch wir wissen, es gibt auch immer wieder Schatten.
Im Frühling 2023 rief uns Ulli, die Frau von Toni an. Trudy nahm den Hörer, dann kam sie kurze Zeit später vollkommen verstört zu mir hinauf und sagte: «Toni gibt es nicht mehr.» Er sei beim Abstieg nach einer Lawinensprengung unglücklich ausgerutscht und tödlich verunglückt. Ich schreibe diese Zeilen im Sommer 2023 und kann mir noch nicht vorstellen, wie es in der nächsten Wintersaison ohne Toni sein wird.
Wir hatten mit der Zeit nicht mehr sehr viel mit ihm zu tun, denn er meinte, er hätte viele Schülerinnen und Schüler, die seine Stunden nötiger hätten. Da war Peter, der ehemalige Lufthansapilot mit seiner Liane, welcher mittlerweile seine ganze Familie, einige Generationen mit nach Sulden nahm und allen von Toni das Skifahren beibringen liess. Dann gab es eine Familie aus Solothurn, die hatten zwei Söhne mit Ambitionen zum Skirennfahrer. Sie beherrschten das Skifahren recht gut, doch blieben sie zu schmächtig, um als Athleten aufzutreten. Die Mutter Simone bekam MS und kann heute kaum mehr laufen. Sie haben eine Wohnung auf Sulden, verbringen sehr viel ihrer Zeit dort, und wenn sie im Winter dort sind, fährt Simone jeden Tag von 9:00 bis 10:00 Uhr mit Toni Ski und da könnte man ihm für diese Stunde Goldbarren offerieren, er würde es ablehnen, denn diese Stunde gehört Simone.
Da wir auch im Januar hinauf gehen, wenn sich viele seiner Schützlinge noch nicht blicken lassen, konnten wir jeweils einige Stunden bei ihm erhaschen. Ich nannte dies «Alpeneinweisung», ein Begriff aus der Fliegerei. Viele Privatflieger lassen sich in den USA ausbilden, da es dort einiges günstiger kommt. Aber nachher das Brevet in einem Alpenland wie der Schweiz überschreiben zu können, bedarf es dieser Alpeneinweisung, um auch über die Berge fliegen zu können. Wir brauchten diese, um nach dem langen Cabriolet-Sommer wieder in die Skisaison eingeführt zu werden.
Wir wissen es einfach nicht, wie wir die nächste Saison ohne Tonis «Alpeneinweisung» überstehen werden. Wie es sein wird, entlang der Sesselbahn hinunterzucarven und keinen verstohlenen Blick auf die Sessel zu werfen mit der Frage, ob Toni dort hinaufschwebt und uns das nächste Mal stecken würde, was wir besser machen könnten.
Laura
Seite 70
Seite 70 wird geladen
70.
Laura
Mein Jugendfreund Sándor, Sohn einer der besten Freundinnen meiner Mutter, kam mit der Zeit auch irgendwie in die Schweiz. Er wurde exzentrisch, schwankte zwischen lieb sowie charmant zu sein, und handkehrum seine Liebsten enorm aggressiv anzugreifen. Bei der Hochzeit meiner Schwester Kati war er eingeladen und dort wollte er mich verprügeln. Natürlich verhinderten dies die anderen Gäste, aber der Eindruck blieb. Später brach ich die Kontakte zu ihm ab. Er heiratete Barbara, eine reizende deutsche Frau, doch die Ehe ging recht rasch in die Brüche. Dann angelte er sich eine Ungarin, die ebenfalls sympathische Monika. Mit dieser Frau hatte er zwei Kinder. Beim ersten, das war Laura, bat er mich Taufpate zu sein. Seine Begründung: «Ich kenne nur Halunken, denen kann ich meine Tochter nicht anvertrauen.»
Ich besprach das mit meiner Frau Trudy, die meinte: «Solange ich Sándor nicht kontaktieren muss, kannst du es machen. Die Frauen sind jederzeit willkommen.»
So sagte ich zu und wurde Taufpate von Laura.
Sie wohnten in Allschwil, in einem schönen alten Eckhaus mit einer runden Essecke unter einem Türmchen. Mit der Zeit kam auch das zweite Mädchen Alexa zur Welt, das sie Lexi nannten. Ich ging manchmal vorbei und brachte die von den Mädchen begehrten Katzenzüngli mit. Oft musste ich Sándor zurechtweisen, denn sein Blondschopf Lexi wurde Laura gegenüber von ihm bevorzugt behandelt, unter dem Motto: «Du bist die Ältere, du musst nachgeben!»«Das geht gar nicht», rebellierte ich, doch ich weiss nicht, wieviel das schlussendlich genutzt hatte.
Als Laura grösser wurde, so etwa ab ihrem achten Lebensjahr, war mein Weihnachtsgeschenk, mit ihr an die Herbstmesse zu gehen, was sich als ganz anstrengende Angelegenheit entpuppte. Wir gingen auf die Bahnen und kaum merkte sie, dass diese sich nach der wilden Fahrt verlangsamten, nahm sie meine Hand fest in die ihre, denn sie wusste ganz genau, welches die nächste Attraktion sein sollte, die sie ansteuern wollte. Da half nichts, sie schleppte mich bedingungslos dorthin.
Doch mit der Zeit holte ich tief Luft und sprach ein Machtwort: «Jetzt gehen wir in die Beiz, trinken etwas und du gehst auf die Toilette!» Mit der Zeit wusste sie, es gibt keine Widerrede und kam widerstandslos mit. Im Restaurant «Alte Warteck» ging sie schnurstracks auf die Toilette – wer hätte das gedacht …? Ich bestellte etwas zum Trinken, dann ging es zum Wurststand oder es gab Käseküchlein oder Quiche und am Schluss Banane in Schokoladenmantel.
Zum Abschluss kamen die wildesten Bahnen dran. Zugegeben, es machte mir schon auch Spass …
Laura wurde älter und interessierte sich nicht mehr für die Herbstmesse. Dafür sassen wir des Öfteren zusammen bei einer Pizza und sprachen über ihre Zukunft. Ich ermunterte sie stets weiterzumachen und machte ihr klar, dass unser wichtigstes Kapital die Bildung sei. Sie lernte Apothekerin, schaffte dann begleitend die Matura und absolvierte die höhere Fachschule für spezielle Labortechniken. Heute ist sie Gruppenleiterin im Labor an der Universitätsklinik Basel.
Sie hat ein etwas zerrüttetes Verhältnis zu ihrem Vater, so sind wir für sie Anlaufstelle für alle ihre Sorgen, aber auch für alle ihre Freuden. Zu uns kommt sie einmal mit Tränen in den Augen, dann wiederum strahlend lachend. Einmal nahm sie mich mit, um ihr erstes Auto zu kaufen. Ein anderes Mal kam sie mit ihrer neuen Errungenschaft vorbei, einem tollen Auto, das sie sich schon immer gewünscht hatte.
Ich merke, sie kann ihren Vater weder ertragen noch ohne Vater sein. Ihretwegen treffe ich mich wieder sporadisch mit Sándor. Ich weiss, ich kann ihm alles sagen, alles an den Kopf werfen, doch wie viel das alles nützt, ist sehr fraglich.
Manchmal braucht es Nerven wie Drahtseile, beide Parteien anzuhören, zu versuchen, die Situation zu klären. Aber wenn sie sich dankbar zeigen, dass ich es fertiggebracht habe, sie einander näherzubringen, macht es unsagbar Freude.
Téli berek
Seite 71
Seite 71 wird geladen
71.
Téli berek
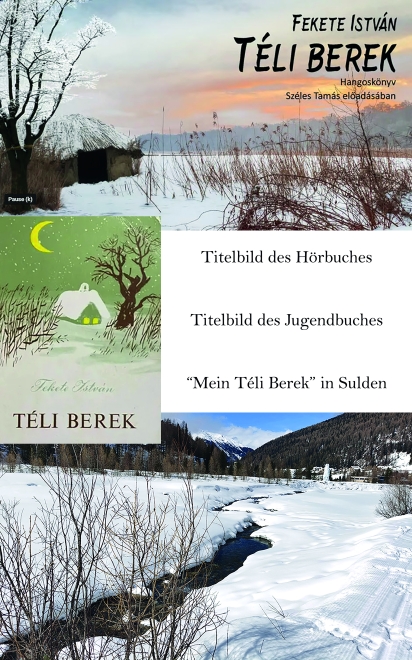
So lautet der Titel eines meiner geliebten Jugendbücher. Was der Begriff auf Deutsch bedeutet, findet man in keinem Wörterbuch, ich muss ihn schildern: «Téli berek» umschreibt eine winterliche Landschaft mit verschneiten Sträuchern, oft am Rande eines Baches oder um einen Tümpel. Das Buch habe ich als Jugendlicher mehrmals gelesen – diesen «Tick» habe ich heute noch und kann auch einen Film, der mir besonders gefällt, mehrfach anschauen und mich über neu entdeckte Nuancen freuen, die ich zuerst durch die noch unbekannte Handlung abgelenkt, übersehen oder überhört habe.
Sulden erstreckt sich um eine Art Hochebene. Der ursprüngliche Dorfkern befindet sich an einem Ende, dann schlängelt sich die Strasse zum anderen Ende, wo die neue Seilbahn zu den Gletscherpisten startet, welche sich auf über 3‘000 m Höhe befinden. Entlang der Strasse sind Hotels und Pensionen angesiedelt. In unseren Skiferien haben wir uns nach einigen Jahren Hotelaufenthalten in einer gemütlichen Pension, später in einer Wohnung einquartiert. Seither streichen wir jeden Abend zu einem der Restaurants, Pizzerias oder Hotels mit öffentlichem Restaurationsbetrieb. Nach Möglichkeit gehen wir dann nicht über die Strasse, sondern durchqueren das langgezogene Tal mit seinen verschlungenen Loipen für Langläufer und Spazierwegen für Fussgänger, welche nachts sogar beleuchtet sind.
Durch dieses Tal fliesst auch der Suldenbach, an manchen Stellen sogar auch im tiefsten Winter sicht- und hörbar mit seinem Geplätscher. Dann gibt es auch ein, zwei Tümpel, die entweder zugefroren oder als Weiher erkennbar sind. An deren Rändern stehen die grossen Sträucher, keine Bäume, sondern eher wildes Geäst. Wenn wir da entlanglaufen, muss ich immer für einige Augenblicke stehen bleiben. Da lacht Trudy und meint: «Ja, ich weiss, das sind deine Téli berek.»
Tatsächlich läuft dort vor meinen geistigen Augen die eine oder andere Episode aus meinem geliebten Jugendbuch ab.
Für mich als Stadtkind war es faszinierend, wie der Autor, István Fekete, dieses für mich damals noch unbekannte Landschaftsbild dermassen plastisch beschreiben konnte, dass ich meinte jeden Strauch zu kennen. Gyula, der junge Held der Geschichte, war auch ein Stadtkind von Budapest. Seine Eltern waren Akademiker und in ihren Berufen sehr eingespannt. Grosseltern waren für die Kindererziehung nicht verfügbar, so engagierten sie für ihn eine Nanny, eine Grosstante namens Piri Mama. Diese schmiss den Haushalt und erzog das Kind, mittlerweile ein junger Mann, der bereits das Gymnasium besuchte. Piri Mama war super, konnte jedoch auch nerven, vor allem in der letzten Zeit … Zum Beispiel mit ihren frisch gebügelten Taschentüchern. Diese steckte sie unserem jungen Helden immer zu, obwohl er ihr bereits unzählige Male erklärt hatte, dass er ausschliesslich Papiertaschentücher verwenden würde, schon wegen der Hygiene.
«Interessiert mich nicht, was du verwendest. Aber ein junger Mann MUSS Stofftaschentücher bei sich haben.»
Widerwillig steckte Gyula diese ein, denn Widersprechen gab es bei Nanny nicht …
Unser Held hatte auch ein Hündchen, einen aufgeweckten Spaniel mit grossen Knopfaugen. Er nahm die Pflege des Tieres sehr ernst und unternahm jeden Nachmittag einen Spaziergang mit seinem Liebling, ungeachtet, ob es Katzen hagelte oder die Sonne den Trottoir-Belag weich werden liess. So machten sie auch diesmal ihre Runde und dabei blieb Gyula vor einem Schaufenster stehen, da ihn darin etwas interessierte. Dann kam ein etwa gleichaltriges Mädchen, blieb ebenfalls vor dem Schaufenster stehen und sprach ihn an: «So ein herziges Hündchen! Darf ich es am Kopf kraulen?»
«Doch sicher!», erwiderte unser Freund und fügte hinzu: «Er ist sehr verspielt, er hat das sicher sehr gerne!»
Die junge Frau beugte sich zum kleinen Hund hinunter und kraulte dessen Kopf und Rücken. Da setzte sich das Hündchen voller Wonne auf seine Hinterläufe und schleckte plötzlich dem Mädchen das Gesicht ab. Sie stand auf und Gyula reichte ihr sein noch nach frischer Wäsche riechendes Taschentuch. Das Mädchen nahm es gerne entgegen, wischte das Gesicht ab und steckte das Taschentuch ein: «Ich gebe es dir frisch gewaschen zurück.»
«OK – und wann?», fragte unser Held und die junge Frau überlegte kurz und meinte: «Übermorgen etwa um dieselbe Zeit könnte ich wieder hier sein.»
Gyula sagte, das sei hiermit abgemacht, dann unterhielten sie sich noch etwas über das Hündchen und gingen heim.
Das war das erste Mal, dass der junge Mann froh war über die aufgezwungenen Taschentücher. Er ging nach Hause, schnurstracks in die Küche, umarmte Piri Mama, gab ihr links und rechts einen dicken Kuss auf die Wange, bedankte sich für alles, was sie für ihn getan hatte und wirbelte sie herum wie im wildesten Rock’n‘Roll.
Sie schaute ihn etwas schräg von unten an, er war mittlerweile ein grosser Junge geworden, und fragte: «Was ist passiert?»
Ihr Zögling meinte: «Ach, nichts…»
Aber sie sagte: «Du musst es mir nicht erzählen, wenn du nicht willst. Aber du musst wissen, ich bin verschwiegen.»
Und tatsächlich, unser Freund hatte das Gefühl, es müsse raus, sonst zerreisse ihn das neuste Erlebnis. Nachdem er das Erlebte seiner Nanny geschildert hatte, meinte sie: «Muss ich von nun an für dich zwei Taschentücher bereithalten?»
«Neee», meinte Gyula und sie lachten ganz herzhaft über diesen Einfall.
Am übernächsten Tag konnte unser Freund kaum erwarten, mit seinem Hündchen spazieren zu gehen und sie gingen gerade zum besagten Schaufenster. Es dauerte nicht lange, da erschien das Mädchen und das Herz unseres Freundes machte einen Satz bis in die Kehle hinauf. Die junge Frau reichte ihm sein Taschentuch zurück und sie gingen ein Stück miteinander weiter. Dann nahm er sein Herz in beide Hände und fragte: «Wollen wir auch weiterhin zusammen spazieren gehen?»
Ganz spontan antwortete das Mädchen: «Ja, doch, warum nicht?»
Daraufhin stellte sich unser Held vor, er sei «Gyula, der Tutajos.»
Die junge Frau erwiderte, sie heisse «Palóc Sári.»
Auch wieder nach Hause schwebend entdeckte Gyula, dass sein soeben zurückerhaltenes Taschentuch nach dem Parfüm von Sári duftete. Er nahm seine mit Samt ausgelegte Holzschatulle, wo er seine kostbaren Münzen aufbewahrte und legte das Taschentuch hinein. Manchmal nahm er es hervor, öffnete es und genoss den Duft. Dann schloss er die Schatulle, damit der Duft noch lange erhalten bleibe.
Bei den anschliessenden gemeinsamen Spaziergängen mit dem Hündchen kam es zum ersten richtigen Kuss – das war der siebte Himmel für unseren Freund.
Es kamen die Winterferien und wie immer musste Gyula seine Sachen für seinen Aufenthalt auf dem Lande packen. Bisher war das immer eine freudige Sache, raus aus der Stadt, hinaus in die unendliche Landschaft. Der Bruder seiner Mutter war diplomierter Agronom und leitete eine dieser Genossenschaften, denen die Bauern nach dem zweiten Weltkrieg zwangsweise beitreten mussten. So nahm er den Jungen bei allen seinen Schulferien mit aus der Grossstadt, hinaus in die Wildnis. So entstanden die Sommerabenteuer mit dem Titel «Tüskevár» und die Wintergeschichten als «Téli berek».
Wie gesagt, bis jetzt war das für Gyula immer ein freudiges Ereignis. Doch diesmal schnürte etwas Unerklärliches die Kehle unseres jungen Freundes zu. Lustlos packte er seine Sachen, denn der Urlaub bei seinem Onkel war Programm, besser gesagt Tradition.
Der Onkel holte ihn zusammen mit seinem langjährigen Freund ab, und der Urlaub nahm seinen gewohnten Lauf, war dann doch wie immer spannend. Die Schneehasen zwischen den Sträuchern, dann das Eisfischen auf dem zugefrorenen See, die winterharten Vögel – all das war dennoch sehr faszinierend für unsere Freunde.
Dieser landwirtschaftliche Betrieb befand sich am Rande eines der grössten Reservate Ungarns, in der unmittelbaren Nähe des «Kisbalaton». Der berühmte Plattensee hat an seiner südwestlichen Umgebung einen Nebensee, den «Kleinplattensee»: ein Sumpfgebiet mit der entsprechend vielfältigen Vegetation und nebenbei ein Paradies für Ornithologen. Das Gebiet ist streng geschützt und für Besucher lediglich auf den dafür vorgesehenen Pfaden begehbar.
Für unseren Agronomen gab es am Rande dieser Zone natürlich genug Naturwunder, die er den Stadtkindern zeigen und erklären konnte und mit welchen er diese zu faszinieren vermochte – wie auch mich, den interessierten Leser: Wie das ist, wenn nach dem Schneefall keine Schneeschleuder kommt, sondern man die Schneeschaufel in die Hand nehmen muss, um den nötigsten Pfad freizuschaufeln. Wie das ist, wenn man nach Einbruch der Dämmerung nicht die Strassenlaternen vor den Augen hat, sondern den sternenklaren Himmel. Wie das anders ist, wenn an Stelle des Lehrers mit seinem Biologiebuch der Onkel den hungrigen Fuchs in der freien Natur aufspürt und zeigt. Wie das ist, wenn man das bisher Gelernte und darüber hinaus noch viel mehr in der freien Natur erleben kann.
Dann aber zurück in der Grossstadt – das Wiedersehen unseres Helden mit seiner Sári war umso aufregender. Er konnte ihr soooo viel erzählen und sie konnte soooo gespannt zuhören und dabei unseren jungen Helden anstrahlen.
Dieser Ausschnitt aus meinem Jugendbuch lässt in mir zwei Erinnerungen wach werden.
Im ersten Schuljahr meines Lebens, als auch Mädchen in der Klasse waren, mussten wir diese russischen Filme anschauen. Meine heimlich angebetete Klara sass einmal neben mir, unsere Hände fanden sich und es kam zum ersten zarten Kuss. Auf dem Heimweg stand ich im Bus auf der hinteren Plattform, es gab Fenster nach hinten, in welchen die Strasse hinter dem Bus entschwand. Ich hatte das Gefühl, die Plattform schwebe auf einer Wolke.
Später, daheim, schaute mich Mutter an und fragte ob etwas passiert sei?
«Nichts Wichtiges», meinte ich.
Doch sie bohrte weiter: «Ich spüre es!»
Es geht sie doch gar nichts an, dachte ich, wusste aber auch, es MUSS raus! So schilderte ich ihr das Geschehene. Irgendwie kehrte damit wieder eine Art Ruhe in mir ein.
An Mutters Gesicht machte sich ein mildes Lächeln breit, sie schaute wie in die Weite und sagte: «JA, so fängt es an …»
In diesem Frühjahr 1964 reisten meine Mutter, Mihály und Kati in die Schweiz, um die Verwandten zu besuchen. In den drei Wochen war ich bei der Cousine Anikó einquartiert. Ich hatte immer noch meine dünnen, blonden Haare. Grossmutter nervte immer wieder mit ihren drahtigen Haarklammern, die sie mir in die Haare steckte, damit ich diese nicht immer vor den Augen hatte. In dieser Zeit bei der Cousine veränderten sich meine Haare von einem Tag auf den anderen: Sie wurden dunkel, kräftiger und leicht gewellt.
Anikó nahm mir partout nicht ab, dass ich nicht beim Coiffeur war, die Haare zu färben und zu trimmen.
Die ungarische Küche
Seite 72
Seite 72 wird geladen
72.
Die ungarische Küche
Zahlreiche Bekannte und Freunde von uns bereisten bereits Ungarn oder nur Budapest – einerseits an Gruppenreisen, die wir organisierten oder ohne uns, aber der Tenor war fast ohne Ausnahme: Die ungarische Küche mundete ihnen allen besonders gut. Wir wurden auch des Öfteren darauf angesprochen, was diese Küche ausmachen würde? Hier einige Antworten:
Würzig: Um es vorweg zu nehmen: Die ungarische Küche ist entgegen landläufigen Meinungen alles andere als scharf. Sie ist lediglich reichlich gewürzt. Es werden Zwiebeln, Knoblauch, Pfeffer, Salz und Paprikapulver nebst anderen Gewürzen ausgiebig verwendet. Paprikapulver ist fast allgegenwärtig und ist in verschiedenen Abstufungen erhältlich: Edelsüsspaprika (édes-nemes), milder Paprika (különleges), Delikatesspaprika (csemege) und scharfer Paprika (csipös). Die edelsüsse Variante verwendet man um das Gericht zu färben, denn die meisten Kreationen sind farbig.
Sämig: Viele Rezepte enthalten Sauerrahm, welcher die Gerichte sämig macht. Es gibt einige köstliche Variationen mit Sauerkraut und allesamt werden diese mit reichlich Sauerrahm zubereitet, der dem Kraut die saure Bissigkeit nimmt. Auch beim Paprikahuhn wird über die obligate Beilage in Form von selber gemachten Knöpfli reichlich Sauerrahmsauce verteilt, natürlich mit edelsüssem Paprikapulver appetitlich rötlich eingefärbt.
Zeitraubend: In der ungarischen Küche wird oft sehr lange gedünstet. Viele Rezepte fangen damit an, Zwiebeln in etwas Fett oder Öl, immer wieder unter Beigabe von verdampfendem Wasser auf kleiner Flamme in etwa Dreiviertelstunden semmelfarbig zu dünsten. Dann fängt das eigentliche Kochen an, wie zum Beispiel beim Gulyás. Dabei werden Mocken von Muskelfleisch vom Rind, also Wade oder Nacken, in der Zwiebelsauce weitere zwei bis drei Stunden gedünstet. Will man Gulyássuppe kochen, so gibt man zum Gulyás etwa eine halbe Stunde, bevor es fertig wird, Wasser, fein geschnittene Kartoffelwürfel und Gemüse nach Gutdünken dazu. Doch woher kommen diese Namen? Gulya ist die Rinderherde, die vom Gulyás, dem Rinderhirten betreut wird. Die Herde grast friedlich auf den unendlichen Weiden und zieht weiter, wenn das Gebiet abgegrast ist. Der Gulyás hat zwei Gehilfen, zwei «Bodri kutya», zwei ungarische Langhaar-Hirtenhunde, die links und rechts neben der Herde aufpassen, damit kein Tier auf die Idee kommt, davonzulaufen.
Trudy und ich, wir beide haben Gemüsesuppe sehr gern. Wenn die Gemüsewürfel frisch oder aus dem Tiefkühler gekocht werden, dampft die feine Suppe nach einer Viertelstunde bereits auf dem Tisch – wenn Trudy diese nach gut Schweizer Art zubereitet. Kocht sie diese nach ungarischer Art, so braucht sie mindestens Dreiviertelstunden, denn die Gemüsestücke werden gedünstet. Beide Suppen sind lecker, aber im Geschmack nicht vergleichbar. So viel macht das Dünsten aus.
Beliebt sind auch reichhaltige Suppen mit Fleisch und Gemüse drin, sowie Eintopfgerichte.
Ein Tipp: Der Herr Google kennt die meisten Gerichte aus Ungarn. Diese kann man in unzähligen Versionen abrufen, natürlich auch auf Deutsch. Aber Achtung! Einige dieser Rezepte neigen zur masslosen Übertreibung. Zum Beispiel wenn es heisst, zum ungarischen Gulyás nehme man gleich viel Zwiebeln wie Fleisch, dann ist Vorsicht geboten. In Wirklichkeit reicht ein Viertel bis ein Drittel Zwiebeln.
Im Zweifelsfalle bitte Trudy anfragen, sie hat sich nebst ihrer internationalen Küche auch in die ungarische Hauskost vertieft, und dies nicht allein bei meinen Eltern, sondern auch bei Verwandten in Ungarn. Als ich ganzwöchige Seminare besuchte oder später bei solchen mitwirkte, ging sie alleine zu den Verwandten mit dem Ziel, ungarisch zu lernen, denn sie wollte bei unseren Aufenthalten nicht nur mittels Übersetzungen teilhaben.
Und wo lernt man als Erwachsene am besten eine Fremdsprache? Erraten: in der Küche.
Unsere Familie
Seite 73
Seite 73 wird geladen
73.
Unsere Familie
Als wir in die Schweiz kamen, waren wir eine vierköpfige Familie. Mittlerweile zählt der engste Familienkreis 16 Personen …
Meine zweite Schwester kam zur Welt, dann gesellten sich Schwiegertochter und Schwiegersöhne dazu sowie mit der Zeit vier Enkelkinder. Auch diese wurden erwachsen und unsere Eltern wären heute bereits Urgrosseltern. Sie starben jedoch zu früh, Mihály wurde 65 Jahre alt und unsere Mutter ebenso. Immerhin erlebten sie das erste Enkelkind.

Unsere Mutter bei ihrer Pensionierung
Mihály konnte sich mit uns auch noch über unsere Diplome freuen und über unsere Heirat sowie unsere «Baustelle» in Zeiningen. Es gefiel ihm, dass wir uns in unseren Träumen und Vorstellungen nicht einschränkten, sondern stattdessen eine Art Rohbau bezogen und uns anfänglich mit provisorischen Einrichtungen begnügten. Das Wichtigste war da, eine Waschküche mit Dusche, eine bereits ausgediente, aber funktionierende Küche und auch der riesige Kachelofen, worin wir bei Familienfesten sogar ganze Ferkel goldbraun braten konnten.
Es war noch möglich, Mihálys letzten Wunsch zu erfüllen, und so ging die ganze Familie vereint auf eine Ungarnreise, wobei wir die Verwandten besuchten. Er schaffte es noch einigermassen gut wieder nach Hause zu kommen, doch dann ging es schnell bergab. Aber am letzten Abend im Spital war er ganz munter, erkundigte sich, ob wir alle Einzahlungen getätigt hätten – er hätte diese auch machen können …
Eine leise Hoffnung kam in uns auf, doch in der darauffolgenden Nacht bekam unsere Mutter die letzte Meldung aus dem Spital. Sie rief uns an, sie hätte nicht die Kraft, dies den Kindern zu sagen. Wir kamen nach Bottmingen, Kati war schon da, Georgina wohnte noch bei ihr. Ich nahm meine Schwestern zur Seite und brachte auch nur heraus: «Ihr könnt nicht mehr davon ausgehen, euren Vater noch lebend anzutreffen.» Sie starrten mich nur mit grossen Augen an, für Tränen war der Schock zu gross. Nachdem wir uns von Mihály verabschiedet hatten, sagte Kati: «Mich kann von jetzt an nichts mehr erschüttern.» Gottlob wurde sie, was ihre Kinder betrifft, diesbezüglich nicht auf die Probe gestellt.
Zu Hause bei den Eltern redeten wir untereinander ungarisch. Meine Schwestern lernten Deutsch auf der Strasse, bei Nachbarn und in der Schule und reden so wie jeder Einheimische. Aber unsere Generation kann immer noch ungarisch, was wir auch pflegen, wenn wir untereinander sind. Kommt jedoch ein Thema auf, das wir erst später oder ausserhalb der Familie kennenlernten, fallen wir unmerklich ins Deutsche. Bei mir ist es so eine Sache. Bereits im Militärdienst, dann aber auch im Oldtimer Club wurde mir die Frage gestellt: «Gell, du bist ein Bündner?» Kürzlich in einem Möbelgeschäft sagte ich einen Satz zu der Verkäuferin und sie fragte: «Höre ich richtig, kommen Sie aus Ungarn?» Sie erklärte dann, dass sie als ehemalige Musiklehrerin die Sprachmelodie erkannt hätte. Die nachfolgende Generation, also die Söhne und die Tochter meiner Schwestern, redet bereits kein Ungarisch mehr.
Für unsere Mutter war Heiligabend, also der 24. Dezember wirklich heilig, aber nur dann, wenn sie alle ihre Küken um sich hatte. So kam die Familie am Heiligabend stets vollzählig zusammen und unsere Mutter lud auch immer eine weitläufig verwandte alleinstehende Tante ein oder aber Sanyi, ihren ebenfalls alleinstehenden Onkel. Der Christbaum wurde üppig geschmückt, darunter unzählige Geschenke. Das traditionelle Nachtessen war eher bescheiden: Schinken mit Kartoffelsalat auf ungarische Art. Dazu rührte Mihály mit Engelsgeduld Eier und tröpfelte das feine Öl dazu, bis eine schöne Mayonnaise entstand. Zur Auflockerung kam Sauerrahm dazu und mit dieser Sauce wurden die gekochten Kartoffeln scheibenweise geschichtet.
Trudy hat zwei ältere Schwestern, aber als ihr Vater ernsthaft krank wurde, hatte er in jeder Hinsicht die Geschicke der Mutter Trudy anvertraut. An seinem Sterbebett wachten abwechselnd ihre Mutter, ihre Schwestern und sie. Er konnte gehen, als Trudy an seinem Bett stand. Sie spürte in dieser lauen Septembernacht eine unglaubliche Ruhe und hätte anschliessend bis ans Ende der Welt fahren können.
Unsere Mutter sagte zu Trudy, für sie sei das selbstverständlich. Sie sei überzeugt, dass Sterbende die Kraft und die Macht hätten zu entscheiden, wem sie den Moment des endgültigen Abschieds zumuten wollen.
Sie selber wurde Opfer einer kurzen, jedoch äusserst aggressiv verlaufenden Krankheit und musste ihre letzten Weihnachten bereits im Spital verbringen. So traf sich die ganze Familie am Heiligabend bei Kati.
Dann ging es ganz schnell. Nach Weihnachten wachten wir abwechselnd an Mutters Bett, wir, ihre Kinder, dann ihre Zwillingsschwester, aber auch Schwiegersöhne. In der Nacht vom 1. auf den 2. Januar ergab es sich, dass Trudy und ich die Nacht gemeinsam bei ihr verbringen konnten. Es war eine sonderbare Nacht. Draussen tobte ein Föhnsturm, aber im Spitalzimmer lag eine merkwürdige Ruhe. Trudy und ich unterhielten uns mit gedämpfter Stimme über unsere Alltagssörgeli und über Mutters Gesicht breitete sich eine entspannte Ruhe aus – und sie konnte loslassen.
Nach einem kurzen Gebet rief ich meine Schwestern an, damit sie noch Gelegenheit hatten, Abschied zu nehmen. Unterdessen legte sich der Sturm und anschliessend standen wir vor dem Spital in dieser fast schon milden Januarnacht. Unter anderem beschlossen wir, dass wir Weihnachten in ihrem Sinne in einem Turnus weiterführen wollen. Das tun wir heute noch und die erfrischende Erweiterung ist, dass eine Schwiegertochter, die Frau von Marco sich auch einbringen wollte und den nächsten Heiligabend bei sich organisiert.
Diese Weihnachten, diese Heiligabende verlaufen immer noch weitgehend so wie damals bei den Eltern. Der Weihnachtsbaum ist üppig geschmückt, vor allem bei Kati haargenau so wie früher, selbst die uralte silberne Spitze darf bei ihr nicht fehlen. Mit den Geschenken haben wir uns einschränken müssen. Erwachsene können nicht mehr jedem etwas schenken, dies bleibt den Kindern vorbehalten. Wir wichteln, das heisst, jedem wird ein anderes Familienmitglied zugelost, das dann etwas erhält. Eine weitere Abweichung hat sich dadurch ergeben, dass nebst dem ungarischen Kartoffelsalat auch einer auf schweizerische Art zubereitet wird.
Erfreulich ist, dass an diesen Weihnachtsabenden die gesamte Familie zusammenkommt, das bleibt einfach Tradition. Was hingegen noch erfreulicher ist, dass dies auch der Fall ist, wenn jemand von uns spontan zum Osterbrunch, «Santichlausabend» oder zu einer Grillparty einlädt. Auch dann kommt nach Möglichkeit die ganze Familie zusammen, «freiwillig» vom Jüngsten bis zu den Ältesten.
Unsere Eltern und Vorfahren können beruhigt sein: Wir sind eine intakte Familie geblieben.
Heimweh
Seite 74
Seite 74 wird geladen
74.
Heimweh
Heimweh muss etwas ganz Schlimmes sein, wie der Name schon sagt, muss es wehtun. Es erfasste auch einige Ungarn, nachdem sie anlässlich des Volksaufstandes ins westliche Ausland geflüchtet waren. Die nach dem Aufstand in Ungarn gebildete, liberal eingestellte Regierung erkannte dies und reagierte entsprechend. Das Gesetz, welches das illegale Verlassen des Landes schwer ahndete, wurde mit einer Ausnahmeregelung ergänzt:
Die anlässlich des Volksaufstandes Geflüchteten erhielten diesbezüglich Amnestie. Die vor dem Aufstand verhängten politisch basierenden Strafen wurden gelöscht. Somit war den Heimwehgeplagten wieder Tür und Tor geöffnet, was diese auch gerne und mit Erleichterung entgegennahmen.
In meinem Fall war es so, dass ich, wenn man «das Kind beim Namen nennen» wollte, regelrecht verschleppt wurde. Ich reagierte entsprechend zuerst mit Groll, anschliessend mit einer Art Apathie. Dann wurden meine Augen Richtung Zukunft geöffnet und ich konzentrierte mich voll darauf, was ich hier in der Schweiz aus mir machen könnte. Solchermassen beschäftigt, gab es einfach keinen Platz für Heimweh. Als sich der Weg nach einigen Umwegen definitiv abzeichnete, war ich damit beschäftigt, diesen auch zu beschreiten.
Im Nu war die Zeit gekommen, als ich mich auf meine baldige Einbürgerung freuen konnte, was gleichzeitig bedeutete, dass ich uneingeschränkt zum Verwandtenbesuch nach Ungarn reisen konnte.
Die geltende Praxis war, dass Flüchtlinge ihren Sonderstatus verloren, wenn sie ihre Heimat besuchten, was einer gewissen Logik nicht entbehrt. Allerdings gab es auch Härtefälle, wie auch bei meinem Freund Bence: Kurz vor seiner Einbürgerung starb seine Mutter und er hatte das Gefühl, er müsste bei ihrer Beerdigung unbedingt dabei sein – koste es, was es wolle. Er vernahm einen «todsicheren Weg», dies zu bewerkstelligen, ohne den Flüchtlingsstatus zu verlieren. Er flog also nach München, wo er irgendwelche provisorischen Papiere besorgen konnte. Aufgrund derer bekam er am ungarischen Konsulat ein Schnellvisum für einen Kurzaufenthalt. So konnte er bei der Beerdigung seiner Mutter dabei sein und noch ein paar Tage mit der Verwandtschaft verbringen. Anschliessend flog er wieder nach München, wo er seine provisorischen Papiere entsorgte. Mit seinem unberührten Schweizer Reisepass kam er heim.
Einige Tage später wurde er von der Fremdenpolizei vorgeladen. Es gab nichts anderes als beichten. Wegen seines Motivs liess man Milde walten und die Strafe hiess lediglich, sein Einbürgerungsverfahren für drei Jahre zu sistieren.
Man muss wissen, die Schweiz wurde nicht nur Zentrale der internationalen Diplomatie, sondern auch Angelpunkt der ebenfalls internationalen Spionage. Es war also kein Wunder, dass die Behörden über alle, auch nur annähernd auffallende Menschen alles wissen wollten.
Meine erleichterte Einbürgerung ging über die Bühne und damit war ich nun ein wahrlich freier Mensch. Ich konnte überall hin, auch nach Ungarn. Die Einbürgerung meiner Eltern war noch nicht soweit, so reiste ich das erste Mal mit Rita in meine ursprüngliche Heimat. Mein erstes Ziel war mein Geburtsort Sárvár, wo meine Cousine wohnte. Der Weg führte über Graz und den kleinen Grenzübergang Heiligenkreuz.
Damals hatten die Österreicher selbst die Ausreise kontrolliert. Wir reichten dem Grenzbeamten unsere frisch ausgestellten Papiere, er untersuchte diese lange und erlaubte sich einen garstigen Streich: «Ihr Reisepass ist ungültig», sagte er zu Rita und reichte ihr den Schweizerpass, den sie erst für diese Reise hatte ausstellen lassen, denn bisher reiste sie mit ihrer Identitätskarte.
Genauso erstaunt wie erschrocken fragte sie: «Wieso?»
Mit eiserner Miene antwortete er: «Ihr Reisepass ist noch ungültig, weil sie diesen noch nicht unterschrieben haben», und reichte ihr seinen Kugelschreiber.
Nach diesem kurzen Schrecken kam die ungarische Grenzkontrolle. Der Beamte schaute unsere Papiere flüchtig an und fragte, was wir dabeihätten. Ich antwortete ihm, es seien Reiseutensilien und einige Geschenke für die Verwandten. Daraufhin tippte er andeutungsweise an seine Schirmmütze und wünschte gute Fahrt sowie einen angenehmen Aufenthalt.
Ich konnte fahren – wirklich?
JA, doch! Vor Aufregung würgte ich den Motor fast ab. Ich vermag das Gefühl nicht zu beschreiben, die ungarische Grenze nach über zehn Jahren wieder in umgekehrter Richtung zu passieren. Bei den ersten Kilometern war ich in einer Art Schwebezustand. Dann hatte ich mich allmählich gefasst und genoss die hügelige Landschaft Westungarns. Es war ein grosses Wiedersehen mit den Verwandten in Sárvár, anschliessend ging es weiter nach Budapest.
Der Weg führte via Székesfehérvár zum Balaton, wo man die Autobahn nach Budapest unter die Räder nahm. Vor Budapest traf sich diese Autobahn mit derjenigen aus Richtung Wien. Eingangs Budapest gab es die üblichen Stockungen, doch dann am «Hegyalja» waren wir auf einer Anhöhe, auf welcher sich ein atemberaubendes Panorama der Stadt präsentierte: Linker Hand erstreckte sich das Burgviertel. Direkt vor uns lag die Erzsébethid, die Elisabethenbrücke, auf der wir in die City gelangten. Aber das Panoramabild umfasste auch ein grosses Stück der Donau mit den historischen Brücken bis hin zur Margitsziget, die Margaretheninsel mitten in der Donau, die Kettenbrücke, das Parlamentsgebäude – Wahrzeichen der Stadt.
Als sich mir dieser Anblick offenbarte, blieb mir der Atem weg.
Heute noch wähle ich diese Route mit Vorliebe und nehme die Stockungen in Kauf – dieser Anblick entschädigt alles.
Wenige Jahre später wurden auch unsere Eltern und damit Kati eingebürgert. Mihály getraute sich noch nicht, so fuhr ich mit Rita und meiner Mutter, die Verwandten und das Land zu besuchen.
Doch dann im Oktober 1980, als ich in Lörrach mein G-Modell endlich abholen konnte und beschloss, das Einfahren der Gesamtmechanik in Form einer Ungarnreise zu absolvieren, war Mihály endlich soweit und verkündete, er käme auch mit. Na wunderbar, so fuhren meine Mutter, Mihály und ich nach Ungarn, wo meine Mutter am 1. November die Gräber ihrer Vorfahren in Sárvár besuchen konnte.
Bei der anschliessenden Fahrt nach Budapest konnte ich nebst den Annehmlichkeiten auch die ersten Eigenheiten des 4x4-Fahrens kennenlernen. Bevor wir losfuhren, kam der erste grosse Schneefall. Vor uns lagen ca. 100 km Landstrasse und etwa gleichviel Autobahnfahrt. Es windete auch recht stark und auf der Landstrasse zog ich einige, in den Schneeverwehungen steckengebliebene Fahrzeuge wieder auf die Strasse. Dann passierte dies: Ich warf das Abschleppseil dem Fahrer eines gestrandeten Zastava, dem in Polen gebauten FIAT 600, zu. Er befestigte dieses an der Stossstange, ich zog das Fahrzeug raus und beim Abnabeln merkte der Fahrer, dass dabei die dünne Stossstange verbogen worden war und fing an zu toben, ich hätte sein Auto kaputt gemacht. «Wie bitte …?», fragte ich erstaunt und hörte mit diesen Manövern endgültig auf, denn schliesslich mussten wir auch einmal in Budapest ankommen.
Auf der Autobahn war vorerst nur die rechte Spur geräumt und auf dieser standen die Autos kreuz und quer. Ich nahm die linke, freie Spur mit mittlerweile ca. 30 cm Schnee darauf unter die Räder, und so gelangten wir endlich nach Budapest. Dort blieben wir ausgerechnet mitten auf der grössten Kreuzung der Stadt, also mitten im achteckigen «Oktogon» stehen. Der Motor machte keinen Mucks mehr. Bis anhin hatte ich nicht auf die Benzinuhr geschaut, denn in Sárvár, wie bei jedem Etappenhalt hatte ich vollgetankt. Doch der Tank war leer. Nun ja, das war eben der Preis der uneingeschränkten Souveränität …
Nun muss ich zurück zu unserem ursprünglichen Thema «Heimweh».
Ich musste einmal erfahren, dass Heimweh und Nostalgie etwas Ähnliches, vielleicht sogar dasselbe sind: Deutsche Schlager und Hüttenmusik sind überhaupt nicht meine Welt, doch es gibt eine Ausnahme. Als Peter Gabriel mit seiner «Du entschuldige i kenn di» in die Musiksender kam, erfasste mich etwas noch nie Dagewesenes. Der Text und vor allem der Refrain faszinierten mich:
Wann i oft a bissl ins Narrnkastl schau‘,
dann siech i a Madl mit Aug‘n so blau,
a Blau des laßt si‘ mit gar nix anderm vergleich‘n.
Sie war in der Schul‘ der erklärte Schwarm,
von mir und von all meine Freund‘, doch dann,
am letzten Schultag da stellte das Leben seine Weich‘n.
Wir hab‘n uns sofort aus die Aug‘n verlor‘n,
i hab mi oft g‘fragt, was is aus ihr word‘n.
Die Wege, die wir beide ‘gangen sind,
war‘n net die gleichen.
Und vorgestern sitz i in ein‘m Lokal,
i schau in zwa Aug‘n und waß auf einmal,
es is dieses Blau, des laßt si mit gar nix vergleich‘n.
Du entschuldige i kenn di,
bist du net die Klane,
die i schon als Bua gern g‘habt hab.
Die mit dreizehn schon kokett war,
mehr als was erlaubt war,
und die enge Jeans ang‘habt hat.
I hab Nächte lang net g‘schlaf‘n,
nur weil du im Schulhof
einmal mit die Aug‘n zwinkert hast.
Komm wir streichen fünfzehn Jahr‘,
hol‘n jetzt alles nach,
als ob dazwischen einfach nix war.
Sie schaut mi a halbe Minuten lang an,
sie schaut, dass i gar nix mehr sag‘n kann,
i sitz wie gelähmt gegenüber, und kann‘s gar net fass‘n.
I hör‘ ka Musik mehr und wart‘ nur drauf,
dass sie endlich sagt, du jetzt wach i auf,
der Peter, der zehn Häuser weiterg‘wohnt hat in der Gass‘n.
Sie zwinkert mir zu wie vor fünfzehn Jahr,
sie sagt „Na wie geht‘s da, mei Peterl na klar,
du hast a schon sehr lang nix mehr von dir hör‘n lass‘n.“
I nick‘ nur ja sehr lang ja viel zu lang,
sie meint komm probier‘n wir‘s halt jetzt miteinand‘.
Und später sag i lachend no‘ einmal zu ihr auf der Strass‘n.
Du entschuldige i kenn di, ...
Jedes Mal, wenn ich dieses Lied höre, komme ich nicht umhin, mir vorzustellen: Ich sitze an einem dieser langen Tische im «Brune Mutz» in Basel am «Barfi», wo die Leute absitzen, so wie sie kommen und gehen und plötzlich schaue ich in zwei Augen, die ich kenne … von Klara, von Ilona oder von Julcsi. Dann spüre ich richtig, wie es war, als sie mich im Schulhof angezwinkert hatten und ich halbe Nächte nicht schlafen konnte.
Dann hört das Lied auf und ich habe zu realisieren, dass ich weit weg vom Schulhof bin, selbst auch vom «Brune Mutz». Wieso muss einen die Realität immer einholen …?
1989 – die Öffnung
Seite 75
Seite 75 wird geladen
75.
1989 – die Öffnung
Immer mehr sowjetische Machthaber strebten eine Art Öffnung der sozialistisch/kommunistischen Isolation an. Glasnost und Perestroika waren die Schlagwörter. Die Zeichen waren gesetzt und Ungarn bewies wieder einmal Mut und öffnete im Mai die Grenzen nach Österreich für tschechische und später für ostdeutsche Flüchtlinge. Daraufhin brach das System gänzlich zusammen. Krönung war der Fall der Berliner Mauer im November – es folgte die Wiedervereinigung Deutschlands.
Über diese in Ungarn ausgelöste Entwicklung ist am ehrwürdigen alten Reichstagsgebäude in Berlin, an prominenter Stelle auf die Strasse gerichtet, eine bronzene Gedenktafel angebracht.

In den Staaten des Warschauer Paktes wurde die Planwirtschaft durch die Marktwirtschaft abgelöst. Dieser Schritt traf so manchen Arbeitnehmer zuerst einmal schwer.
Zwei Beispiele aus dieser Zeit bleiben mir in Erinnerung.
PEPSI: Der Mann meiner Cousine in Sárvár war der technische Leiter einer PEPSI-Cola Abfüllerei. Der Betrieb versorgte halb Westungarn mit Getränken und hatte hierzu 12 Kleinlaster, um die Verkaufsstellen zu beliefern. Für diese Aufgabe waren mit den nötigen Ablösungen auch etwa 50 Personen angestellt, denn ein Gesetz besagte, dass Fahrer weder be- noch entladen durften, dafür gab es Begleitpersonal. Bei den Anlieferungen putzten die Fahrer ihre Fahrzeuge oder nahmen kleinere Reparaturen vor.
Beim Wechsel zur Marktwirtschaft wurden die 12 veralteten Kleinlaster ausgemustert und ein 40-Tönner mit Gabelstapler und hydraulischer Plattform angeschafft. Die Gesamtverteilung übernahmen drei Fahrer, die über den erforderlichen Führerschein verfügten und alles erledigten: beladen, fahren und entladen. Der Mann meiner Cousine musste also alleine in dieser Sparte gegen 50 Mitarbeiter entlassen. Das belastete ihn in dieser Kleinstadt sehr und auch die Reifen seines Autos wurden mehr als einmal aufgeschlitzt …
UNICUM: Das ist ein weltbekannter Magenbitter aus Ungarn, wie der Appenzeller in der Schweiz, nur viel stärker mit seinen 40 Volumenprozenten Alkohol. Jawohl, die charakteristische runde Flasche sahen wir selbst in Australien in einem Pub auf dem Regal stehen.
Der Gründung des traditionsreichen Zwack-Betriebes geht eine Legende voraus. Der Hofarzt des Kaisers Franz Josef II., namens Zwack, reichte ihm diesen Kräuterextrakt mit Alkohol als Medizin. Als der Kaiser diesen nahm, soll er spontan mit voller Begeisterung gerufen haben: «Das ist ein UNICUM!» Daraufhin begann die Familie Zwack das Getränk ab 1790 im Familienbetrieb zu produzieren. Als die Nachfrage die Produktionskapazitäten des Familienbetriebes überstieg, wurde von József Max Zwack1840 in Budapest eine grosse Spirituosenfabrik eröffnet. Als Folge des Regimewechsels nach dem Zweiten Weltkrieg musste die Familie Zwack in den Westen flüchten und der Betrieb wurde verstaatlicht.
Nach der Öffnung und dem Systemwechsel 1989 gab man diese verstaatlichten Betriebe, sofern dies noch möglich war, den ursprünglichen Eigentümern wieder zurück. So bekam auch der alte Herr Zwack seine Schnapsfabrik zurück.
Ich war zufällig in Ungarn, als die Übergabe im Rahmen einer Fernsehreportage stattfand. Herr Zwack schritt durch die Produktionshallen seines ehemaligen Betriebes. Diese waren heruntergekommen, mit verstaubten und zerbrochenen Fenstern sowie uralten Maschinen in einer eher engen, dunklen Umgebung. Da wurde er vom Fernsehreporter gefragt, ob es ihn nicht traurig stimmen würde, seinen ehemaligen Betrieb in diesem Zustand wiederzufinden. Doch der alte Herr Zwack erwiderte: «Nein, die Zeit vergeht. Wissen Sie, ich bin ein Unternehmer und investiere gerne. Ich sehe bereits die hellen Produktionshallen mit grösseren Fenstern, modernen Maschinen und mit den Mitarbeitern, die nicht mehr schwer schleppen, sondern nur noch Maschinen bedienen müssen. Was mich aber sehr, sehr traurig stimmt ist der Umstand, dass ich von den momentan 5‘000 Mitarbeitern mindestens 3‘000 werde entlassen müssen.»
JA, so ändern sich die systembedingten Bedürfnisse. Das Interessante ist, dass durch diesen Systemwechsel in Ungarn keine Arbeitslosigkeit entstanden ist, im Gegenteil, denn heute schliessen Betriebe wegen Mangel an Arbeitskräften.
Find a girl, settle down …
Seite 76
Seite 76 wird geladen
76.
Find a girl, settle down …
Cat Stevens lancierte 1970 den ergreifenden Song «Father And Son» mit der Empfehlung des Vaters an seinen Sohn: «Find a girl, settle down».
Heute, mehr als 40 Jahre zurückblickend und fast so vielen Jahren Ehe kann ich beruhigt behaupten, ich hätte die Empfehlung befolgt und das Girl gefunden. Wir hatten nach dem gemeinsam erarbeiteten Staatsdiplom zusammen ein durch und durch verspieltes Haus gebaut, das wir in etwa zwanzig Jahren Eigenarbeit ausgebaut hatten. Mit Treppen überall, und sei es auch nur als Raumteiler. Mit einer reinen Holzheizung, was jeweils im Frühling 10 bis 12 Ster Holz aus dem Wald zu holen, zu verarbeiten und für die Trocknungszeit zwei Winter zu stapeln bedeutete. Das hatte Spass gemacht, raus aus dem Büro, rein in den Wald. Es war sehr viel Arbeit neben dem stressigen Bürojob, doch all das brachte uns eine willkommene Abwechslung. Dies alles hatten unsere Eltern zum Glück noch erlebt und sich mit uns darüber freuen können.
Dann konnten wir nach 21 Jahren dieses Haus gut verkaufen und an einem neuen Ort nach allen Geboten des Älterwerdens ein neues Heim entwerfen und bauen lassen, unser aktuelles – altersgerecht, mit öffentlichen Verkehrsmitteln bestens erschlossen und mit einer Zentralheizung, die nicht mehr holzbasiert ist. Dennoch wollten wir auf einen Kachelofen und integrierten Holzherd nicht verzichten, doch diese anzufeuern ist heute nur noch optional.
Allerdings ist in unserem zusammenhängenden Bereich Stube, Küche, Essecke die Heizung ganz hinunterreguliert. Wenn die kalten Winde kommen und es sich drinnen feuchtkalt anfühlt, verbrennen wir am Morgen im Herd ein, zwei Ladungen Holz und der Raum füllt sich mit molliger Wärme. Auf dem Herd kann man auch seinen Morgentee zubereiten.
Seit unserer Pensionierung ist es in den Wintermonaten, sofern wir zu Hause sind, tägliches Ritual, nachmittags im Kachelofen ein schönes Feuer anzuzünden und bei einem Apéro durch das grosse Glasfenster des Ofens zu bewundern wie sich das Feuer entfaltet. Je nach Wetterlage geschieht dies schneller oder zögerlicher. Keine Fernsehsendung kann spannender sein.
Ich schätze, Cat Stevens kann sich über mich nicht beklagen …
Schweizer – Land – Leute
Seite 77
Seite 77 wird geladen
77.
Schweizer – Land – Leute
Wie erlebe ich die Schweiz, die Schweizerinnen und Schweizer?
Dass ich das Land faszinierend schön empfinde, ist nicht verwunderlich. Mein Spruch dazu ist, dass ich alle Touristen verstehe, die um die halbe Welt fliegen, um dieses Land wenigstens nur schnell zu erleben. Und wir leben dauerhaft hier.
Eines Tages musste ich in der Mittagspause am Marktplatz etwas erledigen. Soeben fertig geworden, fuhr mir das Tram vor der Nase weg. Zuerst ärgerte ich mich, dann kam ich aber zur Erkenntnis: Ich stehe da, direkt vor dem Rathaus. Um dieses zu bewundern, kommen Leute aus der halben Welt und ich, statt mich sattzusehen, ärgere mich. «Bist du denn noch zu retten?», fragte ich mich und die Antwort war: «doch, doch!» Seither, wenn ich warten muss, bewundere ich die aufregenden Städtebauten oder die beschaulichen Landschaften und bin dankbar dafür, dass ich hier sein kann. Ich hätte genauso gut in irgendwelchen Slums oder in Ghettos auf die Welt kommen können. Aber nein, ich hatte das Glück, im schönen Ungarn zur Welt zu kommen, und die Schweiz ist ein Supplement, das ich geniessen darf. Und das tue ich auch, ob Stadt, Land oder Gebirge.
Die Eingeborenen des Landes verstehe ich in einer Hinsicht nicht ganz. Diese könnten, müssten meines Erachtens unendlich stolz auf ihr Land sein. Aber nein, sie üben sich in übertriebener Bescheidenheit und Zurückhaltung. OK, es waren ihre Vorfahren, die dieses Paradies erschufen. Die Nation hatte viel und hart für seine Unabhängigkeit kämpfen müssen, damit aber Jahrhunderte der Ruhe und Stabilität erreicht. Ein kleines Land ohne jegliche Bodenschätze mit zu wenig Agrarland und zu vielen unbebaubaren Bergregionen so reich und stabil zu machen, brauchte eine kluge Strategie, Besonnenheit und Offenheit für das Neue.
Als die gebildeten Hugenotten Frankreichs sich für die Reformation bekannten, schmiss sie ihr Sonnenkönig Ludwig XIV. hinaus, denn er duldete nur den Katholizismus. Sie fanden ihre neue Heimat teilweise in Basel. Sie wurden freudig empfangen, gründeten und bauten die Basler Chemische Industrie auf.
Dann die Erkenntnis, dass die Schweiz als rohstoffarmes Land teure Erzeugnisse mit wenig Rohstoff produzieren muss, war auch ein Volltreffer. Also hochpräzise, kaum bezahlbare, aber auf der ganzen Welt begehrte Uhren und teure feinmechanische Maschinen.
Drittens das diplomatische Geschick. Dass Genf lange Zeit als Drehscheibe der Weltdiplomatie galt und heute noch gilt, brauche ich hier nicht extra zu erwähnen.
Als ehemaliger Bankangestellter liegt es nicht an mir, den Dienstleistungssektor zu rühmen …
Wir erlebten auch noch ein anderes, eindrückliches Phänomen: In unserer wilden, mit vielen Überstunden bewältigten beruflichen Tätigkeit hatten Trudy und ich uns diese Stunden nie auszahlen lassen, sondern die dem Beruf geopferten Zeiten immer als Freizeit zurückgewonnen. So konnten wir nebst ausgedehnten Winterferien jeweils auch im Herbst grosse Reisen unternehmen. Dabei gab es eine Zeit, wo wir exotische Inseln anpeilten. Diese hatten oft bescheidene Flughäfen, auf denen aber die grössten Jumbos landeten. Diese wendeten auch mal über unseren Köpfen, wenn der Warteraum im Freien eingerichtet war. Über den Gates für Gepäck und Passkontrolle hing oft auch die Tafel für «CD und CH», wo wir dann gar nicht warten mussten. Also die Schweiz wurde mit Diplomatie gleichgestellt und dafür geschätzt.
Aber auch daheim in Europa war es so, wo wir einige Gruppenreisen organisierten. Kaum hatten wir erwähnt, dass wir mit einer Gruppe Schweizer kämen, war sofort für alles Tür und Tor offen.
Als wir einmal mit einer Gruppe Clubkollegen nach Ungarn reisten, war noch Theatersaison. Im Opernhaus von Budapest war für diese Zeit «La Traviata» angesagt. Im Onlineportal hiess es «Eintrittskarten nicht verfügbar». Auf Trudys Ermunterung hin rief ich an und vernahm, die Karten würden erst drei Monate vor der Vorstellung freigeschaltet. Aber für Gruppen hätte es ein eigenes Büro, bei welchem es keine Beschränkungen gäbe. Dort rief ich an und bestellte die Reihe Eintrittskarten im ersten Rang. Als ich bei meinem nächsten Verwandtenbesuch diese abholen ging, erörterte mir die zuständige Dame, dass sie für unsere Schweizer Gäste gleich zwei Reihen Karten zur freien Wahl reserviert hätte: eine in der ersten Reihe Mitte Parkett, aber auch eine in der ersten Reihe der ebenfalls begehrten seitlichen Logenplätze.
Also meine lieben Schweizerinnen und Schweizer: Kopf hoch!
Daheim sein
Seite 78
Seite 78 wird geladen
78.
Daheim sein
Ich half im Oldtimerclub meinen Clubkollegen, ihre alten Autos in Ungarn restaurieren zu lassen. Mailverkehr und Telefonate wickelte ich ab. Da ich die ungarische Sprache gepflegt und dadurch nicht verloren hatte, konnte ich in der Folge mein Ungarisch noch weiter vertiefen. Einige Male mussten wir auch hingehen, um heikle Dinge zu klären oder Ersatzteile zu bringen. Da wir alle noch arbeitstätig waren, bot sich dazu der Autoreisezug von Feldkirch nach Wien an – ein Nachtzug mit Schlafwagen und unser Auto konnten wir auch noch mitnehmen. Wir mussten nur einen Tag freinehmen, da wir erst am Donnerstagabend nach Feldkirch fahren mussten. Zwischen Ankunft in Feldkirch, Autoverlad und Abfahrt blieb genügend Zeit, im Bahnhofbuffet ein herrlich schmeckendes Wienerschnitzel zu geniessen.
Der Zug kam am Freitagmorgen in Wien an und am Mittag waren wir schon bei den Fachleuten. Es blieb also bis Samstagnachmittag genügend Zeit, um alle Fragen zu klären. Am Abend waren wir gewöhnlich bei einem der Beteiligten zu einer ungarischen Spezialität eingeladen, beim Spengler, Lackierer oder Mechaniker oder bei unserer «Puffmutter». Sie unterhielt zwei Dörfer weiter eine Privatpension und beherbergte vorwiegend Arbeiter, die lediglich für begrenzte Zeit in der Gegend tätig waren. Diese gingen oft fürs Wochenende heim, so hatte sie Platz für uns – eine herzensgute Seele, die uns gerne auch mit ihren Spezialitäten bewirtete.
Einmal verbrachten wir einen besonderen Tag bei ihr. Wir hatten ausnahmsweise genügend Zeit, mussten auch auf etwas warten, so schalteten wir einen freien Tag ein. Nach dem Frühstück gab es nicht Aufbruch, sondern Umschauen im Dorf, den Garten bewundern, faulenzen und das ländliche Leben erkundschaften. Mitten am Vormittag kam ein alter Mann vorbei, er hinkte, war aber trotzdem sehr geschäftig. Er füllte den alten riesigen Holzofen im Garten, der früher zum Brotbacken benutzt wurde, mit Holz und machte Feuer. Kati, unsere Gastgeberin, erklärte, der Mann sei das «Mädchen für alles» im Dorf, hätte eine ganz kleine Rente und die Leute würden ihn nach Möglichkeit beschäftigen, damit er seine klägliche Rente aufbessern konnte.
In diesem Holzofen bereitete sie über Mittag «Ungarische Pizza» zu, welche köstlich mit vielem, was die ungarische Küche bietet, belegt war. Am Nachmittag erklärte Kati, der Ofen sei nun heiss genug, der Mann hörte auf zu heizen und schob die Glut und Asche in den hinteren Bereich. In dieser Zeit belegte unsere Gastgeberin ein riesiges Backblech mit allem Erdenklichen und schob dieses für etwa zwei Stunden in den Ofen.
Zum Nachtessen versammelten wir uns im Garten unter der Laube. Dann kam das Backblech zum Vorschein und verursachte bei jedem von uns ein spontanes «Wow!». Allerlei saftige Fleischstücke von Poulet- bis hin zu Schweinstücken, goldbraun gebraten und umrundet von Kartoffeln und den verschiedensten Gemüsesorten, das alles in einer feinen Sauce, begleitet von einem himmlischen Duft. Einige meiner Oldie-Kollegen schwärmen heute noch von diesem Abend.
Am Sonntagmorgen fuhren wir jeweils wieder Richtung Schweiz ab, diesmal auf den eigenen Rädern. Noch am Morgen hielten wir bei einem Einkaufszentrum kurz nach Budapest an, wo auch ein Lebensmittelladen zu finden war. Um die Grössenordnung zu verdeutlichen: Der Laden hat eine Reihe von 84 Kassen. Es kamen an den Sonntagen sehr viele Familien, um ihren ganzen Wocheneinkauf zu erledigen. Für die Kinder gab es Spielecken und für die ganze Familie die unterschiedlichsten Imbissstuben mit Spezialitäten aus der ganzen Welt. Auf uns wartete nach unseren Einkäufen eine italienische Kaffee-Ecke mit Theke, wo wir vor dem Antritt der grossen Etappe in die Schweiz unseren Kaffee oder Espresso schlürfen konnten.
Eine junge Dame an der Theke, die häufig da war und uns bereits vom Sehen her kannte, wünschte uns einmal beim Gehen ein schönes, langes Wochenende. Ich wusste, in Ungarn war nach diesem Sonntag am darauffolgenden Dienstag Nationalfeiertag, so hatte man im ganzen Land eine arbeitsfreie Brücke von drei Tagen. Solche landesweiten Regelungen sind immer noch Überbleibsel aus der zentralistisch sozialistischen Zeit. So sagte ich ihr: «Wir haben leider kein langes Wochenende, denn wir fahren nach Hause in die Schweiz.»
Sie schlug die Hände zusammen und rief: «Ach, kann man sich glücklich schätzen, wenn man behaupten kann, man fahre nach Hause in die Schweiz!»
Daraufhin sagte ich ihr: «Unser lieber Schatz, siehst du, ich kann mich sogar doppelt glücklich schätzen: Fahre ich nach Ungarn, so gehe ich nach Hause. Bin ich auf dem Rückweg in die Schweiz, so fahre ich ebenfalls nach Hause.»
Anhang 1 - Die ungarische Geschichte
Seite 79
Seite 79 wird geladen
79.
Anhang 1 - Die ungarische Geschichte
Wo begann die Völkerwanderung? Woher kommen die Hunnen, die Vorfahren der heutigen Ungarn? Die Geschichtsbücher sind sich in dieser Frage alles andere als einig. Aus der heutigen Mongolei – oder doch aus dem heutigen Japan? Eines stimmt: Die Hunnen kommen ursprünglich aus dem fernen Osten – dafür sprechen auch die tendenziell breiten Backenknochen in den Gesichtern der Ungarn.
Sie hatten kleine, äusserst flinke, schnelle Pferde und waren nur leicht, meist nur mit Pfeilbogen bewaffnet. Sie erreichten Europa, als die hiesigen Heereseinheiten schwer bewaffnet waren, Pferd und Mann gepanzert und mit schweren Waffen in der Hand. Die Strategie der Hunnen war für sie unbekannt und verwirrte die hiesigen Heere: Die Hunnen kamen schnell in einer Dreieckformation auf die schwerbewaffneten Einheiten zu, überraschten, spalteten und durchbrachen diese.
Diese Feldzüge, besser gesagt Raubzüge, waren berüchtigt und erreichten auch Basel. Im Jahr 917 wurde das Basler Münster von den Hunnen ausgeraubt und anschliessend angezündet oder zerstört. Erst 1016 wurde mit den ursprünglichen Bauten des heutigen Sandsteinmünsters begonnen.
Dann erfolgte die entscheidende Wende: Die Schlacht auf dem Lechfeld 955 war der Endpunkt der Ungarneinfälle und der grösste militärische Sieg Ottos des Grossen und führte dazu, dass sich die sieben Feldherren der Hunnen einig waren: Man müsse sesshaft werden. Dies erfolgte dann auch um das Gebiet Siebenbürgen, heute in Rumänien, wo 896 die legendäre «Landnahme» stattfand.
Der damalige Königssohn Vajk erkannte, dass die europäische Ordnung am Vatikan nicht vorbeikomme und pilgerte im Jahre 1000 zum Papst. Er wurde auf den christlichen Namen Stephan, ungarisch István, getauft und versprach, die bis anhin heidnischen Ungarn zu christianisieren. Dieses Versprechen löste er während seiner Herrschaft bis 1038 ein. So waren die Ungarn bis zur Reformation nahezu 100 % Katholiken, danach noch etwa zu 75 %.
Stephan gilt als Gründer des späteren Ungarn und wurde auch heiliggesprochen. Europa wurde also um das neue Land Ungarn reicher.
Der nächste bedeutende König war András II. Dieser hatte 1222 mit seiner «Goldenen Bulle», ein in Urkundenform verfasstes Gesetzbuch, das in Europa verbreitete römische Recht in Ungarn eingeführt und damit das Land vollends in die europäische Ordnung eingegliedert.
Einen weiteren Meilenstein in der ungarischen Geschichte musste Béla V. schreiben. Nachdem die Tataren, korrekterweise Mongolen, auch Ungarn verwüsteten und einen Grossteil der Bevölkerung ausrotteten, wollte er das Vakuum schliessen und rief die Europäer auf, in Ungarn ein Landstück zu übernehmen und zu bebauen. Seither gibt es in Ungarn unzählige Namen mit germanischer, lateinischer, slawischer und sonst allerlei Herkunft.
Eine entscheidende Wende kam mit dem Einfall der Osmanen in Europa. Ungarn leistete daraufhin während 150 Jahren erbitterten Widerstand, wobei auch längere Kampfpausen vereinbart wurden. Daher rühren auch die zahlreichen Moscheen und Minaretts, die man in Ungarn vorfindet. So ging es weiter, bis die «Türken» 1683 vor Wien standen. Endlich erwachten die Österreicher und halfen den Ungarn, die Türken zurückzuschlagen. Danach allerdings stellten sie den Anspruch, Ungarn zu regieren.
Die ungarische Politik war dreigeteilt: Die einen wollten die Österreicher mit türkischer Hilfe zurückdrängen, die anderen wiederum sahen die Türken als wahre Feinde und wollten diese mit österreichischer Hilfe abhalten. Schliesslich gab es die Haudegen, die meinten, wir Ungarn könnten alleine beide Angreifer zurückschlagen. Schlussendlich blieb es bei der österreichischen Unterjochung Ungarns. Dagegen brach 1848 der Aufstand gegen die österreichische Vorherrschaft aus.
Anfänglich wurde der Aufstand brutal niedergeschlagen, doch das Blatt wendete sich: 1867 erfolgte der österreichisch/ungarische Ausgleich, der Ungarn die Souveränität zurückbrachte. Das ungarische Parlament wurde wieder einberufen und eine österreichisch/ungarische Monarchie gegründet. Allerdings bedingten sich die Österreicher aus, dass der österreichische Kaiser auch ungarischer König wurde, daher die Bezeichnung «K & K-Monarchie», also kaiserliche und königliche Monarchie, auch bekannt als Donau-Monarchie.
Es war eine gute Zeit: Ohne Kriege konnte mitten in der industriellen Revolution sehr viel zur Entwicklung beider Länder getan werden.
Doch dann kam 1914 der unsägliche Erste Weltkrieg, den Ungarn mitverloren hatte. Kein anderes Land wurde nur andeutungsweise so hart bestraft, wie Ungarn: Das Land verlor 1920 im Friedensvertrag von Trianon zwei Drittel seiner Territorien, dabei auch grosse Landstriche, wo ausschliesslich ungarisch sprechende Bevölkerung lebte. Das tut heute noch vielen Ungarn und durch die Abtrennungen nicht mehr Ungarn bitter weh.
Viele Geschichtsbücher behaupten, der darauffolgende Zweite Weltkrieg sei lediglich eine Fortsetzung des Ersten Weltkrieges. Für diese These spricht die Tatsache, dass Hitler die Ungarn mit dem Versprechen, Trianon zu korrigieren, an seine Seite locken konnte.
Tatsächlich gab Hitler zu Beginn des Zweiten Weltkrieges im Rahmen der «Reparation» die Hälfte der Gebiete zurück, die 1920 abgetrennt worden waren. Das waren die Gebiete, wo ausschliesslich ungarisch gesprochen wurde.
Ungarn war also Verbündeter Deutschlands, stellte auch militärische Kräfte zur Verfügung. Hingegen Judenverfolgung fand in Ungarn nicht statt. Darum flohen viele Juden nach Ungarn, entweder Zuflucht suchend oder als Zwischenstation für ihre Flucht, meist nach Amerika. Diese Praxis duldeten die Deutschen, allerdings nur bis 1944.
Eine faschistische Bewegung gab es auch in Ungarn, die «Pfeilkreuzer». Diese blieben jedoch unter der Führung von Szálasi politisch unbedeutend. 1944 annektierte das deutsche Heer Ungarn und setzte die «Pfeilkreuzer» mit Gewalt an die Regierung. Somit begann auch in Ungarn die Judenverfolgung. Angeblich wurden in kürzester Zeit 800‘000 Juden deportiert.
Dann wiederholt sich die Geschichte:
Die Sowjetarmee befreit Ungarn vom Faschismus, stellt dafür Ansprüche an die künftige Politik, Wirtschaft und Entwicklung Ungarns, ähnlich wie in der DDR, Tschechoslowakei, Polen, Bulgarien usw.
Doch die überaus freiheitsliebenden Ungarn reissen 1956 den grössten Volksaufstand gegen diese Unterjochung vom Zaun, erfolglos. Dann aber 1989 öffnen sie die Grenzen zum Westen und das kommunistische System fällt zusammen, auch symbolisch mit dem späteren Fall der Berliner Mauer.
Der Rest der Geschichte ist eben nicht mehr Geschichte, sondern Politik.
Anhang 2 - Die bahnbrechende Konstruktion des Kálmán Kandó
Seite 80
Seite 80 wird geladen
80.
Anhang 2 - Die bahnbrechende Konstruktion des Kálmán Kandó
Das «Semaphor» erscheint vierteljährlich als Hochglanzmagazin und rollt seit seiner Erstausgabe im Jahre 2005 die Geschichte der Eisenbahnen der Schweiz in allen Einzelheiten und Hintergründen auf. Kürzlich wurde über die frühe Elektrifizierung des Eisenbahnnetzes in der Schweiz berichtet, die aus der Not entstanden war. Im Ersten Weltkrieg herrschte in der Schweiz Kohleknappheit, da im Land keine Vorkommen zu finden waren und die Nachbarländer die Lieferungen einstellten. Diese brauchten ihre Kohle selbst für die Aufrechterhaltung ihrer Kriegsmaschinerien.
Die Elektrifizierung des Eisenbahnnetzes hatte jedoch einige Tücken, diese betrafen die Antriebssteuerung. Die Erklärung dafür liefert uns die Zeitschrift «Semaphor» etwas technisch, aber einleuchtend, wenn man nur nicht Angst vor technischen Begriffen hat: Der Titel lautet: «Erste Umformerlokomotiven mit Asynchronmotoren»
«Weil Ingenieure sich stets Gedanken darüber machten, wie man scheinbar unüberwindbare Probleme doch lösen kann, verschwand der praktisch unterhaltsfreie Asynchronmotor nie ganz vom Radar der Bahngesellschaften und der Triebfahrzeugingenieure. Stets von Neuem prüften sie die Frage, ob es möglich wäre, mit vernünftigem und beherrschbarem Aufwand innerhalb des Triebfahrzeuges ein steuerbares Drehstromnetz zu erzeugen. Diesbezüglich besonders hervorgetan hat sich Kálmán Kandó, mit seinen ab Mitte der 1920er Jahre gebauten und erfolgreich eingesetzten Lokomotiven für das ungarische Einphasenstromnetz von 15 kV und 50 Hz (Industriefrequenz).»
Weiter heisst es: «Weil die Leistungselektronik in den 1950er Jahren noch in den Kinderschuhen steckte, die Vorteile der Drehstrommotoren jedoch mannigfaltig sind, kam es zu einer interessanten, an die Ideen von Kálmán Kandó sich anlehnende Lösungsvariante: Die Einphasenlokomotive mit rotierenden Umformern.»
Die Thyristor-gesteuerte Technologie brachte den Umbruch der Wechselstromsysteme, war jedoch deutlich spürbar: Die Lokomotiven beschleunigten stufenweise, mit deutlicher «Schubserei» pro Geschwindigkeitsstufe. Erst mit den vollelektronisch gesteuerten Lokomotiven, wie die Re 460, kam die angenehme lineare Beschleunigung.
FALU VÉGÉN KURTA KOCSMA…
Seite 81
Seite 81 wird geladen
81.1.
Anhang 3
– FALU VÉGÉN KURTA KOCSMA….
Falu végén kurta kocsma,
Oda rúg ki a Szamosra,
Meg is látná magát benne,
Ha az éj nem közeledne.
Az éjszaka közeledik,
A világ lecsendesedik,
Pihen a komp, kikötötték,
Benne hallgat a sötétség.
De a kocsma bezzeg hangos!
Munkálódik a cimbalmos,
A legények kurjogatnak,
Szinte reng belé az ablak.
„Kocsmárosné, aranyvirág,
Ide a legjobbik borát,
Vén legyen, mint a nagyapám,
És tüzes, mint ifju babám!
Húzd rá cigány, huzzad jobban,
Táncolni való kedvem van,
Eltáncolom a pénzemet,
Kitáncolom a lelkemet!“
Bekopognak az ablakon:
„Ne zugjatok olyan nagyon,
Azt üzeni az uraság,
Mert lefeküdt, alunni vágy.“
„Ördög bújjék az uradba,
Te pedig menj a pokolba! ...
Húzd rá, cigány, csak azért is,
Ha mindjárt az ingemért is!“
Megint jönnek, kopogtatnak:
„Csendesebben vigadjanak,
Isten áldja meg kendteket,
Szegény édesanyám beteg.“
Feleletet egyik sem ad,
Kihörpentik boraikat,
Végét vetik a zenének
S hazamennek a legények.
(Petöfi Sándor, Szatmár, 1847. augusztus.)
AZ ALFÖLD
Seite 82
Seite 82 wird geladen
81.2.
Anhang 3
– AZ ALFÖLD.
Mit nekem te zordon Kárpátoknak
Fenyvesekkel vadregényes tája!
Tán csodállak, ámde nem szeretlek,
S képzetem hegyvölgyedet nem járja.
Lenn az alföld tengersík vidékin
Ott vagyok honn, ott az én világom
Börtönéböl szabadúlt sas lelkem,
Ha a rónák végtelenjét látom.
Felröpülök ekkor gondolatban
Túl a földön felhök közelébe,
S mosolyogva néz rám a Dunától
A Tiszáig nyúló róna képe.
Délibábos ég alatt kolompol
Kis-Kunságnak száz kövér gulyája;
Deleléskor hosszu gémü kútnál
Széles vályu kettös ága várja.
Méneseknek nyargaló futása
Zúg a szélben, körmeik dobognak,
S a csikósok kurjantása hallik
S pattogása hangos ostoroknak.
A tanyáknál szellök lágy ölében
Ringatózik a kalászos búza,
S a smaragdnak eleven szinével
A környéket vígan koszorúzza.
Idejárnak szomszéd nádasokból
A vadlúdak esti szürkületben,
És ijedve kelnek légi útra,
Hogyha a nád a széltöl meglebben.
A tanyákon túl a puszta mélyén
Áll magányos, dölt kéményü csárda;
Látogatják a szomjas betyárok,
Kecskemétre menvén a vásárra.
A csárdánál törpe nyárfaerdö
Sárgul a királydinnyés homokban;
Odafészkel a visító vércse,
Gyermekektöl nem háborgatottan.
Ott tenyészik a bús árvalyányhaj
S kék virága a szamárkenyérnek;
Hüs tövéhez déli nap hevében
Megpihenni tarka gyíkok térnek.
Messze, hol az ég a földet éri,
A homályból kék gyümölcsfák orma
Néz, s megettök, mint halvány ködoszlop,
Egy-egy város templomának tornya. -
Szép vagy, alföld, legalább nekem szép!
Itt ringatták bölcsöm, itt születtem.
Itt borúljon rám a szemfödél, itt
Domborodjék a sír is fölöttem.
(Petöfi Sándor, Pest, 1844. július)
FÜSTBEMENT TERV
Seite 83
Seite 83 wird geladen
81.3.
Anhang 3
– FÜSTBEMENT TERV.
Egész uton - hazafelé -
Azon gondolkodám:
Miként fogom szólítani
Rég nem látott anyám?
Mit mondok majd elöször is
Kedvest, szépet neki?
Midön, mely bölcsöm ringatá,
A kart terjeszti ki.
S jutott eszembe számtalan
Szebbnél-szebb gondolat,
Mig állni látszék az idö,
Bár a szekér szaladt.
S a kis szobába toppanék...
Röpült felém anyám...
S én csüggtem ajkán... szótlanúl...
Mint a gyümölcs a fán.
(Petöfi Sándor, Dunavecse, 1844. április)
NE LÉGY SZELES...
Seite 84
Seite 84 wird geladen
81.4.
Anhang 3
– NE LÉGY SZELES... .
Ne légy szeles.
Bár a munkádon más keres -
dolgozni csak pontosan, szépen,
ahogy a csillag megy az égen,
ugy érdemes.
(József Attila)
Anhang 4
Seite 85
Seite 85 wird geladen
82.
Anhang 4
Joe Dassins Chanson «Et si tu n‘existe pas» kann auf YouTube in mehreren Videoclips genossen werden. In einem dieser Clips werden die verschiedenen Gesichter von Juliette Binoche gezeigt. Es ist erstaunlich, wie viele Ausdrucksformen eine Schauspielerin haben kann – eine Oscar Preisträgerin haben muss (The English Patient): der apathische, leere Blick auf dem Militärjeep, bis hin zu der vor Lebensfreude sprudelnden jungen Frau und schliesslich die alternde Grande Dame.
Aktuell: https://www.youtube.com/watch?v=cdSFTp3KBUk
oder: https://www.youtube.com/watch?v=C8Dx9Ggotu0