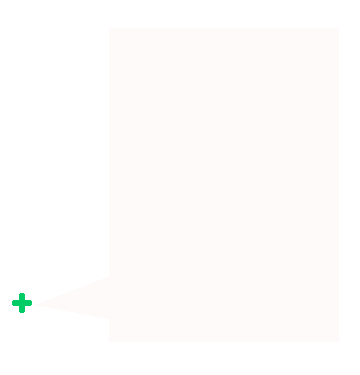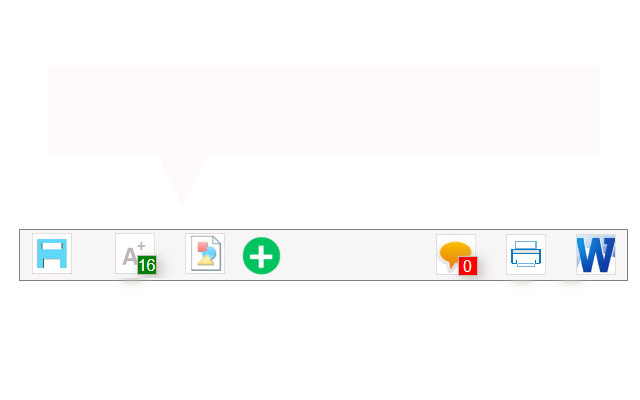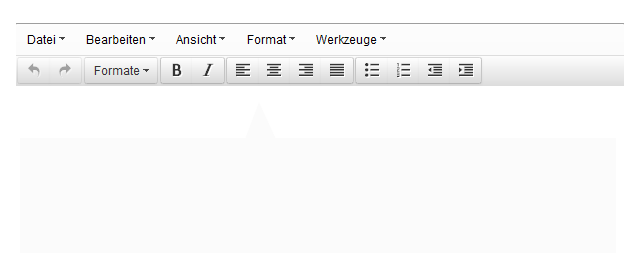Zurzeit sind 552 Biographien in Arbeit und davon 313 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 191

Vor allem möchte ich dieses Buch den jungen Menschen ans Herz legen, die beschlossen haben, abzunehmen, weil sie glauben, «dazu gehören» zu wollen.
Ausserdem widme ich dieses Buch meiner Mutter, die mich in der grössten Krise aufgefangen hatte.
Zu guter Letzt widme ich dieses Buch meinem Ehemann, Peter.

(1) Wir beide im Glück

An meiner Geburt waren, neben den Menschen des Spitales, genau zwei Personen anwesend: meine Mutter und ich. Wie in den 1960-ern so üblich, waren die Väter bei Geburtsereignissen leider ausgeschlossen und meiner ganz besonders. Er traute sich nicht einmal, bei seinem Vorgesetzten, um einen freien Tag zu fragen. Als die Wehen bei meiner Mutter einsetzten, lieh er sich zunächst das Auto des Nachbarn, fuhr mit meiner Mutter ins Spital, liess sie aussteigen und fuhr zurück in seine Firma. Dass sich dieser Einsatz als Fehlstart entpuppte und er nur wenige Stunden später wieder ins Spital musste, ahnte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und dass er seine Frau mit Kind im Bauch von der Strasse aufsammeln musste, auch nicht. Tatsächlich liessen die Wehen gleich nach meiner Mutters Ankunft im Spital nach und waren bald ganz verschwunden, sodass die Arme wieder nach Hause geschickt wurde. Sie solle doch wiederkommen, wenn sie die Schmerzen nicht mehr aushalten könne.
DAS Ereignis, welches meine Geburt prägte, war wohl der Sturz meiner Mutter. Aus ihren Erzählungen weiss ich, dass sie auf dem Weg zum Auto meines Vaters, der bereits vor dem Spital auf sie wartete, um sie wieder heimzuholen, plötzlich ohnmächtig wurde. Sie fiel einfach auf der Strasse um, ihre Hausschuhe, ihr Waschbeutel und alle ihre Habseligkeiten lagen auf der Strasse. Eine Erinnerung, weshalb sie umkippte, hatte sie nicht, sie sah sich nur plötzlich auf der Strasse liegen. Peinlich berührt sammelte mein Vater schnell Frau und Habseligkeiten auf und verfrachtete alles in sein Auto, gemäss der typisch schwäbischen Mentalität - "Was werden wohl die Leute sagen?" Doch bereits in der darauffolgenden Nacht war mir dann der Bauch meiner Mutter definitiv zu eng und ich gab erneut das Signal zum Start ins Leben, worauf der Weg meiner Eltern erneut ins Spital führte. Das war am 15. Oktober 1962, der Tag meiner Geburt. Sternzeichen Waage, Aszendent Waage.
Harmoniebedürftig mal zwei!
Zur Feier des Tages, hatte mein Vater ein eigenes Auto gekauft. Wie bei so manchen anderen Entscheidungen in den darauffolgenden, gemeinsamen Ehejahren, war meine Mutter in diesen Plan nicht eingeweiht und war natürlich sehr überrascht. Vor allem, als sie die Grösse des Autos sah: es war ein Fiat 500, Modell "Topolino". Vom Italienischen ins Deutsche übersetzt heisst das "Mäuschen" und etwa so gross war er auch. Meine Mutter erzählte mir mit leuchtenden Augen: "Wie die Könige haben wir uns gefühlt". Leider war die Fahrt vom Spital nach Hause die einzige Fahrt, die meine Eltern mit ihrem "Königsauto" unternahmen. Nachdem er nach unserer Abholung aus dem Spital in der Garage stand, tat er keinen Wank mehr. Ein paar Tage später wurde das "Mäuschen" in eine Tafel Schokolade umgetauscht, um Platz in der Garage zu schaffen.
Während meine Mutter mit mir im Spital war, betreute meine spätere Patentante Getrud, die ältere Schwester meiner Mutter, meinen Bruder Martin, der zu diesem Zeitpunkt eineinhalb Jahre war. Durch die Erzählungen meiner Tante erhielt ich einen kleinen Eindruck, wie und was im Oktober 1962 die Menschen und die ganze Welt bewegte. Über das Radio verfolgte sie die Nachrichten, die brandgefährlich waren: Im Oktober 1962 erreichte der Konflikt des kalten Krieges seinen Höhepunkt. Nur ganz knapp entging die Welt einem Atomkrieg oder dritten Weltkrieg mit atomaren Sprengkörpern zwischen den Atommächten USA und Sowjetunion. In Kuba wurden die sowjetischen Atomraketen gelagert, die sich auf die Vereinigten Staaten richteten. Die Vorgeschichte begann damit, dass Fidel Castro seine kommunistischen Ideologien mit Hilfe der Sowjetunion in der Welt verbreiten wollte, die USA dagegen diese zurückzudrängen versuchte. Schlussendlich war es ein Machkampf zwischen den USA und der Sowjetunion. Beide Länder hatten auf Kuba Mittelstreckenraketen stationiert und aufeinander gerichtet. Erst in letzter Minute verhinderten Kennedy und Chruschtschow eine Eskalation. Voller Sorge hätte sie die Diskussionen und Drohungen zwischen Kennedy und Chruschtschow verfolgt und sich einmal mehr gefragt, ob die Weltmächte es wieder so weit kommen lassen würden. Zum Glück nicht.
Wie jedes Jahrzehnt waren auch die Sechziger eine spannende Zeit. Mein Vater war während der Studentenunruhen in Berlin. Für einen Studenten ein Muss, denn mittlerweile war er auf dem Weg zu seinem nächsten beruflichen Ziel. Er wollte Lehrer werden. Da mein Vater in den USA geboren wurde, weil sein Vater wiederum in den 20-ern nach Illinois auswanderte, musste er zum amerikanischen Militär, welches unter anderem in Bad Kissingen im deutschen Unterfranken stationiert war. Dorthin also, wo auch Elvis Presley seinen Dienst leistete. Er traf zwar nicht zeitgleich mit ihm zusammen, mein Vater kam ein Jahr nach Presley dort an, aber der Geist des Rock ‘n Roll hatte auch ihn erfasst. Dieses Feeling war lebendig, die Aufbruchstimmung und die gefühlte Freiheit nach den erstickenden und dunklen Jahren, vor allem für die jungen Menschen. Ich wurde also in einer Zeit geboren, in der die ganze Welt in Bewegung war und neue Mächte ausgelotet werden wollten. Die Guten und die Bösen.
Ganz speziell fand ich bei den Erzählungen meiner Mutter über mich und meine frühesten Kindheitsjahre, dass sie an meiner Taufe nicht dabei sein konnte. Was war das für ein Vorzeichen? Sie litt an einer Entzündung der Milchdrüsen und musste mit hohem Fieber das Bett hüten. Sehr wünschte ich mir in dem Moment ihrer Erzählung, ich könnte Ihre Gedanken von damals lesen und ihre Gefühle erahnen. Doch einmal mehr erzählte sie mir im gleichen Atemzug, wie sehr ich erwünscht war, und wie sich alle auf mich freuten, besonders mein älterer Bruder. Ich habe bei meiner Mutter nachgefragt, wer mich denn über dem Taufbecken hielt, wenn sie es nicht tun konnte. Sie gab mir zur Antwort, das wäre mein Grossvater gewesen, also ihr Vater. Er sagte damals, er möchte das übernehmen, aber er wolle kein Pate von mir werden, denn das müsse jemand Jüngeres sein. Weshalb hat mich nicht meine Tante gehalten, die ja dann Patin wurde? Oder mein Onkel? Dass mein Grossvater mich hielt, ist schon sehr bezeichnend, denn zu ihm hatte ich immer ein ganz besonderes Verhältnis. Mein Grossvater starb bereits mit 74 Jahren an Krebs. Ich war damals etwa 15 Jahre alt und in dieser Zeit fingen meine Lebensprobleme an. Immer, wenn es sich besonders schlimm anfühlte, hatte ich das Gefühl, er schaue auf mich. Oft, ganz oft spürte ich eine unsichtbare Kraft, die mir half zu leben. Und ich sah ihn und ich spürte ihn.
Meine Taufpaten sind die ältere Schwester meiner Mutter, Gertrud und ihr Mann, Klaus. Sowohl diese Familie wie auch meine Grosseltern mütterlicherseits sind und waren Anthroposophen. Nur meine Mutter schlug aus dieser Lebensphilosophie aus. Sie heiratete einen Mann protestantischen Glaubens, was für sie nicht immer ganz einfach war, galt meine Mutter doch in den Augen ihrer Mutter als oberflächlich und genügte meist den Ansprüchen ihrer Eltern, resp. ihrer Mutter nicht. Schon in ganz frühen Erzählungen meiner Mutter war dies ein Thema und immer hörte ich in ihren Worten Enttäuschung und eine gewisse Bitterkeit. Tante Gertrud hingegen war das Musterkind, interessiert an Musik und Literatur und an den Schriften Rudolf Steiners. So vergeistigt, mit grossem Interesse an klassischer Musik und vor allem an Literatur habe ich früher und heute meine Paten erlebt. Das war ihre wichtigste Rolle in meinen frühen und späteren Kindheits- und Jugendjahren. Beide waren Walddorfschullehrer, meine Tante jedoch nur eine kurze Zeit, bis sie selbst Mutter wurde. Vermutlich war meine Tante die treibende Kraft in Sachen Geschenke und Verantwortung dem Patenkind gegenüber, denn vor allem ihre Bücher sind mir in Erinnerung geblieben. Ich habe sie durchweg sehr geliebt und immer wieder gelesen. «Die Kinder von Bullerbü» (gefühlt 50 x gelesen), «Mio, mein Mio», «Die Brüder Löwenherz», aber auch «Die schwarzen Brüder» oder «Daddy Long Leg». Ebenso «Singende Geigen», ein wunderschönes Märchenbuch aus der Welt der Zigeuner mit selten schönen Bildern, ich habe es noch heute.

1967, in dem Jahr, in dem ich im Herbst fünf wurde, zogen meine Eltern im Laufe des Frühlings von Stuttgart nach Südbaden. In ein winziges Dorf an der Schweizer Grenze, direkt am wunderschönen, mit vielen Büschen und Bäumen bewachsenen Ufer des Rheins. Ein wunderbarer Kinderspielplatz! Unser neues Haus befand sich in einer völlig neu erschlossenen Wohngegend. Schotterstrassen und Wiesenwege führten zu unserem Haus, welches zunächst mal das Erste und Einzige war. Später folgten natürlich noch einige mehr, aber es ist schon speziell, wenn weit und breit nur ein kleines Häuschen mitten im Nichts steht. Im Dorf gab es zwei winzige Emma-Läden, eine Beiz und eine Kapelle. In der Mitte des Dorfes stand das Schlachthäuschen, ein riesiger Kastanienbaum, der wunderschön weiss blühte und der Dorfbrunnen. Gleich am Eingang des Dorfes befand sich die grosse, majestätische Dorfschule mit Kindergarten. Es war also alles da, was eine junge Familie benötigte. Vor allem der Kindergarten war für solch ein winziges Dörfchen eine Besonderheit, und darüber war meine Mutter zu jener Zeit besonders froh war. So waren immerhin die Kinder fürs Erste versorgt.
Mein Vater schloss sein Studium zum Lehrer ab und meldete sich für eine Stelle nach Südbaden. Er wollte weg von Stuttgart, nicht dort Lehrer sein, wo er selbst Schüler war. Womöglich noch an derselben Schule. Eventuell keimten zu dieser Zeit bereits auch schon die ersten «Freiheits- und hinaus- in- die- Welt»- Gefühle in ihm auf. Meine Mutter sah den Umzugsplänen meines Vaters nicht ganz so euphorisch entgegen, denn sie fühlte sich grundsätzlich wohl in der Stuttgarter Siedlung, wo sie mittlerweile ihr drittes Kind geboren hatte. Zudem kannte sie an ihrem neuen Ort weder die Gegend, noch sah sie vorher jemals das Haus. Wieder so ein "Überraschungspaket" meines Vaters. Meine Erinnerung an diese Zeit ist sehr schwach, doch mit diesem Umzug, weg von der Wohnsiedlung mitten im Wald und doch noch am Rande einer Grossstadt, hin auf das damals noch weite Land in ein Dorf mit nur 300 Einwohnern, sind zwei Erinnerungen verknüpft: meine Mutter macht den Führerschein, um in dieser Einsamkeit zurechtzukommen und meine Eltern haben mich für einige Monate zu meinen Grosseltern an den Bodensee gegeben. Ich war wohl die «freie Kapazität», die sich am einfachsten mobilisieren lies.
An ihren Führerschein erinnere ich mich deswegen, weil sie vorwiegend abends, wenn wir Kinder im Bett und mein Vater zuhause waren, ihre Fahrstunden hatte. Für mich wäre das grundsätzlich kein Problem gewesen, hätte ich im Kindesalter nicht ständig so schreckliche Alpträume gehabt. Oft erwachte ich weinend und voller Angst und erst, nachdem meine Mutter ins Zimmer kam und mich tröstete, konnte ich wieder einschlafen. Während der Zeit ihrer Abendfahrstunden war dies jedoch nicht möglich, weshalb mein Vater mich nach wiederholtem Alptraumgeschrei kurzerhand in eine Decke wickelte und in seinen VW Käfer packte. Gemeinsam haben wir dann meine Mutter von ihrer Fahrschule abgeholt. Das ist ganz sicher eine eigene Erinnerung. Da war ich drei oder vier.
Die weitaus intensivere Erinnerung habe ich an die Monate vor meinem fünften Geburtstag. Wie gesagt, war dies die Zeit sowohl des Umzugs als auch des beruflichen Neustarts meines Vaters. Der grösste Teil der Umzugs- und Familienorganisation hing an meiner Mutter. Sie musste sich zurechtfinden in einem Heim, in welchem sie um Jahre zurückgeworfen wurde. Kein Auto, kein Telefon, keine Freunde, Bekannte oder erweiterte Familienmitglieder, mit drei kleinen Kindern und einem Ehemann, der meistens mit sich und seiner Arbeit beschäftigt war. Ein Kind weniger für eine gewisse Zeit, war daher sicher eine grosse Entlastung.
Die Zeit bei meinen Grosseltern war zu Beginn sicherlich spannend und schön. Ich bin überzeugt, dass ich es auch genoss, einmal im Mittelpunkt zu stehen. Für ein mittleres Kind hat das eher Seltenheitswert. Ich erinnere mich an lange Spaziergänge mit meinem Opa, an Besuche bei den Hirschen im Hirschgraben, dem "Mehlsack"- einem ganz dicken Turm mitten in Ravensburg und auch an einen Restaurantbesuch. Darauf war ich besonders stolz, denn ich kam mir schon sehr gross vor. Auf dem Wochenmarkt, zu den mich meine Oma regelmässig mitnahm, bekam ich eine Salzbrezel. Das war für mich das grösste Glück. Auch das Zuarbeiten in der Küche, wie Äpfel schälen (möglichst ein ganz langes Schalenband schaffen), Gemüse schneiden Erbsen auspuhlen oder die Teigschüssel auslecken, fand ich wunderbar.
Ich verbrachte den ganzen Sommer bis zu meinem Geburtstag im Oktober bei den Grosseltern. Eigentlich entsetzlich lang für eine Fünfjährige, weswegen ich mich je länger, je mehr unglücklich fühlte. Immer öfter weinte ich abends im Bett und sehnte mich fürchterlich nach meiner Mama. Eines Tages sprach mein Grossvater ein Machtwort: "Else (meine Oma) das Kind muss wieder zu seiner Mutter". Mit Sack und Pack, Köfferchen und Kind machte sich meine Grossmutter auf die lange und umständliche Reise von Ravensburg in die Pampa am Rhein. Der Dorfteil, in dem das neue Haus stand, hiess (und heisst auch heute noch so) "Grabenwiesen" und so war es auch. Gemeinsam stiefelten wir beide nach einer langen Fahrt mit dem öffentlichen Verkehr, durch Gräben und Wiesen, Matsch und Schafsböllen, bis ich den Kinderwagen meiner kleinen Schwester vor dem Haus erkannte. Ich fühle es heute noch, wie glücklich ich da war.

Recht bald schon nach meiner Ankunft in unserem Dorf lernte ich ein Nachbarmädchen kennen. Sie stand eines Tages einfach vor unserer Haustüre, wohl um zu schauen, was da für Leute eingezogen sind. Sie war in meinem Alter, auch etwa fünf, so gross wie ich, dunkle Locken, dunkle Augen mit einem sehr interessierten Blick. Sie stand da und schaute mich an, wie ich auf der zweistufigen Treppe vor unsere Haustüre sass und zu ihr hinüberblickte. Ich weiss nicht mehr, ob sie oder ich den Anfang machte, bin aber fasst sicher, dass es meine Mutter war, die mich zum Reden aufforderte: „Sag doch mal, wie du heisst!“
Offenbar sind Carola und ich dann schon ins Gespräch gekommen, denn sie wurde durch alle meine Kindheitsjahre hindurch bis zur Pubertät meine beste Freundin. Oft durfte ich bei ihr übernachten (sie auch bei mir, aber sie wollte nie – vielleicht hatte sie Angst), habe sie bei ihren Kirchgängen begleitet, obwohl ich nicht katholisch war (sie mich in die evangelische Kirche nie) und wir haben viele großartige Spiele erfunden und hatten über Dörfer hinweg einen riesigen Spielplatz. Unvergesslich bleiben mir unsere Abenteuertouren entlang des Rheins. Wir waren wohl neun oder Zehn oder auch schon ein bisschen älter, als unsere Mutproben begannen: „Wer kann am längsten am Rand des Rheins entlang gehen, ohne einen Fuß ins Wasser zu setzen?“ Das Ufer wurde von einer teils steinigen, teils dornigen Brombeer-Böschung gesäumt und fiel relativ steil sehr schnell in Untiefen ab. Es war Sommer und wir gingen barfuß, ich lief unten, Carola begleitet mich oben auf dem normalen Uferweg. Nach nur wenigen Metern waren die Dornen zu hoch und zu breit und für mich unüberwindbar, wenn ich nicht im Wasser waten wollte. Nach weiteren Metern fand ich auch im Wasser keinen Halt mehr und saß definitiv fest. Über mir unzählige Brombeerdornen, unter mir tiefes, mit starker Strömung vorbeifließendes Rheinwasser. Carola war schon ganz aufgeregt und ich bekam auch langsam Angst. Wo sollte ich hin? Der einzige Ausweg war der durch die Dornen, drei Meter nach oben. Barfuß vermutlich, in kurzen Hosen und T-Shirt oder sogar Badeanzug, hielt ich Carola meine Hand hin, sie zog aus Leibeskräften und ich trat mit zusammengebissen Zähnen zwischen Uferbefestigung und Dornengebüsch nach oben. Glücklich wieder festen und geraden Boden unter den Füssen zu haben, begutachtete ich die vielen blutigen Kratzer, insbesondere meine Füße. Alles brannte. Ich kam zu der Erkenntnis, dass das eine blöde Wette war.
Ein anderes Mal spielten wir „Zwei arme, verlassene Waisenkinder auf der Flucht“. Unweit unseres Dorfes stand und steht ein Wasserkraftwerk, was via Staumauer die Schweiz und Deutschland verbindet. Auf der Staumauer kann man bequem von einem Ufer zum anderen gelangen, was wir Kinder natürlich rege nutzten. Nirgendwo ist es schöner als woanders! Am gegenüberliegenden Ufer, auf der Schweizer Seite befand sich in der Nähe des Kraftwerkes eine Bootsanlegestelle, welche insbesondere von den Rheinfischern genutzt wurde, die dort ihre Boote anlegten. Teils waren sie mit Motoren ausgestattet, teils nur mit Paddeln und alle waren mit Wachplachen abgedeckt, um vor Regenwasser, herabfallenden Blättern und Vogelschissen geschützt zu sein. Wir, „zwei arme, verlassene Waisenkinder“ waren von Deutschland in die Schweiz geflüchtet und auf der Suche nach einer Bleibe. Da sahen wir die zugedeckten Boote und waren glücklich, endlich ein neues Zuhause gefunden zu haben. Husch darunter geschlüpft und unserer Fantasie war keine Grenze mehr gesetzt. Uii, da war ja ein Motor! Carola hatte die Idee, den Motor zu starten, um schneller in den Süden zu gelangen, wo es ein Meer gibt und immer die Sonne scheint (sie war in den Sommerferien schon mal mit ihren Eltern in Italien). Ich fand die Idee grundsätzlich gut, hatte aber keine Ahnung, wie man ein Boot steuert. Carola auch nicht, was unserer Vorstellungskraft keinen Abbruch tat, es ging auch ohne. An Ort und Stelle starteten wir den Motor, um zu neuen Ufern aufzubrechen. Laut und nach Benzin stinkend stotterte der Bootsmotor vor sich hin und wir waren schon fasst in Italien, als wir, zunächst ganz weit weg aber immer näherkommender einen sehr aufgeregten und eventuell auch leicht verärgerten Mann schreien hörten. Da wir uns unter der Bootsabdeckung befanden sahen wir zunächst nicht, wen er meinte und taten so, als wäre alles in bester Ordnung, denn es hätte ja sein können, dass unserem Vater das Boot gehörte. Dumm war nur, dass das Boot dem vor uns stehenden und wild herumfuchtelnden Mann gehörte, er jetzt wirklich keine Kinder hatte und auch sonst überhaupt keinen Spaß verstand. Als er Carola und mich nach unseren Namen und Adressen befragte, bekam ich schon ein schlechtes Gewissen und beantwortete ganz artig seine Fragen. Ich war nur etwas verwundert, dass Carola plötzlich Natalie hieß (sie wollte genau wie ich auch viel lieber Natalie genannt werden) und in einer Straße wohnte, die ich gar nicht kannte. Ohhh, was habe ich sie für ihre Schlagfertigkeit bewundert, als wir anschließend die Füße unter die Arme nahmen und machten, dass wir wegkamen. Lange noch dachte ich an den Fischer in der Schweiz zurück, der ja wusste, wo ich wohne und jederzeit vor der Türe stehen konnte. Aus Italien ist dann leider nichts geworden, aber wir waren heilfroh, keine Waisenkinder zu sein.
Neben unseren Abenteuern waren meine beste Freundin und ich auch sehr kreativ. Wir bauten aus Schuhschachteln mehrstöckige Puppenhäuser, aus Medikamentenschachteln die dazugehörigen Möbel und aus Stoffmustern, die wir von einer Nachbarin bekamen, deren Bruder in der Textilbranche arbeitete, Gardinen, Teppiche und Überzüge für Stühle und Sofas. Wir bastelten Schulbücher und Hefte aus Papierabfall und spielten Lehrer und Schüler, Büro oder Post. Aus Karton und Schnur bekamen unseren Puppen eine Gartenschaukel und unsere Schnecken eine Hütte. Aus vielerlei Flüssigkeiten mixten wir stinkende und weniger stinkende Tinkturen, die wir in unserer gedachten Apotheke verkauften. Ich glaube, ich war in dieser Zeit ein sehr glückliches Kind mit einem unfassbar großen Repertoire an kreativen Ideen. Carola und ich ergänzten uns wunderbar bis wir dreizehn / vierzehn wurden und Carola das andere Geschlecht entdeckte. In diesem Alter war ich am liebsten mit meiner Mutter in der Küche, verbrachte meine Freizeit mit Lesen, Babysitten in der Nachbarschaft oder war bei Schulkolleginnen.

Ferien außerhalb unseres Wohnortes oder gar im Ausland gab es für uns Kinder äußerst selten, da all solche „unnützen“ Ausgaben in den Augen meines Vaters (O-Ton Vater: „Was müssen die Junge schon in den Urlaub, die können das später alles von ihrem eigenen Geld machen“) nur Geldverschwendung war. Nur für unseren Vater selbst galten andere Regeln, er unternahm regelmäßig weite Reisen. Für ihn war es keine Frage, mangels nötigen Geldes nicht reisen zu können. Es war eine unausgesprochene Selbstverständlichkeit, dass er seine Sachen packte und irgendwohin verschwand. Er war schließlich der „Verdiener“. Selbst meine Mutter wusste manchmal nicht, wo er sich aufhielt. Erst später erfuhr ich, dass es weit mehr war, als die Welt zu erfahren. Mein Vater lebte ein Parallelleben außerhalb seiner Ehe und unserer Familie. Davon erzähle ich später mehr.
Für mich bedeuteten Autoreisen Stress pur, denn ich litt meine ganze Kindheit hindurch an Reisekrankheit. Schon eine banale Fahrt nach Stuttgart oder an den Bodensee zu unserer Verwandtschaft hieß für mich mindesten drei Mal anhalten, weil ich mich übergeben musste. Am Ziel angekommen, war bei mir zunächst Bettruhe angesagt, das traditionelle Kaffeetrinken fand meist ohne mich statt. Vor diesem Hintergrund war klar, dass während der Skiferien oder in den Sommerferien, wenn es doch einmal vorkam, dass die ganze Familie vereiste, ich maximal zu den Großeltern kam. Oder besser noch, sie betreuten mich oder uns zuhause. Ich erinnere mich an ein einziges Mal, wo auch ich mitdurfte. Das waren Skiferien über Ostern in Sedrun im Bündnerland in der Schweiz. Wir und Freunde meiner Eltern mit ihren ebenfalls drei Kindern fuhren gemeinsam, was eine große Sache war. Skifahren wollte ich weniger, aber ich erinnere mich an den Bau eines Rieseniglu. Erst als junge Erwachsene lernte ich so langsam ein wenig mehr von der Welt kennen. Meine erste und für ein paar Jahre einzige Ferienreise unternahm ich mit meinen Paten nach Holland. Da war ich Fünfzehn.
In meinem fünfzehnten Lebensjahr, das war der Sommer, in dem ich die Hauptschule abschloss, durfte ich mit meinen Pateneltern und ihren drei Kindern nach Holland reisen. Meine allererste Auslandreise und ich war mächtig aufgeregt. In dieser Zeit müssen meine Eltern auch meine beginnende Essstörung entdeckt haben, was wohl ebenfalls ein Grund war, mir eine Auszeit von zuhause zu verpassen. Die älteste Tochter meiner Tante, Rosemarie war nur ein halbes Jahr jünger als ich und man sollte meinen, dass wir dieselben Interessen teilten. Teilweise war das so und doch unterschieden wir uns sehr. Rosemarie war ein Kind der Anthroposophie, Schülerin der Walddorfschule, konnte wunderbar Geige spielen und fantastisch malen, wofür ich sie sehr bewunderte. All das war und konnte ich nicht, dafür war ich mutiger, realistischer und konnte schon richtig gut kochen. Was uns allerdings zutiefst verband war die Abscheu gegen die Mathematik. Wir beide hatten keinerlei Zugang zu den Zahlen und es war uns unerklärlich, wie man Mathematik verstehen, geschweige denn lieben konnte. Das tat nämlich mein Onkel Klaus. In der Walddorfschule war er DER Mathematiklehrer schlechthin, er vergötterte alles, was damit zusammenhing. So war es ihm natürlich ein grosses Bedürfnis, «seinen beiden Mädchen» diese Liebe zu vermitteln, wozu sich die gemeinsamen Ferien hervorragend eigneten, waren wir doch praktischerweise gleich im Doppelpack greifbar. Er mühte sich ab und versuchte uns spielerisch den Dreisatz näher zu bringen, philosophierte über die Logik der Zahlen und dass alles eine Lösung hatte. Haha, und wir verstanden nur Bahnhof. Doch er gab nicht auf und vielleicht weil Onkel Klaus am richtigen Fädchen zog oder weil er ein guter Lehrer war und Mathe alltagstauglich vermitteln konnte, ging uns in diesen Ferien das eine oder andere mathematische Lichtlein auf. Monate später, als ich dann weiterführend an der Hauswirtschaftsschule das erste Zeugnis bekam, hatte ich tatsächlich statt einer Vier, eine Drei in Mathe und darauf war ich dann schon stolz.

Ich bin die zweite und mittlere von drei Kindern, also gab es zum Zeitpunkt meiner Geburt nur meinen älteren, fasst Eineinhalbjährigen Bruder. Wir haben uns wohl im „Irgendwo“ abgesprochen, denn ich wurde sehnlichst von ihm erwartet. Oft erzählte meine Mutter, wie klar und unvoreingenommen mich mein Bruder annahm. „Nei Wess“ sagte er, als meine Eltern ihn auf die Geburt eines Brüderchens, respektive eines Geschwisterchens vorbereiten wollten. Für ihn war es klar. „Nei Wess. Nein Schwester!» Als ich dann da war und im Stubenwagen lag, beschenkte er mich mit all den Sachen, die ihn umgaben. Auf einer Kommode stand eine Obstschale voller Äpfel aus dem schwiegermütterlichen Garten stehen. Nach und nach liess mein Bruder die Äpfel in meinen Wagen fallen, mit den kleinen Ärmchen von unten nach oben ausrollend, da er einfach noch zu klein war, um darüber hinweg sehen zu können. Meine Mutter erzählte mir lachend, dass sie aufpassen musste, dass ich keinen der Äpfel an den Kopf bekam. Ausserdem legte er mir sein Spielzeug in den Wagen. Nur wenn meine Mutter mich stillte und damit ihre Aufmerksamkeit vor allem bei mir war, war er doch etwas eifersüchtig. Dann wollte Martin auch auf ihren Schoss. Meine Mutter hat mir später einmal erzählt, immer wenn sie mich wickelte, an- oder auszog, hat mein Bruder die Türen und Schubladen der Kommode geöffnet, in der die Babysachen lagen und wollte jedes Hemdchen und jedes Strampelhöschen ansehen. Unsere Verbundenheit ist, bis heute geblieben. Ich liebe und schätze ihn sehr und er war in Teilen meines Lebens manchmal noch vor meinen Eltern der erste Ansprechpartner in der Familie. Vielleicht auch, weil mein Vater irgendwann ausfiel. Trotzdem war er kein Vaterersatz, dafür waren wir altersmässig zu nah beieinander.
Ich muss so zehn oder elf Jahre alt gewesen sein, als ich unbedingt auch mal mit meinem Bruder und seinen Freunden Fussball spielen wollte. Eines Tages nahm mich mein Bruder mit und ich war darauf sehr stolz, denn ich war das einzige Mädchen in der Mannschaft. Für Martin, der eher ein zurückhaltender, introvertierter und damals auch noch stotternder Junge war, bedeutete dieses Zugeständnis an mich eine grosse Herausforderung. Musste er sich doch bei seinen Freunden durchsetzen und für seine kleine Schwester einstehen. Dumm war nur, dass mir niemand die Regeln erklärte und so kam es, wie es kommen musste: ich schoss den Ball ins falsche Tor. Zuerst war ich mächtig stolz den Ball überhaupt ins Tor bekommen zu haben, doch als ich das Gesicht meines Bruders sah, schwante mir Böses. Ich wurde schimpfend vom Platz gestellt, mein Bruder schämte sich für mich und das war dann auch schon das Ende meiner Fussballkarriere. In Zukunft zog ich Gummitwist mit meiner Freundin vor.
Leider haben wir später kaum noch Zeit miteinander verbringen können, da mein Bruder mit 13 Jahren in ein Internat an den Bodensee wechselte. Einmal habe ich ihn dort besucht, und einmal, ich war 13 oder 14 Jahre und Martin 15 oder 16, lud er seine ganze Klasse für eine Silvesterparty zu uns nach Hause ein, was wirklich eine ganz grosse Sache war. Es war unsere erste Party und das Buffet habe ich quasi ganz allein auf die Beine gestellt, da meine Eltern und meine kleine Schwester über Silvester und Neujahr bei Freunden waren. Obwohl es damals noch keine Handys gab, kamen im Laufe der Nacht immer mehr Menschen. Leute, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Wie hatten die das bloss erfahren? Es wurde getanzt, gegessen und getrunken und natürlich auch gekifft. Eine wirklich super Party mit einem hohen Aufräum- und Putzfaktor am nächsten Tag. Vor allem die zwecks besserem Tanzerlebnis abgeräumten Teppichfliesen haben uns am nächsten Tag mächtig zu schaffen gemacht. Und das Eintreffen unserer Eltern tags darauf machte es auch nicht besser.

An die Geburt meiner kleinen Schwester im Jahr 1965 erinnere ich mich nicht. Sie war einfach plötzlich da. Ich war selbst noch sehr klein, zweidreiviertel Jahre alt und habe das nicht so verfolgt. Ich fand vor allem ihre Haare schön, aber da war ich wohl auch schon älter. Dadurch, dass ich nur sehr flaumige, kurze und feine Haare hatte, war ich wohl von ihren langen Locken sehr angetan. Meine Mutter steckte sie zu einem Krönchen hoch, was richtig süß ausgesehen hat. Meine kleine Schwester war wirklich ein ganz süßes Baby und Kleinkind. Stupsnäschen, so richtig knuffigen Babyspeck, ihre rotblonden, langen Haare und ihre großen Augen, die oft ängstlich in die Welt schauten. Alles so herzig. Leider bestand zu meiner kleinen Schwester nie solch eine intensive Beziehung, wie zu meinem großen Bruder. Außerdem hatte ich eine ganz dicke Freundin, mit der ich vorwiegend meine Zeit verbrachte. Das Alter zwischen fünf und zwölf war wenig schwestergeprägt, mit der Ausnahme, dass wir ein Zimmer teilten und das für mich mehr ärgerlich, als schwesterlich war. Sie war mir oft lästig und das ließ ich sie auch spüren. Meine Schwester war viel mit meiner Mutter zusammen, ein richtiges Mama-Kind und ab ihrem ersten Schultag war sie außerordentlich ehrgeizig und lernfokussiert. Ich glaube, sie hat sich ihr Selbstbewusstsein, das sie vermeintlich nicht zu Hause als Nesthäkchen bekommen konnte, von Anfang an durch Erfolge in der Schule geholt. Später tat es mir sehr leid, dass ich so wenig an ihrem Mädchenleben teilgenommen habe. Ich habe heute das Gefühl, dahingehend einiges verpasst zu haben. Als sie dann so groß war, dass wir zusammenspannen hätten können, hatte ich mit mir selbst zu tun und sie wechselte mit 13 Jahren nach Rottweil ins Internat. Damit war unsere gemeinsame Kindheit beendet.

Zur Zeit meiner Geburt und während meiner ersten viereinhalb Lebensjahre bewohnten wir ein Reihenhaus in einer Neubausiedlung inmitten des an Stuttgart angrenzenden Waldes. Eine wunderbare Gegend, die in späteren Jahren sehr schnell zu einer Wohngegend der Reichen und Schönen, der Stuttgarter High Society mutierte. Ich bin überzeugt, dass mein Vater es später einmal bereute, weggezogen zu sein, denn die Grundstücke stiegen in den kommenden Jahren enorm an Wert. Wir gehörten damals zu den ersten Zuzügern und hätten somit alle nachfolgenden Menschen von Beginn an kennen lernen oder zumindest verfolgen können, wie sich der Stadtteil weiterentwickelt. Rechts und links, auf und ab unserer Strasse wurde gebaut, überall lugten die Kräne in den Himmel und tiefe Baugruben säumten die Strassen. Natürlich bekam ich all das mit meinen zwei, drei, vier Jahren nicht mit. Später sah ich beeindruckende Schwarzweissfotografien und Luftaufnahmen von der Entstehung dieser «Waldsiedlung». Unser Haus war natürlich gross. In der Perspektive eines Kleinkindes ist naturgemäss alles sehr gross – erinnern kann ich mich allerdings nur noch in Einzelteilen. Wenn ich an dieses Haus denke, sehe ich unten ein grosses Wohnzimmer, von wo aus man auf die Terrasse gelangte. Es gab einen Plattensitzplatz, dem eine Wiese folgte und alles von einer Hecke umrandet. Ich denke, dieser Streifen Garten sah bei allen Häusern der Strasse ähnlich aus. Vom Wohnzimmer aus gelangte man über eine Treppe, die im oberen Abschnitt eine Kurve machte, in die oberen Räume. Dort befanden sich das Elternschlafzimmer, das Kinderzimmer und ein Badezimmer mit WC. Ich weiss noch (warum eigentlich?), dass wir zwei WC hatten, eines oben und ein Gäste-WC unten, neben der Haustüre. In unserem späteren Haus hatte wir nur noch ein WC, was in einem Fünf-Personen-Haushalt in gewissen Zeiten zu Stausituationen führen konnte. Und, na klar, wir hatten eine Schildkröte, die immer auf der Wiese herumlief. Eines Tages, noch bevor wir nach Südbaden zogen, war sie verschwunden. Ich glaube, meine Eltern vergassen sie, weil sie noch Winterschlaf machte.
Während meiner Kindheitstage, nachdem wir von Stuttgart nach Südbaden umgezogen waren, teilte ich ein Zimmer mit meiner kleinen Schwester. Wir schliefen im Doppelbett, sie unten, ich oben. Erst als mein älterer Bruder nach Meersburg in ein Internat umzog, übernahm ich sein Zimmer. Die Zeit mit meiner drei Jahre jüngeren Schwester im selben Zimmer war ab einem gewissen Alter richtig schwierig. Die ersten gemeinsamen Jahre waren unproblematisch, weil wir beide klein waren und sie einfach ein ganz herziges Baby und Kleinkind war. Mit zunehmendem Alter unterschieden wir uns in unseren Bedürfnissen, was das Zusammenleben erschwerte. Meine Schwester hatte einerseits ein ganz anderes Temperament als ich, konnte richtig jähzornig und laut werden, anderseits war sie sehr ehrgeizig und sass stundenlang an ihren Hausaufgaben oder sie schlief. Alle ihre «Stimmungen» waren für mich unangenehm, weil dann «mein» Zimmer für mich gar nicht bewohnbar war.
Als ich etwa Zwölf war, ist unser Bruder von zuhause ausgezogen und ich durfte sein Zimmer übernehmen. Das war für mich eine grosse Freiheit. Endlich konnte ich alles so hinstellen, wie ich es wollte, konnte putzen und räumen und umräumen, wöchentlich oder manchmal täglich und niemand störte sich daran oder schmiss wieder alles durcheinander. An meinen Wänden hingen Poster von Winnetou – Pierre Price und Mark Spitz, dem achtfachen Olympiagewinner im Schwimmen. Für beide habe ich geschwärmt. Meine «allerbesten Sachen» standen schön in den Regalen und überhaupt war ich im Gegensatz zu meiner Schwester sehr viel ordentlicher.
Ich glaube, diese äussere Ordnung gab mir Sicherheit in meinem sonst nicht so aufgeräumten Leben. Mein «eigenes» Zimmer lag gegenüber meinem früheren Zimmer und das Fenster zeigte Richtung Eingang und Strasse. Das hatte einen entscheidenderen Vorteil: ich bekam immer rechtzeitig mit, wenn meine Eltern kamen und gingen. Ich konnte zum Beispiel meine unerlaubt fernsehschauenden Geschwister warnen oder schnell das Licht ausmachen. Lesen war zwar erlaubt, aber ich wollte nicht unbedingt noch nächtliche Gespräche führen. Ab einem gewissen Zeitpunkt hatte ich dann leider noch andere Geheimnisse und dabei half mir ebenso das Wissen der an- oder abwesenden Eltern. Eigentlich war mein Zimmer ein ehemaliger Abstellraum mit Öltank und Sicherungskasten, aber als mein Vater ein eigenes Büro benötigte und meines Bruders Zimmer beanspruchte, musste dringend zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden. Kurzerhand kam der Öltank in die Garage, der Abstellraum wurde isoliert und mit Nut- und Federbrettern verkleidet, einen Teppichboden gelegt und, e voila’, ein neues Zimmer ist entstanden. Nachteilig war die fehlende Heizung. Manchmal hatte ich im Winter ganz blaue Lippen und musste mich nach den Hausaufgaben im Wohnzimmer an unserem Kachelofen aufwärmen. Irgendwann später bekam dieses Zimmer auch einen kleinen freistehenden Ölofen, der an manchen Tagen penetrant nach Öl stank. Aber nichts konnte meine Freude über die eigenen vier Wände schmälern.
Die Küche! Zeitweise hasste ich diese Küche. Ich weiß noch gut, wie unsere Küche ausgesehen hat, denn sie hat sich bis heute nur unwesentlich verändert. Der einzige Unterschied und das ist der Entscheidende, ist die Durchreiche von der Küche ins Wohn-/ Esszimmer und natürlich auch umgekehrt. Diese Durchreiche hat in meinen Jugendjahren eine ganz wichtige Rolle gespielt. Sie war der Durchgang, der Eingang, die Öffnung in mein Essstörungsparadies. Ein Tor, das nicht abschließbar war und mich jederzeit lockte. „Komm Margarete, komm und kriech durch mich und Du wirst reichlich belohnt werden“. In dieser Küche begann meine Essstörungskarriere, begann meine über dreißig Jahre andauernde Leidenszeit, begannen meine Schuldgefühle und mein schlechtes Gewissen, begann mein eigenes Versagen und die ultimative Störung des Familienlebens.
Heute ist diese Durchreiche von der Wohnzimmerseite zu tapeziert und dient meiner Mutter von der Küchenseite als Gewürzregal.
Im Rückblick sehe ich meine Mutter, wie sie köstliche Sachen zaubert, wie winzig diese Küche ist und wie sie darin heute immer noch wunderbare Mahlzeiten, Kuchen und Gebäcke herstellt. Wenn ich an diese Küche denke, denke ich an meine Kindheit und die Augenblicke, als wir nach der Schule unsere Haustüre öffneten und es roch im ganzen Haus während der Adventszeit oder vor unzähligen Wochenenden himmlisch nach frischgebackenem Weihnachtsgebäck oder wunderbaren Kuchen.

Sehr gerne besuchte ich Hubert, den Bauer des größten Bauernhofs im Dorf, denn er war auch meine erste „Liebe“. Ich fand ihn ganz großartig, mächtig stark und er nahm mich immer mit dem Traktor mit. Oft war ich bei der Kartoffelernte oder beim Aussähen dabei oder ich durfte sogar bei der Getreideernte mit auf den Mähdrescher sitzen. Auch das konnte Hubert. Abends, wenn wir aus dem Stall kamen oder vom Feld, gabs dann in der großen, warmen und nach Mist und süßer Milch riechenden Wohnküche, in der auf Tisch und Bänken gefühlte zwanzig Katzen und Katzenbabys herumtollten, ein zünftiges Abendbrot. Es bestand aus selbstgebackenem Brot, Butter, die etwas sauer schmeckte, dicken Speckschreiben und einem großen Stück Käse. Dazu bekam ich heißen Kakao, weil ich pure Milch nicht mochte. Alles fühlte sich so gut an. Manchmal waren Martin, mein großer Bruder und ich gemeinsam bei Hubert und seiner Familie und dann fand ich auch meinen Bruder sehr stark, weil er schon mit der Mistgabel den Mist tragen konnte. Er war zwischen acht und zwölf und ich zwischen sechs und zehn. Wenn wir abends glücklich und müde nach Hause kamen, stank alles nach Kuhstall und unsere Mutter schickte uns zuerst in die Badewanne.
Ein weiterer Lieblingsspielplatz war der Rhein und seine Ufer. Der Reiz dieses Abenteuerspielplatzes, von denen ich im vorigen Kapitel schon erzählt habe, endete erst, als ein Schulkamerad von mir im Rhein ertrank. Ich war kurz vor diesem Drama mit ihm und weiteren Dorfkindern zusammen, hatte dann aber keine Lust mehr und wollte lieber mit meiner Freundin ins Schwimmbad nebenan. Während dieser „Spiele“ am Rhein testeten wir die Tiefe des Flusses und standen teilweise bis zum Hals im Wasser. Bruno überlebte diesen Blödsinn nicht, ihn fand man am nächsten Tag im Rechen des Kraftwerkes, welches einige Kilometer flussabwärts liegt.
Ich liebte meine Puppen, Gummitwist, unsere Katzen und hatte eine unglaubliche Fantasie und Kreativität, um Spiele auszudenken. Brettspiele und sonstige Gesellschaftsspiele mochte ich gar nicht, weil die Gefahr bestand, zu verlieren. Verlieren brachte mich schon als Kind aus der Balance. Vor allem dann, wenn der einzige Verlierer immer ich war, denn ich stand auch früher schon für ausgleichende Gerechtigkeit. Wenn andere auch verloren, war mein eigenes Verlieren nur noch halb so schlimm. Mikado und Domino habe ich dafür gerne gespielt und auch Memory, wobei ich bezüglich meines jeweils momentanen Erinnerungsvermögens ganz schnell von meiner kleinen Schwester übertrumpft wurde. Kniffel, das Würfelspiel mochte ich besonders gerne. Vor allem später auf dem Campingplatz. „Risiko“ mochte ich gar nicht! Da hatte ich mal mühsam ein Land erobert, schon kamen die Truppen von einem Mitspieler und nahmen mir alles wieder weg. Das Problem ergab sich vor allem in meinen Zwanzigern in den neunziger Jahren. Damals war „Risiko“ DAS Trendspiel und ich musste mitmachen. Meine ganze Clique damals war nahezu spielversessen und teilweise spielten wir ganze Sonntage lang irgendwelche Brettspiele – mit Vorliebe „Risiko“. Da war ich dann doch sehr froh, wenn die Sonntage sonnig und heiss waren und es hiess: „Ab ins Freibad“ oder in Freiburg gerade das Zeltmusikfestival stattfand, denn dort war hingehen Pflicht.
In unserer Familie gab es massenhaft Bücher, das Lesen wurde gefordert und gefördert und war bei mir, meinen Eltern und meinen Geschwistern sehr beliebt. Lesen eröffnete mir das Reich der Fantasie, meine Vorstellungskraft kannte keine Grenzen, Lesen war für mich der Schlüssel zur Welt.
Meine Eltern besassen Bücher aller Art. Sowohl Krimis (die roten Taschenbücher vom Rowohlt Verlag), Romane und historisch-literarische Werke als auch Fach - und Sachbücher hatten ihren Platz in den Regalen. «Anna Karenina» von Tolstoi oder «Der Archipel Gulag» von Alexander Solschenizyn sind Bücher, an die ich mich gut erinnere, sie aber nie gelesen habe. Das waren einfach zu «dicke Herausforderungen». «Anna Karenina» sah ich später im Fernsehen. Mein Vater war ein begeisterter Imker und interessierte sich eine Zeitlang für die Lebensart der totalen Selbstversorgung. So fanden sich natürlich diverse Imkerbücher und Sachbücher zu Themen wie: «Wie baue ich ein Haus aus Lehm und Stroh» oder «Urban leben und «Autonom gärtnern» oder «Wie halte ich Schafe und Hühner artgerecht?» bis zu «Das kleine Handbuch zum Schlachten von Schweinen». Tatsache ist, dass wir einen kleinen Bauernhof um unser Einfamilienbungalow hielten und der Vater immer irgendwo am Werkeln war. So konnte es passieren, dass mal ein Huhn kopflos um die Ecke kam, aber das ist ein anderes Thema.
Zurück zu den Büchern! Theoretisch durften wir schon die Bücher unserer Eltern lesen, praktisch gab es allerdings ein paar Hindernisse. Das Erste war die Ordnung im Regal. Das Buch musste selbstverständlich wieder dahin zurückgestellt werden, wo es herkam und das funktionierte nicht immer wie am Schnürchen, was unser Vater wenig honorierte. Das zweite Problem war die Krimis, die wir nicht lesen durften und das dritte Problem war, dass der Rest uns, respektive mich, nicht interessierte. Als spannendste Lektüre meiner Eltern fand ich die Zeitschriften «Stern» und «Brigitte», die sich meine Eltern dann und wann kauften. Mit dem «Stern» verbindet mich eine ganz besondere Geschichte, die ich wohl niemals vergessen werde. Dass ich den «Stern» las, war meinen Eltern nicht recht und sie verboten mir das Lesen des Magazins mit der Begründung, ich würde es nicht verstehen, was da geschrieben wurde. Also tat ich es heimlich und meistens war es vor allem politisch und ich verstand wirklich nichts. Doch an einem Abend stiess ich in einer dieser heimlichen Ausgaben auf das Thema «Der Exorzist». Ich las und las und wurde immer aufgeregter, denn da stand geschrieben, dass «…der Teufel auch bald nach Deutschland käme.» In der darauffolgenden Nacht hatte ich einen schrecklichen Alptraum und wachte total verschwitzt auf. Wach und angsterfüllt lag ich in meinem Bett und traute mich vor lauter Angst nicht mehr zu bewegen. Nur in den Momenten, da ein Flugzeug über unser Dach flog (wir wohnten in der Nähe des Zürcher Flughafen) atmete ich durch, weil der Fluglärm alles übertönte und mir so vertraut war, dass ich mich getraute, mich zu bewegen. Immerzu dachte ich an den Teufel, der bald nach Deutschland kommen wird. Das konnte doch nicht sein, denn wenn das wirklich passieren würde, hätten die Eltern etwas gesagt. Meine Fantasie ging völlig mit mir durch. Das Dumme war, dass ich mit meiner Mutter nicht darüber reden oder sie fragen konnte, weil ich ja etwas Verbotenes getan hatte. Also musste ich mir selbst Klarheit verschaffen und nach langer Überlegung und «Drumherumgetanze» nahm ich am nächsten Tag die Zeitschrift, schlug den Artikel nochmal auf und las ein zweites Mal, wie der Teufel Besitz von einem Mädchen nahm und sie zwei Meter über der Matratze schweben liess. Das war abgebildet. Dann las ich mutig weiter und langsam löste sich meine Beklemmung, denn es handelte sich um einen Kinofilm «Der Exorzist» mit Linda Blair und der Film kommt demnächst nach Deutschland in die Kinos. Aus lauter Scham habe ich diese Geschichte – zumindest damals – niemandem erzählt. Tja, so habe ich auch die Lektion gelernt und einige Zeit keinen «Stern» mehr gelesen. Am liebsten waren mir meine eigenen Bücher und davon hatte ich mehr als genug.

Meine Geschwister und ich waren in der glücklichen Lage, dass unsere Mutter Hausfrau und damit zuhause war, wenn wir aus dem Kindergarten oder von der Schule kamen. Ich empfand das als sehr schön, denn ich wusste, dass das nicht bei allen Kindern so war. Ich hatte eine Schulkameradin, die zeitweise auch meine Freundin war und sie kam immer in eine leere Wohnung nach der Schule und musste sich und ihrem jüngeren Bruder das Essen vom Vorabend aufwärmen. Der Vater war Portugiese, die Mutter Deutsche und beide arbeiteten Schicht. Bei ihr erfuhr ich, was es bedeutete, ein «Schlüsselkind» zu sein.
Wenn unser Vater und wir Kinder nach der Schule gemeinsam nach Hause fuhren und wir dann das Haus betraten und es nach Essen oder Gebackenem duftete, war für mich die Welt in Ordnung. Erst mit der Pubertät im Alter von 15 / 16 Jahren änderte sich das und ich kam nicht mehr gerne nach Hause. Dann nämlich, als ich ein latent schlechtes Gewissen hatte, ob dem, was meine Mutter eventuell im Laufe des Vormittages herausgefunden haben konnte. Trotzdem waren wir nicht überbehütet. Es gab auch Abende, an denen meine Eltern eine Einladung hatten, irgendwohin ausgingen oder beide an Vereins- oder Gemeinderatssitzungen waren. Dann waren wir allein. Wir hatten nie einen Babysitter, die auf uns aufpasste. Bis auf ein, zwei Vorkommnisse, vor allem in ganz jungen Jahren, ging das immer gut. Meine Mutter erzählte mir, dass mein Bruder an einem dieser Abende brechen musste. Er muss 5 oder 6 gewesen sein, meine Eltern waren auf Besuch irgendwo in der Nachbarschaft und dachten wohl, wir Kinder würden ruhig schlafen. Das taten wir ja auch, aber in dieser Nacht muss es meinem Bruder aus irgendeinem Grund schlecht geworden sein. Nachdem nun sein ganzes Bett voll Erbrochenem war, beschloss er seine Bettdecke zu waschen. Also nahm er das Bettzeug und stecke es in die Badewanne und lies Wasser darüber laufen. Das hatte er wohl schon einmal bei Mutter so gesehen. Als meine Eltern nachts nach Hause kamen stand das Badezimmer unter Wasser und mein Bruder schlief seelenruhig ohne Bettdecke in seinem Bett. Ein anderes Mal waren wir zu Besuch bei Freunden meiner Eltern. Ich war auch erst 6, 7 oder 8 Jahre alt. Nachdem wir den Tag miteinander verbracht hatten und auch das Abendbrot fertig war, beschlossen die Erwachsenen noch auf einen Absacker in eine Bar zu gehen. Wir Kinder mussten ins Bett. Vielleicht war ich auch allein mit meinen Eltern dort. Jedenfalls kann ich mich erinnern, dass ich mitten in der Nacht aufwachte, völlig orientierungslos im Zimmer herumtappte und plötzlich schreckliche Angst bekam, weil ich befürchtete, die Eltern wären ohne mich weg gefahren und hätten mich zurück gelassen. Oder sie würden nicht mehr zurück kommen. Ich weinte so lange, bis ich endlich den Schlüssel in der Türe hörte.
Trotz der vereinzelt traumatischen Situationen war ich grundsätzlich ein unerschrockenes, optimistisches und immer gut gelauntes Kind. Bis zum Alter von 13 / 14 Jahren befand ich mich wirklich in meiner kindlichen Mitte. Ich kann sicher sagen, dass ich eine schöne Kindheit hatte, obwohl ganz vieles in unserer Familie nicht im Lot war. Meine Eltern stritten oft, mein Vater entfernte sich mehr und mehr aus der Familie. Aber das bekam ich, bis auf wenige Situationen nicht mit. Manchmal sah ich meine Mutter weinen und vor allem in meiner älteren Kindheit verstand ich, dass etwas nicht stimmt bei uns. Vielleicht hat sich in solchen Momenten in meinem Unterbewusstsein etwas Schadhaftes eingefressen, denn plötzlich kehrte sich mein Leben und das lag nicht nur an der Pubertät. Sicher kann die Pubertät Spannungen verstärken aber solche Erschütterungen passieren nicht nur durch das „normale“ Erwachsenwerden. Was mir sicherlich am meisten Angst machte und was ich wohl auch permanent spürte, mir aber zunächst nicht bewusst war, war die Ablehnung unseres Vaters. Das Gefühl zu haben, mich unsichtbar machen zu müssen oder im Wege zu stehen oder „die Türe von außen zuzumachen“ gab mir den Eindruck der Unerwünschtheit. Ständig gab es Krach, weil wir zu lange duschten oder überhaupt duschten, und damit warmes Wasser verbrauchten. Auch gab es Butter nur für die Erwachsenen, wir Kinder assen Margarine. Wenn es Hühnchen gab, bekam ich immer den Hals oder einen Flügel, obwohl ich so gerne auch mal ein Bein gehabt hätte. Für die Erwachsenen gab es Coca-Cola mit Chips oder Nüsschen. Wir Kinder tranken Wasser mit Sirup, die Knabbersachen wurden weggeräumt. Es gab immer diese Unterschiede, die uns vor Augen führten, dass wir scheinbar weniger wert waren als die Eltern. Wie dankbar wir sein mussten, überhaupt mit am Tisch sitzen zu dürfen. Als Kind realisiert man das nicht, als Halbwüchsige dann mehr und mehr und teilweise konnte das Verhalten meines Vaters gefährliche Züge annehmen. Dann nämlich, wenn es darum ging, wie wir (oder ich) mit vierzehn, fünfzehn, sechzehn Jahren vom Geburtstag oder irgendeiner Party der Freundin hin und in der Nacht wieder heimkam. Die Meinung meiner Eltern war: „Wenn du da hinwillst, musst du selbst schauen, wie du wieder heimkommst“. Das Problem war, wenn man so tief auf dem Land wohnte, waren alle Möglichkeiten immer weit weg. Mit 16 besuchte ich die 25 km entfernte Schule in Waldshut und meine Schulkameradinnen waren allesamt aus dem weiteren Umkreis der Stadt. Da begann ich zu trampen.

Wenn ich an meine Mutter denke, rieche ich zuallererst ihren frisch gebackenen Kuchen. Ich sehe meine Mutter mit roten Wangen, Teig knetend und rührend in der Küche stehen, sehe eine kleine, liebenswerte, sehr kommunikative und politisch interessierte ältere Dame vor mir. Nein, nicht eine Dame, eine sehr bodenständige, praktisch veranlagte Frau, die ihr Herz so was von auf dem rechten Fleck hat. Das Leben meiner Mutter ist geprägt von den Kriegserlebnissen ihrer Eltern, die Anthroposophen waren und somit auf der „grau-schwarzen Liste“ der Nationalsozialisten standen. Meine Mutter wuchs am Bodensee auf. Zuerst in Friedrichshafen, wo sie ausgebombt wurden, dann in Bodnegg, wo sie wieder ausgebombt wurden und zuletzt in Ravensburg, wo ein bescheidenes Familienleben möglich war. Meine Mutter war zwei Jahre alt, als der Krieg ausbrach. Sie erzählt heute, sie erinnere sich vor allem daran, dass die Familie ständig in den Luftschutzkeller eilte. Das Bodenseegebiet war ein bevorzugtes Angriffsziel der Alliierten, da Friedrichshafen der Sitz des Flugzeugherstellers Dornier (früher Zeppelin-Luftschiffe) war. Die Produktionsstätten elementarer Rüstungsindustrie waren der Grund dafür, dass insgesamt elf Luftangriffe auf Friedrichshafen zwischen Juni 1943 und Februar 1945 durchgeführt wurden (Wikipedia: Friedrichshafen). Während des Zweiten Weltkriegs wurde Friedrichshafen zu zwei Dritteln zerstört, es musste daher in den 1950er Jahren fast komplett neu aufgebaut werden. Aufgrund dieser Ereignisse und den persönlichen Erlebnissen meiner Großeltern, die nur knapp einer Verhaftung durch die Nazis entgingen, war ihre politische Einstellung seit jeher sozialdemokratisch, pazifistisch und immer auf der Seite der Schwachen. Ich bewundere sie dafür, wie sie sich in der Gemeinde engagierte. Sie war für die SPD lange Jahre im Gemeinderat, bis heute ist sie in der Partei und bringt sich bei Events ein, wie dem 1. Mai oder Open-Air-Film-Nächte, um Stimmen und natürlich Geld für die Partei zu sammeln. Meine Mutter saß in der ersten Reihe, als es um die großen Flüchtlingsströme ging, die 2015 nach Deutschland kamen. Wo, wie und wieviel Flüchtlinge werden in der Gemeinde aufgenommen? Wer kümmert sich um sie? Sie gründete gemeinsam mit Mitstreitern ein Begegnungscafé für Flüchtlinge, Helfer und Menschen aus der Gemeinde. Sie buk unendlich viele Kuchen für Kaffeestuben in der Schule, war im Freiwilligendienst des Spitals Waldshut, engagierte sich sehr für die Entstehung eines Kinder- und Jugendheims für schwer erziehbare Kinder im Dorf, was dann leider dem Widerstand der konservativeren Dorfseite (oder ängstlicheren?) zum Opfer fiel. Für diesen Einsatz wurde sie von den Gegner-Eltern und Großeltern persönlich angegriffen, worüber sogar die Medien berichteten. Auf der anderen Seite war meine Mutter in jungen Jahren eine schwache Frau. Ich empfand es jedenfalls so, denn sie setzte den Launen meines Vaters kaum etwas entgegen. Später sagte sie mir, sie stand immer zwischen uns und ihrem Mann und musste ausgleichen. Er war so oft schlecht gelaunt, schrie herum wegen Nichtigkeiten, war oft übermüdet, vielleicht auch permanent unzufrieden und unglücklich, was er dann ja auch änderte. Das Einzige, was ich meiner Mutter vorwarf und was ich nie verstand war die Tatsache, dass sie sich nicht früher von ihm trennte. Als ich mit ihr einmal darüber redetet, meinte sie, wir wären einfach noch zu klein gewesen, sie hätte den Mut nicht gehabt, sie hätte sich einfach nicht vorstellen können, wie sie uns ernähren sollte.
Als meine Mutter die Scheidung einreichte, war ich 24 Jahre und längstens aus dem Haus. Mein Bruder 26 und meine Schwester war in Paris. Nie vergesse ich die Situation, als ich 1986 aus Freiburg mit meinem damaligen Freund zu ihr zu Besuch kam. Meine Besuche waren damals äußerst selten. Hatte sie mich vorher angerufen? Bei unserer Ankunft fanden wir sie weinend und sehr verzweifelt auf der Gartenterrasse. Sie erzählte uns, dass sie meinen Vater rausgeschmissen hätte, sie habe genug von seinen „Bums-Reisen“. Damals habe ich ihre Angst gespürt: wie soll es weitergehen? Sie hatte keinen blassen Schimmer von irgendwas, war immer Hausfrau, nie berufstätig, das ganze sonstige Leben wurde von meinem Vater geregelt. Sie konnte nicht einmal eine Überweisung tätigen, sie hatte keinen Zugriff auf sein Bankkonto. Mein Vater hatte meine Mutter immer klein gehalten und sie ließ es mit sich geschehen. Vermutlich war das ihre Komfortzone.
Es gibt Geschichten aus ihrer Ehe, die meine Mutter heute noch beschäftigen, worüber ich jedoch nur den Kopf schütteln kann. Der Tennissport war in Kanada und den USA schon lange ein Trend, als kanadische Freunde meiner Eltern Anfang der Siebziger die Idee hatten, in unserem Dorf einen Tennisclub zu gründen. Meine Eltern waren jung und innovativ (mein Vater ja für alles Neue sofort zu haben) und so gehörten sie zu den Gründungsmitgliedern dieses Tennisvereins. Meine Mutter lernte Tennis und bekam mehr und mehr Spass daran und irgendwann hatte sie meinen Vater sowohl bei der Freude am Tennisspiel als auch in ihren sportlichen Erfolgen überholt. Die Tennismannschaft der Frauen stieg in die Regionalliga auf und mein Vater stieg aus dem Tennisverein aus. Seine Interessen hatten sich verschoben zum Imkern und Spargelanbau und anderem mehr. So ergab es sich, dass meine Mutter irgendwann auch in den Vereinsvorstand gewählt wurde und dort dann zur 1. Vorsitzenden aufstieg. Sie engagierte sich über viele Jahre hinweg für ihren Tennissport, an manchen Sommern sahen wir sie an den Wochenenden nur marginal, weil sie von Turnier zu Turnier reiste. Mein Vater ließ sie machen, fand es aber nicht so lustig, dass sie so oft nicht zuhause war. Mein Vater war nie eifersüchtig. Für ihn stimmte alles, solange er sein Nest hatte und trotzdem seine eigene Freiheit ausleben konnte. Nachdem sowohl die Frauenmannschaft als auch die Männer regional und überregional so erfolgreich spielten, und Städte wie Singen oder Konstanz zu Turnieren in unser Dorf anreisten, wurde der Ruf nach einem ordentlichen Clubhaus laut. Bisher „hauste“ der Club nur in einem ausrangierten Wohnwagen, zum Duschen mussten die Spieler ins nahegelegene Schwimmbad. Der Standort der Tennisplätze direkt am Rheinufer war damals kein Problem, denn „Uferschutz“ oder „Brutgebiete der Wasservögel“, solche Überlegungen waren zu Beginn der siebziger Jahre, als der Gemeinderat den Bau zweier Tennisplätze genehmigte, überhaupt kein Thema.
Mittlerweile hatten sich die Bestimmungen jedoch geändert und somit wurde der Bau eines Clubhauses jahrelang untersagt. Die Gemeinde wollte nicht noch mehr „Wildwuchs“ da unten. Was die Männer des Vorstandes in fünfzehn Jahren nicht geschafft hatten, wurde ausgerechnet dann realisiert, als nur Frauen den Vorstand stellten. Mit einer Eselsgeduld, etlicher Überzeugungskraft und weiblichem Charme, einem ausgeglichenen Budget und enorm viel Eigenarbeit, schafften es die Frauen, ein wunderbares Clubhaus zu bauen. Ich weiß noch, wie stolz meine Mutter damals war. Anlässlich der Einweihungsfeier hielt meine Mutter die obligatorische Rede und war vorher mächtig aufgeregt, denn Ansprachen vor Publikum waren nie ihre Stärke gewesen, ganz abgesehen von der fehlenden Übung. Auch mein Vater war anwesend und folgte ihren Worten. Als sie alles gesagt hatte und viel Beifall erhielt, war der einzige Kommentar meines Vaters: „Mensch Inge, jetzt hättest Du Dich selbst mal hören sollen, was Du für einen Mist erzählt hast.“ Donnerwetter, er war sowas von eifersüchtig auf ihren Erfolg! Wie enttäuscht und traurig sie war, dass solch ein hässlicher Kommentar ausgerechnet von ihrem Ehemann kam, kann man nur erahnen. Damals ist in ihr etwas zerbrochen und Stückchen um Stückchen ist in den nachfolgenden Jahren dazu gekommen. Wenn ich an meine Mutter denke, sehe ich eine Frau, die alles, was sie machte, mit Überzeugung tat. Ihr Leitsatz wurde später auch mein „Innerer Antreiber“. “Wenn Du was machst, dann mach es richtig“. Der Hang zur Perfektion.
Wenn ich an meine Mutter denke, sehe ich sowohl ihre Mutter als auch mich selbst. Wir sind und sehen uns ähnlich und doch unterscheiden wir uns in vielen Belangen, was wohl dem Zeitgeist geschuldet ist. Meine Mutter litt unter ihrer Mutter. Sie fühlte sich ungeliebt, nicht akzeptiert und nicht der Familie zugehörig. Sie galt als oberflächlich, weil sie nicht, wie ihre ältere Schwester dem Geist der Anthroposophie folgte. Meine Mutter mochte nicht lesend oder musizierend ihre Freizeit verbringen, sondern in Gesellschaft, mit den Freunden. Sie liebte praktische Dinge, zog sich modisch im Stil der Fünfziger an und war einfach eine junge Frau, die das Leben liebte. Weil sie schon als junges Mädchen Interesse am Kochen zeigte, bereits mit Dreizehn Jahren die sonntäglichen Kuchen buk, fanden meine Großeltern, sie müsse eine Ausbildung als Hauswirtschafterin machen, welche sie nach einem Jahr Sprachschule in Vevey in der Frauenfachschule in Stuttgart begann. In dieser Zeit lernte sie meinen Vater kennen, der sich intensiv um sie bemühte. Es kam, wie es kommen musste, noch unverheiratet, aber schwer verliebt wurde meine Mutter mit meinem Bruder schwanger. Was für ein Familiendrama!! Sie wurde geächtet, bloßgestellt, ihr ungeborenes Kind wurde von ihrer Mutter als „uneheliches Balg“ bezeichnet und „ach ja, sie haben es ja alle gewusst, dass es mal so mit ihr kommen würde“. Aber meine Eltern liebten sich, heirateten im November 1960, die Geburt meines Bruders war im Mai 1961 und meine Mutter sagte später, dieses Kind war ein Kind der Liebe und sie würde es immer wieder wollen. Seit diesem Ereignis, wandte sich meine Mutter vollends von ihrer Mutter ab. Ja, meine Oma war manchmal herzlos, ohne es zu merken. Sie war ein Kopfmensch durch und durch und vergab ihre Sympathien nach Leistung. Auch bei ihren Enkelkindern. Ich liebte meine Mutter immer, früher wie heute, als Kind war sie meine Sicherheit und manchmal überkam mich ein Sturm der Liebe, worauf ich mich ganz fest an sie drückte. Trotzdem war ich als Jugendliche und in jüngeren Erwachsenenjahren oft enttäuscht von ihr. Ich fühlte mich übergangen, fühlte mich nicht gesehen, unsichtbar, selbstverständlich, bedürfnislos und unwert. Sie hatte meinen 18 ten Geburtstag vergessen, was ich ihr lange nicht verzeihen konnte. Wenn ich an meine Mutter denke, denke ich, sie begleitet mich schon mein ganzes Leben.

Wenn ich an meinen Vater denke, denke ich als erstes an ganz viel Emotionen. Und das, wo er doch Emotionen so verabscheute. Wo soll ich anfangen? Mein Vater hat mich mein Leben lang beschäftigt und tut es auch jetzt noch. Ich liebte und ich hasste ihn, hatte Mitleid mit ihm und lehnte ihn ab, war wütend und vergab ihm. Er ließ mich alle meine Gefühle spüren und erst in den letzten Jahren gelang es mir, ihn (fasst) loszulassen. Heute erinnert er sich an vieles nicht mehr, vielleicht ist das seinem Selbstschutz geschuldet, um nicht durchzudrehen. Mein Vater war sehr jung, als er Vater wurde, zu jung und zu unerfahren, um Verantwortung für eine Familie zu übernehmen und, wie sich später herausstellte, lernte er in dieser Beziehung auch nichts dazu. Die Kindererziehung überließ er im Großen und Ganzen den Müttern. Nach unserer Mutter gab es eine weitere Frau in seinem Leben, mit der er nochmals Vater wurde, ich habe also noch einen Halbbruder. Mein Vater ist ein Jahr und vier Monate jünger als meine Mutter, somit war er bei der Geburt meines Bruders noch keine 24 Jahre alt. Damals war er sehr stolz auf seine Familie, obwohl meine Eltern aufgrund der ungeplanten Ankündigung meines Bruders heiraten mussten. Für meinen Vater war das nicht der schlechteste Weg, hingegen hätte meine Mutter gerne noch ein paar Jahre arbeiten und eigenes Geld verdienen wollen. Mein Vater wurde während der Kriegsjahre in mehr oder weniger bescheidenen Verhältnissen geboren. Seine Mutter war eine einfache Frau, schwäbisch fleißig, bescheiden, sparsam um nicht zu sagen schon fasst geizig, ohne viel Geld im Hintergrund aber mit Land, ein Einzelkind aus einer evangelischen Familie stammend mit den damals üblichen Werten und sehr verliebt in meinen Großvater. Der wiederum, kam aus einer großen Familie, er selbst hatte zwei Brüder und zwei Schwestern und einige Cousins und Cousinen. Die Herkunftsfamilie meines Vaters lebte finanziell ebenso bescheiden, jedoch besaßen die Eltern meines Großvaters verschiedene Grundstücke in und um Stuttgart, die später auf die Brüder verteilt wurden. Die Schwestern gingen leer aus, sie waren ja nur Mädchen und die Eltern dachten wohl, sie heirateten sowieso. Dem war aber nicht so. Luise, die ältere Schwester wurde Diakonissin (durch sie kam ich für eine Ausbildung in das Diakoniekrankenhaus in Schwäbisch Hall) und die jüngere, sie hieß Rösle oder Rose, arbeitete bei ihrem Bruder Fritz auf seinem Bauernhof als Magd. Beide heirateten nie. Der andere Bruder Gotthold war Pietist, was eine protestantische Erneuerungsbewegung war, die sich durch eine besondere, gefühlsbetonte Form der Frömmigkeit auszeichnete. Aufgrund seiner Haltung wurde er von der Kirche als Missionar in besonders arme und vermeintlich entwicklungsbedürftige Ecken der Welt verschickt und landete so in Papua-Neuguinea. Dort lernte er seine Frau, eine Finnin kennen und verlebte die meiste Zeit seines Lebens im Ausland. Der Vater meines Vaters war der einzige Sohn, der eine fundierte Ausbildung als Werkzeugmacher absolvierte. Als meine Großeltern sich kennenlernten, plante mein Großvater bereits, sein Glück in den USA zu suchen. Böse Zungen aus der Familie behaupteten später, er hätte eigentlich noch keine Heiratspläne gehabt und meine Großmutter hätte es nur darauf angelegt, ein Kind von ihm zu bekommen, um ihn an sich zu binden. Ich glaube, dieser Mann war die große Liebe meiner Großmutter und sie nahm für ihn alles in Kauf. Auch die Tatsache, dass sie mit ihm in den USA leben würde. Wie dem auch sei, noch vor Beginn des zweiten Weltkrieges verließen meine Großeltern Deutschland und ließen sich nach einer langen Reise in Sycamore / Illinois nieder, wo mein Großvater einen Job bei Caterpillar fand. Im Oktober 1938 gebar meine Großmutter ihren gemeinsamen Sohn, meinen Vater. Leider währte das Glück nicht lange. Nur kurze Zeit später starb mein Großvater an Tuberkulose und meine Großmutter Emma entschied, nicht allein in dem fremden Land zu leben und kehrte mit einem sechs Wochen alten Kind wieder nach Deutschland zurück. Das war sicher keine gute Idee, denn in Deutschland herrschte Krieg, Armut und Hunger und die Verwandtschaft ihres Mannes waren der Emma auch nicht gerade wohl gesinnt. So lebten sie und ihr Sohn die nächsten Jahre äußerst bescheiden. Meine Oma „war in Stellung“, hatte also eine schlecht bezahlte Stelle als Haushaltshilfe und mein Vater war ihr Ein und Alles. Ich weiß nicht, ob aus Armut oder aus falsch verstandener Liebe, doch mein Vater schlief die ersten sieben Lebensjahre tatsächlich mit meiner Großmutter in einem Bett. Dann lernte sie Emil kennen. Emil war ein sehr bodenständiger Mensch, sowohl vom Aussehen als auch von seiner Art war er das genaue Gegenteil ihres verstorbenen Mannes, hatte ein Organ, so laut wie eine Trompete und war Gipser von Beruf. Emil, ein Handwerker durch und durch, konnte in dem Haus, welches meine Großmutter mittlerweile geerbt oder gekauft hatte, nützliche Dienste erweisen. War es Liebe? Ich glaube nicht aber meine Oma dachte sicherlich auch praktisch und eine Witwe mit Kind war nicht gerade der große Wurf auf dem Heiratsmarkt. So war sie froh, dass da einer war, der zu ihr stand. Das war dann der Zeitpunkt, an dem mein Vater zum ersten Mal sein eigenes Bett und damit vielleicht auch den ersten Knacks bekam. Die nächsten bitteren Erkenntnisse folgten auf dem Fusse, denn innerhalb kürzester Zeit bekam er drei Halbgeschwister und war ab sofort nicht mehr die Nummer Eins. Von Emil wurde er, gemäß meiner Mutter, nie väterlich geliebt. Auch seine eigenen Kinder hatten es bescheiden gut mit ihrem Vater. Grundsätzlich war er sicher nicht der schlechteste Ehemann und Vater aber bei seinen Kindern neigte er zu Schlägen, was in dieser Zeit wohl völlig normal war. Eigentlich hatten sich mein Vater und der Rest seiner Familie niemals viel zu sagen, was dazu führte, dass mein Vater seinen eigenen Weg ging und wenn nötig, Trost bei seiner „Vater-Verwandtschaft“ und den Pfadfindern suchte und auch fand und ansonsten sein „Reise-Gen“ weiterentwickelte. Diese Familiensituation und die für ihn ab seinem 20. Lebensjahr durchlebte, für ihn unsägliche Zeit beim amerikanischen Militär waren die Ausgangspositionen, als er meine Mutter kennen lernte und selbst eine Familie gründete. Nirgends angekommen, jung, mit ersten Erschütterungen in seinen Grundmauern und doch voller Enthusiasmus und Liebe zu meiner Mutter (oder war es eher das Bedürfnis nach einem Nest?) starteten er und meine Mutter im November 1960 ihr gemeinsames Leben. Da war er 22 Jahre. Ich kann mich nicht erinnern, dass unser Vater wirklich liebevoll zu uns war. Nein, vielleicht war es eher so, dass er ausgesprochene Probleme hatte, was Emotionen betraf. Bei jedem Film, in dem eine Kussszene oder gar sexuelle Szenen vorkamen, war seine Reaktion: „Oh, mach doch diesen Mist aus.“ Er war da oder nicht, hatte schlechte oder gute Laune, war zugewandter oder stieß uns ab. Mein Bruder litt darunter, ich noch mehr und meine Schwester entwickelte einen schulischen Ehrgeiz, der in unserem Dorf seines gleichen suchte. Ihr Abitur schloss sie mit der Note 1,2 ab und war dennoch unglücklich darüber. Ich erinnere mich, dass ich ihm zu einem seiner Geburtstage einen Gutschein schenkte. 5- oder 10-mal Autowaschen. Das tat ich nur, um seiner Zuneigung willen. Ich erreichte ihn trotzdem nicht und auch niemals später. Sein Spruch war immer: „Margret mach die Türe zu, aber von außen.“ Geh weg, bleib weg und komm nicht wieder. Lass mich in Ruhe. „Was redest Du für einen Mist“. „Jetzt halt doch einfach mal Deinen Mund“.
Mit Fünfzehn habe ich ihn gehalten. Auch beim Essen und zum Essen. Für kurze Zeit entwickelte ich eine Magersucht. Meine Mutter versuchte einen Ausgleich, aber auch sie litt natürlich an seinen sehr seltenen Zuneigungsbekundungen. Einmal erzählte sie mir, wie schlimm sie sein Verhältnis zu uns Kindern empfand, als wir an einem fürchterlichen Regentag patschnass von der Schule heimkamen und ihr erzählten, dass unser Vater mit seinem Auto an uns vorbeigefahren war, ohne anzuhalten. Für meinen Vater waren wir Konkurrenten bei der Verteilung der Aufmerksamkeit unserer Mutter und vielleicht auch der, der anderen Menschen und dem Dasein des Lebens überhaupt. Er wollte immer, dass wir uns irgendwie entfernen, nicht auffallen, nicht dabei sind, nicht mitreden, nicht fragen, uns an nichts beteiligen, nichts kosten, keine Rechte haben und schon gar keine Forderungen stellen. Wir waren immer „die Jungen“. Wir waren nicht seine Kinder, die man bedingungslos liebt und denen man den Rücken stärkt und bestmöglich auf ein Erwachsenenleben vorbereitet. Nein, wir waren „Die Jungen, die ein Klotz am Bein sind und nur kosten“. Mein Vater hatte immer die Vorstellung, er verdient das Geld und deswegen hat auch nur er das Recht, es auszugeben. Alle anderen sind rechtlos und sollten dankbar sein, um jeden Pfennig, den er uns, aber vor allem unserer Mutter gnädiger Weise zukommen ließ. Immer war das Geld ein Diskussionsthema und oft ein Streitthema. Damals war dies alles normal für mich. Ein Vater der ständig entweder schimpfte oder seine Ruhe haben wollte und uns fortschickte oder ganz abwesend ist und eine Mutter, die nicht glücklich oder auch abwesend war. Ich litt offensichtlich nicht darunter, denn ich kannte nichts anderes. Unbewusst sicher schon, denn dass es anders sein konnte, sah ich bei meiner Freundin. Deren Vater lobte und freute sich an seiner Tochter und ich spürte auch seinen Stolz auf sie. Hinterfragt habe ich die Unterschiede nicht, denn es war halt so.
Paradox war die Tatsache, dass mein Vater unter seinen Schülern ein ausgesprochen beliebter Lehrer war. Er war unkonventionell, wich hin und wieder vom gängigen Stoffplan ab, unternahm - soweit genehmigt - abenteuerliche Reisen mit ihnen, wie beispielsweise Skiferien in den Südtirolern Alpen und unterstützte die Dorfjugend bei der Gründung eines Jugendclubs und der Berufsfindung. Außerdem stellte er sich als Englisch-Dolmetscher bei einer deutsch- / thailändischen Hochzeit zur Verfügung, für die er von einem Bräutigam angefragt wurde, der seine Frau aus einem Katalog bestellt hatte. Er war der Meinung leben und leben lassen, während der große Rest der Dörfler sich darüber empörte. Ich fand das äußerst mutig von ihm. Ab der fünften Klasse war ich Schülerin an derselben Schule, an der mein Vater Lehrer war und im siebten und achten Schuljahr unterrichtete er mich kurzzeitig in Chemie und Religion. Ich war mächtig stolz auf ihn. Deswegen erkannte ich damals sein Versagen als Vater nicht, es musste ja alles so sein. Vieles habe ich erst im Nachhinein verstanden, nachdem ich schon lange von zuhause weg war und mich durch mein eigenes Leben kämpfte.
Mein Vater war nie langweilig. Nein, das war er definitiv nicht. In den Jahren zwischen meinem Zehnten und dem Ende meines Sechzehnten Lebensjahrs also, bis ich mein Elternhaus verließ, war er Lehrer, Landwirt, Imker, Häuslesbauer und Auswanderer. Wir hatten Schafe, Ziegen und Geißen, ein Schwein, einen Hund, unzählige Katzen, zig Hühner, einige Angora Hasen, etwa hundert Stallkaninchen, drei Hamster, ein Meerschweinchen und hundert Bienenvölker. Ich hütete Schafe mit einem unangenehmen Schafsbock, der mich einmal unsanft boxte, pflückte kiloweise Hasenfutter, trank Ziegenmilch, die widerlich schmeckte, entdeckelte Bienenwaben und schleuderte Honig, wurde gefühlt hundert Mal von Bienen gestochen, hielt das Schaf beim Scheren fest und rannte kopflosen Hühnern hinterher, die ich anschließend auch noch rupfen musste. Außerdem strich ich Balken mit Holzschutz und fegte Bauschutt aus neuen Häusern. Ich sah mich in Kanada Schafe hüten, in Neuseeland und Tasmanien auf einer Farm leben und in Italien in einer Marmorfabrik arbeiten. Zwischen all diesen Träumen und Vorstellungen, gab es einen sehr ernstzunehmenden Plan meiner Eltern. Dies war die Übernahme eines Restaurants im Schwarzwald mit Forellenzucht. Der Realisierung dieses Vorhabens waren sie schon sehr nahe, als die Bank einen Strich durch die Rechnung machte. Nach Analyse der Vor- und Vorvorjahresbuchhaltung durch die Bank, erwies sich das Restaurant als Pleitebetrieb, zumal in diesen Jahren bei Inanspruchnahme eines Kredites eine Hochzinszeit herrschte.
Mein Vater war immer auf der Suche nach dem schnellen Glück und Geld. Ausserdem war er nach einer Bewerbungsabsage für die Rektorenstelle (obwohl er im Gegensatz seines Kontrahenten alle Voraussetzungen viel besser erfüllte aber halt nicht katholisch und in der konservativen Partei war) und der Aussicht, einem Chef unterstellt zu sein, dessen pädagogischen und gesellschaftlichen Ansichten er zutiefst ablehnte, maximal frustriert. Ab diesem Zeitpunkt unternahm er mehr und mehr Auslandreisen, welche nicht nur dem Erkunden des Landes und dessen möglichen Lebens-bedingungen galten. Es kamen Reisen hinzu, in denen alles billig war. Billige Hotels, billiges Essen, billige Frauen. Er führte ein Doppelleben und sein bereits schmales Ehe- und Familienleben wurde noch magerer. Meine Mutter begann sich von ihm abzuwenden, als sie herausfand, dass er anstatt, wie er vorgab zum Skifahren in die Berge zu reisen, nach Thailand flog. Seine Skier und die gesamte Skiausrüstung warteten in Frankfurt am Flughafen auf seine Rückkehr. Unerklärlich sauber und trocken waren seine Wintersportsachen, als meine Mutter eine Erklärung von ihm verlangte. Er log, bis sie seinen zweiten Pass fand, der vor allem die Stempel der asiatischen Leichtlebeländer enthielt. Da zog sie die Notbremse. Das war 1986, in meinen Augen zehn Jahre zu spät.
In diesen Jahren fand mein Leben in erster Linie in Freiburg im Breisgau statt. Wie genau, darauf komme ich später zurück, aber es war nicht einfach. In den nächsten zwanzig Jahren war ich mit mir selbst beschäftigt und bekam „et Detail“ die Dinge zuhause nicht mehr mit. 1986 war das Jahr, in dem meine Mutter die Scheidung einreichte und mein Vater nach dem Totalausfall seiner Vertrauenswürdigkeit aus der Ehe und dem gemeinsamen Leben, auszog. Vielleicht hätte meine Mutter nach der Passlüge noch einmal eingelenkt und ihm eine weitere Chance gegeben, welche mein Vater jedoch ein Jahr zuvor anlässlich ihrer Silbernen Hochzeit grausam verspielte. Nach all dem Ärger und der Enttäuschung, die meine Mutter durch seine Soloreisen durchlebte, versprach ihr mein Vater, vielleicht auch bisschen zur Wiedergutmachung aber vor allem aufgrund ihrer Silbernen Hochzeit, eine gemeinsame Reise irgendwo in den Süden. In dieser Zeit handelte mein Vater mit Luxuskarossen, die er in Europa kaufen und in den USA verkaufen wollte – Stichwort: schnelles Geld. Konkret ging es um einen Mercedes SL Cabrio mit allen Schikanen, Kaufpreis gegen 100.00 DM. Mein damaliger Freund durfte diese teure Luxuskarosse nach Bremerhaven fahren, von wo aus das der Mercedes in die USA verschifft und dort von seinem „Companion“ in Empfang genommen werden sollte. Diesen „Kollegen“ kannte mein Vater jedoch nicht persönlich, die näheren Hintergründe weiß ich nicht. Was ich jedoch definitiv weiss, ist, dass das Auto nie am vereinbarten Ziel ankam. Vom Auto und dem Kollegen hat mein Vater nach der Ankunft im Hafen nichts mehr gehört, was ihn zunehmend so beunruhigte, dass auch meine Mutter einsah, dass man das Verschwinden von 100.000 DM nicht so einfach stehen lassen konnte. Also ermunterte sie ihn, das gemeinsame Reisegeld ihrer geplanten Reise lieber dafür zu verwenden, in die USA zu reisen und nach diesem Auto zu suchen. Das musste sie ihm nicht zweimal sagen, bei der nächsten Feriengelegenheit (Lehrer haben ja mehrmals im Jahr Ferienzeit) war er auf und davon. Nein, nicht in die USA, er war auf den Philippinen. Sex, Freiheit und das Gefühl ein ganz „Großer“ zu sein. Ja und das war das Aus seiner Ehe mit meiner Mutter auf immer.
Wenn ich an meinen Vater denke, sehe ich viele Scherben. Wenn ich an meinen Vater denke, fühle ich große Trauer und Beelendung, heute ist Mitleid oder vielleicht auch Wehmut, was früher Wut war. Während der nächsten Jahre hatten wir nur sporadischen Kontakt. Wir schrieben Briefe, wovon ich noch zwei habe. Auch sie beelenden mich. Einige Jahre lang, bis zu seiner vorzeitigen Pensionierung (er wurde von dem älteren Bruder einer seiner Schüler zusammengeschlagen), lebte er mir seiner neuen Familie, Helen und Joshua meinem Halbbruder, in der Nähe von Stuttgart. Einmal habe ich ihn dort besucht, wo er schon wieder mit neuen Ideen aufwartete. Eine Orchideenzucht wollte er aufbauen, wofür er seinem Haus ein mannshohes Gewächshaus verpasste. Ich sah Joshua in den ersten zehn Lebensjahren etwa fünfmal, danach nicht mehr. Heute habe ich keinen Kontakt mehr zu meinem Halbbruder, weil seine Mutter nach der Scheidung von meinem Vater jeden weiteren Kontakt unterband. Mein Vater kehrte wieder zurück auf die Philippinen, wo bereits die nächste Frau auf ihn wartete. In den ersten Jahren seines neuen Lebens auf den Philippinen unterrichtete er an einer Dorfschule englisch. Irgendwann nervte ihn das frühe Aufstehen, worauf er diesen Dienst quittierte. Seit etwa 10 Jahren lebt er nur noch von seiner mehr oder weniger bescheidenen Rente. 2017 habe ich meinen Vater auf den Philippinen besucht und vermutlich war das unsere letzte Begegnung. Jetzt ist er Achtzig, verbringt seine Lebenszeit schlafend, schwimmend, wandernd und ab vier Uhr nachmittags mit Bier und Rum. Er hat vieles vergessen, nichts mehr zu sagen und wartet auf irgendwen oder irgendwas. Alles Glück dieser Welt und noch viel mehr hielt er in seinen Händen, aber gesehen hat er es nie. Für mich war er immer unerreichbar.

Wie bereits beschrieben, war ich nicht gerade ein Kind von Traurigkeit. In frühester Kindheit habe ich gelernt, Probleme möglichst pragmatisch und lösungsorientiert aus der Welt zu schaffen. „Äußerst extrovertiert, keine Berührungsängste und immer das Herz auf der Zunge“, so hatte mich später eine Freundin meiner Eltern beschrieben, nachdem ich sie mit sieben Jahren ganz direkt nach ihrem verstorbenen Kind befragte. Sie hatte eine Todgeburt, worüber damals nur unter vorgehaltener Hand gesprochen wurde, ich das aber irgendwie mitbekommen hatte. Meinen Eltern war das natürlich ausgesprochen peinlich, aber so war ich nun einmal, immer offen und interessiert. Oft im Leben war diese Eigenschaft Fluch und Segen zugleich. Damals, als Kind inmitten den anderen war mir meine Offenheit gegenüber Fremden und Erwachsenen natürlich nicht bewusst. Ich war, wie ich war. Es musste einfach eine Lösung her, wenn man zum Beispiel Lust auf Süßigkeiten hatte, die Mutter aber entweder nichts herausrückte oder nichts Süßes im Hause waren. Grundsätzlich war ich auch sehr neugierig und stattete allen Nachbarn regelmäßig Besuche ab. Ich klingelte, stellte mich zu Beginn artig vor und erklärte, wo ich wohne und wer meine Eltern sind. Da mein Vater Lehrer und Gemeinderat im Dorf war, war die Sache schnell klar und jeder wusste, wo ich hingehöre. In kürzester Zeit hatte ich für alle Bedürfnisse ein Nachbarshaus. Je nachdem pflückte ich auch Blumensträußchen, die ich überbrachte und bei den kinderlosen Nachbarn A. gegen Süßigkeiten eintauschte oder bei der Nachbarin B. dafür das Baby angucken durfte, oder den Hund streicheln oder Chips essen und so weiter. In einem Nachbarshaus habe ich das Schach spielen gelernt. Ich war so bekannt in der Umgebung, dass noch Jahre später sich irgendwelche Leute bei meiner Mutter nach meinem Befinden erkundigten. Sie staunt noch heute, wen ich alles kannte. Durch meine Besuche, mit denen ich die Nachbarschaft beglückte, ergaben sich früher oder später ebenfalls Freundschaften zu meinen Eltern und als ich grösser wurde, durfte ich manchmal Babysitten und mir so ein paar Mark verdienen. Speziell empfinde ich es heute, wie gerne ich Zeit mit Erwachsenen verbrachte. Ihre Gespräche interessierten mich, wissbegierig hörte ich deren Geschichten zu.

Hatte eine Person einen besonderen Einfluss auf mich? Spontan fällt mir zu dieser Frage mein Vater ein. Ja, er hat mein Leben massiv beeinflusst und definitiv nicht nur positiv. Ich habe ihn ja schon ausführlich beschrieben. Und trotzdem möchte ich nochmals wiederholen: während meiner Kindheit war ich in erster Linie stolz auf ihn. Er war Lehrer und seine Schüler mochten ihn. Er war beliebt, weil er sich etwas traute, sich nicht nur in der Komfortzone bewegte, sondern sowohl einen spannenden Unterricht gestaltete (ich weiss das, weil ich selbst in Chemie und Physik bei ihm Unterricht hatte und es ständig stank oder etwas explodierte ), er sich bei den Schulausflügen nicht nur im Raum Südbaden bewegte und den Schülern aktiv zu Lehrstellen verhalf, indem er selbst für die Schwächsten bei den Lehrmeistern vorsprach. Ich war stolz auf ihn, weil er alles andere als langweilig war, auch privat. Wir hatten mit Ausnahme von Kühen und Pferden alle Arten von Tieren, die man in der Landwirtschaft finden kann. Ja, auch ein Schwein und Bienen. Mein Vater war Lehrer, Bauer, Imker, baute drei Häuser, machte weite Reisen, schmuggelte Edelsteine, verkaufte Luxuskarossen, wanderte gedanklich mindestens drei Mal nach Australien, Kanada und USA aus, kaufte sich in eine Marmorfabrik ein, führte eine Gartenwirtschaft, kaufte um ein Haar ein Restaurant im Schwarzwald mit Forellenzucht und vernachlässigte seine Familie aufs Gröbste. Mein ganzes Leben fuhr ich emotional mit meinem Vater Achterbahn. Ich bewunderte ihn, liebte ihn und hasste ihn. Ich hatte Mitleid mit ihm, wollte ihn beschützen und distanzierte mich von ihm, weil ich seine Art mich wegzustossen nicht mehr aushielt. Es gab Zeiten, da er mir einerseits sehr tiefsinnige Briefe schrieb und anderseits stiess er mich per Post ärgerlich weg. Vielleicht zu Recht, denn das war in einer Zeit, als meine Familie mehre Monate nichts von mir hörte, sie nicht einmal wussten, wo ich mich aufhielt und ich ihn nach dieser langen Auszeit um Geld fragte. Immer wieder habe ich mich emotional mit meinem Vater beschäftigt, war traurig, enttäuscht, wütend, freudig, ging auf ihn zu. Erreicht habe ich ihn nie. Heute lebt er auf den Philippinen und den letzten Versuch, Interesse für mich bei ihm zu wecken habe ich vor zwei Jahren unternommen, als ich mit meinem Mann das Land bereist habe. Er hat nicht mal gefragt, was ich so mache.
Eine weitere einflussreiche Person war tatsächlich in der Verwandtschaft zu finden. Mein Großvater mütterlicherseits, den ich leider nicht allzu lange erlebt habe. Er stand mir in meiner Kindheit sehr nahe und später, als ich mit meinem Leben so oft zu kämpfen hatte, erschien er mir wie ein Schutzengel. Tatsächlich hatte ich des Öfteren das Gefühl, er hält seine schützende Hand über mich, besonders dann, wenn ich sehr verzweifelt war. Ich spürte ihn, ich spürte eine Kraft, seine Präsenz, als stände er hinter mir. Das war wirklich unglaublich. Vielleicht ist das die Gabe der Verzweifelten? In meiner Kindheit war ich oft bei den Großeltern am Bodensee und besonders gerne war ich mit meinem Opa unterwegs. Ich habe ihn sehr geliebt, weil er immer lustig war und viele Späße machte. Ansonsten war da niemand mehr. Meine Mutter? Nein, sie war kein Vorbild für mich. Sie war einfach immer da und ich liebte sie und immer noch. Aber als Vorbild war sie ungeeignet. Ich wollte stärker sein, auf eigenen Füssen stehen. Ich glaube, ein wirkliches Vorbild, dem ich nacheifern wollte, hatte ich nie.
Ich weiß nicht, wieviel Sozialisation der Mensch in jungen Jahren lernt und wieviel das Umfeld und die eigene Biografie darauf einwirkt oder inwieweit es sogar möglich ist, sich zum Eremiten zu entwickeln. Tatsache ist, dass ich mit Beginn meiner Liebe, Freundschaft und nun Ehe vor nunmehr 10 Jahren das Gefühl hatte, ich muss Familienleben wieder oder überhaupt erst lernen. Der Zusammenhalt, die vielen Treffen zwischen Eltern und Kinder und einem selbst, die Familienfeste, das Interesse aneinander habe ich nicht mehr gekannt. Ich glaube, das Wichtigste war das Interesse. WIE GEHT ES DIR? Wirklich! Wie es mir geht? DU interessierst Dich für mich? Heute habe ich viele Personen, die mir wichtig sind. Allen voran mein geliebter Mann, meine Mutter, mein Bruder und meine Schwester. Wichtig sind mir aber auch die Personen, die ihnen wichtig sind. Meines Mannes Töchter, meine Schwägerin und Schwager, meine Nichte und mein Neffe. Immer, wenn ich sie sehe (und das ist nicht oft, da alle in der Welt verstreut sind) empfinde ich in erster Linie große Freude und Dankbarkeit.

Unsere Mutter war und ist eine begnadetet Köchin, was jedoch in meiner Kind- und Jugendzeit nicht geheissen hatte, dass ich eine dankbare Esserin war. Im Gegenteil: die Essenszeiten, vor allem das Mittagessen waren für mich meist mit Stress und Ablehnung verbunden. Es gab einfach zu viele Lebensmittel, die ich nicht mochte und aus dem Rest habe ich mir nicht viel gemacht. Essen war unwichtig. Meine Prioritäten lagen bei anderen Dingen und dabei liess ich mich auch ungern unterbrechen, sodass ich etliche Male zu spät zum Essen kam. Ich erinnere mich an unzählige Male, an denen es Bohnen, Kartoffeln, Sellerie und Fisch gab. Dann sass ich bis tief in den Nachmittag allein am Esstisch und versuchte mit viel Wasser das «Zeugs» runterzuspülen, wobei es mir immer wieder der Magen lüpfte. Vor allem Bohnen waren schlimm und von denen hatten wir unendlich viel im Garten. Unsäglich war zudem, dass ich während der Bohnenernte die Bohnen auch noch putzen musste, damit sie eingefroren werden konnten. Unsere ganze Tiefkühltruhe war voller kurzer, breiter und langer Bohnen.
Das Mittagessen war in gewisser Weise der essenstechnische Mittelpunkt in unserer Familie. Täglich brachte meine Mutter ein warmes, wirklich ausgewogenes und hervorragendes Mittagessen auf den Tisch, worauf sich in der Regel alle freuten – manchmal auch ich, wenn es zum Beispiel Pfannenkuchen mit Apfelmus oder Hühnchen gab. Den Stress hatte ich dann, wenn ich aus Prinzip den Teller leer essen musste. Später habe ich dieses Thema ausgiebig mit meiner Mutter besprochen und sie erkannte: «Ja, wir haben so manchen Fehler gemacht, aber das war wohl einer der Gröberen.» Es war noch nicht mal so, dass ich mir die Lebensmittel selbst schöpfte. Das oberste Prinzip meiner Eltern war, dass von allem etwas gegessen oder probiert werden musste. Und dann musste natürlich der Teller leer gegessen werden. Und so kam es, dass ich das eine oder andere Mal noch um 15.00 Uhr nachmittags am Tisch sass und mich mit dem Mittagessen herumquälte. Diese Situationen lassen mich heute, angesichts meiner späteren Biografie, geradezu erschaudern. Aber das war damals wohl ganz normale «Erziehung».
Zum Abendbrot gab es meist «nur» noch Käse-, Wurst- oder Marmeladebrot. Je nachdem, wer welchen Wunsch hatte und wie gross der Hunger war. Wir Kinder assen zusammen, mein Vater früher oder später (je nach Termine und Anwesenheit) und meine Mutter ass manchmal gar nichts oder auch irgendwas. Dazu habe ich einfach keine Bilder vor mir. Sie fand immer, sie sei zu dick und müsse abnehmen, vielleicht habe ich deswegen diese Bilder verdrängt? Solange ich Kind war, also in etwa bis 13 Jahre waren die Mahlzeiten für mich unwesentlich, unwichtig und hatten die letzte Priorität – ausser Pfannkuchen und Apfelkuchen oder, wenn ich etwas selbst backen durfte.
Trotzdem war ich immer gerne zusammen mit meiner Mutter in der Küche, um ihr beim Kochen oder Backen zu helfen. Und trotzdem wurde das Essen in meinem Leben ein über dreissig Jahre andauernder, meist sehr belastender und alles vereinnahmender Lebensinhalt. Ab meinem fünfzehnten oder sechzehnten Lebensjahr bestimmte die Bulimie mein Leben und alles, was danach kommen sollte.

Nun gut! Nachdem ich meine frühesten Kindheitsjahre beschrieben und meine Geschwister am Rande gestreift habe, Einblick in die Leben meiner Eltern gab und auch die Großeltern erwähnt wurden, komme ich jetzt zu dem Lebensabschnitt, der mich und meinen weiteren Lebensweg am nachhaltigsten prägte. Ich schreibe ab sofort nur noch in Jahrzehnt-Schritten, weil sich so die Vielfältigkeit der Jahre einfacher rekonstruieren lässt.
Meine Jahre zwischen Zehn und Zwölf waren, bis auf die normalen Freudinnengeplänkel und der Auszug meines Bruders, zumindest vordergründig, nicht sonderlich ereignisreich. Ich meine vordergründig, weil ich in diesem Alter natürlich mehr und mehr die Ehekrisen meiner Eltern mitbekam. Die Gründe für die Streitereien erschlossen sich mir nicht, ich sah nur meine Mutter manchmal weinen und meinen Vater laut schimpfend davonlaufen. Der laute Vater war normal, aber dass die Mutter weinte, war mehr als sonst und langsam begann ich mir einerseits Sorgen, andererseits ein Gewissen zu machen. Was war mein Anteil am Unglücklichsein meiner Mutter? Meine Gefühlswelt in diesen frühen Teenagerjahren wechselte zwischen den unbeschwerten Stunden mit meinen Freundinnen und Schulkolleginnen und der Spannung, die bei uns zuhause herrschte. In diesen Jahren keimte der Wunsch in mir auf, mein Vater möge doch am liebsten gar nicht mehr nach Hause kommen. Trotzdem möchte ich behaupten, dass ich sicher bis zwölf ein glückliches Kind war. Auf dem Land aufzuwachsen, mit vielen Freiheiten, einer Schule, die mich nur marginal forderte (ich war eine mittelgute Schülerin. Nie wirklich schlecht, aber auch nicht sehr gut. Ich war nicht ehrgeizig, tat das Nötigste und auf Klassenarbeiten lernte ich ein paar Minuten jeweils am Morgen davor, das war’s. Ich würde sagen: einigermaßen intelligent, aber faul oder eher bequem, nicht mehr als nötig), vielen Tieren, Freundinnen und einem riesengroßen Abenteuerspielplatz. Was braucht ein Kinderleben mehr? Über den Auszug meines großen Bruders, der mir im Grunde sehr wichtig war, was mir jedoch erst später so richtig bewusst wurde (und nun, im Erwachsenenalter schätze und liebe ich ihn sehr) war ich mit Zwölf auch nicht sehr traurig, denn er war in dem Alter, in dem er ständig seine Macht in Form von Provokationen demonstrieren musste und darauf konnte ich gut und gerne verzichten. Außerdem war er ja Erstens nicht im Ausland und Zweitens sah ich ihn alle zwei Wochen am Wochenende. Martin wechselte mit Dreizehn in ein Internat nach Meersburg am Bodensee. Diese Entscheidung brachte für alle Familienmitglieder, primär jedoch ihm, nur Vorteile. Der Abstand zu unserem Vater war mehr als nötig, denn er bekam die Wutanfälle meines Vaters am deutlichsten zu spüren. Sobald eine von uns Mädchen wegen der Geschwisterstreitereien heulte, war natürlich der „böse“ Bruder derjenige, der die Konsequenzen tragen musste und mehr und schneller die Hand meines Vaters zu spüren bekam. Manchmal tat er mir richtig leid, obwohl er mich auch bis zur Weißglut ärgern konnte. Auch für meine Mutter war diese Entscheidung eine bedeutende Erleichterung. Einerseits wegen der angespannten Vater-Sohn-Beziehung, anderseits wegen der besseren Zukunftschancen für ihn. Und für meinen Bruder gab es keine andere Option, obwohl er nur mit Ach und Krach die Aufnahmeprüfung schaffte. Er wusste, dass das eine schwere Zeit werden würde, denn eigentlich war er nicht der Abitur-Typ. Alles, aber auch wirklich alles musste er mühsam erlernen, hatte kein Fach, welches ihm leichter fiel. Für Martin war es natürlich die Chance schlechthin und das war ihm sehr bewusst. Er wollte weg vom Vater, weg von seinen kleinen Schwestern (was sich zum Glück später wieder änderte), weg von den Schlägertypen aus dem Dorf, die ihn immer nur striezten, weg von der Lehrerin, die ihm immer eine Fünf in Deutsch gab. Er wollte gemeinsam mit seinen Freunden aus seiner Klasse in eine neue Zukunft schauen. Und für mich? Ja, ich bekam das Zimmer von Martin und das war der Hauptgewinn in diesen Jahren. Endlich ein eigenes Zimmer, endlich konnte ich mich so einrichten, wie ich wollte und die Türe zu machen und keine kleine Schwester macht mehr ein Durcheinander oder wirft mit dem Füller nach mir, weil sie Probleme mit der Mengenlehre hat. Auf der anderen Seite gab es auch keine kleine Schwester mehr, die mich in den Schlaf sang, wenn ich schlechte Träume oder Ängste hatte. Meine kleine Schwester half mir oft über üble Nächte hinweg, sang und summte und vertrieb so die bösen Geister in meinen Gedanken. Mit Zwölf war meine Welt im Grossen und Ganzen in Ordnung.
Meine ganze Kindheit hindurch wurde ich von Tieren begleitet. Nein, nicht nur die Hoftiere unserer Dorfbauern, sondern auch unsere eigenen zwei- und vierbeinigen Mitbewohner, oftmals zugelaufen, meistens aber nur geschenkt bekommen. Wer auf dem Land wohnt, hat irgendwann einmal wenigstens eine Katze. Wir hatten deren acht oder zehn, manchmal gleich zwei oder drei zusammen oder jeweils eine hintereinander. Mein Bruder brachte einmal drei Katzenbabys nach Hause, die er angeblich in einem Stall fand, verlassen von der Mutter, verzweifelt schreiend. Zunächst fand meine Mutter, er müsse sie wieder dahin zurückbringen, wo er sie fand. Die Mutter würde bestimmt nach ihnen suchen. Doch er war sich sicher, dass sie keine Mutter mehr hatten, denn er hätte die Welpen lange schon beobachtet und keine Mutter wäre gekommen. Also gut! So zogen wir die Babys mit dem Fläschchen auf, doch leider verstarb eines der drei schon ziemlich bald. Zwei kamen durch und waren wirklich kleine Rabauken, denen man jedoch anmerkte, dass sie nicht durch ihre Katzenmutter sozialisiert waren. Sie waren nie richtig sauber, machten ständig unter die Betten, blieben tage- und nächtelang weg, sodass wir Kinder sie endlos suchen mussten. Immer wieder gab es aufregende Zeiten wegen der Katzen. Eines Tages lag eine der Katzen tot in einem nachbarschaftlichen Garten. Den Grund haben wir leider nie wirklich erfahren, vermuteten jedoch eine Vergiftung. Die Leute gingen damals achtlos mit Rattengift oder sonstigen Vernichtungsmitteln um. Man machte sich einfach keine Gedanken, dass Katze, Igel und Vögel ebenfalls Schaden nehmen könnten oder stand solchen Kollateralschäden völlig unaufgeregt gegenüber. Das dritte der Geschwister kam auch irgendwann nicht mehr nach Hause, sie wurde nie gefunden. Alles in allem hatten wir die drei Katzenbabys sicher nicht länger als zwei Jahre. Die anderen Katzen bekamen wir von Bekannten meiner Eltern oder Bauern, die ihre Katzenwelpen loswerden wollten. Alle waren nicht besonders alt, als sie entweder starben oder wegliefen. Die letzte Katze, die 1976 oder 1977 zu uns kam, als ich etwa vierzehn oder fünfzehn Jahre alt war und mein Großvater gerade noch lebte, starb 1998. Sie wurde über einundzwanzig Jahre und war auf beiden Augen blind. „Mulle“, die Katze war etwas ganz Besonderes, denn sie begleitete meine Mutter durch die guten und die schlechten Zeiten ihres Lebens. Zweimal bekam sie Junge, bevor wir sie kastrieren ließen. Bei ihrer ersten „Entbindung“ durften wir zuschauen. Sie hatte zwar ein Körbchen mit Decke und allem, was sie benötigte, aber das erste der Welpen gebar sie tot, deswegen suchte sie sich einen anderen Platz. Die fünf oder sechs weiteren, die dann geboren wurden, kamen im Wohnzimmer auf einer Decke im Fernsehsessel zur Welt und das war für uns drei Kinder ein wunderschönes Erlebnis. Im Abstand von mehreren Stunden gebar sie eines nach dem anderen, eingepackt in einen dünnen Hautsack, den sie sofort aufriss und das Baby abschleckte, bevor das nächste kam. „Mulle“ war einfach großartig in ihrer Rolle als Katzenmutter. Liebevoll kümmerte sie sich um ihre Jungen. Da die Katzenmama das Körbchen ablehnte, bekam sie einen Platz im Schrankboden, wo sie sich ein Nest eingerichtet hatte. Eines Tages, als die Welpen schon grösser waren, brachte „Mulle“ eine lebendige Maus ins Haus, damit die Jungen das Mausen üben konnten. Das fand meine Mutter dann doch nicht mehr so lustig und setzte Katzen samt Maus hinaus in den Garten. Wir alle hatten unseren Spaß daran.
Ihren zweiten Wurf bekam sie während der Nacht im Bett meiner Schwester, während sie schlief. Heisa, war das am darauffolgenden Morgen eine Überraschung. Heulend kam meine Schwester aus dem Zimmer, denn ihr ganzes Bettzeug war voller Blut. Sie fand das natürlich gar nicht lustig, obwohl meine Schwester eigentlich stolz sein konnte. Nicht jede Katze möchte neben einem schlafenden Menschen gebären.
„Mulle“ hatte ein gutes und unaufgeregtes Leben. Ihre Rituale ebenso, wie ihre Freuden konnte sie ausleben und wurde auch sonst sehr geliebt. Als sie in hohem Alter auf dem zweiten Auge blind wurde und sich am Ende nur noch wirr im Kreis drehte und gegen die Wände lief, ließ meine Mutter „Mulle“ einschläfern. Sie begrub sie hinter dem Haus im Garten.
Auch ein Hund lebte für eine Zeitlang in unserem Haus. Es war ein Boxer mit Namen „Xiddy“, war nicht besonders schön, aber sehr lieb. Eines schönen Tages brachte unser Vater das Tier von einem Züchter aus Rottweil. Wie so oft, hatten weder meine Mutter noch wir Kinder eine Ahnung von meines Vaters Vorhaben. Natürlich hatten wir Kinder viel Freude mit „Xiddy“, obwohl mich seine Sabberei schon etwas ekelte. Trotzdem gingen wir „stolz wie Oskar“ gerne und jeden Tag mit ihm Gassi. Leider hatte sich mein Vater bei der Anschaffung übers Ohr hauen lassen, denn „Xiddy“ war von Anbeginn krank, was der Züchter wohlweislich verschwiegen hatte. Der Hund hatte die „Staube“, eine Viruskrankheit, die nicht mehr zu behandeln war. Nach nur wenigen Monaten musste Xiddy leider eingeschläfert werden. Wir Kinder waren darüber sehr traurig und gerne hätte wir wieder einen Hund gehabt. Aber es blieb bei Xiddy, unsere Eltern hatten keine Lust mehr auf einen weiteren Hund.
In einem früheren Kapitel habe ich schon einmal vom Traum meines Vaters berichtet, ein komplett autarkes Leben zu leben, was Gartenbau und Viehzucht betraf. Hierzu benötigte es neben ausreichendem Obst- und Gemüseanbau auch Eier, Milch und Fleischlieferanten. Denn vegetarisch zu leben, fand er doch etwas übertrieben. Also wurden Schafe, Ziegen und Hühner angeschafft, die in einer selbstgebauten Hütte, hinter unserem Haus lebten. Die Hühner liefen tagsüber frei herum und sobald es dämmerte, gingen sie freiwillig in ihren Stall. Die Schafe und Ziegen hielt mein Vater nicht parallel, sondern hintereinander. Zuerst Ziegen, dann die Schafe (oder umgekehrt?). Jedenfalls durften sowohl die Ziegen als auch die Schafe, angebunden an einem Seil, nebenan auf einer Wiese grasen. Einmal, nachdem nach ein paar Tagen die Wiese abgegrast war, hatte mein Vater den Einfall, sie außerhalb der Badezeit auf der Wiese des Schwimmbades gegenüber anzubinden. Er fand jedoch, sie müssten beaufsichtigt werden und stellt mich für diese außerordentlich verantwortungsvolle Aufgabe ab. Er hatte ja Wichtigeres zu tun. So stand ich da, das Seil des Bockes in der Hand und fand den Job schon nach fünf Minuten ungeheuer langweilig. Ich begann ein Lied zu singen, auf- und ab zu hüpfen, sprach mit den Schafen (drei „Heidschnucken“ und drei normale Schafe, wovon eines ein Bock war) und zog sie von einer grünen Stelle zur anderen. Ich weiß nicht mehr, was falsch gelaufen war, eventuell wollte er einfach nur spielen oder mein Gesang ging ihm auf die Nerven, aber plötzlich rannte der Bock mit gesenktem Kopf auf mich zu und gab mir solch einen Stoß, dass ich einen Satz nach vorne machte. Als er erneut zum Boxen ansetzte, ließ ich das Seil fallen, lief so schnell ich konnte und rettete mich auf eines der Bänkchen, die sich auf der Schwimmbadwiese befanden. Lauthals rief ich nach meinem Vater, aber natürlich konnte mich niemand hören. Nach einiger Zeit und als die Schafe wieder friedlich vor sich hin grasten schlich ich mich zitternd weg in Richtung Bach, rannte ab dann so schnell ich konnte nach Hause und berichtete heulend von dem rabiaten Bock und dass ich nie wieder auf die Schafe aufpassen wolle. Mein Vater lachte nur. Am nächsten Tag bestaunte ich einen riesigen blauen Fleck am Hinterteil und konnte für eine Weile nicht mehr richtig sitzen. Später, Wochen oder Monate nach diesem Ereignis bekamen die zwei Schafe je ein Lämmchen. Die waren vielleicht herzig und süß und immer wollte ich sie drücken und streicheln. Leider nahm schon nach wenigen Wochen das Drama seinen Lauf. Als wir von der Schule heimkamen, ging mein Bruder wie üblich als Erstes in den Schafstall. Plötzlich ertönte lautes Schreien, Heulen und Klagen meines Bruders, er ließ sich gar nicht mehr beruhigen.
Martin war außer sich, weil die Lämmer verschwunden waren. Zum Schlachten abgeholt. Ich glaube, das hat mein Bruder meinem Vater nie verziehen.
Von unseren Hühnern ist mir vor allem eines in Erinnerung geblieben: die können tatsächlich ohne Kopf herumrennen. Auch so eine Tragödie, die ich meinem Vater zu verdanken habe. Nach dem Schlachten a la „Kopf ab auf dem Holzklotz“, ist ihm eines entwischt. Ohne Kopf drehte es noch ein paar Runden auf der Wiese, bevor es dann unbeweglich liegen blieb. Das war ein Schauspiel wie aus dem Gruselkabinett. Danach wollte ich lange kein Huhn mehr essen.
Neben all den erwähnten Tieren hatten wir unzählige Kaninchen, Bienen und einmal eine Sau. Die nahm ich allerdings kaum wahr, da das arme Vieh tagein, tagaus im Stall verbrachte. Auch sie landete früher oder später in unserer Tiefkühltruhe. 
(1) Meine Mutter, mein Bruder und ich etwa 1978. Auf dem Arm "Mulle", die Katze. Noch ganz klein.

Mit Vierzehn, Fünfzehn Jahren begann auch bei mir so ganz leise die Pubertät. Ich verglich mich äußerlich mit meinen Schulkameradinnen und dabei schnitt ich meistens schlechter ab. Romy, unsere Frühreife aus der Klasse, hatte schon richtig Oberweite und war bei den Jungs sehr angesagt. Ich hatte gar nichts, war flach, wie ein Brett. Im Turnen „mussten“ nach und nach die Mädchen wegen Bauchkrämpfen und anderem auf den Bänken zuschauen und ich nie. Einige Male habe ich dafür geschwindelt…! Alles in Allem war ich entwicklungstechnisch eine absolute Spätzünderin, denn lange noch hatte ich die Figur eines Jungen. Mit Dreizehn durfte ich in den Sommerferien zu Bekannten meiner Eltern. Sie lebten in Baden-Baden und ich fand beide außerordentlich interessant, bewunderte die Familie auch ein bisschen, weil sie nach meinem Empfinden sehr unkonventionell und modern waren. Er arbeitete beim Radiosender Baden-Württemberg als Moderator und sie war Sozialarbeiterin und Streetworkerin und ihr Hobby waren Flohmärkte. Kaufen und Verkaufen von alten Kleidern und Accessoires, richtig hochwertige Ware. Zuerst beteiligte sie sich an den Räumungsverkäufen der alten Villen, von denen es in Baden-Baden und Umgebung einige gab und immer noch gibt und nach der Aufbereitung der Ware kam der Verkauf. An solch einem Flohmarktverkauf durfte ich in diesen Ferien auch teilnehmen, was mir große Freude machte. Überhaupt waren diese Wochen eine Wohltat. Ich wurde ernst genommen, niemand schimpfte, obwohl die beiden auch ihre Diskussionen hatten, aber es waren nicht meine Eltern und niemand weinte. Als die Ferien zu Ende waren, wurde ich von meinem Vater abgeholt.
Er hatte sowieso in der Gegend zutun und konnte dies prima miteinander verbinden. Das war immer so. Wenn er nicht gerade wegen der Bienen oder einem aktuellen Projekt in der Gegend weilte, mussten wir uns selbst organisieren. Dann hätte ich eben schauen müssen, wie ich wieder heimkam. Allerdings hätte ich damals auch problemlos mit der Bahn fahren können. Kaum sassen wir also beide im Auto Richtung Autobahnzubringer, ließ mein Vater folgenden Satz raus: „Hey, bisch du dick g‘worde.“
Zunächst war ich doch konsterniert und begriff gar nicht, was er mir jetzt damit sagen wollte. Gefiel ich ihm nicht mehr? War das jetzt schlimm? War ich nicht seine Tochter? Hat er sich nicht auf mich gefreut und war froh, dass ich wieder nach Hause kam? Mein eh schon kleines Selbstwertgefühl sank noch tiefer, denn im Grunde war ich ja noch in dem Modus, dem Vater gefallen zu wollen.
Während meiner Kindheit war ich eher dünn, deswegen fiel das bisschen Pubertätsspeck umso mehr auf. Doch was dieser Satz mithalf auszulösen, war er sich nicht im Entferntesten bewusst. Heute bin ich mir sicher, dass er damit seine eigene Unsicherheit, die eigene Sprachlosigkeit mit einem flapsigen Satz überspielen wollte. Dass ich aber in ganz anderen Sphären war, ihn in seinen Äußerungen ernst nahm und gerade in diesem Alter eine Anspielung auf meine Figur alles andere, als witzig fand, hat er nicht bemerkt. Ich beschloss etwas zu unternehmen.
Dünner zu werden.
Ich spüre heute noch die unangenehme Sprachlosigkeit von damals bei Autofahrten mit ihm allein. Auch als Erwachsene empfand ich das noch so. Meine Besuche bei ihm in Schwäbisch Gmünd, wo er später ein paar Jahre lebte oder gar auf den Philippinen, immer spürte ich eine Distanz, eine unsichtbare Mauer zwischen uns. Von seiner Seite gab es nichts Herzliches, Verbundenes, kaum Freude des Wiedersehens oder ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Es fühlte sich einfach so falsch an. Und doch bin ich sicher, dass sich mein Vater über meine Besuche, über mich und mein Interesse an seinem Leben freute, aber offensichtlich ist er seit jeher emotional verstümmelt, hat nie gelernt, Gefühle zu zeigen.
Eines Tages mussten unsere Schafe geschoren werden und ich sollte helfen, den Bock zu halten. Ich hielt den Kopf an seinen Hörnern, mein Vater die Hinterläufe und ein für die Schur bestellter Fachmann, setzte die Schere an. In diesem Moment drückte der Bock seine Hörner derart auf die Seite, dass er mir aus den Händen glitt und ich keine Chance mehr hatte, ihn mit meinem Leichtgewicht wieder in den Griff zu kriegen. Mein Vater quittierte mein Versagen mit einem Boxer gegen meinen Arm und dem Satz: „Geh weg! Für nix bisch zum `brauche!“
Solche und ähnliche Sätze habe ich in meinen ersten Teenagerjahren öfter zu hören bekommen und war überzeugt, dass er recht hatte. Ich entwickelte mehr und mehr Hemmungen meinem Vater gegenüber und wollte ihm bei nichts mehr helfen. Ich war der Meinung, ich genüge ihm nie.
Während ich zuhause mit meiner Daseinsberechtigung kämpfte, hatte meine beste Freundin Carola ihren ersten Freund und damit begannen die Jahre unseres Auseinanderlebens. Jede von uns entwickelte sich in eine andere Richtung. Unsere Kinderfreundschaft mit all ihren Abenteuern, ihrer Vertrautheit und dem dicken Zusammenhalt begann zu bröckeln. Ich war in meiner Entwicklung noch nicht dort, wo sie schon war. In meinem Leben war noch lange keinen Platz für Jungs. Aber auch ich spürte mit Dreizehn die ersten Blicke des anderen Geschlechtes. Ich schwärmte für den älteren Bruder meiner Freundin Carola. Sie hingegen entwich mir so langsam.
Doch zuvor erlebte ich gemeinsam mit ihr eine traumatische Szene, an der ich wohl wesentlich länger zu knappern hatte als sie. Nach dem Ende einer Nachmittags-Fasnacht-Veranstaltung beauftrage Carolas Vater zwei Kollegen, die wir auch gut kannten, uns nach Hause zu fahren. Es waren nur 1,5 km, aber es war dunkel und kalt. Sicher hatten die beiden Familienväter die „einmalige Gelegenheit“ schon beim Einsteigen erkannt, denn der eine stieg mit Carola hinten ein, während ich vorne neben dem Fahrer Platz nehmen sollte. Ich war so naiv und vertrauensvoll, dass ich die Situation nicht im Geringsten durchschaute. Beide hatte ausreichen Alkohol intus, auch deswegen fuhren sie den Schleichweg durch den Wald und nicht auf der Landstraße. Mitten im Wald hielt der Fahrer an und begann, seine Hände unter meinen Mantel und seine Zunge in meinen Mund zu schieben. Mir wurde es richtig schlecht und ich dachte, ich sterbe. Auch von der Rückbank hörte ich es schmatzen und keuchen. Ich wollte aussteigen, hatte meine Hand schon an der Türe, fürchtete jedoch, dass schlimmeres passieren würde, wenn ich jetzt nicht mitmachte. Dass die Männer im Wald über uns herfallen könnten. Ich sagte laut und immer lauter, wir sollten jetzt weiterfahren. „Ich möchte, dass du weiterfährt“. Nach mehrmaligem Bitten ließ er dann tatsächlich den Motor an und fuhr weiter. Ich konnte es kaum glauben!
Von meiner Freundin habe ich rein gar nichts gehört. Ich hatte den Eindruck, sie empfand den offensichtlichen Missbrauch eher als „sehr erwachsen“. Zuhause angekommen, war ich völlig durcheinander und schämte mich zutiefst, dass ich mich so hilflos und ängstlich gefühlt hatte und das Geschehene nicht auch so großartig fand, wie Carola. Wie eine erwachsene Frau! Wir haben hinterher nie darüber geredet. Ich glaube, im Grunde war sie mir unendlich dankbar, dass ich unbedingt weiterfahren wollte.
Bestimmt habe ich mich zuhause eine Stunde lang geduscht und ewig lange die Zähne geputzt. Meiner Mutter erzählte ich von all dem nichts. Erst Jahre später erwähnte ich die ganze Sache so beiläufig. Sie war natürlich zutiefst empört, aber zu diesem Zeitpunkt wohnten die beiden Männer mit ihren Familien schon lange nicht mehr in unserem Dorf.
Langsam, aber sicher gehörten wir zu den Ältesten in unserer Schule. Wir waren nun im neunten Schuljahr und mächtig stolz darauf. Natürlich genossen wir den Respekt der Jüngeren aber vor allem begann nun die spannende Zeit der Orientierung nach Draußen. Wie habe ich mich darauf gefreut mit der ganzen Klasse ins Schullandheim fahren zu dürfen. Wir waren in Forbach im Murgtal, zwischen Baden-Baden und Freudenstadt, im Hochschwarzwald. Die Tage waren angefüllt mit langen Wanderungen und Besichtigungen, z.B. der Schwarzenbach Talsperre. Irgendwie musste unser Klassenlehrer uns müde kriegen, denn für ihn war das sicher eine sehr stressige Zeit. Man stelle sich vor, zehn Tage lang vierundzwanzig pubertierende Mädchen und Jungs, die anscheinend nichts als Blödsinn im Kopf haben, Tag und Nacht zu überwachen. Ganz unversehrt kam er auch nicht davon. In der zweiten oder dritten Nacht schlichen sich nämlich ein paar Mädchen in die Zimmer der Jungs, um dort Musik zu hören und sich albern miteinander zu benehmen. Das übliche pubertäre Gehabe eben. Als unser Lehrer mitbekam, was da lief, habe ich ihn das erste Mal richtig wütend erlebt. Er schrie, dass sich alle sofort in ihre Zimmer verziehen sollten und er bei weiteren Auffälligkeiten die Schüler auch nach Hause schicken könnte. Uii, war da Feuer unterm Dach! Und nicht zu Unrecht, denn bei meinem Vater wurde während eines solchen Schullandheimaufenthaltes ein Mädchen schwanger. Konsequenzen hatte es für ihn keine, er durfte weiter im Schuldienst bleiben. Weshalb? Ich weiß es nicht, möglicherweise wurde die Verantwortung Ende der Sechziger Jahre noch nicht in dem Ausmaß von den Eltern an die Lehrer abgegeben, wie es heute oft der Fall ist. Oder es war doch nicht so ganz klar, ob sie tatsächlich während der Klassenfahrt schwanger wurde, oder nicht schon davor. Unser Lehrer machte jedenfalls in dieser Nacht kein Auge mehr zu.
Ich war in meiner Klasse eine der älteren Schülerinnen, weshalb ich und eine weitere Klassenkameradin uns im Amt der Klassensprecherin abwechselnden. Mal sie, mal ich aber meistens sie. Ich fühlte mich wegen meines Lehrer-Vaters befangen und auch, weil alle Lehrerkollegen bei uns zuhause schon auf dem Sofa saßen. Das hieß für mich, gute Miene zum bösen Spiel machen, denn eigentlich fand ich unseren Klassenlehrer unmöglich. Er war das „Antidot“ eines Lehrers. War gehemmt, verklemmt, hatte keinerlei sympathische Ausstrahlung, geschweige denn Charme, rauchte, was das Zeug hielt, war immer auf der Suche nach einer Frau, fand aber keine, lutschte wegen seiner Nikotinsucht ständig Hustenbonbons im Unterricht, trank zu viel Alkohol, schwitze stark wegen seines Übergewichts, hatte eine weißlich-käsige Haut und erschien ständig in seinen drei gleichen, zerknitterten Hemden sowie einer Hose, die vom permanenten Tragen schon richtig glänzte. Gerade von 13 – 15-Jährigen wird der Lehrer oder die Lehrerin als Vorbild gescannt und analysiert und jede noch so kleine Unstimmigkeit, die in den Augen der Teenies als extrem „uncool“ wahrgenommen wird, gibt einen Punkteabzug. Unser Klassenlehrer fiel natürlich in allen Punkten durch. So kam es, dass er nicht mehr ernst genommen wurde. Gerade die Jungs machten, was sie wollten, ignorierten seinen Unterricht und spielten lieber während der Stunden Münzwerfen und Blasrohrschiessen mittels einer leeren Filzstifthülle und eingespeichelten Papierkügelchen. Bevorzugt wurden die Mädchen damit beschossen oder die nassen, ekligen Dinger landeten auf unseren Tischen. Ich war oft genervt, weil unser Lehrer so viel durchgehen lies respektive, er sich nicht durchsetzen konnte.
Unsere Klasse musste sich vier Schuljahre mit ihm rumplagen und später, auf der weiterführenden Schule, habe ich deutlich meine schulischen Defizite zu spüren bekommen. Ich möchte jetzt nicht alles auf diesen Lehrer schieben, aber sicher trug er viel zu meiner damals fehlenden Begeisterung für die Schule bei. Weil es nicht so viel zu holen gab, tat ich auch nur das Nötigste und war oft unmotiviert. Erst als Erwachsene kam die Freude am Lernen wieder zurück. Oft habe ich damit gehadert, dass ich in der Grund- und Hauptschule in vielen Fächern nicht gefördert wurde oder einfach auch so früh die Lust am Wissen und der Schule verlor. Englisch und Deutsch waren meine Lieblingsfächer und darin war ich auch richtig gut. Darauf hätte sich doch prima mehr aufbauen lassen, wie weitere Fremdsprachen, Intensivkurse in Englisch oder gar einen Schüleraustausch. Auch mochte ich Biologie und Musik. Ich denke, auch unsere Eltern haben dahingehend versagt. Vielleicht hatten sie aber auch einfach genug, mich anzuschieben. Nach der Hauptschule hatte ich keine Lust mehr und war ab der 11. Klasse nur noch schulmüde. Diese Unlust schreibe ich tatsächlich meinem Klassenlehrer zu. Meinen Vater interessierte es ebenso wenig, wie und was wir im Unterricht lernten. Obwohl er fließend Englisch sprach und dieses Fach auch unterrichtete, profitieren wir Kinder nicht davon.
Die Hauptschule habe ich schlussendlich mit einem Zeugnisdurchschnitt 2-3 (in der Schweiz ist das wohl eine 4-5) beendet und war zufrieden. Null Ehrgeiz, null Motivation.
Bei meiner jüngeren Schwester verlief die Grund- und Hauptschule ganz anders. In den ersten vier Jahren hatte sie einen sehr empathischen Lehrer, den sie richtiggehend verehrte. So, wie es auch sein sollte bei den ganz Kleinen. Als meine Schwester auf die Hauptschule wechselte, erhielt ihre Klasse die strengste Klassenlehrerin der ganzen Schule. Sie war unverheiratet, hatte keine eigenen Kinder und wollte immer mit „Fräulein“ angesprochen werden. Sie galt als „alte Jungfer“ Niemand konnte sie leiden, weil sie angeblich sehr schwere Klassenarbeiten schreiben ließ und in ihren Klassen im Schulschnitt die meisten Schüler den Klassenwechsel nicht schafften. Das Fräulein Lehrerin war schmallippig und sprach außerhalb des Unterrichts nicht sehr viel. Sie mischte sich jedoch ein, wenn sie Streitereien zwischen den Schülern beobachtet, was manchmal gar nicht gut ankam.
Ich empfand sie als sehr fair und konnte sie eigentlich auch ganz gut leiden. Natürlich behielt ich dies für mich, man möchte ja nicht aus dem Rahmen fallen. Im Nachhinein empfand ich vor allem ihre Intuition großartig, dass sie dasjenige Kind erkannte, welches in einem Fach oder mit gewissen Interessen herausstach und es gezielt förderte. Natürlich gemeinsam mit den Eltern. Meine Schwester zum Beispiel, die einen ungeheuren Fleiß und Ehrgeiz hatte und in eigentlich allen Fächern sehr gut war. Das „Fräulein“ empfahl dringend, Christine auf eine weiterführende Schule gehen zu lassen. Das nächste Gymnasium in Waldshut war pro Weg 25 Kilometer entfernt, also 50 km pro Tag. Außerdem tat es sowohl meiner Schwester als auch der ganzen Familie gut (sie durchlebte eine extrem wütende Pubertät und fühlte sich ständig unverstanden), von der Familie weg zu kommen. Deswegen wurde mit Hilfe von Christines Klassenlehrerin entschieden, dass Sie nach Rottweil auch in ein Internat gehen soll. So kam es, dass ich ab meinem knapp sechzehnten Lebensjahr wie ein Einzelkind in unserer Familie lebte. Aber auch meine Zeit in meinem Elternhaus sollte nicht mehr lange dauern. Ich war ja schon lange der festen Überzeugung, dass ich Kinderkrankenschwester werden wollte und nach Abschluss der Hauptschule führte mein Weg geradewegs dort hin.

Für die nächsten zwei Jahre besuchte ich in Waldshut die Hauswirtschaftsschule, um dort den Abschluss der Mittleren Hochschulreife zu erlangen. Grundsätzlich hatte ich viel mehr Freude an dieser Schule, weil die Fächer eher meinen Interessen entsprachen, aber wie schon gesagt, ich hatte massive Defizite. Mathematik fiel mir enorm schwer (das war sowieso mein Gruselfach), ebenso Physik und Chemie. Auch in Geschichte und Erdkunde war ich keine Leuchte. Alles in allem begann ich ab dem zweiten Jahr einzelne Stunden zu schwänzen, um stattdessen in der Stadt abzuhängen. Das Geld dafür „verdiente“ ich mir über das monatliche Busfahrgeld, welches ich nicht für die vorgesehene Fahrkarte verwendete. Ich trampte morgens die 25 Kilometer nach Waldshut und zurück. Manchmal konnte ich auch mit dem Freund meiner Freundin mitfahren. Er war paar Jahre älter und hatte schon den Führerschein. Auch versuchte ich es mit Ladendiebstahl, worin ich allerdings kläglich scheiterte. In einem Drogeriemarkt stahl ich einen Lippenstift so auffällig, dass ich glücklicherweise sofort aufflog und zu einigen Stunden Sozialdienst verdonnert wurde. Es war nicht meine Zeit!
Wann und wie brach die Bulimie aus? Die Ess-Brech-Sucht? Die Kotzerei? Nicht von einem Tag auf den anderen, aber ich brachte alle Voraussetzungen dafür bereits mit. Als alles begann war ich vierzehn, das Hadern mit mir, meinem Leben, meinem Körper, aber vor allem mit meinen zweifelnden Gefühlen, ob richtig oder falsch, all das trug ich schon mit mir herum. Ich war mir und meinem Dasein nicht sicher, traute und vertraute mir und meinen Gefühlen nicht. Tiefe Zerrissenheit und ständigen Getrieben sein waren die Taktgeber der Essstörung. Das Gefühl des „mich nicht spüren“ war einer der Hauptgründe, wodurch die Essstörung ausgelöst wurde und mich so lange daran festhalten ließ. Manche Menschen ritzen sich oder reissen sich die Haare aus. Ich habe gefressen und erbrochen. Das half mir, mich in meiner Hülle zuhause zu fühlen, zu "Mitten". Zudem fand ich die Kontrolle über mich, meinen Bauch und mein Gewicht sehr praktisch. Im Gegensatz zu meiner Mutter und all den Frauen, die ständig über zu viel Kilos klagten, musste ich keine Angst vor dem Zunehmen haben. Ich musste keine Saftdiät machen oder Kalorien zählen, musste nicht auf Sahnetorte verzichten oder anderes. Ich hatte – vermeintlich - alles wunderbar unter Kontrolle. Das gab mir das Gefühl der Stärke und der Macht über die Regeln der Natur, beziehungsweise der Nahrungsaufnahme und Verwertung.
Never ever!
Niemals hätte ich mir vorstellen können, dass ich innerhalb kürzester Zeit die Kontrolle über mich komplett verlieren würde und die Bulimie die Regie über mein Leben und meinen Lebensweg über eine lange Strecke übernehmen sollte.
Die ersten Wochen und Monate, nachdem ich entdeckt hatte, wie wunderbar ich erbrechen konnte, ging ich einmal pro Tag auf die Toilette, um mich des Mittagessens zu entledigen. Irgendwann fiel meiner Mutter jedoch auf, dass ich auffallend oft auf die Toilette ging, vorwiegend gleich nach dem Essen. Sie begann mich zu kontrollieren und rief, wenn sie etwas Verdächtiges zu bemerken schien.
Ab da änderte ich meine Strategie und die Heimlichkeit beherrschte meine Tage. Das sah so aus: morgens um vier oder halb fünf aufstehen, anziehen, den Plastiksack mit Erbrochenem vom Vortag unter dem Bett oder aus der Garage hervorholen, die hundert Meter ans Rheinufer laufen, die Kotze in den Rhein schütten, Plastiksack ausspülen, zurück zum Haus, Plastiksack tief unten in der Mülltonne vergraben, zurück ins Zimmer, ausziehen, ab ins Bett. Eine Stunde später wieder aufstehen, für die Schule zurechtmachen und ab nach Waldshut. Dort stand ich ja nicht unter Beobachtung und konnte getrost essen und kotzen, wie ich mochte und Geld hatte. Dort konnte ich, wenn nötig, die Toiletten wechseln, beispielsweise wenn der Geruch oder meine ständigen Toilettengänge auffielen. Am Nachmittag ging es mit schlechtem Gewissen wieder nach Hause, vor allem dann, wenn ich morgens nicht alles beseitigen konnte. Danach zu Mittag essen, je nachdem auf die Toilette oder wenn ich das Gefühl hatte, beobachtet zu werden, ab in mein Zimmer oder auf den Estrich um mich da, dort oder dort wieder zu entleeren. Mehr oder weniger sind so die Tage verlaufen, bis ich in Waldshut die Schule beendet hatte. Zu diesem Zeitpunkt steckte ich schon tief drin in der Essstörung, mochte mein Problem aber nicht wahrhaben und niemand erkannte, wie krass die Krankheit tatsächlich war. Es war ja auch so, dass diese Essstörung als Solches noch gar nicht als Krankheit bekannt war. Sie hatte noch nicht mal einen Namen. Der Hausarzt, dem mich meine Mutter nach einiger Zeit sorgenvoll vorstellte, war der Meinung, das „wächst sich aus“. Aber nicht wuchs sich aus, im Gegenteil: innerhalb kürzester Zeit veränderte ich mich äußerlich und innerlich, verlor natürlich an Gewicht, meine Gesichtszüge wurden härter, meine kindliche, naive Unschuld, meine Unbeschwertheit und auch mein bisschen jugendliches Selbstvertrauen verloren sich. Ich begann zu lügen und zu stehlen, fühlte mich als das „schwarze Schaf“ der Familie, als Versagerin und diejenige, die den Eltern nur Sorgen bereitete. Mit Siebzehn hatte ich das erste Mal einen Termin bei einem Kinder- und Jugendpsychiater. Erst da erhielt meine Mutter eine Diagnose, einen Namen des Problems: „Bulimie“, auf Deutsch: „Stierhunger“. Er erklärte ihr, dass er mich leider nicht therapieren könne, da ich schon siebzehn sei, er aber Kinder - und Jugendpsychiater sei. Weiter meinte er, möglicherweise würde sich mein Problem von Selbst lösen, wenn ich nur einmal mit meiner Ausbildung angefangen und somit andere Prioritäten hätte. Auch da wurde die Kraft dieser Krankheit unterschätzt.
Wie ich zu Beginn schon kurz angedeutet habe, hatte die Durchreiche zwischen der Küche und dem Esszimmer in dieser Zeit eine ganz besondere Bedeutung. Die Durchreiche war ein kleines viereckiges Loch mit zwei Türchen, durch welches früher die Speisen aus der Küche auf den Esstisch durchgereicht wurden. Bevor der Trend der offenen Küchen in den achtziger Jahren begann, wurden viele Häuser und bessere Wohnungen mit solch einer Durchreiche ausgestattet. Die Türchen waren per Magnete zu schließen. Im Laufe der Zeit, im Laufe des zunehmenden Kontrollverlustes über meine Nahrungsaufnahme reichten die täglichen Mahlzeiten nicht mehr, um meinen zunehmenden Hunger zu stillen. Ich hatte immer öfter pro Tag Essattacken. Dabei stopfte ich mir alles in den Mund, was ich heimlich aus den Vorräten meiner Mutter entwenden konnte. Zuerst bemühte ich mich noch, immer nur „ein bisschen“ zu nehmen. Nur eine Handvoll Nüsse, immer nur das alte, trockene Brot, welches in einer Tüte gesammelt wurde, nur einen Streifen Schokolade und einen Esslöffel Honig, ein bisschen von diesem und bisschen von jenem. Trotzdem summierten sich die fehlenden Zutaten und meine Mutter stellte nach einer gewissen Zeit fest, dass die Backschokolade sukzessive weniger wurde, das Käsestück von Tag zu Tag kleiner, die Salamischeiben ständig abnahmen und überhaupt die Vorräte wie von Geisterhand verschwanden. Natürlich ahnte sie, dass ich dahintersteckte und stellte mich sogleich zur Rede. Ich stritt natürlich alles ab oder verharmloste die Vorwürfe meiner Mutter. Als Konsequenz schloss sie in ihrer Abwesenheit die Küchentüre ab. Obwohl meine Mutter „nur“ Hausfrau war, war sie wegen ihrer Tennisleidenschaft öfter unterwegs. Während der Sommermonate manchmal fast täglich. Wenn sie nicht gerade trainierte, fanden Mannschaftsturnierte statt oder Freundschafts- und Aufstiegsturniere.
Somit war ich öfter allein zuhause und fand schnell einen Ausweg aus dem Dilemma der abgeschlossenen Küchentüre: ich kroch durch die Durchreiche. Zuerst über den Esstisch, langsam durch den 30 auf 40 cm engen Durchgang in die Küche und über die Spülmaschine wieder runter. Immer wieder stahl ich Lebensmittel, immer wieder log ich. Einmal verschlang ich fasst einen halben Kuchen und als meine Mutter mich drauf ansprach, behauptete ich, dass die Nachbarin zum Kaffee bei uns war und ich ihr anschließend auch noch Kuchen mitgegeben hätte. Schnurstracks lief sie zu dieser besagten Nachbarin, die natürlich von nichts eine Ahnung hatte. Ich fühle es noch heute, wie abgrundtief beschämt ich war und am liebsten in ein Mauseloch gekrochen wäre. Das war wirklich eine elende Zeit, mit tiefsten Gewissensbissen, und doch konnte ich von der Fresserei nicht ablassen. Im Gegenteil, es wurde immer schlimmer und ich sank in den kommenden Jahren in meiner Achtung vor mir selbst in tiefste Tiefen.

Bei meiner ersten kleineren Schwärmerei für einen Jungen (neben dem großen Bruder meiner Freundin) war ich vierzehn Jahre und ging noch in die Schule, in der mein Vater ebenfalls lehrte. Er war ein Jahr älter und wohnte in einem Nachbardorf. Ich kannte ihn aus der Schule und fand ihn sehr nett, vor allem sein Lächeln. Peter (sein Name), hatte Sommersprossen und rotblondes. lockiges Haar. Auch er fand mich wohl sympathisch, denn seine Reaktionen sprachen Bände.
Es war ein langes Wochenende am 1. Mai. Ich war krank und lag mit hohem Fieber im Bett. Im Bett bei den Nachbarn. Unser Haus war an diesem Wochenende voller Verwandtschaft aus Stuttgart, weswegen alle Zimmer und Betten benötigt wurden und ein krankes Kind definitiv keinen Platz hatte. Ich fühlte mich deswegen schon abgeschoben und war entsprechend frustriert. Auch hätte ich sehr gerne auch vom Kuchen gegessen.
Und dann war da der 1. Mai. Bei uns auf dem Land war es Tradition, dass neben dem offiziellen Maibaum im Dorf, die jungen Männer ihren Mädchen, die sie liebten oder für die sie schwärmten, eine junge Buche oder Birke auf das Hausdach stellten. Als ich am Morgen des 1. Mai mit fiebrigen Augen und Kopfschmerzen erwachte, sagte meine Nachbarin, ich solle mal aus dem Fenster schauen. Und da sah ich das Bäumchen auf dem Dach unseres Hauses. Das war wirklich eine wunderschöne Überraschung. Meine Traurigkeit war wie weggeblasen und ich war innerlich ganz stolz. Ich war überglücklich und lange noch dachte ich an Peter und sein Bäumchen. Leider war mein Vater Peters Klassenlehrer und er fand das gar nicht lustig. Ich glaube, insgeheim hat es ihm schon imponiert aber solch ein Gefühl für mich konnte er ja nicht zulassen. Als ihm klar wurde, wer dahintersteckte, versäumte er keine Möglichkeit, ihn vor mir schlecht zu reden. „Was, die Null findesch du gut?“ oder „Was willsch denn mit dem? Der taugt doch gar nix“. Entweder war ich noch zu jung, um mich zu verlieben oder ich traute mich nicht, fand es aber trotzdem wunderschön einen Freund zu haben.
Wir waren nur ein paar Wochen und nur ein bisschen zusammen, dann habe ich mich von ihm getrennt.
Danach gab es noch ein paar Schwärmereien, aber mein Vater machte alle schlecht. Meine Mutter warnte mich dringend vor einem Kind („Wenn ich meine, sie würde sich dann darum kümmern, hätte ich mich aber getäuscht“), dabei war ich noch gar nicht richtig aufgeklärt. Ich: „Mama, was heisst denn Petting“? Sie: „Woher hast du das Wort? Wie kommst du darauf? Hasch du schon wieder dieses Mistheftchen gelesen? Ich möcht nicht, dass du immer das Sch…Heftchen anschleppst“. Eine Antwort bekam ich nicht. Bei mir tat dies die Zeitschrift „BRAVO“ und meine Freundin und meine eigenen Erfahrungen. Leider habe ich damals auch schmerzlich feststellen müssen, wie wenig mir meine Eltern vertrauten. Deswegen habe ich immer weniger erzählt, bis ich dann mit knapp Siebzehn von zu Hause weg ging. Peter wurde ein recht erfolgreicher Hochbauzeichner, der später paradoxerweise die Häuser meines Vaters plante.
Im Sommer 1979, in dem ich im Oktober Siebzehn wurde, lernte ich einen viel älteren Mann kennen und mit ihm schlief ich das erste Mal. Er war Siebenundzwanzig und hatte eigentlich einen zweifelhaften Ruf, was mir jedoch nicht bewusst war. Nur wenige Monate zuvor starb seine Verlobte bei einem sehr merkwürdigen Autounfall wegen Alkohol am Steuer, den er ohne eine Schramme überlebte und der nie restlos aufgeklärt wurde. Man munkelte, er wäre gefahren, hätte jedoch angegeben, dass er auf dem Beifahrersitz saß. Die Familie der Braut wohnte in unserer Nachbarschaft, eine Straße weiter. Natürlich hatte ich von dem schrecklichen Unfall kurz nach der deutsch-schweizerischen Grenze gehört, aber einerseits war die Verstorbene einige Jahre älter als ich und gehörte somit nicht zu meinem unmittelbaren Bekanntenkreis und andererseits kannte ich ihren Verlobten nicht und wusste somit auch nicht, wer sich da um mich bemühte. Er war ein Zugezogener, kein Einheimischer, ich hatte ihn noch nie zuvor gesehen. Ich lernte ihn im Schwimmbad am jährlichen Schwimmbadfest kennen. Er war der Leader und Sänger einer Rockband, die aus drei Mitgliedern bestand: er und zwei Brüder, die mit mir in eine Klasse gingen. Ich wusste gar nicht, dass die Zwei Musik machten und auch noch recht gut. Ich war jedenfalls sehr begeistert. Aber vor allem schwärmte ich für den Sänger, der wunderbar Gitarre spielen und singen konnte. Er verkörperte für mich die Freiheit, nach der ich mich in meiner Krankheit unbewusst so sehr sehnte, aber auch die jugendliche Coolness von damals. Musik lag über allem und ich war über diesem Kanal sehr zugänglich. Und ich fand ihn sehr männlich! Haare auf der Brust, Bart und Muskeln, all diese Merkmale sprachen mich sehr an. Offensichtlich war er von meiner mädchenhaften Schwärmerei auch angetan, jedenfalls durfte ich schon bald als Groupie in der Band mitmachen und in einigen Stücken auch die Schellen schlagen. Nach wenigen Tagen oder auch nur Wochen nahm er die Sache vollends in die Hand und mimte den erotischen Verführer. Es war mein erstes Mal, weswegen ich alles geschehen ließ. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube nicht, dass ich enttäuscht war. Von einem Höhepunkt war ich natürlich weit entfernt gewesen, ich wollte vor allem ihm gefallen. Positiv war wohl, dass er bereits einige Erfahrung hatte, denn für die Verhütung hatte er gut gesorgt. Am Ende der Sommerferien, ungefähr zwei Wochen nach unserer gemeinsamen halben Nacht, verliebte er sich in eine Mittzwanzigerin aus dem nächsten Dorf und ich war sowohl meinen Schwarm als auch meinen „Job“ bei der Band los. Für ihn war ich nur ein süßes Praliné zwischen zwei üppigen Mahlzeiten. Nichts, wofür sich zu viel Einsatz lohnte. Dafür durchlebte ich ein paar Wochen meinen ersten Liebeskummer und war sehr froh, bald das geplante Vorpraktikum in Winnenden bei Stuttgart antreten zu können. Ich wollte nur noch raus aus dem Dorf und weg vom immer enger werdenden Elternhaus.

Die eigentliche Ausbildung zur Kinderkrankenschwester im Diakoniekrankenhaus in Schwäbisch Hall konnte ich erst ab dem achtzehnten Lebensjahr beginnen. Da ich aber noch nicht mal ganz Siebzehn war, musst ich die Zeit bis zur Volljährigkeit mit einem Vorpraktikum überbrücken, welches ich in einer Sprachschule für Hör- und Sprachgeschädigte Jugendliche in Winnenden absolvierte. Diese Schule war damals zumindest in Deutschland einmalig und diente sowohl der Erkennung des Schweregrades der Beeinträchtigung als auch der daraus resultierenden Berufsfindung der Jugendlichen. Winnenden ist den meisten auch bekannt durch den Amoklauf eines 17-jährigen in seiner Schule, bei dem er 2009 fünfzehn Menschen erschoss und elf Menschen zum Teil schwer verletzte. Zuletzt erschoss er sich selbst. Winnenden liegt etwa 20 km nordöstlich von Stuttgart, im Rems-Murr-Kreis. Langjährige Freunde meiner Eltern und Pateneltern meines Bruders hatten mir nicht nur diesen Praktikumsplatz vermittelt, ich durfte auch bei ihnen wohnen. Eigentlich schwerkrank und reif für eine stationäre Essstörungstherapie trat ich mit 16 10/12 Jahren meine erste Stelle an. Mein Einsatzort war die Werkstatt der Berufsvorbereitungsklasse. Der Leiter war schon über 60 Jahre, hatte viel Erfahrung mit Jugendlichen und war ursprünglich gelernter Schumacher. Meine Aufgabe bestand darin, die Jugendlichen bei ihren Aufgaben zu unterstützen. Also Hilfestellung beim Kleben, Schneiden, Sägen usw., aber auch beim Essen und Trinken. Einige Jugendliche hatten, neben ihrer Hör- und Sprachschädigung, leichte bis starke geistige Einschränkungen und konnten niemals einen Beruf ausüben oder sogar selbstständig leben. Andere waren „nur“ taub und dadurch zwar in ihren Sprachmöglichkeiten eingeschränkt aber mit Hilfe der Gebärdensprache hatten sie reelle Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Bei ihnen bedurfte es vor allem einer besonderen Förderung, die sie für einen Beruf befähigte. Um das herauszufinden, wurden die 16 - 20-jährigen Jugendlichen in diesem Vorbereitungsjahr in all ihren handwerklichen und kognitiven Geschicken getestet und entsprechend in weiterführenden Klassen verteilt. Alle durchliefen vor der Berufsfindung bereits eine Sonderschule für Hör- und Sprachgeschädigte Kinder. Ich war gerne mit den Jugendlichen zusammen. Wie ich waren sie nicht perfekt und damit konnte ich gut umgehen. Aber natürlich wusste niemand von meiner Essstörung. Das Einzige, was auffallen musste, waren meine ständigen Abwesenheiten. Ein- bis zweimal am Tag ging ich unter einem Vorwand einkaufen. Das eingekaufte Essen stopfte ich heimlich im Laufe des Tages in mich hinein, um es dann irgendwo wieder zur erbrechen. Ich glaube schon, dass mein Chef einen Verdacht schöpfte, sicher konnte er es nicht einordnen, denn er sprach mich nie darauf an. An eine Essstörung dachte er sicher nicht. Einzig aufgrund meines Zeugnisses hegte ich in diese Richtung einen Verdacht, denn ehrlich gesagt, fiel das nicht besonders prickelnd aus. Aber eigentlich war mir das auch egal. Meine Gasteltern, bei denen ich ein Zimmer mit Familienanschluss bewohnte, hatten mit mir schon eine „dickere Kröte“ zu schlucken. Auch ihnen stahl ich Lebensmittel. Im Winter vom Weihnachtsgebäck, welches im Keller lagerte und zu dem ich Zugang hatte und ansonsten auch mal aus der Küche, während ihrer Abwesenheit. Außerdem hinterließ ich zum Schluss ein ungeputztes Zimmer, weil ich Hals über Kopf auszog, um bei (m)einem Freund unterzukommen. Bedankt und verabschiedet habe ich mich auch nicht, ich war einfach weg. Ich glaube, der Auszug war auch wegen meines schlechten Gewissens eine Nacht- und Nebelaktion, denn gelinde gesagt, habe mich nicht wirklich freundschaftlich benommen. Sicher waren sie im ersten Moment genervt und enttäuscht von mir, trotz dass ich ihnen von meiner Krankheit erzählt hatte. Aber das wunderte mich gar nicht, ich war ja auch zutiefst enttäuscht von mir.
Die Bulimie machte mich zu einem anderen Menschen und oft, oft erkannte ich mich selbst nicht mehr. Eine Essstörung ist nicht nur eine „Störung“, eine Essstörung ist eine Sucht, eine Ess- und Brechsucht, eine Magersucht, eine Fresssucht, bei der man ständig und immerzu nach dem Suchtmittel Essen giert, auch wenn man nichts isst. Die einzige Tagesbeschäftigung ist die Beschäftigung mit dem Essen. Essen organisieren, Essen reinschaufeln, Essen loswerden. Das alles ist eine ständige logistische Herausforderung, von den Kosten ganz zu schweigen. Während einer Essattacke löste ich mich regelrecht auf, war ferngesteuert, hatte manchmal den Eindruck, nicht so viel essen zu können, wie ich kotzen wollte. Nun ja, das Jahr in Winnenden schloss ich jedenfalls nicht gerade glanzvoll ab. Trotzdem hatte ich viel gelernt. Ich wusste zum Beispiel, dass ich ziemlich belastbar bin und mich schwierige Menschen und belastende Situationen nicht so schnell aus der Bahn werfen konnten. Außerdem konnte ich ein paar Brocken Gebärdensprache. Meinen achtzehnten Geburtstag feierte ich noch in Winnenden mit meinen Gasteltern. Das weiß ich deswegen so genau, weil ich von ihnen das Buch „Backvergnügen wie noch nie“ geschenkt bekam. Ich habe es immer noch mit meinem Namen und dem Datum aus dem Jahr 1980. Meine Eltern hatten nicht daran gedacht, auch das habe ich nicht vergessen. Nie! Erst einen oder zwei Tage später gratulierte mir meine Mutter per Telefon und es tat ihr hörbar leid. Für mich war die Enttäuschung groß. Einmal mehr wurde mir bewusst, wie unwichtig ich ihnen war und daran änderte auch die verspätete Gratulation nichts.
Einen Freund hatte ich in jener Zeit nicht. Es funktionierte nicht. Vielleicht wollte ich auch nicht? Oder ich hatte Angst entdeckt zu werden? Oder gar die Essstörung aufgeben zu müssen? Eigentlich hatte ich sie ja als beste Freundin, was braucht ich da einen Freund! Außerdem hatte ich den Eindruck, dass sich immer nur Männer für mich interessierten, die ich zwar nett fand aber mehr nicht. Und ich schwärmte wiederum für diejenigen, die schon eine Freundin hatten oder mich zwar nett fanden, mehr aber auch nicht. Es war sowieso besser allein zu bleiben, den Mut mit einem großartigen Mann zu flirten, hatte ich schon lange nicht mehr. Ich kam mir oft so klein und unscheinbar vor. Was wollte ich da von einem Mann?

Bald darauf begann die Zeit meiner Ausbildung zur Kinderkrankenschwester im Diakoniekrankenhaus in Schwäbisch Hall. Ganze Generationen von Frauen aus unserer Familie hatten dort schon ihre Sporen verdient oder Ausbildungen zu Krankenschwestern absolviert. Die Tante meines Vaters, eine Diakonisse, war noch zu Beginn meiner Ausbildung mit über Siebzig im OP eine angesehene Operationsschwester in leitender Position. Meine Cousine zweiten Grades lernte ebenfalls Kinderkrankenschwester in Hall, hatte allerdings als ich kam bereits ins Tübinger Kinderspital gewechselt. Ihre ältere Schwester Monika, sie war etwa zehn Jahre älter als ich, war ebenfalls in Schwäbisch Hall in der Krankenpflegeschule für Erwachsene und arbeitete mittlerweile in der Schweiz. Und dann kam ich, die Jüngste im Bunde mit einer heftigen Vorgeschichte, was jedoch niemand ahnte.
Schwäbisch Hall ist eine mittelgroße Stadt im fränkisch geprägten Nordosten Baden-Württembergs, etwa 37 km östlich von Heilbronn und 60 km nordöstlich von Stuttgart. Bekannt ist die Stadt durch den nach ihr benannten Heller wie auch für die Salzsieder, die Bausparkasse Schwäbisch Hall und die Freilichtspiele auf der großen Treppe vor der St. Michaels-Kirche. Die Stadt ist auch Sitz des Kirchenbezirks Schwäbisch Hall der Evangelischen Landeskirche in Württemberg und des Dekanats Schwäbisch Hall des Bistums Rottenburg-Stuttgart. Das Evangelische Diakoniewerk Schwäbisch Hall ist eine der größten diakonischen Einrichtungen in Baden-Württemberg. Neben einem Krankenhaus der Zentralversorgung, welches umgangssprachlich als Diak bezeichnet wird, werden Wohn- und Pflegestifte, ambulante Pflege sowie Ausbildungsstätten für Pflegeberufe betrieben. Das Krankenhaus ist ein akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Heidelberg. Insgesamt werden rund 2300 Mitarbeiter beschäftigt. (aus: Wikipedia)
Meine Ausbildung sollte drei Jahre dauern und mit dem Examen zur Kinderkrankenschwester abschließen. Für alle Auszubildenden (früher hießen wir noch „Schwesterschülerinnen“) war es obligatorisch, im Schwesternwohnheim zu wohnen. Auch für die, die aus Hall kamen. Mein Elternhaus lag am weitesten weg, alle anderen kamen aus der näheren und weiteren Umgebung. Somit verbrachte ich jedes freie Wochenende im Spitalgelände oder in Hall, während meine Kurskolleginnen heimfuhren. Ich bekam auch nur wegen dem „Vitamin B“ diesen Ausbildungsplatz. Meine Grosstante hatte ein „gutes Wort“ für mich eingelegt (was mein Vater später sicher bereute), denn grundsätzlich sollten die Spitäler in der Nähe der Elternhäuser vorgezogen werden. Bei mir wäre das das Spital Waldshut gewesen, welches jedoch immer einen etwas wackeligen Ruf hatte und auch keine Lehrstellen für Kinderkrankenpflege anbot. Männer hatten grundsätzlich kein Aufenthaltsrecht im Schwesternwohnheim. Dies beinhaltete auch nahe Verwandte, wie Väter, Brüder, Partner, Verlobte oder Ehemänner. Alle mussten sich zuerst anmelden und wurden dann von einer Diakonisse zum Besuchszimmer begleitet, wo er auf die jeweilige „Schwester“ warten musste. Es war strengstens untersagt, Männer in die Zimmer zu nehmen.
Im Laufe der Ausbildung wurden semesterweise und einzeln alle Stationen und Abteilungen durchlaufen. Also nicht der ganze Kurs auf einmal in die Orthopädie, sondern ein bis drei Auszubildende in der Inneren, zwei in der Chirurgie, usw. und im darauffolgenden Semester änderte der Plan. Unser Jahrgang bestand aus 25 „Schwestern“, meist aus gut-protestantischen Elternhäuser, die natürlich auch regelmäßig die angebotenen Bibelstunden besuchten. Mit war nicht so ganz klar, inwieweit diese Stunden obligatorisch waren oder nicht. Für mich war das jedenfalls auf Dauer keine Option, denn nach ein- bis zweimaligem Besuch hatte ich genug von dem überschwänglichen Beten und Singen. So stelle ich mir eine Sekte vor. Mit erhobenen Händen, geschlossenen Augen und stehen im Kreis lauthals beten, bitten und singen. Nein, das fühlt sich für mich wirklich sehr befremdlich an und so beschloss ich, nicht mehr daran teilzunehmen. Das war mein erster Fauxpas. In einem Diakoniekrankenhaus hat man gläubig zu sein, zumindest nach außen.
Meine liebsten Stationen waren die Frühgeborenen- und die Säuglingsstation. Zwischen all den unschuldigen und hilflosen kleinen Wesen fühlte auch ich mich sauberer und ohne Schuldgefühle. Die Babys gaben mir Halt und auch eine sinnvolle Aufgabe. Ich umsorgte sie überaus gerne und blieb abends oft länger, als meine Dienstzeit dauerte. Bei ihnen konnte ich den Essdruck für eine Weile vergessen. Trotzdem lebte ich auch im Spital die Bulimie. Sie war immer präsent und überall, deswegen war ich froh, wenn wir Schule hatten und ich einfach sitzen bleiben musste. Das waren die einzigen Tage, an denen ich über einen längeren Zeitraum keine Möglichkeit hatte, mich in irgendeiner Form meiner Essstörung zu widmen. Der Unterrichtsstoff gab mir eine gewisse Erfüllung, alle Fächer waren spannend, ich interessierte mich für alles und alles war neu. Anatomie, Physiologie, Psychologie, Hygiene, Laborwesen und einfach alles. Nur Mathe war mühsam, aber das war ich ja gewohnt. Und soweit ich mich erinnere, gehörte Mathe nicht zu den wichtigsten Fächern. Die Ausbildung lief gut an, ich hatte Freude daran und nach kürzester Zeit auch eine Freundin gefunden. Für die ersten zwei Semester wohnten wir in einem Zweier-Zimmer, d.h., mit einer Schulkameradin zusammen. Meine Zimmerkollegin hieß Birgit und kam aus einem Dorf nahe Schwäbisch Hall. Birgit hatte viele positive Eigenschaften, aber Schönheit gehörte nicht dazu. Sie war klein und sehr gedrungen, hatte ein ausgesprochenes Doppelkinn, eigentlich hatte sie überhaupt keinen Hals und extrem dünne, fadenscheinige Haare, die sie täglich waschen musste, weil sie sonst fettig waren. Ausserdem hatte sie rote, manchmal eitrige Pickel im Gesicht. Birgit war aber auch lieb und so was von aufrichtig. Ich konnte wirklich alles mit ihr besprechen, sie hörte einfach immer zu und gab sehr bedachte Antworten. Sie trank keinen Alkohol und rauchte auch nicht. Birgit war sehr gläubig und durch sie besuchte ich die paar Male die Bibelstunden. Ich bin sicher, aus Birgit wurde eine sehr gute Kinderkrankenschwester. Ungefähr nach dem ersten halben Jahr begannen langsam meine Probleme. Jeder Jahrgang oder Kurs bewohnte ein Stockwerk. Auf jedem Stockwerk gab es eine Gemeinschaftsküche, in der die Schwesternschülerinnen an den Wochenenden oder auch je nach Dienst Lebensmittel lagern oder auch kochen konnten. Es gab schon eine Kantine, in der gegessen wurde, aber manchmal waren die Dienste so, dass die Kantinenzeiten mit den Dienstzeiten kollidierten und sich die Mitarbeiter selbst versorgen mussten. Das hatte ich natürlich sehr schnell rausgefunden und nach einer gewissen „Karenzzeit“ begann ich, aus den Schränken und Kühlschränken Lebensmittel zu stehlen. Einige Zeit ging das gut, bis die ersten Infoblätter die Runde machten. Es wurde der Lebensmitteldieb, beziehungsweise die Diebin gesucht. Ich bekam ein furchtbar schlechtes Gewissen und begann mich immer unwohler zu fühlen. Mittlerweile war ich im zweiten Semester und hatte Andreas, einen Zivildienstleistenden kennen gelernt, der in der Stadt in einer WG ein Zimmer hatte. Außerdem war er Psychiatriepfleger, was mir mächtig imponierte. Nachdem im Schwesternwohnheim eine Diebin rumging, beschloss ich als Schutz vor mir Selbst, öfter oder auch bis auf Weiteres bei Andreas zu übernachten und von ihm aus zum Dienst zu gehen. Ich liebte ihn nicht, er mich vielleicht schon, wer weiß das schon, aber ich schätzte sein WG-Zimmer. Die körperlichen „Nebenwirkungen“ nahm ich als gegeben hin. Ich empfand weder positive noch negative Gefühle. Es war eben ein Geben und Nehmen. Ich glaube, dass ich mich damit auch aus meiner essgestörten Einsamkeit befreien wollte, denn in dieser WG war immer was los. Abends oft Party oder zumindest zusammenhocken und altklug politisch daherreden. Ich war immer gerne bei den Zivildienstlern, denn sie waren auch politisch und sozial ganz auf meiner Wellenlänge. Das war auch in Winnenden schon so. Im Jahr zuvor, noch in Winnenden, war ich Teil einer Clique, die aktiv gegen Abrüstung und die Stationierung von Mittelstreckenraketen demonstrierte und auch dahingehend Aktionen durchführte. „Holzspielzeug im Tausch gegen Kriegsspielzeug. Weg mit dem Krieg im Kinderzimmer!“
Die Entscheidung, woanders als im Schwesternwohnheim zu nächtigen kam bei den Diakonissen gar nicht gut an und nach kürzester Zeit wurde ich zu einem Gespräch mit der Mutter Oberin gebeten. Sie empfahl mir eine Rückkehr ins Wohnheim, ansonsten müsse sie mit meinen Eltern Kontakt aufnehmen. Außerdem wurden meine Sommerferien bis auf Weiteres verschoben. Sie wolle mich einer Prüfung unterziehen und ließ mich statt nach Hause fahren, Dienst in der Kinderpsychiatrie tun. Mit meinen Eltern reden? Ich war doch schon bald Neunzehn und konnte tun und lassen, was ich wollte!! Nein, im Diakonissenheim galten andere Regeln und solange man in der Ausbildung war, musste man sich denen fügen. Ich hatte einen Vertrag unterschrieben und also zog ich wieder zurück ins Wohnheim, stellte aber sogleich einen Antrag auf ein Einzelzimmer, welches ich alsbald bekam. Eine oder zwei der Kurskolleginnen hatten die Ausbildung geschmissen und dadurch gab es freie Zimmer.
Somit startete ich in der Kinderpsychiatrie, wo ich selbst wahrscheinlich am dringendsten hingemusst hätte. Mein Einsatz dort war eine Aneinanderreihung von Verstörung, Überforderung und Faszination. Ich lernte Kinder und Jugendliche kennen, die komplette Pflegefälle waren, nur in Betten lagen, denen stündlich via Absaugrohr Schleim über den Mund abgesaugt werden musste (das war u.a. eine meiner Aufgaben) und die Windeln trugen. Warum diese Menschen in der Psychiatrie waren, ist mir heute ein Rätsel. Dann betreute ich einen etwa zehnjährigen Jungen mit Absenzen. Plötzlich und unerwartet hielt er in seinem Tun inne, stand nur da, regte sich nicht mehr und wenn man lange genug wartete, fiel er um oder er kam wieder zu sich. So genau wusste man das nie. Das Umfallen galt es zu verhindern. Ich sollte während solch eines Anfalls die Sekunden der Absenz zählen. Wofür das wichtig war? Ich weiß es nicht. Auch für einen anderen Jungen mit epileptischen Anfällen war ich die zuständige Pflegerin. Und dann kam ich das erste Mal in meinem Leben mit einem ebenfalls essgestörten Mädchen in Kontakt. Sie war dreizehn und hatte Magersucht. Sie war spindeldürr, hatte weizenblonde, lange Haare, ein engelsgleiches Gesicht und war durchtrieben, wie ich es vorher noch nie erlebt hatte. Sie trickste mich ständig aus und irgendwie ging sie mir extrem auf die Nerven. Einerseits weil sie stur und trickreich ihre Krankheit auslebte, anderseits weil ich mich in ihr gespiegelt sah und auf keinen Fall so hinterlistig sein wollte. Ständig musste sie überwacht werden, ansonsten trank sie vor dem morgendlichen Wiegen auf dem WC noch schnell 1 Liter Wasser. Oder sie steckte sich heimlich Fünf-Mark-Münzen in die Scheide. Einerseits verhandelte sie beim Mittagessen ewig wegen einer Bohne oder sonstigen Nahrungsmitteln, andererseits hielt sie sich zwischen den Mahlzeiten ständig in der Küche auf und wollte irgendwas kochen oder backen. Ich verstand dieses Mädchen nicht, verstand nicht, was sie für ein Problem hatte, und fand sie einfach nur blöd und arrogant. Nun ja, ihr Problem war diametral zu meinem. Ich fraß gezwungenermaßen, was das Zeug hielt, und scheute deswegen Küchen, wie „der Teufel das Weihwasser“ und sie fühlte sich genau dort am wohlsten und aß nichts.
Während meiner Zeit auf der Kinderpsychiatrie lernte ich Reiner, einen sehr gutaussehenden und wirklich netten Kinderarzt näher kennen, den ich aus der Ferne schon eine Weile anhimmelte. Fast täglich begegneten wir uns während der Dienste und immer, wenn wir miteinander sprachen, fühlte ich mich ganz beseelt, aber auch klein, hässlich und unbedeutend. Ach herrje, was war das für eine Zeit. Eines Tages lud er mich zu sich nach Hause ein, zu einem Spaghetti-Essen. Zuerst dachte ich, es kämen noch andere, denn für mich war es unvorstellbar, dass ich von einem für mich so wunderbaren Mann eingeladen wurde. Doch tatsächlich war ich die Einzige und sollte es auch bleiben. Als ich in seine kleine Wohnung eintrat, hatte er die Spaghetti schon fast fertig, der kleine Tisch in der Küche (er besaß keinen Esstisch in seinem Wohnzimmer) war gedeckt und ein Kerzlein brannte. Wir erzählten ein bisschen und langsam legte sich meine Nervosität. Das große Problem für mich waren allerdings die Spaghetti. Ich konnte die nicht essen, ohne sie anschließend wieder zu erbrechen. Pasta gehörte auf meine schwarze Liste und diese zu ignorieren war zu jener Zeit ein absolutes No-Go. Es kam, wie es kommen musste: nachdem ich meinen vollen Teller leer gegessen hatte und mich nicht traute, um weniger zu bitten, verzog ich mich auf sein WC. Das war grundsätzlich ja nichts ungewöhnliches, aber Reiner wohnte in einer Altbauwohnung mit einem uralten WC und dementsprechend alten Rohrsystem. Ich weiß nicht, ob früher die Rohre generell enger waren, ich weiß nur, dass ich mit meiner Portion Spaghetti sein WC verstopfte. Ich spülte zweimal, dreimal und war ganz verzweifelt und traue mich schon fast nicht mehr aus der Toilette. Nichts ging mehr, das Toilettenwasser stand am oberen Rand und die Spaghetti schwammen darin. Oje,oje, wie sollte ich das meinem Schwarm erklären ? Ich schämte mich in Grund und Boden, war den Tränen nahe und beschloss, unter Vortäuschung von Kopfschmerzen sofort seine Wohnung zu verlassen. Fluchtartig habe ich mich damals verabschiedet und bin unter Tränen aus dem Haus gestürmt. Der arme Mann war völlig perplex und wusste gar nicht, was geschehen war. All mein Sinnen und Streben in jener Zeit waren, ihm möglichst aus dem Weg zu gehen, sonst wäre ich vor Scham in den Erdboden versunken. Vielleicht lief er mir irgendwann nochmals über den Weg, aber meine Tage in Schwäbisch Hall waren sowieso bereits angezählt. Ich fühlte mich so schlecht und hatte aufgrund meiner Esssucht eine erste Liebes-Chance vergeigt. Nach dieser Erfahrung hielt ich es für besser, von den „großartigen“ Männern Abstand zu nehmen und verzog mich wieder in mein Schneckenloch, respektive hin zur Zivi-WG.
An den Wochenenden oder an meinen freien Tagen hielt ich mich entweder im Notfall auf, wo ich einem Diakonischen Helfer mit Verbänden und Verpflastern unter die Arme griff, im Seniorenpflegeheim, in dem ich mich auch etwas nützlich machen konnte und auch eine Freundin hatte, oder ich war in der WG in der Stadt anzutreffen. Dort wurde debattiert, politisiert, gekocht, getrunken, geliebt (immer mal wieder schleppte einer der Bewohner eine neue Freundin an) und gekifft. Insgesamt wohnten dort fünf bis sechs Zivildienstleistende, die im „Diak“ arbeiteten. Die Wohnung war eine Immobilie der Diakonie, deswegen auch sehr günstig. Und wenn es Probleme gab, wurde die Leitung des Diakoniekrankenhauses informiert, worauf ein Inspektor sich anmeldete, um die Sachlage zu prüfen. So auch, als es wieder einmal während einer Party lauthals zu und her ging und währenddem kräftig gekifft wurde. Ich natürlich mittendrin! Der Hausmeister hatte Meldung gemacht, nachdem sich die Nachbarn beschwert hatten. Am nächsten Tag stand eine Abordnung der Diakonie vor der Türe, die sich die Namen der Anwesenden notierten und eine Sichtung der Zimmer vornahmen. Dabei gerieten die Zimmerpflanzen zweier Bewohner ins Visier, die zwar nicht ganz legal waren, dafür aber einen sehr sonnigen Fensterplatz hatten. Das war mein zweiter Fauxpas.
Meine Eltern wurden her zitiert. Ohne Umschweife erklärte die Mutter Oberin, dass ich noch nicht reif für eine Ausbildung in ihrem Haus wäre und ich doch wiederkommen solle, wenn ich soweit wäre. Meine Eltern erklärten ihr, dass ich das Essstörungsproblem hätte und sie das doch berücksichtigen solle. Daraufhin meinte sie, ich solle wiederkommen, wenn ich gesund wäre, Punkt! Noch am selben Tag musste ich alles packen und das Diakoniekrankenhaus verlassen. Andreas, der Psychiatriepfleger stand im Hof und wollte mich verabschieden, worauf ihn mein Vater anbellte, hätte er mal früher geschaut, dann wäre es gar nicht so weit gekommen. Während der mehr als zwölf Monate meiner Ausbildung in Hall hatte ich keinen Tag Ferien, kein Geld, um heimzufahren und war in dieser Zeit auch nie zuhause. Die anderen Mädchen konnten jedes zweite Wochenende in ihrem Elternhaus verbringen. Damit hatte sich meine 1. Lehrstelle erledigt.

Ich war Neunzehn, bald Zwanzig und hatte nichts. Keine Ausbildung, keinen Führerschein, mit dem ich in Hall begonnen hatte, nichts bis auf eine Kotz-Brechsucht, die mir meine Träume frass. Die Heimfahrt mit all meinem Gerümpel im Auto verlief mehr oder weniger sprachlos. Ich glaube, damals hatte niemand eine Idee, wie es weiter gehen sollte. Zunächst arbeitete ich für einen miesen Stundenlohn in der Marzipanfabrik (ausgerechnet!), um die Schulden des nicht erlangten Führerscheins an meinen Vater zurückzuzahlen. Meine Mutter arbeitete unterdessen an meiner weiteren Zukunft. Das Wichtigste wäre, erklärte sie mir, dass ich gesund werden würde und deswegen habe sie mit Hilfe von Tante Gertrud eine Klinik gefunden, die solche „Fälle “wie mich aufnehmen würden.
Dabei handelte es sich um die „Friedrich-Husemann-Klinik“ in Buchenbach bei Freiburg im Breisgau, meine nächste Station, in der ich die nächsten paar Monate verbringen würde. Die Friedrich -Husemann-Klinik ist eine anthroposophische Einrichtung, eine psychiatrische und psychotherapeutische Klinik, die nach Rudolf Steiners Ansätzen therapiert. Die Therapiemöglichkeiten waren vielfältig: Eurythmie, Malen, Schreinern, Gartenarbeit, Singen, Theater spielen, Küchendienst und Kunst, um nur einige zu nennen. Unterstützt wurde das Ganze mit Badekuren, Wickeln, homöopathischen Mitteln, spezieller Ernährung und natürlich den therapeutischen Gesprächen. Zu meiner Zeit waren dort vorwiegend Menschen, die vorübergehend und kurzfristiger aus dem „Rahmen gefallen“ waren. Burnout, Angstzustände, Sonnenstich, aber auch Depressionen und Schizophrenie. Ich war die einzige mit einer Essstörung. Vermutlich würden sie mich heute nicht mehr aufnehmen. Essstörungen waren zu Beginn der Achtziger-Jahre relativ exotisch in der Psychotherapeutischen Behandlung. Umso mehr kam ich mir in dieser Klinik wie eine Versuchsperson vor. Die Gespräche waren wirklich sehr intensiv und das erste Mal in meinem Leben hörte mir auch jemand zu und nahm mich ernst. Mein damaliger Arzt war ein Niederländer und ich habe ihn sehr gemocht, um nicht zu sagen, ihn fasst etwas als Vaterersatz gesehen, Dr. Laban. Er war ein unkonventioneller Arzt und für mich genau der Richtige. Dumm war nur, dass er nach einigen Monaten die Klinik verließ, um wieder in die Niederlande zurückzukehren. Aber alle weiteren Therapien waren nicht gezielt auf eine Essstörung ausgerichtet. Malen tat mir gut, Singen auch und alles andere war auch interessant, aber nichts half gegen diesen übermächtigen Essdruck und diese sich ständig ums Essen kreisende Gedanken. Irgendwann konnte ich alle überlisten, nahm heimlich Brot mit aus dem Speisesaal, stahl Brot und anderes aus der Teeküche, gab mein Minitaschengeld in einem nahegelegenen Café für Apfelkuchen aus, usw. Mir konnte einfach nicht geholfen werden. Auch die homöopathischen Mittel, wie Blei und Silber zur Erdung waren völlig nutzlos. Das Einzige, was mich und meine Gedanken etwas ablenkte, waren Menschen, in deren Gesellschaft ich mich wohlfühlte. Doch eine ständige Begleitung war völlig unrealistisch, weder ich noch sonst wer strebte das an. Außerdem wollte ich meine „Freundin Essstörung“ gar nicht wirklich loswerden. Sie half mir nämlich bei jeglicher Art der Emotionsregulierung. War ich wütend, fraß ich, war ich traurig fraß ich, war ich glücklich, fraß ich und hatte ich Langeweile oder spürte ein Loch, fraß ich ebenfalls. So nahm ich an, was kam, lebte die Tage malend, singend und so fort und genoss die therapeutischen Gespräche, bei denen sich alles um mich drehte. Hach, wie schön!
Nach einigen Monaten, vielleicht vier oder fünf, verabschiedetet sich mein Arzt aus der Klinik und von mir. Ich tat mich außerordentlich schwer damit und konnte mir gar nicht vorstellen, nochmals so ein Vertrauen in einen anderen Therapeuten aufbauen zu können. Weinte auch, war enttäuscht, dass er zuerst ging. Seine Verabschiedung von mir zelebrierte er auf ungewöhnliche Art und Weise. In der letzten Therapiestunde gingen wir in den Wald, wo er mich bat, hinter einem Baum mit geschlossenen Augen stehen zu bleiben. Während ich stand, erklärte er mir die „Spielregeln“, die ungefähr so gingen: während er langsam weglaufe, solle ich selbst Schritte machen. Wenn er sage: „Augen auf“, sollte ich langsam und in kleinen Schritten Richtung Ausgang Wald gehen, während er in die andere Richtung lief. Ich sähe ihn nicht, würde ihn nur hören. Dies übten wir einige Male. Naja, ob’s geholfen hatte, weiss ich nicht mehr so genau, ich war jedenfalls sehr traurig. Mit seinem Nachfolger hatte ich Mühe, war auch gar nicht mehr bereit, nochmals von vorne anzufangen. Deswegen habe ich mich etwa 1-2 Monate später, nachdem ich bereits auf der Suche nach einer Arbeitsstelle ein paar Mal in Freiburg gewesen war, frühzeitig gegen ärztlichen Rat selbst entlassen. Zu diesem Zeitpunkt war ich zwanzig und hatte weder eine Bleibe noch einen Job.

Nachdem ich meinem Aufenthalt in der Friedrich-Husemann-Klinik ein Ende gesetzt hatte, und zwar ohne nennenswerte Fortschritte in Richtung Gesundung, nahm ich mein weiteres Leben in Begleitung «meiner» Essstörung in Angriff.
Zunächst lebte ich wieder für kurze Zeit bei meinen Eltern zuhause, wo ich immer noch mein Zimmer hatte. Was wollte ich dort? Es erwartete mich nichts ausser die unterschwelligen Vorwürfe meiner Eltern und unserer Sprach- und Planlosigkeit. Weil ich schon einige Monate «Aussenluft» in der grossen Welt geschnuppert hatte, war es verständlich, dass ich nicht im Dorf bleiben konnte und wollte. Deswegen trampte ich wenige Tage später mit einem Rucksack voller Utensilien nach Freiburg. Dort hatte ich eindeutig die besseren Chancen auf eine berufliche Zukunft. Vor allem die einer Berufsausbildung nach meinen Wünschen. Für mich war immer klar, dass ich eine Ausbildung machen würde, am liebsten wieder die zur Kinderkrankenschwester.
Primär benötigte ich eine geeignete Unterkunft. Um aber ein Zimmer oder eine kleine Wohnung zahlen zu können, war ein Job unabdingbar. So packte ich meinen Rucksack in ein Schliessfach am Hauptbahnhof und zog los, um mich auf die Suche nach Arbeit zu machen. Es war Sommer und überall gab es Restaurants oder Beizen, die auf den Strassen und Plätzen Gartenwirtschaften betrieben. Während meiner Zeit in der Buchenbacher Klinik, war ich einige Male in Freiburg gewesen und wusste, wo die vom Tourismus stark frequentierten Restaurants lagen. Nämlich auf dem Münsterplatz. Dort müsste es doch auch einen Aushilfsjob für mich geben. Schon beim zweiten Restaurant «Zum schwarzen Rappen» linksseitig des Münsters hatte ich Glück. Der Chef der Gaststätte war bereit, mich während des ganzen Nachmittags auf der Terrasse bedienen zu lassen. Er wollte sehen, wie ich mich so mache und benötigte wohl auch gerade eine billige Arbeitskraft. Zu dieser Tageszeit gab es nur kleine Speisen und Getränke, somit war die Arbeit im Grossen und Ganzen kein Hexenwerk. Trotzdem gab es viel zu tun, denn es war ja Hochsaison und viele Touristen in der Stadt. Den ganzen Nachmittag rannte ich hin und her und schleppte Kaffee und Wasser und was es dort so alles gab. Und dann, gegen Ende der Schicht, kam die eigentliche Herausforderung: ich hatte immer noch keine Unterkunft! Während der Abrechnung traute ich mich tatsächlich den Chef zu fragen, ob ich morgen auch wieder arbeiten dürfte und wenn ja, ob er mir ein Zimmer hätte. Seine Antwort lautete folgendermassen: «Bedaure, aber Personalzimmer haben wir nicht, nur die Zimmer für Hotelgäste. Aber wenn ich mich mal kurz gedulde, er hätte da einen Kollegen…». Dann lief er weg, um zu telefonieren. Nach ein paar Minuten kam er zurück und fragte mich, ob ich auch bereit wäre, eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau zu machen. Dieser Kollege, mit dem er eben telefoniert hatte, suche einen Lehrling und er könne mich nur empfehlen. Ich hätte eine schnelle Auffassungsgabe und wäre fleissig. Wenn ich Interesse hätte, könne ich heute noch dorthin und mich vorstellen und Personalzimmer gäbe es dort auch.
Juchuu!! Das wäre geschafft! Doch wollte ich wirklich Restaurantfachfrau werden? Das hatte ich mir noch gar nie überlegt. Aber egal, Hauptsache ich war versorgt. Ausbildung ist Ausbildung! Noch am selben Abend holte ich meine Sachen aus dem Schliessfach und begab mich auf den Weg quer durch die Stadt hinauf auf den Lorettoberg. Das waren ungefähr 5 km, mit einmal verlaufen. Dort oben, auf einem Hügel über Freiburg mit allerschönster Aussicht auf die Stadt lag die Gaststätte «Wappen von Freiburg». Ein Restaurant, das von einem österreichischen Ehepaar geführt wurde und in dem die «neue Küche» - «Nouvelle Cuisine» gekocht wurde. Das grosse Vorbild des Chefs war der französische Koch und Küchenpapst Paul Bocuse, den er gemäss seiner Erzählung sogar einmal persönlich kennen lerne durfte. Er hatte nämlich vor dem «Wappen von Freiburg» in Salzburg im «Weissen Rössel» gekocht. Heute frage ich mich schon, ob meine Einstellung ein Entscheid von beiden Chefs war oder nur von ihm. Ich nenne sie jetzt mal nur bei den Vornamen Josef und Elisabeth, damit ein bisschen Anonymität gewahrt bleibt. Sie war die Chefin des Service und er der Chef «Alleinherrscher» der Küche. Sie war der Kopfmensch und er der Gefühlsbetonte. Er war der Schwache, der Choleriker und der Genussmensch. Sowohl beim Essen und Trinken als auch in seinen sonstigen Trieben. Sie war diejenige, die die Finanzen im Griff behielt, wohingegen er meistens mit der «grossen Kelle anrichtete». Ich glaube, er fand mich süss und unkonventionell, als ich da so verschwitzt und barfuss auf dem Lorettoberg ankam und mich vorstellte. Wie sonst musste das bewertet werden, dass er mich überhaupt einstellte. Mit meinem verdreckten Erscheinungsbild habe ich sicher nicht gepunktet, von meinen beruflichen Qualifikationen mal ganz zu schweigen. Sie wussten bis auf die Empfehlung des Kollegen vom Münsterplatz rein gar nichts über mich. Ich war sein potenzielles «Hobby». Er konnte mich formen und niemand redetet ihm dazwischen. Elisabeth hatte wohl mehr Zweifel an meiner Eignung, aber auch sie sah ihre Möglichkeiten. Ich war immerhin volljährig und damit nicht mehr schulpflichtig. Das hieß, ich war eine junge und billige Arbeitskraft, die man wunderbar über den Tisch ziehen konnte. Ich war einfach jung und naiv, aber irgendwie auch mutig. Wir machten einen Vertrag mit Lehrbeginn 01.08.1983 und einem Verdienst, der zwar gesetzlich vorgeschrieben war, aber die Abzüge für Kost und Logis konnten "frei Schnauze" festgelegt werden. Im ersten Lehrjahr sollte ich 585.- DM verdienen, im zweiten 670.- und im dritten 750.-DM. Abzüglich Kost und Logis blieben mir im ersten Lehrjahr 135.-DM, die ich ausbezahlt bekam. Davon musste ich mir noch meine Arbeitskleidung (Servierschürzen) kaufen und alles andere, was ich sonst so benötigte. Ich konnte also nicht einmal kleine Sprünge machen, aber glücklich über die Lehrstelle war ich trotzdem. Nach den Sommerferien sollte dann eigentlich auch die Schule losgehen, worauf ich mich freute.
Die Probezeit betrug drei Monate und war im Flug vorbei. Jetzt musste nur noch die Sache mit der Schule geregelt werden, denn ich hatte noch keine Ahnung, wo die Berufsschule war und wie das Ganze organisiert werden sollte. Als ich Elisabeth darauf ansprach meinte sie nur, da ich ja volljährig sei und demnach auch nicht mehr schulpflichtig, müsse ich keine Berufsschule besuchen. Das Berichtsheft könne ich auch unter ihrer Regie im Restaurant schreiben. Am Ende eines jeden Lehrjahres müsse es dann eingereicht werden und irgendwann käme noch eine Prüfung.
So kam es, dass ich die ganze Woche und jedes Wochenende, alle Abende und Festtage und alle Nächte auf dem Lorettoberg verbrachte. Sonntag und Montagvormittag war Ruhetag, ab Montagabend war das Restaurant wieder geöffnet. Überstunden wurden keine gezählt, am Montagvormittag musste die Tischwäsche gebügelt werden oder manchmal auch während der Zimmerstunden, die täglich zwischen 14.30 Uhr und 17.00 Uhr waren. Ab 17.00 Uhr wurde geputzt, bis das Restaurant um 18.00 Uhr wieder öffnete. Meine Ausbildung begann zunächst im Service. Tische abräumen und neu eindecken. Als Erstes lernte ich das Geschirr auf meinen Armen zu stapeln oder «wie man fachmännisch in einem Aufwasch einen Tisch mit vier Personen abräumt». Für jedes zerdepperte Glas oder Geschirr mussten wir fünf Mark in eine Kasse zahlen. Eine kostspielige Sache, vor allem, wenn man kein Geld besass. Dann musste man Schulden machen und darum habe ich vor allem die Reinigung der Gläser sehr schnell kapiert. Die teuren, grossen Bordeauxgläser oder die langstieligen Champagnergläser spülen und trockenreiben, dass sie 1a glänzten. Für das ganze Service-Team war diese Arbeit die absolute Herausforderung und unter Umständen konnte das sehr teuer werden. Das Team bestand neben den beiden Chefs aus einem ausgelernten Kellner, mir und zwei Kochlehrlingen. Ein paar Monate später kam nochmals ein Restaurantfachlehrling dazu. Der Liebling war eindeutig der ausgelernte Kellner. Er war nicht viel älter als ich, sehr wohlerzogen und schaffte einiges weg. Elisabeth sah ihn ein bisschen, wie ihren Sohn. Karl war sein Name und er kam aus einer wohlhabenden Freiburger Familie, das weiss ich noch. Jeden Morgen um 9.00 Uhr erschien er gutgelaunt am Lieferanteneingang zur Küche, worauf ich mich immer freute. Ich mochte ihn, er war für mich die Verbindung zur Aussenwelt. Zumindest in den ersten Monaten, als ich mich noch keinen Schritt vom Restaurant Lorettoberg weg wagte.
Im Gegensatz zur Küche, ging es bei uns im Service etwas gesitteter zu. Wie bereits erwähnt, war Josef ein sehr emotionsgesteuerter Mensch. Er konnte einerseits nett und verbindlich, manchmal sogar charmant und herzlich sein, andererseits auch richtiggehend toben. Mehrmals warf er mit Geschirr oder Bestecken nach uns. Vor allem, während der Stosszeiten, wenn das Lokal voll war und viele unterschiedliche Speisen bestellt wurden. Dann lief er zur Hochform auf, unter der besonders seine zwei weiblichen Kochlehrlinge, Michaela und Linda zu leiden hatten. Michaela war halb Nigerianerin und halb Deutsche und wuchs in einem Kinderheim im Schwarzwald auf. Wie auch immer es dazu kam, im Alter von 15 /16 Jahren übernahmen die beiden Lorettoberg-Chefs die Vormundschaft Michaelas für die Dauer ihrer Ausbildung. Im Nachhinein betrachtet, war das die grösste Sauerei, denn Michaela war noch minderjährig und dadurch in allen Situationen ihrem «Ziehvater» ausgeliefert. Schlimm wurde es, wenn sie während Josefs cholerischen Phasen nicht sofort verstand, was er wollte oder nicht sofort tat, was er sie geheissen hatte. Dann konnte er sie auch schon mal mit der Fleischgabel ins Gesäss stechen, sodass sie durch ihre weisse Kochuniform und der umgebundenen Schürze hindurch blutete. Mehrmals ist dies geschehen und ich war darüber jedes Mal total konsterniert. Grundsätzlich setzte sich Michaela verbal zur Wehr, aber ausrichten konnte sie nichts. In ihrer «Gossensprache» schimpfte und empörte sie sich, aber er lachte nur. Das demütigte Michaela noch mehr.
Linda stach er nicht mit der Gabel, sondern warf ihr Dinge nach, wie zum Beispiel einen Milchkrug. Einmal verfehlte er ihren Kopf nur um Haaresbreite, worauf Lindas Eltern das Gespräch mit Josef suchten. Erreicht haben sie eigentlich nur das Gegenteil. Es wurde noch schlimmer. Linda wohnte in einem Dorf Richtung Emmendingen. Sie kam aus einfachen Verhältnissen, hatte jedoch sehr nette Eltern und einen Beo. Den lernten wir kennen, als Linda Michaela und mich einmal zu sich nach Hause einlud. Schon an der Türe begrüsste uns der Beo mit lautem «Grüss Gott». Er konnte richtig sprechen und wir alle hatten unseren Spass daran, ihn Wörter oder Sätze nachsprechen zu lassen. Linda wurde von Josef sehr gemobbt. Nichts konnte sie recht machen. Ständig machte er sich über sie lustig. Er quälte sie auch dann, wenn er nicht unter Druck stand. Einfach so aus Spass. Sie war eine sehr ruhige und introvertierte Person und liess sich alles gefallen. Je mehr er über sie herfiel, desto mehr zog sie sich zurück. Ich glaube, dass ihn diese stoische Ruhe so provozierte. Oft beschimpfte er sie als dumm und einfältig, sagte ihr, sie würde niemals die Prüfung schaffen und was sie denn überhaupt in einer Küche wolle, liess sie kiloweise Zwiebeln schneiden und so weiter.
Dieser Josef war ein echtes – Verzeihung! -Arschloch! Bei mir trieb er seine sadistische Seite jedoch auf den Gipfel. Abgesehen davon, dass er es geradezu genoss, mir während dem Service die mit Speisen beladenen, backofenheissen Teller neben das schützende Tuch direkt auf den Arm zu stellen, pflegte er seine Macht auch in der Freizeit auszuleben. Michaela und ich wohnten beide in Zimmern oberhalb des Restaurants. An manchen Wochenenden fuhr sie jedoch zu ihrer leiblichen Mutter, dann war ich allein mit den beiden Chefs. Eines Sonntags klopfte es an meiner Türe und Josef stand da und wollte, dass ich mit ihm und seinen Hunden ein Spiel spielen würde. Klar, liess ich mich darauf ein, warum auch nicht? Wir gingen hinunter in den Hof und Josef liess seine beiden Hunde, einen sehr bulligen Rottweiler und einen Dobermann aus der Voliere und hielt sie am Halsband fest. Dann bat er mich, ich solle unter einen Baum stehen, ungefähr 20 Meter entfernt von ihm, was ich auch tat. Nun erklärte er mir, ich solle ganz ruhig stehen bleiben und mich nicht bewegen. Dann liess er seine Hunde los und rief «Go», worauf die beiden Ungetüme auf mich zu rannten. Ich dachte, «der ist doch verrückt, was macht er denn da? Das kann er doch nicht ernsthaft machen». Ich war zu Tode erschrocken. Ich dachte, mein letztes Stündlein hat geschlagen. Kurz bevor sie an mir hochsprangen oder mich fassten, rief Josef «Stopp» und stiess einen durchdringenden Pfiff aus, worauf die beiden Hunde stoppten, umkehrten und wieder zu ihm zurückrannten. Ich war völlig verängstigt und bekam kein Wort heraus, was Josef sehr amüsierte. Er wollte einfach testen, ob seine Hunde ihm auch aufs Wort folgten. Wochen oder Monate später machte er das ohne Ankündigung noch einmal, während ich leere Flaschen in den Glascontainer warf.
Natürlich litt ich auch im «Wappen» an der Bulimie. Das war meine andere, geheime Seite. Niemand wusste davon und so sollte es auch bleiben. Doch es war nur eine Frage der Zeit, bis ich ertappt wurde. Am Tisch mit den anderen ass ich nie auffallend viel, doch ich stahl Butter, Brot und Käse, auch mal eine Flasche des billigen Landweines, Salami, von den vorgekochten Spätzle oder was es gerade so gab. Heimlich schlich ich mich entweder ganz früh am Sonntagmorgen oder während der Zimmerstunde hinunter in die Küche, packte ein, so schnell es ging und schlich wieder in mein Zimmer. Dort zelebrierte ich dann eine Fressorgie. Ein ganzer Laib Brot mit dick Butter und Käse oder Marmelade und dazu Fanta oder Cola oder sonst was, um hinterher wieder alles zu erbrechen. Den Wein genoss ich, denn das war mein Schutz vor einer weiteren Fressattacke. Mit Alkohol konnte ich auch einen Abend ohne Fressen durchstehen. Im Laufe der Zeit entwickelte ich immer mutigere Fressstrategien.
Mittlerweile wusste ich, dass Josef Samstagabends oder -nachts, nachdem sich der letzte offizielle Gast verabschiedet hatte, mit einem finanziell potenten Kollegen, der irgendwann des Abends erschien, Party machte. Nennen wir ihn Kurt. Kurt war ein einsamer Single im Alter von etwa vierzig Jahren. Dick, bleich und fettig. Aber er hatte Stutz. Josef wickelte Kurt leicht um den Finger. Er liess sich unter fadenscheinigen Begründungen zu Männerabenden in den besten Bars und Restaurants der Stadt einladen. Diese Nächte, die im «Wappen von Freiburg» mit einem Gourmetmenü begannen, mit Austern und/oder Kaviar fortgeführt wurden und mit viel, viel allerbestem Alkohol in einer ausgesuchten Bar irgendwo in Freiburg weiter liefen, endeten meistens in den frühen Morgenstunden des Sonntags im Stüberl des «Wappen von Freiburg». Dort mussten sie unbedingt noch einen Absacker trinken und vor allem etwas Deftiges dazu essen. Dafür weckte er mich. Ich sollte ihnen meistens einige paar Wienerle heiss machen, Brot und Butter und einen deftigen Speck servieren und neben einem gezapften Bier auch noch den teuersten Whiskey, Grappa oder Calvados servieren und anschliessend die leeren Flaschen möglichst ganz unten im Glascontainer vergraben, damit Elisabeth diese Sünde nicht mitbekam. Meist wurde Josef auch noch schmierig und fand, ich solle doch seinen Kurt ganz nett finden und so weiter. Nach ein paar Stunden war die «Sitzung» beendet, worauf der Gast sich verabschiedete und Josef mit dem Auftrag an mich, doch bitte das ganze Zeugs aufzuräumen, zu seiner Elisabeth in die Wohnung unter dem Dach torkelte und sich hernach bis Nachmittag nichts mehr regte. Das war so zwischen neun und elf Uhr am Sonntagvormittag. Dann kam meine Zeit.
Nachdem ich die Gläser und alles andere geputzt und weggeräumt hatte, schlug ich einige Eier in einer Schüssel auf, gab Mehl und Rahm aus der grossen Kanne dazu, die immer im Kühlraum stand, verquirlte alles zu einem Pfannenkuchenteig, schüttete das Ganze in eine Pfanne, die ich bereits auf der Gasflamme heiss werden liess und bereitete mir eine grosse Portion Kaiserschmarren zu. Anschliessend kam alles in eine Schüssel, dazu noch zwei bis drei grosse Löffel Vanilleeis und einen Turm von Schlagsahne aus dem Bläser. Fertig war eine Bombe von etwa 5000 Kalorien. Das alles stopfte ich in ungefähr 15 Minuten in mich hinein, wusch die Schüsseln und die Pfanne und spätestens eine Stunde später war alles wieder picobello sauber. Anschliessend kam der zweite Akt auf dem WC gleich neben meinem Zimmer. Dieses Szenario absolvierte ich x-mal und wurde nie dabei erwischt.
Eines Tages fand Elisabeth eine eingewickelte Butter in meinem Zimmer und das war der Anfang vom Ende. Sie kannte das Einwickelpapier und war ab da überzeugt, dass ich sie bestahl, was ja bezüglich der Lebensmittel auch der Fall war. Der Unterschied war nur, dass sie mich beschuldigte, ihr Silberbesteck zu stehlen und ausser Haus zu schaffen. Das glaubte sie deshalb, weil ich seit kurzer Zeit einen Freund hatte, den ich bei einer meiner sehr seltenen Discobesuche in Freiburg kennen gelernt hatte. Er bewohnte am Bahnhof ein Zimmer und machte nicht gerade einen sehr vertrauensseligen Eindruck auf sie. Das mit dem Silber war natürlich Nonsens, aber ich konnte es ihr im Nachhinein auch nicht verdenken, denn das Vertrauen war dahin. Josef hingegen fand, dass die Vorwürfe von Elisabeth etwas überspannt seien, und hielt in dieser Beziehung eher zu mir, was mich später auch nicht verwunderte. Sah er doch eine reelle Chance, mich endgültig festzunageln. In meiner Not erzählte ich nämlich eines schönen Tages Josef von meiner Essstörung und hoffte, so diese ganzen Vorwürfe abzumildern oder gar aus der Welt schaffen zu können.
Leider verstand er nichts und konnte sich auch keine Sekunde vorstellen, was ich überhaupt für eine Problem habe. Für ihn war klar, die Frau muss mal so richtig rangenommen werden. Eines Abends, ein paar Tage nach unserem Gespräch und nach einem seiner Saufnächte ging bei mir die Türe auf und Josef stand in meinem Zimmer. Das Zimmer war leider nicht abschliessbar, was ja auch seinerzeit Elisabeth bei ihrer Zimmerdurchsuchung zugutekam. Er weckte mich und meinte, er hätte sich das Ganze, was ich ihm erzählt habe, nochmals durch den Kopf gehen lassen und wäre zu dem Schluss gekommen, dass mir nur richtiger Sex helfen könne. Das, was mir fehle, wäre mal richtig durchgebumst zu werden und dann würde ich schon sehen, dass es mir besser gehe. Und um das zu tun, wäre er jetzt zu mir gekommen.
Zuerst drückte er mich gegen die Wand und sich an mich und atmete mir seine abscheuliche Alkoholfahne ins Gesicht. Dann zog er mich aufs Bett, legte sich auf mich und begann mit seiner «Therapie». Ich war wie versteinert, lag da, bewegte mich nicht und wartete, bis er fertig war. Danach schärfte er mir ein, dass Elisabeth aber nichts davon erfahren dürfe und verliess mein Zimmer. Ich erinnere mich noch an ein weiteres Mal in der Badewanne. Danach zog ich in einer Nacht- und Nebelaktion aus.
Sollte ich nun diese Episode auch der Bulimie zuschreiben oder war das einfach nur Pech? Eine grosse Genugtuung erfuhr ich nur wenige Monate später: das Wappen von Freiburg unter der Führung von Josef und Elisabeth musste nicht lange nach meinem Weggang Konkurs anmelden.
Warum überraschte mich das nicht?
Der Typ, den ich in der Disco kennen gelernt hatte und bei dem ich erst einmal unterkommen konnte, war der Sohn eines französischen Generals und hiess Pascale. Er war ungefähr in meinem Alter, vielleicht auch ein bisschen jünger, hatte nichts gelernt und jobbte bei McDonalds. Wie er davon das Zimmer bezahlten konnte und überhaupt seinen Lebendunterhalt bestritt, war mir zwar nicht ganz klar, aber irgendwie war das auch nicht das Grösste meiner Probleme. Ich war einfach froh, der schlimmen Situation im Restaurant entkommen zu sein, obwohl ich jetzt wieder am Anfang stand. Und irgendwie musste ich an mein Zeugnis und überhaupt an alle meine Papiere kommen. Immerhin hatte ich fast ein Jahr im «Wappen von Freiburg» gelebt, gelernt und gearbeitet. Dafür musste ich einen Rentennachweis bekommen und mir standen auch noch die paar Mark meines Gehaltes zu. In dieser Situation unterstützte mich der Kellner, der ein paar Wochen nach mir eingestellt wurde und ebenfalls eine Ausbildung absolvierte. Heute weiss ich gar nichts mehr von ihm. Ich weiss seinen Namen nicht mehr, ob er - so wie ich, die Berufsschule auch nie von innen sah und ob auch er so schikaniert wurde, wie wir alle anderen. Wie ich den Chef einschätzte, stand Schikane sicher auf der Tagesordnung. Einfach nur schon deswegen, weil er ziemlich unter Akne litt. Jedenfalls hatte ich seine private Telefonnummer und rief ihn aus dem nächstgelegenen Telefonhäuschen an. Bald darauf kam er zu Besuch. Ich schilderte ihm die ganze Situation und bat ihn, den Chef um meine Papiere zu bitten. Das tat er zwar umgehend, aber Josef liess ihn ausrichten, wenn ich etwas wolle, sollte ich gefälligst selbst kommen und das Gewünschte abholen. Schweren Herzens ging ich ein letztes Mal den Bergleweg hoch zum «Wappen von Freiburg». Der Bergleweg ist eine Abkürzung der offiziellen Fahrstrasse hinauf auf den Lorettoberg. Sicher um die Hälfte kürzer und teilweise recht steil, aber sehr schön zu laufen. Rechts und links wuchsen Büsche und Bäume, die im Frühling wunderschön blühten. In heissen Sommern war dies ein angenehmer Schattenweg. Oben empfing mich Josef unerwartet freundlich und lud mich ein, am Mittagstisch Platz zu nehmen und etwas mitzuessen. Überaus gut gelaunt erzählte er von Diesem und Jenem, frage mich, wie es mir ginge und was ich jetzt mache. Elisabeth hingegen musterte mich mit ablehnendem Blick. Ich spürte geradezu körperlich ihre Abneigung. Nachdem das Essen beendet war, folgte das unvermeidliche Gespräch unter «vier Augen»
Vermutlich hatte Josef ein sehr schlechtes Gewissen, denn ich weiss wirklich nichts mehr davon. Insofern kann es nicht so schlimm gewesen sein. Ich glaube, er war einfach nur froh, dass ich wegen seiner sexuellen Übergriffe und seiner sadistischen Art weder mit seiner Frau noch mit der Polizei gesprochen hatte. Mir kam es gar nicht in den Sinn, Anzeige zu erstatten. Das war immer so, ich war unfähig, mich für mich selbst einzusetzen. Stattdessen bin ich immer gegangen, wenn es mir zu viel wurde. Als ich nach diesem Abschlussessen den Bergleweg wieder herunterlief mit meinen Papieren in der Hand, fiel mir ein riesengrosser Stein vom Herzen.

(1) Dieses Foto entstand einige Jahre später in London.

Eine Geschichte während meiner Zeit auf dem Lorettoberg muss noch erzählt werden:
Auf dem Heimweg von der Stadt ins Restaurant, während ich den Bergleweg zum Wappen hinauf lief, bemerkte ich etwa auf halbem Weg, dass mir jemand folgte. Ich beschleunigte meine Schritte, worauf auch die Person beschleunigte. Er lief schneller, viel schneller. Angst kroch mir den Rücken hoch und alles Mögliche ging mir durch den Kopf. Ein Vergewaltiger? Innerlich bereitete ich mich darauf vor, dass er mich bald eingeholt hätte und was dann? Was sollte ich nur machen? Als er tatsächlich auf meiner Höhe war und mich ansprach und ich auch schon seine Hand an meinem Gesäss spürte, drehte ich mich blitzartig um und schlug ihm mit all meiner Kraft, die ich aufbringen konnte, mit der flachen Hand ins Gesicht. Verdattert blieb er stehen und ich rannte weiter so schnell ich nur konnte. Einmal habe ich mich noch umgedreht und sah, dass er mit entblösstem und erigiertem Glied dastand und sich daran rieb. Im Restaurant erzählte ich die Geschichte, worauf der Chef die Polizei rief (wie paradox das war!), die ein Protokoll aufnahmen und uns erklärten, dass schon eine ganze Weile ein Exhibitionist hier in der Region sein Unwesen treibe. Ich erstattete jedoch keine Anzeige. Der Mann tat mir leid.
Also, da sass ich nun. In einem Zimmer eines mehr- oder weniger heruntergekommen Hauses, gleich hinter dem Bahnhof, war zusammen mit einem ziemlich gutaussehenden Kerl, der nicht gerade sehr liebevoll war und der tageweise einfach verschwand. Er sagte vorher nichts und als er plötzlich wieder da war, tat er so, als wäre das die normalste Sache der Welt. Natürlich erzählte er auch dann kein Wort. Ich habe nie erfahren, wo er sich aufhielt, bin mir aber sicher, dass Drogen im Spiel waren, oder eine andere Frau. Womöglich beides.
Eines Tages klingelte es an der Wohnungstüre. Ich war allein zuhause und wundert mich, wer kann das sein? Niemand wusste von mir als Untermieterin. Als ich die Türe öffnete, staunte ich nicht schlecht und bekam sofort ein ungeheuer schlechtes Gewissen. Vor der Türe standen meine Mutter und mein Bruder. Seit sechs oder acht Monaten hatte ich nichts mehr von mir hören lassen, geschweige denn meine Familie zuhause besucht. Eigentlich wusste niemand, wo ich mich aufhielt. Meine Mutter erzählte mir, dass sie mich in Freiburg gesucht hätten, Martin wäre gefahren (er hatte zu jener Zeit gerade ein Jahr seinen Führerschein) und dass sie meine Adresse von meinem ehemaligen Chef hätten (meine Eltern hatten mich zu Beginn einmal im «Wappen» besucht) und dass sie ganz entsetzt wären, wie und wo ich wohne und ich solle doch wieder heim kommen und dass Opa und Oma von Stuttgart (die Eltern meines Vaters) kurz hintereinander gestorben wären und sie mich nicht erreichen konnten, wegen des Termins der Beerdigung. Ich wollte nur, dass sie wieder gehen. Ich habe mich entsetzlich geschämt. Nach einer oder zwei Stunden sind sie wieder gefahren. Auf dem Heimweg baute mein Bruder einen Unfall, er hatte Grippe und ist trotz Fieber nach Freiburg gefahren, mich zu suchen. Das habe ich aber erst Jahre später erfahren. Es tat mir furchtbar leid.
Über Pascale bekam ich Arbeit bei McDonalds. Die Nachmittagsschicht am Käse- und Gurkentisch. Das hiess, nachdem die Brötchen aufgebacken waren, und durch einen Kollegen Mayo und Ketchup oder sonst eine Sauce aufgestrichen wurde, bekam ich den Burger zugereicht. Meine Aufgabe bestand darin, Käse- und Gurkenscheiben und manchmal auch Tomatenscheiben daraufzulegen und an den nächsten Kollegen weiterzureichen, der schliesslich das Hackfleischküchle, ein Salatblatt und nochmals Sauce draufpackte. Zu guter Letzt wurde das Ganze in Papier eingewickelt und in den Wärmekasten gelegt oder direkt an die Kundschaft verkauft.
Nach zwei Wochen hatte ich das Gefühl zu verblöden und begab mich erneut auf Lehrstellensuche. Mein Wunsch, Kinderkrankenschwester zu lernen, war immer noch präsent und so erkundigte ich mich an der Kinderklinik des Universitätsspitals in Freiburg nach einem Ausbildungsplatz. Dort kam ich dann aber ganz schnell auf die Welt. Ja, ich könne das schon lernen, aber erst in etwa drei Jahren. So lange wäre die Warteliste der Anwärterinnen. Diese Zeit hatte ich wahrlich nicht und so begrub ich ein für alle Mal meinen Berufstraum. Auch die Beziehung zu Pascale nahm einen dramatischen Verlauf. Als er wieder einmal drei Tage am Stück verschwunden war und ich ihn überall gesucht hatte und ihm dies nach seinem Auftauchen vorwarf, schlug er zu. Er rastete völlig aus, schlug mir ins Gesicht und in die Rippen, zerrte mich wieder hoch und zerriss meine Kleidung und brüllte, dass mich das nichts anginge und ich gefälligst den Mund halten soll und so weiter. Da begriff ich, dass ich mich mit einem Schläger, einem jähzornigen und cholerischen Mann eingelassen hatte und schwor mir, dass dies das erste und letzte Mal war, dass ein Mann mich schlug. Noch am selben Tag packte ich meine wenigen Habseligkeiten und verliess dieses Zimmer und Pascale für immer. Bei einer Bekannten fand ich für ein paar Tage eine Bleibe. Mir war klar, dass ich auf Dauer einen Plan benötige.
Iris, die Bekannte bei der ich für ein paar Tage unterschlupfen durfte, hatte einen Freund, der wiederum einen Freund hatte, den ich in diesen Tagen kennen lernen sollte. In einer Situation, in der ich einmal mehr weder ein noch aus wusste, überhaupt kein Geld, dafür aber Hunger hatte, reichte mir jemand eine Hand, die ich ergriff. Das Erste, was die Hand tat, war mir eine Brezel zu kaufen. Er hiess Klaus. Klaus war der erste Mann, in den ich mich verliebte – soweit ich dazu überhaupt fähig war – und mit dem ich mehrere Jahre eine Beziehung hatte. Insgesamt waren wir, eine Essgestörte und ein Säufer, vier Jahre ein Paar und in diesen vier Jahren ist wahrhaftig viel passiert.
Aber der Reihe nach!

Nach dem Ende der Beziehung zu Pascale verschob ich meine Schicht bei McDonalds auf die Nacht, damit ich nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten musste. Die begann um 18.00 Uhr und endete nach Mitternacht. Die Nachtschicht war die Stressigste, denn die Hauptkundschaft waren vor allem Kino- und Discobesucher und die waren um diese Zeit hundertfach unterwegs. Doch nur wenige Wochen später gab ich die McDonalds-Stelle auf. Ich hatte einen neuen Job in der Küche einer Bäckerei / Konditorei im Stadtteil Günterstal, am Fusse des Schauinslands, dem Hausberg von Freiburg. Meine Aufgaben waren Brote schmieren, Wurstsalate, Toasts Hawaii und andere Speisen für den kleinen Hunger zuzubereiten. Natürlich ass ich kräftig mit, was mich nach nur drei Monaten auch diese Stelle kostete.
Alles in allem jobbte ich über zwei Jahre da und dort, hatte manchmal zwei Jobs parallel und war ständig auf der Suche nach einer Lehrstelle. Ich bewarb mich bei einem Goldschmied, in einer Schreinerei, in einer Praxis, jobbte als Babysitter in einer Familie, in einem Supermarkt und so weiter. An Unterlagen konnte ich nur meinen Schulabschluss vorweisen und die eine oder andere Jobbestätigung. Eines Tages sah ich ein Schild an einer Tankstelle ganz in der Nähe meines Wohnortes: «Lehrling für Tankwart gesucht» und bewarb mich dort. Tatsächlich erhielt ich die Stelle, war sie jedoch zwei Monate später auch schon wieder los war. Das war im Jahr 1984, den Lehrvertrag habe ich heute noch. Sie hatten mich rausgeschmissen, weil ich im Kiosk zu viel Schokolade auf ihre Kosten konsumiert habe und weil ich überhaupt keine Freude an der Arbeit hatte. Ausserdem mussten sie die Tankstelle bald aufgeben, da eine Umgehungsstrasse gebaut wurde und die Tankstelle ab dann keinen Verkehrsanschluss mehr hatte. Den Verlust dieser Stelle habe ich nicht so sehr bedauert, trotzdem summierten sich solche Erfahrungen und mein bisschen Selbstvertrauen nahm analog dazu noch weiter ab. Was sollte ich nur mit mir machen? Im Öfter stieg Verzweiflung in mir auf. Einmal bekam ich einen so schweren Nervenzusammenbruch, dass Klaus den Arzt kommen lassen musste und ich eine Beruhigungsspritze erhielt.
Dann, es war kurz vor Ostern 1985, ich war noch 22 Jahre, erhielt ich die Zusage für eine Lehrstelle als Zahnarzthelferin. Und das kam so: Jeden Morgen las ich die Stellenausschreibungen in der Zeitung, die Klaus am Abend vorher von der Arbeit mitbrachte. Eines Morgens las ich «Zahnarzt sucht Lehrling zur Zahnarzthelferin» und da beschloss ich, mich sofort in der Praxis in Freiburg vorzustellen. Zu dieser Zeit wohnten Klaus und ich in einer 1-Zimmer-Wohnung in Kirchzarten, etwa acht Kilometer ausserhalb Freiburgs und ich hatte immer noch keinen Führerschein. Also bin ich kurzerhand nach Freiburg getrampt, denn eine Zugfahrt war teuer, zu teuer, wenn man latent bankrott ist. Über die ganze Aufregung hatte ich meine Zeugnisse zuhause liegen lassen, was ich jedoch erst in Freiburg bemerkte. Schon wollte ich wieder kehrt machen, als ich mir dachte: Nein, ich habe nichts zu verlieren. Entweder es funktioniert oder eben nicht, aber so habe ich es wenigstens versucht.
Ich erschien unangemeldet. Stand einfach vor der Türe, beziehungsweise sass im Wartezimmer. Mit nichts! Ich war da und wollte die Stelle. Und er? Er liess mich rein. Ich war so, wie ich war.
Praktisch war ich! Und vielleicht auch nicht ganz dumm. Zuerst schüttete er vor mir seine Schublade mit den Bohraufsätzen aus und bat mich, diese nach einem logischen Prinzip zu sortieren. Also sortierte ich alle Kugeln, alle Stifte und alle Kegel. Dann sollte ich Gips anrühren und via Schüttelautomat einen Gebissabdruck blasenfrei mit Gips ausgiessen. Das hat mir dann schon Spass gemacht. Und dann sollte ich Kunststoff und Härter zusammenrühren, sodass das Ganze den richtigen Härtegrad bekommt. Einen ganzen Tag war ich in der Zahnarztpraxis und habe sortiert, gerüttelt, gerührt und geschaut. Dann, am Ende des Tages hatte ich das ultimative Gespräch mit dem Chef. Er meinte, ich hätte mich sehr geschickt angestellt und eine schnelle Auffassungsgabe bewiesen. Und dann sagte er auch noch, dass ich am Dienstag nach Ostern bei ihm anfangen könne, am 2. Mai 1985. Dann solle ich aber mein Schulzeugnis mitbringen. Hurra!! Endlich eine Lehrstelle! Und ich habe mich so gefreut und ich bin so gerne in die Schule gegangen! Und am Schluss war ich auch richtig gut, aber das kommt erst in drei Jahren.

Bevor Klaus und ich in unsere erste Wohnung nach Kirchzarten zogen, wohnten wir sechs Monate bei seiner Mutter in einer stinkigen, dreckigen, kalten Kellerwohnung, in der morgens beim Lichtanknipsen immer zuerst die Kakerlaken das Weite suchten. Die Mutter von Klaus hatte einen Lebenspartner namens Manfred, den sie jedoch immer «Manfreden» nannte, ursprünglich kam sie aus Berlin. Beide waren Mitte bis Ende sechzig und pensioniert. Ab und zu bekam Manfred noch ein Jöpple bei den französischen Kasernen, aber grundsätzlich hatte er den ganzen Tag Zeit, um aus dem Kellerfenster zu schauen. Klaus arbeitete ebenfalls für das französische Militär, welches seit dem zweiten Weltkrieg und bis weit in die achtziger Jahre in Südbaden stationiert war. Einige Freiburger Stadtteile bestanden fasst komplett aus französischen Kasernen und den Wohnhäusern der Militärs und ihren Angehörigen. Für alle diese Gebäude war er der leitende Hausmeister mit zwei oder drei Hilfskräften. Vor allem während der Wintermonate hatte er viel zu tun, musste er doch je nach dem um vier Uhr morgens aufstehen. Seine Hauptaufgabe war dann, die riesigen Heizkessel in den Kellern der Wohn- und Arbeitshäuser in Gang zu bringen. Alle Militärgebäude wurden noch mit Kohle geheizt. Das hiess, er und seine Arbeiter mussten von Keller zu Keller, von Stadtteil zu Stadtteil und zentnerweise Kohlen in die Öfen schaufeln. Wie bei einer Lokomotive. Einen Beruf erlernt hatte er nicht, soviel ich weiss. Klaus kam aus einer Familie, die sozial am Rande der Gesellschaft stand.
Sein Vater starb am Alkohol und schlug vorher regelmässig die Familie. Seine Geschwister waren allesamt dem Alkohol verfallen. Er war der zweitjüngste neben einem älteren und einem jüngeren Bruder und einer älteren Schwester. Der älteste Bruder lebte als Obdachloser in Freiburg und bettelte. Der jüngere Bruder war ebenfalls Heizer bei den Militärs und schlug denselben Weg ein, wie sein älterer Bruder. Er war mehr betrunken auf der Strasse anzutreffen als nüchtern bei der Arbeit. Klaus’ Schwester Heidi war ein ganz besonderer Fall, die uns regelmässig in Atem hielt. So etwa alle 6 bis 8 Wochen, genehmigte sie sich eine Auszeit mit Totalausfall. Heidi war Mutter von zwei Kindern im Alter von sieben und neun Jahren, als ich sie kennenlernte. Die Väter der Kinder, jedes hatte einen eigenen, waren nicht bekannt oder zumindest kannte ich sie nicht. Heidi und ihre Kinder lebten mit Heidis Lebenspartner Gernot, der ebenfalls ein Alkoholproblem hatte, im elften Stock eines Hochhauses im sozialen Brennpunkt von Freiburg. Ab und an bekam Heidi ihren Rappel und verschwand. Also, sie verschwand nicht gänzlich, aber sie tauchte meist für zwei oder mehr Tage ab und soff sich durch die einschlägigen Kneipen von Freiburg. Dabei lernte Heidi diesen oder jenen Typen kennen, von dem sie sich einladen liess, denn das Geld war ja nicht unendlich. Oft nahm Heidi diese Männer nach der Sauftour auch mit nach Hause oder sie landete in deren Betten. In solchen Situationen meldete sich Gernot bei uns. Also dann, wenn er die Kinder allein in oder vor der Wohnung fand, wo sie nach der Schule bereits stundenlang auf die Mutter gewartet hatten. Sie hatten meist keinen Schlüssel dabei, denn am Morgen vor der Schule war die Welt noch in Ordnung und die Mutter daheim. Dann reisten Klaus und ich an, trösteten Gernot, schimpften gemeinsam auf diese verantwortungslose Frau und machten uns Sorgen. Vor allem kümmerten wir uns bis zu Heidis Rückkehr oder zumindest bis zu deren Bettzeit um ihre Kinder. Nach Beendigung ihrer Sauftour war Heidi zwei Tage lang unfähig, irgendetwas anderes zu tun, ausser Hühnerflügel zu essen. Gebratene Hühnerkleinteile waren immer ihre Katermahlzeit. Die neunjährige Tochter wurde von der immer noch betrunkenen, völlig fertigen und nur noch auf dem Sofa liegenden Mutter angewiesen, im Supermarkt Hühnerteile zu kaufen und in der Pfanne zu braten, wonach sie von Heidi mit Wonne verzehrt wurden. Mit taten die Kinder oft leid und ich fragte mich, warum das Sozialamt nicht einschritt. Heidi und ihre Kinder waren Sozialhilfeempfänger und das hiess, regelmässig beim Amt antreten. Warum strichen die nicht mal als Verwarnung einen Teil des Geldes? Vor allem das Mädchen litt unter diesen Eskapaden der Mutter. Sowohl Heidi als auch Gernot gingen sehr oft wirklich schlecht mit ihr um. Schimpfen, runtermachen und auch Schläge musste vor allem die Tochter ertragen. Schon damals habe ich mich gefragt, warum solche Frauen trotz dem vielen Alkohol Kinder bekommen können. Jahre später, als Klaus und ich schon lange nicht mehr zusammen waren, habe ich Heidi wieder einmal im Bus getroffen, wo sie mir mit grosser Freude erzählt hatte, dass sie von Gernot nochmals ein Kind bekommen habe und wie glücklich sie sei. «Das hätte sie sich doch immer gewünscht».
Klaus war von allen vier Kindern der Vernünftigste und Gesündeste, obwohl auch er zu Ausfällen neigte. Klaus tendierte zum Quartals-Saufen. Er trank nicht täglich und auch nicht wöchentlich, aber wenn er trank, dann über alle Massen. Einmal ist er in solch einem Zustand durch eine geschlossene Fensterscheibe unserer Parterre-Wohnung gefallen, worauf uns der Vermieter nach viel Geschrei seitens Klaus die Wohnung kündigte. Das war die 1-Zimmer-Wohnung. Die nächste Wohnung fanden wir auch wieder in Kirchzarten, eine hübsche 2-Zimmer-Dachwohnung mitten im Dorf. Zu dieser Zeit waren wir bereits länger als ein Jahr zusammen und ich war auf eine ganz bescheidene Art glücklich. Ich befand mich im ersten Lehrjahr meiner Ausbildung, die Tätigkeit machte mir sehr viel Freude und ich entwickelte nebenbei ein leises Gefühl von Hausfrau. Waschen, bügeln, putzen, die Wohnung schön machen, daran hatte ich Freude. All diese Tätigkeiten vermittelten mir Sicherheit und Geborgenheit. Ich hatte ein Nest.
Doch leider dauerte dieses Nestgefühl nicht sehr lange an. Nach fünf, sechs Monaten klingelte es eines Abends an unserer Wohnungstüre und der Vermieter stand im Türrahmen. Er wolle uns nur mal erinnern, dass wir mit zwei Monatsmieten im Rückstand seien. Natürlich könne das schon mal passieren, aber er hätte nicht so viel Ressourcen, um den Ausfall zu überbrücken. Ich fiel aus allen Wolken, denn irgendwie kam mir das bekannt vor. Schon bei der vorigen Wohnung waren wir immer irgendwie im Mietrückstand. Klaus und ich hatten klare Abmachungen, er zahlt die Miete und Nebenkosten und ich sorgte mit meinem Lehrlingslohn für die Lebensmittel. Mehr hatte ich einfach nicht. Beziehungsweise, einen Teil benötigte ich natürlich für meine Fressanfälle. Zu jener Zeit handelte es sich allerdings um sehr preisgünstige Fressattacken. Unter der Zahnarztpraxis befand sich der «Penny-Markt», ein sehr billiger Supermarkt. Dort konnte ich für 1,49 DM, 500g Kartoffelsalat mit viel Mayo kaufen, sowie weisse Brötchen für 0,19 DM das Stück. Alles extrem ungesunde Fabrikware, aber gesund war mir dabei überhaupt nicht wichtig. Es musste schnell rein und schnell wieder raus. Damit hatte ich einen Anfall abgedeckt. Abends, wenn ich für uns beide kochte, bereitete ich 500g Spaghetti zu mit zwei Dosen Tomatensosse und viel Reibekäse und ass drei volle Teller, was die zweite Attacke abdeckte. Mit Ausnahmen der Wochenenden, war das in der Regel mein Tagespensum an Ess-Brech-Sucht. Es kam immer darauf an, wie viel Routine meine Tage enthielten. Fiel die Woche aus dem Rahmen, wegen Ferien, durchgemachten Nächten, Partys, Feierlichkeiten oder Krankheit, verlief die Woche mit mehr oder weniger Fressattacken.
Jedenfalls war ich wegen des Besuches unseres Vermieters sehr erschrocken und stelle Klaus zur Rede, der sich herausredetet mit Schulden und Offenbarungseid und so weiter. Klaus war sechs Jahre älter als ich, schon einmal verheiratet und hatte zwei Kinder, für die er offenbar Unterhalt zahlen musste, was er jedoch nicht tat. Das hatte er mir nämlich früher schon einmal erzählt. Also wusste ich eigentlich gar nicht, was er mit seinem Geld anstellte, das er verdiente. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein: er zahlte die Miete nicht, kaufte nie Lebensmittel ein, hatte ein uraltes Auto, mit dem er nach Freiburg fuhr, benötigte also keine Zugfahrkarte. Was macht er dann mit seinem Lohn? Wir fuhren nicht in die Ferien, hatten bis auf eine Hausratversicherung und die Autogeschichten keine sonstigen Versicherungen und die Krankenkasse wurde ja direkt von Lohn abgezogen. Seine Antwort lautete: Schulden bezahlen! Ich vermutete, Klaus verspielte sein Geld in den Spielcasinos von Freiburg. Er versprach mir, in Zukunft immer die Miete zu bezahlen, was er die nächsten paar Monate auch einhielt. Die rückständigen Mieten, stotterten wir stückchenweise mit jeder Monatsmiete ab.

Neben der Wohnungstüre unserer Dachwohnung gab es noch mal eine Türe. Sie führte in ein Zimmer, welches sich die Ehefrau unseres Vermieters als Rückzugsort eingerichtet hatte. Ansonsten wohnten unsere Vermieter im ersten Stock, ein Stockwerk unter uns. Er arbeitete auf dem Bau und sie in einer Einrichtung für Behinderte. Kinder gab es nicht. Ganz unten, im Parterre wohnte eine dreiköpfige Familie. Der Vater sass wegen Multiple Sklerose im Rollstuhl, weswegen sich neben dem aus drei Stufen bestehenden Hausaufgang eine Rampe befand. Im Grunde genommen, hätte das Haus eine friedliche Wohngemeinschaft sein können. Leider war dem ganz und gar nicht so. In regelmässigen Abständen hörte ich, wie unsere Vermieter heftige Auseinandersetzungen hatten, in deren Verlauf der Mann seine Frau auch schlug. Ich wusste, dass auch er Alkoholiker war. Mehr als einmal bedrängte und beschimpfte er mich wegen eines vorgeschobenen Grundes. Alkohol machte ihn sehr aggressiv und ich war immer froh, wenn ich ihm nicht allein begegnete. Eines Abends hörten wir wieder von unten lauthals Geschrei und allerheftigste Streitereien. Dann ging deren Wohnungstüre auf und die Frau floh richtiggehend die Treppe nach oben in ihr Zimmer neben uns und schloss von innen ab. Kurz danach stand der Mann oben und schlug an die Zimmertüre, schrie und fluchte und drohte ihr alles Mögliche an. Nachdem sie nicht öffnete, liess er irgendwann ab und stolperte schimpfend die Treppe nach unten und verliess das Haus. Nebenan hörte ich die Vermieterin heftig weinen. Wenige Wochen oder auch nur wenige Tage später, begegnete ich der Vermieterin im Treppenhaus, worauf sie mich in ihre Wohnung bat. Dort erklärte sie mir zwei Dinge. Erstens, unsere Miete solle auf ein anderes Konto überwiesen werden, welches sie verwaltete und zweitens, sie würde noch in dieser Woche ausziehen. Ab dann war Ruhe im Haus. Da ich mich aus beruflichen Gründen die ganze Woche tagsüber in Freiburg aufhielt, ist mir nur an den Wochenenden deutlich die Ruhe im Haus aufgefallen. Manchmal dachte ich mir, der Vermieter muss doch in seinem Suff ab und zu mal rumgrölen oder schimpfen aber so etwas hörte ich nicht. Ich sah nur immer früh morgens, wenn ich aus dem Haus ging, die Rollläden unten und am frühen Abend, wenn ich nachhause kam, die Rollläden oben.
Ja, und so ging jeder seinem Alltag nach, bis ich eines Tages an einem Freitagabend feststellte, dass die Rollläden unseres Vermieters immer noch unten waren. Sie waren schon am Morgen unten und ich erinnerte mich, dass sie am Abend vorher auch unten waren. Das kam mir ganz komisch vor und so entschloss ich mich, bei ihm zu klingeln. Nichts rührte sich. Nochmal und nochmal. Klaus stand neben mir, man weiss ja nie, vielleicht schlägt er ja auch gleich zu. Still, alles still. Dann klingelte ich bei der Familie im Parterre und erkundigte mich, ob sie den Vermieter gestern oder heute gesehen hätten. Sie verneinten und gemeinsam beschlossen wir, in die Wohnung zu gehen. Die Parterrefamilie hatte einen Ersatzschlüssel, den sie früher einmal von der Vermieterin bekamen. Falls etwas passiert…
Er lag nackt und tot im Bett, mit angezogenen Beinen auf der Seite, weiss wie die Wand und völlig abgemagert. Nach dem Auszug seiner Frau ernährte er sich nur noch vom Alkohol und ist über die vergangenen Monate quasi verhungert. Der Notarzt kam, die Polizei und der Bestatter. Sie mussten ihm die Knochen brechen, damit er überhaupt in den Sarg passte. Danach wollte ich nicht mehr in diesem Haus wohnen. Klaus und ich zogen wieder nach Freiburg. Unsere ehemalige Vermieterin sah ich erst an seiner Beerdigung wieder.
Wir fanden eine Wohnung in Freiburgs angesagtem Stadtteil Stühlinger, ein Stadtteil der Künstler, Studenten, WG’s und Alleinerziehenden. In der Eschholzstrasse. Ich mochte die Wohnung und doch wohnten wir nur kurze Zeit dort. Klaus und ich begannen uns voneinander zu entfernten. Er trank und schlief mit anderen Frauen, ich konzentrierte mich auf meine Ausbildung.

1986 wurde ich schwanger. Ich hatte nie verhütet, es war ein Wunder, dass mir das nicht schon früher passierte. Einerseits war ich überzeugt, dass ich nie schwanger werden würde, anderseits sparte ich an der Verhütung. Die Pille kostete viel Geld, das ich nicht hatte.
«Was nicht sein darf, das nicht sein kann», nach diesem Motto ignorierte ich die ersten drei Monate meiner Schwangerschaft. Als ich mich und das, was in meinem Bauch wuchs, nicht mehr länger ignorieren konnte, ging ich zu Pro Familia, um einen Schwangerschaftsabbruch zu beantragen. Pro Familia ist, wie man weiss, ein christlicher Verein und so rieten sie mir, das Kind doch auszutragen, es würde sich sicher eine Lösung finden. Mir war ganz Elend zumute. Ich konnte mir Klaus als Vater so gar nicht vorstellen und sah mich schon als verarmte, unglücklich Alleinerziehende mit abgebrochener Ausbildung. Ich war erst im zweiten Lehrjahr und wollte endlich einen Fuss auf den Boden bekommen. Nein, das durfte nicht sein. Ich fühlte auch kein Kind, ich fühlte mich nur schlecht und dick. Ich dick und schlecht, ich dick, ich dick…!
In meiner Verzweiflung telefonierte ich mit meinem Bruder und erzählte ihm davon. Eigentlich dachte ich, dass er das für sich behalten würde, aber dafür war das Thema in seinen Augen zu gross. Womit er ja eigentlich auch recht hatte. Bald schon meldeten sich meine Eltern und so begann die Maschinerie zu laufen. Wenige Tage später rief mich meine Mutter an und erklärte mir, sie hätten eine Adresse in Genf, die auch so spät noch Abtreibungen durchführen würden. Vater würde fahren. So fuhren Vater, Mutter und ich an einem extrem schneestürmischen Novembertag 1986 quer durch die Schweiz nach Genf. Die Fahrt war ungemein anstrengend, kaum sah man fünf Meter auf der Strasse. In Genf angekommen, musste ich zunächst bei einem Psychiater vorsprechen, um abzuklären, ob ich auch in der Verfassung wäre, eine Abtreibung psychisch durchzustehen. Er sprach französisch, ich verstand gar nichts. Meine Mutter, die noch etwas Schulfranzösisch konnte, übersetzte rudimentär, was der Psychiater mir erzählte und ich nickte einfach alles ab. «Ja, ja, ich will einfach dieses Ding wieder aus meinem Bauch haben». Anschliessend fuhren wir von der Praxis quer durch die Stadt in Richtung eines tiefverschneiten Parkes in dessen Mitte eine Privatklinik stand. Klein aber exklusiv. Dort angekommen, wurden wir von einer sehr freundlichen Frau begrüsst, die uns in einen im Jugendstil eingerichteten Wartebereich führte und uns zu trinken anbot. Nach kurzer Zeit wurden ich und meine Mutter abgeholt, in einen Untersuchungsraum gebracht, in dem ich bereits von einem ebenfalls sehr freundlichen Mittvierziger mit asiatischem Aussehen und einem schelmischen Lächeln begrüsst wurde. Er war der behandelte Frauenarzt. Nach der obligatorischen Voruntersuchung erklärte er meiner Mutter mit etwas traurigem Blick, dass der Fötus in Hinblick auf die Länge der Schwangerschaft viel zu klein sei und es wohl in den nächsten Tagen oder Wochen ohnehin zu einem Abort kommen würde.
Anschliessend verabschiedetet ich mich für die nächsten, ich weiss nicht wieviel Stunden, von meinen Eltern und kam in ein Spitalzimmer, wo ich meine Kleider ausziehen und in ein Spitalhemd schlüpfen sollte. Es ging alles ungemein schnell, denn schon kurze Zeit später wurde ich abgeholt und mit dem Bett durch Gänge geschoben, die mir irgendwie endlos erschienen, bis vor eine grosse Türe. Dort endete die Fahrt und der sympathische Arzt von vorhin drückte mir fest die Hände und sage irgendetwas, was ich nicht verstand. Vielleicht «Alles wird gut». Ach, am liebsten wäre ich in seine Arme gefallen und hätte alles vergessen wollen. Mit einem steifen Lächeln sagte ich «Ja» und ergab mich in diesem Moment völlig meinem Schicksal. Ja ich dachte auch «Und wenn ich danach nicht mehr bin, ist es auch gut, dann soll es so sein». Kurz danach wurde ich in den OP gefahren, wo mir lächelnde Augen hinter einer Maske eine Infusion legten. Mein letzter Gedanke galt dem gleissend hellen Licht, welches mich in andere Sphären hob.
Ich erwachte von einem entfernten Schluchzen. Mein Mund war völlig ausgetrocknet und ich hatte das Gefühl, in einer Lache zu liegen. Nachdem ich mich etwas orientiert hatte, war mir wieder bewusst, wo ich mich befand, und was passiert war. Um Himmels Willen, mein ganzes Leben hatte eine andere Wendung genommen! Als ich meine Augen öffnete, war es dämmrig hell und neben mir lag noch eine Patientin. Sie war es, die leise vor sich hin weinte. Ich dachte, sie hätte Schmerzen und klingelte nach irgendjemandem. Kurze Zeit später ging die Türe auf und eine Krankenschwester kam herein. Ich bat um etwas zu trinken und zeigte verschreckt auf den Fleck in meinem Bett, der mir riesig vorkam. Zuerst dachte ich, ich hätte versehentlich ins Bett gemacht, aber es war Blut. Die Krankenschwester meinte, das wäre ganz normal und reichte mir eine dicke Lage von Zellstofftüchern, die ich unter mir begrub. Dann verliess sie das Zimmer, um kurze Zeit später mit einer Tasse Tee wieder zu kommen. Es war Schwarztee und er schmeckte herrlich! Niemals zuvor hatte ich so guten Tee getrunken. Langsam kamen meine Körperfunktionen wieder zurück und ich sprach meine Bettnachbarin an, ob sie denn Schmerzen hätte. Sie verstand mich und antwortete mir in französischem Schweizerdeutsch, dies nicht, aber sie wäre so traurig. Es wäre bereits das dritte Mal, dass sie ein Kind abtrieb und langsam hätte sie genug davon. Ich glaube, das ist mir schon sehr eingefahren und ich schwor mir, dieses eine Mal würde einmalig bleiben. Nie, nie mehr in meinem Leben wollte ich das nochmals tun. Entweder kann ich in Zukunft 100% Ja zu einem Kind sagen, oder ich verhüte so gut es geht. Ich selbst habe in den folgenden Jahren diesen Schwur gehalten. Aber manchmal hat eben die Natur auch ein Wörtchen mitzureden.
Nachdem ich mich von dem Eingriff halbwegs erholt hatte, stand ich langsam auf, zog mich an, verabschiedete mich von der Zimmergenossin und verliess das Zimmer. Draussen auf dem Flur sah ich den Wegweiser zum Wartezimmer. Im Wartezimmer, welches eher einem Salon aus der Jugendstilepoche glich und ein Stockwerk tiefer lag, sassen meine Eltern. Beide hatten Kaffee vor sich stehen und lasen in einer Zeitschrift. Mittlerweile war es früher Nachmittag. Es hatte zwar aufgehört zu schneien, doch es war so dämmrig, dass es auch fünf Uhr am Nachmittag hätte sein können. Als meine Eltern mich sahen, standen sie erleichtert auf. Vielleicht weil ich nun alles überstanden hatte, vielleicht auch, weil die Warterei endlich ein Ende hatte. Schweigend und müde fuhren wir wieder nach Hause, wo ich noch eine Nacht blieb, bevor ich wieder nach Freiburg zurückkehrte. Von Klaus bekam ich im Nachhinein einige Vorwürfe zu hören, weil ich ihn nicht in meine Entscheidung miteinbezogen hatte, aber das war mir egal. Er konnte schon nicht für seine bereits geborenen Kinder sorgen, wie wollte er dann für noch eines die Verantwortung übernehmen? Ausserdem musste ich auch an meine Zukunft denken. Ich konnte und wollte mich nicht mehr von einem anderen Menschen abhängig machen. Das zumindest hatte ich schon gelernt.
Umso mehr stürzte ich mich in meine Ausbildung. Ich lernte viel und die Arbeit machte mir immer noch sehr viel Spass. Selbstverständlich trug ich auch immer noch die Bulimie mit mir herum, die ich hegte und pflegte, die mich jedoch auch mehr und mehr forderte. Mittlerweile litt ich bereits zehn Jahre an dieser Essstörung. In dieser Zeit entschied ich mich, eine ambulante Psychotherapie zu machen. Über irgendwelche Kanäle fand ich eine Therapeutin, die sich - für die damalige Zeit ungewöhnlich - etwas mit Essstörungen auskannte. Die einzige Person, der ich mich anvertraut hatte, war meine damalige Freundin und Arbeitskollegin Karin. Sie verstand zwar nicht, was es hiess unter einer Essstörung zu leiden, doch sie checkte die immense Belastung für mich. Als ich ihr darüber erzählte, flossen auch Tränen. Hinzu kam ausserdem, dass die Beziehung zu Klaus immer mehr zum Problem für mich wurde. Ich hatte das Gefühl, wir lebten nicht mehr miteinander. Er trank mehr, war längst nicht mehr treu (er übernachtete immer öfter irgendwo auswärts) und unsere Mietschulden stiegen. Ich fühlte mich sehr unsicher, hatte das Gefühl, zu fallen und meine Kräfte gingen aus. Ich benötigte dringend Hilfe. An die Therapeutin kann ich mich heute kaum noch erinnern und die Bulimie konnte ich durch ihre Hilfe auch nicht bewältigen, aber sie half mir mein Leben drumherum zu ordnen.
Ein grosser Schritt war zum Bespiel die Entscheidung, meine Beziehung zu Klaus zu beenden. Sie bestärkte mich darin, das zu tun, was sich für mich als richtig anfühlte und das Loszulassen, was mir nicht gut tat. Nachdem wir wieder einmal wegen unbezahlter Mieten die Wohnung verlassen mussten, entschied ich mich, nicht mehr mit ihm zusammenzuziehen. Ich wollte zunächst nur eine räumliche Trennung. Eine eigene Wohnung, nur für mich allein.

(1)

Das erste Mal in meinem Leben setzte ich meinen Vater unter Druck. Ich wollte, dass er mir ein Zimmer bei Bekannten bezahlte (die Freunde meiner Eltern, bei denen ich schon mal meine Ferien verbrachte), die in Freiburg ein Haus hatten und mir ein Zimmer angeboten hatten. Und zwar nur so lange, bis ich meine Ausbildung beendet hatte. Meine Forderung war relativ bescheiden in Anbetracht dessen, dass es sich bis zu meiner Abschlussprüfung wirklich nur noch um wenige Monate handelte. Das Zimmer kostete 150 DM pro Monat und bis dahin hatte mein Vater mich noch mit keinen Pfennig unterstützt. Er liess sich darauf ein, in erster Linie auf Betreiben meiner Mutter. Die Zeit, die ich allein mit mir verbrachte, tat mir ausgesprochen gut, konnte ich doch mit all meinen Kräften auf meinen Lehrabschluss hinarbeiten.
Was unausweichlich war kam bald. Das Ende meiner Beziehung zu Klaus. Ich hatte es eingeläutet, Klaus hatte sie beendet. Er zog zu einer gemeinsamen Bekannten, mit der er, wie er mir vorwurfsvoll mitteilte, vorher auch schon mal die Nächte teilte.
Das war Anfang 1988 und im Juli desselben Jahres legte ich meine Abschlussprüfung zur Zahnarzthelferin mit der Note 1,4 ab. Ich bekam einen Buchpreis und war das erste Mal in meinem Leben richtig stolz auf mich. In diesem Jahr wurde ich 26 Jahre. Pünktlich mit dem Ende meiner Ausbildung stellte mein Vater seine Zahlungen wieder ein. Nun musste ich endgültig auf eigenen Beinen stehen.
Während meiner Ausbildungsjahre hatten sich meine Eltern getrennt. Meine Mutter warf meinen Vater aus ihrem Leben, nachdem er sie zum wiederholten Male belogen und betrogen hatte. Viele Jahre danach erzählt sich so eine Trennung einfach, doch für meine beiden Elternteile war die Trennungszeit ausgesprochen happig. Immerhin waren meine Eltern mehr als 25 Jahre verheiratet. Meine Mutter lebte jahrzehntelang in kompletter Abhängigkeit zu meinem Vater, denn nachdem er gegangen war, konnte sie noch nicht einmal eine Überweisung ausfüllen. Sie musste in vielen Dingen ganz von vorne beginnen. Und mein Vater? Er füllte sich amputiert und aus dem Nest gefallen. Dem Nest, das er wie selbstverständlich mit seinen Affären in Thailand, Tschechien und auf den Philippinen beschmutzte und bei dem er dachte, es und seine Frau würden nach seinen Reisen auf ihn und seine Lügengeschichten warten. Eines schönen Tages war dem nicht mehr so und er durfte seine Koffer packen. Für mich hiess die Trennung meiner Eltern «Endlich»! Ich war froh für meine Mutter, auf mein Leben hatte das längst keinen Einfluss mehr.
Nachdem mir klar war, dass ich von nun an mein Leben selbst finanzieren musste (und unbedingt auch wollte) und mir auch klar war, dass das mit einem Zahnarzthelferinnengehalt von 1000.- Mark pro Monat nicht zu schaffen war (zumindest nicht mit Freiburgs teuren Mieten) begann ich, mir weitere Jobs zu suchen. Abgesehen davon, dass ich mir so noch zusätzliches Geld verdienen konnte, sah ich diese Jobs auch als Ausweichmöglichkeit vor allfälligen Fressattacken. Nach dem Motto « ich arbeite so viel wie möglich, dann habe ich keine Zeit zu fressen und zu kotzen», putzte ich von nun an morgens von 5 bis 7 Uhr bei einer Reinigungsfirma die Räume des Makrobiologischen Instituts der Universität Freiburg. Anschliessend fuhr ich mit der Strassenbahn in die Stadtmitte, um rechtzeitig auf 7.30 Uhr in der Zahnarztpraxis zu sein, wo ich bis um 18.00 Uhr arbeitete. Dreimal in der Woche reinigte ich ausserdem abends von 7 bis 9 Uhr die Räume eines chinesischen Homöopathen, um nach einer weiteren halbstündigen Fahrt mit dem Tram um 22.00 Uhr todmüde ins Bett zu fallen. An den Samstagen übernahm ich zudem noch ein Bügel- und Putzjöpple im Privathaushalt des Chinesen und seiner deutschen Frau, die an der Volkshochschule unterrichtete, inklusive deren zwei Kinder, die ich nebenher betreute. Dieses Arbeitspensum hielt ich ein Jahr oder mehr durch, dann klappte ich zusammen. Vor allem, weil ich eben trotzdem nicht Essstörungssymptomfrei war und mir so die wenigen noch vorhandenen Energien vollends raubte. Eines Morgens fühlte ich mich unfähig, auch nur eine Hand aus dem Bett zu hängen. Ich hatte starke Kopfschmerzen und alles tat weh. Ich weiss nicht mehr genau, wie lange ich krank war, aber es dauerte sicher einige Tage. Und in dieser Zeit beschloss ich, meinen Chef um eine Lohnerhöhung zu bitten, damit ich wenigstens einen dieser Putz-Jobs aufgeben konnte.
Die Lohnerhöhung bekam ich und einmal mehr war ich stolz auf mich. Mit solchen kleinen Erfolgen eignete ich mir peu à peu etwas mehr Selbstvertrauen an. Ich gewann die Erkenntnis, dass sich Bemühen und Einsatz auszahlen konnte, was mir wiederum mehr Mut verlieh, etwas zu wagen. Je mehr ich wagte, desto sicherer war ich mit mir Selbst. All das waren wichtige Schritte die, im Gegensatz zu mir, meine Altersgenossinnen bereits in Kindheitsjahren vermittelt bekommen hatten.

Mittlerweile hatten wir das Jahr 1989, denn in dieser Zeit lernte ich den Freund des Freundes meiner Freundin und Arbeitskollegin Karin aus der Praxis kennen. In jener Zeit trafen Karin und ich uns öfter bei ihr oder mir, um gemeinsam mit weiteren Freunden und Bekannten Gesellschaftsspiele zu spielen (primär «Risiko») oder sonst etwas zu unternehmen. Eines Tages brachte Martin, Karins Schatz seinen Arbeitskollegen Karsten als Verstärkung mit. Karsten war ganz und gar nicht der Typ Mädchenschwarm und Aufreisser. Nein, Karsten war eher schüchtern und zurückhaltend und, in meiner Wahrnehmung, auch nicht wirklich gutaussehend. Aber er vermittelte mir von Beginn an Sicherheit und ein großes Maß an Zuverlässigkeit, wie ich dies bis dahin noch nie erlebt hatte. Ich glaube, wirklich verliebt war ich nicht, aber ich schätzte Karstens zuverlässige und verbindliche Art. So dauerte es nicht lange und Karsten und ich wurden ein Paar. Karsten war vier Jahre älter als ich, wohnte noch bei seinen Eltern, war Feinmechaniker auf dem Weg zum Meister und fuhr leidenschaftlich gerne seinen alten Porsche Targa. Er wurde in den kommenden Jahren so eine Art «Leitfigur» für mich. Karsten hier und Karsten dort und Karsten hat gesagt und Karsten hat gemacht. Er tat mir gut und ich holte ihn aus seinem Elternhaus und zeigte ihm das Leben der Erwachsenen. Ich war seine erste Freundin. Außerdem wurde ich mit großer Erleichterung in seiner Familie aufgenommen. Einerseits hielt ihn seine Mutter fest, anderseits war sie froh, dass endlich ein weibliches Wesen den Weg in Karstens Leben gefunden hatte.
Nachdem ich etwa ein Jahr in dem Zimmer der Freunde meiner Eltern gewohnt hatte, meldeten sie Eigenbedarf an. Offensichtlich hatte die jüngere Schwester von Annemie, meiner Vermieterin, eine Lebenskrise, weshalb Annemie die Schwester zu sich holen wollte. Ich glaubte jedoch auch, dass es mit mir zu tun hatte, denn ich stahl auch bei ihnen Lebensmittel. Wie dem auch sei, genau erfahren habe ich es nie und wollte es auch gar nicht, aber ich suchte und fand eine neue Wohnung in der Stadtmitte, gegenüber dem Freiburger Konzerthaus. Klein, alt, aber bezahlbar und vor allem nicht mehr im Haus von jemandem, dem ich Essen wegnehmen konnte. Diese ständigen Schuldgefühle waren auch für mich sehr zermürbend. Eine kleine 1-Zimmer-Wohnung mit Küche und Bad nur für mich! Das war ein herrliches Gefühl. Heizen musste ich über einen Gasofen im Zimmer und für das Warmwasser zum Waschen und Duschen hing im Badezimmer ein riesiger Gasboiler, den man jeden Morgen erst entzünden musste. Der Boiler war so alt und so stark mit Grünspan überzogen, dass ich dachte, wenn ich den Grünspan abkratze, explodiert der Tank. Aber es war meine Wohnung, mein Nest, meine Wohlfühlinsel. 1989 passierten noch zwei wichtige Ereignisse: Erstens fiel die Mauer zwischen Ost und Westdeutschland und zweitens zog ich mir während eines Squashspiels, aber wohl aufgrund des jahrelangen Erbrechens die erste von drei Dissektionen mit vorübergehendem Arterienverschluss am Hals zu. Dies bedeutete massivste Kopfschmerzen, Übelkeit und Sehstörungen, vor allem aber höchster Alarm wegen der Gefahr eines Schlaganfalls. All das war mir zunächst gar nicht bewusst, da auch die Sehstörungen erst nach einigen Tagen auftraten. Mein Hausarzt und ich dachten zuerst an eine Grippe. Er schrieb mich krank und ich schluckte fleissig Schmerzmittel.
Während meiner Rekonvaleszenz zuhause passierte das Unglaubliche. Ich durfte den ganzen Tag hautnah an meinem winzigen Fernseher diese einmaligen Zeitgeschehnisse verfolgen. Nach vielen vorangegangenen Demonstrationen in den Städten der ehemaligen DDR wurde am 9. November 1989 in Ostberlin die Mauer eingerissen. Die Menschen rissen die Mauer und den Kommunismus in Ostdeutschland ein. Wie sensationell war das denn?? Sie tanzten und sangen und die ganzen Tage über waren Sätze zu hören, wie: «Wir sind das Volk» oder «Wir sind ein Volk». Was für eine Sensation. Honecker wurde seines Amtes des SED-Generalsekretärs enthoben und ab dann ist alles ganz schnell gegangen. Deutschland war wieder vereint. Die DDR war ausgelöscht. Ich erinnere mich, wie ich mit dröhnendem Schädel und tränenden Augen auf meinem Bett sass und völlig gebannt die Bilder im Fernsehen verfolgte. Das alles passierte im November 1989.

Im Januar 1990 wurde ich stationär in die Klinik eingewiesen, denn auf der anderen Seite des Halses trat eine weitere Dissektion auf. Die Kopfschmerzen waren dabei noch heftiger und genau im Moment des Wartens im Wartezimmer meines Hausarztes waren meine Pupillen so gross, dass ich sofort zu einer Neurologin überwiesen wurde und von dort ins Spital. Nach einer Woche stationär in der Uni-Klinik Freiburg und vielen, zum Teil sehr unangenehmen Untersuchungen, wurde ich wieder entlassen. Ich erbrach weiterhin, jedoch nicht mehr mehrmals pro Tag. Diese verdammte Essstörung war einfach nicht totzukriegen.
In meinem zweiten Lehrjahr zog die ganze Praxis aus der Altstadt in die Stadtmitte von Freiburg. Die Arbeit in der Praxis aber auch deren Standort machte mir immer viel Freude. Mittendrin im Geschehen einer Stadt und doch auch in der medizinischen Welt. Das war meine Berufung. Fünf Jahre nach Beginn meiner Tätigkeit als Zahnarzthelferin, war ich immer noch überzeugte Praxisassistentin, auch wenn ich mich immer öfter über meinen Chefs ärgerte. Zum Beispiel spürte ich deutlich, dass ich bei ihm keine Aufstiegschancen haben werde, da er mir bereits zweimal eine fremde Zahnarzthelferin als Ersthelferin vor die Nase gesetzt hatte, die ich dann einlernen sollte. Ich wurde erst gar nicht gefragt, ob ich leitende Helferin werden möchte. Karin, meine Freundin verliess bereits ein Jahr zuvor die Praxis und fand eine wesentlich besserdotierte Stelle bei einer Krankenkasse. Ich hingegen hatte das Gefühl, der ewige Lehrling zu bleiben. Hinzu kam, dass er mich während meiner Krankheitszeit von der Krankenkasse abmeldete. Dies erfuhr ich, während meines Spital Aufenthaltes durch Karin, die mich noch am selben Tag der Abmeldung besuchte. Das versetzte mich derart in Panik, dass ich mich sofort nach einer anderen Stelle umsah. Die Zeit nach dem Stationären Aufenthalt, als ich noch krankgeschrieben, aber zuhause war, nutzte ich daher auch für meine berufliche Zukunft. 1990 im Sommer verliess ich nach fünf Jahren die Zahnarztpraxis und meinen Chef, der mich förderte, aber auch forderte und der mich zeitweilig auch ausbeutete. Viele Arbeiten erledigte ich unentgeltlich, wie beispielsweise Malerarbeiten in seiner Praxis und unzählige Überstunden, die er mir nie vergütetet.
Im Gegensatz zu der Zeit heute, war damals ein neuer Job keine grosse Sache. Nach nur einer Handvoll verschickter Bewerbungen erhielt ich eine Zusage vom Zahnärztehaus Freiburg. Das Zahnärztehaus ist, wie der Name schon sagt, eine Institution des Landes Baden-Württemberg für die Zahnärzteschaft. Innerhalb des Zahnärztehauses befindet sich die Kassenzahnärztliche Vereinigung (KZV) und die Bezirkszahnärztekammer. In Baden-Württemberg gibt es vier solcher Einrichtungen, verteilt auf Stuttgart, Karlsruhe, Tübingen und Freiburg. Alle vier unterstehen wiederrum der Landeszahnärztekammer in Stuttgart. Sobald ein Zahnmediziner sein Examen absolviert hat, wird er obligatorisch in die Bezirkszahnärztekammer aufgenommen, in der er Mitglied bis zu seinem Tod bleibt. Die Kammer regelt alle beruflichen Dinge. Versicherungstechnisch, juristisch, personell und die Standorte, respektive unterstützt die Zahnärzte auf dem Weg zu einer Niederlassung in eigener Praxis. Die Kassenzahnärztliche Seite regelt die finanziellen Dinge bezüglich der Krankenkassen. Sie ist eine Zwischenschaltung bei den zahnärztlichen Abrechnungen mit den Krankenkassen. Erst wenn ein Zahnarzt selbst abrechnet (nicht angestellt ist oder als Assistenzzahnarzt arbeitet) wird er Mitglied der KZV. Ich bekam eine Stelle in der Konservierenden Abteilung und sollte dort die Krankenscheine auf deren Richtigkeit vorprüfen, die alle drei Monate anlässlich der Quartalsabrechnungen von den Praxen eingereicht wurden und die wir nach der Prüfung an die Krankenkassen weiterleiteten. Von dort erhielten dann die Zahnärzte ihr Honorar. Manche Praxen reichten eine kleine Anzahl von Krankenscheinen ein, die deutliche Mehrzahl jedoch schickten einige Hundert bis Tausend Scheine. Allein nur von Patienten, die sie konservierend, also Patienten mit Zahnfüllungen oder chirurgisch behandelt hatten. Die Prothetik und die Kieferorthopädie waren extra Abteilungen. Im Regierungsbezirk Freiburg gab es zu meiner Zeit etwa 1200 niedergelassene, also abrechnende Zahnärzte. So kann man sich vorstellen, was für Mengen von Krankenscheinen täglich durch unsere Hände gingen. In meiner Abteilung waren wir zu sechst, mit dem Leiter sieben. Im Zyklus von drei Monaten wiederholte sich der Ablauf von Einreichung, Prüfung, Sortieren nach Krankenkasse und Weiterreichung an die Kassen. Jede Position musste angeschaut werden und war etwas zu beanstanden, eine Position falsch oder zu viel / zu wenig, dann kam ein rotes Strichlein darunter und wurde an die Praxis zur Berichtigung retourniert.

Nach eineinhalb Jahren der roten Striche, der zunehmenden Unterforderung und dem Tratsch der Kolleginnen, wollte ich mehr. Ich hatte das Bedürfnis, meinen Kopf mehr anstrengen zu wollen und begann parallel zu meinem Job ein Volkswirtschaftsstudium. Zu meiner damaligen Clique, die ich vorwiegend durch Karsten kennen lernte, gehörte eine Frau, die ich wirklich bewunderte. Sie war tough, mental sehr stark, hatte immer eine positive Einstellung, und studierte neben ihrem Job Volkswirtschaft. Nach einiger Zeit des Kennens wurde sie zudem neben all dem auch noch Mutter. Jedenfalls fand ich sie ganz großartig und weil sie eben dieses Studium zum Job durchzog, wollte ich das auch. Nach mühsamem Hin und Her mit den Ämtern bekam ich sogar einen finanziellen Zuschuss. Sehr motiviert zog ich das erste Semester durch, obwohl mir vor allem die Finanzbuchhaltung extrem schwer fiel. Zu Beginn des 2. Semesters, ich war schon nicht mehr so richtig motiviert, riss wieder meine Halsarterie, diesmal auf der rechten Seite. Das war am 26. Dezember 1991. Ich erwachte morgens mit extremen Kopfschmerzen und Schmerzen im rechten Kieferwinkel. Sofort, weil ich diese Schmerzen ja schon kannte, begab ich mich in den Notfall der Neurologie, wo eine erneute Dissektion mit 70% Stenose der Carotis diagnostiziert wurde. So langsam musste ich mir ernsthaft überlegen, wie weit ich es noch mit meiner Bulimie treiben wollte. Ich gab mir in allen Belangen die Schuld, war verzweifelt und doch ganz ruhig. Das erste Mal wurde mir so richtig bewusst, dass ich mit meinem Leben spielte und dass ich mit jedem Erbrechen den Tod in Kauf nahm. Sogar während meiner Spitalaufenthalte habe ich gefressen und erbrochen. Diese dritte Dissektion bescherte mir einen fünfwöchigen Krankenhausaufenthalt und allerlei Untersuchungen. Ausserdem wurde ich zunächst voll heparinisiert, d.h., ich bekam Blutverdünner und musste anschliessend für 6 Monate Marcumar einnehmen. Meine Blutgerinnung wurde bis auf 24% gesenkt und ich bekam Buserelin um meine Ovarialfunktion zu unterdrücken. Kurz gesagt, ich war nicht mehr ich selbst. Das Schlimmste war, ich hatte Angst vor mir und der Tatsache, dass ich mich in kleinen Dosen töten würde. Ich traute mir wieder einmal selbst nicht mehr. Aber ich kotzte weiter. Mittlerweile war ich seit gut fünfzehn Jahren essgestört und hatte die Hoffnung auf Heilung aufgegeben. Mir schauderte, wenn ich daran dachte, dass ich noch mit 70 über der Kloschüssel hängen würde und ich wurde traurig, wenn ich daran dachte, dass ich schon seit elf Jahren erwachsen bin und dieses Erwachsensein noch keinen Tag gesund erlebt hatte. In diesem Jahr 1991 hatten Karsten und ich bei uns eine Silvesterparty geplant. Die musste nun ohne mich stattfinden, denn ich lag im Spital an diversen Schläuchen und weinte leise vor mich hin.
Dann begann das Jahr 1992 und am 24. Januar wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen. Schon während meines Krankenhausaufenthaltes fasste ich für mich einen Entschluss: ich stresse mich nicht mehr mit irgendwelchen hohen Zielen, die ich nicht erreichen kann, weil sie mich eigentlich gar nicht interessieren. Lieber schaue ich mich nach dem Naheliegenden um. Das betraf einerseits das Studium und meine Arbeit und anderseits die Essstörung. Das Studium gab ich auf und bewarb mich im Zahnärztehaus um eine anspruchsvollere Tätigkeit. Durch eine Arbeitskollegin hatte ich erfahren, dass eine Stelle im Team des Geschäftsführers frei geworden war, die ich dann tatsächlich auch bekam. Dabei handelte es sich um das Führen und Aktualisieren der Stammdaten sowie die ständige Pflege und Aktualisierung des Bedarfs an niedergelassenen Zahnärzten. Diese Bedarfsplanung musste alle drei Monate neu analysierte werden musste. Somit war ich in beiden Institutionen des Zahnärztehauses tätig: Stammdaten für die Bezirkszahnärztekammer (u.a. meldeten sich die examinierten, jungen Zahnärzte bei mir an) und die Bedarfsplanung für die KZV (wichtige Unterlage für meinen Chef, wenn er seine Niederlassungsberatungen machte). Beide Aufgaben gaben mir Sinn, liessen mich wachsen und füllten mich aus. Die Kombination von beidem war perfekt. So bekam ich viele Kontakte zu unserer Klientel, den Zahnärzten und das war es, was mir zuvor so gefehlt hatte. Ich wollte nicht nur ein «Bürogummi» sein.

Zudem suchte ich mir abermals eine Therapiestelle, um meine Essstörung endlich in den Griff zu bekommen. Ich fand die Praxis «Durch Dick und Dünn» in Freiburgs Altstadt. Die Therapeutin war selbst einmal eine Betroffene mit Anorexie und hatte ihre Essstörung überwunden. Als sie schwanger wurde, war das die Motivation wieder normal zu essen. Ich fand sie immer noch sehr dünn, aber sie war gesund und hatte sich nach ihrer neu gewonnen Freiheit zur Therapeutin auf verschiedenen Gebieten ausbilden lassen. Ich bewunderte sie dafür. Sie hiess Andrea und die Praxis gibt es noch heute. Sie war/ist nur ein Jahr älter als ich. Bei ihr war ich einige Jahre Patientin und auch sie hat mich für vieles motiviert aber meine Essstörung behielt ich trotzdem. All diese Therapien habe ich damals selbst bezahlt, mir mühsam abgespart, in Teilbeträgen abgestottert, nichts, aber auch gar nichts hat mir den Willen und die Kraft gegeben, mit den Essattacken aufzuhören. Ich frass und erbrach weiter. Die Bulimie bestimmte meinen Alltag und war ein fest etablierter Bestandteil meines Lebens. Ich konnte mir ein Leben ohne diese Störung gar nicht vorstellen. Mal litt ich mehr, mal weniger, aber ich litt ständig.
1992 beschlossen Karsten und ich, meinen Vater, auf den Philippinen zu besuchen. Mein Vater, ein Abenteurer und immer auf der Suche nach dem finanziellen, sexuellen und mentalen Kick, hatte sich in dieser Zeit für fünf Jahre gehaltsfrei, aber mit dem Recht auf einen Arbeitsplatz nach seiner Rückkehr beim Oberschulamt Baden-Württemberg beurlauben lassen. Zu Beginn der neunziger Jahre gab es mehr Lehrer als freie Lehramtsstellen, man sprach sogar von einer «Lehrerschwemme», und so wurden Sabbaticals der Lehrer sogar gefördert. Durch solche Auszeiten der Langjährigen und teileweise auch müden Lehrer hatte ein Junglehrer die Möglichkeit, als «Lückenfüller» in den Beruf einzusteigen und konnte so erste Erfahrungen sammeln. Nach der Trennung meiner Eltern 1986 war mein Vater zunächst an zwei Schulen in der Südbadischen Region tätig, bis er eine Stelle in Schwäbisch Gmünd fand, die ihm wohl gefiel. In dieser schwäbischen Kleinstadt lebte er mittlerweile mit seiner zweiten Frau Helen und seinem Sohn, meinem Halbbruder Joshua. Helen war Philippina. Bereits in früheren Jahren ist mein Vater immer wieder auf die Philippinen gereist, bis er eines Tages mit Helen erschien. Ich glaube, er kannte sie schon während der Ehe mit meiner Mutter, was ja auch die Ursache der Trennung war. Seine Art von Freiheit! Ich habe sie kennenglernt, als ich Ende 1991 mit der Dissektion im Spital lag und gerade erfahren hatte, dass es besser wäre, wenn ich in absehbarer Zeit nicht schwanger würde. Auf jeden Fall hatte ich keinen guten Start mit meiner zukünftigen Stiefmutter, die auch noch einige Jahre jünger war als ich. Damals erklärte mir mein Vater im Spital (draussen vor dem Türe wartete Helen mit hochschwangerem Bauch), dass wenn ich es schon nicht schaffe (und man erinnere sich, er war dabei und hat mich darin unterstützt, ein Kind abzutreiben) ein Kind zu machen, er das dann halt übernehme. Wie zynisch!! Ich weiss, dass er mit diesem blöden Satz einfach seine Unsicherheit und sein schlechtes Gewissen verbergen wollte, doch ich war durch sein Geschwätz trotzdem tief verletzt. Ich fragte ihn nur, warum er Helen verstecke, er soll sie doch hereinholen. Mir kam alles so erbärmlich vor.
1992, während seiner 5-jährigen Auszeit vom Lehrerdasein, flogen Karsten und ich also zu meinem Vater nach Manila. Er lebte (und lebt auch heute noch) in Puerto Galera auf der Insel Oriental Mindoro, einem mittlerweile sehr bekannten Surf- und Taucherparadies. 1992 war es jedoch noch kaum bekannt und somit gab es damals auch noch überall einsame, weisse Strände mit maximal einer Strandbar. Asphaltstrassen waren rar und somit fuhren auch keine normalen PKWs, sondern nur Jeepnays, eine Mischung aus Jeep und Kleinbus. Alles wurde damit transportiert: Baumaterial, Maschinen, Lebensmittel, Menschen, Kampfhähne u.a. Diese Fahrzeuge kamen problemlos durch jedes unwegsame Gelände, auch in der Regenzeit. Nach Fünfzehn Stunden Flug landeten wir in Manila, wurden dort von meinem Vater, Helen und Joshua abgeholt und fuhren zunächst zu einem Hotel inmitten Manilas. Die ganze Reise ist an einem Tag nicht zu schaffen, deswegen benötigt man für eine Nacht ein Hotel. Am nächsten Morgen fährt man via Bus etwa drei Stunden bis zum Hafen von Batangas, von wo aus man mit einem Auslegerboot nochmals etwa zwei bis drei Stunden übers Meer schippern muss bis nach Puerto Galera. Damals lebte mein Vater hoch oben über dem Ort auf einem Plateau inmitten des Dschungels. Er war gerade dabei, sein Haus zu bauen. Auf den Philippinen ist das ein längeres Projekt, da die ganze Logistik weniger gut funktioniert. Nach dem Motto «Komme ich heute nicht, komme ich morgen oder auch gar nicht.» In unmittelbarer Nähe befand sich ein Golfplatz, der immer noch existiert und dessen Eigentümer bereitwillig zahlungskräftigen Europäern bezüglich Behörden und Immobilien unter die Arme griff. Manchmal sicher auch nicht ganz legal. Die ganze Lebensweise und alles drumherum hat mich damals sehr beeindruckt. Ich muss sagen, 1992 war mein Vater noch sehr motiviert, etwas auf die Beine zu stellen. Heute ist er nur noch Rentner. 2017 habe ich mit meinem heutigen Partner nochmals die Philippinen bereist, aber das ist eine andere Geschichte. Karsten und ich waren drei Wochen in Puerto Galera und ich war einmal mehr mächtig stolz auf meinen Vater und seine Abenteuer. Ich erinnere mich an eine sehr stürmische Bootsfahrt in einem Einbaum. Wir fuhren flussabwärts auf die andere Seite der Insel. Mein Vater kannte dort einen Schweizer, der ein Ferien-Ressort mit etlichen kleinen Hütten aufbauen wollte. Alle Europäer waren Aussteiger oder Gestrandete, die in ihren Herkunftsländern entweder Probleme mit der Justiz hatten, vor Alimenten Zahlungen flüchteten, Berufsaussteiger waren oder sich zu Tode soffen. Der Rum kostete nur 50 Peso pro Liter, das entsprach damals etwa fünfzig Pfennig. Mein Vater kannte sie alle. Er wusste, wer als nächstes «dran» war. In der Hafenkneipe, wo sich am Ende des Tages alle trafen, hing eine Tafel mit den Namen der Alkoholkranken. Dort war vermerkt, wer demnächst «ins Gras biss». Es wurde auch gewettet. Für mich waren das natürlich nur «die Anderen». Bei meinem Vater hatte ich damals keine Bedenken, denn er hatte ja einen Lebensinhalt mit Hausbau, Ananas- und Macadamianuss-Anbau. Ausserdem war er in meinen Augen fern jeder Suchtgefahr. Ein anderes Mal besuchten wir mit ihm zusammen eine Bar, in der man nicht wusste, ob man mit einem Mann oder Frau tanzte oder flirtete. Die Bar war ein Treffpunkt von Transvestiten. Hinter dem Gesicht der wunderschönsten Frauen verbargen sich oft Männer. Mein Vater hat uns viel gezeigt, wir verbrachten drei faszinierende Wochen mit ihm und seiner Familie auf den Philippinen, aber nach diesen Ferien war mir mein Vater noch fremder als jemals zuvor. Alles, was mich mit ihm aus meiner Kindheit verband, war weg. Er war ein ganz anderer Mensch als der, den ich von früher kannte. In mir brannte so eine komische, undefinierbare Sehnsucht. Wie Trennungsschmerz fühlte sich das an. Ich erkannte, dass er sich komplett von meiner Welt und von mir als mein Vater verabschiedet hatte. Wahrscheinlich war das schon lange so, aber diese schmerzliche Erkenntnis erhielt ich erst in diesen Wochen mit ihm zusammen. Nach Ablauf unserer Ferienzeit wollte ich einerseits am liebsten noch länger dortbleiben, um mich auf die Suche nach seiner Welt zu machen und ihn wiederfinden, anderseits war ich froh, dass wir wieder nach Europa flogen. Die europäische Kultur war mir vertraut und zuhause unter meinen Freunden fühlte ich mich nicht mehr so verloren. Nach dieser Reise wurde mir klar, dass die Essstörung, die ich schon so lange mit mir herumschleppte, wesentlich mit dem Gefühl von verloren und verlassen zu tun hatte. Eine Erkenntnis ist jedoch nur eine Erkenntnis und noch keine Lösung. Das sollte noch viele, viele Jahre so bleiben.

1992 zogen Karsten und ich zusammen. Trotz meinen inneren Vorbehalten war das meine Idee. Einerseits bot sich wohnungstechnisch eine gute Gelegenheit, andererseits wollte ich ein Leben mit Karsten und nicht mit seinen Eltern. Bisher war die Situation eher so, dass wir, abgesehen von unseren Treffen mit und bei Freunden, fasst die ganze Woche und viele Wochenenden im Wohnzimmer, der Küche und anderen Räumen seiner Eltern verbrachten. Das war mir zu viel «Karstens Eltern». Überall redeten sie mit, nahmen Einfluss auf gemeinsame Pläne und schlossen sich unseren Vorhaben (auch Ferien) an. Vor allem Karstens Mutter, die noch viel fitter als der Vater war, nahm die Gelegenheiten gerne wahr, um mit uns Ausflüge zu unternehmen. Dagegen hatte ich grundsätzlich nichts, aber ständig die Mutter dabei, das wurde mir einfach zu viel. Karsten nahm es hin, wie der ewige Sohn, der noch bei den Eltern wohnt. Er kannte ja nichts anderes. Aber ich wehrte mich dagegen. Karsten war fast dreissig, als ich ihn kennenlernte. Für mich war unbegreiflich, dass er nicht auch selbst das Bedürfnis hatte, ein eigenes Leben zu leben.
Die Gelegenheit des Zusammenziehens ergab sich, als im selben Haus, in dem ich bereits meine kleine Wohnung hatte, ein Stockwerk über mir die Dachwohnung mit drei Zimmern frei wurde. Meine Wohnung, die ich bis anhin bewohnte, war für uns zwei zu winzig, es waren ja nur 1.5 Zimmer. Die Grössere ein Stockwerk höher, war deswegen perfekt. Sofort bekundete ich mein Interesse und besprach das Ganze mit Karsten. Er war zwar nicht Feuer und Flamme (was ziemlich normal bei ihm war, da Karsten immer sehr geerdet reagierte) aber auch nicht abgeneigt. Ich glaube, dass Karsten angesichts seines bisherigen «Familienwohnens» zuerst in sich gehen und sich mit dem Gedanken anfreunden musste. Aber wenige Tage später war der Zusammenzug beschlossene Sache und nichts stand uns mehr im Weg. Nach Vertragsunterzeichnung, und nachdem wir wochenlang mit Hilfe eines Malerkollegen und viel Spass an der Sache die Wohnung renoviert hatten, bezogen wir gemeinsam unser neues Reich. Für mich war das natürlich auch eine finanzielle Entlastung, da wir alles teilten. Ich überwies an Karsten monatlich die Hälfte aller Wohnungskosten, was immer noch deutlich weniger war, als eine kleine Wohnung finanziell ganz allein zu stemmen. Ebenfalls übernahm ich die täglichen Lebensmittelkosten und das Kochen, dafür zahlte er die Ausgeh-Ausgaben und das eine oder andere Möbelstück. Ein neues Sofa zum Beispiel. Nur unsere gemeinsamen Ferien übernahm Karsten für uns beide. Dafür reichten meine 1500 Mark einfach nicht mehr. Trotzdem waren wir oft und gerne unterwegs, eben immer günstig. Mit dem Motorrad oder Auto und Zelt in Griechenland, Spanien, Portugal und Frankreich. Und das eine Mal auf die Philippinen, was natürlich kostspieliger war. Trotzdem war es für uns möglich, da wir nur den Flug zahlen mussten. Unterkommen konnten wir bei meinem Vater und alles andere war mehr als günstig. Auch waren wir auf Ibiza und Fuerteventura, im Tessin und in Österreich. So viel gereist bin ich vorher noch nie. Ich genoss es sehr, denn in diesen Wochen war ich nie bulimisch. Symptomfreie Zeit, sozusagen. Ich wollte mir meine Ferien nie mit fressen und erbrechen «beschmutzen». Weshalb ich dieses Gefühl nicht auch auf den Alltag übertragen konnte, war mir lange ein Rätsel. Kaum war ich wieder Zuhause, lebte die Essstörungs-Symptomatik auch wieder auf. Erst Jahre später verstand ich, dass dieses Verhalten mit dem Suchtcharakter der Krankheit zu tun hatte. Die Ess-Brech-Sucht benötigt Rituale, beziehungsweise die immer gleichen Abläufe. Wird der Tag durch irgendwelche aussergewöhnlichen Ereignisse «gestört», wie zum Bespiel andere Tagesabläufe, andere Wohn- und Lebensräume oder Menschen, die die Betroffenen begleiten, stören, tangieren, dann gerät das Fressritual in den Hintergrund und spielt für den Moment eben keine Rolle mehr. Meistens werden solche Störungen bei Menschen mit einer Ess-Brech-Sucht durch «Nichts essen» abgelöst. Das ist auch nicht perfekt, aber wenigstens fällt der Akt des Erbrechens weg und ist von daher schon eine grosse Erleichterung für die Betroffenen.
Trotz meiner Probleme tat mir das Alltagsleben mit Karsten ausgesprochen gut. Ich sprach mit ihm zu Beginn unserer Beziehung sehr rudimentär von meinen gesundheitlichen Problemen. Er wusste also schon, dass es da etwas Unangenehmes in meinem Leben gab, konnte sich das Ausmass jedoch überhaupt nicht vorstellen. Ich hoffte, dass im Laufe unserer gemeinsamen Zeit das Thema wieder aus dem Bewusstsein von Karsten verschwand, oder vielleicht spekulierte ich darauf, dass er die Geschichte gleich wieder vergass und ich somit in Ruhe mit der «Freundin Essstörung» weiterleben konnte. Das war meine Komfortzone. Erst als ich wegen der Dissektion ins Spital musste, wurde die Essstörung wieder thematisiert. Aber auch dann war das Ausmass für ihn nicht greifbar. So war es mir möglich, mich ungehindert auch in unserer gemeinsamen Wohnung den Essattacken zu frönen. Wie selbstverständlich verschwand ich nach den Mahlzeiten auf dem WC. Nie sprach er mich darauf an. Heute bin ich überzeugt, dass er einiges mit bekam, sich aber nicht getraute, etwas zu sagen.

Das Leben mitten in der Stadt war grossartig. Karsten und ich trafen uns oft mit Freunden im Pub nebenan, das Kino war gegenüber, die Biergärten und Clubs um uns herum. Für unseren Alltag benötigte ich zwar kein Auto, aber den Führerschein wollte ich trotzdem und konnte ihn nun auch endlich selbst bezahlen. Meiner Meinung nach gehörte das zur Allgemeinbildung. Die Theorieprüfung schaffte ich locker und auf Anhieb nach nur drei Stunden Unterricht. Während der Fahrstunden allerdings bewegte ich mich zwischen Übermut, Panikattacken und Schockstarre. Nach dem ich die ersten paar Fahrstunden in der Stadt absolviert hatte, dirigierte mich der Fahrlehrer auf die Autobahn Freiburg-Basel. Beim Auffahren auf die Autobahn geriet ich neben eine LKW-Kolonne von vier bis fünf Sattelschleppern, die mich kleiner Zwerg von PKW gar nicht wahrnahmen. Und ich? Traute mich nicht dazwischen. Wir waren schon am Ende der Beschleunigungsspur und ich war immer noch nicht auf die Autobahn aufgefahren. Hilfe! Panik! Dann lies ich einfach mal das Steuer los. In einer Blitzaktion übernahm der Fahrlehrer das Lenken und steuerte uns wenige hundert Meter zum nächsten Parkplatz. Ich hatte mich während des gesamten Vorgangs so verkrampft, dass ich einen sehr schmerzhaften Wadenkrampf im rechten Bein bekam. Auf dem Parkplatz riss ich die Türe auf, rannte hinaus, streckte das Bein in alle Richtungen und Tränen schossen mir in die Augen. Der Fahrlehrer war zwar im Moment genauso erschrocken wie ich, trotzdem bemühte er sich souverän zu bleiben und sprach beruhigend auf mich ein. Nach diesem Erlebnis war ich vor jeder Fahrstunde extrem angespannt, was die Anzahl meiner Fahrstunden bis zur Prüfung dramatisch in die Höhe trieb. Die Prüfung selbst habe ich mit einem Augenzwinkern des Prüfers (etwas zu spät die Spur vor einer Baustelle gewechselt) dann jedoch auf Anhieb geschafft. Ein riesiger Stein fiel mir vom Herzen.
In der Stadt zu wohnen, bedeutet meistens ein Problem mit Parkplätzen. Das war für mich ein Grund kein Auto anzuschaffen, der zweite und viel Wichtigere war das fehlende Geld zur Beschaffung und Unterhaltung eines Fahrzeuges. Alles kein Problem! Unweit unserer Haustüre befand sich die Haltestelle der Strassenbahn. Damit kam ich prima zur Arbeit. Leider schmälerte das meine Fahrübung, was mich um ein Haar zum Nichtautofahrer auf Lebenszeit hat werden lassen.
Davon aber später.
Ich fühlte mich ein bisschen glücklich. Samstags ging ich auf den Markt am Münsterplatz, kochte und backte gerne und für viele Freunde. Oft hatten wir Besuch und genossen die gemeinsame Zeit. Das Einzige, was mir in meinem Glücklichsein (ausgenommen dem Vorhandensein der Essstörung) fehlte, war die Sexualität. Meine Sexualität. Ich fühlte nichts. Mit Karsten intim zu sein, war mechanisch. Ich empfand es als meine Pflicht und absolvierte unsere sexuellen Momente wie eine Schulstunde. Er hatte keine Erfahrung und ich keine Lust. Ich mochte Karsten für seine gesunde Art. Wie er ohne Süchte oder sonstige Probleme sein Leben lebte und genoss. Er zeigte mir, wie lebenswert solch ein Leben sein kann und gab mir auch etwas davon ab. Er nahm mich, wie ich war. Das rechnete ich ihm so hoch an, dass ich mich in unseren sexuellen Augenblicken aussen vor lies. Zudem war ich mir nicht sicher, ob mein Körper in dieser Hinsicht überhaupt richtig funktionierte. Bis dreissig erlebte ich niemals einen sexuellen Höhepunkt, strebte das auch gar nicht an, weil ich es einfach nicht kannte. Ich dachte immer, dass viel zu viel Gewese um Sex gemacht wird. Ich konnte nichts Wunderbares daran finden. Ich war mit meinem Körper alles andere als in meiner Mitte. Ich mochte ihn nicht mal besonders. Er war halt so. Schon immer waren «Entspannung», «Fallen lassen» und «Hingabe» Fremdwörter für mich, «Verspannung» kannte ich dafür sehr gut. Trotzdem war ich im Grossen und Ganzen zufrieden mit meinem gegenwärtigen Leben.

1993 heiratete meine jüngere Schwester Christine. Ihren Lebensweg hatte ich bis dahin fasst nicht wahrgenommen. Natürlich kannte ich ihren Freund Philippe, einen Franzosen, den sie auf ihrer Zugfahrt nach Paris, auf dem Weg zu ihrer Au-pair-Stelle, kennengelernt hatte. Eine wirklich lustige Geschichte, die ich in Versform an ihrer Hochzeit vortrug und die mir wie aus einem Rosamunde-Pilcher-Roman erschien. Sie ist es wert, kurz erzählt zu werden!
Nach dem Abitur, was meine kleine Schwester mit hervorragenden Leistungen abgeschlossen hatte, wollte sie ihr Schulfranzösisch im Land selbst und unter französisch-sprechenden Menschen vertiefen. Außerdem stand es außer Frage, wie wichtig es für ihren weiteren Lebensweg sein würde, eine Zeitlang selbstständig im Ausland zu leben. Meine Eltern organisierten über einen Verein für Au-Pair-Interessierte eine Familie in Paris, bei denen sie wohnen konnte, jedoch unter Mithilfe im Haushalt und bei der Kinderbetreuung. Also stieg sie eines schönen Tages in Basel in den Zug, fand einen Platz in einem Abteil und machte es sich mit einem Buch gemütlich. Sie konnte durchfahren, ohne umzusteigen. Mit ihr im Abteil nahmen drei weitere Personen Platz. Zwei Frauen und ein Mann, alle etwa in Christines Alter. Als der Schaffner die Billette kontrollierte, entpuppten sich die beiden Frauen als Schweizerinnen und der Mann als Franzose. Irgendwann im Laufe der Fahrt nahmen die beiden Frauen, die offensichtlich Freundinnen waren und sich bereits über Gott und die Welt unterhalten hatten, ihren französischen Mitfahrgenossen ins Visier. Sie flüsterten und tuschelten, wie nett er doch aussehen würde und dass sie den auch nicht «von der Bettkante stoßen würden» und so weiter. Wohl in der Annahme, er als Franzose würde das alles nicht verstehen plapperten und kicherten munter weiter. Meine Schwester, die das ganze Gerede mithörte und von den beiden Frauen ignoriert wurde, amüsierte sich köstlich. Trotzdem wollte sie mit den beiden unter keinen Umständen in einen Topf geworfen werden. Sie fand das irgendwie auch peinlich. Währenddessen schaute Philippe unverwandt abwechselnd aus dem Fenster oder in sein Buch und machte einen sehr entspannen, ausgeglichenen Eindruck. In Paris angekommen, stiegen die beiden Mädchen beim Gard de Lyon aus, während Philippe und Christine noch eine Station weiterfuhren. Als sich der Zug langsam wieder in Bewegung setzte, wurde Christine von Philippe in fasst akzentfreiem Deutsch sehr höflich gefragt, wohin sie denn fahren würde. Christine traute ihren Ohren nicht, hatte er doch das ganze oberpeinliche Getuschel der beiden jungen Frauen mitgehört und keine Mine verzogen. Als sie ihn darauf ansprach, fand er das in erster Linie sehr lustig. «Ich wollte schon immer wissen, was Frauen über mich denken». Beide lachten über die ganze restliche Fahrt bis zum Hauptbahnhof, wo die Reise endete. Das war der Beginn ihrer Freund- und Liebschaft. Philippe kannte sich gut aus in Paris, er studierte schon seit einiger Zeit Betriebswirtschaft. So war es für ihn selbstverständlich, dass er sie zunächst zum Meldebüro für Au-Pair-Personal begleitete und anschliessend zu der für sie zuständigen Familie.
Ihr Au-Pair-Jahr startete zwar mit einigen Schwierigkeiten (die Familie war alles andere als nett und verstand sie in erster Linie als billige Hilfskraft und nicht als Sprachschülerin, worauf sie nach ein paar Wochen die Familie wechselte) aber das sind andere Geschichten. Philippe blieb im Leben meiner Schwester, wurde ihr wichtigster Mensch und half meiner Schwester durch sämtliche Unwegsamkeiten ihres jungen Lebens. Nachdem Christine ihr Au-Pair-Jahr in Paris, sowie ihre Ausbildung zur Europasekretärin in Karlsruhe abgeschlossen hatte und Philippe sein Studium der Betriebswirtschaft in Paris beendete und sich auch noch ein Kind ankündigte, wurde 1993 geheiratet. Beide lebten in jener Zeit in Benfeld, einem kleinen Dorf im Elsass, in der Nähe von Strassburg. Gar nicht so weit weg von Freiburg. Das eine oder andere Mal besuchten wir uns gegenseitig, woran ich immer noch gerne zurückdenke. Die Hochzeit der beiden war ein grossartiges Fest. Christines Brautkleid hatte zwar einen etwas seltsamen Schnitt, was wohl eher ihrem schwangeren Bauch geschuldet war, aber ansonsten war sie wunderschön und sah sehr glücklich aus. Die Messe wurde sowohl zweisprachig als auch ökumenisch in Strassburg – Obernai abgehalten. Nur dort waren die Pastoren bereit, sie nach ihren Wünschen zu trauen. Für damalige Verhältnisse war das offenbar sehr fortschrittlich. Das Fest danach fand in einem wunderschönen Restaurant statt, wo wir bis in die frühen Morgenstunden gefeiert haben. Sogar meine damals fünfundachtzigjährige Grossmutter hielt bis weit nach Mitternacht durch.
Ich erzähle darüber so ausführlich, weil meiner Schwester’s neue Lebensphase auch mich inspirierte und sich in meinem Leben schleichend aber kräftig das Bedürfnis nach familiärer Beständigkeit einnistete. Ich war immerhin auch schon dreissig. Beruflich war ich so weit angekommen. Weiter ging es damals für eine Zahnarzthelferin in Freiburg nicht. Karsten war für mich damals als Vater meiner Kinder der richtige Mann und somit war der Wunsch nach Heirat und einem Kind geweckt. Also thematisierte ich «Heiraten» in dieser Zeit immer mal wieder. Karsten wiederum wand sich bei dem Thema. Er wäre noch nicht so weit und wir hätten es doch schön miteinander und so weiter. Grundsätzlich sah ich das auch so, aber meine Lebensuhr tickte im Gegensatz zu Karstens um einiges lauter. Auch hatte ich das Gefühl, privat still zu stehen. Ich dachte, das kann es doch nicht gewesen sein. Er und ich und alles komplett unspannend. Kein Knistern, kein Prickeln, gelebte Eintönigkeit. Nein, ich wolle mehr, war nun genug konsolidiert nach meinen bewegten ersten Jahren. Ein Mann, der lieb ist aber mich überhaupt nicht in Aufregung versetzt, eine berufliche Tätigkeit, die vor Routine nur so strotzt, Schwiegereltern, die es gefühlt schon immer gab und eine Wohnung, die aussieht, als wären wir ein altes Ehepaar. Alles war Routine, eintönig, und fühlte sich langweilig an. Mit dreissig und einunddreissig fühlte ich mich wie eine alte Frau und sah auch schon richtig bieder aus. Karsten und ich waren 1993 erst sechs Jahre zusammen, also eigentlich noch keine Zeit für solche Gefühle und trotzdem für meine Verhältnisse schon eine lange Zeit. Das Thema «Heiraten» blieb ungehört, ich kehrte es irgendwann auch unter den Teppich, wo es langsam vor sich hin mottete. Im Dezember 1993 erblickte Lisa, die Tochter meiner Schwester, das Licht der Welt. Mein Patenkind! Ich war sehr stolz und eine glückliche Tante. In den nächsten Monaten besuchten Karsten und ich öfter meine Schwester und ihre Familie. Ich genoss das junge Familienidyll meiner Schwester. Eifersüchtig oder neidisch war ich nie. Trotz all meinen Niederlagen und der latenten Gegenwart der Essstörung konnte ich mit ihr das Glück geniessen. Ich glaube, in solchen Glücksmomenten vergass ich ganz einfach meine eigenen Probleme.
Etwas anderes nagte in mir. Eine zunehmende innere Sehnsucht nach etwas, was ich nicht beschreiben konnte. Lange Zeit spürte ich eine Unrast, ein inneres «Getrieben Sein». Mehr und mehr machte sich neben der fehlenden Sexualität auch fehlendes begehrt werden bemerkbar. Ich war mir sicher, mit Karsten würde ich Lust und was es dazu noch alles gab, nicht ausleben können. Er war vor allem ein guter Freund geworden, ein Vertrauter aber kein Liebhaber. Das war er nie gewesen. Dieser Zug war definitiv abgefahren. Ich haderte, redete mir ein, dass ich mich nicht beklagen konnte, redete mir ein, jetzt doch gefällig glücklich zu sein. Karsten ist doch lieb und stellte keine Ansprüche, was wollte ich denn mehr? Antworten! Wohin gehe ich in Zukunft? Mit wem? Wann? War das alles? Wenn ich keine Kinder haben würde (was nicht nur an Karsten lag, sondern auch an mir), dann muss ich beruflich weiterkommen. Aber wie? Immer wieder spulten sich diese Fragen und das Dilemma in meinem Kopf ab und immer wieder begrub ich den Druck und die Unruhe in Fressorgien. Am besten gar nicht erst hin fühlen, das Ganze zudecken, vergraben.

Eines Tages konnte ich nicht mehr. Ich wollte mich nicht mehr verleugnen, zwang mich zu einer Entscheidung. Ich wollte weiter gehen. Sehen, was das Leben sonst noch bietet. Spüren, dass ich lebe und nicht nur warte. Mein Lebensweg musste ohne Karsten weiter gehen und irgendwann im Sommer 1994 beendete ich unsere Beziehung. Für Karsten kam meine Entscheidung unerwartet und war für ihn entsprechend schmerzlich. Er hatte die Anzeichen nicht sehen wollen, vielleicht auch nicht sehen können. Dass ich ihm so weh tun musste, tat mir sehr leid, aber ich konnte nicht anders. Als ich ihm meine Entscheidung (ja, ICH hatte entschieden ohne ihn nochmals anzuhören) mitteilte, schmiss er ein Bild von uns nach mir, flehte mich an doch zu bleiben, er würde mich ja auch heiraten. Es zerriss mir das Herz, aber … Scheisse!! Alles kam zu spät, innerlich war ich bereits schon vor Wochen gegangen.
Ich weiss nicht mehr genau, wann das war, aber ich glaube, nur wenige Tage später flog er für drei Wochen zu meinem Vater auf die Philippinen. In dieser Zeit zog ich aus unserer gemeinsamen Wohnung aus, in eine kleine 1-Zimmer-Wohnung in einen anderen Stadtteil von Freiburg. Die Wohnung hatte ich mir irgendwann einmal angeschaut und sowohl der Mietpreis als auch die Grösse stimmten für mich und konnte ich finanziell auch stemmen. In den nächsten Wochen beschäftigte ich mich einerseits mit dem Einrichten der Wohnung, anderseits liess ich es richtig krachen. Wochenends und manchmal auch während der Woche, lies ich keine Party aus. Ich war total im Flirt- und Aufreissmodus. So, als müsste ich die letzten fünfzehn Jahre innerhalb kürzester Zeit aufholen. Ich erkannte mich nicht mehr wieder. Wie eine läufige Hündin rannte ich durch Raum und Zeit. Ich fieberte jeder Gelegenheit entgegen, die sich bot, jemanden kennen zu lernen. Nicht um eine echte Beziehung aufzubauen, nein, nur um des Abenteuers willen. Ich wollte keine Verantwortung, keine Verpflichtung, niemanden, der etwas von mir verlangte oder einforderte. Ich wollte die Freiheit spüren und in meiner Freizeit tun und lassen, was ich für richtig hielt. Auf gut Deutsch: Freiheit leben, das Leben spüren! So kamen und gingen einige Männer in und wieder aus meinem Leben. Dazwischen ergaben sich ein paar tiefere Schwärmereien meinerseits, die jedoch unrealistisch waren. Verheiratet, nicht an mir interessiert, mutlos oder sonst wie gebunden. Aber auch ohne Erfolg genoss ich die Flirterei. Es fühlte sich wunderbar an, wenn der ganze Körper kribbelte, der Magen flau war, die Herzchen tanzten und sich die Bulimie dadurch etwas in den Hintergrund schob. Ich war verliebt ins Verlieben und nicht haben können. Mein ganzer Körper war eine einzige ewige Hormonausschüttung. Ich spürte mich selbst auf eine positive Art und das fühlte sich sehr, sehr gut an. Natürlich war mir auch klar, dass dieser Zustand nicht ewig halten würde, aber ich hoffte, er wäret noch lange und so genoss ich es aus vollen Zügen. Ich war nun zweiunddreissig und redete mir ein, wenn kein (männliches) Wunder geschehen würde, müsste ich den Gedanken an Kinder und eigene Familie wohl begraben. Weit und breit gab es keinen Mann für eine ernsthafte Beziehung und für halbe Sachen (alleinerziehend und so) war ich definitiv nicht zu haben. Ausserdem war ich mir gar nicht mehr sicher, ob ich überhaupt selbst noch bereit für ein Kind wäre. Ich hatte ja schon Mühe, mich selbstverantwortlich durchs Leben zu bringen.
Auf beruflicher Ebene konnte ich dafür Erfolge verbuchen. Mittlerweile war ich ziemlich routiniert mit den Statistiken, konnte dadurch souverän meine Aufgaben erledigen, war anerkannt im Team und fühlte mich wohl mit meinem Chef, auch wenn er manchmal sehr direkt seine Meinung kundtat (Auf die Frage nach einer möglichen Teilnahme an regelmässigen Abteilungsleitersitzungen (wichtig für die Aufgabenerledigung meines neuen Jobs), antwortete er: «Sie spinnen wohl!») Auf der anderen Seite unterstützte er mich, wo es ging. Bei jedem Gehaltsgespräch erhielt ich eine positive Antwort, bei Anfragen zu Fort- und Weiterbildungen sagte er nie Nein und er hörte mir zu und nahm mich ernst. Ich war eine der Sekretärinnen des Geschäftsführers und in dieser Rolle und den damit verbundenen Aufgaben ging ich auf.
Jedes Frühjahr, kurz vor Ostern fand der jährliche Zahnärztekongress im Kurhaus in Titisee im Schwarzwald statt, an dem ich, als direkt dem Chef unterstellte Mitarbeiterin, natürlich auch eingeteilt wurde. Die Verantwortung für die Gesamtorganisation hatte zwar die Chefsekretärin der Bezirkszahnärztekammer, aber sämtliche direkte Mitarbeiter des CEO’s mussten ebenfalls ihren Beitrag leisten. In der Kongresswoche ging es immer donnerstags los. Zunächst mit einer grossen Generalversammlung der gesamten Zahnärzteschaft aus der Region Südbaden. Freitags tagten dann die Berufsverbände und der Kammervorstand. Am Samstagmorgen begannen die Fortbildungsvorträge für die Frauen und Männer Zahnärzte, Assistenten und Studenten und zu diesem Zeitpunkt sollten auch wir vor Ort sein. Also reisten wir immer Freitagsnachmittags an und blieben bis Montag, denn da stand noch grosses Aufräumen und ein gemeinsames Mittagessen für alle Mitarbeiter auf dem Programm. Die drei Nächte bis Montag schliefen wir in einer Pension, die ich immer erst abends sah, wenn wir uns für die entsprechenden Essen bereit machten. Der eigentliche Kongress mit Vorträgen dauerte bis Sonntag Spätnachmittag. Der Samstagabend war der Höhepunkt des Anlasses. Dann fand der Galaabend mit grossem Unterhaltungsprogramm statt, ein rauschendes Fest der Zahnärzteschaft, die zu diesem Anlass herausgeputzt ihre Kollegen und Kolleginnen begrüssten und zu dem jeweils auch die Partnerinnen und Partner anreisten, wenn sie nicht schon vorher am Begleitprogramm teilgenommen hatten. Zu meinen Aufgaben gehörte einerseits die Kontrolle der Eintrittskarten an allen Veranstaltungen der etwa 1200 Zahnärzte und Zahnärztinnen, Assistenten, Studenten der Zahnmedizin und Gäste aus aller Welt, andererseits das Auslegen von Flyern, Infoblättern, Heranschleppen und Abbauen von Stühlen und dem Leisten von weiteren Dienstleistungen, wenn nötig. Für die Vortragstechnik sowie die Betreuung der Diaprojektionen wurde Karl-Heinz, ein entfernter Bekannter meines Chefs verpflichtet, der sich in seiner Freizeit mittels eines Keyboards als Alleinunterhalter auf privaten Events betätigte und somit von Unterhaltungstechnik etwas verstand.
Am Zahnärztekongress, im Frühling des Jahres 1995 wurde der circa 60-jährige Techniker von einem etwa dreissig Jahre jüngeren, sehr gutaussehenden Mann begleitet, der sich als Björn und «guter Freund» von Karl-Heinz vorstellte. Es war allgemein bekannt, dass Karl-Heinz sein Herz mehr an Männer verschenkte, weswegen meine Kolleginnen und ich diesen Björn sofort als «jugendlichen Lover» von Karl-Heinz analysierten. Während der gesamten Veranstaltung war jeder in seine Aufgaben vertieft, somit hatten wir kaum miteinander zu tun. Am Galaabend allerdings wurden Björn und ich nebeneinander platziert. Das hatte keinen weiteren Grund, wir sassen einfach alle am «Mitarbeitertisch». Natürlich kamen wir ins Gespräch. Es stellte sich heraus, dass Björn drei Jahre jünger war als ich, eine 1-jährige Tochter hatte und – aus meiner damaligen Sicht - keinesfalls Karl-Heinz’ens jugendlicher Lover war. Er war ein sehr ernster junger Mann, der offenbar einiges im Leben erlebt hatte und den Eindruck machte, nichts auf die leichte Schulter zu nehmen. Mehr noch, er kam mir damals schon etwas schwer lebend vor. Er hatte keine abgeschlossene Berufsausbildung und krampfte sich irgendwie durchs Leben. Zur Zeit unseres Kennenlernens arbeitete er als Fahrer einer Logistikfirma, die Apotheken mit Medikamenten belieferte. Björn und Moni, die Mutter seiner Tochter waren nie verheiratet, hatten jedoch das gemeinsame Sorgerecht, wobei Björn in Konfliktsituationen mit der Mutter sicherlich immer am kürzeren Hebel sass. Wegen seiner Tochter musste Björn auch noch am selben Abend wieder zurück nach Freiburg, denn am darauffolgenden Sonntag war «Papi-Tag» und das konnte er nicht so einfach ignorieren. Das bedeutete je nach Verkehr etwa 40 - 60 Minuten Fahrt. Nach unserem sehr intensiven Gespräch und zu fortgeschrittener Stunde verabschiedete er sich (schweren Herzens) mit dem Versprechen, er werde mich im Zahnärztehaus besuchen, da er sowieso die vom Chef der Buchhaltung ausgeliehene Krawatte zurückbringen musste.

Wenige Tage später klopfte es an unserer Bürotür und herein spazierte Björn mit einem ziemlich breiten Lächeln im Gesicht. Das war der Anfang unserer Beziehung und meiner ersten Ehe.
Björn wohnte mit zwei anderen Männern in einer WG in einem Stadtteil auf der entgegengesetzten Seite Freiburgs. Sven hiess der eine und der Name des anderen weiss ich nicht mehr. Ich weiss nur noch, dass er Engländer war, extrem unordentlich und gar nicht zu den beiden anderen passte. Mit ihm hatten sie auch ihre Probleme, weil er nie das WC putze und immer die Joghurts von Sven wegass. Am Lebensmittelkauf beteiligte er sich nämlich auch nur sehr rudimentär. Die ersten Monate verbrachte ich viel Freizeit in der WG mit Björn und – unvermeidbar - auch mit Sven, da er immer zuhause war. Sven war einer von Björn’s guten Freunden und ebenfalls Vater einer fasst gleichaltrigen Tochter wie Björns Kind. Die beiden kleinen Mädchen waren komplett unterschiedlich. Die Tochter von Sven war sehr empfindlich, weinte schnell und oft und hatte meistens schlechte Laune. Ich glaube, sie war einfach Elterngeschädigt. Oder vielleicht auch nur Vatergeschädigt, denn die Mutter habe ich nie kennengelernt. Ich bekam immer nur die Endlosdiskussionen zwischen Sven und seiner Ex am Telefon mit und fand das äusserst mühsam. Dasselbe erlebte ich natürlich auch zwischen Moni und Björn, trotzdem war René, seine Tochter ein sehr ausgeglichenes Kind. Mit ihr konnte man alles unternehmen, sie war immer zufrieden.
Björn und Sven kifften. Sehr viel! Sven war teilweise den ganzen Tag stoned, was nicht gerade seinen Arbeitseifer ankurbelte, dafür aber seine Lust auf Süssigkeiten. Björn’s Cannabiskonsum war ebenfalls hoch, trotzdem bekam er auch sonst noch was mit vom Alltag. Für ihn gab es neben dem Kiffen noch andere Prioritäten im Leben, wie zum Beispiel René, seine Tochter. Vor ihr vermied er es zu kiffen. Für mich war das eine ganz neue Seite des Lebens und natürlich rauchte auch ich hie und da mal mit. Aber im Gegensatz zu den beiden Männern, die sich damit ruhigstellen wollten (hatten beide vielleicht ADHS?) schlief ich nach ein paar Zügen ihres Joints ein. Das war mir unangenehm und deswegen gab mir das Kiffen eigentlich nichts. Im Gegenteil, mich nervte dieses ewige «rumgehänge» und glasig «drein geglotze». Und mich nervte Sven. Er war immer da. Eigentlich machte er immer gar nichts. Oft haben Björn und ich uns gefragt, wie Sven seinen Lebensunterhalt verdiente. Er machte mal dies, mal das, war überzeugter Vegetarier, verkaufte damals schon diese «Soda Stream Maschinen» (Ja tatsächlich, die gab es schon 1995, nur wollte damals noch niemand etwas davon wissen. Die «Klimawelle» und «Plastikscham» war noch weit entfernt), aber irgendwie kam er nie auf einen grünen Zweig.
Während unserer ersten Monate erlebten Björn und ich eine wilde, sehr verliebte, von Leidenschaft berauschte Zeit. Ich war stolz auf ihn, auf seinen Charme, sein Aussehen und seine kindliche Liebenswürdigkeit. Er interessierte sich für mich und hob mich sexuell in den Himmel. Mit ihm entdeckte ich meinen Körper. Er zeigte mir meine eigene frauliche Schönheit und ich lernte mich selbst zu akzeptieren. Mit ihm entdeckte ich die Sexualität in ihrer ganzen Leidenschaft. Wir liessen nichts aus, getrauten und vertrauten uns und verbrachten ganze Wochenenden einfach nur im Bett. In dieser Zeit fühlte ich mich sehr gesund, die Bulimie war zu diesem Zeitpunkt extrem in den Hintergrund gerückt. Leider, leider nur vorübergehend. Das war die eine Seite mit Björn, die Schöne. Die Hässliche kam später, denn die gab es auch.

Ab Anfang 1995 griff im Zahnärztehaus Freiburg die sogenannte «Seehofer-Reform». Das Ganze passierte eigentlich schon Jahre früher. Unter dem Politiker Seehofer, der in den Achtzigern Gesundheitsminister in Deutschland war, musste eine neue Gesundheitsreform umgesetzt werden, die unter vielen anderen neuen Regelungen auch vorsah, dass ab 1989 jeder Zahnarzt eine Fortbildungspflicht hatte und diese auch schriftlich nachweisen musste. In Form von Diplomen, Zertifikaten, Zeugnissen oder per Stempel in einem Fortbildungsheft. Die Freiburger Zahnärzteschaft und deren Assistenzpersonal waren daher gezwungen, mindestens zwei bis dreimal pro Jahr den Weg nach Karlsruhe, Stuttgart oder Tübingen auf sich zu nehmen, da Freiburg kein entsprechendes Fortbildungszentrum hatte. Nach Jahren der Benachteiligung beschloss man im Regierungsbezirk Freiburg solch eine Institution ebenfalls aufzubauen, was 1994/1995 seinen Anfang nahm. Zunächst wurde eine ganze Etage in einem neuen Bürogebäude in dem Industriegebiet angemietet, in dem auch ich meine kleine Wohnung hatte. Parallel dazu war der Spatenstich zum Bau eines ganz neuen Zahnärztehauses, in dem auch das Fortbildungszentrum seinen zukünftigen Platz finden sollte. Die provisorische Fortbildungsabteilung beinhaltete einen grossen Schulungsraum, einen Raum für praktische Übungen mit fünf zahnärztlichen Einheiten, einen Eingangsbereich mit Empfangstresen, einem Labor, Küche, getrennte Toiletten für Damen und Herren, sowie einem kleinen Büro für die Sekretärin, die die Kurse organisieren und betreuen sollte. Es wurde eine neue Stelle geschaffen und eine Person eingestellt. Diese war unter Mithilfe eines Professors aus der Zahnklinik und einem niedergelassenen Zahnarzt zuständig für die Erstellung des jährlichen Programmheftes, der Organisation und Betreuung der Kurse und Teilnehmer, sowie der Abrechnung aller Fortbildungen. Eine recht umfangreiche und komplexe Tätigkeit, wenn man bedenkt, dass jeder Kurs seine individuellen Vorbereitungen benötigte. Auf der einen Seite die Dozenten- und Teilnehmer-bedürfnisse (Hotel, Anfahrt, Taxi etc.), auf der anderen Seite die Vorbereitungen von praktischen Übungen (Schweinekiefer, Humanpräparate, etc.), die Technik (Diaprojektoren, Kamera, Ton, Röntgengerät, u.a.), das Catering und die schriftlichen Unterlagen. Die gesamte Verantwortung lag in der Hand einer Person. Die Zahnarzthelferinnen hatten ihre Weiterbildungen während der Wochentage, die Zahnärzte an den Wochenenden. Die Schulungen liefen gemächlich, zunächst mit wenigen Teilnehmern, aber gut an. Trotz der unvermeidlichen Kinderkrankheiten.
Mehr Probleme bereitete meinem Chef die neue Mitarbeiterin, die extra für die Fortbildungen eingestellt wurde und dafür auch vollumfänglich verantwortlich war. Ich kannte sie kaum, aber mir kam sie ziemlich selbstbewusst und taff vor. Sie bereitete alles sehr gut vor, legte die Grundsteine für sämtliche Schreiben, das Kursprogramm und die Abläufe. Die Zahnärzte, vor allem die für das Fortbildungszentrum Verantwortlichen, waren voll des Lobes. Und doch war sie ständig krank. Immer wenn alles vorbereitet war und der Kurs starten sollte, meldetet sie sich krank. Es sah so aus, als ob sie Angst vor den Teilnehmern hätte. Das war wirklich seltsam. Und da der Kurs nicht von allein laufen konnte, musste eine Ersatzperson, die ein bisschen etwas von Zahnmedizin verstand per Interim in das Fortbildungszentrum ins Industriegebiet und dort die Aufsicht, das Catering und alles drumherum übernehmen. Da ich im Stab des Geschäftsführers die einzige Zahnarzthelferin war (alle anderen kamen aus irgendwelchen Bürojobs) traf mich meistens das Los der Vertretung. Grundsätzlich hatte ich viel Freude an den Aufgaben rund um die Schulungen. Diese Arbeit gefiel mir viel besser als meine trockene, und meist auch einsame Statistik- und Stammdatentätigkeit. Die Crux war nur, dass eben diese während der Vertretungen im Fortbildungszentrum, also meine eigentlichen Aufgaben, darüber liegen blieben. Da ich aber auch Abgabetermine oder gewisse Zeitfenster einhalten musste, kam es vor, dass ich entweder meine Statistikunterlagen mitnahm und mit Sack und Pack im Bus hin und her fuhr oder sonntags im Büro sass und dann meine Aufgaben erledigte. Ein paar Monate konnte ich diesen Modus einhalten aber irgendwann im Herbst 1995 rang ich mich durch und bat meinen Chef um ein Grundsatzgespräch. Es wurde mir alles zu viel und vor allem konnte ich keiner meiner Aufgaben richtig gerecht werden. Ich war bei nichts mehr richtig dabei. Nicht bei den Fortbildungen (zwischendrin war die Mitarbeiterin auch mal wieder ein paar Tage anwesend) und auch nicht bei meinen Stammdaten. Manchmal fehlten Zahlen oder meine Statistik war nicht mehr aktuell. Kurzum, ich konnte diese Situation so nicht mehr verantworten. Natürlich hoffte ich auf eine dauerhafte Tätigkeit im Schulungszentrum, aber ich hätte mich auch mit meiner ursprünglichen Arbeit zufriedengegeben.
Im Laufe des von mir erbetenen Gesprächs, erfuhr ich, dass die dafür eingestellt Kollegin aus dem Fortbildungszentrum bereits gekündigt hatte und wieder zurück nach München wollte. Offensichtlich hatte sie sehr unter Heimweh gelitten. Dann kam die entscheidende Frage des Fortbildungsreferenten: «Wo möchten Sie denn lieber arbeiten?» Und ich sagte wahrheitsgemäss: «Im Fortbildungsforum!» Das war der offizielle Name «FFZ-Fortbildungsforum Freiburg für Zahnärzte». Und damit erhielt ich ab Ende 1995 einen neuen Tätigkeitsbereich, in dem ich die nächsten sieben Jahre richtiggehend aufging und der zu meiner wichtigsten Lebensstütze werden sollte.

In diesen Jahren war der Kontakt zu meinen Eltern und Geschwistern sehr mager. Meine Mutter hatte eine Stelle als Hauswirtschafterin und Betreuerin bei einem angesehenen, sehr vermögenden und zu Beginn ihrer Arbeit 93-jährigen alten Herrn in der Schweiz angenommen. Im Geiste war er noch immer fit, nur die körperlichen Kräfte hatten ziemlich nachgelassen. Im Laufe der Zeit entwickelte sich zwischen ihm und meiner Mutter sogar eine recht vertraute Beziehung, fasst wie Vater und Tochter. Ursprünglich bestand die Familie des alten Herrn aus vier Personen und dem Dienstpersonal, leider verstarb die Ehefrau jedoch recht früh. Man munkelte, dass sie keine gute Ehe führten, sie litt unter Einsamkeit und Unterdrückung und er hatte diverse erotische Nebenschauplätze. In seinen jungen Jahren war der alte Herr dreissig Jahre Direktor einer grossen Schweizer Firma, Verwaltungsratsmitglied in diversen anderen Unternehmen, sowie politisch als Grossrat tätig. Die beiden Söhne der Familie lebten in Basel und Zürich und arbeiteten beide im Bankenwesen. Somit war die Achtzehn! -Zimmer-Villa über drei Jahre – solange lebte der alte Herr noch nach Arbeitsantritt meiner Mutter – nur noch von Mann, Hund und meiner Mutter bewohnt. An den Wochenenden kamen die Söhne zu Besuch, welche beide nie geheiratet hatten. Die nächtlichen, im Schlafmittelrausch stattfindenden Spaziergänge des alten Herrn, erforderten zudem die Anwesenheit meiner Mutter auch über Nacht. Nur an den Wochenenden hatte sie frei und dann wurde sie von Jürgen, ihrem Partner absorbiert, der eine totale und absolut masslose Zuwendung einforderte. Für Familie hatte sie einfach keine Zeit und auch keinen Nerv mehr.
Das Leben meines Vaters wiederholte sich gerade in gewisser Weise, denn er hatte ja in Aalen bei Stuttgart eine zweite Familie gegründet, war nach seinen dienstfreien Jahren auf den Philippinen wieder zurück im Lehreralltag und bereits zum dritten Mal auf dem Sprung in die Freiheit (mit Fremdgehen und allem Pipapo). Mein Bruder Martin war seit 1991 fertig mit seinem Studium der Agrarwissenschaften in Hohenheim und arbeitete mittlerweile als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Tierproduktion der Uni Hohenheim für die Tropen und Subtropen. Im Jahr 1995 beendete er seine Dissertation zum Thema Tierernährung. Christine, meine kleine Schwester und ihr Mann Philippe bekamen 1995 ihr zweites Kind, den kleinen Tom, der von allen unheimlich geknuddelt und geliebt wurde. Gleichzeitig arbeitete sie bei einem Kunstverleih in Strassburg, respektive war sicherlich auch schon am Aufbau ihre Nachhilfeschule. Sie hatte ich am meisten aus den Augen verloren. Später einmal erzählte mir meine Schwester, dass sie in jener Zeit unheimlich meine Unterstützung gebraucht hätte, Tom war nämlich die ersten sechs Monate ein ausgesprochenes Schreikind. Sie war allein mit zwei Kindern, eines davon schrie fasst ununterbrochen und Philippe war ständig im Ausland. Wo war ich, die Patentante? Wo die Mutter / Oma? Ich weiss es heute. Ja! Ich war so ziemlich abgetaucht, war nicht einmal an der Doktorfeier meines Bruders. Björn war in mein Leben getreten und er verlangte viel von mir ab. Heute würde ich sagen, dass er ebenso pathologisch narzisstisch veranlagt war, wie Jürgen, der Partner meiner Mutter. Mit dem feinen Unterschied, dass Jürgen ein ausgebildeter Psychotherapeut war und Björn ein einfacher Arbeiter ohne Ausbildung. Aber die erste Zeit genoss ich mit Björn und liess mich auch deswegen auf keine Familienfeste ein. Ich war in Freiburg, alle anderen irgendwo in Deutschland oder im Elsass und das ging mich alles (vermeintlich) überhaupt nichts an. Ich lebte mit Björn wie in einer Blase. Wir zusammen waren 50%, meine berufliche Tätigkeit waren die anderen 50% meines Lebens und die Freizeit verbrachte ich mit Fressen und Kotzen. Dazwischen hatte es für nichts anderes mehr Platz. Heute ist mir durchaus bewusst, wieviel Lebenszeit ich mit meiner Familie verpasst habe. Wieviel gemeinsame Zeit ich nicht wahr nahm. Geht das den Personen in anderen Familien auch so? Wir können ja nicht überall sein und doch hinterlässt die versäumte, gemeinsame Zeit im Älterwerden eine gewisse Schmerzhaftigkeit. Plötzlich ist der Neffe erwachsen, der Bruder wird sechzig, die Eltern sterben. Und wo stehe / stand ich?

Mit meinen 33 Jahren habe ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Ich war nur froh, nicht noch mehr Verantwortung zu haben. In den ersten Wochen unserer Beziehung hatte mir Björn erklärt, dass er keine weiteren Kinder möchte, die Unterhaltszahlungen für ein Kind würde ihm reichen und ich wollte keine Familie, wenn der Vater nicht zu 100% verlässlich ist, insofern waren wir uns also einig. Und drei Dinge waren mir gleich zu Beginn unserer Liebschaft klar: 1. Björn war nicht einmal 50% verlässlich, 2. wenn Björn diese Rolle nicht übernehmen konnte, gab es für mich keine Kinder mehr, 3. dass ich es offenbar nicht schaffte, eine Beziehung zu einem verantwortungsvollen, verlässlichen Mann mit sicherem Einkommen aufzubauen.
Umso mehr stürzte ich mich in das Abenteuer Björn. Wir gingen an vielen Abenden aus, genossen Freiburg bei Tag und bei Nacht. Mal übernachtete ich bei ihm, mal er bei mir.
Irgendwann, nachdem wir uns etwa sechs Monate kannten, schimpfte er nicht das erste Mal über seine Situation in der WG. Obwohl er als einziger der WG-Bewohner früh aufstehen würde, müsse immer er putzen, die beiden anderen würden nur auf der faulen Haut liegen. Es sei so laut, so dreckig, es würde stinken, und so weiter. Eigentlich wollte ich noch nicht mit ihm zusammenziehen. Ich empfand meine kleine Wohnung als Nest und Rückzugsort, an dem ich sein konnte, wie ich wollte. Und ich hatte mir nach dem Auszug bei Karsten geschworen, dass ich so schnell nicht mehr mit jemandem zusammenziehen würde. Irgendwann aber, nachdem ich mir seine Beschwerden zum x-ten Mal anhören musste, in einem Augenblick, an dem ich ihn vielleicht auch heiterer stimmen wollte und ich mich ihm sehr zugewandt fühlte, bot ich ihm an, zu mir zu ziehen. Kaum war der Satz raus, bereute ich mein Angebot. Verflixt! Was hatte ich da nur gedacht? Und dann auch noch gesagt! Aber es war zu spät. Ich hatte das Gefühl, Björn hatte nur auf dieses Stichwort gewartet. Er stürzte sich richtiggehend auf meine Zusage und machte sofort Nägel mit Köpfen. Noch am selben Tag kontaktierte er seine Vermieterin, kündigte sein Zimmer in der WG und informierte seine WG-Kollegen. Ohhh, mir war gar nicht wohl bei dieser Sache, aber das Ganze rückgängig zu machen war keine Option mehr, dafür hatte sich Björn schon zu sehr ins Zeug gelegt. Ausserdem wollte ich ihn nicht enttäuschen und schon gar nicht verlieren. Nur wenige Wochen später (oder waren es nur ein paar Tage?) fuhr Björn mit Sack und Pack bei mir vor. Ab da wohnten wir zu zweit in meiner 1-Zimmer-Wohnung. Gut, die wenigste Zeit verbrachte ich zuhause, denn die Fortbildungen liefen die ganze Woche gemässigt, auch an den Wochenenden. Auch Björn war viel mit seinen Kurierfahrten unterwegs, sodass wir unser Nest in den wenigen gemeinsamen Momenten genossen. Was mir jedoch schon bald auffiel war, wie mühelos Björn über mein Geld verfügte. Kaum war etwas mehr auf meinem Konto, hatte er auch schon eine sehr gute Idee, welche Anschaffungen seiner Meinung nach getätigt werden müssten. Das Erste war ein Futon, ziemlich handgenäht und dadurch für meinen Geschmack auch ziemlich teuer von jemandem, zu dem er einen guten Draht hatte. Björn war wirklich sehr gut vernetzt. Durch seinen Kurierdienst verfügte Björn seit Anbeginn der Mobiltelefone über ein Handy. Er musste ja immer erreichbar sein, falls eine Apotheke notfallmässig etwas Dringendes benötigte. Schon 1995 lief er mir einem tragbaren Kasten mit Telefon herum. Zunächst mal in Schuhkartongrösse, welcher sich aber sehr schnell verkleinerte. Vielleicht ab 1996 / 97 hatte er schon das erste Handy, so wie man sie heute kennt. Björn telefonierte immer. Immer und überall hatte er das Ding am Ohr. Und alles war überaus wichtig. Er war nervös, hektisch, rauchte, was das Zeug hielt, jedoch mit dem Wissen, wie schädlich das für ihn war. Deshalb erklärte er mir auch immer, dass Cannabis eigentlich viel gesünder sei, denn darin wäre ja nur reiner Tabak. Cannabis war sein Beruhigungsmittel. Heute bin ich mir fasst sicher, dass er an einer Art von Hyperaktivität litt. Während unserer gemeinsamen Zeit versuchte er einmal sehr ernsthaft das Rauchen aufzugeben, was für mich fasst nicht auszuhalten war. Der Mann war so unerträglich nervös und schlecht gelaunt, dass ich ihn bat, doch wieder zu rauchen.
Aber zurück zum Thema Geld: er hatte nichts und benötigte viel. Diese Diskrepanz war sein Lebensthema, was er mit den verschiedensten Einfällen auszuloten versuchte. Zunächst einmal mit seinem Job. Er fand, dass die Kurierfahrten nicht viel einbrächten, deswegen suchte er einen höher dotierten Fahrerjob. Er hatte ja keine Ausbildung, aber Autofahren konnte er hervorragend. Eines Tages hatte er die Idee, LKW fahren wäre besser und bewarb sich bei einer grossen Spedition, die vorwiegend Sand und Kies an Baustellen lieferte. Ich war beeindruckt, denn ich hatte einen Heidenrespekt vor den grossen Tanklastern und Sattelschleppern und konnte ja noch nicht mal mehr einen PKW fahren. Trotz meinem Führerschein traute ich mich wegen fehlender Routine nicht mehr hinter ein Steuer. Björn bekam den Zuschlag und fuhr ab dann LKW. Zunächst war er sehr angetan, doch schon nach ein paar Wochen war er so gestresst, dass er permanent schimpfte und fluchte und sich wünschte, von der Strasse wegzukommen. Einmal hatte er sich in einem Wohngebiet so verfahren und in einer Sackgasse fest gefahren, dass er nicht mehr wenden konnte und über diese Situation fasst durchdrehte. Irgendwann, nach einem langen und mühsamen Wendemanöver gelang es ihm dann aber doch zu kehren. Auch der Termindruck und die Wintermonate machten ihm sehr zu schaffen. Nach einem knappen Jahr gab er das LKW fahren wieder auf und kehrte zu den Kurierfahrern zurück.
Bei mir lief es beruflich dafür immer besser. Es gab Zeiten, in denen ich mich über Monate an jedem Wochenende im Fortbildungszentrum aufhielt. Jedes Jahr fanden mehr Kurse statt, mit einer immer grösseren Anzahl von Teilnehmern. Für mich war das sehr erfüllend und ich bekam von allen Seiten die entsprechende Wertschätzung. Was sich in diesen Jahren leider ebenfalls massiv verstärke, waren meine Fressanfälle. Ein Wiederspruch in sich. Aber aus zwei Gründen war diese Entwicklung naheliegend: erstens hatte ich ständig die Gelegenheit zu fressen, bis ich fasst platzte, weil ich allein für die Organisation des Caterings sorgte. Niemand schaute darauf, was ich alles während des Tages in mich hinein stopfte. Die Teilnehmer sassen ja alle im Hörsaal und waren bis zur nächsten Pause versorgt. Und die paar Brezeln oder Portionen von Pasta, Risotto, Fleisch oder sonst was fiel gar nicht auf. Es wurde immer weit mehr angeliefert, als benötigt. Zweitens stand ich unter einem enormen Druck. Nicht die Kurse und die damit verbundenen langen Arbeitszeiten waren das Problem, sondern alles zusammen. Mein fehlendes Privatleben und mein bestehendes Privatleben. Nach den anstrengenden Tagen erwartete mich am Abend ein Mann, der seinen ganzen Tagesfrust auf mir ablud. Seine Erwartungen an mich waren entweder Sex, ausgehen, Kollegen einladen oder seine Tochter war da. Genau in dieser Reihenfolge. Oft wollte ich einfach nur die Türe hinter mir zu machen und meine Ruhe haben, aber das war so gut wie nie möglich. Teilweise erbrach ich drei bis viermal pro Tag, was mich natürlich noch zusätzlich schwächte. Trotzdem trug ich Björn sowohl finanziell als auch mental durch die Tage, Wochen, Monate. Er musste Alimente zahlen, benötige viel Geld fürs Kiffen, Rauchen, Handy, ausgehen und anderes, was mir nie so ganz klar war. Die Miete und Nebenkosten habe immer ich bezahlt. Ebenso die meisten gemeinsamen Rechnungen.
Nach etwa einem halben Jahr des Zusammenlebens in der 1-Zimmer-Wohnung bezogen wir eine, für unsere Verhältnisse zu kostspielige 3-Zimmer-Wohnung unweit der vorhergehenden Wohnung. Sie lag zwar unter dem Dach, trotzdem war sie geräumig, in einer guten Wohngegend mit einer großartigen Aussicht auf den Kaiserstuhl. Auch dazu liess ich mich überschwatzen. Mir war eigentlich von vornherein klar, dass diese Wohnung unser Budget sprengte, was wir jedoch nicht wahrhaben wollten. Sie wuchs uns schon nach wenigen Monaten über den Kopf und so begaben wir uns nach kurzer Zeit wieder auf die Suche nach einer günstigeren Unterkunft. So ganz dunkel erinnere ich mich auch, dass Björn sich mit dem Vermieter überwarf. Ich glaube, Björn warf unserem Vermieter Arroganz vor, weil er ihn nicht so wahrnahm, wie er es sich wünschte und damit kam Björn überhaupt nicht klar. Das war kein Einzelfall. Er fühlte sich oft übergangen, meinte, er wäre den anderen Menschen nicht gut genug. Björn behauptete immer, er sei eine Minute zu früh oder zu spät auf die Welt gekommen, weswegen er deutlich schlechtere Karten im Leben hätte als andere Menschen. Er erwartete ständig ein Entgegenkommen an die Menschen in seinem Umkreis. Sie müssten es für ihn richten, sie wären ihm etwas schuldig. Und genau das reflektierte er auch auf mich. Ich wurde zu seinem fehlenden Ich. Ich sollte mich ganz und gar ihm zuwenden und sonst niemand anderem, nicht einmal meiner Familie, was ich selbstverständlich tat. Leider hatte ich die eben beschriebene analytische Einsicht erst Jahre später. Zunächst lebten wir zusammen in guten und in schlechten Tagen. Unsere nächste gemeinsame Wohnung lag wunderschön in der Nähe eines Baggersees mit einem wunderbaren Naherholungsgebiet drumherum. Einige Jahre zuvor fand in diesem Teil von Freiburg die Landesgartenschau statt und seitdem war dies der Platz für laue Sommernächte mit Konzerten. Die Wohnung an sich war nichts Besonderes. Eine 3-Zimmer-Dach-Wohnung in einem typischen Mehrfamilien-Mietshaus aus den siebziger Jahren. Der Vermieter wohnte zwei Stockwerke unter uns und hatte ein Alkoholproblem, wie ich gleich beim Unterzeichnen des Mietvertrages feststellen konnte. Tatsächlich hatte ich da ein Déjà-vu. Trotzdem war ich zuversichtlich. Das war 1996, in dem Jahr, in dem wir heirateten.

Ja, irgendwie entschieden wir das gemeinsam ohne romantisches Drumherum. So nach dem Motto: «Was meinst Du, sollen wir heiraten? Ach ja, das könnten wir eigentlich! Haben wir ja noch nie gemacht und irgendwann wollte ich schon einmal heiraten.» Was für eine blöde Idee! Von allen Seiten wurde ich gewarnt. Als ich meine Freundinnen informierte, meine Familie, meine Arbeitskolleginnen und Kollegen. Sogar von einem Zahnarzt wurde ich gefragt, ob ich denn schwanger sei. Komisch, gell? Meine beste Freundin und meine Mutter misstrauten dem Ganzen und fragten mich besorgt, ob ich mir das auch gut überlegt hätte. Das wäre ein Mann fürs Bett aber doch nicht zum Heiraten. Von meiner Schwester bekam ich zur Hochzeit einen Ehevertrag geschenkt, was für mich das Fragwürdigste aller Geschenke war. Je mehr die Leute intervenierten, desto trotziger beharrte ich auf meiner Entscheidung. Später erfuhr ich, dass alle wetteten, wie lange die Ehe wohl halten würde. Ich glaube, in jener Zeit habe ich meine nie ausgelebte Pubertät nachgeholt. Ich wollte jetzt einfach heiraten. Punkt! Unser Hochzeitsfest war mehr als bezeichnend für unsere weiteren gemeinsamen Jahre.
Die standesamtliche Trauung war im schönen und ehrwürdigen alten Rathaus in der Freiburger Innenstadt und unsere Hochzeitsgäste, die paar wenigen, fanden alle darin Platz, im rotsamtenen Hochzeitszimmer. Meine engste Familie, ein Bruder von Björn und eine Freundin mit ihrem kleinen Sohn und meine beste Freundin. Sie und der Bruder waren die Trauzeugen. Mehr Gäste gab es nicht und kamen nicht. Dieser Teil der Hochzeit war sogar noch etwas festlich.
Ganz kurz muss ich noch etwas einschieben: um meinen Trauring bezahlen zu können, habe ich das einzige Schmuckstück versetzt, dass ich jemals von meinem Vater geschenkt bekommen habe. Seinen eigenen, mit einem blauen Aquamarin umgestalteten Trauring. Einen Tag nach dem Verkauf an den Juwelier bedauerte ich diesen Entscheid und wollte ihn zurück kaufen, aber leider war er da schon im Schmelzofen. Das war (neben der Idee Björn zu heiraten) eine der dümmsten Ideen meines Lebens, was ich hinterher noch lange bereut habe. Mein Hochzeitskleid, sehr kurz mit einer grossen Schleife auf dem freien Rückenteil, bekam ich von meiner Mutter zur Hochzeit geschenkt. Dazu trug ich einen Hut mit langen Bändern und wunderschönen aber viel zu kleinen italienische Pumps. Es gab sie nur noch eine Nummer kleiner, als ich benötigte, dafür bekam ich sie um 50% ermässigt im Ausverkauf.
Zurück zur Hochzeit! Nach dem Standesamt luden wir die Gesellschaft zum Mittagessen in ein bescheidenes Restaurant, zu Braten, Spätzle und Gemüseplatte ein. Total bünzlig, aber billig. Das Restaurant lag nicht weit entfernt von unserer Wohnung und wir konnten problemlos durch den Park dorthin spazieren. Erst im Restaurant steckten wir unsere Ringe an. Auf dem Standesamt ging das irgendwie vergessen. Björn hatte sich einen protzigen, dicken Goldring gekauft, der zu meinem feinen mit einem Brilliant-Splitter besetzten Ring kaum passte. Aber ihm gefiel er und so war das für mich in Ordnung. Überhaupt haben wir, abgesehen vom traditionellen Restaurantbesuch, alle Konventionen über Bord geschmissen. Nach dem Mittagessen spazierten wir zurück zu unserer Wohnung, wo ich schon am frühen Morgen Kaffee und Kuchen vorbereitet hatte. In der Hoffnung, dass die Familie jetzt doch mal bald wieder abreisen könne, wickelten wir noch ganz schnell unsere Geschenke aus. Den Ehevertrag hat meine Schwester sicher ziemlich Geld gekostet, war aber völlig unnötig. Denn wir waren ja beide arm wie Kirchenmäuse, die Kinderfrage war vom Tisch und einen allfälligen Unterhalt im Falle einer Scheidung kam sowieso nicht in Frage, weil wir beide nicht genug verdienten. Aber für alle Fälle war das schon in Ordnung, das war eben typisch für mein Schwester. Sie lebte nach dem Motto: nur Pragmatismus bringt einen weiter, die Romantik hat im Leben nichts verloren. Nachdem die Gäste abgereist waren und nur noch der harte Kern (der Bruder von Björn und die beiden Freundinnenfrauen) übrig waren, ging die Party richtig los. Zunächst gingen wir in eine Schwulenbar, die derzeit angesagteste Adresse gemäss Björn. Dort sassen die «wichtigen» Leute, die ihm Kontakte zu allfälligen zukünftigen Arbeitsgeber herstellen konnten. Nach einem Anstosssekt und noch einem und noch einem, der Sekt floss nur so in Strömen, war unsere nächste Station eine Disco. Ich war natürlich im Brautkleid unterwegs und genoss die entsprechende Aufmerksamkeit. Dort liessen wir es richtig krachen. Einen Drink nach dem anderen, einen Tanz nach dem anderen – natürlich mit anderen Männern, denn Björn tanzte nicht. Mit einer Braut zu tanzen bringt offenbar für alle ausser dem Bräutigam Glück. Der Hochzeitstag war gerade herum, als mir Björn die erste Eifersuchtsszene hinlegte. Er schimpfte, tobte, zog mich am Kleid und forderte mich auf, jetzt mit ihm nach Hause zu gehen. Die Leute amüsierten sich, aber mir war die Situation trotz reichlich Alkohol oberpeinlich. Ich fühlte mich erdrückt und bereute noch in derselben Nacht, diesen Mann geheiratet zu haben. Ich hatte es ja besser gewusst. Trotz diesem unguten Ausgang des angeblichen schönsten Tages einer Frau waren wir immerhin vier Jahre verheiratet. Vier Jahre, die mich so ziemlich alles kosteten.
In erster Linie erdrückte mich seine latent depressive Stimmung. Er war so zweifelnd, unzufrieden, unglücklich über seine berufliche Situation, die zu verändern er nicht in der Lage war. Er sinnierte über eine Ausbildung zum Kinderkrankenpfleger oder Kindergärtner und ich redete ihm in all seinen Plänen mutig zu, es doch einfach zu versuchen. Nein, er müsse Geld verdienen wegen der Alimente für seine Tochter, könne nicht einfach so in den Tag hinein leben. Dann versuchte er sich in der Schwulenbar als Aushilfe, was ihm jedoch vor allem durchlebte Nächte und diverse Einladungen der Kundschaft einbrachte. Björn begann sich zu verändern…nein, besser beschrieben ist es mit: es kam eine alte Seite an ihm wieder neu hervor. Seine Zugewandtheit zu Männern. Er bekam eindeutige Avancen, denen er nicht unbedingt abgeneigt war. Eines Tages erklärte er mir, dass er mit dem Chef der Schwulenbar – nennen wir ihn mal Marco – einen Trip nach New York unternehmen würde. Marco hätte ihn eingeladen, damit er etwas aufgeheitert würde und für ihn wäre das eine einmalige Chance New York zu sehen. Mir war klar, dass Marco nur einen Grund haben konnte, Björn mitzunehmen: er wollte mit ihm ins Bett. Ich wundere mich heute noch über mich selbst, wie egal mir das war. Ich spürte keine Eifersucht, war einfach nur froh, ein paar Tage kein Jammern und Klagen zu hören. Ich kannte keine grossen Gefühlsneigungen. Keine Freude, keine Eifersucht, keinen emotionalen Schmerz oder gar Wut oder Enttäuschung. In mir war alles pelzig, wie in Watte gehüllt. Das war, wie ich heute weiss, der Essstörung und der permanenten Unzufriedenheit meines Lebenspartners geschuldet. Ich frass und erbrach täglich mehrfach, meine Aggressionen richtete ich gegen mich selbst. All meine Gefühle wurden damit betäubt. Ich spürte mich selbst nicht mehr. So konnte es Björn auch schaffen, mit meiner Unterstützung, eine Annonce als Callboy zu schalten. Als er mir damals seine Idee unterbreitete, war ich erstmal entsetzt. Was denke er sich eigentlich, was er mit mir machen können. Als er mir jedoch ausführlich erklärte, dass das so ziemlich das Einzige sei, was er tun könne, um seine finanzielle Situation zu verbessern und er mit dieser Tätigkeit die Chance hätte, weg vom Kurierfahren zu kommen und er ja keine Affäre plane und die Frauen auch nicht küssen würde, willigte ich um des Frieden willens ein. Auf seine Bitte hin formulierte ich den Text für das Inserat. Was für eine Demütigung! Leider wurde mir das erst im Nachhinein klar. Ende der Neunziger Jahre waren Dating Plattformen noch nicht (zumindest nicht bei solchen IT-Amateuren, wie wir das waren) verbreitet, deswegen lief alles noch über Zeitungen. In Freiburg gab es eine kostenlose Zeitung für Kleinanzeigen, die zweimal wöchentlich erschien und extrem erfolgreich war. Alles war darin zu finden: Jobsuche, Wohnungssuche, Verkauf aller Art, Mitteilungen, Sexseiten, Tiere, Autos einfach alles. Darin platzierte Björn sein Inserat. Noch am Erscheinungstag kamen die ersten Anrufe. Männer, die sich Frauen anboten für erotische Abenteuer jedwelcher Art war ja geradezu ein Novum. Die Ernüchterung kam jedoch schneller, als vermutet. Wenn er dachte, es würden sich reiche, schöne und sexuell offene Frauen melden, dann hatte er sich schwer getäuscht. Es meldeten sich in erster Linie ältere Frauen über sechzig, die aus irgendwelchen Gründen Probleme hatten, wieder einen Partner zu finden. Ausserdem hatte Björn plötzlich Angst, sich eine Krankheit einzufangen und vor seiner eigenen Courage. Ich glaube, er hat keine einzige Frau wirklich getroffen. Nach diversen Telefonaten verliess ihn der Mut. Wie dem auch sei, von da an wusste ich, dass Björn grundsätzlich einem Abenteuer mit anderen Frauen oder Männern nicht abgeneigt war. Zumindest dann, wenn ich nicht so mitspielte, wie er es sich wünschte. Und er wünschte sich oft und öfter, dass ich ihm zur Verfügung stand. Er war wirklich ein grossartiger Verführer und schaffte es immer wieder, mir ein schlechtes Gewissen einzureden, sodass ich mich auf seine permanente Avancen einliess und mitmachte, auch wenn ich keine Lust hatte.

1998 war im Fortbildungsforum eine Kursreihe geplant, zum Thema Parodontologie, der Diagnose und Therapie des Zahnhalteapparates. Er sollte an vier Wochenenden, Freitag bis Sonntag über das Jahr verteilt stattfinden. Von der Theorie bis zur Praxis unter der Leitung des damaligen «Gurus der Parodontologie», einem US-Amerikaner, dessen Namen ich hier nicht nenne. Ich meinte, es ging damals konkret um die «Vorbereitung des Parodonts zur Aufnahme von Implantaten». Der Kurs war recht kostspielig und sehr schnell voll besetzt. Während der ersten beiden Wochenenden wurde die Theorie mit Hilfe von Dias, Röntgenbildern und Videofilmen vermittelt, am dritten Wochenende wurde ein Praxisteil mit Schweinekiefern durchgeführt und am vierten und letzten kam das Finale der Kursreihe, die Live-OPs am Menschen, die mit Hilfe einer Kamera in den Hörsaal übertragen wurden. Die Patienten waren echte Patienten der teilnehmenden Zahnärzte. Der Professor aus den USA sprach aus Überzeugung nur englisch, obwohl er viele Monate im Jahr durch die Welt, vor allem aber durch Deutschland tourte und Vorträge in diversen Universitäten und zahnärztlichen Einrichtungen hielt. Er ging davon aus, dass jeder und jede fliessend Englisch konnte und dies natürlich auch im fachlichen Bereich. Er wurde von seiner Ehefrau begleitet, die während der Kurse als seine Sekretärin fungierte und ständig in Verbindung mit seinen nächsten Destinationen stand. Um Kosten zu sparen, benutzte sie dafür, ohne mit der Wimper zu zucken mein tragbares Diensttelefon, bis der Akku komplett entladen und dadurch keine Verbindung nach aussen oder innen mehr möglich war. Das war etwa ab dem frühen Nachmittag der Fall. Über Nacht konnte es zwar wieder geladen werden aber die Akkus waren damals einfach noch nicht so effizient wie heute. Eigentlich war diese Situation untragbar, denn dadurch konnte im Notfall (z.B. technisches Versagen oder Kollaps eines Patienten) niemand erreicht werden. Mein Diensttelefon war meine einzige Verbindung zu Kollegen oder meinem Chef. Handys waren noch nicht selbstverständlich. Ich mühte mich nach bestem Wissen und Gewissen während dieser Wochenenden auf Englisch Konversation zu betreiben und des Gurus Bedürfnisse zu befriedigen. Er war nicht einfach. Sobald etwas nicht nach seinem Gusto funktionierte, begann er loszuschreien.
Natürlich gab es seiner Meinung nach (und damit hatte er nicht ganz unrecht) viele Unzulänglichkeiten, das Fortbildungsforum waren im Grunde ja erstmal nur ein Provisorium. Es fing schon mit dem Projizieren der Röntgenbilder an. Unser Tageslichtprojektor war dafür zu schwach und unsere Kamera taugte nicht für solche Übertragungen. Auch wollte er nicht in einem dunklen Schulungsraum sitzen. Also sollte ich die Bilder an die Fenster kleben und er richtete die Kamera darauf. Das war aber auch nicht optimal und so brüllte er mich in seinem amerikanischen Slang an, was denn das für ein inkompetentes und besch… Institut wäre, so könne man doch keine Kurse durchführen. Ich war den Tränen nahe und sagte ihm, er solle nicht so herumschreien, ansonsten ginge ich nach Hause und er können seinen Kurs allein weiter machen. Er vergriff sich dauernd im Ton, sodass die Teilnehmer einschreiten mussten. Nach jedem dieser Tage war ich fix und fertig.
Als dann endlich der vierte und letzte Teil mit den Live-OPs stattfand, bemühte ich mich im Vorfeld um Unterstützung. Die Assistenz während der Behandlungen konnte ich nicht auch noch übernehmen und so kam eine liebe und sehr erfahrene Kollegin aus der Zahnklinik, die bei den Operationen assistierte. Es wurde an vier Einheiten parallel operiert und der Professor überwachte die ganz Sache und kommentierte das Geschehene für die Kollegen im Hörsaal, die nicht operierten. Einer der Teilnehmer hielt die Kamera, da die Zahnärzte besser einschätzen konnten, was jetzt gerade interessant genug war. Ich war im Sekretariat und der Küche tätig. Im Laufe dieses Wochenendes kam die Kollegin einmal ganz entsetzt zu mir und berichtete, dass der Professor ein ziemliches «Hygieneschwein» wäre. Ich hakte nach, was sie mit «Hygieneschwein» meine und sie berichtete, dass der Professor mit denselben Handschuhen von einem Mund zum anderen ginge. Meine Kollegin war in der Zahnklinik die Hygienebeauftrage und arbeitete ebenfalls in der Parodontologie. «Sowas habe ich noch nie gesehen. Das macht nicht einmal ein Anfängerassistent. Das verstösst gegen die grundsätzlichsten Hygieneregeln». Nun ja, er war eben der «Chef-Parodontologe» und durfte sich alles erlauben. Am Sonntagabend und dem Ende des Kurses, nach sehr anstrengenden und nervenaufreibenden drei Tagen, als alles fertig und aufgeräumt war, kam ich möglicherweise aufgrund des überbordenten Adrenalins in meinem Körper in einen ganz merkwürdigen Zustand. Jedenfalls konnte ich mich nicht mehr erinnern, wie ich plötzlich auf die Strasse kam. Ich sass da auf dem Randstein und hatte einen totalen Aussetzer. Ich wusste noch, dass ich den Professor und seine Frau verabschiedet hatte, die Küche aufräumte und meiner Kollegin aus der Zahnklinik für ihren Einsatz dankte, aber ab da war Sendepause. Erst als mich Björn ansprach, was ich denn hier mache, kam ich wieder zu mir. Er kam, um mich abzuholen. Zitternd und mit höllischen Kopfschmerzen stieg ich ins Auto und wir fuhren heim.
Am nächsten Tag, dem Montag, begann ein Prophylaxe Kurs für die Zahnarzthelferinnen und ich musste wieder früh aufstehen, was mir ungeheuer schwer fiel, denn ich hatte eine schwere Erkältung. Ich schleppte mich ins Fortbildungszentrum, freute mich eigentlich auch sehr auf die Referenten, die ich ja schon sehr gut kannte und mochte. Diese Fortbildung wurde sechsmal im Jahr durchgeführt und für mich war das jedes Mal wie ein Familientreffen, wenn ich die Referenten wieder begrüssen durfte. Im Laufe des Vormittags hatte ich plötzlich Probleme mit meinen Ohren. Alle Töne und Stimmen kamen nur noch wie durch Watte bei mir an. Ich kam mir vor, wie in einem Vakuum. Als wäre ein Zelt um mich herum. Zunächst war ich überzeugt, dass dies der Erkältung geschuldet war, aber nachdem ich immer tauber wurde, bereitete sich in mir doch eine gewisse Nervosität aus und ich entschied, etwas zu unternehmen. Ich informierte meinen Chef, bat die Referentin für zwei / drei Stunden auch die Aufsicht zu übernehmen und stellte mich nachmittags einem Ohrenarzt in der Stadt vor, der mir nach meiner telefonischen Beschreibung der Fakten sofort einen Termin gab. Es wurde ein Audiotest gemacht, der jedoch nur eine gerade Nulllinie anzeigte. Ich hörte einfach nix. Der Ohrenarzt schaute mich ganz betroffen an, telefonierte kurz und erklärte mir, dass ich noch heute und sofort in die HNO-Klinik müsste. Er hätte schon ein Bett bestellt, wegen des Verdachts auf beidseitigem Ohrinfarkt, auch Hörsturz genannt. Darunter konnte ich mir jetzt gar nix vorstellen, es tat ja auch nichts weh. Während ich zuhause ein paar Sachen für den Aufenthalt im Spital zusammen packte, lief plötzlich aus meinem linken Ohr ein Flüssigkeit heraus. Im Laufe der nächsten Minuten wurde mir so massiv schwindelig und schlecht, dass ich dachte, ich müsste mich noch in der Strassenbahn übergeben. In der HNO, im Notfall angekommen, musste ich extrem lange warten, bis ich endlich in die Sprechstunde konnte. Dort wurden nochmals diverse Tests gemacht, die meine Welt im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf stellen. Mir war so elend zumute, dass ich befürchtete, auf deren Schuhe zu erbrechen. Danach kam ich auf die Station und wurde am nächsten Tag operiert. Der Arzt erklärte mir später an der Visite, dass ich links ein Loch im «runden Fenster» gehabt hätte und sie deswegen eine kreislaufanregende Infusion starten würden. Ich hätte auf beiden Ohren einen Hörsturz erlitten und wenn nicht in den nächsten zwei Wochen das Gehör wieder normal würde, bestehe die Gefahr, für alle Zukunft schwerhörig oder gar taub zu bleiben. Ich war relativ gelassen. Ich hörte den Arzt ja noch.
Aber so blieb es nicht. Links wurde ich tatsächlich vollkommen taub mit einem latenten Rauschen, rechts kam mein Gehör wieder zurück. Das war grosses Glück im Unglück. Aber ich fühlte mich sehr unsicher und verwirrt, denn ab dann konnte ich kaum noch laute Musik oder gar das Schreien von Menschen ertragen. Auch die Richtung eines Geräusches kann ich seitdem nicht mehr orten, was sich besonders im Strassenverkehr als sehr verwirrend herausstellte. Zwei Wochen nach diesem «Vorfall» ging ich wieder arbeiten. Eines änderte sich ab dann: ich bekam eine Kollegin, die vorher schon in der Datenerfassung gearbeitet hatte und ab und zu für mich die unzähligen Skripte und Arbeitsblätter für die Kursteilnehmer vorzubereiten half.

Während der zwei Wochen im Spital, zog Björn in unsere neue Wohnung. Nachdem der Vermieter der Wohnung im Park mich in alkoholisiertem Zustand mehrmals aggressiv und anzüglich belästigt hatte, wollte ich nicht mehr dort wohnen. Ich fürchtete mich vor ihm und davor, ihm nachts zu begegnen. Zuviel schlechte Erfahrungen hatte ich in dieser Beziehung schon gemacht. Über eine gute Bekannte bekamen wir den Tipp für eine freie Wohnung in St. Georgen, einem der schönsten Stadtteile von Freiburg. St. Georgen ist ein Weindorf im Süden Freiburgs. Schon immer wollte ich am liebsten dort leben. Die Wohnung hatte Vor- und Nachteile, wobei ich nur die Vorteile sah und Björn nur die Nachteile. Haha, ja, wir waren ein gutes Team! Die Wohnung lag direkt am Güterbahngleis und hatte Schimmelecken. Sie war sehr günstig und von dort aus konnte man wunderbare Spaziergänge in die Weinberge unternehmen. Ich mochte sie, Björn nicht. Mit Murren und Knurren hatte er während meines Spitalaufenthaltes die Wände neu gestrichen und einen Teppichboden verlegen lassen. Ins Krankenhaus kam er ein- oder zweimal zu Besuch, er mochte den Geruch nicht. Als ich wieder zuhause war, war einer seiner ersten Sätze: «Fasst hätte ich es nicht mehr ausgehalten und wäre zu einer Nutte.» Was für ein Schei…kerl! Ich war enttäuscht, aber nicht wirklich überrascht über diese Aussage. Er machte sich um seinen Sex Sorgen, während ich auf einem Ohr mein Gehör verloren hatte.
So reite sich Enttäuschung an Enttäuschung und mehr und mehr überwog bei mir die Frustration über unsere Art der Beziehung. Was war ich für ihn? Eine gleichwertige Partnerin sicher nicht. Ich war für ihn die Wirtin, an der er sich für alle Lebenslagen wie eine Bazille festsaugen konnte. Den Höhepunkt erreichte unsere kranke Ehe am 60-ten Geburtstag meines Vaters in Aalen. Wir waren beide eingeladen und die ganze väterliche Verwandtschaft, die ich seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hatte, war angereist und ich freute mich sehr, von ihnen und ihrem Leben zu erfahren. Björn jedoch war eifersüchtig und warf mir vor, mich nicht ausreichend um ihn zu kümmern, weshalb er sich zornig, bockig und frustriert, wie ein kleines Kind, das sein Spielzeug nicht bekam, ohne Vorwarnung ins Auto setzte und nach Hause fuhr. Ich war total konsterniert! War Björn wirklich noch gesund? Da stand ich nun und wusste nicht, wie ich am nächsten Tag heimkommen sollte. Vor allem wusste ich nicht, wie ich mich nach dieser Geschichte ihm gegenüber verhalten sollte. Über eines war ich mir jedoch im Klaren: lange wollte und konnte ich das nicht mehr mitmachen.
Mit Karsten, meinem Ex-Freund, der ebenfalls von meinem Vater eingeladen wurde, durfte ich dann nach Freiburg zurück fahren. Sicherlich empfand er über mein "Missgeschick" eine gewisse Genugtuung.
In diesem Jahr, an Silvester, eskalierte nochmals eine Auseinandersetzung. Schon Tage zuvor hatte ich Björn immer wieder gefragt, ob wie Freunde zum Jahreswechsel einladen wollen oder lieber in der Stadt feiern. «Hmm, weiss nicht…» bekam ich dann zur Antwort. Nachdem ich nichts Genaues wusste beschloss ich, für uns beide einen schönen Abend vorzubereiten mit Käse- Fisch und Wurstplatte und einem feinen Wein. Ich stellte mir vor, dass wir einfach einen schönen Abend zu zweit verbringen und um Mitternacht miteinander anstossen würden. Von Björn, der noch unterwegs war und erst am Spätnachmittag nach Hause kam, hatte ich nichts Gegenteiliges gehört. Während ich in der Küche vor mich hin werkelte, nahm Björn ein Bad, rasierte sich, bügelte sein weisses Hemd… und? Er bügelt sein weisses Hemd? Ich stutzte, liess ihn aber machen. Inzwischen deckte ich den Tisch und schaltete schöne Musik ein, als Björn seinen Kopf zum Wohnzimmer herein steckte und mir allen Ernstes mitteilte: «Also Tschüss! Ich habe mich mit Nikki (einem seiner kiffenden Freunde) verabredet.» Ich glaubte, ich hörte nicht recht und fragte Ihn, ob er das ernst meine. Als er bejahte, explodierte etwas in mir. Ich schrie ihn an, ob er eigentlich noch normal sei, nahm das Tischtuch unter dem komplett gedeckten Tisch mit Käse- und Fischplatten an allen vier Ecken, warf alles in die Küche, nahm meinen Schlüssel und den Mantel von der Garderobe und stürmte in die Nacht hinaus. Ich wusste nicht, wohin ich sollte und lief ziellos und heulend etliche Stunden mitten in der Nacht in St. Georgen herum. Bis ich mich wieder beruhigt hatte war es kurz vor Mitternacht. In diesen Stunden beschloss ich endgültig die Trennung von Björn. Es sollte trotzdem noch über ein Jahr dauern, bis ich diesen Schritt auch wirklich ging. In den darauffolgenden Monaten sahen und sprachen wir uns kaum. Jeder kam und ging, wie es ihm passte, wir unternahmen kaum noch etwas zusammen, Sprachlosigkeit herrschte vor. Ich kochte nur noch für mich selbst, weil ich nie damit rechnen konnte, ob Björn da war oder nicht. Manchmal blieb er auch über Nacht weg und mir war klar, dass er bei einer gemeinsamen Freundin übernachtete. Dass er auch mit ihr schlief, war für mich keine Überraschung. 1999 war das Jahr der Konsolidierung. Ich entschied nichts, wusste jedoch, dass mein Leben eine grundsätzliche Veränderung benötigte, für die ich aber noch keinen Mut hatte. So blubberte ich vor mich hin, arbeitete viel, frönte meiner Essstörung und lies die Dinge laufen. Gut ging es mir dabei ganz und gar nicht.

Dann kam die Jahrtausendwende. Im April 2000 beschlossen meine Mutter und ich, Christine, meine kleine Schwester in Malaysia zu besuchen. Habe ich das schon erwähnt? Irgendwann in der Zeit zwischen 1995 und 1998 wanderten meine Schwester und ihre Familie nach Malaysia aus. Mein Schwager arbeitete für eine deutsch – französische Firma, die Verpackungsmaterial herstellte und vertrieb und international tätig war. Philippe war CEO im Asiatischen Aussendienst, von daher meistens in Singapur oder sonst wo in Fernost. Eines Tages, die Kinder waren noch im Kindergartenalter aber der Schuleintritt war absehbar, beschloss meine Schwester, Philippe nicht mehr allein in die Ferne ziehen zu lassen. Sie packte kurzerhand Kinder und Kegel (naja, ein bisschen Vorbereitungszeit benötigte es schon, immerhin musste sie ihre Nachhilfeschule verkaufen) und die ganze Familie verliess das Elsass und liess sich Kuala Lumpur, der Hauptstadt von Malaysia nieder. In den ersten Jahren reisten sie noch sicher einmal jährlich auf Familienbesuche nach Europa. Mit zunehmenden Jahren und auch Schuljahren der Kinder war das nicht mehr so selbstverständlich. Jedes Jahr wurde gerätselt, ob sie denn nun zu Weihnachten oder in den Sommerferien kämen, respektive «kommen sie dieses Jahr überhaupt?».
1999 wurde meine Mutter pensioniert und feierte im Sommer ein «Freiheitsfest». Anlässlich dieses Festes, an dem auch meine Schwester teilnahm wurde entschieden, meine Mutter, ich und eine Bekannte meiner Mutter reisen zu Christine nach Malaysia. Und diese Reise sollte 2000 im April stattfinden. Jede von uns drei Frauen hatte ihre eigenen Gründe dorthin zu reisen. Meine Mutter feierte ihre Pensionierung und wollte unbedingt zu ihrer Tochter, die Freundin meiner Mutter war frisch verliebt mit Anfang 60, was sie sehr verunsicherte und ich gab mir diese Auszeit als Bedenkzeit, um über meine Ehe zu entscheiden. Im normalen Alltag war das kaum möglich, da ich dann meine ganze Energie für Alltägliches benötigte. Zur Ruhe kommen, meinen Gedanken nachhängen, mich nicht mit den Belangen meines Jobs und Ehemannes beschäftigen zu müssen, das war nur in den frühen Morgenstunden oder kurz vor dem Einschlafen möglich. Wird er mir fehlen? Und wenn ja, aus welchen Gründen? Was liebe ich an ihm? Was ich an ihm ablehnte, wusste ich genau. Aber was war noch geblieben von meiner anfänglichen Leidenschaft nach so vielen Frustrationen und Enttäuschungen?
Wir drei Frauen verlebten sehr emotionale drei Wochen, wobei Mutters Freundin nach zwei Wochen schon wieder abreiste. Wegen akutem «Vermissen und Liebesschmerz». Wir waren froh darüber, denn dadurch litt sie unter latent schlechter Laune. Somit bekamen unsere Mutter und wir zwei Töchter die Chance, einmal unter uns zu sein. Wir haben viel geredet, gelacht, gingen abends essen und sind beieinander gesessen. Vielleicht war es meiner Schwester aber dann doch zu viel, denn seitdem hat sie uns nie wieder eingeladen. Wohl sicher auch, weil auch ihr Leben eine ganz neue Wendung genommen hatte. Sie fand bald danach einen Job als Lehrerin in einer Internationalen Schule. Ich für mich habe in diesen drei Wochen viele Gedanken gewälzt und dann entschieden. Ich wollte wieder frei sein. Ich möchte keinen Menschen mehr um mich haben, der mir vor allem schlecht tut. Ich vermisste Björn, wusste aber auch, dass ich handeln musste, und zwar nur für mich. Ich hatte nicht die Kraft, ihn noch weitere Jahre mental auf meinen Schultern tragen.
Wieder zuhause gab es zunächst ein ganz anderes Thema, das das Trennungsthema für den Moment in den Hintergrund schob: unsere Katze. Innerhalb einem halben Jahr sind beide Katzen überfahren worden. Die Zweite nun in der Zeit meiner Abwesenheit, und zwar vor unserer Haustüre. Björn hatte sie bereits beerdigt und alles, was an die Katzen erinnerte beseitigt. Wir hatten die zwei Kätzchen als Welpen zusammen von einem Bauern geholt, sie waren Schwestern und waren in ihrem Charakter ganz unterschiedlich, aber beide waren sehr lieb und schmuselig. «Julie» und «Minou». Obwohl wir in der Zone 30 wohnten, in einem Wohngebiet, waren sie ständig gefährdet, weil die Leute einfach nicht schauten. Schon der Tod von «Minou» hatte mich sehr mitgenommen, sie war noch so jung. Aber als dann auch die Schwester starb, war ich untröstlich. Ich schwor mir, nie mehr Katzen anzuschaffen.
Meinen Wunsch nach Trennung thematisierte ich erst ein paar Wochen später. Björn fiel aus allen Wolken und nannte mich «frigide» und «krank» und noch vieles mehr, was ich sehr schnell wieder vergass. Natürlich war er verletzt und enttäuscht und alles, was ich mit ihm erlebt hatte, spielte keine Rolle mehr. Er war das Opfer. Das war er in seinen Augen ja immer und deswegen durfte er sich auch alles erlauben. So zog er bereits zwei Tage später aus unserer Wohnung aus und bei der langjährigen Freundin ein. Drei Monate später erfuhr ich von ihrer Schwangerschaft, aber das interessierte mich auch nicht mehr.
Ein Jahr später wurden wir innerhalb von zehn Minuten geschieden. Der Ehevertrag wurde, wie erwartet, nicht benötigt. Allerdings flogen mir unsere gemeinsamen Jahre 2003 nochmals um die Ohren. Björn hatte während unserer Ehe das Finanzamt mit Hilfe eines schwulen Freundes, der beim Finanzamt tätig war, aufgrund falscher Angaben zur Steuererklärung betrogen. So erschlich sich Björn Steuerrückzahlungen, die ihm nicht zustanden und die er für einen neuen Fernseher und anderes ausgab. Diese Betrügerei und noch einige andere des Finanzamt-Freundes flogen jedoch irgendwann auf. Der Freund musste ins Gefängnis und alle seine Kunden, die auf betrügerische Weise Geld vom Steueramt ergaunert hatten, mussten dieses und zusätzlich eine Busse zurück bezahlen. So auch Björn. Geschickter weise hatte Björn jedoch Wochen vorher einen Offenbarungseid abgelegt, wodurch er sich einer Nachzahlung entzog. «Einem nackten Mann kannst Du nicht in die Taschen fassen». So gelangten sie an mich, seine Ex-Ehefrau, die ihrer Ansicht nach auch von dem Geld profitierte. Zum Zeitpunkt des Deliktes waren wir leider noch verheiratet. Mit einem Schritt schon in der Schweiz musste ich im Nachhinein alles zurück zahlen. Tausende Euro, meine ersten 6-8 Gehälter, die ich in der Schweiz verdiente. Da war ich echt bedient und sehr, sehr schlecht auf Björn zu sprechen. Irgendwann einmal habe ich ihn telefonisch gebeten, er möchte mir doch einen Teil der Schulden zurück bezahlen, worauf er mir 20 Euro überwies. Nach diesem «Zugeständnis» habe ich ihn definitiv aus meinem Leben gestrichen.
Es ist noch gar nicht so lange her, dass er sich bei meiner Mutter wieder einmal gemeldet hat. 2018 oder so. Er hinterliess seine Telefonnummer mit der Bitte, ich möchte mich doch einmal bei ihm melden. Das tat ich auch mit dem Gedanken, «wie es ihm wohl geht?» und «hat er wohl endlich eine Ausbildung gemacht?». Nein, nichts von alledem. Er erzählte von einer weiteren Ehe und Scheidung mit einer Frau im Allgäu, der er viel Geld schulden würde und er jetzt wieder in Freiburg lebe und bei der SBB als Kaffeewägeli-Verkäufer anfangen wolle. Ob ich ihm da eine Adresse hätte? Nein, es hatte sich gar nichts verändert und Björn sich auch kein Stückchen weiter entwickelt. Er sucht einfach immer wieder den nächsten Wirt.

Nach dem Auszug von Björn fühlte ich mich komisch in der Wohnung. Sie lag im Parterre und ständig hatte ich das Gefühl, beobachtet zu werden. Mehr als einmal dachte ich, ich hätte ein Gesicht am Fenster gesehen. Deswegen beschloss ich irgendwann, eine neue Wohnung zu suchen. Ich wollte die ganze Geschichte hinter mir lassen, wollte wieder ein Nest unter dem Dach. Ich hatte grosses Glück und auch den Willen und die Geduld. Nur ein paar Strassen weiter war eine Wohnung frei, die alles bot, was ich mir wünschte. Ich weiss nicht mehr, wie ich sie fand aber als ich sie besichtigte war ich überwältigt. Zwei Zimmer, unter dem Dach mit Dachterrasse, Zugang vom Wohn- und Schlafzimmer, ein Badezimmer mit Fenster, eine kleine Küche, in die der Besitzer noch neue Geräte einstellen wollte, und vor allem war sie für mich bezahlbar. Niemand wollte gerne unters Dach ziehen wegen Treppen und Hitze im Sommer uns so weiter. Ich aber schon. Ich hatte einen wunderschönen Ausblick auf die Weinberge St. Georgen’ s und über die Dächer der umliegenden Strassen.
Nur der Vermieter war ein etwas schräger Vogel. Ich hatte damals den Eindruck, er interessiere sich nicht nur als Vermieter für mich, sondern machte sich auch private Hoffnungen. Ich verhielt mich ihm gegenüber freundlich, blieb jedoch ganz klar in meinen Aussagen und meinem Verhalten. Damit ja keine Missverständnisse aufkamen. Zum Glück wohnte er nicht im selben Haus. Ich war der glücklichste Mensch, als ich den Zuschlag bekam. Mein Reich!! Bis heute war diese Wohnung die schönste, friedlichste und «wohlfühligste» von all meinen Mietwohnungen. Aber auch dort habe ich gefressen und erbrochen. Leider. Daran hatte sich nichts geändert. Immer noch und manchmal auch ganz schlimm, kämpfte ich mit der Bulimie.
In dieser Zeit fing ich mit dem Joggen an. Birgit, eine Freundin aus dem vorigen Haus, die das ganze Ehe-Elend mit Björn miterlebt hatte, nahm mich eines Tages mit auf ihre Jogging-Tour durch den Freiburger Wald. Zuerst wollte ich gar nicht so richtig. Ich rauchte und hatte überhaupt keine Ausdauer. Nicht mal richtige Joggingschuhe besass ich, lief deswegen in sehr weichen Boots und schaffte beim ersten Mal höchstens 10 - 15 Minuten, um dann keuchend und hustend eine Verschnaufpause einzulegen. Trotz heftigem Seitenstechen und ziemlich atemlos lief ich die Strecke bis zum Ziel. Birgit zog mich. Das zweite und das dritte Mal… bereits nach wenigen Wochen merkte ich jedoch, wie gut mir das Laufen tat. Vor allem spürte ich, dass mein Körper mir auch etwas geben konnte und nicht nur eine Herausforderung und Belastung war. Zuerst liefen Birgit und ich nur an den Wochenenden. Aber schon ganz bald wollte ich mehr. Da Birgit an den Werktagen mit ihrem Schuldienst (sie war Berufsschullehrerin) absorbiert war und daher keine grosse Motivation mehr hatte, mit mir auch noch abends zu laufen, begann ich morgens vor der Arbeit die zehn Minuten bis Viertelstunde im Quartier zu laufen. Bald verlängerten sich sowohl Zeit als auch Strecke. Eine halbe Stunde jeden Morgen, nur bei Regen nicht. Das war herrlich und schon nach ein paar Monaten konnte ich gar nicht mehr aufhören. Ich rannte durch die Weinberge, an den Wochenenden längst ohne Birgit, weil sie keine Lust mehr hatte. Durch den Wald südlich von Freiburg, lief längere Strecken, oft mehr als zwei Stunden. Manchmal, wenn es mit der Essstörung ganz schlimm war, lief ich raus in die Felder in Richtung Basel. Dort, wo sich Fuchs und Hase «Gute Nacht» sagen und ich ganz alleine war, schrie ich mir den ganzen Frust und den Schmerz aus der Seele. Heute wundere ich mich schon sehr, dass ich die vielen Jahre, in denen ich mich selbst quälte, hasste, verabscheute, in denen ich nicht zu mir selbst stehen konnte, mich ständig klein machte, dass ich diese schlimmen Jahre so unverwundet überstanden habe. Ich musste Lehrgeld zahlen, das ist kein Frage, aber ich habe nie einen Selbstmordversuch unternommen. Oder doch? Vielleicht doch. Ich habe das Risiko, an der Bulimie zu sterben in Kauf genommen.
Die Bilanz meines bisherigen Lebens war niederschmetternd: Mittlerweile war ich 38 Jahre alt, hatte seit 23 Jahren Bulimie, ein Kind abgetrieben, sicher ein Kind sehr früh verloren, wurde zweimal vergewaltigt, hatte dreimal eine Dissektion, war auf einem Ohr taub und hatte auf dem anderen einen Tinnitus, war bereits einmal geschieden und hatte meinen Traumberuf der Kinderkrankenschwester und späteren Hebamme an den Nagel hängen müssen. Ich lebte allein, hatte über eine längere Zeit meine Familie aus den Augen verloren und arbeitete in einen Job, der mir alles abverlangte. Ich arbeitete zeitweise über dreissig Wochenenden im Jahr. Die Überstunden liess ich mir ausbezahlen, weil ich das Geld für die vielen Essattacken benötigte. Wenn ich abends nach Hause kam, war ich einerseits froh, die Türe hinter mich zu machen zu können, anderseits hatte ich Angst vor mir Selbst. Mein Hobby war fressen.
Ich war allein, niemand hielt mich auf. Deswegen wurde Joggen so wichtig für mich. Das erste Mal seit vielen Jahren erlebte ich meinen Körper nicht nur als Last. Mir wurde allmählich bewusst, dass ich etwas gefunden hatte, was ich anstatt einem Essanfall einsetzen konnte. Zumindest manchmal.
Nach Björn war ich mehr als ein Jahr solo. Vor einer festen Beziehung hatte ich mittlerweile ziemlichen Respekt. Ich traute mir nicht mehr zu, einen Mann zu finden, der es ehrlich mit mir meint und den ich trotzdem anziehend fand. Ich war inzwischen der Meinung, dass mein «Beuteschema» nur die abenteuerlichen, die Draufgänger, die Unorthodoxen, die Kamikazemänner waren. Männer, die lieb und brav und Bankkaufmann oder Buchhalter waren, waren mir - so glaubte ich damals zumindest- zu langweilig. Von einem Flirt ab und zu war ich jedoch nicht abgeneigt. Ich genoss meine private Freiheit und lernte auch gerne neue Männer und Frauen kennen was durch meine Arbeit im Fortbildungszentrum und meine extrovertierte Art nie ein Problem war. Ausserdem entdeckte ich das Internet. Mit einem gewissen Forschergeist und der ständigen Neugier auf alles Neue, die ich ja auch als Kind schon hatte, erschloss sich mir dadurch eine ganz neue Welt.

Im Sommer 2000, nach zweijähriger Bauzeit, war das neue Zahnärztehaus endlich fertig gestellt und das Fortbildungszentrum konnte, oh Wunder, sein provisorisches Dasein aufgeben und die neuen, grossen, medientechnisch auf dem neuesten Stand, hellen und einladenden Räume beziehen. Tagelang hatte ich im Vorfeld Instrumente, Unterlagen, Akten, Geschirr und vieles mehr in Kartons gepackt. Ich freute mich sehr, endlich in einem Fortbildungszentrum zu arbeiten, das diesen Namen auch verdient. Was für ein Unterschied das war, war unglaublich. Nur schon die Einstellung eines Medientechnikers war für mich eine ungeheure Erleichterung. Und dann die Räume! Ein richtiger Hörsaal mit einer Leinwand wie im Kino und modernsten Projektoren, Filmkameras und Mikrophonen. Auch der Behandlungsraum und das Labor waren mit allem ausgestattet, was eine Zahnarztpraxis benötigte. Und alles so hell und geräumig. Mein Arbeitsplatz war allerdings im drei Stockwerke nach oben offenen Empfangskorridor, da meine Kollegin sich weigerte in der «Öffentlichkeit» zu sitzen und ihren Arbeitsplatz lieber im winzigen Sekretariatszimmer sah. In der Planung war den Verantwortlichen eindeutig ein Fehler unterlaufen, den im Nachhinein niemand zugeben wollte. Das Zimmer war definitiv zu klein. Nur ein Schreibtisch mit einem Drehstuhl und einem Sideboard fanden Platz. All die Aktenordner der Kurse von vergangenen Jahren mussten ausgelagert werden. Und schon begann wieder das Schleppen und Suchen. Mir war es grundsätzlich egal, wo ich sass. Im Gegenteil, ich hatte gerne die Übersicht, wer kam und ging. Nur im Winter zog es manchmal wie «Hechtsuppe», sodass ich mir Mantel und Mütze anziehen musste. Jeder, der vorbei kam, grinste mir zu und gab irgendeinen flapsigen Kommentar ab. Ausserdem war ich die meiste Zeit sowieso unterwegs in irgendwelchen Kursräumen. Ich selbst hatte im Propylaxekurs für Zahnärztliches Assistenzpersonal auch einen Tag, an dem ich unterrichtete. Das Fach: «Verhalten im Umgang mit schwierigen Patienten» - Rollenspiele mit Kameraaufnahmen. Somit benötigte ich des Öfteren gar keinen Schreibtisch. Alles in Allem machte mir meine Arbeit in den neuen Räumen wieder viel mehr Freude.
Etwa zur selben Zeit oder auch etwas später, vielleicht Anfang 2001, traten gleich zwei Männer in mein Leben. Der eine war schon lange eingetreten, ich hatte ihn nur noch nicht gesehen, der andere kam virtuell. Im Grunde genommen hatte beide Männer eine Gemeinsamkeit: die digitale Welt. Urs, «der Andere», lernte ich über eine Dating-Plattform kennen. Damit vertrieb ich mir seit neuestem die Wartezeiten zwischen den Pausen während der Kurstage. Zeit, die ich an den Wochenenden im Fortbildungszentrum zu 90% allein verbrachte. So schuf ich mir etwas Unterhaltung, verband das Angenehme mit dem Nützlichen: «Irgendwo musste doch in dieser Welt da draussen der geeignete Mann für mich sein… «. Einerseits traute ich mich, anderseits traute ich mich nicht, jemanden zu suchen. Aber im einsamen Büro war ich ja in Sicherheit. «Nur mal schauen!»
Ich sah diesen, schrieb auch jenem, fand die Sache mit den Bildern und dem unverbindlichen Geplauder sehr unterhaltsam, manchmal amüsant. Mit Urs, dem charmanten Schweizer fing ich eine intensivere virtuelle Konversation an. Er war definitiv sehr nett und kam mir von Beginn an vertrauenserweckend vor. Sein Aussehen gefiel mir ebenso, wie seine Art zu schreiben. Er hatte Humor und war auf eine angenehme Weise sehr direkt. Urs lebte in der Schweiz und - wie er mir anfänglich weiss machte, kam er aus der Gegend um Basel. Wir schrieben uns hin und her und langsam fasste ich mehr und mehr Vertrauen zu dem Mann aus dem Nachbarland. Er war derselbe Jahrgang wie ich, nur zwei Monate älter, arbeitete als Leiter eines Alters- und Pflegeheims, war geschieden und hatte zwei Kinder. Einen zehnjährigen Jungen und eine achtjährige Tochter. Beide lebten bei der Mutter im Kanton Zürich, doch jedes zweite Wochenende verbrachten sie bei ihm. Ursprünglich stamme er aus Deutschland, seine Mutter wäre Deutsche und hätte einen Schweizer geheiratet, welcher jedoch nicht sein richtiger Vater wäre, wie er mir erzählte. Sein richtiger Vater wäre ebenfalls Deutscher gewesen, aber er kenne ihn gar nicht. Er wäre von dem Schweizer Vater adoptiert worden. Schon recht bald wurde ich von Urs zu einem realen Date nach Basel eingeladen. Zunächst zögerte ich kurz, war jedoch schon so vertraut mit diesem Mann, dass ich einem Treffen dann doch zustimmte.
Zu dieser Zeit hatte ich zwar einen Führerschein, war jedoch seit dem Ende der Beziehung zu Karsten nicht mehr Auto gefahren. Ich traute mich schon gar nicht mehr. Deswegen schlug ich vor, dass wir uns auf einen Kaffee am Badischen Bahnhof in Basel treffen sollten, denn ich käme mit dem Zug. Wenige Tage später war es so weit. Einerseits nervös, anderseits freudig, kam ich in Basel an. Urs stand strahlend am Gleis und sah genauso aus, wie auf dem Foto, was mich schon mal sehr beruhigte. Er hatte nicht geschummelt und sich zehn Jahre jünger gemacht, wie das einige andere taten. Er schlug vor, in Riehen im Café eines Museums Kaffee zu trinken, was mir sehr entgegenkam. Eine schöne Atmosphäre an einem schönen Frühlingstag. Alles wunderbar! Wir redeten und redeten und die Zeit verging wie im Flug. Schnell war es Abend. Als es darum ging, dass ich nun langsam wieder eine Bahn zurück nach Freiburg nehmen sollte, bot mir Urs an, mich nach Hause zu fahren. Nach kurzem Hin und Her: «Das kann ich doch nicht annehmen» und «Ich habe sowieso nichts vor und mache das sehr gern», fuhren wir also gemeinsam nach Freiburg. Mittlerweile war ich schon einigermassen beeindruckt von Urs und fand ihn «seeehhr nett». In Freiburg angekommen blieb er über Nacht bei mir, allerdings ganz brav auf dem Sofa. Am nächsten Tag, einem Sonntag, sassen wir zusammen stundenlang beim Frühstück und erzählten und erzählten. Ich weiss nicht mehr, was wir uns alles erzählten, aber drei Dinge weiss ich noch sicher: 1. Urs erzählte mir nichts darüber, was ich über ihn wirklich wissen sollte, zu diesem frühen Zeitpunkt allerdings noch gar nicht wissen durfte; 2. Ich erzählte Urs von meiner Essstörung; 3. Urs zitterte schon beim ersten Treffen am Vortag sehr stark, worüber ich mich zwar wunderte, dies jedoch der Tatsache seiner Nervosität aufgrund unseres Treffens zuschob. Er machte alles wett mit seinem Charme und seiner unaufgeregten Herzlichkeit. Ich glaube, wie beide hatten einfach von Anfang an «das Heu auf der gleichen Bühne». Natürlich verabredeten wir uns am kommenden Wochenende wieder in Basel. Bei dieser Begegnung wollte Urs nicht in ein Restaurant oder ein Café, sondern er wollte mir zeigen, wie und wo er wohnte. Ich war der Meinung, er lebt in oder um Basel, weil er diese Annahme nie dementierte. Als wir dann fuhren und fuhren und fuhren, auf der Autobahn immer mehr in Richtung Zürich, wurde mir doch langsam mulmig und für einen Moment dachte ich, er wolle mich entführen.
Als ich ihn dann - möglichst ruhig und gelassen – darauf ansprach, dass es mir jetzt aber doch komisch vorkäme, erklärte er mir etwas zerknirscht, dass er ja eigentlich im Aargau wohne, und zwar im Wynental, nicht weit von Aarau. Er wollte mir das nicht gleich sagen, sonst hätte ich ihn womöglich nicht kennen lernen wollen. Naja, dachte ich, das ist jetzt aber schon eine Überraschung! Damals wusste ich nicht so recht, ob ich jetzt enttäuscht oder nicht enttäuscht sein soll und entschied mich für die zweite Option. Ich drückte mein anfängliches Unbehagen weg. «Er ist doch so charmant!»
Bei ihm zuhause angekommen, war ich nochmals erstaunt. Urs lebte in einem herzigen kleinen Häuschen mit Blick auf ein unbebautes Feld und einem kleinen Garten drumherum. Ausser einem Tisch mit vier Stühlen, einem Fernseher und etlichen aufeinander gestapelten Umzugskartons, sah ich zunächst mal gar nichts in dem Haus. Im unteren Stockwerk war das Schlafzimmer, Kinderzimmer, ein Bad und WC. Aber bis auf zwei Betten im Kinderzimmer und einem Bett im Schlafzimmer war alles leer. Er erklärte mir, dass er erst vor zwei Wochen eingezogen wäre. Ein hässlicher Gedanke schoss mir durch den Kopf: «Aha, zum neuen Haus, jetzt eine neue Frau…» «Nein!» dachte ich. «Es ist alles gut. Er hat mir ja erzählt, dass er geschieden ist. Auch wenn das schon ein paar Jahre her ist, jetzt möchte er eben ein neues Leben anfangen.» Manches in Urs Lebenslauf erschien mir etwas seltsam. Was hat er die Jahre nach seiner Scheidung gemacht? Er hätte locker wieder eine Lebenspartnerin finden können, weshalb ist er dann solo und sucht über das Internet? Ich habe alle diese Fragen weggeschoben. Ich wollte einfach nicht glauben, dass es da ein Problem geben könnte. Ich wollte, dass der Mann mein Traummann ist. Ich wollte nicht schon wieder enttäuscht feststellen müssen, dass ich mich für den Falschen interessierte. So verbrachte ich das zweite Wochenende mit ihm zusammen und fühlte mich glücklich. Ich wollte mit ihm zusammen sein und bleiben und doch rumorte etwas ganz gewaltig in meinem Bauch, was mich extrem verunsicherte.

In diesem Jahr, Frühling 2001, genau zeitgleich mit dem Kennenlernen von Urs, kamen Rainer «der Eine» und ich uns näher. Er war ein langjähriger Arbeitskollege aus der IT-Abteilung. Seit einigen Wochen schon, arbeiteten wir zusammen an einem Projekt. Wir hatten den Auftrag, ein Verwaltungsprogramm für das Fortbildungszentrum zu erstellen. Ich lieferte alles, was inhaltlich nötig war, um die Helferinnenkurse digital verwalten zu können und er programmierte das Programm. Also eine Maske für die Anmeldung, eine für die Personalien, eine für die absolvierten und / oder geplanten Kurse, bis hin zur Abrechnung der Kurse und einer Jahresstatistik. Für damalige Zeiten war das ein grosses Projekt, denn all das Digitale steckte ja noch ziemlich in den Kinderschuhen. Als Sicherheitsbeauftragte, die ich ja auch noch war, sollte dem Datenschutz auch noch Genüge getan werden. Eine knifflige Sache, die Zeit benötigte. Rainer war verheiratet und hatte einen Sohn. Das wusste ich und mehr nicht. Sein Privatleben war vorher auch nie ein Thema zwischen uns. Ich mochte und schätzte Rainer sehr als Kollege und ich glaube, auch er arbeitete gerne mit mir zusammen. Wir ergänzten uns gut. Trotzdem wunderte ich mich, dass er offenbar ständig an Gewicht verlor. Von Woche zu Woche kam er mir dünner vor. Sein Bauch war mittlerweile richtig konkav, nach innen. Einmal sprach ich ihn darauf an, was er mit «ich esse nur einmal am Tag» beantwortete.
Dann kam der Tag unseres Betriebsausflugs nach Paris im Juni 2001. Morgens um 7.00 Uhr sollte die Abfahrt sein, der doppelstöckige Bus stand schon bereit zum Einsteigen. Ich wusste, dass sich Rainer auch angemeldet hatte. Also stiegen wir alle ein. Annette, meine beste Freundin und Kollegin und ich nebeneinander. Ich bemerkte zwar, dass Rainer noch nicht da war, dachte mir aber, möglicherweise hat er aus irgendwelchen Gründen wieder abgesagt. Der Bus wollte gerade abfahren, als die Kollegen von Rainer riefen, wir sollten noch warten, Rainer käme, jedoch mit einer kleinen Verspätung. Wenige Minuten später bogen Rainer und sein Auto mit hoher Geschwindigkeit um die Ecke. Nachdem er sein Auto geparkt hatte und eingestiegen war, konnte der Bus endlich abfahren. Seltsam, ich habe mich wirklich gefreut, dass er dabei war, obwohl ich mir eingebildet hatte, dass ich mir gefühlsmässig gar nicht so viel aus Rainer machte. Irgendwann im Laufe der Fahrt, als Annette und ich alle aktuellen Themen besprochen hatten beschloss ich, mich zwecks Gesprächsabwechslung zu Rainer zu setzen. Er sass ganz vorne, neben seinen Kollegen aus der IT. Direkt neben ihm war gerade ein Platz frei geworden, da dieser Kollege sich ebenfalls zu einem anderen Gesprächspartner weiter hinten im Bus gesetzt hatte. Als er mich sah hellte sich sein Gesicht merklich auf und ein ganz charmantes Lächeln kam zum Vorschein. Ich weiss noch, dass ich ihn als Entree unseres Gesprächs fragte, ob er schon einmal in Paris war. Dann begann er zu erzählen und ich auch und schon bald waren wir sehr intensiv in ein Gespräch über «Gott und die Welt» vertieft. So tief, dass wir gar nicht bemerkten, wie die Zeit verging. Flugs kamen wir in Paris an, und von da an, wichen wir uns nicht mehr von der Seite.
Wir waren wie «Verwandte Seelen». Rainer war verheiratet und hatte einen Sohn. Das habe ich ja bereits geschrieben und mehr wusste ich bis dahin auch nicht. Im Laufe der nächsten zwei Tage erzählte mir Rainer, wie es ihm in seinem privaten Leben erging. Seine Frau litt seit einigen Jahren an Multipler Sklerose. Im Verlauf dieser schrecklichen Krankheit veränderte sie sich neben den typischen physischen Anzeichen auch psychisch. Auf eine sehr destruktive Art und Weise, denn sie wurde hochgradig aggressiv. Er erzählte, dass wegen ihrer Tobsuchtsanfälle bereits einmal die Polizei kommen musste. Ohne ersichtlichen Grund warf sie mit Dingen um sich (mal ein Messer nach Rainer), schrie Mann und Kind an und war fasst nicht mehr zu beruhigen. Nun, zunächst war ich der Überzeugung, dass der Grund nur für Rainer nicht ersichtlich war und seine Frau sicher irgendeinen Schmerz (ausser der Tatsache der MS) haben musste. Rainer interpretierte diese Anfälle von Raserei als MS-Symptomatische Hirnveränderungen, was er auch so vom Hausarzt bestätigt bekam. Weil Rainer sich um die physische und psychische Gesundheit des gemeinsamen erst 12-jährigen Sohnes fürchtete, erwog er momentan einen Klinikaufenthalt für seine Frau. Rainer ging es aufgrund dieser privaten Probleme schon lange nicht mehr gut. Er machte sich grosse Sorgen um den Sohn, der diese Wut der Mutter immer wieder zu spüren bekam. Schlimm war es dann, wenn Rainer nicht zuhause war und er deshalb nicht rechtzeitig eingreifen konnte. So kam es vor, dass er nach Hause kam und der Sohn sich völlig verstört bei den Nachbarn oder den Grosseltern aufhielt. Rainer gestand mir auch, dass er gerne noch weitere Kinder gehabt hätte, seine Frau jedoch dagegen war. Sie führten deswegen endlose Diskussionen. Natürlich war das noch in der Zeit vor Ausbruch ihrer Krankheit. Er selbst war in einer Grossfamilie aufgewachsen mit Eltern und acht Kindern, was war das für eine schöne Zeit. Eine grosse Rasselbande wären sie gewesen und immer war was los. Seinen Sohn nun als Einzelkind aufwachsen zu sehen, würde ihn schon sehr bedrücken.
Natürlich erzählte ich auch von mir, erzählte nach vielem anderen auch über meine Essstörung, was Rainer sehr interessiert verfolgte und auch da und dort nachhakte. Er war der erste Mann in meinem Leben, der mir bei diesem Thema wirklich zuhörte, respektive gegenüber dem ich keine Scham empfand, mich bei diesem Thema zu öffnen. So redeten wir, erzählten uns und verlebten miteinander zwei sehr intensive Tage. Tagsüber nahmen wir am Ausflugsprogramm teil, bestaunten den Eifelturm, sassen nebeneinander im Restaurant und so weiter, aber eigentlich befanden wir uns wie in einem Kokon. Alles um uns herum lag im Nebel und wir beide eingehüllt darin. Spät in der Samstagnacht, vor dem Sonntag unserer geplanten Heimfahrt und nach dem Restaurant und anschliessendem Barbesuch, als wir beide im Hotelaufzug standen und auf dem Weg in unsere jeweiligen Zimmer waren, wurde ich plötzlich ganz sanft von Rainer geküsst. Er entzündete in mir ein kleines Feuer, das mich ziemlich durcheinander brachte. Rainer war doch verheiratet, unglücklich zwar, aber immerhin.
Und ich? Wo stand ich beziehungsmässig? Für mich war diese Frage noch nicht geklärt, denn ich mochte Urs, aber eine Beziehung hatten wir noch nicht gestartet. Richtig gestartet, mit allem Drum und Dran. Wir waren noch beim Abtasten. Bis dahin waren wir noch nie intim gewesen. Zu diesem Zeitpunkt war Urs gerade einmal bei mir in Freiburg und ich einmal bei ihm in der Schweiz gewesen. Dazwischen lagen jeweils mindestens eine oder zwei Wochen. Einmal hatte ich ihn über ein Wochenende nicht einmal telefonisch gesprochen. Trotz unzähliger Anrufe konnte ich ihn nicht erreichen. Irgendwann im Laufe der darauffolgenden Woche, in der ich mir irgendwie auch Sorgen machte, meldete er sich bei mir. Ich weiss den genauen Wortlaut seiner Erklärung nicht mehr, aber sie stimmte mich alles andere als zuversichtlich. Einen Hauch von Zweifel bereitete sich in meinem Inneren aus, den ich jedoch beiseite wischte. Was bildete ich mir bloss immer ein!!
Auf der Rückfahrt von Paris, als wir auf einem Rasthof eine Pause einlegten, hatte ich nochmals Gelegenheit mit Rainer unter vier Augen zu reden und da stellte ich ihm die Frage aller Fragen, die dann meine weitere Zukunft bestimmen sollte: «Würdest Du Dich von Deiner Frau trotz ihrer Krankheit trennen?» Er überlegte einen kurzen Moment und antwortete: «Nein, das könnte ich nie verantworten.» Somit war für mich klar, dass Rainer und ich im Sinne einer Seelen-Verwandtschaft immer nur gute Freunde bleiben würden.
Wieder zurück im Freiburger Alltag arbeitete ich viel und intensiv. Die Kurse nahmen zu, ich selbst war auch ständig mit eigenen Weiterbildungen beschäftigt. Die Bulimie liess mich in ungeahnte Höhen schweben, um mich anschliessend in allertiefste Löcher fallen zu lassen. Im Leben und Lieben war ich war zutiefst verunsichert. Rainer und ich trafen uns oft in der Mittagspause zum Joggen, Essen, Reden, Küssen. Er hatte sich in mich verliebt, was ich überall in meinem Körper spüren konnte. Und ich? Wo stand ich? Dazwischen. Bereits in Paris hatte ich Rainer auch von Urs erzählt, aber da war ja noch alles sehr frisch, unsicher und jegliche Beziehung weit weg. Es war so verrückt, ich mochte beide Männer sehr und doch suchte ich in mir das grosse Gefühl, wenigstens für einen von beiden. Aber da war nichts. Nichts als Watte. Himmel nochmal, wer war ich denn? Eine gefühlslose Puppe? Wo waren die Schmetterlinge, die Bauchkrämpfe, die weichen Beine? Fast jedes Wochenende pendelte ich zu Urs oder er kam zu mir oder er meldete sich gar nicht oder ich arbeitete das ganze Wochenende durch. Die Zeiten, in denen ich gar nichts von ihm hörte, waren teilweise dramatisch für mich. Ich konnte mir das gar nicht erklären, wo er dann steckte oder was er tat. Dann dachte ich, er hätte mich fallen gelassen, aber plötzlich war er wieder da. Erst viel später, zu spät, erfuhr ich, was hinter seinem regelmässigen Abtauchen steckte. So durchlebte ich den Sommer. Im Berufsleben sicher, im Privaten schwankend wie auf einem Schiff bei Orkanwetter. Nicht gut, wenn eine Essstörung den Alltag bestimmt. Gar nicht gut!

Dann kam der 11. September 2001 und die ganze Welt bebte. Es war ein Dienstag und er begann morgens mit den ganz normalen Vorbereitungen für einen Vortrag, der am späten Nachmittag stattfinden sollte. Nach der Kaffeepause war ich im Hörsaal damit beschäftigt, die Leinwand mit dem Monitor zu verbinden und zu testen, ob das Bild mittig war. Um ein Testbild zu bekommen, schaltete ich den TV-Kanal ein. Ich drehte und schraubte und plötzlich sah ich ein Flugzeug in Richtung World Trade Center fliegen. Ich dachte noch, der ist jetzt aber nah an den Hochhäusern und wollte mich schon wieder meinem Display zuwenden, als ich sah, wie das Flugzeug direkt in einen der Türme flog. Eine riesige Explosion erfolgte und überall flogen Teile herum. Nein, das konnte doch nicht wahr sein!! Das ist ein schlechter Scherz, dachte ich noch, rief jedoch gleichzeitig nach meinem Chef, den ich gerade an der Türe vorbei laufen sah. Er kam herein und blickte ebenfalls auf unserer riesigen Leinwand in ein Höllenfeuer. Knistern, schreien, laute Ausrufe und Polizeisirenen waren zu hören. Offenbar wurde das Ereignis 1:1 von einer Kamera aus einem gegenüberlegenden Hochhaus oder Hotelzimmer direkt in die Welt gesendet. Mit der Zeitverschiebung musste sich das alles am frühen Vormittag abgespielt haben. Ich traute meinen Augen nicht, als Minuten später ein zweites Flugzeug in den anderen Turm flog. Ein Aufschrei ging durch den Hörsaal, denn mittlerweile standen auch noch meine Kollegin, der Medientechniker und ein paar andere Leute im Saal. Was um Gotteswillen war denn das? Auf der Leinwand spielte sich eine riesige Tragödie ab. War das denn real? Ich konnte es nicht glauben. Gebannt verfolgten wir einige Zeit wie die Türme brannten. Die ganze Szenerie war so irreal, weil wir nur irrwitzige Bilder sahen und niemand das Geschehene kommentierte. Bilder, wie aus einem Katastrophenfilm im Kino. Dann stürzten die Türme ein und begruben unzählige Menschen unter sich und nichts war mehr so als wie zuvor. Der Terror hatte die Welt fest in seinem Griff.
Ich machte mir Sorgen. Um mich, um die Welt, um meine private Zukunft. Die einzige Beständigkeit in meinem Leben war die Arbeit und meine Essstörung. Sie gaben mir Sicherheit. Es kam das Jahr 2002, die USA rief den Krieg gegen den Terror der Islamisten aus und Rainer und ich wurden wirklich gute Freunde und noch mehr als das. Rainer war verliebt in mich und mir tat die Zeit mit ihm gut. Dann vergass ich das Fressen und Kotzen, vergass meine Unsicherheiten gegenüber ihm und der Beziehung mit Urs und spürte mich. Er hauchte mir Leben ein. Wenn ich nicht in die Schweiz reiste und auch sonst nichts von Urs hörte, verbrachten Rainer und ich die sonnigen Nachmittage mit Wanderungen und anderen Aktivitäten. Er blühte dann richtig auf. Es war der Sommer des Films «Die fabelhafte Welt der Amelie», dessen Soundtrack unsere gemeinsame Musik wurde. Wir gingen in Konzerte, u.a. von Jan Garbarek und ab und zu besuchte er mich abends zuhause. Wir assen und tranken etwas, redeten und irgendwann ging er wieder nach Hause. Übernachtet hatte er nie bei mir. Aber je länger, je mehr verunsicherten mich seine Besuche, seine Hingabe mir gegenüber, seine Geschenke, die er mir brachte. Ich wünschte mir eine Perspektive, eine Zukunft, in der ich mich sicher fühlen konnte und die konnte mir Rainer nicht geben. Er war noch verheiratet, mit einer Frau, die zu krank war, um sich scheiden zu lassen.
Dann entschied ich mich. Ich wollte mich ganz zu Urs bekennen. Mein Bauch gab mir deutliche Warnsignale und riet mir ab, eine solche Entscheidung zu treffen. Doch ich hörte nicht auf ihn. Während eines gemeinsamen Wochenendes erklärte ich meinem charmanten Schweizer, dass ich gerne bei ihm und mit ihm zusammen bleiben wolle und auch bereit wäre, in die Schweiz auszuwandern, (was nicht besonders speziell war, denn ich kannte die Schweiz ja seit meiner Kindheit). Urs freute sich wie ein kleines Kind und versicherte mir, dass er mir auch einen Job beschaffen könne. Da ich ja eine Fachfrau im Qualitätswesen sei, wäre das gar kein Problem. Er stellte sich vor, dass ich in dem Alters- und Pflegeheim die Qualitätsbeauftrage sein könnte, denn er plane sowieso das Heim zertifizieren zu lassen. Diese Stelle müsse erst noch geschaffen werden, aber auch so hätte er noch weitere Aufgabengebiete. Ich solle die Bewohneradministration übernehmen und überhaupt gäbe es sehr viel zu tun und alle würden schon auf mich warten. Nun, das waren ja fantastische Aussichten! Ich war begeistert, entgegen allen Vorahnungen und Zeichen.
Mittlerweile wusste ich, dass Urs ein Alkoholproblem hatte. Immer, wenn er mich am Bahnhof abholte, roch er nach Alkohol. Morgens, mittags, abends. Dann entdeckte ich beim Einräumen von Sachen Prospekte einer Entzugsklinik im Thurgau und sprach ihn darauf an. Er erzählte mir bruchstückhaft seine Geschichte. Ja, er wäre in dieser Klinik gewesen, aber es hätte nichts genützt. Schon vorher hätte er eine Therapie gemacht, die auch nicht funktioniert hätte und jetzt wüsste er, dass er immer Alkoholiker bleiben würde. Er wäre wohl therapieresistent. Er trinke nur Wein, der ihm aber überhaupt nicht schmecke, aber er hätte sich schon im Griff. Ich solle mir keine Sorgen machen. Mit einer Naivität, die nicht zu überbieten war, aber auch mit der Ignoranz von Tatsachen, die ich einfach nicht wahrhaben wollte und weil ich mir mit diesem Mann eine blühende Zukunft in der Schweiz erträumte, schob ich alle meine inneren Alarmglocken beiseite. «Liebe heilt alles» war mein selbsttäuschendes Mantra.
Im Oktober wurde ich vierzig. Der Vierzigste ist ein Geburtstag im Leben einer Frau, der per se schon schwierig ist, aber für mich wurde er auch ein Geburtstag der Enttäuschung. Ich hatte extra frei genommen, damit ich diesen Tag mir Urs verbringen konnte. Wir wollten gemeinsam zur Expo 02, die am Bieler-, Neuenburger- und Thuner See stattfand. Es sollte ein ganz besonderer Tag werden. Wir hatten abgemacht, dass ich am Abend vorher zu Urs in die Schweiz kommen würde, er mich aber nochmals anrufen wollte. Doch das ganze Wochenende vorher und auch am Montag kam kein Anruf. Auch meine Versuche, ihn zu erreichen, scheiterten. So hockte ich am Dienstag, den 15. Oktober 2002 tränenreich und tief enttäuscht zu Hause in meiner Wohnung in Freiburg. Alles, was ich mir wünschte, war nicht eingetroffen. Ich war traurig über all dem um mich herum, über mich und mein Leben. Urs hatte mich einfach sitzen gelassen. Den Grund sollte ich in naher Zukunft schmerzhaft erfahren.

Für dieses Jahrzehnt benötigte ich einige Zeit, um mich gedanklich wieder darauf einzulassen. Es ist tatsächlich das Schwerste, das Finale, der Countdown meines Lebens mit der Bulimie. Alles, was davor geschehen oder nicht geschehen ist, war im Hinblick auf diese Jahre nur ein Probelauf.
Im Laufe der nächsten Woche nach meinem vierzigsten Geburtstag, meldete sich Urs einigermassen zerknirscht bei mir, um sich zu entschuldigen. Er werde alles wieder gut machen, er hätte mich nicht vergessen und wir könnten ja auch am kommenden Wochenende noch an die Expo 02. Er würde dort als Zivilschützer arbeiten und könne mir alles zeigen, sozusagen auch «backstage». Wieder liess ich mich durch seine liebenswerte Art und seinen Charme umgarnen und nach kürzester Zeit war ich ihm vollkommen zugewandt. Am darauffolgenden Wochenende fuhren wir tatsächlich nach Biel und Fribourg und verbrachen einen wunderschönen Tag in der Drei-Seen-Region.
Neuenburger See, Bieler See und Murtensee mit den umliegenden Regionen hatten ihr «Festkleid» übergestreift und liessen sich feiern. Erst spät in der Nacht kehrten wir zurück in den Aargau, erfüllt mit Eindrücken aus der ganzen Welt. Am Sonntag fuhr ich zurück nach Freiburg in meinen Alltag. Im Laufe der nächsten Wochen schmiedeten wir an unserem gemeinsamen Plan meiner Übersiedelung in die Schweiz. Urs reichte beim Kanton einen Antrag ein, der bestätigte, dass er für die Stelle «Qualitätsbeauftragte für ein Dienstleistungsunternehmen» in der Deutschschweiz keine geeignete Person fände und somit mich aus Deutschland akquirieren wolle. Und ich kündigte meine Arbeitsstelle im Zahnärztehaus, was mir unheimlich schwerfiel. Wieder und wieder habe ich in mich in ein Leben mit Urs hineingefühlt und mich gefragt, ob diese Entscheidung auch die Richtige wäre und immer wieder habe ich mir selbst Mut zugesprochen und mir versichert, dass ich sowieso auf Dauer ein 120%-Pensum nicht durchhalten könne. Es müsse jetzt etwas geschehen und das wäre die Chance meines Lebens. Nur damit hatte ich recht. Die berufliche Veränderung war tatsächlich die Chance meines Lebens, aber für welchen Preis?
Während dieser Zeit des inneren Auf- und Umbruchs kam es zu einer Situation, die mir aufzeigen sollte, was mich mit Urs in Zukunft erwartete und die mir auch ein letztes Mal die Chance zur Umkehr bot. Ich nutzte sie nicht! Ich wollte an meinem Traum vom neuen, schönen Leben in der Schweiz festhalten. Und ich war sehr verliebt in Urs.
Es war nachts gegen ein Uhr, als das Telefon klingelte. Dran war Urs, der mich eindringlich bat, sofort zu kommen. Es wäre etwas Schlimmes passiert. «Bitte, bitte komm sofort, ich brauche dich». Total verschlafen und vom vielen Rotwein des Vorabends etwas bedeppert, welchen ich zusammen mit Birgit, einer Freundin getrunken hatte, verstand ich gar nichts. «Was? Was ist passiert? Wohin soll ich kommen? Zu Dir? Jetzt in der Nacht? Es fährt doch kein Zug, wie soll ich denn zu Dir kommen, so schnell. Morgen komm ich doch, warte doch noch bis morgen». «Nein, jetzt, ich schicke Dir jemanden, der holt Dich ab. Er ist in einer Stunde bei Dir». Das gefiel mir gar nicht und doch fühlte ich mich verpflichtet, seiner Bitte nachzukommen. Ich dachte, ich könne ihn doch nicht im Stich lassen, wenn er mich bräuchte, was auch immer passiert sein mochte. Ich wollte doch mit ihm leben und konnte nicht schon beim ersten Bitten seinerseits Nein sagen. Ach, ich fühlte mich so zwiespältig. Ich konnte und wollte einfach die Situation, die Gefahr, das Ungute am Ganzen nicht erkennen.
Eine Stunde später klingelte es tatsächlich an meiner Türe. Misstrauisch drückte ich den Türöffner. Nach wenigen Sekunden stand ein noch nie gesehener Typ vor mir, der mir nicht sehr vertrauensselig vorkam. Er wäre Mike und sagte, Urs würde ihn schicken, um mich abzuholen. Ich nickte nur, nahm meine Tasche und folge ihm in sein Auto, Marke Angeber. Ich, eine erwachsene Person von vierzig Jahren, setzte mich um zwei Uhr nachts in das Auto eines wildfremden Mannes, um von Freiburg, Deutschland in den Aargau, Schweiz zu fahren. Das, genau das, ist Bulimie. Ist «Frau ohne Selbstbewusstsein», ist Sucht, ist Krankheit, ist Dummheit. Aber auch Hoffnung sieht so aus!
Die Fahrt ging auf die Autobahn Richtung Basel, über die Grenze und dem Rhein entlang in Richtung Zürich. Mein Chauffeur war recht redselig. Er sei im Auftrag von Urs zu mir gefahren, halte das ganze Unternehmen für verrückt, hätte erst gar nicht fahren wollen, aber wenn sich Urs etwas in den Kopf setze, dann muss das ja unbedingt ausgeführt werden. Ich habe ihn gefragt, was denn dort los sei und in welchen Schwierigkeiten Urs stecke, worauf er mir erklärte, dass er ja schon einige schräge Vögel kenne, mein Freund Urs jedoch den Vogel abschoss. Er wolle mir ja keine Angst machen, aber er empfehle mir, die Hände von dem Mann zu lassen, denn der wäre eindeutig krank. Ich dachte bei mir, das will ich gar nicht hören, will lieber hören, dass alles ein grosser Irrtum sei und wenn ich erst einmal bei ihm lebe, wird alles gut.
Am Rasthof in Pratteln hielten wir kurz an, um einen Kaffee zu trinken. Der Mann sagte, dass ich nicht erschrecken soll, wenn ich Urs sehe, er würde eben schon seit zwei Tagen Party machen. Mir wurde immer mulmiger zumute und eigentlich wollte ich am liebsten wieder umdrehen. Zweimal läutete das Handy des Mannes und immer war es Urs. Wo wir denn bleiben würden, und er würde warten und wir sollten uns beeilen. Irgendwann kamen wir am Haus von Urs an und das erste, was ich wahrnahm, waren die geschlossenen Fensterläden. Das ganze Haus war verrammelt und verschlossen, wirkte völlig abweisend. Es war nach drei Uhr morgens, ich klingelte und nach wenigen Augenblicken öffnete sich die Haustüre einen Spalt breit und ein Mann in einem Bademantel, völlig zerzaust, kreidebleich, stinkend mit roten, glasigen Augen und weissen Mundwinkeln stand vor mir. Ich traute meinen Augen nicht, das war tatsächlich Urs. Der Mann, den ich bisher als attraktiv und charmant wahrgenommen hatte und in den ich verliebt war, wirkte nun abstossend und ekelerregend. «Maggie, Du bist da. Gottseidank. Bitte erschreck nicht, es ist nicht so, wie es aussieht» Als ich eintrat kam mir eine junge Blondine in Reizwäsche entgegen. Zuerst begriff ich gar nichts, bis mir langsam ein Licht aufging. Vor allem, wegen des ganz speziellen Geruchs. Es roch ekelhaft nach Chemie. Eigentlich hätte ich gleich wieder auf dem Absatz kehrt machen sollen, aber es war zu spät, ich blieb. Ich war einfach so dumm!

Das Licht, das mir aufging, erzählte mir in Sekundenbruchteile folgendes: Urs hatte eine Kokainparty gefeiert und dafür aus Zürich seinen Dealer samt Mädchen bestellt. Vielleicht waren es zu Beginn auch noch mehr Mädchen gewesen. Ich kam ja erst, als die Party schon fasst zu Ende war, um Urs während seiner Ausnüchterung am aufgehenden Sonntag zu begleiten. Und irgendwann, wollte er mit mir künftig zusammenleben, musste er ja mit der Wahrheit herausrücken. Der Mann, der mich in Freiburg abgeholt hatte, war ein Zuhälter und Kokaindealer aus dem Quartier Langstrasse Zürich Kreis 4. Er hatte sogar noch Mitleid mit mir, weil ich so völlig unvorbereitet auf das ganze Ausmass der Wahrheit gestossen worden war. Urs hatte ihn dafür bezahlt, dass er mich in Freiburg abgeholt hatte. Er hatte ihn für alles bezahlt. Für den Stoff, die Frau(en) und meine Abholung. Kaum war ich angekommen verzog sich der Typ mitsamt dem Mädchen und rief mir noch zu, ich sollte die Ohren steifhalten. Als wir beide allein waren, fragte ich Urs, was denn das alles solle, was er da mache und wie er sich das mit uns vorstelle. Er verhielt sich sehr unterwürfig, bettelnd, dass ich nicht so schimpfen solle und bot mir ebenfalls eine Linie an. Ich sagte, er spinne wohl und dass ich das nie nehme, «Scheisszeugs» und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, nach nicht nachlassendem Bitten und Betteln von Urs, ich solle das doch mal probieren, nahm ich auch von der Droge, mit der Überzeugung, dass ich sowieso nichts spüren würde. Ja, und dann war ich plötzlich nicht mehr so sauer, wurde gelassener. Ach, im Grunde war doch alles nicht so schlimm… mein Herzschlag beschleunigte sich, eine angenehme Wachheit machte sich breit. Aber ich spürte einfach keine Wirkung…ach, wie war ich naiv, ein Schaf! Irgendwie verbrachten Urs und ich den Sonntag zwischen Sofa, Küche und Bad. Als sein Kokainvorrat zu Ende ging und er vor Erschöpfung auch definitiv nicht mehr konnte, zwang er sich auszunüchtern. Das hiess, er lag zwei Tage und zwei Nächte nur im Bett, konnte nicht schlafen, blutete aus der Nase und hatte schwere depressive Verstimmungen. Er heulte, klagte, ass nichts, trank nur Wasser oder Rotwein. Ich blieb so lange bei ihm (rief bei der Arbeit an und meldete mich krank), bis er wieder auf den Beinen war. In dieser Zeit war er nicht ansprechbar, obwohl ich so viel Fragen hatte. Vor allem hatte ich eine Frage: «Was wird aus uns?»
Zwei Tage später, an dem Tag, als ich abends wieder nach Freiburg fahren musste, stellte ich ihn zur Rede. Er erklärte mir, dass er sich diese «Auszeit» wie er seine Partynächte nannte, ab und zu gönne, nicht oft, so drei bis viermal im Jahr. Aber jetzt wäre ich ja da und es käme sicher nicht mehr vor. Das mit den Frauen sei nur der Sex, lieben würde er nur mich und sonst keine. Ich fragte ihn, warum er das mache, und er erklärte mir, dass das eine reine Kopfsache wäre. Er hätte mit keiner der Frauen echten Sex, das wäre nur in seinem Kopf. Es wäre für ihn wie ein Film, der ablief und nach einer gewissen Zeit könne er diese aufkommenden Gedanken nicht mehr abstellen und dann müsse er so eine Nacht durchziehen.

Nach und nach kapierte ich, wie Urs tickte. Urs war aktiver Alkoholiker. Nach so und so vielen Versuchen eine Therapie zu machen, aber immer wieder scheiterte, hatte er resigniert und sich für therapieresistent erklärt. Den Alkoholkonsum erklärte er mit seiner Kindheit. Seine Mutter war eine Deutsche, ursprünglich aus der Mannheimer Gegend und wurde mit Siebzehn missbraucht (seine Mutter sprach immer von Vergewaltigung). Daraus entstand Urs. Nach Urs Geburt, lernte seine Mutter einen Schweizer Rheinschiffer kennen und verliebte sich in ihn. Wenige Wochen später gab sie Ihr Kind bei ihren Eltern ab und fuhr fortan für die nächsten zwei bis drei Jahre mit ihrem Liebhaber und dem Schiff auf dem Rhein hinauf bis Rotterdam und wieder hinunter nach Basel. Die Jahre bei den Grosseltern empfand Urs als die schönsten seines Lebens. Ich glaube, er fühlte dort Geborgenheit und wurde auch geliebt. Irgendwann beschlossen seine Mutter und der Rheinschiffer zu heiraten und sesshaft zu werden. Er bekam bei den Bergbahnen in St. Moritz – Celerina einen Job, weshalb das Paar sich dort niederlies. Für seine Mutter war das der Zeitpunkt, den kleinen Urs zu sich zu holen, was für Urs zu einem Trauma wurde. Weg von seinen geliebten Grosseltern-«Eltern», weg aus der gewohnten und vertrauten Umgebung, hin zu fremden Menschen, die er ab sofort Mami und Papi nennen sollte und in eine fremde Umgebung.
Der neue «Papi» akzeptierte Urs nicht als seinen Sohn, trotzdem adoptierte er ihn, was er damit begründete, dass alle Behördenangelegenheiten in den sechziger Jahren so einfacher wurden. Inzwischen wurde eine Schwester geboren, die, zumindest für den Vater, das Prinzeschen der Familie wurde. Urs war immer am Rande der Familie, spürte ständig, dass er bei seinem Stiefvater nicht wirklich willkommen war. Dafür verhätschelte seine Mutter ihn, um ausgleichend zu wirken (und wegen des schlechten Gewissens), was sich in Tat und Wahrheit leider negativ auf die ganze Familie auswirkte.
Dieses ganze Familienkonstrukt war ein Drama. Stiefvater und Stiefsohn lagen sich ständig in den Haaren, was sich mit zunehmendem Alter von Urs verstärkte. Mit der Mutter verband ihn eine Hassliebe, die sich bis ins Erwachsenenalter hineinzog. Ich lernte Mutter und Sohn so kennen. Vorwürfe und Opferrolle seinerseits, Schuldgefühle, schlechtes Gewissen und Opferrolle ihrerseits.
Als Urs Siebzehn war, wurde er von seinem Adoptivvater aus der Haus geworfen. Das deswegen, weil Urs den betrunkenen Stiefvater schupste, der seine geliebte Mutter zum wiederholten Male wüst beschimpfte, sodass der ganz blöd gegen den Heizkörper fiel und danach im Spital genäht werden musste. Urs wohnte daraufhin in einer winzigen Wohnung in Zürich, befand sich bereits in der Ausbildung zum Bankkaufmann und jobbte nebenher in einer Bar im Zürcher Niederdorf. So verdiente er sein Geld zum Leben. Später hat Urs mir erzählt, dass er in dieser Bar zum ersten Mal mit Kokain in Berührung gekommen wäre. Wenn er Kokain nahm konnte er tagsüber arbeiten und nachts kellnern. Eine Frau hätte ihm das vermittelt. Dieselbe Frau, durch die er auch die Wohnung bekam und dieselbe Frau, die ihn für sonstige «Zuwendungen» bezahlte. Ich war mir nicht ganz sicher, ob sich Urs das ausgedacht hatte, weil es abenteuerlicher klang, als ganz profan von einem Dealer angefixt worden zu sein.
Nach der Lehre begann Urs ein Studium in Betriebswirtschaft in Zürich und schloss es mit einer Examensarbeit über die Firma «Fogal – Strumpfwarenfabrik » ab. Seitdem war er eine Frauenbeine-Fetischist, wie er mir grinsend erklärte.
Nach seinem Studium machte er sich in der IT-Branche selbstständig. Zusammen mit einem Kollegen entwickelte er ein Programm, welches in den Verwaltungsprogrammen von internationalen Grosskonzernen Fehler, Redundanzen und Missbräuche aufdeckte. Falsch eingegebene Zahlen und andere menschliche Fehler wurden herausgefiltert und korrigiert, was den Konzernen so Ausgaben in Millionenhöhe ersparte. Urs war sehr erfolgreich, verdiente überdurchschnittlich gut und machte sich einen Namen. Es entwickelten sich Mr. Jekyll und Dr. Hyde. Einerseits war Urs genial. Alles, was er beruflich anpackte, funktionierte, weil er sehr strukturiert und logisch vorging und sehr intelligent war. Zumindest auf beruflicher Ebene. Spricht man dann von kognitiver Intelligenz? Ausserdem war er ein Tüftler und scharte immer ein gutes Team um sich.
Die Schattenseite seines Erfolgs war seine innere Einsamkeit und seinen Eigenhass. Er hasste seine Fähigkeiten, sein Leben und er hatte regelmässig depressive Phasen. Dann konnte er nicht arbeiten, schlief und trank und trank und schlief und schaute stundenlang in den Fernseher. Der Alkohol wurde sein Wegbegleiter. Abends, wenn er nach Hause kam und in seinen einsamen Stunden versank. Dass das keineswegs so sein musste, vermochte er nicht zu ändern. Urs war nach Aussen ein Frauenheld, beliebt und anerkannt und wurde sehr umschwärmt. Sein umwerfender Charme, der auch bei mir seine Wirkung nicht verfehlte, konnte er auch früher schon immer wieder erfolgreich platzieren. Die Frauen kannten ja auch nur den «Dr. Hyde» in ihm. Von «Mr. Jekyll» hatte niemand auch nur den Hauch einer Ahnung. Mit Ende Zwanzig lernte er während eines Fluges nach Brasilien eine Stewardess kennen, die ihm sehr gefiel. Er flirtete während des Fluges heftig mit ihr und der Erfolg war ihre Telefonnummer. Aus der fremden Stewardess wurde Marianne, seine erste Frau, mit der er zwei Kinder bekam. Einen Jungen und ein Mädchen. Als ich Urs kennen lernte waren sie zehn und acht Jahre alt. Der Sohn wurde mit einer Sehbehinderung geboren, die ihm nur 30% Sehkraft beschied. Er benötigt Zeit seines Lebens eine sehr starke Sehhilfe. Trotzdem weiss ich heute, dass er in die gleichen Fussstapfen trat, wie sein Vater. Er wurde ein sehr erfolgreicher IT-Spezialist, der auf der ganzen Welt tätig ist. Ich weiss auch, dass sich Urs aufgrund seines Alkoholkonsums die Schuld gab an der Sehbehinderung seines Sohnes.
Leider stand sich Urs auch während der Sonnenseiten seines Lebens im Weg. Er zerstörte das, was er am meisten liebte. So auch seine Ehe mit Marianne. Auch da gab es schon diese Drogennächte. Er verlor sie und dadurch auch das stabilisierende Familienleben. Die Schuld lag natürlich bei seiner Frau, die immer «so zickig» war. Im Nachhinein konnte ich Marianne so gut wie niemand sonst verstehen. Sie hatte immerhin noch Kinder und die mussten in solchen Zeiten vor dem Vater beschützt werden. Nach dieser Ehe begab er sich in eine dreimonatige Therapie, die er später als reine Verschwendung abtat. Er war und blieb in seinen Augen ein Süchtiger. Acht Monate im Jahr funktionierte er hervorragend, die restlichen versank er in Sucht und Depression. Als ich ihn kennenlernte, stand er auch wieder an einem Neuanfang. Er bezog das Haus und wollte eine feste Beziehung. Ich spürte, dass er es ernst meinte und war bereit, diesen Weg mit ihm zu gehen. Urs wurde zu meiner grossen Liebe und ich hätte am Anfang alles für ihn getan.

(1) Mein Bild für den Ausländerausweis

Im Februar 2003 war es so weit. Ich siedelte in die Schweiz um. Ich hatte alle meine Möbel entweder verkauft oder verschenkt, Birgit meine Freiburger Freundin übernahm meine Wohnung und ich fuhr mit Sack und Pack, einem lachendem und einem weinenden Auge in den Aargau. Das Gefühl des Glücks überwog und ich freute mich auch auf meine neue Aufgaben im Altersheim. Ich hatte ein 80%-Pensum, war zuständige Person für die Bewohneradministration, für die Fakturierung, war die Assistentin der Pflegedienstleitung und Qualitätsbeauftragte. Alles sehr spannende Aufgabengebiete. Ausserdem führte ich immer das Protokoll bei den Vorstand- und Generalversammlungen. So bekam ich auch von den Entscheidungsträgern eine Menge mit. Ein Super-Rundumpaket also. Die Arbeit im Altersheim machte mir sehr viel Freude und auch das Haus und der Garten waren keine Last für mich. Wir hatten eine Reinigungshilfe, die einmal pro Woche kam und ansonsten erledigte ich alles selbst. Urs und ich begegneten uns oft während der Arbeit, aber bis auf einmal pro Jahr für den QM-Bericht und die abendliche Sitzungen hatten wir wenig direkte Berührungspunkte. Das funktionierte bestens und gab uns beiden auch das Potenzial zur Weiterentwicklung von Projekten. Ich genoss es sehr abends zuhause bei einem oder mehreren Glas Wein mit Urs über neue Aufgleisungen im Heim zu diskutieren. Wir schmiedeten Pläne, um den Ausbau des Seniorenheimes voranzutreiben, diskutierten über Alterswohnungen gleich neben dem Heim und besprachen, wer von den Mitarbeitern das Potential zum Aufstieg hatte. So wurde aus einer Reinigungshilfe eine Teamleiterin und aus einer Teamleiterin die Chefin Hauswirtschaft. Ich bewunderte den Mut von Urs, auch unkonventionelle Wege zu gehen und das Vertrauen, das er in seine Mitarbeiter setzte. Er wurde geachtet, war ziemlich beliebt und ich war stolz auf ihn. Wir wurden von der regionalen Prominenz da und dort eingeladen. Einmal zum Pferdespringturnier in Wohlen vom Versicherungsagenten, ein andermal für einen Film im Open Air Kino in Aarau. Der Stiftungsratspräsident war gleichzeitig unser bester Freund. Mit ihm und seiner Partnerin waren wir zum Skifahren in Flims. Der grösste Bauunternehmer am Ort lud uns zum Grillabend ein und so weiter. Für mich waren die ersten Monate eine sehr spannende Zeit und ich muss sagen, ich genoss alles Neue und lernte auch gerne neue Leute kennen.
Niemand, bis auf Sonja, eine Mitarbeiterin aus der Pflege ahnte, wie Urs wirklich war und was an manchen Nächten bei uns zuhause ablief. Sonja war verheiratete Mutter von zwei Söhnen im Teenageralter, wusste um die Süchte von Urs, denn sie hatte die eine oder andere Nacht vor meiner Zeit mit ihm gemeinsam durchgezogen. Beide verband eine Affäre. Gemäss Urs war es für Sonja so ernst, dass sie bereit gewesen wäre, ihre Familie zu verlassen. Er hätte sie daran gehindert, wie er mir erzählte, was ich heute nicht wirklich glauben kann. Ich habe Sonja auch kennen gelernt und ich weiss, dass sie die Dinge besser einschätzen konnte. Ich glaube heute eher, dass er es gern gewollt hätte, wenn sie ihren Mann verlassen hätte, sie jedoch zu diesem Schritt nicht bereit war. Das nahm er ihr übel. Er nahm den Frauen grundsätzlich alles übel, was sie nicht bereit waren für ihn zu tun. Er erklärte sich in jedem Fall immer als Opfer, denn so hatte er das gelernt. Das war das Grundproblem! Er füllte sich immer ungewollt.
Im Sommer 2003, nachdem ich bald schon ein halbes Jahr in der Schweiz lebte, unternahmen wir eine «Tour de Swiss». Einmal quer durch die ganze Schweiz für eine Woche. Vor allem die Region um den Genfer See mit Montreux und Vevey faszinierten mich. Ich sah die Denkmäler von Charlie Chaplin und Freddy Mercury, ein spontanes Jazzkonzert auf der Open Air Bühne in Montreux, der Staudamm von Sion und vieles mehr. Während all dieser Tage war Urs ständig am Handy, nuschelte und tuschelte geheimnisvoll und irgendwann bekam ich mit, dass er wieder Stoff orderte für eines der kommenden Wochenenden. Und er sprach auch mit Frauen. Er hatte seinen Laptop dabei und damit die Dating Plattform, um entsprechende Damen zu kontaktieren. Ich war konsterniert – einmal mehr, sprach ihn darauf an, was er verharmlosend herunterspielte. Ab dann war ich nicht mehr bei der Sache und dachte ständig daran, wann er wohl wieder die nächste Nacht durchziehen würde. Tatsächlich lebte er sein «Kopfkino» im Schnitt alle drei bis vier Monate aus und immer lief es ähnlich ab. Doch wie die Droge in unser Haus kam, kann ich nicht sagen. Nach diesem Typen, der mich in Freiburg abgeholt hatte, habe ich nie mehr einen seiner «Kuriere» getroffen. Vermutlich ist Urs an einen Übergabeort gefahren und vermutlich im Laufe des Tages. Als Chef eines Unternehmens fragt meistens niemand, wohin der Chef geht und woher er kommt. Er orderte viel. Einmal sieben Gramm, was er über den Rest des Tages, an dem er das Kokain bekam, die darauffolgende Nacht und den nächsten Tag verteilte. Manchmal kam ich von der Arbeit nach Hause und er war schon mit Prostituierten zugange. Dann wollte er, dass ich mitmachte und überredetet zusätzlich auch entweder telefonisch oder persönlich Sonja, die Kollegin und seine ehemalige «Affäre». Sich dem Ganzen zu entziehen war kaum möglich. Er bettelte und bettelte so lange und in einem fort, bis ich mich irgendwann breitschlagen liess. Es fand ja bei uns zuhause statt, ich wusste dann auch gar nicht, wo ich hin sollte. Einmal, als er eine Nutte mit Peitsche und solchem Zeugs bestellt hatte, schloss ich mich in der Küche ein. Einmal spülte ich sicher zwei Gramm Koks das WC hinunter. Ein anderes Mal, als er aufgrund meines Protests die Sexspiele in ein Hotelzimmer verlegte, schloss ich ihn aus. Diese Nacht im Hotel verlief wohl nicht so nach seiner Vorstellung, denn die Prostituierte, die er aus Berlin hatte einfliegen lassen, wollte nicht so, wie er, weshalb er schon am frühen Morgen wieder vor der Türe stand. Er musste eine ganz Zeitlang flehen, bis ich ihn hineinliess. Dann erzählte er, dass er die Frau schon an den Flughafen Zürich gefahren hätte.
Urs muss Unmengen an Geld in seine Sexfantasien investiert haben und tut es wohl immer noch. Sein Gehalt war schon sehr gut – natürlich als CEO, aber trotzdem nicht überproportional. Ausserdem arbeitete er im Sozialwesen, da sind die Löhne nicht so überrissen wie beispielsweise bei den Banken. Nun, er musste auch sonst einen hohen Preis bezahlen. Der Verlust von Gesundheit, Familie, Liebe (und er wurde tatsächlich viel geliebt) und seiner Selbstachtung. Während dieses Sex-Sessions verlor er von Mal zu Mal an Würde denen gegenüber, die davon wussten. In den Augen aller war er nur noch krank. Mir tat er irgendwann auch leid, obwohl er mir auf ganz subtile Art ungeheure Dinge aufzwang. Kokain zu konsumieren, mit Prostituierten rumzumachen und seinen extremen Fantasien beizuwohnen war das eine, weitaus schlimmer war für mich, dass ich mich dabei mehr und mehr selbst verlor. Ich glitt mit zunehmenden Nächten in eine innere Verlorenheit und Depression.
Die Zeit zwischen diesen Extremen war schön, normal und für mich immer wieder auch Frieden. Wir hatten es gut miteinander, genossen unsere gemeinsame Zeit, unternahmen Ausflüge, genossen den Garten, die Kinder, unsere Katzen, ich meinen Sport und, leider auch das, ich kotzte weiter.
Stetig nahmen die Essattacken zu, die ich eine ganze Zeitlang wirklich klein halten konnte.
Ich musste immer wieder meine Mitte finden. 2003 an Weihnachten hatten wir einen Christbaum, den wir schmückten und uns daran freuten. Urs hatte sich einen Baum gewünscht, wohl auch eine seiner Kindheitserinnerungen. Auch ich freute mich daran, denn seit meinem Auszug aus dem Elternhaus habe ich nie mehr einen Christbaum geschmückt. Wir taten das aber auch für die Kinder, die den ersten Weihnachtstag bei uns verbringen sollten. Leider sagte Marianne den Besuch der Kinder dann aber kurzfristig ab. Immer öfter gab es Diskussionen wegen der Kinder, was mich natürlich nicht erstaunte. Marianne wusste, was bei Urs abging, und versuchte ihn möglichst fernzuhalten. Solche Enttäuschungen schluckte Urs mit Wein hinunter. Schon vormittags auf nüchternen Magen trank er das erste Glas Weisswein und erbrach sich meistens. Ich flehte ihn an, das sein zu lassen, aber er hörte nicht. Er quälte sich und seinen Körper, er quälte mich.

Im Januar 2004 machte Urs mir einen Heiratsantrag und ich sagte Ja. Aus Freude darüber versprach er mir, mithilfe eines Psychiaters und dem Medikament Antabus dem Alkohol zu entsagen, was ich tatkräftig unterstützen wollte. Ich, die ich auch schon Co-Abhängig war und sein Leergut entsorgte. Im Schnitt waren es täglich drei bis fünf Flaschen Weisswein, die ich in die Container warf. Abwechselnd mal da und mal dort, damit es nicht so auffiel.
Einmal in der Woche hatte Urs einen Termin beim Psychiater, der ihm im Laufe der Zeit allerlei an Medikamenten verschrieb: Anti-Depressiva, Schlafmittel, Aufwachmittel, Vitamine, Schmerzmittel und so weiter, aber kein Antabus. Das, so sagte der Psychiater, müsse über den Hausarzt laufen. Die Medikamentenschublade war übervoll mit Pillen, Kapseln, Tropfen und Tabletten, aber Urs ging es de facto nicht besser. Mich interessierte schon, was der Psychiater mit Urs besprach, denn irgendwie ging es keinen Schritt vorwärts. Deswegen wollte ich nach einiger Zeit bei dem Gespräch mit dem Psychiater dabei sein. Es war sowieso an der Zeit, dass auch ich als seine Partnerin einmal mit einbezogen werde. Am Tag des Termins packte ich die vielen Medikamentenschachteln in eine Plastiktüte, die sich sage und schreibe bis oben hin füllte und nahm sie mit. Ehrlich gesagt, zweifelte ich am Durchsetzungsvermögen des Psychiaters und vermutete stark, dass Urs ihn in den Gesprächen um den Finger wickelte und dass der Psychiater primär auf Bitten von Urs die Mittel verschrieb. Ich wusste nur zu gut, wie manipulativ Urs sein konnte. Dort angekommen, schüttete ich die Tüte vor den Füssen des Psychiaters aus. Urs schimpfte, was das denn soll, aber ich wollte Antworten. Für was das alles sei und weshalb die vielen Pillen überhaupt keine Veränderung zeigten. Ausserdem konnte ich mir nicht vorstellen, dass es bei so vielen unterschiedlichen Medikamenten keine Wechselwirkungen gab. Mit meiner Vermutung, dass der Psychiater von Urs manipuliert wurde, lag ich gar nicht so daneben. Nur auf Wunsch von ihm verschrieb der Psychiater das Temesta und die Aufwachmittel, deren Name ich nicht mehr weiss. Und das wiederum bestätigte mir auch den Verdacht der mangelnden Durchsetzungskraft des Psychiaters.
Wie auch immer, an diesem Termin wurde mir klar, dass Urs alles bekam, was er wollte. Bekam er es einmal nicht, drohte er mit Suizid oder entzog sich ganz in seine Süchte.
Ich wusste nun, dass ich Urs zu nichts drängen konnte. Es musste seine Entscheidungen aus einer inneren Überzeugung treffen, sonst hatte alles keine Chance. Er entschied sich dann doch noch für Antabus. Regelmässig, einmal in der Woche ging er zum Hausarzt, wo er das Antabus in der Praxis einnehmen musste. Antabus ist ein Medikament, welches mit gleichzeitigem Konsum von Alkohol massivstes Erbrechen und Angstzustände auslöst. Zu Beginn der Einnahme von Antabus wird dem Patienten zur Veranschaulichung der Wirkung unter ärztlicher Aufsicht das Medi mit einem Schnapsglas voll Wein verabreicht. Schon geringste Alkoholmengen verursachen starke Krämpfe, Übelkeit bis zum Erbrechen und massivste Bauchschmerzen. Dieser Test soll den Patienten zeigen, was passiert, wenn der Alkoholkranke unter der Einnahme von Antabus Alkohol trinkt. Urs war sehr erschüttert, als er mir von der Wirkung erzählte. Aber nur so hatte er eine Chance trocken zu bleiben. Obwohl Urs mir erklärte, dass ich seinetwegen nicht auf Wein verzichten müsse, ging ich am Anfang trocken mit ihm mit. Später dann trank ich nur im Restaurant wieder Wein, zuhause hatten wir weiterhin keine alkoholischen Getränke.
Im April 2004 heirateten wir und dem voraus ging eine mühsame Kleinarbeit, bis alle meine Papiere zusammen waren. In Deutschland gehen die Geburtspapiere immer mit dem Vater. Da jedoch mein Vater eine Odyssee rund um den Erdball hinter sich hatte und mittlerweile auf den Philippinen lebte, war es alles andere als einfach der Standort meiner Unterlagen auszumachen. Aber auch das liess sich mit Geduld lösen. Irgendwann erreichte ich das richtige Stadtteilarchiv in Stuttgart und erhielt, was ich benötigte.
Wir heirateten standesamtlich am Vormittag mit Familie und Freunden. Ab frühem Abend hatten wir eine Waldhütte gemietet, in der wir mit allen Freunden und Bekannten unser Hochzeitsfest feierten. Pünktlich um 11.00 Uhr des nächsten Vormittags startete unser Flieger ab Kloten in die Flitterwoche nach Amsterdam. Wir genossen die persönliche Amsterdam-Besichtigung mit einer eigenen Stadtführerin (mit der Urs sogleich zu flirten begann), den Ausflug in den Keukenhof mit seinen abertausenden Tulpen und anderen Blumen, die indonesische Reistafel und natürlich auch einen Joint aus dem Coffee-Shop. Die Tage verflogen im Nu und bald schon hatte uns der Alltag wieder.
Unsere Trauzeugen waren ein befreundetes Paar und zugleich war der Freund auch Urs Vorgesetzter, der Präsident des Stiftungsvereins. Gemeinsam mit Ihnen planten wir noch im September desselben Jahres für zehn Tage gemeinsame Ferien in Form einer Flussfahrt über die Wasserwege der Niederlande. Ein paar Wochen vorher stellte sich heraus, dass ich schwanger war. Verhütung war bei mir schon lange kein Thema mehr, denn Urs hatte aufgrund seines Alkoholproblems mehr oder weniger Probleme im Bett. Meistens hatte er keine Lust und oft war er impotent. Das ist nichts Neues bei Menschen mit einer Alkoholkrankheit. Für mich war das manchmal schwierig zu akzeptieren, vor allem in Anbetracht seines heimliches «Hobbys». Klar war auch, dass er mich zwar auf seine Art liebte, aber körperlich konnte und wollte er nur mit fremden Frauen, ohne Emotionen. Deswegen und auch wegen meines «fortgeschrittenen» Alters hatte ich mit einer Schwangerschaft nicht mehr gerechnet. Ich erinnere mich, dass ich mich über mich selbst wunderte, wie wenig für mich eine Welt zusammenbrach. Erfasste ich den Ernst der Lage nicht oder war ich einfach so abgebrüht? Ich glaube, dass sich bei mir in Situationen, die einfach nicht zu ändern sind, das Phänomen des Urvertrauens einstellte. Denn eines war sicher: ich wollte das Kind bekommen. Wenn auch sonst vieles unsicher war, aber das war sicher. Ich reduzierte sofort das Rauchen auf ein Mindestmass und strich den Wein. Joggen wollte ich weiterhin, aber nur noch auf sicheren Wegen. Einerseits freute ich mich, anderseits hatte ich grosse Zweifel wegen Urs und seinen Süchten und auch wegen meiner Essstörung. Würde ich das alles schaffen? Wie sollte ein Kind in eine solche Umgebung passen? Urs freute sich, aber sehr geerdet. Ich glaube, er hatte sich damals dieselbe Frage gestellt. So vergingen die nächsten Tage und Wochen mit der Aussicht auf ein Kind und auf zehn Tage Ferien. Etwa 5 bis 6 Wochen nach Beginn der Schwangerschaft, an einem ruhigen Tag in meinem Büro, während ich mich mit der Fakturierung der Bewohner abmühte, spürte ich plötzlich ein komisches Ziehen im Unterleib, so als bekäme ich meine Tage. Auf der Toilette sah ich, dass ich blutete. Sofort packte mich die Angst und voller Sorge lief ich zu Urs. Er sass in seinem Büro am Computer und tippte irgendwas ein. Als ich ihm erzählte, was passiert ist, machten wir uns gleich auf den Weg ins einige Kilometer entfernte Spital, wo ich notfallmässig dem diensthabenden Gynäkologen vorgestellt wurde. Nach einer eingehenden Ultraschalluntersuchung bestätigte er mir, was ich befürchtete…ich hatte das Kind verloren. Er sah nichts mehr! Da war einfach nichts mehr!
Er erklärte mir, dass es besser wäre, eine gezielte Ausschabung zu machen, ansonsten würde mein Körper selbst irgendwann und irgendwo die Schleimhaut abstossen und das könnte unter Umständen peinlich werden. Völlig losgelöst tat ich das, was mir geraten wurde und ergab mich mein Schicksal. Am darauffolgenden Tag wurde unter Vollnarkose der Eingriff vorgenommen.
Als ich irgendwann wieder aus der Narkose erwachte und die ganze Situation realisierte, bekam ich einen massiven Heulkrampf. Alle meine Hoffnung, alle meine Träume, alle meine Freude löste sich von einem zum anderen Moment in Luft auf. Mir war sehr, sehr klar, dass dies die allerletzte Chance war, ein eigenes Kind zu haben. Ich glaube, diese Tatsache das Bewusstwerden dieser Tatsache, war vor allem der Grund für meine tiefe Traurigkeit. Die Krankenschwester, die mich ein bisschen tröstete meinte allerdings das seien die Hormone. Vielleicht war auch das noch zusätzlich ein Verstärker meiner Tränen, aber von meinem ganzen Leben davor hatte sie keine Ahnung. Tieftraurig und innerlich tief, tieftraurig verlies ich mit Urs ein paar Stunden später die Klinik. Dieses Gefühl habe ich dann auch noch irgendwo in meiner Seele vergraben. Auf dem Heimweg weinte Urs ebenfalls.

Im September traten wir unsere Reise zu den Kanälen in Holland an. Nach den schwierigen Wochen zuvor freute ich mich umso mehr auf eine Abwechslung und Ablenkung. Andere Menschen sehen, weg von zuhause, das war genau das, was es nun benötigte. Zunächst fuhren wir vier mit dem Auto an die niederländische Grenze. In Venlo nahmen wir unser Schiff oder Boot in Empfang und bekamen eine kurze Einführung in Nautik. Unser Freund Hans und Urs hatten beide einen Bootsführerschein, was die administrativen Vorbereitungen sehr verkürzte. Wir mussten im Grunde nur die Technik des Bootes erklärt bekommen und dann war alles klar. Der Kapitän war primär Hans, Urs war der Hilfskapitän und wir Frauen bekamen die Matrosenrollen. Für mich war das kein Problem, denn ich verstand sowieso nur Bahnhof. Trotzdem hatten wir eine wichtige Aufgabe: sicher einmal pro Tag, manchmal auch öfter mussten wir die Seile und Fender auswerfen, das Boot an Land festbinden, dann die Seile an Land wieder losbinden und an Bord einholen. Nämlich immer dann, wenn wir durch eine Schleuse fuhren. Das war jedes Mal eine sehr spannende und diffizile Sache und wir kamen uns enorm wichtig vor.
Ich genoss die täglichen Fahrten auf dem Wasser, es war immer so still und friedlich. Auch einen Hund hatten wir an Bord. Hans besass eine Rottweiler Hündin, die dann natürlich auch einmal ins Wasser fiel. Dann waren alle sehr aufgeregt, so nach dem Motto: «Rettet den Hund». Lustig war’s allemal. Immer gegen Abend machten wir an Land fest. In regelmässigen Abständen gab es feste Ankerplätze, die man möglichst bis zur Dunkelheit erreicht haben sollte. Gekocht wurde entweder an Bord oder an Land, sofern ein Grillplatz vorhanden war. Manchmal sind wir aber auch ins Restaurant. Alles in allem funktionierte alles wunderbar, bis etwa zwei Drittel der gemeinsamen Ferientage vorüber waren. Dann kippte die Stimmung. Einerseits weil ich Urs eines Tages Rotwein trinken sah. Ich dachte, ich sehe nicht recht! Urs nahm doch das Antabus und damit konnte er unmöglich Alkohol trinken. Als ich ihn unter vier Augen zur Rede stellte, erklärte er mir, dass er das Antabus schon vor einigen Tagen abgesetzt hatte. Ich fiel aus allen Wolken, war entsetzt und enttäuscht und wusste, jetzt geht alles wieder von vorne los.
Andererseits, weil mir mehr und mehr die Freundin von Franz auf die Nerven ging. Immerzu erklärte sie mir, der Hans macht das so, der Hans mag das so und nicht so, der Hans sagt dies, der Hans sagt das. Sie hatte nie eine eigene Meinung oder sprach mal von «ich…». Ihren Hans hob sie in allen Dingen in den Himmel und sie selbst existierte gar nicht. Ich konnte es nicht mehr hören und ich konnte sie nicht mehr sehen. Sie lebte ein Frauenbild, das mich extrem ärgerte, weil ich das noch als Verstärkung meiner Probleme mit Urs wahrnahm. Es kam, wie es kommen musste, wir bekamen Streit. Ich sagte ihr meine Meinung und sie war beleidigt. Am Ende unserer Reise war ich froh, wieder nach Hause zu kommen.

Dann begann ein neues – altes Kapitel. Urs organisierte seine Nächte, ich sträubte mich mit mehr oder weniger (meistens weniger) Erfolg dagegen. Jede dieser Nächte bohrte eine tiefere Verletzung in meine Psyche und doch war ich dabei. Ich war bei allem dabei und litt so vor mich hin. Alle 2-3-4 Monate war es so weit. Er wurde unruhig. Was sollte ich tun? Wohin sollte ich gehen? Ich hasste ihn in solchen Zeiten und fühlte mich hilflos dem allen ausgesetzt. Vor allem fühlte ich mich masslos enttäuscht. Nicht weil er Frauen orderte, wie andere eine Ware aus dem Internet, und auch nicht, weil er Drogen nahm. Nein, ich war masslos enttäuscht, weil er mich Situationen aussetzte, die im Grunde unvorstellbar waren. Weil er mir etwas zumutete, wovor man normalerweise die Menschen beschützte, die man liebt und die einem nahe stehen. Aber Urs war nicht normal. Er war krank, er hätte dringend in eine Psychiatrie gehört.
Anlässlich unseres ersten Hochzeitstags im Jahr 2005, bekam ich von ihm eine echte Perlenkette geschenkt. «Für all diese Verletzungen…». Ich habe sie heute noch und bisher kaum getragen. Diese Perlen stehen für all die Tränen in diesen Jahren. Und doch liebte ich diesen Mann.
Beruflich hatte ich Urs bisher sehr erfolgreich erlebt. Einerseits hatte er ein Gespür für Menschen und ihre Fähigkeiten. Er verstand es, die Stärken der Mitarbeiter herauszukitzeln, auch wenn sie verschüttet waren oder der Person ihre Stärke gar nicht bewusst war. Beispielsweise arbeitete eine Frau in den End-Dreissigern in der Hauswirtschaft als normale Reinigungskraft. Die Jahre vor ihrem Reinigungsjob war sie zuhause und zog zwei Kinder auf. Sie war die Ehefrau eines Pfarrers, hatte keine Ausbildung, war von Beginn an Hausfrau. Urs spürte, dass sie mehr konnte und auch bereit war, in ihren Beruf zu investieren. Er riet ihr zu einer Ausbildung im hauswirtschaftlichen Bereich und sie packte es an. Als ich sie kennenlernte war sie die Hauswirtschaftliche Leitung des Alters- und Pflegeheims. Ebenso eine andere Mitarbeiterin. Sie stammte aus dem ehemaligen Jugoslawien. Eine junge Frau, die sich gut integriert hatte. Auch sie machte Karriere unter Urs Fittiche. Mich förderte er bezüglich meiner nicht mehr vorhandenen Fahrkünste und in Sachen Qualitätsmanagement von Non Profit-Organisationen. Das war der Dr. Hyde in ihm, den Mr. Jekyll lebte er im Geheimen aus. Den bekam nur ich zu spüren.
Doch seine Alkohol- Drogen und in gewisser Weise auch seine Sexsucht machten ihm mehr und mehr zu schaffen. 2005 fiel er des Öfteren wegen starker Stimmungsschwankungen auf und aus. Er konnte nicht arbeiten, traute sich nicht an den Arbeitsplatz. Der Psychiater verordnete ihm immer stärkere Medikamente. Mehr und mehr drängte ich Urs zu einer stationären Therapie. Leider war das lange keine Option für ihn. Er meinte immer nur, das würde schon wieder werden. Es wären halt so «Phasen». Doch ich blieb dran. Im Spätsommer 2005, als ich eine Woche Ferien hatte und Urs krankgeschrieben war, wollte ich unbedingt mit ihm irgendwo in einer Klinik ein paar Tage Wellness machen. Ich dachte, das täte uns beiden gut und ich könnte auch Urs wieder etwas aufmuntern. Ich selbst wusste nur zu gut, wie es ist, wenn man den eigenen Körper nur noch negativ erlebt. Ich sehnte mich sehr nach einem positiven Körpergefühl. Immer nur Sorgen, Angst und Schmerz und meine eigenen Probleme mit dem Essen. Immer schon taten mir Massagen und Wärme gut und das wollte ich Urs ebenso vermitteln. Zuerst war er einverstanden und von der Wellness-Idee sogar angetan. Wir hatten uns für ein Hotel im Kanton Luzern am Ufer des Vierwaldstätter Sees entschieden. Je näher der Zeitpunkt rückte, desto mehr freute ich mich darauf und umso mehr distanzierte Urs sich davon. Er hatte andere Pläne. Einen Tag vor unserer Abfahrt erklärte er mir, dass er mich hinfahren würde, dann jedoch wieder heimfahre. Er wolle die vier Tage allein zuhause geniessen. Natürlich war mir klar, dass er die Tage allein nützen würde, um wieder eine seiner «Partys» zu feiern. Aber im Grunde war mir das egal, ich konnte ihn sowieso nicht umstimmen. Ich dachte, ich mach jetzt etwas für mich und freue mich darauf und bleibe ganz bei mir.
Ich genoss die Zeit. Joggte morgens am See entlang, machte einmal eine Schifffahrt über den See, meldete mich zu zwei Massagen an und genoss das feine Essen im Restaurant. Am Morgen des vierten Tages erreichte mich der Telefonanruf von Sonja. Mittlerweile hatte ich mich mit ihr angefreundet, denn mit ihr konnte ich alle meine Probleme mit Urs offen besprechen. Mit ernsten Worten informierte sie mich über einen Anruf von Urs, in dem er einen Selbstmord androhte. Er würde sich die Pulsadern aufschneiden, wenn sie nicht sofort zu ihm käme. Einerseits wollte er sie überreden, an seiner Drogenparty mitzumachen, anderseits sei er wohl allein daheim und würde völlig durchdrehen. Ich nahm die ganze Sache nicht so ernst, da ich wusste, dass er zu sehr drastischen Aussagen neigte, wenn er Menschen zu einer seiner Kokainnächte überreden wollte. Doch Sonja versicherte mir, dass er es durchaus ernst meine, denn er hätte schon an sich herum geschnitten. Sie wäre nämlich bei ihm gewesen und er hätte an den Armen geblutet. Sie hätte den Notarzt gerufen, weil er komplett wirres Zeug geredet hätte. Da meine Freundin eine erfahrene Krankenschwester war, war mir klar, dass irgendwas passiert sein musste, was ihn so von der Rolle brachte. Ich sagte ihr, ich hätte hier kein Auto, könne also nicht sofort kommen. Ursprünglich hatten Urs und ich abgemacht, dass mich Urs abholen würde und wir dann noch gemeinsam einen Tag in Luzern verbringen wollten. Da erklärte sie sich bereit, mich abzuholen.
Als ich zuhause ankam, hatte ich das Gefühl in eine Drogenhölle zu steigen. Alle Jalousien waren heruntergelassen, im Haus brannte kaum Licht, es stank nach Kokain, kalten abgestandenem Rauch und kaltem Schweiss. Sonja hatte mich nur abgesetzt und war dann wieder gefahren. Sie meinte, ich sollte jetzt mit Urs unter vier Augen reden. Darüber war ich in diesem Augenblick nicht so glücklich, denn ich fühlte mich höchst unwohl. Urs fand ich vor dem Fernseher auf dem Boden liegend. Er war nackt, in einen Bademantel gehüllt, kreidebleich und der kalte Schweiss lief im herunter. An einem seiner Arme hatte er Schnitte und verkrustetes Blut, doch es war offensichtlich, dass diese Verletzungen harmlos waren. Als er mich sah, stand er sofort auf und lief auf mich zu, wollte mich umarmen. Ich wich ihm aus. Er sah erbärmlich aus. Ich wurde zornig, schrie ihn an, was er denn da mache, ob er nicht einmal nur wenige Tage ohne mich durchhalten könne? Dass er mich fertig mache und noch vieles mehr. Ich habe ihm meine ganze Angst, meinen Frust und Ohnmacht ins Gesicht geschleudert. Er stand da, wie ein begossener Pudel. Und doch war ich ihm ziemlich einerlei. Die Sucht herrschte vor. Die Alkoholsucht, die Drogensucht, die Sexsucht. Letzteres vor allem. Das ganze Ausmass seiner vergangenen Tage habe ich erst Tage später erfahren. Ich fühlte mich so hilflos. Er weinte und bat mich, ihn in ein Spital zu bringen, sonst brächte er sich um. Ich packte ihn, so wie er war ins Auto und beide fuhren wir in ein Spital ganz in der Nähe. Dort überliess ich ihn den Notfallmitarbeitern und informierte den zuständigen Arzt über die Vorkommnisse der letzten Stunden und Urs Zustand, soweit er mir bekannt war. Ich bat den Arzt händeringend, Urs so lange wie möglich stationär zu behalten und ihn dann direkt in ein Suchtspital oder in eine psychiatrische Einrichtung zu überweisen. Leider war das ohne die Einwilligung von Urs nicht möglich und so wurde er nach drei Tagen wieder nach Hause entlassen.
Während einer meiner Besuche bei ihm im Spital erhielt Urs einen Anruf auf seinem Handy. Ich nahm für ihn ab. Dran war eine Mitarbeiterin aus dem Altersheim, die Urs unbedingt sprechen wollte. Nichtsahnend gab ich sie an Urs weiter und hörte mit an, wie Urs beruhigend auf sie einsprach. Es ginge ihm besser und sie solle sich keine Sorgen machen. Mir schwante Böses. Als ich an diesem Tag vom Spital heim kam und bei uns zuhause einparkte, rief die linksseitige Nachbarin meinen Namen. Sie bat mich, kurz zu ihnen hereinzukommen. Nur wiederwillig folgte ich ihrer Bitte. Dann erzählte sie mir, dass all die Tage, an denen ich nicht zuhause war, ein VW-Bus vor unserer Türe geparkt hätte. Ununterbrochen vier Tage lang. Sie hätten auch eine Frau mit langen blonden Haaren gesehen. Sie wüssten ja nicht, was wirklich ablief, aber dumm wären sie auch nicht. Sie wollten mich informieren und warnen. Ich hörte zu, sagte nichts und schämte mich in Grund und Boden.

Ich wusste, um wen es sich handelte. Es war Susanne, die Mitarbeiterin aus dem Altersheim. Mit ihr hatte er ein paar süsse, kokaingeschwängerte, sexreiche Tage verlebt. Deswegen war er auch finanziell so grosszügig, als er mich in meine Wellnesstage entliess. Ab diesem Zeitpunkt war ich mir sicher, dass unsere Ehe angezählt war. Was sich Urs in dieser Zeit noch alles geleistet hatte, kam nach und nach ans Tageslicht. Aufgrund seiner depressiven Verstimmungen, die immer öfter auftraten, blieb Urs immer öfter zuhause. Ich ging arbeiten, er nicht. Während er sukzessive unsere Hochzeitsgeschenke austrank (wir bekamen von den Mitarbeitern aus dem Ex-Jugoslawien Slibowitz und andere Spirituosen geschenkt), nutzte er diese Tage ebenfalls um via E-Mail’s um sich zu schlagen. An die Adresse seines Vorgesetzten und unseres Trauzeugen Franz schickte er unverschämte, beleidigende und ketzerische Mails. Dies, weil der ihn in einem persönlichen Gespräch aufgefordert hatte, in eine stationäre Therapie zu gehen. Natürlich war ihm und anderen Menschen in unserem Bekanntenkreis (zum Beispiel den Mitgliedern des Stiftungsrates) nicht entgangen, dass sich Urs mehr und mehr in den Abgrund trank und mich dabei mitnahm. Jeden Tag erfuhr ich neue Ungeheuerlichkeiten. Er hätte Geld veruntreut, anderen Aufträge zugeschoben ohne öffentliche Ausschreibung, hätte Boni vorbezogen, obwohl die ihm gar nicht zugestanden hätten, und andere schlimme Dinge.
Immer mehr sah ich, in welchem Sumpf Urs steckte, und es wunderte mich nicht, dass er über Suizid nachdachte. Dann kam der Tag, an dem ihm fristlos gekündigt wurde. Ich befand mich in meinem Büro, es war Spätherbst 2005, als ich zu meiner Vorgesetzten ins Büro gerufen wurde. Als ich eintrat, sassen sie, eine Kollegin des Personalbüros und Franz, der Stiftungsratspräsident und unser Trauzeuge (was er sicher mittlerweile bereute) um ihren Bürotisch herum und schauten mich betroffen an. Sie erklärten mir, dass sich Urs so viel geleistet hätte, dass er keine Minute länger mehr tragbar wäre. Und weil ich ebenfalls darin verwickelt wäre, müssten sie mir leider auch kündigen. Ich war mir keiner Schuld bewusst und war sowohl sprachlos wie auch entsetzt. Ich wusste nicht, dass es im Jahre 2005 immer noch die «Sippenhaft» gibt. Sie informierten mich, dass ich noch in Ruhe mein Büro räumen könne und ich dann freigestellt wäre. Es wäre keine fristlose Kündigung, ich würde noch drei Monate meinen Lohn erhalten, aber ab morgen müsste ich nicht mehr kommen. So hätte ich gut Zeit, etwas Neues zu suchen. Wie ein geschlagener Hund verliess ich den Raum, hatte Mühe die Tränen zurückzuhalten, wollte aber unter keinen Umständen vor diesen Menschen, die mich ungerechtfertigt entliessen, auch noch heulen. Einerseits konnte ich sie verstehen, anderseits war ich wirklich tiefverletzt. Wie konnten sie mich mit Urs gleichsetzen? Urs hingegen fühlte sich gar nicht schuldig. Er war der Meinung, endlich hätte er mal allen die Meinung gesagt.
Meine nächsten Wege führten ins RAV, das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum, zum Hausarzt und zur Gemeinde. Ich musste mich arbeitslos melden und meldete mich auch krank. Ich wollte für mich einen Ausweg, wollte mir als Angehörige eines Alkoholikers Hilfe suchen. Ich wusste, dass ich das nicht mehr allein schaffen konnte. Den Lohn hatte ich noch bis einschliesslich Februar 2006 und das war beruhigend, obwohl ich noch nicht wusste, wie es für mich danach weiter gehen sollte. Gleichzeitig trieb ich eine stationäre Therapie für Urs voran. Ich redete auf ihn und seinen Psychiater ein, recherchierte im Internet nach einer ausserkantonalen Klinik, die ihn auch aufnehmen würde. Urs wollte nicht im Aargau in eine Therapie, wegen seines «Rufs». Im Kanton Luzern wurde ich fündig. In Meggen fand ich eine Privatklinik, die uns zunächst einen Termin für ein Aufnahmegespräch anbot. Ich war sehr angetan und auch Urs zeigte sich interessiert und motiviert. Das Problem war nur, dass die Krankenkasse die Kosten nicht übernahm und die waren einfach schon happig. Da ein Aufenthalt von unter drei Monaten von vorneherein nichts nützte, versuchte ich mit aller Kraft das Geld aufzutreiben. Ich pumpte meine Familie an. Mein Bruder lieh mir das Geld für einen Monat Aufenthalt, ich schaute, was Urs und ich noch auf unseren Konten hatten, was auch noch einen Monat abdeckte und der dritte Monat würde sich schon ergeben. Dachte ich.

So startete Urs endlich Ende 2005 / Anfang 2006 seine stationäre Therapie. Ich besuchte ihn regelmässig ein bis zweimal pro Woche. Wie es mir während dieser Zeit ging interessierte niemanden und mich auch nicht. Ich denke, ich habe einfach nur funktioniert. Eines war jedoch klar, ich frass und erbrach wieder viel öfter und trank auch deutlich mehr Wein. Mir war bewusst, dass ich ebenfalls hochgefährdet war, dass ich neben einer Ess-Brechsucht auch noch auf dem besten Weg war, mir ein Alkoholproblem anzueignen. Trotzdem wollte ich alle meine Sorgen manchmal einfach nur vergessen. Was tat ich tagsüber? Ich war ja krankgeschrieben. Ich ging zweimal in der Woche ins Yoga, drei bis viermal ging ich joggen und sass ansonsten am PC oder putzte. Ich schrubbte die Fugen des Plattenbodens mit dem Zahnbürstchen. Und ich frass und erbrach.
Dann, als ich wieder einmal Urs in Meggen besuchte, erzählte er mir freudestrahlend, dass es hier eine tolle Frau gebe. Die müsste ich unbedingt einmal kennenlernen. Die wäre wirklich so was von Klasse! Es war wirklich demütigend und es war mir so verleidet, mir ständig Urs Flirtergebnisse anhören zu müssen. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, habe ich mich in dieser Zeit eigentlich gar nicht gefühlt. Ich hatte keine Freude, keine Trauer, keine Wut und auch sonst nichts in mir. Es war mir so einerlei, wie und was mit uns passierte. Während dieses Besuchs, als ich noch darüber nachdachte, ob ich auf der Stelle wieder abfahren sollte, erklärte mir Urs, dass er seinen Aufenthalt in der Klinik beenden werde. Er wäre jetzt schon einige Wochen hier und entweder er würde es schaffen oder nicht. Er wolle aber nicht noch mehr Geld hier reinbuttern. Er könne das ja auch niemals meinem Bruder zurückzahlen.
Gesagt, getan! Nur wenige Tage später war Urs wieder zuhause und ich befürchtete, dass unser Leben jetzt einfach weiter zwischen Weinflaschen, Kokainnächten (dafür brachte er immer Geld auf) und den wenigen heiteren Momenten dahinplätschern würde. Das wollte ich auf keinen Fall. Und ich wollte raus aus dieser Absturzrolle. Da Urs von Therapie nichts mehr hören wollte, begann ich für mich selbst zu recherchieren. Ich wollte nun endlich etwas gegen meine Ess-Brechsucht unternehmen, wollte nur noch für mich kämpfen und nicht mehr für Urs und ich fand, dass der Zeitpunkt genau der Richtige war.
Damals, während meiner Suche nach einer Klinik für Urs war ich schon einmal auf eine Klinik nur für Frauen gestossen. Sie befand sich in Herzogenbuchsee, im Kanton Solothurn, war also auch ausserkantonal, aber es gab nur diese Eine, die sich auf die Essproblematik spezialisiert hatte und mein Hausarzt unterstützte meine Pläne sehr. Mit seiner Hilfe und meinem Willen auf Veränderung bekam ich in Herzogenbuchsee einen Termin bei der Leitenden Ärztin, und konnte das erste Mal seit Beginn meines Lebens in der Schweiz die ganze Situation darlegen. Ich verschwieg nichts. Oder, naja, vielleicht manch ein Detail der Kokainnächte, aber das interessierte sowieso nicht. Sie hörte zu, schrieb mit, hakte da und dort nach und nickte immer wieder verständnisvoll. Dann, als ich fertig war sagte sie drei Dinge: von ihrer Seite aus könne ich in die Klinik eintreten; der Vertrauensarzt der Krankenkasse müsse zwar noch sein O.k. geben, aber das wäre nicht wirklich ein Hindernis und dass ich die ersten sechs Wochen nicht nach Hause fahren dürfe und mein Mann absolutes Besuchsverbot hätte. Ich war mit allem einverstanden und zog nur wenige Tage später, Anfang März 2006 in die Klinik ein. Es sollten sechs Monate werden. Sechs Monate, in denen ich mein Leben innen und aussen aufrollte, umkrempelte, analysierte, zerlegte und wieder neu zusammenbaute.
Während der ersten Tage hatte ich zunächst nur «Kennenlern-Termine», bei der Psychologin, dem zuständigen Arzt, der jedoch nur auf Termin in die Klinik kam, den verschiedensten Therapeutinnen und der Sozialarbeiterin, die das «Aussenherum» begutachtete. Also die beruflichen, finanziellen und familiären Aspekte. Einerseits genoss ich die Wochen in der Klinik, an denen ich weder Besuch empfangen noch nach Hause durfte. Anderseits waren meine Gedanken ständig bei Urs. Was machte er wohl? Wie ging es ihm? Doch diese Fragen waren müssig. «Er war kein kleines Kind mehr und ich muss versuchen. innerlich ein wenig loszulassen. Ich will für meinen Mann keine Verantwortung mehr übernehmen müssen. Ich habe sie an ihn zurückgegeben und ich schaffe es, mich mehr und mehr auf mich selbst zu konzentrieren». Das alles dachte ich… naja… war dann wohl nichts.
Mit den Wochen begannen die Therapien, Gespräche und ich musste mich mit mir selbst auseinandersetzen. Zuerst wehrte ich mich gegen die übervollen Teller, die sowohl zum Mittag als auch zum Abendessen aufgegessen werden mussten. Ich hatte schon lange keine richtige Essstruktur mehr und fühlte mich völlig überfressen. Auch das war ein langer Prozess: vertraue auf Deinen Körper, er macht es schon richtig. Die Kontrolle über das Essen! Wieviel und was zu welchen Zeiten? Diese Kontrolle aufzugeben, war der grösste Schritt in Richtung «Raus aus der Essstörung». Das ist mir unsagbar schwergefallen und ich fühlte mich so ohnmächtig und ängstlich. Um meine Gefühle kanalisieren zu können, halfen mir primär das Joggen, Malen und die Einzelgespräche.
Eine weitere Herausforderung war die Sache mit den Gefühlen. Ich fühlte mich nicht mehr. Ich wusste nicht, was mir wichtig ist. Ich wusste nicht mehr, wie ich erkennen konnte, was ich will und was ich nicht will. Ich hatte mich über die vielen Jahre mit Essattacken und Erbrechen verloren. Ich war mir unwichtig geworden, kümmerte mich nicht mehr um meine Seele, ging nicht mehr liebevoll mit mir um. Ich hatte viele Jahre auf mich eingeschlagen, behandelte mich selbst archaisch und schlug alle Bauchgefühle in mir tot.
Für die Einzeltherapie hatte ich die ersten vier Monate eine junge, frisch von der Uni kommende Psychotherapeutin. Sie war sehr nett, harmlos und ich konnte sie leicht um den Finger wickeln. Eigentlich schrieb ich ihr vor (natürlich zuerst unbewusst) wie sie mit mir zu reden hatte und natürlich ging sie auf alle meine Wünsche ein, z.B. in welche Therapie ich wollte oder dass ich mehr Salat oder Früchte essen durfte oder dass ich Joggen gehen konnte, wie es mir gefiel und stellt nie unangenehme Fragen. Das war gut fürs Leben dort, half mir in meinem Vorwärtskommen jedoch wenig. Sie forderte mich nicht, dafür war ich einfach viel zu abgebrüht. Die Gruppentherapie wurde von einer erfahrenen, mittelälteren Psychologin geleitet, die die entscheidenden Fragen stellte, allerdings an die ganze Gruppe. In der Gruppe schützt die Gruppe und die Einzelne konnte sich innerhalb der Gruppe ducken. Da ich grundsätzlich zu den älteren Patientinnen gehörte, entwickelte ich von Anbeginn eine mütterlich zuhörende und angeblich psychologisch, lebenserfahrene Seite, die ich in erster Linie den wahnsinnig mageren Anorexie-Mädchen anbot. Speziell für eine hatte ich immer ein offenes Ohr. Sie tat mir auf der einen Seite leid, auf der anderen Seite fühlte ich mich provoziert durch ihre Essensverweigerung. Ich weiss noch, dass sie ständig die Treppen rauf und runter rannte, weil sie so einen ungeheuren Bewegungsdrang hatte, aber nicht draussen joggen gehen durfte. Sie wog bei 175 cm nur 34 kg. Sie musste 6 Mahlzeiten zu sich nehmen, von denen zwei hochkalorische Schokoladengetränke waren, die man ständig auch ausgeleert im Garten hinter den Stühlen fand. Trotz Aufsicht! Das Mädchen war oft so verzweifelt und trotzdem machte sie uns wütend. Das thematisierte ich einmal während einer Gruppentherapie. Ich hatte mit allem gerechnet, aber nicht mit der scharfen Zurechtweisung durch die Psychologin, mich bitte nur um mich selbst zu kümmern und keine Verantwortungen für meine Mitpatientinnen zu übernehmen. Von da an zog ich mich öfter zurück und reflektierte mehr mein eigenes Leben als das der anderen. Ich hatte Maltherapie, Einzel- und Gruppengespräche, Werken und Töpfern, Walken, arbeitete in der Hauswirtschaft mit Küchendienst und Glätten, später auch im Garten und ging zum Trommeln und zur Therapie für Körperwahrnehmung. Alles in allem war ich recht beschäftigt und trotzdem fand ich Zeit zum Joggen und zum Tagebuch schreiben. Täglich am frühen Morgen setzte ich mich hin und schrieb, was mich umtrieb und beschäftigte. Die zwei Hauptthemen waren natürlich meine Ehe und die weitere berufliche Zukunft.
Weil die Essstörung DAS Thema dieser Biografie ist, werde ich nun über einige Seiten aus meinen Tagebüchern zitieren, die meine Zeit im Wysshölzli abbilden. Die Aufzeichnungen zeigen vor allem der innere Kampf, mich von Urs loszusagen. Es ist ein Weg zu erkennen, der sich ganz langsam formt. Die Erkenntnis, dass es Mut benötigt in eine Richtung zu gehen, die das eigene Leben bevorzugt, ist ein wichtiger Schritt raus aus der Opferrolle. Menschen und gewohnte Umgebungen loszulassen ist schwer. Aber wenn sie zerstören, dann lohnt es sich. Nur dann besteht eine reelle Chance auf einen Neuanfang. Zu erkennen, dass Loslassen der richtige Weg ist und dass auch in vermeintlich ausweglosen Situationen bei genauem Hinschauen ein Lichtstreif am Horizont zu erkennen ist, das ist Neuanfang.

1.3.2006
«Heute ist mein Eintrittstag in die «Fachklinik für Essstörungen und Suchterkrankungen Wysshölzli» in Herzogenbuchsee. Urs hat mich auf 10.15 hierher begleitet. Unterwegs war starker Schneefall und Stau, sodass wir das Doppelte an Fahrtzeit benötigten.
Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet in den nächsten 3 Monaten. Zugleich mache ich mir auch Sorgen. Warum sollten die auch mal nicht da sein? Sorgen begleiten mich ja schon seit Beginn meiner Partnerschaft mit Urs. Also auch heute. Gerade heute. Wird er zurechtkommen alleine? Wird er abstürzen? Wird er in ein depressives Loch fallen?
«Wenn es so ist, ist er für sich selbstverantwortlich. Er ist für sich selbst verantwortlich…» Zum – ich weiss nicht wievielten Male sage ich mir das! Mein Mantra seit langer Zeit.»
Gleich zu Beginn des ersten Gesprächs mit Frau Dr. …, der Klinikdirektorin und Psychotherapeutin, wurde ich darüber informiert, dass ich so lange an den Wochenenden nicht nach Hause dürfe, solange Urs zuhause trinken würde und keinen Therapieplatz hätte.
«Das hat mich einerseits geschockt, anderseits habe ich gedacht (gehofft) Urs trinkt ja jetzt nicht und will sich ja auch auf sein Bewerbungsgespräch vorbereiten. Doch wieder mal falsch gehofft! Wir haben am Abend 2x telefoniert und er lag betrunken im Bett. Hat geheult, dass er mich vermisst usw. Das macht mich einfach traurig und fertig. Aber ich ziehe meinen Aufenthalt durch. Das ist MEINE ZEIT! Wie lange habe ich darauf gewartet!!»
Dass ich einen Platz in dieser Klinik bekommen habe, empfand ich als grosses Glück. Ich war mir sehr bewusst, dass dies die allerletzte Chance war, mein Leben doch noch einmal herum zureissen. Dass es aber so schwer würde, hätte ich nicht gedacht.
2.3.2006
«Schon der zweite Tag vorbei. Heute hatte ich mehr Termine, was die Zeit doch massiv verkürzt. Zunächst wurde ich um 6.50 Uhr gewogen. Spezifisches Gewicht: 54.6 kg. Das ist mein Gewicht, mit dem ich mich wohl fühle und deswegen möchte ich eigentlich auch nicht zunehmen. Aber ganz wird sich das wohl nicht vermeiden lassen – bei diesen Portionen und fünf Mahlzeiten am Tag. Das soll jedoch nicht mein Problem werden, ich bin da, um meine Kräfte zu stärken, für mich herauszufinden, wohin mein künftiger Weg gehen soll und um meinen Hang zu Süchten endgültig abzulegen. Also, mit gutem Mut voran!»
Die internen Regeln waren teilweise hart. Wenn man zu spät zu den Mahlzeiten erschien, auch wenn es an Gesprächen oder Therapien lag, musste man sich öffentlich bei allen entschuldigen. Oder man wurde im Plenum – der wöchentlichen Zusammenkunft aller Ärzte, Therapeuten und Patientinnen – bei Rückfällen während der vergangenen Woche, vor allen verwarnt.
«Im Plenum kommen alle Bereichsleiter und alle Patientinnen zusammen. Anhand einer Traktandenliste wird sowohl ein Rückblick auf die vergangene Woche der einzelnen Gruppen gehalten als auch Neuigkeiten (wir beiden Neuen haben uns vorgestellt) Infos und Rückschläge bekannt gegeben. Mein Eindruck war, dass die Anorexie-Patientinnen am meisten Mühe mit den Therapieregeln haben. Eine musste aus der Klinik austreten, weil sie nach sieben Monaten noch immer nicht das Zielgewicht (BMI 18) erreicht hat. Eine andere kommt mit dem Pflegepersonal nicht klar und wurde deshalb vor der ganzen Versammlung zurechtgewiesen.»
Das erste Wochenende in der Klinik fiel mir schwer. Ich durfte mich nur in Begleitung draussen bewegen. Nicht joggen, nur spazieren gehen.
5.3.2006
«Samstag ist rum! Zum Glück ist es nur ein Wochenende, an dem ich nicht raus darf, resp. nur in Begleitung. Aber mit Begleitung am Wochenende ist es so eine Sache. Entweder sind sie im Wochenendurlaub und wenn nicht, machen sie Ausflüge ins Dorf oder nach Bern, Solothurn etc. So habe ich halt viel gelesen, fernsehen geschaut, Wäsche gewaschen, Mahlzeiten eingenommen und zweimal mit Urs telefoniert. Das hat mich schon froh gestimmt, als ich seine aufgestellte Stimme am Telefon hörte. Die Kinder sind dieses Wochenende da und er freut sich sehr.
Nachdenklich stimmt es mich aber auch. Es ist schon erstaunlich, fasst schon erschreckend, wie stark meine Gefühle von der Stimmung meines Partners abhängig sind. Das möchte ich gar nicht, denn das macht mich abhängig. Und dann fällt es mir natürlich auch schwerer, Entscheidungen für mich zu treffen. Liebe macht mich wie gefühlsgelähmt.»
War es wirklich die Liebe, die an allem schuld war? Nein, das war ein Irrglaube. Heute ist mir bewusst, dass ich abhängig war von seiner Akzeptanz und dass ich ständig Schuldgefühle ihm gegenüber hatte. Warum eigentlich? Ich fühlte mich so minderwertig und als Versagerin wegen meiner Essstörung. Wer will schon solch eine Frau?
7.3.2006
«Heute um 9.00 Uhr hatte ich das erste Gespräch mit der Sozialarbeiterin. Sie möchte mit mir das wirtschaftliche Umfeld – vor allem die Situation nach dem Aufenthalt im Wysshölzli, anschauen. Meine Schwerpunkte sind in diesem Bereich ja die berufliche Situation sowie ev. auch noch die private Wohnsituation. Aber das hängt primär von Urs ab. Ich bin zuversichtlich. Das kann ich jetzt einfach so fühlen.»
10.3.2006
«Gestern hatte ich das erste Mal Musiktherapie. Geprägt war diese Stunde von vielen Emotionen. Vor allem deshalb, weil eine Mitpatientin einen Alkoholrückfall hatte. Sie war sehr wütend über sich selbst, aber auch traurig. Bei mir hat diese Stunde Melancholie ausgelöst. Das tut Musik meistens. Mit Musik kann ich Gefühle entdecken und ausleben. Jede Art von Gefühlen. Auch Wut und Hass.
Nach dem Abendessen habe ich mit Urs und Mama telefoniert. Auch das ist für mich wichtig. Zu spüren, dass ich von meiner Familie getragen werde. Ich liebe Urs so sehr und wünsche mir so sehr eine gemeinsame Zukunft mit ihm.»
12.3.2006
«Urs kommt heute auf 10.00 Uhr. Ich freue mich sehr auf ihn. Zumal ich mir gestern fasst den ganzen Tag Sorgen gemacht habe. Er hatte gestern genau zu der Zeit angerufen, als ich joggen war, zwischen 9.00 Uhr und 9.40 Uhr. Ab dann habe ich den ganzen Tag versucht, ihn telefonisch zu erreichen. Erst gestern Abend habe ich ihn dann erreicht. In mir ist einfach immer Angst um ihn. Er könnte einen Absturz (Kokain) haben oder sich etwas antun. Jetzt vermute ich, er hatte eine weibliche Verabredung – welcher Art auch immer. Das ist aber genau das, was ich alles lernen muss – um meiner Selbst willen. Sorgen und Ängste ablegen, ihm seine Verantwortung zurückgeben. Aber auch für mich selbst Verantwortung übernehmen, was heisst: sagen, und zwar sofort, was mir weh tut, was ich nicht möchte. Das ist das Entscheidendste, das ist die Quintessenz meines Lebens, seit ich die Tochter meines Vaters bin.»
Ein Thema beschäftigte mich immer und immer wieder. Die Sorge um Urs. Solange das so war, konnte ich mich nicht auf mich selbst konzentrieren.
14.3.2006
Ich bin schon seit 3.00 Uhr wach und kann einfach nicht mehr einschlafen. So viele Gedanken gehen mir durch den Kopf. Und Sehnsucht. Sehnsucht nach einem leben ohne Sorgen. Gestern Abend hatte ich wieder ein sehr anstrengendes Telefongespräch mit Urs. Ich habe jetzt für mich beschlossen, ihn nur noch vormittags anzurufen, wenn er noch halbwegs nüchtern ist. Er hat geplant, mich zu besuchen.
Dann ist da Virginia. Sie ist anorektisch, sehr anorektisch. Das ist das Mädchen, die ihr Schokigetränk im Garten ausleert. Sie hat in der vergangenen Woche ihr Zielgewicht nicht erreicht. Deswegen gab es um 17.00 Uhr eine Krisensitzung der Gruppe D (unsere sechs Personen). Sie kann darin sagen, was die Gründe für das Nichterreichen sind, resp. was sie daran gehindert hat. Innerhalb der Gruppe werden dann Hilfestellungen überlegt und Erfahrungen ausgetauscht, was dieser oder jener schon einmal geholfen hat.»
Virginia hat mich während meines Aufenthaltes sehr beschäftigt. Sie war wie ein Abbild meinerseits. Sie hätte meine Tochter sein können.
19.3.2006
«Dieses Wochenende verbringe ich also wieder im Wysshölzli. Allerdings mit mehr Freiheiten. Mittlerweile gibt es auch hier ein paar Dinge, die ich nicht verstehe. Warum muss ich z.B. mit der Psychologin absprechen, ob ich meinen Mann am Sonntag besuchen darf oder nicht? Warum muss schon am Donnerstag im Plenum bekannt gegeben werden, wenn man Besuch erwartet oder nicht? Das weiss man dann oft noch gar nicht. Anderseits: wer versteht schon alles? Heute um 10.00 Uhr bekomme ich jedenfalls Besuch von Urs. Gestern war ich wirklich genervt wegen ihm und das werde ich ihm heute auch sagen. Alkoholsucht hin oder her. Am Dienstag oder Mittwoch kann er zum Entzug nach Königsfelden und darüber bin ich sehr froh. Offenbar belästigt er seit Tagen Sonja mit Telefonaten, SMS’ en und Mails. Sie solle kommen, er wolle mit ihr nur Sex, sie solle ihm Geld leihen usw. Wenn ich das so alles höre, muss ich mich echt fragen, ob ich überhaupt für ihn noch etwas machen will. Ich bin echt enttäuscht, dass er sich uns und mir gegenüber so destruktiv, so beschissen verhält. Eines werde ich ihm auch noch sagen; Ohne sein Zutun, und zwar sein dauerhaftes Zutun schaue ich mich nach einer Wohnung für mich um. Nach einer neuen Lebensperspektive. Eventuell auch in Deutschland – egal, ob wir verheiratet sind.»
Ich fasse es nicht, ich war NUR enttäuscht. Er geht wieder und wieder fremd, versucht es nicht einmal zu verheimlichen, trinkt exzessiv, hatte sicher auch Drogennächte und ich? Bin nur enttäuscht über sein destruktives Verhalten. WER WAR ICH? WO WAR ICH?
20.3.2006
«Gestern Abend kam Urs zu Besuch. Ich denke mal, hätte er nicht so dringend Geld benötigt, wäre er nicht gekommen. Es geht ihm schlecht, sehr schlecht. Er hat extrem gezittert, es war ihm schlecht und er konnte keinen klaren Gedanken fassen. Heute entscheidet es sich, ob er morgen oder am Mittwoch nach Königsfelden kommt. Mir ist wichtig, dass er so schnell wie möglich geht und er so lange wie nötig (und darüber hinaus) bleibt.»
22.3.2006
Urs ist nun endlich im Spital. Leider anders als erwartet. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde er per Rettungswagen abgeholt und nach Menziken ins Spital geschafft. Veranlasst hat das nicht zuletzt Urs selbst, jedoch hat sein Arzt diese Blitzeinweisung beantragt. Urs ging es einfach nur noch schlecht, ob mit oder ohne Alkohol. Am Montagabend hat er offensichtlich nach dem Heimgehen seiner Mutter, die für Ihn gekocht und gebügelt hat, drei Stilnox (Beruhigungstabletten) genommen. Danach hat er mir angerufen und mich nach seinem Necessaire gefragt und seinen Badelatschen…
Jetzt ist er noch in Menziken, dann wird er nach Königsfelden verlegt. Dort bleibt er die nächsten 14 Tage zum Entzug. Entweder kann er im Anschluss dort bleiben für eine Therapie oder er wird nach Rheinfelden verlegt. Hauptsache er zieht eine Therapie bis zum Ende durch. Du siehst, liebes Tagebuch, noch immer drehen sich meine Gedanken immer nur um Urs.»
Auch die Wochenenden erforderten immer eine Überlegung, ja manchmal war ich in einem Dilemma. Tut es mir gut, wenn ich nach Hause fahre? Wirft es mich zurück? Mittlerweile durfte ich das ja, aber eigentlich riet mir meine Psychologin davon ab. Anderseits hatte ich den Wunsch, regelmässig Urs zu erleben. Wie ist er drauf? Ist er böse auf mich? Ist er traurig? Bin ich daran schuld, dass er traurig ist? Meine Ehe spielte eine grosse Rolle und beeinflusste massiv mein Denken und mein Tun Das ist sicherlich bis zu einem gewissen Punkt normal, aber in meinem Fall oder im Fall von Sucht-Ehen, so wie unsere eine war, ist genau das der Ansatz der ganzen Therapie. Das zu verstehen, war ich lange nicht imstande. Ich habe mich dagegen gewehrt, dass die Psychologen meine Ehe bestimmen. Ich habe lange nicht kapiert, dass nur eine Trennung von diesem Mann meine Zukunft neu ausrichten konnte. Oder ich wollte es nicht wahrhaben.
25.3.2006
Heute fahre ich das erste Mal offiziell nach Hause. Ich freue mich sehr, obwohl es mir lieber wäre, ich könnte die Zeit für etwas anderes nutzen, als schon wieder Urs im Spital zu besuchen. Natürlich freue ich mich auch darauf, ihn zu sehen, aber irgendwann möchte ich auch von ihm unterstützt werden und nicht immer meine ganzen Gedanken für Urs brauchen. Es ist eh so, dass ich abends wieder zurück ins Wysshölzli muss - zumindest dieses Wochenende. Bis jetzt gibt mir diese Klinik Schutz, ist Rückzug und ein Zufluchtsort. Dort fühle ich mich sicher, auch vor mir selbst. Gestern hatte ich einen Gesprächstermin bei meiner Psychotherapeutin. Dieses Gespräch tat mir gut. Erstmals hat es sich nicht um Urs gedreht. Wir haben in meine Vergangenheit geschaut. Ich sollte eine Übersicht der letzten 28 Jahre erstellen. Sie ist noch nicht ganz fertig – naja, 28 Jahre sind auch nicht so schnell erledigt. Dabei ist mir erstmals wieder bewusst geworden, wie viel ich erlebt habe. Ruhe- und Friedenszeiten sind im Rückblick fasst keine vorhanden. Das ist erschreckend.
Ausserdem haben wir meine Essprotokolle besprochen. Sie hat mich gefragt, in welchen Situationen ich bezüglich der Bulimie Mühe hätte. Mir ist derzeit gar nicht aufgefallen, dass überhaupt eine Situation problematisch gewesen wäre. Und prompt: als ich gestern Nachmittag noch im Dorf war, hatte ich total Lust auf Kuchen oder so was ähnliches. Ich habe diese Esslust dann abwenden können, indem ich in ein Kleidergeschäft gegangen bin und mir etwas gekauft habe. Das ist zwar besser, aber trotzdem eine schlechte Lösung.
Ich fühle mich innerlich schon stabil, aber doch nicht zu 100%. Ich bin fest überzeugt, dass ich keine Essattacken mehr brauche, aber ich muss dafür kämpfen. Wir haben dann festgelegt, dass ich ab
kommendem Montag die Zwischenmahlzeiten unkontrolliert nehmen kann. D.h., bis auf Weiteres werden jetzt das Frühstück und beide Zwischenmahlzeiten bei mir nicht mehr kontrolliert.»
27.3.2006
«Samstag und Sonntag war ich zuhause. Tagsüber. Die Gesamtbilanz war miserabel. An beiden Tagen hatte ich Ess-Brechattacken. Scheisse. Deswegen bin ich dann gestern auch schon um 16.00 Uhr wieder zurückgefahren. Am Samstag hatte ich um 14.00 Uhr einen Termin bei Urs in Königsfelden. Zwei Minuten durften wir miteinander reden. Selbst auf diese zwei Minuten hatte ich keine Lust, denn ich war extrem wütend auf Urs, traurig und verletzt. In der Post vom Samstag befand sich die Strafanzeige einer Frau. Zwischen dem 2. und 7. März hatte Urs sie am Telefon sexuell belästigt. Es ist, als ob Urs gerade etwas abheilende Wunden wieder aufreisst. Immer öfter zweifele ich an einer gemeinsamen Zukunft. Irgendwann sind seine Pluspunkte aufgebraucht und dann kann und will ich nicht mehr. Ich bin so traurig!
Ich habe jetzt das Auto mitgenommen. Das war total schön. Über Land fahren und Musik hören.»
ERKENNTNIS, 29.3.2006, 4.00 Uhr
«Ich weiss nun, wie mein Gefühl war, als ich am Wochenende zuhause war. Ich habe gefroren. Es war mir kalt um meine Seele, kalt um mich herum. Enttäuschung macht kalt. Genauso habe ich mich gefühlt: innerlich frierend. Geborgenheit, das ist das, was mir immer fehlt und gefehlt hat.»
1.4.2006
… o.k., dann war meine Lieblingstherapie dran, das Malen. Die Stunden beginnt mit Meditation, immer. Die Therapeutin führt uns in uns selbst, wo wir unsere Empfindungen, Gefühle, unsere Träume, unsere «Kopfbilder» treffen sollen. Aus diesen Bildern heraus haben wir die Möglichkeit, ein für uns individuelles gemaltes Thema zu finden.
Für mich waren es zwei Fenster. Ein düsteres, dunkles, bedrohliches – aber auch mit Lichtblicken dazwischen, sowie ein helles, leuchtendes, sonniges, in dem sich Geborgenheit wiederfindet.
Als mein Bild fertig war, empfand ich es mehr als ein Fenster mit zwei Seitenteilen, die immer wieder abwechselnd auf und zu gehen. Für mich war das auch der Spiegel der letzten Monate (wenn nicht Jahre) und ganz aktuell, das letzte Wochenende.»
Die Bilder von damals habe ich lange gehütet und dann – in einem Akt des Abschiedes meiner Essstörungszeit - gefaltet und vernichtet. Das Malen selbst ist mir geblieben. Diese «Neuzeit-Bilder» hängen heute in unserem Haus und ich liebe sie.
4.4.2006
Gestern war der anstrengende Montag. Nein wirklich! Der Vormittag verlief noch eher ruhig. Da ich dann keine Therapien und Termine habe, kann ich mein eigenes Programm gestalten. Nach dem Abwaschen erst Joggen, dann Duschen, dann schnell ins Dorf. Päckle für Urs zur Post bringen, paar Sachen einkaufen und wieder zurück. Dann Zwischenmahlzeit und dann noch eine Stunde ins Malatelier.
Scheisse!! Komme gerade vom Wiegen. Heute muss ich meinen ersten Rückfall melden. Ich bin unter 54 kg gefallen. 53.9 habe ich, um genau zu sein. Dabei esse ich immer alles auf. Blöd, ich glaube, die Alkoholkalorien fehlen langsam. Gut, da gehe ich heute durch!!
Anstrengend am Montagnachmittag ist, dass dann allgemein immer die Rückfälle der Woche gemeldet werden, was dann immer zu einer bedrückenden Stimmung führt. So auch gestern. Eine Mitpatientin hat ihr Ziel nicht erreicht und es musste eine Krisensitzung einberufen werden. Die Krisensitzung findet immer innerhalb der Gruppe, in Anwesenheit einer Psychologin statt. Es ist immer erbärmlich und entwürdigend, weil alle einen bemitleiden, aber auch sehr hart ins Gericht gehen. Die Ankläger sind die Patientinnen selbst.
5.4.2006
Heute war unter anderem Kochgruppe. Sie findet von 10.00 bis 13.30 Uhr statt und ist für viele eine echte Herausforderung. Jede Woche muss eine andere aus der Gruppe das Menü bestimmen, einkaufen und unter Mithilfe der anderen kochen. Heute gab es Salatteller, Paella und Beeren Soufflé. Der Salat war fantastisch, das Soufflé auch, die Paella war zu flüssig und zu weichgekocht und geschmacklich…hmhm… naja. Nach den Kochgruppenmenüs fühle ich mich jedes Mal total vollgefressen. Und hinterher ist dann Entspannung bei Frau G. Himmlisch! Die Arme hat, nach Ansicht der Patientinnen, einen völlig blöden Terminplatz für ihre Entspannung. Vor allem die Anorexiefrauen drehen fasst durch. Nach der Kochstunde keine Bewegung! Im Gegenteil! Nächste Woche bin ich dran. Bärlauchsuppe, Spargel mit grüner Sosse und Kratzete und Apfel-Sahne-Creme.
Am Abend hatte ich noch ein Telefonat mit Urs. Er hatte gestern ja diese Orientierungsbesprechung, wie es weitergehen soll. Offensichtlich verlief das Gespräch katastrophal für ihn. Das Fazit von Königsfelden war, dass er in die Klinik im Hasel gehen soll, wo er auf keinen Fall hinmöchte. Hinzu käme noch, dass er auf der falschen Station ist (Drogen) und dass er offenbar massiv «beschnitten» wird. Er darf wohl nur spazieren gehen, wenn er dies oder jenes macht. Gemäss ihm wird weder der Stundenplan eingehalten noch die zu Beginn der Therapie gemachten Versprechungen. Heute nun will er mit dem Stationsleiter sprechen und hat einen Brief an den Klinikdirektor geschrieben. Ansonsten möchte er dort austreten, mit Hilfe von Antabus seinen Sozialeinsatz (Strafe wegen eines Verkehrsdeliktes) absolvieren und währenddessen auf einen freien Platz in Rheinfelden warten. Ehrlich gesagt, ich habe Angst vor einem Austritt von ihm. Vor dem, dass er wieder alleine zuhause ist.»
7.4.2006
Gestern war ein sehr schwieriger Tag für mich. Am Vormittag hatte ich um 10.30 Uhr nur Maltherapie und sonst den ganzen Tag nichts weiter. Bis es so weit war, sass ich im «Lismestübli» und habe an meinem Pulli Fäden vernäht. Plötzlich ist mehr und mehr eine Traurigkeit in mir hochgestiegen, ich konnte gar nichts dagegen tun. Traurigkeit über mein Leben, meine Gefühle, die Einsamkeit um meine Seele, die fehlenden Wärme um mich herum und nicht zuletzt auch das Gefühl der Wertlosigkeit. Während der Anfangsmeditation in der Maltherapie konnte ich meine Tränen nicht mehr zurückhalten. Die Therapeutin hat mir sehr geholfen. Ich bräuchte mich nicht zu schämen. Alle meine Gefühle erlebe ich jetzt ungefiltert, ohne Alkohol und bulimische Essattacken. Am Nachmittag fand das Hauptplenum statt und im Anschluss die Gruppentherapie, wo ich meinen Rückfall vom vergangenen Wochenende bekannt gab. Und während dieser Stunde kamen wieder alle Gefühle hoch und ich brach in Tränen aus. Ich trauere um mich selbst.
Ich habe auch das Gefühl, ich bräuchte mehr Einzeltherapiestunden. Die Therapeutin ist wirklich nicht oft da. Bis dato hatte ich erst drei richtige Gesprächsstunden. In der Gruppe hatte ich das Gefühl des Aufgefangenwerdens. Ich weiss, hier sind Menschen, die mir über solche Momente hinweg helfen können. Ich wurde gefragt, was ich denn vorher unternommen hätte, wenn ich solche traurigen Gefühle bekommen habe. Mir ist tatsächlich nichts anderes eingefallen als «Fressen, Kotzen, Saufen». Halt doch, in den letzten Jahren auch Joggen.
8.4.2006
Heute fahre ich nach Königsfelden, Urs holen. Er tritt aus, weil er in Königsfelden nicht mehr weiterkommt. Am Montag hat er einen Termin bei seinem Psychiater, um mit Antabus zu starten. Am Dienstag trifft er sich mit einem ehemaligen Kollegen, um in dem Seniorenheim, in dem der Kollege Heimleiter ist, seinen sozialen Einsatz abzuleisten. Gleichzeitig wartet Urs auf seinen Eintritt in die Klinik in Rheinfelden. Dort werden in erster Linie Menschen mit Burn Out behandelt. Ob das der richtige Platz für Urs ist? Hoffentlich geht alles gut. Hoffentlich!!
Gestern hatte ich noch ein Gespräch mit meiner Therapeutin. Es verlief sehr gut, ich konnte Ihr vieles aus meiner Vergangenheit erzählen. Sie meinte, meine «guten Zeiten» waren nur dann, wenn ich Single war und alleine gelebt habe. Trotzdem war ich sofort wieder auf der Suche nach einer Partnerschaft. Immer habe ich, um ein Minimum an Wärme und Zuneigung zu bekommen, das Maximum in Kauf genommen, respektive erduldet oder toleriert. Einprogrammiert schon in der Kindheit. Das Muster eines Kindes, das um die Liebe des Vaters bettelt. Natürlich konnte das keiner meiner Partner erfüllen, da ich ja auch gerade deswegen eher schwache, kranke Liebschaften hatte. Aus diesem Grund konnte sich die Bulimie prima in meinem Leben manifestieren. Der Hunger, der unstillbare Hunger nach Liebe, Zärtlichkeit, Anerkennung und Wertschätzung. Über meine Mutter konnte ich das nicht erreichen, weil sie in derselben Lage war, wie ich. Bei ihr hat er sich jedoch anders manifestiert. Sie machte unentwegt Diäten, hat sich in allen Tätigkeiten und Vereinen immens engagiert und schuf sich eigene Inseln, in denen wir Kinder keinen Platz hatten. Tennis gab ihr Anerkennung.
11.4.2006
Nachher habe ich wieder wiegen … mal sehen, was dabei herauskommt. Gestern hatten eine Gruppenkollegin und ich «Krisensitzung». Meine Krise ist ja schon eine Woche her. Blöd, ich habe gar nicht mehr daran gedacht. Ich wog 100g zu wenig. Naja, was soll ich sagen: in der Krisensitzung habe ich die Sachlage nochmals erklärt. Im Grunde konnte niemand aus der Gruppe gross etwas dazu sagen, weil niemand einen Fehler sah, bzw. eine gute Hilfestellung auf Lager hatte. Ich bin aus irgendeinem Grund beim letzten Wiegen um 100g leichter als mein definiertes Gewicht gewesen. Ich möchte, dass diese Definition nach unten auf 53 kg korrigiert wird. Heute wiege ich 54,1 kg. Das ist kein Rückfall, aber ich bin so eng am Limit, dass ich echt unter Druck stehe.
13.4.2006
Gestern war eindeutig Vollmond! Die Frauen spinnen! Oder vor den Osterfeiertagen sind alle so in heller Aufregung. Bei einer wurde 2x hintereinander Methadon im Urin nachgewiesen, was sie jedoch rigoros abstreitet und alle damit verrückt macht. Eine andere poltert herum, weil sie von jemandem verraten wurde. Sie wollte bereits heute am Gründonnerstag heimlich nach Hause fahren, was jedoch nicht erlaubt ist. Anstatt dass sie aber ganz ruhig ihren Mund hält und einfach den letzten Zug nimmt, möchte sie partout herausfinden, wer die Verräterin ist. Dabei ist sie es, die jeder von ihren Snowboardplänen erzählt. Da liegt das Verplappern sehr nahe…
21.4.2006
Gestern war anstrengend. Gestern war ich total wütend. Am Vormittag hatte ich nur Maltherapie, insofern war der Tag bis dahin ruhig. Urs ist jetzt in Rheinfelden – mehr eine Wellnessklinik als eine Suchtklinik. Aber ich kann mich jetzt wenigstens für ein paar Wochen auf mich selbst konzentrieren. Für den Nachmittag stand das wöchentliche Plenum auf dem Programm und anschliessend die Gruppengespräche. Im Plenum kam es zur hitzigsten und anstrengendsten Diskussion, die ich hier je erlebt habe. Es ging um Virginia und ihre Tischmanieren, ihr Zuspätkommen, ihr Desinteresse an der Therapie und an der Gruppe, ihr ganzes Sozialverhalten, ihre Hilfestellungen durch ihre Mitpatientinnen, die sie nicht annimmt.
Das ganze Haus hat ausgepackt.
Virginia sass da, wie versteinert und hat keinen Ton gesagt. Am Ende des Plenum haben wir dann auch noch erfahren, dass am Ostersonntag Virginias Vater total betrunken in der Klinik erschienen ist, um sie zu besuchen. All das war sehr hart für Virginia.
Wütend war ich auf die Leitende Ärztin wegen ihrer Arroganz, ihrer Unprofessionalität als Klinikleiterin und ihrer Nichtkenntnis der Gesamtlage. Ich hatte mich auch zu all den oben beschriebenen Punkten zu Wort gemeldet und anhand von Beispielen die Vorwürfe untermauert. Die Klinikleiterin meinte daraufhin: «Die Unterstützungen können Sie ja weiterhin geben aber therapieren müssen Sie Virginia nicht. Das ist meine Aufgabe. Wenn Sie alle meinen, dass nach sieben Wochen schon Erfolge zu sehen wären, haben Sie keine Geduld». Und zu mir persönlich sagte sie, sie könne mir jetzt schon sagen, dass ich so niemals Therapeutin werden könne, da ich so wenig Geduld habe.
Heute sehe ich das anders. Natürlich hatte die Ärztin Recht. Wir alle befassten uns viel zu sehr mit dem Mädchen, die am schwersten in ihrer Magersucht steckte. Und heute weiss ich auch, dass es Virginia gar nicht möglich war, anders zu sein. Alles an ihr war ein Hilferuf, aber sie konnte nur ganz winzig kleine Schritte machen, die wir gar nicht wahrnahmen. Ich mochte Virginia, aber durch die Zuschaustellung ihrer Krankheit wirkte sie ungeheuer provozierend.
Das war der Nachteil an der Klinik. Das gemeinsame Hochschaukeln der Essstörungen. Wir schauten immer auf die anderen. Haben sie wieder abgenommen? Schwindeln und betrügen sie während der Mahlzeiten? Schmuggeln sie Essen hinaus? All diesen intrigierenden Verhaltensweisen konnte man sich fasst nicht entziehen. Auch ich nicht mit meinen 43 Jahren. Ich war die Älteste der Essgestörten, weswegen sich einige der Mädchen mir anvertrauten. Es ist sehr, sehr schwer in einer Umgebung von psychischen Krankheiten und süchtigen Menschen seine innere, im Angesicht dieser Krankheit eh kaum vorhandene, Stabilität zu bewahren. Borderliner, Alkoholfrauen, unmenschlich magere, ausgemergelte Frauen, Medikamentenabhängige und durch jahrelangen Missbrauch von alledem geschädigte Gehirne und Psychen. Diese Mischung war für mich oft unerträglich. Und doch war dieser Aufenthalt ein grosses Glück für mich. Das erfuhr ich jedoch erst Monate nach meinem Aufenthalt dort, denn der Knopf ging erst später auf. Was meine eigene Bulimie betraf, war ich tatsächlich seit meinem Eintritt mit Ausnahme des einen Wochenendes symptomfrei. Doch das eine ist die Physis und das andere die Psyche, und die war noch lange nicht da, wo sie sein sollte.
Und übrigens, ich wurde später Therapeutin. In diesem Punkt hatte sich die die Klinikleiterin getäuscht.
22.4.2006
Hoffentlich klappt das bald mit dem Waldrandhaus. Ich habe schon vor zwei Wochen einen Antrag gestellt, dass ich in das Aussengebäude zügeln möchte. Wer symptomfrei und auch sonst relativ stabil ist, darf aus dem Klinikgebäude ausziehen und in das Aussenwohnhaus. Es liegt zwar auf dem Areal des Klinikgeländes, aber ist ein altes einzelnstehendes Berner Wohnhaus mit Balkon und wirklich schönen Zimmern. Früher war das sicher mal das Personalhaus der Klinikleitung oder auch der Therapeuten. Es steht wunderschön am Rande des angrenzenden Waldes, umgeben von Blumen und Sträuchern. Zwei Stockwerke können fünf Frauen beherbergen. Oben zwei und unten drei. Daneben gibt es je Stockwerk eine Küche und ein Badezimmer.
Gestern hatte ich eine Einzeltherapie bei meiner Psychologin. Diese Stunde hat mir sehr viel gebracht. Wie haben über das Thema «Verantwortung übernehmen – abgeben» gesprochen, aber auch über meine Schmerzgrenze – Toleranzgrenze und grundsätzlich über Abgrenzung. Sie meinte, wenn ich für mich zufrieden und psychisch gesund leben möchte, muss ich unbedingt lernen, mich abzugrenzen. Gegenüber Urs, gegenüber Virginia, gegenüber allen Menschen in meinem Umfeld, die eine Hilfsbedürftigkeit ausstrahlen. Ich kann andere Menschen nicht retten, wenn sie selbst es nicht wollen. Das müssen sie selbst tun. Ich kann ihnen Tipps geben, einfach für sie da sein und zuhören, aber ich kann ihnen bei ihrem Tun nicht die eigene Verantwortung abnehmen. Das gilt sowohl im privaten als auch im beruflichen Sinn. Keine zig Überstunden mehr und keine Verantwortung für eine Kaderstelle, obwohl ich nicht im Kader bin, resp. nicht dafür bezahlt werde. Wenn ich hier raus gehe, sollt mein Ziel sein, für mich zuschauen.
Noch weiss ich nicht genau, wohin «ich für mich schauen» soll. Was heisst konkret «für mich schauen?» Wie machen das andere Frauen? Bei Virginia kommt noch etwas anderes hinzu: ich erkenne mich teilweise selbst in ihr. Nicht wegen der Anorexie, nein. Aber diese Unfähigkeit zu handeln, bzw. die Unfähigkeit zu erkennen. Wie es um einen selbst steht. Das Ausmass der kranken Seele!
24.4.2006
Heute, Montag ist unser 2. Hochzeitstag!
Urs kommt mich heute Abend besuchen, wir gehen zusammen in eine Pizzeria hier im Ort. Gestern und vorgestern (Wochenende) waren herrliche, sonnige Frühlingstage. So wie das Wetter draussen, so sieht es auch in mir drin aus. Es scheint die Sonne, wir hatten es wirklich gut miteinander. Gestern Morgen bin ich zwar früh aufgewacht, nach dem Müesli zubereiten aber nochmals ins Bett. Ich habe mich so richtig nah an Urs hin gekuschelt. Das tut soo gut. Ich liege so gerne ganz nah an ihm dran.
25.4.2006
Gestern Abend ist Urs gekommen, damit wir zusammen unseren Hochzeitstag geniessen können. Bei Pizza und Mineralwasser. Ganz wohl war mir jedoch nicht. Ich hatte den Eindruck, Urs hatte getrunken. Er roch so sehr nach ausschwitzendem Alkohol. Diese typische alte Alkoholfahne. Auch seine Augen waren etwas gerötet. Dieses Gefühl hatte ich den ganzen Abend, weswegen ich mich gar nicht so sehr ihm zuwenden konnte. Ich habe ihn dann, in Anbetracht unseres Hochzeittages nochmals beschworen, abstinent zu bleiben. Er solle bitte nie vergessen, dass eine gemeinsame Zukunft mit Alkohol nicht möglich ist.
Heute hatten wir das letzte Mal Kunsttherapie bei Frau B. Sie wechselt in eine andere Klinik. Schade! In dieser Sequenz habe ich ein Bild «gestaltet», nicht gemalt. Auf schwarzem Papier habe ich rote, weisse und silbrige Farbe verteilt und dann das Bild gefaltet. Ein Quetschbild zunächst. Was dann danach draus geworden ist, hat mich wirklich erstaunt. Es musste so sein. Ich habe es abends Urs geschenkt. Es war wie für ihn gemacht. Vielleicht kann er darin für sich etwas erkennen. Hoffentlich.
Am Abend war noch jede Menge Radau zu hören: schlagende Türen, schreiende Frauen, eine Mitpatientin, die so den Stepper bearbeitete, dass es sich anhörte wie ein pulsierendes Gehirn kurz vor dem Schlaganfall. Es ist wirklich das Haus der verrückten Frauen.
26.4.2006
Urs trinkt wieder!
Ich bin traurig, enttäuscht, wütend und habe keine Lust mehr. Ich möchte nur noch meine Ruhe haben. Am liebsten möchte ich zurück nach Deutschland. Ich habe die Nase so gestrichen voll. Ich glaube langsam, meine Lebens,- Ehe- und Liebespartner traten nur zu einem Zweck in mein Leben: dafür zu sorgen, dass es mir nicht allzu gut geht!
Mein Filzzwerg fertig. Er sollte eigentlich ein Glücksbringer für Urs werden, aber ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich ihn weggeben will. Urs braucht in erster Linie Druck und einen eisernen Willen. Glück hatte er bis anhin so viel, er konnte es sogar mit Füssen treten.
27.4.2006
Nach einem Gespräch mit einer Mitpatientin, die Alkoholikerin ist, ADHS hat und das Borderline-Syndrom und die von sich und ihrer Familie erzählte, weiss ich nun meinen nächsten Schritt im Umgang mit Urs. Ich muss ihn loslassen. Mein letztes Instrument ist der völlige Rückzug von ihm. Ich habe beschlossen, dass ich kommendes Wochenende nicht nach Hause fahre. Wenn ich ihn jetzt nicht loslasse, beginne ich ihn zu hassen. Und ich selbst verliere mich. Das ist mein Leben und ich habe nur dieses Eine!
29.4.2006
Schlimm an der ganzen Rückfallproblematik von Urs ist die Sache mit dem Vertrauen. Ich lebe in der ständigen Unsicherheit «trinkt er, trinkt er nicht?» Hinzu kommt noch meine eigene Perspektive. Was bleibt vom Ganzen? Ich beginne bei null! Ich habe weder die Kraft noch den Willen ihn weiter durchs Leben zu tragen. Diese Gedanken waren gestern das Thema im Gruppengespräch und der Entscheid: er bekommt mich nur noch ohne Alkohol.
Anschliessend bin ich eine Stunde joggen gegangen, was einmal mehr Kopfreinigend war. Als ich zurück in mein Zimmer kam, hatte ich drei verpasste Anrufe und eine SMS auf meinem Handy. Alle von Urs. Ich habe ihn zurückgerufen und gleich mal festgestellt, dass er nüchtern klang. Das war gut. Er sagte mir, es sei ein Ausrutscher gewesen, den er echt bereue. Er habe ins Antabus hineingetrunken, weswegen es ihm in der Nacht grausam schlecht gegangen sei. Weshalb er das gemacht hat? Keine Ahnung! Wegen vielem und doch gar nichts Relevantem. Fürs Trinken findet der Trinker leider immer einen Grund. Ob ich heimfahre oder nicht muss ich mir trotz seinem Anruf noch überlegen.

1.5.2006
Am Wochenende war ich zuhause. Urs hat mich am Samstag so gegen 10.00 Uhr abgeholt. Er war tip top gut. Kein Geruch von Alkohol, nirgends etwas versteckt, er war guter Dinge und ich auch. Wir hatten es wirklich gut miteinander. Ich habe Kuchen gebacken, gewaschen, geputzt und alles bereitete mir grosse Freude. Gestern dann bin ich nach dem Joggen mit einer Gesichtspackung in die Badewanne und danach…ja, es war wundervoll. Seit langem hatten wir mal wieder tollen Sex!! Gegen 18.30 Uhr sind wir losgefahren, zurück nach Herzogenbuchsee.
Urs, ich liebe Dich! Du bist mein Herzblatt! Aber ein gemeinsame Zukunft gibt’s nur abstinent!
4.5.2006
… neben den mit vielen Therapien angefüllten Tagen kam gestern Abend nach dem Abendessen dann noch die anstrengendste Bombe. Sie heisst Melanie W., ist 28 Jahre alt und kommt aus dem Raum Basel. Wir hatten Vorplenum – sie ist gestern erst eingetreten – und sollte sich vorstellen. Meine Güte, so habe ich das echt noch nie erlebt. Aufgestaute Depressionen, Verzweiflung, Selbsthass und Todesgedanken, alles brach wie ein Schwall aus ihr heraus. Was muss diese Frau gelitten haben. Seit 14 Jahren leidet sie an Essstörungen. Ursprünglich hatte sie Anorexie. Mit einem BMI von 9 (Neun!) fuhr sie noch mit dem Velo in die Schule. Sie wog nur noch 21 Kilo. Der Hausarzt hat sie per FFG in ein Spital einweisen lassen. Mit Magensonde kam sie drei Tage später in die Psychiatrie, weil sie akut suizidgefährdet war. Dort wurde sie zwangsernährt. Der Körper ist jetzt zwar aufgepäppelt aber ihre Psyche kam und kommt immer noch nicht mit all dem klar. Sie hasst sich und ihren Körper über alle Massen, will nicht mehr leben, weil sie gar nicht mehr weiss, wer sie ist. Sie fragt sich, wofür sie überhaupt lebt. Ihre einzige Bezugsperson, ihr Vater, ist vor einigen Jahren gestorben. Traurig, sehr traurig. Und in all das Leid platzt Virginia mit ihrem Bewegungsdang. Sie wollte partout gehen, weil sie abgemacht hat. Dumme Nuss! Wir hätten sie erwürgen können. Wie unsensibel und gleichgültig ist das denn?
6.5.2006
Gestern hatte ich ein Gespräch mit der Psychotherapeutin Frau G. Sie ist die Vertretung von meiner sonstigen Psychologin Frau K. und ich muss sagen: am liebsten hätte ich alle Einzeltherapiestunden bei ihr. Sie ist wesentlich älter als Frau K., routinierter, geht nicht nach Schema F, sondern sieht die Person individuell, die vor ihr sitzt. Ich hatte während des Gesprächs ein sicheres, geborgenes Gefühl. Ich musste mich nämlich dem Thema «Verlängerung meines Aufenthaltes» widmen, und das war bei Frau G in guten Händen. Frühestens nach 3 Monaten Aufenthalt kann man verlängern. Immer um weitere sechs Wochen und nächste Woche muss ich im Plenum bekanntgeben, ob ich verlängere. Ich wollte das und Frau G. hat mich in diesem Entschluss bestärkt.
Am frühen Nachmittag hatte ich ein Gespräch bei Frau E., der Sozialarbeiterin. Es ging um meine berufliche Zukunft. Auch das muss ich langsam angehen. Was soll ich machen? Was passt zu mir? Was habe ich für Möglichkeiten? Nächste Woche fahren wir zusammen ins Berufsbildungszentrum nach Langenthal.
9.5.2006
Gestern hatten wir die erste Lektion in Wen Do, dem Selbstverteidigungskurs. Das war toll! Es ist unglaublich, was für Kräfte in uns stecken. Wir haben alle ein Stück Holz, 2 cm dick, mit der blossen Faust durchschlagen können, verschiedene Faustschläge gelernt und das Schreien ebenfalls. Schreien stärkt das Selbstbewusstsein und wirkt sehr befreiend.
11.5.2006
Gestern war der «Tag des Berufs» für mich. Ich war im BIZ in Langenthal. Dieser Besuch war auf der einen Seite sehr informativ, auf der anderen Seite komme ich wohl um eine KV-Lehre nicht herum. Will ich wirklich als Sekretärin arbeiten? Es gibt für mich derzeit drei Optionen:
- A) einen Job finden und nebenher per Erwachsenenbildung den Lehrabschluss KV nachholen;
- B) ganztags in eine Schule zur Arzt- oder Spitalsekretärin, wobei dieses Diplom kein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis ist; und
- C) einen Job suchen und nebenbei meine Selbstständigkeit forcieren. Supervisionen besuchen etc. Selbständigkeit in Form eines Beratungs- und Betreuungsbüros für Familien mit essgestörten Angehörigen und natürlich für die Betroffenen selbst.
Am ehesten – vom Bauch her, tentiere ich zu C. Am vernünftigsten ist wohl A, wobei einen Job zu finden auch schwierig ist. B schliesse ich jetzt schon aus, weil ich das nicht finanzieren kann. Jetzt habe ich mal viel Material zum Lesen und werde danach für mich ein Profil erstellen und dann am Wochenende ein Konzept schreiben, wie ich mir diese Selbstständigkeit vorstelle.
15.5.2006
Neben vielem anderen an Therapien hatte ich heute wieder einen Termin bei der Sozialarbeiterin Frau E. Sie wollte wissen, was beim BIZ herausgekommen sei. Diese Stunde war seit langem die effizienteste und hat mich definitiv einen Schritt weitergebracht. Zuerst sind wir meinen Lebenslauf durchgegangen, wobei ich mir einige Änderungen und Verbesserungen notiert habe. Danach habe ich ihr vom BIZ berichtet und meine gesammelten Unterlagen erklärt. Was kommt für mich in Frage und was kann ich probieren? Zunächst habe ich die Gedanken und die Unterlagen zur Selbstständigkeit an die hinterste Stelle gestellt. Wichtigste Priorität ist eine Schweizer Qualifikation. Damit haben wir die Antwort auf die Frage nach dem ersten Schritt. Ich muss eine Schule besuchen. Keine 3-jährige Ausbildung, sondern eine Schule, die ich nebenberuflich besuchen kann. Damit wäre die 2. Priorität genannt: einen Job!! Ich muss wieder mit Bewerbungen anfangen. Mit einem guten Gefühl und dem Wissen, wie es weiter geht, bin ich im Anschluss an das Gespräch joggen gegangen. Das tat gut!
Wieder zurück, sind wir am Abend in den Zirkus nach Solothurn. Einfach fabelhaft. Ich hatte solche Freude.
17.5.2006
Die ersten drei Bewerbungsmappen sind fertig und verschickt! Am vergangenen Wochenende habe ich richtig intensiv daran gearbeitet. Urs hat mich sehr dabei unterstützt. Und das erste Mal seit meinem Klinikeintritt hatte ich das Gefühl, nicht zurück ins Wysshölzli zu wollen. Momentan fühle ich mich sehr in einer Um- und Aufbruchzeit. Es gibt noch einen weiteren konkreten Plan: ich bewerbe mich um einen Platz in der Feusi-Schule in Bern. Die Feusi bietet u.a. auch Schulausbildungen für Spital- und Arztsekretärin an.
Am Montagabend war die 2. Lektion in Wen Do. «Fusstritte» war das Thema. Super, toll, ich bin ganz begeistert. Ausserdem wurde noch ein Gesprächsblock eingebaut, in dem man alle diese Verteidigungsanwendungen reflektieren konnte. Wann schlage ich zu? Wo sind meine Grenzen? Welchen Schlag oder Tritt würde ich am ehesten anwenden?
18.5.2006
Urs hat wieder einen Absturz gehabt und ist gestern Abend per Notfall in die Psychiatrie nach Königsfelden gebracht worden.
19.5.2006
Gestern war ein Scheisstag! Das Wetter genauso, wie auch meine Laune. Urs Absturz hat mich wieder komplett fertig gemacht. Deswegen habe ich für mich beschlossen, eine eigene Wohnung zu suchen. Gestern Abend habe ich dies Urs am Telefon mitgeteilt, worauf er mich bat, ihm noch eine Chance zu geben…noch eine…noch eine…und noch eine. Morgen fahre ich mit dem Zug nach Hause und hole das Auto hierher. Am Sonntag besuche ich Urs.
23.5.2006
Alles kam anders. Das Auto konnte ich nicht mitnehmen, Urs wurde nämlich gestern schon wieder entlassen.
Ich werde mit der Wohnungssuche noch warten. Mir ist alles zu viel. 1. bin ich ja die nächsten 6, wenn nicht 12 Wochen noch hier in der Klinik. Das ist die Bewährungsfrist für Urs. Und 2. wäre ich schlichtweg überfordert. Die Jobsuche und das Aufnahmeverfahren für die Feusi-Schule reichen mir momentan. Noch habe ich ja auch einige Therapien zu absolvieren und vielleicht möchte ich tatsächlich Urs noch eine Chance geben.
Am Sonntag habe ich ihn besucht und ihm folgende Punkte vorgelegt:
- Totale Abstinenz sowohl Alkohol als auch Kokain
- Keine Dates mehr mit anderen Frauen
- Kein Chatten mehr mit anderen Frauen
- Eine fundierte, stationäre Psycho- und Alkoholtherapie
- Nachsorge in Form einer Selbsthilfegruppe, psychotherapeutische Betreuung und Wechsel des Psychiaters
- Nachsorge in Form von sinnvoller Freizeitbeschäftigung
- Später ernsthafte Arbeitssuche.
Urs Reaktion auf diese Punkte war nur die Frage, ob ich ihn noch liebe. Für mich ist gerade das die Schwierigkeit, aber auch unsere Chance. Ich liebe ihn wirklich und ich wünsche mir nichts mehr als eine gemeinsame Zukunft. Aber das eine ist unser Leben und das kann ich so nicht mehr leben und das andere ist unsere Liebe. Er möchte alles erfüllen und sich diese Woche explizit darum kümmern.
24.5.2006
Ab kommendem Montag endet endlich mein verhasster Abwaschjob und ich darf in den Garten, juchuu. Ab heute bin ich in der Aufbauphase. Die drei Monate Grundtherapie sind abgeschlossen. U.a. heisst das, ich darf sonntags bis 22.00 Uhr im Wochenende sein. Auch toll! Und toll, toll toll… ich habe nie mehr gefressen und gekotzt!! Toll, toll, ich bin stolz auf mich!
26.5.2006
Coiffeurbesuch, Bummel in Bern mit Urs, Secondhand-Shop, Maltherapie und überhaupt. Ich glaube, ich bin ein bisschen glücklich.
31.5.2006
Ja, man sieht, ich schlafe länger. Ich habe morgens keine Gelegenheit mehr fürs Tagebuchschreiben. Oder das Schreiben ist nicht mehr so wichtig für mich, weil meine Ziele sichtbarer werden. Heute Abend ist der Infoabend in der Feusi-Schule. Bin mal gespannt, was da so erzählt wird. Die grösste Neuigkeit ist jedoch der Umzug ins Waldrandhaus. Nächsten Mittwoch kann ich in das Zimmer von Claudia ziehen. Ich freue mich sehr. Ein Dachzimmer!
Ansonsten geht es vorwärts. Ich bewerbe mich nach wie vor sehr intensiv. Die Therapien hier in der Klinik sind teilweise beendet. Das Rückfallpräventionsprogramm und der Sozialmarkt und in Psychoedukation fehlt mir nur noch ein Thema. Wen Do ist auch beendet, ebenso die Ernährungsberatung. Dafür rücken andere Themen nach. Am Freitag haben wir ein Paargespräch. Mir liegt das sehr am Herzen, denn ich möchte schon, dass Urs miteinbezogen wird. Vielleicht fühlt er dann meine Ängste und Sorgen besser und ist sich seiner Verantwortung bewusster. Seit Montag bin ich im Garten. Das mach mir Spass, obwohl ich dadurch wieder weniger Zeit habe. Aber das ist egal. Ins Dorf ist eh nicht gut für mich. Dort gebe ich nur Geld aus.
1.6.2006
Heute ist der 1. Juni und es ist so richtig kalt draussen. Schnee bis in die Niederungen. Die Sonne und die Wärme stellen uns echt auf eine harte Geduldsprobe. Gestern wurde meine Medikation geändert, weil ich immer so müde und abgeschlagen bin. Und gestern fand auch der Infoabend im Feusi in Bern statt. Ich benötige eventuell gar nicht den Umweg übers KV, weil meine Berufserfahrung schon ausreicht. Das wäre dann nur noch 1 Jahr berufsbegleitend bis zur Medizinischen Sekretärin. Jetzt ist es wirklich wichtig, dass ich einen Job finde.
6.6.2006
Es war Pfingsten. Von Samstagmorgen bis gestern Abend war ich zuhause. In diesen drei Tagen passierte nichts Weltbewegendes und doch habe ich zweimal gekotzt. Und es kümmert mich kaum. Warum? Ich glaube, beim ersten Mal hatte ich etwas Schiss vor den bevorstehenden Tagen und beim zweiten Mal hatte ich Gelüste auf alles, quer Beet. Sollte ich mich jetzt anklagen? Schuldgefühle haben? Rückfälle melden? Nein! Für mich war das kein Rückfall, sondern die Bestätigung, dass ich für mich fünf Mahlzeiten aushalten muss.
7.6.2006
Am Abend ergab sich noch ein interessantes Gespräch mit Piergiulia. Jetzt bin ich der Meinung, hinsichtlich meiner Rückfälle bin ich nur feige. Die Erkenntnis von gestern stimmt schon, aber mich dazu zu bekennen, es laut vor allen zu sagen, das kann ich nicht. Piergiulia hat das vor allen gemacht. Sie ist um Klassen ehrlicher zu sich selbst. Beim nächsten Mal möchte ich anders damit umgehen.
15.6.2006
Habe kaum noch Zeit, meine regelmässigen Tagebucheintragungen zu machen. Seit zwei Wochen habe ich das «Gartenämtli» und da geht’s schon um 8.00 Uhr los. Der Garten macht mir total Spass und ich kann sehr viel lernen. Zurzeit ist es tagsüber bis zu 30 Grad heiss im Schatten. Joggen gehe ich erst nach 21.00 Uhr, denn vormittags habe ich einfach keine Möglichkeit. Im Grossen und Ganzen ist mein Fokus in Richtung Bewerbungen / Zukunftsperspektive. Klar mache ich alle Therapien nach wie vor mit, aber meine Gedanken gehen in der Zukunft spazieren. Ich möchte erst austreten, wenn ich eine Perspektive habe und daran arbeite ich.
16.6.2006
Neben Virginias Problemen in der Gruppe, die immer dieselben sind (Zuspätkommen – wir warten und warten und warten…) steht bei mir der Entscheid einer zweiten Verlängerung an. Nächste Woche muss ich das im Plenum mitteilen, resp. mitteilen lassen. Vom 21. – 24.6. bin ich im Probewohnen. Nächste Woche werden einige wichtige Gespräche anstehen. Ich für mich möchte verlängern, weil ich noch keine berufliche Perspektive habe. Weder Schule noch Job. Mir ist sehr bewusst, dass das wichtig für mich ist, denn ins Leere nach Hause ist definitiv keine Option.
19.6.2006
Diese Woche verbringe ich nur heute und morgen im Wysshölzi. Ab Mittwoch bis Samstagabend bin ich zuhause zum Probewohnen. Urs holt mich ab. Ich denke, es geht gut. Warum auch nicht? Das vergangene Wochenende war ganz gut. Urs hat mir mit dem Serienbrief für Blindbewerbungen geholfen. Wir haben zusammen gegessen, gewürfelt, waren einkaufen usw. Für mich hat es gut gestimmt. So freue ich mich auf zuhause. Mit Urs habe ich ausserdem die 2. Verlängerung besprochen. Er ist der Meinung, ich solle nochmals verlängern. Wir mir schien, mehr aus organisatorischen Gründen (Geld, nicht allein sein), nichtsdestotrotz entsprach das auch meinem Bauchgefühl.
21.6.2006
Heute gehe ich nach Hause zum Probewohnen. Ist ein komisches Gefühl, denn ich wohne ja auch richtig da. Auf jeden Fall freue ich mich, etwas mehr Zeit zuhause verbringen zu können und habe mir dafür auch ein paar Dinge vorgenommen. Ich habe mich auch entscheiden, dass ich definitiv nochmals verlängere. Ab heute in 2 Wochen nochmals um 6 Wochen. Also heute in 8 Wochen wäre mein Austritt. Am 21.8.2006.
Am Montag habe ich im Feusi Bildungszentrum angerufen und nachgefragt, wie es jetzt ausschaut mit der Ausbildung «Mediz. Sekretärin H ». Sie erklärte mir, zu 80% werde ich zugelassen, sie hätte nur die Unterlagen vom H -Komitee noch nicht bekommen, auf die sie täglich warte. Ich könne aber davon ausgehen, dass ich im August starten könne. Toll!! Mit dem RAV in Suhr habe ich mich ebenfalls in Verbindung gesetzt. Sie haben mir Infomaterial zur Kostenübernahme zugesandt. Grundsätzlich ist ein Ausbildungszuschuss abhängig von der finanziellen Lage. Hätte ich bis dahin noch keinen Job bis zum Ausbildungsbeginn, könnte ich maximal 3.500 Franken vom Arbeitsamt beziehen. Also, es geht voran. Ansonsten schicke ich massenhaft Bewerbungen los. Die erste Serie – 10 Stück- Blindbewerbungen habe ich auch schon raus.
Ansonsten fühle ich mich total wohl im Waldrandhaus. Ich bin froh!
(1) Dieses Bild ist später entstanden. Etwa 2016 beim Wandern auf einer Alp. Es ist eines meiner Lieblingsfotos und deswegen musste es unbedingt mit rein.

5.7.2006
Ich stelle fest: Mein Tagebuch rückt in der «To do – Priorität» nach hinten. Ganze 14 Tage keinen Eintrag. Gut, es geht voran, es geht mental nach Hause. Heute beginnt meine 2. Verlängerung und das wird auch die Letzte sein. Ob mit oder ohne Job. Ich verliere die Angst vor der beruflichen Leere, weil ich trotzdem Ziele habe. Einerseits die Schule in Bern (wo ich verbissen auf eine schriftliche Nachricht der Zulassung warte), anderseits habe ich für mich alte und neue Tätigkeiten wieder entdeckt, die mich erfüllen: Stricken, Garten, Filzen, Malen und nach wie vor das Joggen. Auch Yoga werde ich wieder aufnehmen. Ich fühle mich in mir und mit mir zufrieden.
Urs ist seit fasst 2 Wochen in Rheinfelden in der Klinik «Im Schützen». Wie es ausschaut, hat auch er endlich seinen Platz gefunden. Er fühlt sich wohl und ernst genommen, kann die Therapien annehmen, spürt positive Veränderungen und hatte schon einige «Aha-Erlebnisse».
Meine Bewerbungen laufen auf Hochtouren, doch leider zeichnet sich noch nichts wirklich Passendes für mich ab. Gestern hatte ich ein Vorstellungsgespräch in Sarnen, in einem Seniorenheim. Morgen werde ich absagen. Für mich stimmt fasst nichts: nur 40%, 2 Std. Anfahrt mit dem Zug, keine Aufgaben mit Eigenverantwortung. Ich habe das Gefühl, so unter meinem Wert und meinem Können möchte ich mich nicht verkaufen.
Tja und hier im Wysshölzli läuft innerlich meine Zeit ab. Viel gelernt bis jetzt, eine wirklich wichtige und richtige Zeit. Doch habe ich immer öfter Sehnsucht nach Normalität, nach meinem Zuhause. Vor zwei Wochen war ich ja Probewohnen und grundsätzlich ging alles gut. Trotzdem hatte ich einen bulimischen Rückfall. Ich habe Wein getrunken und dann verliere ich meine Hemmschwelle. Ausserdem war ein Anflug von Einsamkeit in mir. In der 3. Juliwoche ist nochmals eine Probewohnzeit geplant. Für mich diesmal aber ohne Rückfall!
10.7.2006
Nun habe ich es Schwarz auf Weiss: ab 15. August bin ich wieder Schülerin! Der Vertrag vom Feusi ist unterschrieben, das erste Ziel habe ich erreicht. Nun muss ich einfach noch einen Job finden, der zu mir passt. Gut wäre eine 60 – 70% Stelle im Raum Aarau oder Bern. So könnte ich Job und Schule gut miteinander verbinden. Ich würde mit dem Zug in die Schule oder direkt nach der Arbeit in die Schule. Das wäre ein Jahr durchaus machbar. Mal sehen, ob ich das hinkriege.
25.7.2006
Zum zweiten Mal trete ich heute mein Probewohnen an. Heute bis Donnerstag. Ich freue mich. Erstens habe ich heute Nachmittag ein Vorstellungsgespräch im Kantonsspital Baden (für eine Stelle in der Radiologie, die neu geschaffen werden soll), zweitens brauche ich immer mehr «Biss» die Wochen mit all den Gesprächen (die mir vorher so gut getan haben) zu durchleben. Ich habe manchmal ungeheure Mühe, mich dafür zu motivieren. Vor allem die Gesprächsgruppe. Diesen «Gruppenseelen-Striptease» vermag ich fasst nicht mehr zu schaffen. Obwohl es genau das Instrument war, welches mir bisher am meisten half. Weil es wahrscheinlich wirklich am intensivsten wirkt und mir deshalb jetzt die grössten Qualen bereitet. Also, immer weiter Margret, immer weiter! Bis zum 16. August.
Heute ist ein wichtiger Tag. Ich möchte so gerne, dass diese Stelle passt und klappt. Dies würde mir für den Austritt sehr helfen.
Virginia wurde am Samstag von ihrer Mutter und einem Polizeibeamten abgeholt. Schade, denn die Mutter weiss nicht, was sie tut. Meiner Meinung nach müsste die ganze Familie in Behandlung. Alle sind krank, aber Virginia trägt alles alleine auf ihren Schultern. Sie wird wieder kommen. Hoffentlich. Und hoffentlich nicht wieder so kaputt, wie zu Beginn ihres ersten Eintritts hier.
31.7.2006
Das zweite Probewohnen ist beendet und alles hat tiptop geklappt. Das Vorstellungsgespräch im Kantonsspital Baden ist gut gelaufen, obwohl ich kaum zu Wort kam. (Vielleicht deshalb?) Die leitende MTRA, die dann meine Chefin werden soll, sollte ich die Stelle je bekommen, ist sehr temperamentvoll. Sie hat endlose Monologe über die Stelle, die Charaktereigenschaften der Stelleninhaberin, das Team etc. gehalten, sodass ich meine Fragen richtig durchdrücken musste. Sie erschien mir aber sehr herzlich. Nach 2 Stunden war ich völlig k.o. und mir hat der Kopf geschwirrt. Grundsätzlich habe ich ein gutes Gefühl, obwohl mir zwei Wörter nicht eingefallen sind. Ich habe aber auch gemerkt, woran ich noch arbeiten muss: Konfliktfähigkeit, Reibungsflächen, Durchsetzungsvermögen, Standfestigkeit. Das sind offenbar wichtige Charaktereigenschaften für diese Position. In der Hierarchie läge ich wie ein Puffer zwischen den Ärzten und den MTRA’s (Medizinisch-Technische Assistentinnen). Es ist eine Kaderstelle. Teamleiterin. Also eine Stelle, bei der man sehr konfliktfähig sein muss. Alles in Allem möchte ich diesen Job sehr gerne, obwohl ich weiss, dass das erste Jahre zusammen mit der Schule in Bern sehr hart werden wird. Diese Tatsache bewog mich dazu, einer 3. Verlängerung zuzustimmen.
4.8.2006
Und doch ist wieder alles anders! Meine innere Motivation, meine Denkrichtung, meine Vorgehensweise.
Seit der 3. Juliwoche habe ich eine andere Psychotherapeutin, denn meine bisherige hat ihre Tätigkeit in der Klinik beendet. Jetzt habe ich eine sehr erfahrende, ältere und routinierte Psychologin. Sie lässt sich nichts vormachen und durchschaut sofort alle Spielchen. Nicht dass ich bisher gespielt hätte, im Gegenteil, aber ich konnte doch das eine oder andere bezüglich der Therapieabläufe für mich durchsetzen. Sie hat vor allem eine andere Vorgehensweise und hat mir beispielsweise in der letzten Sitzung die Überlegung mitgegeben, doch noch eine dritte Verlängerung ins Auge zu fassen. Sie meinte, aus verschiedenen Punkten wäre eine dritte Verlängerung wichtig. Ich habe hin und her überlegt und mich dann dafür entschieden.
Der wichtigste Punkt dafür ist, dass ich weiter an meiner Konfliktfähigkeit arbeiten kann. Mit dieser erfahrenen Psychologin zusammen. Ich spüre, dass sie mich noch ein gutes Stück weiter bringen könnte. Ausserdem ist Urs wieder zuhause und ich könnte aus der Distanz schauen, wie er es mit der Abstinenz schafft.
Dagegen sprich in erster Linie meine Therapiemüdigkeit, mein Wunsch nach Normalität und Selbstbestimmung.
Am 15. August beginnt die Ausbildung zur Medizinischen Sekretärin H . Das wird sicherlich nicht einfach werden, aber ich freue mich drauf.
9.8.2006
Was für eine Aufregung gestern! Ich habe mir massive Sorgen um Urs gemacht, weil ich ihn in den letzten drei Tagen weder auf dem Handy noch übers Festnetz erreichen konnte. Ich habe mir alles möglich vorgestellt: Kokainnacht, Tod im Bett, Übernachtung bei einer anderen Frau. Um 17.00 Uhr hat sich dann alles in Wohlgefallen aufgelöst, er hatte sein Handy auf lautlos, war einkaufen und hat es sonst nicht gehört.
Heute glaube ich nicht mehr an diese «Ausreden». Er war mit anderen Frauen und Drogen beschäftigt.
Mein Gott, ist mir ein Fels vom Herzen gefallen!
Wie naiv!!!
Daran sehe ich, wie wenig Vertrauen ich ihm gegenüber habe und auch, wie sehr ich an Urs hänge.
Morgen und übermorgen habe ich Bewerbungsgespräche.
17.8.2006
Am 1. November beginne ich im Kantonsspital Baden als Leiterin der Leitstelle Radiologie. 80%-Pensum. Und neue Situation: heute ist bereits mein 2. Schultag. Von 18.30 – 21.45 Uhr, Dienstag und Donnerstag. Über beides freue ich mich total, obwohl ich auch richtig Respekt habe. Hoffentlich überfordere ich mich nicht! Vor allem mit dem Autofahren über Autobahn. Ich befürchte, ich komme eventuell nicht rechtzeitig von Baden nach Bern, mitten in der grössten Rushhour.
Ich möchte anfragen, ob ich nicht bis Juli 2007 an den beiden Schultagen nachmittags frei haben könnte. Ansonsten ist es natürlich ein super Gefühl, eine Stelle zu haben. Und nicht nur irgendeine. Eine mit Herausforderungen, Entwicklungsmöglichkeiten, Innovation und gut bezahlt ist sie auch noch. Ich freue mich sehr.
Die beiden anderen Stellen habe ich abgesagt. Riggisberg und Sonnenhof in Bern. Beide wären nur 40% und keine Chance zur Weiterentwicklung.
Hier in der Klinik läuft therapiemässig nicht mehr viel für mich, nur die Einzelgespräche sind noch eine Herausforderung. Ich möchte raus aus der Kochgruppe, die Zeit würde ich lieber zum Lernen nutzen. Und es ist fraglich, ob der Kanton einer 3. Verlängerung zustimmt. Finanziell meine ich. Das ist noch sehr fraglich und somit befinde ich mich bis Ende August in einem komischen Schwebezustand.
24.8.2006
Noch bin ich hier, noch weiss ich nix! Nächste Woche austreten oder nicht? Mir ist beides recht…hmhm, ein kleines bisschen lieber möchte ich schon austreten. Aus der Kochgruppe bin ich raus, das ist schon mal gut.
Momentan bin ich innerlich immer noch etwas aufgewühlt und verunsichert, ob ich alles schaffe. Job, Schule, Therapie, Privates…? Ich bin überzeugt, dass ich im Alltag keine Unterstützung von Urs erhalten werde. Er macht nichts von sich aus, nur auf meine Bitte und dann erst Stunden oder Tage später. Ich spüre keine «Wir-Gefühl». Ich spüre nur: «Toll, Du hast Job, Schule, das ist toll, ich freue mich für Dich!» Ich freue mich, weiss aber auch, dass alles andere auch nicht weniger wird.
2.9.2006
In den letzten Tagen habe ich sehr viel nachgedacht.
Ich habe mich reingedacht in die Situation: Arbeiten in Baden, Schule in Bern, Lernen zuhause im Aargau?? Wann? Wie? Putzen zuhause Waschen, Bügeln zuhause; Urs zuhause – Urs PC – Urs Bett – Urs TV – selber keine Ruhe mehr, selber nur am Rumhetzen, Margret beisst die Zähne zusammen – Margret sieht Urs am Ebay, am Gamen, an der Flasche!
Jetzt zuerst an der Stimme am Telefon; jämmerlich, wehleidig, aggressiv; dann am Geruch an den Wochenenden;
Ich bin sehr traurig. 10 Tage lang. Ich könnte ständig heulen.
Vergangenen Montag hatten wir Krach und seitdem ist mir klar: Urs trinkt wieder! Ich fühle mich so zerrissen in mir drin und ich habe den Eindruck das letzte Hoffnungslichtlein auf eine gemeinsame Zukunft verlöscht langsam. Ich kann diese Zweifel, dieses aber doch Wissen sehr schwer nur annehmen, denn trotz allem liebe ich ihn.
Die Schule habe ich abgebrochen. Diese Entscheidung habe ich am Montag nach dem Telefonat getroffen. Ich musste für mich eine Lösung finden, wie ich diesen Druck, der Angst, nicht alles zu schaffen, bewältigen kann. Für mich ist das jetzt die richtige Entscheidung, es waren einfach zu viele «Neustarts» nach dem halben Jahr «Schutz».
Heute fahre ich nach Hause, obwohl mir das nicht so behagt. Aber ich muss definitiv Abstand zur Klinik bekommen. Ich kann diese tiefschürfenden Gespräche fasst nicht mehr ertragen. Ausserdem glaube ich vor lauter Problemen bald nicht mehr an meine Stärken. Am 26. September trete ich definitiv aus.
6.9.2006
Kommendes Wochenende bleibe ich hier in der Klinik und fahre nicht nach Hause. Das hat mehrere Gründe: zunächst möchte ich auf Distanz zu Urs gehen und meine Gefühle für ihn erspüren. Mich selbst spüren. Urs trinkt wieder. Ich weiss, ich müsste mich jetzt sofort von ihm trennen. Das ist ja der Rat der Psychologin. Aber ich habe keine Wut und keinen Hass gegen ihn. Es fällt mir deshalb schwer. Ich bleibe hier, weil ich alle negativen Gefühle über den Kopf verdränge oder unterdrücke, die ich aber spüren sollte. Ich spüre nichts, Nada, null! Ich weiss nicht, wo ich die negativen Gefühle finde. Im Bauch? Das ist nur Watte. Wo ist die Wut gegenüber Urs, weil er wieder trinkt? Sein Verrat? Wo bleibt meine Traurigkeit? Die ist immer nur da, wenn ich darüber rede. Danach verschwindet sie wieder. Wo ist die ganze Enttäuschung über das, was ich mir wünschte und mir erhoffte und von dem jetzt nichts, gar nichts eingetroffen ist? Noch nie vorhanden war?
Was ist Urs für mich? Warum brauche ich Ihn? Brauche ich ihn wirklich? Was hält mich davon ab, mich von ihm zu trennen? Was gibt mir Urs, was mich so an ihn bindet?
10.9.2006
Es ist Sonntag und ich war das ganze Wochenende im Wysshölzli. Ich wollte Nähe zu mir selbst und Distanz zu Urs. Ich möchte herausfinden, wie ich mit mir selbst umgehe, mit dem Alleinsein (ohne Therapie oder sonstige Ablenkung), mit meinen Gefühlen. Herausfinden, wo ich stehe. Leider hat sich schon am Freitagabend eine Erkältung bemerkbar gemacht, weswegen ich mir nicht mehr so sicher bin, ob dieser innere Schwebezustand zwischen Traurigkeit, Einsamkeit, Enttäuschung und Schmerz nur von meiner Situation im Allgemeinen herrührt. Eine Leere machte sich breit und ich habe das Gefühl, den Boden unter den Füssen zu verlieren. Ein beschissenes Gefühl.
Eines weiss ich aber sicher: ich brauche ein «Nest». Hier habe ich mich abgekoppelt und zuhause bei meinem Mann zieht er mir gerade den Boden weg. Ich habe Angst.
11.9.2006
«Der Mensch darf nie aufhören zu träumen. Der Traum ist für die Seele, was Nahrung für den Körper ist. Wir müssen häufig in unserem Leben erfahren, wie unsere Träume zerstört und unsere Wünsche nicht erfüllt werden, denn och dürfen wir nie aufhören zu träumen, sonst stirbt unsere Seele.
Der gute Kampf ist der, den wir kämpfen, weil unser Herz es so will. Der gute Kampf ist der, den wir im Namen unserer Träume führen. Wenn sie mit aller Macht in unserer Jugend aufflammen, haben wir zwar viel Mut, doch wir haben noch nicht zu Kämpfen gelernt.
Wenn wir aber unter viel Mühen zu kämpfen gelernt haben, hat uns der Kampfesmut verlassen. Deshalb wenden wir uns gegen uns selber und werden zu unserem schlimmsten Feind.
Wir sagen, dass unsere Träume Kindereien, zu schwierig zu verwirklichen seien oder nur daher rührten, dass wir von den Realitäten des Lebens keine Ahnung hätten. Wir töten unsere Träume, weil wir Angst haben, den guten Kampf aufzunehmen.» - aus: «Auf dem Jakobsweg» P. Coelho
19.9.2006
Der Austritt naht! Heute hatte ich das Austrittsgespräch mit der Kunsttherapeutin. Wir haben meine letzten fünf Bilder besprochen. Meine Ängste und Sorgen kann ich über das Malen ganz anders ausdrücken als in Gesprächen.
Ich bin zuversichtlich – trotz allem, was mich erwartet und mit Sicherheit auch noch kommen wird. Ich weiss nun, was ich zu tun habe, sollte die Situation für mich wieder so unerträglich sein, wie vor meinem Eintritt ins Wysshölzli. Im Grunde möchte ich mit Urs zuhause leben. Nur das.
Aber nicht um jeden Preis!
«Die Zukunft hat viele Namen. Für die Schwachen ist sie das Unerreichbare. Für die Furchtsamen ist sie das Unbekannte. Für die Tapferen ist sie die Chance.» Victor Hugo

Die Monate im Wysshölzli prägten mich nachhaltig. All die Gespräche mit den Menschen dort, haben mir irgendwann später geholfen, meinen Weg zu finden. Doch zunächst fühlte es sich ganz und gar nicht so an. Als ich am Samstag mit Sack und Pack nach sechs langen Monaten endlich wieder nach Hause kam, traute ich meinen Augen nicht. Urs wusste, dass ich kommen würde, ich hatte alles mit ihm besprochen. Doch ich dachte, ich wäre in einem falschen Film. Alle Jalousien waren geschlossen, als wären die Bewohner für längere Zeit verreist. Es war erst 11.00 Uhr vormittags an einem sonnigen Spätsommertag. Ich befürchtete das Schlimmste und das Schlimmste traf auch ein. Vorsichtig schloss ich die Haustüre auf und schon an der Türe kam mir der widerwärtige Geruch von Chemie, säuerlichem Schweiss und Zigarettenqualm entgegen. Ich rief seinen Namen, bekam jedoch keine Antwort. Langsam ging ich die Treppe in Richtung Wohnzimmer hinunter. Es war ganz still im Haus, bis auf ein leises röchelndes Schnarchen, das von unten herauf drang. Dazu muss ich noch kurz die Gegebenheiten der Räume beschreiben. Der Hauseingang lag zuoberst im Haus, da es an einen Hang gebaut war. Im obersten Stockwerk befand sich der Eingangsbereich, die Küche und der Essplatz und ein Gäste-WC. Ein Stockwerk und etwa fünf Treppenstufen darunter befand sich das grosse Wohnzimmer mit seiner sehr hohen Decke und einem Ausgang auf den Balkon. Weitere fünf Stufen tiefer waren das Büro von Urs, zwei Schlafzimmer, eine Dusche und das Badezimmer. Im Wohnzimmer schweifte mein Blick über ein Chaos aus übervollen Aschenbechern, leeren und halbleeren Champagner- und Weinflaschen und herumliegender Kleidung. Ein entsetzliche Gestank erfüllte das Haus. Am liebsten hätte ich auf dem Absatz kehrt gemacht und wäre wieder gegangen. Aber im ersten Moment hatte ich keine Idee, wohin. Schliesslich fand ich Urs mit blutender Nase, kreidebleich und zitternd im Bett liegend. Nicht ansprechbar.
Ich brach fasst zusammen. Zuerst bekam ich einen Heulkrampf, war unsagbar enttäuscht, wütend, schrie Urs an, was er sich denn dabei gedacht hatte. Ich fühlte mich verraten und empfand sein Verhalten wie einen Rauswurf. Gerade zu diesem Zeitpunkt, meinem wieder Nachhausekommen, irgendwie auch schutzlos und extrem verletzlich, weil durch die vielen Gespräche psychisch immer noch so aufgeblättert wie ein Buch! Eine Demütigung sondergleichen.
Er liess mich verstehen, dass er sein Leben so leben wollte und dass ich ihm mit meinen Bitten und meinem ständigen Flehen, die Drogen sein zu lassen völlig gleichgültig war. Drei Tage und Nächte wartete ich auf ein Wort von ihm. Auf eine Antwort. Er hatte keine. Als er wieder ansprechbar war und ich ihm sagte, wie verletzt ich sei und dass ich so nicht mehr mit ihm leben könne, sagte er, wenn ich die Absicht hätte ihn zu verlassen, würde er mich einsperren. Ich war erschüttert. Nach längerem inneren Kampf über Für und Wider, über Lieben und Leben beschloss ich, meinen Auszug in Angriff zu nehmen.
Wenige Tage später informierte mich Urs, dass er am Freitag in einer Woche gemeinsam mit seinem Sohn an einer IT-Fortbildung teilnehmen wolle. Die würde den ganzen Tag dauern und wäre vor allem für seinen Sohn wichtig, da die Inhalte einen Teil der Aufnahmeprüfung für eine Praktikumstelle bei der UBS seien. Ich wusste also, dass ich an diesem Freitag den ganzen Tag allein zuhause sein würde. Also war dieser Freitag der Ziel-Tag für meinen Auszug. Sukzessive bereitete ich alles vor. Ich glaube, Urs hatte seine Androhung, mich einzusperren schon wieder vergessen. Vielleicht hatte er es auch nicht wirklich ernst gemeint. Es war ihm sicher nach seinem Totalabsturz nichts Besseres als Antwort eingefallen. Trotzdem wollte ich es nicht darauf ankommen lassen, ich sah einfach keinen anderen Weg mehr. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit, vor allem aber während meiner Einkaufstouren erledigte ich eine Sache nach der anderen. Ich kündigte mein Bankkonto und eröffnete eines bei der Post ohne Zugriff von Urs. Ich meldete mich bei der Gemeinde ab. Auf dem Estrich packte ich heimlich Koffer und Taschen und stellte einen Postnachsendeantrag zu meiner Mutter. Alle meine Papiere, die ich zum Leben benötigte, packte ich in einen Ordner, den ich wiederum in einen der Koffer packte. Vor allem die Unterlagen für das Auto. Es war geleast und der Vertrag lief auf Urs, weil ich noch keine fünf Jahre in der Schweiz lebte. Als Erstes wollte ich das Auto auf mich umschreiben lassen. Dafür benötigte ich aber das Einverständnis von Urs. Ich wusste, das würde noch ein Kampf werden. Natürlich war mir völlig klar, dass das nicht der Einzige sein würde, ich würde noch einige Kämpfe mit ihm ausfechten müssen. Zuletzt schrieb ich einen langen Brief. Ich erzählte und erklärte mich, aber vor allem verabschiedete ich mich von ihm.
Als der besagte Freitag da war und Urs in Richtung Zürich losgefahren war, schleppte ich eilig alle Koffer und Taschen vom Estrich hinunter und packte das Auto so voll, wie es nur ging. Zwischendurch trat ich nach unserem Kater «Mäxle», der genau spürte, dass etwas Entscheidendes anstand. Er folgte mir nämlich auf den Estrich und machte anschliessend keine Anstalten, wieder herunterzukommen. Es tat mir so unendlich leid, mit ihm schimpfen und ihn treten zu müssen, bis er endlich die blöde Estrichleiter hinunter ging. Ich heulte und schniefte und alles war so schwer zum Schleppen. Ich schaffte es kräftemässig kaum, die Koffer vom Estrich zu hieven und doch ging es irgendwie. Der Kofferraum war so voll, dass ich kaum zur rückwärtigen Scheibe hinaus sah. Es war mir egal, ich musste ja sowieso nur vorwärts fahren. Eilig und wie verrückt drückte und herzte ich unsere beide Katzen «Mäxle» und «Zwetschge» und ein paar Stunden später befand ich mich heulend auf dem Weg zu meiner Mutter nach Deutschland.
An diesem Nachmittag nähte sie gemeinsam mit ihrer Patchworkgruppe in der Schule. Ich wusste das, denn sie hatte mich darüber bei meiner Ankündigung zu ihr zu kommen in Kenntnis gesetzt. Kein Problem, der Hausschlüssel lag seit Jahren immer an derselben Stelle. Als meine Mutter gegen 16.00 Uhr nach Hause kam, fand sie mich tränenaufgelöst auf der Treppe sitzend im Garten. Noch Jahre später erzählte sie, wie leid ich ihr in diesem Moment tat. «Das ganze Kind weinte».

Die ersten Tage und Wochen waren schrecklich. Natürlich rief bereits am Abend Urs bei meiner Mutter an. Nachdem seine Bitten, ich solle doch zurückkommen und er würde sich ändern nichts nutzten, warf er mir alles, was er an verletzenden Worten kannte an den Kopf. Irgendwann legte ich auf. Während der nächsten Tage versuchte er immer wieder, mich von seiner Bereitschaft alles, aber auch wirklich alles tun zu wollen, wenn ich nur wieder käme, zu überzeugen. Es tat weh und weh und weh. Ich liebte ihn immer noch. Ich liebte ihn immer noch sehr und deswegen war mir klar, dass der nächste Schritt unbedingt die «Entliebung» sein musste. Ich musste mich entlieben, sonst konnte ich mich nicht von ihm distanzieren. Und das passierte in den nächsten Wochen bei meiner Mutter. Bis zum 1. November hatte ich Zeit, denn dann sollte ich meine neue Stelle im Kantonsspital antreten. Mittlerweile war es Oktober und am 15. feierte ich meinen 44.-ten Geburtstag und ich fing ganz unten bei null ein neues Leben an.
An manchen Tagen lag ich nur im Bett und heulte. Ich war zu nichts zu gebrauchen. War wütend auf die ganze Welt, mich und auch auf meine Mutter. Weil sie so alt geworden war. Auch das wurde ein Thema. Ich kannte sie nicht mehr. So viele Jahre schon war ich aus meinem Elternhaus ausgezogen. Ich hatte ihre Jahre nur aus weiter Distanz miterlebt. Per Telefon und den vereinzelten Besuchen. Nun aber war ich Tage und Wochen um sie herum und erlebte sie in allen Alltagssituationen. Mir fiel auf, dass sie viel vergass, dass ich manches zweimal erzählen musste, weil sie unkonzentriert war und nicht richtig zuhörte. Sie hörte ausserdem schlecht, weshalb der Fernseher oder das Radio sehr laut lief. Ich war ungeduldig, nervös und richtig tief deprimiert, deswegen hatte ich grosse Mühe zu akzeptieren, dass meine Mutter nicht mehr so war, wie früher. Ich musste lernen zu akzeptieren. Ich musste lernen loszulassen. Ich musste lernen vorwärtszusehen und vorwärtszudenken. Ich musste lernen keine Angst vor der Zukunft zu haben. Ich musste lernen zu kämpfen. Ich musste lernen zu fordern. Für mich. Für meine Bedürfnisse. Für mein Leben.
Den ganzen Oktober wohnte ich bei meiner Mutter. Meinen Geburtstag feierten wir ein bisschen im Restaurant, was gerade genug war. Eigentlich wollte ich gar keinen Geburtstag haben. Ich wollte mich am liebsten verkriechen. Aber das kam nicht in Frage, denn als Erstes musste ich einige Dinge erledigen. Das Auto auf mich umschreiben. Das war nicht einfach, musste ich doch Urs davon überzeugen, dass er es auf mich zuliess, was für ihn schon aus Trotz kein Thema war. Mit Engelszungen redete ich auf ihn ein und erklärte ihm, dass ich ja dann auch alle Kosten übernehmen würde und zwei Autos bräuchte er nun wirklich nicht. Wie genau es nun lief, weiss ich nicht mehr so genau, aber irgendwann unterschrieb er den entsprechenden Zettel dafür. Es ging wohl nur noch um die Eintragung beim Strassenverkehrsamt, alles andere bezahlte ich bereits. Dann benötigte ich eine Wohnung. Zuerst stand eine Wohnung in Deutschland zur Diskussion aber diese Idee verwarf ich wieder, weil ich mir nicht vorstellen konnte, täglich zweimal ewig im Stau zu stehen, um durch Baden zu kommen. Anlässlich einer Besprechung im Kantonsspital wegen mehrerer Details, die vor Arbeitsbeginn noch geklärt werden mussten, thematisierte ich auch meine Wohnungssuche. Was für ein Glück! Im Personalhaus war gerade eine Ein-Zimmer-Wohnung frei geworden. Die könne ich haben. Wäre zwar möbliert, aber zumindest hätte ich fürs Erste was und später könne man ja wieder schauen. So schaffte ich auch diese Hürde und alle anderen irgendwann auch. Was blieb, war meine Traurigkeit und die Bulimie. Ja, auch die gesellte sich wieder in mein Leben.

Am 1. November 2006 startete ich an meinem neuen Arbeitsplatz als Teamleiterin Administration in der Radiologie im Kantonsspital Baden. Für mich war der berufliche Neuanfang kein Zuckerschlecken, insbesondere deswegen nicht, weil ich für längere Zeit ausser Gefecht gesetzt war und meine Kräfte für wesentlich andere Projekte benötigt hatte. Der erste Tag fühlte sich für mich an, als wäre ich erst das siebenjährige Mädchen von damals an ihrem ersten Schultag. Bis auf eine Mitarbeiterin, hatte ich ein sehr nettes Team, was mir meinen Start um einiges erleichterte. Besonders eine Kollegin half mir, mich in allen Bereichen schnell zurecht zu finden. Ohne sie und ihr Wissen und ihre Bereitschaft, mir alles zur erklären, hätte ich die Anfangszeit auch geschafft, aber mit viel mehr Mühen. Vor allem das Vertrauen und die Zuversicht der erfahrenen Kolleginnen war wichtig, denn meine allererste grosse Aufgabe war die Neuausrichtung des Teams. Das bedeutete unter anderem auch, dass ich dieser einen Mitarbeiterin, die mir von Anfang an das Leben schwer machte, kündigen musste. Sie war in den vergangenen Jahren «der Sand im Getriebe», denn diese eine Person mobbte. Sie mobbte all diejenigen, bei denen sie das Gefühl hatte, sie würden an ihrer Macht rütteln und könnten ihr gefährlich werden. Diejenigen, die besser ausgebildet waren oder schlauer oder fleissiger waren. Im Grunde also alle. Und «Mobbing» war in den 70-ern, 80-ern und auch in den 90-ern noch kein Thema in diesem Wortsinn. Es gab kein Mobbing, es gab Intrigen. Und das war wohl eher legitim oder gehörte in gewissen Kreisen einfach dazu. Durch ihre Boshaftigkeiten gegenüber allen anderen im Team herrschte eine Klima der Anspannung, Unzufriedenheit aber vor allem Misstrauen. Beispielsweise versteckte sie Unterlagen oder Röntgenberichte, um dann behaupten zu können Frau «So» oder Frau «So» hätte schlampig gearbeitet. Nach einer gewissen Zeit und langer ärgerlicher Suche holte sie die Dokumente wieder hervor und tat so, als wäre sie die Retterin in der Not. Sie war die langjährigste, die routinierteste und diejenige, die immer ein 100%-Pensum arbeitete. Aus diesem Grund gebar sie sich in der Vergangenheit als Leitende des Teams, wozu sie offiziell nie berufen wurde. Sie erstellte die Dienstpläne und nahm alle Meldungen und Informationen innerhalb dem Team entgegen und gab sie an die entsprechende Stellen weiter oder manchmal auch nicht. Sie schikanierte und insistierte.
Bis anhin gab es offiziell keine Teamleitung in der Administration. Alle waren einfache Sekretärinnen, alle ohne medizinische Ausbildung. Also eine gewachsene Hierarchie, die in der Vergangenheit als gegeben, weil schon immer so, toleriert wurde. Eine ungesunde Hierarchie in Spitälern war normal. Auch oder gerade dann, wenn sie nicht über eine zusätzliche Weiterbildung erworben worden war.
Ich hatte noch nie zuvor einer Person gekündigt. Zumal einer Person, der ich fachlich noch gar nicht das Wasser reichen konnte. Eines hatte ich in den vergangenen Monaten jedoch gelernt: mich beirrte so schnell nichts mehr. Wenn man durch solche tiefen Täler gegangen war wie ich, ist die Kündigung einer schwierigen Person auch kein Hexenwerk mehr. Ich vertraute auf mich und das ganze Team, einschliesslich meiner Vorgesetzten. Das Gespräch verlief, wie vorausgesehen sehr unangenehm. Doch jedes Ende birgt die Chance für einen Neuanfang und so war es auch in dieser Situation. Die Mitarbeiterin hatte zwar drei Monate Kündigungsfrist, aber bereits in der darauffolgenden Nacht räumte sie in einer Nacht- und Nebelaktion ihren Schreibtisch und Spint und war ab da nie mehr gesehen.
Die ersten Monate war ich oft noch unsicher. In allen Bereichen meines Lebens. Klar, beruflich war es nicht anders zu erwarten aber auch in meiner Freizeit fühlte ich mich neben mir. Ich hatte Mühe, mich in einem Zimmer in der Nähe des Spitals, welches auch noch fremdmöbliert war, wohlzufühlen. Alles war fremd. Nichts gehörte zu mir. Ich fühlte mich, wie aus dem Nest gefallen. Und ich hatte Angst vor mir selber. Die Bulimie nistete sich wieder mehr in meinem Leben ein. Oft ging ich schon um 20.00 Uhr ins Bett, um einer abendlichen Essattacke zu entkommen. Immer, wenn ich Spätdienst hatte (jeden zweiten Tag) joggte ich morgens um 5.00 Uhr durch die Dunkelheit, was mir enorm half, trotzdem fühlte ich mich einsam. Ausserdem bedrängte mich Urs. Ständig rief er an und bettelt und beschimpfte mich auf übelste Art und Weise («Du bist die teuerste Hure, die ich jemals hatte») oder flehte, ich solle doch wieder zurückkommen. In dieser Hinsicht liess ich mich immer noch zu sehr beeinflussen. Ich kann wirklich sagen, dass dies eine Zeit war, in der es mir nicht gut ging. Ende 2006 wurde ich krank, hatte hohes Fieber und lag einige Tage im Bett. Zum Glück war da meine Mutter, bei der ich jedes Wochenende unterschlüpfen konnte. Irgendwann Anfang 2007 teilte Urs mir mit, dass er die Scheidung eingereicht hätte. Damit das Ganze schnell und unkompliziert über die Bühne ging, hatte er eine Mediatorin aus Winterthur engagiert. Er meinte, ich solle meine restlichen Sachen holen, denn bald würde er die Schlösser austauschen. Es wäre sowieso nicht in Ordnung, dass ich noch einen Schlüssel hätte und theoretisch jederzeit in sein Haus spazieren könne. Als ob ich das gewollt hätte! Trotzdem war ich später noch einige Male bei Urs. Irgendwie hingen wir trotz allem noch aneinander. Mal lief es gut und ich konnte mit ihm reden, mal war es sehr schwierig und ich hielt mich nur so kurz wie nötig bei ihm auf. Er stürzte einige Male ab und immer dann wollte er mit mir telefonieren oder ich sollte kommen. Ich glaube, wir beide hielten wie Ertrinkende aneinander fest. Zweimal hatten wie einen gemeinsamen Termin bei der Mediatorin und beide Male gingen wir hinterher essen und man hätte meinen können, wie wären ein verliebtes Paar. Wir lachten und redeten. Leider hielt das jeweils nur so lange an bis Urs, betrunken und allein zuhause, mich anrief, um mir seine Flüche und Beschimpfungen entgegenzuschleudern.

Im August 2007 hatten wir unseren Scheidungstermin im Gemeindehaus unseres früheren gemeinsamen Wohnortes. Tage vorher verabredeten wir, dass ich Urs zuhause abholten sollte und wir beide gemeinsam zu unserem Termin fahren würden. Wie abgemacht stand ich am Scheidungstag pünktlich vor seiner Türe und klingelte. Ich klingelte einmal, zweimal… nach dem dritten Klingeln schloss ich die Türe auf und trat ein. Urs lag im Wohnzimmer auf dem Sofa und war kaum ansprechbar. Er hatte Medikamente genommen, ich wusste nicht was aber vermutlich Beruhigungstabletten. Seine Schublade war voll davon. Er lallte, war im Dämmerschlaf und nahm mich kaum wahr. Ich redete auf ihn ein, zog ihn hoch und schüttelte ihn. Ich machte ihm ein, zwei Espresso und zwang ihn wachzuwerden. Ich wollte auf keinen Fall den Termin verschieben, alles würde wieder von vorne anfangen. Ausserdem sollte endlich diesem Kapitel ein Ende gesetzt werden. Irgendwie bekam ich Urs ins Auto und wir fuhren so schnell wie möglich zum Gemeindehaus. Urs ging es richtig schlecht. Kaum dort angekommen, schaffte er es gerade noch rechtzeitig auf die Besuchertoilette, wo er sich erbrach. Was hatte er eingenommen? Medikamente natürlich und sicher viel zu viel und alles durcheinander. Dann endlich wurden wir aufgerufen und nahmen beide vor dem dreiköpfigen Scheidungsgremium Platz. Ein Richter, ein Protokollführer und ein Gemeindebeauftragter. Wir wurden aufgefordert, unsere Situation zu erzählen. Warum wollten wir die Scheidung? Ob wir uns sicher wären, dass die Ehe definitiv gescheitert wäre. Anschliessend las der Richter die von uns im Vorfeld mit der Mediatorin festgelegten Fakten vor. Zum Beispiel meinen Verzicht auf allfällige Unterhaltsansprüche, oder seine Pflicht, mir den rechtlich festgelegten Rentenanspruch zukommen zu lassen. Es gab nicht viel zu klären. Dann hatte jeder von uns Gelegenheit, einzeln vor dem Richter zu sprechen. Ich war die Erste und erklärte pragmatisch und emotionslos, ohne ins Detail zu gehen die Gründe für meinen Entscheid einer Trennung. Dann war Urs an der Reihe. Ich weiss nicht, was er erzählte aber als er fertig war und ich wieder in den Sitzungsraum gerufen wurde, sass er tränenüberströmt da und tat mir in diesem Moment unendlich leid.
Im Grunde war das das verdient traurige Ende einer traurigen Ehe. Die Dramaturgie einer Suchtbeziehung, die von vornherein keine Chance hatte. Wir beide trugen Schuld an unserem Unglück und keiner konnte dem anderen den Vorwurf machen, es nicht gesehen und dadurch billigend in Kauf genommen zu haben. Trotzdem hatten wir in unserer gemeinsamen Zeit auch immer wieder die Chance, dem Unglück eine andere Richtung zu geben. Schlussendlich warf ich Urs vor allem vor, nie richtig den Willen aufgebracht zu haben, das Glück zu wollen und dafür gekämpft zu haben. Er lies mich vor allem in der Zeit in Herzogenbuchsee im Stich und entschied sich für den Weg des geringsten Wiederstandes. Für uns beide zu kämpfen und uns beide zu retten, fehlte mir die Kraft und ohne den Willen von Urs war das auch gar nicht möglich. Ich konnte nur mich selbst retten.
Einmal noch verbrachten wir einen Abend und eine Nacht zusammen. An meinem Geburtstag im Oktober, mitten unter der Woche, liessen wir es krachen mit Essen im Restaurant und anschliessendem Spielcasino bis in frühen Morgenstunden. Nach kurzem Schlaf startete ich in einen neuen Arbeitstag und er wurde von seiner Mutter abgeholt.

Mein Leben ging weiter und mit meinem Leben auch meine Essstörung. Sie war da, ob ich wollte oder nicht. Abwechselnd verbrachte ich die Abende entweder mit Fressen und Erbrechen oder mit Alkohol. Alkohol in Form von Wein verhinderte zwar eine Fressattacke, sollte aber leider auch nicht die erste Wahl sein. Ich wusste sehr genau, dass ich mich ständig in Gefahr begab, aber ich hielt die innere Leere fast nicht aus. Ich empfand dieses Gefühl wie ein grosses schwarzes Loch, das ich mit irgendetwas füllen musste. Die Bulimie war für mich das vertrauteste Instrument. Nicht mehr meine Freundin, aber immer verlässlich wirksam. Neben dem Weintrinken, meinen Essattacken am Abend und meinen Joggingrunden am Morgen meldetet ich mich im Yoga an. Ich suchte nach Alternativen, die mir halfen, meine innere Mitte zu finden. Ich wollte unbedingt der Bulimie etwas entgegensetzen. Es konnte nicht sein, dass ich wieder mein Leben durch sie bestimmen lies. Für mich ein schreckliches Déjà-vu. Auch Rainer, mein guter Freund und früherer Kollege aus Freiburger Zeiten trat wieder mehr in mein Leben. Wir standen die ganzen Jahre locker in Kontakt und das intensivierte sich, als ich quasi «beziehungsfrei» war. Ich hatte nun ja die Freiheit, ihn in Freiburg zu besuchen und er mich in der Schweiz. Niemand fragte nun, wohin ich gehe und woher ich komme. Mir tat seine Anwesenheit sehr gut, ich fühlte mich geborgen in seiner Nähe und wir hatten einige gemeinsame Interessen. Oft kam er an den Wochenenden mit seinem Motorrad zu mir. Gemeinsam fuhren wir nach Luzern, ins Tessin, besuchten Konzerte in Freiburg und Zürich und machten lange Spaziergänge. Ich genoss die gemeinsamen Unternehmungen, mochte ihn wirklich auch sehr gerne, aber verliebt habe ich mich nie in ihn. Vielleicht wäre die Liebe ja im Laufe der Zeit gekommen, hätte ich mich nicht von ihm mehr und mehr unter Druck gesetzt gefühlt. Mit jeder Woche und jedem Besuch wurde seine Geschenke grösser und teurer, seine Umarmungen fester und vereinnahmender, seine Zuwendung ausschliesslicher und zwischen den Besuchen seine Telefonate häufiger. Ich war noch nicht so weit und auch noch nicht bereit, wieder eine Paarbeziehung einzugehen. Ich wollte Freundschaft aber noch nicht mehr.
Irgendwann im Sommer 2008 schrieb ich ihm eine Mail, die ihn offenbar tief verletzte. Aus dem damals empfunden Druck heraus, muss ich wohl sehr vorwurfsvoll geschrieben und eine Besuchspause eingefordert haben. Im Nachhinein habe ich oft überlegt, was ich ihm denn so Schlimmes geschrieben habe. Während des Schreibens empfand ich das gar nicht so, doch Rainer reagiert völlig konsterniert und beendete unsere «Beziehung» sogleich. Ich weiss nur noch, dass ich auch geschrieben hatte, er solle sich doch in erster Linie um seinen Sohn kümmern, der ihn nun, da sich seine Mutter in einer psychiatrischen Einrichtung befand, dringender bräuchte als ich. Sie war ja so schwer am Multipler Sklerose erkrankt, was wohl auch eine Schizophrenie ausgelöst hatte. Ich weiss aber auch, dass ich sehr direkt sein kann und ihm womöglich auch mein «Nichtverliebtsein» um die Ohren schlug. Das traf ihn hart und darum beendetet er unsere gemeinsame Zeit von einer Minute zu anderen. Trotzdem blieben wir weiterhin telefonisch in lockerem Kontakt.
Nur wenige Wochen später hatte er Kerstin und nur wenige Monate später, im Dezember 2008 informierte er mich am Telefon, dass er Vater von Zwillingen werden würde. Für mich war das einerseits ein Schlag ins Gesicht, anderseits wusste ich nun definitiv, dass ich nicht die Richtige für ihn war und er nicht der Richtige für mich. Kinder hätte ich ihm nie bieten können und ich wusste, wie gerne er noch weitere Kinder haben wollte. Kerstin war allerdings eine «harte Nuss» für Rainer, denn sie litt und leidet immer noch an einer Persönlichkeitsstörung. Die dramatischen Ausmasse dieser Krankheit erzählte mir Rainer immer mal wieder sporadisch, bis er 2016 den Kontakt völlig abbrach. Eines jedoch blieb nach Rainers Abschied aus meinem Leben: aufgrund seiner Motivation nahm ich Saxofon-Stunden in der Musikschule.
Irgendeinmal im Laufe unserer gemeinsamen Unternehmungen erzählten wir uns unsere Träume, die sich wohl nie oder nie wieder erfüllen würden. Bei Rainer war es das Motorrad, welches ihm vor Jahren von Christine, seiner Frau ausgeredet wurde (zu gefährlich) und bei mir das Saxofon. Ich sagte Rainer damals, wenn er wieder mit seinem Traum, dem Motorradfahren beginnen würde, dann wollte ich Saxofon-Unterricht nehmen. Und so war es dann auch. Er kaufte sich ein Motorrad und ich meldete mich in der Musikschule an und übte fleissig jeden Tag auf dem Saxofon. Während meiner Zeit im Personalhaus des Spitals war das Üben kein Problem, denn ich konnte jederzeit ins Archiv der Radiologie tief unten in den Katakomben des Spitals. Ich hatte ja einen Schlüssel. Als ich dann aber meine neue Wohnung bezogen hatte, wurde jede Übungsstunde zu einem Risiko, wie lange die Mitbewohner wohl still halten würden. Ich hatte zwar alle Mieter vorher informiert, dass ich nur 30 Minuten pro Tag üben werde und nie nach 18.00 Uhr oder über den Mittag. Trotzdem kam, was kommen musste. Eines Tages stand der Sohn des Hauseigentümers in der Türe, der ganz unten eine Kellerwohnung bewohnte und schrie mich an, er wolle schlafen und was mir einfalle, solch einen Krach zu machen. Es war am späteren Nachmittag. Ab da traute ich mich nicht mehr zu üben. Das war einer der Gründe, weshalb mein Saxofon-Spiel langsam wieder einschlief.

Im Herbst des Jahres 2008 zog ich aus dem Personalhaus des Spitals aus. Eine zu diesem Zeitpunkt hochschwangere Kollegin aus der Radiologie erzählte mir eines Tages, dass morgen die Umzugsleute kämen und sie noch alle Kartons packen müsste und sie momentan gar nicht mehr wüsste, wo ihr der Kopf stände. Sie hätte gar kein Zeit und auch ihr Lebenspartner wäre auf Geschäftsreise und überhaupt wäre alles Chaos. Ich bot ihr meine Hilfe an und noch am selben Abend besuchte ich sie, um Kartons zu packen. Ihr Wohnung glich wirklich einem Schlachtfeld. Sie hatte noch nichts, noch gar nichts gepackt. Mit noch zwei weiteren Helfern packten wir den ganzen Abend und dem nächsten Tag Karton um Karton und schafften gleich alles in die neue Wohnung, welche im selben Dorf lag. Währenddessen erzählte sie mir, dass es noch keine Nachmieter gäbe, die Miete wirklich nicht sehr hoch sei und ob ich nicht Interesse an dieser Wohnung hätte. Ich hatte! So kam es, dass ich zum 1. November 2008 meine neue eigene Wohnung bezog. Einen Tag benötigte ich nur, um meine Habseligkeiten in meinem Auto in die neue Wohnung zu schaffen und die alte Personalhaus-Wohnung zu putzen. Alles allein. In der kommenden Woche bekam die Wohnung einen neuen Anstrich und die drei Zimmer neues Parkett und fertig war mein Reich. Drei Zimmer, Küche, Bad und einen Balkon. Als ich durch meine, zwar bis auf einen Schrank und ein Bett – noch - leere, aber eigene Wohnung schritt, schwor ich mir laut, dass ich hier nie mehr erbrechen würde.
«In dieser Wohnung kotze ich nicht!!» Ich zwang mich dazu und behielt das Essen auch nach einer Essattacke mit mehreren tausend Kalorien und unter Schmerzen bei mir. Ich musste da durch, das wusste ich. Und wenn es mein Leben kosten würde.
Das war der zweite Teil des Anfangs vom Ende meiner Essstörung. Der dritte Teil und mein definitives Ende der Bulimie waren zwei weitere Ereignisse. Ein Burnout oder der Beginn der Wechseljahre (so genau weiss ich das nicht) und der Start meiner Ausbildung zur Ernährungstherapeutin oder eine wunderbare Begegnung. Aber der Reihe nach!
Ich starb nicht. Im Gegenteil, ich genoss mein Reich, mein Nest und war die nächsten Wochen und Monate in meiner Freizeit mit grosser Freude mit dem Einrichten und Dekorieren meiner Wohnung beschäftigt. Kein Möbelhaus, in welchem ich nicht war, kein Haushaltgeschäft oder Deko-Laden, den ich nicht kannte. Für mich war das das reinste Seelenbalsam und half mir sehr, meinen Schwur, ohne weitere Essattacken zu leben, zu halten. An den Wochenenden hielt ich mich bei meiner Mutter auf. Auch das unterstützte mich dabei, ein symptomfreies Leben zu führen. Natürlich war das nicht normal, als Mittvierzigerin die Wochenenden nur mit der Mutter zu verbringen. Wenn man jedoch ein so bewegtes Leben hinter sich hatte wie ich, war alles normal, was nicht gefährlich war. So einfach war das. Seit Jahrzehnten konnte ich erstmals wieder ruhig schlafen und hatte für einmal kein schlechtes Gewissen mehr. Mein Mutter und ich redeten und diskutieren, lachten und weinten zusammen, als gäbe es kein Morgen. Es waren Jahre nachzuholen, Gefühle zu analysieren, Ereignisse aufzuarbeiten. Ein Thema jedoch beherrschte fasst jedes Gespräch: der Vater. Warum lebte er so, wie er lebte? Warum klinkte er sich aus der Familie aus? Weshalb war er immer auf der Suche nach dem Glück und hat nicht gesehen, dass er es schon längst in seinen Händen hielt? Warum zog er das Leben in Asien dem in Europa vor? Weshalb konnte er kein Gefühle zeigen? Warum ging er fremd? Warum konnte er keine Beziehung zu seinen Kindern aufbauen? Fragen über Fragen. Vieles konnten wir beide uns nur vage erklären, wirkliche Antworten fehlen bis heute. Durch die Gespräche mit meiner Mutter fand ich Trost und Vergebung mir gegenüber. Auch das gehörte zum Heilungsprozess. Akzeptieren was war und positiv in die Zukunft schauen.

Während meiner beruflichen Arbeit im Kantonsspital besuchte ich immer wieder Fort- und Weiterbildungen. Unter anderem absolvierte ich einen Führungskurs Human Resources des Kanton Aargau, einen Kurs in Finanzbuchhaltung, einen Kurs der SAP – in Personalarbeit IT und einige Ein- bis Drei-Tageskurse. Mein Wissendurst war enorm, ich wollte so vieles in verschiedenen Richtungen, alles interessierte. Trotzdem fühlte ich mich in der Radiologie nie angekommen. Teamleitung war toll, verantwortungsvoll und gefragt. Aber auch anstrengend, immer zwischen Tischen und Bänken, immer Mehrarbeit, Überzeit und nie wirklich erfüllend. Ich konnte mir oft nicht erklären, weshalb ich mir ständig fehl am Platz vorkam. Vielleicht, weil ich mehr Kontakt zu den Patienten wollte? Weil ich mich tagtäglich unter Druck gesetzt fühlte, mich das Strecken nach allen Seiten überforderte? Es war unmöglich es allen recht machen zu können, musste mich oft Unangenehmem stellen, Kritik üben, war die Überbringerin schlechter Nachrichten. Hatte nie wirklich die Handhabe, etwas zu bewirken oder zu verändern. Ich hatte eine leitende Stelle, aber zuunterst in der Hierarchie. Dort ist die Luft sehr dick, ein Spannungsfeld. Ich war der Prügelknabe, trotz einer – in meinen Augen – motivierenden und empathischen Chefin. Sechs Jahre, von 2006 bis 2012 hielt ich durch, dann brach ich zusammen. Bereits Ende 2011 zeichnete sich etwas ab, das ich bis dahin nicht kannte. Ich stand morgens auf und bekam keinen Fuss vor den anderen, musste mir gut zureden, jetzt die Zähne zu putzen, zu duschen, mich anzuziehen. Ich schleppte mich zur Bushaltestelle (die kurze Strecke von meinem Dorf ins Spital fuhr ich mit dem Bus) und stand dann dort. Fragte mich, was ich eigentlich tat und wollte am liebsten wieder umdrehen und nach Hause. Die Jahre davor hatte ich funktioniert, gut funktioniert, war eigentlich glücklich. Die Bulimie hatte ich wirklich hinter mir gelassen. Hatte seit Monaten, ja schon seit Jahren keine Symptomatik mehr. Ich hatte tatsächlich in dieser Wohnung nie gekotzt. Immer wieder musste ich mir das bewusst machen, ansonsten fiel es gar nicht auf. Das war doch ein guter Grund, um überglücklich zu sein, vor Freude zu tanzen, die Sterne zu küssen und auch sonst die Welt zu umarmen. Ich sollte mich doch frei fühlen, aber das tat ich nicht. Im Gegenteil, ich empfand mein Leben in einem Würgegriff. Etwas lastete schwer auf meiner Brust. Ich war traurig, tottraurig.
Eines Tages im Herbst 2011 erlitt ich während der Arbeitszeit einen Nervenzusammenbruch. Ich heulte und heulte und konnte mich nicht mehr beruhigen. Die Chefin der Radiologie schickte mich nach Hause und mein Hausarzt schrieb mich für ein paar Tage krank. Ich war überzeugt, einem Burnout in die Falle gegangen zu sein. Über Monate hatte sich das zugespitzt. Ich war unglücklich verliebt in einen Kollegen aus dem Spital, der mich nicht wollte und ein anderer Mann interessierte sich für mich, den ich nicht wollte. Mit verschiedenen Männern hatte ich mich verabredet, aber keiner war richtig. Ich hatte Angst vor einer Bindung und dem Gefühl der Unfreiheit. Einsamkeit machte sich breit in mir. Ich hatte keine wirkliche Work-Life-Balance, verbrachte meine Freizeit mit Joggen und meiner Mutter. Ausserdem hatte ich Probleme mit den Mitbewohnern in meinem Mietshaus. Die Kleiderwäsche in der Waschküche funktionierte hinten und vorne nicht. Die Leute konnten sich einfach nicht an die verschieden Waschzeiten halten und so kam es, dass ich in meiner Zeit immer besetzte Waschmaschinen vorfand. Es war ein einziges Ärgernis. Auch sonst wollte ich eine Wohnung zum Wohlfühlen und nicht nur billig und praktisch. Deswegen begab ich mich auf Wohnungssuche. Verflixt und zugenäht, war mein Leben kompliziert.
Auf Anraten des Mannes, der sich für mich interessierte, ich mich aber nicht für ihn, suchte ich Hilfe bei einem Psychiater. Der verschrieb mir als erstes ein Medikament, das mich «mental erden sollte», sprich: ich stand unter Drogen. Einige Monate ging ich regelmässig in seine Beratungen, die mir von Mal zu Mal schräger vorkamen. Die Monate November und Dezember 2011 schrieb er mich krank, was mir tatsächlich am meisten half. In dieser Zeit konnte ich mir überlegen, was ich mit meinem Leben anfangen wollte. Wo wollte ich in Zukunft hin, wie stellte ich mir mein Leben in Zukunft vor? Ich wusste nur eines, ich wollte und musste weg vom Spital. Ursprünglich hatte ich das Ziel, mich durch die Fortbildungen für den Platz meiner direkten Vorgesetzten zu qualifizieren. Schon lange hatte sie mich dahingehend motiviert, denn sie plante einen beruflichen Neustart im USZ in Zürich. Mein angestrebter Plan ging in Schall und Rauch auf, als eines schönen Tages ein bis dahin unbekannter Mann vor mir stand und mich grinsend als mein neuer Vorgesetzter begrüsste. Er bekam die Stelle, die ich eigentlich angestrebt hatte und war zusätzlich im Controlling und Qualitätsbeauftragter der Radiologie. Ab da sah ich für mich im Kantonsspital keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr und ausserdem musste ich auch auf Distanz zu dem Kollegen. Das alles war einfach zu viel für mich. Ich hatte mich schon eine ganze Weile auf den Stellenportalen des Internets umgesehen und war auch da und dort bereits fündig geworden. Leider ist ein Vorstellungsgespräch unter den Umständen eines «Fast-Burnouts» nicht gerade ideal, denn tatsächlich vermasselte ich jedes Gespräch. Mein trauriger Anblick war wohl nicht gerade motivierend für zukünftige Arbeitgeber.
Schon im Sommer 2011 meldete ich mich auf Empfehlung meines neuen Chefs, der mich wirklich unterstützen wollte, bei einer Lebensberaterin an. Drei Stunden war ich bei ihr. Sie drehte und wendete meine berufliche Biografie, befragte mich nach meinen Stärken und meinen Interessen, meinem Leben und meinen Ausbildungen. Nach Fort- und Weiterbildungen, nach Neigungen und Abneigungen, nach Erfolgen und Misserfolgen. Am Ende der Beratung hatte ich einen Plan, eine Adresse und ein Duftfläschchen, worin sich eine Flüssigkeit befand, an der ich schnuppern sollte, wenn ich nicht mehr weiter wusste. Doch mein Plan war sehr konkret, ich wusste nun genau, was ich wollte und wohin mich mein Weg führen sollte. Ich wollte eine berufsbegleitende Ausbildung zur Ernährungstherapeutin machen. Für Menschen mit Essstörungen. Auf der Heimfahrt habe ich mich gefragt, weshalb mir das nicht früher eingefallen war. Diese Ausbildung lag doch so klar auf der Hand und ich wusste auch schon wo. Bei der Apamed in Jona.

Ich rechnete und rechnete. Zuerst mein Alter: ich wurde im Oktober 49 Jahre alt, die Ausbildung dauerte drei Jahre. Dann wäre ich 52 Jahre und erst dann könnte ich mich selbstständig machen. Egal, Hauptsache ein Ziel. Außerdem ist man nie zu alt für gute Pläne! Dann berechnete ich die Kosten: Pro Semester würde mich nur schon die Ausbildung der Ernährungsberatung durchschnittlich 2.000 Franken kosten, zusätzlich kämen noch über 600 Stunden Schulmedizin dazu. Ich rechnete mir aus, dass ich drei Jahre lang pro Monat etwa 300 Franken zahlen müsste. Das konnte ich aufbringen aber nicht ein Semester als Ganzes. Am Infonachmittag erkundigte ich mich nach der Möglichkeit einer Ratenzahlung, was genehmigt wurde. Die nächste Herausforderung war die Zeit. Da die Schule berufsbegleitend organisiert war, fanden die Schultage an den Wochenenden statt. Genauer gesagt, immer Freitag und Samstag und manchmal auch am Sonntag. Also kam ich um eine Pensenreduzierung nicht herum. 80 % Pensum, Freitag frei, dafür weniger Verdienst. Als alles geklärt war stand meinem neuen Lebensweg nichts mehr im Weg. Am 14. Oktober 2011 begann ich meine Ausbildung zur Diplomierten Ernährungstherapeutin. Dadurch, dass ich in den Monaten November und Dezember krankgeschrieben war und ab Januar 2012 zunächst nur in einem 60%-Pensum arbeitete, hatte ich einen sanften Start in Schule und Beruf. Denn trotz allem wollte ich so schnell wie möglich wieder zurück in einen geregelten Berufsalltag. Drei Tage arbeiten und zwei Tage Pause dazwischen war für mich eine ideale Situation. Nach jedem Arbeitstag konnte ich für einen Tag wieder durchschnaufen und mich um meine weitere berufliche Zukunft kümmern.
Bis in den Sommer 2012 ging ich regelmäßig in die psychiatrischen Sitzungen und nahm immer noch die Psychopharmaka. Irgendwann hatte ich den Eindruck, dass mir diese Medikamente nicht mehr helfen konnten und auch der Psychiater war nur noch für die Krankschreibungen wichtig. Außerdem kam mir der Gedanke, dass ich mit bald Fünfzig auch in den Wechseljahren sein könnte und es sich bei meinem traurigen Zustand um eine Wechseljahrdepression handeln könnte. Meine Mutter hatte mir das nämlich schon vorgelebt. Warum war ich nur nicht früher darauf gekommen? Kurze Zeit später, im Rahmen meiner nächsten gynäkologischen Routineuntersuchung thematisierte ich meine Überlegungen. Der Gynäkologe meinte, das könnte durchaus möglich sein und verschrieb mir sogleich Ersatzhormone. Parallel schlichen wir die Psychopharmaka aus. Es war unglaublich und für mich extrem dramatisch. Schon ab dem zweiten Tag nach Einnahme der Hormone fühlte ich mich wie ausgewechselt. Ich war positiv, hatte Freude, fühlte mich wie früher so sicher und motiviert und konnte wieder aufrecht durchs Leben. Diese Erkenntnis traf mich wie ein Schlag. Da hatte ich ein halbes Jahr Medikamente genommen, war jede Woche zu einem Psychiater gegangen und dabei war alles so profan. Ich war einfach in den Wechseljahren. Und was soll ich sagen: ab da nahm mein Leben endlich eine Wende nach oben.

Doch nochmal muss ich kurz ein paar Jahre zurück. Nach einigen Monaten oder vielleicht auch bereits einem Jahr wohnen in meinem Dorf hatte ich als Zugewanderte das Gefühl, ich müsste mich mehr innerhalb des Dorfes integrieren. Immer nur arbeiten und schlafen, vielleicht noch maximal joggen, dafür dann die Wochenendaufenthalte bei meiner Mutter waren auf jeden Fall keine gute Grundlage, um mit den Menschen im Dorf mehr in Kontakt zu kommen. Aber was gibt es ohne Hund und Kind für Möglichkeiten Anschluss zu bekommen? In einen Verein eintreten! Grundsätzlich bin ich nicht so der Vereinstyp, aber eines konnte ich mir gut vorstellen: ich wollte bei der Marktkommission mitmachen. Da meine Wohnung gerade gegenüber dem Dorfplatz lag, bekam ich alle Markttage hautnah mit und hatte immer Freude an den Markttagen. Weihnachtsmarkt, Ostermarkt, Kürbismarkt, Kindersachenmarkt, Trödelmarkt und andere. Als ich irgendwann im Laufe der Zeit im regionalen Dorfanzeiger ein Inserat entdeckte, wonach jemand für den Vorstand der Marktkommission gesucht werde, bewarb ich mich, wurde angenommen und durfte ab der nächsten Sitzung im Vorstand mitwirken. Dass muss so im Herbst 2009 gewesen sein. Natürlich wurde jemand für das Amt der Aktuarin gesucht, worauf sich meistens niemand freiwillig bewirbt, aber für mich war das o.k. Der Marktkommissionsvorstand bestand aus vier Frauen und zwei Männern. Sechsmal pro Jahr traf sich der Vorstand zu den Vorstandssitzungen, die immer kurz vor dem nächsten Markttag stattfanden. Dann wurde alles organisiert. Wer macht was und wann und wer steht dann hinter dem Stand. Die Marktkommission war ein Teil der Gemeindegremien, weswegen es kein Verein im herkömmlichen Sinne war. Eigentlich war es gar kein Verein, sondern – wie der Name schon sagte – eine Kommission innerhalb der Dorfgemeinde. Die Mitglieder waren bereits so gut eingespielt, dass es immer nur eine Sitzung benötigte, um einen Markttag auf die Beine zu stellen. Aber die meiste Arbeit hatte tatsächlich die Aktuarin. Sie schreibt das Protokoll der Sitzungen, verschickt die Einladungen zu dem Märkten an die Marktleute und nimmt die Anmeldungen entgegen. Ich hatte vor allem Freude an den Markttagen. Kürbisse wurden verkauft, am Weihnachtsmarkt boten wir Maroni und Glühwein an, am Ostermarkt Enten- Hühner- und Wachteleier und Äste von Haselnuss und Forsythie und ich lernte die Leute des Dorfes kennen. Natürlich traf ich auch einige meiner Kolleginnen und Kollegen aus dem Kantonsspital, die ebenfalls im Dorf wohnten. Dann gab es immer ein grosses Hallo.
Mit einem meiner Vorstandkollegen stand ich besonders gerne hinter den Ständen. Er strahlte solche Normalität, Sicherheit und Souveränität aus. Am liebsten arbeitete ich mit ihm zusammen. In seiner Gegenwart fühlte ich mich wohl und unbeschwert. Anlässlich der Vorbereitungen zum Weihnachtsmarkt im Dezember 2011, als ich so ganz mittendrin in meiner Burnout-Wechseljahresdepression sass, hatte ich beim Schmücken der Räume und Stände die Gelegenheit mich ausführlich und sehr weinerlich mit dem lieben Kommissionskollegen zu unterhalten. Sehr geduldig hörte er meinen frustrierten Ausführungen zu. Die Situation im Spital, bei mir Zuhause und überhaupt. Er war interessiert und erschien mir sehr verständnisvoll. Bevor ich jetzt aber weitererzähle muss ich nochmals zwei Jahre zurückschwenken. Am Ende eines jeden Jahres, quasi als Dankeschön fand für die Mitglieder der Kommission traditionell ein Abschlussessen in einem Restaurant statt. 2009 war ich das erste Mal mit dabei. Wir trafen uns in einem Restaurant im Nachbardorf. Während des Essens, vielleicht nach dem Hauptgericht, kam ein junges, sehr fröhliches, blondes Mädchen an den Tisch und begrüsste meinen bevorzugten Kommissionskollegen mit einem Küsschen auf die Wange. Er stellt sie als seine siebzehnjährige, mittlere Tochter vor, die hier gerade ihre Kochlehre absolvierte und bereits im dritten Lehrjahr war. «Ui», dachte ich, «na klar, der Mann ist verheiratet». Damit war das Thema für mich abgeschlossen. Er war mir ja sehr sympathisch und ich hätte es natürlich besser gefunden, er wäre ohne Familie, aber eigentlich hätte mich das auch erstaunt. Ich nahm diese Tatsache also wahr und damit war er für mich ein liebenswerter Kommissionskollege aber auch nicht mehr. So verging die Zeit von Markttag zu Markttag. Ich war gerne mit und bei ihm, aber ansonsten war er für mich uninteressant. Bis zum Kürbismarkt im September 2011. Der Markt lief gut, wir verkauften viele Kürbisse, aber es waren zum Schluss auch noch jede Menge übrig. Am Ende des Markttages mussten die Übriggebliebenen wieder zurück zum Gemüsebauern gebracht werden, was mein Lieblingskollege und ich übernahmen. Während der Fahrt kamen wir ins Gespräch. Wir haben auch vorher immer miteinander gesprochen, aber das waren eher oberflächliche Themen und gingen meistens um den Markt und die dazugehörigen Leute. Diesmal jedoch redeten wir über Privates. Er erzählte mir, dass er seit fünf Jahren geschieden sei und drei Töchter hätte. Ich erzählte, dass ich auch geschieden sei und sogar zweimal und die letzte Ehe sehr schwer war und was weiss ich nicht mehr noch alles. Der wichtigste Punkt aber war: er war geschieden, hatte offenbar keine feste Partnerin und ich mochte ihn!
Nun komme ich wieder zum Weihnachtsmarkt 2011, respektive zu meinen Umzugsplänen, die ich bereits erwähnt habe. Nun ja, mein Leben ist komplex und alles fliesst...! Ich fand in meinem Dorf keine bezahlbare Wohnung, weshalb ich mich erweitert umschauen musste und doch tatsächlich eine ganz schnuckelige, gemütliche Parterrewohnung etwa 10 Kilometer entfernt von meinem Dorf fand. In Möriken-Wildegg, eine Ortschaft mit einem Schloss und meine Wohnung mittendrin. Ich schloss sie sofort in mein Herz. Alles flutschte. Ich bewarb mich für die Wohnung und erhielt sie. Meine alte Wohnung übernahm eine Kollegin aus dem Spital, die bereits einen Stock tiefer wohnte, ihr aber zu klein war. Auf Ende 2011 zog ich weg von meinem alten Dorf nach Möriken-Wildegg. Ich schwor mir, (wie ich mir immer etwas in der neuen Wohnung schwor) hier bleibe ich den Rest meines Lebens, aber auf jeden Fall für die nächsten Jahre. Dieser Wegzug bedeutete jedoch auch, dass ich Abschied von der Marktkommission nehmen musste. Der Zeitpunkt meines Abganges war das Ende des Jahres 2011, was ich im Oktober / November mittteilte. Den Weihnachtsmarkt habe ich noch mit organisiert, aber dann war Schluss. Während des Marktes, als ich gerade mit den Kindern Stockbrot über dem offenen Feuer backte, kam mein Lieblingskollege zu mir und meinte, ich hätte ja nach dem Ende der Marktkommission wieder freie Kapazität für eine neue Aufgabe. Ob ich nicht in den Trägerverein der Voliere des Schlosses Wildegg mitmachen wollte, auch als Aktuarin. Nun, Vögel waren einerseits ein ganz anderes Thema, mit dem ich mich noch nie vorher auseinandergesetzt hatte, anderseits war ich gerade froh, eine Sache weniger zu haben. Ich befand mich ja momentan eher in der Situation von meinem Leben überrollt zu werden. Ich wollte es mir auf jeden Fall überlegen. Ich habe es mir überlegt und zugesagt.
2012 verkörperte für mich das Jahr der Umkehr, der Entscheidungen, der Neuausrichtung. Im Sommer 2012 entschied ich mich für eine neue berufliche Herausforderung. Nach fast sechs Jahren beendete ich meine Arbeit im Kantonsspital und wechselte in die Stiftung für Behinderte in Lenzburg, denn der Stiftungsleiter benötigte eine neue Sekretärin. Diese Chance erhielt ich durch eine Schulkollegin meiner Ernährungstherapeuten-ausbildung, die diese Stelle vor mir einnahm. Ganz neue «kalte Wasser» eröffneten sich mir und ich musste einmal mehr da «reinspringen». Noch nie zuvor war ich «First Level Supporterin» oder «Assistentin Sozialdienst». Aber wie heisst es so schön? Wer nichts wagt, der nicht gewinnt!

Sodele, jetzt kommt es: Wenn Ihr nun den ganzen Text zurück blättern würdet, wann habe ich das letzte Mal die Essstörung erwähnt??? Eben! Echt schon lange her. Die gab es nicht mehr. Die war einfach verschwunden. Irgendwann zwischen Depression und Wohnungswechsel, zwischen diesem oder jenem beruflichen Umschwung, zwischen Bänken und Stühlen ist sie untergegangen. Das war es, was mein neues Lebens ausmachte. Ich war endlich frei. Über all dem, was passiert war, war ich älter geworden, war ich stärker geworden, war ich weiser geworden. Und in manchen Dingen auch gelassener. Mein Leben hat den Platz wieder eingenommen, der ihm auch gebührt.
Das Letzte, was ich jetzt noch erzählen möchte, ist das:
der liebenswerte Kollege aus der Marktkommission hat mich nicht nur in einen neuen Verein gelockt, sondern wenige Tage später auch in ein ganz wunderbares Restaurant. Wir haben uns unser Leben erzählt. Als Letzte verliessen wir das Restaurant und auch nur nach Aufforderung des Wirtes. Ich versprach, mich bei ihm zu melden, was ich jedoch etwas hinauszögerte, weil ich mir zuerst klar werden musste, was ich wollte. War das wieder nur der schlechte Versuch einer Beziehung?
Nein, soviel Menschenkenntnis traute ich mir doch mittlerweile zu und mein Bauchgefühl sagte mir, «Tu es. Ruf Ihn an!» Ein paar Wochen später habe ihn zum Essen eingeladen. Zu mir nach Hause und selbstgekocht. Schon der Apero zog sich hin, soviel hatten wir uns zu erzählen. Ich sage nur: die Kürbissuppe ist Brei geworden, das Fleisch war trocken und das Dessert ging vergessen… oder so ähnlich. Ab diesem Abend bin ich während zwei Jahre wieder zurück in mein altes Dorf gependelt.
2012 wurde ich Fünfzig. Eine sagenhaft hohe Alterszahl, wenn man noch einiges zu erledigen hat und sich auch noch gar nicht wie fünfzig fühlt. «Da muss irgendetwas schiefgelaufen sein»! Und ja, an keinem meiner «runden» Geburtstage habe ich mich so gut und froh gefühlt, wie an diesem. Ich habe ein Freundesfest gefeiert und alle mir wichtigen Menschen dazu eingeladen. Sogar mein Vater ist von den Philippinen angereist. Ich hatte einen Saxophonist, einen Pianist und einen Cellist organisiert, ein Buffet auf die Beine gestellt und tollen Wein eingekauft. Mein fünfzigster Geburtstag war für mich das Befreiungsfest aus den Zwängen der letzten fünfunddreissig Jahren. Und es war der Beginn einer Liebe, einer Hoffnung, eines neuen Weges, den ich vor gar nicht mal so langer Zeit, nie für möglich gehalten hätte.
Ende 2013 bin ich wieder zurück in mein altes Dorf gezogen, allerdings nicht mehr in ein Mietshaus mit einer öffentlichen Waschküche, sondern in das Haus meines Lieblingskollegen aus der Marktkommission.
2018 haben wir geheiratet.
Bulimie? Es war einmal ein junges Mädchen…
(1) Ein kurze Blick zurück, doch vorwärts wartet die grosse Weite. In Freiheit!

2014 habe ich meine Ernährungstherapeutinnen-Ausbildung abgeschlossen. Bereits ab Sommer 2013, ab dem Stand «Ernährungs-Coach» war ich befugt, Beratungen durchzuführen. Berufsbegleitend habe ich viele Frauen und Mädchen auf ihrem schweren Weg raus aus der Essstörung begleitet und in die Gespräche so gut es ging meine eigenen Essstörungserfahrungen mit einfliessen lassen. Doch ich habe festgestellt, dass jede Betroffene ihre ganz eigene Geschichte lebt. Viele sehr berührend, viele sehr schwierig. Der Kampf für das eigene Leben ist immens. Ich hatte oft das Gefühl, als Therapeutin versagt zu haben, hilflos zu sein, nicht genügt zu haben. Aber das stimmt nicht. Jeder Mensch mit einer Essstörung muss seinen Weg selber finden. Muss bereit sein, die Hände zu ergreifen, die sich ihm entgegenstrecken. Und muss begreifen, dass jede Hand nur eine zusätzliche Hilfestellung sein kann. Was er daraus macht, ist ihm ganz und selbst überlassen. Ich habe von den sehr vielen Hilfesuchenden in den wenigen Jahren, in denen ich die Beratungen durchführte, nur eine Person erlebt, die aus der Essstörungsspirale herausfand.
2018 habe ich nochmals sechs Monate eine Schule in Zürich besucht, um einen Schweizer Abschluss als Arztsekretärin zu erhalten. Ausser einem guten Training für das Gehirn, hat mich dieses Zertifikat leider nicht viel weiter gebracht.
Anfang 2019 beendetet ich meine Beratungstätigkeit. Nicht, weil ich es nicht mehr konnte, sondern weil ich plötzlich das Gefühl hatte, das Thema, mein Lebensthema geht nun endgültig zu Ende. Einmal musste Schluss sein mit dem Thema Essen und den Schwierigkeiten drumherum. Neben der Arbeit als Ernährungsberaterin bin ich ebenfalls als Vorstandsmitglied bei der AES – Arbeitsgemeinschaft Essstörungen Schweiz tätig und war über einige Jahre Teilnehmerin der Vernetzungstreffen aller Therapeutinnen zum Thema Essstörungen. Der letzte Teil, das fehlende Puzzleteil war diese Biografie. Im März 2021 beende ich ebenfalls die Vorstandsarbeit bei der AES.
Parallel dazu zog ich mich zudem aus dem Berufsleben als Solches zurück. Nachdem ich mehrere Male erfahren musste, dass ein Arbeitnehmer nach dem fünfzigsten Lebensjahr zu teuer sein kann oder dass der Mensch am liebsten eine «Eierlegende Wollmilchsau» sein sollte, damit er mit über Fünfzig noch Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat, habe ich mich entschieden, dass nun der Zeitpunkt gut wäre, meine Autobiografie zu schreiben. Ausserdem durfte ich ab März 2020 die Pflege der rund dreissig Vögel einer grossen Vogelvoliere übernehmen, sowie ab September 2020 meinen Mann in seiner Tierarztpraxis unterstützen. Ausserdem liebe ich unsere Hühnchen und Schildkröten und das Haus und den Garten. Es gibt also immer was zu tun.
Die Bulimie ist nie mehr zurückgekommen. Ich hatte auch niemals mehr den Drang zu fressen und/oder zu erbrechen. Mittlerweile erscheinen mir die Jahre meiner Essstörung wie ein böser Traum. Wie einer dieser Alpträume meiner Kindheit. Und doch spüre ich tagtäglich, dass da etwas war. Ich habe zum Glück keine ernsthaften körperlichen oder seelischen Spätfolgen aus dieser Zeit davon getragen aber ein paar «Macken» eben doch. Ich bin weder diplomatisch noch geduldig, wenn es um Macht und Ungerechtigkeit geht und ich habe ein Reizdarmsyndrom. Ausserdem arbeite ich immer noch an meinen negativen Gefühlen im Umgang mit «nicht wahrgenommen werden». Aber damit kann ich – meistens jedenfalls – leben und ein paar Macken muss der Mensch ja haben.
Alles in allem kann ich sagen: «Ja, ich hatte grosses Glück in meinem Leben!» Immer wieder haben sich mir Hände zugesteckt, die ich ergreifen durfte. Diese Menschen werden auch Engel genannt. Das grösste Glück, mein Lieblingskollege aus der Marktkommission, meine kostbarste Liebe, mein Mann, Freund und Diskussionspartner kam zwar reichlich spät, aber zum Glück nicht zu spät.
(1)
Hier noch mein Appell:
Eine Essstörung ist nicht Leben, Gesundheit, Schönheit, Liebe, Achtung, Wertschätzung, Freude, Zufriedenheit, Lebenspläne, Hoffnung, Träume und Verantwortung.
Eine Essstörung zu haben bedeutet der Tod von Träumen, Zukunft, Schönheit, Gesundheit, Freude, Zufriedenheit, Hoffnung, Freude, Achtung, Wertschätzung und der Liebe.
Es lohnt sich nicht, die tägliche Nahrungsaufnahme als Instrument zu gebrauchen, denn der Preis, den Ihr bezahlt, ist viel zu hoch! Ihr bezahlt mit eurem Leben und den Träumen Eurer Familie, Freunde und Eurer Liebe. Der Liebe zu Euch selbst und anderen Menschen.
Die Natur – und ihr seid ein Teil davon – hat Euch so geschaffen, wie Ihr seid. Einzigartig! Diese Einzigartigkeit dürft Ihr nicht wegwerfen für ein paar Kilos mehr oder weniger, für ein bisschen mehr zerstörerische Beachtung durch ebenso zerstörerische «Freunde» oder «Vorbilder».
Nach meinem langen Leben mit der Bulimie, einem schier endlosen Kampf um Selbstbewusstsein und Selbstachtung, vielen zerstörten Träumen und Hoffnungen, einigen daraus hervorgegangenen körperlichen Beschwerden und einer unendlichen Traurigkeit über das eigene Tun, kann ich mit aller Überzeugung sagen: Essstörung ist schlimmer als alles andere. Essstörung zerstört nicht nur ein paar wenige Kilos, die der Körper möglicherweise benötigt, sie zerstört den ganzen Menschen.
Bitte denkt daran!