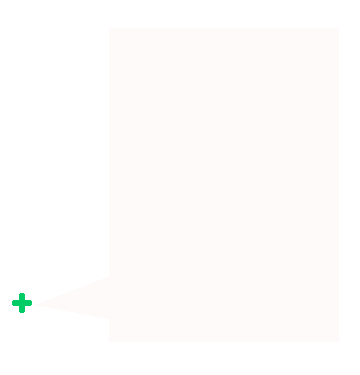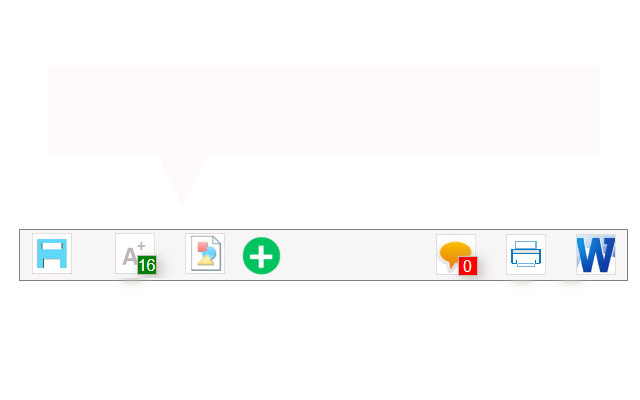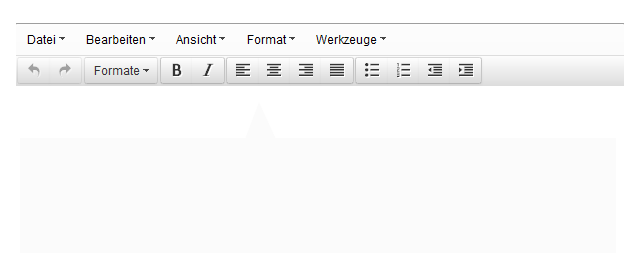Zurzeit sind 552 Biographien in Arbeit und davon 313 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 191

Rückblick und Motivation
Olvidar es como no haber vivido – Vergessen ist, als hätte man nie gelebt.
Dieses beeindruckende spanische Sprichwort drückt mit kurzen Worten eine traurige Realität aus, die nicht nur für einen selber gilt (erinnere ich mich nicht mehr an ein bestimmtes Ereignis in der Vergangenheit, ist es gleichbedeutend, wie wenn ich es gar nicht erlebt hätte), sondern auch für unsere Mitmenschen:
Kaum gestorben – schon vergessen.
In den Todesanzeigen liest man gelegentlich, dass der oder die Verstorbene noch lange in den Herzen der Angehörigen weiterleben wird. – Das ist aber nicht immer so und muss auch nicht unbedingt sein. Wer weder Freunde noch Familie mehr hat – wer soll sich da schon gross erinnern?
Zudem: Auch unangenehme Menschen sterben, und wer schon möchte diese im Herzen behalten?
Schön ist die Vorstellung aber doch, dass man im umgekehrten Fall davon ausgehen kann, nicht sofort vergessen zu werden.
Das jedenfalls ist ein Teil meiner Motivation, das Puzzle meines Lebens zu Papier zu bringen beziehungsweise in den PC einzutippen, damit meine Enkelkinder, sollten sie das später einmal wollen, mehr über mich, über mein Umfeld und die Zeit, in der ich lebte, erfahren können. – Ich hatte und habe so viel Glück gehabt im Leben – darüber berichten, tue ich gern.
Es würde mich heute sehr interessieren, wie meine Vorfahren gelebt haben, wie sie „getickt“ haben, was ihnen wichtig war, welche Höhen und Tiefen sie zu überwinden hatten. – Aber sie haben nicht geschrieben, sie haben sich nicht mitgeteilt.
Den Eltern und Schwestern meines Vaters zum Beispiel bin ich nicht ein einziges Mal begegnet.
Daher kann in meinem Fall der Satz sogar noch krasser formuliert werden:
Nie gekannt – vergessen ist gar kein Thema.
Rückblick und Motivation
Olvidar es como no haber vivido – Vergessen ist, als hätte man nie gelebt.
Dieses beeindruckende spanische Sprichwort drückt mit kurzen Worten eine traurige Realität aus, die nicht nur für einen selber gilt (erinnere ich mich nicht mehr an ein bestimmtes Ereignis in der Vergangenheit, ist es gleichbedeutend, wie wenn ich es gar nicht erlebt hätte), sondern auch für unsere Mitmenschen:
Kaum gestorben – schon vergessen.
In den Todesanzeigen liest man gelegentlich, dass der oder die Verstorbene noch lange in den Herzen der Angehörigen weiterleben wird. – Das ist aber nicht immer so und muss auch nicht unbedingt sein. Wer weder Freunde noch Familie mehr hat – wer soll sich da schon gross erinnern?
Zudem: Auch unangenehme Menschen sterben, und wer schon möchte diese im Herzen behalten?
Schön ist die Vorstellung aber doch, dass man im umgekehrten Fall davon ausgehen kann, nicht sofort vergessen zu werden.
Das jedenfalls ist ein Teil meiner Motivation, das Puzzle meines Lebens zu Papier zu bringen beziehungsweise in den PC einzutippen, damit meine Enkelkinder, sollten sie das später einmal wollen, mehr über mich, über mein Umfeld und die Zeit, in der ich lebte, erfahren können. – Ich hatte und habe so viel Glück gehabt im Leben – darüber berichten, tue ich gern.
Es würde mich heute sehr interessieren, wie meine Vorfahren gelebt haben, wie sie „getickt“ haben, was ihnen wichtig war, welche Höhen und Tiefen sie zu überwinden hatten. – Aber sie haben nicht geschrieben, sie haben sich nicht mitgeteilt.
Den Eltern und Schwestern meines Vaters zum Beispiel bin ich nicht ein einziges Mal begegnet.
Daher kann in meinem Fall der Satz sogar noch krasser formuliert werden:
Nie gekannt – vergessen ist gar kein Thema.
TEIL 1 - Kindheit und Jugend (1953 - 1972)
Grosseltern
Von meinen Grosseltern väterlicherseits weiss ich so gut wie gar nichts. Ich habe sei nie kennengelernt. Ganz offensichtlich stimmte die Chemie zwischen ihnen und meiner Mutter überhaupt nicht. – Das einzige winzige Detail, das sie mir erzählt hat, ist das folgende: Als meine Schwester zur Welt kam (sie ist zwölf Jahre älter als ich), habe die Schwiegermutter ihr als „Geschenk“ ein Stück Zwetschgenkuchen ins Spital gebracht…
Wenn eine solche Episode die einzige Erinnerung beziehungsweise die einzige überlieferte Begebenheit ist, von der man weiss, dann gibt das zu denken. Schliesslich handelt es sich bei den Grosseltern doch um nahe Verwandte, die man eigentlich kennen sollte. – Und wenn ich mir vorstelle, meine eigenen Enkelkinder hätten später mal keine Ahnung davon, wer wir sind, wer wir waren, mein Mann und ich, wie wir leben und gelebt haben, was uns wichtig war und was nicht – dann wäre das doch durchaus ein Grund, sich im Grabe umzudrehen.
Damit das nicht passieren muss, widme ich diesen Text den beiden Mädchen unserer ältesten Tochter Kay:
Ella Sofia (geb. 2010) und Amy Lynn (geb. 2013).
Ebenfalls dem Jungen unserer jüngeren Tochter Kim:
Teo Jaxx (geb. 2017).
Und: Im November 2019 wird Kim ein weiteres Kind auf die Welt bringen. Ein Mädchen oder ein Knabe? - Wir wissen es noch nicht. Es soll für alle eine Überraschung sein.
Es gibt noch weitere Gründe, weshalb ich mich entschlossen habe, bei „meet-my-life“ mitzumachen. Einer davon ist ganz banal: Ich schreibe gern.
Schreiben hilft, Erlebtes nochmals Revue passieren zu lassen, es zu verdauen und sich vielleicht erneut damit zu befassen.
Geschichten erfinden kann ich überhaupt nicht. Ich mag es aber, Situationen zu schildern, die mich in irgendeiner Weise angeregt haben, sie niederzuschreiben, damit ich sie nicht vergesse. So habe ich oft Episoden beschrieben, die ich mit meiner inzwischen längst verstorbenen Schwiegermutter erlebt habe oder auch Begebenheiten aus meinem Schulalltag. Gerne notierte ich auch, was unsere Kinder Lustiges sagten oder taten, als sie noch klein waren. Es wäre jammerschade, wenn das alles verloren wäre.
Heute schreibe ich vor allem Reiseberichte, denn wenn man unterwegs ist, erlebt man viel, vergisst aber auch manches wieder, wenn man es nicht festhält. Und das ist, wie bereits erwähnt, wie wenn es gar nie stattgefunden hätte. – Fotos sind zwar gewaltige Gedächtnisstützen, aber eben nur Momentaufnahmen. Eine Situation beschreiben ist etwas ganz anderes.
Schon eine Zeit lang trage ich mich mit dem Gedanken, meine Reiseberichte und auch die anderen Texte in einem Buch zusammenzufassen, ergo: Hier habe ich die Möglichkeit, das eine mit dem anderen zu verbinden.
Den Streifzug durch mein Leben beginne ich mit meinen frühesten Erinnerungen an meine engste Familie.
Oma
Nur eine meiner Grossmütter habe ich gekannt: Oma – die Mutter meiner Mutter. Sie starb in Schaffhausen, als sie knapp achtzig und ich siebenjährig war, also im Jahr 1960. Am besten beschreibe ich sie aus meiner damaligen Warte:
Schwarz gekleidet sass sie in ihrem Sessel, grobe, graue Strümpfe trug sie und an den Füssen warme Finken aus Filz. Ihr weisses, schütteres Haar, das in kleine Löckchen frisiert war, hatte sie notdürftig zu einem spärlichen Dutt am Hinterkopf zusammengebunden. Was mich besonders faszinierte, waren die Bartstoppeln, die an ihrem Kinn spriessten. Für mich war sie der Inbegriff einer Greisin. - Ihre Hände zitterten ständig – ein weiteres Merkmal, das ich damals nicht einordnen konnte. Sie sprach deutsch, Hamburgerdialekt, und obwohl sie schon seit Jahren in der Schweiz bei ihrer zweitältesten Tochter Wally lebte, sprach sie kein Wort Schweizerdeutsch und gab auch vor, nichts davon zu verstehen.
Zum Frühstück ass sie Brot und Zwetschgenkonfitüre. Ausschliesslich, stur. Nie hätte sie einen anderen Brotaufstrich probiert. „Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht.“ Das war ihre Devise und daran hielt sie sich strikt.
Eine weitere Erinnerung aus meinen Ferien in Schaffhausen:
Tante Wally bat mich, Omas Bluse zu holen, damit sie diese waschen konnte. Ich ging also zu ihr ins Zimmer und bat sie: „Oma, gib mir deine Blause“. Sie hat sehr gelacht und ich war überaus beleidigt. „Bluse“ fand ich absolut nicht dem deutschen Sprachsound entsprechend und das erklärte ich den beiden Frauen auch (man sagt doch auch „Pause“ und nicht „Puse“). Dass dann auch noch meine Tante lachte, machte die Sache für mich nicht besser, führte aber dazu, dass ich dieses Erlebnis nie vergass.
Manchmal hat sie mir aus ihrem Leben erzählt, aus der Zeit rund um den ersten Weltkrieg, als sie noch jung war und in Deutschland lebte. Ein paar ihrer Erlebnisse sind mir im Gedächtnis geblieben, weil sie mich tief bewegt haben und ich sie wohl auch nicht richtig begreifen konnte. Sie muss in einer kinderreichen Familie aufgewachsen sein. Von drei oder vier ihrer Brüder berichtete sie mir. Der eine sei an Cholera gestorben, ein anderer in russischer Gefangenschaft umgekommen, ein dritter nach dem Krieg bei ihr aufgetaucht; er habe kaum mehr gehen können. Während längerer Zeit habe er in einer Grube hausen müssen, und damit er und seine Kameraden nicht hätten fliehen können, habe man ihnen die Achillessehnen durchtrennt. - Solche Gräuelgeschichten musste ich als Sechsjährige verdauen. Vielleicht hat sie mir auch noch andere, schönere Dinge erzählt, meine Oma. Daran kann ich mich aber nicht mehr erinnern.
Meine Mutter erzählt aus ihrer Kindheit und Jugend
Auch meine Mutter hat mir oft aus ihrem Leben erzählt. Geboren wurde sie am 7. Juli 1911 in Hamburg, also kurz vor dem ersten Weltkrieg.
Das Leben in der Stadt muss nicht einfach gewesen sein zu jener Zeit, aber an Einzelheiten aus ihren Schilderungen erinnere ich mich kaum mehr. Erst viel später, als ich selber schon erwachsene Kinder hatte und mich für das Leben meiner Mutter zu interessieren begann, reute es mich, dass ich ihr nicht besser zugehört hatte, als sie von früher erzählte. Das wollte ich nachholen, was mir allerdings nur mit mässigem Erfolg gelang.
Sie war bereits im Altersheim, als ich sie mit Notizblock und Tonband bewaffnet besuchte und bat, mir nochmals aus ihrer Kindheit und Jugend zu berichten. Das war nicht die beste aller Ideen. – Einerseits liess die Qualität der Tonaufnahme auf meinem einfachen Kassettenrecorder mehr als nur zu wünschen übrig, und andererseits, was das Schlimmste war, Mam war emotional so erschüttert über ihre eigene Geschichte, dass sie zu weinen begann und gar nicht mehr weitererzählen wollte.
Einzig das, was sie von ihren Ferien auf dem Lande berichtete, konnte ich zuvor im Detail aufschreiben, da ihr diese Erinnerungen nicht so sehr zusetzten.
Aus diesem Grund gebe ich den nächsten Abschnitt in der Ich-Form wieder, so wie sie erzählte:
„Nach dem Krieg durfte ich oft Ferien bei Verwandten verbringen, nämlich in Mecklenburg, Schönberg, in der Nähe von Lübeck.
Wilhelm, der Grossonkel meiner Mutter, besass dort ein Haus auf dem Land. Er war Viehhändler und hatte zwei Söhne, Willy und Hans. Hans war nicht ganz „hundert“, aber ein sehr liebenswürdiger junger Mann.
Willy heiratete dann Lene Ohlroggen. Bei ihnen fühlte ich mich wohl und ich durfte manchmal mehr als eine Wochen dort bleiben.
Das Land war eben, überall hatte es Wiesen mit wunderschönen gelben Glockenblumen; man sah den Kirchenturm von Lübeck. - Im Haus hatte es kein fliessendes Wasser. Ich sehe noch den Schrank vor mir, in dem grosse Schüsseln mit Milch drin standen, wo täglich der Rahm oben abgeschöpft wurde“.
Aus ihren Berichten musste ich schliessen, dass sie mit ihrer Mutter, meiner Oma, nicht die beste Beziehung hatte. – Sie fuhr weiter:
„Einmal kam meine Mutter mich abholen. Meine Cousine Luise (sie machte den besten Streuselkuchen weit und breit) und die Erwachsenen sassen im Wohnzimmer und schwatzten noch. Ich und Mariechen, ein etwa gleichaltriges Nachbarskind, wir vergnügten uns draussen. Ich hatte schon das Sonntagskleid an, bereit zur Abreise. Unglücklicherweise fiel ich beim Spielen in einen Bach. Mariechen nahm mich mit zu sich nach Hause, gab mir frische Unterwäsche und gemeinsam rangen wir das nasse Kleid aus. Aber natürlich merkte meine Mutter sofort, was passiert war, und zur Strafe fuhr sie alleine heim nach Hamburg – ich blieb zurück. Ohne Essen wurde ich ins Bett geschickt und erhielt nur eine Tasse warme Milch, was ich ja aufs Höchste verabscheue.
Am nächsten Tag musste ich alleine mit dem Zug heimreisen.“
Auch von einem Spitalbesuch erzählte sie. Sie war damals siebenjährig:
„Ich musste mir Polypen aus der Nase wegmachen lassen. Nach der Operation wachte ich in einem Zimmer auf, in dem auch vier Frauen untergebracht waren. Alle waren sehr nett zu mir und die eine zeigte mir, wie man aus Postkarten Puppenbettchen anfertigen kann. Ich war fasziniert von dieser Tätigkeit. Als mich nach wenigen Tagen meine Mutter im Spital abholen wollte, versteckte ich mich und sie zog ohne mich von dannen. Am nächsten Tag allerdings funktionierte dieser Trick leider nicht mehr.
Es muss im Jahr 1925 gewesen sein, kurz nach der Inflation, als ich in die Ferien nach Zürich geschickt wurde. Kaum angekommen, erhielt ich die Nachricht, die ganze Familie ziehe um in die Schweiz, ich solle gar nicht mehr nach Hamburg zurückkehren. - Und so habe ich zum ersten Mal alles verloren, denn weder meine Mutter noch meine Schwester Wally kümmerten sich um meine Habseligkeiten – nichts, was mir gehörte, brachten sie mit.
Erst lebten wir in Zürich, dann in Schaffhausen. Dort gingen wir beide in die Sekundarschule. Wally hatte einen netten Lehrer (sie hat ja immer das bessere Los gezogen), aber mein Lehrer, Herr Isler, war ein Ekel. Nie mehr vergesse ich, wie er jeweils zur Klasse sagte: „Jetzt liest Irène. Hört gut zu; da gibt es wieder etwas zu lachen“. - Natürlich machte mir der Dialekt am Anfang grosse Mühe.
Nach zwei Jahren war die Schule zu Ende. Meinen Vater sah ich selten. Auch die Mutter wusste nicht, wo er war. Geld von ihm erhielten wir so gut wie nie. Ich musste arbeiten gehen; die Mutter wollte es so. Die Korsettfabrik Bachmann suchte Arbeiterinnen. Den ganzen Tag lang musste ich Strumpfhalter an den Korsetts annähen, immer dasselbe. Es gab Nähmaschinen mit einer Nadel, mit zwei und dann sogar mit drei. Bald schon wurde ich an eine Maschine mit zwei Nadeln befördert. Am Ende der Woche war Zahltag. Meine Mutter wartete dann mit Heini an der Hand, meinem damals vierjährigen Bruder, draussen vor der Tür und nahm die Lohntüte in Empfang. Kein Taschengeld, keinen einzigen Franken erhielt ich je für meine Arbeit“.
Da kam der Moment, wo ihre Erzählung ins Stocken geriet, wo sie so tief in die schmerzliche Erinnerung versank, dass sie nicht mehr weiter berichten wollte.
Aus meiner Erinnerung nun wieder die folgenden Gedächtnisfetzen:
Grossvater und seine Familie
Es musste ja einen Grund gegeben haben, weshalb die Familie meiner Mutter so plötzlich in die Schweiz übersiedelte. Offenbar war mein protestantischer Grossvater Vorsitzender einer katholischen Institution gewesen und als dieser „Betrug“ ans Licht zu kommen drohte, gab er Fersengeld. – Eher seltsam zu verstehen aus der heutigen Perspektive, aber damals...
Kennengelernt habe ich ihn nie, was, wie meine Mutter mir versicherte, überhaupt kein Verlust war.
Er war ja Schweizerbürger, und wie es dazu kam, dass er mit seiner Familie eine Zeitlang in Deutschland gelebt hatte, weiss ich nicht. Wann und wo er starb, ist mir ebenfalls nicht bekannt.
Offenbar war er ein Weiberheld, wie man dieses „Phänomen“ oder diesen Typ Mann früher politisch unkorrekt zu bezeichnen pflegte. So jedenfalls hat sie ihn mir beschrieben. Kaum zurück in der Schweiz, habe er sich von Oma (natürlich war sie damals noch alles andere als eine Oma) scheiden lassen.
So hatte meine Mutter kaum Kontakt zu ihren Vater, aber sie erinnerte sich an eine Begegnung am Bahnhof in Schaffhausen, als er sie vom Zug abholte (sie war damals etwa achtzehnjährig). Ein paar seiner Kollegen seien ebenfalls auf dem Bahnsteig gewesen und der eine habe laut und deutlich zum anderen gesagt: „Schau mal, der Spengler hat schon wieder eine Neue“.
Natürlich war auch meine Oma nicht zu beneiden in jener Zeit. Sie hatte kein Geld und keine Arbeit, lebte in einem „fremden“ Land, ihr Mann hatte sie verlassen; sie musste drei Kinder grossziehen, einen zweijährigen Buben (Franz Heinrich, genannt Heini, der später mein Götti wurde) und die beiden Mädchen Irène und Wally, vierzehn und dreizehnjährig. - Irène, die Älteste, hatte schon früh viel Verantwortung übernehmen müssen, während Wally als Mutters Liebling ständig bevorzugt wurde. So zumindest empfand meine Mutter die Situation, und das Gefühl, das fünfte Rad am Wagen zu sein, vom Schicksal stiefmütterlich behandelt, wurde sie zeitlebens nicht mehr los. Nebst der Tatsache, dass sie schon als Kind hatte Geld verdienen müssen, um mitzuhelfen, die Familie durchzubringen, war es auch ihre Aufgabe, manchmal den kleinen Bruder zu hüten, mit dessen Tobsuchtsanfällen sie ihre liebe Mühe hatte.
Irgendwann nach ihrer Schul- und Arbeitszeit in der Fabrik wohnte sie ein paar Monaten lang in Davos, wo sie eine Handelsschule besuchte.
Es war ein kalter Winter. Dort, wo sie wohnte, war’s kaum geheizt und sie sparte während Wochen für einen warmen Mantel. Als sie das Geld fast beisammen hatte, erhielt sie einen Brief ihrer Mutter, in welchem diese sie bat, ihr einen Betrag zwecks Zahlung der Heizkosten zu überweisen. - Sie schickte ihr Erspartes. Ihre Ausbildung musste sie kurz vor Abschluss abbrechen; sie konnte sie nicht mehr bezahlen.
Zeitlebens hegte sie einen unterschwelligen Groll gegen ihre jüngere Schwester, die in ihren Augen ein bequemes Dasein hatte führen können, verwöhnt worden war und ganz allgemein mehr Glück im Leben gehabt hatte als sie. - Ich mochte diese Tante, die auch meine Patin war, sehr. So war es mir oft peinlich, wenn meine Mutter sie aus heiterem Himmel mit irgendwelchen Vorwürfen oder versteckten Beschuldigungen, die meiner Meinung nach absolut haltlos waren, anfeindete.
Ich greife nun ein wenig vor:
Beim Sterben ging‘s in umgekehrter Reihenfolge: Erst starb Heini im Jahr 2003 im spanischen Denia, wo er schon seit über 20 Jahren gelebt hatte, an irgendeiner Krankheit. Drei Jahre später wurde Wally im Alter von 93 Jahren vor ihrem Altersheim mitten in der Stadt Schaffhausen hinterrücks überfahren und der Autofahrer oder die Autofahrerin fuhr einfach davon.
Schliesslich war die Reihe an meiner Mutter Irène. Sie starb am 28. März 2014 kurz vor ihrem hundertdritten Geburtstag an Altersschwäche in einem Pflegeheim in Ittigen, einem Vorort von Bern.
Nicht nur Dramatisches und Schlimmes hat meine Mutter erlebt und erfahren, auch Erfreuliches und Lustiges; allerdings mass sie dem leider nicht die gleiche Bedeutung bei.
Die „Geschichten“, die ich hier niederschreibe, an die ich mich mal besser, mal schlechter erinnere, haben den Mangel, dass mir deren Chronologie teilweise überhaupt nicht geläufig ist und mir oft die Verbindungslinks fehlen. So reihe ich Episoden aneinander, die sich zeitlich unterschiedlich ereignet haben, wie ein Puzzle, halt gerade so, wie sie mir in den Sinn kommen.
Mehr als einmal hat sie dasselbe erzählt und ich dachte und sagte manchmal: „Mam, diese Geschichte kenne ich bereits; die hast du mir schon hundertmal erzählt…“.
Zum Beispiel als sie in Besançon eine Aupair-Stelle bei einer Familie innehatte und miterleben musste, wie der Ehemann seine Frau mit einem Revolver hatte umbringen wollen. Die Waffe sei in einer Hutschachtel versteckt gewesen, die sie beim Aufräumen zufällig entdeckt hatte. Ein dramatisches Ende hat die Geschichte genommen, leider weiss ich die Einzelheiten nicht mehr, nur noch, dass meine Mutter kurzfristig den Zug nahm und zurück in die Schweiz floh, während der Monsieur von der Polizei verhaftet wurde. - Wenigstens war Mam lange genug bei dieser Familie beschäftigt gewesen, so dass sie hatte Französisch lernen können.
Englisch lernte sie dann auch. In der Nähe von London. Sie war 20-jährig, als sie mit einem Einweg-Zug-Ticket nach England fuhr. Im Gepäck hatte sie wenig, ein paar Kleider zum Wechseln nur und die Adresse, die man ihr in einem Englandstellen-Vermittlungsbüro gegeben hatte. In Hemel Hempstead stieg sie aus, einem ländlichen Ort nördlich der Hauptstadt. Niemand erwartete sie, die Adresse war falsch. Ein junger Mann aber, der sich zufällig am Bahnhof aufhielt und merkte, dass da etwas nicht stimmte mit der jungen Frau, fragte sie, wohin sie wolle. Er nahm sie dann in seinem flotten Sportwagen (davon schwärmte sie noch nach Jahren) mit nach Hause, einem Landsitz mit viel Umschwung. Die Eltern des Mannes meinten, eigentlich wären sie ganz froh um eine Haushaltshilfe und ein Kindermädchen und meine Mutter durfte bleiben. „Das war die schönste Zeit meines Lebens“, hat sie mir oft versichert, da habe sie mal endlich Glück gehabt.
Drei Jahre lang blieb sie dort. Sie durfte Autofahren lernen und als sie den Wagen einmal bei dichtem Nebel neben die Garage in eine Mauer gelenkt hatte, habe sie nicht Schimpf und Schande erfahren, sondern die Lady habe gesagt, es sei gut, dass nichts weiter geschehen und sie nicht verletzt sei.
Während ihres Aufenthalts besuchte sie Abendkurse in der Swiss Mercantile School in London und beschloss ihre Ausbildung später mit einem Diplom der Handelsschule Gademann in Zürich.
England und die Engländer hatten zeitlebens eine Art Heiligenschein für meine Mutter. Alles, was mit dem Vereinigten Königreich zu tun hatte, war gut und über alle Zweifel erhaben. – Einen „England-Fimmel“ habe sie, so scherzten wir jeweils.
Die ganze traurige „Brexit-Geschichte“ hat sie nicht mehr erlebt...
Sie hat später, als sie schon längst verheiratet war, selber ein Englandstellen-Vermittlungs-Büro betrieben. Das „Büro“ war in unserer bescheidenen 3-Zimmer-Wohnung an der Steinerstrasse 31 in Bern untergebracht: Verschiedene Ordner, Papier und Kugelschreiber, eine schwarze Schreibmaschine auf einem kleinen runden Tisch im Wohnzimmer.
Zurück in der Schweiz hatte sie ihre erste Anstellung bei der Direktion der Wengernalp- und Jungfraubahn.
Dass sie einen englischen Fahrausweis hatte, darauf war sie sehr stolz. Allerdings musste sie auch noch den schweizerischen Führerschein erwerben, das war aber kein Problem.
Jedenfalls hatte der Umstand, dass sie Autofahren konnte, ihr schliesslich auch eine Anstellung in Zurzach bei einer Familie Dr. Willimann eingebracht, wo sie ein Jahr lang von 1936 – bis 1937 arbeitete. Wie genau ihre Stellenbeschreibung ausgesehen hat, ist nicht ganz klar. Offenbar fungierte sie sowohl als Arztgehilfin, Sekretärin als auch als „Haus-Chauffeuse“ und durfte dort einen grossen Wagen fahren.
Bis zu ihrer Verheiratung im Jahr 1940 arbeitete sie als Redaktionssekretärin bei der Verlagsanstalt Ringier & Co. in Zofingen.
Im selben Jahr wurde sie für die Dauer von vier Monaten bei der eidgenössischen Kriegsmaterialverwaltung in Bern angestellt und anschliessend in verschiedenen Zeitabständen in der Sektion für landwirtschaftliche Produkte und Hauswirtschaft im Kriegsernährungsamt, wo ihr Chef Bundesrat F.T. Wahlen war.
Diese letzten Angaben habe ich in einem Lebenslauf gefunden, den sie, gerade Witwe geworden, im Jahr 1958 schrieb. Es gibt noch manches zu berichten über meine Mutter. In den nächsten Kapiteln. Hier vorgezogen ein Sprung ins Jahr 2006:
Ihren fünfundneunzigsten Geburtstag feierten wir im Schloss Schadau in Thun. Nebst meiner Schwester und meinem Schwager waren auch mein Mann und unsere vier Kinder dabei. – Es war das erste Mal, dass wir anschliessend das Gefühl hatten, es gehe ihr doch nicht mehr so gut wie früher. Sie ass fast nichts; die Hälfte ihrer geliebten Pommes-Frites blieb auf dem Teller übrig.
Meine Geschichte – Kindheit bis 1959
Eigentlich will ich ja über mich selber schreiben, aber der Einstieg fällt gar nicht so leicht, wie ich gerade feststelle. – Wer schon erinnert sich an seine Geburt?!
An einem kalten Tag im Februar 1953 kam ich in einem Spital in Bern zur Welt. Meine Mutter war damals bereits in ihrem zweiundvierzigsten Lebensjahr, hätte also ohne weiteres meine Grossmutter sein können, mein Vater mit seinen siebenundvierzig Jahren mein Opa. Eine Tochter hatten sie schon; meine Schwester war 1941 geboren worden. Mit einem weiteren Kind hatten die beiden nicht gerechnet. - Für mich war später immer klar, dass ich ein „Unfall“ gewesen war, was mich allerdings nie störte, denn ich hatte mich nie unwillkommen gefühlt.
Meine Schwester allerdings muss nicht grad vor Freude gejubelt haben ob meiner Ankunft. Sie war nie der mütterliche Typ, hat sich nichts aus Kindern gemacht, aus Babys schon gar nicht, und die Tatsache, dass sie die bisher uneingeschränkte Aufmerksamkeit der Eltern nun mit mir teilen musste, kam ihr äusserst ungelegen.
Mein Name
Meine Eltern gaben mir den Namen Isabelle. – Eigentlich hätte meine Mutter mich Catherine nennen wollen, schön Französisch ausgesprochen mit „C“. Eine Bekannte von ihr habe gesagt: „Ah, wie schön, äs Kätheli“ – da muss es meinen Eltern wie Schuppen von den Augen gefallen sein, dass es in Bern mit dem vornehmen „C“ nicht weit her ist. – Noch heute bin ich dieser Frau dankbar für ihre (ungewollte) Intervention, denn mit Isabelle bin und war ich immer glücklich und zufrieden. Und als die Kinder in meiner Klasse mich später „Ise“ nennen wollten, hörte ich einfach nicht hin. Auch darauf bin ich stolz, dass ich hartnäckig blieb und es mir gelang, das „durchzuziehen“, so dass mein Name nie zu einer Abkürzung verkümmerte oder zu einem Spitznamen verdreht wurde. - „Catherine“ ist mir als zweiter Vorname erhalten geblieben.
Taufe
An meiner Taufe trug ich ein weisses Kleidchen mit runden Stickereien. Meine Mutter hatte es auf ihrer Nähmaschine angefertigt; aus dem Rest des Stoffs hatte sie einen Lampenschirm gebastelt. - Es war mindestens zweimal so lang wie meine gesamte zarte Körperlänge und hing schleierartig an mir herunter. Das Kleid mahnt mich an das Gefieder eines Pfaus, der allerdings nicht gerade dabei ist, ein Rad zu schlagen. Auch stimmt das Bild nicht mit den Farben überein - bleibt also nicht mehr viel übrig von meinem Vergleich…
So verkleidet reichte man mich offenbar herum wie eine Trophäe von Arm zu Arm der anwesenden Damen, und in dieser Stellung wurden alsdann ein paar Fotos geknipst. Kein Bild existiert von mir auf den starken Armen eines männlichen Familienmitglieds.
Bei meiner Taufe muss ich nur ein paar wenige Monate alt gewesen sein, ich erinnere mich an das Gewand also nur wegen der Fotos und weil ich es Jahre später sorgsam aufbewahrt und schön zusammengefaltet in einer Kartonschachtel auf dem Estrich wiederfand. Durchs Alter war der Stoff allerdings ein wenig spröde geworden und hatte sich leicht dunkler verfärbt. - Meine Mutter hätte es gerne gesehen, wenn ich das Kleidchen für meine eigene Tochter ein weiteres Mal verwendet hätte, sechsundzwanzig Jahre später, aber das kam überhaupt nicht in Frage. Dieses weisse beziehungsweise inzwischen leicht beige Etwas wollte ich meiner Tochter keinesfalls antun. Auch ich hatte selber etwas produziert, ein farbiges Outfit, teilweise genäht, teilweise gestrickt, und genau das sah ich für Kays Taufe vor. – Heute muss ich sagen, wenn ich ehrlich bin, es war ziemlich scheusslich, da hätte sich das weissliche Teil noch fast besser gemacht…
Unsere drei Enkel sind alle nicht getauft worden, so ist also auch das Taufkleid-Thema gar nicht zur Sprache gekommen. So oder so wäre ich natürlich nicht in Versuchung geraten, das eine oder andere zu empfehlen.
Kindergarten
Drei Jahre lang ging ich in den Kindergarten, der sich direkt am Rand des Dählhölzli-Walds befand. Es war für mich eine glückliche Zeit. Ich habe recht viele Erinnerungen. Die Kindergärtnerin, Fräulein „Ptimerme“ (Petitmermet), wie wir den Namen in breitem Berndeutsch aussprachen, mochte ich sehr. Ich sehe mich noch immer im Kränzli sitzen und ihren Geschichten lauschen. Ihre Beine hatte sie beim Vorlesen oft verschränkt oder gar den rechten Fuss aufs linke Knie gelegt. So kam es vor, dass man unter dem glockigen Jupe ihre Unterhosen sehen konnte. Das war ein Gaudi für uns Kinder und wir kicherten und kicherten.
Es wurde viel gebastelt, gemalt, mit Kleister hantiert, mit den Holztieren und dem Stall gespielt. „Chöcherle“ am kleinen Herd oder „Chrämerle“ mit dem Mini-Krämerladen gehörten zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Mit Puppen hatte ich nichts am Hut. Auch zu Hause nicht. Ich hatte meine Stoffbären. Diese liebte ich heiss.
Fast jeden Tag, wenn das Wetter es erlaubte, gab’s Waldspaziergänge und wir bauten „Häuser“ aus Laub und Ästen. Bevor es losging, mussten wir im Garten beim Tor auf die Kindergärtnerin warten. Die Türe war in einen Zaun eingebracht, der mir damals sehr hoch erschien. Als ich Jahre später wieder durch dieses Tor trat, dachte ich erst, man hätte dort bauliche Veränderungen vorgenommen. Ich musste mich bücken, um es zu öffnen, aber merkte dann gleich, es war noch immer dasselbe „alte“ Tor.
Auch Theater wurden aufgeführt im Kindergarten. Stolz war ich, als ich die Rolle der bösen dreizehnten Fee im Dornröschen erhielt. – Einmal war ich auch Maria beim Krippenspiel zu Weihnachten. Diese Rolle fand ich zwar ebenfalls nicht schlecht, aber kein Vergleich mit dem dramatischen Auftritt in der Märchenaufführung. - Es war eine wunderbare und sorglose Zeit.
Als mein Vater im Jahr 1958 starb, wurde meine Mutter Witwe mit siebenundvierzig. Zwei Kinder im Alter von 17 und 5 Jahren hatten ihren Papi verloren. Es war eine schlimme Zeit. Wir waren ziemlich mittellos, Mam musste arbeiten gehen. Zum Glück erhielt sie die Stelle in der Bundesverwaltung, die mein Vater vorher innegehabt hatte. Natürlich nicht zum selben Lohn. - Dort arbeitete sie bis zur Pensionierung. Geheiratet hat sie nie mehr, ich glaube auch nicht, dass sie je einen Freund gehabt hatte.
An die Beerdigung erinnere ich mich kaum mehr. - Erst kürzlich wurde mir aber bewusst, weshalb ich die schönen Hortensien nie mochte: Diese Blumen zierten den Sarg und später das Grab.
Anstatt eingeschult zu werden, als reif genug hatte man mich eingestuft, durfte ich ein weiteres Jahr den Kindergarten besuchen. Meine Mutter hatte das so beschlossen, weil sie wusste, wie sehr es mir dort gefiel und sie mir nicht eine zusätzliche Veränderung zumuten wollte.
Mein Vater
Meine früheste Erinnerung war einschneidend. Ich war kaum drei Jahre alt:
Ich stehe im Schlafzimmer meiner Eltern. Vor mir eine Kommode mit einem Dreifach-Spiegel. Ich trage ein dunkelgrünes Manchester-Kleidchen mit Trägern und kleinen, feinen, hellen Punkten drauf. Mein Vater steht hinter mir neben seinem Bett. Auf einmal fällt er um. Ich seh’s im Spiegel und ich schreie. – Was weiter geschah, weiss ich nicht. Wohl war es sein erster Schlaganfall, bereits ein Anzeichen dafür, dass er ernsthaft krank war.
Es ist nur gerade dieses Bild, das sich in mein Gedächtnis gebrannt hat. Und dann später noch ein anderes.
Im Juni 1958: Zwei Sanitäter tragen meinen Vater auf einer Tragbahre das Treppenhaus hinunter. Ich stehe vor der Tür zu unserer Wohnung im zweiten Stock. Er lächelt gequält, stütz sich auf seinen linken Arm und winkt mir mit der rechten Hand zu. Ich winke zurück. – Das war das letzte Mal, dass ich ihn sah.
Er starb nach einer sechsstündigen Operation im Spital. Seine Nieren hatten versagt, die Aorta war gebrochen. Sein Hausarzt hatte all die vielen Monate vorher nicht gesehen, wie es um ihn stand und hatte ihn nur mit Medikamenten behandelt. - Auf meine Mutter, die ihn mehrmals gebeten hatte, einen anderen Arzt zu konsultieren, hatte er nicht gehört. Er habe das als Vertrauensbruch eingestuft… Erst als sie Jahre später mit Genugtuung die Todesanzeige des besagten Arztes in der Zeitung las, konnte sie ihre ohnmächtige Wut, ihren abgrundtiefen Hass und ihre tiefe Verzweiflung allmählich ablegen.
Das „Konzept“ des Todes ist für ein fünfjähriges Kind nicht fassbar, genauso wenig wie die Vorstellung, wie die Musik in eine Schallplatte hineinkommt. Meine Mutter erklärte mir, Pap sei nicht mehr da, ich würde ihn nie mehr wiedersehen, und dann die Erklärung, die keine Fragen mehr offenlassen soll, aber hundert Fragen auslöst: „Er ist im Himmel“. – Der blaue oder manchmal graue Deckel da oben? – Wie kam er dahin? – Wieso ist er dort? – Was macht er dort? - Viele Nächte lang weinte ich und hielt die Sehnsucht nach ihm kaum mehr aus, wenn ich an der Hand meiner Mutter an seinem Grab stand. Mehr als einmal kam es vor, dass sie einer Fremden, die fragte, was denn passiert sei, die ganze traurige Geschichte im Detail schilderte. Von da an wollte ich nicht mehr auf den Friedhof mitgehen. Sie akzeptierte das und versprach, das Brieflein, das ich ihm schrieb, bei seinem Grabstein zu vergraben.
Erst 55 Jahre später, als meine Mutter starb und meine Schwester das Grab meines Vaters auf den Friedhof in Bolligen neben dasjenige unserer Mutter transferieren liess, stand ich erneut vor seiner allerletzten Ruhestätte.
Pilze sammeln gehen war eine seiner bevorzugten Beschäftigungen in der Freizeit. Manchmal durfte ich mit. Mit dem blauen Worb-Bähnli fuhren wir bis Gümligen in den Hüenliwald. Eine Szene ist mir noch ganz klar im Gedächtnis: Er ging vor mir her, hatte, wie es seine Gewohnheit war, seine Hände hinter dem Rücken zusammengefaltet. Den wunderschönen gelben Eierschwamm, der aus einem zarten Beet von grünem Moos herausschaute, sah er nicht, spazierte an ihm vorbei. – Das war meine Sternstunde. Ich hatte ihn entdeckt und wurde für den Fund gebührend gelobt.
Ganz wenige weitere Erinnerungen habe ich, die aber darauf zurückzuführen sind, dass Fotos existieren. Auf einem Bild ist er mit meiner Mutter zu sehen. Sie reicht ihm nur bis zur Schulter. Er war 1,85 cm gross, was damals eine ziemlich unübliche Körpergrösse war. Aus diesem Grund hatte er offenbar während der Kriegszeit auch zusätzliche Lebensmittelgutscheine erhalten.
Dank der Fotos habe ich auch nicht vergessen, wie er aussah. Auf meinem Nachttisch steht nach wie vor ein Porträt von ihm und es kommt mir seltsam vor, dass er darauf etwa fünfzehn Jahre jünger ist als ich es jetzt bin.
Unsere Wohnung – unser Quartier
Das Haus, in dem ich aufgewachsen war, wurde kurze Zeit später abgerissen. Es musste einem weissen, modernen Bürogebäude Platz machen, welches in keiner Weise ins Quartier passt. All die anderen Häuser in unserer Strasse stehen noch immer dort. Von unserem Balkon aus, wo eine Zeitlang ein grosser Wellensittich-Käfig stand, sah man aufs gegenüberliegende Haus, das mir mit seinen grossen Terrassen und den beiden runden Fenstern wie eine Art Herrschaftswohnsitz vorkam.
An unsere Wohnung erinnere ich mich ebenfalls noch erstaunlich gut. Im Wohnzimmer hatte es zwei Fauteuils, einen Tisch und das „Büro“ meiner Mutter mit der Schreibmaschine und den Ordnern. An der Wand ein Büchergestell.
Manchmal spielte mein Vater Ball mit mir, wenn er abends nach der Arbeit heimkam. Wir setzten uns vis-à-vis voneinander auf zwei Stühle, zwischen uns ein runder Papierkorb. Dort hinein musste ich den Ball werfen.
Auch an die Toilette erinnere ich mich kurioserweise, an die beiden WC-Rollen, die je an einem Halter übereinander an der Wand angebracht waren. Mein Vater benutzte eine andere als wir. Eine aus Pergamentpapier oder so ähnlich. - Sehr seltsam, wenn ich mir das heute so überlege. Ob es derartiges Papier überhaupt noch gibt? Das muss ja nicht gerade schmeichelhaft gewesen sein für einen zarten Hintern, sondern eher „schmirgelhaft“. Und wieso diese eigenartige Papierart von meinem Vater bevorzugt wurde, kann ich mir auch nicht erklären.
Wir besassen auch einen Plattenspieler („His Master`s Voice“ mit dem kleinen Hund als Logo), einen Grammophon also, wie damals üblich mit Kurbel, einem grossen trichterförmigen Lautsprecher und einem Hebelarm, an dem die Nadel dran war, die dann behutsam auf die Schallplatte hinuntergelassen wurde. Dieses Gerät durfte ich keinesfalls anrühren. Das machte mir meine Schwester unmissverständlich klar.
Keine Zweifel gab es für mich auch, dass in den schwarzen Scheiben drin ganz kleine Musiker mit ihren noch viel kleineren Instrumenten sassen, welche die Musik abspielten.
In diesem Zusammenhang kommen mir auch die beiden Langspielplatten in den Sinn, die ich wohl mal zu Weihnachten erhalten hatte. Grimm-Märchen waren darauf eingebrannt, erzählt von Trudi Gerster. Ihre unverkennbare Stimme habe ich noch heute im Ohr, wenn ich daran zurückdenke. Unvergesslich der Dialekt, der mich so komisch dünkte. Wie oft wohl habe ich mir die Geschichten angehört?
Ein Erlebnis, das ich genau datieren kann, erfolgte im Jahre 1956. Meine Mutter und ich, wir waren auf dem Weg in den Keller. Kirchturmglocken läuteten und Mutter wies mich an, nun einen Moment lang stehen zu bleiben und ganz ruhig zu sein. – Es handle sich um eine Schweigeminute im Gedenken an den Ungarn-Aufstand. „I cha aber nid – mini Ohre töne drum“, sagte ich. An diesen Wortlaut erinnere ich mich ganz genau. – Vielleicht war’s das Glockengeläut, das in meinen Ohren nachhallte. Jedenfalls war’s mir absolut ernst mit meinem Einwand.
Im Keller gab’s eine Waschküche: ein Trog, ein Reibbrett, Waschpulver, Bürsten, Lumpen, Wäscheleinen, die von einer Wand zur anderen an der Decke entlang gespannt waren und ganz modern – eine schwere, runde, braun-metallene Maschine zum Auswinden der nassen Wäsche.
Auch ein Kohlenkeller war vorhanden. Von dort musste die Kohle jeweils in die schwarzen Blechkübel geschaufelt und in die Wohnung hinaufgetragen werden. Meine Mutter schimpfe nicht selten wegen dieser schweren Arbeit und fand, die beiden jungen Männer, die zusammen mit ihren Eltern im ersten Stock wohnten, könnten ihr doch hin und wieder mal dabei behilflich sein. – Ich glaube nicht, dass das je stattfand, vermutlich hatten die beiden auch keinen Anlass und Freude schon gar nicht, uns etwas zuliebe zu tun.
Im dritten Stock oben wohnte eine Familie, die ich von Herzen mochte und sie mich offenbar auch. Die Eltern nannte ich „Mueti“ und „Vati“. Ihre Tochter und ihr Sohn waren bereits erwachsen. Sehr viel Zeit verbrachte ich dort oben, liess es mir gut gehen, Mueti verwöhnte mich mit feinem Essen; sie war eine ausgezeichnete Köchin. Mehr als nur gut schmeckte mir ihr Sonntagsbraten, die dunkle, delikate Sauce dazu und der göttliche Kartoffelstock.
Auch sie hörten gerne Schallplatten. Uns allen gefiel am besten: „Äs isch ja nur äs chlyses Tröimli gsy“. Unzählige Male hörte ich dieses Lied und sang mit, bis ich den ganzen Text auswendig konnte. – Wenn ich heute daran denke, wo mir Rock und Pop gefällt…
Mueti und Vati hatten jeweils während der Sommermonate ein bescheidenes Ferienhaus gemietet, in Sigriswil oberhalb des Thunersees, und dann und wann durfte ich ein Wochenende oder gar ein paar Tage in den Ferien mit ihnen dort verbringen. Das sind fantastischer Erinnerungen. Das „Hüsli“, wie sie es nannten, war nur zu Fuss erreichbar. Vom Parkplatz aus musste man mit Sack und Pack durch ein steiles Waldstück pilgern, bis man auf eine grosse Wiese gelangte, wo hin und wieder Kühe und Schafe weideten und an deren oberem Rand allein und verlassen die einfache Hütte stand. Schon nur diesen „Aufstieg“ empfand ich als abenteuerlich. Strom hatte es keinen, Kerzen aber schon und einen Gaskocher. Die Toilette befand sich draussen in einem am Haus angebauten Bretterverschlag, nicht viel mehr als eine Latrine eigentlich. Aber der Aufenthalt im Hüsli war ein Traum. Ein wunderbarer Traum. Die Aussicht auf den Niesen am gegenüberliegenden Ufer des Thunersees war spektakulär, jeden Tag anders, bei jeder Witterung bot sich ein neues Bild, manchmal bei Nebel auch gar keines. Und die Wiese vor der Hütte eignete sich bestens zum Hinunterrollen durchs hohe Gras und die duftenden Blumen, vorbei an den Kuhfladen und Disteln. Sich draussen am Trog zu waschen, bevor man schlafen ging, auch das gehörte zum ausserordentlichen Erlebnis, genauso wie das Eintauchen ins hölzerne Bett mit seinem rot-weiss karierten Kissen- und Duvet-Anzug.
Vati übrigens war als Arbeiter in der Waffenfabrik in Bern angestellt. – Ich stellte mir vor, es sei ein Ort, eine Art Grossküche, wo Waffeln produziert würden. – Etliche Jahre später wurde ich eines Besseren belehrt. Es stellte sich heraus, dass der Direktor der eidgenössischen Waffenfabrik der Vater meines Freundes war, meines jetzigen Ehemanns, also Vatis Chef.
Ganz in unserer Nähe, in einem Haus an der Hauptstrasse, in dem unten ein Ladengeschäft einquartiert war, wohnte eine Frau, die Kinder und Katzen sehr gerne mochte. Beide gingen jederzeit ein und aus bei ihr; wir Kinder trafen uns manchmal nach dem Kindergarten in ihrem Wohnzimmer oder in der Küche und erhielten zum Zvieri leckere Cenovis-Schnitteli.
Fast noch mehr jedoch liebte ich das Schoggi-Spiel, ein Würfelspiel, bei dem es darum ging, möglichst viel von der Tafel Schokolade essen zu können, die mitten auf dem Tisch lag. Wer von uns Kindern eine Sechs würfelte, musste zu Beginn eine Serviette anziehen und durfte alsdann mit Messer und Gabel erst mal die Verpackung öffnen, bevor’s in medias res ging, man endlich ein Stückchen vom Nektar abschneiden und zu Munde führen konnte. Wenn’s denn überhaupt so weit kam. Würfelte ein anderes Kind gleich darauf ebenfalls eine Sechs, musste man Serviette und Besteck abgeben und die Schokolade weiterreichen. - Der totale Stress also. - Die gute Frau hiess Engler und heute denke ich, nomen est omen. Sie hatte selber eine Tochter und einen Sohn, aber die waren schon älter und traten kaum in Erscheinung.
Das Allerinteressanteste aber war, Familie Engler hatte bereits damals einen Fernseher. Schwarz-weiss natürlich. Am Dienstag wurde nicht gesendet, aber an den anderen Nachmittagen gab’s gelegentlich Fury oder Lassie zu sehen, zwei Serien, die bei mir ziemlich gemischte Gefühle weckten. Einerseits faszinierten mich der Bildschirm und die Geschichten an sich, andererseits machte mir das Geschehen Angst und ich schaute verstohlen weg, wenn’s gefährlich wurde, und das war nicht selten.
Die Hauptstrasse, an der die Englers wohnten, war eine Ladenstrasse, im Gegensatz zu heute allerdings nur spärlich befahren. Beim Metzger, in der Molkerei, in der Bäckerei und im kleinen Konsum war alles erhältlich, was man brauchte. Das Beste waren die Eisrölleli für zehn Rappen, ein Wassereiscrème, das einfach himmlisch war, leider aber nirgendwo mehr erhältlich ist.
Was man heute nicht mehr sieht, sind die Kutschen, die Bierfässer geladen hatten und von grobschlächtigen, muskulösen Gäulen gezogen wurden. Eine Tramlinie führte damals schon durch die Thunstrasse.
Eine Episode, in welcher das Tram eine Rolle spielt, kommt mir soeben in den Sinn:
Ich spiele im Wohnzimmer, meine Mutter ist damit beschäftigt, Vaters Hemden zu bügeln. Ich langweile mich ein bisschen, habe dann aber die Glanzidee, den Schulsack meiner Schwester anzuziehen und meine Mutter dahingehend zu informieren, dass ich im Sinne habe, in die Schule zu gehen (meine Schwester ging zu jener Zeit in der Stadt ins Progymnasium). Sie nickt und gibt ihr Einverständnis, was mich ein wenig erstaunt, ist es mir nämlich ernst mit meinem Vorhaben. Trotz Sonnenscheins nehme ich ebenfalls den vielfarbigen Kinder-Regenschirm mit, den ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. – So ausgerüstet begebe ich mich also zum Thunplatz und da kommt auch schon das Tram. Ich steige ein und setze mich.
Damals waren die Tramwagen mit zwei Plattformen ausgestattet, eine hinten, eine vorn, wo’s Stehplätze hatte. In der Mitte des Wagens befanden sich zwei gegenüberliegende lange Holzbänke, auf denen die Passagiere Platz nehmen konnten. In jedem Wagen gab’s einen Kondukteur, der die Billette verkaufte und kontrollierte. Seine Kasse aus Metall, die mit vielen kleinen Abteilen ausgestattet war, in welche die einzelnen Münzen passten, war an einem Ledergurt um seine Hüfte geschnallt.
Er merkt sofort, dass etwas nicht stimmen kann mit der kleinen Kindergärtnerin, die ganz allein unterwegs ist. Er fragt mich, wo Mama sei und wo ich hin wolle. „In die Schule“, sage ich. Ein paar Frauen beginnen zu lachen; sie amüsieren sich köstlich auf meine Kosten. Sie gehen mir so was von auf die Nerven. Ich bin total beleidigt. Der Kondukteur ist sehr nett zu mir und fragt, wo ich lieber hin wolle, zum Zytglogge oder zum Bahnhof. „Zum Bahnhof“ sage ich, denn das sind zwei Stationen weiter. Dort steigt der Beamte mit mir aus und im „Tramhüsli“, das sich zu der Zeit noch auf dem Bahnhofplatz befand, fragt er nach meinem Namen und der Telefonnummer. Die kann ich auswendig, meinen Namen sowieso. – Er ruft meine Mutter an und die muss aus allen Wolken gefallen sein, wie sie hört, was geschehen ist und wo ich bin.
Wenig später kommt sie mit dem Tram angebraust und holt mich ab.
Ich glaube nicht, dass sie mit mir geschimpft hat; ich erinnere mich an nichts dergleichen. Schliesslich hatte ich ihr ja mitgeteilt, was ich vorhatte - alles also völlig auf der Reihe.
Ein lustiges Wort, das meine Mutter häufig brauchte, kommt mir soeben in den Sinn. Wenn sie etwas komisch fand, sagte sie: „dassmichderaffelaust“. Es war für mich ein einziges Wort, welches Erstaunen ausdrückte. Erst Jahre später, als ich in einem Text auf diesen Begriff stiess, merkte ich, dass es sich nicht um ein einziges Wort, sondern um einen ganzen Satz handelte, der nun plötzlich eine ganz andere Bedeutung erhielt beziehungsweise ein Bild erscheinen liess, nämlich um: „Dass mich der Affe laust“.
Frühere Kinderverse, an die ich mich gut erinnere, sind beispielsweise: „Äs schneielet, äs beielet…“ Nicht gerade genderneutral, könnte man sagen, aber damals… Und „Heile, heile Säge…“ half alleweil bei geringfügigeren Verletzungen und Missgeschicken.
„Hoppe, hoppe Reiter, wenn er fällt, dann schreit er, fällt er in den Graben, fressen ihn die Raben, fällt er in den grünen Klee, tun ihm alle Knochen weh, fällt er in den Sumpf, macht der Reiter plumps“, ist ebenfalls unvergesslich. Auf Mutters Knie sitzend und dann beim Reiten geschüttelt und schliesslich sanft fallengelassen zu werden, das machte Spass. Und auch unsere Enkel freuten sich beziehungsweise der Jüngste freut sich dabei und will nochmal und nochmal.
Wohnungswechsel
Im Jahr 59 mussten wir umziehen von der Steinerstrasse 31 an den Sonnenhofweg 6, weil, wie bereits erwähnt, das Haus, in dem ich aufgewachsen war, abgerissen wurde. Der neue Ort war nur grad zwei Tramhaltestellen weiter weg vom alten Zuhause, aber die Distanz war gross genug, um den Kontakt zu den Menschen, mit denen ich oft zusammen gewesen war, ganz oder vorläufig abzubrechen.
Meine Mutter hatte im Sonnenhofquartier eine Vierzimmerwohnung gefunden in einem neueren Sechsfamilien-Haus im ersten Stock. Wir alle drei hatten unser eigenes Zimmer. Das Essen fand meist in der Küche statt. Im Wohnzimmer hielt ich mich nicht oft auf, nur gerade, wenn wir Besuch hatten, was äusserst selten der Fall war.
Später zogen wir ins Parterre. Wieso meine Mutter das so wollte, daran kann ich mich nicht mehr erinnern.
Freunde meiner Mutter
Sie hatte nur wenige Freunde, leider auch kaum Zeit, Freundschaften zu pflegen. Zudem waren Einladungen kostspielig. - Ausser mit ihren Verwandten war sie mit niemandem per du, nicht einmal mit ihrer Bekannten, Frau Hänni, die in der Länggasse wohnte und mich während Jahren jeden Samstagnachmittag „hütete“, damit meine Mutter mal frei hatte. Sehr seltsam, eigentlich... - In Unkenntnis ihres Vornamens nannte auch ich diese herzensgute Dame „Tante Hänni“ (ich sagte natürlich „du“, Tante Hänni). Sie war unverheiratet, wenige Jahre älter als meine Mutter. Ich ging gern zu ihr. - Schon als ich noch im Kindergarten war, fuhr ich alleine mit dem Tram zum Bahnhof, stieg dort in den Bus um, der genau vor ihrer Haustüre anhielt. Samstag für Samstag – Jahr für Jahr.
Manchmal gingen wir im nahe gelegenen Wald spazieren, sie las mir aus Grimms Märchen vor, oder wir vergnügten uns zu Hause mit einem Spiel oder machten zusammen ein Puzzle.
Bei der Bäckerei um die Ecke kaufte sie für uns zum „Zvieri“ Gipfeli. Später, als ich bereits in die Schule ging, durfte ich die feinen Gipfeli selber kaufen gehen; ich mochte gut und gern zwei, drei oder gar vier Stück davon. Die Migros war ebenfalls nicht weit weg und dort gab’s (und gibt’s immer noch) die feinen Schokolade-Eis-Stängel. Auch die zu besorgen, dafür gab sie mir Geld mit, und auch dort übertrieb ich es gelegentlich: Gleich fünf davon hab ich mal gekauft. Sie fand das offenbar amüsant, hat meine exorbitante Einkaufslust nie kritisiert, sondern mich immer gewähren lassen.
Traditionellerweise fand im Stadttheater im Dezember das Weihnachtsmärchen statt. Auf diese Theaterbesuche freute ich mich schon lange im Voraus. – Was für eine wunderbare Atmosphäre herrschte in diesem alten Gebäude. „Zwerg Nase“, sahen wir, „Frau Holle“, „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ und andere Vorstellungen mehr. Wenn es dunkel wurde und der Vorhang aufging, tauchte ich tief in das Geschehen ein. Und in meinem dunkelblauen Samtkleidchen mit den Puffärmeln fühlte ich mich wie eine Prinzessin.
Nicht nur dorthin lud mich Tante Hänni ein. Im Kursaal fanden manchmal am Samstagnachmittag Live-Konzerte statt, Tee und Kuchen gab’s dazu. Auch diese besuchten wir hin und wieder.
An ihre Wohnung erinnere ich mich gut und das absolut Erstaunlichste ist, dass der Zufall es wollte, dass ich nach über vierzig Jahren wieder in derselben Wohnung ein- und ausgehen sollte. Davon aber später.
Unten im Haus, in dem sie wohnte, war ein Kiosk eingemietet. Schon von aussen, bei geschlossener Tür sogar, war klar, was in dem kleinen Laden in erster Linie verkauft wurde: Tabakwaren. Den süsslichen Geschmack würde ich überall wiedererkennen. Zwei Damen führten das Geschäft, Frau Gammenthaler und eine Ungarin, Frau Barasch. An sie erinnere ich mich ganz besonders gut. Sie war schon alt oder so kam sie mir jedenfalls vor, und was mich an ihr am meisten beeindruckte, waren ihre grossen Ohren. Sie trug überdimensionierte, schwere Ohrringe mit Anhängern, welche bewirkten, dass in ihren langgezogenen Ohrläppchen ein langer Schlitz entstanden war. Dieser Anblick faszinierte mich und stiess mich gleichzeitig ab, so dass ich mir damals schon schwor, nie im Leben Löcher in meine Ohren stechen zu lassen. – Und dabei blieb es.
Tante Hänni bewohnte eine Vierzimmerwohnung. Die Zimmer waren entlang eines langen, dunklen Gangs gelegen. Zuhinterst befand sich die Küche. Auch sie war eng und dunkel, ein Kühlschrank war nicht vorhanden, dafür aber ein Vorratsschrank.
Tante Hänni benutzte nur zwei der Räume für sich selber, ihr Schlafzimmer und das Wohnzimmer. Von Fenster aus sah man durch die Krone eines Baumes hindurch auf die gegenüberliegende Strassenseite, wo sich auch heute noch eine Apotheke befindet.
Als ich ein wenig älter wurde, spielten wir oft Karten- und Brettspiele. Eines davon war besonders schön, es muss aus Japan gestammt haben: Die Spielfiguren waren minuziös aus Holz gefertigt, etwa fünf Zentimeter hoch – stellten Menschen dar, Könige, Königinnen und deren Gefolge. Sie waren angezogen mit farbigen Kleidern aus Seide, ihre Gesichter waren weiss angemalt, aber was genau man damit machen konnte – ich habe keine Ahnung mehr.
Die beiden anderen Zimmer hatte sie untervermietet. In einem davon wohnte während Jahren ein deutscher Zimmerherr. Ich glaube, er hiess Baumeister. Er hat von meiner Schwester und mir je ein Porträt gemalt, mit Bleistift. Beide hingen noch jahrelang im Schlafzimmer meiner Mutter. Er hatte wirklich Talent. Wo er gearbeitet hat und weshalb er in der Schweiz war, daran erinnere ich mich nicht.
Einmal war ich in seinem Zimmer. Eines seiner Möbelstücke hat mir einen tiefen Schrecken eingejagt. Es war ein dunkler Armsessel mit grossen ohrenartigen Klappen rechts und links oben. Ich setzte mich hinein und sogleich ergriff mich Panik, weil es mir vorkam, als wickle sich der Stuhl um mich herum und trage mich fort oder fresse mich auf.
Wie alt ich war, als meine Besuche bei Tante Hänni seltener wurden und dann ganz aufhörten, weiss ich nicht mehr. Vermutlich war ich etwa zwölfjährig, als ich nicht mehr hinging. Von da an habe ich den Kontakt zu ihr verloren, und diese Tatsache betrübt mich noch heute sehr.
Ich war etwas älter als zwanzig und schon verheiratet, als mir meine Mutter einmal mitteilte, Tante Hänni sei jetzt in einem Alters- und Pflegeheim und es gehe ihr nicht besonders gut. – Das hat mir sehr leid getan, aber ich brachte es nicht über mich, sie dort zu besuchen. Dass dem so war, kann ich heute überhaupt nicht mehr verstehen; die damalige Unterlassung ist eines der betrüblichsten Kapitel in meinem Leben und ich bereue zutiefst, dass ich nie mehr bei ihr war, dass ich ihr nie sagen konnte, wie gern ich sie hatte, wie dankbar ich ihr war für die schöne Zeit, die ich bei ihr verbringen durfte. Sie starb ein paar Jahre später; ich habe sie seit meiner Kindheit nie wiedergesehen.
Kartenspielen ist übrigens noch immer eine meiner Leidenschaften. Vor etwa vierzig Jahren habe ich begonnen, Bridge spielen zu lernen. Im Bridgeclub lernte ich bald Leute kennen, mit denen ich noch heute spiele. Eine meiner besten Bridge-Kolleginnen ist Muriel. Zusammen mit unserer Lehrerin Marianne hatte sich nach kurzer Zeit schon eine Freundschaft ergeben und wir bildeten ein sogenanntes „Chränzli“. Der oder die Vierte im Bunde wechselte immer mal wieder von Jahr zu Jahr, aber wir drei blieben stets zusammen.
Muriel wohnte im Monbijou-Quartier und zog vor etwa zehn Jahren in die Länggasse um in eine Eigentumswohnung – genau in diejenige, die ich bestens kannte aus meiner Kindheit.
Die Empfindungen beim Betreten des Eingangs bereits und der Wohnung anschliessend nach dieser langen Zeit, sind unbeschreiblich. Der Hauseingang ist noch immer vorhanden, der Kiosk auch, und jedes Mal, wenn ich vor dem kleinen Laden stehe und die Klingel betätige, rieche ich den süsslichen Tabakgeruch oder zumindest meine ich, ihn in der Nase zu haben. Ob dieser Eindruck real ist oder nicht, vermag ich nicht zu sagen.
Neu sind die Briefkästen und eine zusätzliche Haustür. Ebenfalls der Lift. Die ehemalige Vierzimmerwohnung ist völlig umgebaut und renoviert worden. Daraus ist eine Dreizimmerwohnung entstanden, modern und hell. Die Küche ist nicht mehr am selben Ort, das Wohnzimmer aber schon noch. Auch die Aussicht durch die Baumkrone stimmt noch mit meinen Erinnerungen überein. Die Apotheke ist nach wie vor im Betrieb, sicher vom zweiten, dritten oder gar vierten Besitzer geführt.
In dieser Stube zu sitzen, welche mich jedes Mal wieder an die alten Zeiten erinnert, und mit meinen Freunden Karten zu spielen, ist sehr speziell.
Schulzeit – erste bis vierte Klasse Primarschule - 1960 - 1964
Weil wir umziehen mussten, kurz bevor ich eingeschult wurde, ist es relativ einfach für mich, meine Erinnerungen zu ordnen, denn dieser Wechsel war eine Zäsur.
Im März 1960 trat ich im Sonnenhofschulhaus in die erste Klasse ein.
Mein Schulweg war kurz, kaum zwei Minuten dauerte es, bis ich im Klassenzimmer an meinem Pültchen sass.
Manchmal hatte ich Angst, in die Schule zu gehen. Es gab ein paar Jungs, die einem „passten“, wie wir das nannten. Vor allem auf die Mädchen gingen sie los, schupsten diese und rissen ihnen den Schulsack zu Boden. „D‘ Wyber schtinke!“, brüllten sie dazu. Vor allem einer dieser Buben war ein ganz Schlimmer und um zu vermeiden, dem in die Fänge zu geraten, kam es vor, dass ich zu spät zum Unterricht erschien, was mir dann eine Rüge einbrachte. Aus Angst vor Rache gab ich den Grund allerdings nicht an.
Einmal aber wurde ich sogar in der Pause auf dem Schulhof von ein paar Knaben umringt. Was genau sie mit mir vorhatten - wer weiss? Aber sie hatten die Rechnung ohne die Wirtin gemacht. In höchster Not und ganz beherzt schlug ich mit der Faust dem einen, der direkt vor mir stand, auf die Stirne und oh Wunder, alle liessen von mir ab. Der arme Junge wurde daraufhin sogar von seinem Lehrer ausgelacht, weil er nämlich eine ziemliche Beule hatte. Von da an hatte ich nie mehr ein Problem mit Jungs, die mir auflauerten.
An den ersten Schultag erinnere ich mich nur teilweise. Die Lehrerin kam mir uralt vor in ihrer grauen Kleidung. Sie muss damals allerdings kaum älter als vierzig gewesen sein.
Sie sass vorne am Lehrerpult, die Eltern standen hinten und schauten zu. Meine Mutter war nicht da, weil sie arbeiten musste.
Fräulein Witschi erläuterte die Bilder an der Wand des Klassenzimmers. An eines kann ich mich gut erinnern: „Das Schlaraffenland“, gemalt von Bruegel, dem Älteren (meiner Meinung nach nicht unbedingt ein Bild, das in ein Erstklass-Schulzimmer passt). Was abgebildet war, fand ich sehr komisch, die seltsamen Figuren sagten mir nichts. Erst später begann ich Bruegel zu schätzen.
Am Samstagmorgen gab’s jeweils Vorlesestunde. Elisabeth Müller war damals Trumpf. Jedes Mal, wenn wir erfuhren, wie das Schicksal der „6 Kummerbuebe“ weiterging, konnten ein paar Mädchen ihre Tränen nicht zurückhalten. Ich gehörte zum Glück nicht dazu.
Wie ich mich in diesen ersten beiden Schuljahren gelangweilt habe! – Ich sehe mich noch am kleinen Pult mit dem eingebauten Tintenfass sitzen und innerlich fast verzweifeln. Im Rechnen mussten wir auf Häuschen-Papier Zehner-Kasten ausmalen mit roten und blauen Kreisen – zwei plus acht gleich zehn – drei plus sieben gleich zehn – vier plus sechs… und so weiter. Nicht enden wollende Reihen wurden gedrillt. Auch mündlich. Dabei rechnete ich zu Hause bereits bis mehr als tausend.
Schlimmer noch im Deutsch beim Lesen und Schreiben: „Die Maus im Haus“. „Mimi und Hans und Mami im Garten“. Geisttötend fand ich das. – Irgendetwas habe ich aber sicher trotzdem gelernt dabei.
Das Gedicht über die Sonne jedenfalls, das im dritten Schuljahr einmal Hausaufgabe war, fand ich selber unglaublich gut. Ich erinnere mich noch an den Anfang: „Du liebe Sonne, bringst Freud und Wonne. Du kommst, der Tag bricht ein, du hast den wunderschönsten Schein“. Dichtkunst par excellence! - Dass vielleicht schon vor mir ein grosser Denker auf den genialen Reim „Sonne“ und „Wonne“ gekommen sein könnte, das kam mir mit keiner Faser in den Sinn.
Ein traumatisches Erlebnis geschah in den Frühlingsferien 1961. Am letzten Tag vor den Ferien, also am letzten Schultag in der ersten Klasse, sagte Fräulein Witschi, wir dürften ab dem nächsten Schuljahr die Pultordnung wechseln. Evi, ein Mädchen, mit dem ich mich inzwischen angefreundet hatte, und ich, wir beschlossen, in dem Fall nach den Ferien nebeneinander zu sitzen. – Ich freute mich schon sehr auf meine neue Nachbarin am Zweierpult.
Dann geschah es, dass sich ein schrecklicher Unfall ereignete: Ein siebenjähriges Kind war an der Kreuzung am Sonnenhof auf dem Fussgängerstreifen von einem Lastwagen überfahren worden. Das vernahm man zuerst. Kurz darauf erfuhr man, um wen es sich handelte: um Evi.
Unsere ganze Klasse wohnte der Beerdigung bei. Es war für mich die zweite innert zwei Jahren. Detaillierte Erinnerungen daran habe ich verdrängt. – Was ich aber noch weiss: Die Eltern, jetzt kinderlos, kamen einige Tag danach zu uns in die Klasse und brachten sämtliche Spielsachen von Evi mit. Wir durften uns alle etwas aussuchen.
Nicht selten habe ich auch später noch an die beiden gedacht und mich gefragt, wie viele Tränen sie wohl vergossen haben, wie sie es geschafft haben weiterzuleben ohne ihr einziges Kind.
Schlimm war’s, wenn die ganze Klasse die Schulzahnklinik aufsuchen musste. Einzig Franz brauchte nicht mitzukommen. Seine Eltern waren reich, so wurde gemunkelt, er hatte das Privileg, bei Bedarf einen privaten Zahnarzt aufsuchen zu können. Er wurde sehr beneidet. Wir anderen mussten in den sauren Apfel beissen beziehungsweise im Behandlungszimmer den Mund weit öffnen, damit die deutsche Zahnärztin ihres groben Amtes walten konnte. Nur wer die Behandlung hinter sich hatte, konnte aufatmen. - Blanke Angst herrschte nämlich vor der „Rossmetzgerin“, wie wir sie nannten. Spritzen gab es keine; wer ein Loch hatte, musste leiden. Auch beim Anpassen meiner Spange ging sie nicht zimperlich vor. Jede Konsultation bei ihr war mir ein Gräuel.
Da war der Besuch der „Lusetante“ ein Spaziergang dagegen. Sie kam etwa einmal pro Jahr vorbei und untersuchte unsere Haarböden nach Läusen ab. Das war zwar unangenehm und auch ein wenig peinlich, tat aber wenigstens nicht weh.
Irgendwann während dieser ersten vier Schuljahre musste ich die Mandeln schneiden lassen. Daran habe ich zwei Erinnerungen: Betäubt wurde man damals mit Aethermasken. Als sie mir diese aufs Gesicht legten, träumte ich von einer Gruppe von Gestalten, die sich in Viererkolonnen auf mich zubewegten. Sie gingen im Gleichschritt, trugen lange blaue Mäntel und hatten alle eine Maske vor dem Gesicht, etwa so wie sie die Degenfechter tragen. Ich konnte mich nicht bewegen, hatte Angst, aber da hatte ich das Bewusstsein bereits verloren.
Man hatte mir gesagt, nach der Operation könne man Eiscrème essen. Meine Vorfreude war gross, die Enttäuschung dann ebenso, denn damit war leider nichts. Ich bekam nur lauwarmen Tee, was mir sehr widerstrebte.
In der dritten und vierten Klasse hatten wir einen Lehrer. Weil ich „so gute“ Aufsätze schrieb, wie er sagte, kam es vor, dass er mich die Arbeiten einer Mitschülerin korrigieren liess, was mich damals mit Stolz erfüllte. Heute sehe ich das anders: Es war absolut daneben. Er war nur zu faul zum Korrigieren, und viel schlimmer noch – er hat mich dazu benutzt, die Kameradin blosszustellen.
Ich mochte ihn überhaupt nicht. Ein ungutes Gefühl beschlich mich fast ständig, wenn ich in seiner Nähe war. Ich selber hatte zwar nicht direkt unter ihm zu leiden, aber andere schon, und das sogar sehr, wie ich später erfuhr. Natürlich war ich auch dabei gewesen bei einigen seiner Untaten, die er an meinen Mitschülerinnen und Mitschülern begangen hatte, hatte zugeschaut und nichts gesagt. Aber so schlimm das alles war, damit war eine gewisse „Normalität“ verbunden und offenbar ist man als neun- oder zehnjähriges Kind noch nicht ganz in der Lage, solche Geschehnisse richtig einzuordnen und zu beurteilen. Verdrängen war wohl einfacher und ich glaube, wir alle waren froh, wenn sein Zorn, sein Sadismus oder seine Boshaftigkeit sich gegen jemand anderes richtete.
Einmal aber war auch ich Stein des Anstosses: Die Klasse besuchte das naturhistorische Museum und als die Besichtigung zu Ende war, befahl er uns, zu Fuss zurück zum Schulhaus zu gehen. Das Tram zu nehmen, war verboten.
Mit einem Grüppchen von Klassenkameradinnen machten wir uns auf den Weg. Plötzlich merkte ich, dass ich meine Kappe im Museum vergessen hatte. Ich ging alleine zurück und holte sie. Um Zeit wieder gutzumachen, setzte ich mich über das Verbot hinweg und stieg am Helvetiaplatz ins Tram. Dummerweise blieb ich auf der Plattform stehen, statt mich zu setzten. So geschah es, dass ich gesehen wurde bei meinem Fehltritt. Das Pikante daran war: Herr Schweingruber hatte sein Auto in der Nähe des Museums parkiert und fuhr just in dem Moment am Tram vorbei, als ich drin war. Und wer war auch noch drin, in seinem Auto? Vier Knaben aus unserer Klasse, die er zurück zum Schulhaus chauffierte. – Diese waren am nächsten Tag die Zeugen, die er aufrief, als er einen „Prozess“ gegen mich anordnete, um der ganzen Klasse meinen Ungehorsam zu demonstrieren und die Strafe zu rechtfertigen. Einen Pflichtverteidiger hatte ich bei dieser inszenierten Gerichtsverhandlung natürlich nicht und klar wurde ich schuldig gesprochen. – Da nützte es weniger als gar nichts, dass ich vorbrachte, ich fände es ungerecht, dass einige Jungs im Auto hätten heimfahren dürfen während die anderen ein „Tramverbot“ hatten.
Das Urteil wurde verkündet: Ich musste hundertmal irgendeinen blöden Satz ins Heft schreiben, den ich im genauen Wortlaut nicht mehr weiss, der aber wohl ungefähr so gelautet haben mag: „Ich habe dem Lehrer zu gehorchen“. – Es könnte aber auch sein, dass der Satz viel länger war und ich ihn einfach verdrängt habe. Nicht wie eine Kollegin von mir, die mir Jahre später, als wir uns mal über genau solche Strafen unterhielten und uns an die Kindheit zurückerinnerten, erzählte, einmal hätte sie hundertmal schreiben müssen: „Wenn es zum zweiten Mal läutet, sitze ich an meinem Platz und schwatze nicht mehr. Wenn ich das nicht tue, werde ich bestraft. Das verstehe ich gut und beklage mich auch nicht.“ – Der letzte Satz ist ja wirklich die vollendetste Form der Nötigung. - Jetzt natürlich konnten wir darüber lachen. Aber damals...
Erste Klassenzusammenkunft
Nach etwas mehr als dreissig Jahren hatte ich die Idee, eine Klassenzusammenkunft zu organisieren, die erste nach dieser langen Zeit.
Es war nicht einfach, die Adressen zu finden, aber es gelang nach etlichen Anstrengungen recht gut. - Die Lehrerin, die noch immer am selben Ort wohnte wie früher, konnte mir einen säuberlich geführten, von Hand geschriebenen Rodel präsentieren mit all unseren Namen – auf der linken Seite die der Mädchen, auf der rechten diejenigen der Knaben.
Eine Mitschülerin war besonders schwierig aufzuspüren. Sie musste geheiratet haben, aber ihren neuen Familiennamen kannte ich nicht. Auf Fräulein Witschis Liste aber war der Name ihrer geschiedenen Mutter aufgeführt. Anhand dieses Hinweises gelang es mir schliesslich, diese aufzuspüren. – Und was für ein unglaublicher Zufall: Frau Nussbaumer lebte seit Jahren in Spanien, in Denia, im Haus neben dem meines Onkels. - Natürlich teilte sie mir sofort Name und Adresse ihrer Tochter mit.
Ich war überrascht, als mich ein ehemaliger Mitschüler wissen liess, er würde am Treffen nicht teilnehmen, wenn Herr Schweingruber auch eingeladen sei. – Erst fand ich es seltsam, dass Stefan nach so langer Zeit mit der Vergangenheit und dem Erlebten nicht hatte abschliessen können. Als er mir jedoch erzählte, dass er während Jahren in psychiatrischer Behandlung gewesen sei wegen der Erlebnisse mit unserem Lehrer damals, wurde mir manches klar.
Es war ein interessanter Abend; wir erfuhren Dinge voneinander, die wir gar nicht gewusst hatten und ich brauchte eine gewisse Zeit, all das zu „verdauen“, was erzählt worden war. – Jedenfalls schrieb ich daraufhin einen Bericht, den ich hier jetzt einfüge:
Erinnerungen
Nach mehr als 30 Jahren Leuten zu begegnen, die einem einerseits völlig fremd sind, mit denen man andererseits während vier Jahren als Kind täglich zusammen im selben Klassenzimmer gesessen und Freud und Leid geteilt hatte, das ist schon eine Angelegenheit der ganz besonderen Art.
Wer an besagtem Abend ins ehemalige Klassenzimmer eintrat, wurde neugierig begutachtet. Da gab es "klare Fälle", Erkennen auf den ersten Blick. Stimmen konnten wieder zugeordnet werden, Bewegungen wurden wiedererkannt. Andere Mitschüler hingegen musste man mühsam anhand der spärlichen Fotos identifizieren, eine wahre Strapaze fürs Erinnerungsvermögen.
Monica, die im Haus gegenüber gewohnt hatte, erkannte ich sofort, und zwar weil sie genau gleich aussah wie ihre Mutter, die damals genauso alt war wie meine ehemalige Klassenkameradin heute. Es war verblüffend, ich war im ersten Moment völlig verwirrt.
Eines löste vor allem Erstaunen aus: Ausnahmslos alle waren beeindruckt, dass die Erstklasslehrerin noch am Leben war, bei bester Gesundheit, mit lückenlosem Gedächtnis und, wie wir fanden, aussah wie eh und je. Die Jahre schienen spurlos an ihr vorbeigegangen zu sein. Jeder von uns hatte sie als „uralt" in Erinnerung, ohne Frage kurz vor der Pensionierung. Doch beim Zurückrechnen wurde einwandfrei festgestellt, dass sie ja damals nicht viel älter gewesen sein konnte als wir es jetzt gerade waren, und das gab dann doch zu denken. Waren es die grauen Haare und die grossmütterliche Kleidung, die diesen Eindruck erweckt hatten oder war es schlicht die Tatsache, dass sie unendlich viel älter war als wir? Zwangsläufig drängte sich uns die Frage auf, ob Erstklässler uns heute gar ähnlich beurteilen würden...
Die Lehrerin bat dann um Aufmerksamkeit, und augenblicklich verstummte jedes Gespräch. Sie bedankte sich bei der Klasse für die Einladung und führte aus, wie schön es sei, dass aus uns allen „etwas Rechtes" geworden sei. Da merkte ich instinktiv, jeder einzelne von uns fühlte sich unmittelbar um all die Jahre zurückversetzt, einer Zeitreise gleich, die vergangenen Jahrzehnte übersprungen - es war wie damals. Selbst der Tonfall, in dem sie diese Worte sagte, war nur allzu bekannt. So spricht „man" zu Kindern, damit sie es gut verstehen.
Die Besichtigung der ehemaligen Klassenzimmer liess unverzüglich Erinnerungen wach werden. Die Bilder an der Wand waren zwar nicht mehr dieselben, doch im Geist sah ich sogleich wieder den Breugel über dem Lehrerpult hängen. "Schlaraffenland" war's, das Gemälde, das unsere kindlichen Phantasien geweckt hatte, mich jetzt allerdings an die kalte Realität der Aufsatzschreiberei mahnte. Es konnte zu jener Zeit ja nicht angehen, ein Bild unbeschrieben, eine Schulreise oder Ferienerlebnisse unnacherzählt zu belassen. Dieses „dicke Ende" hat uns damals manche Freude an einem Ausflug gleich von Anfang an vergällt.
Die Pultreihen waren jetzt anders angeordnet, dafür war aber die Atmosphäre nach wie vor unverändert. Hatte es damit zu tun, dass der Geruch, eine Mischung aus Kreide und abgestandener Luft, stets derselbe war?
Jedenfalls löste das Betreten des Dritt-und Viertklasszimmers eine unglaubliche Reihe von Gefühlen und Emotionen aus. Es war das Reich unseres Lehrers gewesen, der dort mit unerbittlicher Strenge geherrscht hatte. Für manche muss dieser Raum eine wahre Folterkammer gewesen sein, andere konnten sich gelassener darin umsehen.
Für diese „Braven" war zweifellos alles viel einfacher; sie haben manches nur als Zuschauer miterlebt und konnten mit der Zeit sogar vergessen.
Auch im Laufe des Abends beim gemeinsamen Nachtessen im Restaurant kam man von den damaligen Erlebnissen und Ereignissen nicht mehr los. Bemerkenswert, wie viel in den Gedächtnissen noch weiterlebt; auch Verdrängtes wurde wieder lebendig. Es wurde zwar auch sehr viel gelacht, dennoch ist etliches offenbar noch immer unverdaut.
Neben den Folgsamen gab es nämlich auch solche, die ständig herhalten mussten.
Renate erinnerte sich, dass sie mehr Zeit draussen im Gang verbracht hatte als im Klassenzimmer. Sie gehörte zu den ganz Schlimmen. Das war ja auch kein Wunder, schliesslich hatte sie keine Mutter, und da ist es ja nur natürlich, dass so ein Kind verludert. Alle wussten das. Genau aus diesem Grund trug sie auch nie ein Schürzchen; niemand schaute eben recht zu ihr.
Sie ist jetzt Professorin an der ETH in Zürich. Ich schliesse daraus, dass sie draussen auf dem Gang tatsächlich nicht viel von dem verpasste, was drinnen unterrichtet wurde.
Es versteht sich von selbst, dass sie zu den eingefleischten Besitzerinnen eines "Schimpf- und Schande-Heftchens" gehörte, in welchem sämtliche Schandtaten vom pflichtbewussten Lehrer vermerkt wurden. Die Eltern hatten diese Elaborate jeweils zur Kenntnis zu nehmen und zu unterschreiben. Selbstverständlich war damit die Hoffnung auf tatkräftige Unterstützung durchs Elternhaus verknüpft.
Der kleine Thomas hatte nicht selten gleich mehrere solcher „Akten" mit nach Hause zu nehmen, bis es seiner Mutter eines Tages zu bunt wurde und sie sagte, dieses Zeug unterschreibe sie fortan nicht mehr. Folgerichtig erkannte der Kleine daraufhin, dass diese Aufgabe nun offenbar ihm selber zufalle und um sich aus diesem Dilemma zu befreien, begann er von da an, nach kräftigem Üben der Unterschrift, diese Arbeit selbständig zu übernehmen, sozusagen, um die Mutter zu entlasten. Nur eine sehr kurze Weile sei dies gut gegangen, erinnerte er sich. Er wusste noch genau, wie ihn der Lehrer eines Tages fragte, wer denn hier unterschrieben habe; es fiel nämlich auf, dass die Tinte arg verschmiert war. – „Ich" habe er ganz offen und unvoreingenommen gesagt - und es sei ganz still geworden in der Klasse.
Zuerst sei nicht viel passiert, aber daraus resultierte in der Folge eine Riesensache mit der Schulkommission, und jeder Klassenkamerad war letztendlich froh, nicht selber auf eine dermassen kriminelle Idee gekommen zu sein.
Man kannte damals auch noch andere Methoden der erfolgreichen Erziehung, wie wir uns gegenseitig in Erinnerung riefen.
Dass Hefte grundsätzlich bei offenem Fenster korrigiert wurden, war selbstverständlich. Der Vorteil davon war, man brauchte gar nicht erst aufzustehen, um das „grusige Gsudel" hinauszuwerfen.
Um dem notorisch unordentlichen Roland Ordnung beizubringen, dem ich nota bene sein Aufgabenbüchlein zu führen hatte, da er allein dazu ja nicht imstande war, hatte sich Herr Schweingruber etwas ganz Besonderes ausgedacht: Er liess unsere Mitschülerin Lena, die Bauerntochter, Kuhfladen mit in die Schule bringen, die er dann säuberlich zwischen das Chaos in Rolands Pult platzierte.
Schüler, die nicht gleich begriffen, worum es im Kopfrechnen ging, hatten ein schweres Los. Es wurde jeweils versucht, das Resultat gleichsam aus ihnen herauszuschrauben, indem die Backe des fehlbaren Zöglings mit eiserner Faust gedreht wurde - immer mehr und mehr, bis entweder das erforderliche Resultat geliefert wurde oder sich das Kind auf dem Stuhl oder gar auf dem Pult wiederfand mit Tränen im einseitig hochroten Gesicht.
Zum Glück weiss man heute, dass kein Zusammenhang besteht zwischen Methoden dieser Art und Gedächtnishilfen. Aber damals war die Forschung offenbar noch nicht so weit fortgeschritten. Wenn die Backenschrauberei nämlich nichts nützte, war der Lehrer gezwungen, wirksamere Massnahmen zu ergreifen. So glaubte er, zum Ziel zu kommen, wenn er einen Jungen übers Pult legte und ihn kräftig mit dem Rohrstock traktierte. Als pikantes Detail fand er es offenbar besonders opportun, dem Nichtsnutz zusätzlich den stinkenden, leicht feuchten und vom Staub der Kreiden steifen Tafelputzlappen in den Mund zu stopfen. – Die Klasse als Publikum.
Manchmal kam ein ganzer Schlüsselbund geflogen. Oft traf dieser so, dass er Beulen hinterliess. Nun - der Zweck war damit erreicht: Die Aufmerksamkeit war wieder gewährleistet.
Was Edi verbrochen hatte, dass er seine Arme in die Höhe halten musste (Bergpredigt wurde das Verfahren genannt) und beim geringsten Nachlassen den Rohrstock auf den blutleeren Händen zu spüren bekam, daran erinnere ich mich nicht mehr. Sicher aber war es etwas Unverzeihliches, das solche Behandlung rechtfertigte.Vielleicht hatte er vergessen, seine Hausaufgaben zu machen oder hatte ein ähnliches Verbrechen begangen. Sein Weinen und seine Demütigung mussten wohl ein besonderes Gefühl der Befriedigung und Macht in unserem Erzieher ausgelöst haben. Gewiss war zumindest er davon überzeugt, dass dies ein geeignetes Mittel sei, sich Respekt und die nötige Achtung zu verschaffen.
Harte Zeitgenossen sollten aus uns werden; so mussten wir von unserem Schulhaus aus im Osten der Stadt auf den Bantiger marschieren und wieder heimwärts. - Und welche Freude herrschte bei der Seegfrörni auf dem Bielersee im Jahr 1963! Da durfte es gleich ein Marsch von Biel bis zur Petersinsel sein und selbstverständlich auch zurück. Natürlich waren ebenfalls diejenigen bei dem Spass dabei, die nicht Schlittschuhfahren konnten. Übung macht ja bekanntlich den Meister, und die paar blauen Flecken, Blattern und eiskalten Hände und Füsse konnte man für dieses Erlebnis schliesslich in Kauf nehmen.
Viele Erinnerungen hatten mit der Turnstunde zu tun. Wer ein „Gstabi" war, hatte nichts zu lachen. Da wurde mit Kopfnüssen operiert, und auch die Sprossenwand bot ausgezeichnete Möglichkeiten, Fehlbare hängend über ihre Unfähigkeit nachdenken zu lassen.
David erzählte, bei einem Arztbesuch habe der Arzt eine ganze Reihe blauer Flecken an seinem Körper entdeckt. Davids Vater sei in Verdacht geraten, der Verursacher dieser Verletzungen zu sein. Die Prellungen hatte er sich aber anderweitig zugezogen…
Nebst etlichen Erfahrungen, die besser unerzählt bleiben, wird mir in diesem Zusammenhang eine einzige Episode wieder gegenwärtig, die ausnahmsweise witzig war: Es handelt sich um eine Bemerkung, die Herr Schweingruber beim Anblick der nackten Füsse von Robert machte, der auf augenfällige Weise mit Wasser und Seife wenig am Hut hatte: „Röbu, du solltest wieder mal deine Füsse neu teeren, das Weisse schimmert schon durch!"
Jedenfalls ist es schön zu wissen, dass sämtliche diese hartnäckigen Anstrengungen, uns mit allen Mitteln der Kunst zurechtzubiegen, schliesslich Früchte trugen. Es ist durchwegs aus uns allen „etwas Rechtes" geworden.
Was mich nach diesem Abend besonders beschäftigte, war, dass all diese Verfehlungen ohne irgendwelche Konsequenzen hingenommen worden waren. Niemand von den Eltern hatte je eingegriffen, auch andere Lehrer müssten doch etwas bemerkt haben. Natürlich, wir selber hatten zu Hause auch nichts erzählt. – Trotzdem…
Ein Jahr nach der Klassenzusammenkunft (1996) stiess ich im „Bund“ zufällig auf einen Artikel, der über einen gewissen Herrn Schweingruber berichtete. Der Titel hiess: „Alter, stiller Sozialdemokrat“ und besagte, dass dieser Herr mit fast 65 Jahren zum Ratspräsidenten fürs laufende Jahr ins Könizer Parlament gewählt worden war (höchster Könizer). Weiter konnte man lesen, er sei Schulleiter in Niederwangen und Lehrer einer Kleinklasse für minderbegabte Schüler. – Was mir da alles durch den Kopf ging, will ich lieber nicht erläutern. Jedenfalls hätte ich problemlos noch ein paar andere, passendere Adjektive zum Titel liefern können, denn es stand ausser Frage, dass es sich um unseren Dritt- und Viertklasslehrer handelte, der, wie ich wusste, nach Köniz umgezogen war. Auch war er leicht zu erkennen auf dem Bild neben dem Artikel, den ich nota bene aufbewahrt habe.
Meine Freizeit
In meiner Freizeit war ich oft allen, vor allem am Nachmittag. Ich erhielt einen Schlüssel, den ich an einer Schnur um den Hals trug. Dass niemand zu Hause war, war allerdings kein Problem für mich. Im Gegenteil, es störte mich nicht. Ich liebte es, in meine Bücher zu kritzeln, Länder und deren Hauptstädte aufzuschreiben, Geheimschriften zu erfinden, Pferde zu zeichnen, mit Legoklötzchen zu spielen (es gab damals nur die kleinen, rote und weisse), Rechenaufgaben und Zahlenreihen zu lösen, die mir Jany, der Freund meiner Schwester, der am Gymnasium Mathematik unterrichtete, aufgegeben hatte.
Er lehrte mich auch das griechische Alphabet, das ich noch heute problemlos herunterleiern kann – was allerdings nicht von grossem Nutzen ist, ausser wenn im Kreuzworträtsel mal nicht „eta“ der gesuchte griechische Buchstabe sein sollte.
Auch die sieben Bundesräte des Jahres 1962 konnte und kann ich immer noch aufzählen. Er hatte einen Merksatz „gebastelt“, der dabei half, sich alle Namen zu merken:
„Uf der moosige Burg schaffet der Chaudet u wähut u schpüeut mit Tschüderliwasser“ (von Moos, Burgknecht, Schaffner, Chaudet, Wahlen, Spühler, Tschudi). Hier ist der Nutzen noch geringer...
Ende der Fünfzigerjahre kamen die Hula-Hoop-Reifen auf. Überall sah man sie; jedes Kind hatte einen. Ich natürlich auch, und ich wurde nicht müde zu üben, zu üben: vom Hals in die Hüfte, in die Kniekehlen – rauf und wieder runter. Unermüdlich. - Kürzlich hab ich’s wiedermal versucht. Der Erfolg blieb aus. Gänzlich.
Federball spielen tat ich auch gern, nur musste man dazu natürlich zu zweit sein und ich fand nicht immer eine Partnerin oder einen Partner. Mein Schwager, damals der Freund meiner Schwester, biss manchmal in den sauren Apfel...
Globi-Bücher mochte ich sehr, aber lesen tat ich den Text dazu nie. Die Bilder waren ja aussagekräftig genug, die Geschichten auch ohne Worte verständlich. Die Babar-Bücher mit dem kleinen Elefanten, der zierlichen, schlanken alten Dame, Celste und Zefir liebte ich ebenfalls, jedoch dort, wo der böse „Polomoch“ erschien, konnte ich mich schon sehr fürchten.
„Zehn kleine Negerlein“ und „Der Struwwelpeter“, deren Bilder mir noch völlig präsent sind: Habe ich das richtig in Erinnerung? – Kannte zu der Zeit jedes Kind diese beiden Bücher? – Heute natürlich absolut verpönt und fern von jedem Kinderzimmer, das eine wegen „political correctness“, das andere wegen der absurden autoritären Sicht oder gar Philosophie betreffend Kindererziehung. Während „Zehn kleine …“ weichgewaschen, entschärft und mit „zulässigen Objekten“ abgeändert wurde, also noch heute in abgeschwächter Form existiert, hat sich an eine mildere Struwwlpeter-Adaption meines Wissens niemand herangewagt.
Den „Joggeli söll ga Birli schüttle“ hingegen, die Geschichte der Streikenden, beschrieben in einem Büchlein mit speziellem Format, den gibt’s noch immer. Auch die Märchen der Gebrüder Grimm sind nach wie vor im Umlauf, von denen allerdings nur diejenigen, die gut ausgehen. Schon als Kind haben mich diese fasziniert und später habe ich an der Uni Bern mal ein Seminar besucht, dessen Thema das Märchen war.
Mickey Mouse und Donald Duck waren etwas später Lesestoff erster Güte, noch lieber jedoch waren mir die Streiche von Tom und Jerry, der klugen Maus, die es immer wieder verstand, den ungeschickten Kater zu überlisten.
Vor allem bei den Mädchen war es „Mode“, Tauschbildchen zu sammeln und, wie der Name sagt, sie zu tauschen. Am beliebtesten waren diejenigen mit Silber-Glitter drauf; diese fanden wir besonders kostbar und um ein solches zu erhalten, musste man sich oft gleich von zwei oder drei der weniger glanzvollen Bildchen trennen. Figuren und Tiere waren darauf zu sehen, aus dem Märchen in erster Linie. Wohl war die ganze Angelegenheit eine Art archaische Vorstufe der Paninibildchen. – Mir ist nicht mehr im Gedächtnis geblieben, was genau nachher damit geschah. Ich glaube, man bewahrte sie in einem Album auf.
Ein anderer Brauch bestand darin, einander ein sogenanntes Poesiealbum abzugeben. Der Zweck davon war, dass man pro Seite ein Andenken an eine Klassenkameradin oder einen Klassenkameraden erhielt. Eine Zeichnung, ein Spruch und der Name der Verfasserin oder des Verfassers waren gefragt. Manchmal dauerte es wochenlang, bis man das Album wieder zurückerhielt. Die Einträge waren von unterschiedlicher Qualität, einige Kinder gaben sich grosse Mühe, ein kleines zeichnerisches Kunstwerk anzufertigen, manchmal allerdings war klar ersichtlich, dass eine Mutter ihre Hand dabei mit ihm Spiel gehabt hatte, bei einer arg verklecksten „Arbeit“ hingegen ziemlich sicher nicht. Die Sprüche waren selten von überragender Phantasie geprägt, es kam sogar vor, dass im selben Freundschaftsbuch derselbe Spruch zwei- oder gar dreimal vorhanden war. Beliebt war beispielsweise: „Froh zu sein bedarf es wenig, und wer froh ist, ist ein König.“
In dem Zusammenhang ein kurzer Blick in die Zukunft beziehungsweise in die Vergangenheit - je nach Standpunkt:
Der Brauch, sich im Andenkenalbum seiner Klassenkameradinnen und -Kameraden zu verewigen, den gab’s nicht nur in den Sechzigerjahren. Auch unser jüngster Sohn Gino kam mit so einem Album heim. Das war im Februar 1994.
Als ich es öffnete und schaute, was er soeben hineingekritzelt hatte, sah ich, dass er erstens unseren Familiennamen „Toriani“ mit nur einem „R“ geschrieben hatte, „ittigen“ mit kleinem „I“ und unter der Spalte „Was ich am meisten hasse“ stand: „lessen“.
Auch an die Silvabücher erinnere ich mich. Das waren Bildbände, die man bestellen konnte, wenn man genügend Punkte gesammelt hatte. Diese erhielt man nur, wenn man gewisse Produkte kaufte - ein wenig eine Bauernfängerei natürlich. Die Bilder wurden separat geliefert. Das Buch „Kenya“ gefiel mir besonders. Dort galt es, die Fotos der Elefanten, Löwen, Geparden, Giraffen und all der anderen wilden Tiere am richtigen Ort im Buch sorgfältig einzukleben. – Wenn ich mir nicht genug Mühe gab bei dieser Beschäftigung, erhielt ich sofort „Schimpfis“ von meiner Schwester.
Ein paarmal pro Jahr mussten wir Papiersammeln gehen. - Undenkbar heute. – Zu viert waren wir mit einem Leiterwägeli unterwegs von Tür zu Tür, luden die Zeitungsbündel auf und brachten sie zurück ins Schulhaus. Das war nicht immer nur lustig, vor allem dann nicht, wenn der Wagen überladen war und der eine oder die andere noch darauf herumturnen wollte, was nicht selten dazu führte, dass das Gefährt kippte und Kinder und Zeitungen wieder eingesammelt werden mussten. Aber das Gute daran war natürlich, dass an diesen Tagen die Schule ausfiel.
Ein anderes „Nebengeräusch“ zum Schulalltag war das Pro Juventute-Marken-Verkaufen. Wer eine bestimmte Anzahl davon Eltern, Verwandt und Nachbarn „andrehen“ konnte, erhielt zum Dank ein Kantonswappen geschenkt in einem Bilderrahmen. Diese Trophäen waren sehr begehrt und ich hatte ein paar davon. Was mir daran gefiel und wo sie geblieben sind, weiss ich nicht mehr. Nicht wissen tat man damals etwas anderes auch nicht: Was für empörende, menschenunwürdige Massnahmen unter der Ägide der Pro Juventute und mit Unterstützung der Vormundschaftsbehörde angeordnet wurden. Stichwort: „Kinder der Landstrasse“.
Manchmal durfte ich nach der Schule auch ein paar Stunden bei einer Schulfreundin verbringen. Mal bei Susi, meistens bei Marlies. Ihre Eltern nahmen mich liebevoll bei sich auf – für mich war’s fast wie ein zweites Zuhause. Ich verbrachte sehr viel Zeit dort. Allmählich befreundete ich mich mit Marlies‘ älterer Schwester Kathrin, die mir bis jetzt meine älteste und treueste Freundin geblieben ist. Auch zu ihrer Mutter hatte ich bis zu "Mummerlis" Tod im letzten Jahr ein schönes Verhältnis.
Meine unmusikalische Mutter fand, ich solle Klavierspielen lernen. Nicht unbedingt zu meiner Freude. Von irgendjemandem kaufte sie ein ausgedientes Piano, das erst noch gestimmt werden musste. Es dauerte nicht allzu lange und die ganze Angelegenheit wurde zum Debakel.
Eine Klavierlehrerin musste her. Schlimm, schlimm: Sie war weit übers Pensionsalter hinaus und wohl auch ein wenig behindert. Offenbar hatte sie Probleme mit ihren Füssen, denn die Schuhe, die sie trug, waren ihr mindestens zwei bis drei Nummern zu gross. So klaffte zwischen ihren Fersen und dem hintersten Teil ihrer Schuhe eine grosse Lücke, die anzustarren ich mich nicht sattsehen konnte. Mit schleppendem und schlurfendem Gang bewegte sie sich vorwärts. – Eigentlich hätte sie mir ja leidtun müssen, aber von solchen mitmenschlichen Gemütsregungen war ich damals weit entfernt. Im Gegenteil. Es war mir zuwider, neben ihr sitzen zu müssen. Und was ich richtig eklig fand: Sie pflegte die Spitze des Bleistifts jeweils kurz in den Mund zu stecken und mit Speichel zu befeuchten, bevor sie aufs Notenblatt schrieb.
Kurz erzählt, ich war keine gelehrige Schülerin, das Spielen machte mir überhaupt keinen Spass, üben tat ich nie und Notenlesen war mir das Letzte vom Letzen, ein Buch mit sieben Siegeln. Allerhöchstens konnte ich eine sehr einfache Melodie aus dem Gedächtnis nachspielen, aber niemals vom Notenblatt aus. Den sogenannten Kotelett-Walzer hinzuklimpern, bedeutete das äusserste Limit meines Könnens, aber den hatte mir der Freund meiner Schwester beigebracht. – Nach kurzer Zeit schon musste meine Mutter einsehen, dass alle Mühe vergeblich war, sie besser ihr knappes Geld sparen und die Übung abbrechen würde. - Zu meiner grossen Freude! Lieber ein Ende mit Schrecken…
Meine Mutter – die Köchin
Am Mittag eilte Mam regelmässig von der Arbeit heim, um mir in ihrer kurzen Mittagspause etwas zu kochen. Noch im Mantel und mit der Handtasche am Arm stellte sie die Herdplatte an – das eines der Bilder, das ich nie vergessen werde.
Ihre Kochkünste fand ich nicht umwerfend. Sie war es gewohnt, für meinen Vater Diät zu kochen. Das war ihre Erklärung, wenn ich bemängelte, dass das Gericht, das sie mir aufgetischt hatte, nach gar nichts schmeckte. Nur wenig Salz verwendete sie, Gewürze gab’s damals halt auch nicht so viele, aber sie hat meine Kritik jeweils mit Humor aufgenommen und gekocht, was ich gern hatte, beziehungsweise was sie dachte, ich hätte gern, denn eigentlich war mir zu der Zeit Essen überhaupt nicht wichtig, ausgenommen die feinen Zvieri bei Tante Hänni oder die Pausenbrötli beim Bäcker.
Die „roten“ Spaghetti, wie sie sie nannte, die komische Sauce gleich schon untergerührt, warRAu eines der üblichen Gerichte, mit dem sie mir eine Freude machen wollte. Eigentlich waren sie gar nicht rot, sondern eher orange – keine Ahnung, wie diese Farbe zustande kam, Tomaten waren kaum verantwortlich dafür. „Sauce“ ist übrigens auch ein allzu hochtrabendes Wort – es handelte sich eher um eingefärbte Spaghetti. Vielleicht ein wenig Öl und Paprika?
Teigwaren waren sowieso nicht ihr Ding. Ihre Mutter hatte ihr eingeimpft, dass nur eine Mahlzeit mit Kartoffeln eine richtige Mahlzeit sei. Ihr Vater jedoch hatte darauf bestanden, hin und wieder Pasta auf den Teller zu kriegen, so wie er es aus seiner Zeit in der Schweiz gewohnt gewesen war. Da aber Teigwaren am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts in Deutschland kaum gekauft wurden, musste Oma diese im Kolonialwarenladen jeweils vorbestellen. Meine Mutter holte sie dort ab, was ihr den Spitznamen „Nudel“ eingebracht habe…
Auch briet sie mir dann und wann ein Schweinsplätzli, das ich eigentlich nicht wirklich gut fand, weil es so dünn war, dass es fast nur eine Seite hatte, wie ich zu scherzen pflegte. Auch zäh war’s – eben kein teures Stück Fleisch. Aber ich ass, weil ich ihr damit eine Freude machte.
Und Mam’s Rösti… Sie hat gespart mit Fett und Salz. Resultat: Erstickungsgefahr!
Den Salat fand ich gut. Auf den wurde nämlich kaffeelöffelweise Zucker gestreut. Das hatte Mam von ihrer deutschen Mutter so gelernt. Ich weiss noch genau, wie diese spezielle Kombination zwischen süss und sauer schmeckte, obwohl ich seit mehr als fünfundfünfzig Jahren keinen solchen Salat mehr gegessen habe.
Was bei mir Grauen und Entsetzen auslöste und meine Mutter zu Unverständnis und einer kummervollen Mine veranlasste, war ihr Versuch, mir Rhabarberkompott zu verabreichen, Lauchgemüse oder Porridge. Alle drei Gerichte erinnerten mich unweigerlich an Nasenschleim. Sie tun es nach wie vor…
Auch ihr Versuch, mir mal Schaffleisch unterzujubeln, misslang kläglich. Ich sehe mich noch, wie ich von der Schule heimkomme, die Küchentüre öffne und mich der Gestank fast erschlägt. - Ich dachte, sie hätte ein lebendiges Schaf in der Küche stationiert. – Es war Hammelfleisch, das in der Pfanne brutzelte, „mutton“ halt, etwas Englisches, das in ihren Augen nur gut sein konnte. - Ein ziemlich unglückliches Unterfangen, finde ich heute noch, denn seit diesem Moment kam und kommt mir Schaffleisch nie mehr auf den Teller - nicht einmal Lamm.
Sie nötigte mich nie, etwas zu essen, das mir widerstrebte. – Diesen glücklichen Umstand hatte ich sicher der Tatsache zu verdanken, dass auch sie einschlägige Erfahrungen mit solchen Zwängen gemacht hatte. Als Kind war sie zusammen mit ihrer jüngeren Schwester mal in einem Lager gewesen, wo’s zum Nachtessen Polenta gab, was beide Mädchen komplett verabscheuten. Sie durften nicht ins Bett gehen, bevor beide nicht aufgegessen hatten. So habe sie auch Wallys Portion herunterwürgen müssen…
Ferien bei meinen Verwandten in Schaffhausen
Auch meine Tante Wally, Mams Schwester, hatte mal den Versuch gemacht, mir Kutteln an Tomatensauce zu servieren – mit demselben Resultat. Ich erinnere mich heute noch an den Geruch. Muffig. Eklig. Und die Konsistenz… Unter keinen Umständen hätte ich da zugelangt und seitdem sind Magenwände auf meinem Teller Tabu.
Dort, bei meiner Tante, ging’s allerdings punkto Essen völlig anders zu als bei uns zu Hause:
Ich war oft bei ihr und ihrer Familie in Schaffhausen in den Ferien, nachdem mein Vater gestorben war. Meine Cousins waren Zwillinge, beides Buben, die dreizehn Jahre älter waren als ich. Und die langten zu. Zum Beispiel wusch meine Tante den Spinat in der Badewanne, solche Unmengen musste sie zubereiten. Und Omeletten machte sie - ein Gedicht! - Die waren fingerdick, bedeckt mit Zimtzucker und saftig mit Apfelmus obendrauf. Aber das wusste ich noch nicht, als sie mich fragte, ob ich gerne Pfannkuchen habe. „Ja“, sagte ich, „ich mag sicher etwa fünf Stück“. Die Jungs lachten mich sogleich aus, so dass ich mich richtig schämte. Ich versuchte dann, es ihnen zu zeigen, aber ja, mehr als zwei davon zu essen, war schlicht unmöglich. - Wie ich überhaupt zu dieser Aussage kam? - Fünf von meiner Mutter zubereitete Omeletten hätte ich problemlos essen können, die waren dünn und durchsichtig wie Pergamentpapier.
Ferien in Schaffhausen gefielen mir immer besonders. Mehrere Male durfte ich dorthin. In die Zwillinge war ich fast ein wenig verliebt. Ich mochte Tante Wally und Onkel Richard sehr. Sie gingen manchmal mit mir ins Strandbad, wo ich im Rhein, in der Stadt-Badi, schwimmen lernte.
Grandios war natürlich auch, dass sie bereits einen Fernseher hatten, schwarz-weiss natürlich. Meine Mutter kaufte uns erst einen, als ich etwa zehnjährig war.
Das Vorabendprogramm durfte ich mit der Familie anschauen, denn gegessen wurde in der Stube vor der „Kiste“. Normalerweise gab‘s Brot, Wurst, Gurken und Käse auf einem Holzbrettchen. – „77 Sunset Strip“ schauten wir uns an, die amerikanische Detektivserie. Diese liebte ich und später ebenso „Bonanza“.
An der Stimmerstrasse, wo die Familie Horn wohnte, kam gelegentlich auch der Migros-Wagen hin. Einmal wöchentlich gingen wir dort einkaufen. Auch dies eine ganz spezielle Kindheitserinnerung.
Einmal war ich in Herblingen in den Ferien bei Onkel Heini, dem Bruder meiner Mutter und Tante Wally. Eigentlich hätte es mir dort ganz gut gefallen mit meinem Cousin René, der ein Jahr älter und meiner Cousine Renate, die drei Jahre jünger war als ich. Der Dritte im Bunde hiess Jörg, der ungefähr einjährig war, als ich dort meine Ferien verbrachte. Es muss im Jahr 1961 gewesen sein. Sie hatten ein Haus im Grünen, wo man herrlich draussen auf der Wiese spielen konnte. - Aber ich war unglücklich. Am Abend mussten wir im Keller in einer Blechzeine baden, alle nackt. Das war ich alles andere als gewohnt, und ich schämte mich zu Tode.
Aber das Allerschlimmste war, beim Essen durfte ich nichts trinken. Mein Onkel wusste ganz genau Bescheid, dass das schlecht war für die Gesundheit, und er hielt stur daran fest (er und seine Frau waren Kettenraucher nota bene). Ich hatte Mühe, das Essen herunterzuwürgen, ass fast nichts. - Zu Hause war es normal, dass ich zu den Mahlzeiten trinken durfte. Als ich meine Mutter von meinen Leiden erzählte, hatte sie ein Einsehen. - Das war mein erster und letzter Urlaub in Herblingen.
Auch an andere Ferien erinnere ich mich. Meine Mutter war sicher froh, mal für eine Woche oder zwei die Verantwortung abgeben zu können und Zeit für sich selber zu haben. So schickte sie mich in ein Ferienlager, das nicht nur ein wenig, sondern ziemlich stark religiös angehaucht war. Sie hatte eine Bekannte, die bei den Evangelisten Mitglied war und der ich wohl dieses Lager zu verdanken hatte – sowie auch ein paar Besuche in einem Sonntagsgottesdienst. Meine einzige Erinnerung daran ist die Negerkind-Skulptur, die am Eingang zum Versammlungsraum stand und in der Hand ein Kässeli hielt, in das hinein man ein paar Almosen spenden musste.
Eigentlich seltsam, dass Mam mich dorthin schickte, hielt sie doch von der Religion und dem weltlichen Bodenpersonal der Dreifaltigkeit gar nichts mehr, seit mein Vater gestorben war und der Pfarrer sie eine Woche nach dem Begräbnis nicht einmal mehr auf der Strasse erkannte. Sie hatte sich vorgestellt, dass er sich mal bei ihr melden und sich erkundigen würde, wie es ihr gehe und ihr seine Hilfe angeboten hätte, aber das fand nie statt. So trat sie kurz darauf konsequenterweise aus der Kirche aus.
Später erzählte mir meine Schwester, dass derselbe Geistliche bei seinem ersten Besuch bei uns, als es ums Besprechen der Beerdigung ging, gleich zu Anfang des Gesprächs gesagt habe, er hätte nicht viel Zeit… Meine Mutter habe ihm daraufhin gleich die Tür gewiesen und ihn weggeschickt. – Das war vielleicht der Grund, weshalb er sie gemieden und ignoriert hatte.
Um wieder auf dieses Lager zurückzukommen - es fand irgendwo auf dem Land statt, wohl im Emmental. Jeden Morgen mussten wir ein Heiligenbild zeichnen und fromme Sprüche darunter schreiben. Das lag mir gar nicht. Aber sehr viel schlimmer war, dass man uns eine Geschichte erzählte, in Raten, jeden Tag ein neues Kapitel, und zwar von zwei Kindern aus Düsseldorf, von Gisela und ihrem Bruder, dessen Name ich vergessen habe. Die Geschichte handelte während des zweiten Weltkriegs. Die Geschwister flüchteten aus ihrer zerbombten Heimatstadt, denn sie hatten ihre Eltern verloren. Ich hatte solche Angst, so etwas könnte sich bei uns ebenso ereignen und ich würde meine Mutter auch noch verlieren. Ich war absolut terrorisiert, schlief schlecht, hatte die grässlichsten Albträume.
Wie schön, dann wieder zu Hause zu sein. Selbstverständlich erzählte ich meiner Mutter nichts von alledem, fürchtete mich aber auch später noch lange, wenn ich in der Nacht ein Flugzeug hörte, denn ich dachte, der Krieg sei ausgebrochen.
Mit meiner Verschwiegenheit übrigens muss ich erfolgreich gewesen sein. Erst im Jahr 2015 fanden wir in der Korrespondenz meiner verstorbenen Mutter einen Brief, der mich ziemlich berührte. Sie hatte ihn an den Leiter des besagten Lagers geschrieben und ihm dafür gedankt, dass ich hatte dabei sein können, überzeugt davon, dass ich eine wunderbare Woche verbracht hatte.
Sommerferien in Italien
Nachdem meine Mutter ein paar Jahre lang als Bundesbeamtin gearbeitet hatte, konnte sie sich ein lange ersehntes Auto leisten. Es war ein dunkelgrüner Occasions-VW-Käfer, der mit einem kleinen, ovalen, zweigeteilten Rückfenster ausgestattet war und mit ausklappbaren Zeigern beidseitig in der Mitte oberhalb der Türen.
Mit diesem Gefährt fuhren wir manchmal zu unseren Verwandten nach Schaffhausen. Eine Autobahn existierte damals noch nicht; es dauerte ewig lange, bis wir ankamen. – Auch die Ferienreise im Juli nach Italien wollte kein Ende nehmen, so schien es mir. Rimini war das Ziel, zwei Wochen lang blieben wir normalerweise, aber bis wir dort waren, hatten wir so gut wie jedes Mal eine Panne. Auch auf der Heimfahrt. Einmal mussten wir in einem kleinen Dorf eine Werkstatt aufsuchen und der Angestellte sagte, der Schaden könne nicht so einfach behoben werden, es brauche Ersatzteile. Wir mussten also übernachten. Als wir am nächsten Tag in die Garage kamen, hatte meine Mutter fast einen Zusammenbruch. Da stand unser VW und vornedran lag der ganze Motor in seinen Einzelteilen am Boden ausgebreitet – Schrauben, Schläuche, Metallteile. - Wundersamerweise aber gelang es dem Mechaniker trotzdem nach ein paar Stunden, unser Vehikel wieder flott zu machen, und wir konnten die Heimreise antreten.
Später kaufte sich Mam ein neueres Modell, weiss diesmal, immer noch einen VW-Käfer, dieser nun bereits mit einem „anständigen“ Heckfenster und mit Blinkern. Obwohl sie eine Schwäche für schöne Autos hatte, leistete sie sich auch später nie eines. Einen Karmann hätte sie gerne gehabt, das war ihr Traum, aber diesen Wunsch konnte oder wollte sie sich dann doch nie erfüllen.
Grosse Autos flössten ihr Respekt ein. „Wagen“ nannte sie diese. Waren wir unterwegs, sagte sie oft, in den Rückspiegel blickend: „Da hinde chunnt ä schnäue Wage“, und wenn sie am Überholen war, scherte sie rasch wieder ein, um diesem Platz zu machen.
Als sie mal in Los Angeles in den Ferien war (sie war damals etwa 70-jährig) hatte ich ihr eine Sofortkamera mitgegeben. Knapp zwanzig Fotos hatte sie geknipst, die sie uns dann präsentierte. Die meisten waren verschwommen und auf mindestens der Hälfte davon war der Porsche zu sehen, der dem Sohn ihrer Bekannten gehörte, bei denen sie zu Besuch war. Mal schräg von vorne, von hinten, Seitenansicht, beim Abfahren …
Sicher waren es mehr als fünfmal, dass wir unsere Sommerferien in Rimini verbrachten. Einmal kam auch meine Schwester mit, später nicht mehr. Strand, Sonne und Meer – die absoluten Traumferien für mich. Wir gastierten jeweils in einer billigen Pension, das Essen dort fand ich grossartig – Pasta vom Feinsten.
Auf Drängen meiner Mutter nahm ich einmal an einem Kinderschönheits-Wettbewerb in einem Hotel teil und gewann gleich den Hauptpreis, eine Bambola, eine grosse Puppe, die mir in einer Kartonschachtel überreicht wurde. Schwarze Haare hatte sie, ein weisses Kleid mit rotem Gurt. – Natürlich hatte ich Freude, einen Preis gewonnen zu haben, obwohl ich Puppen ja gar nicht mochte, und so blieb die hübsche Dame auch zu Hause in diesem Karton ihrem einsamen Schicksal, dem Verstauben und wohl später irgendwann mal dem Entsorgen, überlassen.
Winter
Der Winter war nicht meine Jahreszeit. Wahrscheinlich hatte es zumindest teilweise mit dem zu tun, was ich mal beim Schlitteln erlebt hatte. Extrem steil war der Hang zwar nicht, den wir hinunterkurvten, lang auch nicht, aber unten, wo es wieder eben wurde, da schlängelte sich ein schmaler Bach durchs Tal. – Und genau darin fand ich mich wieder, nachdem der Junge, der hinten auf meinem Schlitten gesessen hatte, rechtzeitig abgesprungen war und mich alleine hatte weitersausen lassen. – Das gab Tränen. Ich wollte nichts wie heim, alles war nass und sogar Schlamm hing an meiner Kleidung. Ich fror jämmerlich.
Skilager in der Sportwoche waren damals nicht obligatorisch. Von Lagern hatte ich so oder so genug und war daher froh, dass ich mich stets vor der Teilnahme drücken konnte. Weder meine Mutter noch meine Schwester konnten Skifahren, und Geld für Wintersportausrüstung und –ferien war auch nicht vorhanden. Zudem hatte ich Angst vor Kälte und Beinbruch.
Vom Schlittschuhlaufen liess ich mich ebenso wenig begeistern. Probiert hatte ich es zwar schon mal, im Egelmöösli, einem kleinen See, eher einem Weiher, ganz in der Nähe unseres Schulhauses. Aber kaum hatte ich die „Fasstübeli“, wie die Vorrichtung hiess, die man an die Schuhe band, montiert, schon waren meine Finger klamm vor Kälte, bevor der Spass überhaupt begonnen hatte.
Erst kurz nach meinem sechsundvierzigsten Geburtstag nahm ich einen Anlauf und lernte Skifahren.
Die Heirat meiner Schwester Doris
Im Juli 1963 heirate meine Schwester ihren ehemaligen Klassenlehrer aus dem Gymnasium und die beiden zogen in eine kleine Wohnung in unserer Nähe. Ich war damals zehnjährig.
Ich weiss noch, wie ich an ihrer Hochzeit die ersten paar Verse aus dem Gedicht „Die Frommen Helene“ von Wilhelm Buch rezitierte. Wer mich dazu genötigt hatte, diese auswendig zu lernen und vorzutragen, weiss ich nicht mehr. – Die Strophen, merke ich gerade, kann ich noch jetzt hersagen.
Ratsam ist und bleibt es immer
Für ein junges Frauenzimmer,
Einen Mann sich zu erwählen
und wenn möglich zu vermählen.
Erstens: will es so der Brauch.
Zweitens: will man’s selber auch.
Drittens: man bedarf der Leitung
Und der männlichen Begleitung;
Weil bekanntlich manche Sachen,
Welche grosse Freude machen,
Mädchen nicht allein verstehn;
Als da ist ins Wirtshaus gehen.
Auch erinnere ich mich an die Frisur, die mir meine Mutter am Morgen vor dem Event verpasst hatte: Nach dem Haare-Waschen traktiere sie meine Kopf mit „Bigudi“ (Lockenwicklern), so dass ich mich selber kaum mehr erkannte im Spiegel. Ich hatte jetzt lauter dunkle Locken, und das gefiel mir gar nicht. Vor allem wegen der Kommentare mehrerer Hochzeitsgäste: „Eh, wie härzig!“
Von da an wohnten nur noch meine Mutter und ich am Sonnenhofweg. Inzwischen hatte meine Schwester ihr Studium abgeschlossen und arbeitete als Sekundarlehrerin in Oberdiessbach.
Kurzer Blick in die Zukunft:
Nachdem sie zwei Jahre lang ihren Beruf ausgeübt hatte, ging sie zurück an die Uni und begann ein Studium der Rechtswissenschaften. Das hätte sie gerne von Anfang an tun wollen, aber unsere Mutter bat sie, ein kürzeres Studium zu wählen für den Fall, dass ihr etwas zustosse, so dass Doris für mich hätte aufkommen können. – Das geschah glücklicherweise nicht. Sie beendete ihr Studium mit Bravur als Fürsprecherin, doktorierte, war alsdann Partnerin in einer Bürogemeinschaft, war später Mitglied im Grossen Rat, wo sie eine Zeitlang die Justizkommission präsidierte. Ihre Wahl als Richterin ins Verwaltungsgericht war der Höhepunkt ihrer Karriere. Mit Zweiundsechzig liess sie sich vorzeitig pensionieren.
Zurück in die frühen Sechzigerjahre:
Etwa zu der Zeit kamen die Beatles auf, die „Pilzköpfe“, wie gewisse Leute sie ein wenig despektierlich nannten. Ich liebte ihre Songs, sang sie nach, schrieb sie auf und fragte meine Mutter, die ja gut Englisch konnte, was die Texte bedeuteten. Das war meine erste Begegnung mit dieser Fremdsprache, die ich sogleich liebte und später mit Freude erlernte.
Inzwischen hatte ich einen Radio erhalten, in dessen Deckel ein Plattenspieler eingebaut war. Zum Geburtstag und zu Weihnachten wünschte ich mir nun Schallplatten.
Genau aus diesem Radio hatte ich auch von Kennedys Tod erfahren. Es war der 22. November 1963. Ich stand in meinem Zimmer und konnte kaum glauben, was da Schreckliches berichtet wurde. Der Präsident, den „alle“ liebten, war erschossen worden.
Vier Jahre Progymnasium 1964 - 1968
Nach der vierten Klasse musste man sich entscheiden, wie weiter – Sekundarschule oder Progymnasium? Das war für meine Mutter keine Frage. – „Dies ist das Schulhaus, wo du dann später mal hingehen wirst“. Das hatte sie mich schon im Kindergarten wissen lassen, damals, als meine zwölf Jahre ältere Schwester das Gymnasium Kirchenfeld besuchte und wir dort vorbeispazierten.
So weit war es allerdings noch nicht. Erst gab es eine Prüfung zu absolvieren. Diese fand im Progymnasium am Waisenhausplatz statt. Eigentlich war ich ganz sorglos und hatte keine Angst zu scheitern. Im Tram nach Hause jedoch, nach getaner Arbeit, kam mir plötzlich in den Sinn, dass ich vergessen hatte, meinen Aufsatz mit einem passenden Titel zu versehen, so wie es die Aufgabe verlangt hatte. – Da wurde mir ganz mulmig zumute und ich war überzeugt, ich hätte nicht bestanden.
Dem war aber zum Glück nicht so und ich ging die nächsten paar Jahre ins Progymnasium Manuel. Wir waren der letzte Jahrgang mit dieser Regelung, anschliessend wurde umstrukturiert und ein Übertritt ins Untergymnasium war erst ab dem sechsten Schuljahr möglich. Das bescherte uns denselben Klassenlehrer für vier Jahre, der war aber ein geduldiger und freundlicher Mann und uns wohlgesinnt. Etwas langweilig waren seine Lektionen zwar schon, aber hier musste niemand leiden, weil er oder sie körperlich gezüchtigt, malträtiert oder blossgestellt worden wäre. – Nur der Mathematiklehrer war einer, der nach alter Schule noch den Schlüsselbund nach unaufmerksamen Schülerinnen und Schülern warf.
Ich erinnere mich gut, wie unser Klassenlehrer, wenn wir Geographieunterricht hatten, stundenlang die schönsten farbigen Karten an die Wandtafel zeichnete. Das war immer ein ziemlicher Stress für mich, denn, um’s ebenso schön hinzukriegen, musste ich mich enorm beeilen. Damit die Karten massstabgerecht projiziert werden konnten, legte Herr Gisy in seinem Atlas ein feines Raster aus Bleistift über das Bild, fast wie ein Spinnengewebe. Dasselbe Netz zeichnete er zu Beginn an die Tafel und so konnte er die Vorlage genauestens kopieren. – Diese Arbeit muss ihm ausserordentlich gefallen haben. Sobald er fertig war, löschte er die Hilfslinien auf der Wandtafel fein säuberlich aus, betrachtete sein Werk wohlwollend, indem er den Kopf nach rechts und nach links beugte. Makellos präsentierte sich nun seine Zeichnung. Dann ging er zur Seite und liess uns abzeichnen. - Gerne hätte ich ihm jeweils sagen wollen, er solle doch bitte, bitte den Raster auf der Tafel stehen lassen, damit auch wir das Bild mit demselben Trick beziehungsweise Hilfsmittel hätten ins Heft übertragen können. Aber ich getraute mich nie. So versuchte ich in Windeseile und möglichst gleichzeitig mit ihm, erst Raster, Lineal, dann Strich für Strich, Bleistift, Farbstift, Radiergummi…
Niemand von meiner früheren Klasse war im selben Schulhaus, ich musste neue Bekanntschaften schliessen. Damals war's noch einfach, sich die Namen zu merken. Weder Kevins noch Colins, weder Jessicas, Amélies oder Noemies hatten wir in der Klasse, schon gar keine Anasuyas, Betüls oder Thavakumarans und Kamals. - Es gab unter anderem drei Barbaras zu unterscheiden, drei Regulas ebenfalls, zwei Monikas, eine Margrit und bei den Buben gehörten Stefan, Hanspeter, Hansruedi und Markus zu den gängigen Namen sowie Daniel 1 und 2.
Schon bald hatte ich eine allerbeste Freundin. Die Freundschaft mit ihr war in mancher Hinsicht ein Segen für mich, denn ich durfte von Montag bis Freitag bei ihr zu Mittag essen, und das jahrelang, bis zur Matur. Eine der Barbara war's und sie hatte die beste aller Mütter, eine herzliche und intelligente Frau, die zudem eine gute Köchin war und es nie müde wurde, mit uns über Filme und Bücher, über Politik und Gesellschaft, über Gott und die Welt zu diskutieren. Auf diese Weise machten sogar Abwaschen, Abtrocknen und Geschirr Versorgen Spass.
Dort lernte ich zum ersten Mal ein richtiges Familienleben kennen. Barbara hatte zwei jüngere Brüder und ihr Vater war ein bekannter Psychiater. Ich liebte die Gespräche am Familientisch und das feine Essen, das ihre Mutter auftischte. – Zum Beispiel wurde der Blumenkohl halt nicht nur aus dem Wasser gezogen serviert, so wie das bei uns zu Hause üblich war, sondern, wenn das weisse Kohl-Haupt den Ofen verliess, war es reich bedeckt mit Schinkenstreifen, harten, gehackten Eiern, geriebenem Käse und zur Krönung begossen mit flüssiger Butter. – Davon musste man ja Gewicht zulegen. So nahm ich innert kürzester Zeit vierzehn Pfund zu und wog dann während Jahren 51 Kilo.
Zurück zu den Anfängen in der neuen Schule: Es gefiel mir ganz gut; natürlich war ich stolz darauf, den Übertritt ins Progy geschafft zu haben. Dass wir jetzt verschiedene Lehrer hatten und nicht nur einen, gefiel mir besonders.
Neuerdings ging es darum, Französisch zu lernen. Damit hatte ich meine liebe Mühe, weil ich bisher kaum je hatte Aufgaben machen müssen, aber nun besass ich keinerlei Vorkenntnisse und wusste gar nicht recht, wie lernen. Mir all die fremden Wörter merken und dazu noch diese abstruse Schreibweise anwenden zu müssen, war nicht nach meinem Geschmack. So bekam ich zum ersten Mal schlechte Noten. Mit den anderen Fächern hatte ich nach wie vor keine Probleme, aber irgendwie gelang es Herrn Gisy nicht, mich für diese Fremdsprache zu motivieren. Leider! – Im Gymnasium wurde es nicht viel besser, ich schlug mich jedoch schlecht und recht durch, aber mein Lieblingsfach war Französisch wahrlich nicht. - Das finde ich heute enorm schade. Hätte ich mir damals doch mehr Mühe gegeben…
Anders lief’s mit dem Latein. In der siebten und achten Klasse stand dieses Fach auf dem Stundenplan. Wir hatten eine Lehrerin, die ihre Sache wirklich gut machte. Auf ihren Unterricht freute ich mich jeweils, mir kam das Übersetzen vor wie Kreuzworträtsel-Lösen und ich hatte ganz gute Noten. Ich glaube sogar, dass ihr Vorbild mich schliesslich, zumindest zum Teil, dazu bewogen hat, den Lehrerberuf zu ergreifen.
Nicht ganz alle machten immer so motiviert mit wie ich und so erinnere ich mich an einen Spruch von ihr, der mich so lustig dünkte, dass ich ihn nie vergessen habe und ihn Jahre später auch mal bei meinen eigenen Schülern angebracht habe. Sie sagte, als auf eine Frage von ihr niemand die Hand hochhielt: „Ihr könnt doch nicht auf dem Sofa sitzend durchs Leben segeln“.
Aber ich war voll und ganz dabei und daran war mein Schwager nicht ganz unschuldig. Ich erhielt nämlich von ihm für die erste Sechs bei einer Probe einen Franken, für die zweite zwei Franken, für die dritte wieder den doppelten Betrag. Das hatte er mir versprochen. Relativ rasch hätte diese Abmachung ja ins Unermessliche führen können, aber reich wurde ich leider doch nicht dadurch und er nicht arm, aber die Aussicht auf den grenzenlosen Mammon hatte mich schon sehr angetrieben zu lernen und in diesem Fach zu glänzen.
So gern ich Latein lernte damals, so sehr widerstrebte mir der Unterricht in diesem Fach später im Gymnasium. Davon aber in einem anderen Kapitel.
Eine ganz andersartige Erinnerung an meine Lateinlehrerin kommt mir eben im den Sinn:
Zu jener Zeit kamen die Minijupes in Mode. Unbedingt musste ich so eines haben. Aus hellbraunem, feinem Manchesterstoff war’s gefertigt und ich fand es hinreissend. Nicht so meine Lehrer. Eines Abends erhielt meine Mutter einen Anruf von ihr (sicher wurde sie von der Lehrerschaft dazu verknurrt). Mam wurde darum gebeten oder wohl eher dazu aufgefordert, mich nicht mehr in solch unpassender Kleidung in die Schule zu schicken. – Dabei sah man ja nur gerade knapp die Kniescheibe – von wegen „mini“… Obwohl meine Mutter diese Intervention übertrieben fand, durfte ich von da an das unschickliche Teil nur noch in der Freizeit tragen.
Mein Schulweg war jetzt ein wenig länger. Oft wartete Alex Tschäppat, der spätere Stadtpräsident von Bern, an der Ecke beim Sonnenhofschulhaus auf mich. Wir hatten denselben Schulweg und immer etwas zu plaudern. Er war zwar ein oder zwei Jahre älter als ich, aber inzwischen waren die Zeiten vorbei, wo die Jungs unter keinen Umständen etwas mit den Mädchen zu tun haben wollten.
Meine Freizeit
Die Zeit der Globi-Bücher war natürlich ebenfalls vorbei, ich widmete mich „ernsthafterem“ Lesestoff. „Das Doppelte Lottchen“ von Erich Kästner gehörte dazu, fand ich grossartig, ebenso ein Lexikon für „Wissbegierige“. Schon dieses Wort allein imponierte mir.
Mein Schwager hatte die schöne Angewohnheit, uns jeden Monat an seinem Zahltag ein Buch zu schenken. Beim ersten Mal sagte er, es sei eines, für das wir eigentlich noch zu jung seien. Mutter erhielt einen Roman von Tolstoi, mit welcher Lektüre meine Schwester beglückt wurde, weiss ich nicht mehr. Aber ich bekam den ersten Band von Karl May. – Da öffnete sich mir einen neue Welt.
So erhielt ich nach und nach eine weitere Folge aus dem Wilden Westen mit den fantastischen Indianergeschichten von Winnetou, seiner Schwester Nscho-tschi und Old Shatterhand, und ich verschlang sie allesamt. Anschliessend ebenso die Sammlung, die in der Wüste spielt, in Kleinasien. Von der Beschreibung der wunderbaren Pferde konnte ich kaum genug bekommen und mein allergrösster Wunsch war es, reiten zu lernen.
Es gab einen veritablen Karl-May-Boom zu der Zeit. Im Kino liefen die Winnetou-Filme. Was für ein Bombenerlebnis! – Die Filmmusik von Böttcher musste ich unbedingt haben. Immer und immer wieder konnte ich mir die Platten in voller Lautstärke anhören und dabei in diese einmalige Traumwelt eintauchen.
Natürlich gab’s auch Zeitschriften. Das Bravo war meine absolute Lieblingslektüre und ich konnte es kaum erwarten, bis die nächste Ausgabe am Kiosk erhältlich war, um einen weiteren Teil des Starschnitts ausschneiden und die Wände in meinem Zimmer damit tapezieren zu können. So prangten dort Lex Barker und Pierre Brice in Lebensgrösse über meinem Bett nebst vielen anderen Porträts von Stars, die ich fein säuberlich ausgeschnitten hatte: Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Brigitte Bardot, Marlon Brando, James Dean, James Stuart, Cary Grant, Jean-Paul Belmondo und so weiter. – Mit der Zeit war kaum Tapete mehr zu sehen.
Selbstverständlich bot das Bravo noch viel mehr zu jener Zeit: Aufklärung, interessante Leserbriefe, Klatsch und Tratsch über die Stars aus dem Showbusiness, die viel geliebte Rubrik, wo Leserinnen und Leser ihre Fragen zu Sex und Beziehungen stellten konnten und Fortsetzungsgeschichten, in denen es natürlich ebenfalls um nichts anderes als um Liebe ging.
Als ich in die fünfte Klasse kam, erfüllte sich mein sehnlichster Wunsch: Ich durfte reiten lernen. In Köniz wurde die Reitschule „Eldorado“ eröffnet. Jeden Mittwochnachmittag ging ich hin und hatte eine Reitstunde. Die Pferde zu pflegen, sie zu satteln und schliesslich auf deren Rücken zu sitzen, war das absolut Höchste der Gefühle. Sogar eine Voltigier-Gruppe wurde zusammengestellt, mein Stolz wuchs ins Unermessliche: Aufs Pferd aufzuspringen, auf dessen Rücken stehend ein paar Runden drehen zu können – genau wie im Zirkus - es war grandios.
Ausreiten aber war das Allerschönste. Zu Weihnachten und zum Geburtstag hatte ich nun vor allem einen Wunsch: Geld für ein Reitabonnement zu erhalten. Ein paarmal bezahlte mir meine Mutter sogar Reitferien. Im Jura gab es etliche solcher Angebote. Den ganzen Tag lang mit den Pferden zu verbringen, ein paar Stunden aneinander reiten zu gehen, über Felder zu galoppiere, in eine ganz andere Welt einzutauchen oder darin zu schweben, das war einfach nur herrlich.
Meine Reitstunde am Mittwochnachmittag dauerte etwa bis um drei. Anschliessend nahm ich den Bus zurück in die Stadt. In der Loeb-Bar, im Kaufhaus am Bahnhofplatz, kaufte ich mir von meinem Taschengeld zum Zvieri eine Cola und ein Schinkensandwich. Das leistete ich mir, weil ich es so unsagbar gut fand. Und wo ich nachher hinging, das zu erzählen, ist auch ein paar Zeilen wert.
Meine „Tante Hänni“ hatte eine Bekannte und diese hatte einen älteren Untermieter, der im Kino Central als Operateur arbeitete. Als wir einmal bei dieser Frau eingeladen waren, fragte ich, ob ich den Herrn Ackermann mal besuchen und vielleicht einen Film schauen dürfe. Er murmelte: „Ja“ (vermutlich widerwillig) und von da an stieg ich jeden Mittwoch nach meinem Schinkensandwich-Schmaus die Hintertreppe neben dem Kino hoch zu seinem engen, düsteren Arbeitsplatz. Ich glaube nicht, dass er von meinen Besuchen überaus begeistert war, aber er liess es geschehen. Ich war ja erst zwölf-, später dreizehnjährig, hätte diese Filme gar noch nicht schauen dürfen. - Er war mehr als nur wortkarg und ich erinnere mich nicht, dass wir jemals mehr als zwei, drei Worte gewechselt hätten. Das war übrigens auch kaum möglich, machte die Film-Abspielanlage doch einen solchen Lärm, dass man sich so oder so nicht hätte verständigen können. Die Filme, die ich mir durch ein schmales Fenster in der Wand oberhalb des Kinosaals ansah, es war eigentlich fast nur ein Schlitz, einer Schiessscharte ähnlich, waren entweder Western oder Heldenfilme, Herkules und Goliat, Herkules und Maciste und so weiter. Bequem war’s nicht. Ich sass auf einer Art Barhocker und musste mich ziemlich strecken, um überhaupt etwas mitzukriegen. - Schurken, Revolverhelden, Indianer, Sheriffs, Verfolgungsjagden zu Pferd, schöne Frauen, muskulöse Männer, funkelnde Schwerter, das gab’s zu sehen. Jeden Mittwoch. Hin und wieder passierte ein Filmriss, was gezwungenermassen zu einer kurzen Pause führte, bis Herr Ackermann die Filmrolle wieder im Griff hatte. Wenn der Film Untertitel hatte, bekam ich von der Handlung ein wenig etwas mit, wenn nicht, sah ich nur die bewegten Bilder – im Hintergrund ratterte und dröhnte ja die Maschinerie. Aber mir genügte das. – Ziemlich merkwürdig, wenn ich heute daran zurückdenke. - Nach dem Erlebnis fuhr ich mit dem Tram nach Hause. Meine Mutter kam erst später von der Arbeit heim; ich erzählte ihr nie etwas davon.
Ein ziemlich unrühmliches Kapitel gibt es auch noch zu erwähnen: Ich hatte begonnen zu rauchen. Mit zwölf. Ich wollte halt unbedingt schon als erwachsen gelten und Rauchen gehörte dazu.
Meine Mutter hatte lange Zeit nichts davon bemerkt. Sie selber hat nicht geraucht, meine Schwester und mein Schwager aber schon. Denen stibitzte ich ab und zu mal eine Zigarette, erst nur zum Ausprobieren. Allmählich kaufte ich von meinem Taschengeld ganze Päckli. „Select“ erkor ich zu meiner Lieblingsmarke, nachdem ich manche andere Sorte „getestet“ hatte. Eigentlich gehörte es ja zum guten Ton, „Gauloise bleu ohne Filter“ zu rauchen, da mir aber immer Tabakkrümel auf der Zunge zurückblieben, entschied ich mich für eine weniger „coole“ Marke mit Filter.
Zu Hause stand ich zum Rauchen beim offenen Fenster auf den Badewannenrad. Ich hatte erfahren, dass im unteren Teil eines geöffneten Fensters die frische Luft von draussen hereinzieht, im oberen Teil weht die alte hinaus. Und genauso war es auch. Nicht ein einziges Mal wurde ich erwischt. – Später im Gymnasium brachte ich es auf gut und gern zwei Päckli oder mehr und es gab eine Zeit, wo ich selber dachte, ich würde, sollte das so weitergehen, wohl das zwanzigste Altersjahr nicht erreichen. – Aufhören war aber schwierig, obwohl es mich selber nervte, dass ich Himmel und Hölle in Bewegung setzen musste, um Zigaretten aufzutreiben, wenn sie mir ausnahmsweise mal ausgegangen waren. Zwar hatte ich etliche Male versucht, gegen die Sucht anzukämpfen, hatte mir beispielsweise vorgenommen, nur noch zehn Zigaretten pro Tag zu rauchen. Meinen Tag verbrachte ich dann allerdings vorwiegend damit, auf die Uhr zu schauen und mir auszurechnen, wie lange ich durchhalten musste bis zum nächsten „Lungenbrötli“, wie wir es nannten - also gab ich diesen hilflosen Versuch bald wieder auf.
Erst als ich fünfundzwanzig war und vermutete, ich könnte vielleicht bald schwanger werden, gelang es mir, von einem Moment auf den andern problemlos von der Zigarette wegzukommen.
Die Ferien verbrachten wir zu der Zeit nicht mehr in Italien.
Eine Reise führte uns mal nach Hamburg, wo meine Mutter natürlich das Quartier aufsuchen wollte, wo sie aufgewachsen war. Das war eine traurige Erfahrung, denn die Bomben des Zweiten Weltkriegs hatten ganze Arbeit geleistet. Von dem, was einmal war, war nichts mehr vorhanden, neue Gebäude hatten den Trümmern Platz gemacht. - Sie hatte es zwar geahnt, aber dann dort zu sein und nichts mehr zu erkennen, keine Häuser, keine Läden, keine Strassenzüge und -kreuzungen, war für sie ein einschneidendes Erlebnis, von dem sie sich lange nicht erholte.
Als ich vierzehn war, ging die Reise in den Sommerferien nach England. Wir reisten mit dem Zug zuerst nach Paris, wo wir ein paar Tage blieben und uns „alles“ anschauten, dann ging’s weiter nach London und schliesslich aufs Land, an die Westküste, wo Mam Bekannte hatte, die wir besuchten. Zwei solche Hauptstädte zu erleben – ich war im siebten Himmel. Zu Hause dann erzählen zu können, ich sei in England und Frankreich gewesen, das war schon etwas. Heutzutage kann man mit solchen Destinationen nicht mehr auftrumpfen, damals aber schon.
Viereinhalb Jahre Gymnasium – 1968 - 1972
Durch die Zeit im Gymnasium schlängelte ich mich schlecht und recht durch – von PG zu PG (Promotion gefährdet). Aber es reichte immer grad knapp, so dass ich nie eine Klasse wiederholen musste, denn jedes zweite Zeugnis war genügend.
Nicht alle hatten dasselbe Glück, sich ungeschoren durch die viereinhalb Jahre zu lavieren. Zu Beginn in der Quarta waren wir 24 Schülerinnen und Schüler. Im Laufe der Zeit wurden acht von uns nicht promoviert, mussten das Schuljahr wiederholen oder traten aus. Drei stiessen dazu, so waren wir bei der Matur noch 19 Übriggebliebene, die allerdings alle bestanden. Wir hatten nicht viel Zusammenhalt untereinander; unsere Lehrer sagten, wir hätten keinen sogenannten „Klassengeist“. – Das stimmte schon einigermassen, es hatten sich halt kleine Gruppen gebildet.
Aber während der Maturreise nach Budapest harmonierten wir erstaunlich gut.
Demo
Eine spezielle Erinnerung habe ich an den August 68: Kurz nach den Sommerferien geschah es, dass sowjetische Truppen in die Tschechoslowakei einfielen. - In der Zehnuhr-Pause wurden alle Schülerinnen und Schüler von den Primanern aufgefordert, an einem Protestmarsch teilzunehmen. Wir sollten alle zusammen zum Thunplatz marschieren und vor der russischen Botschaft, die sich kaum einen Kilometer von unserem Schulhaus entfernt befand, demonstrieren. Schon verliessen Dutzende von jungen Leuten den Pausenplatz und begaben sich in besagte Richtung. Wir waren damals die „Kleinen“, die Quartaner, aber die Versuchung war zu gross, sich dem Strom der Protestierenden nicht anzuschliessen. Unisono gingen wir mit. Nur ein paar ganz Brave blieben zurück, die sich von den verzweifelten Versuchen der Lehrer, welche vom Vorhaben erfahren hatten und nun mit Repressalien drohten und sich vergeblich bemühten, uns davon abzubringen, in Scharen das Areal zu verlassen, beeindrucken liessen.
So wurde der ganze Thunplatz von einer riesigen Versammlung von Gymnasiasten bevölkert, die alle aus voller Kehle „Dub%u010Dek, Svoboda“ riefen. Kein Tram konnte mehr passieren, auch kein Auto und die Demo dauerte, bis die Polizei erschien und uns mit Tränengas vertrieb.
Das alles gab natürlich zu reden und zu debattieren, aber die angedrohten Konsequenzen fanden schliesslich doch nicht statt.
Fünfwochenkurs
Bevor ich über Lehrer, Fächer und Lerninhalte berichte, hier ein paar Zeilen über den verhassten, obligatorischen „Füfwücheler“, den wir Mädchen zweimal in den Sommerferien absolvieren mussten, in der Terzia und in der Sekunda.
Drei Wochen kochen und haushalten lernen und zwei Wochen nähen. Und das mitten im Sommer! Alle andern hatten Ferien - es war die Hölle.
Meine Einstellung dazu war so miserabel, dass der Misserfolg schon vorausprogrammiert war. Kochen lernen wollte ich sowieso nicht, meine Schwester war mir da ein (nicht wirklich hilfreiches) Vorbild. Sie hatte zwölf Jahre zuvor einen ebensolchen Kurs durchlaufen müssen, mit dem Resultat, dass die ganze Mühe überhaupt nichts fruchtete. Ich glaube, sie weiss noch heute nicht einmal, wie man ein Spiegelei macht. Zu ihrem Glück hat sie einen Mann geheiratet, der mit dem Kochtopf umzugehen weiss.
Wäre ich nicht so stur gewesen, hätte ich sicher vom einen oder anderen Lerninhalt profitieren können, aber das liess ich gar nicht zu.
Wir hatten ein Haushaltsbuch zu führen. Leider habe ich es nicht mehr, denn aus dem, was wir da hineinschreiben mussten, könnte man heute eine abendfüllende Kabarettnummer gestalten.
Schlimmer noch war’s im Nähkurs. Wir wurden angewiesen, Arbeiten auszuführen, über die man heute nur noch den Kopf schütteln kann. Ich schüttelte ihn schon damals…
Die eine war: ein Leintuch wenden. - Ausgangslage: In der Mitte, dort, wo man draufliegt, ist der Stoff ganz dünn geworden, am Rand ist er wie neu. - Vorgehensweise: Leintuch in der Mitte durchschneiden, Seitennähte öffnen und zusammennähen, so dass die dünnen Seiten nun aussen sind. - Ok, ok, da war dann halt die Naht in der Mitte, dort, wo man draufliegt. –Die Prinzessin auf der Erbse ist ja nur ein Märchen… (Mein) Fazit: Schade für Zeit und Aufwand.
Eine andere Arbeit war: Männer-Hemd-Kragen wenden. – Ausgangslage: ähnlich wie beim Leintuch ist der Stoff im Bereich des Halses dünn geworden. - Vorgehensweise: Kragen sorgfältig abtrennen und als Mustervorlage verwenden. Im unteren Teil des Hemdes („Hemlistoss“) ein Stück Stoff ausschneiden und den zu einem neuen Kragen verarbeiten, inklusive Knopfloch natürlich, und ordentlich an das nun kragenlose Hemd annähen. Fertig. – (Mein) Fazit: Dafür fand ich schon damals keine Worte…
Die Unterrichtsfächer
Englisch machte mir Spass, da war ich motiviert, enthusiastisch sogar, also „eager to learn“. Ich las auch in der Freizeit ein Buch nach dem anderen, nicht nur diejenigen, die wir als Aufgabe lesen mussten. Agatha Christies Krimis zum Beispiel konnte ich kaum mehr aus der Hand legen. Die fesselnden mystischen Romane von Daphne du Mourier ebenso wenig. Alfred Hitchcock muss ebenso ein Fan von ihr gewesen sein, sonst hätte er kaum ein paar ihrer Romane und Erzählungen verfilmt. Spannung pur! - Mein absoluter Lieblingsschriftsteller aber war Somerset Maugham. Seine Kurzgeschichten faszinierten mich. Inhalt und Stil. - Auch unseren Lehrer mochte ich sehr, Mr. Adam. - Mit der Englischnote konnte ich die Lateinnote im Gelichgewicht halten.
Latein war mir inzwischen zum absoluten Gräuel geworden. Ich begriff plötzlich nicht mehr, wieso man so unendlich viele Stunden dafür aufwenden musste, eine tote Sprache zu lernen, die in der Art, wie wir unterrichtet wurden, so oder so niemand je gesprochen hat.
Unser uralter Lehrer sagte mal, er könne sich nichts Schöneres im Leben vorstellen, als auf einem der sieben Hügel Roms im Schatten eines Baumes zu liegen und die Aeneis zu lesen. – Da wusste ich, wir beide sind nicht nur von einem anderen Planeten, uns trennt eine ganze Galaxie. – Rom wäre ja schon ok, unter einem Baum zu liegen ebenfalls, aber doch lieber in der Sonne. Vergil mit seinen Hexameter hingegen… Obwohl - noch heute kann ich die ersten paar Zeilen der Aeneis auswendig hersagen, und das sogar im richtigen Versrhythmus. Dafür hab ich alles andere vergessen, was ich so mühsam büffeln musste. Es gab eine Zeit (jeweils vor einem drohenden PG), da musste ich sogar Nachhilfestunden nehmen. Das reichte dann wieder für eine Drei im Zeugnis, was ich fast als Heldentat empfand. Im letzten halben Jahr ver(sch)wendete ich keine einzige Minute mehr fürs Lateinlernen; ich sass nur noch die Stunden ab. An der Matur schaffte ich in der schriftlichen Arbeit eine Zwei, in der mündlichen eine Eins. Anderthalb im Durchschnitt wurde aufgerundet zu einer Zwei, dazu die Erfahrungsnote – ebenfalls eine Zwei - also alles im Grünen.
Mich reuen auch heute noch die vielen Lateinstunden, die wir über uns ergehen lassen mussten, die zudem von ätzender Langeweile geprägt waren. Natürlich – die Erklärung dafür war, die Logik der Grammatik würde helfen, andere Sprachen besser zu lernen und deren Aufbau zu begreifen. Und wenn wir mal Medizin oder Jura studieren würden, wäre es sowieso unabdingbar, Latein gelernt zu haben.
Nun, in den sechseinhalb Jahren, in denen wir uns mit diesem Stoff abmühen mussten (ich war übrigens nicht die Einzige mit den schlechten Noten und der fehlenden Motivation), hätte ich es problemlos geschafft, Spanisch oder Italienisch oder gar beides zu lernen, und das hätte mir sehr viel mehr gebracht. Spanisch musste ich mir in späteren Jahren viel mühsamer im Selbststudium aneignen sowie mit dem Besuch etlicher Kurse in verschiedenen Schulen in Spanien und Südamerika. – Italienisch liess ich bleiben, ich war der Ansicht, die Ähnlichkeit der Sprachen würde mich nur verwirren. Was ich bestens lesen kann, ist die italienische Speisekarte, und das ist doch schon etwas.
Auch hatte ich schon lange den Verdacht, die Lateinlernerei diene in erster Linie dazu, sich vom „Plebs“ abzuheben, das heisst, das Privileg zu haben, ein wenig despektierlich auf all diejenigen hinunterzublicken, die nicht im Gymnasium waren und sogar auf diejenigen, die zwar das Gymnasium besuchten, aber „nur“ die Abteilung Wirtschaft. - Dass viele Fremdwörter in unserer Sprache aus dem Latein stammen, ist schon klar. Nur sind diese den meisten Leuten auch ohne Lateinstudium geläufig.
Jedenfalls wäre ich heute froh, ich hätte statt all der zahllosen Lateinstunden eine Anzahl davon als Wirtschaft-Unterricht geniessen können. Aber damals war das System alles andere als flexibel. Im B-Gymer, also dem sogenannt „neusprachlichen“ Gymnasium, wo Latein, Deutsch, Englisch und Französisch obligatorisch waren, konnten wir im Nebenfach nicht einmal Spanisch belegen, ein Wirtschaftsfach schon gar nicht. - Was damals unter Allgemeinbildung verstanden wurde, ist mir heute ein Rätsel.
Für mich ist und bleibt eine Sprache etwas Lebendiges, das sich logischerweise auch weiterentwickelt. Latein aber ist tot, ein Konstrukt, stehen geblieben, keine Sprache, sondern höchstens eine „Schreibe“.
Auch verstand ich nie, weshalb Latein in der Medizin so wichtig ist. All die Ausdrücke, Verben, Adverbien, Nomen, Adjektive, die wir lernen mussten, haben so gut wie nichts zu tun mit dem Vokabular, das ein Arzt braucht oder mit den Namen der Medikamente, welche zu einem eigenen Fachgebiet gehören. Auch hier eignen sich die lateinischen Ausdrücke ja besonders gut, um sich vom Wortschatz der „einfachen Leute“ zu unterscheiden. - Die Wörter in unserem Lehrbuch hatten viel mehr zu tun mit dem Krieg; es wäre ja darum gegangen, als erste Lektüre „De Bello Gallico“ zu lesen, so wie das in allen unseren Parallelklassen der Fall war. Dieses Werk zu übersetzten wäre zu Beginn zweifellos einfacher gewesen, als sich an die schwierigen Verse der Aeneis heranzuwagen, aber dazu war Herr Dr. Walther zu feinfühlig. Caesars Beschreibungen waren nicht seine Welt, die waren ihm zu vulgär; er war ausschliesslich der Ästhetik verpflichtet, der erhabenen Lektüre des Vergil. – Und das gab mir endgültig den Bogen.
Was die Logik angeht, hat mich diejenige der Mathematik viel mehr überzeugt. Die Freude an den Zahlen und das Knobeln und Rätseln mit Denkaufgaben und Zahlenreihen hatte ich ja früh schon von meinem Schwager mitbekommen, der inzwischen auch mein Klassenlehrer am Gymer war. Übrigens hatte er daneben auch eine Professur an der Uni Bern. Seine Lektionen waren ausgezeichnet aufgebaut, klar strukturiert und interessant. Zum Glück war Mathematik ein Fach, wo ich keine Angst vor ungenügenden Noten zu haben brauchte. So hatte ich auch nie das Gefühl, dass ich als seine Schwägerin Privilegien genoss; das hätte ich auch gar nicht gewollt. Kombinatorik gefiel mir vor allem, die gerade neu propagierte Mengenlehre ebenfalls. Wenn’s allerdings um irrationale Zahlen ging, verliess mich mein Vorstellungsvermögen völlig.
Zugegeben: Von Geometrie, Vektoren und Algebra habe ich heute keine Ahnung mehr, genauso wenig wie von 99 Prozent meiner ehemaligen Lateinkenntnisse, aber trotzdem denke ich, es ist die Mathematik und die Physik, die die Welt zusammenhält und nicht eine tote Sprache.
Trotzdem: Mit Physik konnte ich nicht viel anfangen. Zwar faszinierte mich diese Wissenschaft einerseits, aber sie war mir zu kompliziert. Und die weit hergeholten Aufgaben, die wir lösen mussten, fand ich, machten wenig Sinn, interessierten mich nicht. Den frischgebackenen, unbeholfenen Lehrer, der uns zugeteilt wurde, mochte ich ebenfalls nicht. Grade mal genügend waren meine Noten, und das war alles, was zählte.
Im Französisch konnte ich mich knapp über Wasser halten, eine Vier auch hier die Note, die mir reichte. Unser System sagt ja, die Vier sei genügend, also wieso sich zusätzlich anstrengen? – Das habe ich später auch häufig von meinen Schülern gehört – sie haben natürlich recht, andererseits macht auf diese Weise niemand Höhenflüge.
Gerne würde ich heute besser Französisch sprechen können. Weniger spicken, besser aufpassen im Unterricht wäre mehr gewesen. – Trotzdem ist mir die Sprache geläufig. Verstehen und Lesen sind kein Problem, nur fehlt mir manchmal das Vokabular, wenn ich etwas sagen will. Ob das damit zu tun hat, dass uns der Lehrer immer gleich korrigierte, kaum hatten wir einen Satz zu formulieren begonnen?
Eigentlich war er ja ein Lustiger, unser Monsieur De La Chaux, zumindest teilweise, vor allem, wenn er eine Probe ankündigte. Dann pflegte er seinen Stuhl aufs Lehrerpult zu stellen, sich draufzusetzen und zu sagen, auf diese Art habe er den besseren Überblick und könne sehen, wer spickt. – Allerdings las er dazu jeweils die Zeitung, was seiner Aufmerksamkeit zum Glück ziemlich abträglich war.
Geographie war todlangweilig. Eine Lektion bestand zwar oft aus lauter interessanten Fragen, die aber am Ende nie richtig beantwortet wurden. Oder ich hatte den Faden verloren, das ist natürlich auch möglich. Als der Lehrer in unser allerersten Stunde den Diaapparat hervornahm, hatten wir alle schon freudige Erwartungen auf einen spannenden Unterricht, aber als es nur drei Dias waren, über welche dreiviertel Stunden lang nachgedacht, debattiert und gerätselt wurden, war die Enttäuschung gross. - Schadenfreude herrschte allenthalben, als sich einmal in einer späteren Stunde das Dia, das Herr Mauerhofer zeigte, entzündete und nur noch ein Räuchlein vom Projektor aufstieg.
Geschichte interessierte mich sehr. Der Lehrer weniger. Er hatte nur eine Methode, und die zog er während der ganzen viereinhalb Jahre durch. Es hatte ein Heft, in dem er eine Zusammenfassung des Geschehenen handschriftlich niedergeschrieben hatte. Daraus las er uns vor, und wir mussten Notizen machen. Aus welchen Büchern er sich seine Sicht der Dinge zusammengereimt hatte, weiss ich nicht. Das hat er uns auch nie erklärt. – Ein Geschichtsbuch hatten wir keines. Natürlich sah er zwischendurch auch mal vom Heft auf, erläuterte etwas, stellte Fragen oder schreib einen Namen an die Tafel. Selten teilte er uns ein Blatt aus, einen Quellentext, den wir dann diskutieren mussten. Alles im Frontalunterricht. Nur den „Putzger“ mussten wir anschaffen, den historischen Weltatlas. Den liebte er.
Einmal mehr begann der Unterricht in der Quarta bei den Römern – gegen Ende der Oberprima hatten wir uns bis kurz vor den zweiten Weltkrieg durchgeackert.
Staatskunde hatten wir keine. Der Kalte Krieg, die Frauenbewegung und wie es schliesslich dazu kam, dass das Frauenstimmrecht in der Schweiz eingeführt wurde, darüber wurde kein Wort verloren. Dabei waren wir damals in der Prima, als das passierte; all diese Themen und viele andere mehr waren höchst aktuell und brisant, aber darüber stand halt nichts in seinem Heft.
Einmal kam er zu spät. Wir alle hofften schon… Aber er kam. Seine Entschuldigung: „Ich habe meine „Präp“ (sein Heft) zu Hause vergessen und musste zurück, um sie zu holen. Sonst hätte ich euch ja gar keinen Unterricht gegen können.“ – Ja, genau! – Und er gibt es auch noch zu… - Wie Herr Dr. Weilenmann zu seinem Doktortitel gekommen war, war uns allen schleierhaft.
Sein Gedächtnis war auch nicht mehr wirklich frisch. So hatte er ständig Mühe mit unseren Namen. All die Jahre lang. Daniel nannte er jedes Mal David, auch wenn dieser nie müde wurde, ihn zu korrigieren. Dabei war’s ja damals noch nicht schwierig mit den Namen so wie heute. Wir waren noch immer die Barbaras, Regulas, Monikas, Michaels und keinen einzigen ausländischen Namen hatte er sich merken müssen.
Chemie war interessant. Wir hatten einen jüngeren Lehrer und dieser hatte die bahnbrechende Idee, vom Frontalunterricht abzukommen. Mit einem Kollegen zusammen hatte er ein Skript ausgearbeitet für einen programmierten Unterricht mit vielen Aufgaben, die zum Unterrichtsziel führen sollten. Das Problem war, diese Unterrichtsform war damals ganz neu und er hätte bei der Verfassung des Skripts auch eine unerfahrene Person hinzuziehen sollen. Dann wäre es wohl nicht so oft vorgekommen, dass uns beim Bearbeiten der Aufgaben Zwischenschritte zum Verständnis fehlten, die für uns wesentlich gewesen wären, bei denen es aber den Experten gar nicht auffiel, dass da eine Erklärung nötig gewesen wäre, um weiterzukommen. So brüteten wir beim Hausaufgaben-Machen nicht selten stundenlang über den Blättern, bis jemand von uns die erleuchtende Idee hatte oder, weil er oder sie Nachhilfestunden hatte, erklären konnte, wie sich die Sache verhielt.
Der Musikunterricht war nicht mein Ding, jedenfalls aber eine Abwechslung im Schulalltag. Ich liebte meine Rock und Pop Songs, die ich im Radio hörte und auf meinen Tonbändern gespeichert hatte. Die Musikstile jedoch, mit denen wir uns in der Schule befassten, berührten mich nicht. Der Lehrer, Herr Götze, war allerdings ein sehr freundlicher Mann, der auch das Berner Stadtorchester leitete. Er hat mein Desinteresse nie mit einer schlechten Note bestraft und ich war und bin ihm dafür dankbar.
Auch Turnen empfanden wir in der Regel als willkommene Abwechslung, trotzdem schwänzten wir den Unterricht nicht selten, erstens weil es einfach war, eine gute (?) Ausrede zu finden und zweitens schön, sich in der gewonnenen Pause im Restaurant gegenüber dem Schulhaus zu treffen, etwas zu trinken, ein paar Zigis zu rauchen und für ein Stündchen vom Lernstress zu erholen.
Der Zeichenunterricht gefiel mir gut, obwohl ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern kann, was ich jemals gezeichnet habe. Da ist auch nie eine verstaubte Mappe in unserem Estrich aufgetaucht mit Werken von mir. Aber die Kunstgeschichte fand ich spannend und Bildbetrachtungen mochte ich sehr. Wie gross ist doch der Unterschied beim Verständnis eines Bildes, wenn man mit den Hintergrundinformationen vertraut ist und über den Maler Kenntnis hat.
Unser Zeichenlehrer wurde mit der Zeit ein guter Freund von mir. Er wohnte vis-à-vis in derselben Strasse und später wurde er der Götti unseres älteren Sohnes. Noch immer haben wir einen guten Kontakt.
Die Erinnerungen an den Deutschunterricht sind mannigfaltig. Wie wenn’s gestern gewesen wäre, sehe ich mich am ersten Schultag das Klassenzimmer betreten. Am Fenster, mit dem Rücken zu uns, stand eine Frau mit breiter Hüfte, einer schmalen Taille, einem engen Jupe, einem zierlichen Oberkörper und hellbraunen, schulterlangen Haaren. Sie hielt sich am Fenstergriff fest und schaute hinaus auf den Schulhof. Als sie sich umdrehte, hatte ich fast einen Schock. Weil sie von hinten so jung aussah, musste ich mich erst daran gewöhnen, dass sie die Fünfzig sicher schon längst überschritten hatte.
Auch sie unterrichtete nur frontal, aber ich mochte, was sie uns beibrachte, obwohl sie immer ernsthaft war und kaum je lachte. Sie sprach Bühnendeutsch, was wir von unseren anderen Lehrern überhaupt nicht gewohnt waren. Von keinem bisher. Wir mussten eine Unmenge von Büchern lesen, von Simplicissimus über Goethe, Schiller, Kleist, Lessing, Conrad Ferdinand Meyer bis hin zu Frisch und Dürrenmatt und vielen anderen mehr.
Auch häufige Theaterbesuche waren üblich. Das dicke Ende kam natürlich in der nächsten Stunde oder auch in Form von Hausaufgaben, wo wir über das besuchte Stück schreiben mussten. Wer geschwänzt hatte, musste sich an „Herrn König“ wenden; es gab ja damals noch kein Internet, wo man sich praktischerweise über alles und jedes bei Google informieren kann. So waren „Königs Erläuterungen“ die unentbehrlichen Helfer bei jedem Aufsatz über Literatur. Aber mir gefiel es, über Bücher zu schreiben und zu diskutieren. Manchmal legte ich ganze Nachtschichten ein, um eine Arbeit, die ich lange hinausgeschoben hatte, rechtzeitig abzugeben. Frau Seebohm war mir gut gesonnen und nicht selten las sie meine Aufsätze oder Teile daraus der Klasse vor. Trotzdem hatte ich jeweils ein mulmiges Gefühl, bevor sie die obligaten drei Aufsatzthemen bekanntgab. Insgeheim dachte ich, wenn’s ganz schlimm wird und ich nichts zu schreiben weiss, kann ich ja sagen, es sei mir schlecht. – Das hab ich nie gemacht, aber einmal wär’s wohl gescheiter gewesen. Das Thema, das mir zwar gar nicht passte und von dem ich wusste, dass sie sicher nicht meiner Meinung war, hiess: „Selbst musizieren – heute noch?“. Welcher Teufel mich geritten hatte, trotzdem darüber zu schreiben, ist mir ein Rätsel. Ich beschrieb das Debakel mit meinen Klavierstunden, die Tatsache, dass ich auch aus einer Flöte ausser einem Pfeifton nichts Anständiges hervorzubringen imstande war und kam zum verhängnisvollen Schluss, dass mir all das nicht leid tat und dass mir die Mainstream-Musik im Radio gefällt. – Das konnte ja nicht gut gehen. Eine Zwei erhielt ich für meine Schreibe.
Eine Deutschstunde werde ich nie vergessen, und meine Klassenkameradinnen und –kameraden auch nicht. An unserer ersten Klassenzusammenkunft nach mehr als zwanzig Jahren wurde noch immer herzlich darüber gelacht. – Die Episode war auch wirklich an Peinlichkeit kaum zu überbieten.
Wir hatten erfahren, dass Frau Seebohm wieder geheiratet hatte, und zwar einen ziemlich viel älteren Mann. Nun hatte sie offenbar den unerklärlichen Drang, uns mitzuteilen, dass da auch sexuell noch etwas laufe. Wohl wollte sie uns gleichzeitig auch mit einer Art Aufklärungslektion beglücken. So stellte sie sich einmal mehr ans Fenster, hielt sich mit der rechten Hand am Griff fest, genauso wie sie es an unserem ersten Schultag getan hatte, legte ihren Kopf etwas schief und richtete sich an uns mit ernsten Worten. Sie tat das immer, wenn’s ein wenig heikel wurde. Wie sie aufs Thema kam, daran mag ich mich nicht mehr erinnern. Aber an den tollen Vergleich, mit dem sie uns anschliessend konfrontierte, schon. Sie sprach lange und geschickt um den heissen Brei herum, liess uns aber auf Umwegen wissen, wie ihre Sicht der Dinge war. Um das zu versinnbildlichen erkläre sie uns alsdann, dass man den Sex mit einem Gewehr vergleichen könne, das so und so viele Schüsse habe. Und wenn man von denen in der Jugend zu viele verschwende, dann hätte man im Alter keine mehr übrig. – Für die meisten von uns war es unmöglich, ein Pokerface zu bewahren. Viele konnten sich kaum mehr beherrschen und versuchten gequält, ihr Lachen zu verbergen. – Später brauchte nur jemand „Gewehr“ oder gar „Maschinengewehr“ zu sagen, und schon ging das Gelächter los.
Die Geschichte war umso mehr daneben, als einige von uns bereits ein ganzes Arsenal dieser erwähnten Schüsse abgegeben hatten, waren wir ja schliesslich bereits in der Prima damals.
Eskapaden
Ich beispielsweise hatte bereits seit ich vierzehn war einen Freund gehabt, mit dem ich regelmässig schlief. Er war zwanzig, hatte seine Lehre als Grafiker bereits abgeschlossen und hatte eine eigene kleine Wohnung. – Als meine Mutter dahinter kam, war die Hölle los. Erst konnte sie es gar nicht begreifen, ich sei doch nie über Nacht weggewesen. Dass ein Liebesabenteuer auch an einem Nachmittag, speziell an einem Samstagnachmittag, stattfinden könnte, das war ihr gar nicht in den Sinn gekommen.
Es funktionierte aber tatsächlich auch in der Nacht. Wann immer es möglich war, schlich ich mich weg. Möglich war’s nur, wenn die Schule am nächsten Morgen nicht bereits um acht begann. Meine Mutter hatte nämlich die strikte Anweisung, mich an diesen Tagen keinesfalls zu wecken, und daran hielt sie sich auch. Wir erwähnt, wohnten wir inzwischen im Parterre und es war für mich einfach, aus dem Fenster zu klettern und die zwei Meter in den Garten hinunterzuspringen. Das tat ich in der Nacht, wenn ich sicher sein konnte, dass alles still war und meine Mutter schon schlief. Zu Fuss suchte ich dann die Wohnung meines Freundes auf - ein Marsch von einer guten halben Stunde. Am nächsten Morgen fuhr ich mit dem Tram zurück und es gelang mir jedes Mal, rechtzeitig daheim zu sein, wenn sie bereits unterwegs war zur Arbeit. Die Erleichterung war jeweils riesig, wenn ich die Türe öffnete, unsere Wohnung betrat und feststellte, dass alles in Ordnung und ich beziehungsweise meine Abwesenheit nicht bemerkt worden war. Dann konnte sich meine Anspannung lösen, die Schmetterlinge in meinem Magen verschwanden - ich machte mich auf den Weg zur Schule.
Die Geschichte würde ich selber kaum glauben, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Nie hat mich jemand die Wohnung verlassen sehen, nie hat meine Mutter gemerkt, dass ich nicht da war – unvorstellbar, was das alles für Konsequenzen hätte haben können.
Gemerkt hat meine Mutter ja dann trotzdem, was da lief, allerdings flog zum grossen Glück die Sache mit meinen nächtlichen „Spaziergängen“ niemals auf.
Unvorsichtigerweise hatten mein Freund und ich an einem Samstagmorgen mal ein Schäferstündchen bei uns zu Hause, als ich dachte, Mam sei weg. Sie kam aber vorzeitig zurück, fand meine Türe verschlossen vor und drohte, sie einzureissen, wenn ich nicht sofort aufmachen würde. In Panik wies ich meinen Freund an, den Fluchtweg aus dem Fenster zu nehmen. Ich hatte nur gerade Zeit, mein Nachthemd überzuziehen, öffnete die Tür, und sie stürmte herein. Dummerweise war es Winter und sie clever genug, die Fussspuren im Schnee zu entdecken, die unter meinem Fenster begannen und durch den Garten Richtung Strasse führten…
Es muss für sie eine schlimme Situation gewesen sein, ein Dilemma, zum Verzweifeln. Wenn ich heute daran denke, tut es mir sehr leid, dass ich ihr so viel Kummer bereitet habe. Verdient hätte sie alles andere. - Sie hätte ja auch angezeigt werden können. Mein Freund natürlich ebenfalls. – Aber nicht im Traum hätte ich einen Gedanken daran verschwendet; ich war bis über beide Ohren verliebt, zu keinerlei Kompromiss bereit und tat von mir aus gesehen genau das, was ich als richtig empfand.
Mein Argument war: „Seit mein Vater gestorben ist, höre ich immer wieder, ich müsse jetzt vernünftig sein und tagsüber alleine zurechtkommen. Und jetzt heisst es, ich solle mich benehmen wie ein Mädchen in meinem Alter.“
Kein Wunder verbot sie mir von da an auszugehen, meinen Freund zu sehen, mich zu schminken, wenn ich zur Schule ging (das tat ich natürlich trotzdem im Hauseingang mit einem kleinen Spiegel bewaffnet und dem Malset) und meine Schwester unterstützte sie in ihren Erziehungsmassnahmen ebenfalls. - Sie schickte mich auch zu einem Frauenarzt, der natürlich feststellte, was schon längst klar war, obwohl ich in meiner Naivität dachte, ich könne ihm eventuell etwas vormachen, und so spitzte sich die Lage zu. Als sie davon zu sprechen begann, mich in ein Internat zu schicken, rastete ich aus, drohte in meiner Verzweiflung mit Selbstmord. Auch stellte ich eine Forderung. Ich hatte von einem Kinder- und Jugendpsychiater gehört, und den wollte ich nun konsultieren. – Darauf ging sie sogleich ein; ich wurde angemeldet und fortan gab es mehrere Gespräche.
Unter anderem erinnere ich mich gut an den Rorschachtest. Der Arzt wollte wissen, was ich auf all den Blättern, die er vor mich hinlegte, erkenne. – Das war nicht einfach für mich, denn alles, was ich sah, waren Tintenflecke in verschiedenen Pastellfarben, die symmetrisch nebeneinander abgebildet waren. Dass ich genau das und nichts anderes sah, erwähnte ich natürlich, und nur mit grösster Mühe und nur um ihm quasi einen Gefallen zu tun, sagte ich, mit viel Phantasie könnte man auf einem Bild eine Maske erkennen, auf einem anderen eventuell einen Schmetterling. – Was er daraus machte, weiss ich nicht, was ich da hervorgebracht hatte, sah ja auch ohne psychologische Kenntnisse nach Sich-Verstecken und Wegfliegen aus, aber egal, wichtig war, die Besuche bei ihm endeten für mich glücklich. – Er sprach natürlich ebenfalls mit meiner Mutter und vermutlich auch mit meiner Schwester und überzeugte sie offenbar, dass ich wohl tatsächlich reifer war als in diesem Alter üblich. Von da an ging es mir sehr viel besser, die Zeit der Inhaftierung wurde ungestraft beendet und meine beiden Erzieherinnen liessen mich mehr oder weniger gewähren.
Ich weiss noch, dass ich zu meinem Retter sagte, ich würde ihm dann eine Karte schicken, wenn wir heiraten würden, mein Freund und ich. – Er lächelte nur. – Wohlweislich.
Der ganze Druck liess nach, ich konnte sogar einen (anderen) Frauenarzt aufsuchen, der mir die Pille verschreib.
Diese hatte ich zwar schon vorher genommen. Eine gute Freundin von mir arbeitete in einer Apotheke und konnte die Präparate dort abzweigen. – Zuhause hatte ich in einem dicken Buch in der Mitte ein grosses Loch ausgeschnitten, in das die runde Pillenschachtel genau hineinpasste, so dass mir meine Mutter nicht auf die Schliche kommen konnte. – Dieses Versteckspiel war nun auch nicht mehr nötig.
Es war die Zeit, als ich mir mit Wasserstoffsuperoxyd die Haare blond zu färben begann. Das gefiel mir halt. Meine Mutter gab nicht einmal einen Kommentar dazu ab.
Freizeit und Jobben
Reiten war nach wie vor meine grosse Leidenschaft. Nach ein paar Jahren wechselte unser Reitlehrer mit seiner Reitschule nach Münsingen. So musste ich vom da an den Zug nehmen. Zuweilen durfte ich mit jemandem mitfahren. Das war einfacher und ging viel schneller. Wenn das nicht möglich war, begann ich, Autostopp zu machen. Nie musste ich lange warten; ich fand das mehr als nur praktisch. Zusätzlich konnte ich das Fahrgeld sparen. Von alledem wusste meine Mutter natürlich nichts. – Lange ging das gut. Nur einmal begann ein Fahrer seine rechte Hand, statt am Steuerrad zu lassen, mir ständig auf die Knie und Oberschenkel zu legen. Zum Glück hatte ich Reithosen und Stiefel an. Das Ganze war mir mehr als nur unangenehm. Passiert war weiter nichts, am Ostring liess er mich aussteigen, aber von da an besann ich mich demütig zurück auf die SBB oder liess mich chauffieren.
Eine andere Leidenschaft war und ist noch immer das Schwimmen in der Aare. Nach wie vor durfte ich bei der Familie meiner Freundin zu Mittag essen, aber im Sommer, wenn das Wetter es zuliess, meldeten wir uns ab, fuhren mit unseren Fahrrädern ins Muribad und verbrachten die freie Zeit dort.
Später wurde das Marzili zu meiner zweiten Heimat. Wann immer ich frei hatte, ging ich hin. Inzwischen hatte ich ein paar Freundinnen und Freunde kennengelernt, es bildete sich ein „Jasskränzli“ und jede freie Minute sozusagen wurde Karten gespielt, nur unterbrochen vom obligaten Schwimmen in der fantastischen, heiss geliebten Aare. Je nachdem, wie kalt das Wasser war, pilgerten wir zu zweit, zu dritt, zu viert oder auch in ganzen Gruppen flussaufwärts bis zum „Schönauer“, dem Eichholz oder weiter noch bis Muri. Sich im Fluss mit der Strömung hinuntertreiben zu lassen, am Dählhölzli-Tierpark entlang, an den Flamingos, Yaks und Steinböcken vorbei und durch die „Büffelwellen“ zu schwimmen, machte und macht nach wie vor enorm Spass. Auch ein Zwischenhalt wurde gelegentlich eingelegt zwecks Erwärmung und eventuell Genehmigung einer Flasche Rosé. Das vor allem im Fähribeizli oder im Eichholz-Camping.
Kurzer Exkurs in die Gegenwart: Unser Jasskränzli besteht noch immer, aber leider nicht mehr im Marzili. Unsere eine Partnerin ist inzwischen 97-jährig und die beiden anderen Jasspartner haben ihre individuellen Gründe, weshalb sie nicht mehr kommen wollen. Nun treffen wir uns hin und wieder in einem Restaurant oder bei jemandem zu Hause. Nach einem feinen Nachtessen werden die Karten verteilt und der Abend kann dauern…
Von den ehemaligen „Jassern“ bin ich also noch die Einzige, die im Marzili anzutreffen ist. Allein bin ich allerdings kaum je, denn der grosse Freundeskreis, der sich während all der Jahre um uns herum gebildet aber auch umgebildet hat, besteht noch immer.
Zurück zu den Sechzigern: Man traf sich damals auch in der Stadt. Erst im Grotto, einem dieser kleinen Restaurants an der sogenannten „Front“ zwischen Bundeshaus und Käfigturm, wo man bei schönem Wetter auch draussen sitzen und wo diejenigen Typen, welche die flotten Schlitten ihrer Väter ausfahren durften, gleich vornedran parkieren konnten, um dann lässig mit dem Autoschlüssel zu jonglieren und wichtig hin und her zu blicken. – Sehen und gesehen werden…
Im Grotto hatte es einen speziellen Kellner. Johnny hiess er, war wohl kurz vor der Pensionierung und wusste nicht, was gute Laune ist. Er war die Unfreundlichkeit in Person, und er jagte mir mit seiner finsteren Mine manchmal fast Angst ein.
Eine Stange Bier kostete damals 45 Rappen. Ein Käseküchlein ebenfalls. Bier war und ist überhaupt nicht nach meinem Geschmack, ich bestellte jeweils eine Tasse Schwarztee, die genau gleichviel kostete. Zehn Prozent Trinkgeld musste man geben, 50 Rappen hätten also genügt, ein Franken mit Käseküchlein, aber wenn man nur gerade diesen Betrag hinlegte, verlor Johnny die Fassung und geriet in grenzenlose Rage. Nicht selten geschah es, dass er uns alle aus dem Restaurant rauswarf. Und wenn er in diesem bizarren Psycho-Modus war, konnte ihn niemand bremsen. Alle mussten dran glauben und das Lokal fluchtartig verlassen, auch gleich sämtliche anderen Gäste, jüngere und ältere. Wer dieses Prozedere noch nie erlebt hatte, wusste nicht, wie ihm oder ihr geschah. Auch andere Gründe konnten ihn zu solchen Zornesausbrüchen treiben, welche auch immer - man wusste nie, wann das Hagelgewitter einsetzte. - Trotzdem gingen wir wieder und wieder hin. Wir liebten es einfach, das kellerartige Lokal mit dem dunklen Gewölbe; es war unser Treffpunkt.
Später wurde es umgebaut zu einer Art Pub. Highnoon hiess es dann. – Wirklich schade; die ganze Atmosphäre war im Eimer. - So traf man sich halt ein paar Meter weiter im nächsten Restaurant, dem Le Mazot, wo die Kellner freundlich waren und das Raclette delikat.
An der Speichergasse gab es ein Restaurant, das hiess UHU. Dort spielten Live-Bands und es ging die Post ab. „Come on Baby balla balla“, war der Song damals, der mir noch bestens in Erinnerung geblieben ist. Eigentlich war ich mit fünfzehn oder sechzehn zu jung, um in diesem Lokal zu verkehren, aber man sah mir mein Alter ja nicht an. – Genauso wenig wie im Spielsalon, wo wir hie und da zu zweit oder zu dritt hingingen, wenn wir eine Ausfallstunde hatten. Den Flipperkastenbetreibern war es offenbar egal, wie alt wir waren, Hauptsache, die Kohle stimmte.
All diese Freizeitvergnügen kosteten natürlich Geld, auch wenn diese Ausgaben heute kaum der Rede wert erscheinen. Mein Taschengeld hatte schon längst nicht mehr gereicht für all das, was ich mir gerne kaufen oder gönnen wollte. So hatte ich schon früh begonnen, nach einem geeigneten Nebenverdienst Ausschau zu halten. Bereits im Progymnasium übernahm ich das Inkasso für eine Zeitschrift, „Die Schweizerjugend“, und erhielt dafür eine bescheidene Entlöhnung. – Vom Verlag bekam ich pro Monat etwa zwanzig (?) Karten zugeschickt, auf denen die Adressen der Abonnenten und der Betrag, den sie bezahlen mussten, aufgedruckt waren. Die Karte galt gleichzeitig als Quittung. Mit dem Velo fuhr ich von Haus zu Haus, läutete an der Tür und hoffte, dass ich das Geld einziehen konnte. Mühsam war’s, wenn jemand nicht zu Hause war, grad kein Geld oder auch kein Kleingeld hatte, denn dann musste ich nochmals und nochmals hin und versuchen, den fälligen Betrag einzukassieren.
In den letzten Jahren im Gymnasium fand ich andere Möglichkeiten, mein Taschengeld aufzubessern:
Einen Ferienjob hatte mir meine Mutter organisiert, nämlich dort, wo sie arbeitete, in der Bundesverwaltung. Meine Aufgabe war es, eine Liste abzuschreiben beziehungsweise aus verschiedenen Vorlagen zu übertrage und anzupassen. Worum genau es ging, habe ich vergessen. Es handelte sich um irgendwelche Ausgaben, am linken Rand der Text, am rechten war der Betrag hinzuschreiben, dazwischen gab es Tabulatoren zu setzen. Rechts unten an der Seite kam das Total zu stehen, das natürlich stimmen musste. Das Tückische an dieser Arbeit war, dass es dafür fünf Durchschläge brauchte, also fünf Bogen Papier und dazwischen je ein schwarzes Tintenblatt. - Wie praktisch ist es doch heutzutage, eine solche Liste in den PC einzugeben, Excel die Rechnerei zu überlassen, am Schluss auszudrucken und zu kopieren. – Ein Kinderspiel! – Aber damals… Wie ein Häftlimacher musste ich aufpassen, dass mir kein Fehler unterlief, denn wenn das geschah, galt es, die ganze Beige Blätter auszuspannen und mithilfe von Tipp-Ex auf jedem Papier einzeln den Fehler zu korrigieren.
Zum Glück hatte ich in meiner Freizeit das Zehnfingersystem gelernt, so machte mir das Schreiben auf der Schreibmaschine an sich keine Mühe, aber hin und wieder liess sich ein Missgeschick eben doch nicht vermeiden.
Gelernt hatte ich das Maschinenschreiben aus folgendem Grund: Mein Schwager hatte sich eine brandneue IBM-Kugelkopfschreibmaschine gekauft. Diese bewunderte ich sehr, hatten wir doch zu Hause nur eine alte, schwarze Maschine, auf welcher der Buchstabe „E“ nicht mehr richtig funktionierte, was ziemlich mühsam war. Er sagte, ich dürfe seine erst gebrauchen, wenn ich das Zehnfingersystem blind beherrsche. Das war mir Motivation genug. Er gab mir ein Buch und im Selbststudium begann ich unermüdlich die endlosen jff, fjj, kdd, dkd etc. zu tippen, bis mein Hirn automatisch die Buchstaben dem jeweiligen Finger zuordnen konnte.
Trotzdem war die Arbeit, die ich zugewiesen bekam, nicht einfach, aber es machte mir Freude, meine Schreibfähigkeiten unter Beweis stellen zu können und am Ender der beiden Wochen sogar noch einen Lohn dafür zu erhalten.
Kinoplatzanweiserin war eine andere Quelle zum Aufbessern meiner pekuniären Situation. Das hätte ich gerne öfter gemacht, aber das Angebot war beschränkt und ich war nicht die Einzige, die sich um den begehrten Job bemühte. Die „Arbeit“ war einfach, strengte in keiner Weise an und gleichzeitig konnte man sich ungestört und gemütlich einen Film ansehen.
Ziemlich anders gestaltete sich mein Sommerferienjob, den ich mal für drei Wochen in der Konservenfabrik Véron annahm.
Denner hatte Aprikosenkonfitüre in Auftrag gegeben und da es sich um einen Grossauftrag handelte (eine Million Gläser, glaube ich), mussten zusätzliche Arbeiterinnen und Arbeiter angestellt werden. Pro Stunde verdienten wir 5.60 Fr. Neun Stunden pro Tag wurde gearbeitet, unterbrochen von einer halbe Stunde Pause am Mittag. Es gab verschiedene Arbeitsplätze. Diese wurden im Akkord ausgeführt, teilweise am Fliessband, und der Patron spazierte von Zeit zu Zeit durch die Reihen, um sicher zu gehen, dass alle fleissig ihrer Arbeit nachgingen und niemand etwa auf die Idee kam, sich auszuruhen und auf der faulen Haut zu liegen. Einen freundlichen Eindruck machte er mitnichten.
Ich weiss noch gut, dass ich am allerersten Tag, nachdem ich eine halbe Stunde lang 8er-Kartons zusammengestellt hatte, in welche die Konfitüren schliesslich verpackt werden mussten, fragte, ob ich nun etwas anders machen könne. Der Vorarbeiter belehrte mich eines Besseren. Ein paar Stunden lang hatte man dieselben Handgriffe zu verrichten. „Vielleicht dann am Nachmittag…“.
Am Fliessband ging es schliesslich darum, mit einem Holzstab auf die Deckel der vorbeitreibenden, bereits verschlossenen Konfitüren zu schlagen und, wenn der Ton nicht stimmte, das Glas also nicht richtig vakuumiert war, dieses auszusortieren. Die Maschine spuckte in gleichmässigem Rhythmus eine ganze Menge dieser Konfitüren gleichzeitig aus, man musste sich also beeilen, um keine zu verpassen. – Eine seltsame Arbeit, fand ich. Aber noch seltsamer und stressvoller ging’s auf dem danebenliegenden Fliessband zu. Dort musste jedes Glas aufgehoben und umgedreht werden. Der Zweck davon war zu erkennen, ob irgendein Fremdkörper drin war. Gemeint waren Aprikosensteine. Aber was wir nicht alles sonst noch fanden – ich ass während Jahren keine Konfitüre mehr. - Irgendwo musste ein hellblaues Stück Plastik in die Maschine geraten sein. Teile davon, kleine Splitter, fanden sich in einigen der Gläsern wieder. Das ging alles noch. Aber Wund-Pflaster… Es war ja gar nicht möglich gewesen, alle vorbeigleitenden Gläser zu prüfen und wer schon hätte erkennen können, ob sich ein Stein nicht mittendrin im Glas versteckt hatte... – Mission impossible. - Die fehlerhaften Konfitüre-Gläser mussten anschliessend geöffnet werden, ein weiterer erquickender Arbeitsprozess, und mit Löffeln wurden der Stein oder die Steine des Anstosses aus der Aprikosenmasse herausgeklaubt.
In der grossen Fabrikhalle hatte es auch riesige Maschinen, in denen Melasse hergestellt wurde. Was war das mal für eine Aufregung, als eine der Maschinen nicht mehr aufhören wollte zu produzieren! – Die Melasse lief oben aus dem Gerät heraus, wie Lava aus einem Vulkan, floss an den Metallwänden auf den Boden runter und niemand konnte sie rechtzeitig stoppen. Es dauerte nicht lange, und der ganze Boden war von der dunklen, klebrigen Masse überflutet. Sagenhaft! - Die Episode erinnerte mich an das Märchen mit dem Brei, der nicht aufhören wollte, aus dem Kochtopf zu quellen und sich schliesslich im ganzen Dorf verteilte. - Irgendjemandem gelang es schliesslich, den Apparat abzustellen, aber die Bescherung war überwältigend.
Kurz nachdem die Lieferung an Denner erfolgt war, konnte man in der Zeitung lesen, dass der Grossdetaillist die ganze Ladung Aktionskonfitüren hatte zurückziehen müssen. Offenbar war der falsche Zucker verwendet worden, was dazu geführt hatte, dass, kaum geöffnet, die Aprikosen bereits zu faulen begannen und die Kunden die Ware in den Laden zurückbrachten. – Ich hätte da auch noch ein paar andere Gründe anführen können als nur den Zucker… - Jedenfalls, wenn ich mich richtig erinnere, war dieser missglückte Grossauftrag der Gnadenstoss für Véron und führte zur Aufgabe der altehrwürdigen Konservenfabrik.
Ich jedenfalls beschloss, niemals mehr in einer Fabrik arbeiten zu gehen.
Da hingegen gefiel mir das Kellnern sehr viel besser. In verschiedenen Restaurants bekam ich Gelegenheitsjobs, mal in den Ferien für eine Woche oder zwei, mal an einem freien Nachmittag. Regelmässig während etwa zwei Jahren durfte ich in der „Schwarzen Tinte“, einem In-Lokal in der Berner Altstadt, servieren. Das machte mir grossen Spass, und das Geld zu zählen am Ende des Abends und all das Trinkgeld davon abzuziehen, noch viel mehr.
Mit dem Wirte-Ehepaar kam ich gut aus, mit den fest angestellten spanischen Kellnern ebenfalls, und wenn nichts oder nicht viel lief in der Küche, sassen wir zusammen an einem Tisch nahe der Theke und plauderten über dies und jenes, über Beziehungen, erfolgreiche und gescheitere.
Auch Dodo Hug, sie war damals noch unbekannt, war nicht selten dabei. Sie gehörte zu den Stammgästen.
Die Schwarze Tinte gibt es heute nicht mehr. Sie geriet Mitte der Siebzigerjahre in Verruf, und das war das Aus.
An der „Front“ hatte ich inzwischen eine Reihe anderer Leute kennengelernt. Die jungen Männer, mit denen ich oft zusammen war, besuchten das Technikum Burgdorf und hatten alle denselben Jahrgang: 1946, waren also sieben Jahre älter als ich. Freundinnen kamen und gingen, einige blieben, nach und nach wurde geheiratet. Auch heute noch habe ich mit mehreren von ihnen Kontakt und wir pflegen Freundschaften.
Jedenfalls war das damals eine lustige und unbeschwerte Zeit. Partys wurden jeden Samstagabend gefeiert, der Wein floss in Strömen. Wenn ich nicht arbeiten musste, war ich gern mit dabei.
Mit der Beziehung zu meinem Freund kam es, wie vorauszusehen war: Nach zwei Jahren war sie zu Ende. Was genau der Anlass dazu war, weiss ich seltsamerweise gar nicht mehr. Aber es war mein Freund, der nicht mehr mit mir zusammen sein wollte, und ich war am Boden zerstört.
Sehr lange dauerte das Tränental allerdings nicht und ich lernte an der Front Theo kennen, der ebenfalls eine Beziehung hinter sich hatte. Ich war grad siebzehn geworden, er war fünfundzwanzig, studierte an der ETH Zürich Elektroingenieur und hatte eine kleine, bescheidene Absteige in der Altstadt.
Eigentlich hatte ich ihn bereits flüchtig gekannt. Irgendjemand hatte ihn mir mal vorgestellt, das war aber zwei Jahre zuvor; er war damals in einem WK. – Meine Mutter hatte mir immer gesagt: „Wenn du jemanden kennst, der im Militär ist, dann schicken wir dem ein Päckli“. - Etliche Päckli hatten wir damals verschickt, also hatte auch Theo eines von mir erhalten. Was drin war - keine Ahnung mehr. Wohl Schokolade, Güezi, Zigaretten und ein nettes Brieflein.
So trafen wir uns also wieder an jenem Samstag im April 1970. Eine gute Freundin von mir lud uns und noch ein paar andere junge Leute zu einer Party bei sich zu Hause ein. Und da geschah es, dass ich mich zum zweiten Mal in meinem Leben bis zum Gehtnichtmehr verliebte. Morgens um zwei fuhr mich Theo heim. In einem weissen Mustang mit roten Lederpolstern… Wer wäre da nicht geschmolzen… Das Auto seines Vaters halt…
Bescheiden, wie ich erzogen worden war, sagte ich, als wir auf der Hauptstrasse vom Burgernziel zum Sonnenhof fuhren: „Ich wohne hier gleich in der Nähe, du kannst mich bei der Telefonkabine absetzen.“ – Er hielt sogleich an und liess mich raus. Den Rest des Heimwegs ging ich zu Fuss. – Ich konnte es kaum fassen! Nie hätte ich gedacht, dass er mich um diese Nachtzeit und nach diesem einmaligen Abend nicht vor die Haustüre fährt. – Man muss halt nicht so dumm sein und Dinge sagen, die man eigentlich gar nicht so meint. Das war mir eine Lehre.
Am nächsten Tag, dem Sonntag, hatten wir abgemacht. Ich konnte es kaum erwarten! Wir trafen uns in der Stadt und er sagte: „Hallo Sibylle“. – Zum zweiten Mal innert Stunden blieb mir die Spucke weg. Wie es möglich war, dass er meinen Namen vergessen oder verwechselt hatte, war jenseits meines Vorstellungsvermögens.
Während der Woche war Theo in Zürich, am Wochenende nur konnten wir uns sehen. Manchmal nicht einmal dann, weil er im Militärdienst war oder übers Wochenende in Zürich blieb, um für eine Prüfung zu lernen.
Aber unsere Treffen hatten ihre Tücken. Normalerweise machten wir am Samstagnachmittag an der Front ab. Zwar wusste er inzwischen meinen Namen, Pünktlichkeit jedoch gehörte nicht zu seinen Tugenden. Es wurde zur Gewohnheit, dass er mich eine Stunde warten liess, oft waren es gar zwei. Klar, dass dann das Feuer im Dach war. Ich konnte es nicht begreifen, hatte doch schon die ganze Woche lang sehnlichst darauf gewartet, ihn wiederzusehen. – Der Grund, weshalb er nicht rechtzeitig kam, war, dass er als Erstes zu seinen Eltern nach Hause ging, bevor er mich traf. Und sein Vater war der absolute Spezialist im Aufträge-Erteilen: Hier musste ein Nagel eingeschlagen werden, dort ein neues Bild aufgehängt, irgendetwas musste dringend repariert werden und vor allem musste der Rasen noch gemäht werden. Alle diese „Wünsche“ konnte Theo seinem Vater nicht abschlagen, und so kam es dann zu diesen Verspätungen, für die ich wenig bis gar kein Verständnis aufbringen konnte. Handys hatte man damals ja noch keine und aus diesem Grund war es doppelt mühsam, nicht genau zu wissen, was los war, wie lange die Wartezeit noch dauern würde und so weiter. - Folglich hatten wir immer wieder mal Streit und Theo sagte in seiner gelassen Art: „Wenn wir uns streiten, geht noch mehr Zeit verloren. Lass uns doch das geniessen, was wir haben.“ – Nicht eben meine Philosophie. Aber was blieb mir übrig bei meinem Grad der Verliebtheit?
Alles ausser der Warterei gefiel mir nämlich an Theo: seine Art, sein Charme, sein gutes Aussehen, seine dunklen Haare, seine schlanken Hände, seine vollen Lippen, seine Figur… Für mich war er der absolute Traummann. Und auch meiner Mutter gefiel er. Welche Erleichterung! Sie hatte nicht einmal etwas dagegen, dass er hie und da bei mir übernachtete. Im selben Zimmer, im selben Bett natürlich.
Mit seinen Eltern war das ziemlich anders. Bei meinem ersten Besuch bei ihnen fühlte ich mich eher unwohl, kam mir ziemlich ausgestellt vor - wie unter einer Lupe. Nicht so sehr vom Vater observiert – der nannte mich Brigit (er sprach es so aus: „Brischit“) – der Einfachheit halber, wie er meinte, so brauche er sich keine neuen Namen zu merken – umso mehr aber von der Mutter, die mich mit unverhohlener Neugierde betrachtete. Sie hätte es lieber gesehen, wenn ich ein „Arzttöchterli“ gewesen wäre, liess mich Theo später wissen. Beide waren zwar freundlich, die Atmosphäre hingegen war steif und künstlich. Ich erhielt Tee und Kuchen serviert und wir sahen uns irgendwas im Fernsehen an. Offenbar waren die Gesprächsthemen bereits ausgegangen.
Zwei Jahre später, kurz vor unserer Hochzeit, hatten wir im Kirchenfeldquartier eine kleine Wohnung gemietet. Dass wir bereits vor der Vermählung dort wohnen wollten, brachte meine Schwiegermutter-in-spe völlig aus dem Konzept. Sie sagte: „Wenn ihr das tut, ist das ein weiterer Nagel an meinem Sarg!“ - „Hoppla“, dachte ich, „wer hat denn da vorgängig schon die anderen geliefert?“, sagte es aber nicht.
Sicher waren wir das gleich selber, denn unsere gemeinsamen Ferien in Venedig, noch „unverheirateterweise“, waren von Theos Eltern überhaupt nicht gebilligt worden, was uns aber wenig kümmerte.
Inzwischen hatte ich Autofahren gelernt. Kaum war ich achtzehn, erwarb ich den Lehrfahrausweis und übte von da an fleissig für die theoretische und praktische Prüfung. An den Wochenenden nahm sich meine Mutter Zeit, mit mir in der Gegend herumzukurven und auch Theo war mit von der Partie. Nur gerade vier Stunden hatte ich bei einem Fahrlehrer gebucht, dann meldete er mich für die Prüfung an. Lernen war ich ja gewohnt, so machte mir das Bogen-Ausfüllen keine grosse Mühe ebenso wenig wie das Kurzzeitgedächtnis-Vollstopfen.
An der praktischen Prüfung hatte ich grosses Glück, einen mir gewogenen Experten zu erwischen. Ich war es gewohnt, dass man mir sagte, ich solle geradeaus, dann links abbiegen oder rechts oder auch in ein bestimmtes Quartier fahren. Ich kannte die Stadt sehr gut. Das alles war also kein Problem. Der Experte aber sagte, ich solle in Richtung Basel einspuren. Da kam ich ins Schwitzen, denn ich war gar nicht gewohnt, auf die Ortsschilder zu achten. – Grosse Erleichterung, als ich das Schild „Basel“ sah. In der Hitze des Gefechts dachte ich wenigstens noch dran, den Blinker nach links zu betätigen und in den Rückspiegel zu schauen, aber die Sicherheitslinie, die ich grad im Begriff war zu überqueren, beachtete ich nicht. – Da griff mir der Experte ins Steuer und sagte, wenn ich über diese Linie gefahren wäre, hätte er mich durchfallen lassen müssen… Manchmal hat man eben Glück!
Hin und wieder verbrachte ich das Wochenende bei Theo in Zürich. Ich lernte seine WG-Partnerinnen und -Partner kennen und wir verbrachten jeweils eine gute Zeit miteinander. Nicht so harmonisch war’s allerdings, wenn’s darum ging, die Küche aufzuräumen. Das lag niemandem, mir auch nicht. Alles war überstellt mit Geschirr und Gläsern, die Salatschüssel, die wohl schon seit Tagen auf dem Tisch gestanden hatte, klebte auf dem Belag so fest, dass man sie mit Gewalt wegreissen musste. Trotzdem kamen wir schliesslich überein, dass Theo und ich den Abwasch und die andern das Kochen übernahmen. Dieses Konzept funktionierte nicht schlecht, denn ich hatte ja bisher überhaupt noch nicht gelernt zu kochen und genauso wenig konnte sich Theo mit dieser Kunst brüsten. Einer der Kollegen aber schon. Das Problem war nur, er war in Pakistan aufgewachsen und gewohnt, solch scharfe Gewürze fürs Curry zu verwenden, dass es mir schlicht unmöglich war, das Gericht zu essen. Ein Biss, mir liefen die Tränen runter und mein Mund brannte wie das Fegefeuer.
Schön und unbeschwert war sie trotzdem, die Zeit in Zürich.
TEIL 2: 1972 – 2013
Heirat
Ein knappes Jahr nach bestandener Matur heirateten wir am 26. Juli 1973; ich war zwanzig, Theo achtundzwanzig.
Die standesamtliche Trauung fand in Köniz statt, ziemlich unromantisch, in einem Büro der Gemeindeverwaltung oberhalb des Warenhauses ABM. Während der Standesbeamte sprach, sahen wir durchs Fenster, wie sich auf der gegenüberliegenden Strassenseite grad die Barrieren senkten, um den Zug passieren zu lassen. Theo empfand dies als ein schicksalhaftes Zeichen – das Ende seines Singledaseins, wie er etwas trocken bemerkte.
Unsere Trauzeugen waren meine Schwester Doris und mein Schwager Jany. Es war übrigens ihr zehnter Hochzeitstag. Eigentlich hatten wir vorgehabt, am 19. Juli zu heiraten, aber meine Schwester überzeugte uns, eine weitere Woche noch zu warten, damit wir später den Tag jeweils gemeinsam feiern könnten. Ihr Argument war, auf diese Weise wäre es möglich, uns gegenseitig ans Datum zu erinnern; irgendjemand von uns vieren würde sicher schon daran denken. – Es war halt noch nicht die Zeit, wo man im Smartphone eine Erinnerungsfunktion aktivieren konnte… Und wie gut taten wir daran zu verschieben, denn sechs Jahre später, am 19. Juli 1979, kam unser erstes Kind zur Welt. Da hätten wir unseren Hochzeitstag bis auf weiteres auf Eis legen können. Tatsächlich trafen wir uns an besagtem Datum wenn immer möglich und feierten den Jahrestag zusammen bei einem gemeinsamen Nachtessen.
Am nächsten Tag, dem 27. Juli 1973, fuhren wir nach Bivio im Graubünden, wo meine Schwiegereltern ein altes Familienhaus besassen (gebaut 1560). Theos Familie und wir übernachteten dort. Nun war der „erfreuliche“ Zeitpunkt gekommen, dass ich Theos Halbbruder und dessen Ehefrau (Halbschwägerin???) beim Vornamen nennen durfte. – Als ich die beiden zwei Jahre zuvor kennenlernte, bestanden sie darauf, Herr und Frau Torriani genannt zu werden – was ich fast nicht glauben konnte. Natürlich ist Theos Bruder sechs Jahre älter als er, aber trotzdem… Es war kein guter Anfang.
Meine Verwandten übernachteten im Hotel Post. Hotelzimmer für sie waren dort gebucht. Ein Bild werde ich nicht mehr vergessen - meine Schwiegermutter „at her best“:
Ich sehe sie, wie wenn’s gestern gewesen wär: Sie stand auf der Strasse und erwartete die Gäste. Als diese ankamen, winkte sie sie mit hastigen Bewegungen heran und nach kurzer Begrüssung teilte sie ihnen mit, sie hätte ihre Reservation geändert. Ein Zimmer ohne Dusche und Bad sei günstiger; sie könnten ja dann im Torriani-Haus duschen. - Erste Handlung meiner Schwester nach Ankunft im Hotel: Zurück zur ursprünglichen Buchung mit en-suite-Badezimmer.
Unser Heimatort war Soglio im Bergell, ein kleiner Ort nahe der italienischen Grenze mit einem wunderschönen Blick auf die Bündner Berge, oft abgebildet in Heimatkalendern. (Inzwischen hat eine Gemeindefusion stattgefunden, daher ist Bregaglia von Amtes wegen neuerdings unser Heimatort). Dort fand die kirchliche Trauung statt. Theo wollte es so und obwohl ich mit der Kirche nichts am Hut habe, war ich einverstanden. Er ist ebenso wenig religiös wie ich, aber irgendwie fand er, es gehöre dazu.
Wir waren eine kleine Hochzeitsgesellschaft, nur Theos Eltern, sein Halbbruder und dessen Ehefrau, und von meiner Seite Mutter, Schwester und Schwager. Bei der Fahrt über den Julier schneite es ein wenig, im Bergell war das Wetter wieder sommerlich und nach der Trauung gab’s im wunderschönen historischen Gartenrestaurant des Palazzo Salis ein Zvieri. – Ein weisses Kleid wollte ich auf keinen Fall anziehen, ein Schleier kam sowieso nicht in Frage. Ich trug ein gelbes, eng anliegendes Kleid mit Spaghettiträgern, das ich dann auch später noch bei anderer Gelegenheit würde tragen können, ein weisses Bolero dazu. Nicht ganz zur Freude meiner Schwiegermutter. Heute würde man sagen: „She was not amused“.
Zurück in Bivio fand das Abendessen im Hotel Post statt. Die Blumenarrangements hatte Theos Mutter aus Köniz mitgebraucht, aus ihrem Garten. – Die waren aber bereits zwei Tage alt, als sie unseren Tisch zierten. Das passte ihnen gar nicht und alle liessen ihre Köpfe hängen. Ein eher trauriger Anblick, aber natürlich sagte niemand etwas. Ein wenig seltsam war’s schon, denn sonst war meine Schwiegermutter nicht so „gitzknäpperisch“ unterwegs... Sie hatte es ja auch nicht nötig.
Natürlich hatten wir trotzdem einen einmaligen Abend; ich war überglücklich. Die halbverdorrten Blümchen konnten den nicht trüben.
Unsere Freunde waren nicht dabei. Wir hatten sie eine Woche vorher in Bern zu einer Gartenparty eingeladen. Ein Spanferkel wurde gebraten, der Wein floss, die Sonne schien - es war ein herrliches Fest. Bilder davon hatte Theos Vater in sein Album eingeklebt und dazu geschrieben: „Verlobung Theo“.
Unsere Hochzeitsreise dauerte vier Wochen lang. Sie führte uns durch Rumänien und Bulgarien nach Istanbul und anschliessend nach Griechenland. Wir hatten auf der Halbinsel Chalkidiki mit einem befreundeten Ehepaar eine Ferienwohnung gemietet. An besagtem Datum kamen wir dort an, wussten aber nicht ganz genau, wo das Haus sich wirklich befand; es gab nämlich nur eine ungenau Skizze, die wir zur Verfügung hatten. Unsere Freunde hatten den Schlüssel und hätten bereits dort sein sollen, um uns zu empfangen. Das waren sie aber nicht. - In der Nähe, wo wir unsere Unterkunft vermuteten, gab’s ein Haus direkt am Meer und der Besitzer war daheim. Ihn sprachen wir an, aber er verstand nur Griechisch und wir kein einziges Wort, so versuchten wir mit Händen und Füssen zu erklären, was unser Problem war. Lösen konnte er es nicht, aber er war unglaublich freundlich, lud uns zum Abendessen ein. Er hatte grad frischen Oktopus gefangen – das erste Mal in unserem Leben, dass wir so etwas serviert bekamen. Ich war skeptisch und hielt mich nur ans Brot, Theo aber fand die neue Erfahrung bereichernd (es dauerte noch ein paar Jahre, bis auch ich an Meeresfrüchten Gefallen fand). Anschliessend durften wir sogar bei ihm übernachten.
Tags darauf kamen unsere Freude an. Die grosse Verspätung war darauf zurückzuführen, dass sie in Rumänien in einem Hotel übernachtet und dort ihre Pässe vergessen hatten. Als sie dies an der nächsten Grenze bemerkten, Hunderte von Kilometern später, mussten sie den ganzen Weg zurückfahren, um die Dokumente zu holen. – Ohne Smartphone gab es damals halt keine Möglichkeit, uns dies wissen zu lassen.
Aber nun war ja alles im Grünen und wir konnten in das Häuschen, das sich tatsächlich ganz in der Nähe befand, wo wir bei dem netten Herrn übernachtet hatten, einziehen.
Eine tolle Unterkunft sieht anders aus; wir hatten uns von der Beschreibung und vom Preis her schon eine etwas komfortablere Bleibe erhoffe, vielleicht sogar mit Strom, aber es war warm und wir gewöhnten uns rasch an die spartanischen Verhältnisse, an die provisorisch montierte Dusche draussen vor der Hausmauer, die nur einen spärlichen Wasserstrahl spendete, und an die harten Matratzen - ans konstante Rattern und an den Gestank des Generators hingegen nicht so sehr.
Unterwegs waren wir mit unserem geliebten weissen VW-Käfer. Wie es uns gelang, all unser Gepäck dort drin zu verstauen, kann ich mir heute kaum mehr vorstellen. Wir hatten nämlich zusätzlich ein Gummiboot mit dabei und einen recht grossen Aussenbordmotor. Mit diesem Boot machten wir einen Ausflug, den ich nie vergessen werde – ein Albtraum!
Wir fuhren ans nahe gelegene Ufer und unser Ziel war es, von dort aus in eine andere Bucht zu gelangen. Bis das Boot startklar war, der Motor montiert und einsatzbereit, dauerte es. Auch war ich nicht ganz sicher, ob das Boot nicht etwa ein Leck hatte, war es doch schon seit langer Zeit nicht mehr benutzt worden. – Nun, wir fuhren los. Unterwegs begann plötzlich der Motor zu stottern und wir verloren an Fahrt. Auch war ich nun sicher, dass tatsächlich Luft am Entweichen war. – Das Boot glitt nur noch ganz langsam dahin und urplötzlich waren wir umgeben von Scharen von tellergrossen dunklen Quallen. Es war entsetzlich. Ich hatte Panik und sah uns schon steckenbleiben inmitten der schwammigen Körper, die uns vertilgen würden.
Wie genau, weiss ich nicht mehr, aber irgendwie gelang es schliesslich mit den Paddeln, zum Ufer zurückzukehren und unversehrt zum Auto zurückzufinden. Boot und Motor wurden wieder im Kofferraum verstaut und kein zweites Mal mehr verwendet. Von solchen Ausflügen hatte ich restlos genug.
Ein paar Tage später fuhren wir weiter südwärts, besuchten erst Delphi und anschliessend Athen – die Akropolis natürlich, auf der man damals nach Herzenslust noch herumklettern konnte, bevor wir schliesslich die Heimreise antreten mussten.
Eine tolle Reise war das mit einzigartigen und unvergesslichen Erlebnissen. Nebst ein paar hübschen Erinnerungsstücken und natürlich zahlreichen Fotos hatte ich nur ein unschönes, kleines Souvenir mit nach Hause gebracht: ein paar Wanzen im Koffer als blinde Passagiere von unserer letzten Unterkunft in Osteuropa.
Die ersten paar Ehejahre
Theo hatte sein Elektroingenieur-Studium an der ETH abgeschlossen und hatte einen etwas seltsamen Job gefunden in der psychiatrischen Klinik Waldau bei einem Professor Pileri. Es handelte sich um ein Forschungs-Projekt des Nationalfonds zur Erforschung der Kommunikationsart und –weise bei Flussdelphinen. Diese sind blind und verständigen sich mit Ultraschall.
Die Tiere, sie stammten aus dem Indus, wurden in einem Becken gehalten und man versuchte, die Töne, die sie abgaben, aufzuzeichnen, um daraus Schlüsse zu ziehen. Theos Aufgabe war es, die technische Seite der Angelegenheit zu installieren und zu überwachen. Da eine solche Stelle aber nicht wirklich existierte, wurde er zu einem Sekretärinnen-Lohn angestellt, was uns in keiner Weise grosse Sprünge machen liess. 1‘500 Franken war sein Monatsgehalt; ich verdiente nichts, da ich gerade das Sekundarlehramt begonnen hatte, meine Ausbildung zur Sekundarlehrerin an der Uni Bern.
Zwischendurch allerdings konnte ich eine Stellvertretung übernehmen und dann doch ein paar Batzen damit verdienen. An die allererste erinnere ich mich gut. In Hinterfultigen vertrat ich einen Lehrer, der in den Militärdienst musste. Die Aufgabe war nicht leicht; die Klasse bestand aus ungefähr zwanzig Schülern mit verschiedenen Jahrgängen. So musste ich die Stunden jeweils drei- oder gar vierfach vorbereiten. Zwei Gruppen wurden beschäftigt, die eine hatte den Auftrag, etwas zu lesen, die andere, Aufgaben zu lösen, der Rest der Klasse musste zuhören, was ich ihnen Interessantes zu erzählen hatte... Das war ein Sprung ins kalte Wasser, aber mir gefiel es sehr, endlich praktisch arbeiten zu können.
Auch hatte ich mich im Zivilschutz angemeldet. Theo fand, ich solle dort mitmachen, denn falls irgendetwas geschehe und man einen Schutzraum beziehen müsse, hätte ich einen sicheren Platz und wäre informiert über alle Geschehnisse. Es war damals halt noch die Zeit des kalten Krieges. – Seine Argumentation leuchtete mir ein und ich meldete mich an. Es dauerte allerdings fast ein Jahr, bis ich aufgeboten wurde, was Theo dazu veranlasste, die Verantwortlichen dort zu rügen. Wenn sich eine Frau schon freiwillig melde… Nun, der Nachrichtendienst war mein Ressort. Ich besuchte verschiedene Kurse, wurde zum „Dienstchef“ ernannt und in einem Stab in Bern eingeteilt. Ich gab dann selber Kurse, bildete Kartenführer aus und mit meinen Kollegen im Stab erlebte ich viel Interessantes und auch Lustiges. Eine Episode, an die ich mich gerne erinnere, war zum Brüllen komisch. Man übte einmal mehr den Ernstfall und der eine oder andere wirkte eher gestresst:
Es ging darum, per Funk einen Namen durchzugeben. Ich hörte zu, was ein Kartenführer dem anderen mitteilen wollte:
- „Er heisst Borgert. - B wie Beat, O wie Orange, R wie Roland, G wie Schorsch …“
- „G wie was?“
- „Schorsch. - S wie Susi, C wie Claudio, H wie Housi, …“
- „Was? - I chume nüm nache!”
Einen Kartenführerkurs musste ich im Wallis geben, in Sitten. Die Walliser sind ein Völklein für sich, wie man ja weiss. Dass dies nicht nur ein Vorurteil ist, erfuhr ich rasch. Nicht extrem motiviert für den Stoff, den ich ihnen beizubringen hatte, waren die jungen Männer zwar ausnehmend freundlich und immer zu einem Spass aufgelegt, aber viel Konkretes kam bei der „Arbeit“ nicht heraus. Sie wollten mich jeweils lieber zu einem „Glesli Wysse“ einladen, als am Pult zu sitzen und zuzuhören. Und das schon am Morgen… Es war eine spezielle Woche; wir haben viel gelacht und wenig gelernt.
Später, als wir nach Ittigen umzogen, wurde ich in die Zivilschutzkommission der Gemeinde gewählt. Zwölf Jahre lang war ich Mitglied in diesem Gremium.
Unsere erste gemeinsame Wohnung
Wir wohnten im Kirchenfeldquartier in einer bescheidenen kleinen Zweizimmer-Altwohnung mit Wohnküche. Diese war aber in null Komma nichts so sehr überstellt mit Theos Laborgeräten, dass weder wohnen noch essen mehr möglich war. Kochen schon, aber das musste ich erst erlernen, denn bisher hatte ich mich erfolgreich vor dieser Arbeit drücken können. Auch Theo war nicht der geborene Koch. Büchsen öffnen konnte er zwar, und das nannte er „kochen“. – Kulinarische Höhenflüge gab es also nicht in diesen ersten Jahren unserer Ehe. Die Ravioli aus der Büchse, die, wenn sie aus dem Blech befreit waren und in die Pfanne „pflutschten“, noch immer eng zusammenhielten, kamen oft auf den Teller, aber als Leckerbissen konnte man sie nicht bezeichnen. Nicht einmal, wenn man sie „verfeinerte“, wie Theo das nannte. Das bisschen Rahm, das sich zu den verkochten Teigtaschen gesellte, vermochte keine Wunder zu bewirken. - Später erfuhr man ja mal aus einem Warentest, was tatsächlich alles für Fleisch in den Büchsenravioli steckt(e) beziehungsweise fehlt(e).
Zum Glück lernte ich allmählich doch, das eine oder andere Gericht zuzubereiten. Apfelkuchen backen war das erste.
Viel Geld zum Einrichten hatten wir nicht. Die Wohnwand in unserer Stube bestand aus Bierharassen, die wir mit dunkelbrauner Beize angestrichen hatten. Ein Teil dieser Kisten existiert übrigens immer noch: als Puppenstube für unsere Grosskinder.
Wir hatten auch eine „Polstergruppe“. Die bestand aus einem alten Bettgestell, auf dem grosse Kissen drapiert waren, die ich selber aus grobem grauem Tuch genäht und mit Schaumstoff gefüllt hatte. Den „Salontisch“ hatte Theo gefertigt: Eine etwa ein Meter lange Spanplatte mit braunem Plastikdeckblatt, an die vier schwarze Metallbeine angeschraubt waren. Nicht eben eine Augenweide, aber auf jeden Fall zweckmässig. – Um das Bild abzurunden: Was in jedem „Bünzlihaushalt“ damals nicht fehlen durfte, war ein Gummibaum. Diesen hatten wir von den beiden Damen, die unter uns wohnten, zur Hochzeit geschenkt erhalten.
Apropos Hochzeitsgeschenk: Von Theos Vater hatten wir eine Miele Abwaschmaschine erhalten, und die war ein Segen. Die mühsame Sisyphusarbeit des Abwaschens übernahm von da an unsere „Marie“.
Theo war oft im Militärdienst und daher wochenlang weg. Am Wochenende heimzukommen war nur selten möglich, fand der Dienst doch in den Bündner Südtälern statt, eine Zugreise von manchmal mehr als sieben Stunden. War er dann endlich daheim, wollte er nichts anderes als schlafen. Und schon ging’s wieder zurück nach St. Moritz oder wohin auch immer.
Als er zum ersten Mal, seit wir verheiratet waren, weg war, liess er mir 20 Franken Haushaltsgeld zurück. Auch damals langte das nicht eben weit, ich musste meine Mutter anpumpen, um zu „überleben“. – Als er das nächste Mal einrücken musste, liess er mir eine Hunderternote zurück. Ich konnte es kaum fassen. Fünfmal so viel! – Es dauerte keine zwei Tage, da besuchte mich ein Freund von uns und bat mich um die hundert Franken, die er Theo kürzlich geliehen habe...
Studium und Fremdsprachenaufenthalte
Die Fächer an der Uni, die ich belegte, waren Deutsch, Englisch, Geschichte und Französisch.
Französisch war obligatorisch, aber da ich nie wirklich viel gelernt hatte, verpatzte ich die erste Prüfung völlig. Zwar hatte ich bereits einen Welschlandaufenthalt von sechs Wochen in Lausanne hinter mir, wo ich zusammen mit einer Freundin einen Job bei der PTT gefunden hatte. Wir mussten Geld zählen, das aus den Telefonkabinen ins Büro gebracht wurde. Darunter fanden sich auch ausländische Münzen und etwas noch viel Raffinierteres: Ein paar ganz Schlaue hatten ein Loch in ihre Einfränkler gebohrt und einen Faden daran befestigt. Somit gelang es ihnen wohl, immer wieder neu den nötigen Impuls einzugeben, mit dem es möglich war, für längere Zeit zu telefonieren. Nur herausziehen funktionierte offenbar nicht, so dass wir wieder und wieder solche Kuckuckseier in den Geldkassetten fanden. Leider aber verhalf mir dieser Stage doch nicht, mein Französisch genügend aufzupolieren, um die Prüfung zu bestehen. – Ich musste mir also etwas einfallen lassen, das ungeliebte Fach zu vermeiden. Ich hatte gehört, dass man die Ausbildung zum Sekundarlehrer auch im Kanton Solothurn absolvieren konnte. Nur wenige Änderungen gab’s in den Bedingungen. Man musste drei Hauptfächer belegen, anstatt wie in Bern zwei Haupt- und zwei Nebenfächer. Das war’s! Kein Französisch mehr! Und da es in Solothurn bekanntlich keine Uni gibt, konnte ich belieben, wo ich war und in Bern weiterstudieren. Auch bei den Auslandsaufenthalten galten andere Regeln. Sie dauerten länger, nämlich ein halbes Jahr, aber man konnte sie in zwei Raten aufteilen, also in zweimal drei Monate, was ich dann auch tat.
Zwei Monate verbrachte ich in Cambridge, wo ich eine Schule besuchte. Am Ende meines Aufenthaltes holte mich Theo dort ab und wir reisten mit unserm VW-Käfer durch Schottland und schliesslich nach Wales, wo Theo Verwandte hatte, die in einem wunderschönen Cottage wohnten, abgelegen, „am Ende der Welt“. Vier Wochen später traten wir die Heimreise an, auf dem Rücksitz des VW ein antikes Davenport-Schreibpult, das noch heute in unserem Esszimmer steht, und noch sonst ein paar hübsche Einkäufe, unter anderem eine Gesamtausgabe von Shakespeares Werken in einer reich verzierten Holzkassette. Die einzelnen Bände sehr klein, mit dunkelrotem Ledereinband, Goldschnittverzierungen und einem feinen, ebenfalls goldenen Bändel als Lesezeichen. – Die Schrift heute selbst mit Lesebrille unmöglich mehr zu entziffern.
Den zweiten Teil meines „Zwangs“-Urlaubs wollte ich nicht mehr in England absolvieren, so beschloss ich, eine dreimonatige Reise durch die USA zu unternehmen. Meine Mutter kam mit und wir verbrachten eine Woche zusammen in New York. Sie flog anschliessend wieder heim und ich setzte meine Reise alleine fort mit einem Rucksack und zwei Greyhound-Tickets im Gepäck, die ich vorab in der Schweiz gekauft hatte.
So ging die Fahrt erst Richtung Florida, dann weiter durch die Südstaaten, New Orleans, San Antonio bis San Diego, Kalifornien, weiter nach San Francisco, Las Vegas, Salt Lake City und durch die Rocky Mountains via Denver, Chicago, Niagara Falls, Toronto zurück nach New York.
An den meisten dieser Orte konnte ich anklopfen beziehungsweise ein paar Tage zu Besuch bleiben.
Wie ich zu diesen Adressen gekommen war, ist eine interessante Geschichte. Meine Mutter erzählte sie uns oft:
Irgendwann in den späten Vierzigerjahren kam mein Vater an einem Sommerabend nach der Arbeit heim, im Schlepptau zwei junge Tramperinnen mit grossen Rucksäcken. Die eine, Douglas, war Kanadierin, die andere, Eleanor, Amerikanerin aus Baton Rouge. Er hatte sie dabei „ertappt“, wie sie irgendwo in der Nachbarschaft hatten in einen Garten eindringen wollen, um dort ihr Schlaflager aufzuschlagen. Er hatte ihnen angeboten, bei uns zu Hause zu übernachten, wo sie zumindest ein Dach über dem Kopf hätten, und sie hatten dankend angenommen. Meine Mutter kochte ihnen ein Nachtessen. Diese grosszügige Geste hatte langwierige Auswirkungen. Meine Eltern blieben zeitlebens mit den Tramperinnen in Verbindung.
Als meine Mutter (sie war damals ungefähr sechzig) ihre erste Amerikareise unternahm, durfte sie bei beiden je eine Zeit lang wohnen und nicht nur das: Man „reichte sie weiter“. Die beiden Freundinnen hatten inzwischen geheiratet, hatten Familie und Freunde an den verschiedensten Orten in den Staaten und Mam durfte viele von ihnen besuchen gehen. So brauchte sie nicht ein einziges Mal in einem Hotel zu übernachten. Douglas Ehemann David zum Beispiel hatte einen Geschäftspartner, der in San Francisco lebte, Lee Langan, und auch dort durfte sie „andocken“, so wie ich nun auch. - Davon aber ein wenig später.
Auch im Bus geschah es manchmal, dass ich jemanden kennenlernte und nicht selten wurde ich sogar zum Übernachten eingeladen. – Es war eine absolut einmalige Reise. Unterwegs war ich meistens allein, legte Tausende von Kilometern im Greyhound zurück, genoss das Abenteuer in vollen Zügen. Ein absoluter Höhepunkt war die Woche in Arizona und New Mexico, wo ich in Albuquerque ein Auto mietete und von Canyon zu Canyon reiste. Natürlich leistete ich mir einen „Ami-Schlitten“, ein ziemlich altes Modell zwar, günstig, aber genau richtig fürs „Grosse-weite-Welt-Amerika-Erlebnis“, so wie ich mir das vorgestellt hatte. Die Schönheit der Gegend ist unvergesslich, die Weite, die Einsamkeit. Touristen hatte es fast keine in diesem Frühjahr 1976; im atemberaubenden Monument Valley war ich ganz allein unterwegs. Im Visitor-Center des Grand Canyon hingegen nicht. Ich bestellte etwas zu essen und ein Glas Weisswein, erhielt einen Becher und ein Röhrli. - Es waren noch andere Zeiten damals...
Meine Fahrt führte auch durch ein Indianer-Reservat. Vor dem Polizeiposten stellte ich mein Auto hin und genau dort passierte es mir dummerweise, dass ich die Türe abschloss, aber den Schlüssel in der Zündung stecken liess. Der big Chief konnte mir helfen. Mit einem Kleiderbügel aus Draht gelang es ihm, durchs leicht geöffnete Fenster den Schliessmechanismus zu erreichen und die Tür zu öffnen. – Noch mal Glück gehabt.
Sehr beeindruckt hatten mich ebenfalls die höhlenartigen ehemaligen Indianer-Behausungen in Mesa Verde und im Walnut Canyon sowie das riesige Loch des Meteor Carter und die versteinerten Baumstämme im Painted Desert Nationalpark. Hunderte von Kilometern legte ich in dieser Woche zurück. Jeden Morgen startete ich um sieben Uhr und suchte erst gegen Abend wieder eine Übernachtungsmöglichkeit.
In San Antonio lernte ich eine Nichte von Eleanor kennen. Sie musste für ein paar Tage weg, liess mich aber in ihrer bescheidenen kleinen Wohnung übernachten. Ich blieb nur eine einzige Nacht, denn diese ist mir unvergesslich. Kaum hatte ich die Lichter gelöscht und war eingeschlafen, hörte ich ein seltsames Rascheln. Es wurde immer lauter und ich begann mich zu fürchten. Als ich das Licht anzündete, sah ich, was der Grund für dieses eigenartige Surren war: Der ganze Fussboden war über und über voll von schwarzen, ziemlich grossen Cockroaches, genauso wie im Film „Indiana-Johnes“. Die Viecher eilten wild durcheinander, ziellos wie es schien, es war entsetzlich. Natürlich schrie ich wie am Spiess und stellte mich in der äussersten Ecke des Bettes auf die Matratze. Niemand hörte mich, aber die ekligen Viecher waren wohl noch schreckhafter als ich, scheuten das Licht und verzogen sich überstürzt und in Scharen zurück in die Küche und dort wohl in die Abläufe, aus denen sie gekommen waren. An Schlaf war natürlich nicht mehr zu denken, aber irgendwie überstand ich diese Horror-Nacht trotzdem. Jedenfalls verliess ich am nächsten Morgen sehr früh die Unterkunft fluchtartig.
Auch eine Nacht im Josemite-Park ist mir im Gedächtnis geblieben: Ich hatte einen Zweitagesausflug im Park gebucht mit einer Übernachtung in einem Zelt. Das kostete viel weniger als ein Hotelzimmer. Aber ich bereute meinen Entscheid bald, denn die Nacht war extrem kalt, ich hatte zu wenig warme Kleider bei mir und fror jämmerlich.
Zuvor allerdings führte mich meine Reise nach Los Angeles, wo ich ein paar Tage bei einem Schweizer Ehepaar verbringen durfte, die vor längerer Zeit bereits dorthin ausgewandert waren. Mit Rahmschnitzel und Nüdeli und anderen Köstlichkeiten verwöhnten sie mich – es war grandios.
Fantastisch war’s ebenfalls in San Francisco bei Karen und Lee Langen, wo ja auch meine Mutter wenige Jahre zuvor zu Gast gewesen war. Ich blieb eine ganze Woche.
Mit ihnen und ihrer Familie (sie haben zusammen sieben Kinder – fünf aus ihren ersten Ehen, zwei gemeinsame) sind wir noch immer eng befreundet, und das nun seit sechsundvierzig Jahren. – So viel zur oft gehörten und viel zitierten Aussage, die Amerikaner seien oberflächlich, was mich immer ärgert, wenn ich es höre.
Zwei unserer Kinder verbrachten je ein Jahr in ihrer Familie, gingen dort zur Schule und erlernten die Sprache. Susan, die jüngste Tochter, ist noch immer wie eine Schwester für die beiden. Vor zwei Jahren waren sie an der Hochzeit unseres Sohnes eingeladen und verbrachten anschliessend eine Woche bei uns. Auch wir haben sie schon mehrmals besucht in ihrem wunderschönen viktorianischen Haus an der California-Street, das auf Kalendern und Postkarten zu sehen ist.
Eine lustige Episode kommt mir in den Sinn: In der Schule, die unser Sohn dort besuchte, war eines der Fächer auch Französisch. Diego war der Beste in der Klasse, denn Französisch hatte er ja schon daheim während ein paar Jahren gelernt und sprach natürlich ohne amerikanischen Akzent.
Französische Filme sind eher eine Rarität in amerikanischen Kinos und als seine Lehrerin dann doch im Kinoprogramm einen entdeckte, wollte sie der Klasse ein authentisches Erlebnis bescheren, was ihr dann auch bestens gelang. Ohne sich vorher anzusehen, wovon der Film handelte, ging sie mit der Klasse hin. – Es war ein Pornofilm...
Zurück zum Jahr 1976: Einen schlechten Tag hatte ich, an den erinnere ich mich gut: Um halb fünf morgens läutete der Telefonapparat auf meinem Nachttisch. Ich schreckte aus dem Schlaf auf, nahm den Hörer ab. Es war Theo. – Was für eine Freude! Aber wir konnten uns kaum begrüssen, schon fiel mir der Apparat zu Boden und die Leitung war tot. Ich hatte ihn in der Aufregung unglücklicherweise und natürlich ungewollt an der kurzen Schnur zu Boden gerissen. – Jetzt wusste ich nicht, was mir Theo hatte sagen wollen. Ich hoffte, er würde nochmals anrufen, das tat er aber nicht. So war ich sicher, dass sich etwas Schlimmes ereignet haben musste, denn sonst hätte er ja nicht zu dieser Unzeit zu telefonieren brauchen. Den ganzen Tag lang machte ich mir Sorgen und hatte ein ungutes Gefühl. – Erst am Abend hatten wir erneut Kontakt und es stellte sich heraus, dass er schlicht und einfach nicht daran gedacht hatte, wie viel Uhr es bei uns gerade war. So oder so wollte er nur hallo sagen. – Typisch Theo. – Skype gab’s halt noch nicht, Smartphones ebenso wenig und ein Anruf war teuer. Deshalb hatten wir nur selten Kontakt. Briefe schreiben war das einfachste Kommunikationsmittel, aber auch das langsamste, und was man in einem Brief an Neuigkeiten erfuhr, war bereits Schnee von gestern.
Natürlich hätte ich den einmaligen Aufenthalt bei der Familie Langan noch lange ausgehalten, aber ich hatte ja einen Plan, wollte weiterfahren. So fragte ich Lee, ob er mir einen Tipp geben könne, in welchem Hotel in Las Vegas ich übernachten könne, das mein Budget nicht über den Haufen werfen würde. Sein Rat war, gar kein Hotel zu suchen, es laufe dort so viel auch während der Nacht, da sei es schade, Geld dafür auszugeben. Er hatte absolut recht. Kaum angekommen, wurde man bereits mit Gutscheinbüchlein beglückt, hier ein paar Chips für fürs Casino, da vergünstigte Tickets für eine Show, hier ein Gutschein für ein Getränk oder ein Geschenk, da ein paar Quarters für die Slotmachines, die ja bereits im Busbahnhof auf Spielfreudige warteten. Es war tatsächlich kein Kunststück, sich eine Nacht um die Ohren zu schlagen. Bei einem einarmigen Banditen hatte ich sogar Glück. Der Apparat wollte nicht mehr aufhören zu klingeln und spuckte eine ansehnliche Menge an Münzen aus, so dass ich mir zwei der Shows ansehen konnte, die mich beide begeisterten. Gegen Morgen bestieg ich anschliessend den Bus und hatte sogar noch etwas von der „Kohle“ übrig.
Auf der Weiterfahrt durch die Rockys konnte ich den verpassten Schlaf im Greyhound nachholen, die Gegend sah sowieso stunden– und tagelang fast gleich oder zumindest ähnlich aus. In St. Louis, bei der Familie eines Geschäftspartners von Lee, durfte ich einen weiteren Zwischenhalt einlegen, ebenfalls in Chicago. In Toronto besuchte ich Douglas, eine der beiden Tramperinnen, denen mein Vater knapp dreissig Jahre zuvor Obdach gewährt hatte.
Eine lustige Erinnerung habe ich an Douglas. Sie hat meiner Mutter immer zu Weihnachten einen Christmaspudding geschickt, also dieses schwere, ultra-süsse und vor Zucker triefende Weihnachtsgebäck mit kandierten Früchten. Das Porto dafür kostete wohl etwa doppelt so viel wie der Inhalt. Als dies zum ersten Mal geschah, bedankte sich Mam natürlich herzlich und schrieb, wie gern sie das Gebäck habe und wie sehr sie sich darüber freue. – So erhielt sie dieselbe Bescherung Jahr für Jahr. Niemand mochte den Kuchen, sie selber inzwischen auch nicht mehr. Aber wie stellt man sowas ab? – Das geht gar nicht. Es ist ein Dilemma. Ich habe daraus gelernt, mich vorsichtig auszudrücken, und versuche, wenn ich etwas erhalte, was ich nicht unbedingt mag, wie zum Beispiel Pralinen mit weiss ich was für Früchten und Marzipan drin, den Dank so zu formulieren, dass zwischen den Zeilen klar wird, dass eine Wiederholung der Bescherung nicht unbedingt mein grösster Wunsch ist. - Nicht ganz einfach. Die Pralinen kann ich meinem Mann zwar weitergeben, der mag alle diese „Leckerbissen“, aber bei Mams Kuchen war’s schwieriger. Es wurde jeweils Frühling und das Backwerk allmählich trocken, bis sie es verzehrt (hier passt das Wort mal) hatte, denn wegwerfen hätte sie es nie und nimmer gekonnt; Esswaren darf man nicht vergeuden! – Ich erinnere mich in dem Zusammenhang an eine Episode, als ich noch ein Kind war:
Ich hatte in der Küche gespielt und verschiedene Esswaren zusammengerührt: Senf, Mehl, Milch, Konfitüre, Orangensaft, ein Ei - was ich grad so finden konnte im Kühlschrank, auch ein paar Gewürze zum Abschmecken. Das wollte ich meinen Stoffbären füttern. Mam schimpfte zwar nicht mit mir, aber sie begann, den fürchterlichen Mix zu essen, was mich selber erschütterte. - Nie mehr habe ich Bärenfutter hergestellt.
Ähnlich wie mit dem Kuchen ging’s ihr übrigens mit Cognac. Wir hatten während Jahren geglaubt, sie liebe diesen Weinbrand und so erhielt sie hin und wieder eine Flasche von uns geschenkt, bis sie sich dann doch mal ein Herz nahm und uns mitteilte, Gin wäre gut, aber Cognac möge sie eigentlich nicht...
Mein letzter Aufenthalt vor der Heimreise war in Poughkeepsie, in der Nähe von New York, wo Freunde von uns aus Bern während ein paar Jahren wohnten. Die Busstationen sind ja immer praktischerweise „downtown“, also direkt im Herzen eines Ortes angesiedelt. Ich erkundigte mich, wie ich zur angegebene Adresse komme, und man sagte mir: „It’s just accross the bridge“. Eine typisch amerikanische Antwort. Hätte ich sie nicht vorher schon mal gehört, hätte ich gedacht, ich könne mich zu Fuss dorthin begeben. Aber ich rief an und wurde abgeholt. Die Fahrt dauerte eine gute halbe Stunde.
Nach ein paar Tagen schliesslich war meine dreimonatige Reise Mitte Juni zu Ende. Im Jumbojet von NYC nach Zürich hatte ich Glück: Zufälligerweise kannte ich den Stuart, er war ein Bekannter aus dem Marzili. Er verschaffte mir ein Upgrade in der Business-Klasse, ich durfte einen Besuch im Cockpit machen und wurde wunderbar verwöhnt. So endete die Reise mit einem weiteren unvergesslichen Highlight.
Ohne Kreditkarten war ich unterwegs gewesen, ohne Laptop, Smartphone und E-Book, die vier wichtigsten Dinge in meinem Gepäck, wenn ich heute auf Reisen gehe.
Der Sommer 76 war ausnehmend schön und warm. Wir wohnten mehr im Marzili als zu Hause. – Was für ein herrliches Jahr!
Neue Wohnung – berufliche Veränderungen
Theo hatte nach etwa zwei Jahren einen neuen Job gefunden, und zwar bei der Telecom PTT. Das Forschungsprojekt mit den Delphinen war im Sande verlaufen, die armen Tiere in den engen Becken inzwischen verendet.
Nun konnten wir uns eine teurere Wohnung leisten. Diese fanden wir ganz in der Nähe, wo ich aufgewachsen war, nicht weit weg vom Sonnenhofschulhaus.
Mein Studium hatte ich abgeschlossen und verdiente nun auch endlich jeden Monat Geld. Am Untergymnasium Eisengasse in Bolligen übernahm ich für einen Kollegen, der einen einjährigen Urlaub hatte, eine Stellvertretung. Geschichte und Deutsch waren die Fächer, die ich unterrichtete. Ausnahmslos nett und freundlich waren die Schülerinnen und Schüler zu jener Zeit. Diese Anstellung machte mir grossen Spass.
Kaum war das Jahr vorbei, erhielt ich gleich zwei Angebote für Englischunterricht an zwei verschiedenen Berufsschulen in Bern, an der BMS (Berufsmaturitätsschule der GIBB) und an der bsd. (Berufsschule für den Detailhandel). Es handelte sich jeweils nur um kleine Pensen, so nahm ich beide Angebote mit Freude an. Ich hatte nur ein kurzes Gespräch mit dem jeweiligen Rektor, weder musste ich ein Zeugnis zeigen, eine Probelektion ablegen, noch ein Bewerbungsschrieben einreichen; das ging damals ohne grosses Trara - man sagte mir einfach, was ich zu tun hatte, wann und wo mit welchen Klassen der Unterricht stattfand und so begann, was in der bsd. bis ins Jahr 2010 dauerte und in der BMS bis zur vorzeitigen Pensionierung im Juli 2013.
Erst nachdem ich bereits während zehn Jahren unterrichtet hatte, wollten beide Schulen von mir einen Nachweis haben, dass ich tatsächlich ein gültiges Lehrerpatent hatte. – Meine Zeugnisse zu finden, war gar nicht so einfach; ich kam ziemlich ins Schwitzen, denn ich erinnerte mich nicht, wo ich sie aufbewahrt hatte. In einer Schuhschachtel zwischen Rezepten fand ich sie schliesslich.
Kinder
Am 19. Juli 1979 kam unsere Tochter Kay Isabella zur Welt. Sie war natürlich das schönste, liebste und bravste Kind, das man sich vorstellen kann. Sie schlief rasch durch, das grösste Geschenk für junge Eltern. - Mit genügend Schlaf gibt’s auch keinen Stress.
Wunderbar war, dass meine Mutter, die natürlich auch in die Kleine vernarrt war, gerne und oft zum Hüten kam, so dass ich ohne Unterbruch nach den Sommerferien gleich wieder unterrichten konnte. Damals gab’s so etwas wie Mutterschaftsurlaub noch nicht, in der Schweiz war das Wort noch nicht einmal erfunden worden. Aber das kümmerte mich nicht. Ich hatte ja den perfekten Beruf gewählt. Nur etwa sechs, später zehn und noch später zwölf Stunden pro Woche ging ich arbeiten, und das machte mir Spass, weil’s eine willkommene Abwechslung war.
Aber trotzdem - das Leben ändert rasch, wenn man nicht mehr nur zu zweit ist.
Und erst recht, wenn man plötzlich zu fünft ist. Am Tag nach Kays zweitem Geburtstag, am 20. Juli 1981, kamen unsere Zwillinge zur Welt, Kim Alessandra und Diego Giancarlo. Kim war 700 Gramm schwerer als Diego, wog 3210 g und der Kleine, dem seine Zwillingsschwester alles „weggefressen“ hatte, wie sich mein Arzt ausdrückte, brachte doch immerhin noch zweieinhalb Kilo auf die Waage.
Bis zum siebten Monat hatte ich nicht gewusst, dass wir zwei Kinder im Doppelpack erhalten würden, denn die Ultraschallgeräte waren zu der Zeit offenbar bereits amortisiert. Mein Arzt hielt es nicht für nötig, meinen Bauch auf Zwillinge hin zu untersuchen, obwohl ich selber das Gefühl hatte, bei dieser Schwangerschaft rasch mehr Gewicht zugelegt zu haben. Das sei normal so, fand er. Aber dann, doch argwöhnisch geworden, holte er ein zweites Herzfrequenzgerät hervor und oh je, ich hatte fast einen Schock, hörte ich laut und deutlich zwei verschiedene Herzschläge.
Bis dahin hatten wir zu Hause gespottet und uns vorgestellt, wie mühsam es wäre, wenn wir Zwillinge bekämen. Wir würden ein grösseres Auto kaufen, einen Doppelkinderwagen, zwei Tragtaschen besorgen, ja wohl sogar umziehen müssen. - Und nun war genau das Realität geworden...
Unsere Wohnung war zu klein, das heisst, die Grösse wäre nicht das Problem gewesen, aber wir hatten nur zwei abschliessbare Zimmer, was mit drei Kindern nicht besonders praktisch ist. – Durch Zufall fanden wir aber ganz in der Nähe ein Reiheneinfamilienhaus am Sonnenhofweg, dort, wo ich aufgewachsen war, und einen Monat vor der Geburt konnten wir einziehen. Unsere Freunde halfen wacker mit beim Umzug. Ich sass auf einem Stuhl im Garten und durfte dirigieren, welches Möbel wohin kommt und welche Schachtel man in welchen Stock bringen konnte.
Auch ein grösseres Auto musste her. Es war ein roter Ford Taunus.
Die beiden Neuankömmlinge machten ebenfalls keinerlei Probleme, schliefen bald schon durch und wir fünf gewöhnten uns aneinander. Drei so kleine Kinder sind allerdings schon ein Haufen Arbeit und viel Zeit für einen selber bleibt nicht. Waren die Zwillinge gefüttert, war die Reihe an Kay, die ebenfalls Zuwendung brachte. Zum Glück war meine Mutter noch immer fit genug, mir oft beizustehen und alle drei zu betreuen, wenn ich arbeiten ging. Endlich hatte sie nun nicht mehr das Gefühl, das „fünfte Rad am Wagen“ zu sein, worüber sie früher so oft geklagt hatte. Nun wurde sie gebraucht.
Mutterschaftsurlaub gab’s noch immer keinen und so musste ich in den ersten Wochen, als ich die Kinder noch stillte, einen Kollegen bitten, meine Unterrichtsstunden zu übernehmen, wenn ich für die „Fütterung“ heimeilte. Seinen Einsatz musste ich natürlich selber berappen. Aber auch jetzt noch genoss ich es sehr, einige Zeit pro Woche mit Leuten zu verbringen, die weder Windeln-Wechseln noch Babynahrung zum Thema hatten.
Meine Schwiegermutter konnte nicht verstehen, weshalb ich meinen Job nicht an den Nagel hängen wollte. Sie selber hatte nie gearbeitet, fand, eine Frau gehöre in den Haushalt. Dort war ich ja oft genug, so oder so.
Kinder Hüten war nicht ihr Ding. Da sie sich relativ kompliziert anstellte, war ich auch nicht besonders erpicht darauf, ihr unsere Kinder anzuvertrauen. Und Theos Vater war sowieso keine Hilfe. Wenn er eines der Kleinen auf dem Arm hielt, was eigentlich nur vorkam, wenn es darum ging, ein Foto zu schiessen, stellte er sich so linkisch an, dass es aussah, als ob er es mit einem Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg zu tun hätte.
Im Sommer verbrachten wir viel Zeit im Marzili, wo die Kinder schnell schwimmen lernten.
War das Wetter schlecht, lief ein anderes Programm ab. Ganze Nachmittage verbrachten wir zusammen mit einer Freundin, mal bei ihr zu Hause, mal bei uns, und die Kinder konnten zusammen spielen oder auch zanken, was halt zuweilen ebenso vorkam, selten zwar. Sie erinnern sich noch heute an unsere feinen Zvieri mit Schwarztee mit Milch und Zucker (nach englischer Art) und an die leckeren Migros-Berlinern, damals noch nach altem Rezept.
Diese Freundin hatte ich im Spital kennengelernt, als Kay zur Welt gekommen war. Ihre Tochter Claudia wurde am selben Tag geboren und Bernadettes zweites Kind, Tina, hätte zwei Jahre später auch fast denselben Tag geschafft wie unsere Zwillinge: Sie ist eine knappe Woche älter als die beiden. Kim und Tina sind noch heute gute Freundinnen.
Geburtstage waren jedes Jahr ein anstrengendes Ereignis. Wenigstens fielen sie in die Sommerferienzeit. Am Nachmittag fand das Kinderfest statt mit Kuchen, Ballonen und Spielen, am Abend dann waren Eltern, Paten und meine Schwester und mein Schwager zum Essen eingeladen. Meistens feierten wir im Garten, denn im Juli war das Wetter in der Regel schön und warm. – Kaum war alles ab- und aufgeräumt, ging die Strapaze am nächsten Tag von vorne los, und das gleich doppelt: der Geburtstag der Zwillinge. – Nicht weniger anstrengend!
Am 4. November 1985 kam unser viertes Kind zur Welt: Ein Junge war’s, wir nannten ihn Gino.
Und wieder waren wir so weit wie vor viereinhalb Jahren vor der Geburt der Zwillinge:
Ein grösseres Auto musste her. Diesmal war’s ein grauer Peugeot, ein Achtplätzer, mit drei Sitzreihen also.
Und umziehen wollten wir auch, weil wir fanden, sechs Zimmer sollten es nun mindestens sein. In Bern ein Haus zu finden, war aber nicht das Einfachste von der Welt. Bei jeder Hausbesichtigung trafen wir wieder dieselben Leute (Dutzende manchmal), die ebenfalls auf der Suche waren, minus ein Ehepaar. Ich wollte keinesfalls aus Bern wegziehen. Sagen zu müssen, ich wohne in Ostermundigen oder Bolligen oder Köniz oder Muri, fand ich absurd und unwürdig. Bern musste es sein. Meine Sturheit gab ich nach gut einem Jahre auf und der „Suchkreis“ um Bern herum wurde vergrössert. – Unter der Hand fanden wir schliesslich ein Haus in Ittigen mit genügend Zimmern, in dem wir seit dem Sommer 1986 wohnen. Einen besseren Kauf hätten wir gar nicht tätigen können. Ein ungefährlicher Kindergarten- und Schulweg, genügend Platz, tolle Aussicht auf die Berge, ein Garten, in den niemand Einsicht hat – was will man mehr?!
Damals waren die Zwillinge bereits fünf und Kay sieben Jahre alt. Da auch Gino ein „gäbiges“ Baby war, hatte ich kaum das Gefühl, viel mehr Arbeit zu haben als bisher. Die drei „Grossen“ halfen mit beim Füttern und vor allem Kim hatte ihre mütterliche Ader entdeckt und begann bereits, den Kleinen zu „erziehen“. Den ganzen Wortschatz dazu hatte sie bestens gespeichert.
Nach wie vor half mir meine Mutter im Haushalt und vor allem mit den Kindern, so dass ich noch immer meine acht Lektionen Englisch und Deutsch unterrichten konnte. Auch wohnte sie in Bolligen, in nächster Nähe.
Die Idee, ein Au-pair-Mädchen anzustellen, verlief im Sand. Es gab Freunde, die uns vor allfälligen Problemen warnten. – Das „Projekt“ könne wohl eine Hilfe sein, aber auch das Gegenteil: ein weiteres Kind zum Betreuen.
Wir entschlossen uns für eine andere Lösung: Während einiger Zeit kam am Mittwochnachmittag regelmässig ein Mädchen aus der Nachbarschaft, eine Babysitterin, die sich um die Kinder kümmerte. So war auch meine Mutter ein wenig entlastet und ich hatte meinen freien Nachmittag.
Ein paar Gedanken übers weitere Vorgehen beim Schreiben
Wenn man über sich selber schreibt, ist es nicht immer ganz einfach zu entscheiden, wie man vorgehen soll oder will. Soll ich alles chronologisch erzählen, schön der Reihe nach wie in einem Tagebuch, oder ist es besser, von den Familienmitgliedern einzeln zu berichten, das Puzzle auf diese Weise zu einem Gesamtbild werden zu lassen?
Ich habe beschlossen, in den nächsten Kapiteln, bevor ich wieder zum Bericht über mich selber zurückgehe, über die Kinder separat zu schreiben; ich glaube, es macht mehr Sinn und ist übersichtlicher. Was ich von ihnen erzählen will, sind vor allem die lustigen Dinge, die sie gesagt haben, als sie klein waren und schliesslich, was aus ihnen geworden ist.
In ihren ersten zehn Lebensjahren hatte ich mir jeweils Mühe gegeben aufzuschreiben, was ich nicht vergessen wollte. Eine Auswahl davon lese ich hier aus:
Kay
Wie bereits erwähnt, kam Kay Isabella am 19. Juli 1979 im Lindenhofspital in Bern zur Welt. Um 13 Uhr 29. Sie war ein kräftiges Baby von 3,340 kg Gewicht.
Mit ihrer übergrossen Liebe haben Mütter ja die eigenartige Angewohnheit, ihre Kinder immer wieder zu hätscheln, zu verküssen und zu drücken. Sogar die ganz Kleinen haben das nicht immer gern.
Kay war knapp zweieinhalb-jährig, als sie mir beim Schlafengehen mitteilte: „Gang jitz abe go ufrume!“ – Und mehr als einmal musste sie mich ermahnen: „Nümme schmüsele; jitzt isch fertig!“
Erheiternd, wie schon die Dreijährigen altklug sein können: Wir nenne es jedenfalls so. Es ist ja klar, von wem sie ihre Wörter und Sätzchen haben. Sie hören zu, lernen, speichern, imitieren und wenden an, was sie aufgeschnappt haben. Lustig für uns ist dann, wenn der Moment oder der Zusammenhang nicht ganz passen:
So sagte Kay nach einem Nachtessen zu mir: „Dr Papi het schön brav gässe, jitz darf är de ä Schläckschtängu ha“.
Ihre Lieblingsbemerkungen: „Das git’s haut“.
An die nervtötende „Warumphase“ („Walum lägnet’s?“ – „Walum isch das Glas gäub?“) schloss sich nahtlos die „Nein-Phase“ an, und als es mir mal zu bunt wurde, sagte ich: „Säg doch nid immer nei!“ – Ihre Anwort: „Nei danke!“
Auch Granny, meine Mutter, wurde beim Tischabräumen und Teller in die Küche Tragen ermahnt: „Aber la se de nid la gheie!“
Kritik musste ich mir nicht selten gefallen lassen: „Du tuesch ä chli soue, du chlini Mama“. Oder in unserem Schlafzimmer: „I mues grad ä chli bette. Das isch so näs Puff bi üs. Du darfsch de nid grad wieder puffe, wen-i bettet ha“.
Ob man hier einen Spruch der Grossmutter heraushört? - „Hinech cha-n-i de gut schlafe, wiu i so viu früschi Luft verwütscht ha“.
Mit Namen wurde ebenfalls experimentiert. Statt ‚Mami‘ kam irgendwann mein Vorname zum Zug: „Merci, Isabelle“ oder „Exgüse, Isabelle“ – und mal sagte sie zu mir, als ich Kuchenteig auswallte: „Guet hesch das gmacht, Isabelle, ganz guet“.
Und als Papa sie beim Essen zur Eile drängte, sagte sie: „Tue nid schtürme, Papi!“
Vielleicht hatte der Grund, dass er sie ermahnte, weil sie so unendlich langsam ass, mit der Art der Pizza zu tun, die sie vor sich auf dem Teller liegen hatte. – Sie sagte: „Das isch de nä gueti Pizza. - Aber i ha se eifach nid gärn“.
Und mit vierjährig:
Leider ist es oft nicht vermeidbar, dass Kinder auch Wörter oder Sätze aufschnappen, die überhaupt nicht in ihr Vokabular gehören.
So gab’s eine Zeit, wo Kay oft sagte: „Jesses Gott!“. – Das gefiel mir gar nicht und ich forderte sie auf, das bleiben zu lassen. Etwa zwei Sätze später sagte sei stattdessen: „Shit, Maria“. (Wo sie das herhatte, war uns allen ein Rätsel.)
Dass Papa nicht immer sofort und genau zuhörte, hatte sie schon lange bemerkt. So sagte sich manchmal zu ihm: „Du, Papi, i rede mit dir!“ - Manchmal beim Essen, wenn auch das nichts nützte und sie schon dreimal um Most gebeten hatte, sagst sie entnervt zu mir: „Du, säg du am Papi, dass i gärn Moscht wett“.
Lustig, dass Ungeduld offenbar allen Kindern eigen ist. Auch die andern drei äusserten sich später in ähnlicher Weise.
Wenn ich beim Büchli-Vorlesen nicht gerade weitererzählte, sagte sie: „Tue jitz wyterverzeue, statt nume desume hocke“.
Und hielt sie mir hier den Spiegel vor? - „I möcht z’Mami sy. Das isch luschtig, we me geng cha schimpfe, we d’Chind ä Blödsinn mache“.
Auf der Fahrt in die Stadt mit dem Tram begann sie mit einer wildfremden Frau zu plaudern. Als wir ausstiegen, sagte sie ganz wichtig zu mir: „Weisch, Mami, i ha drum mit dere Frou no öpis müesse bespräche“.
Einmal erzählte sie mir, sie habe gehört, wie ihre Grossmutter mit einer Frau telefoniert habe: „Die zwöi hei gschnäderet, das isch nid zum Gloube“.
Telefonieren wurde sowieso plötzlich zum Hit.
Dreijährig: Papa hatte ihr das Telefon in Griffnähe gestellt. Sie wusste zwar, dass sie ihren Namen nennen sollte, sie sagte jedoch nur „Tschou“ oder gar nichts. – Und mir hatte sie Verhaltensmassregeln gegeben: „Gäu, du tuesch mir de nid dr Hörer wägrisse; du bisch ja nümme meh so näs chlises Meiteli“.
Ein Gespräch mit ihrer Grossmutter Nana: Plötzlich, mitten im Gespräch, hielt sie mir den Hörer hin und sagte: „I ma nüm!“
In einem anderen Gespräch mit Nana wollte sie dieser klarmachen, dass sie nicht mehr zu ihr kommen wolle. Was genau der Grund dafür war, konnte ich nicht herausfinden. Wieso dies so sei, wollte auch meine Schwiegermutter wissen: „Eh, weisch, i ha drum eifach ä ke Zyt, wiu i dänk öppis anders z’tüe ha“. – Nana räumte daraufhin ein, sie würden sich dann plötzlich nicht mehr kennen, wenn Kay nicht mehr zu ihr käme. Darauf ging die Kleine gar nicht mehr ein, sondern sagte kurz angebunden: „Auso de vieu Vergnüege, tscho-ou“ und legte den Hörer auf.
Das lustigste Gespräch aber, das ich zwischen den beiden mithörte, war das Folgende (kurz vor Kays fünftem Geburtstag): Nana rief an und fragte, was sie sich wünsche: „Ä Schlumpf“ war die Antwort. Nana musste wohl gefragt haben, was das denn sei, denn Kay versuchte zu erklären und zu beschreiben, wie ein Schlumpf aussehe, aber offenbar half es nicht. Sie gab auf und erklärte resigniert: „Das isch z’schwierig. - Chouf lieber öpis, wo’d weisch, was äs isch“.
Umgekehrt hatte Nana Geburtstag (11. Januar 83) und Kay sagte, sie wolle ihr etwas schenken.
Ich schlug vor, etwas zu zeichnen, aber Kay meinte, dafür habe sie keine Zeit. Als ich ihr dann ins Gewissen redete und fand, für Nana könnte sie wirklich eine Zeichnung machen, sagte sie: „Auso guet, zeichne-n-i haut äs Chrüz, das längt“.
Kindergartenzeit (mit sechsjährig):
Amüsant war die folgende Episode. Es ging auf Weihnachten zu (1984): Kay erzählte mir, am Montag werde der Samichlous in den Kindergarten kommen. Sie habe ein wenig Angst vor ihm. – Ich beruhigte sie und sagte, das brauche sie nicht, der Samichlous sei ein lieber Mann, der Kinder gern habe. Da fragte sie: „Isch är eigentlich chinderlos?“
Ein andermal erzählte sie mir, sie habe im Kindergarten mit einer Freundin Memory gespielt und sie hätten so lange Kärtchen aufgedeckt, bis sie zwei gleiche gefunden hätten. Ich wandte ein, das sei doch nicht der Zweck des Spiels. Daraufhin wies sie mich zurecht: „Du bisch doch nid dr Chef, wo üs seit, wi mer müesse schpiele“.
Was den Anstoss dazu gegeben hatte, dass sie sich plötzlich dafür interessierte, wie man zu einem Mann kommt, weiss ich nicht mehr. Mit Bedauern nahm sie jedenfalls zur Kenntnis, dass sie ihren Bruder Diego nicht heiraten könne. Das wäre praktisch und naheliegend gewesen...
So fragte sie mich: „Tuet me de eifach desume schpaziere u eine sueche? Oder luegt me zum Fänschter us u wartet, bis eine dürelouft?“ – Ich erklärte ihr, wie das üblicherweise so gehe und sagte unter anderem auch, dass man sich küsse, wenn man sich lieb habe. Da platze sie einerseits verlegen, andererseits entrüstet heraus: „Nei, merci!“.
Und eine weitere Frage schloss sich in dem Zusammenhang an: (Ich hatte ihr eine Geschichte vorgelesen, in der Räuber eine Rolle spielten. Offenbar war sie davon fasziniert): „I wott de ke Röiber hürate. Wie chame’s de mache, dass me ke Röiber verwütscht?“
Den kleinen Bruder Gino liebte sie innig und half wacker mit beim Füttern. Einmal hielt ich ihn offenbar anders im Arm als sonst. Da sagte sie zu mir: „Iiih, - wi du dä häbsch – das isch ja ungloublech, Mueter!“
Kay hat jetzt selber zwei Mädchen, geboren 2010 und 2013. Es ist eine Freude, die beiden aufwachsen zu sehen, jetzt von einer anderen Warte aus, und auch ihre Sprüche zu notieren, wenn ich welche höre.
Nach der Sekundarschule hätte Kay ins Gymnasium gehen wollen, aber ihr Lehrer fand, sie sei nicht "Material" fürs Gymi. Er empfahl sie nicht. - Eine absolute Fehleinschätzung? - Ich ärgere mich noch jetzt darüber!
Sie besuchte dann das zehnte Schuljahr, anschliessend das Gymnasium Kirchenfeld und begann gleich nach der Matur an der Uni Bern Veterinärmedizin zu studieren, nachdem sie problemlos den Numerus Clausus geschafft hatte. Ohne je eine Prüfung nicht zu bestehen, schloss sie ihr Studium erfolgreich ab. Ihr Spezialgebiet waren Grosstiere. Sie hatte selber ein Pferd, daher wohl diese Wahl. Der Titel ihrer Koktorarbeit (2009) heisst:
"Antikiotikaverbrauch in Tierartzpraxen: Analyse des Antibiotikaeinsatzes bei Bemischt- und Nutztierpraxen in der Schweiz" und ist noch immer bei Amazon erhältlich.
Schon während ihrer Studienzeit arbeitete sie bei Swissmedic und später liess sie sich dort sogar fest anstellen.
Heute arbeitet sie in einer Kleintierpraxis als Tierärztin und ist verheiratet mit einem der zwei besten Schwiegersöhne nördlich wie auch südlich der Alpen. - Er ist Zahnarzt und er ist kein Räuber.
Kim und Diego
Sie kamen kurz vor dem errechneten Geburtstermin (1. August) zur Welt, nämlich am Tag nach Kays zweitem Geburtstag, am 20. Juli 1981. Kim als Erste um 07.32, gefolgt von Diego neunzehn Minuten später um 07.51. – Der Arzt hatte gesagt, mehr als zwanzig Minuten dürften nicht verstreichen zwischen der ersten und der zweiten Geburt, sonst müsste er einen Kaiserschnitt einleiten. So musste ich mich beeilen wie gestört, dann das absolut schlimmste Szenarium für mich wäre gewesen, ein Kind normal zu gebären, das andere mit Kaiserschnitt. – Nein danke! Aber wie gesagt, ich schaffte es grad knapp vor der Deadline.
Wie froh war ich, meinen Riesenbauch los zu sein. Und wie sehr freuten wir uns über unser gesundes Zwillingspärchen!
Es gibt viel zu tun mit drei kleinen Kindern; viel Zeit für einen selber bleibt nicht. Aber darüber habe ich bereits kurz berichtet.
Was nun folgt, sind die Erinnerungen an die ersten paar Lebensjahre von Kim und Diego, die ich in einem Tagebuch niedergeschrieben habe. – Ich habe nur Begebenheiten ausgewählt ab dem zweiten Lebensjahr, als sich die Sprache zu entwickeln begann, also ab 1983, dem zweiten Lebensjahr.
Genau dieselbe Episode wie bei Kay und später bei Gino gibt es auch hier zu beschreiben: Nicht alle mögen die mütterlichen Liebkosungen bedingungslos.
Kim war mitten in der Nacht aufgewacht, weil sie Durst hatte. Ich füllte ihr Fläschchen wieder und wollte sie noch ein wenig liebkosen. Wie fast immer entzog sie sich mir sofort. Ich sagte: „Jitz darf i dir nidemau äs Müntschi gäh u di chli strichle“. Sie sagte nichts, aber da tönte es vom Nachbarbettchen von Diego: „Chasch bi mir ä chli.“
Überhaupt war Diego der „Liebesbedürftigere“, wenn man das so sagen kann. – Er hatte eine Phase, wo er seine Küsse dosiert an die Frau brachte. Ein harter, feuchter Schmatz manchmal, dann wieder nur der Hauch eines Müntschis. So nahm er mal meinen Kopf zwischen seine kleinen Händchen und sagte zu mir „Mein Bijou“ (den Ausdruck hatte er von meiner Mutter, seiner Granny).
Nächtliche Gespräche kamen hin und wieder vor, wenn eines plötzlich aufwachte oder wenn sie sich gegenseitig weckten. Bei einer solchen Gelegenheit sagte Diego mal zu mir: „Ig nid no meh schlöfle möcht i, süsch tue-n-i de fescht gränne.“
Einmal übernachtete die fünfjährige Tochter von Diegos Gotte bei uns (August 85). Kim ist sauer, dass Muriel bei Kay schlafen darf und nicht in ihrem Zimmer. Sie sagt: „Das regt mi uf! I wett o schnädere. Dr Diego tuet immer grad schlafe“.
Als ich den beiden erzählte, dass sie, bevor sie zur Welt kamen, in meinem Bauch gewesen seien, wollte Diego sofort wissen: „Hets de dert o Schpiuzüg gha?“
Zweieinhalbjährig: Kims neuester Tick: Dauernd wollte sie mir etwas ins Ohr flüstern. Keine Ahnung, wo sie diese Taktik herhatte. - So sagt sie manchmal: „I wott öppis säge“ und flüstert dann „Darf i bitte Schoggi ha?“ oder: „Darf i bitte Burtstag ha?“ - Kein einfach zu erfüllender Wunsch...
Immer mal wieder kam sie mit etwas Neuem daher. So wechselten auch ihre Lieblingsausdrücke von Zeit zu Zeit: „neichts“ war’s dann mal. Sollte wahrscheinlich deutsch sein und wurde gebraucht für nichts/nüt/nid/nei.
Auch Diego probierte neues Vokabular aus, die verrücktesten Ausdrücke. Jedenfalls wollte er immer das letzte Wort haben. So sagte er zu mir ganz despektierlich, als ich ihm etwas verweigerte: „Du jungi Dame“ und meinen Schwager bezeichnete er als ganz grosse „Giftnudle“. – Er konnte sich manchmal auch so extrem ärgern, dass er vergass zu atmen, blau wurde im Gesichtchen und umfiel. Kaum in der Horizontalen, kam er sofort wieder zu sich und erholte sich von Schrecken, Ärger und Zorn.
Kims Leben drehte sich zu der Zeit vor allem um Schoggi, Chätschgummi und Täfeli. Als ich sie erwischte, wie sie vor dem Nachtessen am Schoggiessen war, kam ihre Antwort wie aus der Pistole geschossen: „Dä vertrochnet süsch“.
Dreijährig: Diego war ein „Luszapfe“. Er liebte es, hin und wieder seine Schwestern ein wenig zu plagen. Wenn dann Kim zu mir angerannt kam und weinte, kam er angeschlendert, die Hände im Hosensack und sagte, halb entschuldigend, halb stolz und die Situation geniessend: „I bi haut ä chli nä Grobian“.
Oder: Kim kam weinend zu mir in die Küche und fragte: „Gäu, Mami, i überchume nid nume Brot u Wasser!“ - Im Hintergrund lachte Diego diebisch.
Normalerweise wusste sich Kim aber bestens zu wehren. Sich gegenseitig die Schuld zu geben, war auch eine Art Spiel. – So sagte sie oft, schon als sie kaum sprechen konnte: „Diego gmacht“.
Aber auch ihm mangelte es meist nicht an Selbstbewusstsein. So liebte er es zu verkünden: „Gäu, i bi dr gröscht Diego, wo’s uf dr Wäut git!“
Auch war er manchmal ein „Bhoupti“. „Nei“ u „mou“ waren seine Lieblingswörter. Zur Bestätigung seiner Behauptungen (miss)brauchte er dann oft seine Schwestern und sagte: „Äbe, d’Kim het o gseit…“
Aber nicht immer hatte er die Oberhand. So kam Diego mal weinend zu mir und sagte: „I wott o müeterle, aber die lö mi nie“. – Ich wollte ihn beruhigen und sagte: „Di Meitschi lö di doch sicher dr Papi oder vilech z’Bébé si“. – „Nei, die säge, i dörf nume z’Meersöili si!“
Auch da hatte er ein Problem: „I ha dr ganz Chopf vou Püle – (und nach kurzer Pause mit Nachdruck) – wo weh tüe!“
Zählen machte ihm Freude. Lange ging’s nur gut bis 12. Dann zählte er weiter bis 19 und weil er nicht mehr weiterwusste, sagte er dann regelmässig zu mir: „ ..18, 19, gäu, guet!“
Er hatte das Wort für Lampion vergessen. Seine Definition: „Rundum mit änärä Cherze drin“.
Auch übers Milch-Trinken machte er sich seine Gedanken: „Mami, hei si d’Chüe usegnoh u nächär iz Migros bracht u nächär hei mer d Miuch kouft?“
Kim war dreijährig, als ich sie zum ersten Mal im Einkaufszentrum „verlor“.
Nach zehn Minuten wurde sie ausgerufen. Ich fand sie bei Möbel Pfister. Drei Leute kümmerten sich um sie. Und Schoggi-Güezi essend genoss sie es. Von Tränen keine Rede. Als sie gefragt worden sei, wie sie heisse, habe sie nur gesagt, sie sei „äs Meiteli“.
Das war nicht das einzige Mal, dass wir sie aus den Augen verloren.
Im Marzili musste ich sie oft suchen gehen, aber im unserem Umkreis hatte es viele Leute, die uns kannten oder mit der Zeit kennenlernten. Die Kleine verschwand so rasch, dass ich es manchmal kaum glauben konnte. Mal hatte jemand sie beobachtet, wie sie rote Schuhe in den „Buber“ (ein Weiher) warf. Es waren Kays Schuhe, die wir dort wieder rausfischen mussten. Ein anderes Mal war es ihre eigene Unterhose, die sie im Abfalleimer entsorgte (die Gründe dafür lagen ziemlich auf der Hand beziehungsweise in der Hose). Zu dem Mann, der uns seine Beobachtung, den Verblieb unserer Tochter und ihrer Unterhose mitgeteilt hatte, sagte sie: „Du bisch ä Böse!“
In unseren Spanienferien machte es mir grosse Sorgen, als wir mit Freunden auswärts essen gingen und sie plötzlich unauffindbar war. Sie war damals sechsjährig: Wir waren zehn Erwachsene und dreizehn Kinder, da war’s gar nicht so einfach, den Überblick zu bewahren. Ich war mit dem Kinderwagen unterwegs, Gino war noch klein und wir spazierten alle zusammen durchs Städtchen in Richtung Gartenrestaurant. Erst als wir uns setzten, merkte ich, dass Kim fehlte. Zuletzt hatte ich sie mit anderen Kindern und Theo gesehen, ein Stück weiter hinten. Wenn aber Theo einen Bücherladen erspäht, ist er in Nullkommanichts drin und denkt nur noch daran, dort zu stöbern. So hatte er Kim vollkommen vergessen.
Kurz nachdem ich merkte, dass sie nicht da war, fuhr auch schon ein Polizeiauto ganz langsam vor dem Restaurant vorbei. – Die beiden Polizisten suchten die Eltern...
Sofort holten wir unsere Tochter auf dem Polizeiposten ab, wo sie Eiscrème schleckte und Coca Cola trank. Ein holländisches Ehepaar, welches Deutsch sprach, betreute sie. Kim war einmal mehr völlig unbeeindruckt. Ein Grund zum Weinen war das für sie keineswegs. Natürlich erhielten wir eine spanische Strafpredigt, die wir selbstverständlich auch verdient hatten.
Ein paar weitere Episoden aus den Ferien:
Diego kommt am Strand zu mir und berichtet ganz entrüstet und den Tränen nahe: „Mami, z’Wasser het mer Wasser aagschprützt“.
Papa: „Wenn dr nid i füf Minute im Pyjama sit, git’s kes Gschichtli“. - Diego: „I gloube, i wett hüt kes Gschichtli ha.“
Auf der Heimreise aus der Toscana (1986) übernachteten wir in Siena. Die beiden Mädchen wollten unbedingt den Dom besichtigen. Die schöne Kirche faszinierte sie. Vor dem Altar (alles schummrig beleuchtet) hatte es Bankreihen und sie wollten sich dort hinsetzen. - Also gut. - Etwa eine Minute lang sassen wir dort, als Kim plötzlich fragte: „Wenn chunt jitz da ändlech das Chaschperlitheater?“
Fünfjährig, also ebenfalls im Jahr 1986, kurz vor Weihnachten, war Diego bei seiner Gotte eingeladen. Sie hatte ihn gefragt, ob ihm eine Holzeisenbahn als Geschenk gefallen würde. Er erzählte mir das am Abend und sagte, er habe aber alles wieder vergessen, damit es dann auch wirklich eine Überraschung sei.
Und als die Kinder die Stifeli für den Samichlous hinausstellten (Dezember 85), legten sie alle auch noch eine Zeichnung dazu und ich musste nach Diktat etwas hintendrauf schreiben. Bei Diego: „Dr Diego het das fü ä lieb Samichlous gmacht. - Bei Kay: „Samichlous, I ha di gärn“. – Kim diktierte: „Liebe Samichlous, i wünsche dir“ – dann machte sie eine Pause und ich fand, das sei wirklich nett, dass sie dem Samichlaus etwas wünsche, dann fuhr sie aber weiter: „I wünsche dir, dass du mini Güezi bracht hesch“.
Einfach war es nie mit ihr. Ein süsses kleines Ding, aber schon in sehr jungen Jahren ständig bereit, alles Mögliche und Unmögliche auszuprobieren und irgendeinen Unsinn auszuhecken.
In den leeren Koffer, den ich meiner Schwester nach den Ferien zurückgeben wollte, leerte sie Wasser hinein und meine Frisiercrème. – Auf der Kellertreppe leerte sie Durgol aus. - In der Küche braute sie in einem unbewachten Moment eine Mahlzeit für ihren Bruder zusammen aus allem, was sie gerade fand: Ein wenig Schmierseife, Mehl, Zucker, Maggi, Öl, Essig und als besondere Zugabe, sozusagen zum Abschmecken, ein wenig Sigolin. Garniert wurde das „Gericht“ mit Zucker und Zimt. – Einen Löffel voll fütterte sie Diego, der aber glücklicherweise gleich darauf erbrach. Offenbar war ihr das, was sie angerichtet hatte, dann doch nicht mehr so geheuer. Sie ging zu Theo in den Estrich und meldete, was passiert war. So konnte ihr Vorhaben im Keime erstickt werden, bevor sie noch grösseren Schaden anrichten konnte.
Wasser in ihr Zimmer zu nehmen, hatte ich ihr streng verboten. Trotzdem fand ich, kaum war das Verbot ausgesprochen, wieder zwei Ovobüchsen voll Wasser hinter ihrem Schrank. Und kurz darauf erneut eine Wasserlache auf dem Teppich. Eine grosse Spielzeugbüchse stand darüber. Als ich Kim fragte, was da passiert sei, sagte sie ganz unschuldig: „Da ma-n-i mi nümme bsinne“.
Leider nützten weder Verbote, Bitten noch Strafen etwas. Sie tat trotzdem, was sie sich in den Kopf gesetzt hatte. – So fragte ich mich manchmal, wenn ich mit meinem Latein am Ende war, wie das wohl herauskommen werde in der Zukunft.
Die Zwillinge waren viereinhalbjährig, als ihr kleiner Bruder Gino auf die Welt kam.
Eifersucht gab es überhaupt nicht. Beide liebten ihn heiss.
Kim: „I ha-nä so furchtbar gärn, dä chli Schätzu“.
Und Diego zu Gino: „I ha di so fescht gärn, das i’s fasch nümme cha ushaute“.
Kim zur bevorstehende Taufe: „Gäu, mir gö de id Chile go säge, dä heisst Gino“.
In welchem Zusammenhang wir aufs Sterben zu sprechen kamen, daran erinnere ich mich nicht mehr. Aus eigener Erfahrung weiss ich natürlich sehr genau, dass der Tod für Kinder mehr als nur schwer verständlich ist.
Diegos Vorstellung: „Gäu, Mami, we mä gschtorbe-n-isch – das isch de blöd – da mues me immer nume desumeliege“.
Kleiner Exkurs: Als ich das in meinen Aufzeichnungen las, erinnerte es mich daran, was unsere Enkelin zu ihrem Papa sagte, als sie siebenjährig war, also etwa dreissig Jahre später:
(Am 9. September 2017 wurde im Radio gemeldet, der Hurrikan Irma sei unterwegs nach Florida.) Ella sagte: „Dä Michael Jackson het eigentlich Glück, isch er gschtorbe. - Süsch wär är jtz i dem fürchterliche Sturm!“
Zum Abschluss: Zwei Beiträge habe ich in meinen Aufzeichnungen gefunden, die zeitlich allerding zwölf Jahre auseinanderliegen: Diegos Bemerkung zu meiner Bekleidung (er war vierjährig) und Kim war sechzehnjährig, als sie mein Outfit beurteilte:
Diego ist der grösste Schmeichler, den es gibt. Er ist so lieb. So kommt er oft zu mir, küsst mich und sagt: „Du bisch eifach z’liebschte Mami vo dr ganze hundert tusig Wäut“. - Und je nachdem, was ich anziehe (er sieht fast immer, wenn etwas neu ist), sagt er: „Mami, du hesch de ne schöni Bluse (od. Nachthemmli etc.) anne“. Oder: „Du bisch de näs schöns Mami“. Das schmeichelt natürlich meinem Ego. Auch wenn er bei Tisch etwa sagt: „Du chochisch de guet“.
Und nun Kim. Ich hatte einen neuen Rock angezogen und war dabei, die passenden Schuhe dazu auszuwählen:
„Di Schueh si auso trurig – weder die einte no die andere würd i trage. – U i überlege grad, wi me das Chleid no chly chönnt ufmöble. – Dir passt’s guet, aber mir müesstisch sehr viu Gäud gä, dass i das würd aalege.
Kim hatte es fertig gebracht, sich drei Wochen vor der Matur aus dem Freien Gymnasium rausschmeissen zu lassen. Nicht wegen ungenügender Noten, nein, die waren vorzüglich. Es wäre einfach gewesen für sie, die Prüfung zu bestehen, denn sie hatte gute Erfahrungsnoten. Die Proben hatte sie nämlich jeweils geschrieben. Ihr Trick war, sich von einem Heer von Freunden helfen zu lassen. Es waren Studenten, die ihr den Stoff beibrachten – abends, wenn ihr das besser passte. Gesperrt wurde sie wegen ihrer Abwesenheiten. Im letzten Jahr leistete sie sich pro Semester zwischen 190 und 200 unentschuldigte Absenzen. „Migräne“ hatte das arme Kind offenbar die ganze Zeit...
Als ich davon erfuhr, drehte ich fast durch. Man hatte uns nicht benachrichtigt. Kim sei erwachsen, also älter als achtzehn, in dem Fall würde man sich nicht mit den Eltern absprechen, liess man uns wissen. – Bezahlen durften wir allerdings das Schulgeld schon, damit hatte die Schule keine Probleme...
Nun, sie zog mit ihrem Freund für ein Jahr nach Lugano, wo sie Italienisch lernte und anschliessend durften wir ihr ein weiteres Jahr Schulunterricht im Feusi-Gymnasium bezahlen. Dort absolvierte sie anschliessen die eidgenössische Matur, ohne Erfahrungsnoten diesmal und wurde sogar noch ausgezeichnet.
Die beiden zogen anschliessend nach Amsterdam für drei Jahre, wo Kim Business und Economy studierte. Ein Praktikum in der Hypo Real Estate Bank in London in der „Gurke“ gefiel ihr so gut, dass sie fortan in London blieb, den Freund wechselte und auch die Stelle. Bei der amerikanischen Wachovia-Bank (später Wells Fargo) blieb sie ein paar Jahre, bevor sie zu einer Versicherung wechselte (Prudentia) und schliesslich bei Goldman Sachs „landete“. Ihr Gebiet ist das Investment Banking. Vor einem Jahr nun hat sie dort gekündet und ist jetzt selbständig.
Ihren Ehemann (unser zweiter Schwiegersohn – einen besseren hätten wir uns nicht wünschen können) hat sie bei der Arbeit kennengelernt. Er ist Spanier, ein hingebungsvoller Vater und ebenfalls im Banking-Business tätig. Die beiden haben einen Sohn mit Namen Teo (Hommage an Vater Theo), der im August 2019 zweijährig wird. Im November wird er ein Geschwisterchen erhalten. Kim und Javi sind Weltenbummler. Eigentlich wohnen sie seit zwölf Jahren in London, können aber beide auch von irgendwo aus arbeiten, so dass sie die Wintermonate am liebsten in Bivio bei Ski- und Snowboardfahren verbringen, den Sommer in Bern (sie lieben die Aare heiss - genau wie ich) und zwischendurch sind sie in der ganzen Welt unterwegs, besuchen Freunde und oft auch Javiers Eltern in Madrid.
Diego ist seit Oktober 2017 verheiratet. Er und seine Frau wohnen ganz in unserer Nähe, was uns natürlich freut. Oft kommen die beiden am Abend vorbei, wenn sie einen Spaziergang machen. Meistens bleibt es allerdings nicht bei kürzeren Spaziergängen. Zweimal an einem Tag den Niesen rauf und runter, ist für Diego keine Ausnahme. Grosse Wanderungen im Sommer, die lieben sie. Eine davon war zum Beispiel, Korsika von Süden nach Norden zu durchqueren und während der diesjährigen Sommerferien (2019) durfte es nichts weniger Anspruchsvolles sein als den GR5 in vier Wochen zu absolvieren (Wanderung über 46 Pässe von Saint Gingolph nach Nizza). Das brachte ihnen ebenfalls die Bewunderung der ganzen Familie ein. – Lieber sie als ich. Dazu würde uns sowohl die Fitness als auch die Lust fehlen. Trotzdem: Hut ab!
Diego zog früh von zu Hause aus. Mit siebzehn wohnte er zusammen mit einer Freundin in einer eigenen kleinen Wohnung in Bern. Nach seinem Amerikajahr hatte er grosse Mühe, sich in Bern im Gymnasium wieder einzuleben. Er wollte die Schule verlassen (es war ihm mühelos gelungen, fast ebenso viele unentschuldigte Absenzen anzusammeln wie seine Zwillingsschwester) und einen Beruf erlernen. „Etwas, wo man um fünf Uhr den Bleistift fallen lassen kann“, so erklärte er mir. - Nach kurzem Versuch in einem Elektrogeschäft (wenn ich mich richtig erinnere) merkte er allerdings, dass körperliche Arbeit auch nicht unbedingt ein Zuckerlecken ist und besann sich zurück an die Gymnasial-Zeit. Allerdings wurde er im Kirchenfeld nicht mehr aufgenommen, man hatte dort genug von ihm, aber der Rektor im Neufeldgymnasium gab ihm eine zweite Chance, die unser Sohn dann glücklicherweise packte.
Nach der Matur war’s Zeit für den Militärdienst. Ein Jahr lang diente er bei der KFOR SWISSCOY-Truppe in Osteuropa, ein halbes Jahr im Kosovo und die andere Hälfte in Bosnien.
Zurück in Bern begann er in Freiburg Jura zu studieren, anschliessend in Bern. Während dieser Zeit wohnte er wieder bei uns in Ittigen.
Als ich mal auf Reise war, hatte er eine Stellvertretung für mich an der GIBB übernommen. Diese gefiel ihm so gut, dass er sich in der Abteilung IET anstellen liess und seither unterrichtet er dort Technisches Englisch und gibt Recht-Weiterbildungs-Kurse für seine Kollegen.
Seine Frau ist Anwältin und zudem eine liebevolle Schwiegertochter. – Kinder wollen die beiden nicht. Es ist ihre Entscheidung, die wir voll und ganz akzeptieren können.
Gino
Er wurde am 4. November abends um 23.17 Uhr geboren – unser viertes Kind, von allen Familienmitgliedern mit Freude auf dieser Welt willkommen geheissen.
Ganz wie die anderen Kinder mochte es Gino nicht immer sehr gern, wenn ich ihn verküssen wollte.
Folgende Episode habe ich aufgeschrieben; Gino war damals grad zweieinhalb Jahre alt:
Auf die Frage, als ich ihn ins Bett brachte: „Gisch mer jitz no näs Müntschi?“ – sagte er: „Äs längt jitz!“
Und da war er bereits sechsjährig:
Theo war geschäftlich in Holland und ich fragte Gino, ob er ausnahmsweise vielleicht bei mir im grossen Bett übernachten wolle: „Das chunnt nid i Frag, mi Entschluss schteit fescht!“, erklärte er mit grosser Entschlossenheit. – Wer dann doch in meinem Bett schlief, um Mitternacht noch ein Teeli trank und sich am liebsten noch eine Geschichten hätte vorlesen lassen wollen, war Gino...
Schon mit knapp dreijährig konstatierte er immer sofort, wenn ich Lippenstift benutzte. So fragte er einmal: „Wo göh mer häre?“ und als ich sagte „Niene“, dann fragte er: „Warum hesch de d Lippe aagschmiert?“.
Und ein andermal, als er mir beim Schminken zusah, riet er mir: „Schmier nid z viu a, süsch het’s de morn kes meh“.
Auch komplizierte Wörter und Fremdwörter waren natürlich ein Thema: Als er krank war und ich ihm Essigsöckli machen wollte, lehnte er erst ab (wie üblich – das „Nein-Ja-Spiel“), dann sagte er plötzlich: „So mach mer haut di Sicherheitssöckli“.
Ganz ähnlich ging’s in Bivio an Weihnachten, als ich ihn bat, die Sonnenbrille anzuziehen, damit er nicht schneeblind werde. Nach dem obligaten „Nein“ dann kurz darauf: „Gimmer jitzt di Brüue, damit i nid wassersüchtig wirde“.
Knapp fünfjährig: Ich erinnere mich an ein Gespräch, das wir in der Küche hatten, als er vom Vorkindergarten heimkam:
„Du, d Andrea wott mi hürate“. Ich sagte: „Schön; u de du? – Wosch du o?“ – Die Antwort kam dezidiert zurück: „Nei – i wett lieber öppis Ferngschtürets!“ – Klar, Autos, Traktoren, Motorräder – das war das grosse Interessengebiet, Freundinnen damals eindeutig weniger...
Und als ich dieselbe Andrea kurze Zeit später zu uns nach Hause einlud, sagte ihre Mutter zu Gino: „Gäu, morn chunnt de d Andrea zu dir“. Er runzelte seine Stirn und sagte ganz wichtig: „Morn isch’s nid so günschtig – da han i ke Zyt“.
Auch mit knapp achtjährig waren Freundinnen für ihn noch kein Thema.
Ich hörte nämlich zu, wie er am Telefon eine Verehrerin abwimmelte. Das ging so:
Total gelangweilt lehnte er am Türrahmen, hatte den Hörer am Ohr und in kurzen Abständen sagte er zu der ihn Bedrängenden: „I wot das Gschtürm nid ha!“ - etwa dreimal, bis er schliesslich genervt den Hörer auflegte.
Erst zwei Jahre später änderte seine Einstellung. Er war gerade zehnjährig geworden, als er mir ganz stolz ein Brieflein zeigte, das er selber geschrieben hatte, wie ich selbstverständlich annahm. Darin stand: „Ich liebe dich! – Willst du mit mir gehen?“ – Barbara war die Angebetete. Ihr hatte er dieses „Schreiben“ gegeben und nun hatte er es von ihr zurückerhalten. – Zusätzlich hatte sie angekreuzt (mit multiple Choice ging das Ganze nämlich weiter): „Ja“ (die Frage war, ob sie wolle oder nicht) und sie hatte sich sogar zur Äusserung hinreissen lassen (unter der Rubrik zum Ankreuzen bei „Bemerkungen“):
„Ich finde dich süss!“
Der Clou: Was ich erst später herausfand: Er hatte diesen Brief nicht einmal selber verfasst – er hatte ihn schreiben lassen – und zwar von einem Klassenkameraden. Dieser erklärte mir, als ich ihn darauf ansprach, Gino hätte das selber gar nicht gekonnt (womit er zweifellos Recht hatte). – So weit waren wir also bereits: Er engagierte einen „Ghostwriter“, um seine Liebesbriefe zu schreiben...
Ich erwähnte dann, das sei doch nun ganz etwas Neues; er hätte doch bisher nie eine Freundin haben wollen. Das sei gewesen, als er noch achtjährig war, informierte er mich, und damit erschöpfte sich jede weitere Erklärung.
Hier eine lustige Episode aus der ersten oder zweiten Klasse: Er musste in der Schule als Aufgabe aufschreiben, was Mutter, Vater und Geschwister im Moment gerade tun. Zehn Tätigkeitswörter wurden verlangt. Bezeichnenderweise war das erste Wort vorgegeben: „putzen".
Er fuhr dann weiter und schrieb: „kochen, arbeiten, stürmen, computerspielen, schreiben" und dann verleidete ihm offensichtlich die genaue Beobachterei und er schrieb: „nehmen, geben". Dann aber war wirklich Schluss - weitere Verben könne sich die Lehrerin ja selber ausdenken, wenn es ihr Freude mache, meinte er.
Schon als Kleinkind war Gino manchmal ungeduldig. Beim Geschichtenerzählen wurde man oft von ihm gehetzt: „wyter, wyter!“, hiess es, und wenn ich eine Frage stellen oder etwas erklären wollte, zischte er “Mach jitz!“.
Im Marzili (ich lief zu wenig rasch in Richtung Schwimmbad): „I ha gar nid gwüsst, dass Müetere so lahm chöi sy“.
Oder im Shoppyland beim Einkaufen. Der Lift kam lange nicht und ich sagte zu ihm: „Muesch haut chly warte.“ – Er sahst mich konsterniert an und sagte: „Du hesch de Närve!“.
Es ging allerdings auch umgekehrt: (Sommer 93): Wir besuchten die Handarbeitsausstellung in der Sekundarschule. Als ich die Treppe ins Untergeschoss gehen wollte, rief er mir einigermassen erbost nach: „Chasch nid ämau uf di eiget Sohn warte?!“
Im selben Sommer fand auf dem Gurten, unserem Berner Hausberg, ein Festival statt. Theo wollte erst alleine oder nur mit den Zwillingen hingehen, weil er glaubte, es könnte zu lange dauern und eventuell langweilig werden für Gino. So fragten wir ihn, ob er mitgehen wolle oder nicht, und falls ja, ob er dann nicht „blöd tun“ werde. Seine Antwort: „I cha doch d Zuekunft nid vorussäge!“
Altklug sind die Kleinen ja immer wieder mal. Woher haben sie’s? - Man braucht nicht dreimal zu raten. – Episode in der Küche: „Darf ig äs Schoggolädli ha?“ – Ich sagte: „Auso guet. Ja“. – Und er: „Ig ha doch gwüsst, dass du vernünftig bisch“.
Als wir über unser Dach im Wohnzimmer sprachen, welches leckte, fragte er, wieso das so sei. Theo sagte, etwas mit den Ziegeln sei nicht in Ordnung. Dies veranlasste ihn zur Frage: „Hesch öppe öppis dran umegfingerlet?“
In unseren fünfwöchigen USA-Ferien im Sommer 95 hatte er zwei Sätze gelernt, die er alsdann bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit anwendete: „Yes, my dear“ und „Oh, my God!“.
Mit zunehmendem Alter wurden seine Sprüche immer dreister.
Die Kinder waren mit Theo in Bivio in den Ferien und ich hatte wie üblich meine Auszeit, das heisst, ich machte mit einer Freundin Ferien an einem warmen Ort im Süden. An Ostern war ich wieder daheim und fuhr nach Bivio, um die Familie zu besuchen. Ginos Begrüssung war: „Jitz hei mer ja wieder eini, wo nüs chochet“.
In einem Gespräch ging es darum, dass ich Gino klarmachen wollte, dass wir früher besser Sorge getragen hatten zu unseren Velos und nicht jedes Jahr ein neues haben konnten, so wie er offenbar fand, es sei normal. Er meinte nur trocken: „Verzeu doch nid geng Züg us de Füfzgerjahr!“
Als ich ihn wegen seines Haarschnitts hänselte (er hatte sich mit einer Schere kahle Stellen aus dem Hinterkopf geschnitten. - Nicht eben ein ungefährliches Unterfangen, das zudem auch grauenhaft aussah - wie ein gerupftes Huhn), raunte er mir zu: „Dummi Chue!“.
Ich schluckte leer, sagte aber im Moment gar nichts. Als er dann keine halbe Stunde später wollte, dass ich ihm ein Abzeichen ans Pfadi-Hemd nähe, sagte ich: „Chüe chöi nid näje!“ – Seine Antwort kam prompt: „Du scho!“.
Und wann genau (zeitlich) er auf die Idee gekommen war, über Theo das Folgende zu sagen, weiss ich nicht mehr: „Mir hei äs Usloufmodäu verwütscht.“
Gino ging nicht unbedingt ungern in die Schule, aber er war auch kein enthusiastischer Lerner. Wir dachten erst, er würde wohl die ganzen neun Jahre in der Primarschule bleiben, aber es kam anders. Im Gynmasium Muristalden in Bern bestand er 2005 die Matur, die er sogar auf Englisch abschloss. Seine Klasse war damals die erste, die diese Option wählen konnte – ein ganz neues Konzept.
Leider klappte es aber nicht nach Wunsch mit seinem Studium. Geographie interessierte ihn, dort hatte er auch gute Noten, aber BLV im Nebenfach war sein Stolperstein. Er bestand die Prüfung nicht. – Ein Lehre mochte er auch nicht anfangen. IT kam mal zur Sprache, aber er fand sich selber „zu alt“ und hatte keinerlei Lust, in die Schulstube zurückzukehren und mit Teenagern die Schulbank zu drücken.
Seine Lieblingsbeschäftigung ist das Tennisspielen. So hat er sein Hobby zum Beruf gemacht: Er ist Tennislehrer.
Theo
Ginos Bemerkung, wir hätten mit seinem Vater ein Auslaufmodell erwischt, ist ein guter Übergang, um noch ein paar Zeilen über Theo zu berichten:
Da er mir immer half mit den Kindern und auch im Haushalt, wenn er nicht gerade im Militärdienst war, was bis in die Achtzigerjahre für meinen Geschmack leider viel zu oft vorkam, hatte und hat er ein sehr gutes Verhältnis zu ihnen. Seine Stärken sind seine Geduld, seine grosszügige und hilfsbereite Art und nicht zuletzt sein grosses Können, was Zeichnen und Malen betrifft. Im Handumdrehen kann er eine Situation erfassen und sie zeichnerisch verarbeiten. Seine Comics sind einfach herrlich. Seit Jahren verfasst er auch unsere Weihnachtskarte; das tönt jetzt ein wenig prosaisch, ist es aber nicht. Im Gegenteil: Theo stellt eine humoristische Szene aus dem Familienleben dar. Minuziös wird das Dargestellte mit dem PC farbig ausgemalt, anschliessend ausgedruckt und zusammen mit meinem Jahresbericht per Email an unsere Freunde und Bekannten verschickt.
Seine Tierliebe ist ebenfalls erwähnenswert. Ich liebe Tiere ja auch, wir hatten und haben seit Jahren immer mindestens eine Katze, ein von allen geliebtes Familienmitglied, aber wenn’s um Insekten geht, sieht die Sache etwas anders aus. Auch Spinnen mag ich nicht. Keinesfalls kann ich schlafen, wenn sich eine mein Schlafzimmer als Ort ihrer neuen Niederlassung aussucht. Theo fängt sie dann ein und bringt sie irgendwohin, wo sie mich nicht mehr stört. Aber dazu kommt: Er füttert sie – die grossen jedenfalls! Wenn er eine saftige Fliege findet, bringt er sie der Arachnida ins Netz und sieht zu, wie der Leckerbissen eingewickelt und anschliessend verspiesen wird. – Es sieht also ganz so aus, als ob auch bei ihm die Tierliebe etwas mit der Grösse des Objekts zu tun hat.
Seine Grosszügigkeit will ich ebenfalls nicht vergessen zu erwähnen. Seine schönen Gutscheine, die er mir jeweils zu Weihnachten oder zum Geburtstag schenkte, sind ein Beispiel davon. Zum Teil habe ich sie aufbewahrt. Über seine Spendierfreudigkeit freute ich mich jeweils sehr, war beeindruckt und fast ein wenig gerührt. Allerdings habe ich kaum je einen eingelöst... Inzwischen lassen wir das mit den Geschenken. Wir haben ja beide „alles“.
Natürlich könnte ich seitenweise über Theos Stärken, „Heldentaten“ oder Bravourstücke berichten, aber es ist doch so, dass es halt lustiger ist, über die Schnitzer und Fettnäpfchen zu berichten, selbstverständlich ohne zu hadern oder zu spotten.
Spricht man von Stärken, ist der Gegenpol die Schwächen. Dass Theo keinen Sport betreibt, überhaupt keinen, und trotzdem aussieht, wie wenn er täglich joggen ginge, das empfindet er selber überhaupt nicht als Schwäche. Im Gegenteil: Über Sportverletzungen muss er sich nie beklagen.
So war er auch der Einzige, der, als wir (eine Gruppe von Freunden) am 2. August 2003 eine Wanderung auf den Niesen unternahmen, es vorzog, mit der Bahn den Gipfel zu erstürmen. Einzige Aufgabe: Dafür schauen, dass unser gesamtes Gepäck, dass wir unten an der Bahn deponiert hatten, nach oben kommt, denn wir hatten Zimmer gebucht und wollten auf dem Berg übernachten.
Es war ein äusserst heisser Sommertag, 35 Grad am Schatten. Aus dem Grund hatten wir eigentlich früh starten wollen, aber es wurde halb zwölf Uhr mittags, bis wir endlich ab Frutigen, wohin uns Theo mit dem Auto gebracht hatte, losmarschieren konnten. SEHR heiss der erste Aufstieg! – Aber wir nahmen’s gemütlich, legten mehrere Pausen ein, picknickten unterwegs - es war eine wunderbare Wanderung.
Als wir um halb sechs völlig erschöpft und verschwitzt oben ankamen, begrüsste uns Theo strahlend mit einem Bier in der Hand. Schon seit ein paar Stunden war er oben, hatte sich einen Liegestuhl geschnappt und den Nachmittag auf der herrlichen Terrasse mit der einmaligen Aussicht lesenderweise genossen. Für mich hatte er ein Glas Mineralwasser parat (das mehr oder weniger einzige Soft-Getränk, das ich gerne mag). So sah’s zumindest aus. Ich stürzte es hinunter, das heisst, nach ein paar Schlucken merkte ich, dass es ein Citron ist, das mir überhaupt nicht schmeckt. – Typisch Theo! – Er meint es immer gut, tappt aber von einem Fettnäpfchen ins andere. Wir kannten uns damals schon lange genug, um zu wissen, was unsere gegenseitigen Getränkevorlieben waren und sind.
Nun, das alles ginge ja noch. Zum Glück erkundigte ich mich nach dem „Schrecken“ in der Kehle nach unser aller Gepäck. Er habe unten an der Bahnstation den Auftrag erteilt, es nach oben zu transportieren, sagte er. Es war aber nirgends zu finden. – Kontrolle wäre eben manchmal auch nicht schlecht! – Mit der allerletzten Fahrt wurde es dann doch noch befördert und wir konnten es an der Bergstation in Empfang nehmen.
So ist Theo eben. Ähnliches passiert immer wieder. Ich erinnere mich an eine Episode im Tessin. Ganz anders zwar, aber ich ärgerte mich mehr als nur ein bisschen. Es muss ungefähr im Jahr 1983 gewesen sein. Wir hatten drei kleine Kinder und es war das erste Wochenende seit längerer Zeit, dass wir mal „frei“ hatten. Mit Freunden verbrachten wir ein Wochenende im Tessin und meine Mutter hütete zu Hause unsere Kleinen. Aufs endlose Ausschlafen hatte ich mich so etwas von gefreut. Einmal einfach liegen bleiben und schlafen bis zum Gehtnichtmehr, ohne die Kinder betreuen zu müssen oder in die Schule zu eilen... Um halb acht läutete Theos Wecker. Er hatte vergessen, ihn abzustellen. Wieso er ihn überhaupt mitgenommen hatte, war mir auch ein Rätsel. – Ich hätte mich ja umdrehen und weiterschlafen können. Das schlug er mir auch vor in seiner ruhigen Art, aber ich regte mich dermassen auf, dass an Schlaf nicht mehr zu denken war. Mir war zwar bewusst, dass sein Rat in dieser Situation der allerbeste war, aber ich war einfach nicht imstand, mich abzuregen. Den ganzen Tag lang war ich sauer. Auch über mich...
Es blieb nicht das einzige Mal, dass das passierte. Heute erst recht mit der Weckfunktion an seiner Smartwatch. Aber nun bin ich pensioniert...
Ein anderes Kapitel ist das Einkaufen. Wie erwähnt, hilft und half Theo immer viel mit im Haushalt. Aber einkaufen gehört nicht zu seinen Stärken. Ich habe schon so viele unmögliche Erfahrungen gemacht, dass ich es tunlichst vermeide, ihn zu bitten, etwas mitzubringen. Wenn’s unumgänglich ist, versuche ich möglichst genau zu beschreiben, was er einkaufen soll und vor allem mir vorzustellen, was er trotzdem verkehrt machen könnte dabei. So bat ich ihn grad eben, mir Aprikosen mitzubringen. Ich wollte einen Kuchen backen und war äusserst knapp an Zeit. So instruierte ich ihn, nicht etwa Büchsenaprikosen zu bringen oder gefrorene Früchte, auch lieber nicht die grossen teuren Spezialaprikosen, die sich weniger eigneten. – Diese aber erhielt ich dann. – Egal, kein Problem, aber wieder einmal: Typisch Theo.
Ein „Problem“ ist auch, dass er sagt, das oder jenes, das er hätte mitbringen sollen, habe es gar nicht mehr gehabt. Ob er denn gefragt habe? – Das macht er nicht gern...
Vor Jahren hatte ich ihn mal gebeten, mir aus der Stadt aus dem Frischfisch-Offenverkauf Flundern mitzubringen für eine Suppe, die ich bereits parat hatte, die ich nur noch mit ein paar Filetstreifen anreichern wollte. Wir hatten Besuch am Abend und ich freute mich auf unsere Vorspeise. – Was er mir mitbrachte, war ein Sack voller Gräten und sonstiger Fischabfälle. Offenbar hatte er dem Verkäufer gesagt, es gehe darum, eine Fischsuppe zu machen und dieser hatte geraten, die Abfälle gut auszukochen, damit eine schmackhafte Suppe entstehe. - In unsere Fischsuppe am Abend schwammen keine Filet-Streifen...
Seit dieser Zeit bin ich sehr vorsichtig geworden mit der Erteilung von Einkaufs-Aufträgen.
Katzenfutter zu finden, ist ja keine so schwierige Aufgabe, so dachte ich, das geht problemlos. - Kürzlich aber: Ich beschrieb das Packet genau: Ein Sack Trockenfutter, die Verpackung goldig mit dem grossen Bild einer weissen Katze drauf abgebildet, es kann unmöglich fehl gehen und ist einfach zu finden. – Ich konnte es kaum fassen: Was er auf den Tisch stellte, war ein Packet Trockenfutter, goldener Sack mit einem weissen Hund drauf abgebildet...
In diesem Frühling waren wir für zwei Wochen in München. Wir wohnten in einer Wohnung, wo wir auch die Küche benutzen konnten. Normalerweise gingen wir am Abend auswärts essen, aber am Morgen ist es jeweils angenehm, das Frühstück selber zubereiten zu können. Wenn wir tags zuvor Brot gekauft hatten, wurde es im Toaster geröstet, weil es einer meiner „Ticks“ ist, ich esse nur frisches, frisch aufgebackenes oder eben getostetes Brot. Sonst verzichte ich lieber.
Als sich Theo aber für einmal bereit erklärte, vor dem Morgenessen einkaufen zu gehen, bat ich ihn, ein frisches Brot mitzubringen. In der Umgebung hatte es drei Bäckereien. – Ich freute mich wiedermal auf ein schmackhaftes Brot, direkt aus der Backstube. – Was Theo mitbrachte, waren sechs weisse, bröckelige, trockene, papierartige Hamburgerbrötchen in einem Plastiksack ... Er war halt grad im Supermarkt.
In seinem Büro gab’s zum Glück Sekretärinnen, die sich darum kümmerten, die Flüge zu buchen, wenn er auf Geschäftsreise ging. Trotzdem schaffte er es nicht selten, den Flug zu verpassen (um einen ganzen Tag sogar mal – er dachte es sei Dienstag, es war aber bereits Mittwoch). – Typisch Theo!
Einen anderen „Theo-Schnitzer“ vergesse ich nicht so rasch. Er ereignete sich, als Berlin noch zur DDR gehörte. Geschäftlich musste er mit ein paar Kollegen dorthin. Ich wäre liebend gerne mitgegangen für die paar Tage, aber Theo sagte, das ginge leider nicht, seine Begleiter nähmen ihre Ehefrauen auch nicht mit. – Am Bahnhof Bern trafen sie sich. Die Ehefrauen seiner Mitarbeiter waren dort und Theo dachte, es sei sehr nett von ihnen, ihre Männer zum Zug zu begleiten. Er wollte sich von ihnen verabschieden, aber da hatte er etwas falsch verstanden: Alle Damen gingen selbstverständlich mit...
Beim Fliegen läuft auch jetzt noch nicht immer alles rund. Dass er bestimmt schon ein ganzes Dutzend Taschenmesser beim Securitycheck hat abgeben müssen, ist ja nicht so ungewöhnlich. Das passiert auch anderen Leuten. Ich kann mich darauf verlassen: Es ist immer sein Handkoffer, der eine Spezialbehandlung erhält.
Was uns aber mal in Amsterdam passierte, fand ich damals überhaupt nicht lustig. Wir sassen im Restaurant vor dem Schalter der Passkontrolle und tranken vor dem Abflug eine Tasse Kaffee. Es war noch Zeit genug und ich sagte zu Theo: „Pass bitte auf meinen Handkoffer auf, ich geh noch rasch in den Laden dort drüben“. Als ich zurückkam, war Theo verschwunden – bereits durch die Passkontrolle zum Gate. - Mit meinem Handkoffer, in dem ich dummerweise, ich geb’s zu, meine Reiseunterlagen im Aussenfach verstaut hatte, Pass und Boarding-Karte... Ein sehr freundlicher Grenzbeamter ging auf die Suche nach Theo und so gelang mir die Ausreise trotzdem noch rechtzeitig. – Typisch Theo...
Was er aber bewundernswert gut kann, ist es, unser Auto so zu packen, so dass jedes Ding (und es waren und sind jeweils unzählige Sachen, die mitmüssen) seinen Platz hat und gut verstaut ist. – Weshalb dies erwähnenswert ist, klärt sich gleich.
Auch auf dem Autodach fuhr jeweils ein grosser Teil unsere Habe mit, gut verpackt und verschnürt mit einer orangefarbenen Plache bedeckt gegen den Regen (einen „Sarg“ hatten wir damals noch nicht). Diese Arbeit überliess ich ihm gern, ich hatte ja sonst genug zu tun mit meinem Gepäck und dem der Kinder. So fuhren wir während Jahren in die Herbstferien. Erst ein paarmal nach Südfrankreich (Presqu'île de Giens), zweimal in die Toscana und ab 1987 nach Spanien.
In Giens, wo wir 1983 in den Ferien waren, wunderte ich mich, dass Theo so selten an den Strand kam. – Er hatte es schon immer geliebt, „Siesta“ zu machen, aber das ging dann doch zu weit. Oft war ich mit den drei Kindern und unseren Freunden „allein“ am Strand. Es dauerte nur wenige Tage, bis ich hinter das Geheimnis kam: Als ich mal unverhofft im Haus auftauchte, sah ich, wie er vor einem Bildschirm sass. Er hatte sich einen Commodore 64 gekauft und den beim Auto-Packen so gut inmitten unserer Siebentausendsachen versteckt, dass ich ihn nicht bemerkt hatte. Ich war ziemlich sauer und beklagte mich, dass er nun offenbar, statt mit den Kindern am Strand zu spielen, stundenlang bei dem schönen Wetter vor dem PC sass. Der Computer war zu der Zeit das absolut neueste „Spielzeug“, das ihn als Ingenieur natürlich faszinierte und das er unbedingt ausprobieren wollte. Meine Begeisterung hingegen hielt sich in engen Grenzen. Unbedacht liess ich mich sogar zur Bemerkung hinreissen: „Entweder ich oder diese Kiste“. – Das war vorschnell, wenn ich dran denke, wie viele Stunden in meinem Leben ich selber vor dem PC verbrachte und immer noch verbringe. Und wie viele Kurse ich später in der Schule belegte, damit ich Textverarbeitung, Informatik (in kleinem Rahmen) und Korrespondenz unterrichten konnte. – Aber damals...
Manchmal schneidet er sich aber auch ins eigene Fleisch. Wir waren mit der Queen Mary 2 unterwegs von New York nach Hamburg. Zum schwarzen Anzug, der natürlich im Gepäck mit musste, gehörten auch ein Paar schwarze Schuhe. – Schwarz waren beide Schuhe zwar schon, aber zusammenpassen taten sie überhaupt nicht. Der eine war ein Art Mokassin, der andere hatte eine Schnalle. Wenigstens waren’s zum Glück nicht zwei linke oder zwei rechte. – Im Lift zum Speisesaal hätte das Missgeschick wohl trotzdem niemand bemerkt, wenn Theo nicht ständig auf seine Füsse gestarrt und dazu einschlägige Bemerkungen zu mir gemacht hätte, bis alle Fahrgäste ebenfalls auf sein Malheur aufmerksam wurden.
Er spottet ständig über meine übergrosse Handtasche, in der ich, ich kann’s nicht verleugnen, oft lange kramen muss, bis ich finde, was ich suche. – Sie eignet sich aber auch bestens dafür, seine Siebensachen, für die es in seinem Hosensack keinen Platz hat, darin mitzutragen. Seien das Schlüssel, Kleingeld, Zeichenmaterial, Prospekte oder was auch immer. – Das ist mir zwar fast lieber, als alles aufzulesen, was er verliert, wenn ich überhaupt merke, dass dies passiert. Darüber gibt es nämlich auch zahlreiche Geschichten zu erzählen:
Zum Beispiel hat er mehr als einmal sein Notizbuch verloren, seinen Laptop ebenfalls, auch sein E-Book und den rosaroten i-Pod; in Havanna sein Smartphone, auf Long Island (Bahamas) seinen ganzen Sportsack, in Neuseeland brachte er es sogar fertig, meinen Reiseführer (Buch) gleich zweimal zu verlieren (einmal in einem Bus, das andere Mal in einem Hotel), von Münzen nicht zu sprechen, die auf den Boden fallen, weil er sie mitsamt dem Taschentuch aus dem Hosensack zieht oder weil er sich irgendwo auf eine Bank legt, was er liebend gerne macht, worauf unverzüglich das Gesetz der Erdanziehungskraft zum Zug kommt. – Was das Erstaunlichste dabei ist, die meisten dieser Dinge kommen auf irgendeine wundersame Weise wieder zurück.
So hat eine Rangerin in einem Park in Hawaii sein Notizbuch unter einer Bank gefunden und es ihm zurück zu uns nach Hause geschickt.
Sein Laptop, den er in einer Lodge im Südosten von Botswana unter der Bettdecke liegenliess, wurde von den Eltern des jungen Verwalters drei Wochen später nach Maun, in die Hauptstadt gebracht und dort in der Lodge abgegeben, wo wir kurz darauf ankamen und ein paar Tage verbrachten. So fand auch dieses Gerät wieder zu seinem vergesslichen Besitzer zurück.
Beim Smartphone war es anders. Ich stand ein wenig abseits von der Bank, auf die sich mein Gatte gelegt hatte, hob es dann auf, gab es ihm aber erst später zurück. Sozusagen als Erziehungsmassnahme (mit geringer Aussicht auf Besserung, das war mir schon klar). Auch die beiden Reisebücher fanden den Weg zu uns. Sie wurden uns nachgeschickt. Es ist immer gut, wenn man überall seine Adresse hineinklebt oder –schreibt. Seinen Sportsack wiederzuerlangen, war nicht wirklich schwierig, da er ja wusste, wo er ihn liegenlassen hatte. Eine Stunde Fahrt Richtung Süden auf Long Island bis zu „Max‘ Conch Bar and Grill“ und Theo war wieder im Besitz seiner Habseligkeiten.
Glück hatten wir auch in Wellington. Wir hatten das Mietauto bereits gepackt, waren abfahrtbereit, schlossen die Tür zum Apartment, wo wir eine Woche lang gewohnt hatten, warfen den Schlüssel in den Briefkasten und machten uns auf den Weg zum Flughafen. – Kaum dort, merkte Theo, dass er seine Weste, in der alle seine wichtigen Habseligkeiten drin waren: Pass, Geld, Kreditkarten, Smartphone, Notiz- und Zeichenbüchlein in der Garderobe hatte hängen lassen. Ich war sprachlos – aber nicht lange. Das Auto hatten wir noch nicht abgegeben, der Flughafen war nicht weit vom Stadtzentrum weg, wo wir gewohnt hatten, und die Zeit dachte ich, würde sogar reichen, um nochmals zurückzufahren. Das tat er dann auch. Ich blieb mit all unserem Gepäck auf den Flughafen zurück, sass dort wie auf Nadeln und hoffte inständig, dass die Nachbarn daheim waren, die einen Schlüssel zur Wohnung unserer Gastgeber hatten. – Auch das klappte. So viel Glück aufs Mal ist fast nicht erträglich. Theo erschien rechtzeitig, Weste angezogen, Auto abgegeben, Flug noch nicht verpasst, Erleichterung total – alles im Grünen.
Seinem „Hobby“ (so kann man es fast nennen) frönte Theo auch in der Bretagne. Im Sommer 2015 waren wir während sieben Wochen unterwegs und ich hatte fünf Haustausche organisiert. Einen in Lancieux, einen in St. Malo, einen auf der Kanalinsel Jersey, einen in Saint-Etienne de Montluc und den letzten in St. Nazaire.
Kaum hatten wir uns in St. Malo installiert, gestand mir Theo, dass er seinen ganzen Kleidersack mit Hemden, Jacken und Hosen nicht mehr habe. Er hatte keine Ahnung, wo der geblieben war. Beim Einpacken ins Auto verschwunden vielleicht? Oder gar unterwegs irgendwo, wo wir übernachtet hatten? – Als wir nach ein paar Tagen wieder Internetverbindung hatten, fand ich in meinem Email-Briefkasten eine Nachricht von unserer Haus-Tausch-Partnerin in Lancieux. Sie habe in ihrem Schrank einen grossen schwarzen Sack voller Herrenkleider gefunden...
So fuhr mein lieber Gatte am selben Tag dorthin zurück, um seinen ganzen „Plunder“ (den er ja offenbar eigentlich gar nicht brauchte - er packt immer viel zu viel ein), abzuholen. Zum Glück war der Weg dorthin nicht weit, waren die Besitzer überhaupt zurück in ihrem Ferienhaus und hatten gemerkt, dass sich ihr Hab und Gut inzwischen vermehrt hatte.
Ganz alle verlorenen Objekte konnten leider doch nicht mehr gefunden werden. Seine schwarze Regenjacke, die Theo an der Expo 02 in Yverdon gekauft hatte, schützt heute hoffentlich noch immer einen Clochard in Paris vor Regen, denn die Jacke blieb in der Metro liegen.
Einen Kindle-E-Reader hat er in Neuseeland verloren, aber er hat ja immer zwei davon mit dabei, in weiser Vorahnung wohl.
Auch die Landkarte und seine gerade erst gekaufte Cap konnten wir während unserer Rundreise durch Tasmanien nicht mehr wiederfinden. Er hatte beide vermutlich aufs Autodach gelegt und dort blieben sie, bis wir den nächsten Aussichtspunkt erreicht hatten, natürlich nicht.
Krass, all das. Aber trotzdem (im Nachhinein) irgendwie auch liebenswert...
Viele weitere Details aber später im dritten Kapitel in den Reiseberichten.
Eine Weihnachtsfeier
Inzwischen habe ich noch einen weiteren Text gefunden, den ich am 25. Dezember 2001 geschrieben habe nach einer denkwürdigen Weihnachtsfeier. Ich füge ihn hier ein, weil es eine Episode in meinem Leben ist, wo alle „in Aktion“ sind, die ganze Familie also, und das über eine ganz kurze Zeitspanne. Ein spezieller Tag zwar, aber trotzdem eine Art Alltag in dieser Lebensphase.
Kay war damals 22-jährig, Kim und Diego 20 und Gino im November grad 16 geworden.
Es ist doch immer wieder schön, zusammen Weihnachten zu feiern. Alles ist gut gegangen und der Baum ist auch nicht abgebrannt.
Vorbereitungen für den Heiligen Abend:
Wir werden 14 Personen sein am Tisch, was die Kapazität unseres Esstisches hoffnungslos übersteigt. Also muss eine andere Lösung gefunden werden. In knapp zwei Stunden kommen die Gäste: Beide Gartentische werden kurzerhand enteist, getrocknet und ins Wohnzimmer getragen. Ein Tischtuch, ein paar Kerzen und schon ist die Tafel gedeckt. - Ob ich einen Braten mache, will Theo wissen. – Seit dreissig Jahren gibt es dasselbe traditionelle Weihnachtsessen: Bernerplatte. - Offenbar ist ihm das entgangen.
Gino hatte am Mittag die geniale Idee geäussert, Weihnachtsgüezli zu backen. Seit zwei Wochen hatte ich ihn gebeten, die Teige auszustechen und zu backen, die ich extra für ihn gekauft hatte. Dafür aber fehlte ihm bisher die Zeit. Genauso wie mir. Aber ich wollte den Teig ja nicht kaputt gehen lassen und zudem fand ich, Weihnachtsgebäck gehöre unweigerlich zum Fest. Also machte ich mich am Tag zuvor daran, anstatt Tennis spielen zu gehen, die lange hinausgeschobene Arbeit an die Hand zu nehmen. Und nun wollte Gino Güezli backen. - Ausgerechnet an dem Tag, wo ich die Küche selber mit Beschlag belegen wollte/musste. Ich hab’s nicht gern, wenn mich jemand in der Küche stört, vor allem dann nicht, wenn ich für 14 Personen kochen muss. Aber es war Heiliger Abend und allen Menschen ein Wohlgefallen... An Ginos Wille, Güezli zu backen, führte so oder so kein Weg vorbei. Ebenso wenig an seiner Auslegeordnung. Es ist eben nicht einfach manchmal.
So ging er denn am Mittag ins Coop Mailänderliteig einkaufen, weil ja der Teig, den ich bereits verarbeitet hatte, logischerweise nicht mehr da war.
Eigentlich hatte ich gedacht, niemand von uns müsse an diesem hektischen Tag mehr einkaufen gehen und die langen Warteschlangen an der Kasse in Kauf nehmen. Aber alles kam anders. Als ich am Morgen aufstand und mich anschickte, die Zitronencakes zuzubereiten, die ich am selben Tag noch verschenken wollte, musste ich feststellen, dass mir zwei Eier fehlten sowie Puderzucker. Acht Eier brachte ich ja für die Mousse au Chocolat, die ich fürs Dessert geplant hatte. Es war lieb von Kay, dass sie ohne Murren ins Migros ging und mir die fehlenden Zutaten brachte.
Weil ich mir vorgenommen habe, in den Ferien Fotos einzukleben, kam mir gegen Mittag in den Sinn, dass ich unbedingt Fotopapier einkaufen musste. So trat ich den Gang ins Migros selber doch nochmals an, denn nie hätte ich Kay bitten mögen, erneut etwas für mich zu besorgen. Vor allem nicht, weil sie soeben heimkam und klagte, sie sei jetzt auch noch rasch im Coop gewesen, und es hätte ihr fast ausgehängt, weil lauter ältere Leute zwischen den Regalen herumgestanden seien. Ich hielt mich nicht dafür, ihr den guten Rat zu geben, es zu machen wie ich und alles schon ein paar Tage vorher einzukaufen...
Kurz darauf kam Gino heim mit seinem Mailänderliteig.
Später an diesem Nachmittag war die Reihe dann an Theo. Er wollte Kerzen kaufen im Coop für den Weihnachtsbaum, weil ich mich letztes Jahr beklagt hatte, dass er keine Kerzen „montiert“ hatte. Es sei nicht nötig, hatte er damals gesagt, und damit war jegliche Diskussion gestorben. In letzter Zeit hat er öfter solche Anflüge, einsame Entscheidungen zu treffen, aber was soll’s? Ich sagte, was ich davon hielt und das war’s. Offenbar kam ihm dies nun kurz vor Ladenschluss doch wieder in den Sinn und „for good measure“ kaufte er gleich 100 Kerzen. Sie würden länger brennen, meinte er, wenn sie gut gelagert seien. - „Papa ante Portas“ – an diesen Film von Loriot erinnerte ich mich sogleich, die Parallelen sind frappant: Der Held, seit kurzem pensioniert und beflissentlich darauf bedacht, den Haushalt in den Griff zu bekommen, kauft im Supermarkt zwei Palette Essiggurken ein, weil sie gerade Aktion sind und man sie ja so gut aufbewahren kann. – Mit Kerzen sind wir jedenfalls eingedeckt für die nächsten zehn Jahre; ich weiss auch ganz genau, dass irgendwo im Keller noch mindestens 2-3 Schachteln Kerzen lagern müssen. – So viel also zu meinem Vorsatz, ganz sicher am letzten Tag vor Weihnachten nicht einkaufen gehen zu müssen.
Ich bin also daran, das Abendessen vorzubereiten. Mit dem Kartoffeln Schälen bin ich fast fertig, wie Kay freundlicherweise ihre Hilfe anbietet. Sehr gern - noch ein paar wenige Kartoffeln sollten es schon sein. Sie rüstet daraufhin mehr als ein Kilo, weil sie so gerne rüste, sagt sie. Das ist mir zwar neu, aber heute läuft offenbar alles ein wenig anders. Gino ist noch immer am Güezi ausstechen, überall liegen ungebackene und gebackene Güezli herum, heisse und kalte Backbleche, „Teigtröler“ (Nudelholz, wie’s so schön heisst auf Deutsch), Zucker und was es sonst noch so alles braucht. Eine Schüssel voller Eigelb für die Glasur, von der nur ein Bruchteil benötigt wird, erhalten dann wenigstens die Katzen als Festtagsschmaus. Auch diese meinen, sie müssen sich unbedingt in der Küche herumdrücken und betteln. Und jetzt, wo Kay da ist, ist natürlich auch ihr Hund im Weg, es herrscht ein Geknurre und Gefauche, Gino lässt einen Teil seiner frisch gebackenen Güezli zu Boden fallen, Kay schimpft mit dem Hund und ich versuche an meinem Arbeitsplatz nicht die Nerven und den Humor zu verlieren. - Da läutet das Telefon. Es ist Liane, unsere Nachbarin, die in einer Stunde auch zum Essen und zur Weihnachtsfeier eingeladen ist. Sie glaube, sie könne nicht kommen, sagt sie, denn ihre Spitexfrau, die ihr die Haare hätte waschen sollen, sei nicht gekommen. - Dann kommt halt jemand von uns, sage ich mit einem Blick auf die Uhr und wenig Überzeugung. Liane nimmt dankbar an. Ich erkläre Kay den Fall. Meine Tochter kriegt fast Zustände. „Das kann ich schlicht nicht“, sagt sie, „ich bin doch keine Spitexfrau. Wieso nur kommt diese Zwätschge denn nicht? Und wieso ist Kim nicht da, wenn man sie einmal brauchen könnte? Liane ist doch ihre Freundin!“ Tausend Argumente gehen ihr durch den Kopf und durch den Mund und sie gibt in ihrer Verzweiflung ihrer Meinung unverfroren Ausdruck, was man mit älteren Menschen tun sollte, die nicht mehr zu sich selber schauen können. Es ist „strub“, was ich da alles zu hören bekomme. Für mich ist es ein Vorgeschmack dessen, was mir wartet in zwanzig oder dreissig Jahren. - Gino kichert nur dumm. – „Dann gehe eben ich“, drohe ich, „ihr macht halt mit dem Essen hier weiter.“ Das hingegen ist fast noch schlimmer für Kay. Zum Kochen ist sie nämlich auch nicht geboren. Sie ist jetzt in einem grausamen Dilemma. Nein, meint sie jetzt kleinlaut, sie überlege sich den Fall. „Aber was ist dann, wenn ich Liane nicht halten kann? Ich kann sie doch nicht gleichzeitig halten und ihr die Haare waschen!“ – „Dann geht eben Gino mit“, ordne ich an. Sein Kichern hört blitzartig auf. Protest. Ich höre gar nicht hin. Kay zieht sich den Mantel an. Ich muss auf den Stockzähnen lachen. Es kommt mir vor, wie wenn sie sich parat machen würde, in eine Schlacht zu ziehen und jetzt die Rüstung anzog. Da kommt das rettende Telefon. Die Spitexfrau ist da. Ich weiss nicht, wer von uns am erleichtertsten war. Und Liane kann froh sein....
Doris und Jany (meine Schwester und mein Schwager) sind unsere ersten Gäste. Das Fest kann beginnen. Es ist mir gelungen, das Apérogebäck nicht zu verbrennen. Theo geht unsere Mütter holen im Talgut-Zentrum, dem Seniorenheim, wo sie beide in separaten Wohnungen wohnen. Meine Mutter ist nach einer Viertelstunde da. Seine hatte noch keine Kleider an, also holt er sie später. Später hat sie auch noch nichts an, nicht einmal das Gebiss, das einmal mehr nicht aufzufinden ist. Aber er steckt sie in Kleider und bringt sie mit. Es ist erstaunlich, sie sieht aus wie sechzig, sagt sogar Kay. Dabei wird sie in zwei Wochen 95. Wenn sie nur ihre Zähne tragen würde!
Diego und seine Freundin Ladina sind auch eingetroffen inzwischen. Ladina hat die süssesten Florentiner selber gemacht und beschenkt uns alle damit. Diego und Gino holen Liane, die seit Jahren unter Schwindel leidet und nicht mehr selber gehen kann. Sie tragen sie mehr als dass sie sie stützen. Es muss eine Tortur gewesen sein, die 50 Meter bis zu unserem Haus zu gehen. - Kim schwebt herein mit ihrem Freund Dominique. Wie aus dem neuesten Barbi-Film entsprungen, denke ich, aber ich sage es natürlich nicht. Goldene Stiefel mit hohen Absätzen, enge Tigerhosen wie zur Aerobicstunde, bauchfrei, passend zum Anlass. De gustibus non est disputandum; schon gar nicht am Heiligen Abend. – Alle sind da. Wunderschön. Ich bin am vierten Glas Prosecco. Wir stossen zum sechsten Mal an.
Liane hat mir ein Geschenk mitgebracht, ein grosses Pack sündhaft teurer Truffes von Tschirren. Dummerweise lasse ich das Päckli auf dem Tisch vor mir liegen, während ich in die Küche gehe, um etwas zu holen. Liane packt das Päckli, das eigentlich für mich bestimmt ist, gleich selber aus und füttert dem Hund mit meinen Pralinen. N e i n !
Kim hat auch etwas mitgebracht. Wie Ladina hat sie Güezli gebacken, aber sie hat auch genäht. Golden. Slips oder besser gesagt Strings. Nichts für den Winter! Für Beat seien diese, für Kays Freud, den Reitlehrer. Das hab ich erst falsch verstanden und versprach, dass, wenn er diese anziehe, ich auch wiedermal zum Reitunterricht gehen würde. - Gemeint hat sie natürlich für Kay – zur Freude von Beat. - Das Missverständnis wird bald geklärt.
Das Essen verläuft friedlich, alle rühmen die Bernerplatte, die fast nur aus Kartoffeln zu bestehen scheint, und Nana isst mit Appetit den Kartoffelstock, den ich speziell für sie zubereitet habe. Jemand hat eine Weihnachts-CD aufgelegt, um die Stimmung auf die Spitze zu treiben.
Nur die Kinder erhalten je ein Geschenk, so ist es abgemacht. Also ist auch diese Phase des Abends rasch vorbei. - Wie anders war das noch vor zehn Jahren: Berge von Päckli, Mütter mit Zähnen...
Nach dem Essen vermissen wir plötzlich Nana. Sie hat den Weg in unser Schlafzimmer gefunden und hat dort unter etlichen Säcken, die auf einem Stuhl lagen, einen hervorgeholt, der für die Kleidersammlung bestimmt ist. Jetzt hat sie eine Jacke über den Arm gelegt, aber wieso und weshalb und was das alles soll, weiss niemand. Auf der Toilette geht es dann auch nicht so gut. Wie sie wieder herauskommt, ist sie jedenfalls unten nur noch teilweise bekleidet. Es ist jetzt Zeit, heimzugehen und Theo bringt die Mütter einzeln zurück ins Seniorenheim. Liane schafft die 50 Meter auch nicht mit den Jungs. Theo fährt sie im Auto bis vor die Haustüre und Kim bringt sie ins Bett. Wie sie wieder heimkommt, hat sie einen Pelzmantel an, den ihr Liane geschenkt hat. Nach 50 Jahren wieder perfekt in Mode. Er steht ihr ausgezeichnet. Bisamratte, vermute ich, Kay hält den Pelz für Nerz, Ladina denkt an Kaninchen. Kay schwafelt etwas von den armen Nerzen und davon, wie sie sich schämen würde, Pelz zu tragen - das Stichwort für Theo, dieses Jammerthema aufzugreifen und mit Kay zu argumentieren. Genau wie früher sein Vater, dem es unweigerlich gelang, alle mit seinen absonderlichen Ansichten in kürzester Zeit auf die Palme zu bringen...
Theo war viel unterwegs an diesem Abend, er ist geschafft; ich bin es auch. Wir räumen gemeinsam auf. – Es ist fast Mitternacht, Zeit für uns, ins Bett zu sinken und für die Jungen, nun getrost „in den Ausgang zu gehen“ nach diesem Cabaret.
Und nun wieder zurück zu mir:
Job und Nebenjob
Bei einer Nebenbeschäftigung, die ich Ende der Achtzigerjahre annahm, handelte es sich um einen Studie des Bundesamtes für Statistik. Man wollte herausfinden, wie sich eine Gefängnisstrafe auf die Strafgefangenen auswirkt, um Rückschlüsse über die Rückfälligkeit zu ziehen. Von einer Bekannten, die dort arbeitete, wusste ich, dass Leute gesucht wurden, die bereit waren, in verschiedenen Gefängnissen der Deutschschweiz Interviews mit Strafgefangenen zu machen, und zwar kurz vor der Entlassung und dann unter Umständen nochmals kurz nach einer allfälligen Wiedereinweisung. - Verbrecher sind und waren ja nicht unbedingt Leute, mit denen ich im Normalfall zu tun hatte, also war es eine gewisse Neugierde, die mich antrieb, mich für diesen Nebenjob zu bewerben. Auch fand ich, er sei recht gut bezahlt. Interessant auf jeden Fall.
Wir waren alsdann eine Gruppe von etwa sechs Mitarbeitenden und uns war ein Psychologe zugewiesen, mit dem wir in gewissen Abständen Gespräche führen konnten, um über unsere Befindlichkeit zu sprechen, was ich eher unnötig fand, aber einige von uns nutzten das Angebot intensiv.
Es war eine äusserst interessante Aufgabe, die uns zufiel. Es galt als Erstes, einen Fragebogen auszufüllen, aber der Teil des Interviews, der viel aussagekräftiger war, waren natürlich die offenen Fragen. Das Gespräch dauerte jeweils etwa zwei Stunden. Manchmal konnte ich diese Arbeit an einem Nachmittag erledigen, wenn das Gefängnis, das ich besuchte, nicht allzu weit weg war, wie etwa Witzwil oder der Thorberg. Musste ich nach Schaffhausen oder nach Cazis fahren, brauchte ich einen ganzen Tag.
Sehr unterschiedliche Impressionen sind mir von diesen „Besuchen“ geblieben:
Eindrücklich waren sie zwar alle, aber einer im Frauengefängnis in Hindelbank ganz besonders. Wie man uns informierte, traten Frauen als Gefangene in der Statistik gar nicht in Erscheinung, weil es (damals) zu wenige waren. Ich musste trotzdem eine Ausländerin interviewen, die als Drogenkurierin unterwegs gewesen war. Völlig blauäugig und unvoreingenommen war sie offenbar in diese Aktion hineingeraten und machte einen recht gestörten Eindruck, sah gar nicht ein, wieso sie hier gefangen gehalten wurde.
Erstaunt war ich, als ich einen Auftrag im Wauwilermoos auszuführen hatte. Als ich auf die Gebäude zufuhr, dachte ich, es handle sich um eine Feriensiedlung.
In Cazis, in der Strafanstalt Realta, fand an dem Tag, wo ich mein Interview zu machen hatte, ein Picknick-Ausflug mit den Angestellten statt. Der Gefängnisdirektor lud mich dazu ebenfalls ein und ich erfuhr viel Interessantes über die Anstalt und den Strafvollzug. – Es gäbe jeden Herbst ein paar Delinquenten, die einen unbedeutenden Einbruch inszenierten, damit sie über die Wintermonate „eingelocht“ würden, um so ein warmes Bett zur Verfügung zu haben. Immer wieder die Gleichen. Man kenne die Pappenheimer inzwischen.
Zwei Befragungen in Witzwil gaben mir ziemlich zu denken. Der eine Gesetzesbrecher hatte eine Auseinandersetzung gehabt mit seiner Freundin. Sie fuhr in ihrem Auto weg und er wutentbrannt in seinem Wagen hinterher. Er hatte aber einen Gipsfuss zu der Zeit und hätte gar nicht fahren dürfen. Es kam zu einem Unfall, den er verschuldete. Im korrekt entgegenkommenden Fahrzeug starb eine Person und mein Gegenüber zeigte nicht einen Funken Reue, nur Rechtfertigung.
Der andere, mit dem ich mich unterhielt, war ein Hooligan, ein Banker im „normalen“ Leben, der mir versicherte, er würde sich ganz genau gleich wieder verhalten, wenn er hier herauskäme.
Am Skurrilsten war der Besuch im Stemmler-Museum mitten in der Stadt Schaffhausen. Der Mann, den ich befragte, war in Halbgefangenschaft und arbeitete dort tagsüber. Wir sassen uns gegenüber und die Vitrinen rund um uns herum waren voller Tierskelette, Dutzende von Katzenköpfen und Vogelgerippen. Eine seltsame Atmosphäre!
Ich bin nicht mehr ganz sicher, glaube aber, dass die Befragungen etwa zwei Jahre lang dauerten, dann wurde die Studie beendet oder abgebrochen. Was genau dabei herauskam, ist unklar. Sehr viel wohl nicht.
BMS und bsd.
Der Unterricht an „meinen“ beiden Schulen machte mir nach wie vor Spass.
Inzwischen hatte sich einiges geändert. Im Englischunterricht gab’s immer wieder mal ein neues Lehrbuch, welches meistens nach zwei, drei Jahren wieder aus der Gnade fiel, so dass bald darauf erneut evaluiert werden musste. Im Deutsch ging’s ähnlich zu und her. Arbeitsblätter verfassten wir selber, Computer waren am Anfang meiner beruflichen Zeit noch kein Thema. So sehe ich mich noch immer im Arbeitszimmer an der Kopiermaschine stehen, die grosse Trommel drehen, in die ich das Aufgabenblatt eingespannt hatte, das ich vervielfältigen wollte, sorgfältig darauf bedacht, mich nicht schmutzig zu machen an der Tinten-Matrize, was allerdings so gut wie nie gelang. So sind mir die blauen Flecke an den Händen und der Geschmack der alkoholischen Flüssigkeit, die’s für dieses Vorgehen brauchte, unvergesslich. – Später, als wir Computer hatten und Kopiergeräte, die es möglich machten, im Handumdrehen Texte zu scannen und zu vervielfältigen, fühlte zumindest ich mich wie im siebten Himmel.
So waren aus den Zimmern mit Sprachlabor gegen Ende der Neunzigerjahre allmählich Computerräume entstanden, völlig klar, dass unsere Schüler gemäss der neuen Trends geschult werden sollten. So änderte sich auch das Fach deutsche Korrespondenz, das ich während Jahren unterrichtet hatte. Die Briefe waren von Hand geschrieben worden. Das ging nun nicht mehr, was mich und meine Kolleginnen und Kollegen, die dasselbe Fach unterrichteten, zwang, Computerkurse zu besuchen und uns umschulen zu lassen. Ich war fasziniert, aber nicht alle mochten mitmachen, fanden diese Umstellungen nötig. Wenn ich daran zurückdenke, muss ich lachen. Fast archaisch kommt es mir heute vor, wie sich diese Anfänge präsentierten. Die grossen Flobby-Disks hatten ja kaum Speicherplatz, verschwanden daher auch bald wieder und machten neuen Speichermedien Platz. Rasant ging die Entwicklung vor sich.
Später unterrichtete ich auch Informatik. Man war der Ansicht, die Schüler müssten ebenfalls dahingehend geschult werden. Dieser Meinung war ich eigentlich nicht, besuchte aber trotzdem unzählige Kurse und las dicke Bücher, um mich für diese Aufgabe vorzubereiten. Wie ein Telefon funktioniert, weiss ich nämlich auch nicht genau, was mich aber nicht davon abhält, es zu benutzen. Und erst recht ein Automotor… Nun, Lehrplan ist Lehrplan und ich bemühte mich, den Stoff so einfach wie möglich darzustellen, Zusammenhänge bildlich zu gestalten. Auf grosses Interesse an diesem Fach stiess ich aber kaum und nach ein paar kurzen Jahren gab ich der Schulleitung bekannt, ich wolle dieses Fach, das inzwischen „Gesellschaft“ genannt wurde, nicht mehr unterrichten. Das hatte allerdings mehr damit zu tun, dass mir allmählich die vielen Konferenzen zuwider waren, an denen ich teilnehmen musste mit meinem kleinen Pensum. So war’s zumindest eine Fachsitzung weniger pro Monat. Mein Pensum an beiden Schulen betrug nämlich fünfzig Prozent, je halb und halb. Aber an beiden Schulen musste ich je hundert Prozent beim ganzen administrativen „Klimbim“ (Quartals-, Semester-, Gesamtlehrerkonferenzen, Fachschafts- und Qualitätssitzungen) mitmachen, wie wenn ich voll angestellt gewesen wäre. So allmählich wurde mir das zu viel, vor allem, weil ich so oft den Sinn all dieser Sitzungen, die manchmal gefühlte Ewigkeiten dauerten, nicht mehr einsah. Zeitlich fand ich den Aufwand im Verhältnis zum Kerngeschäft, dem Unterrichten, zu gross. So wäre es am einfachsten gewesen, mich nur noch an der einen Schule anstellen zu lassen, aber welche künden? – Dazu konnte ich mich lange Zeit nicht entschliessen. Ich mochte die unterschiedlichen Klassen; in der BMS unterrichtete ich vor allem junge Männer, die einen technischen Beruf erlernten und in der bsd. waren die Klassen gemischt. So entstand eine völlig andere Dynamik oder Atmosphäre, was ganz interessant war festzustellen. Auch hatte ich einen guten Draht zu den meisten meiner Kolleginnen und Kollegen. Im Laufe der Jahre waren Freundschaften entstanden, die, obwohl ich seit sechs Jahren bereits pensioniert bin, immer noch halten.
Erst im Jahr 2010 konnte ich mich dazu entschliessen, bei der bsd. zu künden und fortan nur noch in der BMS zu unterrichten. Ich erhielt dort ein paar Lektionen mehr zugeteilt, so dass mein Pensum wie vorher fünfzig Prozent betrug, aber all die schulischen Aktivitäten ausserhalb des Unterrichts waren nur noch halb so zeitaufwändig. Es kam mir fast vor wie Ferien. Einen äusserst angenehmen Stundenplan hatte ich auch erhalten: drei aufeinanderfolgende Tage Unterricht und vier Tage Wochenende…
Es hatte sich aber auch gesellschaftlich vieles verändert seit Beginn meiner Tätigkeit an den beiden Berufsschulen. Anfangs der Achtzigerjahre gab es in der „Verkäuferinnenschule“, wie sie damals genannt wurde, kaum eine Klasse, in der es nicht mindestens zwei oder drei Schülerinnen oder Schüler gab, die aus Grossfamilien stammten, meist aus ländlichen Gebieten. Acht Geschwister oder gar zehn waren gar nicht selten. Heute ist das kaum mehr so, dafür hat sich die Anzahl der Ausländerinnen und Ausländer drastisch erhöht. – Vorerst waren es vor allem Jugendliche aus der Türkei oder einem anderen osteuropäischen Land, die eine Lehre absolvierten, später vermehrt auch Tamilinnen und Tamilen. Nicht ganz einfach war es, uns die schwierigen Namen zu merken. Eine noch grössere Herausforderung war es, die andere Kultur zu verstehen, mit der wir manchmal konfrontiert wurden: Eltern verboten es ihren Töchtern, an Schulveranstaltungen teilzunehmen, beim Turnunterricht mitzumachen und dergleichen. In der Regel führten auch Gespräche nicht zum Ziel.
Furchtbar und unvergesslich war für mich der Tag im Jahr 1997, an dem ein kurdischer Vater seine Tochter mit einem Messer umbrachte. Es geschah an einem Dienstagabend nach dem Englischunterricht. Er hatte gesehen, dass Yildiz sich nach der Schule auf dem Heimweg mit einem Freund traf, einem Schweizer. – Wieso kommen Leute hierher in unser Land, die unsere westliche Lebensweise aufs Tiefste verachten? – Die junge neunzehnjährige Frau war eine äusserst hübsche, begabte und freundliche Schülerin gewesen, die mit grossem Interesse ihre Ausbildung absolvierte. – Was für ein schwarzer Tag. Unfassbar!
Aber zurück zum Unterricht und den Erlebnissen und Episoden im Schulalltag:
Nicht immer war der Umgang mit den Schülern ganz einfach, im Grossen und Ganzen aber schon. Oft waren es sogar die ausländischen Schülerinnen und Schüler, die sich grosse Mühe gaben, gute Noten zu erzielen. Ich denke, manche von ihnen hatten begriffen, dass ihre Zukunftschancen in der Schweiz besser sind als in ihren Heimatländern. Hingegen erlebte ich nicht wenige Schweizer Jugendliche, die ihre Lehre nur mit dem minimalsten Aufwand und fehlender Motivation zu Ende brachten. – Zu sehr verwöhnt?
Ein grosser Vorteil der Berufsschulen ist, dass man als Lehrerin oder Lehrer so gut wie nichts mit den Eltern zu tun. Das ist wunderbar. Oft hatten mir Kolleginnen und Kollegen, die in der Primarschule unterrichteten, berichtet, wie schwierig und zeitraubend sich zum Teil der Umgang mit den Müttern und Vätern gestalte, die ja alle selber mal in der Schule gewesen waren und sich daher ihrer Meinung nach bestens mit allem, was damit zu tun hat, auskannten.
Unsere Schüler waren in der Regel zwischen sechzehn und zwanzig Jahre alt, an der BMS II sogar von neunzehn bis achtundzwanzig. Diese Klassen waren mir die liebsten, denn wer sich dort anmeldete, hatte ein klares Ziel vor Augen und war normalerweise motiviert.
So hatte ich all die Jahre Spass an meinem Beruf, nahm mir viel Zeit beim Vorbereiten, suchte immer wieder nach neuen Texten und Ideen, um den Unterricht anregend zu gestalten, was natürlich nicht immer hundertprozentig möglich war. Wir hatten ja auch eine Weiterbildungspflicht und Kurse zu besuchen. Das war mir überhaupt kein Müssen.
Während der Ferien gab es Angebote für Lehrerfortbildungskurse in England. Solche besuchte ich, wenn immer möglich, sehr gern. Ich erinnere mich an welche in Cambridge, Torquay, Saffron Walden und Eastbourne. In einem davon machte ich eine interessante Erfahrung mit einer japanischen „Mitschülerin“. Sie war Lehrerin an einer Hochschule in Tokio. Wenn sie englisch sprach, verstanden wir sie anfangs fast gar nicht, aber wenn’s um Grammatik ging, wusste sie „alles“. Sie hatte ein unglaublich grosses Vokabular, konnte aber die Wörter kaum aussprechen. Schreiben war kein Problem.
Sie hätte auch Deutsch gelernt, erzählte sie. Sie hätten in der Schule Thomas Mann gelesen. Sie verstand aber nicht, wenn ich „guten Tag“ zu ihr sagte. – Sehr seltsam war das. Ich freundete mich ein wenig mit Haruko an und sie erklärte mir, wie’s dazu kam, dass ihre Sprachkompetenzen so unterschiedlicher Natur waren: Fragen zu stellen, ist unhöflich. So durften sie ihren Lehrer niemals fragen, wenn etwas nicht klar war. Es muss ein sehr stiller Unterricht gewesen sein, den sie genossen hatte. - Ihr Wissen schöpfte sie aus Büchern. Unendlich viele Übungen hätten sie machen müssen – alle schriftlich. - Da muss sich auch Einstein getäuscht haben, der ja fand: „Das Wichtigste ist, dass man nicht aufhört zu fragen“.
Unter den Kursen, die wir „zu Hause“ absolvieren konnten, waren mir die allerliebsten die eintägigen Veranstaltungen, die von den englischen Buchverlagen durchgeführt wurden. Diese hatten (und haben zweifellos nach wie vor) fast ausnahmslos ausgezeichnete Präsentatorinnen und Präsentatoren, die uns mit viel englischem Humor immer wieder neue methodische „Tricks“ und lustige Aktivitäten für den Unterricht verrieten. Dort ging die Zeit im Nu vorbei und wir Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten enorm profitieren.
Etliches davon liess ich in meinen Unterricht einfliessen, was schliesslich auch mir selber zu abwechslungsreichen Stunden verhalf. – So fand ich den Spruch zwar lustig, den ein Berner Politiker mal verlauten liess und ein Kollege von uns ans Schwarze Brett im Lehrerzimmer gehängt hatte:
„Lehrer haben am Morgen Recht und am Nachmittag frei“. – Wie hilfreich für unser Image solche Aussagen allerdings sind, sei dahingestellt. Das Vorurteil, mit dem Lehrerberuf sei ein Flohnerleben verbunden, ist nicht leicht auszurotten. Das Gute an diesem Beruf ist ja, dass man seine Zeit gut einteilen kann, was halt den Anschein macht, man habe nichts zu tun. Korrigieren und Vorbereiten müssen trotzdem sein. Für mich oft abends oder am Wochenende. Auch verfasst niemand lustige Sprüche über all die vielen Konferenzen am Ende eines langen Schultages, die obligatorischen Sitzungen und die manchmal tagelangen Schulveranstaltungen während den Ferien. Klar, die sogenannten schwarzen Schafe gibt es auch bei uns, wie in jedem anderen Beruf genauso.
Wie steht’s mit den schwarzen Schafen bei den Schülern? – Wenn’s ums nie enden wollende Thema der Absenzen ging und immer noch geht, dann könnte man von ganzen Herden von schwarzen Schafen sprechen. Wäre der Unterricht nicht obligatorisch, könnte man die leidige Angelegenheit vergessen, aber dem ist nun mal nicht so.
An der bsd. waren die Regeln strikter, gegen die Sünder wurde konsequenter vorgegangen als an der BMS. Dort ging’s lascher zu und her, denn nicht alle Lehrer zogen am selben Strick, was mich manchmal ziemlich ärgerte. Wenn es also vorkam, dass eine Lektion ausfiel, konnte es sehr wohl sein, dass einer oder gleich mehrere Schüler von Kopfweh überrascht wurden und daher dem Unterricht, der in der folgenden Stunde stattfand, fernbleiben mussten. Überhaupt traten seltsame Krankheiten vermehrt auch am Freitagnachmittag auf, weniger hingegen am Montagmorgen. Da zeigte sich eher ein andersartiges Problem: Es galt jeweils, gegen die Müdigkeit anzukämpfen.
So wurden Proben mit Vorteil auf die Wochenmitte verlegt, bereits im Semesterplan vermerkt, aber natürlich gab es auch dann immer wieder ein paar „Spezialisten“, die konsequent mit Abwesenheit glänzten, wenn es darum ging, eine mündliche oder schriftliche Note zu generieren. Aber daran gewöhnt man sich als Lehrer rasch. Es gab einfach mehr zu tun, denn eine zweite und dritte ähnliche Probe musste verfasst werden, damit diejenigen, die gefehlt hatten, sich nicht bei ihren Klassenkameraden informieren konnten, was genau gefragt wurde, aber doch auch dieselbe Chance erhielten, eine gute Note zu erzielen. Oft erledigte ich diese Arbeit gleich von Anfang an und hatte schon eine zweite Probe für ihr nächstes Auftauchen im Köcher.
Die Geschichten, die ich manchmal aufgetischt bekam, waren zum Teil köstlich. Die lustigsten habe ich aufbewahrt. Manche waren kurz, andere lang und nicht selten ironisch gemeint, geschwollen in der Ausdrucksweise, um mich ein wenig auf den Arm zu nehmen. - Was denen nicht alles in den Sinn kam, meinen Schülern! Den Ideenreichtum hätte ich mir oft im Unterricht gewünscht. Und Sorgen um nicht ganz adäquaten Sprachgebrauch machte sich ganz offensichtlich niemand. Aber dass nicht einmal das Rechtsschreibeprogramm zum Zuge kam, wenn ich eine Entschuldigung erhielt, die auf dem PC geschrieben wurde, das leuchtete mir beim besten Willen nicht ein. – Nun, Noten gab’s ja keine, aber immerhin mussten sie sich kurz Zeit nehmen und etwas schreiben.
Die Regel war übrigens, wenn man den ganzen Tag da war und nur gerade vor der letzten Stunde heimgehen „musste“, mir das direkt zu sagen und nicht einfach „abzuhauen“. – Hat schlecht geklappt... Eine Lüge aufzuschreiben, ist offenbar einfacher...
Eine zweite Regel war, den Grund der Abwesenheit kurz auf Englisch zu beschreiben. Klappte ebenfalls nicht immer…
Hier ein paar „Entschuldigungen“, die ich erhielt. Sie sind nicht korrigiert, sondern genauso, wie ich sie erhalten habe. Die Anrede habe ich weggelassen sowie auch all die freundlichen Grüsse.
Leider konnte ich den Unterricht am 30.01.2008, aufgrund meiner gesundheitlichen Verfassung, nicht besuchen.
Ich bitte Sie, meine Absenz zu entschuldigen.
*******************************************************************
I excuse me for the last time that I didn’t come to school. I don’t remember the date but I thing it was the 22 of may.
I was in bed and didn’t heare the noise of my natel who should make me to wake up. Or I heard it and shout it down befor I was 100% woken up.
So I styied in bed and waited that my phone ran, bat it didn’t rang, after about an houre I realized that I was late, I was too late.
I tought that you get angry if I come so much time to late an decided to stay at home. I hope it will never happen again. And sorry that it happen two weeks ago.
*******************************************************************
As I was late last Tuesday, I ask you to accept my apologies.
My coming late was absolutely not intentional as I didn’t hear the wake up call and thus got up late.
I thank you for your understanding.
*******************************************************************
Da ich in Österreich war, konnte ich nicht in Bern zur Schule kommen.
*******************************************************************
Because I suffered from a terrible headache, I wasn’t able to visit the english lesson.
If I hadn’t suffered from such a terrible headache, I would have come to school.
Please apologise my absence.
*******************************************************************
Aufgrund meiner Rückenprobleme sah ich mich, da ich solche Schmerzen hatte, gezwungen, nach Hause zu gehen um die Schmerzen zu lindern.
*******************************************************************
Am Dienstag 20.3.07 habe ich am Englischunterricht nicht teilgenommen. Leider habe ich verschlafen und somit den Weg in den Unterricht nicht gefunden.
*******************************************************************
Durch den unwissentlichen Verzehr von verdorbenen Esswaren hatte ich am Montagmorgen starke Magenprobleme. Aus diesem Grund, war es mir nicht möglich, den Unterricht zu besuchen.
*******************************************************************
In the evening of the day before I went to school with a delay of 15 minutes, I had a very thrilling occurrence. While I was doing my homework, my sister’s cat went home with a cute, small, still living sparrow.
First I had to scare away my cat and then I furnished a little nest because the sparrow had to turn upward of his jolt over the night.
In the morning, shortly after my little breakfast I got dressed. While I was hurrying out of the house to catch my train, I reminded of my cute, little sparrow…
The thought to let my sparrow the whole day alone in his little nest was absolutely beyond all bearing. So I went back into my room, put him into my hand, went out of the house and let him fly into the big, wide world.
Needless to say, that I afterwards missed my train.
I’m dreadfully sorry, but I leant of my mistake – I will kill now my sister’s cat that such an occurrence will never happen again.
*******************************************************************
Am Mittwoch dem 20.2.13 bekam ich im VBR Unterricht akute Kopfschmerzen. Aus diesem Grund ging ich nach Hause und ruhte mich aus.
******************************************************************
Excuse.
I can’t visit the last 45 minutes of this period because i have got an important hanball game.
*******************************************************************
Am Donnerstag, dem 20.3.2003 konnte ich wegen starkem Fieber (am 19.3.2003 Abends) nicht an den 2 Englischlektionen teilnehmen. Hiermit entschuldige ich diese 2 Lektionen.
Vielen Dank für euer Verständnis.
*******************************************************************
Am 06.09.06 habe ich Kopfschmerzen und deshalb bin ich nach Hause gegangen.
*******************************************************************
Excuse
On the 23. August 2006 I wasn’t present in your English lesson. I wasn’t ill, but this day I hadn’t the patience to put more stuff in my head, so I decided to go home. I’m sorry…
Yours sincerely,
*******************************************************************
Entschuldigung der Englischlektion vom 29.2.96
Ich war für dem 28.2.96 beim Zahnarzt angemeldet und habe dies irrtümlicherweise in meiner Agenda falsch eingetragen. Als ich dann am 29.2.96 wieder von der Praxis weggeschickt wurde, erwischte ich leider in der Hast den falschen Zug. Dabei musste ich bis Interlaken fahren und konnte erst dort den Weg direkt nach Bern antreten.
*******************************************************************
Explanation
Ich habe das Quiz nicht auf Educanet2 geladen weil ich den Arbeitsauftrag nicht richtig gelesen habe. Ich möchte mich hiermit für meine unsaubere Art und Weise entschuldigen. Ich werde mich bemühen in Zukunft die Aufträge genau zu lesen und sie Termin gerecht abzuschliessen. Ich hoffe, dass Ihnen dadurch nicht ein allzu grosser Mehraufwand entstand
Hochachtungsvoll
*******************************************************************
Excuse
I wasn’t able to join your lesson on the 18 of October 2006 because I had an upset stomach. The chicken I had for lunch was obviously spoilt. I would be grateful if you could excuse my absence.
Yours sincerely
*******************************************************************
Entschuldigung
Da wir am 18. Oktober kurz nach dem Mittag keine Lektion mehr hatten, sah ich es sinnvoller nach Hause zu gehen, um diverse Aufgaben zu erledigen, als in der Schule 2.5h zu warten.
Deshalb entschuldige ich mich für das fern bleiben der Englisch Stunde.
Selbstverständlich habe ich den fehlenden Schulstoff nachgearbeitet.
*******************************************************************
The apology
I like to excuse me for the homework witch I haven’t made.
Because I had a lot to learn for the other School Subjects I couldn’t find thime to do the quiz and the appending document.
*******************************************************************
Sehr geehrte Damen und Herren
Ich habe am 19.12.2002 verschlafen und erschien infolgedessen erst am Nachmittag in der Schule.
Ich möchte mich dafür entschuldigen und hoffe auf ein wenig Verständnis.
*******************************************************************
Absenz
Ich konnte leider am Mittwoch, dem 08.11.2006 Ihren Unterricht im Fach Englisch aufgrund einer Magenverstimmung, hervorgerufen durch eine grosse Portion Gorgonzola Gnocci, nicht besuchen. Ich bitte Sie deshalb freundlichst meine Absenz zu entschuldigen.
Besten Dank
*******************************************************************
Absenzen
- Am 06.09.06 habe ich ein Termin beim Arzt, ich habe Probleme mit dem Fuss.
- Am 18.10.06 habe ich Frei genommen.
- Am 01.11.06 wegen Kopfschmerzen bin ich nicht zur Schule gekommen.
*******************************************************************
Why i didn’t do the taks on the educanet2
It ditn’t do the task on the educanet2 why I forgot it. I do all task who are in the book or on a paper, but I forgot the task on the internet. At the first week I just forgot to write it in my agenda. At the second week I dond’t know why I forgot it. For the future, it is better when I do the homework on the educanet at the same evening who I have BMS.
I hope this was the last one, who I forgot the homework.
With kind regards
*******************************************************************
Entschuldigung für Verspätung
Hiermit entschuldige ich mich für meine halbstündige Verspätung im Englisch-Unterricht am 30.01.2003. Es war keine Absicht, ich musste mit dem Velo vorsichtig fahren und habe deshalb den Zug verpasst.
MFG
*******************************************************************
Excuse
Date: 22.8.2006
I was in the mood to work at home.
*******************************************************************
Entschuldigung für den Englischunterricht vom 18. Oktober 2016
Ich fühlte mich an diesem Tag nicht besonders gut. Ich hatte beim Aufstehen Kopfschmerzen und verspührte Ubelkeit. Darum kam ich am Morgen auch später in den Unterricht.
Als ich mich am Nachmittag immer noch nicht fit war, dachte ich das es keinen Sinn hat in diesem Zustand hier zu bleiben und trat meinen Heimweg an.
*******************************************************************
Aus zeitlichen Gründen konnte ich den Englischunterricht vor zwei Wochen leider nicht besuchen.
*******************************************************************
Ich entschuldige mich, dass ich in den letzten 2 Lektionen (6.11.06) bei Ihnen im Unterricht nicht anwesend war. Der Grund meines fern bleiben des Unterrichts war, dass ich verschlafen habe. Ich wäre ihnen sehr verbunden, wenn sie meine Entschuldigung akzeptieren würden.
*******************************************************************
Mit dem Aufkommen der Natels wurde manches auch nicht leichter. Was man sich da nicht alles ausgedacht hat, um dem Übel Herr zu werden… Meistens mit wenig Erfolg.
Hier eine Entschuldigung diesbezüglich, nachdem mir der Geduldfaden gerissen war:
Es war so dass Herr Beutlers Natel die ganze Zeit vibriert hat, und er euch damit Provoziert hat. Bis dahin hatte ich noch nichts damit zu tun. Als es dann zu viel wurde, hat mein Natel leider im falschen Moment ZUM ERSTEN MAL IN DIESER STUNDE vibriert hat, dachten Sie wahrscheinlich, ich hätte es schon vorher extra gemacht was jedoch nicht der Fall ist und hiermit entschuldige ich mich dafür.
Ja, manchmal erwischt man halt den Falschen...
Und nicht immer hat man den besten Tag. Einen solchen oder gleich zwei davon habe ich vor ungefähr zwanzig Jahren mal beschreiben. - Soeben habe ich ihn wieder gelesen, fast atemlos, und das mit ganz unterschiedlichen Gefühlen.
Sofort kam mir alles wieder „obsi“, wie wir im Berndeutsch sagen; ich befand mich augenblicklich zurück in der Situation von damals und konnte mich genau an diese beiden Tage erinnern. – Die Details wären mir sicher nicht mehr eingefallen, wenn ich nicht alles aufgeschrieben hätte. So freue ich mich nun darüber, dass ich mir damals die Zeit genommen habe, einen „ganz normalen“ Schulalltag zu beschreiben.
Dass ich mit all diesem Stress umgehen konnte, wundert mich heute. Ganz so zerstreut war ich normalerweise natürlich nicht und wenn es mir heute passiert, dass ich etwas vergesse, dann denke ich, das seien eben erste Anzeichen des Alters. Nach dieser Lektüre allerdings sieht alles gar nicht mehr so schwarz aus.
Zweieinhalb Tage im Leben einer vergesslichen Lehr„kraft“
Am Dienstagmorgen erschien Frederic Müller wieder einmal, ein Schüler, der sich nur hin und wieder blicken liess. Ich wusste gar nicht mehr richtig, wie er aussah, ich hatte diese Klasse erst kürzlich übernommen. Er hatte an diesem Tag massenhaft Proben nachzuschreiben, auch in anderen Fächern; es war kurz vor Notenschluss und nur eine einzige Note hatte ich von ihm - drei sollten es sein. Ich bot ihm an, am Abend um halb sechs eine der Proben nachzuschreiben, die andere bewertete ich so oder so mit einer 1, weil sie schon längst fällig gewesen war, es sich zudem um eine Aufgabe handelte, die er hätte zu Hause erledigen und mir dann schicken können. Dies hatte er genau gewusst, da ich das Datum auf dem Stoffplan vermerkt hatte, den jeder Schüler am Anfang des Semesters bekam. Er beklagte sich aber, dass ich ihn nicht noch persönlich aufgefordert hatte, sie einzureichen.
Um halb sechs war er da, ich beschäftigte meine Klasse (Freifach Englisch) für zehn Minuten, denn zwei Schülerinnen mussten ebenfalls eine Probe nachschreiben, für die ich erst noch je ein „spicksicheres“ Zimmer suchen musste. Die Pause hatte dazu nicht gereicht. Dann begleitete ich Herrn Müller ins Informatikzimmer hinunter, wies ihm einen Platz an, händigte ihm das Aufgabenblatt aus, erklärte ihm, aus welchem Verzeichnis er die Unterlage auf seine Diskette laden könne, sagte ihm, wo er mich finde, falls er Fragen habe und überliess ihn seinem Schicksal.
Nach einer halben Stunde tauchte er wieder auf, gab mir die Diskette und das Arbeitsblatt und verschwand. Erst dann merkte ich, dass er gar nichts ausgedruckt hatte.
Inzwischen hatte ich meinen Englischschülern ihre Proben, die sie eine Woche zuvor geschrieben hatten, zurückgegeben und wir besprachen sie. Sie waren überhaupt nicht zufrieden mit dem Resultat beziehungsweise mit ihren Noten - ich noch weniger.
„Wie kommt es“, fragte ich, „dass nur so wenige die Wörter auf Seite 61 gelernt haben?“ In der Probe handelte es sich um drei Aufgaben. Bei der ersten ging es darum, die Monatsnamen hinzuschreiben (da gab es wohl kaum etwas zu lernen für eine Klasse, bei der die meisten bereits mehr als zwei Jahre Englisch gehabt hatten), bei der zweiten musste man etwa zehn Wörter verschiedenen Bildern zuordnen („the moon“ und ein Bild vom Mond, etc.) und bei der dritten Aufgabe mussten ein paar Wörter übersetzt werden. Zusätzlich galt es zu unterstreichen, welche Silbe betont wird. Aus einer Liste von zwanzig Begriffen waren es zehn Wörter, die meist auf der ersten Silbe betont werden („lightning“ z.B.). Selbstverständlich hatten wir das geübt und ich hatte in der letzten Stunde gefragt, ob eines dieser Wörter nicht bekannt sei. Zwei wurden gefragt, die wurden übersetzt, die restlichen also waren offenbar klar. – Aber nein, eine Schülerin warf mir ziemlich vorwurfsvoll vor, es hätte sie viel Zeit gekostet, all diese Wörter zu Hause übersetzen zu müssen. Wieso sie in der Stunde nicht gefragt hatte, konnte sie mir auch nicht erklären.
Eine andere Schülerin übertraf alle meine Erwartungen betreffend Erklärungen, sie beklagte sich nämlich, dass es bei dieser letzten Aufgabe ja nur ums Betonen gegangen sei, ich hätte ihnen nicht gesagt, dass man auch die Bedeutung kennen müsse. – Jetzt gebe ich seit mehr als zwanzig Jahren Schule, aber das ist mir noch nie passiert. Jetzt hatte ich doch tatsächlich vergessen, ausdrücklich zu sagen, dass nicht nur die Betonung stimmen sollte, nein, unvorstellbar, man sollte auch noch die Bedeutung des Wortes kennen, das für die Probe gelernt werden musste. - Ja, das hätte ich sagen sollen. Sonst habe ich dann in einem Jahr eine Klasse voller Schüler, die wunderbar betonen können, aber keine Ahnung haben, was sie sagen. - So lernt man eben immer wieder dazu! - Vor Jahren mal (Google war damals noch unbekannt) hatte ich von einem Schüler eine ähnlich erstaunliche Antwort erhalten. Auf die Frage, weshalb er die Aufgabe nicht hatte machen können, erklärte er mir, da sei eben ein Wort drin gewesen, das er nicht verstanden habe. - Damals hatte ich auch etwas gelernt. Von da an riet ich meinen Schülern gleich von Anfang an, wenn sie schon freiwillig eine Sprache erlernen wollten, wäre es von Vorteil, sich auch ein Wörterbuch anzuschaffen. Es könnte ja immerhin sein, dass man mal ein Wort nicht versteht oder gar eines nachschlagen möchte…
Nun, nach der Englischstunde fuhr ich los in die Stadt, fand zum Glück auch einen Parkplatz und nahm dann, nach meinen eigenen sieben Lektionen Schule, an einem Teachers-Workshop in der Buchhandlung Stauffacher teil, organisiert von OUP. Gerade sechs interessierte Lehrerinnen waren wir dort. Es gab etwas zu trinken, ein paar nützliche Broschüren und Auskünfte. Anschliessend fuhr ich zu Denise, wo unser „Bookworm-Meeting“ stattfand, das ausnahmsweise von gestern auf heute verschoben worden war. Ich hätte schwören können, dass man mich über diese Verschiebung nicht informiert hatte. So war ich schon gestern dort gewesen. Bei strömendem Regen stand ich vor der Tür, alles war dunkel - ich hatte fast eine Stunde verloren.
Heute nun hatte ich das Buch, das besprochen wurde, natürlich nicht bei mir, genauso wenig wie meine Notizen, da ich ja erst im Laufe des Tages erfahren hatte, dass das Treffen an diesem Abend stattfinden würde.
(Diese Lesezirkel mochte und mag ich sehr gern. Sie finden auch jetzt noch immer etwa sechs- bis achtmal pro Jahr statt. Normalerweise sind wir ungefähr zu acht. Wir lesen einen englischen Roman und eine Kollegin, deren Muttersprache Englisch ist, bereitet einen Fragebogen vor, den wir vorab beantworten. Und so treffen wir uns jeweils im Turnus bei einem Mitglied unserer Gruppe und besprechen das Buch bei einem einfachen Nachtessen, angeregte Diskussionen inbegriffen.)
Um halb elf war ich zu Hause nach einem langen Tag, steckte Müllers Diskette ins Laufwerk A und musste feststellen, dass überhaupt gar nichts auf der Diskette war. Gopfriedli! – Statt morgen um neun in der Schule meinen Sieben-Lektionen-Tag zu beginnen, musste ich nun schon vor acht dort sein, denn vermutlich hatte er das Dokument auf irgendein anderes, falsches Laufwerk gespeichert. Was für eine Freude! - Wenn ich früh genug dort war, konnte ich vielleicht noch herausfinden, was genau da gelaufen war. Und zugleich kam mir in den Sinn, dass ich vergessen hatte, nach der Englischstunde am Abend den Informatikraum abzuschliessen und die Geräte abzustellen. Jetzt war’s dafür zu spät, aber vielleicht auch ganz gut, so hatte ich die Möglichkeit, herauszufinden, wo Herrn Müllers Probe abgespeichert war.
Um Viertel vor acht war ich in der Schule, der bsd., gerade rechtzeitig, bevor der Raum von einer anderen Klasse belegt wurde. - Letzte Dateien: Gar nichts war zu finden. Ich konnte mir keinen Reim darauf machen, was passiert war. Schliesslich hatte mir Herr Müller doch die Diskette abgegeben und sich verabschiedet. Er hätte doch sicher etwas gesagt, wenn er die Aufgabe nicht gemacht hätte. – Im Sekretariat dann erfuhr ich seine Telefonnummer - privat und Geschäft. Und sah, dass ein ganzes „Müller-File“ existierte, ein grosses Dossier mit x Verwarnungen und sogar zwei oder drei richterlichen Verzeigungen. Der muss mir ein Früchtlein sein, dachte ich mir; sein Hobby scheint es zu sein, unentschuldigte Absenzen zu sammeln. Kosten scheut er offenbar keine. Ich rief an und erreichte ihn zu Hause. Ja, er habe das nicht machen können, es sei nicht gegangen, da habe es ihn angeschissen, was hätte er sonst tun sollen? - Wieso er denn nichts gesagt habe, fragte ich ihn und erinnerte ihn daran, dass ich ihm ja mit dem Nachschreiben der Probe entgegengekommen sei und dass ich seinetwegen unnütz Zeit verloren hätte. Ich war ziemlich sauer - er überhaupt nicht interessiert – das Wort „Entschuldigung“ ganz offensichtlich in seinem Vokabular nicht existent.
Nachträglich fragte ich mich, ob das „Nicht-Machen“ der Probe eventuell damit zusammenhing, dass ich ihm eine neue Probe vorbereitet hatte und nicht dieselbe, die seine Kameraden zuvor gemacht hatten. – Mit einem gewissen niedrigen Gefühl der Befriedigung trug ich alsdann eine 2 in sein Notenblatt ein, der Durchschnitt seiner Semesterleistung.
Die vier Lektionen mit meiner eigenen Klasse verliefen daraufhin sehr erfreulich, zwar waren gleich drei Schüler nicht aufgekreuzt (war der Grund die angesagte Probe?), aber eines der Ergebnisse der Deutschstunde war zumindest, dass sich die Klasse ziemlich einstimmig auf eine Lektüre einigen konnte, die wir im nächsten Semester lesen wollten. Und was ich total gut fand: Ein Schüler sagte, er lese sonst nie, war nun aber so begeistert von den drei ersten Seiten eines der vorgestellten Bücher, dass er darum bat, es mit nach Hause nehmen und dort lesen zu dürfen. - Was für ein Erfolg!
Um Viertel nach zwölf war die Schule aus. Wo war mein Schlüsselbund? - Nach zehnminütiger Suche fand ich ihn im Kopierzimmer, Gott sei Dank - schon wieder Zeit verloren für nichts. Und eine Kollegin brachte mir den Rodel, den ich im Lehrerzimmer hatte liegen lassen. Diesen hatte ich zuvor auch gesucht, dachte aber, ich würde ihn dann zu Hause in all meinen Unterlagen, die ich vorher in der Eile in meine Mappe gestopft hatte, sicher wieder finden. - Ob ich ihr noch den Fragebogen zurückgeben könne über die Schülerbefragungen, den sie mir in mein Fächli gelegt habe, bat sie mich. Den hatte ich vollkommen vergessen; da war eine Entschuldigung fällig. Zu Hause würde ich heute Abend als Erstes danach suchen müssen. Vorerst aber fuhr ich in die Stadt, fand sogleich einen Parkplatz. Das ist meine Stärke. Ich finde immer einen. Zwar nicht immer einen legalen, aber auch Bussen habe ich selten, obwohl ich stundenlang auf gelben Feldern parkiere. Der „Verkehrsgott“, jedenfalls derjenige des stehenden Verkehrs, meint es gut mit mir. Derjenige, der für die Vergesslichkeit zuständig ist, leider weniger.
In der Buchhandlung Stauffacher kaufte ich ein Buch und merkte beim Zahlen, dass meine Postcard fehlte. Ich nervte mich ob mir selbst. Immer dieses „Gjufu“. Genauso passiert es eben; ich musste mir in Ruhe überlegen, wo ich die Karte zum letzten Mal gebraucht hatte.
Und dann war die Zeit schon wieder knapp. Weiter ging‘s in die Lorraine, in die BMS - noch drei Lektionen. Dort angekommen lief ich unserem ehemaligen Direktor in die Arme, buchstäblich fast gar. Ich konnte ihn ja nicht einfach so stehen lassen, das wäre unfreundlich gewesen, also plauderte ich ein wenig mit ihm, kam dann allerdings fünf Minuten zu spät in die Klasse. An dem Tag aber machte das gar nichts, da die Schüler im Grunde genommen gar nicht zu kommen brauchten, sie hatten die schriftlichen Prüfungen bereits abgelegt, es ging lediglich darum, fürs Mündliche zu üben mit denen, die wollten. Es wollten zwei. Aber nicht lange. Dann wollten sie bei dieser Hitze lieber baden gehen. Ich auch. So wurde aus zwei Lektionen nur knapp eine einzige. - Zwei Stunden Zeit bis zur nächsten Lektion: Das reichte grad knapp für einen Besuch im Marzili. Nach einem kurzen, kühlen Bad in der kalten Aare legte ich mich ins Gras, nahm mein Buch hervor und schlief gleich ein. Nicht lange. Mir kam nämlich in den Sinne, dass ich am nächsten Tag zum Arzt würde gehen müssen. In meiner Agenda wollte ich nachschauen, wann genau, aber die war nicht aufzufinden. Ich musste sie am Morgen in der Schule vergessen haben. Ende also der Musse. Rasch zog ich mich wieder an und raste unverzüglich in die Postgasse (durch die Matte, wo nur Zubringerdienst gestattet war - das hätte mich 120.— Fr. Busse gekostet, wenn da nicht auch der Gott des fliessenden Verkehrs ein Einsehen gehabt hätte), suchte überall nach meiner Agenda, aber sie war nirgends. Zurück in der BMS blieb für diesen Tag noch eine letzte Stunde Unterricht übrig. Trotz aller Hektik schaffte ich es rechtzeitig ins Schulzimmer – zu einer sehr erfreulichen Stunde. Es ist jeweils ein Hit, wenn die Schüler motiviert sind und die Fremdsprache auch anwenden wollen. Ich kämpfe in manchen Klassen vergeblich dagegen an, dass, sobald ich den Rücken gedreht habe, die Schüler Berndeutsch weiterplappern. Hier nicht. Das war ein riesiger Aufsteller! Ich sagte es ihnen.
Um Viertel nach sechs war mein Arbeitstag zu Ende. Im Englisch-Vorbereitungszimmer stellte ich den PC an – Zeit, mich wieder um den Verbleib der Agenda und der Postcard zu kümmern. Inzwischen hatte ich mir überlegt, dass ich sie vielleicht im Migros Ostermundigen hatte liegen lassen. Ich rief an, aber dort war sie nicht aufgetaucht.
Mein nächster Anruf war nach Hause, wo mir Theo sagte, die Buchhandlung Stauffacher hätte angerufen. Sie hatten meine Agenda gefunden, ich könne sie abholen. – Was für eine Freude! - Und bei erneuter Durchsicht meiner Handtasche fand ich auch tatsächlich meine verloren geglaubte Kreditkarte wieder. Zuunterst war sie, dort, wo sie überhaupt nicht hingehört. Aber Hauptsache, sie war da. Ich hatte sie also buchstäblich in meiner Handtasche verloren… „Was bin ich nur für ein Chaot?“, dachte ich.
Ein feines Nachtessen, ein himmlischer Wein und ein Bridgeabend mit Freunden, wo ich recht gute Karten hatte, stellten mich vollends auf. Um Mitternacht war ich zu Hause.
Am nächsten Morgen nahm ich’s gemütlich. An dem Tag hatte ich frei. Zwar fand ich schon wieder den Schlüsselbund nicht, musste den Ersatzschlüssel aktivieren. Den Fragebogen fürs Sekretariat wenigstens hatte ich gefunden. Ich füllte ihn aus und brachte ihn mit den nötigen Entschuldigungen in die Schule.
Meine Agenda und auch das Etui mit meinem Fahrausweis, das ich bei Stauffacher ebenfalls beim Zahlen auf den Tresen gelegt haben musste, als ich nach der Kreditkarte suchte, das ich aber noch gar nicht vermisst hatte, waren wieder in meinem Besitz. Als ich dann am Mittag sogar noch meinen Schlüsselbund wieder fand, war die Erleichterung gross. Ich musste ihn in der Nacht zuvor, als ich heimkam, auf den Stuhl in der Garderobe gelegt haben und dort war er heruntergefallen.
Im Nachhinein kam mir alles vor wie im Märchen mit Happyend. Wie lange diese Glückssträhne anhalten würde, wusste ich natürlich nicht, konnte nur hoffen.
Ein Freund von mir, ein Spanier, hatte mir gestern Nachmittag im Marzili gesagt, diese Woche sei das eben so bei den Wassermännern. Da vergesse man alles. - Das war ausserordentlich beruhigend. Wenn’s sogar im Horoskop stand, konnte ich ja kaum selber verantwortlich sein für das ganze Chaos.
Projektwochen in den beiden Berufsschulen
Jedes Jahr wurde je eine Projektwoche organisiert. Zweck davon war es, den Schülerinnen und Schülern ein besonderes Erlebnis zu bereiten und ihnen die Möglichkeit zu bieten, sich für einmal intensiver mit einem bestimmten Thema zu befassen.
Ich konnte nur selten mitmachen, da ich ja an beiden Schulen angestellt war und somit nicht beliebig einsatzfähig war.
„Alkohol“ aber war mal ein Projekt, bei dem ich eine Kollegin unterstützen konnte. Der Kurs beinhaltete Besuche bei der Polizei, beim Blauen Kreuz, in einer Entziehungsanstalt und natürlich Internet-Recherchen.
„Eine eigene Homepage kreieren“ war ein weiteres Thema, das ich zusammen mit einem Kollegen anbot. Das ist aber sehr lange her – noch im letzten Jahrtausend war das...
Beliebt waren die BMS-Exkursionen in ein anderes Land. Diese waren in der Regel sofort ausgebucht. Nur gerade zum Vergnügen durften diese Reisen natürlich nicht sein. In den Anfängen zwar, als diese neu in den Jahreslehrplan einflossen, wurde alles von den Lehrpersonen selber organisiert. Erst später änderte sich das Prozedere. Museumsbesuche, Betriebsbesichtigungen und auch Theaterbesuche mussten von den Schülerinnen und Schülern selber organisiert werden. So lernten Sie Unterkünfte buchen, Zug- oder Flugreisen reservieren, miteinander im Team arbeiten und entscheiden, welche Vorstellungen oder Aktivitäten gemeinsam besucht werden sollten etc. Auch für mich waren diese Erkundungstouren besondere Erlebnisse. Gut erinnere ich mich an Besuche in Prag, Amsterdam, Berlin und München.
An die vier Tage in München im Mai 1996 erinnere ich mich besonders gut, weil ich dort einen Bericht schrieb, den ich hier einfüge:
Die Sonnenbrille hätte ich nicht einzupacken brauchen. Auch den Sommerrock nicht. Den Regenschirm aber schon. Auch hätte ich Handschuhe, warme Pullover und Socken sowie wetterfestes Schuhwerk brauchen können. So ausgerüstet hätte ich aller Unbill unerschrocken trotzen können. So aber nicht. lch hatte mir Mühe gegeben, meinen Koffer möglichst geschickt und effizient zu packen. Was mir lediglich gelang, war, ihn voll zu kriegen - voll mit unnützen, unbrauchbaren Utensilien wie T-Shirts und dergleichen. Die T-1Shirts wären wenigsten sommerlich farbig gewesen, der Rock ebenso, aber die spärlichen wärmeren Sachen, die ich bei mir hatte, präsentierten sich eher eintönig, ähnlich wie das Wetter. Schwarz und Grau waren die vorherrschenden Farben. Das kommt daher, dass ich eben finde, Schwarz passt zu fast allem, vor allem zu Schwarz.
Die Reise war billig; die Pension „Diana“ dementsprechend. Der miefige Geruch im Frühstückszimmer war auch mit rund um die Uhr geöffneten Fenstern nicht wegzukriegen. Aber wir waren vorbereitet. Wir wussten, dass es pro Etage nur eine Dusche hat. Was wir nicht wussten, war, dass es nur eine einzige Etage gab, vermutlich mit rund dreissig Betten. Und ausgebucht. Es gab auch nur eine Damentoilette. Aus sicherer Quelle weiss ich, dass sie nicht nur von Damen benutzt wurde.
Dafür wurden wir reichlich entschädigt mit unseren Zimmern: Whirlpool, eine reich bestückte Minibar, ein gemütliches Cheminée und jede Menge Platz. So jedenfalls in lvos Phantasie. Einzig das gebündelte Licht des Nachttischlämpchens entsprach nicht ganz seinen Vorstellungen von ambienter Beleuchtung. Er fand, jeder Röntgenstrahl müsste vor Neid erblassen.
(In der Klasse BMSC4C war Ivo der Klassenlehrer (Deutsch); er hatte die Exkursion organisiert, ich war lediglich die Begleitung, kannte aber die Klasse, da sie bei mir Englisch hatten.)
Eines unserer „Probleme“ war, wie viel Freiheit wir unseren Schülern lassen sollten bei der Gestaltung ihres Aufenthalts. Wir kamen bald überein, diverse Programme vorzuschlagen und zu versuchen, ihnen diese schmackhaft zu machen. Die endgültige Wahl sollte dann bei ihnen liegen, und wir waren uns einig, dass wir niemanden zu seinem Glück zwingen wollten. Nur einmal übten wir einen sanften Druck auf sie aus. Um den üblichen und ausschliesslichen Besuch des „Pizza Hut“ oder des „McDonald“ zumindest einmal mit Sicherheit zu umgehen und unseren „Kids", wie lvo sie oft nannte, ein authentisches München - Erlebnis aufzuzwingen, reservierten wir kurzerhand für uns alle zwei Tische in einem echten Münchner Lokal, angeblich dem ältesten Gasthaus der Stadt. Im Merian-Führer steht:
„0riginell und ,urig‘ ist es in jedem Fall!“. ,Derb' und ,deftig‘ wären meiner Meinung nach auch noch zwei passende Adjektive in diesem Zusammenhang. Nicht ganz einfach war es hingegen, auch unsere Vegetarier mit ein paar beruhigenden und aufmunternden Worten dazu zu bewegen, sich mit uns ins Abenteuer zu wagen und sich durch nichts, auch nicht durch die Lektüre der Speisekarte, abschrecken zu lassen. Dies gelang nach vereinten Anstrengungen nahezu perfekt. Alle waren dabei. Allerdings regte sich gewisser Widerstand oder eher Widerwille beim Aussuchen der schmackhaften Gerichte. So waren schliesslich eher Salat und Käsespätzle mit Zwiebelschweize gefragt; eindeutig weniger begehrt waren Spanferkel und Bratenpfannerl, süss-saures Lüngerl mit Knödel, Schweinelendchen (auf die Betonung kommt es an), Ochsenbrust (oder zumindest ein Teil davon), Schweinsherz gesotten (lieblos, diese Bezeichnungen - nicht wie in Frankreich), Surhaxen und Tellerfleisch (?). Auch zu Presssack (Sülzwurst aus gepökeltem Schweinskopf) fehlte den meisten der Mut.- Bedient wurden wir von grazilem, zurückhaltendem weiblichem Servierpersonal…
Niels war am ersten Abend der Bierschwemme wohl nicht ganz gewachsen. Er versicherte am nächsten Tag glaubhaft, er habe nicht bemerkt, dass er den Polstersessel in der Pension mit dem Aschenbecher verwechselt habe. Aber eine Visitenkarte, die er in Form seiner Brille am Tatort zurückgelassen hatte, liess kaum mehr Zweifel offen. Zum Glück war der Pensions-Wirt ein Mann mit Nerven wie Drahtseile und zweifellos etliches von seinen Pensionären gewohnt. Er wies nur auf die Brandgefahr hin und liess sich auch nicht durch die blau verfärbte Dusche (siehe weiter unten) aus der Ruhe bringen. Ob er sich auch durch den absonderlichen Geschmack der Räucherstäbchen, der aus einem bestimmten Zimmer drang, nicht hat beirren lassen, wissen wir nicht. Als wir gingen, hat er sich gar noch entschuldigt, dass die Pension höheren Ansprüchen wohl nicht ganz genüge.
Nachtruhestörung wäre noch ein weiteres behandlungswürdiges Thema, aber das lasse ich jetzt besser. Am letzten Abend war es übrigens Andreas, der einschlägige Erfahrungen mit Bier machte. Zugegeben, Biergenuss ist ein absolutes „Muss" für so manchen Besucher der bayrischen Hauptstadt, aber einer gewissen Standfestigkeit bedarf es natürlich allemal. Ob er je in seinem Leben wieder mal ein Bier trinken wird, ist fraglich. Kleinlaut gab er am nächsten Morgen jedenfalls zu, dass ihm schon beim blossen Anblick dieses Gebräus fast wieder übel werde.
Auch geraucht wurde zeitweise masslos. Aber der Versuch der beiden Philipp (oder war einer der beiden Niels?), im Frühstückszimmer diesem Laster zu frönen, wurde jäh, endgültig und ohne den geringsten Zweifel an der Unanfechtbarkeit seiner Worte offen zu lassen von einem Berner Mitbewohner der Pension abgebrochen oder noch besser gesagt im Keime erstickt. Was dieser, der offenbar schon länger in München weilte und der sich die erfrischend offene unmissverständliche Sprache der Bewohner dieser Gegend bereits angeeignet hatte in ein paar wenigen Sätzen zustande brachte, war bemerkenswert. Zugegebenermassen war seine Botschaft nicht sehr diplomatisch, dafür umso effektvoller und effizienter. Um das Gleiche zu erreichen, hätte es unsererseits wohl eines längeren Gesprächs unter vier Augen bedurft. „Sou-gruusig" sei es, donnerte er, und die Wirkung seiner Worte blieb nicht aus. Augenblicklich wurden die Glimmstengel gelöscht und wir konnten von da an jeden Morgen unser Frühstück rauchfrei und bar jeglicher Diskussion sozusagen in Minne geniessen.
Zur Farbe Blau: Sie spielte bei unserer Exkursion eine nicht unerhebliche Rolle. Ich will hier nur auf einen Teilaspekt des ganzen Problemkreises eingehen. Dieser zeigte sich am zweitletzten Tag unübersehbar auf den Köpfen unserer beiden Damen Marlène und Fränzi. „Blue is beautiful“. Auch die bläulichen Hände (an Wasserleichen erinnernd) verrieten klar und deutlich, wer von den jungen Herren ohne Schutzhandschuhe den Damen beim Haarefärben (in der einzigen Etagen-Douche, wie gesagt) geholfen hatte.
Auch von kulturellen Höhepunkten kann ich berichten, von einem Theaterabend auf den Spuren Karl Valentins: Wer da freiwillig mitkam, und das waren doch immerhin Niels, Philipp B. und Andreas (da noch in makelloser Verfassung), bekam noch ein weiteres Stück münchnerischer Wirklichkeit mit. Es war ein Sprachkurs der besonderen Art, ein schrulliges Volkstheater, bei dem auch der lederhosige Präsentator mit den üblichen baarischen, damischen, depperten Sprüchen nicht fehlte. (Ein Junge ruft aus dem Badezimmer seiner Mutter zu: „Wo ist denn der Waschlappen?" - Die Mutter antwortet: „Seit einer Stunde im Büro!“)
Wir wissen jetzt auch, was 'et cetera' bedeutet: Der Bayer braucht eine Frau fürs Putzen, Kochen, Waschen etc. - Und zusätzlich wurden wir ins Bild gesetzt über weibliche und männliche Nomen, die männlichen, die das Schöne verkörpern (der Mond, der Tag, der Duft, der Frühling, der Sonnenschein und natürlich auch der Busen, obwohl der ja schon auch weiblich ist) und die weiblichen folgerichtig das Schlechte (die Lüge, die Niedertracht, die Gemeinheit und nicht zuletzt die Steuer).
Auf so viel derbe Lustigkeit folgte sogleich ein rigoroser Szenenwechsel, nämlich ein Discobesuch im Herzen Schwabings. Dorthin geführt wurden wir von Fränzi und Marlène (jetzt aus bekannten Gründen äusserlich ziemlich blau) und Michael S., die uns unbeirrt und zielsicher durch die ,Szene' an den Ort des Geschehens führten. Hier war es allerdings so, dass der Rauch eher weniger das Schöne verkörperte hingegen ‚die Lautstärke‘ natürlich schon.
Erneuter Szenenwechsel kurz vor Mitternacht; Dislozierung zur Disco „An der Tankstelle“. Da waren dann wieder fast alle mit dabei, ausser dem unzertrennlichen Trio Cornelius, Philipp Z. und Raffaele. Einmal mehr gingen sie ihre eigenen Wege. Fehlen tat auch Michael L.; bei ihm allerdings wussten wir genau, wo er war und was er dort trieb. Er lag bereits im Bett, der ständigen Übermüdung schliesslich nicht mehr gewachsen. Dafür konnten unsere Damen Peter (schon im Pyjama), der kollegialerweise seinen Freund nicht hatte im Stich lassen wollen, offenbar problemlos überreden, sich doch noch loszueisen und mitzukommen. Er schien sehr zufrieden!
Loszueisen versuchte ich auch Ivo, und zwar um drei Uhr morgens aus besagter Disco. Dies war ein eher schwieriges Unterfangen, denn er war dabei, eine nicht mehr enden wollende Tanzeinlage zum Besten zu geben, wohl inspiriert von Philipp B., der in inniger Versenkung das Ganze anschaulich vorgelebt hatte. Auch Denis war gelegentlich auf der Tanzfläche zu sehen. So gab's wenigstens zwischendurch einen freien Platz zum Sitzen. Seine Spezialität ist es nämlich, sich ohne Rücksicht auf Verluste und in liebenswerter Weise den einzigen frei verfügbaren Platz zu ergattern, sei dies im Tram, in der U-Bahn oder eben in der Disco. Naturgemäss hat jedermann dafür Verständnis; schliesslich leben wir im Zeitalter der Gleichberechtigung.
Andersartige Studien betreiben konnten wir auf den Spuren der deutschen Sprache. Da lernten wir so manches. Wir begriffen rasch, dass auf präzise klare Formulierungen und zackige Bekanntmachungen grösster Wert gelegt wird. Das wird bereits in Tram deutlich. Die „Notfallapotheke A für Kraftwagen" findet man sofort. Aber eigentlich beginnt es schon bei der gedeckten Haltestelle. Es heisst dort im Klartext: „Dies ist eine Strassenbahnhaltestelle. Der Aufenthalt zu anderen Zwecken ist nicht gestattet."
Aber erstaunlich war es doch: Die Tatsache, dass strikte Anweisungen ja bekanntlich wie nichts anderes dazu verleiten, sie zu verletzen oder zu umgehen, scheint dem U-Bahn-Management zumindest nicht ganz fremd zu sein. So hat sich ein findiger Pädagoge daran gemacht, diesem Missstand entschieden entgegenzutreten, und er hat's mit Humor versucht, und zwar mit Humor vom Feinsten. Mit einer Witzzeichnung und einem flotten Spruch in Versform (hab' ihn leider nicht aufgeschrieben, da Projekt für Reisebericht damals noch nicht geboren), im Sinne von: „... tut's dem Nachbarn in den Ohren jucken, ..." (auch der dazugehörige Reim ist leider meinem Gedächtnis entschwunden), wurde der bemerkenswerte Versuch unternommen, die Klientel dazu zu bewegen, den Walkman in angemessener Lautstärke einzustellen. Allerdings liessen sich die anfänglichen guten Vorsätze nicht ganz konsequent zu Ende führen, denn schon im zweiten Teil des Textes driftet der Verfasser in die herkömmliche Sprache ab, und es wird, ohne Umschweife diesmal, mit allfälligen Massnahmen gedroht, wenn man sich nicht vorschriftsgemäss verhält. - So nahm also ein psychologisch äusserst geschickt angelegter Versuch, gegen die Verstösse wider Zucht und Ordnung vorzugehen, ein klägliches Ende.
Bemerkenswert war auch der Hinweis neben dem Fenster im vierten Stock in unserer Pension: „Notausstiegstelle. Fenster bitte freilassen." - Von aussen war absolut nirgends eine Nottreppe auszumachen.
Überhaupt hat sich Ivo fast zu viele Gedanken gemacht über den besonderen Sprachgebrauch oder auch über die Auswüchse der Sprache; er ist ja schliesslich Deutschlehrer. Gegenstand vertiefter Betrachtungen war die Tatsache, dass man eine Fahrkarte „entwerten" soll, um sie sogenannt in Kraft zu setzen. Solche negativen Wörter könnte man doch ohne weiteres ersetzen mit „einwerten" zurn Beispiel oder mit "gültig stempeln" oder ähnlichem, man müsste sich dies schon noch genauer überlegen. Auch etwas gelernt hat Ivo. Er weiss jetzt nämlich, dass ein englisch ausgesprochenes Stück Fleisch nicht „Schtiik" heisst; er sagt jetzt lieber "Plätzli".
Noch ein paar Worte zum ZAM (Zentrum ausserordentlicher Museen), welches unsere „Kids“ leider allesamt verpassten, da sie sich nicht aus ihren Betten bewegen konnten (wollten). Dort lernten wir unter anderem in Wort und Bild die tatsächlichen Hintergründe und Ursprünge des Phänomens ,Osterhase' kennen. Offenbar handelt es sich dabei um das Endergebnis der Kopulation zwischen einem Hahn und einer Häsin. Das Produkt war ausgestopft in verschiedenen Variationen zu besichtigen. Dem Präparator ist offensichtlich seine Phantasie völlig aus den Fugen geraten; durch solche Spielereien angeregt, produzierte er nämlich noch andere ausserordentliche Tierkreuzungen, alle im Detail an Ort und Stelle zu besichtigen. Auch wissen wir jetzt, um was für einen Gegenstand es sich bei einem ,Bourdalou' handelt. Auf den ersten Blick könnte man denken, es sei so etwas wie eine Saucière. - Nachttöpfe aus aller Herren Länder, vermoderter Kram der verehrten Kaiserin Sissi und andere Sonderlichkeiten mehr machten den Besuch in diesem skurrilen Museum zum Erlebnis der besonderen Art.
Und dann das Hofbräuhaus! - Schon in dessen Einzugsbereich (mindestens 100 m im Umkreis) wusste man mit untrüglicher Sicherheit, dass man auf dem rechten Weg dorthin war. Torkelnde, bierselige, lallende, hemdsärmelige Fröhlichkeit wankte uns da entgegen – München, wie es leibt und lebt. Und um das Bild abzurunden, gesellte sich dazu noch das lustige Völklein der Fussballfans, die in ihren frohen gelbgrünen Blusen durch die Strassen grölten.
Vermutlich wird in dieser Stadt pro Tag mehr Bier als Wasser umgesetzt. Auch Cornelius schien sichtlich beeindruckt von der Aussage eines Insiders, der es in 12 Stunden auf 17 Mass gebracht haben soll (oder war es umgekehrt?).
lvos Vorschlag, am Sonntagmorgen mit ihm das Orgelkonzert und den Gottesdienst in der Frauenkirche zu besuchen, fiel auf taube Ohren. Er war der Einzige, der diesen Plan in die Tat umsetze; nicht einmal ich war dazu bereit. Zum Glück jedoch, denn sonst hätte ich seine anschauliche, pathetische Wiedergabe und Zusammenfassung des Erlebten verpasst, und die war auf jeden Fall wesentlich eindrucksvoller als es das Original je hätte sein können.
Beim letzten Frühstück war niemand mehr sehr gesprächig, auch Felix nicht. Er sass bloss da und sagte überhaupt gar nichts. Mir war's recht, denn ich wollte unbedingt noch die einzige Ansichtskarte schreiben, die ich schon frankiert hatte und seit zwei Tagen leer und mit bereits leicht lädierten Rändern mit mir herumtrug. So sass ich bei meiner Tasse Tee; aufs sonntägliche Frühstück hatte ich verzichtet, da es lediglich aus zwei Scheiben gummiartigem Brot bestand. Aber nach nur fünf Stunden Schlaf war mein Geist noch nicht sehr rege, und sämtliche brillanten Ideen waren mir ausgegangen. Da stand mir in verdankenswerter Weise Ivo einmal mehr hilfreich zur Seite mit äusserst brauchbaren Vorschlägen. Er sagte, ich solle schreiben: „Besonders beeindruckt standen wir vor dem stillen, in sich gekehrten Wesen der Bayern.“ Und noch etwas Weiteres fand er erwähnenswert: „Wie auf Flügeln trug uns der Anblick der grazil gebauten Landestöchter.“ Da war die Karte voll. Und so geht endlich auch mein Reisebericht seinem Ende entgegen.
Fazit: München ist mehr als nur eine Reise wert. Es ist immer gut, wenn man bei der Heimreise genau weiss, was mal beim nächsten Besuch noch alles planen kann. Vielleicht wird es mir ein anderes Mal sogar gelingen, hinter das Geheimnis der Verteilung der Hausnummern in dieser Stadt zu kommen. Welches System dem genau zugrunde liegt, ist mir ein Rätsel. Da gibt es beispielsweise Strassen, wo plötzlich auf ungerade Nummern gerade folgen in unwillkürlicher Anordnung; auch werden Nummern ganz einfach übersprungen oder noch verwirrender: Dieselbe Strasse ändert unvermittelt ihren Namen. Die Adresse „Im Tal 10' gibt es gegenüberliegend auf beiden Strassenseiten. Für Eingeweihte ist das sicher kein Problem, aber für Touristen kann es durchaus zu einem werden.
Einmal möchte ich gerne durch den Englischen Garten schlendern (vielleicht kommt es auch in München vor, dass die Sonne scheint), auf den Olympiaturm steigen (war zwecklos, da alles Grau in Grau), die Neue Pinakothek besuchen (lag nicht drin aus Zeitmangel; eine Schande, ich weiss), ebenso Schloss Nymphenburg und manches andere mehr - was haben wir denn eigentlich gemacht die ganze Zeit?
Erwähnen will ich zur Beruhigung aber doch noch, dass wir gleich am ersten Tag, kurz nach Ankunft, gemeinsam eine Stadtrundfahrt unternommen haben. Ebenfalls waren wir alle zusammen im Deutschen Museum, auch wenn ich nicht im Besonderen darüber berichtet habe (einige von uns sind jetzt Experten im Bergbau). Auch die Bavaria Filmstadt war für uns ein fester Programmteil unseres ,Sightseeing'. Davon blieb ein mannigfaltiger Eindruck zurück. Sicher werden wir die erfrischende Fahrt im offenen Bähnli durch das weitläufige Gelände nicht so rasch vergessen. Auch werden wir uns stets an unsere Statisten erinnern, an Ivo als angetrunkenen Kapitän, Philipp B. als Liebhaber in Not und an Philipp Z. mit einer Schönen auf dem Untier durch die unendliche Geschichte schwebend.
Bevor nun meine Geschichte auch unendlich wird, komme ich zum Schluss. - So gut auch alles gegangen war, froh war ich trotzdem, als wir schliesslich alle vollständig und unversehrt im Zugabteil sassen, bereit zur Heimfahrt. Dass mir dann die Klasse kurz vor Bern eine Rose überreichte und einen kleinen uralten Asbach, hat mich gefreut und gerührt. Ich nehme die Rose als Ausdruck dafür, dass alle mit ihrer Exkursion zufrieden waren und sie in bester Erinnerung behalten werden.
Den Bericht hatte ich in der darauffolgenden Woche geschrieben mit der Absicht, die Schülerinnen und Schüler zu ermuntern, ihre Erlebnisse ebenfalls zu Papier zu bringen. Nur wenige taten das tatsächlich, was uns ausserordentlich freute und einer schickte uns sogar einen Dankesbrief.
Witze und Humor
Witze hatte ich immer gern. Schon als Kind. Und was ich überhaupt nicht begreifen konnte, war, dass mir Erwachsene fast ausnahmslos sagten, sie kennten keine oder würden sie gleich wieder vergessen. – Ein paar Dekaden später hatte und habe ich keine Mühe mehr, das zu verstehen.
Meine Mutter berichtete mir einmal, der erste Witz, den ich erzählt habe, ging so: „Eine Mutter schickte ihr Kind in den Laden. Es sollte ein Kilo Mehl holen. Es brachte dann aber ein Kilo Zucker“. – Kinder haben eben andere Gemüter und auch einen anderen Sinn für Humor. Wie ich das lustig finden konnte, kann ich mir heute nicht mehr vorstellen, und ich weiss auch nicht, ob ich diese Überlieferung überhaupt glauben soll... – Allerdings, wenn ich sehe, was manchmal an „lustigen“ Videos und Texten übers Internet verbreitet wird, dann erscheint mir mein Kinderwitz noch fast plausibel.
Dass der Humor verschiedene Fassetten hat, ist schon klar. Nicht jeder kann über dasselbe lachen. - Nach wie vor liebe ich die Kleinkunst, Kabarett vor allem. Und das Schöne ist, man geht mit Freunden ins Kleintheater, hat sich wiedermal gesehen und einen äusserst vergnüglichen Abend zusammen verbracht. Vielleicht noch ein Nachtessen vor oder nachher – das Tüpfchen aufs i. – Weil ich einmal eine schlechte Erfahrung gemacht habe, sehe ich nun in der Regel erst auf YouTube nach, ob mir der Künstler, die Künstlerin passt oder nicht, wenn er oder sie mir unbekannt ist.
Als ich noch unterrichtete, begann ich normalerweise die Englischstunde mit einem Witz, mal kürzer, mal länger. So war garantiert, dass es zumindest einmal pro Stunde etwas zu lachen gab. - Natürlich war da zusätzlich eine unauffällige Vokabelübung mit inbegriffen.
Ein kleines Beispiel:
Clever Idea
I decided to stop worrying about my teenage son's driving and take advantage of it.
I got one of those bumper stickers that say:"How's my driving?" and put a 900 number on it.
At 50 cents a call, I've been making $38 a week.
Theos Job
Inzwischen arbeitete Theo bei der Unisource, einem Unternehmen der PTT, die am 24. April 1992 gegründet wurde und international mit den Tlekommunikationsgesellschaften von Schweden, den Niederlanden und Spanien zusammengeschlossen war. Am 1. Oktober 1997 wurde aus der Telecom PTT die Swisscom. Theo blieb der Firma treu bis er Ende 1999 das ausserordentliche Angebot erhielt, sich bereits mit 55 Jahren pensionieren zu lassen. Das liess er sich nicht zweimal sagen. Sein Grossvater hatte in Vicosoprano ein Hotel geführt und sich mit 45 Jahren in den Ruhestand versetzt. Das wäre auch Theos Ziel gewesen, das er nun um zehn Jahre verpasst hatte. Zehn Jahre vorher pensioniert zu werden, war aber auch nicht schlecht, vor allem, weil er kaum eine Lohneinbusse hatte, woran unsere vier Kinder nicht ganz unschuldig waren (Kinderzulagen).
Mit seinem Job bei der Swisscom war er allerdings immer zufrieden gewesen. Mit dem, was er ursprünglich gelernt hatte, hatte seine effektive Arbeit jedoch wenig zu tun. Es ging darum, Verträge auszuhandeln und dazu musste er auch hin und wieder in Schweden, Holland oder Spanien an Sitzungen und Verhandlungen teilnehmen.
War er aber daheim, genoss er seinen kurzen Arbeitsweg und ich war froh, dass er so gut wie immer mittags zum Essen heimkommen konnte. Das schätzte ich besonders wegen der Kinder sehr. So sahen und erlebten sie ihren Vater nicht nur am Abend und an den Wochenenden.
Auch ging er mit ihnen in den Frühlingsferien nach Bivio zum Skifahren. Sein bester Freund und dessen zwei Kinder gingen ebenfalls jeweils mit, so dass wir Frauen mal „frei“ hatten von Familie und Job und unsere Batterien in einem völligen anderen Umfeld wieder aufladen konnten. Was für ein wunderbarer Tapetenwechsel!
Da ich nicht Skifahren konnte und den Winter überhaupt nicht liebte, waren die Destinationen, die wir auslasen, immer weit im Süden, wo’s heiss und schön war. Ein paarmal führte uns die Reise nach Kenya, wunderbare Rundreisen in Indien sind mir unvergesslich, aber auch die Malediven, Thailand, Bali, Hongkong und Singapur waren Orte, die wir besuchten.
Reisen war schon immer etwas, das mir besonders gefiel und immer noch gefällt. Jetzt, wo auch ich pensioniert bin, erst recht.
Nach einer bestimmten Anzahl Jahren, die man im Schuldienst angestellt war, erhielten wir das Angebot, entweder eine Auszeit von zwei Wochen zu nehmen oder sich auszahlen zu lassen. In meinem Fall geschah das damals nach zwanzig Jahren zum ersten Mal. - Diejenigen von meinen Kolleginnen und Kollegen, welche die zweite Option wählten, konnte ich überhaupt nicht verstehen. Ein Drittel des Zusatzverdienstes ging ja für die Steuern weg und Zeit zu haben, ausserhalb der Schulferien eine Reise zu unternehmen – was konnte es Erstrebenswerteres geben in diesem Zusammenhang!
Mit dem Urlaub war auch die Möglichkeit verbunden, die Überstunden, die sich angesammelt hatten, abzubauen. Davon machte ich jedes Mal liebend gern Gebrauch und wählte das lange Quartal zwischen Herbst- und Winterferien, das ich überhaupt nicht liebte, für meine Auszeit. So konnte ich den grauen Herbsttagen im November, die immer kürzer, nässer und kälter wurden, entfliehen sowie auch der hektische Vorweihnachtszeit. Ich nutzte die Wochen dazu, in verschiedenen Schulen in Südamerika Spanisch zu lernen beziehungsweise meine Sprachkenntnisse, die ich mir in verschiedenen Kursen in Spanien angeeignet hatte, aufzufrischen und zu vertiefen. Auch besuchte ich Lehrerfortbildungskurse in den USA, einmal in La Holla, einen anderen in Fort Lauderdale. Den werde ich nie mehr vergessen, so intensiv und anstrengend war der. Ich beschreibe ihn später im Kapitel Reisen.
Diese langen Aufenthalte im Ausland waren natürlich nur möglich, als die Kinder schon älter waren und mich nicht mehr so sehr brauchten. Meine Mutter war ja auch immer noch da und konnte trotz ihres hohen Alters noch hie und da einspringen, wenn Not an der Frau war. Ich fand es zudem ganz gut, die Kinder und den Vater für eine Zeitlang alleine zurechtkommen zu lassen. Als ich im Jahr 1999 zum ersten Mal so lange weg war, war Kay ja bereits zwanzig und studierte, die Zwillinge achtzehn und der Jüngste lernte mit vierzehn zu kochen und seine eigene Wäsche zu waschen und zusammenzulegen (oder wohl zumindest im Schrank zu versorgen).
So konnte ich unbeschwert die Aufenthalte in Ecuador, Peru und Guatemala geniessen. In Guatemala kam mich Theo in den drei Wochen vor Weihnachten besuchen und wir unternahmen während dieser Zeit eine zehntägige Reise nach Nicaragua. Der Zweck davon war, mein „Patenkind“, das ich dort hatte (World Vision), zu besuchen.
Auch diese Reiseberichte im letzten Kapitel.
Meinen ersten langen Urlaub konnte ich sogar bis zum Ende des Semesters ausdehnen, also bis Ende Januar 2000. Am Tag vor Silvester 1999 flog ich heim und wir konnten den denkwürdigen Millennium-Übergang mit Freunden feiern.
Die erste Woche des neuen Jahres verbrachten wir anschliessend in Bivio mit der Familie. Da ich noch nicht wieder arbeiten musste, blieb ich ganz alleine dort. Für die Kinder (drei von ihnen waren bereits erwachsen) begann der Schul- und Unialltag wieder und obwohl Theo nun pensioniert war, hatte er sich anerboten, mit ihnen heimzufahren und sich dort um sie zu kümmern.
Inzwischen besassen wir seit ein paar Monaten selber ein Haus in Bivio, ein ebenso altes. Schon in den Achtzigerjahren, nach Vaters Tod, hatten Theo und sein Halbbruder das 450 Jahre alte Familienhaus geerbt und wir hatten einen Plan, wie es benutzt werden sollte: abwechslungsweise die eine oder die andere Familie jedes zweite Jahr. Nach den Ferien das Haus aufzuräumen und zu putzen, dass es meiner Schwägerin recht war, war ein Kunststück. Man musste das Wasser abstellen, damit es nicht gefror. Das dauerte mehrere Stunden. Putzen war dann recht schwierig. Heisses Wasser musste in Kübeln parat gestellt werden. Beispielsweise war’s auch nicht einfach, die Böden in dem alten Haus sauber zu kriegen, man sah fast gar nichts von der getanen Arbeit. Ebenfalls galt es, die ganze Bettwäsche auszutauschen. Wir hatten ja auch die vier kleinen Kinder, welche inzwischen irgendwie beschäftigt werden mussten. - Eine Putzfrau, die am nächsten Tag die Arbeit für uns erledigt hätte, wäre die Lösung des Problems gewesen, zumindest teilweise, aber meine Schwägerin und mein Schwager waren dagegen, jemandem einen Schlüssel anzuvertrauen. So ging ich nur wenige Male mit, später während Jahren aber nicht mehr, denn schon vom Anfang der Ferien an graute mir, wenn ich an den letzten Tag vor der Heimreisereise dachte. Theo nahm das gelassener. Er bot mir an, im Frühling ohne mich in die Berge zu gehen. Sein Freund ging jeweils mit und die beiden hatten sechs Kinder zu betreuen. Mir war das mehr als nur recht, ich konnte ja sowieso nicht Skifahren, und die Frühlingsferien fern der Familie in einem warmen Land zu verbringen, war zu jener Zeit das Höchste der Gefühle.
Ohne mein Zutun lernten die Kinder bald schon Skifahren. Es existieren Fotos und Videos aus jener Zeit, wo Kim im Pyjama im Skianzug steckt und ohne Strümpfe oder Socken in den Skischuhen.
Aber diese Bivio-Ferien waren im Jahr 2000 auch schon Schnee von gestern. – Nun waren die Kinder grösser, drei davon erwachsen.
Weil das Wetter strahlend schön war, es kaum Leute hatte auf der Piste, für die ich hätte eine Bedrohung sein können, und niemand von der Familie da war, der blöde Bemerkungen hätte machen können, hatte ich plötzlich die abenteuerliche Idee, doch noch Skifahren zu lernen. Und das in meinem Alter und nach all den Jahren, wo ich schon nur Panik bekam bei dem Gedanken, auf einem Brett zu stehen, das sich bewegt. Meine grösste Angst war, mich zu verletzen und im Spital zu landen. Nichtsdestotrotz nahm ich schliesslich Skiunterricht bei Nino, unserem Nachbarn.
Der Anfang war nicht einfach. Genau wie in meinen Vorstellungen machten mir schon nur die Skischuhe Mühe: eng, unbequem im höchsten Mass - keine Bewegung mehr möglich, fast wie in einem Gips. Spanische Stiefel?! – Mit war nicht einmal klar, ob es einen rechten und einen linken Ski gibt. – Aber all das lernte ich rasch. Genauso, wie mich richtig anzuziehen. Trotz blauem Himmel und Sonnenschein war es sehr kalt und aus Furcht, ich könnte mich bei dem Experiment zu Tode frieren, zog ich unter den Skihosen Manchesterhosen an, Strumpfhosen und dicke Socken, oben ein Hemd, dann zwei warme Pullis, darüber natürlich die Skijacke. – Es dauerte keine zehn Minuten und ich kam mir vor wie in einer Sauna, musste schnellstens die überflüssige Kleidung ausziehen.
Nie hätte ich gedacht, dass ich innerhalb einer Woche tatsächlich lernte, den ganzen Berg schlecht und recht hinunterzufahren von der Bergstation auf 2600 Meter zurück ins Dorf auf 1800 Meter bis vor unsere Haustüre. - Ohne Beinbruch!
Es bedurfte noch vieler Übung, bis ich einigermassen sicher auf den Brettern stand. An manchen Wochenenden übte ich das Gelernte und war fast ein wenig enttäuscht, als Ende März die Skisaison vorbei war. - Mein Stolz, dass mir das gelungen war, kannte fast keine Grenzen, und zum ersten Mal freute ich mich wie verrückt auf die Winterferien im nächsten Jahr, wo ich dann erneut Skifahren gehen konnte.
Es war im Februar 2000, als ich meine Arbeit in den beiden Schulen wieder aufnahm, und es vergingen kaum ein paar Tage, schon war ich wieder an den alten Trott gewohnt. Mit frisch aufgeladenen Batterien hatte ich zum ersten Mal fast eine volle Stelle, denn überall fehlte es an Lehrpersonal und mir war’s ganz recht, neue Überzeit anzuhäufen, die ich dann für den nächsten Urlaub nutzen konnte.
Den Kindern und mir, da ich nun Skifahren konnte, gefiel der Winter in Bivio immer besser und wir erwarben 2003 ein weiteres Haus („nur“ etwa 350 Jahre alt), so dass es uns und auch den Jungen möglich war, Freunde einzuladen und die Ferien mit ihnen zu verbringen.
Die Tatsache, dass wir an einem so schönen Ort zwei Häuser besitzen, ich aber im Sommer nicht gerne nach Bivio gehe, weil es mir am Abend dort zu kalt ist, hat dazu geführt, dass wir seit mehr als zehn Jahren unsere Ferien an fantastischen Orten verbringen können, weil wir Häuser tauschen. Ein Kollege hatte mich auf eine Internetplattform aufmerksam gemacht, die Haustausche vermittelt – eine wunderbare Sache. Im dritten Kapitel „Reiseberichte“ werde ich darüber Näheres erzählen.
Vorerst aber noch all die „Kurzberichte“ über meine Schwiegermutter, deren Besuche mich ständig zum Schreiben animierten. Zwar nicht, weil sie das wollte, nein, ich hätte ihr meine Berichte nie zeigen können/wollen, auch wenn ich schwöre, dass sich alles genau so zugetragen hat, wie ich es damals beschrieb. – Tatsächlich fand ich manches so komisch, dass ich gar nicht anders konnte, als es niederzuschreiben, wenn ich es nicht vergessen wollte.
Kurze Begegnung der seltsamen Art (1995)
Meine Schwiegermutter ist wieder mal aufgekreuzt. Es ist eine Eigenheit von ihr, ganz plötzlich da zu sein.
Mit einem bisschen Gespür würde das drohende Herannahen allerdings voraussehbar sein - unsere Katzen beginnen nämlich, kurz vor der unausweichlichen Begegnung, unruhig zu werden. Solches Verhalten bei Tieren sei ja auch bei Erdbeben zu beobachten, sagt man, allerdings auch dort offenbar zu spät, um rechtzeitig Vorkehrungen treffen zu können.
Zwar glaube ich nicht, dass es sich in unserem Fall um eine Erschütterung der Erde handelt - oder etwa doch? Ist es die Art der Schritte, die unsere Katzen von weither erkennen? Für sie lohnt die Angelegenheit jedenfalls - ohne Frage. Was die Schwiegermutter nämlich mitbringt, sind die Fleischresten ihrer Mittagsmahlzeit aus dem noblen Seniorenheim. Das heisst mit anderen Worten: Kalbsschnitzel, Rindsfilet, Lachs, Entrecôte - wie im Schlaraffenland. Und nie handelt es sich nur um armselige Überreste, nein, ganze Portionen sind es. Aus unerfindlichen Gründen ist Mutter nämlich der unumstösslichen Überzeugung, all diese leckeren Dinge seien ihr nicht bekömmlich. - Die Katzen danken es ihr.
So war es auch heute. Aufs Mal stand sie im Esszimmer, umschmeichelt von Häxli, Zwärgli und Charlie.
Eher lustlos trennte ich mich von der Übung, die ich gerade im Begriff war, in den PC einzugeben, und begrüsste unseren Gast. - Nein, trinken wolle sie nichts, sie müsse gleich wieder gehen, sie habe zu Hause noch so viel zu tun. - Das alte Lied…
Ob ich ihr noch zeigen könne auf der Landkarte, wo ihr Sohn sich jetzt gerade befinde.
(Sie sagt immer „mein Sohn“, das ärgert mich jedes Mal!) Auf ihrer Karte könne sie kaum etwas erkennen. Kein Wunder, dachte ich, bei dem Massstab und erst noch ohne Brille. Selbst für mich ist Hong Kong auf der Europakarte schwierig auszumachen und die Städte in Rajastan, die er während der letzten zwei Wochen besucht hatte, ebenso wenig. Bereitwillig holte ich Atlas und Indienkarte hervor und zeigte ihr, wo „ihr Sohn“ wohl gerade war. Sie begriff daraufhin auch, dass es wenig wahrscheinlich sei, dass Theo die Reise von Delhi aus nach Hong Kong mit dem Auto unternommen habe. Zum besseren Verständnis legte ich ihr die Fotoalben hin, die ich nach meiner letzten Indienreise zusammengestellt hatte. Zwei dicke Alben voll sind es; die Schwiegermutter war also beschäftigt. - Da sass sie nun in Hut und Mantel (einem ausgesprochen hässlichen, der neckischen Anstecknadel längstens verlustig gegangenen Hut, allwettertauglich, der ehemals, das heisst wohl etwa in den dreissiger Jahren, als elegant gegolten haben mag, beige oder jetzt eher „a shade of grey“) und für mich war es jetzt an der Zeit, mich in die Küche zu begeben, um das Abendessen zuzubereiten. Die seltsamen Kommentare, die sie von Zeit zu Zeit zu den Fotos murmelte, kriegte ich nur zum Teil mit; ich konzentrierte mich eher auf die Nachrichten am Radio.
„Ich habe genug Rösti gemacht für uns alle“, sagte ich zu ihr und forderte sie auf: „Iss doch gleich mit uns!“ - Da war nicht einmal der Schatten eines Widerspruchs; sie zog endlich Hut und Mantel aus, und da sah ich, dass sie, offenbar bereits in Erwartung einer Einladung, ihr zweitbestes Kleid angezogen hatte. Sie weiss schliesslich, was sich gehört: Wenn man eingeladen ist, zieht man sich auch anständig an. Geflissentlich übersah sie meine Jeans.
Das Abendessen verlief in Minne. Die Kinder waren nicht so laut wie sonst manchmal, ihre Diskussionen waren ausnahmsweise recht zahm. Vermutlich waren sie alle müde vom Skilager, aus dem sie am Mittag heimgekommen waren. So verschwanden sie auch gleich nach dem Essen und überliessen mich meinem Schicksal.
Das bestand darin, mir Geschichten anhören zu müssen von Leuten, die ich von Haut und Haar nicht kenne, von deren Verwandten und Bekannten auch, die ich demzufolge noch weniger kenne - es dauerte nicht lange und ich verlor den Faden.
Aber das war nicht so wichtig; meine Zwischenbemerkungen „oh“, „sicher?“, „na ja“ etc. schienen richtig gestreut zu sein. Gedanklich glitt ich ab und dachte an die Schulstunde morgen früh, und mir kam in den Sinn, was ich noch vorbereiten musste.
Die Rede war inzwischen von einer Frau, vermutlich der Tochter einer Bekannten, die irgendwann mal an einem Ball ein offenbar fast provokativ tief ausgeschnittenes Kleid getragen haben musste. Der Blick meiner Schwiegermutter, als sie davon berichtete, war eine Mischung zwischen verschwörerisch und missbilligend, und mein Gefühl sagte mir, es sei doch bemerkenswert, dass sie mir solche Intimitäten anvertraue. Bald merkte ich jedoch, dass sich diese Angelegenheit vor etwa fünfzig Jahren zugetragen haben musste, denn die Bekannte, von deren Tochter die Rede war, ist jetzt schon mehr als neunzig, die Tochter dementsprechend gegen siebzig, der besagte Ball also in den vierziger Jahren anzusiedeln –Schnee von vorgestern also.
Zum Essen trank ich eine halbe Flasche Wein - ganz alleine. Wein kann nämlich der Gesundheit schaden, da ist sich meine Schwiegermutter absolut sicher, deshalb verzichtet sie lieber. Mir hingegen tat der Wein gut; er liess mich alles mit Gelassenheit ertragen. Normalerweise flüchte ich nicht in den Alkohol, diesmal empfand ich ihn jedoch durchaus als Wohltat.
Dann erfuhr ich auch noch von der Nachbarin, die immer so gross angegeben hatte, dabei hat sie nun ihr ganzes Geld aufgebraucht und ist jetzt gezwungen, in ein einfacheres Heim zu ziehen. Dabei habe sie eine Tochter, die scheinbar fast in einem Palast wohne - nun - in Australien irgendwo, da könne man's ja auch nicht nachprüfen. Sie (die Schwiegermutter) habe ja immer gesagt, man müsse halt ein Budget machen, aber eben, da kann man predigen und predigen...
Da war's dann doch Zeit zu gehen, und ich gebe zu, ich habe keine grossen Anstalten gemacht, sie zurückzuhalten. Meine Bemühungen gingen eher in der Richtung zu versuchen, möglichst alle Habseligkeiten als da sind Handschuhe, Tasche, Echarpe, Schirm und natürlich Schlüssel, Lese- und Weitsichtbrille, die üblicherweise auf wundersame Weise während ihrer Besuche in unseren Haushalt eingehen und anschliessend kaum mehr aufspürbar sind, einzusammeln, ihr zurückzugeben und darauf zu achten, dass nicht doch noch im letzten Moment (wie schon unzählige Male vorgekommen) erneut etwas davon unbemerkt deponiert wird und schliesslich doch noch liegen bleibt.
Und siehe da - es gelang! Sie machte sich auf den Heimweg, und ich nahm meine Arbeit am PC wieder auf.
Ein Nachtessen im Mai (1996)
Heute Abend kam wieder einmal meine Schwiegermutter zu Besuch. Ich konnte es fast nicht glauben, als mein Mann sagte, sie komme zum Essen. Normalerweise erhalte ich nämlich einen Korb, wenn ich sie frage, ob sie bei uns essen wolle. Das ist manchmal recht praktisch, so kann ich sie nämlich relativ gefahrlos einladen, habe „meine Pflicht“ erfüllt, brauche kein schlechtes Gewissen zu haben, und sie ist trotzdem nicht da. So hab' ich's, ich geb's zu, schon öfters gemacht in der guten Hoffnung, dass sie die Einladung abschlägt; und sie hat mich nur selten enttäuscht. Aber heute, wie gesagt, kam sie. Ich hatte zuerst den Verdacht, da gehe etwas nicht mit rechten Dingen zu, denn das sah ihr gar nicht ähnlich, einfach die liebe Wäsche zu Hause so sträflich zu vernachlässigen. Sonst hatte sie doch immer so viel zu tun. Wenn man nämlich alleine lebt, muss man erst recht schauen, dass man den Haushalt in Ordnung hält, die anderen könnten ja sonst denken ... Also die Bettwäsche, die darf nie länger als drei, höchstens vier Tage im Bett sein, sonst (ich hab' vergessen, was sonst ...); bei Vorhängen kann man getrost ungefähr zwei Wochen warten. Aber dann wird's höchste Zeit! - So ist meine Schwiegermutter immer vollauf mit wichtigen Dingen beschäftigt, die sie ganz und gar in Anspruch nehmen. Und das ist gut so. Sie kann dann im Seniorenheim gleich vier Waschmaschinen gleichzeitig belegen, damit die ganze Arbeit wieder mal erledigt ist. So kommt in die erste Maschine der Morgenrock. Man muss ihn schon alleine waschen; er ist so delikat, er würde sonst den Waschgang mit anderen Sachen gleichzeitig kaum überstehen. In die zweite Maschine kommt die Leibwäsche. Die muss auch separat behandelt werden, das ist ja sonst „grusig“. Dann die Küchentücher. Die muss man kochen, die werden sonst nie sauber und rein. Ja, dann braucht's noch eine Maschine für die feinen, farbigen Sachen. Auch dort ist viel Sorgfalt nötig, zu viel aufs Mal darf man nicht zusammen in dieselbe Trommel füllen. So hat's dann schon wieder Wäsche für die nächste Woche. Irgendetwas bleibt immer übrig. Die Wäsche ist eben eine Sisyphusarbeit; die nimmt nie ein Ende. Und so muss meine Schwiegermutter eine Einladung nach der andern absagen, weil sie eben nie Zeit hat.
Genau das wurde mir erst letzte Woche wieder unmissverständlich klar, als ich sie fragte, ob sie mit dem neuen CD-Spieler klar komme. Schon lange hatte sie sich ein solches Gerät gewünscht, damit sie ihre CDs mal hören könne, die sie immer bei „Das Beste“ bestellt, weil sie sich einfach nicht dafür hält, die nette, an sie persönlich gerichtete Werbung nicht zu beachten. So kaufte ich kürzlich ein solches Gerät, Theo brachte es zu ihr, und unser Sohn Gino machte ihr sogar noch eine Zeichnung, damit sie genau wisse, wie und wo sie die Disc einschieben und auf welchen Knopf sie anschliessend drücken müsse. Gemeinsam wurde die „Hightech“ installiert. Beeindruckt von so viel technischem Verständnis unseres Zehnjährigen sagte sie ihm schon eine Karriere an der ETH voraus. Das teilte sie mir am nächsten Tag am Telefon im Vertrauen mit. Darauf ging ich nicht ein, aber ich fragte sie, ob das Gerät gut funktioniere und ob sie Freude daran habe. Da lachte sie und sagte: “Wo denkst du hin, Schätzeli, ich hatte doch noch gar keine Zeit zum Musik Hören.“ Meinen Einwand, man könne ja arbeiten und Musik hören gleichzeitig, nahm sie überhaupt nicht zur Kenntnis.
Nun ja, technische Geräte sind eine Sache für sich. Auch Toaster haben ihre Tücken. Sie braucht jährlich im Minimum zwei bis drei davon. Das kommt daher, dass sie wieder und wieder versucht, mit der rohen Gewalt eines Messers oder zur Abwechslung auch mit einer Gabel abgebrochene, steckengebliebene Brotstücke aus dem Gerät zu entfernen. Das funktioniert leider nur selten, und so geht ein Toaster nach dem andern vor die Hunde. Aber daran sind wir bereits gewöhnt, und ich kaufe sie nur noch, wenn's gerade eine Aktion hat oder wenn es sich um ein Sonderangebot handelt. Alles andere hat keinen Zweck. - Nun, ob sie je dazu kommen wird, ihre CDs zu hören, wage ich zu bezweifeln. Bis sie nämlich einmal Zeit finden wird dafür, wird sie längst nicht mehr wissen, wo der Einschaltknopf ist, und die Gebrauchsanweisung wird ebenfalls schon im Altpapier gelandet sein.
Es ist auch so, dass, wenn ich anrufe und sie frage, ob sie am nächsten Mittwoch zum Beispiel zu uns zum Nachtessen kommen möchte, sie mir zuerst aufzählt, was alles los ist in der nächsten Woche. Das kostet mich immer Geduld, denn die Aufzählung dauert. Es nützt auch nichts, wenn ich versuche, sie zu unterbrechen und ihr klarzumachen, dass all das für mich nicht relevant ist. Ich möchte nur eine „Aussage“ über den kommenden Mittwoch haben. So kann ich dann den Hörer ablegen und erst mal warten, bis das „Wochenprogramm“ durch ist, das meistens etwa so beginnt: „Also am Montag komm Frau Sowieso zu Besuch am Nachmittag. Und am Dienstag habe ich Wäsche. Am Mittwochmorgen muss ich Herrn Sowieso telefonieren wegen einer bestimmten Angelegenheit, am Donnerstag bin ich beim Coiffeur angemeldet und am Freitag - da ginge es“. – „Am Freitag geht es uns leider nicht; meine Frage betraf den Mittwochabend...“
Nun, heute jedoch schien sie sich doch ein paar freie Minuten zu gönnen. Heute war alles anders. Ich dachte schon, sie sei krank. Dem war aber gar nicht so. In reger Aufmerksamkeit bemerkte sie, wie unsere Tochter ohne Manieren ihre Spaghetti ass, und sie prophezeite ihr, auf diese Weise werde sie sicher nicht so ohne weiteres durchs Leben kommen, sie werde dann schon sehen. Auch das bauchfreie T-Shirt war Gegenstand des Anstosses. Schon Doktor Sowieso habe immer gesagt, das gäbe dann eine Nierenentzündung, und auch das werde sie dann schon sehen. Im Alter dann („Bauchfrei in den frühen Vierzigerjahren...??“ dachte ich bei mir, sagte aber nichts.). - Dass unsere Tochter ungerührt blieb ob so viel Weisheit und genauso unanständig weiter ass mit erhobenem Ellenbogen, das war natürlich ein starkes Stück. - Seltsamerweise fallen Bemerkungen dieser Art nie auf fruchtbaren Boden. Es ist nicht einmal so, dass solche wertvollen Hinweise bei einem Ohr hineingehen und beim andern wieder hinaus; nein, ich glaube viel eher, sie hört sie wohl nicht einmal. Meine Rolle ist dann jeweils auch nicht vollkommen klar. Normalerweise ziehe ich es vor, das Ganze ebenfalls nicht gehört zu haben.
Dafür hörten wir einmal mehr den beliebten Ausspruch: "Arbeiten und nicht verzweifeln!" In welchen Zusammenhang er diesmal erwähnt wurde, weiss ich nicht mehr, aber er passt ja eigentlich immer. „Schon in der siebten Klasse haben wir das gelernt“ fügte sie hinzu und ich dachte mir, wenn es mir als Lehrerin einmal gelingen würde, meinen Schülern so viel Lebenserfahrung in einem einzigen Satz zu vermitteln, und sie das, genau wie meine Schwiegermutter, selbst noch nach sechsundsiebzig Jahren zitieren könnten, dann hätte ich wirklich etwas erreicht als Pädagogin.
Aber das Gespräch drehte sich noch um etwas anderes: Der Vermögensverwalter meiner Schwiegermutter hatte sie am nächsten Tag zum Mittagessen eingeladen. Ob er sich im Klaren darüber war, worauf er sich da im Begriff war einzulassen, bezweifelte ich stark. Und weshalb sie dieses Mal keine Ausrede hatte, die Einladung zurückzuweisen, kam auch einem Wunder gleich. Es konnte doch wohl nicht sein, dass alle Wäsche schon erledigt war! Und normalerweise konnte sie derartige Verabredungen sowieso nicht annehmen, wenn der Coiffeurbesuch noch in derselben Woche geplant war. Und dann hatte sie doch der Frau Hauri versprochen, mit ihr eine Tasse Tee zu trinken. - Das musste schliesslich alles erledigt sein. Aber morgen ging es. Vielleicht hatte es damit zu tun, dass der geduldige Herr Bäumlin mindestens schon drei erfolglose Versuche gestartet hatte, sich mit meiner Schwiegermutter zu treffen. Hartnäckig muss man das schon nennen. Dass sich der nette Herr trotz aller Widrigkeiten nicht von seinem Vorhaben abbringen liess, ist mehr als nur erstaunlich. Schon fast ein wenig suspekt. – „Unterschreibe nur ja nichts!“ riet meine Schwester, die ebenfalls am Tisch sass und mein Schwager raunte ihr zu: „Sag's noch mal, sie hat's vielleicht nicht ganz begriffen!“ - Da war ich hingegen ganz gelassen. In dieser Hinsicht ist hundertprozentig auf sie Verlass. Sie wird sich nichts aufschwatzen lassen; sie ist schon in Ordnung, wenn's drauf ankommt. - In der Haut des armen Herrn Bäumlin jedenfalls möchte ich ja wirklich nicht stecken. Der weiss noch gar nicht, was da alles auf ihn zukommen wird. Aber spätestens morgen nach dem Mittagessen wird er's wissen. Unterschreiben wird sie gar nichts. Aber er wird das Mittagessen bezahlt haben und mit einem ganzen Kratten voller guter Ratschläge das Restaurant verlassen. Zeitweise wird er sich vorkommen wie ein Schuljunge. Erreicht haben wird er allerdings weniger als nichts. Was er genau von ihr will, weiss ich natürlich auch nicht, aber das braucht mich auch keineswegs zu kümmern; es ist schliesslich seine Zeit, die er verlieren, und es sind seine Nerven, die er strapazieren wird. Er tut mir richtig leid. Sie wird ihn sicher auch ins Bild setzen darüber, dass schon der Vermögensverwalter ihrer Eltern selig damals gesagt hat: „Frau Torriani“, hat er gesagt, „es ist wichtig, dass Sie nie Schulden haben und ihr Geld sicher in erstklassigen Obligationen anlegen“. Und dagegen wird der liebe Herr Bäumlin keine Argumente haben. Punkt (sie wird nicht sagen: „Punkt!“; sie wird sagen: „Fertig!“; auch eines ihrer Lieblingswörter.). Wir können also geruhsam der Dinge harren, die da kommen mögen.
Schade nur, dass sie so beratungsresistent ist, dass sie unser aller Appell, ihre Schuldbriefe nicht zu lochen, bevor sie im Ordner verschwinden, in den Wind schlägt. Sie weiss es eben besser.
Es ist nicht immer einfach... (1999)
Es wird immer komplizierter. Gestern rief sie an, ich war soeben vom Einkaufen zurück. Ob ich ihr Milch bringen könne von der Migros, wollte sie wissen. Nun, ich hätte welche daheim, Vollmilch oder Milchdrink, ich würde sie ihr gleich bringen, sagte ich. Die „Milch“, die sie meinte, stellte sich aber nach einigem Hin und Her als Vollrahm heraus. „Ein halber oder ein Viertelliter?“, war meine nächste Frage. Das Paket mit den vier Ecken sei es und ob ich wisse, wo der Eingang sei beim Migros. Ich würde lieber im Coop den Rahm einkaufen, das gehe schneller, weil’s dort Parkplätze habe, gab ich zu bedenken, und der Rahm sei ja derselbe. - Nein, dann gehe sie eben selber, sie habe sich nur nicht wieder anziehen wollen. - „Schon recht, ich gehe auch ins Migros“, lenkte ich sogleich ein. Aber das war nun natürlich zu spät und der Hörer war schon aufgelegt.
Das allerdings war schon wesentlich besser als die Story mit dem Weckdienst von neulich. Weil Mutter am nächsten Tag um halb zehn eine Verabredung hatte, wollte sie, dass man sie telefonisch um sieben Uhr morgens wecke. Unser 17-jähriger Sohn Diego wollte den Auftrag übernehmen, aber nach dem dritten Versuch und jeweils ungefähr 20maligem Läuten gab er auf. Ob sie wohl den Anruf nur nicht höre oder gar plötzlich vom Tod ereilt worden war in dieser Nacht? Schliesslich ist sie 92 Jahre alt. - Ob er noch rasch vor der Schule schauen gehen solle? - „Ich kümmere mich um den Fall“, sagte ich, „geh du nur“. Mit noch grösserer Ausdauer liess ich das Telefon nochmals lange läuten. Nichts geschah, ich legte eine Pause ein von zwanzig Minuten und dann versuchte ich es nochmals. Nur wer nicht aufgibt, kommt ans Ziel. Und es klappte. – Endlich hörte ich ein Klicken in der Leitung, der Hörer wurde abgehoben, aber sie sagte nichts, sondern legte gleich wieder auf. - So also funktioniert der Weckdienst; aber vielleicht geht es ihr ja ähnlich wie mir und sie mag mit niemandem sprechen so früh am Morgen. Da gäbe es dann tatsächlich eine Gemeinsamkeit ... Trotzdem hoffe ich, dass sie sich nächstes Mal wieder auf ihren Wecker verlässt und uns verschont mit solchen Aufgaben, denn wie gesagt, ich rede ja auch nicht gerne am Morgen.
Eine weitere Episode (2000)
Mit dreiundneunzig Jahren ist nicht mehr alles ganz so einfach, zugegeben. Manchmal erwartet man eben zu viel. Wie werden wir uns benehmen, wenn wir so alt sind? Das ist die bange Frage, die ich mir immer wieder stelle, wenn ich mit meiner Schwiegermutter zu tun habe.
Am Sonntag kommt sie jeweils zum Nachtessen. Theo holt sie dann ab. Aber er muss früh genug gehen, sonst kommt sie nämlich ohne ihr Gebiss und das, ich gebe es zu, mag ich gar nicht. Es sieht schlicht schrecklich aus und dass es für sie unpraktisch ist zum Beissen, ist sowieso klar. – So plant er denn im Minimum eine Viertelstunde für die Suche der falschen Zähne ein. Mittlerweilen kennt er eine Mehrzahl von Verstecken, aber Mutter findet immer wieder neue. Das Ganze scheint für sie ein Spiel zu sein. Mit Haushaltspapier umwickelt liegt es unter dem Bett, im Apothekerschrank bei den Tabletten, in der Besteckschublade, in einer Pfanne versteckt, im Kühlschrank oder zwischen der Bettwäsche. Auch in meinem Esszimmer hab ich’s schon mal gefunden, es lag in einer silbernen Schale und hat mich zwischen Hausschlüsseln und Brillen angebleckt, unverpackt dieses Mal.
Aber auch wenn sie dann da ist, die dritten Zähne am richtigen Ort, ist nicht alles so, wie es sein sollte. Sie hat sich nämlich die unangenehme Angewohnheit angeeignet, ständig Kiefer, Mund und Zunge hin- und herzubewegen, so dass man davon ganz nervös wird. – Jany, der Mann meiner Schwester, hat schon besorgt und vorsorglich seinen Zahnarzt konsultiert um zu fragen, ob es später noch andere Lösungen gäbe, als sich ein Gebiss zu beschaffen...
Wenn sie sagt, sie dürfe dieses und jenes nicht essen, der Arzt habe es ihr verboten (vor siebzig Jahren), dann habe ich erst mit der Zeit gemerkt, dass dies lediglich eine Ausrede ist, wenn sie etwas nicht gern hat. Aber neuerdings ist sie keineswegs mehr so diskret. Als ich nämlich die „Tarte au Vin“ zum Dessert aufstellte, ihr ein Stück davon auf einem Teller servierte, sagte sie ohne Umschweife: „Was isch das für nä Pflatsch?“ – Essen wollte sie den Pflatsch unter keinen Umständen, und als sie dann begann, mit der Gabel darauf herumzustochern, habe ich das Kuchenstück rasch für uns andere gerettet.
Ginos prosaischer Kommentar dazu: „Die Frau länkt unheimlich ab bim Ässe.“
Sehen tut sie ausserordentlich gut, auch ohne Brille – nach wie vor. Die kleinsten Fasern auf dem Teppich erkennt sie ohne das geringste Problem. - Auch ihr Gehör ist phänomenal. Kürzlich sagte sie zu Theo durchs Telefon hindurch (sie war am andern Ende der Leitung), sein Natel läute, das er in seiner Jackentasche hatte und selber wie üblich nicht hörte.
Wenn sie etwas nicht hören will, hingegen, dann sagt sie einfach, sie habe es nicht verstanden, wiederholt man es, beklagt sie sich, man spreche zu laut. Man hat dann keine Chance, nicht die geringste.
Gerne bringt sie nach wie vor ihre immer gleichen Sprüche an den Mann beziehungsweise an die Familie, die da sind: „Nobel muss die Welt zu Grunde gehen“ oder „Trink Wasser wie das liebe Vieh“. Wiederholungen sind ihr einfach lieb.
Die Blumen, die letzten Rosen aus unserem Garten, die allmählich ein wenig schäbig aussahen, pries sie wieder und wieder an. „Schön, diese Blumen“, sagte sie immer und immer wieder, bis einige unserer weniger gut erzogenen Kinder es nicht lassen konnten und zu spotten begannen, die arme Nana mit Fragen hänselten, ob sie nicht auch finde, die Blumen seien wunderschön. - Mich erinnerten die Rosen ganz stark an unsere Hochzeit vor fast dreissig Jahren, als der Blumenschmuck auf unserem Tisch aus Schwiegermutters Garten stammten, halb verwelkt bereits, ein eher trauriger Anblick, dafür hatte man aber ein paar Franken sparen können.
Beim Verabschieden hatte sie während Jahren die Angewohnheit gehabt zu sagen, es könnte sehr wohl das letzte Mal sein, dass wir uns sähen. Sie sagt es jetzt nicht mehr, sie hat selber gemerkt, dass es recht seltsam wirkt; Sonntag für Sonntag derselbe Spruch.
Soeben telefoniert Theo mit ihr um ihr zu sagen, wann er sie abholen kommt. Es ist natürlich Sonntag. Es ist der zweite Anruf. Beim ersten hob sie nur den Hörer ab, sagte: „Da ist niemand!“ und hängte wieder ein. Heute will sie nicht kommen, tatsächlich nicht. Sie hat gesagt: „Ums Gottswille nid!“ und dabei bleibt es.
Aber nicht immer haben wir so viel Glück. Und so liessen wir uns ein anderes Mal wieder unheimlich ablenken beim Essen. Seltsam war’s. Ich beschloss, uns allen etwas Feines zu kochen. Dass sie den grünen Kopfsalat nicht mag, habe ich inzwischen begriffen und langsam dämmert es mir, dass sie ihre „Arztstorys“ lediglich als Ausrede braucht, wenn sie etwas nicht gern hat. Völlig überflüssig zwar, aber ich verstehe sie. Also machte ich als Vorspeise Rüeblisalat an französischer Sauce und als Hauptspeise Nudeln mit Lachs und Rahm. Ich fragte mich, ob diesmal wohl alles in Ordnung sei oder ob’s Beschwerden geben werde. – Und es gab welche: „Die Teller sind kalt“, bemerkte Nana. Ich bot ihr an, ihren Teller rasch in der Mikrowelle zu wärmen, sah allerdings nicht ein, wieso der Salatteller warm sein sollte. „Für das kleine Bisschen lohnt es sich nicht“, wurde ich belehrt. Nun, dachte ich, es ist auf alle Fälle besser, ich sage nichts. Wenigstens brachte sie diesmal nicht ihr eigenes Stück Fleisch mit, wie sie es früher manchmal tat.
„Willst du deinen Rüeblisalat nicht essen, Mutter?“, fragte ich. Auf ihre Antwort war ich nicht gefasst. Sie liess mich sprachlos. „Nein, das Essen ist kalt. - Es ist eine Frechheit, älteren Leuten kaltes Essen zu servieren.“
Besuche
Die Besuche werden von Mal zu Mal merkwürdiger.
Vor einer Woche ging’s um weiches Gebäck, das Mutter mitgebracht hatte. Zum Tee, meinte sie, wäre das. Ich rümpfte die Nase, weil sie jeweils mit untrügerischer Treffsicherheit genau das auswählt, was ich gar nicht mag. Und nicht selten ist auch das Datum abgelaufen auf den feinen Mitbringseln. Dass es diesmal tatsächlich aus unserem eigenen Haushalt stammen sollte, konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen. – Nun, so ergab es sich, dass niemand davon ass, und die Törtchen lagen während etwa drei Tagen herum. Nicht einmal Gino, unser Jüngster, nahm sich ihrer an. Ich war schon drauf und dran, alles wegzuwerfen, was mir eigentlich gegen den Strich geht, als Mutter einmal mehr zu Besuch kam. Theo machte Tee und legte das Gebäck hin. Und wieder wollte niemand davon essen. Aber dann kam Gino und sagte: „Ich nehme die mit; ich gehe mit einem Kollegen in unsere Baumhütte, da haben wir dann gerade ein Zvieri.“ Und weg war er und weg waren die Törtchen. Gerade als ich erwähnen wollte, wie froh ich sei, dass das Gebäck nun endlich doch noch einen Abnehmer gefunden habe, hörte ich eine seltsame Unterhaltung zwischen Mutter und Theo. Sie sagte: „Also das ist wieder mal ein typisches Beispiel von schlechter Erziehung. Nimmt der Kleine einfach diese teuren Törtchen. Der kann doch ein paar Güezi nehmen; so etwas, einen Fünfliber haben die gekostet; das macht man doch nicht.“ - „Du wolltest sie ja auch nicht essen,“ versuchte Theo zu argumentieren, „und zudem sind es ja diejenigen, die ich dir vor einer Woche gebracht habe.“
Ich dachte, ich höre wohl nicht recht, aber genau so war’s. Weil Mutter ihr Gebiss beim Zahnarzt hatte richten lassen müssen, hatte ihr Theo diese weichen, osterfladenartigen Kuchen mitgebracht, in der vergeblichen Hoffnung, sie würde etwas essen, denn sie scheint wirklich nur noch aus Haut und Knochen zu bestehen. - Man kann sich jetzt fragen, wie gut diese Idee tatsächlich gewesen war...
Ja, und dann war sie schon wieder da vorhin. Wir hatten verschiedene Themen. Beerdigung war eines, das Wetter wurde mehr als einmal erwähnt und ein weiteres drehte sich um die Ferien. Sie fragte, ob ich jetzt nach Bivio gehe (mindestens schon viermal habe ich ihr davon erzählt, aber ich weiss ja, man muss geduldig sein, denn auch mir passiert es immer öfter, dass ich Dinge gleich wieder vergesse und ich bin schliesslich nur halb so alt wie sie). Nur drei Tage über Ostern würde ich dort verbringen, wiederholte ich, und anschliessend für zwei Wochen nach San Francisco fliegen mit unserer Tochter Kay. Wir würden Kim besuchen, die dort für ein Jahr in eine Schule gehe und bei Freunden wohne. Daraufhin sah sie Theo an und fragte ihn, ob wir uns darauf freuen und ob das dann ein halbes Jahr dauern werde, bis wir wieder zurückkämen. „Zwei Wochen“, sagte Theo und wegen dem Freuen könne sie mich ja direkt fragen, ich sitze ja schliesslich neben ihr am Tisch ... „Weird, it’s getting really weird“, dachte ich bei mir, so habe ich sie wirklich noch nie erlebt. Und als ich sie fragte, ob sie die (trockene) Kirschtorte, das sie diesmal mitgebracht hatte und von der sie ein Stück vor sich auf dem Teller liegen hatte, nicht essen wolle, sagte sie aus heiterem Himmel und mit grösster Seelenruhe: „Ich kann nicht essen, wenn ich mich aufrege.“ - Ganz erstaunt blickten wir beide erst uns und dann sie an und fragten, worüber sie sich denn aufrege, sie machte nämlich keineswegs den Anschein, es war auch kein Anlass vorhanden. „Ich bin eben älter als ihr und sehe manches anders“, war ihre Antwort, womit aber nach wie vor nicht klar war, was es genau war, das sie anders sah oder worüber sie sich hätte aufregen müssen. Im Grunde genommen weiss ich natürlich schon, dass sie so ziemlich alles anders sieht als ich, aber darum ging es im Moment ja gar nicht und zudem war das schon längst weder für sie noch für mich ein Grund, sich aus der Ruhe bringen zu lassen.
Sie wechselte dann gleich selber das Thema und fragte mich mit einem Blick auf die Unordnung in meiner Küche, ob ich eigentlich nicht meinen Job aufgeben wolle. „Was soll das jetzt wieder?“, dachte ich bei mir. Sagen tat ich aber nur: „Nein“, und damit war auch dieses Thema endgültig erschöpft.
Ziemlich abstrakt kam mir allmählich unsere Unterhaltung vor, eine Art surreales Spiel, bei dem ich allerdings nicht dabei war, als die Regeln erklärt worden waren. So wird Mitmachen natürlich schwierig.
Die leidigen Steuern wurden dann als nächstes behandelt und Mutter meinte, sie sei schon froh, wenn ihr Vermögensverwalter Theo beim Ausfüllen der Steuererklärung helfe. Das sei keineswegs der Fall, dass der das tue, beteuerte Theo, er mache das selber, aber das war egal, sie war trotzdem froh darüber.
Kompliziert wurde es für ihn ein anderes Mal, als er sie dazu bewegen wollte, ein Formular für die Bank auszufüllen, genauer gesagt zu unterschreiben. Da hatte sie ihre Sternstunde. Sie machte sich ein Spiel daraus, so zu tun, als ob sie das nicht tun könne. So versuchte Theo nach dem Mittagessen im „Tertianum“ (der Seniorenresidenz, wo sie seit ein paar Jahren wohnte) mit ihr die Unterschrift zu üben. Auf einer Serviette. Das ging gut. Sie schrieb wieder und wieder ihren Namen. Aber auf dem Formular war’s nicht möglich. Sie weigerte sich standhaft, lächelte dazu und brachte Theo, der sonst die Ruhe in Person ist, fast zur Verzweiflung. Nach zwei Stunden gab er auf.
Und die unendliche Geschichte geht weiter:
Wenn Theo, den sie übrigens neulich vermehrt mit Antonio (ihr verstorbener Mann) anspricht oder gar mit „Papi“ (was mir dann jeweils innerlich unheimlich auf den Wecker geht) sie im Seniorenheim besucht und mit ihr zu Mittag isst, dann kann er sich einiger sehr spezieller Erlebnisse erfreuen.
Bestellt er ein Bier, wird sie nimmer müde, den Kellner gleich zu ermahnen: „Aber temperiert!“ (So wie unsere Kinder früher die Joghurts essen mussten, wenn sie bei ihr waren, was sie alle verabscheuten.)
Den unteren Rand der Serviette legt sie ihm unter den Teller, damit das Tischtuch sauber bleibt, wie sie sagt.
Und aufpassen muss er wie ein Häftlimacher, wenn Fleisch serviert wird. Sie beugt sich dann hinüber zu ihm und beginnt, sein Essen kleinzuschneiden. Theo ist eben geduldig und auch manchmal ein wenig abwesend; so kommt es vor, dass er nicht sogleich merkt, was da vor sich geht.
Was er aber wirklich nicht mag, aber jedes Mal erzwingen muss, ist der Kampf um eine Tasse Kaffee nach dem Essen in Mutters Wohnung. Es gibt nur Instantkaffee. Das wäre ja noch akzeptabel, aber die Tatsache, dass sie findet, ein halber Teelöffel Pulver sei genug und diese Meinung auf Biegen und Brechen auch durchsetzen will, ist dann doch sogar für ihn zu viel des Guten, und er wehrt sich ausnahmsweise.
Ob er wirklich als Sieger hervorgeht aus diesem Disput, vermag ich nicht zu sagen, ich kenne aber die Antworten von Mutter, wenn man nicht tut, was sie für richtig hält, aus eigenem Erleben. Ist eines von uns zu wenig warm angezogen, trinkt ein zu kaltes Getränk, isst ein grilliertes Stück Fleisch (etwa noch Rindfleisch) oder den nitrathaltigen Nüsslersalat, von dem ihr Doktor sowieso schon vor 40 Jahren abgeraten hat, dann sagt sie nur: „Du wirst dann schon sehen, wenn du älter bist ....!“
Mal sehen, was ich dann sehen werde.
Aber Befürchtungen scheinen auch ihr Schönes zu haben. Eine 89-jährige Bekannte von ihr, welcher der Arzt schon vor Jahren nur noch wenige Monate, allerhöchstens ein Jahr, zu leben prophezeit hatte, und die jetzt unbedingt eine Bluttransfusion haben sollte, verweigert diese standhaft, weil sie Angst habe vor Aids.
Ist das jetzt positives oder negatives Denken?
In der Pflegeabteilung / Spital (2002)
Ziemlich viel hat geändert seit ich zum letzten Mal über meine Schwiegermutter geschrieben habe. Sie hat im letzten Januar ihren 95sten Geburtstag gefeiert; ein richtiges Gespräch ist inzwischen nicht mehr möglich. Zwar empfand ich, dass ein „richtiges“ Gespräch zwischen uns so oder so eigentlich nie stattgefunden hat, denn wir waren und stammen seit jeher von zwei verschiedenen Planeten oder gar Galaxien.
Nana wohnt inzwischen im Pflegeheim und hat bereits vergessen, dass da noch eine 3-Zimmer Wohnung vorhanden ist im sechsten Stock, die sie gemietet hat. Es scheint ihr an nichts zu fehlen, endlich hat sie ein wenig Abwechslung, sie sieht Leute hin- und hergehen, sie ist nicht mehr so einsam wie vorher, wo sie nur aus dem Fenster schaute, stundenlang. Sie hat Satzfragmente gespeichert, Redensarten auch, die sie beliebig anwendet, egal ob sie passen oder nicht. Gerne sagt sie: „Herrgott noch mal“ und „In Gottes Namen“. Wenn man das Zimmer betritt, findet die erste automatisch Anwendung.
„Herrgott noch mal“, sagte sie, als ich vor zwei Wochen in den Speisesaal kam und zu ihrem Tisch trat. Eigentlich hatte ich die Essenszeit vermeiden wollen, aber mein Vorhaben missglückte, Nana war mit Appetit am Mittagessen. Pürierte Rübchen, Kartoffelstock und püriertes Kalbfleisch gab’s, daneben das Dessert, ein Teller mit Vanillecrème. Ich setzte mich zu ihr. „Willst du auch ein wenig?“, fragte sie und streckte mir eine Gabel voll hin. Dankend lehnte ich ab und log, ich hätte schon gegessen. Beim nächsten Bissen schaufelte sie ein wenig Fleisch auf die Gabel, dazu Kartoffelstock und schon landete die Gabel in der Vanillecrème. Ich zuckte erschrocken zusammen, wollte sofort hilfreich eingreifen und sie auf den Irrtum aufmerksam machen, gleichzeitig aber schob sie den Leckerbissen bereits in den Mund, vorbei an den goldenen Hacken, an denen eigentlich ihr Gebiss hätte verankert sein sollen, das sie nun aber schon seit Monaten so gut versteckt hat, dass nicht einmal mehr Gino im Stande ist, es zu finden. (Einmal, als es Theo beim besten Willen nicht gelang, die dritten Zähne seiner Mutter aufzuspüren, fragte er Gino, ob er Zeit hätte, danach zu suchen. Er versprach ihm einen Finderlohn von 200 Franken. – Für diese „Arbeit“ hatte er Zeit. Es dauerte keine Viertelstunde, und Gino wurde fündig. In einem „Earl Grey-Päckli“ zwischen den Teebeuteln lag der oft gesuchte Gegenstand - und unser Jüngster war um zweihundert Mäuse reicher.)
Es ist egal inzwischen; hier herrschen andere Regeln. - Auch die pürierten Rübchen mit Vanillecrème schmeckten ihr offenbar gut. Wieder bot sie mir an...
An einem anderen Tisch war eine junge Pflegerin daran, zwei Greisen im Rollstuhl das Essen klein zu schneiden und sie abwechslungsweise zu füttern. Die Szene erinnerte mich an die Fütterung unserer Zwillinge. Nur waren damals die Lätzli mit irgendwelchen lustigen Tierchen gemustert und auch sonst gab es da noch gewisse Unterschiede. Der eine Herr fragte die Pflegerin, woher sie sei. „Aus Spanien“, sagte sie. - „Dass ich einmal mit einer Spanierin esse...“, murmelte er und ich fragte mich, wie oft sich diese Szene wohl wiederholt. Die Spanierin nahm sich daraufhin einer Dame an unserem Nebentisch an, putzte ihr den Mund mit einem feuchten Tuch und schon rief ihr der Alte zu und bat oder befahl ihr, nochmals zu ihm zu kommen, er müsse ihr etwas sagen. „Sie sind eine schöne Frau“, liess er verlauten, sie lachte und ging wieder an ihre Arbeit zurück.
Nana hatte inzwischen fertig gegessen, Mund und Hände wurden ihr von der Pflegerin geputzt und sie wurde gelobt für ihren guten Appetit. Die Frau neben Nana sagte zu mir: „Ich möchte lieber sterben; wieso nur kann ich nicht?“ – Ja, wie gut ich das verstehe! Ich habe keine Antwort. - Es tut mir alles so Leid.
Zwei Wochen später: Bei der morgendlichen Zeitungslektüre lese ich auf der letzten Seite des Bund: „Unerklärliche Tat eines Demenzkranken“. In einem Altersheim hat ein 86-jähriger Bewohner seinen Zimmernachbarn mit einer Krücke erschlagen. Er kann sich offenbar nicht mehr an seine Tat erinnern. Das Motiv ist auch unbekannt. – Und so wurden mit einem Schlag zwei Betten frei im Altersheim. – Diese Nachricht ist mir lebendig vor Augen, wie ich heute durch die Tür der Pflegeabteilung trete.
Ich besuche Nana im Ess- und Aufenthaltsraum. Dieselben Leute wie immer sitzen dort. Die meisten schlafen. Nana auch. Mit weit geöffnetem Mund. Der Herr, der sich so sehr an der Spanierin ergötzt hat, ruft unaufhaltsam nach der „Serviertochter“. Es passiert nichts. Eine Frau, die alleine am Tisch sitzt, stöhnt laut und sagt, sie müsse auf die Toilette. Sie jammert, bettelt und bittet, es passiert nichts. Das Personal lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Alle sitzen im Office hinter der Glasscheibe im Kreis, sie haben eine Besprechung, die Türen sind offen, Handlungsbedarf besteht keiner. Soll ich eingreifen? Es ist kaum zum Aushalten. Eine Pflegerin kommt herein und weist die Alten an, jetzt endlich still zu sein; sie hätten Rapport und es komme dann nachher schon jemand. So geht die Bettlerei weiter. Ist dies das tägliche Brot? Hat die Frau Windeln an und die Ruferei ist ihr Ritual? Soll ich mich einmischen? Ich bin im falschen Film. Ich will nie in ein Pflegeheim. Endlich ist der Rapport zu Ende, Erlösung naht. Die Frau bedankt sich wieder und wieder, dass man sie endlich erhört.
Nana sagt, es seien ohnmächtige Leute hier. Ich kann sie fast nicht verstehen. Wie es meinem Bruder gehe, will sie wissen. Das habe ich genau verstanden. Ich habe keinen Bruder. Sie besteht darauf, weiss aber seinen Namen auch nicht. - „Hast du das verrückte Haus gesehen, das dort herumspringt?“, will sie wissen. Das „verrückte Haus“ ist ein Pfleger, der ein Tablett abräumt. Er bewegt sich nicht rascher als alle andern und worin sich seine Verrücktheit ausdrückt, ist mir auch nicht klar.
Was ich denn so mache, möchte Nana nun wissen. - Nun, immer etwa dasselbe: Arbeiten, Haushalt, wie das eben so ist. – Ob es mit den Lehrern denn gut gehe? Das könne ich ihr doch wohl genau erzählen, meint sie, ein wenig vorwurfsvoll, wenn ich ihren Tonfall richtig interpretiere. „Ich habe keine Lehrer, ich selber gebe seit 25 Jahren Schule“, erkläre ich ihr. - Das habe sie nicht gewusst, Herrgott noch mal, na ja. - „Theo lässt dich grüssen“, wechsle ich das Thema. „Welche Farbe hat er?“, ist ihre Gegenfrage, auf die ich einmal mehr nicht weiss, was ich antworten soll.
Zehn Minuten später sitze ich im Auto und fahre aus der Tiefgarage. In eine andere Welt.
Ein kalkulierbares Ereignis (12. August 2002)
Nun war es so weit. Am Montag früh starb meine Schwiegermutter. Mit 95 Jahren ist der Tod keine Überraschung mehr, eher ein kalkulierbares Ereignis. - Erstaunlicherweise starb sie auf den Tag genau elf Jahre nach ihrem Ehemann, Theos Vater.
Der Beamte des Bestattungsamtes sass im Wohnzimmer zusammen mit Theo. Es gab einiges zu organisieren. Die Behörden mussten verständigt, die Krankenkasse benachrichtigt und der Zeitpunkt für die Urnenbeisetzung bestimmt werden. Geschäftlich das Ganze.
Dass die Abschiedsworte tröstlich sein würden, war schon klar. Man konnte den Text fürs Beileidzirkular bereits festlegen. „Wollen Sie ‚in stiller Trauer’ oder ‚in Liebe’“? fragte der diskrete Herr. „Und wie steht es mir der Todesanzeige? In welchen Zeitungen soll sie erscheinen?“ – Wenn man fast ein Jahrhundert alt ist, hat man kaum mehr Bekannte, höchstens noch im Pflegeheim. Die Freunde sind alle längst gestorben. Eine Anzeige über die ganze Stadt zu streuen, schien eher absonderlich. Das Blatt, das zweimal wöchentlich in der Region erscheint, war wohl gerade richtig.
Ich war nachdenklich. „So alt sollte man gar nicht werden“, hatte Kay kürzlich gesagt und mir damit aus dem Herzen gesprochen. Das Wort Lebensqualität wurde diskutiert. Am traurigsten war, dass niemand wirklich traurig war. Würde meine Schwiegertochter später einmal gleich empfinden? Mich nicht vermissen, wenn ich nicht mehr da bin? Froh sein, dass alles „gut gegangen war“ und die Verstorbene keine Schmerzen hatte leiden müssen? - Natürlich war da eine Trauer. - Für Theo ging ein Teil seiner eigenen Geschichte zu Ende. Die Mutter, die ihn aufgezogen hatte, um die er sich in den letzten Jahren in fürsorglicher Weise gekümmert hatte, war nicht mehr.
Und ich? Der Alltag ging weiter. Ändern tat sich nichts. Keine Besuche mehr im Pflegeheim, das war alles. Was blieb, waren Erinnerungen. Erinnerungen und Fotos.
Schon drei Wochen zuvor hatten wir gedacht, die alte Frau würde sterben.
Sie war umgefallen und hatte sich ein Bein gebrochen. Die Folge war ihr erster Spitalaufenthalt seit Theo vor 57 Jahren geboren worden war. - Sie wurde gleich operiert. Am nächsten Morgen sah es schlecht für sie aus. Zwar war die Operation gut verlaufen, jedoch traten Schwierigkeiten mit dem Kreislauf auf. Alle, auch die Ärzte und Schwestern dachten, sie würde den Tag wohl nicht überleben. Die ganze Familie besuchte sie, alle machten sich ihre Gedanken, nahmen Abschied. An unzähligen Schläuchen hing sie, ein mitleiderregender Anblick, nur Haut und Knochen. Ansprechbar war sie nicht. Aber zäh. Zwei Tage späte waren alle Schläuche weg, Nana lag im Bett und sah wieder ganz passabel aus. Zwar konnte ausser Theo kaum jemand verstehen, was sie sagte, er war der Einzige, dem das Familienkauderwelsch vertraut war.
Tags darauf ging’s noch besser, sie war sogar an dem Bild interessiert, das an der Wand gegenüber ihrem Bett hing. Es stellte einen Teich mit Seerosen dar; sie allerdings bestand darauf, es seien Hühner. Es hätte zum Disput kommen können, wenn ich darauf eingegangen wäre. - Dann geht’s ihr ja tatsächlich nicht mehr so schlecht, dachte ich. – Die alte Frau sprach wie ein Buch, aber eben, das meiste davon war unverständlich, nur wenige Wortfetzen machten Sinn. Es tat mir Leid, auf Fragen nicht antworten zu können, weil sie diese nicht verstand. „Das weiss ich nicht mehr“, murmelte Nana. „Was weisst du nicht mehr?“, fragte ich und die Antwort folgte auf dem Fuss: „Ich weiss nicht.“
Ich war mir auch nicht sicher, ob meine Schwiegermutter mich überhaupt erkannte.
Sie schlief, als ich am nächsten Tag zu Besuch kam und wachte erst auf, als die Schwester hereinkam. Es dauert ziemlich lang, bis sie merkte, dass da noch jemand im Zimmer war. Endlich fokussierte Nana mich, die ich am Fussende ihres Bettes stand, deutete mit ihren langen Knochenfingern auf mich und sagte zur Schwester: „Negerfrou“ (ich war von der Sonne gebräunt). - So lange sie ihre Witzchen macht, dachte ich, erkennt sie mich schon noch. So sicher war ich dann aber nicht mehr, als Diego die Grossmutter im Spital besuchte und diese ihn fragte: „Dir kennet doch der Theo, gäuet?“
Das war zwei Wochen vorher. Jetzt ist sie tot.
Während Jahren hatte sie jeweils beim Verabschieden gesagt: „Vielleicht ist es das letzte Mal, dass wir uns sehen“, ein Satz, der mir unheimlich auf die Nerven ging. Sonntag für Sonntag. Jetzt werde ich ihn nie mehr hören; die Prophezeiung war eingetroffen.
Die Familie stand versammelt vor dem Grab, und der Pfarrer sprach die tröstenden Abschiedsworte. Es traf mich hart, als ich den Friedhofgärtner sah mit der Urne in den Händen. Das ist also das Ende, dachte ich. Nach 95 Jahren ist das alles, was übrig bleibt: Asche in einem Gefäss, das jemand mit sich herumtragen kann. - Die Endgültigkeit der Situation war schuld daran, dass ich Tränen in den Augen hatte. Es rührte mich auch zu sehen, wie meine vier Kinder weinten um eine Grossmutter, die seit je zur Familie gehört hatte, mit der sie manches Schöne und Lustige, aber auch viel Eigenartiges erlebt hatten. Zweiunddreissig Jahre lang hatte ich die Frau gekannt, die jetzt nur noch ein Häufchen Asche war, mit der mich herzlich wenige Gemeinsamkeiten verbunden hatten, deren Schrullen mir aber doch mit den Jahren fast lieb geworden waren.
Ich erinnerte mich an ein Telefongespräch mit meiner Schwiegermutter, das ungefähr neun Jahren zuvor stattgefunden hatte. Es drehte sich um Gräber, genauer gesagt um das Grab, vor dem wir jetzt standen. Nana hatte mich damals gefragt, ob meine Mutter wohl einverstanden wäre mit der Verschiebung des Grabes meines Vaters neben dasjenige von Nono, ihres zwei Jahre zuvor verstorbenen Ehemannes. – „Väter unter sich“, dachte ich und staunte nicht schlecht über diese neueste Idee aus dem Hause Torriani.
Ich wollte mehr wissen über den Zweck dieses seltsamen Vorhabens. - Mit meinem spontanen Gedanken lag ich offenbar nicht weit daneben, denn die Schwiegermutter fuhr unbeirrt fort: „Weisst du, ich werde dann auch für mich dort einen Platz reservieren lassen, ebenso für deine Mutter, so sind wir dann alle beisammen.“ - Ich war endgültig sprachlos und Nana, die offenbar merkte, dass sie dem Ganzen einen etwas plausibleren Anstrich geben musste, fuhr weiter: „Auch für die Jungen, die dann die Blumen giessen müssen, ist es einfacher, wenn wir alle am gleichen Ort sind.“
Bei dieser Vorstellung beschlich mich für den Bruchteil einer Sekunde eine Art Panik. Sich auszumalen, wie das wäre, wenn da allenfalls doch vielleicht noch etwas stattfinden könnte nach dem Ableben und dann alle wieder zusammen wären, eine Art virtuelle Party also – einfach nur makaber. Nicht, dass der Gedanke ans Zusammensein so schrecklich gewesen wäre, nein, aber... Und dann das Bild: Jemand giesst die Blumen.
„Tot ist tot“, dacht ich für mich, und „Zusammensein“ tönte in meinen Ohren nach dem gemütlichen zweiten Teil nach einer Sitzung oder einem Jassabend; auf jeden Fall nach Minne, ein Herz und eine Seele etc., etc. Dabei war unsere Familie nicht anders als andere auch, man kam zwar gut miteinander aus, aber es gab auch Meinungsverschiedenheiten und überhaupt: Das Ganze war vollkommen absurd.
Ich riet meine Schwiegermutter dringend, bevor sie etwas unternehme und eigenmächtig Gräber verschieben lasse, diese Angelegenheit unter allen Umständen zuerst mit meiner Mutter zu besprechen.
Und so geschah es. Nana hatte sich anscheinend schon sehr genaue Vorstellungen gemacht, hatte bereits die Friedhofverwaltung avisiert und auch schon eingeteilt, wer wann drankommt, wenn’s ums Sterben geht. „Die nächste bin ich“, hatte sie zu meiner Mutter gesagt, „dann bist du dran (jetzt war es an ihr, leer zu schlucken), dann kommt Jany ...“. Das war der Moment, wo meine Mutter eingriff und tapfer einzuwenden wagte, man könne unter Umständen davon ausgehen, dass die Sterberei in einer Familie nicht zwangsläufig chronologisch zu und her zu gehen habe...
Ich mischte mich nicht ein und dachte bei mir, man werde ja dann sehen, wie das alles schliesslich herauskommt. - Die Verhandlungen mit der Friedhofsverwaltung zwecks gemütlichen Zusammenseins nach dem Tod waren zu dem Zeitpunkt ja bereits eingeleitet und kurz darauf auch ausgeführt. Dazu gehörte, dass das Grab von Herrn Weder, einem ehemaligen Richter, welches damals neben demjenigen meines Schwiegervaters selig platziert war, verschoben werden musste. Ich erinnere mich noch genau an die Worte von Nana, die elf Jahre zuvor nach der Urnenbeisetzung ihres Mannes mit grosser Genugtuung gesagt hatte: „Hier liegt Nono gut. Den Herrn Weder, den habe ich gekannt. Das war ein rechtschaffener Mann. Da ist Nono in guter Gesellschaft.“
Und so liegen sie denn dort zu dritt, falls man das Liegen nennen kann, die Einigkeit sichtbar gemacht durch gemeinsame Blumenbanden, ein wenig abseits von Herrn Weder.
Und was es sonst noch alles zu erzählen gibt:
Tennis
Inzwischen hatte ich auch gelernt, Tennis zu spielen. Eigentlich hätte mir diese Sportart schon längst gefallen, aber ich hatte oft Rückenschmerzen und dachte, so gehe das auf keinen Fall. – Als ich im Jahr 1998 eine Woche lang alleine in der Dominikanischen Republik in den Ferien war, überredete mich dort ein Tennislehrer im Hotel, es doch mal zu probieren. Er gab mir ein paar Schuhe, einen Schläger und los ging’s. Und es machte mir solchen Spass! Zu Hause kaufte ich mir sofort eine ganze Ausrüstung, überredete eine Freundin, ebenfalls Tennisspielen zu lernen und wir meldeten uns in einem Club an und nahmen fleissig Unterricht. Rückenschmerzen waren kein Thema mehr. – In einem Doppel oder Mixed mitzuspielen, macht mir unglaublich Freude, es gibt Wochen, da bin ich fünfmal auf dem Platz anzutreffen. Auf einen richtig grünen Zweig schafft man es jedoch leider nicht mehr, wenn man diese Sportart nicht schon als Kind oder Jugendlicher gelernt hat, aber das stört mich nicht. Etwas vom Schönsten dabei ist nämlich auch, dass ich viele neue Freundinnen und Freunde gewonnen habe und wir unzählige lustige und anregende Stunden zusammen verbracht haben und immer noch verbringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, wenn's möglich ist, einen der Orte zu besuchen, wo die "richtigen" Matches stattfinden. Roger zu sehen in Gstaad oder am Davis-Cup in Bern, war ein absolutes Muss für uns Tennisfans, und mit einer Freundin die einzigartige Stimmung an einem grandiosen Tag in Wimbledon zu erleben, sowieso.
Tennisferien waren von da an immer ein Highlight; gemeinsam verbrachte Wochen in der Türkei, in Sardinien, in Spanien, in Kroatien, im Brandnertal in Österreich und viele Male im Allgäu und in Zermatt sind unvergesslich.
„Auto-Geschichten“ - (Karosserie-Abänderungen)
Was sich wie ein Witz erzählen lässt, mir aber tatsächlich vor ein paar Jahren passiert ist, ist Folgendes:
Mit einer Freundin war ich unterwegs im Allgäu. Wir fuhren Richtung Kempten, als von rechts, aber aus einer nicht vortrittsberechtigten Strasse ein Auto ungebremst in uns hineinfuhr. Zum Glück wurde niemand verletzt. Der fehlbare Fahrer stieg aus und entschuldigte sich. Er sei in Gedanken gewesen. Es stellte sich heraus, dass er der Pfarrer der Gemeinde war, wo der Unfall passiert war. Er gab mir seine Adresse und Telefonnummer und versprach, gleich seine Versicherung zu avisieren. Obwohl die Karosserie hinten rechts ziemlich beschädigt war, konnten wir sogar noch weiterfahren. Die Polizei brauchten wir nicht zu rufen. – Zurück im Hotel rief ich ihn am Abend an. Offenbar schon wieder in seine Seelsorge-Aufgabe vertieft, antwortete er sofort und sagte: „Guten Abend. – Haben Sie ein Problem?“ – Ich kam nicht umhin zu antworten: „Diesmal, so glaube ich, haben Sie wohl ein Problem“. – Meine Freundin, die neben mir stand, musste laut lachen.
Alles verlief bestens mit der Versicherung. Wir erhielten ein Ersatzfahrzeug und der Schaden von 10‘000 Euro wurde anstandslos bezahlt.
Auch ein anders Mal hatte ich Glück. Auf dem Parkplatz der Tennishalle fuhr ich rückwärts aus der Parklücke heraus, schaute in die Rückspiegel rechts und links, da war nichts. Genau hinter mir war aber ein Auto parkiert, dass ich völlig übersehen hatte. Der Ton verhiess nichts Gutes. Ich stieg aus und schaute mir den Schaden an. Genau unterhalb des Nummernschilds hatte ich die Anhängerkupplung ins Blech hineingerammt. Keine riesige Beule, aber immerhin. Ärgerlich, ärgerlich! - Ich liess meinen Wagen stehen und ging auf die Suche nach dem Fahrer, dessen Auto ich beschädigt hatte. Nach kurzem Suchen fand ich ihn an der Bar. Wir schauten und die Delle an und er sagte: „Da ist gar nichts passiert. Da hatte ich bereits eine Beule.“ – Gibt’s denn sowas?!
Auch Pech hat man manchmal, alle drei Episoden schon mehr als dreissig Jahre her: Meine ungebremste Fahrt in einen Findling in der Nähe, wo wir wohnten, hatte mir einen riesigen Schrecken eingejagt. Ich fuhr überhaupt nicht schnell, wollte nach rechts abbiegen, die Strasse war aber völlig vereist und der Wagen war dadurch nicht von seiner Spur abzubringen. Bremsen ging auch nicht mehr, so geschah dann das Unvermeidliche. Wenn dort zufälligerweise ein Fussgänger spaziert wäre...
Auch zwei weitere Kühlerhauben gingen auf mein Konto. – In der Kolonne stehen, anfahren bei grün, einen kurzen Moment schaue ich seitlich aus dem Fenster und bemerke zu spät, dass die Autos vor mir trotz Grünlicht wieder zum Stehen kommen. – Schon ist’s passiert. Ich schiebe den Wagen vor mir in denjenigen vor ihm. Der in der Mitte erleidet Totalschaden. Zum grossen Glück wurde niemand verletzt. – Mein Portemonnaie natürlich schon. Die Versicherung zahlte zwar den Schaden, den ich angerichtet hatte, aber da wir keine Vollkasko-Versicherung hatten, musste ich selber „bluten“.
Kühlerhaube Nummer drei: Diesmal war es nicht meine Schuld: Aus einer Stoppstrasse heraus fuhr ein Auto voll vorne links in meinen Peugeot hinein. Grad vor einer Garage. Das zumindest traf sich gut. Wieso die Autofahrerin mich nicht gesehen hatte, wusste sie selber nicht. Die Situation war übersichtlich. Verletzt wurde zum Glück auch da niemand.
Der Stufenbau, unser Eventlokal, unsere Galerie
Im Jahr 2005 ersteigerte mein Mann im Stufenbau in Ittigen (eine ehemalige Zellulosefabrik, die verschiedene Ateliers und kleinere Handwerksbetriebe beherbergt und jetzt denkmalgeschützt ist) die ehemalige Diskothek, die Konkurs gemacht hatte. Es handelte sich um die oberen beiden Stockwerke auf der linken Seite mit einer Gesamtfläche von ungefähr 300 m2. Es gab unendlich viel zu tun, bis das Lokal, in dem es drei Bars, etliche Räume und Nebenräume und einen Garten hatte, auf Vordermann gebracht war. Bis schon nur die unendlich langen Reihen von Fenstern, die mit gelber, blauer und rosaroter Farbe übermalt waren, geflickt und geputzt waren und ein Zwischenboden in der hohen Haupthalle, die fast die Ausmasse einer Kirche hatte, eingebaut war, dauerte es Monate. Aber es lohnte sich: Wir besassen nun ein wunderbares Eventlokal, das fast jedes Wochenende für Firmenanlässe, Hochzeitsfeiern und Partys gemietet wurde. Ohne die unermüdliche Hilfe unserer Söhne hätten wir es nicht geschafft.
Ebenfalls organisierten wir ungefähr dreimal pro Jahr eine Kunstaustellung. Dazu luden wir in der Regel etwa zehn verschiedene Künstlerinnen und Künstler ein, die während zwei bis drei Wochen ihre Werke ausstellten. Es war ein grosser Erfolg und wir waren mit Herz und Seele dabei. Allerdings war es ein hartes Stück Arbeit, alles zu organisieren und durchzuführen.
Ich hatte ein paar Töpferkurse besucht und besass inzwischen ein eigenes kleines Atelier und einen Brennofen. So stellte ich meine „Kunst“ ebenfalls aus, es waren vor allem eine Art Totempfähle, die ich töpferte nach dem Vorbild derjenigen in Vancouver und Vancouver Island.
Nicht viel weniger Arbeit machten auch die Events. Unsere beiden Söhne Gino und vor allem Diego knieten sich hinein und hatten mehr als ihnen lieb war damit zu tun. Es galt, fast jeden Tag etliche Emails zu beantworten, den Leuten die Lokalität zu zeigen, Verträge abzuschliessen und an den Wochenenden in der Nähe zu sein, falls etwas nicht so lief, wie es sollte. Vor allem mit dem Schräglift gab es Probleme, der sich von Zeit zu Zeit weigerte zu funktionieren. Wer von den Partygästen nicht konnte oder nicht gewillt war, die 144 Stufen hochzusteigen, den musste man per Auto auf einem riesigen Umweg zum Ort des Geschehens fahren. - Kurz gesagt, unser „Hobby“ artete sozusagen in einen Vollzeit-Job aus. Und so kam es nach sieben Jahren, wie es kommen musste: Unsere Söhne hatten genug von der Arbeit, wir selber waren nicht bereit, voll einzusteigen und all das zu übernehmen, was es brauchte, damit der Betrieb aufrechtgehalten werden konnte. Wir wollten lieber frei sein und auf Reisen gehen können, Theo war ja bereits seit zwölf Jahren pensioniert und ich würde mich mit sechzig, also im Jahr 2013 ebenfalls pensionieren lassen. Jemanden anzustellen, das wäre vielleicht eine Lösung gewesen, aber aus verschiedenen Gründen kamen wir von der Idee ab und verkauften das Business schliesslich im Herbst 2012 - schweren Herzens, aber mit gutem Gewinn.
Nur noch ein Jahr...
Nur noch ein Jahr lag vor mir bis zur vorzeitigen Pensionierung. Dieses verflog im Nu. Verbunden mit vermischten Gefühlen fand immer wieder etwas „zum letzten Mal“ statt: unser Vorbereitungskurs für den Einstieg in die BMS, die einzelnen Kapitel im Lehrbuch, das Generieren einer neuen Probe, die Korrektur derselben, die Betreuung einer Maturarbeit, der Sporttag der gesamten GIBB im Wankdorf, die Gesamtlehrekonferenz, die Fachsitzung, die schriftlichen und die mündlichen Prüfungen und schliesslich die Abschlussfeier.
Am 4. Juli 2013 war mein allerletzter Einsatz in der Lorraine: mündliche Prüfungen. Er dauerte nur bis am Mittag. Der letzte Schüler, den ich mit einer externen Expertin zu prüfen hatte, erhielt eine Sechs. Er hatte seine Sache perfekt gemacht, es gab diskussionslos die Bestnote. – Was für ein fabelhafter Abschluss nach 35 Jahren im Schuldienst!
Und was für ein unvergesslicher Tag: Die Prüfungen am Morgen, ein Bad in der Aare am Mittag, Tennis am Nachmittag und am Abend lud ich einige meiner Freundinnen zum Nachtessen und Feiern in ein Gartenrestaurant ein.
Das war der Anfang meines Lebens als pensionierte Lehrerin, was in meinen Ohren übrigens ziemlich schrecklich tönt. Allerdings kann ich mich leicht mit der Terminologie abfinden, da ja ein wunderbares Stück neue Freiheit damit verbunden ist.
Im dritten Kapitel berichte ich ausschliesslich über die Reisen, die wir von da an unternahmen. Den Spätherbst in der Schweiz zu verbringen, kam für mich überhaupt nicht mehr in Betracht. – All die Tage, die immer kälter, dunkler und nasser werden und auch die Nebeldecke lassen wir gern zurück.
Meine Mutter
So gibt es nur noch eines zu berichten. Ich habe es schon am Anfang kurz erwähnt, zeitlich aber gehört das Ereignis ans Ende dieses Teils meines Berichts:
Am 28. März 2014 starb meine Mutter im hundertdritten Altersjahr.
Bis sie fast neunzig war, lebte sie im eigenen Haus, ganz in unserer Nähe. Als ihr Treppensteigen, Putzen und Gärtnern zu viel wurden, zog sie ins Tertianum um, ein Seniorenheim in unserer Gemeinde. Leider gefiel es ihr dort nicht und so nahmen wir sie für kurze Zeit in unserem Haushalt auf. Gerne hätten wir ihr das Beste geboten, was für sie möglich war, aber erneut fühlte sie sich als das fünfte Rad am Wagen. Allmählich hörte sie auch nicht mehr so gut und ihr Sehvermögen liess ebenfalls nach. So wurde alles schwieriger und schwieriger. Sie wurde pflegebedürftig, so dass wir sie nach einem halben Jahr in ein Alters- und Pflegeheim umsiedeln mussten. Dort allerdings gefiel es ihr, was wir mit grosser Erleichterung feststellten. – Zu sehen und mitzuerleben, wie es ihr aber von Jahr zu Jahr schlechter ging, war nicht leicht zu ertragen. Eine Kommunikation wurde mit der Zeit fast unmöglich. Wir verstanden nicht mehr, was sie uns sagen wollte, sie verstand uns nicht mehr und bald schon war es so weit, dass sie nur noch meine Schwester und mich erkannte, schliesslich nicht einmal mehr das. Und bald schon kam der Tag, wo sie ihren Altersbeschwerden erlag. Für uns war es ein trauriger Abschied, trotzdem auch eine Erlösung. Unsere geliebte Mutter, die immer für uns da gewesen war, musste nun nicht mehr leiden. Ihr langes Leben, das sich über ein Jahrhundert erstreckt hatte, war Geschichte; ein weiteres Kapitel in meinem Leben zu Ende.
Ihre Urne ist im Bolliger Friedhof vergraben, dort, wo auch Theos Eltern ihre letzte Ruhestätte gefunden haben – genauso, wie es meine Schwiegermutter vorausgesagt und angeordnet hatte, ein wenig abseits von Herrn Weder...
TEIL 3: REISEN
Blick zurück: Drei Urlaube (1999 / 2004 / 2009) - und ein paar andere Reise-Erinnerungen
„Reisen macht uns zuerst sprachlos und dann zum Geschichtenerzähler“.
Dieser Satz stammt von Ibu Battuta, einem marokkanischer Autor aus dem 14. Jahrhundert.
Die Reisen, die wir oder ich bis zum Ende des zwanzigsten Jahrhunderts unternahmen, haben mir Appetit gemacht auf mehr, auf sehr viel mehr.
Leider habe ich während dieser Zeit noch keine Reiseberichte geschrieben, viele Details also vergessen, aber ich freue mich, dass ich später dann damit begonnen habe. Fotos existieren schon, aber das ist nicht das Gleiche.
Eine Episode kommt mir aber trotzdem in den Sinn aus dem Jahr 1994: Eine lustige Reise war das! – Wir, drei Freundinnen, hatten eine kurze Kreuzfahrt gebucht nach Istanbul. Einen Tag lang hatten wir Zeit, uns Venedig anzusehen. Ich sehe uns noch, wie wir auf dem Bootssteg stehen und nicht ganz sicher sind, ob das Boot, das eben landet, das richtige ist, um zum Petersplatz zu gelangen. Wir stehen nebeneinander an der Schiffsanlegestelle, alle schwarz gekleidet. Da kommt ein Paar angelaufen mit Säcken und Taschen und er müht sich zusätzlich mit einem Koffer ab. Sie hat einen riesigen Hut auf, wie direkt aus Ascot entsprungen und auch er ist elegant gekleidet. Die beiden kommen uns vor wie aus einem Film. Sie drängt sich vor uns aufs Boot und das legt genau in dem Moment ab, sie drauf, wir noch nicht und ihr Partner auch nicht. – Sie ruft ihm etwas zu und er schreit hinüber: „I couldn’t get on the boat because of these three witches!“ – Seit dann erinnern wir uns natürlich an diese Reise als die „Drei-Hexen-Fahrt“.
In Istanbul hatten wir ein anderes Erlebnis, das uns sehr zu denken gab. Wir besuchten den Bazar und gegen Abend auf dem Weg zurück ins Hotel wurden wir aufs Gröbste von einer Gruppe von Männern angemacht und bedrängt, obwohl wir alle sehr ziemlich angezogen waren. Es war nicht sehr warm und wir hatten Hosen und Mäntel an und sogar Kapuzen übergezogen. Die Situation wurde so angespannt, dass wir uns entschlossen, einen halben Kilometer vor dem Hotel ein Taxi zu rufen, um den Weg nicht weiterhin zu Fuss zurücklegen zu müssen. - Fast vom Regen in die Traufe geraten: Der Taxifahrer war ebenso penetrant und machte mit obszönen Bemerkungen mehr oder weniger dort weiter, wo die andern, denen wir knapp entkommen waren, aufgehört hatten und wollte uns in ein „Etablissement“ fahren. – Statt irgendwo in einem hübschen Restaurant zu Abend zu essen, bleiben wir im Hotel.
Als ich Jahre zuvor mit Theo in dieser Stadt war, hatte ich keine Probleme dieser Art, aber offenbar, wenn Frauen alleine unterwegs sind...
In bester Erinnerung sind mir auch die Studienreisen, die wir in fünfjährigen Abständen mit dem Kollegium der bsd. unternahmen (Lissabon, Rom, Veneto, Aquitaine und Bordeaux, Andalusien). Interessant waren dabei die Besuche in Berufsschulen, ähnlich der unseren, und die sehr verschiedenen Betriebsbesichtigungen (Produktionsstandort Autoeuropa in Portugal, landwirtschaftliche Betriebe in Spanien und Frankreich und viele mehr).
In den Sommerferien blieben wir am liebsten zu Hause mit den Kindern, denn nach wie vor finde ich, es gibt keine schönere Destination im Juli und August, als das Ufer der Aare. All die Leute, die an die überfüllten italienischen, französischen und spanischen Strände pilgern müssen, beneiden wir nicht.
Etwas anders war das allerdings im Herbst. Die Berner Herbstferien beginnen jeweils bereits vor Ende September, also eine Woche früher als in den anderen Kantonen, so war und ist man am Strand in Spanien als Berner „unter sich“, zumindest an den Werktagen.
So reisten wir ab 1987 jedes Jahr für zwei Wochen nach Spanien (nördlich von Roses), wo uns ein Freund einen Geheimtipp anvertraut hatte, eine Terrassensiedlung direkt am Meer, ideal für Kinder und Erwachsene (Restaurant mit den Füssen im Sand). Inzwischen waren wir bereits mehr als dreissigmal dort und es ist uns noch immer nicht verleidet.
Es ist schön, irgendwo hinzukommen und sich dort gleich zu Hause zu fühlen. Genauso schön aber ist es, irgendwo hinzureisen, wo man nichts kennt, wo es gilt, alles neu zu erkunden. - Dafür war der Frühling jeweils die Zeit. Wie in Teil zwei bereits erwähnt, nutzte ich die Frühlingsferien regelmässig für eine Familienauszeit (Kenya, Indien, Singapur, Hong Kong, Malaysia, Bali, Malediven, Sri Lanka, Ägypten). Normalerweise reiste ich mit einer Freundin, später auch ein paarmal mit meiner Tochter Kay (Malaysia, Namibia, Mauritius, Thailand, Mittelmeerkreuzfahrt nach Italien und Griechenland, Tennisferien in der Türkei).
Reiseberichte habe ich damals nur wenige verfasst; es sind eher kleine Fotoreportagen mit nur wenig Text.
Das änderte sich, als ich nach zwanzig Jahren Schuldienst meinen ersten Urlaub beziehen durfte. Das wäre im Jahr 1998 gewesen, ich hatte ihn aber ins 1999 verschoben.
Die Berichte schickte ich der Familie heim und auch an einige Freunde. Ich erwähne jeweils Restaurants und Hotels, manchmal sogar mit dem dazugehörigen Link, weil ich denke, dies könnte unter Umständen nützlich sein. Und die vielen Ortsnamen, die ich nenne, helfen mit, mich später wieder an die Reise zu erinnern, sie auf Google Maps zu verfolgen und überhaupt, sie nicht zu vergessen.
Noch eine Bemerkung zu den Texten
Zum Teil sind sie im Präteritum geschrieben, dann wieder im Präsens. Das ist darauf zurückzuführen, dass ich sie manchmal erst nach ein paar Tagen geschrieben habe, oft aber am selben Abend oder am folgenden Morgen, wo das Erlebte noch absolut gegenwärtig war. – Ich will das nicht abändern, denn es würde für mein Empfinden so nicht stimmen.
Nicht selten brauche ich berndeutsche Ausdrücke, manchmal sogar ohne Anführungszeichen. Das, weil sie exakt das aussagen, was ich fühle und wie es mich richtig dünkt.
Und noch etwas: Wenn ich sie durchlese, finde ich immer wieder Fehler: ein Komma hier, ein Fallfehler da, unnötige Wortwiederholungen, auch Orthographiefehler, die ich übersehe und die mir Word seltsamerweise manchmal nicht unterstreicht, „verzworgelte“ Sätze und manches mehr. „It’s a never ending story“...
Reisebericht Urlaub 1999 Florida und Ecuador
Fünfzehn Wochen Urlaub – was für eine wunderbare Perspektive! - Die wollte ich natürlich nicht auf dem Sofa sitzend verstreichen lassen. So meldete ich mich nach den obligaten zwei Familien-Ferienwochen in Spanien erst für einen Lehrerkurs in Florida an. Für die folgenden Wochen bis kurz vor Weihnachten war ein Schulbesuch in Ecuador geplant, um meine Spanischkenntnisse zu vertiefen.
CELTA
Die vier Wochen in Florida werden mir unvergesslich bleiben, weil ich, soweit ich mich erinnern kann, in meinem Leben noch nie einen solchen Stress gehabt habe. Der Kurs, den ich gebucht hatte, hätte mir erlaubt, am Nachmittag jeweils an den Strand zu gehen, ein wenig die Gegend zu erkunden (Everglades, Key West etc.), und Tennisspielen wollte ich jeden Tag eine Stunde lang. Ich hatte mir ein Apartment gemietet mit Fitnesscenter und einem Swimmingpool gleich vor der Terrassentüre. Am Pool war ich während der ganzen Zeit nur dreimal kurz, im Fitnesscenter einmal und am Strand zweimal für ungefähr zwei Stunden. Den Tennisschläger habe ich nie auch nur angerührt.
Als ich am ersten Tag in der Schule meine Eintrittstest machte, wurde mir mitgeteilt, es hätte sich niemand sonst für diesen Kurs angemeldet, ich wäre die Einzige, was mir nicht sehr behagte. Man schlug mir vor, lieber beim CELTA - Cambridge Kurs (Certificate in English Language Teaching to Adults) mitzumachen, da wären wir zu fünft. Dieser sei zwar mehr als nur streng, etliche würden aussteigen und auch dass es Tränen gäbe, sei nicht unüblich. Ebenfalls müsse man sich nicht vorstellen, viel daneben unternehmen zu können. Eigentlich sei er nur für „native speakers“ ausgeschrieben, aber sie würden eine Ausnahme machen und ich würde nicht draufzahlen müssen. - Obwohl nicht gerade begeistert, war ich einverstanden. Man sagte mir, der Kurs fange täglich um neun Uhr an, aber vermutlich sei es unerlässlich, schon um acht Uhr dort zu sein. Genau so war‘s natürlich. Bis um sechs würde es dann dauern und man müsse mit mindestens drei Stunden Hausaufgaben rechnen. Das allerdings war eine masslose Untertreibung, denn unter sechs Stunden zusätzlich hat‘s niemand von uns geschafft. Wir waren zu fünft (drei Frauen und zwei Männer) und das Ziel der Tortur war, ein Zertifikat zu erhalten, das einem ermöglicht, in jedem Land der Welt Englisch unterrichten zu können. Das brauchte ich zwar gar nicht, die bsd. und die BMS taten‘s mir allemal, aber ich dachte, es tue mir vielleicht ganz gut, mal vier Wochen lang das zu tun, was mir zu Hause ja auch warten würde mit den neuen Qualitätsansprüchen. Zudem fand ich, es würde eine wertvolle Erfahrung sein, im Schulzimmer wieder mal auf der „anderen Seite“ zu sitzen.
Nun, dem war dann nicht ganz so. Der Inhalt des Kurses war genau das, was ich eigentlich eine Zeitlang hatte vergessen wollten: Unterrichten, Stunden präpen, stundenlang vor dem Computer sitzen (zum Glück hatte ich meinen Laptop bei mir - ohne den wär das alles unmöglich gewesen).
Am Morgen wurde uns jeweils gezeigt, wie „man“ Schule gibt (auch den alten Hasen!), wir mussten hospen (nicht hopsen) und Methodik, Phonetik und Grammatik etc. lernen. Am Mittag hatten wir eine Stunde Pause, aber niemand kam je dazu, gemütlich etwas zu essen, man musste seine Stunden vorbereiten, die man am Nachmittag zu halten hatte, es gab natürlich Kopien auszudrucken, Bücher und Zeitschriften nach geeignetem Material durchzuforsten, den Proki-Schreiber, das Tonband, den TV-Apparat herzurichten, die Sitzordnung zu planen, was eben alles so dazu gehört. Dann mussten wir unsere Lektionen halten und zwar beobachtet von den vier Mitkolleginnen und Mitkollegen oder „Mitleidern“ und unseren zwei Lehrerinnen, denen wir jeweils vorher ganz genaue Lektionenpläne hatten abgeben müssen. Auf die Minute musste Rechenschaft abgelegt werden, was wir mit unseren Schülerinnen und Schülern, den Versuchskaninchen aus aller Herren Länder, vorhatten. Die Verhältnisse im Schulzimmer waren allerdings nicht ganz so wie bei uns. Zuweilen waren nur ungefähr fünf oder sechs „Students“ aus der Schweiz, Frankreich, Spanien, Italien, zum Teil aus Südamerika und wenigen anderen Ländern in unserer Versuchsklasse. Die meisten von ihnen aber waren Japanerinnen und Japaner, die einen Sprachkurs gebucht hatten und sich daher prima als „Material“ für unsere Unterrichtssequenzen eigneten. Kein anderes Wort als Englisch durfte gesprochen werden, der minuziös ausgearbeitete Unterrichtsplan musste peinlich genau eingehalten werden. Falls nicht, hatte man sich im Anschluss bei der Besprechung auf ein „Gewitter“ gefasst machen müssen. Auch musste die „TTT“ (Teacher Talking Time) auf ein Minimum beschränkt werden. Und dann kam das dicke Ende am späten Nachmittag. Alles wurde zerpflückt und beurteilt bis zum Gehtnichtmehr.
Mit manchem war ich überhaupt nicht einverstanden. Schliesslich hatte ich bereits zwanzig Jahre Erfahrung. Zudem hatte ich nämlich viel gelernt von unserem Lehrer im Gymnasium, der im Vergleich zur hier praktizierten Methode eine riesige TTT aufwies, was mir jedoch sehr gefiel. Wendungen, die er brauchte, schrieb ich oft auf. - Was mir auch nicht passte, war diese „Minuten-Vorbereiterei“. - Wo blieb Zeit, auf Fragen der Students einzugehen? Wie stand’s mit Flexibilität? – Unser Unterricht zu Hause sieht völlig anders aus und führt ja auch zum Ziel, und das überhaupt nicht schlecht. - Natürlich planen wir den Unterricht, aber nie dermassen minuziös aufgegliedert. Das fand ich absolut stumpfsinnig, aber argumentieren nutzte nicht viel, dazu war ja auch in unserem Unterricht keine Zeit eingeplant und die Struktur eines Cambridge-Kurses zu ändern, das konnte ich so oder so vergessen.
Zurück zum „CELTA-Alltag“: Am frühen Abend um sieben war ich normalerweise zu Hause. Es reichte jeweils kaum für ein Nachtessen, schon gar nicht für eines in Musse, und schon musste ich wieder die Stunde vom nächsten Tag vorbereiten. Dazu wurde täglich eine Seite Tagebuch verlangt über alles, was man im Unterricht und beim Unterrichten gelernt hatte, wie man sich fühlte und so weiter. - Und nicht genug: Zusätzlich wurde von uns verlangt, vier umfangreiche Arbeiten abzugeben über die vier Kurswochen verteilt. Eine beinhaltete etwas über Grammatik - für mich relativ einfach, für meine muttersprachigen Kolleginnen und Kollegen aber recht schwierig, weil sie nicht so sattelfest waren in ihrer eigenen, der englischen Grammatik.
Dann musste man sich eine Schülerin oder einen Schüler suchen und mit ihr oder ihm ein etwa zweistündiges Interview durchführen, zum Teil auf Tonband, ihre/seine „Geschichte“ aufschreiben, wie er oder sie Englisch gelernt hatte oder lernt, weshalb, seit wann, etc. Dann analysieren, welche Laute sie/er wie ausspricht, was dabei falsch gemacht wird, wo die Probleme liegen, was man empfehlen könnte, wie weiterfahren und so fort. Auch musste sie oder er einen Aufsatz schreiben, der korrigiert und genau nach der Art der Fehler analysiert werden musste. - Jemanden zu finden, der all das in der Freizeit auf sich nahm, war übrigens auch nicht „a piece of cake“, das Einfachste auf der Welt...
Eine andere Arbeit war, eine Stunde, die man gegeben hatte, selber zu zerpflücken und genau zu beschreiben, was man wieso anders machen würde oder nicht und das hatte 1500 Worte lang zu sein.
Natürlich bestand die vierte Arbeit aus einer ausführlichen Kursevaluation.
Und jede Woche fand ein Gespräch mit einer unserer Lehrerinnen statt, wo man sich selber beurteilen musste und von ihr auch beurteilt wurde. - So ein Stress!
Zwei Tage lang war ein Assessor aus Cambridge da, der einen dann noch zusätzlich unter die Lupe nahm. Auch die Schule wurde von ihm auf Herz und Nieren geprüft. - Ziemlich übertrieben, das Ganze, fand ich. - Ja, so war‘s und ich werde es nie vergessen, nicht den enormen Schlafmangel, nicht die Strapaze und den Druck.
Am letzten Tag wäre nach Stundenplan um 4.15 Uhr Kursende gewesen. Aber weil an einem Nachmittag wegen eines Hurrikans die Schule hatte ausfallen müssen, wurden wir dazu verdammt, unsere Stunden halt dann nachzuholen (kein Erbarmen!) und es wurde wieder sechs Uhr bis wir gehen konnten. - Einer allein glaubt‘s fast nicht: Zwei von uns mussten deshalb ihre Flüge verschieben. - Und dann fiel auch einer der Kollegen noch durch am Schluss und erhielt sein Diplom gar nicht.
Schlimm am Ganzen war auch die Tatsache, dass ich kaum dazu kam, etwas zu organisieren betreffend meiner Weiterreise. Natürlich hatten die Reisebüros schon alle geschlossen, wenn wir endlich das viel zu kalt klimatisierte Gebäude verlassen konnten. Und dabei war‘s draussen so schön warm!
Eine Freundin kam mich für zwei Wochen besuchen; sie wohnte bei mir im Apartment, aber ich hatte kaum Zeit, mit ihr etwas zu unternehmen, was mir ein ziemlich schlechtes Gewissen bescherte, denn jeweils am Nachmittag oder am Wochenende gemeinsam Ausflüge zu unternehmen, wäre ja der Zweck ihres Besuches gewesen.
Es hatte auch fast eine Woche gedauert, bis es mir endlich gelang, ein Velo zu kaufen, das mir ermöglichte, auf dem Schulweg Zeit zu sparen, denn auch der Bikeshop hatte schon geschlossen, als wir aus der „Hölle“ entlassen wurden. Eigentlich hätte ich ja eines mieten wollen, aber weil Ray, einer meiner Kollegen aus dem Kurs, sagte, er würde es später gerne noch eine Zeitlang benutzen und es dann für mich verkaufen, war ich einverstanden. – Ich würde Ray dann nach meiner Südamerikareise wieder in Miami treffen. Er nahm auch einen meiner Koffer in Gewahrsam, den ich nicht mitnehmen wollte. - Das war ein perfekter Deal.
Die Schulzeit in Fort Lauderdale hatte ich also hinter mir; jetzt waren Reisen angesagt.
Ecuador – Quito
Als ich anschliessend an diese verrückten vier Wochen glücklich in Quito ankam, kam mir alles vor wie ein kleines Paradies: kein Stress mehr, Zeit für mich, alles wunderbar. Nur wenige Tage blieb ich dort, denn Cuenca war der Ort, wo ich für ein paar Wochen bleiben wollte. Vorerst aber erkundete ich die Stadt, die in einem schmalen Becken hoch oben in den Anden gelegen ist. Dort erstreckt sie sich lang und dünn wie eine Schlange. Ihre Ausdehnung ist etwa 30 km lang, aber nur höchstens 3 km breit. Mit 2‘850 Metern Höhe über Meer und ist sie somit die höchst gelegene Hauptstadt der Welt. Ihre fantastische Altstadt gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Avenida de Chile war ein einziger, dichtgedrängter Markt. Vor Taschendieben hatte man mich gewarnt. Mehrmals. So war ich ziemlich gewappnet, merkte aber trotzdem nicht, dass mir jemand im Gedränge mein „Kitcherner-Rucksäckli“ aufgeschlitzt hatte. Erst später im Hotel fiel es mir auf. Passiert war aber nichts, das Geld hatte ich im Hosensack. – All die Menschen, die mir begegneten und mit denen ich ins Gespräch kam, fand ich sehr nett. Ausser dem Dieb natürlich. Mein Rucksäckli aus der Spar- und Leihkasse Münsingen flickte ich am nächsten Tag mit Faden aus der Kantonalbank, einem weiteren Werbegeschenk.
An einem Samstag unternahm ich einen Tagesausflug nach Otavalo. Die Stadt nördlich von Quito ist bekannt und beliebt bei den Touristen wegen ihres farbenfrohen Marktes. Der Ort ist schön gelegen, von drei Vulkanen umgeben. Ich hatte einen Taxifahrer kennengelernt, der mich dorthin führte und mit dem ich einen Pauschalbetrag vereinbart hatte. Wir verbrachten den ganzen Tag zusammen. Die Fahrt war lang und etwas mühsam, weil die Strasse schlecht und voller Löcher war, aber die Gegend gefiel mir sehr. Auf der Rückreise fuhr mich Wilson zum „Mitad del Mundo“, dem Mittelpunkt der Erde, welcher auf dem Äquator liegt, eben bei 0° 0′ 0″ N 78° 27′ 21″ W, wie’s auf einem Schild steht. Zur Versinnbildlichung ist eine gelbe Linie gezogen. Heute weiss man allerdings, dass nicht ganz exakt gemessen wurde und diese demnach nicht genau am richtigen Ort durchführt.
Cuenca
Wenige Tage später flog ich nach Cuenca und für weitere zwei Wochen besuchte ich auch dort eine Schule, diesmal als „echte“ Schülerin. Und ich genoss den Unterricht. Er war ganz so, wie ich das vom eigenen Lernen her gewohnt war: Viel Grammatik wurde gebüffelt, eine ganze Menge schriftliche und mündliche Übungen gab’s dazu - das exakte Gegenteil von CELTA. Ganz klar führen verschiedene Wege nach Rom, und der hier entsprach mir viel besser, selbst wenn diese Art Unterricht eher der Vergangenheit angehört. Am Nachmittag hatten wir jeweils frei, so kam ich dazu, das Gelernte zu vertiefen oder etwas zu unternehmen. Kurse wurden angeboten, von denen ich regen Gebrauch machte: Keramik modellieren und Kochen.
Bald schon hatte ich Kontakt zu verschiedenen Leuten, die ich in der Schule und in der Freizeit kennengelernt hatte und ich fühlte mich äusserst wohl in der Stadt, wo’s so viele gemütliche Restaurants hat, eine grosse Anzahl von Internetcafés, alle so freundlich sind und das Klima angenehm ist. Man sagt, die vier Jahreszeiten würden sich jeweils an einem Tag abspielen. Das traf ziemlich genau zu: Normalerweise war es warm oder sogar heiss, aber dann begann es plötzlich zu regnen, meist so gegen vier Uhr nachmittags, und in der Nacht war es relativ kalt. Ohne Regenschirm in der Tasche ging ich jedenfalls nirgendwo hin. Schnee war natürlich kein Thema.
Das Leben in diesem armen Land präsentierte sich nach meinem Aufenthalt in Florida wie von einem anderen Planeten. Ich hatte mitten in der Altstadt eine nette Unterkunft gefunden in einer einfachen Pension, die von einer freundlichen Dame geführt wurde (laorquidea.com.ec/">laorquidea.com.ec/). Nur 8 Dollar pro Tag kostete das Zimmer, ein Preis, von dem wir zu Hause nur träumen können. Überhaupt war das Thema Geld ein ganz besonderes:
Wenn ich am Morgen meinen Milchkaffee und ein 3 dl grosses Glas frisch gepressten Brombeersaft zahlte, legte ich eine Note von 20'000 Sucres hin. Dann erhielt ich 15‘000 Sucres zurück, also kostete mich mein Frühstück 50 Rp. (für 10'000 Sucres erhielt man damals einen Franken). Ein Brötchen beim Bäcker kostete 5 Rappen, ein Mittagessen in einem guten Restaurant rund anderthalb Franken. Mein Tennislehrer verlangte 3 Franken für die Privatstunde (einen für die Platzmiete, der Rest war sein Lohn). Eine Fahrt mit dem Taxi kostete einen Franken. Und mein Spanischlehrer in der Schule fand das angemessen...
Auf der Bank bezog ich einmal mit meiner Visa Karte 2 Mio. Sucres (200 Fr.). Ich erhielt eine Riesenbeige von 70 mal 2- und 60 mal 1-Frankennoten. Der Kunde neben mir liess sich einen viel grösseren Betrag auszahlen. Wer weiss, was er damit im Sinn hatte. Jedenfalls stand er da mit zwei grossen Zuckersäcken, die man ihm mit Noten füllte...
Vor den Banken standen Menschen stundenlang an, um ihren Lohn in Empfang zu nehmen und diesen möglichst rasch in Naturalien umzusetzen, denn die Inflation nahm immer krassere Formen an. In den wenigen Wochen, als ich dort war, erhielt ich nach kurzer Zeit bereits 30 Rappen mehr für einen Dollar. So war für die Leute dort alles extrem teuer und Luxusgüter, falls überhaupt vorhanden, waren kaum mehr erschwinglich. Eine Auslandreise zum Beispiel wurde immer utopischer (ein Professor an der Uni erhielt 220 Franken Lohn pro Monat, aber nur, wenn er mindestens zehn Jahre Erfahrung hatte. Der Lohn für eine Primarlehrerin betrug rund 150 Franken). Deshalb kam es dann auch zu Protesten und die Strassen in der Stadt waren voller schwer bewaffneter Polizisten.
Was ich sehr schätzte, waren die Ausflüge, die von der Schule organisiert wurden mit dem Zweck, Kultur, Land und Leute besser kennenzulernen.
So fuhren wir an einem Tag nach Ingapirca, Ecuadors bedeutendste präkolumbianische Inka-Ruinenstätte. Unterwegs hielten wir bei einer Käserei an. Fast wie bei uns in der Schweiz kam es mir vor: Kuhherden und landwirtschaftliche Betriebe. - Beeindruckend: Papas (Kartoffeln) werden sogar noch auf 3‘000 Metern Höhe angebaut. Kleine zwar... Auch Eukalyptusbäume wachsen dort.
Die Ruinen sind imposant. Ein gelblicher Sonnentempel gehört zu den Hauptsehenswürdigkeiten der antiken Stätte. Interessant auch die Geschichte und die geheimnisvollen Legenden, die wir zu hören bekamen. Weniger geheimnisvoll als vielmehr mühsam war der plötzliche Wolkenbruch, der die Wege fast nicht mehr begehbar machte. Teilweise rannen ganze Bäche die erdigen Pfade hinunter. Auch der Nebel mischte sogleich mit und man sah überhaupt nichts mehr. Bald sassen wir alle wieder im Bus. Klatschnass natürlich. Zweieinhalb Stunden dauerte die Reise zurück nach Cuenca.
Am nächsten Tag wollte ich zur Abwechslung mal baden gehen. Im nahe gelegenen Ort Baños hat’s Thermalquellen. Mitten auf der Strecke hielt der Bus an und musste umkehren, weil erzürnte Bürger Strassensperren errichtet hatten und brennende Pneus die Weiterfahrt versperrten. Ich stieg aus und machte ein paar Fotos. Wohl war mir dabei allerdings nicht. Jemand schimpfte auf mich ein. Auf der anderen Seite der Barrikaden hielt ich ein Taxi an und war kurze Zeit später am Ziel. Der Ausflug war’s nicht wert. Es handelte sich um einen Swimmingpool mit 30-35 Grad warmem Wasser, die Anlage sehr bescheiden, Rasen war keiner vorhanden. Das Schlimmste aber war, ich bemerkte, dass ich meine Kamera nicht mehr hatte. Wie und wo genau sie mir abhandengekommen war, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich hatte einen sehr schlechten Nachmittag, ärgerte mich über den Verlust des Fotoapparates und sträflich über mich selber. Als ich dann noch meinen Schirm irgendwo liegen liess, war klar, das war nicht mein Tag.
Ein Ausflug mit besseren Vorzeichen war derjenige in den Süden nach Vilcabamba, ins „Tal der Hunderjährigen“ oder wie der Ort auch genannt wird, ins „Tal der Langlebigkeit“. Weshalb die Einwohner dort so alt werden (bis zu 120 Jahre wird überliefert), darüber gibt es verschiedene Spekulationen, aber ein wissenschaftlicher Beweis erhärtet diese Thesen überhaupt nicht. Vielmehr wird vermutet, dass nicht ganz alle Angaben bezüglich Geburtsdaten korrekt sind.
Mit einer Kollegin, die ich in der Schule kennengelernt hatte, fuhren wir am frühen Nachmittag los, aber weil die Strasse in katastrophalem Zustand war, dauerten die hundert Kilometer bis zum ersten Zwischenhalt in Oña zweieinhalb Stunden. Manchmal hatte es überhaupt keinen Asphalt mehr auf der Fahrbahn, dafür grosse Löcher und Steine. Umso schöner präsentierte sich die gebirgige Gegend. Die Vegetation änderte alsdann stark von 3‘500 auf 1‘500 Meter hinunter. Es wurde immer wärmer. Fast sieben Stunden waren wir unterwegs. Das Hotel, das uns das Reisebüro gebucht hatte, gefiel uns nicht, wir fanden aber eines, das uns absolut begeisterte: das „Madre Tierra“ (www.madretierra.com.ec/">www.madretierra.com.ec/).
Am Hang gelegen mit einmaliger Aussicht auf das Dorf und die Berge, die es umgeben und die mich an unsere Voralpen erinnerten, ausgestattet mit speziell ansprechend eingerichteten Zimmern, fast wie in einem Palast, und einem fantastischen Tropengarten war für uns sofort klar: Dorthin ziehen wir sogleich um.
So sehr es mir in Cuenca gefiel – mitten in der Stadt zu leben, fand ich zur Abwechslung absolut grossartig – zahlreiche Restaurants, Internetcafés und Reisebüros in nächster Nähe, die Post gleich nebenan, Geschäfte, Lädeli und Apotheke um die Ecke, der Nachteil waren die stinkenden Abgase und die rücksichtslose Fahrweise der Autofahrer. Fussgänger müssen sich oft rennenderweise auf die andere Strassenseite retten, sonst werden sie mit der Hupe weggefegt. Zwar gewöhnt man sich an alles, aber umso schöner empfanden wir die Ruhe und Schönheit der Natur nun im Süden.
Am nächsten Morgen, von einem beispiellosen Vogelgezwitscher geweckt, bei dem aber auch Esel mitmischten, Hähne sowie Kühe, erhielten wir früh schon ein wunderbares Frühstück. Anschliessend fuhren wir ins Dorf, wo tatsächliche viele alte Leute unter den schattenspendenden Bäumen auf Bänken sassen und sich die Touristen ansahen, die es bis dorthin ins Dorf geschafft hatten. Gegenseitige Betrachtung sozusagen. Auch im kleinen Zoo funktionierte das ähnlich. Dort gab’s ein paar wenige Tiere zu sehen, aber das Beste an diesem Tag war der dreistündige Ausritt, den ich am Nachmittag unternahm. Im Westernsattel ging es bergauf und runter, im Schritt, im Trab und im Galopp, an einem Fluss entlang, durch enge Wege, über Weiden, an Bauernhöfen und Kuhherden vorbei und meistens mit einer „vista maravillosa“. – Eine herrlich kühle Dusche anschliessend, ein delikates Nachtessen, eine feine Flasche Wein – was kann man sich noch mehr wünschen?! - Der krönende Abschluss war beim Einnachten die Sicht auf das Dorf und die Gegend von unserer Terrasse aus. Dreifache Lichtquellen beobachteten wir: Die Lichter im Dort, die sich wie ein Hufeisen präsentierten, die unendliche Sternenpracht und die Leuchtkäferchen, die überall auf der Suche nach einem geeigneten Partner herumschwirrten.
Am nächsten Tag reisten wir wieder zurück nach Cuenca. Vorerst aber liessen wir uns noch im Spa verwöhnen, genossen ein Sprudelbad und Massagen. Auf der Rückfahrt machen wir Halt in Joja und später in Saraguro, wo wir den Markt besuchten. Dort war es mir nicht sehr wohl, Margrit und ich waren nämlich die einzigen Ausländerinnen weit und breit. Die Leute waren fast alle ihrer Tradition gemäss schwarz gekleidet, was ziemlich seltsam wirkte, denn sonst sind die Kleider der Indigenas meist farbig und das erzeugt einen sehr viel fröhlicheren Eindruck. Man begegnete uns weder freundlich noch feindlich. Die Atmosphäre befremdete mich jedenfalls; vielleicht aber liess ich mich von der ungewohnten Farbe beziehungsweise Farblosigkeit zu stark beeinflussen.
Wegen der miserablen Strasse zog sich die Fahrt wieder endlos in die Länge. Gegen Abend kamen wir „zu Hause“ an. - Auch dieser Ausflug ist unvergesslich.
An einem anderen Wochenende meldete ich mich für eine Wanderung an, die mich ziemlich schaffte. Als nicht besonders geübter Wandervogel war der Hike in der dünnen Luft für mich eine grosse Anstrengung und Herausforderung, aber wunderschön. Die Gegend dort heisst „Las Cejas Altas“ und von einem Restaurant aus, wo wir Rast machten, das 3‘500 Meter über Meer liegt, ging‘s erbarmungslos bergauf bis zum Gipfel Avicahuaycu (4‘198 m), der von weitem aussieht wie unser Stockhorn, eine Art Zuckerhut. Er flösste mir grossen Respekt ein und ich fragte mich, was wohl in mich gefahren war, so eine Exkursion überhaupt mitzumachen. Da ich die Älteste war in der Gruppe, war ich speziell stolz, dass ich mithalten konnte bis zuoberst. Fast die Hälfte unserer Gruppe gab nämlich ungefähr 200 Meter vor dem Ziel auf. Einige sogar noch früher, weil sie an starken Kopfschmerzen und an Übelkeit zu leiden begannen. Dank dem Umstand, dass ich endlich Zeit hatte, jeden Tag eine Stunde Tennis zu spielen, hatte ich mich bereits an die Höhenverhältnisse gewöhnen können (Cuenca liegt auf 2‘500 m), wohingegen den andern, die erst kurz da waren, sowohl das Klima als auch die Höhe zu schaffen machten. Unterwegs gab’s einiges zu sehen: Bis zu einer Höhe von 4‘000 Metern gibt es noch Quinoa-Bäume oder -Sträucher, die etwa ein halbes Jahrhundert alt sind, wie man uns sagte, und deren Rinden ganz faserig sind. Sie bilden sogar eine Art Wälder. Noch weiter oben wächst dann ausschliesslich hohes Gras. - Der allerletzte Aufstieg bestand hingegen nur noch aus steilen Felsen, so dass unsere Wanderung allmählich in eine „Kletterung“ ausartete und man mich die letzten paar Meter hinaufhieven musste. Die Luft wurde immer dünner und dünner. Aber als wir oben waren, war es ein erhabenes Gefühl, bis nach Cuenca hinunterschauen zu können und der Anblick des Bergpanoramas war überwältigend. Das Tüpfli auf dem „i“ war dann der Condor, der hoch über uns leicht und anmutig durch die Lüfte segelte – „El Condor pasa“. - Aber das Wildeste, was daraufhin passierte, war, dass urplötzlich das Wetter umschlug und es zu hageln begann.
Mir graute vor dem Abstieg. Über die nassen und glitschigen Felsen und Gräser herunterzurutschen, war keine begehrenswerte Perspektive. – Es war mühsam, aber wir schafften es. Wie froh war ich, als ich endlich die grosse Coca-Cola-Reklame auf dem Dach des Restaurants erblickte, von wo aus wir gestartet waren. Allerdings hatte ich mir nebst ein paar Blasen an den Füssen einen äusserst schmerzlichen Muskelkater eingehandelt, der mich noch mehr als eine Woche lang quälte. Treppensteigen rauf und vor allem runter war in den ersten Tagen fast ein Ding der Unmöglichkeit.
Galapagos
Trotzdem fuhr ich, kaum zurück, von Cuenca aus mit dem Bus nach Quito, dann nach Guayaquil, von wo aus ich einen Flug auf die Galapagos-Inseln gebucht hatte. Die fünfstündige Busfahrt war ziemlich speziell. Unterwegs stiegen ständig Leute zu, die im Gang stehen mussten. So hatte ich immer wieder mal einen Ellenbogen am Kopf. – Ein paar Reihen weiter hinten verlangte einer immer „fundas“, Papiertüten, weil er seinen Mageninhalt nicht bei sich behalten konnte.
Hielt der Bus in einem Ort an, war es üblich, dass ein paar Verkäufer zustiegen, die sich dann durch die Reihen drängten und ihre Ware feilboten: Früchte, Eis, Getränke, Hühner. Einer wollte den Passagieren homöopathische Mittel andrehen. Ausgerüstet war er mit Bildern und Bildtafeln, zeigte diese herum und er sprach von Prostata, über Frauenleiden und Sexhilfen. – So wurde es jedenfalls nie langweilig. Die Gegend jedoch zeigte sich grau in grau, denn es regnete wieder mal und war neblig. Während gut drei Stunden führte die Fahrt an Berghängen vorbei, dann endlich ging’s bergab und die Vegetation änderte frappant. Wir zogen an kilometerlangen Bananenplantagen vorbei.
Die Woche auf den Galapagos war ein einmaliges Erlebnis. Das Schiff, in dem ich eine Kajüte gemietet hatte, die ich mit jemandem teilen musste, die oder den ich vorerst noch nicht kannte, war sehr gut; es hatte gerade die richtige Grösse - mit sechzehn Passagieren aus fünf verschiedenen Ländern und sieben Mann Besatzung nicht zu gross und nicht zu klein. Wir waren eine fröhliche Gesellschaft und hatten es alle zusammen immer lustig. Zwei ausgezeichnete Köche machten uns zudem das Leben leicht. Köstliches hatten sie jedes Mal vorbereitet, wenn wir von einem Ausflug zurückkamen, auch alle übrigen Mahlzeiten waren stets schmackhaft und liebevoll präsentiert.
Die Kajüte allerdings war „etwas" eng. Zwar hatte ich mein Gepäck radikal vermindert, aber für die bestehenden Verhältnisse immer noch weit entfernt von ideal. Entweder konnte ich das Gepäck hineinstellen, dann musste ich aber draussen bleiben, oder ich war drin und das Gepäck draussen. Dazu kam, Anke, meine deutsche Mitpassagierin und ich, wir mussten uns in die enge Kabine teilen. So behielten wir beide nur das Allernotwendigste bei uns und gaben die grossen Reisetaschen und Rucksäcke in den Bauch des Schiffes, wo wir sie eine ganze Woche lang nicht mehr zu Gesicht bekamen. Gerade so gut hätten wir die Bagage gar nicht mitschleppen müssen, wieder hatte ich nämlich viel zu viel eingepackt. So trug ich fast während einer Woche mehr oder weniger dieselben Kleider, oft natürlich den Badeanzug. Den andern ging’s selbstverständlich genauso.
Das Schiff fuhr uns von Insel zu Insel (Santa Cruz, San Cristobal, Bartolomé, Baltra, Genovesa, Plaza), und jedes Mal wurden wir von neuem überrascht von der Schönheit der Natur und der einzigartigen Tierwelt. Es ist unglaublich, wie die Tiere ohne Scheu dort leben. Ich hatte mir das nicht so vorgestellt. Man musste aufpassen, dass man nicht auf sie trat. Vor allem bei den Maskentölpeln war das sonderbar. Die brüten am Boden, meist so gut getarnt, dass man sie kaum wahrnimmt. Anders hingegen die Rotfusstölpel. Sie bauen ihre Nester in den Büschen oder Bäumen. - Die drachenähnlichen Leguane hingegen konnte man ihrer Grösse wegen kaum übersehen, obwohl sie sich wie Galionsfiguren starr und bewegungslos auf den Felsen oder im schwarzen Vulkansand sonnten.
Riesige Kolonien von Seelöwen zu beobachten, war ebenfalls eindrücklich genauso wie ein Besuch bei den Riesenschildkröten. Den verspielten Delphinen zuzuschauen, die oft das Schiff begleiteten, machte sowieso Spass.
Und erst die Fregattenvögel! Ihre Taktiken mitzuverfolgen, davon konnten wir kaum genug bekommen. Sie attackieren andere Seevögel im Flug, bis die Bedrängten ihren eben gemachten Fang nicht mehr halten können und noch im Flug schnappen sie sich die fallen gelassene Beute. - Frech, aber sehr effizient! Einmalig auch, wenn die Männchen beim Balzen ihre roten Brüste bis fast zum Zerspringen aufplustern. Genauso lustig auch zu beobachten, wie die Blaufusstölpel-Männchen ihren Weibchen ihre blauen Füsse zeigen, bevor sie sie besteigen. – Da läuft etwas bei den Vögeln. – Überhaupt: Was für ein wunderbares Vogelparadies. Pinguine und Pelikane gibt es ebenfalls viele, den Austernfischern konnten wir zuschauen, wie sie mit unendlicher Geduld und ohne Unterlass mit ihren langen roten Schnäbeln im Sand nach Muscheln bohrten.
Unser letzter Abend auf dem Schiff bleibt unvergesslich. Mario, der eine Koch hatte einen Kuchen gebacken, auf dem „Adios Amigos“ stand. Nach dem Abräumen wurden CDs aufgelegt und man begann zu tanzen. Der Wein floss und anschliessend offerierte die Crew allen ein Rumgetränk. Immer wieder wurden die Gläser nachgefüllt, immer lustiger wurde die Gesellschaft. Das Boot stand völlig schief, was noch mehr Fröhlichkeit hervorrief. Auch wer kaum Alkohol getrunken hatte, torkelte herum. Der Däne, er wurde „Papa“ genannt, wollte nicht mehr mit Tanzen aufhören. Er holte blaue Flossen und machte damit vor seiner Frau, der „Mama“ ganz nach Tölpelart einen „Blue-footed-boobie-Tanz“, es war zum „Göisse“ komisch. Seine Tochter sagte zu mir, so habe sie ihren Vater noch nie gesehen... Offenbar war die Scharade ansteckend und Serge, einer der Franzosen, der sonst immer still war und kaum je ein Wort sagte, zog eine rote Rettungsweste verkehrt herum an und begann den Balztanz der Fregattenvögel zu imitieren. – Schade, dass uns nach einer Woche unsere Wege bereits wieder trennten.
Bei der Reise zurück nach Quito hatte ich ein wenig Pech. Auf Puerto Ayura wurden wir um halb sechs Uhr morgens geweckt. Um acht Uhr kamen wir in Baltra an, wo der Flug um neun Uhr hätten starten sollen. Dann jedoch wurde der Flughafen in Quito geschlossen, weil ein Vulkan ausgebrochen war, die Pisten voller Asche und weder Starten noch Landen mehr möglich war. So dauerte es neuneinhalb Stunden, bis wir endlich abheben konnten, am Abend um halb sechs. Das war obermühsam, denn es gab auf dem kleinen Flughafen, wo wir gestrandet waren, überhaupt nichts zu tun. Man wurde kaum informiert und zu essen oder zu trinken kriegte man auch nichts. Wenigstens hatte ich ein gutes Buch dabei, welches ich gleich fertig las, und mein Bikini im Handgepäck, so dass ich mich dort in die Sonne legen und auf diese Weise den ganzen Tag lesend verbringen konnte.
Landen konnten wir noch immer nicht in Quito, aber in Latacunga, etwa hundert Kilometer südlich der Hauptstadt. Eine zweistündige Busfahrt kam daher noch dazu. Müde und erschöpft kam ich kurz nach Mitternacht in der Posada Real an, wo ich sehr freundlich empfangen wurde.
La Selva
Ein paar weitere Tage verbrachte ich im Urwald, das heisst, ich buchte eine Unterkunft in der Yuturi-Lodge (www.yuturilodge.com/">www.yuturilodge.com/), wo es mir ebenfalls ausserordentlich gut gefiel. Die Unterkunft liegt mitten im Urwald von Amazonien (zwölf Stunden Fahrt mit dem Bus von Quito oder eine Stunde mit dem Flugzeug); sie war bescheiden ausgestattet, aber man hatte alles, was nötig war. Gleich nach meiner Ankunft unternahmen Marco, der Führer, der mir in den nächsten Tagen viele der Geheimnisse des Regenwaldes zeigen würde, und ich eine idyllische Bootsfahrt in einem Kanu, die wir allerdings nach einer Stunde abbrechen mussten, weil es wie aus Kübeln zu regnen begann. Zurück in der Lodge hängte ich meine Kleider zum Trocknen auf und legte mich in eine Hängematte.
Am Abend gab es nur zwischen 6 und 10 Uhr Strom, dann wurde es dunkel wie in einer Kuh und die Stille war wunderbar. Nichts als Tierlaute waren zu hören, Grillen vor allem und in der Ferne ein Donnergrollen.
Trotzdem schlug Marco vor, gleich am ersten Abend einen „Spaziergang" durch den Wald zu machen, ausgerüstet mit Taschenlampe und Gummistiefeln. Mir war’s fast zumute wie in einem Gruselkabinett und ich war nicht ganz unfroh, als unsere Exkursion zu Ende war, denn der Boden war noch immer völlig nass, sumpfig und glitschig und ich lernte sehr bald, einen Stock zu Hilfe zu nehmen, weil es keine gute Idee ist, an den Bäumen Halt zu suchen. Der Grund dafür ist, man muss überall mit grusig grossen Ameisen rechnen, genannt „La Conga“, die einem offenbar während zwölf Stunden tödliche Schmerzen verpassen können, wenn sie einen stechen.
Und dann grübelte Marco eine Tarantula aus ihrer Höhle. Ich hatte fast einen Herzstillstand, so geschockt war ich. Das Ding war faustgross und ich bin alles andere als eine Spinnen-Liebhaberin.
Aber alles, was mir Marco zeigte und erzählte, war phantastisch und spannend. Er kannte jeden Baum und jede Pflanze im Wald und wusste, wozu sie gut waren. Es gibt Kräuter gegen Fieber, Schmerzen, Serum gegen den Biss der giftigen Schlangen und und und.
Er zeigte mir einen Baum, der den Waldbewohnern als Trommel dient. Wenn man mit einem Ast an die Rinde schlägt, tönt es meilenweit, so kann man kommunizieren. Eine Art Morsecode hilft dabei. Am Baum mit den grossen Stacheln konnte man Übeltäter fesseln und foltern, die Früchte eines andern Baumes dienen als Kamm oder Bürste, gewisse Blätter haben solch scharfe Kanten, dass man sie perfekt als Feilen benutzen kann. Ritzt man die Ride eines anderen Baumes auf, treten kleine rote Tropfen aus, wie Blut. Verreibt man diese auf der Haut, wird das Sekret weisslich, wie eine Salbe also, und diese wirkt gut gegen Insektenstiche. Die kleinen Ameisen, die wie Zitronensaft schmecken sollen, und die man, von aussen nicht sichtbar, in den Zweigen eines bestimmten Baumes findet, wenn man diese aufbricht, mochte ich nicht probieren, Marco schon.
Tiere bekamen wir natürlich auch zu Gesicht: kleine Affen, Nager und Vögel, aber im Gegensatz zu den Galapagosinseln meistens nur von weitem. Es soll auch Riesenschlangen geben, Boas, Anacondas. Die kreuzten unseren Weg zum Glück jedoch nicht. Tausendfüssler in allen Grössen, giftige und harmlose, Blutegel, Spinnen, Frösche, Schnecken und anderes Kriechgetier en masse hingegen oft.
Weiter führte mich Marco in die Behausung einer indigenen Familie, mitten im Wald in einer kleinen Lichtung gelegen, wo ich freundlich begrüsst wurde. Ohne weiteres durfte ich mich in ihrem Haus, das auf Stelzen gebaut war und in dem Eltern, Grosseltern und acht Kinder wohnten, umschauen. Es ist beeindruckend, wie die Leute dort leben: Alles, was der Wald hergibt, verwenden sie zu ihrem Nutzen. So werden beispielsweise aus Palmenfasern Netze angefertigt oder schmucke Armbänder, aus Wurzeln und Holz Gefässe und Werkzeuge.
Sie hatten auch ein paar Haustiere: zwei kleine Hunde, Hühner, eine Art Riesenmeerschwein an der Leine, das kläglich quiekte, Papageien. Ums Haus herum wuchsen Kaffee, Limonen und andere Früchte.
Von einem vierzig Meter hohen Hochsitz aus, „Casa del Diabolo“, der in die Baumkrone einer Ceiba eingebaut war, hatte man einen fantastischen Blick über den endlos scheinenden Wald bis zum Rio Napo im Hintergrund.
Diesmal hatte ich gelernt und reiste mit noch leichterem Gepäck als beim Galapagos-Ausflug. Einen Koffer und meinen Laptop hatte ich bereits in Miami gelassen bei Ray, einem meiner Kollegen, ein anderer wartete auf mich in Quito. Wie ich all mein angesammeltes Hab und Gut dann schliesslich heimschaffen würde, wusste ich zwar noch nicht, aber das würde dann erst mein Problem sein, wenn die Zeit reif war.
Nun hatte ich doch fast zu wenige Kleider mitgenommen, denn schon nach der Bootsfahrt und nach einem abenteuerlichen halbtägigen Marsch am folgenden Tag waren zwei meiner drei Paar Hosen triefend nass und vollkommen verschmutzt. Denn wie Jane musste ich mich nämlich teilweise von Liane zu Liane durch den Urwald schwingen oder besser gesagt kämpfen, und wie ein Tölpel steckte ich mehr als einmal bis weit übers Knie im Sumpf und zog jeweils einen Stiefel voller Wasser und Schlamm heraus. Das Gefühl im Stiefel anschliessend war nicht von der angenehmsten Sorte. Der Ausflug war eine richtige Sumpftour; das Ding aus dem Sumpf lässt grüssen. - Die Dusche nachher war kalt, aber vom Feinsten.
Einen Tag lang war ich alleine in der Lodge, dann waren wir zu zweit und tags darauf kamen gleich vierzehn weitere Gäste. „So viel" Betrieb war fast seltsam; mir hatte es vorher besser gefallen.
Am folgenden Tag stand Piranhas-Fischen auf dem Programm. Zum Glück war ich nicht erfolgreich, ich hoffte immer, dass keiner anbeissen würde; es hätte mich „tschuderet“. Jemandem aus der Gruppe gelang es dann doch, einen an die Angel zu kriegen und wir sahen die gefürchteten Zähne. Der Raubfisch war allerdings ein Teenager, also wurde er nach eingehender Besichtigung wieder ins Wasser zurückgelassen.
Drei Nächte dort waren gerade genug. Am nächsten Morgen wurde ich nach einer anderthalbstündigen Kanufahrt auf den Flughafen nach Coca gebracht. Wieder zurück in Quito, in der Zivilisation, gefiel es mir überhaupt nicht: Überall lag Vulkanasche am Boden, einige der Arbeiter hatten einen Mundschutz übergestreift. Es war kaum zu glauben, aber noch immer waren ganze Heerscharen von Putzequippen auf dem Flugplatz unterwegs und reinigten die Pisten, bewaffnet mit Schaufeln und Besen (!). Putzmaschinen hatte es keine. Kein Wunder, dass es tagelang dauerte, bis endlich alles sauber war und der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden konnte.
Cotopaxi
In einer Reiseagentur buchte ich beim „Flying Dutchman“ eine Biketour auf den Cotopaxi, weil ich nicht in der staubigen Stadt bleiben wollte. Morgens um acht ging's los mit dem Jeep. Wir waren zu acht, der Fahrer, ein blonder Holländer mit Pferdeschwanz, war unser Guide. Ein junges Paar aus Deutschland sass hinter mir. Ich hörte, wie die Frau zu ihrem Mann sagte: „Genauso habe ich mir vorgestellt, dass man aussehen muss, wenn man so eine Tour begleitet“.
Wir wurden bis zur Schneegrenze auf 4'500 Metern Höhe gefahren. Die Fahrt mit den Mountainbikes den Berg hinunter führt über 42 km bis auf 3'200 m Höhe und dauert fünf Stunden. – Diese Abfahrt hatte ich mir sehr viel einfacher und anders vorgestellt. Bei schönem Wetter wäre der Ausflug vielleicht weniger spektakulär gewesen, aber wir hatten das Pech, dass, je weiter wir bergauf fuhren, das Wetter schlechter und schlechter wurde, der Nebel senkte sich unablässig, der Jeep hatte Mühe, auf dem Track zu bleiben. Auf dem Parkplatz oben stiegen wir aus. Man sah keine fünf Meter weit. Wir wurden mit Knie-, Ellenbogenschonern und Helmen ausgestattet. Ich zog meine Handschuhen an, über dem T-Shirt und dem Sweatshirt trug ich meine Jeansjacke und darüber die Regenjacke, unter der Kapuze Helm und eine Wollmütze. Trotzdem war mir kalt und schwindlig. Dann ging’s los. Die unebene holprige Strecke mit den tausend Löchern führt nicht geradewegs bergab; manchmal ging der Weg geradeaus, und es gab Abschnitte sogar mit Steigung. Wegen der dünnen Luft schaffte ich diese kaum, musste jeweils absteigen und das Velo stossen. Das Schlimmste waren die Spurrinnen von Fahrzeugen, die kreuz und quer über den Weg verliefen. Nach kürzester Zeit schon taten mir meine Hände vom Bremsen so weh, dass ich sie fast nicht mehr spürte und den Lenker kaum mehr fassen konnte. Dann wieder führte die Strecke steil in die Tiefe und mir wurde von der Geschwindigkeit fast übel und ich hatte grosse Angst, nicht mehr bremsen zu können. Auch hatte ich das beklemmende Gefühl, mein Hirn fahre aus dem Schädel, so sehr wurde ich geschüttelt (wohl gehörte das zum „fun“, der angepriesen wurde...). Ich sah mich nach der Qualenfahrt schon beim Zahnarzt statt auf dem Flug nach Lima, den ich für den nächsten Tag gebucht hatte. Je länger desto mehr machte mir auch die Kälte zu schaffen. Es blieb neblig und nass, die Sicht miserabel und nicht genug: Zur Krönung begann es auch noch zu hageln.
Wie froh war ich, als wir völlig durchnässt und abgekämpft endlich einen Zwischenhalt machen konnten, um uns ein wenig zu erholen. Der „nette Blonde“ begleitete uns stets mit seinem Jeep und nun packte er für unseren Lunch Sandwiches und Getränke aus. Anschliessend blieb sogar ein wenig Zeit, sich im Museum umzusehen. Sehr skurril fand ich die Ausstellung. Besucher waren keine drin. In zwei Räumen gab es ausgestopfte Tiere zu sehen, nicht etwa hinter Glas. An der einen Wand hingen Hals und Kopf eines Rehs mit weissem Hintern. So jedenfalls war’s angeschrieben. Aber eben, dieses Teil war nicht sichtbar. Dafür hatte der Fuchs nur einen halben Schwanz, der Rest war ein verrosteter Stab.
Weiter ging die wilde Fahrt. Die Bikes waren natürlich nicht die allerbesten, das machte die Sache auch nicht einfacher. Als meine Bremse hinten versagte, gab ich auf und liess mich vom Reisebegleiter die letzten paar steilen Kilometer im Jeep mitnehmen. Die vier Stunden auf dem Bike hatten mir restlos gereicht.
Peru - Lima
Am nächsten Tag flog ich nach Lima. Übernachtung im „Hostal del Parque“ für 25 $. Alles ist sehr viel teurer als in Ecuador, das wurde rasch klar. Ich machte eine Stadtbesichtigung, hielt mich zwei Stunden im prächtigen und interessanten Museo National de Arqueología auf, trank in der Bar des altehrwürdigen Hotels Bolivar einen Pisco Sour, der mich fast vom Stuhl haute und fuhr anschliessend per Taxi ins Quartier Miraflores, wo ich einen Handwerkermarkt besuchte.
Von Lima gings’s weiter per Flugzeug nach Cusco. Die Stadt begeisterte mich sofort. Die Häuser sind grösstenteils auf einer ehemaligen Inkasiedlung aufgebaut. Überall hat’s kleine Läden mit allerlei Artesanías. Die holzgeschnitzten Balkone sind wunderschön.
Mit meinem Hotel war ich nicht besonders glücklich. Es war einmal mehr eines dieser Häuser, die keine Fenster haben. Eines hatte es zwar schon, aber das führte nur in einen Schacht hinein, und wenn man die Vorhänge aufzog, konnte man seinen Nachbarn grüssen. Das war nicht so ganz mein Fall. So wechselte ich gleich am ersten Tag die Unterkunft. Ich fand ein schmuckes kleines Hostal, das mir auf Anhieb gefiel, auf einem Hügel hoch über der Stadt gelegen, von dem man eine fantastische Aussicht über die ganze Stadt hat, das Casa de Campo. Sogar einen Balkon hatte ich, ein hübsches Zimmer mit Cheminée, ein Ort, wo es mir absolut wohl war. So ein Bijou! (www.hotelcasadecampo.com/">www.hotelcasadecampo.com/). - Zwar hatte ich einen etwas längeren „Heimweg“ musste den Berg hinauf „pilgern“ und anschliessend noch 100 Stufen hinaufsteigen, was zugegebenermassen nach gar nichts tönt, mir aber fast den Atem nahm, bis ich oben war, ist doch Cusco auf fast 3‘500 Metern über Meer gelegen. Mit dem Taxi ging’s rascher, auch wenn der Weg sehr steil war und der Taxista ein ganzes Stück weit rückwärts zurückfahren musste. Aber erst schleppte er mir noch meine Koffer in die neue Unterkunft. Er kam arg ins Schwitzen und ins Schnaufen.
Ganz in der Nähe des Hotels steht die Kirche San Blás. Die berühmte Kanzel, von einem Indianer in vierjähriger Arbeit aus einem einzigen Stück Holz geschnitzt, ist eindrücklich. Nebst Engeln sind die Balken auch mit Drachen verziert: eine nette Abwechslung zur obligaten Ausstattung.
Eine City-Tour, eigentlich genauso, wie ich sie nicht mag, mit vielen Touristen, die in einem Bus von Ort zu Ort befördert werden, um ihre Fotos zu „erledigen“, machte ich am nächsten Tag mit. Aber der Ausflug lohnte sich doch. Wir besuchten drei Kirchen und die eindrücklichen Ruinen der riesigen Inka-Festung Sacsayhuamán oberhalb des Stadtzentrums. Die Aussicht von dort ist einmalig. Das finden wohl die Alpacas auch, die dort friedlich grasen. Über der Stadt erhebt sich der 6271 Meter hohe Salcantay. Weiter ging die Tour nach Puka Pukara, einer Festung aus rötlichem Stein, dann zu einem Wassertempel, Tambomachay, und zuletzt nach Kenko, wo’s eine Art Amphitheater hat und in einer Höhle einen Opferaltar.
Über Pisac, eine ehemalige Inka-Festung im Valle Sagrado, dem heiligen Tal der Inkas, durch welches der Riobamba fliesst, hatte ich im Reiseführer gelesen, der Ort sei ein beliebtes Ausflugsziel. Vor allem am Sonntag wegen des Marktes. Ich wollte aber am Samstag hin und das war ein sehr guter Entscheid, denn ich konnte fast alleine in den Ruinen und den grünen Geländeterrassen herumkraxeln und auf dem Markt war fast gar nichts los. Gringos sah ich keine, die paar wenigen Touristen, die es hatte, waren wohl Einheimische. Ich kaufte einen Teppich für zwanzig Franken, der nun in unserem Haus in Bivio an der Wand hängt und mich stets an diesen prächtigen Ausflug erinnert. Im Reisebüro hatte man mir den Trip für 40 Franken angeboten. Am Busterminal kostete mich das Ticket nur einen Franken. Sehr froh war ich, überhaupt noch einen Sitzplatz erhalten zu können. Wer nach mir kam, musste sich mit einem Stehplatz zufrieden geben. Einen Moment lang überlegte ich noch, ob ich der Frau, die neben mir stand, meinen Platz anbieten solle – ich schätzte sie ein paar Jahre älter als mich – entschied mich aber dann aus Bequemlichkeit und weil ich ja dann nicht mehr hätte zum Fenster hinausschauen können, dagegen. Kurz nach der Abfahrt wurde eine Liste herumgereicht, auf der man seinen Namen, Nationalität, Adresse und Alter angeben musste. Ich fragte, weshalb das so sei und mir wurde erklärt, die Polizei wolle das so. Es gäbe immer wieder Unfälle auf der steilen, engen Strasse und dann wisse man, wer im Bus gewesen sei. – Sehr beruhigend!
Auf der Liste sah ich auch, wie alt die Frau war, die neben mir im Gang stand. 35-jährig! – Mein leicht schlechtes Gewissen sank augenblicklich auf Null.
Am folgenden Tag, dem Sonntag unternahm ich einen weiteren Ausflug. Weil Pisac ein Zwischenhalt war während dieser Fahrt, besuchte ich den Markt dort erneut. Nun erkannte ich den Ort fast nicht mehr wieder. Überall hatte es Touristen, der berühmte Markt war nun viel grösser. Es wimmelte von Leuten, die Preise ähnelten denen vom Vortag nicht mehr.
Weiter ging die Reise durch herrliche Gegenden nach Ollantaytambo, Urubamba und schliesslich nach Chichero. Unterwegs gab’s weitere Märkte und Kolonialkirchen zu besichtigen, aber etwas vom Schönsten fand ich jeweils den Blick von einer Krete aus aufs hehre Bergpanorama.
Machu Picchu
Niemand, der von Cusco aus nicht zum Machu Picchu wandert, pilgert fährt oder fliegt. Ich nahm den Zug, welcher, um den Höhenunterschied zu bewältigen im Zick-Zack fuhr, hin und zurück. Es galt, 1000 Höhenmeter zu verlieren. Wie im Schüttelbecher kam’s mir vor. Die Fahrt führte durch eine bezaubernde Landschaft: erst durch kahle „Voralpen“, nur karg besiedelt, die schönen Schneeberge im Hintergrund, bald wird der Urubambafluss zu einem wilden Gewässer, am Ufer stehen riesige Agaven und Kakteen und schliesslich geht die Vegetation in Urwald über. Die hohen Hügel oder Berge sind von Bäumen und Sträuchern bewachsen. Unter einem solchen wurden die Ruinen im Jahr 1911 von einer Expedition der Yale Univerity unter der Leitung von Hiram Bingham durch Zufall wiederentdeckt. Die Siedlung war von dichter Vegetation überwuchert. Bingham war auf der Suche nach der geheimnisvollen Inkastadt Vilcabamba, in die sich die Inkas geflüchtet haben sollen, nachdem Pizarro 1536 Cusco eingenommen hatte.
Vier Stunden später fuhr der Zug langsam im Bahnhof von Aguas Calientes ein. Mein erster Eindruck war, der Ort bestehe nur aus Marktständen. Sie waren alle entlang der Bahnlinie aufgebaut. Die Frauen in ihren wunderbar farbigen Trachten sassen auf dem Trottoir und versuchten, ihre Waren anzubieten. „¡Señorita, por favor acercese, compreme una cosita!“ Aber auch sonst hatte es Massen von Leuten, diejenigen, die nun aus dem langen Zug ausstiegen, zu denen auch ich gehörte, und andere Touristen, die bereits vor den Bussen warteten, bis ihre Tour in die „Stadt in den Wolken“, begann.
Der Name ist sehr gut gewählt. Auf dem Berg angelangt bildete sich den Besuchern ein wunderbares Schauspiel. Zeitweise wurden die berühmten Felsen von Wolken und Nebelschwaden verdeckt – manchmal sah man sie überhaupt nicht mehr - dann wiederum schien die Sonne ein wenig und die ganze Pracht der verlassenen Inka-Stadt, die in der Hochblüte von ungefähr tausend Menschen bewohnt worden war, zeigte sich in einem besonderen Licht. Weniger wünschenswert natürlich waren die unendlich vielen Reisenden, die wie Ameisen in den Ruinen herumkletterten. Das änderte aber, als die dreistündige Tour vorbei war und die meisten von ihnen wieder die Busse bestiegen und die Rückreise antraten, wohin auch immer diese führen mochte. Da ich zwei Nächte in einem Hotel gebucht hatte, konnte ich länger oben bleiben und die überwältigenden Eindrücke noch eine Weile in Ruhe auf mich einwirken lassen. Ich suchte mir ein schönes Plätzchen inmitten der Ruinen (es hat nur solche), legte mich hin und beobachtete das Spiel der Wolken. Neben mir grasten ein paar Alpacas.
Auch am nächsten Morgen fuhr ich nochmals hoch vor dem neuen Touristenstrom, der gegen Mittag zu erwarten war und genoss zum zweiten Mal den Kraftort vor der grossartigen Kulisse, die sich auch an diesem Tag ständig in anderem Licht präsentierte, abwechslungsweise bei Sonne, Wolken, Nebel und gar Nieselregen.
Am Abend dann im Restaurant ging’s weniger mystisch zu und her; ich hatte Pech mit meiner Kreditkarte. Beim Zahlen mit der „Ritsch-ratsch-Maschine“ teilte mein Kellner die Karte kraftvoll entzwei. Sie sah traurig aus, die beiden Teile hingen nur noch am Metallfaden zusammen. Freude herrschte nicht! Zum Glück hatte ich noch ein paar Travelers-Cheques bei mir und eine Ersatzkarte, sonst wär die Weiterreise schwierig geworden.
Lago de Titicaca
Am nächsten Tag fuhr ich per Zug zurück nach Cusco und am übernächsten war mein Ziel Puno am Lago de Titicaca. Leider konnte ich keinen Flug buchen, da sich zu wenige Passagiere angemeldet hatten, so blieb nichts anderes übrig, als einmal mehr per Bus dorthin zu fahren - weitere fast zehn Stunden. Das hatte sich der Zwischenhalte wegen auf jeden Fall gelohnt. Der erste fand in Pikillaqta statt, einer grossen archäologische Stätte der Wari-Kultur, die von einer 3 km langen Steinmauer umgeben ist. Der nächste in Andahuaylillas, wo die berühmte Jesuiten-Kirche San Pedro Apóstol steht. Sie stammt aus dem Jahr 1580 und wird auch „Sixtinische Kapelle der Anden“ genannt. Ihre unauffällige Aussenfassade steht im kontrastreichen Gegensatz zu den aufwändigen Malereien und Dekorationen im Barockstil im Inneren der Kirche. - Weiter ging’s zur Präinkastätte Raqchi, wo’s einen riesigen Tempel, eine stattliche Anzahl von Speichertürmen und speziell gestaltete Säulen aus Lavastein und Lehm zu sehen gibt. Die Bauweise ist anders als bei den bisher besuchten Ruinen, viel wenige exakt. Imponierend aber auf jeden Fall.
Recht mühsam kämpfte sich der Bus zur Passhöhe des Abra la Raya auf 4350 m hoch. Es war recht kühl dort oben, es regnete auch leicht und dass die Luft sehr dünn ist, merkte man sofort, wenn man ein paar Schritte ging. Die Gegend ist kahl, in der Steppe weiden Lamas und Schafe. Der Farbtupfer sind die schönen Kleider und Trachten der Einheimischen.
Der Bus hielt in Puna direkt vor dem Hotel Colon Inn, in dem ich ein Zimmer gebucht hatte. Kaum ausgestiegen, wurde man bereits von Händlern belagert. Unzählige Frauen sassen auf dem Trottoir und alle wollten etwas verkaufen, junge Männer boten Touren an. Nach der langen Busfahrt legte ich mich aber erst mal ins Bett, weil ich seit ein paar Tagen eine Magenverstimmung hatte und mich nicht sehr gut fühlte. Ich ernährte mich von Bananen und Reis und trank Mate de Coca, dem seit Jahrhunderten weit verbreiteten und beliebten Tee mit leicht kokainhaltigen Substanzen, der gegen Hunger, Kälte, Müdigkeit und die Höhenkrankheit helfen soll. Trotzdem buchte ich schliesslich eine Bootsfahrt auf dem Titicacasee für den nächsten Tag zu den bekannten Inseln Uros und Taquile. Frühmorgens, nachdem ich ein trockenes Stück Toastbrot hinuntergewürgt und eine Tasse Tee getrunken hatte, wurde ich abgeholt und in eine Gruppe von jungen Trampern aus Israel eingeteilt, deren Kleider schon lange kein Wasser und keine Seife mehr gesehen hatten. – Was für ein Gegensatz zu den adrett gekleideten französischen Hotelgästen, die vorher in der Lobby gesessen hatten, einige mit einen Atemgerät ausgestattet, das sie herumreichten, um die Höhenverhältnisse besser zu ertragen. Mir kam’s vor, als ob ich in ein Altersheim geraten wäre.
Die Bootsfahrt zu den schwimmenden Inseln dauerte eine knappe Stunde. Eine erstaunliche Art zu wohnen. Alles ist auf Binsen gebaut. Die Bewohner sind sehr freundlich, aber was mir weniger gefiel, war der Umstand, dass dieser ausserordentliche Ort sehr touristisch ist. An jeder Ecke oder besser gesagt in jeder Nische werden Waren angeboten, kleine Körbchen aus Binsen, Puppen aus Binsen, Binsen überall. Auch die Häuser und Boote sind aus Binsen gebaut.
Die Weiterfahrt zur Isla Taquile dauerte drei Stunden. Dort bot sich uns ein ganz anderes Bild. Eine ellenlange Treppe mit mehr als 500 Tritten führt 300 Meter hinauf zum Dorfplatz auf 4‘100 m. Diese schaffte mich fast bei der Hitze, die im Moment herrschte. Schatten hatte es keinen. Die Männer, die Baumaterial nach oben schleppten, lange, schwere Stangen, beneidete ich nicht. Sie mussten immer wieder einen Zwischenhalt einlegen (ich natürlich auch, brauchte aber zum Glück nichts zu tragen); aber wenigstens versuchten sie nicht einmal mehr, uns etwas zu verkaufen...
Das Restaurant oben hatte zwar eine atemberaubende Aussicht, auf der einen Seite sah man ans andere Ufer des Sees, nach Bolivien, aber sonst war es „nothing to write home about“. Die Toiletten erst recht nicht. Mir war zwar immer noch mulmig zumute, aber ich war sehr froh, dass Verlass aufs Imodium war. Vor der Bootsreise hatte ich mich nämlich gefürchtet.
Etwas ganz Spezielles gibt es in diesem Ort zu sehen: strickende Männer. Man sah sie überall sitzen, in den Händen die langen Nadeln und die Handarbeit, im Schoss die Wollknäuel. – So was! - Sie weben auch und ihre Textilprodukte sollen zu den hochwertigsten in Peru gehören.
Auf der Rückfahrt war es kalt im Boot und als wir in Puna ankamen, begann es gleich in Strömen zu regnen. So sehr, dass ich das Hotel gar nicht mehr verliess. Hunger hatte ich ja noch immer keinen, dafür nahm ich eine heisse Dusche, trank zwei Tassen Tee und verkroch mich unter die Decke.
Fahrten zu den Grabtürmen von Sillustani wurden am Vormittag keine angeboten. Ich aber hatte mir in den Kopf gesetzt, den Ort am Morgen zu besuchen. Am frühen Nachmittag nämlich ging mein Flug zurück nach Lima. Also suchte und fand ich einen Taxifahrer, der mich zum Flughafen nach Juliaca brachte und vorher nach Sillustani. Sehr gut, dass das Tourenangebots-System in Puno dermassen unflexibel ist. So konnte ich den Ort ohne die üblichen Touristenmassen besuchen. Er übte eine besondere Faszination auf mich aus. Vielleicht gerade deshalb, weil ich ganz alleine dort war, vielleicht wegen der Ruhe, der speziellen Atmosphäre. - Eigentlich habe ich für esoterisches Gedankengut gar nichts übrig, aber da fragte ich mich doch, ob man irgendwo in einer verborgenen Schublade seines Gehirns eine Vergangenheit spüren kann, ohne konkret etwas wahrzunehmen.
Die Schönheit der Gegend ist überwältigend. Was für ein Ort, um begraben zu sein! Die Farben, der stille, tiefblaue See (Lago Umayo), die runden Steinkolosse, die wilden Meerschweinchen, die grünen Papageien, ein Fuchs, der in den Ruinen nach Essbarem schnüffelt, die Insel in der Ferne, die von weitem aussieht wie ein Sombrero, die Schneeberge im Hintergrund, die Vorstellung, wie es vor Jahrhunderten hier ausgesehen haben mag, was vor sich ging – zum Leben oder zum Sterben schön!
Da wir am Morgen früh gestartet waren, hatten wir auf dem Weg nach Juliaca genügend Zeit, noch ein kleines Museum mit ein paar wenigen Exponaten aus den Gräbern zu besuchen: Mumien, Schädel, Keramikgefässe, Schmuck. Und der Taxista führte mich auch noch aufs Land zu einer Familie, die äusserst anspruchslos lebte, so wie ich es vorher auch in Indien oder Afrika gesehen hatte. Die Frau freute sich über unseren Besuch. Stolz zeigte sie uns ihre bescheidene Behausung – eine andere Art zu leben.
Auch der Flug über die Anden, die Schneeberge, die liebliche Landschaft, begeisterte mich.
Zurück in Lima hatte ich einen weiteren Tag lang Zeit, das berühmte Museo de Oro zu besuchen. Und genau wie’s im Polyglott steht – die Schaukästen sind leider viel zu sehr überladen. Vor lauter Bäumen sieht man den Wald nicht mehr. Trotzdem lohnt sich der Besuch tausendmal. All die wunderbaren Tumis, der Schmuck, das viele Gold und die Tongefässe gefielen mir ausserordentlich, vor allem auch die Chavin-Keramikfiguren, Mischwesen zwischen Mensch und Tier, aber auch die Dutzenden von Gefässen, Töpfen und Figuren aus der Moche-Kultur, auf denen noch und noch erotische Szenen dargestellt sind.
Als das Flugzeug Richtung Quito abhob, war ich erst sehr enttäuscht, denn Lima lag versunken im Nebel. Die Wetterverhältnisse änderten jedoch allmählich und die Spitzen des Chimborazo, des Cotopaxi und all der anderen Vulkane tauchten aus dem Nebelmeer auf. Was für ein gewaltiger Anblick! Das Flugzeug flog eine Schlaufe, so dass sogar die Krater sichtbar wurden. Die Nebel lichteten sich, man sah die Ebene rund um den Cotopaxi, ich erkannte von oben die Strecke, auf der ich mich vor zwei Wochen auf dem Mountainbike dermassen abgemüht hatte. – Faszinierend!
Zurück in Ecuador : Esmeraldas
Nach zwei Tagen Quito fand ich, ich hätte „Ferien“ verdient und flog nach Esmeraldas, der Stadt an der nördlichen Pazifikküste. Es war mein letzter Ausflug in diesem Land, das ich nun in den verschiedensten Gegenden erkundet hatte. Dort herrscht ein völlig anderes Klima, es ist heiss und die afro-ecuadorianische Bevölkerung verleiht der Stadt ein karibisches Flair. Mit einem sogenannten „Tricicleta“ wurde ich in mein Hotel gefahren, wo ich sehr freundlich von zwei bewaffneten Angestellten begrüsst wurde und für 18 Franken pro Nacht ein riesiges Zimmer erhielt. Andere Gäste schien es nicht zu haben. Auch die Strandpromenade, durch die ich am nächsten Morgen spazierte, war völlig ausgestorben, ein paar Jungen schlenderten am Strand herum, Touristen sah ich keine. Ebenso wenig fand ich ein Internet-Café. Postkarten konnte man keine kaufen; ich hatte den Eindruck, sogar die Mücken seien entweder nicht vorhanden oder zu faul zum Stechen. Nur ein Restaurant hatte geöffnet, ich war der einzige Gast. Plastiktischtücher, kitschige Poster an den Wänden, der Fernseher lief und mitten im Raum stand ein riesiger kitschig geschmückter Tannenbaum. Mir kam’s vor, als wär ich im falschen Film. Aber das Essen war gut und reichlich. Und für 3 Franken absolut erschwinglich.
Ich hatte vergessen, einen Lippenstift einzupacken. Natürlich hatte ich wenig Hoffnung, in diesem Kaff einen zu finden. Aber siehe da: Im einzigen kleinen Lädeli, das offen war, kaufte ich zwei Flaschen Mineralwasser und erkundigte mich wegen des Lippenstifts. Der Verkäufer sagte, das habe er nicht, schaute dann aber trotzdem nochmal nach und wurde in dem ganzen Wirrwarr von Sachen und Sächelchen in einer verstaubten Schublade tatsächlich fündig. Auswahl und Farbe waren kein Thema, nur ein einziges Expemplar war vorhanden. Mein ganzer Einkauf kostete mich 1.50 Franken. Per Tricicleta liess ich mich ins Hotel chauffieren.
Am nächsten Morgen stellte ich fest, dass ich doch nicht der einzige Gast war. Es gab noch einen anderen. Beim Frühstück kam ich ins Gespräch mit Salvatore, einem Kakao-Einkäufer. Auf den ersten Blick dachte ich, er sei grad einer Schlägerei entronnen, auf den zweiten eigentlich immer noch. – Er bot mir an, mich später ein wenig in der Gegend herumzuführen. Das Angebot nahm ich gerne an. Ich checkte aus und kurz vor Mittag fuhren wir in seiner gelben Schüttelbüchse los, in der die eine Türe klemmte, etliches wie zum Beispiel der Rückspiegel fast abzubrechen drohte, der Auspuff ständig Fehlzündungen hatte und der Anlasser erst beim fünften Anlauf machte, was der Fahrer wollte. Auch langte ich immer wieder ins Leere, wenn ich versuchte, mich anzuschnallen. – Erst fuhren wir nach Sua, einem trostlosen Ort, wo ich mir nicht vorstellen konnte, dass sich irgendein Tourist dorthin verlaufen könnte. Weiter ging’s nach Same. Dort hatte es ein paar lustige Restaurants direkt am Strand; in einem davon assen wir zu Mittag. Der graue Strand aber war verlassen.
Unseren letzten Halt machten wir in Atacames. Dort war Salvatores Ziel. Wir verabschiedeten uns und ich bedankte mich herzlich für die Tour und die Gesellschaft.
In diesem Ort konnte ich mir gut vorstellen, dass in der Ferienzeit viel los ist; am Strand gibt es eine Bar an der anderen, dahinter reiht sich ein Restaurant ans andere, ein Lautsprecher dröhnte lauter als der andere, obwohl in dem Moment ja kaum jemand unterwegs war, der sich hätte anhören können, was alles angeboten wurde.
Es dauerte eine gute Viertelstunde, bis mir der Kellner die Piña Colada, die ich bestellt hatte, brachte. Die beste ever! Sie war reich verziert mit tropischen Früchten und Blumenblüten, fast eine Mahlzeit für sich. Für zwei Franken konnte man sich da nicht beklagen... Ein Nickerchen am Strand beendete den schönen Nachmittag. Bus und Velotaxi brachten mich anschliessend nach Tonsupa, wo ich eine Cabaña, eine Art Bungalow im Hotel Cabaplan gebucht hatte. Mein leichtes Gepäck hatte ich dabei, für die kurze Zeit brauchte ich nicht viel, das hatte ich inzwischen gelernt. Was für eine sehr spezielle Erfahrung: Der Hotelkomplex bot 180 Zimmer an, ein riesiges Schwimmbad, einen Tennisplatz. Ich glaube, das Konzept in dieser Hotelanlage war ähnlich wie dasjenige, welches dem Postpersonal in der Schweiz angeboten wird: günstige Ferien am Meer. – Ferienzeit war noch gerade nicht und so war ich einmal mehr der einzige Gast in diesem riesigen „Resort“. Das war ziemlich skurril, ich kam mir verloren vor, Erinnerungen an den Film „Shining“ drängten sich auf.
Im grossen, leeren, wenig einladenden Essraum wollte ich nicht zu Abend essen, also fuhr ich mit dem Velotaxi zurück nach Atacames. Im Garten von Marcos Restaurant bestellte ich „Spaghetti a la marinera“ und stellte mir einen schönen Teller mit Venusmuscheln vor. Was dann kam, war eine Riesenschale, gelb, mit lauter Tieren drauf, so dass man von den Teigwaren gar nichts mehr sah. Langustines, Miesmuscheln als Garnitur und zuoberst thronte ein grosser Krebs von der Sorte, wie ich sie am Nachmittag noch lebendig in Reih und Glied vor einem anderen Restaurant hatte hängen sehen und die mir total leid taten. Obwohl ich Krebsfleisch sehr gern habe, war mir nun überhaupt nicht danach, solches zu essen. Dazu servierte man mir noch ein Brett mit einer Mulde drin und einen Holzhammer, um den Krebs zu knacken. Ein Dilemma! – Zurückgeben wollte ich den Krebs auch nicht, dann wäre er für nichts gestorben. Netterweise half mir der Kellner mit der Zertrümmerung der harten Schale. Einen Bissen nahm ich, der war sehr schmackhaft, aber mir war sofort klar, dass ich wohl kaum einen Drittel von all dem würde essen können. Dasselbe Problem hatte ich auch mit all den anderen Tieren, die sich noch immer auf meinem Teller befanden. Vielleicht hätte ich vorher besser überlegen sollen, was ich bestelle. – Dann aber kam die Rettung: Ein etwa zehnjähriger Junge stand auf dem Trottoir neben mir und schaute sehnsüchtig auf mein Nachtessen. Ich fragte ihn, ob er den Krebs haben wolle. Ja, natürlich. Alles nahm er, den ganzen Teller, der noch immer ziemlich voll war. Der Kellner gab ihm alles bei der Hintertüre, wo der Junge sich auf einen Randstein setzte und gierig Teigwaren und Meerfrüchte „rübis und stübis“ aufass. – So war uns beiden gedient. Er kam dann sogar noch vorbei und bedankte sich.
Am nächsten Tag konnte ich zum ersten Mal seit langem ausschlafen.
Ein Angestellter bot mir an, mit mir Tennis zu spielen. Er trieb irgendwo in einem Lager zwei Schläger auf, aber mit den Bällen hatte er weniger Glück. Leider hatte ich alle meine Bälle in Cuenca verschenkt. So hatten wir nur noch drei Stück, von denen einer bereits keine „Haare“ mehr hatte, dafür ein Loch, ein anderer nach zwei, drei Schlägen einen Riss bekam, so dass nach kürzester Zeit nur gerade noch einer übrig blieb, der einigermassen spielbar war. Die Bälle passten zum Platz: Er war in einem dürftigen Zustand: An etlichen Orten war der Belag gespalten; es gab nicht wenige Stellen, wo bereits Pflanzen drauf wuchsen. Obwohl die Sonne nicht schien, war es heiss und wir kamen ins Schwitzen – mehr zwar vom Bälle- oder Ballauflesen als vom Spielen. Spass machte es aber sehr. Royer, so hiess mein Partner, (es war seine erste „Tennis-Erfahrung“) trug nach wie vor seine Arbeitskleidung mit langen Hosen, das Schulterhalfter mit Revolver allerdings hatte er abgelegt. Und er schloss dann auch die Tür zum Platz, nachdem er viermal den Ball dort draussen hatte holen müssen. – Eine Stunde später, nachdem auch der letzte Ball ein Loch aufwies, gaben wir notgedrungen auf. Aber die Erinnerung ist einmalig! Ein Bad im Pool daraufhin war sehr erfrischend.
In der Rezeption wurden Dekorationen zur bevorstehenden Weihnachtsfeier aufgehängt und ich half der jungen Frau, „Jingle Bells“ auf Spanisch zu übersetzten. Am Strand war nach wie vor nichts los, aber gegen vier Uhr nachmittags zeigte sich die Sonne zum ersten Mal und ich beschloss aus diesem Grund, meinen Flug um 24 Stunden zu verschieben, es hätte ja sein können, dass auch der folgende Tag sonnig sein würde.
Am Abend liess ich mich mit dem Velotaxi nach Atacames fahren und wieder kehrte ich bei Marco ein, bestellte aber diesmal eine Pizza. Der Wein war gerade ausgegangen, aber der Kellner war flexibel genug, welchen einkaufen zu gehen. Und wieder war der kleine Junge zur Stelle, bei dem ich den Teller mit den Meerfrüchten losgeworden war. Ich teilte meine Pizza mit ihm und beinahe hätte ich ihn gefragt, ob er mir einen Vorschlag machen könne, was wir am nächsten Tag zusammen essen könnten. Zurück im Hotel hatte es keinen Strom, ein Angestellter führte mich mit einer Taschenlampe zu meiner Cabaña. Und wie als Kind oder vor drei Wochen in der Wald-Lodge musste ich in der Nacht bei Kerzenlicht und mit der Taschenlampe lesen.
Leider war der letzte Tag dann doch wieder verregnet, schön warm aber immerhin. Ein Spaziergang am Strand lag trotzdem drin; ich sammelte ein paar hübsche Muscheln und las in der Hängematte mein Buch fertig.
Abends am Strand von Atacames gönnte ich mir meine letzte Piña Colada und spendierte drei Buben je einen Drink. Ich ass wieder im selben Ort wie üblich, aber diesmal war der kleine Junge nicht zur Stelle, so teile ich mein herrliches, aber viel zu grosses Nachtessen mit einem Büsi.
Weder einen Bus noch ein Velotaxi konnte ich finden für die Heimfahrt. Mit drei jungen Männern, die auf einer Bank bei der Busstation sassen, kam ich ins Gespräch und sie boten mir an, mich nach Tonsupa zu fahren. Es sei auch ihr Heimweg. Ich nahm das Angebot an. Der eine ging zum nahe gelegenen Parkplatz und holte einen grossen Bus, in den sie mich einluden mitzufahren. Erst dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass dies das Dümmste hätte sein könnte, was ich jemals gemacht hatte. Da hätte ja wer weiss was passieren können. Wie kann man nur so blöd sein, fragte ich mich, sagte aber nichts, denn die Fahrt ging schon los. Sie dauerte nur kurz, wir kamen beim Hotel an, die drei liessen mich aussteigen und verabschiedeten sich. – Alles war gut gegangen, aber trotzdem war mir auch nachher noch ganz mulmig zumute. Lange noch an diesem Abend dachte ich über Arglosigkeit, Vertrauen, Dummheit, Leichtgläubigkeit, Angst und solche Dinge nach.
Mein Flug am nächsten Morgen war ausnahmsweise mal pünktlich und noch vor dem Mittag war ich zurück in Quito, zum fünften Mal innerhalb von sieben Wochen.
Meinen letzten Tag verbrachte ich mit Einkäufen, Packen und Umpacken und im „La Chopa“ genehmigte ich mir mein letztes Nachtessen in diesem schönen Land. Nicht zum ersten Mal bestellte ich „Tamal de Mote“ und „Plato Typico“. Dazu trank ich ein Glas Wein. Der Kellner brachte mir drei, die beiden letzten als Abschiedsgeschenk.
Ich ging früh ins Bett und begann mein neues Buch zu lesen, das ich an dem Tag gekauft hatte: Mary Higgins Clarke auf Spanisch.
Zurück in die USA - Miami
Am nächsten Morgen (17. Dezember 1999) musste ich bereits um vier Uhr auf dem Flughafen sein. Erst kurz vor acht Uhr flogen wir mit grosser Verspätung ab. Der Zwischenhalt in Panama gestaltete sich ziemlich speziell. Irgendwo im Terminal war ein Brand ausgebrochen, nirgendwo hatte es mehr Strom, überall war’s dunkel, nur an wenigen Orten funktionierte die Notbeleuchtung und Hunderte von Passagieren standen auf den Pisten herum – das absolute Chaos herrschte. Irgendwann aber, vorausgesetzt man erwischte das richtige Flugzeug in dem ganzen Durcheinander, konnte man wieder einsteigen und weiterfliegen. – In Miami musste ich zwei Stunden auf mein Gepäck warten, das mit einer anderen Maschine angereist kam. Zum Glück - ich hatte schon gefürchtet, es sei verloren gegangen.
An die Preise in Land der unbegrenzten Möglichkeiten musste ich mich erst wieder gewöhnen. Das Hotel in South Beach kostete pro Nacht so viel wie meine Unterkunft in Cuenca für zehn Tage. Aber ich blieb ja nur für zwei Nächte. Ray brachte mir am nächsten Tag meinen Koffer, den er bei sich aufbewahrt hatte und den Laptop. Mein Velo hatte er für 55 $ verkaufen können, das war auch nicht schlecht. Wir machten uns einen schönen Tag und gingen zusammen essen. Natürlich erzählte ich von meiner wunderbaren Reise, aber bald driftete das Gespräch ab und wir liessen all das Revue passieren, was wir in Fort Lauderdale im CELTA-Kurs erlebt hatten. Für ihn hatte sich der Aufwand gelohnt. Er hatte einen Job gefunden in China und dorthin wollte er bald reisen, um in irgendeinem Dorf auf dem Land nach der Cambridge-Methode Englisch zu unterrichten. – Lieber er als ich.
Karibik-Kreuzfahrt
Ich hatte noch eine letzte Woche Urlaub vor mir, bevor es heimwärts ging. Weil ich über Weihnachten nicht in Florida bleiben wollte, hatte ich eine einwöchige Karibik-Kreuzfahrt mit der „Carnival Paradise“ gebucht, einem ganz neuen riesigen Schiff, auf dem es mir auf Anhieb sehr gut gefiel. Was für ein absoluter Gegensatz zu allem, was ich in den letzten Wochen in Ecuador erlebt hatte!
Schon am ersten Abend wurde mir ein Platz an einem grossen runden Tisch mit anderen elf „Singels“ zugewiesen, ausser mir alle Amerikaner. Wir wurden fast augenblicklich zu einer Art Familie, unternahmen viel zusammen und hatten es absolut fidel und gut.
Schön waren die Stunden auf See, die man lesenderweise beim Sonnenbaden und in einem der verschiedenen Pools plantschend verbringen konnte, interessant und lustig waren die Abende bei den gemeinsamen Mahlzeiten, in der Bar oder in einer der Shows, die ausnahmslos von ausgezeichneter Qualität waren. Für Unterhaltung jeglicher Art war gesorgt: Kino, Theater, Comedy-Shows, Magier-Darbietungen, Zirkus- und Tanz-Vorstellungen, Vorträge und vieles mehr konnte man täglich besuchen. Natürlich hatte es auch verschiedene Bands, Talent-Shows, Sängerinnen und Sänger, wer noch nicht genug gegessen hatte, konnte sich am schön präsentieren Mitternachtsbuffet erneut den Magen vollschlagen, das Angebot war endlos.
Spannend wurde es einmal ganz unverhofft, als wir während des Essens plötzlich merkten, dass das Schiff ein wenig schwankte und der Kapitän den Kurs änderte. Er hatte ein Boot gesichtet mir fünf kubanischen Flüchtlingen. Die nahm er auf. Wir sahen zu, wie ihr Boot, das im Vergleich zum riesigen Schiff wie eine Nussschale aussah, ganz unten, knapp über der Wasseroberfläche in einem geöffneten Tor in der Schiffswand verschwand.
Wunderbar waren die verschiedenen Ausflüge, die wir machen konnten: Erster Port of Call war Cozumel in Mexiko, wo ich an einem herrlichen Strand mit kristallklarem Wasser baden ging. Von Playa del Carmen aus brachte uns ein Bus nach Tulum, einer Maya-Stätte, die auf einem Felsen direkt am Meer gebaut ist. Der Ort ist einmalig in seiner Art, Tempel wurden in der Regel nur im Landesinnern gebaut. Aber weil es so viele Leute hatte, die dort herumwanderten und auf den Ruinen herumkletterten, machte der Besuch nicht nur eitel Freude. Und die Fahrt zurück im unterkühlten Bus noch weniger.
Der verrückteste Ausflug fand auf einer Sandbank bei der Insel Grand Cayman statt. Mit Booten wurde man zur Stingray-City-Sandbar gebracht. Dort konnte man bis zu den Hüften im warmen Wasser stehen und auf die Ankunft der grossen Rochen warten. Es dauerte nicht lang, schon näherte sich ein ganzer Schwarm in Erwartung ihrer obligaten Leckerbissen. Wie im Wind flatternde Leintücher schwammen sie auf uns zu. Wir erhielten Fischreste und Crevetten, die man den Tieren füttern konnte. Das Gefühl, das herrschte, wenn sie sich wie Samt um einen schmiegten, einen manchmal ganz umhüllten und uns wie Staubsauger die Delikatessen aus den Fingern saugten, ist unbeschreiblich. Ein riesiges Geschrei ging los unter den Touristen, niemand, der erst nicht Angst bekam, bis man merkte, dass nichts passierte, niemand verletzt wurde. Stingrays sind ja normalerweise nicht ganz so harmlos, aber diese Fische dort sind offenbar seit Jahren an die Menschen gewöhnt und daher ungefährlich. Die Sandbank war nämlich der Standort, wo die Fischerboote aus der Umgebung normalerweise ihre Netze säuberten, die Fischreste ins Wasser warfen und so gewöhnten sich die Mantas allmählich ans Schlafaffenland. Die Konsequenz davon: Was dort vor sich ging, wusste man bald schon geschickt touristisch auszunutzen.
Am herrlichen Seven Mile Beach bei George Town konnten wir uns vom Erlebnis weitere drei Stunden erholen, bis wir von den Tendern wieder abgeholt und aufs Schiff zurückgebracht wurden.
Auch auf Jamaica gefiel es mir. In Kingston besuchte ich den Markt, einen botanischen Garten und die Wasserfälle, die man allerdings vor lauter Leuten kaum mehr sah. Mit den Touristen kann man schon Geld machen. Die Amerikaner sind grosszügige Trinkgeldspender. Der Guide im Garten, der mehr oder weniger nur den Weg wies und ausser ein paar Sätzen („Jamaica-no problem, watch your steps, everybody is gonna make it, no worries – be happy“) rein gar nichts sagte, wurde jedenfalls reichlich entlohnt.
Heimreise
Zurück in Miami blieben mir zwei Tage bis zur Heimreise. Ich traf mich nochmals mit Ray. Er ist Amerikaner, hat aber gitano-hispanische Wurzeln. Ich erwähne es, weil es im Restaurant, wo wir assen, zu einer lustigen Episode führte. Als der Besitzer ihn sah, rief er aus: „Wooo, Salman Rushdie“, verschwand und versteckte sich hinter der Bar. So ein Spassvogel. Obwohl – mit der Ähnlichkeit lag er gar nicht so weit daneben.
Rechtzeitig für die grosse Silvesterparty 1999 mit Freunden war ich daheim in Bern.
Ein neues Jahrtausend nahm seinen Anfang.
Kanada
Im Herbst 2004 war es das einzige Mal, wo wir unseren Spanienferien untreu wurden. Wir besuchten unsere langjährigen Freunde Denise und Jim in Toronto, verbrachten ein paar herrliche Tag mit ihnen in ihrem Cottage in Muskoka, in dieser wunderbaren Gegend, wo nicht genau klar ist, ob es sich um Inseln und Halbinseln in einem riesigen See handelt oder ob es eine Landschaft ist mit zahllosen Seen. Der eigentliche Grund, weshalb wir diesmal Kanada unseren geliebten Spanienferien vorzogen, war Gino. Er besuchte ein Semester lang eine Schule in Vancuver und wir gingen ihn anschliessend dort besuchen. Zusammen untenahmen wir im viel gelobten „Indian Summer“ eine dreiwöchige Reise durch die herrlichen Herbstwälder in British Clolumbia und Alberta, fuhren nach Lake Louise und besuchten Freunde in Whistler. Auf einer schnurgeraden Strecke ohne jeglichen Verkehr in Richtung Jasper (100 km Höchstgeschwindigkeit) wurden wir von einem Polizeiauto angehalten. Ich sah das „Unheil“ von weitem, ging sofort vom Gas weg, aber es reichte nicht mehr. Die Autopapiere wurden geprüft sowie mein Fahrausweis. Das dauerte fast eine Viertelstunde lang. Wie schnell ich gefahren sei, fragte mich der Beamte. Etwa 110, beichtete ich. Da lachte er und sagte, in dem Fall hätte er mich gar nicht angehalten. 133 km/h seien es gewesen. – Aber er würde ausnahmsweise von einer Busse absehen, wir sollten uns lieber die schöne Gegend ansehen. – Freundlich, freundlich, die Polizei in diesm Land! Da fiel mir natürlich ein Stein vom Herzen und ich hielt mich fortan brav an die Verkehrsvorschriften.
Auf der Strecke gab’s immer wieder mal einen Wegweiser, der mit einem Pfeil auf einen der Berge zeigte, an denen wir entlangfuhren. Ans „Klapperhorn“ erinnere ich mich gut. Mir gefiel der Name ganz besonders.
Das erstaunlichste Erlebnis in diesen Ferien aber geschah auf Vancouver Island. Wir schlenderten durchs Stadtzentrum in Nanaimo, ich war dabei, einen Laden zu betreten, wo ich im Schaufenster etwas gesehen hatte, das ich mir näher anschauen wollte. Im selben Moment stiess ich mit jemandem im Türrahmen zusammen – es war ein Kollege von mir aus der BMS. So ein unglaublicher Zufall. Auch jetzt, wo ich das schreibe, gibt es mir zu denken: am selben Ort, zur selben Zeit... Wir hätten ja auch beide in derselben Stadt sein können, ohne uns zu begegnen. Fünf Minuten vorher oder nachher und die Begegnung wäre nicht zustande gekommen. – Verrückt!
Wir gingen dann alle vier zusammen essen, und da geschah schon wieder etwas Lustiges: Wir bestellten Wein und die Serviererin brachte nur drei Gläser. Eines für Theo, eines für mich und das dritte für Gino. Gino war ja erst neunzehnjährig zu der Zeit und hätte in diesem Land ja noch gar keinen Alkohol trinken dürfen. Und mein Kollege war damals etwa fünfunddreissig, sah allerdings sehr jung aus. Trotzdem...
Reisebericht Guatemala - Nicaragua 2004
Zurück aus Kanada packte ich gleich die Koffer um, denn meine dritte Urlaubsreise „stand vor der Tür“. Sie führte mich einmal mehr nach Lateinamerika, allerdings erst nach San Diego, wo ich zwei Wochen lang in einer Schule mein Englisch wieder ein wenig ajour bringen wollte, neue Wörter und Redewendungen lernte und den „American way of life“ genoss. Ich konnte bei Freunden von uns wohnen, die mich sehr verwöhnten.
Der Plan war, dass ich nach dieser Zeit nach Guatemala fliegen und Theo, der ja inzwischen pensioniert war, mich dort für drei Wochen, kurz vor Weihnachten, besuchen würde.
Am Samstagabend um halb neun kam ich in Guatemala City an. Per Internet hatte ich in Antigua eine Schule gebucht, um mein Spanisch zu vertiefen, und Mario, der Direktor, holte mich am Flughafen ab. In seiner Email hatte er mir geschrieben, ich solle kein Taxi nehmen, da wisse man nie - er werde dort auf mich warten und unterschrieben hatte er mit: „Your friend Mario“. - Really sweet, fand ich!
Guatemala
Es klappte bestens. Die Fahrt nach Antigua dauerte fast eine Stunde. Mario brachte mich in eine kleine Pension, da das Hotel, in dem ich wohnen wollte, an diesem Abend kein Zimmer mehr frei hatte. Offenbar hatte er mit Buchen gewartet, bis er sicher war, dass ich wirklich kommen würde. Zwar hatte ich im Juli bereits gebucht, aber erst ein paar Tage vorher nochmals bestätigt. - Ich mit meinem Gepäck! Da ich einen Tag vor meiner Abreise nach San Diego erfahren hatte, dass nicht nur 20 kg Fluggepäck erlaubt seien (ich war schon kurz vor dem Verzweifeln beim Kofferpacken), sondern 64 kg (!!!!!), hatte ich mir keinen Zwang angetan, hatte sofort einen grösseren Koffer gekauft (meine Kinder und Theo sagten im Chor: „Schpinnsch?“) und schon zu Hause tüchtig geladen (was man eben so braucht, aber auch viele Mitbringsel und Kleider zum Weggeben, muss ich zu meiner Verteidigung erklären). Die Malls in den USA sind nicht sehr hilfreich, wenn’s darum geht, beim Einkaufen zurückhaltend zu sein, so schleppte ich dann gegen 50 kg mit mir herum, inklusive Handgepäck.
Die kleine Pension, wo ich übernachte, wurde von einer jungen Familie geführt. Alles war sauber, aber die Ausstattung eher karg, ungefähr das Gegenteil von meiner schönen Unterkunft in San Diego, wo ich die letzten drei Wochen gewohnt hatte. - Und ich weiss jetzt wenigstens, was „familiäre Atmosphäre" heisst. Das ist, wenn am Sonntagmorgen von sieben bis acht der kleine Sohn einen Hahn imitiert, der im Hof nebenan den kleinen Jungen imitiert. Die Leute sind jung, sie müssen Nerven haben wie Drahtseile. Aus der Fassung geriet der Herr des Hauses zwar trotzdem fast, als er meinen Koffer in den ersten Stock hissen musste (auf der Waage 31,5 kg).
Schule Dann kam mein erster Schultag. Die Schule ist ein wenig anders, als wir es gewohnt sind. Sie findet in einem Hof statt, im Freien. Wir sind etwa fünfzehn Schülerinnen und Schüler. Alle sitzen mit ihren Lehrerinnen oder Lehrern jeweils zu zweit an einem kleinen, schitteren Tischli auf einem noch schittereren Plastikgartenstuhl. Das sieht komisch aus. Klassen oder Gruppen gibt es keine, jeder erhält Einzelunterricht. Kosten tut’s pro Stunde 4 $. Der Lehrer erhält davon einen Viertel, der Rest geht an die Schule. Kaffee ist gratis in der Pause. Er ist wie Abwaschwasser, zubereitet in einem grossen Gefäss, wo er ständig warm gehalten wird. In Guatemala wird sehr viel Kaffee produziert, aber eine Kaffeekultur ist keine zu finden. - Viva Italia! Hin und wieder läuft eine Ameise über mein Heft. Eine Tafel hat’s natürlich auch nicht. Der Lehrer, er heisst Edgar, schreibt alles auf ein Blatt auf. Er sieht eigentlich mehr aus wie ein Bauarbeiter, aber das sind Vorurteile, ich weiss. Jedenfalls verstehe ich mich gut mit ihm. Er hat nur ein Buch, das teilen wir. Es muss schon bessere Zeiten gesehen haben. Wenn ich es berühre, habe ich unweigerlich das Bedürfnis, nachher die Hände zu waschen. Bücher sind in der Verantwortlichkeit der Lehrer. Jeder hat sein persönliches Unterrichtsmaterial. - Eines Tages bringt Edgar ein anders mit, aber da ist ihm offenbar ein Holzwurm hineingeraten, von Deckel zu Deckel ist ein grosses Loch gefressen. Aber sonst ist alles OK.
In der Schule geht es ziemlich anders zu und her als bei uns. Immer wieder stelle ich das fest. Während des Unterrichts eines Morgens kam Mario, der Direktor der Schule, vorbei und verteilte allen Lehrern je zwei Blatt Papier für ihre Notizen. - Wenn ich an unser Kopierzimmer denke in der Schule und den Verschleiss an Material...
Bisher habe ich noch alle meine Habseligkeiten, und es sind deren viele. Edgar hat mir gesagt, es sei überhaupt nicht so schlimm mit der Kriminalität in Antigua, in Guatemala Ciudad schon, dort gehe keiner freiwillig hin, aber ich solle am Abend auf jeden Fall lieber mitten in der Strasse und nicht auf dem Trottoir gehen... Es könnte sein, dass man aus einem dunklen Hausgang heraus überfallen werden könnte. Das ist zum Glück nie passiert. So oder so lässt es sich auch tagsüber besser auf der Strasse spazieren als auf den Trottoirs, die zum Teil riesige Löcher aufweisen und wenn man nicht aufpasst, man einen Beinbruch absolut in Kauf nehmen muss. „Hans-guck-in-die-Luft“ geht gar nicht, der Blick muss stets auf den Boden gerichtet sein.- Ich hab’s unfallfrei überlebt.
Antigua
Die alte Kolonialstadt, wie es deren etliche gibt in Lateinamerika, liegt auf 1‘500 m über Meer. Das Zentrum ist angeordnet wie ein Schachbrett von circa 1 km2, etwa 30'000 Einwohner leben in und um die ehemalige Hauptstadt, die umgeben ist von Hügel- beziehungsweise Bergketten. Drei davon sind Vulkane: Agua, Fuego (noch aktiv) und Acatenango; alle etwas über 3000 m hoch. In der Mitte befindet sich der Parque Central, auf der einen Seite flankiert von der Kathedrale oder was davon noch übrig ist, auf den andern Seiten die Municipalgebäude, Läden, Restaurants und Banken. Es hat unendlich viele Kirchen und Ruinen, ebenso viele Internetcafés und Mini-Reisebüros. Noch mehr Restaurants. Und eines sieht gefälliger aus als das andere. Die meisten haben einen Innenhof, es wird eine Freude sein, sie alle auszuprobieren. Das Hotel, wo mich Mario am nächsten Tag hinbringt, ist sehr geschmackvoll eingerichtet und äusserst sauber, aber das Problem ist, dass mein Zimmer keine Fenster hat. Es erinnerte mich an meine letzte Reise nach Südamerika, wo das genau so war. Das ist nicht ungewöhnlich, bedingt durch die Bauweise (Innenhöfe) und es hat sicher auch noch andere Gründe. Eine Grosszahl aller Hotelzimmer, zumindest die preisgünstigeren in den Städten, haben keine Fenster oder wenn sie welche haben, kann man sie nicht öffnen; meist sind sie klein, weit oben angebracht und oder mit Glas versehen, durch das man nicht hindurchschauen kann.
In der ersten Woche hatten wir in der Schule einen Kochkurs. Das heisst, in Ermangelung einer Küche brachte die Lehrerin die drei Desserts mit und erklärte uns, wie sie gemacht werden. Aussehen taten sie nicht besonders gut; zwei davon erinnerten mich stark an das, was wir bei uns ins Robby-dog Säckli füllen, eines eher, wie wenn es jemand bereits gegessen hätte. Aber ich habe mich tapfer „durchgebissen". Diese Desserts bereitet man nur in dieser Saison zu; sie sind für die Toten gedacht, die am 1. November zurückkommen. Die Familien bringen diese Gaben auf die Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen und essen dort wacker mit. Ebenso bringen sie deren Lieblingsgerichte auf den Friedhof. - Da kann man sich ja richtig aufs Ableben freuen.
Normalerweise kann man hier den Friedhof nicht besuchen, weil es zu gefährlich ist (Raub und Vergewaltigungen), aber in dieser heiligen Woche geht es in Ordnung, da werden alle Vorbereitungen getroffen, die Gräber neu gestrichen etc. So kann man ihn ohne Polizeibegleitung besuchen. Um auf den Hügel Cierro de la Cruz zu spazieren, ist es hingegen besser, sich vorher bei der Touristenpolizei zu melden, damit man begleitet wird. Es ist nett, unterwegs mit den Polizisten zu plaudern, und man hat einen wunderbaren Blick über die Stadt und die Vulkane.
Allerheiligen in Todos Santos
Am ersten Wochenende fuhr ich mit ein paar Schulkameraden (tönt ein wenig komisch, fast wie Gschpändli) in den Norden in die Berge. Wir organisierten die Reise selbst, das heisst, wir mieteten einen Minibus mitsamt Fahrer für drei Tage, so war’s nur halb so teuer. In Todos Santos, auf 2‘450 m Höhe, findet jedes Jahr zu dieser Zeit ein 5-tägiges Fest statt, wo die Toten geehrt werden und das mit Unmengen von Alkohol. Am ersten November, als Höhepunkt sozusagen, findet etwas absolut Abstruses statt: Ein Pferderennen mit betrunkenen Reitern (?!?!?!), die nach jeder Runde eine Glas Alkohol trinken müssen, der so stark ist, dass er einen so oder so fast vom Pferd haut. Das Rennen dauert von morgens 8 bis nachmittags um 5 Uhr und ist fertig für die Teilnehmer, wenn sie entweder tot sind oder vom Pferd gefallen und nicht mehr in der Lage sind, wieder in den Sattel zu steigen. Hotels hat´s keine in diesem Ort, jedenfalls nichts, was diesen Namen verdienen würde, nur Unterkünfte mit kaltem Wasser. Toilettenpapier und Rucksack soll man mitnehmen, hiess es. Das kann ja heiter werden, dachten wir und reservierten daraufhin ein Hotel in Huehuetenango, etwas näher an der gewohnten Zivilisation und nicht weit weg vom Ziel.
Am nächsten Morgen um sechs Uhr starteten wir und kamen um acht in Todos Santos, einem Ort mit etwa 2000 Einwohnern, an.
Die Fahrt dorthin ist wunderschön, man sieht Bergzüge, einen hinter dem andern, Felder, die fein säuberlich mit Agaven voneinander abgetrennt sind, wenige Häuser nur oder kleinere Siedlungen.
Es war total bizarr. So etwas Verrücktes habe ich noch nie erlebt. Das Fest oben in den Bergen schlägt dem Fass den Boden aus
Es war bereits allerhand los bei unserer Ankunft. Von überall her kamen Reiter in ihren bunten Trachten angeritten. Zahlreiche Besoffene lagen schon am Morgen früh herum, torkelten und lallten, aber das kümmerte niemanden, offenbar gehört es einfach dazu.
Und dann das Pferderennen. Nein, es ist nicht zum Glauben: etwa fünfzig Reiter, 150 Pferde zum Auswechseln zwischendurch, circa 5000 Zuschauer aus der ganzen Gegend (nur etwa 200 Touris) und Rum und Bier (oder was auch immer das für ein Gebräu war) à gogo. Die ganze Gruppe Reiter muss (!) schon vor dem Starten trinken, und nach jeder Runde wird nachgefüllt. Sie starten dann gemeinsam aufs Kommando und rasen los, eine Strecke von ungefähr 300 m der Strasse entlang, die ins Dorf führt, und wieder zurück. Nach jeder Strecke sind sie betrunkener und früher oder später fällt natürlich jeder mal vom Pferd, die nächsten galoppieren über die Körper hinweg. Wer am Boden liegt, kann sich manchmal kaum noch aufrappeln; von Kameraden müssen sie aus der Gefahrenzone geschleppt werden und sobald sie wieder einigermassen da sind, lassen sie sich erneut auf die völlig verängstigten Gäule hissen. Gekleidet sind sie in den neuesten Trachten, die extra für diesen Tag hergestellt werden. Manche Reiter schwenken ihre Bierflaschen während des Rennens umher und galoppieren freihändig und laut johlend. Das Ganze dauert acht Stunden lang. Am Mittag können sie sich einen Moment ausruhen. Es gibt jedes Jahr Tote, aber das wird dann als gutes Zeichen ausgelegt, dann gelingt sicher die Ernte. Absolut crazy, der ganze Spektakel!
Das Event hat einen geschichtlichen Hintergrund: Als die Spanier das Dorf vor rund 450 Jahren eroberten, seien sie total besoffen ins Dorf galoppiert. Wahrlich ein guter Grund, während Jahrhunderten dieses fatale Ereignis zu zelebrieren. - Es ist eine blutige Sache, die Reiter spucken und kotzen, ein gruuuusiges Schauen. Aber manchmal muss man trotzdem lachen, es ist fast nicht zu fassen, dass es so was gibt. Gegen Abend, sozusagen als Schlussbouquet, versuchen sie dann noch mit Säbeln, Hühner, die an einer Schnur am einen Ende der Strecke aufgehängt sind, im Galopp zu killen. Diesen Anblick haben wir uns allerdings erspart. Es war sogar so, dass es gegen Mittag zu regnen begann. Das hat uns dann gereicht. Wie die Rennstrecke aussah, konnten wir uns vorstellen; das ganze Dorf war ein einziger Morast.
Am Mittag assen wir eine Kleinigkeit in einem Restaurant und der Kellner war so zugedröhnt, dass es etwa eine Viertelstunde dauerte, bis er unsere Bestellung begriffen hatte. Sich merken, was wir wollten, lag nicht mehr drin. So musste er es sich alles aufschreiben. Ich weiss gar nicht, ob er wirklich schreiben konnte. Er zeichnete die Buchstaben aus der Speisekarte auf seinen Bestellblock ab und das dauerte. Ich wollte eine Omelette und dieses Wort kam nur einmal vor auf der Karte. Es hätte also gelangt, „Ometet“ zu schreiben. Aber er kopierte alles, mitsamt dem Druckfehler und den dazugehörigen cebollas y tomates. Meine Kollegin bestellte ein Sandwich und da ging die Abschreiberei wieder los. Was dann kam, war ein normales Sandwich und eines, in dem eine Omelette eingeklemmt war...
Gut, sind wir nicht über Nacht dort geblieben, denn was uns ein Engländer erzählte, der im Dorf übernachtet hatte, hätte mich aus der Reserve gelockt. Er hatte in einer Privatunterkunft ein Doppelzimmer gemietet. Da er es für sich allein wollte, hatte er den vollen Preis dafür bezahlt. Als er von einem kurzen Spaziergang zurückkam, hatte die Vermieterin drei weitere Gäste bei ihm einquartiert, zwei Personen im andern Bett, eine in seinem eigenen.
Dieser Ausflug wird mir unvergesslich bleiben, nicht nur, weil alles so krass komisch war, auch wegen der einmaligen Aussicht auf der Fahrt dorthin.
Auf der Heimfahrt nach Antigua besuchten wir den farbenfrohen Markt in Chichicastenango (2'000 m), die Mayaruinenstadt Zacuelu und in Huehuetenango den Friedhof am 1. November - ein Volksfest und ein Blumenmeer! Vor den Toren des Friedhofs fand eine Kilbi statt mit Schiessbuden, Musik, Essständen und einem Riesenrad. Der Friedhof sah aus wie eine Ferienkolonie. Die Häuser, die sie ihren Toten aufstellen, sind zum Teil grösser als ihre eigenen. Spaziergänger, Musiker, Marimbaspieler vor den Urnengräbern - andere Länder - andere Sitten.
Ausflüge
An einem Nachmittag der folgenden Woche machte ich bei einem Ausflug mit ins nahe gelegene Dorf Santiago Somorra. Es war sehr eindrücklich. Sechzehn Frauen, die versuchen, bessere Bedingungen für ihre Kinder (Schule) zu erreichen, haben sich dort zu einer Assoziation zusammengefunden, anfangs gegen den Willen ihrer Männer. Sie verkaufen die Dinge, die sie herstellen, ohne Zwischenhandel und zeigen einem genau, wie sie diese anfertigen. Weben (Bettdecken, Taschen, Tücher, und tausend andere Dinge) sowie Matten flechten sind ihre Hauptarbeiten. Zuerst aber führen sie einen auf einem Spaziergang zu einer ehemaligen Lagune und erzählen gemeinsam die Geschichte ihres Dorfes. Hoch oben in den Bergen sind noch immer die Fussabdrücke eines Helden zu sehen, der nach dem Erdbeben vor 400 Jahren das Dorf verlassen hatte. Die Frauen selber haben diese zwar noch nie gesehen, aber sie wissen, dass sie dort sind. – Sozusagen als Schlussbouquet kochten sie für uns Besucher am späten Nachmittag ein tolles Essen, Pepian (besser als in jedem teuren Restaurant in der Stadt); wir konnten unsere Tortillas selber formen, es war ein einprägsamer Nachmittag.
Ein anderer halbtägiger Ausflug führte uns ins Dorf San Andrés Itzapa. Die indianische Bevölkerung (und offenbar nicht nur diese) verehrt dort einen Heiligen, der zwar offiziell nicht anerkannt wird, aber man trifft auf Schritt und Tritt auf seine Spuren. Es ist San Simón Maximon, ein komischer Kauz. Er trägt einen schwarzen Anzug mit Krawatte, in der einen Hand hat er eine Flasche Rum und im Mund eine Zigarre. Vertrauenerweckend sieht er nicht aus. Vor seinem Altar steht eine Art Priester, der den Leuten, die San Simón huldigen wollen, erst mit grünen Zweigen, Münze oder etwas Ähnlichem, über den Kopf und den Rücken schlägt und sie anschliessend mit Rum begiesst. - Na ja.
Am folgenden Wochenende wurde es etwas brenzlig. Die Wahlen waren eine Riesensache. Es wurde empfohlen, nicht zu reisen. Mich hatte aber inzwischen das Reisefieber gepackt und ich wollte möglichst nicht in Antigua bleiben, sondern ein paar Tage ans Meer fahren. Einige rieten davon ab und sagen, man soll nicht einmal das Haus verlassen, andere glaubten, es könnte schon gehen, vor allem die Südachse sollte befahrbar sein. Vorsorglich meldete ich mich bei der Botschaft an, damit sie wussten, falls ich in Schwierigkeiten geraten sollte, dass ich da war und sie mich auch per e-mail über allfällige Geschehnisse oder besondere Gefahren informieren konnten.
In der Schule hatte ich viel über die Wahlen erfahren, es war unheimlich spannend. Es wäre an der Zeit, das korrupte System zu ändern.
5. November 03: Man denkt und hofft, dass Berger („Bersché“ sagen sie) oder Colóm Präsident wird, nur ja nicht wieder Montt, der ja Tausende von Indígenas auf dem Gewissen hat. Jetzt besticht er sie mit Geld und Versprechungen, man rechnet damit, dass er deshalb trotzdem eine beachtliche Stimmenzahl erhalten wird.
Gestern hat die Regierung ein Dekret erlassen, welches bestimmt, dass am Wochenende bis und mit Montag nicht gearbeitet wird, also auch keine Läden geöffnet sind, keine Gruppen grösser als zehn Menschen sich treffen dürfen, Hotels und Restaurants geschlossen bleiben müssen, und so weiter. Das heisst aber, dass gar niemand reisen kann, denn Benzin soll auch keines erhältlich sein. Und das wiederum bedeutet, dass viele Leute gar nicht zu den Wahlurnen gelangen können, denn sie müssen dort wählen, wo sie registriert sind. Die nicht abgegebenen Stimmzettel zählen dann für die Regierungspartei, die aber im Grunde genommen ganz klar keine Chance hat gemäss den Opinionpools. Es gibt jetzt grosse Opposition gegen dieses Dekret, morgen sollte herauskommen, ob es gelang, die Regierung zu zwingen, davon abzukommen.
Sitze ich tatsächlich hier fest, ist die Frage. Ich kann mir die Situation nicht vorstellen. Wo gehen all die Touristen hin? Und wo esse ich? Ab Freitag habe ich nicht einmal mehr ein Zimmer in meinem Hostal.
Soeben bin ich in ein anderes Hotel gezogen, da meines überbucht ist. Hier möchte ich am liebsten bleiben, denn es ist ein wunderschönes Haus mit zwei Innenhöfen, einem prächtigen, tropischen Garten, und ich bewohne es alleine (für 22$). Das Beste: es hat drei Fenster! Aber ich kann leider nur für zwei Nächte bleiben. mal sehen, ob's dann nächste Woche auch noch frei ist. Ich muss halt ein wenig „stürmen“.
6. November 03: Judihui! Sie haben das dumme Regierungsdekret über Bord geworfen. So kann ich nun morgen nach Monterrico ans Meer fahren. Ich freue mich sehr!
Bei den Wahlen scheint jetzt alles auf bestem Weg zu sein, so hoffe ich wenigstens. Die Regierungspartei hat keinerlei Chance, die Wahl zu gewinnen, wenn sie nicht totalen Wahlbetrug begeht. Ich möchte dem Volk den Wechsel gönnen. Man hofft allgemein, dass Berger das Rennen macht und dass es nicht einen zweiten Wahlgang geben wird, denn das kostet dieses arme Land enorm viel Geld für nichts. (Anmerkung im Januar 04: Berger wurde am 28. Dezember im zweiten Wahlgang gewählt.)
Am Meer - Monterrico
10. November 03: Es ist Montag und ich bin zurück von meinem ersten „Ferienwochenende". Bisher war ich ja ständig in der Schule und das Todos Santos-Wochenende war eher anstrengend. Also ich bin zurück mit hundert neuen Eindrücken und mindestens ebenso vielen Mückenstichen. Beeindruckend war die Fahrt von Antigua an die Pazifik-Küste. Anderthalb Stunden unterwegs und schon befand man sich in einer völlig anderen Klimazone - ein kompletter Wechsel der Vegetation. Antigua liegt ja auf über 1‘500 m über Meer; die Temperatur ist angenehm, immer so zwischen 20 und 25 Grad, in der Nacht relativ kühl, etwa 15 Grad. In Monterrico hingegen ist es sehr heiss und da der Strand schwarz ist (Vulkansand), ist es dort kaum auszuhalten. Hier sagte man mir allerdings, es sei in dieser Jahreszeit (Sommeranfang) eher ein wenig „fresco" und Mücken habe es auch nur sehr wenige.
Ich übernachtete in „Johnny's Backpacker“ in einem Sechserzimmer - nein, natürlich nicht, das waren zwei andere Girls aus der Schweiz; ich „stieg“ im besten Hotel des Ortes „ab", dem „Pez de Oro“, aber im Bett waren wir auch zu sechst - nein, auch nicht. Wir waren viel mehr. Einige Ameisenfamilien und ich. Sie hatten sich in den Kopf gesetzt, durch mein Bett zu marschieren, unaufhörlich, nicht davon abzubringen, von ihrer Route abzuweichen. Das Moskitonetz ist eben nicht zugleich ein Ameisennetz. - Die Kakerlake in der Dusche liess ich von einer mutigeren Frau entfernen, aber kaum war diese gegangen und ich parat fürs Bett, war da auch schon das Gschpänli der eben Ausgewiesenen zur Stelle.
Monterrico ist ein Kaff, in dem man nicht einmal eine Postkarte kaufen kann, geschweige denn sonst etwas. Zwar fand ich einen Postkartenständer, einen verrosteten, die Karten teilweise vergilbt und verbogen bis zur Unkenntlichkeit. Die letzte Karte habe eine Schweizerin gekauft, sagte man mir, vor etwa einem Monat. Sicher nicht um sie zu schreiben, dachte ich, eher wohl als Kuriosum. Nicht schlecht ein solches Andenken für sechzig Rappen.
Monterrico ist ein Naturreservat (ich vergesse jetzt mal den ganzen Abfall, der überall herumliegt, im Dorf, am Strand, und das in Unmengen. Es ist gruuuuuusig!!!!!!!). Aber meine Fahrt auf dem Boot bei Vollmond morgens um fünf durch den Mangrovenwald war paradiesisch.
Im Ort hat es ein Centro und dort wird versucht, die acht (von 250) übriggebliebenen Arten von Riesenschildkröten vor dem Aussterben zu retten. Die Eier werden eingesammelt und nach ein bis zwei Tagen werden die kleinen süssen Schildkröten freigelassen. In der „Eierleg-Saison" werden täglich jeweils um 5 Uhr nachmittags etwa hundert Stück Richtung Meer geschickt. Es ist eine Freude zuzusehen, wie sie den Wellen entgegentorkeln. - Wenige allerdings werden lange überleben, nur etwa ein Zehntel, so wird geschätzt.
Drinks gibt‘s gute bei „Johnny's“, riesige. La „Pura Vida“ ist mein Lieblingsdrink. Aber oh weh: Am Sonntag durfte wegen der Wahlen kein Alkohol ausgeschenkt werden. Und das fing schon am Samstagmittag an, so dass ich meinen Fisch zum Nachtessen ohne Wein trinken musste. Damit ich dann am nächsten Tag nicht herumpöble, versteht sich. - Das Essen war übrigens Spitze dort, der beste Fisch, den ich je gegessen habe. Robalo. Ja, und die Heimfahrt dann: Der Bus, der hätte kommen sollen, kam nicht. Schliesslich gelang die Heimreise doch in einem Minibus, der für acht Personen gedacht war, elf waren wir (Anmerkung am Ende meiner Reise: das ist ja zum Lachen: elf statt acht, da gibt’s noch ganz anderes!). Dass er nicht auseinanderfiel bis Antigua, ist ein Wunder, die Fensterkurbel war durch einen Nagel ersetzt worden, die Tür konnte man nur zu zweit öffnen, schliessen fast gar nicht, alles schepperte und ratterte, aber wenigstens eines funktionierte vorzüglich: die Heizung. Auf Hochtouren. Die Fahrt erinnerte mich an unseren alten Peugeot. In seinen letzten Zügen schlich auch der nur noch mit 25km/h den Berg hinauf. Aber wir haben´s geschafft und in Antigua anzukommen war wie „coming home".
Zurück in Antigua
Ich hab sowieso total Glück: Ich kann in der neuen Unterkunft bleiben. Sie gehört derselben Besitzerin des Hotels, in dem ich bisher war, es ist aber eigentlich ihr Ferien- beziehungsweise Wochenendhaus. Sie lässt mich für den Rest der Zeit dort wohnen, auch wenn Theo später kommt. Sogar wenn wir unterwegs sind, können wir das überflüssige Gepäck dort lassen. Soo nett von ihr! Das Haus ist mitten in der Stadt gelegen und es hat Fenster und einen Garten. - Himmlisch! - Wenn ich will, kann ich Ess- und Wohnzimmer ebenfalls benutzten wie auch die Küche (kommt mir natürlich nicht in den Sinn). Tagsüber ist eine Haushälterin da, Tina, die fürs Hotel die Wäsche macht und meine gleich damit und am Abend kommt ein junger Mann, Rojelio, dessen Job es ist, einfach da zu sein, „Security“ sozusagen. Mit ihm habe ich gestern den ganzen Abend lang die Wahlen am Fernsehen verfolgt.
Überhaupt gefällt es mir gut in Antigua. Die meisten Leute sind freundlich und grüssen, wenn man vorbeigeht. Und ich bin jetzt auch der Meinung, dass es nicht so gefährlich ist. Man muss sich eben informieren über die „Dos“ und „Don’ts“. Offenbar nicht zu vergleichen mit Guatemala City. Über die besuchenswerten Highlights in der Hauptstadt heisst es im „Lonely Planet" Guidebook kurz und bündig, das Beste sei „leaving“.
Zu Beginn meiner dritten Woche ging ich brav wieder zur Schule. Edgar war anderweitig beschäftigt, meine neue Lehrerin hiess Caroline. Sie erzählte mir viel von sich und ihrer Familie, und an meinem letzten Schultag lud sie mich sogar zu sich nach Hause ein. – Sie könnte ein Buch schreiben über ihr Leben. Die ersten siebzehn Jahre wohnte sie in einem kleinen Dorf, wo’s weder Elektrizität noch Wasser hatte. So musste sie vor Schulbeginn (Schulweg eine Stunde) erst Wasser holen gehen zum Brunnen, nach der Schule um vier Uhr nachmittags dem Vater auf dem Feld helfen und nach dem Essen konnte sie dann endlich bei Kerzenlicht ihre Hausaufgaben machen. Die Familie sei von den übrigen Dorfbewohnern stets als Aussenseiter behandelt worden, weil sie ihre Kinder in die Schule geschickt hatten. Daher hatte man sie als „reich“ eingestuft.
Das Erdbeben 1976 hatte ihre Familie zwar verschont, aber obdachlos gemacht. - Caroline ist jetzt 34-jährig, zum zweiten Mal verheiratet, hat vier eigene Kinder (das jüngste fünf Monate alt) und sie sorgt auch für ein Waisenkind, das bei ihr wohnt. Sie macht den Haushalt, muss morgens Schule unterrichten, damit sie ein wenig etwas verdient, und ihr grösster Wunsch ist es, ihr Studium abzuschliessen (Jura), von dem ihr noch zwei Jahre fehlen.
Im Norden
Das nächste Wochenende war der Karibikseite von Guatemala gewidmet. Mit Beatrice, die ich in der Schule kennen gelernt hatte, und ihrem Bruder Norbert reisten wir westwärts. Beatrice ist Schweizerin, lebt aber seit dreissig Jahren bereits in Kalifornien. Sie hat eine Tochter und einen Sohn im Alter meiner Kinder. Wir verstanden uns auf Anhieb sehr gut. Unterwegs war unser erster Stopp in Copán, der Maya-Ruinenstadt in Honduras. Um dorthin zu gelangen, fuhren wir um vier Uhr morgens in Antigua los. Dem Reise-Car fehlte bereits dort ein hinteres Rad. Das habe sich am Tag zuvor selbständig gemacht, wurde berichtet. - Vertrauenerweckend! - Aber das sei kein Problem, meinte der ca. 150 kg schwere Fahrer. Er fuhr noch grässlicher, als er aussah. Ständig war er mit dem grossen Bus am Überholen, am besten war´s, gar nicht hinzusehen. Wir hatten jedoch Glück: Von einer Frau, die wir später trafen, erfuhren wir, dass der Bus am folgenden Tag kurz ausserhalb von Guatemala City endgültig zusammengebrochen war, dass aber unser verwegener „Piloto“, wie man die hier nennt, es doch tatsächlich nach einer Stunde fertig gebracht habe, ihn soweit wieder zusammenzuflicken, dass er es bis zur nächsten Garage schaffte. Er (nicht der Bus) sei dann über und über von Öl verschmiert gewesen. Rio Dulce, Livingston und Lago de Izabal Nach den Ruinen in Copán besichtigten wir jene in Chiriguá, anschliessend die Migros-Bananen-Plantage Del Monte und kamen schliesslich in Rio Dulce an, einer Siedlung, etwa 30 km vom Karibischen Meer entfernt. Der Ort selber ist klein und eher unattraktiv, Ausgangsort für Ausflüge in die Umgebung. Eine riesige Brücke überquert den Rio Dulce. Im Reiseführer steht, man solle ja nicht etwa den Fehler begehen und am Südende, nach der Ortstafel, aussteigen. Es ist etwa ein halbstündiger Marsch bis zurück ins Zentrum auf die andere Seite. Und es ist heiss. Zuoberst auf der Brücke halten alle Autos an, es hat genügend Platz, man hat einen wunderbaren Blick von dort aus. Eiscrème-Verkäufer und andere Händler mit ihren kleinen fahrbaren Verkaufsläden haben sich mitten auf der Strasse etabliert. Wir übernachteten in einem hübschen Hotel am Lago de Izabal, besichtigten die Festung San Felipe und machten einen Ausflug nach Livingston, dem kleinen Hafen direkt am Meer, der nur per Boot erreichbar ist. Ein karibisch anmutender Ort, voller Leben, farbig, mit dunkelhäutigen Bewohnern, Abkömmlinge der ehemaligen Sklaven. Aber der Abfall am Strand, in und neben dem die Leute leben, ist unbeschreiblich. Dabei wäre es ein Paradies. Der Weg dorthin auf dem Fluss war einzigartig. An der breitesten Stelle ist der Rio Dulce acht Kilometer breit, und das auf einer Länge von zwölf Kilometern (el Golfete). Der Fluss frisst sich durch den Regenwald und hin und wieder hat es Behausungen am Ufer, die meisten ziemlich primitiv. Im Reiseführer habe ich von einer „Finca Tatín“ gelesen, in der ich ursprünglich ein paar Tage hätte bleiben wollen. Ich liess mich vom Boot hinfahren und schaute mir die Unterkunft an. Es war dort, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, kein Sonnenstrahl dringt durch den dichten Regenwald, nur schlechtes Licht in der offenen Hütte, kein privates Baño. Ich hätte wirklich nicht viel tun oder unternehmen können an diesem Ort. Es hiess, Spanischstunden würden angeboten, aber die Frau, die diese gab, machte das nun nicht mehr. - Und dann das Kriechgetier und die Mücken! - Im Reiseführer heisst es: „It's not a place for phobics of bugs or creeping fauna". Zu denen gehöre ich aber. Also nehme ich mir das zu Herzen und fahre mit Beatrice und ihrem Bruder zurück nach Rio Dulce. Nach einer letzten gemeinsamen Mahlzeit: „Tortilla con Carne“ für 2 Franken in einem ganz einfachen Beizli am Wasser (ich hätte glatt das Zehnfache dafür bezahlt, sie war so welts-gut) verabschiedeten wir uns. Die beiden fuhren am Sonntagabend wieder zurück nach Antigua, Beatrice hatte einen Flug nach Costa Rica gebucht; mir gefällt es, ich bleibe.In einer sogenannten Ecolodge, der Hacienda Tijax. (www.tijax.com) finde ich eine Unterkunft. Es gibt hier gutes Essen, die feinsten Drinks (mono loco), sogar einen Swimmingpool hat’s. „It truly is a great place to hang out“, meint Lonely Planet.Meine Unterkunft ist eine Cabaña für mich alleine für 25 $ pro Nacht. Sie steht auf Stelzen direkt neben dem Bootssteg, und wenn jemand dort drüber geht, schüttelt meine Behausung wie ein Schiff. Auf der andern Seite des Stegs, direkt vor meiner Tür, sind etliche Yachten stationiert, natürlich gehören sie alle Ausländern. Ausritte werden angeboten, Boot- und Kajak-Fahrten. Ich will ein paar Tage hier bleiben und dann das Terrain per Pferd auskundschaften. Es ist eine Kautschuckplantage, 36 km2 gross. In Rio Dulce funktioniert fast der gesamte Verkehr per Boot. Um zum Hotel zu gelangen, wird man abgeholt. Ich hatte Glück gestern, dass ich diese Cabaña überhaupt buchen konnte, denn an der Rezeption im Ort sagte man zuerst, es habe keine Zimmer mehr frei mit eigenem Bad und WC. Ich war trotzdem einverstanden, aber als ich dann mit der Chica, der Angestellten im Touristenbüro, ein wenig plauderte und das auf Spanisch, rief sie an (von sich aus) und ich hörte sie sagen, ich sei nett, keine Amerikanerin, sie sollen mir ein Cabaña geben. - So geht das hier. Aber ich war froh, denn in der Nacht auf den schmalen Stegen herumzuturnen, falls man auf die Toilette muss, hätte mir wenig Spass gemacht. Dazu kam, dass es die halbe Nacht lang wie aus Kübeln schüttete. Nun, wenigstens war’s schön warm.Ein dreistündiger Ausritt am nächsten Tag über Stock und Stein durch die Kautschukplantage (10'000 junge Bäume, 25'000 produktive) war sehr eindrücklich (grandiose Aussicht über das ganze Gebiet des Rio Dulce), erholsam (lieber mal im Sattel als ständig im Bus), fun (durch wildes Gestrüpp und unsere Zimmerpflanzen galoppieren) und lehrreich: Ein Arbeiter in der Plantage verdient pro Monat 220 Fr. Pro Tag muss er 500 Bäume anschneiden und den Latex einsammeln. Ein Baum kann während vierzig Jahren viermal pro Woche beschnitten werden, sobald er 45 cm Umfang hat. Das ist nach ungefähr neun Jahren der Fall, hilft man mit Chemie nach, dauert’s nur sechs bis sieben Jahre.Von Rio Dulce aus machte ich einen Ausflug an den El Paraíso Wasserfall. Erst wollte ich noch ein Mückenmittel kaufen, aber als ich sah, dass der Bus gerade kam, liess ich es, denn ich wollte ihn ja nicht verpassen. Man sagte mir, er fahre nur immer zur vollen Stunde, und es war gerade zehn Uhr. Also stieg ich ein und setzte mich auf die äusserste Kante des Kunststoffsitzes, denn es war sehr heiss und weil im Bus alles so schmutzig war, wollte ich möglichst jeglichen Hautkontakt mit der Einrichtung vermeiden. So sass ich eine Viertelstunde lang steif auf meinem Sitz und schwitzte. Es hätte längst gereicht, das Mückenmittel zu kaufen. Der Motor aber lief und ich war sicher, dass der Busfahrer jeden Moment zurückkommen und die Fahrt beginnen würde. Da war ich eben noch ein „Chickenbus-Greenhorn“. Nach einer weiteren Viertelstunde lehnte ich mich an und nahm mein Buch hervor. Der Motor lief immer noch. Nach einem Kapitel und weiteren zwanzig Minuten kam der Fahrer und endlich ging’s los. Der Bus war inzwischen gestossen voll (Körperkontakt auch mit Mitpassagieren nicht mehr zu vermeiden), Hühner reisten mit in den verschiedensten Verpackungen, in Körben, Kisten und sogar Plastiksäcken. Die Bibis schauen aus kleinen Schlitzen und gequältes Quieken war ständiger Begleiter auf der ganzen Fahrt. - Chickenbusse heissen diese öffentlichen Busse in der Touristensprache, weil, aus mir noch immer unbekannten Gründen, ständig Hühner mitfahren. Wieso die dauernd unterwegs sind, kann ich mir nicht vorstellen. Natürlich habe ich gefragt; eine Passagierin hat mir gesagt, sie sei beim Tierarzt gewesen. Diese Erklärung schien mir aber doch ein wenig fadenscheinig. - Immer hat’s Hühner. Sogar im Erstklass-Bus (später auf meiner Reise). Dort dachte ich, dies sei nun tatsächlich die erste hühnerlose Fahrt, aber weit gefehlt: Als wir bei der Ankunft in Guatemala City das Gepäck aus dem unteren Teil des Busses in Empfang nahmen, beklagte sich ein junger Amerikaner lautstark. Sein Rucksack war voll verschmiert von Hühnerscheisse. Der Ausflug gefiel mir übrigens gut. Man kann in einem Wasserloch bei ungefähr 25 Grad baden und der Wasserfall, der vom Felsen stürzt, ist mindestens 10 Grad wärmer. Ein tolles Gefühl, darunter zu stehen. Ein Guardia passt auf, dass keine bösen Räuber an diesem abgelegenen Ort auf dumme Gedanken kommen.Dort, wo ich aus dem Bus gestiegen war, ist ein Wegweiser, auf dem es heisst: „Finca Paraíso“. Ein Hotel am Ufer des Lago de Izabal. Dort wollte ich hin und ich dachte, es sei gleich auf der anderen Seite der Strasse. Ein Traktor überholte mich und hielt an. Der Bauer deutete mir aufzusteigen und ich fand das ganz locker, obwohl ich den Sinn nicht ganz begriff. Erst nachher sah ich, dass das Ufer überhaupt noch nicht in Sichtweite war und je länger die Fahrt dauerte, desto grösser wurde in meinen Gedanken das Trinkgeld, das ich ihm dann zu geben beabsichtigte. Er fuhr sogar einen Umweg für mich. Am Ufer angekommen wollte er zwar nichts, aber meinen Proviant nahm er gerne an – ein „Zvieri“ für seine beiden Söhne. Ein schöner Ort am See, ein Restaurant, günstige Cabañas zum Ausruhen, abgeschieden wie die meisten Orte in dieser Gegend. Der Rückweg zur Hauptstrasse dauerte eine gute halbe Stunde (ohne Traktor), und ich hatte Glück, ein Bus kam exakt in dem Moment, als ich die Strasse erreichte (übrigens: Eine Stunde Busfahrt kostet knapp einen Franken). Vorbei an endlosen Bananenplantagen und Rinderherden (eine Rasse gefällt mir besonders gut: Sie hat lange Lampi-Ohren, und die Tiere mit ihrem treuherzigen Blick sehen aus wie zu gross geratene Dackel) erreichten wir nach anderthalb Stunden auf Naturstrasse wieder Rio Dulce. Unterwegs hielt der Bus einmal an, weil ihm der rechte Rückspiegel abgefallen war. Der Junge, der für die Fahrkarten zuständig war, fand ihn zwar wieder, aber er lag da in tausend Splittern. Ich wunderte mich, dass er sich die Mühe genommen hatte, ihn überhaupt noch zusammenzulesen und mitzunehmen.Die nächsten zwei Tage verbrachte ich in einer Dschungel-Lodge „Casa Perico“ (www.casa-perico.com/de/start/">www.casa-perico.com/) ein paar Minuten flussaufwärts. Vier junge Schweizer wanderten vor fünf Jahren dorthin aus und haben sich dort ein kleines Paradies aufgebaut. Nicht, dass ich mich nach Cervelats und unserer wunderschönen Sprache besonders gesehnt hätte, aber jemand hatte mir diese Lodge empfohlen und da ich ja Zeit hatte... Empfehlenswert, erstaunlich, dschungelig, feines Essen, ein paar junge Giele (Gäste), die tatsächlich jassten, aber da am folgenden Morgen wegen einer (der unzähligen) Strompannen überhaupt nichts mehr funktionierte, es seit meiner Ankunft in Strömen geregnet hatte (es hatte auf der Bootsüberfahrt zu regnen begonnen wie aus Kübeln und nichts war mehr trocken), verleidete es mir dann doch (keine WC-Spülung mehr, kein Licht zum Lesen), ich packte meine nassen Kleider in den Koffer und liess mich von Bruno mit der Lancha nach Rio Dulce fahren. Dort nahm ich den Bus nach El Estor am Lago de Izabal. In den Bus konnte ich kaum einsteigen, da er mehr oder weniger auf einer Müllhalde parkiert war. Erst musste man die Hühner verscheuchen, die im Abfall nach nicht vorhandenen Körnern pickten. Dass dieser Bus noch fahrtüchtig war, war fast nicht zu glauben. Aussen verrostet und verbeult, innen fehlen mir die Worte für die Beschreibung. Dreckig ist ein viel zu sauberes Wort. Der Boden übersäht von Abfällen und wegen der Regenfälle und dadurch, dass die Strasse nicht geteert ist, brachte jeder Fahrgast seinen eigenen Anteil an Morast selber auch noch mit. Und die Ausstattung! Wie wenn man den Bus einer Horde wild gewordener Vandalen überlassen hätte zwecks Demolierung.Die Falttüre war mit einer Schnur am Türrahmen angebunden, die Scheibe fehlte, es muss Jahre her gewesen sein, seit sie sich zum letzten Mal entfalten konnte. – Aber der Motor lief und nach zweieinhalb Stunden kamen wir in El Estor an. Ich deponierte mein Gepäck in einem kleinen Hotel und machte dann einen Spaziergang durch den Ort. Das Zimmer kostete nur sechs Franken, hatte sogar ein eigenes Baño, das ich aber erst gar nicht erkannte im dunklen Loch hinter der Schranktüre, die Dusche über dem abgebrochenen WC-Sitz installiert. Es war Markt im Dorf, aber es hatte kaum Leute. Weit und breit war ich die einzige Touristin. Alle schauten mir nach. Ich fand den Ort seltsam und wusste gar nicht recht, was dort machen. Das Wetter war grau, zwar regnete es nicht, aber irgendwie fehlten doch die Farben. Am Ufer des Sees fand ich ein Restaurant, das sehr schön gelegen ist. Ich sah mir die Speisekarte an und beschloss, dort am Abend einen Robalo zu essen. Bis es so weit war, setzte ich mich auf eine Bank am Ufer und las ein wenig in meinem Roman. Auch fand ich ein besseres Hotel, das andere bereitete mir wirklich ein wenig Kopfschmerzen. Sie gaben mir sogar das Geld zurück. Lediglich zwei Franken kostete mich der Umzug. Das, fand ich, könne ich mir leisten.Das Restaurant, in dem ich hatte essen wollen, war leider abends geschlossen, meinen Robalo erhielt ich aber trotzdem, und zwar in „Hugo’s Place“. Ich war der einzige Gast und erhielt Hugos volle Aufmerksamkeit und sein Fotoalbum zum Anschauen. Cobán, Lanquín und Semuc Champay Am nächsten Morgen wollte ich weiterreisen nach Cobán. Es ist immer empfehlenswert, sich mindestens an drei bis fünf Orten zu erkundigen, wann genau ein Bus fährt. Wenn man drei übereinstimmende Auskünfte gesammelt hat, ist die Chance gut, dass es klappt. So sagte man mir, morgens um eins fahre der erste (bei Dunkelheit, ohne Licht, Naturstrasse: nein, danke). Um fünf Uhr und um sechs Uhr habe es ebenfalls einen Bus. Drei Leute waren sich sicher, dass sechs Uhr stimme, also richtete ich mich darauf ein. Sechs Stunden solle die Fahrt nach Cobán dauern. Das kann ja heiter werden, dachte ich. Und heiter hat es begonnen. Kurz vor Sonnenaufgang war ich dort, wo er abfahren sollte. Und siehe da: Er war pünktlich. Ich stieg ein, mein Köfferchen wurde zwischen dem Fahrer und dem Beifahrersitz deponiert und dort versuchte ich es immer im Blickfeld zu behalten. Und los ging’s. Der Bus fuhr kreuz und quer durchs Dorf und hielt überall an, um Passagiere einsteigen zu lassen. Eine halbe Stunde später waren wir wieder am Ausgangspunkt. Das nervte mich ein wenig. Diese Zeit hätte ich mir sparen können, vor allem, weil ich ja noch eine lange Strecke vor mir hatte. Der Bus fuhr streckenweise kaum mehr als 200 Meter weit und schon hielt er wieder an, um Leute und ihre mitgebrachten Hühner ein- und aussteigen zu lassen. Zeitweise waren wir zu sechst auf der Zweierbank (drei Erwachsene und drei Kinder), im Gang zwischen den Sitzreihen standen ebenfalls Leute und der Blick auf mein Hab und Gut war meist verdeckt. Längst schon waren andere Gepäckstücke darauf gestellt worden, gegen Schluss der Reise waren es zwei Hühnerkisten. Einen längeren Halt machte der Bus nie, nur mal ganz rasch zum Tanken (das funktioniert mit Flaschen und grossen Trichtern) und ein paar Mal wurde er in einer grösseren Ortschaft aufgehalten, weil Markt war und Fahrzeuge kreuz und quer im Weg standen. Getrunken und gegessen hatte ich nichts (so musste ich zum grossen Glück auch nicht auf die Toilette – seltsamerweise musste nie jemand) und langsam sehnte ich mich danach, gegen Mittag in Cobán zu sein. Aber da hatte ich nicht mit den Strassenverhältnissen gerechnet. Als ich um halb eins den Fahrer fragte, ob wir jetzt dann bald ankämen, sagte er, nein, erst etwa um zwei. Ich habe ja Geduld. So wurde es dann halb drei. Eigentlich hatte ich im Sinn gehabt, in Cobán zu übernachten und am nächsten Morgen nach Lanquín weiterzufahren. Aber die Stadt mochte ich nicht. Es war kühl und unfreundlich (es gibt dort einen Regen, der sogar einen eigenen Namen hat) und ich beschloss, an meine acht Stunden Chickenbusfahrt noch eine weitere Stunde anzuhängen. Jedenfalls dachte ich, dass die 60 km nach Lanquín in einer Stunde zurückgelegt werden könnten. Aber da irrte ich schon wieder. Erstens war der Bus soeben abgefahren und zweitens sagte man mir, die Strecke sei nicht sehr gut zu befahren, es daure drei Stunden, es gebe Busse und öffentliche Minibusse, der nächste fahre um drei. Uff! – Trotzdem beschloss ich, auf den Drei-Uhr-Bus zu warten. Ein Minibus kam und der Fahrer sagte mir, er sei schon ausgebucht, an diesem Tag fahre kein weiterer Bus mehr, der nächste erst wieder am frühen Morgen. Zwei andere Touristinnen (die ersten Ausländer, die ich seit 24 Stunden sah), wollten auch noch mit, sie erhielten dieselbe Antwort. Mühsam – ich wollte es nicht glauben. Ein Lastwagenfahrer hörte unsere Unterhaltung mit und bot uns an, in seinem Lastwagen hinten drin mitzufahren. Bei dieser Kälte! Und als ich dann noch sah, was er geladen hatte: nichts als Hühner. Nein, danke vielmals! Ich insistierte erneut beim Fahrer des Minibusses und versuchte ihn zu überzeugen, einen Platz könne er mir wohl noch frei machen. Es waren auch gar nicht alle Plätze besetzt. Er willigte schliesslich ein und los ging’s. Nun begann wieder die Herumkurverei im ganzen Ort, anhalten, Passagiere einladen, Gepäck aufs Dach, Plane drauf wegen des Regens, wieder anhalten, eine Gruppe Kinder einladen - langsam verstand ich, weshalb er gesagt hatte, es habe keinen Platz mehr. Schliesslich waren wir 19 Personen im kleinen Bus - mit sehr viel Körperkontakt. Die Kinder sassen teilweise auf dem Schoss der Erwachsenen, die ganz kleinen zwischen den Füssen der Passagiere am Boden.Keinen Meter geteerte Strasse gibt es zwischen Cobán und Lanquín. Die Strecke glich teilweise eher einem Flussbett, überall hatte es zudem Trucks, Raupenfahrzeuge und Strassenarbeiter, die offenbar versuchten, die Strasse zu flicken und zu verbreitern.Irgendjemand hatte Mühe, seine Verdauung im Griff zu behalten und das war dann gleich offen das Thema. Die Frau vor mir, die auf dem Vordersitz in der Mitte zwischen dem Fahrer und dem Mitfahrer eingequetscht war, hatte aber an alles gedacht. Sie hatte eine Art Notfallkoffer bei sich. Vielleicht hatte sie Erfahrung. Sie spritzte den halben Inhalt einer Duftspraydose nach hinten und machte dazu ganz eindeutige Bemerkungen. - Das fand ich auch nicht so toll, aber wenn ich’s mir jetzt nochmals überlege, muss ich sagen: Das Problem war gelöst – zumindest teilweise.Nach einer Stunde Fahrt blieben wir in einer Kolonne stecken und man sagte uns, die Strasse sei für ungefähr eine Stunde gesperrt wegen der Bauarbeiten. - Super, das hatte mir noch gerade gefehlt. Und dann stiegen meine Mitsardinen alle aus. Ich wusste genau, wie das herauskommt; der Boden glich ja schliesslich nicht gerade einem Teppich. Sie brachten feuchte Erde mit, die dann für den Rest der Reise auf dem Boden des Minibusses und auch sonst überall noch klebte (die Sardine, die über mich kletterte, streifte ihre Schuhe an meinen Hosen ab). Freude herrscht! - Und der Motor lief die ganze Zeit. - Einen Moment lang dachte ich, wir würden nie ankommen, es war auch schon stockdunkel mittlerweile, aber dann sagte jemand: „Noch zwei Kilometer und wir sind dort.“Und tatsächlich, ich war dem Glück noch selten so nah. Wunderbarerweise hatte ich mich nicht in einem Sechserzimmer, wie sie dort üblich sind, einquartieren müssen, sondern erhielt eine hübsche, freistehende Cabaña mit Baño privado für mich allein, in der ich mich sehr wohl fühlte. Eine halbe Stunde später sass ich frisch geduscht und zufrieden auf einem Rytigampfi (statt Barstühle) an der Bar in der Lodge „El Retiro“ (https://elretirolanquin.com/) und freute mich, dass mein Tag nach fast zwölf Stunden Busfahrt ein so glückliches Ende genommen hatte. Das Nachtessen, das spät am Abend am langen Tisch serviert wurde, vegetarisch, war absolut köstlich und unvergesslich. Es ist so spannend, irgendwo hinzufahren und noch nicht zu wissen, was man alles erleben wird den ganzen Tag lang und wo und wie man schliesslich schläft.
Da es dunkel war bei meiner Ankunft, hatte ich gar nicht richtig gesehen, wie die Gegend, wo ich war, eigentlich aussah. Als ich am Morgen erwachte, graste eine Kuh vor meiner Tür und etwa 100 Meter unterhalb sah ich die Aare. Der Fluss sah zumindest so aus: genauso grün, genauso schnell, genauso kalt, nur floss er in die falsche Richtung.
Lankín, das kleine Dorf in Alta Verapaz, ist ein komischer Ort. Es sieht aus wie in den Bergen, hat Hügel, Geissen, Hühner und Kühe, aber es liegt nur auf 380 m Höhe über Meer. Am Tag ist es sehr heiss und in der Nacht relativ kühl. Die Attraktion dort ist es, in Lastwagenreifen den Fluss Rio Lanquín hinunterzupaddeln. Ein Pickup brachte uns ans Ende beziehungsweise an den Anfang des Dorfes. Wir schnappten uns einen Pneu und ab in die Fluten... Aber so einfach war es nicht; der Fluss fliesst nämlich doch noch schneller als die Aare und hat viele Kurven. Ständig wurde ich wie magisch angezogen von allem, was ins Wasser hing, von Bäumen und Ästen, aber das Mühsamste war, es hatte manchmal auch Steine und Felsen mitten im Fluss, die man nicht sehen, aber am Hinterteil dann recht brutal fühlen konnte. So war das eine eher rasante 25-minütige „Reise“ zurück ins Retiro. Fun, ja, ok, aber natürlich gelang es mir auch nicht, meinen Reifen dort ans Land zu steuern, wo wir hätten auswassern sollen und mit schon fast aufkommender Panik dachte ich an die Notiz am Anschlagbrett, die davor warnte, man solle nicht weiterschwimmen, denn es habe entwurzelte Bäume unterhalb der Landestelle. Ja, und eben in einem solchen landete ich unweigerlich. Zum Glück war nichts weiter passiert, aber lustig fand ich’s einen Moment lang nicht mehr. - Am nächsten Tag nahm ich all meinen Mut zusammen und ging doch noch mal, schwimmenderweise diesmal ohne Pneu und schaffte es ganz gut.
Zehn Kilometer von Lanquín entfernt gibt es ein Naturwunder zu sehen, Semuc Champey. So etwas Schönes! Der Fluss Rio Lanquín verschwindet unter grausamem, ohrenbetäubendem Getöse unterirdisch in einer Höhle, die aussieht wie ein Höllenloch, und kommt etwa 300 Meter später wieder heraus. Seine Farbe ist beige. Oberhalb hat sich eine natürliche Brücke gebildet aus etwa zwanzig verschiedenen Wasserpools, in denen man baden kann. Das Spannende ist, dass dieses Wasser mit dem Fluss überhaupt nichts zu tun hat; es kommt aus den Bergen und hat auch eine ganz andere Farbe. Es ist dies der Río Cahabón - türkis, grün und blau. Z’Wunder!!! Und wenn man eine halbe Stunde lang den Hang hinaufklettert, sieht man die Szenerie von oben aus der Höhe, und sie ist atemberaubend. Die ganze mühsame Busfahrt hierhin hätte sich einzig nur für den Blick auf diese Naturschönheit gelohnt.
Ein Erlebnis der besonderen Art war mein Besuch in den Grotten von Lanquín. Schon der Eingang kam mir vor wie ein riesiger Schlund. Am Abend vorher spazierten wir dorthin und warteten bis zum Sonnenuntergang. Wenn die Dämmerung einsetzt, verlassen Riesenschwärme von Murcielagos (Fledermäuse) ihre Behausungen, die sie dort im Eingang der Höhle haben, und fliegen zu Tausenden in die anbrechende Nacht hinein. Um ein leichtes Grauen kommt man kaum herum. Das Höhlensystem ist 23 km lang, der erste Kilometer davon ist mehr oder weniger gut ausgeleuchtet, und es hat teilweise Geländer oder Seile, an denen man sich halten kann. Das Geländer in Semuc Champay, auf das ich mich tags zuvor gestützt hatte, hatte allerdings nachgegeben wie weiche Knie, so dass ich hier also eher skeptisch war. Der Weg war glitschig und teilweise recht steil, ich musste aufpassen wie ein Häftlimacher, um nicht auszurutschen. Manchmal kletterte ich auf allen Vieren und ich dachte ständig an Erdbeben und wie es wohl wäre, wenn plötzlich das Licht ausginge. Vorsorglich hatte ich eine Taschenlampe bei mir, trotzdem war der Spaziergang so alleine in dieser fahl beleuchteten Tropfsteinhöhle ein wenig unheimlich. Auf halbem Weg etwa kam mir ein völlig verängstigtes junges Paar entgegen. – Die beiden suchten den Ausgang und erzählten mir, dass zuhinterst plötzlich das Licht ausgegangen sei und sie dann in Panik und in absoluter Dunkelheit versucht hätten, wieder zurückzufinden. Taschenlampen hatten sie keine bei sich. Hänsel und Gretel lassen grüssen, meine Albträume auch. Mutig kletterte ich noch ein paar dutzend Meter weiter, aber dann hatte ich auch genug und kraxelte wieder zurück.
Draussen war es noch heisser als in der stickigen Höhle und die Aussicht auf den halbstündigen Weg zurück zum Dorf reizte mich nicht besonders. So machte ich Autostopp. Sogleich hielt ein kleiner Lieferwagen an, ein junges Paar war drin mit einem kleinen Jungen, und da sie nach Samuc Champey fahren wollten, konnte ich ihnen gleich den Weg erklären. Ich durfte auf dem Rücksitz mitfahren. Dort sass eine Grossmutter und die hatte einen grossen Korb auf dem Schoss: Schon wieder Hühner. Vier oder fünf Stück. Irgendwie kommt man in diesem Land an den Hühnern nicht vorbei.
Die Fahrt zurück nach Antigua war einfacher als die Reise hierhin. Sie dauerte „nur“ etwa neun Stunden, fünf davon im Erstklass-Bus „Monja Blanca“ von Cobán nach Guatemala. Erste Klasse heisst, dass man einen garantierten Sitzplatz hat und nicht damit rechnen muss, dass jemand diesen mit einem teilt. Mein Sitzplatz war allerdings der engste im Bus, hinten in der Mitte neben der Toilette. Links neben mir sass eine Amerikanerin. Entweder hatte sie den Arm unten, dann war meiner oben oder umgekehrt. Sie war zum Glück nicht dick. Aussicht hatte ich auch keine von dort, wo ich sass, aber da war ich dann nicht einmal so sehr unglücklich darüber: Nach etwa einer Stunde Fahrt wurde es einem Mitpassagier in der zweitvordersten Reihe schlecht. Er öffnete das Fenster und kurz darauf waren all die dahinter liegenden Fenster in abnehmender Weise von seinem Mageninhalt überdeckt. - Niemand hat ein Wort über den Vorfall verloren. Das an sich war schon ein Wunder. Da es wieder relativ kühl war, waren die Fenster geschlossen. Wären sie offen gewesen... Im Erstklass-Bus hat es zwar eine Toilette, wie gesagt, aber sie ist kaum begehbar, denn erstens ist sie mit kleinen Tabourettli vollgestopft, die vom Kondukteur nach und nach hervorgeholt werden, wenn ein weiterer Gast einsteigt (eigentlich hatte ich gedacht, das sei jetzt hier nicht mehr der Fall), und auf diese Weise wird der Gang allmählich so belegt, dass ein Durchkommen keinesfalls mehr möglich ist. - So viel zur Nützlichkeit einer Toilette in einem Erstklass-Bus.
Lesen konnte ich nicht während der Fahrt (zu viel Angst vor dem Schlechtwerden) und zum Fenster hinausschauen eben auch nicht, so fand ich es umso freundlicher von einem jungen amerikanischen Mitpassagier, dass er mir in selbstloser Weise seinen CD-Player für fast die Hälfte der Fahrt auslieh und Nora Johnes auflegte. Ich fragte mich nachher, ob ich so elend ausgesehen hatte, dass er auf diese Idee gekommen war.
Umsteigen in Guatemala mit allem Gepäck und sechs Blocks weit zu Fuss zur anderen Busstation gehen, erzeugte ein eher unangenehmes Gefühl. Die schlimmsten Geschichten kursieren über die Kriminalität in Guate. Wir waren sieben Ausländer; wir blieben dicht zusammen und achteten auf unser gemeinsames Gepäck. Eine weitere Stunde und ich war einmal mehr zurück in Antigua.
Zurück in Antigua
Wie schon gesagt, hat es zahllose Kirchen dort. Und viel Verkehr, der aber sehr langsam nur fliesst, weil es mühsam ist durch die unebenen Stassen zu fahren, da es überall Kopfsteinpflaster hat, Löcher sowieso und auch sonst keinen einzigen ebenen Quadratmeter. So stand ich also vor einer Kirche und wollte auf die andere Strassenseite. Da kam ein Auto gefahren, in dem drei Nonnen sassen. Autos haben immer Vortritt vor den Fussgängern, also fuhr der Wagen direkt an mir vorbei. Die drei Frauen beugten sich wie auf Kommando zu mir hin (zur Kirche, ja, ja, ich weiss schon) und bekreuzigten sich. Sie sahen aus wie Synchronschwimmerinnen. Ich dachte bei mir, was für ein Stress das für sie sein musste, durch Antigua zu fahren und sich bei jeder Kirche zu bekreuzigen. Eine Art Frühturnen vielleicht.
Komisches erlebt man allemal. Das Leben ist sehr spannend. Immer wieder wird man überrascht. Mal wollte ich mir in einem der zahlreichen kleinen Lädeli ein Mineralwasser kaufen, damit ich in der Nacht etwas zu trinken hatte. Das Wasser hier kann man aus dem Hahnen ja nicht trinken. Wie ich nach meinem Geld kramte, hatte mir der Verkäufer den Inhalt des Fläschchens bereits in einen Plastiksack geleert und ein Röhrli hineingesteckt. Nicht gerade gäbig für aufs Nachttischli! - Was denen nicht alles in den Sinn kommt!Und kurz darauf machte mir der 24-jährige Portier in meinem Hotel eine Liebeserklärung. Mein Haar gefiel ihm so gut, gestand er mir und mein Alter schätzte er auf 35!!! – Es kommt noch besser: Mein tatsächliches Alter (50) konnte ihn nicht abschrecken. Er versicherte mir, das Einzige, was ihm an mir nicht gefalle, sei, dass ich verheiratet sei. - Schön, nicht wahr! – Da kann man sich nur mit Begeisterung ins nächste Abenteuer stürzen. Lago de Atitlán Eine Agencía de Viajes habe ich gefunden, bei der ausnahmslos alles bestens und auf Anhieb klappte. „Centroamericana“ heisst sie. Cécile, die junge Frau, die dort arbeitet, ist absolut kompetent und effizient und gab mir manchen guten Tipp. Unter anderem vermittelte sie mir das für mich schönste Hotel am Lago de Atitlán (1'560 m), in San Marios. In der Woche, bevor Theo kam, reiste ich nach Panajachel (Gringotenango genannt von den Einwohnern, weil viele amerikanische Hippys dort hängen geblieben sind oder im Reiseführer bezeichnet als „Gringomagnet“). Dort nahm ich eine Lancha nach San Pedro und kurz vor der Ankunft am Fusse des Vulkans San Pedro bat ich den Bootsführer, mich gleich beim Bootssteg des Hotels Jinava abzuladen. Das sei aber in San Marios, erklärte er und alle lachten. Klar, so stand es auf meinen Notizen; ich hatte den Ort verwechselt - bei all diesen „Giele-Näme“ - kein Wunder. Es hätte gerade so gut auch Juan, Pablo, Tomás, Antonio, Andrés, Lucas oder Santiago sein können; fast alle Dörfer um den See herum haben die Namen von Aposteln. Das Lustigste sagte der Typ, ein Einheimischer, der neben mir im Boot mitgefahren und vor Müdigkeit ständig eingenickt war. Meistens hatte er den Kopf auf seinen Knien. Nur wenn er am Gestänge anschlug, sah er kurz auf und rutschte ein wenig in meine Richtung. „Das kommt eben davon“, murmelte er, „wenn man so müde ist“... Mein Lapsus war eigentlich gar kein so grosser. Ich hatte ja Zeit. Einen Spaziergang ins Dorf hinauf und den See von der andern Seite her betrachten zu können, das zumindest hatte ich mir damit eingehandelt.
Das Hotel Jinava ist ein Hit. Es gehört einem Deutschen, der sich dort ein kleines Paradies erschaffen hat. Die einzelnen Zimmer sind in den Hang gebaut, Sonne hat man von morgens neun bis abends um sechs, bis es innerhalb von wenigen Minuten Nacht wird. Jin, wie er sich nennt, ist Ché Guevara- und Jimi Hendriks-Fan, zudem aber auch ein Gartenfreak. In seinem Garten findet man verschiedene Palmenarten, Bananen, Kakteen, Kaffee, Baumwolle, allerlei blühende Pflanzen wie Lilien, Weihnachtssterne, Vergissmeinnicht und manches mehr.
Jin hat vier sehr nette einheimische Angestellte, die ihm helfen, die Gäste zu betreuen, so oder so immer, aber vor allem dann, wenn er’s selber nicht mehr so genau sieht. Auch Haustiere hat es. Zum Beispiel Mojito, der Papagei, der bellt wie ein Hund. Zu den Haustieren scheint auch die dicke Spinne zu gehören, die in meinem Zimmer an der Wand hing, die ich selbstverständlich entfernen, aber nicht töten liess und die beharrlich, jeden Tag, selbst nach drei Wochen, erneut am selben Ort an der Wand oben links auftauchte. Den Skorpion im Badezimmer jedoch musste von Theo (beim nächsten Besuch im Dezember) mehr als 100 Meter weit weggetragen werden in die Nähe eines anderen Badezimmers.
Jin hat auch einen kleinen Strand errichtet mit Kieselsteinen, wo man gut liegen und sich die Stille und Schönheit des Ortes „hereinziehen“ kann, wie Diego sagen würde. Auf dem See hat es ein paar wenige Fischer in ganz einfachen Booten, Jin nennt sie „Wasser-Cowboys“ und so sehen sie auch aus mit ihren Texas-Sombreros. Immer wieder sind sie dabei, Wasser aus ihren Booten zu schöpfen. Fangen tun sie so gut wie nichts, sagt Jin. – Die Aussicht ist atemberaubend, der See wechselt seine Farbe je nach Tageszeit, am Horizont erhebt sich der Volcan San Pedro (3'020 m). Von der Hängematte aus zuzuschauen, wie die Dämmerung einbricht und im Vordergrund die Wassercowboys immer schwärzer werden und schlechter zu erkennen sind, ist einmalig. Zwei Tage und Nächte blieb ich dort, und ich reservierte auch gleich für Mitte Dezember, denn es war sonnenklar, dass auch Theo von diesem Ort begeistert sein würde.
Theo in Guatemala
Am 30. November abends kam Theo in Guatemala City an, ich hatte ihm den Flug zu unserem dreissigsten Hochzeitstag geschenkt (Uff, tönt das uralt!). Ich holte ihn am Flugplatz ab mit einem Shuttle, denn es ist nicht ratsam, ein Taxi zu nehmen. Es gibt sehr viele nicht registrierte und die Kriminalitätsrate ist hoch. Auch vom Übernachten dort wird abgeraten, denn das Risiko, selbst in den Hotels bestohlen zu werden, wird als nicht eben gering eingestuft. Nach zweiundzwanzig Stunden unterwegs war Theo froh, endlich ins Bett sinken zu können.Als er am nächsten Morgen aufwachte und vom Bett aus den Volcan de Fuego sah,der Rauch ausspuckte, war er nicht wenig beeindruckt.An diesem ersten Tag zeigte ich ihm die Stadt. Als erstes gingen wir zu Doña Luisa, wo das beste Frühstück in town serviert wird, frisches, hausgemachtes Brot, die Omeletten (drei Eier!) gefüllt mit Avocado, Sprossen und Tomaten, frisch gepresste Fruchtsäfte und was man sich alles Feines vorstellen kann. Und das in schönster Atmosphäre, in einem zweistöckigen Kolonialhaus. Man kann entweder unten im Patio im Freien sitzen und sich von der Sonne bescheinen lassen oder im Schatten auf einer der Galerien.Den Markt besuchten wir anschiessend, ich zeigte Theo meine Lieblingsläden und am Abend nach dem Nachtessen schleppte ich ihn mit ins Kino. Das, weil es ein besonderes Erlebnis war, sicher nicht wegen des Films. Das Kino war in einem Haus untergebracht, in welchem jemand eine Wohnung gemietet hatte. Einen Teil davon verwendete der Besitzer als Restaurant und drei weitere Zimmer hatte er in Kinos „umgebaut“; Sala 1-3 hiessen sie. Vorne stand ein Fernseher, der mit einem Videogerät verbunden war, und das war eben das Kino. Die Bestuhlung war besonders geil (würden unsere Jungen sagen): Sie bestand aus drei bis vier Reihen von ausrangierten Polstergruppen (bei uns wären die nicht einmal mehr im Brockenhaus erhältlich), die in keiner Weise zusammenpassten, höchst unbequem waren, denn überall quoll der Schaumstoff heraus und hie und da guckte eine Metallfeder aus dem verschlissenen, fleckigen Stoff hervor. Als Erlebnis einzigartig. Das Vergnügen kostet auch keine drei Franken.
Vulkan Pacaya
Am nächsten Morgen liess ich Theo ausschlafen und ging alleine auf Erkundungstour. Was ich schon lange hatte tun wollen, war, den Vulkan Pacaya zu besteigen. Nach einer gut einstündigen Fahrt nach San Francisco auf 1‘900 m Höhe, begannen wir mit der Wanderung.Man sah natürlich schon von weitem, dass der Ausblick nicht grandios sein würde, denn der Gipfel (2‘550 m) war von einem Wolkenmeer umgeben. Man unternimmt den Aufstieg in Gruppen und wird von einem Führer und von Polizei begleitet (Touristen waren auch hier ausgeraubt worden). Der Weg führt durch Maisfelder, dann durch Wald, allmählich hat’s nur noch Gestrüpp und einzelne Bäume, bis man dann 200 m unter dem Gipfel auf ein riesiges Lavafeld stösst, das seit der letzten grossen Eruption im Jahr 2000 besteht. - Von dort an hüllte uns dichter Nebel ein, das heisst, Nebelschwaden kamen geflogen, ein Wind blies, der einen fast aus den Kleidern riss, so dass es unmöglich wurde, weiterzugehen. Meine Windjacke flatterte mir so sehr um die Arme, dass ich Angst hatte, sie würde zerreissen. Dazu machte sie einen solchen Lärm, dass ich mein eigenes Wort nicht mehr verstand. Sand und kleine Steinchen kamen geflogen, wie feine Nadeln fühlte es sich an auf nackter Haut, genau wie in einem Schneesturm, nur zur Abwechslung eben schwarz. Kalt war es auch. Der Guide sagte, das sei nicht ungewöhnlich, auf dem Gipfel habe es Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h. Noch vierzig Minuten hätte der Aufstieg gedauert, aber jedermann war klar, dass wir umkehren mussten. Unser Guide wählte eine andere Route und die machte enorm Spass. Wir rutschten und rannten eine steile Lava-Geröllhalde hinunter, etwa 300 Meter weit; es war wie Ski fahren ohne Skis. Teilweise versank man bis zu den Knöcheln im Sand, unten angekommen war die erste Handlung, die Schuhe vom Sand und den Steinchen zu befreien.
Nicaragua
Am nächsten Tag fuhren wir nach Nicaragua mit dem Tica-Bus, erst mal bis San Salvador, wo wir übernachten mussten, und das in einem ziemlich schrecklichen Hotel, in einer schlimmen Gegend der Hauptstadt, aber Hauptsache die Unterkunft war gleich beim Busterminal. Der Bus wurde in den Hof gelotst, der umgeben war von hohen Mauern, und sogleich wurde das hohe Tor geschlossen und verriegelt, damit ja nicht etwa ein Dieb sich hätte Zugang verschaffen können. Nach einer kargen Mahlzeit in einem schäbigen Lokal innerhalb der Mauern gingen wir schlafen und um vier Uhr morgens (eine gigantische Herausforderung für den lieben Theo) musste man schon wieder parat sein zur Weiterfahrt. Tica-Bus ist nun wirklich sehr komfortabel und modern. Mit Toilette, Air-Condition und Video. Nach etlichen Grenzüberquerungen (San Salvador, Honduras, Nicaragua) und noch mehr Filmen und etwa fünfmal demselben Essen (Bohnen, Reis, Huhn, gebrätelte Bananen) kamen wir nachmittags um vier Uhr in Managua an. In einem einfachen, aber zweckmässigen Hotel nahe der Busstation wohnten wir in Cabañas, die sich in einem weitläufigen parkähnlichen Garten befanden. Es gab dort eine Attraktion, die ich ganz besonders süss fand, nämlich einen kleinen Affen (zwei Monate alt und wie ein Baby), genannt Lorenzo. Beeindruckend, wie behänd sich diese Tiere bewegen können und faszinierend, wie frech sie sind.Auf meine Ohrringe hatte er es abgesehen, da musste ich unheimlich aufpassen, dass er sie nicht zu fassen kriegte, die hätte ich sonst zum letzten Mal gesehen. Seine Händchen waren samtweich und flink und es war ihm nicht zu trauen. Auf Theos Kopf sitzen und lausen, fand er auch ganz locker. - Am lustigsten war es, wenn er aus sicherer Entfernung die Frau, die das Restaurant (Essstand fast eher) führte und die ihn ständig von den Tischen scheuchen musste, ankeifte und man merkte, wie er zutiefst beleidigt war und ihr mit gefletschtem Gebiss jeden Schlämperlig nachrief. Und wehe, sie machte einen Schritt auf ihn zu, da gab's nur noch eines für den Feigling: die Flucht.Einer der Höhepunkte meiner Reise war der Besuch meines Patenkindes in Nicaragua. So besuchten wir das Projekt Xolotlan von „World Vision“ (www.worldvision.ch). Man zahlt als Gönner pro Monat einen gewissen Betrag für ein Kind, und mit diesem Geld wird dann die Familie unterstützt, dem Kind wird ermöglicht, eine Schule zu besuchen (die zwei Franken pro Monat, welche die Schule kostet, können nicht alle bezahlen) und ein Teil des Betrags kommt dem Dorf und dem Projekt als Ganzes zu Gute. Es hat mich interessiert, wie das dort so läuft, ob die Spenden dorthin kommen, wofür sie vorgesehen sind, ob die Organisation viel Geld schluckt etc, etc. Ich kann nur Gutes berichten. Es war ein tolles Erlebnis, das Kind und seine Eltern kennenzulernen. Wir reisten dafür nach San Francisco Libre, so heisst dieser Ort am Lago de Managua, ans Ende der Welt, wie es uns schien. Wir kamen nach einer zweieinhalbstündigen holprigen Fahrt mit dem Pickup an, mit welchem zwei junge Frauen von Vision Mundial uns im Hotel abgeholt hatten.Der Ort liegt am Lago de Managua, ein zwar schöner See, der aber so verschmutzt ist, dass er in keiner Weise genutzt werden kann, offenbar nicht einmal zur Schifffahrt. Die Familie wartete schon auf uns, die Mutter heisst Aura Americana, der Vater (er ist Bauer) Miguel Angelo, aber, als ich sagte, was für ein berühmter Name das sei, war ihm dies das Neueste.Das Kind heisst Maykelin, ist allerliebst, aber sehr schüchtern, was ich gut verstehen konnte. Die Kleine ist sechsjährig und geht in den Kindergarten. Die Familie ist so gut wie mittellos, sie wohnen von dort nochmals Dreiviertelstunden weiter in einem kleinen Dorf und langsam hatten wir ja eine Ahnung, wie solche Dörfer aussehen. Es ist die Gegend, wo vor drei Jahren Hurrikan Mitch alles verwüstet, Felder und Häuser wegrasiert und Tausende von Menschen getötet oder obdachlos gemacht hat. Wer überlebt hat, ist arm und das Leben ist hart.Man stellte uns die Organisation vor. Während fünf Tagen pro Woche arbeiten vierzehn Angestellte in einem einfachen Gebäude, das spartanisch eingerichtet ist. Obwohl es dort sehr heiss ist, haben sie nicht einmal klimatisierte Räume, die Küche ist dürftig eingerichtet wie überall und die Toilette ist lediglich eine Latrine. Es ist also nicht so, dass die dort „abrahmen" und mit den Spendegeldern luxuriöse Einrichtungen finanzieren. Im Gegenteil: Ich fand es gut zu sehen, dass die monatliche Einzahlung von 45.- Franken gut angelegt ist und ihren Zweck erfüllt.Das Projekt dauert voraussichtlich fünfzehn Jahre und hat zum Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“, das heisst, Kindergärtnerinnen und Lehrer werden ausgebildet, man lehrt die Leute unter anderem Hygiene, man unterrichtet sie in ihren eigenen Traditionen (Tänze, Feste feiern), damit sie diese aufrecht erhalten können und so ihre eigene Identität wieder finden; die medizinische Versorgung wird gewährleistet. Die Familie war schon dort, als wir ankamen, alle aufs Schönste gekleidet, sie hatten sich Mühe gegeben für diesen besonderen Tag. Nur wir hatten schmutzige Kleider an. Das passierte im Hotel, als wir in der Lobby warteten, bis man uns abholte. Das kleine Ungeheuer Lorenzo benutzte uns als Absprungrampen, um wie wild überall hinzuhechten. Offensichtlich musste er vorher in irgendwelcher feuchter Erde (das zumindest war unsere Hoffnung) herumgeturnt sein, und so geschah es, dass er nach einer Viertelstunde wieder sauber war, unsere Kleider hingegen leicht bräunlich. Zum Umziehen reicht die Zeit nicht mehr.Was die Familie von unserer Bekleidung hielt, kann ich nicht sagen, ich habe ihnen aber erklärt, weshalb wir so schmutzig waren.Die Geschenke und Kleider, die wir ihnen mitgebracht hatten, nahmen sie mit Freude entgegen, schade, hatten wir nicht noch viel mehr dabei. Wir assen zusammen zu Mittag und unterhielten uns. Es war ein eindrückliches, unvergessliches Erlebnis. Die Familie kam dann noch eine Strecke lang mit uns mit im Pick-Up und an irgendeinem gottverlassenen Ort trennten uns unsere Wege. Die 16-stündige Busfahrt von Antigua nach Managua hat sich gelohnt für dieses Erlebnis, ich würde die Reise wieder auf mich nehmen. Es ist speziell zu wissen, dass es an einem so abgeschiedenen, für uns bisher unbekannten Ort in der Welt eine Familie gibt, zu der wir nun eine Beziehung haben.Am nächsten Tag fuhren wir per Bus nach Granada, der ältesten Kolonialstadt in Mittelamerika. Sie ist hübsch gelegen am Lago de Nicaragua. Wir fanden eine angenehme Unterkunft und machten von da aus verschiedene Ausflüge. Unbedingt wollte ich nach Ometepe, der Insel im See. Dieser ist riesig; seine Fläche ist so gross wie ein Fünftel der Schweiz. Vor zig Jahren ist er vom Meer abgetrennt worden und ist jetzt ein Süsswassersee, auch genannt Mar Dulce. Es soll Haifische drin haben, die sich mit der Zeit an die Umstellung ans Süsswasser gewöhnt haben. Als ich in einem Reisebüro fragte, wie’s sei mit dem Baden dort, erklärte mir Christian, der Agent, er würde mir für diesen Zweck eher die Laguna de Apoyo empfehlen, denn er persönlich sehe sich lieber im Wasser, wenn er schwimme. Das war deutlich genug und er hatte Recht. Ob er uns einen Ausflug ans Meer empfehle, fragte ich ihn auch. Da stellte er mir eine Gegenfrage: „Te gusta beber?“, ob wir gerne trinken. Ja, schon, sagte ich, aber wo ist der Zusammenhang? Das sei alles, was man dort mache, meinte er. Diese Antwort war auch klar genug und wir beschlossen, an einem anderen Ort zu trinken.Ja, und dann gelang es uns auch, den windigsten Ort in Nicaragua zu finden (laut Reiseführer), obwohl wir so viel Wind eigentlich gar nicht finden wollten.Die Kellner nageln das Tischtuch kurzerhand am Tisch an, damit es nicht wegfliegt. Aber schön war es. Der See hat Wellen wie ein Meer. So viele sogar, dass es tönt wie ein Wasserfall. Und wenn man drin badet: Man sieht nicht einmal bis zum Ellenbogen. Wir leben trotzdem noch. - Mit dem Schiff dauert die Überfahrt von San Jorge zur Insel Ometepe eine Stunde. Die Insel ist wunderschön; sie besteht aus zwei Vulkanen, Conception und Madera, und sieht aus wie eine 8. Dort, wo der Gurt ist, war unser windiges Hotel. Die Strassen sind voller Löcher, es dauerte fast eine Stunde, um zwanzig Kilometer zurückzulegen. Aber eben, wir hatten ja Zeit. In der Laguna de Apoyo, einem sensationell schönen Kratersee, wieder auf dem Festland in der Nähe von Granada, badeten wir ein paar Tage später ebenfalls und tatsächlich: Bis zu den Zehenspitzen konnte man sich sehen. - Weniger gut sah man durch den Schwefelrauch des Vulkans Masaya. Mit dem Auto konnten wir bis zum Krater fahren, so hatte doch auch Theo noch sein Vulkanerlebnis, ohne eventuellen Muskelkater riskieren zu müssen.Die Heimreise nach Guatemala zog sich noch mehr in die Länge als der Hinweg, die Zollformalitäten nahmen fast kein Ende.
Tikal
Einen Tag ausruhen in Antigua und schon ging die Reise weiter, diesmal in entgegengesetzter Richtung, nämlich nach Norden: ein Flug nach Tikal. Der geschichtsträchtige Ort (16 km2 Fläche, davon erst etwa 15% ausgegraben - in der Blütezeit um 800 n.Ch. beherbergte die Stadt circa 90'000 Einwohner) besitzt eine besondere Magie, die verschiedenen Geräusche der Vögel, der Affen, vor allem das Gekreisch der Howler-Monkeys, die wie ungeölte Rasenmäher tönen, erzeugen eine einzigartige Atmosphäre. Die hohen Tempel aus der Mayazeit zu besteigen, machte Spass, war aber nicht immer ganz einfach, dafür aber ziemlich abenteuerlich. An zwei Tagen während je vier Stunden musste Theo mit mir den Park erforschen und auf den diversen Ruinen im Urwald herumklettern. Tempel IV war die grösste Herausforderung, Tempel V war zum Glück einen Monat zuvor geschlossen worden.Schliesslich sah ich ein, dass Theo endlich Ferien verdient hatte und so buchte ich unseren letzten Ausflug an den Atitlánsee. In Panajachel gibt es einen Naturpark und ich fand, den könnten wir eigentlich doch noch besuchen, bevor wir uns der Hängematte widmeten. Es gibt ein Mariposario dort, wie in Marin das „Papillorama“. Dorthin gingen wir zuerst, und als wir die zwei Schmetterlinge gesehen hatten (ja, ich weiss, es ist ein wenig untertrieben, aber wir waren halt zur falschen Jahreszeit dort), begannen wir den Natur-Pfad-Rundgang (Tiere, Pflanzen und zwei Wasserfälle). Nach 1,6 km Marsch (45 Minuten), je 75 Höhenmetern Auf- und Abstieg, der Besichtigung des Affen, der Aussicht auf die beiden Rinnsale, mindestens fünfzehn guten Ratschlägen von Theo, (wie es immer besser sei, einen Stock auf eine Wanderung (!) mitzunehmen – er hatte einen dabei - eine Hand solle ich mindestens immer frei lassen etc. etc.), kamen wir wieder im Besucherzentrum an. Der einzige gute Ratschlag wäre gewesen, Mückenschutzmittel einzureiben, daran hatten wir aber beide nicht gedacht. Die unzähligen Stiche (die Mücken bevorzugten natürlich mich) erinnerten mich noch an Weihnachten an unseren Spaziergang.Eine Nacht in der Casa del Mundo in Jaibalito und zwei Nächte bei Jin rundeten schliesslich unsere Erlebnisse in Guatemala ab.
Zurück in Antigua – letzte Tage – Land und Leute
Einen letzten Tag hatten wir noch in Antigua, den verbrachten wir verschieden, Theo und ich - er mit Ausruhen und ich hatte mir in den Kopf gesetzt, unbedingt nochmals den Volcan de Pacaya zu besteigen, nachdem das erste Mal ja „in die Hose gegangen“ war. - Es hatte mich ständig gewurmt, dass es damals nicht möglich gewesen war, zum Krater zu gelangen. Zweimal zuvor hatte ich im Sinn gehabt, nochmals dorthin zu gehen, einmal war das Wetter aber schlecht und beim zweiten Mal hörte ich meinen Wecker nicht. Somit war mein Vorhaben ins Wasser bzw. ins Bett gefallen. - Aber diesmal klappte es. Es hatte zwar Nebelschwaden und war recht kalt, aber der Krater war spektakulär. Der letzte Teil des Aufstiegs ebenfalls. Oft rutschte man zwei Schritte wieder hinunter, nachdem man sich gerade mühsam einen hinauf bewegt hatte. Zweieinhalb Stunden dauerte die Wanderung. Alle waren froh, die Krete erreicht zu haben. Ein einmaliger Ausblick war die Belohnung: links knallgelb die steile Kraterwand, rechts die pechschwarze Lava, im Hintergrund drei weitere Vulkane und die Stadt Guatemala eingebettet zwischendrin. Der Schwefelgestank war abscheulich, die Löcher im Boden, aus denen heisser Wasserdampf strömte, ein willkommenes Öfeli für die kalten Hände. Der Abstieg bzw. Abrutsch dann ein weiterer Höhepunkt. Dass der Berg nicht längst schon abgetragen ist von den vielen Touris, die dort hinunterschlittern, ist ein wahres Wunder.Das erste, was ich sah, als ich „zu Hause“ durch die Tür trat, war Theo schnarchend auf der Dachterrasse in der Sonne liegend. Noch ein paar Worte zu den Menschen, denen wir begegnet sind: Sie waren ohne Ausnahme freundlich und sehr hilfsbereit, sowohl in Guatemala als auch in Nicaragua. Sie helfen gerne, wenn’s drum geht, einen Weg zu erklären, auch wenn sie keine Ahnung haben, was genau man sucht. Im Managua sind die Strassen teilweise überhaupt nicht bezeichnet, so dass man also zur Antwort erhalten kann: „Das Haus, welches du suchst, ist einfach zu finden. Geh zwei Quadras geradeaus, zwei links und dort, wo früher mal der grüne Toyota stand, gehst du dann rechts.“Sogar der Bus-Kondukteur blieb nett, den ich „angehässelt“ hatte, weil er mein Köfferchen wegnehmen und nicht dort hinstellen wollte, wo ich es sehen konnte. Als ich ihn später fragte, ob er den Sänger kenne, der in eben jenem Moment aus dem Lautsprecher ein Lied sang, drückte er sich von zuvorderst nach zuhinterst durch die Fahrgäste hindurch und wieder nach vorne, um alle bekannten Passagiere zu fragen, ob jemand meine Frage beantworten könne. Gerne wollen die Leute wissen, woher man kommt. „Suiza“, sage ich dann und die Antwort ist immer die gleiche. Bei den Kindern: „Muy lejos, verdad? - Viniste en avion?“, bei den Erwachsenen: „Oh! - De Europa!“ Viele wissen natürlich nicht, wo Europa ist. Hauptsache, es ist nicht in Amerika, denn sie haben die „Gringos“ nicht sehr gern. Sie stehen auch offen dazu. Das manifestiert sich ebenfalls darin, dass jeder zweite Strassenhund „Gringo“ heisst. - Manchmal versuchte ich zu sagen, dass man Regierungen und Bewohner nicht in denselben Topf werfen sollte, dass viele junge Amerikaner (Europäer natürlich auch) Guatemala bereisten und nicht wenige von ihnen anschliessend für Wochen oder gar Monate freiwillige Arbeit leisteten. Es hat unzählige Hilfsorganisationen, bei denen man sich melden kann. Gesucht werden Volunteers, die in Spitälern arbeiten; es gibt Projekte, die versuchen, die Strassenkinder in Guatemala von den Schutthalden fernzuhalten, sie zu betreuen und zu sozialisieren, und und und. Diese Argumente nützen nicht viel. Dass die amerikanische Regierung sich ständig in fremde Angelegenheiten mische, das ist die vorherrschende Meinung.Die Adventszeit verbringen wir normalerweise anders. In diesem Jahr entfielen die Adventseinladungen, die Güezlibackerei, der Weihnachtseinkaufsrummel. Das alles habe ich nicht vermisst. Etwas davon spürten wir ja auch in jenem andern Teil der Welt, nur, dass ich mich dort nicht beteiligt fühlte.
Wie bei uns waren die Vorboten von Weihnachten auch hier schon im November vorhanden.
Allerdings kamen uns die vielen Plastik-Samichläuse und kitschigen Verzierungen im warmen Klima ein wenig komisch vor. All das ganze Glitzer- und Glimmerzeug, die Schneegirlanden, dann wieder Krippendarstellungen jeder Grösse überall auf den Dächern, in der Apotheke, in jeder Lobby, in jedem Laden, schienen fehl am Platz. In Granada hatte schon anfangs Dezember jeder Haushalt seinen geschmückten Tannenbaum im Wohnzimmer und den konnte man nicht übersehen, denn am Abend sassen die Bewohner in Schaukelstühlen vor ihren offenen Wohnzimmern auf dem Trottoir und genossen den Feierabend. Passanten und Autos taten der Freude keinen Abbruch, die Abgase offenbar auch nicht - sehen und gesehen werden. - Speziell, das Ganze!
Gestohlen wurde mir beziehungsweise uns nie etwas. Man muss einfach aufpassen, das ist klar, es kann einem auch in Bern passieren, dass man beraubt wird. Sicher, man kann Pech haben, aber manche Touristen, denke ich, sind vielleicht allzu unachtsam. Am Strand einschlafen und sich dann wundern, dass man nur noch den Badeanzug hat...
Ein Franzose, mit dem Beatrice ein paar Tage unterwegs war, wurde im Chickenbus gleich dreimal ausgeraubt. Ein älteres Ehepaar, das wir in Tikal begegneten, erzählte uns, ihnen sei am hellen Tag die Uhr vom Handgelenk gestohlen worden und zwar mittels eines Sprays, der sie einen Moment lang ein wenig dizzy gemacht hatte. Aber das war bis dahin die einzige schlechte Erfahrung auf ihrer monatelangen Fahrt. Gemessen an der Tatsache, dass die beiden (er ist 78 Jahre alt!) im eigenen Auto vom Maine, USA, bis nach Feuerland, der südlichsten Spitze von Chile, unterwegs waren, ist dieser Vorfall ein Detail. Ihr Motto:
„Wir müssen jetzt reisen, wo wir noch können“.
Eines meiner liebsten Fotosujets waren die Autos, die man in Guatemala herumfahren sieht. Beim ersten Wrack, das ich an einem Strassenrand parkiert gesehen hatte, dachte ich, ich könne es dann am nächsten Tag fotografieren, denn dass dieser Wagen nicht mehr fahrtüchtig war, davon war ich überzeugt. Weit gefehlt, der Fahrer stieg ein und fuhr weg. Ich gewöhnte mich allmählich daran, dass einem auch unterwegs manchmal fast nur Gestelle mit Fahrern drin entgegenkommen. Wenn ich an unsere Motorfahzeugkontrolle in der Schweiz denke, muss ich lachen. Offene Eingeweide, Kabel, die heraushängen, fehlende Hauben und Schutzbleche, Pneus so smooth wie Cervelats, herausgeschlagene Lampen und Blinker – alles an der Tagesordnung. Selbst die Polizei fährt in einem Auto herum, dessen Karosserie mal ziemlich anders ausgesehen haben muss. Solange ein Motor noch läuft, ist alles OK. Der schönste Minibus, in dem ich fuhr, datierte vom Jahr 2003, ganz neu also. Der Fahrer pflegte ihn sehr, putzte ihn auch und er hatte sogar liebevoll Stoffüberzüge auf die Sitze gelegt, aber in der Frontscheibe hatte es bereits zwei lange Spalten, der Blinker funktionierte nicht mehr und wo der Radio ursprünglich gewesen war, klaffte ein dunkles Loch, aus dem nur noch die Drähte heraushingen. Er war gestohlen worden. Kay hat mal ein Mail erhalten von einem Freund, in welchem er ihr Fotos geschickt hat aus Afrika, zum Teil ebenfalls von Autowracks. Die Aufnahmen waren zum Schreien komisch, aber das Lustigste an dieser Mail war der Kommentar des Absenders. Er schrieb nämlich: „Läck mir, si das geili Sieche!“ – So ähnlich könnte ich mir eine Randbemerkung zu meiner Guatemala-Autowrack-Picturegallery vorstellen.Keine einzige schlechte Erfahrung, nur tag- täglich neue und unvergessliche Erlebnisse sowie interessante neue Bekanntschaften – das ist das Fazit meiner Reise nach Guatemala.
In einem Ferienprospekt hiess es: „When did you last do something for the first time?“ Diese Frage kann ich hier ganz rasch beantworten: „Every day - many times.“
Reisebericht Herbst 2009 New York – Mexiko
Vor der Reise
Inzwischen war auch Theo auf den Geschmack gekommen und anders als bei meiner letzten grossen Urlaubsreise nach Mittelamerika, wo er mich ja nur während drei Wochen besucht hatte, wollte er diesmal von Anfang bis Ende mitkommen. Schliesslich war er ja auch schon seit neun Jahren pensioniert, hatte also Zeit genug, mich zu begleiten.
Inzwischen hatte mir ein Kollege von einem Internetportal erzählt, wo man in den Ferien Häuser tauschen könne. Die Idee fand ich genial und meldete mich sogleich bei „Homelink“ an. - Das war im Jahr 2007 (Später meldete ich mich noch bei einer anderen Webseite an: HomeExchange).
Wir tauschten eines unserer Biviohäuser gegen eine Wohnung oder ein Haus irgendwo, wo es uns gefiel, ein paar Tage zu verbringen. So waren wir vorher bereits in London gewesen, in Amsterdam, Rom, Bibione, Paris und in den USA, an der Ost- wie auch an der Westküste.
Beim Planen dieses, meines nächsten Urlaubs, hatte ich drei verschiedene Tausche in Mexiko vereinbaren können, den ersten in Cuernavaca, den zweiten an der Pazifikküste in Guayabitos und den letzten in Puerto Vallarta. Auf der Hinreise stand ein Besuch in New York auf dem Programm, wo Dany, Kays Götti, für zwei Jahre bei der Uno arbeitete.
Angefangen hatte unsere Reise schon gut: Am Abend vorher ass ich ein Amaretti und dachte, komisch, da ist etwas Hartes drin. - Ein halber Zahn war’s, und nicht ein kleines Stück. - Neun Uhr abends und meine Koffer noch nicht fertig gepackt. – Raphael, Kays glücklichste Auswahl an Freunden, war meine Rettung. Er lachte zwar, als er von meinem Missgeschick hörte, war aber bereit, sich am nächsten Morgen um halb acht der Sache anzunehmen. So stand ich in aller Frühe auf, packte meinen Koffer fertig und musste in der Eile ohne Handschuhe die völlig vereisten Scheiben an meinem Auto notdürftig freikratzen, um rechtzeitig in der Zahnarztpraxis zu sein. Raphael machte seinen Job vorzüglich: Um acht Uhr war ich wieder unterwegs nach Hause mit einer provisorischen Füllung und einem halbtauben rechten Unterkiefer.
Das nächste Unglück erfolgte auf dem Fuss: Als ich meinen Koffer auf die Waage stellte, riss er dort, wo der Henkel ist. Hier war‘s Theo, der Abhilfe schuf mit einem Befestigungsseil vom Auto. – Ja, und dann erwischten wir das 9-Uhr-Bähnli in Ittigen und alles war im Butter. (Ursprünglich hatte Anja, meine Patentochter, die auf dem Flughafen Belp arbeitete und jeweils meine Flüge buchte, unsere Abreise um 11 Uhr geplant. – Aus irgendeiner weisen Voraussicht heraus hatte ich den Flug auf 13 Uhr verschoben...). Zweite Klammer: (Eigentlich ist der Grund ja klar: Theo steht nicht gern früh auf und wenn’s vermeidbar war/ist, wollte ich ihm diese Ungemach ersparen).
New York
In New York ging alles reibungslos, wir waren ja bereits um halb fünf dort, nahmen den Shuttle nach Manhattan und fanden Danys Apartment im 39sten Stock des Atelier Buildings im äussersten Westen der 42nd Street. Dany war noch bei der Arbeit, aber wir erhielten an der Rezeption den Schlüssel und staunten nicht schlecht, als wir in der Wohnung ankamen: eine atemberaubende Aussicht auf den Hudson River und die Skyline. Grade unter uns das Museumsschiff „Intrepit“, das Theo jedes Mal, wenn wir dort sind, wieder ansehen geht. Diesmal auch, aber sicher ohne mich.
Ja, und dann hatten wir sechs Tage Zeit, die Stadt einmal mehr zu besichtigen. Wir entdeckten viel Neues, aber es ist auch immer wieder schön, an Orte zurückzukehren, wo es einem gefallen hat. Zum Beispiel ins Guggenheim Museum, wo in dem Moment eine wunderschöne Ausstellung von Kandinsky stattfand. Und dort sagte plötzlich jemand hinter mir: „Tschou, Isabelle“. Was für eine Überraschung! - Das waren Peggy und Urs Hügli, gemeinsame Freunde von uns.
Am Samstagabend lud Dany uns alle zu sich ins Apartment ein zum Apéro und zwecks Betrachtung der Aussicht. Und gerade dann begann es wie aus Kübeln zu regnen, mein Schirm schrottreif, die Schuhe triefend nass. Und im BBQ, wo wir uns entschieden hatten hinzugehen, konnten wir nur noch in einer Ecke gedrängt stehend essen, hintereinander wie die Hühner im Stall, aber gerade das sind ja schliesslich die Erlebnisse, die man nicht so rasch vergisst.
Die Stadt ist immer wieder eine Reise wert, es gibt unendlich viel zu sehen und zu erleben. Jedoch wundere ich mich immer mehr, wie solche riesigen Zentren organisiert werden können. Wenn man schon nur an den Abfall denkt, der jeden Tag produziert wird und die riesigen Mengen an Waren, die hin-und hertransportiert werden, die unendlichen Verkehrsstaus (an manchen Kreuzungen reicht die Rotlichtanlage nicht mehr, zwei bis drei Polizisten regeln den Verkehr zusätzlich), an die Menschenmengen in den Subways und sonst überall – ja dann denkt man fast schon wieder wehmütig zurück an Bern. In Mexico City mit seinen mehr als 20 Millionen Einwohnern ist das Ganze noch absurder.
Dorthin flogen wir am nächsten Morgen bei schönstem Wetter.
Unerlässlich nach unserem kurzen Amerika-Aufenthalt: Wir mussten einen zusätzlichen Koffer kaufen, aber den konnten wir dann zum Glück in Mexico City lassen, denn die warmen Klamotten und die schweren Bücher, die Theo unbedingt hatte kaufen müssen, brauchten wir ja nicht durchs ganze Land zu schleppen.
Mexico City (2’240 m ü. M)
Mit der Homelink-Bekanntschaft, das heisst mit der Familie, mit der wir den Haustausch (Cuernavaca-Bivio) organisiert hatten, hatten wir unglaubliches Glück. Solche Gastfreundschaft trifft man nicht alle Tage.
Da wir erst gegen Mitternacht in Mexico City ankamen, war ursprünglich geplant, am Flughafen ein Hotel zu buchen, aber Patty offerierte uns, bei ihren Eltern zu übernachten. Diese wohnen in einem grossen Haus in einer vornehmen Gegend mitten in der Stadt. – Wir blieben drei Tage dort, erhielten alle erdenklichen Informationen, man verwöhnte uns mit feinen Nachtessen und wir kamen uns vor wie die Könige. So riesig diese Stadt auch ist, das Zentrum ist überblickbar. Dieses und die nächste Umgebung erkundeten wir während einer vierstündige Stadtrundfahrt im Turibus (uh, schon nur dieser Name...). So erhielten wir zumindest mal einen Eindruck eines (kleinen) Teils dieser interessanten, pulsierenden Metropole. Um neun Uhr hätte der Bus abfahren sollen, aber das nimmt man dort nicht so genau. Mit 45 Minuten Verspätung kam er dann. (Zwei Fotos zeigen mich auf den Bus wartend. Es sieht aus, als wäre inzwischen hinter mir ein ganzer Wald gewachsen. In Wahrheit kam ein Gartenarbeiter und stellte dort, wo ich sass, Grünzeug hin zur Dekoration für ein Event, das am Abend stattfinden sollte). Sich durch den Verkehr zu schlängeln dauerte ebenfalls seine Zeit; zwei religiöse Umzüge und politische Demonstrationen machten die Arbeit des Buschauffeurs nicht einfacher.
Im Museo National de Antropología verbrachten wir einen ganzen Tag. Es ist äusserst eindrücklich und wunderbar gestaltet. – So schade, was die Spanier alles zerstört haben, um dann auf den Trümmern ihre Kirchen aufzubauen. Es macht einen noch jetzt sauer! - Toll war der Blick über die riesige Stadt vom 37sten Stock des Torre Latinoamericana aus. Bei klarem Wetter, was offenbar wegen all den Abgasen (ca. 12‘000 Tonnen täglich) äusserst selten ist, konnten wir sogar den Popocatépetl (5452m) sehen.
Lunch hatten wir in einem tollen, völlig versteckten Restaurant, das uns Patty empfohlen hatte. Wir assen wir die Fürsten, wurden von drei Kellnern bedient, Touris hatte es keine anderen und bezahlt haben wir für die feine Mahlzeit fast nichts.
Am nächsten Morgen nach dem Ausschlafen hiess es wieder die Koffer packen. Wie schon erwähnt, konnten wir den einen dort lassen, so dass ja jetzt schon klar war, dass wir auch vor unserer Heimreise wieder bei Shapiros übernachten durften. „Mi casa es su casa“ ist der Leitsatz.
Von Mexico City über Xochimilco nach Cuernavaca
Patty’s Vater, Sergio, organisierte uns ein Taxi nach Cuernavaca, unserem eigentlichen Ziel. Unterwegs machten wir Halt in Xochimilco, den „Schwimmenden Gärten“. Flachkielige, blumengeschmückte Barken, alle mit einem Frauennamen versehen, gondeln dort Passagiere in den Kanälen herum. Es herrscht eine äusserst fröhliche Stimmung. Alle wollen etwas verkaufen, und alle sind auf Booten unterwegs: Mariachi-Sänger preisen ihre Lieder an (25 Pesos pro Melodie), ganze Kapellen ebenfalls, eine lauter als die andere. Tacos- und Getränke-Verkäufer versuchen, ihre Produkte an den Mann oder an die Frau zu bringen, Spielzeug- und Bäbiäden sind unterwegs, ganze Mahlzeiten oder auch nur geröstete Maiskolben kann man kaufen, Blumen, Teppiche, und und und… Was man sagen muss, trotz all dem Kommerz sind die Verkäufer überhaupt nicht aufdringlich; sagt man entschieden NEIN, zeihen sie sich zurück, oder besser gesagt, sie paddeln zurück.
Maiskolben wollten wir haben, die sahen vorzüglich aus, aber wieso der Verkäufer sie erst noch mit beiden Händen tüchtig abreiben musste, bevor er sie mit Zitrone und Salz bestrich, war mir ein Rätsel und eigentlich wäre ich sehr froh gewesen, er hätte es nicht gemacht. Bisher hatten unsere Mägen zwar noch nicht protestiert, aber ich fand, man müsse es ja nicht gerade herausfordern.
Die Boote werden wie in Cambridge von einem Paddler geführt, der mit einem langen Stock das Gefährt in die richtige Richtung steuert. - Wenn’s gelingt. Unser Bootführer war schon pensioniert (wie Theo) und er hatte die Sache nicht mehr so ganz im Griff. Immer wieder putschte er in andere Schiffe oder geriet zu nahe ans Ufer oder gar in Kanaleinfahrten, die er eigentlich hätte vermeiden wollen. Wenn das geschah, sagte er jeweils „iiii iiii“, aber niemand kümmerte sich darum, ich glaube, alle kannten ihn und seine Manövrierweise. Beim ersten Mal wollte Theo hilfsbereit aushelfen, aber der Alte deutete ihm, das sein zu lassen („iii!“). Das war sicher besser. Zwei Pensionierte am Paddel… – Ich weiss nicht, wie das herausgekommen wäre. Und das Wasser sah nicht ausgesprochen sauber aus. – Uns gefiel die Bootsfahrt jedenfalls. Allerdings konnten wir uns kaum vorstellen, wie das sein musste an den Wochenenden, wenn ganze Familien ihr Picknick mitnehmen und sich auf den Booten vergnügen, wie das offenbar der Brauch ist.
Cuernavaca
Unser Taxifahrer hatte über eine Stunde gewartet und auf unser Gepäck aufgepasst. Dann ging‘s weiter nach Cuernavaca. Das Ferienhaus von Pattys Familie ist ein Hit: Ein grosser Garten mit wunderbaren exotischen Pflanzen, etlichen verschiedene Sitzplätze, zwei grosse Terrassen, Swimmingpool und Jacuzzi, vier Schlafzimmer, aus denen wir aussuchen konnten, welches uns am besten gefiel (Pattys Mutter Susi allerdings bestand darauf, dass wir in ihrem schliefen, weil es mit zugehörigem Wohnzimmer das schönste sei). Es war wirklich alles wunderbar. Ein Caretaker-Ehepaar schaute zu Haus und Garten und auch zu den drei Hunden (Retriever), einem älteren, genannt „Horus“ und zwei jungen, „ Athos“ und „Aramis“, die bei der Begrüssung vor lauter Übermut und Freude an unseren neuen Koffer pinkelten.
Man zeigte uns alles, und wir wurden schon wieder mit einem feinen mexikanischen Nachtessen beglückt. Es hätte uns nicht besser gehen können!
Vorher gingen wir noch im nahe gelegenen Supermarkt einkaufen. Der Kofferraum des Taxis war prall gefüllt; Augustino, der Caretaker, staunte nicht schlecht, als er sah, was da nicht alles an Lebens- und Genussmitteln in die Küche gebracht wurde.
Am nächsten Tag fanden wir einen Bus, der uns ins Stadtzentrum führte und dort meldeten wir uns als Erstes in einer Sprachschule an für zwei Wochen zum Spanischlernen. Theo auch!
Vorerst jedoch geschah Theos grosses Erlebnis: Er ass Höigümper. Ui ui ui! Wir sassen in einem lustigen kleinen Restaurant am einzigen Tisch auf dem Balkon und da kam eine dicke Mexikanerin mit einem Kessel voller grillierter Grillen, wollte ich grad schreiben, aber es waren, glaube ich, Heuschrecken. Auf Spanisch „Chapulines“. Da musste ich Theo schon bewundern, dass er ohne mit der Wimper zu zucken, eine Handvoll von diesen Viechern ass und sich dann sogar noch eine zweite Handvoll aufschwatzen liess. Und das ohne noch ein Getränk zu haben. Ich winkte energisch ab, aber Theo sagte, es sei eigentlich ganz gut. – Er sagt es mindestens viermal…
(Nebenbei bemerkt: Frei nach Wikipedia, wo’s auch einschlägige Bilder dazu gibt:
Chapulines (amerikanisches Spanisch, aus Nahuatl chapolin entlehnt) sind Heuschrecken der Gattungen Sphenarium, Schistocerca, Taeniopoda, Trimerotropis, Spharagemon und Melanoplus. Sie werden im Mexiko, vor allem im Bundesstaat Oaxacaals Lebensmittel verwendet; geröstet werden sie dort von Frühjahr bis Herbst als Imbiss auf den Märkten angeboten. Zur Zubereitung werden Chapulines üblicherweise erst blanchiert, dann frittiert oder in einer Comal genannten, flachen Pfanne geröstet und mit Salz und Limetten- oder Zitronensaft gewürzt, teils auch mit Chili, Knoblauch. Die Beine und Fühler werden vor der Zubereitung oder vor dem Verzehr entfernt.
Der letzte Satz dieser Beschreibung stimmte übrigens in unserem Fall nicht. Da stachen etliche Tentakel in die Luft).
Später hatten wir Chapulines an vielen anderen Orten ebenfalls gesehen (aber nicht mehr gegessen; eigentlich seltsam, da Theo ja so sehr betont hatte, wie gut sie ihn dünkten).
In diesem Restaurant übrigens wurden wir aufs Netteste bedient vom beleibten und redseligen Chef. Das Mittagsmenu bestand aus zwei Vorspeisen, einem Hauptgang (gar nicht mal so schlecht), Dessert und Kaffee und kostete 40 Pesos, also gerade mal 3.20 Fr. Bald war klar: Das Geld wurde man fast nicht los. - Ok, ok, die zweite Vorspeise bestand aus einem Teller Reis und Theos Kaffee war eine Riesenglungge. Aber schön serviert in farbigem Geschirr aus einheimischer Produktion. Auf dem Tischtuch hatte es ein paar Flecken, aber für den Preis… Und Theo erhielt zwei Bier zum Preis von einem.
„Zu Hause“ kochten wir dann selber und ich lernte, dass und wie man den Salat erst desinfizieren muss, bevor man ihn geniesst. Wasser ist ein Problem, vor allem sauberes. Augustin hatte auch tags zuvor schon alles Gemüse gründlich mit Desinfizierungsmittel geschruppt, bevor er es im Kühlschrank versorgte. Dieser Umstand machte mir nicht eitel Freude, ich gewöhnte mich jedoch allmählich daran, das ebenfalls zu tun.
Der Samstag war ein Tag zum Ausruhen, Sonnenbaden, Lesen, Fotos sortieren, Emails Scheiben. Am Sonntag dann gingen wir mit Augustin nach Tepoztlán, einem Ort in der Nähe von Cuernavaca. Dort ist ein bekannter Markt und irgendwo in den Hügeln eine Maya-Ruine. Die älteren Einwohner sprechen noch Nahuatl, die Sprache der Azteken vor dem Einfall der Spanier. Wie auch in Cuernavaca geschieht an diesem Wochenende alles unter dem Zeichen der Tage der Toten. Ziemlich fremd, das Ganze. Schädel und Skelette aus Zucker, Plastik, Holz, Ton, was auch immer.
Eine Ausstellung mit x verschiedenen Catrinas (das Skelett einer Frau, dargestellt mit verschiedenen Kleidern und Hüten - Symbol für die Toten, die an diesen Tagen zurückkehren und ihre Angehörigen besuchen) aus allen erdenklichen Materialien wie Mais, Blechbüchsen, Blättern usw. besuchten wir am Montag, ebenso einen Friedhof. Dort war unendlich viel los. Blumen wurden gebracht, Mariachi-Sänger waren am Werk, ganze Bands gingen von Grab zu Grab beziehungsweise von Familie zu Familie und alle sangen die Lieder mit.
Unbedingt musste Theo eine Catrina aus Ton kaufen. Manchmal komme ich einfach nicht gegen ihn an. – Was ihm daran so gefiel, war, dass sie eine Zigarette in ihrer Knochen-Hand hält und ihr Décoltée nur noch ein Skelett ist. Wunderschön – zugegeben!
Sein grösstes Problem war dann allerdings: „Wie verpacke ich die zierliche Dame, damit sie die Reise übersteht?“ – Eine Flasche Tequila half: Die runde Verpackung aus Karton war wie gemacht für Theos Catrina (ich hör schon die Kinder stöhnen, wenn wir solches Zeugs mit heimbringen).
Schule
Der Montag war auch unser erster Schultag. Wieder mal auf der andern Seite im Schulzimmer zu sein, fand ich gar nicht schlecht. Theos Klasse bestand aus ihm, einer Mitschülerin und der Lehrerin; wir waren zu viert, alles ganz lernbegierige Schülerinnen und Schüler. Theo fand den Unterricht recht anstrengend. Aber er hielt sich gut, macht seine Aufgaben zu Hause, nur manchmal musste er sie auf den Morgen verschieben, weil er tags zuvor keine Zeit gehabt hatte, weil er so viel hatte nachschlafen müssen.
Theo war übrigens ebenfalls ein sehr eifriger Schüler, was das Spanischlernen anging. Immer wieder erfragt er ein Wort. Aber mit dem Hören klappte es dann manchmal nicht so ganz. – Was heisst „empezar?“, fragt er. „Aafa“, sage ich. Damit kann er nichts anfangen. Ich muss ihm’s jetzt auf Deutsch sagen, damit er’s besser versteht. „Beginnen“ – zum Glück hört uns niemand. La banqueta = der Bürgersteig (z‘ Trottoir hätte ich lieber gesagt).
Und noch ein Schwank aus der Schule, der mit exaktem Hören zusammenhängt: Von eins bis zwei am Nachmittag fand jeweils eine Spezialklasse statt, die man besuchen konnte oder nicht. Theo berichtete mir, es sei ganz lustig, dass alle drei Männer in der Klasse Miguel hiessen (er sprach den Namen mit dem „U“ aus). Seltsam, sagte ich, aber sicher betonen sie doch alle das „U“ nicht. - Es war in Tat und Wahrheit so, dass keiner Miguel hiess, mit oder ohne „U“, der eine hiess Mike, der andere Ryan und der Lehrer Daniel (später hatte ich herausgefunden, dass auch das nicht ganz stimmte und Ryan in Wahrheit Bryan hiess). – Theo wie er leibt und lebt! - Was da für ein Gestürm entstanden sein musste bei der Vorstellung, konnte ich mir kaum vorstellen. Aber das mit dem „U“ schon, schliesslich nennt er auch mich nach 40 Jahren immer noch „Isabeu“.
Unser Schultag sah so aus: Am Morgen um halb neun holte uns ein Taxi ab und nach etwa 20-minütiger Fahrt kamen wir in der Schule an, auf der anderen Seite der Stadt. Waren wir fünf bis zehn Minuten zu früh, reichte es noch, sich einen Moment auf einen Liegestuhl im Garten hinzulegen. Bis um zwei Uhr dauerte der Unterricht jeweils mit zweimal zehn Minuten Pause zwischendurch. Nachher war meistens genügend Zeit, in der Umgebung oder im Stadtzentrum etwa einkaufen oder ein Museum zu besuchen, bevor wir heimfuhren (unbändige Begrüssung der drei Retriever), uns am Pool ausruhten und/oder Aufgaben machten. Das war jeweils eine ziemlich zeitaufwändige Angelegenheit, denn ich musste jeden Tag ein mindestens zehn-minütiges Vorträgli halten und dafür war es unerlässlich, erst einen passenden Artikel in einer Zeitung oder im Internet zu suchen und den dann vorzubereiten (meinen Schülern mutete ich das nur einmal pro Semester zu). - Ja und dann gingen wir irgendwo in der Stadt essen (wieder mit dem Taxi hin und her; eine Fahrt kostete 2-3 Fr. - Da wäre man ja blöd, wenn man ein Auto mieten würde bei diesen Preisen und in diesem stressigen Verkehr).
Es gab Tage, da war ich alleine mit der Lehrerin – eine ziemliche Herausforderung. Wie die Schule so überleben konnte, war mir ein Rätsel. Es hatte kaum mehr Schüler, auch fast keine Touristen. Dies ist nur eines der zahllosen Probleme in diesem Land, wie wir inzwischen erfahren hatten. Es gibt fast nur Missstände und keine Lösungen. Arbeitslosigkeit ist eines der grössten Probleme. Einige sagen, etwa 40 % seien arbeitslos, was natürlich nicht den offiziellen Zahlen entspricht. Ein Teufelskreis ist die Folge. Wer kein Geld hat und seine Familie ernähren muss, stiehlt und landet früher oder später im Drogengeschäft. Erst von da an geht es vordergründig besser, aber es ist ein Weg ohne Rückkehr. Die grausamen Nachrichten, vor allem aus dem Norden (Entführungen, Hinrichtungen, Vergewaltigungen und andere Gräueltaten), füllen die Zeitungen. Der Staat ist machtlos. Weil er dermassen korrupt und in alles verwickelt ist, will er auch gar nichts ändern am Sysrtem, so dass, wer an der Macht ist, auch kontrolliert, was mit dem Drogenhandel und der Mafia passiert. Die Zeugenschutzprogramme sind das Schlimmste, dadurch wir alles verdeckt und niemand, der Geld hat, hat je das Pech, hinter Gitter zu kommen oder wenn doch, dann nur für kurze Zeit. Die Korruption treibt die seltsamsten Blüten ebenso wie die Bürokratie. Es muss unheimlich mühsam sein, wenn man hier in die Räder der Justiz gerät oder auch nur eine Bewilligung beispielsweise fürs Eröffnen eines Marktstandes haben möchte. Unsere Lehrer erzählen uns tagtäglich von solchen Dingen, die Haare könnten einem zu Berge stehen. Schon in unserem Reiseführer hiess es, man solle immer genügend Bargeld bei sich haben, damit man, falls man es mit der Polizei zu tun bekomme, die Angelegenheit mit Scheinen aus der Welt schaffen könne, denn Recht erhalte man so oder so nicht. Mit wem man auch sprach, alle bestätigten diese Einschätzung. Soziale Ungleichheit, Schwierigkeiten mit den Ureinwohnern, eine unglaublich hohe Armutsrate von über 50 Prozent, dies sind weitere Krisenherde. Dabei gibt’s so viele reiche Leute hier; der reichste im Land ist Carlos Slim, ihm gehört fast alles, sagt man. – Dazu kommen die Probleme in der Hauptstadt, wo täglich 1‘500-2‘000 Neuzuzüger registriert werden; die Slums ziehen sich Kilometer über Kilometer gegen Norden hin. Die entsetzliche Luftverschmutzung kommt zum Elend noch dazu. Welche Attraktion denn übt die Stadt auf die Landbewohner aus? Keine; im Gegenteil. Sie haben aber keine Wahl. Auf dem Land können sie nicht bleiben, denn sie haben ihr Land „verkauft“. Das heisst, verkaufen wollten sie eigentlich nicht, aber man hat es ihnen „abgekauft“ („Wenn du nicht kaufen willst, dann wird vielleicht deine Witwe einsichtiger sein…“).
Ausflug nach Teotihuacàn
Vieles von all dem hörten wir auf dem Weg nach Teotihuacán von Charlie, dem Direktor unserer Schule, einem Amerikaner, der seit 36 Jahren in Cuernavaca lebt. Er ist ein begnadeter Erzähler, der unglaublich viel weiss über Land und Leute, Geschichte, Ökonomie, Traditionen, Kultur, Architektur, Archäologie (diese hat er studiert) und natürlich Politik. Die Details, die er kennt, sind unglaublich, ich hätte ihm stundenlang zuhören können. Er hat auch die Gabe, die Dinge sehr bildhaft darzustellen. Schön, mit ihm die prachtvolle Stadt Teotihuacán zu besuchen. Aber auch die Reise dorthin war mehr als nur interessant. Wir legten mehrere Zwischenhalte ein und er zeigte uns unterwegs Dinge, die wir nie selber bemerkt hätten. Zum Beispiel: In einem Dorf in der Nähe von Cuernavaca ist es verboten, Boden zu erwerben. Die staatliche Ölgesellschaft setzte sich darüber hinweg und begann, dort eine Tankstelle zu bauen. – Wir fuhren daran vorbei: Sie war nicht zugänglich; die Dorfbewohner hatten Wälle aus Erde darum herum erstellt, so dass kein Auto dort hineingelangen kann.
Wir wissen jetzt auch, wieso es in Tres Marias, dem Dorf auf der Passhöhe des Passes, den man überqueren muss, wenn man nach Mexiko City gelangen will, auf der einen Strassenseite Restaurants und ein Geschäft nach dem andern gibt, in dem raue Mengen an Wasserspielsachen (Luftmatratzen, Wasserbälle etc.) angeboten werden, auf der anderen Seite jedoch nicht. Der Ort liegt nota bene auf 3‘100 Metern Höhe und es ist kalt. – Des Rätsels Lösung: Die Einwohner haben gemerkt, dass es sich lohnt, diese Dinge günstig anzubieten, denn an den Wochenenden fahren Städter ans Meer und kaufen dann lieber ihre Wasserutensilien unterwegs, wo sie billiger sind als in den Badeorten. Zudem wird ein besonderes Frühstück angeboten, und es ist zum Brauch geworden, im Dorf anzuhalten, sich zu verpflegen und einzukaufen. Bei der Rückreise braucht‘s kein Wasserspielzeug mehr, da geht’s ja wieder zurück in die Stadt. Cool, nicht wahr?! („Cool“ heisst hier auf Spanisch übrigens: „Que padre!“ - Auch cool, nicht wahr!)
Auch eine Pyramide im Süden der Stadt besuchten wir, Cuicuilco, die Geschichte drum herum bis zum heutigen Zeitpunkt wurde uns eindrücklich geschildert, der Einfluss der Vulkane und der Glaube an die Götter, die in diesen Bergen wohnten, wie auch die Geschichte der umliegenden Hochhäuser. Wieso bei der Ausgrabungsstädte ein grosses Schild hängt, auf dem eine Unzahl von Dingen aufgelistet ist, die man nicht tun oder mitbringen darf (keine Musikinstrumente {der Ort heisst übersetzt: Ort des Gesangs und der Gebete}, kein Essen, keinen Rucksack etc. etc. etc.) und wieso es dann doch niemanden interessiert, dass wir Rucksäcke bei uns haben, das hat Charlie in seiner sarkastischen Art höchst humorvoll geschildert: Die katholische Kirche hat Angst vor den weiss bekleideten New Age Angehörigen, die den gefährlichen Glauben haben, dass auch andere Religionen ihre Existenzberechtigung haben. An diesen Orten wollen sie Energie tanken, das aber soll verhindert werden. Man will sie nicht nennen, um gar nicht auf das „Problem“ aufmerksam zu machen, so ist es eben einfacher, all das, was sie mitbringen, zu verbieten und uns, die wir eben keine weissen Kleider trugen und eindeutig Ausländer waren, ohne weiteres einzulassen.
Was in den Wäldern um die Stadt herum passiert, ist weniger lustig. Noch und noch werden Bäume gefällt (strengstens verboten), nachts, man vermutet, von der Regierung unterstützt, (es sollen bestens ausgerüstet Trupps sein mit Leibwächtern und elektronischen Sägen), und wer sich getraut, eine Anzeige zu machen, dem tut das sehr bald sehr leid. Statt 20 Pesos Verdienst pro Stunde erhält der Holzfäller 1000 Pesos - ja und wer macht da nicht gerne mit bei diesem lukrativen Geschäft?! - So geschieht, was kommen muss: Der Wasserhaushalt fällt völlig ins Ungleichgewicht, es gibt Überschwemmungen, aber Hauptsache, einige verdienen sich dumm und dämlich.
Mit dem Bus fuhren wir weiter Richtung Norden, mitten durch die Stadt, und dann im Norden durch die endlosen, trostlosen Slumsiedlungen. Ganz plötzlich war diese Besiedlungsart zu Ende, es folgte eine neue: Lauter farbige Reiheneinfamilienhäuser, die auf den ersten Blick ganz hübsch aussahen. Charlie sagte: „Wenn du dein Auto vors Haus stellen willst, reicht das Heck bis in die Hälfte des Grundstücks vors Haus deines Nachbarn zur Linken, die Front in das deines Nachbarn zur Rechten.“
Ja, und dann endlich Teotihuácan. Die antike Stadt mit ihren riesigen Pyramiden „Sonne“ und „Mond“ und der etliche Kilometer langen schnurgeraden Strasse der Toten sind mehr als nur eindrücklich, aber Details kann man im Reiseführer nachlesen. Überall hatte es Verkäufer. Sie taten mir leid, sie verkauften nicht viel, es gab auch nur wenig, was uns hätte gefallen können (keine Skelettdamen für Theo).
So war auch dies wieder ein reicher und unvergesslicher Tag. Dreizehn Stunden waren wir unterwegs gewesen, Theo und ich und andere acht Estudiantes aus unserer Schule. Wir waren übrigens nicht die einzigen älteren Semester, und das war ganz angenehm so.
Weitere Ausflüge
Am Freitag nach der Schule unternahmen wir einen Ausflug nach Xochicalco, einer Kolonie von Teotihuácan, südlich von Mexico City, allerdings ganz anders aufgebaut: eine Stadt ohne Strassen nämlich, auf einem Hügel gelegen und mit verschiedenen Plattformen, über die man nach oben gelangen konnte. Früher allerdings kam‘s auf den sozialen Status drauf an, wie weit nach oben man sich begeben durfte. Die Stadt war ausgerüstet mit einem perfekten Wassersystem mit Kanälen, einem Observatorium, Bädern und drei Spielfeldern, wo jeweils das berühmte Teamspiel stattfand, das in ganz Mesoamerika gespielt wurde in dieser Zeit des ersten Jahrtausends n.Ch. Die Pyramide zuoberst ist teilweise sehr gut erhalten, sie ist Quezalcuatl, dem Schlangengott gewidmet. Charlie war wieder unser Reiseleiter. Drei Stunden lang waren wir mit ihm unterwegs und er rüstete uns bestens aus: Jeder / jede von uns erhielt ein Klappstüehli zum Draufsitzen, wenn er erzählte und sogar die vier netten aber schwatzhaften American Girls, die diesmal mit dabei waren, verhielten sich mäuschenstill bei seinen Schilderungen. Er erklärte uns bis ins Detail alles über die Ausgrabung des Ortes, über die Gebräuche in jener Zeit, die Verkehrs- und Handelsbeziehungen, eben übers Ballspiel, über das er eine leicht andere aber durchaus einleuchtende Theorie hat, als diejenige, die üblicherweise in den Reiseführern vertreten wird, über den Kalender, den die Mayas hatten (soooo kompliziert, aber erstaunlich genau), wieso sie Menschenopfer brachten, welches ihre Probleme waren (z.B. war‘s eine fast unlösbare Aufgabe, am richtigen Datum zu opfern, denn an einem anderen hätte man den Gott erzürnt - und den richtigen Zeitpunkt zu finden, war oft fast unmöglich). Ein bedeutender Unterschied zwischen der Götterverehrung damals und unseren Religionen heute muss offenbar gewesen sein, dass nicht nur die Menschen von den Göttern abhingen, sondern auch die Götter von den Menschen, und wenn man ihnen nicht Genüge tat, das heisst, die richtigen Opfer zum richtigen Zeitpunkt brachte und genau wusste, was sie wollten, dann hätten auch sie untergehen können.
Die Pyramidenstadt ist übrigens herrlich in die Landschaft eingebettet mit der wunderbarsten Aussicht weit übers Land, über bewaldete Hügel und Berge. Cuernavaca und die ganze Vulkankette in der Ferne, die Mexico City umgibt, sähe man bestens von hier, so wurde uns geschildert, aber da war nur eine dicke Abgaswolke, die alle Sicht verbarg.
In einem Dorf, das wir unterwegs zur Ruinenstätte durchquerten, erfuhren wir, dass fast sämtliche Einwohner zwischen 30 und 40 an unheilbaren Lungentumoren leiden, da während Jahren in der Nähe aus einer riesigen Schutthalde (Abfall aus Cuernavaca) giftige Stoffe ins Trinkwasser des Dorfes geflossen waren. Es erfolgte eine ähnliche Geschichte wie sie im Film „Erin Brockowich“ erzählt wird. – Die Grube wurde inzwischen disloziert - in die Nähe eines anderen Dorfes…
Charlie machte uns auch aufmerksam auf eine Schule, an der wir vorbeifuhren. Auf der einen Seite ist angeschrieben, dass es sich um eine Primarschule handelt, um die Ecke ist ein zweites Schild angebracht mit einem völlig anderen Namen - eine Berufsschule. Aus Platz- wahrscheinlich eher Geldmangel sind diese beiden Institutionen völlig unabhängig voneinander im selben Gebäude untergebracht; der Unterricht in der einen findet am Morgen statt, derjenige der anderen am Nachmittag in denselben Räumen. Sie haben zwei verschiedene Direktoren, zwei verschiedene Sekretariate (eben nur ein Zimmer je), und alle, die Schüler natürlich sowieso, müssen um ein Uhr und abends ihre Plätze räumen, ihre Sachen heimnehmen (Schliessfächer hat’s keine), weil ja dann die andern kommen. – Gäbig, stell ich mir das vor.
Auf dem Heimweg von der Schule mit dem Taxi gerieten wir in einen Stau, eine Stunde lang waren wir unterwegs. Der Verkehr ist grauenhaft, ich kann mir nicht vorstellen, wie das noch lange so weitergehen kann. Die ganze Stadt ist obendrein völlig konzeptlos angelegt, Strassen kreuz und quer, vielerorts sind Bodenwellen eingebaut, um den Verkehr zu verlangsamen. Obwohl fast zu jeder Tageszeit ein Riesenchaos herrscht, fliesst’s trotzdem erstaunlicherweise gar nicht schlecht, es kommt einem vor wie ein riesiger Reissverschluss, die Autos schlängeln sich von Bahn zu Bahn, jeder lässt jeden rein, aus einer Seitenstrasse drängt man sich rein, dies ist kein Problem, niemand hupt, Busse tun‘s sowieso auch. Wollte man nämlich warten, bis eine echte Lücke entsteht, würde man sowohl als Fahrer als auch als Fussgänger in alle Ewigkeit dort stehen. - Die Autos sehen auch entsprechend aus: Es gibt Vehikel, wo man sich schlicht nicht mehr vorstellen kann, dass die überhaupt noch fahrtüchtig sind. Oft sind‘s nur noch rostige Gestelle, Scheinwerfer oder Blinker sind für manche ein Fremdwort, Abgas- und Motorfahrzeugkontrollen wohl erst recht. Einen VW-Käfer sahen wir am Strassenrand stehen, der gar keine Türfalle mehr hatte, dafür innen eine Lenkradbremse (wie verschafft sich ein Dieb wohl Zugang zu einem so begehrenswerten Objekt?). Velofahrer sahen wir in den letzten zwei Wochen einen einzigen, Motorräder nur gerade zwei. Die andern hatten wohl nicht überlebt. Die Taxis sind ok, mehr oder weniger, aber wir gaben schon am zweiten Tag auf, nach funktionierenden Sitzgurten zu suchen. Man muss ja Vertrauen haben…
Am Freitagabend gab‘s wieder Fiesta, weil’s ja für einige der letzte Schultag war. Das ist auch ein sympathischer Teil an der Schule: Man lernt nicht nur die Sprache, man erfährt auch viel übers Land und macht nette Bekanntschaften. So ist immer etwas los.
Die beiden ersten Wochen unseres Aufenthalts verflogen wie nichts; schon war die Schule vorbei. Der drauffolgende Sonntag war der erste Tag, wo wir nichts vorhatten und mal ruhig zu Hause ausruhen, Garten und Pool geniessen und etwas lesen konnten, das nichts mit der Schule oder einer Exkursion zu tun hatte. Theo sagte, dies sei nun sein erster Ferientag.
Auch spielten wir ein wenig mit den Hunden, wenn man das spielen nennen kann. Vor allem die beiden jungen waren wahnsinnig liebesbedürftig und goldig, aber absolut ungestüm. Sie liessen uns keinen Moment lang in Ruhe, hauten ab mit meinem Buch und rasen durch den Garten - Seite an Seite wie Simultanschwimmerinnen. Sie klauten meine Lesebrille und das Etui, das Badetuch und natürlich die Schuhe, die ja umwerfend gut gerochen haben mussten. Alles stereo. So genossen wir den wunderschönen Tag. Das Wetter war immer gleich: Wolkenlos, etwa 26 Grad an der Sonne, im Schatten relativ kühl, die Nächte waren ebenfalls frisch, ein super Klima.
Taxco
An Theos zweitem Ferientag konnte er wieder nicht ausschlafen, ich hetzte ihn in die Stadt auf den Busbahnhof Estrella Blanca. Dort fuhr der Bus nach Taxco, der Silberstadt in den Bergen. Eine Fahrt kann man dummerweise nicht vorher buchen (tolle Einrichtung), so mussten wir den ersten um 9 Uhr ziehen lassen und auf den nächsten um 10 Uhr warten. Das gab uns Zeit, die Kathedrale in Cuernavaca zu besichtigen und natürlich gegenüber einen Espresso (??? – nicht, was man bei uns unter Espresso versteht) zu trinken.
Die Busse sind gut ausgerüstet, sehr bequem und relativ sauber. Billig sowieso. 5 Fr. pro Person und Strecke mussten wir bezahlen. Musik hat‘s und ein Film wird gezeigt, allerdings kann man nicht auslesen, was man hören und sehen will, und ob überhaupt, beides läuft gleichzeitig. Der zweistündige Film ist natürlich nicht fertig, wenn man ankommt, aber das sind Details. - Die Fahrt dauerte eineinhalb Stunden und hat sich sehr gelohnt. Taxco ist ein herrlich buntes Städtchen an einem Hang gelegen, etwa auf gleicher Höhe wie die Mittelstation des Skilifts in Bivio (2‘200m), mit zahllosen verwinkelten Gässchen, ein wahres Labyrinth und totales Chaos von Verkehr und Fussgängern, mittendrin die Kathedrale, die tatsächlich ein Prunkstück ist. Was mir aber noch mehr gefiel, war, dass es auf manchen der umliegenden Gebäuden Rooftop-Restaurants hat oder Restaurants mit bezaubernden kleinen Balkonen und Terrassen. Natürlich landeten wir sogleich in einem mit Blick auf das Geschehen auf dem Zócalo (Hauptplatz einer mexikanischen Stadt). Das Lustigste in der Stadt waren die unendlich vielen Taxis, alles weisse VW-Käfer. Farbige hat‘s auch ein paar, aber die sind in der Minderzahl. Es gelang kaum, ein Foto zu machen, ohne dass im Minimum einer drauf war. Die meisten Taxistas haben den Beifahrersitz rausgenommen, so dass man „bequem“ einsteigen und hinten sitzen kann. – Ein richtiges Käferfest.
Und dann der Markt: So etwas habe ich noch nie gesehen. Es hatte hunderte von Ständen mit Silberschmuck, alles sehr billig, die Hälfte vom Preis an anderen Orten. Vor lauter Begeisterung vergass ich völlig, ein Foto zu machen. Die Stände am Hang sind so konstruiert, dass sie auf der einen Seite längere Beine haben, so dass die Verkaufsfläche doch gerade ist. Auch ohne all die Marktstände besteht die Stadt fast nur aus Läden, die Silber verkaufen. Nach wie vor gilt: Es ist sehr angenehm hier. Niemand ist aufdringlich, alle sind freundlich, ein Lächeln gehört immer dazu.
Zurück in Cuernavaca
...gingen wir in ein nettes Restaurant essen mit einer super Ambiente, grad wie man sie so oft auch antrifft in Guatemala: Das Gebäude war ursprünglich eine Hacienda mit einem Innenhof mit Brunnen und geschmückt mit lauter tropischen Pflanzen. In der Mitte eine Tanzfläche für Salsa-Darbietungen. Das Lokal heisst „India bonita“, schön, nicht wahr! Das kann man wenigstens aussprechen, aber manchmal sind die Namen hier schon eine Herausforderung. Aber ich liebe sie. Die meisten Ortsnamen stammen aus der Aztekensprache Nauhatl, die noch immer von ein paar Indigenas gesprochen, aber wie unsere Schweizerdialekte nicht geschrieben wird. All die Götter hiessen so exquisit, den schönsten Namen fanden wir im Palacio Cortéz, der Gott heisst Ehécatl. - Que padre!
Im selben Palast, mitten in Cuernavaca, an dessen Stelle früher mal ein Aztekentempel stand, gibt es auch eine Galerie mit Mauerbildern von Diego Riveras. Sehr eindrücklich! - Der Tempel war von den Spaniern zerstört worden und mit den Trümmern der Ruinen wurde das Gebäude, jetzt ein Museum, „neu“ aufgebaut.
Noch was zur Schweinegrippe (oder Spanische Grippe): Wie ich lese, hat sie die Schweiz erreicht, aber ich glaube nicht, dass sie schlimmer ist als unsere ’normalen‘ Grippen. Bisher wenigstens. Hier ist es überhaupt kein Thema. Was im Frühling passiert ist, davon sagt unsere Lehrerin, die Regierung habe das Ganze aufgebauscht, um Geld aus dem Ausland zu erhalten, was ja dann auch gelang. Aber sie seien eben zu geldgierig und zu dumm gewesen, um zu merken, dass dies ein Eigengoal gewesen sei, denn der Tourismus ging dadurch ja erheblich zurück und noch mehr Arbeitslosigkeit war und ist die Folge.
Leute mit Mundschutz auf der Strasse sieht man so gut wie keine, dagegen ist es in jedem Supermarkt und in jeder Bäckerei fürs Personal, welches mit unverpackten Lebensmitteln zu tun hat, Vorschrift, einen zu tragen, Haarnetzli und Handschuhe übrigens auch.
Was ich zu erzählen vergessen habe, ist, dass man hier die Schweiz sehr wohl kennt. Es gibt beispielsweise. „Enchiladas suizas“. Ich weiss zwar auch nicht, was genau damit gemeint ist. Wohl mit Käse. Den kann man im Supermercado kaufen. Greyerzer ist angeschrieben. - Er hat riesige Löcher...
Interessant kann‘s werden, wenn man eine Strassennummer sucht. Wir wohnen an der Galatea 45, am Haus vorne dran steht 38 und etwas weiter vorne 147. Die nächsten Nummern sind 50, 52, 54, 90 und so geht’s munter weiter.
Teopanzalco Pyramide
An unserem letzten Tag in Cuernavca besuchten wie noch die Teopanzalco-Pyrmide, die mitten in der Stadt steht. Nach den grossen Ruinenstädten ist dies ein ganz bescheidener Ausgrabungsort, aber uns gefiel, dass wir dort einen Tempel des Ehécatl gefunden haben und ich weiss jetzt, was er mit Vögeln zu tun hat: Er erscheint gefiedert. Sein Tempel ist rund, das hatten wir bisher noch nicht gesehen. Charlie könnte uns bestimmt ganze Bücher darüber erzählen, aber seine fantastische Reiseführung war ja nun leider vorbei. Die Tempelanlage ist aber dem Tláloc gewidmet, dem Regengott und dem Huitzilopochtli, dem Kriegsgott. So ein schöner Name und so einfach zu merken. Offenbar wurde der Bau der Pyramide unterbrochen und dann ringsum ein grösseres Gebäude erstellt: Ein Tempel im Tempel.
Rincon de Guayabitos
Inzwischen sind wie in Rincon de Guayabitos angekommen, einem kleinen Fischerdörfchen, etwa eine Autostunde nördlich von Puerto Vallarta. Der Ort ist so klein, er ist nicht mal im Lonely Planet Mexico angegeben. Hier herrscht eine völlig andere Klimazone, es hat keine Vulkane mehr, dafür die Sierra Madre. Am Tag ist es sehr heiss und auch während der Nacht sinkt die Temperatur kaum. Die Regenzeit ist vorbei, mit Niederschlägen muss niemand mehr rechnen. Alles Langärmlige bleibt im Koffer bis zu unserer Abreise. Unser erster Eindruck ist, der Ort ist ziemlich ursprünglich, eben nicht wie Acapulco und Puerto Vallarta, wo’s Hochhäuser und ein reges Touristenleben gibt. – Unser Haus haben wir gefunden (der zweite Tausch, den ich organisiert hatte), das heisst, der Taxifahrer hat uns wohlbehalten hergebracht. Schön, zur Abwechslung fast keinen Verkehr mehr zu haben. Am Flughafen will man uns sofort Taxis aufschwatzen, geht man aber über die Überführung auf die andere Strassenseite gleich beim Flughafengebäude (keine fünf Minuten zu Fuss), sind die Fahrpreise grad nur noch halb so teuer. Und unser Taxifahrer war von der intelligenteren Sorte: Unterwegs fragte er, ob wir nicht einkaufen wollten, er würde gerne bei einem Supermercado anhalten. Das tat er dann auch und Theo kaufte Schinken, Brot, Eier, Käse, Bier, Mineral und eine Flasche Wein, die einzige, die’s dort hatte. Der ganze Einkauf kostete 10 Fr. – Ich freue mich schon auf den Wein! (Theo öffnete die Flasche gestern Abend zum Nachtessen und spülte ihn sogleich den Abguss hinunter).
Im Haus angekommen, zeigte uns eine Nachbarin alles. Mit einem riesigen Schlüsselbund versehen machten wir uns daran, die Schlösser sämtliche Terrassentüren, Gartentore und der Haustüre in den Griff zu bekommen. Alles ist hier zwei- und dreifach gesichert. Mauern und Gitter ums Haus herum, Alarmanlage; man sei halt hier in Mexico, meinte sie. – Das Haus ist toll gelegen, 50 Meter vom Strand entfernt. Es ist schlicht aber geschmackvoll eingerichtet, hat eine riesige Küche mit Wohn-Esszimmer, vier grosszügige Schlafzimmer, Garten mit Sitzplatz und eine grosse Dachterrasse. Wir werden uns hier auf jeden Fall wohl fühlen.
SMS
Um ins Dorfzentrum zu gelangen, „müssen“ wir am Strand entlang einen Spaziergang von fünfzehn Minuten machen. Im Restaurant fand Theo dann, er wolle der Familie ein SMS schreiben, dass wir gut angekommen seien. Er spielt zwar ständig auf seinem iPhone herum, aber die Texterei hat er nicht so ganz im Griff. Offenbar passiert es ihm öfter, dass er jemandem schreibt, dem er gar nicht schreiben will, weil die zuletzt angekommene Meldung noch immer auf dem Display erscheint. - So weiss jetzt also Swisscom, dass wir gut angekommen sind, wie warm es hier ist, dass wir am Pizzaessen sind (die kleinste mögen wir zusammen nicht fertig essen) und dass sie diese Mitteilung weiterleiten soll. Unterschrieben hat er mit Mad. „Mad Theo???“ frage ich. „Nein, nein, sie wissen zu Hause, dass das Mom and Dad heissen soll. Ob Swisscom diese Codes auch kennt? - Hab gerade erfahren, dass Swisscom zurückgeschrieben hat. – Unpersönlicher Hinweis, dass dies wohl die falsche Nummer sei.
Nach dem Nachtessen kaufen wir ein, was Theo noch fehlt, seinen Whisky zum Beispiel und Milch. Tolle Kombination. - Dann ein Taxi: Wir sind gewohnt, dass es kaum eine Minute dauert, bis man eines heranwinken kann, in Cuernavaca waren sie ständig und überall unterwegs; hier dauert’s eine Viertelstunde, bis endlich eines kommt. Aber wir haben ja Zeit.
Kränklich
Dummerweise habe ich mich am zweitletzten Tag vor unserer Abreise erkältet. Und dazu gleich noch einen Hexenschuss eingefangen. Auch tolle Kombination. Und soo gäbig für unterwegs beim Koffer herummanövrieren. Glücklicherweise hat mir Rosio, unsere liebe Housemade in Cuernavaca noch dreimal eine wohltuende, profimässige Massage mit Arnikasalbe gemacht, so dass ich den Tag ganz gut überstand. Sicher habe ich nicht die gripa porcina: Auf dem Flugplatz wird mit Wärmelampe automatisch und fast unbemerkt die Temperatur jedes Passagiers gemessen und der Bildschirm zeigte bei mir 36,1° an. Inzwischen habe ich Halsweh, Husten, Schnupfen, das ganze Programm also, und der Rücken tut mir noch immer weh, aber all das wird vergehen und jammern kann ich nicht, denn meine Stimme ist momentan weg. (Theo hat’s wohl gar nicht gemerkt, vorhin krächzte ich was und er sagte, er verstehe es nicht, er habe sein Hörgerät noch nicht montiert / fixiert / angezogen /eingesetzt / in Betrieb genommen / angeschnallt / appliziert / befestigt – wie sagt man das?).
Markt in in La Peñita
„Unser“ Haus ist am nördlichen Ende von Guayabitos gelegen, an einer Strasse, an der offenbar viele Ausländer Liegenschaften besitzen. Einige (die Häuser) sehen aus wie kleine Schlösser, venezianische Villen und ähnliche Prachtsbauten. Einzelne aber wurden wohl mitten im Bau gestoppt und zeigen bereits erste Zeichen des Zerfalls. - Ist da wohl jemandem das Geld ausgegangen? - Wenn wir die Strasse zu Ende gehen, kommen wir zu einer Hängebrücke und auf der andern Seite gelangt man nach La Peñita, dem Nachbardorf im Norden. Hier sind die Häuser fast alle am Zerfallen und es gibt auch keine Anzeichen von Ausländersiedlungen. Dafür ist das Kaff ein wenig grösser und heute ist Markt.
Theo beim Coiffeur: Eine neue Frise musste sein, beziehungsweise das Fell ein wenig stutzen. Es ist gelungen, dauerte eine Viertelstunde und kostete 3.20 Fr.
Theo hat eine Maske gekauft (die in sein Gruselkabinett passt), deren Nase eine nackte Frau darstellt. Nur war sich der Künstler wohl nicht ganz im Klaren, ob er die Frau von hinten oder von vorn darstellen sollte – er hat sich dann für beides gleichzeitig entschieden. Picasso hatte ja ganz ähnliche Ideen. Die Maske ist aus Holz und die Dame natürlich rosarot angemalt. Muss ja so sein, sie ist ja schliesslich blutt. Und sie ist ein Engel.
Rincón de Guayabitos wie gesagt ist klein, ruhig und weit weg vom üblichen Massentourismus. Es hat zwar ein paar ganz schöne Hotels, aber die sind nichts im Vergleich zu den „All Inclusive – Resorts“ an anderen Orten. Die Strassen sind nicht aus Asphalt, sondern noch nach alter Manier: Steine und Erde. Wie Bachbette. Die beiden schweren verrosteten Velos, die’s im Haus hat, wagen wir überhaupt nicht zu benutzen bei diesen holprigen Strassen, obwohl’s kaum Verkehr hat und eigentlich sehr praktisch wäre. Man hat hier schon das Gefühl, noch irgendwas vom ursprünglichen Mexico zu erleben. Das ist sehr angenehm, hat aber auch seine Tücken. Zum Beispiel kann man rein gar nichts mit Kreditkarten bezahlen.
Wetter / Kleider
Wie ich schon erwähnt habe, ist es wunderbar warm hier. Tagsüber etwas über 30 Grad, in der Nacht nie unter 26°. Obwohl es manchmal ein paar Wolken hat (fast immer über der Sierra Madre) gibt’s keinen Regen mehr nach Ende Oktober, jetzt ist ja November. Zum Glück auch (fast) keine Mücken!
Sogar Theo verzichtet jetzt auf seine Socken und er hat sich eine knallgelbe Badehose gekauft. Er sieht aus wie ein (in die Jahre gekommenes) Kanarienvögeli. Er besitzt jetzt auch einen Stroh-Sonnenhut, nicht den ursprünglichen Sombrero, davon kam er dann doch selber ab, eher so was amerikanisch Anmutendes, etwas Cowboyartiges. Er steht jetzt auf Gelb, schon in Cuernavaca erstand er sich zwei gelbe T-Shirts.
Gestern wollte ich (zur Demonstration) ein Foto von ihm in Gelb machen, aber er sagte, er habe seine neue Badehose nicht dabei, er habe unterdessen ein wenig Angst, sie könnten vielleicht durchsichtig werden im Wasser. – Am nächsten Tag bestand sie aber den Test.
Bewohner und Sprache
Es hat etliche Amerikaner aus den nördlichen Staaten der USA und Kanadier, alles Paare gesetzteren Alters, die hier Häuser besitzen und dem Winter im Norden ausweichen. „Snowbirds“ werden sie genannt. Auch wenn man nicht will, kommt man sofort mit ihnen in Kontakt, sie stellen sich sogleich mit Vornamen vor, sei das am Strand, im Strandbeizli, im Restaurant oder wo auch immer. Und alle sind dann beeindruckt, wie weit weg wir wohnen in Europa („so far away from home“). Sie sind sehr freundlich und gut gelaunt, unsere „Nachbarn“ haben wir beim Abendspaziergang am Meer kennengelernt beziehungsweise sie uns, und sie haben uns sogar eingeladen vorbeizukommen. Mal sehen, vielleicht machen wir das.
Spanisch können die Gringos in der Regel aber nicht. Wenn ich zu einem Kellner zwei Worte auf Spanisch sage, wird das schon bewundert.
Dann gibt’s auch noch Mexikaner hier. Sie sind es, die den Strand bevölkern. Sie sind sowieso immer fröhlich und hilfsbereit. Die meisten haben ein paar Worte Englisch aufgeschnappt und sind sehr stolz auf ihre Sprachkenntnisse. Wenn ich also etwas erfragen will, schliesslich will ich meine in der Schule erworbenen Kenntnisse auch anwenden, sieht unsere Unterhaltung folgendermassen aus: Ich stelle eine Frage auf Spanisch und der Mexikaner antwortet unverzüglich in gebrochenem Englisch. Aber ich bleibe stur und wenn‘s schwieriger wird und die Antwort nicht nur aus „over there“, „you guys like?“ und „yes“ oder „no“ bestehen kann, geht’s dann plötzlich und manchmal gibt’s ganz lustige Gespräche. Sie halten uns ja immer für Amerikaner. Wenn ich das dann berichtige, geht’s los. - In Cuernavaca war’s einfacher, ins Gespräch zu kommen, dort ist Amerikanisch nicht so in Mode.
In der Zeitung haben wir gestern grad gelesen, dass der Schwede Roger Federer gegen Verdasco gewonnen hat. – Auf diesem Kontinent kann niemand Schweiz und Schweden unterscheiden; und so halten sich die Vorurteile hartnäckig.
Strand und Strandverkäufer
Apropos Strand: Jeden Tag versuchen dieselben Verkäufer ihre Waren an den Mann, an die Frau zu bringen: Schmuck, Esswaren, Plastikspielzeug, Kleider, Tattoo- bzw. Bodypainting-Vorschläge und so weiter. Schon die Kleinsten sind dabei. Wir fragen uns, wie die Familien von diesen paar Pesos, die sie auf diese Weise verdienen, leben können. Ausser den Esswaren wird kaum etwas verkauft. Einer der Kanadier meinte: „Man sollte mal bei uns versuchen, Teenager und Kinder den ganzen Tag lang arbeiten zu lassen fast ohne Verdienst, vielleicht würden sie dabei etwas lernen…“
Gestern sahen wir einen jungen Mann mit einer anderen Masche. Er war weiss gekleidet wir ein Arzt, hatte auch ein Stethoskop umgehängt und ein Blutdruckmessgerät in der Hand, mit dem er herumfuchtelte und rief: „Check?“ Vielleicht hat er Erfolg damit; seine Idee find ich nämlich gar nicht so abwegig, da die weisse Rasse hier ja nicht gerade mit den jüngsten Exemplaren vertreten ist.
Am Strand tummeln sich auch haufenweise Pelikane und andere fischende Vögel. Sie haben überhaupt keine Angst vor den Menschen und es ist unterhaltsam, ihnen zuzuschauen. So sind ganze Familien von Pelikanen im Wasser, am Strand ganze Familienclans von Mexicanos.
Am Abend ist der Strand sofort leer, leider auch die Strandbeizli. Nur in einem war am letzten Samstagabend etwa los. Die Sekundarschule des Ortes wollte nicht aufhören mit ihren Darbietungen. 15 Franken Eintritt pro Person fanden wir erst ein wenig viel, aber das Billet beinhaltete nebst dem wohltätigen Zweck auch das Nachtessen und zwei Drinks. So blieben wir sitzen und sahen und hörten zu. Es gab auch eine Tombola, fast wie jeweils in Mauss bei der Theatervorführung. Wir haben nichts gewonnen; Züpfe, Cakes Weihnachtssterne und WC-Papierhalter gehörten hier allerdings nicht zu den Preisen. Gerne hätte ich ein Glas Wein gehabt zum Essen, aber die beiden Drinks waren entweder Margaritas, Tequila oder Bier. Ich entschied mich für zweimal Nummer eins. Tequila haut mich um.
Gegen Ende des Tages
Die Sonnenuntergänge hier sind unglaublich. Die ganze Bucht wird tiefrot – so eindrücklich, dünkt mich, hab ich’s noch gar nirgends gesehen. Das Dumme dran ist nur, dies findet schon kurz vor sechs Uhr abends statt und um zehn nach sechs ist’s stockdunkel und ein Sternenhimmel erscheint wie bei uns um Mitternacht. So gehen wir jeweils zu der Zeit dem Strand entlang ins Dorfzentrum zum Nachtessen. Und auch wenn wir noch ein wenig lädele, im Internetcafé unsere Mails anschauen und nach einem schönen Restaurant Ausschau halten, so sind wir doch regelmässig allerspätestens um acht Uhr fertig mit Essen. Ja, und dann – Taxi und nach Hause. So haben wir eine Art verschobene Tage. Fernsehen haben wir auch nicht im Haus, so bleibt vor allem Lesen und Schreiben. Um zehn Uhr bin ich meist im Bett, vor Müdigkeit fallen mir die Augen zu. (Daheim bin ich krank, wenn ich mal vor Mitternacht im Bett bin.) Dafür bin ich dann zwischen sechs und sieben wieder auf. Theo nicht. Er schläft und schläft und schläft. Er hat’s auch verdient nach dieser anstrengenden Zeit… Vor neun Uhr steht er nicht auf, schon das dünkt ihn unglaublich früh. – Es „jagt“ ihn aus dem Bett (so seine Ausdrucksweise), weil ihn die Hunde wecken, die in der Nachbarschaft immer in diesen frühen Morgenstunden bellen.
San Francisco
Gestern nahmen wir ein Kollektiv-Taxi und fuhren an einen Strand eine halbe Stunde südlich von hier. Der Ort hat zwei Namen, San Pancho, auf der Karte und auf dem Ortsschild heisst er San Francisco (einmal mehr - der fünfte Ort dieses Namens, den ich kenne). Es ist ein schmuckes kleines Dörfchen in einer Bucht gelegen, etwa so gross wie die Almadraba-Bucht bei Rosas, mit einem wunderschönen Strand, klarem, blauen Meer und grossen Wellen. Nur eine Handvoll Leute vergnügen sich dort, ein paar Surfer in den Wellen, alles junge Einheimische – ein kleines Paradies. - Zwei Strandrestaurants zum Chillen sind ebenfalls vorhanden und im Dorf hat’s ein paar Lädeli, viele bunte Häuser, etliche davon zu verkaufen, sogar das Historische Museum wird zum Kauf angeboten. Ich hatte den Eindruck, es ist oder war ein Ort, wo sich in besseren Zeiten mal ein paar Aussteiger niedergelassen haben; man erkennt sie an ihren farbigen Kleidern und den Sandalen.
Unfall
Auf der Heimfahrt hielt unser Bus irgendwo ausserhalb eines Dorfes an, um jemanden aussteigen zu lassen. Da passierte gleich neben uns ein Unfall. Wir hören und sahen ein Auto auf der Hauptstrasse mit pfeifenden Bremsen herankommen, aber die Kollision mit dem von rechts aus der Dorfstrasse kommenden Motorrad war unausweichlich. Ein riesiger Knall und er prallte mit voller Wucht in den Polizeipickup, auf dem hinten drei Polizisten standen. Funken sprühten, ich sah nicht mehr hin. In unserem Bus wurde es sehr ruhig. Das Polizeiauto fuhr dann an den Strassenrand und als ich wieder hinsah, standen alle beisammen und der Töff- Fahrer, den ich schon tot gewähnt hatte, fuchtelte wie wild mit den Polizisten herum, schien unverletzt. Er hatte weder ein Hemd, verschweige denn einen Helm getragen. Mir kam‘s vor wie ein Wunder.
Nochmal zur Schweinegrippe
Jetzt war doch wieder mal was in der Zeitung über die Schweinegrippe. Ein paar Zahlen nur. Das Einzige jedoch, was man hier davon merkt, ist, dass es neuerdings in einem der Strandcafés einen neuen Drink gibt für 25 Pesos: „Swine Flu Shot“. – Ich nehm‘ lieber meine Piña Colada.
Die Seuche selber hat mutiert, oder jedenfalls ihr Name: Vielleicht ist das aber nur der Kantönligeist, den’s hier auch gibt. In Morelos hiess das Ding Gripa Porcina und hier in Nyarit plötzlich Influenza Humana.
Theos Geburtstag
Er sagt, es sei sein 56ster. Es könnte ja sein, dass man Legastheniker sei, wenn man die Zahl liest (???). – Wie dem auch sei, er ist jetzt wirklich pensioniert. Seit gestern. Er hat sich für einen neuen Job umgesehen, Baywatch-Chef, am Strand posierte er in einem Hochstuhl; ich musste ein Foto davon schiessen. – Nach einem Strandtag gingen wir in einem Restaurant essen mit fantastischer Aussicht über die Bucht und den Ort. Schon um fünf Uhr waren wir dort, um die Aussicht und den Sonnenuntergang zu geniessen, weil’s, wie gesagt, um sechs ja schon Nacht ist. Die Portionen, die man hier serviert bekommt, sind mega. Meine Chiles Rellenos con Camarones hätten für eine ganze Familie gereicht. Auf dem Teller sahen sie aus wie zwei Hühnerschenkel.
Wir haben einen Taxifahrer gefunden, der die Zuverlässigkeit in Person ist. Pünktlich um acht Uhr hat er uns wieder abgeholt. Wir machen jetzt immer mit ihm ab, wenn wir irgendwo hin wollen. Er heisst Samuel und ist eigentlich Bauarbeiter. Er wird uns am Samstag nach Puerto Vallarta fahren.
Whalewatching-Bootsfahrt
Heute waren wir auf einer Bootstour und sahen tatsächlich Wale. Vor lauter Aufregung glückten mir natürlich keine guten Fotos. Ich musste auch an das Buch von Frank Schätzing „Der Schwarm“ denken und hatte fast ein wenig Angst, die Riesen könnten die Boote kentern lassen. Es waren nur etwa drei oder vier, aber sie kamen zum Teil ganz nah ran. - Auf einer vorgelagerten kleinen Koralleninsel, hat’s einen kleinen Strand mit türkisblauem Wasser und feinem weissen Sand. Wie in der Karibik. Dort blieben wir drei Stunden lang. Und kaum waren wir dort, liess ich mich auch gleich von einer obergiftigen Wespe stechen.
Dank Anjas Bemühungen hat Theo seinen Flug verschieben können. Als ich zuhause die Reise organisierte, war er ein wenig skeptisch und dachte, er habe noch so viel zu erledigen. Aber inzwischen hat er gemerkt, dass Diego und Gino das alles ebenso gut machen können (sie haben ja auch den ganzen langen und mühsamen Umbau geleitet, organisiert und selber zahllose Wände gestrichen und Teppiche rausgerissen) und zudem gefällt es ihm hier offensichtlich. Also haben wir den Aufenthalt um neun Tage verlängert, er wird also erst am 10. Dezember wieder daheim sein (ich mit meinem Miami-Abstecher erst am 17ten).
Tennis
Bälle haben wir bei uns und zwei Rackets auch. Aber Tennis gespielt haben wir noch nie. Leider.
Erst am zweitletzten Tag sah ich den Tennisplatz in Guayabitos, ganz am Rand des Dorfes. Ich wusste gar nicht, dass es hier überhaupt einen gab und ehrlich gesagt, erkundigte ich mich auch gar nicht danach, denn die einzige Zeit, wo man hätte spielen können, wäre wegen der Hitze morgens um sieben gewesen. – Und mit Theo, dem Siebenschläfer… Das wäre so oder so nicht gegangen, denn dies war die Zeit, wo er sich über die Hunde aufregen musste.
Den Platz sah ich nur ganz kurz vom Taxi aus zwischen den Bäumen hindurch. Einen sehr verlassenen Eindruck machte er. Der Belag war grün - kaum Farbe, eher Vegetation; jedenfalls war der Traum von Tennis in Mexico ausgeträumt.
San Blas
Am Freitag war das Wetter zur Abwechslung nicht ganz so schön, also unternahmen wir ein Busreisli nach San Blas, einem Ort etwa 80 km nördlich von Guayabitos. Der Bus hätte um 10 Uhr fahren sollen, bis er aber kam, war’s zehn vor elf. Die Fahrt dauerte fast zwei Stunden und führte zwischen dem Meer und der Muttersäge (Sierra Madre) durch, vorbei an Fruchtbaumplantagen, bewirtschafteten Feldern, über enge, holprige Strassen und durch kleine Ortschaften, wo der Fuchs und der Hase…
Das Schöne dort: Man kann mit der Lancha eine Fahrt durch die Mangroven unternehmen und da es keine Touristen hat, ist man ganz allein unterwegs mit dem Bootsführer und der kleinen angenehmen Brise vom Fahrtwind. Gemäss „Lonely Planet“ ist es ein Birdwatcher-Paradise und tatsächlich, wir sahen alle möglichen Arten von Vögeln, Kormorane zum Beispiel, auch Krokodile, Leguane und Wasserschildkröten. – Que padre!
Strassenküche
Bisher hat sich Theo immer geziert, wenn’s drum ging, von einer Strassenküche etwas zum Essen zu kaufen. Eine Ausnahme machten die Chapulines, aber wahrscheinlich war der Eindruck doch nachhaltiger als erwartet...
Nach der Bootsfahrt wollte ich aber einen Maiskolben haben. Maiskolben sind ja schliesslich gebraten und nicht so ein Problem – also ass Theo die Hälfte davon, was allerdings den Hunger nicht ganz stillte. Zeit, in einem Restaurant zu essen, hatten wir keine mehr.
Da trug es sich nun aber zu, dass bei der Haltestelle, wo wir auf den Bus warten mussten, eine attraktive Dame die Köchin der fahrbaren Küche war, und weg waren Theos Vorbehalte. Ich schoss ein Foto und dann kauften wir unsere Tacos-Zwischenverpflegung. So einfach ist es mit Männern… (manchmal).
Am Abend dann im Restaurant bestellte ich Pozole, eine Spezialität hier, eine Suppe aus Mais mit Huhn. Als Vorspeise bestellte ich die kleine für 2.10 Fr. Mindestens ein halbes Huhn war dreingeschnätzelt - ich übertreibe nicht. Das Gericht hätte problemlos für vier gereicht. Wahrscheinlich muss ein ganzes Huhn dran glauben, wenn man nicht die Pozole chica, sondern die normale Portion bestellt. Auf einem Nebenteller erhält man zusätzlich Salat dazu, ganz fein geschnitten, sowie eine gehackte Zwiebel. Dieses Gemüse und der Saft von zwei Limonen gehören ebenfalls in die Suppe.
Zur Sicherheit bestellten wir nur eine Portion (für beide) in Kokosteig eingebackene Shrimps und dazu Mangosauce. Himmlisch war’s, aber auch das fast zu viel.
Puerto Vallarta
Inzwischen sind wir in Puerto Vallarta angekommen. Wir wohnen in einem Apartment in einem Block, hoch über einer Bucht. Die Wohnung bietet alles, was man braucht, und ist gut und stilvoll eingerichtet. Traumhaft ist die Aussicht aus dem achten Stock aufs Meer. Sie auf dem bequemen Sofa liegend von der Terrasse aus zu geniessen, ist ein absolutes Highlight. - Also auch hier haben wir einmal mehr Glück gehabt mit dem Homelink-Exchange.
Es ist aber ganz anders als in Guayabitos. Stadt und Land. Es ist eben ein Ort wie Cancun oder Acapulco, voller Leben, Musik, Amerikanern und Kanadiern (hier gibt’s auch jüngere Vertreterinnen und Vertreter der Rasse). - Im Bus vorhin hat eine Frau zur anderen gesagt: „We’re popping from happy hour to happy hour here.“ Und am Pool meinte eine andere: „Another terrible day in paradise“. Das bringt die Stimmung gar nicht schlecht rüber. Halb Seattle ist hier; die werden dort ein trauriges Weihnachtsfest erleben in dieser ausgestorbenen Stadt.
Leider hab ich keine Chance mit meinem Spanisch; Amerikanisch scheint die ortsübliche Sprache zu sein. Alle sprechen es. Man braucht keinen halben Tag lang hier zu sein und schon ist klar, die Amis haben die Stadt voll im Griff. – Irgendjemand hat mal gesagt: „Willst du Spanisch lernen, geh nach Miami, willst du Amerikanisch lernen, geh nach Cancun.“ Könnte auch Puerto Vallarta sein. - Und alles ist doppelt so teuer. Wir nehmen jetzt den Bus, der grad unter dem Condominiumkomplex „Costa de Oro“ hält und alle fünf Minuten fährt (jeweils 92 Stufen rauf und runter). Das Taxi kostet vom Zentrum bis heim 4 Fr. und solche Wucherpreise zu zahlen, sind wir nicht mehr gewohnt; ein Busticket kostet nur 40Rp.
Jetzt sind wir seit drei Tagen da und es gefällt uns sehr gut, die Leute sind auch hier auffallend freundlich und der alte Dorfkern hat sehr wohl etwas für sich. Es gibt eine lange, sehr schön ausgebaute Strandpromenade (Malecón), gesäumt mit Palmen und Kunstskulpturen, von wo aus man einen fantastischen Blick hat auf die ganze Bucht und den Sonnenuntergang, der hier zum Glück eine Stunde später stattfindet, nämlich um sieben (andere Zeitzone). Es ist ein Leben wie im Sommer, alle scheinen zufrieden, es läuft Musik, es hat Gaukler, eben das dolce vita oder besser dulce vida. Auf manchen Häusern hat’s Restaurants mit Terrassen, von denen man das Geschehen bei feinem Essen überblicken kann oder Innenhöfe in Haciendas mit toller Atmosphäre. Wer sich lieber direkt am Strand aufhält, für den gibt‘s dort eine Menge Palapa Restaurants - teurere und weniger teure. – Die Füsse im Sand beim Nachtessen: „Que padre“ - „Big time awesome“ – „Hölle schön“! - Es hat massenhaft Läden (zwar die meisten mit ziemlich denselben Touristen-Angeboten), Restaurants, Bars und etliche Galerien mit zum Teil sehr schönen Bildern und Skulpturen. Morgen wird ein „Artwalk“ angeboten, wo die Skulpturen am Malecón von den Künstlern selber erklärt werden, dazu wird dann am Abend in einer Galerie ein Apéro serviert (Open House and Reception). Man kann auch Kochkurse besuchen (speziell für Paare…), es gibt „Evening under the stars“ (was immer das auch sein mag), „Let the Dogs Out“ (?) ist ebenso eine Veranstaltung, „Bingo is back“, natürlich gibt’s auch Bridge, x Ausflüge zum Buchen, aller Gattung Sportevents; vielleicht hat man Lust fürs „10th Annual Vallarta Yacht Club Chili Cook-Out“, „Whale-Watching“ sowieso und und und... Vom 2. – 6. Dezember gibt’s sogar ein Filmfestival (www.vallartafilmfestival.com). Alles very exhausting und eben gar nicht wie in Guayabitos und schon gar nicht wie in Cuernavaca. – Aber wie gesagt, wir geniessen es!
Essen (schon wieder)
Theo hat inzwischen gemerkt, dass die Strassenküchenmahlzeit in San Blas sehr gut verdaulich war und all die grässlichen Krankheiten, die man sich da holen kann, über die er im Reiseführer gelesen hat, nicht eingetroffen sind. – Um genau zu sein: Die absolut grüsigste Mahlzeit, die er gegessen hat in den letzte Wochen, hat er höchst persönlich zubereitet und ich weiss noch immer nicht, wie ihm das gelingen konnte.
Es waren Spaghetti. Ich wollte mal aufs Nachtessen verzichten, da wir schon zu Mittag gegessen hatten, Theo aber, der Spaghetti-Fan, bereitete sich einen Teller eben dieser Teigwaren selber zu. Ich sah schon, dass er nicht begeistert dreinschaute beim Verzehr, und als der Teller noch halb voll war, hielt er ihn mir unter die Nase und fragte: „Findest du nicht auch, dass die seltsam riechen?“ - Mir fehlten und fehlen die Worte. - Ob er ranziges Öl drübergeleert hat oder was da sonst passiert ist, irgendein seltsames Gewürz erwischt – es bleibt ein Geheimnis (vielleicht lüftet er’s dann in „seinem“ Kochbuch, von dem er ständig spricht). Er meinte, es sei vielleicht das Wasser gewesen, das er aus dem Wasserhahn verwendet hatte statt dem purifizierten aus der Ciel-Flasche. Jedenfalls ass er tapfer weiter und er hat’s ja überlebt.
Nachtruhestörung
Inzwischen hat sich Theo erholt. Zum Glück! Er hatte nämlich eine obermühsame Nacht, gleich die erste, als wir hier waren. Wenigstens waren’s zum Abwechslung mal nicht die Hunde, die ihm den Schlaf geraubt hatten! (Kurzer Exkurs: Wären wir länger in Guayabitos geblieben, hätte er sich mit der Alarmanlage gerächt, das war sein Plan, der allerdings nicht zur Ausführung gelangte, da ich strikte dagegen war).
Ich habe ja erwähnt, dass Puerto Vallarta ein Party-Ort ist, und die Disco, die gleich unterhalb unseres Wohnblocks direkt am Meer gelegen ist, hatte am Samstagabend natürlich Hochbetrieb. Eigentlich wohnen wir im südlichen Teil der Stadt in einer ruhigen Bucht (ähnlich wie jeweils in Spanien), aber der Samstag ist auch in dieser Gegend offenbar etwas ganz Besonderes). Jedenfalls wurde die ganze Umgebung mit dröhnender Musik bedient bis sicher etwa um drei Uhr morgens. Auch ein Entertainer kündete uns jeweils an, wie das nächste Stück hiess, das gespielt wurde. Wenigstens gefiel uns die Musik, Frank Sinatra, mexikanische Rhythmen und so in dem Stil, zum Glück nicht etwa Techno oder Hip Hop oder gar Hudigäggeler. Übrigens hat NIEMAND reklamiert wegen des Lärms; in der Schweiz hätte dieser Spektakel keine zwanzig Minuten gedauert, bis jemand die Polizei gerufen hätte. - Auch Feuerwerk gab’s, aber das störte ja nicht so sehr. Im Gegenteil. Jedenfalls konnten wir uns (mit oder ohne Hörgerät) überhaupt nicht mehr unterhalten, ich ging dann halt ins Bett mit meinem Buch, las zwei Seiten und schlief bei Sambarhythmen zufrieden ein, nur Theo gelang es einfach nicht, den wohlverdienten Schlaf zu finden. So hatte er eben einen ganz miesen Tag am Sonntag, war völlig schlapp und zu gar nichts mehr zu gebrauchen, so dass ich alleine an den Strand und zum Einkaufen gehen musste und ihn zu Hause zeichnen liess (so nennt er das jetzt). Die Müdigkeit ist noch immer nicht ganz vorbei, da sind noch irgendwelche Nachwehen vorhanden. Heute Morgen ging ich wieder alleine in die Stadt, um unseren Rückflug zu buchen und um die Gelegenheit zu nutzen, „ein wenig“ zu lädele. - Jetzt ist Theo wieder auf dem Damm.
Es gibt noch einen nächsten Samstag…
Art Walk
Gestern Morgen fand der Art-Walk statt mit dem Galerist Gary Thomson. Er bietet diesen Gratisspaziergang jeden Dienstag an von Oktober bis März, hat aber normalerweise rund 50 Zuhörer und Zuschauer. Diesmal waren wir nur ein sehr kleines Grüppchen, zu sechst mit ihm. Es hatte geregnet und war ein wenig kühler (nur noch 26 Grad), so dass offenbar die Kunstbegeisterten es vorzogen, in den Federn zu bleiben. Theo hätte das auch lieber gewollt (wen erstaunt‘s?) oder den Spaziergang auf den nächsten Dienstag verschoben, hat sich dann aber doch aufgerafft, als ich ihn darauf aufmerksam machte, dass wir am nächsten Dienstag bereits wieder in Mexico City sind.
Skulpturen entlang des Malecón / Millenium
Begonnen hat der Walk am nördlichen Ende des Malecón, bei der Millennium-Skulptur. Der Künstler selbst, Mathis Lidice, erklärte uns bis ins Detail, was auf dem Kunstwerk zu sehen ist, weshalb er es so konzipiert hat, all die Bedeutungen dahinter, wie’s hergestellt wurde, aus was für Materialen es besteht (Bronze und in der Mitte Eisen), dass er selber der grösste Teil davon zahlen musste mit Sponsorengeldern und was alles geschah, bis es im Jahr 2001 aufgestellt werden konnte. Im Jahr darauf wurden etliche der Statuen oder Teile davon sowie die Sockel und Beschriftungen vom Hurrikan Kenna weggerissen und -geschwemmt und konnten zum Teil nicht wiedergefunden werden. Millennium stand noch, zwei Beschriftungstafeln fand man im Swimmingpool des nahe gelegenen Hotels.
Kurz zusammengefasst besteht die Skulptur aus vier Teilen, welche die Erdgeschichte symbolisieren und den Werdegang des Menschen durch die Zeitalter: Unten sind die Wellen, das Meer und sodann die Tiere, die nach und nach entstanden, dann folgt das erste Jahrtausend mit Karl dem Grossen, die Religionen werden dargestellt und die Kriege, dann versinnbildlicht der dritte Teil das zweite Jahrtausend mit seinen Entdeckungen und Errungenschaften, die einerseits Fortschritt bedeuteten, andererseits katastrophale Auswirkungen hatten, dargestellt im Gesicht der zweituntersten männlichen Figur, dem weisen Azthekenkönig Netzahualcóyotl, das auf der einen Seite fein ausgearbeitet ist und auf der anderen nur einen Skelett-Schädel zeigt (ebenso Leben und Tod) und schliesslich die oberste Figur, eine Frau im Allgemeinen, die das Leben bringt und nach Frieden strebt (dieTaube) - die Hoffnung im neuen, erst gerade begonnenen Jahrtausend. Die ganze Skulptur ist etwa so lang und verzworgelt wie mein eben geborener Satz (den ich meinen Schülerinnen mit Wellenlinie unterstreichen würde).
Rotonda del Mar
Die Beschreibung der anderen Figuren schenke ich uns, nur noch kurz zu meiner Lieblingsgruppe, der Rotonda del Mar. Sie wurde 1997 installiert; Alejandro Colunga ist der Künstler. Die Figuren, jede repräsentiert ein anderes phantasievolles Meeresgeschöpf, bilden einen Kreis und alle laden ein zum Draufsitzen. Sie sind aus Bronze gearbeitet, dort wo schon x Füdli drauf waren, glänzen sie noch immer golden, der Rest der Figuren ist im Laufe der Zeit grün geworden, so wie unsere Bundeshauskuppel. Die würde auch prachtvoll glänzen, wenn …
Das Schöne an der Gruppe ist eben, dass sie so viele Leute anzieht, jeder macht Fotos dort, alle haben Freude an den Figuren, die mich irgendwo auch an Giger erinnern. Nicht nur Kinder, auch Erwachsene klettern darauf herum.
Galerien
Der Artwalk übrigens endete in Gary Thomsons „Galerie Pacifico“ und das hiess für uns, dass der gratis Spaziergang im Endeffekt doch recht teuer zu stehen kam. – Ich kann’s einfach nicht lassen, wenn ich Bilder sehe, die mir soooo gefallen.
Das Dumme ist, dass es in relativ geringem Umkreis etwa zwanzig Galerien gibt und dort teilweise ausserordentlich gute Bilder und Skulpturen ausgestellt sind. Theo schleppte ich dann mit, einige davon zu besuchen, bis dann glücklicherweise um 14 Uhr die Siestazeit anfing, so dass wir nur noch Window-Shopping machen konnten. Das kommt wesentlich billiger. Heute Abend aber ist Tag der offenen Tür in den Galerien, wo überall eine Art Vernissage stattfindet und einige der Künstler anwesend sind…
Bis dahin aber gibt’s einen Strandtag. Gestern, wie gesagt, hat’s während der Nacht geregnet und war erst gegen Mittag wieder schön, obwohl vorher alle behauptet hatten, im November und Dezember regne es nicht, und jetzt sagen sie halt: „Very unusual; doesn’t normally happen, – muy raro!“ Für den Artwalk war’s das perfekte Wetter. Schirm, Regenmantel oder Jacke konnte man daheim lassen.
Theo hat gestern übrigens tapfer mitgehalten, trotz Galerie-Siesta-Time sind wir erst am späten Nachmittag heimgekommen (acht volle Stunden unterwegs!). Von einem Restaurant aus sahen wir nämlich zufälligerweise das Flying-Bird-Dance-Ritual, welches äusserst eindrücklich ist.
Los Voladores de Papantla
The flying men of Papantla ist ein prä-spanisches, mexikanisches Ritual, genannt „Totonacas“, ausgeführt von Indígenas aus der Gegend von Veracruz. Fünf Männer nehmen teil, vier fliegende Vogel-Männer (hombres pajaros) und ein Priester (el sacerdote / el chaman). Mit dem Vogeltanz wird der Gott um Regen gebeten (der nota bene in der Nacht zuvor bereits im Massen herunterprasselte – der Regen natürlich). Der 25 Meter lange Pfahl symbolisiert die Verbindung zwischen Erde und Himmel, die vier Stricke die Nabelschnur zu den vier Polen Nord, Ost, Süd, West. Die Giele sind rot-weiss bekleidet, was die Sonne darstellen soll und eben auch Vögel, zudem die Samen, die auf die Erde fallen. Ihre farbigen Hüte repräsentieren den Regenbogen. Der Priester leitet den Tanz ein mit Flöten- und Trommelmusik (Vogelgezwitscher und Stimme der Götter) und die vier Vögel gleiten anschliessend kopfvoran in 13 Runden hinunter auf den Boden. Das sind 4 mal 13 Umdrehungen, das ergibt insgesamt 52. Dies die magische Zahl des aztekischen Kalenders, die Anzahl der Jahre, die’s braucht für einen Sonnendurchgang. – Wem’s davon nicht sturm wird...
Wieder was vom Essen
Anschliessend an den Spektakel spazierten wir noch ein wenig herum, dem Strand entlang, diesmal in südlicher Richtung, und ich fand einen Verkäufer mit meinen heiss geliebten Cocadas, einer Güezispezialität, die ich dann unbedingt zu Hause ausprobieren muss (Kokosnuss, Honig und Vanille), bevor ich Entzugserscheinungen kriege.
Zur Abwechslung haben wir uns zu Hause selber ein Znächtli präpariert und das bei Kerzenlicht auf der Terrasse genossen.
Am Abend vorher assen wir gleich unterhalb des Apartmentblocks, wo wir wohnen, in einem super Restaurant, ein wenig erhöht auf der Terrasse, direkt am Strand und so wild wie das Meer sich gebärdete, schlugen die Wellen manchmal fast bis zu den Tischen hoch. Von der Balustrade aus konnten wir zwei Krebsen zuschauen, gleich unterhalb, die im immer kürzer werdenden Strandabschnitt ständig ihre Löcher, in denen sie wohnten, wieder vom Meerwasser und dem eingespülten Sand befreien mussten. Sie hatten unglaublich viel zu tun, rasten im Querstep hin und her, griffen sich zwischendurch mal kurz an, und wenn das erledigt war, huschten sie wieder in ihr Apartment. Währenddessen erhielten sie von den Gästen im Restaurant stückchenweise Brötchen zugeworfen, was ihren Terminplan wohl vollends durcheinanderbrachte. Mit rasender Geschwindigkeit stürzten sie sich jeweils drauf und transportierten das Brioche in ihre Behausung. - Offenbar sind die beiden bei den Gästen im Restaurant bekannt und eine kleine Attraktion, denn sie haben schon Namen. Jemand fragte mich, wie’s denn heute Oskar und Humphrey gehe.
Wir können es sehr gut aushalten hier, wir haben’s gefunden, das Dolce Vita.
Filmset
Herrliche Strände gibt es hier in pittoresken Buchten. Die Hauptbucht heisst Bahía Banderas, da muss es ja schön sein. Unsere kleine Bucht heisst Conchas Chinas und gestern und vorgestern fuhren wir mit dem Bus ein wenig weiter südwärts und „probierten“ andere Strände aus. Zuerst La Playa de Mismaloya (den Namen können wir uns gut merken, die Eselsleiter könnte etwa sein: Misbivio oder Missoglio).
In Mismaloya wurde im Jahr 1964 der Film „Die Nacht des Leguan“ gedreht. Vom Filmset sieht man nicht mehr viel, John Huston hat sich beklagt, dass er den Ort Puerto Vallarta mit seinem Film berühmt gemacht hat, aber dass man das Filmset zerfallen liess. Tatsächlich ist nur noch der Bootssteg vorhanden mit dem Pfahl, an dem der Leguan angebunden war/ist, das Restaurant ein wenig oberhalb ist nur noch eine Ruine und der Zugang gesperrt. Und wie aus dem Bilderbuch begegneten uns unterwegs dorthin zwei Leguane. Wir erschraken alle vier, sie blieben wie versteinert stehen, aber ich hatte natürlich sofort meine Kamera zur Hand.
Der Strand ist schön, Theo gefielen die Liegestühle und das Corona-Eiskübeli mit dem Bier drin, in das die hilfreichen Kellner jeweils sofort neues Eis nachfüllten, wenn das alte geschmolzen war.
Kleine Exkurse (Eselsleitern und anderes)
Wir haben über ein Wort gesprochen, das Theo sich schlecht merken kann und er erklärte mir die Eselsleiter, die ihm „hilft“ sich an dieses Wort zu erinnern. Die ist so was von kompliziert, dass ich mir unmöglich vorstellen kann, dass man in nützlicher Frist auf das kommt, was man eigentlich sucht. Nebenbei habe ich noch erfahren, dass er für meinen Namen auch eine Eselsleiter hat… (Die hilft ihm ja auch oft wenig – da gab’s eine Episode zu Hause, die ich Mühe habe zu vergessen: Theo war mit einem Freund von uns am Telefon und ich deutete ihm, ich wolle dann auch noch was sagen. – Kurz vor Ende des Gesprächs erinnerte er sich wieder daran, da ich immer noch am Fuchteln war und er sagte zu Franz: „Z Ding wott o no öppis säge.“).
Das Wort übrigens, das er sich hatte merken wollen, war „la cuchara“ = der Löffel. Am besten könne er es sich mit „Küche“ merken. - „Wie Küche?“, frage ich, „die heisst doch „cocina“. – „Nicht auf Spanisch. Küche auf Berndeutsch, Chuchi“. – „Aber in „cuchara“ kommt überhaupt kein „CH“ vor. Wie kannst du dir’s dann merken?“ – Ja, und so geht das endlos weiter. Jedenfalls versteht der Kellner nicht, dass Theo gerne einen zweiten Löffel hätte zu meinem Dessert. - Da kann ich halt auch nicht helfen.
Apropos Theo: Dass es manchmal mit seinem Gehör nicht zum Besten steht, ist ja nichts Neues, aber nun das mit dem Sehen: Als wir gestern auf den Bus warteten und dabei all den scheppernden Autos, die an uns vorbeifuhren, zuschauten, sagte er zu mir: „Das Pferd kann einem schon leidtun auf der holprigen Strasse.“ - „Welches Pferd?“ fragte ich. „Das auf dem Anhänger, der soeben vorbeigefahren ist.“ – Theos Pferdeanhänger war ein Transport von vier mobilen toi-toi-Toilettenkabinen.
Andererseits hat er ganz spezielle Assoziationen manchmal. Am Strand von Guayabitos – wir waren dabei, ins Dorf zu spazieren - überholte uns eine joggende Amerikanerin. „Wie geht’s eigentlich deinem Hexenschuss?“, fragte er mich.
Zurück zum Reisebericht – PV und kleinere Ausflüge
Eigentlich hätte ich heute (Sonntag) nochmals nach Mismaloya fahren wollen, hätte dann Theo im Liegestuhl abgeliefert, dem Kellner übergeben und hätte einen dreistündigen Ritt buchen wollen in die Berge zum anderen Filmset „Predator“ (mit dem kalifornischen Gouverneur in der Hauptrolle). Leider aber regnet‘s wieder mal. Es ist trotzdem 26 Grad warm - wir finden ein anderes Programm. Zum Beispiel Packen.
Ausflug in die Umgebung
Gestern fuhren wir weiter mit dem Bus nach Boca, so genannt, weil dort ein Fluss aus den Bergen ins Meer fliesst. Der Strand ist klein, aber es hat Liegestühle und „Corona“, „Pacifico“ und „XX“. Von dort aus kann man mit dem Wassertaxi nach Yelapa fahren, einem idyllischen Ort in einer Bucht ein paar Kilometer südlich, den man aber nicht per Auto, sondern nur per Boot erreichen kann. Das reizte mich mehr, also nichts wie los, das Taxi war schon bereit. Was mich ein wenig beunruhigte, war, dass sich der Bootsmann vor der Abfahrt bekreuzigte. Das Boot flog nur so über die Wellen, schlug hin und wieder hart auf dem Wasser auf, aber nach fast einer halben Stunde Fahrt kamen wir unversehrt am Ufer an. Die Liegestühle schon bereit, der freundliche Kellner Alfonso ebenso. Auch ein Typ mit einem Leguan, der einen fast nötigen wollte, mit dem armen Tier Fotos zu machen. Das mag ich eigentlich gar nicht, aber ja, irgendwie müssen die Leute ja ein wenig zu Geld kommen. - Es hat kaum Touristen, die Liegestühle sind zu zwei Prozent belegt. Der Service aber könnte nicht zuvorkommender sein. Alfonso erklärt uns alles, was man in Yelapa machen kann - nicht viel, aber man kann zum Wasserfall spazieren, Pferde mieten und irgendwo wird sogar noch Paragliding angeboten. Die Plakate sind schon ziemlich vergilbt, wer weiss, ob da überhauupt noch was läuft. Die Pferde sahen wir angebunden hinter dem Restaurant auf allfällige Reiter warten. Etwa dreissig Tiere standen parat, bereits gesattelt, niemand wollte aber reiten gehen.
Erst mal entschlossen wir uns, das Dorf anzuschauen und zum Wasserfall zu spazieren. Alfonso reservierte uns die Liegestühle (schwierig bei dem Andrang) und versprach, auf unsere Sachen aufzupassen. Der Weg schlängelt sich durch die Häuser am Hang zum Wasserfall hinauf. Erst musste aber ein kleines Flussdelta durchquert werden (keine zehn Meter breit), aber das ging nicht, ohne bis zur Hüfte nass zu werden. Ein alter Fischer war für die Passage zuständig. Er sass dort und lachte, wenn er den paar Touristen zusah, die’s ohne seine Hilfe versuchten. Erst reichte einem das Wasser bis zu den Knöcheln, dann aber wurde es eben doch ein wenig tiefer und es hatte Strömung. Mit der Kamera wollten wir die Überquerung lieber nicht riskieren und „heuerten“ gleich den Bootsmann an. Es war wirklich lustig: Er begab sich nicht mal ins Boot hinein, liess nur uns einsteigen und zog das Boot hinüber, er bis zum Bauch im Wasser. 80 Rp. kostete das Vergnügen.
Der Wasserfall ist nicht spektakulär, das hatte ich vermutet, aber mir gefiel der Walk dorthin trotzdem. Theo wusste schon von vornherein, dass es da nicht viel zu sehen geben würde, er wäre nämlich lieber gleich in Boca im Liegestuhl geblieben oder dann zumindest hier in Yelapa am Strand. Sein Argument war: „In der Schweiz haben wir viel schönere Wasserfälle.“ Dabei war’s ein hübscher Spaziergang durch das Dorf, das keine Strassen hat, weil’s ja auch gar keine Autos gibt. Wunderschöne Aussichten auf die kleine Bucht kann man immer wieder geniessen. – Unterwegs trafen wir einen älteren Mann, der uns erzählte, er gehöre zur zweiten Generation von Einwohnern, die sich hier niedergelassen hätten, und erst seit acht Jahren gäbe es Strom und eben auch Licht, und die Wege seien einigermassen gangbar gemacht worden. Auf die Frage, ob er diese Neuerungen schätze, bejahte er vehement, was mich eigentlich erstaunte. - Es gibt jetzt auch ein paar wenige Hotels im Ort, aber alle sehr einfach, gut in die Gegend eingepasst, die zum Verweilen einladen. So zwei, drei Tage könnte man es hier sehr gut aushalten, finde ich. - Auf dem Rückweg zum Strand schlugen wir eine andere Route ein, wir wateten weiter hinten durch den Fluss, der ins Meer mündet und auf der anderen Seite hatte es plötzlich eine Ansammlung von schwarzen Vögeln, es sah aus, als ob die Geier schon auf uns warteten. Die Vögel heissen Zopilotes. Im Internet hab ich gelesen, dass sie sich von Kleintieren ernähren und zu den wenigen Vögeln gehören mit ausgezeichnetem Geruchssinn. Sie hatten offenbar gemerkt, dass ein Garza Blanca (ein Fischreiher) sich eine Mahlzeit geangelt hatte, und gleich in Horden galt es nun, diesem die Beute zu entreissen.
Zurück am Strand genossen wir das Verwöhnungsprogramm im Restaurant; es ist extrem, wie nett, zuvorkommend und freundlich alle Leute hier sind. Ein feines Essen hatten wir auch - was will man mehr...
Unser Wasser-Taxi holte uns später wieder ab, pünktlich um halb vier. Es hielt mit dem Bug voran, normalerweise machen sie das umgekehrt, damit es einfacher ist zum Einsteigen. Wir waren alle schon drin, da kam ein älteres, mexikanisches Ehepaar. Er schaffte den Einstig auch, aber sie hatte Mühe. Junge, starke Männer waren gefragt. Theo in seiner spontanen hilfreichen Art stellte sich sofort zur Verfügung und auch zwei wirklich junge Männer halfen beim Hereinhieven mit. Die Dame durfte Theo den Arm um die Schulter legen, und einer der Jungen hielt sie beherzt hoch und ruck zuck schob/warf/hievte er sie wie einen Zuckersack mit Schwung über den Bootsrand ins Schiff. - Eine filmreife Szene! Ich hätte sie problemlos fotografieren können, ich sass direkt gegenüber, Kamera parat wie ein Paparazzi, aber ich hielt mich nicht dafür. Der Kommentar des Kanadiers hinter mir war: „There’s no way to do it gracefully, but at least it’s done.” – Ich dachte mir, wie wird’s wohl sein beim Aussteigen? - Das Boot landete diesmal gleich von Anfang an mit dem Heck voran, so dass das ganze Drama nicht wiederholt zu werden brauchte. Jedoch Theo, der junge Spund, blieb ganz gentlemanlike bis zuletzt im Boot, falls seine Hilfe doch noch gebraucht werden würde.
Ein Schläfchen im Liegestuhl hatte er sich danach verdient, und ich eine Piña Colada.
Ich sah die längste Zeit einem Fischer zu. Die Fischerei hier ist ziemlich anders als wie wir das von Spanien gewohnt sind, wo die ganze Rosas-Armada fast täglich ausläuft, das Meer völlig ausfischt und die eigene Existenz wohl gleich damit.
Hier scheinen die Fischer nur rauszufahren, wenn’s nötig ist. Es gibt jeden Tag frischen Fisch und feine Camarones, aber nirgends werden die Fische in Massen angeboten. Es sind nur einzelne Fischerboote, die unterwegs sind, einzelne Fischer, die vom Ufer beziehungsweise von einem Felsvorsprung aus ihre Angel ins Wasser werfen. – Der Angler, dem ich zuschaute, hatte eine andere Methode. Er war mit seinem Netz bis zu den Schultern im Wasser und warf es alle paar Minuten immer wieder in ebenmässigem Bogen vor sich hin. Er war schon dort, als wir ankamen, eine Stunde später noch immer. Sehr erfolgreich kann seine Arbeitsweise nicht sein: Wenn ich richtig beobachtete, fing er nicht einen einzigen Fisch während der ganzen Zeit. Wo hätte er ihn auch hintun wollen, er hatte ausser dem Netz nichts dabei.
Am Abend assen wir wieder in der Stadt, im Strand-Restaurant „Daiquiri Dick’s“ und so fein wie dort habe ich schon lange nicht mehr gegessen, obwohl wir eigentlich immer gute Restaurants finden. Ich kam aus dem Ah und Oh gar nicht mehr raus. Tacos mit Shrimps und grünen Spargeln, Sauce Hollandaise, Kartoffelstock und Guacamole. – Espresso, Grappa und für mich Cappuccino gab’s dann bei Michel Ferrari, einem jungen Schweizer, der seit zwei Jahren ein Restaurant in Puerto Vallarta führt. Bei ihm haben wir kürzlich mal gegessen. Sehr gut. Aber seine Preise nota bene sind nicht mexikanisch.
Filmfestival
Vorgestern waren wir übrigens am Filmfestival. Nicht zu vergleichen mit Locarno. Die Webpage ist auch so schlecht konzipiert, dass wir den Ort, wo der Event stattfand, am ersten Abend gar nicht fanden und niemand konnte uns Auskunft geben. Auch wusste ich nicht, ob man Tickets im Vornherein kaufen musste, wo und wieviel die kosten etc. Michel konnte uns dann weiterhelfen, wir fanden den Cinépark in einem Einkaufszentrum und „zogen uns einen Film rein“. Aber es war ein ganz normaler Kinoabend, Billet lösen (4 Fr.) und das war’s dann auch. Von Festival und dergleichen war nichts zu sehen, ausser ein paar netten, adrett gekleideten Girls, die beim Eingang standen und den drei geladenen Gästen irgendwas überreichten, wohl einen freien Eintritt oder so. Offenbar findet das Drum-Herum eher in den tollen Hotels statt, wo Partys veranstaltet werden im Beisein von ein paar Filmleuten. Aber was dann am eigentlichen Ort des Geschehens läuft, nämlich dort, wo die Kinos sind, ist mehr oder weniger tote Hose. Wenn ich vorhin erwähnte ‚drei‘ Gäste, dann ist das gar nicht so sehr daneben. Es waren kaum mehr als zwanzig Personen im Saal. So schrieb ich dem Direktor des Festivals eine Email mit ein paar Tipps und Fragen. Er bedankte sich dafür und trug mir auf, wenn wir wieder in der Schweiz seien, Herrn Polanski ein paar Grüsse auszurichten…
Der nördliche Teil von Puerto Vallarta, die Hotelzone Nord, ist völlig anders als der gemütliche, lebhafte, südliche Teil von Vallarta Vieja (fast wie Empuria Brava von Rosas aus gesehen). Überhaupt nicht aamächelig. Da stehen sie alle, die Sherada, Ramaton, Holidott und Marri Inn. Dort befindet sich auch der Hafen und jeden Tag kommt ein anderes Kreuzfahrtschiff und bringt Passagiere.
Völlig anders geht’s zu und her im Städtchen. Ein riesiges Volksfest ist jeden Abend im Gang. Einige Strassen rund um die Kathedrale sind abgesperrt und zahlreiche verschiedene Essstände sind aufgestellt, ein fröhliches Miteinander findet statt (vorwiegend mexikanische Bevölkerung). Man plaudert, isst und schaut den Umzügen zu. Jetzt ist die Zeit der Prozessionen und abends während sicher etwa zwei Stunden wandern ganze Völkerscharen zur Kirche. Es sind Berufsgruppen, die dort empfangen werden. Zum Beispiel sahen wir die „Zunft“ der Spitalangestellten. Die kamen gleich mit einem Krankenwagen mit Blaulicht, der im Umzug mitfuhr. Eine Mariachiband war auch dabei und zahlreiche Krankenschwestern und -brüder. Den ganzen Spektakel konnten wir wie von einer Loge aus mitverfolgen von der Terrasse im ersten Stock des Restaurants „Omelet“ aus direkt gegenüber der Kathedrale.
Letzter Tag in Puerto Vallarta
Unser letzter Tag sah anders aus, als ich mir das vorgestellt hatte. Es war regnerisch, so machten wir einen letzten Spaziergang in die Stadt. Ein paar Tage zuvor hatten wir in einer Galerie Jim Demetro kennengelernt, einen Amerikaner, von dem eine der Skulpturen stammt, die entlang des Malecón aufgestellt sind, nämlich „Los Bailarines de Vallarta“. - Er hatte uns eingeladen, bei ihm vorbeizuschauen, falls wir Lust hätten, und genau dieses Programm hätte ich nun gerne „eingeschaltet“, da’s ja nicht unbedingt ein Strandtag war (zu viele Wolken für meinen Geschmack). Aber ich fand Jim’s Visitenkarte nicht mehr, konnte ihn also nicht erreichen. – Schade.
Wir setzten uns ein letztes Mal für längere Zeit in ein Strandrestaurant, bestellten uns etwas zu essen, was hervorragend war, und liessen uns anschliessend das eine oder andere von einem Strandverkäufer andrehen. Ich kaufte einen kleinen handgewobenen Teppich (wir haben ja noch so viel Platz im Koffer). Natürlich muss man märten und alle haben Freude, wenn man das auf Spanisch macht. Aus diesem Grund, so sagte der Verkäufer, lasse er mir den Teppich für einen sehr günstigen Preis (so hat sich wenigstens ein Teil meiner Spanisch-lern-Investitionen ausbezahlt). Zehn Minuten später kam er zurück und erzählte mir strahlend, wie zu einem Kumpel, er habe grad denselben Teppich für den dreifachen Preis einer Amerikanerin verkaufen können. - Und das Geldausgeben am Strand fand seine Fortsetzung:
Theos Tattoo
… ist ein Delphin. Ich fand, er solle sich eines machen lassen, wenn auch nur, um die Kinder zu schocken. Ok, ok, so leicht lassen sie sich nicht mehr erschrecken und natürlich ist’s nicht ein richtiges mit Nadel und Schmerz und lebenslänglich und so. Es ist eines von denen, die die Strandverkäufer anbieten, das mit hartnäckiger schwarzer Farbe auf die Haut appliziert wird und das, wenn man sich an der Stelle möglichst nicht wäscht, etwa vierzehn Tage lang bestehen bleibt. – Bis wir in Bivio sind, wird’s längstens verbleicht sein.
Noch immer sitzen wir am Strand und sehen den Wellen zu. - Und wer spaziert da am Strand entlang, vor unserem Tischchen durch, mitten in meinen Teppichverhandlungen? – Jim. – So ein Zufall. Er wohnt gerade „um die Ecke“ und so konnte also doch auch dieser Programmpunkt abgehäkelt werden. Er lud uns auf ein Glas Wein ein und zeigte uns seinen Katalog und etliche seiner Skulpturen, die in Miniatur in seiner Wohnung stehen. Eine davon steht übrigens auch in Lisas Apartment, in dem wir zurzeit wohnen, auf dem Tisch.
Ja, und da war’s Zeit zum Abreisen. Um sieben Uhr abends holte uns ein Taxi ab und brachte uns auf den Flughafen. Der späte Flug (21.45 – 23.10) brachte nur Vorteile: Wir hatten den ganzen Tag noch für uns, kaum Leute an beiden Flughäfen, rasche Abfertigung, Abflug und Landung pünktlich, und so schafften wir es, noch vor Mitternacht bei unseren lieben Gastgebern, den Shapiros, in Mexico City anzukommen.
Letzter gemeinsamer Tag in DF (Mexico City)
Gestern, an Theos letztem Tag, machten wir als Erstes einen Spaziergang durch das bunte, lebhafte Viertel Zona Rosa, entdeckten auch ein Schweizer Restaurant, in dem man nebst Fondue auch Bratwurst mit Rösti haben kann. Rossignol Skis stehen parat bei der Eingangstür, Föteli vom Matterhorn und den Bernhardinerhunden sind im Schaufenster zu sehen, so wie man sich das eben vorstellt. In Anbetracht der Tatsache, dass wir in ein paar Tagen zurück in unserem schmucken Land sein würden, wo die Skis auch schon parat stehen, konnten wir erfolgreich der Versuchung wiederstehen einzukehren und irgendetwas estilo suizo zu bestellen.
Stattdessen verleibten wir uns im Hotel Majestic auf der Terrasse im siebenten Stock ein Mittagsmenu mit vier Gängen für acht Franken ein (ich hätte auch schreiben können: verzehrten wir…; man soll ja nicht immer dieselben langweiligen Wörter gebrauchen beim Schreiben, hab ich gelernt), und das mit einmaligem Blick auf den Zócalo, den Hauptplatz der Stadt. Wir erkannten ihn kaum wieder. Als wir Ende Oktober dort waren, hatte es politische Demonstrationen, Polizei, Megafone, Menschenmassen. - Jetzt eine Kunsteisbahn für Gross und Klein zum Schlittschuhlaufen (bei 26 Grad!), eine Art Bob-Schlitten-Bahn und eine Rutschbahn aus Schnee für Kinder. In einem der Zelte können die Niños mit künstlichem Schnee Schneemänner formen. Klar, hier schneit es so gut wie nie, so muss die kalte weisse Masse eben ein Erlebnis sein (kleiner Vorgeschmack für Bivio). - Und alles gratis. - Zum Zuschauen ist’s wunderbar. - Der Energieverschleiss für diese Freude muss allerdings beachtlich sein. - Ob das Geld nicht besser ausgegeben werden könnte?
Templo Mayor
Nach den Essen besuchten wir den Templo Mayor, die grosse Tempelanlage neben der Kathedrale, im Herzen der Stadt. Die Spanier hatten, wie das offenbar ihr Hobby war, in ihrer grenzenlosen Arroganz und Unkenntnis, den Tempel zerstört und die neue Stadt an dessen Stelle erbaut. Nun ist dieser Tempel aber ein ganz spezieller Bau, eigentlich sind beziehungsweise waren es sieben Tempel, die übereinander gebaut worden waren, jeder eine Erweiterung und Vergösserung des vorhergehenden. Diese Bauweise hatte verschiedene Gründe, einer davon war, dass der Boden praktisch überall in der Stadt schlammig ist, weil vorher das ganze Plateau ein See war und etliche Gebäude daher mehr oder weniger stark einsinken (der Palacio de Bellas Artes beispielsweise sank anfangs 20stes Jahrhundert, als er erbaut wurde, gleich um vier Meter ein). – Zurück zu den Tempeln: Was die Spanier ab 1521 sahen und zerstörten, war nur der oberste, nämlich der neueste Tempel, und dass sich weitere sechs Schichten darunter verbargen, haben sie gar nicht bemerkt. Vor dreissig Jahren nun hat man mit Ausgrabungen begonnen und was da alles zum Vorschein kam, war und ist natürlich gewaltig. Allerdings wurde nur ein kleiner Teil der alten Stadt Tenochtitlan ausgegraben. Was klar ist, ist die Tatsache, dass an manchem Ort unter der heutigen Stadt weitere archäologisch hoch interessante Gebäude und Skulpturen vorhanden sind. Wollte man sie ausgraben, müsste man die halbe oberste Schicht zuerst wegräumen, wohl auch die Kathedrale.
Namen
Die Erwähnung dieser alten Funde gibt mir die Gelegenheit, nochmals ein paar Namen zu nennen, die mir ja immer so gut gefallen: Die Legende der Göttin Coyalxauhiqui wird oft erwähnt, deren Bildnis man an diversen Orten in Ausgrabungsstätte findet. Sie hatte ihre Mutter ermorden lassen wollen, fand sich dann jedoch selber in sechs Teilen wieder (Kopf ab, Arme und Beine ebenfalls) – so wird sie auch verschiedentlich dargestellt. Ihr Bruder ist der Tlaltecuhtli, und der Dios del Fuego hat auch so einen „easy to remember name“, er heisst: Xiuhtecuhtli oder Huehueteótl (fast ein wenig theoähnlich – Kommt mir grad in den Sinn: Wenn immer er mir in Zukunft „Isabeu“ sagt, könnte ich ihn Theotl nennen).
Letzter gemeinsamer Abend
Unseren letzten gemeinsamen Abend in Mexiko verbrachten wir zusammen mit der Familie Shapiro. Wir luden sie zum Essen ein in ein spitzengutes Restaurant (diesmal Schweizerpriese) und konnten uns so ein wenig für all das revanchieren, was sie uns zuliebe getan hatten. Sie schenkten uns dafür noch ein Buch über Mexiko City, das etwa 5 kg wiegt, oder so kam’s mir jedenfalls vor. Nachdem wir so oder so schon Probleme haben mit all unseren Gepäckmassen und Prospekte und auch Zettel weggeworfen haben, nur damit das Ganze ein wenig leichter wird – und jetzt auch das noch. Es ist ja eine äusserst liebenswürdige Geste, aber wenn ich dran denke, dass Theo schon so oder so viele ‚gewichtige‘ Bücher bei sich hat (er liebt Kunstkataloge, denen kann er nicht wiederstehen, je schwerer desto lieber), dann ….
Mein letzter Tag in DF (Die Mexikaner nennen ihre Stadt DF (Districto Federal), niemand spricht hier von Mexico City oder Mexico ciudad).
Ja, die schönen Tage von Mehico (wer Mexico mit „X“ ausspricht, wird von jedermann unverzüglich korrigiert) sind vorbei. Morgen geht’s weiter nach Miami. Jetzt, wo ich das schreibe, sitzt Theo im Flugzeug nach Zürich. Es war und ist ein langer Tag für ihn. Schon seit einiger Zeit hatte er gejammert in Erwartung seines unausweichlichen Schicksals. Er musste nämlich heute Morgen bereits um halb sieben aufstehen, es war noch dunkel, als der Wecker läutete. Völlig neue Erfahrung! Das Taxi war pünktlich um sieben vor der Tür und da staunte mein lieber Ehemann schon sehr, als er sah, dass die jüngere der beiden Haushälterinnen bereits dabei war, die Autos auf Hochglanz zu polieren. Um diese Zeit! - Solche Anblicke machen ziemlich kleinlaut.
Spaziergang in Coyacán / Museo Frida Kahlo
Da ich auch früh auf war, nutzte ich die Zeit und machte eine Tour in den Süden der Stadt mit Bus und Metro in einen sehr schönen und völlig ruhigen Stadtteil, Coyacán. Ich spazierte durch einen ziemlich grossen Park, genannt Viveros, der im Grunde genommen eine riesige Gärtnerei beziehungsweise Plantage ist, wo Grünpflanzen, vor allem Bäume, gezogen werden. Ein ganzes Netz von Wegen zieht sich durch den Park hindurch und dies wiederum ist ein einziger Jogging- und Vitaparcours, ein kleines Paradies für Bewegungsfreudige. Ich war die Einzige, die gemütlich spazierte, immer wieder keuchten schweisstriefende, sportlich Begabte an mir vorbei. Anders als in der Schweiz: DF-Jogger tragen nicht diese farbigen Kleider sämtlicher wichtigen Sportmarken, die bei uns üblich sind mit all dem, was da noch mit angehängt wird, sie sind bekleidet mit „normalen“ Trainern oder T-Shirts. Vielleicht ist dies der Grund, dass ich bei den meisten, die mich überholten, das Gefühl hatte, sie brechen gleich zusammen oder stehen (bzw. rennen) kurz davor. Die Nichtsportbekleidung ist halt wahrscheinlich weniger atmungsaktiv, das Fasergemisch nicht ganz so ausgeklügelt und ohne Musik, Kilometerzähler und angeschnalltes Getränk geht’s wohl nicht so ring. Die Bekleidung ist auch weniger körperbetont, aber das hat mich im Speziellen gar nicht gestört. – Auf jeden Fall war’s ein angenehmer Spaziergang, ein wenig kühler im Schatten der Bäume als auf der Strasse und vor allem hatte ich zum ersten Mal wieder das Gefühl, reine Luft zu atmen. Es ist übrigens verboten, im Park zu essen, zu trinken, Blumen und Pflanzen zu stehlen und Fotos zu machen. - Mein Weg führte mich dann weiter durch Strassen, die wie früher nur aus Steinen und dazwischen aufgeschütteter Erde bestehen, vorbei an schönen Häusern (sofern man die sehen kann, denn so gut wie alle sind hinter hohen Mauern versteckt) und immer wieder mal an kleineren Parkanlagen und farbigen In- und Outdoor-Märkten. Keine Hektik, (fast) keine verbeulten Autos.
In dieser Gegend haben Frieda Kahlo und Diego Rivera gewohnt und Trotzki hatte bei ihnen Asyl erhalten. Ihre „Casa azul“, in der sie während 25 Jahren zusammen gemalt, gelebt, geliebt und sich gestritten hatten, ist ein Museum und war mein Ziel am Vormittag. Ein wunderschönes, gemütliches, grosses Zuhause mit malerischem Garten, eine traurige Geschichte, viele Bilder, Fotos und Einrichtungsgegenstände zum Besichtigen.
Im Zentrum
Von dort aus nahm ich wieder einen Bus (Mikrobus heisst der Kleinbus hier) und dann die viel schnellere Metro ins Zentrum (eine Fahrt, wohin auch immer, kostet 15 Rp.!)
Mein zweites Ziel war der Palacio de Bellas Artes, ein einzigartiger Jugendstilbau, der als Theater dient und riesige Wandmalereien von Rivera und anderen Künstlern beherbergt. Dieser Besuch war ebenfalls ein eindrückliches Erlebnis. Gleichzeitung fand auch eine Sonderausstellung von Pedro Friedeberg statt, einem mexikanischen Künstler, Architekten und Designer, dessen Werk mir ausserordentlich gut gefällt.
Meine letzten Peseten kratzte ich dann zusammen und leistete mir in der Nähe des Zócalo für 10 Franken eine wunderbare Sushimahlzeit (japanisches Essen in Mexiko - sogar der Kellner sprach mich darauf an und ich entschuldigte mich noch fast), ein Mineral mit Blöterli und zum Dessert meine letzte Piña Colada in diesem Land, bevor ich mich ins unglaubliche Verkehrsgestürm begeben musste (es gibt grosse Kreisel, in denen plötzlich auch von links Verkehr hineinströmt und das gleich auf drei Bahnen; kein Wunder, läuft dann plötzlich gar nichts mehr), auf den Weg „nach Hause“, Lomas de Chapultepec (das heisst in der Nauatl-Sprache auf den Höigümperhügel) zu den liebenswürdigen Gastgebern, den Shapiros.
Abflug
Der nächste Morgen verlief ungefähr gleich wie derjenige von Theo am Vortag: Meine Abreise stand auf dem Programm. Die junge Dame war bereits wieder am Autoputzen, als ich das Haus um sieben verliess. Weil man nie weiss, ob die Fahrt zum Flugplatz zwanzig Minuten dauert oder zwei Stunden, ist’s eben besser, zeitig loszufahren. Um halb acht war ich bereits am Ziel, fix fertig eingechecked und reisebereit. Dreieinhalb Stunden später war Take Off. Bei Tag über die Stadt zu fliegen, ist eindrücklich: Man startet mitten im Zentrum, sieht also die riesige Ebene mit endlosen Strassen, quadratisch angelegt, am Horizont eine dichte, breite, gelb-braune Schicht aus Abgasen, darüber der wunderbare, tiefblaue Himmel.
Das Flugzeug machte eine Zwischenlandung in Cancun und sämtliche Passagiere mussten aussteigen, erneut durch zwei Gepäck-Kontrollen durch (elektronische und menschliche Handtaschendurchnuscherin), nur um wieder ins gleiche Flugi einzusteigen und sich auf denselben Platz neben dieselben Passagiere zu setzen. Das Ganze dauerte eine Stunde und niemandem hat der Sinn der Sache eingeleuchtet, Mexicana hat sich zwar für die Verspätung entschuldigt, aber eine einleuchtende Erklärung blieb sie schuldig.
Miami
Ja, und jetzt bin ich eben in den Estados Unidos, aufs herzlichste aufgenommen von Liza und Urs Lindenmann, in ihrem schönen Haus in vornehmer Gegend im südlichen Teil von Miami. Schon am ersten Abend machten sie mit mir eine Stadtrundfahrt, es gab Hamburger an einem der Yachthäfen, einen Schlummertrunk („one for the road“, für mich schon wieder eine Piña Colada; ich kann’s einfach nicht lassen) auf Key Biscayne mit herrlichem Blick auf die nächtliche Skyline von Miami downtown und heute Morgen fuhr mich Urs vorbei an prächtigen „Einfamilienhäusern“ (viele zum Verkauf angeboten) ins nächst gelegene „Dorf“ zum Frühstückeinkaufen. – Endlich gibt’s meine feinen English Muffins wieder. Dazu Philadelphia Frischkäse und Grapefruitsaft.
Übers Wochenende müssen Liza und Urs beide einen Weiterbildung in Naples besuchen, und sie haben mir Haus und Hof, nein, Haus und Auto und Swimmingpool anvertraut, mir noch alles gezeigt und erklärt, was ich tun kann, wo ich hin kann, wo welcher Strand ist, wem ich telefonieren kann, wenn ich Probleme habe, welche Shoppingcenters in der Nähe sind, in der Hoffnung, dass ich in ihrer Abwesenheit nicht etwa den Hungertod erleide oder gar an Langweile eingehe. Fürsorglicher geht’s nicht. Aber das sind wir uns ja schon von Shapiros gewohnt. Wie wird das sein, wenn ich wieder zu Hause bin?
Die letzte Woche war also der krönende Abschluss meiner Reise. Von Liza und Urs wurde ich verwöhnt nach Strich und Faden, jeder Wunsch wurde mir von den Augen abgelesen.
Liza überliess mir in ihrer Abwesenheit ihr Auto, und wenn sie Zeit hatte, fuhr sie mich von Shoppingmall zu Shoppingmall um all das, was ich noch „brauchte“, ohne Zeitverlust und sehr effizient einzukaufen. Sie brachte mir meine Kamera in den Park, die ich zu Hause vergessen hatte, sie fand, vielleicht sei der Pool zu kühl für mich (27 Grad), man könne ihn gerne ein wenig aufheizen…
Urs bereitet das Frühstück zu, während ich sein Büro und den PC mit Beschlag belege. Die beiden nehmen mich mit zu einem Empfang des argentinischen Botschafters, im Biltmore Hotel mit dem ehemals grössten Pool in den USA („the world-famous Biltmore pool“ - wahrlich riesige Ausmasse). Alles muss das Grösste sein, das Höchste, was auch immer für ein Superlativ. Einfamilienhäuser sind wie Schulhäuser, Shoppingcenter wie Dörfer, Hochhäuser wie Hochhäuser, Hotellobbys wie Turnhallen, Kaffeetassen wie Wasserkrüge während bei uns: bescheidene Auobahnen, Moccatässli, jö, der süsse, kleine Kühlschrank, Küchen wie in der Bäbistube. Und so sind auch die Steaks, die Urs für sich und „seine beiden Weiber“ an einem Abend zubereitet, von uneuropäischer Grösse. Offenbar sind auch die Rinder hier gewöhnt, grössere Steaks zu liefern als bei uns, weil sich das im Land der unbegrenzten Möglichkeiten so gehört.
Am Wochenende, als Liza und Urs in Naples waren, ging ich nach South Beach. Dort ist immer etwas los. Der Strand, die Promenade und die Cafés und Restaurants sind bevölkert; es hat Musik, tolle Schlitten kurven herum, fast wie vor Jahren bei uns am Bärenplatz vor der „Front“, am Sonntag sogar eine Militärausstellung mit Jeeps und Zelten aus dem zweiten Weltkrieg.
Am selben Tag traf ich Jim Shenkman dort zum Mittagessen, einen Freund aus Kanada, der zufälligerweise zur selben Zeit in Miami war, weil seine Eltern dort leben und sein Vater tags zuvor operiert werden musste. Vor 37 Jahren hat mich Jim im Zug zwischen Interlaken und Bern angesprochen und seit dieser Zeit sind wir befreundet. Unsere Familien haben sich immer wieder mal getroffen, in Toronto, in Südfrankreich, Ittigen oder Bivio. Ihn zu treffen, hat Spass gemacht, und gab uns Gelegenheit, Familiennews auszutauschen.
Der Strand in South Beach ist meilenlang, es hat ziemliche Wellen aber dummerweise auch Quallen. Bläuliche. So musste ich aufpassen wie eine Häftlimacherin, um ihnen nicht zu nahe zu kommen.
Apropos Nähe: Ich legte mich in den Sand und las ein wenig in meinem Buch. Ich muss dann eingedöst sein. Links von mir, nur wenige Meter entfernt, sah ich eine kleine Gruppe von Leuten herumstehen, darunter zwei spindeldürren Models, die instruiert wurden, wie sie sich im Sand hinzulegen hatten. Die Fotografen, die die beiden ablichteten, standen etwas abseits von mir, ich war also irgendwie im Weg und konnte daher den Gedanken nicht ganz loswerden, als wäre ich eventuell sogar mit auf dem Foto, sozusagen als Gegensatz zu den beiden Spargeln.
Heute war ich im Fairchild Tropical Botanic Garden, dem grössten Garten dieser Art in den USA. Er ist sehr schön angelegt, ein riesiger Park, 83 Acres gross, wie viel das auch immer ist, es hat, laut Prospekt, 28‘000 Bäume und Blumen. Auch die Kunst kommt nicht zu kurz. Skulpturen sind an manchen Stellen im Park zu sehen, Blumen aus Glas, Gorillas aus Metall, das Nessi im See und die fliegepilzartigen Ballone stammen von einer japanischen Künstlerin, die einzige lebende Künstlerin, die mehr als 5 Millionen Dollar für eines ihrer Kunstwerke erhielt.
Das Schöne am Park ist unter anderem, dass man sich nicht an die Wege halten muss, man kann überall durch den Rasen gehen, es hat zur Abwechslung mal keine Verbotsplakate. Zudem ist er gleich neben dem Grundstück von Lindenmanns gelegen, also zu Fuss erreichbar. Im Park hat’s ein Tram beziehungsweise eine Art offener Bus mit dem man eine stündige Tour machen kann.
Der Park ist ein El Dorado für Leguane und Eidechsen, die überall im Park herumflitzen, ebenso für Pensionierte, die an vielen Weggabelungen stehen und über die Pflanzen informieren; sie fahren auch die Busse. Der Buschauffeur sagte, er sei einer von 500 freiwilligen Mitarbeitern dieser Gattung.
Nachdem ich alle Bäume und Blumen fotografiert hatte, spazierte ich heim, ein kleiner Schwumm im Pool, ein letztes sommerliches Nachtessen, wunderbar zubereitet von Urs, dann brachte er mich zum Flughafen und elf Stunden später war ich zurück in der geliebten, aber kalten Schweiz.
Wieder zu Hause
Inzwischen sind wir beide wieder daheim. Den Kulturschock von Mexico nach USA könnte man symbolisch mit den Autos darstellen, die ja eines meiner Lieblingssujet waren: von schrottreif auf Hochglanz poliert. Der Wechsel von Miami nach CH von grün und blau nach weiss und grau, von 35 Grad zu minus 4 (Bivio minus 19), von Klimaanlage zu Heizungen. Nur gerade Starbucks bietet dasselbe, Cappuccino tall, grande, venti, nur nicht zum selben Preis.
Und was für eine Überraschung: Unser Haus erkennen wir kaum wieder. Diego und Gino haben in unserer Abwesenheit fast den ganzen Wohnbereich renoviert. Neuer Anstrich an Wänden und Decken, ebenso jede Türe frisch gestrichen, neue Böden im Esszimmer, im Gang, im Schlafzimmer und auf den Treppen. Es ist fantastisch. Das wieder Einräumen allerdings weniger, aber das nehmen wir gerne in Kauf.
Trotz der Kälte ist es schön, wieder daheim zu sein, Freunde zu treffen oder zumindest mit ihnen zu telefonieren, ein Stündchen Tennis zu spielen, das feine Weihnachtsapéro in der Schule nicht zu verpassen, zu erleben, dass meine 98-jährige Mutter mich noch erkennt und sich freut, mich zu sehen, vorgezogene Weihnachten zu feiern mit der Familie - am 19ten Dezember, weil ja nachher Bivio Trumpf ist und man („man“ sind vor allem Gino und ich) nicht künstlich aufs Fest warten will. Schliesslich ist ja die Hauptsache, die Familie trifft sich und verbringt einen friedlichen, schönen Abend zusammen beim traditionellen Weihnachtsessen (Bernerplatte seit Menschengedenken). Und es sind (waren) weisse Weihnachten, was alle, die am 24sten im Unterland feiern werden, wohl nicht erleben.
Inzwischen hat Theo endgültig seine gelbe Badehose mit dem blauen Skihelm ausgetauscht. Das heisst, wir sind in Bivio angekommen und haben sogar schon unsere erste Skiabfahrt hinter uns. Der Schnee ist wunderbar, das Haus schön warm, die Gedanken hängen noch dem Erlebten nach, der letzte Teil des Berichts ist zu Ende.
Das Jahr 2011
Noch zwei Jahre bis zur vorzeitigen Pensionierung. Da muss das Hobby langsam aber sicher ausgeweitet werden, damit ich dann nicht in das viel zitierte und befürchtete „Loch“ fallen würde, in das Senioren ja unweigerlich fallen, wenn sie nicht mehr ihrer gewohnten Arbeitsroutine nachgehen. - Nicht dass ich eine einzige Sekunde an diese dunkle Perspektive geglaubt hätte, aber noch ein wenig mehr reisen als bisher, dagegen hatte ich überhaupt nichts. Also: ein paar Tage ins Tennishotel im Allgäu, im April eine Studienwoche in Andalusien mit dem bsd.-Kollegium, anschliessend ein Haustausch in Paris. Im Juli eine Woche London (grosse Feier zum 30. Geburtstag der Zwillinge mit Familie und Freunden in einem Rooftop-Restaurant, „Kensington Roof Gardens“). Kurz darauf hatte ich ein verlockendes Angebot gefunden im Internet: Flug nach New York und Rückfahrt mit der „Queen Mary 2“ nach Hamburg. Kurz entschlossen buchte ich die Reise und Theo, der erst grosse Bedenken gehabt hatte (kaum Zeit zum Packen etc. etc.), willigte schliesslich ein. Nur grad drei Tage blieben uns in New York, wo wir bei Dany, Kays Götti, übernachten durften, dann fuhr der Transatlantikliner ab. – Grossartig, in dieser Riesenmetropole bei schönstem Wetter loszulegen, zu beobachten, wie die Freiheitsstatue kleiner und kleiner wird, die Insel Manhattan allmählich im Dunst verschwindet. Zehn Tage dauerte die Reise, immer auf See, nie Land in Sicht. Hin und wieder Lautsprecherdurchsagen, die über die Distanz zum Ort der Havarie der Titanic hinwiesen.
Wunderbar waren diese Tage. Keine Minute war uns langweilig. Aus unbekannten Gründen wurden wir „upgegraded“, konnten unsere Malzeiten in einem speziellen und exklusiven Raum einnehmen, wo’s nur einen Service gab und man am Abend somit kommen und gehen konnte, wann man wollte. Dort kamen wir mit sehr netten Leuten in Kontakt, mit denen wir noch immer in Verbindung stehen. Besser hätte es uns nicht gehen können.
Was mir besonders gefiel, war, dass wir einmal erleben konnten, wie gross die Distanz von Erdteil zu Erdteil tatsächlich ist. Mit dem Flugzeug ist man in sechs Stunden „drüben“, mit dem Schiff geht das gemächlich. – Was mir weniger gefiel: Fast an jedem Tag „verloren“ wir wegen der Zeitzonen eine Stunde, und diese fehlte uns tatsächlich. 23-Stunden-Tage – weniger Schlaf für Theo – ein Riesenproblem...
Unvergesslich bleibt auch die Ankunft der Queen Mary in Hamburg. Begrüsst von einer riesigen Menge von Leuten, die den Ankömmlingen zujubelten, glitt das Riesenschiff ruhig in den Hafen. Das trieb Tränen der Rührung in manche Augen.
Im Herbst folgte sodann eine Woche Wanderferien im Montafon mit einer Freundin. Auf dem Heimweg ein letztes Highlight, nämlich eine Übernachtung in Luzern im „Jailhotel Löwengraben“, dem ehemaligen Zentralgefängnis des Kantons Luzern. Sehr lustig hatten wir’s dort.
Es war auch das Jahr, wo ich an der bsd. nach 30 Jahren Schuldienst kündete, weil mir der administrative Aufwand an zwei Schulen zu viel wurde. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wie es heisst. Genau so ging es mir.
Kurzfassung – „Reisebericht“ (Amsterdam) - Polen im Sommer 2012
Ende April 2012 besuchte ich mit einer Abschlussklasse Amsterdam. Wir waren zu zweit, mein Kollege und ich, mit der Aufgabe betraut, den Sack voller Flöhe unbeschadet durch die Exkursion zu führen.
Wir verbrachten ein paar lustige und interessante Tage zusammen, unternahmen einige Besichtigungen gemeinsam (vor allem tagsüber), was allerdings nicht durchwegs klappte. So kamen beispielsweise beim Besuch des erstklassigen MEMO-Museums nur etwa die Hälfte unserer „Schützlinge“ mit, die anderen hatten ein Problem zu lösen: Sie hatten Fahrräder gemietet und eines davon war in einer Gracht gelandet, unerklärlich natürlich, wie das hatte passieren können...
Und wie das so ist mit von der Leine gelassenen Schülern: die bringt man abends kaum ins Bett (war ja auch nicht unsere Aufgabe, schliesslich waren sie ja alle erwachsen) und dafür am nächsten Tag nicht aus den Federn. Aus dem Grund nahm ich an einem Morgen den Bus nach Lisse und besuchte ganz alleine den riesigen Keukenhof-Park mit seinen einzigartigen, farbigen, prächtigen Tulpenbeeten. Tulpen so weit das Auge reicht. In der Anlage gibt es auch Restaurants und verschiedene Pavillons. In einem setzte ich mich zum Ausruhen hin und sah mir einen zwanzigminütigen Werbefilm über Polen an. Bis dahin wusste ich so gut wie nichts über dieses Land, aber die Aufnahmen begeisterten mich und sogleich entstand die Idee, im kommenden Sommer dorthin zu reisen.
Theo kam mit. Wir flogen nach Warschau und mieteten dort ein Auto, mit dem wir während drei Wochen im ganzen Land herumkurvten, von Westen nach Osten, von Norden nach Süden. Durch die ausgedehnte, malerische Seenlandschaft der Masuren, ins Ermeland, von dort an die Ostsee, nach Danzig, Leba, dann über Posen, Breslau und Krakau zurück nach Warschau.
Es war eine fantastische Reise. Was für prachtvolle Landschaften und Städte, was für eindrückliche Bauten, was für ein schönes Land!
Unter vielen andern Orten, die wir besichtigten, haben uns all die geschnitzten Holzfiguren in Galindia, dem „masurischen Paradies“, enorm gut gefallen. Erholsam der Besuch der Klekotzki-Mühle, die in einer Waldlichtung an einem idyllischen See gelegen ist. Eindrücklich war auch die Besichtigung der Marienburg, des Freiluftmuseums in Olsztynek und erst recht der Spaziergang durch die Wolfschanze, Hitlers ehemaliges Führerhauptquartier. Eine seltsame Atmosphäre herrscht an diesem Ort. Die Bunker sind fast alle von Bäumen und Sträuchern be- oder überwachsen, es war feucht und heiss, Mücken begleiteten und plagten uns während der Besichtigung sowie finstere Gedanken an die dunkle Vergangenheit.
Umso vergnüglicher war die Schifffahrt durch den Elblag-Kanal (Oberlandkanal), dort, wo Schiffe über Land fahren durch grüne Auen, zeitweise durch Wasser natürlich auch.
Ebenfalls faszinierten uns die riesigen Ausmasse der Salzmine Wieliczka, UNESCO-Weltkulturerbe, und liessen uns staunen.
Einen Bericht habe ich leider nicht geschrieben während dieser Reise. Es sind daher vor allem die Fotos, die noch immer mannigfaltige Erinnerungen und Eindrücke hervorrufen.
Ein gutes Jahr später hiess es dann aber endgültig: Leinen los! - Unsere Reise in östlicher Richtung konnte beginnen.
Reisen ab 2013 (Pensionierten-Leben) - wir sind dann mal weg!
Wie schon erwähnt, fand mein allerletzter Arbeitstag am 4. Juli 2013 statt. Und sogleich machte ich mich daran, eine lange Reise zu planen, und zwar von Mitte Oktober bis Mitte März; wir würden also ungefähr fünf Monate lang unterwegs sein. Destination: Australien, Neuseeland.
Aber vorher war ja auch noch Zeit, Neues „in der Umgebung“ zu entdecken. Weil ich aus Belgien über Homelink zwei Anfragen für einen Häusertausch erhalten hatte, fand ich, das wär doch grad der ideale Einstieg in unser neues „Reiseleben“.
Reisebericht Belgien August 2013
„Was, ihr geht nach Belgien im August?“
Diesen Satz hab ich oft gehört, als ich unseren Freunden unsere Reisepläne darlegte. „Was wollt ihr denn dort?“
Ja, das wusste ich auch nicht so genau. Ausser ein paar Stichworten: Pommes Frites, Bier, Schokolade (kommt ja sicher keinesfalls an unsere heran!), des Nachts beleuchtete Autobahnen, ein bedauerlicher Sprachenstreit und eine äusserst unrühmliche Vergangenheit im Kongo kam mir nicht gerade viel über dieses Land in den Sinn. Aber es ging uns ja letztes Jahr ähnlich, als es Polen war, wo wir hin wollten. Und Polen ist eine Reise wert. Nicht nur eine!
Jetzt also Belgien dieses Jahr. - Belgien ist ebenfalls eine Reise wert, und nicht nur eine!
Auslöser waren, wie gesagt, die zwei unabhängigen Homelink – Haustausch-Offerten, die eine in Brügge, die andere in Antwerpen, und da wir, weil wir ja nun beide pensioniert sind, nichts anderes mehr zu tun habe als zu reisen, sagten wir zu.
Nicht einmal der Eintrag in unserem „Top 10“ Reiseführer über belgische Städte, wo wir unter „Top 10 General Information“ den Eintrag fanden: “What to pack: Regarding clothing, assume the worst in weather and you’ll be fine. – Pack comfortable shoes - you will be walking“, brachte uns vom Vorhaben ab, dieses Land zu bereisen. Und wir haben es nicht bereut. Der erste Teil des Eintrags können wir nämlich in keiner Weise belegen (zwei Regentage und sonst den ganzen Monat schön und warm), den zweiten Teil schon.
Stopover in Speyer und Köln
Begonnen hat unsere Reise allerdings in Speyer, in der Nähe von Heidelberg, wo die älteste romanische Kathedrale Deutschlands steht. Im Mittelalter war sie eine der bedeutendsten Städte. Bei uns eher nicht so bekannt; das war eben im Mittelalter.
Es war so heiss (über 30 Grad), dass wir nicht viel mehr taten, als jeden Tag an einen anderen Baggersee zu fahren und zu baden. An einem Tag allerdings fuhren wir in die Pfalz, an der Weinstrasse gelegen (nördlicher Ausläufer des Elsass), mit pittoresken Orten wie zum Beispiel Neustadt und St. Martin. An einem Vormittag besuchten wir Heidelberg. - Am Abend zurück in Speyer gab’s jeweils ein feines Nachtessen in einem der schönen Biergärten, und wir wunderten uns über die mehr als nur moderaten Preise. Auch über die deftigen, riesigen Portionen und über die nicht unbedingt eleganteste Art, ein Gericht zu beschreiben. Zum Beispiel: „Pfälzer Saumagen auf Kraut mit Brot“ – Wem fliesst da nicht das Wasser im Mund zusammen?
Speyer war ein Zwischenstopp auf dem Weg nach Belgien, auch ein Homlink-Tausch. Ein hübsches Einfamilienhaus, ein schöner Garten, nette Eltern der Tauschfamilie, die uns alles zeigten und erklärten.
Nach drei Übernachtungen fuhren wir weiter nach Köln, wo wir einen Zwischenhalt bei Karin Simon machten, eine Freundin, die wir in Bivio kennengelernt hatten, vor Jahren schon. Sie lud uns (zu unseren Ehren, wie sie sagte), ihre Familie und noch sechs weitere Gäste, die wir bereits kannten, zum Weisswurst-Zmittag ein auf der grossen Terrasse in ihrem Haus direkt am Rhein. Zu den Würsten servierte Karin feine, selbst gemachte Salate, natürlich Brezel, Weisswein, Bier und Sekt. Um halb drei fuhren wir mit vollem Magen los Richtung Brügge. Drei Stunden hätte die Fahrt dauern sollen, daraus wurden allerdings fünf. In einem Stau kurz nach Aachen sassen wir eine Stunde lang fest ohne einen Meter vorwärts zu kommen. Benzin brauchten wir alsdann. Mit dem Navi geht das ja problemlos, also weg von der Autobahn, 2 km zur nächsten Tankstelle. Die war allerdings nicht zugänglich, eine Baustelle rings herum. Die nächste, wieder nichts: eine weitere Baustelle, Tankstelle geschlossen. Das Navi war langsam ratlos – wir ebenso. Irgend in einem Kaff schafften wir es dann doch noch, den Tank zu füllen für den stolzen Preis von 110 Euro.
Brügge
Um halb acht kamen wir an, in einem Aussenquartier, genannt Sint Andries. Ein hübsches Haus mit üppigem Garten erwartete uns dort, voller Blumen, die wir ja dann (Theo vor allem) würden giessen müssen. Ein freundlicher Nachbar zeigte uns alles, auch den kaputten Gartenschlauch.
In Sint Andries an einem Dienstagabend um neun Uhr ein Restaurant zu finden, das geöffnet hatte, war ein kleines Kunststück, aber es gelang uns dann doch, in einem Gartenbeizli, eher so ein Snackding für die Einheimischen, eine Lasagne für 10 Euro zu bestellen. Die war sogar ausnehmend gut. Das Beizli heisst „In de Vriendschap“ und dort hatten wir auch gleich die erste Begegnung mit der seltsamen Sprache. Auf der Speisekarte fanden wir den Hinweis, dass beim Salade kip en parmesanschiffers fritjes enkel als bijgerecht 2 Euro 50 kosten. Die poetische Suppe (Verse soep) haben wir nicht probiert. Als Überschrift auf der Speisekarte stand übrigens: „Als de maag begint te knorren... of als knabbel bij de babbel…) – einiges versteht man ja, aber…
Jedenfalls haben wir uns sehr rasch eingelebt und wohl gefühlt im „Klein Kraaienest“, wie unser Homelink-Heim hiess.
Bis ich allerdings mit dem PC und dem WLAN klar kam, dauerte es ein Weilchen. Nicht nur die unmögliche Tastatur machte mir zu schaffen, auch die freundliche Mitteilung auf dem Bildschirm: „Kann geen verbinding maken met internet“. So musste ich wieder „afsluiten“ und später nochmals versuchen.
In Brügge verbrachten wir zwölf traumhafte Tage mit perfektem Wetter durchwegs. Die Stadt ist fantastisch schön, die Bootsfahrt auf den Kanälen des „nördlichen Venedig“ trotz der vielen Touristen absolut empfehlenswert. - Weiteres kann man im Reiseführer nachlesen.
Zweimal erhielten wir Besuch, am ersten Wochenende von Barbara und Bob Ensslin, die wir auf unserer Transatlanktüberfahrt von New York nach Hamburg mit der QM2 kennen gelernt hatten. Sie sind amerikanische Diplomanten, die im Moment in Paris leben, also „ganz nah“. Wir hatten‘s sehr lustig zusammen, die beiden hatten fürs BBQ Krabbenbeine und Rindsfilet mitgebtracht, so schlemmten wir aufs Beste. Bei der Stadtbesichtigung waren sie es, die uns herumführten, weil sie Brügge bereits kannten. Am Sonntag begleiteten wir sie auf ihrem Heimweg nach Lille und hatten dort ein letztes gemeinsames Mittagessen. Moules hätten es sein sollen, das Restaurant war bekannt dafür. Die waren zwar an oberster Stelle auf der Speisekarte erwähnt, aber grad ausgegangen…
Moules mussten es sein, halt dann nicht in Frankreich, sondern in Belgien. Ich hab noch kein Restaurant gesehen, das Mosselen (in witte wijn z. B.) und fritjes nicht im Angebot hätte. Auch im August. Es muss ein gewaltiges Muschel-Massensterben herrschen in diesem Land, und das täglich.
Also assen wir Mosselen in De Haan an der Strandpromenade am nächsten Tag. Jeder von uns ein Kilo. Uns beiden langt’s jetzt für ein Weilchen: „bit tom ablujten“ (erstes Wort des Zitats korrekt, zweiter Teil meine Interpretation der Sprache). Das Tussentotaal unserer Rechnung kam auf 71 Euro, recht teuer eigentlich. Dabei war da nur eine halbe fles wijn dabei (weil Theo noch fahren musste) und zwei frisdranken.
Apropos: Spezialitäten sind natürlich Muscheln und Frites. Aber ich hab auch noch anderes gefunden, was mir sehr gut dünkt: Waterzooi und Stoofvlees. Zum Dessert dann Pofferties.
Unser zweiter Besuch kam aus Köln; es waren Karin, Angelika und Paul. Auch mit ihnen zusammen verbrachten wir zwei schöne Tage, wieder Stadtbesichtigung, BBQ zu Hause und Streifzug ans Meer: Zeebrugge und Knokke.
Ein paar Ausflüge ans Meer unternahmen wir auch sonst noch, nämlich mal nach Blankenberge, Ostende und mal nach Dünkirchen. Theo ist ja immer sooo interessiert an den Weltkrieg-Schauplätzen (Nach Waterloo bei Brüssel mussten wir zum Glück nicht hin, da erinnert wohl nur noch der Name an die Schlacht – im Führer stehen zwar schon noch ein, zwei Sätze mehr).
Also in Dünkirchen hatten wir trotz Navi etliche Mühe, das Museum zu finden (offensichtlich nicht ein sehr touristischer Anziehungspunkt), aber als es dann endlich gelang, war Theo ganz freudig und ich fand gleich nebendran ein wirklich schönes und besuchenswertes Museum, das LAAC (museesdunkerque.voila.net/LAAC.html">museesdunkerque.voila.net/LAAC.html: bemerkenswerte Architektur, eingebettet in einem grosszügigen Skulpturengarten), in dem ich mich eine gute Stunde lang vertörlen und freuen konnte an Werken unter anderem von Tinguely und Nicki de St. Phalle.
An der Strandpromenade von Dünkirchen, da läuft was. Strandbars, massenhaft Leute, Lautsprecher, Musik, alle möglichen Attraktionen wie bei uns am Ziebelemärit, ja sogar Bungee kann man jumpen.
Zwischen unseren beiden Homelink-Swaps besuchten wir Gent, wo wir zweimal übernachteten und Brüssel - eine Übernachtung. Beide Städte haben uns ausserordentlich gut gefallen, vor allem Gent ist grossartig. Drei Museen haben wir besucht, das STAM, das Design-Museum und die Burg (vollgetextet vom Audioguide). Auch dort wieder eine Bootsfahrt auf der Schelde und viele Kilometer zu Fuss, vorwiegend durch die Altstadt.
In Brüssel musste es das Tintin-Museum (CBBD: Centre Belge de la Bande Dessinée) sein (Theos dringendster Wunsch), am nächsten Morgen dann das Magritte – Museum (mein dringendster Wunsch). Der Grand Place erschlägt einem fast vor Fassaden, Gold- und sonstigen Verzierungen und Pomp (Barockes Ensemble), der (das?) Männeken Piss vor Bedeutungslosigkeit, aber an all den wunderbaren Art Déco – Häusern und –Fassaden konnte ich mich kaum sattsehen und -fotografieren.
Auch das Atomium gefiel uns. Schön, dass man es hat erhalten können; eigentlich hätte es nach der Weltausstellung ja abgebrochen werden sollen.
Antwerpen
In Antwerpen (genauer: in einem Vorort genannt Brasschaat - wir sind nota bene beide nicht fähig, das Wort richtig auszusprechen) werden wir von unseren Homelinkpartnern, Annemie und Egbert, aufs Herzlichste begrüsst.
Annemie und Egbert sind beide „Shrinks“, sie ist Psychotherapeutin, er Psychiater. Anthroposophisch und homöopathisch. - Wie wir ankommen, läuten wir an der Tür und sogleich fragte mich Theo (wie üblich hat er sich nicht so sehr bemüht, sich zu merken, wer unsere Gastgeber sind, wie sie heissen und wo sie wohnen. Zwar hab ich’s ein paar Mal gesagt und ihm auch per E-Mail sämtliche Informationen geschickt, aber…. Erst wenn’s dann ernst wird, beginnt er sich zu kümmern. So fragt er mich (eben hat er das Schild an der Tür gesehen): „Welche Rolle sollen wir spielen?“
Das Haus ist umwerfend, es könnte ein Ferienhaus sein von Laura Ashley. Überall hat’s frische Blumensträusschen, in Violett, Hellgrün und Weiss gehalten, liebliche, englisch anmutende Details ebenfalls, alles ist rustikal – helles Holz, Rosa und Hellblau sind die vorherrschenden Farben, es duftet zart nach Lavendel und Rosenblättern, ist hell und gemütlich, hat einen schönen Wintergarten, einen gepflegten Garten und zwei Haustiere, für die wir aber nicht zu sorgen brauchen. Bei den Pets handelt es sich um zahme Poulets, die gestreichelt werden wollen und jeden Morgen um zehn Uhr dafür ein Ei legen (das Ei des dunkleren Huhns ist etwas kleiner). Diese Eier dürfen wir essen. Den ganzen Tag lang picken und gackern sie im Garten herum (die Poulets natürlich), beim Essen versuchen sie auf den Tisch zu flattern, was sie allerdings nicht tun sollten. Abends gehen sie von selbst in ihr Haus. Die Tür schliesst dann automatisch bei Sonnenuntergang mit Hilfe eines Sonnenkollektors.
In der Küche hat es unendlich viele Schubladen und alle sind aufs Akkurateste aufgeräumt (nicht grad wie bei uns). In einer Schublade hat‘s Küchenschürzen, links für die Frau, rechts für den Mann. Annemie trägt offenbar immer eine Schürze. Sollt ich mir echt auch mal überlegen.
Die beiden sind mehr als nur nett und herzlich; sie zeigen uns alles und Annemie hat bereits ein wunderbares Nachtessen für uns zubereitet: Gurkensalat und Fisch-Gemüse-Lasagne (selbst gemachter Nudelteig mit Bio-Mehl). Gekrönt wurde das Dinner von einem delikaten Pfirsichauflauf (mit Bio-Pfirsichen, ein Teigli aus besagtem Mehl, Bio-Milch und Eiern von „the grey and the blonde“. Dazu gibt’s frisdranken: je ein Glas selbstgemachter Holundersirup. - Annemie und Egbert trinken nichts.
Es gab nette Gespräche, wir erhielten zahllose Tipps und dann gingen wir schlafen. So nüchtern haben wir beide schon lange keinen Tag mehr erlebt beziehungsweise beendet. Tagsüber waren wir noch im Brüssel und hatten erst das Magritte Museum und anschliessend das Atomium besucht. Theo sagte nach der Besichtigung, wie sehr er sich dann nach der Fahrt auf ein Bier freue… Ich mag ja Bier überhaupt nicht. Ein Gläschen Wein hingegen…
(Das war dann schon ziemlich anders im „Amadeus“ in Gent, wo wir mal zum Essen gingen. Dort gab’s eine Magnum fles Roten auf den Tisch und am Schluss wurde per Zentimeter abgerechnet.)
Nach dem Essen verziehen sich unsere Gastgeber in den anderen Teil des Hauses, wo sie mit zwei anderen Ärzten ihre Praxen haben, aber auch Schlafräume und eine Küche. Ihr Haus überlassen sie uns.
Unser erster Tag war sehr gemütlich. „Endlich“ regnete es mal, so dass wir uns in Ruhe unseren Mails, Fotos und Reiseunterlagen widmen konnten. Nur kurz für einen Einkaufe (nicht im Bio-Laden) verliessen wir das Haus
Unser Znacht bereiteten wir auf dem AGA Ofen zu (ein wundersames, extrem gewöhnungsbedürftiges Ding). Zur Vorspeise gab’s Ravioli mit Oesterwammen (Austernpilze), anschliessend Salat und dann Ossenhaas. (Ja, ja, ich hab auch „Osterhase“ gelesen, als ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal das Rindsfilet auf einer holländischen Menukarte entdeckte. Irgendwie muss Ostern da schon mit im Spiel sein, auch bei den Pilzen). Zum üppigen Mahl gab’s ein paar feine Zentimeter Wein.
Ein paar ruhige Tage haben wir in Antwerpen, wir geniessen den schönen Wintergarten, während das Federvieh im Garten gackernd an uns vorbeispaziert, mal im Pick-Modus, mal rasen die beiden wie gestörte Simultansprinterinnen an der Fensterfront vorbei, mal gucken sie frech zu uns rein (das dann eher im Digital-Kopf-Schwenk-Modus), mal sehen wir sie stundenlang nicht, weil sie im hinteren Teil des Gartens, einer Art Wäldchen, irgendwelche Aktivitäten pflegen, von denen wir keine Ahnung haben, und ich fahre weiter mit der Vorbereitung für die nächsten Reisen. Theo plant akribisch einen Wintergarten am Sonnenrain (er steht sogar des Nachts auf, um seine Aufzeichnungen zu ergänzen) – hoffentlich ohne Hühner als Zugabe.
Die Eierlieferung klappt übrigens vorzüglich. Gestern allerdings wollte das grau-braune Huhn unbedingt auf den Eiern sitzen bleiben und brüten. Das Ei ihrer Kollegin gleich mit. Das geht natürlich nicht, wir brauchen ja schliesslich unsere Frühstücks-Eier. So war ich gezwungen, die Eier unter der Henne hervorzuholen. Sie waren so etwas von warm. Das Huhn war so etwas von indigniert. – So nahe war ich noch nie an der Produktion und ich muss schon sagen, was da passiert, mutet wundersam an. Normalerweise kaufe ich die Eier ja im Migros. Schön in Karton verpackt.
Einkaufen ist immer interessant an fremden Orten. Man muss zwar manchmal lange suchen, bis man das gefunden hat, was man sucht, man lernt aber auch Neues kennen. Die Supermärkte sind riesig, sehr gut bestückt, man kann alles haben, was das Herz oder besser gesagt der Magen begehrt. Da gibt’s frisches Gemüse wie bei uns, die diversesten Sorten von kaas und beispielsweise auch "gevogelte worst". Das Fleisch ist billig, es ist nicht zum Glauben. 100g Carpaccio kosten knapp 2 Euro, den Ossenhaas kriegt man für 26 Euro das Kilo.
Den ersten Einkauf tätigen wir mit dem Auto, einen (nur einen!) Nacheinkauf hier in Brasschaat mit dem Velo. Das Gejammer von Theo, als ich diese Art der Fortbewegung vorschlug, will ich hier nicht weiter erläutern. Als ich mich am späteren Nachmittag auf den Weg machen wollte, fand ich ihn nicht einmal mehr. Er war am Schlafen. Seine Siesta, versteht sich. Als er dann um halb sechs auftauchte, bestand ich trotzdem auf den autolosen Einkauf. Eine Ausrede nach der anderen musste ich mir anhören. Da stand nicht mehr das Fahrrad, das Annemie uns angeboten hatte, das, welches da stand, hatte kein Körbchen - wie sollten wir denn die Einkäufe transportieren? - gefährlich ist‘s! etc. etc. – Ich fuhr dann einfach los. Er hintendrein. Das Gesicht… Nur ein einsamer Jogger begegnete uns auf unserem ungefähr vier Kilometer langen Ausflug. Seiner Miene nach zu schliessen schien er unter ähnlich jämmerlichen Qualen zu leiden wie mein Göttergatte. Zudem tropfte er von Schweiss, was man von Theo nicht behaupten konnte.
Velofahren ist übrigens ein Kinderspiel. Überall hat’s fantastisch ausgebaute Fahrradwege, teilweise auf den Trottoirs, was uns als Fussgänger allerdings schon mehr als eine Schrecksekunde beschert hat. Einen Helm trägt niemand. Wie in Holland sind auch hier die Velofahrer die Könige auf der Strasse, sie haben überall Vortritt, ihre Klingeln sind allgegenwärtig, ständig bellen sie (bellen = läuten auf Holländisch), jedermann fährt (und bellt), wir fielen nicht auf.
Auch sonst ist Lädele jeweils beliebt. Bei mir jedenfalls. So ein T-Shirt oder eine broek (Hose), eine Tasse, oder sogar eine handtasse (Handtasche) sind immer willkommen. Und Theo wartet geduldig bis ich meine Einkäufe getätigt habe. Nie beklagt er sich. Er hat immer sein E-Book dabei – ich kann mir Zeit nehmen. Wenn er dann aber einen Media-Markt erspäht, ist er es, der nicht mehr zu halten ist, und ich muss warten, denn er findet immer etwas, das er dringend braucht. Diesmal war’s (unter anderem) tatsächlich ein kleiner Drucker. – Was soll das? - Für Ellas Bäbistube? Auf der Einkaufstüte heisst’s jedenfalls: „Ik ben toch niet gek“. – Und was druckt er mir zu Hause aus? Ein Bild von ihm, in der Badehose, wie er grad aus dem Meer steigt (seinen Bauch hat er vorher im Paintshop moderiert). – gek?
Ob er diesen Drucker dann mit nach Neuseeland nehmen wird? Schon jetzt ist ein riesiges Arsenal an Steckern, Doppelsteckern, Adaptern, Kabel, Verlängerungskabel, Flashmemories und sonstigem technischem Equipment mit dabei. Natürlich auch sein Tablet, ein Laptop und sein i-Phone. - Jetzt sind wir ja mit dem Auto unterwegs, das wir auch problemlos füllen bis am Ende der Ferien, aber bei der Australien-Neuseelandreise dürfen’s ja dann nur noch 20 kg sein pro Person. Mir graut schon jetzt.
Zeeland
Vorläufig aber sind wir Fans von Zeeland. Dies ist die südlichste Region der Niederlande, das Vordelta der Scheldemündung. Eigentlich sind es Halbinseln und Inseln, mit Dämmen und Bücken verbunden, ellenlangen Sandstränden und riesigen Dünen, sonst aber flach, flach, flach. Die alten, ursprünglichen Windmühlen trifft man nur noch selten an, die riesigen weissen jedoch sind zahlreich. Die Inseln sind nicht gross, sie sind praktisch mit dem Velo zu befahren, wir sind natürlich mit dem Auto unterwegs. Die kleinen Städte oder eher Marktflecken sind reizend (den Ausdruck brauche ich sonst eigentlich nicht, aber hier passt er). Middelburg gefällt uns sehr und auch Zierikzee (ich les entweder „Zürichsee“ oder „Zierkerze“) ist zum Beispiel ein solcher Ort wie aus dem Bilderbuch, ein mittelalterlich anmutendes Städtchen mit Windmühle, wie der Tourist es sich wünscht (mehr als 500 historische Gebäude), einem Stadttor mit zwei Türmen und vier absolut unterschiedlichen Kirchen, einem Hafen mit historischen Schiffen, fein herausgeputzten Häusern und Gärten, einem Marktplatz mit zahlreichen Cafés zum Draussen-Sitzen, ein paar schmucken Lädeli-Strassen und –Gassen… Einfach gemütlich!
Es zieht uns fast jeden zweiten Tag in diese Gegend, die Strände sind sauber und zum grossen Teil einsam (Verklikkerduinen), das Meer noch mindestens 20 Grad warm und die Temperatur fast wie im Hochsommer. Manchmal hat’s eine kleine Brise, darüber sind wir aber froh. Abends suchen wir uns jeweils ein Vis-Restaurant (lekker uit eten in een restaurant), wo man draussen essen kann (z. B. in Bruinisse oder Yerseke oder Westenschouwen, Vlissingen oder Zoutelande an der „Zeeländischen Riviera“) und geniessen ein paar feine Meeresfische oder Muscheln - mit Blick aufs Meer, auf den Hafen oder eine Promenade, wo Spaziergänger und Velos vorbeiziehen, weiter draussen Frachter und Segelschiffe. Dunkel wird’s erst gegen neun Uhr, bis dahin bleibt es auch schön warm. – Das sind Ferien! – Oft denke ich an meine Kolleginnen und Kollegen, die jetzt am Unterrichten sind...
Nebenbei bemerkt: Wie liederlich die heutzutage die Reiseführer verfassen... In Annemies Guidebook heisst es doch tatsächlich übers Wetter in Belgien: „On the whole Belgium is rather a rainy country, with Brussles experiencing constant low rainfall throughout the year“.
Belle-Epoque-Viertel und Museen
Antwerpen gefällt uns auch, nicht ganz so sehr wie Brügge oder Gent, aber ein spezielles Quartier ist absolut fantastisch: Art Déco-Häuser vom Schönsten und Verschnörkeltsten. In den 60-er Jahren hätten die alle abgebrochen werden sollen. Zum Glück gab’s von der ganzen Bevölkerung massive Proteste (Annemie war dabei), so dass man von diesen unsinnigen Plänen abkam und der einzigartige Stadtteil in Zurenborg erhalten geblieben ist. All die wunderbaren Details, Skulpturen, Symbole, Inschriften und Mosaike! Dabei sieht man ja nur die Fassaden. Was sich alles dahinter verbirgt, kann man nur erahnen.
Das M HKA – Museum gehört zu den Kunsttempeln, wo sich der Laie die üblichen Fragen stellt: „Ist das Kunst“? – „Was genau ist daran Kunst“? – Wir hatten eine Führung mit einer netten jungen Dame, die uns das eine oder andere ganz gut erklären konnte. Ideal auch die Internetlinks bei den Kunstwerken, so dass man sich in Ruhe zu Hause die Werke in Bild und Wort nochmals ansehen kann und Hintergrundinformationen über die Künstler erhält (Nur, wir haben ja keine Zeit…).
Theo hatte ein weiteres kleines Problem beim Aufsuchen der Toilette. Er war nicht sicher, welche der vier Türen (Frauen und Behinderte klar ausgeschlossen) er wählen sollte, ob MEN oder ARTISTS (auch das natürlich Kunst).
Das Rubenshuis dann wieder ein Museum ganz im gewohnten Stil, dunkel, gross, beeindruckend – klar das Haus eines Mannes, der schon zu seiner Zeit (1577 -1640) eine Berühmtheit war und dementsprechend wohlhabend.
An unserem letzen Abend luden wir unsere Gastgeber, Annemie und Egbert (gesprochen Echbert) zu einem Dim Sum - Nachtessen in der Antwerpener Chinatown ein. Die beiden haben viel Humor und wir haben uns bestens unterhalten. Sie tranken Tee, wir eine fles Roten. Bei dieser Gelegenheit fanden wir dann auch heraus, dass Annemie und Egbert keinen Alkohol trinken (als Gastgeschenk hatten wir drei Flaschen Wein mitgebracht), er keine Käse isst (ich hatte ihnen ebenfalls ein grosses Stück Gstaader Bergkäse in den Kühlschrank gelegt) und so gut wie kein Fleisch (eine Wurst aus dem Berner Oberland war auch dabei). So viel zu meiner auserlesenen und treffsicheren Auswahl an Gastgeschenken.
Es war ein ausgesprochen gemütlicher Abend, wir genossen eine vorzügliche Küche und hatten einen absolut nüchternen Chauffeur.
Heimfahrt
Am folgenden Morgen verliessen wir Brasschaat Richtung Leuven, wo wir einen Zwischenhalt machten. Den Grote Markt wollten wir uns ansehen. Ausgerechnet an dem Tag fand dort ein riesiges Volks-Fest statt (einmal im Jahr, wir hatten es also ‚gepreicht‘), die ganze Innenstadt war abgeriegelt für jeglichen Verkehr (sogar für fiets = Velos), so dass wir fast eine Stunde brauchten, bis wir zu einer Parkgarage gelangten. Überall hatte es Marktstände, Marktschreier, laute Musik, ein riesiges Gedränge - man konnte die Gebäude kaum mehr sehen.
Um die Heimfahrt zu ‚entschärfen‘, übernachteten wir in Metz. Allerdings fanden wir, nach den belgischen Städten, in denen wir uns so unglaublich wohl gefühlt hatten, seien ein paar Stunden Aufenthalt genug. Wir wollten dann am Dienstag noch das Centre Pompidou besuchen, aber das war geschlossen. In der ganzen Welt ist der Montag der Tag, wo die Museen geschlossen sind (stimmt vielleicht nicht ganz 100%-ig), in La Grande Nation ist’s der Dienstag. – Im Whatsapp-Family-Chat schrieb ich ganz enttäuscht: „CP fermé le mardi“, worauf mir Raphael sofort antwortete: „Ohhh mais non! Ou lala! Comme ci comme ça!“ –
So weit so gut. Einem Mega-Stau in Härkingen konnten wir grad noch knapp ausweichen, schon sahen wir die Alpen, heimatliche Gefilde, die Ortstafel von Ittigen, ein Monat Ferien war vorbei.
Wir sind glücklich, dass alles so gut gegangen ist, es keine Pannen gab, wir viel Spass hatten, so viel Schönes erlebt haben, gesund wieder zurück sind, das Wetter hier noch wärmer ist als im Norden, die Aare noch immer 19 Grad hat und ich somit morgen ins Marzili gehen und am Abend im Sporting Club ein Mixed Double mitspielen kann.
Reisebericht Bali – Australien – Neuseeland – Australien – Singapur
(Mitte Oktober 13 – Mitte März 14)
Wir hatten uns vorgenommen, unseren Reisebericht diesmal als Blog zu veröffentlichen. Das machte zwar Spass, es war eine Art „Joint Venture“, manchmal aber auch Stress, weil entweder Theos Zeichnungen, mein Text oder unsere Fotos nicht rechtzeitig parat waren, vor allem aber weil das Hinaufladen ins Internet nicht immer gut funktionierte (die Verbindung war oft mangelhaft, wieder und wieder stürzte das System ab).
Hier trotzdem der Link: torriani.ch/reisen1314/">torriani.ch/reisen1314/
Träume vor der Abreise
Offenbar beschäftigt mich unsere Abreise doch mehr, als ich selber wahrhaben will. Natürlich gibt es viel zu organisieren, zu packen und dran zu denken. - Aber das:
Verschiedene Träume am selben frühen Morgen:
Christine Ruder (eine gute Freundin von mir) kommt mit uns auf die Reise. Wir haben abgemacht, ihr Gepäck mitzunehmen. So fahren wir zu ihr ins Egghölzli. Mit dem Bus, nicht etwa mit dem Auto. Das dauert aber endlos lang, ich frage mich dann plötzlich, was das Ganze soll, schon anderthalb Stunden sind wir unterwegs und immer noch nicht dort. Wieso haben wir das Auto nicht genommen und was sollen wir dann mit dem Gepäck? Jetzt reicht es nicht einmal mehr, zurück nach Hause zu fahren, weil unser Zug ja schon bald abfährt. Mich beschleicht ein beklemmendes Gefühl… Aufwachen zum Glück!
Nächste Episode:
Nur noch Theo und ich: Im Bus zum Zug: Plötzlich merke ich, dass ich meinen neuen Fotoapparat, den ich extra für die Reise gekauft habe, vergessen habe einzupacken… Aufwachen zum Glück!
Nächste Episode (sehr kurz):
Wir sind zu Hause und wollen gehen, es ist Zeit, da finde ich meine Schuhe nicht, die ich glaubte, parat gestellt zu haben. Da sind nur die schwarzen, aber ich hatte mich doch entschieden, die braunen anzuziehen… Aufwachen zum Glück!
Nächste Episode (eine längere Angelegenheit):
Wir sitzen im Zug, Theo und ich. Es sind noch andere mit dabei, die zu unserer Gruppe gehören. Wir sind unterwegs zum Flughafen und haben sehr viel Gepäck bei uns. Vor mir ist eine Art Ablage aus Metall, ein Kasten, welcher oben eine Öffnung hat. Dort schaut irgend ein Stück Stoff hervor. Ich ziehe daran, es ist ein Schal. Ich greife weiter hinein, da kommen noch mehr Halstücher zum Vorschein, aber auch Taschen und Etuis. Mit uns reist zufälligerweise der Chef des Zugs und ich zeige ihm, was ich gefunden habe. Er sagt, da müsse er dann mit seinen Untergebenen ein Hühnchen rupfen, dass die all diese liegengebliebenen Sachen nicht selber gefunden hätten, aber er dankt mir, dass ich ihn darauf aufmerksam gemacht habe. – Nur ist inzwischen die Zeit sehr kurz geworden, ich sehe auf meiner Uhr, dass wir nur noch fünf Minuten haben zum Umsteigen. Alle anderen sind schon ausgestiegen. Jetzt pressiert‘s. Das Problem ist, dass der Zug, den wir erreichen müssen, gar nicht im Bahnhof abfährt, sondern irgendwo draussen auf dem Feld, mindestens 500 Meter weit entfernt. Man sieht das Gleis in der verlassenen Landschaft, ziemlich weit unterhalb von dort, wo wir uns befinden. Ein nicht asphaltierter steiler, staubiger, steiniger Weg (eher ein stillgelegtes Bachbett) führt hinunter.
Ich seh den Zug schon kommen, die anderen Mitreisenden sind bereits dort. Ich renne los. Theo irgendwo hinter mir her. Vorne versperrt mir eine Frau den Weg. Ich versuche, an ihr vorbeizueilen. Da kommen von unten her zwei Hunde auf uns zu, ein grösserer und ein kleinerer. Ich verlangsame mein Tempo, das nützt aber nichts, der kleine Hund hat mich schon in die Hand gebissen…. Aufwachen zum Glück!
In Wirklichkeit erreichen wir den Flughafen jedoch ohne Probleme und können rechtzeitig abfliegen.
Frühstück im Flugzeug
Was ist das denn? Kläglich sieht’s aus auf dem Teller, bleich und unappetitlich. Es ist das Frühstück. – Das geht gar nicht! – Nahrungsverweigerung!!!
Sonst ist alles ok mit dem Flug, weniger allerdings mit meiner Erkältung, vor allem mit meiner Nase, die meint, sie müsse, je länger der Flug dauert, desto akribischer in Produktion steigen und auch meine Augen dazu veranlassen, ohne Unterhalt zu tränen. Das führt dann auch zu nie vorher gekannten Ohrenschmerzen bei den Sinkflügen. – Bin ich froh, habe ich diesen Zwischenhalt in Indonesien geplant. Einen weiteren langen Flug hätte ich schlicht nicht mehr ertragen.
Bali
Nach dreizehnstündigem Schlaf fühlen wir uns beide sehr viel besser. Meine Erkältung ist am Abklingen, die Ohren haben den Druckausgleich mehr oder weniger geschafft, Theo klagt auch nicht mehr so sehr über seine Grippe.
Alles ist fantastisch: Die wunderbare Unterkunft, der paradiesische Garten, unsere liebenswerten englischen beziehungsweise australischen Gastgeber Anna und Steve, Wetter und Temperatur, das Meer, die Sonnenuntergänge, die freundlichen Balinesen, das feine Essen, die Tatsache, dass wir unendlich viel Zeit haben zu geniessen und dass wir erst am Anfang unserer Reise sind.
Und schon die Aussicht auf ein Tennis-Doppel. Wir waren noch keine Stunde da, schon bot mir Anna an, an einem der nächsten Tage mitzuspielen. Nicht im Traum hätte ich das erwartet. Und schon reut es mich, dass ich keine Tennisschuhe mitgenommen habe. Das Gepäck…
Ausflug nach Ubud – Vulkan – Goa Gajah
Am Dienstag buchten wir einen Ausflug, das heisst, wir mieteten ein Auto mit Chauffeur. Benzin und Essen des Fahrers alles inklusive – Kosten 50 Franken.
Um Viertel nach acht ging‘s los am Morgen (erstaunlicherweise ohne grossen Kommentar von Theo), abends um sechs waren wir wieder daheim.
Schön war’s, sich zurücklehnen und die mühsame Fahrerei jemand anderem überlassen zu können. Ständig umgeben zu sein von Motorrädern, welche die Autos umschwirren wie Motten das Licht, hätte mich überfordert. Aber unser Fahrer, Cypriano, war das natürlich gewohnt. Er liess sich durch nichts aus der Ruhe bringen und fuhr uns sicher durchs Verkehrschaos in Küstennähe, später über Landstrassen durch zahllose Dörfer entlang von Reisfeldern und Mandarinenplantagen. Alle Strassen waren gesäumt von Penjors (lange, verzierte Bambusstangen, deren Spitzen sich wie Laternen zur Strassenmitte neigen. Der Penjor, aufgestellt zur Zierde der Götter, ist ein Symbol für das Gute, das das Böse abschrecken soll. Am Tag vor Galungan werden sie in den Dörfern vor den Häusern beidseits der Strasse aufgestellt. Die Penjors baumeln im Winde und es bietet sich einem ein Bild wie eine Allee. Am Penjor selber sind verschiedene Dinge angebracht, die symbolische Bedeutungen haben. So ist beispielsweise die Kokosnuss das Symbol für Fruchtbarkeit.), einige wurden erst noch aufgestellt, die meisten standen schon parat für den Festtag am folgenden Tag, Galungan (zehn Tage später gefolgt von Kuningan - diese beiden sind die höchsten Feiertage der Balinesen. Anlass für diese Feiertage bildet ein historischer Hintergrund, die Niederlage eines Despoten aus dem 3. Jahrhundert. König Maya Danawa hatte seinen Untertanen die Anbetung der Götter und Ahnen verboten, das Volk erhob sich und besiegte ihn nach blutigen Kämpfen. - Galungan wird alle 210 Tage gefeiert und gilt als das aufwendigste Tempelfest. Das Fest symbolisiert auch den Kampf der Götter gegen das Böse. Deshalb finden zu dieser Zeit in den balinesischen Familien viele Gebete und Opferzeremonien statt). - Es war ein schöner Anblick. Die Stangen sind aufs Hübscheste verziert, offenbar werden die schönsten davon prämiert.
Die meisten Dörfer scheinen mehr aus Tempeln zu bestehen als aus Häusern, diesmal noch mehr geschmückt als wohl üblicherweise.
Unterwegs machten wir immer wieder mal Halt. Wir besuchen eine Batikwerkstatt (Legong Batik Pressing), einen Gold- und Silber- Schmied, eine Holzschnitzerei (die Balinesen sind absolute Künstler was das Holzschnitzen betrifft) und in Ubud dann eine der x Malerwerkstätten. All die vielen Bilder, die dort zum Verkauf angeboten werden… Und so viele verschiedene Stile. Für jeden (wirklich jeden) Geschmack etwas, das ist wohl die Idee. Auf meine Frage hin, ob er die alle verkaufen könne und ob auch Balinesen kaufen würden, erklärte mir der nette junge Mann, der uns alles zeigte und mir nebenbei auch von seiner Familie berichtete, dass dem sehr wohl so sei, vor allem im August seien die Touristen sehr kauflustig. Balinesen würden keine solchen Bilder kaufen, erklärte er, die könnten selber malen, wenn sie was für ihr Wohnzimmer bräuchten. - Ok, ok, kann ja sein.
Eine einstündige Theatervorführung wurde uns beim zweiten Halt geboten: „Jamba Budaya“. Es geht immer ums selbe Thema: der Kampf zwischen Gut und Böse, Barong and Kris Dance. Nach ein paar Kameraklicks in Tegallalang bei den prächtigen Reisterrassen ging‘s weiter nach Kintamani, wo wir im Gunung Sari Restaurant Halt machten und zu Mittag assen. Von der Terrasse aus hat man eine exzeptionell schöne Aussicht auf den Vulkan Gunung Batur und den See Danau Batur. Der Anblick in das friedlich daliegende Tal liess mich gar nicht mehr los. Wir selber befanden uns dort eigentlich auch auf einem Kraterrand, ein sehr viel grösserer Vulkan musste mal ausgebrochen sein und hatte die Landschaft so gestaltet. Besser und von oben sieht man’s natürlich auf Google map.
Einen weiteren Halt gibt’s in Santis‘ Gardens, einem Lehrpfad für tropische Pflanzen. Kakao, Vanille, Ginseng, Pfeffer, Kaffee, Snakefruit (Salak), Mangousteen und was es da sonst noch alles zu sehen gab.
Das Seltsamste allerdings: Animal Coffee.
Ein Tier, Civet, das aussieht wie ein Nerz, sie nennen es hier Mungo, sitzt in einem kahlen, trostlosen Käfig und sieht elendiglich aus. Es versucht verzweifelt, einen Ausgang zu finden.
Seine Aufgabe ist es, Kaffeebohnen zu fressen, sie in seinem Magen zu fermentieren und dann passiert der Prozess umgekehrt.
Im Internet gefunden unter Luwak-Kaffee:
Kopi luwak is coffee made from the beans of coffee cherries which come out from the other end of the civet cat after they’ve been eaten. Civets were long regarded as pests, but the research nowadays shows that the coffee cherries fermented internally by digestive enzymes of the civets adds a unique flavour to the beans which the resulted beans are the highest quality.
(Extrem spezielles Englisch! - “the other end of the cat“. Oder die seltsamen Bezüge: Hier wird das Tier gleich selber gefressen, von wem ist nicht ganz klar, eventuell von den Kaffeebohnen? – Aber eben, das Ganze ist in meinen Augen so oder so ein abstruser Vorgang. Wer kommt auf solche absurden Ideen? Man stelle sich das vor…Der einzigartige Geschmack – klar – comes from the other end oft he cat, also: The most expensive coffee in the world is made from animal poop.
Im Internet steht auch, wenn mehr Leute wüssten, wie schlimm die armen Tiere gehalten würden, würden wohl einige auf diesen Kaffeegenuss verzichten.
Man hat uns eine grosse Auswahl an Tees und Kaffees offeriert zum Probieren, Luwak zum Glück nicht.
Der Tempel Goa Gajah, auch genannt Elephant Cave (UNESCO Welterbe, erbaut im 9. Jhd.) war dann unser letzter Halt. Wir waren relativ spät dran, die meisten Souvenir-Lädeli hatten bereits geschlossen, sogar der Ticket-Verkäufer hatte schon Feierabend gemacht, so kamen wir in den Genuss eines völlig unbehelligten Gratisbesuchs des bekannten Heiligtums.
Mir kam sogleich die Episode in den Sinn am Flughafen Belp vor einem Jahr, als wir mit wenig Verspätung um ungefähr elf Uhr abends von London her kommend landeten. Man sagte uns, der Zollbeamte sei jetzt halt schon heimgegangen. Es tönte fast wie eine Entschuldigung. Wer also etwas zu deklarieren gehabt hätte, zu viel Booze, ein wenig Drogen oder so, hätte halt diesmal Pech gehabt. - Das kann nur in Bern passieren.
Nach diesem Exkurs zurück nach Bali:
Nach dem Tempelbesuch Rückfahrt nach Seminyak. Es war ein Tag mit vielen unterschiedlichen, schönen, aber auch besinnlichen Eindrücken. An diesem Abend waren wir zu müde, um noch etwas essen zu gehen. Theo machte sich ein Rührei mit Schinken, ich ass in Stück von der Wassermelone, die noch im Kühlschrank lag.
Ein paar Eindrücke (Bali)
Whisky
Am zweiten Tag hat Theo doch endlich einen Spirituosenladen gefunden und kann seinen Whisky kaufen. Allerdings keinen „Famous Grouse“. Sonst etwas Grausiges. Er ist jetzt glücklich, seine Welt ist vollkommen in Ordnung.
Money
Wir sind Millionäre. Als ich gestern nur noch etwas mehr als 500‘000 Rupien in Noten hatte, mussten wir doch noch zwei weitere Million wechseln gehen. Auch wenn (ausser dem Wein) alles relativ günstig ist, irgendwie wird man sein Geld doch schnell los.
(10 Franken sind ca. 120‘000 Rupien, also eine 1000er Note grade mal 8 Rappen)
Sydney und Buschfeuer
Kaum hatten wir unsere Reise begonnen, lasen wir auch schon von den Buschbränden in der Gegend von Sydney. Ausgerechnet! Dorthin wollen wir ja. Bald schon. Wir sehen uns im Fernsehen die Berichte an. Die Leute, die ihre Häuser verlieren, tun uns sehr leid. Die Brände sind verheerend.
Kaffee
Theo versucht’s immer wieder mit Espresso. Schwieriges Unterfangen!
Über LUWAK hab ich ja bereits berichtet. Ein mehr als nur betrübliches Kapitel.
Den besten Kaffee aber gibt’s gleich vorne an der Ecke: „illy“. Aus eigenem Anlass hätten wir den nie probiert. Steve musste uns erst darauf aufmerksam machen. Super Cappuccino und Milchkaffee. Es dauert allerdings eine ganze Weile, bis das Gebräu parat ist, die Kaffeemaschine befindet sich im hinteren Teil eines Vans und die Angelegenheit sieht sehr kompliziert aus. Die Dame, die den Kaffee braut, giesst um, schäumt auf, giesst wieder um und das Resultat ist beeindruckend. Der Preis auch. Der Kaffee kostet doppelt so viel wie eine 5-minütige Fahrt mit dem Taxi (trotzdem nur halb so viel wie bei uns). Sie seien in Facebook zu finden, sagt die nette Dame, wir sollten doch bitte „liken“ (damit hab ich ziemlich grosse Mühe, ich finde das so überaus blöd – nicht mal ihr zuliebe kann ich ausnahmsweise über meinen Schatten springen).
Packen – Reiseliste
Soeben sagt Theo zu mir: „Ich hab glaub‘ ich doch falsch gepackt; ich hab‘ drei Paar lange weisse Hosen bei mir und nur ein Paar kurze.“ – Ich sage nichts.
Das Problem ist ja immer dasselbe: Was genau nehm‘ ich mit? Was brauch‘ ich, was kann ich allenfalls kaufen? Was brauch‘ ich sicher nicht? Was fehlt mir, wenn ich’s nicht mitnehme?
Nun, da wir ja selten auf Reisen gehen, habe ich mir längstens eine Reiseliste zusammengestellt und auf dem PC gespeichert. Dort gibt’s einen allgemeinen Teil, einen Teil zusätzlich für Tennisferien, einen Teil zusätzlich für Rosasferien (inklusive Einkaufsliste für den ersten Einkauf vor Ort), und ein Teil (er wird immer länger) für Theos Dinge, die er ständig vergisst. Als da wären: Pyjama, kleines Kissen, Wäschblätz (braucht er dringend zum Rasieren am Morgen), Nagelbürstchen, Halbtaxabi, Strandschlarpen und sogar seinen Umhang mit den unendlich vielen Taschen hat er schon mal vergessen mitzunehmen.
Hingegen finde ich es gut, wenn er seine Coop-, Migros-, Globus-, etc.-Karten zu Hause lässt sowie Schweizer Bargeld und seine ganzen Bankkärtchen, die ihm in der „Fremde“ ja nicht dienen.
Also: Am Abend vor unserer Abreise gingen wir diese Liste nochmals durch, familienintern, Gino war dabei, Debo und Diego ebenfalls, alles wurde nochmal erwähnt und klargestellt.
Fazit: Der Wäschblätz fehlt. (It’s not the end of the world but anyway…)
Auf meiner Reiseliste hab ich übrigens seit neuestem eine weitere Rubrik eröffnen müssen. Sie heisst: „Dinge, die zwar auf der Liste sind, die ich aber doch nicht eingepackt habe, was mich dann sehr nervt.“ – Ich kann’s also auch, diesmal aber hab‘ ich nichts vergessen.
Theo hat jetzt übrigens inzwischen ein paar neue kurze Hosen gekauft. Rosarote!
Restaurants
Restaurants hat’s wie Sand am Meer. Gut und günstig sind die meisten. Durchschnittlich kostet ein Gericht etwa 3-8 Franken. Wie schon erwähnt, Alkohol ist teuer. Ein Drink kostet fast gleich viel wie bei uns und für eine Flasche Wein kann man gut und gern 50 Franken und viel mehr bezahlen, auch im Laden. Sogar der einheimische Wein kostet über 20 Franken und den probieren wir schon gar nicht. Theo, mutig wie er ist (er ist sich einiges gewohnt und seine Furchtlosigkeit in der Beziehung scheint mir oft keine Grenzen zu kennen), hat gleich am ersten Abend einen balinesischen Drink bestellt. Arak (de.wikipedia.org/wiki/Arabische_Sprache">arabisch %u0639%u0631%u0642, „Schweiß“ – klingelt was?) war drin, er hat ihn tatsächlich nicht fertig getrunken. Sogar er fand, er schmecke wie ein Putzmittel der übelsten Sorte.
Unsere Erfahrungen sind mannigfaltig. Anna und Steve sind natürlich Insiders und kennen die tollsten Restaurants. Gestern waren wir zusammen im „La Luccida“ - sooo schön. Wunderbare Aussicht auf Meer, Strand und Palmen. Sehr gediegenes Ambiente, freundlicher Service, wunderbares Essen, nicht ganz billig allerdings.
Am Abend dann ein völlig anderes Szenarium:
Swiss Restaurant Legian
Nein, nein, wir haben nicht bereits Heimweh. Wir sind auch nicht von einer Tarantel gestochen oder haben einen Sprung in der Schüssel. Es ist vielmehr so, dass uns Genny und Giancarlo Torriani (Hotel Solaria, Bivio), die jedes Jahr im November hier Ferien machen, ans Herz gelegt haben, unbedingt ihren Freund Jon Zürcher zu besuchen und Grüsse auszurichten. Er ist der Besitzer dieses Etablissements, führt das Restaurant seit 35 Jahren (genau so lange, wie ich Unterricht gegeben habe – also ewig), ist in St. Moritz aufgewachsen, hat nebenbei ein Reisebüro und ist Honorarkonsul für Bali. Die Grüsse richteten wir gerne aus und hatten einen netten Abend im Fonduestübli. Statt Fondue, Raclette, Ghackets oder Wurst-Käsesalat assen wir Mie Goreng, dazu nur noch Bier und Wasser, da wir mit Anna und Steve ja bereits am Mittag zwei Flaschen Wein geleert hatten.
Es ist immer wieder amüsant zu sehen, wie Schweizerisches im Ausland fast überschweizerisch wird. Der Abstand verstärkt offenbar die Beziehung. Ist das so?
Gestern war’s das „Gado Gado“. Terrasse am Meer, niederländischer Koch, der sein Handwerk versteht, ein tolles Restaurant. Das Degustationsmenu (jeder der fünf Gänge extrem delikat und schön präsentiert) ein Hit für 400‘000 Rupien (32 Franken), dafür erhält man bei uns ja kaum ein Schnipo.
Die Rechnung am Schluss kommt uns dann trotzdem sehr heimisch vor. Es ist halt wieder der Wein, der den Betrag ausmacht, die Abgabe fürs Government (gehen die dann mit unserem Geld essen?) und die überrissene Servicecharge, welche ja ok wär, aber ich kann keinen Moment lang glauben, dass sie den Kellnerinnen und Kellnern zugut kommt.
Tennis
Unsere Gastgeber sind die absolut Besten! Wir haben solches Glück, dass wir sie kennengelernt haben (Genny und Giancarlo Torriani sei Dank; sie haben uns den Haustausch vermittelt).
Gestern haben sie ein Doppel organisiert, ich war begeistert! Anna hat mir einen Schläger geliehen, meine Sneakers hab ich kurzerhand in Tennisschuhe umfunktioniert und los ging’s. Heiss war’s und meine Füsse taten mir schon bald weh, aber das sind ja für Tennisfreaks die geringsten Probleme.
Dazu gehört nach dem Spiel das Bier am Strand (für mich halt Wasser, da ich immer noch nicht gelernt habe, Bier zu trinken). Steve organisierte dann doch noch eine Flasche Weisswein, schön gekühlt, so sassen wir da und schauten dem Sonnenuntergang zu.
Julie, eine Neuseeländerin, die Vierte im Doppel, fuhr uns anschliessend nach Hause, wo uns alle und zwei weitere Gäste und Freunde von Anna und Steve, ein wunderbares balinesisches Nachtessen erwartete, das die Maid Neoman für uns vorbereitet hatte.
Ein unvergesslicher Abend in einem herrlichen Ambiente, lustige Gespräche – einfach gut!
Reisebericht Australien 1
(Sydney – Coffs Harbour - Byron Bay – Brisbane)
Sydney, 28. Oktober – 2. November 2013
Ankunft pünktlich am Morgen um 7 nach sechsstündigem Flug, obwohl sich der Abflug in Denpasar um fast eine Stunde verzögert hatte. Alles lief bestens bei der Immigration, der Beamte hiess uns willkommen in „Streilia“ und erzählte, als er unseren Namen las, seine Frau sei aus Norditalien, er kenne „unsere“ Gegend. Auch bei der Einfuhr-Kontrolle schlüpften wir problemlos durch, vor und nach uns wurden Reisende gefilzt, ihre Koffer durchleuchtet und durchsucht. Kein Brösmeli aus einem anderen Land wollen die Aussies in ihrem Kontinent dulden.
Zehn Grad kühler, ein wenig Nebel, es riecht leicht nach Verbranntem. Wir werden von unseren HomeExchange-Partnern am Flughafen abgeholt. Das Gepäck wird im Auto verstaut, eine halbe Stunde später sind wir in Lilli Pilli, wo Kerrie und Robert, drei Katzen und zwei Hunde (der kleinere davon, ein Chichiwawa – eine Miniaturausgabe von einem Hund - mit Beinchen und Pfoten wie von einer Maus) - ich musste fast die Lesebrille anziehen, um ihn überhaupt zu sehen, wohnen. Das Haus ist an einem Hang gelegen und reicht über mehrere Stockerke bis zum Bay hinunter. Von der offenen Terrasse oben hat man einen wunderschönen Blick auf die Bucht und die Schiffe, die vor Anker liegen.
Mit Robert hatte ich regen Email-Verkehr. Ich hatte ihn angefragt, ob er sich einen Haustausch mit uns vorstellen könne und er war sofort dabei. Ein Skigebiet in der Schwiz sei genau das, was ihm auf seiner Bucket-Liste noch fehlte, meinte er. Die ganze Familie liebt es offenbar, Skifahren zu gehen. Sie waren schon fast überall auf der Welt, wo’s im Winter Schnee hat. – Da hatte ich ja ins Schwarze getroffen. Und das gelich doppelt: Auf HomeExchange hatte er nämlich sein Ferienhaus auf der Südinsel in Neuseeland angeboten. Damit wollte ich tauschen. Im Laufe unserer Korrespondenz dann fragte mich Robert mal, ob wir in Sidney bereits einen Tausch gefunden hätten. Das war zu dem Zeitpunkt noch gerade nicht der Fall, also lud er uns für ein paar Tage zu sich heim ein. So ein tolles Angebot konnte ich natürlich nicht ablehen. Und einmal mehr erlebten wir unglaubliche Freundschaft im Zusammenhang mit unseren Haustausch-Erlebnissen.
Theo geht erst mal eine Runde schlafen (was sonst…), Kerrie nimmt mich mit in den Supermarket, wo wir fürs BBQ am Abend einkaufen. Ich muss mich erst ein wenig an ihren Slang gewöhnen, “bee“ höre ich, wollen wir kaufen - Bienen??? – „Bier“ meint sie...
Die Prides sind äusserst grosszügige, nette und liebenswürdige Gastgeber. Robert ist der grosse Organisator (das hat er jahrelang für die Deutsche Bank getan in Hongkong und Sydney und sich dann mit 50 pensionieren lassen). Er hat unseren 5-tägigen Aufenthalt voll durchgeplant, ich bin ganz froh, muss ich mal nicht.
Nach Theos Siesta geht’s aber jetzt als Erstes los nach Cronulla, wo wir das Auto stehen lassen und uns auf einen zehn Kilometer langen Marsch um die Halbinsel herum begeben. Nach einem Apéro am Ende unseres Walks geht’s heimzu und beim Abendessen werden unsere weiteren Pläne besprochen.
Ein feines BBQ wird vom Hausherrn zubereitet und dazu ein hervorragender Wein serviert. Robert zeigt uns seinen Weinkeller. Umwerfend! - Keller ist falsch. Es ist ein riesiger Weinschrank mit 1500 Flaschen. Alle schön geordnet, ein Computerprogramm sagt ihm, welche Flaschen wo sind, woher sie kommen, wie viel sie gekostet haben, welche getrunken werden müssten etc. Es gibt noch einen zweiten Weinschrank – kleiner mit nur 1000 Flaschen. Dieser befindet sich im Keller.
Am zweiten Tag fahren die beiden mit uns von Beach zu Beach und zeigen uns die schönsten Strände und Aussichtspunkte rund um Sydney. Erst Botany Bay, wo einst die ganze Australien-Geschichte mit der Landung der Engländer unter James Cook 1770 ihren Anfang genommen hat und die Bare Island, ebenfalls ein historischer Ort – ein Fort, gebaut zur Verteidigung der Stadt. Weiter geht‘s an den Bronte Beach. Von dort aus gibt es im Moment eine Art-Exhibition, einen Skulpturenweg entlang des Tamarama Beach, Marks Park, Hunter Park bis Bondi-Beach (4,5 km lang). – Ein Kunstwerk schöner und origineller als das andere! Ich kann mich fast nicht satt sehen. Leute hat’s wie Sand am Meer, ganze Schulklassen sind unterwegs. Ein Wind kommt plötzlich auf und wird immer stärker. Man muss aufpassen, dass es einen nicht über die Klippen bläst. - In der Zeitung lese ich am nächsten Tag, es seiner Sturmböen bis zu 95 km/h gewesen, die etliche Schäden zur Folge hatten und am Nachmittag musste die Ausstellung sogar geschlossen werden, da Teile davon gefährlich durch die Luft geflogen waren. Wir selber sind wie sandgestrahlt, überall paniert, und statt den ganzen Weg zurückzugehen, nehmen wir ein Taxi dorthin, wo das Auto parkiert ist. Mittagessen in Watsons Bay, von wo aus man einen einzigartigen Blick auf die Skyline von Sydney hat. Ein weiterer Spaziergang führt uns einem Strand und den Klippen entlang durch einen Park zum Hornby Leighthouse. Gap ist dann der Ort mit dem zweifelhaften Ruf, ein idealer Ausgangspunkt für Selbstmörder zu sein. - Immer sieht’s nach Regen aus, aber ausser ein paar Tropfen ist da nichts. – Mehr als 10 km lang war unsere Wanderung auch an diesem Tag.
Am Abend lädt uns Robert zusammen mit seiner Familie in ein Restaurant im Ort (Caringbah) ein; wir lernen die beiden Töchter und deren Partner kennen.- Gerne möchten wir zahlen, das wird aber gar nicht akzeptiert.
Am folgenden Tag haben wir „frei“, das heisst, unser Tag ist für die Besichtigung von Sydney vorgesehen. Der arme Theo muss schon wieder um acht aufstehen. Karrie bringt uns nach dem Frühstück auf den Zug. Nach 40 Minuten sind wir mitten in der Stadt, machen einen Rundgang genau nach Roberts minutiös ausgeklügelten und auf unsere Bedürfnisse angepassten Plan. Dem folgen wir getreu und haben anschliessend auch wirklich das Gefühl, recht viel von dem gesehen zu haben, was man so sehen will/sollte/muss. Die Stadt hat eine gute Atmosphäre, Neu und Alt erscheinen in einem manchmal recht anmutigen Zusammenspiel, der „englische Geist“ gut spür- und sichtbar, ein seltsames Gemisch aus altmodisch-englisch und hypermodern-amerikanisch und das teilweise ein wenig chaotisch konzipiert. Uns gefällt’s jedenfalls. Auf die Geschichte wird grossen Wert gelegt, jedenfalls auf die Geschichte der ersten Siedler; die Aborigines werden kaum erwähnt.
Das stellen wir im Hyde Parks Barracks Museum fest, wo ausführlich über die Geschichte der Stadt und die erste Besiedelung durch die Sträflinge berichtet wird.
Der Botanische Garten ist eine wunderbare grüne Oase mit exotischen und auch englischen Bäumen – in der weiten Anlage zur Mittagszeit herumzuspazieren ist allerdings ein Erlebnis der besonderen Art, schwirren da doch zahllose Jogger um einem herum wie die Motten ums Licht. Sie kommen dahergekeucht von hinten und von vorn, von links und von rechts, zum Glück nicht noch von oben und von unten, erstaunen würde es mich allerdings kaum, ich weiss schon so manchmal gar nicht mehr, wohin ausweichen. Ihre Gesichter sind verzerrt und gequält; Freude herrscht wenig, eher offenbar das Fitness-Diktat.
Das berühmte Opernhaus ist gewaltig. Ich kann‘s gar nicht genug fotografieren. Von allen Seiten.
Die Quiche, die wir im Restaurant essen wollen, müssen wir aufs Schärfste verteidigen – vor den Möwen. Die frechen Viecher sind überall und lauern auf jedes Brösmeli, das sie ergattern können. Steht jemand auf und geht, fallen sie gleich in kreischenden Scharen über das Übriggebliebene her, eine Szene wie bei Hitschkock.
Wir spazieren weiter zur Harbour Bridge, schlendern im Stadtteil ’The Rocks’ umher, gehen die St. George Street hinunter und enden schliesslich in ’Darling Harbour’, wo wir grad zur Aperitif-Zeit ankommen, happy hour. Nachtessen in Chinatown und zurück mit dem Zug. Kerrie holt uns am Bahnhof in Caringbah wieder ab. – Daheim ist Whisky-time für Theo und Robert, ich verzieh mich mal ins Bett.
Heute hat Robert wieder Zeit für uns. Kerrie hat Tennis-Interclub, kann also nicht mitkommen. (Zur Verpflegung muss sie Früchte mitbringen. Ein Blick in den Picknickkorb in ihrem Wagen sagt mir allerdings, dass sie unter Früchten wohl vor allem Trauben versteht, abgefüllt in grüne Flaschen.)
Wir fahren in südlicher Richtung durch den Royal National Park, mit ein paar herrlichen Lookouts mit Blick auf die Küste und die Stadt Wollongong. Weiter geht’s nach Illawarra. Hier nehmen wir den „Illawarra Fly Treetop Walk“ in Angriff, ein lohnenswerter Ausflug mit schöner Aussicht, die allerdings ein wenig beeinträchtigt wird von den vielen Wolken. Die Sonne zeigt sich heute kaum. Dieser Skywalk ist über den Bäumen angelegt auf einer circa 500 m langen und 25 m hohen Metallkonstruktion – man geht also quasi den Baumkronen entlang und kann auch den 45 m hohen Turm besteigen.
Lunch gibt’s am Meer im bekannten alten Scarborough Hotel (gebaut 1886). Anschliessend fahren wir über die See Cliff Bridge und gehen zu Fuss ein paar hundert Meter wieder zurück; der Spaziergang ist pittoresk, von dort aus hat man einen fantastischen Blick auf die Küste. Die Brücke wurde gebaut, weil der Hang die Küstenstrasse verschüttet hatte und diese dann während fast zweier Jahre geschlossen werden musste. - Gegen fünf geht’s dem Grand Pacific Drive entlang heimwärts.
Am Abend laden wir Kerrie und Robert zum Essen ein, vorher aber zaubert Robert noch eine Flasche Moët & Chandon aus dem Kühlschrank und wir trinken unten auf dem Bootssteg in den letzten paar Sonnenstrahlen zusammen ein Gläschen.
Am nächsten Tag spielt Robert Golf, Kerrie ist mit ihren Freundinnen unterwegs zu einem Girls-Weekend und Theo und ich haben nochmals einen Stadt-Tag vor uns. Kerrie fährt uns ins Queen-Viktoria-Building, ein renoviertes Einkaufs-Warenhaus im englischen Stil (fast wie Harrods in London), mitten in der Stadt. Von dort aus geht Theo ins Maritime Museum, wo er die „Endeavour“ anschauen geht, das Schiff, mit dem Cook damals nach Australien segelte. Ich schau mich ein wenig in der Innenstadt um (auf Berndeutsch: lädele).
Anschliessend nehmen wir die Fähre nach Manly, wo wir herumschlendern, dem Strand und der Promenade entlang spazieren bis zum Shelly Beach. Unterwegs sehen wir etliche Water Dragons (eine Art grosse Eidechsen) und essen etwas im Restaurant „The Kiosk“. Eigentlich haben wir unser Badezeug dabei und haben im Sinn gehabt, ein wenig zu schwimmen, aber dann wird es zusehends wolkiger und wir kommen von unserem Vorhaben ab. Also spazieren wir zurück zur Fähre (erst doch noch eine kurze Theo-Siesta im Rasen oberhalb des Strandes) und fahren zurück nach Circular Quai, ins Herz von Sydney.
Die Zeit reicht noch grad für den Besuch im Sydney Aquarium, das bis abends um 8 Uhr offen hat. Beeindruckend ist die Vielfalt der Meerestiere. In Unterwassertunneln erlebt man Haie, Rochen und what not (mehr als 12‘000 Exemplare von ungefähr 650 Arten). Sie schwimmen neben und über einem durch; man geht durch einen Glastunnel und kann ihnen auf diese Weise hautnah zuschauen.
Wir essen in einem Restaurant in Darling Harbour, nehmen den 10 Uhr Zug zurück und schliesslich ein Taxi nach Lilli Pilli.
Ein feines Glas Wein (Theo Whisky) und dann wollen wir schlafen gehen.
Daraus wird aber vorerst mal nichts. Am nächsten Tag soll ja unser Mietauto abgeholt werden und ich will unsere Fahrausweise sowie die internationalen Füherausweise, die wir extra beim TCS hatten ausstellen lassen (für 80 Fr. nota bene), für Theo parat machen. Die finde ich aber nicht unter all meinen Reiseunterlagen. – Eine chaotische Suche geht los, Panik kommt auf, wir telefonieren Gino in die Schweiz, er soll nachsehen, ob wir die zuhause haben liegenlassen, bis ich dann tatsächlich in einem Fach in meinem Rucksack, das ich inzwischen vergessen habe, dass es existiert, fündig werde. - Wie die Eichhörnchen mit ihren Nüssen: sammeln, irgendwohin in ein tolles Versteck vergraben und dann vergessen. - Beide Ausweise sind gefunden, klein und grau und teuer und sie sagen nichts. –Totale Erleichterung!!!
Endlich können wir schlafen. Zum Glück erinnere ich mich am Morgen an keinen meiner Träume.
Beim Frühstück erzählen wir vom nächtlichen Drama. Rob nimmt‘s gelassen und sagt, wenn’s ein Problem gewesen wäre, hätten wir ja einfach ein Auto kaufen statt mieten können. – So einfach…
Übrigens der Clou am nächsten Tag: Der Angestellt bei AVIS sagte, es wäre kein Problem gewesen, sie bräuchten die Ausweise gar nicht...
Von Sydney nach Coffs Harbour 2. - 3. November
Am Morgen fährt Robert Theo zu Taren Point, wo ich das Mietauto, um das ich mir solche Sorgen gemacht habe, für unsere Reise bestellt habe. Eine halbe Stunde später sind die beiden zurück. Mit einem Toyota geht unsere Reise nordwärts weiter, all unser Gepäck hat problemlos drin Platz.
Eine Stunde lang dauert es, um an den nördlichen Stadtrand von Sydney zu gelangen, die letzte halbe Stunde wie in tiefem Nebel, kaum 100 Meter Sicht, es handelt sich aber um den Rauch der Buschbrände. - Krass!
Die Linksfahrerei geht einigermassen gut, in der Stadt ist ja immer ein Auto vorne dran, an dem man sich orientieren kann. Nur hat Theo die Tendenz, zu weit nach links an den Strassenrand zu fahren, so hab ich hin und wieder eine kleine Schrecksekunde. Er nimmt eben die Aufforderung: „Keep left unless overtaking“ sehr wörtlich.
Dann die Sache mit dem Zeiger beziehungsweise mit dem Scheibenwischer. Die sind halt vertauscht. Ich erinnere mich, dass das in rechtsgesteuerten Autos immer das Problem ist. Will man die Richtung anzeigen, scheibenwischert man erst mal. Jedermann sieht dann gleich, dass der Fahrer wohl ein Ausländer ist.
Aus der Stadt heraus wird‘s recht langweilig auf dem Pacific Highway. Wenig Verkehr. Nach ungefähr drei Stunden sind wir im Hunter Valley. Dort wollen wir einen Halt machen; es ist ein grosses und bekanntes Weinanbaugebiet. Die Gegend ist sehr schön, ziemlich flach, aber Reben sehen wir nirgends. Wo nehmen die nur die Trauben her, fragen wir uns.
Robert hat uns genau angegeben, welche der 74 Winerys, die teilweise sehr weit auseinander liegen, wir besuchen sollen, um das Beste zu machen aus der Zeit, die wir haben. Es sind zwei kleinere, die nahe beieinander liegen und ich muss sagen, die Wahl war hervorragend (wie bei absolut allen seinen Vorschlägen). Sein erster Tipp war der Briar Ridge-Vinyard, wo wir einen Lunchhalt machen sollten. – Sehr guter Rat, weil es sonst weit und breit nirgends ein Lokal hat, wo man etwas essen könnte und ein sehr schöner Ort, wo’s uns auf Anhieb gefällt. Scheibenwischenderweise fahren wir vor. Leider liegt zum Essen nur ein Glas Wein drin, weil wir ja noch fahren müssen. Ohne zu degustieren kaufe ich einen Karton von diesem Wein, „The Trio“, Merlot, Shiraz, Cab Sauv (wie sie den Cabernet Sauvignon hier nennen – ist ja auch viel weniger mühsam auszusprechen). Dann ist Zeit für Theos 10-minütige Siesta im Schatten der grossen Fichten.
Auch das andere Weingut, das wir anschliessend besuchen, „Petersons“ (in unserem Reiseführer beschrieben als exklusiv, teuer und für ihre im Hunter Valley einzigartige Produktion von Schaumweinen bekannt), ist sehr hübsch gelegen, auf einem sanften Hügel, wo man ein wenig Aussicht hat und das doch tatsächlich auf Reben. Es ist Frühling hier, also die Trauben noch sehr grün und klein.
Weiter geht’s Richtung Forster, wo ich von zu Hause aus bereits ein Motel gemietet hatte. Unser vorläufiges Ziel ist Coffs Harbour, also suchte ich auf der Karte einen Ort, der mehr oder weniger auf halbem Weg liegt, damit wir die etwa 600 km lange Strecke nicht an einem Tag hinter uns bringen und wie blöd nur gerade der Autobahn entlang fahren müssen. - Ich übernehme für die restlichen 100 km das Steuer. Auch mich zieht‘s beim Fahren oft gegen den linken Strassenrand. Seltsam, daheim passiert das ja nicht (mit rechts natürlich).
Forster
Ein Städtchen am Meer, wunderbar gelegen mit Tuncurry als Schwesterstadt. Es hat viele Motels hier, auch Trailers, ich denke, es ist eher so ein „low-budget“ Ferienort. Das bestätigt sich, wie wir ein Restaurant suchen. Es habe eine ganze Menge zur Auswahl, versichern uns unsere freundlichen, hilfsbereiten Motelnachbarn, chinesische, italienische, Thai, what not. Ihnen hätte besonders das Seafood-Restaurant gefallen. Sie würden uns die Daumen drücken, dass es uns auch gefalle (nett, nicht?). - Keine zwei Minuten zu Fuss und schon stehen wir vor dem chinesischen Etablissement, also richtigerweise vor einer kleinen chinesischen Imbissstube mit Plastik-Tischen. Die Tischtücher sind aus demselben Material, wie man’s halt so kennt. Wir wollen ja aber ins Seafood-Restaurant. Das finden wir auch. „Beach Street Seafood“ heisst es (sogar im Tripadvisor zu finden und sehr gut beurteilt). - Restaurant? - Eine Snackbar, wo man am Counter bestellt wie bei MacDonalds. Aber ok, wir sind nicht wählerisch, es hat viele Leute dort, eine Terrasse, alles sehr sauber und die Fische sehen gut aus. Tische und Stühle auch hier natürlich aus Plastik. Aber sehr nette junge Leute, die bedienen. In der Ecke steht ein Getränkeautomat, Wein gibt’s natürlich keinen. Ob wir unseren eigenen Wein, den wir vorsorglich mitgebracht haben, trinken dürfen, frage ich. „Natürlich. Möchtet ihr einen Eiskübel und Weingläser dazu?“ – Super! So sitzen wir also auf der Terrasse, vor uns je eine Aluschale mit Fisch und Chips, daneben ein Eiskübel (aus Metall!), wo sowohl das vis-à-vis gekaufte sparkling Mineralwasser Platz hat als auch der Wein. Andere Gäste haben ihre Getränke ebenfalls mitgebracht, die Männer nebendran gleich einen grossen Karton Bier. Die Dämmerung beginnt und damit der Einzug der Mücken. Sie sind aggressiv. Im Lokal werden Spraydosen gegen die Plage herumgereicht. Theo scheint da etwas misszuverstehen. Er besprüht die Mücke, die leblos auf dem Tisch liegt, weil er sie nämlich bereits erschlagen hat, mit dem Zeug. - Mein Stück Lachs übrigens ist absolut fein zubereitet. Wenn es auf einem Teller in einem vornehmeren Restaurant läge, würde es zwar einen besseren Eindruck machen, aber delikater wäre es nicht. Die Pommes Frites übrigens genauso. – Wir finden nach dem Essen eine Cafébar, „Tartt“, die uns beiden auf Anhieb sehr gut gefällt. Gemütlich. Und guter Kaffee, sagt Theo. Dort wollen wir am nächsten Tag frühstücken. Auf dem Heimweg kommen wir an einem Ice-Cream-Parlour vorbei. Auch für mich hat der Abend so einen krönenden Abschluss gefunden.
Am nächsten Morgen sehen wir erst, wie schön der Ort ist. Nicht unbedingt die Häuser, aber die Umgebung und die Lage. Auf der einen Seite das Meer mit starker Brandung, in der Mitte das Zentrum mit Shops, Snackbars und Häusern, auf der andern Seite, keine zweihundert Meter entfernt, Seen mit türkisblauem, glasklarem Wasser, Lagunen, Sandbänke, wo sich die Leute tummeln und mindestens so viel Freude dran haben wie wir Berner am Marzili. Das Frühstück im „Tartt“ ist superb (Eggs Benedikt – mein Lieblings-Frühstück). Wenn wir in diesem Ort Ferien machen würden, wären wir hier Stammgäste.
Gegen Mittag verlassen wir die Gegend, die „Great Lakes“ heisst (auf Google Maps sehen wir, wie gross das Gebiet ist und wie viele Seen es tatsächlich hat) und fahren weiter Richtung Coffs Harbour. Noch nicht einmal aus dem Städchen Tuncurry heraus, schon sagt unsere Navi-Lady: „Bitte 249 km geradeaus fahren“. – So hat sie diesmal nicht viel zu tun. Aber über sie zu erzählen gibt es manches; sie hat streckenweise für grosse Unterhaltung gesorgt:
TomTom - GPS – unser Navigationssystem, das uns von Ort zu Ort führt
Wir fahren von Lilli Pilli weg Richtung Norden. Zum ersten Mal stellen wir das Navi ein, das uns den Weg ins Hunter Valley und anschliessend nach Forster leiten soll.
Die Dame kennen wir gut, es ist die gliche wie zu Hause. Sie spricht deutsch. Ich kann‘s aber nicht glauben: Was ist das denn? Sie liest die Wörter phonetisch ab, ein absolutes NO GO! Erst meine ich, ich hör nicht recht, wie sie sagt, wir sollen auf dem Expressweg Richtung Nius Kastele bleiben. Betonung auf dem „A“, auch das End- „E“ betont sie. Was meint sie? Sie sagt’s noch oft. Es ist jetzt klar, ich seh die Schilder: Newcastle ist’s. – Wo nimmt sie das „S“ nur her? – Das geht ja gar nicht. Aber es kommt noch strüber:
Lake Rd: Statt Lake Road sagt sie „Lake Er De“. (nicht „leik“, sondern wie deutsch „Laken“ –jeder Buchstabe betont). Die Snape St in Cessnock: Statt Snape Street ist’s die: „S n a p e Es Te“. / Mitchell Ave: „Mit Schell A We“)
Langsam seh‘ ich den Puck. Sie buchstabiert genau, was sie sieht (sieht???). Für welche deutschen Touristen tut sie das? - Unterste Schublade!
Es wird aber noch viel krasser: Hier kommt der Burner:
„John Renshaw Dr“ steht auf dem Strassenschild (John Renshaw Drive). - Sie sagt tatsächlich: John Renn Schau Doktor (den Vornamen hat sie fehlerlos hingekriegt).
Wenn sie wenigstens bei ihrem Schema geblieben wäre und D R gesagt hätte, aber nein, sie interpretiert.
So gibt’s noch viele weitere Ärzte unterwegs.
Eigentlich wollte ich schon lang auf einen englischsprachigen Herrn umschalten, aber ich muss zugeben, der Unterhaltungswert ist nicht zu verkennen, so bleiben wir der wegweisenden Dame im Moment treu. Wenn sie zu sehr nervt, können wir ja immer noch wechseln.
Der Gerechtigkeit halber muss ich allerdings erwähnen, dass sie ihren eigentlichen Job, nämlich uns an den richtigen Ort zu leiten, gut macht. Dafür haben wir sie ja auch bezahlt.
Unterwegs
Gerne möchte Theo irgendwo in einem schönen Kaff eine Tasse Kaffee trinken, aber davon kann er noch lange träumen. Wir fahren 200 km weiter, verlassen unterwegs den Pacific Highway (zwecks Kaffeesuche und Sightseeing) und fahren auf der Scenic Route 12 einem Fluss entlang, fahren an Tausenden von Rindern vorbei, an Farmhäusern, durchqueren etliche kleine Dörfer, die vorwiegend aus Trailern bestehen, vorbei an Bäumen, deren Stämme verbrannt sind, aber ein Beizli, wo es sich lohnen würde, Halt zu machen, finden wir nicht. An zwei Stränden versuchen wir unser Glück ebenfalls (dort muss doch ein hübsches Lokal sein!!), der eine ist leer, kaum jemand am Spazieren, von Restaurant keine Spur, der andere das Gegenteil, es wimmelt nur so von Besuchern. Ebenso von Picknickplätzen, aber eine Strandbar hat’s tatsächlich auch keine. Man nimmt halt seinen Eski mit, gefüllt mit Eis und Getränken, Kartons voller Food und that’s it. Wer braucht denn schon ein Restaurant am Beach? – Wir sind noch weit weg vom „Aussi way of life“.
Coffs Harbour
In Coffs Harbour, genau genommen in Sapphire Beach, finden wir das Haus, das wir für die nächsten neun Tage bewohnen werden. Wir staunen nicht schlecht: Ein Traumhaus direkt am Strand. Aussen wie innen modern und sehr geschmackvoll gestylt mit enorm viel Platz - erstklassig. Hier wird es uns wohl sein. Im Kühlschrank finden wir einen Kürbis-Pie, liebevoll vorbereitet von Leanne, damit wir heute Abend gleich zu Hause essen können, was wir mit Freude auch tun. Wein haben wir ja bei uns. Wir geniessen die feine Mahlzeit auf der Terrasse, das Meer quasi zu unseren Füssen, umschwirrt von Insektenschwärmen; es sind Ameisen, die ausgerechnet heute ihren Flugtag haben. Im Ohr also die starke Brandung, im Auge ebenfalls und um uns herum die Flugobjekte. Vor allem Theo scheinen sie zu schätzen. Ich hab eben meine Fingernägel neu lackiert, wahrscheinlich ist es das, was sie davon abhält, mich zu belästigen.
Zusätzlich zum Essen kriege ich noch eine Geschichtslektion von Theo. Exklusiv für mich. Er erzählt von den Japanern, Pearl Harbour, von den Australiern im zweiten Weltkrieg, von MacArthur (er muss wieder – mindestens zum fünften Mal – einen seiner Lieblingsromane von W.E.B. Griffin gelesen haben) – ja also für mich war’s eine Art Guet-Nacht-Gschichtli.
Wir räumen dann ab und gehen hinein. Es ist immer noch sehr warm. Urplötzlich aber kommt ein Sturm auf, er bläst und pfeift wie verrückt - wie ums Haus von Rocky Docky. Obwohl die Fenster alle zu sind, flatterten die Vorhänge entlang der langen Fensterfront; es ist fast ein wenig geisterhaft. Vielleicht wird hier doch nicht ganz so stabil gebaut wie in der Schweiz...
Trotzdem: Wir schlafen wie die Murmeltiere.
Am nächsten Morgen lese ich in der Zeitung, dass ein Kälteeinbruch stattfinden würde, von 34 hinunter auf 17 Grad. Wahrscheinlich ist’s das, was da grade passiert. Es bläst noch immer sturmmässig und die Brandung hat fast den ganzen Strand aufgefressen; heute ist wohl nichts mit Baden, das wäre mir viel zu gefährlich, aber wir haben ja einen Swimmingpool, wenn’s sein muss. Es ist sowieso nicht mehr so warm, die Wettervorhersage war also richtig.
Für uns stimmt das wunderbar; wir können’s gemütlich nehmen, ein wenig einkaufen gehen, endlich am Blog weiterschreiben, auf den Liegestühlen ins Meer gucken und schliesslich wieder einmal ein paar Zeilen im E-Book lesen. Dazu bin ich seit Bali, also seit einer Woche, nicht mehr gekommen. Das ist mir seit Jahren nicht mehr passiert, dass ich mehr als einen Tag lang nicht zum Lesen kam. So ein Stress, dieses Pensioniert-Sein. Das hab ich mir schon anders vorgestellt.
Am Abend dann werden wir essen gehen mit Leanne und John Watson, unseren hiesigen Gastgebern und HomeExchange-Partnern, die uns ihr Haus überlassen und sich in ihr Apartment - ein paar Beaches nördlich von hier - zurückgezogen haben. Sie waren im Juli bei uns in Bivio mit der ganzen Familie, acht Personen.
Meine Vorstellungen vom Tag entsprachen nicht ganz der Realität.
Es stürmt den ganzen Tag lang, ist aber herrliches Wetter. Ich mache mich parat für den Liegestuhl. Keine halbe Minute dauert mein Versuch, schon bin ich wieder im Haus. Der Wind ist eisig kalt und bläst alles weg, was nicht angekettet ist. Theo lacht mich aus.
Zusammen gehen wir einkaufen. Sogar Aldi ist vorhanden. Wer hätte das gedacht? – Uns interessieren eher Läden, die wir zu Hause nicht kennen, denn es ist immer interessant zu sehen, was ausländische Supermärkte alles zu bieten haben. Hier: eine Auswahl wie bei uns, eher noch viel grösser. Ein Espresso-Tassli möchte Theo gerne kaufen, diese jedoch gibt es nicht. Mugs schon. In der Not findet er als Ersatz eine Art Schnapsgläser.
Mit Kartons und Taschen voller Ware fahren wir nach Hause, vorher noch rasch bei der Post vorbei, um den Schlüssel aufzugeben, den wir vom Motel in Forster haben mitlaufen lassen.
Gegen Abend treffen wir Leanne und John am Beach von Woolgoolga. Theo kennt sie bereits von Bivio her. Er hat ihnen mal ein Raclette serviert (sie haben’s überlebt).
So ein sympathisches Ehepaar! Sie fahren zuerst mit uns in ihrem alten VW-Bus ein paar wenige Kilometer weit zum Safety Beach Golf Course, wo sie wissen, dass es Kängurus hat. Und ob es welche hat, eine ganze Menge. Jetzt wissen wir, dass wir in Australien sind. Die Tiere haben keine Angst vor uns, sind Menschen offenbar gewohnt. Sie spitzen zwar erst ihre Ohren und schauen in unsere Richtung, dann aber widmen sie sich wieder ihrem Futter. Die Hopserei ist allzu komisch, auch zu beobachten, wie das relativ grosse Kleine (Joey) beim Gehopse der Mutter fast aus der Bauchtasche fällt. Wenn ich die so betrachte, denke ich, da muss was falsch gelaufen sein bei der Konstruktion.
Wir fahren weitere zwei, drei Kilometer zu einem Lookout auf einer Anhöhe über der Küste. Der fantastische Ausblick von dort ist/wäre zum Verweilen, aber es bläst uns fast von den Klippen. Geplant war ein Picknick am Stand, wie man’s hier so macht, aber wegen dem Wind bleiben wir in der Fischbude, „White Salt“, und essen dort. The „Catch of the Day“ ist King- und Swordfish. Beide ausgezeichnet zubereitet, auf einem feinen Salat (viel zu viel Salat, meint Theo) mit leckeren Pommes-Frites (homemade und aus der Region) und gegrillten Pastinaken. Dazu hat John einen Eski voll Bier, Mineral, Rot- und Weisswein mitgebracht: Verwöhnung vom Feinsten.
Theo versucht zu Hause seinen Laptop an den Fernseher anzuschliessen zwecks Movie-Schauen, das gelingt aber nicht. Also geh ich ins Bett und lese noch ein bisschen.
Auch die nächsten beiden Tage sind stürmisch und eher kühl. Wir sind fast froh, so können wir am Blog weiterarbeiten. Einen Ausflügli machen wir aber doch. Ins Outback, also ins Hinterland. Nach Bellingen (nicht das bei Basel) in die Old Butter Factory, ein Art- und Craftvillage. An dem Ort haben sich offenbar etliche Künstler und Schauspieler niedergelassen. Wenn man also Russel Crowe im Postoffice begegnet, ist er es wirklich. Wir besuchen auch eine Winery, Raleigh-Winery, aber die Rotweine sind mir zu leicht, die Weissweine ein wenig zu süss; wir kaufen nur eine Flasche. Das Schönste aber ist die Fahrt am Bellinger River entlang. Es ist ländliches Gebiet mit Farmen, saftig grünen Weiden, Pferden, Rindern und Mangroven am Ufer entlang.
Im Supermarkt kaufen wir uns ein gebratenes Poulet und zusammen mit Kartoffeln und einem feinen Salat (nur ganz wenig für Theo) ergibt das ein wunderbares Znächtli.
Am nächsten Morgen ist es sehr viel wärmer, das Wetter scheint neblig und wie wir die Terrassentür öffnen, schlägt uns ein rauchiger Wind entgegen. "Macht da eine äs Fürli?", fragt Theo. "Äuä ender äs Für!", denke ich. - In den Nachrichten erfahren wir, dass zwei neue Buschbrände ausgebrochen sind, westlich von Kempsy, etwa 100 km weit wer von hier, an dem Ort, wo wir vor drei Tagen versucht hatten, ein Beizli zu finden, wo Theo einen Espresso hätte trinken wollen ("Bushfire back-burning generating smoke haze along Coffs Coast").
11'000 Hektaren Wald sind betroffen, man glaubt, ein 10-jähriger Junge habe das Feuer extra entfacht. – Das gibt zu denken! – Was geschieht mit dem Kind? – In Sydney war’s ähnlich, der eine Brand wurde offenbar durchs Militär verursacht (sehr peinliche Angelegenheit), der andere aber absichtlich durch zwei 12-Jährige.
Gegen Mittag dreht der Wind ganz plötzlich, bläst in der entgegengesetzten Richtung und wir haben den perfekten, klaren, sonnigen Tag, den wir lesenderweise am Strand vor dem Haus verbringen. Ferien pur!
Die Tage hier gehen viel zu rasch vorbei. Wir unternehmen keine grösseren Ausflüge. Auf dem Weg nach Sewtell (hübscher Vorort von Coffs mit ein paar schmucken kleinen Geschäften und Cafés) sehen wir von einem Lookout aus einen fantastisch schönen Strand, wo der Boambee Creek in den Pazifik fliesst. Weisser Sand, das Wasser in allen verschiedenen Schattierungen von Grün und Blau, völlig ungefährlich zum Schwimmen. Dorthin gehen wir baden. Nur hin und wieder kommt jemand vorbei, ein Spaziergänger mit Hund, ein Fischer.
Am Abend gibt’s Barbecue. Theo grilliert!!! Ich kann’s nicht glauben: Er, der immer sagt, er könne (wolle!) das nicht. Er legt unsere Porterhouse Steaks auf den Grill – und zum Glück schau ich nach – da liegt er bereits wieder in der Stube auf dem Sofa und drückt an seinem i-Phone herum. „Das geht nicht!“, ermahne ich ihn (die Lehrerin in mir noch immer aktiv), „Wenn man am Grillieren ist, bleibt man dort und läuft nicht weg.“ - Tausend Ausreden, aber er geht doch hin und wir sind beide froh, denn das Fleisch ist grad genau richtig und ohne meine Intervention müssten wir Schuhsolen essen.
Schweizer gehen gerne wandern, fahren alle Ski und essen viel Schokolade. – Etwas in dieser Richtung haben wir schon oft gehört. Also das mit dem Wandern, na ja, wenn ich da an unsere Niesen-Wanderung vor zehn Jahren denke und an Theos Rolle in diesem Glanzstück, aber das ist lange her…
(Für Nicht-Eingeweihte: Wir waren etwa zu acht, alle wanderten bis auf meine bessere Hälfte; er nahm das Bähnli. Seine einzige Aufgabe war – er war ja logischerweise als Erster oben – sich um unser Gepäck zu kümmern, d. h. sicher zu stellen, dass auch wirklich alles hinaufbefördert worden war; wir wollten ja auf dem Berg übernachten. Um halb sechs kamen wir Wanderer auf dem Gipfel an. Ich stellte sogleich fest, dass wir alle zwar oben, unser aller Gepäck jedoch noch unten an der Talstation war. Zum Glück konnten wir veranlassen, dass die letzte Bahnfahrt unser Gepäck dann doch noch hochtransportierte. – Theo hatte ein paar wunderbare Erklärungen, weshalb der Auftrag nicht einmal ansatzweise hatte ausgeführt werden können - an den genauen Wortlaut kann ich mich allerdings nicht mehr erinnern, vermutlich weil sie mir nicht sehr plausibel klangen.)
Hier macht man uns immer wieder wandern, „go on a walk“, heisst’s dann, und diese Walks sind kaum je kürzer als fünf Kilometer. Meist allerdings über ebene Strecken, es hat ja keine Berge, die wir erklimmen müssen.
So ergeht es uns auch am Samstag, wie Leanne und John uns zum Lunch abholen. Dieses Mittagessen müssen wir uns aber erst noch verdienen. Die Wanderung führt durchs Gehölz, entlang der Headlands, auf einem gut präparierten Küstenweg, von dem aus man immer wieder herrliche Ausblicke auf die endlosen, menschenleeren Strände hat. Zwischendurch kommen wir dann tatsächlich mal an einem Resort vorbei, wo wir etwas trinken können, ein Gläsli Weissen für mich, die anderen drei nehmen ein Bier. An diesem herrlichen Ort wird auch eine Hochzeit gefeiert, am folgenden Strand eine Taufe. – Nachmittags um drei sind wir im „Mangroves Jack“, einem einfachen Restaurant (Plastiktische) mit hervorragender Küche (die Desserts sehen aus wie im 5*-Hotel und schmecken auch so) und einem tollen Ausblick auf den Coffs Creek. Eigentlich ist man hier mehr oder weniger mitten in der Stadt, aber weit und breit sind nur der Fluss zu sehen, der Busch und die Mangroven. Der freundliche, blauäugige (wörtlich gemeint, es fällt auf) Kellner schwärmt von einem spanischen Wein, den er grad neu bekommen habe, bringt uns dann aber einen feinen Shiraz aus Australien, weil wir hier ja nicht Wein aus Übersee trinken wollen.
Wir haben ein solches Glück mit unseren Haustausch-Partnern; es ist sagenhaft. Auch Leanne und John kommen uns vor wie langjährige Freunde; sie geben uns gute Tipps für die Weiterreise, haben Humor, kurz, wir verbringen einen mehr als nur angenehmen, interessanten und amüsanten Nachmittag zusammen. Eigentlich ist beim Homelink-oder HomeExchange Deal ja in erster Linie der Haustausch das, worum es geht, eine absolut gloriose Einrichtung, wie wir finden. Dass man die Partner dabei kennenlernt, ist nicht immer der Fall. Wir wohnen ja auch nicht in Bivio, also haben oder hatten wir mit etlichen Tauschpartnern nur per Email oder Telefon Kontakt. – Was wir aber hier in Australien an Gastfreundschaft und Grosszügigkeit erleben, ist einzigartig. Diese Begegnungen allein sind eine Reise wert.
Im Buch „Down Under“ von Bill Bryson beschreibt er unter anderem die Bewohner von Sydney folgendermassen: „Sydneysiders, as they are rather quaintly known, have an evidently unquenchable desire to show their city off to visitors…”. Das scheint auch auf andere Bewohner dieses Kontinents zuzutreffen. Wir haben es genau so erlebt und können davon nur profitieren!
Übrigens: Dieses Buch von Bill Bryson kann ich wärmstens empfehlen (und nicht nur dieses). Es liest sich flüssig wie ein Krimi, er beschreibt Orte und Begegnungen auf humorvolle Art, ohne je zu verletzen, mit sehr viel Selbstironie. Selten so gelacht! – Auch wer keine Australienreise am Planen ist, nie dort war oder dorthin gehen möchte - das Buch ist äusserst lesenswert. In der deutschen Übersetzung heisst es: „www.amazon.de/Fr%C3%BChst%C3%BCck-mit-K%C3%A4ngurus-Australische-Abenteuer/dp/3442453798/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1384044996&sr=1-1&keywords=bill bryson k%C3%A4nguru">Frühstück mit Kängurus: Australische Abenteuer“.
Normalerweise steh ich relativ früh auf. So um sieben oder gar noch früher. Es ist so friedlich hier. Den unermüdlichen Wellen und Möwen zuzuhören und zuzuschauen, das haben wir ja nicht zu Hause. Und erst die Sonne zu beobachten, wie sie am Morgen um halb sechs aus dem Meer steigt („emporsteigt“, wollte ich zuerst schreiben, aber das wäre dann doch zu poetisch oder kitschig gewesen) – atemberaubend! Theo sagt auch, er stehe immer früh auf, so wie ich – um sechs. Manchmal zweifle ich an seiner Urteilsfähigkeit oder besser gesagt an seiner Zeitempfindung. Jetlag kann’s ja nicht mehr sein. Noch nie hat er’s nämlich vor halb neun geschafft (klar ist das für ihn in aller Herrgottsfrühe), in Bali war’s gut und gern zwischen zehn und elf Uhr. Den Sonnenaufgang kennt er nur von meinen Fotos.
Es gibt auch noch einen anderen Grund, der mich so früh aus dem Bett treibt. Sicher nicht schwierig zu erraten: Theos morgendliche Rasenmäh-Forstmaschinen-Häcksel-Geräusche sind‘s, die mir das Aufstehen leicht machen. Spätestens dann, wenn er auf Turbo schaltet und tönt wie ein Dampfkochtopf kurz vor der Explosion, verlasse ich das Bett.
Der Sonntag ist ein verregneter Tag. Er fängt zwar gut an, es ist schön, und, obwohl ein weiteres Buschfeuer etwa 50 km nördlich von hier ausgebrochen ist, dringt der Rauch nicht bis an die Küste. Es windet stark und beginnt zu regnen. Am Mittag ist’s wieder sonnig, wir benutzen die Gelegenheit für ein weiteres Ausflügli an die Marina und spazieren auf die Muttonbird-Island, von wo aus man einen spektakulären Blick auf Coffs, den Hafen und die verschiedenen umliegenden Strände hat. Die ganze Insel sieht aus wie „verlöchert“. Es sind Behausungen von Zugvögeln, die ihre Eier dort im Boden ablegen, brüten und dann Richtung Norden ziehen auf die Philippinen. Das Dumme ist nur, die Insel wird auch von kleinen Nagetieren bewohnt, deren Leibspeise offenbar ausgerechnet die Eier der Mutton-Birds sind. – Da greift dann halt der Mensch wieder ein und stellt den armen Rodents Fallen.
Auf dem Weg zurück nach Sapphire Beach kommt man an der „Big Banana“ vorbei, einem Themenpark vor allem für Familien. Schon von weitem sieht man die Riesenbanane aus Kunststoff beim Eingang prangen (The Banana Slip Water Park {Australia's first 3 story high inflatable waterslide – the biggest in the world}, Ice Skating Rink, Wild Toboggan Ride, Going Bananas Cafe, Gift and Souvenir shop, Candy Kitchen, Sunset Lakes Nursery, “The World of Bananas" multimedia theatre experience, plantation and packing shed tour and a state-of-the-art Laser Tag arena – “Australia’s first big thing. – It’s a whole bunch of fun“). Überall nichts als Fun, Fun, Fun. - Bryson hat dieser Banane und anderen grossartigen kulturellen Errungenschaften der Australier (Big Lobster, Big Oyster, Big Koala, Big Lawnmower und vielen weitere) in seinem Buch ein paar äusserst lesenswerte Zeilen gewidmet. Wir trinken ein Bananenfrappé (what else?!) und machen dann einen Abstecher auf den Hügel hinter der grossen Banane. Es geht recht steil bergauf und wir fahren durch riesige Bananenplantagen, die ungeheuer schwierig zu pflegen und zu pflücken seine müssen. Irgendwo hab ich gelesen oder gehört, dass dort schon seit mehr als hundert Jahren Bananen angepflanzt würden, dass es vor allem Inder seien, die in den Plantagen arbeiteten, denn die Australier würden ja nicht so gern solche harten Arbeiten verrichten. – Oben auf diesem Hügel hat’s einen weiteren Lookout (wie viele haben wir schon gesehen…) und wir fragen uns, ob wir den Walk dorthin in Angriff nehmen sollen oder nicht. Inzwischen ist es nämlich wieder ziemlich grau geworden und sieht nach Regen aus. Theos Mine nach zu urteilen (Runzeln und Donald-Duck-Lippen) ist mir sofort klar, dass er dem halbstündigen Spaziergang lieber entsagt. – Boy, oh boy, haben wir gut entschieden, dass wir verzichtet und uns in Auto zurückgezogen haben. Keine zwei Minuten später fängt es an zu schütten wie aus Kübeln.
Der nächste und letzte Tag bringt wieder viel Sonnenschein und ab Mitte Nachmittag Gewitter und Sturm. Aber das ist ok. Wir müssen langsam ans Packen denken.
Es fällt uns schwer, diesen Ort, das tolle Haus und unsere netten Gastgeber zu verlassen. Wir haben aber noch viel vor uns, worauf wir uns natürlich auch sehr freuen.
Unterwegs - Coffs Harbour – Byron Bay
Um halb elf verlassen wir „Seawash“, so heisst das Haus, in dem wir so gerne gewohnt haben.
Entlang dem Pacific Highway (unser Navi-Güezi nennt ihn Pazific Ha We Üpsilon) machen wir zum ersten Mal Halt in Grafton, „einem malerischen Städtchen aus dem 19. Jahrhundert mit eleganten Strassen und Flusspromenaden, bekannt für seine Jakaranda-Bäume, deren violetten Blüten jedes Jahr im Oktober ein Fest gewidmet ist“, so heisst es in unserem Führer.
Tatsächlich gibt’s im südlichen Teil des Städtchens eine Menge dieser „alten“ Häuser. Dieser Stadtteil erinnert mich an Orte in den USA, wo man sich noch immer im wilden Westen wähnt. Goldgräberartig. - Zwei, drei Pubs hat`s, bevölkert je mit ein paar Typen, die aussehen, als hätten sie die ganze Nacht dort verbracht. Kaufen kann man nicht viel, ausser man braucht grad einen neuen Sattel für sein Pferd oder ein paar Gummistiefel, eine Motorsäge, Anglerutensilien, ein paar Schrauben oder Werkzeuge beim Eisenwarenhändler. Eine Bücheraustausch-Börse gibt’s auch sowie zwei Läden mit Nippsachen, von denen ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand je auf den Gedanken kommen könnte, dort etwas zu kaufen. Um das Bild abzurunden, stehen vor den Geschäften Pick-Ups, die Farmer sind offenbar am Einkaufen. Im Grafton-Emporium, in dem ein unglaubliches Chaos von herumstehenden Möbeln herrscht, Krimskrams und vergilbten Fotos von einer Protestaktion der Graftoner Bürger gegen irgendetwas Umweltartiges, sind auch ein paar völlig verwahrloste Lädeli einquartiert, unter anderem ein Café, das allerdings alles andere als einladend aussieht. Es ist eine Art dunkle Höhle. Trotzdem bestellen wir bei der freundlichen Kellnerin nach kurzer Überlegung (wie weit müssen wir wieder fahren, bis wir ein „anständiges“ Café finden? – Wir haben ja einschlägige Erfahrungen gemacht) dann doch Kaffee und Kuchen und setzen uns draussen hin, wo’s ein paar Plastikstühle und Sonnenschein hat. So ein gutes Zitronechüechli wie dort habe ich überhaupt noch nie gegessen (ausgenommen die von Christine Ruder)!
Wir finden anschliessend doch noch das Zentrum des Städtchens (wir sind zu früh abgezweigt und landeten somit in Süd-Grafton), dort sieht‘s auf der Hauptstrasse nicht anders aus als in so manchem ähnlichen Ort: Läden, Supermärkte, Tankstellen, viel Verkehr etc., aber wenn man durch die Quartiere fährt, kommt man an wunderschönen, schmucken Häusern aus der Zeit um 1900 vorbei mit liebevoll gepflegten Gärten und prachtvollen Bäumen und Sträuchern.
Weiter geht die Reise auf dem Highway, der nicht mit unseren Autobahnen vergleichbar ist. Oft ist er nur zweispurig, manchmal hat’s auf der einen Seite einen dritten Track zum Überholen, so wie das bei uns früher auf der Strecke Lyss-Biel der Fall gewesen ist. Gefährlich also, fast immer mit Gegenverkehr.
Wir machen einen Abstecher nach Yamba, gemäss Führer „traditionelles Fischerdorf aus dem 19. Jahrhundert, wird wegen seiner gepflegten Strände immer beliebter.“ – Ein malerischer Ort am Meer, sicher ein beliebter Ferienort mit tollen Stränden, aber auch Seen- und Flussgebieten. Es ist friedlich hier, hat nur wenige Leute, ein paar Cafés, ein paar Läden (Theo kann wieder Whisky-Nachschub kaufen, Gott sei Dank), wir essen Lachs-Sushi und fahren dann weiter.
Gegen Byron Bay zu wird viel Strassenbau betrieben, es werden wohl Autobahnen entstehen ähnlich wie bei uns, man sieht Ansätze von Brücken und sogar ein Tunnel ist am Entstehen. Es ist sicher nötig, hier eine passable Strasse zu bauen, denn diese einzige Verbindung zwischen Sydney und Brisbane, die sich stolz Highway nennt, ist oft nicht mehr als eine holprige Drittklass-Strasse. Somit wird man wegen der Road Works immer wieder mal auf eine Ersatzbahn geleitet, was unser Navi-Güezi (ich nenn sie ab jetzt der Einfachheit halber Rösi) ziemlich aus der Fassung bringt. Uns aber nicht, die Umfahrungen sind jeweils gut beschildert.
Die Route führt nun „in die Berge“. Es ist ein schönes Gebiet im Hinterland von Byron Bay, grüne Weiden, ländlich. Jetzt müssen wir abbiegen, grad auf einer Anhöhe. Wir halten rasch an, um ein Foto zu machen. So ein schöner Ausblick: rechts am Horizont das Meer. Auf der linken Seite sieht man weit ins Land hinein – Hügelketten und Täler; in diese Richtung weist uns Rösi.
Häuser hat’s kaum mehr. Wir sind SEHR gespannt, wo wir landen werden. Das ist immer das Lustige dran, sich vorzustellen, wie’s dann sein wird, dort wo wir unseren nächsten Haus-Swap haben. Normalerweise sieht man ja im Internet, wie das Haus und die Umgebung aussehen, aber diesmal war’s nicht so. Julie und Ian Riches, unsere neuen Gastgeber, haben kein Inserat mehr bei Homelink. Sie kamen schon im Jahr 2008 nach Bivio, also vor sechs Jahren, als wir noch mit keiner Faser dran dachten, in Australien Ferien zu machen. Sie wohnten damals noch direkt in Byron Bay. Vor ein paar Jahren sind sie umgezogen, weil es ihnen im Ort zu hektisch wurde und sie lieber die Einsamkeit suchten. – Die hat man hier. - Glücklicherweise hatte ich ihre Email-Adresse aufbewahrt. So konnte ich sie kontaktieren.
Die Gegend wird immer verlassener, wir biegen in eine Einbahnstrasse ab, durch Wald und Wiesen, bis die Strasse nicht mehr weitergeht. Hier ist es, das Haus, wo sich der Fuchs und der Hase gute Nacht sagen. Eher das Possum und das Wallaby zwar. Das Anwesen liegt in einer Art Park, wir schätzen das Grundstück auf mehr als 10‘000 m2, mit den verschiedensten Bäumen und Sträuchern, mit Palmen, Franchipani, Strelizien, Banksia, Red Silk Cotton Trees und so weiter. Es ist wunderschön. Gesäumt wird der „Garten“ von einem Wald, Nachbarn sieht man keine. Wir werden herzlich begrüsst von Julie; sie zeigt uns das Haus, sagt, wo was zu finden ist, wie was funktioniert, es ist easy. Natürlich habe es an so einem Ort auch Tiere, laute zum Teil, vor allem des Nachts. Ein Possum wohne grad da in der Palme, es liebe es halt, übers Blechdach zu rennen. Schlangen habe es nur selten. Sie hätten erst viermal eine gesehen, seit sie hier wohnten. Ja, doch, ziemlich giftige. Aber no worries, no worries. Da passiere sicher nichts, man müsse halt sonst Emergency anrufen: „000“. - Sehr beruhigend zu wissen! – Die sind sicher schnell vor Ort, kann ich mir vorstellen.
Gegen sechs kommt Ian heim von der Arbeit, es gibt Apéro und Julie bereitet ein leckeres Nachtessen zu. Lachs, Spargelsalat und zum Dessert Erdbeeren. Es ist ja schliesslich Frühling. - Es wird ein vergnüglicher Abend. Sie beide sind ganz ähnlich wie unsere anderen australischen Homelink-Freude, die wir bisher haben kennen gelernt: grosszügig, nett und völlig unkompliziert und es kommt uns vor, als würden wir uns schon lange kennen (nur von den Emails, die wir damals und jetzt ausgetauscht haben. Gemeinsamkeiten: Wir haben beide Zwillinge im ähnlichen Alter, a boy and a girl). Sie erzählen uns von Bivio und wie sehr es ihnen dort gefallen hat. Julie hat damals zum ersten Mal Schnee gesehen. Unvergesslich für sie - wir sehen all die Schneefotos im Album. Ein Schnee-Bivio-Foto hängt in einem Rahmen über dem Esstisch.
Coorabell und Byron Bay
Julie und Ian fahren am nächsten Morgen sehr früh weg; wir sehen sie nicht mehr. Sie fliegen für zwei Wochen nach Tasmanien in die Ferien und überlassen uns ihr Heim. Ihre Koffer sind schon gepackt. Unsere packen wir aus.
Es wäre eine Oase der Stille in der Nacht, wären da nicht all die nachtaktiven Tiere und Theo, der mit seiner Motorsäge neben mir liegt.
Das Tosen der Brandung haben wir jetzt ausgetauscht mit dem ohrenbetäubenden Quaken der giftigen Kröten, dem Gezirp der Grillen, den anderen Lauten, die ich nicht zuordnen kann. Gegen Morgen Vogelgezwitscher und es kommt ein Specht dazu. Ich bin sicher, er hat einen Hammer oder sonst ein schweres Werkzeug dabei, um den Baumstamm zu bearbeiten. Ich hör auch das “Crybaby“, einen Vogel, der diesen Namen nicht zu Unrecht erhalten hat. Wenn mir Julie nicht davon erzählt hätte, wäre ich drauf und dran gewesen, das arme Kind im Wald zu retten.
In der Nacht hat es stark geregnet, jetzt ist der Morgen hell und klar. Nachdem Theo aufgestanden ist, machen wir eine Einkaufsliste, die wir dann allerdings zu Hause vergessen, und fahren ins nächste Dorf zum Einkaufen. Wir wohnen hier in Coorabell, so heisst es auf der Karte, aber das ist nur die Bezeichnung, eine Art Flurnamen. Hier findet man weder einen Laden noch ein Café, einen Pub oder eine Bar. Alle paar hundert Meter verbirgt sich hinter Bäumen ein Einfamilienhaus oder eine Farm. Die sehen alle ähnlich aus, mal grösser, mal kleiner, man hat den Eindruck, sie seien aus weissen Fertigelementen zusammengebaut mit einem grünen Blechdach als Abschluss. Kühe und Pferde hat’s, die Gegend erinnert uns an England. Nur vereinzelte Palmen vermasseln einem die Illusion. Ein paar Kilometer weiter weg ist Possum Creek, dort gibt’s wenigstens ein Restaurant. „Lilian’s“ (nur Breakfast und Lunch). Zum Einkaufen müssen wir nach Bangalow. Bangalow ist ein reizendes Dorf; es hat ausgesucht schöne (teure) kleine Läden dort, Restaurants und Cafés. So richtig zum Sich-wohl-Fühlen. Wir frühstücken, kaufen im Supermarkt ein und erstehen beim freundlichen Metzger – dessen Slang zu verstehen ich total Mühe habe, Theo versteht kaum ein Wort - zwei tolle Steaks für fast gar nichts. Wir dachten, es koste 40 $, auf der Quittung sind’s dann nur 14. Wie er hört, dass wir aus der Schweiz kommen (wegen unseres seltsamen Akzents), kommt er kaum mehr aus dem Schwärmen heraus, wie schön es dort sei. Die Wurst, für die sich Theo interessiert, legt er uns noch gratis dazu.
In einer der Boutiquen finde ich eine Second-hand-Abteilung. Angeschrieben steht: „Pre-loved“ – was für ein einfühlsamer Ausdruck!
Zu Hause geniessen wir den schönen Ort, an den es uns hier verschlagen hat. Ich schreibe ein bisschen, Theo liest und setzt sich mit dem Land, der Flora und Fauna auseinander. Er liest in Bill Bryson’s „Down Under“, muss oft lachen und erzählt mir immer wieder Episoden aus dem Buch, das ich ja auch gerade erst gelesen habe. Soeben fragt er mich, ob männliche Kamele auch einen Beutel hätten. ????? „Kängurus meinst du wohl?“ „Ja“ - „Nein, nur Seepferdchen…“
Zum Nachtessen am ersten Abend fahren wir nach Mullumbimbi (ich liebe den Namen). Der Slogan des Ortes lautet „The biggest little town in Australia“. Es wird davon ausgegangen, dass der Name von denBunjalung-Aborigines stammt, welche das Gebiet ursprünglich bewohnten. Übersetzt bedeutet der Name des Ortes demnach in etwa: „kleiner, runder Hügel“ und scheint sich daher deutlich auf den Mount Chincogan zu beziehen, welcher mit einer Höhe von 308 m „über den Ort wacht“.
Wir essen in einem japanischen Restaurant, dem „Izakaya“, das uns Julie und Ian empfohlen haben. Mega gut war’s! Den japanischen Kellner können wir zwar noch schlechter verstehen als den australischen Metzger, aber seine Lieblingsfloskel, „you guys“ ist gut im Gewaschel erkennbar („hungry, you guys?“, „liked it, you guys?“).
Die Heimfahrt (ca. 20 Minuten) gestaltet sich eher harzig und beschwerlich. Kaum sitzen wir im Auto, beginnt es sintflutartig zu regnen. Die Strassenschilder sind fast nicht mehr zu lesen, und weil es wegen der Strassenbauarbeiten lauter Umleitungen hat, wird auch Rösi ganz konfus, will uns immer wieder ins Abseits lotsen und beharrt auf Ausfahrten, die schlicht nicht vorhanden sind. Wir ignorieren sie, wie sie dann aber sagt: „Biegen sie in zweihundert Metern in die Strasse Kol Amon Es-zenik Doktor“ (Coolamon Scenic Drive), wissen wir, dass wir auf dem rechten Weg sind. Jetzt geht’s nur noch 5 km bis zur Abzweigung der Lofts Er De. Jedenfalls sind wir recht froh, unversehrt zu Hause anzukommen, dort, wo es heisst: ROAD ENDS.
In Byron Bay gibt’s vor allem zwei Dinge, die man unbedingt gesehen haben muss, nämlich den Strand beziehungsweise die kilometerlangen Beaches, die man ja gar nicht nicht sehen kann und dann den Leuchtturm. Er ist besonders gefällig, weil er auf einer hohen Klippe steht, am alleröstlichsten Punkt des Kontinents.
Die Aussicht ist fantastisch, man sieht von oben her auf die unendlich langen Strände und den Küstenstrich.
Byron Bay ist ein schmuckes, lebendiges Städtchen, ganz anders als Coffs Harbour, wo wir fanden, es gäbe gar kein richtiges Zentrum.
Hier ist’s ganz hippyhaft, man sieht viele junge Leute mit farbigen Kleidern, gelb-grüne Haare sind wohl grad in Mode, schön gestylt (hatten wir das nicht schon mal?), Andreas Thiel würde hier nicht sonderlich auffallen. Eine Gitarre in der Hand macht sich auch gut, Thongs (Flip-Flops) an den Füssen gehören selbstverständlich dazu, Tatoos sowieso. Hat’s uns ins Jahr 1968 zurückversetzt? - Ein Backpacker-Ort. - Es ist eine lässige Stimmung. Viele haben noch ihr Surfboard dabei, man kommt ja schliesslich grad vom Strand. – Dort waren wir auch, klar doch, es ist trotz der Hitze angenehm, weil stets ein starker Wind weht, der die Windsurfer im Höllentempo vorbeiflitzen und uns kaum das Strandtuch positionieren lässt, weil alles, was wir nicht fest im Griff haben, weggeblasen wird.
Ein Spaziergang durch den Ort, ein Bier und Ringli (Calamares wie im Almadraba-Büchtli) im ersten Stock eines Restaurants mit Aussicht aufs pulsierende Stadtzentrum – easy life. Im Hinterland ziehen wieder dunkle Wolken auf, wir beschliessen, heimzufahren. Und wieder giesst’s wie aus Kübeln. Es dauert nur eine Viertelstunde, bis wir daheim sind. Denken wir. Da haben wir die Rechnung ohne Rösi gemacht. Sie hat sich heute etwas Besonderes für uns ausgedacht, damit wir die Sintflut noch ein wenig länger geniessen können: Sie hat eine Strecke herausgetüftelt, die gesperrt ist und wir kennen den Weg noch nicht gut genug, um sie zu ignorieren. Der Umweg, den wir daher fahren müssen, beträgt ca. 20 km auf einer engen, schlecht ausgebauten Strasse. Rösi versucht uns ständig zur Umkehr zu bewegen, sie besteht beharrlich auf der NO THROGH ROAD, der Regen prasselt aber jetzt so stark auf die Windschutzscheibe, dass wir sie gar nicht mehr hören. - Ich hab manchmal fast Zustände, weil Theo dermassen weit links fährt, dass er oft die Löcher am Pflasterrand so trifft, dass zusätzlich zum Regen riesige Wasserfontänen an die Frontscheibe spritzen, und das vor allem dann, wenn ein Auto entgegenkommt. Dort, wo der Asphalt aufhört, kann man sowieso nie sicher sein, ob nicht sogar ein Graben oder mindestens ein paar rechte Dellen vorhanden sind. Es kommt dazu, dass mir Theo kurz vor Abfahrt gesagt hat, unser Mietauto habe ziemlich schlechte Reifen, fast ohne Profil, wenn es also regne, müsse man besonders aufpassen. Kommt weiter dazu, die Strasse ist flutgefährdet, immer wieder hat es Schilder, die vor Überschwemmung warnen. Es scheint nicht, als ob er sich selber noch an seine Aussage erinnert. Er fährt meiner Meinung nach (die verkünde ich auch lautstark) viel zu schnell und manchmal noch dazu mit nur einer Hand am Steuer. – Wie wir endlich doch noch zuhause ankommen nach etwa vierzig Minuten, sagt er, ich hätte ihn an seine Mutter erinnert, die jeweils vom Hintersitz aus seine Fahrweise kritisiert hatte (sie hat nie einen Führerschein besessen, und ich erinnere mich, dass sie in jeder Kurve gesagt hat „Pass auf“ und auch sonst während der ganzen Fahrt jede Ampel, jeden sich nähernden Fussgänger und jede Querstrasse erwähnte, die sie von ihrer Position aus sehen konnte – meistens bereits im Nachhinein. Theos Gelassenheit in solchen Situationen und/oder seine Fähigkeit einfach nicht hinzuhören, habe ich damals bewundert). Sie habe aber, wenn’s richtig schwierig wurde, jeweils zur Beruhigung ein paar Tropfen Koramin eingeworfen. – Die fehlen mir!
Kein Wunder ist die Gegend hier so schön grün, wenn’s immer so stark regnet gegen Abend. Für beziehungsweis gegen Buschbrände natürlich die beste Medizin.
Am Samstagmittag haben wir mit Leanne und John Watson (unsere Haustausch-Freunde aus Coffs Harbour) in Newrybar im Restaurant „Harvest Café“ zum Mittagessen abgemacht. Sie sind auf einer Biketour in der Gegend und dachten, wir könnten uns doch hier treffen, da wir ganz in der Nähe wohnen. Sie haben einen Freund mitgebracht, der ebenfalls mit von der Partie ist beim Velofahren und wir verbringen zwei gemütliche Stunden zusammen in diesem hübschen Restaurant bei sehr feinem, aber recht teurem Essen. Marius ist Südafrikaner, wohnt mit seiner Familie in Coffs Harbour und arbeitet als Solicitor in Johns Anwaltsfirma. – Ob sich da ein neuer Haustausch anbahnt? Seine Familie hat eine grosse Farm in Südafrika und ihn würde es sehr interessieren, Ferien in Bivio zu machen. – Mal sehen…
Da ist was los, in Byron Bay am Samstagabend. Es wimmelt von jungen Leuten, gute Stimmung herrscht. Aus heiterem Himmel kommt ein orkanartiger Wind auf, alles Mögliche wirbelt durch die Luft - urplötzlich steht da eine schwarze Wolkenwand, wir können grad in den nächst besten Hauseingang flüchten (Ozy Mex-Snackbar), schon beginnt ein Hagelsturm, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Innert Sekunden prasseln die Eisstücke wie aus einem Guss mit einem Höllenlärm auf den Asphalt, der Verkehr steht still, die nussgrossen Hagelkörner bedecken die ganze Strasse und um den Kreisel fliesst ein weisser Fluss wie eine riesige Schneedecke, etwa 10 cm hoch. Wer noch nicht in Deckung ist, presst sich an die nächste Häuserwand, ein junger Mann lässt sein Sixpack Bier mitten auf der Strasse fallen, Bier und Glassplitter vermischen sich mit dem Hagelregen, die Girls im Ozy Mex vesuchen, mit Handtüchern das Wasser, das ins Lokal fliesst, zu stoppen – ein Chaos. Der Spuk dauert etwa eine Viertelstunde, dann regnet’s nur noch. Auf den Strassen liegt ein weiss-grüner Teppich, von den Fichten sind haufenweise Äste und Zweige abgebrochen, wir gehen barfuss zum Auto. Die Strassencafés, wo’s gerade eben noch so laut und lustig zuging, sind leer gefegt, nasse Gestalten drücken sich an die Hausmauern, es ist ein seltsames Schauen.
Ein kurzer Einkauf noch im Supermarkt, bei einem Stromausfall wird’s einen Moment lang stockdunkel (goldige Zeiten für Shoplifters…), dann geht’s heimwärts. Rösi legt uns nicht mehr rein dieses Mal („Los nid uf di Geiss!“, weise ich Theo an). Wie kennen nun den Weg.
Von einem der Häuser auf einem Hügel vis-à-vis in ein paar hundert Metern Entfernung dringt laute Musik zu uns rüber. Da ist wohl jemand dran, eine Riesenparty zu veranstalten. Wir kümmern uns nicht weiter, gehen gegen Mitternacht ins Bett mit den hektischen Rhythmen der heissen Musik. Bis um vier Uhr morgens dauert die Unterhaltung. Ich frage mich schon, wann die endlich zusammenbrechen dort drüben. – Und weiter geht’s um halb sieben am nächsten Morgen. Ich fasse es nicht. Sind die nie müde? Uns stört’s zwar nicht, Theo schläft sowieso, (hoffentlich stört er sie nicht…) und ich hab ja Ferien. Gegen neun stoppt die Musik, kurz darauf kommt eine Nachbarin vorbei und fragt, wie’s uns gehe, ob wir hätten schlafen können. „No worries, no worries“, sage ich, „jemand wird ja einen triftigen Grund zum Feiern gehabt haben“. - Sie habe die Polizei kommen lassen, sagt sie, jetzt gehe es ihr zu weit. Diese Festereien kämen mindestens einmal pro Monat vor und sie habe nun genug davon. – Eine halbe Stunde später ist die Musik wieder auf voller Lautstärke zu hören. Aber jetzt ist es ja Tag und tagsüber ist es kaum verboten, Musik zu machen. – Zum Glück sind Nachbarsstreitigkeiten nicht unser Problem. Es gibt sie offenbar überall, auch hier, wo man so weit auseinander wohnt. Wer hätte das gedacht…
Der Sonntag bringt wieder sonniges Wetter, jedenfalls am Anfang. Gegen Mittag fahren wir in die Stadt, wo ein allwöchentlicher Markt stattfindet, ein Handwerkermarkt, wo man aber auch Gemüse und Früchte kaufen kann, es genügend Verpflegungsstände gibt, wie sie eben so sind, diese Märkte: farbig, farbig, farbig. In den Strassen in Byron sind die Leute am Aufräumen. All die Äste müssen weg, es sieht fast wieder aus wie vor dem Sturm. Auf dem Marktgelände ist’s auch fast überall trocken, erstaunlich, wie rasch die Normalität wieder eingekehrt ist. Wir verleben zwei vergnügliche Stunden, schauen uns die bunten Stände und Leute an, essen feine Crèpes und hören zwei Bands zu, die sehr gute Musik spielen – eine davon eine südamerikanische, die andere eine Schülerband. So vergeht die Zeit rasch. Wir treffen Leanne und John nochmals, sie haben ihre Biketour hinter sich, wir gehen zusammen ins Byron Bay Hotel, wo man sich offenbar trifft und steigen ins Apéro. Da beginnt es wieder zu regnen. Allmählich sind wir’s gewohnt. Aber diesmal sieht‘s eher nach Dauerregen aus, nicht nach einem Gewitter wie bisher üblich. Die Watsons nehmen ihren 250-km Weg nach Coffs unter die VW-Bus-Räder, wir fahren nach Hause nach Coorabell. Die Musik hat aufgehört, alles ist friedlich. Zwei wild gewordene Hühner flitzen vor unserem Auto durch. Ich sehe sie jeden Tag; es scheint ihr Spiel zu sein, wie die Irren hintereinander herzurennen, fliegen können sie nur schlecht, ihr Spurt sieht völlig komisch aus. Sie erinnern mich an unsere „Haustier“-Hühner in Antwerpen. Sie drehen Kreise im Gelände und kommen immer wieder vorbei. Theo möchte sie filmen, die beiden sind aber viel zu schnell, so gelingt das nicht. Es handelt sich um ganz spezielles Federvieh, schwarz mit gelben Hälsen und roten Köpfen. Es sind Buschhühner, die zur Gattung Grossfusshühner gehören, hat mich das Internet gelehrt. Sie werden bis zu 75 cm gross.
Im Strauch neben unserem Esstisch hat sich ein anderer Vogel niedergelassen. Er hat offensichtlich keine Angst oder keinen Respekt vor uns. Er sieht prächtig aus. Nicht grösser als eine Taube, es muss ein Papagei sein: grünes Gefieder, gelber Kragen, blauer Kopf, roter Schnabel, gelbe Brust mit einem rot-orangen Lätzli. Die Farbigkeit ist fast zu viel des Guten. Was hat sich da die Natur bloss ausgedacht? Ich glaube, er weiss, dass er eine Schönheit ist, so keck und selbstbewusst schaut er in die Welt hinaus. Es ist ein „Allfarblori“, wie ich grad lese.
Von Byron Bye nach Brisbane
Die letzten 200 km auf dem ersten Teil userer Australienreise, eine herrliche Fahrt durchs Hinterland, sind geschafft. Unterwegs besuchten wir den Springbrook – Nationalpark, den Hinze-Damm und den Ort Surfers Paradise an der Gold Coast – ein völliger Szenenwechsel. Vom Land in die Stadt, von Natur pur zu Beton nur (nein, natürlich nicht ganz, nur des Reimes wegen – Beaches ohne Ende hat’s ja auch hier wie überall).
Brisbane
Kurz vor unserem Ziel kommen wir zwar in einen grossen Verkehrsstau, aber Rösi führt uns geradewegs dorthin, wo wir für die nächsten sechs Tage wohnen werden.
Die Stadt gefällt uns ausserordentlich gut, sie hat eine ganz speziell gefällige Atmosphäre. Alles ist sauber, die Leute sind sehr freundlich und hilfsbereit; so richtig zum Wohl-Fühlen. Man kann sie auf äusserst praktische Art besichtigen, der öffentliche Verkehr ist bestens ausgebaut. Rasche Fährschiffe (Katamarane), die sogenannten City Cats, verkehren regelmässig und mit hoher Frequenz von einem Anlegeplatz zum andern hin und her an beiden Seiten des breiten Brisbane River. Die eine Schiffslinie, die City Hoppers, sind sogar gratis. Dazu hat’s massenhaft Busse, die ganze Strassen und Tunnels nur für sich alleine haben, so dass sie effizient vorwärtskommen.
Es gibt haufenweise trendige Restaurants, viele davon schön am Flussufer gelegen, man könnte während Wochen jeden Tag wo anders essen, ohne dass es einem verleidet.
Wir wohnen in einem Aussenquartier, in einer ruhigen Nebenstrasse, der Heidelberg-Street (diesmal hatte Rösi keine Probleme mit der Aussprache), die Busstation ist direkt vor der Haustüre, zur Schiffsanlegestelle geht’s 400 Meter weit zu Fuss. In einer guten Viertelstunde sind wir also mitten in der Stadt. Einkaufen können wir bei „Spar“; der ist gleich um die Ecke. Ja, so haben wir auch hier ein easy Life, alles ist bestens, uns fehlt’s an nichts!
Erstaunlich, wie nett die Leute überall sind. Begegnet man jemanden beim Vorbeigehen auf der Strasse oder auch an der Bushaltestelle, wird man sehr oft gegrüsst, grad so wie das bei uns in den Dörfern noch üblich ist. Und das in einer Grossstadt - sehr sympathisch! Manchmal gibt’s sogar ein kleines Gespräch, meistens übers Wetter (Überbleibsel aus dem Englischen Erbe? - Smalltalk natürlich, aber wieso auch nicht?), an der Kasse im Supermarkt sowieso, auch sonst in den Geschäften, und dort sogar in der Innenstadt.
Unsere Homelink-Partner wohnen im selben Haus im ersten Stock, wir haben eine Wohnung für uns allein im Parterre. Kay und Lauie (Lorenz) Topping sind viel auf Reisen unterwegs, jedes Jahr für drei Monate in Europa. Gleich nach der Begrüssung liess Lorie uns wissen, dass sie beide nicht Skifahren könnten, aber SKI doch wichtig für sie sei, nämlich: „Spend (your) Kids Inheritance“. - Ja, das leuchtet ein, wir sind genauso am Üben, das Erbe unserer Kinder zu verprassen. Die beiden sind im Mai 12 bei uns in Bivio gewesen, es ist also ein weiterer Haustausch, den wir noch zugute haben, jetzt also beziehen.
Im Brisbane-Fluss kann man nicht baden (es habe kleine Flusshaifische, erzählt man uns), es gibt aber einen „man-made“ Beach im Gebiet der South Bank mit feinem weissen Sandstrand, gepflegten Wiesen und ziemlich grossen Poolanlagen - gar nicht mal so schlecht. Als ich vor sechzehn Jahren zum letzten Mal hier war, hiess der Strand „Kodak-Beach“, jetzt geht es denen nicht mehr so gut (wer kauft noch Filmrollen?), so hat der Sponsor halt gewechselt und die Anlage heisst „Streets-Beach“, genannt nach einer Eiscrème-Marke. - Mit unserer Aare und dem Marzili natürlich nicht vergleichbar. Wir Berner wissen ja, etwas Schöneres gibt es nicht. (Ich hab übrigens einen unterhaltsamen Link zum Aarebad im Internet gefunden, vielleicht interessiert’s jemanden; es war ein TV-Beitrag der BBC. Der Link: www.youtube.com/watch?v=hly8NG3y-vE">www.youtube.com/watch?v=hly8NG3y-vE).
Brücken über den Fluss hat es unzählige, so scheint mir. Und es werden noch neue gebaut. Einige sind für Fussgänger nur, andere für Autos und Busse. Mit der Fähre fahren wir von einer Endstation zur anderen (knapp anderthalb Stunden) und bestaunen vor allem auch die Gateway-Bridge, von der unser Freund Franz Fischli erzählt hat. Er war 1980 beim ersten Spatenstich dabei, seine Firma „Bouygues“ hat damals die Vorspannarbeiten zum Bauwerk geliefert. Die Brücke ist imposant, schön geschwungen, war damals die längste ihrer Art und jetzt, wenn man genau hinsieht, hat man das Gefühl, man sehe doppelt (mitten am Tag), denn gleich hintendran ist eine exakt gleiche Brücke gebaut worden (seit drei Jahren im Betrieb); die beiden verbinden jetzt stereo zwei Vorstatteile miteinander.
Das ganze Gebiet von South Bank, es wurde im Jahr 1988 für die Weltausstellung ausgebaut, mahnt mich an London, und wohl nicht nur mich. Alles ist ähnlich wie das Südufer der Themse, Theater und Museen findet man dort, lauschige Wege zum Spazieren – ja, und sogar das London-Eye fehlt nicht, das Riesenrad, von wo aus man einen sensationellen Blick über die Stadt hat. Nur wissen sie es hier nicht so effizient zu propagieren wie in England; ein „Ride“ kostet nur halb so viel und niemand steht Schlange, die Kabinen sind halb leer. In London steht man gut und gern eine Stunde an, wenn man sein Ticket nicht vorher per Internet bestellt hat. Auch so muss man mit einer halben Stunde Wartens rechnen. Hier aber nicht.
So ist das „Mutterland“ England überall noch spürbar. Auch die schachbrettartig angeordneten Strassen sind nach Königin Victoria und ihren Kindern benannt, die Nord-Südstrassen nach ihren Töchtern, die Ost-West-Tangenten nach ihren Söhnen.
Zurück zur Innenstadt: In South Bank hat’s etliche schön gelegene, trendige Restaurant mit tollem Blick auf den Fluss und die gegenüberliegende Skyline. Dort aber einen Platz zu finden an einem Samstagabend ist fast aussichtslos. Dies gelingt uns aber dennoch nach etlichen Pleiten, mit der Auflage allerdings, den Platz bereits um halb acht Uhr zu räumen. Na ja, wir sind schon lange unterwegs, haben Museen besucht, es sieht sowieso nach Regen aus und hungrig sind wir auch. – Einmal mehr muss ich sagen, wir essen super fein, Entenbrust vom Zartesten, Risotto vom Schmackhaftesten, Gemüse vom Leckersten. Ich muss bei Gelegenheit im Internet nachschauen, was das für Gemüse sind, die da auf dem Teller liegen. Nach einem kurzen Spaziergang entlang der Promenade nehmen wir die Fähre. Die Heimfahrt ist ein besonderes Erlebnis. Obwohl noch nicht sehr spät, ist es tief dunkel, die Stadt ist überall schön beleuchtet (fast kitschig teilweise), die Story Bridge wechselt alle paar Sekunden ihre Lichterketten von Gelb auf Orange, Rot, Blau, Grün, Violett, Weiss - grad wie ein Regenbogen. Auf dem Boot weht ein Wind, endlich, es ist nämlich sehr heiss und schwül und das Besondere: Rings um uns herum blitzt und wetterleuchtet es immer stärker, sekundenweise wird es taghell; es muss ein Riesengewitter im Anzug sein. Die City Cat legt bei Mowbray Park an, wir müssen aber noch rasch Weinnachschub kaufen gehen (der Bottle-Shop hat bis spät in die Nacht geöffnet). Erledigt. Wir schaffen’s grad bis zum Spar, dann fängt es an zu regnen. Nur noch einhundert Meter bis zur Haustüre. Das aber schaffen wir gerade nicht, die kurze Strecke langt und wir werden durch und durch nass. Zum Glück ist’s ein warmer Regen und schliesslich sind wir ja wasserdicht.
Zoo
Etwas vom Besten, was wir in Brisbane erlebt haben, ist „Lone Pine Koala Sanctuary“, eine Art Tierpark im Süden der Stadt, wo man all die Tiere sehen kann, die man sonst eventuell verpasst (zum Teil weil sie nachtaktiv sind und wir nicht mehr so sehr, jedenfalls nicht in ihrem Lebensraum) oder weil sie in einem andern Teil dieses „Sunburned Country“ zu Hause sind.
Die Koalas sind zum Todlachen. Es gibt im Park etwa hundert Stück davon und alle sind total müde. Unglaublich, wie die in den Baumgabeln sitzen oder darin herumhängenhängen, wie’s grad kommt, und nichts als dösen. (Wieso nur kommen mir diese Tiere so bekannt vor?) Nur ganz selten ändert eines seine Stellung, nur um gleich weiterzuschlafen. Wenigstens schnarchen sie nicht. Ein Einzige sehen wir in Bewegung. Das sieht sehr seltsam aus. Sich bewegen ist ganz offensichtlich nicht so sein Ding. Ich habe den Eindruck, es leidet an Gsüchti oder hat sich zu lange im Pub aufgehalten. Weil man so nah an sie herangehen kann, sieht man auch, dass sie ganz weiche Füdli haben. Wie ein Windelpack. Das brauchen sie – klar - einfach, sich das vorzustellen. Jedes Hinterteil ist zudem weiss gefleckt, eines mehr, eines weniger. Daran und an ihren unterschiedlichen Gesichtern würde man sie gut auseinanderhalten können, erklärte die Rangerin, namens Kerry. Nebenbei bemerkt: Jedes Tier dort hat einen Namen. Auch die Schlangen. – An Flucht denken Koalas übrigens gar nicht, nicht einmal im Traum offenbar – ihre Gehege sind nämlich nicht eingezäunt. Sie könnten sich also ohne weiteres aus dem Staub machen, aber dazu sind sie eindeutig zu faul. Und sowieso auch, was soll’s? Sie haben lauter nette junge Damen um sich herum, die ihnen täglich frische Stauden Eukalyptus servieren, frei Haus, und dazu noch den Kot wegputzen. Theo ist begeistert von ihnen (ich meine hier jetzt die Tiere). Ihn dauert es nur, dass sie möglicherweise im Schlaf gestört werden von den Rangerinnen, die zweimal am Tag mit Mikrophonen (!) den Parkbesuchern über diese putzigen Beuteltiere berichten und Auskunft geben. Ich erkenne allerdings keinerlei Anzeichen, dass irgendeiner der herumhängenden Koalas sich durch diese Aktion stören lassen würde. Wahrscheinlich sind auch ihre Ohren schlaff. - Wir vernehmen, dass die Tiere 18 – 20 Stunden pro Tag schlafen – und sind absolut beeindruckt.
Diese Schlaferei scheint ansteckend zu sein. In einem grossen Gehege, einem Park, hat’s dutzende von Kängurus. Auch die liegen herum und lassen sich streicheln und füttern.
Theo legt sich gleich dazu, schliesslich ist er schon seit ein paar Stunden auf.
Wir sehen Wombats; auch die haben so gepolsterte Hinterteile; eines der Tiere wird an der Leine von seinem Wärter spazieren geführt. Sehr komisch. Ob ihm das gefällt? – Ich glaube, so wie es unmutig hinterherschleicht - auch es möchte lieber schlafen.
Wir besuchen das Gehege der Tasmanian Devils, die gerade gefüttert werden. Es sind kleine Allesfresser; sie komme mir vor wie überdimensionierte Ratten, die ziemlich grässliche Zähne haben und ihre Beute, meistens Kadaver, mit Haut, Knochen und Haaren fressen und verdauen können. Die scheinen mir eindeutig weniger müde zu sein.
Der stolze Cassowary, ein flugunfähiger Laufvogel, ist ebenfalls ein äusserst dekoratives Fotomotiv mit seiner eigenartigen Haube auf dem Kopf, seinem blauen Hals, dem roten Kragen, dem schwarzen Gefieder und seinem selbstbewussten Gehabe. Er ist ähnlich wie ein Emu, nur wenig kleiner. Ihn allenfalls in der Wildnis zu treffen, würde jedoch nicht sehr viel Spass machen - auch wenn der Mensch natürlich nicht unbedingt auf seiner potentiellen Futterliste steht – der eigenartige Vogel hat an seinen Füssen messerscharfe giftige Kanten, mit denen er seine Beutetiere erheblich verletzen kann. So gehört es sich für Australien. Wer in der Tierwelt etwas auf sich hält, ist giftig. Von den Schlangen ganz zu schweigen. Der Inland Taipan kann seine Farbe wechseln und wird folgendermassen beschrieben: „Er ist etwa 50mal giftiger als eine Indische Kobra und 650–850 mal giftiger als eine Diamant-Klapperschlange und damit auch die giftigste bekannte Giftschlange der Welt. Die bei einem Biss durchschnittlich abgesonderte Giftmenge reicht theoretisch aus, um über 230 [bei voller Giftdrüse bis zu 250] erwachsene Menschen, 250‘000 Mäuse oder 150‘000 Ratten zu töten.) – Ziemlich effizient, scheint mir. Wieso er’s aber so übertreibt, ist schleierhaft. Er braucht ja wohl pro Mahlzeit kaum mehr als eine Ratte aufs Mal zu verspeisen.
Giftdrüsen hat auch der Platypus, das seltsamste Tier, von dem ich je gehört oder gelesen habe. Er ist ein Säugetier, Schnabeltier auf Deutsch, das Eier legt. Den in der freien Natur zu sehen, ist sehr schwierig, lebt er doch in Flüssen, teilweise unter Wasser, ist extrem agil, aber scheu und nicht viel grösser als eine ausgewachsene Forelle. Seltsamer Vergleich, aber einen Vergleich zu finden, ist nicht gerade einfach. Das Tier hat eine Art Entenschnabel, hinten sieht’s eher aus wie ein Biber, hat wie ein Delphin oder eine Fledermaus eine Sonareinrichtung, um seine Beute zu orten und (natürlich) giftige Drüsen an seinen schaufelartigen Füssen oder Flossen. Auch diesen bizarren Kreaturen kann man gut zusehen im Park. Dafür ist eigens ein verdunkeltes Aquarium eingerichtet. Sie flitzen pfeilschnell durchs Wasser und manchmal ist man nicht ganz sicher, was ist vorne und was ist hinten. – Bizarre Wesen!
Ebenfalls kann man zusehen, wie ein Schäferhund eine Schafherde zusammentreibt und bestens im Griff hat. Zweimal täglich wird zudem demonstriert, wie ein Schaf geschoren wird. – Ziemlich schlimm, finden wir. Das arme gestresste Tier, ohnmächtig seinem Peiniger (oder Wohltäter? – es ist ja heiss und wird immer heisser und mit dem Wollmantel…) ausgeliefert, wird in Minutenschnelle vom Wollknäuel in ein weisses, nacktes Etwas verwandelt.
An Theos Geburtstag muss der Arme bereits um halb acht aufstehen, weil Kay und Lorie uns eingeladen haben, mit ihnen eine Stadtbesichtigung zu machen und uns Orte zu zeigen, wo wir noch nicht waren. Anschliessend wollen sie am Fluss ein BBQ organisieren. Der Stadtbummel ist sehr informativ, wir sehen und erfahren viel Neues, was nicht im Führer steht. Gegen Mittag dann gehen Theo und Lorie das ehemalige Büro von McArthur besichtigen und wir Frauen schlendern über den Riverside-Market. Dann hat Theo offenbar die gute Idee, sich die Haare schneiden zu lassen, am Geburi kann man ja tun und lassen, was man will, so kehren Kay und ich ein wenig früher nach Hause zurück als die Männer, weil wir ja nicht warten wollen und es dann immer noch früh genug ist, Theos Coup zu besichtigen. Kaum sind wir daheim, beginnt es in Strömen zu regnen, Theo und Lorie schaffen’s zwar auch grad noch, aber weil’s zu hageln beginnt, will Theo unbedingt unser Auto mit einer Plache zudecken. Er ist so besorgt um den armen Toyota, seitdem diesem in Byron Bay vom Hagel so übel mitgespielt wurde (auf diese paar Hageldellen mehr käm‘s nun auch nicht mehr drauf an, finde ich). Jedenfalls sind die beiden „pflotschnass“ und müssen erst ihre Kleider wechseln. Mit dem River-BBQ ist’s halt dann nichts, obwohl schon kurz nachher die Sonne wieder scheint, aber der Boden ist ja immer noch nass. So gibt‘s den Geburtstags-Lunch stattdessen auf der Terrasse, auch nicht schlecht, mit der Skyline von Brisbane im Hintergrund, im Vordergrund und zum Glück in Reichweite feine Steaks, Salate und Wein aus dem Barossa-Valley.
Flughunde
Dann aber ist es Zeit für Theo, sich in die Horizontale zu begeben. – Eine halbe Stunde später finde ich, es reicht jetzt und wecke ihn. Da gibt’s noch einen Spaziergang, den wir machen wollen zu einem Flussarm in der Nähe, wo wir wohnen, Heim von Tausenden von Flying Foxes oder Fruit Bats, so genannt, weil sie beim Einnachten in Scharen ausfliegen und alles kahlfressen, was ihnen an Früchten oder Gemüsen „über den Weg läuft“. Unser Ausflügli artet in einen enorm ausgedehnten Verdauungsspaziergang aus, es dauert fast zwei Stunden, bis wir zurück sind. Was wir an diesem Creek sehen, löst gemischte Gefühle aus. Man hört und sieht die Tiere schon von weitem, sie sind bereits in Scharen unterwegs auf Nahrungssuche, alle fliegen mit ihren Batman-Mänteln weit ausgespannt in die gleiche Richtung. Erinnerungen an Horrorfilme werden wach, eine ganze Armee überliegt uns. Zudem machen sie ein erbärmliches Geschrei, ein paar Krähen halten tüchtig mit. Nur wenige Tiere hat es, die noch in den Bäumen hängen und sich erst noch für den Abflug wappnen. Auch die sind komisch anzusehen, wenn sie ihren Mantel zusammenfalten und da so herumhängen, quasi down under. Wie wir heimkommen, ist es bereits dunkel. – Theo bastelt an unserem Blog weiter, es scheint eine Never-ending-Story zu werden, aber diesmal nicht wegen der langen Texte, sondern weil’s wieder mal mit dem Heraufladen nicht klappt, irgendetwas hat er da völlig verkorkst; das System weigert sich nun konstant mitzumachen; es stürzt lieber ab.
Um neun Uhr beschliessen wir dann doch noch, etwas essen zu gehen, schliesslich ist es ja Theos Geburtstag. Auf halbem Weg (beim Spar) merke ich, dass wir vergessen haben, den Wein mitzunehmen. Also gehen wir zurück, holen ihn und unternehmen einen zweiten Versuch, in unserem Quartier ein Restaurant zu finden, das noch offen hat. Das italienische schliesst gerade, das japanische hat zwar noch viele Gäste, aber keine Stühle und Tische mehr frei und die Küche möchte nun auch lieber heim. Hundert Meter weiter gibt’s ein indisches Restaurant und die freundlichen Betreiber bedienen uns gern. Wunderbar ist’s, wir sind aber froh, haben wir den Wein noch geholt, es hat nämlich gar keinen auf der Getränkekarte (Geburi-Essen mit Wasser – das hätte sich für immer und ewig in unsere Gedächtnisse eingeprägt).
Um zwölf sind wir im Bett, zu Hause würden weitere neun Stunden zum Geburi-Feiern verbleiben, wir haben’s bereits hinter uns, es ist der 25ste.
Museen besuchen wir auch, das Goma (Gallery of Modern Art), das Museum of Brisbane gemeinsam, ich am letzten Nachmittag auch das QMA (Queensland Museum of Art).
Es gibt viel Spannendes zu sehen, mich interessieren vor allem Bilder australischer Künstler, speziell die indigene Kunst. Sogar ein Bild von Picasso ist ausgestellt, „Die schöne Holländerin“. Ich finde sie zwar nicht so schön. Auch hängt da ein Bild von Walter Sickert, einem englischen Maler aus dem 19. Jhd. Den kenn ich aus unserem Englisch-Buch in der Schule. Er gehört zu denen, die man im Verdacht hatte, Jack the Ripper zu sein. - Dass der Eintritt überall gratis ist, erstaunt mich sehr. Mehr als nur grosszügig, finde ich! - Draussen ist es sehr heiss, der Museumsbesuch bietet eine schöne Abkühlung. Aber nach anderthalb Stunden bin ich fast durchgefroren und froh, wieder nach draussen an die Wärme zu kommen. Ich treffe Theo am „Strand“, wir fahren heim und wieder mal werden die Koffer gepackt. Kay hat wunderbar für uns gekocht, es ist unser letzter Abend; wir verbringen ihn gemeinsam auf ihrer gemütlichen Terrasse.
Von Brisbane über Auckland nach Riverhead und schliesslich Tutukaka
Ende November 2013
Ein kurzer Flug war’s von Brisbane nach Auckland, nur drei Stunden dauerte er, aber auch wieder drei Zeitzonen dazwischen. Wir flogen um zwölf Uhr mittags ab und landeten um sechs. Die Airline diesmal war die „Air New Zealand“, mir bis anhin unbekannt. Interessanterweise beschäftigen sie dort ganz spezielle Stewardessen. Sie sind männlich und zwischen 50 und 70 Jahre alt. Sehr bemerkenswert. Wahrscheinlich gehört es zum Anstellungsprofil, in dieses Alterssegment zu gehören. Theo könnte es noch grad knapp schaffen, er würde keineswegs auffallen. Jedenfalls nicht vom Alter her. Allerdings muss ich sagen, dass sie alle sehr, sehr freundlich und zuvorkommend sind, these guys. Sie haben ja zwangsläufig schon viel erlebt und lassen sich nicht mehr so rasch aus der Ruhe bringen. – Ziemlich bequeme Sitze hat es übrigens in diesem Flugzeug und ein gutes, reichhaltiges Unterhaltungsangebot (bis man evaluiert hat, welchen Film man sich anschauen will, ist man schon fast angekommen).
Auch etwas anderes ist bemerkenswert bei dieser Airline. Es heisst, es gäbe keine Mahlzeiten an Bord und eine Getränke- und Snackliste mit Preisangaben findet man auf dem Bildschirm am Vordersitz. Nach einer halben Stunde Flug wird aber dann (von den netten Stewarts) munter alles Mögliche serviert. Sandwiches, Salat, Güezi, Täfeli, Getränke, alles gratis. – Ok, wir haben unsere Sandwiches halt schon gehabt, wir verzichten.
Und noch was: Die Gähn-Sicherheits-Instruktionen kurz nach dem Start bei jedem Flug werden ja kaum je beachtet. Die Air New Zealand wusste Abhilfe. Sie hat einen Spot gedreht mit echten Schauspielern (Rose aus „Golden Girls“ leitet durch den Sketch) und das sieht sich jetzt jeder an, weil‘s eben absolut lustig aufgemacht ist. Hier der Link: www.youtube.com/watch?v=O-5gjkh4r3g">www.youtube.com/watch?v=O-5gjkh4r3g
Ich freu mich schon auf die nächsten beiden Flüge mit Air New Zealand. Nun gibt’s auch noch ein zweites Video dieser Art. Protagonisten sind die Hobbits. Wen’s interessiert:
www.smh.com.au/travel/travel-news/air-nz-does-it-again-bear-grylls-stars-in-latest-comedic-safety-video-20130227-2f56h.html">www.smh.com.au/travel/travel-news/air-nz-does-it-again-bear-grylls-stars-in-latest-comedic-safety-video-20130227-2f56h.html
Eine Stunde nach Ankunft in Auckland haben wir unser Mietauto schon bezogen, einen Nissan diesmal, sehr geräumig, aber nicht das neueste Modell, mit einer ziemlich scheusslichen Farbe, eigentlich gar keiner, so was zwischen braun und beige. Aber Theo fühlt sich sofort wohl, diese Karosse gefällt ihm sehr viel besser als der neue Toyota von AVIS, den wir am gleichen Morgen ja erst grad auf dem Flughafen in Brisbane abgegeben haben. Das Nummernschild heisst: FQU 92. Kann ich mir gut merken. Ohne die „9“ wär’s allerdings noch besser gewesen…
(Das Auto übrigens hatten wir bei Apex gebucht. Dies ist ein guter Tipp für alle Neuseeland-Reisenden: Die Autos sind nicht die neuesten, sie laufen aber sehr gut, sind absolut zuverlässig, der Service ist ausgezeichnet, es spielt überhaupt keine Rolle, ob man mal einen Kratzer oder eine Delle macht oder nicht, die hat’s sowieso schon. Die Pneus sind beste Ware, das haben wir dankbar zur Kenntnis genommen, als wir auf all den unwegsamen Strassen fuhren. Unser Gefährt hatte auf dem Fahrersitz ein Zigarettenloch, aber was soll’s? Dazu kommt, Apex ist billiger als Avis und Co. - Macht ja auch nichts.
Schon als wir unsere „Reisschüssel“ in Empfang nahmen, dachte ich, die ist wohl lange nicht mehr unterwegs gewesen, weil nämlich über dem Rückspiegel auf der Beifahrerseite ein Spinnennetzt klebte. Ich liess es dabei bleiben und dachte, das geht dann schon weg durch den Fahrtwind oder falls es mal regnen sollte. – Wir sind stundenlang durch die wildesten Regenstürme gefahren, das Netz war immer noch dort. Mal machte ich es weg mit einem Stäckli und einem Blatt. Am nächsten Tag war’s wieder da.
Fazit: Eine Spinne wohnte zwischen dem Spiegel und dessen Umrandung. Sie hat die ganze Fahrt durch die Nordinsel mitgemacht. Gratis und franko.
Dreiviertelstunden dauert die Fahrt bis Riverhead, einem Vorort im Norden von Auckland, wo wir eine Nacht verbringen werden, bevor wir am nächsten Tag nach Tutukaka weiterfahren, ans Meer.
So herzlich wie wir von Kay und Lorie verabschiedet wurden, so herzlich werden wir von Gail und Stuart King begrüsst. „Kia Ora“. Ein schöner Beginn unserer Reise durch Neuseeland. - Gail sagt, sie habe das Gefühl, also ob wir uns schon lange kennen würden. Das stimmt schon, mir kommt’s ähnlich vor, obwohl wir ja nur Emails ausgetauscht haben. Während des Nachtessens kommen wir sofort ins Gespräch über alles Mögliche und es wird Mitternacht, bis wir ins Bett kommen.
Bis dahin habe ich mich schon ein bisschen an das komische Englisch gewöhnt, das hier gesprochen wird. Wie wenn eine Lautverschiebung stattgefunden hätte. „E“ wird oft als „I“ ausgesprochen, das ergibt dann statt wie üblich “Wednesday“ „Wiensday“ (ich schreib‘s jetzt mal so, wie’s Rösi aussprechen würde), „tien“ statt “ten“, “ix-husband“ und so weiter. Gewöhnungsbedürftig.
Mit den Kings haben wir einen ganz besonderen Homelink-Deal: Sie waren letztes Jahr in Paris. Das Ehepaar, dem das Pariser Apartment gehört, wollte aber keinen Tausch mit Neuseeland eingehen, so haben wir eine Art Dreieckstausch organisiert. Die Kiwis nach Paris, die Pariser nach Bivio und wir nach Neuseeland. Nicht ganz einfach zum Organisieren das Ganze, aber alles bestens, alle zufrieden, Ende gut, „all good“, wie man hier sagt. Und weil wir ja erst gegen Abend ankamen, luden sie uns zu sich zum Essen und zum Übernachten ein; sie wohnen unterwegs an die Küste, wo wir hin wollen.
Sie haben ein hübsches Haus mit viel Umschwung, zwei Schafe und zwei Ziegen. Diese sind ihre Rasenmäher. Die Ziegen heissen auch so, benannt nach der weltgrössten Rasenmähermarke Husqvarna (world‘s largest manufacturer of outdoor equipment – a Swedish company), die eine Husq, die andere Varna. – Mir gefällt das: the Kiwi sense of humour.
Es sind drollige Tiere, fast ein wenig überdimensioniert, ganz zutraulich, kommen gleich her in der grossen Hoffnung, dass es auf der andern Seite des Zauns was zu fressen gibt, was noch besser mundet. Das ist offenbar auch häufig der Fall. Gail sagt, es gäbe viele Leute in der Nachbarschaft, die beim täglichen Spaziergang etwas zum Naschen mitbringen. Man sieht es den Geissen auch an. Sie sind äusserst gut „zwäg“. Den Schafen geht’s auch gut, aber diese seien sehr dumm, erklärt man uns.
Irgendwie haben wir trotz des kurzen Fluges doch eine Art Jetlag erwischt, denn wir erwachen erst um zehn Uhr. Bei Theo wäre das ja nicht weiter erstaunlich oder erwähnenswert, bei mir aber schon, denn ich stehe ja meistens spätestens um sieben auf. – Der Tisch ist schon wieder gedeckt, die armen beiden haben sicher seit zwei Stunden mit dem Frühstück auf uns gewartet. Es ist mir sehr unangenehm, wir entschuldigen uns, aber „no worries, no worries“.
Gegen drei Uhr nachmittags endlich ziehen wir los Richtung Norden an die Küste ins Beachhouse der Kings, bewaffnet mit dem Hausschlüssel, etlichen Tipps, wo was zu finden ist, was wir unternehmen könnten, ein paar neuen Ideen betreffend Bücher, die ich herunterladen könnte (Gail ist wie ich auch in einer Lesegruppe) und zwei grossen Säcken voller Gemüse aus Gails Gemüsegarten. „Kale“ nehm ich mit, Grünkohl lese ich im Internet, ein altes, aber neu absolut trendiges Gemüse, nicht nur hier. Früher nur Viehfutter. Mit anderen Worten, wir essen jetzt den Geissen ihr Fressen weg.
Leider hat’s jetzt zu regnen begonnen, gut für die Landwirtschaft, schlecht für uns Touristen. Wir erahnen, wie schön es hier sein muss, wenn die Sonne scheint. Wir fahren durch wunderbare Gegenden mit Wäldern und saftig grünen Wiesen.
In Whangarei machen wir Halt bei der Tourist-Information. Eingedeckt mit etwa zwei Kilogramm Broschüren und Prospekten fahren wir weiter zum nächsten Supermarkt, wo wir uns für die kommende Woche mit Lebensmitteln eindecken. Mit vielen. Für 250 NZ$.
Das Haus zu finden ist gar nicht so einfach, es hat keine Hausnummer und es regnet in Strömen. Es gelingt dann doch und wir richten uns ein. Der Vogel, der drin herumfliegt und uns im ersten Moment ziemlich erschreckt, lässt sich schliesslich fangen und in die Freiheit entlassen. Drei Tage lang muss er eingesperrt gewesen sein. Gut, dass wir gekommen sind. Schön ist’s, gemütlich innen; wie’s draussen aussieht, zeigt sich dann morgen. Spaghetti gibt’s, Theo ist zufrieden.
Tutukaka 27. November – 4. Dezember
Jetzt sind wir also endgültig in Neuseeland angekommen, dem Land der Kiwis, wie sich die Neuseeländer gerne selber nennen. Nicht die Frucht ist gemeint, klar. - Wieso sie sich mit einem Vogel identifizieren, der am Aussterben ist, nicht fliegen kann und daher am Boden brütet, wo er sich nicht gegen Feinde wehren kann, wissen sie selber nicht.
Wir schlafen aus, Theo zumindest, ich erlebe den ersten Sonnenaufgang, es ist eine bezaubernde Gegend. Das Haus liegt ein wenig erhöht direkt am Meer, das heisst, aus dem Garten führt eine steile Treppe hinunter zum Sandstrand. Eine wunderbare Aussicht aufs Meer, aufs gegenüberliegende Ufer, auf Inseln am Horizont, auf einzelne Wolken und einen blauen Himmel. Zwei Boote liegen vor Anker. Es hat zwar die ganze Nacht geregnet, jetzt aber sind nur noch die Blumen, Sträucher und Bäume nass im Garten und das Wetter ist wieder so, wie wir es uns wünschen. Frühstück im Freien, es ist paradiesisch schön, absolut ruhig und friedlich.
Hier werden wir uns auch wieder wohl fühlen.
Die Tutukaka-Coast, sagte mir Gail, sei eine der schönsten Buchten der Nordinsel. Nun, das „Problem“ ist, es gibt Dutzende der schönsten Buchten in diesem Teil Neuseelands. Eine schöner als die andere. Man kann’s fast nicht glauben: Hinter jede Kurve gibt’s wieder eine neue Bay, traumhaft schöne Inselchen, Meeresarme, Strände, bizarre Felsgebilde, wunderbare Sandbänke, Natur vom Feinsten.
Aber das ist nicht alles. Im Landesinnern kommt man auch zum Schwärmen nicht raus: zart grüne Felder, so weit das Auge reicht. Hügel, Bäume, Wälder, Baumgruppen, jede Art Grün ist vorhanden. Manchmal erinnert uns die Gegend ans Emmental, ans Appenzellerland, ans Entlebuch, an den Jura - den Gurten haben wir auch schon ein paar Mal gesehen (natürlich ohne Meer und Bucht vornedran), es ist faszinierend. Wieso man immer vergleichen will – es passiert automatisch. Macht ja nichts. Es ist nie gleich, nur ähnlich. Häuser hat’s nur wenige. Ja, die sind schon anders als in der Schweiz. Immer wieder gibt’s Hinweise auf historische Gebäude, klar, hier ist Maoriland, eine geschichtsträchtige Gegend. Viel Blut wurde vergossen. Wem hat’s genützt? - Wenn die Menschen vor 160 Jahren hätten sehen können, wie die Welt hier und jetzt „tickt“, die hätten das wohl kaum geglaubt.
Das älteste noch erhaltene Haus haben wir in der Nähe von Kirikiri gesehen, das Kemphaus, erbaut 1822, eine christliche Mission. Daneben das älteste aus Stein gebaute Haus, ein Warenhaus, eben „Stone Store“, datiert anfangs der Dreissigerjahre im 19. Jhd. (Nota bene: - unser Haus in Bivio wurde 1564 gebaut).
Wir unternehmen mehrere Ausflüge, und weil die Fahrerei nicht eben sehr einfach ist, übernachten wir zweimal unterwegs, einmal in Kaitaia, einmal in Mangonui. Die Strassen sind teilweise sehr kurvenreich, manchmal recht schmal und auch die sogenannten Highways (Rösi würde sagen „Ha We Üpsilon“) sind mit unseren Strassen in keiner Weise vergleichbar. Mit wenigen Ausnahmen sind sie nur zweispurig und bei Brücken sogar nur einspurig. Macht aber nichts, weil es fast keinen Verkehr hat. Manchmal sind wir weit und breit allein auf weiter Flur.
Im Kaitaia haben wir einen eintägigen Busausflug gebucht an die nördlichste Spitze des Landes, an das Cape Reinga. Unterwegs halten wir verschiedene Male an, mal, um einen Strand zu besuchen (nicht nur einen), mal um das weltbeste Eiscrème zu konsumieren, mal für Lunch und unser Maori-Driver erklärt, informiert und erzählt pausenlos Geschichten und Witze und selber muss er am meisten drüber lachen
(I love seafood. Every time I see food I want to eat it. – ha ha ha ha).
Der Spaziergang zum Leuchtturm an der Nordspitze ist mehr als nur eine Reise wert. Eine wilde Gegend, herrliche Aussicht, wunderbare Klippen und Strände und gut zu sehen im Meer die Stelle, wo der Pazifische Ozean und die Tasmanische See aufeinandertreffen, wo die Wellen nicht genau wissen, in welche Richtung sie jetzt fliessen sollen. Kein Wunder ist dieser Ort ein Heiligtum der Maori.
Wieso eine Busfahrt? Den 90-Miles-Beach, der sich vom Cape Reinga bis hinunter nach Kaitaia erstreckt, hätten wir mit unserem Auto nicht befahren dürfen, der Bus aber schon. Und wie! Durch Sand und Flussbette fährt er, dass es nur so spritzt, erst mal bis zu einer riesigen Düne und dort halten wir an, um hinaufzuklettern (total schwierig und mühsam, weil uns der starke Wind ständig entgegen bläst und obwohl wir ja instruiert worden sind, den Mund nicht zu öffnen, …) und mit den Bobs hinunterzuschlitteln. Für einmal auf Sand und nicht auf Schnee. Lustig ist‘s, aber auch sehr sandig. Erst wie ich mich am Abend ausziehe um zu duschen, merke ich, dass mein BH voller Sand und ziemlich schwer ist.
Der Bus fährt etwa eine Stunde lang dem Strand entlang, dort, wo der Sand am kompaktesten ist, etwa mit 60km/h. (In der folgenden Nacht träume ich davon, wie ich in einem Taxi versuche, einen Bus einzuholen, was nicht gelingt.)
Um fünf sind wir zurück, holen unser Auto im B&B ab, wo wir es haben stehen lassen. Alaistair, unser freundlicher südafrikanischer Gastgeber, gibt uns viele nützliche Tipps für unsere Weiterreise und so schlagen wir den Weg der Küste entlang ein, um weitere viele schöne Strände und Gegenden zu erkunden. Das aber für den nächsten Tag.
In Mangonui (Doubtless Bay) finden wir ein nettes Motel (es hat nur zwei Zimmer, diese aber sind kleine Apartments mit Küche, Bad, Schlaf- und Wohnzimmer und einem Mini-Vorgärtchen mit Blick auf die Bay). Wir essen im „World Famous Fish Shop“; tatsächlich ist das Lokal überall bekannt. Fein, was sie dort bieten, und die Preise natürlich unschlagbar.
Es ist schon erstaunlich, wenn ich denke, wir würden irgendwo in der Schweiz essen – wir gingen nach der Mahlzeit wieder heim und wären mit niemandem ins Gespräch gekommen. Ganz anders hier. Eine Dame am Nebentisch bietet uns an, ein Foto von uns zu machen und daraus entwickelt sich ein Gespräch über die Schweiz und die schöne Nordinsel. Ich glaube, unser Kauderwelsch ist der Auslöser für all die interessanten Begegnungen. Man ist hier einfach neugierig, wo die Leute herkommen. - Kaum ist die Familie gegangen, kommen zwei ganz junge Männer, nicht älter als etwa zwanzig, zu uns an den Tisch und der eine sagte „Grüezi“. Auch mit ihm haben wir ein längeres Gespräch, sein Vater sei Schweizer, aus Zürich, er selber sei auch mal dort gewesen als Kind, aber er könne nur noch ein paar wenige Worte verstehen. – Dass zwei so junge Typen uns Oldies überhaupt zur Kenntnis nehmen, finde ich ober-lässig. - Last but not least outet sich noch die Kellnerin, ebenfalls die Tochter eines Schweizers, aber auch sie kann unsere Sprache nicht mehr sprechen. Trotzdem – eigentlich wollte sie um 20 Uhr Feierabend machen, den Laden macht sie dann erst um neun Uhr dicht. – Awesome evening - indeed.
Leider ist der nächste Tag nicht sonnig, wie wir das gerne gewünscht hätten; es regnet zwar nicht, aber der Himmel zeigt sich in „different shades of grey“. Wir fahren der Küste entlang und halten dann mal an, oben auf einer Anhöhe, wo’s wieder so einen fantastischen Ausblick gibt. Dort steht ein Haus und davor ein Schrotthaufen, eine Radarstation aus dem zweiten Weltkrieg. Das erfahren wir, als eine Gestalt auf uns zukommt, die aussieht wie ein in die Jahre gekommener Rocker, grau in grau, seine langen Haare zu einem Rossschwanz „frisiert“. Er ist voller Staub. Er erklärt, er habe grad Bretter gesägt. Sofort kommen er und Theo ins Gespräch, klar, WW II ist ja ein beliebtes Gesprächsthema unter „alten Kriegern“, und schon werden wir ins Haus eingeladen. Es gibt noch mehrere Relikte aus dem Krieg zu entdecken, ein ganzes Sammelsurium an Fotos und Bildern. Auch sonst gibt’s viel zu sehen in dem Chaos. Unter anderem zwei ausgestopfte Kiwis, Mutter und Kind, in einem Glaskasten unter dem Stubentisch. Ich verzieh mich in die Küche, wo auch die Hausfrau offensichtlich Freude hat, mit jemandem zu plaudern. Freundlicherweise erhalte ich eine Zitrone aus dem Baum vor der Küche für meinen Gin and Tonic, den ich dann um vier haben werde. Ok, ok, werd ich dran denken um vier.
Die beiden leben ja wirklich sehr abgelegen und ich kann mir denken, sie warten nur drauf, ein paar Touristen abzufangen, um mit denen ins Gespräch zu kommen; mir kommt das Ganze ein wenig vor wie bei Hänsel und Gretel.
Die Aussicht aufs Landesinnere auf der einen Seite und auf die Bay auf der anderen Seite ist aber genial. Sie wollen ein B&B eröffnen, erzählen sie uns. Dafür braucht er offenbar ein paar Bretter. Das erklärt auch seine Staubigkeit. Er hat übrigens Jahrgang 41, mitten aus dem Krieg. Aber ich muss schon sagen, noch ein Business aufzubauen in diesem Alter, alle Achtung. Wenn’s funktioniert, hat er ja dann vermehrt Gesprächspartner. - Wir entkommen unbehelligt eine halbe Stunde später.
Drei Strände besuchen wir auf Geheiss von Alastair, unserem B&B-Gastgeber. Übrigens, als er hörte, dass wir in Tutukaka wohnen, sagte er, also eigentlich sei „Kaka“ etwas, das man bei ihnen in Südafrika im Klo mache. – Die Sprachen sind halt ähnlich, bei uns ja auch nicht so abwegig, erwähne ich. Aber die Maori-Sprache hat da sicher einen anderen Hintergrund. Anyway, die Strände, Buchten und Inseln sind fantastisch, leider, wie gesagt, wenn die Sonne nicht scheint, scheint alles ein bisschen weniger brillant. Wir fahren nach Kerikeri, mitten in das geschichtsträchtige Gebiet, wo die ersten Siedler und die Maori ihre kriegerischen Auseinandersetzungen hatten, wo viel Blut und Tränen flossen und 1840 der berühmte Vertrag von Waitangi unterschrieben wurde. Weiterfahrt nach Pahia, wo wir eine Fahrt auf einem zweimastigen Segelschiff buchen. Inzwischen hat sich das Wetter gebessert, der Himmel ist blau, alles in bester Ordnung. So ein eleganter Kahn. Wir geniessen die gemütliche zweistündige Fahrt ab Russell (früher Sin City und auch mal Hauptstadt von NZ) entlang der Küste, an kleinen Inseln vorbei, friedlich treibend im Meer.
Die Heimfahrt ist wieder recht mühsam, beginnt es doch erneut stark zu regnen. Was für ein Glück wir doch hatten während der Fahrt; der Himmel hatte sich extra für uns aufgetan.
Zuhause gibt’s Ravioli. Theo kann nicht recht ergründen, was genau da drin ist. Fleisch ist’s wohl nicht, da ist er sich fast sicher. Seiner Mine nach zu urteilen, merke ich, dass er mit Kürbis in den Teigtaschen nicht viel anfangen kann. – Ich schon, ich finde meine Kocherei sehr gut, hab ich doch noch Spargeln und Béchamelsauce drüber drapiert. So bin ich halt die Einzige, die mein Gericht lobt. Und vorher gab’s ja noch Salat. Mit jungen Spinatblättern und Alfalfa-Sprossen. Da hab ich seinen Geschmack halt auch nicht so „gepreicht“.
Einen wunderbaren Strandtag erleben wir als Nächstes. Nichts tun, lesen, am Strand bräteln, ein kleiner Schwumm im Meer hin und wieder. Einfach herrlich! Am Abend fahren wir ins Dorf. Dort hat’s ein Lokal, wo’s Internet gibt. Wie die Gestörten starren wir auf unsere Bildschirme, schreiben und lesen. Stereo gleich. Natel und Laptop bzw. Mac Air. Wir unterbrechen fürs Nachtessen. So grosse und feine Muscheln habe ich noch gar nie gegessen. Sie sind grün und riesig, richtig überdimensioniert. Was aus den Muschelhälften herauskommt, sieht fast aus wie halbe Cervelas. Und die exquisite exotische Sauce dazu: soooo lecker!
Der nächste Tag sieht schlecht aus. Regen. Ohne Unterlass, so schient‘s. Daheim bleiben oder etwas unternehmen? Ich bin dafür, den Waipoua Forest an der Westküste zu besuchen. Den hatte ich so oder so auf dem Programm. Zweieinhalb Stunden ein Weg, der Rückweg dann drei Stunden. So viele Kilometer fahren, um einen Wald zu sehen? Das käme uns zu Hause nie und nimmer in den Sinn. Aber hier und weil man in den Ferien ist, ist eben alles anders. Das Wetter kann ja schlechter kaum mehr werden, wir versuchen’s trotzdem.
Schon fast dort gegen Mittag, hört der Regen tatsächlich auf, die Sonne zeigt sich wieder. Wir haben ja so ein Glück! Noch ein paar Kilometer, dann sind wir dort. Dann macht uns Rösi einen Strich durch die Rechnung. Sie sagt, wir sollen links abbiegen. Es ist eine Strasse ohne Asphalt. Wir sind beide skeptisch, es ist nämlich gar nichts angeschrieben, aber sie tut so bestimmt, dass wir ihr blind vertrauen und die Strecke unter die Räder nehmen, umso mehr als es nur noch fünf Kilometer geht bis zum Ziel. Diese Strecke können wir allenfalls ja ohne weiteres wieder zurückfahren. Tun wir dann auch. Aber vorher dauert’s noch mindestens eine Viertelstunde, bis uns klar wird, sie will uns ins Abseits führen. Schon wieder besteht sie darauf, rechts abzubiegen, aber diesmal lassen wir uns nicht mehr so leicht reinlegen. Wir sehen genau, dass der Weg kaum breiter ist als unser Auto, nur noch eine Grasnarbe in der Mitte – also nein - jetzt langt’s. Wir kehren um. Etwas weiter vorne sehen wir dann, dass ein Schild am Strassenrand steht, wo’s drauf heisst, NO ACCESS – nur für Waldarbeiter. Das sind wir ja nicht gerade, also ist unser Entscheid umzukehren richtig. Theo sagt, er habe das Schild schon gesehen (ich hab’s übersehen, muss mich grad mit dem Navi oder der Karte beschäftigt haben), er habe aber gedacht, da wolle einer Honig verkaufen (??!!) An einem Ort, wo nie jemand vorbeifährt und es nicht einmal Häuser gibt?! Einzig ein Lastwagen, beladen mit Baumstämmen, ist uns mal begegnet. Nun, wir sind glücklich wieder auf der Hauptstrasse, biegen nach links und schon ein paar Kilometer weiter kommt die Abzweigung zum Visitor Center des Waipoua Forest. Dort gibt’s dann auch endlich eine Tasse Kaffee und ein Stück ober-feine Rüebli-Torte.
Wie wir da an einer Info-Tafel im Visitor Center stehen, legt plötzlich jemand von hinten die Hände auf unsere Schultern und sagt: „Can we help you guys?“
Was für eine Überraschung! Dies ist jetzt das vierte Mal innert vier Tagen (!), wo wir einem Ehepaar begegnen, Kanadiern, die mit uns auf der 90-Mile-Beach-Tour waren. Kaum zu glauben. Dreimal ginge ja noch, aber viermal! Natürlich besucht man als Tourist etliche ähnliche Orte, aber da muss ja auch das Zeitfenster genau stimmen und immerhin waren da etliche hundert Kilometer zwischen den jeweiligen Begegnungsorten. Wir finden, diese Zufälle sind sagenhaft. Leider müssen sie grad gehen, sie fliegen am nächsten Tag heim (sonst gäb’s eventuell ein fünftes Mal), und wir machen uns auf den Weg, die riesigen Kauri-Bäume zu sehen. Die vielen Kilometer zu fahren, hat sich gelohnt. Nach einem Spaziergang von zwanzig Minuten kommt man zu einer Art Lichtung im Wald und da steht er, voll beschienen im Sonnenlicht, es ist ein gigantisches Erlebnis, metaphysisch fast. Sein kahler Stamm, bevor die Krone beginnt, ist 30 Meter hoch und sein Umfang ungefähr 15 Meter. Er ist etwa 2‘300 Jahre alt und sein Name ist „Te Matua Ngahere“. Er ist nur der zweitgrösste noch lebende Baum dieser Art. Den grössten sehen wir kurz darauf an einer andern Stelle im Wald. Er heisst „Tane Mahuta“ (Lord of the Forest) und der Anblick ist ebenfalls gewaltig. Sein Stamm ist 50 Meter hoch, bevor die Krone beginnt. Allerdings ist er nicht ganz so dick wie der andere; er ist halt nur etwas über tausend Jahre alt. Man kommt sich vor wie ein Zwärgli, wenn man darunter steht oder vielleicht eher wie ein Hobbit.
Auf dem Heimweg passieren wir wieder mal Kawakawa; man kommt dort unweigerlich etliche Male vorbei, es ist eine Art Knotenpunkt. Bekannt ist der Ort wegen seiner öffentlichen Toiletten. Hundertwasser, der dort seine letzten Lebensjahre verbrachte, hat sie konzipiert. Die zu sehen ist auf jeden Fall einen Stuhlgang Wert oder zumindest eine Besichtigung. Die fand für uns allerdings bereits bei der ersten Durchquerung des Ortes statt, auf unserem ersten Ausflug gegen Norden.
In der Tourist Information Agency gibt’s die netteste Maori-Angestellte, die man sich denken kann. Sie scheut keine Mühe, uns ausgiebigst zu informieren, für uns herumzutelefonieren, B&B zu finden, Trips zu buchen, eine Telefonkarte zu organisieren, etc. etc. Das alles hätte ich auch selber machen können, aber wenn man kein Internet hat… Zwischendurch stillt sie ihren kleinen 3-jährigen Jungen, der ansonsten, wenn er nicht so hungrig ist, als Batman im Laden herumsaust. Das sieht dann so aus: Telefonhörer zwischen Schulter und Ohr eingeklemmt, Kind an der Brust, Hände auf der PC-Tastatur. Wenn das nicht Multitasking ist! - Und Kelly war auch später noch hilfreich, als wir feststellten, dass wir im Bus unseren Reiseführer vergessen hatten, das Buch, wo ich Notizen drin gemacht und mit dem ich mich auf unsere Reise vorbereitet hatte). Sie kontaktierte die Agentur und zwei Tage später schon war mein heiss geliebtes Buch im Briefkasten. Wenn das nicht Effizienz ist!
Im Ort hat’s auch einen Zug, der nur noch für touristische Zwecke eine kurze Strecke fährt und ganz offensichtlich der Lebensinhalt ein paar älterer „Eisenbähnler“ ist. Mit Leib und Seele sind sie dabei, alles über ihre Vintage Train- and Railway - History zu erzählen, und selbstverständlich fahren wir mit. Das Zügli rattert durchs Städtchen, dann ein paar Kilometer weit über Land, wo uns erzählt wird, wo welches Gebäude mal stand (jetzt sieht man nur noch Weiden), bis zu einer Brücke, die zu überqueren (zum Glück!) verboten ist. Sie ist mehr als nur schitter zwäg. Wir werden vollgetextet von vergangenen Zeiten und all den Plänen, die the old guys mit ihrer Bahn noch haben; die Brücke muss unbedingt instand gestellt werden, der Zug soll wieder Passagiere befördern.
Wir rattern zurück und weil wir so interessiert waren, dürfen wir noch die Dampflock näher anschauen, die auf dem Abstellgleis steht. Bis zu den Weihnachtsferien wollen sie auch diese wieder fahrtüchtig machen. Der kleine Bahnhof ist wirklich nett, man kommt sich vor wie in einem alten Western. John Wayne und Garry Cooper fehlen noch.
Am Mittwoch ist unser Aufenthalt in Tutukaka beendet. Einmal mehr regnet es in Strömen, was den Abschied sehr viel leichter macht. Das Haus putzen, die Koffer packen und schon sind wir unterwegs Richtung Auckland. Schade, dass man wieder kaum was von der Gegend geniessen kann, der Regen will nicht nachlassen. Einen Vorteil hat’s, man kann ein Museum besuchen ohne das Gefühl zu haben, draussen wär’s doch viel schöner. Also machen wir einen kleinen Umweg über Matakohe und besuchen das Kauri-Museum, „an excellent choice“, wie’s auf dem Prospekt heisst. Ja wirklich, das stimmt. Man lernt sehr viel über die Riesenbäume, die früher von den Pionieren gefällt und für den Häuser- und Möbelbau verwendet wurden. Jetzt sind sie bedroht durch andere Schädlinge, gegen die noch keine Abhilfe gefunden worden ist.
Um sieben Uhr kommen wir in Auckland an, herzlich begrüsst wiederum von Jay und Brian Holloway. Die beiden kennen wir bereits, wir haben vor etwa zwei Monaten einen lustigen Abend mit ihnen bei uns zu Hause verbracht, bevor sie nach Bivio fuhren. Jetzt besuchen wir sie in ihren Gefilden, die im Moment recht traurig aussehen, da’s immer noch regnet. Sie wohnen attraktiv, direkt unter der Harbour-Bridge, ein wenig erhöht mit einem schönen Garten und einem sensationellen Blick auf die Skyline. Die aber sehen wir natürlich nicht bei diesem Nebel und Regen. Wir glauben jedoch schon, dass sie dort ist.
Auckland
Hier sind wir wieder – in der Stadt, wo die restlichen Neuseeländer die Bewohner JAFA nennen. Just another ……. Aucklander. Das dritte Wort ist nicht schwer zu erraten, es heisst nicht “friendly“ und es ist auch nicht schwer zu erraten, ob es da etwa doch auch gewissen Animositäten gibt unter all diesen freundlichen Menschen in diesem Land. – Diejenigen, die wir kennengelernt haben, sind sehr hilfsbereit und mehr als nur freundlich. Unsere Gastgeber überlassen uns ihr Haus, das sich direkt unter der Brücke im Vorort Northcote Point befindet, und das, wie gesagt, eine wunderbare Aussicht hat auf die Skyline. Von der Fähre aus kann man die Glasfront „unseres“ Wohnzimmers gut sehen.
Die spektakuläre Aussicht bekommen wir am ersten Tag nicht mit, es regnet ohne Unterlass. Zwischendurch ist es ja ganz gäbig, dass man nichts Grossartiges unternehmen muss. Es ist eine Art Verschnauf- oder Siestapause, wie sie Theo so sehr liebt.
Grad den ganzen Tag zu Hause herumsitzen mag ich zwar auch nicht, so gehen wir am Nachmittag ins Kino gleich um die Ecke. „Bridgeway“ heisst es, von der Ambience her vergleichbar mit unserem „ABC“, ein wenig nostalgisch halt, aber im Unterschied dazu hat es verschiedene Säle, auch ein Restaurant und eine Bar. Und es laufen neue Filme. So sahen wir den „Butler“ – sehr guter Film, schlimme Periode der US-Geschichte. Die Tatsache, dass nur etwa zwanzig Personen im Kino sind, erinnert mich auch ans ABC, alles ältere Ehepaare, ich hab wohl den Altersdurchschnitt sogar ein wenig heruntergezogen.
Wie wir aus dem Kino kommen, hat’s tatsächlich ein paar Sonnenstrahlen.
Einkauf und anschliessend Nachtessen in einem japanischen Restaurant in Birkenhead, einem trendigen Vorort. Man merkt jetzt überall schon, dass Weihnachten vor der Tür steht, in jedem Lokal muss so ein kitschiger Baum mit blinkenden, farbigen Lichtern herumstehen, sogar im „Hayashi“.
Am zweiten Tag fahren wir auf den „One Tree Hill“, einen Hügel, von dem aus man einen prächtigen Rundblick über das ganze Stadtgebiet, die Vororte und die umgebenen Bays hat. Vom Monument aus, einem Obelisken, welcher einem Maori gewidmet ist, sieht man die Stadt für einmal „von hinten“, auch nicht schlecht zur Abwechslung. Der Hügel ist vulkanischen Ursprungs, 183 m hoch, es führt eine recht steile Strasse den „Berg“ hinauf; vereinzelte Jogger keuchen hinauf, wir nicht, wir nehmen ihn unter die Räder. Schafe grasen an den Abhängen ringsum im Cornwall Park, es ist ein idyllischer Anblick, ein gemütliches Ausflugsziel, nicht nur für Touristen.
Eine halbe Stunde Fahrt und wir befinden uns in Westauckland, an der Küste mit den schwarzen Stränden. An einem, dem Karekare-Beach, wurde der Film „The Piano“ gedreht. Es zeigt sich uns eine völlig verlassene Landschaft, eine einsame Bucht, öd, und der schwarze Sand unterstreicht diesen etwas depressiven Eindruck noch. Sogar die Möwen sind schwarz dort, so, dass ich nicht einmal eine Foto machen kann, man würde sie gar nicht sehen. Klar, es sind keine Möwen, sie sehen nur so aus; es sind Toreapango, auch Oystercatcher genannt , bewaffnet mit einem langen roten Schnabel, so dass sie ihre Austerndelikatessen viel gäbiger als wir ohne Brecheisen gleich selber öffnen können.
Der andere schwarze Strand an der Westküste ist Piah. Den hätten wir fast nicht erlebt, weil wir um Haaresbreite in einen schlimmen Unfall verwickelt worden wären. Die Küstenstrasse ist eng und kurvenreich. Wir machen Halt bei einem Lookout, um die herrliche Aussicht auf Piah, den Strand und Lion Head zu geniessen. Wir fahren wieder los, biegen um die nächste Kurve - da kommt uns ein Auto entgegen. - Zwei Europäer treffen aufeinander, wir auf der richtigen (linken) Seite, der andere auf der falschen. Was dann geschieht, spielt sich im Bruchteil einer Sekunde ab. Mein geistesgegenwärtiger Ehemann und Fahrer reisst das Steuer herum auf die rechte europäische Seite und entgeht somit dem sicheren Aufprall und dessen Folgen. Gleichzeitig flitzt an mir das Fenster vorbei mit der Beifahrerin des ausgeflippten Fahrers. Ein Gesicht wie „Der Schrei“ von Munch – das ist alles, was ich sehe. Sie muss von mir wohl den gleichen Eindruck haben. – Das ist grad nochmal gut gegangen. Das Verrückte: Ich schau natürlich zurück und sehe, dass das Auto immer noch auf der falschen Strassenseite weiterfährt… Und, die Strecke, die vor uns liegt, ist für etwa zweihundert Meter kurvenlos, also muss der Fahrer schon eine Zeitlang so gefahren sein. Die beiden müssen die Aussicht genossen haben, die, zugegebenermassen von der falschen Strassenseite her imposanter ist.
Uns sitzt der Schreck tief in den Knochen. Was hatten wir nur für ein Glück! – Dann fängt die Nachbetrachtung an: „Wenn jetzt einer entgegengekommen wäre… / Wenn jetzt einer gleich hinter uns gefahren wäre… / Wenn wir eine Minute früher oder später gestartet wären… / Wenn wir schneller gefahren wären… / Wenn der andere, im Moment, wo er seinen Fehler bemerkt hätte, auch auf die andere Seite ausgewichen wäre (dann hätte es ausgesehen, als ob wir auf der falschen Spur gefahren wären)… - und und und. Und immer wieder kommt einem von uns beiden ein „Wenn“ und „Wäre“ in den Sinn. Am Abend trinken wir einen Schluck aufs Überleben, aber vorher gibt’s noch ein wenig Sightseeing in der Gegend, im Arataski Forest Park: ein Wasserfall, Kauribäume, die einmalige Gegend im Allgemeinen.
Am Abend gehen wir mit Jay und Brian in ein italienisches Restaurant essen. – Das speziell Italienische dort war vor allem der Lärm, so dass man kaum das eigene Wort verstand. Die Kellnerin war aus Peru, der Rotwein aus Australien, das Essen: Nothing to write home about.
Stadtbesichtigung am Samstag: Die Fähre ist zwar sehr zuverlässig aber nur halb so effizient wie die in Brisbane, wo sie im Viertelstundentakt verkehrt. – Hier kommt nur jede Stunde eine vorbei und man muss sie heranwinken, sonst kommt sie gar nicht. Am Wochenende nehmen sie’s noch gemütlicher: alle drei Stunden reicht. Um 12 Uhr fährt sie, zu Fuss zwei Minuten von „unserem“ Haus entfernt. Den Nachmittag verbringen wir in der Innenstadt (Busfahrt zur Orientierung, Spaziergang durch die Queens-Street, zum Viktoria-Market und der Marina entlang). Wir werweisen, ob wir dort essen wollen oder nicht. Eigentlich gefällt es uns sehr, es herrscht ein buntes Treiben, in den attraktiven Bars sitzen viele Leute, die den freien Tag geniessen. Es wäre wohl ein kleines Kunststück, einen freien Platz zu finden. Wir haben so eine schöne Aussicht von unserer Unterkunft aus und die nächste Fähre ginge erst wieder in drei Stunden, so beschliessen wir, auf Jubel und Trubel zu verzichten und zurück nach Northcote Point zu fahren. Dort angekommen, laden uns unsere Gastgeber, die ein paar Häuser weiter weg ein Apartment haben, zum Apéro mit ein paar Freunden ein. – Nachtessen im Pub um die Ecke (ehrwürdiger, alter Pub – Ende19. Jhd.) Wenn ich nicht sicher wäre, dass wir in Neuseeland sind, ich dächte, ich sei in England.
Die Insel Whaiheke ist unser Reiseziel am letzten Tag - eine idyllische Insel, wo viele Leute ihre Ferienhäuschen am Meer haben, trendig, nicht weit von Auckland entfernt, erreichbar mit der Fähre in einer guten halben Stunde (8‘000 Einwohner, im Sommer mit den Feriengästen bis zu 40‘000). Seit dreissig Jahren wird dort Wein angebaut und einige der am besten bekannten und prämierten Weine kommen von dort. Man kann also Touren buchen, um Weingüter zu besichtigen (115 NZ $ - für Kinder ungeeignet). Wir verzichten. Unser Besuch auf der Insel ist ja nur kurz und fürs Kofferpacken heute Abend ist es wohl besser, nüchtern zu sein. So machen wir eine Erkundungsfahrt mit dem Bus, verbringen eine kurze Zeit an einem der pittoresken Strände und dann noch im Hauptort Oneroa.
Letztes Cüpli auf der Terrasse bei Sonnenuntergang. Es ist wieder sehr heiss, den ganzen Tag lang war’s abwechslungsweise regnerisch, windig, dann wieder angenehm warm und teilweise sogar heiss. Ein typisches „Auckland-4-Season-Weather“. - Zum Glück keine Schnee!
Von Auckland über Coromandel nach Tairua
Wir starten um halb zehn, nachdem wir das Haus geputzt, aufgeräumt und uns von unseren Gastgebern verabschiedet haben. Wir wählen die Küstenstrasse und fahren via Miranda und Thames nach Coromandel. Die Strasse ist oft recht mühsam, sehr kurvig und eng, manchmal geht’s rauf und wieder runter, dann wieder ganz eben an der Bay entlang. Die Gegend ist sagenhaft schön, immer wieder findet sich ein lohnenswerters Fotosujet. Die Bäume sind faszinierend in ihrer Art, ihrem Aussehen, ihrem Wuchs. Zum Teil sind sie riesig, haben knorrige Stämme und die farbigsten Blüten. Der eine Baum leuchtet wie Gold im Sonnenschein, dabei sind es „nur“ seine Blätter, die zitronengelb und auf der Unterseite der Krone hellgrün sind. Auch Blumen gibt es einzigartige, etliche ähnliche Arten wie bei uns, zum Beispiel Kapuziner-Blümchen in gelb und orange - ganze Hänge davon. Oder wilde rosarote Rosen überwuchern die Hecken. Ebenso ein gelber Strauch, der von weitem aussieht wie Forsythien, aus der Nähe eher wie kleine gelbe Finkli - eine Augenweide.
Unterwegs besuchen wir Waterworks, einen privaten Themepark. Nicht nur Kinder gönnen sich dort ein paar vergnügliche Stunden.
Wo wir übernachten heute Abend? - Wir sehen einfach, wie weit wir kommen und dort suchen wir uns eine Unterkunft. – Tairua ist’s. Der Ort liegt am Meer und umringt eine riesige Bucht. Bei Ebbe ist’s eine Sandbank, teilweise von Mangroven bewachsen. Das ganze Becken ist sicher der Kraterrand eines Vulkans. Ein bewaldeter und mit Häusern besprenkelter Hügel wie ein Zuckerstock gehört auch zum Bild. Dort finden wir ein Motel, wo wir die Nacht verbringen. Kaum angekommen, legt sich Theo gleich ins Bett und um sein Schnarchen nicht hören zu müssen und weil mich die Gegend interessiert, mache ich einen Strandspaziergang. Der Walkway führt einen Hügel hinauf, von wo aus man einen tollen Ausblick hat. Da seh‘ ich ein merkwürdiges Gefährt sich dem Ufer nähern: eine Art riesige Kiste, vollgestopft mit Kühen. Es sind etwa zwanzig Stück Vieh. Ein Boot zieht das Floss, ein anderes stösst es, zwei Männer turnen drauf herum. Der passendste Ausdruck, der mir für sie in den Sinn kommt, ist Water-Cowboys. – Ich beobachte den Transport und immer mehr Leute kommen dazu. Die „Kuhbuben“ haben Schwierigkeiten, das Gefährt an Land zu bringen, es ist Ebbe und irgendwie funktioniert das Ganze nicht. Es ist ein Hin und Her mit Booten und Seilen. Ich geh dann zurück und es dauert zwei Stunden, bis iwir einen Viehtransporter in Richtung Quai fahren sehen, der wohl die Kühe abholen wird. Wir gehen inzwischen essen ins Dorf. Es gibt wieder Muscheln und auch die sind absolute Spitze.
Von Tairua über Matamata (Hobbiton) nach Rotorua
Die Küstenstrasse geht weiter. Sie nimmt kein Ende. Es lohnt sich allemal, sie zu fahren, auch wenn’s recht mühsam ist, die Gegend ist idyllisch: waldbewachsene Hügel, saftige Weiden, Tausende von Schafen und Kühen. Für dreissig Kilometer brauchen wir fast eine Stunde. Unterwegs nehmen wir Autostopper mit, ein Paar aus Holland, noch grad nicht pensioniert. Mit dem Rucksack sind sie unterwegs. Wir tauschen Erfahrungen aus und nehmen sie mit bis in den nächsten Ort, der Minen- und Goldgräberstadt Waihi. Es ist interessant, ein ganz klein wenig von der Geschichte mitzubekommen. Es hat ein Museum (wie fast in jedem noch so kleinen Flecken), aber wir wollen weiter, haben andere Pläne. Trotzdem sehen wir uns vorher noch das ehemalige Pumphaus an, das um 300 Meter verschoben worden ist, ein Denkmal aus vergangener Zeit. Es steht dominant in der Gegend, gross, grau, halb zerfallen und sieht aus wie eine abgebrannte Kirche. Merkwürdig. Und dahinter befindet sich eine offene Mine, in welcher mit Lastwagen und Kranen gearbeitet wird. Die Grube ist so riesig, dass die Laster drin aussehen wie Spielzeugautos. Eigenartig.
Wir fahren weiter nach Matamata. Der Plan ist, uns das Filmset der „Lord oft he Rings“ – und der „Hobbit“ – Filme anzusehen. Das klappt auch wunderbar. Im Informationszentrum erleichtern sie uns um 150 NZ $, dann geht’s los mit dem Bus zum Set. – Hier also wird in einer wunderbaren Landschaft die Fantasie eines Mannes sichtbar gemacht, ein anderer hat die Idee beziehungsweise die Geschichten aufgenommen und in Filme verpackt, die Millionen einspielen. Und Millionen sind ausgegeben worden, um die Szenen so darzustellen, wie der Zuschauer sie dann in teilweise nur sekundenlangen Sequenzen sieht, genau nach Tolkiens Vorlage. Nach zwei Stunden haben wir 44 Hobbithäuser gesehen, haben einen langen Rundgang durch Hobbiton gemacht, haben etliche Episoden rund um die Dreharbeiten gehört und sind im „Green Dragon“ eingekehrt.
Um halb sechs sitzen wir in unserem Auto und fahren Richtung Rotorua. Wir erreichen den Ort eine gute Stunde später, finden auf zweiten Anhieb unsere bereits in Bern gebuchte Unterkunft, ein B&B mit Blick auf den See. Theo möchte gerne ein wenig Durchzug machen, frische Luft reinlassen; er hat noch nicht gemerkt, dass der penetrante Schwefelgeruch nicht wegzukriegen ist. Den haben wir hier gratis, er gehört quasi zum Image; im wilden Garten raucht, brodelt und dampft es aus allen Ecken und Enden.
Wir gehen essen in eines der vielen Restaurants im Touristenort (Thai) an der „Eat Street“ und gehen dann schlafen.
Den nächsten Tag, den 11. Dezember 2013, nehmen wir gemütlich. Das Wetter ist nicht wirklich fabelhaft, mehr grau als blau. Wir machen einen Rundgang im Government Garden, bemerkenswert finde ich dort die Blumenbeete: hellgrüne Bande und in der Mitte ein Meer von Petersilien. Sieht aber gut aus: - Das Museum im schönen Tudorhaus sehen wir uns nur von aussen an (langsam nervt’s uns, dass man immer und überall so viel Eintrittsgeld zahlen muss), trinken gemütlich eine Tasse Flat White, essen dazu ein Stück Lemon Pie (ich muss immer wieder probieren und vergleichen) und fahren anschliessend an den Lake Tarawera. Beim „Begrabenen Dorf“ machen wir Halt, aber heute ist nicht unser spendenfreudige Tag, Theo sagt, die hätten ja bei dem Vulkanausbruch nur ein paar Schuhe und den Hut des Pfarrers, den sie nach vier Tagen ausgegraben haben, ausgestellt… - schon wieder 50 Franken – nein! Wir fahren weiter, sehen beim nächsten Lookout die beiden Seen (gratis!), der eine ist blau, der andere grün. Am See ist es dann höchste Zeit für Theos Siesta. Wir legen unsere Standtücher in den Sand und lesen (Theo nur kurz, dann hör ich sein Schnarchen). Speziell an diesem schmalen Strand ist ein einzelner schwarzer Schwan, der ständig seine Runden dreht. Anmutig sieht er aus mit seinem langen Hals und dem roten Schnabel. Wenn er seine Flügel hebt, sieht man, dass er auch noch weisse Federn hat, die er geschickt versteckt.
Ein Lastwagen mit einem grossen Tank kommt an den Quai und da passiert etwas Spezielles: Der Fahrer steigt aus, schliesst einen Schlauch an den Tank an und spritzt und spickt Dutzende von kleinen, etwa 20 cm langen Forellen in den See. Die werden offenbar in einem Becken gezüchtet und dann, wenn sie gross genug sind, in die Freiheit ausgesetzt, um den Fischbestand zu vermehren und sicher auch zur Freude der Angler. Achtmal pro Jahr geschieht das, so ist es grad absolut ein Zufall, dass wir diesem Spektakel beiwohnen können.
Zurück in Rotorua machen wir einen Spaziergang durch das Quartier, an dessen oberem Ende wir wohnen. Ohinemuti ist die ursprüngliche Maorisiedlung, die seit 700 Jahren existiert und noch immer wohnen vor allem Maoris dort. Die meisten Behausungen sind sehr ärmlich. Es sind zwar „Einfamilienhäuser“, besser gesagt Baracken, die teilweise am Zerfallen sind oder, wenn noch jemand drin wohnt, dringender Renovation benötigten. Es hat eine Kirche dort, einen Friedhof, verschiedene Statuen und andere Orte der religiösen Verehrung, ein Gemeinschaftshaus natürlich auch. Das für uns aber am allerverwunderlichsten sind all die unzähligen Orte in den Gärten und mitten auf der Strasse oder dem Trottoir, wo es aus Löchern brodelt, raucht und grausam nach Schwefel stinkt. - Hier zu wohnen, ist schon ein wenig speziell, finden wir.
Zwischendurch gibt’s auch ganz ansehnliche Häuser. Aus einem kommt uns ein älterer Mann entgegen und fragt, wo wir herkommen. – Aus der Schweiz.- Ah, er habe einen Kaffee-Löffel aus Luzern, den wolle er uns schenken, meint er, wir sollen einen Moment warten. Ich bin ein wenig sprachlos. So eine seltsame Situation: Ein Maori (er erzählt uns später, sein Grossvater sei ein grosser Häuptling gewesen in seinem Dorf und ihm habe die ganze Gegend hier gehört) will uns einen Souvenirlöffel aus Luzern schenken. Er kommt dann tatsächlich zurück mit dem Löffel. Eine Gabel mit Zacken, die dazu da sind, Essiggurken besser aus dem Glas zu angeln, hat er auch noch dabei. Irgendwie gelingt es mir, ihm plausibel zu machen, dass wir den Löffel zwar sehr hübsch finden (kleine Lüge), ihn aber unter gar keinen Umständen annehmen wollen. Die Gabel drängt er uns auf. Ok, sie wird mir auf jeden Fall ein spezielles Andenken sein. Ich hab gar nichts dabei ausser dem Fotoapparat, nicht einmal meine Handtasche. Drum geb ich ihm dafür den rosaroten Ring aus Plastikperlen, den ich zufälligerweise anhabe, für seine Enkelin, falls er eine hat, und den nimmt er gern. – Dieser Spaziergang und die besondere Begegnung haben gar nichts gekostet. In der Tourst Information verkaufen sie für teures Geld Veranstaltungen in Maoridörfern, wo man sogenannt authentisch mit Maoris zusammenkommt, ihren Tänzen beiwohnen kann und auch aufgefordert oder gar dazu gedrängt wird mitzumachen (nicht ganz jedermanns Sache – meine ganz bestimmt nicht), und wo man Hangi (Fleischgericht, das zuvor ein paar Stunden im Boden eingegraben wird, bis es gar ist) essen kann und so weiter. Ich habe im Tripadvisor nachgeschaut und Berichte über diese Darbietungen gelesen. Neben einigen, denen diese Veranstaltungen natürlich gefallen haben, hat’s auch ein paar, die meine Skepsis solchen Angeboten gegenüber bestärkten und uns einen weiten Bogen um diese touristische Abzocke machen liessen.
In unserem Bed and Breakfast haben wir’s gut. Unser Schlafzimmer ist allerdings relativ klein, aber dafür hat’s ein grosses, sehr geschmackvoll eingerichtetes Wohnzimmer mit Küchenanteil, das wir ganz für uns alleine haben, da wir die einzigen Gäste sind. Auch die Besitzer haben wir nie zu Gesicht gekriegt, ganz seltsam eigentlich. An der Tür gibt’s ein Telefon und eine Nummer, die man wählen kann. Das war der einzige Kontakt mit der Besitzerin (vorher natürlich per Email). Sie gab mir eine Nummer, um mit dem Zahlenschloss ins Haus zu kommen, sagte, welches unser Zimmer sei, dass ein Manual mit Anweisungen und Tipps drinnen vorhanden sei und dass sie jederzeit telefonisch für Auskünfte erreichbar sei. Das Frühstück muss/kann man sich übrigens auch selber zubereiten, es hat Toastbrot, Milch, Butter und Konfitüre im Kühlschrank. Tee, Kaffee und Zucker ebenfalls. Um 10 Uhr morgens kommt jemand, um Zimmer und Bad aufzuräumen, die Betten zu machen und neue Tücher hinzulegen. Diese Person haben wir auch nie gesehen.
So ein Business zu führen – nicht schlecht. Kommt mir ein wenig vor wie die Chirurgen, die gar nicht mehr direkt am Patienten operieren, sondern aus einiger Distanz.
Wir gehen also zurück in unsere Unterkunft, vor dem Nachtessen möchte ich ein Bad nehmen im Whirlpool, der auf der Terrasse steht, aber das Wasser drin ist so heiss, dass ich nicht mal die Hand länger hineinhalten kann. Also nichts gewesen mit Baden, gehen wir essen. Indisch heute.
Von Rotorua nach Whakatane
Heute hat’s endlich keine Wolken, nur noch Sonne. Wir packen unsere Siebensachen und fahren erst mal in entgegengesetzter Richtung, nach Waimangu. Google lehrt mich: „Das Waimangu Valley oder Waimangu Volcanic Rift Valley ist ein Grabenbruch etwa 25 km südlich von Rotorua auf der Nordinsel Neuseelands. Es entstand am 10. Juni 1886 durch einen Ausbruch des Mount Tarawera. Durch die Eruption entstand ein 17 Kilometer langes Tal, das vom Besucherzentrum durch den heutigen Lake Rotmahana hindurch reichte. 22 Krater entlang des Grabens brachen gleichzeitig aus. Der Ausbruch verschüttete die auf dem Gebiet des Laka Rotomahana am Ende des Tales gelegenen Sinterterrassen der Pink and White Terraces, damals die bedeutendste Sehenswürdigkeit Neuseelands.
Das Tal ist das jüngste Thermalgebiet der Welt, das einzige bekannte Beispiel für ein direkt infolge eines Vulkanausbruches entstandenes, geothermales Ökosystem und das einzige Beispiel in Neuseeland für die natürliche Regeneration eines heimischen Ökosystems nach der völligen Vernichtung“.
Die farbigen Seen und Krater sehen sicher schöner aus bei Sonnenschein als wenn der Himmel bedeckt ist. - Dem ist so. Die Landschaft, die vor etwas mehr als hundert Jahren durch einen Vulkanausbruch entstanden ist, ist äusserst spektakulär. Es brodelt und zischt, der eine See hat eine unglaublich intensive Farbe, ist türkisfarbig, fast magisch anzusehen, ladet zum Bade, würde man denken, aber doch lieber nicht, das Wasser muss extrem heiss sein. Erstaunlicherweise stinkt es gar nicht so sehr nach Schwefel wie etwa in Rotorua. Wir unternehmen eine etwa zweistündige Wanderung zum Lake Rotomahana. Der Weg ist sehr gut unterhalten und ausgeschildert. Eine bizarre Landschaft reiht sich an die andere – faszinierend! Weiss, grün, blau, gelb, unfassbar, wie dünn hier die Erdrinde sein muss. Beim See angekommen, treffen wir auf eine Vielzahl von schwarzen Schwänen. Wo wir gestern nur einen einzigen gesehen haben, ist hier eine ganze Kolonie zu Hause. Wir treffen auch auf eine Vielzahl von Touristen. Wo die plötzlich alle herkommen? Wir waren meistens ganz allein auf unserer Wanderung. Sie warten alle auf den Bus. Wir auch. Das ist eine praktische Dienstleistung des Visitor Centers. Der Bus bringt alle an den Ausgangspunkt zurück.
Lustigerweise haben wir unterwegs die beiden holländischen Hitchhiker getroffen, die wir tags zuvor im Auto mitgenommen haben. Schon wieder so ein Zufall. Sie geben uns einen heissen Tipp. Ein paar Kilometer weiter gibt es einen grünen See, der ziemlich warm ist und in dem man baden kann, noch etwas weiter dann ein Bach, der ebenfalls heisses Wasser führt. Dort hat sich ein Bassin gebildet, etwa 15x15 Meter, wo man sich wie in einem Whirlpool hineinsetzen kann. Das machen wir natürlich, aber das Wasser ist so warm, dass ich am Anfang fast Mühe habe, hineinzugehen, ich denke, es sind mindestens 35°. Theo wagt es allmählich auch, er jammert ja immer über die kalte Aare, jetzt ist die Gelegenheit da zum warmen Bade, zum Klagen gibt’s keinen Anlass - oder doch? - Er murmelt etwas von „Spiegeleiern“ …
Mehr als etwa zehn Minuten bleiben wir nicht drin, obwohl man sich mit der Zeit ganz gut an die Temperatur gewöhnt. Ein paar Leute, die länger drin bleiben, kommen raus wie Lobster; das muss ich nicht haben.
Wir sind vorher an einem anderen See vorbeigefahren. Dort war keine Menschenseele, obwohl er absolut idyllisch aussah. Gehen wir zurück dorthin. Am Ufer steht ein Schild mit einer Warnung, man soll das Wasser weder trinken noch drin baden. Blau-grüne Algen treiben dort offenbar ihr Unwesen. Daher also ist niemanddort. Dann taucht doch plötzlich ein Pickup auf, der Fahrer und sein Hund steigen aus und beide gehen fröhlich schwimmen. Ich bin natürlich neugierig und frage, ob es keine Probleme gäbe für Schwimmer. Er sagt, er komme seit 32 Jahren hierher zum Baden, seine Kinder auch und noch nie sei etwas passiert. Dann geh ich halt auch. Schön, dieses kühle Wasser.
Soeben google ich blau-grüne Algen und finde Folgendes:
„Die Supernahrung: Blaugrüne Uralgen - Die Afa-Algen - Enzyme halten die chemischen Prozesse im Körper, seinen gesamten Metabolismus auf Trab. AFA-Algen verfügen über Tausende von besonders starken Enzymen. Essen wir AFA-Algen, profitieren wir von der Kraft dieser Enzyme.“
Hätte ich den See doch austrinken sollen…
Bei Wikipedia finde ich dann dieses:
„Einige Stämme von Aphanizomenon flos-aquae produzieren Anatoxine, Gifte, die entweder direkt eine permanente Stimulation der de.wikipedia.org/wiki/Acetylcholin">Acetylcholinrezeptoren in den Nervenzellen bewirken oder das Enzym Acetylcholinesterase hemmen und so in ihrer Wirkung vergleichbar sind mit Nervengasen wie de.wikipedia.org/wiki/Sarin">Sarin und de.wikipedia.org/wiki/Tabun">Tabun. Weiterhin produzieren in Deutschland gefundene Stämme von Aphanizomenon flos-aquae die Gifte de.wikipedia.org/w/index.php?title=Cylindrospermopsin&action=edit&redlink=1">Cylindrospermopsin und de.wikipedia.org/wiki/Saxitoxin">Saxitoxin. Diese Gifte können beim Trinken kontaminierten Wassers oder beim Schwimmen in verseuchten Gewässern für Tiere lebensbedrohlich sein. Die Universität Konstanz fand in einer Untersuchung von sechzehn als Nahrungsergänzung vertriebenen Produkten in zehn Fällen bedenklich hohe Mengen de.wikipedia.org/wiki/Microcystin">Microcystin, einem starken Lebergift.“
War vielleicht doch gut, dass ich das Wasser nicht getrunken habe…
Wir fahren weiter nach Whakatane, an etlichen Seen vorbei, sehr zügig, Theo hat gesagt, er freue sich auf ein Bier. Da kann ich lange sagen, ich möchte gerne noch ein paarmal Halt machen an einem Lookout oder sogar irgendwo verweilen, weil’s doch so schön ist. – Das Bier ruft. Geflissentlich übersieht er jeden Lookout – wie mit Scheuklappen fährt er Richtung Küste.
Heute Morgen hab ich per e-Bookers ein Motel in Whakatane reserviert für zwei Nächte, das „Pacific Coast“. So müssen wir keine Unterkunft suchen. Das kommt Theo grad recht. Das Bier ist in Reichweite.
Das Gebräu erhält er gleich bei Ankunft an der Rezeption, wir beziehen unser komfortables, grosses Zimmer und Theo legt sich aufs Bett. Ich geh erst mal in den nächsten Supermarkt, Booze-Nachschub kaufen. Mit drei Flaschen Wein komm ich zurück und finde Theo in der Horizontalen, schnarchend, das Bier steht leergetrunken auf dem Nachttisch.
Apropos Booze: Eine Flasche Wein hab ich immer bei mir in der Handtasche, wenn wir abends essen gehen, es könnte ja sein, dass es sich um ein „byo“-Restaurant handelt, (bring your own), so dass wir nur ein wenig Zapfengeld zahlen müssen und unseren eigenen Wein trinken können. Das schätze ich sehr, nicht nur wegen dem Preis. Die Neuseeländer sind vor allem spezialisiert auf Weissweine und wenn es sich um Roten handelt, dann ist das oft Pinot Noir, den ich nicht so mag.
So trinken wir auch heute Abend, nach Theos Siesta, eine Flasche australischen Cap Sauv aus meiner Handtasche mit dem klingenden Namen: „Sqeaking Gate“.
Von Whatakane nach Gisborne
Mat, der Besitzer des Motels, wird bei Tripadvisor über alle Massen gelobt. Das war natürlich mit einer der Gründe, weshalb ich gerade diese Unterkunft gewählt habe. Und ja, Mat ist wirklich mehr als nur charmant, hilfreich und nett. Für den folgenden Tag gibt er uns die besten Tipps, die wir selbstverständlich alle befolgen.
Zuerst fahren wir nach Ohope Beach, wo wir im Quay-Café (Where the gossip is as fresh as the coffee) frühstücken, dann geht’s auf eine kleine Wanderung von einer Bucht in die andere, etwa ein stündiger Spaziergang hin und zurück mit spektakulärer Aussicht und sehr vielen Treppenstufen hinauf und hinunter. Der Otarawairere Bay gilt als eine der schönsten Buchten im Bay of Plenty. Der Sand besteht aus lauter Muscheln - kleinen, die fast schon zu Sand verwaschen sind und grösseren, aber leider alle zerbrochen.
Wir legen uns ein Stündchen an den Strand und lesen ein bisschen. Dann geht’s weiter zu einem Lookout (Kohi Point Scenic Reserve), von wo aus man einen genialen Ausblick hat weit übers Land, im Hintergrund Hügel, Berge und ein Vulkan, im Vordergrund Busch, das Städtchen Whakatane, der breite Fluss, das Delta, der Hafen, Strand und Meer. Wir fahren anschliessend den Berg hinunter und „plegere“ ein wenig am Fluss, Theo schreib in sein Tagebuch und macht ein paar Zeichnungen.
Zurück im Motel starten wir einen neuen Versuch, an unserem Blog weiterzuarbeiten, was dann auch gelingt, jedenfalls kann ich einen Teil davon am nächsten Morgen abschicken.
Es ist ein schöner Abend, wir fahren nochmals in den Hafen, kaufen uns Fish and Chips (frischer geht’s nicht – der Fisch ist am selben Tag gefangen worden, das Schiff steht vor dem Shop), setzen uns an einen der Picknick-Tische am Flussufer und geniessen unser Nachtessen. Selbstverständlich ist auch die Flasche aus der Handtasche mit dabei und Weingläser aus dem Motel. Theo mag nicht alle vier Stück Fisch fertig essen und teilt sie mit den Möwen, die schon lange geduldig parat stehen, weil sie offenbar damit rechnen, irgendwann irgendwas zu kriegen. – Ein Riesengeschrei und schon ist alles weg.
Auf dem Rückweg ins Hotel möchte ich noch einen Spaziergang zum Fluss machen; es ist schon halb neun Uhr und immer noch hell. Vielleicht sehen wir den Sonnenuntergang. Wir gehen über eine Brücke und machen ein paar Fotos. Es ist immer wieder grossartig zu sehen, wie die Nacht langsam einbricht: das Wolkenspiel, die verschiedenen Farben am Horizont, die sich fast von Sekunde zu Sekunde ändern.
Das war ein sehr gemütlicher Tag, völlig ohne Hektik – Ferien eben.
Wir nehmen‘s auch am nächsten Morgen gemütlich, haben nur eine zweieinhalbstündige Fahrt vor uns. – Denken wir. Zuerst fahren wir nach Opotiki, wo wir einen Halt machen im Städtchen, um eine Tasse Kaffee zu trinken. Die Hauptstrasse ist abgesperrt und es hat einen Haufen Leute, ganze Schulklassen stehen am Strassenrand. Worauf die warten? Man erklärt uns, in fünf Minuten würde eine Christmas Parade stattfinden. - So ein lustiger Umzug, den wir da rein zufällig zu sehen bekommen! Das halbe Gewerbe der Stadt macht mit, zuerst kommt die Feuerwehr, dann der Abbruchwagen, beladen mit einem zu Schrott gefahrenen Auto, die Lebensretter, der Fussballclub, auch das Pflegeheim ist vertreten: Ein Pfleger stösst eine Greisin im Rollstuhl vorbei, ein paar Soldaten patrouillieren ebenfalls sowie zwei, drei Pferde, Batman ist dabei und alle sind geschmückt mit Weihnachtsschmuck und Bändern auf denen „Merry Christmas“ steht. Den Kindern, die dem Umzug zuschauen oder mitlaufen, werden Süssigkeiten zugeworfen, es ist eine Freude zuzuschauen. – Ein spezielles Erlebnis, wie schön, dass wir zur rechten Zeit an diesem Ort vorbeigekommen sind.
Wir fahren daraufhin weiter Richtung Gisborne, durch die Waioeka Schlucht, dem Motu-Fluss entlang. Unterwegs machen wir Halt an einer historischen Ziehbrücke, deren Aufhängung schon etwas abenteuerlich aussieht. – Irgendwo, etwa fünfzig Kilometer weiter, soll eine Strasse zum Rere Wasserfall abzweigen (Rere ausgesprochen wie unser Reissverschluss). Wir haben ja Zeit und beschliessen also, diesen Umweg unter die Räder zu nehmen. Schon nach wenigen Kilometern hört die geteerte Strasse auf und es beginnt auch noch zu regnen. Wir fragen einen Bauern, ob wir überhaupt auf dem richtigen Weg seien, was er bestätigt. Verkehr hat’s so gut wie keinen, auch kaum Siedlungen. Nach weiteren fünf Kilometern überhaupt keine Häuser mehr. Hin und wieder noch ein Wegweiser mit einer Strassenbezeichnung, die uns gar nichts sagt. Dass uns kein einziges Auto mehr begegnet, stört mich gar nicht, ist die Strasse doch sehr eng und ohne Belag; man könnte sowieso schlecht kreuzen. Endlich dann ein Wegweiser: „Rere-Falls: 36 km“. Zurück hat nun auch keinen Sinn mehr, wir fahren weiter, aber es ist mehr als nur mühsam, auf dem feuchten, rutschigen und kurvenreichen Weg vorwärtszukommen. Mehr als 30 km/h kann ich kaum je fahren, ohne zu fürchten, ins Rutschen zu geraten. Ich hoffe nur, die Pneus machen das alles mit. Hier einen „Pladi“ zu haben, stünde nicht grad auf meinem Wunschzettel. Auch könnte ja ein Auto entgegenkommen. Da kommt aber keines, zum Glück, die Pneus halten durch, wir auch und sind dann sehr froh, wie wir nach etwa anderthalb Stunden endlich wieder auf eine geteerte Strasse treffen. Die Rere-Fälle, na ja, ob sich dieser riesige, beschwerliche Umweg gelohnt hat… Zwei Kilometer weiter eine weitere Attraktion: „Rere Rockslide“. Es regnet immer noch, trotzdem hat’s etwa zehn Jugendliche, die sich deswegen nicht beirren lassen. Der Fluss bildet hier eine etwa dreissig Meter lange Rutschbahn, die in einem natürlichen Becken endet, bevor dann ein paar hundert Meter weiter unten der Wasserfall entsteht. Auf diesem Fels kann man mit einem Board oder einem Pneu hinuntergleiten. Einmal in Fahrt, ist bremsen nicht mehr möglich. Die Jungen haben enormen Spass und ich denke, das würde ich niemals wagen, mir scheint diese Rutsche viel zu gefährlich. Ich stelle mir geschundene Knie und Ellenbogen vor, zerquetschte Finger – nein, dieses Vergnügen (erstaunlicherweise verlangt hier niemand Eintrittsgeld) steht auch nicht auf meiner „To-do-Liste“, aber zuzuschauen ist amüsant. Zum Teil verlieren die „Rutscher“ ihre Boards, werden abgeworfen oder putschen ineinander, aber niemand verletzt sich; ich kann‘s fast nicht glauben. Dabei ist dort nur blank geschliffener Fels mit relativ wenig Wasser drauf. Immer wieder wandern sie den Hang hinauf und probieren‘s erneut.
Es sind jetzt nur noch wenige Kilometer bis Gisborne, auf einer richtigen Strasse. – Wunderbar! Wir beziehen ein Motel gleich beim Strand, hier ist das Wetter wieder wie wir es uns wünschen, geregnet habe es nicht. Theo legt sich ins Bett (Kopfweh, vermutlich vom vielen Kurvenmitfahren), ich mach einen Strandspaziergang, nehme ein Bad im Meer, und lese ein bisschen; es ist ein angenehmer, warmer Spätnachmittag.
Gegen acht fahren wir ins Städtchen, finden einen der letzten Zweiertische in einem der hübschen Restaurants am Hafen bei der Werft und lassen uns vom Koch, den überaus freundlichen Serviertöchtern und der schönen Aussicht verwöhnen. Es ist fast neun Uhr, die Sonne geht gleich hinter den Schiffen unter und tönt den Horizont in blaue, rosarote und graue Streifen.
Von Gisborne nach Hastings
Am nächsten Morgen machen wir eine kurze Besichtigung des Ortes, der dadurch bekannt wurde, dass Captain Cook im Jahr 1769 zum ersten Mal neuseeländischen Boden betreten hatte. Nicht nur ihm, sondern auch seinem Schiffsjungen, dem „Young Nick“, der als erster vom Schiff aus Land gesehen haben soll, ist eine Statue gewidmet.
Vorerst aber gibt’s noch Kaffee und Kuchen im „Food 4 Thought“, einem Café mitten im Ort. Zu denken gibt mir allerdings weniger deren Food als vielmehr die Tatsache, dass ich schon am Morgen früh mit einer Flasche Wein in der Handtasche im Lokal sitze (vergessen rauszunehmen – hat dort übernachtet, weil am Vorabend Wein im Lokal bestellt – kein „byo“ – also doch kein Grund, sich Sorgen zu machen).
Vom Hafen aus führt ein Weg steil den Hügel hinauf zu einem Aussichtspunkt (natürlich Captain Cook Lookout), von wo aus man einmal mehr einen herrlichen Blick über die Gegend hat. – Wie die das immer hinkriegen, diese Neuseeländer: eine hübsche Ortschaft, fantastische Strände, Bergketten im Hintergrund, ein, zwei Flüsse, die sich durch die Landschaft schlängeln und ein Hügel so platziert, dass man die bestmögliche Aussicht auf das ganze Panorama hat. - Grossartig!
Gegen Mittag fahren wir los in Richtung Hastings, etwa drei Stunden wird die Fahrt dauern. An der nächsten Tankstelle machen wir Halt (Tankstellen sind rar über Land), tanken, Theo geht in den Shop zum Zahlen und schon wieder bahnt sich so ein lustiges Gespräch an mit einem jungen Mann auf der andern Seite der Tanksäule. Er hält einen kleinen Plastiksack in der Hand, gefüllt mit Wasser und einem Fisch drin. Er zeigt mir das Exemplar von nahem. Es ist ein winzig kleiner Haifish, nicht länger als etwa sieben Zentimeter, genannt Red-Tailed-Black-Shark (laut Wikipedia: Feuerschwanz-Fransenlipper. – So ein schöner Name…). Er erzählte mir, er sei auf dem Weg, den Kleinen in die Tierhandlung zurückbringen, denn dieser sei aussergwöhnlich aggressiv und beisse alle seine andern Fische im Aquarium. – Kleinen Episoden wie diese finde ich so „witzig“. Mich dünkt, in der Schweiz würden sich kaum solche Gespräche unter Fremden ergeben, wie sie hier tag-täglich vorkommen. So oft wird man gegrüsst, rasch werden ein paar Lappalien übers Wetter ausgetauscht oder zumindest erhält man ein Lächeln beim Vorbeigehen, was wir natürlich sehr gerne erwidern. Herrlich! (Wenn ich das dann zu Hause immer noch mache, fürchte ich, die Leute denken, ich hätte einen Webfehler…)
Von Gisborne aus fahren wir gegen Süden, es gibt eine einzige Strasse, die in diese Richtung führt, die SH 2 (State Highway 2), Highway = Autobahn? – Nein, eine solche hat’s nur grad um Auckland herum. Die Strasse ist zwar ausgebaut und gut unterhalten, wie bei uns hat’s Baustellen und neu asphaltierte Abschnitte, wo man nur 30 fahren darf, aber woher der Name „Highway“ kommt, ist mir ein Rätsel. In Wairoa machen wir Halt, kaufen ein Sandwich, etwas zu trinken und ein extrem pinkes Gebäck (Theo will’s) und legen uns unter einen Pohutukawa-Baum ins Gras ans Ufer des Flusses, der uns sehr an die Aare erinnert. – Das extrem rosarote Gebäck ist extrem gut, erst wollte ich gar nicht davon probieren, dann hab ich ihm alles weggegessen. Nach einem gemütlichen Lese- beziehungsweise Siestastündchen geht’s weiter. Die nächsten hundert Kilometer fahr ich wieder mal, dann kann ich auch anhalten, wenn und wann ich will. An einem schönen See tue ich das auch, auf dem Informationschild lese ich, dass da ursprünglich eine Schaffarm war mit 35‘000 Schafen. – Offenbar gab’s früher mal insgesamt 50 Millionen Schafe in ganz Neuseeland. Diese Zeiten sind vorbei, Wolle ist kaum mehr gefragt, die Rinderzucht hat Einzug gehalten. Immerhin sollen’s noch etwa 30 Millionen Tiere sein.
Eigentlich sind es gleich zwei Seen, der Lake Tutira und der kleinere Lake Waikopiro und der Halt hat sich allemal gelohnt, weil’s so idyllisch ist dort, auch wenn Theo gar nicht aussteigen will.
Von da an geht’s nicht mehr weit bis Hastings. Wir fahren am Flughafen von Napier vorbei, dort, wo jetzt die Landebahnen sind, hat man vor 1930 Fische gefangen. Das Erdbeben hat das Land um fast zwei Meter angehoben, so fliegt man jetzt halt statt zu fischen. Auch ganze Quartiere sind entstanden auf dem gewonnenen Land.
Die Adresse in Hastings, wo Kay und Mike Whelan wohnen, findet Rösi ohne Probleme. Sie erwarten uns schon. Auch sie sind Homelink-Freunde, die wir vor vier Jahren kennengelernt haben, als sie bei uns in Ittigen Halt machten auf dem Weg nach Bivio.
Sie haben eine grosse Familie, vier verheiratete Töchter und elf Grosskinder. Bei der einen Tochter, Claire, sind wir zu einem verfrühten Christmas-BBQ, einem „real Kiwi-Xmas-Event“ eingeladen. Die junge Familie wohnt gleich um die Ecke. Sie besitzen eine grosse Gärtnerei, die ihre Eltern zuvor bewirtschaftet haben. Genug Platz also zum Feiern. Wir sind zehn Erwachsene und sehr viele Kinder, sicher etwa zwanzig. So kommt’s mir jedenfalls vor. Auch ein Hund, ein Golden Retriever, und eine Katze sind mit von der Partie. Die Männer am Grill mit einem Bier in der Hand, die Kinder baden im Pool, bevor sie wie die Heuschrecken übers Salatbuffet herfallen, aber es hat genug für alle. Irgendwo zwischen den Kleiderbergen im Türrahmen steht ein geschmückter Tannenbaum, einer mit langen Nadeln, es muss eine Fichte sein. Die Kinder sind sehr musikalisch. Klavier, Trompete, Gitarre, Gesang, ich bin beeindruckt. Zum Glück sind’s keine Weihnachtslieder, mit denen sie uns beglücken; sie spielen Michael Jackson und andere Songs dieser Art. Wirklich gut. Mir gefällt’s. Nach der Darbietung spielen die Jungs ein Kartenspiel, bei dem’s ziemlich bunt zugeht und die Mädchen vergnügen sich wieder im Pool mit dem jüngsten Familienmitglied, Ricky, der immer wieder sagt: „not yet“, wenn man ihn mahnt, es sei langsam „bedtime“. – Auch für uns wird’s Zeit zu gehen, einige der Kinder haben am nächsten Tag noch Schule, zwei von ihnen reisen in die Schweiz zu ihrem Vater, der in Orbe wohnt, und wir sind auch allmählich müde.
Eine grosse, nette Familie, ein vergnüglicher Abend - wir haben alles sehr genossen. Wirklich freundlich, dass man uns dazu eingeladen hat.
Hastings
Am Montagmorgen fahren Kay und Mike mit uns auf einen Hügel südlich von Hastings, den Te Mata Peak (400 m), von wo aus man eine atemberaubende Aussicht über die ganze Gegend von Hawke’s Bay hat. Im Westen sieht man sogar den schneebedeckten Mount Ruapehu (2797 m), den höchsten Vulkan in Neuseeland, der ziemlich zentral in der Nordinsel gelegen ist. Zum letzten Mal war er vor sechs Jahren aktiv.
Hawke’s Bay ist ein grosses Weinanbaugebiet (mehr als 40 Weingüter) und eine Früchte- und Gemüseplantage reiht sich an die andere. Drei Flüsse sieht man gut von oben, den Tutaekuri, den Ngaruroro und den Tukituki-River, viele Weingüter ebenfalls. Die wollen wir dann zwar noch aus der Nähe anschauen, ein paar davon jedenfalls. Sicher nicht nur anschauen. Sure thing! Jetzt aber gibt’s Kaffee im Peak Café.
Kay und Mike übergeben uns anschliessend ihr Haus, sie übernachten bei ihrer Tochter Kim und fliegen am folgenden Tag nach Dunedin auf die Südinsel, wo ihre vierte Tochter Paula, die einzige, die wir gestern nicht kennengelernt haben, mit ihrer Familie wohnt. Ein paar Instruktionen noch, dann sind sie weg.
Es ist heiss, ich möchte gerne an einen Fluss baden gehen. Theo möchte lieber daheim bleiben, ich merke es schon, aber er gibt klein bei. Bis wir sein Portemonnaie gefunden haben, dauert’s allerdings eine halbe Stunde. Theo sucht überall. Ich rufe schon mal im Honig-Zentrum an, wo wir uns auf dem Heimweg über die Honigproduktion haben ins Bild setzen lassen und für Ella ein paar „Biendli- Finkli“ gekauft haben. Mike wird angerufen und gefragt, wo sein Autoschlüssel ist, denn eine Vermutung ist, dass sich die Geldbörse mitsamt sämtlichen Ausweisen und Kreditkarten vielleicht im Peugeot befindet, der zum Glück in der Garage steht. Den Schlüssel haben wir, das Portemonnaie nicht. Schliesslich finden wir das Ding. Es ist ihm aus der Hosentasche gefallen, als er sich auf den Lehnstuhl gesetzt hat. Dort steckt es zwischen Armlehne und Sitz und sagt nichts. Ich sag auch nichts, bin einfach froh, dass uns eine mühsame Wiederbeschaffung erspart geblieben ist. Der Fluss läuft uns ja nicht davon. Allerdings dauert unser Badevergnügen nicht sehr lang, denn es ziehen Wolken auf und wir wollen lieber gehen. Ein Einkauf im nächstgelegenen Ort, Havelock North, und schon sind wir wieder daheim. Wir wollen draussen essen, dann aber fängt’s doch noch an zu regnen und wir machen es uns drinnen gemütlich. Salat gibt’s aus Kays Garten, Spaghetti im Hauptgang, Theos Favourite, und schon wieder ist Bedtime. – Das Haus ist aus Holz gebaut und fast pausenlos knarrt es im Gebälk. Man hat das Gefühl, da sei einer im Estrich – beinahe ein wenig geisterhaft. Den gibt es aber nicht, weder den Estrich noch den Geist; es ist ein Bungalow.
(Kleiner Exkurs zum ständigen Suchen: Diesmal war’s das Portemonnaie. Theo sucht aber fast jeden Tag irgendetwas. Kürzlich war’s der Pullover und nachdem er ihn beim Bettende unter dem Duvet gefunden hatte, war‘s am nächsten Tag gleich nochmal derselbe Pulli. Manchmal sind’s ein Paar Schuhe, manchmal auch nur einer (???). Socken sowieso. Da gibt’s nur eines: 100 gleiche Paare kaufen, dann fällt das nicht so auf. - Seine E-Zigaretten finde ich auch laufend irgendwo, zu seinem Glück meist bevor er sie überhaupt vermisst. Seltsam dünkt mich, wenn es die Unterhosen sind, die er sucht. Das ist mir jetzt noch nie passiert. Ich suche auch gelegentlich was, aber ich verliere meine Sachen meist in der unendlichen Tiefe meiner Handtasche, und wenn ich mich entschliesse, sie mal zu leeren, mache ich so manche erstaunliche Entdeckung.)
Am Dienstag machen wir einen besonders schönen Ausflug - ans Cape Kidnappers. Vögel und Geologie sind hier das Thema. Um zehn Uhr geht die Tour los, und zwar mit einem Traktor. Genau das ist das Gefährt, das bei niedrigem Wasserstand dem Strand entlang die Strecke bis zum Cape ohne grosse Probleme meistern kann. Touristen haben wir bisher nur sehr wenige gesehen, hier gibt’s zwei Traktoren mit je einem Anhänger voll davon. Die Küstenfahrt, die wir hier machen, ist etwas vom Gigantischsten, was ich je gesehen habe. Die Steinformationen, die Schichten, die sich während Jahrtausenden gebildet haben, sind gewaltig. Der Fahrer hält oft an und erklärt, wie alt das Gestein ist, wie sich die Schichten gebildet haben, er zeigt, wo man genau sehen kann, dass sich ein Erdbeben ereignet hat, weil die Verschiebung gut sichtbar ist. Faszinierend! Dass wir nicht noch einen Felssturz miterleben, dünkt mich fast ein wenig speziell, weil Sand- und Kalkstein der vordersten Schichten zum Teil aussehen, wie wenn sie grad nächstens am Abstürzen wären. Noch ein Gewitter und dann… Es macht Spass, auf dem Traktor mitzureiten. Manchmal fährt er durchs Wasser, dann spritzen die Wellen einen an, aber das ist sogar sehr willkommen, denn es ist recht heiss. Murry, der Fahrer, hält hin und wieder an, holt ein Stück Fels oder Stein und erklärt dessen Bewandtnis. Natürlich sind da auch die üblichen Witze. Am Anfang werden alle gefragt, woher sie kommen. Sicher hat’s immer Australier dabei, so auch diesmal. Murry kann seinen obligaten Scherz platzieren: „Oh, there are three Austalians on board. - I’ve got to speak slowly so they can understand” - etc, etc. Sie kommen immer wieder dran, die Aussies. Das ist wohl die Retourkutsche, weil sich die Australier gerne lustig machen über die Aussprache der Neuseeländer. Sich gegenseitig zu necken, muss ungeheuren Spass machen. Das kennen wir ja auch in der Schweiz: die Freiburger, die Aargauer, die Basler und Zürcher...
Wir kommen nach etwa anderthalb Stunden an Felsen vorbei, wo Gannets brüten, australische Tölpel. Die lassen sich in keiner Weise beeindrucken oder stören von den beiden Traktoren und den vielen Leuten, die sie fotografieren. Sie haben überhaupt keine Scheu.
Je weiter wir fahren, desto älter werden die Gesteinsschichten. Wie Murry sagt, sind wir jetzt bei den grau-blauen Schichten angelangt, die drei Millionen Jahre alt sind. Man kann sich das ja kaum vorstellen, aber eindrücklich ist die wilde Gegend schon.
Am Cape Kidappers (so genannt, weil es ein Scharmützel gab zwischen der Mannschaft von Captain Cook und den Maoris, die dann versucht haben, einen von Cook’s tahitianischen Schiffsjungen zu entführen, was dann aber verhindert werden konnte) gibt’s einen Spazierweg zu einem Leuchtturm und zu weiteren Gannet-Kolonien. Es ist ein Walk von etwa einer Stunde hin und zurück. Sagenhaft. Eine Unmenge an Vögeln sitzt dort, brütet am Boden, (manchmal sieht man ein Junges neben beziehungsweise unter oder zwischen den Beinen seiner Mutter sitzen), nur ein paar Meter von uns entfernt. Ein gewaltiger Anblick, vom Gestank mal abgesehen. Der ist auch sagenhaft. - Ich hab gelesen, die Vögel können über dreissig Jahre alt werden und eine Flügelspannweite von bis zu zwei Metern haben. Wenn sie sich ins Wasser fallen lassen, um Fische zu fangen, können sie eine Geschwindigkeit bis zu 100 km/h entwickeln. Es muss die grösste Gannet-Kolonie der Erde sein, die hier auf verschiedenen Felsköpfen lebt und brütet; schätzungsweise 10‘000 Vögel insgesamt. Im Juni fliegen sie nach Australien, bleiben dort für gewisse Zeit, und wenn sie zurückkommen, gehen sie nie wieder dorthin zurück. – Diesen Umstand hat Murry selbstverständlich mit grosser Freude erläutert („No wonder they don’t go back. There are nothing but poisonous beasts, bushfires and Tony Abbott“).
Auf dem Rückweg vom Cape fragt Murry, ob jemand Lust hat, neben ihm auf dem Fahrersitz mitzureiten. Niemand will – ich schon. Lustig ist’s. Es spritzt gewaltig, ist ja aber nur Wasser. Stossdämpfer haben nur die Anhänger, der Traktor selber nicht, aber was soll’s, er sagt immer „hang on“, wenn’s allzu holprig wird. Die Schalterei auf diesem Gefährt ist auch erwähnenswert. Da muss man ja Schwielen haben an den Händen nach so einer Fahrt. Es hat drei unterschiedliche Schalthebel, und die in den Gang zu werfen, bedarf eines ganz besonderen Geschicks. Alles geht gut bis am Schluss, die letzte Steigung schafft der Traktor nicht mehr mit den circa dreissig Leuten am Board, seine Räder versinken immer tiefer im Kies. Macht aber nichts. Wir sind schon angekommen, alle steigen aus, der Traktor kann jetzt ohne Ballast auch die letzte Herausforderung nehmen. Es ist Nachmittag um drei.
Was hatten wir für ein Glück: Super Wetter bis genau jetzt, nun fängt’s an zu regnen.
Nachtessen zu Hause, Spargeln, Risotto und Steaks. Auch ein paar Gläschen „Squeaking Gate“ natürlich.
Der nächste Tag ist wieder mal unseren elektronischen Geräten gewidmet, denn Theo hat durchblicken lassen, dass er Ruhe braucht, das heisst, er will nirgendwo hin. Ok. Das Wetter ist nicht allzu schön, mir soll’s recht sein. Emails schreiben, Fotos ordnen, Blog fabrizieren – ja und da passiert das Unvermeidliche erneut: Totaler Absturz. Theo sitzt den ganzen Nachmittag am Computer – ein paar Stunden sind dahin ohne Resultat. Mir sind die Kommentare ausgegangen. Ich leg mich auf die Hollywoodschaukel und lese.
Wir sind zwar in Hastings, aber wir waren noch gar nicht wirklich im Stadtzentrum. Also schlage ich vor, gegen sechs Uhr die Stadt, die immerhin etwas mehr als 70‘000 Einwohner hat, zu besichtigen und dort zu essen. Theo ist einverstanden, lässt seinen Mac Mac sein und kommt mit.
Wir sollen durch die Strasse „Wildschwein Ade“ fahren, so verstehe ich Rösi. Wir haben uns eigentlich schon gut an sie gewöhnt, lassen sie ihr seltsames Zeug plappern, ignorieren ihre Fabulierereien oder Buchstabierereien meistens, aber diesmal nimmt mich schon wunder, was genau sie meint. Auf dem Strassenschild steht: Wilson Ave (Wilson Avenue).
Im Zentrum können wir kaum glauben, was wir sehen beziehungsweise nicht sehen. Kein Mensch ist zu sehen, nur hier und da biegt ein Auto um einen Kreisel. Ist da eine Seuche ausgebrochen? Szenen aus Horrorfilmen kommen mir in den Sinn. - Alle Geschäfte sind geschlossen (es ist erst Dienstag, Viertel nach sechs), ein seltsamer Ort - wie eine Geisterstadt. Da wohnt nämlich gar niemand in diesen Häusern. Sie sind alle nur einstöckig und beherbergen jeweils ein Geschäft. Da die aber bereits geschlossen sind (seit fünf Uhr), ist der Ort fast menschenleer. An der einen Strassenkreuzung steht ein Hotel. Verwahrlost, geschlossen, am Zerfallen.
Mir fallen die vielen Blumenarrangements auf, die in gleichmässigen Abständen in jeder Strasse hängen. Es müssen Hunderte sein. Auch Blumenkisten hat’s überall. Da kommt mir in den Sinn, dass Claire und ihr Mann Cam, bei denen wir eingeladen waren, uns erzählt haben, dass sie den Auftrag für die Bepflanzung von der Stadt erhalten hatten, und das mit einem vierjährigen Vertrag. - Nicht schlecht. – Lustiges Detail: Es war genau ausgerechnet, wie viele Pflanzen (Fleissige Lieschen) in die Ampeln gepflanzt werden mussten, nämlich 35 Stück. Das Ganze ging dann aber nicht auf; es hatte nicht genug. Bis Cam dahinter kam, dass der Lehrling je 47 Stück eingepflanzt hatte. Sie liessen es so bleiben, die Ampeln könnten nicht schöner sein. Sie sind übrigens alle mit einem Selbstbewässerungssystem versehen. Mal sehen, ob der Lehrling noch immer dort arbeitet.
Irgendwo steht auf dem Trottoir ein Schild mit der Aufschrift: „The sun is shining! The drinks are cold and the garden bar is open”. Nicht zu fassen! Da ist noch jemand umä Wäg - da gehen wir rein. Kleiner könnte der Garten nicht sein, drei Tische hat’s. Die angekündigte Sonne auch, alles ein bisschen handgestrickt-grün, aber eigentlich ganz originell und gemütlich. Wir nehmen einen Apéro und wollen dann ein Restaurant suchen. Könnte schwierig werden. – Auf der gegenüberliegenden Strassenseite gibt’s zumindest ein Kino, und das in einem dekorativen Art Déco-Gebäude. Was spielen die? – „Hobbit –The Desolation of Smaug“, der zweite Teil der Trilogie. Fängt in vierzig Minuten an. – Machen wir, gehen wir uns anschauen. Ich hab ja erst gerade das Buch gelesen und Hobbiton haben wir auch besucht – gute Idee also, ganz spontan. Restaurant ade, aber da hat’s ein anatolisches Fastfood-Kebab-Café vis-à-vis des Kinos, das kommt uns grad recht. Das Lokal, wenn man es denn so nennen will, ist ohne Lizenz, das heisst, ich darf nicht einmal meine Flasche aus der Handtasche aktivieren, also ein recht nüchterner Abend wird das werden.
Wir sind nur etwa zu zehnt im Kino. Der Film dauert drei Stunden, für meinen Geschmack etwa eine zu lang. Dasselbe dachte ich vom ersten Film. – Das Buch jedenfalls gefällt mir besser. Trotzdem war’s ein gelungener Abend, ziemlich ungeplant – weder die Stadt, noch das Restaurant hätten wir uns so vorgestellt, als wir losfuhren, aber gerade das war das Gute dran.
Auf der Heimfahrt spielt uns Rösi einen Streich. Sie besteht auf der Routeneinstellung „Fussgänger“, da ist nichts zu ändern. Wir finden trotzdem heim.
An unserem letzten Tag schlafen wir aus und besuchen dann nochmals Cam in der Plantation Nursery, dem Gartenhaus. Er gibt uns eine Führung und zeigt uns die Maschinen, die ihm helfen, Arbeitskräfte einzusparen. Wofür jemand früher einen Tag lang brauchte, schafft die Maschine in einer Stunde. Beeindruckend! Er hat immer noch vier Ganztagsangestellte und ein paar Hilfskräfte, die vor allem im Frühling mithelfen. Der Lehrling, den ich oben erwähnte, ist gar keiner. Es waren zwei japanische Backpacker, halt auch der Sprache nicht eben mächtig, die nur vorübergehen Arbeit gesucht und die Blumen falsch eingepflanzt hatten. Offenbar keine Gartenspezialisten. Übrigens: Die Blumenkörbe, die wir am Abend zuvor in Hastings gesehen hatten, sind 1300 an der Zahl. Pro Jahr verkaufen sie vier Millionen Pflanzen, sagt Cam, das sei ein mittelgrosser Betrieb.
Am Nachmittag haben wir eine Wein-Tour gebucht. Wir werden um zwölf Uhr abgeholt und besuchen zusammen mit anderen Gästen (sechs Frauen, Theo ist der einzige Mann) vier verschiedenen Weingüter, „Mission“ (die älteste Winery in Neuseeland; sie wurde 1851 von Mönchen gegründet), „Moana Winery“, eine sogenannte Boutique Winery¸ ein sehr kleines, aber exklusives Weingut. Ihr Produkt ist ein Wein ohne jegliche Zusätze, also mehr als nur „Bio“, und ihre speziellsten Weine (etwas mehr als 4‘000 Flaschen lediglich) verkaufen sie nur gerade dort und an exklusive Restaurants.
Die dritte Winery ist „Wgatarawa Stables“, ein sehr schönes, gepflegtes Haus, war früher ein Pferdestall. Im Garten hat Hamish, unser Tourguide und Fahrer, für uns eine schöne Käse-Platte parat gemacht.
Die vierte Visite findet im „Black Barn“ statt, sehr exklusiv und wunderbar gelegen. Restaurant, Gartenrestaurant und Openair-Kino gehören auch dazu. Die Rebstöcke sehen so geputzt und gepflegt aus, wie wenn sie gar nicht echt wären. Riesige Felder von Reben umranden das Anwesen.
Es ist halb sechs, wie wir zu Hause ankommen und es beginnt grad zu regnen. Die Temperatur ist mittlerweilen auf 17 Grad gesunken (das ist ja wie daheim). Von unserem nüchternen Fahrer vor der Haustüre abgeladen, finde auch ich zur Abwechslung, eine Siesta wär gar nicht schlecht, aber wir haben ja noch so viel zu tun: Ich muss die Bohnen rüsten für den Salat, den ich zum Nachtessen machen will, es müssen noch Emails geschrieben werden, vielleicht kommt auch unser Blog einen Schritt weiter und schliesslich müssen wir schon wieder packen.
Wir haben „quite a few“ Weine probiert heute Nachmittag. Meistens Weissweine, von denen mir die meisten sehr gut schmeckten. Aber am liebsten ist mir der Syrah, die kräftigen Rotweine liebe ich halt besonders.
Von Hastings über Lake Tapo – Turangi nach Kuratau
Nachdem wir alles gepackt und das Haus in Ordnung gebracht haben, fahren wir nach Napier, der Stadt, die für ihre Art Déco Bauten bekannt ist. Mir gefällt es dort sehr; dieser Baustil ist einer meiner liebsten. Das Wetter ist schön, die farbigen Häuser mit ihren dekorativen Ornamenten kommen wunderbar zur Geltung. Mit Hastings zusammen bilden die beiden Städte eine Art Gemeinschaft (twin cities) und offenbar ist da aber auch eine Art Rivalität im Gang. Napier ist eindeutig trendiger; ich kann mir schlecht vorstellen, dass hier so wenig läuft wie in Hastings, das dagegen den Eindruck einer Schlaftablette macht. Es hat elegante, teure Läden und Restaurants, die zum Bleiben einladen. Nach zwei Stunden Herumschlendern und Kaffee und Kuchen Geniessen in der Fussgängerzone, fahren wir weiter Richtung Lake Taupo. Die Fahrt dauert knapp zwei Stunden und führt durch die Berge, die wir vom Te Mata-Aussichtspunkt aus im Westen gesehen haben. Es ist eine wilde und einsame Gegend, während 130 km gibt es keine Tankstelle. Nichts als Hügel, rauf und runter, keine Häuser, nur Busch mit seinen verschiedenen Bäumen und Sträuchern in jeder Grünschattierung, es hat aber auch Wälder, die neu aufgeforstet worden sind – alle Bäume im genau gleichen Abstand, ganze Bezirke mit schnellwachsenden, aber leider nicht indigenen Pinien verschiedener Grössen und Alters – und weite Gebiete, wo all die Bäume abgeholzt worden sind. Das Restholz wird einfach liegen gelassen. Dort sieht‘s zum Teil recht trostlos aus.
Wir nähern uns dem See. Jetzt sieht man den Ruapehu (man könnte meinen, es sei der Fujiama) und daneben den Ngauruhoe. Für Peter Jacksons Filmtrilogie „Der Herr der Ringe“ wurde der Ngauruhoe als Vorlage für den Schicksalsberg genutzt, was ihm zu weltweiter Bekanntheit verhalf. Das ganze Gebiet ist vulkanisch, Lake Taupo selber ist ein Vulkantrichter, irgendwann wird’s hier wieder einen Supergau geben, das ist jedem Wissenschaftler klar, die Frage ist nur, wann. – Kann ja jetzt noch grad ein wenig warten, wenn wir da sind.
Im Städtchen decken wir uns in der Information mit Broschüren ein über die Gegend und dann gibt’s ein Apéro, Piña Colada und Mojito. Wir beziehen unser Motel, das Huka Falls Resort. Es ist uns sehr wohl hier, wir haben einen eigenen Bungalow, eine ganze Wohnung mit Küche und Wohnzimmer für uns, das Restaurant (Café Pinot), das dazu gehört, ist erstklassig, wir geniessen einen schönen Aufenthalt.
Am Morgen besichtigen wir die Huka Falls, die nur grad wenige Kilometer weit weg gelegen sind. Die riesigen schäumenden Wassermassen, die der Waikato River führt, sind imposant, obwohl sie nur etwa zehn Meter hoch in die Tiefe stürzen. Es hiesst, pro Sekunde seien es 200‘000 Liter Wasser, in einer Minute wäre ein Olympiabecken gefüllt. Theo bezweifelt diese Angaben natürlich sofort und beginnt zu rechnen. Mir ist das gleich. Ich bin beeindruckt.
Ein paar Kilometer weiter gelangt man zu den „Craters of the Moon“, wo man einen interessanten Spaziergang machen kann, der etwa ein Stunde lang dauert. Eine Mondlandschaft stellen wir uns zwar anders vor (wo kommen all die Bäume und Sträucher her?), aber die Gegend hat’s schon in sich. Überall raucht‘s aus diversen Löchern in der Erde hervor, es brodelt und stinkt. Wir fahren anschliessend zurück in die Stadt, wo am Samstagmorgen am Flussufer ein Markt stattfindet. Eine gute Stimmung herrscht, es gibt lustige Dinge zu sehen. Was da nicht alles ausgestellt wird: Viel Selbstgebasteltes wird dargeboten, Gehäckeltes, Getöpfertes, Gedrechseltes. Theo lässt sich die Schuhe putzen, die’s tatsächlich mehr als nur nötig haben und kauft auch noch die Crème, die aus Bienenwachs hergestellt ist. – Etwas mehr für unsere übervollen Koffer…
Anschliessend fahren wir weiter dem linken Seeufer entlang in Richtung unseres nächsten Homelink-Swaps. Irgendwo am Ufer halten wir an, legen uns in die Sonne und lesen ein bisschen. Es ist nicht mehr weit. In Turangi, dem grössten Ort in der Gegend (etwas mehr als 3‘000 Einwohner) suchen wir einen Supermarkt, denn wir wollen Verpflegungsnachschub für die nächsten Tage kaufen. Ich fürchte nämlich, dort, wo wir hinwollen, hat’s wohl nicht grad einen Laden in der Nähe. So was von ausgestorben, dieser Ort. Da ist ja Hastings ein wahrer Rummelplatz dagegen. Alle Geschäfte sind zu in der Hauptstrasse, keine Menschenseele ist unterwegs (es ist halb fünf nachmittags an einem Samstag!), aber da, der Supermarkt ist noch offen. Die Angestellten sind jedoch auch bereits am Aufräumen, leeren die Gemüse- und Früchtegestelle, nur knapp noch finden wir, was wir brauchen. Seltsamer Laden. Was Fleisch anbetrifft, so hat‘s nur Würste, Schinken oder gefrorenes Schaffleisch in der Tiefkühltruhe. Auch das Personal kommt mir merkwürdig vor, irgendwie alle ein wenig „neben den Schuhen“. Wir fahren weiter und finden die Te Puka Road, an welcher das Haus steht, wo wir die nächste Woche wohnen werden. Es liegt ganz alleine auf weiter Flur, auf einer Anhöhe über dem kleinen Dorf Kuratau. Ein einzigartiges Panorama zeigt sich uns. Ums Haus herum hat’s kilometerweite Wiesen und Schafe, die dort friedlich weiden; sie kommen bis zum Garten – weiter unten sieht man das Dorf, das direkt am See gelegen ist (wo’s weder einen Laden noch ein Restaurant hat, wie wir später erfahren – meine Vorahnung also bestätigt). Der Blick auf den tiefblauen Taupo See ist herrlich. Ringsum reihen sich Berge. Das Gebiet ist vulkanisch, an einem der Hänge auf dem Weg hierhin dampft‘s und raucht’s aus diversen Rissen und Spalten, fast wie in Rotorua.
Wir können fast nicht glauben, dass dies das Haus ist, wo wir wohnen werden. Es ist riesengross. Wir haben abgemacht, wir kommen um fünf Uhr und typisch schweizerisch – um Punkt fünf Uhr „stehen wir auf der Matte“. Vor dem Arbeitsschuppen ein wenig weiter weg steht ein Pickup und Tony (Theo hat ihn und seine Frau Kitrena bereits im Juli in Bivio kennengelernt) ist gerade dabei, auf der Ladefläche des Wagens mit einem Beil irgendwelche Knochen zu zerhacken für den Hund. Teile eines Schafs natürlich. Das fängt ja gut an…
Tony zeigt uns alles, gibt uns Instruktionen, bevor er in seine andere Farm, die Foxley Station, die eine Stunde von hier entfernt ist, fährt. Im Gemüsegarten sollen wir uns bedienen, die Him- und Brombeeren sollen wir lesen, sie gehen ja sonst kaputt, es hat mehrere Kühlschränke und Tiefkühltruhen, bis obenhin gefüllt mit Fleisch. Einfach nehmen, was wir brauchen. Er hat sogar ein Brot gebacken für uns. - Mit den Schafen haben wir zum Glück nichts zu tun. Auf diesem „kleinen“ Grundstück sind es ungefähr 2‘000 Stück, erklärt er uns, und ein paar Rinder. – Hm… Die Dimensionen hier sind eben anders. Seine andere Farm muss viel grösser sein, er hat dort 20‘000 Schafe und ich weiss nicht wie viele Rinder. Dort sind wir am 25sten eingeladen, mit der Familie Weihnachten zu feiern. – Awesome!
Tony geht, wir richten uns ein. Das Haus ist so gross, dass wir uns am Anfang drin verlaufen. Es ist grosszügig, modern und sehr geschmackvoll eingerichtet. Sogar ein geschmückter Tannenbau steht drin. Extra für uns, sie sind ja nicht da. – Unglaublich, die Gastfreundschaft und Fürsorge, die wir hier stets erleben. Wir sind einmal mehr gerührt.
Rings um den Wohnraum hat’s verschiedene Fensterfronten auf drei Seiten (ohne Vorhänge zum Glück - es hat ja schliesslich auch keine Nachbarn, nur Aussicht). Eine davon sollen wir nicht öffnen, weil die Tür verklemmt ist. – Der gewiegte Leser merkt sofort: da kommt noch was. Ich bin am Kochen (Penne) und mache vorher einen Salat, auch wenn Theo bei diesem Teil des Menus nicht besonders freudvoll dreinblickt. Er wandert ein wenig herum nach dieser Vorspeise und öffnet die hintere Tür zum Patio (er hat offenbar nicht gehört, was Tony gesagt hat und ich hab nicht gemerkt, dass er es nicht gehört hat). - Also öffnen lässt sich die Türe schon, aber schliessen… Sie steht jetzt weit offen und draussen hat’s begonnen, sturmartig zu winden. Unser erster Versuch, den Schaden wieder gut zu machen, misslingt kläglich an der Konstruktion, wie Theo sagt. Die Tür mit ihrer Schiebevorrichtung lässt sich keinen Zentimeter weit bewegen. - Nach dem Essen macht mein findiger Gatte (dem „Äscheniör ist nichts zu schwör“) einen Besuch in der Werkstatt. Mit Motorenöl, Feile und Hammer bewaffnet macht er sich an die Arbeit und mit vereinten Kräften (er von aussen, ich von innen) gelingt es uns endlich, die Tür wieder zu schliessen. - Uff, das war knapp. Die Klinke können wir zwar nach wie vor nicht bewegen, aber die Tür ist zu, und das ist die Hauptsache. Sie würden das Haus nie abschliessen, auch nicht, wenn sie weg sind, hat Tony gesagt. Also: no worries. Er kommt am nächsten Dienstag vorbei, um nach den Schafen zu sehen, dann können wir ja beichten.
Kuratau – Foxley Farm
Die Sonne geht über dem See auf. Man kriegt gar nicht genug von der fantastischen Aussicht. Es ist absolut friedlich, nur Vogelgezwitscher ist zu hören, manchmal blökt ein Schaf.
Etwas weiter unten in der Ebene sieht man Tonys Flugzeug stehen, eine einmotorige Cessna, er braucht sie hin und wieder, um von einer Farm zur anderen zu gelangen und sowieso liebt er die Fliegerei. Der Blick aus den Wolken muss umwerfend sein: Der See, die Vulkane, die grünen Weiden und Wälder…
Ich geh erst mal zu Fuss auf Erkundung den Hügel hinauf durch all die Schafweiden. Tony hat gesagt, der Blick von dort oben lohne sich. Das muss ich natürlich ausprobieren. Theo hat anderes zu tun. Wenn’s schon mal läuft mit der Weihnachtskarte, die er am Kreieren ist, dann will er dran bleiben. Sagt er. Ich denke, er nutzt meine Abwesenheit nebenbei auch gezielt für eine kleine Siesta. Das könnte schon sein.
Und ich, ich hätte lange Hosen anziehen sollen. Die vielen Disteln sind meinen Waden nicht wohlgesinnt. Es geht teilweise recht steil bergauf und dauert fast dreiviertel Stunden, bis ich ganz oben bin und auf die jetzt winzig klein erscheinende Farm hinunterblicken kann. Unterwegs begegne ich einem Kaninchen, das in grosser Panik das Weite sucht. Den Schafen geht’s ebenso. Sobald sie mich sehen – nichts wie fort und weg. - Die sollten sich ein Vorbild nehmen an den Tölpeln in Hastings, die sich durch gar nichts aus der Ruhe bringen lassen!
Zuoberst setzte ich mich auf einen Stein, der nicht gar so verschissen ist, und schaue auf die Gegend hinunter, die beiden Dörfer Kuratau und Omori, den See – ja, ich weiss, wieder die alte Leier. Aber es ist sooo schön! Und um das Bild vollständig zu machen: Dort, wo die Vulkane sind, speit doch gerade in dem Moment tatsächlich einer Asche in die Luft, ein dunkler Rauch steigt auf.
Abstieg den ausgetrampelten Pfaden entlang, durch die Absperrgatter für die Tiere, links von mir eine Herde von tiefschwarzen Rindern, von denen mich ausnahmslos alle konzentriert und argwöhnisch beobachten, rechts der Vulkan, dazwischen ich. – Zugegeben - es ist nur halb so dramatisch und abenteuerlich. Das Vieh ist relativ weit weg, der Vulkan noch viel weiter - der Apéritif ist sehr viel näher.
Theo möchte noch immer daheim bleiben, kein Wunder, das nächste Restaurant ist mindestens eine Viertelstunde Fahrt weit weg. Es gibt Spaghetti mit einer Peterlisauce, das Rezept von Pia Steiner, weil ich keine Tomaten mehr habe (die im Garten sind noch nicht reif), auch kein Fleisch, und die Schafe in der Tiefkühltruhe möchte ich lieber drin lassen. Theo sieht nicht gerade begeistert aus. „Könnte man da eventuell noch ein Ei in die Sauce rühren?“, ist seine Frage, die ich natürlich beleidigt abschmettere. Mich dünken die Spaghetti ober-lecker und ich werde sie wieder machen. Es hat ganze Petersilien-Beete im Garten, offenbar lieben diese Kräuter die vulkanische Erde. Und ich liebe die Kräuter. Noch viel weniger enthusiastisch wirkt Theo, wie er erkennen muss, dass es uns an Salat nicht mangelt.
Wir beobachten beim Essen, wie der Tag langsam zu Ende geht, und da wird Theo poetisch. „Jetzt nimmt die Nacht den See in Besitz.“ Wahrscheinlich hat ihm die grosse Portion Petersilie tatsächlich nicht so gut getan.
Der See ist ganz silbrig heute Morgen. Graue Streifen hat’s auch drin. Das sieht zwar schön aus – Sonnenaufgang genau über dem See – aber die vielen Wolken verheissen keinen schönen Tag. Ausruhen, gemütlich lesen und schreiben, am Abend 15 Minuten zum nächsten Restaurant fahren und eine halbe Stunde zurück, weil wir uns verfahren haben. Ich war dagegen, Rösi einzuschalten, sie hat sich gerächt.
Waitomo
So darf sie am nächsten Tag wieder kommentieren und uns ihre Schleichwege aufschwatzen. Wir fahren zu den Waitomo-Höhlen, nördlich von hier; die Fahrt dauert gut zwei Stunden. Da findet sie wieder eine Abkürzung (kann ja sein, dass ihre Variante zwei, drei Meter kürzer ist als die Strecke gewesen wäre, wenn wir auf der Hauptstrasse geblieben wären), Kurve um Kurve, rauf und runter, überhaupt kein Verkehr, aber schliesslich kommen wir in Waitomo an. Es ist der 24ste Dezember.
Manchmal ist es recht schwierig zu entscheiden, welche Tour man mitmachen will, welche diejenige ist, die einem am besten passt. Es gibt vier verschiedene Anbieter. Die einen organisieren abenteuerlichere, die anderen weniger abenteuerliche Höhlenbesichtigungen, teuerlich sind sie aber alle. Praktisch ist stets der Tripadvisor, da kann man bei den Bewertungen ein wenig sehen, was die Leute gut finden beziehungsweise bemängeln. Also, wir entscheiden uns für „Spellbound“, die dreieinhalbstündige Besichtigung zweier Höhlen (über hundert soll’s geben in der Gegend, nur wenige begehbar). Das Gute dran ist, die Gruppen bestehen aus höchstens zwölf Personen, wo hingegen die anderen Anbieter fünfzig Personen durch die drei bekanntesten Höhlen schleusen.
Die erste Begehung ist mehr als nur eindrücklich. Es ist die Höhle, in der Sir David Attenborough einen Teil seiner neunteiligen „Life-Series“ aufgenommen hat und ebenso entstand die BBC-Dokumentation „Planet Earth“ dort drin. Das Interessante sind die Glowworms (nicht zu verwechseln mit unseren Glühwürmchen), die an den Höhlenwänden und vor allem an der Decke dicht aneinanderkleben. In einem Gummiboot gleitet man ganz langsam und gemächlich auf einem unterirdischen Fluss durch die völlige Dunkelheit. Was man hört: das Rauschen des Wassers und eines Wasserfalls in der Ferne. - Was man sieht: etwa zwei Meter über unseren Köpfen Tausende von kleinen Lichtern wie ein extremer Sternenhimmel und das in 3D. Es ist überwältigend, märchenhaft, wie nicht von dieser Welt. Anderseits, wenn man’s genau betrachtet, ist das Ganze eigentlich eher eklig. Es sind keine Würmer, sondern weibliche Pilzmücken-Larven, ca. 2-2,5 cm lang, die an ihren Hinterteilen leuchten, wenn sie hungrig sind (das bläuliche Licht wird aus Luziferin mit Hilfe des Enzyms Liziferase erzeugt), um Mücken anzuziehen oder um zu signalisieren, dass sie sich paaren wollen. Wenn sie gestört werden, so schalten sie ab, erfahren wir. Sie lassen dünne, fast unsichtbare, klebrige Fäden herunterhängen, in denen sich die Beute dann verfängt. Wenn sie nichts zu essen haben – kurzer Prozess - fressen sie sich gegenseitig. Etwa neun Monate lang sind sie, ohne sich von der Stelle zu rühren, mit dieser Tätigkeit beschäftigt, bis sie sich anschliessend während zwei Wochen verpuppen. Dann schlüpfen sie und als „erwachsene“ Fliegen leben sie noch zwei bis drei Tage weiter, ohne Mund, mit dem einzigen Zweck, Eier zu legen, die Art zu erhalten und Touristen zu erfreuen. – Aber leuchten tun sie schön.
Auch die andere Höhle war eindrücklich - wie Höhlen eben so sind. Irgendwo liegt das Skelett eines Moa (oder zumindest Teile davon). Das war ein Riesenvogel (grösser als der Vogelstrauss; sie wurden bis zu drei Meter hoch), der vor 600 Jahren ausgestorben ist.
Norm, unser Führer, hat uns auf sehr unterhaltsame Art viel Wissenswertes, Fakten, Geschichten und Anekdoten erzählt. Begonnen hat’s mit der Beschreibung des Ortes Waitomo. Im Ort hat‘s drei Ticketoffices, einen Laden, ein Hotel, ein Motel, ein Rugbyfeld und 41 Einwohner. Auf die Frage, ob die alle verwandt seien, sagt er nur, er selber wohne nicht dort.
Die Gegend ist sehr interessant. Es gibt nichts als Hügel, nirgends eine flache Stelle (ausser dem Rugbyfeld). Die Hügel sind teilweise wie Zuckerstöcke und Pyramiden ineinandergeschoben, alle grün bedeckt mit Schaffutter, ausnahmslos alle gerillt in völlig parallel scheinenden horizontalen Linien, Trampelpfade von Tausenden von Schafen, die seit über hundertfünfzig Jahren die Weiden abgrasen. Die Gesteinsformationen sollen ungefähr 25 Millionen Jahre alt sein. Mal ein Meer, so hat es auch Fossilien in den Kalksteinablagerungen, und sehr gut sind die verschiedenen Lagen und Schichtungen in den Felsen zu sehen. Zwischendurch hat’s tiefe Löcher, die zum Teil in Höhlen enden, nicht unbedingt sehr praktisch für die Schafe.
Gute zwei Stunden Heimfahrt, unterwegs kurzer Einkauf im New World Supermarkt von Te Kuiti, der heute, am Heiligen Abend, bis um neun Uhr geöffnet hat. Wir sind aber froh, weil wir schon fürchten, nirgendwo ein Restaurant zu finden, das sich unser an diesem speziellen Abend erbarmen würde. Um halb neun sind wir zu Hause, es ist noch so hell, so dass ich ohne weiteres im Gemüsegarten Salat holen kann und eine Schüssel Him- und Brombeeren zum Dessert. Den ganzen Tag lang haben wir nebst zahllosen Glühwürmern und massenhaft Schafen auch etliche Rinder gesehen. Letztere (oder zumindest Teile davon) nun am Abend zu Hause auch noch auf unseren Tellern. Filet gibt’s und Kartoffeln, die zu verbrennen mir leider ganz gut gelingt in Unkenntnis der Pfanne und des Herds.
Theo räumt die Küche auf nach dem Essen. Das ist unser Deal: Ich koche, er übernimmt das Nachspiel. Also habe ich jetzt Musse, nach draussen zu schauen über die Ebene und zu sehen, wie’s langsam dunkel wird. Je dunkler es draussen wird umso besser sehe ich Theo, der sich beim Hantieren in der Küche hinter mir in der Scheibe spiegelt. Wie ein Geist, über dem Lake Taupo schwebend, sieht er aus.
25. Dezember – Weihnachtstag
Weihnachten feiern am Strand, bei Temperaturen um die 30 Grad, Sonne, Liegestuhl und Dolce far niente – so oder so ähnlich haben wir uns das ursprünglich vorgestellt. - Dem ist nicht so!
Der Sommer hier erinnert mich an einen Sommer in der Schweiz: Wenn die Sonne scheint, kann‘s sehr heiss sein, wenn nicht, eher kühl und unfreundlich. So ist’s heute leider.
Um elf sind wir bei unseren Gastgebern auf ihrer Farm zur Weihnachtsfeier eingeladen. Wir müssen eine gute Stunde fahren, bis wir Foxley Farm an der Ohura Road erreichen. Lieder müssen wir wieder genau die Strasse entlang fahren wie gestern und das zudem bei schlechtem Wetter. Es regnet immer wieder mal und in höheren Lagen hat’s sogar Nebel. Nichts gewesen mit Aussicht.
Wir werden herzlich empfangen von Kitrena, Tony und Edna, einer Freundin der Familie. Sohn Andrew mit Gattin Prue und Freddie, dem zweijährigen Sohn, sind auch schon dort sowie Tochter Sarah mit ihrem Ehemann Alan und den beiden Söhnen, Frazer (knapp zwei) und Thomas, fünf Monate alt. Da läuft also was. Der Gschänklisegen ist nicht anders als bei uns, er hört nicht auf und die Kleinen sind für Monate eingedeckt mit neuen Spielsachen, Trucks und Bilderbüchern.
Vor dem Festmahl nimmt uns Tony in seinem Pickup mit und zeigt uns das ehemalige Wohnhaus auf der Farm, das jetzt an seinen Manager vermietet ist, wo die Familie aber jahrelang gewohnt hat. Sogar ein Swimmingpool hat’s und einen Tennisplatz. Der hat aber schon sehr, sehr, sehr viel bessere Tage gesehen. Er dient jetzt als Spielplatz für die Kinder. Kitrena und Tony selber haben noch ein „Cottage“, wie sie es nennen, wo sie sich aufhalten, wenn sie die Farm besuchen. Mindestens einmal pro zwei Wochen ist das für wenige Tage der Fall sowie auch jetzt, wo wir ja in ihrem Haus wohnen. Wir sehen anschliessend die Scherstation, wo sechs Scherer jeweils gleichzeitig die Schafe scheren. Dazu kommen vier Frauen, welche die geschorene Wolle untersuchen, bewerten und trennen und zwei weitere Männer, die sie an zwei Maschinen weiterverarbeiten. Jedes Tier kommt zweimal im Jahr dran (ca. 20 Tausend Tiere insgesamt). Das geschieht in verschiedenen Abständen von Mai bis August, ausgenommen im Winter. Tony erklärt uns alles; für mich ist es interessant, da in den Romanen, die ich über Neuseeland gelesen habe, sehr oft die Rede ist vom Schafscheren, den Männern, die dafür angeworben wurden und dem Leben in diesen Gegenden zur Zeit der Pioniere. Geändert hat sich seit dem 19. Jahrhundert nicht sehr viel, natürlich, die Scherwerkzeuge sind jetzt elektrisch, es hat ein paar Maschinen, aber immer noch werden die Scherer angeworben, sie erhalten einen äusserst niedrigen Lohn, arbeiten im Akkord und müssen recht „strubi Giele“ sein, die sich nach der Arbeit mit Bier volllaufen lassen und was da so alles dazu gehört. Es hat Behausungen zum Übernachten für sie (da seien jeweils wüste Partys gefeiert worden), aber das hat sich auch geändert. Heute würden die Scherer zur Farm gefahren und abends wieder abgeholt.
Der Farmbesitzer hat nichts mit alledem zu tun, er überlässt und zahlt alles einem Contractor, einem Mittelsmann, der das Ganze organisiert und regelt. Der sei zwar sehr teuer, es lohne sich aber einen zu beauftragen, um Stress und Ärger zu vermeiden. Pro Schaf, das geschoren wird, muss ihm Tony ca. 2 Franken zahlen, der Scherer erhält grad mal die Hälfte davon. Die Schafe wiegen 50 – 60 kg und ein guter Scherer schaffe pro Tag 300 Stück. – Unglaublich. - Wie das geht, haben wir ja in Brisbane gesehen, im Koala Lone Sancturay: der ultimative Riesenstress für Tier und Scherer.
In der Lokalzeitung, unter der Rubrik „Farming“, lese ich ein paar Tage später, dass es grad einen Rekord gegeben hat von fünf Scherern, die in 9 Stunden 2‘638 Lämmer geschoren haben. Der Rekord einer Schererin (Emily Welch) im November 2007 waren 648 Lämmer in neun Stunden. Auch das wird im Artikel erwähnt. Bemerkenswert in mancher Hinsicht, muss ich sagen! – Ausrechnen kann, wer will...
Zurück zum Besuch auf der Foxley-Farm: Wir sehen und lernen auch über die unterschiedliche Qualität der Wolle: Die schönste ist ganz weiss und viel dichter, und nur auf der Südinsel hat’s Schafe (Merinoschafe), die solche Wolle liefern. Die Schurwolle hier wird für Teppiche gebraucht. Ballen von 200 kg stehen bereit zur Auslieferung.
Das Essen, das uns anschliessend serviert wird, ist phänomenal. Da stecken mehr als zwei Tage Vorbereitung dahinter. Meine Sorge war, dass es nur Lammfleisch gibt, das ich ja nicht besonders mag, aber es gibt auch eine riesige, fein zubereitete, mit Honig glasierte Hamme - einfach köstlich. Dazu verschiedene Salate und Saucen und natürlich auch ein Stück Gigot, zubereitet zur Perfektion während vier Tagen. Ich halte mich nicht dafür, nicht zu probieren und muss sagen, es war ausgezeichnet, butterweich. Kaitrena sagt, es sei eben ein besonders junges Lamm, eines, das man in dieser Art nicht im Laden kaufen könne…
Zum Dessert gibt’s homemade Icecream, Christmaspudding, Christmas-Mintpie, Brandy-, Rahm- und Joghurtsauce dazu, Erdbeeren, selber gemachte Meringuen – sagenhaft, wie wir verwöhnt werden – das reinste Schlaraffenland.
Zum Trinken gibt’s „Bubbles“, so nennen sie doch tatsächlich die Flasche Moët & Chandon, so dass, als verschiedene Getränke zur Auswahl stehen, ich denke, sie meinen Mineralwasser mit Kohlensäure.
Zum Essen wird Saint-Emilion serviert, es muss am heutigen Tag ja etwas Spezielles sein – es geht uns sehr gut!
Letzte Tage in Kuratau
Zu Hause sind wir recht müde von der Fahrt und dem Erlebten, es ist aber Weihnachtsmorgen in der Schweiz und ich will meine Mails noch anschauen. Dort bleib ich hängen und geh dann doch auch wieder erst gegen Mitternacht ins Bett. Essen mag ich nichts mehr, Theo schon, er macht sich eine seiner (meiner Meinung nach) grässlichen Büchsensuppen, die er so gerne mag, und sein Kommentar beim Aus-dem-Fenster-Gucken ist diesmal: „Dunkelheit und See gehen ineinander über“.
Am Stephanstag sieht’s ein wenig besser aus. Denken und hoffen wir. Wir nehmen’s sehr gemütlich, beschliessen dann aber doch, nicht den ganzen Tag daheim zu verbringen, sondern ein Ausflügli (was unter einer Stunde ist, verdient die Verkleinerungsform) zu machen. Der Tongariro-Nationalpark ist ja quasi nebenan. Dort sind die drei Vulkane, von denen ich vorher schon berichtet habe. Auf halbem Weg zum Gipfel des Ruapehu gibt’s im Whakapapa-Village (ich liebe diese Namen!) einen Sessellift, der bis auf 2020 Meter Höhe führt. Vielleicht sieht man ja doch was… Nach dreiviertelstündiger Fahrt sind wir im Village. Dichter Nebel herrscht und es beginnt gleich zu regnen. Es ist wie in den Bergen bei uns: ein Restaurant, ein Sportshop, wo man die Dinge kaufen kann, die man zu Hause vergessen hat oder die man dringend braucht wie Ski-, Regen- und Windjacken, Brillen, Hand- und Wanderschuhe, etc. etc. Das mit der Sesselbahn vergessen wir augenblicklich, die Betreiber sind offenbar gleicher Meinung, sie schliessen sie gleich. Wir trinken einen Kaffee, auf den wir eine halbe Stunde lang warten müssen und der, weil’s doch ein Feiertag ist, heute ganz exklusiv 10% mehr kostet. Der Nebel lichtet sich ein wenig, der Regen lässt nach, wir haben grad Zeit, einen kleinen Spaziergang zu machen zu der steilen Felswand, der „Mead’s Wall“, wo eine der Szenen zum Film „Lord of the Rings“ gedreht wurde. Der Vergleich mit unseren Schweizer Bergen hinkt natürlich gewaltig. Impsant sind die schwarzen Felsen und Lavabrocken, die überall herumliegen. Vegetation scheint’s keine mehr zu geben. Eine steinige Gegend. Bei näherem Hinsehen merkt man allerdings, dass die Steine, welche in jeder Grösse vorhanden sind, die verschiedensten Farben haben und dass auch vielerorts ganz winzig-kleine Bergblümchen wachsen.
Es regnet wieder, ziemlich stark sogar; wir fahren zurück Richtung Turangi. Es ist schon merkwürdig und natürlich sehr schade zu wissen, dass wir auf unserer rechten Seite eine absolut spektakuläre Aussicht auf die Vulkane hätten, falls die Sonne scheinen würde. Beim See tut sie uns netterweise den Gefallen und schaut ganz kurz aus den Wolken, so dass es uns gelingt, einen Blick auf die andere Seite, nämlich auf den Lake Taupo, den Tangariro River und Turangi zu werfen.
Rascher Einkauf im Supermarkt – Snapper ist’s diesmal – dann fahren wir nach Hause. Schon als wir losfuhren heute Mittag, sahen wir, dass sich zwei Schafe auf dem 600 Meter langen Schotterweg, der zum Haus führt, ausserhalb des Zauns aufhielten. Was tun? – Nichts, entschieden wir. Uns kam keine gute Strategie in den Sinn. Wir sahen auch nirgends ein Loch, durch das sich die beiden hindurchgezwängt haben mussten. – Jetzt ist das anders. Wir haben einen Plan. Die beiden, Mutter und Kind, also Lamm, stehen immer noch ziemlich dumm auf dem Weg, auf der anderen Seite des Zauns blökt das Geschwister ganz laut und kläglich, so dass wir wenigstens wissen, wohin die beiden Abtrünnigen gehören. Vor dem Auto flüchten sie bergauf. Das ist mal gut, so gelangen sie nicht auf die Strasse. Aber die Mutter will auch nicht zu weit weg von ihrem andern, folgsamen Kind. So bleiben die zwei nicht weit vor unserem Auto stehen. Ich steige aus, gehe ganz langsam an ihnen vorbei, so dass sie zwischen mich und das Auto geraten. Es gelingt mir dann, die Gattertür weit zu öffnen. Die anderen Schafe rennen natürlich wie von der Tarantel gestochen von mir und dem Gatter weg, was gut ist, denn so laufen nicht noch andere aus dem Gehege. Theo steigt jetzt auch aus und wir gehen beide (super, nicht wahr!) auf die beiden Schafe zu, die jetzt ebenfalls die Flucht ergreifen und durch das offene Tor auf ihre Weide rennen. Wir sind ja beide so stolz, dass wir dieses Kunststück vollbracht haben. Das Allerschönste ist es dann, zu sehen wie das Lamm, das seine Mutter wohl schon verloren geglaubt hat, mit Freudesprüngen auf diese zuspringt und wie die beiden Lämmer sogleich anfangen, am Euter der erleichterten (so denk ich mir das) Mutter zu saugen. Immerhin waren sie einen ganzen Nachmittag lang getrennt. – Aktion Schaf erfolgreich abgeschlossen, das war unsere gute Tat für heute.
„Jetzt frisst der Nebel den See“, sagt mein poetischer Gatte soeben, bevor er sich seinen Whisky einfüllt und zur Siesta ins Schlafzimmer verschwindet.
So hab ich noch ein wenig Zeit, hole mir im Garten zwei grosse Portionen wunderbaren Salat und mach mich dann allmählich ans Zubereiten des Nachtessens. Ich brauch noch ein wenig mehr Petersilie für die Sauce, kommt mir grad in den Sinn.
Etwas Grosses unternehmen wir nicht an unserem letzten Tag. Kuratau ist eine sehr kleine Siedlung. Wir sind schon vor ein paar Tagen durch ein paar Strassen gefahren und haben gleich gesehen, dass es da eigentlich nur Ferienhäuser gibt. Inzwischen sind die meisten Häuser bewohnt, endlich sind Ferien, und beim Bootanlegeplatz herrscht sogar ein Gewimmel von Leuten. Aus allen Löchern strömen sie plötzlich. Jedes Auto hat einen Anhänger mit Motorboot und alle wollen jetzt aufs Wasser. Mir kam’s schon komisch vor, dass man keine Boote sieht auf dem See. In all den Tagen seit wir hier sind, hab ich nur ein einziges Segelboot gesehen und eine Handvoll Motorboote. Dabei – soo schlecht war das Wetter nun auch wieder nicht.
In einem Weingut in der Nähe findet ein Markt statt, da gehen wir mal hin. Es sind zum Teil die gleichen Marktleute wie in Taupo, offenbar reisen sie von Markt zu Markt wie bei uns ja auch. Einzig der Helikopterfluganbieter ist neu. Einen Flug über dieses schöne Gebiet mitzumachen, das hätten wir uns überlegt, das wär schön gewesen, wenn das Wetter besser wär, aber so… Es hat ja keinen Sinn, die Wolken zusätzlich von oben zu betrachten und dafür auch noch zu zahlen. Von unten genügt.
Ganz in unserer Nähe, etwa zwei Kilometer vom Haus entfernt in der Ebene, hat’s ein weiteres kleines Weingut (Boutique Winery Floating Rock), das wir bisher völlig übersehen haben. Dem ist ein kleines Café angeschlossen, wo’s auch Pizza gibt’s und natürlich Wein. Den müssen wir allerdings vor sieben Uhr abends bestellen, so will es die Lizenz und das Gesetz. - Lustig, diese Neuseeländer.
Machen wir aber so, ist ja kein Problem, wenn man’s weiss und nicht etwa erst um Viertel nach sieben antrabt. Sogar mit ein wenig Sonne werden wir verwöhnt, wir geniessen’s. So ein schöner Ort: klein, mitten in den wohl gepflegten Reben. Der Chef erzählt uns ein wenig etwas über seinen Wein und auch über die Pflege der Reben. Wenn das Gras zu hoch wird zwischen den einzelnen Stöcken, holt er seine Schafe, die fressen dann alles glatt und am Schluss kann man die wohlgenährten Schafe essen, meint er (win-win-situation). – Billige Angestellte, finde ich. Und auch ein wenig dumm.
Von Kuratau nach Wellington
Putzen, packen, weg. Wieder mal. Und einmal mehr tut es uns leid, diesen schönen, ruhigen Ort, an dem wir uns so wohl gefühlt haben, zu verlassen, wo wir nie eine Türe schliessen mussten, wenn wir weggingen, wo die Schafe so friedlich um uns herum grasten tagein, tagaus. Der nächste Ort wird sicher hektischer werden – mitten in der Hauptstadt Wellington. Aber eben, das ist ja auch das Schöne: Abwechslung macht das Leben süss.
Wir fahren auf der anderen Seite des Tongariro-Nationalparks gegen Süden und obwohl es auch heute wieder bedeckt ist, sehen wir, mindestens teilweise, die beeindruckenden Vulkane, Ruapehu und Ngauruhoe.
In Ohakune machen wir Halt, es ist ein richtiger Höhenkurort, ähnlich wie bei uns, mit lauter Sportgeschäften und Cafés. Den absolut bittersten Kaffee gibt’s im Utopia Café. Die reinste Utopie. Tschuder!
Von dort aus gibt es zwei Wege nach Wanganui, zu unserem heutigen Ziel, wo ich heute Morgen ein Motelzimmer gebucht habe. Der eine dauert gut zwei Stunden, der andere fast nur halb so lang. Wir haben ja Zeit, also wählen wir trotzdem den ersten, der ist offenbar viel schöner. Es ist der Whanganui-River-Scenic-Drive. Auch das Wetter hat sich inzwischen eines Besseren besonnen. Jerusalem, London, Athen, Korinth – durch alle diese Orte fahren wir hindurch, Missionare haben sich dort in der Mitte des 19. Jahrhunderts niedergelassen - abgelegener geht fast nicht mehr, die Strasse ist dementsprechend. Sie ist kurvenreich und eng, schlängelt sich oberhalb des Flusses in der Höhe den Felsen entlang; man hat oft das Gefühl, den nächsten Steinschlag gibt’s gleich um die Ecke beziehungsweise nach der nächsten unübersichtlichen Kurve. Während etwa 20 km ist sie nicht einmal mehr asphaltiert, so dass ich wieder mal Angst habe um unsere Pneus. Wie durch ein Bachbett mit groben Steinen muss sich unser armer Nissan quälen, aber er schafft es. Allerdings nicht mit 70 km/h, so ist nämlich auf den Strassenschildern die Höchstgeschwindigkeit angegeben. Pikantes Detail, finden wir. Normal darf man ja überall 100 fahren, ausser innerorts oder bei Baustellen. Hier finden sie offenbar, 70 lange auch - wie wenn jemand auf diesem Pfad auch nur auf die Idee kommen könnte, mehr als 30 zu fahren…
Endlich ist die Strasse wieder gepflastert. In Matahiwi besuchen wir eine historische Mühle, ursprünglich gebaut im Jahr 1850, hundertdreissig Jahre später restauriert. Etwas später machen wir einen zweiten Halt in einer Maori-Siedlung. Es gibt dort ein Café. „Offen“, steht auf dem Schild geschrieben, aber die beiden Maori-Damen, die im Garten unter einem Sonnenschirm sitzen, erklären uns, es sei doch zu. Aber wir könnten doch etwas zu trinken haben, Tee, Kaffee oder etwas Kaltes. Nehmen wir gerne an. Offen - geschlossen – doch offen? – Die beiden haben Truthahnfedern vor sich, Wäscheklammern und Schachteln mit sonstigen Bastel-Zutaten. Auf meine Frage, was sie machen, erklärt mir die eine, sie wisse es eigentlich selber nicht so genau, es sei eben ein wenig „arti-crafty“.
Ein paar Kilometer weiter muss es Fossilien haben im Fels, denn vor Urzeiten war das ganze Gebiet hier ein Meer. Diese Versteinerungen möchte ich gerne sehen. Oft ist die Beschriftung am Wegrand nicht ganz so toll, so dass es uns schon mehr als einmal passiert ist, dass wir an etwas, das wir uns eigentlich hätten ansehen wollen, vorbeigefahren sind. So frage ich, wo genau diese Cliff Fossiles denn seien. Die Antwort ist: „You cannot not see it.“ Also bin ich beruhigt und es stimmt. Wir fahren ein paar Kilometer weiter und die Fossilien sind tatsächlich nicht zu übersehen. Faszinierend: Hier muss ein ganzes Riff gewesen sein, es hat hunderte von Muscheln, die im weissen Fels drin stecken, an dem die Strasse vorbeiführt. Alle natürlich versteinert.
Wir kommen gegen sechs in Wanganui an, finden (dank Rösi) gleich unser Motel und sind ganz zufrieden mit dem kleinen Studio. Immer hat’s einen Kühlschrank, Tee und Kaffee kann man machen, eine kleine Küche ist dabei – was will man mehr? Eigentlich eher weniger würden wir brauchen, aber was soll’s, das ist eben Standard.
Gegen acht gehen wir in die Stadt. Man könnte gut zu Fuss gehen, aber Theo möchte lieber das Auto nehmen, denn er könnte ja nass werden; es regnet nämlich wieder. – Eine Stadt von etwas mehr als 40‘000 Einwohnern – Samstagabend - kein Mensch auf der Strasse. Kaum zu glauben. Und daran ist sicher nicht nur der Regen schuld. Wie in Hastings. Wir finden ein Thai-Restaurant und essen ganz fein. Der Wein aus meiner Handtasche heisst „Odd Socks“. Ungleiche Socken – das passt ganz gut zu Theos ewiger Suche nach Socken, von denen er behauptet, die Waschmaschine fresse sie. Beim ersten Blick auf die Etikette hatte ich allerdings gelesen „Old Socks“ und hatte die Flasche gleich wieder ins Regal zurückstellen wollen. Lesebrille sei Dank, tat ich das dann doch nicht.
Am Morgen regnet es. Schon wieder oder immer noch? - Es langt allmählich!
Trotzdem bestehe ich auf den Besuch auf dem Lookout der Stadt, einem ganz besonderen diesmal. Es ist ein Lift, der „Durie Hill Elevator“, der dort hinauffährt, 1919 innerhalb des Felsens gebaut (es gibt nur zwei davon in der Welt, wird stolz berichtet – „The only earthbound elevator in New Zealand“), um den Leuten, die auf der Anhöhe wohnen, den Zugang zu Stadt und Fluss zu erleichtern. Eine Treppe hat’s auch, die nehmen wir für den Aufstieg (191 Tritte), hinunter dann, um unsere Knie zu schonen, geht’s mit dem historischen Lift („historisch“ ist eines der Lieblingswörter in den NZ- und AU-Prospekten).
Die Aussicht ist bemerkenswert: Fluss, Stadt und im Hintergrund die Vulkane, die wir nicht sehen. - Gerne hätte ich auch das Museum besucht und die Galerie, die besuchenswert sein soll, aber es ist Sonntag – sehen wir also auch nicht.
Dann Weiterfahrt Richtung Süden. Unterwegs wollen wir (Theo, ich nicht) ein Luftfahrtmuseum besuchen, das im Reiseführer erwähnt wird („Royal New Zealand Air Force Base at Ohakea, home to the No. 75 Squadron of the RNZAF and its Airforce Museum“, sogar die Öffnungszeiten sind genannt). Rösi schon, und sie dirigiert uns direkt nach Ohakea. Da ist tatsächlich militärisches Gebiet, eine Absperrung und ein aufgespiesstes Flugzeug vor dem Eingang. Aber: Niemand weiss etwas von einem Museum. Nicht auf der Air Base selber, nicht der Polizist, den Theo in seiner Not fragt, nicht der Restaurantbesitzer im nächsten Ort, in Sanson. In Interlaken war er, das hat ihm sehr gefallen, aber das Flugzeugmuseum…?
Mir macht’s nichts aus. Also Weiterfahrt. Um halb sechs kommen wir in Wellington an, nach einer kurzen Extrafahrt mit Rösi, die darauf besteht, kurz vor dem Ziel doch noch eine weitere Schlaufe auf dem Weg in unser neues Domizil einzubauen.
Die freundlichen Nachbarn erwarten uns schon, das Auto wird in der Garage versorgt, Jonathan zeigt uns alles und schon können wir es uns gemütlich machen in dem hübsch gelegenen Apartment auf drei Stöcken, das alles andere als rollstuhlgängig ist, aber das brauchen wir zum Glück ja nicht. Im obersten Stock ein grosses Wohnzimmer, ein Wintergarten und eine schöne Terrasse mit Blick aufs Häusermeer - das ist unsere neue Behausung für eine ganze Woche.
Wellington
Einmal mehr: der absolute Szenenwechsel!
Wir sind mitten in der Hauptstadt angelangt (the coolest little capital), wohnen in einer Terrassenwohnung an einem Hügel mit grossartiger Aussicht. Eine lange, steile Treppe (174 Tritte) führt mitten ins Geschehen. In 5 Minuten sind wir in der Hauptgeschäftstrasse, in zehn Minuten im Te Papa Museum, an der attraktiv gestalteten Promenade am Hafen entlang, der „Waterfront“, in einer Viertelstunde am Strand. Den Berg hinauf wär’s ein wenig mühsamer, aber da gibt’s zum Glück einen Lift vom Zentrum aus gleich ins James Cook-Hotel, welches etwa 300 Meter von unserem Apartment entfernt in der gleichen Strasse (The Terrace) steht. Sehr praktische Einrichtung!
Es ist unser zehnter Homelink- bezeihungsweise HomeExchange-Tausch seit wir unterwegs sind, es ist daher die zehnte Küche, in der wir versuchen müssen, uns zurechtzufinden. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Wo sind die Handtücher, wo die Schöpflöffel und Kellen, die Käseraffel, die Zitronenpresse, wo die Salatschleuder und die Eierbecher? Aus den Eierkartons produzieren wir Eierbecher, das geht recht gut, die Salatschleuder vergessen wir und kaufen schon gerüsteten und gewaschenen Salat. Mit den Bratpfannen ist es so eine Sache. Da gelingt es mir immer wieder, etwas anzubrennen, ich schaff’s einfach nicht. Das liegt klar an den Belägen.- Ich denke sehnsüchtig an unsere Teflonpfannen daheim am Sonnenrain.- Übrigens haben wir inzwischen Eierbecher gekauft. Das löst das Eierproblem natürlich elegant und ein für alle Mal.
Am unserem ersten Tag in Neuseelands Hauptstadt besuchten wir das Te Papa Museum, ein absolutes Muss, wie alle sagen, auch die Reiseführer. Wie besuchen nur grad den zweiten Stock vorerst, wir haben ja Zeit, können in Ruhe auch den Rest des Museums ansehen an einem anderen Tag.
Vorherrschend sind die Naturgewalten beschrieben und eindrücklich dargestellt, was passiert ist oder passieren kann, wenn ein Vulkan ausbricht oder ein Erdbeben geschieht. Die Gegend hier ist ja extrem erdbebengefährdet; es scheint zwar niemanden wirklich zu kümmern, aber dennoch stösst man überall auf Evakuierungspläne, und Tipps, was man zur Vorsorge tun soll (Schränke annageln, Bücher anbinden etc.). Diese werden sogar im Kino als Vorspann gezeigt.
Eindrücklich ist der „Colossal Squid“, ein Riesenkalamar, der in einer Formaldehydlösung in seinem gigantischen, durchsichtigen Sarg liegt. Das einzige Exemplar dieser Art worldwide! Als er gefangen wurde (es soll eine Sie sein, Teenager noch), soll er/sie 300 kg gewogen haben und 5,4 Meter lang gewesen sein, jetzt ist sie ein ganz klein wenig geschrumpft, durch die schonungslose Behandlung wahrscheinlich. Giant Squids können bis zu 10 Meter lang werden, heisst es, sie haben Augen wie Fussbälle und mit ihrem schnabelähnlichen Mund müssen sie die Beute vor dem Genuss so klein zerhacken, dass die Stücke die Gurgel gut passieren können, denn diese führt durchs Gehirn und da könnte es sonst passieren, dass das Tier einen Hirnschaden bekommt, wenn’s seine Beute zuvor nicht gut zerstückelt („So what?“, denke ich unwissenschaftlicherweise). All so was lernt man im Museum. Schnell wird klar, dass Heisshunger und Herunterschlingen also fatale Folgen haben könnten. - Dazu kann man sich einen Film anschauen, wie und wo das Tier gefangen wurde, von Wissenschaftlern betatscht, die enormen Tentakel entwirrt, untersucht und jedes Körperteil ausgemessen. Alles ein wenig gruslig, schlüpfrig, feucht und nicht sehr intim.
Weshalb Wellington als „Windy Wellington“ bezeichnet wird, hatten wir keine Mühe, sofort herauszufinden. Ich mag eigentlich Wind ganz gern, aber was die hier bieten… Ständig muss man dagegen ankämpfen. Theo hat gestern seine Finken gesucht auf dem Balkon, konnte eigentlich nicht glauben, dass es sie über die Brüstung hinauskatapultiert haben könnte (wär zwar nicht wahnsinnig schade gewesen um die Schlarpen). Hat’s auch nicht. In einer entfernten Ecke hinter dem Wasserschlauch tauchten sie dann auf, vom Winde verweht. – Heute Morgen können wir nicht einmal draussen frühstücken. Man kann ja nicht alles anbinden.
Es ist jetzt der 3. Januar, Freitag bereits. Ich glaube nicht, dass wir uns heute gross nach draussen begeben werden, wenn das so weitegeht. Eigentlich ist unser zweiter Besuch im Te Papa Museum geplant, aber es windet orkanartig und wenn ich an den Marsch dorthin denke, fühle ich mich nicht sehr motiviert. Auch ziehen oder besser gesagt rasen die Wolken vor unserer Aussicht vorbei, in einer Geschwindigkeit, wie man es selten erlebt. Auf Berndeutsch: „Äs chutet wi blöd!“ Schon in der Nacht bin ich oft erwacht, weil ich dachte, das Haus stürze jetzt dann gleich ein. Der Wind heulte und blies mit einer Stärke und mit Lärm, dass ich es fast ein wenig beängstigend fand. Sonst ist es nämlich absolut ruhig in der Nacht, obwohl wir ja im Zentrum wohnen und eine Autobahn ganz in der Nähe verläuft. Oberhalb „unserer“ Strasse verschwindet sie zum Glück in einem Tunnel. Vielleicht würde zwar auch ohne Tunnel Stille herrschen, denn hier läuft eben wirklich nichts mehr, sobald es dunkel wird. Eigentlich schon sehr viel früher. Die Läden schliessen ja auch alle schon um halb sechs, die Museen um fünf und das Restaurant im Botanischen Garten gar um halb vier. Und sowieso - was soll man bei so viel Wind in dieser Beamtenstadt schon anfangen? Draussen sitzen in den Gartenrestaurants kann man vergessen. Kino wär noch eine Option oder Theater. Ich muss mal schauen. - Tu ich: Das Internet lässt keine Zweifel offen: Die Theater haben alle Pause in dieser Jahreszeit. Nur Kino kann’s sein in dem Fall.
Jetzt beginnt‘s zu allem Überfluss auch noch zu regnen, und das mit voller Wucht an alle Scheiben, wo immer es Fenster hat. - November in der Schweiz; so kommt’s uns vor. Wir können unmöglich das Haus verlassen, nach spätestens fünf Metern wären wir durch und durch nass, an einen Schirm gar nicht zu denken. Mein kleiner Knirps kollabiert schon nur beim Gedanken an einen Einsatz. Am nächsten Tag lese ich, es seien Sturmböen gewesen bis zu 100 km/h.
Gut, sind wir gestern im Botanischen Garten gewesen. Das war sehr schön, die Vielfalt der Bäume, das Hortensienmeer, der Rosengarten – nicht auszudenken, wie das im Moment dort aussieht. Die Fahrt dort hinauf war übrigens auch ein Muss. Ein Cable Car („historisch“ natürlich) führt den steilen Berg hinauf, fast so wie unser Marzilibähnli, nur ist die Strecke ziemlich viel länger.
Am späten Nachmittag hört es auf zu regnen und der Wind hält sich in erträglichen Grenzen, Wir beschliessen, der Unbill zu trotzen und uns ins Abenteuer Kino zu stürzen („The Secret Life of Walter Mitty“). Abenteuer tatsächlich, Comedy und sehr viel schöne Landschaftsbilder (Island, Grönland, Afghanistan) werden uns geboten von Ben Stiller und unter anderen auch Sean Penn, Kristen Wiig, Adam Scott, Kathryn Hahn und wieder mal Shirley MacLaine. Die älteren Semester, so wie wir, dürfen den Film für acht Franken besuchen. Da gibt’s dann nichts mehr zu bemängeln und zu klagen.
Da, wo der Kinokomplex ist, hat’s tatsächlich mehr Leute auf der Strasse als Finger an meiner Hand. Ich kann jedoch immer noch nicht sagen: „Da läuft was“, das wäre extrem übertrieben. Aber es hat doch ein paar Restaurants, die offen sind, ein, zwei 7/24 Lädeli sogar und an den Theaterfassaden und –Entrees hat’s Leuchtreklamen, aber eben, Vorstellungen dann doch keine. Wenn ich mir vor einer Woche noch vorgestellt hatte, wie „hektisch“ es in der Hauptstadt nach unserem ländlichen Aufenthalt in Kuratau sein würde, so habe ich mich gründlich getäuscht.
Nach Ben Stillers zweistündiger Darbietung essen wir im „Dragon“, einem chinesischen Restaurant zur Abwechslung. Die kleine chinesische Kellnerin fragt uns: „You guys here to travel?“ – Ich bejahe und sie will weiter wissen, wo wir her seien. „From Switzerland“, sage ich. „Ooooh, oh, hello then!“ – Wie wir gehen, fragt sie: „Right full now?“ - Für den Heimweg, weil wir „right full“ sind, beschliessen wir, statt dem Lift die Treppe in Angriff zu nehmen. – Oben angekommen, muss ich sagen, zum ersten Mal heute habe ich wirklich sehr warm und einmal keine kalten Füsse mehr beim Ins-Bett-Gehen.
Auf den „Wellington Underground Market – every Saturday from 10am - 4pm“ habe ich mich bereits gefreut. – Ich schau im Internet nach, wann und wo der genau stattfindet. “We will be having a break after Christmas, and the market will resume weekly opening from the 18th January“. – No comment meinerseits.
Silvester
Unser Silvestererlebnis in dieser Stadt: nicht wirklich ein Erlebnis: Der Einunddreissigste lässt sich zwar gar nicht mal so schlecht an, ein schöner Tag mit sehr viel Sonne und blauem Himmel, so fahren wir nicht an den nächstgelegenen Strand, sondern ein wenig weiter weg an die Worser Bay, ein kleines Ausfährtli halt. Sünnele, lesen, Strandspaziergang – richtig perfekt zum Jahresabschluss.
Einkauf unterwegs und daheim sind wir bei unseren Nachbarn von Apartment 4 und 5, Kathy and Johathan, Jenny and John, zum Apéro eingeladen. Beide sind auch Homelink-Mitglieder und so gibt’s angeregte Gespräche und gegenseitigen Erfahrungsaustausch. Das ist eine weitere gute Seite beim Haustauschen: Man hat sofort Kontakt (wenn man will) mit Einheimischen, lernt dadurch Dinge, die nicht im Reiseführer stehen und überhaupt: So viele nette Bekanntschaften, wie wir hier bisher gemacht haben, die gibt’s nicht gratis mitgeliefert im Reisebüro-Angebot.
Wir haben feine Sachen eingekauft auf dem Nach-Hause-Weg, also beschiessen wir, daheim zu essen und dann anschliessend vielleicht in die Stadt zu pilgern. Allerdings haben wir erfahren, dass es kein Feuerwerk geben wird (den ganzen Nachmittag lang wurden Interviews mit erbosten Zuhörern gesendet, die nicht verstehen konnten, weshalb die Hauptstadt nichts, aber auch gar nichts für das Jahreswechselereignis organisieren will). Geldsorgen sind offenbar der Grund; auch sind ja viele in den Weihnachts-Sommerferien. – Na ja, wir hätten die ultimative Aussicht auf das Geschehen von unserer Terrasse aus, aber eben, nichts gewesen, nicht einmal Spesen. - Auch diese Stadt hier scheint ein wenig eine Schlaftabletten-Oase zu sein. Wir sind ja nicht gerade wild auf Nachtleben und Jubel, Trubel, aber so ein wenig Lichter und Feuerwerk am Silvester… Wir lassen uns leider anstecken:
Schon ein wenig „gchäppelet“ vom Apéro und dem zusätzlichen Wein, den wir uns natürlich zu unseren köstlichen Silvestermal gönnen, schläft Theo immer wieder vor dem Ferni ein (es war ja soo anstrengend am Strand heute Nachmittag). TV zur Abwechslung – ok, aber das Programm - ja, also ich kann meinen Gatten ausnahmsweise gut verstehen. Ich schlage vor, wir könnten uns ja mal den Maori-Channel ansehen. Nach einer Viertelstunde schon habe ich vollkommen genug davon. Da geht‘s nur ums Fischen. Nach dem dritten Fisch, der sich kläglich auf der Schlachtbank windet und schliesslich bluttriefend auf dem Boden landet, bin ich für einen Kanalwechsel. Der Film, der dort läuft, tut das bereits seit einer halben Stunde (laufen, meine ich) und ich mag’s nicht, Filme nicht von Anfang an zu sehen. Zudem hab ich ihn schon mal gesehen und nach Herz-Schmerz-Zeug ist mir sowieso nicht zumute. Ein dritter Channel bringt ebenfalls einen Film, den man nicht unbedingt sehen muss, also lass ich Theo schnarchen und geh lesen. Jussi Adler – Olsen (der fünfte Fall für Carl Moerk) macht sehr viel mehr Spass zum Lesen, aber obwohl der Roman äusserst spannen ist, passiert mir das Gleiche - ich falle in einen jahresübergreifenden Schlaf. So gehen unsere Fast-Pläne, in der Stadt ein wenig zu feiern, kläglich flöten und nur der Gedanke daran ist übrig geblieben. Unrühmlich, ja. Wir sind eben doch auch schon ein wenig in die Jahre gekommen; es ist offensichtlich. - Um eins erwache ich, weil doch ein paar Leute grölenderweise am Haus vorbeiziehen. Es müssen Ausländer sein. Ich hör immer wieder „Skol“, und den Rest versteh ich nicht. Nachher ist wieder ruhig und ich erwache erst wieder am Morgen, im Januar 2014.
Dafür feiern wir um 12 Uhr mittags mit unserer Familie in Bivio mit einer wilden WhatsApp-Bildli-hin-und-her-Schickerei, Line- und Facetime-Telefoniererei, und das macht mehr als nur Spass. Für uns jedenfalls. In der Chesa Arcadia ist leider die Waschmaschine ausgestiegen, was dort zugegebenermassen und auch verständlicherweise nicht zu Freudentänzen führt. Freude macht aber, dass es allen gut geht, sie es trotzdem lustig haben und uns berichten, dass es seit Jahren nicht mehr so viel Schnee gehabt habe wie gerade jetzt.
Wenn ich an Bivio mit seinen knapp 200 Einwohnern denke und was dort los ist in der Silvesternacht, dann sind das ganz andere Dimensionen als hier in der „coolen“ neuseeländischen Hauptstadt mit fast einer halben Million Einwohnern. In Bivio geht die Post ab: Feuerwerk, Treffen auf der verschneiten Hauptstrasse auf der Piazza San Giovanni vor dem Silvia-Sport-Geschäft, aufs neue Jahr anstossen mit allen, die sich dort versammelt haben, anschliessend kurzer Spaziergang ins Solaria und zuschauen, wie Giancarlo mit einem Sabel die Champagnerflaschen öffnet, erneut mit ein paar weiteren Gläschen „Bubbles“ auch dort wieder Genny und Giancarlo und ihren Gästen alles Gute wünschen... – Aber jetzt sind wir hier, es ist Sommer - auf der anderen Seite der Weltkugel ist eben etliches anders, nicht nur die Silvesternacht.
Zwölf Uhr mittags ist eine gute Zeit zum Silvesterfeiern, finden wir. Sollte man auch bei uns einführen. Da ist man viel besser zwäg. - Auf dem Balkon stossen wir auf die Familie und auf alle unsere Freunde an, aufs alte und aufs neue Jahr. Dazu gibt’s Lachs und Toast, wie das zu Hause auch der Fall wär – eine alte Tradition. Niemand ist zum Umfallen müde, auch Theo nicht.
Letzte Tage auf der Nordinsel
Das tönt jetzt alles ein wenig negativ, merke ich gerade. Aber wir lassen uns unsere gute Laune keineswegs verderben. Klar, es wär schon schön, wenn das Wetter schön wär. - Sehr schön wär das! Wir hatten ja Sonne am letzten Tag des Jahres, sogar am Strand waren wir – wer will sich da beklagen?! Wir haben Zeit und nehmen’s gelassen. Es hat ja sogar Vorteile: Wir können grosse Teile unserer Weihnachtsmails erledigen, am Blog weiterbasteln und Theo kann endlose Siestas einwerfen, ohne dass ich meine Bemerkungen dazu mache.
Morgen ist es so weit: Unsere Reise geht weiter, wir fliegen nach Queenstown auf die Südinsel. Es regnet im Moment schon wieder beziehungsweise immer noch, also kommt es uns grad recht, weiterzuziehen mit der Hoffnung auf besseres Wetter.
Unsern Plan, das Te Papa Museum ein weiteres Mal zu besichtigen, haben wir gestern in die Tat umgesetzt. Drei Stunden lang waren wir dort. Sie haben eine faszinierende Sammlung von Maori-Artefakten, Kanus, Schmuck, Waffen, Bildern und sonstigen Gegenständen. Um die Geschichte der Ureinwohner darzustellen, ist man hier sehr bemüht.
Wir haben sogar das Bild gesehen von Poetua, das John Webber (Johann Wäber – „Auslandberner“) auf seiner Reise mit der Discovery (Cooks dritte, verhängnisvolle Reise 1776 – 1780) gemalt hat. Das Bild ist ja zu sehen auf der Titelseite des Buches von Lukas Hartmann „Bis ans Ende der Meere: Die Reise des Malers John Webber mit Captain Cook“ und der Roman ist spannend, sehr interessant, äusserst minuziös recherchiert offenbar und wunderbar geschrieben.
Im sechsten Stock hat’s eine Aussichtsplattform. Zum Glück ist die gut verschalt mit Glasscheiben, es hätte einen sonst schlicht nicht vom Hocker, sondern von der Terrasse gerissen beziehungsweise geblasen.
Eine weitere erwähnenswerte Ausstellung, eine Sonderausstellung, ist „The WOW – Factor: 25 years in the making“ – The Worlds of Wearable Art. Was da an Ideen, Fantasie und Schneiderkunst zusammenkommt, ist wirklich sehens- und bemerkenswert.
Die Besiedelung der beiden Inseln, die unglaubliche Abholzung während all der Jahre, die ja noch immer voll im Gang ist (bad, sad, mad), die Tiere und Pflanzen, die von den Siedlern eingeführt wurden und welche die einheimische Flora und Fauna bedrohen, verdrängen und teilweise sogar zum Aussterben gebracht haben und bringen, all dies sind Themen in diesem Museum.
Viel Platz hat’s für Kinder – zum Lernen und Staunen. Alles sehr gut und mit viel Gespür gemacht, muss ich sagen. Und freier Eintritt. Sehr ungewohnt in diesem Land und enorm begrüssenswert!
Was machen wir heute, an unserem letzten Tag (ausser wieder mal packen, aufräumen, putzen)? – Theo will das Auto nehmen, um die Old St. Paul’s Kirche zu besuchen, das Parlamentsgebäude und noch ein weiteres Museum. Ich bin sogar dafür, denn es windet ohne Unterbruch und der Regen dazu – nicht zu fassen, dass ein Sommer im Südpazifik so aussieht.
Wir warten noch, bis die Waschmaschine ruft und wir den Wäschetrockner, der kurioserweise wie in Australien auch hier upside-down an der Wand hängt, füllen können. Gut so, denn inzwischen hat es aufgehört zu regnen und wir gehen zu Fuss.
Die City-Gallery begeistert uns nur in Grenzen. Im Parterre geht’s um Sound. In einem Ausstellungsraum herrscht ein derart dumpfer, aufdringlicher Dauerton, dass ich grad sofort Kehrum mache und woanders hingehe. Theo kommt mit. Mit Mühe ergattern wir grad noch je einen Sitz im zweihundertplätzigen Aditorium, wo an der Riesenleinwand eine Lichtinstallation gezeigt wird, untermalt mit Ton. – Nein, nein, stimmt natürlich NICHT! Das mit der Installation schon, eine grüne Lichtschlange tanzt hin und her, aber Platz hat’s für 198 weitere Interessierte. Wir sind die zwei Einzigen. Aber nicht lange. Wir überlassen die Installation sich selbst.
Im ersten Stock gefällt’s uns besser. In der einen Galerie zwar auch nicht so sehr, da frage ich mich wieder mal, wieso es Künstler gibt, die’s in ein Museum schaffen und andere nicht. Die alte Diskussion, ich lasse es. Man müsste sich wohl intensiver damit befassen, um sich ein Urteil zu erlauben.
Was mir hingegen sehr gefällt, sind die Bilder von Huhana Smith „Rae ki te Rae / Face to Face“ Die Liebe zu ihrem Land ist sicht- und spürbar in ihren Bildern.
Wo ist Theo? - Er hat heute den Spinner drin. Ob das mit dem Wind zu tun hat? – Er sagt, er wolle ein bisschen Farbe ins Grau bringen (???). - In einem der Säle will er, dass ich ihn fotografiere, wenn er sich auf den Boden legt. Der Raum ist riesig, es hängen nur fünf kleine Bilder drin, eines an der einen Wand neben dem Eingang, die andern vis-à-vis. - Das mag ich nun wirklich nicht machen – so peinlich! Zudem glaube ich, ich fürchte mich ein wenig vor den Aufsehern. – Also macht er es selbst, währendem ich in einem anderen Raum bin. Was genau er dort treibt, hat er in seinem Blog gleich selber erläutert beziehungsweise in einem Filmli präsentiert.
Hier meine Sicht: Er schwitzt, wie er herauskommt und ich ihn wiederfinde. Er hat sich selber gefilmt. Mehr als einmal: Beim ersten Mal hat er nur seine Jacke gefilmt, weil die Kamera falsch eingestellt war, beim zweiten Mal hat er das Gerät (i-Phone) falsch gestartet, beim dritten Mal hat’s geklappt. Die Aufsicht hat’s nicht gemerkt, auch wollte sich sonst offenbar niemand die Kunst in diesem Raum ansehen während Theos Shooting-Session.
In Hafengelände muss ich auch noch eine Foto von ihm machen, wie er sich an einer Boje festklammert, es soll aussehen, wie wenn er grad fast am Ertrinken wär oder so ähnlich. Sein Gesichtsausdruck jedenfalls lässt darauf schliessen. Hier hat’s keine Aufseher, ich mach’s also. – Wenn’s ihm doch Freude bereitet! – Der Sinn allerdings...
The „Beehive“, das neuseeländische Parlament, so genannt, weil es wie ein Bienenhaus aussieht, gehen wir uns auch noch ansehen, allerdings nur von aussen. Es gibt zwar täglich mehrmals stündliche Führungen, aber so sehr interessieren uns die Räume und Geschichten dort drin nicht.
Unterwegs zum Hafengelände steht die John’s Kirche „Old St. John’s“. Es ist eine spezielle Kirche, sehenswert, weil sie vollständig aus einheimischem Holz gebaut wurde. Eine Hochzeit wird grad gefeiert, die ganze Gesellschaft steht vor der Kirche, wir müssen einen Moment warten, können dann aber doch auch hinein. Bemerkenswert ist unter anderem, dass der Souvenirshop mit jeglichem Krimskrams auch gleich drin ist, grad neben der Kanzel.
Wir gehen ins nächste Museum: “Museum of Wellington City & Sea” (voted one of world’s top fifty museums (www.museumswellington.org.nz/">www.museumswellington.org.nz/). Eine ausgezeichnete Sammlung und Ausstellung; wir bleiben fast zwei Stunden dort.
Und wie wir rauskommen: Surprise, surprise! – Kein Wölkchen mehr am Himmel. Was ist denn da passiert? Die Sonnenbrille zu Hause, Jeans, T-Shirt (langärmlig), Pulli, Leder- und Regenjacke – so sind wir ausstaffiert. Jetzt aber wären Shorts und Sommeroutfit angesagt, denn sogleich wird’s heiss. Der Wind bläst zwar immer noch, aber der ist ausnahmsweise ganz angenehm. – Wir sind versöhnt mit Wellington: an unserem letzten Spätnachmittag und Abend doch noch schönes Wetter. Wir feiern diesen Umstand mit einem Glas Prosecco und einem Erdinger Bier in einer Kneipe am Hafen.
Apéros und Haushaltsgeräte
Kleiner Exkurs zu den Apéros, hier „nibbles“ genannt, die wir bisher hatten: Die sind immer genau gleich: Auf einem Servierbrett liegen Crackers, ein oder zwei Dips in Schälchen (Humuspaste oder etwas Derartiges, vielleicht eine „Käsesalbe“), ein bis drei Weichkäsesorten und zu jedem ein kleines Messerchen dazu. Ok, ok, das Servierbrett ist nicht in jeder Familie dasselbe, auch die Käsesorten nicht, aber annähernd. Bisher haben wir uns nur einladen und verwöhnen lassen, es gibt also gar nichts zu meckern, im Gegenteil, es ist nur so eine Feststellung.
Lustig ist doch immer, was man als Ausländer in einem anderen Land wahrnimmt. Wir haben ja auch unsere Seltsamkeiten. Wenn ich Bücher von Deutschen oder Engländern über uns lese zu diesem Thema, merke ich schnell, wie komisch einige unserer Schweizer Eigenarten auf Fremde wirken müssen. Aber über sich selber zu lachen, soll ja ganz heilsam, wohltuend und vielleicht auch horizonterweiternd sein.
So kann sich Theo zum Beispiel kaum sattsehen an den komischen upside-down aufgehängten Trocknern über den Waschmaschinen. Schon seltsam, dass es den Herstellern offenbar noch nie in den Sinn gekommen ist, die Schalter andersherum anzubringen, was ein Leichtes wäre, man könnte dann sogar lesen, was draufsteht. Dieselben Hersteller waren trotzdem innovativ und haben Geschirrspüler entwickelt, die in zwei verschiedenen Schubladen (je halb so gross wie „normal“) in der Küchenkombination untergebracht sind. Das hat für Juden den Vorteil, dass sie Gläser und Teller gleichzeitig waschen können, ohne dass die sich gegenseitig „kontaminieren“ (also das Geschirr) und für uns Normalsterblichen: Wir brauchen nicht mehr in die Knie zu gehen vor unseren Abwaschmaschinen (obwohl viele von uns - wir gehören dazu - diese Küchenhelfer ja aufs Innigste verehren).
Wenn ich schon von Haushaltsgeräten berichte: Theos Lieblingsgerät hier ist der Toaster. Perfekt für Muffins, Crumpets und Bagles ebenfalls. Ich find ihn auch gut, aber grad soo… Also: Man kann Toast oder Muffinscheiben in die Spalten legen, den Startknopf drücken und dann geht alles wie von Geisterhand. Das Gerät nimmt auf sanfte Art und Weise die Scheiben selber in seinen Schoss und röstet sie ganz vorsichtig. Von alleine werden die getoasteten Scheiben behutsam und sozusagen lautlos wieder emporgehoben – es spickt sie eben nicht aus, wie das manchmal der Fall ist bei herkömmlichen Modellen, wo man anschliessend das (verkohlte) Resultat auf dem Boden zusammenlesen kann/muss - und jetzt heisst es: „Lift and look“ (ist das nicht eine nette Aufforderung?!). Ist man nicht vollkommen zufrieden mit dem Ergebnis, kann man nun wählen: „A bit more“. - Zugegeben, diese Vorgehensweise macht den ganzen Vorgang fast ein wenig menschlich. Meine Muffins am Morgen jedenfalls lieben diesen Toaster. Sie sind genau richtig, nicht verbrannt und nicht zu wenig geröstet. Und wie gesagt, Theo ist absolut Fan. Er hat schon im Internet nachgeschaut, ob man so ein Ding auch in Europa erstehen kann. – Man kann! - Und schon hat er ein Geburtstagsgeschenk für mich… (nur zur Klärung: nicht von mir für ihn – er will das Gerät mir schenken...)
Von Wellington nach Queenstown
Es ist der 6. Januar. Die Packerei liegt mir schwer auf dem Magen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie all das viele Zeug, das wir haben, in unsere Koffer und ins Handgepäck passt. Es sind ja schliesslich noch zwei Eierbecher dazu gekommen und hie und da ein T-Shirt, ein paar Schuhe und was man sonst noch so dringend braucht. Auch Prospekte. Das alles ginge ja noch, aber die Kilos…
Um neun Uhr morgens sind wir startbereit. Es ist geglückt, alles ist gepackt, nur Weniges muss zurückbleiben, so eine von Theos grässlichen Büchsen, die er sich jeweils im Supermarkt kauft mit irgendwelchen Suppen drin, gepökeltem Fleisch, vielleicht vom Pferd oder vom Esel, wer weiss, ein bisschen Tomate, sicher einer Portion Lebensmittelfarbstoff und Konservierungsmittel. „Campbell’s Chunkey – fully loaded“ heisst‘s auf der Büchse. Da wird nichts versteckt, muss man zugeben - volle Deklaration. Wenigstens hat er noch nie die Büchsenspaghetti gekauft.
Ich bin sicher, dass mein Koffer mindestens 25 kg wiegt, mein Rucksack auf jeden Fall etwa zehn, das war schon so, als wie in Auckland ankamen (7 kg sind zugelassen). Zuoberst hab ich Dinge gepackt, die ich notfalls wegwerfen kann, Kleider, die ich sowieso nicht mehr will, aber vielleicht doch noch brauche bis zum Ende der Ferien. Übergewicht mag ich nicht zahlen.
Es ist die letzte Fahrt mit unserem inzwischen geliebten Nissan. – Denken wir. - Wir tanken ihn auf, fahren zum Flughafen, Theo lässt mich und das Gepäck aussteigen, ich warte dann auf ihn, während er das Mietauto zurückgibt. So war’s abgemacht aber so weit kommt’s vorerst noch nicht. Also, ich steige aus, hole ein Wägeli, lade alles Gepäck drauf – da sagt Theo: „Weisst du, was ich vergessen habe?“ - Weiss ich natürlich nicht, aber ich ahne Schlimmes. – Sein Umhang mit den unendlichen vielen Taschen und Reissverschlüssen, den er ja sonst fast immer und in allen Lebenslagen anhat, auch bei 30 Grad am Schatten, ist das Corpus Delicti. Aber eben nicht, wenn wir abreisen wollen und auf dem Flugplatz sind. – Ja nu, no worries. Muss er halt nochmal zurückfahren und die Weste holen gehen, die er so nachlässig über dem Treppenpfeiler im Entrée aufgehängt hat, dass es fast nicht anders ging, als sie zu übersehen. Alles war nämlich drin, Portemonnaie, Kreditkarten, Geld, seine e-Zigaretten, Täfeli, Notizbüechli, Tagebuch, was weiss ich, was noch alles, nur der Pass nicht. Nach dem hatte ich ihn nämlich bei der Abfahrt noch gefragt, den aber hatte er in Aussenfach des Koffers stecken, so hat er’s nicht gemerkt. - Theo…
Wir haben genug Zeit eingeplant, und die Fahrt zurück in die Stadt dauert nur grad zehn Minuten, also ist er in einer halben Stunde schon wieder zurück. Und Rösi darf nochmal sagen: „Biegen Sie in 200 Metern nach links ab, Richtung Eier Port“. - Ein Glück, dass die Nachbarn daheim waren, die einen Zweitschlüssel besassen. Wir hatten unseren ja in den Briefkasten geworden, nachdem wir abgeschlossen hatten. Unerreichbar also. - Noch mal gut gegangen!
Tolkien und seine Ring-Trilogie beherrschen auch den Flughafen. Gandolf rast grad vorbei und auch die Orcs sind gegenwärtig. Einige der Figuren hängen an der Decke und verbreiten Angst und Schrecken. Alle in Übergrösse.
Inzwischen habe ich eingecheckt und mit einem höchsten Gefühl der Ungemach gehe ich zum Förderband, wo die Koffer abgegeben werden. Die beiden schweren Handgepäckstücke habe ich vorsorglich etwas weiter weg hingestellt, so dass die Angestellte nicht sehen kann, dass ich die auch noch habe. Sie fragt mich, ob die Koffer mehr als 23 kg wögen. „Das sehen wir ja jetzt dann grade“, denke ich, sage aber, „Ich glaube nicht“, und sie lässt mich die Koffer aufs Band legen ohne sie zu wiegen. Das glaub ich jetzt wirklich nicht. Das ist mir noch nie passiert. Ich könnte jubeln.
Theo kommt, er hat das Auto abgegeben, hat seinen Kampfanzug an und könnte wohl auch jubeln. Zeit haben wir immer noch genug, es ist ja nur ein Inlandflug, da braucht man gar nicht so früh schon parat zu sein. Wo ist denn die Sicherheitskontrolle? Diese mühsame Prozedur „stinkt“ mir jedes Mal sehr, die ganze Auspackerei sämtlicher elektronischer Geräte, die Abtasterei, weil irgendwo vielleicht ein Druckknopf Probleme macht, Schuhe und Gurt ausziehen, das ganze Theater mit den Flüssigkeiten etc. etc. – Super Wellington! Das alles gibt’s hier nicht. Nicht zum Glauben. Keine Kontrolle, jeder könnte sein Schiessgewehr mitnehmen, auch den Patronengürtel, sogar unbehelligt Nagelscherchen und Feile. Sogar meine Mineralwasserflasche, von der ich dachte, ich müsse sie dann wegwerfen, kann ich behalten, niemand will etwas davon wissen. – So was! Das hab ich noch nie erlebt oder vielleicht mal als Kind, als es noch keine mutmasslichen Terroristen gab. Klar, dies hier ist ein kleiner Flughafen, nur wenig grösser als derjenige in Belp, aber immerhin. Und es ist „nur“ ein Inlandflug. Wie in Belp geht man auch hier zu Fuss auf die Rollbahn – es kommt mir eher vor wie eine Bus- oder Tramfahrt, nur dass das Gefährt dann eben doch abhebt und nicht rollt. - Ich bin so was von erleichtert!
Queenstown
Das Wetter ist ausnahmsweise gut und wir erhalten durchs Flugzeugfenster den ersten Eindruck von der Südinsel: grüne Hügel, Flüsse, die in einer Art mäandern, wie ich es noch nie gesehen habe, Seen, Strände, das Meer in den verschiedensten Blautönen und lauter unbesiedeltes Gebiet. Am Horizont Bergketten, die Südalpen, von Schnee bedeckt und von Wolken gesäumt. Da werden wir viele Kilometer fahren müssen für die Reise, die ich gemäss Robert Prides Angaben und Vorschlägen geplant habe.
Nach ungefähr anderthalb Stunden und achthundert Kilometern Flug kommen wir in Queenstown an, nehmen ein Taxi und fahren in die Belfast Terrace, wo uns Kathy von der Agentur mit dem schönen Namen „Relax is Done“, die mit der Vermietung betraut ist, bereits erwartet und uns alles zeigt. Das Apartment ist traumhaft schön gelegen, wieder an einem sehr steilen Hang, über drei Stockwerke gebaut, aber diesmal mit Lift. Es gehört ja Robert und Kerrie, bei denen wir in Sydney am Anfang unserer Reise fast eine Woche lang eingeladen waren. Wir sind begeistert. So viel Platz, so stylish und geschmackvoll eingerichtet, Luxus vom Feinsten. Aus den drei Doppelschlafzimmern mit en-suite-Badezimmer können wir aussuchen, welches uns am besten gefällt. Auch da wird es uns wieder sehr gefallen. Robert hat uns wissen lassen, er vermiete es normalerweise für 1000 NZ$ pro Tag (750 CHF).
Ein Mietauto brauchen wir nicht, Robert lässt uns sein Auto gratis brauchen den ganzen Monat lang. Statt dass es in der Garage stehe, hat er gesagt… Es ist ein 4x4 Holden. Wir sind sooo verwöhnt. Da hatte ich wirklich ein ausgezeichnetes Händchen beim Aussuchen dieses Homelink-Swaps – muss ich selber sagen. Wir probieren das neue Auto grad mal aus und gehen einkaufen. Hier sind die Lebensmittel noch teurer als sonst überall. Es ist schon erstaunlich. Queenstown ist halt ein Ort wie St. Moritz, Zermatt oder Gstaad und ziemlich abgelegen; da wird wohl fast alles per Flugzeug eingeflogen.
Auch vom Bett aus haben wir einen prächtigen Blick über den See und die Berge. Eigentlich sieht’s ein wenig aus wie Interlaken, nur dass hier nicht der „Thunersee“ ist, sondern der „Lake Wakatipu“ und der „Niesen“ ist oben ein bisschen abgetragen und heisst auch anders, nämlich „Cecil Peak“, fast 2‘000 Meter hoch. Wenn’s Nebel hat, sieht man aber kaum einen Unterschied. Das Dampfschiff ist auch nicht die „Blüemlisalp“, sondern die „Ernslaw“, mit anderem Namen die „Lady oft he Lake“; es ist ein Raddampfer, 100 Jahre alt. Nur einer dieser Sorte kreuzt über den See, dafür lässt er eine schwarze Dampfwolke aus dem Kamin aufsteigen, grad wie zwei Schiffe auf einmal.
Nur ein paar wenige Sonnenstunden gibt’s am Tag unserer Ankunft, nachher ist aber genug.
In der Nacht hat’s wieder stark zu regnen begonnen und die Temperaturen lassen auch zu wünschen übrig. So sehr, dass wir heizen müssen. Sommer???
Der ganze Tag ist grau und verregnet. Nun, wir haben ja eine sehr schöne Unterkunft und geniessen das Relaxen, Filme schauen, Blog bearbeiten, lesen und sogar die vernebelte Aussicht. Um halb vier finde ich, wir sollten doch noch ein Ausfährtli machen, obwohl es noch immer regnet. Wir fahren nach Arrowtown, einer ehemaligen Goldgräberstadt, die jetzt zum Touristenort mutiert ist. Kaum haben wir das Auto abgestellt, hört der Regen auf und die Sonne zeigt sich. – Wenn Engel reisen… – Das Dorf wurde restauriert und es ist klar, weshalb man dort gern hingeht. So ein charmanter Ort. All diese Restaurants, Boutiquen und Shops – Verweilen macht Freude.
Am Rand des Ortes befindet sich das historische „Chinese Settlement“, wo während des Goldrausches viele Chinesen zum Schürfen hergekommen waren, aber nicht beliebt waren bei den weissen Goldgräbern und aus dem Grund ihre eigene Siedlung bauen mussten. Primitivere Behausungen kann man sich fast nicht vorstellen. Einige davon wurden wieder mehr oder weniger restauriert, so dass man sehen kann, wie die Männer damals hausen mussten. Wenn‘s auch zu der Zeit so viele Mücken hatte wie gerade eben, dann muss das zur Einsamkeit, zum Schmutz, zur Kälte, zu den unmenschlichen Arbeitsbedingungen und zur ganzen verheerenden Lebenssituation im Allgemeinen eine zusätzliche Herausforderung gewesen sein.
Das Wetter hält, wir sind ganz erstaunt, also setzen wir uns in eines der hübschen kleinen Restaurants an die Sonne und bestellen einen Apéro. Daraus wird allmählich ein Abendessen. Wieder mal draussen essen ohne dass es zu kalt ist oder dass es einem den Salat aus dem Teller weht – wir geniessen es. Zu Hause angekommen, regnet es bereits wieder.
Auch der nächste Tag verspricht keine umwerfenden Temperaturen und höchstens sonnige Abschnitte. - Dem ist so am Morgen. Es hat sogar Schnee auf den Gipfeln, aber dann klart es auf und wir beschliessen, eine Fahrt auf dem See zu machen. – Plötzlich Sommer! Und ich sitzt da auf dem Schiff mit einer ganzen Ladung viel zu warmer Kleider und denke, wie blöd… Das Girl neben mir hat Flip Flops an und Shorts. Aber bald fiert sie, wie sich das Schiff in Bewegung setzt und der Fahrtwind eben doch recht kühl ist. Sie zieht jetzt Handschuhe an, ich zusätzlich zum T-Shirt den Pulli, die Lederjacke, die Windjacke. Nun denke ich nicht mehr, wie blöd…, sondern bin froh, dass ich in weiser Voraussicht genügend warme Sachen mitgenommen habe. Es ist eine schöne 90-minütige Fahrt mit dem „Million-Dollar-Cruise-Ship“ und Max, dem Kapitän. Er ist ein Plauderi, aber ganz lustig. Kaum sind wir abgefahren, kommen schon wieder die armen Australier daran; es geht offenbar nicht ohne: „There must be some Australians on board. Just a short announcement: - The bar is open. Jump in and go for it“. – Wir fahren am Ufer des Lake Wakatipu entlang. Die Szenerie ist bilderbuchmässig und erinnert mich an St. Moriz: der See, die steilen Hänge, die Häuser, die Tannenwälder, im Hintergrund die Bergspitzen der „Remarkables“, eines der Skigebiete, jetzt schneebedeckt, gestern noch nicht. Nur dass offenbar hier vor 200 Jahren kein einziger Baum stand, Häuser sowieso nicht. Wir sehen Hotels, endlos viele Feriensiedlungen, Luxusvillen, die einen absolut atemberaubend, die anderen weniger. – Bauvorschriften? - Von der einen Siedlung erzählt uns Max, die gehöre der staatlichen Eisenbahngesellschaft und sei als Ferienanlage für die Bahnangestellten erbaut worden. Nur habe diese Institution die strikte Regelung, dass ihre Bauten immer „face north“, also mit der Frontseite gegen Norden gebaut werden müssten. Das wurde auch hier gut sichtbar und mit absoluter sturer Konsequenz durchgezogen. Dort, wo gegen Süden die schöne Aussicht auf den See und die Berge ist, haben die Häuser nur kleine Fensterchen, Badezimmer- und WC-Fenster. Gegen Norden, wo sich die Wohnzimmer befinden, dort seien die Terrassen – mit Aussicht auf den steilen Grashang, direkt vor der Nase. Max weiss, wovon er spricht. Vom Schiff aus können wir die Vorderseiten natürlich nicht sehen, nur die kahlen Fassaden: „Loo with a view“ würde ich es nennen. Was hat sich die Bauherrschaft nur dabei gedacht? – Was machen solche abstrusen Vorschriften für Sinn? – Und wieso nur erinnert mich diese Bauweise an die Wäschetrockner in Down Under?
Die Bäume übrigens sind alle nicht einheimisch, sie sind von den Siedlern eingeführt worden. Ein Schafzüchter war der erste Siedler, der sich hier in der Gegend in den fünfziger Jahren in 19. Jhd. niedergelassen hatte. Einwohnerzahl damals:14. Dann wurde im Jahr 1862 Gold gefunden, seine Schaffarm wurde in ein Hotel umfunktioniert und die Einwohnerzahl schnellte innert eines Jahres auf 10‘000. Nach dem Goldrausch wieder drastische Senkung. Heute sind’s 15‘000 Einwohner und im Sommer und Winter mit den Kurgästen grad mal die doppelte Anzahl. Einnahmequelle ist fast zu hundert Prozent der Tourismus. Gold und Schafe hat’s keine mehr, angepflanzt wird nichts, ausser ein wenig Wein. Trotzdem ist Queenstown der Haupt-Winterkurort der Südinsel, jeden Tag gehen und kommen über 4‘000 Touristen. – Wir gehen morgen. – Das Beste aber ist: Wir kommen wieder. Anfangs Februar. So fällt der Abschied nicht so schwer.
Ein riesiges Angebot an Freizeitvergnügen, -abenteuern und -events sind die Folge dieses Booms. Man kann Paragliding, Bungeejumping und Helikopterflüge buchen, Jetboote mieten, auch Paddelboote, Wasserfahrzeuge, die ich noch nie gesehen habe, alle bekannten Arten von Wassersport, sogar „Hydro-Attack“ gibt’s, (the ultimate blend of shark and machine – world’s first tour operator), ein ganz aggressives Ding (www.hydroattack.co.nz/">www.hydroattack.co.nz/) man muss aber mindestens 8-jährig sein, um vom ultimativen Erlebnis profitieren zu können. – „Take the ride of your life for only $159“. Vom Bob’s Peak aus kann man mit der Gondel wieder hinunterfahren oder man entscheidet sich für die „Skyline Luge“, eine Art Gefährt zwischen Schlitten und Go-Kart. Ballonfahrten sind sowieso im Angebot, Mountainbike- und Quad-Rides ebenso und noch vieles mehr. Der Spass nimmt kein Ende. – Wir mit unserer gemächlichen Schiffscruise kommen uns ziemlich altbacken und wenig abenteuerlich vor.
Nach dem Ausflug noch ein Drink im Städtchen - es ist bemerkenswert, wie bei Sonnenschein alles gleich anders aussieht. Die unzähligen Strassencafés und Bars sind plötzlich belebt, es hat Musikanten, alle haben gute Laune, wir auch.
Sogar für ein kleines Einkäufli langt es noch. Theo hat wieder Unterhosen verloren (???) und alle drei Tage die restliche zu waschen, macht wenig Sinn. So werden nach längerer Diskussion neue gekauft: superschöne! Kiwis sind drauf in Orange auf schwarzem Grund; diejenigen, wo’s drauf hiess „Sweet Ass“, auf die haben wir verzichtet.
Zum Nachtessen gibt’s Menu Nr. 2: Hohrückensteaks mit Kartoffeln und Salat. Wir packen auch schon wieder, aber diesmal ist’s einfacher: Einen Koffer lassen wir nämlich da und reisen nur mit leichterem Gepäck. Dazu aber kommt eine Kühlbox. Die ist unerlässlich, gehört hier schliesslich zur Ausrüstung. Sie macht uns viel Kiwi-authentischer. Zudem haben wir noch einen Pick-Nick-Rucksack bei uns, ausstaffiert mit Tellern, Besteck und Gläsern, so dass wir wieder mal wie die Camper eine Mahlzeit im Freien einwerfen können.
On the road: Von Queenstown nach Te Anau und zum Milford Sound
Wir nehmen’s gemütlich. Um zehn pünktlich erscheint das Putzpersonal; wir fahren weg Richtung Süden. Es hat kaum Verkehr unterwegs, so alle zehn Minuten kommt uns ein Fahrzeug entgegen. Nach ungefähr zwei Stunden sind wir in Te Anau, dem Ausgangspunkt zum Fjordland. Milford Sund ist das Thema hier, alles dreht sich fast nur darum. Es gibt unzählige Anbieter, Busse der verschiedenen Gesellschaften kurven im Ort herum. Trotzdem: Sehr viele Leute hat es nicht, zu der Jahreszeit hätte ich mir das anders vorgestellt. Ich habe gestern bereits per Internet gebucht, so muss ich mich dem Entscheidungsstress heute nicht mehr aussetzen. Wir haben also Zeit, ein wenig ans Ufer des Sees zu gehen, wieder mal in die Sonne zu liegen, die sich so unendlich rar macht, und zu lesen. Lange haben wir das Vergnügen nicht, schon ist der Himmel wieder bedeckt. Ich habe ein Zimmer für zwei Nächte in einem B&B gemietet, und das bereits im April, weil hier jetzt Hochsaison ist und ich sicher sein wollte, dass wir eine Unterkunft haben. „Sheakespeare’s House“ heisst die Bleibe und unser Zimmer „Henry V“. Alles tip top, gut gelegen; Margaret, die Besitzerin, gibt uns nützliche Tipps und macht ein sagenhaft leckeres Frühstück.
Im Kino läuft ein Film übers Fjordland; er dauert eine halbe Stunde und Margaret hat uns eindringlich empfohlen, ihn zu sehen. Er wird täglich dreimal gezeigt, es kommen ja auch jeden Tag neue Touristen, so geht das schon. Den schauen wir uns an – und ja – fantastische Filmaufnahmen aus dem Helikopter, die diesen einmalig schönen und zum grössten Teil unberührten Naturpark zeigen. Anschliessend Happy-Hour in der Kinobar, auch nicht schlecht - das Leben ist doch wunderbar.
Essen im „Dolce Vita“. Richtig italienisch diesmal, wir finden’s Spitze. Zur Vorspeise die grossen, grünen Muscheln, die wir so gern haben, dann Nudeln Carbonara, eine Flasche australischen Shiraz aus meiner Handtasche, für den wir nicht einmal ein Zapfengeld bezahlen müssen, und Theo kann doch ein paar Worte Italienisch parlieren mit dem Besitzer und dem Kellner.
Grosses Problem am nächsten Morgen: Die Schifffahrt, die ich gebucht habe, beginnt bereits um elf, wir müssen um acht Uhr spätestens abfahren, um rechtzeitig dort zu sein, das heisst also, um sieben Uhr aufstehen. Das ist eine Zeit für Theo, die er nur noch aus seinen Militärtagen kennt, und die sind längst vorbei. – Erstaunlicherweise tut er sich gar nicht so schwer damit, mir fällt einfach auf, dass er kein Wort sagt. Margrets feines Frühstück und das wolkenlose Prachtswetter heben seine Lebensgeister. Wir fahren rechtzeitig los und denken, es habe dann sicher recht viel Verkehr unterwegs nach Milford Sound. Seltsamerweise ist dem überhaupt nicht so. Umso besser.
Unterwegs hat’s verschiedene Lookouts. Die meisten lassen wir links oder rechts liegen, damit wir nicht die Zeit vertrödeln. Aber den „Mirror Lake“ wollen wir uns dennoch ansehen. Unglaublich, die Spiegelwirkung dieser drei kleinen Seen. Kein Wind bläst, man hat den Eindruck, da sei nicht Wasser, sondern tatsächlich Spiegel.
Wir können fast nicht fassen, was wir mit dem Wetter für ein Glück haben. Heute ist‘s wirklich 1A. Kaum hab ich das gesagt, kommt in der Höhe plötzlich ein dichter Nebel auf. Mit dem haben wir überhaupt nicht gerechnet. Wenn’s mal nicht regnet…
Der riesige Parkplatz ist ziemlich stark belegt, aber wir finden trotzdem eine Lücke. Um elf geht unsere Tour los. Den Mitre, der höchste und bekannteste Berg, sieht man nicht, auf den Fotos, die herumhängen, schon. Er muss also da sein. Es herrscht dichter Nebel und bei den Passagieren eine Art Katerstimmung. Es ist wirklich schade, dass die Sicht so schlecht ist, die Fahrt hat ja schliesslich über 100 Fr. gekostet pro Person, da würde man schon gerne das sehen, was einem die Prospekte versprechen. Aber klar, fürs Wetter kann niemand zur Rechenschaft gezogen werden. Verschiedentlich wurde uns gesagt, auch bei Regen sei der Milford Sound sehenswert, die Wasserfälle seine dann noch spektakulärer. Aber ich denke, etwas müssen sie ja sagen, um die Besucher zu trösten und bei der Stange zu halten. Das Schiff fährt durch den Fjord, die Felsen auf beiden Seiten fallen fast senkrecht ins Wasser. Die Szenerie ist beeindruckend. Das Schiff fährt ganz nah an die Felsen heran, man sieht Seehunde und die Wasserfälle sind wie überdimensionierte Duschen. Nach 14 km erreicht das Schiff die Tasmanische See. Cook ist offenbar mehrmals am „Eingang“ des Fjords vorbeigefahren, ohne zu erkennen, welche Schönheit dahinter verborgen liegt. Könnte ja sein, dass es neblig war… Hätte er sehen können, wie viele Touristen 240 Jahre später täglich dort spazieren gefahren werden, ich weiss nicht, ob er das geglaubt und was er sich dabei gedacht hätte.
Das Schiff wendet und fährt wieder in den Fjord hinein. Und ganz langsam beginnt sich der Nebel zu lösen. Wir werden zum Conservatory gebracht, einer 10 Meter tiefen Unterwasserstation, die mit Fenstern ausgestattet ist, so dass man wie ein Taucher sehen kann, was da im Meer vor sich geht. Schwarze Korallen kommen normalerweise erst in 100 Meter tiefem Wasser vor, hier aber sind sie schon 10 Meter unter dem Meeresspiegel angesiedelt. Sie sind übrigens weiss und nicht schwarz. – Wie wir die 60 Treppenstufen wieder nach oben steigen und nach draussen gehen, hat das Wetter stark gebessert. Jetzt sieht alles ganz anders aus. Die Farben werden immer intensiver, man erkennt Berge, die vorher nicht zu sehen waren, auch Schneeberge. Jetzt kann ich mich fast nicht mehr satt sehen. Den Mitre gibt es wirklich.
Auf dem Rückweg erkennen wir, was wir am Morgen wegen des dichten Nebels verpasst haben. Die Strasse erinnert uns an den Julierpass - Felsen, Schnee, Steine, es ist eine malerische Fahrt. Wir merken erst jetzt richtig, wie hoch der Hunter-Tunnel in die Felsen eingemeisselt ist. Er wurde Ende des 19. Jhd. mit „normalen“ Werkzeugen von fünf Arbeitern erstellt. Er ist einspurig, unbeleuchtet und an beiden Enden hat’s grüne Vögel, die vor dem Eingang „herumlungern“ und die fast nicht von der Strasse wegzuscheuchen sind, weil sie sich um etwas Essbares zanken. Ich lese nachher, die Kea seien Hochland-Papageien, die nicht fliegen können und vom Aussterben bedroht sind. Kein Wunder. Wir waren das erste Auto vor dem Tunnel und ich musste aussteigen, um die Vögel dazu zu bewegen, Platz zu machen, damit sie nicht überfahren würden. Sie sind wirklich schön, wenn sie sich aufregen, flattern sie herum wie die Hühner und man sieht, dass sie unter den Flügeln ganz rote Federn haben.
Unterwegs möchte ich noch einmal die Mirror Lakes besuchen, will der Anblick so einmalig war, aber diesmal ist es ganz anders. Ein Wind weht, es hat kleine Wellen und dadurch halt keine Spiegelwirkung mehr. Man sieht auch auf den Grund, weil die Sonne anders einfällt – was am Morgen so magisch schien, ist verschwunden. Ich bin so froh, haben wir uns am Morgen die Zeit genommen, die Seen zu besuchen.
Nachtessen im Redcliff, dem besten Restaurant im Ort. Es war tatsächlich sehr gut, aber wir mussten über eine Stunde aufs Essen warten. – No worries, wir haben ja Zeit.
On the road: von Te Anou nach Dunedin und Wanaka
In der Nacht fängt es wieder an zu regnen. Am Morgen auch noch. Um zehn sind wir reisebereit und fahren der Southern Scenic Route entlang. Unterwegs gibt’s einen ersten Halt an der „Clifton Suspension Bridge“. Sie wurde 1898 erbaut, man kann sie zwar zu Fuss noch überqueren, aber der Verkehr wird über eine neuere Brücke geleitet. Gut sieht sie aus. Ich mag Brücken sehr.
In Tautapere, wo wir ein ganz charmantes Café und Museum finden, halten wir erneut an, um eine Tasse Kaffee zu trinken. Eigentlich eine Krimskrams-Ausstellung, aber irgendwie mit einer herzlichen und liebevollen Atmosphäre, gutem Kaffee und leckeren, home-made Gebäcken, besonders zu erwähnen die Rüeblitorte mit der dicken Zuckerglasur obendrauf.
Daneben ein Laden, „Art- und Crafts Centre“ steht auf dem Schild, wo lauter gestrickte und gehäkelte Baby-Kleidchen und sonst welche Handarbeitsartikel zum Kauf angeboten werden. Mir wird sofort klar, das müssen Frauen vom Dorf sein, die sich da an Strickmodellen gegenseitig überbieten. Und so ist es. Die dürre, ältere Dame, die dort sitzt, eingehüllt in einen selbstgestrickten Schal, und die fein säuberlich alle Verkäufe notiert, so es welche hat, bestätigt meine Vermutung. Es ist aber schön warm im Raum, sie hat ein Feuer gemacht im Cheminée. Ich kaufe ihr ein kleines Etui ab für Taschentücher mit Teddy Bären drauf. Vielleicht kann’s ja dann Ella gebrauchen. Jetzt hat die Lady was zum Notieren und Einkassieren. Ins Gästebuch sollen wir uns auch noch eintragen. Rührend irgendwie.
Weiterfahrt Richtung Invercargill. Es wird immer „strüber“ mit dem Wetter. Wir sind jetzt an der Südküste und der Wind bläst, so dass man kaum mehr das Auto verlassen kann, ohne dass es einem die Tür aus der Hand reisst. Ich bestehe aber darau, bei diversen Aussichtspunkten anzuhalten, Theo kann ja im Auto bleiben, und das tut er auch. Beim „McCrackens Rest“ geht’s zwar grad noch, da lassen wir uns sogar noch fotografieren. Am „Gemstone-Beach“ geb ich meine Exkursion aber auch rasch auf, es regnet von allen Seiten, ich bin innert Sekunden völlig durchnässt.
Einen weiteren kurzen Umweg fahren wir zu „Cosy Nook“, einer kleinen Fischersiedlung. Es hat nur etwa vier Häuser dort und ein paar Boote. Auch nach „Colac Bay“ gibt’s einen Abstecher. Dort hat’s einen schönen Sandstrand und sogar ein paar Surferinnen, was eher erstaunt bei dieser Witterung. Am Morgen war’s 9 Grad, jetzt nur gerade 15 und der Chillfactor…
Speziell ist der Friedhof in diesem Ort: Er sieht aus wie ein leeres Fussballfeld, und es hat genau drei Gräber dort. – Was mir besonders gefällt: die Haltestellen für den Schulbus: Ein Bus ist draufgemalt und die Passagiere sind die ganze Simson- Crew. Bei der nächsten Haltestelle ist Homer Simpson am Surfen.
In dieser wilden Gegend ist es nicht schwer zu erkennen, woher der Wind weht. Es gibt Baumgruppen, die alle in eine Richtung geneigt sind, und zwar so stark, dass sie fast am Boden liegen. Der Baum, der dem Wind direkt ausgesetzt ist (es sieht aus, wie wenn er die anderen beschützen würde), ist nicht mehr grün, sonder bereits abgestorben. Sehr speziell! Ich weiss gar nicht, wie diese Bäume heissen. Muss mich mal erkundigen. Solche Baumgruppen gibt es en masse.
In Invercargill zu bleiben, davon haben uns viele abgeraten, da gäbe es nicht viel zu sehen. Das Museum hingegen sei einen Besuch wert. Gegen zwei Uhr sind wir dort. Die Tourist Information ist im Museum untergebracht, sehr praktisch. Ich habe nämlich ausnahmsweise noch keine Unterkunft gebucht, weil ich dachte, wir wollen mal sehen, wie weit wir kommen und wo es uns gefällt, da bleiben wir dann. Jetzt wissen wir mehr und ich möchte in der Nähe von Fortrose oder Tokanui übernachten, dem Ausgangsort zu den Catlins. Die freundliche Angestellte gibt uns aber zu bedenken, dass es in dieser Gegend überhaupt keine Unterkünfte hat, nicht einmal Motels. Einzig ganz im Süden, beim Waipapa Point Lighthouse gäbe es eine Farm und die würden ein Cottage vermieten. Also, einverstanden, das nehmen wir. Der Leuchtturm ist sowieso unser erstes Ziel entlang der Küste, trifft sich bestens. Restaurants habe es aber keine in der Gegend, wir müssten uns dort selber versorgen, es sei ein voll eingerichtetes kleines Haus. Ok, wir gehen halt vorher noch einkaufen. Wir erhalten weitere gute Tipps für die Weiterreise. Es muss sehr viel zu sehen geben in den Catlins, dem südlichsten Gebiet der Südinsel. Die Wetterprognosen allerdings lassen keine übertriebenen Hoffnungen aufkommen.
Wir schauen uns das Museum an und die Galerie. Es sind zwei absolut lohnenswerte Stunden, die wir dort verbringen. In der Galerie stellt eine Frau aus, in deren Werk habe ich mich sofort verliebt: Sie stellt Geschöpfe dar aus verschiedenen Materialien, vor allem Ton und Metall, die eigentlich wenig hübsch aussehen, aber eine ganz liebevolle Ausstrahlung haben. „The boy who realised he can communicate with extraterrestrials“ oder „The girl who knittet her dream lover”. So lustig. Sie sieht schon grässlich aus, ihr gestrickter Traumgeliebter noch viel krasser.
Im Museum, wie zu erwarten, sind viele Maorischnitzereien ausgestellt, ebenfalls Steine, Muscheln, Tiere und ein ganzer Stock ist den sechs Inseln und deren Geschichte gewidmet, die zwischen der Antarktis und Neuseeland liegen, „the Roaring Forties“, absolut unwirtliche Gebiete, aber auch dort haben Menschen versucht, sich eine Existenz aufzubauen. Unverständlich! Auch gab es verschiedene Gruppen von Schiffbrüchigen, die auf den Inseln Zuflucht fanden. Einige mussten bis zu 20 Monaten dort ausharren. Kaum vorstellbar!
Wie wir das Museum verlassen, sehen wir blauen Himmel. Sehr, sehr unüblich! Dieses absonderliche Wetterphänomen lädt zu einem kurzen Bummel durch den Queens Park ein.
Eine Stunde dauert die Fahrt zu unserer ländlichen Unterkunft. Wir wollen ja erst noch einkaufen. Eigentlich haben wir alles, was es zum Überleben braucht, bei uns: Spaghetti, ein Gläschen Jamie Oliver Pesto Rosso, Toast, Butter, Orangensaft, Milch, Käse, Schinken, Wein, Mineralwasser. Nur der Salat fehlt. Da ist Theo mal ganz schnell mit seinem Vorschlag: „Wenn wir jetzt gehen und auf den Einkauf (Salat) verzichten, schaffen wir’s vielleicht noch grad, den Leuchtturm bei schönem Wetter zu sehen. Wer weiss, wie’s morgen ist…“. Ich bin einverstanden, verkneife mir sämtliche Bemerkungen und wir fahren los. Das war genau die richtige Entscheidung. Das Wetter hält, der Leuchtturm steht auf einem kleinen Hügel umgeben von grasbewachsenen Dünen, sehr abgelegen und schön anzusehen. Es ist Ebbe und wer hätte das gedacht: Da liegt doch tatsächlich ein Seelöwe am Strand. Erst denke ich, der sei vielleicht tot, aber er ruht sich nur aus, macht offenbar Siesta, lässt sich von uns auch nicht beirren. Theo überlegt einen Moment lang, ob er sich dazu legen soll (wie in Brisbane zu den Kängurus), lässt es dann doch sein, denn das Tier richtet sich auf und das macht einen gewissen Eindruck.
Das war’s dann auch schon mit dem schönen Wetter. Vorhin konnte ich eine Foto machen mit strahlend blauem Hintergrund, jetzt ist wieder alles normal: grau in grau.
Wir erreichen unsere Unterkunft. Beim Bauernhaus empfängt uns Tim, der Farmer, und zeigt uns das Cottage. Ein wirklich nettes Häuschen, eine Art Schuhschachtel eigentlich. Ringsum hat’s Schafe, Ziegen und Kälber, die uns neugierig betrachten. Wir richten uns ein, stellen die Heizung an und machen’s uns gemütlich. Teigwaren gibt’s natürlich und zu Theos Freude zur Abwechslung keinen Salat.
Wir haben den Eindruck, wir seien im nördlichsten Norden, aber wir sind ja im südlichsten Süden. Es sieht ganz so aus, als würde das keinen grossen Unterschied machen. In der Nacht bläst der Wind ums Cottage herum wie gestört, so dass ich denke, unsere Unterkunft fliegt bald davon oder sie bricht in Stücke. Es regnet in Strömen, und es ist kalt. Mir tun die Tiere leid. Einen Stall haben sie ja nicht. – Wir überleben aber alle. Theo sagt am Morgen zwar, sein linkes Auge sei eingefroren, aber das ist halt so ein „Theo-Spruch“. Unter der Dusche ist’s warm, im Wohnzimmer können wir heizen. Alles ok. Es ist ja Sommer.
Das Wetter scheint besser zu werden, die Tiere grasen emsig, die kleineren versinken fast in ihrem Futter. Es ist so wechselhaft, das Wetter. Gerade noch schön, jetzt hagelt’s und die Geissen rennen wie gehetzt ins Wäldchen unter den Schutz der Bäume. Kurz darauf, wenn ich zum Fenster herausschaue, ist der Himmel wieder blau gegen Westen, die Tiere wieder auf der Weide, auf der anderen Seite gegen Osten jedoch ist der Himmel tief schwarz. Das wird nicht lange dauern, bis die nächste Schütte kommt.
Genau so ist es. Und genau so geht’s weiter den ganzen Tag lang, am Anfang im 10-Minuten-Rhythmus, später wechselt’s jede halbe Stunde. Man kann fast die Uhr danach stellen. Um elf Uhr fahren wir los nach einer weiteren Hageleinlage. Beim Curio-Beach gibt’s den versteinerten Wald zu sehen, kaum sind wir dort, fängt’s wieder an zu regnen, und nicht zu knapp. Wir flüchten ins Auto. Die gleiche Szenerie am nächsten Strand, am Porpoise Bay. Man könnte dort Delphine, Pinguine und Surfer sehen, heisst es im Führer, von denen lässt sich bei dieser Witterung jedoch keiner blicken. Ein paar Surfer hat’s zwar, aber die sind am Zusammenpacken, am Strand ist niemand. Der Wind ist eh so stark, dass es einen fast wegbläst. Und kalt ist es: 12 Grad und dazu kommt noch der Chillfaktor.
Es regnet in Strömen und wir bleiben mit dem Auto stehen, es ändert sicher wieder. Das ist das Gute dran und lässt niemanden verzagen. Es kommt mir vor wie ein Spiel: im Auto warten, bis der Regen stoppt und sich die Sonne wieder zeigt, rasch raus und ansehen, was man ansehen will, zurück ins Auto und warten, bis die nächste Dusche vorbei ist. Wenige Kilometer weiter gibt‘s das „Niagara Falls – Café“, dort kehren wir ein. Wir setzen uns in den Wintergarten und können uns wunderbar aufwärmen. Inzwischen scheint nämlich wieder die Sonne und der Himmel ist blau, blau, blau, grad wie wenn gar nichts gewesen wär. – Den „Niagara Fall“ sehen wir uns selbstverständlich bei diesem Wetter auch noch an. Es heisst, es sei „World‘s smallest waterfall“. Und so ist es wohl. Lustig, wirklich. Die „Fluten“ „stürzen“ über ein etwa dreissig Centimeter hohes Steinmäuerchen hinunter. - Da hat einer der Pioniere Humor gehabt bei der Namensgebung.
Der nächste Wasserfall, der „McLean Fall“ ist umso spektakulärer. Da prasseln die Wassermassen ins Tal, dass es nur so dröhnt und das Spezielle dran ist zudem die Farbe des Wassers. Es ist ganz dunkelbraun. Wir lesen später, dass hier die Erde voller Torf ist und die Verfärbung daher rührt. Das Wasser sieht sehr ungesund aus. Auch ein See in der Gegend hat dieselbe Farbe. Da möchte man nicht schwimmen gehen. Übrigens hat’s in diesen Gewässern auch keine Fische. - Es regnet wieder, wir fahren zum nächsten Wasserfall, dem am meisten fotografierten in ganz Neuseeland, heisst es. Der „Purakaunui –Fall“. – Seltsame Statistik. Ok, wir tragen auch dazu bei. Wir haben das Zeitfenster wieder genau richtig getroffen, die Sonne scheint, der Wasserfall zeigt sich im besten Licht. Wie ein Vorhang fällt er über verschiedene Steinterrassen. Wie allerdings der Weg dorthin aussieht, ist fast nicht zu beschreiben: Wasserlachen, tiefer Sumpf, Gummistiefel wären das Richtige, Theos Discoschleifer eher weniger. – Gegen fünf kommen wir in Owaka (Ort des Kanus) an. Ein seltsamer Ort, gross angelegte Strassen, da könnte mal Paris draus werden, etwa 350 Einwohner nur, die begegnen sich aber wohl kaum. Eine Tankstelle, drei Hotels und Restaurants, ein Supermarkt, ein Frisör, ein paar Geschäfte, wo man nur raten kann, dass es sie mal gab, weil noch Teile ihres Namens auf den abgebröckelten Fassaden erkennbar sind.
Wir finden Unterkunft im Okawa-Lodge-Motel und sind sehr zufrieden damit. Es ist ein Studio mit Küche und Bad, wie man sie oft hier findet. Die Heizung funktioniert, das ist vom Allerwichtigsten.
Frühstücken tun wir auch gleich dort, dank der Kühlbox haben wir ja alles mit dabei.
Da es immer noch regnet, besichtigen wir das Dorf-Museum, das sich gleich gegenüber unserem Motel befindet. Bisher fanden wir alle diese kleinen lokalen Museen überaus besuchenswert. Sie sind mit viel Liebe gestaltet und was man da alles erfährt über die Gegend und die Geschichte, ist jeweils sehr interessant. Schon oft haben wir festgestellt, dass die Neuseeländer extrem an ihrer eigenen Familiengeschichte interessiert sind. Ahnenforschung ist absolut im Trend und so findet man zahllose Ordner, in denen akribisch aufgeführt ist, was an Wissen vorhanden ist.
Nugget Beach Lighthouse: Das gleiche Szenarium wie wir es schon gewohnt sind: Schönes Wetter bis zum Parkplatz, Regen. Wir warten, bis der Regen aufhört. Das dauert fünf Minuten. Der Spaziergang zum Leuchtturm und zurück dauert 40 Minuten. Das wird ohne Regenschauer nicht reichen, aber henusode. Wir haben unsere Regenjacken und sind waterproof. Der Walk den Klippen entlang ist wunderschön, weit unten sieht man Robben sich tummeln, und es gelingen ein paar gute Fotos, bis es wieder zu regnen beginnt.
Kaffee und Kuchen in Kaka Point, wo sich Theo sehr um eine ausrangeierte Kirche interessiert, an der angeschrieben steht: „For Sale“. – Das fehlte grade noch! Als Fotomotiv eignet sie sich allerdings bestens.
Wir fahren weiter nach Dunedin, der achtgrössten Stadt in Neuseeland, von der Einwohnerzahl her etwa gleich gross wie Bern, von der Fläche her nicht zu vergleichen.
Das B&B, das ich ausgelesen habe (in einem alten, viktorianischen Haus untergebracht, das extrem an England erinnert), ist bestens gelegen, fünf Minuten zu Fuss vom Zentrum entfernt, so dass wir ohne Auto problemlos Stadtspaziergänge machen und abends essen gehen können, einmal thailändisch, einmal italienisch.
Am 15. Januar ist das Wetter ausnahmsweise so gut und schön, dass wir den Tag am Strand von St. Clair verbringen, einem Vorort von Dunedin. Wassertemperatur 14 Grad.
Wir besuchen aber auch das „Royal Albatross Centre“ auf der Otago Halbinsel. Es ist der einzige Ort auf der ganzen Welt, wo man Albatrosse auf dem Festland brüten sehen kann. Die Vögel sind brilliante Segler; sie schwingen sich in unglaublicher Lässigkeit und Eleganz durch die Lüfte. Weniger geschickt sieht es aus, wenn sie am Boden landen. In enem seiner Trickfilme hat Disney perfekt und spassig dargestellt, wie das aussieht. Es ist tatsächlich auch in natura so: Nicht selten purzeln sie ein paar Meter weit, bis sie schliesslich zum Stillstand kommen. – Da bleibt kein Auge trocken…
Am nächsten Tag, bevor wir Richtung Wanaka weiterreisen, kurzer Besuch der Boy-School. Die haben ja Ferien, der Campus ist also ausser dem Sekretariat ziemlich verlassen. In der Eingangshalle fallen uns die Ständer auf, auf denen Plakate hängen, wo bestimmte Schüler speziell erwähnt und gepriesen werden wegen ihrer Leistungen. Solche Auszeichnungen öffentlich aufzustellen wäre bei uns absolut undenkbar, all die Bemerkungen, die da fallen würden von wegen Strebertum und Ähnlichem, das ginge gar nicht.
Ich möchte mir noch das Olveston Historic Home anschauen, in der Beschreibung heisst es, es sei eines der ältesten Privathäuser in ganz Neuseeland, gebaut anfangs des 20. Jahrhunderts, ein schönes Beispiel eduardischer Bauweise. Wir besichtigen es nur von aussen, innen hätten wir eine einstündige Führung mitmachen müssen, aber Theo hat seine Protestminute und findet es total daneben, dass wir zu Hause x Schlösser haben, die viel, viel älter sind als dieses Ding und die gehen wir nie besuchen. Übrigens regnet es gerade wider.
Also halt Weiterfahrt an die Bedford-Street, die sich rühmt, die steilste Strasse der Welt zu sein und es damit ins Guiness-Buch der Rekorde geschafft hat. Steiler noch als in San Francisco soll sie sein und mit Betonplatten belegt, da der Asphalt abrutschen könnte. Ich darf sie hinauffahren, zuoberst ober-mühsam wenden und wieder hinunterfahren.
Jetzt sind wir parat für die Weiterfahrt durch die Goldgräberstädte ins Landesinnere der Region Otago.
In Lawrence gibt’s einen Zwischenhalt mit Kaffee, Kuchen, Museum und Spaziergang den historischen Gebäuden entlang. Während des Goldrauschs stieg die Einwohnerzahl innerhalb eines Jahres von wenigen Duzend auf 11‘000 an, jetzt wohnen noch knapp 400 Leute dort. Ein Tasmanier, Thomas Gabriel Read, hat seinerzeit den Goldrausch ausgelöst in diesem Ort (ab 1861). Man kann sich gar nicht vorstellen, wie es ihm gelang, am richtigen Ort zu graben und gleich Gold zu finden. Nach ihm ist der Ort benannt: „Gabriel’s Gully“: ein Tal wie ein anders auch, und ein Jahr später sieht’s aus, wie wenn Maulwürfe Einzug gehalten hätten, überall kleine Erdhügel, abgesteckte Claims, ein Zelt am anderen. All das sieht man auf den Fotos im Museum. Am Ort selber sieht das Tal wohl wieder mehr oder weniger so aus, wie’s vor dem grossen Ansturm war.
Weiterfahrt über Alexandra. Seen, Stauseen, karge Landschaft, bizarre Gesteinsformen, es wird nicht langweilig. In Cromwell machen wir einen Halt. Um diese Stadt herum hat’s unzählige Plantagen von Früchten: Äpfel, Aprikosen, Kirschen und natürlich Trauben. Nicht mehr lang und wir erreichen Wanaka, das Interlaken der Südinsel. Was ist nur mit dem Wetter passiert? 26 Grad und kein Regen. - Nicht zu fassen. Wir beziehen unsere zwölfte Homelink-Unterkunft, erneut mit wunderbarem Blick über den Wanaka-See, die Stadt und die schneebedeckten Berge im Norden. Apéro auf dem Balkon. Wir finden’s ziemlich heiss, weil wir ja solche Temperaturen gar nicht mehr gewohnt sind. Plötzlich kommt ein Wind auf, ich muss die Gläser halten, damit sie nicht umfallen, es ist klar, Nachtessen können wir nicht mehr draussen, der Wind ist zu stark. Nach unserem BBQ schauen wir uns im Fernsehen einen Match von von Roger Federers im Australian Open in Melbourne an.
Wanaka
Mit Wind haben wir ja so allmählich unsere Erfahrungen, aber was hier passiert, ist die absolute Spitze. Die ganze Nacht lang bläst’s und heult’s ums Haus herum, es knackt im Gebälk, so dass man kaum schlafen kann. Theo steht dreimal auf – ein Jahrhundertereignis. Er träumt von schreienden Kindern (die er retten will) und Einbrechern, wie er mir am nächsten Tag erzählt. Um halb vier Uhr morgens ist’s plötzlich ruhig, aber offenbar werden wieder Kräfte gesammelt, um gegen acht mit neuer Puste und frischem Elan loszublasen. Die Stühle und der Tisch auf dem Balkon sind umgeworfen, das Wetter wär wunderschön, aber es bläst einem fast davon. Wanaka liegt auf 300 Metern über Meer, trotzdem kommt es uns vor, wie bei uns in den Bergen tausend oder tausendfünfhundert Meter höher.
Nach dem Frühstück fahren wir ins Dorf, nehmen unsere Strandtücher und Badesachen mit, aber besser hätten wir Windjacken und Daunenwesten angezogen, der Wind ist extrem. Wir finden ein Café mit Internet (dummerweise hat’s kein WIFI in „unserem“ Haus) und erledigen ein paar E-Mails. Zudem versuche ich, den Fortgang unserer Reise weiterzuplanen. Im Ort ist viel los, es wimmelt nur so von Sportlern, denn am nächsten Tag findet ein Gigathlon statt. Der Himmel ist noch immer stahlblau, niemand ist im Badeanzug, obwohl der Stand voller Leute ist. Ich bin aber sicher, wenn wir ein windgeschütztes Plätzchen fänden, können wir wunderbar sonnenbaden. Das ist aber nicht so einfach. Trotzdem werden wir auf der anderen Seite des Sees hinter einem Wäldchen fündig. Erstaunlich, in den Baumwipfeln bläst der Wind noch wie wild, am Strand beziehungsweise am Ufer kann man ohne weiteres liegen, lesen und es ist keineswegs zu kalt. Im Gegenteil, so ein laues Lüftchen wär doch ganz schön…
Ravioli gibt’s zum Nachtessen (Menu Nr. 3), Salat natürlich vorher und anschliessend verfolgen wir weitere Matches am Australian Open am Fernsehen.
Am folgenden Morgen um sechs schon ist aus und fertig mit Schlafen. Für mich jedenfalls. Der Gigathlon hat begonnen, einer brüllt durchs Megaphon Anweisungen über den See und übers ganze Gebiet. Neben mir liegt Theo mit seiner Motorsäge und dem Versuch, den Lautsprecher zu übertönen. Wie er wohl diesmal den Lärm da draussen in seinen Traum einbaut? Er wird es mir erzählen und darüber klagen, wie schlecht er geschlafen habe…
Um Viertel vor sieben kommt noch ein Helikopter dazu, der das Geschehen überwacht, fotografiert oder was auch immer. Ich hab genug und stehe auf. Von da, wo ich auf dem Sofa sitze und schreibe, habe ich Sperrsitz auf das, was da unten am See alles läuft. Es muss bitter kalt sein. Die Masse von Zuschauern und Athleten, die am Ufer stehen, sind alle warm angezogen. Jetzt werden die Schwimmerinnen und Schwimmer losgelassen, der am Megaphon flippt fast aus mit seinen Ansagen und vor lauter Ansporn. - Ich mach mir mal eine Tasse Tee.
Theo taucht auf und beklagt sich, dass er schlecht geschlafen habe… Nach dem Morgenessen haben wir etwas Grosses vor. Ich schlug gestern vor, eine Wanderung zu machen (10 km / 3-4 Std.) zum Rob Roy Glacier. Theos sah nicht gerade glücklich aus, als er merkte, dass es mir ernst war mit meiner Absicht, aber ich übersah sein Stirnrunzeln geflissentlich. Jedenfalls ging er ins Informationszentrum um zu fragen, wie steil, wie lang und breit diese Wanderung denn sei. Grosse Bedenken. Aber ok, über Nacht hat der Gedanke offenbar Fuss gefasst und es sieht aus, als ob er sich ins Unabänderliche schicken wird. Das Problem ist allerdings, dass die Strasse, die dorthin führt, bis um 12 Uhr geschlossen ist wegen der Sportveranstaltung. Das ist wirklich Pech, denn es dauert eine Stunde, bis wir dort sind und eigentlich würde ich lieber so gegen zehn Uhr spätestens starten. Ich packe meinen Rucksack, denke, für die kurze Strecke langt einer längst. Theo will seinen Sportsack auch mitnehmen (den peinlichen, wo „Swiss“ draufsteht), prall gefüllt mit fast einer Überlebenspackung. Natel-Ersatz-Akku, für den Notfall, eine halbe Biwak-Ausrüstung würde er ebenfalls gerne mitnehmen; man weiss ja nie... Nur mit Mühe kann ich ihn davon abhalten und ihn überzeugen, dass wir nur wenig brauchen und dass alles längst in einem Rucksack Platz hat. Um halb zwölf fahren wir ins Dorf, um dann parat zu sein, wenn die Strasse wieder offen ist. – da können wir noch lange warten. Immer wieder kommen Athleten angekeucht, das wird noch ewig dauern. Und jetzt beginnt es noch zu regnen. Nein, also nein: Unser Vorhaben ist ins Wasser gefallen.
Wir gehen heim und machen uns einen gemütlichen Nachmittag, sehr zu Theos Wohlgefallen.
Noch am Nachmittag um vier höre ich den Lautsprecher über den See dröhnen. Wenn der Typ nur langsam heiser würde…
Es gibt ein wunderbares, kleines Kino hier in Wanaka, das „Cinema Paradiso“, geführt von jungen Leuten. Sie backen home-made Cookies, auch ihr Eiscreme ist selbst gemacht, man kann Wein und Bier und was auch immer kaufen und mit in die Vorstellung nehmen, es hat sogar eine Pause (sehr unüblich sonst in den Kinos hier), und wenn diese beginnt, kommt eine junge Frau und fragt uns „guys“, ob uns der Film gefällt und ob es zu warm oder zu kalt sei, sie würde dann die AC an- beziehungsweise ausschalten. – So zuvorkommend. Es hat sicher etwa zwanzig verschiedene Arten von Sitzen, zusammengekauft wohl aus Secondhand-Institutionen und aus ausrangierten Kinos. Ebenfalls ein altes Auto steht im Saal und auch dort hat’s vier verschiedene Sitze drin, die hinteren leicht erhöht, so dass man sich dort wie im Drive-In-Cinema fühlen kann. Der Film war „Jack Ryan: Shadow Recruit“, Action pur, Action bis zum Gehtnichtmehr und dann geht doch noch mehr. Ernst nehmen kann man das Ganze ja nicht, aber immerhin hat der Held doch hin und wieder eine unbeduetende Wunde abgekriegt. Das waren zwei Stunden voller Unterhaltung und Spannung, bis zum Bauchweh fast. Die beiden Kritiken, die wir gelesen haben, sind sehr lustig aufgemacht, aber nicht allzu wohlmeinend. Den Titel des Films habe man wohl schon vergessen, wenn man wieder daheim sei, meint der eine Kritiker, der andere findet Kenneth Branagh (hier der Bösewicht – sonst ja eher ein Shakespeare-Darsteller) eine völlige Fehlbesetzung, er als Regisseur habe sich selber wohl als Schauspieler gewählt, damit er nicht so viel Gage bezahlen müsse. Ersterer wiederum meint, wenn der Regisseur selber mitspielt, mache es wenigster einer richtig, die anderen Hauptdarsteller hätten ja gerade mal so viel Charisma wie das, was man sich am Morgen aufs Toastbrot streiche. Na ja, bei mir ist es Butter, Theo hat gern Margarine, Emmentaler, Schinken und am Schluss dann noch Marmelade. Hat tatsächlich alles keine Ausstrahlung…
Von Wanaka nach Christchurch
Schon wieder ist es Zeit abzureisen. Diesmal geht’s nordwärts, erst mal in Richtung Mount Cook. Gesehen haben wir ihn ja bereits vom Flugzeug aus, jetzt wird’s ernst. Es ist ein strahlend schöner Tag, das sind wir nicht mehr gewohnt, aber wir freuen uns natürlich sehr darüber. Erst besuchen wir die Geisterstadt Bendigo. Stadt ist übertrieben. Das war einmal. Es ist nur noch eine halbe Ruine vorhanden und im Gebiet, wo im vorletzten Jahrhundert Zentimeter für Zentimeter nach Gold gegraben wurde, gibt es noch ein paar offene Schächte und Teile von Maschinen, aber wirklich zu sehen ist fast nichts. Unser erster Kaffeehalt ist in Twizel, einem Ort, der erst in den Sechzigerjahren errichtet wurde für die Arbeiter, die den Damm am Lake Pukaki bauten. Nach Abschluss der Bauarbeiten hätte der Ort wieder aufgehoben werden sollen, aber die Bewohner begannen sich dagegen zu wehren und inzwischen hat sich das Dorf fast zu einem Touristenzentrum gemausert wegen der Nähe zum bekannten Reiseziel Aoraki - Mount Cook.
Am Pukaki See entlang führt die SH 80 bis ins Mount Cook Village. Eine Stunde lang dauert die Fahrt. Die Farbe des Sees ist tief türkisblau, fast kitschig. Auf den Fotos wird’s aussehen, als ob wir den Photoshop ein wenig zu sehr strapaziert hätten. Man kann gar nicht glauben, dass so eine Farbe möglich ist. Der Grund dafür sind Mineralien. Kein einziges Haus steht am See, kein Boot ist irgendwo zu sehen, offenbar lebt auch kein Fisch im See. In der Schweiz wär das ganz anders. Aber hier… Es ist ein majestätischer Anblick: im Hintergrund die schneebedeckten Berge und im Vordergrund dieser fast unnatürlich wirkende See. Beinahe ein wenig gespenstig kommt er mir vor. Wir erreichen das Village und haben Glück, dass wir in der Aoraki-Backpacker-Lodge noch ein Doppelzimmer erhalten. Diesmal hab ich nämlich keine Unterkunft gebucht, weil ich dachte, wenn das Wetter schlecht ist, hat’s keinen Sinn, in die Berge zu fahren, um den Nebel zu bestaunen. So wie bei uns in Zermatt jeweils die armen Japaner, die das „Hore“ nur auf den Postkarten sehen. Aber alle beglückwünschen uns geradezu zu unserem Glück, die Bergwelt in ihrer wolkenlosen Pracht zu erleben. - Grossartig, ja. Wir geniessen es. Es ist auch endlich warm, der Anblick der Gletscher, die zum Greifen nah scheinen, grandios. Ein wunderbares Nachtessen im Restaurant und ein feines Frühstück am nächsten Morgen - uns geht’s wieder mal mehr als nur gut.
Am folgenden Morgen hat’s zwar wieder Nebel, aber wir haben sie ja gestern zur Genüge gesehen, Mount Cook (3754m) und Konsorte, The Footstool, Mount Sefton. Eigentlich dachte ich, wir würden dann noch eine Wanderung machen an diesem Tag, aber auch dieses Vorhaben scheint ins Wasser zu fallen. Wie wir allerdings fertig sind mit dem Morgenessen, wird’s wieder schön, wir schnallen unsere Wanderschuhe (eher Allround-Tennis-Sneakers) an und ziehen los, umgeben von lauter Japanern, die dasselbe Ziel haben, den Walk zum Kia-Point. Wir nehmen’s gemütlich, die Aussicht ist einmalig. Auf dem Rückweg sind wir fast allein. Die ganze Wagenladung Japaner musste wohl rasch wieder zurück zum Mittagsbuffet ins Hotel gebracht werden. Wir fahren anschliessend ins Tasman-Valley und eine weitere kurze aber steile Wanderung führt uns zu einem Aussichtspunkt, von dem aus man ein paar kleine Seen und den Tasman-Gletscher sieht. Hier geht’s wohl nicht anders als bei uns: Er hat sich zurückgezogen, das untere Ende ist braun und scheint dreckig, obwohl Abgase kaum der Grund dafür sein können. Der See unten am Gletscher ist grau-grünlich, ein paar wenige Eisblöcke sind noch zu sehen drin, das Wasser soll ein halbes Grad warm/kalt sein.
Wir fahren die SH 80 zurück, aber ich will unbedingt unterwegs mal die Füsse ins türkisfarbene Wasser halten. Es ist nicht einmal sehr kalt, aber irgendwie wage ich nicht, darin zu schwimmen, ich weiss eigentlich auch nicht, wieso. Vielleicht, weil niemand sonst das tut. – Im Nachhinein reut es mich.
Wir fahren weiter an den Lake Tekapo. Immer noch ist das Wetter herrlich, es ist Sommer – endlich (oder zumindest ein warmer Frühlingstag). Im lokalen Reisebüro finden sie uns sofort ein Motel direkt am See. Es ist ein Bijou. Der See ist genauso blau wie der Lake Pukaki, ein sensationeller Ferienort ist das. Und es ist uns sogar gelungen, die am meisten fotografierte Kirche in ganz Neuseeland ebenfalls abzulichten. Mit ein paar Japanern drauf. Wir haben uns wirklich gefragt, wie’s möglich ist, so viele Touristen anzulocken, um eine kleine Kirche zu fotografieren, die 1925 gebaut worden war. Schön gelegen ist sie zwar, sie hat keinen Altar, statt dessen ein Fenster, durch das man auf den See und die Berge im Hintergrund sehen kann. Da muss in einem Reiseführer gestanden sein, diese Kirche sei sehenswert und schon pilgern tausende von Touristen dorthin (wir ja auch...). Noch an Abend um acht, wie wir dran vorbeifahren (100 Meter von unserer Unterkunft entfernt), hat es drei Autobusse dort stehen und eine ganze Traube von Leuten mit ihren Kameras. 50 Meter nebendran steht aus Bronze ein Denkmal für einen Hund. Dank dem Collie war’s möglich, in dieser Gegend (MacKenzie) die Schafzucht einzuführen. Der Hund wird dann gleich mitfotografiert, ist wohl auch der am meisten geknipste Hund in ganz Neuseeland. Selbstverständlich hab ich auch da zur Statistik beigetragen, ich will mich doch nicht abgrenzen.
Apropos Reiseführer: „Theo, wo hast du den Reiseführer?“, fragte ich, „Ich will etwas nachschauen.“ - Den haben wir nicht mehr. Einmal mehr nicht mehr! Ich kann’s nicht fassen. Gestern noch hab ich ihn meinem lieben Ehemann aufs Bett gelegt und ihn gebeten nachzulesen, was der nächste Tag bringen wird. Er ist ihm aber irgendwie geglückt, das Buch, das nota bene fast ein Kilo wiegt, so zwischen seinem Bett und der Wand hineinzuquetschen, dass ich es nicht mal mehr bei der Nachkontrolle beim Verlassen des Zimmers gesehen habe. Dabei ging ich extra nochmal zurück (schlechte Erfahrung hat mich das gelehrt), ging auf die Knie und schaute unters Bett, ob da auch wirklich nichts mehr lag. – Ich glaub’s ja nicht. In Polen schon ist genau dasselbe passiert im letzten Sommer. In einem Hotel in Danzig gibt’s einen Reiseführer, der eigentlich uns gehört. Und der Neuseeland Reiseführer wurde uns ja auch bereits mal nachgeschickt von der nördlichsten Stadt auf der Nordinsel nach Auckland. Die Ablage in der Rückenlehne des Vordersitzes im Autobus war damals die Bleibe, die Theo für unser Buch ausgesucht hatte. – Jetzt ist es wieder weg. Im Mount Cook Village. - Am Ufer des Sees versuche ich, meinen Ärger ein wenig zu vergessen; ich lege mich in die Sonne und lese eine gute Stunde lang in meinem neuen Krimi, den ich grad angefangen habe. – Wir gehen dann ins Dorf, kaufen Fish and Chips (Fisherman’s Choice) und essen dieses Pick Nick auf unserem Balkon mit einer Flasche Roten und Blick auf den See. Das Schöne ist, bis um neun ist’s hell und wenn der Wind endlich aufhört zu blasen, ist’s ganz angenehm warm.
Am Morgen gibt’s wieder Frühstück auf unserer Terrasse. Wir haben Toastbrot gekauft, Butter, etc. haben wir noch. Milch gibt’s immer frische in den Motels, das gehört zum Service. Die erste Tätigkeit dann ist, die Dame in der Tourist-Information zu fragen, ob sie Kontakt aufnehmen könne mit dem Motel, in dem unser Reiseführer übernachtet hat. Gefunden hat ihn noch niemand, Theo muss ein remarkables Versteck für ihn gefunden haben. Jemand geht dann nochmals nachschauen ins Zimmer 552; wir warten auf den Rückruf – und ja, das Buch ist gefunden worden. Es musste ja dort sein. Ich frage dann, ob eventuell irgendjemand, der nach Christchurch fährt, das Corpus Delicti mitnehmen und es dort auf der Tourist-Information abgeben könne. Ja, das ginge, erklärte mir der nette Manager, ein Bus fahre am nächsten Morgen dorthin, er würde den Chauffeur beauftragen, das Buch mitzunehmen und dort abzugeben. – Es gibt zwar hundert Broschüren und wir haben ja auch immer wieder mal Internet-Zugang, aber der Reiseführer ist mir wichtig. Ich habe damit weitgehend unsere Reise geplant, Notizen reingeschrieben, es ist alles gut erklärt, hat Karten und ist übersichtlich gegliedert. Deshalb war ich ärgerlich, dass das Buch zum zweiten Mal verschwand und jetzt ganz glücklich, dass wir es eventuell, wenn alles gut geht, wieder erhalten werden.
Wir nehmen nicht die normale Route der Küste entlang nach Christchurch, sondern die SH 72, die Inland Scenic Route. Sie führt uns durch weites Landwirtschaftsgebiet, vorbei an Tausenden von Schafen einmal mehr, an Rindern und an ein paar Pferden. In Geraldine gibt’s einen Kaffeehalt und einen Museumsbesuch. Es ist wieder schönes Wetter und wir wollen uns ein Plätzchen suchen an einem See oder Fluss, um ein wenig an der Sonne zu liegen und zu lesen. Theos tägliche Siesta ist nach wie vor ein Muss. Wir finden einen Fluss, den Rakaia-River, einer von denen, die wir vom Flugzeug aus gesehen haben und die uns stark beeindruckt haben, weil sie so sehr mäandern und in voller Breite durch die Gegend fliessen. Wir fahren durch eine Schlucht und oberhalb des Flusses hat es einen Campingplatz. Dort halten wir mal an. Aber es reisst uns fast die Tür aus der Hand, so stark bläst der Wind. Wir pilgern zum Fluss hinunter, dort ist ebenfalls kein Bleiben. Die Bäume, die vom Sturmwind wie wild hin- und hergerissen werden, machen mir Angst. Im Windschatten einer dichten Hecke finden wir doch ein Plätzchen und die Siesta kann statfinden.
Gegen sechs sind wir in Christchurch (der englischsten Stadt in Neuseeland) und finden unsere neue Homelink-Adresse. Zuerst zwar fast nicht, es sind alles kleine Häuschen, dicht aneinander gedrängt und die Nummern sind kaum lesbar. Der Schlüssel stecke unter der Matte, hat mich Fjona wissen lassen. Nachdem ich etwa drei Matten vor fremden Haustüren gelüftet habe, werde ich endlich fündig. Ein kleines Haus ist’s diesmal, keine Aussicht, aber völlig ok für die drei Nächte, die wir hier nur verbringen werden. Unsere Homelink-Partner, Fjona und Iain, haben eine Farm etwa zwei Stunden nördlich von hier und das Haus hier ist ihre Bleibe, wenn sie in der Stadt zu tun haben. Fast zeitgleich mit uns kommen sie vorbei, zeigen uns alles und wir machen uns bekannt. Die beiden sind ein sehr sympathisches, nettes Ehepaar, sie laden uns auch ein, auf ihrer Farm vorbeizukommen und dort zu übernachten auf unserem Weg in den Norden. Mal sehen, eigentlich hab ich die Unterkünfte zum Teil schon gebucht. Sie haben uns den Kühlschrank gefüllt mit feinen Sachen, so dass wir fast nicht mehr Platz haben für all die feinen Sachen, die wir gerade eben eingekauft haben. Jetzt haben wir alles doppelt; 2 l Milch, 12 Eier, 4 l Orangensaft etc. etc. Und Gipfeli haben sie gekauft für uns zum Frühstück morgen. Nicht etwa zwei, nein gleich zehn.
Sie müssen dann gehen und überlassen uns unserem Schicksal, welches da ist, Menu Nr. 2 zuzubereiten: Angus-Filet, Bratkartoffeln und vorher eine grosse Portion Salat.
Christchurch
Ein Besuch in der Stadt lehrt uns, dass entgegen unserer Vorstellung, nach dem Erdbeben vor drei Jahren sei alles wieder aufgebaut, da noch immer ein riesiger Trümmerhaufen vorhanden ist. Unglaublich, wie das aussieht: Die Kathedrale ist eine Ruine, Häuser sind teilweise noch vorhanden, andere werden wieder aufgebaut, überall hat’s riesige Lücken, leere Grundstücke, wo wenigstens schon der Schutt weggeräumt worden ist. So hat’s überall Parkplätze, überall auch Absperrungen, überall sind Strassen blockiert, weil gearbeitet wird, überall hat’s Umleitungen, Läden sind zum Teil in Containern untergebracht. Ein trauriges Bild. - Iain, der hier aufgewachsen ist, sagt, er kenne sich gar nicht mehr aus, weil so viele Häuser, an denen man sich hatte orientieren konnte, nicht mehr vorhanden seien; das Stadtbild muss jetzt völlig anders aussehen. In einem Vorort gibt’s eine Siedlung von 20‘000 leer stehenden Einfamilienhäusern, eine Geisterstadt.
Das Haus, wo die Touristeninformation beherbergt war, ist auch so sehr beschädigt, dass es nicht mehr brauchbar ist, der Wegweiser zeigt aber nach wie vor dorthin. Wir finden den neuen Ort aber trotzdem und fragen nach unserem Reiseführer. Davon weiss allerdings niemand was. Wir wollen schon abziehen, da kommt eine Japanerin herein mit unserem Guidebook in der Hand. So sehr hab ich mich noch nie über den Anblick einer Japanerin gefreut! Sie ist die Reiseführerin und soeben mit dem Bus von Mount Cook her angereist. So ein Zufall, dass wir grad zu der Zeit da sind.
Ich hab mein Buch wieder! Judihui! In Zukunft werd ich’s Theo nicht mehr geben, so viel steht fest!
Wir machen am Nachmittag einen Ausflug nach Akaroa, einem idyllisch gelegenen Ort auf der vorgelagerten Halbinsel. Die Fahrt dorthin dauert etwa eine Stunde. Kaffeehalt in der Hilltop Tavern, von wo aus man eine einmalige Aussicht hat. Der Ort hat einen französischen Touch, die Fahne der „grand nation“ hängt an ein paar Geschäften, auch sind etliche Ortsnamen in der Gegend französischen Ursprungs. Wir besuchen den historischen Friedhof und staunen, wie wir sehen, dass eine Vielzahl der Grabsteine vom Erdbeben umgeworfen worden sind und nun mit ausgedienten Autopneus gestützt werden. Ein einziger Pneufriedhof- ziemlich gewöhnungsbedürftig.
In ihrem Ferienhaus oberhalb des Städchens treffen wir Robyn und Mike, ein Ehepaar, mit denen ich durch Homelink Kontakt hatte, aber dann kam doch kein Tausch zustande. Wir machten aber ab, dass wir sie besuchen würden. Das taten wir dann auch, gingen zusammen essen und hatten einen angenehmen, interessanten Abend in einem kleinen Restaurant am Hafen. Hier erzählen natürlich alle vom Erdbeben, es ist in aller Gedanken und Munde. Überall habe es noch Schäden und man dürfe wegen der Versicherung nichts ändern oder flicken. Fotos würden nicht akzeptiert. Sie seien auf der Schadenliste 34‘000 und etwas. - Da werden sie wohl noch ein wenig warten müssen, bis sie an der Reihe sind mit der Schadensaufnahme.
Den nächsten Tag verbringen wir am Strand, dem Sumner-Beach. Schönes Wetter, blauer Himmel, aber wieder ein Wind vom Schtrübschte. Wir finden ein geschütztes Plätzchen hinter einer Düne, wo, wenn man flach im Sand liegt, es richtig heiss ist, ich kann nicht einmal barfuss gehen. Es ist aber trotzdem nicht nötig, sich im Wasser abzukühlen. Es reicht, aufzustehen und sich vom kalten Wind abkühlen zu lassen. So extrem hab ich das noch nie erlebt.
In die Stadt zurück fahren wir über die Scenic Route, die über die Hügel führt, und von wo aus man (zum x-ten Mal) einen grandiosen Blick über die Stadt, die Berge und den Strand hat.
Im Hagley Park findet ein einwöchiges World-Busker-Festival statt und das wollen wir nun besuchen. Sehr lange halten wir es nicht aus. Es ist sooo kalt. Nicht einmal mein vierlagiges Outfit vermag den Wind abzuhalten. So essen wir nur kurz etwas, hören und schauen noch kürzer einer Performance zu und verziehen uns heimzu. Wir sind schon Weicheier, muss ich sagen. Es hat sehr viele Leute dort, die ausharren, einige immer noch im T-Shirt, Girls in Hotpants und Flip Flops. Die sind eben härter im Nehmen als wir.
Im Norden der Südinsel
Am nächsten Morgen fahren wir ab Richtung Norden. Ziel ist Blenheim für heute Abend, Zwischenhalt wollen wir in Kaikura machen. Wir beschliessen, Fjona und Iain zu besuchen, deren Farm unterwegs auf unserer Strecke liegt. Sie haben ein feines Mittagessen für uns zubereitet und wir lernen sie ein wenig besser kennen. Was uns Iain von seiner Arbeit erzählt, beeindruckt mich enorm. - Er ist Ingenieur und arbeitet in Australien in irgendwelchen Minen. Sein Arbeitsweg ist 7‘000 km lang, er arbeitet meistens während vier Wochen, dann hat er eine oder zwei Wochen frei, wieder vier Wochen Arbeit etc. Australien sei ein harter Arbeitsort, aber gut bezahlt. Er habe erlebt, dass er am Morgen um sechs wie üblich im Office erschienen sei, der Boss habe dann ihn und etwa dreissig Mitarbeiter zusammengerufen und ihnen mitgeteilt: „We have plans. You are not included in these plans. There is a bus at eight which you can all easily catch.” – Das nach zweieinhalb Jahren bei derselben Firma. „Der Boss sei eigentlich ein „nice guy“ gewesen, mit dem er ganz gut ausgekommen sei. Er habe dann in aller Eile seine Werkzeuge und persönlichen Sachen zusammengesucht, und es sei ihm nichts anderes übrig geblieben, als mit seinen Kollegen den Bus zu nehmen… Und dies sei nicht das einzige Mal gewesen, dass ihm etwas in der Art passiert sei in Australien. – Harte Sitten. Undenkbar in Neuseeland, meinte er.
Fjona und er möchten jetzt ihre beiden Häuser verkaufen und nach Europa umziehen. Pikantes Detail: Iain sagt, ihm sei es egal, ob er von Europa aus oder von Neuseeland aus nach Perth, Australien, zur Arbeit gehe. Es sei so oder so ein weiter Arbeitsweg.
Ihr Haus ist völlig abgelegen, der nächste Laden ist mindestens 20 km entfernt. Es ist aber wunderschön dort. Ums Haus herum hat Fjona einen Rosengarten angelegt, allerlei Gemüse gibt’s im Garten, drei Hunde rennen herum, Sam, der älteste, wird sechzehnjährig. Auf der Weide steht ein Pferd. Alle Kinder hätten darauf reiten gelernt, erzählt sie uns. Jetzt erhält es sein Gnadenbrot. Brot und Konfitüre liebt es besonders. Es ist unglaubliche 34 Jahre alt, sieht aber ganz gut aus für sein Alter.
Nach einstündiger Fahrt sind wir in Kaikura. Den Ort kenne ich aus den Romanen, die ich gelesen habe. Die ersten Siedler dort betrieben Walfang und das muss schrecklich zu- und hergegangen sein. Grässlich, wie die Tiere abgemetzelt wurden damals. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei.
Es herrscht grad Ebbe und die Küste ist sehr zerklüftet. Offenbar lieben die Seehunde diese Bucht. Wir sehen recht viele, die sich von den fotografierenden Touristen überhaupt nicht beirren lassen; sie räkeln sich und dösen vor sich hin. Man hat fast das Gefühl, sie geniessen es, sich so zur Schau zu stellen.
Es ist eine lange Etappe zum Fahren heute. Nach knappen zwei weiteren Stunden kommen wir in Blenheim an und sind einmal mehr sehr zufrieden mit unserer Bed and Breakfast-Unterkunft. Es ist wirklich sagenhaft, wie freundlich, nett und hilfsbereit die Leute hier alle sind. Ein indisches Restaurant wird uns empfohlen, es sei das Beste auf der ganzen Südinsel. – Schön. Da gehen wir hin. Es ist, falls ich mich richtig erinnere, das fünfte, von dem das behauptet wird. Es ist Samstagabend und wir sind es gewöhnt, dass in den Städten überhaupt nichts läuft zu dieser Tageszeit. Aber hier ist’s doch mal anders. In einem Pub gleich um die Ecke (nur gerade da, sonst scheint der Ort ebenfalls ausgestorben) läuft tatsächlich ausnahmsweise was. Live-Musik, ein junger Mann unterhält die Gäste mit seinem Ein-Mann-Orchester. Ganz gut sogar. Wir können draussen sitzen, es ist mal nicht zu kalt, auch nicht für einen eisgekühlten Drink.
Der nächste Tag ist vom Wetter her eine ziemliche Katastrophe. Aber wir haben ja keine Eile, nehmen uns am Morgen Zeit, besuchen das Omaka Aviation Heritage Centre mit etlichen Flugzeugen und Artefakten aus dem Ersten Weltkrieg. Peter Jackson, der bekannte neuseeländische Regisseur, hat sehr viel Geld in die Präsentation der Exponate gesteckt. Es sind Szenen dargestellt mit Flugzeugen und Personen, die so echt aussehen, dass man das Gefühl hat, sie bewegen sich gleich. Und ja, ich muss sagen, auch mir hat der Besuch gut gefallen, obwohl ich am Anfang eher skeptisch war und dachte, ich lese dann lieber ein bisschen in Auto und lasse Theo alleine in der Militärgeschichte schwelgen.
Es sieht nach einem Landregen aus. Kein Problem. Wir sind in Marlborough, einer Gegend, wo hektarweise Rebbau betrieben wird (vor allem Sauvignon Blanc) und es unzählige Weingüter gibt. Wir besuchen drei davon, zwei ohne zu degustieren, bei der dritten kommen wir grad recht mit ein paar anderen Besuchern und probieren uns durch die ganze Liste durch, von Sauvignon Blanc über Chardonnay zu Rosé, zu Pinot Gris und Noir, Syrah und Merlot uns schliesslich zu guter Letzt zum Dessertwein. Dazu lassen wir uns von einer netten jungen Dame volltexten. Den Wein aus der Kellerei „Villa Maria“ wird auch in die Schweiz exportiert, vertrieben durch Bataillart. Dieses Wort muss sie uns allerdings aufschreiben, weil wir unmöglich verstehen können, was sie meint. Für den Hausgebrauch beziehungsweise für meine Handtasche kauften wir zwei Flaschen; Kartons kommen natürlich nicht in Frage.
Nur eine halbe Stunde dauert die Fahrt und schon sind wir in Picton, dem Ausgangspunkt zur Nord- oder je nachdem zur Südinsel. Von da gehen alle Fähren nach Wellington. Allerdings gibt’s jetzt ein Problem: Nur eine Fährgesellschaft ist momentan noch im Geschäft, da bei der anderen der Propeller abgebrochen ist und bis der repariert ist, dauert‘s mindestens drei Monate.
In unserem B&B haben die Besitzer bereits Fähnchen hingestellt für die Gäste, die heute hier übernachten: ein englisches, ein amerikanisches und ein Schweizer Fähnchen. Lieb – wirklich. Nach wie vor regnet es in Strömen, immer heftiger. Aber rechtzeitig zum Nachtessen wird’s wieder schön, trockenen Fusses und ohne Regenschutz gehen wir die paar Schritte bis zum Zentrum und suchen uns ein Restaurant. Der Fisch wär nicht schlecht, aber wieso auf einem einzigen Teller Fisch, Sauce, Kartoffelgratin und Salat mit Sauce serviert werden muss, leuchtet mir nicht ein. Klar kommt im Magen auch alles zusammen, aber vorher auf dem Teller…
Von Picton nach Queenstown
Am nächsten Tag schlafen wir aus, erhalten ein liebevoll zubereitetes Morgenessen und machen daraufhin einen kurzen Ausflug auf einen der vielen Hügel in der Nachbarschaft. Ein Lookout wiedermal. Leider zeigt sich die Sonne nicht wirklich berauschend, so lange es jedoch nicht regnet, sind wir zufrieden. Für den Nachmittag habe ich eine Bootstour gebucht, eine ganz besondere: die Beachcomber – Mailboat-Tour. Im Charlotte Sound hat es unendlich viele kleine Bays und Inselchen, wo Leute wohnen, abgelegen, oft nur mit dem Boot erreichbar. Diese Bewohner erhalten zweimal pro Woche ihre Postsendungen per Boot geliefert. Für den Service müssen sie nicht einmal bezahlen. Das Mail-Boot fährt direkt an den Landesteg, wird bereits erwartet und flux wird der Postsack ausgetauscht. In die entlegendsten Buchten fährt das Boot und wir staunen, wie der Kapitän mit grösster Nonchalance und Selbstsicherheit die Ziele ansteuert, durchs Fenster hindurch das Tau am Bootssteg anbindet, den Postsack austauscht und schon geht’s wieder weiter. Total cool. Das Boot ist nicht etwa ein Bötchen. Es hat für mindestens achtzig Personen Platz. „Was sowieso getan werden muss, mit dem Lukrativen verbinden“ ist hier wohl die Devise, so kann man gleichzeitig zur Arbeit eine Tour anbieten und ein paar zahlende Touristen mitnehmen. Clever!
Das Mailboot wird immer schon erwartet und nicht selten ist auch ein Hund dabei, der sehnsüchtig darauf wartet, vom Kapitän ein Hundebiscuit zu erhalten. Etwa zehn Mal geht das so, zweimal halten wir auch bei einem Holiday-Ressort an und nehmen Passagiere mit. Wir haben uns sehr warm angezogen, denn auf dem Boot bläst ein kalter Wind. Einmal steigen wir aus, nämlich dort, wo Captain Cook damals gelandet ist und die Flagge für sein Vaterland gehisst hat. Fünfmal ist er schliesslich in dieser Bucht gelandet und hat mit den Maori Handel getrieben.
Die Fahrt dauert gut vier Stunden, es wird aber nie langweilig, die Gegend ist absolut idyllisch und malerisch.
Am Abend essen wir im „Le Café“, einem Restaurant, das von einem Schweizer Koch geführt wird. Unnötig zu sagen, dass unser Nachtessen Spitze war.
Das Wetter ist wunderschön heute Morgen. Eigentlich wäre ich gerne so um neun Uhr gestartet, aber das geht nicht mit Theo. Um die Zeit steht er erst auf, wenn ich Glück habe. Um halb elf starten wir. Es ist keine lange Strecke, die wir zu fahren haben, es geht westwärts zum Abel Tasman Nationalpark, etwa zweieinhalb Stunden Fahrtzeit. Wir nehmen die Strasse der Küste entlang, den Queen-Charlotte-Drive. Lookouts (Shakespeare’s Bay, Gouvernor’s Bay, Aussie Bay und wie sie alle heissen) und Briefkästen kann man auf dieser Strecke en masse bewundern. Eine Bucht ist schöner als die andere und mit den Briefkästen scheinen sich die Bewohner dieser Bays gegenseitig übertreffen zu wollen. Einer ist kreativer gestaltet als der andere. Wenn ich da an unsere Schweizer Briefkasten-Normen denke…
Unterwegs machen wir Halt in Havelock „world’s green mussels‘ capital“, trinken einen Flat White am Hafen und fahren dann weiter nach Nelson. Von dort aus geht’s weiter über Motueka nach Little Kaiteriteri. - All diese Namen. Immer wieder muss ich mir Eselsleitern merken, um noch zu wissen, wo wir gewesen sind und wie der Ort, an dem wir uns aufgehalten haben, geheissen hat. Mein Kopf ist voller Eselsleitern – ein riesen Leiterhaufen ist da drin: wai und wa, ka, nui und kai – pi, pa, po. Manchmal geht’s einfacher: aus Tapawera wird für mich „Tupperware“. Andere Eselsleitern hab ich auch noch präsent: Unsere Autonummer. So einfach wie die FQU auf der Nordinsel ist’s nicht mehr, jetzt hab ich mir gemerkt: DZJ154: die zarte Jungfrau…
Wir haben wieder ein gemütliches B&B ausgesucht, ganz nah am Strand. Martin, der Gastgeber ist ein Spassvogel. Ich will ihn fragen, wo wir essen gehen könnten, da seh ich, wie er sich grad selber ein Znächtli zubereitet. Eine Büchse Spaghetti ist er im Begriff zu öffnen. Ich sag ihm, was ich davon halte und er meint, das sei eben „a boy’s meal“. – Den Inhalt der Büchse drapiert er auf ein Stück Toast und darüber noch ein Ei. - Auf seine Restaurant – Empfehlungen gebe ich nicht viel. Wir essen in Kaiteriteri, das wir nach einer kurzen Wanderung über den bewaldeten Hügel (mit Lookout am höchsten Punkt) am nächsten Strand erreichen. Schön, dass wir wieder mal draussen essen können. – Risotto und Ravioli.
Beim Frühstück tags darauf unterhalten wir uns mit Martin und seiner Frau Diane über dieses und jenes und auch über die hohen Preise, die man hier überall für Touren bezahlen muss (unsere Wassertaxifahrt hat auch schon wieder hundert Franken gekostet). Ich sage, wir würden uns dann rächen, wenn sie mal in die Schweiz kämen und unsere SBB benutzten. Das sei schon geschehen, meinte Martin, er habe sich überlegt, eine Hypothek aufzunehmen, als er mit dem Zug von Freiburg nach Basel reisen wollte.
Heute nehmen wir das Wassertaxi und fahren eine knappe Stunde nordwärts in den Abel Tasman – Park, an die Torrent Bay, was eigentlich nichts anderes ist als die über-über-über-übernächste Bucht. Es ist nicht möglich, mit dem Auto dorthin zu gelangen; der Park ist nur zu Fuss oder per Boot erreichbar. Am Strand werden wir ausgeladen. Es ist das erste Mal, dass ich meinen Rucksack mit dabei habe, weil‘s diesmal einen Hike gibt, der länger ist als „Theos-höchstens-zwanzig-Minuten-Spaziergänge“. Durch den Busch geht’s rauf und runter, und das während zwei Stunden, zurück zur vorherigen Bucht, Ancorage. Dort legen wir uns zwei Stunden lang an den Strand und freuen uns am klaren Wasser, dem gold-gelben Sand, lesen und warten dann wieder aufs Wasser-Taxi, das uns abholt. Am Strand hat’s nur wenige Leute, aber für hiesige Verhältnisse sind das recht viele, sonst sind die Stände ja menschenleer. Auch eine Ente wackelt mit ihren sechs Jungen zwischen den Touristen herum, Angst kennt sie keine. Zwei Stingrays schwimmen am Boot vorbei, mir kommt‘s vor wie in der Karibik.
Zurück im B&B duschen wir und fahren nach Motueka. Dort haben wir ein Kino entdeckt, in dem heute Abend „La cage doré“ – „The Gilded Cage“ läuft, den wir uns gerne ansehen möchten. Wir essen im „Hot Mama’s“, ich Laksa, Theo eine Lasagne, die leider mehr gross als gut ist, serviert mit einem Haufen Pommes-Frites, Catch-up und Salat, alles auf dem gleichen Teller. Sicher würde diese Mahlzeit Martin sehr gefallen.
Das Kino ist wieder so hübsch wie in Wanaka. Lauter verschiedene Sessel hat’s. Eigentlich sind es Sofas, was Theo sehr gelegen kommt. Es hat nämlich auch Hocker, auf denen man die Beine ausstrecken und kleine Tischchen, auf die man sein Getränk hinstellen kann. So kann Theo den Film liegend geniessen, in seiner Lieblingsstellung. Das geht problemlos, wir sind nämlich nur zu acht im Kino, der Film wird in der französischen Originalsprache mit englischen Untertiteln gezeigt. Er war Publikumsliebling bei den neuseeländischen Filmtagen und auch uns hat er sehr gefallen.
Westküste
Am folgenden Tag Weiterfahrt an die Westküste Richtung Süden. Wir haben mindestens fünf Stunden im Auto vor uns. Es ist richtig warm, 24 Grad zeigt das Thermometer, was ziemlich ungewöhnlich ist. Wir sind froh über die Klimaanlage. Es ist eine malerische Fahrt vorbei an Früchteplantagen, Weideland, unzähligen Hügeln. Kaffeehalt in Murchison und dann geht’s durch die Bullergorge, wo wir aussteigen und auf einer Hängebrücke den Buller-River überqueren. Passieren kann ja nichts, aber die Schaukelei, die Höhe, der Fluss, die steilen Felsen am Ufer und das Jetboot, das unten vorbeirast, beeindrucken mich schon. Unsere Unternehmung kommt mir jedenfalls sehr abenteuerlich vor.
Die Küste erreichen wir gegen vier Uhr nachmittags und obwohl wir inzwischen ja zahllose Strände, Buchten und Felsformationen gesehen haben, finde ich das, was sich uns hier zeigt, atemberaubend. Die wildesten und verrücktesten Gesteinsformationen sehen wir in Punakakei, nämlich die Pancake Rocks, wo die Kalksteinlagen wie Pfannkuchenberge aufeinander liegen, wo’s sogenannte Blowholes hat in den Felsen, so dass die Wellen wie wild hineinpreschen und mächtige Fontänen erzeugen. Man kann sich gar nicht sattsehen und auch –hören an diesen Naturschönheiten.
In Greymouth finden wir ein gutes Motel und gleich nebendran ein feines Restaurant. Ich probiere zum ersten Mal die Spezialität Whitebait. Das sind ganz kleine Fischchen, die man in Olivenöl anbrät, ein Ei dazu schlägt, Salz und Pfeffer beifügt und fertig. Die Omelette, die daraus resultiert, sieht nicht aus, wie wenn Fische drin wären. Zitrone drüber träufeln - köstlich.
An der Hafeneinfahrt von Greymouth sind etliche Schiffe gekentert, 35 Menschen bisher umgekommen. So nah am Ziel, fast nicht vorstellbar. Das Meer muss extreme Strömungen haben an diesem Ort. Eine Gedenktafel steht an der Fluss-Mündung.
In Hokitika (the cool little town) gibt’s Kaffee, ein Sockenmuseum- und Verkaufsladen und das nationale Kiwi-Zentrum. Kaffee trinken wir, Socken kaufen wir, Kiwis sehen wir. Endlich! – Zumindest einen. Mir wird immer schleierhafter, weshalb die Neuseeländer sich so sehr mit diesen unbeholfenen Vögeln identifizieren. In diesem Kiwizenturm gibt’s nur grad zwei Exemplare, ein Männchen, das so schüchtern ist, dass man’s gar nicht zu Gesicht bekommt und ein Weibchen, das wenigstens in die Nähe der Besucher kommt, so dass man es bei dem schwachen Licht bewundern kann, wenn auch nur schlecht. Es pickt mit seinem langen Schnabel im Boden herum und macht seltsame Sprünge fast wie ein Känguru. Man darf keinen Mucks machen, um die Tiere nicht zu erschrecken, Fotografieren geht gar nicht, wär auch gar nicht möglich bei der Dunkelheit, es dauert so oder so mindestens zehn Minuten, bis man sich ein bisschen an die dunkle Umgebung gewöhnt hat. – Seltsame Lebewesen, diese Kiwis!
Die Neuseeländer hätten sich lieber die Possums als Nationaltier gewählt, das wär viel einfacher. Jetzt aber setzen sie alles daran, diese Räuber mit Gift und Fallen um die Ecke zu bringen, um die raren Kiwis zu schützen. Pikantes Detail: In Australien sind die Possums geschützt.
Dann gibt’s noch Aale in einem grossen Wassertank zu sehen. Vierzig Weibchen sind’s. Sie werden zur Freude der Besucher dreimal täglich gefüttert. Irgendwie erinnern sie mich an die Koalas in Brisbane. Die meisten der Tiere bewegen sich kaum, ein paar nur kommen zur Fütterung, die andern liegen planlos nebeneinander herum beziehungsweise flauten reglos irgendwo im Wasser, wie’s grad kommt, und sind zu müde für die Nahrungsaufnahme. Das weckt noch andere Erinnerungen…
Den einen Aal nennen sie „die Grossmutter“. Er soll zwischen 120 und 140 Jahre alt sein (normal werden sie zwischen 80 und 100 Jahre alt). Sie sind auch ellenlang und dick, etliches grösser als sie in der Natur in Neuseeland vorkommen. Offenbar gefällt ihnen das Nichtstun in ihrem Gefängnis, in dem sie seit 18 Jahren herumhängen.
Genau an diesem Ort, dem Kiwizentrum, verliere ich Theo. Eben hab ich ihn noch gesehen, schon ist er nirgends mehr. Ich warte draussen, auch die beiden Angestellten am Eingang haben ihn nicht gesehen. Müsste er also noch drin sein. Bei den Aalen ist er nicht. Auch nicht bei den Kiwis. Ich rufe ihn, erhalte viele fragende Blicke von Besuchern, aber keine Antwort von Theo. Beim Auto ist er auch nicht. Ein Bücherladen ist keiner in der Nähe, das ist sonst jeweils ein Ort, wo ich ihn in solchen Situationen schon gefunden habe. Ich geh dorthin zurück, wo wir Kaffee getrunken haben, kein Erfolg. Erinnerungen an Filme kommen auf, einer mit Harrison Ford, wo er in Paris mit seiner Frau ankommt und diese plötzlich von der Bildfläche verschwindet. Im normalen Leben allerdings ist’s nicht ganz so ereignisreich. Eine Angestellte, die grad vom Lunch zurückkommt, findet ihn auf einer Bank liegend, seine Siesta machend. Er habe gedacht, dort sei ein Ausgang und da würde ich dann dran vorbeikommen und ihn sehen, entschuldigt er sich. – Der Ausgang ist aber dort, wo der Eingang ist und ich zwanzig Minuten auf ihn gewartet habe.
Übrigens könnte man auch ein historisches Gebäude kaufen in Hokitika, ein beachtliches. Wir lassen’s mal.
Nächster Halt an einem malerischen See, dem Lake Mahinapua, der mich an den Lac de Joux im Jura erinnert. Siesta wird eingeschaltet, Sonnenbaden, Lesestündchen. Weiterfahrt zu den Gletschern. In Franz Josef finden wir ein Motel, den Gletscher sehen wir nicht, es hat Nebel. Vielleicht morgen. Hier hat’s jetzt zur Abwechslung mal wieder ziemlich viele Leute. Vor allem sind es Junge, die in den Backpacker-Unterkünften logieren. Alle hoffen auf besseres Wetter am nächsten Tag.
Dem ist aber nicht so. Der Nebel hängt am Morgen bis ins Dorf hinunter. Wir nehmen’s gelassen und gemütlich, trinken im Dorf eine Tasse Flat White und warten im Gartenrestaurant bei angenehmer Musik und eingehüllt in Decken darauf, dass sich der Nebel lichtet. Das tut er dann netterweise auch, und zwar grad am richtigen Ort. Dort, wo der Franz Josef Gletscher ist, öffnet sich eine Lücke. Man sieht das Eis, den Berg, die Helikopter, die grad losdüsen, und wir begeben uns auch in besagte Richtung. Vom Parkplatz aus führt ein Weg zu einem Lookout; den schlagen wir ein. Eine gute halbe Stunde dauert der Spaziergang. Schön ist, dass wirklich nur genau das Stück Berg und der Gletscher zu sehen sind, welche alle gerne sehen möchten; die umliegenden mit dichtem Busch bewachsenen Hügel sind vom Nebel verhangen und nur bis zur Hälfte sichtbar.
Wir fahren eine halbe Stunde weiter nach Fox Glacier. Auch hier dreht sich alles um den Gletscher, speziell natürlich die Helikopter-Rotoren. Der Nebel hängt hier noch tiefer und wenn man nicht wüsste, dass der Mount Cook und der Fox Gletscher tatsächlich dort sind, würde man es kaum glauben.
Erst fahren wir ein paar wenige Kilometer weiter an den Lake Matheson, wo’s einen See hat, in dem sich Mt Cook und seine Kollegen spiegeln. Wenn sie im Nebel sind, natürlich nicht. So trinken wir nur etwas und obwohl es recht heiss geworden ist und der Himmel blau abseits der Berge gegen das Meer zu, mag sich das Gewölk über den Alpen nicht zu lichten. Wir lassen also den Spiegelsee See sein und fahren weiter zum Parkplatz, von dem aus die Wanderwege zum Gletscher beginnen. Eine Stunde soll’s dauern, steht auf dem Schild. Nach zehn Minuten erreichen wir eine Stelle auf dem Weg, von wo aus man eine Gesamtaussicht auf den Gletscher hat. Theo möchte lieber umkehren, er hat ja gesehen, was es zu sehen gibt. Er macht ein relativ säuerliches Gesicht, als er erkennt, dass ich den ganzen Weg zu Ende gehen will und mich von ihm davon nicht abhalten lasse. Nach weiteren zwanzig Minuten geht’s nicht mehr weiter, man ist aber bereits recht nah am Gletscher und kann die Strukturen, Spalten und Farben gut sehen. Es ist sehr eindrücklich und Theo gibt zu, er sei ganz froh, dass er doch auch bis hierher mitgekommen sei. – Was für ein Kompliment!!!
Wir fahren weiter der Küste entlang Richtung Süden. Ausser über den Bergen ist der Himmel blau und wolkenlos. Es ist eine lange Fahrt durch weite unbewohnte Gegenden. An einem Küstenabschnitt steigen wir aus. Bruce Bay. Der Strand ist voller Schwemmholz und Steine. Es wäre ein Paradies für Steinesammlerinnen und –Sammler, aber das geht ja nun leider gar nicht. Ich kann‘s zwar nicht lassen, sammle trotzdem ein paar schöne Exemplare, die ich dann in Queenstown im Garten deponieren werde. Es ist ein besonderer Anblick, noch bemerkenswerter in mancherlei Hinsicht ist aber die Tatsache, dass es überall lauter Sand- oder Black-Flies hat, gleich wie im Milford Sound. Diese kleinen, schwarzen, elenden, stechwütigen Biester sind eine absolute Pest. Man sieht sie kaum, aber sie sind all überall. Wir flüchten ins Auto. Aber dort hat es sich eine Hundertschaft der Quälgeister auch bereits bequem gemacht und sich eingerichtet, mit der Absicht, uns bis aufs Blut zu peinigen. An den Scheiben hängen sie herum, in der Mittelkonsole wollen sie eine Siedlung gründen, an meinen Füssen tun sie sich gütlich. Diese Invasion ist das Schlimmste, was uns auf unserer Reise bisher passiert ist (abgesehen vom zweimaligen „Verlieren“ unseres Guide-Books), also können wir uns eigentlich ganz glücklich schätzen. Trotzdem sind die Blutsauger eine Qual, und ich weiss genau, wir werden noch tagelang an sie denken. Wir versuchen unsererseits, sie zu plagen beziehungsweise zu liquidieren, aber ganz so gut funktioniert das nicht, immer wieder findet eine den Weg auf unsere Haut. Zum Glück hab ich den Insektenspray in Griffnähe und spraye damit alles voll, so in der Not und Eile auch mein Smartphone. Dem macht’s zum Glück nichts, den Mücken leider auch nicht so viel. Schon wieder schwirrt eine herum. Auch beim nächsten Lookout sind sie sofort zur Stelle, eine neue Crew diesmal, total motiviert fliegen sie ihren Einsatz und treten sogleich in Aktion. Theo steigt schon gar nicht aus. Er ist voll damit beschäftigt, die Viecher im Auto zu vernichten, die neu hereingekommen sind, weil ich die Autotür geöffnet habe. Die wollen jetzt ihre Kollegen besuchen und haben ja Aussicht auf frische Opfer.
Eigentlich wollen wir in Haast übernachten. Aber wenn das dort so eine Sandfly-Hochburg ist… Wir müssen aber dort übernachten, es geht nicht anders, weil der Haast-Pass in der Nacht geschlossen wird, wie wir später erfahren. Es hat ein paar ganz schlimme Unfälle gegeben in der letzten Zeit; es gibt halt immer wieder Felsstürze und wenn es regnet und stürmt, ist die Strecke mehr als nur gefährlich. Man erzählt uns, dass im September ein Campervan mit einem jungen Paar drin von der Strasse gefegt worden sei und man sie erst eine Woche später im Tobel gefunden habe.
Einen Umweg nach Wanaka gibt’s nicht, also doch, schon, über den Arthur Pass, das wären an die tausend Kilometer.
Haast Beach: Ein Motel, ein Mini-Supermarkt, eine Tankstelle. Es ist noch ein Zimmer frei, das Motel heisst „Erehwon“. Der Name kommt mir sehr bekannt vor. Der Besitzer hilft mir auf die Sprünge: Es gibt ein Buch von Samuel Butler, das so heisst. Ich hab’s vor mehr als vierzig Jahren gelesen (Maturlektüre sogar). Es ist eine Satire, den Namen muss man rückwärts lesen, dann heisst es eben „Nowhere“. Ja, und das passt. Wir haben das Gefühl, wir seien hier im Nirgendwo gelandet. Zum Glück hab ich meinen Mückenstecker mitgenommen. Das ist so ungefähr das Erste, was ich aus dem Koffer hole und montiere.
Ein kurzer Weg führt zum Strand. So weit das Auge reicht, zieht er sich über die Küste hinweg, keine Bucht, nichts als Sand und Meer. Und natürlich Mücken wie gestört. So halte ich mich nicht eben lange dort auf, sondern gehe zurück ins Nirgendwo.
Haast Junction ist 4 km weiter weg an der Hauptstrasse gelegen: eine Tankstelle, ein sehr gutes Visitor Center (interessante Informationen über die Gegend, eine Art Museum auch), ein Motel und doch zumindest ein Restaurant. Dort gehen wir essen. Wie wir eintreten, nicke ich dem Koch zu und grüsse ihn. Da sehe ich, wie der gleich die Arme verrührt. Offenbar hat er wenig Freude, zwei weitere Gäste zu sehen. – Das fängt ja gut an, denke ich. Es könnte natürlich sein, dass ich mich getäuscht habe und er nur ein paar Mücken verjagt hat, ich also seine Geste missdeute. Wir müssen sehr lange warten, bis wir unsere feinen grünen, riesigen Muscheln erhalten, anschliessend das Pouletbrüstchen. Aber gut war’s. Nach dem Essen unterhalte ich mich kurz mit dem Koch und er gibt zu, dass er nicht grad Freude hatte an den vielen Gästen (viel = ungefähr zwanzig), da er alleine war in der Küche. Aber er freut sich sehr über unser wohlwollendes Feedback. Er entschuldigt sich, dass es so lange gedauert hat, bis das Essen parat war. Wir haben ja Ferien und geniessen den Sonnenuntergang während des Wartens sehr. Er ist erleichtert zu hören, dass wir nicht sauer sind. Theos Bier jedenfalls ist gratis. Auf der Terrasse zu sitzen so fern ab von allem, war ganz wunderbar. Auch war‘s amüsant, den Gesprächen der anderen Gäste zuzuhören. Die drei beleibten Typen am Tisch vor uns sind schon in die Jahre gekommene Töff-Giele; sie haben gleich zweimal eine röhrende Show geboten, bevor sie ihre heissen Stühle vor dem Restaurant parkiert und auf der Terrasse ihr Bier in sich hineingekippt haben. – Links von uns sitzen vier ähnliche Typen. Sie sind Strassenarbeiter, angestellt, um die Strasse über den Haast-Pass, die vor kurzem an einer Stelle wieder verschüttet wurde, von den Felsbrocken zu befreien. Auch diese Männer sind nicht eben vom elegantesten Schlag und mit der edelsten Sprache begnadet.
Wir schlafen ruhig und ohne Mücken im Zimmer, aber ich wache ein paar Mal auf, weil mich die Juckerei an den Füssen fast zum Wahnsinn treibt. Ich habe mindestens fünfzig Stiche an jedem Bein und tue mir selber leid.
Am nächsten Morgen um zehn Uhr fahren wir los. Mal sehen, wie viele unserer Freunde im Auto die Nacht überlebt haben. Hoffentlich keine. Ein, zwei Exemplare hat’s doch noch. Ich zermalme sie an der Scheibe. Übrig bleibt ein Blutgeschmier.
Es ist der 2. Februar. Blauer Himmel, etwa 25 Grad – ein prächtiger Tag und eine wunderschöne Fahrt über den Haast-Pass (564 m über Meer, etwa grad so hoch wie Ittigen), dem teilweise breiten Haast-Fluss entlang, der oft fast nur aus einem Bachbett aus Steinen besteht und sich zwischendurch in eine tiefe Schlucht gegraben hat. Zwei Wasserfälle gibt’s unterwegs zu sehen (Thunder Creek Falls, Fantail Falls. - Roaring Billy Falls haben wir nicht gesehen, aber mit gefällt der Name). Fast verpasst hätten wir die Blue Pools, weil der Walk dorthin und zurück eine halbe Stunde dauert und das knapp an der Grenze des für Theo Zumutbaren liegt. Ich bestehe aber auf dem Spaziergang, denn Zeit genug haben wir ja. Zwei Hängebrücken müssen wir überqueren, gratis diesmal, und der fantastische Anblick des klaren, türkisblauen Wassers der verschiedenen Poole oder Becken, die der Haast Fluss dort bildet, hat den Aufwand allemal gelohnt. Das muss auch Theo zugeben.
Die Tracks sind immer gut beschildert und meistens gibt’s zudem Informationen über Flora und Fauna. Hier ein wenig Hintergrund zu den Sandflies, den mir Theo mit Freuden vorliest: Es seien nur die Weibchen, die sich so unangenehm und hartnäckig verhalten. Sie brauchen Blut für ihre Eier. - Der Mann, der neben uns steht und mitliest, sagt: „Nothing new“. – Weiter heisst es, die Mücken lassen sich besonders von der Farbe Schwarz und Rot anziehen. Ich hab heute ein schwarzes T-Shirt angezogen…
In Makarora machen wir Halt, Rüeblitorte hat’s und kein Gingerbier. Also ein Cola Zero.
In Wanaka wird der Tank gefüllt; Theo hat die letzten zwanzig km bereits Angst, dass uns das Benzin ausgeht, aber das tut es schon nicht. Der Clutha River, kurz vor Wanaka, erinnert uns an die Aare. Er ist prächtig, etwa gleich kühl, türkisfarben, aber nicht ein Hundertstel so viele Leute wie bei uns im Sommer baden und vergnügen sich drin. Wir legen uns ans Ufer, baden und lesen ein wenig. Während dieser knapp zwei Stunden sehe ich grad mal vier Gummibote und etwa zehn Schwimmer. Nicht unbedingt wie im Marzili. Über die Cardrona Valley Road oder Crown Range Highway (von wegen Highway…) fahren wir nach Queenstown. So eine schöne Strecke. Mitten drin gibt’s den kleinen Ort Cardrona (kaum mehr als 100 Einwohner), ein ehemaliges Goldgräberstädtchen (damals 5‘000 Einwohner), jetzt ein Winter Skiort. Kurz vorher entlang der Strasse entdecke ich eine ganze Reihe Büstenhalter auf etwa hundert Metern Länge an einen Zaun geheftet. Das sieht mehr als nur cool aus. Und Theo hat’s gar nicht bemerkt. Er muss umkehren. – Wie ich später im Internet lese, hängen die nicht einfach so dort. Hintergrund ist offenbar Brustkrebs (Cardrona Bra-Fence: www.tagblatt.de/Home/nachrichten/ueberregional/blick-in-die-welt_artikel,-Aerger-mit-Dessous-Ein-mit-BH-behaengter-Zaun-ist-in-Neuseeland-eine-beliebte-Attraktion-_arid,244335.html">www.tagblatt.de/Home/nachrichten/ueberregional/blick-in-die-welt_artikel,-Aerger-mit-Dessous-Ein-mit-BH-behaengter-Zaun-ist-in-Neuseeland-eine-beliebte-Attraktion-_arid,244335.html).
Zurück in Queenstown
In Queenstown waren wir schon, es ist ganz schön, wieder an diesen pittoresken Ort zurückzukehren, obwohl er ja den Endpunkt unserer Neuseeland-Reise bedeutet. Noch drei Übernachtungen, dann fliegen wir nach Melbourne.
Anders als bei unserem ersten Besuch hier müssen wir aber nicht mehr heizen, im Gegenteil, es ist noch am Abend um sieben 26 Grad warm. Wir essen Spaghetti auf dem Balkon und geniessen die wolkenlose, traumhafte Aussicht auf die kleine Stadt und schauen zu, wie nach neun Uhr langsam die Nacht einbricht und die Berge immer dunkler werden.
Unseren zweitletzten Tag in Neuseeland nehmen wir sehr gemütlich. Auf einer der Halbinseln, die in den Wakatipusee hineinragen, finden wir ein schönes Plätzchen zum Sonnenbaden, Lesen, den Booten Zuschauen, die über den See treiben oder rasen. Am Abend fahren wir mit der Gondel auf den Bob’s Peak, einen der umliegenden Berge, von wo aus man die perfekte Aussicht auf Queenstown hat. Im Preis inbegriffen ist das Nachtessen im Restaurant. Es ist ein herrliches Buffet mit vielen feinen Sachen, Seefood, eine grosse Auswahl an Hauptspeisen und Desserts. Alles ist schön zubereitet, alles sehr gepflegt, der Service ausgezeichnet.
Es hat mindestens zweihundert Gäste im Restaurant, ungefähr 5% Weisse, alle anderen sind Chinesen und Japaner. „Little China Town auf dem Gurten“, sagt Theo. Das chinesische Neujahr wird gefeiert, daher die vielen Gäste aus dem Reich der Mitte. Aus dem Grund sagte man uns auch, als wir tags zuvor an Ort und Stelle reservieren wollten, es sei alles ausverkauft, hoffnungslos, in den nächsten drei Tagen noch einen Platz reservieren zu können. Es gäbe auch keine Warteliste.
Mit dieser Aussage gab ich mich nicht zufrieden. Schon zu Hause in Bern hatte ich eine App über Neuseeland heruntergeladen und dort sind sämtliche Angebote des ganzen Landes aufgeführt. Also sah ich nach, fand das Queenstown-Gondel-Dinner-Angebot und reservierte für uns zwei die Fahrt und das Abendessen. Problemlos und noch ein wenig billiger.
Es war ein super Abend, den wir total genossen haben. Die Gondeln frequentieren ohne Unterbruch; etwa um zehn fahren wir wieder talwärts und eine Viertelstunde später schon sind wir daheim. Inzwischen ist es ganz dunkel geworden. Das Sternenmeer und die Milchstrasse sieht man zum Greifen nah. So klar haben wir den Sternenhimmel noch selten gesehen. Ein hehrer Anblick.
Unser letzter Tag ist dem Packen gewidmet und dem Autoputzen. Nicht so schön, aber notwendig. Den Wagen lassen wir putzen, dies ist uns die 60 $ wert.
Wie wir all unser Zeug in die beiden Koffer und ins Handgepäck bringen, weiss ich am Anfang noch nicht, aber es geht. Ich lasse einige Kleider von mir zurück, das war so geplant. Ein letztes Nachtessen auf der Terrasse mit der traumhaften Aussicht – was für ein Abschluss!
Reisebericht Australien 2 (Melbourne, Tasmanien, Lorne)
Februar 2014
Wir sind zurück im Land der giftigen Tiere, der emsigen Pick-Nicker, der unermüdlichen Surfer, der upside-down-montierten Wäschetrockner.
Noch ein knapper Monat, dann geht’s heimwärts. Aber vorerst wollen wir wieder mal eine lebendige Stadt geniessen, nämlich Melbourne, weiter sind zehn Tage in Tasmanien geplant und zuletzt genehmigen wir uns eine letzte ruhige Woche in Lorne, einem Beachresort, zwei Stunden südlich von Melbourne. Dort wollen wir zum vorläufigen Abschluss noch ein wenig den Strand geniessen, bevor wir über Singapur nach Zürich fliegen, in Ittigen die Koffer umpacken, um dann in Bivio die Skis anzuschnallen.
Von Qweenstown nach Melbourne 5. Feburar 2014
Unsere Neuseelandreise ist vorbei. Erst noch, und das scheint lange her, hab ich sie geplant, hab nachgelesen über all die Orte und was es dort zu sehen gibt, und jetzt ist das alles schon passé.
Wir sitzen im Flugzeug, die Koffer sind abgegeben (ich bin jeweils sooo froh, wenn’s so weit ist); wir schauen uns wieder mit Freude das Sicherheitsvideo der New Zealand Air an. Es gibt inzwischen ein neues. Auch das wieder super gemacht mit Hobbits und Peter Jackson (www.youtube.com/watch?v=cBlRbrB_Gnc">www.youtube.com/watch?v=cBlRbrB_Gnc).
Für die Flugdauer waren 3 Stunden 40 Minuten geplant, in zwei Stunden 55 Minuten sind wir schon da. Da hatte es jemand pressant.
Kurz vor Melbourne sehen wir von oben weite Ebenen, alles gelben Felder, kein Gräschen ist mehr grün. Es ist einfach, sich vorzustellen, dass es nicht viel braucht, um ein Feuer und damit einen Buschbrand zu entfachen.
Für den Zoll in Australien hab ich alles schön aufgeschrieben, was wir an suspekten Dingen mitbringen, alles, was aus Holz ist, Bienenprodukte (in der Gesichtscreme und Schuhcreme sind die ebenfalls vorhanden), Schuhe, die im Wald herumgelaufen sind, Anhänger aus Muscheln, Senf in der Büchse, ein paar Teebeutel, Salz, etc. etc. Diesmal mag der Beamte nicht mit mir diskutieren, ein kleines Wunder, er lässt uns durch, wir müssen auch die Koffer nicht nochmal durchleuchten lassen. So geht’s natürlich rasch und wir sind froh. Daher warten wir fast eine Stunde lang auf Marg Mackie, unsere hiesige Homelink-Partnerin, die uns abholen kommt. Sie fährt uns nach Brighton Beach, wo sie wohnt, das ist ein hübscher Vorort von Melbourne, 25 Minuten mit der Metro zum Zentrum, fünf Minuten zu Fuss zum Strand.
Sie fährt uns in der Gegend herum, zeigt uns, wo man einkaufen kann, wo’s Restaurants hat, wo der Zug fährt. Wir essen in Hampton, in einem japanischen Restaurant und laden Marg selbstverständlich ein. Es ist sehr laut im Lokal, Theo versteht so gut wie kein Wort von dem, was Marg uns fast ohne Unterbruch erzählt.
Bei den Buschfeuern im Jahr 2009 (Black Saturday Bushfires) haben sie und ihr Mann ihren Laden, das Lager dazu und ihr Ferienhaus in Marysville verloren, eine mehr als nur tragische Geschichte. 86 Menschen haben bei der Katastrophe ihr Leben verloren, darunter Freunde und Nachbarn. Dass ihr das noch immer nachgeht, ist verständlich. Wir haben auch von ihren Kindern und Grosskindern erfahren. Der Sohn wohnt in Singapur (sie hat mir mal geschrieben, sie sei sehr froh, dass die Familie jetzt nicht mehr so weit weg wohne – nur noch 7 Stunden Flugzeit, zuvor lebten sie in London). Sie geht manchmal die Kinder hüten… Da haben wir’s in Ittigen ein wenig näher.
Jetzt zieht die Familie nach Shanghai um. Marg geht nächste Woche wieder Kinder hüten und mit dem Umzug helfen. – Ja, da haben wir mehr nur zugehört und nicht so sehr viel gesagt.
Marg fährt uns anschliessend nach Hause. Es ist ein geräumiges, schönes, grosszügig gestaltetes, doppelstöckiges Haus mit Garten; es wird uns sehr wohl sein hier. Der Kühlschrank ist bis oben gefüllt mit Dingen für uns, da müssen wir kaum einkaufen gehen. Auch im Vorratsraum dürfen wir alles nehmen, was wir wollen. Das reicht für ein paar Monate.
Oben am Fenster bei der Eingangstür sitzt eine Spinne. Mich trifft fast der Schlag. Schwarz ist sie und für meine Begriffe riesig. Theo muss sofort her und etwas dagegen unternehmen. Leider gelingt das nicht auf Anhieb, sie entwischt. – Zum Glück ist unser Schlafzimmer im oberen Stock. Wir sind recht müde, für uns ist es zwei Uhr morgens nach NZ-Zeit, hier ist es erst Mitternacht, wir haben zwei Stunden gewonnen, sind also schon wieder auf dem Heimweg. Etwas mehr als 16‘000 km trennen uns von Ittigen und von unseren Lieben.
Bevor ich ins Bett gehe und mich meinen süssen Spinnenalbträumen hingebe, prüfe ich zur Sicherheit alle Storen und Fenster.
Melbourne, Sonntag, 9. Februar
An unserem ersten Tag unternehmen wir nicht viel. Es ist heiss, etwa 30 Grad; baden gehen ist das Vernünftigste, finden wir. Fünf Minuten zu Fuss und schon sind wir dort. Der Strand ist breit; es hat viele Muscheln und Steine, die mich natürlich grad wieder zum Sammeln anregen. Wenige Wellen, das Wasser ist klar, etwa 23 Grad, wunderbar zum Schwimmen. Lesen, abkühlen, Muscheln sammeln, lesen, abkühlen etc. Theo geht sogar ins Wasser und plötzlich ruft er mir. Neben ihm ist ein grosser schwarzer Fleck im Wasser, sieht aus wie einer der Steine, die’s dort hat, es ist aber ein Stingray. - Ja, klar, wir sind ja wieder in Australien, wo’s all diese giftigen Viecher hat. Auch wenn die Rochen nicht unbedingt aggressiv sind, können sie doch sehr schmerzhafte Stiche austeilen, sogar tödliche, also fänd ich es besser, wenn Theo sich aus dem Wasser begäbe. Das tut er. Inzwischen haben sich ein paar Leute am Strand versammelt, um den Manta zu begutachten. Er kommt ganz nah ans Ufer – erstaunlich. Ich behalte ihn und die Leute im Auge und will mich wieder abkühlen. Was ich erst als meinen eigenen Schatten einschätze, ist der Kollege des anderen. So rasch war ich noch nie aus dem Wasser wieder raus. Jetzt sind‘s also zwei, und das macht nicht sonderlich Spass. Die Idee vom Schwimmen ein wenig weiter draussen ist vorbei. – Jemand sagt uns später, es sei sehr selten, dass man Stingrays am Strand sähe…
Es hat ein Restaurant grad vis-à-vis der Promenade und da gehen wir am Abend essen, nach der Dusche natürlich. Wir sehen ein Senioren-Menu auf der Speisekarte. Das nehmen wir. Drei Gänge für 17$, das kann ja keine exorbitante Sache sein. – Erst kommt ein grosser Teller Kürbissuppe. Der gegrillten Barramundi, der anschliessend serviert wird, hängt über den Tellerrand hinaus. Die Pommes Frites kann ich nicht alle essen, und Theo mag nicht so viel Salat. Dann noch das Dessert. Nächstes Mal bestellen wir besser nur das Donald-Duck-Menu.
Schön ist es, den Sonnenuntergang zu beobachten.
Zu Hause macht mir Theo Angst wegen der Spinne. Er empfiehlt mir, den Koffer, der im Entrée steht, besser zu schliessen. – Jetzt macht mir auch mein Koffer noch Angst.
Am zweiten Tag (7. Februar) machen wir eine Stadtbesichtigung. Die öffentlichen Verkehrsbetriebe sind sehr effizient und einfach zu benutzen. Wir kaufen je eine Wochenkarte für 5 Fr. pro Tag. Damit kann man sämtliche Trams (250 km Tramlinien), Busse und die Metro benutzen. Gäbig!
Der Metrobahnhof ist keine fünf Minuten von unserem Haus entfernt, in 25 Minuten sind wir im Zentrum. Es ist jetzt richtig heiss. 35 Grad. Im Zug war’s schön kühl.
Als erstes decken wir uns in der Tourist Information mit Prospekten ein, dann machen wir ein Rundfährtli mit dem Tram und erhalten so ein wenig einen Überblick. Im Tram hat’s keine Aircondition, dafür sehr viele Leute. Wenigstens haben wir einen Fensterplatz. Wieder am Ausgangspunkt unserer Tramreise angekommen, steigen wir aus, Theo hat den Vodafone-Laden entdeckt, bei dem er unsere Simkarte neu laden lässt. Wir gehen durch eine enge Gasse, die uns an einen orientalischen Markt erinnert. Auf beiden Seiten hat’s kleine und kleinste Läden und Restaurants, davor meistens nur grad ein oder zwei Tische; es ist eine gemütliche Ambience, die ich hier nicht erwartet hätte.
Ein anderes Tram bringt uns zum Victoria Market, einem riesigen Markt, wo man so circa alles kaufen kann, was man braucht oder nicht braucht. Ähnlich wie in der Markthalle in Rosas hat’s ein Geschäft am anderen mit frischem Fisch und Fleisch, und ausserhalb des Gebäudes gibt‘s Duzende von Ständen mit Früchten und Gemüsen. Ebenfalls Kleider kann man kaufen, Souvenirs, Schuhe, hunderterlei Krimskrams, wie das so üblich ist auf solchen Märkten überall in der Welt.
Wir fahren mit der Metro heim, das heisst, wir steigen eine Station vorher aus, in Middle Brighton und machen dort unseren ersten mehr oder weniger Grosseinkauf, grad so, dass wir alles noch tragen können, ein Auto haben wir ja nicht mehr. Viel brauchen wir eigentlich nicht, Marg hat ja schon vorgesorgt, aber Wein natürlich, Orangensaft, Theo kann sein Konserven-Grusel-Kabinett wieder aufforsten: Spam-Büchsen (es gab sie grad zum halben Preis), Salat, Steak und meine English Muffins.
Zu Hause beschliessen wir, nun doch nicht zu kochen und fahren wieder zurück nach Middle Brighton, wo wir im indischen Restaurant ganz fein essen. Es ist Freitagabend und da geht eine Fuhr ab. Überall wird die Tatsache gefeiert, dass heute Freitag ist. Es ist so anders hier als in Neuseeland. Dort war’s fast immer tote Hose und hier läuft etwas, die Restaurants sind voll, die Leute draussen vor den Pubs am Bier trinken und Plaudern. Alles erinnert mich an London.
Grad kurz vor neun Uhr schaffen wir’s noch, einen weiteren Einkauf zu tätigen (Wein und Mineral), bevor der Laden schliesst. Im selben Komplex ist auch ein Kino untergebracht. Um neun beginnt ein Film – wieso nicht? – „Her“ heisst der Streifen (romantisches US-SF-Drama von Spike Jonze mit Joaquín Phoenix in der Hauptrolle) und er ist mindestens eine halbe Stunde zu lang. – Die Idee ist nicht uninteressant, läuft sich aber nach einer Stunde zu Tode. Es geht um einen geschiedenen Angestellten, der sich in das OS seines Computers verliebt. Das Betriebssystem heisst „Samantha“ und wird durch die Stimme von Scarlett Johansson „verkörpert“.
Der Samstag ist der heisseste Tag bisher. Das Thermometer zeigt 41 Grad. Wir gehen erst gegen Mittag los, entlang der Brunswick Street, auf der Schattenseite. Es ist eine trendige Gegend mit vielen kleinen Läden und Cafés, das Studentenviertel. Die Leute sitzen nicht draussen in den Strassencafés, sondern drinnen, wo die Airconditions für angenehmere Temperaturen sorgen.
Mit dem Tram geht’s anschliessend zurück in die Innenstadt, wo sich Theo bei einem Coiffeur die Haare schneiden lässt, dann fahren wir zu den Docklands. Ein wenig lädele (das ist angenehm, denn in den Läden ist es nicht so heiss) und der Marina entlang wandern, das sind unsere nächsten „Tätigkeiten“.
Es gefällt uns so gut dort, dass wir beschliessen, nicht zu Hause zu essen, sondern an der Waterfront zu bleiben. Drinnen sind die Restaurants ausgebucht, draussen findet man problemlos Platz, es ist noch immer 33 Grad warm.
Zuhause ist’s dann auch nicht kühler, die Dusche bringt nur kurze Linderung. Vor dem Schlafengehen haben wir noch eine kurze Facetime-Session mit Kay und Familie. Es macht immer sehr viel Spass, die Girls zu sehen und mit allen zu plaudern.
Und wieder bin ich der Spinne begegnet. Sie hat sich gegens Wohnzimmer verschoben und an der Wand eingerichtet. Diesmal gelingt es Theo, sie mit einem Glas zu fangen und auf meine Anweisung hin draussen, sehr weit weg, wieder auszusetzen. Sie sitzt jetzt im Baum in Nachbars Garten und ich hoffe, es gefällt ihr dort mindestens ebenso gut. Und was ich vor allem hoffe, dass sie nicht noch Kolleginnen hat in unserem Haus.
9. Februar: Es ist wieder extrem heiss, aber heute weht ein starker Wind dazu. Theo möchte lüften am Morgen, aber merkt dann selber, wie er das Fenster öffnet, dass da nichts als schwüle Luft hereinströmt, wie von einem heissen Fön. Gegen Mittag ziehen wir wieder los. Mit dem Zug fahren wir zur Station Parliament und dort nehmen wir das Tram bis St. Kilda.
Wann immer wir in einem Tram oder im Zug sind, kommen wir mit Leuten ins Gespräch. Ich finde das super. Kaum nimmt man einen Stadtplan hervor oder den Reiseführer, wollen alle helfen. Sie geben uns Tipps und wollen wissen, wo wir her kommen und erzählen von ihren Reisen in die ferne alte Welt. Vorgestern war’s Evan, ein Geschäftsmann, gestern plauderten wir mit einem Schweizer, der seit acht Jahren hier wohnt und einen Optikerladen in der City führt, und seinem australischen Partner. Vielleicht besuchen wir sie mal. - Hier im Trämli sind‘s drei junge Damen, mit denen wir uns unterhalten.
Die Fahrt zur Destination dauert gut zwanzig Minuten, das Tram ist vollgestopft mit Leuten, die dorthin wollen. Am Sonntag findet ein Markt statt. Heute aber nicht nur, wie wir sogleich merken. Es ist wie bei uns am Ziebelemärit, allerdings ungefähr 40 Grad wärmer. Seit anderthalb Wochen ist das St. Kilda Festival im Gang, heute ist der letzte Tag. In einem Pub kaufen wir ein Bier und ein Glas Cidre. Dazu gibt’s einen Sonnenhut gratis (Werbung für ein tasmanisches Bier). Die Security-Leute, die’s überall hat, machen uns darauf aufmerksam, dass wir uns setzten müssen, wenn wir Alkohol trinken. ??? Lustige Sitten gibt’s in diesem Land. Setzen wir uns halt auf die Harassen, die herumstehen, und wo zwei grad frei sind.
Den Durst gelöscht, kämpfen wir uns weiter durchs Gedränge an Marktständen vorbei; Theo findet eine Wiese, wo er sich hinlegen kann, andere sitzen auch und hören der südamerikanischen Band zu, die vorne spielt. Überall hört man Bands, eine spielt lauter als das andere, sie übertönen sich gegenseitig. Auch am Strand entlang ist viel los, Musik, Busker, Beachvolleyball. Wir bleiben dort etwa zwei Stunden lang. Hier hat es viel mehr Wellen und natürlich auch Leute als in Brighton, dafür keine Rochen, das ist mir lieber so.
Gegen fünf packen wir zusammen und setzen uns in eines der zahllosen Strassen-Restaurants in der Acland Street – es ist Apérozeit. Heute gibt’s alles nur in Plastikbechern, auch den Prosecco, ist ja klar bei diesem Andrang. Amüsant ist es, den Leuten zuzuschauen. Was man da nicht alles sieht an Outfits, Farben, Frisuren und Tatoos. - Köstlich!
Heute Abend essen wir daheim. Nach dem Salat haben wir bereits genug - ganz schön, mal nur wenig zu essen. Es ist auch angenehm, draussen zu sitzen, erstaunlicherweise hat’s einen Kälteeinbruch von etwa 15 Grad gegeben. Im Moment ist es noch 24 Grad warm.
Geburtstag und so…
Der 10. Februar: Ausschlafen, mich an all den Geburi-SMS, Whatsapps und Emails erfreuen, einige bereits beantworten, dann ab an den Strand, zurück unter die Dusche, um halb sieben mit dem Zügli in die City fahren, an der Southbank ein Restaurant suchen, das „geburi-genehm“ ist – das ist die Zusammenfassung dieses Tages.
Theo steht ausnahmsweise (ziemlich zerknittert) schon um halb neun Uhr morgens auf der Matte – ob das ein Geburtstagsgeschenk für mich sein soll? Ich drücke mein Erstaunen aus und bedaure zutiefst, dass er ganz offensichtlich zu wenig Schlaf erhalten hat. Eine ganze Weile höre ich dann nichts mehr von ihm, bis er eine Stunde später wieder erscheint. Tatsächlich ging er zurück ins Bett und schlief noch eine Runde, weil er fand, ich hätte wirklich Recht gehabt...
Unser Abendessen ist wunderbar, im Restaurant „Sake“ landen wir schliesslich, direkt am Yarra-River, mit Blick auf die Skyline, fein zubereitete japanische Köstlichkeiten werden uns serviert, und den Wein geniessen wir selbstverständlich auch. – Schön, meinen Geburtstag mal nicht im Schnee zu feiern, sondern in einem Land, wo’s Sommer ist.
Die restlichen Tage vergehen schnell, am Anfang hatten wir das Gefühl, wir seien ja ewig hier, viel zu lang. Aber jetzt möchten wir gerne noch länger bleiben.
Wir besuchen Thomas, den Schweizer, den wir in der Metro kennen gelernt haben, in seinem Optikergeschäft, und Theo kauft ihm gleich zwei Brillen ab. Diese sind hier viel billiger, sie kosten beide zusammen knapp halb so viel wie seine, die er daheim hat machen lassen. Zusätzlich erhält er noch 15 % Rabatt. Wirklich cool! Jetzt hat er endlich Ersatzbrillen, die Hoffnung herrscht, dass er weniger suchen muss. Es ist auch nicht so schlimm, wenn er eine veliert…
Am nächsten Tag schon können wir die Brillen abholen. Theo ist sehr zufrieden mit seinem Kauf.
Am Mittwochabend verpflegen wir uns auf dem Victoria Night Market. Er findet (ausser im Winter) jeden Mittwoch statt. Da würde ich jede Woche hingehen, wenn ich hier leben würde. Es herrscht zwar ein unglaubliches Gedränge, aber auch eine super Stimmung, es hat Bands, die spielen, Busker, x verschiedene Food-Stalls aus x verschiedenen Ländern, bis man sich da durch alle durchgegessen hätte, wär man grad ein paar Jährchen älter. Vor lauter Auswahl kann man sich kaum entscheiden. Sollen wir anatolisch, philippinisch, indisch, indonesisch, chinesisch, spanisch, japanisch, amerikanisch, afrikanisch essen? - Wir bleiben am türkischen Stand „hängen“, zum Dessert gibt‘s eine französische Crèpe. Deutsche Brezel, holländische Proffertjes hätte es auch noch gehabt. Keine Cervelats hingegen, auch kein Fondue oder Raclette. Aber Eiscreme und Kaffee und Wein und Bier und Marktstände mit Kleidern und allem Möglichen und Unmöglichen.
Wir haben Tickets fürs Musical Grease. Es ist ein Geburtstagsgeschenk von Theo an mich. Die Vorstellung fängt um acht Uhr abends an, wir haben genug Zeit mit dem Tram an die Exhibition Road zu fahren, die öffentlichen Verkehrsmittel sind sehr effizient und praktisch zum Benutzen. - Das Tram kommt aber nicht. Wir warten fast eine Viertelstunde. Aus der Gegenrichtung sind bereits fünf Trams vorbeigefahren. Da muss ein Unfall passiert sein oder sonst etwas, das ist nicht normal. Wir geben auf, haben noch knapp zwanzig Minuten Zeit. Zu Fuss mag ich nicht gehen, es ist doch noch recht weit. In der übernächsten Parallelstrasse könnte es Busse haben. Der erste, den wir sehen, ist „Out of Service“. Wir eilen weiter, es ist fast schon zehn vor acht. Jetzt kommt ein Bus, hätten wir doch an der vorderen Haltestelle gewartet, ich glaube, wir verpassen ihn, er fährt an uns vorbei. Wir erreichen ihn dann doch noch – er hält sogar ein paar Minuten. Nach uns steigen noch viele Fahrgäste ein. Wie er endlich losfährt, bin ich doch sehr froh, er hält fast vor dem Theater, alle Leute stehen noch draussen mit einem Drink in der Hand, wir sind keineswegs zu spät.
Die Vorstellung gefällt uns sehr: Die Musik führt uns geistig zurück in die Fünfzigerjahre, alles ist farbig, ein wenig kitschig halt, die amerikanischen Highschoolgirls kreischen, singen aber auch, die Männer mit ihren Grease-Frisuren sind alle kleine Elvis und das Bühnenbild ist Spitze. Zwei australische Popstars sind im Musical dabei; sie werden von den Zuschauern und vor allem von den Zuschauerinnen frenetisch jubelnd beklatscht - wir kennen sie nicht.
Der Heimweg ist problemlos. Wir nehmen zwei verschiedenen Trams und dann unser Zügli, keine zwei Minuten müssen wir jeweils auf die Verbindung warten.
Die NGV (National Gallery Victoria) besuchen wir an unserem letzten Tag, sie ist in zwei verschiedenen Gebäuden untergebracht und wie das so ist in Museen, die Zeit vergeht im Flug und schon ist ein ganzer Nachmittag vorbei. Mir hat vor allem die Ian Potter Gallery sehr gut gefallen, wo australische Kunst ausgestellt wird.
Ursprünglich wollten wir die Stadt vom Eureka-Tower aus anschauen, das war unser Plan. Dummerweise haben wir das verschoben, weil wir dachten, am nächsten Tag sei’s vielleicht noch schöner, das sagte jedenfalls die Wettervorhersage, und genau das soll man ja nicht tun: „Verschiebe nie auf morgen, was du heute kannst besorgen.“ Das Pech war, dass es im Norden erneut Wald- oder Buschbrände gab und der Rauch die ganze Stadt dermassen einnebelte, dass man überhaupt nicht viel gesehen hätte. Alles war grau in grau, die Farben fehlten vollständig, die Sichtweite kaum weiter als etwa 200 Meter. Vom 300 Meter hohen Turm aus hätten wir wohl nicht mal auf den Boden gesehen. So verzichteten wir und ich ärgerte mich über mich selbst. – So muss es ein Nächstes Mal geben, ein Grund mehr, ein anderes Mal nach Melbourne zu reisen.
(Erfreulicherweise, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, galt diesmal das Sprichwort: „Verschiebe nie auf morgen, was du auch übermorgen kannst besorgen“.)
Vorerst aber müssen wir packen. Mit unserem netten Nachbarn haben wir abgemacht, dass wir einen Koffer bei ihm in seinem Haus lassen können. Marg und Alistair sind am 2. März in China, deshalb können wir den Koffer nicht bei ihnen lassen. Wir hätten ihn auch im Flughafen abgeben können bei der Gepäckaufbewahrung, aber das hätte mehr als 200 Fr. gekostet, dafür gehen wir lieber zweimal fein essen.
Hunderterlei Krimskrams, Dinge, die wir in den letzten vier Monaten erstanden haben, Kleider, die wir in den nächsten zwei Wochen nicht brauchen, packen wir in einen unserer Koffer und geben ihn Larry ab. Zum Dank, dass er unser Gepäckstück aufbewahren darf, lädt er uns zum Apéro ein und das ist ein netter Abschluss zu unserem Melbourne-Aufenthalt.
Im Haus nebenan, 31 Werestreet, drehen sie heute und morgen einen Film, Teil der Serie „House Husbands“, eine australische Produktion als Gegenstück zu „Desperate Housewives“. Überall stehen Kameras, Abschrankungen, Arbeiter und Helfer herum. Die Serie will ich mir dann mal anschauen, wenn ich wieder zu Hause bin.
Ankunft in Tasmanien, 15. Februar 2014
14. Februar: Diesmal haben wir kein Problem mit zu vielen Kilos für den kurzen Flug nach Hobart, aber trotzdem war es beim Packen nicht einfach, den ganzen Rest unserer Habe auf die verbleibenden Gepäckstücke zu verteilen. Aber es gelang. Nur wird es uns nicht möglich sein, ein einziges Blatt Papier mehr im Koffer zu verstauen; er ist zum Bersten voll. – „No more shopping“ heisst das im Klartext.
Um Viertel vor neun kommt uns Marg abholen. So lieb von ihr, uns zum Flughafen zu bringen. Wir sind eine gute Stunde vorher dort, alles bestens, Inlandflüge sind problemlos. Um halb eins kommen wir in Hobart an und werden schon erwartet von Lyn und Biran Muir, mit denen ich im Vornherein viele E-Mails gewechselt habe. Ich hatte sie angefragt, ob sie mit uns tauschen wollten und im Laufe der Hin- und Herschreibereien fanden wir heraus, dass wir gemeinsame Homelink-Bekannte haben, Kay und Mike Whealan in Hastings, mit denen wir beide einen Tausch gehabt hatten. – So klein ist die Welt. Auch Kay und Laurie Topping aus Brisbane sind gemeinsame Homelink-Swap-Partner, nicht zu glauben! - Weiter kam heraus, dass sie Bern kennen, „schlimmer“ noch, sie kennen Jegenstorf und waren schon öfter dort bei Heinz und Ingrid Vollenweider. Heinz hatte in den Siebzigern während ein paar Jahren mit Brian in Hobart zusammengearbeitet. Als ich das erfuhr, luden wir die beiden kurz vor unserer Abreise auf ein Plauderstündchen ein. – Alle zusammen werden wir im kommenden Juli eine Woche in Bivio verbringen.
Lyn und Brian wohnen in Hobart, haben aber ein Ferienhaus an einer anderen Bay, anderthalb Stunden von ihrem Haus entfernt. Wir haben abgemacht, dass wir erst ein paar Tage gemeinsam dort verbringen werden und sie uns die Gegend, die sie aus dem FF kennen, zeigen. Auf dieses Angebot sind wir gerne eingegangen. Auf dem Heimweg vom Flughafen nach „Eagleshawk Neck“ halten wir in einem Fischerdörfchen an und essen eine Kleinigkeit. Dunalley hat kaum mehr als etwa 300 Einwohner. Die Leute sind dabei, das Dorf wieder aufzubauen, die meisten Häuser wurden bei den verheerenden Waldbränden im letzten Jahr zerstört. Das Feuer wütete über viele Hektaren und Kilometer, übersprang Flüsse und Kanäle und breitete sich bis ganz in die Nähe von Muirs Ferienhaus aus. Ihre Tochter und deren Familie mussten evakuiert werden.
Überall sieht man die schwarzen, verbrannten Bäume noch, die Natur übernimmt aber wieder fleissig, und um die meisten schwarzen Stämme herum wachsen grüne Kletterpflanzen.
Unser nächster Halt unterwegs ist ein Lookout beim Pirates Bay. Leider ist das Wetter nicht sehr schön, es regnet zwar nicht, ist aber völlig bewölkt. Das Thermometer zeigt nur noch 18 Grad, etwa zehn weniger als in Melbourne. Hier bietet sich wieder ein Anblick vom Fantastischsten: Die Klippen, zu denen ein kurzer Wanderweg führt, sind wie von einem Lineal zerschnitten und in Blöcke zerteilt, „tessellated pavement“. Auf einer Tafel wird erklärt, wie dieses seltene Naturphänomen entstanden ist. Wenn man nicht wüsste, dass die Blöcke nicht von Menschenhand entstanden sind, man würde es nicht glauben.
Ein paar wenige Kilometer weiter gibt es weitere Sehenswürdigkeiten zu bestaunen: „The Blowhol“ und „Tasman Arch“: ein Bogen und ein riesiges Loch in den Felsen, durch das die Wellen peitschen und in welches man das Berner Münster so hineinstellen könnte, das man darauf hinunterschauen müsste.
Dann „Devil’s Kitchen“. Auch hier wieder Felsfomationen vom Unglaublichsten und Beeindruckendsten. Ringsherum sind Lookouts eingerichtet, so dass man, wenn man nicht allzu grosse Höhenangst hat, wunderbar hineinschauen kann. Ein halbstündiger Walk zu Waterfall Bay ist auch Teil unserer Besichtigung.
Mit Lyn und Brian haben wir die perfekten Reiseführer gefunden. Wir erreichen schliesslich ihr Ferienhaus, 20 km von Port Arthur entfernt, dem Reiseziel aller Touristen in Tasmanien. Es ist ein schmuckes, kleines Holzhaus, einfach eingerichtet, schön gelegen, alles ist da, was man braucht. Im Garten kann man die verschiedensten Vögel beobachten; es gefällt uns gut. Wir erhalten ein hübsches Zimmer mit Blick aufs Meer. Unsere Gastgeber verwöhnen uns mit einem feinen Apéro (wir sind wieder im Land der Crackers-und Käsehäppchen angelangt) und einem Glas Bubbles; ich weiss ja inzwischen, was damit gemeint ist.
Zum Znacht gibt’s eine wunderbare Scheibe Lachs mariniert mit Limetten-Teriyaky-Sauce und Knoblauch, dazu Kartoffeln und Salat.
Nach dem Essen dann das Schönste: Wir gehen an den Strand, bewaffnet mit einer grossen Taschenlampe mit roter Folie umspannt und einer Plache. Es ist am Einnachten, neun Uhr abends. Wir setzen uns hin und harren der Dinge, die da kommen werden. Es ist die Zeit, wo die Pinguine aus dem Wasser auftauchen, an Land torkeln (das scheint der richtige Ausdruck), über den Strand wackeln und ihre Nester aufsuchen, wo sie tagsüber die Jungen zurückgelassen haben (in Obhut eines Partners oder Nachbarn). Wir sitzen dort in der (fast völligen) Dunkelheit, machen keinen Mucks, die Taschenlampe auf die Wasserkante gerichtet und ich denke, da passiert sicher nichts. Es dauert aber keine fünf Minuten, schon sehen wir einen weissen Punkt am Ufer auftauchen, dann einen zweiten, einen dritten. Sie tauchen aus dem Meer auf und finden ihren Weg zwei Meter an uns vorbei, das Bord hinauf zu ihren Nestern. Sie scheinen uns überhaupt nicht wahrzunehmen. - Ihnen zuzuschauen ist ein Mix aus verschiedenen Gefühlen: ihre (vermeintliche?) Hilflosigkeit rührt einen, ihre Scheu; man muss lachen, wie sie sich das Bord heraufkämpfen, manchmal fallen sie wieder zurück und straucheln, dann geht’s ein Stück weit ganz gut. Sie sind relativ klein, die Fairy Penguins, eben Zwergpinguine. Sie haben sich entschieden, ihre Nester auf der anderen Seite der Strasse zu bauen, weshalb, wissen sie wohl selber nicht. Das ist nämlich sehr beschwerlich und auch gefährlich. Vielleicht sind sie einfach nur stur oder speziell gepolt wie zum Beispiel Bienen oder Ameisen und können nicht anders. Jedenfalls sind sie putzig anzuschauen. Man hat eine Unterführung für sie gebaut, aber die scheint ihnen auch nicht so ganz geheuer, sie stehen vor der Abschrankung und wissen nicht, ob sie sie benutzen sollen oder nicht. Eine weitere Gruppe von drei Pinguinen kommt nach, sie sind noch weniger zielstrebig, aber sie schaffen den beschwerlichen Weg schliesslich trotzdem.
Offenbar waren wir müder als ich dachte, ich erwache erst um zehn vor zehn am nächsten Morgen, was Theo natürlich sehr freut.
Nach unserem Morgenessen um halb zwölf fahren wir los, Lyn und Brian wollen uns die Halbinsel zeigen. Leider ist es sehr neblig, man sieht nicht weit, ich nehme jedenfalls mal warme Kleider und meinen Regenjacke mit. Brian sagt aber, es sei gut möglich, dass 20 km weiter weg das Wetter ganz anders sein könne. Wie bei uns nördlich und südlich der Alpen, nur dass es hier keine hat. Und tatsächlich, zwar ist das noch nicht so beim ersten Strand, den wir besuchen, Fordescue Bay, aber beim zweiten ist plötzlich der Himmel blau, die Sonne scheint, die Regenjacke und die warmen Kleider bleiben im Auto. Leider bleibt aber Theos Mütze und die detaillierte laminierte Strassenkarte, die uns Brian gegeben hat, und auf der wir nachsehen konnten, wo wir genau sind, ausserhalb des Autos. Bei irgendeinem Lookout müssen die beiden beim Ein- oder Aussteigen herausgefallen sein. Sooo ärgerlich! Theo bringt‘s immer wieder fertig, etwas irgendwo liegen zu lassen. Sogar jetzt, wo wir fast gar nichts bei uns haben. Von Queenstown habe ich vorgestern eine Email erhalten, man habe seinen rosaroten i-Pod gefunden. Der wird uns jetzt nachgeschickt. – Ich bin nur froh, dass wir auf unsere Ausfahrt unseren Reiseführer nicht mitgenommen haben. Sonst wären wir den sicher auch wieder los. Zum dritten Mal. Den hüte ich jetzt allerdings wie meinen Augapfel.
Stewarts Bay war unser zweiter Halt, ein wunderschöner Strand mit weissem Sand und sogar ein paar Leuten beim Baden.
Das Verrückteste und Schönste war die „Remarkable Cave“, ein riesiger Bogen im Fels, eine Höhle mit zwei Ausgängen. Wenn man von der einen Seite hineinblickt, sieht die andere aus wie die Landkarte von Tasmanien. Die Felsen sind zufällig so geschnitten. Erstaunlich. Wir klettern über die Abschrankung (obwohl Lyn das gar nicht gutheisst, es aber denn trotzdem auch selber tut) und gehen in die Höhle hinein. Der Anblick ist überwältigend. Es kommt mir vor wie in einer Kathedrale. Alle paar Sekunden flutet eine Welle mehr oder weniger stark hinein.
Weiter geht’s zum Shelly Beach, einem hübschen Strand, wo wir unsere von Lyn liebevoll zubereiteten Sandwiches essen und den schönen Blick geniessen.
Ein kurzer Spaziergang führt zur nächsten Bucht. Dort lesen wir Muscheln von den Felsen ab, Brian will sie später für uns BBQen. – Fein sind sie zu einem Gläschen Wein, sie sind zwar nur etwa einen Sechstel so gross wie die grünen, die wir in Neuseeland gegessen haben, aber mit einer delikaten Sauce gar nicht zu verachten. Wie gestern auch schon werden wir mit einem feinen Nachtessen verwöhnt, zubereitet von Lyn. Fünf Gemüsesorten gibt es, da wird Theo wieder Gelenkschmerzen bekommen vom „Schtrübschte“.
Port Arthur
Nach dem Morgenessen am nächsten Tag, dem Sonntag, überlässt uns Brian sein Auto und wir fahren nach Port Arthur, dem berühmten historischen Gefängniskomplex in Tasmanien, der von 1830 bis 1877 in Betrieb war, wohin die Engländer alle ihre Sträflinge hinschickten beziehungsweise wo sie sie los wurden. Als wir wegfuhren, regnete es immer noch, dort angekommen, fing grad die Sonnen an zu scheinen. Es hat mal wirklich viele Touristen für hiesige Verhältnisse. Alles ist aber sehr gut organisiert, man steht sich nicht auf den Füssen herum und das ganze Areal ist sehr viel grösser, als ich mir das vorgestellt hatte. Man könnte gut und gern mindestens einen Tag hier verbringen.
In unserem Ticket ist eine Schifffahrt mit inbegriffen zur Island of the Dead, dort, wo Sträflinge und auch Soldaten, Offiziere und deren Familien begraben sind. Was die armen Convicts im Straflager alles haben erdulden müssen, ist fast nicht vorstellbar. Ich habe vorher viel darüber gelesen, es gab mir mehr als nur zu denken, wie unglaublich streng und menschenverachtend die Gesetze damals waren, wenn man bedenkt, dass diese ganze grauenhafte Geschichte eigentlich noch nicht sehr lange her ist. Wenn man sich ein wenig auf die Einzelschicksale der Gefangenen einlässt, packt einen das Grauen. Was da für Ansichten vertreten wurden von der Obrigkeit und den Psychiatern - es wird einem schlecht. Tiefstes Mittelalter. Das Durchschnittsalter der jugendlichen Straftäter war 14; die jüngsten Inhaftierten waren 9-jährig. Das heisst, die wurden in England, Irland oder Schottland aus ihren Familien fortgerissen, in ein Schiff verfrachtet, unter abscheulichsten Bedingungen dauerte die Überfahrt mehr als drei Monate und an eine Rückkehr war sowieso nicht zu denken. Die Delikte (auch diese der Männer) waren manchmal lächerlicher Art: Zum Beispiel gab’s schon nur für einen Ladendiebstahl (getätigt aus Hunger) mindestens sieben Jahre Verbannung. Ein Sträfling, so wurde erzählt, erhielt 14 Jahre Straflager, weil er ein Taschentuch gestohlen hatte. Härteste Arbeit mit Fussfesseln, die 18 kg wogen, waren ebenfalls Gang und Gäbe sowie monatelange Einzelhaft mit Sprechverbot. Wer dagegen aufmuckte oder gar einen Fluchtversuch wagte, wurde ausgepeitscht und aufs Strengste bestraft.
Der Ort ist so schön gelegen, es ist ein eklatanter Gegensatz zwischen der Geschichte, also dem, was damals geschah und der schönen Landschaft, der Bucht, dem Meer. Auch zeitlich. Jetzt sind so viele Touristen da, sie fotografieren die Gebäude, die zum grossen Teil nur noch als Ruinen vorhanden sind, schiessen Selfies von sich vor den Zellen und Gebäuden, in denen Menschen vor nicht allzu langer Zeit die grössten seelischen und körperlichsten Qualen ausstehen mussten, Dinge, die wir uns gar nicht richtig vorstellen können. Die Japaner haben auf all ihren Fotos zusätzlich das „V“ als Siegeszeichen, das sie mit Mittel- und Zeigefinger machen, wenn sie geknipst werden, es geht offenbar nicht anders. – Ich frag mich immer wieder, was das soll. – Zeigen sie damit, dass sie da waren, alles gesehen und begriffen haben oder was? – Wenn sie’s nur selber wissen…
Fast sechs Stunden verbringen wir auf dem Areal, dann fahren wir wieder zurück nach Eaglehawks Neck, wo uns Lyn und Brian bereits erwarten.
Gepackt haben wir schon vorher, alles wird ins Auto verladen und wir fahren nach Hobart beziehungsweise nach Kingston oder Blackmans Bay, wo sie wohnen, einem Vorort von Hobart an der Little Oyster Bay gelegen. Nach einer kurzen Stadtrundfahrt kommen wir zu Hause an. Die Muirs wohnen auch hier sehr schön mit Blick auf die Bucht, fünf Minuten zum Strand. Wir laden sie in ein Thai-Restaurant ein, so dass Lyn mal nicht kochen muss. Wir besprechen unsere weiteren Ferien- und Reisepläne. – Morgen geht’s weiter Richtung Norden, wir dürfen Lyns Auto haben für unsere dreitägige Exkursion. Wenn ich da an Leute denke, die ich kenne, die fast überbeissen, wenn sie sich nur vorstellen, dass jemand anderes als sie selbst ihr Auto fahren würde…
Nach Norden im Süden der Insel 17. Februar 2014
Am Morgen stehen wir relativ früh auf, so gegen acht, („Morgengrauen“, nennt das Theo) und nach dem Frühstück geht’s los. Wir fahren nach Triabunna, wo wir möglicherweise die Fähre zur Maria Island nehmen wollen, es kommt noch aufs Wetter an. Wir sind grad ein wenig zu spät, aber eigentlich sind wir so oder so nicht so versessen drauf, hinüberzufahren, weil es eben doch nicht so schön ist, ein bisschen neblig leider, man bis um vier Uhr bleiben muss, weil nur eine Fähre in Betrieb ist und die angebotene Tour für uns beide fast 300 Fr. kosten würde. Bei dem Preis sollte wenigstens das Wetter stimmen, finde ich. Nun, die Fähre ist soeben abgefahren (um 10.30 Uhr), eine zweite fährt heute nicht mehr, Plätz hätte es sowieso keine gehabt, man hätte vorher buchen müssen. – Ok, der Fall ist geklärt und gelaufen, können wir „abhäkeln“. Sollen die Kängurus, Wombats, seltenen Vögel und was es noch alles dort zu sehen gibt, halt ohne uns in den Tag hinein leben.
Wir machen einen kurzen Halt bei der Spikes-Bridge, einer Brücke, die in den 1830er-Jahren von den Sträflingen mit vielen Spickeln, aber ohne Mörtel gebaut wurde.
Wir fahren weiter nach Swansea, an die Great Oyster Bay, wo’s wieder mal einen Flat White gibt und dazu ein Zitronentörtchen mit Doppelrahm (!).
Anschliessend geht’s nach Bicheno, einem weiteren einsamen Fischerdorf an der Ostküste von Tassie. Das Blowhole (Rösi sagt „Blof Hole“), das man dort sehen kann, hat uns mächtig beeindruckt. Es ist absolut spektakulär zuzuschauen und auch zuzuhören, wie die Wellen in diese von ihnen selber geformte Höhle hineinpreschen und dann meterhoch in die Höhe spritzen.
Die Felsen darum herum sind gelblich, grünlich und rötlich gefärbt; das kommt von verschiedenen Algen, die sich dort eingenistet beziehungsweise niedergelassen haben. Etwas weiter weg davon, am Safe Beach, finden wir ein schönes Plätzchen am Strand, wo Theo seine Siesta machen und ich mein Buch fertiglesen kann. Der Himmel weist inzwischen ein paar blaue Flecken auf und manchmal scheint sogar die Sonne ein wenig.
Zurück in Swansea beziehen wir unser Hotel (Waterloo Inn), das wir am Abend zuvor per Internet gebucht haben. Wir essen auch dort, es ist ganz gut. Die blutjunge Kellnerin (offenbar die Tochter der Besitzer, die wir nicht zu Gesicht bekommen haben) könnte eventuell besser Fussball spielen als Servieren, was zwar im Moment auch nicht hilfreich wäre, aber der Typ, der alles sonst machen muss, Gäste empfangen, Bar bedienen, kochen und auch servieren, schon. Er ist so vielseitig wie sein Aussehen: Rossschwanz, der hinten aus dem weissen Baseball-Cap heraushängt, Kochkittel und schwarz-weiss karierte Hosen, beide Arme tätowiert (hier absolut alltäglich allerdings) und gesegnet mit einem ausgedehnten Aussie-Slang. Den Wein, den wir bestellt haben, hole ich selber an der Bar, die Serviertochter sagt, sie sei zu jung und dürfe ihn nicht bringen. - Ja, solche Gesetze haben sie in Australien zum Jugendschutz. Das nützt sicher. Die minderjährige „Kellnerin“ muss davor geschützt werden, eine Weinflasche anzurühren und sie fünf Meter weiter an den Tisch der Kunden zu tragen. Recht so! Wenn man bedenkt, wie sehr sie in dem Fall geschädigt werden könnte – nicht auszudenken! Man kann nur hoffen, dass ihr der Anblick der vielen Flaschen in der Bar nicht allzu viel Schaden zufügt. Vielleicht wären Scheuklappen in dem Moment das Richtige.
Der 18. Februar ist ein wunderbarer Tag! Wir fahren nach Coles Beach und das Wetter ist einmalig. Und so ist die Gegend. – Erst aber gibt’s für mich noch ein paar Schrecksekunden; die erste, wie ich im Dorf zum Auto aussteigen will und sehe, wie eine Spinne im Strassenrand auf meinen Fuss zusteuert. Das geht für mich gar nicht. Spinnen ekeln mich bis ins Mark, und so grosse sowieso.
Auf der Weiterfahrt überquert eine schwarze, etwa anderthalb Meter lange Schlange die Strasse, Theo hat sie um Haaresbreite verfehlt. – Es ist die erste, die wir sehen, zum Glück gut geschützt aus dem Auto heraus und nicht etwa auf einer Wanderung.
Coles Beach ist eine Halbinsel, die wir von Swansea in etwa einer Stunde erreichen. Unterwegs fahren wir an sechs Weingütern vorbei, alle aufs Schönste gepflegt. Sie laden zur Degustation ein. Dafür haben wir heute allerdings keine Zeit.
Im Freycinet Nationalpark angekommen, unternehmen wir als Erstes den Walk zum Wineglass Bay Lookout. Dieser Strand wurde als einer der zehn schönsten in der Welt eingestuft. Der Weg ist teilweise steil, er führt aber meistens im Halbschatten durch den Busch, vorbei an riesigen Felsbrocken, die irgendwann mal von den Bergen (ursprünglich Vulkane) heruntergerollt sind. Der ganze Walk dauert etwa anderthalb Stunden. Der Blick, der sich dann bietet, wenn man oben ist, ist absolut grossartig.
Die Wineglass Bay bei diesem Wetter zu sehen, ist wahrlich ein Geschenk, fast zu schön, um wahr zu sein.
Wir besuchen auch den Tourville Leuchtturm, von dem aus man ebenfalls grandiose Ausblicke hat auf die Klippen, den Regenwald und das Meer. Noch schöner ist die Sleepy Bay. - Rote Felsen, riesige Felsbrocken, türkisfarbige See, grünes Gebüsch, tiefblauer Himmel - mir fehlen die Worte.
Honeymoon Bay: Die verschiedenen Farben in dieser wunderbaren Bucht setzen uns erneut in Erstaunen. Eine Küstenlandschaft ist schöner als die andere. Hier bleiben wir ein wenig und genehmigen uns ein Bad im glasklaren, türkisfarbigen Wasser. Es ist etwa 23 Grad warm, würde ich schätzen. Was für eine schöne Abkühlung an diesem heissen Tag. Das Meer hier muss sehr salzig sein, es trägt mich auf dem Rücken, ich bewege mich kaum.
Auf dem Weg zum Auto begegnet uns ein Wallaby. Es sitzt dort völlig unbekümmert und isst etwas – egal, wer zuschaut. Auch das noch; was für ein Bilderbuchtag!
In der Freycinet Lodge gibt’s anschliessend Apéro. Das wär der perfekte Ort, um Ferien zu machen. Wir aber nehmen den Heimweg unter die Räder, zurück nach Swansea zu unserem Waterloo Inn Motel, wo wir eine weitere Nacht bleiben.
Nachtessen im Ort, im „Saltshaker“, dann Kollaps ins Bett und gute Nacht.
Es regnet am Morgen, macht nichts, wir nehmen’s gemütlich. Frühstück in der „Saw Mill Backery“ und Fahrt nach Campbell Town, von dort aus Richtung Süden nach Ross, Oatlands und Richmond, alles geschichtsträchtige Orte am sogenannten Heritage Highway (früher Midland Highway), der Verbindung zwischen Hobart und Launceston.
Es ist inzwischen fast wolkenlos und sehr warm.
In Richmond steht die älteste Brücke des Landes (von den Sträflingen 1823 gebaut, in Ross gibt’s ebenfalls eine zu besichtigen, die nur wenig „neuer“ ist, ebenfalls von Sträflingen gebaut, und erstaunliche, fein gemeisselte Strukturen aufweist. Die Queen begnadigte damals die beiden talentierten Verurteilten, die diese Baumeisterarbeiten geschaffen hatten. Eigentlich hätten sie lebenslange Strafen zu verbüssen gehabt.
Es gab zu der Zeit auch ein Frauengefängnis; davon steht nur noch ein Gebäude mitten in der Landschaft. Sehr eindrücklich wird geschildert, wie die Frauen leben mussten und was Gefangenschaft für sie und ihre bemitleidenswerten Kinder bedeutete.
Um halb sieben sind wir daheim in Hobart beziehungsweise in Kingston – Blackmans Bay, wo die Muirs wohnen. Wir werden herzlich empfangen, ein Apéro wird gleich serviert und es gibt ein Seafood-BBQ mit Salat. Wir können draussen essen; das geniessen wir sehr. Brian zeigt uns anschliessend drei Filme aus seinen Ferien mit Lyn, den ersten von der Westküste, wo sie mit ihrem Boot auf dem Fluss durch die bezauberndsten Landschaften fuhren, den zweiten von Bern (auch Jegenstorf) und der Schweiz, wo sie schon dreimal waren, den letzten von Island und seiner überaus beeindruckende Landschaft. - Interessante Filme, gut gemacht, schön anzusehen.
Es beginnt wieder stark zu regnen, wir gehen ins Bett.
Donnerstag, der 20. Februar. Theo taucht schon um halb neun fertig angezogen im Wohnzimmer auf. Ein Wunder ist geschehen! – Was für eines, weiss ich zwar nicht, aber ich frag auch nicht lange nach. Jedenfalls können wir uns also nach dem Frühstück bereits um Viertel nach neun (in aller Herrgottsfrühe) auf dem Weg machen zu einer Fahrt rings um die Halbinsel – wieder mit Lyns Auto. Wir fahren durch verschiedene Orte, kleine Ansiedelungen, wo‘s oft nicht einmal ein Restaurant gibt, durch Kettering, Woodbridge, Peppermint Bay und wie sie alle heissen.
Auch schöne Strände hat’s, zum Beispiel Randalls Bay oder Egg and Bacon Bay.
Huonville und Cygnet sind etwas grössere Orte, da machen wir Halt und kehren ein.
Um drei Uhr sind wir wieder daheim, das Wetter ist nicht schlecht, aber auch nicht grossartig, so haben wir grad ein wenig Zeit noch, an unserem Blog weiterzubasteln und Emails zu beantworten. Nur noch drei Tage, dann geht’s wieder zurück nach Melbourne.
Theo hat inzwischen seinen i-Pod per Express erhalten. Die Sendung hat 40 Dollar gekostet und da steckt eine ganze Geschichte dahinter. Verloren hat er ihn ja in Queenstown. Die Gäste, die nach uns dort waren, haben ihn gefunden und der Agentur gemeldet. Diese brachten das Gerät (ca. 4X5 cm gross) auf die Post, aber die wollte es nicht annehmen, weil eine Batterie drin war/ist. Diese kann man nicht herausnehmen. Also musste das Ding mit Sonderpost und Express befördert werden. – Die Agentur wollte Theo’s Kreditkartennummer, aber die hat er falsch angegeben, also ging wieder Zeit verloren und es wurde erneut hin- und hergeschrieben. Ich glaube fast, die müssen jemanden zusätzlich anstellen bei der Agentur „Relax – it’s done“. Die werden Freude haben an Gästen wie uns. Theo stört das wenig, im Gegenteil, er habe mit drei Girls Kontakt, berichtet er (Wahrscheinlich gibt eine entnervt seine Emails der anderen weiter). – Übrigens hat er auch sein e-Book verloren, wie er gestern gebeichtet hat. Zum Glück hat er zwei bei sich, so kann er den Verlust gut verkraften. Vorsorge ist die Mutter der Porzellankiste oder wie heisst das genau? – Nein, das ist Vorsicht und hat mit dem nichts zu tun. Aber irgendein Sprichwort wird sicher passen. Etwa: Vorsorge ist der Vater des Notvorrats oder ähnlich. – Kaum hat Theo seinen i-Pod wieder in Händen, klingelte das Telefon. Es ist Marg aus Melbourne. Ihr Mann hat Theos e-Zigarette zwischen den Sofakissen gefunden… Von denen hat (hatte) er drei bei sich… - Ich glaube, es wird langsam Zeit, mit dem, was wir noch haben, den Rückzug anzutreten.
Am Freitag fahren Lyn und Brian mit uns in den Mount Field National Park. Wir nehmen warme Kleider mit, in den Bergen sei es kalt, sagen sie.
Die Fahrt führt dem schönen Dermont River entlang. Im Visitorcentre des Parks gibt’s erst mal eine Tasse Kaffee, dann geht’s los mit dem ersten Walk zu den „Russell Falls“. Sie plätschern über verschiedene Stufen in die Tiefe, es ist wunderschön zu schauen, obwohl sie im Moment nicht sehr viel Wasser führen.
Ein weiterer Spaziergang heisst „Tall Trees Walk“. Die Bäume (eine Art Eukalyptus) sind sehr beeindruckend. Sie sind bis zu 90 Meter hoch und haben schlanke Stämme ohne Rinde und Geäst (bis etwa auf zehn Meter Höhe). Die Kronen oben wirken fast lächerlich klein, wir Menschen unten wie Zwerge.
Nach einem kurzen Lunch geht’s weiter den Berg hinauf durch den Wald bis zu einer Lichtung. Wir sind auf 1040 m Höhe und es ist 6 Grad „warm“. Dazu bläst ein kalter Wind. Zum Glück hat mir Lyn eine Skijacke geliehen, ohne die wär’s schwierig geworden. Der Walk führt um einen kleinen See herum, den Lake Dobson, auf dem man ganz andersartige Bäume und Pflanzen sieht als in tieferen Lagen. Die Pencil Pines zum Beispiel wachsen nur hier und sind schon 1000 Jahre alt. Am interessantesten finde ich den Pendani-Forest. Er besteht aus Bäumen, die’s nur hier in Tasmanien gibt. Sie sehen aus wie „Strubelibuebe“. Wie in einem Märchenwald kommt es mir vor.
Es muss auch Platypus haben in diesem Gewässer, die sehen wir aber nicht, das Wasser ist durch den Wind zu sehr bewegt. Ausser zwei kleinen Kängurus (Pandemelons) sind keine anderen Tiere zu sehen.
Wie wir am späteren Nachmittag wieder gegen Hobart zu fahren, beschliessen wir, auch noch gleich den Mount Wellington, den Hobarter Hausberg „abzuhäkeln“. Das Wetter war den ganzen Tag lang nicht schlecht, es hatte immer wieder ein paar sonnige Abschnitte und blauen Himmel zwischendurch, jetzt aber ist es fast wolkenlos. Die Fahrt führt durch den Wald steil hinauf bis auf 1‘200 Meter. Die Aussicht ist sagenhaft schön, wie vom Flugzeug aus, leider ein wenig dunstig, also für die Fotos nicht vom Besten, fürs Auge aber schon.
Zum Nachtessen gibt’s Lachs und Salat. Lyn hat einen Freund eingeladen, der ebenfalls Homelink-Mitglied ist und wir haben einen vergnüglichen Abend.
Hobart
Am 22. Februar geht’s nach Salamanca. Dies ist ein Quartier direkt am Hafen gelegen, wo an jedem Samstag ein Markt stattfindet. Der Markt ist sehr gross, ausgebreitet über verschiedene Strassen, und es geht sehr gesittet zu. Es ist auch nicht so laut wie etwa in einem spanischen Markt, niemand schreit herum, aber alle sind sofort bereit zu einem kleinen Schwatz, auch ohne dass man sich gedrängt fühlt, etwas zu kaufen. Die angebotene Ware ist sehr sorgfältig präsentiert und ausgesucht. Zum grössten Teil werden Produkte verkauft „made in Tasmania“, nicht Massenware aus China, Thailand oder Indien. Küchenutensilien aus einheimischem Holz, Merino-Woll-Produkte, Honig und Konfitüre, Früchte, Gemüse werden feilgeboten und so weiter und so fort. Es hat viele hübsche Strassencafés und auch Buskers sind zur Stelle, eine richtig gemütliche Atmosphäre herrscht.
Brian hat uns in die Stadt gefahren, direkt zum Markt, es ist unglaublich, wie wir von den Muirs verwöhnt werden. – Das Wetter ist seltsam, man weiss manchmal gar nicht recht, was anziehen. Es ist nur 14 Grad am Morgen und ich überlege mir fast, ob ich einen Pullover kaufen soll. Aber in welchen Koffer pack ich den?
Kurze Zeit später muss ich zwei Schichten Kleider ausziehen und hab so noch fast zu heiss im T-Shirt. – So ist es eben in Tasmanien. Es gibt einen Spruch, der heisst:
„You don’t like the weather in Hobart? Come again – in five minutes.” Das ist gar nicht so übertrieben. So ähnlich haben wir’s in diesen paar Tagen schon mehrmals erlebt. Gestern zum Beispiel war’s sechs Grad und zwei Stunden später zweiundzwanzig.
Um halb drei nehmen wir die Fähre nach MONA, dem neuen Museum auf einer Halbinsel gelegen, ein paar Kilometer weiter flussaufwärts. Hervorragende Kunst ist dort ausgestellt, wie immer natürlich auch Werke, über die man diskutieren kann, aber gerade darum geht’s ja wohl.
Nicht nur die Kunst ist kontrovers, auch der Museumsshop. Auf dem Prospekt heisst es dazu: „Come and visit us. We have a lot of shit to sell.“ – Tatsächlich, das stimmt sogar. – Sie haben schon einen eigenartigen Sinn von Humor, die Aussies.
Um halb sieben sind wir zurück in Hobart am Hafen. Es ist Apérozeit am Elisabeth Pier. Free WIFI ist immer gefragt, da können wir ein wenig Whatsapplen und unsere Mails checken.
Lyn und Brian holen uns dort ab um Viertel vor acht und wir gehen zusammen in einem schönen, am Meer gelegenen Restaurant in Sandy Bay essen. Fisch, Austern, Jakobsmuscheln – eine feine Schlemmerei erwartet uns dort.
Selbstverständlich laden wir die beiden ein. Was sie für uns alles getan haben, ist mehr als nur aussergewöhnlich. Ich kann nicht genug rühmen: Sie haben uns vom Flughafen abgeholt (auch wieder hingebracht), sind unzählige Kilometer und Stunden mit uns herumgefahren und mit ihrem Boot herumgekurvt, um uns die Gegend zu zeigen; haben uns tagelang ihr Zweitauto benutzen lassen, haben uns irgendwo hingebracht und später woanders wieder abgeholt, haben für uns Apéros zubereitet, gekocht, Tipps gegeben, Brian hat unseren Koffer, der beim Flug so malträtiert wurde, dass er fast ein Rad verlor, so professionell geflickt, dass es bestimmt auch nach hundert Jahren noch hält und und und. - Es war schön mit ihnen zusammen zu sein, wir werden sie vermissen.
Die Muirs sind pensioniert und jetzt in diverse Wohltätigkeitsprojekte engagiert (unter anderem spricht Lyn am Radio und liest Zeitungsartikel und Bücher vor für Leute, die nicht oder nicht mehr lesen können. – Wenn sie nicht zu Hause war, konnten wir sie manchmal trotzdem aus der Küche hören). Die zehn Tage, die wir in Tassie waren, glaube ich, waren wir ihr Wohltätigkeitsprojekt…
Und schon ist wieder Zeit zum Schlafen.
Unser letzter Tag ist over the top. Brian holt sein Boot aus der Garage und wir fahren mit „Bluey“ auf dem Angänger nach Margate. Es ist ein kleines Motorboot, aber oho! Super, wie’s über die Wellen fliegt.
Wir fahren von einer Bay in die andere: Tinderbox Beach, Denn’s Point, Killora Bay - wenn’s Leute hat an einem Strand, fährt man eben zum nächsten… Das ist in unserem Fall Barns‘ Bay – dort gibt’s Kaffee und Kuchen (wir bleiben auf dem Boot und ankern). Weiter geht’s nach Ducks‘ Pond – dort gibt’s Lunch, Sandwiches, Rotwein – ein Vergnügen. Diese Bay sollte eigentlich eher Oyster Bay heissen, denn so viele Austern an einem Ort habe ich noch gar nie gesehen. Und so riesig grosse schon gar nicht.
Was für ein schöner Ort: ein einsamer Strand, der nur mit dem Boot erreicht werden kann. Niemand ist dort ausser uns. Ein Bad im klaren Wasser ist das Highlight.
Wir fahren weiter nach Quarantene Bay, wo seit einem Monat erst die historische Quarantene Station besichtigt werden kann, ein Camp, wo die Kriegsheimkehrer (erster Weltkrieg), bevor sie entlassen wurden, eine Woche lang in Quarantäne bleiben mussten, bevor sie heimkehren konnten. Die Barracken sind relativ gut erhalten. In dieser Bay treffen wir verschiedene befreundete Ehepaare der Muirs, und die einen laden uns anschliessend auf ihre Yacht zu einer Tasse Tee oder Kaffee ein.
In Cunningham Beach halten wir nicht an, es hat so viele Leute dort, dass das gar niemandem in den Sinn kommt (viele Leute = etwa dreissig).
Unterwegs sehen wir mitten in der Bay einen Seehund, der am Schlafen ist (Theo- Seal?). Lustig, wie er seine Flossen in der Luft baumeln lässt. Brian fährt ganz nah an ihn heran. Plötzlich sieht oder hört er uns – und weg ist er.
Nach 43 km Fahrt sind wir zurück in Margate. Schade, ist die Reise schon zu Ende. Ich werde sie nicht vergessen. „One more day in paradise“.
Zu Hause wird das Boot in der Garage verstaut, alles ausgeladen und wir machen uns ans Packen. Lyn hat einmal mehr nach einem feinen Apéro ein leckeres Nachtessen für uns zubereitet, und das ist dann mehr oder weniger das Ende unseres Tasmanien-Trips.
Schön war’s!!!
Lorne
24. Februar: Brian bringt uns zum Flughafen (Muir-Shuttle-Service), wir verabschieden uns herzlich; im Juli werden wir uns in der Schweiz wiedersehen.
Nach einstündigem Flug landen wir in Melbourne, wo wir unser Mietauto in Empfang nehmen. Ein weisser Toyota Corolla ist es diesmal, ohne Spinne im Aussenspiegel. Übrigens: Nicht nur unser Apex-Auto in Neuseeland, auch Lyns Auto war mit einer solchen gesegnet – es muss eine Spinnenart geben, die sich auf Aussenspiegel spezialisiert hat und offenbar gerne reist.
Die Fahrt führt uns über Geelong, wo wir an der Marina einen Halt machen, Kaffee trinken, und ein riesiges Stück Zitronentorte mit Meringue-Garnitur verzehren (fast schon eine Mahlzeit – hab vor lauter Schreck, dass das Ding so gross war, vergessen, eine Foto zu machen), über Torquay, Anglesea nach Lorne.
Unsere sechzehnte Unterkunft finden wir sofort und sehen gleich, dass wir wieder einen ausgezeichneten Tausch eingegangen sind. Paula und John Hayden sind ein sehr nettes Ehepaar, sie haben wie wir vier Kinder, etwa im gleichen Alter, und vier Enkelkinder. Ihr Haus ist grosszügig und modern gebaut und eingerichtet und nur durch eine Strasse, die Grand Ocean Road, vom Meer getrennt. Wir können auslesen, welches Zimmer wir wollen. Wir entscheiden uns für eines mit riesiger Terrasse und schöner Aussicht.
Sie zeigen uns gleich den Ort, fahren uns herum und am Strand trinken wir einen Apéro. Das fängt sehr gut an. Zu Hause gibt’s ein BBQ und dazu einen feinen Wein aus der Gegend. In Johns Weinkeller hängt ein Plakat, das zeigt, dass Humor in diesem Haus nicht zu kurz kommt:
My wife said: “Watcha doin‘ today?“
I said: “Nothing”.
She said, “You did that yesterday.”
I said: “I wasn’t finished”.
Das würde allerdings eher zu Theo und mir passen. Die Haydens sind sehr sportlich: John hat sich grad ein neues Bike gekauft; er trainiert für eine einwöchige Biketour in den Dolomiten. Auch Tennis und Golf werden gespielt, gesurft wird sowieso.
Es bleiben uns nicht sehr viele Tage hier, aber wir geniessen sie. Baden, am Strand liegen und lesen, die feinen Restaurants besuchen (es hat unzählige), la Dolce Vita, wie’s im Buch steht.
Im Fischrestaurant am Pier haben wir eine Paella gegessen, da könnten die Spanier davon lernen. Überhaupt sind die vielen Fischgerichte ein Genuss. Im Beach Pavillion, unserem liebsten Restaurant direkt am Strand, gibt’s ein Kilo Muscheln für 10 AU$. Wer könnte da widerstehen?
Auch viel Kunst gibt es zu sehen in Lorne: am Strand, in Galerien und in Restaurants. Im nächsten Monat findet eine Biennale statt; leider sind wir dann nicht mehr da.
Wir gehen auch mal ins Kino und sehen uns den viel gerühmten italienischen Film „The Great Beauty“ an. Rom – Fellini – italienisch, italienisch, italienisch – laut aber auch leise, skurril zum Teil; ich muss zugeben, ich hab etliches nicht verstanden und eine Zeitlang dachte ich auch, der Film nimmt nie mehr ein Ende. Fast wie bei Kafka. Als er dann doch eines nahm, war ich nicht ganz unfroh.
Entlang der Grand Ocean Road zu fahren, ist ein Erlebnis. Auf der kurvenreichen Strasse hat’s einen Lookout am anderen; die Küste, die zahllosen Strände und die Felsformationen sind grossartig anzusehen und obwohl wir ja schon etliche spektakuläre Küstenabschnitte gesehen haben, sind wir immer wieder begeistert.
Unterwegs hat’s auch Regen- und Eukalyptuswälder und in einem davon haben wir Koalas gesehen, wie sie in den Bäumen herumhängen. Diesmal in der Wildnis und nicht in einem Park. - Sie sind unschlagbar, diese Faulenzer, wie sie da müde in den Astgabeln kleben; ich kann mich nicht sattsehen.
Am selben Ort hat’s bunte Papageien, mit roten und blauen Federn, die ganz zahm sind und sich netterweise gut fotografieren lassen.
Auch Kakadus gibt’s. Sie sind allgegenwärtig und sehr schön anzusehen, diese grossen, weissen Papageien mit ihren gelben Hauben. In Lorne hat’s ganze Schwärme von ihnen, die vor allem gegen Abend herumfliegen und bei der Suche nach ihrem Nachtessen einen ziemlichen Lärm veranstalten. Sie haben den Ort fest im Griff. Sie lieben die Abfallstellen und sind clever und frech genug, die Deckel der grossen schwarzen Abfalleimer zu heben. Das tun sie zu zweit (einer zieht, der andere hebt), um sich dann an den Essresten satt zu fressen. John sagt, man muss aufpassen, wenn man ein BBQ zubereitet, dass sie einem nicht das Fleisch vom Grill wegstehlen.
Die letzten zwei Tage sind wir nicht mehr sehr aktiv, wir lieben den Strand und der genügt uns vollauf. Ich hatte gedacht, wir hätten langsam genug davon nach unserer langen Reise, aber das Strandleben kam zwar nicht zu kurz, war aber doch weniger ein Thema, als ich ursprünglich bei der Planung gedacht hatte.
Die Haydens sind nicht mehr da, wir haben das Haus für uns. Schade eigentlich, wir hatten’s sehr gut zusammen.
Morgen werden wir zurück nach Melbourne fahren, unterwegs auf dem Golfplatz in Anglesea Kaffee trinken und den Kängurus zuschauen, die dort ihren Wohnsitz haben. Eine Population von circa tausend Tieren ist’s, die dort leben und oft im Weg stehen, unbeeindruckt von den Golfern und deren Geschossen, so hat man uns erzählt.
In Brighton Beach werden wir unseren Koffer abholen, den wir bei Margs Nachbarn Larry deponiert haben, und dann ins Motel fahren beim Flugplatz, das ich schon vor einem halben Jahre reserviert habe.
Falls das Wetter gut ist und wir genügend Zeit haben, möchte ich das nachholen, was wir beim letzten Besuch in Melbourne verpasst haben, nämlich auf den Eureka-Tower steigen beziehungsweise „liften“, und einen letzten Blick auf die Stadt werfen, die uns so gut gefallen hat.
Das Packen macht mir diesmal weniger Sorgen, mit der Singapur Airline können wir 30 kg pro Person mitschleppen.
Farewell in Melbourne 2. März 2014
Eigentlich wären wir sehr gerne noch ein paar Tage länger in Lorne geblieben, aber auch die längste Reise hat mal ein Ende. Da der Montag regnerisch begann, fiel uns der Abschied dann aber weniger schwer. So ähnlich wie ich mir den Tag vorgestellt hatte, war er dann auch, nur noch viel schöner. Als Erstes fuhren wir auf den Golfplatz in Anglesea, um noch ein letztes Mal ein paar Kängurus zu sehen. Interessant, wie die ganze Kolonie dort lebt, quasi mitten unter den Golfern. Ohne Scheu hüpfen sie herum als wäre diese Symbiose das Allernatürlichste der Welt.
Immer noch regnete es leicht, der Himmel ganz farblos. Ohne einen weiteren Halt fuhren wir weiter nach Melbourne, wo wir gegen Mittag ankamen. Und die Sonne schien und der Himmel war blau. Wenn Engel reisen…
Und einen super Parkplatz fanden wir auch gleich, genau dort, wo wir hinwollten, gratis weil Sonntag. Wir machten nochmals einen Spaziergang durchs Stadtzentrum, welches sehr einfach konzipiert ist: ein Schachbrett wie in Amerika.
Theo kaufte sich bei Mayer in der Haushaltsabteilung seine viel bewunderten Servierzangen (zehnmal teurer als im Supermarkt), von denen er behauptet, es gäbe sie nicht in Europa (!) - Ich habe mindestens zwei davon in der Küchenschublade. - Mit diesen Dingern kann man Gemüse zielgerecht von der Servierplatte auf den Teller befördern, Grilliertes ohne sich die Finger zu verbrennen vom Grill entfernen (Theo weigert sich zwar zu grillieren) und Brotscheiben problemlos aus dem Toaster angeln (werden wir nicht mehr brauchen, wenn er den Toaster kauft, der ihn in Wellington dermassen fasziniert hat).
Wir wandelten durch die Hosier Lane, eine Strasse, die voller Graffitis ist und Touristen, die diese fotografieren.
Ja, und dann machten wir uns auf, den Eureka-Tower (fast 300 Meter hoch, circa 300 Millionen Baukosten) zu besteigen, ein Vorhaben, das wir ja schon vor fast einem Monat geplant, dann verschoben und endlich davon abgesehen hatten, weil die Fernsicht wegen der Buschbrände alles andere als optimal war. Ich hatte mich noch geärgert, dass wir diese „Must-Do-Attraction“ verpasst hatten. Jetzt muss ich sagen: zum Glück, denn einen schöneren Tag mit besserer Sicht hätten wir fast nicht finden können.
Von ‚Besteigung‘ kann man zwar nicht reden, es hat einen Lift, der einen in 40 Sekunden in den 88 Stock hochbringt (285 Meter Höhe). Wir erfahren: Dies ist der schnellste Aufzug der südlichen Hemisphäre (über 9 Meter pro Sekunde). Die Sicht von der Aussichtsplattform auf die CBD, die Vororte, das Meer ist atemberaubend.
Anschliessend fuhren wir nach Brighton Beach und machten einen letzten Strandspaziergang.
Dort hatten wir unseren Koffer deponiert bei Margs Nachbarn, mit all den Sachen drin, die wir für die letzten Wochen nicht mehr benötigten und auch all den Sachen, die wir gar nie gebraucht hatten wie zum Beispiel Theos weisse Jeans, die er gleich in dreifacher Ausführung mitgenommen hat (wahrscheinlich dachte er, Waschmaschinen seien inexistent oder zumindest sehr rar in Down Under) oder einen erstaunlich schweren Kleiderbügel, der dafür vorgesehen war, das schönste Paar Hosen, die er gar nie anhatte, ordentlich aufzuhängen. Wahrscheinlich dachte mein lieber Gatte, auch Kleiderbügel könnten Mangelware sein. – Immer diese Abwägerei mit den Kilos und dann das… Auch eine Büchse SPAM war im Koffer, mehr als nur überflüssig, fand ich, und auch diese ein zusätzliches Pfund in unserem Gepäck.
Unsere letzte Fahrt an diesem Tag führte uns ins Best Western Airportmotel, das ich schon vor Monaten gebucht hatte. Dort sortierten wir unser Gepäck neu und gingen danach zum Abendessen. Die freundliche Serviertochter brachte uns gleich Wasser und die Menukarte, dann aber vergass sie uns völlig. Wie es uns endlich gelang, ihre Aufmerksamkeit zu wecken, entschuldigte sie sich aufs Höchste und sagte, die Flasche Wein, die wir bestellt hatten, ginge aufs Haus. – Nicht schlecht. Da hat sich das bisschen Warten bestens gelohnt.
Singapur
Am nächsten Morgen hatten wir sogar Zeit, bis um neun zu schlafen. Kaffee und Tee tranken wir gleich im Zimmer und ab ging’s auf den Flughafen, eine Fahrt von fünf Minuten. Mietauto abgeben, einchecken, alles klar. Der Flug dauerte etwa siebeneinhalb Stunden, wir gewannen drei Stunden und landeten ungefähr um vier Uhr nachmittags in Singapur. Ich war sehr froh, dass ich diesen Zwischenhalt eingeplant hatte, denn anschliessend noch weitere dreizehn Stunden in einem Flugzeug zu verbringen, wäre nicht mein Ding gewesen.
Auf die Zollabfertigung sind die Singapurer stolz, und das mit Recht. Es dauerte keine 20 Minuten, bis alles erledigt war. Kein Anstehen, kein Fingerabdrucktheater wie in den USA, freundlich, effizient, die Koffer schon abholbereit, keine Probleme am Zoll; es geht also auch so.
Taxis sind billig in Singapur, der Fahrer war nett und freundlich und brachte uns in etwa 20 Minuten mitten ins Zentrum, zum Riverside Gate. An das Englisch des Fahrers musste ich mich erst wieder gewöhnen, man nennt den „Dialekt“ hier „Singlish“.
Ich war vor etwa zwanzig Jahren zum letzten Mal in dieser Stadt, hätte sie aber kaum wiedererkannt. Es hat zahllose neue Wolkenkratzer und andere Gebäude, nur das Raffels Hotel ist noch immer dasselbe.
Wir wurden sehr herzlich willkommen geheissen von Wenche und Even, unseren norwegischen Homelink-Partnern; es war dies der siebzehnte und letzte Tausch auf unserer Reise. Wir blieben vier Tage lang. Sie hatten uns angeboten, bei und mit ihnen in ihrem Apartment zu wohnen in einem der Riverside Towers im 32sten Stock mit toller Aussicht auf den Fluss und aufs Zentrum.
Am ersten Abend bereitete Wenche uns ein super feines japanisches Nachtessen zu, das wir zu fünft genossen. Ihr siebzehnjähriger Sohn Lars war ebenfalls dabei.
Even hatte mir schon zuvor eine Liste geschickt mit „Things to do in Singapur“, für die wir gut und gern einen Monat lang mindestens Zeit gebraucht hätten. So aber mussten wir aussuchen, was wir unternehmen wollten.
Am ersten und zweiten Tag kauften wir ein Ticket für den Sightseeing-Bus, hop on hop off, so verbrachten wir eine sehr lange Fahrt durch die Stadt im Doppeldeckerbus, und das gab einen fabelhaften Eindruck.
Ausserordentlich gut haben uns die beiden Dome in den „Gardens by the Bay“ gefallen. Die sensationell ausgeklügelte Bepflanzung mit Blumen, Bäumen und Sträuchern aus aller Welt ist beachtlich (speziell die Baobab) und wir verbweilten etwa drei Stunden an diesem schönen Ort.
Auch genossen wir die Fahrt durch Little India, den Spaziergang durch den Botanische Garten, im Besonderen durch den Orchideengarten und vorbei am Lotusteich sowie den „Stroll“ durch Chinatown, welche ihren asiatischen Charakter gut beibehalten hat.
Ebenso fanden wir einen Bummel durch die Geschäftsstrasse Orchard Road ganz amüsant, wo sich ein Shoppingcenter ans andere reiht und es ein Restaurant am anderen gibt. Da hat man die Qual der Wahl.
Die uneingeschränkte Gastfreundschaft, die wir auch hier wieder erleben durften, beeindruckte uns sehr: Jeden Morgen bereitete uns Wenche ein anderes Frühstück zu mit lauter feinen Sachen: Eiern, Früchten, verschiedenen (norwegischen) Käsesorten, Fleisch und Lachs. Und das Tüpfli auf dem i: Sie hat extra für uns in der Schweizer Bäckerei frisches Brot gekauft. So lieb! Sicher hätten wir ja diese drei letzten Tage noch warten können…
Das letzte Attraktionen – Multipack 6. März 2014
An unserem letzten Tag hatte ich drei Programmpunkte vor, und da hätte es fast unsere erste ernsthafte Auseinandersetzung gegeben. Am Morgen wollte ich in den Jurong Bird Park (highly recommended, world's largest) besuchen, aber so viel Programm fand Theo dann doch zu viel. Er hatte sich vorgestellt, er könne packen und den ganzen Tag am Swimmingpool liegen…
Erst am Abend um elf mussten wir zum Flughafen fahren, also war da genügend Zeit, noch etliches zu „erledigen“. – Ich also blieb hart: „Sicher nicht! – Unser letzter Tag; du kannst die ganzen nächsten Wochen ausruhen und tun, was du willst. Heute nicht!“ – Zum Glück waren meine Argumente überzeugend genug, wir schnappten uns ein Taxi und fuhren nach Jurong. Vom Taxifahrer erfuhr ich, wie das so läuft mit den vielen Taxis in der Stadt. Als Fahrer mietet man bei einem Taxiunternehmen ein Auto und muss dann pro Tag mindestens 250 km mit Gästen fahren, sonst gibt’s eine Busse. So angeordnet von der Regierung. Harte Sitten! Ferien kann der arme Kerl nicht machen, er arbeitet etwa zwölf Stunden am Tag inklusive sonntags.
Wieso der Verkehr relativ flüssig ist und es gar nicht sooo viele Autos hat, erfuhren wir auch: Wer in Singapur ein neues Auto kaufen will, muss fast 100 % Einfuhrsteuer bezahlen. Dazu kommt das Road Pricing, das offenbar gut und gern bis zu 500 S$ (ca. 350 Fr.) pro Monat kosten kann und die dritte Schikane: Man muss für ein Fahrzeug eine Lizenz kaufen. Die kann bis zu 60‘000 S$ kosten und läuft nach 10 Jahren aus. – Das ist nichts für Sparer und Geizkragen.
So ein Stündchen hätte Theo im Vogelpark bleiben wollen. Wir waren um zehn Uhr dort und um halb vier wieder zurück. Es gab viele interessante Vögel zu sehen und auch Shows konnte man beiwohnen, so dass die Zeit im Nu verflog.
Dann war da doch noch Musse für einen Schwumm und eine ausgiebige Siesta am Pool unten an „unserem“ Hochhaus.
Zwei Tennisplätze hat es dort übrigens auch, gleich vor der Haustür, und unsere Gastgeber luden mich sogar zu einem Spiel ein; das war mir aber dann doch auch zu viel am letzten Tag.
Um halb sechs waren wir parat für Programmpunkt Nummer zwei: eine Schifffahrt flussabwärts. Die Anlegestelle ist grad vor der Haustür, aber wir mussten etwa 20 Minuten aufs nächste Boot warten. Kein Problem, wir hatten ja Zeit. Die halbstündige Fahrt war sehr schön und geruhsam; vom Fluss aus zeigt sich eine ganz andere Perspektive als wenn man mit dem Bus durch die Gegend fährt.
Bei der Oper sollten wir bei den Food-Stalls essen, hat uns Wenche gesagt. Das taten wir. Sehr leckter und sehr billig war unser Abschiedsdinner.
Dann wurde es allmählich dunkler und Programmpunkt drei nahte: die Lightshow (the free outdoor Wonder Full sound and laser show at Marina Bay Sands). Der Spaziergang über die beleuchtete Brücke vorbei an der neuen Art Gallery und der Marina Bay war an sich schon fantastisch – der Himmel wurde immer dunkler, immer mehr Lichter konnte man erkennen – eindrücklich und überwältigend!
Für die Lichtschau hatte sich alsdann eine grosse Menge Leute versammelt, um dem Spektakel zuzusehen, ähnlich wie in Bern bei der Bundeshaus-Lichtshow. Hier aber wird keine Fassade angestrahlt, es werden in der Bay zwei Wasserfontänen beziehungsweise Wasserwände hochgespritzt und an diese werden Bilder und Lichtspiele projiziert. Ein Millionenprojekt offenbar, ganz imposant anzusehen, aber auch ein wenig kitschig. Uns hat’s trotzdem gut gefallen. Dazu kam die tolle Temperatur, etwa 25 Grad am Abend, kein Gedanke an eine Jacke. T-Shirt und Hemd mit kurzen Ärmeln waren angesagt.
Was war das für ein schöner Abend! Sogar Theo musste zugeben, dass es mehr als nur schade gewesen wäre, wenn wir uns „mein“ Abendprogramm hätten entgehen lassen. Für den Heimweg wär‘s am praktischsten gewesen, wieder das Boot zu nehmen, aber da hätten wir zu lange warten müssen. Ein Taxi zu finden, war allerdings auch gar nicht so einfach, alle waren besetzt. Endlich gelang es doch und kurz nach neun waren wir daheim. Nach einer guten Stunde Packen war auch das zum letzten Mal geglückt; ein zusätzliches Gepäckstück hatten wir tags zuvor in der Stadt gekauft.
Home, sweet home 7. März 2014
Wenche und Even begleiteten uns hinunter, wir bestiegen ein letztes Mal ein Taxi und waren eine halbe Stunde später schon am Flughafen. Unseren deponierten Koffer bei der Gepäckaufbewahrung holen, einchecken, Koffer abgeben (vier Gepäckstücke unterdessen - 58,5 kg), warten bis zur Boardingtime - um halb zwei Uhr morgens startete unser 13-stündiger Flug. – Das war‘s. - Eine ewig lange Nacht, nur wenig Schlaf, mehrere Filme, ein paar Mahlzeiten, und schon landeten wir morgens um acht bei minus 2 Grad und schönstem Wetter in Zürich. Theo kann endlich seinen Famous Grouse Whiskey in der Tax Free Zone kaufen.
In Bern holt uns Gino am Bahnhof ab. Zu Hause wartet uns einmal mehr eine Überraschung: Diego und Gino haben die Renovation unseres Wohnzimmers geplant, organisiert und überwacht. Alles wunderbar. Nur unsere Katze Maxi will nichts mehr mit uns zu tun haben. Wie sie uns sieht und hört, nimmt sie entsetzt Reissaus.
Unsere grosse Reise ist eigentlich zu Ende, aber doch noch nicht ganz. Wenige Tage daheim (bei schönstem Wetter), schon geht‘s weiter nach Bivio; schliesslich wollen wir ja doch noch das Skisaison-Ende in Graubünden miterleben. Und wieder darf ich schreiben: „Wenn Engel reisen...“: blauer Himmel, strahlender Sonnenschein und Schneemassen, wie wir sie selten zuvor erlebt haben. So erwartet uns die Perle am Julier.
Neue Reisepläne im selben Jahr 2014
Eigentlich ist’s ja noch nicht lange her, seit wir von unserer 5-monatigen Reise zurück sind. Aber nach einem schönen Sommer in der Heimat wird ja auch der Herbst wieder Einzug halten und eines ist sicher: Solange wir gesund sind und reisen können, will ich keinen November mehr in der Schweiz verbringen. Es wird kalt und kälter, neblig und nebliger, die Tage werden kurz und kürzer, es wird dunkel und dunkler, Schnee kann schon fallen. „Herbst-Schweiz-Flucht-Ferien“ sind es, die von nun an zu unserem Jahres-Programm gehören. Schon Mitte Oktober werden die beginnen und nicht vor Mitte Dezember zu Ende sein.
So auch in diesem Jahr.
Normalerweise planen wir individuelle Ferien, diesmal aber habe ich ausnahmsweise eine Gruppenreise gebucht. In einem Prospekt wurden Asienreisen angeboten, die mir auf Anhieb zusagten (eine Besichtigung der Tempelanlage Angkor Wat stach mir besonders ins Auge), und ich fand es auch ganz angenehm, mich für einmal führen zu lassen und nicht alles selber organisieren zu müssen. Das in einem Land, in dem ich der Sprache nicht mächtig bin und Englisch oder Deutsch vielleicht nicht überall gut verstanden werden. Man kann unglaublich viel Zeit verlieren, wenn man sich nur schlecht verständigen kann. Aber zweiwöchige Reisen kommen für uns glückliche Pensionierte natürlich keinesfalls in Frage. So buchte ich gleich zwei solche Reisen, die erste (Vietnam) nur mit Hinflug, die zweite (Vietnam, Kambodscha, Thailand) ohne Flüge. Zwischendrin ist’s mir gelungen, einen HomeExchange-Tausch zu organisieren und am Ende der zweiten Tour noch zehn Tage in Thailand „anzuhängen“. Den Heimflug buchte ich individuell.
Reisebericht Vietnam 1
Rundreise Hanoi – Halong Bucht - Da Nang – Hoi An – Hue – Saigon – Mekongdelta – (Phan Tiet) Mui Ne
Vietnam ist mir in Erinnerung geblieben, weil jeden Tag davon die Rede war. In den Nachrichten. Vom Vietnamkrieg in den Sechziger- und Siebzigerjahren: Nord- und Südvietnam, Hanoi, Saigon, Hue, Da Nang, Demarkationslinie, 17ter Breitengrad, Napalm, Entlaubung, Entmilitarisierte Zone, Vietkong, Tet-Offensive, Ho Chi Minh-Pfad etc. etc.
Jetzt sind wir hier und an den Krieg erinnern ein paar Bunker, Museen, Berichte von Reiseführern, die uns versichern, man komme mit allen Touristen gut aus, aber im Innersten seien es noch immer die Franzosen, Amerikaner und Japaner, die man hasse.
Als Tourist merkt man vom Sozialismus in Vietnam wenig bis gar nichts. Dass das Internet rigorosen Zensuren unterworfen ist, stellt man auch nicht auf Anhieb fest, aber dass die Partei nach wie vor empfindlich auf Systemkritik jeglicher Art reagiert und die Kluft zwischen Arm und Reich, zwischen Stadt und Land immer grösser wird, kann man sich gut vorstellen. Das BIP liegt bei 1‘400 $. Wer mehr als zwei Kinder hat, verliert seinen Job.
Unsere Reise beginnt am 21. Oktober
Um halb acht steigen wir in Ittigen ins Bähnli ein – eine ziemliche Herausforderung für Theo. Am Bahnhof Bern kommt er gar nicht aus dem Staunen heraus, wie viele Leute da bereits wach sind und zielstrebig irgendwohin eilen.
Seinen ersten Adrenalinstoss hat er bereits im Zug nach Zürich, wo er plötzlich merkt, dass er seine Halbtaxkarte vermisst. Er ist jetzt ganz wach. – Nicht im Portemonnaie ist sie – nein, in den Koffer hat er sie eingepackt. Klar, es ist ja alles so rasch gegangen mit dem Packen. Wir hatten nur fast zwei Wochen Zeit gehabt dafür.
Der Flug nach Singapur dauert zwölfeinhalb Stunden und vier Filme lang. Wir haben eine Viererreihe für uns allein, so dass Theo doch recht viel zum Schlafen kommt. Nach fast drei Stunden Aufenthalt geht die Reise weiter und gut drei Stunden später landen wir in Hanoi. - Wir haben ein spezielles Visum, durch ein Reisebüro in Vietnam ausgestellt; aus diesem Grund müssen wir vor den Zollformalitäten im Einreisebüro unseren Pass abgeben zwecks Stempeleingabe, Foto- und Dollarabgabe. Das dauert. Es ist Mittag und da macht man halt Pause. Im Büro hat’s sechs Arbeitsplätze und haufenweise Pässe zum Bearbeiten. Unsere roten Dokumente werden abgelegt und dann passiert gar nichts mehr. Fünf Angestellte sitzen vor dem Büro brav nebeneinander auf Plastikstühlen und essen ihren Lunch. Zwanzig einreisewillige Touristen schauen ihnen dabei zu.
Ich bin wie auf Kohlen, denn gleich werden wir unsere Reisegruppe treffen, deren Teilnehmerinnen und Teilnehmer alle ihre Stempel im Pass schon haben. Die werden auf uns warten müssen und sich wohl unbekannterweise schon eine abschätzige Meinung von uns gebildet haben.
Nach einer halben Stunde ist die Pause vorbei, gemächlich macht sich der eine und die andere Zollbeamte an die Arbeit. Unsere Pässe sind weit unten. Endlich sind wir dran. 90 Dollar kostet das Vergnügen, zwei Passfotos geben wir ab, dann sind wir entlassen ins Land der freundlichen Menschen, der Motorradfahrer, der Nudelsuppen-Esser, der fantastischen Landschaften.
Wir sind zwar die Letzten, die zur Reisegruppe stossen, aber niemand sieht uns schräg an; die andern haben sich auch gerade erst getroffen, denn sie hatten sehr lange auf ihre Koffer warten müssen. – Für uns ist dieser Teil des Ablaufs easy: Beide Koffer stehen allein und verlassen vor dem Rollband; keine Sekunde haben wir mit Warten verloren.
Hanoi
Schon geht ‘s los mit der Stadtbesichtigung. Ein freundlicher Vietnamese stellt sich vor, Hang ist sein Name, und obwohl er Deutsch spricht, haben wir anfänglich Mühe, ihn gut zu verstehen. Seine Aussprache ist gewöhnungsbedürftig und wir müssen uns sehr konzentrieren, um zu begreifen, was er meint. Wir sind alle müde und seiner netten Bitte, ihm doch Fragen zu stellen, kommt niemand nach. Er hatte zehn Jahre lang in der DDR gelebt, dort Deutsch gelernt und hat einen riesigen Wortschatz. Deutsch ist eine schwierige Sprache zum Lernen, er kann’s wirklich gut – Respekt! - Aber die Aussprache… Wie ich dann begriffen habe, dass er das „sch“ nicht aussprechen kann, geht’s schon besser. Der „Swissenhalt“ hat nichts mit uns Schweizern zu tun, ist einfach ein Zwischenhalt. – Und was es in dieser Stadt nicht alles zum „Ansauen gibt“!
Auf der Stadtrundfahrt besichtigen wir den Präsidentenpalast, das Wohnhaus des Ho Chi Minh, die Ein-Säulen-Pagode, den Literaturtempel und den Hoam Kiem See. Als Erstes fallen uns jedoch die unendlich vielen Motorradfahrer auf, die wie die Motten ums Licht in der Stadt herumschwirren. Sagenhaft. 5% Autos, würd ich mal schätzen, und 95% Mofas. Wenige Fahrräder, dafür eine ganze Menge Rikschas, die meine Prozentrechnung in Frage stellen. Das Verrückte ist, alle fahren kreuz und quer, manchmal kommt einer oder auch eine ganze Gruppe in der falschen Richtung entgegen, das stört aber offenbar niemanden. Geschickt wird ausgewichen und umfahren. Transportiert wird, was irgendwie Platz hat auf dem Gefährt, Kisten, Fässer, TV-Apparate, zusätzliche Passagiere - einer hatte gar ein anderes Motorrad, quer liegend, hinten auf dem Gepäckträger aufgeschnallt.
Kameradschaft ist: Wenn man selber auf dem Motorrad sitzt und einem Kollegen, der auf dem Velo zwei 5 Meter lange Stangen transportiert, insofern hilft, als dass man den linken Fuss hinten in dessen Velosattel einklinkt und ihn mit mehr Power als durch seine eigene Kraft durch den Verkehr stösst.
Gehupt wird ständig. Das sei Vorschrift hier. Beim Überholen müsse man die Hupe betätigen. Das erfahren wir von Hang.
Rotlichter werden teilweise befolgt, von den wenigen Autos und Bussen schon, allerdings entspricht die Situation, die auf einem T-Shirt beschrieben wird, eher der Realität, jedenfalls für sämtliche Zweiräder: Eine Verkehrsampel ist abgebildet. Bei grün: „I can go“ – Bei orange: „I can go” – bei rot: „I still can go”.
Fast alle tragen bunte Helme. Auch das sei Vorschrift, wird uns gesagt. Pikantes Detail: Die Kinder brauchen keine Helme. Bei mehr als einem Töff war eine Art Hochstuhl aus Bambus fabriziert worden und zwischen Lenkrad und Fahrersitz montiert. Dort drauf sitzt das Kind und hat beste Aussicht auf den Verkehr und lernt schon früh, wie der gehandhabt wird. Fast alle Fahrerinnen und Fahrer tragen eine Gesichtsmaske. Klar, die Abgase würden sie ja sonst fast ersticken. Farbig sind ihre Kleider. Ob Muster und Farben zueinander passen, spielt keine Rolle. Hauptsache, bunt.
Das grösste Problem ist, durch diesen Verkehr hindurch über die Strasse zu gelangen. Wir erhielten eine Art Kurs von Hang. Man geht zielstrebig los und bleibt keinesfalls stehen oder verändert sein Tempo. Das braucht Mut! Aber es funktioniert bestens, wenn man die Sache beherzt angeht. Mir ist’s nur einmal passiert, dass ich stehenblieb, weil mich angesichts des nahenden und heftig hupenden Mofas plötzlich der Mut verliess. Das wäre beinahe schief gegangen. Die Fahrerin musste bremsen und fiel fast vom Sattel. Wäre ich weitergegangen, hätte sie problemlos an mir vorbeigekurvt. Die haben eine Art Ortungssystem in ihrem Hirn, habe ich das Gefühl. Wie Fledermäuse, Fische oder Vögel in einem Schwarm.
Kein Wunder dürfen Ausländer in Vietnam keine Autos fahren. Motorräder schon.
Fasziniert beobachten wir später den Verkehrsfluss auch vom Restaurant aus, wo wir am ersten Abend essen gehen. Wir suchten es aus, weil’s vom fünften Stock aus eine sensationelle Aussicht hat auf einen belebten Platz in der Nähe des Sees. Wir werden nicht müde, dem Spektakel im Kreisverkehr zuzuschauen.
Der Verkehr läuft bestens und die Fussgänger überqueren den Platz nicht etwa an der engsten Stelle, nein, etliche schlendern gemütlich mitten durchs Verkehrschaos quer hindurch, wo der Weg am längsten ist, so dass sie möglichst etwas davon haben. So wenigstens scheint es uns.
Natürlich haben wir uns auf unser erstes echt vietnamesisches Essen gefreut. Leider geht das ein wenig schief, weil ein Restaurant mit solcher Aussicht wohl eher etwas für Touristen ist. Vietnamesen essen auf dem Trottoir, auf ihren obligaten roten Plastik(kinder)stühlen oder sie hocken auf dem Boden.
Jedenfalls machen wir dort unsere ersten einschlägigen Erfahrungen mit der Sprache. Auf der Karte hat es auch eine vietnamesische Ecke. Sehr vietnamesisch scheint mir der dort angepriesene Hamburger allerdings nicht zu sein. Wir bestellen ihn dann doch, aber wollen keine French Fries, sondern Reis dazu. Unsere Kellnerin versteht beim besten Willen nicht, was wir meinen (ist NO mit entsprechenden Gebärden sooo schwierig zu verstehen?). Es wird ein Kollege hinzugezogen und schliesslich noch ein dritter Kellner, bis wir endlich das Gefühl haben, jetzt hat’s geklappt, denn es wird heftig genickt. - Was wir dann erhalten, sind unsere Hamburger mit ZWEI Portionen Pommes Frites. – Na ja. – Schlacht verloren. So viel zu unserem ersten Abendessen in Hanoi. Gerne würde ich ein Trinkgeld hinlegen, aber nicht grad 100‘000 Dong, einen Fünfliber. An der Kasse kann sie mir diese Note aber nicht wechseln.
Einen weiteren Spiessrutenlauf durch den Verkehr ertrage ich nicht mehr; ein Rikschafahrer bringt uns ins Hotel zurück, wo ich sofort einschlafe und nicht mal mehr Theos Schnarchen höre.
Unterwegs in die Halong Bucht
Früh geht’s los am nächsten Morgen. Die Halong Bucht, UNESCO Weltnaturerbe seit 1994, ist das Ziel. Um acht Uhr sind wir alle parat und stehen vor dem Hotel. Auch das Gepäck steht bereit am Strassenrand. Die Polizei auch. Die Beamten händigen dem Busfahrer, der dort eben ein paar Passagiere aufnimmt, grad eine Busse aus, denn vor dem Hotel darf man nicht anhalten. Und was ist mit unserem Bus? Der darf auch nicht anhalten. Was tun? Er wäre auch parat, der Fahrer hat aber offensichtlich keine Lust, eine Busse zu riskieren. Also dreht er Runden in der Hoffnung, die Polizisten verschwinden irgendwann mal. Aber denen verleidet’s vorerst noch nicht. Kein Wunder. Die sehen ja genau, was da abgeht: Neunzehn Touristen, über zwanzig Gepäckstücke und ein Reiseleiter stehen da und wollen abgeholt werden. Völlig klare Situation. Warten bringt’s. Also machen wir noch ein Spaziergängli. Der Bus dreht weiterhin Runden und der Reiseleiter gibt dem Buschauffeur per Handy laufend die Lage durch. Nach zwanzig Minuten ziehen die Beamten ab, vielleicht sind sie zu einem lukrativeren Ort abgezogen worden, vielleicht verlangt ihre Dienstvorschrift eine bestimmte Patrouille oder die Lust zu warten ist ihnen schliesslich doch vergangen. Wer weiss? Kaum sind sie weg, schon ist der Bus da, die rote Flanke des Fahrzeugs wird geöffnet, die Koffer werden in Windeseile in dessen Bauch einverlebt und los geht’s.
Unterwegs gibt’s immer wieder mal einen Halt zwecks Besichtigung eines Tempels und dessen Toilettenanlage oder es bietet sich ein schöner Lookout oder der Reiseführer sichtet schon von weitem einen BMW (Bauer mit Wasserbüffel).
Tags zuvor bereitet uns Hang bereits auf das bevorstehende Erlebnis vor. Er ist mehr als nur besorgt um unser Wohlergehen. Rührend! - Er sagt, es wäre wohl einfacher, für die einzige Übernachtung nicht das ganze Gepäck auf die Dschunke mitzunehmen, es sei überhaupt kein Problem, die grossen Koffer im Bus zu lassen, die seien dort vom Fahrer und vom Beifahrer bestens gehütet. Aber natürlich, wer gerne sein ganzes Gepäck dabei habe, das sei auch kein Problem, es habe in der Kabine genügend Platz, aber man könne die Koffer wirklich ohne Weiteres im Bus lassen etc. etc. Auf dem Weg an die Küste erklärte er nochmals alles ganz genau, wie das sei mit und/oder ohne Koffer. Wenn er Berndeutsch gekonnt hätte, hätte er nur zu sagen brauchen: „Machet doch mit dene Gofere, was dr weit!“
Hangs Art und Weise sich auszudrücken, ist äusserst freundlich. Er will es uns immer recht machen, versucht aber, wie bei den Koffern, durch die Blume mitzuteilen, was er gerne möchte.
So erklärt er bei einem kurzen Swissenstop: „Hier können Sie 15 Minuten Pause machen, also sagen wir lieber 13“. Nett war auch seine Aussage zum Stromverbrauch des Landes: „Wir bauen Atomkraftwerke. Ein bisschen (sein Lieblingswort) gefährlich, aber es muss sein“.
Auch hat’s manchmal Neukreationen in seiner Sprache, was ich allerding sehr charmant finde, wenn’s dann auch manchmal mit dem Verständnis leicht hapert. Und ja, wieso heisst’s eigentlich nicht „Einpflanzerung“? – könnte ja sein.
Immer schaut er wie ein Border Collie, dass er seine Herde beieinander hat. Wie Theo mal grad nicht neben mir geht, was ja doch öfter mal vorkommt, fragte er mich sogleich: „Haben Sie Ihren Mann verloren?“ - Auch beim Frühstück, mit Blick auf Theos leeren Stuhl, will er wissen: „Schläft er noch?“ - So viel Fürsorge. Wirklich nett!
Halong
Für unsere Gruppe ganz allein wurde ein sehr schönes und gemütliches Schiff ausgewählt, die „Garden Bay“. Eine äusserst freundliche Crew verwöhnt uns mit Speis und Trank. Wir lernen, wie man frische Frühlingsrollen zubereitet, erhalten Unterricht im Gemüse-Schnitzeln und eine hübsche Kabine erwartet uns zur vorerst nur kurzen Siesta. Per Boot (zu zweit oder zu viert - wir werden von einer Vietnamesin gerudert) machen wir nach dem Mittagessen eine Rundfahrt durch einen kleinen Teil der Tonkin Bay entlang der beeindruckenden Kalkfelsen, die hoch aus dem Meer herausragen und vorbei an Fischerdörfern beziehungsweise -siedlungen, die auf dem Wasser schwimmen.
Ein reger Handel findet statt, alles Mögliche wird auf den Booten angeboten, nicht nur Lebensmittel. Ein spezielles Leben muss das sein für die Menschen dort.
Etwas vom Schönsten an diesem Tag aber war dann vor dem Apéro das Schwimmen um unser Schiff herum im warmen Meer. Was für eine herrliche Abkühlung trotzdem.
Am nächsten Morgen besichtigen wir eine Höhle – Stalaktiten und Stalagmiten – riesig, gut ausgebaut und beleuchtet.
Leider ist das Wetter nicht ganz so wunderbar, so dass auf unseren Fotos der blaue Himmel fehlt. Wir haben die beiden Tage auf dem Schiff aber trotzdem sehr genossen und das Gute dabei war auch, dass wir, unsere Reisegruppe, sich ein wenig hat kennenlernen können.
Wir haben grosses Glück: Alles nette Leute aus verschiedenen Teilen der Deutschschweiz. 19 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir hatten‘s durchwegs bis am Ende der Reise sehr gut zusammen, hatten viel Spass und die meisten gingen jeweils zusammen essen. – Eine typisch schweizerische Gruppe: Niemand kam je zu spät, niemand hat sich beschwert, alle waren „easy drauf“. Wunderbar. Tan war einer der Teilnehmer (wie „Tannenbaum“, aber nach dem ersten „N“ kannst du’s sein lassen). Er wohnt in der Schweiz, hat aber keine schweizerischen Wurzeln, wurde in einem Dorf im Norden von Hanoi geboren, lebte dort während sieben Jahren und besuchte nun sein Heimatland nach 49 Jahren zum ersten Mal. Wenn er dabei war, ging’s einfach, er sprach und verstand die schwierige Sprache.
Apropos Sprache: Die ist wirklich nicht einfach zu lernen. Wie Hang erzählt, ist die Grammatik einfach, alle Verben werden in der Grundform verwendet und wenn etwas in der Vergangenheit passierte, ergänzt man den Satz einfach mit einem Wort ähnlich wie „schon“. Das wär dann also etwa so: „Ich schon essen.“ – Ein Kinderspiel! Aber dann die Aussprache! Dort wird’s unüberblickbar: Dasselbe Wort hat verschiedenen Bedeutungen, je nachdem wie man es ausspricht. So gibt’s nur ein Wort für langes Kleid und Büstenhalter sowie für drei verschiedene Früchte. Ebenfalls werden Schwiegermutter und Hexe gleich geschrieben aber anders ausgesprochen. Ist’s ein Zufall? Da muss man ja höllisch aufpassen.
Geschrieben wird die Sprache mit einer Unmenge an verschiedenen Sonderzeichen, ähnlich wie im Französischen, aber viel komplizierter. Das Cédille kommt auch oben am Buchstaben vor, manchmal sind Buchstaben gleich mit zwei oder gar drei Zeichen verziert, eines unten, zwei oben – auch auf der Seite gibt es welche. Und wie das dann tönt! Nicht so, wie wir das lesen. Der Ort, wo wir jetzt sind, wird so geschrieben: Phan Tiet. Das Girl an der Rezeption hat mich gelehrt, wie man das ausspricht. Ganz zufrieden war sie zwar nicht (vielleicht Berndeutscher Accent?): Fan Tiiii (letzte Silbe ganz hoch betonen!)
Bisher hab ich nur zwei Wörter gelernt: Eines geht ganz einfach: „Xin chào“ („Sin tschau“ - schreib ich jetzt mal so, wie’s für mich tönt). Hallo. Guten Tag, guten Morgen, Abend oder was auch immer.Das andere ist noch einfacher: „C%u1EA3m %u01A1n“ („Cam on“). Da muss ich immer an Roger Federer denken. Das Wort heisst „danke“. – Ich hab dann noch gefragt, was „bitte“ heisst. Das komme sehr auf die Situation und auf die Aussprache an. – Dann vergess ich’s lieber und sag einfach „please“. Wer’s nicht begreift, würde mich wohl so oder so nicht verstehen. Es geht mir ja gleich beim Soda-Wasser, das ich im Restaurant jeweils gerne bestelle. Wenn ich Glück habe, versteht mich der Kellner oder die Kellnerin, strahlt dann und sagt: „Sodaa“. Der Unterschied macht’s eben aus. Vielleicht hab ich das A am Ende nicht ganz hoch und lang genug ausgesprochen. „With ice“ will ich’s dann noch. “Ah, Ei“, sagen sie. Das geht sehr viel besser. Ein riesiger Klumpen Eis kommt jeweils, der fast das ganze Glas ausfüllt.
Hang hat ein grosses Wissen und er erzählt viel und gern. Auch von den Toten. Vom „Zwei-Mann-Begräbnis“. So hab ich’s jedenfalls verstanden, und nicht nur ich. In meiner Phantasie hab ich mir gleich vorgestellt, man müsse noch einen zweiten Toten suchen, wenn jemand stirbt. – Dem ist nicht so. Richtig wär: „Zweimal-Begräbnis“. Also das geht so (sehr kurze Kurzversion): Wenn jemand stirbt, wird er in der Wohnung während dreier Tage aufgebahrt. Die Idee dahinter ist (gemäss Hang), dass man sicher ist, dass er oder sie auch wirklich tot ist. Dann wird der Leichnam in einem weissen Tuch begraben. Nach frühestens einem Jahr werden in einem religiösen Zeremoniell, das noch wichtiger ist als die Erstbestattung, die Knochen aus der Erde geholt, gereinigt, und für die Ewigkeit im Familientempel aufbewahrt. Der liegt oft auf dem Reisfeld der Familie. - Es müssen wirklich alle Knochen sein, sonst wird das nichts.
Der Totenkult ist extrem wichtig in diesem Land. Geburtstagsdaten kann man getrost vergessen, aber nicht das Datum des Todes. Bis drei Generationen vorher müssen die Ahnen verehrt werden und das ist vor allem auch Sache der Schwiegertochter, all diese Daten zu kennen und zu verwalten.
Es scheint eine ziemliche Bürde zu sein, aber wer da nicht mitmacht, wird verachtet. Eine Zeitlang war dieser Kult von der Regierung verboten worden, jetzt ist er wieder erlaubt.
Kranksein scheint auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei: Hang erzählt, dass wegen Platzmangels in den Spitälern die Betten normalerweise doppelt belegt werden. Die Verpflegung der Patienten ist auch nicht gewährleistet, die muss von den Angehörigen bestritten werden. – Ich hab vergessen zu fragen, wie’s denn mit dem Spitalkäfer sei…
Hoi An
Am Freitag Flug nach Da Nang. Auf dem Programm sind zwei Übernachtungen in Hoi An, einer alten, ausgesprochen hübschen kleinen Handelsstadt (75‘000 Ew.) in Zentralvietnam, UNESCO-Weltkulturerbe seit 1999. Die Altstadt ist erhalten geblieben; es ist die einzige in Vietnam, die nicht im Krieg zerstört wurde.
Des Nachts, wenn alle Laternen leuchten und ein reges Leben herrscht rund um den Fluss Sông Thu B%u1ED3n herum, bei der japanischen Brücke, auf den Strassen und in all den netten Restaurants entlang der Promenade, ist’s besonders gemütlich. Wenn dann allerdings der Regen sintflutartig einsetzt, nicht mehr so. Zum Glück gibt’s Taxis. Es ist deren liebste Zeit; sie haben Hochbetrieb.
Hoi An hat einen malerischen, lebendigen lokalen Markt, viele Cafés, Restaurants und eine ganze Menge Geschäfte. Unser hiesiger Reiseführer Noggi (oder wie auch immer – er hat uns den Namen erklärt: Das war eine längere Episode und die Quintessenz, weil die Touristen das immer falsch aussprechen würden, bot er uns eben dieses „Noggi“ an) führte uns in ein Schneideratelier, wo sie Seidenraupen züchten und Kundenwünsche. Unsere Reisegruppe hat kräftig zugeschlagen. Ganze Anzüge, Winterjacken, Hosen, Hemden, Blusen wurden bestellt, alles auf Mass, gefertigt aus auserlesenen Stoffen und für unsere Verhältnisse spottbillig. Unglaublich, wie die Schneider rasch arbeiten. Alles war am Abend bereits parat, fünf Stunden nachdem die zahlreichen Aufträge erteilt worden waren. Allfällige Änderungen wurden während der Nacht erledigt und am Morgen früh ins Hotel geliefert. Alles passte bestens, alle waren zufrieden.
Es geht nicht nur um Shopping und Essen in Hoi An, nein, wir besuchen auch das ehemalige Wohnhaus einer Kaufmannsfamilie und die Versammlungshalle der chinesischen Gemeinschaft, ein Tempel, wo wir mit einer neuen Art von Räucherstäbchen konfrontiert werden. Eigentlich sind’s nicht Stäbchen, sondern Riesenspiralen, die zu Dutzenden an der Decke hängen. Man kann einen Wunsch aufschreiben und diesen Zettel (gelb muss er sein) in deren Mitte hängen. Dann wird die Spirale angezündet. Das Geniale dabei ist, sie brennt während dreier Monate, so dass also der Wunsch sehr viel grössere Chancen hat, erfüllt zu werden als bei einem lächerlichen Räucherstäbchen, das nur grad einen Tag lang brennt. Selbstverständlich muss man sich das aber etwas kosten lassen. Die Spirale kommt auf umgerechnet 25 Franken zu stehen.
Da Nang und Hue
Am folgenden Tag fahren wir über die Drachenbrücke nach Da Nang. Dort besichtigen wir zuerst das Cham-Museum, wo wir ausführlich über die Gegend und die Geschichte der Region informiert werden. Anschliessend gibt’s einen kurzen Halt am Strand in Da Nang (ehemals China Beach, wo sich die amerikanischen Soldaten ausgeruht und vergnügt haben und wo jetzt Luxushotels die Promenade säumen) und gleich geht’s weiter über den Wolkenpass (496 m). Guter Name: Man sieht schon von weitem, dass auf dem Gipfel Nebel herrscht.
Hue ist unser nächstes Ziel. Wir besuchen zuerst das Wahrzeichen, die Thien Mu-Pagode (Pagode der himmlischen Frau), ebenfalls UNESCO Weltkulturerbe seit 1993 und machen anschliessend auf dem Perfume River, dem Fluss der Wohlgerüche (Song Hurong), eine Flussfahrt in einem Drachenschiff. Eindrücklich und sehr schön die Pagode, erholsam die Bootsfahrt, obwohl nicht alle von uns grad begeistert sind von der jungen Frau, die uns aus einem nicht mehr enden wollenden Arsenal von Souvenir-Angeboten irgendetwas andrehen will, egal was. Darunter zum Beispiel einen ca. 20 cm langen, am Boden herumrobbenden, wild um sich schiessenden amerikanischen Plastik-Soldaten, ausgerüstet mit rotem Blitzlicht. Unnötig zu erwähnen: Den will niemand kaufen.
Der Kaiserpalast in Hue ist am nächsten Tag auf dem Programm, nachdem unsere ganze Reise-Gruppe per Rikscha dorthin gefahren wird. Mitten durch all den Verkehr, der allerdings nicht halb so wild ist wie in Hanoi. Trotzdem: Was für ein Anblick - all die herumgekäreleten Touris. Und urplötzlich, wie aus dem Nichts, taucht auch ein Fotograf vor uns auf, der, breit lächelnd, ein paar einschlägige Fotos schiesst, immer mal wieder, ich weiss nicht, wie er das schafft. Und 20 Minuten später, wir sind grad erst am Ziel angekommen, schon wieder im Grüppchen um Noggi herum, aufmerksam seinen weitschweifenden Ausführungen lauschend, kommt er bereits mit den Abzügen daher. - Jeder versucht eben auf seine Weise, zu einem Verdienst zu kommen. Wenigstens hat die Zeit nicht gereicht, die Fotos auf die obligaten in Asien üblichen grässlichen weissen Plastikteller zu applizieren. Die Fotos kaufen wir ihm natürlich ab. Unterbelichtet, mega-dünnes Fotopapier, aber eben… Mein Souvenir zerlege ich im Hotel später kurzerhand in kleine Fötzeli und versorge es im Rundordner. Theo, wie immer, war zwar sogar da recht fotogen drauf.
Lange lässt sich Noggi Zeit, uns im Kaiserpalast und in der verbotenen Stadt alles zu erklären. Und das ist viel. Viele Kaiser, viele Konkubinen (bei einem waren’s 142), viele Kaisermütter und –gemahlinnen, viele Anekdoten, viel Geschichte, viel, viel, viel. Sein Wissen erscheint unerschöpflich, sein Stehvermögen auch. Interessant ist’s alleweil, aber manchmal, so lange in der Sonne bei mehr als 30 Grad um ihn herumzustehen und vollgetextet zu werden…
Auch Noggi hat in der DDR Deutsch gelernt. Er ist enorm eloquent und hat wie Hang einen grossen Wortschatz. Anfänglich haben wir das Gefühl, wir verstünden ihn besser als Hang, aber das ist wohl eher, weil wir inzwischen weniger müde und allmählich an die Lautverschiebungen gewohnt sind. Irgendwas erzählte er tags zuvor im Bus mal von einem „Krapp“, wahrscheinlich etwas mit Krabben dachte ich, aber es stellte sich später heraus, er sprach von der Grab-Anlage des Kaisers Tu Duc (de.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B1_%C4%90%E1%BB%A9c">T%u1EF1 %u0110%u1EE9c), die wir besichtigen würden. Den Namen des Kaisers sprach er auch (für meine Ohren) seltsam aus, eben vietnamesisch. Es tönte wie eine einzige Silbe „Tdc“ etwa, und er spuckte den Namen mehr aus als dass er ihn sprach. Das bereitete mir ebenfalls ein wenig Mühe. Dank Wikipedia kam ich dann aber doch dahinter, worum es ging.
Dieser Kaiser hatte vorher bereits 16 Jahre lang in dieser Anlage gelebt, schön mit Teehaus, See und kleiner Insel, wo er, wie uns erzählt wurde, vom Ufer aus auf Kaninchen schoss. Auch lebte er dort mit etlichen Konkubinen, zwei davon mussten offenbar jeweils morgens in der Früh den Tau von den Blättern einsammeln, damit er sich Tee aus Morgentau zubereiten lassen konnte. Ja, die Herrscher damals hatten tolle Ideen. Heute ja auch, wenn man zum Beispiel an Nordkorea und „unser“ in Köniz ausgebildetes, im Moment hinkendes Staatsoberhaupt denkt…
Der Sarkophag in der Anlage war allerdings leer, liess uns Noggi wissen, aus Angst vor Grabräubern habe man den Kaiser irgendwo verscharrt, man wisse jetzt aber nicht mehr, wo. Na ja… Das Ganze erinnert mich ein wenig an die Eichhörnchen, die ja auch ihre Nüsse vergrabe und dann nicht mehr wissen, wo. – Vielleicht hinkt der Vergleich zwar ein wenig…
Dort, in der Krapp-Anlage, haben wir, Theo und ich, es fotografierenderweise fertig gebracht, die Gruppe zu verlieren. Wie wir sie wiedergefunden haben, hat uns Edgar zurück zu den sehenswerten Orten geführt und zusammengefasst, was Noggi den anderen wortreich mitgeteilt hat. Was für eine angenehme Erfahrung: Alle Informationen auf Schweizerdeutsch, deutlich und konzis.
In dem Zusammenhang: Eine von Noggis Eigenheiten ist es, etwas zu erzählen und dann in die Runde zu fragen: „Wissen Sie warum?“ – Manchmal lässt sich jemand auf eine Spekulation ein, aber meistens stehen wir nur dumm da. Er hat sein Erfolgserlebnis und kann’s dann erklären. Er lüftet sozusagen das Geheimnis, lässt die Katze aus dem Sack. – So wird die Geschichte spannend! Vielleicht hat er das in einem Lehrerfortbildungskurs gelernt…
Bevor wir ins Hotel zurückkutschiert werden, besuchen wir noch eine kleine Räucherstäbchen-Werkstatt. Auch die all überall beliebten Sonnenhüte werden dort geflochten.
Zudem findet Theo hier mit Noggis Hilfe auch seinen originalen Vietnam-Coffee-Filter, ein kleines Gefäss aus Aluminium, eine Art Mini-Löchersieb, das auf die Tasse gestellt wird. Durch dieses Ding rinnt der Kaffee in zäher Langsamkeit ins Glas. Das ergibt eine Art Ristretto. Der Vietnam Coffee wurde in der Gruppe immer beliebter, wird aber nicht überall gleich serviert. Hauptsache: starker vietnamesischer Kaffee und am Boden der Tasse eine Lage gezuckerte Kondensmilch – nichts für Leute, die an Decaf gewöhnt sind. Detail: Wenn man nicht sagt, man möchte einen heissen Kaffee, wird einem oft ein kalter serviert in einem Glas mit Röhrli und zehn Eiswürfeln. Monica hat von der besseren Geschirr-Ausführung gleich zehn Stück mit nach Hause genommen inklusive zwei kg vietnamesischen Kaffee. – Da bin ich also glücklich zu einer Neuanschaffung in unserem Haushalt gekommen, welche genauso herumstehen wird wie die Schöpfzange, die auf unserer vorletzten Reise in Melbourne unbedingt hatte gekauft werden müssen, obwohl sie in zweifacher Ausführung bereits vorhanden ist. Zuhause wird ja dann Herrn Clooneys Kaffeemaschine wieder Trumpf sein.
Monica ist übrigens noch der grössere Kaffeefan als Theo. Sie hat ein ganzes Glas Nescafé von zu Hause mitgenommen und zwei Tuben gezuckerte Kondensmilch. Da sie nun all das gar nicht braucht und es nicht wieder mit heimnehmen will, „erbt“ Theo beides und ist glücklich. Die Kondensmilch überlebt die nächste Woche nicht.
Um halb sechs wird’s fast von einer Minute auf die andere stockfinster. Also bringt uns der Bus zurück ins Hotel. Nach einer kurzen Siesta lassen wir uns in einem hübschen Gartenrestaurant kulinarisch verwöhnen. Grad bevor der nächste Regenguss kommt, sind wir zurück.
Saigon oder Ho-Chi-Minh-Stadt
Am Dienstag, dem 28. Oktober, fliegen wir von Hue nach Saigon. Nur eine Stunde dauert der Flug.
Wieder ein neuer Reiseleiter, wieder mit einem u-komplizierten Namen, der sich schliesslich auf Don reduzieren lässt. Stadtrundfahrt und Spaziergang durch die ehemalige Hauptstadt: Historisches Museum (Ho-Chí-Minh-Museum), Kathedrale Notre Dame (von den Franzosen dem Pariser Vorbild „nachgebaut“), altes Postgebäude, Opernhaus, Rathaus. Den Ben Thanh Market mitten in der Stadt besuchen wir ebenfalls. Stickig ist’s dort drin und heiss. Die gedeckte Markthalle ist ein riesiges Labyrinth mit Dutzenden von kleinen und kleinsten Shops, die alle etwa dasselbe verkaufen, nämlich T-Shirts, Stoffe, Hüte und immer wieder T-Shirts. Theos neues Tommy-Hilfiger-Shirt stammt auch von dort.
Unser Hotel, das Signature Hotel, ist dort ganz in der Nähe, und am Abend essen wir in einem Strassen-„Restaurant“ neben dem Markt. Wir setzen uns, obwohl wir die ersten dort sind, was ja immer ein wenig suspekt ist. Es dauert jedoch keine zehn Minuten und die Bude ist voll. Ungefähr hundert Gäste sind’s mindestens. Der Service ist rapid und sehr freundlich. Die Strassenküche mit ihren etwa fünfzehn Köchen arbeitet auf Hochtouren. Es hat auch Angestellte, die den Gästen die Crevetten und anderes Meergetier schälen und hübsch wieder präsentieren. Wer hätte das gedacht! Schliesslich ist’s ja nicht grad ein 5-Stern-Lokal. Wein gibt’s jedenfalls keinen. Bier schon. In rauen Mengen.
Mekong-Delta
Am nächsten Tag fahren wir ins Mekong-Delta. In der Stadt My Tho besteigen wir ein Schiff und fahren entlang von Inseln, durch Kanäle, an Fischerdörfern vorbei. Eine Fahrt mit einem kleineren Boot durch einen engeren Kanal wird uns auch geboten, sogar eine kurze Fahrt auf einer Pferdekutsche. Darauf hätt‘ ich zwar fast lieber verzichtet, denn die Tiere tun mir jeweils leid bei solchen Unternehmungen.
In einem Fischerdorf werden uns Honigtee und Früchte serviert. Wir können bei der Täfeli-Produktion zusehen. Diese werden unter anderem aus Kokosmilch und Erdnüssen hergestellt, und das Resultat ist eine Art Karamell. Der Teig wird ausgewallt, in keine Quadrate geschnitten, mit einem feinen Reispapier umwickelt, das man mitsamt dem Bonbon essen kann, und schliesslich in ein Papier verpackt. Die ganze Produktion (vier Leute sind an der Arbeit) geht rasend schnell vonstatten und der Kauf danach ist selbst für mich ein Muss. Sie kleben so herrlich an und zwischen den Zähnen und haben ein absolutes Abhängigkeits-Potenzial.
Im Verkaufslädeli wird auch Schlangenschnaps angeboten. Theo probiert freiwillig davon aus der 5l Flasche, gefüllt mit Reptilien – mit wird fast schlecht.
In einem idyllischen Restaurant erhalten wir ein fabelhaftes, liebevoll präsentiertes Mittagessen. Elefantenohr-Fisch gibt’s unter anderem, schön zubereitet vom Personal (Plastik-Handschuhe!) und in frischen Frühlingsrollen serviert.
Zurück in Saigon
Wir haben noch ein wenig Zeit. Theos Siesta ist immer einmal mehr zu kurz gekommen, aber bald gibt’s ja Ferien. Ab morgen…
Da sich an meinem Laptop der Cursor via Touchpad nicht mehr bewegen lässt, will ich eine Maus kaufen, um den Schaden zu umgehen. Don hat uns gesagt, wo ein solches Geschäft zu finden ist. Wir machen uns also auf zum Mauskauf. Das wird ein Erlebnis der besonderen Art. Es beginnt zu regnen, grad wie wir beim Laden ankommen. Nguyenkim ist so etwas zwischen Interdiscount und Mediamarkt.
Wir finden die Maus; sie kostet umgerechnet vier Franken. Aber wir dürfen sie nicht einfach so nehmen und damit zur Kasse gehen. Nein, da braucht’s zuerst einen Verkäufer, der ein Formular ausfüllt, hinschreibt, was ich kaufen will und mein Name muss auch vermerkt werden. Mit diesem Zettel dann geh ich zur Kasse. Vor mir ist nur eine Kundin, die am Zahlen ist, aber ich nehm’s jetzt vorweg: Es dauert geschlagene zwanzig Minuten, bis ich auf meinem Beleg den Stempel habe, der beweist, dass ich bezahlt habe. Das Girl an der Kasse muss nämlich alles in eine Tastatur eintippen und das dauert. Hinter mir hat sich eine ganze Schlange von Kunden gebildet, die auch bereits ihr Formular und die Geldscheine abgeben. Das ganze Prozedere erinnert mich an die Zoll- bzw. Visum-Formalitäten in Hanoi. Kompliziert muss es sein. Erst wenn alles fein säuberlich erledigt ist, kann ich „meinen“ Verkäufer wieder suchen und er gibt mir endlich, was ich kaufen will.
Ja, und jetzt kann ich eben auch wieder meinen Bericht schreiben, den zu verfassen ich vorher so oder so gar keine Zeit gehabt hätte.
Es hätte auch noch länger dauern können an jener Kasse. Das wär ziemlich egal gewesen, denn inzwischen ist der Regen so stark geworden, dass an ein Weitergehen nicht zu denken ist. Es giesst wie aus Kübeln. Wir setzen uns vor den Laden auf die Treppe und warten auf bessere Zeiten. Inzwischen fragt (Gebärdensprache) der Wachtmann, ob er mal Theos e-Zigarette ausprobieren dürfe. Er zieht, hustet und gibt sie ihm unergründlich lächelnd zurück.
Alle zehn Minuten findet Theo, es regne jetzt weniger und wir könnten doch nun endlich gehen. Aber erst nach einer halben Stunde willige ich ein. Noch immer tropft es von den Dächern und Bäumen und gegen die riesigen Wasserlachen auf den Strassen gibt’s auch kein Mittel.
Wir finden schliesslich eine nette Grill-Bar, ganz trendig, wo wir ein feines Nachtessen erhalten, wieder mal ein Stück Fleisch mit Kartoffeln für Theo, ganz unasiatisch. Der Buddha auf dem Tisch schaut zu.
Eine weiter unasiatische Mahlzeit hat Theo später in Mui Ne gegessen: Spaghetti Carbonara. Leicht süsslich. Wurde wohl mit gesüsster Kondensmilch verfeinert. – Selber schuld!
Phan Thiet / Mui Ne
Am nächsten Morgen geht’s bereits um acht Uhr los. Per Bus nach Phan Thiet. Die Strecke ist ca. 200 km lang, aber Don hat uns gedanklich auf eine mindestens fünfstündige Busfahrt vorbereitet. Sechs Stunden dauert sie dann tatsächlich mit zwei kurzen Halten zwischendurch. Vorbei an Hunderten von Reisfeldern führt sie. Erst gegen Süden wechselt der Anbau und es sind Dragon-Fruit-Plantagen, die kein Ende nehmen.
Vorbei an den Fischerhäfen von Phan Tiet und Mui Ne mit ihren zahllosen farbigen Fischerbooten und -körben erreichen wir endlich am frühen Nachmittag unser Hotel, „Sailing Bay“. Dort nun beginnen unsere Bade- und Erholungs-Ferien von der Rund- und Stress-Reise. Theo kann endlich wieder ausschlafen, allerdings nicht zu lang: Frühstücksbuffet gibt’s nur bis halb zehn.
Das Hotel ist sehr schön ausgestattet mit modernen, grosszügig konzipierten Zimmern, mit tropischem Garten und riesigem Swimmingpool – hier kann es uns wohl sein. Leider ist es ein wenig weit weg vom Geschehen; das nächste Dorf, Mui Ne, mit vielen Restaurants und Lädeli ist etwa 20 Minuten Fahrt weit weg. Es gibt aber einen Shuttle-Service und Taxis.
Was wir alle ein wenig seltsam fanden, ist die Tatsache, dass man nach zehn Uhr abends nichts mehr zu trinken bekommt. Keine Bar - man ist quasi dazu verdammt, aufs Zimmer zu gehen und dort eventuell einen Tee zu trinken, wenn man nicht vorgesorgt und wie Theo immer eine Flasche Whisky dabei hat.
Besonders gefallen hat uns aber das jeweilige nachmittägliche Spektakel am Strand: Da kommen im Abstand von etwa einer Viertelstunde drei bis fünf Fischerboote ziemlich nah ans Ufer heran, wenden und vom Heck des Schiffes aus springen etwa zwanzig junge Männer ins Meer mit Säcken und Netzen voller Muscheln, die sie vorher gesammelt haben. Damit die Säcke nicht zu schwer zu tragen sind, binden sie aufgeblasene Plastik-Handschuhe an die Netze und schwimmen damit durch die stürmische Brandung ans Land. Das sieht recht komisch aus: Wie Fabelwesen und wie aus dem Nichts tauchen die Muschelgiele mit den seltsamen rosaroten Plastikbällen, die aussehen wie Kuheuter, aus dem Meer auf und entsteigen den Wogen. - Aber dann geht’s los. Händlerinnen haben sich bereits am Strand versammelt, bewaffnet mit Waagen und Geldscheinen, gleich bündelweise. Auch Grillvorrichtungen haben sie dabei, um anschliessend an Ort und Stelle einen Teil der gekauften Ware mit der Familie zu verspeisen. Der Handel blüht. Muscheln werden gewogen, Preise in den nassen Sand geschrieben, Geldscheine wechseln den Besitzer. Die jungen Männer haben auch Kleidung bei sich, die sie in Plastiksäcken mitgebracht haben (ähnlich wie das gewisse Aareschwimmer im Marzili tun). Sie ziehen sich an, essen mit und begeben sich dann Richtung Dorf.
Tan kauft zwei Kilo Muscheln und lässt sie auf dem Grill zubereiten. Zum Apéro. Für einen knappen Fünfliber. Netterweise lädt er uns zu diesem Schmaus mit ein.
Vier Übernachtungen waren‘s im Sailing Bay und wir alle haben die Musse genossen. Ausruhen, ein wenig baden im Meer, die Sonne geniessen, dem Muschelhandel zusehen, die letzten paar Mal zusammen essen gehen – ein gediegener Abschluss.
Am 3. November ist dieser Teil unserer Ferienreise vorbei. Wir verabschieden uns herzlich von den anderen Reiseteilnehmerinnen und - teilnehmern und werden von Christina und Shina Fullerlove abgeholt, einem jungen Ehepaar, das hier in der Gegend wohnt (10 km weiter) und mit denen wir über die Plattform HomeExchange einen Haustausch (mit Bivio) vereinbart haben. Sie sind mit dem Motorrad unterwegs, wir fahren mit dem Taxi hinterher.
Zwischen-Reisebericht Mui Ne 3. – 20. November 2014
Adressen sind, wie wir erfahren, so oder so eine Sache für sich in diesem Land, erst recht, wenn man der Sprache nicht mächtig ist. Da hapert es schon bei der Übermittlung. Also ist es für die beiden viel einfacher, uns abzuholen. Wir fahren eine kurze Strecke, dann sind wir dort, wo wir für die nächsten elf Tage und Nächte bleiben werden. Auf dem Land, könnte man sagen. Auf einer schmalen Landstrasse halten wir an. Die Gegend scheint unbewohnt. Wie wir sehr bald merken, ist dem aber doch nicht ganz so. Entlang der Strasse hat’s immer wieder mal ein Haus oder auch nur eine Hütte, ein wenig im Gebüsch versteckt, so dass man gar nicht sieht, dass dort jemand wohnt. Es dauert allerdings nicht lange, bis wir unmissverständlich merken, dass wir Nachbarn haben, unsichtbare sozusagen. Auch deren Hunde sehen wir nicht, aber wir hören sie. Vor allem nachts. Ganze Rudel, dünkt es uns. Hühner und Güggel bevölkern die Umgebung ebenso. Die hören wir auch. Nicht nur morgens in der Früh. Die Kräherei nimmt Formen an, die Theos empfindlichen Schlaf durchaus stören könnte. Dann auch die Lastwagen, die um sechs Uhr morgens wie bei einem Downhill-Rennen vorbeidonnern. Wer hätte gedacht, dass an diesem Ort so viel Verkehr herrscht. Vielleicht wird irgendwo gebaut und die liefern den Zement und die Baumaterialien ab. Egal, wir haben Ferien. Mich stört das nicht und tagsüber hört man ausser den obligaten Mofas und deren ständigem, nervtötenden Gehupe nicht viel. Im Haus sind wir allein; es ist ein Bijou inmitten eines tropischen Gartens, mit einem Swimmingpool, drei geschmackvoll eingerichteten Schlafzimmern, einer gut ausgerüsteten Küche (wir finden sogar Eierbecher und Espresso-Tassen – Theo hat ja aus Frust wegen früherer einschlägiger Erfahrungen immer eine im Gepäck mit dabei) und einem gemütlichen Wohnzimmer. Wasch- und Abwaschmaschine natürlich auch.
Unsere Gastgeber erklären uns alles und ziehen dann in ihr anderes Haus am Strand um.
Im Kühlschrank entdecken wir einen Notvorrat bestehend aus etwa zehn Flaschen Bier und auf dem Küchentisch steht ein riesiger Korb voller Früchte. Nun ist es so, dass ich kein Bier-Aficionado bin und Theo hat ein wenig Angst vor Früchten. Er ist überzeugt, die bewirken Gelenkschmerzen und allenfalls auch Haarausfall, genauso wie es ja auch das Gemüse tut. Also müssen wir als Erstes einkaufen gehen, wenn wir hier überleben wollen.
Etwa hundert Meter weiter vorn hat’s ein Lädeli, ja eigentlich sogar ein Restaurant. Ein paar wenige Tische sind vorhanden. Die einen bestehen aus auf Hochglanz poliertem Metall, aus Plastik die anderen. Ein Supermarkt ist es gerade nicht; die Auswahl ist weit weg von atemberaubend. Trotzdem können wir 8 Eier erstehen, 1 Säckli UP-Milch (2,5 dl), 5 Büchsen Cola, 4 Pack Nudelgerichte, 8 Flaschen Süssgetränke, 2 Päckli Güezi (für Theo) und für all das haben wir nur gerade 137‘000 VND bezahlt, das sind knapp sieben Franken. – Brot gibt’s nicht, mein Soda-Wasser ebenso wenig, an Wein ist nicht zu denken - aber wir haben ja Mui Ne ganz in der Nähe und all die netten Restaurants.
Um halb sechs wird’s von einem Augenblick auf den andern dunkle Nacht. Wir geniessen ein karges, weinloses Mahl; Theo muss sich mit der Nudelsuppe und den Güezis zufriedengeben (Whisky hat’s ja dann auch noch); ich halte mich an die Früchte. Es ist aber schön, draussen zu essen bei der romantischen Gartenbeleuchtung.
Eine zwei auf drei Meter hohe Leinwand kann man beim Terrassenfenster herunterlassen und von Hunderten von Filmen, die Fullerloves gespeichert haben, aussuchen, welchen wir uns ansehen wollen. Wir habe ebenfalls eine ganze Menge Filme bei uns, Gino hat uns etliche auf einen Stick geladen und mitgegeben, damit es uns nicht etwa langweilig wird. Theo hat sogar eine DVD-Serie dabei, die wir uns dann mal anschauen wollen: „Homeland“. Er hat aber bemerkenswerterweise nur die Season 2 mitgenommen. Das gibt Rüge. Klar. Man nimmt doch nicht einfach nur den zweiten Teil einer Serie mit, beginnt die ganze Geschichte also in der Mitte. Wir tun’s doch. – Kurz bevor wir die zwölf Episoden hinter uns haben, findet Theo im Gepäck Season 1. Na also, beginnen wir die Serie doch von Anfang an. Wir wissen ja jetzt, dass die Helden wenigstens ein Stück weit überleben.
So gibt’s also gar nicht viel zu erzählen von diesen stillen Tagen in Clichy. Wir geniessen beide vor allem das Nichtstun, lesen viel, erholen uns von der Rundreise und lassen diese mit Fotos-Bearbeiten und -Sortieren sowie Reisebericht-Schreiben Revue passieren. Etwa jeden zweiten Abend lassen wir uns ein Taxi kommen (wir haben von unseren Gastgebern ein pre-paid Natel erhalten mit den Taxi-Telefonnummern von Herrn Dung und Herrn Phi drauf, die ein bisschen Englisch können und wissen, wo wir wohnen, so dass sie uns immer wieder wohlbehalten nach Hause fahren können. Erschwerend für uns kommt allerdings dazu, dass wir die Herren beim besten Willen nicht auseinanderhalten können (das alte Vorurteil - einmal mehr bestätigt), so dass wir mehr als einmal ins falsche Taxi einsteigen und erst realisieren, dass es sich um den falschen Fahrer handelt, wenn er kein einziges Wort Englisch spricht. Wir merken dann aber bald, dass die Taxi-Zentrale das Problem fest im Griff hat und die Fahrer sich entsprechend gegenseitig orientiert haben, was sie mit uns anfangen beziehungsweise wohin sie uns bringen sollen. Wir werden immer auf direktem Weg an den richtigen Ort geführt. Es gelingt sogar, ein Taxi auf den Freitag unserer Abreise zu bestellen, um elf Uhr morgens. Datum und Uhrzeit notiert sich der Fahrer, und wer hätte das gedacht: Pünktlich steht das Taxi da und bringt uns ans nächste Ziel unserer Reise. Ob es derselbe Fahrer ist, kann ich halt nicht sagen.
Es dauert noch fast eine Woche bis unsere zweite Gruppenreise beginnt. Fullerloves haben neue Gäste, wir ziehen für weitere sechs Tage in ein Hotel um.
Nach einer fünfminütigen Taxifahrt kommen wir im Sunshine Beach Hotel an, wo wir einen Bungalow direkt am Strand gemietet haben; uns trennt nur unsere leicht erhöhte Terrasse vom Geschehen. So haben wir auf unseren Liegestühlen quasi Sperrsitz zu allem, was dort geschieht. Auch vom Bett aus. Es ist herrlich hier: ein gemütliches kleines Hotel mit nur wenigen Gästen, einem lauschigen, tropischem Garten, einem hübschen Swimmingpool, der von hohen Kokospalmen umgeben ist und der zum Glück, im Gegensatz zum überwarmen Meerwasser, mit frischem und fast ein wenig kühlem Wasser gefüllt ist. Sehr freundliches, hilfsbereites und aufmerksames Personal gehört ebenfalls zum Service. Ein Wachmann dreht seine Runden Tag und Nacht (natürlich nicht immer der gleiche), so dass niemandem etwas Schlimmes passieren kann. Weil’s aber so friedlich ist, ist’s für ihn auch langweilig. Man sieht’s gut, wenn er wieder mal an seiner Krawatte herumkaut.
Wir geniessen den Aufenthalt aufs Beste. Chillen und nicht viel tun - das ist die Devise. Tagsüber findet es Theo wunderbar, dass es vom Bett aus nur gerade sechs Meter sind bis zur nächsten Liege auf der Terrasse. So jagt dann eine Siesta die andere.
An Strand ist sehr viel los. Es wimmelt nur so von Kite-Surfern. Ein ständiger starker Wind bläst, ein Paradies für all diejenigen, die diesen Sport ausüben oder lernen wollen. Man könnte stundenlang zusehen. Tun wir oft auch. Es ist faszinierend, wie diejenigen, welche die Technik beherrschen, über die Wellen sausen, sich hoch in die Lüfte ziehen lassen, zum Teil das Brett zum Zwirbeln bringen und dann gleich wieder mit der nächsten Welle mitreiten oder sie quer dazu durchkreuzen. Vor allem die jungen Einheimischen sind absolute Profis. Es gibt zwar auch Europäer, die diesen Sport gar nicht mal so schlecht beherrschen, aber die bärenartigen Russen, die sich in dieser Kunst versuchen, haben oft Mühe, zu Schwung zu kommen. Das sieht dann nicht mehr so beflügelnd und elegant aus.
Kite-Surfen sollte eine neue Olympia-Disziplin werden, finde ich. Ok, ok, wie man das Meer und den Wind dann an die einschlägigen Orte bringen könnte, darüber müsste man sich schon noch ein wenig den Kopf zerbrechen.
Ehrlich gesagt, würde es mich auch gelüsten zu versuchen, in dieser Höllen-Geschwindigkeit über die Wellen zu flitzen, so wie all diese vietnamesischen Jungs. Es sieht so einfach aus. Da ich aber keine Grossmütter sehe, die das tun, lass ich’s lieber.
Ein Kochkurs ist da wohl eher angebracht. Den buche ich für Montag.
Zwar fühle ich mich gar nicht so alt. Das hat vielleicht auch mit unserem Badzimmer hier zu tun. Es ist im hinteren Teil des Bungalows platziert, ziemlich gross, aber die Beleuchtung würd ich nicht grad als optimal bezeichnen. Schummrig kommt der Sache schon näher. Das Gute dabei ist, wann immer ich in den Spiegel schaue, sehe ich keine Falten mehr. - Ich muss mir ernsthaft überlegen, bei uns zu Hause im Badezimmer eine ähnliche Beleuchtung installieren zu lassen.
(Nachtrag: Erst am allerletzten Tag sehe ich, dass es da einen Schalter gibt, der eine Neonröhre direkt oberhalb des Spiegels in Gang setzt. – Jetzt sieht alle etwas anders aus…)
Übrigens hab ich neulich, seit wir hier an der Küste sind, meine Parfum-Marke gewechselt. Sie heisst jetzt „Autan – Active“ (Repelente de Insectos; hab’s mal in Spanien gekauft).
Des Nachts ist Mückenschutz natürlich nicht nötig, wir haben ja ein Moskitonetz. Wenn es aber gelingt, wie gehabt, sich mit einer Mücke dort drin einzuquartieren, gereicht das nur gerade dem Insekt zu eitel Freude und Entzücken. Nicht dass Theo das stören würde; die Biester lieben ausschliesslich mich.
Mui Ne ist ein spezieller Ferienort. Er besteht eigentlich nur aus einer einzigen Hauptstrasse, die während 15 km Nguyen Dinh Chieu heisst und dann den Namen für weitere 10 km in Huynh Thuc Khang wechselt. Auf der Meerseite der Strasse ist ein Resort ans andere gebaut, dazwischen reiht sich Kite-Surf-Schule an Kite-Surf-Schule. Auf der gegenüberliegenden Strassenseite gibt’s kleine Shops am Laufkilometer, Bars, Massagelokale, Guest-Houses, ATM-Maschinen in kleinen Kabinen, in denen man vor lauter schlechter Luft beinahe erstickt oder wenn’s ganz chic geht, fast erfriert, weil drinnen ein Klima herrscht wie in einer Tiefkühltruhe und man froh ist, wenn man die Kohle endlich hat, so dass man wieder nach draussen in die frische, 30-grädige Luft entfliehen kann. So geschah es auch, dass ich vor lauter Pressieren nur 200‘000 Dong eingab statt zwei Millionen (immer diese endlosen Nullen) und also wohl einen Fünfliber bezahlt habe für die zehn Franken, die mir der Automat schliesslich ausgespuckt hat. – Selber schuld!
Aber eigentlich bin ich noch immer dabei, die Strasse zu beschreiben. Neben den bereits erwähnten Annehmlichkeiten gibt es natürlich auch Reise-„Büros“. Etliche bieten zusätzlich noch Massage- und Tattoo-Service an. Es hat Mofa-Miet-Stellen, Mofa-Tanksäulen, Garküchen und Restaurants, alle mit einem ganzen Arsenal von Tanks beziehungsweise Aquarien vornedran, wo die bemitleidenswerten Fische, Frösche, Krebse, Muscheln, Hummer und anderes Meergetier ihre letzten Atemzüge tun, bevor sie von Touristen fotografiert und anschliessend (von wem auch immer) verspeist werden. Sogar kleine Krokodile haben wir ausgestellt gesehen, wie ein Partybrot von hinten her in Tranchen geschnitten, bereit zum Verzehr.
Eigentlich heisst dieser Strip gar nicht wirklich Mui Ne, obwohl alles so angeschrieben ist. Der Ort selber befindet sich am östlichen Ende der langen Bucht, dort, wo der Hafen ist.
Wie dem auch sei: Es handelt sich hier vor allem um ein Kite-Surfer- und Backpacker- Paradies, ist aber ganz offensichtlich auch besonders bei den Russen beliebt. In der Hauptsaison soll‘s auch viele Pauschal-Touristen haben. Klar, da gibt’s dann zwangsläufig Schnittmengen.
Überall ist alles in zwei Sprachen angeschrieben: vietnamesisch und russisch. Das gilt für ausnahmslos alle Speisekarten. Manchmal steht da sogar auf Englisch, was man bestellen kann, oft auch mit einem Bild, was die Auswahl doch wesentlich erleichtert. Nicht immer sind die Speisekarten sehr einladend, nicht nur von der Gestaltung her, nein, es kommt vor, dass ich das Gefühl habe, nach der Lektüre möchte ich mir am liebsten die Hände desinfizieren. Auch sind die Fotos eher selten appetitanregend. - Auf den letzten paar Seiten wird’s meist recht abenteuerlich, für unsere mitteleuropäischen Geschmäcker jedenfalls. Da gibt’s Aal, Froschschenkel, Schlange, Krokodil und all die dazugehörigen leckeren Zubereitungsarten, eben das Tagesangebot, das vor den Restaurants zur Schau gestellt wird.
Gut ist das Essen allemal. Sehr sogar! Im Reiseführer lese ich, die Vietnamesen seien Philosophen, was die Nahrung anbetreffe. Jedes Lebensmittel habe eine bestimmt Wirkung oder sei für etwas gut. Das eine gegen die Hitze, das andere gegen die Kälte, eines helfe, irgendwelche Schmerzen zu vertreiben, das andere fördere die Libido oder spende Energie.
Und natürlich sind die Mahlzeiten preiswert. In unserem Hotel kann man beispielsweise kein einziges Gericht bestellen, das teurer ist als fünf Franken. Eine Flasche Bier kostet 70 Rappen, ebenso eine Büchse Schweppes Soda. Vietnamesischen Wein gibt’s auch. Grade mal zwei Sorten, Dalat und Dalat Export. Die zweite Variante ist sehr viel besser als die erste, die immer ein wenig nach Zapfen riecht und vorwiegend bei Zimmertemperatur (30 Grad) serviert wird. Kosten tut so eine Flasche im Restaurant fünf Franken – gleichviel wie im Laden, der edlere Tropfen sechs Franken fünfzig. Geht man in ein Etablissement, das von einem Europäer geführt wird, sieht alles schon ein wenig anders aus. Die müssen ja schliesslich was verdienen; der arme Franzose akzeptiert nicht einmal Kreditkarten, weil er ja so einen kleinen Betrieb nur hat. Dafür ist an solchen Orten die Auswahl an Weinen um ein Mehrfaches grösser, die Preise dementsprechend fast wie bei uns. Trotzdem gibt’s ausnahmsweise eine Abwechslung – für Magen und Portemonnaie.
Mit Christina und Shina sind wir auch mal essen gegangen. Es war interessant zu erfahren, wie es sich hier als Einheimische lebt. Sie ist Schweizerin, er Australier; Ihr Business ist eine Kombination aus Reiseagentur und Kite-N-Surf – Schule.
Fishing Village
Am Sonntag machen wir einen Ausflug ins Fishing Village, eben in den Hafen von Mui Ne, wo täglich das gleiche Prozedere stattfindet: Die Fischer kommen heim, ihre Ware wird verhökert, dann wird aufgeräumt. Dieses Spektakel findet am frühen Morgen statt; allerorts wird empfohlen, dass man um halb acht Uhr dort ist. – Also das geht natürlich nicht mit Theo, da kann ich mir den Atem und sämtliche Argumente sparen. Entweder gehe ich alleine oder ich lass ihn ausschlafen, wir gehen zusammen und verpassen dann halt den Hauptteil der Show. Genau so ist’s dann auch. Nach dem Frühstück (gemächlich!) machen wir uns auf zur Bushaltestelle. Wir haben Glück: Der Bus kommt grad, aber irgendwas machen wir wohl falsch, er hält jedenfalls nicht an. – Wir haben ja Ferien, also warten wir ein Weilchen. Dieses dauert eine halbe Stunde. Man muss höllisch aufpassen, im richtigen Moment aufzuspringen, sonst ist er wieder weg. Es gelingt. An der Rezeption hat uns die zierliche Angestellte ein Zettelchen parat gemacht mit dem Satz: „Sie wollen ins Fishing Village“, natürlich auf Vietnamesisch. Das hilft sehr. Wir bezahlen 45 Rappen pro Person und erhalten dafür unsere Tickets. Mit beiden Händen müssen wir uns an den Sitzen festhalten (so könnte ich es mir auf einem Rodeo-Pferd vorstellen), denn der Fahrer fährt wie vom leibhaftigen Teufel gehetzt. Herrscht hier tatsächlich Rechtsverkehr? Und hat er eine Brille, welche die Mofa-Fahrer ausblendet? Oder sind’s einfach nur Scheuklappen? - Immer wieder mal wird beim Überholen wild gehupt und so legt er die Strecke in einer Rekord-Viertelstunde zurück. Irgendwo unterwegs steigt ein junger Mann dazu (springt auf, besser gesagt) und verlangt, die Tickets zu sehen. Nein, so was: ein Kontrolleur. Das hätte ich hier nun gar nicht erwartet. – Christina hat uns vor den Bussen gewarnt, nur - wir haben nicht hören wollen. Sie wohnt seit sechs Jahren hier und hat noch kein einziges Mal den Bus genommen, wie sie berichtet. Sie findet es zu gefährlich.
Die Rückfahrt gestaltet sich dann ziemlich anders, davon aber später.
Wie ja nicht anders zu erwarten war, ist der ganze Fisch- und Muschelhandel am Hafen bereits vorbei. Nicht ein einziger Tourist ist mehr zu sehen. Die waren wohl alle um halb acht da und sind sich gegenseitig auf die Nerven gefallen, weil auf all ihren schönen Foto-Schnappschüssen immer wieder andere Touris oder Teile davon zu sehen sind. Uns passiert das nicht – Theo sei Dank. Wir bekommen halt nur die Aufräumete zu sehen, aber die hat’s auch in sich. Netze werden aufgerollt, Schiffen wird ein neuer Anstrich verliehen, das Fischer-Gerätzeug wird gereinigt und parat gemacht für den nächsten Einsatz. Die grösste Arbeit aber ist es, all die Tausenden von Muscheln zu öffnen oder zu zerstampfen, deren Fleisch oder die darin versteckten Krebse aus den Schalen zu klauben und in Becken zu sammeln. Es sind die Frauen, die zu Dutzenden am Strand sitzen, in der prallen Sonne, und sich damit beschäftigen. Der ganze Strand (etwa zwei Kilometer lang) ist voller zerschlagener Muschel-Schalen. - Ein unheimliches Massensterben muss da jeden Tag vor sich gehen. Abschreckend und faszinierend zugleich, finde ich.
Auch die Kulisse mit den unzähligen fröhlich farbigen Fischerbooten ist gewaltig. Es ist eine ganze Armada, die jeden Tag aufs Meer hinaus fährt. Von unserem Hotel aus sehen wir sie jeden Morgen, ebenso gegen Abend. Beim Frühstück ziehen die grösseren Schiffe am Horizont vorbei, die kleineren ganz in der Nähe. Diese sind besonders sehenswert. Von weitem scheinen sie wie zu gross geratene Waschbecken. Kreisrund und aus Polyester. Absolut einzigartig! - Genau ein Mann hat Platz darin. Nach getaner Arbeit ketten sie sich aneinander und einer von ihnen, derjenige mit einem Motor (oder eher Motörli) zieht die anderen zurück in den Hafen. Manchmal sind’s nur zwei oder drei, manchmal kommt eine ganze Kolonne solcher Becken daher. Wie im Gänsemarsch, auch wenn das vielleicht nicht das passendste aller Bilder ist. Bis zu zehn Stück hab ich gezählt. Die älteren Boote dieser Art sind Körbe, gefertigt aus Bambus und Palmenblättern. - Heute Morgen hat einer wohl den Anschluss verpasst oder sie hatten eine Auseinandersetzung oder was auch immer der Grund dafür sein mochte, dass er ganz alleine gegen die Wellen paddeln und gegen die Strömung ankämpfen musste, um die vielen Kilometer bis zum Hafen zu schaffen. Das sah nach einer gewaltigen Anstrengung aus.
Auf dem Rückweg vom Hafen zur Hauptstrasse und zur Bushaltestelle kommen wir an einem Coiffeur-Geschäft vorbei. Eigentlich hätt‘ ich’s ja nötig, mir langsam wieder mal einen „anständigen“ Schnitt verpassen zu lassen. Wieso auch nicht? - Zeit haben wir ja und viel verderben kann sie wohl auch nicht. Es gelingt mir, der netten jungen Coiffeuse mit Handzeichen begreiflich zu machen, was ich gerne möchte und sie nimmt die Arbeit in Angriff. Haare Waschen ist gar nicht nötig. Mein Haar ist vom vielen Schwitzen sowieso schon tropfnass. Also beginnt sie gleich. Und ich muss sagen, ich finde, sie macht das ganz gut. Die Schere ist scharf, für mich sieht’s absolut profimässig aus, und ich bin mit dem Resultat zufrieden. Ob Bürste und Kamm jeweils gereinigt werden nach Gebrauch?
Es ist wohl besser, solche Gedanken zu verdrängen. - Sie reinigt auch meinen Haaransatz am Nacken mit einer Rasierklinge. Da halte ich extrem still. - Zwei Franken will sie für den Schnitt. Sie strahlt, wie sie 100 % Trinkgeld erhält.
Oben im Dorf angekommen, sehen wir den Bus schon stehen. Bei dieser Hitze mögen wir uns aber nicht beeilen, wir können ja irgendwo was trinken, falls er uns durch die Lappen geht. Das tut er aber nicht. Im Gegenteil. Der Busfahrer sitzt auf einem der hinteren Sitze und hat die Beine auf die Lehne des Vordersitzes gelegt. Er schläft (Siesta?). Wir steigen dann trotzdem ein, er erwacht und wir können unsere Billets kaufen. Nach zehn Minuten spekulieren wir, ob das vielleicht so ist wie bei uns in der Schweiz, wo die Busfahrer sich beeilen, dass sie an der Endstation etwas länger Zeit haben für eine Zigarettenpause. Jetzt lässt er den Motor an. Fünf Minuten später stellt er ihn wieder ab und legt sich wieder hin. Es ist ziemlich warm im Bus, aber wenigstens sind die Fenster offen – und ja, genau, wir haben ja Ferien. Ich nutze die Zeit und mache ein paar Fotos vom vorbeihastenden Verkehr. An all diesen Mofas kann man sich schlicht nicht satt sehen. Riesige Eisblöcke werden transportiert und Blumenkränze, WC-Papier (XXL-Packungen), einer hat eine ganze Fensterscheibe (ohne Rahmen) hinter seinen Sitz geklemmt, Kisten, Fässer, Baumaterial, Kinder, Babys und so weiter und so fort. Und alles ist farbig, farbig, farbig: die Motorräder, die Helme, Kleidung und der Mundschutz der Fahrer.
Jetzt tut sich was in unserem immer noch kaum besetzten Bus: Tatsächlich kommt der Fahrer nun doch, stellt den Motor an uns setzt sich erst mal hin – so ein Fortschritt. Inzwischen sind schon mehrere Busse an uns vorbeigefahren. Uns mangelt’s an einer plausiblen Erklärung. Was genau geht da ab? Wieder sind fünf Minuten vergangen. Plötzlich fährt er los. Völlig unmotiviert - natürlich braucht er keinen Zeiger, um sich in den Verkehr einzugliedern. – Aber was ist das denn? Er fährt nicht schneller als höchstens 20 km/h. Ist er krank? Oder kann es sein, dass wir unter all den hektischen Fahrern das eine seltene Exemplar erwischt haben, das nicht wie die anderen tickt (Specie Rara)? – Es muss so sein. In einer Gemütsruhe fährt er der Strasse entlang; manchmal hält er einen Arm hinter den Sitz an die Kopfstütze, manchmal auch beide, das heisst, er fährt dann freihändig. So wie wir als Kinder auf den Velos. Ich erinnere mich: Da war ich voller Stolz, als mir das zum ersten Mal gelang. – Aber hier – ob das der Sache dient? Wenigstens vergisst er das Hupen nicht, so ist zumindest teilweise gewährleistet, dass er die Hand hin und wieder mal ans Steuer hält. Nach einer halben Stunde Trödelfahrt kommen wir beim Hotel an, er verlangsamt und wir springen ab. Wir haben unverletzt überlebt - beide Fahrten, die ja unterschiedlicher nicht hätten sein können.
So hat sich also unser Exkursiönli dreifach gelohnt: Wir sind um ein Busfahrt-Erlebnis reicher (oder eigentlich um zwei), haben die farbenfrohen Fischerboote gesehen im Hafen von Mui Ne und ich komme mit einer neuen Frisur zurück ins Hotel.
Kochkurs
Um neun Uhr morgens bin ich parat, nachdem ich bereits gefrühstückt habe, ein grosser Fehler, wie sich im Nachhinein herausstellt. Nur ein paar Schritt von unserem Bungalow entfernt, gleich hinter dem Restaurant, sind im Sand drei Tische aufgestellt, zwölf rote Plastik-Stühle stehen darum herum und unter dem Palmendach ist eine gut ausgebaute Show-Küche eingerichtet mit einem grossen Spiegel, der zum Zweck hat, dass man von überall her sieht, was da vorne auf dem Tresen geschieht. Eine zierliche, hübsch gekleidete Vietnamesin mit Namen Han empfängt mich und gibt mir erst mal Tee. Die Kanne ist in einer Kokosnuss-Schale gut eingepackt, damit die Brühe auch schön warm bleibt. Ingwer-Tee ist es und Han schenkt mir grosszügig in das Mini-Schnapsglas ein, das vor mir steht. Es daure nur zwei Minuten, sagt sie, dann sei sie parat. Die zwei Schluck Tee sind auch rasch getrunken und ich bin ebenfalls parat.
„Wo sind die anderen Teilnehmerinnen?“, will ich wissen. Die gibt’s heute nicht. Ich bin die einzige Schülerin. – Auch gut. Wieso nicht… Ein wenig seltsam zwar… Ob sich all der Aufwand lohnt, frage ich mich. - Han ist aber guter Dinge, das scheint sie in keiner Weise zu stören.
Der Kurs beginnt damit, dass wir auf den Markt gehen und dort einkaufen, was wir brauchen. Han winkt ein Taxi heran und wir fahren zum Ham Tien Markt. Unterwegs werde ich interviewt. Wo ich herkomme, will sie wissen, wie viele Kinder ich habe (sie macht grosse Augen, wie ich sage vier). „You very lucky“, ist ihr Kommentar. Dann kommt die unweigerliche Frage nach meinem Alter. Ich schummle ein ganz klein wenig, eigentlich eher, weil ich denke, „sechzig“ ist einfacher zu verstehen für sie als „einundsechzig“. – Kaum habe ich die Zahl genannt, nimmt sie wie elektrisiert ihre Hand von meinem Arm, schaut mich entsetzt und ungläubig an, wie wenn ich sie zutiefst erschreckt hätte. Was hab ich bloss gesagt, frage ich mich. „Sixty???“, wiederholt sie. “No. Fifty. You so fresh and strong!“ – Hm. Natürlich fühle ich mich ein wenig geschmeichelt. Wirklich nur ein wenig. - Sie ist vierundzwanzig.
Wir erreichen den Markt nach kurzer Fahrt; ein reges Treiben herrscht in der überdachten Halle. Vor allem Händlerinnen bieten ihre Waren an, Männer hat es fast keine. Der Eindruck ist farbig, aromatisch, exotisch. Es ist sicher kein Touristenmarkt. Hier kaufen die Einheimischen ein. Der „Duft“, der in der Luft liegt, ist ein Mix aus all den verschiedenen Nahrungsangeboten: Fisch, Fleisch, Früchten, Gemüse, Gewürzen. Auch bunte Kinderkleider und Spielwaren gibt’s zu kaufen, wenig Handwerkszeug ebenfalls – wie das eben so ist in solchen Ländern.
Han textet mich voll; ich muss mich enorm konzentrieren, damit ich verstehe, was sie meint, denn ihre Beschreibungen von Früchten und Lebensmitteln und was man wie, woraus und warum herstellt, sind recht kompliziert. Ihr Englisch, obwohl enorm fliessend, ist nur teilweise verständlich und gespickt mit vietnamesischen Wörtern, eben mit den Bezeichnungen der verschiedenen Gerichte und Gewürze, deren Übersetzung sie nicht kennt. Zum besseren Verständnis braucht sie dann oft treffende Vergleiche. Sie sagt, ein Gericht sei wie jenes, das sie gerade beschrieben habe, nur ein wenig anders („same, same – but different“).
Als Erstes nimmt sie mich mit zur „Pancake-Lady“. Diese Dame sitzt oder beziehungsweise kauert direkt vor uns auf einem Podest, so dass sie grad gleich gross ist wie wir, die wir vor ihr stehen. Neben ihr ist ein kleiner Herd installiert und in vier Crèpe-Pfännchen gleichzeitig bereitet sie eine Art Omelette zu, in die sie kleine Tintenfisch-Stücke hineingibt, Gewürze, Nudeln und was weiss ich noch alles, diese dann in eine Styropor-Schale bettet und mit scharfer Chili-Sauce grosszügig übergiesst. – Das muss ich essen; es ist mein Frühstück. Ich leiste keinen Widerstand, auch nicht sprachlicher Natur, setze mich auf das angebotene rote (Kinder-) Plastik-Stühlchen und muss sagen, sehr schmackhaft ist die Speise! - Beide Frauen schauen mir wohlwollend lächelnd zu – ich komme mir fast ein wenig ausgestellt vor. Die Omeletten-Frau sei dreiundsechzig Jahre alt, erzählt Han, drei Jahre älter als ich. Sie sei jeden Tag hier und verkaufe diese Spezialität – seit sie sechsundzwanzig sei. – Grosses Staunen meinerseits.
Auf Han‘s Anweisung hin muss ich mich auf Vietnamesisch bedanken, „Cam on“, sage ich, dann gehen wir weiter. Bei einer Verkäuferin in der Nähe gibt’s eine Art Cup-Cakes zu probieren, in der Grösse einer Clementine. Grünliche und weisse. Ich rate richtig. Hier handelt es sich sicher um Kokosnuss. Han ist begeistert ob meiner raschen Auffassungsgabe. Allerdings prophezeit sie: „You not like very much.“ – Doch, doch, die sind überhaupt nicht schlecht. Ich nehm noch einen Bissen. „You full now?“. Da hat sie allerdings nicht ganz unrecht. Wenn das so weitergeht – wie soll ich dann all das essen, was im Kochkurs noch auf mich zukommen wird? - Die nächste Lady (sie ist sechsundsechzig Jahre alt (Han vergleicht jetzt laufend mit mir) stellt Desserts her, Bananen in Teig und kleine süsse Bälle, in Puderzucker gewendet, die absolut wunderbar schmecken. Sie sehen aus wie Mini-Berliner oder wie die Quark-Kugeln, die’s in Bern bei Reinhard gibt. Nur sind diese hier zehnmal besser und dreissigmal billiger.
Anschliessend gehen wir Jackfruit kosten (gut für die Haut und gibt Energie), Poulet-Teile kaufen wir ein und etwas, das aussieht wie kleine geschnetzelte Hühnerlebern. Ich schaue und höre beim Verhandeln zu. - Und dann, als besonderes Highlight gegen den Durst, gibt’s den Zuckerrohrsaft, den wir bereits unterwegs auf unserer Rundreise kennengelernt und getrunken haben. Sugarcane sei ebenfalls gut für die Haut und mache einen jünger. - Super! Da nehm ich doch glatt noch einen Becher mehr.
Eine Paste aus vorwiegend Zitronenessenz könne man auch noch drein tun (tut sie auch gleich, einen ganzen Kaffeelöffel voll), das sei besonders empfehlenswert, wenn man unter Kopfschmerzen leide. Sie erklärt mir, wie die Paste hergestellt wird. Vier Monate lang müsse man die Zutaten an der Sonne trocknen lassen oder so ähnlich, wenn ich das richtig verstanden habe, und das könne ich ja dann zu Hause auch herstellen. – Ich verzichte darauf, ihr begreiflich zu machen, dass so viel Sonne eher eine Rarität sei in unseren Breiten und dass aus dem Grund voraussichtlich ein paar Probleme auftauchen könnten beim Versuch, diese Essenz zu produzieren.
Nach einer knappen Stunde ist genug gekauft, probiert und erläutert; Han fordert mich dazu auf, dem Markt good bye zu sagen. - Tu ich.
Mit dem Taxi zurück zur Openair-Küche.
Han weist mich an, mir die Hände zu waschen, und wenn das erledigt sei (zwei Minuten), könne ich kommen und IT geniessen. – IT??? IT hab ich mal unterrichtet. Was aber hat Informationstechnologie hier in dieser Küche zu suchen und was bitte, soll ich dabei geniessen (denk ich nur, sag ich aber nicht)? - Das Geheimnis löst sich rasch. IT steht auf dem Tisch. An meiner immer noch mangelnden Fähigkeit, Vietnam-Englisch zu verstehen, ist das Verständnis gescheitert. Ice Tea ist gemeint. - Da bin ich aber froh!
Zwei weitere Köchinnen sind jetzt dort bereit (langsam erscheint mir das Verhältnis Lehrerinnen – Schülerinnen ein bisschen speziell) und die drei hübschen Girls, alle in der gleichen seidenglänzenden Bluse gekleidet, stehen hinter der Theke vor dem Spiegel, ich vor ihnen. Sie erinnern mich an Simultanschwimmerinnen, obwohl sie ja nicht schwimmen, sondern kochen. Sie lächeln süss und wie auf Kommando sagen sie zu mir: „Hello, everybody“.
Zuerst erhalte ich eine Schürze…
Jetzt geht’s los. Han gibt das Zepter ab an Voi. Voi erklärt mir, was ich machen muss. Für sie ist wichtig, dass ich jeden Handgriff selber ausführe, sozusagen aus eigener Kraft (learning by doing). So zeigt sie mir zu Beginn, wie man den kleinen Tischherd anstellt. Sie stellt ihn wieder ab, ich muss ihn selber in Gang bringen (damit ich das zu Hause dann auch tun kann?). Es gelingt mir tatsächlich. Lauter kleine Schälchen mit Gewürzen, geschnippelten Zwiebeln und anderen Zutaten, Nudeln und was ich sonst noch alles brauchen werde, stehen bereits parat. Manches ist schon vorbereitet worden, so dass wir sofort starten, uns also gleich in medias res begeben können. - Offenbar traut sie mir zu, dass ich weiss, wie man Zwiebeln schneidet.
Das erste Gericht ist die Nudelsuppe.
Aus einem Topf muss ich ihr („please do that for me“, sagt sie immer) eine Schale voll Bouillon bringen (ich nenn das jetzt mal so), denn dort schwimmt ein Kniegelenk (einer Kuh) seit einer Stunde in einer Brühe. Auf meinem kleinen Herd muss ich nun zwei Löffel Öl in eine Wok-Pfanne giessen, Knoblauch und Zwiebeln darin anbraten und nach Vois Anweisungen erst die Brühe und nach und nach dieses und jenes Gewürz dazugeben, das hauchdünn geschnittene Fleisch und die Nudeln. Und immer ist meine Lehrerin drauf bedacht, dass ich das mit dem Löffel, den sie mir hinhält, auch selbständig bewerkstellige. Nach kurzer Zeit ist die Suppe fertig und ich darf sie essen. „Enjoy“, sagt Voi.
Mega gut, was ich da zusammengebraut habe! Theo ist zum Glück in der Nähe, in unserem Bungalow, nur etwa hundert Meter entfernt vom Geschehen. Ich kann ihn holen gehen und er hilft mir beim Essen; ich selber wär mit dieser riesigen Portion nie fertig geworden. Er hat zwar nicht bezahlt, gehört ja auch gar nicht zum Koch-Team (mit seinen viel gepriesenen Allerhöchstens-Viertelstunden-Büchsen-Mahlzeiten wäre er in einem derartigen Kochkurs sowieso völlig fehl am Platz), aber die Girls freuen sich, dass er kommt - eine Person mehr, die sie und ihre Kochkünste lobt.
Jetzt muss ich mit einem scharfen Messer eine Tomate schälen. Die würd ich daheim doch ins kochende Wasser werfen und nicht einen solchen Aufwand betreiben, denke ich. – Naiv! - Um die Tomate geht’s gar nicht. Es geht um die Schale, die ich abziehen muss, so dass sie wie eine Schlange aussieht, um sie dann wieder aufzurollen und eine Rose daraus entstehen zu lassen. - Genial! - Wichtig ist eben auch, dass das Gericht schön präsentiert wird. Ich erhalte viel Lob, weil mir die Rosen-Herstellung auf Anhieb gelingt.
Frische Frühlingsrollen, verschiedene Saucen, eine Omelette (ähnlich derjenigen, die ich auf dem Markt gegessen habe: „same, same but different“) und schliesslich ein Meerfrüchte-Salat sind anschliessend auf dem Programm. – Mit Theo kann ich alles teilen. Wir sind beide völlig erledigt nach all den feinen Dingen, die wir serviert bekommen haben. Rambutan gibt’s zum Nachtisch und eine kleine Ansprache. Diese beinhaltet Dank und die Bitte, auf Facebook und Tripadvisor ein gutes Wort für die Kochschule einzulegen. Ein hübsches, recht professionelles kleines Rezeptbüchlein erhalte ich zum Abschluss, ich gebe die Schürze zurück, bedanke mich ebenfalls, dann bin ich entlassen.
Ich freue mich jetzt schon darauf, zu gegebener Zeit zumindest die Tomatenrose mal „nachzukochen“.
Ausflüge
Ein Ausflug ist geplant für Dienstag. Zu den Cham Türmen in Phu Hai und zum Ta Cu - Mountain, wo der grösste liegende Buddha in ganz Vietnam zu sehen ist. Um acht Uhr wäre es am besten loszufahren. „Neun Uhr tut’s auch“, sagt Theo.
Um neun Uhr erwartet uns der Fahrer vor der Hotelrezeption mit einem kleinen Bus. Eigentlich hätte es ein Fahrer mit Englischkenntnissen sein sollen, das hat aber leider nicht geklappt. Nur ein Wort kann er sagen, nämlich „ok“. Sagt er aber nicht zu mir, weil er ja nicht versteht, was ich gerne möchte. Also kommuniziere ich mit ihm via Handy. Wenn ich etwas will oder eine Frage habe, ruft er seinen Chef an, dem ich dann meine Wünsche mitteile und der gibt sie weiter. Unser Dreiecksgespräch funktioniert ausgezeichnet; ich höre ihn „ok“ sagen und er fährt dorthin, wohin ich gerne möchte.
Das sind zuerst die Cham Türme, Ruinen aus der Zeit der Cham-Dynastie (Ende 8. Jahrhundert). Die Cham sind heute nur noch eine ethnische Minderheit, ein Volksstamm, der in den Bergen lebt. Die Türme sind aus roten Sandsteinziegeln gebaut. Sie sind sehr eindrücklich, und vom Hügel aus, worauf sie gebaut sind, hat man eine herrliche Aussicht auf die Hafenstadt Phan Tiet (ausgesprochen wie Fanta, aber eben mit „I“ am Schluss und den muss man betonen, also: „Fantii“).
Wir sind die einzigen Besucher an diesem schönen Ort. Der Weg zu den Türmen ist bestens ausgebaut und am Wegrand hat’s im Abstand von etwa 20 Metern jeweils Lautsprecher, aus denen eine Frauenstimme auf Englisch erzählt, was es da zu sehen gibt. Das ist gar keine schlechte Idee. Neu für mich. Man spaziert den Weg entlang und hat das Gefühl, eine Reiseleiterin gehe mit.
In einem der Shops kaufen wir einen zusammenfaltbaren Rucksack. Den Stoff, aus dem er gefertigt ist, weben die Frauen dort an Ort und Stelle. Eigentlich will ich ja gar nichts kaufen (Koffergewicht auf dem Rückflug!), und einen Rucksack brauche ich schon gar nicht, aber die Frauen tun mir leid. Niemand ist da, der etwas kaufen will. Freundlich laden sie uns ein einzutreten und die Aufforderung tönt überall gleich, nämlich wie ein einziges Wort: „Youcancomeandlooknoproblem“. Der Rucksack ist doppelt so teuer wie im Touristenort, aber die dreizehn Franken ist er auf jeden Fall wert. Bei uns wären schon die beiden Reissverschlüsse teurer, die eingenäht sind. - Es braucht einen Tag, um ein Band von einem Meter Stoff zu weben.
Unser nächster Halt ist der Fischmarkt in Phan Tiet. Ein spezielles Erlebnis auch hier: Wir sehen die Fischerboote aus nächster Nähe. Von weitem sehen die farbenprächtigen Kähne ja so anmutig aus. Aber wir wundern uns, dass die überhaupt noch fahrtüchtig sind, denn sie sind restlos alle derart heruntergewirtschaftet, dass es eine seltsame Gattung macht.
Am Quai sind Männer damit beschäftigt, riesige Eisblöcke mit Maschinen zu Eiswürfeln zu zerstückeln. Körbe über Körbe gefüllt mit Fischen werden von Frauen verarbeitet und schliesslich auf Lastwagen verfrachtet.
Nächster Halt: Van Thui Thu Tempel. Der Tempel ist ein Heiligtum für die Schifffahrer und in ihm sind hinter etwelchen Altären Wal-Skelette ausgestellt. Wie es im Reiseführer heisst, auch ein 22 Meter langes Wal-Skelett, das einzige in dieser Grösse in Asien. Pech ist nur, dass die Knochen schön sortiert und zusammengestellt hinter Glas in einem Schrank stehen, so dass man die 22 Meter nur erahnen kann. Es könnten gut auch nur 21 sein. Ich will die Schuhe ausziehen, wie es normalerweise üblich ist bei einem Tempelbesuch, um mir das alles anzusehen, aber die Männer, die dort sitzen, bedeuten mir, die Schuhe anzubehalten. Ok, no problem. Einer führt mich zu einem Altar, wo ich ein Räucherstäbchen anzünden muss. Er deutet auf die Spende-Box. Das musste ja kommen. Ist aber auch kein Problem – non-verbal läuft hier alles wie am Schnürchen. Theo durchläuft dasselbe Prozedere. Der Alte lässt sich fotografieren (mit den Wal-Rippenknochen im Hintergrund), will dann jedoch einen Obolus. Das war ebenfalls vorauszusehen. Den kassiert er und steckt ihn in seine Hosentasche - hat ihn ja schliesslich verdient.
Wir fahren weiter zum Ta Cu - Mountain. Da steht ein Berg (rund 700 Meter hoch) mitten in der Ebene. Mit einer Gondel (Schweizer Fabrikat, von österreichischer Firma moniert) kann man hochfahren zu einem Restaurant, in dem es aber gar keine Gäste hat. Seltsam - Touristen hat’s so gut wie keine. Was ist denn da los? - Eigentlich hat die Hauptsaison doch bereits begonnen. Kein Mensch in den Souvenirläden, nur Verkaufspersonal.
Dafür hat’s Aussicht. Vom Restaurant aus führen ein Weg und dann eine steile, sehr lange Treppe zu einem Tempel hinauf. Nochmal hundert Meter weiter bergwärts erreicht man schliesslich den grössten liegenden Buddha in Vietnam oder gar Asien? – Er ist 49 Meter lang und 11 Meter hoch, sieht aus wie frisch poliert, strahlend weiss im Sonnenlicht. Ein friedliches Lächeln umspielt seine Lippen, die so gross sind wie Gullivers Sofa.
Zwei Stunden dauert dieses Vergnügen (Gondelfahrt, Spaziergang, Buddha-Besichtigung, Kurzbesuch im Restaurant zwecks Kauf eines Erfrischungsgetränks und Gondelfahrt andere Richtung), bis wir wieder unten beim Taxi sind. Unser Fahrer, der auf einer Hängematte Siesta gemacht hat, schrickt auf und wir fahren weiter durch den wilden Verkehr entlang der Küstenstrasse, vorbei an endlosen Drachenfruchtplantagen sowie an roten und weissen Dünen, zurück zu unserem Hotel.
Am Donnerstagmittag laden wir unser Gepäck ins Taxi und fahren nach Phan Tiet zum Bahnhof. Dort werden wir den Zug nehmen und nach Saigon fahren.
Reisebericht 2 Vietnam – Kambodscha – Thailand
20. November – 2. Dezember 2014
Koh Samui 2. – 16. Dezember
Saigon
Es ist immer lustig, in einer Stadt anzukommen, in der man schon mal war. Bei uns war‘s ja erst gerade (vor drei Wochen) und auch nur für drei Tage. Trotzdem ist es anders, als wenn man’s gar nicht kennt. Diesmal kommen wir mit dem Zug an. Zugfahren ist sehr viel angenehmer als mit dem Bus die mühsame Strecke zurückzulegen (5-6 Stunden für 200 km). Der Zug braucht viereinhalb Stunden und die Fahrt ist sehr viel weniger gefährlich. Man ist zwar ziemlich eingepfercht, noch schlimmer als in der Economy-Class im Flugzeug, aber das nehmen wir gerne in Kauf.
Erster Abend: Sushi-Bar. Wunderbar!
Am nächsten Tag nehmen wir’s gemütlich. Einfach ein wenig durch die Stadt schlendern, darum geht’s und um nicht viel mehr. In der bekannten Backpackerstrasse, Bui Vien, die sich grad hinter unserem Hotel befindet, hat’s neben all den Shops und Restaurants auch ein paar Bilderhändler, die ab Fotos Bilder herstellen oder Werke bekannter Künstler nachmalen. Ein Bild gefällt uns so sehr, dass wir überlegen, es uns zu kaufen. Wir gehen aber vorerst weiter, können ja später immer noch zurückkommen.
Nach einer Stunde, 30 Fotos und nur einem relativ kurzen Spaziergang um den Block sind wir völlig schweissgebadet, und da meine Kamera mir mitteilt, sie hätte auf der Speicherkarte keinen Platz mehr, gehen wir zurück ins Hotel, um eine neue zu holen.
Per Taxi fahren wir anschliessend zum Bitexco-Tower, einem ziemlich neu erstellten Wolkenkratzer, von dessen Sky Deck im 49sten Stock aus man eine fantastische Aussicht über die ganze Stadt hat. - Cafépause in einem heruntergekühlten, überteuerten Café, dann geht’s weiter zu Fuss durch die Strassen und Gassen, durch den wilden Verkehr, an den ich mich wohl nie gewöhnen könnte. Wie ein Spiessrutenlauf gestaltet sich eine Strassenüberquerung. Ich bin jedes Mal froh, wenn wir heil auf der anderen Seite ankommen. Dessen bin ich aber nie so sicher. Theo hat nachgelesen und gesagt, es habe in Vietnam 2 Millionen Autos, 27 Millionen Motorräder und 90 Millionen Einwohner.
Am späten Nachmittag, zurück von unserer Tour, kommt es wie es kommen muss: Ein Bild ist zwar das Allerletzte, was wir brauchen, aber irgendwie ist unsere Bilderkauflust übermächtig und lässt mich sogar den Transport nach Hause vergessen. Mit der Zahlung ist’s nicht ganz so einfach, weil der Maler kein einziges Wort Englisch sprechen kann, sein Gehilfe ebenso wenig. Ein völlig verstaubtes Kreditkarten-Gerät hat’s dort zwar zwischen all dem Plunder, der herumliegt, aber beide wissen nicht, wie es funktioniert. So probiere ich halt, ob’s mir gelingt, die Transaktion zu bewerkstelligen. Erschwerend kommt dazu, dass alles auf dem Display in Vietnamesisch geschrieben steht. Nach Gutdünken probier ich, drücke ein paar Tasten und habe tatsächlich Erfolg. Ein Zettel wird ausgedruckt, den unterschreibe ich. Die beiden diskutieren und rufen die Bank an. Der eine beginnt, das Bild vom Rahmen zu nehmen, aufzurollen und in eine Kartonhülle zu verpacken. Mehre Telefonate mit der Bank werden zwischendurch getätigt, aber dann ist alle in Ordnung, und wir können die Rolle mitnehmen.
Am Abend gehen wir ins Opernhaus und sehen uns die AO Vorstellung an, die uns der nette junge Mann im Hotel aufs Wärmste empfohlen hat. Super war’s. Was diese jungen Leute für eine tolle Show bieten, ist bemerkenswert und hat grossen Spass gemacht.
Mit nur wenigen, aber eindrücklichen Mitteln (Körben, Stöcken) erleben wir eine Darbietung, die ihresgleichen sucht: anmutig, sehr lustig, auch exotisch, aber nicht fremd, mit grösster Leichtigkeit auf die Bühne gezaubert - Lebensfreude pur.
Trommeln und fein auf das Geschehen abgestimmte Musik untermalen das Ganze. Es ist ideenreich, vielfältig, hervorragend, nichts geht schief. Sehr artistisch, gute Choreographie. Breakdance-Elemente hat’s ebenfalls. Die Stunde ist leider im Nu vorbei. Das Geld ist es wert. Sehr grosser Beifall am Schluss; ganz klar: allen hat die Darbietung gefallen.
In der Lobby kann man nach der Vorstellung das ganze Ensemble auf der Treppe fotografieren mit oder ohne sich selber.
Anschliessend wollen wir essen gehen. Das hat weniger Spass gemacht. Obwohl wir ja das Gefühl haben, nach einem Monat Vietnam seien wir gegen das Schlimmste gewappnet, merken wir, dass wir noch sehr viel lernen müssen. Sehr oft hat‘s mit der Sprache zu tun, wenn man nicht kommunizieren kann, ist alles so viel schwieriger. Langsam sollten wir begriffen haben, dass es besser ist, im Restaurant ein Gericht nach dem anderen zu bestellen. Das Servierpersonal möchte nämlich alles besonders gut machen und grad alles auf einmal bringen. Auch sollten wir wissen, dass man die Kreditkarte der Kellnerin nicht einfach mitgibt, ohne vorher die Rechnung gesehen zu haben. Auch sollte man die Karte nicht aus den Augen lassen. Gut, das war wohl kein Problem, aber man tut es einfach nicht (man = Theo).
Bestellt haben wir einen Salat, der auf der Karte zwar angeboten wurde, den es aber nicht mehr hatte. Den wollten wir zur Vorspeise und ihn dann teilen. Die Kellnerin empfahl mir einen anderen, der sehr gut sei. Ok, nehm ich. Theo wollte wieder mal Fleisch mit Pommes Frites. – Das Getränk kam, dann die Pommes Frites. Dazu ein Stück Butter und ein kleines Schälchen Salz. Dachten wir… Theo sprenkelte ein wenig davon über unsere „Vorspeise“, merkte dann aber, dass es Zucker war. Wir bestellten eine zweite Portion. Dann kam das Fleisch - erst mal ohne Pommes Frites. Zwei Gabeln lagen da zur Auswahl, auch Stäbchen. Das Messer fehlte. Dann kam die Beilage endlich, nachdem das Steak schon fast gegessen war. Wir möchten gerne ein wenig Salz. Ein Kellner bringt ein Salzgefäss. Es ist leer. Ein zweites. Ebenso leer (das alles dauert natürlich länger als dass es sich jetzt liest). So kommt jetzt ein bekanntes Schälchen mit etwas Weissem drin. Diesmal probieren wir erst (gebrannte Kinder).
Ok, diesmal ist es Salz. Jetzt hat doch tatsächlich auch der Salat den Weg auf unseren Tisch gefunden. Er ist schmackhaft, muss ich sagen, aber so scharf, dass ich ihn kaum essen kann. - Manchmal geht eben alles schief. Zu guter Letzt kommt die Rechnung. Natürlich müssen wir zwei Portionen Pommes Frites bezahlen, wir haben schliesslich zwei bestellt. Ja, unsere europäischen Seelen haben schon ein wenig Mühe damit, obwohl der „Schaden“ ja an einem kleinen Ort und eigentlich vernachlässigbar ist. Unsere Prinzipien halt… Auf der Rechnung sehe ich dann, dass wir sogar für die Servietten bezahlen müssen. Das ist wirklich absurd. - Aber in diesem Land darf man ja nur lächeln. Das sagt uns der Reiseführer (Buch). Tun wir. Wir bezahlen schön brav alles, schnappen uns ein Taxi und kehren zurück ins Hotel. Es ist eine Fahrerin dieses Mal, die erste Frau, die wir am Steuer eines Taxis sehen. Sie ist auch die erste, die geradewegs ohne Umweg zum Hotel fährt (wir kennen mittlerweile die Strecke) und die erste, die uns direkt vor dem Hotel absetzt.
Cu Chi Tunnel
Im Hotel treffen wir unsere neue Reisegruppe und machen uns bekannt.
Am nächsten Tag sind die Cu Chi Tunnel auf dem Programm (meine Eselsbrücke: Armani).
Die Car-Reise für die etwa 50 km dauert fast zwei Stunden. Der Besuch der Tunnelanlage ist äusserst eindrücklich. Es ist dort, wo die Partisanen eine Art unterirdische Stadt gebaut haben und es dann zu entsetzlichen Kämpfen kam zwischen den Vietnamesen und den Amerikanern. Das ganze Tunnelsystem soll ca. 200 km lang gewesen sein, zum Teil bis zu drei Stockwerke hoch beziehungsweise tief. Was wir von unserem Führer (er heisst Long – meine Eselsbrücke „short“) über die Geschichte hören, ist natürlich sehr einseitig, ebenso der Film, der als Einstieg dort gezeigt wird. Die Tunnel sind schmal und eng und dunkel; einige davon sind ein bisschen vergrössert worden, so dass auch für den Durchschnittseuropäer im Kauer-Gang ein Sich-Durchdrängen möglich wird, jedenfalls für die nicht übersättigten Exemplare. Nicht einmal die Hälfte unserer Reisegruppe macht mit. Und nur drei „unserer“ Männer riskieren sogar eine Strecke, wo man nur grad auf allen Vieren vorwärts kommt. Die müssen da durch, sagt ihnen wohl ihr Ego. - Wie Theo, der Held, nach dreissig Metern wieder aus dem Boden auftaucht, bin ich echt froh, dass er es geschafft hat. Man stelle sich vor, wenn er stecken geblieben wäre… Jetzt beklagt er zum ersten Mal, dass es mit seiner Fitness doch nicht mehr so ganz zum Besten steht. Er ist total verschwitzt, aber glücklich, dass das Unterfangen gelungen ist. Ich meinerseits habe auf diesen weiteren Teil der Strecke gern verzichtet, weil ich vorher von Fledermäusen umflattert worden bin, was eindeutig nicht nach meinem Geschmack ist. Und überhaupt, man soll ja nicht übertreiben. (Nachtrag: Der unerklärliche Muskelkater, über den Theo am nächsten Tag klagt, ist zweifellos auf die 30m-Tunnel-Kriecherei zurückzuführen.)
Im Gelände werden uns auch all die verschiedenen Arten von Fallen gezeigt, die im Dschungel in den Boden eingegraben wurden – es ist grauenhaft!!!
Mit dem Bus geht’s zurück in die Stadt. Unterwegs fängt es heftig an zu regnen. Die uns umschwirrenden Motorradfahrer lassen sich dadurch nicht heftig stören; sie tragen jetzt bunte Pelerinen.
Unterwegs nach Kambodscha
Am folgenden Tag heisst’s wieder Koffer packen und früh los. Wo wir schon vor drei Wochen waren, gehen wir nun wieder hin: ins Mekong Delta. Besuch der Obst- und Kokosnussplantagen, Bootfahrt entlang der Nipapalmen (stehen im Wasser und haben keinen Stamm, aus dem Saft der Frucht wird Zuckersirup und Alkohol gewonnen). Der Tag verläuft ähnlich wie mit der ersten Reisegruppe, obwohl wir nicht dieselben Orte besuchen, an denen wir schon waren, nur, dass wir anschliessend weiterfahren Richtung Westen. Unterwegs Besichtigung des Cao Dai Tempels, von dem sogar unser Guide sagt, er sei „ein wenig kitschig“. Es ist der Tempel einer hinduistisch-buddhistisch-christlichen Sekte (Trinh Do Ku Si).
In Can Tho (Eselsleiter: El Canto) übernachten wir. Hier ist die Kommunikation noch schwieriger als in Saigon. Die englische Sprache scheint noch nicht bis hierhin vorgedrungen zu sein. So gestaltet es sich recht schwierig, in einem Restaurant etwas zu bestellen. Wir finden eines, das gar nicht mal so schlecht aussieht. Das Personal ist ober-freundlich, legt uns die Speisekarte hin und zu dritt stehen sie hinter meinem Rücken und schauen zu, was ich mit der Karte anstelle. Es hat schlecht gezeichnete Bilder drin. Auf der ersten Seite beginnt’s mit Aal, Spatzen, Tauben und Schlangen. Nein, also so doch nicht. Wir stehen auf, entschuldigen uns und suchen ein anderes Restaurant. Theo wieder mal mit seinen Pommes Frites. – Und hier machen wir eine Entdeckung: Pommes Frites, serviert mit Butter und Zucker, sind offenbar normal. Ein kulturelles Missverständnis also. Wer wieso auf die Zucker-Idee kam, nähme mich schon wunder, aber fragen kann man hier ja niemanden.
Der nächste Tag ist Theos 70ster Geburtstag. Schon um halb sechs läutet der Wecker (und tags drauf um fünf Uhr). Man stelle sich den lieben Theo vor! - Ziemlich speziell: Einen so langen Geburi-Tag hat er wohl noch nie im Leben gehabt.
Eine Bootfahrt ist’s, die uns so früh aus den Federn lockt. Wir fahren nach Cai Rang zum schwimmenden Markt. Käufer und Verkäufer aus den umliegenden Provinzen betreiben einen regen Handel von Boot zu Boot. Wunderbar zu schauen.
Nach der Bootsfahrt ein weiterer Markt, diesmal an Land. Theo kauft sich zum Geburtstag eine neue Baseball-Cap für drei Franken. Unterwegs zum Tagesziel Chau Doc, dem Grenzort zwischen Vietnam und Kambodscha, machen wir in einer Krokodilfarm einen Mittagshalt. 40‘000 Tiere hat’s dort, Exemplare in jeder Grösse. Wie bei Hänsel und Gretel warten sie alle darauf, bis sie dick genug sind, so dass man ihr Fleisch essen und aus dem, was drum herum vorhanden ist, Taschen, Schuhe Gürtel und Portemonnaies machen kann. Frühlingsrollen aus Krokodilfleisch ist die Spezialität. Mein Mut verlässt mich, ich bestelle welche aus Schweinefleisch, probiere aber ein Stück geschnetzeltes Krokodilfleisch von einem anderen Teller. So schlecht schmeckt es nicht, etwas gummig zwar, ein wenig wie zu zäh gekochtes Schweinefleisch.
Wieder unterwegs fahren wir, einmal mehr, an zahllosen Reisfeldern vorbei, an BMWs (Bauer mit Wasserbüffel) und etwas ganz Besonderes sehen wir in den abgeernteten Feldern: eine riesige Schar von Gänsen, die, eng zusammengepfercht, in eine Richtung marschieren. Ein Gänsejunge treibt sie an. Ein Bild wie eine Schafherde, die von einem Border Collie getrieben wird. Nur braucht es hier gar keinen Hund, sie bleiben alle schön zusammen und trippeln in die gewünschte Richtung. - Gegen vier Uhr, Theo wird schon ganz quengelig und möchte endlich ins Hotel gebracht werden (zwecks Siesta), macht der Bus einen Abstecher in ein Naturschutzgebiet, den Tran Su Kajeput Wald. Diese Bootsfahrt verpasst zu haben, wäre sünd und schad gewesen. Die Bäume stehen im Wasser, es sind eine Art Süsswasser-Mangroven. Dazwischen hat sich ein grüner Teppich gebildet aus Wasserpflanzen, durch den man mit kleinen Booten hindurch fährt. Es herrscht eine Stille, die nur vom Plätschern der Ruder und von Vogelschreien durchbrochen wird, eine sagenhaft betörende Gegend. - Weiter geht die Fahrt durch einen Lotus-See; ein Sonnenuntergang wird zusätzlich geboten. Märchenhaft.
Das Hotel in dieser kleinen Provinzstadt ist dann weniger märchenhaft. Von aussen ganz flott, innen lässt manches zu wünschen übrig. Sogar der Manager sagt, es wär vermutlich besser, man würde es niederreissen und neu bauen. Was sich die Architekten da wohl gedacht haben (nur ein Beispiel): Es gibt keinen Lift, und die armen Angestellten müssen jeweils all die schweren Koffer zwei Stockwerke hochschleppen und am nächsten Morgen wieder runter. Es ist übrigens nicht das erste Hotel mit diesem personalfreundlichen Konzept.
In der Mitte hat es einen Pool, der ist ganz in Ordnung, aber jetzt ist es zu spät, um den zu nutzen, obwohl eine Abkühlung sehr willkommen gewesen wäre. Wir essen im Hotel, weil der Ort so klein ist und Long, unser Reiseführer, sagt, es habe keine akzeptablen Restaurants in der Nähe. Das Buffet, das am Pool aufgestellt wird, ist aber sehr lecker, und es gelingt mir sogar, eine Flasche Rotwein aufzutreiben (die einzige, die es noch hat), die allerdings in einem Eiskübel auf Normaltemperatur herunter gekühlt werden muss, damit man nicht denkt, es handle sich um Glühwein. So ist also Theos Geburtstagsessen doch noch ganz „nett“ ausgefallen. Wir sitzen am Pool an einem Zweiertischchen gleich neben der lauten Wasserpumpe und sind sicher, dass wir diesen Ehrentag nicht so rasch wieder vergessen werden.
Grenzübertritt und Phnom Penh
Am nächsten Tag geht’s, wie schon erwähnt, sehr früh zur Sache. Tagwacht um fünf, um Viertel vor sieben sind wir mit Sack und Pack am Bootssteg und besteigen das Schnellboot nach Phnom Penh. Nach einer Stunde Fahrt erreichen wir die Grenze. Alle müssen aussteigen und warten. Die beiden Boys, die das Schiff managen, sind so etwas von effizient und freundlich; es ist unglaublich. Geschickt werden alle Koffer verstaut und wir kriegen Schwimmwesten, die wir nur tragen müssen, so erklären sie uns, bis wir die ersten Polizeikontrollen unterwegs passiert haben. Schon am Vorabend kamen sie ins Hotel, haben unsere Pässe, das ausgefüllte Aus- und Einreiseformular und die Kohle (34$ pro Person) eingesammelt und haben für uns alle Ausreiseformalitäten erledigt. Wir können wieder einsteigen und weiter geht’s zum kambodschanischen Zoll. Dort müssen wir selber Schlange stehen bei 35 Grad ohne Sonnendach. Bis wir am Schalter den Pass gezeigt, ein paar Stempel drein gedrückt bekommen haben und dann endlich wieder das Schiff besteigen können, ist eine knappe Stunde vergangen. Jetzt geht’s weiter mit Vollspeed Richtung Hauptstadt. Auch wie die beiden Boys das Schiff im Griff haben, ist bemerkenswert. Es fliegt flussaufwärts. Wie im Flugzeug wird uns sogar ein Mittagessen serviert, ein paar Sandwiches, Früchte, Getränke. Nach weiteren drei Stunden kommen wir in Phnom Penh an und werden von unserem nächsten deutschsprachigen Reiseführer empfangen. Er heisst Daviin und ist sehr eloquent, intelligent und gebildet. Er macht so gut wie keine Deutschfehler und hat einen riesigen Wortschatz. Er ist ein Freelancer und auch recht kritisch gegenüber allem, was Politik und Geschichte betrifft. Sehr interessant, was er uns alles erzählt. Mit ihm machen wir eine Stadtrundfahrt (zur Abwechslung wiedermal ein Tempel, die königliche Residenz mit der Silberpagode und das Nationalmuseum), dann geht’s zum Hotel. Wir sind zu müde, um gross ins Zentrum zu fahren und beschliessen, gleich am Ende der Strasse etwas zu essen, wo’s zwei Restaurants hat. Einheimische. Von Daviin nicht empfohlen. Von diversen Mitreisenden als zu scheusslich eingestuft, als dass man es dort wagen könnte zu essen. Wir gehen trotzdem hin. Wir sind zu acht und bestellen irgendwelche Dinge, Fleisch, Reis, Nudeln, Fisch – wie’s grad geht mit unseren nicht existenten Sprachkenntnissen. Natürlich - man isst aus Plastiktellern und das Auge isst nicht mit, aber alles ist super gut, wunderbar gewürzt und inklusive Getränke kostet unser üppiges Nachtessen 4$ pro Person. Wir haben brav, wie sich das für Schweizer gehört, die Teller zusammengestellt und die Servietten hineingelegt - nicht so die anderen Gäste, alles Einheimische. Es scheint üblich, nach dem Essen alles auf den Boden zu schmeissen und so eine unermessliche Sauerei zu hinterlassen. Auch dieses Abendessen eine Erfahrung mehr.
Erwähnenswert ist auch: Niemand hatte irgendwelche Magenprobleme am nächsten Tag. Ebenfalls das Eis, das ich mit meinem Soda bestellt hatte, war einwandfrei.
Fahrt nach Siem Reap und Angkor Wat
Am nächsten Tag, dem Mittwoch, 26. November, haben wir eine lange Busfahrt vor uns. Ziel ist Siem Reap (man spricht‘s aus, wie’s geschrieben steht), und dort werden wir (endlich!) drei Nächte lang bleiben können. Angkor Wat zu besuchen, war schon seit jeher mein Wunsch und genau dieser Ort ist der Grund, weshalb ich diese Reise (und alles drum herum) überhaupt gebucht habe. Nach Angabe des Reisebüros sollte die Fahrt etwa sieben Stunden dauern (400 km), wir kommen nach neun Stunden an. Unterwegs begibt es sich nämlich, dass der Bus-Chauffeur mal unter dem Bus liegt, statt auf seinem Sessel sitzend durch die Gegend zu fahren, denn beim Passieren des tausend-und-x-ten Schlaglochs ertönt ein lauter Knall - ein Luftkissen ist geplatzt. Etwa eine Stunde dauert die Reparatur. Der Fahrer tut mir leid. Niemand hilft ihm. Ganz allein muss er den riesigen Bus hinten hochkurbeln und den Schaden flicken. Wir müssen natürlich alle aussteigen und warten. Es ist sehr heiss. Nach getaner Arbeit geht er sich im Kanal, der sich zwischen der Strasse und dem Reisfeld befindet, waschen und abkühlen. Er zieht ein neues Hemd an und weiter geht die Fahrt.
Eigentlich habe ich im Sinn gehabt, auf der langen Reise ein wenig zu lesen, aber ich komme gar nicht dazu, weil es so spannend ist, hinauszuschauen, all die Reisfelder zu sehen, die bunten, zum Teil schwer beladenen Motorradfahrer, die wir überholen und die Orte, die wir durchqueren. In einem Städtchen halten wir an, wo’s einen ganz besonderen Markt hat. Weniger zum Einkaufen für Ausländer, aber zum (gruselige) Fotos Machen schon. Es sind vor allem Insekten und Spinnen, die dort zum Verzehr verkauft werden. Grillen in rauen Mengen, schön aufgetürmt, auch Eier mit halb ausgebrüteten Hühnern drin werden angeboten. Theo ist fasziniert. Ein kleiner Junge kommt mit einer noch lebenden Vogelspinne und legt sie ihm auf den Arm. Theo meint erst, das Ding sei aus Plastik. Ist es aber nicht. Der Bub hat ein Zahnbürstchen dabei, mit dem er dem Tier hin und wieder über den Kopf streicht, damit es sich bewegt. Ein Mädchen bringt eine zweite Spinne, so tummeln sich jetzt zwei auf dem Vorderarm meines Gatten. Die armen Dinger sind wohl irgendwie sediert, sie bleiben schön brav sitzen. Sicher sind auch sie dem Tode geweiht. Theo kauft auch eine Grille, die er dann essen will. Sie ist noch jetzt in einem Plastiksäckchen in seinem Gepäck. Das Happening, das zu inszenieren er vorhatte, ist aus Zeitmangel (zum Glück) nicht zustande gekommen.
Apropos Grillen: Auf den Reisfeldern sieht man vielerorts Fallen, in denen sich die Tiere zuhauf fangen lassen. Dies zur grossen Freude der Schädlinge auf den Reisfeldern, denn wenn ihre Feinde tot sind, von den Menschen gefressen, können sie ihnen ja nichts mehr anhaben und sich wieder ungestört an die Reiskörner heranmachen. Allerdings ist die Freude nicht von langer Dauer, weil die natürlichen Feinde fehlen, werden sie jetzt mit Insektenvertilgungsmittel um die Ecke gebracht. So läuft das.
Angkor Wat und Angkor Thom (wir verstehen beide immer: Onkel Tom) sind mehr als nur eine Reise wert. Das riesige Gebiet der Ausgrabungen ist UNESCO Weltkulturerbe und ich hatte immer Angst, irgendwann würde man vielleicht wegen des Massentourismus nicht mehr hingehen können. Im Moment aber ist das noch überhaupt kein Thema. Touristen hat’s zwar wie Sand am Meer (wir gehören auch dazu, ich weiss schon), die überall herum kraxeln (der höchste Turm der Tempelanlage ist 65 Meter hoch). Das Business blüht. Als Erstes muss man eine Ticket lösen, 20$ pro Tag, und man wird fotografiert. Dieses Föteli kommt aufs Eintrittsbillet, das man immer mit sich herumtragen muss. Durchorganisiert. Toiletten hat’s auch. Unser Führer, ein anderer wieder mit Namen Dopi, sagt zu uns Frauen, es habe dort sogar „schöne Stühle“. Was man unter „schön“ nicht alles verstehen kann. Ich beschreibe die schönen Stühle jetzt mal lieber nicht. Die Löcher nebendran auch nicht. Es hat auch Lavabos dort (und auch die beschreibe ich lieber nicht), um sich die Hände zu waschen, aber leider fehlt das Wasser; es könnte sein, dass es gebraucht wird, um den Boden unter und neben den schönen Stühle zu schwemmen.
Sonst gibt’s nichts auszusetzen. Was man sehen, fotografieren, beklettern und bestaunen kann, ist einmalig. Grossartig. Die Grösse der Tempelanlagen ist mehr als nur eindrücklich. Das ganze Gebiet erstreckt sich über 400 km2. Noch längst ist nicht alles ausgegraben. Während 700 Jahren wurden an diesem Ort etwa sieben Hauptstädte gebaut und unzählige Tempel. Mehr als eine Million Einwohner sollen dort gewohnt haben. Nur noch die Tempel sind übrig geblieben, die Behausungen der Einwohner waren aus Holz gebaut und sind daher nicht mehr vorhanden.
Neben Angkor Wat ist auch Angkor Thom imposant wegen der rund 200 bis zu 7 Meter hohen Gesichtern, die aus Stein in über 40 Türme gehauen sind.
Am besten gefiel mir der Jungle-Temple-Bezirk, der Ta Prohm. Einfach gewaltig, wie die Natur die von Menschen erschaffenen Bauten zurückerobert. Mit ihren riesigen Wurzeln umgarnen und durchdringen die Bäume (Silk-Cotton-Tree and Strangler Fig = Würgefeigen) wie Schlangen die Ruinen und lassen sie zerfallen. Dieser Mix zwischen Natur und Bauwerk ist einzigartig. Ich könnte mir einen Zeitlupen-Horror-Film vorstellen, der zeigt, wie die Tempelanlage entstanden beziehungsweise zerstört wurde und wohl auch weiterhin zermalmt werden wird. Die Wurzeln scheinen zu leben, Medusa kommt mir in den Sinn. - Creepy!
Mehr als 12‘000 Mönche sollen damals (im 12. / 13. Jhd.) dort gelebt haben.
Die Stadt Siem Reap lebt natürlich vom Tourismus. Da ist immer etwas los. Laden reiht sich an Laden, oft wird dieselbe Ware an jeder Ecke verkauft: T-Shirts, Kleider, Stoffe, Etuis und Taschen jeglicher Art und Grösse, Souvenirs, Buddha-Köpfe und -Statuen, Gewürze, Früchte etc. etc. Und Duzende von Restaurants, die Gerichte aus aller Welt anbieten. Wir bevorzugen die Khmer-Küche. Es sind fein gewürzte Gerichte, ähnlich wie die Thai-Küche sie kennt, aber (fast) ohne Chili. Amok hab ich am liebsten.
Theo entdeckt einen Coiffeur und beschliesst, sich die Haare schneiden zu lassen. Vor mir sehe ich folgendes Bild: Im Geschäft, vor dem ich stehe, hat’s auf der Strasse zwei pinkfarbene Sofas und davor Aquarien mit Fischen drin, wo man sich die Füsse und Waden abknabbern lassen kann (seit wenigen Jahren vielerorts der neueste Gag - die armen Fische!). Hinter diesen Tanks eine Mutter, die ihr Kleinkind mit Nudeln füttert, dann eine Reihe rosaroter Massagestühle und zuhinterst der Coiffeur-Stuhl. Dort thront Theo, zugedeckt mit einer rosaroten Frisier-Schürze (nur sein Kopf schaut heraus) und lässt sich von einem jungen Kambodschaner eine neue Frise verpassen. Sehr zufrieden ist er, fünf Franken hat’s gekostet.
Tonle Sap See und Grenzübertritt nach Thailand
Am nächsten Tag machen wir einen Ausflug auf den Tonle-Sap-See. Er ist der grösste Binnensee in Südost-Asien. In der Regenzeit wird er bis zu viermal grösser (25.000 km²) als in der Trockenzeit und fünfmal tiefer. Im Moment sieht er aus wie ein Meer; man sieht das gegenüberliegende Ufer nicht. Ein Naturphänomen findet in November statt, wenn der Tonle-Sap-Zufluss zum Mekong hin seine Fliessrichtung ändert. Entlang des Ufers haben sich Hausboote einquartiert. Vietnamesen seien es, erklärt uns Dopi. Diese dürfen kein Land kaufen in Kambodscha, aber auf den Booten leben, ist erlaubt. Sie sind Fischer, arbeiten tagsüber aber nicht, nur des Nachts. Für die Touristen hat’s auch Restaurants und Verkaufsläden auf Flossen mit Lookouts, so dass man, wenn man dort in den zweiten Stock hinaufsteigt, einen schönen Blick über die Gegend und die Hausboote hat. Entlang der Strasse zum See stehen Häuser auf Pfählen, und viele der Restaurants (für die Einheimischen eher) sind versehen mit mehr Hängematten als Stühlen, wo nach dem Essen geruht wird. Theo gefällt dieses Detail besonders gut.
Wieder haben wir eine längere Bus-Reise vor uns. 420 km sind’s diesmal. Wir werden an die kambodschanisch-thailändische Grenze gebracht. Dort herrscht ein geschäftiges, buntes und lautes Treiben, ein Hin und Her mit Schubkarren, Waren und Menschen, die von drüben kommen oder, wie wir, hinüber wollen. Die Ausreise dauert eine knappe halbe Stunde, Anstehen, Pass zeigen, tief in die Augen schauen, Passfoto mit Lebendobjekt vergleichen, wie das eben so ist. Als besonderes Gadget hat der Beamte ein kleines Gerät vor sich stehen und wir müssen unsere Fingerabdrücke abgeben. Wie in Amerika bei der Einreise. Was das hier aber bei der Ausreise soll? Das Apparätli sieht auch eher aus wie ein Spielzeugtruckli, das grün aufleuchtet, wenn alles ok ist. Na ja. Auf Theos Fingerabdrücke verzichten sie. Ich versteh’s heut noch nicht, glaube aber stark, dass gar nichts dahinter steckt. Es sieht einfach ziemlich wichtig aus.
Das alles war erst der Anfang.
Bis zum Zoll auf der anderen Seite sind‘s etwa 500 Meter. Dorthin muss man seine Koffer selber schleppen. Seltsamerweise hat’s niemanden, der sich einem anbietet, dies zu tun. Meine einzige Erklärung dafür ist, dass das strikte verboten ist. Sonst wird ja immer und überall versucht, ein wenig Geld zu verdienen.
Weshalb dem Erfinder der Rollen am Reisegepäck noch kein Denkmal gesetzt wurde, ist mir ein Rätsel. Rollkoffer sind ein Segen (genauso wie die Erfindung des Reissverschlusses, der Wasch- und Geschirrspülmaschine, des Staubsaugers, des Kühlschranks etc. etc.), vor allem auch diejenigen mit vier Rollen, die man mit zwei Fingern stossen kann, Gewicht egal.
Wenn allerdings der Boden so beschaffen ist wie das Niemandsland zwischen Kambodscha und Thailand… Luftkissen-Springfedern oder etwas Ähnliches wären allenfalls eine Folge-Erfindung wert.
Die letzten hundert Meter bis zum Zoll führen durch eine enge Passage, in der sich zahlreiche Bettler niedergelassen haben, die einem den Weg halb versperren. Da mit einem grossen Koffer und einem Handgepäckstück durch zu zirkeln, ist nicht das Einfachste vom Einfachen. Aber gleich haben wir‘s ja geschafft. Denke ich. Jetzt wird einem ein Einreiseformular ausgehändigt, und weiter geht’s zum Zollgebäude. Dieses ist nicht ebenerdig. Es hat auch keinen Lift, dafür mindestens zwanzig Stufen bis zum Eingang. Dort hinauf muss jetzt jeder sein Gepäck selber hinaufbefördern. Wer nicht vorher schon völlig verschwitzt und abgekämpft war, ist es spätestens jetzt. - Endlich gelangt man in die Zollabfertigungs-Halle. Die ist bereits voller Leute, die Schlange stehen. Hin und zurück, hin und zurück, hin und zurück, immer dem gespannten Band entlang. Hinter all den Leuten sieht man (von fern), dass es sechs Schalter hat. Zwei sind den Einheimischen vorbehalten, von den anderen vier ist nur einer besetzt. Etwas später dann noch ein zweiter. Nach der Mittagspause alle vier. Niemand muckst. Das macht man einfach nicht beim Zoll, das scheinen alle zu wissen. Aber einer aus unserer Gruppe fällt um. Er ist achtzig und das alles ist dann doch zu viel für ihn. Er erhält nun das Privileg, ganz vorne bei den Schaltern auf einen Stuhl sitzen zu dürfen.
Immer mehr Leute stehen an, die Halle ist nicht gross genug, viele müssen vor und auf besagter Treppe in der brütenden Sonne warten. Bis wir dran sind, dauert es anderthalb Stunden. Gut, dass wir beide unsere e-Books dabei haben. So wird die Warterei erträglicher. - Endlich! – Stempel etc. Als Nächstes müssen die Koffer natürlich auf der anderen Seite wieder die Treppe hinuntergeschafft werden, Lift hat’s auch da keinen, Helfer ebenso wenig. Wieso dieses Gebäude nicht ebenerdig ist, frage ich mich. Sind Touristen hier überhaupt willkommen?
Der Bus nach Bangkok wartet bereits und wir fahren los. In Vietnam und Kambodscha war immer ein Bus-Beifahrer dabei, der dafür besorgt war, dass es den Gästen gut ging. Hier hätte ich nach all den Strapazen auch erwartet, dass man uns ein Feuchttüchlein reicht und eine Flasche gekühltes Wasser. Aber nein. Der Bus fährt fast zwei Stunden lang bis zu einer Tankstelle, wo’s Toiletten und einen 7/11-Laden hat. Weitere fast drei Stunden dauert die Fahrt bis zum Hotel. Von dort an ist alles gut. Sehr sogar (bis für zwei aus unserer Gruppe, die bei der Tankstelle offenbar etwas gekauft und gegessen haben, was ihren Mägen nicht wirklich hold war).
Von der Reiseleitung erhalten wir ein Schreiben, das uns vor terroristischen Anschlägen warnt. Orte mit Menschenansammlungen soll man vermeiden. Ok, ok, dann ist halt nichts mit Sightseeing, Metrostationen kommen wohl auch nicht in Frage - da bleibt man wohl am besten im Hotel, was sicherlich keine Strafe wäre. - Obwohl, in diesen grossen Hotels könnte es ja auch gefährlich werden…
Bangkok
Zwei Tage in Bangkok - ich hätte die Stadt nicht wieder erkannt, es ist aber auch schon etliche Jahre her, seit ich zum letzten Mal hier war. Jetzt hat’s einen Sky-Train, mit dem man sich bequem und schnell von Ort zu Ort begeben kann. Auch eine Metro. Es hat massenhaft neue Gebäude, Hochhäuser und im Gegensatz zu den beiden anderen Ländern, wo wir bis anhin waren, kriegt man fast einen Kulturschock. Lauter teure Autos fahren herum, der Verkehr ist grauenhaft, die Abgase dementsprechend. Motorräder hat’s kaum mehr, Velos schon gar nicht; es ist wie bei uns, die Strassen und die vielen über- und untereinander gebauten Autobahnen sind oft verstopft. Tuc-Tucs gibt‘s zwar noch, vor allem im Zentrum, aber deren Zahl ist deutlich kleiner geworden.
Wir schieben eine ruhige Kugel. Theo kann endlich wieder einmal länger ausschlafen. Acht Uhr kommt ihm neuerdings schon spät vor - wer hätte das gedacht! Das Frühstücksbuffet im Hotel ist eine Bombe. Da gibt’s alles von Nudelsuppe über Sushi, Dim Sum, Eierspeisen, Früchten und und und bis zu Birchermüesli und Fotzelschnitten. Und alles prächtig und aufwändig präsentiert.
Dann ziehen wir los, kaufen uns ein Tagesticket für den Sky-Train, unternehmen eine Bootsfahrt durch die Klongs, nur wir zwei, sicher total überbezahlt, aber sehr erholsam, interessant und beschaulich. An x Tempeln und Wohnhäusern gondeln wir gemütlich vorbei; die Fahrt dauert eine Stunde.
Abends schlendern wir durch den Night-Market von Patpong. Meine Ausbeute: ein Bikini. Abendessen in einem Strassenrestaurant mit sehr freundlicher Bedienung, zähem Hühnerfleisch und dröhnendem Strassenverkehr.
Für 60 Euro pro Person wird von der dortigen Reiseleitung ein Trip angeboten zu einem Markt, ein wenig ausserhalb der Stadt. Das Spezielle daran ist, ein Zug fährt ein paarmal täglich mitten durch den Markt hindurch und die Händler müssen jeweils rasch ihre Ware von den Schienen wegnehmen und die Storen zurückziehen. Das muss mal was anderes sein zur Abwechslung. Märkte haben wir ja inzwischen genug gesehen, aber wieso nicht? Nur nicht mit Reisecar und Gruppe.
Im Tripadvisor hat jemand geschrieben, dass man einen Minibus dorthin nehmen muss, aber er hat nicht erwähnt, wie weit die Strecke ist. Sonst hätten wir uns den Fall vielleicht doch noch überlegt. Und vielleicht hätte ich diesen Ausflug im Vorfeld doch etwas besser recherchieren sollen… Den Minibusbahnhof finden wir relativ rasch, ein Bus ist gleich startbereit, die Tickets kosten zwei Franken pro Person. Der Bus ist voll besetzt; wir sind ziemlich eingepfercht – wie Sardinen in einer Büchse. Niemand spricht ein Wort Englisch, auch die zwei Japanern nicht, die mit uns die einzigen ausländischen Passagiere sind.
Nach einer halben Stunde Fahrt kommen mir leise Zweifel, ob wir wirklich im richtigen Bus sind, wir rasen über Stadtautobahnen, fahren über Land und durch Dörfer, die nicht enden wollen. Zehn Minuten später hält der Bus an, aber nur, um eine Sardine herauszulassen. Weiter geht’s. Nach fünfzig Minuten biegt er ab. Endlich! - Nein, er geht nur tanken.
Nach einer guten Stunde kommen wir dann doch noch an. Wir sind am richtigen Ort, in Mae Klong, und mithilfe des freundlichen Ortspolizisten finden wir auch den riesigen Markt. Und tatsächlich: Eine Eisenbahnlinie zieht sich durch den Markt, sogar eine Haltestelle ist dort. Wir schauen zu, wie das oben beschriebene Spektakel vor sich geht: Ein dumpfes Hupen ertönt, dann kommt unter den Händlern eine rege Tätigkeit in Gang. Sie schieben ihre Ware von den Schienen weg, klappen die Vordächer hoch und schon erscheint der Zug. Lustig, lustig! Ich finde, die lange Reise hat sich gelohnt, es war zwar ein kurzes Vergnügen letztlich, aber schon ziemlich speziell. Zehn Franken hat der Ausflug gekostet für uns beide, zwei Getränke inbegriffen. Nicht 120 Euro, wie offeriert.
Gut gefällt uns das Abendessen zurück in der Stadt in einem sehr speziellen Restaurant, dem „Cabbages and Condoms“. (Wohltätigkeits-Projekt um die Überbevölkerung in den Griff zu bekommen und Aids zu stoppen). Lebensgrosse Figuren sind ausgestellt (jetzt unter anderen der Sankt Nikolaus) - wenn man näher hinsieht, alle aus Kondomen angefertigt. Ebenso sind die Lampen aus diesen Gummis gebastelt und wenn man zahlt, erhält man mit der Rechnung statt eines Bonbons ein Kondom. Das Restaurant befindet sich in einem schönen Garten, ist hübsch beleuchtet, aber wenn man nicht weiss, dass es dort ist, würde man den Spaziergang durch diese dunkle Gasse wohl eher nicht in Betracht ziehen. Das Essen ist wunderbar, wir würden wieder dorthin gehen.
Noch ein Abschnitt zu unserer Reisegruppe im Nachhinein:
Diese zweite Reisegruppe war ein wenig seltsam. Und viel zu gross. Wir waren 15 Schweizerinnen und Schweizer. Dazu kam eine Gruppe aus Deutschland - zusätzlich zwölf Leute. Eine weitere Gruppe aus Österreich machte dieselbe Reise; wir sahen sie aber immer nur am Abend im Hotel. Sie reisten mit einem anderen Führer und in einem anderen Bus.
In unserer ersten Gruppe in Vietnam hatten alle gleich Kontakt zueinander. Es war unterhaltsam und man ging oft zusammen essen, auch wenn man „frei“ hatte.
Hier war fast das Gegenteil der Fall. Seltsamerweise kamen wir mit den deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer so gut wie nicht ins Gespräch. Einige von ihnen vergassen gar zu grüssten jeweils am Morgen. Nach ein paar hilflosen Versuchen, ein Gespräch in Gang zu bringen, gab ich’s auf. Auch am Ende der Reise wussten wir deren Namen nicht einmal. – In Kambodscha wurde unsere Gruppe geteilt. Keine Ahnung, wieso. Die Deutschen waren nun mit den Österreichern zusammen, wir Schweizer allein, nur noch zu sechzehnt, weil doch einer aus der deutschen Gruppe nicht wechseln wollte. Auch er hat so gut wie nie etwas gesagt, aber offenbar war’s ihm bei den Schweizern wohler.
Mit der kleineren Gruppe war’s dann viel angenehmer, das Durchschnittsalter hatte sich trotz unserer Anwesenheit erheblich gesenkt, und wir hatten mit mindestens sieben Reiseteilnehmerinnen und -teilnehmern guten Kontakt. So gut, dass uns zwei davon sogar überflüssige Kilos Gepäck mit nach Hause nahmen. So sind wir also unser allgegenwärtiges Problem mit dem Übergewicht los, weil sie bei ihrem Rückflug 30 kg Freigepäck und wir dann nur 20 kg haben. Mit anderen Worten: Wir können erneut wieder ein bisschen was einkaufen. – Was für ein Segen!
Kleines Detail: Ich habe ihnen Theos roten, relativ schweren Schweizer-Sportsack mitgegeben, den er so gerne als Badetasche benutzt. Als ich ihn leerte um zu sehen, ob da doch noch etwas drin war, was er eventuell brauchen möchte, hab ich unter anderem eine Windel von Amy gefunden. Eine ungebrauchte zum Glück.
So wird am zweiten Dezember die Schweizergruppe bereits um halb sieben abgeholt und zum Flughafen gebracht. Wir hingegen können ausschlafen, fein, gemütlich und lang frühstücken, packen, zwei Stunden am Pool verbringen und uns schliesslich per Taxi an den Flughafen fahren lassen (halbe Stunde Fahrzeit - 12 Franken). Alles easy, easy, easy, so wie’s Theo richtig gerne mag.
Koh Samui
Nach einem einstündigen Flug kommen wir auf der Insel Koh Samui an. Wenn’s in Bangkok bedeckt war, so reissen hier die Wolken auf und das Wetter ist prächtig. Heiss sowieso. Eine Viertelstunde nachdem wir unser (jetzt etwas leichteres) Gepäck in Empfang genommen haben, sind wir bereits im Hotel angelangt, im „Peace Resort“ in Bo Phut.
Schön ist’s hier, es gibt kein Haupthaus, nur einzelne Bungalows in einem dschungelartigen Garten angelegt – Ruhe pur. Nur Vogelgezwitscher weckt mich manchmal schon vor sechs Uhr morgens. Restaurant und Bar direkt am Strand gehören natürlich auch dazu, genauso wie ein Pool, Souvenirshops, Schneider (mit einer Anzahl Musterbüchern aus dem vorigen Jahrhundert), Bibliothek sogar (brauchen wir mit unseren e-Books nicht mehr) und so weiter. Hier lassen wir uns zwei Wochen lang verwöhnen.
Am Strand ist’s angenehm, es hat auch Schatten, und im Meer zu baden macht Spass. Es ist mir zwar zu warm, aber man kann gut schwimmen, was in Mui Ne wegen der hohen Wellen weniger der Fall war.
Ein Strandtag sieht etwa folgendermassen aus: Nach dem ausgiebigen Frühstück Liegestuhl suchen und beziehen, Sudoku lösen und ein wenig lesen (Theo macht inzwischen Siesta), Strandspaziergang und dazwischen immer wieder mal ein warmes Bad nehmen. Wieder im Liegestuhl kommen schon die ersten Strandverkäuferinnen und -verkäufer. Sie sind überaus nett, plaudern gerne ein wenig, sind aber nie aufdringlich oder gar frech, wie das in arabischen oder afrikanischen Ländern manchmal leider der Fall ist. Immer ein Lächeln, immer freundlich, kein Problem, wenn man nichts kaufen will. Vielleicht ja dann „tomorrow“ (Gleich geht’s übrigens mit den zahllosen Massageangeboten - am Strand und im Ort selber. Wer einen da nicht alles massieren will…).
Dann ist schon Zeit fürs Mittagessen, das per Boot angeschwommen kommt. Ein junges thailändisches Paar macht ein grossartiges Geschäft: Er bringt auf seinem kleinen Boot einen Grill mit und lauter leckere Sachen, seine Frau im zweiten Kanu Nachschub: Frühlingsrollen, Fisch, Maiskolben, Früchte, Crevetten- und Poulet-Spiesse, die sie gleich am Strand zubereiten. Von den hungrigen Hotelgästen werden sie während mindestens zwei Stunden teilweise fast belagert.
Oft kaufe ich einen Maiskolben und die Reste davon sind nicht für die Katz, sondern für die Vögel, welche die übriggebliebenen Körner mit grosser Freude picken. Zum Dank für die feine Mahlzeit plustern sie sich auf und trällern uns ein Lied. Es sind zwei Vögel (weiss nicht, wie sie heissen und ob’s immer dieselben sind, kann sie so wenig auseinanderhalten wie die asiatischen Menschen), die mir sogar aus der Hand fressen, wenn ich ihnen zusätzlich ein paar Brotkrümel anbiete.
Fast jeden Tag regnet’s - oft in der Nacht. Ist’s am Tag, dann dauert der Segen kaum eine halbe Stunde und schon ist man zurück am Strand. Der Regen bringt aber keine Abkühlung; er putzt die Wolken weg und macht der Sonne wieder Platz.
Restaurants hat’s in der Umgebung in Hülle und Fülle; das absolut feinste ist das 69-Café. Ein überaus netter Besitzer (Vivian) und gleichzeitig begnadeter Koch treibt dort sein Wesen. Die schönsten Kreationen der thailändischen Küche zaubert er auf den Tisch, alle ein wenig nach seinen einfallsreichen Ideen abgeändert, also nicht so, wie man die Gerichte sonst überall erhält.
Einmal aber wollten wir doch wieder mal ein Stück Fleisch auf dem Teller, das man mit einem Messer behandeln muss. „Churrasco Steak House“ ist angeschrieben. Ziemlich teuer für die Gegend. Leute hat’s zwar keine drin, das Lokal hat Aussensitzplätze an der stark befahrenen Hauptstrasse und drinnen die ungeliebte Air Condition. Theos Lust auf ein Steak ist aber stärker als alle meine negativen Argumente, also gehen wir hinein beziehungsweise hinaus auf die lärmige Terrasse. Ich stelle mich auf Brasilianisch ein. Aber surprise, surprise: Die Bude ist schweizerisch, Besitzer ist ein Schweizer namens Jürg Frei, der bereits seit neunzehn Jahren hier lebt und arbeitet. Wie er auf den Namen Churrasco gekommen ist, hab ich vor lauter Erstaunen vergessen zu fragen. Und er ist ein vorzüglicher Koch. Das Filet ist absolute Spitze. Perfekt gekocht, wunderbar zart und fein im Geschmack. Auch Theos Cordon Bleu ist wie nicht von dieser Welt. Lecker auch die wilden grünen Spargeln mit Bechamel-Sauce zur Vorspeise. Zwar komme ich mir schon ein wenig komisch vor: Fliegen wir den weiten Weg nach Thailand und gehen dann schweizerisch essen. Ich glaube aber trotzdem, wir wiederholen den Besuch. Man muss ja nicht alles so eng sehen. Es gibt dort nämlich auch Spaghetti, das könnt‘ ich wagen, die werden keinen süsslichen Geschmack haben wie die in Vietnam. Und Teigwaren westlicher Art habe ich seit langer Zeit nicht mehr gegessen.
Wir blieben den ganzen Abend lang die einzigen Gäste und ich glaube, der Jürg hatte ziemliche Freude an unserem schweizerdeutschen Plauderstündchen, Theo ebenfalls an seinem Espresso und Grappa zur Abrundung.
Theo hat sich beim Schneider zwei Paar weisse Hosen machen lassen. Auf unserer letzten Reise hatten wir ja deswegen gewisse Differenzen, weil er drei Paar weisse Jeans mitgenommen und von denen nur gerade ein Paar ein einziges Mal angezogen hatte. – Diesmal hab ich mich durchgesetzt: In seinem Koffer waren also keine weissen Hosen mehr drin bei unserer Abreise. Jetzt sind‘s wieder drei (weisse Hose Nummer eins hat er sich in Hoi An machen lassen). Nicht dass ich etwas gegen Hosen hätte, und in den Ferien schon gar nicht gegen weisse. Aber es muss einen Sinn dahinter geben, so viele eizupacken, bemühe ich mich doch immer, die Kilos in Bezug auf unser Gepäck nicht aus den Augen zu verlieren.
Die Insel ist klein, man hat rasch alle Sehenswürdigkeiten gesehen, die angepriesen werden. Auf einer 6-stündigen Fahrt in einem Minibus haben wir uns diese zeigen lassen: den mumifizierten Mönch, den Big Buddha, die Monkey Show, den View Point, die beiden Grandmother and Grandfather Rocks, den Joa Mae Kuan Im, eine eindrückliche Tempelanlage im nördlichen Teil der Insel. Vom Schönsten jedoch war das Bad in einem natürlichen Becken, das sich unterhalb eines der grossen Wasserfälle gebildet hat, in dem wir uns ein wenig abkühlen konnten. Als Schlussbouquet eine bisschen Shopping in der Hauptstadt Nathon Town, wo sich auch der Fährhafen aufs Festland befindet.
Essen an der stark befahrenen Hauptstrasse - na, ich weiss nicht. – Heute lieber nicht. Inzwischen haben wir das Fisherman‘s Village Bo Phut entdeckt, ungefähr zehn Minuten zu Fuss von unserem Hotel entfernt. Da könnte man wochenlang jeden Tag in einem anderen Restaurant essen - direkt am Strand, die Füsse im Sand, oder auf einer der gemütlichen und hübsch eingerichteten und dezent beleuchteten Terrassen mit diskreter Musik und Blick aufs Meer. Dazu noch Vollmond. Paradiesisch. Romantisch. Ein kühler Drink, Fisch und Meeresfrüchte vom Feinsten, Currys jeglicher Art, ein freundlicher, zuvorkommender Service; ich frage mich, wie wir es verdient haben, so verwöhnt zu werden.
Einmal gehen wir zu acht essen, zwei Schweizer Ehepaare, ein russisches und ein Deutscher mit seiner thailändischen Frau. Eine ziemlich zusammengewürfelte Gesellschaft. Olga spricht etwa fünf Wörter Englisch und Mitri kann ein wenig Deutsch. Theo benutzt die einmalige Gelegenheit, den armen Russen völlig vollzutexten. Er erklärt ihm unser politisches System (zum besseren Verständnis zeichnet er dazu auf die Serviette), was die Nato macht, gewisse Ansichten über die Probleme in der Ukraine und äussert sich zu anderen weltbewegenden Ereignissen und Fragestellungen. Ich höre nur mit einem Viertelohr zu, staune aber doch und frage mich, wie viel Mitri von all dem mitbekommen hat. Olga auf jeden Fall gar nichts.
Eigentlich hätte ich im Sinn gehabt, noch eine Schifffahrt rund um die Insel oder eine Fahrt zu ein paar nördlich gelegenen Inseln zu unternehmen. Das Problem ist, die starten schon so früh am Morgen… Ja, und leider ist mein Vorhaben schliesslich an eben dem gescheitert.
Am Montag fliegen wir nach Bangkok, dort übernachten wir in einem Flughafenhotel und anschliessend geht’s am nächsten Tag gegen Mittag (gemütlich, gemütlich) weiter gegen Westen, vom Backofen in die Tiefkühltruhe.
Reiseberichte ab 2015
Sommerferien im Ausland, etwa noch im Norden – das gab’s für mich seit Jahren nicht mehr. Aber wenn man pensioniert ist, kann man ja mal eine Ausnahme machen. Kaum aus dem Schuldienst entlassen, sah das daher ganz anders aus und wir liessen uns dazu verleiten, zwei HomeExchange-Tausche in Belgien zu akzeptieren. Mit dem Wissen, dass der Sommer im November und Dezember anderswo stattfindet, also problemlos an einem warmen Ort nachgeholt werden kann, öffneten sich völlig neue Perspektiven. Und so auch in diesem Sommer 2015.
Ich erhielt eine Anfrage, ob wir unser Ferienhaus in den Alpen mit einer Familie aus Jersey tauschen möchten. Dort hat’s ja schöne Strände und vielleicht, vielleicht, wenn das Wetter mitmacht, könnte die Kanalinsel doch eine Reise wert sein. – Mit den Auto? – Aber sicher. Und wenn schon die lange Fahrt, dann auch die Bretagne besuchen. So gelang es mir, vier weitere Tausche einfädeln zu können, was natürlich bedeutete, sieben Wochen unterwegs zu sein, genau zu der Zeit, wo die Aare am wärmsten ist und das Marzili am schönsten.
Aber ich hatte unsere Herbst-Flucht-Ferien ja bereits geplant – Hawaii war diesmal auf unserer Bucket-Liste, also beschlossen wir, eventuell Regen und kältere Temperaturen im Nordwesten von Frankreich in Kauf zu nehmen.
Die verschiedenen Kriminalromane von Jean-Luc Bannalec, alias Jörg Bong, (Bretonische Verhältnisse, Bretonisches Gold etc.), animierten mich sehr, diese Gegend kennenzulernen. In seinen Bestsellern geht es nämlich nicht nur um Mord und Totschlag, sondern auch Ort- und Landschaften werden beschrieben. Sein charmanter Kommissar und dessen Vorliebe für gute Restaurants und exquisite Menus verleiten erst recht zu einem Besuch.
Reisebericht Bretagne – Jersey
7. Juli – 16. August 2015
Wie wir losfahren, ist es extrem heiss. 38 Grad am Schatten.
Dreimal übernachten wir auf dem Weg in den Norden, einmal in der Gegend von Beaune bei Freunden, die dort ein Bauernhaus gekauft haben und nun ein „Table d’Hôtes“ betreiben, wo alle Gäste gemeinsam zu Abend essen, eine Einrichtung, die wir ganz erstklassig finden. Schon öfter haben wir an einem solchen Ort auf dem Weg nach Spanien logiert und sind nicht selten mit interessanten Leuten ins Gespräch gekommen.
Nach einem angenehmen Bad im Pool wird uns ein feines Nachtessen serviert und zum Dessert sozusagen beginnt es zu hageln, dass es kein Sagen hat. Innert Sekunden bedeckt ein dicker Teppich, weiss wie Schnee, die ganze Umgebung und alle flüchten ins Haus.
Der nächste Tag bringt einen extremen Wetterumschwung. Es ist nur noch knapp 20 Grad warm.
Nach dem Frühstück fahren wir los in nordwestlicher Richtung durch liebliche landwirtschaftliche Gebiete nach Avallon. Unterwegs kommen wir immer wieder an Feldern vorbei mit Strohballen. Sie sind eine Augenweide. Wie bei Breughel.
Avallon ist sehr hübsch. In der Nähe des Tour d’Horloge essen wir in einem charmanten Restaurant eine Kleinigkeit zu Mittag. Auch in Auxerre lohnt es sich, eine Zeitlang durch die schöne Altstadt zu schlendern. Beides sind Städte, die wir bis anhin überhaupt nicht kannten. Unsere nächste Unterkunft hatte ich in Fontenailles (20 km südwestlich) gebucht, auch wieder in einem Table d’Hôtes. – Diese befindet sich in einem munzigen Dörfchen am Ende der Welt. Auch hier übernachten wir in einem äusserst gepflegten Haus mit schöne Park, der „nie“ aufzuhören scheint und in endlose Felder übergeht. Zypressen, Lavendel, was in dieser Gegend so dazu gehört. Am Horizont ein paar Windräder. Leider können wir den Pool nicht benutzen, denn heute ladet die Temperatur überhaupt nicht mehr zum Bade. – Wir sind die einzigen Gäste und trotzdem wird uns vom Gastgeber ein absolut exquisites Menu zubereitet.
Am nächsten Morgen ist es nur noch 8 Grad „warm“, und das im Juli!
Nach einem ausgiebigen Frühstück fahren wir los in Richtung Orléans. Unterwegs machen wir einen äusserst lohnenswerten Abstechen nach Guédelon, wo eine mittelalterliche Burg mit den Mitteln der damaligen Zeit aufgebaut wird. Eine interessante Führung bringt uns das Geschehen und die Geschichte näher. Etwa zwei Stunden verbringen wir dort. So „verpassen“ wir Orléans, weil wir gleich weiterfahren zum „Château La Touanne“ in Baccon. Um vier sind wir dort und werden vom Schlossherrn freundlich begrüsst. Er erklärt uns alles und gibt Ratschläge für den nächsten Tag. An diese halten wir uns und besuchen nicht Orléans, sondern den kleinen Ort Beaugency. Das hübsche kleine Städtchen ist idyllisch gelegen an der Loire; es hat einen seltsamen viereckigen Turm, einen Glockenturm auch und schönen Fachwerkhäuser.
Welche der unzähligen Schlösser besuchen, wenn man an der Loire unterwegs ist? Auf zwei wollen wir uns beschränken. Diese Frage habe ich „unserem“ Schlossherrn auch gestellt und er riet uns, Château Chambord und Château Cherny zu besuchen. Chambord ist unglaublich eindrücklich mit seinen x Türmen und Kaminen – ein Märchenschloss schlechthin. Cheverny ist ganz anders, viel kleiner, aber ebenfalls sehenswert. Es ist der Palast, welcher Hergé als Vorlage für Kapitän Hadock’s Schloss bei „Tim und Struppi“ diente. Man kann einen Rundgang machen durch die Innengemächer. Auch die Tintin-Ausstellung hat uns gefallen.
Von da aus nehmen wir die Autobahn nach Le Mans. Inzwischen ist es wieder sehr heiss geworden, 29 Grad. Diesmal übernachten wir in einem hübschen B&B am Rande der Altstadt. Nach einer wohlverdienten Dusche gehen wir zu Fuss ins Zentrum. Eine lange steile Treppe führt durch die Stadtmauer hinauf zur Kathedrale. Im Tripadvisor habe ich mich über die Restaurants informiert. Nr. 1 ist: „La Baraque de Boef“. Wir haben Glück und finden grad die letzten zwei Plätze draussen, gegenüber dem Rathaus am Place de la Mairie. Essen vom Allerfeinsten. Die Vorspeise bereits: Theo hatte einen Camembert gefüllt mit Nüssen und Honig auf Toast, absolut Spitze, ich Tsatsiki vom Lachs. Dann aber die Pavé de Beouf Emincé. Mit einem Kartoffelstock nicht von dieser Welt. Himmlisch! Dorthin würde ich jederzeit wieder essen gehen.
Auf dem Spaziergang heimwärts bleiben wir erst vor der Kathedrale, dann vor der Stadtmauer sitzen und bewundern die fantasiereichen, farbigen Lichtspielereinen von „Son et Lumière“. Wie im November beim Bundeshaus. – Einfach schön!
Unterwegs nach Lancieux, unserem Ziel am folgenden Tag, besuchen wir Vitré, eine hübsche Stadt mit gut erhaltenem (nie eingenommenem) Schloss und schöner Altstadt, anschliessend Rennes.
Erster Haustausch in Lancieux
Nach einem „Gross“-Einkauf in Dinan kommen wir kurz nach sechs in Lancieux an. Catherine, unsere Haustauschpartnerin, zeigt uns das hübsche Haus, wo wir uns sicher wohl fühlen werden eine Woche lang. Ein Seemannshaus, gross und gemütlich mit gepflegtem Garten. – Auf der anderen Strassenseite eine alte Mühle wie in Holland.
Es ist schön und warm; wir fahren zum Nachtessen nach Dinard. Dort gibt’s Moules marinière mit Frites und Fish and Chips direkt am Strand – ein genussvoller Anfang unserer „sesshaften“ Ferien.
Das Wetter ist mehr oder weniger so, wie wir’s erwartet haben: manchmal regnerisch, eher kühl, eben Bretagne-Klima. Den Strand besuchen wir daher eher selten, dafür machen wir ein paar schöne Ausflüge in die Umgebung. Wir besuchen das hübsche Hafenstädtchen St-Cast-le-Guildo, Fort la Latte und Cap Fréhel (Côte d‘Emeraude). Wie’s im Führer steht: wilde Klippen, Blumen und Sträucher, Seevögel en masse. Typisch Bretagne – idyllisch, so wie’s angepriesen wird.
Sehr bald schon lernen wir, dass die Menschen, die in diesem Landesteil leben, sich in erster Linie als „Bretonen“ bezeichnen und sich auch so fühlen - und erst in zweiter Linie als Franzosen.
Finistère
Ein Zweitagesausflug führt uns an die Côte de Goëlo, an die Côte de Granit Rose und anschliessend ins „Landes“innere. Den ersten Halt machen wir in St. Brieuc, einem kleinen Städchen mit einer prächtigen Altstadt. Es gibt in dieser Gegend wohl gar keine anderen... Es ist Nationalfeiertag, der 14. Juli, und das erste Anzeichen dafür ist ein älterer Päpu, der eine offensichtlich schwere Fahne irgendwohin schleppt. Kurz darauf sehen wir auf einem Platz, dass sich dort eine ganze Menge älterer und weniger älterer Leute versammeln. Alle haben Fahnen mitgebracht. Da wird’s dann wohl abgehen später.
Wir fahren durch enge Landstrassen, weil Theo wieder mal in rasanter Fahrt die richtige Ausfahrt verpasst hat. Aber wir haben ja Zeit und auf den Nebenstrassen gibt’s sowieso mehr zu sehen. Fast in jedem auch noch so kleinen Dorf hat es einen Trödlermarkt. Und immer viele Besucher. Vor allem Einheimische nehme ich an.
An der Küste spazieren wir an der Promenade von St-Quai-Portrieux entlang. Dies ist ein hübsches Seebad mit grossen Hauptstrand. Die Temperatur ist mir zu kalt zum Baden, nur knapp 20 Grad (in der Schweiz 35 Grad); es ist bedeckt. Nur ein paar Verwegene suchen das Meer, das sich im Moment bei Ebbe ziemlich stark zurückgezogen hat. Wir fahren weiter nach Paimpol, das mich fast ein wenig an St. Tropez erinnert, das Hafenviertel zumindest, die zahllosen Restaurants, die vielen Leute. Aber Yachten hat’s keine mondänen, Schiffe beziehungsweise Boote schon eine ganze Menge.
Weiterfahrt zu den rosaroten Granitsteinen an der Côte de Granit Rose. Wir machen Fotos vom Lookout aus, Theo will nicht richtig nah ran. Zu viele Spaziergänger sind unterwegs für seinen Geschmack.
In Morlaix gibt’s den nächsten Halt zum Apéro. Auch hier finden wir eine besuchenswerte Altstadt mit Fachwerkhäusern, besonders zu erwähnen das Laternen-Haus von Königin Anne. Die geschnitzte Holztreppe im Innenhof ist einzigartig.
Unser Ziel heute ist Huelgoat. Unmöglich, den Namen auszusprechen. Wir übernachten in einem hübschen B&B, bei Suzie. (Double Locks). Es ist dort so etwas von englisch… Ein delikates Nachtessen gibt’s gleich nebenan mit Blick auf den See: „Le Mirabelle“. Ein älteres Ehepaar macht einen richtig guten Job dort. Sie serviert, er kocht. - Vom „Quatroze Juillet“ ist rein gar nichts zu sehen und zu hören. Seltsam! Das Feuerwerk hätte am Tag zuvor stattgefunden, liess man uns wissen.
Nach dem Frühstück machen wir eine kurze Wanderung entlang der riesigen Chempe, für die das Städtchen bekannt ist. Sie sind gewaltig, absolut beeindruckend! Die Legende besagt, dass ein Riese wütend war und sie herumgeworfen habe. Richtigerweise waren sie durch die Gletscher der Eiszeit dorthin transportiert worden. In der Umgebung steht auch ein Menhir – wir sind im Land von Asterix und Obelix angekommen.
Weiter geht die Reise in die „Mitte“ des Finistère, wo’s Christliches zu sehen gibt. Auch wenn wir dem nicht besonders angetan sind, sind wir doch beeindruckt von den Kalvarienbergen in St-Thégonnec und Guimiliau, von den Figuren, die aus dem frühen 17. Jahrhundert stammen. Die meisten sind gut erhalten und wenn man sie genau betrachten, entdeckt man so einiges…
Hier erhält Theo auch seinen lange gesuchten „Lambig“ (bretonischer Calvados) und bei einem Holzschnitzer finden wir eine umgekehrte Sirene, eine Meerjungfrau mit Fischkopf und Frauenunterkörper, die Theo unbedingt haben muss. Geld haben wir nicht mehr genug, die Karte kann der Künstler nicht akzeptieren, also fahren wir ins nahe gelegene Städtchen Landivisiau, wo wieder ein Markt stattfindet, ich natürlich wieder Verschiedenes finde und 500 Euro abheben kann. Zurück in Guimiliau werden wir 200 € los und sind stolze Besitzer der Holzsirene.
Einen Strandtag erleben wir doch noch gegen Ende der Woche. Mit dem Schwimmen im Meer ist es allerdings so eine Sache: Es ist Ebbe wieder mal, also weit weg und bis man sich wenigstens in knietiefem Wasser ein wenig abkühlen kann, muss man Dutzende von Metern weit wandern, vorbei an Booten, die im Sand stecken.
Gestern Abend hat Theo den Abfall-Container auf die Strasse gestellt. Er ist noch immer dort, obwohl man uns gesagt hat, er werde am Freitagmorgen sehr früh geleert. – Eine Nachbarin klärt dann auf: Es könnte sehr wohl sein, dass sie ihn erst am Samstag abholen kommen oder auch erst am Montag. Aber ganz sicher: sehr früh!
Erst sieht das Wetter gut aus, dann wieder ist es bedeckt. Im Fernsehen zeigt die Wetterkarte für ganz Frankreich schön, Paris 30 Grad, hier: einzige Region mit zum Teil sogar Regen… Wir bleiben im Garten uns lesen. Wenn die Sonne durch die Wolken bricht, ist es von einem Moment auf den anderen richtig heiss, aber schon kurz darauf beginnt es wieder zu regnen. Wir beschiessen trotzdem, etwas zu unternehmen und fahren nach Dinand. Ein Spaziergang über die Stadtmauer bietet fantastische Ausblicke über die Dächer der Altstadt und den Hafen.
Zurück zu Hause heisst es packen, denn am nächsten Tag beginnt unser zweiter Haustausch.
St. Malo
Der Weg dorthin ist nicht weit, es dauert nur eine knappe halbe Stunde. Hätte es gedauert, wenn Theo nicht schon wieder die richtige Ausfahrt verpasst hätte. Unbedingt musste er noch überholen und dann waren die Abstände zu klein…
An unserer Destination angekommen, treffen wir Sylvie und Jean-François, die uns in ihrem kleinen Ferien-Apartment, das uns vorzüglich passt und welches in Saint-Servan quasi vor den Toren der alten Stadt bestens gelegen ist, alles zeigen. Auch auf einem kurzen Spaziergang erhalten wir Hinweise, wo einzukaufen, wo essen und wie „Intra Muros" zu gelangen. Der Strand ist 50 Meter von der Wohnung entfernt, Restaurants hat’s genügend in nächster Nähe und ins alte Zentrum von St-Malo zu spazieren, dauert etwa zwanzig Minuten.
Nach dieser Riesenanstrengung muss sich Theo natürlich ein wenig hinlegen und er fällt in einen zweistündigen Schlaf (Siesta nennt er das).
Später am Nachmittag machen wir uns auf, St-Malo auszukundschaften. Wir erreichen die Stadt durch die Porte St-Louis.
Touristen, so weit das Auge reicht. Aber eine gute Stimmung herrscht. Ein wenig Shopping muss sein. Zwei T-Shirts mehr besitze ich jetzt. Um sieben treibt uns der Hunger in ein Restaurant. „La Bisquine“. Gerade in dem Augenblick beginnt es zu regnen. Wir haben einen Fensterplatz im Wintergarten und es ist lustig, all den verregneten Gestalten zuzusehen, die auf der Suche nach einem Restaurant und/oder Obdach umherirren. Eine Art eigenartige Modeschau präsentiert sich uns. Einige tun, als wenn sie den Regen gar nichts anginge, andere versuchen, mit irgendwas (Prospekten, Kleidungsstücken) wenigstens die Frisur zu schützen. – Das Essen ist so so la la, es reisst uns nicht aus den Socken, aber wir verbringen trotzdem einen schönen Abend in unserer neuen Umgebung. Auf dem Nachhauseweg entlang des Ufers bietet sich uns ein atemberaubender Sonnenuntergang.
19. Juli (Kays Geburtstag) Normandie: D-Day-Ausflug
Das Wetter ist nicht eben wunderbar, es nieselt sogar ein bisschen. Ich kann Theo davon überzeugen, seinen Trip an die Invasionsstrände der Normandie heute zu „erledigen“, ein idealer Tag für diesen Ausflug. Wir fahren also gegen zehn Uhr los und sind etwa zwei Stunden später in Caen. Dort hat’s einen riesigen Markt, Theo setzt sich in ein Café und stellt die Exkursion anhand der Prospekte zusammen, die wir im Tourist Office erhalten haben. Ich schau mich auf dem Markt um. Er ist riesig, aber ich finde wirklich nichts zu kaufen. Theo schon. Eine Weste mehr zum Umhängen mit 1000 Taschen, in die er alles hineintun kann (Schlüssel, Brille, Pfeife, Tabak, Geld, Prospekte, e-Book), aber dann nichts mehr findet ausser zu einem späteren Zeitpunkt etwa verschiedene Münzen.
In Ouisteham am Sword Beach besuchen wir das Museum im „Grand Bunker“. Weiterfahrt der Küste entlang auf der D 514 durch eine Ortschaft an der andern. Alles D-Day-Schauplätze, jetzt Seebäder, wo’s massenhaft Autos und Touristen hat: Juno Beach, Gold Beach bis zum Omaha Beach. Inzwischen zeigt sich auch der Himmel teilweise blau und es ist angenehm warm. Theo besucht zwei Museen, das Omaha-Memorial Museum und ein weiteres in St-Laurent-sur-Mer. Ich geh in beide nicht hinein, sehe mir aber den Strand und die eindrücklichen Memorials dort an. Es ist so traurig, wenn man denkt, wie viele junge Männer da sterben mussten. Dieser schreckliche Krieg…
Den Tag lassen wir mit einem Rundgang in Point du Hoc ausklingen (Küste mit vielen Bunkern und Einschlaglöchern, wo jetzt zum Teil Schafe grasen). - Um halb elf sind wir daheim.
20. Juli (Geburtstag der Zwillinge)
Ich gehe eine Baghette einkaufen und die Zeitung Ouest France im kleinen Lädeli etwas weiter oben bei der Kirche. Es ist vollgestopft mit Waren und daher können kaum drei Personen gleichzeitig drin sein.
Nach dem Frühstück machen wir einen Spaziergang um die Halbinsel Cité d’Alet herum, an deren „Eingang“ wir in Saint-Servan wohnen. Ein Kreuzfahrtschiff hat inzwischen angelegt und das Meer ist „voll“. Es gibt viele Fotos, die Boote, die vor Anker liegen, stehen jetzt tatsächlich im Wasser. Fast gegen Ende unseres Erkundungs-Spaziergangs finden wir eine Bar (L’Atterrage), trinken dort Kaffee und haben endlich besten Internet-Empfang. – 101 WhatsApp-Meldungen kündigen sich an und jede Menge Emails.
Gestern hat mir Theo gestanden, dass er seinen ganzen Sack mit Hemden und Jacken nicht mehr hat. Er hat keine Ahnung, wo sich die Habe befindet. – Nun lese ich in der Email von Catherine, dass er den Sack in ihrem Haus in einen Schrank gehängt hat…
Ich habe bereits zuvor von diesem Missgeschick berichtet. Dass er immer Glück hat und in den meisten Fällen sein Eigentum, mit dem er so nachlässig umgeht, wieder zurückerhält, kommt einem kleinen Wunder gleich. So auch diesmal. Nur eine Stunde kostete ihn die Hin- und Zurückfahrt – ging halt von der Siestazeit ab – Strafe genug...
Um sieben Uhr treffen wir uns auf dem Bänkli vor dem Haus am Strand und schauen, wie’s jetzt ganz anders aussieht bei Ebbe: all die gestrandeten Schiffe und der ellenlange braune Strand. An Schwimmen ist nicht zu denken.
Am Abend des nächsten Tages treffen wir unsere Freunde Katharina und Hanspeter Intra Muros. Sie sind ebenfalls unterwegs in der Bretagne und wir haben abgemacht, dass wir uns in St. Malo treffen und die Woche in Jersey gemeinsam verbringen.
Wir gehen zusammen essen. Einen wahrlich spektakulären Sonnenuntergang sehen wir von der Mauer aus Richtung Fort und Petit Bé. Jetzt ist Flut und das grosse Wasserbecken, wo sich vor kurzen noch viele Schwimmer vergnügt haben, ist nicht mehr zu sehen. Es ist überschwemmt und nur noch der obere Teil des Sprungturms ist im Gegenlicht zu sehen. Das sieht sehr gut aus!
Auf dem Nachhauseweg können wir den Damm vorerst nicht überqueren, weil ein riesiges Frachtschiff durch den Kanal geschleust wird (Bahrein St. John’s). Es dauert etwa 20 Minuten, bis der Spektakel vorbei ist und die Brücke zurückgeschoben wird, so dass Autos und Fussgänger passieren können.
Am nächsten Mittag wollen wir nach Cancale fahren, aber die Strasse, die dorthin führt, ist von Traktoren versperrt. Die Bauern streiken.
Wir fahren stattdessen nach Rothéneuf, wo ein Einsiedlermönch, der Abbé Fouré, während 25 Jahren 300 Gesichter und Figuren in die Klippen am Meer eingemeisselt hat. Ganz spannend zu sehen - ein ruhiger und friedlicher Ort. Wir fahren weiter zur Pointe du Grouin, von wo aus man eine schöne Aussicht auf den Leuchtturm hat und von weitem den Mont St. Michel sehen kann, der sich wie eine Pyramide aus dem Dunst erhebt. Von dort aus entlang der Küste nach Cancale zu gelangen, ist dann kein Problem; es hat auf dieser Seite keine Sperren.
Im „Grain de Vanille“ (Marco-Polo-Tipp) essen wir die beiden letzten köstlichen Crèmeschnitten, also Millefeuilles, die noch übrig sind, bevor wir am Hafen von Cancale bei Ebbe die riesigen Austernfelder sehen. Günstig werden sie auf dem Markt angeboten, hunderte von Austern.
Auch am nächsten Tag macht das Wetter nicht eitel Freude: starker Wind, etwa 18 Grad, bewölkt.
An unserem zweitletzten Tag in dieser Gegend wollten wir den Mont St. Michel besuchen, aber das geht leider nicht, weil die Bauern noch immer streikten und mit ihren Traktoren die Zufahrtsstrassen versperrten. An unserem letzten Tag jedoch ist’s den Bauern wohl verleidet und wir können unser Vorhaben in die Tat umsetzen.
Das Wetter lässt zu wünschen übrig, wen wundert’s, aber so schlecht ist es doch nicht. Auf dem Mont gibt’s zweimal mitten aus dem Nichts eine halbminütige Riesen-Schütte, sehr komisch. Alle Besucher hasten ins Innere des Gebäudes. Zum Öffnen eines Schirms reicht es in keiner Weise. Es ist wie wenn jemand grad aufs Mal Riesenkübel voller Wasser ausschütten würde.
Der Hügel ist wirklich sehr beeindruckend, die Aussicht aufs Wattenmeer atemberaubend. Was für ein fantastischer Ort, um eine Kirche zu bauen. Das ganze Lädeli-Gschtürm, die Unmengen an kitschigen Souvenirs und die vielen Touristen, zu denen wir ja auch gehören, unvermeidlich. In der Kirche aber ist man oft allein und es herrscht Ruhe.
Nach der Besichtigung fahren wir zurück nach St. Malo, parkieren ausserhalb der Mauer und finden eine ganz nette Crêperie. –Natürlich fängt‘s grad wieder an zu regnen – in Strömen. Ein ganzer Männerchor hat sich vor dem Restaurant aufgestellt und grad, wie sie zu singen beginnen, regnet es wieder Bindfäden. Sie lassen sich jedoch nicht beirren, suchen kurz Unterschlupf und lassen dann erst recht los.
25. Juli, Samstag - Überfahrt nach Jersey
Aufstehen um 20 vor 6! – Packen und dann ab auf den Port du Naye zur Fähre. Um sieben sind wir dort, unsere Freunde ebenfalls, gleich im Auto neben uns. Um 10 vor acht fahren wir los. Es ist kühl aber schön.
Anderthalb Stunden später sind wir dort – eine Stunde Zeitverschiebung, für uns wär‘s 20 nach neun.
Unsere GPS-Dame führt uns nach Gorey und St. Martin, wo wir das Haus von Naomie und James Mews, unseren HomeExchange-Partnern gleich finden.
Sie sind sehr nett, zeigen uns alles und überlassen uns dann ihr Haus. Sie selber ziehen mit ihren beiden Söhnen nebenan ins Cottage.
Naomie hat uns Brot und Kuchen gebacken. Das essen wir gleich draussen im Garten. Das Wetter zeigt sich von der besten Seite; diese Gelegenheit muss man packen: Wir gehen gemeinsam an den Strand. Der Blick auf das Orgueil Castle, die Hafenpromenade und die Küste ist bezaubernd. Das Wetter hält, es hat aber immer wieder ein paar Wolken und dann wird’s grad empfindlich kühl. Ins Wasser gehen wir nicht und geben den Strandsonntag bald auf. Programmänderung in dem Fall: Ein Weingut könnten wir besuchen, also Fahrt der Nordküste entlang zum „Vinyard La Mare“, das zwar einladend aussieht, aber um sechs geschlossen ist. Dafür finden wir ganz in der Nähe einen Lookout, von wo aus man die zerklüftete Küste, das weite Meer, Frankreich im Hintergrund und den stahlblauen Himmel sieht.
An der Westküste hat’s riesige Strände. Wir möchten irgendwo etwas essen. „El Tico“ wurde uns empfohlen. Da hätten wir eine halbe Stunde auf einen freien Tisch warten müssen und es war sowieso sehr laut und eher eine Surfer-Bude. Ein weiteres Restaurant finden wir an der Küste, direkt am Meer. Garten ganz passabel mit schöner Sicht, aber um draussen zu essen ist’s bereits zu kalt und innen: Wer würde es für möglich halten: Keine Fenster mit Meerblick. Nicht zu fassen. Dabei ist „La Braye“ das einzige Haus weit und breit und das direkt am Strand gelegen…
Wir halten bei einem weiteren Pub an. Fast eine Stunde hätten wir dort warten müssen. Erfrierungsängste kommen auf. – Wir fahren weiter und finden das non plus ultra am Point de Corbière: Südwestspitze der Insel mit Klippen und Leuchtturm. Apéro draussen und feines Nachtessen drinnen. Perfekt! - Todmüde kommen wir nach halbstündiger Fahrt zu Hause an.
Die Insel ist 9 Meilen lang und 5 Meilen breit. Es dauert aber etwa 35 Minuten von einem „Ende“ zum anderen. Die Strassen sind extrem schmal, Kreuzen ist oft schwierig. Zudem sind sie total verschlängelt und verästelt, ein richtiges Chaos, schwer also, ohne Insiderkenntnisse oder GPS irgendwohin zu finden. Weil man zwischen hohen Hecken durchfahren muss, sieht man auch kaum je etwas vom der Gegend, was die Orientierung erheblich erschwert. Höchstgeschwindigkeit ist 40 Meilen pro Stunde. Und nicht selten lauert eine Polizeipatrouille um die Ecke mit einem Radargerät. - Auf einer ganz kurzen Strecke darf sogar 60 Meilen pro Stunde gefahren werden, das ist dann aber das allerhöchste der Gefühle. Was muss das für ein Frust sein für all die Leute, und das sind nicht wenige (die Bankgeschäfte blühen ja auf dieser Insel), die Luxuskarossen fahren, schnelle Porsches, BMWs und Mercedes, wenn sie deren Potenz gar nie ausleben können. Kein Wunder begegnen wir Dutzenden von denen nach der Überfahrt mit der Fähre auf französischem Boden. Dort stehen sie am Sonntagabend Schlange auf dem Weg nach Hause. Am Wochenende fahren sie offenbar ihre „Schlitten“ auf dem Kontinent und können dort zumindest ein wenig auf die Tube drücken.
An einem regnerischen Nachmittag besuchen wir das eindrückliche War-Tunnel-Museum. Die Geschichte der Kanalinseln im zweiten Weltkrieg ist eindrücklich dargestellt.
Es ist der 26. Juli, unser zweiundvierzigster Hochzeitstag. Das muss gefeiert werden, und zwar in St. Aubin im schönen „Old Court Inn“ am Hafen. Es nieselt zur Abwechslung wieder mal. Der viele Regen schlägt allmählich aufs Gemüt.
Trotzdem können wir ab und zu im Garten frühstücken, wenn sich die Sonne wieder mal zeigt. Gegen Ende der Woche erleben wir sogar noch einen Tag am Strand, an einem schönen Ort im Norden der Insel, der nur bei Ebbe zugänglich ist. Wie die Flut allmählich einsetzt, wird der Strand kleiner und kleiner, so packen wir zusammen und starten einen neuen Versuch im „La Mare Vineyard“, ein Gläschen zu trinken. Diesmal ist das Weingut offen, aber leider schmeckt uns allen der Wein nicht sehr. – Könnte es eventuell sein, dass die Trauben nicht genügend Sonne erhalten dort oben im Norden?
An diesem Abend haben wir mit unseren Gastgebern Naomie und James Mews abgemacht. Zusammen mit ihren beiden Buben spazieren wir nach Gorey und geniessen im Crab Shack ein schmackhaftes Nachtessen.
Leider müssen sich Katharina und Hanspeter bereits auf den Heimweg machen, für die beiden ruft die Arbeit. - Theo und ich, wir bleiben noch zwei Tage länger. Wir besuchen den schmalen Strand in Rozel, den kleinen Markt in St. Aubin und machen einen Spaziergang durch den hübschen Hauptort St. Hélier. Zur Abwechslung scheint die Sonne und das macht einen gewaltigen Unterschied.
Ein letztes Nachtessen in Gory im Crab Shack und ein fantastischer nächtlicher Spaziergang zurück ins Haus, wo ein riesiger orangefarbiger Mond tief unten am Himmel hängt und das Schloss ganz fahl beleuchtet, beenden unseren Aufenthalt auf der pittoresken Kanalinsel.
Zurück auf dem Kontinent
Am Sonntag, 2. August, sind wir zurück in St. Malo. Wunderbar warm ist es heute: 29 Grad.
Unterwegs besichtigen wir die schönen Altstadthäuser in Rennes und fahren dann weiter Richtung magischer Wald, le Forêt Brocéliande. In Iffendic habe ich ein B&B gebucht. Es ist super gut und originell und wir freuen uns über den Pool. Dort liegen und entspannen ist das Einzige, was wir noch tun mögen. Nachtessen im 15 km entfernten Les Fourges de Paimpont (Jadghaus).
Tags darauf fahren wir durch den Wald nach Paimpoint. Porte de Secret, Abbaye de Paimpoint, weiter dann nach Tréhorenteuc ins „Val sans Retour“, wo wir nach einem wunderbaren einstündigen Spaziergang (Arbre d‘Ore und Miroir aux Fées), den Weg „retour“ zum Glück doch noch finden. Von dort geht’s weiter nach Monteneuf, wo eine eindrückliche Megalithen Sammlung zu sehen ist (Les Menhirs de Monteneuf). Dass es hier fast keine Touristen hat, kann ich kaum glauben. Die Steinblöcke sind äusserst imposant und es hat haufenweise davon in dieser Umgebung.
Auf den Heimweg in La Gacilly (Yves Rocher), wo eine tolle Fotoausstellung stattfindet, halten wir an und schauen uns um. Touristen hat’s en masse, aber das ist kein Wunder. Das Dorf ist ein Bijou: überall geschmückt mit Blumen, zahlreiche Art Ateliers hat’s an jeder Ecke und gemütliche Bistros, guter Stimmung herrscht – ein wunderbarer Stopp.
Saint-Etienne de Montluc
Hier befindet sich unsere neue HomeExchange-Unterkunft, die zweitletzte. Wir finden ein schönes, teilweise renoviertes Bauernhaus vor, mitten in ländlichem Gebiet mit riesigem Garten. Es gefällt uns auf Anhieb.
Der nächste Tag ist dem Ausruhen gewidmet. Das braucht Theo! Sagt er.- Der einzige „Ausflug“ ist derjenige zum Supermarkt, wo wir Verpflegung für die nächste Zeit einkaufen müssen. Ein gemütliches Nachtessen im Garten beschliesst diesen Teil der Reise.
Jetzt ist aber genug geruht! – Am nächsten Tag steht Menhir-Besichtigung in Carnac auf dem Programm. – Schon gegen acht Uhr morgens fahren wir los ins Morbihan.
Erst mit einem kleinen Zug, der die Touristen durchs ganze „steinige“ Gebiet führt, anschliessend mit dem eigenen Auto und auch zu Fuss, lassen wir uns von der riesigen Menge der Steinkolosse beeindrucken.
In Locmariaquer hat’s noch mehr Steineblöcke, der grösste liegt umgefallen auf dem Boden. Den sogenannten „Table du Marchand“ und etliche weitere Dolmen kann man ebenfalls besichtigen - schlicht überwältigend die riesigen Ausmasse!
Auf dem Weg zurück machen wir Halt in Auray. Der Spaziergang durch die hübsche Altstadt lohnt sich für Theo sehr. Eine Frau, die in der Fussgängerzone vor ihrem Nähatelier den Passanten ihre Nähmaschine vorführt, flickt ihm sein Gilet Nummer eins, was ich schon längst hätte tun sollen, aber entweder nicht das richtige Werkzeug dafür hatte oder es mir einfach an mangelnder Lust dazu fehlte.
Erst abends um acht sind wir zurück in Saint-Etienne de Montluc. Die Sonne scheint noch immer. Theo isst draussen irgendwas Seltsames (Spaghetti 1,5 Minuten); ich mag nichts mehr, lese nur noch ein bisschen im Liegestuhl und plane die nächsten Tage.
Es ist schön und warm. Heute geht’s an die Loire. Um halb zehn geht’s los. Dem Château de Montreuil-Bellay gilt unser erster Besuch. Das zweite ist das Château de Brézé. Was für ein Gebäude! Ein Schloss unter einem Schloss, eine riesige unterirdische Festung und der höchste Schlossgraben (28 Meter) in Frankreich. Mehr als nur eindrücklich. Es ist sehr heiss; die Besichtigung der Keller-und Festungsanlagen dort unten ist eine Wohltat.
Weiter nach Saumur und anschliessend Angers. Die Schlösser dort besichtigen wir nur noch von aussen. Beide Städte haben sehr schöne Altstadtbauten. Crêpe essen, Apéro trinken und gegen halb acht Uhr heimwärts.
Am folgenden Tag besichtigen wir Nantes. Auch diese Stadt gefällt uns sehr. Vor allem der elektrische Elefant auf der Ile de Nantes. – Nachtessen im „La Cigale“. Wir genissen es, draussen sitzen zu können.
Nun ist aber wieder ein Theo-Schlaftag vonnöten. Nicht nur schlafen natürlich kann es sein. Nein, er hat noch eine andere Aktivität in Angriff genommen: Beim Hantieren mit seinen Fotos auf seinem i-Phone hat er es fertig gebracht, sie alle zu löschen. Von Jersey bis gestern Abend. ???!!!
St. Nazaire
Am Sonntag, dem 9. August, erreichen wir am Nachmittag unsere letzte Destination, wo wir eine knappe Woche lang bleiben werden: St. Nazaire.
Diesmal ist es eine 4-Zimmer-Wohnung mit schöner Aussicht auf die Hafenanlage. - Heute ist es heiss, um die 30 Grad. Ab an den Strand, der sich grad vor der Haustür befindet. Auch am nächsten Tag ist es uns an der Plage am wohlsten. Diesmal am 8 Kilometer langen Sandstrand in Le Baule. Wieder mal ein Moules-Menu gibt’s später in Le Croisic.
An einem der weniger schönen Tage besuchen wir den Markt in St. Nazaire, die überdimensionierte Hafenanlage, welche die Nazis ausgebaut hatten. Gut gefallen haben uns auch unsere Ausflüge nach Guérland ins Salzland und nach Batz sur Mer, wo’s einen Turm hat, von dem aus man einen tollen Blick über das Städtchen und den Marché nocturne hat.
Eine zweitägige Kurzreise bringt uns nach Vannes, eine weitere wunderbare Stadt, dann nach Pont Aven, Pointe de Trévignon und Raguénez Plage. Wir übernachten in Forêt Fuesnant im „Manouir du Stang“, einem reizenden kleinen Schloss.
Ein leckeres Fisch-Menu in Vieux Port im „Café du Port“ beschliesst diesen schönen Tag.
Weiter geht’s am folgenden Morgen über Quimper nach Pont Croix (schöne Kirche in dem kleinen Dorf). Gut, dass ein Markt stattfindet, denn ein Schirm-Kauf drängt sich auf. Es regnet und ist neblig.
Die Pointe du Raz, den westlichsten Punkt Frankreichs, wollen wir heute besuchen. Erst sieht man von der Küste und dem Felsen gar nichts, dichte Nebelschwaden verhindern die Sicht (in ganz Frankreich ausser gerade in der Bretagne herrscht schönes und sonniges Wetter...). Wie wir auf den Klippen herumklettern, Theo in seinen „Discoschleifern“ – er hätte auch seine Regenjacke nicht mitgenommen, wenn ich nicht drauf bestanden hätte, löst sich der Nebel und man sieht zumindest teilweise, wie die Gegend aussieht.
Auf der Rückfahrt wollen wir in Quimper Halt machen. Das geht aber nicht, denn wir finden keinen Parkplatz. Wegen eines Festes ist es überall gesperrt und es herrscht ein riesiges Chaos, man steht im Stau, alle suchen Parkplätze, die aber ausnahmslos gesperrt sind. Wir entschliessen uns daher, nach Concarneau weiterzufahren.
Auch dort ist’s schwierig zu parkieren, weil ebenfalls Festivitäten stattfinden: das Fête des Bleus. Endlich gelingt es. So viele Touris wie hier haben wir auf unserer Reise noch nirgends gesehen. Vor allem in der Ville Close, wo wir einen Rundgang auf der Stadtmauer machen, kommt es uns vor wie in Bern am Ziebelemärit. Wieso hier so viele Touristen herumschwärmen - der Grund dafür ist Jean-Luc Bannalec, der mit seinen Büchern verschiedene Ort in der Bretagne bekanntgemacht hat, so dass nun alle auf seinen Spuren dieselben Köstlichkeiten versuchen wollen wie sein Kommissar Dupin. Wir ja auch, hatten uns den Andrang aber nicht in dieser Art vorgestellt. Im „L’Admiral“, Dupins Stammlokal, versuchen wir einen Tisch zu reservieren, das hätten wir aber schon viel vorher tun müssen. Seit Tagen ausgebucht. – Nur gerade ein Apéro wurde uns gewährt.
Zweistündige Heimfahrt nach St. Nazair, wo wir um halb zehn noch eine Brasserie finden, die offen hat. Eine ganze Stunde lang warten wir aufs Essen. Wenigstens hat sich das Ausharren gelohnt. Sie sind gut, die Elsässer-Spezialitäten, auch kurz vor Mitternacht. Theo isst Sauerkraut und ich Flammenküch.
An unserem letzten Tag sind wir bei Anne-Gaëlles Eltern in 222 Kerbourg, Saint-Lyphard, mitten im Parc de Brière zu einem Apéro eingeladen. Mit Anne haben wir den Haustausch vereinbart. Wie und wo die Eltern wohnen, ist einzigartig. Es sieht aus wie in Südengland, überall aus Beste gepflegte Cottages mit Strohdächern. In einem solchen werden wir empfangen, werden reichlich verwöhnt und dürfen das ganze Haus besichtigen. Und der Weg dorthin und zurück durch die Gegend, wo das wunderbare Salz gewonnen wird, ist ebenfalls eindrucksvoll. Am Menhir de Kerbourg kommen wir vorbei, ein weiterer Steingigant, der einfach so in der Landschaft steht.
Nochmal Nantes auf dem Nachhauseweg
Auf dem Weg zurück in die Schweiz möchte ich noch einmal in Nantes anhalten.
Gerne wäre ich der Aussicht wegen auf den LU-Turm gestiegen, aber dieser ist leider das ganze Jahr geschlossen, was im Internet nicht vermerkt war. Aber es gibt noch mehr zu sehen in Nantes: Der „Grüne Weg“, eine Ausstellung, die grad zu der Zeit stattfindet (Le voyage à Nantes). Teile davon haben wir schon bei unserem letzten Besuch vor ein paar Tagen gesehen. Originell und einzigartig. Auch am Place du Buffay gibt‘s eine total lustige Installation mit farbigen Gartenstühlen zu bestaunen, die zum grünen Weg gehört. Dort nehmen wir „un petit café“ und fahren dann weiter Richtung Tour.
Unterwegs von der Autobahn zweigen wir ab zum Château Ussée. Ganze Trauben von Besuchern stehen an der Kasse an, wir verzichten und besichtigen es nur von aussen. Weiter geht die Fahrt nach Tours, aber eine Stadtbesichtigung lassen wir ebenfalls aus (von der Schlacht, die 732 stattgefunden hat, sehen wir wohl keine Blutspuren oder zerbrochene Speere mehr). Um halb sechs kommen wir in Orléans an, wo ich ein Hotel gebucht habe. Hotel Marguerite, zweckmässig, komfortabel, ein schönes Zimmer und sogar ruhig in der Nacht. Dazu kommt, es ist absolut gut gelegen, direkt am Eingang zur Altstadt und hat eine Tiefgarage, die ausnahmsweise mal nicht so eng ist wie sonst üblich, sondern viel Platz hat und hell ist. Und das für nur 3 € pro Tag.
Wir unternehmen einen langen Spaziergang durch die schöne Altstadt, die voller Leben ist. Draussen sitzen und den letzten Abend in Frankreich geniessen, das haben wir im Sinn.
Aber drei Restaurants, die ich im Tripadvisor ausgesucht habe, sind zu (Ferien), bei fünf weiteren hätte man reservierten müssen. Endlich finden wir die letzten beiden Plätze im „Un Faim en Soi“. Wir haben keine grossen Erwartungen, aber das Essen ist ausgezeichnet.
Wir schlafen herrlich aus und fahren nach dem Frühstück die restlichen sieben Stunden zurück nach Hause in Ittigen. Es ist Sonntag, der 16. August 2015.
Zwei Monate lang haben wir nun Zeit, den letzten Teil des Sommers in Bern zu verbringen, die Koffer neu zu packen und uns auf die bevorstehende Reise vorzubereiten.
Reisebericht San Francisco – Hawaii – Florida
20. Oktober – 17. Dezember 2015
San Francisco
Pünktlich um Viertel nach vier, nach einem eindrücklichen Flug über das weite Meer, über Grönland, Kanada und über die Rocky Mountains, landet unser Flugzeug in San Francisco. Es dauert eine Stunde, bis wir durch den Zoll sind. Lee holt uns ab und sogleich fühlen wir uns wieder daheim im schönen Haus der Langans an der California Street, wo wir sieben Tag lang bleiben werden.
Währen dieser Zeit suchen wir viele Orte auf in der Stadt, wo wir schon waren, Fisherman’s Warf am Pier 39 zum Beispiel, unternehmen eine Bootsrundfahrt unter der Golden Gate Bridge durch und rund um die ehemalige Gefängnisinsel Alcatraz, gehen zu Fuss die Lombardstreet rauf und runter (cruckedest Street in the world) und verzichten auch nicht auf einen Einkaufsbummel in der Unionstreet und in Chinatown. Aber auch neue Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel das Science Museum im Golden Gate Park (Regenwald-Komplex mit vielen exotischen Pflanzen und Schmetterlingen) besuchen wir und natürlich das De Young Museum von Herzog-De Meron, von dessen Turm aus man einen herrlichen Blick auf die SF-Halbinsel hat.
Mit unseren Freunden essen wir jeden Abend in einem anderen Restaurant. Ich will nicht, dass Karine für uns kochen muss, wenn wir schon zum x-ten Mal bei ihnen wohnen dürfen, deshalb laden wir sie jeweils gerne ein. Es gibt ja das chinesische Sprichwort, das etwa so lautet: „Fische und Gäste stinken nach drei Tagen“ und wir bleiben ja mehr als doppelt so lang.
Erwähnenswert in diesen Zusammenhang sind die Restaurants „SPQR“ (teuer, aber jedes Gericht ist kreativ angerichtet und ausserordentlich schmackhaft), „Joe’s“ am Washington Square, wo wir draussen essen (wunderbare Burger, riesengross).
Eine Show am North Point sehen wir uns an: „Babylon” (super unterhaltsam – selten so gelacht).
An einem Abend jedoch laden die Langens uns ein: zu einem Vortrag über Kartographie im Explorer Club, in dem Lee im Vorstand ist. Nach dem Buffet-Dinner (Der Koch hat eine Mutter aus der welschen Schweiz; er spricht gut Französisch) hören wir und ungefähr weitere 50 Besucher mit grossem Interesse einem interessanten Vortrag zu, der mit einer Karte über Zermatt beginnt, die als exemplarisches Vorbild gilt. Dann wird uns im Gegensatz dazu amerikanisches Kartenmaterial gezeigt, in dem ein absolutes Chaos herrscht, Orts-, Flur-, Fluss- und Städtenamen sind in jeder Richtung geschrieben, und das in unterschiedlicher Schriftart und -grösse. Ausrichtung nach Norden eher selten.
Ein für uns völlig neues Erlebnis ist an einem Abend unser Ausflug nach Stanford, wo wir erst den Campus besuchen, wo Lee früher studiert hat, ein wenig im riesigen Bookshop stöbern, dann bei einem der Stände ein grosses BLT Sandwich essen, damit wir nicht mit leerem Magen den eigentlichen Spektakel, für den wir hergekommen sind, anschauen müssen, nämlich den Football-Match Stanford-Washington, der um halb acht beginnt. Es hat 60‘000 Zuschauer und ist eine Riesenshow. Stanford gewinnt 34:14. Eine tolle Stimmung herrscht und obwohl Lee geduldig versucht hat, uns die Regeln beizubringen, begreifen wir kaum, worum es geht und weshalb wann und wieso gejubelt oder gepfiffen wird. Aber Hauptsache, Stanford hat gewonnen.
An einem anderen Tag kommt Oliver, der jüngste Sohn der Langans, den ich erstmals vor 39 Jahren kennengelernt habe, als er sechs-jährig war, mit seiner chinesischen Frau Snow, den beiden Söhnen Teo und Filas und Snows Verwandten zu Besuch. Er ist dabei, Snows Eltern und ihre Tante auf den Flugplatz zu bringen, die fast zwei Monate lang bei der jungen Familie gewohnt haben. Snow scheint froh zu sein, ihre Gäste „los“ zu werden, denn sie klagt, alle drei verstünden kein Wort Englisch und könnten nicht Autofahren. So war sie ständig Chauffeuse, Übersetzerin, Köchin und Unterhalterin.
Wir dürfen Karines Auto für einen zweitägigen Ausflug brauchen und fahren der herrlichen Küste entlang nach Monterey, wo wir in der Stage Coach Lodge übernachten. Einen halben Tag lang verbringen wir im grossartigen Monterey Bay Aquarium. Es ist wunderbar, die Fischschwärme, die Quallen, die Kraken und all die anderen Meerestiere zu beobachten.
Auf dem Heimweg machen wir in Cupertino Halt, wo wir Oliver treffen, der am Apple-Hauptsitz arbeitet. Er lädt uns ein, mit ihm in der riesigen Kantine (Infinite Loop) zu Abend zu essen.
An unserem letzten Tag in SF besuchen wir wiedermal das Exploratorium, das inzwischen an den Pier 15 umgezogen ist. Es ist immer wieder einen Besuch wert. Stundenlang könnte man drin verbringen. Das tun wir auch, einen ganzen Nachmittag lang. Begeisternd, interessant, lehrreich, erstaunlich, aber auch ermüdend.
Am Abend gehen wir mit Karine und Lee in einem mexikanisches Quartierrestaurant essen, dem „Tia Margarita“. Ja, und die Margaritas sind köstlich, die Burritos wie Babyoberarme so gross. Ich liebe die Tamales und Flautas.
Oahu - Honolulu
Am Mittwoch, dem 28. Oktober, bringt uns Lee auf den Flughafen und fünf Stunden später kommen wir auf der Insel Oahu an. Wir nehmen unser Mietauto in Empfang; ein kleiner weisser Nissan ist es diesmal. Mein Navi führt uns in die Berge. Das dauert nur kurz, eine Fahrt von circa zwanzig Minuten, aber dass hier eine ganz andere Klimazone herrscht, ist eindeutig. Es ist warm und feucht. Die Strecke führt steil den Hang hinauf zum Haus, wo wir zehn Tage lang wohnen werden.
Sue erwartet uns. Sie stammt ursprünglich aus Vietnam, ist fünfzig, sieht aber aus wie dreissig. Sie hat unseren Kühlschrank völlig vollgefüllt, wir brauchen so gut wie gar nichts mehr einzukaufen. Zum Nachtessen sind wir eingeladen und verbringen einen sehr netten Abend mit unseren neuen Gastgebern Sue und Greg Hansen und ihrem elfjährigen Sohn Jacob. Die beiden sind unendlich gastfreundlich. Uns kommt es vor, als wären wir schon seit Jahren befreundet.
Wir wohnen im Parterre ihres Hauses, haben eine elegante Wohnung mit riesiger Küche für uns allein, die wir dann aber kaum je brauchen, weil Sue uns ständig bekocht oder uns leckere Speisen bringt. Auch den grossen, gepflegten Garten dürfen wir benutzen.
Unsere ersten Unternehmungen in der näheren Umgebung führen uns zum Pali Lookout (einer der 10 Sterne im Marco Polo Reiseführer), von wo aus man einen spektakulären Blick auf die nördliche Seite der Insel hat. – Die Krieger, die dort der Geschichte oder der Legende nach von ihren Feinden über die hohen Felsen in den sicheren Tod gestürzt wurden, hatten vermutlich andere Probleme, als sich die Schönheit der Gegend anzusehen. – In Kailua geniessen wir das Strandleben und besuchen den fröhlichen Markt, wo’s allerlei zu kaufen gibt, vor allem wunderbare Leckerbissen aus aller Herren Länder.
Die verschiedenen Surfer-Strände lernen wir im Norden der Insel kennen: den Sunside Beach, den Bonzai Beach. Stundenlang schauen wir den unerschrockenen Surfern zu. Unglaublich, wie diese mit grossem Geschick in und auf den Wellen reiten. Am Pipeline Beach ist grad ein Wettkampf im Gange, an dem nur die besten teilnehmen.
Unterwegs gibt’s viele leckere Dinge zu probieren: zum Beispiel Shave-Ice in Kahuku-Sugercane, und die weltbesten Coconut-Shrimps in Wahi.
In der Nacht regnet es so stark, dass ich im Schlummern denke, wenn ich rausgehen würde, würde es mich grad in Scheiben trennen.
Wir stehen um acht schon auf. Nach einem feinen Frühstück, das Sue uns bringt (Papaya mit Lime und Bananen), fahren wir an den Strand mit Greg. So wie man sich das vorstellt: ein Riesen-Pick-Up mit Surfbrettern oben drauf. Theo möchte versuchen, SUP (Stand-up-paddle) zu üben. Greg gibt ihm die ersten Anweisungen. Wie wir uns am Strand einrichten (ich auf einem Klappsessel schaue lieber nur zu) und die beiden losgehen (Theo steht schon mal auf auf dem Board) beginnt es wie aus Kübeln zu regnen. Ich kann mich fast nicht halten vor Lachen. Es ist soo komisch! Die Übung muss abgebrochen werden, wir fliehen zurück ins Auto, platschnass ist ausnahmslos alles. Ich habe Angst, dass meine Kamera das Zeitliche gesegnet hat. Wir sitzen im Auto, völlig durchnässt und sandig und Greg sagt, er habe seit Jahren keinen solchen Regen mehr erlebt und sein Freund Alan, der ihm für den Morgen eine günstige Wettervorhersage gemacht hatte, solle sich vielleicht lieber nicht als Wetterfrosch bewerben.
Nach etwa zwanzig Minuten stoppt der Regen plötzlich, wir gehen zurück an den Strand, es wird richtig heiss, die beiden Männer setzen ihre sportlichen Tätigkeiten fort. – Ich bin mehr als nur erstaunt, dass mein völlig unsportlicher Ehemann die Sache recht gut begreift und mit Greg in Richtung Waikiki davonpaddelt.
Eine gute halbe Stunde später kommen die beiden zurück. Theo, der Held, völlig erledigt.
Time for lunch. Wir fahren in ein chinesisches Einkaufzentrum mit Restaurant „Nice Day“, wo wir Sue treffen zu einer exquisiten Dim Sum-Mahlzeit mitten in mindestens hundert Asiaten - wir drei die einzigen Weissen beziehungsweise Nicht-Asiaten.
Zu Hause ist dann Zeit für Siesta. Muss ja sein! - Aber am späten Nachmittag brechen wir wieder auf nach Waikiki, wo wir grad noch den Sonnenuntergang miterlebten. Halloween! Es ist wie bei uns am Ziebelemärit, ohne Kälte und Käsekuchen zwar. Es herrscht eine ausgesprochen lockere, fröhliche Stimmung – ein Riesenfest. Ich mache zig Fotos von all den wunderbar originell verkleideten Menschen, gross und klein, die so viel Spass haben und sich gerne zur Schau stellen. Schwierig ist, irgendwo einen Drink zu kriegen, alle Bars und Restaurants sind übervoll. Dies gelingt dann doch noch und wir freuen uns über eine überdimensionale Margarita. Grad, wie wir gegen zehn ins Auto steigen, beginnt es wieder leicht zu regnen.
Essen mögen wir nichts mehr daheim, denn Sue hat uns, grad bevor wir gingen, einen Teller voll Fleisch Teriaki und gegrillte Ananas-Würste gebracht – mehr als nur eine volle Mahlzeit. Sie verwöhnt uns nach Noten! (Im Restaurant gelang es mir auch nicht zu zahlen…)
Ich lese im Internet, welche Auswirkungen Halloween in der Schweiz zum Teil hatte. Vandalismus wieder mal… Und überhaupt, wieso man auf Biegen und Brechen seit wenigen Jahren auch bei uns versucht, dieses Fest, mit dem wir so gar keine Geschichte und auch sonst nichts gemeinsam haben, zu lancieren, will mir auch nicht in den Kopf. Ich vermute stark, es geht um Kommerz. Ob’s damit klappt auch in Zukunft? Wer weiss? – Im Migros werden all die dümmlichen „Zutaten“ anschliessend zum Viertelpreis angeboten.
Ganz anders ist das in den Staaten: Dort gehört der Brauch hin und man kann sich kaum satt sehen an den grusligen aber lustigen Dekorationen überall: Hauseingänge und Fenster sind schon im Vorfeld überspannt mit Spinnennetzen, Riesenspinnen hängen an den Wänden und Mauern, Skelette bevölkern die Gärten - fast wie mit den Weihnachtsdekos. Jeder versucht den Nachbarn zu übertreffen. Schon in SF konnten wir uns in der vorigen Woche daran erfreuen.
Am Sonntag, dem 1. November, schlafen wir lange aus. Greg bringt uns zum Frühstück ein von Sue selber hergestelltes Mango-Smoothie. Sie kann’s nicht lassen, uns zu verwöhnen.
Hansens nehmen uns mit in ihren Club, wo’s einen privaten Strand hat zum Schwimmen und Sonnenbaden. Ich geh ins Wasser, aber bald auch wieder raus, denn der Lifeguard sagt, man habe einen drei-Meter langen Hai gesichtet. Dem sein Nachtessen möchte ich lieber nicht sein. Da gehen wir dann anschliessend lieber zum Pick-Nick im Park mit Hansens Freunden. Es ist eine Vorfeier für Rob’s kleines Töchterchen (erster Geburtstag), das er zusammen mit seiner „neuen“ Frau Jane hat. Sie ist 30, Kambodschanerin, und er 63, lebt seit Jahren in Hawaii, hat sich mit 35 pensionieren lassen, denn er verkaufte sein Business für etliche Millionen und musste dann nicht mehr arbeiten. Er besass alle US-Payphones. Kein schlechter Deal, finden wir. Vor allem, weil fünf Jahre später niemand mehr eines brauchte… Jetzt unterhält er Schulen in Kambodscha.
Regen wieder mal am nächsten Tag. Das stört uns gar nicht mal so sehr. Wir erledigen Emails, machen Zahlungen und gehen dann downtown Honolulu ins Art State Museum, das uns ausserordentlich gut gefällt und machen eine kleine Stadtbesichtigung.
Ein Ausflug in Richtung süd-osten entlang der Küstenstrasse führt uns anderntags zur Hanauma Bay Nature Preserve – ein Krater eigentlich. Die Bucht sieht fast aus wie die Wineglass-Bay in Tasmanien – wie mit dem Zirkel geformt, ein Strand vom Schönsten, umgeben von Palmen - wie aus dem Ferien-Prospekt. - Hier im Hintergrund der Koko Crater. Sue und Greg haben uns mit Schnorchel-Ausrüstung ausstaffiert. Wir sehen die farbigsten Fische schon nur wenige Meter vom Ufer entfernt.
Zu Hause bringt uns Sue eine selber gemachte Suppe und zwei feine Margaritas.
Am 4. November ist Ginos Geburtstag. Wir telefonieren mit ihm. Zu Hause läuft alles bestens. Das ist immer gut zu wissen.
Rund ums Aloha-Stadium besuchen wir einen riesigen Flohmarkt. Er scheint kein Ende zu nehmen. Ums ganze Stadium herum sind die Stände verteilt. Die meisten verkaufen allerdings das Gleiche: farbige Hawaii-Klamotten.
Unterwegs gibt’s beim Pagoden-Friedhof einen Lookout. Den lass ich mir nicht entgehen. - Was für wunderbare Aussicht vielerorts die Toten doch haben. Auch in unserem Heimatort Soglio ist das zum Beispiel so.
Nächste Station: Pearl Harbour. Theo macht eine zweistündige Tour mit; ich schaue mich ein wenig um, lege mich irgendwo in den Rasen und lese ein bisschen in meinem E-Books (Adler Olsen).
Zuhause, kaum ausgestiegen, fragt Sue, ob wir Spaghetti wollen. So kommen wir schon wieder zu einer feinen Mahlzeit ohne dass wir selber kochen müssen.
Es regnet in Strömen am folgenden Tag. Theo bleibt zu Hause, ich fahre mit Sue zum Shopping in den Supermarkt Costco. Wer eine Kleinigkeit kaufen möchte, ist dort fehl am Platz. Nur palettweise kann man einkaufen, die Waren sind bis zur hohen Decke hoch gestapelt. Dem Teddybär beim Eingang reiche ich bis zur Hüfte. Unser Abendessen kaufen wir lieber in Restaurant ein; Laulau kann man dort portionenweise beziehen.
Mitten am Nachmittag machen wir uns auf zum Diamond Head. Bei uns in den Bergen regnet’s zwar noch immer heftig, aber an der Küste ist’s klar. Bald kommen wir mitten im Krater auf dem Parkplatz an. Der Aufstieg beginnt. Weil wir relativ spät dran sind, hat’s nicht so viele Leute, was eine Wohltat ist, denn der Weg ist schmal und steil. Auch ist es nicht extrem heiss; es weht immer wieder ein Wind, der Abkühlung bringt. – Über den Bergen bilden sich immer wieder neue Regenbogen. Die Lookouts unterwegs sind atemberaubend und erst recht der Blick zuoberst vom Kraterrand aus auf Waikiki, Honolulu und die Berge. Der Abstieg dauert etwa eine halbe Stunde, dann fahren wir zur Diamond Head Küstenstrasse und gehen dem Sonnenuntergang entgegen bis zum Leuchtturm. Es wimmelt nur so von Surfern.
Auch der nächste ist ein schöner Tag. Wie immer hat’s in der Nacht geregnet und am Morgen werden wir wie üblich geweckt von wohl stets demselben „crazy“ Bird, der seinen Kopf an unserer Fensterscheibe schlägt, weil er sich vermutlich durch das spiegelnde Glas angezogen fühlt… Mein Versuch, das Fenster mit Karton abzudecken, hat allerdings nichts gebracht. Der Vogel muss einen harten, aber unbelehrbaren Schädel haben.
Nach dem Frühstück (Sue bringt wieder das herrliche Smoothie) fahren wir auf den Friedhof im Punchbowl-Crater und geniessen die herrliche Aussicht rings um den Kraterrand. Es ist sehr heiss. Weiter geht der Ausflug anschliessend entlang des Tantalits Drive und Round Top Drive fast 500 Meter durch den Jungel bergauf und immer wieder hat’s zwischendurch die schönsten Lookouts auf die Stadt, das Meer und die Berge.
Unser nächstes Ziel ist Waikiki. Theo möchte gerne dort mal am Strand liegen – ein Muss schliesslich, wenn man schon da ist. Das tun wir dann während fast drei Stunden. Um sechs geht Theo für drei weitere Stunden die Parkuhr füttern und wir nehmen eine Piña Colada in der überfüllten Duke’s Bar vom Outrigger Hotel.
Etwa 500 Meter weiter am Strand gibt’s um Viertel vor acht ein Feuerwerk zu bestaunen und zu Hause, wen wundert’s – ich wollte eigentlich nichts mehr essen – bringt Sue eine Platte voller exquisiter chinesischer Köstlichkeiten.
Dies ist unser letzter Tag hier. Traurig, traurig! Wir schlafen aus und packen. Zu beeilen brauchen wir uns nicht. Unser nächster HomeExchange ist nur ein paar Kilometer weit weg auf der anderen Seite der Berge an der nördlichen Küste der Insel. Sue und Greg schlagen vor, den Nachmittag im Kino zu verbringen, denn es regnet seit Stunden in Strömen. Das ist ein guter Plan. Lustig finde ich, dass im Kino offenbar auch sogenannte „Crybaby-Matinées“ angeboten werden. Das sind Vorstellungen, die speziell für Mütter (vielleicht auf für Väter) gedacht sind, die sich mit ihren Kindern einen Film anschauen wollen, sich dabei aber nicht über allfälliges Kindergeschrei beschweren dürfen.
Anschliessend führen uns Hansens in ein ganz spezielles hawaiianische Restaurant, in den „La Mariana Sailing Club“ (one of the few remaining original Tiki bars / 50 Sand Island Access Rd, Honolulu) in einem Industriequartier, wo’s kaum Touristen hat. Die Bar ist dann doch perfekt gelegen, nämlich direkt an einem kleinen Hafen, ein richtiges Juwel. Kam im Elvis-Film vor, meint Greg. Burgers isst man dort – what else?!
Zu Hause sind wir erst gegen sechs, laden unser Auto mit unserem Hab und Gut und fahren nach Kahaluu zum nächsten Häusertausch. Dank dem Navi finden wir’s und lassen uns nieder. Von der Umgebung sehen wir nichts, weil’s halt schon dunkel ist.
Kailua
Sonntag, 8. November: Wir schlafen aus und sehen dann, wo wir sind. Das Apartment ist ok, nicht mehr ganz neu zwar, man könnte einiges bemängeln, aber die Aussicht aufs Meer ist wunderschön und der Garten eine Dschungel-Wildnis.
Den Tag verbringen wir am Strand, wo’s sehr viel Wind und Wellen hat.
Bereits vermissen wir Sue, die uns mit ihren Köstlichkeiten stets überhäuft und verwöhnt hat. – Jetzt müssen wir wieder selber kochen.
An den Regen in der Nacht sind wir bereits gewohnt. Der gehört offenbar einfach dazu, aber am Morgen scheint wieder die Sonne. Eigentlich hatten wir vorgehabt, nochmals in den Norden der Insel zu fahren, wir fahren aber nur ein Stück weit und verbringen den Tag am Strand beziehungsweise im Gras im malerischen Kualoa-Park. Auf der einen Seite das Meer, Palmen, Strand, Rasen und Blick auf die hübsche Insel Mokolii, auch genannt Chinaman’s Hat. Auf der anderen Seite, 180° gegenüber: hohe Felsen, grün und längs gefaltet wie ein geschlossener Fächer. Das Wetter ist ebenso abwechslungsreich: Es wechselt von Minute zu Minute von grau zu blau und Sonne, dann gibt’s sogar ein paar Regentropfen und schon fängt das Karussell wieder von vorne an.
Am Abend treffen wir Sue und Greg zum Nachtessen in einem japanischen Restaurant. Und wieder gelingt es mir nicht zu zahlen.
Während der nächsten Tage machen wir verschiedene Ausflüge, mal nach Norden, mal nach Süden. Die Wellen am Sandy Beach sind beeindruckend. Sie sind riesig und kommen bis ans Ufer. An Schwimmen ist nicht zu denken. Und immer wieder können wir uns kaum sattsehen an den zerklüfteten Küsten, am Meer mit all seinen verschiedenen blau-grün-türkis-weissen Farben, an den vorgelagerten Inselchen und den sagenhaft pittoresken Stränden.
Die Wellen vielerorts sind unberechenbar; ich werde noch weit oben am Strand von einer erwischt mit beiden Smartphones in der Hand. Es ist heiss und stets windig. Wir bleiben etwa eine halbe Stunde, dann sehen wir uns das sagenhafte Halona Blowhole an. Meterhoch spritzt das Wasser durch die Löcher im Fels. Tafeln warnen die Besucher vor gewagten Kletterpartien. Von weitem sehen wir, wie ein paar Touristen, die trotzdem auf den Felsen herumkraxeln, fast von den Wellen hinuntergespült werden. Das war knapp!
Am folgenden Morgen schaffen wir es ausnahmsweise, ungefähr um zehn morgens loszufahren. Richtung Norden diesmal. Das Meer ist jetzt zum Teil ganz rostbraun, bevor es in blau und türkis übergeht. Wir machen unterwegs Halt im Kahuku-Grill. Ich will unbedingt die Kokos-Makademia-coated Shrimps nochmals essen. Sie sind himmlisch! Best ever!
Weiter zum Turtle Beach. Wir schauen uns um, machen ein paar Fotos. Zurück im Auto kommt wieder mal ein Regenguss vom Schönsten.
Nächster Halt: Pupukea Beach. Es regnet immer noch. Die Leute, die dort in den Felsen im Wasser herumklettern, stört das nicht. Waimea Valley. Das ist ein gut gepflasterter, etwa ein Kilometer langer Trail zum Waimea Wasserfall. Unterwegs sind Bäume und Pflanzen angeschrieben, es ist gleichzeitig ein botanischer Garten. Immer wieder regnet’s ein wenig. Das stört niemanden. Es ist 29 Grad am Schatten. Der Wasserfall ist keine Wucht, wenn man andere schon gesehen hat. Unterhalb ist ein Wasserloch, wo man schwimmen kann. Es hat viele Leute und Lifeguards. Man muss Schwimmwesten anziehen. Das kommt gar nicht in Frage! - Das Wasser ist auch nicht sooo aamächelig. Die bräunliche Farbe stammt vom Eisen in den Felsen; das jedenfalls ist die Erklärung (Waimea heisst: rötlich). Wir verzichten also, spazieren zurück zum Auto und fahren zum Waimea Beach, wo wir zum ersten Mal nicht grad sofort einen Parkplatz finden, sondern etwa zehn Minuten warten müssen, bis jemand alle seine Surfbretter, nassen Tücher, Eisboxen etc. verpackt hat. Dann geht’s an den breiten Strand, wo, oh Wunder, die Wellen nicht so giftig sind und man sehr gut schwimmen kann. Was für eine Freude! - Fast wie am Almadraba-Strand in Spanien: erst ein paar Meter flach, dann abfallend, aber immer noch sandig – eine tolle Abkühlung. Natürlich hat’s auch mehr Leute als an anderen Stränden, wo Schwimmen nur für Profis empfehlenswert ist. - Schon bald geht die Sonne unter. Wir machen uns auf den Heimweg. Es wird bereits dunkel gegen sechs, dann geht’s sehr schnell und es ist Nacht. Nach einer Stunde und 53 km sind wir daheim.
Der Regen ist auch am nächsten Morgen pünktlich zur Stelle. Inzwischen wissen wir ja, dass das kein Problem ist. Trotzdem bleiben wir am Morgen daheim. Regen, Sonne, Regenbogen, Regen wieder und so weiter.
Wir besuchen am Nachmittag das Valley of the Temples, ein Friedhof für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen: Chinesen, Japaner, Hawaiianer, Christen… Im schönen Haiko-Park, der zum Haleiwa-Joe’s Restaurant gehört, essen wir eine Kleinigkeit und lesen ein wenig im gedeckten Pavillon währendem es regnet. – Kein Wunder, ist diese Insel so grün!
Freitag, 13. November: unser letzter Tag auf Oahu. Wir bleiben daheim.
Im Fernsehen erfahren wir von den furchtbaren Terroranschlägen in Paris. Menschenleben werden geopfert für fatalistische Ideen – so viel Leid geschieht für nichts und wieder nichts. Was sind das nur für irregeleitete Typen, die zu so etwas fähig sind?
Am Nachmittag besuchen wir Sue und geben ihr die Standsachen zurück, die sie uns geliehen hat. Bei der Heimfahrt leisten wir und ein „Verfahren“. Mein Fehler: Ich hab die falsche Route eingegeben und wir geraten auf die H3 in Richtung Pearl Harbour. Dummerweise hat gerade diese Autobahn, die durch einen langen Tunnel führt, während fast 20 Kilometern keine Ausfahrt. Zudem ist das Benzin am Ausgehen. Endlich kommt eine Doppelausfahrt. Theo möchte tanken gehen. Dummerweise verpassen wir den richtigen Exit von neuem und gelangen auf die falsche Bahn - zwar direkt zurück aber eben wieder auf die fast 20 km lange Strecke durch den Tunnel und der Tank steht schon seit einiger Zeit auf Reserve. Wir schaffen die Ausfahrt knapp - lauter Ameisen im Bauch. Dort müssen wir for ever am Rotlicht stehen, am zweiten auch, wir sind beide wie auf Nadeln und wissen nicht, ob’s besser ist, den Motor abzustellen oder nicht. Wenn er in diesem Stau nicht mehr anspringt… Ich weiss, es hat in der nächsten Strasse ein paar Tankstellen, aber noch grad nicht. - Eine weitere Ampel, sie wechselt auf orange. Ich dränge Theo, er soll zufahren, was er zum Glück auch macht. Und endlich: da ist die Garage, mit den letzten Tropfen im Tank stehen wir vor der heiss ersehnten Säule.
Am Samstag, dem 14. November, stehen wir um halb sieben auf, zu früh für Theo, das schon, aber trotzdem schön ohne Stress. Heute fliegen wir nach Hawaii, der Haupinsel des fünfzigsten US-Bundesstaates, wo unser nächster Haustausch stattfindet. Eine knappe Stunde später landen wir in einem riesigen Lavafeld auf Big Island.
Big Island - Hawaii
Mietauto beziehen, dann Fahrt an den Ali’i Drive, wo wir auch gleich das Windham Resort finden, unseren dritten Haustausch auf dieser Reise. Das Apartment lässt keine Wünsche offen, es ist grosszügig konzipiert und sehr gut ausgestattet. Die Betten ganz offensichtlich für jegliche Eventualität gewappnet: „The beds have a 400 (four hundred!) pound total weight limit, recommended by manufacturer”.
Im hübschen Restaurant Lava Java essen wir am Abend. Den Wein können wir selber mitbringen; wir finden im ABC-shop sogar eine Flasche „Hess Select“.
Am nächsten Morgen findet im Hotelkomplex eine Präsentation der verschiedenen Sightseeing-Angebote statt. Sie dauert fast zwei Stunden, ein wenig lang, finden wir. Wir buchen einen Helikopterflug für den 25. November (an Theos Geburtstag, dem Tag zuvor sind die Wetterprognosen leider schlecht).
Am Nachmittag fahren wir Richtung Norden. Wir nehmen die Abzweigung in den Lava-State-Park. Die Strasse ist die reinste Katastrophe. Es schüttelt gewaltig. Wir fürchten um die Pneus unseres Mietautos. Später lese ich, dass man dorthin nur zu Fuss oder per 4-wheel-drive gelangen kann…
Der Ausflug hat sich aber gelohnt. Wir gelangen an einen schönen, schwarz-weissen Strand, wo’s kaum Leute hat. In der Nähe gelegen ist das exklusive 4-Season-Resort inmitten eines gediegenen Golfplatzes (700$ pro Nacht).
Zu Hause gibt’s Rib Eye Stake und Gemüse, das Theo auf dem Gartengrill zubereiten muss. – Freude seinerseits herrscht nicht ob der Zuteilung dieser Aufgabe, aber ich bestehe darauf. Die Kartoffeln bereite ich in der Bratpfanne zu.
Auch diese Insel, die jüngste aber grösste des Archipels, wollen wir erkunden. Das Erstaunliche ist, dass es auf diesem doch relativ kleinen Gebiet 11 der möglichen 13 Klimazonen gibt, die auf der Welt existieren.
Ich erwache vor acht und sehe im Internet, dass das Wetter heute besser ist in Hilo als in den nächsten Tagen, so wecke ich Theo und nach dem Frühstück machen wir uns um neun auf den Weg dorthin. Wir wählen die Bergroute und sind knapp zwei Stunden später dort. Unser vorläufiges Ziel sind die Akaka-Fälle. Es regnet immer wieder mal ein wenig (es soll jeden Tag regnen an der Ostküste – Hilo ist der Ort mit der höchsten Niederschlagsrate weltweit), aber das ist ja hier nicht so ein riesiges Problem. Erstens ist’s warm, zweitens dauert die Traufe nie lang.
Ein schöner Rundgang führt durch eine herrliche Vegetation mit riesigen Bäumen, Bambus zum Teil und dann sieht man neben anderen Fällen den Akaka-Fall, der 135 Meter in die Tiefe stürzt. Ein eindrucksvoller Anblick.
Unterwegs halten wir immer wieder mal an in einem der hübschen kleinen Orte, schliesslich auch in Hilo. Nach eine Spaziergang und ein paar Einkäufen machen wir uns auf den Heimweg. Um sechs wird’s dunkel, so muss Theo die Hälfte der Strecke in der Dunkelheit heimfahren.
Was für ein weiterer schöner Tag, der nächste: Wir fahren um Viertel vor acht los. Ziemlich viel Verkehr hat’s schon so früh. Trotzdem kommen wir rechtzeitig in Waimea an. Um 9 Uhr treffen wir im Starbucks, im Parker Center, Christopher Langan, Lees ältesten Sohn, der seit Jahren in Hawaii lebt. Er hat sich anerboten, uns „seine“ Insel zu zeigen. Unser „Wägeli“ lassen wir auf dem Parkplatz stehen und wechseln in seine Riesenkarosse, einem Pickup, wie es sich hier gehört, mit dem wir dann den ganzen Tag lang auf den abenteuerlichsten Strassen unterwegs sind.
Erst fahren wir an die Ostküste nach Honokaa, einem malerischen kleinen Ort mit Holzhäusern im Westernstil. Von einem bekannten Aussichtspunkt aus eröffnet sich uns ein grandioser Blick hinunter ins Waipio-Valley. Noch ein paar andere Touristen stehen dort, staunen und knipsen Fotos. Genau dort hinunter, wo’s wilde Pferde hat und grüne Taro-Felder, dort wollen wir hin. Die steile, um 25% abfallende Strasse ist voller Löcher und nur mit einen 4X4-Gefährt passierbar. Das haben wir ja, aber trotzdem: einfach ist die Fahrt hinunter ins Tal überhaupt nicht. Die Landschaft ist spektakulär. Die hohen Felswände werden wir in ein paar Tagen auch von oben sehen können, vom Helikopter aus. Unten im Tal angekommen, sind die Pfade keineswegs besser befahrbar. Wo die Strecke durchführt, ist kaum sichtbar. Es hat riesige Pfützen, Löcher und wir müssen den Fluss mehrere Male überqueren. An einem pechschwarzen Strand halten wir an und vertreten uns die Beine, essen die Starfruits, die wir unterwegs an einem Stand gekauft haben und schauen den wilden Pferden zu.
Anschliessend fahren wir zurück nach Waimea.
Unser nächstes Ziel ist das auf 4‘200 Metern gelegene Observatorium auf dem Mauna Kea. Das Wetter wechselt von Minute zu Minute. Nebel, Wolken, man sieht gar nichts mehr, dann wieder blauer Himmel und Sonnenschein. Dazu ist es sehr windig und kalt. Kein Wunder bei dieser Höhe. In knapp drei Stunden einen solchen Höhenunterschied zu erleben, von null auf über viertausend Meter, ist auch für den Organismus kein Kinderspiel. Hier herrscht ein völlig anderes Klima als unten im warmen Tal. Gegen die Kälte aber hat Christopher vorgesorgt: Er hat Daunenjacken und Handschuhe für uns mitgebracht. Einen besseren Guide hätten wir uns nicht wünschen können!
Ich bin erstaunt über die vielen Observatorien dort oben. Ich wusste gar nichts davon. Sie sind riesig und natürlich an einem Ort stationiert, wo kaum ein Lichteinfall die Beobachtungen stören kann.
Zurück in Waimea gehen wir Nachtessen im „Red Waters“, einem originellen Schuppen. - Das war ein super Abschluss für einen genialen Tag. - Theo muss noch eine Stunde ans Steuer, dann sind wir daheim.
Nur kurze Ausflüge unternehmen wir während der nächsten paar Tage; wir besuchen Dörfer in der Nähe und finden immer wieder mal einen Strand, der zum Baden und zum Ruhen einlädt.
Nach einer Woche ist es Zeit, unser Apartment im Windham Resort zu verlassen und zu unserem nächsten Haustausch zu wechseln, einem hübschen Haus, das mitten in ein Lavafeld hineingebaut ist. Nur wenige Pflanzen ragen aus dem schwarzen Gestein hervor. Echsen und anders Kriechgetier lieben den Ort. Auch wir haben keine Mühe, uns gleich wieder einzunisten. – Von einem luxuriösen Sitzplatz mit Bar und Grillstelle aus hat man einen tollen Blick aufs Meer und in der Nacht auf die Sternenpracht. Die Mücken finden’s ebenfalls ganz angenehm, von dort aus mit uns die Dämmerung zu erleben.
Ein Ausflug bringt uns in den Süden. Bei „Coffee Joe’s“ machen wir den ersten Halt, wo’s Kaffee-Tasting gibt und zusätzlich eine herrliche Aussicht auf die Kaffeeplantage und die Küste. An Captain Cook vorbei (das Monument finden wir nicht, lesen später, dass es nur vom Meer aus sicht- und erreichbar ist) geht’s weiter Richtung „Place of Refuge“. Unterwegs besuchen wir das hübsche kleine Kirchlein „Painted Church St. Thomas“ und fahren dann weiter zur ältesten Siedlung der Insel, wo sich früher Flüchtlinge, die ein Tabu verletzt hatten, begnadigen lassen konnten. War wohl nicht so leicht, weil sie nur schwimmend dorthin gelangen konnten. Es ist ein einmalig schöner Ort; das Schattenspiel der hohen Kokospalmenwedel im weissen Sand erinnert an Ferienprospekte. Wir unternehmen einen Spaziergang in der Hitze und hören anschliessend einer Rangerin zu, die uns Legenden erzählt und über die Geschichte informiert.
Grad nebenan gibt’s einen Strand, an dem man sehr gut schnorcheln kann. Wir probieren’s. „Two Steps“, heisst er; von den vorgelagerten Felsen aus kann man über zwei Stufen mehr oder weniger gäbig „beschnorchelt“ ins tiefe Wasser losschwimmen. Wir versuchen‘s, sind aber keine Profis und tun uns ein bisschen schwer damit. Auch wage ich mich nicht sehr weit ins Meer hinaus, denn vor etwaigen Strömungen habe ich grossen Respekt. Trotzdem sehen wir viele Fische.
Auf dem Heimweg kaufen wir ein und daheim mach ich einen Salat, der offenbar so riesig ist, dass Theo sein eben gekauftes Fertigmenu gar nicht mehr mag und schon aufgetaut, wieder im Kühlschrank versorgt. – Er sagt nichts, aber ich merke, was er denkt.
Das war ein schöner Ausflug mit vielen Highlights.
Wieder ein Beach-Tag, der nächste. Eine Fahrt durchs Gelände führt uns am Hilton, Marriott, und deren Golfplätzen vorbei. Diese Resorts sind äusserst weitläufig, zwei grosse Shoppingmalls gehören dazu, aber dort Ferien zu machen, würde mir nicht gefallen, obwohl alles perfekt und total gepflegt aussieht. Für mein Dafürhalten macht die Anlage aber einen unpersönlichen Eindruck. Die Gäste werden mit Bussen in herumtransportiert, denn bis zum Strand ist der Weg weit. Gemütliche Bistros fehlen völlig. Hier war nie ein gewachsener Ort, ein Fischerdorf oder so. Mitten im Lavafeld wurde eine künstliche Hotelanlage hingestellt, schön gelegen zwar, aber eben, die Seele fehlt völlig.
Der Hapuna-Beach ist recht gross, es hat genügend Parkplätze und man kann gut schwimmen. Wir halten es recht lange dort aus, von Mittag bis halb fünf, dann brechen wir auf und fahren zurück in die „Stadt“, wo wir im „Citizen Pub“ grad rechtzeitig zur Happy Hour ankommen und super feine Pouletflügeli geniessen. Eine charmante junge Kellnerin, die von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, bedient uns. Es ist ihr erster Tag in diesem Restaurant, erzählt sie uns; ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch ihr letzter ist.
Ich mag dann gar nichts mehr essen daheim, Theo wärmt sein Fertiggericht auf, das er gestern nicht mehr mochte (weil viel zu viel Salat).
Dienstag, 24. November – Theos Geburtstag
Wir starten früh, das wird ein langer Tag, der uns zu den Vulkanen führt.
Um acht geht’s los. Theo bemerkt ganz poetisch: „Jetzt fahren wir in den Morgen hinein…“.
Leider wird das Wetter nach circa einer halben Stunde Fahrt ganz neblig und so beschliessen wir, nicht nach South Point zu fahren und auch auf einen Halt am Green Beach zu verzichten. Schade, aber bei Regen macht das keinen Spass. Auch die Sicht wird schlecht sein und den Fotos wird der Glanzprospekt-Effekt fehlen.
Wir fahren weiter und machen erst nach anderthalb Stunden Halt beim Black Beach. So ein schöner Anblick: Kohlenrabenschwarz ist der Sand. - Wenigstens hat’s aufgehört zu regnen, aber berauschend ist die Wetterlage nicht. Im Visitor Center des Volcano National Parks wird man informiert; Kaffee gibt’s im Volcano House.
Ein ungefähr dreiviertelstündiger Walk führt uns durch ein Gebiet, das uns stark an Rotarua, NZ, erinnert, wo’s auch überall aus allen Ritzen qualmt und vom Schwefel die farbigsten Stellen zu sehen sind. Eindrücklich! Den Rückweg schlagen wir entlang des Kraterrands ein.
Theo trägt übrigens seine hellen Discoschleifer, weil er die Turnschuhe daheim vergessen hat. – Es ist ja sein Geburtstag – ich sag mal nichts…
Nächster Halt: Jagger-Museum. Von dort hat man einen wunderbaren Blick über den Kilauea-Krater – wenn’s denn keinen Nebel hätte. Hat’s aber und man sieht nichts. Nach einem kurzen Museumsbesuch lösen sich die Wolken ein wenig auf und man erkennt den Krater. Er ist riesengross (17 km2?).
Als Nächstes gibt’s einen etwa hundert Meter langen unterirdischen Lavatunnel zu durchschreiten, ein eindrücklicher „Spaziergang“.
Weiter zum nächsten Krater. Ich wage mich aufs Lavafeld hinaus und mache ganz schöne Fotos. Theo schläft im Wagen. Dann kommt der Nebel und es hat keinen Sinn mehr, bei den anderen Kratern anzuhalten. Sicht gleich null. Wir fahren doch die 20 Meilen lange Crater Rim Road zum Meer hinunter und dort hört dann der Nebel auf und wir sehen, wo die Lava ins Meer fliesst oder geflossen ist. Spektakulär. Es haben sich Bögen und Brücken gebildet, die bis ins Meer reichen. Die Insel wächst also stetig.
Zurück in Kona schaffen wir’s grad um acht, bei „Huggo’s“ on the rocks über dem Meer bei einem feinen Essen auf Theos Geburtstag anzustossen.
Helikoper-Flug
Dieser findet am nächsten Tag statt (Geburtstagsgeschenk für Theo). Es hat die ganze Nacht geregnet, eigentlich denke ich, der Flug würde verschoben werden. Dann bessert das Wetter, kurz nach neun werden wir abgeholt und auf den Flughafen in Kona gebracht. Um halb elf geht’s los. Dass ich neben dem Piloten sitzen darf, freut mich sehr. Nun sehen wir aus der Vogelperspektive, wo wir überall bereits waren, durch welche Strassen wir gefahren sind.
Wir kreisen über den Lavafeldern des Mauna Loa, dann geht’s runter über den Kilauea, wo wir gestern waren, den Kratern entlang und nun ist die rotglühende Lava gut erkennbar. Es ist gewaltig. Weiter überfliegt der Heli die ganze Vulkanebene, die zum Teil glänzt wie Quecksilber. Wälder sind überflossen worden, abgestorbene Bäume ragen aus der schwarzen Landschaft heraus, überall hat’s tiefe Krater. Immer wieder ziehen Wolken vorbei, aber das macht die grossartigen Bilder, die sich einem bieten, noch attraktiver. Nebel- und Rauchschwaden gehören dazu.
Weiter über Hilo, dann zum Waipio-Valley, wo wir mit Christopher waren. Die grünen zerklüfteten Täler, in die wir hineinfliegen, sind unendlich schön, aus nächster Nähe die Wasserfälle zu sehen, die an vielen Orten aus den Felsen sprudeln und tief hinunter ins Tal stürzen, ist spektakulär. Man kann sich kaum satt sehen. Der Heli geht so nah ran und macht Kurven, dass es einem fast Angst werden könnte. Die Gegenden auf dieser Seite der Insel sind völlig unbewohnt. Der Heli macht einen Schwenker aufs Meer hinaus. In dem Moment schickt mir die SOS-App in meinem Smartphone eine Meldung: „Sind Sie noch in den USA?“ – Da wird mein Standort also auf Schritt und Tritt überwacht. Ich bin beeindruckt. - Weiter nördlich geht’s über die satt-grünen Felder von Kohala, man erkennt ein paar wenige Rinderherden. An der Ostküste sind die Farben prächtig: von türkis bis tiefblau präsentiert sich das Meer entlang der schneeweissen Strände und rund um die Korallenriffe. All die mondänen Resorts sind an dieser Küste gelegen. – Zwei Stunden später landen wir auf dem Flugplatz. - Das war ein einmaliges und unvergessliches Erlebnis.
Am Abend fahren wir ins Sheraton Kona. Dort hat es eine Art Kanal, der sich bis ins Areal des Hotels erstreckt, wo es Mantas zu sehen gibt. Gesehen haben wir zwar keine, aber die Bar ist schick, gute Musik, Aloha-Stimmung, kühler Weisswein und Burger vom Feinsten.
Donnerstag, 26. Dezember – Thanksgiving-day
Wir beschliessen, an den Strand hinter dem alten Hafen zu gehen. Der Zugang mit unserm Auto über das Lavafeld gestaltet sich ziemlich schwierig; ich hatte grosse Angst um unsere Pneus. – Wir hätten uns die Mühe, dorthin zu gelangen, auch sparen könnten, denn kaum dort, textet uns Christopher, er wäre unterwegs Richtung Norden, wir könnten uns treffen. So packen wir sogleich zusammen, fahren die holperige, mühsame Strecke wieder zurück zur Hauptstrasse und treffen Christopher eine halbe Stunde später am Napuna Beach im Norden. Nach einem Bad im stürmischen Meer nimmt er uns mit nach Kohala und zeigt uns auch andere kleine Orte. Es folgt ein Besuch auf seiner Farm, 800 Meter über Meer, in einer wunderbaren grünen Gegend. Genau darüber sind wir gestern geflogen. - Wir staunen! Das Anwesen befindet sich völlig allein auf weiter Flur, besteht aus zwei Häusern. Vier Autos stehen herum, eines davon ein massiges Schneegefährt. Von zwei Schäferhunde werden wir stürmisch begrüsst. - Es wird noch viel zu tun geben, bis das Haus ganz ausgebaut ist.
Ein kühler Wind weht hier oben, nur noch etwa 15 Grad zeigt das Thermometer an. Knapp nach sieben Uhr abends sind wir daheim, duschen rasch und fahren zurück in die Stadt, wo wir für ein Thanksgiving-Dinner einen Tisch auf der Terrasse eines Restaurants mit Blick übers Meer reserviert haben.
Tags darauf besuchen wir einen Strand in einem Nationalpark, an dem wir bisher noch nicht waren. Paradiesisch ist es hier, es hat kaum Leute, aber ganz speziell: viele Riesenschildkröten sonnen sich auf den Felsen und am Strand. Theo legt sich ebenfalls hin und ich geh ein wenig rekognoszieren. Nicht weit weg davon gibt es einen kurzen Trail mit Petroglyphen, die von den Ureinwohner Hawaiis stammen und die viele Jahrhunderte als sein sollen. Diesem Pfad gehe ich entlang. Er ist bestens beschildert und die einzelnen Felszeichnungen sind gut kommentiert.
Später, auf dem Weg zum Auto, begegnen wir einem Paar und kommen mit ihnen ins Gespräch; er ist Schweizer, sie von hier (Anjani und Eric). Sie wohnen in der Gegend und besitzen ein grosses Boot. Wir machen mit ihnen ab, am Montag mit den Delfinen schwimmen zu gehen.
Unser Haustausch dauert nur bis am Samstag, dem 28. November. Wir bleiben allerdings noch ein paar Tage länger auf der Insel und ziehen um, mitten in den Ort, ins Royal Kona Hotel.
Während dieser Zeit machen wir keine „grossen Sprünge“ mehr. An einem Abend laden wir Christopher zum Abschied noch zum Essen ein, an einem anderen haben wir eine weitere komische Begegnung mit einer Kellnerin. Lehren, wie sie bei uns üblich sind, kennt man in Amerika halt nicht, die Amis legen mehr Wert auf „learning by doing“. Aber wie das Beispiel zeigt, klappt das nicht immer auf Anhieb vorzüglich. Jedenfalls auch nicht bei Cindy, wie sie sich uns vorstellt: Was sie bietet, ist unglaublich. Sie ist noch sehr jung und auch sie erzählt uns, es sei ihr erster Tag. Sie will’s sooo gut machen, bringt drei Teller aufs Mal, dann fällt allerdings die Hälfte der Pommes Frites vor uns auf den Boden, das Ketchup im Töpfli grad dazu. Zum Glück haben wir Hochsitze, so dass wir mit unseren Füssen nicht auf den Frites herumstehen müssen. Sie wischt sie nämlich nicht weg. Sie ist überfreundlich und überschwänglich, wie man das von Ami-Frauen oft gewöhnt ist („oh my God, oh my God“ – „Enjoy your food, you guys“…). Sie betatscht mich auch dauernd am Oberarm und tätschelt mir auf den Rücken. Irgendwie kommt sie mir vor, als ob sie ein wenig high wäre. Vielleicht hat sie sich tatsächlich ein bisschen gedopt für ihr Debut. Mit der Zeit würde sie mir so was von auf die Nerven gehen… Ich könnte mir gut vorstellen, dass es ihrem Chef bald ähnlich geht und er auf ihre Dienste verzichtet.
Zu Hause bin ich todmüde und schlafe schon um halb neun. Wie ein Baby. Sonnenuntergang ist halt bereits vor sechs Uhr abends und so verschiebt sich alles. Um neun sind die Restaurants so gut wie leer, schliessen sodann und irgendwie hat man das Gefühl, der Abend sei gelaufen.
„Swimming with the Dolphins“
Wie abgemacht, sind wie am Montag früh parat fürs nächste „Abenteuer“. Anjani holt uns ab und bringt uns zum Hafen. Eric macht das Boot startklar - Leinen los. Kaum aus dem Hafen heraus – ich glaub’s ja nicht - schon umschwärmt eine ganze Reihe von Spinning-Dolphins unser Boot. Sie schwimmen unter dem Schiff durch und mit uns mit.
Wir fahren weiter Richtung Norden. Auf der Höhe des Flughafens hat’s wieder eine ganze Kolonie. Wir legen Flossen, Taucherbrillen und Schnorchel an und Anjani zeigt uns genau, wie’s geht. Ich bin froh um ihre Hilfe, mir ist die Sache schon nicht so geheuer mit den um mich herumpfeilenden langen Fischen. Aber es ist grossartig.
Leider ist es Theo schon bald schlecht vom Schaukeln auf dem Boot, aber im Wasser geht’s einigermassen. Wir fahren weiter, gehen wieder schwimmen, fahren weiter und so fort. Verrückt, wie nah man den Tieren ist, wie behänd sie sich fortbewegen. Es ist aber auch schön, ihnen nur vom Boot aus zuzuschauen, wie sie in Fünferkolonen zum Teil Pas-de-Cinqs vollführen, nebeneinander wie Synchronschwimmer auf- und wieder abtauchen. Auch Babys sieht man. Sie sind völlig verspielt, noch mehr als ihre erwachsenen Artgenossen. Sie fliegen oder besser gesagt schiessen in die Luft und drehen sich bis zu sieben Mal, bevor sie wieder kopfvoran ins Wasser tauchen. Daher der Name Spinning Dolphins.
Nach etwa viereinhalb Stunden peilen wir den Hafen an und Anjani bringt uns zurück ins Hotel. - Das war ein wunderbares Erlebnis, ein wenig teuer zwar (160$ pro Person). Aber es hat sich gelohnt, wir waren auch die einzigen Gäste.
Den Nachmittag verbringen wir am Strand im Hotel und am Abend essen wir in einem Thai-Restaurant. Die Portionen sind riesig. Die Tom Ka Suppe hätte für vier gereicht. Zum Dessert finden wir ein lustiges Frozen Joghurt Lädeli, wo man, ausser die Kasse bedienen, alles selber machen muss. Man füllt das Softice seiner Wahl in einen Becher, toppt mit einer riesigen Auswahl an Schoggi-Bitzli oder Nüssli-Bitzli oder Täfeli-Bitzli oder was auch immer für Bitzli, stellt den Becher anschliessend auf die Waage und bezahlt den Schaden. – Gar nicht schlecht. Weder die Idee noch die Glace.
Inzwischen ist es bereits Dezember. Der erste – für uns ein Tag am Strand. Bewaffnet mit Schnorchel-Ausrüstung nehmen wir den lustigen offenen Bus (der nur alle zwei Stunden fährt) Richtung Süden und gehen an die Kahaluu-Beach. Es hat recht viele Leute dort und das Schnorcheln macht Spass. Man sieht die buntesten Fische. Am besten gefällt mir der kleine zitronenfarbige, der lächelt.
Im gemütlichen „Huggo’s“ gibt’s unser letztes Abendessen auf dieser wunderbaren Insel: Ravioli mit Hummer, Shrimps und grünen Böhnchen vom Feinsten. – Theo bestellt Teryaki-Steak.
Zurück aufs Festland
Am 2. Dezember abends fliegen wir zurück auf den Kontinent, das Zwischenziel ist Los Angeles. Schlafen konnte ich kaum im Flugzeug, Theo schon, er hatte zwei Plätze für sich. Um halb sieben sind wir in LA. Der Anflug in der Morgendämmerung ist spektakulär: Im Hintergrund dringt ein heller Schein über die schwarze Bergkette, rote und gelbe Streifen sind zu sehen, weiter oben erahnt man schon den blauen Himmel und ein paar wenige Wolkenschleier. Im Vordergrund all die Lichter der Stadt wie in der Nacht aber nun eben nicht mehr ganz dunkel. Ein Anblick für Götter. Und unser Flugzeug kreist wie ein Adler ein paar Mal über der Riesenstadt, ziemlich tief unten, der Horizont steht schief - manchmal wird mir fast Angst.
Umsteigen. - Eine Stunde später sitzen wir schon wieder in der zweiten Maschine und fliegen über Wüstengebiete, den Golf von Mexiko, dringen erst über, durch und unter dichten Wolken hindurch und landen schliesslich in Florida.
Drei Tage Regen werden’s dann... Fünf Stunden haben wir „verloren“; es ist bereits später Nachmittag, wie wir im Hotel, das ich zu Hause bereits gebucht hatte, mit unserem neuen Mietauto ankommen. Später treffen wir unsere Freunde Liza und Urs Lindenmann und bleiben zum Nachtessen gleich im Hotel, weil’s in Strömen regnet. Nach einem gemütlichen und wie immer lustigen Abend mit den beiden sinken wir müde ins Bett und schlafen am nächsten Morgen lange aus.
Gegen Mittag treffen wir Jim aus Kanada. Er ist zufälligerweise in Miami, wie schon letztes Mal, als ich da war und wir zusammen essen gingen. Solche Zufälle gibt es eben. - Na ja, seine Eltern wohnen in Miami in einer Alterssiedlung, also ist es doch nicht so abwegig, dass er sie zur selben Zeit, wie wir da sind, besucht. In einem gemütlichen Restaurant am Hafen geniessen wir zusammen einen leichten Lunch. Neuigkeiten werden ausgetauscht und Fotos und schon ist’s Zeit für Jim, zum Flughafen zu fahren und zurück nach Toronto zu fliegen. Unsere Reise führt ebenfalls in Richtung Norden zur Adresse, wo wir unseren letzten Haustausch in diesem Jahr vereinbart haben, nach Hutchinson Island.
Letzter Haustausch – Hutchinson Island
Am späten Nachmittag kommen wir an. Nach kurzem Suchen finden wir das hübsche Condo im Mariatt Hotel-Komplex. Alles, was wir brauchen, ist vorhanden.
Wir sind zwar müde, aber gehen trotzdem noch einkaufen. Das dauert mehr als eine Stunde. Alles hier ist nun billiger als in Hawaii und mich dünkt, wir haben uns für mindestens einen Monat eingedeckt mit Waren…
Am nächsten Tag regnet es nach wie vor in Strömen. „Büro machen“, emailen und dann schau ich mal, was es so für Malls und Kinos gibt in der Gegend. In Jesper hat’s grad beides, und das ist nicht weit. Also verbringen wir den Nachmittag in der Mall, dann gehen wir ins Kino und sehen uns den Film „Secret in your Eyes“ an mit Nicole Kidman und Julia Robert, Remake des argentinischen Thrillers „El secreto de sus ojos“, der mich damals so sehr beeindruckt hat. Das Original hat mir allerdings noch besser gefallen, trotz der dramatischen und tragischen Geschichte war nämlich auch noch ein wenig Humor drin eingepackt.
Auf CNN läuft immer und immer wieder, was in Paris passiert ist vor drei Wochen. Wie eine Endlosschlaufe… Haben sie nichts anderes zu senden? – Mir scheint, sie warten aufs nächste „school-shooting“, das ist ja auf jeden Fall schon vorprogrammiert und wird gleich „um die Ecke“ stattfinden.
Sonntag, 6. Dezember: Nichts von Grittibänze und Samichlöisen weit und breit. - Leider. - Aber wenigstens ist das Wetter besser. Theo will daheim bleiben und das „Danke-Mail“ zu seinem Geburtstag fertig kreieren. Ich glaube, damit hat er die seiner Ansicht nach perfekte Ausrede gefunden, um ungestört Siesta ad Infinitum machen zu können. - Zimmerpflanze! – Ich bleib sicher nicht daheim. Vorher telefonieren wir noch mit Kay und Familie. Kay fragt Ella, ob sie auch mit uns reden möchte; sie sagt, sie müsse noch überlegen…
Ich nehme dann das Auto und fahre an den Strand. Das Meer ist wild, der Strand ellenlang, besser gesagt kilometerlang. Beim Refuge House (das einzige noch vorhandene in Florida; dort hat man früher Schiffsbrüchigen Unterkunft gewährt) lege ich mich in den Sand und lese ein gutes Stündchen. Die Wolken kommen wieder und ich will gehen. Da wird’s wieder schöner. Auf der andern Seite der Strasse (die Insel ist ja eigentlich ein Damm), setze ich mich nochmals hin aufs Gras, lese und schaue den Fischen zu, die aus dem stillen Indian River hoch aus dem Wasser springen – fast wie die Delphine am letzten Montag.
Zu Hause ist Theo dann doch nicht; er hat sich tatsächlich ins Swimmingpool begeben.
Am 7. Dezember machen wir einen Zweitagesausflug nach Orlando. Da wir nicht den Florida Turnpike nehmen (Toll-Road), dauert die Fahrt fast drei Stunden.
Unser Hotel ist perfekt gelegen. Der Zufall will es, dass der Universal Studio Theme Park in nächster Nähe ist. „Across the street“, wie es hier heisst. Es dauerte dann doch fast eine halbe Stunde zu Fuss, bis wir bei den Kassen sind. 315$ kostet das Vergnügen für uns beide für beide Parks. Die Unterkunft habe ich über „hotwire.com“ gebucht, eine Webseite, die nicht genau preisgibt, wo das Hotel ist, nur in welcher Gegend ungefähr und man kann gewisse Vorgaben wählen (wie viele Sterne, Pool oder nicht, am Strand gelegen etc). Dafür gibt es geniale Preise. Wir sind jedenfalls sehr zufrieden damit. Es entspricht zwar nicht dem modernsten Standard, aber wir haben alles, was wir brauchen: Ein grosses Bett, kleine Küche sogar, Wohnzimmer und Bad, und das alles für 105$ für zwei Nächte.
Auch eine feines japanisches Restaurant ist gleich um die Ecke: „Kobé“. Dort gib’t die weltbesten Nudeln und wunderfeine Sushis. Dazu eine Flasche Malbec, was wollen wir mehr!
Wir stehen früh auf am nächsten Morgen. Nach dem „Grab and Go-Frühstück“ marschieren wir um halb neun los.
Alles, was mit Harry Potter zu tun hat, ist schlicht unsagbare Spitze. Sogar die Mauer, durch welche die Passagiere am Bahnhof durchgehen, ist vorhanden. Die Reise im Zug nach Hogwarts, die der Besucher dann miterlebt, ist unglaublich gut gemacht und aufs Beste inszeniert, genauso wie auch Diagon Alley. Wie es gelungen ist, all die vielen Zaubereien in „Realität“ umzusetzen, geht über mein Fassungsvermögen. Wir haben enorm Spass und finden schliesslich nicht einmal den Eintrittspreis mehr exorbitant. Schön ist auch, dass es nicht allzu viele Besucher hat - es ist halt kurz vor Weihnachten - wir müssen kaum irgendwo Schlange stehen.
Am Ende des Tages sind wir pflotschnass (Popeye), es geht nichts ohne Wasser auf den Bahnen. Die aufregendsten Attraktionen sind die 3-D-Attractions, auf einer ist mir fast schlecht geworden.
Ein super Tag war das. Nachtessen wieder im „Kobé“.
Cape Canaveral
Mittwoch, 9. Dezember. - Zu Hause: Bundesratswahlen. Guy Parmelin wird gewählt. – Endlich ein Ende dieses Vor-Wahlen-Theaters!
Wir fahren Richtung Osten und sind kurz vor Mittag im Kennedy Space Center. Letztes Mal war ich vor 39 Jahren dort. Da hat sich viel geändert unterdessen. Ich hätte den Komplex nicht wiedererkannt. Nur die grosse Halle noch. Eine Busfahrt führt die Besucher durchs Gelände und man wird mit unzähligen Informationen eingedeckt, auch I-MAX-Filme gibt’s zu sehen. Einen weiteren sehr interessanten Tag haben wir verbracht.
Letzte Tage vor der Heimreise
Nach einem Regentag (zum Glück nicht die beiden vorher) können wir wieder ein paar Stunden am Strand verbringen und besuchen anschliessend das kleine hübsche Städtchen Stuart. Am besten gefällt uns der River-Walk. Wir essen in einem netten Restaurant, wo wir wie überall sehr freundlich und aufmerksam bedient werden.
Auch der folgende Tag bringt schönes Wetter, aber auch einen starken Wind.
Wir fahren vor dem Mittag Richtung Süden. In Jupiter finden wir einen schönen Strand, wo wir ein paar Stunden verweilen. Mit Schwimmen ist allerdings nicht; das Meer ist zu stürmisch. Es hat zwar einen „Lifeguard on Duty“, aber niemand ist im Wasser. - Theo kann seinen Strand-Stuhl nicht zuklappen; statt zu helfen, muss ich lachen. Ich kann’s auch nicht. Zum Glück hat das Teil im Auto auch so Platz. Zu Hause gelingt uns dann das Unterfangen des Zusammenklappens gemeinsam.
Wir haben in Stuart fürs Abendessen im Riverwalk-Café einen Tisch reserviert. Es hat überall viele Leute, eine tolle Stimmung herrscht, offenbar sind die Boote auf Weihnachte getrimmt worden.
Der 15. Dezember ist unser letzter Strandtag. Es ist schön und warm und die Wellen sind grad so, dass ich es wage, schwimmen zu gehen.
Am Abend gehen wir essen in einem gemütlichen Restaurant direkt am Wasser, die Schiffe vor der Nase, Livemusik, feiner Fisch, der krönende Abschluss, bevor‘s zurück geht in den Kühlschrank in der Schweiz.
30 Grad warm ist es an unserem Abreisetag, dem Mittwoch, 16. Dezember 2015.
Wir besuchen Liza und Urs in ihrem neuen Heim, erhalten einen köstlichen Lunch und machen uns gegen Abend auf in Richtung Flughafen. Die Autoabgabe ist kein Problem, auch nicht das Einchecken und Koffer abgeben. Wie froh bin ich jeweils, wenn das alles erledigt ist! Eine Stunde nur hat’s gedauert. Der Flug hat ein wenig Verspätung, kurz nach acht Uhr abends ist es dann aber so weit und früh am nächsten Morgen landen wir in Zürich. – Schönes Wetter, 6 Grad, alles ok. Wir nehmen den Zug nach Bern, Gino holt uns am Bahnhof ab, unsere Reise ist Geschichte.
Reisebericht Südafrika 11. Oktober – 16. Dezember
Der Dienstag, unser erster Reisetag, war reich befrachtet. Unsere beiden zuckersüssen (diesen Ausdruck hätte meine Mutter gebraucht) Grosskinder, Ella und Amy, wurden gegen Mittag von ihren Eltern, Kay und Raphael, abgeholt, nachdem sie eine Woche lang bei uns in den Ferien gewesen waren. So eine schöne Woche war das mit den Girls und daher auch ein wenig traurig, sie wieder „abgeben“ zu müssen. Aber schliesslich mussten wir ja langsam ans Packen denken, unser Flug ging um Viertel vor elf Uhr abends, der Zug um sieben. Natürlich hatten wir vorher schon ein bisschen was zusammengetragen, was mit sollte, aber Packen mit Amy im Schlepptau ist nicht ganz einfach. Sie will alles ganz genau anschauen, und Auspacken macht ihr besonderen Spass.
Gino brachte uns zum Bähnli und los ging’s.
Mit den Kindern hatte sich Theo ein neues Spiel ausgedacht, an dem alle drei grosse Freude hatten: „Frag Siri“. Immer wieder hörte ich ihn sein i-Phone befragen: „Siri, wie alt ist Ella?“ oder „Wann hat Amy Geburtstag?“ und Siri gab jeweils schlagfertig die richtige Antwort. Da konnten die Kleinen gigele und wollten’s immer wieder hören.
Als wir nun am Bahnhof Bern noch ein wenig Zeit hatten und beim Treffpunkt standen, nahm Theo sein Smartphone hervor und fragte doch tatsächlich: „Siri, wo bin ich?“ … Kann ja nicht wahr sein, dachte ich, sagte es wohl auch. Das fängt ja gut an…
Diesmal hatte Theo seine Halbtax-Karte dabei, nicht zu Hause zurückgelassen und auch nicht im Koffer zuunterst verstaut. Wegen meiner grossen Erfahrung diesbezüglich hatte ich darauf geachtet, dass wir diese Anfangsklippe umschiffen konnten. So ging alles gut bis zur Security am Flughafen, wo Theo es fertigbrachte, eine Angestellte mindestens 20 Minuten für sich alleine in Anspruch zu nehmen. Alle seine vier Gepäckschalen wurden beanstandet. Da waren unerklärliche Metallteile im Handgepäck, deren Terrorunverdächtigkeit erst festgestellt werden musste, Flüssigkeiten fanden sich in jeder Tasche und Jacke, die durch die Scanner-Maschine geschleust wurden; es war ein einziges langes Warten. Er habe halt am Schluss alles noch in den Handgepäck-Koffer geworfen, entschuldigte er sich. – Ja, so geht’s halt, wenn man zum ersten Mal mit einem Flugzeug unterwegs ist…
Der Flug war dann, wie lange Flüge eben so sind, viel zu lang. Bevor ich nach dem Nachtessen, das um Mitternacht serviert wurde, etwas zu schlafen versuchte, dachte ich, es wäre gut, noch einen Film zu schauen. Aus dem riesigen Angebot an Movies wählte ich schliesslich den „Schellen-Ursli“, den ich zu Hause verpasst hatte - sozusagen als Einstimmung auf Südafrika.
12. Oktober
Pünktlich um Viertel nach neun Uhr landeten wir in Johannesburg. Eine gute Stunde später standen wir mit all unserem Gepäck am Ausgang und sahen uns für eine Fahrgelegenheit um. – Ein Schwarzer mit offizieller Weste und Namenspatch sprach uns an und bot seine Dienste an: Door-to-door-Transport in seinem eigenen Fahrzeug, eben ohne den nervig tickenden Zählkasten. Er verlangte 550 Rand (ca. 40 Fr.) für eine dreiviertelstündige Fahrt nach Dainfern, wo wir hinwollten. Ein fairer Deal; wir nahmen an. Seit morgens um halb sechs sei er bereits am Flughafen gestanden und habe auf Fahrgäste gewartet. Wir seien seine ersten; er war glücklich, wir waren glücklich.
Steve erzählte auf der Fahrt von seiner Heimat und seiner Familie und bot uns auch weiterhin seine Dienste an. Wir machten gleich ab mit ihm am nächsten Tag für eine ganztägige Erkundungsfahrt nach Soweto und Johannesburg.
Am Zielort wurden wir begrüsst von Richard, dem Caretaker, der uns alles im Haus zeigte, uns die Schlüssel aushändigte und sich dann in seine angrenzende Wohnung verzog. Eva und Ken, die Home Exchange-Partner, mit denen wir den Tausch Bivio-Johannesburg vereinbart haben, sind beide im Ausland, das Haus „gehört“ uns also ganz allein.
Wir richteten uns ein und am Abend freuten wir uns auf unser erstes Abendessen in Afrika. Im Tripadvisor sah ich mal nach, was für Restaurants es in der Nähe gibt.
Da stand zum Beispiel:
„Gut ist schön, der Service ist gut Restaurant etwas einfach hungrig Portionen sind nicht für Personen. Wir kommen wieder.“
Was mach ich mit dieser Beurteilung? Am ehesten mal lachen. Aber noch komischer war die Frage von Tripadvisor unter diesen Zeilen: „Wie hilfreich fanden Sie diese Übersetzung?“
Wir fuhren dann einfach mal los, kauften unterwegs noch was zum Frühstück ein und fanden in der Nähe einen Square mit ein paar hübschen Restaurants, „Jonny‘s“ wählten wir, hatten auf der Terrasse ein feines Znacht mit Riesenportionen (zum Glück teilten wir uns in den Salat. Er hätte problemlos für vier Personen gereicht) und zahlten am Schluss mit Dessert und Wein nur grad 40 Franken.
Die erste Nacht nach einem langen Flug in einem grossen, schönen Bett zu verbringen, ist immer ein Highlight. Wir schliefen selig bis in den Donnerstag hinein, wo uns Steve pünktlich um zehn Uhr abholte.
Während der Nacht war’s kühl, aber gegen Mittag bereits wieder gegen dreissig Grad warm.
Dritter Reisetag: 13. Oktober
Den Ausflug beginnen wir mit einem Besuch im geschichtsträchtigen Soweto, wo im Hector Pieterson-Museum auf eindrückliche Art und Weise die Vorkommnisse des 16. Juni 1976 beschrieben und mit unzähligen Fotos belegt werden. Das Foto, das den 13-jährigen Jungen zeigt, der von der Polizei erschossen wurde, von einem Passanten getragen und von der entsetzten Schwester begleitet, ging damals um die ganze Welt und war wohl einer der Steine, der das Rad ins Rollen brachte, die Apartheit schliesslich abzuschaffen. - Touristen hat’s wenige, dafür umso mehr Schulklassen, die das Museum besuchen. Ein tolles Pflaster für Selfies…
Steve fährt uns auch am Haus der Minnie Mandela vorbei, und anschliessend besichtigen wir das Mandela-Haus, sicher ein Muss für jeden Township-Besucher.
Nach einem kurzen Lunch geht die Fahrt weiter entlang einer riesigen Shanty-Siedlung (es ist unmöglich sich vorzustellen, wie so viele Menschen so dicht gedrängt in solch armseligen Hütten hausen können) zur bekannten Kirche Regina Mundi und weiter nach Johannesburg Downtown. Auf dem Carlton Hotel hat’s im fünfzigsten Stock eine Aussichtsplattform. Da muss ich unbedingt hinauf, eine Stadt oder eine Gegend aus der Vogelperspektive zu sehen, ist für mich immer ein Highlight.
Letzter Fixpunkt des Tages: Old Fort. Dort wurde Mandela (man kommt nicht an ihm vorbei, alles dreht sich um ihn) während 27 Jahren gefangen gehalten. Die Führung verpassen wir grad um 10 Minuten, was mich sehr reut, aber den Ort zu besuchen, lohnt sich trotzdem. Da ist noch das ältere Gefängnis, in dem er ebenfalls einsass und auf den Erdwällen, die das Fort umrunden, kann man gut spazieren, hat einen schönen Ausblick und kann sich die ehemaligen Wärterhäuschen, die ganz schief in der Gegend stehen, ansehen.
Auf der Heimfahrt schlägt Steve vor, auch am nächsten Tag einen Ausflug zu machen. Da gäbe es einen riesigen afrikanischen Markt in Rosebank, den zu sehen es sich lohne. Zudem könnten wir nochmals zum Old Fort, um die Führung im Gefängnis doch noch zu erleben. - Ich liebe Märkte, also gefällt mir der Vorschlag ganz gut und wir sagen zu.
Wir essen zu Hause.
14. Oktober
Um elf Uhr holt uns Steve ab. Nach zweimaligem Überlegen bin ich dafür, das Programm zu ändern. Wenn ich mir vorstelle, ein paar Stunden über einen Markt zu schlendern und nichts kaufen zu können, wird mir ganz mulmig zumute. Unsere Koffer sind so voll, dass sie keine weiteren Einkäufe vertragen. Die Kleider, die ich mitgenommen habe, werde ich fast alle da lassen, aber nicht schon am zweiten Tag. Und wir werden ja noch etliche Märkte besuchen können, stelle ich mir vor.
Pretoria, die Hauptstadt von Südafrika interessiert mich. Sie wird auch Jacaranda-City genannt wegen der ungefähr 80‘000 Jacaranda-Bäume, die in der ganzen Stadt und der Agglomeration vorhanden sind. Diese Bäume mit ihrem intensiven Violett haben mich schon in Australien fasziniert, aber in der Menge, wie sie sich in Pretoria präsentieren, gibt es sie dort nicht. Man kann sich nicht satt sehen. Die wunderbaren Bäume säumen die unzähligen Alleen und auch die Strassen sind violett von all den Blüten, die bereits zu Boden gefallen sind. Und es ist genau der richtige Zeitpunkt dafür; sie blühen nur im Frühling, nur einen Monat lang, irgendwann zwischen Oktober und November.
Also fahren wir nach Pretoria. Erst Besichtigung des Voortrekker-Momuments, das sich auf einem Hügel ausserhalb der Stadt erhebt, dem Monument Hill. Es ist ein kolossaler, 40 Meter hoher Bau ohne Fenster, der ein Museum beherbergt (27 Marmorfresken, die den Grosser Treck der Buren nach Norden darstellen und den Sieg über die Zulu bei der Schlacht am Blood River 1838). Von der Aussichtsplattform hat man einen herrlichen Blick über die Ebene und die darin eingebettete Stadt.
Anschliessend fahren wir durch die Jacaranda-Alleen. Einfach überwältigend! Wir besuchen das Melrose House, ein elegantes, viktorianisches Stadthaus mit einem schönen Park und einem grob vernachlässigten Tennisplatz. Das Haus war während des Krieges 1899 – 1902 (Buren gegen Briten) britisches Hauptquartier. Drei Angestellte hat’s dort an der Rezeption; für Pensionierte kostet der Eintritt achtzig Rappen (das Doppelte für Verdiener). Wir sind die einzigen Besucher.
Steve fährt uns an den Church Square, dort, wo sich die erste Siedlung entwickelte. In unserem Führer heisst es, man könne dort in historischen Café Riche einen ausgesprochen angenehmen Halt machen. Machen wir doch.
Zweitletzter Programmpunkt vor der Rückreise ist das Pretoria Art Museum. Nicht alle Säle sind zugänglich, deshalb kostet auch hier der Eintritt nur achtzig Rappen. Das vermögen wir gerade noch. Der Saal mit der afrikanischen Kunst ist offen und genau das ist es ja, was ich sehen will. Erstaunlich ist: Wir sind auch hier wieder die einzigen Besucher.
Zu allerletzt fährt uns Steve zu den eindrucksvollen Unionbuildings. Man kann sie nur von aussen betrachten, aber man kann in den gepflegten Gärten mit Aussicht auf die Stadt verweilen und sich die riesige Mandela-Statue anschauen. Es ist dies der Ort, wo er als Präsident seine erste Rede hielt. 1994.
15. Oktober
Diesen Teil des Reiseberichts möchte ich lieber nicht schreiben. Aber manchmal kommt es halt anders als geplant.
Wir wurden von Rudolf abgeholt in seinem Safari-Jeep und machten einen Ausflug zur Wiege der Menschheit. (Immer, wenn ich Rudolf höre, denke ich an Weihnachten und an Rudolph, the red-nosed raindeer und muss lachen.) In Sterkfontein wurden Fossilien und Knochen gefunden von den ersten Menschen, z. B. Little Foot und Mrs. Ples, ihr Schädel soll 2-3 Millionen Jahre alt sein. Man wandert und kriecht durch eine Höhle (60 Meter tief, an der tiefsten Stelle), lässt sich die verschiedenen Fundstellen zeigen. Ein paar Kilometer weiter weg in Maropeng besichtigt man das Museum, wo auf eindrückliche Art die Geschichte der Menschheit dargestellt wird.
Lunch dann in einem ganz speziellen Garten-Restaurant, oben im ersten Stock auf Augenhöhe mit einer Giraffe. Ringsum ein Park für Tiere, die aus irgendeinem Grund aus dem Zoo oder Park entlassen wurden.
Wir gehen am späten Nachmittag kurz einkaufen und essen am Abend eine Kleinigkeit zu Hause. Anschliessend sehen wir uns einen Film an. Gerade, wie ich ins Bett gehen will, beginnt Theo über ein Engegefühl im Brustraum zu klagen. Dasselbe war schon am Freitagabend passiert, besserte sich aber dann rasch wieder. Nun ist’s wieder das Gleiche und wir beschliessen, ins Spital zu fahren zwecks Kontrolle. Zum Glück finden wir, dank GPS, das nächstgelegene Spital, Life Fourways Hospital fast auf Anhieb. Um halb zwölf sind wir da. Alles ist dunkel, aber wenigstens ist die Rezeption besetzt. Bis alles geregelt, unterschreiben und alle Papiere ausgefüllt sind, dauert es eine gute halbe Stunde. Schwierig wurde es mit der Anzahlung. Meine Kreditkarte fiel in Angst und Schrecken, als sie den Betrag sah und verweigerte ihre Unterstützung, was dem administrativen Angestellten an der Rezeption Stirnrunzeln und Ungemach verursachte. So ohne diese Kohle könne er keine Patienten aufnehmen, versicherte er mir. Einen zweiten Versuch startete ich anschliessend mit Theos Kreditkarte. Die wunderte sich nicht und liess die 8'000 Franken zu, was den Angestellten dazu veranlasste, einen Seufzer der Erleichterung auszustossen und zu sagen: „God bless!“. Mich dünkte, er hätte eher sagen sollen: „UBS und Kreditlimite bless“. Von da an begannen die Mühlen zu mahlen: Blutdruckmessung, Blutentnahme, Röntgen und sogleich war dem Arzt klar, Theo geht nicht mehr heim heute. Ein Wert (Cardiac Marker / Tropinin T), der normalerweise zwischen 0 und 14 liegt, zeigte bei ihm 159!
Also Intensivstation. Um zwei Uhr morgens war der Kardiologe, Dr. A. Dalby an Ort und Stelle und erklärte uns, er werde am nächsten Morgen einen Eingriff machen, um eventuell einen Stent zu fixieren. Theo wurde still gelegt, fünf schwarze Schwestern standen um ihn und um sein Bett herum, schlossen ihn an Schläuche an, stellten nochmals dieselben Fragen, die wir schon zuvor beantwortet hatten. Sie nahmen ihm alles ab, was er bei sich hatte, Schuhe, Kleider, Uhr, Ehering, sämtliche e-Books und Natels, sein ganzes mit allerlei Karsumpel bestücktes Gilet. Endlich war alles erledigt und ich war bereit zu gehen, nachdem ich wieder an x Orten unterschrieben hatte. - Das Einzige, was er hätte bei sich behalten können, waren Zahnbürste und Zahnpasta. Wir hatten ein Notfall-Übernachtungs-Köfferli mitgenommen, mit Unmengen an Elektronik drin, Zeitung, E-Book, E-Zigarette, Pillen à gogo, Pyjama, etc. etc. Aber was drin fehlte, waren Zahnbürstli und Zahnpasta.
Es war drei Uhr morgens. Das Auto wollte ich mitten in der Nacht nicht nehmen, also bestellte ich ein Taxi. Da aber fragte mich eine Nacht-Schwester, ob ich nicht lieber im Spital übernachten wolle und bot mir ein Zimmer an. Ich fragte mich, ob diese Übernachtung dann auf der Rechnung erscheinen würde. Ich hatte eher das Gefühl, sie hatte Mitleid mit mir. Ihr Angebot nahm ich jedenfalls dankend an und kam somit zu etwa drei Stunden Schlaf.
Am Morgen um halb neun war der Ops parat für Theo. Eine Stunde später etwa erklärte mir Dr. Dalby, dass es schlimmer sei als angenommen mit Theos Herz und eine Bypass-Operation gemacht werden müsse. Das allerdings erst am Mittwoch wegen der vielen Medikamente, die er hatte schlucken müssen. Dr. G. Dragne (ausgesprochen: Drachne) werde die viereinhalb-stündige Operation vornehmen. Eine Verschiebung zurück in die Schweiz komme nicht in Frage.
In der Intensivstation sind die Besuchszeiten streng geregelt, so ging ich um halb zwölf nach Hause und besuchte den Patienten von drei bis vier wieder.
Erste Handlung auf der Fahrt nach Hause: Halt im Einkaufszentrum. Dort kaufte ich mir bei Vodacom ein Handy, damit ich hier im Kontakt sein kann mit der ICU (Intensive Care Unit) und unseren Exchange-Partnern, in deren Haus wir wohnen. Eva und Ken sind äusserst grosszügig und gastfreundlich und lassen mich, so lange ich will, in ihrem Haus bleiben. Auch ihr Auto darf ich brauchen. Sie kommen übers Wochenende heim, aber das Haus ist gross genug für mehr als eine Familie. Ich bin froh, muss ich nicht in ein Hotel wechseln, wo ich viel weniger Platz hätte für die kommende Zeit. Auch wohnt ja Richard gleich nebenan, der Haushalt und Garten besorgt und mir hilft, wenn ich etwas brauche (z. B. mein neues Natel in Betrieb nehmen). So langsam aber sicher werden mir die vielen elektronischen Helfer fast zu viel. Dazu kommt die Aufladerei jeden Tag und der ewige Kampf mit den tausenden von Kabeln, die Theo dabei hat, um die ich mich normalerweise nicht kümmern muss. Nun habe ich nebst dem kleinen Gerät, mit dem ich die Garage öffnen und schliessen kann, vier Handys in meiner Tasche: mein Schweizerisches, das neue Vodacom, Theos i-Phone und noch dasjenige, das ich brauche, um aus dem Ghetto hier hinaus und wieder hereinzukommen. Ghetto ist schon nicht das richtige Wort. Trotzdem kommt es uns fast vor, als wären wir irgendwie eingesperrt. Die Siedlung, in der wir wohnen, ist völlig abgesichert. Niemand kommt rein, ohne sich auszuweisen. Auch Kofferraumkontrollen werden gemacht und ohne Bestätigung der Gastgeber geht gar nichts. Vom Gate aus wird am Checkpoint angerufen, ob jemand erwartet werde und wenn ja, wer. Deshalb darf ich nie vergessen, dieses Ding bei mir zu tragen, man lässt mich sonst nicht rein. Ich antworte dann jeweils selber, wenn bei unserer Adresse (1157 Aspen Drive) angerufen wird. Erst dann geht die Barriere hoch und die gelben Zacken, die im Boden eingemacht sind, um bei Flucht die Pneus zu zerfetzen, werden eingerollt. - Natürlich merkt man nicht, dass das ganze Gebiet abgeschlossen ist, wenn man drin ist. Man sieht keine Mauern, nur Golfplätze, Villen und Vorgärten. Es ist ein riesiges Dorf ohne Zentrum, ich nenne es weisse Township. Shopping Mall und Restaurants sind ausserhalb des Gates. Nur der Country Club befindet sich innerhalb.
Gerade eben, als ich dem Security-Menschen schon meinen Fahrausweis zeigen wollte, sagte er freundlich zu mir: „I know you, you don’t need to talk to me“ und öffnete mir die Barriere. Schon ein Fortschritt also.
Das Herumkurven mit Evas Mercedes geht ganz gut, es macht mir nichts aus, auf der „falschen“ Seite fahren zu müssen. Es braucht lediglich grosse Konzentration, die mir beim Einsteigen zwar die ersten paarmal gefehlt hat. Ich muss dann über mich selber lachen, wenn ich die Tür öffne, die Tasche auf den Beifahrersitz knalle, mich setzte und dann merke, dass da gar kein Steuerrad ist.
16. Oktober
Heute hätte unsere Safari beginnen sollen. Der Tag gestaltete sich aber anders. Am Morgen hatte ich ein einstündiges Gespräch mit der Versicherung, und später ein fast so langes mit dem TCS, wo wir mit dem Eti-Schutzbrief versichert sind. Es ist eine grosse Entlastung zu wissen, dass zumindest das Finanzielle gesichert ist und dass von beiden Seiten gut gesorgt wird. Die Sorgen um Theo, um seine Gesundheit und die bevorstehende Operation sind so schon gross genug. Viel zu tun zu haben, lenkt aber ab.
Zweimal fuhr ich heute ins Spital. Beim ersten Mal wär das fast schief gegangen. Ich war dabei, das Auto aus der Garage zu manövrieren, als ich im Rückspiegel sah, dass hinter mir mindestens zehn Arbeiter aufgeregt mit den Händen fuchtelten. Sie hatten einen langen Graben ausgehoben, in den hinein sie Telefonkabel verlegen wollten. Alles war abgesperrt und es war fast schon elf, ich hätte bereits im Spital sein sollen. Der Vorarbeiter entschuldigte sich hundertmal und wies seine Untergebenen an, den Graben wieder zuzuschütten, die Steine wegzutragen und die Absperrung wegzunehmen, damit ich wegfahren konnte. Wie auf einer Galeere kam’s mir vor: Mindestens zwanzig schwarze Hände schaufelten in grosser Geschwindigkeit die Erdhaufen wieder zurück in die Grube und bald schon konnte ich losfahren. Erst war ich fast ein wenig verzweifelt und auch ärgerlich, als ich die Bescherung sah, dann kamen mir aber die Witze in den Sinn, die ich mal meinen Schülern gezeigt hatte mit dem Titel: „Nur in Afrika…“. Genau so. Nur in Afrika… (Leider finde ich die nun gerade nicht auf meinem Laptop, aber irgendwann werde ich sie vielleicht nachliefern.) Lochen die doch den Boden vor der Garage auf, ohne dies vorher anzukündigen. - Es war ur-komisch.
Als ich wieder heimkam vom Spital, sassen und lagen einige der Arbeiter im Vorgarten im Schatten der Palmen. Ich holte ihnen aus dem Kühlschrank ein paar Fläschchen Mineralwasser, die sie gerne annahmen. Es war über dreissig Grad am Mittag.
Theo geht es so weit gar nicht allzu schlecht bisher; er kann mal lange liegen, was er ja so gerne tut (sein „Indian walking“: Wär nid louft, ligt). Und er ist zuversichtlich, dass alles gut kommt. Ich natürlich auch. Das ist wichtig.
Gerne schaut er zu, was da so alles läuft in der Intensivstation. Ungefähr 30 Betten hat’s und fast alle sind besetzt. Dementsprechend hat’s eine ganze Menge Angestellte. Es ist ein Kommen und Gehen. Auch in der Nacht, sagt er. Sie sprechen miteinander und lassen Dinge fallen, es ist immer etwas los. Nicht alle nehmen’s gleich streng wie seine gestrige Tagesschwester Gladys. Wohl ein wenig anders als bei uns geht’s schon zu und her, denke ich mir. Ich habe bemerkt, dass man sich nicht allzu streng an die Besuchszeiten hält und auch die Vorschrift: „Nur zwei Besucher pro Patient“ wird kaum beachtet (von mir schon). Der Typ neben Theo hatte heute sieben Besucher um sein Bett herum stehen. Dazu schaute er Fernsehen.
Der Bildschirm ist so eine Sache für sich. Er ist klein und befindet sich weit oberhalb des Bettes. Das Flimmern alleine könnte einen krank machen. Und die Programme, die angeboten werden, na ja – erst recht. Auf etlichen Kanälen laufen Trickfilme. Tom und Jerry, meine Lieblingsfiguren als ich ein Kind war, kann man sich dort beispielsweise anschauen. Ein Kochprogramm hat’s auch. Tolle Sache für Theo. Vielleicht zeigen sie, dass man noch anders kochen kann als nur, indem man Büchsen öffnet.
Ein Programm mit Nachrichten – oh Wunder. - In Bantu oder Zulu oder was auch immer.
Leider gibt’s kein CNN. Da wird Theo sehr darunter leiden. In letzter Zeit war dies sein Lieblingssender und er konnte kaum genug bekommen von seinem Freund Trump und dessen dreisten Entgleisungen. Ich fürchte, dies könnte demnächst zu Entzugserscheinungen führen. Zusätzlich.
Ich freue mich sehr über all die Whatsapps, die ich von unserer Familie bekomme (nur sie wissen bisher, was passiert ist), die Verbundenheit und ihr Mitfühlen tun mir gut. Obwohl wir etliche tausend Kilometer voneinander entfernt sind, empfinde ich eine grosse Nähe. Nicht nur Trost, Zureden und Unterstützungsangebote helfen mir. Gerade auch Banalitäten, die wir die ganze Zeit austauschen, „do the trick“.
Wann genau die Operation stattfindet, weiss ich noch immer nicht, ich hoffe, morgen mehr zu erfahren. Und wie’s weitergeht, steht ebenfalls noch in den Sternen. Es könnte gut sein, dass wir wieder mal einen November in der Schweiz verbringen werden.
Dienstag, 18. Oktober
Bei unserer Visite am Morgen hatten wir die Gelegenheit, mit dem Ärzteteam zu sprechen und jeder hat uns genau erklärt, was er machen wird, wie was funktioniert und was die Risiken dabei sind. Eugene, der Kardio-Techniker zeichnete auf, was er mit seinen Maschinen zu tun gedenkt (wenn das Herz für ungefähr 40 Minuten nicht mehr schlägt, sorgt er dafür, dass da trotzdem noch was läuft) und George, der Chirurg, hat so bluming oder vielleicht blutig berichtet, dass mir beim Zuhören mulmig und mulmiger wurde. Ich spürte, wie mir langsam das Blut aus dem Kopf rieselte und konnte mich grad noch rechtzeitig auf das zum Glück freie Bett neben Theo legen, bevor mir ganz schwarz wurde.
Für kurze Zeit war ich dann der Mittelpunkt des Geschehens: Zwei Schwestern massen mir den Blutdruck, den Puls und der Herzchirurg hielt meine Beine in die Höhe, damit das Blut wieder dorthin zurückfloss, wo es hingehört. – Irgendwie fand ich das Ganze zum Schreien komisch. – Filmreife Szene! - Ein paar Minuten später hatte ich mich erholt und war wieder funktionstüchtig.
Kim
Sehr froh war und bin ich, dass Kim hier bei uns ist. Sie war bei all den Gesprächen dabei, hat Fragen gestellt und wirkt sehr positiv auf Theo. Und ich bin nicht allein. Es hätte mir nichts ausgemacht, „I’m a big girl“, liess alle wissen, ich brauche keine Unterstützung an Ort und Stelle, aber jetzt, wo sie da ist, bin ich total froh.
Als ich die Kinder anrief am Sonntag, waren alle natürlich entsetzt und konnten kaum glauben, was ich ihnen mitteilen musste. Kim rastete völlig aus, sagte, sie könne so nicht arbeiten, liess alles stehen und liegen und setzte sich in London mehr oder weniger ins nächste Flugzeug.
Ihre Firma, Goldman Sachs hat sie in vorbildlicher Weise aufs Beste unterstützt. Ihre Chefs haben ihr Mails geschickt und gesagt, die Familie sei jetzt wichtig, sie solle die Arbeit vergessen und nach Südafrika fliegen. Nicht einmal den Flug musste sie selber buchen. Sie kam am Dienstagmorgen um acht Uhr in Johannesburg an. Steve, „mein“ Taxifahrer, holte sie ab und brachte sie ins Hotel, das zwischen dem Spital und meinem hiesigen Zuhause liegt. Gemeinsam gingen wir dann Theo besuchen, der völlig überrascht und gerührt war, als er sie sah.
Am Nachmittag besuchten wir ihn zum zweiten Mal, aber am Abend war ich so erschöpft, dass ich nicht nochmals ins Spital fahren wollte. Ohnehin fahre ich hier lieber nicht in der Nacht, denn der Verkehr ist teilweise hektisch, die Strassen schlecht beleuchtet, es hat Fussgänge, die in jeder Verkehrslage die Strasse überqueren und Strassenverkäufer, die an jeder Kreuzung stehen und den Fahrern irgendetwas dringend Notwendiges andrehen wollen. Einige Lenker sind absolut rücksichtslos und sowieso wird davon abgeraten, in den Städten des Nachts herumzukurven.
Kim nahm sich dann ein Taxi und besuchte Theo nochmals für eine Stunde bis um neun Uhr. Anschliessend kam sie zu mir und wir tranken zusammen eine Flasche Wein ins Elend hinein. – Essen mochten wir beide nichts.
Mittwoch, 19. Oktober 2016
Um fünf Uhr bin ich wach. Langsam wird es Tag. Ein trüber Tag, es regnet leicht. Entspricht absolut meiner Stimmung. Vielleicht wird es schöner werden gegen Mittag oder zumindest gegen Abend. Es regnet hier nie lang.
Heute ist es so weit. Theo wird am offenen Herzen operiert. Um halb zehn. Viereinhalb bis fünf Stunden soll es dauern (es dauerte sechs). Irgendwie kann ich’s fast nicht fassen. Erst noch sind wir von zu Hause abgefahren, voller Pläne, was da alles auf uns zukommen würde und jetzt…. Ja, wer eine Reise tut…
Trotzdem ist alles sehr real. Um halb neun hole ich Kim in ihrem Hotel ab, es herrscht stockender Verkehr, aber wir sind um neun im Spital. Theo schläft tief; wir lassen ihn. Kim hat ihm aus London ein Gerät mitgebracht, von dem er total begeistert ist: Ohrhörer, die machen, dass man überhaupt nichts von den Umgebungsgeräuschen mehr hört, so kam er auch während der Nacht zu mehr Schlaf als in den Nächten zuvor. (Das Gerät, „noise blocker“ muss etwas ganz Spezielles sein. Kosten: 280£!)
Kim hat mich enorm aufgestellt mit ihrer positiven Art. Sie hat mir immer wieder gesagt: „positiv denken!“ und auch Javi, ihr Partner, mit dem sie ständig am Texten ist, schreibt immer wieder, wie er an uns denkt und wie wir ja nicht weinen sollen, wenn wir in Theos Nähe sind. Das ist nicht ganz einfach, aber wir schaffen das vorbildlich. Wie er schliesslich aufwacht, witzeln wir mit ihm, Kim rät ihm, er solle den Drogen-Flash geniessen und er sei ja dann morgen wieder „fit as a fiddle“.
Die Operationsschwester (eine Zulu-Frau) kommt hinzu und erklärt, was ihre Aufgabe sei und wir sollten nicht erschrecken, wenn wir ihn nach der Operation sehen würden. Er sehe dann aus „like a Christmastree“. Sie hatte damit nicht ganz unrecht, wie wir zu gegebener Zeit feststellen konnten. Er war an x Apparate angeschlossen, Schläuche hingen aus seinem Oberkörper heraus, eine Unzahl von Monitoren, in allen Farben, leuchteten und blinkten um ihn herum.
Dr. Zoran, der Anästhesist, ein sehr sympathischer Typ, kommt anschliessend vorbei und auch er erklärt uns genau, was er tun werde, dass alles für das Team „business as usual“ sei, dass wir uns aber bewusst sein sollten, dies sei „major, major operation, not serious but very serious“. Er versichert uns aber auch, dass Theo sehr gute Werte habe, eine gute Kondition und alles sicher bestens über die Bühne gehen werde. Er verabreichte ihm dann ein Dormicum, und diese Schlaftablette wirkte relativ rasch, so dass er bald dizzy wurde und kaum mehr reagierte. Dann lösten die Schwestern die Bremsen an seinem Bett und er wurde in den Operationssaal gefahren. Dies war dann doch der Moment, wo unsere Tränen flossen, aber das sah er ja nicht mehr. Es war halb elf.
Alle Ärzte hatten uns zuvor dringend davon abgeraten, im Spital zu warten, wir sollten unbedingt etwas unternehmen. Das taten wir. Autofahren wollte ich auf keine Fall, so hatte ich vorsorglich schon ein Taxi bestellt. Steve konnte nicht kommen, schickte aber einen Kollegen, der uns den ganzen Tag herumführte beziehungsweise stundenlang auf uns wartete. Das dann bei der Shopping-Mall in Rosebank. Er lachte und sagte, es mache ihm nichts aus, drei Stunden lang zu warten: „When ladies go shopping, they are very slowly”.
Aber vorerst fuhr er uns ins Old Fort, wo wir das Gefängnis besuchten, in dem Mandela lange Jahre verbracht hatte. Ich war mit Theo am letzten Freitag ja bereits einmal dort gewesen, aber damals hatten wir die Tour grad um zehn Minuten verpasst. Nun konnten Kim und ich die Tour buchen und was wir erfuhren und sahen, war äusserst eindrücklich und bedrückend. Es liess uns Theo zwar nicht vergessen, aber wir wurden abgelenkt. Die Zustände in diesem Gefängnis waren grauenhaft, ähnlich wie in den deutschen und polnischen Konzentrationslagern. Unvorstellbar, wie Menschen dieses Grauen hatten überleben können. Eingesperrt waren viele wegen lächerlicher Vergehen (die Schwarzen, weil sie keinen Pass bei sich trugen oder gegen andere Regeln der Apartheit verstiessen, eine Grosszahl von ihnen waren politische Gefangene), und das teilweise jahrelang.
Im Anschluss daran besichtigten wir das Verfassungsgericht, ein Gebäude, das grad neben dem Gefängnis und mit Teilen aus dessen Ziegelsteinen neu erbaut wurde. Auch dieser Bau ist eindrücklich in seiner Architektur; er drückt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aus. Man hat eher das Gefühl, es sei ein Kunstmuseum. Betont werden jetzt die neuen Grundpfeiler der Verfassung. Hinter den Sitzen der Richter sind zum Beispiel Tierfelle aufgehängt, in Schwarz und Weiss. Eine dünne Fensterschicht schlängelt sich um den Saal herum, so dass man auch von aussen in den Gerichtssaal sehen kann, was Transparenz versinnbildlichen soll.
Die Sonne zeigt sich noch immer nicht und ein sehr kühler Wind weht, so dass uns richtig kalt ist. Trotzdem machen wir noch den Spaziergang zu den Wachtürmen und schauen uns das Frauengefängnis an, in dem weisse und schwarze Frauen getrennt inhaftiert waren. Im Gegensatz zu dem, was wir bisher gesehen haben, ist der „weisse Teil“ grad komfortabel.
Nachdem Jerry, unser Taxifahrer, anderthalb Stunden auf uns gewartet hat, fährt er uns nach Roseberg in die Shoppingmall, wo wir erst mal zu Mittag essen und dann eben „slowly“ einen Einkaufsbummel machen. Grad auf Anhieb finde ich ein Kleid, das ich nächstes Jahr zu Kims Hochzeit tragen werde. Es wird von ihr gebilligt und für gut befunden. – Ein Problem weniger!
Um fünf Uhr läutet das Telefon in meiner Hosentasche. Es ist Dr. Zoran, der uns mitteilt, die OP sei vorbei, alles sei gut gegangen, wir könnten Theo besuchen kommen. – Was für eine Erleichterung! Sofort steigen wir ins Taxi und Jerry bring uns durch den dichten Verkehr in vierzig Minuten heil zurück ins Spital.
Die beiden Ärzte sitzen in der Cafeteria und laden uns ein, etwas mit ihnen zu trinken. Sie wirken überhaupt nicht abgekämpft, berichteten uns von der Operation und von ihnen selbst und ihren Familien. Die Operation sei nach Wunsch verlaufen, es sei „einfach“ gewesen, der Rolls Roice einer Bypass-Operation, erklärte George, weil er nicht Theos Beine hatte aufschneiden müssen, um dort Venen zu entnehmen, sondern weil es ihm gelungen sei, die „Mammary-Arteries“ für die beiden Bypasse zu verwenden, die eine sehr viel längere Lebensdauer hätten. - Ui ui ui, was man da nicht alles lernt, wenn der Tag lang ist. – Der morgige Tag mache ihnen wesentlich viel mehr Kopfzerbrechen, meinen die beiden. Da hätten sie es mit einer sehr viel komplizierteren Arbeit zu tun. Was genau, sagten sie nicht; ich vermute, es war eine Herztransplantation. - Beide kommen anschliessend mit uns mit zu Theo, checkten und erklären nochmals Facts zu seinen Werten, machen sogar noch Fotos von Theo, dem tief schlafenden Weihnachtsbaum, und uns zweien. – Die nächsten sechs Stunden seien noch kritisch, aber dann sei alles auf besten Wegen. - Er werde schlafen bis am nächsten Morgen, versicherte man uns. Da könnten wir ihn um neun Uhr besuchen kommen, und er werde ansprechbar sein.
Wir lassen den Patienten in der Obhut zweier Krankenschwestern zurück, die fleissig wie Ameisen alle Monitore überwachen und Schläuche kontrollierten. Während zwei Stunden würden sie nicht von seiner Seite weichen.
Beide sind wir wie ausgelaugt, glücklich aber total müde. Ich fahre Kim ins Hotel und mich heimzu, giesse mir ein Glas Wein ein, lasse Freunde und Familie wissen, wie’s gegangen ist und sinke dann völlig erschöpft ins Bett.
Übrigens hatte das Wetter gegen Abend gebessert und es gab sogar ein wenig Sonne. Seltsam, dieser Tag. Graue Stimmung am Morgen, kalter Wind und nichts als Wolken, Sonnenschein gegen Abend.
Donnerstag, 20. Oktober
Um neun Uhr pünktlich sind wir im Spital. Gespannt natürlich, was uns da erwartet. Theo ist wach, zwar nicht grad fit as a fiddle, aber doch recht gut ansprechbar gemessen an den Verhältnissen. Schmerzen habe er keine und aussehen tut er nicht mal so schlecht. Es ist ihm sogar schon ein wenig zum Scherzen zumute. Wie die Schwester ihn fragt, ob er etwas anderes zum Trinken wolle als Wasser, sagt er: „Jägermeister“ (erwartet hätte ich „Famous Grouse“. - Da muss doch noch etwas nicht ganz in Ordnung sein mit ihm!). – Beide Ärzte kommen auch grad vorbei, der Kardiologe und der Chirurg. Beide versichern uns, der Patient habe die Nacht sehr gut überstanden; sein Zustand sei ausserordentlich, besser als dies im Durchschnitt der Fall sei; man könne mehr als nur zufrieden sein. - Wir sind natürlich MEGA froh über diesen Bericht. Theo sei eben in guter Konstitution (bei dem vielen Sport, den er treibt, ja kein Wunder…). Und sie hätten ihn sehr viel jünger eingeschätzt.
George ist ein eher trockener Typ, aber sogar er erlaubte sich einen Scherz, indem er zu Theo sagte: „You look like you were hit by a train, but you won.“
Ein erster Trend, wie’s weitergeht: Drei Tage Intensivstation (morgen kommen die äusseren beiden Schläuche weg, übermorgen die inneren, die zum Herzen führen), anschliessend eine Woche Spitalaufenthalt. Dann wieder einigermassen mobil. AutoMITfahen ab zwei Wochen (und ich dachte, ich hätte einen Fahrer…) und fliegen erst ab drei Wochen von jetzt an gerechnet.
Erst in sechs Monaten wird der Brustkasten ausgeheilt sein. Das erfordert Geduld, ich hoffe, er hat sie.
Wir werden sehen, machen Pläne erst, wenn’s Sinn macht.
Wir müssen dann gehen, kommen aber wieder zurück zur regulären Besuchszeit um elf.
Theo sitzt bereits im Sofa neben dem Bett, was uns schon sehr erstaunt. Das müsse so sein, damit das Blut abfliessen könne, das noch in seinem Brustkasten sei. Das passt ihm gar nicht; er liegt ja lieber. Er sei sehr müde und wolle schlafen, aber nicht im Sitzen, so macht er seine Absicht klar. - Ein kleiner Schweissausbruch, ein wenig jammern und schon legen ihn drei Schwestern gemeinsam wieder aufs Bett. Er sieht tatsächlich sofort besser aus. Die Verantwortliche aber sagte uns, sie müsse ihn bald wieder auf den Stuhl setzen, sonst erhalte sie vom Arzt einen Rüffel. Wir gehen dann, weil wir ihn schlafen lassen wollen. Drei Stunden später fahren wir wieder hin.
Er sieht den Umständen entsprechend gut aus, gar nicht etwa bleich, aber natürlich ist es noch ein sehr langer Weg bis zur Genesung.
Er hat jetzt auch ein wenig Schmerzen, sie geben ihm Mittel dagegen, aber alles mit Mass, wie George sagt. Ich bin sicher, dass diese Ärzte alles bestens im Griff haben. Dafür bin ich sehr dankbar.
So ist also Theo gerade noch rechtzeitig und erfolgreich dem Sensenmann entgangen. Was hatten wir doch für ein Glück! Wäre das Ganze drei Tage später auf der Safari passiert… Oder vor einem Monat in Spanien… Auch nicht die Erheiterndste aller Vorstellungen.
Aber hier in Südafrika, wo die besten Herzchirurgen der Welt tätig sind und das Team hier mehr als nur überzeugt hat, waren und sind wir in besten Händen. Was uns auch beeindruckt, wie locker der Umgang mit den Ärzten ist, wie nett und freundlich alle sind – wir haben genau den richtigen Ort gewählt, um dieses Drama zu überstehen.
Zwischen Spital und „zu Hause“
„Hallo, Mami, the door is open for you!“, so werde ich nun oft begrüsst von den Angestellten am Gate. Die meisten kennen mich und so hab ich freie Fahrt durchs „Pre-cleared-visitors-door“ und muss nicht mehr in der oft langen Kolonne anstehen und die ganzen Ein- und Ausfahrtskontrollen über mich ergehen lassen. Mama oder Mami (Koseform) werde ich hier oft genannt, etwa gewohnheitsbedürftig zwar, aber doch irgendwie rührend.
Als wir gestern Morgen (21. Oktober) ins Spital kamen, ging’s Theo nicht so gut. Er hatte die ganze Nacht nicht schlafen können, hatte Gespräche zwischen Krankenschwestern mitbekommen, die hinter seinem Rücken Meinungsverschiedenheiten ausgetauscht hatten über die Handhabung irgendwelcher Geräte, hörte später auch, wie ein Arzt zu einer Krankenschwester sagte, er traue ihr nicht, beklagte sich über zwei Schwestern, die die ganze Nacht in seiner Nähe laut zusammen geschwatzt hatten. Auf Berndeutsch sogar, habe er das Gefühl gehabt. All das regte ihn auf, und das ist ja nicht gut für ihn. (Später hat er selber gemerkt, dass diese „Wahrnehmungen“ offenbar zumindest teilweise nicht real, sondern irgendwelche Hirngespinste gewesen sein müssen – zurückzuführen auf seinen Zustand und die Medikamente.)
Jedenfalls erhielt er inzwischen ein paar Schläuche mehr und zwei Blutkonserven, was nicht vorgesehen war. Im Gegenteil, der Chirurg hatte uns nach der Operation gesagt, er habe überhaupt kein Blut gebaucht. Wenn es ohne funktioniere, sei das ein äusserst gutes Zeichen. – Man beruhigte uns aber, es sei trotzdem alles in Ordnung.
Als wir am Nachmittag wiederkamen, ging es ihm bereits erheblich besser.
Aus seinem Brustkasten hängen vier Schläuche (Pipelines kommt den Tatsachen näher, finde ich), die natürlich seine Beweglichkeit stark einschränken. Die sind da, um Blutreste und andere Flüssigkeiten aus dem Herzen und der Lunge zu pumpen. Zwei davon hatten sie ihn nach unserem Besuch weggenommen. Das sei eine grosse Erleichterung gewesen, meinte er.
Ich hab ihm auch sein i-Phone und den i-Pad gebracht, was die Schwester zwar ausdrücklich nicht haben will, er aber schon. – Ich misch‘ mich nicht mehr ein.
Ein paarmal waren wir dabei, als Thabela Ramban kam (so steht’s auf ihrem Namensschild), um die Mahlzeiten-Bestellung aufzunehmen. Bei uns erhält man im Spital einen Zettel, den man studieren, ausfüllen und schliesslich abgeben kann. Das ist hier nicht so. Es gibt nur ein Blatt Papier, und das sieht kläglich aus. „Wie wes ä Chue hät i dr Schnure gha“, wie man im Berndeutsch sagt. Die Hostess, so steht’s auf dem Batch neben Thabelas Namenschild geschrieben, geht von Patient zu Patient, jeder nimmt den Zettel in die Hand (Hilfe-Bakterien!), versucht mühsam die kaum lesbare kleine Schrift zu entziffern und teilt ihr dann seine Wahl mit. Dann geht sie weiter zum nächsten Patienten. Auch mit der Lesebrille gelingt es mir nicht, zu entziffern, was dort steht. Zudem ist der Zettel immer „verchrümelet“ und oben rechts ist ein Teil ausgerissen, was Theo am ersten Tag dazu veranlasste zu fragen, ob es Mäuse habe im Spital. – Kim wollte gestern das Corpus Delicti fotografieren, aber Thabela sagte, sei bringe morgen eine neuen Liste. Wohl wurde ihr zum ersten Mal bewusst, dass die aktuelle nicht gerade photogen ist. – Mal sehen. Bis sie ihren Rundgang gemacht hat, dauert’s.
Wenigsten ein Job mehr. 27 % Arbeitslose hat’s in diesem Land.
Kim regt sich ein wenig auf über den Menuplan. „Ein leichtes Menu für Dad“, da kommt nur ein Schulterzucken. Die Hostess weiss nicht, was „leicht“ in diesem Zusammenhang bedeutet, verspricht aber, sich zu erkundigen. Am Mittag Spaghetti, am Abend Makkaroni, tags darauf Meetballs mit „creamy“ Sauce – na ja… Vegi-Menu- Angebot gibt’s übrigens auch keine. Nicht, dass Theo sich das wünschen würde, „unerstaunlicherweise“ findet er das Essen gar nicht schlecht.
Überraschung
Nach dem Spitalbesuch fahren wie zu einem Geschäft, das Hochzeitskleider anbietet: Pronovias „De La Vida Bridle Couture“, eine spanische Brand, das Geschäft gibt’s auch in London, aber Kim sagt, man müsse sich dort einen Monat vorher anmelden. Vielleicht ist es hier nicht so. Wir erfahren‘s nicht, denn das Geschäft ist geschlossen. Ein neuer Anlauf wird gemacht werden müssen. In der Nähe, wo Kim wohnt, hat es eine Einkaufs- und Restaurant-Meile. Wir nehmen einen Apéro dort (ich ein Coke Zero, weil ich ja noch Auto fahren muss) und essen auch gleich im „Brazen Head“. In jedem Restaurant, in dem wir bisher waren, hat’s mehr oder weniger dieselbe Karte, und das sogar im mehr oder weniger gediegenen Country Club mit Blick auf den Golfcourse in unserem „Ghetto“. Pizza, Wraps und Burger fehlen auf keiner.
Nach dem Essen fahre ich Kim in ihr Hotel zurück und mich nach Dainfern.
Inzwischen ist Ken, unser HomeExchange-Gastgeber, heimgekommen. Zum ersten Mal begegnen wir uns; bisher waren wir nur mit Emails in Verbindung gewesen. Er versichert mir erneut, ich könne im Haus bleiben, so lange ich wolle, später auch wieder mit Theo, und Richard, der Caretaker, sei die ganze Zeit zu unserer Verfügung. Er selber und seine Frau würden am nächsten Mittwoch wieder abreisen, das Haus sei dann so oder so wieder leer. Ursprünglich hatten wir ja abgemacht, das wie vier Tag und Nächte im Haus bleiben und anschliessend auf Safari gehen würden. Nun also wird aus dieser kurzen Zeit ein ganzer Monat. Und mein Angebot, zumindest etwas fürs Auto zu zahlen, das ich täglich brauche, lehnt er kategorisch ab.
Diese Gastfreundschaft ist überwältigend. Wie gesagt, eigentlich kennen wir uns ja nicht einmal.
Wir trinken ein Glas Wein und ich gehe dann schlafen, (Richard hat inzwischen Zimmer und Bad sauber gemacht und das Bett frisch angezogen – wunderbar!) lösche ab, werde aber gleich wieder geweckt vom Surren meines Telefons, das ich hier auch des Nachts nicht ausschalte.
In Whatsapp erscheint ein Bild von Theo im Bett, daneben Diegos Kopf. Ich schreibe zurück: „Photoshop?“ Javi reagiert aus London fast gleichzeitig mit derselben Vermutung.
Nein, real! – Ich kann‘s nicht fassen: Diego ist ebenfalls nach Johannesburg geflogen, Debo bestätigt es. Er fuhr offenbar gleich ins Spital und hat anschliessend ein Zimmer gebucht in derselben Lodge wie Kim. – Was für eine Riesenüberraschung muss das gewesen sein für Theo! Eine Mega-Überraschung natürlich auch für uns. Kim ist fast ausgeflippt, ihren Zwilling bei sich zu haben. Leider bleibt er nur zwei Nächte, aber daraus wollen wir alle vier zusammen das Beste machen. – Ich kann mir gut vorstellen, dass die beiden in diese Nacht nicht zu sehr viel Schlaf gekommen sind.
22. Oktober
Weil er so kurzfristig keinen Direktflug finden konnte, flog Diego hierher mit Stopover in Abu Dhabi. 18 Stunden dauerte das „Vergnügen“. Er sagt, das mache ihm nichts aus, er habe die ganze Woche nicht richtig schlafen können, er wolle Theo sehen und sich vor Ort überzeugen, dass alles gut läuft.
Wir haben natürlich grosse Freude, ein weiteres Familienmitglied hier zu haben, sei’s auch nur für sehr kurze Zeit. Den Rückflug hat Diego am Sonntagabend.
Gemeinsam fahren wir um elf Uhr ins Spital zu Theo. Er habe eine gute Nacht gehabt und schlafen können. Wir sind erleichtert. Er sieht auch besser aus. Obwohl mit dem Blut, das noch immer aus seiner Lunge tropft, etwas nicht ganz in Ordnung ist, ist er nicht einmal sehr besorgt. Ich will mich auch nicht stressen lassen und denke, die Ärzte hier haben’s im Griff. Kim macht sich grosse Sorgen, möchte den Arzt sehen, der allerdings im Wochenende ist. Sie schreibt Emails und bittet um eine Besprechung. Die Schwester beruhigt, der Stellvertreter sei vorher da gewesen, alles sei im grünen Bereich.
Vor der Eingangstür zur Intensivstation sitzt ein Security-Guard. Er hat und macht immer ein finsteres Gesicht, ich grüsse ihn jeweils freundlich, er schaut konstant an mir vorbei und sagt kein Wort. Nun aber kommt er herein und weist uns darauf hin, es seien nur zwei Besucher pro Patient erlaubt. – Jetzt ist es an mir, auszuflippen. Natürlich steht das so geschrieben, nur, niemand hält sich daran. Diego ist nur einen Tag lang hier, er hat einen langen Flug hinter sich, um Theo zu sehen. Bei den anderen Patienten, vor allem den schwarzen, hat’s jeweils ganze Trauben ums Bett herumstehen. Auf nicht mehr sehr höfliche Art lasse ich ihn wissen, was ich von seiner Intervention halte. – Er verzieht sich.
Am Mittag gehen wir drei essen. Auch wenn die Menu-Karten eher fastfoodmässig daherkommen, ist das, was schliesslich serviert wird, in der Regel sehr schmackhaft und gut. Diego hat Hunger und von den grossen Portionen, die wir bestellen, bleibt nichts übrig.
Wir fahren anschliessend heim zu mir, damit ich auch Diego zeigen kann, wie und wo ich wohne, und Ken lernt unsere Zwillinge kennen.
An jeder Kreuzung, an jedem Rotlicht, ich hab’s schon erwähnt, hat’s Bettler und Verkäufer, die einem rasch etwas andrehen wollen, wenn man anhalten muss: Zeitungen, Rosen, Früchte, Getränke, Sonnenbrillen, Kopfhörer und so weiter. Natürlich lehne ich immer ab, jedoch muss ich sagen, dass sie alle freundlich bleiben und nie einer frech wird, wie ich das in anderen Ländern schon erlebt habe. Nein, diese hier lachen oft, grüssen, wenn sie einen wiedererkennen (ich fahre ja immer dieselbe Strecke) und lassen einen Spruch fallen. Diesmal war’s ein Typ mit einer Menge Sonnenhüten. Er war ganz originell drauf und sagte: „This is my outdoor-business and I’m the CEO”. - Der nächste wollte uns Handtaschen andrehen. Diego lehnte sich zum Fenster hinaus und sagte, auf uns deutend: „These are ladies. They don’t need any bags. They have tons of them at home.” – Das zu begreifen hatte der Verkäufer keine Mühe. Er zog ab.
Um zwanzig vor drei ist es wieder Zeit, ins Spital zu fahren. Wieder geht’s Theo ein wenig besser, haben wir den Eindruck. Er ist ganz guter Dinge. Er braucht im Moment auch keinen weiteren Blutbeutel, die beiden Schläuche, die noch immer in seiner Lunge stecken und die heute hätten entfernt werden sollen, ist er aber noch immer nicht los. Vielleicht dann morgen. Theo möchte so oder so lieber noch einen Tag länge in der Intensivstation bleiben. Da wird er halt während 24 Stunden überwacht, in einem Spitalzimmer dann nicht mehr.
Schwierig ist für ihn einfach die Kommunikation mit den Schwestern, die alle kein deutliches, korrektes Englisch sprechen. Mit Raten kommt man oft weiter. Fantasie hilft manchmal auch. „Schüschca too“ wurde von Diego endlich verstanden als „Surgical 2“.
Nachdem die Besuchszeit abgelaufen ist, fahren wir drei zusammen in die nächstgelegene Mall. Diego kauft ein Aufladekabel für Theos iPhone, das ich dummerweise nicht bei mir hatte; Kim und ich erkunden noch ein paar Läden.
Am Abend gehen die beiden nochmals Theo besuchen und holen mich dann um neun Uhr ab. Wir gehen in den Country Club, der sich hier im „Ghetto“ befindet, Nachtessen. Diego hat ja ein Auto gemietet und er bietet an, dass er fährt und Kim und ich uns einer Flasche Wein widmen können. Das nehmen wir gerne an.
Wir essen draussen, es ist recht warm. In der Ferne muss ein kräftiges Gewitter toben, Wetterleuchten und Blitze zeugen davon. Plötzlich kommt auch bei uns ein heftiger Wind auf. Mit Tellern, Gläsern und Besteck verziehen wir uns fluchtartig in die Bar, und es dauert keine Minute, schon setzt ein starker Regen ein. – Glück gehabt! – Eine halbe Stunde später ist es Zeit zu gehen. Wir brauchen keinen Schirm mehr, der Regen hat bereits wieder aufgehört und Diego fährt mich heim.
Sonntag, 23. Oktober
Ich habe zum ersten Mal seit Tagen recht gut geschlafen. Wir treffen uns um elf im Spital. Zu dritt. Der Security-Guard macht keinen Mucks. Der hätte sich sonst wieder „a piece of my mind” anhören müssen.
Dummerweise habe ich mein Telefon heute Morgen nicht gehört. Eva, Kens Frau, ist inzwischen ebenfalls angekommen und wir tranken zusammen eine Tasse Tee im Garten. Kim und Diego versuchten, mich zu kontaktieren, aber eben leider vergeblich. Das Spital hatte sie angerufen, der Chirurg sei vor Ort und würde gerne unsere Fragen beantworten. So war‘s dann halt nur ein Gespräch zu dritt, aber ich wurde von den Zwillingen bis ins kleinste Detail informiert. – Erfreulicherweise gibt’s nur Gutes zu berichten. Alles laufe bestens und Theo könne nach unserem Besuch am Mittag in ein Spitalbett überführt werden. Und genau so ist es dann auch. Er erhält sogar ein Einzelzimmer, ebenerdig mit Blick ins Freie. Zwei Perlhühner wackeln grad vorbei. - Nach einer Woche in der Intensivstation endlich ein wenig Privatsphäre – Judihui! – Und nur noch wenige Schläuche; diejenigen in den Armen und Händen sind endlich weg. Wir sind glücklich! Eine hübsche Physiotherapeutin ist schon zur Stelle – wir gehen, uns braucht’s jetzt nicht mehr.
Über Mittag fahren wir heim, holen Theos Laptop inklusive Maus und Auflade-Kabel, Brille und Uhr und gehen nochmals ins Clubhaus essen. Jetzt sieht‘s anders aus als gestern Abend, wo es kaum Gäste hatte und natürlich dunkel war. Es ist ein schöner Ort. Mit Blick auf den Golfplatz kann man in Ruhe seine Mahlzeit geniessen. Mit knapper Not erhalten wir noch einen Tisch im Garten, denn es hat eine Menge Besucher heute, an diesem herrlichen Tag. Es wird auch Buffet angeboten, ein Schwein am Spiess gebraten, wir essen à la carte. - Die Gäste sind weiss, das Servierpersonal schwarz.
Essen im Spital
Darüber hab ich bereits berichtet, hier kommen aber der zweite und der dritte Streich:
Einer kommt ins Zimmer mit einem Servierboy voller kleiner Säckli mit Chips, Nüssli, Schokoladeperlen und anderen Süssigkeiten. Wie die Tamilen mit dem Büffet-Wägeli in der SBB. Er geht bei allen vorbei, auch bei den Diabetikern??? !!! - Eben wurde gesagt, Zucker, also auch Schokolade und Fett seien Gift und müssten unbedingt vermieden werden…
Zum Mittagessen gibt’s zwei grosse, fette Bratwürste. Ein wenig Kartoffelstock noch dazu…
Also wirklich! - Klar hat er das bei Thabela bestellt (Lunch - Menu Nr. 2), aber nein.
Ob sie da schon mal was gehört haben von Diäten, abgestimmt auf die jeweiligen Patienten? – „Huere ungsundi Ernährig“, sagt Kim.
Die Ärzte sind absolut top. Sie sind hier gar nicht angestellt, arbeiten auf eigene Rechnung, sind Freelancer. Sie sagen selber, der Betrieb hier sei nicht immer ganz über alle Zweifel erhaben, aber das sei eben Afrika. Theo kann ein Liedchen davon singen, wenn seine Stimme dann wieder normal tönt. Bei der Anstellung gebe es viele Bedingungen und Vorgaben, und diese seien nicht unbedingt der Sache (Pflege der Patienten) förderlich. - Ausbildung und Standard sind nicht wie in der Schweiz. So viel ist klar.
Zurück im Spital hat Diego nur noch kurz Zeit, sich von Theo und uns zu verabschieden, dann muss er los, Destination R. O. Tambo-Flughafen, Abu Dhabi, Genf, Ittigen.
Es war eine schöne Zeit mit ihm, wenn auch nur kurz. Wir haben sie genossen und sind ein wenig traurig, dass er geht. Er aber sagt, es sei ok für ihn, seine „Mission“ erfüllt, alles im Lot, er könne beruhigt heimkehren.
Alle diese Tage werden wir wohl nicht so schnell wieder vergessen.
23. Oktober
Am Sonntagabend gibt’s Besuch im Haus in Dainfern. Ein Ehepaar aus Alaska, Kathy und Mike, sind soeben angekommen. Genau wie wir haben sie den Weg hierher durch Home Exchange gefunden und genau wie wir haben sie mit Eva und Ken abgemacht, erst ein paar Tage in Johannesburg zu verbringen und anschliessend mit Ken, der Jurist und Besitzer eines Safari-Reisebüros (www.barefoot-safaris.com/">www.barefoot-safaris.com/) ist, eine zweiwöchige Safari zu unternehmen. Im Unterschied zu uns sind Eva und Ken letzten Sommer bereits für drei Wochen in Alaska gewesen, Bivio haben sie noch zugut. Und im Unterschied zu uns treten sie am Mittwoch diese Safari auch wirklich an.
Die beiden Neuankömmlinge sind todmüde, Eva hat aber gekocht; wir essen alle zusammen. Gesprächsthema ist vor allem Theo. Mike ist Arzt und Kathy hat als Schwester im Spital in der Aufwachstation gearbeitet, so wissen beide bestens Bescheid drüber, was genau passiert ist und weiterhin passieren wird.
Sie nehmen regen Anteil an unserer traurigen Geschichte.
Wir gehen alle früh schlafen.
Diego ist wieder abgereist, inzwischen ist er angekommen nach seinem langen Flug. Alles ist gut gegangen, wir sind froh, vermissen ihn aber bereits.
Montag, 24. Oktober
Die Schwestern haben uns gesagt, dass auch im Spitaltrakt dieselben Regeln gelten wie in der Intensivstation, nämlich Besuchszeiten nur von elf bis halb zwölf, von drei bis vier nachmittags und abends noch von halb acht bis halb neun. Daran haben wir uns gestern gehalten, bis uns der Arzt sagte, das stimme überhaupt nicht, für uns sowieso nicht; wir könnten kommen und gehen, wie es uns beliebe. - Darüber sind wie sehr froh; es ist einfacher. Davon hätte übrigens auch Diego gestern profitieren können, aber wir hielten uns ja an die Regeln.
Heute nun sind wir wieder gegen Mittag im Spital. Theo geht es merklich besser. Was uns Sorgen macht, sind immer noch die beiden Pipelines, die in seinen Oberkörper eingelassen sind und aus denen nach wie vor ständig Flüssigkeiten in zwei Glasbehälter tropfen, die aussehen wie überdimensionierte Konfitüre Gläser (Himbeergelée könnte es sein). Um zu sehen, wie’s aussieht mit dem Zuwachs, knien die Schwestern jeweils auf den Boden, machen einen Strich am Glas und anschliessend eine Notiz im Journal. Einfacher wäre es wohl, die Behälter aufzuheben und auf den Tisch zu stellen, aber vielleicht sehe ich das falsch.
Kim und ich, wir möchten nochmals mit Dr. Dalby, dem Kardiologen, über das weitere Vorgehen sprechen. Er ist in seiner Praxis im Nebentrakt und wir warten dreiviertel Stunden, bis er uns empfängt. Er beruhigt uns bezüglich dieser Drainage, das könne vorkommen, sei eben eine der zuvor als möglich beschriebenen Komplikationen, weiter aber nicht bedenklich, wenn man sie im Auge behalte. Er rechne, Theo könne in wenigen Tagen entlassen werden und zwei Wochen nach der Operation könnten daraufhin die Fäden beziehungsweise Klammern entfernt werden. – Wir bedanken uns und gehen in die Cafeteria, um draussen eine Kleinigkeit zu Mittag zu essen. Da kommt zufälligerweise Dr. Zoran, der Anästhesist, vorbei, sieht uns und setzt sich an unseren Tisch. Er trinkt mit uns eine Tasse Kaffee und eine geschlagene Stunde lang sprechen wir über Theo, die Zustände in afrikanischen Spitälern, über seine Heimat und die Welt. Er ist Jugoslawe, sein Kollege George, mit dem er seit Jahren zusammenarbeitet, Rumäne und beide wollen zurück nach Europa, sobald sie pensioniert sind. Er ist so charmant und sympathisch, man muss ihn einfach gern haben. Dann muss er gehen, ein weiter Herzpatient wartet im Operationssaal.
Zum „Dreamteam“ (Theo nennt sie die „Balkanmafia“) gehört übrigens auch noch Eugen, der Kardio-Techniker. Er ist Serbe. – Ich habe mir ernsthaft vorgenommen, nie mehr Witze zu machen über unsere östlichen Nachbarn in Europa.
Zurück bei Theo ist wieder nicht ganz klar, ob die Schläuche endlich entfernt werden können oder nicht. Die Schwestern sagen ja, sind sich aber nicht sicher, ob beide und wenn nicht, derjenige rechts oder derjenige links. Grosse Verunsicherung einmal mehr. Kim und Theo beharren darauf, erst nochmals die Meinung des Arztes abzuwarten, womit sie eindeutig Recht haben. Ich denke jeweils, die Schwestern wissen schon, was sie zu tun haben, man muss ein wenig Vertrauen haben, aber allmählich kommen mir doch auch Zweifel.
Die Schläuche bleiben schliesslich, wir fahren heim und treffen uns wieder um sieben Uhr bei uns. Gemeinsam fahren wir einmal mehr in den Country Club, wo wir sechs zusammen essen. Ich lade die ganze Gruppe ein, so kann ich mich ein ganz kleines Bisschen erkenntlich zeigen für all die grossartige Gastfreundschaft, die mir hier widerfährt.
Dienstag, 25. Oktober
Es war ein langer Tag heute. Um halb elf sind wir im Spital, wieder sind wir einen Schritt weiter, ein paar Kanülen sind weniger und das ganze Gesteck an Theos Hals ist ebenfalls weg.
Grad rechtzeitig kommen wir an, denn Dr. Dalby hat eine Ernährungsberaterin hinbestellt, mit der wir nun zu viert das weitere Vorgehen punkto Ernährung besprechen können. Gut sind wir dort, so kann Theo keine Lügen erzählen oder netter gesagt, nicht seine Witzchen machen, die sie so oder so nicht verstehen würde. Kim hat ihn mehrmals ermahnt, er solle sagen, wie’s wirklich ist, was er isst beziehungsweise nicht isst. – Im Klartext!
Die junge Frau erklärt uns, was gut ist, was schlecht, und wo man selten mal auch einen Ausnahme machen kann. Speziell auf diese Ausnahmen wird sich Theo konzentrieren. – Ich kenne ihn!
Nachdem Debbie gegangen ist, kommt die Physiotherapeutin und lädt ihn auf einen Spaziergang ein. Ein spezielles Schauen ist das mit seinen beiden Flaschen, die mitspazieren müssen. Wie Hanteln sehen sie aus. Eine rechtes, eine links. Aus den Schläuchen kommt nach wie vor zu viel Flüssigkeit. Wäre das nicht der Fall, hätte er gestern oder vorgestern bereits das Spital verlassen können. Wir setzten uns in die Cafeteria; es ist das erste Mal seit zehn Tagen für Theo, dass er draussen an der frischen Luft ist. Er geniesst es, mich aber erinnert die Szene irgendwie an Drakula, der sich soeben mit genügend frischen Blutkonserven eingedeckt hat.
Theo bestellt sich, dreimal dürft ihr raten: a) einen Fruchtsalat b) einen Gemüseteller c) Einen Kaffee mit weisser Schokolade. - Und das, nachdem Debbie grad erklärt hat, wie schlecht Zucker sei. Natürlich hat sie auch gesagt, ein kleines Dreieck Toblerone hin und wieder sei ok. – Da fangen wir doch gleich mal damit an…
Apropos Fruchtsalat: Den bestellt er nun immer, um sein Gewissen zu beruhigen, vermute ich. So stehen jetzt bereits ein Teller und eine Schale mit Früchten, die er aus dem Menu ausgelagert hat, auf der Ablage, „für später“, wie er sagt.
Übrigens ist nun doch noch eine Menu-Karte mit leichter Kost aufgetaucht. Es gibt sie also doch. Die bekommen wir allerdings erst zu Gesicht, seit wir uns bei Dr. Dalby beklagt haben. (Anmerkung einen Tag später: Das Wort „diet“ ist wohl nur zur Dekoration da.)
Zurück im Spitalbett ist Theo ziemlich erschöpft. – Ruhen kann er aber nicht lange. George, der Chirurg, kommt auf Visite, untersucht Theo und sieht sich im Protokoll an, was gelaufen ist. Mit den Schwestern ist er gar nicht zufrieden und liest ihnen die Leviten. Deutlich! - Offenbar haben sie selber etwas an den Medikamenten geändert und auch eines unterschlagen, das sie ihm hätten geben sollen. – Jetzt kommt Leben in die Bude. Sieben Schwestern, inklusive Stationsschwester (Trine, „the skinny one“, wie Dr. Dalby sagt) kommen ins Zimmer und jetzt geht offenbar alles nach Buch. Sie legen sogar Plastikschürzen an. Was genau sie an ihm herummachen, sehe ich nicht, denn ich verlasse mal besser den Ort des Geschehens.
Wie der ganze Spuk nach etwa zwanzig Minuten zu Ende ist, sind die beiden roten Flaschen ersetzt und er hat ein weiteres Pflaster auf dem Handrücken, wo sie ihm zum x-ten Mal Blut genommen haben.
Ich bin ziemlich müde, die ganze Geschichte hier ist anstrengend. Für Kim auch. Aus dem Grund hat sie sich zwei Stunden Fitness gegönnt in einem Spa ganz in der Nähe. Sehr gute Idee! – Jetzt kommt sie zurück, wir bleiben noch ein wenig, gehen dann heim.
Alle sechs (Eva, Ken, Kathy, Mike, Kim und ich) gehen wir auch heute Abend wieder zusammen essen. Diesmal im Montecasino, einem absolut speziellen Ort. Der ganze Komplex ist riesengross, hat die Ausmasse eines Dorfes. In der Mitte gibt’s ein Kasino mit unzähligen Geldspielautomaten wie in Las Vegas, darum herum ist ein italienisches Dorf gebaut mit Plätzen, Häusern, Brunnen, sogar ein Bach ist da, eine Wäscheleine hängt über der Strasse zwischen den Häusern – man wähnt sich in der Toskana. – Absoluter Kitsch natürlich; es ist zum Schreien. Trotzdem ist dieses Make-Believe-Dorf, das da aufgebaut wurde mitten in Johannesburg, echt sehens- und besuchenswert. Und man fühlt sich wohl in diesem seltsamen Italien. Wir essen draussen auf einer Piazza. Der Salat, den Kim und ich bestellt haben und den wir teilen wollen, reicht reichlich für uns alle sechs und wir lassen den Rest noch einpacken als Doggie-Bag. Das Essen ist sehr fein, der Service ausgezeichnet.
Drei Theater beherbergt der Komplex zusätzlich und fünfzehn Kinos. Offenbar hat’s auch noch eine Menge Läden, eine ganz Mall, die ebenfalls zu Montecasino gehören, die wir aber nicht gesehen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass Kim und ich…
Morgen geht für Kathy, Mike und Ken die Safari los. Spätestens um sechs wollen sie starten. Eva fliegt geschäftlich nach Kenia, sie muss auch früh raus, also fahren wir gleich nach dem Essen nach Hause und verabschieden uns. Nur Eva werde ich noch sehen, sie kommt am Freitag wieder heim.
Mittwoch, 26. Oktober – „Klammertag“
Heute vor einer Woche wurde Theo operiert. Was für ereignisreiche Tage seither!
Um halb elf sind wir im Spital. Sie haben Theo das Pflaster auf der Brust weggenommen, eine lange, blutverkrustete Narbe ist zu sehen, die schön gleichmässig mit lauter Klammern zusammengeheftet ist. 32 an der Zahl! - Kim wagt einen Blick darauf aus nächster Nähe, ich bin nicht so tapfer.
Aber da sind immer noch die Schläuche… George kommt, wie immer in seiner Strassenkleidung, und sagt genau das Gleiche. Eine Schwester ist beauftragt, diese Tubes zu entfernen. Es geht ihm aber zu lang, bis sie da ist, so legt er gleich selber Hand an, krempelt seine Hemdsärmel rauf, desinfiziert sich die Hände und legt los. Kim und ich, wir machen uns schleunigst aus dem Staub.
Nach fünf Minuten ist die Sache erledigt. Von ihm aus könne Theo am nächsten Tag heim, sagt er. Kim fällt ihm um den Hals. Er lacht, herzt sie auch und sagt, zu mir gewandt: „I like her“.
Am Mittag haben wir einen Brautkleid-Anprobe-Termin, bei dem spanischen Designer, wo wir vor kurzem bereits einmal waren. Erste Triage: Wir kämpfen uns durch zwei dicke Kataloge hindurch. Dann geht’s zur Anprobe. Eine weitere Stunde dauert die Modeschau, dann weiss Kim ziemlich genau, womit sie Javi im nächsten Juni überraschen will.
An verschiedenen Kleidern hat’s hinten am Rücken eine ganze Reihe von Knöpfen. Spontan erinnern mich diese an die Klammern auf Theos Brust, die ich vor kaum zwei Stunden gesehen habe. Ok, ok, schon ein vielleicht allzu weit hergeholter Vergleich, aber trotzdem… Und nochmals Klammern: Die Kleider, die Kim anprobiert, werden auf ihrem Rücken mit solchen zusammengeheftet.
Das alles macht Hunger und wie gehen eine Kleinigkeit essen in einem nahegelegenen Restaurant, bevor wir wieder ins Spital zurückfahren.
Wir begleiten Theo in die Cafeteria. Er ist jetzt ohne seine beiden Konserven unterwegs, aber immer noch im Spitalnachthemd. Morgen wird er auch das los sein.
Zurück im Zimmer warten wir auf Dr. Dalby. Er ist sehr zufrieden mit Theos Genesung und bestätigt, dass Theo morgen heimgehen kann. Um zehn sollen wir ihn abholen kommen. Sehr aufgestellt verlassen wir das Spital und den Patienten und fahren nochmal ins Montecasino, wo wir uns ein paar Einkäufen widmen, uns ein Sushi-Nachtessen gönnen und anschliessend ins Kino gehen. Einen Psychokrimi schauen wir uns an („The Girl on the Train“. - 3 Fr. kostet das Ticket), grad so als ob wir noch gar nicht genug vom Psychokrimi der letzten Woche hätten.
Um zehn Uhr fahren wir bei Blitz und Donner und Regenguss zurück zu unseren Unterkünften. Ich muss Kim whatsappeln, dass ich gut angekommen bin. Schon kürzlich hat sie mir gesagt, dies sage zwar normalerweise nur eine Mutter zum Kind, aber jetzt sei’s eben umgekehrt, sie wolle es einfach wissen.
Inzwischen habe ich mich auch daran gewöhnt, des Nachts heimzufahren, dort, wo ich den Weg gut kenne. Wenn’s regnet, ist es allerdings doppelt unangenehm mit der schlechten Beleuchtung. Aber einen Vorteil hat es doch: Der Regen hat all die Bettler und Verkäufer von den Kreuzungen vertrieben, man muss nicht mehr damit rechnen, dass einer unverhofft vor oder neben dem Auto auftaucht.
Donnerstag, 27. Oktober – Entlassung aus dem Spital
Letzte Fahrt zum Spital vorläufig. Leider finden wir keinen Parkplatz am Schatten. Das wird eine Sauna werden, bis wir hier wegfahren können. - Das Köfferchen mit Theos Kleidern ist im Kofferraum. Nur bringe ich den nicht auf. Das wär ein Anfang… Theo dann doch noch im Spitalnachthemd auf der Heimreise… - Ein netter Herr hilft uns. Alles bestens!
Bevor wir Theo um zehn abholen können, gibt uns Dr. Dalby noch ein Rezept, mit dem wir in der Spitalapotheke die Medis abholen können. Das dauert. Ich muss sie gleich bezahlen, denke, das kostet sicher ein Vermögen, aber nein, mit umgerechnet 80 CHF bin ich dabei. Acht Schachteln sind’s (mir kommt’s vor wie an der Pharma-Prüfung, wo die Kandidatinnen jeweils drei Medis aus einer ganzen Menge Verpackungen heraussuchen und beschreiben müssen; ich muss alle mitnehmen). - Die Schwester wirft einen Blick auf die Liste, auf die Medikamente und sagt, sie sehe da ein Problem, die Liste der beiden Ärzte stimme nicht überein. Sie wolle das abklären.
Theo und Kim warten inzwischen in der Cafeteria. Theo wieder in Hose und T-Shirt, so wie er vor zehn Tagen eingerückt ist. - Eine halbe Stunde später kommt die Schwester endlich wieder und geht mit mir zurück in die Apotheke. Dort geben wir zwei Medikamente zurück, eines soll ausgetauscht werden. Das dauert eine knappe weitere Stunde, bis die ganze Abrechnerei erledigt ist. Ich erhalte 15 Franken zurück. Inzwischen hat Kim nochmals Dr. Dalby aufgesucht um zu fragen, wie sich die Angelegenheit erklären lasse. - Es ist schon so, die beiden Ärzte sind sich in dieser Frage nicht einig. George will keinesfalls Antibiotika verabreichen, Dr. Dalby schon, nur für ein paar Tage. Er hat das Sagen, ist nicht sehr zufrieden über die Änderung, aber die Medikamente sind ja jetzt wieder weg von der Liste, also bleibt’s dabei, nur noch sechs Medis sind übrig, von denen eines Schmerztabletten sind und das andere ein Schlafmittel, also nur bei Bedarf zu nehmen. So bleiben genau vier übrig, und das dünkt mich eigentlich gar nicht schlecht. Ich hätte mit einem ganzen Drogen-Cocktail gerechnet.
Das Herz sei in einwandfreiem Zustand, Reha nicht notwendig, Theo brauche nun einfach Erholung, solle sich viel bewegen (!), Zucker vermeiden und weniger Fett essen, dann habe er noch viele sorglose Jahre vor sich. Herz mit Garantie…– Das sagen alle drei Ärzte. – Wir sind entlassen.
Mittlerweilen ist es zwölf Uhr mittags.
Vor dem Spital möchte Kim noch eine Foto machen lassen von und dreien von diesem denkwürdigen Augenblick. Sie fragt einen Mann, der dort am Schatten sitzt, ob er ein Bild von uns machen könne. – Sie hat sich nicht grad einen Ausbund an Intelligenz ausgesucht. Er stellt sich neben Theo und mich hin, lächelt und denkt offensichtlich, Kim habe ihn gefragt, ob er mit uns aufs Foto wolle. – Ein zweiter Versuch mit einem Passanten verspricht mehr Erfolg.
Es ist über 30 Grad heiss und im Auto noch ein bisschen wärmer. Ich verbrenne mir fast die Hände am Steuerrad, auf den Sitz lege ich Zeitungen.
Um die Klammern zu entfernen, muss Theo in einer Woche zurück ins Spital, dann seien wir frei, unsere Reise fortzusetzen, meinten die Ärzte. Fliegen allerdings erst in zwei Wochen ab jetzt, selber Auto fahren in sechs Wochen, mitfahren in einer Woche. Brustkasten wieder ganz zusammengewachsen: sechs Monate, Skifahren ab Januar kein Problem, wenn’s keine schwarzen Pisten seien (die sind in Bivio so oder so eher rar).
Das sind ja verlockende Aussichten. – Wir warten ab, wie sich die Genesung entwickelt und entscheiden in einer Woche, wie’s weitergeht.
Auch für mich wird jetzt die Phase der Erholung anfangen, ich bin mehr als nur froh!
Der Albtraum ist also vorbei. Ich kann noch immer kaum fassen, was passiert ist, dass das überhaupt passiert ist, und dass es jetzt vorbei ist: das Herz geflickt, alle Knochen wieder an Ort und Stelle, der Brustkasten fein säuberlich zugenäht (da kommt mir der böse Wolf im Märchen in den Sinn – natürlich ohne die Szene mit den Steinen und anschliessend dem Brunnen) - Theo wie neu.
Wir sind dankbar, dass wir solches Glück im Unglück hatten. Theo hat Zeitpunkt und Ort des Dramas perfekt gewählt – wir waren rechtzeitig in Spital – es war genau das richtige Spital (es war nicht fünf vor zwölf; es war ein paar Sekunden vor zwölf), wir haben eine Unterkunft, die keine Wünsche offen lässt und dass schliesslich, wie im Märchen, alles gut herausgekommen ist und Theo eine zweite Chance erhalten hat, ist das Beste, was wir erhoffen konnten. - … and they lived happily ever after.
Theo richtet sich ein im Haus, legt sich hin; er ist ober-happy. Kim und ich fahren in den nächsten Supermarkt und kaufen ein. – Jetzt geht’s aber bunt: Schon bald ist das Wägeli bis obenhin beladen mit Gemüse und Früchten, Kim ist sehr darauf bedacht, dass nur das Beste vom Besten gekauft wird. Und gesund muss es sein! - Das schlägt sich schliesslich auch auf die Rechnung nieder und ich denke, wir haben genug gekauft für mindestens einen Monat. Wenn wir nur genügend Platz haben im Kühlschrank…
Kim fährt zurück in ihre Lodge, ich fahr heim und schlafe ein bisschen im Garten; der Tag hat mich sehr müde gemacht.
Es ist unser letzter gemeinsamer Abend, morgen fliegt Kim zurück nach London. Wir feiern mit Champagner den glücklichen Ausgang dieser dramatischen Woche, sie kocht uns ein feines Nachtessen (Stirfry chicken) und verlässt und gegen elf.
Freitag, 28. Oktober – Kim reist ab
Mit Hilfe einer Schlaftablette hat Theo einigermassen schlafen können.
Es ist Kims letzter Tag heute, sie hat einen Flug um 20.20 Uhr. Am Mittag hole ich sie im Dainfern Shopping Center ab, wo sie einen Coiffeur Besuch abgemacht hat.
Zu Hause verwöhnt sie uns schon wieder; sie macht uns einen feinen orientalischen Salat nach Javis Rezept. – An ihre Küche könnte ich mich gewöhnen.
Gegen halb fünf kommt ihr Taxi, wir versabschieden uns und schon wieder ist ein Kapitel abgeschlossen.
Ich muss jetzt schauen, wie ich mich als Krankenschwester eigne. Ich habe da so meine Zweifel…
Inzwischen ist Kim gut zu Hause angekommen. Am Samstagmorgen kurz nach sechs Landung in Heathrow. Wir haben ihren Flug mit der „Flightrader 24“- App verfolgt und sind froh, dass alles gut gegangen ist.
Kurze „REHA“ in Dainfern
Auch bei uns geht’s gut. Super sogar. Es ist erstaunlich, wie schnell sich Theo erholt. Jeden Tag geht’s ein wenig bergauf. Aussehen tut er wie vor der Operation. Als Eva heimkam am letzten Freitag, dachte sie wohl, sie finde einen schwer angeschlagenen, tief darniederliegenden bleichen Patienten in ihrem Haus vor. – Alles andere; sie konnte es kaum glauben. Als sie dann den Reissverschluss an seiner Brust sah…
Er selber kann’s auch fast nicht fassen, dass ihm nichts weh tut. Schmerztabletten braucht er keine zu nehmen, aber jetzt nimmt er doch tatsächlich Schlaftabletten. Ausgerechnet Theo! Noch mehr Siesta…
Er fühlt sich sehr wohl in diesem hellen grossen Haus mit den vielen Fenstern und dem genialen Parcours, den er täglich mehrmals zurücklegt. Es ist so gebaut, dass alle Zimmer im Parterre und im ersten Stock rings um ein Atrium herum angelegt sind. So kann er treppauf, treppab so viele Umgänge machen, wie es ihm beliebt. Zudem hängt und steht überall schöne afrikanische Kunst, die er bewundern kann, wenn ein Halt nötig ist, ein lohnender Spaziergang also.
Auch ist es absolut ruhig hier. Strassenlärm gibt’s keinen. Nur Vögel hört man; es ist fast wie in einem Bird-Sanctuary, so viele verschiedene Arten hat’s. Gezwitscher und Gekeife hört man tagein tagaus, unermüdlich. – Höchstens diejenigen, welche nebelhornartig miteinander kommunizieren, können manchmal ein wenig nerven. Nur in der Nacht für wenige Stunden, wenn sie endlich ihre Schnäbel halten, übernehmen Grillen und Frösche.
Einer von Theos Lieblingsplätzen ist im Garten auf dem Sofa am Schatten mit Blick ins Grüne. Ein weiterer Lieblingsplatz, wenn’s dunkel ist: auf dem Liegesofa vor dem Bildschirm mit Aussicht auf Trump und Hillary.
Nochmals zu den Spaziergängen: Sie werden mit jedem Tag ausgedehnter. Es ist ein tolles Gebiet zum Herumschlendern oder –wandern. Das allerdings nur morgens oder kurz vor Sonnenuntergang, wenn’s noch nicht oder nicht mehr so heiss ist. Erste Rundgänge fanden entlang der Strasse statt, an prächtigen und auch weniger prächtigen Villen vorbei, 10 Minuten. Dann wurden es 20 Minuten durchs Green des angrenzenden Golfplatzes. „Dank“ Regenmangels ist’s inzwischen teilweise zwar mehr ein Yellow oder Brown. Der Rasen wird fleissig bewässert, aber ich bin nicht sicher, ob das Rechtens ist, denn durch die Medien und auf Plakaten wird man aufgefordert, Wasser zu sparen.
Schon 30 Minuten! Bis zum Zaun und Entlang der Umzäunung im „Ghetto“. Es ist sehr merkwürdig: hohe Mauer, Stromkabel, Stacheldraht, Videoüberwachung – ist man hier auf der richtigen Seite? Gefängnis oder Paradies?
Dazu und auch zur Pipeline die sich durch die Gegend zieht (von weitem könnte man meinen, ein silberner Zug überquere eine Brücke - so ist es aber überhaupt nicht) habe ich einen sehr aufschlussreichen und interessanten Artikel gefunden:
www.theguardian.com/world/2005/feb/28/southafrica.features11">www.theguardian.com11/world/2005/feb/28/southafrica.features
Vor zwei Tagen war ich zum ersten Mal, seit wir da sind, im Swimmingpool, das zu einem Gemeinschaftszentrum gehört, fünf Minuten zu Fuss von hier. Es hat dort auch ein Clubhaus, einen Fussballplatz, eine Beach-Volley-Anlage, drei Tennisplätze, Grillstellen; man kann Basketball spielen und vieles mehr. Für Unterhaltung ist gesorgt. Am Wochenende profitieren viele vom Angebot, durch die Woche ist fast niemand dort.
Ich hatte ziemliche Bedenken, was meine neue Rolle als Krankenschwester und Health-Food-Köchin anbetrifft, aber es ist weniger schlimm als vermutet. Der Patient ist recht genügsam, schickt mich zwar manchmal herum, Dinge zu holen, die er selber auch holen könnte (er soll sich ja bewegen!), aber im Grossen und Ganzen kommen wir gut über die Runden. Da ihm nichts weh tut, braucht er auch nicht zu jammern. – Den Salat isst er bereits ohne Murren und auch seine Bedenken und Bemerkungen, dass Salt- und Gemüseessen nur zu Haarausfall und Gelenkschmerzen führten, hat er in letzter Zeit nicht mehr erwähnt.
Administratives
Übrigens hat alles bestens geklappt mit der Versicherung und dem TCS. Das möchte ich erwähnen, denn Versicherungen zahlt man zwar ungern, ist aber froh, wenn man sie nicht braucht. Wenn aber doch, war es für uns eine grosse Erleichterung zu erleben, wie gut, professionell und trotzdem einfühlsam die Unterstützung ist.
Die Kosten belaufen sich bis jetzt auf 54‘000 Franken. Eine riesige Summe. Ich frage mich aber, wie viel das Ganze in der Schweiz gekostet hätte.
Farben
Manchmal muss man ja auch eine Wäsche machen. – Gelb ist jetzt das neue Weiss. Nach Jahren ist es mir wieder mal gelungen, eine ganze Trommel Wäsche so zu verfärben, dass alles, was zuvor weiss war, nun gelb ist. Wenigstens gleichmässig.
Theo war froh, dass er vergessen hatte, zwei seiner Hemden mitwaschen zu lassen. Das erledigten wir allerdings unverzüglich tags darauf. - Violett ist jetzt ebenfalls das neue Weiss.
Und ich glaub’s ja nicht: Wieder hat er vergessen, das eine weisse Hemd mit in die Trommel zu geben. – Da drängt sich allenfalls ein dritter Versuch auf. Vielleicht rosarot zur Abwechslung.
Am Montag habe ich ein Auto gemietet. Eva ist ja wieder zu Hause, so braucht sie ihres und ich fühle mich sehr eingesperrt, wenn ich nicht mobil bin. Zudem haben wir noch ein paar Arzt-Besuche im Spital vor uns, und einkaufen muss ich schliesslich auch. So war auch der Montag der erste Tag, an dem wir abends auswärts essen gingen. Wir haben’s beide sehr genossen, Theo natürlich erst recht nach diesen zwei langen Wochen.
Mit dem königsblauen VW-Polo fallen wir überall auf. - Wie ein roter Hund. - In der ganzen Zeit hier habe ich kein Auto gesehen mit solch auffälliger Farbe.
Inzwischen hab ich Auto und Farbe gewechselt. Service und Ölwechsel wären in 1000 km nötig gewesen, dem mag ich allerdings nicht „nachrennen“ und zudem fand ich den Laderaum ein wenig eng. - Goldbraun ist das neue Gefährt.
Weiterreise – Pläne
Ich glaube nicht, dass wir bald den Heimflug antreten werden. Theo möchte gerne die nächsten Wochen in diesem Land verbringen (ich natürlich auch), so sind wir vorsichtig am Planen, wie’s weitergehen könnte. Das Auto hab ich ja vorsorglich schon gemietet und nach den Arztvisiten vom Mittwoch und Donnerstag wissen wir sicher mehr.
Meine Idee ist es, von hier nach Port Elizabeth beziehungsweise Sedgefield (unsere nächste HomeExchange-Destination) zu fahren und dabei etwa vier- bis fünfmal zu übernachten. – Soeben erhielt ich eine Mail von diesen Tauschpartnern mit dem grosszügigen Angebot, dass wir mit Werner Frei (ein Schweizer – unschwer zu erraten) in seinem Auto mitfahren könnten. Er ist momentan geschäftlich in Johannesburg beschäftigt und fährt am Freitag, 11. November, heim. Das also eine Option, die es zu überdenken gilt. Er würde die 1‘200 km in zwei Tagen fahren, je sechs Stunden im Auto. Mal überlegen, ob das gut ist für Theo. - Mein Vorschlag mit den vielen Zwischenhalten hat den Vorteil, dass die Reise weniger anstrengend ist, und wir würden etwas vom Land sehen, was vermutlich nicht in jedem Reiseführer steht. Werners Vorschlag hingegen würde bedeuten, dass ich nicht die ganze Strecke alleine fahren müsste.
Wir trinken Tee und warten ab.
Ich staune übrigens immer wieder, wie fantastisch diese „HomeExchange-Familie“ funktioniert. Noch nie haben wir schlechte Erfahrungen damit gemacht (wir hatten bisher rund 50 Tausche), genau das Gegenteil ist der Fall. Man kennt den Tauschpartner nur per Email und von den Angaben auf der jeweiligen Webseite und macht dann die genialsten Erfahrungen, wenn man die Gastgeber kennenlernt. Mit manchen haben wir nach Jahren noch Kontakt.
Mittwoch, 2. November - Spitalaustritt
Was für ein Tag!
Es ist jetzt genau zwei Wochen her seit der Operation. Um zehn Uhr sind wir im Spital und nach knapp sechs Stunden und zwei Kilometern Durch-x-Gänge-Gehen verlassen wir es wieder.
Inzwischen gab es zwei Ärztekonsultationen in deren Praxen. Sowohl George als auch Dr. Dalby waren höchst erfreut über Theos Zustand, alle Werte bestens, Herz wie neu (20 Jahre Garantie), Lunge tut ihre Dienste, Patient entlassen. Beide ermunterten uns, gleich morgen schon unsere Reise fortzusetzen. – Übermorgen wird’s schon werden.
Eine halbe Stunde lang dauerte es, die 32 Klammern zu entfernen. Die Schwester, die das machte, war auch des Lobes voll und sagte, sie habe noch nie einen Patienten gehabt, der nach einer solchen Operation nicht auch Klammern an den Beinen gehabt habe, da man normalerweise dort die Venen für die Bypässe „holt“.
Ich wartete in der Cafeteria auf Theo, wollte bei der „Entzipperei“ nicht dabei sein. Dort, wie kürzlich auch schon, traf ich George beim Kaffee an und auch Dr. Zoran setzte sich wieder zu mir an den Tisch. Beide warteten auf einen Kollegen, die nächste Operation schon in den Startlöchern. Von beiden erhielt ich Tipps bezüglich Weinsorten und Orte, die wir besuchen sollten auf dem Weg nach Cape Town. Theo kam eine halbe Stunde später dazu mit seiner neu gestalteten Brust: der Reissverschluss weg, die Narbe ein wenig „äs Gschnurpf“.
Was mich dann fast aus der Fassung brachte, war, was George beim Abschied sagte. Er lud uns am selben Abend zu sich nach Hause zum Nachtessen ein. – Also so was!!!!!
„You guys are so far away from home and had such an experience. I want you to have a good impression of South Africa!” – (We certainly do…)
Ich hatte mich erkundigt, was wir den Schwestern als Abschiedsgeschenk geben könnten. Dabei hatte ich an einen gemeinsamen Fond oder so gedacht, aber Leigh, die Dame, die das Administrative im Spital regelt, sagte, sie hätten schlechte Erfahrungen gemacht mit Geld, besser sei, beiden Abteilungen ein Kilo Güezi zu bringen. – Nein also nein, dachte ich, aber was soll’s? So kaufte ich die von ihr vorgeschlagenen Bakers Assorted Cookies, die wir alsdann den Schwestern in die ICU und Ward G brachten. Sie freuten sich über das Abschiedsgeschenk und Trini (the skinny one) ermahnte Theo noch, das Rauchen total aufzugeben. „Dream on“, dachte ich, sagte es aber nicht.
Die Ärzte übrigens bedachten wir mit Wein, nicht mit Güezi.
Erstaunlicherweise war die Intensivstation fast leer. So kannten wir sie fast nicht mehr. Theos Bett verweist… Im Dezember und Januar würde sie sich dann schon wieder füllen, meinte eine Schwester zuversichtlich.
Es folgte ein weiterer Besuch in der Apotheke: Theo setzte sich hin und ich beobachtete, wie er grad dabei war, ein Selfie von seiner Narbe zu machen. - Dann endlich konnten wir das Spital verlassen.
Zu Hause war dann Siesta-Time. Wohlverdient für Theo nach diesem langen „Ausgang“.
Kurz nach sechs rief George an, gab uns seine Adresse bekannt. Wir wurden gegen acht erwartet.
Ein heftiges Gewitter brach los gegen sieben, so mochte ich nicht Auto fahren. Wir nahmen ein Taxi beziehungsweise Uber und kamen rechtzeitig bei Livia und George Dragne an.
Ein tolles Haus haben sie mit einem Garten ähnlich wie in einem französischen Landhaus. Ein ganzer Teil davon nur Gemüsegarten, den die sympathische Livia offenbar liebevoll pflegt.
Zwei Hunde und zwei Katzen sind die andern vier Bewohner.
Ein Braai (BBQ) im Garten hätte es sein sollen, aber das Wetter hatte das schliesslich verhindert. Stattdessen stellte uns Livia eine Platte mit lauter feinem Finger-Food auf (Samosas, Fleisch-Spiesschen, gefüllte Omeletten, Crackers mit Humussauce etc.), dazu gab es Wein (nicht zu knapp) und zu den Häppchen eine spassige Bemerkung von George, all dies nun seine Dinge, die zu essen man eigentlich eher vermeiden sollte. - Am Morgen noch hatte er gesagt, zwei Gläser Wein pro Tag seien ok, sogar gut; Theo und ich, wir leerten eine Flasche Rotwein, George eine Flasche Weisswein fast allein. (Wenn man hier in einem Restaurant ein Glas Wein bestellt, dann kommt eine kleine Karaffe mit 2,5 dl Inhalt. Zwei Gläser wären also ein halber Liter. - Vielleicht hatte er so gerechnet, dann wären wir ja im grünen Bereich gewesen, noch ein wenig drunter sogar…). – Über Gott und die Welt wurde geplaudert, es war ein unvergesslicher Abend, eine herrliche Abwechslung.
Nun wurde es Zeit zu gehen. Ich wollte Uber bestellen, aber Livia bestand darauf, uns heimzufahren. Es war elf Uhr, stockdunkel. Beide kamen mit und Livia fuhr uns in ihrem schnittigen weissen Jaguar pfeilschnell auf den fast leeren Strassen heim, wo wir im Nullkommanichts Dainfern erreichten nach einer Fahrt, die mir vorkam wie auf einer Achterbahn.
Was für ein Tag!
Und jetzt geht’s schleunigst ans Planen: Am Freitag Abfahrt Richtung Port Elizabeth, erster Halt, wie schon erwähnt, in Clarens. – Wir haben uns also entschieden, selber zu fahren, damit die Reise für Theo weniger stressig wird.
Freitag, 4. November - Abfahrt Richtung Süden (Ginos Geburtstag)
Alles ist gepackt und parat. Noch frühstücken, anschliessend „Take-off“. Wir sind dann mal weg!
Wir verabschieden uns von Eva und ihrer Tochter Anna, die inzwischen aus Amsterdam angereist ist, um ihrer Mutter zu helfen, ein Inventar fürs Haus, das im Dezember verkauft werden soll, zusammenzustellen. Es wird Mittag, bis wir losfahren. Clarens ist unser Ziel für heute.„On the Road again“, tönt es aus dem Radio; der Song von Willy Nelson begleitet uns aus Johannesburg hinaus. Der Verkehr auf der vierspurigen Autobahn ist dicht und hektisch, ständig werden die Spuren gewechselt, überholen darf man rechts und links. Wir haben noch etwas Mühe, das Navi richtig einzustellen, ich verpasse daher ein paar Ausfahrten, die wir hätten nehmen sollen, denke, wir fahren im Kreis herum, aber dann, nach etwa einer Stunde, sind wir aus dem Gröbsten raus. Die Autobahnen werden drei- und schliesslich zweispurig, dann allmählich sind wir auf der Landstrasse in Richtung Heidelberg.
Ab hier ist die Gegend kaum mehr besiedelt, die Route führt zwar noch an einzelnen erbärmlichen Hüttendörfern vorbei, aber vorwiegend durch weite Ebenen, bestehend aus Grasland, durchsetzt mit ein paar Bäumen hin und wieder. Die beachtliche Zahl der Rinder, an denen wir vorbeifahren, schätze ich auf etwa gleich gross wie die Anzahl der Schlaglöcher in der Strasse, die ich möglichst umfahre, aber die immer genau dann am tiefsten sind, wenn’s Gegenverkehr hat und ich nicht ausweichen kann. Das Verkehrsschild mit der Aufschrift: „Potholes next 5 km“ steht ständig von neuem am Strassenrand, wenn die fünf Kilometer vorbei sind. Bald schon bemerke ich, dass, je schneller man über sie hinwegfährt, desto weniger fallen sie ins Gewicht. Wichtig dabei ist, sich am Steuerrad festzuklammern, bis die Hände ganz klamm sind.
Geschwindigkeitsbeschränkung ist meist 100 km/h, manchmal sogar 120. Immer öfter fahre ich 20 km schneller, denn sonst kommen wir ja nirgends hin. Das ist normal hier auf diesen ewig langen Strecken - selbst so werde ich nicht selten überholt, auch von Lastwagen, deren Limit 80 wäre, so zumindest steht’s hinten neben dem Nummernschild.
Trotzdem wird recht gesittet gefahren und der Umgang ist freundlich. Weicht man ein wenig aus, wenn man überholt wird, dankt der Fahrer mit der Warnblinke und das Betätigen der Lichthupe heisst dann: „Bitte, gern geschehen“.
Ein Streckenabschnitt ist brandneu gepflastert. Ohne Schlaglöcher noch. Da lohnt es sich sogar, eine Mautstelle einzubauen. Ich halte an, sehe, dass ich 42 Rand zahlen muss, gebe eine 100er-Note und der Typ am Schalter gibt mir 8 Rand zurück. Die Barriere geht hoch, er fragt uns, weshalb wir nicht fahren. – Ich warte auf die restlichen 50 Rand, sage ich. – Ah, ich hätte ihm hundert Rand gegeben, tut er unschuldig, wie wenn er es nicht genau wüsste. Hinter mir wird bereits gehupt. Er lenkt ein und gibt mir die Kohle zurück. – Das ist das erste Mal in diesem Land, dass jemand versucht hat, uns zu betrügen. Oder ich hätte es nur nicht bemerkt. Dreieinhalb Franken wären es zwar lediglich gewesen, aber trotzdem… (Zum Vergleich: Richard, der Houseboy in Dainfern, verdient pro Tag für seine Arbeit rund 15 Fr.).
Der nächste grössere Ort auf der Strecke, den wir passieren, ist Frankfort, Heilbron lassen wir rechts liegen, Reitz kommt etwas später, dann Betlehem, wo wir nach vier Stunden Fahrt den ersten Halt machen, um in der Mall etwas zu trinken und uns ein wenig die Beine zu vertreten. - Theo geht’s erstaunlich gut; er sagt sogar, die feine „Massage“ am Rücken über die holprige Strasse habe seiner Lunge gut getan. – In dem Fall ist ja alles bestens - morgen wird’s wohl nicht viel anders sein mit der Beschaffenheit der Strasse. Der nächste Streckenabschnitt ist 400 km lang und führt entlang der Westgrenze von Lesotho.
Nur noch 26 km bis Clarens! Die Gegend verändert sich, es wird gebirgig. Gegen fünf sind wir dort.
Der Ort wurde 1912 gegründet, liegt auf 1891 Meter und hat etwas mehr als 6‘000 Einwohner. Bei booking.com habe ich ein Zimmer im Guesthouse Lake Clarens gebucht. Mit Blick auf den See. Das Bild im Internet sah so schön aus mit den Pappeln, die sich im glasklaren Wasser spiegeln. – Wir kommen an, die Enten, Gänse, Esel und Ponys (ebenfalls auf den Bildern zum Hotelbeschrieb) sind da, die Pappeln auch, aber wo ist der See? – Es habe seit ungefähr zwei Jahren nicht mehr richtig geregnet, erklärt man uns, also habe er sich verabschiedet. – Angelina Jolie habe auch schon mal hier übernachtet, heisst es weiter. - Ob sie den See gesehen hat?
Wir haben ein hübsches Zimmer, ebenerdig, und das ist gut so, dann muss ich nicht so viel „schleppen“. Zusätzlich zur Chauffeuse bin ich ja nun auch noch die Gepäckträgerin. Das liest sich jetzt viel schlimmer als es ist; wir haben so gepackt, dass wir nur je ein Übernachtungsgepäckstück brauchen (und natürlich Theos 10-kg schwere Elektrokabel und –Apparate-Tasche). Die grossen Koffer sind und bleiben schön verstaut im Kofferraum, der zum Glück so gross ist, dass alles bestens darin Platz hat.
An den Toyota Etios (nie vorher gehört) habe ich mich übrigens inzwischen gar nicht schlecht gewöhnt. Leider hat er kein automatisches Getriebe. Das wäre einfacher gewesen, aber dort, wo ich ihn gemietet habe, hatte es so kurzfristig kein solches Auto mehr im Angebot. Nun mach ich halt alles mit links! - Einzig das, was man zu Hause mit links macht, nämlich den Zeiger bedienen, macht noch immer Mühe manchmal - dort ist eben der Scheibenwischer…
Einsteigen tue ich nie mehr von der falschen Seite her, das habe ich gelernt, nur hin und wieder passiert es mir doch noch, dass ich die Sitzgurten aus der Luft ergreifen will.
Nach einer kurzen Siesta machen wir einen Spaziergang durchs Dorf. So ein hübscher ländlicher Ort ist das! Interessant ist, woher der Name stammt: von Clarens, einem Quartier von Montreux in der Schweiz (nie gehört), wo Paul Krüger, der erste Präsident und Held der Südafrikaner, der die Unabhängigkeit von Grossbritannien erwirkt hat, seine letzten Tage verbracht hatte und dort starb.
Es ist friedlich hier, endlich keine Zäune mehr, ein ganz anderes Afrika. Die Strassen sind nicht gepflastert;, wenn ein Auto vorbeifährt, hinterlässt es eine Staubwolke. Läden hat’s wie im wilden Westen und hübsche Restaurants. Wir essen in „Clementines“ - nach Tripadvisor die Nummer 1 am Ort. Eigentlich wollten wir draussen essen im schönen Garten, aber da kommt aufs Mal ein Sturmwind auf, der dieses Vorhaben zunichtemacht. Auch drinnen ist es gemütlich; wir erhalten einen Tisch im Wintergarten. Eine wunderbare Forelle wird mir serviert (wohl kaum aus dem Lake Clarens – wie ich aber später lese, ist dies das Gebiet mit den meisten Forellenbächen und -zuchten in SA), Theo bestellt sich Nudeln mit Pesto, die Serviertochter versteht nicht gut und fragt: „Vegetables?“, das wiederum versteht Theo nicht so gut und sagt „Ja“. – Ich verstehe es schon, entscheide mich aber, nicht einzugreifen, schliesslich soll er ja gesünder essen (und wie wär’s mit dem Hörgerät, das friedlich verstaut im Koffer liegt und dort keinesfalls gestört werden will?). – Seine Miene, wie er den Teller vor sich sieht, kann ich jedoch nicht als heiter beschreiben. Ich hätte mich wohl doch einmischen sollen. Er isst nämlich nur die Hälfte (das sind die Nudeln) und sagt, so viel Gemüse stelle ihm einfach ab.
In der Nacht regnet es. Ob der See…
Am Morgen hat’s Nebel. Ich glaub’s ja nicht. Wenn ich zum Fenster rausschaue, denke ich, es könnte November sein - irgendwo in der Schweiz.
Nach einem ausgiebigen Frühstück gehen wir tanken. Zum Glück haben wir uns zuvor bei unserem Gastgeber erkundigt, ob es ok sei, in der Garage zu tanken, die nur etwa 200 Meter vom Hotel entfernt ist. Sie sah mir nämlich ein wenig suspekt aus. Davon rät er uns dringend ab. Es passiere oft, dass im Benzin noch ein wenig Wasser drin sei, vor allem, wenn’s vorher geregnet habe. – Oben im Dorf hat’s eine andere Tankstelle. Ohne lange zu zögern, berücksichtigen wir diese.
Das Dorf oder Städtchen, eine Art Kurort zum Wandern offenbar und Fliegenfischen, ist jetzt voller Leben. Es hat aufgehört zu regnen, die Sonne zeigt sich, die Temperatur ist angenehm. Erstaunlich viele Touristen stöbern in den hübschen Boutiquen und Art-Shops herum und lassen sich in den Restaurants bewirten.
Kurz vor zwölf fahren wir los. Die Gegend ab hier ist atemberaubend schön und so gut wie menschenleer. Es ist, wie wenn man durchs Monument Valley fahren würde, das nie aufhört. Immer wieder tauchen erodierte Hügel auf aus Sandstein oder Basalt mit den krassesten Felsenformationen, Tafelberge manchmal auch. Weite farbige Ebenen tun sich vor uns auf, grünes Grasland, dunkelrote Erde, gelbe Felder, braune Felsen, rost- und dunkelbraune Kühe und Rinder und die schwarze Strasse führt geradeaus direkt zum endlosen Horizont, dorthin, wo die Welt aufhört. Im Rückspiegel aus der gegensätzlichen Perspektive dasselbe Bild - und wir sind mitten drin. Es geht rauf und runter und wenn wir den Horizont geschafft haben, geht alles von vorne los. Dasselbe Bild immer und immer wieder.
Ende des Philosophierens! - Verkehr hat’s spärlich, nicht selten dauert es zehn Minuten, bis einem ein Fahrzeug entgegenkommt. Verfahren kann man sich auch kaum mehr. Das Tom Tom zeigt zuverlässig an, wann die nächste Abzweigung kommt. – In 105 km. Das heisst, erst in etwa einer Stunde muss ich wieder in einen niedrigeren Gang schalten…
Etwas weiter südlich windet sich die Strasse durchs Gebirge, führt uns über Ficksburg (!), Ladybrand und Wepener schliesslich nach Zastro, wo wir nach dreistündiger Fahrt einen Halt machen. Ein ziemlich heruntergekommenen Ort ist das, wo zu wohnen ich mir überhaupt nicht vorstellen könnte. Nicht einmal ein Restaurant finden wir, wo man etwas hätte trinken können. Die meisten Läden sind geschlossen, dabei ist es Samstagnachmittag um drei. Eine Cola kaufen wir im Supermarkt, machen einen kurzen Spaziergang um den Block und verlassen das ungastliche Dorf. Eine halbe Stunde später passieren wir eine Brücke, welche die Provinz Freistaat mit der Provinz East Cape verbindet. Ab dort fahren wir durch Sterkspruit, eine Ortschaft, die auf der Karte ganz klein aussieht, die sich aber über ein ausgedehntes Gebiet erstreckt, das über viele Kilometer hinweg erst locker, dann dicht besiedelt ist. Nur Schwarze sehen wir. In der Ortsmitte läuft etwas: Es ist ein Durcheinander von Kühen, Ziegen, Schafen und Menschen, die alle irgendwohin wollen. Am Strassenrand hat’s lauter Marktstände und auf der Strasse selber alle paar dutzend Meter Bodenschwellen, die einen zwingen, nicht mehr als 20 km/h zu fahren.
Um halb fünf, nach gut vier Stunden Fahrt, sind wir in Lady Gray (1‘600 m über Meer). Auf dem Weg hierhin war’s stets ziemlich bedeckt, was wir schätzten, denn es war dadurch nicht so heiss und die Wolkenbilder zeigten die Landschaft immer wieder im neuen Licht. Zeitweise sah man immerhin den blauen Himmel zwischen den Wolken durchschimmern, aber endlich ist klar, dass wir dem Regen nicht würden entkommen können. - Kaum sind wir bei der Comfrey Lodge angekommen, beginnt es wie aus Kübeln zu giessen. Müsste ja nicht gerade jetzt sein, denke ich, doch hier sieht man das anders: Man ist über jeden Regentropfen froh.
Wir erhalten ein ganzes Cottage mit Küche, Schlaf-, Wohn- und Esszimmer, was wir zwar gar nicht brauchen, denn morgen geht’s schon wieder weiter. Wir sind die einzigen Gäste. Man kümmert sich rührend um uns, George, gediegen gekleidet in weisser zweireihiger Koch-Montur, kocht ein feines Dreigang-Menu, eine Flasche „Allesverloren“ Shiraz trinken wir dazu und freuen uns anschliessend aufs Bett und den nächsten Tag.
Zum Guesthaus gehört ein Park, in dem sieben Alpaccas frei herumlaufen. Sie sind grad kürzlich geschoren worden, erzählt man uns. Daher sehen sie auch seltsam aus: wie Pudel nach dem Hundecoiffeur-Besuch. Noch komischer ist’s am nächsten Morgen. Wie apathisch stehen sie in der Gegend herum, wie Statuen, völlig durchnässt und schauen bewegungslos stur in eine Richtung - jetzt eben wie begossene Pudel.
Sonntag, 6. November
Wir haben beide wunderbar geschlafen, obwohl es die ganze Nacht ohne Unterbruch geregnet hat. Das monotone Geräusch im Hintergrund hat wohl einschläfernd gewirkt.
Gegen halb zwölf mittags brechen wir auf. Das Dorf ist wie ausgestorben; es ist Sonntag. Wenigstens hat es endlich aufgehört zu regnen, die Temperatur ist angenehm. Ich möchte gerne tanken, denn irgendwo im Nirgendwo steckenzubleiben, wär nicht grad das höchste der Gefühle. Aber die Garage ist zu. Das macht mir ein wenig Sorgen, doch zum Glück finden wir schliesslich doch noch eine zweite Tankstelle, die bedient ist und wo wir den Tank wieder füllen lassen können.
Weiter geht’s durch die herrliche Landschaft. Es hat kaum mehr Verkehr, über weite Strecken sehen wir weder Menschen noch Kühe. Nur knapp 300 km ist der heutige Streckenabschnitt. Ständige Begleiter über all die Hunderten von Kilometern sind die Telefonmasten, die abwechslungsweise mal links, mal rechts der Strasse in Reih und Glied stehen.
Unterwegs machen wir dreimal Halt und wundern uns über die ausgestorbenen und heruntergekommenen Dörfer, durch die der Weg uns führt. Die Kirche ist jeweils das einzige gepflegte Gebäude, so scheint es uns. Gerne hätten wir irgendwo eine Tasse Kaffee getrunken. Das war nicht möglich. Alles zu. Und sogar, wenn das nicht so gewesen wäre, hätte es uns nirgends animiert zu verweilen. Rund um solche Ortschaften hat es schwarze Townships. Hütte reiht sich an Hütte, eine meist verlotterter als die andere. Abfall liegt überall herum, Ziegen und Menschen kümmert das offenbar wenig.
Wir fahren durch Aliwal North, Burgersdorp, Steynsburg, Hofmeyr und kommen schliesslich in Cradock an.
Gesten Abend habe ich „Annie’s House“ gebucht und die Unterkunft ist eine sehr gute Wahl. Wir haben ein kleines Cottage mitten im Garten mit einem himmlischen Bett, modernem Badezimmer und bestens funktionierendem Wi-Fi.
Theo erklärt Peter, unserem netten Gastgeber, dass er mir mit dem Gepäck nicht helfen könne, er dürfe nichts Schweres tragen wegen der Operation. – Da haben sich aber zwei gefunden! Vor vier Jahren hatte Peter dieselbe Operation (tripple Bypass sogar) und so ist das Thema fürs Erste gegeben: Erfahrungen und gute Ratschläge wurden ausgetauscht; jeder erzählte seine Geschichte.
Cradock macht auf den ersten Blick einen sehr viel besseren und saubereren Eindruck als die Orte, durch die wie heute gefahren sind. Es hat zum Teil gepflegte, schöne Häuser, aber auch hier ist alles wie ausgestorben. Auf einem fast dreiviertelstündigen Spaziergang sehen wir, dass auch im Ortskern manche Häuser stark zerfallen sind und Strassen und Trottoirs sind in so miserablen Zustand, dass es gar keine Geschwindigkeitsschwellen braucht, um den Verkehr zu beruhigen.
Kein einziges Restaurant ist offen. Wimpy nur bis fünf Uhr nachmittags und KFC drive-in ist die einzige Bude, die auch am Sonntagabend bis elf ihre Chicken an die Frau oder den Mann bringt. - Zum Glück hat Peter Bedauern mit uns und unseren trüben Nachtessens-Aussichten, so dass er eine Bekannte anruft und sie fragt, ob sie nicht für uns kochen kommen könne. Geneviève erbarmt sich unser ebenfalls, kommt und serviert uns Suppe, einen gut gehäuften Teller voller Fleisch, Reis, Kartoffeln und Gemüse, zum Schluss ein Dessert – wir sind gerettet.
Montag, 7. November
Nur zwei Stunden Fahrt haben wir heute vor uns. Ich bin sehr froh, dass wir die langen Strecken bereits hinter uns haben. Beim Losfahren sagt Tom Tom: „In 200 m rechts abbiegen“. Machen wir. Auf dem Display sehe ich anschliessend: in 175 Metern rechts abbiegen. Dazu kommt aber kein Ton, bis ich merke, gemeint sind nicht Meter, sondern Kilometer. Also gut, los in Richtung Port Elizabeth - im fünften Gang.
Unterwegs gibt’s doch mal ein Strassenschild, das 80 km angibt, und eines, das zeigt, dass eine Rechtskurve zu erwarten ist. Dazu eine Warnung für Lastwagen, dass die Strasse abschüssig wird. – Ja, und genau da sehen wir den ersten Unfall. Polizei und Krankenwagen sind zum Glück schon zur Stelle. Ein Lastwagen konnte nicht mehr bremsen, ist durch die Leitplanken gebrochen und hat sich im Gelände überschlagen. Wir sehen nur die Räder, die gegen den Himmel zeigen. Überall liegen Heuballen herum, er muss mit denen vollbeladen gewesen sein. – Man kriegt Gänsehaut und geht vom Gas. Ob der Fahrer das überlebt hat? – Kurz darauf begegnen wir einem grossen Tross mit etwa zehn Lastern, von Pilotfahrzeugen angekündigt. Sie transportieren je einen Windmühlenflügel, diese grossen, weissen Dinger. Jetzt, wo man sie aus der Nähe sieht, erkennt man erst, wie riesig die sind.
Je südlicher wir fahren, desto öfter sieht man grüne Felder, die mit überdimensionierten Wassersprinkler-Anlagen bewässert werden. Weizen wird angepflanzt, aber auch Gras für die riesigen Rinderherden. Ebenfalls erkennt man Obstplantagen von der Strasse aus. Die Farmen, von denen aus all dies bewirtschaftet wird, müssen enorm gross sein.
Wir machen auch heute wieder ein paarmal Halt auf offener Strecke. Mich faszinieren die Eisenbahnlinien, sowohl die vergammelten, die nicht mehr im Betrieb sind, still vor sich hin rosten und auf denen Büsche wachsen, als auch jene, wo doch täglich immer wieder mal ein Zug durchfährt. Sie sind ein vorzügliches Fotomotiv, so wie ebenfalls die Wind- und Wasserräder bei den Brunnen, die wilden Pflanzen, die Kühe und Schafe, vor allem, wenn sie dabei sind, selenruhig vor uns die Strasse zu überqueren.
Endlich kommt nach 175 km die Abzweigung. Jetzt geht’s nicht mehr weit und wir sind in Addo, dem Ort in der Nähe des Addo-Elephant-Parks. Dort wollen wir zwei Nächte lang bleiben, Theo kann ausspannen, ich geh einen Tag lang auf Safari und hoffe, die Big Five halt hier zu sehen, statt, wie ursprünglich geplant, im Krügerpark. Theo möchte lieber nicht mitkommen, was ich gut verstehen kann, denn ungepflasterte Strassen tun seinem zusammengeflickten Brustkorb nicht gut.
Abends gehen wir in einem sehr gepflegten Restaurant auswärts essen und erhalten viel zu grosse Portionen. 300 g Filet (vom Feinsten!) – kleiner gibt es das nicht. Theo isst (zum Teil zumindest) Pasta mit Huhn. Mit zwei Vorspeisen, einer Flasche Wein und einem Liter Mineralwasser zahlen wir am Schluss, Trinkgeld inklusive, knapp 40 Franken.
Dienstag, 8. November 16 – Addi –Elephantpark
Mein Tag: Safari von morgens bis abends. Wir sind zu siebt im halboffenen Jeep, Emanuel, der Fahrer, drei Israeli, zwei Holländer und ich. Viele Tiere sehen wir, allerdings nur zwei der Big Five: Büffel und Elefanten. Die dafür in rauen Mengen. Und Warzenschweine. Die sind so lustig, wenn sie mit ihren Schwänzen, die sie wie Antennen hoch in die Luft strecken, über die Strasse in den Busch hineinwackeln. Mit ihren knackigen, prallen Hintern kann ich mir gut vorstellen, dass sie für jeden Löwen ein Leckerbissen sind. Sie selber schmausen auch nach Gaumenfreuden am Boden herum, und damit sie diese Köstlichkeiten mit ihren viereckigen Mäulern besser erreichen können, gehen sie auf die Knie. Das sieht echt komisch aus.
Wie uns Emanuel erklärt, hatte es in dieser Gegend ursprünglich etwa 150 Elefanten. Sie wurden bis auf 11 Stück von den Bauern und Wilderern eliminiert, bis 1931 der Park gegründet wurde. Jetzt sind’s wieder ungefähr 700 Stück. Man sieht sie von sehr nahe, fast zu nahe für meinen Geschmack, und sie tummeln sich am Wasserloch in Scharen, was wunderbar ist zum Beobachten.
Der Park dehnt sich über eine Fläche von 1‘640 km2 aus; geplant ist, dass er doppelt so gross wird. Er ist der drittgrösste in SA. Nur gerade zehn Löwen hat’s auf diesem Gebiet, also kaum ein Wunder, dass wir weder einen von ihnen noch die Nadel im Heuhaufen gefunden haben. - Giraffen hat’s übrigens auch keine, das aber wegen der Vegetation. Hohe Bäume fehlen, die armen Tiere hätten sonst „Äkegschtabi“ und / oder würden verhungern. - Das kann’s ja wirklich nicht sein. - Dafür fühlen sich die Zebras, Büffel, Strausse, Vögel, Kudus und all andern Antilopenarten sehr wohl in den Ebenen und dem niedrigen Gebüsch. Genauso wie die Leoparden-Schildkröten, wobei ich lieber Schildkröten-Leoparden sähe, obwohl ich Mühe habe, mir genau vorzustellen, wie die dann aussehen würden.
Am Mittag werden wir von Emanuel mit einem vorzüglichen Braai verwöhnt. Er macht aus Orangenholz ein Feuer und wie nach einer halben Stunde eine ausgezeichnete Glut entstanden ist, legt er Spiesse aus Poulet und eine lange Wurst aus Antilopenfleisch auf den Grill. Dazu gibt’s Kartoffelsalat und Griechischen Salat sowie Toastsandwiches, gefüllt mit Käse und Tomaten, die er ebenfalls auf dem Grill röstet. Die Israelis möchten lieber Fisch…
Neun Stunden sind wir unterwegs, dann sind alle müde aber zufrieden, auch wenn wir keine Löwen gesehen haben.
Theo hat inzwischen den ganzen Tag lang „frei“ gehabt, und vielleicht erzählt er mal in seinem eigenen Blog, was er so getrieben hat. – Mir hat er erzählt, er sei dreimal ins Dorf gewandert und wieder zurück: neue Tagesbestleistung!
Mich nähme auch wunder, wie seine Kommunikation mit den Leuten im Dorf und im Hotel so vor sich gegangen ist. Er hat nämlich grosse Mühe, den Slang der Schwarzen zu verstehen. Seltsam, was er manchmal antwortet auf Fragen, die gar nicht gestellt wurden. – Mir fällt das weniger schwer, allerdings habe ich mich heute auf der Safari auch gefragt, was Emanuel genau meinte, als er von den „national beds“, den „Indwe“ sprach. Erst als er mit den Armen Flugbewegungen machte, wurde mir klar, er meinte „national birds“, die Blue Crane.
Wir essen im Pub des „Kraal“, unserer Lodge, ein Ehepaar aus St. Gallen leistet und Gesellschaft, anschliessend gehen wir früh schlafen.
Mittwoch, 9. November – Port Elizabeth
Heute ist es genau drei Wochen her, seit Theo operiert wurde. Das Ganze kommt mir immer noch völlig unwirklich vor, so als hätten wir es gar nicht erlebt.
Nur eine Stunde Fahrt liegt vor uns, ein „Nasenwasser“.
Unterwegs gibt‘s nur ein Thema: der neue amerikanische Präsident. Nicht zu fassen! - An 9/11 reiht sich 11/9 – die schwärzesten Tage der neueren amerikanischen Geschichte. - „If Trump is the answer, how stupid is the question?”
Kurz nach elf erreichen wir Port Elizabeth.
So sind wir die Strecke von Johannesburg hierhin halt gefahren, statt geflogen, wie ursprünglich geplant. Dafür haben wir eindrücklich erlebt, wie riesig die Distanzen sind, sind durch wunderschöne Landschaften gefahren, haben nette Leute kennengelernt in den Lodges, wo wir übernachtet haben, haben in Betten geschlafen mit hundert Decken je und zweihundert Kissen, so wie das hier üblich ist (die Prinzessin auf der Erbse hätte besagte Hülsenfrüchte unter ihrem zarten Körper nie und nimmer gespürt) und sind mehr als nur froh, dass wir das alles überhaupt tun können.
Jetzt beziehen wir unser Hotel und fragen, was man uns empfehlen würde anzuschauen in der drittgrössten Stadt vom Südafrika. – Nein, eine Mall hatten wir uns nicht vorgestellt, die gibt’s schliesslich auf der ganzen Welt. Sonst etwas Sightseeing-mässiges? Die beiden jungen Männer an der Rezeption sind ziemlich ratlos, aber wenigstens können sie uns ein Restaurant empfehlen.
Schon bei der Planung unserer Reise hatte ich im Internet nachgeschaut, was es hier Sehenswertes gibt, aber auch dort werden fast ausschliesslich Wildtier-Parks erwähnt, sonst nicht viel. - Ein Museum gibt’s, das mich interessiert, aber Theo ist eingeschlafen (Siesta!) und ich will ihn nicht wecken. Wie wir um vier schliesslich doch dort vor der goldenen Türe stehen, ist es bereits geschlossen. – Macht nichts. Morgen um zehn ist’s wieder offen, vielleicht können wir’s dann besuchen, das Schöne ist, wir haben ja Zeit.
Stattdessen fahren wir ans Meer, machen einen Spaziergang den Dünen entlang und trinken in einem Strandrestaurant einen Apéro. – Einem Strassenverkäufer kaufen wir zwei Bilder ab, die zwar ein wenig kitschig sind, uns aber doch gar nicht schlecht gefallen. In seine farbige Malerei hat er noch Teile von Blechbüchsen appliziert. – Er ist überglücklich, Käufer gefunden zu haben.
Endlich am Meer: Das müssen wir geniessen, auch vom Kulinarischen her. Im Restaurant „Ocean Basket“ mit herrlichem Blick auf die Promenade, den Strand und die Stadt im Hintergrund bestellen wir eine Fisch- und Meerfrüchteplatte für zwei.
Donnerstag, 10. November – Unterwegs ins Gamtoos Valley
Nach dem Frühstück besuchen wir die Art-Galerie, in der wir eine gute Stunde verbringen. Nebst einer zeitlich begrenzten, gibt’s auch eine Dauerausstellung, die uns begeistert. Ein lokaler Künstler, R. Belling, hat die verschiedensten Flugzeugtypen gemalt, und zwar gestochen scharf, wie fotografiert. Ebenso ist das Art-Deco-Haus, in dem die Bilder ausgestellt sind, sehenswert: weiss, schlicht – mit wunderbaren glänzenden Holz-Riemenböden, einer ansprechenden Architektur, einem Park ringsum. Der Besuch hat sich mehr als nur gelohnt.
Weiter geht’s in Richtung Westen. Es ist keine lange Fahrt in die Kouga – Region, ins Gamtoos Valley. Beeindruckend ist der Loerie-Damm, der Port Elizabeth mit Wasser versorgt. Er ist zwar halb leer und keine Menschenseele ist in der Umgebung…
In Loerie machen wir Halt, vielleicht gibt’s eine Tasse Kaffee. Ja, die gibt’s. Eine gut unterhaltene Kirche steht dort, daneben eine weniger gut unterhaltene „Einkaufsmeile“, mitten in der Landschaft, ein wenig abseits der Strasse nur, bestehend aus drei „Geschäften“, einem MINI-Supermarket, einem Secondhand-Shop sowie einem Coffee-Shop. Wie wir ankommen (die Parksituation erinnert mich stark an diejenige an der „Front“ in Bern damals, als man seinen Schlitten schnittig direkt vor dem „Grotto“, dem „Highnoon“, dem „Mazot“ oder dem „Fedi“ parkieren konnte, die Autoschlüssel lässig klimpernd in der Hand…), schliesst die Fundgrube grad die Tür, was ich ein wenig bedauere, denn manchmal kann man in so einem Etablissement schon noch eine überraschende Trouvaille finden oder sich zumindest wundern... – Kaum sind wir im Coffee-Shop verschwunden, öffnet die Besitzerin den Laden wieder, wohl in freudiger Erwartung, vielleicht doch ein Geschäft machen zu können. – Es bleibt allerdings beim Wundern. Zwar kann man allerlei Nützliches kaufen, unter anderem völlig verkratzte Bratpfannen für eine Fünflieber, ausgelatschte Schuhe, gebrauchte Kleider aus der Modekollektion 1950, schätze ich, ausgediente Kühlschränke und viel „Aamächeliges“ mehr, aber es fällt mir trotzdem nicht schwer, für einmal auf einen Erwerb zu verzichten.
Auch in der Cafeteria kann man seine Shopping-Gelüste aufs Beste befriedigen, wenn man Fan ist von religiösen Sprüchen auf Karton- oder Blech-Plakaten. - Theo jedenfalls findet den Kaffee ganz in Ordnung.
Die erschöpfende Shopping-Meile ist höchstens etwa fünfzig Meter lang, man ist also relativ rasch durch. Und sollte die Kohle beim Grosseinkauf doch nicht reichen, hat’s noch eine ATM-Maschine, wo man Bargeld beziehen kann.
Der Ort ist offenbar auch Treffpunkt der örtlichen Polizei, grad drei Polizeiwagen parkieren vornedran.
Ich aber sehe etwas anderes, was mich völlig fasziniert: Loerie hat einen Bahnhof beziehungsweise hatte mal einen. Er ist stillgelegt seit ungefähr fünfzehn Jahren, wie wir später erfahren. Zwischen den Gleisen wachsen Büsche und Sträucher, eine ganze Güterzug-Kombination steht noch dort, verweist, ausgehöhlt, ein Relikt aus einer anderen Zeit. – Was für ein Ort! Das Bahnhofgebäude ein Wrack, das Ortsschild noch knapp zu lesen: „LOERIE – 29 m über Meer“. Unweigerlich stellt man sich vor, wie das hier vor hundert Jahren ausgesehen haben mag. – Natürlich knipse ich viele Fotos.
Ein leichter Regen setzt ein, fast eine Wohltat, denn es ist recht warm geworden.
Inzwischen ist Theo in ein Gespräch mit zwei Cops vertieft. Beim Kaffee-Holen hat er offenbar seine Kamera draussen auf dem Tisch liegen lassen und das Auto ist auch nicht abgeschlossen - den Schlüssel hab ich in meiner Hosentasche. Die Polizisten ermahnen ihn, nicht so fahrlässig zu sein; wir seien hier nicht in der Schweiz, sondern in Südafrika und da seien auch die Polizisten korrupt…
Wir fahren ein paar Kilometer weiter nach Hankey, einem grösseren Ort, schön in der Ebene gelegen im grünen Gamtoos-Valley. Ein paar meiner Lieblingsbäume, die violetten Jakaranda-Trees, säumen die Strasse. Die grösste Sonnenuhr Südafrikas soll’s dort geben, die sehen wir aber nicht, weil die Zufahrt gesperrt ist. Der „weisse“ Stadtteil ist klein, besteht fast nur aus dem SPAR-Supermarkt, der Caltex-Tankstelle und sonst noch ein paar Häusern; die schwarze Township darum herum ist allumfassend. Grad ist die Schule aus, hunderte von Schulkindern sind auf dem Nachhauseweg.
Es beginnt in Strömen zu regnen. Wir fahren zurück Richtung Süden gegen Jeffrey’s Bay. Bei der Mündung des Gamtoos-Rivers habe ich vor etwa einem Monat ein Hotelzimmer gebucht, das ich dann allerdings wieder stornieren musste. Mir hat die Idee gefallen, zur Abwechslung an einem Fluss zu übernachten; im Internet hiess es, man könne am Abend dort auch an romantischen (!) Flussfahrten teilnehmen. - Nun denke ich, es wäre grad gut, die nächste Nacht dort zu verbringen, auch ohne Reservation. Allerdings ist es nicht ganz einfach, das Haus zu finden, aber schliesslich, kurz vor der Brücke, steht der Wegweiser zur Lodge und wir sehen von oben her auf den Hotel-Komplex hinunter. - Sie haben noch ein Zimmer. – Kein Wunder. Wer verirrt sich bei diesem Wetter schon hierhin? - Eigentlich wäre die ganze Anlage wunderschön gelegen, direkt am Fluss, der recht breit ist, fast doppelt so breit wie die Aare, und erstaunlicherweise auch viel Wasser führt. Ebenfalls gehört ein Campingplatz dazu. Nur ist alles völlig ausgestorben, die Nebengebäude des Hotels teilweise in desolatem Zustand, aber das Zimmer, das wir erhalten, ist gemütlich und wir fühlen uns sehr wohl. Wir sind die einzigen Gäste, müssen schon um sechs essen gehen, weil nachher die Küche bereits schliesst. Im Speisesaal hätten gut und gern einige Dutzend Gäste Platz, wir essen aber lieber in der Bar, da fühlen wir uns nicht so verloren. Zudem ist es kalt geworden und ungemütlich. Die Angestellten tragen Wollkappen und warme Jacken mit Kapuzen. Eine ganze Küchenmannschaft und drei Service-Angestellte sind nur für uns da, die Szene wirkt ein wenig skurril. Aber jetzt – alles ok, wir sind sehr froh, dass wir eine Unterkunft haben, ein feines Nachtessen bekommen, ohne dass wir zwecks Nahrungsaufnahme bei diesem Dauerregen in den nächsten Ort zu fahren brauchen. Leider müssen wir auch auf die „River-Cruise“ verzichten; sie fällt buchstäblich ins Wasser.
Wir hoffen sehr, dass es am nächsten Tag trocken ist und wir zumindest einen Spaziergang machen können in dieser schönen grünen Gegend.
Freitag, 11. November – Plettenberg Bay
Wir haben gut (früh) geschlafen und bekommen ein feines Frühstück serviert. Die vielen Mitarbeiter sind emsig am Vorbereiten: Am nächsten Tag findet eine Hochzeit statt, siebzig Personen werden erwartet.
Es hat fast die ganze Nacht durchgeregnet und ist nicht wärmer als etwa 15 Grad, dazu bläst ein kühler Wind. Erstaunlicherweise ist das weiche Gras so gut wie trocken und wir machen einen Spaziergang durch den Park zum Fluss hinunter. Das kleine Fährschiff steht ganz verlassen da, im Supermarkt ist auch nichts los – morgen, wenn die Hochzeitsgäste da sind, wird’s wohl anders aussehen…
Theo trägt ein Hemd, darüber sein Allerwelts-Holdall-Gilet, darüber eine Windjacke. – Jetzt übertreibt er aber. Sooo kalt ist es nun auch wieder nicht heute Morgen.
Gegen elf Uhr fahren wir los in Richtung Plettenberg Bay. Unterwegs gibt’s zwei Zwischenhalte, den ersten bei der Storm River Bridge (Paul Sauer Bridge) im Tsitsikamma Coastal National Park, wo wir einen feinen Cappuccino trinken und anschliessend von der Brücke aus einen atemberaubenden Blick in ein tiefes Canyon haben.
Der zweite Halt bietet ebenfalls den Blick auf eine Brücke, von der aus man einen spektakulären Adrenalin-Sprung machen kann („The world's highest bridge bungee jump“ - Bloukrans Bridge, South Africa - 216 Meter), wenn’s einem gefällt. - Uns gefällt nur das Zuschauen.
In Plettenberg Bay finden wir ein Hotel im Zentrum, mitten in der Mainstreet - mal zur Abwechslung ein wenig Leben um uns herum. Hier wiederum erfahren wir erneut ein völlig anders Afrika, sehr westlich. Es hat Läden, Restaurants und Verkehr, so wie wir das bei uns gewohnt sind. Und Tripadvisor sei Dank finden wir ein schönes, gemütliches Restaurant, das „Look Out“, direkt am Meer gelegen mit einer phänomenalen Aussicht auf den Strand und die Lagune.
Ich bestelle ein Thunfisch-Steak, Theo versucht’s wieder mal mit Tagliatelle Pesto. Und wieder versinken die Nudeln im Gemüse und er hat seine liebe Mühe, dieses säuberlich auszusondern. Ein Broccoli-Stück hat sich trotzdem auf seine Gabel verirrt. Das ist nur möglich, weil, kaum haben wir unser Essen vor uns, es einen Kurzschluss gibt, das Licht geht aus und kommt nicht wieder. Die Kellner bringen sogleich Kerzen. Niemand reklamiert. Im Gegenteil: alle Gäste geniessen ihr Candle-Light-Dinner.
Theo mag den steilen Hang zum Hotel hinauf nicht gehen, also nehmen wir ein Taxi und verkriechen uns alsdann im warmen Märchenbett.
Samstag, 12. November – Unterwegs nach Sedgefield
Im Hotel ist das Frühstück nicht inbegriffen. Aber da wir mitten im Ort sind, haben wir ganz in der Nähe eine grosse Auswahl an Lokalen, also suchen wir ein nettes Café.
Dummerweise kommen wir dabei an einem Haushaltsgeschäft vorbei und ober-dummerweise führen die die sogenannten Breville-Toaster. Trotz all meiner heftigen Protesten und Gegenargumente kann ich meinen Ehemann nicht davon abhalten, einen solchen zu kaufen. – Ich ärgere mich total!!! - Da gebe ich mir eine solche Mühe, unsere Koffer nicht zu überladen (nur 23 kg sind erlaubt), möchte doch auch das eine oder andere noch „gänggele“ vor der Heimreise und Theo kauft sich einen Toaster!
Ein solches Gerät hatte er in Wellington kennengelernt auf unserer Neuseeland-Reise vor zwei Jahren. Er war fasziniert von der effizienten und schonenden Art und Weise, wie dieser mit den Brotscheiben umging. Zu Hause wollte er dann einen ebensolchen kaufen (und mir zum Geburtstag schenken...). Das war allerdings nicht möglich, europäische Normen verhinderten den Erwerb, auch online wurde er nicht fündig. – Aber jetzt hat er ja einen…
Wir checken aus dem Bay View - Hotel aus und fahren weiter in Richtung Westen. Unterwegs machen wir in einem Farmers-Market Halt, es ist Samstag, da sind solche bunten Märkte an vielen Orten zu finden. Allerlei Kunsthandwerkliches, frische Farm-Produkte und auch Kleider sowie Schmuck werden angeboten. Ich kaufe Gemüse und frische Kräuter, schliesslich haben wir von heute Abend an wieder eine Küche zur Verfügung und können selber kochen.
Auch in Knysna gibt’s einen Stopp. Theo trinkt eine Tasse Kaffee; ich erleichtere eine ATM-Maschine mit Knete-Nachschub.
Es regnet immer wieder mal, die Landschaft zeigt sich grau in grau. Eine halbe Stunde später sind wir in Sedgefield und finden dank Navi unsere neue HomeExchange-Unterkunft auf Anhieb.
Werner hat die Fahrt von Johannesburg aus in nur zwei Tagen geschafft und ist bereits kurz vor uns zu Hause angekommen. – Mit einem Glas Wein werden wir von ihm und seiner Frau Cheryl herzlich begrüsst. Anschliessend beziehen wir ihr hübsches Cottage, das mit separatem Garten neben ihrem Haupthaus steht und bestens bestückt ist mit allem, was wir brauchen.
Endlich können wir nach acht Tagen mal alles aus dem Auto ausladen und uns gemütlich einrichten.
Ein Einkauf bei Pick n‘ Pay, ein gesundes Nachtessen mit Salat, Gemüse und Poulet-Fleisch, dazu die Hoffnung, morgen etwas Sonne zu sehen, beschliessen unseren Tag.
Sedgefield
Theo geht’s gut! - Wären wir heimgeflogen, wär er jetzt eventuell in Heiligenschwändi zur Kur oder an einem ähnlichen Ort. Kalt wär’s draussen, Nebel und Regen... – Wir finden es hier viel schöner!
Die Woche in Sedgefield ging rasch vorbei, obwohl wir gar nicht sehr viel unternommen haben. Ausruhen war schliesslich angesagt, und das haben wir ausgiebig getan. Leider war’s die ersten paar Tage ziemlich regnerisch und recht kühl, aber eigentlich hat uns das gar nicht gross gestört; wir haben ja Zeit.
Sedgefield ist ein seltsamer Ort. Die N2, die Strasse, die durch die Garden Route führt, teilt den Ortskern, wenn man so sagen kann, in zwei Teile. Beidseitig auf der Länge eines Kilometers etwa hat es Läden, aber alle machen einen mehr oder weniger heruntergekommenen Eindruck. „Nothing to write home about“, für Touristen kein Paradies. – Nur die Apotheke macht einen guten Eindruck und auch der Autohändler am Eingang des Dorfes mit seinen Oldtimern. – Über den Schuhmacher sind wir froh; der schwarze Angestellte flickt unsere Schuhe, bei denen sich vom vielen Spazieren (!) die Sohlen gelöst haben, perfekt in Rekordzeit für einen Pappenstiel und das in einem Mini-Ladenlokal von nicht grösser als 3m2.
Der „Rest“ des Ortes besteht aus unzähligen Einfamilienhäusern, einige wohl nur als Ferienhäuser bewohnt, bis hinunter zum Meer. Sicher war nicht nur ein Architekt am Werk. Trotzdem: Am beliebtesten sind die dreieckigen Häuser, nach holländischem Vorbild. Sie sind, wir sehen das auch bei unseren Gastgebern, speziell einfach zum Möblieren...
Schön ist die Ruhe, die dort herrscht und es ist ein tolles Gebiet für Spaziergänge im Goukamma Naturschutzgebiet. Zweihundert Meter entfernt von wo wir wohnen, ist man bereits am Wasser. Flussarme und Meeresbuchten fliessen ineinander über, und hinter den hohen Dünen findet sich das weite Meer.
Wie erwartet hält sich Theo kaum an die Nahrungsvorschriften, die ihm im Spital gemacht wurden, aber zumindest versucht er die Ermahnung, sich viel zu bewegen, mehr oder weniger zu beherzigen. So macht er jeden Tag seinen Spaziergang.
Spaziergänger anderer Art haben wir auch im Garten unseres Cottage.
Schildkröten kriechen vorbei. Kleinere und grössere. Sie gehören niemandem, sind also wild. Obwohl „wild“ im Zusammenhang mit Schildkröten eine etwa seltsame Bezeichnung ist.
Ein Perlhuhn Ehepaar wandert am liebsten auf der Mauer, die das Grundstück umgibt, da haben die beiden einen schönen Ausblick.
Zum Glück hat’s so gut wie keine Mücken, und auch „the creepy and crawly“ verschonen uns fast gänzlich.
Das Nachbarsbüsi kommt vorbei, wenn ich Wäsche aufhänge auf der Stewi-Libelle (auch so eine Nostalgie-Erinnerung und wohl etwas typisch Schweizerisches). - Es muss grauenhaft jammern, weil es überall Vogelgezwitscher hört, aber zu träge ist, einen zu fangen.
Ja, Vögel hat’s unendlich viele. Demnach auch ein unaufhörliches Gezwitscher, Geschnatter und Gekeife. Vor allem der eine Typ regt ziemlich auf, der nur gerade ein Sechs-Ton-Lied beherrscht, das er immer und immer wieder vor sich hin flötet. Ich glaube, der sucht eine Gespielin, aber bei dem Gesang… Ich gönnte ihm zwar gerne zwei oder gar drei davon, wenn er doch nur endlich den Schnabel hielte!
Zu Sedgefield gehört auch der grösste salzhaltige Binnensee Südafrikas, der Swartvlei. Die Gegend um den See herum erinnert an die Schweiz, nur dass da keine Häuser zu sehen sind. Es hat aber einzelne exquisite Lodges; in der Lake View Lodge kann man Wein degustieren oder auch nur eine Flasche zum Apéro trinken, dazu lassen wir uns an einem schönen Spätnachmittag sehr gerne verleiten.
Auf unserer Reise haben wir ja jeden Abend auswärts gegessen, so sind wir nun ganz froh, gemütlich „zu Hause“ tafeln zu können. Es gibt nur einen Supermarkt in Sedgefield, den Pick n‘ Pay, aber die Auswahl, die er anbietet, ist nicht umwerfend. Nicht einmal Fisch ist im Angebot. Da muss man schon 20 km nach Knysna fahren, um welchen zu kaufen oder in die andere Richtung nach George, 35km. - Seltsam, ein Ort direkt am Meer… Einmal sind wir bei unseren Gastgebern eingeladen mit einem weiteren Ehepaar aus der Schweiz, also eine Art Schweizerabend, zum Glück aber ohne Fondue und dergleichen. Cheryl hat ein herrliches Gericht zubereitet aus Ente (aus Knysna), Nudeln und Salat. Cheryl ist übrigens Südafrikanerin, aber sie spricht, soweit ich das beurteilen kann, ein lupenreines Züridütsch; Werner hat’s ihr beigebracht.
Restaurant direkt am Meer hat’s keine in Sedgefield. Hinter den Dünen schon. Im Pili Pili, die Füsse im Sand, am wärmenden Feuer, gibt’s feine Pizzas, nette Bedienung und eine gemütliche Atmosphäre.
Samstag ist Markttag – Farmers-Market - rain or shine. Sehr bekannt offenbar in der ganzen Gegend. Fein frühstücken kann man dort, es gibt guten Kaffee und so einiges zum Gänggele.
Ausflüge
An einem grauen Nachmittag fahren wir nach George, mit circa 250‘000 Einwohnern eine der grösseren Städte des Western Cape und das Herz der Garden Route. Viel Sehenswertes gibt’s nicht, den Ort selber kann man sich sparen, aber es hat ein tolles Transportmuseum (und ein Museumsbesuch ist bei diesem Regen genau das Richtige), wo all die Züge ausgestellt sind, die einst in dieser Gegend Passagiere und Güter von Ort zu Ort gebracht haben. Jetzt stehen sie in einer riesigen Halle und man kann sie zum Teil auch von innen besichtigen und bewundern. – Ebenfalls bietet das Museum Platz für eine Vintage-Car-Ausstellung. – Sogar den Borgward Isabella hat’s dort. An den erinnere ich mich gut…
Zum Coiffeur hätten wir beide schon längst mal gehen sollen. Auch dafür ist das Wetter ideal. Die drei Damen im Haarsalon haben nichts zu tun und freuen sich über unseren Besuch. Sie machen’s richtig gut; wir sind sehr zufrieden. 18 Fr. für beide neuen Coupes - reichlich Trinkgeld inbegriffen – nicht schlecht!
Am Dienstagabend, dem ersten schönen Tag in dieser Woche, laden wir Cheryl und Werner zum Nachtessen ein. In Wilderness, dem Nachbarort, kehren wir in einem Restaurant ein mit Terrasse und Blick direkt aufs Meer und den Sonnenuntergang.
Die beiden und auch Theo, der Wild gerne mag, bestellen Springbok-Shanks, was der Kellner als Today’s Special anbietet. Ich bleib lieber beim Fisch. – Und bin froh! – Es kommen sechs Schenkel daher (der Springbock - eine Antilopenart - kann zwei Meter hohe Sprünge machen und seinen Feinden mit Geschwindigkeiten bis zu 90 km/h entfliehen. – Diesen hier auf den Tellern ist das offensichtlich nicht gelungen). - Ich kann mir nicht vorstellen, wie man all das essen kann. Aber es geht. Nur Werner lässt sich einen Doggie-Bag geben.
Einen Tag verbringen wir doch am Strand. Das Wetter ist jetzt besser. Allerdings hat es einen so starken und kühlen Wind, dass er uns fast wegbläst. Die Kite-Surfer freut’s – auch die Gleitschirmflieger; wir finden ein geschütztes Plätzchen in den Dünen.
Ein paar Kilometer weiter westlich hat’s ein sogenanntes „Organic Village“, „Timberlake“, also ein Bio-Dorf mit verschiedenen kleinen Geschäften, die allerlei Alternatives und Hausgemachtes anbieten, aber man kann dort auch Tree-Top-Climbing buchen und Reiten. – Da kann ich nicht widerstehen. Auf dem Pferderücken eine Gegend zu erkunden hat mir immer schon gut gefallen, speziell in den Ferien; man kommt oft an Orten vorbei, die man weder zu Fuss noch mit dem Auto erreichen kann. Und zudem macht es Spass. Schon seit längerer Zeit hab ich das nicht mehr gemacht, aber jetzt und hier - an einem schönen Nachmittag lass ich mir die Gelegenheit nicht entgehen.
Wir sind zu dritt, zwei Girls aus Holland, die dort einen Freiwilligeneinsatz leisten und ich. Wir reiten durch dichte Vegetation, es geht zum Teil steil bergauf und von einer Krete aus haben wir einen herrlichen Blick auf ein stilles Tal mit verschiedenen Seen. Weit und breit sind keine Häuser in Sicht.
Ein weiterer Ausflug bringt uns nach Knysna (ausgesprochen: Naiss-na), einer Feriendestination mit netten Läden und Restaurants an der Waterfront. Dort essen wir am Abend in einem Fischrestaurant und geniessen den Blick auf den Hafen und die untergehende Sonne.
Vorher aber, am Nachmittag, besuchen wir den Nachbarort Brenton-on-Sea, von wo aus man einen fantastischen Blick hat auf Küste und Felsen. Ein Weg führt hinunter zum Strand und wir machen einen langen Spaziergang. Ein Schild sagt, man solle lieber dort nicht schwimmen, und damit auch Deutsche das gut verstehen, hat einer wohl den Google-Translator bemüht – es heisst „Höre auf zu schwimmen“. - Ok, ok, wir haben zwar noch gar nicht angefangen, aber machen wir doch. - So viele Quallen wurden angeschwemmt, dass einem die Lust zum Schwimmen so oder so vergeht, bevor sie sich überhaupt einstellen kann.
George – Choo Tjoe-Fahrt
Am Tag, an dem wir Sedgefield in Richtung Mossel Bay verlassen, kommen wir wieder in George vorbei. Das Transport Museum bietet eine Zugfahrt in die Berge an, auf die wir beim letzten Besuch wegen des Regens gerne verzichteten, aber jetzt, wo’s zwar wieder nicht strahlend schön ist aber doch einigermassen passabel, entschliessen wir uns, die zweieinhalb-stündige Fahrt mitzumachen. Ursprünglich gab’s einen Zug, der von George bis Port Elizabeth fuhr, aber weil bei Überschwemmungen vor zehn Jahren ganze Teile des Bahn-Trassees weggespült und nicht wieder aufgebaut worden waren, ist diese „Outeniqua-Powervan“-Fahrt das einzige Überbleibsel dieser Strecke, die nur noch etwa 30 km lang ist.
In den beiden Powervans haben je ungefähr zehn Personen Platz. Diese dienten ursprünglich dazu, die Züge anzustossen, jetzt stossen sie Touristen den Berg hinauf. – Aber der Ausflug hat sich gelohnt. Was für eine spannende kleine Reise in die wunderbare Gegend der Outeniqua-Mountains, durch weite Fynbos-Landschaften und Wälder, durch sechs Tunnels. Immer wieder mal überqueren Affen und Bush-Böcke die Gleise vor uns. An der „Endstation“, wo der Zug wendet, schauen wir auf den Montague-Pass hinunter (745 m hoch, anno 1847 nach drei Jahren Arbeit durch 250 Häftlinge fertiggestellt, die älteste unveränderte Passstrasse in Südafrika) und bei einem Pick-nick-Halt gibt’s einen Panorama-Ausblick auf George und Umgebung.
Bis Mossel Bay ist’s nur noch eine gute halbe Stunde Fahrt, das schaffen wir in Nu. – Wieder mit dem Auto natürlich.
Mossel Bay
Vom 21. bis am 30. November wohnen wir in einem Apartment im sechsten Stock mit Blick auf die Diaz Bay. Wir unternehmen etliche Strandspaziergänge und besuchen auch gerne das Städtchen. Lieblings-Coffee-Shop: Blue Shed / Lieblings-Restaurant: La Peron.
An Theos Geburtstag, dem 24. November: Wir frühstücken bei herrlichem Wetter in einem Restaurant am „Point“, der Strandpromenade, spazieren anschliessend zum Leuchtturm (St. Blaize Trail) und besuchen am Nachmittag die verschiedenen Museen im Barthalomeu Diaz-Museum-Komplex. Drinnen und draussen gibt es manches zu sehen: Historische Gebäude, Schiffe und Teile davon, Muscheln, Meergetier, den alten Postbaum und und und.
Am Abend essen wir im Kaai4. - Das Restaurant am Hafen mit toller Aussicht und „Füsse im Sand“ wurde uns empfohlen und auch im Tripadvisor ist’s die Nummer 2 am Ort.
So günstig haben wir noch nie gegessen (15 Fr. alles inklusive). Aber schön war’s und gut. Wein gab’s keinen; zum Glück hatte ich eine Flasche bei mir, weil ich noch fast befürchtet hatte, dass es dort keinen gibt, denn der Beschreibung nach handelte es sich nicht um ein Fünfsterne-Etablissement, eher ein gemütliches Backpacker-Lokal. Was ich nicht wusste, war, dass dort alles nur in Blechgeschirr serviert wird. Gläser gibt’s nämlich auch keine, für den Wein erhielten wir an der Bar, wo man bestellen muss, zwei ziemlich fragwürdig aussehende Blechtassen. Als der Barkeeper mein entsetztes Gesicht sah, hatte er Bedauern und schliesslich, nachdem er sich mein Gejammer angehört hatte, auch ein Einsehen. Jemand ging uns zwei Gläser holen, irgendwoher – ein Weisswein- und ein Rotwein-Glas.
Es war ein unvergesslicher Abend, ich möchte ihn nicht missen.
An einem Nachmittag überlasse ich Theo seinem Schicksal und geh auf Safari im Botelierskop-Game-Park. Der Name stammt von dem speziellen Felsen, der irgendwann mal kippen könnte, wenn’s dumm geht.
Am lustigsten finde ich die gut getarnten Straussen-Küken, die im Gänse- oder eben im Straussenmarsch aufs Beste bewacht von ihren Eltern, brav durchs hohe Gras hinter ihnen herwackeln.
Die Augen der Strausse seien grösser als ihr Hirn, erzählte der Guide. Daher seien sie mehr aufs Sehen als aufs Denken fokussiert. Sie sehen sehr gut, so dass, wenn sich etwas Verdächtiges bewegt 300 Meter weiter weg, ihr Auge ihnen sagt, hau lieber ab, solang noch Zeit ist. So sind sie oft auf der Flucht auch ohne tatsächliche Not. - Sogar der „national bed“ zeigt sich diesmal, der Blue Crane.
Unterwegs von Mossel Bay nach Cape Town 30. November – 4. Dezember
Ziemlich schwer tat ich mir mit der Auswahl des Übernachtungsorts am ersten Abend. Da gibt es so viel zu sehen unterwegs, so schöne Orte zu besuchen – das alte Lied von Wahl und Qual.
Ich erwähne die Orte, die ich im Auge hatte, dann aber nicht gewählt habe, trotzdem, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, wieder mal in dieser Gegend Ferien zu machen, und dann würde ich mich daran zurückerinnern, ohne lange suchen zu müssen.
Erstens: bei Heidelberg („Skeiding Guest Farm“, eine Schaf- und Strauss-Farm) / zweitens: Witsand / drittens: Barrydale, „Karoo Moon Hotel“ und viertens: Still Bay „Anchoridge“).
Das Letzte haben wir schliesslich gewählt, das fabelhafte Guest House liegt am Goukou River, der nicht weit davon ins Meer fliesst. Je nach den Gezeiten aber ist es genau umgekehrt und das Meer fliesst in den Fluss, so dass dieser die Richtung ändert. Man kann im Fluss schwimmen und ich stellte es mir ganz interessant vor, wenn es der Aare mal in den Sinn käme, in die andere Richtung zu fliessen.
An der Mündung, wo der Goukon ins Meer fliesst, kann man wunderbar spazieren, dem Strand entlang – kilometerweit, wenn man möchte. Still Bay ist auch bekannt unter dem Namen „The Bay of the Sleeping Beauty“, das ist eine Bergkette, die mit viel Fantasie eben aussieht wie eine schlafende Frau – man sieht die Dame, wenn man gegen Norden schaut.
In der Nähe des Hafens kann man bei Ebbe die sogenannten „Fish-Traps“ erkennen, Fallen, mit denen schon die Khoisan (Hottentotten und Buschmänner) vor Jahrhunderten Fische gefangen haben. Es sind runde Steinkreise, die Pools bilden, aus denen es kein Entrinnen mehr gab.
Heute fängt man die Fische anders und zwei dieser Exemplare essen wir zum Znacht am „Fisch-Kiosk“ im Restaurant „Viking Fishing Anchor Restaurant“ – direkt aus dem Kutter auf den Teller.
Von der N2, die von Osten nach Westen und natürlich auch umgekehrt durch die Garden Route führt, gibt es an manchen Abzweigungen Abstecher ans Meer. Nicht immer führt an der Küste eine Strasse entlang, so muss man also, wenn man einen solchen Ort wählt, dieselbe Strecke gegen Süden und wieder zurück zur N2 fahren, was manchmal doch einen Umweg von 30 oder noch mehr km mal zwei bedeutet. Für Still Bay hat sich dies gelohnt. Und wir hatten Glück: Während etwa zehn Kilometern ist die Strasse nur einspurig befahrbar, weil der Belag erneuert wird. Da kann es vorkommen, dass man sehr lang warten muss, bis die Ampel wieder auf grün schaltet beziehungsweise bis man von den Arbeitern das Schild „GO“ zu sehen bekommt und durchgewinkt wird. Aber eben – wir konnten beide Male ohne Verzug fahren. Überhaupt hat es unterwegs etliche Baustellen, fast wie bei uns auf den Autobahnen. Die Strassen werden in diesem Teil des Landes also bestens unterhalten; Schlaglöcher hat’s so gut wie keine mehr.
Auf dem Rückweg zur N2 machen wir einen kurzen Halt in der exklusiven Gin-Distillery „Inverroche“, wo Theo drei verschiedene Gin degustieren kann und eine Flasche dann natürlich auch kauft. Ich halte mich zurück.
Richtung Norden kommt die Sleeping Beauty immer näher und die Route führt zu ihren Füssen über den Garcia Pass. Vor dem Anstieg ist die Landschaft prächtig grün, dann sieht’s fast aus wie auf dem Julier bei uns in Graubünden auf über 2000 Metern, wo’s keine Bäume mehr hat, nur noch Weiden, dann Felsen und Geröllhalden. Aber hier sind wir ja nur wenige Meter über Meer. Die Passhöhe ist 550 m hoch. Auf der anderen Seite, wo’s wieder bergab geht, ändert das Klima völlig. Es ist der Beginn der kleinen Karoo, einer Art Vorwüste. Die Temperatur ändert, es ist jetzt viel wärmer als drüben. Auch die Vegetation ist karger, nur wenn eine Farm in der Nähe ist, gibt es grüne Flecken in der braunen Landschaft.
Mitten auf der Strecke steht „Ronnie‘s Sex-Shop“. - Da hat einer ein glückliches Händchen gehabt in der Wahl seiner Geschäftsidee. – Wohl jeder Touristenbus hält dort an, jedes Auto ebenfalls. Wir natürlich auch. Es ist sowieso Zeit für einen Drink. In der dunklen Bude sind alle Wände vollgeschrieben mit Adressen, Visitenkarten sind überall angeklebt, Büstenhalter in rauen Mengen hängen von der Decke herab sowie T-Shirts oder Caps (was sollen die armen männlichen Besucher auch anderes beitragen zum Zirkus, Unterhosen können’s ja lieber nicht sein).
Wir fahren weiter nach Barrydale. Man hat das Gefühl, es sei ein Bergdorf, es macht zum Wandern an. Was für ein lustiges Hotel ist dann das Karoo Moon Hotel, das ich fast für eine Nacht gebucht hätte. Hier hat man das Gefühl, man sei in den USA. „Route 62“ heisst’s auf dem Schild, grad gleich wie die berühmte „66“. Der Besitzer hat ein riesiges Sammelsurium an Oldtimer-Kotflügeln, -Stossstangen und sonstigen Wrack-Teilen, ausgedienten Benzinzapfsäulen, Plakaten, Krimskrams jeglicher Art und Weise, alles überfüllt und überhäuft mit Karsumpel, aber originell und zum Teil wirklich sehenswert. Wie der Besitzer merkt, dass es mir hier gefällt und ich Fotos mache, zeigt er mir die Herrentoilette mit all dem Schnickschnack, der dort drin ist und holt dann noch den Schlüssel zum Hotel, zeigt mir alle Zimmer und erzählt mir vom Werdegang dieses speziellen Ortes. - Lustig, lustig!
Anschliessend führt uns die Route über den Tradow-Pass. Und wieder hat man das Gefühl, man sei im Hochgebirge (Passhöhe 348 m) mit schroffen Felswänden, fast wie in einem amerikanischen Cañon, und tiefen Einschnitten.
Nach 50 Kilometern erreichen wir Swellendam. Je nachdem, welche Broschüre man liest, ist der Ort der zweit-, dritt- oder viertälteste in Südafrika.
Ich habe eine Nacht gebucht in der Marula-Lodge und wir hatten ein für hiesige Verhältnisse ober-teures Nachtessen im Koornlands Restaurant. Eine wunderbare Küche (ein Springbock mehr hat dran glauben müssen und so auch ein Strauss - ich erfreute mich an seinem zarten Filet) und ein gediegener Rahmen rechtfertigen den Preis (die teuerste Flasche Wein 22 Fr., die Gesamtrechnung 70 Fr.).
Tags darauf besuchen wir das Droste-Museum (verschiedene Gebäude aus alter Zeit – Gefängnis, Herrenhaus, Handwerkerschuppen und -utensilien sowie viele Beiträge zur Geschichte der Sklaverei) und werfen einen Blick auf die Kirche, die nicht genau wusste, welchen Stil sie denn wählen sollte.
Die Fahrt geht anschliessend weiter Richtung Süden nach Bredasdorp und von dort aus an die südlichste Spitze des Kontinents, ans Cap L’Aghulas. Auch wenn man dorthin fahren will, muss man es auf sich nehmen, etwa 40 km unter die Räder zu nehmen und dieselbe Streck wieder zurückzufahren, aber wir finden, es hat sich gelohnt. Die Küste ist zerklüftet und es hat wunderbare Spazierwege entlang der Felsen, mitten durch die Fynbos-Vegetation, Holzstege, über die man fast endlos wandern kann.
Gegen sechs kommen wir in Hermanus an, wo ich für zwei Nächte im charmanten „16 Main“ ein Zimmer gebucht habe.
Hermanus
Wenn man zwei Nächte am selben Ort bleibt, kann man’s am Morgen gemütlich nehmen. Es ist Samstag, also wieder Markttag. Sie gefallen mir einfach, diese Farmers‘ Markets. Und immer kommt man mit Leuten ins Gespräch. So auch jetzt mit Leon und Natalie. Sie geben uns viele nützliche Tipps.
Da wird dann Theo auch seine Geschichte los und allmählich bitte ich ihn, sich davon eine Kurzfassung zu überlegen, so dass das Drama auch im Gespräch mal ein Ende findet.
Ein Spaziergang durch Hermanus, welches direkt an den Klippen gelegen ist, zeigt uns die zahlreichen malerischen Ecken des Ortes. Es ist kein Wunder, dass es hier so viele Touristen hat.
Theo möchte sich am Pool ein wenig erholen vom Stress (!), klar, machen wir doch.
Schliesslich haben wir am Abend noch was vor: eine Fahrt nach Fisherhaven in ein Schweizer Restaurant, das uns von Cheryl und Werner aus Höchste empfohlen wurde. „Le Châlet“ heisst es und so sieht es auch aus. Auf dem Weg dorthin machen wir Halt auf einem Hügel, der einen schönen Blick auf die Bay bietet und fahren dann weiter nach Fisherhaven, einem verschlafenen Örtchen am Ende einer Lagune. Wir sind ein wenig früh, also bin ich für einen Spaziergang dem Wasser entlang. Ich muss vorgehen – es könnte eventuell Schlangen haben… Auch ein Hochzeitspaar hat diesen idyllischen Ort ausgewählt zu einem Fotostopp.
Was uns Marianne und ihr Mann Leo, der Gourmet-Koch, dann servieren, ist Spitze. Unter anderem endlich seit Wochen zum ersten Mal ein feines Brot. Perlhuhn-Patée, Springbock einmal mehr, Filet vom Bio-Rind mit liebevoll zubereiteten Zutaten, alles frisch aus dem Garten, Mozzarella home-made - Freude herrscht!
Der Abstecher dorthin sehr lohnenswert, nicht nur, um die Schweizerfahne in einem Garten flattern zu sehen.
Am nächsten Tag geht’s zuerst ins „Hemel-en-Aarde“-Tal (Himmel und Erde), wo’s im Weingut „La Vierge“ den ersten Cappuccino gibt mit Zugabe einer herrlichen Aussicht über die Weinberge im Tal, das Gebirge im Hintergrund und die Bay am Horizont.
Via Kleinmond (toll ausgebauter Wanderweg entlang der Küste) geht’s weiter nach Betty’s Bay, wo Tausende von Brillen-Pinguinen ihr Zuhause haben. – Man sieht sie nicht nur, man hört und vor allem riecht sie auch, könnte ihnen aber trotzdem stundenlang zuschauen, wie sie in ihren Fräcken herumstehen wie an einer Veranstaltung, die noch nicht begonnen hat. Einige wackeln herum, andere balgen sich mit den Kormoranen, die ebenfalls Gefallen finden an den Felsen in dieser Bucht, sich dort tummeln und brüten.
Weiter geht die Fahrt der Küste entlang und bald schon hat man eine atemberaubende Sicht über die False Bay, die Klippen, die Strände und das Meer.
Am späteren Nachmittag erreichen wir unser neues Ziel – fast wie wir begonnen haben in Dainfern - ist es ein Golf Estate (Greenways), eingezäunt und auf allen Seiten bewacht mit Gates, Stacheldraht, Mauern und Security. 24 Stunden am Tag.
Strand ist ein Vorort von Cape Town, etwa 50 km vom Zentrum entfernt. – Dazu später mehr.
Cape Town
Schon an unserem ersten Tag machen wir einen Ausflug auf den Tafelberg. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen, und das heisst , man muss es ausnützen, wenn die Sicht gut und die Tafel nicht mit einem Tischtuch in Form von Wolken bedeckt ist. Ist’s dazu noch ein Wochentag und nicht das Wochenende, wo man offenbar lange anstehen muss, dann heisst es: Nichts wie los!
Nicht wenige Leute haben dieselbe Idee wie wir, aber wir finden einen Parkplatz in nächster Nähe der Talstation der Gondelbahn, müssen nicht Schlange stehen und sind im Nu oben (mit der neuen grossen Schweizer-Gondel), wo’s eine Aussicht hat vom Feinsten.
Nach einem Rundgang und 100 Fotos im Kasten, geht’s wieder hinunter, diesmal zur Marina, von wo aus wir den berühmten Berg auch von unten sehen. – Das Gebiet am Hafen ist ebenfalls ein Anziehungspunkt für Touristen, aber auch für Einheimische. Die Restaurants sind voll, alle wollen den milden Abend und den schönen Ausblick geniessen. Wir machen sogar eine halbstündige Hafenrundfahrt und essen dann in einen feinen Restaurant – mit Blick auf den Tafelberg natürlich – z’Nacht.
Die fast einstündige Heimfahrt über die Autobahn bei Nacht macht dann weniger Spass, aber da müssen wir halt durch.
In Strand (Ortsname) selber gibt‘s „nothing much to write home about“, deshalb lass ich’s auch bleiben. Die Unterkunft aber, die wir durch Home Exchange gefunden haben, ist sehr schön, es ist auch dieses Mal wieder eine Wohnung. Sie liegt im zweiten Stock eines Mehrfamilien-Hauses, direkt am Strand.
Auch hier gibt’s Vögel en masse, denen es auf dem Green gefällt; Herr und Frau Perlhuhn mit ihren Kindern sind ebenfalls da. Verschiedene Familien sogar, und wenn sie nicht grad am Fressen sind, ist es ihre Lieblingsbeschäftigung, über den Rasen zu rasen.
Dass es hier stunden- und tagelang fast orkanartig winden kann, wussten wir nicht, aber es stört uns auch wenig, denn wir sind ja immer unterwegs und lassen die Winde in Strand zurück. Schon ein paar hundert Meter weiter weg am Strand in Strand bläst der Wind nur noch mässig. – Dass jedoch die hohen Palmen dieses ständige Gebläse aushalten, ist kaum vorstellbar. Die Vögel stört’s jedenfalls nicht, sie sind’s wohl gewohnt, aber ihre Flugbahnen sind seltsam.
Was das Beste ist bei unserem neuen Exchange: Steffi und Bert, mit denen wir den Tausch vereinbart haben (sie wohnen seit 35 Jahren in SA und die Wohnung hier ist ihr Feriendomizil), gehören einmal mehr zu den nettesten Gastgebern, die man sich vorstellen kann.
An einem Tag besuchen wir mit ihnen zwei Weingüter in Constantia, ganz in der Nähe, wo sie wohnen.
Im „Cape Point Vineyards“ hat Steffi zum Lunch einen Tisch reserviert. Der Ausblick über die Ebene, die Reben, die Berge, den Strand und das Meer ist vom Schönsten, was ich je gesehen habe.
Eine zweites Weingut besuchen wir nachher, „Buitenverwachtig“, auch das ein wunderbarer Ort zum Pick-nicken, Weine Probieren, Chillen.
Am späteren Nachmittag laden die beiden uns zu sich nach Hause ein zu Kaffee und Kuchen.
Und wieder eine Stunde Heimfahrt…
Eigentlich wollten wir heute (8. Dezember) ans Kap der Guten Hoffnung fahren, aber es scheint, der Himmel ist nicht ganz so blau, es könnte sein, dass man nicht allzu viel sieht. Im letzten Sommer an der Pointe du Raz in der Bretagne hatten wir ja bereits so ein Erlebnis: Regen, Nebel und Sicht fast gleich Null; darauf können wir verzichten; die Fahrt dorthin dauert ja etwa anderthalb Stunden, ist also nicht grad nur „accross the bridge“.
Neues Programm also: Besuch in Kirstenbosch, dem nationalen botanischen Garten. Bei einer geführten Wanderung lernen wir viel Neues und Erstaunliches über die Bäume, Blumen und Sträucher, die hier heimisch sind.
Lunch dann im 330 Jahre alten Weingut „Groot Constantia“. Auch hiervon könnte ich mindestens eine Seite lang nur schwärmen, ich lass es jetzt aber. Habe sowieso gemerkt, dass ich wieder ins Plaudern geraten bin…
Gegen fünf fahren wir weiter nach Hout Bay, wo wir uns erst verfahren und durch die Township fahren, eher noch durch einen „noblen“ Teil. Dennoch sind wir einmal mehr erstaunt, wie viel Abfall dort herumliegt, den man ohne grosse Mühe wegräumen könnte, wenn er einen denn störte… Aber die Leute hier sind fröhlich, sie grüssen und die Kinder spielen zufrieden miteinander mit dem wenigen, was sie haben.
Am Hafen gefällt es uns dann sehr. Im Restaurant „The Wharfside Grill“, das wie ein Schiff gebaut ist und dessen Servierpersonal gekleidet ist wie Matrosen, essen wir Fisch und Meerfrüchte und machen uns dann wieder auf die einstündige Heimfahrt, wo wir grad knapp vor Beginn der Dunkelheit um halb neun ankommen.
Der Freitag ist ein Regentag. Alle sind froh: wer hier lebt, weil Wasserknappheit herrscht und Regen dringend nötig ist und wir, weil Theo eine „Pause einschalten“ muss/will. Ich benutze die Zeit zum neu Planen, Emails schreiben, aber dann machen wir am Nachmittag doch noch einen „Ausflug“ ins nahe gelegene Einkaufszentrum, die Somerset Mall. Theo hat nämlich seine Brille fallen lassen – Splitter über Splitter - am besten, er lässt sich gleich einen neue machen. In der Zeit, wo er sich beim Optiker beraten lässt, lasse ich meine Füsse pflegen. In einem kleinen Shop „Pedinail“ throne ich also auf einem Sessel, vor mir am Boden kniend die junge Dame, die sich über einen Stunde lang an meinen Füssen zu schaffen macht. Links von mir eine andere Kundin, eine Schwarze, die mit ihrem Umfang fast zwei Sitze braucht, rechts neben mir eine Weisse, mit der ich dann ins Gespräch komme. Eigentlich hatte ich ja lesen wollen…
Die Szene kommt mir vor wie in einem schlechten amerikanischen Film – wir drei Frauen (zwei zusammen am Chatten) auf unseren erhöhten Stühlen, drei schwarze junge Angestellte am Füsse-Baden, Massieren, Raspeln, Nägel-Schneiden, -Feilen und -Lackieren.
Ja, und eine Stunde später hat mir Petra ihre halbe Lebensgeschichte erzählt, die ich hier natürlich nicht wiederholen will. Aber trotzdem muss ich lachen, wie ich erfahre, dass sie mit ihrem zweiten Mann auf einer Schaffarm mitten im Karoo lebt, ihr Mann züchte die Tiere und beide sind Vegetarier… Wenn ich das nächste Mal in dieser Gegend sein sollte, müsse ich sie unbedingt besuchen, sagt sie.
Theos Brille ist bestellt, wir kaufen ein und essen am Abend wieder mal daheim.
Der Samstag ist dann ein wolkenloser Tag, nicht zu heiss und nicht zu kalt. Jetzt brechen wir auf Richtung Kap. Unterwegs sehen wir die pittoresken farbigen Standhäuser von St. James, in Kalk Bay gibt’s einen Kaffee-Halt. Der Ort gefällt uns sehr gut. Es hat viele Touristen, vor allem junge, aber es herrscht eine ausgelassene, fröhliche, mediterrane Stimmung, ein Ferienort, wo man sich wohl fühlen kann, wo’s nette kleine Geschäfte, Antiquitäten- und Kurios-Shops und viele gemütliche Cafés und –Restaurants hat’s, zum Teil mit Sicht direkt aufs Meer. Vor lauter Auswahl weiss man kaum, wo man nun den Cappuccino trinken will. Ganz ähnlich ist’s in der nächsten Ortschaft, Simons Town. Auch diese macht einen bunten Eindruck. Ein Markt findet statt, neben Ständen mit afrikanischen Souvenirs bieten weisse Händler ihre Produkte an, oft auch selbst Gestricktes und Geschnitztes, home-made Konfitüren, Kunst und Kitsch, ein lebendiger Markt. Jedenfalls macht es einen an, herumzuschlendern, mit den Händlern zu plaudern, am Hafen die Schiffe zu fotografieren, einfach zu chillen.
Am Parkeingang zum Cape-National-Park dauert’s schliesslich eine ganze Weile, bis sich die Schranke öffnet und man hineinfahren kann. Wenn’s halt jedes Mal pro Auto fast fünf Minuten braucht, bis der Kreditkartentürk abgelaufen ist mit Pin Eingeben und Unterschreiben (ein fast mittelalterliches Vorgehen, wenn man an die französischen Mautstellen auf der Autobahn denkt), dann ist das nicht erstaunlich. Ein Vorteil hat das gemächliche Vorgehen doch: Man ist dann alleine auf weiter Flur, denn der Fahrer im Wagen hintendran muss ja auch erst das ganze Prozedere über sich ergehen lassen.
Eine schöne Fahrt durch die wunderbare Fynbos-Vegetation führt zum Parkplatz, wo ziemlich viel los ist. Man muss sich jetzt überlegen, ob man zum Leuchtturm marschieren, das Bähnli dort hinauf nehmen oder zu Fuss zum viel besagten Cape of Good Hope wandern will. Theo muss sich ja bewegen, wir wählen den Weg zum Kap. Den wählen auch ein paar Pavian-Familien, was nicht sehr Spass macht, denn die Tiere können sehr aggressiv sein. Ich hoffe, Theo hat nichts zum Essen im Rucksack (den ich tragen muss). Die Affen lassen uns in Ruhe, alles bestens. Den Weg kann man nicht als eben beschreiben, ich bewundere Theo, dass er während dieser anderthalb Stunden in seinen Discoschleifern über Stock und Stein mithalten kann.
Auf dem Rückweg (Westseite der Kaphalbinsel) machen wir Halt in einer Straussenfarm und fahren dann die berühmte Chapman’s Peak Road entlang. Kein Wunder, wird gesagt, dies sei die schönste Route in ganz Südafrika. Die Aussicht von den unzählligen Lookouts aus ist atemberaubend. Die Strasse ist in den Felsen gehauen und fantastisch ausgebaut. – sie endet in Hout Bay, wir essen diesmal in einem italienischen Restaurant und treten dann wieder den einstündigen Heimweg über die M63, dann die N2 an.
Sonntag und Montag sind dem Wein gewidmet. Stellenbosch, Paarl, Franschhoek – das sind unsere Ziele. Von da, wo wir wohnen, dauerts nur gerade eine halbe Stunde nach Stellenbosch. Bei der riesigen Auswahl an Weingütern ist es fast nicht möglich, sich zu entscheiden, welche man besuchen will und welche nicht. Der Reiseführer, das Internet und die Tipps von Bekannten helfen weiter.
Wir beginnen bei Blaauwklippen, dann Vrendenheim und essen fein zu Mittag im Neethlingshof. Kaffee bei Asara.
Die Gegend ist grün und wie viele Rebstöcke es hier gibt, nähme mich echt wunder. Überall am Horizont erheben sich Berge, wo immer man ist, das Panorama ist einmalig.
Ein Weingut ist schöner als das andere; es ist sagenhaft. Oft sind es Herrenhäuser aus der kapholländischen Epoche, einige wurden bereits im 17. Jahrhundert gegründet, andere im 18ten und 19ten. Jedes Einzelne hat seinen eigenen Charakter, restlos alle sind aufs Aufwändigste gepflegt, Blumengärten gehören dazu, Garten- und Parkanlagen mit idyllischen Bächlein und Brücken, der Rasen sieht aus wie mit der Nagelschere geschnitten. Man fährt durch Alleen mit altem Baumbestand oder durch endlose Rebenhaine. Die meisten Güter haben luxuriöse Keller oder stiylische Bereiche, wo man den Wein degustieren und kaufen kann, bei etlichen kann man auch essen, bei manchen ist es einfach nur gemütlich. Zum Bleiben laden alle.
Freundlich empfangen wird man überall, für lediglich etwas drei Franken kann man fünf Weine probieren, die Qualität ist fantastisch, die Preise unglaublich tief.
Wir übernachten in Paarl und zum Nachtessen habe ich ein Restaurant ausgesucht, das wir bequem zu Fuss von unserer Unterkunft aus erreichen können (Bosman’s). Und was für ein Festessen erwartet uns da. Zwar nähern wir uns jetzt den Schweizerpreisen und auch der Wein ist nicht mehr billig, aber was der Koch zustande bringt, ist absolute Spitze. Unvergesslich! Wir hätten das 7-Gang-Menu nehmen sollen. Leider hatten wir nur drei Gänge, aber wie gesagt, die waren sensationell. – Wieder mal in Paarl – keine Frage, wo wir einkehren werden.
Am nächsten Morgen fahren wir weiter nach Franschhoek, wo alles an die Hugenotten, die im Jahr 1688 hier angesiedelt wurden, erinnert. Sogar die Gegend. Man könnte sich vorstellen, irgendwo in den französischen Alpen zu sein.
Wir besuchen La Motte, Môreson, Rickety Bridge und Haute Cabrière. Eigentlich hatte ich mir vorgestellt, dort zu Mittag zu essen, aber leider (Montag) ist das Restaurant geschlossen. Gibt’s halt nur Tasting. Wir fahren zurück in den Ort und essen dort etwas. Dann geht die Fahrt weiter über drei Pässe zurück nach Strand.
Der Signal Hill fehlt noch im Programm, dann bummeln wir im farbige Zentrum herum: Bo-Kaap, Long Street, Company’s Garden und zum Nachtessen fahren wir noch einmal an die Waterfront, wo auch heute eine fröhliche und ausgelassene Stimmung herrscht.
Museumsbesuche lassen wir aus, es ist zu heiss (über 30 Grad seit ein paar Tagen) und ich finde es immer schön zu wissen, was man nächstes Mal, wenn man dort ist, noch alles unternehmen kann.
An unserem zweitletzten Tag besuchen wir Eva und Ken, die uns zu einem Braai
eingeladen haben in ihrem Haus in Rooi Els, in das sie mittlerweile umgezogen sind. Es ist ein Traumhaus, direkt am Meer, in einen Felsengarten hineingebaut. Auch das Braai ist die kurze Reise dorthin wert, Bananen mit Speck umwickelt zum Apéro, Elan-Filet, Kudu-Wurst, Lamm-Kotletts, Maiskolben, Salat und Garlic-Bread. Wir sind nur zu viert, für zehn Personen hätte die Mahlzeit allemal gereicht.
Den letzten Tag verbringen wir am Strand in Gordon’s Bay – wir wollen ja schliesslich nicht als Bleichmäuse heimatlichen Boden betreten.
Noch ein Znächtli in Stellenbosch auf dem Eikendal-Weingut („Man sitzt dort so schön und das Essen ist fein“, sagt Steffi), dann aber ist es Zeit zum Kofferpacken.
Am 16. Dezember kommen wir glücklich, zufrieden und gesund zu Hause an. Wir sind zurück von einer Reise, die auch einen völlig anderen Ausgang hätte haben können.
Nun war ich an der Reihe: Nicht halb so dramatisch allerdings. Kaum zu Hause, hatte ich mich einem kurzen, geplanten Spitalaufenthalt unterziehen müssen (Fussoperation) und war dann für mehrere Wochen ein armes Hinkebein.
Aber das zählte nicht. Ich freute mich, dass es uns trotz allem so unendlich gut ging, dass es Theo, flink wie ein Wiesel, in letzter Sekunde gelungen war, dem Sensenmann von der Karre zu springen, dass wir trotz allem ein fabelhaftes Jahr hatten und unendlich viele wunderbare Beweise von Freundschaft erfahren durften.
Neue Pläne
Schon wieder ruft die Ferne. Ich habe durch HomeExchange eine Anfrage erhalten, ob wir mit einem Paar aus Mexiko, aus der Provinz Quintana Roo, im Juni gerne einen Tausch vereinbaren würden. – Wieso auch nicht? – Einen Tausch auf den Bahamas, Long Island, haben wir auch noch zugut und diese Destination zu besuchen ist im Herbst wegen der Hurrikane wenig empfehlenswert, die beste Zeit für eine Reise dorthin sind April und Mai. Lässt sich gut kombinieren, finde ich. Kuba liegt ja auch in jener „Gegend“, kommt mir in den Sinn. Diese Insel figuriert sowieso schon längst auf meiner „To-do-Liste“. Lässt sich ebenfalls gut kombinieren genauso wie ein Zwischenhalt in Miami, wo wir die Gelegenheit packen und unsere Freunde, die Lindenmanns, besuchen können. – Gedacht – geplant.
Reisebericht Kuba 11. – 29. April 2017
Es ist so weit: Unsere Frühlingsreise hat begonnen. Beim Zwischenhalt in Paris kauft sich Theo tatsächlich ein Stück Brie und eine Terrine. Diese zumindest im Glas. Der Käse allerdings wird seinen ganzen Handgepäck-Koffer verstinken; ich kann’s nicht fassen, dass er sich sowas kauft.
Nach langer Reise kommen wir in Havanna an. Als Erstes geht’s wieder durch den Security-Check, Handgepäck aufs Band, elektronische Geräte separat, Jacke ausziehen, Uhr und Gurt ebenso – wieso das alles, ist mir nicht klar. Es hätte ja gar niemand das Flugzeug besteigen können, der nicht genau diese Prozedur bereits hinter sich gebracht hatte am Einstiegsort. – Arbeitsbeschaffung? - Ich frage lieber nicht, sonst mache mich noch unbeliebt. Am Zoll ist nicht zu spassen.
Trotz der vielen Leute, die soeben angekommen sind, geht das Einreiseprozedere erstaunlich schnell über die Bühne. Auch unsere Koffer sind rasch da, wir laden sie auf einen Trolley und damit dem Ausgang entgegen. – Ich bin gespannt, ob das, was ich mit Maria Elena abgemacht habe, klappt. Sie und ihr Mann Abel bieten eine Unterkunft an (Casa Particular) und mit ihr habe ich etliche EmMails ausgetauscht. Ihre Adresse habe ich von unseren Haustausch-Partnern auf den Bahamas, deren Tochter Maria Elena kennt. Maria Elena hat versprochen, uns am Flughafen José Martí abzuholen. Das klappt wunderbar. Ich hab ihr auch ein Bild geschickt von uns beiden, so dass sie uns erkennt.
Aufs Herzlichste werden wir begrüsst. Die beiden haben auch einen Freund mitgebracht, der uns dann mit seinem Oldtimer Chevrolet nach Hause bringt. – Das ist ein guter Anfang: Der Chevi ist gleich alt wie ich, Jahrgang 1953. Von aussen strahlt er schön gelb – bei näherem Hinsehen allerdings ist schon nicht mehr alles Gold, was glänzt. So ist das eben bei diesen Jahrgängen. Das Chassis…
Das Haus, in dem wir in den nächsten Tagen wohnen werden, ist bescheiden, wir erhalten aber eine ganz nett zurechtgemachte kleine Wohnung für uns allein, ein Mini-Wohnzimmer, ein Schlafzimmer mit zwei Schränken und einem Doppelbett, eine Küche und ein Badezimmer. Dieses ist neu gemacht mit glänzenden Kacheln, die Dusche funktioniert mit einer Art Tauchsieder (geht aber gut), die blaue Toilette hat weder Brille noch Deckel. (Erst später stellen wir fest, dass auch in Hotels teilweise diese Zutaten fehlen – warum, das wissen die Götter oder vielleicht Fidel).
Doch - Abel weiss es auch: WCs werden nicht als Ganzes verkauft, Deckel und Brille sind separat und da kauft man eben nur, was unbedingt nötig ist.
Wir haben sogar einen Fernseher. Nur kubanische Sender sind zu sehen. Für ausländische bräuchte man Kabel, aber das gibt es gar nicht, nur für die Botschaften, erklärt man uns. „No hay…“. (Gibt es nicht… ist hier das geflügelte Wort, das wir noch oft zu hören bekommen werden.
Ich öffne den Kühlschrank in der Küche – 24 Eier lagern darin, zwei Fläschchen Wasser. Nun, wir gehen ja dann morgen einkaufen, da wird das ja dann anders aussehen.
Todmüde sinken wir ins Bett. Inzwischen ist es halb elf geworden (um acht Uhr abends kamen wir an). Nach unserer Zeit wär’s ja bereits halb fünf Uhr morgens.
Am nächsten Morgen macht uns Maria Elena Frühstück. Ich denke, eine Tortilla wär nicht schlecht, sie macht uns je zwei Spiegeleier. Erst später merke ich, das Mehl und Milch fehlen.
Der Kaffee scheint mir zu stark, ich möchte lieber Tee. Zufälligerweise findet sich ein einziger Beutel in der Schublade. Rum, Bier und Kaffee gäbe es in Kuba vorwiegend zu trinken, Tee sei unüblich. Das lernen wir. – Dafür erhalte ich eine ganze Schüssel voll Mangos, der Baum steht im Garten, zwei Kübel mit Früchte drin auf der Küchenablage.
Aufs Brot verzichte ich. Gern sogar. Es ist Weissbrot, sieht aus wie Karton und schmeckt auch so.
Theo tut sich an seiner Terrine und dem stinkigen Brie genüsslich. Er gibt unseren Gastgebern zum Probieren. – Schlimm finden sie den Geschmack und rümpfen die Nase; Weichkäse kennen sie nicht.
Gabel und Messer passen nicht zueinander. Das Messer ist riesig, fast wie ein Brotmesser. Auf der Klinge heisst es: „Nura Hotel“.
Havanna
Maria Elena und Abel nehmen sich den ganzen Tag Zeit, mit uns nach Havanna zu fahren und uns dort herumzuführen. An Zeit mangelt es ihnen nicht, das gehört zum Service.
Mein erster Eindruck von der Stadt: Sie erinnert sehr an spanische Städte, wen wundert’s!
Weniger dann die fantastischen Oldtimer. Jeder Fünfte, der in Havanna herumfährt, sei so einer. Die ergeben die herrlichsten Fotos. Welcher Tourist würde da nicht schwelgen!
Es hat massenhaft prächtige, herrschaftliche Häuser im Kolonialstil, reich an Ornamenten, wunderbaren Details und farbigen Fassaden, aber die allerwenigsten davon sind in gutem Zustand. Im Gegenteil, die meisten sind baufällig, bei einigen sind weder Dach noch Fenster mehr vorhanden, Ruinen über Ruinen, überall liegt Schutt herum. Bäume wachsen aus dem Stein, Töpfe sind gar nicht nötig. - So schade, wenn man sieht, was da alles vor die Hunde geht. Und erstaunlicherweise sieht man doch immer wieder mal auf einer Terrasse eine Wäscheleine gespannt; offensichtlich gibt es Personen, die dort wohnen – gefährlich wohnen, da gibt es keine Zweifel. Die Hausgänge, an denen wir vorbei gehen, sind teilweise so schmal, dass sich wohl nur Magersüchtige durchzwängen können und für gewisse abenteuerliche Treppenkonstruktionen müsste man athletisch veranlagt sein, um zur Wohnung zu gelangen.
Aber die Leute sind fröhlich, es herrscht ein guter Geist in dieser Stadt, aus fast allen Restaurants tönt live Musik, man tanzt und scheint zufrieden.
Auf der Plaza Vieja trinken wir Mojito und Bier und bei meinem Gang auf die Toilette merke ich bald, dass wir nicht in Europa mehr sind. Eigentlich macht das Etablissement einen eher gediegenen Eindruck, aber die Toiletten… Vor dem Eingang sitzt eine Dame, die mir ein paar Blatt Toilettenpapier reicht und natürlich auf ein Trinkgeld hofft. Klar erhält sie das. Drei Toiletten hat’s, die Türen, die nicht bis zum Boden reichen, schliessen nicht alle, aus den beiden Lavabos im Vorraum kommt kein Wasser (in den Toiletten schon gar nicht). Wenigstens ein Wasserkanister steht auf der einen Ablage, so dass man sich doch mehr schlecht als recht die Hände waschen kann.
Wir spazieren weiter durch die Strassen und Gassen und gehen am späten Nachmittag im „El Guajarito“ essen, einem attraktiven Restaurant im zweiten Stock, wo später am Abend dann „Buena Vista Social Club“ aufspielen wird. Die hübschen jungen Serviertöchter mit ihren adretten, engen, weissen Kleidchen und den kecken Hütchen sind sehr nett aber auch ein wenig vergesslich. Für den Wassernachschub braucht’s mehr als zwei Anläufe.
Theo bestellt Rindfleisch, ich „Ropa Vieja“, eine Spezialität der Cocina Criollo. Altes Tuch ist gar keine schlechte Bezeichnung für das, was ich dann auf dem Teller habe. Es sieht tatsächlich aus wie ein Haufen Fasern von einem alten braunen Mantel. – Schmackhaft aber und fein. – Kubanischen Wein gibt’s keinen (Tabak und Zuckerrohr wird angepflanzt – also kein Platz mehr für Trauben), eine Flasche Wein aus Chile tut’s aber auch.
Nach dem Festmahl spazieren wir weiter über die Plaza de la Revolution, entlang des Paseo Prado, eine Art Rambla, bis zum Meer und dem Beginn des Malecón. Viele Spaziergänger sind unterwegs. Wir beobachten, wie’s langsam Nacht wird, die Wellen sich schwarz wiegen, die Lichter angehen.
Der Weg zurück mit dem Taxi kostet erneut 25 CUC (1 CUC = 1 US$); die Taxifahrerei kommt langsam teuer…
Die Fahrt ist speziell. Es ist wieder einer dieser wunderbaren alten Schlitten, dunkelgrün metallisiert aus den Fünfzigern. Die Polster zerschlissen, die Türen schliessen zwar noch, aber passen nicht mehr optimal in den Rahmen. Es regnet ja nicht oft, also, was soll’s? – Die Ampel wechselt auf Grün – unser Chauffeur rührt in der Kupplung herum, es ist ein Graus; eine gefühlte Minute lang passiert gar nichts ausser einem ohrenbetäubenden Geheul, bis die Kutsche einen Ruck macht, der Gang endlich drin ist und die Fahrt weitergeht. – Unweigerlich stelle ich mir ein Zahnrad vor, das bald nur noch ein Rad ist…
Unterwegs halten wir bei einem Supermarket an, schliesslich wollen wir morgen in unserer Küche frühstücken. Der Laden schliesst erst um neun. Er ist hell erleuchtet, sieht auf den ersten Blick gar nicht schlecht aus. Drei Kassen hat’s, dem ersten Gestell an der linken Wand gehört unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Es ist auf der ganzen Länge des Ladens bestückt mit Rum, Schnaps und Wein.
Rum und Wein gehen in den Einkaufskorb. Nun möchte ich Orangensaft kaufen. „No hay“. Ok. Milch fehlt uns auch. „No hay“. Was? Keine Milch? – Ok. Tee brauche ich auch noch. „No hay“. – Dasselbe mit Pfeffer. „Brauchen wir hier nicht“, sagt Maria Elena. Teigwaren hat’s. Ganze Gestelle davon, allerdings nur eine Sorte. Ich hab’s jetzt auch gemerkt. Es ist hier nicht wie bei uns im Migros.
Früchte und Gemüse fehlen gänzlich; die kann man ja auf dem Markt kaufen.
Zwei Joghurts finden wir dann doch. Eier haben wir genug, also zurück ins Taxi mit fast leeren Händen und heim ins Bett.
13. -April
Fürs Frühstück landen wir wieder in Maria Elenas Küche. Unser Kühlschrank ist ja noch immer fast gänzlich leer ausser der Eierschwemme, und er wird es wohl auch bleiben. Theo ist froh, hat er seinen Käse und auch ich muss jetzt kleinlaut zugeben, dass sein Kauf auf dem Pariser Flughafen gar nicht so daneben war. So muss ich zumindest während der ersten paar Tage, solange der Brie noch nicht aufgegessen ist, kein Gejammer mit anhören, wenn der Käse auf dem Frühstückstisch fehlt.
Im Haus wohnen übrigens Abel und Maria Elena, Abels Mutter, Marias jüngster Sohn Daniel und zwei Hunde. Zusammen haben die beiden sieben Kinder - eine Patchwork-Familie. Die eine Tochter ist tagsüber auch zu Hause, schlafen tut sie anderswo. Immer wieder kommen Freunde und Bekannte vorbei, so läuft immer mal wieder etwas.
Ein anderes Thema ist die Verständigung. Sie ist nicht ganz einfach. Im Führer, den ich gelesen habe, stand, dass die Kubaner gerne den Buchstaben „S“ vermeiden würden. Daran muss man sich erst gewöhnen. So heisst es etwa: „Etoemacaro“. „Esto es más caro“ hätte ich verstanden. – Wie’s zu dieser „S-Aversion“ gekommen ist, ist mir nicht klar. Natürlich geht’s noch schneller, wenn man ein paar Buchstaben beim Sprechen auslassen kann, das dürfte ein Grund sein, aber wirklich…
Wie mir Maria Elena erzählt, Abel gehe jeden Morgen sündigen, komme ich überhaupt nicht nach, habe grosse Zweifel, ob ich richtig verstanden habe und erst, wie sie zum besseren Verständnis Angelbewegungen dazu macht, kommt mir die „S-Sache“ in den Sinn. - Ich begreife, dass „pecar“ eigentlich „pescar“ heissen sollte…
Dazu kommt, dass alle Wörter zusammengehängt werden, so dass es scheint, ein Satz bestehe fast nur aus einem einzigen Wort. Man kann so in kürzerer Zeit wesentlich mehr sagen. Darum geht es wohl. Zudem sind diese Einwortsätze oft sehr laut, so dass nicht selten der Verdacht aufkommt, da seien zwei Typen im Streit, dabei ist es nur ganz einfache Konversation.
Ein komischer Tag war es dann. Kuba wohl in Reinkultur. Ich hatte ja vorgehabt, ein paar Tage in Havanna zu bleiben und dann eine Rundreise durch die Insel zu unternehmen. Das hatte ich Maria Elena so mitgeteilt und sie hat mir geantwortet, ich solle mir keine Gedanken machen, das würden wir alles organisieren, wenn wir da wären. Ihr Mann sei Taxifahrer, er habe ein Auto und wir könnten dann mit ihm auf Reisen gehen. Im Kuba-Führer hatte ich zwar gelesen, die Kubaner seien sehr hilfsbereit, würden einem das Blaue vom Himmel versprechen, aber bei der Ausführung würde es dann öfters dennoch hapern, was sie aber charmant zu verniedlichen wüssten.
Nun, Abels Auto ist gerade in der Reparatur und man hoffe, hoffe inständig, so versichert er uns, dass die Garage bis zum Wochenende alle Arbeiten erledigt hätte, aber eben, die Garagen…, man wisse ja. Zudem kann er mit seinem Taxi die Provinzgrenze nicht überqueren, dazu hat er keine Genehmigung. Also ist so oder so nichts mit einer Rundfahrt um die Insel.
Um es vorweg zu nehmen: Am Freitag schon steht das Auto da, ein schwarzer Chevi mit Jahrgang ziemlich alt. Wie Abel ihn vor die Haustüre gefahren hat, ist mir ein Rätsel: Der Wagen ist völlig leer. Leer heisst: Keine Sessel sind drin. - Ich glaube, er hat auf einer Harasse gesessen bei der Heimfahrt.
Ja, dann würden wir gerne eine Rundreise buchen bei einem Reisebüro, schlage ich vor. Bei drei Reiseagenturen versuchen wir unser Glück. Die erste bietet nur Eintages-Reisen an, das höchste der Gefühle eine zweitägige Reise mit einer Übernachtung und vier Städtebesichtigungen in dieser Zeit. Das ist nicht eben, was ich im Sinn habe, ich hatte mir mindestens eine zehntägige Rundreise vorgestellt. Auch wollte ich die Reise lieber in Kuba selber organisieren, das Geld also dort ausgeben und nicht einen europäischen Zwischenhändler am Verdienst beteiligen. – Ein wenig naiv, wie’s mir jetzt scheint.
Bei der dritten Agentur im Hotel La Habana (ich will dort noch Geld wechseln, der Schalter wird aber grad geschlossen), warten wir eine halbe Stunde, bis die Reihe an uns ist. Wie wir endlich hätten bedient werden sollen, teilt uns die Angestellte mit, es tue ihr leid, aber sie müsse jetzt etwas essen gehen, wir müssten halt warten. – Mehrtägige Reisen gäbe es sowieso nicht, erwähnt sie noch en passant und erspart uns damit zumindest ein weiteres vergebliches Warten auf Godo.
Heute habe ich darauf bestanden, den Bus zu nehmen, denn erstens gefällt es mir, eine Stadt per Bus zu erkunden und zweitens bin ich nicht mehr gewillt, jedes Mal pro Fahrt 25 Franken auszugeben. Der Kuba-Führer (Buch) hat bereits vorgewarnt, dass in den Augen der Kubaner alle Ausländer reich sind, was von ihrer Warte aus sicher nicht ganz an den Haaren herbeigezogen ist. Ein Monatslohn von 10 – 12 CUC ist hier normal. Wie man damit über die Runden kommt… Kellner haben dazu noch ein Trinkgeld, das sie aber abgeben und am Monatsende mit allen Angestellten teilen müssen. Denen geht’s also relativ gut. Ebenso den Taxifahrern, die allerdings dem Staat eine hohe Steuer zahlen müssen. Der Unterhalt ihrer Autos ist wohl auch nicht unbedingt billig.
Wer eine Casa Particular, also eine Privatunterkunft für Touristen betreibt, zahlt (in Varadero) 150 CUC pro Monat Steuern, ob er Gäste hat oder nicht. Zusätzlich muss pro Gast 10 % Abgabe geleistet werden.
So stehen wir also am Strassenrand und warten auf den Bus Nr. 179. Eine Stunde lang. Endlich kommt er. Klar ist nach dieser Zeit die Schlange so lang, dass er so oder so schon aus allen Nähten quillt. Wir vier letzten Möchte-gern-Passagiere haben einfach keinen Platz mehr; er fährt los und lässt uns am Strassenrand stehen. – Dann halt eben doch wieder ein Taxi.
Das führt uns auf einer längeren Reise zum Busbahnhof der Überlandbusse Víazul. Langsam ist mir egal, wohin die Reise geht, wenn ich nur ein Ticket ergattern kann, das uns irgendwo hin bringt. Nach Trinidad und von da aus werden wir weitersehen. Ok. Morgen, in dem Fall. – Das geht nicht. Alle Busse sind bereits voll, der nächste, den wir buchen können, fährt erst am Montag um sieben Uhr morgens. – Was bleibt mir anderes übrig? Ich nehm das Billet und hab nun die schöne Aufgabe, Theo beizubringen, dass wir am Montagmorgen schon um halb sieben am Busbahnhof sein müssen…
Wir essen am Abend bei Maria Elena. Sie kocht für uns Fisch, Tostones (gebratene Gemüsebananen-Scheiben), frittierte Malangas (eine Art Kartoffeln – wie Kroketten zubereitet) und dazu gibt’s einen Salat aus Kohl (Kabis) und ein paar wenigen, fast farblosen Tomatenscheiben. Ein feines Essen. Dazu trinken wir die Flasche Wein, die wir im Supermarkt gekauft haben.
14. April, Karfreitag
Mein rechtes Auge hat wohl eine Entzündung eingefangen. Es weint die ganze Zeit; ich muss unbedingt in einer Apotheke Tropfen kaufen.
Wir fahren in die Stadt (per Bus) und finden die einzige Apotheke weit und breit in der Calle Obisbo, aber sie ist heute geschlossen. So wird halt weitergeweint.
Wir wollen das Museo de Bellas Artes besuchen. - Heute geschlossen…
Auf der Dachterrasse, von wo aus man eine schöne Aussicht über die Stadt hat, im sechsten Stock des Hotels „Ambos Mundos“, wo Hemingway im fünften Stock während ein paar Jahren gelebt und „To Whom the Bell Tolls“ geschrieben hat, essen wir eine Kleinigkeit zu Mittag. Theo die Sopa Hemingway, ich einen Hühnersalat. Zu beiden Gerichten wird ein Salat serviert…
Mit einem wunderbar alten Lift sind wir hochgefahren, die Fahrt hinunter geht bereits nicht mehr, der Lift hat grad den Geist aufgegeben.
(Doch noch kurz zu den Toiletten in diesem berühmten Hotel: Kein Wasser! Nicht einmal einen Plastikeimer diesmal…).
Wir spazieren entlang der Calle Ignacio und wundern uns immer wieder über den absolut desolaten Zustand der einst prachtvollen Häuser. In einem alten Hafengebäude ist ein grosser Markt untergebracht mit Bildern und Souvenirs. Farbig, farbig! Und immer mehr oder weniger das Gleiche. Dieselben Sujets tausendmal, Ché und wieder Ché, die Strassenschlucht mit der Bodega del Medio, dem Oldtimer vornedran und dem Kapitol im Hintergrund.
Dem Ufer entlang geht’s zurück zur Plaza San Francisco. Dort findet der erste Apéro statt, der zweite dann in der Colchón 162, einem Strassencafé, wo’s den absolut feinsten Daiquiri gibt.
Inzwischen ist’s schon Zeit fürs Nachtessen. An der Plaza de la Catedral finden wir ein Restaurant, wo man hübsch draussen sitzen kann, und bestellen Fisch (ich) und Theo glaubt, sein Fleisch sei Huhn, es ist aber vom Schwein. Dazu bestellt er sich eine ganze Portion schwarze Bohnen, weil er findet, die gehören hier dazu.
Von dort aus, wo wir sitzen, haben wir den Überblick über den Platz. Es ist ja Karfreitag, aber es läuft nicht viel in Sachen Prozessionen. Nicht wie in Spanien. Nur ein einziger violett angezogener Jesus mit schwarzem Kreuz wird herumgetragen, dazu tönt aus einem Lautsprecher eine Stimme, die etwas Tragisches herunterbetet: „Misericordia etc.“
Eine Strassenverkäuferin bietet kleine weisse Tüten an (mana, mana ruft sie) und wir kommen ins Gespräch mit ihr. Theo vermutet Haschisch, aber es sind spanische Nüsschen drin – nicht viel mehr als etwa zehn. Aber sie ist nett, sehr gut gelaunt, sehr grün angezogen und wir kaufen ihr für einen Franken (1 CUC) drei dieser Tüten ab. Kurz darauf erschient eine zweite Verkäuferin, pink angezogen.
Sie sieht unsere Flasche Wein (nur noch ein kleiner Rest ist drin) und sagt, sie habe sooo gerne Wein. Wie viele ihrer weissen Tüten sie dafür denn anbiete, frage ich. Eine nur. - Dann halt keinen Handel, sage ich. – Sie aber schnappt sich die Weinflasche und trinkt rasch einen Schluck daraus. Wir müssen lachen, da hat sie uns schön reingelegt. – Natürlich kann sie die Flasche haben, wir sind Besitzer einer weiteren Tüte.
Mit dem Taxi geht’s nach Hause. 18 CUC, wenigstens nicht grad 25.
15. April, Karsamstag
Ich muss heute dringend eine Apotheke suchen. Maria Elena weiss, wo’s eine hat: im Hotel Comodoro. – Wir warten eine Ewigkeit auf den Bus, Taxis halten auch grad keine an. Wie er dann endlich kommt, ist er so vollgestopft, dass man sich vorkommt wie eine Sardine in einer Büchse. Wie wir schliesslich am Ziel sind, uns durchgefragt haben, wo genau das Hotel und wo die Apotheke sei, ist mehr als eine Stunde vergangen. Aber endlich hab ich Tropfen gegen mein tropfendes Auge erhalten; ich bin sehr froh!
Endlich möchten wir auch eine Karte für Internetzugang kaufen, die’s ja nur in wenigen Hotels gibt, aber die Dame am Schalter sagt einmal mehr: „No hay. – Ni hoy y ni mañana.“ Sie schickt uns in ein anderes Hotel. Wieder durch Gänge pilgern (mein armer Fuss tut mir mehr und mehr weh vom vielen Gehen) und wie wir das Centro de Commercio endlich gefunden haben, will man dort 10 CUC für eine Stunde Internet. Das nervt, wir verzichten. – Nicht einmal die Gäste können das Internet gratis benutzen (die Zimmer in diesem Laden, der natürlich dem Staat gehört, kosten zwischen 500 – 800 Fr.) Mit dem Geld könnten doch ein paar Häuser in der Altstadt renoviert werden, finde ich.
Wir fahren heim per Taxi und können nicht hinein. Wir läuten an der Tür, aber die Nonna hört nichts. Sie ist wohl am TV Schauen. Theo, der scharfe Beobachter, entdeckt eine Schnur, die man durch die Verzierung an der Mauer erreichen kann und die mit der Türklinke verbunden ist. Dran zieht er und schon öffnet sich die Tür. – Da bin ich aber froh. Das hätte noch gefehlt, dass wir draussen in der Hitze hätten warten müssen, bis jemand heimkommt.
Wir ziehen uns um und gehen an den Strand. Das dauert ungefähr zehn Minuten zu Fuss, vorbei an heruntergewirtschafteten Häusern, in denen zum Teil trotzdem noch Leute wohnen. Der Strand macht ebenfalls einen nicht eben lieblichen Eindruck. Zwar hat’s Sonnenschirme aus Palmenblättern, dort aber Abfall wie überall. Ein paar Jugendliche spielen Ball und baden. Dazu weht ein Wind, der uns völlig sandstrahlt und keinesfalls zum Baden einlädt. Wir legen uns trotzdem eine Stunde in die Sonne, gehen dann aber wieder zurück ins Haus, duschen und ruhen uns aus.
Nachtessen im Fisch-Restaurant „Santi“, keine fünf Minuten zu Fuss von unserer Wohnung. Es ist das einzige Restaurant in der ganzen Umgebung, wo auch Touristen hingehen. Absolut schön gelegen mit seinen zwei Terrassen am Fluss mit Sicht auf die Boote – jedoch sind auch die in mehr als nur lamentablem Zustand. – Teuer sei es dort, sagt Maria Elena. – Alles sieht sehr einfach aus, ich kann mir kaum vorstellen, dass man dort gut isst. Aber eben – es ist nichts so, wie es scheint.
Offenbar haben sie einen japanischen Koch. Die Sushis sind delikat, genauso wie auch der Fisch, den ich bestelle, und Theos Spaghetti à la Marinera. Dazu gibt’s Weisswein, Roten haben sie keinen. 50 Franken mit Trinkgeld für ein herrliches Abendessen zu zweit.
16. April, Ostern
Nach dem Frühstück fahren wir per Bus in die Stadt, kommen an der Plaza Curita an und fahren per Rikscha weiter zum Museo de Bellas Artes (Cubano contemporano). Es bleibt uns grad eine Stunde für die Besichtigung. Wie das so ist in diesen Museen: Einige Kunststücke gefallen einem ausserordentlich gut, mit andern kann man nichts oder nur wenig anfangen. Der Eindruck ist aber gut. Das Museo de la Revolution ist gleich gegenüber. Aber dort stehen so viele Leute an, dass es uns verleidet und wir auf den Besuch verzichten. Stattdessen essen wir eine Kleinigkeit in einem hübschen kleinen Strassencafé. Weiter spazieren wir durch die Altstadt wie tags zuvor und machen wieder Halt im Hotel „Ambos Mundos“. Wir kaufen Internetkarten, aber nur Theo gelingt es, eine Verbindung zu kriegen. Wenigstens kurz kann er Verbindung mit der Familie aufnehmen und mitteilen, dass es uns noch gibt.
Zurück in unserer Unterkunft packen wir unsere Koffer für die Reise, von der wir noch nicht genau wissen, wohin sie uns führt. Einen Koffer, den Handgepäck-Koffer und meinen Rucksack lassen wir zurück. Ein Koffer für zwei muss genügen.
Maria Elena kocht für uns; wir gehen früh schlafen.
17. April, Ostermontag – Start zur Rundreise
Um halb sechs stehen wir auf, packen unsere Siebensachen. Um sechs wartet das Taxi schon. Es ist wieder Jasmin, der Nachbar, der uns schon vom Flughafen abgeholt hat mit seinem gelben Chevi 53. Es ist noch Nacht, Verkehr hat es kaum. Wir rasen durch die fast leeren Strassen, offene Fenster, was sehr angenehm ist, und die Musik läuft auf voller Lautstärke. „Corazon, amor eterna etc.“ hören wir mit. Sehen wir doch hin und wieder ein Auto, klärt uns Jasmin über die Automarke und den Jahrgang auf.
Um halb sieben sind wir an der Busstation, checken und steigen ein.
Zum Glück habe ich in dem Buch, das ich zu Hause über Kuba gelesen habe („Kulturschock Kuba“) gelernt, dass die Überland-Busse mit voll aufgedrehter Air Condition fahren, es sich also lohnt, einen Pullover dabei zu haben. So trage ich nun eine lange Hose, Socken und mein einziges Woll-Jäckchen, das ich mitgenommen habe. Auch den Regenschutz ziehe ich an. Nach einer Viertelstunde auch die Kapuze, denn die AC lässt sich nicht regulieren und bläst mir direkt ins Gesicht. – Schon bevor wir losfahren, denke ich, die Reise überstehe ich nicht. Mit Theos Windjacke zusätzlich geht’s dann besser.
Unser vorläufiges Ziel heute ist Trinidad. Nach zwei Stunden Fahrt gibt’s den ersten Halt in Australia Township. Ein wundersam feines Cappuccino gibt’s dort zu haben und ein ebenso feines getoastetes Sandwich. Es geht also doch!
Zwei Fahrer sind im Bus, die sich abwechseln; sie machen ihren Job sehr gut. - Die Fahrt geht zum Teil über die dreispurige Autobahn, dann wieder durch Landstrassen und Dörfer, durch Gegenden mit wenig Landwirtschaft. Kurzer Halt in Playa Girón, wo sich ein berühmtes Museum befindet (Revolution – wen wundert’s?). In Cienfuegos gibt’s ebenfalls einen Halt, viele Leute steigen aus, viele steigen ein.
Unterwegs stehen immer wieder Plakate, die den Sozialismus und die Revolution verherrlichen.
Trinidad
Pünktlich um Viertel nach eins, also nach fast sechseinhalbstündiger Fahrt, kommen wir in Trinidad an. Kaum ausgestiegen werden die Angekommenen von einer ganzen Horde Einheimischer belagert, die auf einen losstürmen wie die Motten aufs Licht. Sie bieten Taxis an und wollen einem Unterkünfte aufschwatzen. Zum Glück hat die Busgesellschaft eine Schnur gespannt aus Metall, so dass man nicht schon beim Beziehen des Gepäcks überrannt wird.
Internet hatte ich ja keines. Normalerweise bin ich gewohnt, Hotels im Voraus zu reservieren, das geht hier ja nicht. So war ich ein wenig besorgt, wie und wo wir landen würden, ob wir überhaupt eine Unterkunft finden würden und und und. Gut, dass ich zumindest eine Offline-App heruntergeladen hatte, die ein paar Tipps über Hotels anbietet. Casa Meyer hat eine gute Bewertung und ist nur 100 Meter vom Busbahnhof entfernt. Ideal also. Die finden wir auch sofort, die beiden Zimmer sind aber bereits ausgebucht. Netterweise telefoniert die Besitzerin einem Kollegen, der uns gleich darauf abholt. Sein Hostal ist nur 50 Meter vom Busbahnhof entfernt, es heisst El Mirador – Fernando y Laidys. Fernando ist ein ziemlicher Bär von einem Mann, sehr nett und hilfsbereit. Er zeigt uns zwei Zimmer, die noch zu haben sind. Wir sind mehr als nur zufrieden. (Ich dachte schon, wir müssten vielleicht von Tür zu Tür wandern und es könnte uns ergehen wie Maria und Josef, ohne die Details natürlich mit dem Heiligen Geist.) – Aber da ist alles, was man braucht, sogar die Toilette hat eine Brille und einen Deckel, das Wasser fliesst bestens, AC und Ventilator sind neu und funktionieren nach einem Batteriewechsel prima. Es ist ein hübsches Haus, das Zimmer im Eingang ist bestückt mit sehr vielen Antiquitäten, Möbeln, Geschirr und Nippsachen. Verschiedene Treppen führen je zu einem Zimmer, alles ist verwinkelt. Zuoberst hat’s eine entzückende Terrasse, von der aus man über die Dächer von Trinidad sieht und sich wunderbar verweilen kann. Das Frühstück wird auch dort serviert.
Wir richten uns ein und machen anschliessend einen Spaziergang durch das Städtchen, das uns ausserordentlich gut gefällt. Nicht nur uns. Alles hier ist SEHR touristisch, aber eben, das hat auch Vorteile und nicht nur einen Grund. Die Häuser sind viel besser erhalten als in der Altstadt in Havanna, man hat das Gefühl, man werde in vergangene Zeit versetzt. Karren, von kleinen Pferden gezogen, rattern durch die Gassen, Autos hat es wenige, denn die Strassen sind mit Pflastersteinen verschiedenster Grösse ausgelegt. Stöckelschuhe sind kein Thema, mein Problem zum Glück schon lange nicht mehr. – Eine Gaststätte an der andern säumt die Strassen, Hostals gibt’s in Massen, ebenso kleine Läden aller Art, Musik tönt von überall her; es herrscht eine pulsierende, lebhafte Atmosphäre. Marktstände mit all den hundertmal gleichen Souvenirs für die ausländischen Gäste gibt’s an jeder zweiten Ecke. Wie auch in der Hauptstadt ist Ché allgegenwärtig. In jeder Form: auf Bildern, T-Shirts, Tabakdosen, Postkarten, Taschen, Geldbörsen, Magneten - man kommt nicht um ihn herum. Zum Glück sieht er gut aus und nicht etwa wie Trump…
Bei der Plaza Mayor, in einem absolut pittoresken kleinen Restaurant (Los Conspiradores) im Garten unter einem riesigen Bougainvillea-Strauch gibt’s ein feines Crevetten Cocktail und dazu zwei eisgekühlte Daiquiris. Es könnte uns nicht besser gehen!
Zurück im Hostal ist eine Dusche nötig, wir ruhen uns ein wenig aus (Theos Siesta muss sein) und suchen und dann ein nettes Restaurant. Die Auswahl ist gross, die Entscheidung schwierig. Im „Nueva Era“ gefällt’s uns gut; es ist ein typisches Kolonialhaus mit Patio und luftigen Terrassen mit Blick auf die Dächer, den Hof, die Band, die natürlich auch dort aufspielt. Es ist ein Paladar, also ein Lokal, das ausnahmsweise mal nicht der Regierung gehört. Die Bedienung ist nett wie überall, aber auch ein wenig langsam. Das Essen – na ja, sie haben sich Mühe gegeben. Theos Paella Marinera ist etwas seltsam: Auf einer grossen Portion Reis thront eine Krabbe, die zu öffnen aber ein Ding der Unmöglichkeit ist. Theo lässt das Tier in der Küche „behandeln“, es kommt zerschlagen zurück, aber Fleisch gib’s so gut wie keines…
Zum Dessert eine Piña Colada. Daran gibt’s dann nichts auszusetzen.
18. April
Wir nehmen’s gemütlich. An den Strand gehen steht heute auf dem Programm. Die Busse dorthin fahren aber nur um elf und um 14 Uhr. Erst muss ich aber noch Geld holen gehen. Fernando erklärt mir, wo die Bank ist. – Eine Riesenschlange von Leuten steht am Schalter an. Das geht mindestens eine Stunde, bis ich drankomme, denke ich. Aber da hat’s auch zwei Bancomaten. Einer davon ist sogar frei. Ich glaub’s ja nicht. Und er spuckt mir problemlos und bereitwillig 500 CUC aus.
Als Nächstes muss ich bei Viazul das Ticket für unsere Weiterfahrt kaufen. Ein Schalter ist offen. Wie ich nach zehn Minuten an der Reihe bin, sagt mir die Dame, hier würden Tickets nur an Cubanos verkauft, Viazul sei nebenan. Dort steht an der Tür, das Büro sei bedient von halb zehn bis halb vier Uhr nachmittags. Jetzt ist es fast elf, aber geschlossen. Jemand sagt mir, der Schalter sei nur geöffnet, wenn ein Bus ankomme. Das sei heute Mittag um eins. – Was, nebst der Tatsache, dass der Schalter auch zu den angegebenen Öffnungszeiten geschlossen ist, die Planung der Reise zusätzlich schwierig macht und zeitraubend ist, ist der Umstand, dass es nirgends einen Fahrplan hat, auch keine Landkarte, auf der man sich orientieren könnte.
Auf unserer schönen Terrasse warte ich also, lese ein wenig, Theo brätelt in der heissen Sonne, und gegen eins bin ich wieder am Busbahnhof. Es gelingt mir, ein Ticket zu kaufen für übermorgen mit Destination Sancti Spiritus. Ein Gesamtticket zurück nach Havanna, wo man zwischendurch Aufenthalte einlegen könnte, ist leider nicht zu haben.
In einem kleinen Reisebüro reservieren wir für morgen eine Zugfahrt ins Valle de los Ingenieros. Dort sind stillgelegte Zuckerfabriken zu besichtigen.
Playa de Acona
Bis wir genau wissen, wo der Bus hält, der uns an den Strand bringt, braucht es mindestens vier verschiedene Auskünfte. Jeder will hilfreich sein und auch wenn er oder sie überhaupt nicht weiss, wo der Bus hält – macht nichts, man zeigt in eine bestimmte Richtung und sagt, dort sei der Bus-Stopp. Eine Passantin wollte uns gleich weismachen, es gäbe keinen Bus, der um zwei Uhr fahre, sie wollte uns gleich ein Taxi vermitteln. Von solchen Hilfeleistungen haben wir aber vorgängig gelesen. Darauf fallen wir nicht herein!
Der Bus kommt dann doch, aber die Fahrt kostet 10 CUC und man muss retour lösen, was uns nicht gefällt, denn der letzte fährt bereits um sechs wieder zurück und wir möchten eventuell dort essen und uns nicht auf eine Rückfahrtzeit festlegten.
Einem jungen Paar geht es gleich. So nehmen wir zusammen schliesslich doch ein Taxi und das kommt sogar noch billiger. Die beiden sind Türken und arbeiten in London. Von ihnen erfahren wir, wie die Wahlen in der Türkei ausgegangen sind, dass nachgezählt werden muss. Sie hoffen auch, dass Erdogan nicht durchkommt mit seinen diktatorischen Gelüsten. - Hier sind wir ja ohne Internet und ohne ausländische Zeitungen völlig vom Weltgeschehen abgeschottet, daher ganz froh, wenigstens etwas zu erfahren.
Der Strand ist gut besucht, aber wir finden doch noch einen Schattenplatz. Das Meer ist warm, trotzdem eine Wohltat, eine schöne Abkühlung. – Lesen, an der Sonne liegen, Daiquiri trinken – so macht’s Spass. Wir beschliessen nun doch, gegen sechs Uhr wieder zurückzufahren, denn das Strandrestaurant lockt nicht unbedingt so sehr zum Verbleib am Abend. Auch das türkische Paar sieht das so. Wir nehmen zusammen ein Taxi und die Fahrt in der kleinen Klapperkiste ist unvergesslich. Das Chassis besteht aus mehr Rost als etwas anderem, Fensterscheiben hatte das Auto sicher mal, jetzt aber wohl schon seit längerer Zeit nicht mehr. Die Frontscheibe ist von Spalten übersäht, deren Tage sind auf jeden Fall gezählt. Ein Scheibenwischer ist abgebrochen, der andere mitten in der Scheibe steckengeblieben. Keine Anzeige funktioniert, der Rückspiegel ist abgebrochen.
Der Fahrer knallt die Türen von aussen zu, anders schliessen sie nicht. Zu dritt sitzen wir auf dem zerschlissenen Rücksitz zusammengepfercht, Theo, der vorne sitzt, hält seinen Rucksack vor den Bauch. Er sagt, das wäre dann so etwas wie ein Airbag, falls ein abrupter Stopp stattfinden werde. Träfe das allerdings ein, würde sicher der ganze Boden durchbrechen, fürchte ich. Aber ok, es ist im Moment das einzige Taxi, das zur Verfügung steht, und wir beten alle insgeheim, die Fahrt zu überleben und gut in Trinidad anzukommen.
Beim Einschalten macht der Motor ein Geräusch, wie wenn er am Sterben wäre, aber der Fahrer bringt ihn schliesslich doch noch auf Touren. Er holt aus der Karre heraus, was möglich ist und wir rasen mit Höllenlärm zurück in die Stadt. – Es ist nochmal alles gut gegangen, Gott sei Dank!
Gleich um die Ecke, wo wir wohnen, gibt es ein sehr hübsches kleines Restaurant mit Namen Lis. Dorthin gehen wir zum Nachtessen. So eine schöne Ambience. Das Essen ist ok, der Wein ebenfalls, der Service ist aufmerksam, die Preise unschlagbar (mein Fischgericht mit Salat als Vorspeise und viele Zutaten nur 7 CUC). Der obligate Sänger (wenigstens nur einer) unterhält uns den ganzen Abend lang. Zum x-ten Mal hören wir „Guantanamera“ und „Besa me mucho“, dann „Chan Chan“ und „Comandante Ché Guevara“ („Cuando salí de Cuba“ ist verboten, darf er nicht singen). – Diese Lieder gehören einfach dazu. Es geht nicht ohne. Wir kaufen ihm eine CD ab.
19. April
Nach dem Frühstück fahren wir an den Bahnhof per Rikscha. Der Zug, der uns ins Tal der Zuckerrohr-Fabriken bringen wird, funktioniert nur noch für Touristen und fährt genau einmal am Tag. Sogar ein Fahrplan ist angeschlagen; das ist ja ganz was Neues. – Erst auf der Fahrt merken wir, dass dieser hinten und vorne nicht stimmt. Dabei wär’s nicht schwierig…
Die Fahrt ist lang, laut und „ratterig“, aber wir geniessen sie. Es ist eine angenehme Abwechslung. Wir kommen vorbei an Bauernhöfen (meist schäbige Hütten), Bananenplantagen, Busch- und Weideland, auf dem ein paar wenige ausgemergelte Rinder und Pferde das spärliche Gras suchen. Landwirtschaft wird kaum betrieben. Hier muss mal überall Zuckerrohr angepflanzt worden sein, von dem ist gar nichts mehr zu sehen.
In Iznaga, nach einer Stunde Fahrt etwa, werden der Zug beziehungsweise seine Fahrgäste schon erwartet. Es hat dort einen etwa 30 Meter hohen Turm, der natürlich von jedem Besucher erklettert werden muss nach Abgabe eines Obolus von einem CUC. – Der Weg dorthin ist wie ein Spiessrutenlauf durch all die Verkaufsstände hindurch. Alle wollen etwas verkaufen: gestickte Decken, Strohhüte, Puppen und Blusen. Es scheint, das ganze Dorf stehe dort Spalier.
Sehr steile Treppen führen zur Turmspitze. Sie zu erklimmen ist nicht ganz einfach, da immer wieder Gegenverkehr herrscht und man warten muss, bis die nächste Touristengruppe sich hinauf- oder hinuntergequält hat. Zur Belohnung gibt’s schliesslich einen wunderbaren Ausblick aufs Dorf, übers Tal, auf die Hügel und Berge am Horizont.
Weiter fährt der Zug in eine stillgelegte Zuckermine. Sie ist riesengross, aber nur noch eine Ruine. Nachdem die privaten Besitzer nach der Revolution enteignet worden waren, ging sie vor die Hunde. Das wird natürlich nicht so dargestellt. Geschrieben steht, man habe sie aufgegeben, weil es besser Standorte gegeben habe…
Zurück am Bahnhof in Trinidad beginnt es in Strömen zu regnen. Ein Rikscha-Fahrer bietet sich aber trotzdem an, uns zum Hotel zu fahren für 4 CUC. Regen töte einen ja nicht, meint er. Trotzdem – die Fahrt für ihn ist sehr mühsam; erstens geht’s bergauf und zweitens fliessen innerhalb kürzester Zeit ganze Flüsse die Strassen hinunter, die nun wie Bachbette aussehen. Genau zum Zeitpunkt des heftigsten Regens kommt uns ein Trauerzug entgegen, alle tragen sie dieselben Kränze, alle und alles wird tropfnass.
Unsere durchnässten Kleider hängen wir im Zimmer auf und legen uns ein wenig hin. Ich hätte gedacht, der Regen würde bald wieder aufhören, dem ist aber nicht so, also gibt’s eine längere Siesta.
Nach zwei Stunden wird’s erst wieder freundlich und die Strassen sind trocken. Wir spazieren zwei Quadras bergauf zum Convento de San Francisco de Asis. Auf den Turm kann man steigen und man hat von oben neben den Glocken durch einen herrlichen Blick auf die Stadt. Das ehemalige Kloster beherbergt auch ein Museum: Museo de la Lucha Contra Bandidos. Viele vergilbte Fotos und Bilder sind an den Wänden zu sehen und in Vitrinen, die sicher schon bessere Tage gesehen haben; alles handelt von den Helden der Revolution.
Zeit zum Nachtessen. Draussen, aber wie in einem grossen Wohnzimmer mit sehr hoher Decke und riesigen Fenstern und Türen, gedeckt also, weil’s doch immer wieder ein paar Tropfen gibt, landen wir im Restaurant Shango. Dort gibt’s für wenig Geld ein gar nicht mal so schlechtes Essen. Wären die Tomaten in der Tomatensuppe geschält und wäre nur halb so viel Wasser für die Brühe verwendet worden, wär diese Vorspeise sogar richtig gut.
20. April – Sancti Spiritus
Um neun sind wir an der Bushaltestelle, die ja grad nebenan ist. Nun ist auch ein Typ am zweiten Pult und bei dem kann man sogar Tickets bestellen für die Weiterfahrt. Toll! So kann ich bereits für die Weiterreise für morgen und übermorgen ein Billet kaufen und muss nicht wieder so viel Zeit dafür verlieren.
Die Fahrt nach Sancti Spiritus dauert nur etwa eine Stunde. Die Busstation befindet sich nicht im Zentrum. Wir nehmen ein Taxi und der Fahrer ist sehr hilfreich. Seine Klapperkiste (Chevi mit Jahrgang 1948) fällt fast auseinander und um den Motor auszuschalten, muss er erst die Kühlerhaube öffnen und dort drin irgendwo die Zündung unterbrechen. Er führt uns in ein ganz nettes Hostal, mitten in der Stadt und schleppt uns den schweren Koffer zwei enge Treppen in den ersten Stock hinauf.
Ein super Zimmer für 25 Fr. erhalten wir. Alles ist vorhanden, was man braucht, sogar ein Safe ist in der Wand eingelassen und eine Waage steht im Badezimmer - eine nette: Sie zeigt fünf Kilo zu wenig an. Auch hier hat’s wieder eine Terrasse, von der aus man über die Dächer der Stadt sieht.
Sancti Spiritus ist ganz anders als Trinidad. Es hat kaum Touristen, ist aber ein absolut sehenswertes Städtchen. Alle Leute sind freundlich und grüssen, oft wird man in ein kleines Gespräch verwickelt. In der Bank hat’s überhaupt keine Kunden, ich werde gleich sehr freundlich bedient. Die Angestellte prüft meine Hunderternoten sehr genau – mindestens vier Mal. Dann zählt sie die Pesos ab. Das ebenfalls viermal. Und einmal noch lässt sie sie durch eine Zählmaschine laufen. Sie sucht mir die schöneren Noten aus, schaubt die schmutzigen aus.
Auch hier hat’s eine hübsche Kirche aus dem 17. Jahrhundert mit einem Glockenturm, den man besteigen kann. Eine einmalige Aussicht mehr. Die Kirche ist blau angestrichen und heisst Iglesia Parroquial Mayordel Espiritu Santo. In einer Galerie sehen wir ein Bild, das wir gerne kaufen möchten, wir überlegen noch, aber wie wir zwei Stunden später zurückkommen, ist die Galerie schon zu. – Morgen ist auch noch ein Tag. Dafür haben wir drei Autos aus Pappmaché gekauft. Die sind zum Glück sehr leicht.
Eine Sehenswürdigkeit der Stadt ist die Ponte Yayabo, eine alte Brücke über den Yayabo Fluss.
In einem Restaurant, von dem aus man einen schönen Blick auf die Brücke hat, trinken wir unsere Daiquiri und Mojito und essen ein wirklich feines Sandwich. Der junge Kellner ist äusserst zuvorkommend. Er ist nur für uns da; wir sind die einzigen Gäste.
Gleich neben der Bar hat’s ein etwas seltsames Museum. In einem Zimmer sind alte Telefonapparate ausgestellt, im anderen Hemden mit vier Taschen, offenbar ein spezielles Design hier.
Im Telecom-Shop muss ich draussen anstehen, um eine Internet-Access-Karte zu kaufen. Die lassen die Kunden draussen vor der Türe stehen und nur einzeln wird Einlass gewährt.
Um die Karte zu beziehen, brauche ich meinen Pass. Die Verkäuferin tippt alles ab; ich habe das Gefühl, sie schreibt den ganzen Text ab. Anschliessend schreibt sie die Nummern der Karten auf, die sie mir endlich übergibt. 1.50 CUC kostet die Karte nur. In Havanna im Hotel hab ich für die gleiche Karte 4.50 zahlen müssen, in einem andern Hotel haben sie 10 CUC verlangt…
Natürlich versuch ich gleich, mit dem Laptop ins Internet zu gelangen. Was für eine Geduldsprobe! – Nach etwa einer Viertelstunde kann ich wenigstens meine Mails sehen, das heisst, die erste Zeile nur, öffnen kann ich keines, beantworten schon gar nicht. Whatsapp ist verschwunden, die Information über unsere Flüge kann ich nicht öffnen, ein Hotel buchen geht schon gar nicht. Zum Verzweifeln!!!
Wir kommen mit einem Ehepaar ins Gespräch, die ebenfalls ein Zimmer vermieten. Auch sie sind sehr gerne behilflich, geben uns einen Rat, wo wir gut essen können (gleich gegenüber vom Park bei einer Freundin von ihnen). Wir erwähnen, dass wir morgen nach Santa Clara fahren werden und auch dort wieder ein Zimmer brauchen. Dort hat Aracelio auch eine Freundin, die eine Casa Particular hat, also Zimmer vermietet. - Mitten im Zentrum. Er reicht mir sein Telefon und ich kann bei der Dame ein Zimmer reservieren. Sie wird uns ein Taxi an die Busstation schicken. Das lässt sich ja fabelhaft an; für einmal alles schon organisiert!
Im Gegensatz zum touristischen Trinidad hat’s hier nicht an jeder Ecke ein Restaurant, das zum Verweilen lädt. Die paar, an denen wir vorbeikommen, machen einen erbärmlichen Eindruck. Wir versuchen’s mit demjenigen, das uns empfohlen wurde. Die teuerste Flasche Wein kostet 9 CUC – wir bestellen sie, die Kellnerin aber sagt, sie habe nur noch zwei Gläser davon übrig. – Nehmen wir halt die. Ok, ok - das hätte ich mir besser überlegen sollen. Die beiden Gläser kommen ja aus einer angebrochenen Flasche und wann die angebrochen wurde… Bestellt ist bestellt, wir beissen in den sauren Apfel beziehungsweise …
Der Fisch, den ich bestellt habe, wär gar nicht mal so schlecht, wäre er nicht versalzen. Der Salat ist so, wie er überall ist: viel Kabis, ein paar wenige geschmacklose Bohnen und ebensolche dünne Tomatenscheiben. Theo klagt nicht, aber der Anblick seines Fleisches reisst mich auch nicht vom Hocker. Mineralwasser hat’s übrigens auch keins. Bier für Theo schon.
21. April
Nach einem reichlichen Frühstück gehen wir nochmals auf die Walz. Es regnet in Strömen, wir erhalten einen Regenschirm. Nackte Frauen sind drauf abgebildet. Wir suchen erneut die Galerie auf, in der wir das Bild gesehen haben, das uns gefällt. Statt für erst 150 CUC erhalten wir es für 120 CUC. Der Galeriebesitzer lässt den Künstler kommen und der stellt uns dann eine Quittung und eine Bescheinigung aus, damit wir am Zoll keine Schwierigkeiten bekommen.
Auch möchte er uns eine Kiste Cohiba Zigarren (25 Stück) für 40 CUC verkaufen, von einem Freund, der in der Fabrik arbeitet. „Alles echt und kein Problem mit dem Zoll“. Theo liebäugelt schon sehr mit dem Angebot, aber wir haben uns ja vorher informiert und gelesen, dass man nur in Geschäften, die der Regierung gehören, kaufen soll, keinesfalls auf der Strasse. – Wir lassen’s also.
Das eine Museum, das wir besuchen möchten, ist geschlossen. Wahrscheinlich wegen des Regens, denken wir. Wir versuchen ein anderes, ein schmuckes Stadthaus eines reichen Mannes aus dem neunzehnten Jahrhundert. Das ist offen und wir sind die einzigen Besucher. Man darf keine Fotos machen, da wird aufgepasst. Eine Angestellte kommt mit uns mit von Zimmer zu Zimmer, zündet vor uns das Licht an und wenn wir durch sind, löscht sie es wieder aus. – Wirklich gelohnt hat sich der Besuch ja nicht, aber für einen CUC…
Wir haben Zeit und es regnet noch immer, daher: Noch ein Drink in einem schönen kolonialen Haus mit bequemen Sesseln. – Eigentlich wollte ich ja nicht mehr über die Toiletten schreiben, aber hier „lohnt“ es sich doch noch fast: Nebst dem, was üblicherweise fehlt, fehlen hier auch die Toilettentüren…
Langsam wird’s Zeit, zum Busbahnhof aufzubrechen. Ein Taxi bringt uns hin. Der Bus hat über eine halbe Stunde Verspätung. Nach einer guten Stunde Fahrt kommen wir um halb sechs in Santa Clara an.
Santa Clara
Der aufgebotene Taxifahrer hat brav gewartet. Er ist mit einem Kollegen dort. Sofort hat er uns erspäht, die Beschreibung (Frau mit weissen Haaren) hat dabei geholfen. Zum ganz sicher sein, hat er sich meinen Namen auf die Handfläche geschrieben; das fand ich sehr lustig!
Nach knapp zehnminütiger Fahrt kommen wir in unserer neuen Unterkunft an. Wir werden von der ganzen Familie herzlich begrüsst und ein Zimmer mit allem, was man braucht, ist unsere Bleibe für die nächste Nacht. Auch hier hat’s einen Safe, Seife und warmes Wasser. 25 CUC kostet die Übernachtung für uns beide.
Auf einem Spaziergang um die Plaza Vidal kommen wir am Palacio de la Musica vorbei. Eine freundliche schwarze Frau lädt uns ein, den Palast zu besichtigen. Das Gebäude hat schon sehr viel bessere Zeiten erlebt, aber immerhin ist es noch nicht ganz dem Zerfall erlegen. In einem Zimmer werden Tänze eingeübt, in einem andern findet Gitarrenunterricht statt und zwei Chicos üben Breakdance. Sie zeigt uns den Tanzsaal und gibt uns beiden ein Ständchen auf dem Klavier (R. Cleidermann und „Haleluja“). Sie spielt gut und wir geben ihr am Schluss des Rundgangs ein Trinkgeld, obschon sie sagt, die Besichtigung sei gratis. Nach zwei Daiquiris in einem staatlichen Restaurant am Platz verköstigen wir uns in einem Restaurant ganz in der Nähe unseres Hostals. Gerade mal 20 CUC (eine Flasche Wein inklusive) stehen auf der Rechnung; das wird ja immer billiger.
Wir wohnen zwar mitten im Zentrum, aber in der Nacht ist es absolut ruhig bis auf einen Hahn, der ab zwei Uhr im Zweistundentakt unbedingt krähen muss und den Zug, der im Dreistundentakt das ganze Quartier aufweckt mit seinem Gehupe. – Es gibt keine Barrieren an den Bahnübergängen, daher der Lärm.
22. April
Nach einnem reichlichen und mit viel Liebe von der Grossmutter zubereiteten Frühstück geht‘s zum Sightseeing.
Die Revolution ist hier in Santa Clara das Thema. Nur ein paar Blocks weiter stehen die fünf Eisenbahnwagen, die von Ché im Jahr 1958 mit einem Bulldozer zum Entgleisen gebracht worden waren. Die Wagen dienen heute als Museum.
Ein Velotaxi bringt uns an den andern Ort des Geschehens, das Mausoleum, wo Chés Gebeine und die seiner Kumpane begraben sind beziehungsweise nach 30 Jahren aus Bolivien übersiedelt wurden. Unterwegs will Theo eine Zigarre kaufen. Der junge Fahrer ist gerne behilflich, hält an drei verschiedenen Orten an, geht fragen, ob Zigarren dort verkauft werden und beim dritten Mal klappt’s dann. Theo kann für einen CUC einen billigen Glimmstengel erstehen. – Vor lauter Kaufeifer lässt er seine Sonnenbrille dort liegen. – Der freundliche Velotaxifahrer hat fast eine Stunde auf uns gewartet, bis wir die Ché-Besichtigung hinter uns haben und fährt uns anschliessend zurück ins besagte Geschäft. Er selber kann die Zigarren viel billiger kaufen. Für einen CUC erhält er gleich fünf Stück derselben Marke. Theo strahlt. – Natürlich ist die Ware eine Katastrophe, aber das tut Theos Freude keinen Abbruch.
Zurück im Zentrum spazieren wir durch den Boulevard, das ist (wie auch in Santi Spritus) die Fussgängerzone mit all den Einkaufsläden. Es hat viele Leute, aber einkaufen kann man nichts, was einen gelüsten würde. Es hat auch kaum Schaufenster, nicht zu vergleichen mit einer Einkaufsstrasse in Europa.
Wir haben noch Zeit, gehen zurück in das Restaurant, wo wir am Abend zuvor unseren Apéro hatten und bestellen nochmals dasselbe am selben Tisch: zwei Daiquiris. „No hay“, ist die Information. Kann doch nicht sein… Doch, inzwischen hat die Eiszertümmerungsmaschine das Zeitliche gesegnet.
In einem anderen staatlichen Restaurant bestellen wir eine Pizza. Die Kellnerinnen sind so etwas von abgestellt, es ist kaum zu glauben. Das Wasser, das wir bestellen, kommt nicht. Das hat sie bereits wieder vergessen. Die Pizza sieht nicht besonders italienisch aus. Man kann sie aber essen, vor allem, wenn man Hunger hat. Zum Glück suche ich erst nachher die Toilette auf (kein Wasser, kein Lavabo, kein Papier – wen wundert’s?!). Auf dem Weg dorthin komme ich an der Küche vorbei. Der Anblick – keiner für die Götter! Ein paar Pizzas liegen auf dem Boden unter dem Wachbecken. Da hat’s aber wenigstens Wasser…
Schon wieder ist Zeit zum Weiterreisen. Ein Taxi bringt uns an den Busbahnhof und diesmal fährt der Bus zehn Minuten zu früh los, alle Fahrgäste sind offenbar schon da. Unser nächstes Ziel ist Varadero, der Ort, an dem in unseren Reisebroschüren mit „All-inclusive-Resorts“ geworben wird. Wir sind ja gespannt... Solche Hotels allerdings sind nicht unser „Ding“. Wir bevorzugen die Privatunterkünfte. Diese sind sehr viel authentischer als die anonymen Hotelkästen und man hat einen besseren Einblick in die Lebensweise der Kubaner. Unsere nächste Unterkunft dort konnten wir bereits telefonisch buchen; unsere hiesigen Gastgeber besorgten uns die Adresse. Man kennt sich eben...
Varadero
Unterwegs regnet es in Strömen. Der Bus erreicht Varadero in knapp drei Stunden, zwanzig Minuten früher als vorgesehen. Auch gut so. Und gerade in dem Moment hört’s zum Glück auf zu regnen. Taxis hat’s keine oder nur solche, die bereits besetzt sind. Zwei Typen bringen uns aber in unsere nächste Unterkunft. Sie haben ein Privatfahrzeug, das mal endlich ein wenig besser aussieht als die üblichen Bruch-Vehikel. Kaum dort angekommen, beginnt es wieder zu giessen wie aus Kübeln, fast sintflutartig.
Unsere Gastgeberin hier heisst auch Maria und sie ist äusserst nett und sympathisch. Wir erhalten ein Zimmer mit Bad und einer kleinen Küche, die wir aber wiederum nicht brauchen werden.
Wir haben aber noch nichts gegessen. Mit zwei Schirmen bewaffnet suchen wir das nächstgelegene Restaurant gleich um die Ecke auf. Beim Überqueren der Strasse treten wir unweigerlich in die tiefsten Wasserlachen, nasse Schuhe und Füsse sind einfach nicht zu vermeiden. Der Kellner dort will grad schliessen, hat eine Schnur gespannt vor den Eingang des Gartenrestaurants; der Regen hat die Gäste offenbar vertrieben und es ist schon nach neun. Er hat dann doch noch ein Einsehen. Es habe nur noch Fisch oder Filet Mignon, wenn das ok sei, könnten wir kommen. - Sehr ok, je eins der Gerichte bestellen wir und eine Flasche Wein. Aber die könnten wir nicht in Ruhe fertig trinken, lässt er uns wissen, er wolle nachher schliessen und heim. – So geht das hier…
23. April
Als wir gestern ankamen, war’s dunkel und wir sahen gar nicht so genau, wo wir eigentlich „gelandet“ sind. Jetzt merken wir, wie gut die Casa, in der wir wohnen, gelegen ist. 50 Meter zum Supermarkt (sieht zwar „gut“ aus, hat aber doch auch hier kaum etwas Kaufenswertes), 100 Meter zum Meer, zum Centro Commercial, wo’s einen Bancomat hat, ist’s kaum fünf Minuten zu Fuss. – Wir sind mitten im Zentrum, Calle 41. – Da haben wir wieder grosses Glück gehabt mit der Unterkunft.
Den Nachmittag verbringen wir am Strand. Wie’s im Büchlein steht: Palmen, weisser Sand und das bis weit hinaus klare kristallblaue und türkisfarbene Wasser des Meeres ist eine Augenweide. Und warm ist das Wasser; es ist eine Freude.
Unseren inzwischen üblichen Daiquiri trinken wir zur Apérozeit in einem Restaurant gegenüber. Wir verwickeln uns in ein Gespräch mit einem Amerikaner, der Trump gewählt hat… Das gibt zu diskutieren! Aber es geht friedlich zu.
Eine Casa Habana gibt’s auch gleich um die Ecke. Da kann man jetzt die teuren originalen Zigarren kaufen. Theo ist im siebten Himmel. Hier wird zum ersten Mal mit der Kreditkarte bezahlt – das Kleingeld reicht nicht.
Dusche und Siesta „zu Hause“, Nachtessen in einem Restaurant ein wenig weiter weg als das gestrige. Sie sehen übrigens alle ähnlich aus, diese Lokale: Man isst draussen unter grossen ausladenden Palmendächern, ähnlich wie in Afrika.
La Viscaria ist auch wieder ein Restaurant, das der Regierung gehört. Man merkt’s – das Übliche: gelangweilte, uninteressierte Kellnerinnen, die ziemlich vergesslich sind. Langsam frage ich mich, ob diese Eigenschaft Voraussetzung ist, um in einem staatlichen Lokal zu arbeiten, niedergeschrieben im Pflichtenheft. - Statt des Crevetten Cocktails bringt sie uns etwas, das aussieht wie ein Spaghetti-Köpfchen und nach gar nichts schmeckt. Ich denke erst, da habe sich der Koch vielleicht etwas Spezielles einfallen lassen mit den Crevetten. – Nein, ein Poulet-Salat sei das, klärt sie uns auf. Also doch etwas Spezielles: Wo ist das Poulet?
Apropos: Theo bestellt sich ein Poulet-Cordon-Bleu. Er findet, es sei etwas dünn und ich denke, es hätte gut sein können, dass das Huhn, wäre es nicht geschlachtet worden, an Hunger gestorben wäre. – Mein Fisch ist ein wenig zäh, der Rotwein ein wenig viel zu warm.
24. April
Es gibt einen Touristenbus, Hop on – hop off, so wie in den meisten europäischen Städten auch. Er kostet nur 5 CUC pro Person und fährt den ganzen Tag im Viertelstundentakt der Halbinsel Varadero entlang, die wie ein 18 km langer und etwa fünfhundert Meter breiter Blinddarm in den Atlantik hineinreicht - hin und zurück, hin und zurück. So können wir die ganze Halbinsel erkunden, die teuren All-Inclusive-Hotel-Ghettos ganz oben an der Spitze und die zahllosen Souvenir-Märkte und Restaurants in der Mitte, wo sich das Zentrum des Ortes befindet. Alle bieten das Gleich an, und trotzdem können wir’s nicht lassen, das eine oder andere zu kaufen. Mal sehen, was unser Koffer dann dazu meint.
Unterwegs kommen wir an einem „Reisebüro“ vorbei (ein Tischchen und ein Stuhl draussen vor einem Geschäft und eine verbleichte Auslage mit Ausflugs-Angeboten. Wir buchen für den Mittwochabend „Buena Vista Social Club“, die bekannte Show in einem der Hotels am Ende der Halbinsel. Wir werden von einem Oldtimer-Cabriolet abgeholt werden, es gibt einen Apéro, man wird mit den Sängern und Musikern ein paar Worte wechseln können und dann beginnt die Show um zehn und dauert anderthalb Stunden. Das Vergnügen kostet 120 CUC; glücklicherweise kann man das mit der Karte zahlen. Es ist ein horrender Preis gemessen an den Verhältnissen hier. Die Angestellte plaudert ein wenig mit uns und erzählt, sie sei vorher Lehrerin gewesen. Ihr Gehalt damals 10 – 12 CUC pro Monat, jetzt sei’s besser – 15 CUC. Und wir zahlen so mir nichts dir nichts für eine Abendunterhaltung das Zehnfache…
Essen am Abend dann in einem wirklich schmucken kleinen privaten Restaurant (Paladar). Maria hat es uns empfohlen, wir selber hätten es wohl nicht gefunden: „Casola del Arte“. Das Essen ist mindestens um eine Klasse besser als in den offiziellen Restaurants (Beilagen wie überall).
25. April
Nach dem Frühstück gehen wir in die Casa de la Musica, wo’s einen Internet Hot Spot hat. Und wieder dauert’s eine gefühlte halbe Stunde, bis die Verbindung klappt. Aber endlich kann ich wenigstens zwei wichtige Emails schreiben. Das ist schon mal was wert.
Bei Maria habe ich einen ganzen Sack voll Wäsche abgegeben, ich habe gesehen, dass sie eine Waschmaschine hat. Ich würde warten und die Wäsche dann aufhängen, bot ich an. Nein, nein, das komme gar nicht in Frage, meint sie. – Ich sehe dann, wie ihre Mutter alle unsere Wäschestücke von Hand vorwäscht, bevor sie sie in die Maschine legt. Wie wir am Abend heimkommen, finden wir die Wäsche schön zusammengelegt auf unserem Bett vor. Sie wollte kein Geld für die Dienstleistung, natürlich ist’s jetzt an mir zu sagen, das komme nicht in Frage.
Den Tag verbringen wir alsdann am herrlichen Strand in Liegestühlen am Halbschatten unter Palmen.
Am Abend Nachtessen im Caney, wo wir am ersten Abend waren. Eine richtig gute Pouletbrust gibt’s (Pollo Supreme), so zart, ich kann fast nicht glauben, dass wir in Kuba sind.
26. April
Etwa gleich wie der Vortag:
Nach dem Frühstück gehen wir ins Centro Commercial. Theo hat sich erkältet, das ist ein wenig mühsam. In der Apotheke kaufen wir Tabletten gegen die Erkältung. Die Verkäuferin gibt uns aus zwei Schachteln je eine Folie mit zehn Stück drin und eine Rechnung dazu von 23 CUC. Die Schachteln und die Beschreibung dazu erhalten wir nicht, sie gibt sie uns zwar zuvor zum Lesen. Erst wie wir draussen sind, wird mir klar, dass sie uns übers Ohr gehauen hat. Sicher hat sie die Hälfte der Tabletten behalten und gibt sie mit dem Rest der Medis an jemanden Gescheiteres weiter, der oder die dann zwar auch nur die Hälfte der Medis erhält, aber mit Schachteln und Packungsbeilag. So hat sie dann recht verdient. Eigentlich will ich zurück und die Sache in Ordnung bringen. Theo aber will nicht…
In der Casa de la Musica dann gibt‘s wiederum ein Internetstündchen und zwei Cappuccinos.
Liegestühle und Strand am Nachmittag. Der Sand ist so heiss, dass man ohne Flip-Flops gar nicht drauf gehen kann. Sowieso ist es heute noch heisser als gestern. Abkühlung bringt das Meer.
Aber Theo will nicht baden gehen, auch ein Spaziergang, zu dem ich ihn mehrmals auffordere (was ihn nervt), ist offenbar nicht auf seinem Programm. Er will lieber auf dem Liegestuhl schwitzen, lesen und schlafen, und das stundenlang. – Erst am späten Nachmittag macht er sich dann doch noch auf, ein paar Schritte am Strand entlang zu gehen und ins nicht so ganz kühle Nass zu steigen. Und da merkt er, dass ihm sein Fuss weh tut. Er hat ihn beim langen Liegen irgendwie verknackst. Jetzt humpelt er. – Ja, die Strafe folgt manchmal halt auf dem Fuss.
Humpeln tut er auch am nächsten und übernächsten Tag noch. Er fragt sogar Kay an, was sie meint, was er habe und erklärt ihr seine Beschwerden im Detail. Dazu muss er nochmals ins Internetcafé hinken… Grad amputieren muss man den Fuss wohl nicht, sage ich, aber er goutiert Bemerkungen dieser Art nicht sehr. Ebenso wenig wie meine Nicht-Anteilnahme an seinem Gebrechen.
Es ist unser letzter Abend in Varadero. Maria hat uns ein tolles Restaurant empfohlen in der 31sten Strasse. Es ist ein Paladar („Salsa Sanchez“), also ein privates Unternehmen. Das merkt man sofort an der sehr gediegenen Einrichtung, der Art, wie die Kellnerinnen gekleidet und ausgebildet sind. Das Essen ist exzellent, die Drinks ebenso und das Dessert einzigartig. Die Rechnung natürlich auch für hiesige Verhältnisse.
Pünktlich um halb neun sind wir beim Hotel Delphino, wo wir von einem Oldtimer (Chevi Convertible 54) abgeholt werden und uns ins Hotel Paradiso chauffieren lassen. Dort gibt’s einen Drink und um zehn Uhr beginnt die Vorstellung der Band: „Cuban Soneros All Stars“. Elf Männer und zwei Frauen machen gute Unterhaltung, kubanische Musik eben. Die eine Frau ist eine hervorragende Sängerin. Der Clou aber ist schon der Älteste der Gruppe, ein kleiner, dürrer Kubaner mit weissem Schnurrbart, gegen die neunzig Jahre alt. Er sieht nicht aus, wie wenn er noch grosse Sprünge machen würde, (seine kleinen Schrittchen, die er im Takt zur (lauten) Musik macht, sind fast ein wenig unbeholfen), aber seine Stimme ist unglaublich. Wie die eines jungen Mannes. Und schalkhaft ist er auch. „I love you“ haucht er zwischendurch ins Mikrophon.
Der alte Chevi bringt uns wieder heim und um zwölf sind wir im Bett. Ein schöner Abend war’s, nicht ganz billig, aber wir gönnen uns ja sonst nichts…
27. April
Wir frühstücken gemütlich. Wie jeden Morgen macht uns Maria einen grossen Teller voller Früchte parat. Sie erwähnt, dass die Bananen aus dem Hotel seien, wo ihre Schwester arbeite. Aus dem Grund seien sie auch so gut und süss. Diese Bananen seien nur für die Touristen, Kubaner könnten nur schlechtere Qualitäten kaufen.
Auch die Löhne sind nochmals ein Thema und sie bestätigt, dass ein normales Gehalt nicht mehr als 20 CUC pro Monat beträgt.
Wir packen wieder mal unseren Koffer und unsere Taschen und begeben uns gemütlich zum Viazul Busbahnhof. Unterwegs sehe ich eine Bank, die offen hat und mir kommt in den Sinn, dass ich noch eine 3-Peso-National-Banknote kaufen möchte mit dem Gesicht von Ché drauf. Diese Noten sind sehr gefragt bei Touristen, die dafür, wie ich gelesen habe, oft ein paar Franken ausgeben. Auf der Bank kosten sie jedoch nur, was sie wirklich wert sind, nämlich etwa 15 Rappen. – So kann ich mir ja gleich drei davon leisten…
Beim Eingang zur Bank steht jeweils ein Typ, bei dem man sich anmelden und erklären muss, was man will. – Er geht sofort von Schalter zu Schalter und wie er einen gefunden hat, wo solche Noten vorhanden sind, weist er mich gleich dorthin. Alle andern Bankkunden (es sind ausschliesslich Kubaner), die dort warten, warten noch ein Weilchen länger. Das ist mir natürlich nicht recht, aber so werden hier die Touristen halt behandelt.
Zurück in Havanna
Der Bus nach Havanna fährt mit geringer Verspätung kurz nach zwölf Uhr mittags ab. Es gibt einen kurzen Zwischenhalt auf der Strecke, eine Kaffeepause. Nach gut drei Stunden hält er mitten in der Hauptstadt an, noch zwei weitere Haltestellen gibt’s, dann sind wir an der Endstation, dort, wo unsere Reise begonnen hat. Ich sitze noch im Bus, als schon eine Horde Taxifahrer durchs Fenster andeuten, dass sie gerne ihre Dienste zur Verfügung stellen würden.
Paolo hat das Rennen gemacht. Sein Auto ist zwar nicht gerade ein Traum, aber all unser Gepäck und wir selber haben Platz und er ist sehr sympathisch. Der Preis ist abgemacht, er fährt uns aber nicht ganz auf direktem Weg zum Ziel. Er fährt durch Quartiere, die wir nicht kennen und erklärt uns, welche Gebäude zu sehen sind. Er wäre der perfekte Gide, um mit ihm eine Stadtrundfahrt zu machen. Auch klärt er uns über die Nationalblume (Mariposa), den Nationalbaum (Palma Real) und den Nationalvogel (Tocororo - rot, weiss, blau wie die Farbe der kubanischen Flagge) auf. Auf seinem Handy hat er Bilder davon, die er uns zeigt.
Sogar auf der Tripadvisor-App sei er zu finden und er bittet uns, dort eine gute Beurteilung für ihn abzugeben. Das mache ich auf jeden Fall. Sobald wir wieder mal Internet haben. Ich habe noch zwei Tafeln Schokolade, die gebe ich ihm als Trinkgeld.
Und wieder eine Überraschung bei unseren Gastgebern: Abels Bruder aus Schweden, der für einen Monat zu Besuch kommt, wird bereits morgen erwartet und nicht übermorgen, wie Maria Elena uns versichert hat. Wir könnten also nur eine Nacht noch bei ihnen bleiben und müssten dann eine andere Bleibe suchen. Das macht für mich keinen Sinn, da will ich lieber gleich für unsere beiden letzten Tage eine andere Unterkunft suchen. – So landen wir bei Nachbarn, und dort ist es mindestens ebenso gut.
Abel schwärmt von einem wunderschönen Restaurant mit Blick aufs Meer und auf einen prächtigen Sonnenuntergang. Er reserviert uns einen Tisch und sagt, er bringt uns hin. Sein Auto ist inzwischen Strahl und Glanz. Er hat neue grüne Sitzbänke eingebaut; edel sieht es aus. Die werden für Classic-Cars in den USA hergestellt, nach Mexiko verkauft, von wo aus sie den Kubanern geliefert werden können. Direkt aus den USA kann noch immer keine Ware bezogen werden.
Wir duschen und um halb sieben werden wir von Abel und Maria Elena abgeholt. Das Restaurant, ein Paladar, sieht wirklich gut aus. Es hat sogar einen Swimmingpool und ringsum kleine romantische Zweiertische, von denen aus man die versprochene Sicht hat. Rechts vom Gebäude aber sieht es grauenhaft aus. Es hat zwei Häuser, die wohl früher mal genau gleich ausgesehen haben, beide ebenfalls mit je einem Swimmingpool. Der eine ist leer, im andern ist noch Wasser drin, dunkelgrün, voller Algen. Die Häuser sind unbewohnbar, sie sind zerfallen, nur noch Ruinen. Sie gehören dem Staat…
Wir laden Maria Elena und Abel ein, mit uns zu essen. Erst wollen sie nicht so recht, es sind nur Touristen in diesem Lokal, aber dann nehmen sie die Einladung doch an.
Das Essen ist delikat, die Rechnung am Schluss auch. 125 CUC sind sehr viel Geld für kubanische Verhältnisse.
Unsere beiden Gäste geniessen den Abend offensichtlich und statt heimzufahren gibt’s einen Abstecher ins Hotel National, ein Gebäude mit viel Geschichte, gebaut 1930. Wir sehen uns die Hall of Fame an, eine grosse Bar, wo Fotos all der illustreren Gäste hängen, die dort abgestiegen sind, Filmstars und Politiker. Ein Spaziergang durch den schönen Garten, vorbei an den riesigen Kanonen bildet schon fast den Abschluss unseres speziellen „Ausgangs“.
Kurz vor der Strasse, wo wir wohnen, gibt’s einen Park beziehungsweise ein Quartier, genannt „Fusterlandia“, wo ein reicher Ausländer, José Fuster, alle Häuser mit Mosaiken hat verzieren lassen. „Homage a Gaudí“ ist das Motto. Dorthin führen uns die beiden noch und ich muss sagen, wir waren begeistert; die Häuser sind absolut sehenswert. Einen solchen Ort in dieser Stadt hätte ich nicht erwartet. Und der Touristenbus fährt nicht mal hin.
28. April
Raquel möchte lieber kein Frühstück machen, sie hat weder Früchte noch Fruchtsaft noch Brot; uns ist es grad recht. – Es ist unser letzter Tag in La Habana, wir haben vor, mit dem Touristenbus Hop on Hop off eine Rundfahrt durch die Stadt zu machen und uns noch ein paar Sehenswürdigkeiten „reinzuziehen“, wie man heute so sagt. Wir gehen als Erstes nochmals in das schöne Quartier und machen dort ein paar Fotos, jetzt am Tag. Mit einem Taxi fahren wir zur Haltestelle Cecilia, dorthin, wo der Touri-Bus hält. Nach zwanzig Minuten ist er da und wir steigen ein. Es ist sehr heiss heute, auf dem Dach des Doppeldeckers ist der Fahrtwind ganz angenehm. Seinen Hut allerdings muss man festhalten, sonst ist er weg.
Wir fahren vorbei am Cementerio Colon, einem riesigen Friedhof, dem bedeutendsten in Lateinamerika. Weiter geht’s zum Platz der Revolution, wo ein Standbild von José Martí (kubanischer Nationalheld) steht, Chés Konterfei einmal mehr an einer Hausmauer verewigt ist und wo in drei Tagen der Erste Mai gefeiert werden wird.
Man ist schon am Einrichten: Beleuchtung, Lautsprecher, WC-Kästen, Tribünen. – Theo macht wieder mal „sein Ding“; er legt sich auf einen der im Moment noch leeren Bänke und lässt sich von mir fotografieren. Wir gehen weiter. Er hat nicht gemerkt, dass ihm sein i-Phone aus der Hosentasche gerutscht ist und nun dort unter der Tribüne liegt. So hat er schon soo viel verloren, sein e-Book oder in Hawaii zum Beispiel sein Sketchbuch, das ihm dann glücklicherweise eine nette Rangerin in die Schweiz geschickt hat. Und soooo oft hab ich ihm gesagt, er solle nichts in diese Hosentaschen stecken. - To no avail. – Es nützt einfach nichts. Am nächsten Tag passiert ihm übrigens dasselbe nochmals. Es ist sein Fotoapparat, der ihm in Abels Auto aus der Hose rutscht. Abel hat’s zum Glück noch grad rechtzeitig bemerkt, bevor wir uns verabschieden.
Noch einmal machen wir einen letzten Spaziergang durch die Altstadt, essen eine Kleinigkeit zu Mittag in einem netten Restaurant im ersten Stock mit schönem Blick auf die Plaza Vieja. Per Rikscha geht’s zum Museo de la Revolution, das wir uns letztes Mal nicht angesehen haben. – Fotos über Fotos von den Heldentaten sind im ehemaligen Palast zu sehen und so langsam aber sicher geht es mir gleich wie Maria Elena, die sagt, die Revolution gehe ihr bis dahin – und sie zeigt mit der Hand bis zum Hals.
Den besten Daiquiri, den wir in diesen achtzehn Tagen in Kuba getrunken haben, gibt’s meiner Meinung nach im Chacón 162. Das Café ist ganz in der Nähe des Museums, also nichts wie hin.
Ein weiterer Bici-Taxi-Fahrer bringt uns anschiessend zur Bushaltestelle an der Plaza Central, wo wir grad rechtzeitig den Bus erreichen, der uns zurück nach Cecilia fährt. Ein Taxi für die kurze Strecke von dort aus heim nach Jaymanita finden wir nicht auf Anhieb; wir sind nicht bereit, die überhöhten Touristenpreise, die sie für die kurze Strecke haben wollen, zu bezahlen. Wir gehen ein paar Schritte – es beginnt zu regnen. Ein Bus hält an und ich frage den Fahrer, ob er in Richtung Marina Hemingway fahre. Es ist kein „normaler“ Bus. Er fährt mit seinen Gästen zu einem bestimmten Ziel, ein Band auf dem „Primer de Mayo“ steht, schmückt die Kühlerhaube, aber wie die Leute hören, wo wir hinwollen, sagen sie, wir sollten nur einsteigen. Ein Gejohle im Bus, laute Musik, Gelächter und Salven von Gesprächsfetzen begleiten unsere Fahrt. Ich habe den Eindruck, da ist ziemlich viel Rum mit im Spiel. Wie wir bei der Marina Hemingway ankommen, hält der Bus an und wir steigen aus. Der Fahrer hupt mehrmals und alle winken noch, bis das Vehikel um die nächste Ecke biegt. So lustig war das. Und das Vergnügen hat nur einen CUC gekostet. Auch hat’s während der Fahrt geregnet, wie wir aussteigen, hört’s grad auf.
Schon vor Tagen hat uns Maria Elena gesagt, wir sollen doch mal zur Marina Hemingway spazieren, nicht weit von ihrem Haus entfernt. Es habe dort ein paar Geschäfte und Restaurants. Bisher haben wir’s nicht geschafft, jetzt aber schon. Man sieht ein paar Yachten, aber laufen tut überhaupt nichts. Im Supermarkt will ich Mineralwasser kaufen; „no hay!“.
Eine Bar hat’s. Eher ein trauriges Lokal. Laute Musik dröhnt aus dem Lautsprecher, Theo ist wenig begeistert. Ich will aber was trinken. Es gibt nur Bier und Mojito. Also, das ist ja genau, was wir brauchen. Auch in meinem Mojito fehlt irgendwie das Mineralwasser. Ich glaube, er besteht nur aus Rum, ein paar Eiswürfeln und einem dürren Blättchen Minze. In einem Plastikbecher. Ist aber ok. Und so nett sind die Männer alle. Ich mache ein paar Fotos und sofort setzen sie sich in Pose, prosten uns zu. - Das ist, was wir oft hier erlebt haben, diese heitere Fröhlichkeit und Freundlichkeit. Dann beginnt einer ein Lied zu singen und die Welt ist in Ordnung.
Auf dem Heimweg gehen wir bei Maria Elena und Abel vorbei, um uns zu verabschieden. Der Bruder aus Schweden ist inzwischen angekommen. Verrückt, wie sich die Brüder gleichen, obwohl sie nicht Zwillinge sind. Beide sind ziemlich beleibt. Wir sitzen alle beieinander, Abel, sein Bruder und die Mutter der beiden, Maria Elena, ihr Sohn Daniel und dessen Freundin. Gebannt hören sie zu, wie der Bruder mit uns Englisch spricht.
Zu Hause dann die dringend nötige Dusche und schliesslich gehen wir ins einzige Restaurant weit und breit, ins „Santy“, wo wir vor etwa zehn Tagen so feine Sushis hatten und Fisch. Ins Restaurant am Fluss, das so schön sein könnte, wär da nicht die Umgebung mit den vergammelten Booten und dem verschmutzten Wasser. Das sieht man allerdings nicht bei Nacht und so ist das Lokal trotzdem sehr romantisch. – Die Sushis sind wiederum Spitze, Fisch und Spaghetti ebenfalls; wir essen dasselbe wie beim ersten Mal. – Heute hat’s sehr viele Leute, es ist Freitagabend, man feiert, singt, isst, trinkt und freut sich. Die meisten Gäste scheinen mir Kubaner zu sein. Dass sie sich das leisten können? Es müssen Leute sein, die im Tourismus ein wenig Geld machen können, was Raoul ja neuerdings in gewissem Masse zulässt.
29. April – Weiterreise auf die Bahamas
Um sieben steh ich auf. Unsere Koffer habe ich beide total geleert, jetzt geht’s drum, sie geschickt zu packen, so dass wir nur einen davon nach Long Island mitnehmen müssen und einen in Nassau zurücklassen können. Mit dem Resort auf Stella Maris, welches Flüge für siene Gäste auf der Insel anbieten, hatte ich mehrfach per Email Kontakt und Alissa liess mich wissen, dass pro Person nicht mehr als 15 kg mitfliegen sollten/dürften.
Die Kofferpackung gelingt, auf den schwarzen Koffer können wir verzichten, der graue und das Handgepäck sind genug.
Von Theos Brie und der Terrine, die er auf dem Flugplatz in Paris gekauft hat, ist noch immer etwas übrig. Die beiden Nahrungsmittel haben jetzt bereits zwei Kühlschränke verpestet, jetzt muss man sie endlich wegwerfen, und zwar bald. Ich erkläre das Rahel, unserer Vermieterin, damit sie sich nicht wundert… Sie beruhigt mich und sagt, das sei kein Thema. Die Hunde und Katzen würden es sicher gerne fressen. – Da bin ich gar nicht so sicher, aber Hauptsache, das Problem ist gelöst.
Um zehn Uhr holen uns Maria Elena und Abel ab. Sie fahren uns auf den Flugplatz. Unterwegs kommen wir an der Residenz von Raoul vorbei, an einer der Universitäten, an Spitälern und Abel erklärt wortreich und mit vielen Gesten, so wie ein Italiener, was wo ist. Fast jeden Satz beginnt er mit „Isabel, mira…“. Dazu schaut er zu mir nach hinten statt auf die Strasse. Ich schwitze so schon genug und hoffe einfach, dass wir gut am Flughafen ankommen. – Es gelingt, wir steigen aus, verabschieden uns und stehen am Check-in-Schalter Schlange. – Die letzten Pesos, die wir noch haben, geben wir aus für zwei Getränke, ein T-Shirt für Theo und eine Flasche Rum.
Pünktlich um Viertel nach eins starten wir Richtung Bahamas – in eine völlig andere Welt.
Bahamas, Long Island - 29. April – 17. Mai 2017
29. April 2017 – Unterwegs nach Stella Maris
Der Flug von Havanna nach Nassau dauert eine gute Stunde. Theo freut sich, endlich wieder mal eine nicht-kubanische Zeitung lesen zu können. Das Gelbe vom Ei ist der Bahamas Guardian zwar nicht gerade, aber immerhin, etwas von Trump darin zu finden, und sei es nur eine Karikatur, erfreut Theos Herz, das schon längst unter Entzugserscheinungen leidet, sehr.
Für die Immigration braucht’s Geduld, aber irgendwann ist auch die erledigt, die Koffer sind ebenfalls angekommen, wir gehen durch den Zoll, wo beide grossen Koffer, die ich so schön gepackt habe, durchwühlt werden, aber dann sind wir durch. Ein Taxi bringt uns zu einem andern Ort am Flughafen, wo Joël (lässig in Shorts und T-Shirt) und sein kleines Flugzeug schon auf uns warten. Unser Handgepäck wird in einem der Flügel verstaut, unser grosser Koffer hinter zuhinterst hinter unseren beiden Sitzen –Alle Plätze sind besetzt: acht Passagiere und Joël, der Pilot. Los geht‘s. Es ist schon ein seltsames Gefühl, mit einer so kleinen Maschine zu fliegen. Zwar ist’s ein wenig lärmig, aber es macht Spass. Schön, das türkisblaue Meer zu sehen, die Wolken, ein paar wenige der 700 Inseln der Bahamasgruppe. – Eine gute Stunde dauert auch hier der Flug und schon landen wir in Stella Maris auf Long Island, der langen, schlanken, grünen Insel.
Long Island
Rolf holt uns ab. Keine fünf Minuten dauert die Fahrt über die Holperpiste von der Landebahn zu „unserem“ Haus, wo wir während zwei Wochen wohnen werden. Es ist sechseckig, hat im Parterre vier grosse, weiss getünchte Schlafzimmer. Eine Wendeltreppe führt in den oberen Stock, der aus dem Busch herausragt. Dort befinden sich Küche und Wohnzimmer und eine schöne, grosse Terrasse, von der aus man sowohl den Sonnenaufgang über dem Atlantik wie auch den Sonnenuntergang über dem karibischen Meer sehen kann.
Erst aber lädt uns Rolf in sein Haus ein, welches nur ein paar Minuten zu Fuss nebendran gelegen ist. Wir trinken zusammen eine Flasche Weisswein und erhalten erste Informationen über die Insel und alles Wissenswerte, was unseren Urlaub hier betrifft.
Wir haben Rolf und seine Partnerin Susan bereits in Bivio kennengelernt beim Haustausch. Sie waren schon zweimal dort; nun sind wir dran. Er ist Schweizer, wohnt aber seit über vierzig Jahren auf dieser Insel, kennt alles und jeden, besitzt etliche Grundstücke hier und handelt mit Immobilien. Susan ist Amerikanerin. Diese Wochen besucht sie noch ihrer Tochter in Florida; sie wird am Sonntag zurückkommen.
Um halb acht gehen wir zusammen im Stella Maris Resort essen. – Es ist eine andere Welt als auf Kuba. Das Essen kostet 200 $ für uns drei. Die Steaks sind gut, mein Fisch ein wenig trocken. Aber wenigstens gibt’s mal wieder einen Salat, der diesen Namen auch verdient.
30. April
Wir haben wunderbar geschlafen, die Temperatur ist angenehm in der Nacht, viel kühler als während der letzten beiden Wochen.
Rolf holt uns um halb zehn ab und wir gehen zusammen einkaufen in einem Lädeli in „Burnt Ground“, das etwa fünf Meilen entfernt ist. Dort kommt es uns vor wie im Schlaraffenland nach den Erfahrungen, die wir in Kuba mit Supermärkten gemacht haben. Der Laden ist zwar mehr eine Hütte, relativ klein, aber wie auch in Bivio bekommt man hier fast alles, was man braucht. Das Schiff aus den USA kommt nur zweimal pro Woche (gut koordiniert: am Dienstag und am Mittwoch); heute ist Sonntag, nicht der ideale Tag für den Einkauf. Trotzdem finden wir fast alles, was wir gerne hätten. Teuer ist es allerdings; ein Liter Milch zum Beispiel kostet 4 $ (sie stammt aus Frankreich…). Für 100 $ kaufen wir ein. Gerne hätte ich eine Foto gemacht von der Dame, die hinter der Theke sitzt, aber ich fürchte, nicht einmal mit meinem Weitwinkelobjekt würde ich sie ganz erfassen können.
In Rolfs Haus hat’s unten drin ein kleines Apartment, das immer offen ist und wo wir WIFI haben, also mehr oder weniger jederzeit das Internet benutzen können. Endlich! – Wir verbringen mindestens eine Stunde dort. Ich kann ein paar Rechnungen bezahlen, mit der Familie und mit Freunden Kontakt aufnehmen, Dinge nachschauen, die mich interessieren - es ist wunderbar.
Heute machen wir keine grossen Sprünge mehr, richten uns ein, liegen ein wenig auf der Terrasse in den bequemen Liegestühlen, lesen und schon ist‘s Zeit fürs Nachtessen.
Bald merken wir: Nicht ganz alles ist Gold, was glänzt, auch hier nicht.
Die Waschmaschine funktioniert nicht. So langsam wär‘s wieder mal an der Zeit, ein paar Kleidungsstücke zu waschen. Bei genauerer Inspektion findet Theo heraus, dass sie verrostet ist. So geht’s auch in der Küche. Die Messer halten das salzige Klima sichtlich schlecht aus und sind voller Rostflecken. Wie ich versuche, sie mal wenigstens gründlich zu waschen, stelle ich fest, dass gar kein Wasser aus der Röhre kommt. Kein einziger Tropfen. Das ist ziemlich mühsam, ich kann den Salat nicht waschen, die Teller nachher auch nicht. – Eigentlich sollte Regenwasser aus der Leitung kommen. Den Tank haben wir am Nachmittag gesehen; er ist voll und am Rand sitzen drei Frösche, Mutter, Teenager und Baby. Theo ist entzückt, er mag solche Viecher, füttert ja zu Hause jeweils „unsere“ Spinnen. Meine Begeisterung allerdings, wenn’s um solche Mitbewohner geht, hält sich in engen Grenzen. – Es muss an der Pumpe liegen. – Morgen muss was passieren, jetzt ist es zu spät dazu.
Eine Tomate schneide ich auf, etwas Zwiebeln dazu und ein paar Scheibchen Rüben, das ist unser Salat; das Steak, das wir vorhin gekauft haben, ist köstlich.
Im unteren Stock hat’s wenigstens noch grad genügend Wasser zum Zähneputzen, fürs Duschen reicht der Vorrat auch noch knapp.
1. Mai – unterwegs in der Umgebung
Rolf kommt um halb zehn vorbei. Wir klagen ihm unser Leid.
Die Wäsche bringen wir in sein Haus, waschen sie dort und hängen sie anschliessend bei uns an einer Wäscheleine auf, die zwischen zwei Bäumen angebracht ist. Bei dem Wind, der hier herrscht, ist sie schnell trocken.
Die Sache mit dem Wasser ist schon schwieriger. Da muss er jemanden kommen lassen. Das passiert dann am Nachmittag.
Wir fahren ans Nordende der Insel. Theo fährt mit Rolf, der ihm auf der Strecke erklärt, wo was zu finden und zu sehen ist. Ich fahre hinterher. Susan hat uns ihr Auto überlassen, einen kleinen schwarzen Jeep, der einfach zu schalten und zu lenken ist und mit dem herumzukurven mir grossen Spass macht. Hinten auf dem Reserverad heiss es: „Life is good!“ – Sehr einverstanden!
Speziell ist, dass auf den Bahamas Linksverkehr herrscht, aber alle Autos kommen aus den USA, sind also wie bei uns auch links gesteuert. – Nicht extrem praktisch, aber man gewöhnt sich an alles…
Die Strassen hier sind zum Teil die grösste Katastrophe; es hat Schlaglöcher vom Gröbsten. Wie ein Emmentaler sieht der Belag aus, Löcher hat’s in allen Variationen und Tiefen. Fast am schlimmsten ist die Strasse dort, wo noch ein wenig Asphalt vorhanden ist. Die armen Pneus tun mir richtig leid. - Zweigt man von der Hauptstrasse ab, wird’s erst recht zur Herausforderung. Es geht über Stock und Stein, wie durch Bachbette manchmal - Theo klagt schon nach wenigen Minuten, er habe jetzt dann Kopfschmerzen. Aber Rolf will uns zeigen, wo er fünf Grundstücke hat, auf denen man bauen könnte („Kingdom Project“), wo er einen Hochstand aufgebaut hat mit toller Aussicht, wo’s die herrlichsten Strände hat. Die Lagunen, die Strände, die kleinen Buchten, das klare türkisblaue Wasser – all das ist traumhaft schön, besser noch als in den Glanzprospekten.
Im Santa Maria Resort kehren wir ein, trinken etwas und essen eine Kleinigkeit. Das Resort ist märchenhaft gelegen.
Rolf fährt anschliessend zurück und wir suchen uns einen Platz am kilometerlangen weissen Sandstrand, wo keine Menschenseele zu sehen ist. Nur zwei Boote ankern weiter draussen. Das Meer ist phantastisch: schön warm, kristallklar, ruhig und ideal zum Schwimmen.
Gegen sechs fahren wir zurück, machen noch rasch Halt im Laden und sind gespannt, wie die Lage ist im Haus, ob’s Wasser hat zum Duschen und in der Küche. – Etwas muss offenbar ersetzt werden, aber für diesen Abend funktioniert beides, wenigstens mal provisorisch. Ohne zu duschen ins Bett gehen zu müssen, wär nicht grad nach meinem Geschmack. – Eddy (schwarz wie die Nacht) hat’s gerichtet. Zumindest für heute Abend, morgen muss er nochmals dahinter.
2. Mai 2017
Eddy hat’s gerichtet, aber da der Kühlschrank mit der Pumpe verbunden ist, hat er den ausgeschaltet, den Tiefkühler auch. Die Milch, die Butter, das Eiscrème, das Steak…
Eddy kommt wieder und bringt einen Kumpel mit, Kevin (cafébraun). Die beiden reparieren die Pumpe, aber da gibt’s noch einen Rohrbruch zu beklagen – warmes Wasser wird wohl erst nächste Woche ein Thema sein. Nun, das ist das kleinste Übel. Fürs Rasieren muss Theo das Wasser in der Pfanne aufheizen. Auch für den Abwasch. Zum Duschen ist uns kaltes Wasser sowieso viel lieber.
All das fasst Rolf zusammen unter dem Titel: „Bahamas Inselleben“.
Er fährt mit uns zu einem weiteren seiner Häuser, dem Lake House. Es steht völlig allein mitten im Busch, direkt an einem See, wo’s Riesenschildkröten drin hat. Zwei davon sehen wir sogar im Wasser paddeln. Leider ist das Haus ein wenig verwahrlost; es wohnt nur selten jemand drin, aber es würde nicht viel brauchen, es wieder flott zu machen. Wir fahren noch an anderen Häusern vorbei, zum Teil prächtigen Villen, zum Teil aber nur Ruinen, gar nicht fertig gebaut oder erst seit kurzem verlassen. Wie es aussieht, ist auf dieser Insel sehr viel spekuliert worden, grosse Mengen an Geld stecken in zahllosen Projekten, die abgebrochen worden sind.
Im Garten eines Hauses von Bekannten von Rolf hat’s wunderbare Papayas (Er ist es gewohnt, sich bei Nachbarn zu bedienen, sich mit Früchten und Blumen einzudecken. Das sei so hier, das mache man so…). Die beiden Männer schlagen zwei der reifen Früchte vom Baum. Theo fängt sie auf, bevor sie am Boden zerbersten. Er ist ganz stolz auf seine Ernte und Reaktion.
Am Nachmittag machen wir einen Ausflug zu den Love Beaches, einer Reihe von sieben oder acht einsamen Stränden. Oberhalb des ersten steht eine verlassene Siedlung, mehrere teuer gebaute Bungalows mit künstlichen Strohdächern, die noch immer absolut perfekt im Stand sind, ein attraktiver grosser Pool, der jetzt natürlich leer ist - auch dies hätte ein Resort werden sollen, ein Millionen-Projekt, das offenbar aus Geldmangel in die Hose ging. Es wäre ein Paradies. Jetzt dehnt sich der Busch wieder aus und beginnt, alles zu überwachsen. Es wird kaum mehr lange dauern, bis die Parzelle nicht mehr zugänglich sein wird.
Eigentlich wollten wir baden, aber nun machen wir eine langen Spaziergang am Strand entlang oder besser gesagt geht die Route über die schwarzen, zackigen Korallen-Felsen bis hin zum nächsten Strand, wo vor etwa sieben Jahren ein Schiff gekentert ist: ein Frachter aus der Dominikanischen Republik. Ein Teil davon, das Heck, steht verrostet am Ufer. Das gibt wunderbare Fotos. Auch für den Kilometer langen Rückweg mit unseren Flip Flops über die spitzen Felsen brauchen wir eine gute halbe Stunde. Man muss höllisch aufpassen, dass man sich nicht verletzt. Theo gelingt dies leider nicht ganz, aber die paar Kratzer sind sicher schnell verheilt.
Jetzt haben wir einen Drink verdient. Im Resort an der Moonlight-Strandbar gibt’s einen Erdbeer-Daiquiri, der so gross ist, dass man damit grad gegessen hat. In der Schale, die mir Sue, die Barkeeperin, bringt, sieht’s aus wie fünf Kugeln Erdbeer-Sorbet.
3. Mai 2017 Ausflug in den Süden der Insel
Rolf holt uns um neun Uhr ab. Los geht’s Richtung Süden. Es gibt eine einzige Hauptstrasse entlang der etwa 130 km langen Insel. Diese ist einigermassen im Stand, eine Wohltat verglichen mit den Nebenstrassen. Wir fahren durch mehrere Dörfer oder besser gesagt Siedlungen; die meisten bestehen nur aus ein paar Häusern. Die Ortsschilder sind grün, oft kann man sie kaum mehr lesen, weil sie halb abgerissen oder verbleicht sind. Die Ortsnamen sind auch bemerkenswert; sie gehen zurück auf die Sklavenzeit, einige sind Namen der damaligen Gutsbesitzer: Millers, Mckanns, O’Neills, Doctor’s Creek, Scrub Hill, Burnt Ground, Hard Bargain, Cabbage Point etc.
Rolf weiss überall was zu erzählen. In Simms zum Beispiel stehen ein paar schmucke Häuser gleich an der Hauptstrasse nebeneinander: das Gemeindehaus, das Gericht, das Gefängnis, die Polizeiwache und die Post. Aber auch das „Amt“ für die Motorfahrzeug-Kontrolle ist dort. Eine solche Kontrolle dauere zwischen 30 und im schlechtesten Fall 60 Sekunden… Gebe man ein Trinkgeld, falle sie auch weg.
Auf Long Island leben etwa 3000 Menschen, etwa ebenso viele Autos habe es.
In Petty wohnten fast nur Griechen, die auch untereinander heirateten…
In Clarence Town hat’s zwei Kirchen – vom selben Architekten erbaut. Diejenige links eine anglikanische – diejenige rechts eine katholische. – Nach dem Bau der ersten habe der Architekt konvertiert…
Am Hafen in Clarence Town trinken wir etwas. Es ist nicht viel los, die meisten Schiffe sind auf See am Fische Fangen.
Wir fahren wieder gegen Norden und machen Halt bei Dean’s Blue Hole, der Attraktion auf Long Island. Das „Loch“ ist 200 Meter tief (world’s deepest) und es ist dort, wo die Weltmeisterschaften im Tauchen ohne Sauerstoffgeräte stattfinden. 102 Meter Tiefe wurden letztes Jahr als Weltrekord erreicht, 124 Meter mit Flossen.
In ein paar Tagen findet wieder ein Event statt, Vorbereitungen sind bereits im Gang.
Rolf fährt uns zu einem anderen Strand, der absolut superb ist. Rund wie eine Riesen-Wanne mit fünfzig Metern Durchmesser kann man wunderbar drin baden. Nur durch einen schmalen Streifen zwischen den Felsen strömt das Meerwasser in das Becken hinein.
Zurück beim Auto beginnt’s grad zu regnen. Das dauert aber nicht lang, schon ist es wieder trocken. Heute ist‘s meistens bedeckt, aber dadurch ist die Temperatur sehr angenehm. Kommt die Sonne durch, gibt man fast den Geist auf.
Der nächste Halt ist bei „Max‘ Conch Bar and Grill“. Eigentlich heisst der Besitzer ja Gerry und er macht den besten Conch Salad (ausgesprochen: „Konk“) der Insel, sagt Rolf. Es ist ein lustiges, kleines, farbiges Garten-Restaurant, und ja, der Muschelsalat ist wirklich exquisit - etwa wie Ceviche, aber halt mit Muscheln statt mit Fisch. Gerry sucht die Tiere selber und man kann zuschauen, wie er sie aus der Schale holt, wenn man will. – Ich will nicht. Theo isst eine Minestrone, die er auch sehr mag. – Die Flasche Chardonnay dazu ist fein und kühl, aber sie macht mich richtig schläfrig.
Im Supermarkt ein paar Kilometer weiter nördlich in Salt Point wird nochmals kräftig eingekauft, dann geht’s heimzu. Dort angekommen, merkt Theo, dass er seinen Sportsack im Restaurant hat liegen lassen. Dabei hab ich ihn noch gefragt, weshalb er ihn nicht im Auto lasse… Ich hätte meine Tasche, sagte er - er seinen Sportsack. – (Nur, dass ich meine Tasche normalerweise nicht im Restaurant liegen lasse…)
4. Mai 2017
Heute ist nicht der Tag der grossen Unternehmungen. Theo braucht ja immer wieder mal einen zum Ausspannen, wie er sagt. Also spannen wir aus.
So gegen fünf aber finde ich dann doch, wir könnten uns zumindest im Resort an der Strandbar einen Drink genehmigen. Er ist einverstanden. Es ist aber so schön dort, dass wir noch ein bisschen am Strand verweilen. Zu lange, wie sich herausstellt – die Bar hat um sechs bereits die Schotten dicht gemacht.
So gibt’s den Cuba Libre halt daheim. Inzwischen habe ich auch ein Abtropfsieb gekauft, so kann ich den Salat waschen. Mit Trinkwasser aus dem blauen Gallonen-Behälter. Das Frosch-Regen-Trinkwasser kommt dafür nicht in den Einsatz. Kommt überhaupt nicht in Frage - ganz sicher nicht!
Also gibt’s Salat zum Nachtessen, frische grüne Spargeln, Bratkartoffeln und Steak. – Lecker!
5. Mai – Ausflug in den Norden der Insel
Um halb zehn holt uns Rolf ab. Er will uns einen seiner Lieblingsplätze auf der Insel zeigen. Wir fahren zur Kolumbus-Bucht. Ein sehr unwegsamer Pfad führt dorthin. Dass die Pneus da noch mitmachen…
Vor dem Monument zweigen wir rechts ab und Rolf lässt den Wagen mitten im Busch stehen. Den Rest bis zum Strand gehen wir zu Fuss weiter. – Was für ein paradiesischer Ort! Es ist eine weite Lagune, die jetzt, bei Ebbe, nur teilweise mit Wasser durchflutet ist. In allen Schattierungen von Türkisblau schimmert das Wasser. Wir deponieren unsere Sachen am Strand im Schatten. Vor uns fliesst eine Art Fluss in Richtung Meer. Wie wir später nach zwei Stunden wieder an diesen Ort zurückkommen, hat die Richtung durch die Flut gewechselt – er fliesst landeinwärts.
Nur noch mit einem Badetuch bewaffnet, mit Sonnenhut, Schnorchel-Ausrüstung und Kamera, waten wir durch diese stille, menschenleere, atemberaubend schöne Landschaft. Manchmal geht’s durch hüfthohes Wasser, dann wieder über Sandbänke, vorbei an Mangroven und deren Tausenden von kleinen und grösseren Sprösslingen. Nach etwa einem Kilometer sind wir da, wo Rolf hin will, es ist eine Art Muschelfriedhof. Das Wasser ist hier viel tiefer und hat eine ziemliche Strömung. Wir ziehen Taucherbrille und Schnorchel an und lassen uns ans andere Ufer treiben. Und tatsächlich: Da liegen Dutzende von zersplitterten Conchs auf dem Boden; es empfiehlt sich dringend, nicht draufzustehen.
Auch am Strand finden wir Muscheln, Sanddollars und diese riesigen, schweren Dinger, von denen auch die leeren Schalen mehr als zwei Kilo wiegen. Sie sind hier auf der Insel eines der Hauptnahrungsmittel.
Eine mittelgrosse Conch hebe ich auf. Sie ist wunderschön rot, orange, gelb, pink und weiss gefärbt. Das Tier drin lebt noch und wie ich genau hinsehe, sehen wir uns in die Augen. Da werden zwei Stilaugen herausgestreckt, wie von einer Schnecke. Aber damit hat sich’s noch nicht. Das schleimige Tier schiebt einen grösseren Teil seines Körpers aus der Schale heraus, jetzt noch so eine wurmfortsatzartige Spitze, die sich gegen meine Finger hin bewegt, so dass mir gerade in dem Moment, wo Theo fotografieren will, Angst und Bang wird und ich die Muschel vor lauter Schreck fallen lasse. – „Z, z, z“, sagt Theo, hebt sie wieder auf, nimmt noch zwei andere dazu und wir tauschen die Rollen. Ich fotografiere, er gibt sich mit den Tierchen ab.
Erst jetzt wird mir bewusst, dass diese Conchs ja tatsächlich Schnecken sind und gar keine Muscheln. Ich habe vorgestern also Schneckensalat gegessen…
Wir wandern zurück an die Stelle, wo wir unsere Sachen haben liegen lassen. Der „Fluss“, der, wie bereits erwähnt, jetzt die Richtung gewechselt hat, ist auch tiefer geworden; das Wasser reicht mir fast bis zu den Schultern. Theo muss den Sack mit der Kamera drin auf dem Kopf tragen, damit sie nicht nass wird.
Und jetzt hat Rolf eine Überraschung parat: Er hat in der Kühlbox eine Flasche Chardonnay mitgebracht. Das hört sich nicht schlecht an! – Aber oh weh, er hat die Gläser dazu vergessen. – Wir sind jedoch erfinderisch: Die Schweizer Thermosflasche, die wir auch dabei haben, hat einen Deckel. Der dient mir als Glas. Das Wasser in der Flasche wird ausgeschüttet und wird zu Theos Trinkgefäss, Rolf trinkt seinen Drittel aus der Flasche. – Zum Essen gibt’s Orangen.
Mindestens eine halbe Stunde lass ich mich anschliessend im warmen Wasser treiben, es ist am angenehmsten dort; die beiden Männer liegen am Strand im Schatten und unterhalten sich über Trump und den Unterschied zwischen digital und analog. - Siesta dann.
Gegen drei brechen wir auf und wandern doch noch den Hügel hinauf zum Kolumbus-Monument, von wo aus man einen fantastischen Blick hat auf die Lagune und die Stelle, wo der Seefahrer am 17. Oktober 1492, vor 525 Jahren also, gelandet ist. In seinem Logbuch habe es geheissen, das sei die schönste Insel, die er bisher gesehen habe.
Um vier Uhr nachmittags sind wir daheim. – Wunderbar, die kalte Dusche.
Zwei Stunden später hab ich die Idee, statt selber zu kochen, wieder loszufahren und in einem der einheimischen Restaurants zu Abend zu essen. Das machen wir, aber die Sache stellt sich als nicht allzu einfach heraus. Unterwegs kommt mir in den Sinn, dass die dort wohl keinen Wein anbieten, also gehen wir erst noch in den Liquor-Store und kaufen eine Flasche Cabernet Sauvignon. – Das Restaurant vis-à-vis des Ladens ist zwar offen, aber heute haben sie keine Zeit zu kochen. Morgen besucht der Premierminister der Bahamas die Insel und da muss vorbereitet werden. Die Männer in ihren gelben T-Shirts, die für die (ober-korrupte – wie Rolf sagt) Regierungspartei werben, sind beschäftigt wie die Bienen, und bringen überall an den Strassenrändern ihre Parteiplakate an.
Sie werden übrigens nicht gewinnen. Völlig überraschend gewinnt die FNM (Free National Movement) statt wie erwartet die PLP (People‘s Liberal Party), und das sogar haushoch mit umgekehrter Sitzverteilung - Rolf ist begeistert.
Nur eine Kurve weiter gibt es eine Abzweigung zum Restaurant „Two Sisters“. An der Eingangstür ist ein kitschiges, farbig blinkendes Schild angebracht, auf dem steht OPEN, aber die Köchin sagt, sie müsse grad an einer Vorstandssitzung teilnehmen, es tue ihr sehr leid, aber sie müsse schliessen.
Zwei Hütten weiter vorne jedoch gibt’s „Rose’s Takeaway“, ein sehr einfaches kleines „Restaurant“, wo man sogar draussen sitzen kann. Es hat zwei Tische und je eine schmale Bank ohne Lehne, welche wohl eher dazu dient, aufs Essen zu warten als darauf, bequem zu tafeln. Melvin, der Besitzer und Partner von Rose, ist sehr liebenswürdig. Er sagt, was er uns anbieten kann und wir bestellen Pouletschenkel mit Salat und Pommes Frites. Der Laden läuft. Immer wieder kommt jemand vorbei und bestellt ein Gericht zum Mitnehmen. Alle Kunden sind tiefschwarz; wir sind die einzigen Weissen. Immer wieder ergibt sich ein kurzes Gespräch und ich merke, dass ich den einen oder anderen bereits „kenne“, weil Rolf von ihm erzählt hat. Der Typ zum Beispiel, der verschiedene Frauen geschwängert hat – unter anderem eine Deutsche und der jetzt zwei schokoladebraune Kinder von ihr hat. Er erzählt uns von seinen Jungs, die Deutsch sprechen. Er selber gibt auch ein, zwei teutonische Wortfetzen zum Besten.
Und ich hatte recht: Sie haben keine Lizenz, Alkohol auszuschenken, aber wir dürfen selbstverständlich unseren mitgebrachten Wein trinken. Die Suche nach zwei Gläsern gestaltet sich zuerst zwar als problematisch, aber dann wird Melvin doch noch fündig. Eine halbe Stunde später ist unser Essen parat. Theo füttert einen Teil seines Poulets den wilden Katzen, die sich inzwischen zu uns gesellt haben. Mir gefällt das Essen. Auch die Stimmung und der Ort. Es macht mir viel mehr Spass hier zu essen als in dem teuren, steifen Restaurant im Resort mit den nicht sehr freundlichen Service-Angestellten. Die Flasche ist leer, wir zahlen. 30 $ kostet unser Essen, ich lege 35$ hin. Zwei Zehnernoten kleben ein wenig aneinander, Melvin sieht daher nur fünfundzwanzig und macht mich auf das „fehlende“ Geld aufmerksam. Wie er seinen Fehler bemerkt, ist es ihm echt peinlich, er entschuldigt sich und küsst mich auf die Schulter (bin ich nicht gewohnt, ha, ha, ist noch speziell…).
Übrigens sind alle Menschen hier äusserst liebenswürdig und freundlich. Man grüsst sich, winkt sich zu. Susan ist auf der ganzen Insel bekannt und ihr Auto auch. So denken wohl die meisten Leute, ich sei sie, wenn wir an ihnen vorbeifahren.
Wir treten den Heimweg an - zurück über die holprige Strasse, vorbei an pechschwarzen Velofahrern, die ohne Licht unterwegs sind.
Etwa um zehn Uhr beginnt es zu regnen, und nicht zu knapp. Wir schliessen rasch alle Fenster und stellen die Ventilatoren an. Ein kurzer Stromausfall. Ich versuche, mein Natel zu finden, merke aber, dass es fehlt. Die letzten Fotos hab ich bei Rose und Melvin gemacht. Ich muss es dort auf dem Tisch liegen gelassen haben. – Fang ich das jetzt auch noch an…
Ja, und dann beginnt es, in mein Schlafzimmer zu regnen. Auch im Nebenzimmer findet das Wasser seinen Weg durch die Decke. Ich stelle Kübel unter und lege Badetücher hin. Das Bett zeihe ich in die Mitte des Zimmers, den Stecker zur Lampe aus, denn es tropft heftig auf die Steckdose. So prasselt der Regen die halbe Nacht lang; erst gegen Morgen hört er auf.
6. Mai 2017
… und geht dann doch gleich weiter mit voller Kraft den ganzen Morgen lang. Heute wird’s kaum Sonne geben. Warm ist es trotzdem.
Wie’s einen Moment lang aufhört zu regnen, fahren wir zu Rose’s Takeaway, um mein Natel zu suchen. Wie Melvin mich sieht, strahlt er und ruft: „Madam, I know why you’re here. I wanted to come and search you today.” – Ich bin natürlich sehr froh, dass ich das Gerät wieder habe. So dumm von mir, dass ich das einfach auf dem Tisch habe liegen lassen. – Wäre das Theo passiert…
Auf dem Rückweg machen wir Halt im „Bonafide Fishing Shop“, wo sich Theo Mütze Nummer zehn (mindestens) kauft und ein paar Hosen (mit meiner Kreditkarte – seine hat er praktischerweise daheim vergessen). Es ist ein teurer Laden, aber er hat ein ganz interessantes Sortiment.
Nächster Halt im „New Watering Hole“ zwecks Weineinkauf, und anschliessend trinken wir in der Strandbar einen Daiquiri. Diesmal vorsichtshalber nur einen für uns beide. Er hätte glatt für vier Personen gereicht, so gross ist er. Und Sue hat viel zu viel zubereitet. Den Rest aus dem Mixer giesst sie in ein grosses Glas, schüttet noch ein wenig mehr Rum dazu und stellt uns das auch noch hin. – Theo mag nicht mal mehr eine Suppe essen zu Hause, so gesättigt ist er.
Auch unser Auto mag nicht mehr. Es raucht zur Motorhaube raus, dass ich denke, nächstens explodiert es grad. – Das tut es dann glücklicherweise nicht. Nach ein paar Minuten schütten wir Wasser nach und hoffen, dass damit das Problem gelöst ist. Aber schmutzig ist der Jeep, verspritzt bis aufs Dach hinauf von den riesigen Wasserlachen, die sich in den zahllosen Schlaglöchern gebildet haben.
Ein Internetstündchen gibt’s, dann braucht Theo seine Siesta, ich schreibe und lese ein wenig und schon wieder wird es Abend. Die Tage vergehen rasch.
Mückenstiche und andere Brästen
Jetzt sind sie hier, die bösen Biester, vor denen uns Susan schon mehr als einmal vorgängig per Email gewarnt hat. Es sind die gefürchteten Sandflies, mit denen wir auch in andern Ländern schon einschlägige Erfahrungen gesammelt haben. Sie kommen nur, wenn’s keinen Wind hat und jetzt, nach dem Regentag ist es so weit. Es ist windstill. Die Plagegeister haben die nette Eigenschaft, dass sie problemlos auch durch die Mückengitter in die Häuser eindringen können, so klein sind sie. Man sieht sie kaum, man spürt sie im Moment auch fast gar nicht, aber später dann ist man übersäht mit Stichen. Zum Leidwesen der armen Opfer lieben sie es offensichtlich, gleich mehrere Saugstellen nebeneinander anzubringen. Frauen werden für diese Behandlung bevorzugt (ein Unterfangen von Frau zu Frau sozusagen). Deren Blutqualität ist wohl besser geeignet fürs Wachstum der Eier als die der Männer.
Vorgewarnt, wie ich war, hatte ich mich vorsorglich mit Antibrumm eingerieben und den Mückenstecker aktiviert; Theo machte die Fenster dicht (leider eben nicht alle gleich dicht) und liess die Ventilatoren laufen. Trotzdem blieb ich nicht verschont, ich habe mindestens hundert Stiche gefasst, überall, vom Scheitel bis zur Sohle. Theo hat dreissig Stiche an der einen Wade. Er hat sie gezählt. Wundersamerweise aber jucken sie ihn nicht.
Dafür geht es meinem Fuss etwas besser, seitdem ich ihn weniger anstrengen muss und mehr schonen kann. Am liebsten gehe ich im Sand, da merke ich gar nicht, dass etwas nicht gleich ist wie mit dem anderen Fuss.
Mein rechtes Auge hingegen weint noch immer ohne Grund. Die Augentropfen, die so mühsam zu beschaffen waren, haben kein bisschen geholfen und die homöopathischen Tropfen, die ich später in der Not in Sancti Spiritus erstanden habe (bei leerem Magen einmal täglich fünf Tropfen unter die Zunge), schon gar nicht. Ok, ok, ich würde ja gerne dran glauben, aber mein Auge hat da offenbar seine Zweifel.
Apropos Brästen: Da hatte ich grad etwas sehr Seltsames: Beide Oberarme taten mir während Tagen so weh, dass ich kaum was tragen oder aufheben konnte, nur unter grösster Pein eine Bluse anziehen oder die Arme nach hinten bewegen. Wie wenn sich ein Messer im Muskeln drehen würde, verspürte ich einen ständigen Schmerz, egal in welcher Lage. Woher der kam, habe ich keine Ahnung. Einzig möglich wäre, dass ich mal in der Nacht komisch drauf gelegen bin – zu müde, es zu merken (das Alter, das Alter…).
Seit gestern geht es mir besser; ich habe begonnen, Voltaren zu schlucken.
Und jetzt, oh Wunder, hat auch mein Auge die Tränerei endlich aufgegeben. Nach vier Wochen! - Ich bin schön froh, denn obwohl das wenigstens nicht schmerzte, war es enorm lästig. Ständig musste ich die Tränen abputzen. – Wieso grad jetzt die Besserung eingetreten ist? Ob das ganze Gift der Quälgeister genau das richtige Gegenmittel war? Seltsam, seltsam…
Dafür hab ich mir was Neues zugelegt: ein sogenannter Schnappfinger. – Ich kann’s so erklären: Mein Daumen an der rechten Hand bewegt sich digital.
Im Internet hab ich dann nachgeschaut, was es darüber zu berichten gibt:
Kommt häufig vor. Vor allem bei Frauen über sechzig. Es ist meist der Daumen…
7. Mai 2017
Es regnet nicht mehr, aber das Wetter ist nicht besonders schön, auch heute nicht. Macht wirklich nichts. Wenn man so lange unterwegs ist, geniesst man das süsse Nichtstun und ein paar Regentage stören überhaupt nicht.
Ich lese im Führer und im Internet über Yucatan und versuche, die bevorstehende Reise ein wenig zu planen.
Am Nachmittag ist’s wieder sonnig. Theo mag nichts unternehmen, die Terrasse ist angesagt. Mir wird’s zu heiss, ich schlage vor, ins Resort zu dislozieren, dort ein wenig an den Strand zu liegen und eventuell im Meer zu schwimmen. Etwas trinken wär auch nicht schlecht. Ok. Nichts dagegen. Wir brechen auf; im Auto ist die Hitze fast unerträglich, aber am Strand weht ein Wind, der mir mit der Zeit fast zu kühl wird. Theo liegt auf einer Hängematte, auf dem Bauch das i-Phone, das seine Musik trällert, er am Schlafen – seine Welt ist in Ordnung.
Jetzt ist’s aber Zeit für einen Drink, bevor die Bar wieder schliesst. Wir bestellen dazu einen Snack (Mahi-Mahi-Wrap) und zahlen für unsere Konsumation schliesslich fast 50 $. Zumindest ist in meinem Drink (Buccaneer diesmal) so viel Alkohol drin, dass ich Theo fast doppelt sehe (ui ui ui!!!).
Ich koche dann nichts mehr an diesem Tag. Der Kühlschrank ist voll und Theo kann sich zur Not ja selber verpflegen; er hat genügend Büchsen gekauft für diese Eventualität.
Die Schotten sind dicht, der Ventilator läuft, der Mückenstecker ist moniert – ich lege mich Schlafen.
Mitten in der Nacht allerdings wache ich auf, ein verräterisches Sausen hat mich geweckt – eine Mücke ist am Werk! Sonst ist es extrem ruhig, heiss ist es auch. – Kein Wunder – der Ventilator läuft nicht mehr, der Mückenstecker auch nicht – Stromausfall.
8. Mai 2017
Meine Haut fühlt sich stellenweise an, wie eine Bircherraffel; die Mücken haben ganze Arbeit geleistet. Äs bisst wi gschtört!
Es gibt einen gemütlichen Tag. Wir fahren rüber zu Rolfs Haus und begrüssen Susan, die inzwischen heimgekommen ist. – Am Abend sind wir zum Essen eingeladen.
Den Nachmittag verbringen wir am Strand in Cape Santa Maria, wo wir bereits einmal waren. Es gefällt uns dort ausserordentlich gut. Es hat keine Leute und das Meer ist wunderbar zum Baden. Das Türkis des Wassers mutet fast kitschig an, man sieht bis auf den Grund, der Sand ist weiss und fein wie Mehl. Palmen hat es keine, dafür Fichten, die willkommenen Schatten spenden, ohne dass man Angst haben muss, von einer Kokosnuss getroffen zu werden.
Um halb sechs Uhr pünktlich, wie sich das für uns Schweizer schliesslich gehört, stehen wir bei Susan und Rolf „auf der Matte“. Erst gibt’s Apéro (selbstgemachte Savoury Cheese Dollars {das Rezept hab ich!} und eine Flasche Weisswein) anschliessend werden wir exquisit bewirtet mit Sparerips, Kartoffelsalat uns feinem homemade Brot. – Es ist ein einmaliger Abend. Zum Dessert gibt’s einerseits Papayasorbet (von den Früchten aus Nachbars Garten) mit gerösteten Kokosraspeln und andererseits einen Sonnenuntergang vom Feinsten. Das Spezielle: Auf der anderen Seite der Terrasse, über dem Atlantik, steht jetzt der Vollmond in seiner ganzen Pracht.
9. Mai – „Down North“
Wir machen eine Wäsche. Wegen Stromausfalls während des Waschvorgangs dauert es etwas länger, bis alles erledigt ist. Egal, wenn wir nach dem Ausflug heimkommen, wird alles trocken sein. Auf Sonne und Wind ist Verlass.
Susan und Rolf holen uns ab und wir fahren nordwärts bis die Strasse aufhört. Dort hat’s eine Brücke, die durch einen Hurrikan zerstört worden ist. Zu Fuss überqueren wir sie und nach einem Spaziergang durch den Busch erreichen wir einmal mehr eine grosse Bucht mit einem langen Sandstrand. Diesem gehen wir entlang, durchqueren die Lagune durchs knietiefe Wasser bis wir zu einer Insel kommen, wo wir unsere Siebensachen deponieren. Einmal mehr ist die Aussicht atemberaubend. Rolf zieht Taucherbrille und Flossen an und macht sich auf die „Jagd“ nach Conchs. Wir anderen lassen uns ein wenig im seichten Wasser treiben, spazieren dem Ufer entlang und geniessen den wunderschönen Ort.
Nach einer Stunde etwa kommt Rolf zurück. Im Schleppnetz hat er fünf Conchs, drei davon riesengross und je etwa zwei Kilo schwer. – Der Fall ist klar: Zum Nachtessen gibt’s Schneckensalat. Wir sind auch heute Abend wieder dazu eingeladen. Auf dem Heimweg halten wir bei einem Freund von Rolf an, der die Tiere dann präpariert, also schlachtet, wenn man dem so sagen kann. Ich habe etliche Mühe mit der Idee, dass denen ihr letztes Stündchen nun geschlagen hat, aber so geht das halt. Solange ich nicht zuschauen muss, wie das Prozedere vor sich geht… In einer Broschüre über diese Queens Conchs habe ich gelesen, dass sie sechsmal pro Saison zwischen 250‘000 bis 750‘000 Eier legen. Wenn da also die eine oder andere ermordet wird, hat’s noch immer ein paar übrig. Trotzdem…
Inzwischen habe ich die ganze Broschüre gelesen. Unglaubliche Tiere sind diese Mollusken – faszinierend! Und sie sind tatsächlich gefährdet, weil von den vielen Eiern, die gelegt werden, nur ein kleiner Teil überlebt und viel zu viele von ihnen „geerntet“ werden. Nur die erwachsenen darf man konsumieren, was aber ganz offensichtlich nicht von allen respektiert wird. Immer wieder entdeckt man am Strand oder im Gebüsch ganze Haufen von aufgeschlagenen, viel zu kleinen Muschel-Schalen.
Nun, der Salat, den Susan zubereitet, ist köstlich. Sie serviert dazu Zopf, selber gemachten natürlich. Wer hätte das gedacht, eine Schweizer Züpfe auf den Bahamas – gebacken von einer Amerikanerin! Nur eine Schnecke brauchte es für den Salat, und es war mehr als genug; die andern wurden tiefgefroren.
Übrigens sieht man auf Schritt und Tritt die leeren Schalen als Dekoration bei Hauseingängen, in Gärten, im Haus, als Türstopper. Die Vielfalt an Farben, Formen und Strukturen ist grandios.
10. Mai 2017
Es gibt nicht viel Neues zu erzählen heute. Wir probieren mal einen anderen Strand aus, nur etwa fünf Minuten zu Fuss von unserem Haus entfernt. Diesmal auf der Atlantikseite. Das Meer ist hier ganz anders, ein wenig stürmisch und viel dunkler in den Blautönen. Baden können wir nicht gut, denn es hat Felsen, die einem gefährlich werden könnten. Es hat keinen Schatten, so bleiben wir nur etwa zwei Stunden und dislozieren dann ins Resort, wo wir uns eine feine Piña Colada genehmigen und am Strand liegen bleiben bis fast um halb sieben.
Inzwischen war Eddy wieder im Einsatz. Wir haben nun sogar warmes Wasser und der Kühlschrank läuft auch.
Allerdings stellen wir erst später fest, dass man das Wasser nicht mischen kann. Der Hahn ist locker und lässt sich nicht arretieren. So duschen wir jetzt heiss, was bei der Hitze draussen und auch im Haus nur wenig Freude macht.
11. Mai 17 – „Up South“
Heute wird die Südinsel erkundet. Es geht also „up south“, wie das hier heisst. Die seltsame Ausdrucksweise kommt von den Schiffen, die gegen den Wind fuhren, wenn sie nach Süden wollten. Und dementsprechend heisst es „down north“, aber da waren wir ja schon.
Um neun Uhr holen uns Susan und Rolf ab. Es ist eine unterhaltsame Fahrt mit Zwischenhalten verschiedenster Art. Erst geht’s nach Simms, wo die Post abgeholt werden muss. – Heute ist niemand im Gefängnis, nur Theo sitzt davor.
Das Auto macht Zicken: Aus dem Motor dringt Rauch und sämtliche Anzeigen tun keinen Wank. – Das ist kein guter Anfang für die Reise. Rolf sieht, dass der Deckel des Wassertanks nicht mehr dort ist, wo er sein sollte. Theo findet ihn zum Glück und Wasser wird nachgefüllt. Es kann weitergehen. Nächster Halt in Deadman’s Cay nahe der Tankstelle, wo das Postboot grad ankommt. Da man nicht feststellen kann, wie viel Benzin noch im Tank ist, scheint es besser, sicher mal vollzutanken. Die Insel ist ja 130 km lang, also reicht das auf alle Fälle.
Bei der Bank werden Dollars getankt und ein paar Kilometer weiter gibt’s einen Halt beim Schiffsbauer. Ein Boot für die nächste Regatta ist am Entstehen.
Bei „Max’s Grill and Bar“ halten wir ebenfalls an, weil Theo dort ja seinen Badesack hat liegen lassen. Er ist glücklich, ihn wiederzuhaben.
Susan trifft überall Freunde. David Dean begrüsst uns. Er ist ziemlich dunkelhäutig und hat hell-türkisblaue Augen, wie die Farbe des Meeres. Das sieht seltsam aus, ist aber nicht selten bei einigen der Einheimischen hier.
Wir fahren wieder und wieder an Kirchen vorbei. Es hat mindestens etwa fünfzig davon auf der Insel; sie sind alle entlang der Hauptstrasse gebaut oder zumindest von dort aus zu sehen. Zum Teil hätten sie weniger als zehn Anhänger, erzählt Rolf, aber eine Kirche muss trotzdem sein. So würden sich die Kirchen und die Bars regelmässig darum streiten, wovon es mehr gibt. - Ein amüsantes Detail auch dieses: In einem Prospekt haben wir gelesen, was man auf der Insel alles unternehmen kann. Natürlich ein Tauchversuch im Blue Hole. Aber nebst etlichen Angeboten, welche die Fischerei betreffen, wird beispielsweise auch „Church-Hopping“ offeriert…
Im Oktober 2015 gab es einen gigantischen Hurrikan, der enorme Schäden angerichtet hat, vor allem im Süden. Noch immer sieht man zertrümmerte Häuser, Bäume, die kein Laub mehr tragen und etliche Autofriedhöfe, wo all die Autos lagern, die damals kaputt gingen. Auch an Salinen kommen wir vorbei, ähnlich wie diejenigen in der Bretagne; die wurden aber ebenfalls vom Hurrikan zerstört.
Ab Clarence Town geht’s dann nochmals etwa 30 km weiter bis Gordon’s Settlement, vorbei an der letzten Bar, bis die Strasse am Ende der Insel plötzlich aufhört. Dass dort ein Stopp-Zeichen steht, ist fast ein Witz.
Ein langer Strand mit weissem Sand erstreckt sich bis zum wirklichen Ende von Long Island. Immer wieder mal liegen Kleiderfetzen im Sand oder im angrenzenden Gestrüpp. Dahinter verbirgt sich eine traurige Geschichte. Susan erzählt, diese würden von Haitianern stammen, die in Booten ihr Land verlassen, um auf den Bahamas Zuflucht zu finden. - Nicht alle schaffen die Überfahrt.
Etwa drei Kilometer lang wandern wir bis zu einer Stelle, wo zwei Schiffe gekentert sind. Das eine muss schon seit Jahrzehnten dort liegen, nur noch ein Gerippe und ein Teil des Motors ragen aus dem Sand, das andere, ein privates Segelschiff, wohl kaum länger als ein paar Monate. Beide müssen auf Sand aufgelaufen sein, das Meer ist sehr seicht an dieser Stelle.
Wir sammeln Muscheln, Schmetterlingsmuscheln hat’s vor allem, und irgendwo unterwegs ist auch ein rostiger Kubus im Wasser, der uns sehr an denjenigen von Jean Nouvel erinnert, damals bei der Expo in Murten.
Eine der südlichsten Siedlungen heisst „Roses“ (wie der Ort in Spanien, wo wir seit über dreissig Jahren unsere Herbstferien verbringen). Da muss ich natürlich ein Foto vom Dorfschild machen. Beim Hinweg hatte es keines, es muss vom Sturm weggerissen worden sein, aber auf dem Heimweg „down north“ finden wir es und halten davor an, um es zu fotografieren. Auf dem Schild sonnt sich eine Schlange! Das ist natürlich doppelt fotogen!
In Clarence Town kehren wir ein bei „Rowdy Boy‘s Bar and Grill“, trinken etwas und teilen uns Conch-Fritters, eine weitere Schnecken-Spezialität. Sie sehen aus wie Hack-Bällchen und sind köstlich.
Über der Theke in der Bar läuft ein Fernseher. Tennismatches werden gezeigt. Nadal und Thiem gewinnen in Madrid, Murrey kriegt aufs Dach.
Weiter geht die Reise nordwärts. Einkaufen steht als nächstes auf dem Programm. Wir brauchen fast nichts mehr, aber Susan schlägt zu; ich glaube, sie deckt sich gleich für die nächsten zwei Wochen ein.
Zeit fürs Nachtessen bei Tiny’s. Dies ist ein hübsches kleines Restaurant direkt am Meer, ein offenes Holzhaus auf Stelzen. Das Essen ist sehr fein, die Drinks ebenso, die Atmosphäre einzigartig: Füsse im Sand, Palmen spenden Schatten, Hängematten sind auch vorhanden. Wir sind die einzigen Gäste und erhalten so die ungeteilte Aufmerksamkeit von Michelle, der Besitzerin.
Es ist schon dunkel auf der Heimfahrt, die etwa eine halbe Stunde dauert, aber wenigstens hat’s so gut wie keinen Verkehr. Drei Autos begegnen uns.
12. Mai 2017
Theo möchte heute die Sonne ein wenig meiden, sagt er. Also bleiben wir in der Nähe. Beim Stella Maris Resort hat’s Liegestühle am Strand und Schatten. Da gehen wir hin.
Am Abend sind wir schon wieder zum Nachtessen eingeladen von Susan und Rolf. Wunderbar, da brauch ich nicht zu kochen beziehungsweise Theo braucht keine Büchse zu öffnen. – Freunde von ihnen sind grad angekommen am Nachmittag und die werden ebenfalls dabei sein. Randy und Liza sind oft mit Susan und Rolf auf Reisen, und so waren sie auch schon mal zusammen in Bivio.
Liza fühlt sich aber nicht gut, so kommt nur Randy. Das Nachtessen ist absolute Spitze. Es gibt Sirloin-Steak vom Feinsten, perfekt auf dem Grill zubereitet von Susan. Dazu hat sie einen Teigwarensalat gemacht mit Rucola und zum Dessert homemade Brownies.
Das Essen findet statt im Garten-Pavillon neben ihrem Haus mit Aussicht aufs Meer - der perfekte Ort fürs Zusammensein mit Gästen.
Wie könnte es anders sein: Das Hauptthema des Abends ist Präsident Trump.
Seit wir wieder Internet haben, kann Theo jeden Tag von dessen neuesten Eskapaden lesen und sich daran freuen und/oder darüber ärgern.
Noch eine Bemerkung zum Rucola: Im Garten von Susan und Rolfs Haus wächst kaum etwas „Vernünftiges“, der Boden ist steinig und hart. Weder Blumen noch Fruchtbäume mögen das. Im einzigen Beet hat Susan ein wenig Basilikum angepflanzt und jemand hat mal eine Handvoll Rucola-Samen mitgebracht. – Denen gefällt’s erfreulicherweise besonders gut. Sie haben sich über dem Rasen ausgebreitet, er besteht fast nur noch aus Salat.
13. Mai 2017
Diese Nacht träume ich von Schnecken, Reisekoffern und meiner Handtasche, die ich nicht mehr finde. – Gut ist endlich Morgen!
Rolf kommt vorbei. Nun ist sein Auto völlig kollabiert. Es steht nicht weit von unserem Haus entfernt am Strassenrand und ist unter keinen Umständen mehr bereit, sich von der Stelle zu rühren. Das automatische Getriebe ist blockiert und das Auto muss aufgeladen und abtransportiert werden. – Was weiter geschieht, wissen wir noch nicht. Eigentlich wollten wir zusammen an einen weiteren Strand fahren, den wir noch nicht kennen, so aber fahren Theo und ich wieder ans Cape Santa Maria, wo’s uns so gut gefällt. Es ist so heiss, dass man sich immer wieder abkühlen muss im klaren Wasser. Theo hat seine „Bewegungstherapie“ in letzter Zeit ein wenig vernachlässigt, nun macht er sogar einen fast einstündigen Strandspaziergang.
Gegen halb sechs kehren wir im Santa Maria Resort ein und bestellen zwei Drinks, dazu gibt es gratis Conch-Fritters.
Zu Hause essen wir nur noch einen Salat; auf Wein verzichten wir für einmal, wir hatten gestern mehr als genug. – Aber auf den Sonnenuntergang, auf den verzichten wir nicht.
14. Mai 2017
Zweitletzter Tag, letzte Wäsche, ein neuer Strand.
Wir fahren eine gute halbe Stunde lang up south, wo’s bei Simms einmal mehr einen gut versteckten menschenleeren Strand hat, O‘Neill’s Beach, an der Atlantik-Seite diesmal. Die letzten acht Kilometer sind mühsam, der Holper-Pfad geht über Stock und Stein durch den Busch. Mir tun die beiden Jeeps leid; es ist eine Strapaze. Rolfs Auto ist ja im Moment ausser Kurs, Randy und Liza, der es jetzt zum Glück wieder besser geht, nehmen Susan und Rolf mit, Theo und ich fahren in unserem kleinen schwarzen Jeep hinterher. Unterwegs gibt’s einen kurzen Zwischenhalt. Rolf will wieder mal was ernten gehen (diesmal nicht in Nachbars Garten), und zwar die süssesten Früchte, die es gibt, „Dillies“ (Sapodilla) heissen sie. Er weiss genau, wo es mitten im Busch einen solchen Baum hat. Er hat einen langen Stab mitgebracht, um sie in der Baumkrone zu erreichen. – Allerdings fällt die Ernte mager aus. Es habe zwar mindestens hundert Früchte dort, berichtet er, aber kaum eine davon sei reif. – Er wird in einem Monat oder so nochmals einen Versuch starten müssen.
Wir erreichen anschliessend den Strand. Es ist der erste hier, an dem es viele Abfälle hat. Sehr schade! Die sind allerdings nicht von den Strandbesuchern, sondern angespült vom Meer. Überall liegen kaputte Plastikbehälter herum, Flaschen, Teile von Schiffen. Mit den angeschwemmten Schuhen könnte man fast einen Laden aufmachen – jedenfalls für Einbeinige.
Rolf ist sofort wieder mit der Schnorchel-Ausrüstung unterwegs. Er findet ein Meer-Güezi (see biscuit), ein Getier, das sehr dem Sanddollar ähnelt, aber viel grösser ist. Theo „vergnügt“ sich mit einer Conch, die Liza gefunden hat. Die Schnecke lässt sich teilweise aus ihrer Schale heraus, aber das mit dem „Schau mir in die Augen, Kleines“ funktioniert nicht. Sie will ihre Augenfühler einfach nicht ausfahren. Er legt sie zurück ins Wasser.
Auf solche Exkursionen kommt auch immer eine Kühlbox mit. Bier gibt’s, Wasser, Heidelbeeren und Peperoni. Eine relativ seltsame Auswahl an Picknick-Drinks und –Snacks finde ich, aber jedem das Seine.
Zum Schwimmen ist es ausgezeichnet, man könnte sich stundenlang im warmen Wasser treiben lassen. Nach etwa drei Stunden fahren wir zurück.
Unsere Wäsche ist trocken, aber ich muss mich beeilen mit Einsammeln; die Mücken sind schon in den Startlöchern.
Leider ist das Restaurant, in das wir heute Abend gerne gehen würden, zu. So gibt’s halt Salat (mit Rucola) und Spaghetti daheim.
15. Mai 17 – Der letzte Tag
Es regnet – grad gäbig zum Kofferpacken. So verpasst man wenigstens nichts.
Wir müssen noch unsere Rechnung zahlen im Resort, den Jeep wieder volltanken, den Kühlschrank ausräumen und den Abfall entsorgen.
Gegen Mittag haben wir unser obligates Internetstündchen (Hotels buchen in Yucatan, Rechnungen zahlen). Es hat aufgehört zu regnen und wir beschliessen, noch rasch einen kleinen Ausflug zu machen in die „Adderly Plantation Ruin“. Ruinen haben mich schon immer fasziniert und eigentlich hätten wir die Plantage schon längst besuchen können, denn sie ist sehr nah von hier und wir sind x-mal an der Abzweigung vorbeigefahren. – Im Grunde genommen ist es ja eine Schnapsidee, bei diesem feuchten Wetter dorthin zu pilgern, aber jetzt muss es sein. Die Mücken werden einen „field day“ haben.
Zur Vorbeugung ziehe ich lange Hosen an und eine Bluse mit langen Ärmeln. Doppelt einreiben und einsprühen mit Anti Brumm ist ebenso eine Vorsichtsmassnahme, bis ich mich selber fast nicht mehr riechen kann, und los geht die Expedition.
Wir begleichen erst unsere Rechnung im Stella Maris Resort, fahren dann der Hauptstrasse entlang bis zur Abzweigung mit dem Schild zu den Ruinen. Von dort aus führt ein etwa zwei Kilometer langer Weg bis zu einem Strand, wo es nicht mehr weitergeht. Die Strecke dorthin durch den Busch ist die absolute Katastrophe, der kleine Jeep quält sich über Stock und Stein, durch die Löcher und Wasserlachen – es ist wie auf einem wild gewordenen Karussell. Und zudem regnet es wieder. In Strömen! – Das haben wir wirklich gut gemacht: Während mindestens vier Stunden hat’s nicht geregnet und jetzt, wo’s wieder anfängt…
Die Mücken sind auch schon einsatzbereit; sie riechen den Braten sofort. Erst schicken sie ein Begrüssungs-Komitee, dann eine ganze Kohorte hinterher. – Jetzt aufgeben, wo wir schon da sind? Der Gedanke wird verworfen, wir „stürzen“ uns ins Abenteuer. Wegweiser hat es keine. Dem Strand entlang links oder rechts? Wir entscheiden uns für rechts. Das ist richtig. Nach etwa zweihundert Metern führt ein Pfad ins Gestrüpp, gekennzeichnet mit Muscheln. – Inzwischen sind wir beide triefend nass, Theo trägt zumindest seine Regenjacke, ich habe meine im Koffer in Nassau gelassen. Meine weisse Bluse klebt an mir wie eine zweite Haut; sie ist jetzt ganz durchsichtig. Ein Schild steht da – endlich – so wissen wir zumindest, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Nach etwa einem halben Kilometer kommt eine Treppe in Sicht und dann die Ruinen. Da ist nicht mehr viel vorhanden: Stützmauer-Überreste von zwei Häusern, ein Kamin und ein paar zerbröckelte Treppenstufen. Der grösste Teil des Grundstücks ist völlig überwachsen. Wenigstens hat’s eine Tafel, auf der die Geschichte der Plantage beschrieben ist. Im Jahr 1790 wurde sie errichtet, man baute Baumwolle an, später Sisal, und lebte auch von der Viehzucht. Eine tragische Familiengeschichte, Erbschaftsstreitigkeiten und Besitzerwechsel führten zum Niedergang und schliesslich erledigte 1927 ein Hurrikan die Angelegenheit noch vollständig. Vor etwa neunzig Jahren also wurde das Gut verlassen und seither dem Zerfall preisgegeben. – Mich erstaunt, dass in so relativ kurzer Zeit kaum mehr etwas davon zu sehen ist.
Wir gehen alle zusammen (Theo und ich und eine Armada von Blutsaugerinnen, die uns ständig auf den Fersen sind und uns umschwirren) den Weg zurück zum Strand und zum Auto. Froh, heil auf der Hauptstrasse angekommen zu sein (ein geplatzter Reifen hätte noch gefehlt!), biegen wir nach links ab und fahren nach Burnt Ground, wo’s eine Tankstelle hat. Einige unserer Begleiterinnen haben es mit uns bis ins Auto und zur Tankstelle geschafft und versuchen weiterhin, uns zu peinigen. Theo ist ziemlich erfolgreich und erlegt ein paar von ihnen mit viel Geschick. Trotzdem hat’s Nachschub gegeben – mindestens zehn Stiche mehr, aber das ist eigentlich recht bescheiden.
Es hat noch nicht aufgehört zu regnen und unterwegs spritzen ganze Wasserfontänen übers Auto. Ich hoffe, dass es dadurch gerade ein wenig gewaschen wird, denn es ist über und über voller Sand und Dreck. – Der Tank ist wieder voll und wir beratschlagen, was wir machen wollen heute Abend. Wir haben vorgehabt, auswärts essen zu gehen in einem einheimischen Restaurant, wo man draussen sitzen kann/muss. – Das kommt natürlich nicht in Frage wegen des Regens und der Mücken.
Wir beschliessen, im Laden nochmals ein Steak zu kaufen und halt wieder daheim zu essen. Eine Flasche Wein, Kartoffeln und ein wenig Salat hab ich noch. – Steaks hat’s erst wieder, wenn das nächste Schiff kommt. Aber es hat Schweinekoteletts. In einem Packet sind sechs Stück, einzeln kann man sie nicht kaufen. Sie kosten alle zusammen 6 $. – Diesen lächerlichen Preis für so viel Fleisch finde ich gar nicht gut, aber die drei, die wir essen, sind wenigstens schmackhaft.
16. Mai 2017
Um vier in der Nacht wache ich auf. Die Mikrowelle im oberen Stock hat sich selbständig gemacht und piepst die ganze Zeit. - So nervig! Theo stellt sie ab und ich versuche anschliessend wieder einzuschlafen. Das funktioniert so aber nicht, denn jetzt ist’s ein anderes Geräusch, das mich wach hält, ein bekanntes... Zwei Mücken erwische und erschlage ich, und immer wenn ich denke, es sei jetzt erledigt, taucht eine neue auf. – Und es regnet wieder. Hoffentlich dann nicht beim Abflug!
Irgendwann wird’s doch Morgen, wir stehen auf, essen kurz etwas zum Frühstück und machen uns parat zum Gehen. Der Regen hat aufgehört, das Gepäck ist im Auto, es ist Viertel vor neun, wir fahren rüber zu Rolf und Susan, bedanken und verabschieden uns. Rolf fährt mit zum Flughafen, um neun sind wir dort, eine Viertelstunde später werden wir starten.
Der Schwarze, der sich unserer Koffer annimmt, stellt sich vor. Er heisst Greg und ist auch gleich der Pilot. Ich darf vorne neben ihm im Cockpit sitzen. Das macht Spass! Greg hat offenbar nicht viel zu tun. Er schreibt die ganze Zeit – etwa eine Reisebericht?
Wir fliegen genau über den Norden der Insel und die Orte, wo wir waren, sind jetzt aus einem anderen Winkel sichtbar. Ich geniesse den Flug durch die Wolken und den spektakulären Blick aufs Meer und die vielen Inseln.
Eine Stunde später sind wir in Nassau; wir erhalten unseren dort deponierten Koffer, nehmen ein Taxi zum International Airport und können ohne Schlange zu stehen grad einchecken für den Flug um drei.
Die Zeit bis dahin möchten wir nicht auf dem Flughafen verbringen, so verhandeln wir mit einem Taxifahrer, dass er uns Nassau zeigt, eine kurze Sightseeing-Tour also, und uns zu einem Restaurant führt, wo wir etwas essen können. Drei Stunden haben wir Zeit dafür. Erst will er 70 $ pro Stunde, dann aber einigen wir uns auf 110 $ für drei Stunden. Er fährt uns durch die prächtigen Villenviertel der Reichen, am Golfplatz und den grossen Hotels vorbei, Downtown und an den Hafen, wo die riesigen Kreuzfahrtschiffe ankern und es ebenso viele Touristen hat wie Luxus- und Souvenirläden. Weiter geht die Fahrt dem Strand entlang, vorbei am Bob Marley-Hotel, am Haus von Sean Connery und vom Ufer aus ist die Privat-Insel von Michael Jordan, Paradise Island, zu erkennen. Als Nächstes geht’s weiter zum Fort Charlotte und zu „The Queen’s Staircase“, einer steilen Treppe mit 66 Stufen, die von Sklaven am Ende des 18. Jahrhunderts in mühsamster Arbeit in den Stein gehauen wurde. Schliesslich landen wir in einem lustigen kleinen Restaurant, wo wir etwas zu Mittag essen. Unser Fahrer sagt, er würde im Auto warten, aber das lassen wir natürlich nicht zu und laden ihn ein. Er erzählt, er habe vier Söhne, der jüngste noch ein Baby, und achtzehn Geschwister, alle vom selben Vater, aber von fünf Müttern. Und er kann das noch toppen: Einer seiner Kollegen, auch ein Taxifahrer, habe 53 Kinder! – Zustände sind das!
Er bringt uns zurück zum Flughafen. Wir sind gut drin mit der Zeit, die Koffer sind wir ja schon los. Dann geht’s zur Sicherheitskontrolle. Theo, Theo, Theo! Es ist zum Verzweifeln mit ihm. Jedes Mal, aber auch wirklich jedes Mal irgendein „Gestürm“. Sein Handkoffer wird gescannt, gleich zwei Beamte sehen sich den geröntgten Inhalt an, ein weiterer wird dazu geholt. Eine Dame durchsucht seine Habe und da kommt wieder mal ein Messer zum Vorschein. Ich glaub’s ja nicht! Gestern noch hab ich ihm gesagt, er solle alle seine Fläschchen und Messer und die andern terrorismusverdächtigen Utensilien in den grossen Koffer packen… Das geht offenbar einfach nicht. Wie mich das nervt!
Wie wir endlich durch sind, (sein Messer hat er einem Beamten geschenkt) wurde unser Flug schon zweimal aufgerufen. Theo ist immer noch bei den Spirituosen und hört nicht auf die Lautsprecher. – Last call! Ich hole ihn und wir eilen zum Gate. Wir sind die letzten Passagiere. – Ab geht’s.
Eine Stunde später landen wir in Miami. Da das Immigrationsprozedere bereits in Nassau stattgefunden hat, geht hier alles sehr einfach vor sich, kein Zoll, keine Kontrolle; es ist wie ein Inlandflug. Im Flughafen selbst hat es ein Hotel, in dem ich für eine Nacht ein Zimmer gebucht habe. Das ist äusserst praktisch, morgen können wir quasi vom Bett zum Check-in.
Zum Nachtessen treffen wir uns mit Liza und Urs Lindenmann im „Monty’s“ an der Marina, und zum Dessert fahren wir nach Key Biscane in den „Rusty Pelican“, von wo aus man einen grossartigen Blick auf die nächtliche Skyline von Miami hat. Anschliessend fahren sie uns zurück ins Hotel.
Es war sehr schön, die beiden wieder mal zu sehen und einen gemütlichen und lustigen Abend zusammen zu verbringen.
17. Mai 2017
Wir haben sehr gut geschlafen. Mal keine Mücken - was für paradiesische Zustände!
Gemächlich stehen wir auf und fahren mit dem Lift hinunter in die Lobby. Von dort aus sind es keine hundert Meter zum Check-in. So ober-gäbig! Es steht auch niemand an; im Nu ist alles erledigt.
Dann die Sicherheitskontrolle: Diesmal können wir ja keine Probleme mit dem Handgepäck haben, denn Theo ist sein Messer inzwischen los und er hat auch sonst nichts mehr, womit er die Beamten beschäftigen könnte. – Viele Leute stehen an, aber es geht so rasch, wie ich das noch gar nie erlebt habe. Man kann schon fast von „Windeseile“ sprechen, wie das vor sich geht. Niemand muss seine Schuhe ausziehen, auch den Gurt darf man lassen, wo er ist, die elektronischen Geräte braucht man nicht separat auszupacken und aufs Band zu legen – kein Wunder geht es so schnell. So haben sie auch keine Plastik-Becken, in die man seine Habe einzeln hineinlegen muss. Die einzigen Behälter, die’s hat, sind bestimmt für kleinere Handtaschen. Sie sind schwarz, rund und sehen aus wie Fressnäpfe für mittelgrosse Hunde. Auch das hab ich noch nie gesehen auf einem Flugplatz. Und das in den USA – kaum zu glauben. Sonst sind die da so pingelig und kompliziert…
Der Flug dauert knapp zwei Stunden und kommt fast eine halbe Stunde früher an als vorgesehen.
Der dritte Teil unserer Reise beginnt. Wieder eine andere Welt – so ziemlich das Gegenteil von dem, was wir bisher erlebt haben und noch ein wenig heisser; es sind schwüle dreiunddreissig Grad.
Mexico - Playa del Carmen - 17. – 31. Mai
Leider habe ich während dieses Teils der Reise keinen Bericht geschrieben. Es lief ziemlich viel, und ich hatte keine Zeit oder wollte mir keine Zeit nehmen zum Schreiben. – Das ärgert mich nun ein bisschen, weil ich soeben feststelle, dass ich einiges bereits vergessen habe, an das ich mich gerne erinnern würde. Anhand des Fotoalbums, das ich gemacht habe, muss ich nun wieder all die Namen nachschauen.
So skizziere ich nur kurz, wo wir waren und was wir gesehen haben.
Unser HomeExchange fand in Playa de Carmen statt in einem modernen, grossen Apartment im obersten Stock eines Wohnblocks in einem grossen luxuriösen Hotelkomplex, direkt am Meer gelegen, genannt „The Azul Fives Beach Resort Hotel & Residences“ („Where your new life begins“, wie’s im Prospekt beschrieben wird. Was auch immer damit gemeint sein mag).
Wir verbrachten dort ein paar gemütliche Tage im Liegestuhl am Strand, liessen uns in den verschiedenen exquisiten Restaurants im Resort verwöhnen und genossen das Dolce far niente. – Allerdings wollten wir nicht die ganze Zeit nur mit Nichtstun „vergeuden“. Bereits zu Hause schon hatte ich eine einwöchige Reise durch Yucatán geplant.
Erste Übernachtung war in einem Hotel ganz in der Nähe von Chichén Itzá. Die weltberühmte Ruinenstätte der Maya-Kultur zu besuchen, war ein „Muss“. Weil wir gleich dort wohnten, hatten wir den Vorteil lange vor all den Touristenbussen in der Anlage zu sein und die eindrucksvollen Bauten in Ruhe bestaunen zu können. Zusätzlich war’s interessant den Händlern zuzusehen, wie sie ihre unzähligen Souvenirstände für den kommenden Ansturm ins Gelände schleppten und aufbauten.
Am Abend wohnten wir der Ton- und Lichtshow bei, welche die ausgeklügelte Geometrie der Anlage eindrücklich und sehr farbig in Szene setzt.
Grad gegenüber von unserem Hotel befand sich der Cenote Ik Kil. Dieses „Wasserloch“, wenn man so will, hat mich fast noch mehr fasziniert.
Laut Wikipedia sind die Cenotes („heilige Quelle“ in der Sprache der Maya) tiefe Höhlen. Sie entstehen in Karstgebieten. Durch die Auflösung des Kalkgesteins bilden sich Höhlen und unterirdische Wasserläufe. Brechen die Decken dieser Höhlen ein, so entstehen Tagöffnungen, die in der Fachsprache Dolinen genannt werden und bis zum Grundwasser reichen können. Die Maya betrachteten sie als Eingänge zur Unterwelt und nutzten sie häufig als religiöse Opferstätten. Die gewaltigen Höhlen galten als Sitz von Göttern der Unterwelt. Insgesamt wird die Zahl der Cenotes auf über 10.000 geschätzt. Sie besitzen im Durchschnitt eine Tiefe von etwa 15 Metern, vereinzelt auch von über 100 Metern.
Auf unserer Reise haben wir einige davon besucht, sind in ihnen baden gegangen. Die grösseren sind viel besucht, wie eben diejenige von Ik Kil. Das kreisrunde Loch im Boden ist fast 20 Meter tief, unter dem Wasserspiegel geht es noch einmal 46 Meter in die Tiefe. Jeden Tag planschen hunderte Menschen unter der atemberaubenden Kulisse des natürlichen Pools im etwa 22 Grad warmen Wasser. Sogar ein Sprungturm ist eingerichtet für die Wagemutigen. In den mit Hängepflanzen bewachsenen Höhlenwänden nisten farbige Vögel.
In den kleineren hat’s dann kaum Touristen, sie sind abgelegen, weit weg vom üblichen Trampelpfad und sind oft recht abenteuerlich und gruselig zu begehen.
Den Abstecher zu den drei Cenotes de Chunkanan, Chelentun, Tzapakal und Santa Cruz jedenfalls bleibt unvergesslich. Erst fanden wir den abgelegenen Ort fast nicht, dann fuhr ich einen Nagel ein im Pneu, wobei ich den Verdacht nicht ganz loswurde, dass es sich hierbei nicht um einen echten Zufall handelte. Sofort waren drei junge Männer zur Stelle, die halfen, das Reserverad zu montieren. Natürlich erhielten sie ein gutes Trinkgeld und ein paar Pullover, die ich so oder so hatte verschenken wollen. Es war 40 Grad am Schatten und urplötzlich begann es wie aus Kübeln zu regnen. Trotzdem wollten wir uns die Cenotes ansehen. Für die Tour dorthin wurden einfachste Pferdekutschen, eher Schlitten zwar, angeboten, die auf engspurigen Geleisen fuhren und von einem mageren Pferd gezogen wurden. Dies war die einzige Art und Weise, wie man zu den Höhlen gelangen konnte. Theo zog seine Regenjacke an, ich nur den Badeanzug, nass waren wir ja so oder so schon bis auf die Haut. Ganze Bäche stürzten aus seinen Jackenärmeln. Das wäre ja alles noch gegangen, aber plötzlich gab’s einen markanten Temperatursturz, innert einer Stunde war’s nur noch gerade 20 Grad warm und ich begann zu frieren. Nun empfand ich das Wasser in der Höhle noch fast als warm; Theo setzte sich mit all seinen Kleidern in den Teich. Was für ein Anblick!
Der Abstieg in die kleinste Höhle unternahm ich allein, aber ich schaffte es auch nicht bis ganz nach unten. Mir wurde ganz unheimlich zumute in dem dunklen, engen Schacht mit den glitschigen, behelfsmässige Stufen, die in den tiefschwarzen Schlund bis zur Wasseroberfläche führten. Manchmal konnte ich die nächsten Tritte kaum sehen, so weit auseinander lagen sie. Auch traute ich der Konstruktion nicht besonders. Alles sah recht unprofessionell aus, auch die Seile, die als Handgriffe dienen sollten. – Auf jeden Fall nichts für Menschen, die an Klaustrophobie leiden.
Die Übernachtung in der Hacienda Viva Sotuta de Peón, einem grossen landwirtschaftlichen Gut, entschädigte uns für alle „Ungemach“. – Was für ein schönes Hotel (Cabaña mit eigenem Pool) ich da ausgelesen hatte! - Ein Bijou.
Dort sagte man uns auch, wo wir den kaputten Pneu würden reparieren lassen können. Weit wollte ich damit nicht mehr fahren. In Ticul fanden wir eine Werkstätte. Theo hatte Bedenken und fand, wir sollten lieber eine andere suchen. Ich war anderer Meinung und fuhr in den Hof hinein, in dem überall Pneus herumlagen. Sein Bauchgefühl war nicht richtig. So ein rascher, professioneller und überaus freundlicher Service würde ich mich auch zu Hause wünschen. Zudem hat die Arbeit kaum was gekostet.
Sehr viel weniger Besucher begegneten wir auf der Ruta Puuc. Diese Rundreise führt durch Maní, Loltún (ähnliche Grotten wie die Beatushöhlen), Labna, Xlapak, Sayil, Kabah, Uxmal entlang von einzigartigen Ruinenstätten. Nicht ganz so gross wie Chichén Itzá, aber nicht minder beeindrucken. In jeder trifft man auf einen anderen architektonischen Stil. Wunderbar, durch die Anlagen zu spazieren, zu klettern, sie zu erforschen. Und das Schöne eben: Es hat kaum andere Besucher.
Auf dem Weg nach Mérida machten wir Halt in Santa Elena und besuchten einen weiteren Cenote, nämlich den von San Antonio Mulix, wo sich wieder mehrere „Badegäste“ tummelten.
Mérida gefiel uns sehr gut, wir übernachteten zweimal in dieser farbigen Stadt, in welcher eine fröhliche Stimmung herrschte, besuchten das fantastische Museo Regional de Atropología Yucatàn und fanden ein paar behagliche Restaurants.
Auf dem Rückweg an die Küste in die Provinz Quintana Roo besuchten wir die historisch bedeutende „gelbe Stadt“ Izamal, wo grade ein riesiges Volksfest rund um den Convento de Izamal stattfand. Laute Bands untermalten das ausgelassene Treiben und auf dem Platz vor dem Kloster drängten sich die Besucher um die Marktstände herum. Der Klosterkomplex wurde 1561 fertiggestellt. Dadurch, dass für den Bau das unterliegende Pyramidenfundament verwendet wurde, hat das Kloster einen Kirchhof mit einer Ausdehnung, die nur noch vom Vatikan übertroffen wird. Zum Bau des Klosters und der umliegenden Stadtgebäude wurden Izamals Pyramiden als Steinbruch missbraucht.
Die Stadt erhielt übrigens die touristische Auszeichnung „Pueblo Mágico“. Berühmt ist die gigantische Pyramide Kinich Kak Moo mit Seitenlängen von 200 m und einer Höhe der Plattform von 36 m, sie stammt aus dem Mittleren Klassikum und war dem Sonnengott geweiht. Theo legte sich an ihrem Fusse in den Schatten der Bäume (zwecks Siesta) während ich die zahlreichen Stufen hochkraxelte bis zuoberst, wo sich mir eine grandiose Aussicht bot.
Zurück in Playa del Carmen verlebten wir noch ein paar weitere gemütliche, schöne Tage bei bestem Wetter im Azul Fives Resort.
Im Städtchen selber waren wir etliche Male. Der hübsche Ort am Meer ist beliebt bei Touristen und Einheimischen gleichermassen. Die vielen Restaurants, Bars und Läden laden zum Bummeln, zum Verweilen und zum Geld-Ausgeben ein.
Zwei Kurzausflüge auf die vorgelagerten Inseln Cozumel und Isla Mujeres (mit einem Katamaran) waren weitere Highlights unserer Ferien in Mexiko – auf der Atlantikseite diesmal.
Anfangs Juni waren wir zurück und konnten den Sommer in der Schweiz verbringen, oft in der Aare baden, was ich so sehr liebe. - Mitte Juni reiste die ganze Familie nach London. – Am 17. Juni, an einem der heissesten Tage im Jahr, heiratete Kim ihren Partner Javier, mit dem sie schon zehn Jahre lang zusammengelebt hatte.
Dann der absolute Höhepunkt des Jahres: Zwei Monate später brachte Kim einen kleinen Jungen zur Welt: Teo Jaxx Torriani Villanueva. Alles ging gut – die Familie war glücklich.
Zurück zu Hause hiess es aber wieder Kofferpacken, denn am 5. Oktober war’s höchste Zeit, unsere „Schweiz-Herbst-Flucht-Ferien“ in Angriff zu nehmen
Die Reise begann in Myanmar, wo wir drei Wochen lang einen Teil dieses wunderschönen Landes erkundeten. Diesmal hatten wir einen Fahrer engagiert, dem es ein Anliegen war, uns (nebst den obligaten „Must-sees“) sein Land möglichst abseits der Touristenströme zu zeigen. Es war fabelhaft. Während Tagen sahen wir kaum andere Reisende und entdeckten die schönsten Orte und Landschaften.
Reisebericht Myanmar 5. – 24. Oktober 17
Wieder sind wir unterwegs. Wie praktisch, erst am Abend abreisen zu müssen. Gino bringt uns um sechs nach Bern an den Bahnhof. Der Zug nach Zürich hat Verspätung und wie er endlich kommt, merken wir sofort, dass wir froh sein müssen, wenn wir überhaupt noch einen Platz finden. – Es gelingt – in zwei verschiedenen Wagen. Die Passagiere sitzen sogar auf den Treppen; es herrschen sardinenbüchsenartige Zustände.
Check-in habe ich schon online erledigt. Nur die Koffer müssen wir noch abgeben. Grosse Mühe haben wir uns gegeben beim Packen. Einen Koffer wollen wir nämlich gleich in Yangon lassen. Der nützt uns nicht auf der Rundreise, da sind Dinge drin, die wir erst in Australien brauchen werden.
Am Baggage-Drop-Schalter aber müssen wir unser Handgepäck wägen lassen und oh weh – beides darf nur 7 kg schwer sein, unseres wiegt je 10 kg. Wir müssen also umpacken in die grossen Koffer. Mühsam, mühsam. Aber ok, wir schaffen’s. Zum Glück erlaubt Emirates je 30 kg beim Abgabegepäck, so müssen wir nicht draufzahlen. Das hätte noch gefehlt – schon zu Beginn der Reise.
Eine 380-er Boing bringt uns nach Dubai, wo wir drei Stunden Aufenthalt haben. Mit grosser Freude stelle ich fest, dass Theo es diesmal unterlassen hat, irgendwelche seltsamen und unnützen Dinge zu kaufen und ebenso erfreulich ist es, dass er ausnahmsweise beim Security-Check kein Messer hat abgeben müssen. Das ist doch mal ein Anfang! – Kurz nach neun geht’s weiter nach Yangon, wo wir am folgenden Tag pünktlich um 17.25 ankommen.
Geschlafen haben wir nicht viel in dieser kurzen Nacht – viereinhalb Stunden sind „verloren“ gegangen. Wir freuen uns aufs Hotel und aufs Bett.
Yangon
Die Zollkontrolle geht reibungslos, der erste Koffer kommt gleich auf dem Rollband daher. Das geht ja rasch, freue ich mich. Aber der zweite Koffer – auf den müssen wir eine geschlagene Stunde warten. Wir sind nicht die Einzigen, die dort herumstehen und sehnlichst aufs Gepäck warten. Niemand weiss, wieso es so lange dauert. Aber endlich: Es ist jetzt fast sieben und bereits dunkel, wie wir auch die Zollabfertigung hinter uns haben.
Ob Tunlin da ist, um uns abzuholen? – Ich zweifle nicht. Tunlin habe ich im Internet gefunden, er bietet Rundreisen an durch Myanmar in seinem Auto. Eine Deutsche hat ihn in ihrem Reisebericht empfohlen und seine Email-Adresse erwähnt. So haben wir während Wochen zusammen kommuniziert. Er hat Vorschläge gemacht in Bezug auf die Route und ich habe Hotels gebucht, wieder storniert, wenn er andere empfohlen hat, neu gebucht etc. etc.
Ein Foto von uns hab ich ihm geschickt, damit er uns am Flughafen erkennt, und das hat bestens geklappt. Von weitem schon hat er uns zugerufen und gewinkt.
Ich glaube, wie haben Glück. Er ist ein sympathischer Mann Mitte dreissig, schlank und freundlich. Er ist ein Jahr jünger als unsere Zwillinge, wie wir später erfahren.
Etwa 40 Minuten dauert die Fahrt zum Hotel Chatrium. Wegen der Dunkelheit haben wir kaum etwas von der Stadt gesehen, no problem, wir werden sie ja morgen erkunden.
Tunlins Auto, mit dem wir reisen werden, ist ein Toyota-Bus mit acht Plätzen. Theo frohlockt schon und sieht, dass er genügend Platz hat, so dass er sich ab und zu auf einer Dreierbank seiner Lieblingsbeschäftigung wird hingeben können.
Im Hotel hat’s drei Restaurants. Wir wählen das japanische, können ja dann noch lange burmesisch essen auf der Rundreise. – Ein feines Büffet hat’s; wir essen mehr als wir eigentlich wollten, geniessen’s aber sehr. Und noch mehr die Dusche und das weiche Bett.
Nach einem achtstündigen dornröschenähnlichen Schlaf starten wir nach dem Frühstück mit Tunlin zur Stadtrundfahrt.
Erst aber gibt’s noch eine „Thanaka-Behandlung“. In der Lobby steht parat, was man dazu braucht: das richtig Stück Holz (besagter Baum wächst nur in Myanmar), dessen Rinde man auf einem Stein zu feinem Puder reiben muss. Mit etwas Wasser vermengt entsteht eine feine gelbliche Paste, die man sich ins Gesicht streicht. Sie schützt vor der Sonne und sieht „gut aus“. Tunlin appliziert mir welche. Sie fühlt sich nass und kühl an. Mal schauen. Jedenfalls freuen sich Frauen, die uns begegnen, dass ich es ihnen gleich tue – mir kommt’s allerdings ein bisschen blöd vor. Sie deuten wohlwollend auf ihre beziehungsweise auf meine Wange. Theo jedoch ist eher irritiert. Er will mir den „Fleck“ auf der Nase wegwischen. Das funktioniert hingegen nicht gut; er erscheint immer wieder.
Wir fahren zur Sule-Pagode, die mitten in der Stadt steht, schauen sie aber nur von aussen an. Es sei zu heiss dort, meint Tunlin, und er wolle uns nicht schon am ersten Tag mit Buddhas und Pagoden überfüttern. Es scheint, er hat seine Erfahrungen mit Touristen schon gemacht.
Wir gehen zu Fuss durch die Strassen rund um den Platz, sehen, dass es auch eine Moschee dort hat, eine Kirche und einen Hindutempel ebenso. Verlotterte Kolonialbauten gibt’s zuhauf, fast wie in Havanna. Einige sind im Begriff, restauriert zu werden, andere scheinen kurz vor dem Zerfall zu sein.
Überall hat’s Garküchen, Fleisch und Gemüse werden gebraten und angeboten. Die kleinen blauen und roten Plastikstühle sind allgegenwärtig und sehen aus, als wären sie für eine Kindergarten- oder Zwergenparty bereitgestellt worden, die jeden Moment stattfinden könnte. Sie erinnern mich an Vietnam.
Anders als zum Beispiel in Hanoi aber geht’s im Verkehr zu und her. Motorroller sind in dieser Stadt verboten. So sind’s halt die Autos, die das Strassenbild dominieren. Hupend verscheuchen sie die Fussgänger, die auf die andere Seite wollen, egal, ob die sich grad auf dem Zebrastreifen befinden oder nicht. Daran ändert auch das Grünlicht nicht das Geringste. Sie sind Quantité négligable. Wo bleibt der vielzitierte Respekt gegenüber den Mitmenschen? – Ok, ok, alles hat ja etwas Positives, man muss es nur sehen: das tägliche Keep-Fit-Training ist kostenlos.
Einen liegenden Buddha besuchen wir anschliessend in der Kyau-htat-gyi-Pagode. Besonders sehenswert sind seine Füsse beziehungsweise seine Fusssohlen. 108 Bilder oder fast eher Piktogramme sind dort eingemeisselt.
Am Fluss herrscht ein reges Treiben. Seit einem Tag erst gibt es neu ein Wasser-Taxi, das 85 Passagiere gleichzeitig ans andere Ufer bringen kann. Aber man müsste dazu lange anstehen. Wir verzichten und gehen lieber Mittagessen. „Monsoon“ heisst das Restaurant, wohin Tunlin uns führt. Es ist „sicher“ für Touristen und ja, tatsächlich, netter Service, gutes Essen und eine saubere Toilette.
Anschliessend besuchen wir die grösste katholische Kirche der Stadt, St. Mary’s. Die Pfeiler sind aus weissen und roten Ziegeln gebaut, das sieht ganz gut aus. Ein holländischer Architekt hat sie 1895 entworfen.
Es regnet in Strömen, ist feucht und heiss und Tunlin bringt uns zurück ins Hotel zum Ausruhen. Siesta! Das kommt Theo gerade recht. Um halb sechs werden wir wieder abgeholt. Den Besuch der Shwegadon Pagode empfiehlt Tunlin erst um diese Zeit, weil die Pagode am schönsten ist beim Einnachten und man sich die Fusssohlen nicht mehr verbrennt.
Wir essen anschliessend wieder im Hotel. Chinesisch diesmal. Auf der Karte steht zu jeder Speise S M L, wie bei T-Shirts. Ich denke, M wird wohl richtig sein und wir bestellen drei Gerichte. S ist besser, belehrt man uns. M ist für vier Personen, L für zehn. – S war ok, aber zwei Gerichte hätten mehr als nur gereicht. Eigentlich würde ich ja gerne ein, zwei Kilos abnehmen, daraus wird so aber gar nichts.
Sonntag, 8. Oktober – Beginn der Rundreise mit Tun Lin
Um exakt 9 Uhr fahren wir los Richtung Süden. Den ersten Halt gibt’s bereits nach einer Stunde, und zwar beim Militärfriedhof Toukkyant, wo über sechstausend Gräber an die gefallenen britischen Soldaten im zweiten Weltkrieg erinnern. Die Anlage ist wunderbar gepflegt und ein Spaziergang entlang der endlosen Gräberreihen führt einem einmal mehr die Unsinnigkeit des Krieges vor Augen. So viele junge Männer mussten sterben, grad kurz vor Ende des Krieges – sinnlos verschwendete Menschenleben. Beeindruckend, traurig, bitter, unverständlich!
Weiterfahrt nach Bago. Wir hätten sehen wollen, wie die Mönche im Kloster Kya Chat Wine ihr Essen erhalten. Wir kommen aber grad ein wenig zu spät, sahen nur noch, wie sie mit ihrer Gamelle (ich nenn‘ das Gefäss jetzt mal so – Reisschalen wär richtig) im Gänsemarsch hintereinander an uns vorbei aus dem Essenstrakt in ihre Unterkunft abmarschieren. Eine schier nicht enden wollende Kolonne von jungen Männern, alle kahl geschoren, alle gleich gekleidet in ihrem dunkelroten Tuch, alle mit zum Boden gesenktem Blick - das physische Gruseln könnte einen packen beim Anblick dieser Identitätslosigkeit…
2000 Mönche leben übrigens in diesem Kloster.
Weiter geht die Fahrt zu einem Tempel (Hin Taw Hill), wo grad ein Fest im Gang ist. Ein sehr lautes! Trommeln, Lautsprechergesang und Tanz – recht ungewöhnlich für europäische Augen und Ohren - ohne Ende auch hier.
Überall liegt Abfall herum. Schade! Das sieht nicht gut aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es den Leuten, die in und um diesen Dreck herum leben, wohl sein kann.
Vor dem Mittagessen machen wir noch kurz Halt beim Schlangentempel. Recht skurril geht es dort zu und her und gar nicht etwa buddhistisch, wie Tunlin betont haben will: Anbeten kann man dort einen 9 Meter langen Python, der 114 Jahre alt und die Verkörperung eines verstorbenen Abtes sein soll. Es brauche 5 Mönche, um ihn hochzuheben. – Ob ihm das gefällt? – Nun, er liegt lethargisch dort, zusammengerollt, und neben ihm sitzt ein Typ, der die Besucher singenderweise dazu animiert, Geld fürs Futter zu spenden (für seines vielleicht auch). Die Scheine legt er der Schlange auf den Leib. Im Zimmer dieser Schlange, es ist eher ein Zimmer als ein Tempel, sind auch zwei Typen dargestellt (aus Plastik wohl), die Geldscheine in ihren Händen halten und grässlich dreinschauen. Auch vor denen knien Gläubige, die durch ihre Andacht hoffen, zu Geld zu kommen.
Apropos Geld: Dollars werden an manchen Orten gerne angenommen, aber nur ganz neue, saubere Noten, die noch nie gefaltet worden sind und keinen einzigen Fleck aufweisen. Gut, das vor der Reise bereits zu wissen. Was man dann allerdings beim Wechseln zurückerhält, sind ihre Kyats (ausgesprochen „Tschats“) – meist dreckig, und das so sehr, dass man jedes Mal, wenn man sie berührt, das Gefühl hat, man müsse sogleich die Hände waschen.
Übernachtung ist in Kyaikto, in einem hübschen Hotel mit Aussicht auf die „Berge“ (Thuwunna Bomi Mountain View Hotel). Eigentlich sind’s eher Hügel, aber der weite Blick übers Land ist herrlich. Vor allem vom Pool aus. Ein kleiner „Schwumm“ nach der langen Fahrt in der Hitze tut gut.
Wir essen draussen, warten aber eine ganze Stunde lang auf unsere Bestellung. Das Restaurant ist sehr gut besetzt; alle Gäste sind einheimische Touristen. Ok, wir haben ja Ferien. Es beginnt stark zu regnen und so warten wir eine weitere Stunde, bis wir unter dem Schutz des Regenschirms den Aufstieg zu unserem Bungalow unter die Füsse nehmen.
Montag, 9. Oktober 2017
Wie gestern auch, fahren wir um neun Uhr los. Der Regen hat aufgehört. Es ist wieder heiss und schwül. Tunlin will uns irgendwo hinführen, wo’s keine Touristen hat und auch in keinem Führer etwas drüber steht. – Mal schauen… Es handelt sich um ein Fort aus dem 4. Jahrhundert (Zoke Thoke). (Wenn ich diesen Ortsnamen google, erscheinen Schuhe: „Nike Khaki“ – nicht, was ich suche…) Tunlin hat nicht zu viel versprochen: Eine der Mauern ist noch erstaunlich gut erhalten und ist mit prächtigen Reliefs verziert, mit Pferden, Tempelwächtern, Krokodilen, Affen etc. Dass hier keine Touristen sind, wundert mich. Die Kinder im Dorf begleiten uns, von Betteln keine Spur. Sie sind Besucher tatsächlich nicht gewohnt.
Auch im Fischerdorf, das wir anschliessend besuchen (Zok Kali), werden wir freundlich begrüsst. Kaum hält unser Auto an, versammelt sich wie aus dem Nichts eine ganze Gruppe Frauen um uns herum. Sie fassen mich an, wollen meine (weisse) Haut spüren. Nur allzu gern lassen sie sich mit mir fotografieren.
Beim anschliessenden Spaziergang durchs Dorf zieht Theo einen ganzen Schuh voller Lehm und Dreck aus dem Sumpf. Es braucht etliche Kacheln Wasser, die uns eine Dorfbewohnerin bringt, bis er wieder passabel aussieht. Tunlin kugelt sich vor Lachen.
Noch ein paar Worte zur Verständigung mit Tunlin: Diese ist nicht immer sehr einfach. Er hat zwar einen ausserordentlich grossen Wortschatz und ein umfangreiches Wissen, kann auch alles flüssig erklären, aber bei der Grammatik und vor allem bei der Betonung – da happert’s gewaltig. Gewisse Lautverschiebungen erkenne ich nach ein paar Tagen, aber immer klappt auch das nicht. Wenn ich ihn mit lauter Fragezeichen anschaue, dann buchstabiert er mir das Wort, das ich nicht verstanden habe in rasender Geschwindigkeit, was dann allerdings ebenfalls selten zum Erfolg führt. – Was zum Beispiel heisst „Lassía“? – Ich hab’s: „Last year“.
Sehr gut hingegen verstehe ich seine manchmal ziemlich sec zusammengefassten Inhalte wie „no like“ und „no have“ oder wie er mir auf meine Frage, was denn passiere, wenn jemand sterbe, antwortete, der Körper werde verbrannt und irgendwo im Wind zerstreut. „No use!“. Damit hat er ja nicht ganz unrecht.
Wir fahren an Plantagen vorbei und er erklärt, da würden neben Papayas, Erdnüssen und Mais auch „Papa“ angepflanzt. Ich denke, da handle es sich tatsächlich um eine exotische Frucht oder Pflanze, die vielleicht nur in Burma heimisch sei, die ich nicht kenne. Als ich „Papa“ dann zu Gesicht bekam, war mir klar, er meinte „Pepper“.
Mittagessen in Thatou (Two Lakes Resort)
Wir sd die einzigen Gäste. Wie unser Auto vorfährt, werden wir von drei Kellnern mit Schirmen begrüsst und abgeholt. Die zehn Meter ohne Sonnenschirm hätte ich ohne weiteres geschafft – sooo heiss war’s nun doch nicht. Aber die Angestellten haben im Moment ja sonst nichts zu tun und sind sehr beflissen, alles richtig zu machen, wenn sie es mit Touristen zu tun haben. Jetzt aber gibt’s Arbeit: Einer weist uns den Platz am Tisch an, den ich aber wechselte, weil ich wie ein Zwärgli hätte sitzen müssen. Ich entschied mich für einen Stuhl mit Aussicht auf den Tisch. – Einer bringt die Menu-Karte, einer springt herum, ohne genauen Plan, einer bringt eine Serviette, die so klein ist, dass ich sie zwar zumindest ohne Lesebrille sehen kann, aber das ist’s dann auch schon, einer holt noch zwei andere Kellner, damit es an nichts und niemandem mangelt, einer von denen merkt, dass die Serviette schon ein wenig klein ist, bringt also noch eine zweite, die er hübsch neben die anderen hinlegt, einer stellt die restlichen Servietten in die Mitte des Tisches, ein anderer kommt sogleich und schiebt sie wieder an den Rand, ein weiterer stellt uns diskret einen kleinen Plastik-Papierkorb zu Füssen zwecks Entsorgung der gebrauchten Servietten, eine dritte Serviette wird gebracht, und schliesslich versucht sich einer auf Englisch, um unsere Wünschen zu ergründen. Ja, und so bestellten wir das Mittagsmenu; Tunlin hilft beim Übersetzen. Das Essen wird gebracht, es ist sehr fein, wir stehen aber die ganze Zeit unter schärfster Beobachtung. Die ganze Kellnerschar reiht sich in nicht allzu grossem Abstand um uns herum und alle schauen uns beim Essen zu, ohne je „to miss a beat“; es könnte ja sein, dass irgendjemand noch einen Wunsch hegt. Vor allem beim Nudel-Suppen-Schmaus ist das etwas gewöhnungsbedürftig. Die Szene ist teils rührend, teils ein wenig peinlich.
Die Rechnung kommt, von Hand geschrieben in der wunderbaren Schrift, welche die Burmesen haben, und mit zwei hübschen Stempeln versehen. Knapp zwölf Franken, Trinkgeld inbegriffen, kostet die Mahlzeit für uns drei.
Wieder werden wir mit Schirmen zum Auto begleitet, damit wir ja nicht etwa einen Sonnenstich erleiden auf dem Weg dorthin, und ein Kellner rennt mir sogar noch nach, um darauf aufmerksam zu machen, dass ich das Retourgeld nicht eingepackt habe…
Genau so geht es uns, um das vorweg zu nehmen, beim Abendessen. Da sind wir nur zu zweit im Restaurant. Der zuständige Kellner lässt kein Auge von uns. Ich gäbe viel darum zu wissen, was der sich beim Zuschauen denkt. Und Theo wieder mit seiner Nudelsuppe… Und eine ganze Flasche Wein (aus Myanmar - sehr gut übrigens!), verarbeiten wir zu zweit…
Höhlen
Am Nachmittag stehen zwei Höhlen auf dem Programm:
Die erste (Cave Ba Yin Nyi) ist am Fusse eines dieser für die Gegend typischen Karstberge gelegen. Schon von weitem sieht man die goldenen Spitzen der Pagoden im Sonnenlicht glänzen. Die Höhle ist offenbar tief, aber man besichtigt nur einen kleinen Teil davon. Buddhas sitzen dort geduldig in Reih und Glied, sie spiegeln sich im „Teich“, der sich durchs herabtropfende Wasser gebildet hat. Das sieht schön und würdevoll aus. Durch diese Pfütze muss man waten, wenn man das dringende Bedürfnis hat, auch die Buddhas in den hinteren Gewölben zu begutachten. Das kühle Nass an den Füssen zu spüren ist ganz angenehm. Sauber kann das Wasser zwar nicht gerade sein, hunderte von Füssen haben die Stelle schon passiert, aber es ist so dunkel, dass man das nicht sieht. Lieber nicht dran denken…
Die zweite Höhle (Kaw Gion) ist gar keine richtige Höhle. Eigentlich handelt es sich mehr um eine Ausbuchtung an einem dieser Karstfelsen, in die unzählige Reihen von kleinen und kleinsten Buddhas in den Felsen eingraviert respektive angebracht worden sind. Aus dem Grund heisst es in der Übersetzung die „Grotte der 10’000 Buddhas“, und das ist wohl nicht einmal übertrieben. Die kleineren Reliefs stammen aus dem 7. Jhd. und es ist nicht vorstellbar, wie die Menschen damals diese in die überhängenden, steilen und hohen Felswände haben einmeisseln können. Später, vor etwa hundert Jahren, sind die grossen Buddhas dazu gekommen, welche unterhalb und nebeneinander in verschiedenen Reihen sitzen, auf Augenhöhe, entlang des Weges, den die Besucher gehen. – Es ist ein fantastischer Ort. Eindrücklich und einmalig.
Die Gegend (Bee Lin Township) hier ist ebenfalls grossartig: Reisfelder wechseln sich ab mit Kautschukplantagen und –wäldern - am Horizont die Berge und die einzelnen alleinstehenden Felsen, ähnlich wie im Monument Valley in den USA, aber anders als dort sind sie dicht bewaldet. Die Gräser, die im Vordergrund und am Strassenrand silbern glänzen, wiegen sich sanft im Wind.
Auf dem Weg ins Hotel müssen wir etliche Strassenposten passieren. Immer wieder muss Tunlin anhalten und Kohle abladen. Es ist zwar nicht viel (manchmal sogar weniger als vierzig Rappen), aber immerhin. Auch Militärkontrollen sind vorhanden – es ist die Strasse nach Thailand; Autos werden auf Drogen kontrolliert. Wir nicht. Wenn sie sehen, dass wir Touristen sind, lassen sie uns durch.
Zurück im Hotel: Bad im Pool, welches viel zu warm ist und mich die Aare aufs Schlimmste vermissen lässt. Trotzdem tut es gut, sich nach dem langen Tag ein wenig im Wasser zu bewegen.
Abendessen schon erwähnt.
Dienstag, 10. Oktober
Das Frühstück hier ist „nothing to write home about”. Ich halte mich an die Früchte, denn das asiatische Buffet, das es hier gibt, ist am Morgen nicht so mein Ding. Theo hingegen langt kräftig zu: Nudelsuppe und sonstige Köstlichkeiten. Für die wenigen europäischen Touristen, die sich hierhin verlaufen, genügen ein paar trockene Toastscheiben, Butter und Konfitüre (welche beide mehr als nur suspekt aussehen) vollauf. Mir läuft jedenfalls nicht das Wasser im Mund zusammen. Auch den Orangensaft würde man nicht zwingend als solchen erkennen, selbst wenn ein paar dünne Orangen-Rädchen drin baden. - Tee in dem Fall: Im 1-Liter-Thermoskrug schwimmen 10 Beutel Lipton’s Tea. Kohlrabenschwarz wie Kaffee, bitter wie Galle - wen wundert’s?
Um neun geht’s los; Tunlin wartet bereits in der Lobby auf uns. Wir fahren zur Saddha Cave. Unterwegs besuchen wir eine Kautschukplantage. Vater, Tochter und Schwiegersohn sind dort die Angestellten. Vier Tage pro Woche arbeiten sie, ein Tag frei, dann wieder vier Tage Arbeit und so weiter. Morgens um vier Uhr fängt für die drei der Tag an. Bei 3‘000 Bäumen gilt es täglich, die weisse, zähe Flüssigkeit zu gewinnen. Sie arbeiten dann bis gegen Mittag und gehen anschliessend schlafen. Ein einfach eingerichtetes Häuschen mit zwei Zimmern ist ihre Wohnung. Zwei Bastmatten dienen dem Ehepaar als Bett, daneben stehen Geschirr und Kochutensilien am Boden. Dies ist ihre Küche. 25$ pro Tag verdienen sie alle zusammen. Schon während zwölf Jahren haben sie diesen Beruf ausgeübt - in Thailand; jetzt sind sie hier angestellt.
Ich hab noch eine Tafel Cailler’s – Schokolade bei mir; die gebe ich ihnen. Eine Mütze für den jungen Mann werden wir auch noch los.
Die Fahrt geht weiter an einem Kanal entlang auf einer mehr als nur schwierigen Buckelpiste. Im Auto kommt es einem vor, als nähme man an einem Rodeo teil.
Rechts und links der „Strasse“ hat es Reisfelder, auch Weiher, in denen Fischer mit grossem Geschick ihre Netze auswerfen. Was für ein Anblick! Im Hintergrund die Karstfelsen, die wie Löffelbiskuits aus einer flach gestrichenen Quarktorte aus der Ebene ragen. – Der Vergleich ist ein wenig sehr weit hergeholt; ich weiss. Es kommt mir einfach nichts Passenderes in den Sinn. Meinen Englischschülern habe ich zur Auflockerung mal ein Blatt ausgeteilt mit den schlimmsten Analogien (Worst analogies ever). Mein Tortenbespiel würde gut dort hineinpassen.
Die Höhle ist mit Buddhas ausgestattet, ist ja klar, mit kleinen und grossen, mit liegenden, sitzenden und stehenden. Es tropft überall und das Geschrei der Fledermäuse hallt an den Wänden wider. Wir kommen an Stalagmiten und Stalaktiten vorbei, wie sich das so gehört in einer Höhle.
Nach vielleicht eine halben Stunde sind wir beim Ausgang auf der anderen Seite des Felsens. Was für ein grandioser Anblick auch hier: Ein See, in dem sich die steilen Hügel im Hintergrund und die Wolken spiegeln. Im Vordergrund ein paar farbige Boote. Eines davon bringt uns rund um den Felsen auf die andere Seite. Erst aber geht’s etwa hundert Meter durch eine andere Höhle hindurch. Das Wasser drin ist schwarz und klar wie Glas und wie in einem Spiegel bildet sich auf der dunklen Oberfläche die Decke der Höhle ab. Man muss sich ducken, damit man mit dem Kopf nicht anstösst.
Unser Bootsführer, der uns äusserst geschickt navigiert, ist etwa zehn Jahre alt. Am Ausgang der Höhle – wieder ein Bild für Götter: ein See voller Lotusblätter und –blüten. Absolut friedlich zieht das Boot still dahin, der Junge steht hinten und steuert mit einer langen Stange das wackelige Gefährt. Er ist ein Künstler. Ein paar Fischer sind am Werk, diesmal sind es allerdings Fischerinnen, die mit Reusen kleine Fischchen fangen, die sich, wenn sie aus dem Wasser gezogen werden, wie kleine weisse Kugeln aufblähen oder aufblasen. Sowas hab ich noch nie gesehen. Wirft man sie zurück ins Wasser, lassen sie die Luft raus und sehen wieder aus, wie Fische eben so aussehen. Mit bemerkenswerter Präzision legt der „Kapitän“ an einem Felsen an, wir klettern aus dem Boot, Tunlin bezahlt die Fahrt und wir machen uns zu Fuss zurück zum Auto.
Drei Girls kommen auf mich zu und bitten darum, mit mir eine Befragung machen zu dürfen. Sie lernen Englisch und haben in der Schule den Auftrag bekommen, Touristen zu interviewen. „What’s your name?“ - „Where are you from?“ und so weiter. Die eine ist flinker im Fragen stellen, die andere macht sich Notizen, die Dritte schaut zu. Was mir in der Gegend hier am besten gefällt oder gefallen hat, wollen sie wissen (die netten, freundlichen Leute und die wunderbare Landschaft – strahlend wird diese Antwort entgegengenommen), und was ich ändern würde, wenn ich hier leben würde. Da kommt mir spontan schon was in den Sinn: Ich würde dafür sorgen, dass überall der Abfall weggeräumt wird und versuchen, den Leuten beizubringen, dass man nicht sorglos alles wegwirft, wo’s einem grad passt. – Die drei schauen perplex, haben wohl erwartet, ich würde sagen „nichts“, aber das lässt meine immer noch intakte Lehrerseele natürlich nicht zu. – Ich hege die Hoffnung, dass dieser Gedanke zumindest ansatzweise zur Erleuchtung führt. Ihr Lächeln finden sie rasch wieder, denn jetzt wollen sie mit mir Fotos machen – eine Schweizer Grossmutter mit drei jungen burmesischen Girls…
Auch in der Höhle haben mich junge Leute angesprochen und gefragt, ob sie von mir mit ihnen ein Foto machen dürften. Sie scheinen allgemein sehr interessiert zu sein an Touristen, welche hier im Süden zumindest sowieso recht dünn gesät sind, eine Specie Rara sozusagen. - Sie winken einem zu, freuen sich, wenn man sie fotografieren will und setzen sich sogleich in Pose. Und ich mit meinen weissen Haaren bin offensichtlich eines der begehrteren Objekte dieser Art. – Es nähme mich aber schon wunder, was genau so interessant dabei ist. – Vielleicht findet mich irgendjemand mal „dank“ Gesichtserkennungsprogramm auf Facebook und übersetzt mir den allfälligen Kommentar.
Auf der Rückfahrt Blick auf den 732 m hohen Mount Zwe Ka Bin, der höchste in der Gegend. Ein Kloster befindet sich zuoberst. Man kann es besuchen, aber der Aufstieg dauert mindestens sechs Stunden, wir lassen’s mal. – Am Morgen war der Berg in Wolken gehüllt, jetzt präsentiert er sich majestätisch.
Mittagessen im Veranda Youth Community Coffee (ein Projekt, das von der EU und Helvetas unterstützt wird. Junge Leute sollen eine Perspektive erhalten und lernen, einen Betrieb zu führen). Die feinsten Getränke machen sie dort, Säfte aus frischen Zutaten. Auch alles andere ist gut. Sitzen tut man draussen auf Bambusstühlen, es ist eine angenehme, lockere Atmosphäre, ein wenig „backpackerisch“.
Unser nächstes Ziel ist der Fels mit der Pagode oben drauf, der Kyauk Kalat. Ganz offensichtlich haben die Mönche die skurrilsten Orte gesucht und gefunden, um zu meditieren und die Erleuchtung zu erlangen. Am liebsten sind ihnen offenbar hohe Felsen, die möglichst bizarr in der Landschaft stehen. Bis dort, wo der Fels seine Taille hat, darf der Plebs hinaufklettern, was höher liegt, ist nur den Mönchen vorbehalten.
Das Heiligtum sieht gut aus: Im Hintergrund ist der Himmel schwarz. Der Regen kommt immer näher; vorne scheint aber noch die Sonne.
Wir verlassen den Ort und Tunlin fährt uns in einen „Garten“ am Fuss des Mount Zwe Ka Bin, der mit 1‘000 Buddhas „angereichert“ ist. Sie sitzen in nicht enden wollenden Reihen, etwa so, wie die Bäume angeordnet sind in den Kautschuk-Plantagen.
Jetzt aber lässt der Regen nicht mehr mit sich spassen. Monsunartig setzt er ein. Tunlin bringt uns ins Hotel. Zwei Stunden später holt er uns wieder ab und wir gehen zusammen essen – nochmals ins gleiche sympathische Restaurant zu den jungen Leuten, die so gut kochen. Wein und Bier haben sie zwar nicht und der Tee ist auch grad ausgegangen. Ein Stromausfall in der halben Stadt macht’s auch unmöglich, den frisch gebrauten Kaffee zu servieren.
Mittwoch, 11. Oktober 17 - Golden Rock
9 Uhr: Wie jeden Morgen steht Tunlin bereit, das Auto ist geputzt, alles bestens. Wir sind startbereit.
Es hat die ganze Nacht lang geregnet und es hat noch immer nicht aufgehört. Eigentlich war geplant, am Thanlwin Fluss den schönen Ausblick auf die Berge zu geniessen, aber leider ist alles verhangen; dieser Programmpunkt wird also gestrichen. Wir fahren zur nächsten Destination, dem Goldenen Felsen (Kyaikhtiyoe oder eben Golden Rock), einem der wichtigsten buddhistischen Wallfahrtsort. Nach zwei Stunden kommen wir im „Base-Camp“ an. Es wimmelt nur so von Besuchern und Pilgern, alle mit dem Ziel, den mehr oder weniger runden Felsbrocken, der aussieht als ob er nächstens herunterfallen würde, zu besuchen. Die Männer dürfen ihn sogar berühren und mit einem Goldplättli versehen, den Frauen ist das vergönnt.
Wir müssen in Pick-Ups umsteigen, die Platz bieten für 42 Personen, in unseren Truck werden 50 gequetscht. Dagegen war die Besetzung im Zug Bern-Zürich im Nachhinein gesehen ein Nasenwasser. Mir kommt’s vor wie eine Fuhre mit Schlachtvieh. Es sieht auch ähnlich aus. Dann geht die Höllenfahrt los. Der Fahrer gibt Gas wie ein Berserker, muss dann allerdings zwischendurch immer wieder mal anhalten und warten, bis herunterfahrende Trucks an uns vorbeigerauscht sind, denn Kreuzen geht nicht. Die Fahrt dauert so fast dreiviertel Stunden und kommt mir vor wie ein Achterbahn-Trip auf den Gotthard –mit anderer Flora am Strassenrand zwar. Es regnet nicht mehr, aber es ist neblig und ich bin heilfroh, wie wir oben auf 1‘100 Metern Höhe unfallfrei ankommen.
Souvenirstände und die allgegenwärtigen Garküchen säumen den ganzen Weg entlang bis zum Fels. Der Spaziergang dauert etwa eine Viertelstunde. Einmal mehr müssen wir die Schuhe abgeben und einen Obolus entrichten (nur für Touristen). Es hat zwar massenhaft Besucher, aber weisse sehen wir nur gerade sechs – alles Schweizer… So kommt nicht grad viel Geld in die Kasse.
Vom Pick-Up-Parkplatz zum Fels wird vieles herumgeschleppt, in grossen Hutten auf dem Rücken oder zum Teil auf dem Kopf: Bambusstangen, Baumaterialien, Koffer und Gepäck zu den drei Hotels, sie’s dort oben gibt. Sänftenträger hat’s auch; für 8 Fr. pro Weg kann man sich tragen lassen. Zu tun haben die Sänftenträger zwar nicht viel, aber immerhin, eine Japanerin macht Gebrauch vom Angebot. Theo wär natürlich voll dafür – ich bin dagegen…
Den Fels sehen wir erst gar nicht vor lauter Nebel. Wie wir aber vor ihm stehen, sind wir schon beeindruckt. Dass und wieso sich der riesige Felsbrocken festhält auf dem unteren Stein und nicht schon längst abgestürzt ist, ist mir ein Rätsel. Absolut imponierend! - Aber er steht ja schliesslich auf einem Haar Buddhas…
Frauen dürfen ihn nicht berühren. – Das macht mir jetzt echt nicht viel aus. – Theo darf, und er tut es auch. Nur klebt er nicht wie seine Mitberührer Goldplättchen an den Brocken, er drückt nur ein paar lose wieder an und lässt sich von mir, aus sicherer Distanz, fotografieren.
Wir treten den Rückweg an. Wieder wird der Truck vollgepfercht, erst dann geht’s los. Der Weg zurück ist noch abenteuerlicher als derjenige nach oben. Wie ein wildes Pferd schnaubt der Wagen vor jeder steilen Kurve und Theo fragt sich (und mich) mehr als einmal, was wohl wäre, wenn die Motorbremsen versagen würden. – Nicht sehr hilfreich diese Überlegungen in dem Moment, denn die Antwort ist klar: Das Gefährt würde in den Abgrund stürzen mitsamt der ganzen Ladung.
Das passiert zum Glück nicht, wir und alle anderen überleben die Fahrt heil und ganz. Auch ist es mir gelungen, mich aus der Spucklinie des Typs vor mir und des Typs hinter mir herauszuhalten, die beide während der ganzen Fahrt ihre Betelnüsse gekaut und im Fünfminutentakt die rötliche Sauce auf den Boden gespuckt haben (Sougruuusig, das ständige Kchoder!).
Nach einem feinen Mittagessen im Dorf Kyaikhtiyoe bringt uns Tunlin ins Hotel im „Base Camp“, das er uns empfohlen hat (Golden Sunrise Hotel). Es ist relativ bescheiden, trotzdem ist alles bestens organisiert, die Angestellten sind wie überall überaus freundlich, und wir sind sehr zufrieden. Die Bungalows sowie die Rezeption und das Restaurant sind aus Bambus und Holz gefertigt; der Garten ist gepflegt und die ganze Anlage sieht hübsch aus. Stromausfall herrscht zwar, und das während Stunden. WIFI funktioniert auch nicht, aber ein Tag ohne ist kein Drama und ein Dinner bei Kerzenlicht.... Wir essen im Restaurant, sind wieder mal die einzigen Gäste und werden demnach aufs Aufmerksamste bedient. Sogar Spezialwünsche werden erfüllt und am Schluss, wie ich zahlen will, sagt der Chef, wir seien eingeladen, er würde sich so für den Stromausfall entschuldigen (für den er ja gar nichts dafür kann). – So nett! Daran gibt’s nichts zu rütteln, wir akzeptieren und bedanken uns herzlich.
Donnerstag, 12. Oktober 17 - Autofahren in Myanmar
Um neun Uhr sind wir parat. Herzliche Verabschiedung und los geht’s nordwärts. Die Strecke kennen wir schon, wir sind sie schon auf dem Hinweg gefahren. Langweilig wird’s trotzdem nicht. All die mit Menschen und Material vollbepackten Pick-Ups und die Motorräder mit ihren Lasten zu beobachten, macht Spass. Oft kann man sich kaum vorstellen, dass ein Vehikel mit all dem Gepäck überhaupt noch fahrtüchtig ist. Gefährlich sieht das aus. Babys fahren auf den Motorrollern mit, eingequetscht zwischen Lenker und Mitfahrer, bei Regen sieht alles noch viel verwegener aus. - Wenn ich da an die Schweiz und unsere Verkehrsvorschriften denke…
An die hiesigen Verhältnisse müssen wir uns aber erst noch gewöhnen. Mit recht grosser Geschwindigkeit braust Tunlin durch die Dörfer. Ausgezogene Linien sind reine Dekoration. – Wäre ja lachhaft, wenn man sich von denen irritieren lassen würde! Das Gleiche gilt auch für ausgezogene doppelte gelbe Mittelstreifen. Die kann man ebenso getrost ignorieren. Auch das Telefonieren während der Fahrt ist weiter nicht der Rede wert. Wenn ich ein paar schüchterne Anstalten mache, ihm zu erläutern, wie der Verkehr bei uns so läuft, hat er nur ein müdes Lächeln dafür übrig. – Schon gut, meint er, dass Touristen in Myanmar nicht Autofahren dürfen. Die wüssten ja eh nicht, wie das geht.
Oft weicht er im letzten Moment erst aus, wenn jemand die Strasse überqueren will. Manchmal denke ich, er muss eine Art Radar eingebaut haben in seinem Hirn oder es gibt eine telepathische Erklärung dafür, dass sich die streunenden Hunde immer im richtigen und letzten Moment aus der Gefahrenzone begeben. - Ich hab dann jeweils einen Mini-Schock. Auch nach Tagen noch geht es mir gegen den Strich, dass er beim Überholen ja kaum etwas sieht, weil er rechts sitzt und ich als Beifahrerin links.
Alle Autos sind nämlich falsch gesteuert. Das kommt daher, dass im Jahr 1975 die Militärregierung von einem Tag auf den anderen beschlossen hat, vom Linksverkehr auf den Rechtsverkehr zu wechseln. – Man stelle sich vor… Und so sind die Autos noch immer falsch gesteuert. Auch die seit diesem Zeitpunkt importierten. Wieso das so ist, leuchtet mir nicht ein, muss es wohl auch nicht. Nicht alles in diesem Land ist einfach zu verstehen. Tunlins Kommentar dazu: Das sei überhaupt kein Problem; er könne beides gut.
Nun sitze ich also da, eigentlich an der richtigen Stelle, angespannt und machtlos, mir fehlen einzig Pedale und Steuerrad. Abenteuerlich wird’s, wenn auf beiden Strassenseiten je einer überholt, also vier Fahrzeuge kurzfristig nebeneinander auf der ein- oder zweispurigen Strasse Platz haben müssen. Ich habe mir angewöhnt, dann lieber zum Seitenfenster hinauszuschauen und die Situation zu ignorieren, vor allem dann, wenn von meiner Warte aus die Situation eher unübersichtlich ist oder das Überholmanöver mit nur wenigen Zentimetern Abstand zum nächsten Fahrzeug eingeleitet wird . Falls mir das mal doch nicht ganz gelingt und mir reflexartig ein „Uh“ herausrutscht, lacht Tunlin und sagt, diese Reaktion sei es, die ihn erschrecke, alles andere sei überblickbar. (Vielleicht ist „U“ halt noch von einem anderen Standpunt aus merkwürdig für ihn: „U“ heisst in der burmesischen Sprache „Herr“ [ich erinnere mich an U Thant]).
Und wenn’s dunkel wird und wir immer noch unterwegs sind, erscheint alles noch viel Schlimmer. Licht schaltet man erst im allerletzten Moment ein, falls man überhaupt welches hat. – Der Entgegenkommende könnte ja denken, man habe einen Webfehler oder einen Sprung in der Schüssel, wenn man mitten am heiterhellen Tag (= Dämmerung oder Regen) mit Beleuchtung herumfährt. – Tunlin erklärt mir auch, dass, wenn neuere Autos importiert würden, die mit automatischer Lichteinschaltsteuerung ausgestattet seien, diese sofort ausgebaut werde.
Nach etwa zweieinhalb Stunden Fahrt erreichen wir die Autobahn. Da wird’s doch dann monoton – zum allerersten Mal. Sie führt durch fast vollständig unbesiedeltes Gebiet, durch eine grüne Landschaft. Verkehr hat’s fast keinen mehr. Wie in Frankreich oder Spanien hat’s aber Mautstellen, ganz ähnlich ausgebaut wie dort. Sehr selten gibt’s eine Ausfahrt, eine Wendestelle sehe ich auch keine. Einmal, nach weiteren zwei Stunden Fahrt, erreichen wir eine Art Raststätte, wo wir etwas essen, trinken, tanken und die Füsse ein wenig vertreten. Unterwegs regnet es teilweise wie aus Kübeln. Mal nur eine Minute lang, dann ist’s wieder trocken, fünf Minuten Schütte und wieder trocken, eine halbe Stunde lang, so dass es riesige Wasserfontänen gibt auf der Fahrbahn – seltsam dieses Ende der Regenzeit. Weiter geht’s anschliessend nochmals anderthalb Stunden, bis wir zu unserem Hotel kommen, dem Nga Laik Kan Tha Eco Resort. Es liegt an einem künstlichen See, bei einem Damm.
Inzwischen hat es aufgehört zu regnen. Wir ruhen uns ein Stündchen aus, dann gibt’s von dort aus eine etwa zehnminütige Bootsfahrt zu einem Elefantencamp. Eintritt für Einheimische 75 Rappen, für Ausländer 15 Franken. Zehn Elefanten „wohnen“ dort und ebenso eine Familie, die zu ihnen schaut und sie zu Arbeitstieren erzieht.
Ein Ritt ist im Preis inbegriffen, er führt uns durchs Dickicht. Zu viert reiten wir mit, ein etwas seltsames Gestell ist das schon, in dem wir uns befinden. Fast wie ein Embryo muss ich mich verbiegen, damit ich in den Kasten hineinpasse. Theo, der auf der anderen Seite des Halses hängt, sehe ich gar nicht. Mitten zwischen uns thront Tunlin, vor ihm auf dem Nacken des Tieres der Elefantentreiber.
Die 14-jährige Elefantendame versucht, wo’s geht, ein paar leckere Bambusstangen zu ergattern. Sie wird weitergetrieben; sie hat ja etwas zu tun.
Mit dem Boot geht’s anschliessend wieder zurück ins Hotel. Wir essen mit Tunlin, das ist praktisch; er kann uns beraten mit der Speisekarte, wenn die Verständigung zur Herausforderung wird. Drei gebackene Fische aus dem See, ganz frisch, werden aufgetischt, Nudeln, Reis und Brunnenkresse-Salat mit frittiertem Poulet. Dazu wieder mal eine Flasche Wein. Tunlin hält kräftig mit.
Freitag, 13. Oktober - Nay Pyi Taw
Geht da etwas schief? Wenn man abergläubisch ist, schon. Sind wir aber nicht. Und dennoch…
Frühstück, Koffer packen und ab. Eigentlich hatte ich gedacht, am gestrigen Tag hätten wir die längste Strecke unserer Reise zurücklegen müssen. – Nein, heute werden es siebeneinhalb Stunden sein, sagt Tunlin. Zwar viel weniger Meilen, dafür aber Kurven ohne Ende.
Es wird ein „buddha- und pagodenloser“ Tag werden heute. Tunlin will uns nicht überfordern. Er hat Erfahrungen gemacht mit seinen Gästen. Das erzählt er auch gern: „First day: Oh, Buddha, oh! – second day: very nice Buddha – third day: Buddha again – fourth day: oh no, not Buddha again!”
Übrigens fährt ein Buddha auch mit. Er baumelt in einem tropfenförmigen, etwa fünf Zentimeter hohen Glaskästchen am Rückspiegel und meint, er müsse ständig glöckeln. Daran muss ich mich erst gewöhnen. Wenn wir durch Schlaglöcher fahren, überschlägt er sich jeweils – ich bin sicher, es wird ihm schlecht.
So fahren wir zuerst nach Nay Pyi Taw, der Hauptstadt von Myanmar im Kayah State. Bis 2007 war Yangon der Regierungssitz, dann aber wurde dieser von der Militärregierung ins Landesinnere verschoben beziehungsweise neu dort gebaut. Offenbar hatten die Generäle die Idee, dass eine Stadt an diesem Ort im Kriegsfall weniger gut angegriffen werden könne. Das war auch die Meinung der Astrologen, so erzählt man sich.
Nun, es ist kaum zu glauben, was man da zu sehen bekommt. Wir fahren über eine achtspurige Strasse (je vier Spuren auf beiden Seiten) und merken sofort, dass da etwas seltsam ist. Es hat kaum Verkehr. Die Strasse ist schön angelegt, mit bepflanztem, äusserst gepflegtem Mittelstreifen. Vielerorts hat’s Gärtner an der Arbeit. Um riesige Kreisel fährt man und immer breiter wird die Strasse, am Schluss sage und schreibe 22-spurig, auf beiden Seiten elf Spuren. Kaum ein Auto ist unterwegs. Ein Jumbo könnte leicht auf dieser Bahn landen. Nach etwa einer Viertelstunde Fahrt sehen wir linkerhand die protzigen Regierungsgebäude. Wenn keine Session ist, steht alles leer. Und auch die vielen Villen, an denen wir anschliessend während vieler Kilometer vorbeifahren, sind unbewohnt. Eine ganze Reihe von Plattenbauten steht ebenfalls leer. Sie wären für die weniger Begüterten gedacht gewesen. Aber auch die zieht es nicht in dieses künstliche, seelenlose Konstrukt. Vor einem Einkaufszentrum sind zwei Autos parkiert. Es ist eine riesige Geisterstadt, niemand lebt hier, auch ein Zentrum ist nicht vorhanden. - Ein krasses Beispiel von Fehlplanung der damaligen Militärregierung, meint Tunlin. Er regt sich auf, sagt, 14 Milliarden seien verbaut worden, und das nur um zu imponieren. Dabei hätte es viele arme Leute in diesem Land. Schön gelegen ist die Stadt; im Hintergrund sieht man die Berge, in die wir gleich fahren werden.
Die vielen Stunden Fahrt lohnen sich. Die Strasse führt durch eine grossartige Landschaft, abwechslungsreich und voller Überraschungen. Erst ist das Gelände eben. Am Strassenrand steht ein Gemüse- und Früchtestand am anderen. Die Hunderten von Pomelos sind hübsch in kleinen Pyramiden aufgetürmt. Dann geht’s bergauf. Die enge Strasse windet sich steil den Berg hinauf durch den Dschungel, es gibt Kurven über Kurven und immer wieder mal kann man einen Blick in ein tiefes Tobel werfen. Man fährt an steilen Abhängen vorbei, hat oft die wunderbarste Aussicht und hin und wieder ist sogar eine Hütte oder gar eine kleine Siedlung zu sehen. Wer hier oben wohnt…
Dass die Menschen hier Angehörige anderer Ethnien sind, sieht man an ihren unterschiedlichen Kopfbedeckungen. Sie winken uns freundlich zu.
Die Temperatur ist jetzt sehr angenehm, wir stellen die Klimaanlage ab und öffnen die Fenster.
Bei Gegenverkehr auf dieser kurvenreichen Strasse macht mein Magen immer wieder ein wenig einen Hüpfer. Aber Tunlin hat seinen Toyota fest im Griff. Trotzdem kommt es mir oft vor, wir würden nur um Haaresbreite an entgegenkommenden Vehikeln vorbeiflitzen. Wie dann an einer der engsten und steilsten Stellen ein Wagentross mit etwa zehn Geländewagen aus Thailand bergab dahergerast kommt, einer schneller als der andere, zuvorderst ein Polizeiauto, das die Ralley pilotiert, fürchte ich, mein letztes Stündchen habe geschlagen. Tunlin denkt nicht daran zu stoppen, um die Meute durchzulassen, im Gegenteil, ihm passt das und er steuert sein Gefährt im Garacho den Berg hinauf, immer hart am Gegner dran, mit zwei Rädern abseits der Strasse im Schotter. – Wir überleben. Kein Kratzer, aber das war knapp!
Auf der Passhöhe werden wir mit einem herrlichen Blick hinab ins Tal auf einen idyllischen See beglückt. Nach fünfzehn Haarnadel- und etliche andere Kurven weiter unten erreichen wir den See und machen einen verdienten Mittagshalt im Städtchen Pin Long.
Weiterfahrt. Eine Vorspannbrücke (Lane Lee Suspension-Bridge) gilt es zu überqueren. Tunlin lädt uns aus, wir wandern über die Brücke und auf der anderen Seite steigen wir wieder ein. Es hat gut getan, ein paar Schritte zu Fuss zu gehen, auch wenn die Hitze drückt.
Umzugstag bei einer Burmesischen Familie. Ihr Laster ist voll bepackt. Sie winken uns fröhlich zu. Zwei Kilometer weiter sehen wir sie am Strassenrand. Ihr Vehikel hat den Geist aufgegeben und ist kollabiert. – Es tut mir so leid für sie, aber ich wüsste nicht, wie wir helfen könnten.
Ein zweites Mal müssen wir eine Bergkette überqueren. Es geht wieder hinauf auf 1‘500 Meter, die Gegend ist immer noch grün, Mais wird angepflanzt und tonnenweise Bananen.
Wie im Märchen sehen wir plötzlich vor uns ein paar hohe schwarze Felsen, die bizarr aus der Ebene ragen. Obendrauf eine Pagode (Taung Htlvwar Village) mit verschiedenen Stupas, die golden in der Sonne leuchten. Was für ein Anblick! – Auch auf der anderen Strassenseite ein ähnliches Bild. Sieht ganz aus nach Konkurrenz.
Endlich unten im Tal. Es ist flach, wir fahren dem See entlang. Man sieht jetzt ein paar Kirchen. Tunlin sagt, in dieser Gegend seien etwa fünfzig Prozent der Einwohner Christen.- Und immer noch dauert die Fahrt bis zum Hotel eine gute Stunde. Und genau nach siebeneinhalb Stunden, um halb fünf, so wie er gesagt hat, fahren wir bei unserem Hotel vor (Famous Hotel Loikaw) - die Strapazen haben ein Ende.
Erstaunlich auch hier, wie er sich auskennt. Nie fährt er falsch, nie konsultiert er eine Karte, oft wählt er eine Nebenstrasse, von der er weiss, dass dort weniger Verkehr herrscht, ein Navi hat er sowieso nicht.
Beim Hotel angelangt wird’s ernst: Beim Gepäck-Ausladen stellt Theo mit grossem Schrecken fest, dass er seinen Whisky im letzten Hotel vergessen hat. – Was hätte Schlimmeres passieren können an diesem Freitag, dem Dreizehnten?!
Ich denke dann, so hat er wenigstens was getan für seine Gesundheit, weniger allerdings für seinen Seelenfrieden.
Im Hotel mögen wir nicht essen, es hat wieder so einen „schönen“, für asiatische Verhältnisse geschmackvoll ausgestatteten Ess-Saal. Um halb sieben ist es schon dunkel. Innert weniger Minuten ist es tiefste Nacht. Wir spazieren dem See entlang über die zum Teil kitschig LED beleuchtete, farbig blinkende Fussgängerbrücke und finden dort ein Restaurant, das uns passt. Ein feines Nachtessen mit verschiedenen Gerichten und Wein kostet fünfzehn Franken. Der Rückweg über die Brücke führt uns vorbei an Fischern, die mit kleinen Leuchtlämpchen an ihren Angeln Fische fangen oder dies zumindest versuchen und ebenso an etlichen Liebespärchen, die in den dunklen Nischen die laue Nacht geniessen.
Samstag, 14. Oktober – Long-Neck-Women – Lost in translation - Loikaw
Heute geht’s in aller Herrgottsfrühe schon um acht Uhr los – eine ziemliche Herausforderung für Theo, aber er schafft’s - sogar ohne zu murren. Und um’s gleich vorweg zu nehmen, er geht sozusagen als Held von der Bühne, so unausgeschlafen, wie er ist. Dazu aber später mehr.
Wir besuchen den lebhaften Markt von Loikaw. Uns präsentiert sich ein buntes Gemisch aus Waren und Menschen aus verschiedenen ethnischen Gruppen. Tunlin freut sich und sagt einmal mehr: „Where are the tourist? – Only you!“ – Das freut uns natürlich auch. Nicht zu vergleichen mit dem Markt in Rosas, wo man ausser Berndeutsch und Französisch kaum eine andere Sprache hört. Auch ist das Warenangebot recht unterschiedlicher Natur. Zwar werden auch Kleider angeboten, die beliebten Fussball-T-Shirts, Gemüse und Früchte, Chillys, aber dann auch frische Fische, die noch zappeln, getrocknete Frösche, Blumen, Nägel und Schrauben in jeder Grösse, Kinderspielzeug – man kann alles haben.
Hier sehen wir zum ersten Mal ein paar „Langhals-Freuen“, die ihre Ware anbieten. Es sind vor allem Shawls, die sie selber aus Baumwolle spinnen, die Fäden färben und dann verweben. Ein solches fein gewobenes Tuch kaufe ich. Ich bin ganz perplex, wie ich weiter hinten im Markt eine andere Verkäuferin sehe, die die Zwillingsschwester der ersten sein könnte. Und dann noch eine dritte… Es ist ja eigentlich kein Wunder, wenn man aus seinem kleinen Dorf nicht rauskommt und dann ähnlich aussieht wie die Nachbarin…
Nach dem Marktbesuch geht’s in die Berge zu den Long-Neck-Women. Wir besuchen in einem Dorf (Panpat) zwei Familien. Wir müssen einen Dolmetscher mitnehmen. Ein junger Mann, der beide Sprachen spricht, die der Einwohner und Burmesisch, kommt mit uns. Die Grossmutter, die wir zuerst besuchen, lässt sich gerne fotografieren, zeigt ihren Schmuck und ihr Haus, Küche, Schlaf- und Wohnzimmer, ist sehr freundlich und bietet uns Tee und Wein an. Der Wein wird selber hergestellt aus den Millet-Pflanzen (eine etwa zwei Meter hohe Reissorte), die praktischerweise gleich vor dem Dorf in grossen Mengen wachsen. Die Körner dieser Pflanze werden in Wasser, Reisbrei und Hefe eingelegt, das Gebräu ist dann 15 %-ig und wird warm aus einem Tonkrug getrunken. Tunlin erklärt uns, dass bei diesem Tribe die Männer, wenn sie sich verheiraten wollen, sich die Frauen nicht nach dem Aussehen aussuchen, sondern diejenige wählen, die den besten Wein herstellt.
Lost in translation: Lustig ist unsere Konversation mit der Dame: Sie fragt etwas, der Junge übersetzt ins Burmesische, Tunlin erklärt mir’s auf Englisch, und ich sag’s Theo, der ja ein wenig schwerhörig ist, auf Berndeutsch. Bis die Übersetzung bei mir angekommen ist, dünkt mich fast, ist sie ziemlich viel kürzer geworden – grad wie im Film mit Bill Murray. Wir bekommen aber mit, dass sie 63 Jahre alt ist, sieben Kinder hat und vierundzwanzig Grosskinder. Zwei bis dreimal war sie in der Stadt, in Loikaw, das etwa 20 km weiter nördlich liegt. Ich kaufe ihr ebenfalls einen Shawl ab und – pikantes Detail – sie steckt das Geld oben in ihren überlangen goldenen Halsschmuck, gleich unter dem Kinn.
Um dieses Dorf überhaupt besuchen zu können, muss man erst eine Bewilligung bei der Regierung einholen. Tunlin zeigt uns das Dokument. Alles bestens mit Stempel versehen und bewilligt. Unsere Passnummern sind vermerkt und unsere Vornamen. Der Nachname scheint uninteressant, der ist gar nicht erwähnt.
Es leben neun verschiedene Stämme in der Gegend um Loikaw, sieben davon darf man nicht besuchen. Untereinander haben sie Fehden.
Der Weg zu den Kaya-Stämmen ist eindrücklich. Man fährt durch eine seltsame Landschaft, die voller stark bewaldeter Berge ist; wie grüne Zuckerhüte sind sie überall verstreut.
Mu Er (oder so) heisst unsere Gastgeberin. Sie ist eine Lustige. Mit ihr kann man lachen, obwohl wir uns ja nicht verstehen, und sie erklärt uns bereitwillig, wie man den schweren Messingschmuck, den sie um den Hals trägt, anzieht. Die Prozedur dauert einen Tag lang und wenn man die Ringe wieder loswerden will, was eher utopisch ist, braucht man während dreier Wochen eine Stütze, sonst würde man den Eingriff nicht überleben. - Da verzichte ich lieber.
Die zweite Frau, die wir besuchen, zeigt uns, wie man aus Baumwolle einen Faden spinnt. Sie weist uns Plätze an in einem Halbkreis vis-à-vis von ihr auf ganz kleinen niedrigen Bänklein, unbequemer geht’s gar nicht. Auch sie ist sehr freundlich und beantwortet unsere Fragen bereitwillig. – Von uns möchte sie nur gerne wissen, wo wir herkommen und ob wir auch Reis essen.
Mit einem kurzen Besuch auf dem langen künstlichen Damm endet unser Vormittag.
In einem sehr hübschen Restaurant mit faszinierender Aussicht auf die Reisfelder und die Berge, „Marco Polo“, essen wir eine kleine Mahlzeit und anschliessend geht die Fahrt in den Südwesten zu einem anderen Dorf, zu einer anderen Ethnie, nach Hta Nee Lar Lae. Ein älteres Ehepaar (in unserem Alter) spielt uns Musik vor auf einem selbstgemachten Instrument aus Bambus und einer einfachen Geige aus Holz. Er singt sogar dazu und sie hat sich zu Ehren ihrer Gäste in die traditionelle Kleidung gezwängt. Was sie sich über Knie und Oberschenkel gezogen hat, sind meterweist Baumwoll-Schnüre oder Bändel, schwarz lackiert, die aussehen wie die Lakritze-Spaghetti, die wir als Kind manchmal hatten.
Auch das ist nicht das bequemste aller Outfits, man kann sich nur wundern, weshalb und wieso man sich solche Beinkleider freiwillig anzieht.
Die Frau spielt zuerst alleine, ihr Mann kommt von der Jagd zurück, wie er sagt. Bewaffnet ist er mit einem Pfeilbogen. Das macht natürlich Eindruck! (Eine Beute sehe ich allerdings nicht.) Um zu beweisen, was für ein guter Jäger er ist, schiesst er auf ungefähr zehn Meter Entfernung mit dem Ding auf einen Baum, an dem eine kleine weisse Zielscheibe aus Papier hängt, etwa 10 cm im Durchmesser. Der Pfeil trifft in die Mitte. – Grosse Bewunderung allerseits. Ein paar Dorfjungen schauen zu.
Jetzt ist Theo gefragt. Ob er das auch kann? In allen Gesichtern steht schon eine Art „Vor-Schadenfreude“ geschrieben. Der weisse Touri… Und siehe da: Ich kann’s selber kaum glauben: Theo legt an und trifft ebenso mitten in den weissen Kreis! – Einen Moment lang herrscht betretenes Schweigen. Niemand hätte das erwartet. Theo, der grosse Held!!! Ich bin natürlich stolz. Er aber, bescheiden, wie er ist, erklärt, dass die Armbrust halt sozusagen unsere „National-Waffe“ sei seit dem 12. Jahrhundert, für Schweizer also ein Nasenwasser (das hat er zwar nicht ganz so gesagt, aber in etwa so gemeint) und er fügt hinzu, schon unser Nationalheld, der Wilhelm Tell, habe damit auf den Landvogt geschossen, sei also eigentlich ein Terrorist gewesen. – Ich glaube nicht, dass irgendjemand ausser mir von dieser Geschichtsstudie etwas mitbekommen hat, Tunlin hat jedenfalls nichts übersetzt.
Auf der Rückfahrt nach Loikaw besuchen wir die Town Quell Pagode, das Wahrzeichen der Kayah Region, die entweder mit einem angebauten Lift (Schindler), eine architektonische Scheusslichkeit, oder mit einer nicht enden wollenden Treppe hoch oben auf dem Hügel erreichbar ist. Endlich wieder mal etwas Buddhistisches, dünkt uns fast. Sie ist mehr als nur sehenswert. Oh und ah!!! Sie ist auf neun Felsen gebaut in etwas mehr als hundert Metern Höhe. Sagenhaft. Und sagenhaft ist auch der Ausblick von dort oben über die Stadt. Dazu kommt im Moment noch die ausnehmend schöne Stimmung: Im Norden ist der Himmel schwarz, man sieht, es regnet, und auf der andern Seite leuchten die grünen Reisfelder in der Sonne.
Am Abend möchten wir uns gerne einen Apéro genehmigen; das ist aber schwierig. Im Restaurant auf der andern Seite unseres Hotels sagen sie, sie hätten keinen Alkohol. Über dem Tresen allerdings sehen wir Flaschen stehen – ein Missverständnis also. Aber Cocktails können sie keine machen. Wir gehen weiter und landen schliesslich wieder im selben Restaurant wie gestern. Wir essen gut, es gibt ein Bier für Theo und eine Flasche Wein für uns beide, dann machen wir uns auf den „Heimweg“. Unterwegs bei der Brücke treffen sich die Jungen; es sind noch viele mehr als gestern. Schliesslich ist es Samstagabend. Einige grüssen, kichern dann, wenn sie „Hallo“ sagen, einer sucht das Gespräch (ich glaube, er wollte mit seinen paar Brocken Englisch seinen Kameraden imponieren) und sagt: „Excuse me, where are you from?“ – „From Switzerland“, entgegne ich. Seine Antwort: „Oh, my God!“. Ich fand’s lustig, weiss aber nicht, was ihn zu diesem ausserordentlichen Ausruf bewogen hat.
Sonntag, 15. Oktober 17
Im Speisesaal sind wir die einzigen Gäste. Sechs runde Tische mit goldenen Tischtüchern und zehn Stühlen drum herum laden zum Frühstück ein. Eine Atmosphäre wie im Eisschrank. Lange dauert unser Aufenthalt dort nicht.
Es ist wieder mal neun Uhr. Tunlin holt uns ab und mit ihm kommt ein Bekannter, ein zweiter Fahrer, denn auf dem Programm steht eine Bootsfahrt über den Pékon-See zum Inle Sanctuary Resort, wo wie übernachten werden. Der andere Fahrer übernimmt den Toyota und bringt ihn in drei Tagen wieder dorthin, wo wir mit dem Schiff ankommen werden.
Wir sind hier im Gebiet der Shan, der grössten ethnischen Minderheit in Myanmar.
Erst machen wir kurz Halt beim Kayan-Community-Center. Es ist Sonntag, man trifft sich dort, die Jungen lassen ihre selbst gebastelten Drachen fliegen. Auf dem Feld gibt es eine ganze Anzahl hoher Totem-Pfähle mit Ornamenten aus Metall obendrauf: Mond und Sonne, Reiskorn, Hühnerknochen und so weiter. Die Kayans, auch wenn sie vielleicht Buddhisten oder Christen sind, sind auch Animisten. Das haben wir schon in den Dörfern gesehen, die wir am Vortag besucht haben. Vor den Hauseingängen sind Verzierungen aus Hühnerfedern und –knochen angebracht. Jedes Dorf hat auch seinen Schamanen.
Paradiesische Bootsfahrten
Wir fahren weiter nach Phe Khon zur Bootanlegestelle. (Fast jeder Ortsname hat mindestens eine zweite Schreibweise, dann auch noch eine auf Englisch, was der Orientierung auf der Karte nicht unbedingt förderlich ist).
Es ist Markt und der Toyota muss sich durch die Menge drängen. Unser Gepäck wird aufs Boot verladen, wir dann ebenfalls. Hübsch: Die drei Sitze sind mit roten Plüschkissen ausgestattet. Wir sind startklar - diesmal geht’s mit Motor zur Sache. Das Boot flitzt über den stillen dunklen See, der kaum Wellen aufweist. Die Berge, das Ufer und die riesigen Kumuluswolken spiegeln sich darin – eine einzigartige und faszinierende Fahrt. Tunlin freut sich wieder und sagt: „That’s what I told you: only one boat on the lake“. Sein Stolz ist es, uns sein Land „off the beaten track” zu präsentieren, nicht nur, aber doch zum grössten Teil. - Ja, und das gelingt ihm gut. Was wir in den letzten Tagen erlebt haben, steht in unserem sonst ausführlichen Führer nicht drin. Zum Inle-See, der wohl im Programm jedes Myanmar-Reisenden steht, will er uns über zwei andere Seen führen – eben per Boot.
Und erneut ist unser heutiges Ziel ein einmaliger Ort: das „Inle Sanctuary“, in Pha Yar Tawng. Nach einer wunderschönen, fast anderthalbstündigen Fahrt durch Seegras und See-Hyazinthen erreichen wir den paradiesischen Ort. Das Hotel ist gerade mal ein Jahr alt und hat nur sechs Zimmer. Es sind Bungalows, die auf hohen Stelzen im Wasser stehen. Sie sind geräumig, schön und grosszügig aus Holz gebaut, eine Terrasse mit zwei Liegestühlen lädt zum Verweilen. Aber das Beste: Im See, in dem die Hotelanlage steht, kann man schwimmen. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Wie gut, bei dieser Hitze ein Bad zu nehmen. Oben ist die Wasserfläche warm, weiter unten schwimmt man in kälteren Schichten.
Zurück im Zimmer sehen wir, wie die umliegenden Berge immer mehr im Nebel verschwinden. Dann beginnt es zu regnen. Macht nichts. Es ist immer noch warm und wir essen auf dem Deck im Restaurant mit Tunlin zu Mittag.
So langsam aber sicher geht mir das burmesische Geld aus, die roten, blauen und grünen Noten. – Das ist aber kein Problem, Tunlin sei Dank. Er ist meine Bank und hat immer genügend Reserve dabei.
Ein Ruhestündchen. Um fünf treffen wir uns wieder und machen einen etwa zwanzigminütigen Spaziergang zum Kloster. Es wird von dreizehn Mönchen geführt; 1‘200 Kinder werden dort betreut. Sie sind entweder Weisen oder haben arme Eltern, die die Ausbildung nicht bezahlen können. Die meisten Kinder sind grad beim Essen, einige spielen Fussball, wie wir unseren Rundgang beginnen. Man hat den Eindruck, es gehe sehr fröhlich zu und her. Alle haben eine Gamelle, die sie nach der Mahlzeit selber wieder abwaschen. Gleich ist Gebetsstunde, dann wird gelernt bis um neun und anschliessend ist Feierabend. Der nächste Tag beginnt für alle wieder um fünf Uhr morgens. – Mit Gebetsstunde.
Der „Vize-CEO“ gesellt sich zu uns und stellt sich vor. Er führt uns herum, Tunlin übersetzt. Inzwischen ist es dunkel geworden. Wir werden auch vom Chef empfangen, dürfen uns auf Stühle setzen, Tunlin kniet auf einer Bastmatte vor ihm hin und verneigt sich. Zwei Girls sitzen in gebührendem Abstand ihm gegenüber und warten untertänigst auf Order. Tee und Papaya bringen sie für uns.
Ich gebe dem Boss eine „Donation“. Das Problem ist, er darf Geld nicht von mir direkt annehmen. Also wird ein goldener Kelch als Go-Between benutzt. Ich lege die Kohle hinein und dann ist die Schose perfekt. Tunlin spendet ein Buch – das kommt auch in die goldene Schale. – Während einer geschlagenen Stunde trinken wir Tee und „unterhalten“ uns. Wie in einem fremdsprachigen Film ohne Untertitel läuft’s ab. Zur Abwechslung geht’s mal nicht darum zu erfahren, wie viele Kinder wer hat.- Er will wissen, wie die Schule und das Ausbildungssystem in der Schweiz funktioniert. Bereitwillig geben wir Auskunft, wie viel aber herüberkommt mit der Übersetzung, weiss ich nicht. Manchmal wird genickt, manchmal nachgefragt. Die beiden Girls hängen an unseren Lippen, obwohl sie nichts verstehen. Noch mehr Tee wird angeboten, auch ein Abendessen. Aber das haben wir ja bereits im Hotel bestellt (zum Glück).
Wir bedanken uns (chesuba) und verabschieden uns. Weils im Moment wieder zu regnen begonnen hat, bestellt uns der Mönch ein Auto, um uns zurück ins Hotel zu bringen. Wir sind natürlich froh, denn mit unseren Flip Flops bei Dunkelheit den Weg zurückzulegen, wäre tatsächlich eine Herausforderung gewesen. – Wir werden herzlich verabschiedet und beide erhalten wir eine Papaya mit auf den Weg. – Im Auto stinkt’s gewaltig. Es ist ja nur ein kurzer Weg; wir werden keinen Schaden davontragen. – Im Hotel warten sie schon auf uns. Mit Schirmen. So bedacht werden wir zu unserem Häuschen begleitet. Jetzt hab ich eine Dusche nötig. – Ein feines Nachtessen erwartet uns. Wir sind ja die einzigen Gäste; alle Aufmerksamkeit der Welt konzentriert sich auf uns, wir konnten sogar zuvor beraten, was wir zum Essen haben möchten. „This is your home“, sagt Aung Min. Die Herzlichkeit dieser Leute ist einmalig, wie gerne würden wir eine weitere Nacht hier an diesem stillen, friedlichen Ort verweilen.
Am nächsten Morgen werden wir mit einem köstlichen Frühstück überrascht. Das Toastbrot, das ich sonst überall verschmähe, ist ausnehmend gut. Die Omelette ebenso und erst die Guacamole und der frisch gepresste Limejuice! – Schade, geht die Reise schon wieder weiter.
Um neun sind sowohl Tunlin als auch unser Bootsführer (Cruise-Captain, wie Tunlin ihn nennt) pünktlich zur Stelle. – Es gibt eine herzliche Verabschiedung (wir versprechen, per Whatsapp in Kontakt zu bleiben) und schon fährt das Boot los Richtung Norden.
Mit grossem Geschick steuert Tin das schmale Gefährt durch den stillen See, in dem sich die ganze Gegend spiegelt; man hat das Gefühl, man segle durch eine doppelte Welt, immer schön unterhalb der Schnittstelle entlang. Am meisten mag’s der Captain, wenn er durch Schilf- und Wasserhyazinthen–Pfade hindurchdonnert. Uns macht’s auch Spass; es scheint, als ob das Schiff über Land dahinsause. Wahrscheinlich ist die Geschwindigkeit etwa 30 km/h, mir kommt’s aber oft schneller vor. Nur hin und wieder begegnet uns ein Fischer in einem Boot wie dem unseren, ein paar Enten sehen wir und eben all die schwimmenden Pflanzeninseln, Seerosen manchmal auch, und Lotus. – Es ist atemberaubend schön.
Von weitem erkennt man am Ufer die Spitzen von Stupas. Nicht golden, aber rötlich und grau. Wir kommen näher und halten an. Samkar heisst das Dorf, nach dem der See benannt ist (oder umgekehrt). Bis zum Wasser reicht der Stupa-Friedhof, den wir schon von weitem gesehen haben (Das Wort Stupa heisst übrigens Friedhof, wie mir Tunlin erklärt. In jedem dieser Türme ist eine Reliquie begraben). Der Anblick ist gewaltig und treibt mir fast die Tränen in die Augen. Die Pagode stammt aus dem 15. Jahrhundert. Einige der Stupas aber werden renoviert; es sind Arbeiter dort, die viel zu tun haben, denn die etwa siebzig Bauwerke sind arg zerfallen oder stark von Bäumen bewachsen. Was für ein bezaubernder Ort!
Weiter geht die Bootsfahrt. Auf einem Kleinstinselchen steht ein grosser Baum. Oder ist es ein Stupa? - Beides. Völlig ineinander verflochten. Und ein wenig weiter weg gleiten wir erneut an ein paar zerfallenen Stupas vorbei, diesmal sind’s nur etwa ein Dutzend. Ein Tempel steht dort, gerade noch; wie der schiefe Turm von Pisa hat er Schlagseite und ist stark beschädigt. – Alle diese Bauten spiegeln sich im Wasser, was das Bild noch viel erhabener macht.
Etwas weiter nördlich erneut eine Pagode. Sie ist riesig im Vergleich zu den anderen und ist gut erhalten. Umgeben von rot blühenden Blumen (eine Art Gladiolen) ist auch dieser Anblick einer für Götter und sicher auch für Touristen, nur hat’s davon keine. Viele der über hundert Türme sind mit Reliefs geschmückt, auch kleine Tempel sind vorhanden, in die man eintreten kann. Drinnen dann, wen wundert’s - Buddhas, Buddhas, Buddhas.
Mindestens eine halbe Stunde lang spazieren und fotografieren wir im Gelände herum und staunen ob der Vielfalt und der stillen Schönheit der Anlage.
Vom oberen Ende des Sees führt ein Fluss zum Inle-See. An dessen Ufer halten wir bei einer Töpferei an und die Töpferin offeriert uns Tee. Ihr Können demonstriert sie uns mit einer einfachen Drehscheibe, die sie von Hand betreibt. In etwa zwanzig Minuten entstehen ein mittelgrosser Krug und fünf kleine Gefässe. Wir dürfen auch probieren, wie das geht. Ich verzichte, Theo aber formt einen Aschenbecher, so wie er schon früher welche produziert hat: Am Rand der Schale hält eine Lippe eine Zigarette. - Ob sie das Teil je färben, glasieren und brennen wird…
Die Bootsfahrt dauert weitere zwei Stunden. Ich geniesse jede Minute davon. In der Sonne sitzen und sich durch die schönste Gegend steuern lassen, das angenehme Fahrtwindchen geniessen – wie phantastisch ist das denn?
Inle-See
Durch Dörfer, die alle im Wasser stehen, tuckern wir hindurch, der Bootsverkehr nimmt jetzt zu, da wird reger Handel getrieben. Ohne Boote geht hier gar nichts, denn mit dem Auto sind die Pfahlbauer-Dörfer nicht erreichbar. Wie wir in Ywama im Inle-See ankommen, ändert alles komplett. Jetzt sind es nicht nur Boote der Einwohner, die Waren transportieren, oder Fischer, jetzt hat es auch Boote, die Touristen herumkutschieren. Der Lärm von den vielen Motoren lässt den Zauber der stillen Landschaft, durch die wir in den letzten vier Stunden gefahren sind, verschwinden. Innerhalb von fünf Minuten sehen wir so viele Touristen, wie während der ganzen letzten fünf Tage nicht. Es hat viele Restaurants und Hotels, die Gegend boomt. Tunlin sagt, als er vor fünf Jahren hier gewesen sei, habe es nur gerade drei Hotels gegeben am ganzen See. Jetzt sind es unzählige. Und die Farbe des Wassers ist braun. Wie ich im Internet lese, dass dieses Paradies hier in Gefahr ist, wundere ich mich nicht.
Das Boot hält vor einem eleganten Restaurant, dem Golden Moon, an dem angeschrieben steht, es gäbe Espresso. Wir staunen auch über die Menu-Karte. Europäische Speisen kann man bestellen, in verschiedenen Sprachen steht geschrieben, was es alles gibt – ganz klar: hier ist man auf Touristen eingestellt. An den Bootsstegen wird man erwartet, beim Aussteigen wird geholfen, es gibt hier sogar eine Art Valet-Service: Ein Angestellter parkiert das Boot irgendwo anders und bringt es wieder hin, wenn man gehen will. Das alles funktioniert reibungslos; es ist das tägliche Brot der Bewohner, die mit den langen, hübschen Booten so vertraut sind wie die Holländer mit ihren Fahrrädern.
Die Inthas (Kinder des Sees), wie sich der Volksstamm hier nennt, sind offenbar vor etwa 200 Jahren vor den Thailändern aus dem Süden ins Innere des Landes geflohen, und weil man sie nicht ansiedeln lassen wollte, bezogen sie das Land im See, auf das niemand Anspruch erhob, und seitdem haben sie ihr Leben dort angepasst.
Um vier sind wir im Hotel Shwe Inn Tha Floating Resort. Alle Bungalows sind schön ausgestattet mit Holz und stehen natürlich im Wasser. Es ist sehr gemütlich hier. Eigentlich wollten wir noch eine Weile den anmutig angelegten Pool geniessen, aber es beginnt zu regnen. Fast jeden Tag regnet es gegen Abend. Mal länger, mal kürzer.
Hier gibt’s auch eine Bar. Schön, wieder mal einen Cocktail zu trinken und zuzusehen, wie die Nacht den Tag ablöst. – Die Mücken interessiert dieses Bild wenig. Sie tun sich gütlich an meinen Füssen, was ich leider erst spüre, wie der Schmaus schon vorbei ist und sie längst abgezogen sind.
Dienstag, 17. Oktober - Handwerkerbetriebe
Neun Uhr: Tunlin wartet bereits am Bootssteg, Tin ebenfalls; wir können einsteigen und unsere beiden Handgepäckskoffer werden verstaut.
Heute ist ein Werkstatt-Besuchs- und Shopping-Tag. Zuerst geht’s in die Weberei. Schon von weitem hört man das Ritsch-Ratsch der Webstühle. Es ist eine Fabrik, die wir besuchen, aus Bambus gebaut und natürlich auf Stelzen. Mindestens fünfzig Frauen verrichten all die verschiedenen Arbeiten, die es braucht, um die wertvollen Stoffe herzustellen. Erst müssen die langen Stängel der Lotusblumen und -blätter aus dem Teich gefischt, angeschnitten und gebrochen werden, um die Fasern zu gewinnen. Anschliessend werden die feinen weissen Fäden aufgewickelt, getrocknet, zu Zwirn verarbeitet, gefärbt und schliesslich verwoben. Aus Seide und diesen Lotusfäden entstehen schliesslich am Webstuhl hübsche Stoffe. Die Frauen arbeiten in Windeseile, lassen die Schiffe durch die gespannten Kettfäden gleiten, treten mit den Füssen die richtigen Pedale und mit grösster Konzentration und Geschicklichkeit entstehen so Stoffe mit Mustern, die sie ohne Vorlage aus dem Kopf hinzaubern.
Ich kaufe mir einen Schal und eine Bluse.
Beim Schmied schauen wir zu, wie zu fünft gearbeitet wird. Ein Messer entsteht. Eine Frau betreibt die Blasbalgvorrichtung, der Schmied hält ein Stück Eisen in die Glut, das legt er dann auf den Amboss und drei Jungen, fast noch Kinder, schlagen im Takt in immer gleichem Rhythmus auf das glühend rote Eisen ein und hämmern es nach und nach platt. Ein paarmal wird dieser Vorgang wiederholt. Die Präzision ist unglaublich, die Konzentration meint man fast zu spüren; es sieht so einfach aus - der Tanz der Hämmer... Ich versuche, eines dieser Werkzeuge hochzuheben. Die sind so schwer, es gelingt mir kaum. Wie die Jungen, die so mager und kraftlos aussehen, diese schwere Arbeit schaffen, ist mir schleierhaft. Und noch dazu bei dieser Hitze.
Einen weiteren Besuch statten wir bei einem Bootsbauer ab. Schön, wie das Holz gesägt, gebogen und zusammengeleimt wird, so dass schliesslich eines dieser eleganten, schmalen, langen Boote entsteht, wie sie in dieser Gegend Gang und Gäbe sind.
In einem Nebenraum dieser Handwerksstädte werden Zigarren gedreht. Drei Frauen sitzen am Boden und wir können zuschauen, wie genau das geht. Sie sind äusserst geschickt; wie im Traum geht das Drehen vonstatten. Den Handgriff haben sie sicher schon mehr als x-zehntausend Mal ausgeführt.
Jetzt ist wieder Zeit für eine Tempelbesichtigung. Es ist der wichtigste Tempel in dieser Gegend. Sein Name: Phaung-Daw-U-Pagode. Das ganze Drum und Dran kommt uns natürlich ein wenig (sehr) kitschig vor. Aber die Leute sind bei der Sache. Die Frauen sitzen vor dem Altar herum, die Männer sind mitten auf dem Podest, wo fünf Buddhas stehen, die man auf Anhieb niemals als solche erkennen würde. Ich, als Banause, dachte erst, was Komisches das sein soll, die fünf Figuren sehen aus wie überdimensionierte Eiscreme-Scoops in je einem Becher. Goldenes Eiscreme halt. Gar nicht so daneben eigentlich, denn auf einem Bildschirm, der an einem Balken hängt, kann man in Echtzeit zusehen, was genau da oben abläuft, also grad genauso wie in einer Schauküche. – Peinlich, peinlich dann meine Fragen. Tunlin erklärt mir, die Figuren (Eiscremes) seien die fünf Buddhas, die von den anwesenden (Köchen) seit Jahrzehnten Tag für Tag mit kleinen Goldblättchen bedeckt und beklebt würden (genauso wie beim Golden Rock) bis sie eben gar nicht mehr zu erkennen seien.
Frauen dürfen übrigens auch hier nicht mitmachen bei der Goldankleberei (Ladies prohibited). - Ok, kleb ich halt nicht. Aber ich geh auch nicht vor der Szene auf die Knie und bete. Das besorgen andere. Touristen hat es nämlich viele, die meisten allerdings aus dem eigenen Land.
Vor dem Mittagessen liegt noch eine Handwerkstätte drin: eine Gold- und Silberschmiede. Das gefällt mir gut, denn was man da kaufen kann, macht keine Probleme im Koffer. – Also gönn ich mir etwas.
Beeindruckend auch hier, wie die paar Männer, die an ihren Pulten sitzen, mit äusserster Geduld, Geschicklichkeit und Präzision die minuziöse Arbeit mit den Silberfäden und –plättchen und –kügelchen erledigen. Eine enorme Herausforderung für die Augen im Halbdunkel. Auch hier dürfen wir zuschauen, fotografieren, niemand lässt sich bei der Arbeit stören.
Tin bringt uns wieder ins „Golden Moon“, wo das Essen wirklich hervorragend ist.
Anschliessend werden wir zur Inthein-Pagode gefahren, einem weiteren Stupa-Ruinen-Feld. Über tausend Stupas kann man besichtigen. Viele Boote haben bereits angelegt, aber wo sind die Touristen? Tunlin geht mit uns einen Weg, den sonst offenbar niemand einschlägt. Er führt uns durch den untersten und ältesten Teil der Anlage, wo’s Stupas hat, die aus dem 15. Jahrhundert stammen. Sie sind teilweise fast völlig überwachsen, was den Bauwerken meiner Meinung nach einen besonderen Scharm und Reiz verleiht. Hier wie auch in Samkar sieht man wie die Gebäude mit Ziegensteinen aufgebaut wurden, dann mit Stuckatur verziert. Und später hat die Natur begonnen, sie in Besitz zu nehmen – Gras, ganze Büsche und sogar Bäume wachsen auf ihnen und durch sie hindurch. Einer dieser Tempel ist besonders schön und reich verziert. Bis zur Hälfte war er offenbar bereits im Boden verwachsen, jetzt wurde der Erdhügel abgetragen und das Bauwerk renoviert. Wir folgen Tunlin und erreichen den Hauptteil der Tempelanlage (18. Jhd.) von einer anderen Seite her, als das offenbar üblich ist. Mit gutem Grund, wie wir bald schon merken. Eine Touristengruppe kreuzen wir, die gehen aber einen anderen Weg und wir sind wieder alleine mitten im dichten Stupa-Wald. Einige der Bauwerke sind bereits renoviert, an anderen wird gearbeitet; sie werden neu aufgebaut, so wie sie vermutlich einmal waren. Diese gefallen mir aber viel weniger gut als diejenigen, die von der Zeit gezeichnet sind. Ich bin nicht sicher, ob das viele Geld, das man in diese Renovationsarbeiten steckt, so gut angelegt ist. Es ist jedenfalls eine Riesenarbeit, ein monströses Projekt.
Wir sind jetzt zuoberst auf der Tempelanlage angelangt. Von unten, von der Bootsanlegestelle bis hierhin führt der Zugang zum Heiligtum, so wie das überall üblich ist (teils Treppe, teils eben), nur ist dieser hier der längste, den es gibt in diesem Land. Er ist 700 Meter lang und mir erscheint er noch sehr viel länger. Er will nicht enden. Und gesäumt ist er beidseitig mit Souvenir-Ständen der Einheimischen. Zum Glück sind die Dutzenden von Händlern bereits am Abräumen und Zusammenpacken. Sie behelligen uns kaum mehr. - Ich stelle mir jetzt vor, wenn wir vor einer Stunde den umgekehrten Weg genommen hätten, vom Bootssteg bis oben an all den Verkäufern vorbei, das wäre ein Spiessrutenlauf geworden. Auch hier hat Tunlin unsere Besichtigungstour zeitlich gut gewählt und einmal mehr äusserst geschickt geplant. Wir drei sind nämlich wieder mal die Einzigen, die noch unterwegs sind. – Es ist jetzt fast schon fünf Uhr; die Boote sind alle weg, wir werden zum Hotel gefahren und haben vor dem Apéro in der Bar noch Zeit, ein wenig im Pool zu baden und uns auszuruhen.
Theo ist der vielen Nudeln doch bereits überdrüssig. Reis ist auch ein wenig suspekt, ist ja schon fast wie Gemüse, wächst ja auch in der Erde. Und wenn schon, dann Risotto. Also: Er will eine Pizza Hawaii. Ich rate ihm ab, aber nein, es muss sein. Sie sieht schon ein wenig seltsam aus – mit einer käseartigen Masse ist sie überbedeckt, die Ananasstücke sieht man nicht, die sind irgendwie darunter versteckt, den Schinken sieht man ebenso wenig - kein Wunder, er ist gar nicht vorhanden. – Ich will nicht probieren.
Nach der Hälfte gibt mein Gatte auf. Im Reiseführer stand, man müsse sich nicht sorgen, wenn man seinen Teller nicht ausesse. Da gäbe es immer jemanden, der oder die sich gerne mit den Resten begnügen würden. Nicht wie bei uns, wo alles weggeworfen und nicht einmal den Schweinen gegönnt wird. – So darf sich also jemand anderes an der andern Hälfte einer köstlichen Pizza Hawaii erfreuen.
(Die Pizza kostet übrigens ein Vermögen für hiesige Verhältnisse: 10 US$. – Für weniger als diesen Betrag haben wir unterwegs zu dritt zu Mittag gegessen, Getränke und Trinkgeld inbegriffen.)
Mittwoch, 18. Oktober - Unterwegs nach Bagan
Es wird ein langer Tag werden heute. Wir sind im ganzen neuneinhalb Stunden unterwegs.
Um acht Uhr holt uns Tin ab und fährt uns quer über den Inle-See bis nach Nyaung Shwe. Er lässt nichts anbrennen, das Boot speedet geradewegs zum Nordende des Sees. Dort verlangsamt er, so dass wir den Fischern zuschauen können, die ihre Kunststücke vorzeigen, die in jedem Reiseführer stehen und die man einfach im Kasten haben muss: Die Männer stehen mit einem Fuss hinten auf dem wackligen Boot, mit dem anderen und der einen Hand balancieren sie die Reuse hoch in der Luft und mit der anderen Hand halten sie sich am Paddel fest. „Einbeinruderer“ werden sie genannt. Das sieht sehr graziös aus und ist natürlich mehr als nur ein Foto wert. Das wissen sie ganz genau und bitten dann auch um einen Obolus. - Es ist das erste Mal, dass jemand Geld haben will, aber für diese tolle artistische Vorführung ist so eine grüne Note à 1000 Kyat (75 Rp.) nicht zu viel verlangt. – Bei den zahllosen Touri-Booten, die hier herumkurven, werden die Fischer bald ein Vermögen verdient haben.
Von nun an geht’s durch den Kanal, der nach Nyaung Shwe führt, wo’s wieder Strassen und Autos hat. Noch sechs Kilometer weiter, dann sind wir am Ziel, am Bootssteg, wo Tunlin und sein Toyota bereits auf uns warten. Eine Stunde hat die Überfahrt gedauert.
Leider ist das Wetter für einmal nicht strahlend schön, es ist bedeckt und sieht stark nach Regen aus. Kaum sind die Koffer und wir im Auto verladen, fallen auch schon die ersten Tropfen. So ein Glück! Auf dem Boot wär das nicht ganz so angenehm gewesen. – Nach einer kurzen Fahrt halten wir an beim Kloster Shwe Yaunghwe Kyaung und wer hätte es gedacht: Der Regen hat schon wieder aufgehört. So nett von ihm!
Im Kloster werden grad ein paar Novizen unterrichtet. Sie sitzen im Halbdunkel am Boden und schreiben in ihr Heft. Nicht eben eine praktische und gesunde Körperhaltung. Sie tun mir leid, die kahlgeschorenen Kleinen. Im Chor singen sie nach, was ihnen ihr Lehrer vorgibt. Absolute Disziplin herrscht.
Im Tempel nebenan gibt es eine Art Kreuzgang. Buddhas über Buddhas sind dort in kleinen Nischen untergebracht, die meisten sind in ein kitschiges rotes Tuch gehüllt. Darunter steht der Name der Person, die eine Schenkung gemacht hat. Auch Schweizer sind dabei.
Die Fahrt geht weiter; eine Bergkette haben wir zu überqueren. Tunlin hält unterwegs bei einer Familie an, die eine kleine Werkstatt hat, in der chinesische Sonnenschirme hergestellt werden. Alles wird von Hand fabriziert und wenn ich nicht gesehen hätte, wie all diese minuziösen Arbeiten tatsächlich ohne elektrische Maschinen ausgeführt werden, ich hätte es nicht geglaubt. Die Präzision ist einmalig. Und in welcher Geschwindigkeit gearbeitet wird, ebenfalls. Exakt passt alles ineinander, sogar die Vorrichtung, die beim Schirm das Gestell festhält, funktioniert tadellos. Stolz wird uns präsentiert, wie das gemacht wird. Ich bin tief beeindruckt. Und die Girls zeigen, wie das Papier geschöpft wird, das für die Bespannung benötigt wird. Am Ende wird der „Stoff“ imprägniert; er ist dann absolut wasserdicht. Leider kommt ein Kauf nicht infrage, Holz und Bambus nach Australien einzuführen, ist strikte verboten. Zwei kleine Bilderrahmen aus dem hübschen mit Blumen verzierten Papier aber kaufen wir doch, dann heisst es, sich zu verabschieden. Wir haben einen weiten Weg vor uns bis nach Bagan. Achteinhalb Stunden dauert es noch mit einem kurzen Halt um ein Uhr zum Mittagessen. Erst geht es durch die Berge, über einen Pass – durch eine unwegsame grün bewaldete Landschaft, wo nur am Rande der Strasse hin und wieder ein paar Hütten stehen. Etwa auf 1‘500 Meter erreichen wir die Passhöhe. Kurven bis ins Tal, wo’s wieder saftig grüne Reisfelder hat und Bananenplantagen. Dort, wo die Felder bereits dunkelgelb sind, sind die Bauern gerade dabei, den Reis zu ernten. Es muss stark geregnet haben; unterwegs dirigiert die Polizei die Autos am äussersten Rand der Strasse entlang. Der Damm ist überlaufen, die Strasse überflutet, die Helfer stehen alle bis zu den Knien im Wasser. Wir kommen durch; ich bin sehr froh. Weiter geht’s durch landwirtschaftliches Gebiet, durch Dörfer und Städte.
Wo immer wir bisher durchgefahren sind, werden die Strassen erneuert und verbreitert. Neue Tankstellen werden errichtet, obwohl es bereits sehr viele davon hat. Strassenarbeiter sehen wir fast so viele wie Buddhas und Mönche. Aber jetzt, auf den letzten hundert Kilometern vor Bagan, wo die Strasse in einem katastrophalen Zustand ist, ist kein einziger Arbeiter zu sehen, keine Vorkehrungen sind getroffen, um die Strasse zu flicken. Tiefe Schlaglöcher hat’s und manchmal fehlt sogar der Belag.
Tunlin fährt rassig dem Ziel entgegen, er hupt sich durch, könnte man sagen. Manchmal kann ich fast nicht mehr hinschauen, wenn streunende Hunde, Kühe oder Fussgänger unterwegs sind. Ich lerne es wohl nie. Und immer diese Mofa-Fahrer, voll beladen und mit Babys unterwegs. Diesen Mut oder besser gesagt diese uneingeschränkte Sorglosigkeit hätte ich nicht. - Voll beladen sind auch die Pick-Ups, nicht selten steht einer am Strassenrand, weil das arme überladene Gefährt sich weigert weiterzufahren.
Bagan
Jetzt endlich erreichen wir Bagan. Links und rechts der Strasse sind die herrlichsten Bauten zu sehen, Stupas und Tempel. Sicher sind auch unter den Hotelkomplexen und unter der Strasse welche begraben. Es kann anders nicht sein. Sie geht nämlich schnurgerade durch das ganze Gebiet dieser ehemaligen Hauptstadt hindurch und wie man im Reiseführer nachlesen kann, hatte es ursprünglich 10‘000 solcher Gebäude. Heute existieren „nur“ noch rund 2‘000. Die meisten sind recht gut erhalten, einige werden renoviert. Die Blütezeit war zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert.
Um halb sechs Uhr kommen wir endlich beim Hotel Thande in Old Bagan an. Zeit für ein Bad im Pool und dann ein Nachtessen im feinen Restaurant. – Wie’s genau aussieht, sehen wir dann morgen bei Tageslicht.
Donnerstag, 19. Oktober
Heute genau vor einem Jahr wurde Theo in Johannesburg am Herzen operiert und erhielt zwei Bypässe. Für ihn ist das wie ein Geburtstag, den es zu feiern gilt. Ja, was für ein Tag damals, was für ein Jahr.
Eigentlich geht es ihm ja seit Monaten wieder bestens, aber leider ausgerechnet heute nicht. Er hat sich das Essen von gestern in der Nacht nochmals durch den Kopf gehen lassen. Zum Frühstück gibt’s nun halt nur Tee und ein Stück Toast und wir hoffen beide, dass es bald wieder besser geht. Trotzdem rafft er sich am Morgen auf und kommt mit auf Entdeckungstour. Es ist sehr heiss und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 97%; man kommt zum Schwitzen gar nicht mehr raus. Während der Nacht und bis am Morgen um sieben hat es stark geregnet und dementsprechend sehen auch die Strassen aus, die im ganzen Gebiet nicht asphaltiert sind. Aber im Moment ist es schön und wir geniessen unsere Tour. Die Tempel sind grandios und die Tatsache, dass es überall welche davon gibt, ist schon beeindruckend. Nur noch auf wenige kann man hinaufsteigen. Enge, schmale, dunkle Treppen führen im Innern auf eine höhere Terrasse und von dort aus hat man eine prächtige Aussicht über die weite Ebene mit ihren Feldern und Bäumen, aus denen so weit das Auge reicht, immer wieder ein Stupa guckt. Es ist ein überwältigender Anblick. In die meisten Tempel kann man reingehen und sie besichtigen. Erst aber gilt es, sich durch die Scharen von Händlern durchzukämpfen, die überall ihre Waren anbieten. Ist man dann im Tempel drin, begegnet man Buddhas in jeder Grösse, riesige, zehn Meter hohe im Eingangsbereich, solche, die in Nischen stehen (Nischen sind SEHR buddha-anfällig), mal sind sie an den Wänden gemalt, mal als Reliefs in Stein gemeisselt. Die Wandmalereinen sind einmalig. Zum Teil gut erhalten, zum Teil leider kaum mehr zu erkennen. Sie sind überall, an den Wänden und an den hohen Decken. Wie vor all den Jahren die Menschen diese Massen von Zeichnungen applizieren konnten, ist unvorstellbar. Meist ist es auch so dunkel, dass man nur mit einer Taschenlampe erkennt, was dargestellt wird. Erahnen kann man’s allerdings allemal: Szenen aus dem Leben von Buddha.
Damit wir nicht völlig „over-buddhad“, „out-pagodad“ und „templed-out“ sind, was allmählich tatsächlich bald zutrifft, schlägt Tunlin einen Besuch eines Lackfabrikations-Betriebs vor. In der Tat: Eine wohltuende Abwechslung. Auch hier sind wieder gut zwanzig Arbeiterinnen und Arbeiter am Werk, mindestens eine Person für jeden Arbeitsgang. Man kann zusehen und es wird einem erklärt, was genau passiert vom einfachen Bambusschälchen bis hin zur vierfarbig bemalten und lackierten Schale. Es ist eine aufwändige Arbeit, kein Wunder, sind diese echten Produkte so teuer.
Es ist Mittag. Wir machen eine Pause. Theo legt sich hin im Hotelzimmer, ich besuche noch zwei Tempel, die gleich neben dem Hotel stehen. Einer ist riesengross mit vielen Nischen, also vielen goldenen Buddhas drin. Auf den anderen kann man hinaufsteigen. Eine Frau, die dort Kleider und Souvenirs verkauft, hilft mir mit ihrer Taschenlampe, die steilen Stufen bis zur ersten Terrasse hinaufzuklettern. Man hat von dort aus einen tollen Ausblick. – Ich bin alleine dort, eben nicht einmal mit Theo, und bei den vielen Touristen, die hier in Bagan „herumschwirren“, ist das eigentlich schon erstaunlich. Aber die Besucher verteilen sich eben gut auf die vielen Tempel in einem Bereich von 50 km2. Bei den grossen hat’s manchmal ganze Wagenladungen von einheimischen und „ausheimischen“ Touristen, bei kleineren kaum jemand, und die ganz kleinen Stupas schaut schon gar niemand an. Aber es herrscht ein reges Treiben in den Strassen. Einige Besucher sind mit den Pferdekutschen unterwegs (die kleinen mageren Pferde tun mir so leid in dieser Hitze), andere mit Fahrrädern und die allermeisten mit Bussen oder Motorrädern, die man überall für wenig Geld mieten kann.
Jetzt ist’s Zeit für einen kühlen Drink. Ich setze mich im Gartenrestaurant des Hotels mit Blick auf den breiten Irrawaddy an einen Tisch und trinke ein Sodawasser.
Danach bleiben mir noch anderthalb Stunden, bis Tunlin mich wieder abholt zwecks weiterer Besichtigungen, also ist ein Bad im Pool ein Genuss und ein wenig Zeit zum Lesen bleibt mir auch. Theo liegt im Bett, tief unter der Bettdecke und „tötelt“. Besser, er ruht sich aus und ist dann morgen wieder fit.
Um halb vier geht’s los und ich wundere mich zum x-ten Mal, über Tunlin und seine Fähigkeit, überall daheim zu sein. Er weiss immer genau, wo er abzweigen muss, kennt offenbar alle Tempel und weiss, wo was zu sehen ist. Auch von welcher Ecke aus man die beste Foto schiessen kann, wo er parkieren kann, wo’s kaum andere Fahrzeuge hat, ist für ihn völlig klar; er weiss Bescheid über Details der Geschichte und Legenden und überhaupt, es ist erstaunlich, wie er sich auch in all den Städten, wo wir waren, auskennt. Ohne Navi wohlverstanden. Immer zielsicher führt er uns in unser Hotel.
Er zweigt in einen Feldweg ab und zu Fuss geht’s an einem Maisfeld entlang zu einem Turm, von dem aus man den Sonnenaufgang sehen kann, wenn’s denn überhaupt einen gibt. Es sind noch andere Leute dort, alle bewaffnet mit Kameras, zum Teil mit professionellen Vorrichtungen. – Es ist schön von dort oben – man sieht über die Felder, die mit Erdnüsschen, Sesam und Mais bepflanzt sind.
Ein Sonnenuntergang im eigentlichen Sinn findet zwar nicht statt, aber es ist trotzdem ein Erlebnis, von dort oben die ganze Gegend mit ihren endlosen Türmen und Türmchen überblicken zu können.
Zurück im Hotel geht es Theo ein wenig besser. Seine „drop-dead“-Siesta scheint ihm gut getan zu haben. Wir gehen essen, er verzichtet auf ein Bier, bleibt ganz spartanisch beim Mineralwasser (da scheint tatsächlich etwas noch nicht ganz im Lot zu sein) und isst nur eine halbe Portion Nudelsuppe.
Freitag, 20 Oktober – Unterwegs nach Mandalay
Die letzte Etappe unserer Reise mit Tunlin führt nach Mandalay („Mändely“, wie die Burmesen die Stadt liebevoll nennen). Vier Stunden dauert die Fahrt. Einen Zwischenalt aber gibt’s in Natogyi, wo wir uns einen Betrieb anschauen, der versteinertes Holz verarbeitet.
Grad massenhaft muss es in dieser Gegend solche Bäume geben. Es ist faszinieren, wie die Natur das Holz während Jahrmillionen Zelle für Zelle in Stein verwandelt hat. Die Steine werden zu Schmuck und Skulpturen verarbeitet, die mir allerdings nicht sehr gefallen, weil sie so lange poliert werden, bis sie ganz glänzend sind. Trotzdem kaufe ich mir ein Armband. – Wir essen auch dort; angeschlossen ist ein nettes kleines Restaurant.
Dann geht’s weiter über die Autobahn zur Abwechslung nach Inwa, ehemals Ana, der alten Hauptstadt. Pagoden über Pagoden gibt es dort, auch Klöster. Drei davon sehen wir uns an. Es sind grandiose Bauten, das erste Kloster, (Htat Gyi Kyaung) beeindruckt mich am meisten. Es wurde im Jahr 1838 teilweise von einem Erdbeben zerstört, seine verbleibenden Mauern sind mit faszinierenden Stuckaturen verziert. Das zweite (The Queen’s Brick Monastery – Maha Aung Mye Bon Zan) wird grad von einer grossen Gruppe von Mönchen aus Mandalay besucht, mit zwei von ihnen komme ich ins Gespräch.
Das jüngste Kloster (Bagaya Kyaung,18. Jahrhundert) ist aus Holz gebaut. Theo ist für einmal gar nicht begeistert, er meckert über die Nägel, die nicht säuberlich im Holzboden verankert sind. Mit nackten Füssen muss man halt ein wenig aufpassen. Den ganzen Bau findet er demzufolge nicht sehr sehenswert; ich dagegen schon. Das Kloster ist mit prachtvollen Schnitzereien ausgestattet. - Einmal mehr bin ich erstaunt über die Dunkelheit in diesen Gebäuden. Die Mönche tun mir leid.
Als letzte Sehenswürdigkeit besuchen wir heute die U-Bein-Brücke. Sie wurde 1850 erbaut, überquert den Taungthaman-See in der Nähe von Amarapura und ist mit 1,2 km Länge die älteste und längste Teakholzbrücke der Welt. Sie fehlt in keinem Touristenprogramm. Das wird deutlich klar, wie wir dort ankommen. So viele Touris auf einem Haufen sieht man nur vor dem Louvre oder am Times-Square.
Ganze Touristengruppen mit Fähnchen und Namensschildchen versehen werden losgeschickt, ganze Altersheime sind unterwegs – die Brücke muss man offenbar einfach gesehen haben. – Wir ja schliesslich auch. Es ist nicht so wie im Reiseführer, wo man ein wunderbares Foto sehen kann mit zwei Fahrradfahrerinnen hoch oben auf dem Holzsteg. – Nein, vor lauter Besuchern sieht man die Brücke kaum mehr. Man kann froh sein, dass man nicht hinuntergestossen wird, es wimmelt nur so von Menschen. Aber eines muss man sagen: Den Sonnenuntergang von dort aus zu geniessen, ist trotz allem ein schönes Erlebnis.
Eine Stunde dauert es dann noch, bis wir unser Hotel erreichen und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass wir unversehrt dort angekommen sind, mitten in Mandalay. – Es war ja bereits dunkle Nacht und Verkehr herrschte vom Schlimmsten. Motorräder drängten sich überall zwischen den Autos hindurch, beleuchtet waren einige überhaupt nicht oder nur teilweise. Auch dunkle Gestalten, Fussgänger und Hunde, überquerten die Strasse. – Woher die Menschen die Zuversicht hernehmen, dass ihnen nichts passiert, ist mir unverständlich.
Um sieben Uhr sind wir im Hotel Yadanar Oo. Ich biete Tunlin an, ein Zimmer im selben Hotel zu nehmen, er winkt dankend ab. Das kommt für ihn nicht in Frage. Er sucht sich ein Gästehaus, das seinen Vorstellungen entspricht. – Morgen ist unser letzter Tag mit ihm. Er wird wieder pünktlich da sein mit frischen Kleidern, geputztem Auto und einem strahlenden Lächeln. Ich freue mich!
Samstag, 21. Oktober – Letzter Tag der Rundreise
Unser letzter Tag. Buddhas, Pagoden, Klöster. Und das nicht zu knapp. Mindestens zweihundert Buddhas mehr haben wir am Ende des Tages auf unserem Konto. – So allmählich langt’s, aber diese ziehen wir uns nun doch noch rein. In vier Tagen sind wir ja in Australien, konfrontiert mit einer völlig anderen Kultur.
Die Fahrt durch die lebendige Stadt alleine ist schon interessant mitzuerleben und es ist erfreulich, im Nachhinein erleichtert sagen zu können, dass wir sie überlebt haben. Man sieht einmal mehr die verrücktesten Dinge. - Der Verkehr ist absolut chaotisch. Nur in Hanoi geht es ähnlich zu und her mit all den Scooters und Autos, die hier wie wild gewordene Insekten herumschwirren.
In Mingun besuchen wir einen weiss getünchten Tempel (Settawya-Pagode). Ein Treppengang, geschmückt mit weissen Tempelwächtern, führt bis zum Irrawaddy-Fluss hinunter. Dort sind ein paar Frauen dabei, ihre Wäsche zu waschen. Offenbar werden Kleider sauber, auch wenn sie in hellbraunem Wasser gebadet werden.
Besuch Nummer zwei ist ein gigantischer Bau - nur noch eine Ruine aus rotem Backstein, die Mingun Pagode. Im Jahre 1790 veranlasste der etwas grössenwahnsinnige König Bodawpaya den Bau der dieses Bauwerks. Mit einer Höhe von 150 m auf einer Fläche von 150 m² sollte es die grösste Pagode der Welt werden. Vollendet wurde sie allerdings nie. Der König starb nach zwanzig Jahren und sein Nachfolger trieb den Bau nicht weiter voran, so dass nur der Sockel errichtet wurde - immerhin aber auch 50 Meter hoch. Ein Erdbeben im Jahre 1838 zerstörte den bis dahin errichteten Teil. Jetzt ist es wahrscheinlich der grösste Ziegelhaufen der Welt. Die riesigen Risse im Gemäuer beeindrucken vor allem von ihrer Grösse her. Eine Treppe kann man hinaufsteigen, über hundert Stufen, und dort oben findet man sich vor monströsen Gesteinsbrocken, die aus dem Tempel herausgerissen wurden. Oben hat man eine schöne Aussicht auf den Fluss, die zig Souvenirläden und die Autos, Motorräder und Pferdekutschen, welche Touristen herbringen.
Die grösste Glocke des Landes (die zweitgrösste noch funktionierende der Welt) gibt es als Nächstes zu bestaunen. Sie ist 3,7 Meter hoch, 87 Tonnen schwer und wurde trotz ihrem Sturz beim Erdbeben im Jahr 1838 nur schwach beschädigt.
Weiterfahrt zum „Taj Mahal“. Der Tempel heisst natürlich nicht so, Hintergrund dazu ist aber eine ganz ähnliche traurige Geschichte. König Bagyidaw liess sie 1817 errichten zur Verehrung und zur Erinnerung an seine Frau, die im Kindsbett gestorben war. Die Hsinbyume Pagode ist eine absolute Augenweide. Sie bildet den buddhistischen Kosmos nach - den Berg Meru und die sieben Meere. Weiss getüncht scheint sie wie ein Palast im Märchen. Man kann hinaufsteigen und hat von da aus ein weiteres Mal eine einmalige Aussicht. Natürlich im Innern auch auf einen Buddha oder zwei…
Noch nicht genug: Tunlin fährt uns zu Pagode Nummer x2 (x=unendlich) in Sagaing, die Soon U Ponya Shin-Pagode, die ursprünglich im Jahr 1312 gebaut wurde. Gold und nochmals Gold, farbig auch – für uns der Inbegriff von Kitsch. Da das Heiligtum auf einem Hügel gelegen ist, hat man auch hier wieder Aussicht auf den Irrawaddy und die zahllosen, im Übermass vorhandenen Klöster, Stupas und Pagoden, die aus den grünen Baumwipfeln ragen.
Eine Pagode will uns Tunlin unbedingt noch zeigen, bevor wir etwas essen gehen. – Huch! - Aber auch diese Tempelanlage ist bemerkens- und besuchenswert. In der U Min Thounzeh Pagode sitzen in einem halbkreisförmigen, in den Fels eingetriebenen Gang 45 Buddhas nebeneinander, einer goldiger als der andere, einer lächelt weiser und herablassender als sein Nachbar.
Nach dem Lunch fahren wir zurück nach Mandalay. Jetzt gilt es, den Königspalast zu besichtigen. Dieser wurde zwar im zweiten Weltkrieg zerstört, aber man hat ihn originalgetreu wieder aufgebaut. Der Komplex ist riesig und umgeben von einer roten, relativ niedrigen Stadtmauer. Nur einer der Wachtürme steht noch, der Nan-Myin-Wachturm, welcher als Einziger verschont wurde. Man kann ihn besteigen. Das mache ich natürlich. Genau 121 Stufen winden sich um den Turm herum hinauf bis zum Dach. Von dort aus sehe ich Klein-Theo wie eine Ameise unten seine Siesta machen.
Und zum Dessert noch ein Kloster. Auch das zu besichtigen lohnt sich unbedingt. Der Bau stammt aus dem späten neunzehnten Jahrhundert und ist völlig aus Holz konstruiert. Die Schnitzereien an Türen und Fenstern sind einmalig. Im Innern ist es auch hier wieder sehr dunkel, so wie das offenbar in all den Klöstern üblich ist. Trotz der vielen Touristen ist’s immer wieder mal möglich, ein Foto zu schiessen ohne mindestens einen Mitfotografen vor der Linse zu haben.
Und noch zu einer weiteren Sehenswürdigkeit führt uns Tunlin, nämlich zur Kuthodaw-Pagode. Die Anlage wurde 1868 fertiggestellt. Sie besteht aus 729 pavillonartigen Tempeln, in denen je eine weisse Marmorplatte steht. Auf jeder davon ist eine Seite des Pali-Kanons niedergelegt, der das Leben und die Lehren Buddhas beinhaltet. Die ursprünglich vergoldeten Lettern sind heute nur noch schwarz eingefärbt. Die Pagode wird wegen dieser umfangreichen Darstellung auch als „Das grösste Buch der Welt“ bezeichnet. Vor der Erschaffung dieser Anlage waren die Texte ausschliesslich auf Pergament niedergeschrieben. Die Inschriften wurden von der UNESCO in die Liste des Weltdokumentenerbes aufgenommen.
Jetzt ist aber genug. Es ist schon kurz nach fünf. Tunlin bringt uns zurück ins Hotel. Es ist unser letzter Abend mit ihm, wir laden ihn also ein, mit uns zu essen, was er diesmal ausnahmsweise auch annimmt. Es ist angenehm, draussen auf dem gut besuchten Roof-top-Restaurant (Brolly Sky-Bar) in Ruhe ein feines Znächtli und anderthalb Flaschen Wein zu geniessen – Tunlin hält damit nicht zurück.
Sonntag, 22. Oktober – Zurück nach Yangon
Heute werden wir erst um elf Uhr abgeholt. Judihui! Da bleibt mal Zeit, auszuschlafen, zu frühstücken, dann aber heisst es, Koffer packen, denn um halb drei geht unser Flug zurück nach Yangon.
Offenbar beschäftigt mich die Packerei schon im Traum. Da war Theo dabei, auf einem Trottoir unsere drei Koffer vor sich hin zu rollen beziehungsweise hinter sich herzuziehen. Kurz darauf waren’s nur noch zwei. – Und dann gibt er dem einen mit dem Fuss einen Stoss, so dass der auf die Fahrbahn rollt. Ein Auto und ein Bus überrollen den Koffer (zum Glück ist es der kleinere), aber er ist unbeschädigt. Ich ärgere mich sehr, aber dann gibt’s einen Filmriss; wir sind in einem Saal und da wird wild auf uns geschossen. Ich erinnere mich noch daran, dass mich dies eher wenig kümmert, dann ist auch diese Szene zu Ende. - Gut so, vielleicht…
Wir fädeln uns erneut durch den Verkehr. Es ist Sonntag, also geht’s recht zahm zu und her. Trotzdem, gearbeitet wird vielerorts und manche sind unterwegs. Und immer wieder diese Babys, eingeklemmt zwischen zwei Erwachsenen. „Sometimes brest-feeding“, sagt Tunlin. Genau! Da ist es auch schon, dieses Bild, das ich eigentlich lieber gar nicht sehen möchte: Die Mutter auf dem Scooter, die rechte Hand am Lenkrad, mit der linken hält sie ihr Kind fest uns stillt es gleichzeitig. Geht’s eigentlich noch??? – Ich bin so schockiert, dass ich vollkomme vergesse, die Kamera zu starten. An all die absurd überladenen Trucks, Mofas und Taxis haben wir uns allmählich gewöhnt – aber das...
Die Fahrt zum Flughafen dauert eine Stunde, aber ohne Zwischenhalt mit Besichtigung geht’s einfach nicht. Tunlin führt uns in eine Goldplättchen-Werkstatt. Aus einem feinen Streifen 22-Karat Gold werden hauchdünne kleine und grössere, meist quadratische Plättchen auf traditionelle Art hergestellt, die dann dazu dienen, den Buddha zu bekleben, damit – ja, weshalb eigentlich? Damit er dick und feiss wird und man ihn unter dem Goldmantel gar nicht mehr erkennt. Er freut sich sicher über jeden Kleber sehr. Die jungen Männer, die wie in der Schmiede im Takt auf das Metall einhämmern, damit es dünner wird als Pergament, arbeiten wie Sklaven.
Die Autobahn ist halb leer. Sie kostet halt. Da macht’s auch nichts, wenn mal ein Mofa-Fahrer entgegenkommt oder eine Kuh-Herde über die Fahrbahn getrieben wird. Wen kümmert das denn schon?
Um halb zwei sind wir am Ziel. Herzliche Verabschiedung natürlich. Immerhin waren wir achtzehn Tage lang mit Tunlin zusammen. Er hat sein Bestes gegeben und uns, seine Familie, wie er sagt, für besagte Zeit grossartig betreut. Sein Karma muss unheimlich gewachsen sein in den letzten zwei Wochen. Er fährt jetzt zurück nach Yangon, besucht aber unterwegs seine Eltern, bleibt dort ein paar Tage, bevor er zu Frau und Kind nach Hause fährt.
Security und Check-In verlaufen problemlos. Keine Minute müssen wir anstehen.
Mit fast einstündiger Verspätung fliegen wir in ungefähr neunzig Minuten zurück in die ehemalige Hauptstadt, die im Herzen der Burmesen noch immer die Hauptstadt geblieben ist.
Es regnet in Strömen, wie wir ankommen. Beim Aussteigen allerdings hört der Regen grad auf und wir gelangen trockenen Fusses (der „Rest“ bleibt auch trocken – seltsame Redenswendung eigentlich) ins Flughafengebäude. – Dort werden wir bereits erwartet von einem Taxifahrer, der von Tunlin engagiert und auch bereits bezahlt wurde. Dieser fährt uns ins Chatrium Hotel, wo wir schon nach unserer Ankunft in Myanmar zwei Tage lang gewohnt haben. Unser Koffer, den wir nicht auf die Rundreise mitgenommen haben, wird uns gebracht und ich denke einmal mehr, wir haben viel zu viel eingepackt und mitgebracht. Eigentlich hätte auch die Hälfte gereicht.
Wie vor drei Wochen essen wir im japanischen Restaurant, das zum Hotel gehört, ein feines Buffet ist aufgestellt, und gehen dann satt und zufrieden in die Klappe.
Montag, 23. Oktober
Der Hotel-Shuttle-Bus bringt uns ins Stadtzentrum, wo wir bereits mit Tunlin waren.
Schon wollte ich schreiben: „Es ist unser letzter Tag in Myanmar und trotz der gewöhnungsbedürftigen und abenteuerlichen Fahrweise der Burmesen haben wir nie einen Unfall gesehen“. Nur einmal beinahe. Aber jetzt liegt doch ein Kleinbus auf der Seite am Strassenrand. Hoffentlich haben’s die Insassen überlebt. Die Polizei ist zur Stelle und regelt den Verkehr.
Im zwanzigsten Stock des Sakura-Towers hat’s eine Sky-Bar. Von dort aus hat man eine herrliche Aussicht über die Stadt. Wir sind die einzigen Gäste. Wir bestellen Kaffee; von vier Kellnern werden wir bedient.
Ganz in der Nähe befindet sich auch ein grosses Shoppingcenter. Mich nimmt wunder, wie ein solches in einer Stadt wie Yangon aussieht (gute Ausrede...). – Modern, aufwändig dekoriert, grosszügig ausgebaut, mit unter anderem den üblichen Markengeschäften – so wie überall. Trotzdem kommt es mir wie ein Fremdkörper vor. Allerdings läuft nicht viel, obwohl die Waren viel günstiger sind als bei uns. Aber Kleider kaufen (abgesehen davon, dass unsere Koffer strikte dagegen sind) könnte ein schwieriges Unterfangen werden - die Asiaten lieben es SEHR bunt, und Blusen ohne Fledermausärmel sind im Moment offenbar nicht in Mode.
Ich kaufe mir im Markt nebenan dann doch noch eine Bluse, obwohl Theo sie „fast ein wenig zu lebendig“ findet. – Muss er’s halt in Kauf nehmen, mit mir und der farbenprächtigen Bluse „in den Ausgang zu gehen“, um es so zu formulieren, wie sich meine Schülerinnen und Schüler jeweils ausgedrückt haben. (Gegen meine Korrektur dieser Ausdrucksweise waren sie allesamt konstant und einhellig beratungsresistent.)
Auch weckt die Episode in mir die Erinnerung an meine Mutter. - Sie hätte dazu wohl in ihrem Hamburgerdialekt gesagt: „Bunt wie Schümann’s Mutter ihr Unterrock“.
Mit „lebendig“ versuchte mir Theo vermutlich durch die Blume mitzuteilen, dass er das Kleidungsstück abscheulich findet. Ich habe meine Lesebrille grad nicht auf und sehe nicht, was auf dem Stoff abgebildet ist. Theo erwähnt etwas von „Langusten oder Hummern“ auf grünem Grund (jetzt, wo ich’s schreibe, kommt es mir auch ein wenig speziell vor…). Später sehe ich dann, dass es rote Papageien sind, die der Schneider oder die Schneiderin wohl unabsichtlich auf der Vorderseite verkehrt herum zusammengenäht hat. Sie hängen alle auf dem Kopf. Am Ärmel allerdings nicht, das ist doch wenigstens schon etwas. Auch die Rückseite ist gut geglückt. – Nun, sie ist total bequem, hat so wenig gekostet, dass ich gegen meine Gewohnheit nicht im Traum an Märten gedacht habe. - Und ich liebe sie jetzt schon.
Wir nehmen ein Taxi und fahren zurück ins Hotel. Ein wenig am Pool auszuruhen, ist jetzt gerade das, was wir brauchen.
In einem Reiseführer habe ich gelesen, ein schönes Erlebnis sei es, sich in der Belmond Governor’s Residence einen Drink (Sun-Downer) zu genehmigen. Mit dem Taxi fahren wir hin, grad bei Sonnenuntergang. Und ja, das ist eine gute Empfehlung. Die Drinks sind speziell gut, und wir beschliessen, dort zu essen. Exquisit präsentiert und zusammengestellt ist das Dinner ein absoluter Höhepunkt vom Kulinarischen her gesehen. – Sehr aufmerksamer Service und Schweizer Preise, aber das ist nicht weiter erstaunlich.
Das Hotel selber ist eine herrliche Oase, friedlich und ruhig, und man hat das Gefühl, in die Kolonialzeit zurückversetzt zu sein. – Ein gediegener letzter Abend.
Morgen müssen wir dieses schöne Land mit seinen freundlichen, liebenswerten Menschen verlassen, die von ihren Buddhas, Stupas, Pagoden und Klöstern nie genug bekommen können und deren Lieblingsfarbe – da besteht kein Zweifel - Gold sein muss.
Dienstag, 24. Oktober 17 - Abreise
In einer Stunde sind wir am Flughafen. Alles geht reibungslos, aber bei der dritten Sicherheitskontrolle innerhalb einer Zone von nicht mehr als hundert Metern, die immer genau gleich abläuft, auch mit Leibesvisitation, frage ich dann doch die hübsche junge Beamtin, was das eigentlich soll. Eine Antwort erhalte ich zwar nicht, Englisch ist eindeutig nicht eine ihrer Stärken, dafür schenkt sie mir ein entwaffnendes Lächeln. Jetzt ist Theo am Ball. In seinem Handgepäck befindet sich zur Abwechslung wieder mal etwas, das laut Vorschrift nicht dort hineingehört. – Ein Feuerzeug ist es diesmal, das allerdings bereits seit Zürich mit uns gereist ist. Es ist nota bene keines dieser ganz billigen. Ein erfahrener burmesischer Sicherheitsbeamter ist der stolze Finder. Theo zeigt, dass es gar nicht funktioniert, wird aber gnadenlos angewiesen, den Stein des Anstosses in einen Container zu werfen. Ich stehe ein paar Meter weiter weg, schaue dem Geschehen mit finsterer Miene zu, und murmle ein paar unmissverständliche Worte auf Berndeutsch vor mich hin.
Wir setzen uns auf die Sessel im Gate und warten, bis unser Flug aufgerufen wird. Keine fünf Minuten dauert es, da sehen wir die beiden Sicherheitsbeamten, die uns vom oberen Stock her zuwinken und zurufen, Theo solle nochmals zu ihnen raufkommen. – Und oh Wunder! – Sie geben ihm sein Feuerzeug zurück. – Ich fasse es ja nicht… Meine Version ist, dass sie nicht wollten, dass unser allerletztes Erlebnis in Myanmar ein negatives bleibt. – Möglicherweise hat mein Kopfschütteln zu diesem Umdenken beigetragen. Oder hat jemand eine bessere Erklärung?
Drei Stunden dauert der Flug bis nach Kuala Lumpur. Weitere neunzig Minuten haben wir „verloren“. Jetzt also beträgt der Zeitunterschied zur Schweiz sechs Stunden. Wir müssen weitere dreieinhalb Stunden auf den Anschlussflug nach Perth warten. Ich nutze die Zeit, um ein wenig an diesem Reisebericht herumzubasteln. Und ihn dann auch zu beenden.
Pünktlich fliegen wir ab. Die Bestuhlung ist sehr eng gehalten, mir tun schon nach kurzer Zeit die Kniescheiben weh. Wie wird’s nur Leuten gehen, die viel grösser sind als ich? Auch gibt’s kein Board-Entertainment-Programm (Theos Schnarchen kann man ja nicht als solches bezeichnen). Vergeblich suche ich den Bildschirm, der üblicherweise im Vordersitze angebracht ist. Ich hatte mich schon auf einen Film gefreut. Nun, es ist ja ein Nachtflug und er dauert nur sechs Stunden. Ein Nachtessen wird serviert, dann lese ich ein wenig (zum zweiten Mal und zur Einstimmung den absolut amüsanten Reisebericht „Down Under“ von Bill Bryson) und schlafe dann tatsächlich ein. Wenigsten etwa für ein Stündchen.
Reisebericht Australien
Perth - Fremantle – Pinnacles – Wave Rock – Margaret River – Baldivis
Als wir kurz nach ein Uhr morgens in Perth ankamen, musste ich als Erstes meine Woll- und die Regenjacke hervorkramen, denn es war so kalt, dass ich fand, eigentlich hätten wir bei den Temperaturen grad so gut zu Hause bleiben können. - 12 Grad nur.
Fremantle
Autobezug und Fahrt zum ersten Haustausch in South Fremantle, wo wir um drei Uhr morgens trotz der frühen Stunde herzlich von unseren Gastgebern, Jan und Russell Candy, begrüsst wurden. - Am nächsten Morgen machten wir mit ihnen einen Spaziergang durchs Quartier und gingen fein frühstücken. Am Mittag fuhren sie mit ihrem Camper in die Ferien und überliessen uns ihr Haus.
Leider war’s die ersten paar Tage nicht sommerlich warm und schön, wie wir es erwartet hatten, aber zum Ausspannen, den Reisebericht fertig schreiben, die Fotos dazu aussuchen, war mir’s gerade recht. Wir nahmen‘s also wesentlich gemütlicher als während der drei Wochen zuvor. – Ferien endlich!
Fremantle ist der Hafen von Perth und einer der zahllosen Vororte. Schön am Meer gelegen, gefiel uns der Aufenthalt dort sehr: breite, gepflegte Strände und nette Restaurants mehr oder weniger vor der Haustüre.
An den „Fremantle-Doctor“ mussten wir uns allerdings erst gewöhnen. Dies ist ein kühler Südwind, der jeweils am frühen Nachmittag aufkommt und einem den Strandbesuch vorzeitig verleiden lässt. – Schnell haben wir gelernt, dass wir bereits am späteren Morgen Baden gehen müssen und nicht erst nach dem Mittag.
Ein Art-Festival fand grad statt und auf einem Entdeckungsspaziergang durch den Ort hörten wir den Vortrag eines Schweizer Künstlers (Felice Varini), der sein Werk erklärte, nämlich, wieso er die Hauptstrasse in der Stadt mit gelben Kreisen versehen hatte (optical illusion artwork). Auch wenn mir sowohl die Idee als auch das Produkt gefallen hat, weiss ich leider auch nicht mehr, was genau für künstlerische Überlegungen dahinterstecken. Es könnte sein, dass mir die Erklärung nicht einleuchtete oder aber sie war mir zu hoch. Einerseits fand ich die Idee nämlich genial, andererseits war mir nicht ganz klar, was sie bringt. - Von genau einem Ort aus, dem Roundhouse, dem ältesten Gebäude in Westaustralien (dort befand sich das erste Gefängnis, das 1830 errichtet wurde), sieht man die Kreise perfekt, und wenn man anschliessend durch die Highstreet geht, erkennt man an jedem Haus, sogar an der Kirche, wie und wo gelbe Farbe angebracht worden war, um diesen speziellen Eindruck zu vermitteln. Manchmal wurde ein Teil einer Fassade eingefärbt und manchmal brauchte es nur einen kleinen Farbfleck. Die Planung mit den Behörden und anschliessend die Ausführung stelle ich mir relativ schwierig vor.
Die zehn Tage dort vergingen im Flug. An einem Tag besuchten wir Perth – eine hübsche Stadt, schön gelegen am Swan River. Vor zwanzig Jahren war ich zum ersten Mal dort, wiedererkannt hätte ich die Metropole mit fast zwei Millionen Einwohnern aber überhaupt nicht mehr. Überall wird gebaut; nur ein paar Häuser gibt es noch, die an die Kolonialzeit erinnern. Im Zentrum stehen jetzt mehrere Wolkenkratzer und am Flussufer ist die Esplanade entstanden zum Flanieren und Verweilen. Erst vor etwa zwölf Jahren wurde mit der Ausebnung des Gebietes und dem Bau begonnen.
Und schon sehr speziell: Die nächstgelegene Grossstadt ist knappe 2'000 km entfernt. Die Distanzen sind gewaltig. Sehr praktisch sind die Bus- und Zugverbindungen, Busse in der Innenstadt, auch in Fremantle, sind gratis und verkehren alle zehn Minuten. Das wär‘ doch was für Bern…
Ein paar eindrückliche Museumsbesuche liessen wir uns nicht entgehen. Was uns auch immer gefällt ist die Street- oder Graffiti-Art.
Pinnacle-Destert
Das Auto, das wir gemietet hatten, musste aber auch bewegt werden und so planten wir einen Ausflug zur Pinnacle-Desert im Nambung-Nationalpark. Drei Stunden hin, drei wieder zurück, aber das Reisli in die Wüste hat sich gelohnt: Man fährt in den Park hinein, muss beim Gate seine Tantiemen fürs Parkieren abladen, fährt ein paar Meter weiter und schon ist man, wie aus dem Nichts, mitten in einer unglaublichen Landschaft voller dunkelgelber Felsformationen, die wie die Menhire in der Bretagne aus der Erde ragen - hier aus dem Sand. Und überall sind sie, so weit das Auge reicht, kleine und grosse, teilweise dicht aneinandergedrängt oder in losen Gruppen, keine gleich wie die andere. Im Hintergrund weisse Dünen, darüber der tiefblaue Himmel; der Anblick ist atemberaubend.
Ein Abstecher an den Lake Thesis war ebenfalls interessant. Nur an wenigen Orten in der Welt findet man noch Stromatolithen. Was das sind, wusste ich auch nicht, aber jetzt natürlich schon, mehr oder weniger zumindest. Um genau zu begreifen, was die „Steine“ für eine Bewandtnis haben, müsste man Erdforscher sein. Es sind Fossilien und sie werden als die ersten erkennbar durch Organismen aufgebauten Gebilde, also die erste Form von Leben auf unserem Planeten angesehen. Vor mehr als 3,5 Milliarden Jahre haben sie begonnen zu existieren, so wird geschätzt. Sie befinden sich im Wasser nahe am Ufer und sehen aus wie eine unbewegliche Wasserschildkröten-Kolonie.
Noch etwas weiter nördlich assen wir in einem Pub eine Kleinigkeit zu Mittag. Das Kaff (Fischerdorf) heisst Cervantes und alle Strassen im Ort haben spanische Namen (García-Road, Cadiz Street, Cordoba Way etc.). Spanier waren allerdings nie dort, aber ein Schiff, das so hiess, versank 1844 vor der Küste. Das Dorf ist erst etwa sechzig Jahre alt und hat gemäss Wikipedia eine Einwohnerzahl von 461 (im Jahr 2011).
Wie man dort leben kann/will, so weit weg von allem, ist mir ein Rätsel. Aber das gehört ja ein wenig zu Australien. Ziemlich alles ist ziemlich abgelegen…
Wave Rock
Das fanden wir auch, als wir eine Woche später nach Hyden fuhren. Wie man dort leben kann…
Um halb acht schon (!) ging die Reise los. Einen Umweg machten wir, zwecks Frühstück-Einverleibung, über das historische Städtchen York. Um halb zehn waren wir dort. Diesen Abstecher hatte man uns empfohlen. Eine gute halbe Stunde lang mussten wir auf unseren Kaffee und auf die Eggs Benedict warten (Zeit spielt in so einem verlassenen Flecken Erde wohl keine grosse Rolle), was meine Laune momentan nicht gerade hob, denn wir hatten ja noch immer knappe drei Stunden Fahrt vor uns. Trotzdem – ein hübscher Ort, der uns an die Dörfer im Wilden Westen erinnerte.
Weiter auf dem Weg zur grossen Welle gab’s ausser Strasse, Eukalyptusbäumen und Busch nicht viel zu sehen. Ah doch, da wird der Hundefriedhof in Corrigin im Reiseführer erwähnt. – Wenn’s sonst nichts hat in dieser einsamen, trockenen Gegend, sehen wir uns den halt an.
Nur aus wenigen Häusern besteht Hyden (281 Einwohner), eines davon zum Glück ein Hotel/Motel. Dort übernachteten wir und hatten ein feines Znacht. Man sucht sich das Fleisch aus, das man gerne essen möchte, zahlt und bereitet es sich dann selbst zu auf dem grossen Grill im Restaurant. Gewürze und Saucen sind vorhandene, ein Salat- und Gemüsebuffet ebenfalls sowie andere Gäste, mit denen man eventuell ins Gespräch kommt. Sein Steak selber zubereiten – eine ziemliche Herausforderung für Theo. Manchmal ist das Leben einfach hart.
Wieso wir aber so weit gefahren sind, bis zum viel zitierten Outback, durch den sogenannten Weizengürtel, der jetzt gegen den Sommer hin immer gelber und gelber wird, immer dürrer und dürrer, hat folgende Bewandtnis: Es gibt einen Felsen, den Wave Rock, der aussieht wie eine riesige Welle und den wollte ich unbedingt sehen. – Irgendwie ist es schon erstaunlich, was einen anzieht und wieso. - Und auch hier fand ich, die fünf Stunden Fahrt dorthin auf endlosen Strassen fast ohne Verkehr hat sich gelohnt. Man kann gar nicht nicht beeindruckt sein. Die Welle ist riesig, 110 Meter lang, 15 Meter hoch und 2,7 Millionen Jahre alt.
Wenn man oben draufsteht, hat man eine herrliche Aussicht über das weite Land.
Wir waren nicht die Einzigen, die sich von diesem Naturwunder angezogen fühlten. Ein paar Japaner waren auch mit ihren Fotoapparaten zur Stelle, eine Schweizer Familie ebenfalls. Das Motel war ziemlich gut belegt.
Ganz in der Nähe gab‘s auch eine Höhle (Mulka’s Cave) zu besichtigen, in welcher der Legende nach ein Aborigine gelebt haben soll (eine Art Romeo- und Julia-Geschichte, die dann in eine Kindlifresser- und Motherkiller-Story abdriftet). Diese (die Höhle) besuchten wir ebenfalls. Speziell sind die Handabdrücke, die man an den Wänden erkennen konnte, welche Hunderte von Jahren alt sein sollen.
Speziell auch die vielen Fliegen, die dort herumschwirrten auf der Suche nach Flüssigkeit. Die Quellen vermuteten sie in den Gesichtern der Touristen. – In erster Linie könnten sie in den Nasenlöchern, dem Mund, in den Augen und Ohren fündig werden, so dachten sie sicher. Wenn man nicht ständig herumfuchteln und dabei fast verrück werden wollte, tat man gut daran, einen Mücken-Gesichts-Schleier zu tragen. Damit hatten uns unsere Gastgeber glücklicherweise ausgerüstet.
Ein schöner, fast einstündiger Spaziergang (Bush-Walk) war ausgeschildert und führte durch die felsige, trockene und verlassene Landschaft. Die Blumen, die wild dort wachsen, waren eine Pracht.
Die Fahrt zurück am nächsten Tag war dann noch länger - 500 km, für die wir sechseinhalb Stunden brauchten – neun Stunden, wenn man die Aufenthalte mitrechnet. Wir fuhren aber nicht direkt nach Perth; etwa dreihundert Kilometer südlich der Stadt hatten wir noch zwei Nächte gebucht in Margaret River, einem bekannten Weingebiet.
Die Strecke führte an einem sehr eindrücklichen Salzsee (Lake Grace) vorbei, wo’s den ersten Kaffee-Halt gab, und dann hiess es wieder Kilometer für Kilometer unter die Räder nehmen, erneut durch den Wheat-Belt, durch Farmgebiete, die zum Teil grösser sind als ein mittelgrosser Kanton in der Schweiz.
Die Strasse ist zweispurig, meistens schnurgerade, man kann fast immer 110 km/h fahren, nur selten begegnet einem ein anderes Auto oder ein „Road-Train“, ein ellenlanger Lastwagen, der oft Benzin, Tiere oder sonst irgendwelche Waren transportiert. Wenn ein solcher an einem vorbeibraust, tut man gut daran, die Fahrt zu verlangsamen und auszuweichen, wenn man vom Windsog hinterher nicht in den Busch transferiert werden will.
An einem idyllischen See, dem Dumbleyung Lake, machten wir einen kurzen Abstecher und in Wagin den nächsten Halt. „Sehenswert“ in diesem Ort ist der „Giant Ram“, ein fast zehn Meter hoher Schafsbock aus Polyester (glaube ich wenigstens). Wert gelegt wird auf der Webseite der Stadt, dass der Bock anatomisch korrekt dargestellt ist… Keine Ahnung, wieso die Australier eine derartig wundersame Vorliebe haben für solche absurden Riesendarstellungen von irgendwas. - Ein sehr lustiger Abschnitt ist in Bill Brysons Buch „Down Under“ oder auf Deutsch „Frühstück mit Kängurus“ nachzulesen. Auch er kann nicht verstehen, was es mit dem „Big Lobster“ oder der „Big Banana“ (die wir vor vier Jahren in Bayron Bay gesehen haben) genau auf sich hat. - Ziemlich skurril das Ganze, aber natürlich und gerade deswegen eine Foto wert.
Der nächste Halt in Collie: Diesmal, weil Theo Siesta machen musste (d. h. sich 20 Minuten im Schatten eines Baumes ins Gras legen mit dem Baseball-Cap über dem Gesicht [und eventuell dazu ein wenig schnarchen]), weil er als Beifahrer ja so müde wird, und ich lieber mal einen Kaffee trinke, damit mich die monotone Fahrerei nicht einschläfert.
Weingebiet im Südwesten – Margret River
So gab’s doch immer wieder mal einen Unterbruch während der langen Reise. – Ich war froh, als wir endlich gegen fünf Uhr nachmittags in Margret River ankamen und unser Motelzimmer beziehen konnten.
Wenn ich jetzt auf der Karte nachschaue, wo wir überall durchgefahren sind, so ist das eine beinahe lächerlich kurze Strecke im Verhältnis zu diesem riesigen Land.
Margaret River sieht sehr touristisch aus, es gibt viele kleine Läden und auch Cafés, aber die allermeisten schliessen bereits um fünf und so war es dann fast ein wenig schwierig, irgendwo essen zu gehen. Die Dame an der Rezeption, die ich gefragt hatte, ob sie uns ein Restaurant empfehlen könne, sagte, das sei wirklich schwierig, weil es sooo viele habe. Aber eben: Weder McDonald noch Subway waren was wir suchten. Ein Pub war offen und der natürlich „packed“ - Biertrinker in erster Linie.
Erst am nächsten Abend fanden wir ein Lokal, das uns sehr gefallen hat mit guten Drinks und vorzüglicher Küche: „Morries“ (benannt nach dem Buch von Mitch Albom, das ich vor Jahren mal gelesen habe: „Tuesdays with Morrie“).
Die Gegend dort im Süden ist sehr belebt und viel besucht. Es gibt den Bussell-Highway, der von Augusta bis nach Bunbury führt, im südlichen Teil durchs Weingebiet. Schöner und mit viel weniger Verkehr aber fährt man entlang der Cave Road durch Eukalyptus-Wälder und landwirtschaftliches Gebiet bis nach Yallingup. Überall gibt es Wegweiser zu den unzähligen Weingütern, eines schöner gelegen als das andere. Jedes aufs Raffinierteste gepflegt, man hat das Gefühl, ein Heer von Gärtnern sei täglich damit beschäftigt, Rosen zu giessen und mit der Nagelschere den Rasen zu pflegen. Einige Winerys sind ganz versteckt – ohne Landkarte würde man sie überhaupt nicht finden. – Die Weine haben zum Teil stolze Preise, sie sind ja schliesslich auch oft „award-winning“. Im Pub zum Beispiel, wo wir am ersten Abend waren, konnte man ein Glas speziellen Weins bestellen – 1 dl zu 45 AU$, also etwa 35 Franken… Ich liess es.
In den Wäldern gibt es Kängurus; meine grosse Angst war (und ist es immer noch), mal eines anzufahren, aber zum Glück ist das nicht passiert. Nur fast. Zwei Tiere wollten grad die Strasse überqueren. Eines blieb am Strassenrand stehen und das andere drehte sich um, konnte grad noch rechtzeitig die Flucht ergreifen und in den Wald hineinhopsen. Theo rief ihm nach: „Gumpi-Tante“. – Das brachte mich sehr zum Lachen.
Auch eine Höhle besichtigen wir, „Jewel Cave“ - die grösste in Westaustralien. Sie ist eindrücklich, der Besuch eine gelungene Abwechslung. Die Rangerin führte uns während einer Stunde durch die gut ausgebauten Pfade, treppauf, treppab und erklärte, was es eben zu erzählen und zu erklären gibt, ganz in der Manier der Amerikaner und Australier – sie sprach zu uns wie zu einer Kindergartengruppe.
Wunderbare Strände, beeindruckende Felsformationen, Blumen und Bäume vom Schönsten, nette kleine Cafés, Eis-Stuben, Kunstgalerien – das alles findet man ebenfalls in dieser Gegend.
Erholung für Theo nach „all dem Stress“ muss auch immer wieder sein. Ein vorzüglicher Ort, dies zu „erledigen“, bot sich an in Augusta, an der Flinders Bay, wo der Blackwood River in den Indischen Ozean mündet.
Was für ein Unterschied zwischen den drei Wochen in Myanmar und der Zeit nun in Australien:
Hier Städte, die sich über Dutzende von Quadratkilometern erstrecken, ein Bungalow neben dem andern, alles neue Quartiere - dort kleine Dörfer mit zum Teil armseligen Hütten. Hier „alte“ Bauten aus der Kolonialzeit, keine zweihundert Jahre alt und dort Tempel, Pagoden und Stupas aus längst vergangenen Jahrhunderten.
Die Verkehrssituation könnte unterschiedlicher nicht sein. Niemand fährt hier schneller als vorgeschrieben, gesitteter geht’s gar nicht. Und in Myanmar scheint’s überhaupt keine Vorschriften zu geben.
In beiden Ländern aber sind die Menschen überaus nett und freundlich. Das ist eine Gemeinsamkeit.
Die Australier sind ein „Völklein“ für sich, eine Art Mischung zwischen Engländern und Amerikanern.
„No worries“ ist eine ihrer Lieblingsredensarten. Auch wenn man weit davon entfernt ist, sich irgendwelche Sorgen zu machen, kommt diese beschwichtigende Bemerkung stets daher. – Frage ich im Supermarkt, wo’s Eier hat - „no worries“ und man zeigt mir, wo. - Da bin ich natürlich schon froh, dass meine Sorgen ein Ende haben, hatte ich doch schon befürchtet, dass es in diesem Laden eventuell gar keine Eier vorrätig hat. Ich bedanke mich. – „No worries“, kriege ich zur Antwort.
Auffällig ist auch das Adjektiv „award-winning“, das so oft gebraucht wird, dass es schon gar keine Auszeichnung mehr sein kann. Weine und Weingüter sind „award-winning“, Restaurants sowieso, jedes zweite Info-Zentrum ebenfalls. Es müssen wohl landauf, landab fast monatlich solche Auszeichnungen vergeben werden, so viele davon hat es.
An den australischen Slang muss man sich erst wieder gewöhnen. Ob ich „Chaise“ haben wolle in meinem Burger? – Da muss ich erst mal überlegen. - Käse, natürlich, aber nein, „please no cheese“. – „No worries“. - Sorgen natürlich auch lieber keine im Burger.
Was mir unter anderem an ihnen sehr gefällt, ist, sie haben Humor.
In dem Zusammenhang kommt mir der Witz in den Sinn, wo einer bei der Einreise nach Australien vom Zöllner gefragt wird: „Did you come today? (ausgesprochen „to die“ (zum Sterben) – Die Antwort: „No, I’ve just come for a holiday“.
Aber immerhin: Mit „Heloi“ als Begrüssung ist man dabei.
Und dass ich hier mit „Honey“ oder „Darling“ angesprochen werde (im Supermarkt an der Kasse zum Beispiel), kenne ich bereits aus England. - Ist doch schön, dass diese guten, alten britischen Sitten auch in Down Under erhalten geblieben sind.
An einem Tag besuchten wir das Swan Valley, eines der schönsten und bekanntesten Weingebiete in Australien. Von Perth aus ist es nur gerade eine knappe Stunde Fahrt mit dem Auto. Weil es so viele Weingüter hat und wir nur etwa vier besuchen wollten, dachte ich, es wäre von Vorteil, im „award-winning“ Informations-Center in Guildford eine Karte der Region und ein paar Ratschläge zu holen.
Wir wollten auch irgendwo zu Mittag essen – möglichst an einem schönen Ort. Nicht alle Weingüter haben Restaurants, so dachte ich, wir lassen uns beraten. Oft eine gute Idee, diesmal – na ja… Da war ein pensionierter Herr, ein freiwilliger Mitarbeiter, wie es sie in manchen dieser Info-Stellen gibt. Bereitwillig erklärte er uns, was es im Valley, das er wie seine Hosentasche kennt, alles zu sehen gibt. Auf der Karte zeichnete er ein, wo wir als Erstes mal einen Kaffee trinken könnten (etwa sieben Empfehlungen), wo eine Winery besuchen, ein Pfeil folgte dem anderen, bis die Karte voller Pfeile, Striche und Kreise war - die Beratung nahm kein Ende, zwanzig Minuten bereits vergangen. – Und waren so klug als wie zuvor…
Nicht nur Wein, sondern auch Käse wird angeboten:
Zum Glück ist das Tal nicht allzu lang. Anhand einer jungfräulichen Karte, die ich dort aus einem Regal nahm, fanden wir ein paar schöne Orte zum Degustieren, zum Verweilen, zum Spazieren und schliesslich auch zum Lunchen in einem idyllischen Weingut. Gegen vier Uhr fuhren wir durch die Perth Hills zurück nach Fremantle.
Baldivis
Unser zweiter Haustausch war in Baldivis, einem Vorort von Perth, etwa 50 km südlich des Zentrums.
Kareen und Stuart Dunlop, unsere Gastgeber (sie waren im Sommer ein paar Tage in Bivio), sind äusserst liebenswerte Tauschpartner. Sie haben uns nach Strich und Faden verwöhnt, uns bekocht vom Feinsten und uns herumgeführt an Orte, die wir ohne sie vermutlich nie gefunden hätten. Zur Abwechslung musste ich mal nicht Autofahren; das kam mir sehr gelegen.
Stuart zeigte uns die besten Strände (mit und ohne Wind). Strandstühle, Kühlbox und Sonnenschirm kamen selbstverständlich mit und in Rockingham gab’s als Zugabe eine Kunstausstellung am Strand – alle Werke aus natürlichen oder rezyklierbaren Materialien. – Dort, an der Strandpromenade war es auch, wo wir am zweiten Abend essen gingen und als weitere Zugabe zuschauen konnten, wie die Sonne langsam im Meer versank.
Manchmal waren wir auch allein unterwegs und machten Tagesausflüge. Zum Beispiel an die Serpentine Falls, wo man zur Abwechslung in einem Süsswasserbecken unterhalb eines Wasserfalls baden kann. - Oder nach Jarrahdale, einem Ort, der früher für den Holzabbau bekannt war. Weingütern begegnet man sozusagen auf Schritt und Tritt, in dieser Gegend ebenfalls, so kommt man kaum darum herum, auch dort ein Auge hinzuwerfen und ein Gläschen zu trinken. Das funktionierte sehr gut in der Millbrook Winery. – Auch den Kängurus gefällt es, in den Weinbergen zwischen den Reben herumzuhopsen.
Am unserem letzten Tag fuhren wir gemeinsam nach Mandurah, einer Trabantenstadt, 70 km südlich von Perth. Die Stadt liegt am Meer, ist rasant gewachsen, besteht fast nur aus neuen Häusern, viele davon liegen an Kanälen, so dass man sein Boot oder seine Yacht grad gäbig vor der Haustür stationieren kann. Kleine Brücken und der Stil der Bauten erinnern fast ein wenig an die Toskana, was sicher auch die Absicht der Architekten war. An den Wochenenden, so hab ich gelesen, hat der Ort mit 300‘000 Gästen fast dreimal so viele Bewohner wie während der Woche.
Ein Spaziergang am Lake Clifton führte uns zu den sogenannten Thromboliten, die ähnlich wie die Stomatholiten im Lake Thetis ebenfalls lebende Fossilien sind. So nennt man sie auch „lebende Steine“. Zusammen bildeten diese Einzeller vor Jahrmilliarden die erste Sauerstoff-Atmosphäre auf der Erde. Auch sie sehen aus wie runde Steine, sind aber eine fürs Auge nicht sichtbare Anhäufung von Mikroorganismen, meistens bestehend aus feinen Schichten von Kalkstein - die früheste Form von Leben auf der Erde. Diese hier sind zwar „nur“ ungefähr 2000 Jahre alt, aber ihr Anblick fasziniert, auch wenn man kein Erdgeschichte-Freak ist. Schlicht und einfach beeindruckend!
Am selben Nachmittag, währendem Kareen zu Hause diverse Sorten von Pizzas für unser letztes gemeinsames Abendessen vorbereitete, fuhr Stu mit uns nach Perth in den Kings Park, einen der schönsten botanischen Gärten des Kontinents. – Wie gut, dass wir den Park nicht schon früher auf eigene Faust besucht hatten, denn Stu weiss über alle Bäume, Sträucher und Blumen bis ins kleinste Detail Bescheid, kennt ihre Namen, auch die lateinischen (australisch ausgesprochen zwar, was recht seltsam klingt); er weiss, in welcher Weise die Aborigines von ihnen Gebrauch gemacht haben - es war ein interessanter und äusserst lehrreicher Nachmittag.
Eine herrliche Aussicht auf die Skyline der City hat man von dort aus, das kommt noch dazu.
Und schon waren auch weitere zehn Tage unserer Reise vorbei.
Restaurants
P.S. Hier noch ein kleiner Exkurs: Ich schaue ja immer gerne bei Tripadvisor nach, welche Restaurants in der näheren Umgebung, wo wir uns gerade aufhalten, empfehlenswert sind. – Die Bewertungen sind teilweise recht aufschlussreich.
Am schönsten sind die, die mit Google-Translator aus dem Englischen ins Deutsch übersetzt wurden. - Ich frage mich, wie viele Jahre es noch dauern wird, bis sie tatsächlich dem ursprünglichen Text entsprechen. – Nett ist ja dann immer noch am Schluss die Frage: „War die Übersetzung hilfreich?“
Über Frühstück in York wollte ich Informationen. – Sehr nützlich das folgende Feedback:
Terrace Fruit Veg And Cafe
www.tripadvisor.de/ShowUserReviews-g495089-d3194398-r382612657-Terrace_Fruit_Veg_And_Cafe-York_Avon_Valley_Western_Australia.html#REVIEWS">Sehr zufriedenstellend
Ich entschied mich schreien, um dies Morgen Frühstück und froh, dass ich das gemacht habe. Reizend Speck, Eier und Hash Brown. An was ich kalt nicht beenden. Noch besser war meine sehr heiß, heiße Schokolade.
Und Dinner – ein Restaurant in Adelaide:
Wir nur für das Abendessen an einem Donnerstag Abend. Wir hatten das "Futtermittel mich" Menü Option. Keiner von uns waren besonders beeindruckt von der Mahlzeit insgesamt. Herausragende waren die Austern, die ganz offensichtlich frisch geknackte - sehr lecker. Und das Gemüse Teller, oh mein Gott, atemberaubend, das erste Mal, dass ich Brokkoli oder Rosenkohl genossen haben.
Das wär‘ dann doch mal was für Theo. In dem Restaurant könnte er vielleicht auch atemberaubendes Gemüse essen, ohne zu befürchten, schwere gesundheitliche Beschwerden oder Haarausfall davontragen zu müssen… Oh, mein Gott!
Adelaide 12. – 27. November
Am Sonntag, 12. November, brachte uns ein dreistündiger Inlandflug nach Adelaide in den Süden des Landes. Der Zeitunterschied zur Schweiz betrug dann, 1‘800 km östlich, neuneinhalb Stunden. Wir hatten den Tag also fast schon „erledigt“, wenn Bern aufstand.
Daryl Burton und seine Partnerin Christiane Niess waren im Sommer ein paar Tage in Bivio; jetzt ist unser Gegenbesuch an der Reihe, unser dritter Haustausch während dieser Reise. Sie leben hier seit mehreren Jahren und wollen nicht mehr zurück nach Europa. Nur noch während unseres Sommers besuchen sie manchmal ihre ursprüngliche Heimat (GB und Deutschland), weil es dann im Süden von Australien recht kalt ist.
Einmal mehr hatten wir wunderbare Gastgeber gefunden. Sie luden uns ein paarmal zum Essen ein und wir bekamen von ihnen eine ganze Menge nützlicher Tipps.
Die beiden haben ein schönes Haus oben auf dem Mount Lofty (727 m), dem Hausberg hier, mit einem prachtvollen Garten, der in Wald übergeht, und den Christiane vorzüglich pflegt. Wenn’s nicht gerade regnet und neblig ist, was leider öfter der Fall war, hat man auch vom Wohnzimmer unserer hübschen Einliegerwohnung aus eine tolle Aussicht auf die Stadt, sozusagen durch die Blumen.
Kürzlich, als wir heimkamen, raschelte es neben uns im Gebüsch und ein Känguru hopste davon, blieb aber ein paar Meter weiter weg wieder stehen. Wir sahen uns in die Augen, ich sagte ein paar Worte auf Berndeutsch zu ihm, aber die verstand es offensichtlich nicht. Wahrscheinlich schätzte es die Lage ab, ob es einen Rückzug in Erwägung ziehen solle oder nicht. Irgendein Gewächs im Garten schien ihm besonders zu munden. Zwei Stunden später war es immer noch da. Und wieder klappte die Unterhaltung nicht. Es starrte mich nur unentwegt an, bereit zur Flucht. – Gegen Ende unseres Aufenthalts sahen wir es noch oft. Es machte dann auch Siesta und war ganz furchtlos. Weil’s im Garten so schön war, brachte es sogar ein „Gschpänli“ mit.
Ein Känguru (oder gar zwei) im Garten – das war schon ein besonderes Erlebnis.
Alles lief wie am Schnürchen: Eine gute Woche blieben wir bei Christiane und Daryl, dann war eine Woche „Ferien“ beziehungsweise Rundreise im Roten Zentrum geplant. Und nach unserer Rückreise am 27. November durften wir für weitere acht Tage bei unseren Gastgebern wohnen.
Unser erster Eindruck von Adelaide: Sooo grün! Überall hat’s Bäume, Büsche, Blumen, Parkanlagen – gar nicht, wie man sich Australien vorstellt.
Gleich zu Beginn unseres Aufenthalts machte Daryl mit uns eine Stadtrundfahrt. Im Zentrum selber waren wir anschliessend nur ein paar Mal. Ein paar lohnende Museumsbesuche waren der Grund dafür und Einkäufe.
Der Verkehr ist eher mühsam, man verbringt gefühlte Ewigkeiten vor den Verkehrsampeln – die perfekte rote Welle wird hier gepflegt.
Für die Fussgänger ist es noch mühsamer. Und wenn dann endlich grün wird, wird man mit rotem Blinklicht auf die andere Strassenseite gehetzt. – Sonst aber macht Adelaide eher einen gemütlichen Eindruck. Das Zentrum ist gar nicht mal so gross, es hat auch kaum Hochhäuser - viele Pubs dafür, und die werden rege genutzt fürs Feierabend- oder Wochenendbier.
Biertrinken und Wochenend-Feiern sind gross im Trend in Australien, klar, nicht nur hier, aber hier besonders, so scheint mir, und daher auch der Spruch: „The five days after a weekend are the hardest.”
Ausflüge in die Umgebung liebten wir besonders. Und deren gibt es unzählige. Rings um Adelaide gibt es ein Weingebiet am anderen und die galt es natürlich auszukundschaften: Barossa ist ja weltbekannt; was wir allerdings weniger kannten, waren Adelaide Hills (bei uns sozusagen vor der Haustür), McLaren Vale, Fleurieu, Clare Valley und Coonawarra.
Den Ausflug ins Barossa-Valley sparten wir uns für die zweite Woche. In unserer ersten machten wir, wie gesagt, keine grossen Sprünge; an einem heissen Tag klapperten wir ein paar Strände ab und erkundeten die Gegend in den Adelaide Hills. Zum Beispiel besuchten wir Hahndorf, ein deutsches Dorf, zehn Kilometer weiter östlich vom Mount Lofty, in den Adelaide Hills. 1838 gründeten deutsche Siedler (Lutheraner auf der Flucht vor Verfolgung) den Ort, der heute fast 2‘000 Einwohner zählt und eine Touristenattraktion geworden ist. Die deutschen Wurzeln sind unschwer erkennbar in den Beschriftungen der Läden, der Strassennamen und der Art und Weise, wie gepflegt das Dorf aussieht. Der deutsche Bäcker, die deutsche Wurst, der deutsche Pub (da gibt es schon Annäherungen ans Englische).
Dort (man kommt sich vor wie in einer Kneipe im Schwarzwald) nahmen wir einen Apéro. Theo bekam plötzlich einen unheimlichen Appetit auf Sauerkraut. Das musste aber noch warten. Ein Bayer kam hereinspaziert in seiner Tracht - ich traute meinen Augen nicht. Wir kamen ins Gespräch mit ihm (Reinhard). Jeden Donnerstagabend würde er und seine „Truppe“, eine halbstündige Vorstellung geben in einem der Restaurants im Ort. Es war grad Donnerstag und sie waren zu viert. – SEHR speziell, aber diese Vorstellung interessierte mich schon: Da fliegen wir um die halbe Welt und sehen im Süden von Australien einen Schuhplattler. - Deutscher geht’s gar nicht. Wie im falschen Film. Lauter Japaner und Chinesen wohnten dem Spektakel ebenfalls bei - wie wir - bewaffnet mit Kameras.
Reinhard stellte den Zuschauern ein Ehepaar vor. Die beiden feierten an diesem Tag ihren goldenen Hochzeitstag. Das gab’s dann ein „ Hoch soll’n sie leben, holdrio etc…“ und ich dachte mir, ob Theo und ich unseren 50sten Hochzeitstag (schon in fünfeinhalb Jahren) dann auch irgendwo in ähnlicher Weise feiern könnten. – Wär doch eine Option!
Anschliessend hatte auch ich Hunger. Zum Glück bestellten wir nur ein Wienerschnitzel mit Kartoffelsalat plus eine Portion Sauerkraut. Das Fleisch hätte für drei gereicht und die Hälfte des Krauts nahmen wir im Doggie-Bag mit nach Hause.
Acht Tage ins Innere des Kontinents: The GHAN Train – Alice Springs – Uluru – Kata Tjuta – King’s Canyon – Mereenie-Loop – Glen Helen – Alice Springs
Sonntag, 19. November 2017 – Zugfahrt nach Alice Springs mit dem GHAN
Um halb elf brachten wir unser Auto zurück ins Zentrum von Adelaide; die Hertz-Autovermietung ist keine zweihundert Meter vom GHAN-Bahnhof entfernt.
Dort geht’s zu wie am Flughafen, zumindest fast. Die Security-Kontrolle fällt weg, was für eine Wohltat. So bleiben uns diesmal Theos Sackmesser, Schraubenzieher und sonstigen gefährlichen Werkzeuge auf Sicher. Man wird freundlich begrüsst und zum Check-in-Schalter begleitet. Dort zeigt man den Pass, erhält eine Boarding-Card und mit dem Gepäck geht’s gleich wie auf dem Flughafen, es wird gewogen, erhält eine Etikette und rauscht dann übers Rollband irgendwohin in den Hintergrund, hoffentlich auf Wiedersehen.
Anschliessend darf man sich in der Lounge mit Getränken bedienen, soviel man will: Wein, Sparkling, Bier oder alkoholfreie Getränke, was (Letzteres) natürlich nicht in Frage kam.
Wenn wir in die Runde schauten, mussten wir eindeutig feststellen, dass wir das Durchschnittsalter eher herunterdrückten. Es musste sich um eine Art Seniorentransport handeln. Kinder hatte es keine, aber ein paar Rollatoren fuhren mit.
Unser Abteil war klein, klar – keine Suite, aber alles vorhanden, was man braucht, inklusive Bade“zimmer“ mit Dusche und WC. Während man abends am Essen ist, wird die Kabine bereit gemacht zum Schlafen (zwei sehr bequeme Kajüten-Betten mit wohligen Duvets und Kissen) und am nächsten Morgen wird das obere Bett versorgt und man kann sich wieder setzen.
Die Mahlzeiten sind Spitze; so fein und schön serviert hätte ich sie mir nicht vorgestellt. Wein, Bier und auch sonst alle Getränke sind inklusive; Verwöhnung vom Allerbesten.
Der Zug fährt zweimal pro Woche. „Heute“ misst er 972 Meter, es sind 276 Passagiere zugestiegen, die Fahrt nach Alice Springs dauert etwa 27 Stunden (wovon er während etwa vier Stunden in Marla hält). Die Strecke ist 1‘559 km lang. Durchschnittsgeschwindigkeit 85 km/h, Höchstgeschwindigkeit 115 km/h.
Die lange Fahrt kam mir „interweilig“ vor. Langweilig, weil man stundenlang an derselben Kulisse vorbeifährt, interessant, weil gerade diese Eintönigkeit faszinierend ist. Kurz nach Adelaide fährt man an zahllosen Weizenfeldern vorbei, dann allmählich ändert die Landschaft und die Halbwüste beginnt, wo nichts mehr wächst ausser Salzbüschen und ein paar hartgesottene Akazien. Menschen und Tiere sahen wir keine.
Absoluter Höhepunkt war in Marla, wo der Zug gut vier Stunden lang hielt, man aussteigen und Fotos vom Sonnenaufgang machen konnte. Um Viertel vor sechs wurden wir geweckt, um Viertel nach sechs wurden die Türen geöffnet und man konnte aussteigen. Theo aus dem Bett zu kriegen, war eine Tortur, die ich lieber nicht nochmals mitmachen möchte.
Was für ein atemberaubendes Bild sich einem bot! Die von den ersten Sonnenstrahlen beleuchteten Wolken, die sich in den Fenstern des silbernen Zugs spiegelten – umwerfend!
Der „Bahnhof“ in Marla besteht nur gerade aus einer Wellblechhütte, ein Dorf oder Häuser sieht man nicht. Was man aber sieht, sind die beiden Feuer, die das Zugspersonal für all die Passagiere entfacht hatten. Tische und Bänke wurden aufgestellt, ein Frühstücksbuffet mit Getränken, Bacon and Egg – Sliders (eine Art Burger, in dem Speck und ein Spiegelei eingeklemmt sind), frische Früchte, schön in mundgerechte Stücke geschnitten und Gebäck. So hätte ich das nicht erwartet. Es mutete schon ein wenig seltsam an, Mitten im Nichts ein solches Gelage zu veranstalten und so viele Menschen zu sehen, die herumstanden, assen, tranken, spazierten und Fotos schossen.
Schön war auch, den Zug in seiner ganzen Länge zu sehen. Stimmt zwar nicht ganz, denn von dort aus, wo wir standen, sah man weder den Anfang noch sein Ende. Beide Teile verschwanden je im Horizont.
Freude an unserem frühmorgendlichen Besuch hatten auf jeden Fall auch die Mücken. Wahrscheinlich sind der Montag- und der Donnerstagmorgen jeweils ihre Festtage. So eine grosse Auswahl an köstlichen Stech-Gelegenheiten wie zu dem Zeitpunkt, wo der Ghan anhält, werden sie sonst kaum je haben.
Um halb zwei am Montagnachmittag fuhr der Zug in Alice Springs ein. Schade, ich wäre sehr gerne noch viel weiter gefahren.
Nach all den langen Stunden im Zug, wo man durch die endlos scheinende immer gleiche Gegend fährt, kann man fast nicht glauben, dass da plötzlich Häuser stehen, Autos auf befestigten Strassen fahren, man sich in der Zivilisation zurückfindet. – K-Mart, McDonalds (geöffnet sieben Tage pro Woche, denn: „Hunger never sleeps“) – also irgendwie scheint das alles schon ziemlich schräg. Bill Bryson muss es ähnlich vorgekommen sein. Er drückt es so aus: „Alice Springs attracts thousands of visitors to see how remote it no longer is.”
Aber die Stadt, die im Jahr 1954 4'000 Einwohner zählte, jetzt auf 28‘000 angewachsen ist (zusätzlich 6‘000 Aborigines – die zählt man offenbar nicht dazu), war ja schliesslich unser Ziel im Moment, zwei Übernachtungen hatte ich gebucht, ein Auto ebenfalls und einen Flug am kommenden Montag, also in einer Woche.
Den einen Tag in Alice Springs verbrachten wir recht geruhsam: Besichtigung des Desert-Parks (Was – die haben in der Wüste eine Wüsten-Park errichtet???). Sehr sehenswert und lehrreich allerdings. Über 40 Grad am Schatten – unser Hitze-Gewöhnungs-Ausflug. Durch drei Arten von Wüsten kann man wandern und immer wieder gibt’s es Tafeln, die Erklärungen zu Flora und Fauna liefern. Interessant ist auch das Noctarium. Sobald sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, entdeckt man die erstaunlichsten nachtaktiven Tiere wie Schlangen, Spinnen und kleine Säugetiere.
Am Nachmittag dann besuchten wir drei Galerien. Dort wurde ich den Eindruck nicht ganz los dass nicht ganz alles, was einem als Kunst angeboten wird, auch wirklich welche ist. Ich vermute, dass manches, was man in den Galerien kaufen kann, ganz rasch produziert wurde, und jetzt, wo viele Leute auf Aborigines-Kunst „abfahren“, viele sogenannte Künstler auf diesen Zug aufspringen, rasch was auf die Leinwand tüpfeln und das dann als Kunst verkaufen. Interessant war unser Besuch anschliessend in einer Heilsarmee-Werkstatt, wo man zuschauen kann, wie Aborigines (vor allem ältere Semester) Leinwände bemalen. Ein Werk haben wir erstanden.
Auch das historische Alice Springs besuchten wir. Es hiess früher Stuart, bestand nur aus wenigen Häusern und war lediglich eine Repeater-Station zwischen Darwin und Adelaide.
Das Rote Zentrum
Jede und jeder kennt den Uluru oder wie er früher hiess, der Ayers Rock. Man hat ihn hundertmal gesehen in Bildbänden, auf Prospekten, Reisepostern etc. Und doch kommt man um die seltsame Faszination nicht herum, die dieser Monolith, der aus der kargen, aber farbigen Ebene fast 350 Meter hoch herausragt, auf einen ausübt. Das Farbenspiel ist gewaltig: braun, rot, schwarz, gelb, fast rötlich-blau von weitem am frühen Morgen. Dass er teilweise aussieht, wie ein Schweizer Käse, war mir weniger bewusst. – Ich freue mich, dass wir diesen mystischen Ort besuchen konnten. Wir übernachteten zweimal in Yulara, dem Retortenresort, das etwa 20 km vom Fels entfernt errichtet wurde, mit verschiedenen Arten von Unterkunftsmöglichkeiten (vom Backpacker zum Camper, zur Lodge und zum 5-Stern-Hotel), einem Shoppingcenter, Souvenirläden, Poststelle, Cafés, Restaurants, Galerien, einer Tankstelle und so weiter.
Mit dem 3-Tages-Pass machten wir ausgiebig Gebrauch von mehreren Eintritten in den viel besuchten Nationalpark.
Nicht weniger eindrücklich fanden wir die Kata Tjuta, ehemals The Olgas, übersetzt „Die Köpfe“. Die Felsformation besteht aus 36 abgerundeten Felsbrocken, der höchste ist über 1000 Meter hoch, ragt 564 Meter aus der Ebene hinaus, also höher als sein berühmter Bruder. Es sieht so aus, als ob dieses Massiv eine Art Zwilling des Uluru hätte gewesen sein können, aber irgendwann vor langer Zeit in sich zusammengesackt ist. Beide sind schliesslich etwa zur gleichen Zeit entstanden, vor 550 Millionen Jahren. Das könnte dem Uluru auch passieren, denke ich. Wer weiss, vielleicht in ein paar hundert Millionen Jahren? Und dann sehen die Touristen eine ganz andere Landschaft. Mal abwarten...
Jedenfalls – der Besuch der Köpfe war ebenfalls einmalig. Wir machten zwei verschiedene Wanderungen, die eine (Valley of the Winds) war eine rechte Herausforderung bei der Hitze. Wir wussten, dass der Trail um elf geschlossen wird, wenn’s mehr als 36 Grad heiss ist, also starteten wir früh. In aller (Theo)-Herrgottsfrühe, um zehn Uhr, waren wir schon abmarschbereit vor Ort, ausgestattet mit Wasser, Sonnenschutz und Sonnenhut. Drei Stunden später waren wir ziemlich erschöpft, ausgeschwitzt und mit tollen Eindrücken zurück auf dem Parkplatz. Zwischen den roten Felsköpfen waren wir gewandert, hatten fantastische Lookouts erstiegen mit Blick auf die grünen Landschaften, die von weitem wie saftige Berg-Wiesen aussehen, in Wahrheit aber die überall wachsenden Spinifex-Gräser sind, welche wenig Wasser brauchen.
Die zweite Wanderung, den Walpa-Gorge-Walk, musste ich alleine unternehmen. Theo hatte genug und ich wollte mir nichts entgehen lassen. Der Spaziergang dauerte nur etwa eine Stunde. Einmal verlief ich mich, weil irgendwer wohl die Richtungspfeile entfernt hatte, aber als der Pfad zu extrem wurde, merkte ich, dass dies so nicht sein konnte und ging zurück. Am Ende des Trails befand sich ein halb ausgetrocknetes Wasserloch, in dem eine Menge Kaulquappen ums Überleben kämpften. – Hätte ich nicht meinen Fliegenschutz-Kopfschleier übergezogen, hätte ich wohl auch ums Überleben gekämpft. Die Viecher sind schlicht eine Pest.
Theos Geburtstag
Meinen Wecker stellte ich auf 05.05 Uhr, zog mich an, schlich mich aus dem Schlafzimmer und fuhr nochmals zum Lookout, wo man den Sonnenaufgang hinter dem berühmten Felsen sehen kann.
Theo liess ich schlafen, um diese Zeit aufzustehen, und das noch an seinem Geburtstag, kommt schlicht nicht in Frage! Und schon gar nicht wegen eines Felsens. Und die Sonne geht jeden Tag auf; also was soll’s…
So machte ich mich eben allein auf den Weg. Es war bereits ein wenig hell, als ich losfuhr, und ich wählte den Parkplatz, den mir ein Ranger empfohlen hatte, wo’s nicht Hunderte von Leuten hat, sondern nur wenige. Logischerweise kann man sich das Spektakel von Osten oder von Westen her ansehen. Mal wird der Uluru beleuchtet, mal ist er im Vordergrund schwarz und die Sonne steigt hintendran auf. Um Viertel vor sechs war’s so weit und ich wurde nicht enttäuscht: ein Anblick für Götter – still und schön…
Ich fuhr dann noch zur anderen Stelle, wo Dutzende von Reisecars und Auto parkiert waren und die meisten Besucher schon wieder abzogen. Auch schön von dort. Man sieht gleich auch noch die Olgas in der Ferne. Aber der ganze Rummelplatz... Ich blieb, bis niemand mehr dort war und nur noch ein einziges Auto auf dem Parkplatz stand.
Kurz nach sieben war ich zurück im Motel und das Geburtstagskind kam nun allmählich auch zu sich.
Es war wieder mal Zeit zum Packen, wir holten uns im Supermarkt etwas zum Frühstück und fuhren dann los Richtung King’s Canyon, eine Fahrt von 304 Kilometern. – Unser Navi beharrte darauf, dass wir sechseinhalb Stunden unterwegs sein würden, aber das konnte ja nicht sein. Die Strasse ist sehr gut ausgebaut, Verkehr hat es so gut wie keinen und man kann auf dem grössten Teil der Strecke 110 km/h fahren (unsere Navi-Dame rechnete mit 50 km/h, da hat sie wohl eine Angabe aus dem letzten Jahrhundert).
Nach knapp vier Stunden und einem Zwischenhalt in Curtin Springs kamen wir an. Das Resort besteht aus einer Reihe von Bungalows für die Gäste, einem Pool, einer Tankstelle, einer Bar, zwei Restaurants (eines davon geschlossen) und einem Camping-Platz.
Schon bei der Planung hatte ich mich gefragt, ob das wohl der geeignete Ort sei für Theos Geburtstagsfeier, aber im Nachhinein hätte ich kaum besser wählen können.
Ein Helikopterflugplatz gehört nämlich auch noch zum Resort und da musste ich ja nicht mehr lange überlegen, was ich Theo schenken könnte. Wir flogen also, pilotiert von einer jungen Dame, eine halbe Stunde lang über den Canyon und das ganze Massiv (George Gill Range), das 400 Millionen Jahre alt ist. – Spektakulär und wunderschön war’s.
Begleitet von einer Unzahl von Fliegen machten wir anschliessend eine kurze Wanderung ins Canyon hinein zum Wasserloch, das wir grad eben noch von oben gesehen hatten.
Die längere, steile und sehr anstrengende Wanderung kam nicht in Frage, weil der Weg ab neun Uhr morgens wegen der grossen Hitze geschlossen wird. – Da war jemand sehr froh, dass diese Option bereits ausser Kraft war – ganz ohne vorhergehende Diskussion. Und die Wanderung auf den nächsten Tag vor neun Uhr zu verschieben, na ja… Für die unermüdlichen Wandervögel gibt’s allerdings schon ab fünf Uhr Frühstück im Restaurant, aber ich gebe zu, ich war auch nicht ganz unglücklich, am nächsten Morgen ein wenig länger schlafen zu können, hatten wir auch noch den Mereenie-Loop vor uns, eine Strecke von 155 km, die man nur mit 4x4-angetriebenen Auto befahren darf, denn sie ist nicht asphaltiert. – So fahren die meisten Besucher wieder die ganze Strecke über den Lasseter- und den Stanley-Highway zurück nach Alice Springs. – Mir passte das nicht recht, aus dem Grund hatte ich einen entsprechenden Wagen gemietet und hoffte, dass die Strasse dann tatsächlich offen sei an diesem 25. November. Sobald es nämlich regnet, ist diese Route gesperrt und man muss tatsächlich 500 Kilometer dieselbe Strecke zurückfahren, woher man gekommen ist.
Nun, nach der Canyon-Wanderung gab’s noch ein Stündchen Ausruhen und Baden am Pool, sicher einer der Höhepunkte an diesem Tag…
Duschen und zum Sonnenuntergang-Lookout pilgern (fünf Minuten zu Fuss) waren als Nächstes auf meiner Liste, wobei es Theo nicht unendlich gestört hätte, wenn auch dieser Programmpunkt ins Wasser gefallen und stattdessen ein Schläflein drin gelegen wäre. – Er hatte ja bereits den Sonnenaufgang verpasst, den Sonnenuntergang aber zwang ich ihm auf… Und er (so sagt er wenigstens) hat es nicht bereut. – Diese Sonnenspektakel kann man sich ja anschauen, wo man will; sie sind immer eindrucksvoll.
Ja, und dann das Nachtessen. Da stellte ich mir eine Art Fastfood-Auswahl vor. Aber nein, ganz im Gegenteil. Ein ausgezeichnetes Abendessen wurde uns serviert, eine feine Flasche Wein dazu – was will man mehr!?
Wie man an einem so abgelegenen Ort mit so feinen Zutaten so wunderbar kochen kann, das konnte ich mir kaum vorstellen. Der nächst gelegene Supermarkt ist nämlich 300 km weit weg. – Ich fragte dann, wie das mit den Lebensmitteln funktioniere und man erklärte mir, alle zwei Wochen käme ein 80-Tönner vorbei mit allem drin für die nächsten Tage. – Ich bestellte einen Barramundi, denn ich esse sehr gerne Fisch. Erst nachher kam mir in den Sinn, dass es wohl nicht sehr viele Orte gibt auf der Welt, wo man Fisch weiter entfernt vom Meer essen kann als hier. – Vielleicht hätte ich doch besser Känguru bestellt…
Dann gab’s einen weiteren Höhepunkt an diesem Abend: Wir hörten, wie in hinteren Teil des Restaurants „Happy Birthday“ gesungen wurde. Da musste Theo natürlich nach dem „Gschpänli“ sehen. – Es war Liza, die junge, hübsche Dame aus der Rezeption, die mit Kollegen (wo hat sie die wohl hergenommen?) ihren Geburtstag feierte.
Diese Begegnung führte dazu, dass nun auch die Küche Bescheid wusste über unser Freudenfest und man uns ein Stück Geburtstagstorte offerierte. Und dann: Die kleine chinesische Kellnerin stellte sich zu uns an den Tisch und begann mit ihrem dünnen Stimmchen für Theo „Happy Bilthday“ zu singen. – Mir gab’s fast was…
Aber ich nahm mich zusammen und lächelte tapfer. – Zwei Strophen lang ging das Ständchen.
Rührend! – So ging der 24. November 2017 zu Ende und Theo geht nun in seinem 74sten…
Die letzten Tage im Herzen des Kontinents
Die 155 km Mereenie-Loop schafften wir in drei Stunden. Anfangs hatte ich ein wenig ein fahles Gefühl, als die asphaltieren Strasse zu Ende war und die Naturstrasse begann. „Reduce Speed“ hiess es – aber gleichzeitig zeigte die Geschwindigkeitsbegrenzungstafel 110 km/h Speed Limit an. Ein Witz wohl! Im ersten Drittel war die Strasse recht mühsam zu befahren, Bodenwellen und Unebenheiten à gogo – die totale Kopfweh-Piste. Ohne 4x4 wären wir kaum vorwärts gekommen. Später allerdings konnte man teilweise gar mit 80 km/h dahinbrettern, die Strecke war breit und ziemlich eben. Verkehr hatte es ja so oder so keinen. Das einzige Fahrzeug, das wir überholten, war ein am Strassenrand stehengelassenes, verwaistes Wrack. - Erst nach zweieinhalb Stunden begegnete uns ein entgegenkommendes Fahrzeug. Trotzdem: Wenn wir da ein Panne gehabt hätten… Oder wenn ein Pneu geplatzt wäre… 35 Grad am Schatten… Schatten??? – Nun, unser Mitsubishi war zuverlässig. Schon schön, wie man sich auf die Technik verlassen kann. – Oft denke ich an die Pioniere, die vor allem im vorletzten Jahrhundert diese und andere Gegenden in diesem weiten Land erkundet haben. Ohne Mitsubishi und ohne Strassen, bei Trockenheit und enormer Hitze.
Wir hielten Ausschau nach Kamelen. 200‘000 Stück soll es geben, die frei in diesem Gebiet leben. Gesehen haben wir gerade eines davon (ausser diejenigen in der Kamel-Farm auf dem Weg nach Yulara) und wir sind nicht sicher, ob es nicht doch ein domestiziertes war. Hingegen sahen wir viele wilde Pferde und das Seltsame war, auf der Strasse lag immer wieder Pferdemist, Kameldung auch, und wir fragten uns, weshalb die Tiere so unheimlich gern auf die Piste scheissen, wenn es doch unendlich viel Land gibt, wo das Toilettieren sicher auch eine Option wäre.
Toll war auch unsere nächste Unterkunft: Glen Helen. Auf Anhieb machten die paar Gebäude, die das Resort ausmachten, keinen einladenden Eindruck. Alles schien ein wenig verwahrlost, höchstens „back-packerisch“, hat aber zumindest eine einsame Tanksäule, und unser Zimmer war ganz ok, einfach, aber zweckmässig, die Betten richtig bequem. - Und fantanstisch gelegen: direkt am Finke-Fluss, der – wer hätte das gedacht – sogar Wasser führt. Zehn Minuten dem Ufer entlang – in der Glen-Gorge konnte man sogar baden. Was für eine schöne Abkühlung bei der Hitze! Die liessen wir uns natürlich nicht entgehen.
Glen Helen ist ebenfalls weit abgelegen, weit und breit gibt’s keine Nachbarn, nirgends, wo man übernachten oder etwas kaufen könnte. Die Wasserquelle, die dort zwar vorhanden ist, ist zu salzig, als dass man sie brauchen könnte; das Wasser muss per Lastwagen hertransportiert werden. – Und wie staunten wir, was für ein wunderbares Essen uns im hübschen (award-winning) Restaurant serviert wurde. – Erstaunlich, wie eine so feine Küche so weit weg von jeglicher Zivilisation so fabelhaft funktioniert.
Das war unsere letzte Übernachtung vor Alice Springs. Unterwegs, es waren noch etwa 150 km zum Fahren, machten wir noch drei Abstecher, die uns ebenfalls eindrücklich in Erinnerung bleiben werden: Ormiston Gorge, Ellery Creek und Standley Chasam. Bei allen dreien ist ein angenehmer Walk ausgeschildert und in den ersten beiden kann man sich auch im Wasserloch abkühlen. Besonders Ellery Creek eignete sich gut zum Schwimmen. Wir verweilten dort fast zwei Stunden.
Standley Creek hingegen führt kein Wasser. Das Territorium wird von Aborigines verwaltet – man muss Eintritt zahlen. Ein schöner Weg entlang von Palmen und Ghost-Gum-Trees führt vorbei an imponierenden Felsformationen und endet schliesslich in einer Klus mit achtzig Meter hohen Steilwänden. Ein beeindruckender Ort – fast beängstigend!
Die letzten paar Kilometer zurück nach Alice Springs führen entlang der MacDonnell-Ranges, die gerade in dem Moment in besonderem Licht erschienen. Ein riesiges Gewitter mit Blitz und Donner kündigte sich an. Wie gut, dass dies nicht ein Tag früher geschehen war. Wir hätten den Mereenie-Drive nicht befahren können.
Auf der ganzen fast 1‘300 Kilometer langen Strecke gab es immer wieder Schilder, die vor überfluteten Strassen warnten (Floodway). Das konnten wir uns kaum vorstellen, fuhren wir doch an zahllosen Flussbeeten vorbei oder spazierten hindurch, die schon seit langem keinen Tropfen Wasser mehr gesehen hatten. Aber am folgenden Tag sahen wir im Fernsehen einen Live-Bericht aus der Gegend, wo Sturzbäche über die Felsen flossen und Strassen und Flussläufe überflutet waren.
Als wir in Alice Springs ankamen, war der Sturm gerade vorbei; es hatte aufgehört zu regnen. Riesige Wasserlachen überall und abgebrochene Äste, die auf den Strassen herumlagen, zeugten von einem starken Unwetter.
Uns reichte die Zeit noch gerade, das Aviatik-Museum zu besuchen, von dem Bill Bryson in seinem Buch berichtet, und die Galerie, die eine bemerkenswerte Sammlung von einheimischer Kunst beherbergt.
Am nächsten Morgen nahmen wir’s gemütlich. Wir packten unsere Koffer und hatten grad auf die Sekunde Zeit, sie im Auto zu verstauen, als es wieder zu regnen begann, und das in Strömen. - Aber no worries, in gut anderthalb Stunden hatten wir ja einen Flug in sonnigere Gefilde. Zum Flugplatz dauert es nur etwa eine Viertelstunde, wir dachten, wir könnten dort dann noch frühstücken. Unterwegs war noch Zeit, ein letztes Foto vom Monument „Welcome in Alice Springs“ zu schiessen, dann Einfahrt zum Terminal. - In dem Moment kam mir in den Sinn, dass wir vergessen hatten, das Auto vollzutanken. – Der Tank war fast leer und ich hatte gelesen, dass sie 3,5 $ pro Liter verlangen, wenn man den Wagen nicht vollgetankt zurückgibt. – Ein bisschen viel, fanden wir. Nun kam ich doch ein wenig ins Schwitzen. Zum Glück ist der Flughafen „Belp-ähnlich“, also klein aber fein, so dass es vielleicht reichen würde, nochmals zurück in die Stadt zu fahren zum Tanken (ein bisschen Abenteuer muss ja sein…). Es war jetzt zwanzig vor neun, Abflug in einer Stunde. - Ich parkierte also auf dem Kurzzeitparkplatz, wir gingen zum Check-In, wo günstigerweise gerade niemand vor dem Schalter stand, gaben unsere Koffer auf, erkundigten uns, wo die nächste Tankstelle war, ich holte das Auto wieder und wir fuhren zurück nach Alice. – Der Weg schien lang, die Zeit kurz, wir fanden eine Tankstelle, ich parkte vor der ersten Säule. Dort hiess es „out of order“. Kann ja nicht anders sein, wenn’s pressiert… Ummanövrieren, vor die nächste Säule, die war ok. Theo füllte den Tank, ich drehte Däumchen, es war inzwischen fünf nach neun, endlich konnte Theo bezahlen, kam zurück ins Auto und los ging’s Richtung Flughafen. Diesmal ohne Fototermin unterwegs. – Auto parkieren, am Hertz-Schalter Schlüssel abgeben, zur Sicherheitskontrolle. Wir sind die Einzigen, judihui! – zum Gate Nummer 3 - und da war‘s grad Zeit zum Einsteigen. In aller Selenruhe zeigten wir unsere Boarding-Cards und spazierten mit den anderen Passagieren im Regen zum Flugzeug.
Abflug wie geplant um 09.40 – Torrianis mit on board - No worries at all!
Zwei Stunden später kamen wir in Adelaide an – schönes Wetter, 35 Grad.
Zurück in Adelaide 27. November – 5. Dezember
Die Wetterprognosen machten Sorgen – alles andere als no worries! Die nächsten zwei Tage sollte es weit über dreissig Grad sein, dann die Katastrophe – ein Kälteeinbruch vom Gröbsten. Das hiess für uns, schleunigst einen weiteren Strand-Tag einbauen. Einer genügte aber vorerst. Unsere Gastgeber gaben uns alles mit, was man so braucht am Strand: Stühle, Strandtücher und einen Windschutz, der so zusammengefaltet war, dass er sich wie von Geisterhand öffnete, wenn man das richtig anstellt. – Das war relativ einfach, aber das Schliessen… Wir übten zwar noch vorher, aber dann am Strand gelang das Kunststück des Zusammenfaltens überhaupt nicht mehr und wir mussten das sperrige zeltartige Gebilde hinten ins Auto hineinzwängen und so heimfahren. Peinlich, wirklich. Trotz Anleitung mit Bildern (fold like this: / twist your hands 180° / …). Daryl wusste dann wieder, wie.
Für den Mittwoch bot sich Christiane an, uns einen ganzen Tag lang herumzukutschieren, um uns die Schönheiten von Süd-Australien zu zeigen und uns zu Weingütern zu begleiten, so dass wir degustieren konnten, ohne anschliessend selber fahren zu müssen. – Was für ein wunderbares Angebot! Wer könnte dazu schon nein sagen?!
Es war ein herrlicher Tag. Ein wenig warm zwar (das Thermometer pendelte zwischen 39 und 41 Grad), aber wir genossen jede Minute. Einmal hatte ich allerdings fast das Gefühl, meine Füsse schmelzten mir aus den Schuhen weg, aber da hatte ich mich geirrt; sie steckten doch noch drin.
Im Deep Creek Canyon Conservation Park hat man grandiose Ausblicke auf Strände und sanfte Hügelketten. Kängurus hopsen herum, allerdings nur die argwöhnischen, die vielleicht wissen, dass hin und wieder mal das eine oder andere Exemplar von ihnen auf der Speisekarte und im Teller landet. Andere sind zu faul sich zu bewegen, liegen im Schatten der Bäume und sind intensiv mit Siesta beschäftigt.
Die Fahrt dorthin durch landwirtschaftliches Gebiet mit Kühen, Weiden, Weizenfeldern, Weinbergen, Kirschenplantagen, vorbei an idyllischen Gewässern und Häusern mit den wunderbarsten Blumengärten liess beinahe den Eindruck entstehen, man sei hier in England oder gar in der Schweiz, wären da nicht die Eukalyptuswälder und –alleen.
Wir besuchten Blowhole Beach, Victor Harbour, Port Elliot, Myponga Beach, Port Noarlunga und am absolut Eindrücklichsten war Hallett Cove. Vor 270 Millionen Jahren war die ganze Gegend dort von einer dicken Eisschicht überdeckt und noch heute sieht man „Überbleibsel“ aus jener Zeit, als sich die Gletscher zurückgezogen hatten. Der „Sugarloaf“ ist am Imposantesten. Erst denkt man, da hat sich jemand einen Spass geleistet und einen Berg aus Polyester errichtet, der kann doch nicht natürlich sein, aber dann liest man, wie diese Felsformation entstanden ist. Erstaunlich! - Verschiedene Schichten von Sand und Kalk haben durch Erosion eine Art Zuckerstock gebildet – eine sonderbare farbige Landschaft ist erhalten geblieben. Ein „Boardwalk“, ein bestens ausgebauter und befestigter Holzpfad, führt darum herum und anschliessend für drei Kilometer auf den Felsen dem Meer entlang, der sogenannte „Hallett Cove Glacier Hike“.
Wir haben uns mit einem Kilometer begnügt, denn die Hitze…
Kühler war’s beim Wein Degustieren in den McLaren Vale Wineries.
Von morgens neun bis abends um sieben war Christiane unsere Reiseleiterin. Sie kennt sich bestens aus in der Gegend, ist eine ausgezeichnete Fahrerin und wir erlebten einmal mehr einen unvergesslichen Tag.
Im Barossa-Valley übernachteten wir einmal, obwohl der Hauptort Tanunda nur eine knappe Stunde weit weg ist von da, wo wir wohnen. Aber wir nahmen’s gemütlich, besuchten eine ganze Menge Winerys und liessen es uns gut gehen. Ich war die arme Fahrerin, konnte nicht ganz so viel degustieren wie Theo, aber ich hab’s überlebt. Die schöne Gegend, das perfekte Wetter am ersten Tag (33 Grad) und die gepflegten Gärten, Felder und Weingüter waren Entschädigung genug.
Ein paar Zeilen wert ist auch unsere Unterkunft, die ich am Morgen unseres Reisetags kurzfristig bei Booking.com gebucht hatte.
Ich suchte ein Hotel- oder Motelzimmer im Ort Tanunda selber, so dass wir am Abend nicht mehr würden fahren müssen und uns ein Restaurant in der Nähe aussuchen konnten. In der Beschreibung hiess es, schöne Unterkunft (Suite) in historischem Haus für zwei Personen, drei Schlafzimmer (?) und dann seltsamerweise 11 m2. Da konnte irgendwas nicht stimmen, aber Lage und Preis waren ok, ich reservierte.
Das Haus war 1890 gebaut worden, einstöckig und sehr gross, mit Rosengarten zur Strasse hin und Swimmingpool hintendran (wohl kaum historisch). – Eigenartig, was ich da gebucht hatte. Erst kamen wir in ein Entree, dann war rechterhand ein Wohnzimmer, ein langer Gang (15 Meter – hab mit Riesenschritten gemessen) führte nach hinten, an dem entlang es linkerhand tatsächlich drei Schlafzimmer hatte (sieben Betten im Ganzen), dann ein Esszimmer, eine gut ausgebaute Küche und noch ein Badezimmer (Dusche aus Messing oben an der Badewanne, die auf goldenen Füssen steht, angebracht), das ich erst gar nicht fand, weil alles so weit verzweigt war. Eine ganze Wohnung war das mit 110 m2 Wohnfläche. Irgendwer hatte wohl bei der Beschreibung das Gefühl gehabt, diese Angabe könne nicht stimmen und hatte kurzerhand die Null gestrichen. – Wir zwei kamen uns ziemlich verloren vor in der alten Wohnung, die mit den Möbeln aus Grossmutterzeiten ausgestattet war (ausser dem Breitwand-Bildschirm und den Klimaanlagen). Mir kam‘s vor wie das „Haunted Mansion“ im Disney-Land: ziemlich düster und fast ein wenig unheimlich. Schöne Holzböden gab es überall, aber die knarrten, wenn man umherging und bei jedem Schritt wackelte auch die Tür im Schlafzimmerschrank. Dieses Geräusch wiederum erinnerte mich an etwas aus meiner Kindheit, von dem ich aber nicht mehr genau weiss, wo und wann es genauso tönte.
SEHR speziell also das Ganze, aber nach kurzer Eingewöhnungszeit waren wir ganz zufrieden mit diesem wunderlichen Übernachtungsort. Wir konnten uns sogar ein wenig abkühlen im Pool; das war herrlich. Ja, und eigentlich war alles da, was man braucht, sauber war’s auch und wir schliefen wunderbar.
In der Nacht dann kam der Regen und der kühle Wind aus der Antarktis. Das Thermometer sank auf 19 Grad hinunter. Am Abend zuvor hatten wir noch fein im Freien zu Abend essen können in einem hübschen Restaurant, genannt „1918“.
Bevor‘s am nächsten Morgen mit der Weintour weiterging, machten wir (jetzt eingepackt in Jacken und Regenschutz) einen Spaziergang durchs Dorf.
Kirchen hat’s nicht wenige und wie überall eine ganze Menge von kleinen Boutiquen, die Nippsachen verkaufen, die niemand braucht, die aber offenbar doch mit Vorliebe gekauft werden. Besonders jetzt, in der Adventszeit, boomt das Geschäft. Auch kleine Weihnachtsmärkte findet man; hinter jedem Stand eine Granny, die ihr Selbstgestricktes anbietet. Auch der Samichlaus fehlt nicht.
Was uns gut gefallen hat, sind die überaus freundlichen Angestellten, die uns ihre Weine beschrieben und zum Kosten reichten. Mit ausnahmslos allen gab’s interessante Gespräche, man fühlte sich überall willkommen, auch wenn man nichts kaufte. „No worries“, hiess es ganz natürlich. Wir kündigten jeweils zum Voraus an, dass wir leider keinen Wein mit nach Hause nehmen könnten, gern aber fürs Probieren zahlen würden, aber das kam gar nicht in Frage und trotzdem durften wir von den teuren Weinen probieren, bei „Peter Lehmann“ sogar einen Shiraz für 100 AU$.
Am besten hat es Theo aber bei „Jacob’s Creek“ gefallen. Die haben tolle Liegestühle im Garten…
St Hugos war jedoch auch nicht schlecht:
Das war aber am Tag zuvor. Wieder zurück auf dem Mount Lofty war’s am späten Nachmittag grad nur noch 10 Grad kalt. Die riesigen Temperaturunterschiede waren zwar angekündigt worden; sie sind aber kaum zu glauben.
Einen schönen Abend verbrachten wir zum Abschied mit unseren Gastgebern in einem Pub in den Hills, „The Scenic @ Norton Summit“, wo Theo doch noch zu seinem Känguru-Filet-Menu kam (35 ½ pancetta wrapped kangaroo fillet, hand cut potato wedges, green beans & chimichurri), mich hingegen nahm wunder, was ein „deconstructed“ chicken sei (30 ½ deconstructed chicken cordon bleu with brie & pancetta on grilled asparagus and fried spinach & ricotta gnocchi). – Keine Knochen mehr drin – ich fragte mich allerdings, ob das Wort nicht eher in den Bereich des Bauwesens gehöre… Und „Chimichurri“ habe ich nachgeschaut - ist eine argentinische Sauce, ähnlich wie Pesto.
Essen und Wein waren vorzüglich. Der Shiraz auf der Getränkekarte hiess „Kay Brothers“, keine Frage – den mussten wir bestellen, und wir haben es nicht bereut.
Am allerletzten Tag war’s wieder kalt und regnerisch und wir beschlossen, zwar nicht mehr viel zu unternehmen, aber doch noch unser letztes Kleingeld loszuwerden. Nicht weit von da, wo wir wohnten, gibt’s die Bridgewater Mill, ein Weingut mit feinem Restaurant. – Ein vorzügliches Essen wurde uns serviert, ein Dessert vom Feinsten und das Beste: Es hatte dort ein Cheminée, so dass man schön warm hatte. Schliesslich ist es ja Dezember… - Und lustig: Die Kellnerin, eine Australierin, hat eine Saison lang in Savognin gearbeitet. Sie spricht ausgezeichnet deutsch.
So gingen auch unsere letzten Tage im schönen Süden des Landes viel zu rasch vorbei und bald hiess es wieder Koffer packen und die Heimreise antreten - mit zehn Tagen Aufenthalt in Bali vorerst noch, damit der Flug nicht so endlos lang wird.
Kleiner Exkurs: Theo im Duty-free-Shop. Er musste seine Boardingkarte zeigen und die Verkäuferin fragte ihn beim Bezahlen seiner obligaten Flasche Famous Grouse:
“Is that your final destination?” Er anwortete: “Hopefully not!!!” – Ihre humorvolle Antwort war dann: “Bali is a nice place to die.” – Solche Spassvögel, die Australier!
Bali Reisebericht 5. – 17. Dez. 2017
Lange wussten wir nicht, ob die australische Airline Jetstar fliegt oder nicht, denn am Sonntag war der Flughafen in Denpasar noch geschlossen. Der Vulkan Agung war ausgebrochen und Tausende von Menschen mussten evakuiert werden. Am Montag dann erfuhren wir, dass unserer Reise nichts mehr im Weg stehen würde, sich der Vulkan inzwischen beruhigt hatte.
5. Dezember: Um halb zehn Uhr abends kamen wir an. Eine Stunde später sassen wir im Taxi, das uns zu unserem vierten Haustausch führte, in Seminyak. Ein Angestellter begrüsste uns, ein bequemes Bett und ein riesiger Fruchtkorb standen schon parat.
Ein schönes Haus, einmal mehr: Nur das geräumige Schlafzimmer hat eine Türe zum Schliessen, alle anderen Räume sind offen, sowohl das elegante Badezimmer als auch die Dusche. Von der Küche/Esszimmer/Wohnzimmer aus kann man direkt in den Swimmingpool steigen, ebenso führt die Terrassentür aus dem Schlafzimmer schnurstracks dorthin: eine willkommene Abkühlung bei 28 – 33 Grad im Schatten und der hohen Luftfeuchtigkeit.
Am ersten Tag schon „versumpften“ wir, wenn man dem so sagen kann. (Polo Hofer hat eine ähnliche Situation mal so beschrieben: „Lieber über Nacht versumpfen als im Sumpf übernachten….“). Anna und Steve luden uns zum Apéro in ihr Haus ein, dorthin, wo wir vor vier Jahren gewohnt hatten. Der Vorabend war dann relativ weinselig, Steve brachte eine Flasche Weisswein nach der anderen und auch Wodka, den er selber herstellt, aber nicht trinkt (!).
Zwei Freunde der beiden, Rose (eine junge Engländerin, deren Eltern in Bali ein Haus haben) und Graham (ein etwas älteres Semester, ein Engländer, der jetzt in Australien wohnt), waren auch dort und halfen tüchtig mit, den Alkohol zu vernichten (NB später erfuhr ich, dass Graham zwei Jahre jünger ist als Theo...). Schon nach kurzer Zeit lud uns Graham alle zu sich nach Melbourne ein, um dort die Australien Open zu besuchen. - Na ja, ob er sich am nächsten Tag noch daran erinnert und ob’s soweit je kommen wird - wer weiss. Hört sich aber gut an und ich wär‘ auf jeden Fall dabei. Das dann frühestens im Januar 2019. – Da könnt ich doch glatt ein Reisli darum herum basteln…
Also so gegen acht Uhr fand Anna, wir sollten etwas essen gehen. Alle waren sofort einverstanden. Per Taxi ging’s ins „Made‘s“, wo während des Dinners balinesische Tänze gezeigt wurden und anschliessend eine Live-Band spielte. Uns wurde ein feines Abendessen (Babur Ayam) seviert und dazu drei Flaschen Wein. Es dauerte dann nicht lang und sowohl Graham als auch Steve standen auf der Bühne und sangen mit (Theo zum Glück nicht!). Und es war überhaupt nicht peinlich, denn beide haben eine sonore Stimme und es tönte echt sehr gut. So jedenfalls empfand ich das. Ob bei totaler Nüchternheit… – Und wir tanzten auch alle, bis es aus Kübeln zu regnen begann. Da sich die Tanzfläche unter freiem Himmel befindet, war damit unserem fröhlichen Beisammensein ein jähes Ende beschert.
Ein Taxi brachte uns „heim“. Dort angekommen: Nichts wie los in den Pool. Herrlich war das!
Anna versprach, ein Tennis Double-Mixed in ihrem Club zu organisieren. Am Montag um ein Uhr mittags. Darauf freue ich mich mehr als nur ein bisschen. – Bei dieser Temperatur; muss dann eine Eisbox mitnehmen, dachte ich… Schon als wir letztes Jahr hier waren, spielten wir ein paarmal Tennis. Aus dem Grund hatte ich auch meine Tennisschuhe seit zwei Monaten um die halbe Welt mitgeschleppt. Ich erinnerte mich nur allzu gut an meine wunden Füsse, die ich damals hatte…
Elf Tage lang sind wir in Bali. Immer wieder mal gibt’s einen Theo-Tag, das ist ein Tag, wo man eigentlich gar nichts macht ausser immer mal wieder Siesta. - Ok, ok, am Abend gehen wir irgendwo essen.
Was es nicht alles Wunderbares und Leckeres hat hier auf den Speisekarten, auch zum Frühstück – eine endlose Schlemmerei für wenig Geld noch dazu. – Und an einem solchen Tag gehen wir beide und lassen uns die Haare schneiden bei Nike, einem hübschen kleinen Salon ein paar Minuten zu Fuss von wo wir wohnen.
Theos Schnitt kostet 3 Fr. 20 Rp., meiner ganze 4 Franken. Schon lange habe ich nicht mehr das Gefühl gehabt, so gut und kompetent bedient worden zu sein. Intensive Kopfmassage inklusive. Abgezogen vom Preis waren 20% Rabatt. Wegen des Vulkans gibt’s vielerorts Spezialangebote und Rabatte.
Mit dem Trinkgeld tue ich mich ein wenig schwer. Wie viel gibt man bei solchen Preisen? Ich weiss es wirklich nicht. Das Doppelte ist ja vielleicht ein wenig überheblich, aber ich hab’s dann trotzdem so gemacht.
An einem Nicht-Theo-Tag buchten wir ein Taxi mit Fahrer. Schon um halb neun Uhr ging’s los.
Frengky, ein sehr sympathischer junger Mann im gleichen Alter wie Gino, war zeitig parat und er fuhr uns überall dort hin, wo ich vorher recherchiert hatte. Auch auf einige seiner Vorschläge gingen wir ein. In Celek (dort wird Silber und Gold verarbeitet) machten wir unseren ersten Halt. Entlang der Hauptstrasse hat es einen Shop nach dem anderen, grössere und kleinere, wo man den Handwerkern bei der Arbeit zuschauen kann, dann in den Laden geführt wird, wo die vielen herumstehenden Verkäuferinnen und Verkäufer anschliessend auf ein gutes Geschäft hoffen. So haben wir es vor vier Jahren erlebt. Jetzt ist es sehr befremdlich: Auf den riesigen Parkplätzen steht kaum ein Bus, die Verkäufer sitzen herum und haben nichts zu tun. - Der Vulkan, der doch ein heiliger Berg ist und daher auch verehrt wird, weiss gar nicht, was er der ganzen Bevölkerung und vor allem den Menschen, die in den Dörfern um ihn herum leben, antut. Mehr als 100‘000 Bewohner mussten evakuiert werden und wir hörten, dass die Belegung in den Hotels höchstens 10 % beträgt. Viele Unterkünfte mussten schliessen, die Restaurants, wo man normalerweise Mühe hat, einen Platz zu finden, sind leer. Oft sind wir die einzigen Gäste, fast nur Einheimische sind anzutreffen.
So sieht’s auch in den Verkaufsläden und -werkstätten aus, wo Batik hergestellt wird. Der stolze Besitzer der Galerie, in welcher 100 Künstler aus Ubud ihre Bilder ausstellen, sieht ziemlich niedergeschlagen aus. Seine Geschäfte sind im Eimer. Die ganze Reisebranche blutet, es braucht auch keine Fahrer mehr, keine Tourguides, keine Tourenverkäufer. - Und ob sich zu Weihnachten doch noch alles ändern wird, ist fraglich. Zu viele Australier (sie machen die grosse Mehrzahl der Bali-Touristen aus) sind vor wenigen Tagen am Flughafen gestrandet, zu viele Gäste haben ihre Reisen abgesagt und umgebucht, zu viele Touristen haben Angst, dass das noch einmal passiert und sie dann das grosse Fest mit Turky, Tannenbaum, Glitter und Glanz zu Hause verpassen.
Wir haben unsere Reise schon im März gebucht und hoffen nun einfach, dass wir auch wieder ausreisen können. Sonst bleiben wir halt noch ein Weilchen…
Diesmal wollen wir uns ein wenig mehr Zeit nehmen in Ubud als beim letzten Besuch. Als Erstes war der Monkey-Forest auf dem Programm. Eine gute Stunde spazierten wir auf den gut ausgebauten Wegen durch den eindrücklichen Regenwald und freuten uns über das Spiel der kleinen Langschwanz-Makaken, die den ganzen Wald für sich beanspruchen, überall herumturnen – auch auf den Köpfen der Touristen, wenn man nicht aufpasst. Hier hatte es doch eine recht grosse Anzahl Touris, fanden wir. - wie das wohl gewesen wäre, wenn Mount Agung sich nicht so schlecht benommen hätte…
Den Affen ist der Vulkan sicher egal, sie sind überhaupt nicht scheu, lassen aber die Besucher im Grossen und Ganzen in Ruhe, wenn man nicht gerade Esswaren bei sich trägt. Sie sind mit der Aufzucht und nicht selten auch mit der „Herstellung“ ihrer Jungen beschäftigt. Untereinander scheinen sie oft recht aggressiv. Lustig, wie die eine Affenmutter ihr Junges am Schwanz zieht – wie an einer Leine lässt sie ihm nur einen bestimmten Radius.
Zeit fürs Mittagessen. Frengky führte uns in ein sehr hübsches Restaurant im balinesischen Stil mit gedeckter Terrasse und Blick auf endlose Reisfelder. Das Restaurant war alles andere als voll, aber trotzdem, ein paar Gäste hatte es schon. Die Spezialität: Ente. - Also bestellte ich Crispy Duck. Das arme Tier wäre wohl von selber gestorben, an Hunger, hätte man es nicht geschlachtet. Eine halbe Ente hatte ich auf dem Teller, etwa drei Bissen Fleisch konnte ich ausfindig machen, der Rest war Knochen. Aber eben, wenigstens die Aussicht war schön.
Unser nächster Besuch galt dem „Antonio Blanco – Museum“, dem Dalí von Bali. Die Bilder selber (meist Tempeltänzerinnen) fand ich nicht sehr berauschend, aber die Bilderrahmen schon. Dort lässt der Maler seinen Phantasien freien Lauf: protzige Holzrahmen mit den wildesten Ornamenten drauf, auch Samt und Seide kommen zum Einsatz. Leider durfte man nicht fotografieren. Das Museum selber und vor allem der pompöse, über drei Stockwerke offene Innenraum wirken ein wenig deplatziert - nicht der Grösse wegen, sondern wegen seiner Architektur, die ebenfalls an Dalí erinnert. Auf dem Dach hat’s zwar keine goldenen Eier, dafür aber goldene Tempeltänzerinnen.
Die Familie Blanco liebt offenbar bunte Vögel, so hat es Volieren im Garten, Papageien und ein Hornbill fliegen frei herum und quieken die Besucher an, wenn sie vorbeigehen.
Die Reis-Terrassen, die wir schon vor vier Jahren besichtigt haben, wollten wir uns nochmals anschauen. Der Blick von Tegalalang aus ist einmalig. Und jetzt, im Dezember, ist Erntezeit; man sieht Bauern bei der Arbeit.
In den Reisplantagen verstecken sich auch verschiedene Tempel. Wir fuhren zum Gunung Kawi, das ist nicht nur eine Tempelanlage, sondern es sind Königsgräber aus dem elften Jahrhundert. Ein sehr eindrücklicher Ort, aber mindestens ebenso eindrücklich ist die lange Treppe, über 300 Stufen, die steil entlang der Reis-Terrassen zu einem schmalen Fluss und der ganzen Anlage herunterführt. Schweisstriefend bei der Hitze war nicht nur der Abstieg, sondern auch der Spiessrutenlauf zwischen all den unzähligen kleinen Souvenirläden vorbei, die mehr oder weniger dasselbe verkaufen und im Moment ja keine Käufer haben. Fast wie die Motten das Licht umschwärmten einen die „ausgehungerten“ Händlerinnen und Händler, die wohl den ganzen Tag lang kaum ein lohnenswertes Geschäft hatten machen können. So besitzt Theo nach unserem Besuch ein neues Hemd und einen Sarong, („only one dollar“) - umgerechnet dann doch drei.
Die Treppe wieder hinauf – absolut geschafft. Es war halb fünf und obwohl Frengky noch ein paar Ideen hatte, was wir machen und wo wir hingehen könnten, war uns am liebsten zurück nach Hause. Auch ohne Touristen herrschte eine Riesenmenge Verkehr. Die Motorräder schwirrten links und rechts an unserem Auto vorbei; ich kam mir vor wie in einem Bienenhaus und war sofort wieder in Myanmar-Stimmung: Ich sass links neben dem Driver und schaute zum Seitenfenster hinaus, damit ich all die knappen Überholmanöver und Fast-Kollisionen mit Hunden, Fussgängern und sonstigen Verkehrsteilnehmern möglichst ignorieren konnte. Gut zwei Stunden dauerte die Fahrt zurück nach Seminyak. Frengkie ist ein sehr guter und ruhiger Fahrer, er war vorher Lastwagenfahrer. Mühelos und wie wenn’s für ihn ein Kinderspiel wär, manövrierte er uns durchs Chaos und lieferte uns schliesslich unversehrt um sieben in unserer Villa, wie die hier heissen, ab. – Wir buchten ihn nochmals für einen zweiten Tag.
Im Haus war alles schön aufgeräumt, geputzt, versorgt. Man braucht keinen Finger zu rühren; drei freundliche junge Frauen sind angestellt, jeden Tag alles in Ordnung zu halten, das Geschirr zu waschen, frische Tücher hinzulegen. Die zwei jungen Männer, die Tag und Nacht Security-Dienst haben, sind fürs „Grobe“ verantwortlich, und falls etwas nicht funktioniert oder etwas geflickt werden muss, sind sie unverzüglich zur Stelle. Sie rufen uns ein Taxi, wenn wir eines brauchen. – OMG - da werden wir schön ins Leben B hineinplumpsen, wenn wir wieder in Ittigen sind.
Tennis fand am Montag statt, aber in der Halle zum Glück, wo’s zwar auch nicht gerade kühl war, aber einem zumindest die Sonne nicht direkt auf den Deckel brannte. Anna hatte zwei junge Balinesen engagiert, damit wir ein Mixed spielen konnten. Wir hatten viel Spass; die beiden liefen wie die Wiesel, wir zwei eher nicht wie Wiesel, gaben aber dennoch unser Bestes. Mein Outfit jedenfalls war triefend nass nach dem Spiel.
Der Club ist exklusiv, members only, ein Schwimmbad gehört dazu, ein Restaurant mit Bar und auch eine zweite Anlage am Meer mit einem weiteren Pool, Restaurant und Disco. Dorthin fuhren wir anschliessend mit dem Taxi, hatten Lunch und liessen es uns gut gehen.
Ausflüge
Anna machte den Vorschlag, am nächsten Tag gemeinsam einen Ausflug zu unternehmen. Gede, der Taxifahrer, den sie normalerweise beschäftigt, hatte natürlich Zeit und Ideen, wohin es gehen solle. Er wollte mit uns in sein Dorf fahren und uns seine Familie vorstellen. Diese wohnt knapp ausserhalb der Sperrzone um den Mount Agung herum.
Unterwegs gab’s einen ersten Halt in Samarapura, der Hauptstadt der Provinz Klungkung, wo sich der hübsche Tempel Taman Wisata Kertha (Kerta Gosa) befindet. Das Dach ist aufwändig bemalt mit Geschichten aus alter Zeit.
Die Fahrt wurde allmählich kurvenreich und führte uns vorbei an Reisfeldern, durch Regenwald, bis zu einem Lookout auf fast 1000 Metern Höhe, von dem aus man über die grüne Landschaft sehen konnte bis zum Meer (Bukit Jambul). Rund um den Vulkan herum ging’s weiter, an Lagern vorbei, wohin man vor zwei Wochen die mehr als 100‘000 Menschen evakuiert hatte, die innerhalb der 10-km-Zone am Fusse des Berges wohnten. Wie lange sie dort bleiben müssen, weiss niemand. Das stelle ich mir ziemlich schrecklich vor.
Es war ein einigermassen bedeckter Tag und nur ganz selten konnten wir einen Blick auf den Bösewicht werfen, der sich hinter dichten Wolken versteckte. Zwischendurch regnete es sogar und hatte Nebel. Was aber sichtbar ist, ist die frische Lava, die er vor wenigen Wochen hinterlassen hat.
Von Gedes Familie wurden wir herzlich empfangen. Im abgelegenen Bauerndorf, wo sie leben, hätte ich mir eine einfache Behausung vorgestellt, aber das war überhaupt nicht so. Nebst dem Familientempel stehen vier Häuser auf dem Grundstück, eines davon die Küche, die andern drei sind Wohnhäuser (dasjenige des Bruders modern und fast zu nobel für die Gegend). Sie erzählten uns, dass der Vater das Stück Land (700x700 Meter) damals für 150$ gekauft hätte, jetzt sei es mehr wert.
Die Mutter bereitete Tee und Kaffee zu, Gedes Bruder las ein paar Mangos ab vom Baum im Hof und rüstete sie für uns. Der Vater kam ebenfalls noch dazu und die eine Schwester brauste aus dem Nachbardorf mit dem Roller an, um den ausländischen Besuch zu begrüssen und zu begutachten.
Gemeinsam machten wir einen kurzen Spaziergang durchs Dorf und besuchten den Stall, wo’s sechs Kühe hat und drei Schweine. Kampfhähne halten sie auch; die sind in Einzel-Käfigen eingesperrt.
Im Haus unten an der Strasse ist das Büro untergebracht, von wo aus der Berg beobachtet wird. Interessant wäre es gewesen, mit den Seismologen zu sprechen, leider waren die aber grad abwesend, genauso wie auch der Agung hinter den Wolken.
Die weitere Strecke führte uns am Meer entlang über Kubu zu einem schwarzen Strand mit weissen Booten – ein schönes Bild - und schliesslich zum Wassertempel Tirta Gangga, wo es Usus ist, die Fische zu füttern. Auch diese, so glaube ich, leiden im Moment unter Touristenmangel und haben daher Hungeräste vom Schlimmsten; sie führten jedenfalls ein Theater auf sondergleichen, als wir ihnen die leckeren Fischkörner ins Wasser streuten, die’s dort für sie zu kaufen gibt. Auch dieser Tempel lädt zum Spazieren ein. Es ist ein geruhsamer Ort.
In Tenganan machten wir zum letzten Mal Halt vor der langen Rückreise. Ein seltsames Dorf: Den Nachkommen der Ureinwohner Balis, als die sie sich bezeichnen, ist es gelungen, die prähistorische Kultur der Insel lebendig zu behalten. Durch strikte Abschottung über Jahrhunderte hinweg haben sie ihre kulturellen und religiösen Traditionen bewahren können. Heiraten werden nur unter Dorfbewohnern toleriert, wer sich daran nicht hält, darf nur noch als Gast das Dorf besuchen. – Das alles erinnert mich an die Amischen in den Staaten.
Eine spezielle Art zu weben ist Ikat. Stoffe dieser Art sollen angeblich nur dort noch hergestellt werden. Ein solches Tuch habe ich dann erstanden.
Die Fahrt zurück nach Seminyak war mühsam und dauerte lang. Der Verkehr und die halsbrecherische Fahrweise zerrten an den Nerven, vor allem, als es noch zu regnen begann und dunkel wurde. Müde kamen wir zu Hause an; Theo „töipelet“ und will am nächsten Tag, wo ich doch mit Frengkie abgemacht habe, nicht mehr so lange Auto fahren.
So geht’s erst um neun Uhr los. Nach einer knappen Stunde Fahrt kommen wir in Mengwi an und besichtigen den Pura Taman Ayun, einen Tempel, der ins UNESCO Welterbe aufgenommen worden ist. Keine Souvenirläden ringsum, das ist ganz was Neues. Den Tempel selber kann man nicht betreten, aber ringsum führt ein Weg, von dem aus man die beste Aussicht hat und touristenlose Fotos schiessen kann.
Es ist ein idyllischer Ort. Ein Park schliesst sich an, der zwischen zwei Flüssen angelegt ist - friedlich und schattig.
Unterwegs zum Tanah Lot bleiben wir im Verkehr stecken. Eine Prozession ist im Gang, die kein Ende nehmen will. Erst denken wir, es sei eine Hochzeit, Frengkie aber meint, es gehe darum, Opfergaben zu spenden und dadurch den Berg zu besänftigen. – Grossartig und schön, all die vielen Menschen in ihren traditionellen Kleidern zu beobachten.
Ein Highlight ist auch Tanah Lot, der Meerestempel. Wunderprächtig gelegen, von Wellen umspült, ein fast mystischer Ort. Dort hat es nun doch mal viele Touristen - finden wir. Aber Frengkie lacht und sagt, das seien höchstens etwa zehn Prozent der „Normalbesetzung“. Der riesige Parkplatz sei sonst voller Busse und Autos, was tatsächlich nicht der Fall ist.
Wie in Myanmar werden wir auch hier mehr als einmal darum gebeten, auf Fotos mitzuposieren. – Specie Rara…
Unterwegs gibt es die absolut wunderbarsten Reisfelder zu fotografieren und auch den Lunch nehmen wir in einem hübschen Restaurant mitten im Grünen.
Anschliessend fährt uns Frengkie heimzu mit kurzem Zwischenhalt in einem Supermarkt, da wieder mal Nachschub von Nöten ist.
Um vier Uhr ist unsere Tour vorbei, Theo glücklich, dass er im Liegestuhl vor dem Pool in tiefe Siesta versinken kann.
Drittletzter Tag
Shoppingtour mit Anna. Anschliessend wollten wir doch noch mal an den Strand. Bisher hatten wir keine Zeit (!) oder das Wetter lud nicht zum Bade. Auch an dem Nachmittag war’s nicht strahlend schön, warm aber allemal. Nach dem erschöpfenden Herumschlendern vom Shop zu Shop (Theo suchte dieselben pinkfarbenen Bermuda-Shorts, die er vor vier Jahren hier gekauft hatte und die wir inzwischen hatten entsorgen müssen. Gewisse Kriterien mussten dabei erfüllt sein: Pink eben möglichst, bis über die Knie reichend und ganz wichtig: Viele Taschen links und rechts, vorne und hinten, oben und unten! – Nein, natürlich nicht, das gibt’s ja gar nicht… – Nun hat aber die Mode zwischenzeitlich geändert, Rosarot ist nicht mehr „in“, überknielang ebenso wenig; unsere Hosen-Such-Aktion war also von Anfang an zum Scheitern verurteilt. In der Verzweiflung wurden wir dann doch noch fündig, nicht ganz dem Ideal entsprechend zwar, aber immerhin: Viele Taschen hat die Hose. Mit Klebverschlüssen und einem Reissverschluss ist sie ausgestattet! – Sogar die Länge stimmt fast – wohl ein Ladenhüter - und die Farbe: Schwarz…Nach dem Shopping-Stress gab’s nur noch Eines: Zusammenbruch auf dem bequemen Liegestuhl am Double-Six-Beach und zweistündige Siesta mit gelegentlichen Schnarchphasen - weg vom Fenster - tief in der Traumwelt.
Der Strand
Ja, und der Strand: Eine traurige Angelegenheit! Man kann sich kaum vorstellen, wie viel Abfall dort herumliegt. Es gibt nur einen Ausdruck dafür: grauenhaft! – Zwar wurden alle paar Meter Haufen von Kehricht zusammengerecht, aber diese Berge stehen nun einfach dort und weiter geschieht nichts – jedenfalls nicht während der drei Stunden, als wir dort waren. Auch wenn sie abgeholt würden – ich mag mir gar nicht vorstellen, wohin sie gebracht werden…
Und im Meer baden gehen: Unter keinen Umständen! Man müsste sich durch all die Plastikschnipsel und den sonstigen ekligen Müll, der unaufhörlich angeschwemmt wird, durcharbeiten; da kommt keine Freude auf. Als Erklärung dient die Meeresströmung, aber die allein ist auf keinen Fall schuld.
Bali ist eine so fantastisch schöne Insel, aber wenn das Abfallproblem nicht in Kürze angegangen wird, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass auch der Tourismus bald darunter leidet. Der Vulkan ist das eine, den kriegt man nicht in den Griff, die Verunreinigung der Dörfer und der Strände das andere. Da müsste etwas unternommen werden. Aufklärung in den Schulen zum Beispiel; Aufräumkampagnen wären auch hilfreich. - Ich verstehe nicht, wie diese freundlichen Menschen, die sich gerne schön kleiden und ihre Kinder in adretten Uniformen in die Schule schicken, einfach wegschauen, wenn’s mancherorts elendiglich aussieht und riecht wie in einer Kloake. – Auf einer unserer Touren, wir standen auf einer Brücke mitten in der schönen Landschaft, sah ich einen Mann mit einem grossen Plastikeimer voller Müll und ich dachte: „Super, der hat’s begriffen, ist ein Vorbild und sammelt all den Abfall ein. – Was er dann aber tat, war Folgendes: Er schüttete seinen Eimer übers Brückengeländer in die Tiefe. Mir blieb die Spucke weg und ich vergass sogar zu fotografieren.
In dem kleinen Salon, wo wir uns die Haare schneiden liessen, bieten sie auch Massagen aller Art an, Maniküre und Pediküre. So eine Pediküre und Fussmassage wollte ich mir leisten. Um Viertel vor sechs war ich dort, um Viertel vor acht verliess ich das Lokal mit rot lackierten Fussnägeln und Samtpfoten. Keine zehn Franken kostete der zweistündige professionelle Service. - Wie die bei diesen Preisen überleben können, ist mir ein Rätsel. Die beiden Girls aber freuten sich über ein für sie wohl fürstliches Trinkgeld.
Anschliessend war Zeit zum Abendessen.
Die letzten beiden Tage waren/sind Theo-Tage - nichts Nennenswertes mehr wird unternommen; zum letzten Mal müssen die Koffer gepackt werden und dann geht die lange Reise um Mitternacht los. Neuneinhalb Stunden bis Dubai, dort drei Stunden Aufenthalt und weitere sieben Stunden bis nach Zürich.
Sommer- beziehungsweise Winterferein
Eigentlich, wie schon oft erwähnt, bleiben wir im Sommer am liebsten daheim, aber das Angebot, das wir diesmal erhielten, konnten wir nicht abschlagen, das ging einfach nicht.
Denn Ken sagte, er möchte unbedingt eine längere Reise machen durch das südliche Afrika mit seiner Frau Eva und wir sollten doch mitkommen.
Eva und Ken lernten wir bei unserer letzten Reise nach Südafrika kennen, im Herbst 2016. Es handelte sich dabei um einen unserer HomeExchange-Haustausche. Wir hatten abgemacht, dass wir vier Tag lang bei ihnen in Johannesburg wohnen und anschliessend eine zwei-wöchige Safari machen würden, die Ken für uns organisierte hatte.
Manchmal kommt’s eben nicht so, wie man es plant und es sich vorstellt. Theo hat es zwei Tage vor Beginn der Safari vorgezogen, lieber mal zu erkunden, wie die Spitäler im Lande von Christiaan Barnard so aussehen und hat dann beschlossen, gleich zwei Wochen lang in einem davon zu verbringen... - So wurde aus dem 4-tägigen Aufenthalt im Haus unserer Tauschpartner ein Besuch von einem Monat.
Ken ist Südafrikaner, ist ursprünglich Jurist und hat in späteren Jahren eine Safariagentur gegründet. Sie heisst Barefoot-Safaris und existiert seit 1992. Er kennt sein Land wie den eigenen Hosensack, ist somit der beste Guide, den man sich vorstellen kann und ein wandelndes Lexikon, was wir allerdings erst während unserer Reise in Extremis erfahren durften. Dass wir von seinen Spezialpreisen für die Unterkünfte profitieren konnten, war ein weiteres Plus.
Eva ist Ungarin und reist für die UNO in der ganzen Welt herum, vor allem aber in afrikanischen Staaten; sie ist für die Weltbank tätig. Sie gehört zu den liebenswertesten Menschen, denen ich je begegnet bin. – Die beiden sind seit zehn Jahren verheiratet.
Der Tausch mit unserem Haus in den Bergen fand dann im Januar 2018 statt. Es gefiel ihnen sehr. Die ersten paar Tage waren wir gemeinsam dort, anschliessend die beiden alleine. Eva berichtete, ihr Mann habe sich im Schnee benommen wie ein sechsjähriger Junge...
Dort war es, wo Ken den Vorschlag machte, wir könnten doch zusammen auf Safari gehen, er habe ja das Know-How, das Safari-Gefährt und die ganze Ausrüstung - zu viert wär’s lustiger. Gleich begann er mit Hilfe seiner Sekretärin in Cape Town die Reise zu planen und kaum gesagt, schon getan, ein erster Entwurf stand bald schon fest. – Mir passte zwar der Zeitpunkt nicht so ganz, denn auf den Sommer in Bern zu verzichten, ist für mich nicht das Höchste der Gefühle. Schon gar nicht, wenn die Reise in ein Land führt, wo’s grad Winter ist. Aber Eva mag die Hitze nicht besonders und die Tiere sind in dieser Jahreszeit offenbar besser zu sehen, weil’s nicht regnet und daher das Gras nicht so hoch ist. Wir konnten Ken in seinem Planungseifer fast nicht stoppen. Aus seinen vorgeschlagenen neun Wochen wurden schliesslich sieben. Wir einigten uns, beschlossen aber, Malawi (wo er selber während 27 Jahren gewohnt hatte) auszulassen und von Windhoek aus direkt heimzufliegen, also die Reise von dort zurück nach Cape Town, wo die beiden jetzt wohnen, nicht mehr mitzumachen.
Nun ist also Zeit, einen neuen Safari-Versuch zu starten, in der Hoffnung, Theo lässt diesmal seine Eskapaden.
Reisebericht Südafrika-Sommer bzw. Winter-Trip mit Eva und Ken
7. Juli – 26. August 2018
Rooiels / Sutherland – 8. – 16.Juli
Die Koffer sind gepackt, es kann losgehen. Genauso wie Ken empfohlen hat, hab ich’s gemacht: Mal packen, dann die Hälfte wieder aus dem Koffer nehmen und dafür das Geld, das ich mitnehme, verdoppeln.
Los geht’s allerdings erst heute Abend um zwanzig vor elf. Gino bringt uns um halb sieben auf den Bahnhof in Bern.
Bis dahin aber ist noch viel Zeit. Die Aare ist jetzt schon über 19 Grad warm um 10 Uhr morgens; noch mindestens einmal vom Schönauerli ins Marzili schwimmen, kann ich mir also nicht entgehen lassen. Um halb fünf geh ich heim.
Alles läuft problemlos, Theo hat seinen Swisspass für den Zug dabei (nicht im Koffer, sondern zur Hand!), bei seinem Handgepäck gibt es ausnahmsweise nichts zu beanstanden, der Flug startet pünktlich, zehneinhalb Stunden später sind wir in Johannesburg. Es ist nur gerade fünf Grad warm morgens um neun, aber die vierstündige Wartezeit bis zum Weiterflug nach Kapstadt verbringen wir ja im Flughafengebäude. Die Zeit vergeht recht schnell – lesen, Sim-Karte kaufen, etwas essen und trinken. Nur der Toilettenbesuch ist ziemlich gewöhnungsbedürftig: Es kommt kein Wasser aus den Hähnen, man kann also die Hände gar nicht waschen. Nur ein paar Hand-Sanitizers sind an der Wand angebracht - eine Folge der monatelangen Wasserknappheit hier wie auch im Kap-Gebiet.
In Kapstadt werden wir von Tinashe abgeholt. Eva hat ihn für uns organisiert. Die einstündige Taxi-Fahrt nach Rooiels, wo Eva und Ken seit zwei Jahren wohnen, kostet 40 Franken. Der Ort ist nur schwach besiedelt, ein paar Häuser sind entlang der Küste verstreut, wilde Baboons rennen in der Gegend herum.
Das Piano-Zimmer, wo wir wohnen können, ist sehr grosszügig konzipiert, ein Klavier ist zwar nirgends zu sehen, dafür hat’s eine Einbauküche, in der nichts fehlt, eine Bar in der Mitte, TV, ein breites, gemütliches Bett, und alle Möbel und Einrichtungsgegenstände, wie auch diejenigen im ganzen übrigen Haus, sind in Weiss gehalten, nur die Stühle und Tische sind aus Plexiglas. Sehr stylish. - Die Aussicht – gewaltig!
Es ist 25 Grad warm, ein sommerlicher Wintertag also. Der Apéro steht auch schon bereit auf der Terrasse. Wir geniessen den milden Spätnachmittag und die wunderbare Aussicht auf die Stein- und Felsbrocken im wilden Garten, der sich bis ans Meer erstreckt, bis hin zu den tobenden Wellen. Nach einem Sonnenuntergang vom Feinsten kurz nach sechs wird’s kühl, im Haus verbreiten die Öfen eine angenehme Wärme. Mit einem feinen Nachtessen werden wir verwöhnt und endlich geht’s ab ins Bett.
Die paar Tage, die wir in Rooiels verbringen, geniessen wir sehr. Die ersten drei sind sommerlich warm, dann kommt der Regen und die Temperaturen sinken. Stundenlang kann ich den Wellen zusehen, es ist ein gewaltiges Schauspiel.
Eva gibt uns ihr Auto und wir fahren einmal mehr auf der inzwischen aufs Beste ausgebauten Küstenstrasse entlang der False Bay mit ihren atemberaubenden Lookouts. In Summerset West gibt’s eine grosse Mall, wo Theo sich vor gut anderthalb Jahren eine Brille hat machen lassen. Die ist inzwischen geschlissen (er hat sich beim Siesta-Machen draufgelegt). Sie ersetzen ihm die Bügel (Garantie) und ein unglaubliches Angebot kann er nicht ausschlagen: Zusätzlich wird eine neue Brille für 35 Franken offeriert. Eine mit stärkeren Bügeln diesmal (auf der man vielleicht sogar ausruhen kann). Und drei Tage später kann er sie abholen, was auch tatsächlich so geklappt hat.
Bei ManiPedi verwöhnen wir uns beide mit einer angenehmen einstündigen Pedicure und auf Samtpfötchen fahren wir wieder zurück nach Rooiels, wo wir uns im Fernsehen noch grad noch den dritten Satz Federer-Mannarino ansehen.
Am letzten schönen Tag fahren wir nach Stellenbosch, wo wir Steffi und Bert treffen, in deren Ferienwohnung wir letztes Mal wohnten, als wir in Cape Town waren. Eva und Ken sind auch dabei. Das Mittagessen im schönen Garten des Babylonstoren (grosse Wein-, Früchte- und Tierfarm mit verschiedenen Restaurants und Hofläden und etwa 200 Parkplätzen) ist ausgezeichnet.
Ebenso geniessen wir am Donnerstag, dem ersten kühlen und regnerischen Tag seit wir da sind, ein köstliches Fischdinner im „SeaBreeze, Fish & Shell“, einem ausgezeichneten Restaurant in gediegener aber gemütlicher Atmosphäre im schönen und farbigen Bo-Kaap-Viertel.
Anschliessend besuchen wir ein Konzert im Artscape-Theatre mit Joseph Clark und seiner Band, „featuring the Queens and Freddie Mercury“. Auch das hat uns begeistert. Nie hätte ich den Unterschied zu den echten Queens gehört. – Beim Verlassen des Theaters hat es grad aufgehört zu regnen. Wir frohlocken schon. 50 Meter - und los geht der Wolkenbruch von neuem. Knapp können wir uns ins Auto retten.
Ansonsten kann sich Theo seinem grössten Hobby, dem Ausruhen, widmen. Er muss aber auch helfen, das Auto zu packen, eine nicht ganz einfache Arbeit, weil wir eben wieder zu viel bei uns haben. Und Ken hat einen neuen Wagenheber kaufen müssen. Das Ding ist so riesig, dass es einen grossen Teil des Kofferraums versperrt.
Auch Eva hat eingekauft: Ein halber Gemischtwarenladen wird mitfahren, Trockenfrüchte, Nüsse, Teigwaren, Reis, Milch, x verschiedene Büchsen und Gläser mit was auch immer drin. Ich traue meinen Augen nicht, was alles zum Mitnehmen bereitsteht. In einer grossen Box sind nur Gewürze drin, mehr als wir zu Hause haben. Zusätzlich reist eine Bücherkiste mit, eine Kaffeemaschine, Campingmaterial, eine kleine Bibliothek mit Vögel- und Tierbüchern, Reiseführern und Kartenmaterial und was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht weiss: mehrere Kolonien von Mehlwürmern.
Ob da auch unser restliches Hab und Gut noch Platz hat? Heute Abend kommt’s aus. Ken will alles jetzt schon packen, damit wir um sieben Uhr morgens gleich losfahren können.
Auch zwei Angelruten sind im Kofferraum. Die wurden im „Men‘s Cave“, einem Secondhandladen für Camping-Freaks, gekauft. Ken findet, Theo soll sich mal mit Fischen versuchen. – Ich staune ein wenig, denke aber, das ist ja nicht eine allzu anstrengende Betätigung; die wird ihn nicht gleich aus der Bahn werfen. Eva und ich allerdings haben gleich kundgetan, dass Fischen für uns keinesfalls eine Option sein wird.
Schon am Vorabend ist das Auto gepackt, kein Quadratzentimeter Raum scheint mehr frei - wir können also in Ruhe erst um acht Uhr losfahren. Ken scheint unendlich erleichtert. Er hatte Angst, wir hätten nicht für alles Platz. Und auch Theo ist froh, dass er nicht schon um Viertel nach sechs aufstehen muss.
Samstag, 14. Juli:
Um fünf vor sieben stehe ich auf und höre mir die 7-Uhr-Nachrichten auf SRF1 an. Der Moderator wünscht seinen Zuhörern einen guten Start in den fantastischen Tag. 28-32 Grad soll es heute werden. – Ich stehe neben dem Ofen, bin warm angezogen, draussen ist es 13 Grad „warm“ und es regnet leicht. In Sutherland, wo wir hinwollen, wird’s in der Nacht 0 Grad werden. – Ich hab’s ja so gewollt, denke aber trotzdem sehnsüchtig an die Aare…
Mein Job ist es jeweils, die sogenannte Nachkontrolle zu machen, wenn wir weggehen, das heisst schauen, ob wir alles bei uns haben, nichts vergessen einzupacken. Das ist dann fast wie bei Hänsel und Gretel: Ich seh‘ genau, wo Theo seine Spur hinterlassen hat. Am Boden liegt dies und das: ein Kugelschreiber, dann ein paar Münzen, meistens Schweizergeld (das uns ja hier sehr viel nützt), auch sein i-Phone hab ich schon mal aufgehoben, sein Notizbüchlein ebenfalls. – Seine Whisky-Flasche jedoch hab ich mal übersehen, die hatte er im Zimmer in eine dunkle Ecke gestellt – was für ein Drama!
Aber diesmal hält es sich in Grenzen. Die paar Geldstücke, die ihm aus der Hosentasche gefallen sind, lese ich auf und stecke sie ein. – Wir sind parat zum Losfahren.
Wie schön, dass ich diesmal weder fahren noch irgendetwas organisieren muss. Reiseführer lesen, einmal mehr einen Thriller von Deon Meyer und auf jeden Fall die Bücher von Alexander McCall Smith lesen, das schon; Theo hat zur Vorbereitung den Film „Crocodile Dundee“ geschaut – sag er selber...
„Hi guys“, ruft Ken. „Hallelujah, praise the Lord - we are ready to rock and roll“.
Nach einer Stunde gibt’s einen Kaffeehalt. Die Fahrt führt anschliessend durch Wein- und Obstanbaugebiet, dann durch eine grüne hügelige und bergige Landschaft, wo lange Zeit keine Siedlung mehr zu sehen ist. Es sieht aus wie bei uns, wenn man über den Julier fährt: eine Art Steinwüste mit niedrigen Gestrüpp.
Kurz vor Mittag sind wir in Matjiesfontain, wo Eva Mittagessen für uns reserviert hat im Hotel Milner, der ehemaligen Residenz eines englischen Gouverneurs. Fast ein kleines Schloss steht da in der kargen Gegend, daneben ein paar hübsche kleine Läden, die Post, eine Bar, ein Museum. Auch ein Zug hält dort, der Blue Train nach Cape Town. Very English all das. Was die Engländer nicht alles hertransportiert haben, nur damit sie sich in der Fremde wie zu Hause fühlen konnten. Ein solches Gebäude hätte ich hier nicht erwartet. Im dunklen englischen Pub essen wir zu Mittag. Ein Feuer brennt im Cheminée, so ist die Temperatur drinnen wenigstens einigermassen angenehm (9 Grad draussen).
Und dann Sutherland: Der Ort liegt in der Karoo-Wüste auf 1450 m Höhe, ist 350 km von Cape Town entfernt, lebt vor allem von der Schafzucht und ist der kälteste Ort in Afrika. Fast 3000 Einwohner hat’s, ein paar Restaurants und B&Bs. Die Hauptattraktion ist der Schnee im Winter, also jetzt, und das SALT Teleskop, das drittgrösste auf der Welt.
In einem hübschen B&B (Skitterland) sind wir untergebracht: alt englisch, ein Wohnzimmer mit Cheminée und ein Schlafzimmer, beide mit all den schweren, dunklen kolonialen Möbeln ausgestattet. Das Badezimmer ist neu und sehr gross. – Eva und Ken haben ihre Unterkunft im Annex. Hier ist alles neu und modern: ein stylishes, geräumiges Wohnzimmer mit eingebauter Küche und daneben ein grosses Bad. Und das Beste: Der Esstisch steht mitten im Badezimmer, umgeben von Toilette, Bad und Dusche. Zum Todlachen! Der Raum ruft Erinnerungen wach an den italienisch-französischen Film von Luis Buñuel (Le Fantôme de la liberté) aus dem Jahr 1974, wo die Gäste auf den Toiletten sitzen und sich von Zeit zu Zeit verschämt in einen kleinen Raum begeben, um dort etwas zu essen.
Gut eingepackt in unsere Jacken haben wir noch Zeit, an der kraftlosen Sonne zu sitzen und ein wenig zu lesen. Wenigstens schneit‘s nicht. Um sechs Uhr geht’s zum Sternegucken. Es ist jetzt nur noch gerade 0°C und ein chilliger Wind weht. Wie froh bin ich, dass wir Handschuhe, Kappe und warme Jacken bei uns haben. Trotzdem frieren wir. „It’s fucking winter“, sagt Ken. Und weil es zu viele Wolken hat, sehen wir auch so gut wie nichts von den Sternen und dem Mond.
Wir brechen die Übung vorzeitig ab und fahren zurück ins Dorf. Der Tisch im Restaurant Cluster d’Hote ist noch nicht parat – also Apéro in einer Bar. Dort ist’s wenigstens ein bisschen wärmer, die haben die Gas-Heizstrahler, die’s sonst in Gartenrestaurants hat, in die Stube gestellt (wohl nicht ganz ungefährlich), aber eben, man ist froh um die Wärme.
Zurück im Restaurant (nur grad ein Wohnzimmer mit ein paar wenigen Tischen) ist unser Tisch jetzt parat. Der alte Besitzer und gleichzeitig Kellner erinnert mich an den Butler James im „Dinner for One“. Hier heisst er Johannes. Mit gemächlicher Langsamkeit schlendert er herum, er bringt uns die Karte, auf der’s etwa sechs Hauptspeisen hat, von denen drei bereits ausverkauft sind. Aufs Essen warten wir dreiviertel Stunden lang. Dann kommt mal die Suppe. Die ist sehr gut und wärmt uns auf, denn hier gibt’s keinen Wärmestrahler und im Cheminée brennt nur ein ganz kleines Flämmchen, eher zur Dekoration. Eine halbe Stunde später kommt dann doch noch der Hauptgang, sehr fein, das muss ich sagen (Bobotie für mich und Lamm für die andern). Ein Dessert wage ich nicht zu bestellen, wer weiss, wie lange wir würden warten müssen.
Zurück in unserer Unterkunft gehen wir sofort ins Bett. Ein kleiner Heizkörper an der Wand im Schlafzimmer mag überhaupt nicht zu wärmen, aber ich freue mich über die Heizdecke, die ich sogleich in Betrieb nehme.
Kalt ist’s am Morgen. Draussen 2 Grad. Im Frühstücksraum wird’s wohl wärmer sein. – Weiterträumen! – In dem kleinen Zimmer sitzt eine Familie, alle in ihren Wintermänteln und Daunenjacken. Eine Feuerstelle hat’s, aber dort ist kein Holz drin, Feuer schon gar nicht. Wir vier sitzen auch in unseren warmen Jacken am Tisch, die Besitzerin bedient uns in Stiefeln und Kamelhaarmantel. – Wie man hier leben kann - ich kann’s mir nicht vorstellen. Die Fenster sind nur einfachverglast, und der warme Tee, den wir bestellen, ist fast ein Schock für den Magen. - Und in Bern zeigt das Thermometer 30 Grad...
Das englische Frühstück ist aber mit Liebe zubereitet, der Tisch hübsch gedeckt, feine frische Früchte gibt’s, und wir hätten auch Lamm-Koteletts bestellen können (Ken tut’s). Alles im Preis inbegriffen.
XAm Mittag machen wir einen längeren Spaziergang durch und ums Dorf herum. Ein stahlblauer Himmel über dem etwas trostlosen Ort bringt wenigstens ein wenig Farbe in die Gegend. Nur gerade die Hauptstrasse ist gepflastert, alle andern Strassen sind ohne Asphalt. Es gibt nicht viel zu sehen. In der Mitte des Ortes steht die Kirche, die geschlossen ist, die meisten Häuser sehen eher verwahrlost aus. Kaum jemand ist unterwegs, ein paar Hunde kläffen, wie wir vorbeispazieren. Es ist Sonntag, ausser einem Supermarkt sind alle Läden zu. Der OK-Markt ist aber ganz gut bestückt, sehr sauber sind alle Produkte präsentiert, sogar Aromat kann man kaufen.
Dort, wo die Siedlung endet, beginnt, wie in all diesen Städten und Dörfern, die Black Township, die Slums der schwarzen oder farbigen Bevölkerung.
Es wird nun doch wieder wärmer (9 Grad) und wir können auf der Terrasse in Liegestühlen eine Zeit lang ohne Wintermantel liegen und lesen.
Abendessen gibt’s diesmal im „Blue Moon“.
Auch das ist ein Erlebnis der besonderen Art. Wir sind die einzigen Gäste. Das Restaurant ist bar jeglichen Stils. Ziemlich schlimm. Fast schon gut wieder. Über jedem Stuhl hat’s eine Wolldecke. So muss man wenigstens nur partiell frieren. Auf den Sets sind verschiedene Gebäude aus dem Dorf aufgedruckt. Unser B&B ebenfalls. Wie gestern geht es uns auch heute: Die meisten Gerichte, die auf der Karte angeboten werden, sind ausverkauft. Es gibt als Vorspeise noch genau eine Suppe. – Ken möchte gerne einen Whisky. – Hat’s keinen. Wir bekommen aber eine Flasche Rotwein. Zimmertemperatur, fast gefroren also. Wie wir später eine zweite Flasche bestellen, müssen wir erfahren, dass es nur noch Weisswein hat. Da ist aber noch eine halbe Flasche Cap Sauv übrig vom Vortag. Den schenken sie uns. – Passiert bei uns auch nicht gerade häufig. Wir sind dankbar!
Ich bestelle Pizza – na ja, Theo Lasagne – auch na ja – sieht überhaupt nicht aus wie Lasagne, aber ok, etwas müssen wir ja essen. Die Bedienung ist sehr nett, Stiefel, Mantel und Kappe gehören zur Ausrüstung.
So eine Wärmedecke im Bett ist zweifellos das Höchste der Gefühle! – Theo merkt erst jetzt, am zweiten Abend, dass auch er eine hat…
Der nächste Tag bringt uns eine Strecke von etwa 600 km - sieben Stunden Fahrt mindestens. Besser, wir schlafen jetzt mal.
Sutherland – Mokolodi - Tuli Block 16. – 22. Juli
Um halb neun sind wir parat. „Halleluja, off we go“. Ken wählt eine nicht in Google vorgesehene Route, die zweieinhalb Stunden über nicht asphaltierte Strassen führt, mitten durch die Karoo. Dafür ist sie kürzer. Nur ganz selten begegnen wir einem entgegenkommenden Fahrzeug. Alle hundert Kilometer hat’s eine Siedlung (Fraserburg, Viktoria West, Britstown, Hopetown). Wer da nur wohnen mag…
Bäume wachsen keine. Was aussieht wie eine grüne Ebene, sind nur niedrige, trockene Grasbüschel, die im sandigen Boden offenbar doch überleben. Hin und wieder sieht man irgendwelche Tiere: Affen, Springböcke, mal sogar zwei Pferde in der Nähe einer Siedlung, auch Vögel auf der Suche nach Nahrung. Die Strecke führt grösstenteils durch eine Hochebene, am Horizont und auf beiden Seiten ist’s gebirgig, oft sind es Tafelberge. Da die Sonne heute nicht scheint, ist alles mehr oder weniger grau in grau.
Der Bordcomputer meldet: Etwas stimmt nicht mit dem Reifen hinten links. Er verliert Luft. Das hat noch grad gefehlt. – Unser Glück ist, wir sind nur fünf Kilometer entfernt von Loxton, wo’s auf jeden Fall eine Garage hat. Und so ist es. Ken setzt uns in einem hübschen Café-Shop ab und fährt dorthin. Eine halbe Stunde später ist er zurück und er strahlt. Ein recht grosser Stein hatte sich in den Reifen gebohrt. Dieses Missgeschick ist hier allerdings an der Tagesordnung; der Schaden konnte behoben werden, der Pneu ist geflickt. – Wäre das fünfzig Kilometer früher passiert - hätten wir das Reserverad montieren müssen - alles Gepäck ausladen - den Wagenheber in Betrieb nehmen - ich darf gar nicht dran denken…
Wir drei anderen hatten inzwischen einen Cappuccino und konnten uns ein wenig am Cheminée wärmen. Es ist hier übrigens zehn Grad wärmer als in Sutherland – immer noch kalt.
Loxton ist notabene der Ort, wo Deon Meyers stets betrunkener Detektiv Lemmer sein Zuhause hat. Die Bücher kann man dort alle kaufen. Ich hab sie auf meinem Kindle. Gelesen habe ich etwa vier davon.
Ab Loxton ist die Strasse wieder asphaltiert. Ein paar Kilometer nördlich von Britstown machen wir Halt, essen eine Kleinigkeit und nehmen anschliessend den Rest der Etappe in Angriff. Um halb fünf sind wir in Kimberley. 560 km waren es bis hierhin.
Im ehrwürdigen und historischen Kimberley Club, wo jetzt auch Frauen logieren dürfen, bleiben wir für zwei Nächte. Das Nachtessen ist ausserordentlich gut (Filet vom Feinsten), das Zimmer wäre auch nicht schlecht („Executive-Suite“ - drei Räume), aber es ist wieder mal saukalt und einen Fön hat’s auch nicht. Das merke ich allerdings erst, wie ich meine Haare schon gewaschen habe… Und beim Ins-Bett-Gehen: „A kingdom for an electric blanket“!
Dienstag, 17. Juli 18
Im Frühstücksraum sind wir die einzigen Gäste, vier Bedienstete stehen herum.
Ken möchte gerne Porridge. Das gehe nicht, sagt man ihm. Diese Aussage jedoch geht für Ken gar nicht. Er macht klar, dass er in dem Fall selber in die Küche gehe und sich sein Porridge zubereite. – Da geht’s dann plötzlich doch. – Er kennt eben seine Pappenheimer.
Es ist wieder ein schöner, sonniger, wolkenloser Tag, etwas kühl zwar, 14 Grad auch am Mittag nur. Wir fahren fünf Minuten zum Big Hole, einem Riesenloch, das von den Edelsteinsuchern am Stadtrand von Hand gegraben wurde. Ich kann nicht glauben, dass beim Aushub keine Maschinen mit im Spiel waren. Die Ausmasse sind enorm, das Loch mehr als nur beeindruckend. Details erklärt man uns bei einer Führung. Ken, der hier in der Gegend aufgewachsen ist, weiss selber allerdings viel mehr zu erzählen, zu ergänzen und zu berichtigen. Seine Ausführungen sind auch beim Besuch des angrenzenden Museums sehr interessant, wo Häuser und Strassen aufgebaut sind, so wie Kimberley zur Zeit der Edelsteinförderung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts offenbar ausgesehen hat. Die Stadt war damals die absolut reichste in der ganzen Welt. Jetzt hat sie an Bedeutung verloren. Es gibt auch kaum Touristen in dieser Gegend; man geht in den Krüger-Park, in die Kap-Gegend und allenfalls fährt man entlang der Garden-Route. Ken sieht keine Zukunft für Kimberley.
Gleich in der Nähe befindet sich das Art Museum, wo’s ebenfalls keine Besucher hat. Das bescheidene Eintrittsgeld beträgt 5 Rand für Erwachsene (ca. 40 Rp.). Das Museum gehört jetzt der Stadt, ist also nicht mehr privat. Der Mann an der Rezeption freut sich sehr, dass wir kommen, er fragt, ob wir das Museum besuchen wollen (!?) und in dem Fall sei’s doch gleich gratis für uns. – Lustiges Afrika…
Ein paar ganz gute Bilder, Keramiken und Skulpturen sind ausgestellt und in einem angrenzenden hübschen Garten hat’s ein kleines Restaurant. Dort essen wir eine Kleinigkeit zum Zvieri; Ken bestellt sich einen Teller voller Schafs-Koteletts.
Wir essen wieder im Club. Es war so fein gestern, dass wir ein anderes Restaurant gar nicht ausprobieren wollen. Diesmal bestellen alle Filets, denn der Fisch, den Eva gestern hatte (Ken hatte sie davor gewarnt, im Landesinnern Fisch zu bestellen), riss sie nicht vom Hocker.
Jetzt ist’s übrigens warm im Zimmer; ein Angestellter hat uns gezeigt, wie man die Aircondition auf Heizung stellt.
Mittwoch, 18. Juli 16
Porridge ist heute Morgen kein Thema.
Um Viertel vor neun starten wir – noch immer Richtung Norden. Die Landschaft hat geändert, es gibt auch Bäume und viel mehr Siedlungen.
Kaffee- und Benzinhalt in Vryburg und nach viereinhalb Stunden Fahrt sind wir an der Grenze zu Botswana. Ken ist ein wenig nervös, er hat schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht bei Grenzübertritten in Afrika. Er weist uns an, unser Vokabular aufs Nötigste zu beschränken. „Yes, Sir“ würde genügen.
Es geht jedoch alles wie am Schnürchen. Wir haben Glück; wir sind die ersten Reisenden am Schalter, hinter uns muss wohl ein Bus angekommen sein, denn jetzt stehen viele Menschen Schlange. - Das ist so bei der Ausreise aus Südafrika wie auch bei der Einreise nach Botswana.
In Lobatse gehen wir einkaufen. Unsere Unterkunft für die nächsten drei Tage befindet sich im Busch, self-catering Chalets sind für uns gebucht, also müssen wir unsere Mahlzeiten selber zubereiten.
Zwei Wägeli voller Waren legen wir auf den Counter, kosten tut das alles etwas mehr als 30 Franken. – Was Eva und Ken alles einkaufen, würde für uns zu Hause für zwei Wochen reichen, hier sind’s nur grad mal zwei Tage. Und dabei haben wir doch schon sooo viel Ess- und Trinkbares im Auto mitgebracht. Aber unsere Freunde sehen das anders. Die zwei 1-kg schweren Rindsfilets sind für heute und morgen Abend geplant. Ein Kilogramm kostet übrigens knapp sieben Franken… Ich mache mir Sorgen, wo wir all die Einkäufe im Auto verstauen wollen. Wir nehmen sie auf den Schoss; es ist ja nicht mehr weit.
Nach einer weiteren Stunde Fahrt kommen wir in Mokolodi an, der Lodge, die Ken für uns reserviert hat. An der Rezeption erhalten wir die Schlüssel. Weitere zwanzig Minuten Fahrt durch den Busch über Wege wie Bachbeete führen uns endlich zu den Chalets. Es gibt vier davon; wir sind die einzigen Gäste.
Die Bungalows sind runde Häuser mit Strohdächern, „Rondavel“, wie bei „Globi im Kongo“. Es sind einfache, aber funktionell eingerichtete Unterkünfte mit Schlafzimmer, Bad mit Dusche und einer Küche, die vom Wohnbereich abgetrennt ist. Wir werden instruiert, beide Türen immer abzuschliessen und nichts auf der Terrasse liegen zu lassen. Nicht, weil’s Diebe hat an diesem abgelegenen Ort, sondern ganze Affenhorden, mindestens fünfzig Tiere, die wir auch gleich zu sehen und zu hören bekommen. Sie sind so laut, dass sie einem fast Angst einjagen. Es sind Baboons, also Paviane. Ganze Familien rasen wie die Wilden (wie auch sonst…) in alle Richtungen um die Häuser herum, den Hügel hinauf und wieder hinunter. Dazu machen sie einen Heidenlärm.
An einem schönen Ort sind wir gelandet. Die vier Chalets sind direkt an einem Wasserloch gelegen. Wenn die Affen still sind, ist es herrlich ruhig, man hört nur Frösche und Vogelgezwitscher.
Wir packen unsere sieben Sachen aus und versuchen uns ein wenig einzurichten. Es ist sehr kalt im Haus. Wir haben beschlossen, nur eine unserer beiden Küchen zu benutzen, so treffen wir kurz vor Sonnenuntergang Eva und Ken in ihrem Chalet. Ken hat bereits zwei Feuer angefacht, eines fürs Braai (BBQ würde man bei uns sagen) und eines zum Ums-Feuer-Herumsitzen-und-sich-Wärmen. Bis alles parat ist, dauert‘s eine gute Stunde, Eva deckt den Tisch und bereitet Süsskartoffeln vor, ich mache den Salat. Ken fragt Theo, ob er ein wenig Holz ins Feuer schieben könne. Das gehe schlecht, erwidert mein Gatte, es habe Dornen am Holz. – Das sei für ihn nicht anders, meint Ken… Theo versucht dann doch noch einen nützlichen Beitrag zu leisten, nämlich Feuerholz zu holen, aber das wird ein kleines Desaster, kommt er doch zurück mit einem dürren Baumstamm im Schlepptau - am Kopf blutend, ebenfalls am Ohr und auch an der einen Hand hat er sich verletzt.
Wie kurz darauf zwei Angestellte Feuerholz bringen, sehen sie, was Theo angeschleppt hat und werfen seine Trophäe kurzerhand zurück in den Busch. - Wir anderen drei finden das sehr lustig!
Ken weiss, wie grillen; das Filet ist wunderbar, alles andere auch. Wein, Whisky und Brandy sowieso. Das ganze Kilo Fleisch ist verschwunden. Ken hat etwa die Hälfte davon gegessen, wir anderen drei haben uns den Rest geteilt.
Wie kalt es genau ist, weiss ich nicht, wir haben keinen Internetempfang, können also nicht Google befragen. Es wird knapp über null Grad sein. Alle warmen Kleider, die wir haben, ziehen wir an. Bei mir sind’s fünf Schichten und Handschuhe und wir Frauen wickeln uns zusätzlich in je eine dicke Wolldecke ein. So hält man es aus. Jedenfalls nahe an der Feuerstelle.
Früh gehen wir ins bequeme Bett und schlafen recht gut, auch ohne Heizdecke. Während der ganzen Nacht hören wir Tiere, vor allem die Affen, und diese ganz besonders. Morgens um sechs geht die wilde Jagd auf unserer Terrasse los. Eine Schar Affen-Teenagers rasen hin und her, reissen die schweren Stühle um, schreien wie gestört und wie ich den Vorhang von innen ein wenig bewege, nehmen sie, wie von der Tarantel gestochen, Reissaus.
Donnerstag, 19. Juli (Kays 39. Geburtstag)
Nach einem feinen von Eva zubereiteten Frühstück gehen wir auf einen Erkundungsspaziergang in die Umgebung. Es gibt keinen Baum und keinen Strauch, über den Ken nichts zu erzählen wüsste. Welches Holz sich als Brennholz eignet, welches weniger, weil es zu wenig hart und dicht ist und welches nicht, weil der Rauch am Bratgut Durchfall auslöst (Tambuti-wood), all das gehört ebenfalls zu dem, was wir jetzt lernen. Er kennt alle Namen und auch die der Vögel, deren Gesang natürlich auch. Zum Beispiel hören wir den „Work-har-der – Vogel“, der am Abend allerdings „Drink La-ger“ singt.
Spuren kann er lesen - ich erinnere mich an die Winnetou-Bücher und Old Shatterhand. Auch von welchem Tier die Exkremente sind, erklärt er uns, wie sie ihre Reviere damit abgrenzen und welches Tier was frisst. – Da haben wir einen extrem kundigen Guide bei uns, ein wandelndes Lexikon sozusagen. Und zudem ein exzellenter Koch: Zurück am Wasserloch macht er uns eine feine Suppe und wir können beim Essen bequem den Tieren zuschauen, die inzwischen die gegenüberliegende Seite des Teichs aufgesucht haben: eine ganze Familie von Warzenschweinen, sechs Zebras, zwei Kudus und ein paar Impalas. Verschiedene Wasservögel ebenfalls.
Den restlichen Nachmittag verbringen wir an der Sonne sitzend vor unserer Behausung, lesen und geniessen den schönen Tag. Es ist wohl um die 20 Grad warm, aber bald schon wird die Temperatur wieder gegen null Grad sinken. – Schliesslich ist es immer noch Winter.
Es wird doch nicht ganz so kalt. Es ist wohl etwa um die 5 Grad. Ken hat wieder zwei Feuer gemacht, das zweite Kilo Filet wird gebraten, same procedure as yesterday. Eva bereitet ein marokkanisches Gemüsegericht zu, ihre endlose Gewürzbox beinhaltet sämtliche exotischen Zutaten, die dazu nötig sind. Ich mache wieder den Salat – Öl, Essig, Salz und Pfeffer - alles wie gehabt.
Der Blick auf das Wasserloch ist wunderschön. Langsam geht die Sonne unter und da kommt eine Giraffe vorbei. Graziös steht sie am anderen Ufer, senkt ihren Kopf, um Wasser zu trinken und das Allerschönste: wegen dem Zwielicht sieht man sie kaum noch, aber sie spiegelt sich schwarz im Wasser. Was für ein Anblick!
Dann wird es immer dunkler und der Sternenhimmel stiehlt den Tieren die Show.
Freitag, 20. Juli 18 (Kim und Diegos Geburtstag)
Um acht Uhr hätten wir starten wollen. Theo sagt, er habe den Wecker gestellt. Um zwanzig vor acht weckt uns Ken. Theo hat den Wecker eine Stunde zu spät gestellt… Jetzt gibt’s ein Gjufu. Alles rasch packen, Theo kann nicht einmal mehr rasieren (was ihn von da an gleich dazu verleitet, einen Bart wachsen zu lassen) und dann muss er wieder helfen, das Auto zu laden. Das ist alles andere als einfach. Mich dünkt, wir bringen überhaupt nicht mehr alles hinein, was vorher drin war. Zusätzliches Gepäck haben wir ja nicht. Mit Müh und Not gelingt es schliesslich und da ist überhaupt kein freier Platz mehr im Kofferraum.
Nach kurzer Fahrt sind wir in Mokolodi. Wir halten bei einer Shoppingmall. Dort wird erst mal gefrühstückt und dann geht’s zum Einkaufen. Ich kann’s nicht fassen: Was die beiden in den Trolley füllen, würde den Kofferraum meines Autos füllen ohne weiteres Gepäck. Säcke voller Früchte und Gemüse, Wein (sehr einverstanden!), mehrere Kartons Eier, drei Brote, ein Knoblauchbrot, verschiedene Beeren und gut fünf Kilo Fleisch sind im Einkaufswägeli. – Auch drei neue Gläser Gewürze – Gewürz Nummer 35, 36 und 37. Wohin damit, frage ich mich, und das im doppelten Sinn: Erst mal - wo im Auto kann die ganze Ware verstaut werden und dann, wann wollen wir das alles essen???
Eva hat gesehen, dass es in der Mall noch einen Woolworth Food gibt. - Eine weitere Einkaufstasche voller Köstlichkeiten findet den Weg zu uns.
So muss der Land Rover erstmal wieder ausgeräumt werden, zumindest grösstenteils. Dann wird neu geladen. Das Fleisch wird keinen weiteren Platz einnehmen, denn eine grosse Kühlbox, die bisher leer war, fasst auch noch gleich Butter und all die übrigen Produkte, die gekühlt werden müssen.
Früchte und Gemüse werden einzeln zwischen dem Gepäck verteilt – eine Melone da, ein Sack Tomaten hier. Die Gurke hineindrillen, geht ganz einfach, der Wein gehört unter den Beifahrersessel und was wirklich keinen Platz mehr hat, nehmen wir in die Mitte zwischen uns auf den Rücksitz. Hoch aufgetürmt.
Und so geht’s weitere fünf Stunden über Land, der A1 entlang immer noch in nördlicher Richtung, durch Gaborone hindurch (wo Alexander McCall Smith‘s Mma Ramotzwe, aus seinen überaus amüsanten und herzerwärmenden „Nr. 1 Ladies‘ Detective Agency“ - Romanen „wohnt und agiert“) und dann in den Tuli Block, wo wir gegen vier Uhr „Stevensford Game Reserve“ erreichen. Dort werden wir dreimal übernachten.
Die Farm wird von einem jungen Paar geführt. Sie ist extrem abgelegen. Wie in Mokolodi sind wir auch hier die einzigen Gäste. Ein hübsches Doppelchalet wird uns zugewiesen, alles ist sauber und einladend. Auf der Fahrt vom Parkeingang zur Rezeption sehen wir verschiedene Impalas, auch Affen, Bushbock und Eichhörnchen. Im Park hat’s keine Raubkatzen, man kann also problemlos auf Wanderschaft gehen. Viele andere Tiere jedoch sind hier heimisch und die Liste der Vögel, die man beobachten kann, nimmt kein Ende.
Vor unserem Bungalow ist separat eine offene Küche eingerichtet mit Kühlschrank, Mikrowelle, Bar, Grill, Feuerstelle und einem Esstisch, der bereits für uns gedeckt ist.
Es dauert eine halbe Stunde, bis alle Esswaren affensicher versorgt sind und unser Gepäck in den Zimmern verstaut ist.
Theo und ich, wir gehen auf einen Erkundungsspaziergang. Die Pfade durch den Busch sind über und über besäht mit Huf- und Pfotenabdrücken der Tiere. Die Farm endet am Limpopo-Fluss (er ist etwas doppelt so breit wie die Aare im Marzili, zieht aber eher gemächlich gegen Süden und ist der Grenzfluss zwischen Botswana und Südafrika), der ebenfalls oft erwähnt wird bei McCall Smith sowie die Krokodile, die’s dort hat. Ich wage mich nicht sehr nah ans Ufer – aus diesem Grund eben. Auch Nilpferde soll’s haben im Park, denen möchte ich ebenfalls nicht unbedingt begegnen.
Ken hat bereits wieder beide Feuer vorbereitet und das Nachtessen auch schon. Das Fleisch ist mariniert und steht bereit. Zur Abwechslung gibt’s heute nicht Filet, sondern Rump-Steak. Ein Kilo aber schon. Ich mach den Salat dazu, Eva kocht Reis.
Erst aber gibt’s ein stündiges Apéro, bis fast alles Holz fürs Braai verbrannt ist.
Wir sind verwöhnt, wir brauchen nicht abzuwaschen. Die Angestellten hier regeln alles. Es ist ihr Job. Wenn wir morgen früh aufstehen, ist alles sauber versorgt, blitzblank und der Tisch schon wieder gedeckt für die nächste Mahlzeit – mit Blumen und frischen Stoffservietten.
Nach dem Essen setzen wir uns ums Feuer. Es ist zum ersten Mal auf unserer Reise nicht schon beim Dinner kalt wie blöd, aber nun ist die Wärme des Feuers doch willkommen. Eva, sie ist Ungarin, singt ein Lied in ihrer Sprache. Ken hat dafür nur ein einziges Wort übrig als Kommentar: „Awful!“. Er singt dann selber eines: „Bobby McGee“ und das tönt mit seiner sonoren Stimme auch ohne Instrumente zugegebenermassen Spitze. Theo und ich, wir verzichten auf einen Beitrag aus der Schweiz.
In der Nacht ist’s wieder kalt, und trotz Duvet und dicker Wolldecke muss ich aufstehen, einen zusätzlichen Pullover anziehen und Socken.
Samstag, 21. Juli 18
Heute geht’s geruhsam zu. Morgenessen (inbegriffen) um neun in der Lobby. Es dauert recht lang, bis das englische Frühstück auf dem Tisch steht. Ich frage mich schon, ob sie die Hühner nicht gefunden haben oder ob die ihre Eier noch nicht gelegt haben. Wie’s dann serviert wird, ist es sehr lecker. – Auf meine Frage, wie der Einkauf hier funktioniere, erklärt mir Sean, er gehe etwa einmal im Monat mit einer grossen Liste ins nächste Dort und bringe mit, was nötig sei. Der Weg dorthin dauert anderthalb Stunden.
Ich mach eine Wäsche. Vor dem Haus hat’s einen Dornenstrauch. Der eignet sich bestens als Stewi-Libelle.
Ken ist es ernst mit seinem Vorhaben, Theo das Fischen beizubringen. Die beiden ziehen los mit ihren Angelruten - ein aussergewöhnlicher Anblick. Eva schaut ihnen nach und meint, Männer würden eben nie erwachsen. Ken gebe ein Vermögen aus für Zubehör und Utensilien und werfe die Fische, wenn er überhaupt einen fange, wieder zurück ins Wasser, denn er esse keinen Fisch.
Eine halbe Stunde später suchen wir die beiden Fischer am Limpoporiver auf. Erst finden wir sie gar nicht, aber dann sehen wir ihre Fussspuren im Sand und folgen denen. - Theo und Fischen... Ich find’s schon ober-speziell! – Also gefangen haben sie noch nichts, aber damit haben wir auch nicht gerechnet. Sie haben jedoch bereits herausgefunden, dass die Fische Würmer mögen – Eva meint daher, sie würden ja gar nicht fischen, sondern nur die Fische füttern.
Wir gehen zurück ins Camp, Spaghetti gibt’s zum Mittagessen. Ich mache den Salat…
Eva und ich, wir bleiben daheim, ziehen unsere Liegestühle an ein sonniges Plätzchen und lesen. Die beiden unermüdlichen Fischer ziehen wieder los.
Nebst den Würmern, die übrigens immer wieder mal versuchen zu fliehen, hat Ken noch eine andere Idee, was den Fischen eventuell munden würde: Maiskörner eingelegt in Whisky. Theo muss dafür von seinem Whisky opfern, was ihm ganz und gar nicht behagt, aber Ken besteht darauf.
Gegen Abend kommen sie heim – müde, zufrieden, aber ohne Fische. Schon ist wieder Zeit, das Nachtessen zuzubereiten. Heute gibt’s mal was ganz anderes: ein vegetarisches Menu soll es diesmal sein. Mit Poulet. - Huhn, so findet Ken, ist kein Fleisch.
Er zündet das Feuer an, ich mache den Salat und Eva bereitet mit tausend Gewürzen und unendlich vielen Zutaten ein Spitzen-Curry zu. Es könnte problemlos für sechs Personen reichen; wir essen alles fertig.
Am Lagerfeuer erzählt Ken von Theos Fisch-Fang-Versuchen. Er beschreibt alles sehr farbig, so wie es seine Gewohnheit ist. „If your fishing-line gets tangled in the tree behind you, it takes a hell of a time till you get back in the fishing-game“.
Wir erfahren auch, dass er ihn mit der Fischrute in der Hand liegend vorgefunden habe, was mich überhaupt nicht erstaunt.
Heute sind alle müde und gehen schon um neun Uhr zu Bett. Schliesslich war’s ein anstrengender Tag.
Sonntag, 22. Juli 18
Fischen ist wieder angesagt. Ich glaube allerdings nicht, dass wir zum Nachtessen von einem Fang werden profitieren können, aber warten wir‘s mal ab und trinken Rooibos-Tee.
Wir fahren an einen schönen Ort im Park, wo der Limpopo ziemlich breit ist und es Überreste eines Damms hat. Heute gehe es zur Sache, meint Ken. Gestern wär nur Instruktions-Fischen gewesen. – Ich bin ja gespannt. Eva und ich, wir legen uns auf eine Decke auf den trockenen Boden, lesen ein bisschen, lassen uns von der Sonne verwöhnen und schauen den fischenden Männern zu. Theo steht erst am Ufer, dann sitzt er, anschliessend liegt er. Passieren tut sonst nichts. Eine Stunde später allerdings – wer hätte es gedacht – kommt Ken daher mit einem Fisch an der Angel, einem Fischchen eher, kaum geeignet fürs Nachtessen. Er freut sich aber sehr. - Das Fischchen auch, wie es wieder ins Wasser geworfen wird.
Wir fahren zurück ins Camp, wo Eva schon wieder in der Pfanne rührt. – Ich verzichte diesmal auf ein Mittagessen, es wird mir langsam zu viel.
Der Nachmittag verläuft ruhig, Eva und Ken gehen auf die Pirsch, ich schreibe an meinem Reisebericht, Theo ruht sich aus.
Am Abend werden wieder zwei Feuer und ein Filet vorbereitet. Bevor das Essen allerdings parat ist, gibt Theo noch eine Sondereinlage. Er nimmt den direkten Weg zur Bar, wie ein junger Springbock steigt er über eine niedrige Mauer, statt den normalen Eingang zum Esstisch zu benutzen, rutscht auf einem Tierfell, das am Boden liegt, aus (Erinnerungen an Butler James kommen hoch, nur dass der sich jeweils wieder fangen konnte) und landet der Länge nach auf dem Bauch. Die Pfeife, die er im Mund hatte, ist gebrochen, seine Nase blutet, ist aber hoffentlich nicht auch gebrochen. An beiden Schienbeinen ist er verletzt – Merfen und unser Pflastervorrat kommen zum Zug. – Es ist grad nochmal gut gegangen; mehr oder weniger jedenfalls. Schmerzen, sagt er, empfinde er keine. Kein Wunder. Bei dem Whisky-Konsum zum Apéro. - Nun kann man Witze drüber machen. Ken dankt ihm, dass er uns mit so einer spektakulären Vorstellung unterhalten habe und bietet an, die Blutlachen am Boden aufzuwischen.
An der Stirne und am Ohr die Kratzer der Dorne, in die er hineingelaufen ist, als er Feuerholz sammeln wollte, die aufgeschlagene Nase, das blutunterlaufene linke Auge, das er seit vorgestern hat, die malträtierten Schienbeine, die weiteren Verletzungen an Händen und Armen, deren Ursache ich gar nicht kenne (ah ja, doch, eine stammt noch von einem Angelhaken) – er sieht langsam aus wie ein Zombie, mein lieber Ehemann.
Morgen werden wir die Grenze zu Zimbabwe passieren. Ich hoffe, sie werden ihn auf seinem Passfoto erkennen…
Montag, 23. Juli 18
Frühstück gibt’s um acht; vorher wird das Auto schon gepackt, wir sind also um Viertel vor neun bereit zur Abfahrt.
Ken, der sonst immer guter Laune ist, wirkt heute Morgen etwas griesgrämig. – Ich weiss schon: Es hat mit dem Grenzübertritt zu tun.
Und dass wir nach halbstündiger Fahrt auf schnurgerader, fast verkehrsloser Überland-Nebenstrasse geblitzt werden (109 statt 80 km) macht die Sache momentan auch nicht besser. Aber er hat wieder mal alles im Griff. Vom Auto aus sehen wir, wie er mit den beiden Polizisten verhandelt, die uns angehalten haben. Wie er nach einer Viertelstunde zurück ins Auto humpelt (schauspielerisches Talent), ist die Sache erledigt. Irgendwie hat er die beiden beschwatzt, uns ohne die 1000 Pula (100 Fr.), die die Busse gekostet hätte, ziehen zu lassen.
Etwa drei Stunden später sind wir in Francistown, der zweitgrössten Stadt in Botswana. Mich dünkt, die Stadt bestehe nur aus Einkaufszentren – wo das eine aufhört, fängt das andere an.
Vorräte Ergänzen ist wieder angesagt. Whisky und Wein stehen zuoberst auf der Liste.
Ich muss unbedingt versuchen, Internet-Zugang zu erhalten, gewisse Emails erledigen, sehen, wie’s der Familie geht. Im „Wimpy“ gibt’s nebst matschigen Hamburgern (ich verzichte) auch WIFI. Das Internet ist allerdings sooo langsam, dass man dabei fast verzweifelt. Eva und Ken gehen derweil selber einkaufen. Wo sie die Ware verstauen wollen, überlassen wir ihnen. Irgendwie funktioniert‘s ja wundersam doch immer wieder.
Weiter geht die Fahrt. Um zehn vor drei sind wir an der Grenze und knapp zwei Stunden später sind alle Formalitäten erledigt. Wir haben zwar wieder das Glück, grad vor einem Bus anzukommen, aber dann ist da eine Azubi, die unsere Pässe mit Stempeln und Klebern versehen und irgendwelche Papiere mit unseren exotischen Namen und Adressen abschreiben muss - und das tut sie mit aufreizender Langsamkeit.
Ken hat ebenfalls ein Problem: Sein Führerschein sei nicht mehr gültig, lassen sie ihn wissen, und sie rufen sogar Interpool an. Dort sei man derselben Meinung, heisst es. Das alles dauert seine Zeit. Wie unser Schweizer Führerschien hat auch sein südafrikanischer kein Verfallsdatum, aber das ist hier kein Argument. – Fazit: Eva muss ihren Fahrausweis zeigen. Der wird akzeptiert und sie muss über die Grenze fahren. Nach 100 Metern übernimmt Ken wieder das Steuer. - Immer wieder würden sie eine neue Schikane erfinden, regt er sich auf.
Angst hat er auch davor, dass sie uns am nächsten Posten das ganze Auto auseinandernehmen werden, wir alles auspacken müssen… Genau das passiert bei einem grossen Bus, der dort steht. Alle Passagiere mussten aussteigen und die ganze Bagage wurde ausgeräumt. Massen von Gepäckstücken stehen um das Fahrzeug herum - ich frage mich, wie lange die Inspektion wohl dauern mag. – Wir werden glücklich verschont und können endlich weiterfahren.
Nun ist’s schon fünf und wir haben noch immer einen langen Weg vor uns. Um sechs beginnt es einzunachten und Ken fürchtet, dass das Gate zum Matobo Nationalpark um sechs bereits schliesst. Unsere nächste Unterkunft ist mitten im Park und wenn wir nicht rechtzeitig ankommen… Zudem fährt er nicht gern bei Dunkelheit, was auch verständlich und tatsächlich nicht ratsam ist. Die Nebenstrassen sind nicht alle sehr gut ausgebaut und man muss mit Tieren oder Menschen rechnen, die unverhofft die Strasse überqueren. – Die A1 führt nach Bulawayo, aber irgendwo vorher müssen wir abzweigen, nur ist nicht ganz klar, wo. Ken misstraut unseren Navis, was die Sache nicht einfacher macht. Wir fahren am „Road-View-Motel“ vorbei. Falls wir zu spät ankommen, kann es sehr gut sein, dass wir halt so irgendwo übernachten müssen. – Netter Name übrigens – da weiss man wenigstens, was man zu erwarten hat. - Nun, wir erreichen das Tor um halb sieben, es ist schon Nacht, aber zum Glück sind noch zwei Angestellte dort, die erst noch unsere Pässe sehen wollen, sonstige Papiere ebenfalls und die Kens Nerven damit noch mehr strapazieren. Endlich lassen sie uns durch. Bis zu den Chalets sind’s weitere zwanzig Kilometer, aber dann ist’s geschafft. Es ist jetzt sieben und bereits stockdunkel. Genau zehn Stunden waren wir unterwegs. – Wir beziehen unsere Unterkünfte und beschliessen wieder, nur eine Küche zu brauchen, nämlich nicht unsere.
Wie’s genau aussieht, wo wir jetzt sind, ist schwer zu sagen. Es ist eine steinige Umgebung, das ist klar. Am Morgen, wenn’s hell ist, wird es sich ja zeigen. Die Bungalows sind ok, aber eben - wir sind in Afrika: Die Küche seht auf den ersten Blick ganz gut aus. In einer Schublade liegt eine lange Liste mit Dingen, die vorhanden sein sollten, aber die kontrolliert wohl niemand. Kein einziges Glas können wir finden, keine Schüssel, dafür sieben Pfannen, lauter leere Küchenschränke und -Schubladen, kein Geschirrtuch, kein Rüstmesser, keine Teelöffel, zwei Gabeln nur und zwei Eierbecher. Genau die vermissen wir sonst an fast allen Orten – hier aber hat es sie. Ein Schwamm zum Geschirrspülen, der wohl aus den Anfängen der Vortrekkerzeit stammt, dazu kein Abwaschmittel.
Auch das Badezimmer ist neueren Datums und macht einen ersten guten Eindruck. Über dem Bassin gibt’s jedoch keinen Spiegel, dafür ist die Eingangstür beidseitig verspiegelt (sehr praktisch zum Schminken und Rasieren), in der Lampe ist eine 25er-Birne drin, beim Händewaschen muss man aufpassen, dass man den Wasserhahn nicht aus der Verankerung löst. Man kann nirgendwo etwas abstellen und die Tür hat eine so enge Klinke, dass sich Theo gleich mal die Finge einklemmt und dann erklärt, dass man jemanden, der so etwas konzipiere, bei uns sofort entlassen würde…
Aber das Bett ist gemütlich und das ist uns im Moment das Wichtigste. Nachttischlämpchen hat’s keine, aber wir sind ja mit Taschenlampen ausgerüstet. Lediglich die grosse Spinne, die an der Decke lauert, kann dort nicht bleiben. Sie mag Moskitos lieben und daher sehr nützlich sein, aber das kann sie gerne überall tun, nur nicht dort, wo ich schlafe. Da kommt Theo zum Einsatz mit einem improvisierten Glas, das er aus einer Plastikflasche geschnitten hat und einem Karton. Er ist erfolgreich; sie lässt sich übertölpeln und wird irgendwo draussen, weit weg von unserer Behausung, ausgesetzt. Drei andere Spinnen kleinerer Art erhalten eine andersartige Behandlung.
Vor dem Zubettgehen aber hat Eva rasch ein Nachtessen für uns zubereitet: Spaghetti mit Kichererbsen-Tomatensauce. Seit dem Frühstück haben wir nichts mehr gegessen. - Ich rüste den Salat mit dem Brotmesser und aus Mangel an einer Schüssel serviere ich ihn in einer Pfanne. In Eva und Kens Chalet hat’s zwei Gläser, die erhalten wir netterweise. Sie trinken den Wein aus den Teetassen.
Den Wasserkocher, der bei ihnen fehlt, bringe ich mit, stelle aber bald fest, dass das keine gute Idee war, denn der Stecker ist nicht derselbe. – Englische Stecker – rund und eckig… Was die Engländer nicht alles Nützliches ins Land gebracht haben…
Dienstag, 24. Juli 18
Bei Tageslicht sehen wir, wo wir gelandet sind. Es ist eine fantastische Landschaft. Die Chalets sind zwischen riesigen Felsbrocken eingebettet. Man kommt sich vor wie auf einem anderen Planeten.
Eva bereitet ein feines Frühstück vor. Leider ist es unmöglich, es draussen zu essen, denn es sind ganze Horden von Affen unterwegs, die nur darauf warten, etwas Essbares zu erhaschen.
Anschliessend gibt’s eine Fahrt durch den Nationalpark. Die Felsformationen sind spektakulär. Wie wenn ein Volk von Riesen hier gelebt hätte. Ganz ähnlich sieht’s aus in Huelgoat, in der Bretagne. Von manchen der gigantischen Felsbrocken hat man das Gefühl, als ob sie gleich herunterfallen würden („Welcome to the Home of Balancing Rocks“ heisst’s beim Eingang zur Lodge). Die meisten von ihnen sind rund und abgeschliffen. - In Myanmar wird der Goldene Felsen als Heiligtum verehrt und man pilgert hin; hier hat’s haufenweise solches Gestein und kaum Touristen. Ein einziges Paar haben wir gesehen.
Wir fahren über einen Damm. Auf der einen Seite hat’s fast kein Wasser, auf der anderen gar keines und man hat Aussicht auf ein grandioses Flussbett, bestehend aus überdimensionierten, rund abgeschliffenen, dunkelbraunen Riesenmarmeln oder Bowlingkegeln. Man kommt sich vor wie ein Zwerg.
Einzigartig schön ist diese Gegend. Eine kurze Wanderung bringt uns auf einen der Felsen und zu einem Ort, wo Höhlenzeichnungen aus längst vergangener Zeit noch knapp zu sehen sind. Sie sollen von Buschmännern stammen.
Fischen kommt für Ken und Theo hier weniger in Frage. Der eine Fluss ist ausgetrocknet (Dry-Fishing?) und am idyllischen See, an dem wir vorbeikommen, sonnt sich eine Nilpferdfamilie. Zudem es hat Schilder, die vor Krokodilen warnen. – Müssen die Würmer halt noch ein wenig warten…
Wir brauchen unbedingt Benzin. Wir verlassen den Park und fahren ins nächste Dorf zum Tanken. Das hätte fast schief laufen können. Bei der ersten Garage sagt man, sie hätten kein Benzin mehr, es gäbe im ganzen Land Knappheit. Bei der nächsten Garage jedoch klappt’s glücklicherweise dann doch, und der Tank ist wieder voll.
In einem für hiesige Verhältnisse gediegenen Restaurant essen wir etwas zu Mittag. Dort hat es auch WIFI und Theo öffnet seine Emails. Eine stammt vom Manager der Unterkunft in Botswana: Sie hätten seinen iPad im Zimmer gefunden… Ich fasse es nicht: Es ist schon wieder passiert! Wo er den diesmal versteckt hat? - Keine Ahnung. Unter dem Kissen vielleicht? Dort habe ich tatsächlich nicht nachgeschaut. Keine Reise vergeht, ohne dass es ihm gelingt, etwas zu verlieren, und zwar keine Kleinigkeit. – Erkenntnis: Ganz offensichtlich eigne ich mich nicht besonders gut als Endkontrollöse. – „Clusterfuck“, sagt Ken…
Am Abend hat Ken das Feuer bereits wieder entfacht und es gibt einmal mehr ein perfekt grilliertes Filet. Ein Riesenteil. Eva serviert ein schmackhaftes Gemüsecurry dazu und Theo findet Kerzen für ein Candle-light-dinner. – Schon längst hat Ken seine gute Laune wieder gefunden und er macht seine üblichen Witze. Wir haben einen sehr lustigen Abend.
Mittwoch, 25. Juli 18
Vor dem Morgenessen erkunden wir die Gegend. Es hat eine ganze Reihe solcher Chalets wie das unsere, schön eingegliedert zwischen den Felskolossen. Auch einen Tennisplatz. Eigentlich ein Multi-Funktions-Platz - Basketball kann man darauf auch spielen, Fussball sowieso. Es ist aber niemand dort. Im Sommer dann wohl erst recht nicht. Auch ein Pool-Table steht dort, auf den jemand gekritzelt hat: „Pull-Table“.
Die Dame im Office, die für die ganze Anlage beziehungsweise Lodge verantwortlich ist, ist sehenswert. Sie ist eine „extremely big Mama“. Genauso stelle ich mir Mma Ramotze vor, McCall-Smith’s „traditionally built“ Detektivin. Ihr Umfang ist einfach enorm. Sie kann sich zwar kaum von Ort zu Ort bewegen, hat aber alles fest im Griff: Ihre Angestellten dirigiert sie herum, gibt Anweisungen und löst jedes Problem (lässt lösen) und ausser der Kontrolle in den Chalets funktioniert’s eigentlich bestens.
Nach Evas feinem Frühstück fahren wir wieder auf Pirsch. Es ist ein wunderbar schöner, wolkenloser Tag – etwa 15 Grad warm am Mittag, aber ganz angenehm an der Sonne. Unterwegs sehen wir Mungos, viele Vögel und immer wieder Affen. – Ich staune von neuem, was Ken alles weiss. Er kennt jeden Vogel und kann schon von weitem sagen, was für einer das ist, welche Gewohnheiten er hat, was er frisst.
In diesem Park allerdings sind die Hauptattraktion nicht unbedingt die Tiere, sondern die einzigartige Gegend mit diesen mächtigen Felsbrocken, die oft in Gruppen die eigenartigsten Gebilde darstellen – man kann alles Mögliche in ihnen sehen. „Giants‘ Playground“ – diese Bezeichnung trifft sehr gut zu auf diese märchenhafte Landschaft. Schön ist aber auch die Vegetation: Vorherrschend ist überall das hohe Gras. Majestätische Euphorbien, Akazien und Paperbark-Bäume wechseln sich ab mit einer Art lichtem Wald aus Laubbäumen, deren Blätter verwelkt sind, teilweise aber noch an den Zweigen hängen und im Sonnenlicht farbig wirken.
Bei einem Stausee machen wir Halt und picknicken. Eva hat alles aufs Beste vorbereitet. Ken macht ein Feuer, wir alle helfen mit beim Feuerholz Sammeln, und über der Glut rösten wir das Brot für unsere Sandwiches. Eine Flasche Rosé rundet das Bild ab – ein Picknick für Götter (und Göttinnen). Anschliessend legt sich Theo unter einen schattigen Baum und schläft, Eva liest in ihrem Buch, Ken und ich gehen auf Entdeckungsreise. Es hat Plakate, die vor Krokodilen warnen, aber gesehen haben wir keines und auch keine Spuren von diesen Biestern. Dass es aber Nilpferde und Nashörner hat, wird allenthalben klar, ihre Dung-Hinterlassenschaften sind weit verbreitet. Keines dieser Tiere zu sehen, macht mir gar nichts aus, im Gegenteil, wir sind zu Fuss unterwegs und daher ist’s mir lieber, sie bleiben, wo sie sind.
Die Spezies Homo Sapiens aber sieht man ab und zu. Es sind Dutzende von schwarzen Arbeiterinnen und Arbeitern, die Gräser schneiden und diese zu Büscheln zusammenbinden zwecks Bau von Dächern und Häusern. Wie bei uns Holzhaufen am Strassenrand in Waldgebieten sieht man hier immer wieder mal eine ganze Ansammlung und Aufhäufung solcher hübscher Strohgarben. – Mir tun nur die Leute leid, die diese mühsame Arbeit machen müssen. Mit Sicheln und Messern sind sie unterwegs, von morgens bis abends. Sicher werden sie kaum dafür bezahlt. Es ist aber eindrücklich, wie sie immer lachen, freundlich grüssen und einen fröhlichen Eindruck machen, wenn wir vorbeifahren.
Evas Mutter lebt in Budapest und ist momentan im Spital. Sie ist krank und Eva will sie unbedingt mindestens einmal pro Tag anrufen, aber das ist nicht so einfach. Wir fahren einen Umweg von fünfzig Kilometern, um endlich ein Telefonsignal zu erhalten, so dass eine Verbindung möglich ist.
Zurück im Camp wollen wir duschen, aber da fliesst nur kaltes Wasser. Das geht gar nicht; das ist mir eindeutig zu kalt. Wir erhalten den Schlüssel für ein anderes, leeres Chalet – das ist zwar ein wenig umständlich, aber lieber so als unter der „eigenen“ Dusche zu erfrieren.
Es ist Zeit zum Nachtessen. Was gibt’s wohl? - Wen wundert’s? - Filet Nummer sechs oder sieben; ich habe den Überblick verloren. Ab morgen sind wir vorwiegend in Hotels untergebracht, was Ken gar nicht so mag. Er möchte lieber jeden Abend ein Feuer machen und unter freiem Himmel zu Abend essen – egal wie kalt es ist. Er meint, falls sich Gelegenheit biete, doch draussen statt im Restaurant zu essen: „I’m your man!“.
Ok, ok, aber wieder mal drinnen essen und nicht draussen frieren, könnt ich mir jetzt zur Abwechslung doch auch vorstellen.
Heute Abend freue ich mich jedenfalls wieder, ins warme Bett zu kommen, denn die Temperaturen sind ziemlich gesunken.
Und wieder wird gepackt am nächsten Morgen.
Chinhoyi – Siavonga - Lower Zambezi 26. Juli – 3. August 018
Donnerstag, 26. Juli (unser 45ster Hochzeitstag)
Ein wunderschöner wolkenloser Morgen mit blauem Himmel – 9 Grad. Ab acht Uhr wird das Auto geladen. Das ist immer ein riesiges Unternehmen und alle sind froh, wenn endlich die letzte Tasche im Innern des Fahrzeugs verschwunden ist.
Ohne Frühstück fahren wir los. In Bulawayo wollen wir was essen. Das scheint erst keine gute Idee, denn ein Restaurant, wo’s ein gutes Morgenessen gibt, ist nicht ganz so leicht zu finden. Jemand gibt uns dann einen Typ, wo Weisse hingehen (nur ein Prozent der Bevölkerung in Zimbabwe sind Weisse, hab ich gelesen) und ja, das ist ein wirklich super schöner Ort - idyllisch unter Palmen, das „Earth Café“. Einen wunderbaren Kaffee und ein feines Frühstück erhalten wir in dieser sehr gepflegten Oase. Ein wenig teuer zwar, aber absolut empfehlenswert. Und ein schnelles Internet haben sie auch. So können wir uns über Whatsapp mit Kim unterhalten und das macht uns sehr viel Freude. Was wir da nicht alles an News erfahren…
Eine lange Fahrt bringt uns weitere 500 km nordwärts. Die Strecke führt über Gweru, Kwekwe, Chegutu bis schliesslich Chinhoyi.
Jetzt stimmt etwas nicht mehr mit dem Auto. Es muss die Aufhängung sein. Ken hält an, startet den Motor erneut und dann geht’s wieder gut für die nächsten etwa zwanzig Kilometer. So geht das immer weiter, wir halten x-mal an während der letzten Stunde bis nach Chinhoyi, im Norden des Landes, wo unsere nächste Station ist. Wir hoffen natürlich, dass der Land Rover es bis dorthin schafft, und das tut er. Wenigstens ist hier im Cave Motel ein Aufenthalt von zwei Nächten für uns geplant.
Ein Anruf bei der Land Rover Vertretung in Harare bringt vorerst keine Lösung des Problems. Am nächsten Tag muss weiter geplant werden.
Das Motel hat schon sehr viele bessere Zeiten gesehen, aber es ist die einzige passable Unterkunft in der Gegend und liegt auf halber Strecke zu Zambia, wo wir übermorgen hin wollen. Sogar einen Fernseher hat’s im Zimmer, der allerdings führt ein etwas seltsames Eigenleben. Plötzlich springt er von selber an.
Unser Hochzeitstags-Dinner ist nicht halb so idyllisch wie’s während der letzten Abende war. Das Restaurant im Motel ist „nothing to write home about“. Eine Atmosphäre wie in einem Abstellraum. Die Beleuchtung ist ziemlich schlimm, lila, rosarot und weiss - an der einen Wand steht ein verstaubter, ausgestopfter Springbock vor einer dunklen Holzwand, welche bei genauem Hinsehen die Höhle, deren Eingang gleich neben dem Motel gelegen ist und die wir morgen besuchen werden, als geschnitztes Relief darstellt. Daneben hängt der Kopf einer Antilope an der Wand. - Ui, ui, ui! – Zudem werden wir aus irgendwelchen Nebenräumen von drei verschiedenen Lautsprechern mit unterschiedlicher Musik bedudelt. Zudem riecht‘s auch nicht besonders gut im Speisesaal.
Aber wir müssen mal nicht frieren und haben eine Abwechslung im Speisezettel. Der Fisch ist ausgezeichnet, stammt aus einem der Flüsse hier (Bream = Brasse). Theo bestellt sich aus Übermut ein halbes Poulet, von dem er aber nur grad die Hälfte isst. – Den Wein kann man trinken.
Freitag, 27. Juli 18
Wir schlafen ein wenig länger als gewöhnlich und sind beim Frühstück allein. Eva schickt uns eine Whatsapp-Meldung, sie seien unterwegs nach Harare, um das Auto flicken zu lassen. O weh, ein Weg von 130 km – wie von Bern nach Zürich. - Offenbar hat’s in der Gegend hier keine Autowerkstatt, die den Rover flicken könnte
Wir frühstücken erst mal, dann machen wir es uns gemütlich. Es ist kalt am Morgen, wird aber tagsüber 26 Grad warm. Jetzt steht die Besichtigung der Höhle auf dem Programm. Steile Treppen führen zu einem riesigen Loch im Gelände und unten hat man einen Blick auf einen tiefblauen See, in dem sogar ein paar Taucher schwimmen. Ein weiterer Weg führt unterirdisch durch einen engen Gang zu einem anderen See. Wieder im Freien begegnet uns eine junge Familie mit drei Kindern und sie bitten uns, ob sie mit und von uns Fotos machen könnten. Klar doch; das sind wir gewohnt. Schon in Myanmar wollten alle ständig mit uns fotografiert werden. Irgendetwas an uns muss dran sein…
Im Motel hat’s einen recht grossen, gepflegten Garten und einen Swimmingpool. Der ist natürlich leer in der Winterzeit, obwohl‘s ja heute gar nicht so daneben wäre, sich ein Bad zu genehmigen. So legen wir uns im Badeanzug auf den Liegestuhl. Das sieht doch endlich mal wie Ferien aus.
Auch finde ich Zeit, an meinem Reisebericht weiterzuschreiben. Das Internet funktioniert einigermassen gut und das Passwort kann ich mir leicht merken: „buy2beers“.
Eva und Ken sind zurück. Sie brauchten drei Stunden bis in die Hauptstadt, schlimm sei’s gewesen, berichten sie, weil sie ständig hätten anhalten müssen und nicht mehr als 50 km hätten fahren können. Dann ein einstündiger Stau im Stossverkehr.
Innerhalb von einer Viertelstunde sei das Auto repariert worden, ein winzig kleines Stückchen durchgescheuerter Schlauch war die Ursache der Panne gewesen. Gekostet habe die Reparatur nichts. Die Fahrt zurück dauerte anschliessend nur eine Stunde.
Wir sind natürlich froh, dass alles so rasch und gut hat erledigt werden können und wir morgen, ganz nach Plan, nach Zambia weiterreisen können.
Nachtessen im Motel, wie gehabt – nochmals den Fisch bestellt. – Theo Curry, weder Fisch noch Vogel.
Samstag, 28. Juli 18
Um neun ist Abfahrt. Ken kennt die Gegend aufs Beste. Sein Onkel hatte eine Farm in dieser Gegend. Als Junge hat er die meisten seiner Sommerferien hier verbracht und hat bei der Tabakernte mitgeholfen. Er erklärt uns genau, wie die mühsame Arbeit der Saat und der Ernte abläuft. – So sehr ins Detail geht er mit seiner Beschreibung, dass Eva fragt, ob wir am Ende der Reise einen Test würden absolvieren müssen...
Auch hat er uns bereits darauf vorbereitet, dass es unterwegs eine speziell gute Metzgerei gäbe, die er besuchen wolle. Und ja, so viele Weisse, wie dort am Einkaufen sind, haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Wir halten also an im „Lyon’s Den“ und ich sehe gleich, das ist genau die Art Laden, die Ken liebt. Wurmbüchsen kann man kaufen (Chinhoyi ist bekannt dafür, besonders feine Würmer anzubieten) und jede Art von Angelhaken. Alles ist absolut sauber und gepflegt, auch ein Restaurant ist angeschlossen. Und dann in der Metzgerei: Biltong muss es sein. Sowieso. – Und was kaufen wir sonst noch ein, was? – Wir hatten ja schon seit zwei Tagen kein Filet mehr, also liegt es auf der Hand, dass wieder eines gekauft werden muss. Wir leiden doch alle schon an massiven Entzugserscheinungen.
Die Fahrt geht weiter in Richtung Karoi. Früher war hier eine Farm nach der anderen und seit die weissen Farmer vertrieben oder ermordet worden sind, läuft nicht mehr viel. Die Felder sind grösstenteils verwahrlost. Ken zweigt ab, um uns zu zeigen, wo die 6000 ha grosse Farm seines Onkels gewesen war. Es ist eine sehr traurige Exkursion. Schon das Tor zur Einfahrt ist halb zerstört und vom ehemaligen Farmhaus sind kaum mehr Mauern vorhanden; die Anlage für die Tabak-Verarbeitung ist noch grösstenteils sichtbar, aber nur in Ruinen. Dort, wo die Pferde gehalten wurden und dort, wo all die Ziegen und das Vieh gegrast hatten, ist nichts mehr. Nur noch Gestrüpp und hohes Gras. – 250 Arbeiter mit ihren Familien sollen hier gelebt und gearbeitet haben. Wo sind sie geblieben? Jobs hat’s keine mehr, der Bevölkerung geht es schlechter denn je. Da ist offensichtlich alles völlig falsch gelaufen.
Eva meint, die Arbeiter seien wohl nicht genügend gut bezahlt und behandelt worden, sonst wär’s vielleicht nicht so weit gekommen. Diese Ansicht kann Ken nicht akzeptieren. – Die Diskussion bringt nichts.
Zimbabwe (früher ein Teil Rhodesiens) muss ein sehr fruchtbares Land gewesen sein, der Brotkorb von Afrika, bevor Mugabe es wirtschaftlich zugrunde gerichtet hat. Jetzt ist es ein armes Land, zwar landschaftlich wunderschön, muss Nahrungsmittel aus dem Ausland einführen, hat viele Arbeitslose und es besteht kaum Aussicht auf Besserung. Überall, wo man hinkommt, scheint die Gegend heruntergekommen und verwahrlost. Das Geld hat keinen Wert mehr, seit 2009 zahlt man mit Dollars. Weltrekord war eine 100-Billionen-Zimbabwe-Dollar-Note, mit der man so gut wie gar nichts kaufen konnte.
In zwei Tagen, am 30. Juli, sind Wahlen. Überall sind Wahlplakate angebracht und es wird mit einer Wahlniederlage der amtierenden Partei gerechnet. Nur wird wohl doch nichts ändern, denn alles ist abgekartet, wie befürchtet wird, und die Regierung wird wohl kaum einen Wechsel tolerieren. – Wir werden ja sehen. Jedenfalls sind wir froh, dass wir am Montag nicht mehr da sind; es könnte Ausschreitungen geben.
Im Cave-Motel hat mich der junge Mann, der unser Zimmer aufgeräumt hat, angesprochen. Sein Englisch ist nicht sehr gut; ich hab nur was von Zimbabwe verstanden und hab geantwortet, was für ein schönes Land es sei. Da hat er vehement den Kopf geschüttelt und gesagt: „Not nice, Zimbabwe. No cash!“ Er hat dann noch was gemurmelt von Adresse geben, aber auf diese Idee bin ich nicht eingestiegen.
Nach Karoli ändert sich die Landschaft. Wir fahren durch einen Nationalpark. Soweit das Auge reicht, sieht man Büsche und Bäume. Die Gegend erinnert an einen lichten Herbstwald in Kanada ohne rote Blätter jedoch. Der Boden ist nicht mehr fruchtbar. Es ist hügelig, hat viele Kurven. Verkehr hat’s keinen, Siedlungen auch nicht; die sind verboten. An mehreren Orten sind zwischen den Bäumen eine Art schwarz-blaue Leintücher aufgehängt. Es sind Tse-Tse-Fliegen-Fallen.
Ken erzählt, früher habe es sehr viele Tiere gehabt in diesem Park, Elefanten, Zebras, Antilopen und auch Giraffen habe man nicht selten sehen können. Der Grund? Wilderer haben die Tiere bis zum Aussterben gejagt und vertrieben. Die Regierung ist an dieser Misere nicht unbeteiligt. Das schwarze Nashorn ist hier bereits ausgestorben. - Wir sehen lediglich ein paar Baboons.
Bis auf 1200 Meter führt die Strasse bergauf, dann geht’s hinunter ins Zambezi-Valley. Immer wieder sieht man talwärts auf den riesigen Lake Kariba, den Stausee, der nach einer Bauzeit von sechs Jahren 1960 eingeweiht wurde. Er ist 280 km lang und 40 km breit, zehnmal so gross wie der Bodensee. Knapp sieht man im Dunst das gegenüberliegende Ufer. Ansonsten hat man das Gefühl, es handle sich um ein Meer.
Italienische Arbeiter haben mitgeholfen, den Damm zu bauen. Für sie wurde ein Dorf errichtet (Kariba Heights), wo sie wohnen konnten. Von dort aus hat man eine wunderschöne Aussicht auf den See und so war das auch ein viel besuchter Touristenort nach dem Bau des Damms.
Ken erzählt, wie jeweils die grossen Busse auf dem Parkplatz mitten im Ort parkiert und die Reisenden vom Restaurant aus die Aussicht bewundert hätten. – Jetzt, seit der Machtübernahme, ist alles heruntergewirtschaftet. Niemand geht mehr hin, im Restaurant gibt’s nichts mehr zu essen, überall liegt Abfall herum, von den Toiletten schreibe ich lieber nichts. Nur ein paar vergilbte Schilder stehen noch da. Einzig die Kirche ist gut unterhalten und an der Aussicht hat sich nichts geändert.
Auch einen zweiten Aussichtspunkt besuchen wir. Von dort aus sieht man auf den Zambezi-River hinunter, auf die Schlucht und auf die beeindruckende Staumauer. Auf der anderen Seite der Mauer beginnt Zambia – dorthin wollen wir nun.
Bis wir aber dort sind, dauert es noch ein paar Stunden. Die Zoll- und Grenzformalitäten in Zimbabwe sind rasch erledigt, aber dann… Wir fahren über den Damm, Theo und ich gehen vorerst mal zu Fuss und schiessen ein paar Fotos, bis uns Ken wieder auflädt.
Nach kurzer Fahrt erreichen wir den Grenzposten. Ken schwitzt bereits. Er hat uns vorher schon erzählt, wie es dort meistens zugehe, dass sie einem das Leben schwer machen würden mit x verschiedenen Papieren, die man vorweisen müsse, die gar niemand bei sich hat, weil sie weder nötig sind noch existieren.
Die Passkontrolle läuft ohne Zwischenfälle ab, eine junge Angestellte stempelt unseren Pass, knöpft uns je 50$ ab für unser Visum und dann scheint alles in Ordnung. Ken, weil er der Fahrer ist, wird mit seiner ganzen Aktenmappe voller Papiere von Schalter zu Schalter geschickt und muss als letzte Anlaufstelle noch bei der Polizei vorsprechen. Da ist aber im Moment keiner im Büro. Der hat uns, Theo und mich, entdeckt, die wir im Schatten auf einem Treppenabsatz sitzen, lesen und warten. Er macht ein finsteres Gesicht und schnauzt uns an. Ich kann gar nicht verstehen, was er will. Theo soll kommen! – Es stellt sich dann heraus, dass er meinte, Theo sei der Fahrer. Ken hat er gesucht und er ist äusserst schlecht gelaunt. – Und jetzt geht genau das los, was Ken uns vorher beschrieben hat. Er will eine Bestätigung, dass das Auto nicht gestohlen ist, also einen Fahrzeugausweis. Selbstverständlich ist der vorhanden. Das Auto gehört Eva und der Ausweis ist mit ihrem Foto versehen, farbig und laminiert. – Er will ein anderes Papier. Auch geht er jetzt ums Fahrzeug herum und prüft jede Nummer und weiss ich was. Ken regt sich auf, Eva besänftigt ihn, denn es hat keinen Sinn, den Typen noch mehr zu reizen. Alle wissen wir genau, was er will. Die grüne Seite im Pass fehlt (100$-Note), aber Ken sagt, er wolle diesem Idioten (er braucht einen ziemlich viel stärkeren Ausdruck, den ich hier lieber nicht hinschreibe) kein Bestechungsgeld bezahlen. Eva zeigt nochmals ihre Papiere und auch ihren Diplomatenpass. Der Polizist lässt sich aber in keiner Weise beeindrucken und schliesslich muss Ken ihm zähneknirschend die Kohle geben. Wir würden sonst noch immer am Zoll stehen oder wir hätten den Wagen dort lassen müssen. Es hätte auch gut sein können, dass er noch mit anderen Forderungen herausgerückt wäre. Eva erzählt von allerhand Erfahrungen, die sie gemacht haben, immer und immer wieder. So hatten sie vor ein paar Jahren in Namibia zwei Wochen Ferien gebucht, alles bereits bezahlt und man liess sie nicht ins Land einreisen.
Endlich können wir losfahren – wer hätte gedacht, dass wir das Tor schliesslich doch noch passieren können mitsamt dem Land Rover.
Ken schäumt vor Wut. Während 27 Jahren organisiere er Safaris, schimpft er, und genau wegen diesem ewig gleichen Theater möge er das nun nicht mehr machen. – Er wünscht dem Beamten, dass er Durchfall kriege. Da kommt ihn noch eine schlimmere Strafe in den Sinn: Möge er doch mit unseren Dollars heute Abend zu einer Prostituierten gehen, die Aids habe…
Theo kann’s auch nicht fassen. Man müsste dem Konsulat schreiben, man müsste etc. etc. – Es ist Afrika. So ist das hier halt. Gehört habe ich schon oft von solchen Zwischenfällen, erlebt hab ich’s aber nie. Nun sehen wir selber an einem kleinen Beispiel, wie’s so läuft, wenn ein Land korrupt ist. – Ich denke, die paar Beamten haben sich den „Lohn“ geteilt und machen sich einen schönen Abend damit. Mit oder ohne Prostituierte…
Nur etwa fünf Kilometer müssen wir fahren, bis wir in Siavonga sind, wo Ken für uns zwei Bungalows in der „Eagles Rest - Lodge“ gebucht hat. Er war schon mehrmals da, kennt die Besitzer und wie immer hat er uns an einen herrlichen Ort geführt. Die Lodge liegt direkt am Wasser, ein kleiner Sandstrand und eine Bar laden zum Verweilen ein. Baden wird leider nicht empfohlen, da’s Krokodile hat und Nilpferde. Nicht in Massen zwar, aber immerhin. Schon mehr als einmal, so erzählt man uns, seien Menschen hier von Croks angegriffen und sogar gefressen worden. – Da verzichte ich gern und überlege mir allenfalls, ob ich doch den Pool vorziehen soll. Warm genug ist es; 28 Grad macht Freude nach all der Kälte, die wir bisher „erleiden“ mussten.
Es ist Winter und trotzdem erscheint die Vegetation hier wie im Sommer. Besonders gefallen mir die riesigen Mangobäume, die in Blüte sind.
Gestern gab’s das „Mond-Spektakel“ mit dem roten Mond, eine Jahrhundert-Finsternis. Wir haben’s verspasst. - Heute Abend aber sitzen wir im Strandrestaurant beim Abendessen, die Füsse im Sand und sehen den Mond ebenfalls ganz orangefarbig und riesig. Leider ist es uns nicht gelungen, gute Fotos davon zu schiessen. Nur die Spur im Wasser (the stairway to heaven) sieht man einigermassen.
Es ist noch immer knapp 20 Grad – das sind wir nicht mehr gewohnt. Wir geniessen den warmen Abend sehr. Sogar Ken hat sich beruhigt nach drei doppelten Whiskys.
Sonntag, 29. Juli 18
Alles easy, so wie wir’s gern haben. Kein Stress. Um neun frühstücken wir und packen dann die Dinge ein, die wir für drei Tage und zwei Nächte auf dem Hausboot brauchen, das Ken gemietet hat, die „Buccaneer“. Den Rest des Gepäcks lassen wir in der Lodge, wo wir anschliessend eine weitere Nacht verbringen werden. Eva, fürsorglich wie sie ist, packt noch zusätzlich ein paar Lebensmittel ein, die wir eventuell während der nächsten zwei Tage vermissen würden, falls wie sie nicht dabei hätten: Kens Honig, den er jeweils reichlich in den schwarzen Kaffee träufelt, Theos Orangen-Marmelade, braunes Toastbrot und Butter, mein Schwarztee und was noch mehr.
Um halb zwölf sind wir auf dem Boot. Es ist einfach super. Konzipiert ist es für zehn Leute. Wir sind die einzigen vier Passagiere. Zwei schöne Kabinen werden uns zugewiesen.
Der Kapitän heisst Pete; er ist ein Südafrikaner, der auch deutsch spricht. Die weitere Crew besteht aus Raymond und Gerard. Sie kochen und putzen für uns, erledigen alles, was nötig ist, um ein solche Schiff zu betreiben und machen das Beiboot parat, wenn’s gebraucht wird.
ch kann sie schlecht auseinanderhalten, sie sind beide etwa 25-jährig, hübsche junge Männer und sehr schwarz. Der eine hat ein weisses Hemd an, der andere ein blaues. Eva geht es gleich; sie hat eine hilfreiche Idee: „Blueray“ ist die Eselsleiter. Der blau angezogene ist also Raymond. – Dumm nur, dass am nächsten Tag auch Gerard ein blaues Hemd anhat…
Es ist eine fabelhafte Reise: ein bisschen lesen, ein bisschen sonnenbaden, ein bisschen schlafen. Dazu tuckern wir der Küste entlang. Kurz nach der Abfahrt wird ein feines Mittagessen serviert (Salate, Samosas, Pizza). Nach ungefähr 40 Kilometern legt das Boot in einer schönen Bucht (Eagles Bay) an, von drei Seiten her geschützt. Das sei wichtig, sagt Pete, denn hier könnten die hohen Wellen dem Boot nichts anhaben, falls des Nachts plötzlich ein Sturm aufkäme. - Da werden wir also auch übernachten. Auf Google-Map sehe ich, wo wir sind. Weit sind wir noch nicht gekommen, wenn man die Läge des Sees in Betracht zieht.
Die Männer wollen fischen. Es geht nicht lang und Ken hat einen Fisch an der Angel. Der ist noch kleiner als derjenige, den er aus dem Limpopo gezogen hat. Bald hat er Nr. 2 und 3 an der Angel. Immer kleiner werden sie. Ich muss langsam meine Lesebrille anziehen, um die Trophäen zu erkennen. Die Würmer, an denen sie hangen, sind besser sichtbar. Aber immerhin – ein erster Erfolg. Auch Theo versucht sein Glück weiterhin, gibt aber bald auf und widmet sich seinem Zeichenblock. Zeichnen kann er eindeutig besser als Fischen.
Zum Abendessen gibt’s ein feines Rinds-Goulasch mit Reis und anschliessend einen Fruchtsalat. – Um neun gehen wir schlafen.
Was für eine Idylle. Die Motoren sind abgestellt, nur das laute Quaken der Frösche hört man noch bis weit in die Nacht hinein.
Montag, 30. Juli 18
Um neun Uhr haben wir das Frühstück bestellt, um zehn ist es parat. Wir sind ja in den Ferien, nicht auf der Flucht – niemand hat ein Problem damit. Ken ist bereits wieder am Fischen, Theo am Zeichnen, Eva und ich sind am Schwatzen und am Lesen.
Das ganze Morgenessen wird von unseren beiden blauangezogenen Stewarts auf dem Grill zubereitet (Eier, Würste, Schinken, Speck, Tomaten, Zwiebeln und das feine, hausgemachte Brot). – Auch Pete hat jetzt übrigens ein blaues Hemd an, aber den zu erkennen oder besser gesagt zu unterscheiden, ist ja nicht das Problem.
Das Schiff verlässt die Bucht und fährt weiter durch eine enge Passage zu einer Nebenbucht des Sees. Bei einer Lodge wird es vertäut. Gerard und ein Typ, der dort am Ufer steht und auf seinem T-Shirt eine Ente abgebildet hat, was ein wenig lächerlich wirkt, helfen, das Boot an Bäumen anzubinden. Da werden wir übernachten.
Erst gibt’s schon wieder zu essen. Wunderbares haben sie hingezaubert, die beiden Stewarts. Sie haben sich umgezogen – der eine hat ein weisses Hemd an, der andere ein orangefarbenes…
Eigentlich ist’s nur eine Camp-Site und auch die Lodge ist keine richtige Hotel-Unterkunft, privat also. Sie gehört offenbar einem Mann, der hier nur für seine Familie und Freunde ein Ferienresort gebaut hat. Weit und breit gibt’s keine Siedlung und ich kann mir nicht vorstellen, wie man an einem so abgelegenen Ort wohnen will.
Trotzdem ist da der junge Mann (mit der Ente am Bauch), der unser Boot eingewiesen hat, der den Rasen sprengt und die absolut saubere WC- und Duschanlage pflegt. Sonst nirgends eine Menschenseele. Das Ganze ist richtig absurd. Und ungefähr 50 Meter im See vor dem Ufer ist eine Art Insel eingebaut mit einem krokodilsicheren Swimmingpool drauf und einem Sonnendach.
Überhaupt sieht man währen der ganzen Fahrt ausser diesem etwas seltsamen Camp nirgendwo am Ufer eine Siedlung. Auch keine anderen Boote sind unterwegs. Nur gerade hier, in dieser Bucht, hat’s ein paar Fischerboote. Pete sagt, die würden mit Netzen fischen und das sei absolut verboten. Sie machen’s trotzdem.
Auch über unsere Fischer gibt’s was zu erzählen: Ken ist es doch noch gelungen, einen ansehnlichen Fisch aus dem Wasser zu ziehen. Wir alle schauen natürlich zu und befürchten, die Rute würde gleich brechen, aber dem ist nicht so. Nach einem kurzen Kampf ist der Fisch an Bord gezogen und windet sich im Netz. Etwa zwei bis drei Kilo schwer und knapp ein Meter lang ist er, so schätzen wir. Es ist ein Wels, den sicher niemand essen will, also wird er wieder ins Wasser befördert. Gruuusig finden wir, (Eva und ich). Die Männer allerdings sind ganz aus dem Häuschen…
Nach einem feinen Nachtessen (Braai) sind wir früh schon müde und gehen schlafen. In der Nacht soll ein Flusspferd ums Boot „herumgeschlichen“ sein, erzählen uns Pete und Ken am Morgen - ich hab’s verschlafen…
Dienstag, 31. Juli 18
Schon früh am Morgen ist Raymond dabei, das Deck zu schruppen. Überall wird säuberlich geputzt. Dann gibt’s wieder ein üppiges Frühstück. Es ist schon richtig heiss an der Sonne um neun Uhr. Ich geniesse es und denke ans Marzili, an die Aare und an alle unsere Freude, die den aussergewöhnlich heissen Sommer zu Hause geniessen können. Theo und ich, wir nehmen ein Bad im Swimmingpool. Pool ist zwar richtig, „Swimming“ eher nicht. Die Temperatur ist wohl etwa die gleiche wie heute in der Aare – ungefähr 23 Grad.
Langsam fahren wir zurück nach Siavonga. Kurz nach ein Uhr mittags kommen wir an und nach einer weiteren Mahlzeit beziehen wir wieder unsere Bungalows.
Ich geh baden im Pool und mach ein paar Fotos vom schönen Garten. Etwas bewegt sich im Bild, von dem ich eigentlich dachte, es sei ein abgeschliffener Felsbrocken. Aber nein, es ist ein Flusspferd. Es grast gemütlich genau auf dem Weg, den wir vorher vom Boot gekommen sind. – Ich glaub’s ja nicht. Ich hatte nämlich leise vermutet, dass die Warntafeln mehr zur Freude der Touristen da seien und Krokodile und Hippos kaum so nah an die Siedlung herankommen würden. – Fehl gedacht. Fürs Personal ist’s jetzt schwierig, unbehelligt zum Boot zu gelangen, welches für die neuen Gäste parat gemacht werden muss. Alle sind zu einem Umweg gezwungen.
Auf unser Nachtessen warten wir heute Abend sehr lang. Es sind neue Gäste angekommen, eine ganze Gruppe Irländer. Da bricht der Service halt zusammen.
Erst um halb zehn sind wir im Bett – ungewöhnlich spät für unsere hiesigen Verhältnisse.
Mittwoch, 1. August (CHs Geburtstag)
Wir hören, dass es gestern in der Schweiz sehr warm war, 37 Grad in Oerlikon. Ist ja krass. Und Feuer kann man auch keine machen heute, hab ich gelesen. Das wird mir ja ein Nationalfeiertag ohne all die Pyromanen.
Da haben wir’s besser. Endlich warm, schön warm, Ende der Kälte. Kühl in der Nacht aber sommerlich am Tag. So langsam fängt der afrikanische Winter an, mir zu gefallen.
Heute haben wir nur eine relativ kurze Fahrt vor uns. Die Kiambi-Lodge im Lower Zambezi ist das Ziel. Unterwegs halten wir an, um einen kleinen versteinerten „Wald“ zu besichtigen. Nur wenige „Baumstücke“ liegen herum. Ich denke, im Hügel drin sind noch sehr viele mehr versteckt.
Schon nach drei Stunden kommen wir an. Eine tolle Lodge ist das mit einzelnen Cabins aus Holz und Zeltplachen. Alles ist sehr gepflegt und man hat einen einmalig schönen Blick auf den Zambezi River, der dort grad eine Kurve macht. Ein feines Mittagessen wird serviert und anschliessend haben wir Zeit für Siesta (Theo!) und eine Abkühlung im Pool (ich). Auf dem Weg dorthin zieht sich Theo allerdings Verletzung Nummer 7 oder 8 (?) zu. Er kommt daher gehumpelt, hat nicht aufgepasst, wo er hintritt. Die Dornenbüsche hier sind nicht „Micky Mouse“, wie sich Ken ausdrücken würde. – Drei Dornen haben einen seiner Flip-Flops durchstochen und eine davon hat sich erfolgreich in Theos grosse Zehe gebohrt. Ich zieh sie raus und es blutet einmal mehr Bedauern erweckend.
Ab vier Uhr nachmittags beginnt schon die „Sundowner-Cruise“. Mit dem Motorboot geht’s flussaufwärts und am Ufer entlang sehen wir viele Vögel. Am besten gefallen mir die farbigen White-Fronted-Bee-Eaters, die zu Duzenden an den Böschungen herumfliegen, wo sie in kreisrunden Löchern ihre Nester gebaut haben und nun ihre Jungen versorgen. Auch der Nationalvogel von Zambia und Zimbabwe, der African Fish Eagle ist unterwegs sowie zwei Elefanten, die grad dabei sind, einen seichten Flussarm zu durchqueren, um auf die Insel zu gelangen, auf der wohl noch bessere Kräutchen wachsen – ein fantastisches Bild, die beiden im Zwielicht zu beobachten. Und der Sonnenuntergang auf dem langsam dahinfliessenden Fluss ist unvergesslich.
Der Fluss wimmle nur so von Hippos, hat man uns gesagt. Das stimmt. Ganze Familien tummeln sich im Wasser, vier, sechs, zehn Köpfe gucken aus den Wellen, schauen in unsere Richtung, tauchen wieder ab, und das an etlichen Stellen. Sie machen mir Angst. Die Töne, die sie dabei ausstossen und die man auch des Nachts immer wieder mal hört, sind unheimlich. Erst ist’s eine Art dumpfes Schnorcheln, dann folgen ein paar Geräusche, die sich anhören, wie wenn jemand ein schweres Sofa ruckweise über einen Steinboden schleifen würde - ein gespenstischer Chor. Manchmal ist‘s auch nur ein einzelner Ton, grad wie aus einer Posaune geblasen. - Das macht Eindruck. Einige der Kolosse heben sich aus der Strömung hoch. Ob das Drohgebärden sind? - Wenn das Boot übers Wasser schiesst, hab ich die Befürchtung, es rase in eine solche Herde hinein. Der Steuermann ist aber sehr geschickt; er scheint den Fluss gut zu kennen.
Wie wir zurückkommen, ist der Tisch für uns bereits gedeckt. Auch das Kerzenlicht fehlt nicht. Draussen im Freien mit Aussicht auf den Fluss und aufs Lagerfeuer werden wir aufs Beste bedient und verwöhnt.
Für morgen ist für uns eine Kanufahrt gebucht. Wir fahren auf eine Insel und dort werden wir in Zelten übernachten. Richtig abenteuerlich. - Ich bin nicht sehr begeistert. Wie wir an all diesen Flusspferden vorbeisteuern wollen, kann ich mir noch nicht vorstellen. Krokodile hat’s ja schliesslich auch. Wir haben ein paar von ihnen gesehen auf unserem Ausflug, Exemplare in jeder Grösse. – Am liebsten würde ich passen.
Dazu kommt noch, dass wir für die Kanufahrt ein Notfallblatt ausfüllen mussten mit sämtlichen Personalien, Passangaben, wer im Notfall zu erreichen wäre, Nummer der Versicherung und des Arztes… All das trägt nicht dazu bei, dass ich denke, es sei „Micky Mouse“. – Jedenfalls habe ich in der Nacht bereits Albträume.
Donnerstag, 2. August 18
Frühstück um sieben, anschliessend Packen, Instruktionen um acht, Abfahrt um neun.
Ins Kanu sollen wir möglichst nichts mitnehmen. Sollte es kentern, sei Hab und Gut verloren, heisst es…
Mit dem Motorboot fahren wir flussaufwärts an eine Stelle, wo vier grüne Kanus bereits auf uns warten. Wir sind zu zehnt. Vier von uns werden nur bis zu dem Ort mitreisen, wo’s Lunch gibt; wir andern sechs (ein junges Paar aus England ist mit dabei) paddeln weiter bis zur Insel, wo wir übernachten werden.
Bevor wir einsteigen, werden wir nochmals genau instruiert und für mich wird unser Vorhaben immer unheimlicher. Eva geht es gleich. Sie nimmt vorher noch eine Schmerztablette, nimmt einen tiefen Schluck aus ihrer Wasserflasche, merkt dann aber, dass das ja die Flasche ist, in die sie ihren Gin abgefüllt hat, den sie mitnehmen will. – Das sei vielleicht gar nicht das Dümmste gewesen, meint sie, sie habe jetzt gar nicht mehr so grosse Bedenken.
Unser Guide erklärt, wie wir uns zu verhalten haben. Er fährt voraus, die andern müssen hinter ihm bleiben und Abstand halten. Sollte ein Hippo das Boot von links angreifen (es sei sehr selten und wenn, dann würde es das nur zur Verteidigung tun – wie wenn mir in dem Moment seine Gemütslage interessieren würde), dann solle man auf der rechten Seite des Bootes ins Wasser springen und zur nächsten Insel schwimmen. Mit der Hand zeigt er aber nach links. Ui, ui, ui – was jetzt? Wie Theo – der verwechselt auch oft links mit rechts. Die Tiere würden wenn schon eher das Boot angreifen und nicht die Menschen… Diesen Job könnte dann aber ein anderer übernehmen, überlege ich mir, denn wie Ken jeweils sagt: „If there is a hippo, his friend Mr. crocodile is not far“. - Mir wird immer mulmiger zumute. - Und nicht zu nah am Ufer paddeln, da habe es oft Hippo-Mütter mit ihren Jungen, und mit denen sei nicht zu spassen. Ebenfalls aus der Herde ausgestossene Männchen. - Und ja nicht etwa einen Fuss oder eine Hand ins Wasser halten. - Und ob jemand noch eine Frage habe…
Er erklärt weiter, dass wir je zu dritt in einem Kanu sitzen müssten, derjenige hinten habe 80% Arbeit zu leisten mit Rudern und derjenige vorne etwa 20%. – Eva bringt es auf den Punkt und sagt: „In this case the one in the middle is the useless person“. Genau so ist es!
Die Boote werden zugeteilt und mir fallen etwa fünfzig Steine vom Herzen, als Morat sagt, er werde unser Kanu steuern, Theo könne vorne sitzen. Ich bin also the useless person und sitze in der Mitte.
Wir fahren los, es schaukelt, die Hippos schauen bereits zu und stossen ihre seltsamen Laute aus. Es geht nicht schnell, der Zambezi fliesst gemächlich, Theo hält zwar das Paddel in der Hand, aber er tut nichts. – Kein Problem, „hakuna matata“ – Morat steuert uns geschickt an den Flusspferden vorbei, weist auf Vögel hin und Krokodile, die an der Sonne liegen und so geht’s gemächlich flussabwärts. Der Zambezi ist unterschiedlich breit, zeitweise sind‘s zwei bis sogar drei Kilometer. Wir gleiten manchmal mitten drin, manchmal eher am linken Ufer entlang, nicht zu nah natürlich, nie am rechten, denn dort drüben ist Zimbabwe. Etliche Inseln umfahren wir, auf der einen steigen wir kurz aus, um uns ein wenig die Füsse zu vertreten.
Drei Stunden lang sind wir unterwegs, bis wir an den Ort gelangen, wo’s Mittagessen gibt. Dort werden vier von uns mit dem Schnellboot abgeholt; für uns andere geht die Reise bald schon weiter. Aber erst erwartet uns ein feines Picknick und wir sind alle froh, dass bis hierhin alles gut gelaufen ist und niemand einen Sprung ins krokodilverseuchte Nass tun musste.
Etwa hundert Meter weiter vorne liegt ein Flusspferd im Gras. Es ist genügend weit weg, sagt Morat, kein Problem. Theo liegt nach dem Essen auch im Gras; nach der schweren Arbeit ist es Zeit für Siesta.
Er ist jetzt aber gestärkt und hilft wacker mit zu paddeln, es ist nämlich ein Wind aufgekommen und der bläst in die falschen Richtung. Will man nicht nur schrittweis vorwärtskommen, muss man an die Paddel. Nach weiteren drei Stunden kommen wir auf der Insel an, wo wir über Nacht bleiben werden. – Die Kanureise war sehr schön, ein tolles Erlebnis, aber trotzdem bin ich froh, dass sie zu Ende ist und nichts passiert ist. Nach sechs Stunden im Kanu sitzen, tut einem auf jeden Fall das Hinterteil weh. Und Ken hat sich die Knie an der Sonne verbrannt. Kein Wunder in seinen Shorts.
Wir landen am östlichen Ende einer langen Insel. Auf diesem schmalen Streifen Strand, nur knapp 50 Meter breit, werden wir uns fünfzehn Stunden lang aufhalten. Es ist jetzt fast schon halb fünf. Das Motorboot mit unserem Übernachtungsgepäck, den Zelten, Küchenutensilien etc. ist bereits da und die drei Angestellten beginnen sofort mit der Arbeit. Morat ist der Chef. Es hat weder Strom noch irgendwelche Infrastruktur, also muss alles von Grund auf erstellt werden. Erst werden zwei Feuer gemacht, eines zum Kochen, eines als Lagerfeuer und schliessend werden eine Latrine, eine Waschstelle und fünf Zelte aufgestellt. Dort hinein legen sie Matratzen (dünne) und warmes Bettzeug, eine Art Schlafsack und Wolldecken. Der Tisch wird gedeckt, Stühle aufgestellt und sobald all das fertig ist, gibt’s Spaghetti Bolognese mit Rapskäse sogar und zum Dessert Pfirsiche mit Rahm. Was wir dazu trinken, haben wir vorher schon bestellt – auch das ist in der Kühltruhe im Schnellboot mitgereist.
Wie die drei Männer arbeiten, ist sagenhaft. Ich bewundere sie zutiefst. Alles klappt wie am Schnürchen, jeder weiss, was er zu tun hat, alles tadellos.
So heiss wie’s tagsüber im Kanu war (grad wie in Bern, also etwa 32 Grad), so kalt wird’s in der Nacht wieder werden. Ein einmaliger Sternenhimmel ist bald schon zu sehen. Nach dem Essen und einem Plauderstündchen am Feuer ziehen wir uns warm an und verschwinden in unseren Zelten. Trotz der Matratzen und dem Sand darunter ist es ein wenig hart, aber zumindest ganz schön warm. Trotzdem habe ich Mühe einzuschlafen. Ich glaube, es geht allen etwa gleich, wie am nächsten Morgen erzählt wird (Ken meint, sein Rücken gehöre nicht mehr zu ihm). Immer wieder werden wir nämlich auch von den unheimlichen Lauten der Flusspferde geweckt, die keine Nachtruhe kennen. Fängt auf der einen Seite eines damit an, antwortet ein anderes und so geht das Geschnorchel im Kreis um uns herum los.
Freitag, 3. August 18
Wie’s um sechs Uhr hell wird, bin ich jedenfalls wach und sehe, wie unsere drei Guides bereits wieder am Arbeiten sind: Feuer machen, Kaffee und Tee kochen und ein wenig etwas zum Frühstück parat stellen. Es ist sehr kalt und ich bin froh um die warmen Jacken, die ich bei mir habe und die Kappe. Essen mag ich nichts. Um sieben Uhr fahren wir mit dem Motorboot zurück zur Lodge, wo wir kurz vor acht Uhr ankommen, halb tiefgefroren. Es war eine Fahrt wie in der Arktis. Wie Morat mit seinem kurzärmligen Hemd überlebt hat, ist mir ein Rätsel. Kens Shorts sind wohl im Moment ebenfalls nicht unbedingt das geeignetste aller Beinkleider.
In der Lodge gibt’s nochmals Frühstück und bald schon sind unsere Zimmer parat. Die warme Dusche ist einfach wunderbar!
Ein wenig Reisebericht schreiben, am Pool an der Sonne liegen und lesen, das ist genau das, was jetzt Freude macht. Jedenfalls für Eva und mich. Die Männer haben beschlossen, Angeln zu gehen. Sie nehmen ein Lunchpaket mit und wir Frauen geniessen unser Mittagessen in der Lodge.
Eine weitere „Sundowner-Cruise“ erleben wir alle am späteren Nachmittag, wie die Männer wieder zurück sind - ohne Beute. Ob alles, was sie erzählen, auch stimmt, weiss ich nicht genau.
Kiambi Lodge / Livingstone / Kasane / Gweta 4. – 14. August 18
Samstag, 4. August 18
Eine lange Reise haben wir erneut vor uns – nicht kilometer-, aber stundenmässig.
Wir starten früh, schon vor acht Uhr, gleich nach dem Morgenessen. Erst geht’s zurück nach Chirundu über eine Schotterstrasse, anschliessend während 140 km über eine bestens ausgebaute neue Strasse, die offenbar von den Chinesen erbaut wurde (gegen was auch immer für Zusicherungen) und welche auf Kens Road Atlas noch gar nicht vermerkt ist. Sie ist so gut wie überhaupt nicht befahren, obwohl wir an unzähligen Dörfern vorbeikommen. Hier hat man das Gefühl das „echte“ Afrika zu erleben, weit weg von jeglicher Zivilisation. Bescheidener kann man kaum leben. Die Menschen hausen in den einfachsten Lehmhütten, leben von der Ziegenzucht - Landwirtschaft hat’s so gut wie keine. Es sind die Frauen, die grosse Lasten auf ihren Köpfen tragen. Ihre farbigen Kleider tragen sie stolz zur Schau.
Die Vegetation ist ebenfalls bemerkenswert. Während mindestens einer Stunde lang fahren wir an den knorrigsten Baobab-Bäumen vorbei. Sie wachsen nur auf basalthaltigen Böden. Plötzlich hat’s keine mehr, nur noch Mopani-Trees und Euphorbien. Dann wieder wechseln sich Grasland mit hohen Bäume ab und mit verschiedenen Arten von Akazien. So geht das bis Gwembe. Weitere 50 km führt die Strecke über eine nicht asphaltierte Strasse über Chomo, Kalomo und Zimba, bis sie in die Schnellstrasse nach Livingstone mündet, wo’s wieder mehr Verkehr hat, vor allem viele Lastwagen.
Schnurgerade und langweilig geht’s weiter, bis wir endlich ziemlich müde, steif und gerädert, nach fast acht Stunden Fahrt, mit nur zwei fünfminütigen Zwischenhalten, in der Maramba River Lodge in Livingstone ankommen.
Schön ist es hier. Die Lodge ist direkt am Maramba-River gelegen, der an der Stelle etwa halb so breit ist wie die Aare im Marzili und sozusagen keine Strömung hat, fast ein stehendes Gewässer also. Daher spiegelt sich auch das gegenüberliegende Ufer prächtig auf der grünen Oberfläche. Es ist ein idyllischer Ort. Vom Swimmingpool aus, der von hohen Palmen und Kakteen umgeben ist, wie von der Bar aus und auch beim Nachtessen hat man Aussicht auf eine spektakuläre Show, die die Hippos im Fluss abziehen. Eines sperrt den Rachen auf, was ich bisher so noch nicht gesehen habe und alle Zuschauer knipsen wie wild drauflos. - Ich bin zu spät. Dass diese riesigen Tiere mit ihren überdimensionierten Mäulern Vegetarier sind, ist kaum zu glauben. Feines Gras wächst in der Lodge, denn die ganze Zeit wird der Rasen besprengt. Kein Wunder, dass das eine oder andere immer wieder mal auf den Geschmack kommt, sich am diesseitigen Ufer zu verköstigen.
Fünf Nächte lang bleiben wir hier. Das macht Freude! Endlich müssen wir nicht schon wieder packen und können es gemütlich nehmen. Die „En-Suite-Luxury-Tents“, in denen wir wohnen, sind komfortabel, wenn sie von aussen auch nicht gerade nach grossem Luxus aussehen. Aber innen sind sie sehr gut eingerichtet, ziemlich geräumig sogar.
Das Bett ist bequem und warm (4 Lagen Wolldecken und Duvets), was wichtig ist, denn am Morgen ist es wieder extrem kalt, nicht viel mehr als fünf Grad zeigt das Thermometer.
Sonntag, 5. August 18
Erst um neun gehen wir zum Frühstück, wenn’s viel wärmer ist. Grad gegenüber am anderen Ufer steigt ein Krokodil gemächlich aus dem Wasser und legt sich an ein sonniges Plätzchen. Auch es hat ja eine kalte Nacht hinter sich.
Heute nehmen wir’s gemütlich nach der langen Fahrt gestern. Die Viktoriafälle, die hier die Hauptaktion sind, wollen wir erst am nächsten oder übernächsten Tag besuchen, wenn wir ausgeruht sind.
Am Mittag gehen wir einkaufen, Theo bleibt „daheim“. Ken will heute Abend sein Filet braaien, das wir unterwegs eingekauft und inzwischen tiefgefroren haben, und dazu braucht’s wieder Zutaten. Ein Rieseneinkauf wird’s einmal mehr; ein weiteres Filet inbegriffen. Noch was Feines für die Fische: Ken hat erfahren, dass sie geil auf Hühnerlebern sind…
Ich lege mich anschliessend am Pool auf einen Liegestuhl und schreibe an meinem Reisebericht, Theo schläft im Zelt, Eva und Ken haben den halben Nachmittag lang Massagen gebucht.
Kaum ist die Sonne kurz vor sechs untergegangen, beginnt Ken, ein Feuer fürs Braai anzufachen. Das Holz, das wir haben, ist relativ frisch und hart und so dauert es zwei Stunden, bis die Glut parat ist. Konsequenterweise zieht sich der Apéro ziemlich in die Länge und eine Flasche Wein ist bereits Geschichte, bevor etwas auf dem Teller liegt. Wir haben hier keine Küche, also gibt’s ausnahmsweise keine Zutaten ausser Salat. Auch fehlen Stühle und ein Tisch, aber das ist kein Problem, sind unsere Zelte doch grad neben dem Campingplatz gelegen, wo‘s Tische und Bänke hat. Evas Tischtuch ist inzwischen frisch gewaschen worden und kommt nun wieder zum Einsatz. Da es ziemlich dunkel ist, haben wir unsere Stirnlampen angezogen, damit wir sehen, was wir essen. Ziemlich schräg sieht das aus (wir – nicht das Menu).
Montag, 6. August 18
Ausschlafen. Wunderbar! Nur die ewigen Helis und Mikrolights, die ständig über dem Wasserfall kreisen, wecken uns (mich) schon früh morgens. Theo hat seine Earplugs montiert – er schläft wie ein Baby. – Aber es ist ihm trotzdem nicht ganz wohl. Eigentlich hätten wir heute „Fall-Besichtigung“ auf dem Programm, aber Theo möchte zur Abwechslung lieber einen weiteren Tag lang ausspannen und gar nichts tun. – Wir haben ja Zeit. Und die Fälle laufen nicht davon. Sie sind auch noch übermorgen da (obwohl in meinem Reiseführer steht, irgendwann in Tausenden von Jahren werde es sie nicht mehr geben - kümmert uns aber nicht im Moment).
Nach dem Morgenessen geht’s daher geruhsam weiter. Nachdem das Internet während einer Stunde lang nicht funktioniert hat, gibt’s nun keine Probleme mehr und ich kann meinen Reisebericht 2 abschicken. – Es ist schon einmalig, in einer Bar zu sitzen, vor sich den Laptop auf dem Tisch und keine zwanzig Meter entfernt eine Hippo-Familie zu beobachten, die noch die viel grössere Ahnung hat von Siesta-Machen als mein lieber Gatte. Vögel versammeln sich auf den Dickhäutern, picken Parasiten und die Algen ab, die sich in deren Haut angesammelt haben – eine bemerkenswerte Symbiose.
Anstatt nur herumzusitzen, hab ich beschlossen, reiten zu gehen.
Ich werde von einem Kleinbus abgeholt, im dem mindestens zehn Personen Platz haben. Niemand ausser mir har offenbar dasselbe Bedürfnis. Zuerst fährt mich der Driver ins Batoka-Zentrum, wo erst mal Kohle abgeladen werden muss, bevor die Fahrt weitergeht. Der Stall befindet sich im fünf-Sterne-Hotel „Royal Livingstone“, welches am Zambezi gelegen und von einem Park umgeben ist, in dem’s Zebras hat, vier Giraffen und etliche Impalas.
Likwita ist mein Guide; er weiss viel zu erzählen über Flora und Fauna und seine Heimat Zambia. - „Night Delight“ heisst mein Pferd, und es ist ein sehr braves. Nur vor den Monkeys hat es Angst; es muss wohl mal eine schlechte Erfahrung gemacht haben.
Wir reiten durch den Hotelkomplex und anschliessend überqueren wir die Strasse und die Bahnlinie. Dort beginnt der Nationalpark. Elefanten hat’s, ihre Spuren sind überall zu sehen: Dung sowie abgebrochene und ausgerissene Bäume und Äste. Aber sehen tun wir sie nicht. Unser Ritt dauert zwei Stunden und führt durch den Busch, vorbei an einem ausgetrockneten Fluss, an einzelnen Büschen und Bäumen. Die Weaver-Birds sind eifrig am Nesterbauen. Über die Ebene ist die Gischt der Viktoria Fälle zu sehen. Gewaltig! – Einen Moment lang reiten wir am Ufer des Zambezi entlang, bevor‘s zurück zum Stall geht. Absteigen ist mühsamer als Aufsteigen. Ich bin ziemlich steif, denn seit mehr als einem Jahr sass ich nicht mehr auf einem Pferderücken. - Und zwanzig bin ich auch nicht mehr… Es war ein sehr schönes Erlebnis, den teuren Preis sicher wert.
Heiss war’s und ziemlich mühsam, die vielen Fliegen abzuwehren. Aber lieber natürlich als die Moskitos, vor denen wir uns alle fürchten. Wir nehmen brav unsere Malariaprophylaxe und versuchen auch, möglichst zu vermeiden, dass die elenden Biester sich an uns gütlich tun, aber einfach ist das nicht, obwohl „Peaceful Sleep“, der Anti-Mücken-Spray, genau das verspricht.
Ein weiteres Nachtessen im Restaurant und anschliessend eine traumlose, kühle Nacht in unserem bequemen Zelt.
Dienstag, 7. August 18
Heute ist Vic-Fall-Besucher-Tag. Absolut grandios, obwohl momentan bei weitem nicht am meisten Wasser fliesst. Das wird erst in der Regenzeit soweit sein, aber dann kann man offenbar die Fälle kaum mehr sehen, weil der Sprühnebel so riesig ist.
Hier ein paar Zahlen (im Durchschnitt je nach Jahreszeit): 10‘000 Liter Wasser pro Sekunde / 550 – 700 Mio. Liter Wasser pro Minute. Grösste Falltiefe 108 Meter. Breite: 1688 Meter!
Wenn ich mir vorstelle, wie das gewesen sein muss für Livingstone, als er 1855 dieses gewaltige Naturschauspiel zum ersten Mal sah… Sagenhaft!
Zu meiner grossen Freude gibt es viele Lookouts, von wo aus man einen Blick auf die tosenden Fälle werfen kann, zumindest stückweise. Die Gischt verhindert oft die Sicht. Ohne Pelerine wird man durch und durch nass. Aber bei der Hitze ist das ganz angenehm.
Eindrücklich ist es auch, an der Abbruch-Kante zu stehen und zu sehen, wie der Fluss, der langsam und ruhig durch die Ebene fliesst, urplötzlich mit wildem Getöse in den Abgrund stürzt.
Wir haben noch ein Filet im Tiefkühler, das muss heute gegessen werden. Weil wir nur das harte Feuerholz haben, das so lange braucht, bis eine Glut entsteht, hat Ken die Idee, dem Chef im Restaurant den Fleischzubereitungs-Job zu übertragen. In der Schweiz würde sein Vorhaben wohl eher nicht von Erfolg gekrönt sein, hier aber schon. Er erhält fast immer, was er will. So geht er gleich selber in die Küche und gibt Anweisungen, wie das Fleisch zu braten sei. Und er erklärt dem Koch zudem, was falsch gelaufen sei bei der Suppe, die dieser am Vorabend serviert habe. Da gehöre weder Butter noch Milch hinein. Er macht sich gleich selber an den Kochtopf und würzt nach seinem Gutdünken. Man lässt ihn gewähren und alles wird so serviert, wie er es wünscht. Die Suppe ist ziemlich „hot“, das Filet 1A. - Nummer zehn oder elf?
Immer wieder lustig finden wir, wie der Kellner dann kommt, um uns unsere Bestellungen unterschreiben zu lassen. Zwei grosse Bücher bringt er an den Tisch, eines fürs Getränk, das andere fürs Essen. Die dunkelblauen Kopierfolien (drei Durchschläge), mit denen wir uns ebenfalls bis in die Achtzigerjahre herumschlagen mussten, werden hier noch immer gebraucht; Kopierer hat’s keine - auch keine Waschmaschine, Waschservice aber schon. Das fanden wir allerdings erst heraus, als Ken sein iPhone verloren hatte. Er suchte es überall und dachte, es könnte vielleicht in einer Hosentasche gewesen und in der Waschmaschinentrommel stecken geblieben sein. Lucy, die Verantwortliche für die Wäsche, habe aber gelacht und gesagt, das sei unmöglich – sie selber sei die Waschmaschine…
Ken hat sein iPhone dann wieder gefunden. Vor dem Zelt lag’s im Busch; es muss ihm aus der Hemdtasche gerutscht sein beim Feuerholzsammeln.
Mittwoch, 8. August 18
Unsere erste „Tätigkeit“ heute beginnt um vier Uhr nachmittags. Wir haben eine Fahrt mit dem Nostalgiezug „Royal Livingston Express“ gebucht. Die kurze Reise führt auf die berühmte Brücke, von wo aus man auf der einen Seite einen einmaligen Blick auf die Fälle hat, auf der anderen in die Schlucht sieht, in welche die gewaltigen Wassermassen des Zambezi hinunterstürzen und anschliessend ihren Weg weiter landeinwärts gegraben haben. Der höchste Bungee-Jump der Welt wird von der Mitte der 125 Meter hohen Brücke aus angeboten, über dem „Boiling Pot“. 111 Meter weit geht’s am Gummiseil in die Tiefe. – Nicht mein Ding.
Der Zug tuckert gemächlich dahin. Wein und kleine, feine Apérohäppchen werden serviert, gediegen, gediegen. - Es kommt bald noch besser, andere Köstlichkeiten sind später ebenfalls im stolzen Preis inbegriffen.
An der Stirnseite des Zugs hat’s einen offenen Wagen; die Lok ist hinten. Von da aus hat man eine schöne Aussicht auf den Busch, durch den wir fahren. Der Fahrtwind ist willkommen in der Hitze, die auch heute wieder herrscht. Im Abteil drin hat’s eine Klimaanlage, die zur Nostalgie zwar nicht ganz passt, aber dennoch angenehm ist.
Grad richtig zum Sonnenuntergang hält der Zug mitten auf der Brücke an, wo die Grenze zwischen Zimbabwe und Zambia durchführt. Da gibt’s massenhaft zu fotografieren, viele Händler bieten ihre Waren an, bestürmen die Touristen, Souvenirs zu kaufen. Ein reger Verkehr herrscht auch sonst, die Brücke ist ebenfalls für Fussgänger, Velos und Autos begeh- beziehungsweise befahrbar. Der Zug hält für zwanzig Minuten; wir dürfen aussteigen und zu unserem grossen Erstaunen treffen wir dort genau zu diesem Zeitpunkt das junge Paar aus England, das bei unserem Insel-Übernachtungs-Ausflug dabei war. Die beiden sind mit ihren Fahrrädern unterwegs. Es ist kaum zu glauben, was für eine Reise sie bereits hinter sich und auch noch vor sich haben (von Tanzania bis Namibia). Stundenlang über diese mühsamen Strassen radeln… All die Lastwagen…
Erst jetzt bemerken wir, dass nicht nur weisse Touristen im Zug mitreisen. In einem Wagen weiter hinten steigen eine ganze Menge Schwarze aus – eher seltsam, diese Zweiteilung.
Wie die Sonne untergegangen ist und die tausend Fotos im Kasten sind, fährt der Zug wieder zurück Richtung Livingstone. Auf der Höhe des „Royal Livingstone Hotel“ hält er an und aus dessen Küche wird uns ein feines 5-gängiges Gourmet-Menu serviert. Man kommt sich vor wie in der Kolonialzeit, in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts, die Kellner sind livriert, die Tische im Speisewagen hübsch gedeckt, eine Ambience vom Feinsten. – So hatte es sich Cecil Rhodes vorgestellt, als er die Brücke bauen liess. Er starb aber, bevor sie fertig gestellt war, und er hat auch die Fälle nie gesehen.
Um neun Uhr werden wir zurückgefahren in unsere Zelte in der Maramba River Lodge. – Ein schönes Erlebnis war das, absolut empfehlenswert!
Donnerstag, 9. August 18
Früh geht’s los, Ken macht sich jetzt schon Sorgen wegen des Grenzübertritts. Es ist zwar nur eine kurze Strecke, die wir heute zurücklegen müssen, etwa 70 Kilometer. Unser Ziel ist Kasane in Botswana, gleich nach der Grenze. Er beschreibt uns, wie es vor sich gehe: Ausreise und Zoll in Kazungula, dann würden wir über den Zambezi mit der Fähre übersetzen und drüben wieder die Einreiseformalitäten über uns ergehen lassen müssen.
Es wird gute vier Stunden dauern, bis das alles erledigt ist, und das nicht, weil die Strassen schlecht sind. – So weit sind wir aber noch gar nicht. Auf der ganzen Reise hat’s immer wieder mal Roadblocks, an denen man anhalten und der Verkehrspolizei irgendwelche Papiere zeigen muss. Ken weiss von den meisten, wo sie sich befinden. Dieses Wissen bringt allerdings nicht viel, denn Umwege gibt es kaum. Bisher hatten wir fast immer Glück und wurden selten aufgehalten, manchmal durchgewinkt, manchmal sah man die Ordnungshüter im Schatten sitzen und schlafen, die Barriere offen.
Nicht so heute: Kaum aus Livingstone raus, schon steht da eine Dame in Uniform, die ihren Auftrag sehr ernst nimmt. Sie will die Versicherungspapiere sehen. Mit denen, die Ken ihr zeigt, ist sie nicht zufrieden. Die Registrierungsnummer stimmt nicht. Eva kann aber anhand eines Emails ihrer Versicherung belegen, dass alles vorschriftsgemäss bezahlt ist. Das genügte der Beamtin aber nicht und sie weist uns an, ihr auf den Polizeiposten zu folgen. Das hiess: wieder zurück nach Livingstone – ihr Kollege steht schon bereit im Polizeiauto, dem wir nun folgen müssen.
Ich bewundere Eva. Sie ist die Ruhe selbst, lässt sich nicht aus dem Konzept bringen, zeigt keinerlei Nervosität. Ken sagt auch nicht viel, aber dass er innerlich kocht, ist völlig klar.
Theo und ich, wir warten im Auto, lesen ein wenig und harren der Dinge, die da kommen werden. Wie viel kostet’s wohl diesmal? - Es dauerte mehr als eine Stunde, bis Eva und Ken aus dem Büro herauskommen. Passiert war Folgendes: Eva hatte inzwischen ihre Versicherungsgesellschaft angerufen und gebeten, dass jemand eine Mail mit dem heutigen Datum schicken würde mit der Bestätigung, dass die Versicherung bezahlt worden sei. Das ging blitzschnell, aber die Polizistin war noch nicht zufrieden. Sie wollte ein Datum sehen, wann die Versicherung auslaufen würde, ein Dokument also, welches das belegt. – Genau das gibt es aber nicht, weil die Versicherung gar kein Ablaufdatum hat. Eva rief erneut bei der Versicherung an und die Dame am andern Ende sprach direkt mit der zambischen Ordnungshüterin und erklärte ihr das. – Daraufhin kam dieser etwas Neues in den Sinn: Sie wolle noch eine Bestätigung haben, dass Schäden an Personen gedeckt seien. Das sei inbegriffen und ebenfalls gedeckt, erklärte Eva, dafür gäbe es kein spezielles Formular. Drei weitere Telefonate mit der Versicherung wurden organisiert, aber auch die nützten nichts. - Es gäbe ein Gesetz aus dem Jahr 2002, das besage, sie müsse sich ein solches Formular zeigen lassen. Worauf Ken offenbar fragte, ob dieses Gesetz ein Auslaufdatum habe. Die Beamtin merkte die Ironie nicht und sagte, es gäbe keines… Nun sei es eben so, dass er halt die Busse bezahlen und sich schuldig bekennen müsse. Es blieb ihm nichts anderes übrig. Dollars nähmen sie nicht, er müsse Geld wechseln gehen, den Pass bei ihr lassen. Das ging ihm aber zu weit und er liess sie unmissverständlich wissen, das komme überhaupt nicht in Frage – sicher nicht in Afrika! Da wenigstens lenkte sie ein. Wieder fahren wir dem Polizeiauto hinterher zur Wechselstube. 450 Kwetchas, umgerechnet etwa 50 Dollar, wechseln den Besitzer, also halb so viel Bestechungsgeld wie beim letzten Mal. Und Ken muss unterschreiben, dass er sich eines Vergehens schuldig gemacht habe. „I’m now officially a criminal“, sagt er, wie er wieder ins Auto steigt.
Diesmal erhält er ein sehr offiziell aussehendes Dokument mit Stempel und auch Unterschrift eines Zeugen. – Sehr beeindruckend.
Wir fahren erneut in Richtung Grenze. Der Roadblock ist geöffnet, niemand ist mehr dort – sie haben ihr Geschäft für heute im Kasten, können sich der Siesta hingeben.
Pikantes Detail noch: Kurz nach der Barriere ist am Strassenrand ein grosses Plakat angebracht, auf dem steht, dass alle mithelfen sollten, gegen Korruption vorzugehen und melden sollten, wenn Unregelmässigkeiten dieser Art vorgefallen sein sollten… Wir wissen jetzt, wo’s einen Polizeiposten hat; vielleicht könnten wir uns ja dort beschweren.
Am Grenzposten auf der Zam-Seite ist sehr viel los. Es ist heiss, 35 Grad. Dutzende von Lastwagen stehen herum, Leute überall, es ist ein Kommen und Gehen. Trotzdem dauert’s fast nur eine halbe Stunde, bis wir unsere Stempel im Pass haben und gehen können. Wie jedes Mal geht’s aber länger bei der Zolldeklaration fürs Auto. Eine lange Schlange von Fahrern steht vor dem Schalter und wartet, bis die Beamtin Buchstabe für Buchstabe vom Dokument in ihr Buch übertragen hat. Sie muss halt zwischendurch immer wieder ihr Phone checken. Und bis der Beamte gefunden wird, der das Tor öffnet, geht eine weitere Viertelstunde vorbei. Aber dann sind wir durch und da ist auch gleich eine Fähre, auf der’s hinter zwei Lastwagen noch grad Platz hat für den Land Rover. Wir sind froh, dass wir hier überhaupt nicht warten müssen. Während der kurzen Überfahrt dürfen wir nicht im Auto bleiben.
Eine Brücke wird gebaut über den Zambezi. Wenn die in ein bis zwei Jahren fertiggestellt ist, werden manche Leute froh sein, stelle ich mir vor.
Die Zollformalitäten auf der Botswana-Seite sind relativ rasch erledigt. Das Visum ist ja noch gültig. Nur einen letzten Posten müssen wir überstehen, dann ist alles, was verlangt wird, erledigt. Ken muss bestätigen, dass wir keine Lebensmittel an Bord haben, was grösstenteils tatsächlich stimmt. Auch hier hätten sie uns schikanieren können, aber zum Glück bleiben wir verschont. Einzig einen kurzen Spaziergang müssen wir unternehmen zu einem ungefähr 1 m2 grossen, niedrigen Becken, das in den Boden eingelassen ist. Dort liegt ein schmutziger, nasser Teppich drin, getränkt mit irgendwelchen Chemikalien. Auf den müssen wir in unseren Schuhen draufstehen, dann können wir gehen. Schutz gegen Maul- und Klauenseuche heisst es. – Und unsere anderen Schuhe im Auto?
Aber wir sind durch und alles ist wunderbar. Die Lodge ist nicht mal zehn Kilometer von der Grenze entfernt; das ist praktisch. Wir haben ein sehr luxuriöses Chalet, so kommt es uns wenigstens vor – mit TV, Kühlschrank, Klimaanlage und sogar einem Fön (den ich hier sicher nicht brauchen werde). Vor Hippos und Croks braucht man sich nicht zu fürchten, für einmal ist unsere Unterkunft nicht am Wasser gelegen. Dafür hat’s Mungos, die wie vom Teufel gehetzt durch den Garten rasen. Es sind mindestens fünfzig Tiere - putzig sehen sie aus.
Theo und ich, wir verbringen den Nachmittag am Swimmingpool und wundern uns, weshalb Eva nicht auch kommt. – Ken hatte nach unserer Ankunft den Wagen in den Schatten manövriert und musste feststellen, dass schon wieder etwas nicht stimmt. Diesmal mit der Hydraulik – das Chassis berührt fast die Reifen. So fuhren er und Eva in die nächste Garage nach Kasane, wo man allerdings im Moment auch keinen Rat wusste. Ein Diagnostikgerät besitzen sie nicht in der kleinen afrikanischen Werkstatt, die ich mir übrigens vorstelle wie diejenige von Mr. J. L. B. Matekoni’s „Tlokweng Road Speedy Motors“ in McCall Smith’s „Nr. 1 Ladies‘ Detective Agency“.
Morgen werden wir weitersehen. (Solange nicht Charlie Hand anlegt…).
Das Nachtessen ist nicht besonders fein, Theo versucht’s wiedermal mit Spaghetti (eine Kinderportion diesmal), Eva bestellt Fisch (kaum was dran ausser Gräten), ich ein chinesisches Gericht (wo sind die chinesischen Gewürze geblieben?), Ken bestellt ein Rumpsteak, 300 Gramm, will es dann gewogen haben, wie es schliesslich kommt. Auch ohne Waage ist klar, dass nicht viel mehr als 150 Gramm auf dem Teller sind. Und ein Rumpsteak sei es auch nicht, davon ist er überzeugt. Genau so würden sie es hier machen, die Hälfte abschneiden und selber essen, regt er sich auf. Auf die Zucchetti, die dazu serviert werden, sei er allergisch, lässt er den ratlose Kellner wissen, er müsse mehr Fleisch bringen, so gehe das überhaupt nicht. Ein weiteres Stück Fleisch wird gebracht, aber auch das sei kein Rumpsteak, ärgert er sich. Die Sache mit dem Auto schlägt ihm aufs Gemüt und die Sache mit dem Fleisch macht die Situation auch nicht besser.
Theo erklärt nach italienischer Manier etwas Dramatisches, fuchtelt mit den Händen herum und schlägt mein Weinglas um. – Ein sehr gemütlicher Abend. – Morgen ist ein neuer Tag.
Freitag, 10. August 18
Ken ist sehr wortkarg heute Morgen, die Angelegenheit mit dem Auto liegt ihm auf dem Magen. Er fährt dann nochmals nach Kasane, wo man soweit helfen konnte, dass ein Diagnosegerät bestellt wurde, das morgen ankommen soll. Erst wenn das Problem erkannt ist, kann man damit beginnen, etwas zu unternehmen. – Er ruft von der „Garage“ aus an. Er muss aufhängen – da kommt grad ein Elefant daher, alle sind in grosser Aufregung, das Tier soll erschossen werden (später erfahren wir, dass der Eindringling hatte vertrieben werden können).
Sehr speziell ist aber, dass Ken auch meldet, das Auto habe wieder ganz normal reagiert und auch der Computer habe nichts Besonderes angezeigt. - Eva denkt, der Land Rover habe eine Seele für sich selbst…
So heisst es also abwarten. – Am Nachmittag gehen wir auf eine dreistündige Bootsfahrt auf dem Chobe-River. Erst bin ich ein wenig erstaunt, dass es da sooo viel Touristen hat. Dutzende von Booten, kleinere und grössere mit Hunderten von Menschen an Bord, kreisen auf dem weitverzweigten Fluss im Chobe-Nationalpark herum. Bald merke ich: Es ist kein Wunder, dass dieser Park so begehrt ist. Es hat eine Unmenge an Tieren, die man hier beobachten und fotografieren kann. Sie alle sind an die Schiffe gewohnt; sie scheinen sie überhaupt nicht zu beachten. So kann das Boot auch in nächster Nähe „parkieren“, ohne dass ein Tier flüchtet oder auch nur hinschaut. Bis auf fünf Meter Distanz an ein Krokodil heranzufahren und es quasi auf Augenhöhe abzulichten – das macht mir fast ein wenig Angst, denn so träge wie sie scheinen, so schnell können die Biester sein.
Mehrere Elefanten- und Büffelherden sehen wir, Kudu- und Impala-Familien am Grasen und Wassertrinken, Giraffen ebenso. Für die ist es ein schwieriges Unterfangen, sich bis zur Wasseroberfläche zu beugen. Ihre unbedarften Grätschen sehen sehr komisch aus. Irgendwas ist da wohl ziemlich schiefgelaufen beim Designen der Art. - Affen, die miteinander spielen und streiten und Vögel, die sich durch nichts stören lassen, können wir ebenfalls gemächlich beobachten.
Es ist eine wunderbare Sunset-Bootsfahrt, und ja, gegen sechs wiederholt sich einmal mehr das prächtige Schauspiel des Sonnenuntergangs mit der farbigen Licht-Leiter auf den Wellen des Chobe.
Ob beim Nachtessen ein anderer Koch am Werk war oder ob Kens Beschwerde beim Manager geholfen hat – heute Abend sind alle zufrieden mit dem, was sie bestellt haben. Kens Rumpsteak ist ein Rumpsteak und die 300 Gramm sieht man ihm an; Evas ¼ Huhn ist ebenfalls schmackhaft und so sind Theos Sirloin Steak, seine Spaghetti und mein Fisch (ohne Gräten).
Samstag, 11. August 18
Eva, Theo und ich frühstücken gemeinsam; Ken ist schon früher mit dem Auto nach Kasane in die Werkstatt gefahren. – Die Vermutung liegt nahe, dass es dem Land Rover stinkt, immer so viel Last zu befördern und er daher streikt. Ist alles Gepäck raus und wir Passagiere ebenfalls, pumpt sich die Hydraulik brav wieder auf. Bisher ist ja alles gut gegangen, vielleicht liegt das Problem darin, dass wir zu viele Filets gegessen haben in letzter Zeit, die Grenze, was er an Ballast ertragen kann, überschritten ist und wir so seine Geduld strapaziert haben. Grad wie bei einem Esel, stelle ich mir das vor; der soll ja auch seine Schmerzgrenze haben und sich dann strikte weigern weiterzugehen.
Ken ist zurück und wir beraten, was zu tun ist. Ein Auto mieten ist eine Option, Gweta sein lassen und nach Maun fliegen eine andere – wir warten vorerst mal ab.
Der Rover macht heute Morgen einen aufgestellten (!) Eindruck, also findet Ken, wir könnten gut zusammen eine Pirschfahrt in den Park unternehmen, unser ganzes Gepäck ist ja nicht im Auto.
Das geht mehr als eine Stunde lang gut, der Land Rover kämpft sich über holprige Pfade mit riesigen Löchern, durch Sandpisten vorbei an Herden von Impalas, zum Ufer des Chobe. Wir sehen wieder Krokodile, Flusspferde, Wasser- und andere Vögel, Warzenschweine, Giraffen, Kudus und Buschböcke - da verleidet es unserem Vehikel erneut. Wir hören ein Zischen, das Chassis senkt sich, die Hydraulik gibt auf. – Kein guter Ort zum Aussteigen. Schliesslich gibt’s Löwen und Leoparden im Park, auch wenn wir die noch nicht gesehen haben. Ebenso wenig sind die Elefanten hier Zootiere. – Aber es bleibt uns nichts anderes übrig, als mal auszusteigen. Eva denkt, wenn wir drei draussen sind (gut 200 kg weniger) und nur noch der Fahrer drinnen, erholt sich das eigensinnige Gefährt vielleicht wieder.
Das tut es aber nicht. Ein paar Safarifahrzeuge fahren an uns vorbei. Einer hat Erbarmen mit uns und nimmt uns drei mit zum Parkeingang. Ken versucht, alleine weiterzufahren. Erst sehen wir ihn noch hinter uns in der Ferne, dann aber nicht mehr. Am Gate warten wir und etwa eine halbe Stunde später hat auch er’s geschafft. Die Räder hatten sich tief in den Sand vergraben und alleine hatte er keine Chance rauszukommen. Zum Glück hat ihm schliesslich jemand geholfen, sich und sein Fahrzeug aus der misslichen Lage zu befreien.
Wir steigen wieder ein und ganz langsam geht’s auf der Teerstrasse zurück zur Lodge.
Ken will unbedingt, dass wir unsere Reise so wie geplant weiterführen können. Er hat für uns einen Driver organisiert, der uns morgen nach Gweta, zu unserer nächsten Lodge fahren wird. – Wir hätten gern auch warten können, bis das Auto geflickt ist, aber das will er nicht. Er war ja schon oft dort, kennt die Gegend bestens und will auf keinen Fall, dass wir etwas verpassen.
Sonntag, 12. August 18
Nach dem Frühstück und herzlicher Verabschiedung fahren wir um neun Uhr los. Eva und Ken sollen nachkommen, sobald ihr Gefährt wieder instand gestellt ist, eventuell morgen oder übermorgen.
Zwei Fahrer sind gekommen. Sie sind beide Mechaniker und arbeiten in der Werkstatt, wo der Land Rover jetzt steht. - Charlie und Fanwell? – Sie heissen Kabelo und Fikile. Im Toyota ihres Chefs fahren wir los. Kabelo, der Fahrer, ist ein kleiner dünner junger Mann mit ganz spitzigen Knien, den ich etwa 15-jährig schätze. Später erfahre ich, dass ich mich arg getäuscht habe. Sein Fahrausweis beweist, dass er 1992 geboren wurde.
Bevor wir uns auf den Weg machen, gibt’s einen Abstecher in die Werkstatt. Wir haben ein paar Sachen im Land Rover, die wir mitnehmen möchten und ich würde mir die Garage gerne ansehen.
Dort steht er, total staubig und dreckig. Ein Rad ist weg, man sieht teilweise in sein Inneres. – Ob dieser Wagen irgendwann wieder fahrtüchtig sein wird – ich bezweifle es stark. Wir werden ja sehen.
Die Strecke bis Nata ist 300 km lang und schnurgerade. Nur ein einziges Mal gibt’s eine Kurve. Das ist so aussergewöhnlich, dass die beiden uns darauf aufmerksam machen. Sie halten auch ein paarmal an, wenn sie Elefanten oder Giraffen sehen, damit wir ein Foto machen können.
Kabelo fährt schnell. 150 sehe ich mal auf dem Tacho. Gut 100 hat er drauf, wie eine Radarkontrolle hinter einem Baum auftaucht. Glücklicherweise haben die Polizisten schon zwei Autos angehalten, sie haben keine Kapazitäten mehr für uns; sie winken uns durch.
Weiter geht’s wie der Blitz, die beiden möchten die Strecke in mindestens fünf Stunden schaffen. Die erste Stunde fahren wir auf einer gut ausgebauten Strasse durch den Busch entlang eines Nationalparks, dann gibt’s eine lange landwirtschaftliche Zone, wo sich eine Farm an die andere reiht. Es sind riesige Ländereien, die Furchen in den Feldern ziehen sich gerade hin bis an den Horizont. Mais wird angebaut und etwas Grünes; ich werde dann Ken fragen müssen, was das ist. Siedlungen sieht man so gut wie keine, obwohl ein paar Landarbeiter auf den Feldern sind. Auch das hohe Gras wird hier geschnitten zum Bau von Dächern, grad so wie wir es im Matopo-Nationalpark gesehen haben. Die Leute, die diese Arbeit betreiben, wohnen in farbigen Zelten entlang der Hauptstrasse.
In Nata, nach vier Stunden Fahrt, fragen wir die beiden Jungs, ob sie mal anhalten und etwas essen oder trinken möchten. „I’m still fresh“, antwortet Kabelo. Uns ist es recht; wir sind froh, wenn wir endlich am Ziel sind, denn es ist sehr heiss im Auto und die Chance, in diesem Ort ein Restaurant zu finden, das uns passt, sehr gering. Jetzt gibt‘s zum ersten Mal eine Abzweigung nach rechts. Gweta 99 Kilometer. Das können wir wohl in einer knappen Stunde schaffen, denke ich. Dann aber ist die Strasse voller Schlaglöcher, und das nicht zu knapp. Die meisten umfährt Kabelo ganz geschickt, aber sehr schnell kommen wir doch nicht mehr voran. – Trotzdem, um Viertel nach zwei kommen wir in der Gweta Lodge an.
Hier gibt’s endlich was zu essen für uns alle vier und dann verabschieden wir uns. Bevor die beiden gehen, wollen sie noch ein Foto machen von sich mit uns. – Lustig finde ich das immer. - Mir tut es unendlich leid, dass sie nun genau diese lange Strecke, 408 km, wieder zurück nach Kasane fahren müssen. Es wird Nacht sein, bis sie ankommen. Fikile meint, es sei nicht so schlimm, sie würden jetzt viel schneller fahren können, 180 km/h denke er. – Ich weiss darauf nichts zu sagen.
Eine so hübsche Lodge zu finden „in the middle of nowhere“, hätte ich nicht gedacht. Es ist die einzige Unterkunft weit und breit (ausser dem „Planet Baobab“, vor dem uns Ken gewarnt hat – vorausgesetzt wir seien nicht an Drogen interessiert). - Auch diesmal „hippolos“; Affen hat’s ausnahmsweise ebenfalls keine.
Hierhin kommt man nicht wegen der „Big Five“, sondern wegen der Meerkats, den Erdmännchen, den Baobab-„Wäldern“ und der Salt-Pans. – Morgen oder übermorgen werden wir Ausflüge dorthin buchen.
Die Lodge ist ausgebucht, etwa vierzig Leute sind beim Nachtessen dabei; es gibt Buffet mit Braai, Rindsfilet wieder mal, dazu feine Salate, Reis, Lasagne, selbst gebackenes Brot und wie immer und überall Nzima oder Pap, wie die Beilage hier heisst (eine weisse Paste aus fein geriebenem Mais).
Der Sternenhimmel ist überwältigend; es hat keinerlei Lichteinfluss von irgendwoher aus der Gegend.
Montag, 13. August 18
Schon früh erwache ich und denke, ich sei auf einem Bauernhof. Ein Hahn kräht, ich höre Kühe muhen, Esel wiehern und Ziegenglocken bimmeln.
Der Strom ist ausgefallen, das Frühstück wird trotzdem serviert, Holz und Gas funktionieren allemal.
Um halb drei beginnt unser Ausflug. In drei Safarifahrzeugen sind wir unterwegs. Lesh, unser Guide, prescht durch den Busch, was das Zeug hält. Auf einem Rodeo-Pferd könnt’s kaum stürmischer schütteln. Es hat Pfade, die verlässt er aber nur allzu gern; wir müssen uns festhalten und den Dornbüschen ausweichen, an denen wir vorbeipfeilen. Die Gegend sieht aus wie ein lichter Herbstwald. Auf dem sandigen Boden (Kalahari sandveld) liegen braune welke Blätter. Dann hat’s plötzlich keine Bäume mehr, nur noch das dürre goldgelbe Gras. Vereinzelt grasen Kühe und Ziegen, ein paar Esel und Pferde ebenfalls.
Bei einem Termitenhügel hält Lesh an und erklärt, wie der Bau funktioniert. Millionen von Termiten hausen in einem solchen Hügel. Die Königin ist streng bewacht und soll 30 Tausend Eier pro Tag legen. Eine Frage kommt: „Schläft die je? – Falls nicht, legt sie alle drei Sekunden ein Ei“, rechnet einer unserer Mitreisenden aus.
Der nächste Halt ist bei einem alleinstehenden riesigen Baobab-Baum, der etwa 1‘500 Jahre alt ist. Seine Ausmasse sind gewaltig; wir kommen uns vor wie Ameisen.
Und weiter geht die wilde Jagd. Wir erreichen eine weite Ebene. Nur wenige niedrige Grasbüschel wachsen auf dem Sand. Hier gibt’s etliche Erdmännchen-Kolonien. Aber die zu finden…
Dafür ist aber gesorgt. Die Lodge hat einen jungen Mann angestellt, der jeden Tag den Auftrag hat, die Safarifahrzeuge an den richtigen Ort zu leiten. Er winkt von weitem, steigt in unser Geführt ein und führt uns mitten in der Ebene dorthin, wo die putzigen Tierchen heute anzutreffen sind. Ein, zwei sehen wir auf wilder Flucht in riesigen Sprüngen davonrasen und ich denke schon, das wird schwierig werden, die zu fotografieren. Sie sind auch relativ klein. Dann aber schaltet Lesh den Motor aus und wir können aussteigen. Wir werden angewiesen, einen Kreis zu bilden und ruhig zu sein. Und siehe da: Schon strecken einige Vorwitzige den Kopf aus ihren Höhlen hervor und schauen sich um. Und dann kommt eines ums andere hervor, es ist kaum zu glauben. Sie scheinen keine Angst zu haben. In gewohnter Manier stehen sie auf ihre Hinterbeine, die „Arme“ lustig vor dem Bauch gefaltet oder verschränkt und wie Späher drehen sie sich ruckartig in alle Richtungen. - So unglaublich drollig, die Kleinen. Wir alle können kaum aufhören zu fotografieren. Wir sollen ruhig ein wenig näher treten, sagen die Guides, die Meerkats würden den Ort nicht verlassen. Sie sind offenbar an den jungen Mann gewöhnt, der sie jeweils sucht, und daher sind sie nun ganz zutraulich. Und nicht nur das - sie scheinen genauso neugierig an uns interessiert zu sein wie wir an ihnen. – Das ist ein absolut schönes Erlebnis, besser noch als eine Elefantenherde zu beobachten. Wir können uns kaum losreissen von diesem Ort, aber jetzt geht’s weiter zum oder besser gesagt auf den Salzsee, die Ntwetwe Pan. Es gibt drei solcher Seen beziehungsweise „Pfannen“ in dieser Gegend, dem Makgadikgadi Nationalpark; zusammen sind sie so gross wie die ganze Schweiz. – „kgadi“ heisst übrigens „trocken“ – „kgadikgadi“ sehr trocken oder doppelt trocken und „ma“ ist der Verstärker = wahnsinnig trocken.
Schon von weitem sieht man die weisse Ebene und mit den Autos fahren wir ein paar hundert Meter in den „See“ hinein, wo nun wirklich nicht ein einziges Kräutchen wächst. Dort steigen wieder alle aus und das ist die nächste Fotogelegenheit. Die Schatten sind inzwischen länger geworden – das sieht gut aus durch die Linse. Lesh und seine beiden Kollegen stellen einen Tisch auf, nun gibt’s Apéro, eben den „Sundowner“.
Wir schauen der Sonne zu, wie sie untergeht – ein herrlicher Blick bietet sich einmal mehr. Um vier Minuten nach sechs ist sie hinter dem Busch am Horizont verschwunden und wir treten die Rückreise an. Es wird bald kühler und ein Wind beginnt zu blasen. – Noch wilder als vorher scheint mir die Fahrt zurück durch den Busch zu sein. Wie in einem Schüttelbecher. Und sie hört nicht auf. Kreuz und quer jagt Lesh den Toyota durch die Steppe, ich hab schon längst die Orientierung verloren. Dass das Gefährt nicht zusammenbricht, ist kaum zu glauben. Es rattert und scheppert, dass man das eigene Wort nicht versteht. – Und wo sind die Stossdämpfer? - Nach einer halben Stunde finde ich, es genüge allmählich, es wird langsam ungemütlich, denn es ist bereits dunkel und die Scheinwerfer des Toyota sind nicht sehr lichtstark. Lesh rast durch die Gegend, ich muss mich festhalten wie auf einem wilden Pferd. Wie er den Weg durch diese Gegend, die immer ähnlich aussieht und wo’s keine Wegweiser hat, findet, ist mir das grösste Rätsel. Er sagt, er sei hier aufgewachsen, also kenne er jedes Grasbüschel und jeden Dornenstrauch…
Nach einer Stunde Fahrt denke ich noch immer, eigentlich hätte ich genug, aber es dauert eine weitere halbe Stunde, bis wir ein paar Lichter sehen, die zur Lodge gehören.
Auch die beiden anderen Fahrer sind gleich weit. Jeder hat eine andere Route gewählt, sie fahren nicht hintereinanderher, und schliesslich kommen doch alle so gut wie gleichzeitig an.
Gerädert, steif, ziemlich kalt, völlig sandgestrahlt und mit Haaren, die sich anfühlen wie Stroh, steigen wir vom Fahrzeug. - Die Dusche macht dann manches wieder gut und das feine Nachtessen ebenfalls.
Dienstag, 14. August 18
Eva schreibt ganz früh am Morgen, der Land Rover sei geflickt, sie seien auf dem Weg zu uns. – Ich kann’s kaum glauben. – Darüber freuen wir uns sehr.
Nach dem Frühstück um neun nimmt Lesh uns beide mit auf einen Spaziergang durchs Dorf. Als wir vorgestern ankamen, hatte ich den Eindruck, der Ort sei ziemlich klein, dem ist aber überhaupt nicht so. Etwas mehr als 7‘000 Menschen wohnen in Gweta; sie leben hauptsächlich von der Viehzucht. Die Siedlung ist weit verstreut, der grösste Teil der Behausungen besteht aus Lehmhütten und neben der Hauptstrasse, die geteert ist, geht man wie auf einem grossen Sandstrand. Nur das Meer fehlt.
Erst geht’s aufs Postamt, wo Theo Marken kaufen will. Da ist ziemlich was los, offenbar ist man mit der Welt verbunden. Es hat ein paar Sitzgelegenheiten vor dem Schalter. Dort setzt man sich hin und wartet, bis man an der Reihe ist. „That’s the procedure“, sagt Lesh.
Anschliessend zeigt er uns die Bibliothek. Dieser Bau ist ganz neu und könnte auch in einem Dorf bei uns stehen. Von der Regierung gesponsert. In einem Nebenzimmer wird eine Kindergartenklasse unterrichtet. Sie singen und sind dabei vollkommen bei der Sache.
In einer einfachen Lehmhütte ist der Frisör-Shop untergebracht. Man kann ihn nicht verfehlen, an der Wand draussen steht geschrieben: „Larona Haircut Salon“. Wer das angeschrieben hat, hat nicht sehr gut geplant, die Mauer ist zu kurz für den Schriftzug. Zudem ging dem Künstler offensichtlich mitten während der Arbeit fast die Farbe aus.
Die beiden Damen, die drin auf Kundschaft warten, freuen sich über unseren Besuch, aber sie sehen natürlich sofort, dass da wohl nichts zu holen ist. Eine übersichtliche Preisliste, die schief an der Wand hängt, gibt Auskunft über all die möglichen Frisuren, die man sich machen lassen kann und was die kosten. So erhält man beispielsweise einen „Fishtail-Cut“ für 30 Pula, also umgerechnet drei Franken. Gleich teuer kommt „Iron Hair“, „Pineapple“ ist dann schon mehr als das Doppelte wert, nämlich 75 Pula.
Der nächste Besuch gilt der Primarschule. 650 Schüler werden dort unterrichtet, eine recht grosse Anlage. Die Vorsteherin führt uns gern herum und beklagt, dass es an allem fehle, an Kopierern, Druckern, aber auch an ganz normalem Schulmaterial wie Büchern und Heften.
Sie erinnert mich an Mma Makuzi, die Partnerin von Mma Ramotzwe, vor allem wenn sie die Brille mit den grossen Gläsern trägt.
Unsere bescheidene Spende wird verdankt und in einem Heft notiert. Anschliessend besuchen wir eine Klasse von Erstklässlern. Auch sie singen uns was vor und rezitieren voller Eifer englische Kinderreime. Sieben Unterrichtsfächer gibt’s. Nebst ihrer eignen Sprache wird Englisch gelehrt, Motorik wird geübt, Zeichnen, Hygiene und soziales Zusammenleben. Fünfzehn Mädchen sind in der Klasse und fünfzehn Jungen. Sie sind kaum zu unterscheiden in ihren Uniformen und mit ihren gleichen kurzgeschnittenen Frisuren. Sie sind voller Energie, aber folgen der Lehrerin aufs Wort.
Lesh führt uns anschliessend zu einer Frau, die Körbe und Untersätze bastelt. Sie sitzt in einer völlig verwahrlosten Behausung am Boden, vor sich ein Feuer, auf dem ein Topf mit einem merkwürdigen brauen Brei brodelt, in dem sie von Zeit zu Zeit herumrührt. Neben ihr sitzt ihre 88-jährige Mutter, ebenfalls am Boden. Die Tochter, die unter starken Rückenschmerzen leidet, zeigt uns, wie sie arbeitet. Mit einer Art Nadel fügt sie die Palmenfasern, die sie teilweise mit einer Mischung aus Wasser und altem Rost schwarz färbt, zusammen und es entsteht Reihe an Reihe ein schönes Muster. Sie ist gleich alt wie ich, erfahren wir…
Die ärmlichen Verhältnisse, in denen die beiden Frauen leben, geben zu denken. Lesh übersetzt: Von den drei Kindern, die die Frau gehabt habe, lebe nur noch eines, so habe sie niemanden wirklich, der für die beiden aufkomme. Wir kaufen ein kleines Körbchen und gehen dann weiter.
Der Wahrsager und Medizinmann ist gleich um die Ecke anzutreffen. Er ist ein sehr interessanter Mann. Sein altes, zerfurchtes Gesicht wirkt sympathisch. Er freut sich über unseren Besuch. Wir dürfen ihn fragen, was wir wollen.
Offenbar kann er Schlangen- und Skorpionbisse mit seinen natürlichen Heilmitteln kurieren. Ich frage ihn, wie denn sie Sterberate seiner Patienten sei - also so hab ich natürlich nicht gefragt, sondern politisch korrekt - ob er immer Erfolg habe mit der Heilung. Diese Frage beantwortet er mit ja.
Die 50 Pula, die Lesh vor ihn auf den Boden in den Sand legt, lockern seine Zunge. Er nimmt vier Holzklötzchen hervor, die er schüttelt und in den Kreis im Sand wirft, den er zuvor mit Wasser befeuchtet hat. Lesh muss alles übersetzen, was er sagt, und dann ist es an ihm, das Hölzli-Programm zu zelebrieren. Er will wissen, ob sein Team (irgendein Ballspiel) morgen gewinnen wird und der Alte sagt, es werde ein sehr hartes Spiel sein, aber sie würden gewinnen.
Der Dorfbesuch sollte eine bis anderthalb Stunden dauern, es ist jetzt schon Mittag, also seit drei Stunden sind wir unterwegs – langsam Zeit, zurück zur Lodge zu gehen und uns ein wenig im Pool abzukühlen.
Inzwischen sind Eva und Ken angekommen. Ohne Probleme. Nicht einmal ein Ersatzteil war nötig gewesen für den Land Rover; an unserem Gewicht ist’s auch nicht gelegen, er war einfach so stark verschmutzt und versandet, dass er sich weigerte weiterzufahren. - Nun also, Kapitel Panne hoffentlich abgeschlossen.
Wir essen zusammen eine Kleinigkeit zu Mittag und um vier haben Theo und ich den „Baobab-Sundowner“ - Ausflug gebucht. Wir sind wieder die einzigen beiden Teilnehmer, was uns natürlich sehr passt und Lesh ist unser Guide. Er mag uns gut, hat grosse Freude, dass wir die McCall – Bücher gelesen haben und erzählt, er selber komme in der Serien-Verfilmung auch vor. So werde ich mir diese Filme nun auch ansehen, wenn wir wieder zu Hause sind. Das hab ich bisher nicht getan, weil ich meine eigenen Vorstellungen, die ich von den Protagonisten habe, nicht verderben wollte.
Im achtsitzigen offenen Safari-Toyota-Cruiser geht die Fahrt wieder los. Theo sitzt diesmal vorne neben Lesh, ich wieder oben wie der Kutscher auf dem Bock und muss höllisch aufpassen, dass mich die Dornenbüsche nicht streifen. Leider gelingt mir das nicht ganz so gut diesmal, ein Ast erwischt mich am Unterarm, es blutet und tut weh. – Jetzt hab ich doch auch endlich etwas zu klagen.
Lesh erzählt, dass er mit einem Freund, einem Engländer, zusammen selber eine Lodge für Camper und Backpacker am Aufbauen sei, und dorthin führt er uns als Erstes. Das Gelände ist gross und alles sieht sehr gut und gepflegt aus. Zwei Baobab-Bäume bieten das gewisse Etwas. Unter einem wunderschönen Strohdach ist bereits eine gemütliche Bar eingerichtet, ein paar Sofas stehen drin und ein Pool-Tisch, ein Swimmingpool ist bereit, zwar noch ohne Wasser, sehr schön gestaltete Toiletten- und Dusch-Anlagen hat’s ebenfalls und sein Freund und dessen Verlobte sind grad dabei, ein Haus einzurichten, in dem Reisende, die ohne Zelt unterwegs sind, allenfalls ein Bett mieten können. – Wir wünschen den jungen Unternehmern, dass alles bestens klappt. Am nächsten Tag sollen sie endlich die Genehmigung bekommen, die Anlage eröffnen zu können.
Wir fahren weiter. Unser Ziel ist die kleine Lichtung vor den grossen Baobab-Bäumen, wo Lesh ein kleines Tischchen (mit Tischtuch!) aufstellt und uns ein feines Apéro zelebriert mit Frühlingsrollen, Chips und dem Getränk, das wir vorher in unserer Lodge ausgewählt haben. Gin Tonic ist’s diesmal. Die Bäume sind absolut phänomenal. Man kommt sich vor wie in einer anderen Welt. Wenn ich drunter stehe, machen sie mir fast Angst; sie haben etwas Magisches an sich. Auch das Wissen, dass sie zwei- bis dreitausend Jahre alt sind, Wurzeln haben, die sich bis zu einem Kilometer weit ausbreiten können, trägt zu diesem besonderen Gefühl wohl bei. Die Rinde ist hart wie Stein. Sie stehen absolut still, kein Zweig bewegt sich, sie sind im Moment ohne Blätter, nur ein paar Vogelnester sind zu sehen.
Den Beginn des Sonnenuntergangs sehen wir durch die Baumkrone hindurch. Wir packen zusammen und auf der Heimreise fahren wir der tiefroten, untergehenden Sonne entgegen.
Zum Nachtessen sind wir wieder zu viert.
Maun (Jump Street Chalets) / Ghanzi (Thakadu Lodge) / Zelda Lodge (Namibia) / AUAS Lodge
Mittwoch, 15. August 18
Nach dem Frühstück wird gepackt und das Auto geladen. So langsam aber sicher wird’s zur Routine.
Die Fahrt heute ist kurz, nur grad 200 km sind es bis Maun. Google sieht dafür 3 Stunden vor. Das ist so, weil nach der Hälfte der Route die Strasse, die bis dahin sehr gut war, auf einer langen Strecke ziemlich schlimme Schlaglöcher aufweist, welche die Reisegeschwindigkeit wesentlich vermindern. Schlangenlinienartig muss ausgewichen werden - neben der Strasse oder auf der falschen Strassenseite fahren, ist oft besser.
Auch sonst ist es eine kurzweilige Reise. Esel auf der Strasse sind stur, es kommt ihnen nicht in den Sinn auszuweichen. Ken sagt, „That is the Botswana stop-street“. Und später gibt’s noch „Zebra-Crossing“. Wirklich lustig anzusehen, wie eine ganze Menge dieser schön gestreiften Tiere die Strasse im Trab oder im Galopp überquert. Auch Pferde finden, sie möchten lieber auf der andern Seite grasen, Kühe und Ziegen ebenso. So muss Ken oft bremsen, um eine Kollision zu vermeiden. - Elefanten sind ebenfalls unterwegs, aber sie bleiben, wo sie sind.
Ganz speziell ist ein Honey-Badger, der über die Strasse pfeilt. Dass es ein solches Tier überhaupt gibt, hab ich bisher gar nicht gewusst. Die deutsche Übersetzung ist Honig-Dachs – nie gehört. Er ist schwarz, knapp einen Meter lang und muss ein ganz besonderer Geselle sein. Ken sagt, den zu sehen, käme höchstens „once in a lifetime“ vor. Der aggressive Räuber habe eine ganz spezielle Haut, die, wenn ein Löwe ihn angreife, dieser den Kürzeren ziehe, weil er ihn gar nicht richtig fassen könne. Auch sei er völlig resistent gegen Schlangenbisse und Bienenstiche, er könne in aller Seelenruhe ein Bienennest ausrauben (daher der Name) – kein Problem. Und wenn er in einen Hühnerstall eindringe, dann töte er alle Hühner, einfach nur, weil er das könne, fressen täte er vielleicht höchstes eines. – Den haben wir also gesehen, aber er war zu schnell, fotografieren ging nicht.
Nach dreistündiger Fahrt kommen wir in Maun an, finden nach kurzem Suchen unsere neue Unterkunft, die Jump Street Lodge. Sie ist am Stadtrand gelegen, weit weg von der Hauptstrasse, also bereits wieder im Busch, ruhig und klein, nur aus ein paar hübschen Häuschen bestehend. Ein offenes Restaurant unter einem Strohdach und ein Mini-Swimmingpool gehören dazu. Affen hat’s keine, aber ein paar Hauskatzen. Und nicht weit weg muss ein Fluss sein, denn die Hippos hört man deutlich.
Fünf Nächte werden wir da verbringen; ich freue mich. Ein rotgestrichenes, rundes Häuschen, den afrikanischen Rondavels nachempfunden, wird uns zugewiesen. Sogar eine kleine Küche gehört dazu und ein winziges Badezimmer. – Hier kann es uns wohl sein.
Und das Beste: Theo hat seinen iPad wieder! – Die Eltern der jungen Frau, welche die Stevensford Game Lodge in Sherwood betreibt, reisten vor einer Woche nach Maun und haben Theos vernachlässigtes und liegengelassenes elektronisches Gadget mitgebracht und abgegeben. So hat er doch immer wieder Glück…
Ken hat sofort ausgekundschaftet, ob eine Braai-Möglichkeit bestehe und ob es Feuerholz habe.
Und ob wir die Küche in der Lodge brauchen dürften (unsere ist sooo klein und bei genauerem Hinsehen merke ich, dass es gar keinen Herd hat, nur einen Kühlschrank, ein Spülbecken und ein Tischchen) und ob es ok sei, dass wir den Wein, den sie hier anbieten und der ihm nicht passt, selber mitbringen könnten.
Niemand schlägt ihm einen Wunsch ab. So ist der nächste Schritt: einkaufen gehen. Eva geht mit. Die beiden kommen zurück mit Feuerholz, einem Filet (1 ½ kg diesmal), vier Flaschen Wein, sechs Büchsen Cola light für Theo, Salat, Früchten, Mineralwasser und Eva hat Frühlingsrollen gefunden, die ich so gerne habe. Der Köchin könne die uns dann als Vorspeise servieren. – Die wird sich freuen!
Ein tolles Feuer zaubert Ken her, das Filet ist erneut Spitze, der Salat fein und frisch, der Reis aus dem Woolworth-Beutel in 90 Sekunden in der Mikrowelle erwärmt – alles wie gehabt.
Donnerstag, 16. August 18
Wir nehmen’s gemütlich. Erst mal erkundigen wir uns, was man in der Gegend alles unternehmen kann. Ken erklärt: Kanufahrten (Mokoro day trip), Motorbootfahrten, Flüge übers Delta, Übernachten auf einer Insel, reiten, fischen natürlich! – Wir beschliessen, schön eines nach dem anderen anzugehen, aber die Insel-Übernachtung haben wir ja bereits abgehäkelt, die lassen wir. So beginnen wir mal mit der Motorboot-Exkursion. Um halb vier nachmittags werden wir abgeholt. Gut dreissig Minuten dauert die Fahrt bis zur Bootanlegestelle. Wir vier sind alleine auf dem Boot, das ist gut so. Die Fluss-Landschaft, durch die wir geführt werden, ist einmalig schön. Das Wasser zeigt kaum Bewegung und aus diesem Grund reflektieren die Büsche, Bäume, Termitenhügel und die Kühe, Esel und Pferde, die im Wasser stehen, wie in einem Spiegel.
Das Okavango-Delta ist ein Nationalpark, ein Binnen-Feuchtgebiet und UNESCO-Welterbe. Es wird auch „Okavango-Grassland“ genannt, was meiner Meinung nach fast besser passt. Es besteht aus Sümpfen, Seen, natürlichen Kanälen und Inseln. Speziell ist, dass alles Wasser, welches das Delta vom Okovango-River aus erreicht, im Kalahari-Becken versickert oder evaporiert und nirgends in ein Meer fliesst. Das ganze Gebiet ist etwa 20‘000 km2 gross.
Vor allem Vögel können wir beobachten. Ken kennt sie alle, weiss genau, wie sie aussehen im Flug und im Stehen und weiss manches mehr über sie zu berichten. Er kennt auch die „Unterabteilungen“, die neuen und die alten Namen - es ist sagenhaft.
Drei Eier liegen im Nest zweier „Blacksmith Lapwing“ oder „Blacksmith Plover“ (auf deutsch „Waffenkiebitz“ – ich kann zwar nichts damit anfangen), die ihrem Namen alle Ehre machen. Wie Samson unser Boot ganz nah ans Nest heranmanövriert, erkennen wir das sofort: Ihr Warnruf gleicht dem eines Schmieds, der auf den Ambos schlägt.
Auch Krokodile hat’s – wir sehen allerdings nur eines. – Zwei Stunden lang dauert die gemütliche, friedliche Fahrt, dann geht’s wieder zurück zur Lodge.
Eva ist dafür, auswärts essen zu gehen – mal eine Abwechslung: indisch. – Ken fährt uns in ein bekanntes Lokal, das „Tandoori“, das zusätzlich auch chinesische Speisen anbietet. Es gefällt uns gut dort unter dem ausladenden, gewaltigen Strohdach und den kitschigen farbigen Lämpchen. Und die Speisen sind ausgezeichnet – riesige Portionen. Theo lässt sich einen Doggie-Bag geben.
Freitag, 17. August 18
Heute ist Kanu-Tag. Anders als beim letzten Mal sind die Kanus auch ungleich ausgestattet, nämlich gar nicht. Jetzt sind sie aus Kunststoff, früher waren sie aus Holz gefertigt. Zwei Schalensitze aus Hartplastik werden hineingelegt, in die wir uns setzen können. Sie sehen extrem unbequem aus, sind aber erstaunlicherweise gar nicht so übel.
Aber erst mal müssen wir dorthin gebracht werden, wo die Kanus stationiert sind. Das dauert über eine Stunde. Kurz nach acht Uhr fahren wir los. Nach einer halben Stunde auf der geteerten Hauptstrasse zweigen wir in den Busch ab, wo sich der Safari-Cruiser mühsam durch die Sandpisten quält. Ähnlich wie in Gweta ist’s eine Schüttel- und Ratterfahrt. Langsam denke ich, bei diesen Fahrzeugen werden wohl die Stossdämpfer serienmässig gar nicht eingebaut. – Die Strecke führt über einfach konstruierte Holzbrücken, durch Wasserläufe, vorbei an Kühen und Eseln - wir haben das Gefühl, weit weg von jeglicher Zivilisation zu sein. Doch da tauchen armselige Lehmhütten auf, ein Kraal, und urplötzlich finden wir uns mitten in Dutzenden von Touristen wieder. Dort ist die Anlegestelle für Motorboote und all die Kanus.
Unsere zwei Mokoros sind bereit. Lukas stellt sich uns vor; er ist unser Guide und wird das Boot von Eva und Ken übernehmen. Unser „Kapitän“ heisst Titi und ich muss lachen: So heissen nämlich zwei von Diegos besten Freunden. Unsere beiden jungen Guides stehen hinten auf den Kanus und mit ihren langen Stangen steuern sie uns während zweier Stunden durch das seichte Gewässer hin zu einer Insel, wo wir Lunch haben werden. Wir müssen uns erst daran gewöhnen, wie es ist, in diesem wackligen Gefährt zu sitzen. Möglichst nicht bewegen, lautet die Devise. Manchmal schaukelt‘s ein bisschen, aber schon bald ist klar, dass Lukas und Titi absolut geübt sind im Kanufahren; sie machen diesen Job seit Jahren. Und sie sind nicht die Einzigen. Wir begegnen einer ganzen Menge von Frauen und Männern, die völlig selbstverständlich diese Art von Kanus steuern, sei es mit Touristen an Bord oder Waren, die sie transportieren.
Gleich beim Losfahren sehen wir ein paar Elefanten im Wasser stehen, etliche Motorboote kreisen um sie herum. Aber bald schon sind wir weit weg vom Motorenlärm, es ist absolut friedlich, die einzigen Laute, die wir noch hören, sind ein paar Kuhglocken von fern und das leise Plätschern der beiden Stäbe, die ins Wasser tauchen, mit denen wir vorwärts gesteuert werden. Idyllischer geht’s nicht mehr. Ganz nahe an der Wasseroberfläche gleiten unsere Boote durchs Seegras dahin, es ist schlicht und ergreifend paradiesisch schön.
Nach einer Stunde machen wir Halt auf einer Insel. Lukas und Titi stellen ein „Znüni“ für uns auf, Güezi und Kaffee. – Ken sagt: „You can choose: There is coffee, coffee or coffee“.
Die gemächliche Fahrt geht weiter durch die grüne Ebene, vorbei an moosartigen Wasserpflanzen und an vereinzelten Seerosen. Ein ganz kleiner Frosch (reef-frog – Schilf-Frosch) hängt an einem Grashalm. Er ist weiss, kann aber seine Farbe wechseln wie ein Chamäleon – lila und pink. Dass Lukas den erspäht hat, ist schon bemerkenswert. Beide Kanus werden ganz nah heranmanövriert, so dass wir den Winzling perfekt vor die Linse kriegen.
Schon denke ich: „Wie gemütlich und lauschig ist es hier - keine Flusspferde.“ – Kaum gedacht. schon gehört und gleich darauf auch gesehen. – Aber überlebt. - Unsere Steuermänner machen einen grossen Umweg um die Kolosse und wir hören sie nur noch aus der Ferne.
Nun sind wie auf der Insel angekommen, wo wir zwei Stunden Aufenthalt haben. Wir machen einen einstündigen Spaziergang. Tiere sehen wir keine, aber massenhaft Spuren und Dung. Die grossen Löcher in der Erde stammen von Ameisenbären, die Verwüstungen an Bäumen und Sträuchern von Elefanten, die abgenagte Baumrinde von einem Borkenkäfer. Anhand von Fussabdrücken und Exkrementen erklärt uns Ken alles Wissenswerte über die Dickhäuter. Wie ihre Füsse geformt sind, wie sie gehen und warum das alles so ist - wir erhalten eine Unterrichtsstunde – pfannenfertig.
Die beiden Guides hören ebenfalls aufmerksam zu. Für sie scheint auch manches neu, sie geben den Job des Erklärens gern ab. - Speziell ist auch die Lektion über all den Dung, dem wir auf Schritt und Tritt begegnen. Die riesigen Haufen von Shitkugeln gehören natürlich zu den Elefanten, relativ kleine Bällchen stammen von Giraffen - seltsam, man würde denken, die wären grösser… Dung von Zebras, Impalas, Kudus kriegen wir zu sehen, und das aus nächster Nähe. Ken liest die Dinger nämlich auf („It’s a shit story“, sag er, „but there you go…“), bricht sie entzwei und erklärt, was besagtes Tier gegessen hat, ob’s von einem Graser oder einem Browser stamme, sehe man ganz genau – Struktur, Dichte, Farbe, Inhalt. Elefanten müssten sehr viel fressen, weil sie etwa 70% davon nicht verdauen könnten. - Und ja, da sind in den Strohballen Palmkerne vorhanden und ganze Mopani-Blätter unverdaut nachweisbar. – Theo muss dann natürlich das Zeugs auch anrühren, was nicht zu meiner grossen Freude beiträgt.
Eva schaut all dem ebenso skeptisch zu wie ich uns sagt, so wie sie das empfinde, seien wir auf einem „shit-photographic-trip“. Die ganze Insel, auf der wir nun Mittagessen würden, sei also eine Toiletten-Insel. – Ich bin ganz ihrer Meinung.
Ich frage Lukas, der unsere kleine Expedition anführt, ob er ein Foto von uns machen könne. Da sagt Ken zu ihm, er solle ihn möglichst schlank erscheinen lassen auf der Aufnahme. Er macht immer wieder Witze mit Kellnern, Guides, Tankstellenangestellten und allen möglichen Leuten, die uns begegnen, und freut sich dann an deren Reaktion. Viele verstehen den Witz nicht ganz, sind nicht sicher, ob’s ernst gemeint ist oder nicht oder sind zu schüchtern für eine Entgegnung. – Daher muss er jetzt lachen, wie Lukas spontan sagt: „It’s impossible!“
Wie wir zurück bei den Booten sind, hat Titi bereits den Lunch vorbereitet, der von der Lodge früh am Morgen bereitgestellt und mitgegeben wurde. Es gibt Kartoffelsalat und Sandwiches, Chips und Wasser.
Er hat noch was anders ausgebreitet auf einem Plastiksack: ein paar handgeflochtene Körbchen und Armbänder. Lukas Freundin hat die hergestellt. - So versucht doch jeder noch ein kleines Nebengeschäft zu tätigen…
Nach dem Essen haben wir eine halbe Stunde lang Zeit zum Nichtstun und die absolute Ruhe dieser friedlichen Landschaft zu geniessen. Für Theo heisst das natürlich: Siesta. Kaum angekommen, hat er sich schon ein gäbiges Plätzchen im Schatten eines Baumes ausgesucht. Dort schnarcht er jetzt, den Kopf aufgestützt auf seinen roten Sportsack mit dem weissen Schweizerkreuz drauf.
Anderthalb Stunden dauert die stille, gemütliche Rückfahrt zur Bootanlegestelle. Genau im dem Moment, wo wir ankommen, ist auch gleich unser Safari Land Cruiser an Ort und Stelle, der uns in rasanter Fahrt, so ziemlich im Gegenteil von dem, was wir auf dem Wasser erlebt haben, wieder zurück zur Lodge bringt.
Wie essen heute Abend dort; wir sind die einzigen Gäste.
Samstag, 18. August 18 (Teos erster Geburtstag)
Gemütlich, gemütlich!
Um drei werden wir abgeholt und auf den Flugplatz gefahren (Maun – International Airport – tönt beeindruckend!). Um vier soll unser Flug starten. – Security check wie überall und anschliessend werden wir zum fünfsitzigen Flugzeug gefahren. Der Pilot stellt sich vor. „Wing“, verstehe ich, ist sein Name und ich finde, das passt eigentlich ganz gut. „Wayne“ ist es allerdings, wie ich später realisiere. Wir sitzen zu fünft eingeengt in der kleinen Cessna. Heiss ist es. - Der Pilot startet den Motor, der stirbt ab, er versucht es erneut, jedoch die Geschichte wiederholt sich zehnfach. Schwache Erinnerungen an unseren Land Rover steigen in mir auf. Er/sie mag einfach nicht. Auf Berndeutsch würde man sagen, der Motor ist „versoffe“. Nach dem zwanzigsten Versuch fragt Eva schüchtern, ob das in der Luft dann auch passiere. – Und Ken, der sonst keine Bedenken kennt, findet’s auch nicht mehr so gemütlich.
Eine andere Cessna kommt an, wir steigen in diese um, erst aber muss sie noch aufgetankt werden. Aber dann, mit einer halben Stunde Verspätung, starten wir. Es ist ein wunderbarer Flug über das Delta. Es lohnt sich, aus der Vogelperspektive diese einmalige, prächtige Landschaft zu betrachten. Die Farben sind einzigartig.- Ebenfalls ist es ein Erlebnis, die riesigen Büffelherden zu sehen, die Elefanten, einzelne Flusspferde und sogar Vögel.
Der Flug dauert dreiviertel Stunden und wir fliegen meistens in circa 150 Metern Höhe über die fantastische Landschaft. Nur so kann man die gewaltigen Ausmasse erahnen.
Auch heute Abend ist das „Tandoori“ wieder gefragt. Chinesisch diesmal. Vier Doggie-Bags nehmen wir mit „heim“ – die Portionen sind selbst für Ken zu gross.
Ken ist sehr gut aufgelegt und wir erhalten eine ausführliche Lektion Rugby- oder Cricketregeln erteilt, ich weiss nicht mehr genau, welches, weil mein Interesse an diesen Sportarten sich in Grenzen hält. Eva fragt, ob wir am nächsten Tag ein Quiz zu bestehen hätten…
Sonntag, 19. August 18
Am Sonntag soll man ruhen… Theo passt das gut. Eva und Ken gehen einkaufen, Theo ist, nebst Siesta selbstverständlich, den ganzen Tag damit beschäftigt, sein Projekt Kinderbuch für die Enkel: „Nani and Nono go Safari“ weiterzutreiben.
Fischen wär ja auch ein Thema. Ken hat sich natürlich schon erkundigt und einen Spaziergang zum Fluss unternommen zwecks Rekognoszierung. Leider (!) eignet sich dieses Gewässer wenig zum Fischen, das Buschwerk ist zu dicht, Theo würde vermutlich wieder ein Chaos anrichten mit der Angelrute und überhaupt – keine nennenswerten Fische gäbe es zu fangen (oder nicht zu fangen), schon gar keinen Tigerfisch, der muss das A und O sein für einen Angler.
Andere Flüsse hat’s auch in der Umgebung, aber dort ist das Problem, dass sie alle ausgetrocknet sind und unsere beiden Ehemänner einfach nicht auf „dry – fishing“ spezialisiert sind.
Ich habe mich für einen Ritt angemeldet. Wann genau ich abgeholt werde, ist Gegenstand mehrerer Befragungen, Telefonate und Vermutungen, die gestern während des ganzen Nachmittags andauerten. 06.30 hiess es einmal, was mich zwar nicht gleich aus der Bahn geworfen, aber Theo dazu verleitet hat, mir nahezulegen, ich solle gleich draussen vor dem Rondavel schlafen, damit ich ihn dann nicht wecke. Auch acht Uhr war eine Option, 09.30 war’s schliesslich - also kann ich doch drinnen schlafen und sogar noch frühstücken, bevor’s losgeht.
Eine gute halbe Stunde dauert die holprige Fahrt über Sandpisten durch den Busch bis zur Royal Tree Lodge. Unterwegs kommen wir an verschiedenen Behausungen vorbei, die Leute winken uns zu, was mich immer ein wenig seltsam dünkt. - Die Touris, die auf den Safari-Vehikeln herumkutschiert werden….
Ein Schild an der Strasse zeigt den Weg zum Vorschul-Kindergarten. Bei uns hiess diese Institution, die unsere Kinder damals besucht haben, „Strubelimutz“. Hier: „Precious Jewels Academy – (Preschool)“.
Und wieder hab ich das Gefühl, irgendwo im Nirgendwo zu sein, wie wir in der Lodge ankommen, wo’s Stallungen für zwanzig Pferde hat. Das hätte ich hier nicht erwartet. Es ist eine Farm, eine Game Reserve.
Mein Pferd ist eine Schimmelstute namens „Janie“ und mein Begleiter ein liebenswerter Guide aus dem Stamm der „Bayei“. Er heisse „Flood“, stellt er sich vor. - Seltsamer Name, finde ich. Wir reiten los und schon begegnen wir Zebras, Giraffen mit ihren Jungen, Elands, die grösste Antilopenart, die es gibt, Blessbock, Springbock, Gemsbock und Strausse. Eine Straussendame sitzt brav auf ihren Eiern, an einem anderen Nest kommen wir vorbei, auf dem niemand sitzt. Flood denkt, die Straussin ist vielleicht zu jung oder zu dumm, um sich richtig um die Aufzucht zu kümmern. In der Hitze gibt das grad Spiegeleier, wenn die Temperatur nicht stimmt.
Wie bei Ken erhalte ich auch hier eine weitere Lektion Vogelkunde. – Den „Crimson-Breasted Shrike“ sehen wir ein paar Mal; sein tiefrotes Brüstchen ist prächtig. Auch der „African Long Tailed Shrike“, oder genannt „Magpie-Shrike“, der zwölf verschiedene Vogelstimmen nachahmen kann, ist unterwegs sowie der „Fork Tailed Drango“. Eine ganze Menge von „Marabu-Storks“ bevölkert das Flussufer des Thamalakane-River, und einmal mehr ist der „Black Smith Plover“ zu hören.
Wie die Vögel heissen, die ihre Nester am liebsten auf den Telefonmasten bauen, habe ich vergessen, wir haben sie ja auch nicht gesehen (Sie heissen „Social Weavers“, wie Ken mir später erklärt. Fast eine Art Mehrfamilienhaus würden sie bauen mit verschiedenen Eingängen, der richtige Zugang gut versteckt, die anderen zum Teil mit Dornen ausgelegt, so dass es einer Schlange verleiden würde, die Eier zu suchen). - Ja und immer und immer wieder ruft die „Cape Turtle Dove“, die mir mit ihrem Gesang langsam aber sicher auf den Wecker geht. Sie ist überall zu hören, wohin man auch geht. Seit Beginn unserer Reise „verfolgt“ sie uns auf Schritt und Tritt. - Eine ganz ähnliche Taubenart ist die „Red-Eyed-Dove“ und ihr „Song“ geht so: „I’m red-eyed dove, I’m red-eyed dove“. – Lustig, wie es mit diesen Eselsleitern tatsächlich einfach ist, die Vögel zu erkennen - wenigstens vom Gesang her. Auch die „Emerald oder Green Spotted Wood Dove“ singt ein besonderes Lied: „My mother is dead; my father is dead. – What shall I do do do…“
Es soll im südlichen Afrika 740 verschiedene Vogelarten geben, sagt Ken; da bin ich mit meinem Latein natürlich erst am Anfang.
Aber zurück zum Ausritt. – Erstaunlich ist, dass der Ritt durch drei völlig verschiedene Vegetationszonen führt: erst durchs sandige Buschland mit den vielen Dornensträuchern, vor denen mich Flood jeweils warnt, dann durch eine Art Wald mit dicht aneinander stehenden, hohen Bäumen und schliesslich durch ein sumpfiges Gebiet mit hohem Gras, dort, wo der Fluss jeweils übers Ufer tritt.
Nach zwei Stunden sind wir zurück bei den Stallungen. Schön war’s, wirklich schön!
Den Nachmittag verbringe ich vorwiegend am Pool mit Lesen und Faulenzen. Auch schön!
Wie schon erwähnt sind Eva und Ken inzwischen einkaufen gegangen. Sie kommen zurück mit Mineralwasser, Salat und vier grossen Stück Lachs. Eva dachte, das wäre genug für uns alle vier zum Nachtessen, aber da fehlt halt das Fleisch. Ken hat sich vom Metzer zusätzlich zwei riesige Rumpsteaks frisch zuschneiden lassen (abgepackt kommt nicht in Frage), eines für sich und eines für seinen „Fisherman friend“. – Dieser mag dann allerdings nicht das ganze Steak – Ken springt in die Bresche, während wir beiden Frauen (wife number one and wife number two) den Fisch essen. Ken hat für diesen Abend die Küche in der Lodge grad selber übernommen, denn sowohl das Fleisch wie auch der Fisch müssen zur Perfektion gebraten sein, was er den beiden Köchinnen nicht zutraut. Sie dürfen aber unseren Tisch decken und den Salat rüsten.
Zum Glück haben wir noch eine Flasche Wein vorrätig, am Sonntag kann man im Einkaufszentrum nämlich keinen kaufen. Ken habe gefragt, wieso. Die Antwort sei gewesen: „Because……“
Montag, 20. August 18
Es ist wieder ein Reisetag, Ken will früh losfahren. Es wird dann doch halb neun. Eine Strecke von 300 km haben wir vor uns; ausser zweimaligem Aussteigen an einem Roadblock der Seuchenpolizei, um unsere Schuhe wegen der Maul- und Klauenseuche zu „waschen“, ist sie ziemlich ereignislos. Hin und wieder überqueren Ziegen und Kühe die Strasse, aber daran sind wir inzwischen gewohnt. Seit Kasane ist das Land völlig eben (Kalahari Sandveld), nur grad kurz vor unserem Ziel findet sich eine Art sanfter Hügel, fast eine Sensation. Dann wird’s wieder flach. Nach knapp vier Stunden kommen wir in Ghanzi an; die Lodge befindet sich ausserhalb des Dorfes und ist nur erreichbar über einen mühsamen drei Kilometer langen Sandpfad, den man nur im Schritttempo befahren kann. Auch hier muss ich wieder staunen, wer auf die Idee kommt, an diesem Ort eine Unterkunft hinzubauen.
Wir erhalten ein feines Mittagessen. Theo bestellt eine Spinatsuppe und erst eine halbe Stunde später merkt man in der Küche, dass es gar keinen Spinat hat (wir sind die einzigen Gäste). Wir teilen uns in den Poulet-Salat, der so oder so zu gross ist für mich. Anschliessend beziehen wir unsere Cabins. Sie sehen auf Stelzen, die Aussenwände bestehen aus einer Art dicker Zeltplache, innen sind sie mit kartonartigen Platten isoliert und überdeckt ist das Ganze mit einem Strohdach. Sie sind ganz ok, kein Luxus, aber zweckmässig eingerichtet und das Wichtigste: ein bequemes Bett erwartet uns. Unsere „Reisegruppe“ hat keine Lust auf Aktivitäten an diesem Nachmittag, es ist auch sehr heiss, also ist der Fall für Theo klar: Siesta und für mich: Pool. Der ist allerdings eher auf der kälteren Seite, auf keinen Fall mehr als etwa 18 Grad, was mich nicht stört, ich denke wieder mal an die Aare, die allerdings viel wärmer ist im Moment.
Gegen Abend genehmigen wir uns wiedermal einen Apéro. So gut wie nirgends auf unserer Reise scheint dieser schöne Brauch im schwarzen Kontinent angekommen zu sein. Wenn’s eine Bar hat, dann gibt’s dort verschiedene Sorten von Whisky, und wenn’s hoch kommt, steht da eine Flasche Gin. Damit hat es sich.
Für Ken und seinen ebenfalls Whisky-liebenden Fisherman Friend oder „my partner in crime“, wie Theo auch genannt wird, ist das ja kein Problem. Eva liebt Gin und ich fange den Abend halt mit einem Glas Rotwein an. Auch nicht schlecht eigentlich.
Was die für ein Geld machen könnten mit all den schönen Drinks, die die Touristen doch so lieben, Piña Colada, Caipirinha, Mojito, Sex on the Beach, Margarita und wie sie alle heissen. Aber wir sind hier in Afrika, da ist eben manches anders.
Nun – eine Flasche Malibu ist vorhanden, ein kleiner Rest von Martini Rosso und natürlich Jägermeister - schliesslich sind wir ganz nah an der Grenze von Namibia, und dieses Gesöff ist dort das Nationalgetränk.
Im „Garten“ der Lodge, grad vor dem offenen Restaurant hat’s ein Wasserloch. Gegen Abend strömen Tiere herbei, die ebenfalls Lust haben auf einen Sundowner. Es sind Gnus, Impalas, Kudus und später, wie’s fast dunkel ist, sehen wir auch noch Warzenschweine und einen Schakal.
Ein sehr feines Nachtessen wird serviert. Theo isst drei Spiesse mit verschiedenem Antilopen-Fleisch, Eva Eland-Potjie, mir ist nicht abenteuerlich zumute, verzichte daher auf Zebra-Steak und Kudu-Leber und begnüge mich mit Rindsfilet. Ken bestellt ein T-Bone-Steak (man-size) - so ein grosses hab ich noch gar nie gesehen. Es könnte von einem Elefanten stammen.
Dienstag, 21. August 18
Nach dem Frühstück ziehen wir zu Fuss los – „Bushman-Walk“ nennt sich der Spaziergang. Unser Guide heisst „Narongi“. Er führt uns ein kurzes Stück weit in den Busch und schon stehen wir vor zwei jungen Männern und einer jungen Frau im „Buschmann-Outfit“. Sie sind von der Lodge angestellt, das erfahren wir allerdings erst später. Ken weiss es natürlich. Aber ja, die drei gehören tatsächlich zum Stamm der Buschmänner oder San, aber das Tragische an der Geschichte ist, man hat diese Menschen aus ihren ehemaligen Revieren vertrieben. Die Regierung hat sie umgesiedelt, hat ihnen Unterkünfte bereitgestellt, sogar fliessendes Wasser und Nahrung erhalten sie. Allerdings ist das alles nicht, was sie wollen, aber gegen diese Neuerungen können sie sich nicht wehren. So sind jetzt zwei Familien-Clans hier ganz in der Nähe angesiedelt und die Lodge versucht sie zu unterstützen, indem sie ihnen eine Art „Arbeit“ zuweist. Sie seien wie Kinder, sagt Narongi, es sei nicht immer einfach mit ihnen. Auf einem Bush-Walk zeigen sie, wie sie noch vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich gelebt haben, wie sie gekleidet waren, wie sie sich vom kargen Boden und den Sträuchern und Bäumen ernährt haben. So kommen sie mit uns (barfuss) und zeigen, wie sie Wurzeln finden, die für allerlei Beschwerden gut sind, zum Beispiel gegen Kopf- oder Rückenschmerzen, sogar eine Art Anti-Baby-Pille stellt der Busch bereit. Sie wollen uns zeigen, wie sie ein Feuer machen, aber heute ist nicht ihr „lucky day“, da helfen alle Gebete nichts, denn es hat sehr viel Wind und wenn auch immer wieder mal ein Räuchlein aufsteigt, ein richtiges Feuer kommt nicht zustande. Sie tun mir leid – ihre Hände müssen völlig wund sein nach der langen Prozedur. Der Versuch erinnert mich an den Flugzeugstart vor zwei Tagen, der auch nicht gelingen wollte…
Wir verabschieden uns, geben aber kein Geld. Sie würden am Abend für uns tanzen und wenn sie jetzt schon ein Trinkgeld erhielten, könne es sehr wohl sein, dass sie überhaupt nicht mehr auftauchen würden, erklärt Ken, denn offenbar haben sie ein Alkoholproblem. Grad wie die Aborigines in Australien und die Indianer in den US. – Was haben wir Weissen nur angerichtet, denke ich. – Zurück in der Lodge erhalten wir von Ken eine ausgedehnte Lektion über die afrikanischen Stämme und deren Geschichte.
Ein Tisch ist schön gedeckt für uns beim Lagerfeuer und wir beobachten wieder zwei Springböcke, die ganz nah ans Restaurant herankommen, völlig ohne Furcht. Ein wirklich super gutes Nachtessen wird serviert mit erstklassigem Filet. Ken hat es so für uns bestellt. Ein Hintergrundkonzert von verliebten „Bull-Frogs“ müssen wir über uns ergehen lassen. Ich denke, es sind etwa 37 Frösche, die am Balzen sind, Ken meint, es seien nur etwa drei („The one with the nicest voice gets all the girls“.).
Nach dem Essen freuen wir uns auf die Tänze. Am selben Ort im Busch, wo wir heute Morgen waren, finden diese statt. Ken hat ein Auto bestellt, das uns dorthin führt, er denkt, dass der Spaziergang im Dunkeln um diese Zeit zu mühsam für uns sein würde. Eine sehr holprige Strecke legen wir zurück, aber die kurze Fahrt dauert kaum fünf Minuten. Schon sehen wir die beiden Buschmänner und ihre drei Frauen (Buschmänninnen / Buschmannfrauen / Buschfrauen???) rund ums Feuer stehen. Vier Stühle stehen dort für uns. Wir setzen uns, die Vorführung kann beginnen.
Leider ist es ein ziemliches Debakel; wir merken bald, dass die eine Frau und einer der Männer stockbetrunken sind. Die Frau verbrennt sich zweimal fast die Füsse im Feuer. Ken sagt zu unserem Guide, dass er nicht bezahlen werde, wenn nicht das geboten werde, was abgemacht sei. Ein ziemliches Tohuwabohu geht los, aber die Gruppe ist leider nicht imstande, sich zusammenzuraufen. Eva möchte lieber gehen. Wir steigen ins Auto und fahren zurück in die Lodge. Schade! Mir tun die Leute leid, sie haben wenige Perspektiven, ich weiss selber nicht recht, was ich von all dem halten soll. – Was sie zeigen wollten, ist ein Stück vergangener Geschichte, was passiert ist, ist die Realität.
Heute Nachmittag habe ich ein Buch zu Ende gelesen, das mir Ken empfohlen hat: „Hold my hand; I am dying“ (by John Gordon Davis). Es handelt vom Bau des Staudamms am Zambezi-River bei Kariba, ist auch eine leidenschaftliche Liebesgeschichte und zugleich eine absolut schreckliche Beschreibung der grauenhaften Zustände, die bei der Machtübernahme der Schwarzen in Zimbabwe herrschten. – Ein faszinierender Roman, gleichzeitig ein Stück schrecklicher Geschichte der Gebiete, durch die wir in den letzten Wochen gereist sind. - Das wird mir Albträume geben…
Mittwoch, 22. August 18
In fünf Minuten ist der Land Rover gepackt. Inzwischen wissen die beiden Männer genau, was wo hineingehört.
Beim Frühstück erfahren wir, dass das gestrige Drama der fünf Buschmänner völlig ausgeartet sei. Sie hätten ihre Hütte angezündet und es sei ein Glück, dass sie bei dem trockenen Wetter nicht gleich die ganze Farm abgefackelt hätten. – Wie’s dort jetzt weitergeht, wir werden es wohl nicht erfahren.
Um neun Uhr starten wir in Richtung Namibia. – Wieder ein Grenzübertritt. – Keine freudige Erwartung. Kurz vor der Grenze tanken wir. Es dauert fast eine Viertelstunde, bis die langsame Pumpe 60 Liter Benzin ins Auto gefüllt hat. Ken mag nicht mehr warten, bis der Tank voll ist. Wir fahren weiter. – Bei der Tankstelle steht übrigens angeschrieben: „Quick Stop“.
Ausreise aus Botswana ist kein Problem, wir kommen mühelos durch. – Am Grenzübergang in Namibia sitzt ein Beamter am Schalter, dem man grad ansieht, dass er heute Morgen mit dem linken Fuss aufgestanden ist. „Schikane“ steht auf seiner Stirn geschrieben. Ken kommt zuerst dran, dann ist ein Deutscher an der Reihe, der einen schweren Rucksack am Rücken trägt. Der Beamte will von ihm wissen, wann er das Land verlasse, wann sein Rückflug sei. – Er habe keinen gebucht, reise seit zwei Jahren im Afrika herum. – Das kann nicht gut gehen. Diese Antwort ist die falsche. Woher er sein Geld habe, ob er gearbeitet habe. Ja, aber ohne Lohn, er sei pensioniert und erhalte jede Woche seine Rente aus Deutschland. – Schon wieder falsch. – Es gäbe niemanden auf dieser Welt, der ohne Lohn arbeite, sowas könne er ihm nicht weismachen. Ich stehe direkt neben ihm und höre die ganze Unterhaltung mit. - Wer denn seine Übernachtungen bezahle, ist die nächste Frage. – Eben, das Geld aus Deutschland. – Dafür würde das Geld niemals langen... Und er sei doch noch zu jung, um Rente zu kriegen. – Er sei sehr krank gewesen, versucht der Deutsche zu erklären… – Und so geht das weiter und weiter, ich bin ziemlich sicher, dass diesem Typ die Einreise schliesslich verweigert wurde.
Ken wird ungeduldig, unterbricht mal und fragt, wir seien eine Gruppe zu viert, ob wir andern drei nicht vorher drankommen könnten. Eva, die beim letzten Mal nicht reingelassen wurde (eine lange, unglaubliche und schikanöse Geschichte), hat diesmal kein Problem, ihr Visum ist in Ordnung. Wir Schweizer brauchen keines und ich bin eigentlich ganz froh, dass der mürrische Beamte sich auf den Deutschen fokussiert, den er sicher nicht aus seinen Klauen lassen wird. Bevor er mir meinen Pass zurückgibt, will er wissen, weshalb wir mit dem Südafrikaner unterwegs seien. – Ich erklärte ihm, wir seien Freunde und zusammen auf einer siebenwöchigen Reise. – Wo wir uns denn kennengelernt hätten. – Im Internet. – Wie genau? – Wir würden Häuser tauschen, sie seien bei uns gewesen, wir bei ihnen; jetzt seien wir befreundet. – Das sei unmöglich, erwidert der allwissende, lebenserfahrene Staatsdiener, so mache man keine Freunde. „Tell me if I’m wrong“. – Ich antworte darauf nichts, denke, es ist wohl besser, mit diesem Kerl nicht zu argumentieren. Er wirft mir daraufhin meinen Pass hin und wendet sich wieder dem Deutschen zu. Sehr gut. Wir können also gehen.
„Was sollte das alles?“, frage ich Ken. Seine Erklärung ist, er hätte aus mir herausbringen wollen, dass wir mit dem „Südafrikaner“ auf Safari seien, ihn also für seine Dienste bezahlen würden, was ja nicht den Tatsachen entspricht, und Ken somit eine Arbeitsbewilligung hätte vorweisen müssen. Dann wäre die Sache erst richtig losgegangen. – Was für ein Glück, dass er ein anderes Opfer bereits an der Angel hat.
Nur noch wenige Kilometer weiter müssen wir fahren und schon sind wir in der Lodge angekommen, wo wir einmal übernachten werden. 14‘000 ha gross ist die Zelda Guest- and Game Farm.
Schöne grosse Zimmer hat’s, die hübsche parkähnliche Anlage mit den riesigen Euphorbien und Palmen ist sehr gut unterhalten, der Pool ist sauber, die Bar gut bestückt und aufgefüllt, ein Weinschrank vorhanden, mehrere lauschige Plätze hat’s zum Sich-wohl-Fühlen und alles funktioniert bestens – in Namibia ist eben manches ein wenig anders – deutsches Erbe...
Um halb sechs ist Tierfütterung angesagt. Der Leopard erhält seine fünf Kilogramm Zebrasteaks. Wie er in der Nähe zwei Hunde sieht, rührt er seinen Bissen nicht an, sondern lässt die beiden nicht mehr aus den Augen. – Natürlich ist da ein Zaun dazwischen - dumm gelaufen…
Lustig ist das Stachelschwein. Es ist ein grosses mit langen Stacheln – fast wie Federn sehen sie aus. Es mag seinen Wärter sehr, das merkt man gleich. Es lässt sich von ihm streicheln und folgt ihm wie ein Hündchen zum Futtertopf.
Zwei Emus erhalten ebenfalls ihre abendlichen Leckerbissen. Man darf ins Gehege hinein und ihnen Futter reichen. Ich verzichte…
Nun ist’s sieben Uhr und auch für die Touristen Zeit, zum Buffet zu schreiten. Zur Unterhaltung singt und spielt ein älterer Typ allerlei Musik, Country and Western, Rock and Pop (nicht vom Neuesten) und deutsche Schlager.
Donnerstag, 23. August 18 (Debos Geburtstag)
Es ist wieder mal sehr kalt heute Morgen, 10 Grad. Wir ziehen alle unsere warmen Sachen an, denn man isst draussen unter einem grossen Strohdach; es gibt kein geschlossenes Restaurant. Wir verlassen Zelda gegen neun und fahren zu unserer allerletzten Destination, einer Game Farm ausserhalb von Windhoek. Dort werden wir zweimal übernachten und von dort aus zum Flughafen fahren, wo wir am Samstagnachmittag um vier Uhr unsere Heimreise via Johannesburg antreten werden.
Ja, unsere letzte Fahrt auf dem Rücksitz im Land Rover. Zum letzten Mal profitieren wir von Evas kleinen Dienstleistungen: „Glas-Cleaning-Service“, damit Fahrer und Mitfahrer besser sehen. Dann kommt „Accounting“ dran. Sie schreibt in ihr Büchlein, wer wann was bezahlt hat, wie‘s jetzt aussieht mit dem „Kitty“, unserem gemeinsamen Portemonnaie, wer wieder Kohle nachliefern muss. – Ich werde das vermissen – den Brillen-Putz-Service jedenfalls. Und Eva und Ken sowieso, mit denen wir so viel Schönes und Lustiges erlebt haben. Eine weitere Reise wird folgen. – Vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr…
Wir machen einen kurzen Kaffeehalt in einem witzigen kleinen Shop zwecks Kauf von Biltong, alsdann passieren wir Gobabis, wo wir kurz anhalten zum Tanken.
Um eins erreichen wir die AUAS-Farm – sie liegt fast auf den Meter genau so hoch wie Bivio, an einem Ort, wo sich Fuchs und Hase, beziehungsweise Kudu und Gnu gute Nacht sagen. Wie man auf die Idee kommt, so weit im Nirgendwo eine luxuriöses Anlage dieser Art zu bauen, ist schwer zu begreifen. Es ist schön warm an der Sonne heute Nachmittag, aber relativ kühl im Schatten. In der Nacht wird es kalt werden, aber es hat zu meiner grossen Freude flauschig weiche Bettflaschen und einen Ofen im Zimmer mit genügend Holz, der von einem Angestellten eingefeuert werden wird.
Und in drei Tagen sind wir zu Hause, im Sommer – die kalten Nächte des afrikanischen Winters werden Geschichte sein.
Vom Liegestuhl aus hat man eine fantastische Aussicht aufs Wasserloch und über die Savanne auf die 56 km lange AUAS-Bergkette am Horizont, die höchste in Namibia (höchster Peak fast 2‘500 Meter hoch).
Zum Nachtessen gibt’s Gnu-Stroganoff mit Teigwaren und Gemüse. Überaus lecker – muss ich zugeben.
Freitag, 24. August 18
Ein äusserst feines Frühstück wird serviert. Und auch ein Impala namens „Boky“ und ein Straussenehepaar (Bonny and Clyde) kommen zur Lodge und wollen ihr Futter haben. Sie sind es gewohnt, das Frühstück gleichzeitig mit den Touris serviert zu bekommen. Mit vollem Magen ziehen sie weiter in den Busch. Die obligaten Perlhühner sind ebenfalls zur Stelle und rennen kreuz und quer in der Gegend herum, darauf bedacht, ebenfalls ein kleines Bisschen Etwas zu erhaschen.
Wie seit Wochen ist es schön, wolkenlos, und es wäre angenehm warm, wäre da nicht dieser penetrante Wind. Aber eben – Windhoek – auf Berndeutsch würden wir sagen: „Ä zügige Egge“.
Wie ich über Mittag im Liegestuhl liege, kommt Boky wieder, steht minutenlang boky-still und findet dann, sie könne sich doch auch hinlegen, das sehe doch super entspannt aus. – Gemütlich finde ich das: im Liegestuhl liegen, den achtzehnten Band McCall Smith am Lesen und eine Antilope (ohne Buch) keine fünf Meter entfernt von mir ebenfalls am Chillen.
Heute Nachmittag werde ich einen Game-Drive mitmachen, den letzten für einige Zeit. Theo macht lieber Siesta und Eva und Ken haben Massage gebucht.
Genau sieben Wochen waren wir unterwegs. Eine Strecke von ungefähr 5‘500 km haben wir zurückgelegt, an sechzehn verschiedenen Orten übernachtet.
Eva und Ken werden morgen sehr früh weiterreisen, heimwärts nach Cape Town – weitere knapp 2‘000 km. Theo und ich, wir werden erst kurz nach Mittag mit einem Shuttle zum Flugplatz fahren.
Kein Tag war wie der andere. – An jedem haben wir etwas anderes erlebt, neue Erfahrungen gemacht. – Und was für ein Glück: Gesundheitliche Probleme hatten wir keine, nur ein paar vernachlässigbare Schrammen, die bereits wieder verheilt sind; Theo hat uns also verschont mit weiteren Eskapaden.
Diese einmalige Reise werden wir niemals vergessen.
Wieder daheim - Samstag, 25. August 2018
Den heissen Sommer in der Schweiz haben wir verpasst, aber auch Ende August ist es noch immer Zeit, ein paar Mal in der Aare schwimmen zu gehen, bevor die Koffer für Spanien erneut gepackt werden müssen. Und nach diesen zwei „chilligen“ Wochen gibt’s anschliessend eine Lücke von acht Tagen, um umzupacken und uns auf die zweimonatige Endjahres-Reise vorzubereiten.
Miami – Südamerika – Bonita Springs 18. Oktober – 17. Dezember 2018
Miami 18. – 29. Oktober 2018
Wir waren ja schon im Sommer unterwegs, und das nicht zu knapp, aber wie gesagt, den Spätherbst in der Schweiz zu erleben, muss nicht sein, jedenfalls nicht, so lange wir noch gesund und „rüstig“ sind.
Der Anfang einer Reise ist immer aufregend – man hat noch so viel vor sich. Und nicht aller Anfang ist schwer. Überhaupt nicht - vor allem dann nicht, wenn die Koffer noch immer halb gepackt sind von der vorigen Reise, wenn Theo seinen Swisspass im Zug bei sich hat, wenn er zum ersten Mal in unserer Reisegeschichte keine Probleme hat bei der Security am Flughafen, seinen Handkoffer nicht öffnen, sein(e) Sackmesser nicht abgeben, sich keiner Leibesvisitation unterziehen muss und am Ende der vorläufigen Reise noch all sein Hab und Gut bei sich hat.
Natürlich ist man froh, wenn dieser nicht unbedingt angenehme Teil der Reise vorbei ist, das lange Warten am Flughafen und der fast zehnstündige Flug. Aber dann kann’s beginnen.
Die ersten zehn Tage in Miami sind bereits Geschichte. Es hat uns gefallen; wir haben einmal mehr von einem Haustausch profitieren können. Diana und Bill verbrachten bereits ein paar Tage im letzten Sommer bei uns in Bivio; nun bewohnten wir ihre Wohnung im sechsten Stock eines sogenannten Kondominiums, von denen es in Miami Beach zahllose gibt. Sie reihen sich nebeneinander an der Uferpromenade entlang und je nach Höhe werfen sie früher oder später am Nachmittag Schatten auf den Strand. Alle haben „ä fürnämi“ Lobby mit Concierge, und per Lift kommt man zu seinem Apartment, nachdem man durch unpersönliche, karge Gänge gewandelt ist, die an den Film „Shining“ erinnern. Die Gänsehaut in diesen langen Korridoren stammt aber ebenso von der Kälte, die im ganzen Gebäude herrscht – wie in einem Kühlschrank.
In der kleinen Wohnung finden wir aber alles, was man so braucht; sie ist gut ausgestattet und das Beste: Die Aussicht vom Balkon aus ist wunderschön; man sieht auf den breiten, meilenlangen Strand und aufs Meer mit seinen satten Farben und sanften Wellen. Wir sitzen gerne dort gegen Abend und schauen zu, wie’s dunkel und dunkler wird, wie der Mond sich zeigt; wir spielen mal Karten, essen feine Sachen, die wir zuvor im Publix eingekauft haben, schauen den Kreuzfahrtschiffen zu, die Richtung Bahamas ziehen und den Flugzeugen, die Kurs auf Europa eingeschlagen haben.
Manchmal essen wir auswärts. Es habe unzählige Restaurants gleich in nächster Nähe, hat uns Bill gesagt. – Mit denen ist es aber so eine Sache: Man sieht sie nicht und nirgends steht ein Schild am Strassenrand, so dass man sie finden könnte. Seltsam! – Ich kann nur anhand des Internets mit Tripadvisor ihre Adressen finden, die dann bei Google Maps eingeben und so machen wir uns schliesslich zu Fuss auf den Weg. Tatsächlich wurden wir in der näheren Umgebung nach einigem Suchen fündig. Diese Restaurants sind alle in diesen anonymen Kondominium-Komplexen untergebracht, versteckt besser gesagt, denn auch dort drin findet man sie schlecht. Wieso kein Schild vorhanden sei, fragten wir natürlich. Es sei verboten, erklärte man uns. – Die Amis und ihre seltsamen Gesetze – wenn da einer drauskommt?? – „It’s the law“ – so steht es an vielen Orten, wo man per Schild darauf hingewiesen wird, was man tun muss oder ja nicht tun darf. Das lässt keinerlei Fragen offen. Wenn dann noch Bussen angedroht werden bei Widerhandlung – da lässt man seine „kriminellen Absichten“ lieber bleiben. Seine Knarre hingegen kann man ja bei Walmart und Co. kaufen. Das ist nicht verboten.
Speziell ist auch, dass diese Restaurants zum Teil als Beach Bar bezeichnet werden. Am ersten Tag versuchten wir naiverweise bei einem Strandspaziergang ein solches Chiringuito aufzusuchen, aber da konnten wir lange suchen. Der Zugang vom Strand ist nicht möglich; man sieht sie ja auch gar nicht, weil sie eben bestens in den Gedärmen der Hochhäuser versteckt sind.
Weiter südlich in South Beach ist das ganz anders. Da pulsiert das Leben, ein Restaurant reiht sich ans andere, die Häuser in ihrem wunderbaren Art Deco–Stil sind eine Freude anzusehen.
Sehr viel haben wir nicht unternommen in den zehn Tagen, wo wir dort waren. Oft verbrachten wir die Nachmittage am Strand, wo der Wind manchmal so stark blies, dass es zwecklos war, den Sonnenschirm zu öffnen, aber immer war es heiss und das Wasser schätzte ich auf mindestens etwa 25 Grad.
Einmal machten wir ein kleines Reisli auf die Keys, aber nicht bis nach Key West hinunter, nur grad bis Islamorada.
Ein feines Mittagessen hatten wir im „Marker 88“. Dieses Restaurant wurde uns von Liza und Urs Lindenmann empfohlen. Schön war’s, in einer Strand-Schaukel bedient zu werden, die Füsse im Sand, den Blick aufs Meer und die Bootsstege. In einem kleinen Motel am Strand ganz in der Nähe blieben wir über Nacht.
Vorerst aber zeigte sich uns ein märchenhaft schöner Sonnenuntergang der unser Apéro und Abendessen begleitete. Die Kamera konnte die Farben leider nicht entsprechend wiedergeben.
Auf der Heimfahrt am nächsten Tag sahen wir uns in Miami Downtown die „Wynwood Walls“ an, eine Ausstellung mit Strassenkunst. Ähnlich wie in Shoreditch, in London, wo Kim wohnt, ist auch das ganze Quartier mit Graffitis und Wandmalereien vollbemalt. – Mir gefällt das. Viele dieser Maler sind grossartige Künstler. Schmierereien sind zum Glück selten. Ein anderer Ausflug brachte uns nördlich bis fast nach Boca Raton, wohin Javis Schwester und Kims Schwägerin Natalia mit ihrer sechsköpfigen Familie vor zwei Monaten übersiedelt sind. Sie sind von Seattle dorthin gezogen, wo es ihnen nun besser gefällt. Sie wohnen in einer neuen Einfamilienhaus-Überbauung am Rande der Everglades.
Schon in der Gegend, buchten wir auf dem Heimweg eine einstündige Everglades-Adventure-Bootsfahrt. Die Landschaft ist herrlich, aber die Boote, die durch dieses Grasland speeden, eher weniger. - Wie anders war das vor zwei Monaten, als wir in Botswana im Okavango-Delta waren. Ich musste unweigerlich an die ruhige, idyllische Kanufahrt dort denken, wo man nur das Eintauchen der langen Stangen, mit denen unsere Boys uns durchs seichte Gewässer führten, das sanfte Gleiten des Bootes durchs Wasser und Vogellaute hörte.
Hier aber geht’s laut und amerikanisch zu: In einer Touristengruppe kommt man sich immer ein wenig vor wie im Kindergarten. Der „Kapitän“ reisst seine Sprüche (seit 50 Jahren, so erklärte er uns, mache er diesen Job, auch an den Wochenenden, ohne je Ferien gemacht zu haben), stellt Fragen, die keiner so richtig beantworten kann und mit seiner Antwort ist er dann der King. Wie öd muss es sein, tagtäglich dasselbe zu erzählen und auf dieselben Lacher zu warten. – Dann kommt, was kommen muss: „Would you guys like to go speeding?“ – Natürlich rufen die Passagiere wie aus einem Munde: „ Yeah!!!“. Lauter will er es, also nochmals. Wir Schweizer sind halt im Allgemeinen ein wenig zurückhaltender und brüllen nicht mit. Ich vermute, es fehlt uns an Temperament. Hätte ich „no“ gerufen, wär ich wohl nicht besonders gut angekommen, falls man mich überhaupt gehört hätte. – Und ab geht die Post. Das Boot braust durch die Flusslandschaft, durch den grünen Teppich der Wasserpflanzen hindurch mit riesiger Geschwindigkeit. Und dazu dröhnt der Motor, so dass wir uns die Ohren zuhalten müssen.
Andere Boote sausen und lärmen ebenso. Manchmal bleibt eines stehen, weil der Kapitän einen Alligator gesichtet hat. Dorthin gleitet unser Boot dann auch, damit wir alle den „Gator“ sehen und fotografieren können. – Nach einer Stunde sind wir zurück und erhalten noch eine Alligator-Show vorgeführt, die im Preis inbegriffen ist sowie auch das fürchterliche Foto, das man von uns beim Einsteigen ins Boot gemacht hat – etwas fürs „Familien-Grusel-Album“.
Die Show hat mir allerdings gefallen, vielleicht weil der junge Typ sehr attraktiv aussah, seine Sprüche und sein Humor Niveau hatten und gut ankamen und die Art und Weise, wie er mit den grossen Echsen umging, schon beachtlich war. 40 Zähne im Oberkiefer und 40 unten sollten ja genügen, um mal mindestens einen Finger oder zwei oder eine ganze Hand abzubeissen. Das geschieht allerdings nicht. Der Tierbändiger geht unversehrt aus der Show heraus. - Wie gern diese Tiere allerdings den ganzen Zirkus mitmachen, ist fraglich. Sie schienen mir sehr lethargisch.
Unser Flug nach Buenos Aires dann war am frühen Abend des 29. Oktober geplant. Wir fahren früh genug los, um rechtzeitig am Flughafen zu sein. Schon als wir letztes Mal in Miami waren, hatten wir die grösste Mühe, die richtige Einfahrt zum Mietwagen-Verleih zu finden. Davor graut mir auch diesmal. Ebenso vor dem vielen Verkehr, der pausenlos auf den mehrspurigen Highways kursiert, die spaghettiartig in und um die ganze Stadt und den Flughafen geschwungen sind, und den Staus, die’s nicht selten gibt. Es wird immer aggressiver gefahren, so habe ich den Eindruck. Schon bei der Fahrt gegen Fort Lauderdale kamen wir an einen Unfall vorbei, wo ein Auto am Rand der Autobahn auf dem Dach lag. Dies war grad eben geschehen, Polizei und Feuerwehr erst angekommen. Auf dem Rückweg eine lange Auffahrtskollision, Krankenwagen und Co. - alle bereits vor Ort – Sirenengeheul - eine Riesensache.
Nun, am Anfang geht alles recht gut und flüssig, dann gibt’s den ersten Stau. Aber wir haben ja genügend Zeit eingeplant. Theo mit dem Navi in der Hand weist die Route, ich fahre und muss aufpassen wie ein Häftlimacher, nicht etwa auf eine der Toll-Roads zu geraten, denn wir haben keinen Transponder und die Bussen für wiederrechtliches Fahren auf einer dieser Mautstrassen sind beachtlich (it’s the law). Bei der Autovermietung (Dollar) hätten wir uns für 10 Dollar pro Tag dagegen versichern können, aber das ist eindeutig das Geld herausgeschmissen. Bei anderen Anbietern zahlt man nur die Hälfte, was immer noch viel ist, finde ich. Im Vergleich zu unserer Schweizer 40ig-fränkigen Vignette, die ein ganzes Jahr lang gültig ist…
Nach nur einmaligem Falschfahren, was fast eine Viertelstunde gekostet hat, gelangen wir endlich in die Nähe des Flughafens. Jetzt heisst es tanken. Tankstellen hat es genug in der Nähe, wir finden eine, bei der die Tanksäule nicht funktioniert. Bis das klar ist, vergehen ein paar lange Minuten. Und weiter sitze ich eine gefühlte halbe Stunde im Auto bei der Hitze, während Theo ich weiss nicht was alles mit dem Tankwart besprechen muss. Irgendein Problem gibt’s mit der Kreditkarte. Allmählich wird die Zeit knapp.
Noch fünf Kilometer bis zum Flughafen. Die Navi-Dame sagt, wir müssen rechts abbiegen. Diese Strasse ist aber gesperrt, wir fahren geradeaus. Sie denkt wohl, wir hätten nicht gut zugehört und will uns wieder dorthin zurückführen. Das sind die Sternstunden des Autofahrens mit dem Navi. Jetzt wird’s chaotisch. Hören wir auf sie, kommt’s nicht gut, höre ich auf Theo…
Ein Schild weist in Richtung Mietauto-Center. Diese Strasse nehme ich, allerdings fehlen dann weiterhin die Hinweisschilder (oder wir übersehen eines), also fahre ich wieder falsch und finde die Einfahrt nicht. So geht’s rund um den Flughafen herum, an all den Terminals, Taxis und Bussen vorbei; es ist zum Verzweifeln. – Wir sind wieder am Anfang und gliedern uns erneut in den Verkehr ein. Wieder finden wir uns auf einer Autobahn, wieder steht Toll-Road, die Strasse führt vom Flugplatz weg. Es ist ein riesiges Labyrinth. Ich nehm‘ die nächste Ausfahrt. Nach rechts ist’s wohl richtig, angeschrieben steht nichts. Jedenfalls kann ich grad noch vor einer Barriere anhalten, die auf einen Langzeit-Parkplatz führt. Theo steigt aus, um den Parkwärter um Rat zu fragen. Das funktioniert dann ENDlich. Er erklärt, wo’s lang geht. Auf dieser Strasse waren wir noch nicht, die ist ganz neu. Selten hab ich mich so über ein Strassen-Schild gefreut. Darauf steht: „Car Rental Center“. Dort geht’s dann rasch, das Auto können wir hinstellen, das Gepäck ausladen und die lange Reise bis zum Check-in mit Zug und ellenlangen Moving Walkways (Personenförderband auf Deutsch – was für ein Wort…) antreten. Erstaunlicherweise hat es wenige Passagiere, so dass uns die verbleibende Zeit bestens reicht, um alles Nötige zu erledigen, einzuchecken, die Koffer abzugeben (wir hätten problemlos je zwei Gepäckstücke à 23 kg abgeben und 10 kg als Handgepäck mitnehmen können) und die Security hinter uns zu bringen.
Wir kommen im Dezember wieder nach Miami. Ich freue mich jetzt schon auf das fröhliche Um-den-Flughafen-Kreisen…
Argentinien 1 30. Oktober – 9. November 2018
Córdoba / Villa Carlos Paz / La Cubrecita / Villa General Belgrano
Mitten in der Nacht kommen wir in Buenos Aires an. Der Blick aus dem Flugzeug auf das endlose Lichtermeer ist grandios. Nach Erledigung der Zoll- und Einreiseformalitäten, einem Terminalwechsel und zweieinhalb Stunden Aufenthalt besteigen wir das Flugzeug nach Córdoba. Es regnet - der erste Regen seit Wochen. Wie wir nach einem anderthalbstündigen Flug aussteigen, hat sich das Wetter beruhigt und die Temperatur ist angenehm warm, wenig über zwanzig Grad.
Unser zweiter Haustausch findet in Villa Carlos Paz statt, einem kleinen Städtchen, etwa fünfzig Kilometer westlich von Córdoba. Der Ort hat mit der Agglomeration ungefähr 80‘000 Einwohner und ist beliebt bei Touristen, aber wie wir bald feststellen eher bei einheimischen Touristen und Wochenendbesuchern aus Córdoba. Ich glaube nicht, dass diese Destination in einem europäischen, asiatischen oder amerikanischen Reisebüro angeboten wird. Obwohl – die Stadt ist hübsch gelegen am Rande einer Sierra und an einem stattlichen See, dem Lago San Roque, in dem man aber nicht baden kann, weil er kontaminiert ist.
Wieder haben wir ein Auto gemietet. Eigentlich hätten wir nach einer Stunde Fahrt dort ankommen sollen, aber ich glaub’s ja nicht: Jetzt geht die chaotische Fahrerei von neuem los.
Das Navi ist eingestellt, die Dame, wir nennen sie Rösi, ist parat und will uns in ihrer kühlen, unaufdringlichen und unpersönlichen Art den Weg zu unserem Ziel weisen. Aber das ist nicht so einfach, weil die Ringstrasse um Córdoba (ca. 1,5 Millionen Einwohner) herum auf Dutzenden von Kilometern eine einzige Baustelle ist. Wie wir später erfahren, waren zwei Bauphasen geplant. Die erste fand nicht statt, und nun werden beide gleichzeitig ausgeführt in und um die Stadt. – Dort also, wo Rösi hinwill, ist die Strasse entweder gesperrt oder überhaupt nicht mehr vorhanden. Man wird über Schotterpisten geleitet, manchmal nur einspurige, und die Hinweisschilder sind karg. Wir stellen Rösi ab, sie bleibt zwar cool, macht uns aber völlig konfus. Gefahren wird wie im Wilden Westen - dort wurde zwar eher geritten, wenn ich mir’s richtig überlege. - Rechts und links wird vorgefahren und die einzige Überlebenschance ist es, mitzuhalten und auch auf die Tube zu drücken. Das heisst, all die vielen Tempolimiten-Schilder, 40 und manchmal nur 30, gilt es geflissentlich zu übersehen und mit dem Strom zu fliessen, also mit möglichst 80 km durch die Gegend zu preschen, sonst wird man von Lastwagen überholt und so erst recht zum Verkehrshindernis. Daher passiert es uns auch hier mehr als einmal, dass wir ein Schild, auf dem Carlos Paz steht, zu spät sehen und ergo einmal mehr im Kreis herumfahren. Mein Orientierungssinn ist normalerweise recht gut, aber hier versagt er völlig. Es nervt gewaltig, wenn man wieder am selben Rotlicht anhält, an dem man eine Viertelstunde vorher bereits auf Grün gewartet hat.
Nach langer Irrfahrt sind wir endlich aus dem Gröbsten raus. Rösi darf wieder mitreden - wir sind auf dem rechten Weg. Wenn man endlich den Baustellenbereich verlassen hat, gibt’s nur eine direkte Strecke nach Carlos Paz, nämlich über eine gebührenpflichtige Autobahn. Aber kurz vor der Zahlstelle heisst es: rechts abbiegen. Fromm wie ein Lamm folge ich Rösis Anweisungen. - Zu spät kommt mir in den Sinn, dass ich dummerweise vergessen habe, im Navi auf meinem Smartphone die Mautstrassensperre aufzuheben, die ich vorher in Florida aktiviert hatte. – Auch das noch; ich könnte mich ohrfeigen. Wir geraten in eine militärische Sperrzone, müssen wenden und wieder in Richtung Baustellen zurückfahren, bis wir endlich auf der richtigen Strecke sind. – Völlig dumm gelaufen!
Aber damit nicht genug: Jetzt kommt das nächste Problem: Wir haben noch gar keine Pesos gewechselt. Wir hoffen, mit der Kreditkarte zahlen zu können. Geht nicht! - Zum grossen Glück aber wird der 1$-Schein akzeptiert, den ich im Hosensack habe; ich erhalte 2 Pesos zurück (etwa 5 Rappen); so geht die seltsame Reise weiter.
Zum dritten Mal innerhalb der letzten 24 Stunden fahren wir im Kreis herum im Quartier, wo das Haus, in dem wir die nächsten sechs Tage lang wohnen werden, zu finden sein muss. Rösi kommt selber nicht mehr draus, ist völlig verwirrt, will uns durch gesperrte Strassen locken, schickt uns steile Hänge hinunter, die noch nie etwas von Asphalt gehört haben und wo man, unten angelangt, kaum mehr wenden kann – es macht keinen Spass. Mit Hilfe der Google Offlinekarten schaffen wir das Kunststück schliesslich doch und erreichen Donatello 102 (Kein Wunder, gestaltete sich die Suche so tückisch: das Haus gegenüber hat eine völlig andere Adresse und Hausnummer). Eine halbe Stunde müssen wir warten, bis Sonia kommt und uns einlässt. Ihr Sohn, der auf uns gewartet hat, musste gehen, er hat viel früher mit uns gerechnet. Wir warten im Auto, das ist im Moment besser, denn es beginnt gerade in Strömen zu regnen und dann auch noch gleich zu hageln. Mir ist es „Wurst“, ich bin einfach froh, dass wir angekommen sind.
Die Tage in Villa Carlos Paz vergehen rasch. Das Wetter ist launisch. Manchmal regnet’s, dann wieder hat’s starken Wind, der die Wolken dann jedoch vertreibt und gleich darauf wird es ziemlich heiss.
An einem Tag erkunden wir das hübsche Tal, durch das der Rio San Antonio fliesst, ein Zufluss zum Lago San Roque. Man kann es sich am Ufer bequem machen, nur an wenigen Stellen ist das Wasser allerdings tief genug, so dass man sich zumindest liegenderweise ein wenig abkühlen kann.
Zu „unserem“ Haus gehört ein Swimmingpool. Den benutzen wir manchmal auch, aber die Idee, so nah an einem schönen See zu wohnen und nicht darin baden zu können, ist für mich fast unfassbar.
An unserem dritten Tag machen wir einen Ausflug nach Córdoba, obwohl mir die Fahrerei dorthin ein wenig zuwider ist. Aber die Hinfahrt lässt sich gut an, die Baustellen in dieser Richtung sind besser beschildert, und so dauert es nur grad eine Stunde bis ins Zentrum. Ein Parkhaus in bester Lage finden wir auch gleich.
Als Erstes müssen wir jetzt Geld wechseln. Theo findet einen Coiffeur, lässt sich die Haare schneiden und ich versuch mein Glück bei der Bank. In der ersten geb‘ ich sofort auf, wie ich sehe, dass dort so viele Menschen herumsitzen und Schlange stehen, dass es wohl Stunden dauern würde, bis die Reihe an mir ist. In der zweiten erklärt mir ein Polizist, ich könne hier so oder so kein Geld wechseln, die Banken würden nur Dollars von Einheimischen akzeptieren. Aber er gibt mir den Tipp mit den öffentlichen Geldwechselbüros. Davon gibt es zwei in nächster Nähe. Und das klappt dann endlich. Wie mühsam ist es, sich in einem Land ohne die entsprechende Art Cash zu bewegen. In Villa Carlos Paz haben wir natürlich auch versucht zu wechseln, aber dort fanden wir nur Geldautomaten, keine Wechselstuben, und die meisten von denen wechseln nur für einen Betrag von umgerechnet höchstens 50 Franken. Versuchte ich 300 Dollar einzutippen, haben mich die Geräte grad ausgelacht, so zumindest kam es mir vor, und sogleich meine Karte höhnisch wieder ausgespuckt. Ich hab dann trotzdem einen Kasten gefunden, der ein wenig grosszügiger war, was die Ausgabe betrifft, so dass das höchste der Gefühle war, 3000 Pesos (ca. 100 CHF) beziehen zu können. Eigentlich hätte dieser Betrag an jenem Tag tatsächlich einen Wert von etwa 80 Franken gehabt, aber bezahlen musste ich dafür 100 Franken, wie ich bei der Kontrolle meines Kontos am Abend feststellte. 20 % Kommission und Gebühren – das ist ja kompletter Wucher!
Für zwei 100-$-Noten erhalten wir schliesslich eine riesige Beige schmutziger 20-Pesos-Scheine zu einem angemessenen Wechselkurs und sind froh, dass wir endlich Kleingeld haben.
Wir schlendern durch die Strassen, sehen uns die alten Bauten der Jesuiten an, die Kathedrale, die Uni (eine der ältesten und grössten in Lateinamerika) und etliche andere Gebäude, die unter UNESCO Welterbe stehen. Die Stadt ist sehr belebt, hat einen ähnlichen Charakter wie die meisten südamerikanischen Städte, die wir bisher besucht haben - mit dem zentralen Platz im Kern, der Plaza de Armas oder dem Zócalo, um die oder den herum sich die Hauptkirche und die meisten der historischen Gebäude gruppieren.
Viele der Fussgängerzonen sind hübsch angelegt, die Läden allerdings nicht besonders vielfältig und einladend. Wieder und wieder trifft man auf dieselben Schuh- und Kleiderläden, das Angebot ist eher langweilig, die Qualität „nothing to write home about“. – Gerne hätte ich irgendwelche handwerklichen Artikel gekauft oder zumindest angeschaut, aber der Handwerkermarkt findet nur an den Wochenenden statt und Läden dieser Art haben wir keine gefunden. Wie immer bei einer Stadtbesichtigung legt man fast unbemerkt viele Kilometer zu Fuss zurück, so auch hier; wir kehren mehr als einmal ein und nehmen anschliessend gegen fünf den Weg zurück nach Carlos Paz unter die Räder, Theo mit einer neuen „Frise“ und ich mit leeren Einkaufstüten. Es ist Hauptverkehrszeit und mir schwant schon Fürchterliches.
Rösi gibt ihr Bestes, weist uns rechts und links und wieder rechts und wieder links und nach einer Stunde chaotischer Odyssee sind wir endlich am Stadtrand angelangt. Durch den Baustellengürtel werden wir diesmal besser geschleust; wir erreichen die Mautstelle, die Autobahn und sind nach insgesamt zwei Stunden Fahrtzeit um sieben Uhr zurück in Carlos Paz.
Auch dort hat’s natürlich ein Stadtzentrum, ohne Plaza de Armas allerdings, der Ort wurde erst im Jahr 1914 gegründet. Aber es gibt eine Ladenstrasse, wo ziemlich viel läuft, jedenfalls gegen Abend. Vor allem junge Leute sind unterwegs. Am oberen Ende dieser Avenida steht auf einem kleinen Platz eine grosse Kuckucksuhr. Echt jetzt? - Oh je, wie kitschig. Sagenhaft!
Die Läden geben leider auch nicht viel her, ich wüsste nicht, was ich wo kaufen möchte. Ebenso wenig laden die vereinzelten Restaurants in dieser Gegend zum Verbleiben ein. – Was mich allerdings beeindruckt hat: Wenn man mit Leuten ins Gespräch kommt, merkt man sogleich: Alle lieben diesen Ort!
Eine andere Sehenswürdigkeit ist die Puente Uruguay, eine Brücke über den südlichen Teil des Sees. In der Nacht wird sie illuminiert – abwechslungsweise lila, türkis, hellblau, weiss und pink. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, muss ich zugeben.
Von der Uferpromenade aus kann man dieses „Spektakel“ sehr schön beobachten. Jener Teil der Stadt hat mir am besten gefallen. Man kann gemütlich spazieren und es hat etliche Restaurants, die schön gelegen sind, hübsch eingerichtet und feine Speisen servieren. Fleisch, Fleisch und nochmals Fleisch muss es ja sein in Argentinien. Mit der echten Parillada jedoch können wir uns leider nicht besonders anfreunden, denn sie besteht aus vielen Fleischstücken, die ich eher als Schlachtabfälle bezeichnen würde, so dass mir schon vom Anblick schlecht wird. Blutwürste, Magenwände, Eingeweide liegen auf dem Grill - da sind mir die köstlichen Empanadas Criollas doch viel lieber, auch das Provolone (eine Art Raclette vom Grill mit Tomatenscheiben drauf). – Qualitativ bessere Fleischstücke kann man natürlich auch bestellen. Sie sind schmackhaft, aber oft mit relativ viel Fett versetzt. Die richtig guten und zarten Stücke, so haben wir gelesen und auch gehört, sind für den Export bestimmt…
Der Wein ist ein anderes Thema. Wir lieben ja den Malbec, und Argentinien produziert bekanntlich eine Unmenge davon. Auch die Preise machen Freude. Für sechs bis zehn Franken findet man in der Regel eine grosse Auswahl an Rot- und Weissweinen auf der Speisekarte.
Wie ich bei unserem ersten Abendessen in diesem Land den Kellner frage, welchen er empfehlen würde, bringt er uns einen besonders guten, der nicht auf der Karte aufgeführt ist. Natürlich hat er sofort bemerkt, dass wir Ausländer sind und vielleicht auch einen teureren Tropfen bezahlen können. - Ja, das können wir verantworten. Die zwanzig Franken lohnen sich…
Ein anderes Weinerlebnis haben wir in einem japanischen Restaurant, wo wir zur Abwechslung statt Carne mal Sushi essen gehen. Wir haben beschlossen, diesmal vernünftigerweise nicht eine ganze Flasche Wein zu bestellen, sondern nur je ein Glas (in einem solchen seltenen Fall bestellt sich Theo zuvor ein Bier, damit nicht etwa Entzugserscheinungen auftreten); ich muss ja dann auch immer noch die zehn Kilometer heimfahren in die Calle Donatello 102.
Die Kellnerin öffnet die Flasche und schenkt in die beiden grossen Copas ein - mehr und mehr (nicht wie daheim…). Ich wundere mich schon über ihre Grosszügigkeit. Sie dann plötzlich auch, wie sie merkt, dass nur noch knapp ein Deziliter Wein in der Flasche zurückbleibt. Diese „Fast-Flasche“ fungiert auf der Rechnung mit knapp fünf Franken.
Übrigens waren wir die einzigen Gäste in dem Lokal, weil wir bereits um halb neun auf der Matte standen. Zu dieser frühen Stunde geht ja niemand zum Abendessen - ausser Touristen mit ihren seltsamen Essensgewohnheiten. – Einen Vorteil hat das aber trotzdem: Man hat die ganze Kellnerschar und Küchencrew für sich alleine. Volle Aufmerksamkeit und bester Service!
Zweimal essen wir zu Hause. Das Stück Fleisch, ein Quadril, vom Metzger empfohlen, reicht für zwei Mahlzeiten. Es ist schön zart, wiegt mehr als ein Pfund und hat vier Franken gekostet.
An unserem letzten Abend in Carlos Paz laden uns Sonia und Carlos zum Essen auswärts ein. Sie wohnen in Córdoba, scheuen den Weg zu uns nicht, tun sich offenbar auch mit dem Baustellengewirr nicht schwer und holen uns ab. Neun Uhr abends ist es, noch etwas früh fürs Nachtessen, aber bis wir am Sonntagabend ein passendes Restaurant gefunden haben, ist es halb zehn geworden. Es wird ein gemütlicher Abend und wir freuen uns natürlich, unsere HomeExchange-Tauschpartner nun auch persönlich kennenzulernen. Die beiden sind ein liebenswürdiges Ehepaar, seit dreissig Jahren verheiratet und haben drei erwachsene Kinder.
Mit Carlos habe ich unseren Tausch per Email organisiert, jetzt sehen wir uns also zum ersten Mal. Er ist Bauingenieur und arbeitet momentan in Iguazu (Umbau des Hotels Melia). Wir fliegen im Dezember dorthin und werden ihn erneut treffen.
Das ist eine der vielen absolut fantastischen Seiten unserer Haustausche: Man lernt Einheimische kennen und erfährt von ihnen viel über Land und Leute, Gebräuche und den Alltag. Mit manchen unserer Tauschpartner sind wir nach wie vor im Kontakt und es sind sogar Freundschaften entstanden. Einige von ihnen haben wir mehr als einmal getroffen; mit Eva und Ken beispielsweise waren wir im Sommer auf einer siebenwöchigen Safari im südlichen Afrika.
Da wir nicht nur Städte und Strände erleben, sondern auch ein kleines Bisschen vom Landesinnern sehen wollen, habe ich uns eine kurze, viertägige Rundreise zusammengestellt, die am 9. November in Córdoba endet, von wo aus wir nach Uruguay fliegen werden, nach Punta del Este.
Im Internet habe ich recherchiert und fand im Norden von Córdoba das Mar Chiquita (ist auf die Fläche bezogen der grösste See Argentiniens und der zweitgrösste See Südamerikas nach dem Titicaca-See. Er ist zudem der fünftgrösste abflusslose See der Welt. Sein Wasser ist salzhaltig).
Dorthin sollte unsere Reise führen und Hotels hatte ich bereits gebucht. Als ich Carlos meine Pläne mitteilte, meinte er, wir sollten eher einen Ausflug nach Süden in die Berge unternehmen, in die Gebiete der Schweizer- und der deutschen Siedler, das sei sehr viel interessanter und schöner. – Seinem Rat folgend hab ich umgebucht. Mich nahm ja auch wunder, wie die europäischen Auswanderer dort leben, wie’s aussieht und was daraus geworden ist. – Ja, und da haben wir nun eine Nase voll davon gekriegt. In der Gegend des Mar Chiquito hätten wir während dieser Tage schönes, warmes Wetter angetroffen, bei uns im Süden hingegen, in Calamuchita und in der Sierra, hatten wir es mehr mit Regen und Nebel zu tun und mit Temperaturen von nur knapp zwanzig Grad. – Ganz kurz nur zeigte sich die Sonne am blauen Himmel, dann verleidete es ihr. Vom Wetter her hätten wir gerade so gut daheim bleiben können, aber eine lustige Erfahrung war unsere „Exkursion“ trotzdem.
Die Fahrt nach La Cumbrecita (vor allem Schweizer Auswanderer haben sich dort niedergelassen) sollte gemäss Google etwa zweieinhalb Stunden dauern. Sie führt durch die Sierras de Córdoba und auf halber Strecke etwa befindet sich ein Ort namens San Clemente. Dort, hatte ich vorgeschlagen, könnten wir einen Halt machen und einen Cappuccino trinken. Kaum haben wir Carlos Paz und seine Vororte verlassen, steigt die Strasse an, es geht bergauf, man ist urplötzlich ganz alleine unterwegs und fährt durch schönes, wildes und völlig unbewohntes Gebiet.
Weit über die Hügelketten hinaus blickt man auf eine grüne, liebliche Landschaft. Wir staunen über die gut ausgebaute Strasse, die durch diese menschenleere Gegend führt. Unser Navi wollte uns unbedingt eine andere Strecke aufschwatzen, Google beim ersten Versuch ebenfalls – ich vermute, dass diese Landstrasse völlig neu gebaut wurde und auf den Karten noch nicht verzeichnet ist. Natürlich haben wir uns zuvor über den Zustand der Route erkundigt, denn unbefestigte Strassen will ich unserem kleinen Mietauto nicht zumuten. – Nur an einem Ort, kurz vor San Clemente, denke ich, nun ist’s so weit, es gibt nichts anderes, wir müssen umkehren und den ganzen Weg zurückfahren. Da schlängelt sich die Strassen steil zu einem Fluss, dem Rio San José hinunter, und die Brücke, die darüber führt, steht völlig unter Wasser. Verschiedene Schilder warnen am Strassenrand: „Atencion! – Vado profundo peligro!“ Daneben, ziemlich erhöht, sind mehrere Arbeiter dabei, eine neue Brücke zu bauen. Ich halte an, kurble (ja, das Auto ist noch mit der guten alten Handkurbel ausgestattet) das Fenster herunter und rufe den Männern zu, ob man durch die Fluten durchkomme. Ja, meinen sie, erst mehr rechts fahren, dann eher nach links; so sollte es gehen. Ich kann’s mir nicht vorstellen, habe in Sekundenschnelle Visionen vom steckengebliebenen oder gar weggeschwemmten kleinen Ford, der mitsamt uns und unserem Gepäck in die Tiefe saust. Theo ist da zuversichtlicher und die Arbeiter schauen jetzt ja alle zu („Frau am Steuer“ steht auf ihren Gesichtern geschrieben)… Ich nehme also all meinen Mut zusammen und fahre im ersten Gang durch die reissenden Fluten. - Ok, ok, so kommt’s mir jedenfalls vor, in Wirklichkeit war’s wohl nicht ganz so dramatisch, denn wir kommen heil und ganz auf der anderen Seite an und fahren ungeschoren den Hügel hinauf. Eine Kaffeepause hätten wir nun verdient, aber daraus wird nichts. Die Siedlung San Clemente hat gar keinen richtigen Dorfkern, besteht nur aus einer Reihe von alleinstehenden Häusern, an den meisten von denen zudem ein Plakat angebracht ist, auf dem VENDO steht. Kein Wunder – wer will schon in einem so abgelegenen Kaff wohnen?! Irgendwo stehen zwei gesattelte Pferde herum und einen Mini-Supermarkt gibt’s auch. Dort erkundigen wir uns, ob man irgendwo Kaffee haben könne. Der Mann lacht und sagt, es gäbe wohl ein Restaurant, das sei aber nur am Wochenende offen. Erst in vierzig Kilometern befinde sich die nächste Gaststätte. – Was will man da machen? – Weiterfahren natürlich. In Rearte angekommen, finden wir sogar auf Anhieb die Touristeninformation. Diese aufzuspüren war allerdings nicht schwer, ist das kleine Dorf doch kaum mehr als 500 Meter lang. Die junge Frau gibt uns Auskunft, wo wir ein Restaurant finden würden, das am Montag offen hat - nur eines, alle anderen seien geschlossen und im ehemaligen (historischen) Krämerladen, der Pulpería, einzukehren, käme sowieso nicht in Frage, da würden nur Männer verkehren… Aber den Tio Edmundo fänden wir direkt ausserhalb der Altstadt (etwa zwanzig Häuser aus dem Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts rechts und links der einzigen Strasse, die durch den alten Dorfteil führt). Wir kehren ein. Wohl wären wir nie dort „gelandet“, hätten die anderen Lokale offen gehabt. Aber wir haben den (erzwungenen) Entscheid nicht bereut. Der witzige Besitzer, eben der Tio Edmundo, begrüsst uns mit der Frage, ob wir reserviert hätten. Das Lokal ist absolut leer nota bene. Und so fährt er weiter mit seinen Spässen. Er kommt an unseren Tisch, kniet sich neben uns nieder wie ein untertäniger Diener und beschreibt, was er zum Essen anbieten könne. Ich frage ihn, ob diese Stellung bequem sei oder ob er nicht lieber einen Stuhl nehmen wolle. Er erklärt daraufhin, dass, so lange er auch wieder aufstehen könne, seine Knie noch in Ordnung seien, er also noch nicht alt und gebrechlich sei. – Ich denke an meine bevorstehende Knieoperation…
Tatsächlich kommen bald noch andere Gäste in die gute Stube, die durchs gleiche Prozedere durchmüssen. Für die hat er sich zusätzlich etwas Spezielles einfallen lassen: Er zieht sich eine pinkfarbene Perücke über, während er ihre Bestellungen aufnimmt – ein richtig lustiger Onkel! - Wir teilen uns einen Teller Noquís. Das sind hausgemachte Gnocchi an einer feinen Sauce. Brot und Leberwurst gibt’s vorher gratis.
Auf dem kurzen Spaziergang zurück zum Auto sehen wir, dass in einem der Häuser die Erziehungsdirektion untergebracht ist. – Ein Minihaus und ganz in Gelb. Einstöckig. Das finde ich richtig cool. Verglichen mit derjenigen in Bern…
Wir fahren weiter nach La Cumbrecita. Der Ort befindet sich auf 1400 Metern über Meer, liegt in einem Talkessel, umgeben von Hügeln und einer lieblichen Landschaft mit Tannen und Fichten, ähnlich wie in der Schweiz oder in Bayern. Das Hotel, das ich gewählt habe, ist am Hang gelegen mit schönem Blick über die Gegend. – Bis man aber oben ist… Der steile und enge Weg dorthin führt über eine katastrophale, steinige Strasse, die gespickt ist mit tiefen Löchern oder besser gesagt Spalten und Furchen, und weil es geregnet hat, ist sie zudem noch glitschig. Mit unserem kleinen Ford Ka gelingt es mir in dieser Situation problemlos, den Motor abzumurksen. Wie es eigentlich nicht seine Eigenart ist, kommentiert Theo augenblicklich meine Fahrweise (without missing a beat), ich nerve mich und es passiert gleich wieder. – Klar steige ich aus und lasse ihn ans Steuer. – Und er schafft‘s natürlich auf Anhieb…
Leider zeigt sich das Wetter nicht von der besten Seite, es regnet leicht und Nebel ist ebenfalls ein Thema.
Nur etwa zwanzig Minuten lang zeigt sich die Sonne; es reicht grad zu einem kurzen Spaziergang in der Hotelanlage und zu ein paar einschlägigen Fotos, dann zieht der Nebel über die Hügel hinunter und das Dorf ist nicht mehr zu sehen.
Wir nehmen’s aber gemütlich. Es gefällt uns sehr hier, von unserem grossen, behaglichen Zimmer im Châlet-Stil aus geniessen wir die Aussicht trotzdem, man kommt sich vor wie in einem Wolkenpalast; wir spielen Karten, lesen ein wenig und gehen dann um halb neun zum Nachtessen. Theo bestellt Spätzle mit Hirschgoulasch, ich entscheide mich für eine Forelle, die ihr kurzes Leben in einem der nahegelegenen Seen gefristet hat, um sich schliesslich auf meinem Teller wiederzufinden (diese Wendung ist wohl ein bisschen daneben, ich denke ja nicht, dass ihrerseits Absicht dahinter steckte).
Um fünf Uhr früh wecken uns die Vögel, die fröhlich ihr Frühlingsgezwitscher vom Stapel lassen. Ein Fuchs schleicht ums Haus. Der Nebel hat sich nicht verzogen; wir schlafen weiter.
Nach dem Frühstück checken wir aus und besichtigen den verkehrsfreien Ort, wo es, obwohl nicht Hauptsaison, etliche Touristen hat. Ich glaube, die meisten sind Einheimische, denn ausser dem seltsamen Spanisch, das man hier in Argentinien spricht, haben wir keine andere Sprache gehört.
Ganz sicher haben die Menschen hier einen ausgesprochen ausgeprägten Sinn für ausgesprochen ausgeprägten Kitsch. Kein Haus, Châlet richtigerweise, wo’s nicht irgendwelche lustigen Trolle, farbenfrohe Zwerge, herrliche Blumenverzierungen oder was auch immer für Figuren hat. - Es könnte einem schlecht werden!
Das allererste Restaurant, an dem man vorbeikommt, wenn man die autofreie Zone betritt, heisst „Prosit Biergarten“. – In dem Stil geht’s weiter.
Vor allem Schweizer und Deutsche haben sich hier niedergelassen und so findet man auf Schritt und Tritt Hunderte von übelsten Souvenirs, in die Schweizer- und deutschen Wappen eingeprägt sind (oder Fliegenpilze und Zwerge in Anlehnung an die Gebrüder Grimm. Wenn die wüssten…). Wer nur kauft all das Zeug? - Ich kann’s mir nicht vorstellen, denn ein Laden verkauft denselben Ramsch wie der nächste.
Schweizerisch scheinen vor allem Bierhumpen zu sein und Kuckucksuhren. – Wusste ich gar nicht. – Lederhosen auch.
Aber eine Tasse mit dem Berner Wappen drauf müssen wir natürlich doch auch kaufen, das schon. Eine solche würden wir zu Hause ja wohl kaum finden.
Der Verkäufer freut sich, wie er merkt, dass wir Schweizer sind. Sein Vater sei aus dem Thurgau, lässt er uns wissen. Aber kein einziges Wort Schweizerdeutsch spricht er. Es fehle ihm die Praxis, meint er.
Unser nächstes Ziel, wo wir zwei Nächte gebucht haben, ist Villa General Belgrano (VGB), auch dies ein putziger Ort, den man gesehen haben muss, fand Carlos.
Vorher aber machen wir noch einen kurzen Abstecher nach Villa Berna, einer Siedlung, die nur ein paar wenige Kilometer weit weg von La Cumbrecita gelegen ist. Laut Wikipedia soll es dort nur gerade 135 Einwohner haben. Trotzdem - ich hätte mir vorgestellt, dort einen Kaffee zu trinken oder zumindest einen kurzen Spaziergang zu machen, aber es gibt überhaupt keinen Dorfkern, kein Restaurant, einfach nichts. Wir erinnern uns an San Clemente - allmählich sollten wir ja wissen, wie solche Dörfer „ticken“. Zwei-, dreimal zeigt ein Wegweiser zu einer abgelegenen Unterkunft, ein paar Häuser sieht man von der Strasse aus versteckt hinter irgendwelchem Dickicht. – Das ist alles.
Weiter geht’s; wir überqueren eine Brücke. In der steilen Kurve danach wird auf mehreren Schildern angepriesen, dass es unten beim Fluss einen „Mirador“ gäbe, einen Aussichtspunkt mit Blick auf einen Wasserfall. Getränke, Eiscremes, und so weiter.
Wir fahren auf den verlassenen Parkplatz und treffen eine Art Geisterort an. Überall Schutt und Dreck und ein paar verwahrloste Hütten in übelstem Zustand sind alles, was übrig geblieben ist sowie eine Reihe von einstöckigen Hütten, die aussehen, als ob die Bauleute mitten in der Arbeit abgehauen wären. Werkzeuge und Baumaterial liegen herum. Die kleine Aussichtsplattform steht zwar noch, aber der Blick von dort ist nicht überwältigend. Kaputte Grillstellen, Abfall und dann doch noch der „Wasserfall“, der nur wenige Meter über ein paar grosse Felsbrocken „stürzt“. Oben die Brücke, über die wir soeben gefahren sind. - Was wohl die kleine Jungfrau Maria aus Plastik von all dem hält, die in der Nähe auf einem bescheidenen Holzpodest fixiert das Chaos überblickt?
Die Fahrt nach Villa General Belgrano dauert nicht lang. Leider herrscht noch immer dichter Nebel und die Landschaft zeigt sich grau in grau. Wir finden unser Hotel und ruhen uns erst mal aus. Wenigstens ist es nicht kalt, das hätte sonst den Eindruck erweckt, viel anders als zu Hause sei es nicht.
Ein Spaziergang durchs Dorf macht klar, dass wir in einem Städtchen gelandet sind, wo vor allem deutsche Einwanderer ihr (Un)wesen getrieben haben. So deutsch findet man’s nirgends in Deutschland. Alles dreht sich ums Bier, vor den Kneipen stehen lebensgrosse, farbige Figuren aus Kunststoff mit Bierbäuchen und Bierhumpen in der Hand.
Die Speisekarten sind überall mehr oder weniger die gleichen. Sauerkraut kann man haben, Knackwürste, Frankfurter, Spätzle, Strudel zum Dessert und so weiter. In den zahlreichen Läden gibt’s Souvenirs „vom Feinsten“, ich zähl sie nicht auf.
Mitten im Zentrum gibt’s einen Turm, von dem aus man eine prächtige Rundum-Aussicht hat aufs Dorf und die Sierra im Hintergrund. Den besteigen wir an unserem zweiten Tag und kaum sind wir oben an der langen Wendeltreppe angelangt, beginnt die Sonne zu scheinen. Endlich wieder mal! – Ein kurzer Spaziergang entlang des Baches liegt daher auch noch drin und sogar eine Siesta und ein Lesestündchen an der Sonne im Garten unseres Hotels („Blumig“ heisst es übrigens).
Bei schönstem Wetter treten wir nach zwei Übernachtungen die Rückfahrt nach Córdoba an. Die Strecke führt an einem See entlang. Bei einem Campingplatz halten wir an, um uns die Füsse ein wenig zu vertreten. Ein friedlicher Ort, idyllisch, im See kann man baden, er scheint sauber und klar. Ausser einem Gärtner und einer jungen Frau mit Kind, die offenbar zum Rechten schaut, ist niemand dort. Sie erklärt uns, man könne hier auch Unterkünfte mieten. Ich verzichte gern. Die angebotenen Camper laden in keiner Weise zum Verweilen ein. Am Wochenende sei alles immer voll besetzt und in der Hauptsaison (Januar und Februar) sowieso.
Weiter führt die kurvenreiche Route in die Hügel hinauf und man hat einen grossartigen Blick auf den See. Leider hat’s auch viel Verkehr. Trotzdem gelingt es zwei-, dreimal anzuhalten und die Aussicht zu geniessen. Inzwischen ist es sommerlich heiss geworden. Wir lieben es!
Ein Zwischenziel erreichen wir in Alta Gracia. Auch dort gibt es eine „Manzana Jesuítica“, ein ganzer Gebäudekomplex mit Kirche, Turm und Museum, den die Jesuiten im 17ten und 18ten Jahrhundert erbaut haben. Das kommt uns spanisch vor. Weniger das Eiscreme, das an ein Mövenpick-Cornet erinnert, nur viel grösser ist und dafür wesentlich billiger.
Bevor wir uns auf den vorläufig letzten Abschnitt unserer Reise machen, besuchen wir das Che-Museum, das Haus in dem Che Guevara aufwuchs. Es ist ein hübsches Gebäude in einem Aussenquartier der Stadt und ich finde, der Besuch hat sich gelohnt. Zwar kennen wir die Fotos von unserer Kubareise zur Genüge, aber trotzdem, die Stätte hat einen besonderen Charme.
Eine weitere Stunde dauert’s, bis wir in Córdoba, mitten in der Stadt ankommen, wo ich ein kleines Apartment gemietet habe, gross genug, so dass wir genügend Platz haben, unsere Koffer aus- und umzupacken. Die Wohnung befindet sich im neuen Teil der Metropole und diesmal kommt es uns vor, als ob wir in einer völlig anderen Stadt gelandet wären als beim letzten Besuch, wo wir vor allem in der Altstadt herumschlenderten. Hier herrscht reges Leben, massenhaft Verkehr, ein Mini-Supermercado neben dem anderen bietet 24/7 Waren an, Restaurants hat’s an jeder Ecke und in jeder Art, die meisten nur kleinste Imbissstuben oder Take-Aways. Eng aneinandergereiht sind moderne mehrstöckige Wohnblöcke und genau in so einem sind wir untergebracht. Gebucht hab ich bei Booking.com, aber die Vermietung erinnert eher an Airbnb. Kurz vor dem Hauseingang, wo wir unsere Unterkunft vermuten, finde ich glücklicherweise am Randstein eine Parklücke, wo wir aus dem Verkehrsgewühl ausscheren und kurz anhalten können. Wir stehen vor Haus Nr. 651. Die Adresse, die wir suchen, ist 625, sollte also ein paar Häuser weiter weg sein. Das ist jedoch nicht so. - Gleich nebenan steht Diego, der überaus freundliche Besitzer, schon parat, (so funktioniert das mit den Hausnummern – nicht eben praktisch), weist uns ein und wir zirkeln übers viel begangene Trottoir hinunter in die enge Tiefgarage. Er zeigt uns die Wohnung und übergibt uns die Schlüssel. Eine kleine Küche ist vorhanden, ein Wohn-, Schlaf- und Badezimmer. Alles ist sauber, zweckmässig, sogar ganz nett eingerichtet, es fehlt an nichts – ich bin zufrieden mit meiner Wahl.
Zu Fuss, es ist überhaupt nicht weit, spazieren wir am Faro vorbei ins MEC (Museum Emilio Caraffa) und schauen uns auf vier Ebenen Werke südameikanischer Künstler an. Der Eintritt ist gratis, denn der Lift funktioniert nicht.
Ein Weg führt durch den Bicentario Park, vorbei an grossen, farbigen Ringen, dann entlang des Parque Sarmento zurück in die Häuserschluchten.
Nach einer kurzen Siesta (die muss einfach sein, wenn man mit Theo unterwegs ist), machen wir einen Spaziergang durch unser Quartier by night und suchen ein passendes Restaurant in der Nähe. Im „Ciento Volando“ werden wir fündig. Auch diese Bar ist in einem Hochhaus untergebracht. Sie ist zweistöckig und oben auf einem Mini-Balkon hat’s noch einen freien Tisch mit zwei Stühlen – wie gemacht für uns. So können wir auf die Strasse hinunterblicken und auf das gegenüberliegende Restaurant, sehen Gäste und Autos kommen und gehen, den Pizzakurier zirkulieren und halten uns die Ohren zu, wenn ein wildgewordener Motorrad-Fahrer nach dem anderen durch die Gegend rast. Von diesem Tisch aus wir’s nicht langweilig. Wir sind froh, nicht irgendwo drinnen sitzen zu müssen, denn es ist noch immer fast 30 Grad warm. Ein sehr netter junger Kellner bedient uns, wir bestellen beide Pasta und dazu eine Flasche Wein – ein perfekter letzter Tag und Abend in Córdoba.
Der nächste Tag wird anstrengend: Flug nach Buenos Aires, mehr als sechs Stunden auf dem Flughafen warten bis zum Weiterflug nach Uruguay. - Zu dem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, dass es noch viel mühsamer werden wird als angenommen.
Am Freitag, 9. November, reisen wir frühzeitig ab. Die schlechten Erfahrungen, die wir mit den zahllosen Baustellen gemacht haben, hoffen wir, nicht nochmal erleben zu müssen, aber man weiss ja nie. Diesmal geht’s aber recht zügig voran, obwohl die Art und Weise, wie gefahren wird, extrem anstrengend ist. Viele Autos fahren mit so geringem Abstand einander hinterher, wie wenn sie zusammengebunden wären. Kein Wunder, gibt es zahlreiche Unfälle. Grad ist die Polizei vor Ort und kümmert sich um das, was noch aufzuräumen und zu erledigen ist: Ein Wagen steht auf dem Dach, der andere ist total zerquetscht und wohl nur noch etwa halb so gross wie kurz vorher. Ein paar Kilometer später können wir einer Auffahrtskollision ausweichen. Aber wir schaffen die Strecke zum Flughafen in einer knappen Stunde, ohne uns ein einziges Mal zu verfahren.
Der Flug nach Buenos Aires ist nur kurz, die Wartezeit auf die Verbindung nach Punta del Este umso länger. Wir kommen sogar fast eine halbe Stunde früher an als geplant, somit stehen uns sechseinhalb lange Stunden zur Verfügung, das Gate zu wechseln, etwas zu essen und zu trinken und ansonsten die Zeit totzuschlagen. Um halb zehn Uhr hätte es weitergehen sollen - die Abflugzeit wird jedoch um eine Stunde verschoben. Dabei aber bleibt es nicht. Die Putzequipe macht schon langsam Feierabend, das Restaurant schliesst wohl auch bald, auf der Info-Tafel steht, man solle sich beim Personal melden. Das verheisst nichts Gutes. Das mühsame Herumstehen und auf Informationen Warten nimmt erst ein Ende, wie neue Boarding-Cards ausgestellt werden und wir um Mitternacht endlich einsteigen und weiterfliegen können. Somit waren wir genau neun Stunden lang am Warten für einen knapp einstündigen Flug. – Ein langer Tag. - Kurz vor ein Uhr morgens kommen wir an.
Uruguay 10. – 22. November
Punta del Este / Montevideo / Colonia del Sacramento / Nueva Helvetia / Florída / 25 de Agosto / Minas / Villa Serrana / Garzon / Punta Bellena
Nach diesem mühsamen Freitag, wo wir das Warten gelernt haben, kommen wir kurz vor ein Uhr morgens in Punta del Este an. Der wortkarge Zollbeamte scheint nicht sehr angetan von der Tatsache, dass er um diese Zeit seinen Job noch machen muss. Zumindest macht er ihn schnell, so dass die lange Schlange vor dem Schalter relativ rasch passieren kann. Das ganze Personal im Duty-Free-Shop durfte offenbar ebenfalls noch nicht heim. Sie stehen alle erwartungsvoll herum, kein einziger Passagier allerdings interessiert sich für einen Kauf. Nicht einmal Theo zieht’s zum Whisky-Gestell. Erstaunlich! - Und der Typ vom Autoverleih hat auch ausgeharrt. Er hatte ja die Flugnummer und zudem hab ich ihm eine Mail geschrieben, sobald wir von der Verspätung wussten. Auch ins Hotel rief ich an, um zu sagen, dass wir wohl nicht vor zwei Uhr auftauchen würden. Zum Glück hatte ich in weiser Voraussicht zu Hause schon ein Hotel gebucht, das einen 24-Stunden-Service anbietet und nur ein paar Kilometer vom Flughafen entfernt ist.
Wir finden es auch relativ rasch, obwohl unsere beiden Navi-Güezis (Sygic und Google) entweder streiken oder einfach zu müde sind, um uns einwandfrei den Weg zu weisen. Auf Google sehen wir wenigstens, wo wir sind, und stumm läuft der blaue Punkt auf dem Display mit uns zum eingegebenen Ziel auf der Karte mit. Sehr froh bin ich, wie wir endlich ankommen und uns eine junge Dame gleich entgegenkommt, uns freundlich begrüsst und mit den Koffern hilft. Einchecken sollen wir dann am Morgen früh, meint sie, jetzt aber vorerst mal gut schlafen. – Das tun wir.
Nach einem kargen Frühstück machen wir uns auf zum nächsten Haustausch. Nach nur wenigen Kilometern sind wir dort. Das Google-Rösi hat auch gut geschlafen und ist wieder bereit, uns zum Haus zu führen, das keine Adresse hat, nur eine Koordinate. Ein Punkt auf der Karte genügt, uns richtig zu leiten. Das Haus mit seinem Strohdach gefällt uns gut. Marisol, die Frau, die sich um alles kümmert, wenn die Besitzer nicht da sind, kommt auf ihrem Scooter dahergebraust, öffnet Tor und Türen und zeigt uns alles.
Auf den ersten Blick scheint alles gut eingerichtet zu sein, aber wir sind es gewohnt bei unseren Haustauschen, dass gerade bei Ferienhäusern, die nicht allzu oft bewohnt werden, einiges ansteht, das man flicken oder ersetzen sollte.
So kann man hier die Waschmaschine nicht benutzen, weil die Schliessvorrichtung abgebrochen ist, die Birne vom Nachttischlämpchen funktioniert nicht, Abwaschmittel ist keines vorhanden (Abwaschmaschine leider auch nicht), die Gläserauswahl ist eher beschränkt und so weiter. Aber das sind alles Kleinigkeiten. Der Einkaufzettel, den ich auf dem Smartphone immer schon parat habe, wird um ein paar Posten ergänzt (frische Abwaschlappen, Servietten, Salz, Öl und Essig, Rüstmesser etc.), und schon lässt es sich wunderbar hantieren. Die Waschmaschine natürlich…
Was sehr oft „ein Stein des Anstosses“ ist, sind die Bratpfannen. Sie sind in vielen Küchen so sehr verkratzt und verbeult, dass ein Braten darin nicht mehr in Frage kommt. Sie wären lediglich noch dafür geeignet, einem eines über den Schädel zu ziehen (wahrscheinlich lese ich zu viele Krimis, merke ich gerade, dass mir so eine Anwendungsweise überhaupt in den Sinn kommt), aber darum geht es ja nicht. – So kommt es nicht selten vor, dass bei unserem ersten Einkauf am neuen Ort nebst allem Ess- und Trinkbaren auch eine Bratpfanne im Wägeli landet.
Der Einkauf macht immer Spass und wir lassen uns Zeit dazu. Es ist spannend zu sehen, welche Produkte die gleichen sind wie bei uns und welche völlig anders. Zum Beispiel Greyerzer, der aussieht wie Emmentaler, aber in Holland hergestellt wurde … Für ein bis zwei Abendessen „zu Hause“ decken wir uns ein, lassen uns beraten, welches Fleisch besonders zart, welcher Fisch frisch und welcher Wein zu empfehlen ist.
Gestern gab’s Ravioli oder Sorrentinos, wie sie hier heissen. Theo tut sich meistens schwer damit, meine Kochkünste zu rühmen; oft hat er einfach viel zu viel anders im Kopf als sich aufs Essen zu konzentrieren. Gestern aber war das nicht so. Was ihm am Menu besonders gefallen hat, war die Abwesenheit von Salat.
Leider haben wir mit dem Wetter ziemlich Pech. Es ist zwar nicht kalt, aber regnerisch, extrem feucht und neblig. Der Vorteil: es ist wunderbar ruhig, es hat wenig Verkehr und kaum Touristen.
Trotzdem haben wir jeden Tag ein Programm. Am ersten Sonntag war’s ein Besuch im Museo Ralli. Dort hat es uns sehr gefallen; wir haben mindestens zwei Stunden damit verbracht, Bilder und Skulpturen südamerikanischer Künstler zu betrachten.
Ein anders Mal war’s ein Besuch im Fünfstern-Hotel L’Auberge, wo’s Mode ist, Tee und Waffeln mit Dulce de Leche zum Zvieri zu bestellen. Statt Tee war’s für uns Cappuccino. Ein wunderschönes Ambiente und tatsächlich ausgezeichnete Waffeln zu einem nicht ganz günstigen Preis wurden uns serviert – der Besuch absolut wert.
Den Tipp haben wir von Hernán erhalten, einem jungen Anwalt, mit dem wir in Buenos Aires beim gemeinsamen Warten auf unseren verspäteten Flug vor dem geschlossenen Gate ins Gespräch gekommen sind. Ich „whatsapple“ im Moment täglich mit ihm und er gibt mir wertvolle Tipps, was zu unternehmen, wo gut essen zu gehen. – So hatte die mühsame Warterei auf dem Flughafen doch noch einen positiven Aspekt.
Ein Ausflug an die Südspitze der Halbinsel Punta del Este und zu „Los Dedos“, einem Kunstwerk am Strand (fünf gigantische Finger einer Hand ragen hoch aus dem Sand heraus) ist vor allem erwähnenswert, weil es uns vor lauter Wind fast weggeweht hat.
Die grauen Finger sind ein beliebtes Fotomotiv für Touristen. Selbstverständlich schossen auch wir ein paar Erinnerungsbilder.
Am Hafen dann war etwas los. Zwar nicht, weil es so viele Besucher hatte – kaum jemand war dort, und die wenigen Fischbuden, die geöffnet hatten, warteten vergeblich auf Käufer. Aber die Fischabfälle, die die Verkäuferin übers Geländer ins Hafenbecken warf, lockten Seelöwen und Möwen gleichermassen an. Lautstark stritten sie sich gegenseitig ums Futter.
Nach drei Regentagen wurde das Wetter endlich doch noch schön. Erst zwar nur zögerlich mit starkem Wind, aber dann gab’s nichts mehr zu klagen.
Wir machten einen Ausflug nach José Ignazio, einem kleinen, malerischen Dorf an der Küste mit einem viel besuchten Leuchtturm. Auf dem Weg dorthin ging’s über die Puente Leonel Viera in La Barras. Sie erinnert an eine zweispurige Achterbahn oder an den DNA-Bauplan. Oder dem Erbauer der Brücke muss es ganz einfach „sturm“ im Kopf gewesen sein, als er sie entwarf.
Es ist eindeutig Zwischensaison, die paar Restaurants, die’s hat, waren fast alle geschlossen. Nur mit Mühe fanden wir schliesslich eines, wo wir etwas essen konnten. Mehr als einmal wurden wir drauf aufmerksam gemacht, dass es jetzt eben Winter sei und der Sommer erst Mitte Dezember beginne. Nun – inzwischen war die Temperatur auf 30 Grad gestiegen… Schön so! - Im Sommer muss es grauenhaft sein, nur so von Touristen wimmeln, wie man uns versichert - alle Restaurants überfüllt, die Strände ebenso. Ich kann's mir kaum vorstellen.
Gegessen haben wir vorzüglich während unseres Aufenthalts. Tripadvisor hat uns gut geleitet:
Lo de Ruben / Nuestra Mesa / Las Pavas Resto.
Der Wein ist ebenfalls erwähnenswert: Was für Chile der Carménère, für Argentinien der Malbec – ist für Uruguay der Tannat, den ich bisher nicht kannte. Er mundet, dieser farbintensive, kräftige Wein.
Im Zentrum von Maldonado gibt’s eine Kathedrale mit einem, laut Wikipedia, berühmten Altarbild. Allerdings steht in der Kirche selbst nirgends etwas darüber geschrieben.
Der Markt hingegen, an dem wir per Zufall vorbeikamen (endlich schönes Wetter zwar, aber kalter Wind – wir hatten grad gar nichts anderes zu tun) – über den steht nicht einmal im Web etwas. Wen wundert‘s? Er war unterste Schublade, und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass irgendjemand irgendetwas Brauchbares dort finden könnte. - Wir schon! - Erste Trophäe: ein Nummernschild, auf dem MAD 2171 steht. Da wir, wenn wir an unsere „Kinder“ schreiben, oft mit „MAD“ unterschreiben (Mom and Dad), musste das natürlich unverzüglich in unseren Besitz übergehen.
Und Theo fand ein langärmliges, weisses Hemd, das er inzwischen schon ganz ins Herz geschlossen hat. – Tatsächlich ist die Qualität wirklich gut und ich frage mich, wo das wohl herkommt. – Nicht einmal fünf Franken hat’s gekostet.
Trophäe Nummer drei: ein Trinkröhrchen für den Mate-Tee, Bombilla, das in Theos Kuriositäten-Kabinett in der Vitrine in Bivio seinen Platz finden wird.
Am Ende jenes „Sightseeing-Tags“ in Maldonado war es erst halb sieben, also noch viel zu früh für einen Restaurantbesuch. Aber vielleicht ein Apéro? - Wir schauten bei einem Restaurant zum Fenster rein, die Vorhänge waren zwar noch zugezogen, aber trotzdem sah uns der Kellner offenbar. Er öffnete die Tür und sagte, wir sollten in einer Stunde wiederkommen. Grad wollten wir zum Auto zurück, als der Besitzer uns rief und sagte, es sei ok, wir sollten nur kommen. Was für eine Ausnahme – mitten am Nachmittag – um sieben Uhr schon essen! Das Feuer für die Parilla brannte bereits und der Koch war dabei, etliche Fleischstücke vorzubereiten. Ein dickes Stück Fleisch mit Knochen wurde uns angeboten, ebenso ein halbes Lamm-Gigot. Wir entschieden uns fürs Ojo de Bife. Nur eine Portion, zwei hätten wir niemals geschafft. Gegen acht erschien dann die Kellnerin, die nun den Job übernahm, uns noch ein Dessert zu servieren. Als wir gingen, begann sich das Lokal zu füllen. Paare kamen mit ihren Babys im Kinderwagen. – Da hatten wir’s ja vorher richtig gemütlich. Kein Kindergeschrei und die volle Aufmerksamkeit des Personals.
An unserem letzten Tag waren wir sogar noch ein paar Stunden am Strand, bevor wieder mal Packen auf dem Programm stand.
Ich hatte uns eine Rundreise zusammengestellt mit sechs Übernachtungen. Einen Koffer konnten wir bei Nachbarn lassen, damit wir für diese kurze Zeit nicht so viel Gepäck mitnehmen mussten, so oder so eine grosse Herausforderung für unser kleines Auto.
So ging’s am Donnerstag, dem 16. November, los. Kaffee in einem pittoresken Hotel mit toller Aussicht über die Lagune und das Meer - noch ganz in der Nähe von Maldonado: „Las Cumbres“ – ein Tipp von Hernán.
Weiter ging’s nach Piriapolis, wo grad ein Heer von Angestellten dabei war, die Balustraden an der kilometerlangen Uferpromenade weiss zu tünchen – Vorbereitung auf den Touristenstrom, der ab Mitte Dezember erwartet wird.
In Montevideo führte uns unser Google-Rösi mitten ins Zentrum, wo ich ein Hotel für eine Nacht gebucht hatte. Wir waren sehr früh am Nachmittag schon dort, so hatten wir mehrere Stunden Zeit, einen Spaziergang durchs Zentrum zu machen, die Gegend am Hafen zu erkunden, und es reichte sogar noch für eine kurze Siesta, bevor wir ein Taxi nahmen und zu einer Show aufbrachen mit Tango und Nachtessen, die uns von der Rezeptionistin im Hotel empfohlen worden war.
Der Abend war unterhaltsam, verschiedene Show-Blöcke wurden gezeigt: Nebst den hinreissenden Tangoeinlagen wurden auch Milonga (laut Wikipedia die fröhliche Schwester und Vorgängerin des Tango Argentino) und Candombe (folkloristische Tanzeinlage mit Afro-Lateinamerikanischem Hintergrund) gezeigt. Im Lokal hatte es 12er-Tische – wir zwei Schweizer unter lauter Brasilianern, die kaum Englisch oder Spanisch sprechen konnten. Trotzdem kam eine Art Gespräch zustande.
Das Essen jedoch war nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Gelb sowieso nicht, weil nämlich die Beleuchtung im Saal so speziell war, dass der Salat, den man uns als Vorspeise reichte, grau in grau daherkam. Die Hühnerpastete ebenfalls. Dafür erschien das Grau unserer Haare eher grünlich. – Kurz gesagt, beleuchtungstechnisch der totale Flopp.
Eigentlich war die Vorspeise gar nicht so schlecht, hätte man sie mit verbundenen Augen gegessen. Bei den Ravioli allerdings hätte auch das nichts genützt; ihnen fehlte das Salz. Al dente schon, aber völlig ohne Geschmack. Theos Poulet war in Ordnung, fand er, einfach die Farbe… Dass wir Fleisch nicht bestellen sollten, hatte ich vorher im Tripadvisor bei den verschiedenen Feedbacks und Bewertungen gelesen, und das leuchtete ein. Mindestens zweihundert Personen waren in dem Lokal und individuelle Fleischbestellungen wohl eher nicht an der Tagesordnung. Die Dame neben Theo klagte jedenfalls über die Schuhsole auf ihrem Teller und liess sie dort auch liegen.
Aber wie gesagt, die Show war gut, einige der Sängerinnen und Tänzerinnen zwar schon etwas in die Jahre gekommen, dafür aber sehr redegewandt und farbig angezogen.
Apropos Rede: Kaum öffne ich den Mund, rühmen mich die freundlichen „Uruguaschos“ und sagen, wie gut ich Spanisch spreche. Da muss ich dann immer lachen und sagen, ich hätte ja gerade eben nur drei Wörter gesagt… Es hätte ja gut sein können, dass gar nichts mehr folgt. So wie bei dem Angestellten der Aerolineas Argentinas in Punta del Este beim Einchecken nach Buenos Aires. Er hatte offenbar gehört, dass wir deutsch oder wenigstens so was Ähnliches sprachen. Er sah mich an und sagte: „Was machen wir jetzt? – Wir trinken ein Bier!“ – Ich musste ihn wohl ein wenig eigentümlich angesehen haben, denn er erklärte sogleich, er habe einen Freund in Deutschland, und der habe ihm diese beiden Sätze beigebracht. Sonst könne er nichts sagen auf Deutsch. - Das fand ich wirklich lustig und pflichtete ihm bei, dies seien in Deutschland tatsächlich die beiden wichtigsten Sätze, die es brauche, um sich überall durchzuschlagen.
Sie sind einfach höflich, die Menschen hier, und hilfsbereit und es macht Spass, mit ihnen zu plaudern. Immer wollen sie wissen, wo wir herkommen. „De Suiza“ löst bei ausnahmslos allen ein Lächeln aus und weiter geht’s mit „Oh! - Que hermoso!“ oder alternativ „Que lindo!“. - Dabei zweifle ich stark, dass allgemein bekannt ist, wo dieses Land sich befindet, und ob’s nicht etwa zu Skandinavien gehört. Einige allerdings erwähnen gleich die Schokolade; die sind offenbar bestens im Bild.
An die seltsame Angewohnheit der Uruguayer, Mate-Tee immer und überall zu trinken, konnte ich mich kaum gewöhnen. In kleinen tassenähnlichen Gefässen aus Mate-Holz oder Metall, innen beschichtet mit Glas oder Keramik, stopfen sie eine eigene Mischung aus verschiedenen Teesorten hinein. Diese werden aufgegossen mit heissem Wasser und von morgens bis abends mit den Bombillas (eine Art Trinkröhrchen aus Metall) in kleinen Schlucken getrunken oder besser gesagt aus dem Röhrchen gesaugt. Was mich einerseits befremdet, andererseits belustigt, ist, dass diese Trinkgefässe überall hin mitgenommen werden. Genauso wichtig ist der Thermoskrug mit heissem Wasser. Auch der muss mit, damit die Teekräuter jederzeit befeuchtet werden können. Es ist absolut normal, jeder hat seine Utensilien dabei, sei das im Bus, im Laden, auf der Strasse, beim Spazieren – unglaublich!
Wenn ich mir vorstelle, dass ich neben meiner Handtasche (meinem Notfallkoffer, wie Theo meint) immer noch einen Thermoskrug unter den Arm geklemmt und eine Kalabasse mit Bombilla mit mir herumtragen müsste – oh je. Nicht auszudenken!
Zurück zur Reise: In Montevideo blieben wir nur gerade 24 Stunden, denn das „Stadterlebnis“ würden wir ja in Buenos Aires, wo wir zwei Wochen bleiben werden, noch genügend erhalten, also interessierten mich eher kleinere Orte und Dörfer.
Die nächsten zwei Tage verbrachten wir in Colonia del Sacramento, einer kleinen am Rio de la Plata gelegen Stadt (die älteste Stadt in Uruguay), seit 1995 zum UNESCO Welterbe erklärt. Und sicher nicht zu unrecht. Colonia liegt fast vis-à-vis von Buenos Aires (eine gute Stunde mit der Fähre), ist ein hübscher, gepflegter Ort, sehr touristisch zwar, aber wunderschön gelegen, umgeben vom Wasser und voller kleiner Restaurants, eines einladender und gemütlicher als das andere. Auf die urigen Kopfsteinpflasterstrassen sind die Einwohner sehr stolz und der Leuchtturm ist ihr Wahrzeichen. Die prächtigen Bougainvilleas, die weissgetünchten Häuser, der blaue Himmel – fast könnte man denken, man sei auf einer griechischen Insel gelandet.
Einzig die Farbe des Wassers mutet merkwürdig an. Es ist ganz braun, und das kommt vom Schlamm und dem lehmigen Boden, der der Rio de la Plata mitbringt. Dort, wo er ins Meer fliesst, sieht man deutlich den Wechsel der Farbe - wirklich eindrücklich!
Auf der knapp dreistündigen Fahrt dorthin regnete es wie aus Kübeln, aber kurz vor unserer Ankunft (wenn Engel reisen…) „öffneten sich die Himmel“, die Sonne zeigte sich und so blieb es die nächsten Tage bis zu unserer Abreise eine knappe Woche später.
Das Hotel, das ich gebucht hatte, war eine absolut glückliche Wahl. Etwa zehn Kilometer vom Ort entfernt und nur über eine holprige, nicht asphaltierte Strasse mit riesigen Schlaglöchern erreichbar, übernachteten wir zweimal in der idyllischen „Casa de los Limoneros“. Umgeben von einem Hain mit 1200 Zitronenbäumen steht das alte Herrschaftshaus, das voll von Efeus bewachsen ist, inmitten eines wunderbar gepflegten Parks mit exotischen Bäumen, zwei Teichen und einem Swimmingpool. Ein wahres Bijou. Ein ähnliches Konzept wie in Frankreich die „Table d’Hôtes“ – so gibt’s auch hier ein Nachtessen, wo man mit anderen Gästen an einem grossen Tisch sitzen kann. Das köstliche Frühstück ist ebenfalls erwähnenswert. Beim Gespräch lernten wir nette Leute kennen und erhielten etliche gute Tipps für die Weiterreise.
Diese führte erst nach Villa Helvetia, wiedermal eine Schweizersiedlung, wo allerdings ausser den Strassennamen, dem Hotel Swizo und der Speisekarte dort nicht mehr viel an die ehemalige Heimat der dortigen Dorfbewohner erinnert.
Aber es war lustig, durch die Calle Guillermo Tell zu fahren, bei der Calle Frau Vogel eine Foto zu schiessen, zu sehen, dass bei der Calle Haberli mit den Jahren wohl das „Ä“ abhandengekommen ist.
In Florída hatte ich unsere nächste Unterkunft gebucht. Aber bis wir dort waren, galt es noch, etliche Kilometer zurückzulegen. Ohne Google-Rösi hätten wir die abgelegene Farm niemals gefunden. Die „Estancia de Ceibo“ ist etwa zwanzig Kilometer vom Ort entfernt, steht alleine, und weit und breit sind keine Nachbarn zu sehen. Genauso hatte ich es geplant, mal zu erfahren, wie die Leute auf dem Land leben und vielleicht sogar zum Reiten zu kommen – nach alter Gaucho-Manier. Und siehe da: Endlich am Ziel angelangt, wurde unser Auto bereits von zwei bellenden Hunden stürmisch umringt und eine Reihe von Hühnern kam ebenso neugierig herbeigeeilt. Von Joselo, dem attraktiven und charmanten Besitzer der Ranch wurden wir herzlich empfangen. Er führte uns herum, bot uns Kaffee und Kuchen an, zeigte und erklärte uns alles und… hatte bereits zwei gesattelte Pferde bereit zum Ausritt!
Der Ritt durch die herrliche Landschaft war ein absolutes Highlight. Bis zum Einnachten waren wir unterwegs, ritten über die saftig grünen Felder, vorbei an Kühen, Pferden, Schafen, sahen Vögel und Hasen, eine Eule auch, und die beiden Hunde begleiteten uns vergnügt auf Schritt und Tritt.
Inzwischen war Carmen heimgekommen, Joselos Ehefrau. Auch sie erzählte vom Leben auf der Farm, von ihrer Familie und den Sorgen, die sie haben. Als Gast auf dieser Estancia fühlt man sich wie zu Hause. - Um neun wurde uns von einer Angestellten ein feines Nachtessen serviert, bevor wir müde und zufrieden ins bequeme Bett sanken.
Um neun gab’s Frühstück. Wir machten nochmals einen Rundgang um die Farm und die Gebäude. Am absolut grossartigsten fand ich die Glyzinie, die zwischen zwei der Wirtschaftshäuser steht. Der Baum ist 120 Jahre alt, dehnt sich über 14 Meter über ein Metallgestell aus, und dient so als ein 4 Meter breites Sonnendach, das im Sommer wohl wunderbaren Schatten spendet und sich im Frühling mit Blühen selbst übertrifft. Diese Fülle zu sehen, waren wir leider zu spät dran, aber das prallvolle grüne Blätterdach ist auch so überwältigend. Carmen schickte mir am nächsten Tag per Whatsapp ein Bild von der violetten Blütenpracht.
Bevor wir gehen mussten, führt uns Joselo mit seiner Camionetta (Pick-Up) noch durchs Gelände an einen kleinen Fluss, in dem man baden kann und zeigte uns die schöne Gegend. Die beiden Hunde rannten wiederum mit Begeisterung vor dem Auto her. Sie wussten genau, wo’s lang geht und es war eine Freude zuzusehen, wie sie voller Wonne ihr Bad im kühlen Nass genossen. – Ein absolutes Paradies für die Hunde muss das sein und auch für die andern Tiere auf der Ranch.
Schade, dass ich hier nur eine einzige Nacht gebucht hatte. Ich wäre gerne länger geblieben.
Vier Stunden Fahrt hatten wir am nächsten Tag vor uns. Es hätte einen kürzeren Weg gegeben bis zur nächsten Destination, die Ruta 12, aber Carmen empfahl uns, die längere Strecke in Angriff zu nehmen, weil dort die Strasse besser sei.
Einen Abstecher machten wir nach dem Bauerndorf „25 de Agosto“, einem kleinen schachbrettartig angelegten Ort, wo’s Wandbilder hat, die zu sehen man uns empfohlen hatte. Bis wir sie gefunden hatten, dauerte es allerdings eine gewisse Zeit. Fragten wir nach dem Weg, hiess es: drei Quadras nach links und dann rechts und wieder links etc. Die Fahrt ging einmal mehr im Kreis, bis wir endlich, fast hätten wir die Suche aufgegeben, den zentralen Platz fanden, wo es auch eine ganz interessante, verlassene Eisenbahnstation zu besichtigen gab.
Über siebzig Wandbilder kann man sehen. Eine französische Künstlerin hat sie gemalt. Sie wollte dem verschlafenen, vergessenen, grauen Dorf Farbe verleihen, was ihr sehr gut gelungen ist. Wir empfanden das Dorf nach wie vor als sehr verschlafen, aber offenbar hat’s im Sommer etliche Touristen, die den Weg zum/nach 25. August jeweils finden.
An der Tür des Dorfladens hiess es „abierto“, dennoch war sie geschlossen. Doch eine Frau hatte uns gehört und öffnete. Ein paar wenige Stühle und Tische waren vorhanden – alles sehr einfach und zweckmässig eingerichtet. - Ein Bier und zwei Gipfeli für Theo, ein Eiscreme für mich – das war unser Mittagessen.
Weiter ging die Fahrt auf den endlos langen, geraden Strassen Richtung Osten gegen Minas in „die Berge“. Seit Tagen waren das die einzigen Erhebungen oder Hügel, die wir zu sehen bekamen. Dort war das nächste Ziel: erneut eine völlig andere Unterkunft als bisher: ein Hotel in der Sierra mit Blick übers weite Land, mit Swimmingpool und einem Restaurant. Auf knapp 200 Metern über Meer. Und auch hier wurden wir nicht enttäuscht. Die kleine Siedlung, wo’s grad nur ein paar Ferienhäuser hat, welche über die Hügel verstreut sind, hat nur knapp einhundert Einwohner und heisst Villa Serrana. Einen Dorfkern gibt es nicht. Wer sich hier in dieser verlassenen Gegend ein Hotel baut, dachte ich bei mir…
Auf der Strecke dorthin hatten wir eine Begegnung: Eine Spinne lief uns von links nach rechts vor dem Auto über den Weg. Wenn man die sieht (ohne Lesebrille), kann sie nicht sehr klein sein. So sehr ich mich vor diesen Tieren ekle, so sehr war ich fasziniert. Jedenfalls hielt ich an und ging hin, um sie zu fotografieren. Sie lief langsam auf die andere Strassenseite, ich mit dem Smartphone hinterher, bis mir Theo zurief, die könne sicher springen. Zwei Fotos der Tarantel hatte ich bereits im Kasten, also beschloss ich, lieber Fersengeld zu zahlen, denn ich war nicht ganz so sicher, ob mein lieber Ehemann es ernst meinte oder nicht.
Später im Hotel passte ich sehr gut auf, wo im Garten ich hintrat, denn wo eine ist…
Einer zweiten begegnete ich zum Glück nicht, dafür aber einem Leguan, der allerdings Reissaus nahm, als er mich sah.
Friedlich war’s dort im „Meson de las Cañas“, völlig ruhig und erholsam. Nur ganz wenige Gäste hatten den Weg dorthin gefunden.
Noch zwei Stunden konnten wir bei schönstem Wetter am Pool ausruhen (längst fällige Siesta!), ein wenig lesen und dösen, auf der Terrasse einen Apéro geniessen und später nach dem Nachtessen in die Federn sinken, in der Hoffnung, nicht von Spinnen träumen zu müssen.
Am nächsten Tag, unserem letzten in Uruguay, ging die Fahrt zurück Richtung Süden ans Meer. Bis zum nächsten Hotel hätte es laut Google anderthalb Stunden gedauert, aber weil wir ja genügend Zeit hatten und weil uns verschiedentlich zu einem Besuch der Bodega Garzon geraten wurde, dachte ich, der Umweg dorthin würde sich lohnen, mehr als doppelte Fahrtzeit halt. Wir konnten nicht genau herausfinden, wie die Strasse dorthin beschaffen ist, aber viel schlimmer als das, was wir bereits hinter uns hatten, konnte es wohl nicht sein. Dachte ich. – Die Rutas 8, 13 und 39 sind bestens ausgebaut, schon frohlockten wir, da schickte uns Rösi gnadenlos von der Strasse ab auf einen Schotterweg, der nichts Gutes verhiess. Aber wir hatten uns ja dafür entschieden, also zogen wir es durch. Für die knapp 30 km brauchten wir eine Stunde bis zur Bodega, eine Stunde durch eine Gegend, wo zwar manchmal Kühe und Pferde zu sehen waren, aber weder Häuser noch Menschen, Strassenschilder schon gar nicht. Dafür viele Steine und Löcher. Meine ständige Angst, unser kleines Auto würde den Geist aufgeben oder zumindest einen Pneu (ob wir einen Reservereifen dabei hatten, hatte ich überhaupt nicht kontrolliert), fuhr die ganze Strecke mit. Ohne Google-Rösi wären wir vermutlich nie angekommen.
Dann endlich tauchte auf einem Hügel mitten im Nichts ein Gebäude auf, von dem wir erst dachten, es habe vielleicht mit Wasserkraft oder Elektrizität zu tun. Eine hohe Mauer, ganz modern, zwei Barrieren und ein Wärterhaus. „Bodega Garzon“ in kaum leserlichen Lettern stand an der Wand. – Welche Erleichterung, endlich am Ziel zu sein! Der Angestellte kam aus seinem Karbäuschen heraus und teilte uns mit, die Bodega sei heute leider geschlossen. - Und wir sind den ganzen mühsamen Weg hierhin gefahren. Ich konnte es kaum fassen. Laut Tripadvisor hätte sie geöffnet sein sollen.
(Mit den Bodegas hatten wir wirklich Pech: Die erste, die wir besuchen wollten kurz nach unserer Abfahrt in Montevideo (Bodega Bouza), war so überfüllt mit Besuchern, dass uns nichts anderes übrig blieb, als gleich weiterzufahren. Da gab’s ja noch die Bodega Establecimiento Junico zum Beispiel. Den Umweg von zwanzig Kilometern und die Suche nach dem Standort nahmen wir in Kauf. - Dort angekommen, liess man uns wissen, das Restaurant sei geschlossen, die Bodega ebenfalls...)
Weitere zehn Kilometer auf nicht asphaltierter Strasse und dann endlich wieder Belag für die restliche Strecke brachte uns nach Garzon, einem mini kleinen Dorf (etwa 200 Einwohner). Dort hat’s das Hotel Garzon, das dem bekanntesten Chef in Uruguay gehört, Francis Mallmann. Ich habe den Michelin Führer nicht konsultiert, aber das Restaurant hat sicher drei Sterne oder zumindest wird es im Buch heissen: „ist einen Umweg wert“. Nun, den hatten wir ja bereits hinter uns und das Gefühl, ein Drei-Stern-Mittagessen verdient zu haben nach dieser langen Fahrt auf jeden Fall. Zudem gab es kein anderes Lokal weit und breit.
Vor dem Hotel stand ein Bentley. Im Restaurant gab’s zwar keine Besucher, aber alle Tische waren schön gedeckt. Um zwölf Uhr isst ja auch noch niemand. Ein bezaubernder Garten lud zum Verbleiben ein und eine noch bezauberndere Getränke- und Menu-Karte liess uns fast den Atem rauben. Aber wir beschlossen trotzdem zu bleiben und uns diesen Exzess ausnahmsweise zu leisten.
Die billigste Flasche Wein kostet dort 120 Fr. (genau dieselbe Flasche mit demselben Jahrgang kauften wir später im Laden für 15 Fr.). Ein Glas Wein ist für zwanzig Franken zu haben, der günstigste Salat zur Vorspeise für 40 Fr. Etwa 55 Fr. muss man für einen Teller Teigwaren aufwerfen und schon das Gedeck wird mit 10 Fr. pro Person berechnet. Aber da muss ich sagen, die drei hausgemachten Brote, die uns der Kellner brachte, waren absolut Spitze. Dazu gab’s Humus und einen etwa zwanzig Zentimeter langen aufgeschnittenen Knochen mit feinstem Mark drin. - Also ein Anblick für Götter war das ja nicht gerade, und ich kam nicht umhin, an meine bevorstehende Knieoperation zu denken…
Weil ich dem Brot überhaupt nicht widerstehen konnte, hätte ich eigentlich nach dieser Vorspeise bereits genug gehabt, aber wir hatten ja noch Fisch bestellt (ich) und Theo ein New York Steak. Beide Gerichte waren absolut delikat, der Lachs rosa und zart, das Fleisch perfekt grilliert, die Beilagen fein, nur Theo fand, für den horrenden Preis, den wir schliesslich bezahlen mussten für dieses „einfache“ Mittagessen, hätte die Präsentation einfallsreicher sein können. Er hatte ja recht, da könnten sie noch dazulernen; eine Augenweide sieht anders aus. Aber es war ein unvergessliches Erlebnis auf jeden Fall. - Theo wollte mich zur Abwechslung mal einladen, aber seine Karte wurde nicht akzeptiert…
Am frühen Nachmittag kamen wir im Hotel Casapueblo an. Das nun ist eines der schönsten und speziellsten Hotels, wo wir je waren. Gebaut von Carlos Paéz Vilaró, einem äusserst vielseitigen uruguayischen Künstler (Maler, Architekt, Bildhauer, Schriftsteller, Komponist), der dieses fantastische Gebäude als Hommage an seinen Sohn gebaut hat, einem der sechzehn Überlebenden des entsetzlichen Flugzeugabsturzes in den Anden im Jahr 1972.
Hier muss es einem einfach wohl sein. Die Zimmer sind gross; keines hat eine Nummer, dafür einen Namen (cubiertos). Jedes ist anders, die weiss getünchten Nischen, Terrassen und Erker geben einem das Gefühl, eher auf Santorini zu sein als in einer Bucht in Uruguay.
Das Hotel ist in einen Hang hineingebaut mit einer fantastischen Aussicht aufs Meer – Sonnenuntergang vom Feinsten inklusive. Und wir hatten solches Glück: Es war heiss an diesem Tag, kein Wölkchen war zu sehen, wir konnten Pool und Garten ausgiebig geniessen. Freundliches Personal, ein gutes Restaurant, ein bequemes Bett – was will man mehr?!
Nach dem Frühstück am nächsten Morgen besichtigten wir vorerst noch das Museum, das in einem separaten Teil des Gebäudes untergebracht ist. Anschliessend holten wir unseren Koffer bei der Nachbarin ab und fuhren zum nahe gelegenen Flughafen. Ähnlich wie in Belp kam es mir dort vor: klein und praktisch. Kein Stress, keine Warteschlangen, kaum Passagiere – alles sehr sympathisch.
Nach einem kurzen aber turbulenten Flug kamen wir in Buenos Aires an, unserem Ziel für die nächsten zwei Wochen.
Buenos Aires 22. November – 5. Dezember 2018
Vierzehn Tage Grossstadt – wie ich meinen eigenen Reiseplan anschaue, finde ich plötzlich selber, das ist doch fast des Guten zu viel. Aber dann, als wir dort waren, gefiel uns dieses Leben mitten im pulsierenden Zentrum ganz gut und das Beste daran war: Wir hatten genügend Zeit, uns in Ruhe das anzusehen, was auf meiner Liste stand und zwischendurch auch mal gar nichts zu unternehmen, was besonders während des G20-Gipfels gezwungenermassen sehr gut gelang.
So wird mein Bericht diesmal eher eine Aufzählung sein von Orten, wo wir waren, von Restaurants, die uns gefielen, so dass ich mich bei einem nächsten Besuch in dieser Stadt (was ich mir sehr gut vorstellen kann) wieder daran erinnere.
Buenos Aires ist eine sehr westliche Stadt, mit vielen Grünzonen. Etliche Strassen und Häuser erinnern an Paris, was auch nicht weiter verwunderlich ist, denn nicht wenige französische Architekten waren beim Aufbau der weiten Avenidas, der Hotels, Palacios und sonstiger Prunkbauten entlang der Hauptverkehrsachsen beteiligt. All die verspielten Türmchen verleiten zum Fotografieren. Nicht immer ist die Verbindung zwischen Alt und Neu gut gelungen. Wie überall waren auch hier nicht immer nur Stararchitekten am Werk.
In einem ehemaligen Hotel an der Avenida de Mayo, das inzwischen zu Wohnungen umgebaut wurde, waren wir im obersten, fünften Stock einquartiert, mitten im Zentrum, 200 Meter von der berühmten Plaza de Mayo entfernt.
Diesmal fand unser Haustausch mit einem Ehepaar statt (Mimí und José Louis), das im Sommer in Bivio war, wo es ihnen sehr gefallen hat. Nun stellten sie uns ihre Stadtwohnung zur Verfügung, ein Loft, also ein einziges grosses Zimmer mit einer Galerie. Sehr gemütlich war’s dort und wir hätten es problemlos noch länger als zwei Wochen ausgehalten.
Die „Küche“ (Anführungszeichen unumgänglich) liess uns keine riesigen Menus zubereiten, war da doch nur eine einzige mobile Herdplatte vorhanden und nur ein einziger Kochtopf, in dem man zum Beispiel eine Suppe oder Ravioli kochen konnte. Wie froh war ich, dass ich die Bratpfanne, die ich in Villa Carlos Paz bereits gekauft hatte, in Uruguay einige Male im Einsatz hatte, wieder auspacken konnte; so gab’s wenigstens eine Sauce zu den Teigwaren.
Nun - man isst ja dort auch nicht daheim, man geht ins Restaurant, die Preise sind so niedrig, dass dies fast günstiger kommt, als sich die Kocherei zu Hause anzutun. Die Empanadas (de carne, de pollo, de jamon y cheso), die man an jeder Ecke kaufen kann, sind ja so etwas von gut und billig (pro Stück zwischen 50 Rappen und 1 Franken) - von denen könnte ich leben. Zwei Tomaten aufgeschnitten, ein paar Zwiebelringe drauf (ja kein Salat, denn Theo mag das grüne Zeug einfach nicht), Salz, Pfeffer, Olivenöl und Aceto Balsamico drüber träufeln, und schon ist eine wunderbare Mahlzeit fertig, die nach keiner Kochplatte verlangt.
Restaurants, die uns empfohlen wurden und die wir unbedingt wieder besuchen würden:
„Napoles“ in San Telmo = absolutes Lieblingslokal.
Der Besitzer muss während Jahren alles Mögliche zusammengekauft haben, und als er in diesem grossen Raum an der Avenida Caseros 449 sein Restaurant eröffnete, gleichzeitig eine Art Museum eingerichtet haben. Da sind alte Autos ausgestellt, Motorräder, Statuen und Büsten aus Bronze, Holz und Ton, grosse Schiffsmodelle in noch grösseren Vitrinen (etwa zwei bis drei Meter lang, ein bis zwei Meter hoch), jegliche Art von Stühlen und Tischen. Diese sind hübsch gedeckt und es ist schwierig zu entscheiden, an welchem man am liebsten seine Mahlzeit geniessen möchte. Vielleicht oben auf der einen Galerie auf Barstühlen mit Blick auf das Geschehen im unteren Teil des Restaurants oder doch lieber in einer Sitzgruppe im indischen Stil, an einem runden Tisch neben einem ausgestopften Raubvogel oder gar auf den bequemen Coiffeur- oder Zahnarztsesseln? - Und geniessen kann man. Gleich wenn man das Lokal betritt, ist links an einem Tisch ein Angestellter damit beschäftigt, frische Teigwaren herzustellen und mit feinen Zutaten zu füllen. Beim Eintreten wird einem ein erfrischender Drink gereicht, das Rezept musste ich gleich erfragen (Cinzano, Apérol Spritz, Orangen- und Zitronensaft, ein paar Blätter Minze).
Gefallen hat uns auch die „Florería Atlantico“, ein Lokal im Quartier Recoleta. Speziell ist, dass man erst einen Blumenladen betreten muss, um in die Bar zu gelangen. Durch eine schmale Tür gelangt man zu einer Treppe, die in den Keller führt, wo „das Geschehen“ dann stattfindet. Das Lokal befindet sich in einem schmalen, etwa zwanzig Meter langen Gang, ausgestattet mit einer ebenso langen Bar, hinter der die Küche versteckt ist. Wir waren früh dort, bereits um halb acht und dachten, wie üblich seien wir die einzigen Gäste. Dem war überhaupt nicht so. Wir hätten reservieren sollen, alle Tische waren bereits besetzt oder reserviert. Noch gerade zwei Plätze an der Bar waren frei, und dort konnten wir essen – mit Blick auf die geschäftigen Köche. Das Lokal ist bekannt für seine ungewöhnlichen Drinks, einer komplizierter als der andere. Wir haben sehr gut und originell gegessen und auch der Wein entsprach unserer Erwartung.
Im „Sagardi“ in San Telmo waren wir dann doch wieder mal die ersten Gäste. Dies ist ein Lokal im spanischen Stil. Vorne an der Bar gibt’s die köstlichsten Tapas und im hinteren Teil ist das Restaurant, das erst später am Abend öffnet. Das Sagardi und seine Tapas sind beliebt, gegen neun war das Lokal nicht wiederzuerkennen – ein einziges Gedränge vor den Köstlichkeiten in der Auslage.
„El Obrero“ in La Boca war nicht ganz leicht zu finden, am Schild sind wir vorbeigegangen, so unscheinbar und unbeleuchtet präsentiert sich das Restaurant von aussen.
Hausmannskost gibt’s dort, und kein Zentimeter an den Wänden ist nicht von Fotos oder Bildern bedeckt, vor allem im Zusammenhang mit Fussball. Das Stadion der La Boca Juniors ist ja nur ein paar Blöcke von dort entfernt. An der Decke hängen Dutzende von Fussballerleibchen (oder sagt man Tricots?).
Am 8. November hätte ja der Fussballmatch zwischen den beiden rivalisierenden Fussballclubs La Boca Juniors und River Plate stattfinden sollen, aber der ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden, weil ein paar Hooligans den Bus der Juniors angegriffen und ein paar Spieler verletzt hatten. Alle waren in grosser Erwartungshaltung an jenem Nachmittag, Fan-Umzüge zogen durch die ganze Stadt und in La Boca wurden auf den umliegenden Strassen Riesenmengen von Fleisch auf der Parilla vorbereitet für das grosse Fest und blau-gelb angezogene Fans waren überall zu sehen. Aber eben, es kam nicht zur grossen Show.
Die andere grosse Show jedoch fand statt, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit, der G20-Gipfel. Dafür war ein riesiges Aufgebot von Polizistinnen und Polizisten vor Ort. Eine Unzahl von Schutzschildern zierten die Strassen, Blockaden gab’s überall. Und die breiten Avenidas waren leer. Keine Autos durften mehr fahren, keine Busse, auch die Untergrundbahn hatte zwei Tage lang „frei“ und der Staat machte den Freitag effektiv zum Freitag für die Porteños („Buenos Airer“, wie Theo sagt) und umging auf diese Weise ein Chaos in der 2km-Sperrzone, da die Metro ja auch ausserhalb nicht in Betrieb war). Die Metropole wurde zur Geisterstadt.
Man konnte mitten in den Strassen promenieren oder diese überqueren, wo man grad wollte, das Rotlicht war nur noch zur Dekoration vorhanden. Erst hatte ich versucht, für uns eine Kurzreise zu organisieren ausserhalb der Stadt, aber da auch keine Züge verkehrten und der Flughafen geschlossen wurde, liess ich es; es war mir zu kompliziert. Wir fanden in unserer Umgebung doch ein paar Restaurants, die geöffnet hatten, so war es einfach zu überleben.
Dass die Politiker eine Grossstadt wählten, um sich zu treffen und nicht eine einsame Insel, geht über mein Begriffsvermögen. Was das die Stadt gekostet haben muss, geht in die Millionen. Das ist Geld, das sehr viel vernünftiger hätte ausgegeben werden können, wenn man an die Probleme denkt, die vorhanden sind.
Einkaufen war ein Kinderspiel. In der Strasse, wo wir wohnten, hat’s überall Restaurants, kleine Geschäfte und Supermercados, so dass wir jedes Mal beim Heimkommen ein paar Flaschen Mineralwasser und Bier einkaufen konnten, ohne einen Grosseinkauf machen zu müssen. Speziell der Carrefour, ein paar Blocks weiter, hat eine grosse Auswahl an Waren. Da fand Theo auch weisse Schokolade und Biscuits, die immer auch noch mit aufs Waren-Förderband müssen. Eine 400g schwere Büchse mit Dulce de Leche, die ebenfalls Richtung Kasse steuerte, fand jedoch meine Zustimmung überhaupt nicht (man kann doch nicht immer sagen, man wolle abnehmen und dann solches Zeug einkaufen!). Ich hielt mit meiner Meinung nicht zurück und diesmal, oh Wunder, stiessen meine Argumente ausnahmsweise auf fruchtbaren Boden. – Ein paar Meter neben dem Ausgang des Geschäfts sass eine Bettlerin mit ihrem Kleinkind auf dem Boden. Die nahm die Dose mit der Zuckermasse sehr gern entgegen, strahlte und wünschte meinem Gatten Gottes Segen.
Überhaupt: Bettler, Obdachlose, Kartonsammler und andere arme Leute sind überall unterwegs. Vor allem am Abend sieht man welche, die in den Abfallkübeln nach Ess- und Brauchbarem suchen. Es gibt ein ganzes Quartier, das Barrio 31, welches ein grosses Problem darstellt. Viele tausend Menschen, und es werden immer mehr, leben dort in diesem Elendsviertel in erbärmlichen Unterkünften, die sie wie Legoklötze übereinander bauen; das sieht nicht nur gefährlich aus, es ist es auch. Die Bahnlinie trennt das Viertel von der neuen Stadt; die Autobahn zum Flugplatz fährt oben drüber.
Mit den 30% Arbeitslosen und der Inflation kommt die Regierung nicht klar.
Vor unserer Abreise haben wir zu Hause in der Tagesschau einen Bericht gesehen, der zeigte, dass sich neuerdings viele Märkte spontan bilden, wo Waren getauscht werden, so wie das früher im Mittelalter auch bei uns Gang und Gäbe war.
Mehr als einmal haben wir gehört und gelesen, die Argentinier seien die am wenigsten liebenswürdigen Südamerikaner, eher arrogant und unfreundlich. - Nicht eine einzige Begegnung hatten wir, die dieses Vorurteil bestätigen könnte. Ganz im Gegenteil. Hernán, der Anwalt, den wir auf dem Flughafen Aeroparke kennengelernt hatten während unserer neunstündigen Warterei auf den Anschlussflug, und der mir von da an fast täglich Tipps per Whatsapp schickte, lud uns zusammen mit seiner Frau Julieta in ein feines Restaurant zum Abendessen ein. Gerne hätte ich bezahlt, das kam aber überhaupt nicht in Frage.
Ebenso luden uns Mimí und José Louis zum Brunch ins historische Café Tortoni ein, das grad gegenüber unserer Wohnung gelegen ist und vor dem ständig lange Schlangen von Einheimischen und Touristen stehen und auf Einlass warten, da das Lokal, in dem abends auch Tango-Darbietungen stattfinden, in jedem Führer zu finden ist.
Aber auch Leute auf der Strasse sprachen uns an, wenn sie sahen, dass wir den Stadtplan konsultierten oder auf dem Handy etwas suchten und boten ihre Hilfe an. Unweigerlich kam auch hier immer wieder die Frage, woher wir kämen. Und genau wie in Uruguay die stereotype Antwort: „Oh, que lindo!“.
Am lustigsten fand ich den Buschauffeur, der vor uns am Rotlicht anhalten musste (wir standen am Strassenrand und mussten ebenfalls auf Grün warten). Er liess die Scheibe hinunter und rief uns dieselbe Frage zu. Woran er gesehen hat, dass wir Ausländer sind, ist mir ein Rätsel, denn wir hatten weder einen Fotoapparat umgehängt, noch einen Stadtplan in der Hand. Seine Antwort auf unser „De Suiza“ hat uns allerdings überhaupt nicht erstaunt. – Dann winkte er uns zu und fuhr los.
Apropos lustig: Ich liess mir die Haare schneiden, was zwar normalerweise nicht naturgemäss ein amüsantes Erlebnis ist, aber der Coiffeur, der sich an dieses Unternehmen heranmachte, schon. Er weigerte sich, mit mir Spanisch zu sprechen, er wollte unbedingt sein Englisch an den Mann beziehungsweise an die Frau bringen. – Er wusch mir die Haare und dann dauerte es eine kleine Weile, bis er sich ein Sätzchen zusammengereimt hatte. Urplötzlich sagte er (die Sache mit unserer Herkunft hatten wir bereits hinter uns): „Why you not bring me chocolate?“ – Wir mussten beide lachen. Er führte mich dann zum Coiffeur-Stuhl und jetzt ging’s mit Befehlen los: „Sit down!“ – Er legte mir eine Schürze um, dann sagte er: „Stand up!“ – Das kam mir schon ein wenig komisch vor, aber brav, wie ich bin, gehorchte ich sofort. Wahrscheinlich war ich nicht seine erste Kundin, die erstaunt auf seine Aufforderung reagierte. Er liess mich wissen: „This is my technique“ und schon begann er, rings um mich herum, meine Haare abzuschnipseln.
Seltsam, seltsam! Eine seiner anderen Techniken (ich durfte wieder sitzen) lernte ich dann beim Föhnen kennen: Ohne Bürste fuhr er mit der Hand wie wild auf meinem Kopf herum; es muss ausgesehen haben, wie wenn er mich Ohr- oder eben Haarfeigen würde. – Aber tatsächlich – nach einer halben Stunde hatte ich eine perfekte neue Frisur, mit der ich ganz zufrieden war/bin.
Noch ein Wort zu Mate:
Auch in Argentinien ist Mate ein Thema, allerdings nur am Rand. Zwar kann man vielerorts die entsprechenden Gefässe und Bombillas kaufen, aber man sieht kaum jemanden damit herumspazieren. Und wenn, dann denke ich, er oder sie stammt sicher aus Uruguay.
Museen:
Diese beiden haben uns besonders gefallen:
MALBA
Hier ist lateinamerikanische Kunst ab dem Jahr 1900 ausgestellt. Nebst anderen uns bekannten und unbekannten Künstlern ist ein ganzer Stock Pablo Suárez gewidmet. Der hat einen ausgeprägten Sinn für skurrilen Humor.
Museo Benito Quinquela Martin
Malereien eines italienischen Einwanderers (letztes Jahrhundert), ausgestellt in seinem Haus, das er später bewohnte. Eindrückliche Szenen am Hafen in La Boca. Auch interessante Galionsfiguren kann man bestaunen.
Gefallen hat uns auch der Wasserpalast (Palacio de Aguas Corrientes), eine architektonisch bedeutende Wasserpumpstation mit einer aufwändigen Fassade aus Terrakotta-Verzierungen und –Ornamenten, die aus England eingeführt wurden. 1894 eröffnet, diente er lange Jahre der Wasserversorgung der Stadt.
Eine faszinierende Buchhandlung ist „El Ateneo Grand Splendid“. Ehemals ein Theater mit über 1000 Sitzplätzen wurde sie im Jahr 1920 zum Kino umfunktioniert und später in einen Buchladen umgewandelt. Sie befindet sich an der Avenida Santa Fe 1860 im Stadtteil Recoleta. Dort, wo mal die Bühne war, befindet sich jetzt ein Café.
In einer Stadt legt man ja immer viele Kilometer zu Fuss zurück, auch wenn’s eine U-Bahn und Busse hat. Mit der SUBTE-Karte ist es sehr einfach, von Ort zu Ort zu gelangen; eine einfache Fahrt kostet nur etwa fünfzig Rappen. Die App „Cómo llego“ ist eine geniale Hilfe, das am besten geeignete Verkehrsmittel am richtigen Standort zur rechten Zeit zu finden. – So haben wir verschiedene Stadtteile ausgekundschaftet, besuchten am ersten Sonntag den schönen Handwerkermarkt im Recoleta-Quartier und den Friedhof dort, der in jedem Führer als sehenswert beschrieben wird und wo auch Evita Peron begraben ist. Die zum Teil riesigen Mausoleen sind eindrücklich, aber auch ein wenig unheimlich und schauerlich anzusehen, und mir kommen sogleich die armseligen Behausungen der (noch lebenden) Menschen im Elendsviertel nicht weit weg von diesem Ort in den Sinn. Dort ist nichts in Marmor gebaut und es schweben auch keine Engel aus Stein über den Gebäuden.
Vitalität und Lebensfreude strahlt das Viertel La Boca aus. Jeder mag die farbigen Häuser. Auch dieser Stadtteil war vormals ein Armenquartier. Was von den Schiffsfarben übrig blieb, so erklärte man uns, verwendeten die Bewohner ursprünglich, um ihre Häuser oder Baracken farbig zu bemalten. - Vor allem am Wochenende ist viel los. Touristen hat’s zuhauf, die Restaurants sind voll, auf den Strassen wird Tango getanzt.
Auch in Palermo macht es Spass, die verschiedenen Restaurants auszuprobieren und die unzähligen Graffitis zu betrachten.
San Telmo, das älteste Quartier der Stadt, ist ebenfalls sehenswert. Ruhig durch die Woche und am Wochenende wie am Zibelemärit in Bern: Hunderte von Touristen sind unterwegs. Auf der Plaza Dorrego und entlang der ganzen Avenida Defensa, über eine Strecke von 2,5 km vom Parque Lezama bis zur Plaza de Mayo, steht ein Marktstand neben dem anderen mit Antiquitäten, Handwerksartikeln, und all den tausend Dingen, die niemand braucht.
Apropos Tango: An dem kommt man nirgends vorbei in Buenos Aires; und das ist auch sehr schön so. Es gibt unzählige Tangolokale und -veranstaltungen, unterschiedlich auch im Preis, und einige davon sind sehr touristisch. Welche wählen? – Da gab uns wieder Hernán einen Tipp und der war ausgezeichnet:
An Theos Geburtstag, dem 24. November, besuchten wir „Esquina Homero Manzi“. Mit Dinner. Und diesmal war das Essen vorzüglich, nicht so wie in Montevideo. – Einmal mehr waren wir die ersten Gäste im Lokal (kurz vor halb neun) und sahen von oben (wir hatten einen schönen Platz auf der Galerie mit bestem Blick auf die Bühne), wie sich der Saal allmählich füllte. Dem Treiben der Kellner zuzusehen, war sehr unterhaltsam. Mir fiel eine Gabel herunter und landete unten auf einem Tisch grad neben einem Sektkübel. Sie hätte sehr wohl auch die Glatze des Kellners, der danebenstand, treffen können. Theo hat sich das Szenarium unverzüglich bildlich vorgestellt. – Ich war natürlich froh, dass sich die Angelegenheit nur in seiner Phantasie so abgespielt hatte.
Elegant und anmutig alsdann die Vorstellung auf der Bühne. - Sicher ein Tag zum Erinnern.
Nicht zu vergessen Puerto Madero, ein wiederbelebtes Hafengebiet. In umgestalteten Backsteingebäuden sind gehobene Steakhäuser zu finden. Schicke Wolkenkratzer beherbergen multinationale Unternehmen und Luxusapartments. Elegant überspannt die Puente de la Mujer das Hafenbecken.
Eine Stadt aus der Adlerperspektive zu betrachten, falls das von irgendeinem Turm aus geht, ist für mich ein Muss. Die Galerie Güemes macht’s möglich. Mit dem Lift in den 14. Stock und schon sehen alle Häuser aus wie Zündholzschachteln.
Iguazú 5. – 9. Dezember 2018
Am Mittwoch, dem 5. Dezember, kamen Mimí und José Louis vorbei, um uns zu verabschieden. Kein Problem war es, ein Taxi zu finden; die sind ständig überall unterwegs, nur nicht dann, wenn’s regnet, wie José Louis sagt. Aber das war ja nicht der Fall. In einer knappen halben Stunde erreichten wir den Flugplatz.
Um vier Uhr nachmittags bereits lagen wir im Hotel Saint George auf den bequemen Liegestühlen am Pool und genossen den restlichen Teil des heissen Nachmittags.
Am nächsten Tag besuchten wir die Iguazú-Fälle von der argentinischen Seite her, am folgenden Tag von der brasilianischen. Welche Seite schöner oder spektakulärer ist zum Besuchen, ist schwer zu sagen. Absolut eindrücklich sind die donnernden Wasser auf jeden Fall. Wer dort war, schwärmt davon, wir haben’s zigmal gehört und jetzt auch selber erlebt. Die bestens ausgebauten Wege ermöglichen es den Besuchern, die Fluten von allen Seiten her zu sehen, von vorne, von oben und von unten.
Und wir beiden Glückspilze: Gleich zwei der grössten Fälle der Erde konnten wir in diesem Jahr besuchen, die Viktoria-Fälle im August und die Cataratas de Iguazú im Dezember.
Was uns auf der brasilianischen Seite zusätzlich besonders gefallen und Freude bereitet hat, war der Besuch im Parque das Aves, einem sensationeller Vogelpark, gleich gegenüber dem Eingang zu den Wasserfällen. Flamingos und andere wunderbar farbige Vögel fliegen und stolzieren dort herum, exotische Blumen und Schmetterlinge gibt’s zu sehen, Papageien, die mit lautem Geschrei im Sturzflug an einem vorbeipfeilen, Krokodile und furchtlose Schildkröten. Die eine hatte sich einem Krokodil auf den Rücken gesetzt, welches aber offenbar grad am Siesta-Machen war und daher zu müde, um etwas gegen den aufdringlichen Schulterhocker zu unternehmen.
An einem Abend gab’s Tacos und Burritos, am zweiten trafen wir Carlos, in dessen Ferienhaus in Villa Carlos Paz wir vor ein paar Wochen gewohnt hatten. Er und seine Tochter sind beide Bauingenieure, die im Hotel Melia seit einem Jahr damit beauftragt sind, Umbauten vorzunehmen. Es war ein interessanter Abend, wir sassen im Restaurant Doña Maria, das zum Hotel gehört, in dem wir wohnten, auf der Terrasse und genossen das feine, viel zu üppige Essen und die milden Temperaturen.
Das waren zwei wunderbare Tage! Am dritten und letzten fand unser Flug über Buenos Aires nach Miami erst um halb sieben Uhr abends statt, so hatten wir nochmals Gelegenheit, bis um vier am Pool zu liegen, zu lesen, ebenfalls Siesta zu machen und das warme Wetter zu geniessen – ähnlich wie das Krokodil im Teich im Vogelpark.
Florida 9. – 17. Dezember
Schön ging’s gleich weiter in Miami. Sehr früh am Morgen kamen wir an, holten unser Mietauto ab und schon zwanzig Minuten später (es war Sonntag - sonst braucht man mehr als die doppelte Zeit) kamen wir bei Liza und Urs Lindenmann an, Freunden, die seit 40 Jahren in Miami leben. Eigentlich hatten wir mit HomeExchange-Partnern einen weiteren Haustausch in Bonita Springs vereinbart, aber wir waren sehr froh, dass wir nach dem neunstündigen Flug (vorher zusätzlich zwei Stunden zurück bis BA und zweieinhalb Aufenthalt im Flughafen) nicht noch bis an die Westküste fahren mussten.
Die beiden hatten uns angeboten, bei ihnen zu übernachten und erst am nächsten Morgen weiterzufahren. - Mit einem feinen Frühstück wurden wir verwöhnt und dann konnten wir uns im weichen, warmen Bett vom langen Flug erholen. So mühsam die Fliegerei jeweils, so fantastisch ein bequemes Bett, wo man sich anschliessend ausstrecken und murmeltierartig schlafen kann.
Ein paar Stunden später nach dem Auftauchen aus Abrahams Schoss, machte Liza den Vorschlag, einen Spaziergang durch die nahe gelegenen Pinecrest-Gardens zu machen. Da war ich sofort dabei. Karen, eine Freundin von Liza, die ich vor ein paar Jahren schon kennengelernt hatte, kam ebenfalls mit. - Theos Siesta-Zeit hingegen zog sich den ganzen Tag hin, nur unterbrochen von gelegentlichem „Trump-Watching“ am Fernseh-Bildschirm.
Wir drei Frauen aber genossen den Bummel durch den schönen Park bei milden Temperaturen.
Am Abend waren wir bei Lindenmanns Nachbarn zu einer Christmas-Party eingeladen. – Von da an ging’s amerikanisch zu, amerikanischer geht’s nicht. Für uns ein ziemlicher Kultur-Schock. Bob, den Gastgeber, trafen wir eine Stunde vor Beginn des Geschehens völlig gestresst vor der Haustüre an. – Kein Wunder!
Was da alles hatte organisiert werden müssen, damit es den vielen illustren Gästen wohl ist: Valet-Service (betreut von zwei Angestellten), damit niemand Parkplatzsorgen hat, eine Sängerin, die von der Galerie aus die Gäste beschallt und zum Tanzen animiert, damit sowohl weihnachtliche wie auch Party-Stimmung aufkommt, eine Bar mit dem dazugehörigen Barkeeper und allen Alkoholika, die das Herz und die Leber begehren, damit niemand Durst leiden muss, eine Handvoll weitere Angestellte vom Caterer-Service, die die Gäste mit Champagner empfangen und mit feinen Häppchen versorgen, damit gleich von Anfang an alles glatt läuft, und die zu gegebener Zeit alle diese Köstlichkeiten wieder abräumen und das Buffet für den Hauptgang parat machen, danach auch das alles wieder ver- und entsorgen, damit das Dessertbuffet aufgestellt werden kann, damit niemand Hunger leiden muss.
Hui. Und das ist noch nicht alles. Die ganzen Weihnachtsdekorationen… Glitzer und Glimmer, Lämpchen, Lichter und Farben, der obligate Tannenbaum draussen und drinnen, Kränze und Schleifen. – Der arme Bob. Wie froh muss der gewesen sein, als er alle Gäste wieder los war.
Und was alles vom Buffet übrig blieb, hätte für eine weitere Party problemlos gereicht: Silvia und Bob würden für die nächsten Wochen sicher nichts mehr einzukaufen brauchen.
Mit vollem Magen und interessanten Eindrücken verliessen auch wir das gastliche Haus gegen elf und legten uns im wunderbar kahlen und stylishen Haus unserer Freunde erneut ins bequeme Bett.
Am nächsten Morgen wollten wir um elf spätestens weiterfahren, aber ausschlafen, ein weiteres feines Frühstück gemeinsam geniessen und angeregte Gespräche liessen uns fast bis um zwei Uhr nachmittags in der gemütlichen Stube sitzen.
Die Fahrt an die Westküste auf der Route 41 durch die Everglades dauerte zweieinhalb Stunden, begleitet im Radio von Weihnachtsrock und –pop ohne Ende. Ein Unterbruch in „Joanie’s Blue Crab Cafe“ (was für ein Schuppen!) liess keine Zweifel mehr aufkommen: Jetzt sind wir in Amerika angekommen! - Die Wirtin in ihren viel zu engen, viel zu kurzen Shorts, dem viel zu engen T-Shirt (wer weiss, ob es ihr vor zwanzig Jahren besser gestanden hätte) und dem kleinen Schürzchen mit dem amerikanischen Wappen drauf, unter dem sie das Portemonnaie verbarg, begrüsste uns überschwänglich und lud uns ein, etwas zu essen und zu trinken. „My darling, let me know, what I can do for you”, auch mit „honey“ und „my love” sprach sie mich an. Das ist hier ja alles völlig normal, aber dass sie mich einmal (sie ist sicher mindestens zehn Jahre jünger als ich) mit „my daughter” ansprach, kam mir schon etwas merkwürdig und „over the top” vor. – Nun, die Crab-Soup, die sie Theo servierte, war tatsächlich ausgezeichnet. Alles könne ich von ihr haben, liess sie mich (her daughter) wissen, nur nicht ihren Koch. – Auf ihn mit seiner dreckigen Schürze hätte ich trotz der Suppe verzichten können; das sagte ich aber nicht, dachte es nur.
Wir fuhren weiter, immer noch den Weihnachtssound im Ohr.
Das Haus, das wir in Bonita Spring antrafen, hat unsere Erwartungen übertroffen: grosszügig und geschmackvoll eingerichtet, eine riesige Küche, erstaunlicherweise sehr gut ausgerüstet, unzerkratzte Bratpfannen, scharfe Rüstmesser, zehn Betten, drei Badezimmer, ein Swimmingpool und sogar ein geschmückter Tannenbaum – all das erwartete uns.
Schön, hier ein paar Tage lang zu wohnen und zu haushalten.
Das Wetter allerdings könnte etwas wärmer sein, Jacke statt Badehose war angesagt bei unserem Spaziergang am Strand entlang. Die unzähligen Muscheln, die dort liegen (250 verschiedene Arten soll’s in dieser Gegend geben, hab ich gelesen), lassen mein Muschelsammler-Herz höher schlagen, aber wenn ich dann an unsere Koffer und an die damit verbundene Gewichtsbeschränkung denke…
Naples ist eine halbe Stunde von hier entfernt. Ein Spaziergang auf dem Pier am späten Nachmittag ist sehr erhol- und unterhaltsam. Fischer, Surfer, Pelikane und anderes Gefieder kann man beobachten und anschliessend durch die historische Altstadt (!!!!) zu schlendern, ist ein Vergnügen. Alles ist äusserst gepflegt und macht einen gemütlichen Eindruck. Bei Nacht sind sämtliche Palmen mit zahllosen Lämpchen beleuchtet (es weihachtet SEHR). Es hat verschiedenste Shops, Galerien und so viele einladende Restaurants, dass man vor lauter Auswahl gar nicht weiss, in welchem man essen soll. Wir wählen zur Abwechslung ein thailändisches. Dessert dann bei Tommy Bahama, ein Muss, wie alle meinen.
Noch immer ist es von der Temperatur her möglich, draussen zu sitzen. – Wir geniessen es!
Fort Myers ist ein wenig anders. Der Charme von Naples fehlt, es hat dort zwar ebenfalls eine Art Flaniermaile, aber die ist überhaupt nicht vergleichbar mit der von Naples.
Und was ganz anders ist als in Argentinien: Bereits vor sechs Uhr sind die Restaurants gut besetzt. Um neun schliessen die meisten bereits. Das ist dann, wenn weiter südlich das Geschehen erst beginnt.
Am Freitag endlich stieg die Temperatur wieder auf 28 Grad, aber leider war’s bedeckt und regnerisch. Ein Einkaufsbummel in den wohligen „Outlet-Kühlschränken“ kam grad gelegen. Man findet ja immer was, um den Koffer noch eine bisschen mehr zu belasten.
Farmers-Market-Besuch war am Samstag auf dem Programm. Da geh ich immer gern hin.
In der Nacht hatte es stark geregnet, aber nun war es einigermassen schön, also beschlossen wir, auf Sanibel-Captiva-Island zu fahren. Die Fahrt dorthin dem Meer entlang dauerte nur etwa eine Stunde. - Im Visitors‘-Center sind Spassvögel angestellt: Wir erhielten von ihnen einen Schneeschaber, der uns bei gelegentlichem Gebrauch zurück an die schöne Insel erinnern soll. Den haben sie offenbar parat, um ihn den „Snowbirds“ zu überreichen, den Besuchern aus den kälteren Landesgegenden, Kanada und Europa, die den Winter in Florida verbringen.
Auf Captiva fanden wir ein Restaurant direkt am Meer gelegen, einen englischen Pub, und dort verbrachten wir ein Zeitlang mit Mittagessen, Theo mit Siesta-Machen im Liegestuhl und ich mit Muschelsammeln am Strand.
Der Sonntag, unser zweitletzter Tag in Florida, bescherte uns doch noch einen Strandtag. Etwa vier Stunden lang liessen wir uns von der Sonne bräteln. Ein gutes Kilo Muscheln fand auch noch den Weg zurück an die Springs Lane 4021, nur ein kleiner Teil davon, die allerschönsten, allerdings in meinen Koffer.
Unser letztes Nachtessen verbrachten wir in einem hübschen Restaurant am Estuary.
Am nächsten Morgen, dem 17. Dezember, machten wir keine grossen Sprünge mehr, sondern begannen, langsam unsere Zelte abzubrechen. Mit Betonung auf langsam, denn unser Flug ging erst am Abend gegen acht Uhr, so hatten wir viel Zeit zum Packen - das letzte Mal während dieser Reise. Für die Rückfahrt nach Miami planten wir genügend Zeit ein, so dass wir ohne Stress die Heimreise antreten konnten. Und oh Wunder: Diesmal gelang es uns auf Anhieb, die Einfahrt für die Mietwagen-Rückgabe zu finden, so dass wir das fröhliche „Um-den-Flughafen-Herumkreisen“ für einmal vermeiden konnten.
So schön eine Reise auch war, der letzte Höhepunkt ist es, gesund wieder zu Hause anzukommen, mit vollem Koffer, unvergesslichen Eindrücken und Erinnerungen vom Besten.
Reisen 2019
Um Ostern herum verbrachten wir vierzehn sehr schöne Tage in München und Umgebung. Wir hatten zwei HomeExchange-Tausche, den einen in der Stadt selbst, den anderen am Starnberger See. Das Wetter war sommerlich warm, so richtig zum Biergarten-Erforschen geeignet.
Genau umgekehrt war unser Besuch im Piemont im Mai. Es regnete nur einmal. Aber der Zweck der Reise war vor allem, Eva und Ken zu besuchen, die dort ein Haus gekauft haben. Sie wollen in Zukunft einen Teil des Jahres in dieser einzigartigen Gegend in Italien verbringen. So werden wir sie wohl noch einige Male besuchen können. – Keine schlechte Perspektive...
So konnten wir dieses Jahr endlich den ganzen Sommer in Bern geniessen, im Marzili in meiner zweiten Heimat sozusagen.
Und bereits ist es Oktober, Zeit nach den Spanienferien die nächste Herbstreise anzutreten. Diese wird wie üblich zwei Monate dauern. Sie bringt uns mit einem Kreuzfahrtschiff von Genua aus nach Durban, Südafrika. - Einmal mehr. In der zweiten Hälfte der Reise wollen wir die Safari machen, die wir vor drei Jahren verpasst haben, weil Theo statt wilder Tiere nette Krankenschwestern um sich scharte...
Schlussbemerkung
Das Puzzle ist noch nicht zu Ende. Das Bild erkennt man zwar, aber es gibt noch etliche offene Stellen.
Inzwischen sind wir älter geworden. Das sieht man gut daran, dass unsere Kinder auch bereits um die Vierzig sind und sich das Gespräch bei Einladungen mit Freunden mindestens eine Stunde lang nur um Krankheiten dreht, obwohl alle sagen, darüber möchten sie sicher nicht berichten.
Auch bei mir haben schon gewisse Ersatzteile montiert werden müssen. Im rechten Fuss halten ein paar Nägel und eine kleine Metallplatte meine Knochen zusammen. Auch bin ich Besitzerin eines neuen Kniegelenks. Aber trotzdem beziehungsweise gerade deswegen kann ich fast wieder herumspringen wie ein junges Reh.
„In der Kürze liegt die Würze“ – das ist mir mit dem Rückblick auf mein Leben überhaupt nicht gelungen. Aber schliesslich bin ich ja bereits sechsundsechzig Jahre alt, da hat man halt einiges schon erlebt, obwohl, wie Udo Jürgens uns wissen liess, da das Leben erst an fängt. - Es wird sich zeigen...
Wir haben und hatten also bisher ein formidables, erfülltes und überaus glückliches Leben. Unserer ganzen Familie geht es gut und das Wichtigste: alle sind gesund.
Ich denke oft, unsere Generation hat die absolut beste Epoche in der vergangenen aber auch in der kommenden Weltgeschichte „erwischt“. Und in der Schweiz geboren zu sein, einem Land, wo Frieden und Freiheit herrscht, auch als Frau tun und lassen zu können, was man gerne möchte, gesund zu sein, weiss zu sein, keinen Krieg erlebt zu haben, keine Not, welcher Art auch immer, erleiden zu müssen, sich alles Erdenkliche leisten zu können, das sind Privilegien, die auf dieser Erde nicht überall gang und gäbe sind und die man nicht genug schätzen kann.
Es werden noch mehr Reisen folgen, wir hoffen es jedenfalls. So lange wir „zwäg“ sind, sind wir unterwegs und neugierig darauf, andere Menschen und Lebensarten kennenzulernen, fantastische Landschaften zu besuchen, Neues zu sehen und zu erleben. In dem Sinn:
Carpe Diem.

Erster Teil: KINDHEIT UND JUGEND (1953 – 1972)

Meine Familie
Grosseltern
Von meinen Grosseltern väterlicherseits weiss ich so gut wie gar nichts. Ich habe sei nie kennengelernt. Ganz offensichtlich stimmte die Chemie zwischen ihnen und meiner Mutter überhaupt nicht. – Das einzige winzige Detail, das sie mir erzählt hat, ist das folgende: Als meine Schwester zur Welt kam (sie ist zwölf Jahre älter als ich), habe die Schwiegermutter ihr als „Geschenk“ ein Stück Zwetschgenkuchen ins Spital gebracht…
Wenn eine solche Episode die einzige Erinnerung beziehungsweise die einzige überlieferte Begebenheit ist, von der man weiss, dann gibt das zu denken. Schliesslich handelt es sich bei den Grosseltern doch um nahe Verwandte, die man eigentlich kennen sollte. – Und wenn ich mir vorstelle, meine eigenen Enkelkinder hätten später mal keine Ahnung davon, wer wir sind, wer wir waren, mein Mann und ich, wie wir leben und gelebt haben, was uns wichtig war und was nicht – dann wäre das doch durchaus ein Grund, sich im Grabe umzudrehen.
Damit das nicht passieren muss, widme ich diesen Text den beiden Mädchen unserer ältesten Tochter Kay:
Ella Sofia (geb. 31.06.2010) und Amy Lynn (geb. 22.05.2013).
Ebenfalls dem Jungen unserer jüngeren Tochter Kim:
Teo Jaxx (geb. 18.08.2017)
und dem noch ungeborenen zweiten Kind von Kim, das im November 2019 auf die Welt kommen wird.
(Gerade eben ist der Junge geboren worden, am 24. Oktober 2019. Er heisst Romeo Cruz und wiegt bereits 3,7 kg)
Es gibt noch weitere Gründe, weshalb ich mich entschlossen habe, bei „Meet-my-Life“ mitzumachen. Einer davon ist ganz banal: Ich schreibe gern.
Schreiben hilft, Erlebtes nochmals Revue passieren zu lassen, es zu verdauen und sich vielleicht erneut damit zu befassen.
Geschichten erfinden kann ich überhaupt nicht. Ich mag es aber, Situationen zu schildern, die mich in irgendeiner Weise angeregt haben, sie niederzuschreiben, damit ich sie nicht vergesse. So habe ich oft Episoden beschrieben, die ich mit meiner inzwischen längst verstorbenen Schwiegermutter erlebt habe oder auch Begebenheiten aus meinem Schulalltag. Gerne notierte ich auch, was unsere Kinder Lustiges sagten oder taten, als sie noch klein waren. Es wäre jammerschade, wenn das alles verloren wäre.
Heute schreibe ich vor allem Reiseberichte, denn wenn man unterwegs ist, erlebt man viel, vergisst aber auch manches wieder, wenn man es nicht festhält. Und das ist, wie bereits erwähnt, wie wenn es gar nie stattgefunden hätte. – Fotos sind zwar gewaltige Gedächtnisstützen, aber eben nur Momentaufnahmen. Eine Situation beschreiben ist etwas ganz anderes.
Nicht selten brauche ich übrigens berndeutsche Ausdrücke, manchmal sogar ohne Anführungszeichen. Das, weil sie exakt das aussagen, was ich fühle und wie es mich richtig dünkt.
Schon eine Zeit lang trage ich mich mit dem Gedanken, meine Reiseberichte und auch die anderen Texte in einem Buch zusammenzufassen, ergo: Hier habe ich die Möglichkeit, das eine mit dem anderen zu verbinden.
Den Streifzug durch mein Leben beginne ich mit meinen frühesten Erinnerungen an meine engste Familie.
Oma
Nur eine meiner Grossmütter habe ich gekannt: Oma – die Mutter meiner Mutter. Sie starb in Schaffhausen, als sie knapp achtzig und ich siebenjährig war, also im Jahr 1960. Am besten beschreibe ich sie aus meiner damaligen Warte:
Schwarz gekleidet sass sie in ihrem Sessel, grobe, graue Strümpfe trug sie und an den Füssen warme Finken aus Filz. Ihr weisses, schütteres Haar, das in kleine Löckchen frisiert war, hatte sie notdürftig zu einem spärlichen Dutt am Hinterkopf zusammengebunden. Was mich besonders faszinierte, waren die Bartstoppeln, die an ihrem Kinn spriessten. Für mich war sie der Inbegriff einer Greisin. - Ihre Hände zitterten ständig – ein weiteres Merkmal, das ich damals nicht einordnen konnte. Sie sprach deutsch, Hamburgerdialekt, und obwohl sie schon seit Jahren in der Schweiz bei ihrer zweitältesten Tochter Wally lebte, sprach sie kein Wort Schweizerdeutsch und gab auch vor, nichts davon zu verstehen.
Zum Frühstück ass sie Brot und Zwetschgenkonfitüre. Ausschliesslich, stur. Nie hätte sie einen anderen Brotaufstrich probiert. „Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht.“ Das war ihre Devise und daran hielt sie sich strikt.
Eine weitere Erinnerung aus meinen Ferien in Schaffhausen:
Tante Wally bat mich, Omas Bluse zu holen, damit sie diese waschen konnte. Ich ging also zu ihr ins Zimmer und bat sie: „Oma, gib mir deine Blause“. Sie hat sehr gelacht und ich war überaus beleidigt. „Bluse“ fand ich absolut nicht dem deutschen Sprachsound entsprechend und das erklärte ich den beiden Frauen auch (man sagt doch auch „Pause“ und nicht „Puse“). Dass dann auch noch meine Tante lachte, machte die Sache für mich nicht besser, führte aber dazu, dass ich dieses Erlebnis nie vergass.
Manchmal hat sie mir aus ihrem Leben erzählt, aus der Zeit rund um den ersten Weltkrieg, als sie noch jung war und in Deutschland lebte. Ein paar ihrer Erlebnisse sind mir im Gedächtnis geblieben, weil sie mich tief bewegt haben und ich sie wohl auch nicht richtig begreifen konnte. Sie muss in einer kinderreichen Familie aufgewachsen sein. Von drei oder vier ihrer Brüder berichtete sie mir. Der eine sei an Cholera gestorben, ein anderer in russischer Gefangenschaft umgekommen, ein dritter nach dem Krieg bei ihr aufgetaucht; er habe kaum mehr gehen können. Während längerer Zeit habe er in einer Grube hausen müssen, und damit er und seine Kameraden nicht hätten fliehen können, habe man ihnen die Achillessehnen durchtrennt. - Solche Gräuelgeschichten musste ich als Sechsjährige verdauen. Vielleicht hat sie mir auch noch andere, schönere Dinge erzählt, meine Oma. Daran kann ich mich aber nicht mehr erinnern.
Meine Mutter erzählt aus ihrer Kindheit und Jugend
Auch meine Mutter hat mir oft aus ihrem Leben erzählt. Geboren wurde sie am 7. Juli 1911 in Hamburg, also kurz vor dem ersten Weltkrieg.
Das Leben in der Stadt muss nicht einfach gewesen sein zu jener Zeit, aber an Einzelheiten aus ihren Schilderungen erinnere ich mich kaum mehr. Erst viel später, als ich selber schon erwachsene Kinder hatte und mich für das Leben meiner Mutter zu interessieren begann, reute es mich, dass ich ihr nicht besser zugehört hatte, als sie von früher erzählte. Das wollte ich nachholen, was mir allerdings nur mit mässigem Erfolg gelang.
Sie war bereits im Altersheim, als ich sie mit Notizblock und Tonband bewaffnet besuchte und bat, mir nochmals aus ihrer Kindheit und Jugend zu berichten. Das war nicht die beste aller Ideen. – Einerseits liess die Qualität der Tonaufnahme auf meinem einfachen Kassettenrecorder mehr als nur zu wünschen übrig, und andererseits, was das Schlimmste war, Mam war emotional so erschüttert über ihre eigene Geschichte, dass sie zu weinen begann und gar nicht mehr weitererzählen wollte.
Einzig das, was sie von ihren Ferien auf dem Lande berichtete, konnte ich zuvor im Detail aufschreiben, da ihr diese Erinnerungen nicht so sehr zusetzten.
Aus diesem Grund gebe ich den nächsten Abschnitt in der Ich-Form wieder, so wie sie erzählte:
„Nach dem Krieg durfte ich oft Ferien bei Verwandten verbringen, nämlich in Mecklenburg, Schönberg, in der Nähe von Lübeck.
Wilhelm, der Grossonkel meiner Mutter, besass dort ein Haus auf dem Land. Er war Viehhändler und hatte zwei Söhne, Willy und Hans. Hans war nicht ganz „hundert“, aber ein sehr liebenswürdiger junger Mann.
Willy heiratete dann Lene Ohlroggen. Bei ihnen fühlte ich mich wohl und ich durfte manchmal mehr als eine Wochen dort bleiben.
Das Land war eben, überall hatte es Wiesen mit wunderschönen gelben Glockenblumen; man sah den Kirchenturm von Lübeck. - Im Haus hatte es kein fliessendes Wasser. Ich sehe noch den Schrank vor mir, in dem grosse Schüsseln mit Milch drin standen, wo täglich der Rahm oben abgeschöpft wurde“.
Aus ihren Berichten musste ich schliessen, dass sie mit ihrer Mutter, meiner Oma, nicht die beste Beziehung hatte. – Sie fuhr weiter:
„Einmal kam meine Mutter mich abholen. Meine Cousine Luise (sie machte den besten Streuselkuchen weit und breit) und die Erwachsenen sassen im Wohnzimmer und schwatzten noch. Ich und Mariechen, ein etwa gleichaltriges Nachbarskind, wir vergnügten uns draussen. Ich hatte schon das Sonntagskleid an, bereit zur Abreise. Unglücklicherweise fiel ich beim Spielen in einen Bach. Mariechen nahm mich mit zu sich nach Hause, gab mir frische Unterwäsche und gemeinsam rangen wir das nasse Kleid aus. Aber natürlich merkte meine Mutter sofort, was passiert war, und zur Strafe fuhr sie alleine heim nach Hamburg – ich blieb zurück. Ohne Essen wurde ich ins Bett geschickt und erhielt nur eine Tasse warme Milch, was ich ja aufs Höchste verabscheue.
Am nächsten Tag musste ich alleine mit dem Zug heimreisen.“
Auch von einem Spitalbesuch erzählte sie. Sie war damals siebenjährig:
„Ich musste mir Polypen aus der Nase wegmachen lassen. Nach der Operation wachte ich in einem Zimmer auf, in dem auch vier Frauen untergebracht waren. Alle waren sehr nett zu mir und die eine zeigte mir, wie man aus Postkarten Puppenbettchen anfertigen kann. Ich war fasziniert von dieser Tätigkeit. Als mich nach wenigen Tagen meine Mutter im Spital abholen wollte, versteckte ich mich und sie zog ohne mich von dannen. Am nächsten Tag allerdings funktionierte dieser Trick leider nicht mehr.
Es muss im Jahr 1925 gewesen sein, kurz nach der Inflation, als ich in die Ferien nach Zürich geschickt wurde. Kaum angekommen, erhielt ich die Nachricht, die ganze Familie ziehe um in die Schweiz, ich solle gar nicht mehr nach Hamburg zurückkehren. - Und so habe ich zum ersten Mal alles verloren, denn weder meine Mutter noch meine Schwester Wally kümmerten sich um meine Habseligkeiten – nichts, was mir gehörte, brachten sie mit.
Erst lebten wir in Zürich, dann in Schaffhausen. Dort gingen wir beide in die Sekundarschule. Wally hatte einen netten Lehrer (sie hat ja immer das bessere Los gezogen), aber mein Lehrer, Herr Isler, war ein Ekel. Nie mehr vergesse ich, wie er jeweils zur Klasse sagte: „Jetzt liest Irène. Hört gut zu; da gibt es wieder etwas zu lachen“. - Natürlich machte mir der Dialekt am Anfang grosse Mühe.
Nach zwei Jahren war die Schule zu Ende. Meinen Vater sah ich selten. Auch die Mutter wusste nicht, wo er war. Geld von ihm erhielten wir so gut wie nie. Ich musste arbeiten gehen; die Mutter wollte es so. Die Korsettfabrik Bachmann suchte Arbeiterinnen. Den ganzen Tag lang musste ich Strumpfhalter an den Korsetts annähen, immer dasselbe. Es gab Nähmaschinen mit einer Nadel, mit zwei und dann sogar mit drei. Bald schon wurde ich an eine Maschine mit zwei Nadeln befördert. Am Ende der Woche war Zahltag. Meine Mutter wartete dann mit Heini an der Hand, meinem damals vierjährigen Bruder, draussen vor der Tür und nahm die Lohntüte in Empfang. Kein Taschengeld, keinen einzigen Franken erhielt ich je für meine Arbeit“.
Da kam der Moment, wo ihre Erzählung ins Stocken geriet, wo sie so tief in die schmerzliche Erinnerung versank, dass sie nicht mehr weiter berichten wollte.
Aus meiner Erinnerung nun wieder die folgenden Gedächtnisfetzen:
Grossvater und seine Familie
Es musste ja einen Grund gegeben haben, weshalb die Familie meiner Mutter so plötzlich in die Schweiz übersiedelte. Offenbar war mein protestantischer Grossvater Vorsitzender einer katholischen Institution gewesen und als dieser „Betrug“ ans Licht zu kommen drohte, gab er Fersengeld. – Eher seltsam zu verstehen aus der heutigen Perspektive, aber damals...
Kennengelernt habe ich ihn nie, was, wie meine Mutter mir versicherte, überhaupt kein Verlust war.
Er war ja Schweizerbürger, und wie es dazu kam, dass er mit seiner Familie eine Zeitlang in Deutschland gelebt hatte, weiss ich nicht. Wann und wo er starb, ist mir ebenfalls nicht bekannt.
Offenbar war er ein Weiberheld, wie man dieses „Phänomen“ oder diesen Typ Mann früher politisch unkorrekt zu bezeichnen pflegte. So jedenfalls hat sie ihn mir beschrieben. Kaum zurück in der Schweiz, habe er sich von Oma (natürlich war sie damals noch alles andere als eine Oma) scheiden lassen.
So hatte meine Mutter kaum Kontakt zu ihren Vater, aber sie erinnerte sich an eine Begegnung am Bahnhof in Schaffhausen, als er sie vom Zug abholte (sie war damals etwa achtzehnjährig). Ein paar seiner Kollegen seien ebenfalls auf dem Bahnsteig gewesen und der eine habe laut und deutlich zum anderen gesagt: „Schau mal, der Spengler hat schon wieder eine Neue“.
Natürlich war auch meine Oma nicht zu beneiden in jener Zeit. Sie hatte kein Geld und keine Arbeit, lebte in einem „fremden“ Land, ihr Mann hatte sie verlassen; sie musste drei Kinder grossziehen, einen zweijährigen Buben (Franz Heinrich, genannt Heini, der später mein Götti wurde) und die beiden Mädchen Irène und Wally, vierzehn und dreizehnjährig. - Irène, die Älteste, hatte schon früh viel Verantwortung übernehmen müssen, während Wally als Mutters Liebling ständig bevorzugt wurde. So zumindest empfand meine Mutter die Situation, und das Gefühl, das fünfte Rad am Wagen zu sein, vom Schicksal stiefmütterlich behandelt, wurde sie zeitlebens nicht mehr los. Nebst der Tatsache, dass sie schon als Kind hatte Geld verdienen müssen, um mitzuhelfen, die Familie durchzubringen, war es auch ihre Aufgabe, manchmal den kleinen Bruder zu hüten, mit dessen Tobsuchtsanfällen sie ihre liebe Mühe hatte.
Irgendwann nach ihrer Schul- und Arbeitszeit in der Fabrik wohnte sie ein paar Monaten lang in Davos, wo sie eine Handelsschule besuchte.
Es war ein kalter Winter. Dort, wo sie wohnte, war’s kaum geheizt und sie sparte während Wochen für einen warmen Mantel. Als sie das Geld fast beisammen hatte, erhielt sie einen Brief ihrer Mutter, in welchem diese sie bat, ihr einen Betrag zwecks Zahlung der Heizkosten zu überweisen. - Sie schickte ihr Erspartes. Ihre Ausbildung musste sie kurz vor Abschluss abbrechen; sie konnte sie nicht mehr bezahlen.
Zeitlebens hegte sie einen unterschwelligen Groll gegen ihre jüngere Schwester, die in ihren Augen ein bequemes Dasein hatte führen können, verwöhnt worden war und ganz allgemein mehr Glück im Leben gehabt hatte als sie. - Ich mochte diese Tante, die auch meine Patin war, sehr. So war es mir oft peinlich, wenn meine Mutter sie aus heiterem Himmel mit irgendwelchen Vorwürfen oder versteckten Beschuldigungen, die meiner Meinung nach absolut haltlos waren, anfeindete.
Ich greife nun ein wenig vor:
Beim Sterben ging‘s in umgekehrter Reihenfolge: Erst starb Heini im Jahr 2003 im spanischen Denia, wo er schon seit über 20 Jahren gelebt hatte, an irgendeiner Krankheit. Drei Jahre später wurde Wally im Alter von 93 Jahren vor ihrem Altersheim mitten in der Stadt Schaffhausen hinterrücks überfahren und der Autofahrer oder die Autofahrerin fuhr einfach davon.
Schliesslich war die Reihe an meiner Mutter Irène. Sie starb am 28. März 2014 kurz vor ihrem hundertdritten Geburtstag an Altersschwäche in einem Pflegeheim in Ittigen, einem Vorort von Bern.
Nicht nur Dramatisches und Schlimmes hat meine Mutter erlebt und erfahren, auch Erfreuliches und Lustiges; allerdings mass sie dem leider nicht die gleiche Bedeutung bei.
Die „Geschichten“, die ich hier niederschreibe, an die ich mich mal besser, mal schlechter erinnere, haben den Mangel, dass mir deren Chronologie teilweise überhaupt nicht geläufig ist und mir oft die Verbindungslinks fehlen. So reihe ich Episoden aneinander, die sich zeitlich unterschiedlich ereignet haben, wie ein Puzzle, halt gerade so, wie sie mir in den Sinn kommen.
Mehr als einmal hat sie dasselbe erzählt und ich dachte und sagte manchmal: „Mam, diese Geschichte kenne ich bereits; die hast du mir schon hundertmal erzählt…“.
Zum Beispiel als sie in Besançon eine Aupair-Stelle bei einer Familie innehatte und miterleben musste, wie der Ehemann seine Frau mit einem Revolver hatte umbringen wollen. Die Waffe sei in einer Hutschachtel versteckt gewesen, die sie beim Aufräumen zufällig entdeckt hatte. Ein dramatisches Ende hat die Geschichte genommen, leider weiss ich die Einzelheiten nicht mehr, nur noch, dass meine Mutter kurzfristig den Zug nahm und zurück in die Schweiz floh, während der Monsieur von der Polizei verhaftet wurde. - Wenigstens war Mam lange genug bei dieser Familie beschäftigt gewesen, so dass sie hatte Französisch lernen können.
Englisch lernte sie dann auch. In der Nähe von London. Sie war 20-jährig, als sie mit einem Einweg-Zug-Ticket nach England fuhr. Im Gepäck hatte sie wenig, ein paar Kleider zum Wechseln nur und die Adresse, die man ihr in einem Englandstellen-Vermittlungsbüro gegeben hatte. In Hemel Hempstead stieg sie aus, einem ländlichen Ort nördlich der Hauptstadt. Niemand erwartete sie, die Adresse war falsch. Ein junger Mann aber, der sich zufällig am Bahnhof aufhielt und merkte, dass da etwas nicht stimmte mit der jungen Frau, fragte sie, wohin sie wolle. Er nahm sie dann in seinem flotten Sportwagen (davon schwärmte sie noch nach Jahren) mit nach Hause, einem Landsitz mit viel Umschwung. Die Eltern des Mannes meinten, eigentlich wären sie ganz froh um eine Haushaltshilfe und ein Kindermädchen und meine Mutter durfte bleiben. „Das war die schönste Zeit meines Lebens“, hat sie mir oft versichert, da habe sie mal endlich Glück gehabt.
Drei Jahre lang blieb sie dort. Sie durfte Autofahren lernen und als sie den Wagen einmal bei dichtem Nebel neben die Garage in eine Mauer gelenkt hatte, habe sie nicht Schimpf und Schande erfahren, sondern die Lady habe gesagt, es sei gut, dass nichts weiter geschehen und sie nicht verletzt sei.
Während ihres Aufenthalts besuchte sie Abendkurse in der Swiss Mercantile School in London und beschloss ihre Ausbildung später mit einem Diplom der Handelsschule Gademann in Zürich.
England und die Engländer hatten zeitlebens eine Art Heiligenschein für meine Mutter. Alles, was mit dem Vereinigten Königreich zu tun hatte, war gut und über alle Zweifel erhaben. – Einen „England-Fimmel“ habe sie, so scherzten wir jeweils.
Die ganze traurige „Brexit-Geschichte“ hat sie nicht mehr erlebt...
Sie hat später, als sie schon längst verheiratet war, selber ein Englandstellen-Vermittlungs-Büro betrieben. Das „Büro“ war in unserer bescheidenen 3-Zimmer-Wohnung an der Steinerstrasse 31 in Bern untergebracht: Verschiedene Ordner, Papier und Kugelschreiber, eine schwarze Schreibmaschine auf einem kleinen runden Tisch im Wohnzimmer.
Zurück in der Schweiz hatte sie ihre erste Anstellung bei der Direktion der Wengernalp- und Jungfraubahn.
Dass sie einen englischen Fahrausweis hatte, darauf war sie sehr stolz. Allerdings musste sie auch noch den schweizerischen Führerschein erwerben, das war aber kein Problem.
Jedenfalls hatte der Umstand, dass sie Autofahren konnte, ihr schliesslich auch eine Anstellung in Zurzach bei einer Familie Dr. Willimann eingebracht, wo sie ein Jahr lang von 1936 – bis 1937 arbeitete. Wie genau ihre Stellenbeschreibung ausgesehen hat, ist nicht ganz klar. Offenbar fungierte sie sowohl als Arztgehilfin, Sekretärin als auch als „Haus-Chauffeuse“ und durfte dort einen grossen Wagen fahren.
Bis zu ihrer Verheiratung im Jahr 1940 arbeitete sie als Redaktionssekretärin bei der Verlagsanstalt Ringier & Co. in Zofingen.
Im selben Jahr wurde sie für die Dauer von vier Monaten bei der eidgenössischen Kriegsmaterialverwaltung in Bern angestellt und anschliessend in verschiedenen Zeitabständen in der Sektion für landwirtschaftliche Produkte und Hauswirtschaft im Kriegsernährungsamt, wo ihr Chef Bundesrat F.T. Wahlen war.
Diese letzten Angaben habe ich in einem Lebenslauf gefunden, den sie, gerade Witwe geworden, im Jahr 1958 schrieb. Es gibt noch manches zu berichten über meine Mutter. In den nächsten Kapiteln. Hier vorgezogen ein Sprung ins Jahr 2006:
Ihren fünfundneunzigsten Geburtstag feierten wir im Schloss Schadau in Thun. Nebst meiner Schwester und meinem Schwager waren auch mein Mann und unsere vier Kinder dabei. – Es war das erste Mal, dass wir anschliessend das Gefühl hatten, es gehe ihr doch nicht mehr so gut wie früher. Sie ass fast nichts; die Hälfte ihrer geliebten Pommes-Frites blieb auf dem Teller übrig.

Meine Geschichte – Kindheit bis 1959
Eigentlich will ich ja über mich selber schreiben, aber der Einstieg fällt gar nicht so leicht, wie ich gerade feststelle. – Wer schon erinnert sich an seine Geburt?!
An einem kalten Tag im Februar 1953 kam ich in einem Spital in Bern zur Welt. Meine Mutter war damals bereits in ihrem zweiundvierzigsten Lebensjahr, hätte also ohne weiteres meine Grossmutter sein können, mein Vater mit seinen siebenundvierzig Jahren mein Opa. Eine Tochter hatten sie schon; meine Schwester war 1941 geboren worden. Mit einem weiteren Kind hatten die beiden nicht gerechnet. - Für mich war später immer klar, dass ich ein „Unfall“ gewesen war, was mich allerdings nie störte, denn ich hatte mich nie unwillkommen gefühlt.
Meine Schwester allerdings muss nicht grad vor Freude gejubelt haben ob meiner Ankunft. Sie war nie der mütterliche Typ, hat sich nichts aus Kindern gemacht, aus Babys schon gar nicht, und die Tatsache, dass sie die bisher uneingeschränkte Aufmerksamkeit der Eltern nun mit mir teilen musste, kam ihr äusserst ungelegen.
Mein Name
Meine Eltern gaben mir den Namen Isabelle. – Eigentlich hätte meine Mutter mich Catherine nennen wollen, schön Französisch ausgesprochen mit „C“. Eine Bekannte von ihr habe gesagt: „Ah, wie schön, äs Kätheli“ – da muss es meinen Eltern wie Schuppen von den Augen gefallen sein, dass es in Bern mit dem vornehmen „C“ nicht weit her ist. – Noch heute bin ich dieser Frau dankbar für ihre (ungewollte) Intervention, denn mit Isabelle bin und war ich immer glücklich und zufrieden. Und als die Kinder in meiner Klasse mich später „Ise“ nennen wollten, hörte ich einfach nicht hin. Auch darauf bin ich stolz, dass ich hartnäckig blieb und es mir gelang, das „durchzuziehen“, so dass mein Name nie zu einer Abkürzung verkümmerte oder zu einem Spitznamen verdreht wurde. - „Catherine“ ist mir als zweiter Vorname erhalten geblieben.
Taufe
An meiner Taufe trug ich ein weisses Kleidchen mit runden Stickereien. Meine Mutter hatte es auf ihrer Nähmaschine angefertigt; aus dem Rest des Stoffs hatte sie einen Lampenschirm gebastelt. - Es war mindestens zweimal so lang wie meine gesamte zarte Körperlänge und hing schleierartig an mir herunter. Das Kleid mahnt mich an das Gefieder eines Pfaus, der allerdings nicht gerade dabei ist, ein Rad zu schlagen. Auch stimmt das Bild nicht mit den Farben überein - bleibt also nicht mehr viel übrig von meinem Vergleich…
So verkleidet reichte man mich offenbar herum wie eine Trophäe von Arm zu Arm der anwesenden Damen, und in dieser Stellung wurden alsdann ein paar Fotos geknipst. Kein Bild existiert von mir auf den starken Armen eines männlichen Familienmitglieds.
Bei meiner Taufe muss ich nur ein paar wenige Monate alt gewesen sein, ich erinnere mich an das Gewand also nur wegen der Fotos und weil ich es Jahre später sorgsam aufbewahrt und schön zusammengefaltet in einer Kartonschachtel auf dem Estrich wiederfand. Durchs Alter war der Stoff allerdings ein wenig spröde geworden und hatte sich leicht dunkler verfärbt. - Meine Mutter hätte es gerne gesehen, wenn ich das Kleidchen für meine eigene Tochter ein weiteres Mal verwendet hätte, sechsundzwanzig Jahre später, aber das kam überhaupt nicht in Frage. Dieses weisse beziehungsweise inzwischen leicht beige Etwas wollte ich meiner Tochter keinesfalls antun. Auch ich hatte selber etwas produziert, ein farbiges Outfit, teilweise genäht, teilweise gestrickt, und genau das sah ich für Kays Taufe vor. – Heute muss ich sagen, wenn ich ehrlich bin, es war ziemlich scheusslich, da hätte sich das weissliche Teil noch fast besser gemacht…
Unsere drei Enkel sind alle nicht getauft worden, so ist also auch das Taufkleid-Thema gar nicht zur Sprache gekommen. So oder so wäre ich natürlich nicht in Versuchung geraten, das eine oder andere zu empfehlen.
Kindergarten
Drei Jahre lang ging ich in den Kindergarten, der sich direkt am Rand des Dählhölzli-Walds befand. Es war für mich eine glückliche Zeit. Ich habe recht viele Erinnerungen. Die Kindergärtnerin, Fräulein „Ptimerme“ (Petitmermet), wie wir den Namen in breitem Berndeutsch aussprachen, mochte ich sehr. Ich sehe mich noch immer im Kränzli sitzen und ihren Geschichten lauschen. Ihre Beine hatte sie beim Vorlesen oft verschränkt oder gar den rechten Fuss aufs linke Knie gelegt. So kam es vor, dass man unter dem glockigen Jupe ihre Unterhosen sehen konnte. Das war ein Gaudi für uns Kinder und wir kicherten und kicherten.
Es wurde viel gebastelt, gemalt, mit Kleister hantiert, mit den Holztieren und dem Stall gespielt. „Chöcherle“ am kleinen Herd oder „Chrämerle“ mit dem Mini-Krämerladen gehörten zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Mit Puppen hatte ich nichts am Hut. Auch zu Hause nicht. Ich hatte meine Stoffbären. Diese liebte ich heiss.
Fast jeden Tag, wenn das Wetter es erlaubte, gab’s Waldspaziergänge und wir bauten „Häuser“ aus Laub und Ästen. Bevor es losging, mussten wir im Garten beim Tor auf die Kindergärtnerin warten. Die Türe war in einen Zaun eingebracht, der mir damals sehr hoch erschien. Als ich Jahre später wieder durch dieses Tor trat, dachte ich erst, man hätte dort bauliche Veränderungen vorgenommen. Ich musste mich bücken, um es zu öffnen, aber merkte dann gleich, es war noch immer dasselbe „alte“ Tor.
Auch Theater wurden aufgeführt im Kindergarten. Stolz war ich, als ich die Rolle der bösen dreizehnten Fee im Dornröschen erhielt. – Einmal war ich auch Maria beim Krippenspiel zu Weihnachten. Diese Rolle fand ich zwar ebenfalls nicht schlecht, aber kein Vergleich mit dem dramatischen Auftritt in der Märchenaufführung. - Es war eine wunderbare und sorglose Zeit.
Als mein Vater im Jahr 1958 starb, wurde meine Mutter Witwe mit siebenundvierzig. Zwei Kinder im Alter von 17 und 5 Jahren hatten ihren Papi verloren. Es war eine schlimme Zeit. Wir waren ziemlich mittellos, Mam musste arbeiten gehen. Zum Glück erhielt sie die Stelle in der Bundesverwaltung, die mein Vater vorher innegehabt hatte. Natürlich nicht zum selben Lohn. - Dort arbeitete sie bis zur Pensionierung. Geheiratet hat sie nie mehr, ich glaube auch nicht, dass sie je einen Freund gehabt hatte.
An die Beerdigung erinnere ich mich kaum mehr. - Erst kürzlich wurde mir aber bewusst, weshalb ich die schönen Hortensien nie mochte: Diese Blumen zierten den Sarg und später das Grab.
Anstatt eingeschult zu werden, als reif genug hatte man mich eingestuft, durfte ich ein weiteres Jahr den Kindergarten besuchen. Meine Mutter hatte das so beschlossen, weil sie wusste, wie sehr es mir dort gefiel und sie mir nicht eine zusätzliche Veränderung zumuten wollte.
Mein Vater
Meine früheste Erinnerung war einschneidend. Ich war kaum drei Jahre alt:
Ich stehe im Schlafzimmer meiner Eltern. Vor mir eine Kommode mit einem Dreifach-Spiegel. Ich trage ein dunkelgrünes Manchester-Kleidchen mit Trägern und kleinen, feinen, hellen Punkten drauf. Mein Vater steht hinter mir neben seinem Bett. Auf einmal fällt er um. Ich seh’s im Spiegel und ich schreie. – Was weiter geschah, weiss ich nicht. Wohl war es sein erster Schlaganfall, bereits ein Anzeichen dafür, dass er ernsthaft krank war.
Es ist nur gerade dieses Bild, das sich in mein Gedächtnis gebrannt hat. Und dann später noch ein anderes.
Im Juni 1958: Zwei Sanitäter tragen meinen Vater auf einer Tragbahre das Treppenhaus hinunter. Ich stehe vor der Tür zu unserer Wohnung im zweiten Stock. Er lächelt gequält, stütz sich auf seinen linken Arm und winkt mir mit der rechten Hand zu. Ich winke zurück. – Das war das letzte Mal, dass ich ihn sah.
Er starb nach einer sechsstündigen Operation im Spital. Seine Nieren hatten versagt, die Aorta war gebrochen. Sein Hausarzt hatte all die vielen Monate vorher nicht gesehen, wie es um ihn stand und hatte ihn nur mit Medikamenten behandelt. - Auf meine Mutter, die ihn mehrmals gebeten hatte, einen anderen Arzt zu konsultieren, hatte er nicht gehört. Er habe das als Vertrauensbruch eingestuft… Erst als sie Jahre später mit Genugtuung die Todesanzeige des besagten Arztes in der Zeitung las, konnte sie ihre ohnmächtige Wut, ihren abgrundtiefen Hass und ihre tiefe Verzweiflung allmählich ablegen.
Das „Konzept“ des Todes ist für ein fünfjähriges Kind nicht fassbar, genauso wenig wie die Vorstellung, wie die Musik in eine Schallplatte hineinkommt. Meine Mutter erklärte mir, Pap sei nicht mehr da, ich würde ihn nie mehr wiedersehen, und dann die Erklärung, die keine Fragen mehr offenlassen soll, aber hundert Fragen auslöst: „Er ist im Himmel“. – Der blaue oder manchmal graue Deckel da oben? – Wie kam er dahin? – Wieso ist er dort? – Was macht er dort? - Viele Nächte lang weinte ich und hielt die Sehnsucht nach ihm kaum mehr aus, wenn ich an der Hand meiner Mutter an seinem Grab stand. Mehr als einmal kam es vor, dass sie einer Fremden, die fragte, was denn passiert sei, die ganze traurige Geschichte im Detail schilderte. Von da an wollte ich nicht mehr auf den Friedhof mitgehen. Sie akzeptierte das und versprach, das Brieflein, das ich ihm schrieb, bei seinem Grabstein zu vergraben.
Erst 55 Jahre später, als meine Mutter starb und meine Schwester das Grab meines Vaters auf den Friedhof in Bolligen neben dasjenige unserer Mutter transferieren liess, stand ich erneut vor seiner allerletzten Ruhestätte.
Pilze sammeln gehen war eine seiner bevorzugten Beschäftigungen in der Freizeit. Manchmal durfte ich mit. Mit dem blauen Worb-Bähnli fuhren wir bis Gümligen in den Hüenliwald. Eine Szene ist mir noch ganz klar im Gedächtnis: Er ging vor mir her, hatte, wie es seine Gewohnheit war, seine Hände hinter dem Rücken zusammengefaltet. Den wunderschönen gelben Eierschwamm, der aus einem zarten Beet von grünem Moos herausschaute, sah er nicht, spazierte an ihm vorbei. – Das war meine Sternstunde. Ich hatte ihn entdeckt und wurde für den Fund gebührend gelobt.
Ganz wenige weitere Erinnerungen habe ich, die aber darauf zurückzuführen sind, dass Fotos existieren. Auf einem Bild ist er mit meiner Mutter zu sehen. Sie reicht ihm nur bis zur Schulter. Er war 1,85 cm gross, was damals eine ziemlich unübliche Körpergrösse war. Aus diesem Grund hatte er offenbar während der Kriegszeit auch zusätzliche Lebensmittelgutscheine erhalten.
Dank der Fotos habe ich auch nicht vergessen, wie er aussah. Auf meinem Nachttisch steht nach wie vor ein Porträt von ihm und es kommt mir seltsam vor, dass er darauf etwa fünfzehn Jahre jünger ist als ich es jetzt bin.
Unsere Wohnung – unser Quartier
Das Haus, in dem ich aufgewachsen war, wurde kurze Zeit später abgerissen. Es musste einem weissen, modernen Bürogebäude Platz machen, welches in keiner Weise ins Quartier passt. All die anderen Häuser in unserer Strasse stehen noch immer dort. Von unserem Balkon aus, wo eine Zeitlang ein grosser Wellensittich-Käfig stand, sah man aufs gegenüberliegende Haus, das mir mit seinen grossen Terrassen und den beiden runden Fenstern wie eine Art Herrschaftswohnsitz vorkam.
An unsere Wohnung erinnere ich mich ebenfalls noch erstaunlich gut. Im Wohnzimmer hatte es zwei Fauteuils, einen Tisch und das „Büro“ meiner Mutter mit der Schreibmaschine und den Ordnern. An der Wand ein Büchergestell.
Manchmal spielte mein Vater Ball mit mir, wenn er abends nach der Arbeit heimkam. Wir setzten uns vis-à-vis voneinander auf zwei Stühle, zwischen uns ein runder Papierkorb. Dort hinein musste ich den Ball werfen.
Auch an die Toilette erinnere ich mich kurioserweise, an die beiden WC-Rollen, die je an einem Halter übereinander an der Wand angebracht waren. Mein Vater benutzte eine andere als wir. Eine aus Pergamentpapier oder so ähnlich. - Sehr seltsam, wenn ich mir das heute so überlege. Ob es derartiges Papier überhaupt noch gibt? Das muss ja nicht gerade schmeichelhaft gewesen sein für einen zarten Hintern, sondern eher „schmirgelhaft“. Und wieso diese eigenartige Papierart von meinem Vater bevorzugt wurde, kann ich mir auch nicht erklären.
Wir besassen auch einen Plattenspieler („His Master`s Voice“ mit dem kleinen Hund als Logo), einen Grammophon also, wie damals üblich mit Kurbel, einem grossen trichterförmigen Lautsprecher und einem Hebelarm, an dem die Nadel dran war, die dann behutsam auf die Schallplatte hinuntergelassen wurde. Dieses Gerät durfte ich keinesfalls anrühren. Das machte mir meine Schwester unmissverständlich klar.
Keine Zweifel gab es für mich auch, dass in den schwarzen Scheiben drin ganz kleine Musiker mit ihren noch viel kleineren Instrumenten sassen, welche die Musik abspielten.
In diesem Zusammenhang kommen mir auch die beiden Langspielplatten in den Sinn, die ich wohl mal zu Weihnachten erhalten hatte. Grimm-Märchen waren darauf eingebrannt, erzählt von Trudi Gerster. Ihre unverkennbare Stimme habe ich noch heute im Ohr, wenn ich daran zurückdenke. Unvergesslich der Dialekt, der mich so komisch dünkte. Wie oft wohl habe ich mir die Geschichten angehört?
Ein Erlebnis, das ich genau datieren kann, erfolgte im Jahre 1956. Meine Mutter und ich, wir waren auf dem Weg in den Keller. Kirchturmglocken läuteten und Mutter wies mich an, nun einen Moment lang stehen zu bleiben und ganz ruhig zu sein. – Es handle sich um eine Schweigeminute im Gedenken an den Ungarn-Aufstand. „I cha aber nid – mini Ohre töne drum“, sagte ich. An diesen Wortlaut erinnere ich mich ganz genau. – Vielleicht war’s das Glockengeläut, das in meinen Ohren nachhallte. Jedenfalls war’s mir absolut ernst mit meinem Einwand.
Im Keller gab’s eine Waschküche: ein Trog, ein Reibbrett, Waschpulver, Bürsten, Lumpen, Wäscheleinen, die von einer Wand zur anderen an der Decke entlang gespannt waren und ganz modern – eine schwere, runde, braun-metallene Maschine zum Auswinden der nassen Wäsche.
Auch ein Kohlenkeller war vorhanden. Von dort musste die Kohle jeweils in die schwarzen Blechkübel geschaufelt und in die Wohnung hinaufgetragen werden. Meine Mutter schimpfe nicht selten wegen dieser schweren Arbeit und fand, die beiden jungen Männer, die zusammen mit ihren Eltern im ersten Stock wohnten, könnten ihr doch hin und wieder mal dabei behilflich sein. – Ich glaube nicht, dass das je stattfand, vermutlich hatten die beiden auch keinen Anlass und Freude schon gar nicht, uns etwas zuliebe zu tun.
Im dritten Stock oben wohnte eine Familie, die ich von Herzen mochte und sie mich offenbar auch. Die Eltern nannte ich „Mueti“ und „Vati“. Ihre Tochter und ihr Sohn waren bereits erwachsen. Sehr viel Zeit verbrachte ich dort oben, liess es mir gut gehen, Mueti verwöhnte mich mit feinem Essen; sie war eine ausgezeichnete Köchin. Mehr als nur gut schmeckte mir ihr Sonntagsbraten, die dunkle, delikate Sauce dazu und der göttliche Kartoffelstock.
Auch sie hörten gerne Schallplatten. Uns allen gefiel am besten: „Äs isch ja nur äs chlyses Tröimli gsy“. Unzählige Male hörte ich dieses Lied und sang mit, bis ich den ganzen Text auswendig konnte. – Wenn ich heute daran denke, wo mir Rock und Pop gefällt…
Mueti und Vati hatten jeweils während der Sommermonate ein bescheidenes Ferienhaus gemietet, in Sigriswil oberhalb des Thunersees, und dann und wann durfte ich ein Wochenende oder gar ein paar Tage in den Ferien mit ihnen dort verbringen. Das sind fantastischer Erinnerungen. Das „Hüsli“, wie sie es nannten, war nur zu Fuss erreichbar. Vom Parkplatz aus musste man mit Sack und Pack durch ein steiles Waldstück pilgern, bis man auf eine grosse Wiese gelangte, wo hin und wieder Kühe und Schafe weideten und an deren oberem Rand allein und verlassen die einfache Hütte stand. Schon nur diesen „Aufstieg“ empfand ich als abenteuerlich. Strom hatte es keinen, Kerzen aber schon und einen Gaskocher. Die Toilette befand sich draussen in einem am Haus angebauten Bretterverschlag, nicht viel mehr als eine Latrine eigentlich. Aber der Aufenthalt im Hüsli war ein Traum. Ein wunderbarer Traum. Die Aussicht auf den Niesen am gegenüberliegenden Ufer des Thunersees war spektakulär, jeden Tag anders, bei jeder Witterung bot sich ein neues Bild, manchmal bei Nebel auch gar keines. Und die Wiese vor der Hütte eignete sich bestens zum Hinunterrollen durchs hohe Gras und die duftenden Blumen, vorbei an den Kuhfladen und Disteln. Sich draussen am Trog zu waschen, bevor man schlafen ging, auch das gehörte zum ausserordentlichen Erlebnis, genauso wie das Eintauchen ins hölzerne Bett mit seinem rot-weiss karierten Kissen- und Duvet-Anzug.
Vati übrigens war als Arbeiter in der Waffenfabrik in Bern angestellt. – Ich stellte mir vor, es sei ein Ort, eine Art Grossküche, wo Waffeln produziert würden. – Etliche Jahre später wurde ich eines Besseren belehrt. Es stellte sich heraus, dass der Direktor der eidgenössischen Waffenfabrik der Vater meines Freundes war, meines jetzigen Ehemanns, also Vatis Chef.
Ganz in unserer Nähe, in einem Haus an der Hauptstrasse, in dem unten ein Ladengeschäft einquartiert war, wohnte eine Frau, die Kinder und Katzen sehr gerne mochte. Beide gingen jederzeit ein und aus bei ihr; wir Kinder trafen uns manchmal nach dem Kindergarten in ihrem Wohnzimmer oder in der Küche und erhielten zum Zvieri leckere Cenovis-Schnitteli.
Fast noch mehr jedoch liebte ich das Schoggi-Spiel, ein Würfelspiel, bei dem es darum ging, möglichst viel von der Tafel Schokolade essen zu können, die mitten auf dem Tisch lag. Wer von uns Kindern eine Sechs würfelte, musste zu Beginn eine Serviette anziehen und durfte alsdann mit Messer und Gabel erst mal die Verpackung öffnen, bevor’s in medias res ging, man endlich ein Stückchen vom Nektar abschneiden und zu Munde führen konnte. Wenn’s denn überhaupt so weit kam. Würfelte ein anderes Kind gleich darauf ebenfalls eine Sechs, musste man Serviette und Besteck abgeben und die Schokolade weiterreichen. - Der totale Stress also. - Die gute Frau hiess Engler und heute denke ich, nomen est omen. Sie hatte selber eine Tochter und einen Sohn, aber die waren schon älter und traten kaum in Erscheinung.
Das Allerinteressanteste aber war, Familie Engler hatte bereits damals einen Fernseher. Schwarz-weiss natürlich. Am Dienstag wurde nicht gesendet, aber an den anderen Nachmittagen gab’s gelegentlich Fury oder Lassie zu sehen, zwei Serien, die bei mir ziemlich gemischte Gefühle weckten. Einerseits faszinierten mich der Bildschirm und die Geschichten an sich, andererseits machte mir das Geschehen Angst und ich schaute verstohlen weg, wenn’s gefährlich wurde, und das war nicht selten.
Die Hauptstrasse, an der die Englers wohnten, war eine Ladenstrasse, im Gegensatz zu heute allerdings nur spärlich befahren. Beim Metzger, in der Molkerei, in der Bäckerei und im kleinen Konsum war alles erhältlich, was man brauchte. Das Beste waren die Eisrölleli für zehn Rappen, ein Wassereiscrème, das einfach himmlisch war, leider aber nirgendwo mehr erhältlich ist.
Was man heute nicht mehr sieht, sind die Kutschen, die Bierfässer geladen hatten und von grobschlächtigen, muskulösen Gäulen gezogen wurden. Eine Tramlinie führte damals schon durch die Thunstrasse.
Eine Episode, in welcher das Tram eine Rolle spielt, kommt mir soeben in den Sinn:
Ich spiele im Wohnzimmer, meine Mutter ist damit beschäftigt, Vaters Hemden zu bügeln. Ich langweile mich ein bisschen, habe dann aber die Glanzidee, den Schulsack meiner Schwester anzuziehen und meine Mutter dahingehend zu informieren, dass ich im Sinne habe, in die Schule zu gehen (meine Schwester ging zu jener Zeit in der Stadt ins Progymnasium). Sie nickt und gibt ihr Einverständnis, was mich ein wenig erstaunt, ist es mir nämlich ernst mit meinem Vorhaben. Trotz Sonnenscheins nehme ich ebenfalls den vielfarbigen Kinder-Regenschirm mit, den ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. – So ausgerüstet begebe ich mich also zum Thunplatz und da kommt auch schon das Tram. Ich steige ein und setze mich.
Damals waren die Tramwagen mit zwei Plattformen ausgestattet, eine hinten, eine vorn, wo’s Stehplätze hatte. In der Mitte des Wagens befanden sich zwei gegenüberliegende lange Holzbänke, auf denen die Passagiere Platz nehmen konnten. In jedem Wagen gab’s einen Kondukteur, der die Billette verkaufte und kontrollierte. Seine Kasse aus Metall, die mit vielen kleinen Abteilen ausgestattet war, in welche die einzelnen Münzen passten, war an einem Ledergurt um seine Hüfte geschnallt.
Er merkt sofort, dass etwas nicht stimmen kann mit der kleinen Kindergärtnerin, die ganz allein unterwegs ist. Er fragt mich, wo Mama sei und wo ich hin wolle. „In die Schule“, sage ich. Ein paar Frauen beginnen zu lachen; sie amüsieren sich köstlich auf meine Kosten. Sie gehen mir so was von auf die Nerven. Ich bin total beleidigt. Der Kondukteur ist sehr nett zu mir und fragt, wo ich lieber hin wolle, zum Zytglogge oder zum Bahnhof. „Zum Bahnhof“ sage ich, denn das sind zwei Stationen weiter. Dort steigt der Beamte mit mir aus und im „Tramhüsli“, das sich zu der Zeit noch auf dem Bahnhofplatz befand, fragt er nach meinem Namen und der Telefonnummer. Die kann ich auswendig, meinen Namen sowieso. – Er ruft meine Mutter an und die muss aus allen Wolken gefallen sein, wie sie hört, was geschehen ist und wo ich bin.
Wenig später kommt sie mit dem Tram angebraust und holt mich ab.
Ich glaube nicht, dass sie mit mir geschimpft hat; ich erinnere mich an nichts dergleichen. Schliesslich hatte ich ihr ja mitgeteilt, was ich vorhatte - alles also völlig auf der Reihe.
Ein lustiges Wort, das meine Mutter häufig brauchte, kommt mir soeben in den Sinn. Wenn sie etwas komisch fand, sagte sie: „dassmichderaffelaust“. Es war für mich ein einziges Wort, welches Erstaunen ausdrückte. Erst Jahre später, als ich in einem Text auf diesen Begriff stiess, merkte ich, dass es sich nicht um ein einziges Wort, sondern um einen ganzen Satz handelte, der nun plötzlich eine ganz andere Bedeutung erhielt beziehungsweise ein Bild erscheinen liess, nämlich um: „Dass mich der Affe laust“.
Frühere Kinderverse, an die ich mich gut erinnere, sind beispielsweise: „Äs schneielet, äs beielet…“ Nicht gerade genderneutral, könnte man sagen, aber damals… Und „Heile, heile Säge…“ half alleweil bei geringfügigeren Missgeschicken.
„Hoppe, hoppe Reiter, wenn er fällt, dann schreit er, fällt er in den Graben, fressen ihn die Raben, fällt er in den grünen Klee, tun ihm alle Knochen weh, fällt er in den Sumpf, macht der Reiter plumps“, ist ebenfalls unvergesslich. Auf Mutters Knie sitzend und dann beim Reiten geschüttelt und schliesslich sanft fallengelassen zu werden, das machte Spass. Und auch unsere Enkel freuten sich beziehungsweise der Jüngste freut sich dabei und will nochmal und nochmal.
Wohnungswechsel
Im Jahr 59 mussten wir umziehen von der Steinerstrasse 31 an den Sonnenhofweg 6, weil, wie bereits erwähnt, das Haus, in dem ich aufgewachsen war, abgerissen wurde. Der neue Ort war nur grad zwei Tramhaltestellen weiter weg vom alten Zuhause, aber die Distanz war gross genug, um den Kontakt zu den Menschen, mit denen ich oft zusammen gewesen war, ganz oder vorläufig abzubrechen.
Meine Mutter hatte im Sonnenhofquartier eine Vierzimmerwohnung gefunden in einem neueren Sechsfamilien-Haus im ersten Stock. Wir alle drei hatten unser eigenes Zimmer. Das Essen fand meist in der Küche statt. Im Wohnzimmer hielt ich mich nicht oft auf, nur gerade, wenn wir Besuch hatten, was äusserst selten der Fall war.
Später zogen wir ins Parterre. Wieso meine Mutter das so wollte, daran kann ich mich nicht mehr erinnern.
Freunde meiner Mutter
Sie hatte nur wenige Freunde, leider auch kaum Zeit, Freundschaften zu pflegen. Zudem waren Einladungen kostspielig. - Ausser mit ihren Verwandten war sie mit niemandem per du, nicht einmal mit ihrer Bekannten, Frau Hänni, die in der Länggasse wohnte und mich während Jahren jeden Samstagnachmittag „hütete“, damit meine Mutter mal frei hatte. Sehr seltsam, eigentlich... - In Unkenntnis ihres Vornamens nannte auch ich diese herzensgute Dame „Tante Hänni“ (ich sagte natürlich „du“, Tante Hänni). Sie war unverheiratet, wenige Jahre älter als meine Mutter. Ich ging gern zu ihr. - Schon als ich noch im Kindergarten war, fuhr ich alleine mit dem Tram zum Bahnhof, stieg dort in den Bus um, der genau vor ihrer Haustüre anhielt. Samstag für Samstag – Jahr für Jahr.
Manchmal gingen wir im nahe gelegenen Wald spazieren, sie las mir aus Grimms Märchen vor, oder wir vergnügten uns zu Hause mit einem Spiel oder machten zusammen ein Puzzle.
Bei der Bäckerei um die Ecke kaufte sie für uns zum „Zvieri“ Gipfeli. Später, als ich bereits in die Schule ging, durfte ich die feinen Gipfeli selber kaufen gehen; ich mochte gut und gern zwei, drei oder gar vier Stück davon. Die Migros war ebenfalls nicht weit weg und dort gab’s (und gibt’s immer noch) die feinen Schokolade-Eis-Stängel. Auch die zu besorgen, dafür gab sie mir Geld mit, und auch dort übertrieb ich es gelegentlich: Gleich fünf davon hab ich mal gekauft. Sie fand das offenbar amüsant, hat meine exorbitante Einkaufslust nie kritisiert, sondern mich immer gewähren lassen.
Traditionellerweise fand im Stadttheater im Dezember das Weihnachtsmärchen statt. Auf diese Theaterbesuche freute ich mich schon lange im Voraus. – Was für eine wunderbare Atmosphäre herrschte in diesem alten Gebäude. „Zwerg Nase“, sahen wir, „Frau Holle“, „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ und andere Vorstellungen mehr. Wenn es dunkel wurde und der Vorhang aufging, tauchte ich tief in das Geschehen ein. Und in meinem dunkelblauen Samtkleidchen mit den Puffärmeln fühlte ich mich wie eine Prinzessin.
Nicht nur dorthin lud mich Tante Hänni ein. Im Kursaal fanden manchmal am Samstagnachmittag Live-Konzerte statt, Tee und Kuchen gab’s dazu. Auch diese besuchten wir hin und wieder.
An ihre Wohnung erinnere ich mich gut und das absolut Erstaunlichste ist, dass der Zufall es wollte, dass ich nach über vierzig Jahren wieder in derselben Wohnung ein- und ausgehen sollte. Davon aber später.
Unten im Haus, in dem sie wohnte, war ein Kiosk eingemietet. Schon von aussen, bei geschlossener Tür sogar, war klar, was in dem kleinen Laden in erster Linie verkauft wurde: Tabakwaren. Den süsslichen Geschmack würde ich überall wiedererkennen. Zwei Damen führten das Geschäft, Frau Gammenthaler und eine Ungarin, Frau Barasch. An sie erinnere ich mich ganz besonders gut. Sie war schon alt oder so kam sie mir jedenfalls vor, und was mich an ihr am meisten beeindruckte, waren ihre grossen Ohren. Sie trug überdimensionierte, schwere Ohrringe mit Anhängern, welche bewirkten, dass in ihren langgezogenen Ohrläppchen ein langer Schlitz entstanden war. Dieser Anblick faszinierte mich und stiess mich gleichzeitig ab, so dass ich mir damals schon schwor, nie im Leben Löcher in meine Ohren stechen zu lassen. – Und dabei blieb es.
Tante Hänni bewohnte eine Vierzimmerwohnung. Die Zimmer waren entlang eines langen, dunklen Gangs gelegen. Zuhinterst befand sich die Küche. Auch sie war eng und dunkel, ein Kühlschrank war nicht vorhanden, dafür aber ein Vorratsschrank.
Tante Hänni benutzte nur zwei der Räume für sich selber, ihr Schlafzimmer und das Wohnzimmer. Von Fenster aus sah man durch die Krone eines Baumes hindurch auf die gegenüberliegende Strassenseite, wo sich auch heute noch eine Apotheke befindet.
Als ich ein wenig älter wurde, spielten wir oft Karten- und Brettspiele. Eines davon war besonders schön, es muss aus Japan gestammt haben: Die Spielfiguren waren minuziös aus Holz gefertigt, etwa fünf Zentimeter hoch – stellten Menschen dar, Könige, Königinnen und deren Gefolge. Sie waren angezogen mit farbigen Kleidern aus Seide, ihre Gesichter waren weiss angemalt, aber was genau man damit machen konnte – ich habe keine Ahnung mehr.
Die beiden anderen Zimmer hatte sie untervermietet. In einem davon wohnte während Jahren ein deutscher Zimmerherr. Ich glaube, er hiess Baumeister. Er hat von meiner Schwester und mir je ein Porträt gemalt, mit Bleistift. Beide hingen noch jahrelang im Schlafzimmer meiner Mutter. Er hatte wirklich Talent. Wo er gearbeitet hat und weshalb er in der Schweiz war, daran erinnere ich mich nicht.
Einmal war ich in seinem Zimmer. Eines seiner Möbelstücke hat mir einen tiefen Schrecken eingejagt. Es war ein dunkler Armsessel mit grossen ohrenartigen Klappen rechts und links oben. Ich setzte mich hinein und sogleich ergriff mich Panik, weil es mir vorkam, als wickle sich der Stuhl um mich herum und trage mich fort oder fresse mich auf.
Wie alt ich war, als meine Besuche bei Tante Hänni seltener wurden und dann ganz aufhörten, weiss ich nicht mehr. Vermutlich war ich etwa zwölfjährig, als ich nicht mehr hinging. Von da an habe ich den Kontakt zu ihr verloren, und diese Tatsache betrübt mich noch heute sehr.
Ich war etwas älter als zwanzig und schon verheiratet, als mir meine Mutter einmal mitteilte, Tante Hänni sei jetzt in einem Alters- und Pflegeheim und es gehe ihr nicht besonders gut. – Das hat mir sehr leid getan, aber ich brachte es nicht über mich, sie dort zu besuchen. Dass dem so war, kann ich heute überhaupt nicht mehr verstehen; die damalige Unterlassung ist eines der betrüblichsten Kapitel in meinem Leben und ich bereue zutiefst, dass ich nie mehr bei ihr war, dass ich ihr nie sagen konnte, wie gern ich sie hatte, wie dankbar ich ihr war für die schöne Zeit, die ich bei ihr verbringen durfte. Sie starb ein paar Jahre später; ich habe sie seit meiner Kindheit nie wiedergesehen.
Kartenspielen ist übrigens noch immer eine meiner Leidenschaften. Vor etwa vierzig Jahren habe ich begonnen, Bridge spielen zu lernen. Im Bridgeclub lernte ich bald Leute kennen, mit denen ich noch heute spiele. Eine meiner besten Bridge-Kolleginnen ist Muriel. Zusammen mit unserer Lehrerin Marianne hatte sich nach kurzer Zeit schon eine Freundschaft ergeben und wir bildeten ein sogenanntes „Chränzli“. Der oder die Vierte im Bunde wechselte immer mal wieder von Jahr zu Jahr, aber wir drei blieben stets zusammen.
Muriel wohnte im Monbijou-Quartier und zog vor etwa zehn Jahren in die Länggasse um in eine Eigentumswohnung – genau in diejenige, die ich bestens kannte aus meiner Kindheit.
Die Empfindungen beim Betreten des Eingangs bereits und der Wohnung anschliessend nach dieser langen Zeit, sind unbeschreiblich. Der Hauseingang ist noch immer vorhanden, der Kiosk auch, und jedes Mal, wenn ich vor dem kleinen Laden stehe und die Klingel betätige, rieche ich den süsslichen Tabakgeruch oder zumindest meine ich, ihn in der Nase zu haben. Ob dieser Eindruck real ist oder nicht, vermag ich nicht zu sagen.
Neu sind die Briefkästen und eine zusätzliche Haustür. Ebenfalls der Lift. Die ehemalige Vierzimmerwohnung ist völlig umgebaut und renoviert worden. Daraus ist eine Dreizimmerwohnung entstanden, modern und hell. Die Küche ist nicht mehr am selben Ort, das Wohnzimmer aber schon noch. Auch die Aussicht durch die Baumkrone stimmt noch mit meinen Erinnerungen überein. Die Apotheke ist nach wie vor im Betrieb, sicher vom zweiten, dritten oder gar vierten Besitzer geführt.
In dieser Stube zu sitzen, welche mich jedes Mal wieder an die alten Zeiten erinnert, und mit meinen Freunden Karten zu spielen, ist sehr speziell.

Schulzeit – erste bis vierte Klasse Primarschule - 1960 – 1964
Weil wir umziehen mussten, kurz bevor ich eingeschult wurde, ist es relativ einfach für mich, meine Erinnerungen zu ordnen, denn dieser Wechsel war eine Zäsur.
Im März 1960 trat ich im Sonnenhofschulhaus in die erste Klasse ein.
Mein Schulweg war kurz, kaum zwei Minuten dauerte es, bis ich im Klassenzimmer an meinem Pültchen sass.
Manchmal hatte ich Angst, in die Schule zu gehen. Es gab ein paar Jungs, die einem „passten“, wie wir das nannten. Vor allem auf die Mädchen gingen sie los, schupsten diese und rissen ihnen den Schulsack zu Boden. „D‘ Wyber schtinke!“, brüllten sie dazu. Vor allem einer dieser Buben war ein ganz Schlimmer und um zu vermeiden, dem in die Fänge zu geraten, kam es vor, dass ich zu spät zum Unterricht erschien, was mir dann eine Rüge einbrachte. Aus Angst vor Rache gab ich den Grund allerdings nicht an.
Einmal aber wurde ich sogar in der Pause auf dem Schulhof von ein paar Knaben umringt. Was genau sie mit mir vorhatten - wer weiss? Aber sie hatten die Rechnung ohne die Wirtin gemacht. In höchster Not und ganz beherzt schlug ich mit der Faust dem einen, der direkt vor mir stand, auf die Stirne und oh Wunder, alle liessen von mir ab. Der arme Junge wurde daraufhin sogar von seinem Lehrer ausgelacht, weil er nämlich eine ziemliche Beule hatte. Von da an hatte ich nie mehr ein Problem mit Jungs, die mir auflauerten.
An den ersten Schultag erinnere ich mich nur teilweise. Die Lehrerin kam mir uralt vor in ihrer grauen Kleidung. Sie muss damals allerdings kaum älter als vierzig gewesen sein.
Sie sass vorne am Lehrerpult, die Eltern standen hinten und schauten zu. Meine Mutter war nicht da, weil sie arbeiten musste.
Fräulein Witschi erläuterte die Bilder an der Wand des Klassenzimmers. An eines kann ich mich gut erinnern: „Das Schlaraffenland“, gemalt von Bruegel, dem Älteren (meiner Meinung nach nicht unbedingt ein Bild, das in ein Erstklass-Schulzimmer passt). Was abgebildet war, fand ich sehr komisch, die seltsamen Figuren sagten mir nichts. Erst später begann ich Bruegel zu schätzen.
Am Samstagmorgen gab’s jeweils Vorlesestunde. Elisabeth Müller war damals Trumpf. Jedes Mal, wenn wir erfuhren, wie das Schicksal der „6 Kummerbuebe“ weiterging, konnten ein paar Mädchen ihre Tränen nicht zurückhalten. Ich gehörte zum Glück nicht dazu.
Wie ich mich in diesen ersten beiden Schuljahren gelangweilt habe! – Ich sehe mich noch am kleinen Pult mit dem eingebauten Tintenfass sitzen und innerlich fast verzweifeln. Im Rechnen mussten wir auf Häuschen-Papier Zehner-Kasten ausmalen mit roten und blauen Kreisen – zwei plus acht gleich zehn – drei plus sieben gleich zehn – vier plus sechs… und so weiter. Nicht enden wollende Reihen wurden gedrillt. Auch mündlich. Dabei rechnete ich zu Hause bereits bis mehr als tausend.
Schlimmer noch im Deutsch beim Lesen und Schreiben: „Die Maus im Haus“. „Mimi und Hans und Mami im Garten“. Geisttötend fand ich das. – Irgendetwas habe ich aber sicher trotzdem gelernt dabei.
Das Gedicht über die Sonne jedenfalls, das im dritten Schuljahr einmal Hausaufgabe war, fand ich selber unglaublich gut. Ich erinnere mich noch an den Anfang: „Du liebe Sonne, bringst Freud und Wonne. Du kommst, der Tag bricht ein, du hast den wunderschönsten Schein“. Dichtkunst par excellence! - Dass vielleicht schon vor mir ein grosser Denker auf den genialen Reim „Sonne“ und „Wonne“ gekommen sein könnte, das kam mir mit keiner Faser in den Sinn.
Ein traumatisches Erlebnis geschah in den Frühlingsferien 1961. Am letzten Tag vor den Ferien, also am letzten Schultag in der ersten Klasse, sagte Fräulein Witschi, wir dürften ab dem nächsten Schuljahr die Pultordnung wechseln. Evi, ein Mädchen, mit dem ich mich inzwischen angefreundet hatte, und ich, wir beschlossen, in dem Fall nach den Ferien nebeneinander zu sitzen. – Ich freute mich schon sehr auf meine neue Nachbarin am Zweierpult.
Dann geschah es, dass sich ein schrecklicher Unfall ereignete: Ein siebenjähriges Kind war an der Kreuzung am Sonnenhof auf dem Fussgängerstreifen von einem Lastwagen überfahren worden. Das vernahm man zuerst. Kurz darauf erfuhr man, um wen es sich handelte: um Evi.
Unsere ganze Klasse wohnte der Beerdigung bei. Es war für mich die zweite innert zwei Jahren. Detaillierte Erinnerungen daran habe ich verdrängt. – Was ich aber noch weiss: Die Eltern, jetzt kinderlos, kamen einige Tag danach zu uns in die Klasse und brachten sämtliche Spielsachen von Evi mit. Wir durften uns alle etwas aussuchen.
Nicht selten habe ich auch später noch an die beiden gedacht und mich gefragt, wie viele Tränen sie wohl vergossen haben, wie sie es geschafft haben weiterzuleben ohne ihr einziges Kind.
Schlimm war’s, wenn die ganze Klasse die Schulzahnklinik aufsuchen musste. Einzig Franz brauchte nicht mitzukommen. Seine Eltern waren reich, so wurde gemunkelt, er hatte das Privileg, bei Bedarf einen privaten Zahnarzt aufsuchen zu können. Er wurde sehr beneidet. Wir anderen mussten in den sauren Apfel beissen beziehungsweise im Behandlungszimmer den Mund weit öffnen, damit die deutsche Zahnärztin ihres groben Amtes walten konnte. Nur wer die Behandlung hinter sich hatte, konnte aufatmen. - Blanke Angst herrschte nämlich vor der „Rossmetzgerin“, wie wir sie nannten. Spritzen gab es keine; wer ein Loch hatte, musste leiden. Auch beim Anpassen meiner Spange ging sie nicht zimperlich vor. Jede Konsultation bei ihr war mir ein Gräuel.
Da war der Besuch der „Lusetante“ ein Spaziergang dagegen. Sie kam etwa einmal pro Jahr vorbei und untersuchte unsere Haarböden nach Läusen ab. Das war zwar unangenehm und auch ein wenig peinlich, tat aber wenigstens nicht weh.
Irgendwann während dieser ersten vier Schuljahre musste ich die Mandeln schneiden lassen. Daran habe ich zwei Erinnerungen: Betäubt wurde man damals mit Aethermasken. Als sie mir diese aufs Gesicht legten, träumte ich von einer Gruppe von Gestalten, die sich in Viererkolonnen auf mich zubewegten. Sie gingen im Gleichschritt, trugen lange blaue Mäntel und hatten alle eine Maske vor dem Gesicht, etwa so wie sie die Degenfechter tragen. Ich konnte mich nicht bewegen, hatte Angst, aber da hatte ich das Bewusstsein bereits verloren.
Man hatte mir gesagt, nach der Operation könne man Eiscrème essen. Meine Vorfreude war gross, die Enttäuschung dann ebenso, denn damit war leider nichts. Ich bekam nur lauwarmen Tee, was mir sehr widerstrebte.
In der dritten und vierten Klasse hatten wir einen Lehrer. Weil ich „so gute“ Aufsätze schrieb, wie er sagte, kam es vor, dass er mich die Arbeiten einer Mitschülerin korrigieren liess, was mich damals mit Stolz erfüllte. Heute sehe ich das anders: Es war absolut daneben. Er war nur zu faul zum Korrigieren, und viel schlimmer noch – er hat mich dazu benutzt, die Kameradin blosszustellen.
Ich mochte ihn überhaupt nicht. Ein ungutes Gefühl beschlich mich fast ständig, wenn ich in seiner Nähe war. Ich selber hatte zwar nicht direkt unter ihm zu leiden, aber andere schon, und das sogar sehr, wie ich später erfuhr. Natürlich war ich auch dabei gewesen bei einigen seiner Untaten, die er an meinen Mitschülerinnen und Mitschülern begangen hatte, hatte zugeschaut und nichts gesagt. Aber so schlimm das alles war, damit war eine gewisse „Normalität“ verbunden und offenbar ist man als neun- oder zehnjähriges Kind noch nicht ganz in der Lage, solche Geschehnisse richtig einzuordnen und zu beurteilen. Verdrängen war wohl einfacher und ich glaube, wir alle waren froh, wenn sein Zorn, sein Sadismus oder seine Boshaftigkeit sich gegen jemand anderes richtete.
Einmal aber war auch ich Stein des Anstosses: Die Klasse besuchte das naturhistorische Museum und als die Besichtigung zu Ende war, befahl er uns, zu Fuss zurück zum Schulhaus zu gehen. Das Tram zu nehmen, war verboten.
Mit einem Grüppchen von Klassenkameradinnen machten wir uns auf den Weg. Plötzlich merkte ich, dass ich meine Kappe im Museum vergessen hatte. Ich ging alleine zurück und holte sie. Um Zeit wieder gutzumachen, setzte ich mich über das Verbot hinweg und stieg am Helvetiaplatz ins Tram. Dummerweise blieb ich auf der Plattform stehen, statt mich zu setzten. So geschah es, dass ich gesehen wurde bei meinem Fehltritt. Das Pikante daran war: Herr Schweingruber hatte sein Auto in der Nähe des Museums parkiert und fuhr just in dem Moment am Tram vorbei, als ich drin war. Und wer war auch noch drin, in seinem Auto? Vier Knaben aus unserer Klasse, die er zurück zum Schulhaus chauffierte. – Diese waren am nächsten Tag die Zeugen, die er aufrief, als er einen „Prozess“ gegen mich anordnete, um der ganzen Klasse meinen Ungehorsam zu demonstrieren und die Strafe zu rechtfertigen. Einen Pflichtverteidiger hatte ich bei dieser inszenierten Gerichtsverhandlung natürlich nicht und klar wurde ich schuldig gesprochen. – Da nützte es weniger als gar nichts, dass ich vorbrachte, ich fände es ungerecht, dass einige Jungs im Auto hätten heimfahren dürfen während die anderen ein „Tramverbot“ hatten.
Das Urteil wurde verkündet: Ich musste hundertmal irgendeinen blöden Satz ins Heft schreiben, den ich im genauen Wortlaut nicht mehr weiss, der aber wohl ungefähr so gelautet haben mag: „Ich habe dem Lehrer zu gehorchen“. – Es könnte aber auch sein, dass der Satz viel länger war und ich ihn einfach verdrängt habe. Nicht wie eine Kollegin von mir, die mir Jahre später, als wir uns mal über genau solche Strafen unterhielten und uns an die Kindheit zurückerinnerten, erzählte, einmal hätte sie hundertmal schreiben müssen: „Wenn es zum zweiten Mal läutet, sitze ich an meinem Platz und schwatze nicht mehr. Wenn ich das nicht tue, werde ich bestraft. Das verstehe ich gut und beklage mich auch nicht.“ – Der letzte Satz ist ja wirklich die vollendetste Form der Nötigung. - Jetzt natürlich konnten wir darüber lachen. Aber damals...
Erste Klassenzusammenkunft
Nach etwas mehr als dreissig Jahren hatte ich die Idee, eine Klassenzusammenkunft zu organisieren, die erste nach dieser langen Zeit.
Es war nicht einfach, die Adressen zu finden, aber es gelang nach etlichen Anstrengungen recht gut. - Die Lehrerin, die noch immer am selben Ort wohnte wie früher, konnte mir einen säuberlich geführten, von Hand geschriebenen Rodel präsentieren mit all unseren Namen – auf der linken Seite die der Mädchen, auf der rechten diejenigen der Knaben.
Eine Mitschülerin war besonders schwierig aufzuspüren. Sie musste geheiratet haben, aber ihren neuen Familiennamen kannte ich nicht. Auf Fräulein Witschis Liste aber war der Name ihrer geschiedenen Mutter aufgeführt. Anhand dieses Hinweises gelang es mir schliesslich, diese aufzuspüren. – Und was für ein unglaublicher Zufall: Frau Nussbaumer lebte seit Jahren in Spanien, in Denia, im Haus neben dem meines Onkels. - Natürlich teilte sie mir sofort Name und Adresse ihrer Tochter mit.
Ich war überrascht, als mich ein ehemaliger Mitschüler wissen liess, er würde am Treffen nicht teilnehmen, wenn Herr Schweingruber auch eingeladen sei. – Erst fand ich es seltsam, dass Stefan nach so langer Zeit mit der Vergangenheit und dem Erlebten nicht hatte abschliessen können. Als er mir jedoch erzählte, dass er während Jahren in psychiatrischer Behandlung gewesen sei wegen der Erlebnisse mit unserem Lehrer damals, wurde mir manches klar.
Es war ein interessanter Abend; wir erfuhren Dinge voneinander, die wir gar nicht gewusst hatten und ich brauchte eine gewisse Zeit, all das zu „verdauen“, was erzählt worden war. – Jedenfalls schrieb ich daraufhin einen Bericht, den ich hier jetzt einfüge:
Erinnerungen
Nach mehr als 30 Jahren Leuten zu begegnen, die einem einerseits völlig fremd sind, mit denen man andererseits während vier Jahren als Kind täglich zusammen im selben Klassenzimmer gesessen und Freud und Leid geteilt hatte, das ist schon eine Angelegenheit der ganz besonderen Art.
Wer an besagtem Abend ins ehemalige Klassenzimmer eintrat, wurde neugierig begutachtet. Da gab es "klare Fälle", Erkennen auf den ersten Blick. Stimmen konnten wieder zugeordnet werden, Bewegungen wurden wiedererkannt. Andere Mitschüler hingegen musste man mühsam anhand der spärlichen Fotos identifizieren, eine wahre Strapaze fürs Erinnerungsvermögen.
Monica, die im Haus gegenüber gewohnt hatte, erkannte ich sofort, und zwar weil sie genau gleich aussah wie ihre Mutter, die damals genauso alt war wie meine ehemalige Klassenkameradin heute. Es war verblüffend, ich war im ersten Moment völlig verwirrt.
Eines löste vor allem Erstaunen aus: Ausnahmslos alle waren beeindruckt, dass die Erstklasslehrerin noch am Leben war, bei bester Gesundheit, mit lückenlosem Gedächtnis und, wie wir fanden, aussah wie eh und je. Die Jahre schienen spurlos an ihr vorbeigegangen zu sein. Jeder von uns hatte sie als „uralt" in Erinnerung, ohne Frage kurz vor der Pensionierung. Doch beim Zurückrechnen wurde einwandfrei festgestellt, dass sie ja damals nicht viel älter gewesen sein konnte als wir es jetzt gerade waren, und das gab dann doch zu denken. Waren es die grauen Haare und die grossmütterliche Kleidung, die diesen Eindruck erweckt hatten oder war es schlicht die Tatsache, dass sie unendlich viel älter war als wir? Zwangsläufig drängte sich uns die Frage auf, ob Erstklässler uns heute gar ähnlich beurteilen würden...
Die Lehrerin bat dann um Aufmerksamkeit, und augenblicklich verstummte jedes Gespräch. Sie bedankte sich bei der Klasse für die Einladung und führte aus, wie schön es sei, dass aus uns allen „etwas Rechtes" geworden sei. Da merkte ich instinktiv, jeder einzelne von uns fühlte sich unmittelbar um all die Jahre zurückversetzt, einer Zeitreise gleich, die vergangenen Jahrzehnte übersprungen - es war wie damals. Selbst der Tonfall, in dem sie diese Worte sagte, war nur allzu bekannt. So spricht „man" zu Kindern, damit sie es gut verstehen.
Die Besichtigung der ehemaligen Klassenzimmer liess unverzüglich Erinnerungen wach werden. Die Bilder an der Wand waren zwar nicht mehr dieselben, doch im Geist sah ich sogleich wieder den Breugel über dem Lehrerpult hängen. "Schlaraffenland" war's, das Gemälde, das unsere kindlichen Phantasien geweckt hatte, mich jetzt allerdings an die kalte Realität der Aufsatzschreiberei mahnte. Es konnte zu jener Zeit ja nicht angehen, ein Bild unbeschrieben, eine Schulreise oder Ferienerlebnisse unnacherzählt zu belassen. Dieses „dicke Ende" hat uns damals manche Freude an einem Ausflug gleich von Anfang an vergällt.
Die Pultreihen waren jetzt anders angeordnet, dafür war aber die Atmosphäre nach wie vor unverändert. Hatte es damit zu tun, dass der Geruch, eine Mischung aus Kreide und abgestandener Luft, stets derselbe war?
Jedenfalls löste das Betreten des Dritt-und Viertklasszimmers eine unglaubliche Reihe von Gefühlen und Emotionen aus. Es war das Reich unseres Lehrers gewesen, der dort mit unerbittlicher Strenge geherrscht hatte. Für manche muss dieser Raum eine wahre Folterkammer gewesen sein, andere konnten sich gelassener darin umsehen.
Für diese „Braven" war zweifellos alles viel einfacher; sie haben manches nur als Zuschauer miterlebt und konnten mit der Zeit sogar vergessen.
Auch im Laufe des Abends beim gemeinsamen Nachtessen im Restaurant kam man von den damaligen Erlebnissen und Ereignissen nicht mehr los. Bemerkenswert, wie viel in den Gedächtnissen noch weiterlebt; auch Verdrängtes wurde wieder lebendig. Es wurde zwar auch sehr viel gelacht, dennoch ist etliches offenbar noch immer unverdaut.
Neben den Folgsamen gab es nämlich auch solche, die ständig herhalten mussten.
Renate erinnerte sich, dass sie mehr Zeit draussen im Gang verbracht hatte als im Klassenzimmer. Sie gehörte zu den ganz Schlimmen. Das war ja auch kein Wunder, schliesslich hatte sie keine Mutter, und da ist es ja nur natürlich, dass so ein Kind verludert. Alle wussten das. Genau aus diesem Grund trug sie auch nie ein Schürzchen; niemand schaute eben recht zu ihr.
Sie ist jetzt Professorin an der ETH in Zürich. Ich schliesse daraus, dass sie draussen auf dem Gang tatsächlich nicht viel von dem verpasste, was drinnen unterrichtet wurde.
Es versteht sich von selbst, dass sie zu den eingefleischten Besitzerinnen eines "Schimpf- und Schande-Heftchens" gehörte, in welchem sämtliche Schandtaten vom pflichtbewussten Lehrer vermerkt wurden. Die Eltern hatten diese Elaborate jeweils zur Kenntnis zu nehmen und zu unterschreiben. Selbstverständlich war damit die Hoffnung auf tatkräftige Unterstützung durchs Elternhaus verknüpft.
Der kleine Thomas hatte nicht selten gleich mehrere solcher „Akten" mit nach Hause zu nehmen, bis es seiner Mutter eines Tages zu bunt wurde und sie sagte, dieses Zeug unterschreibe sie fortan nicht mehr. Folgerichtig erkannte der Kleine daraufhin, dass diese Aufgabe nun offenbar ihm selber zufalle und um sich aus diesem Dilemma zu befreien, begann er von da an, nach kräftigem Üben der Unterschrift, diese Arbeit selbständig zu übernehmen, sozusagen, um die Mutter zu entlasten. Nur eine sehr kurze Weile sei dies gut gegangen, erinnerte er sich. Er wusste noch genau, wie ihn der Lehrer eines Tages fragte, wer denn hier unterschrieben habe; es fiel nämlich auf, dass die Tinte arg verschmiert war. – „Ich" habe er ganz offen und unvoreingenommen gesagt - und es sei ganz still geworden in der Klasse.
Zuerst sei nicht viel passiert, aber daraus resultierte in der Folge eine Riesensache mit der Schulkommission, und jeder Klassenkamerad war letztendlich froh, nicht selber auf eine dermassen kriminelle Idee gekommen zu sein.
Man kannte damals auch noch andere Methoden der erfolgreichen Erziehung, wie wir uns gegenseitig in Erinnerung riefen.
Dass Hefte grundsätzlich bei offenem Fenster korrigiert wurden, war selbstverständlich. Der Vorteil davon war, man brauchte gar nicht erst aufzustehen, um das „grusige Gsudel" hinauszuwerfen.
Um dem notorisch unordentlichen Roland Ordnung beizubringen, dem ich nota bene sein Aufgabenbüchlein zu führen hatte, da er allein dazu ja nicht imstande war, hatte sich Herr Schweingruber etwas ganz Besonderes ausgedacht: Er liess unsere Mitschülerin Lena, die Bauerntochter, Kuhfladen mit in die Schule bringen, die er dann säuberlich zwischen das Chaos in Rolands Pult platzierte.
Schüler, die nicht gleich begriffen, worum es im Kopfrechnen ging, hatten ein schweres Los. Es wurde jeweils versucht, das Resultat gleichsam aus ihnen herauszuschrauben, indem die Backe des fehlbaren Zöglings mit eiserner Faust gedreht wurde - immer mehr und mehr, bis entweder das erforderliche Resultat geliefert wurde oder sich das Kind auf dem Stuhl oder gar auf dem Pult wiederfand mit Tränen im einseitig hochroten Gesicht.
Zum Glück weiss man heute, dass kein Zusammenhang besteht zwischen Methoden dieser Art und Gedächtnishilfen. Aber damals war die Forschung offenbar noch nicht so weit fortgeschritten. Wenn die Backenschrauberei nämlich nichts nützte, war der Lehrer gezwungen, wirksamere Massnahmen zu ergreifen. So glaubte er, zum Ziel zu kommen, wenn er einen Jungen übers Pult legte und ihn kräftig mit dem Rohrstock traktierte. Als pikantes Detail fand er es offenbar besonders opportun, dem Nichtsnutz zusätzlich den stinkenden, leicht feuchten und vom Staub der Kreiden steifen Tafelputzlappen in den Mund zu stopfen. – Die Klasse als Publikum.
Manchmal kam ein ganzer Schlüsselbund geflogen. Oft traf dieser so, dass er Beulen hinterliess. Nun - der Zweck war damit erreicht: Die Aufmerksamkeit war wieder gewährleistet.
Was Edi verbrochen hatte, dass er seine Arme in die Höhe halten musste (Bergpredigt wurde das Verfahren genannt) und beim geringsten Nachlassen den Rohrstock auf den blutleeren Händen zu spüren bekam, daran erinnere ich mich nicht mehr. Sicher aber war es etwas Unverzeihliches, das solche Behandlung rechtfertigte. Vielleicht hatte er vergessen, seine Hausaufgaben zu machen oder hatte ein ähnliches Verbrechen begangen. Sein Weinen und seine Demütigung mussten wohl ein besonderes Gefühl der Befriedigung und Macht in unserem Erzieher ausgelöst haben. Gewiss war zumindest er davon überzeugt, dass dies ein geeignetes Mittel sei, sich Respekt und die nötige Achtung zu verschaffen.
Harte Zeitgenossen sollten aus uns werden; so mussten wir von unserem Schulhaus aus im Osten der Stadt auf den Bantiger marschieren und wieder heimwärts. - Und welche Freude herrschte bei der Seegfrörni auf dem Bielersee im Jahr 1963! Da durfte es gleich ein Marsch von Biel bis zur Petersinsel sein und selbstverständlich auch zurück. Natürlich waren ebenfalls diejenigen bei dem Spass dabei, die nicht Schlittschuhfahren konnten. Übung macht ja bekanntlich den Meister, und die paar blauen Flecken, Blattern und eiskalten Hände und Füsse konnte man für dieses Erlebnis schliesslich in Kauf nehmen.
Viele Erinnerungen hatten mit der Turnstunde zu tun. Wer ein „Gstabi" war, hatte nichts zu lachen. Da wurde mit Kopfnüssen operiert, und auch die Sprossenwand bot ausgezeichnete Möglichkeiten, Fehlbare hängend über ihre Unfähigkeit nachdenken zu lassen.
David erzählte, bei einem Arztbesuch habe der Arzt eine ganze Reihe blauer Flecken an seinem Körper entdeckt. Davids Vater sei in Verdacht geraten, der Verursacher dieser Verletzungen zu sein. Die Prellungen hatte er sich aber anderweitig zugezogen…
Nebst etlichen Erfahrungen, die besser unerzählt bleiben, wird mir in diesem Zusammenhang eine einzige Episode wieder gegenwärtig, die ausnahmsweise witzig war: Es handelt sich um eine Bemerkung, die Herr Schweingruber beim Anblick der nackten Füsse von Robert machte, der auf augenfällige Weise mit Wasser und Seife wenig am Hut hatte: „Röbu, du solltest wieder mal deine Füsse neu teeren, das Weisse schimmert schon durch!"
Jedenfalls ist es schön zu wissen, dass sämtliche diese hartnäckigen Anstrengungen, uns mit allen Mitteln der Kunst zurechtzubiegen, schliesslich Früchte trugen. Es ist durchwegs aus uns allen „etwas Rechtes" geworden.
Was mich nach diesem Abend besonders beschäftigte, war, dass all diese Verfehlungen ohne irgendwelche Konsequenzen hingenommen worden waren. Niemand von den Eltern hatte je eingegriffen, auch andere Lehrer müssten doch etwas bemerkt haben. Natürlich, wir selber hatten zu Hause auch nichts erzählt. – Trotzdem…
Ein Jahr nach der Klassenzusammenkunft (1996) stiess ich im „Bund“ zufällig auf einen Artikel, der über einen gewissen Herrn Schweingruber berichtete. Der Titel hiess: „Alter, stiller Sozialdemokrat“ und besagte, dass dieser Herr mit fast 65 Jahren zum Ratspräsidenten fürs laufende Jahr ins Könizer Parlament gewählt worden war (höchster Könizer). Weiter konnte man lesen, er sei Schulleiter in Niederwangen und Lehrer einer Kleinklasse für minderbegabte Schüler. – Was mir da alles durch den Kopf ging, will ich lieber nicht erläutern. Jedenfalls hätte ich problemlos noch ein paar andere, passendere Adjektive zum Titel liefern können, denn es stand ausser Frage, dass es sich um unseren Dritt- und Viertklasslehrer handelte, der, wie ich wusste, nach Köniz umgezogen war. Auch war er leicht zu erkennen auf dem Bild neben dem Artikel, den ich nota bene aufbewahrt habe.
Meine Freizeit
In meiner Freizeit war ich oft allen, vor allem am Nachmittag. Ich erhielt einen Schlüssel, den ich an einer Schnur um den Hals trug. Dass niemand zu Hause war, war allerdings kein Problem für mich. Im Gegenteil, es störte mich nicht. Ich liebte es, in meine Bücher zu kritzeln, Länder und deren Hauptstädte aufzuschreiben, Geheimschriften zu erfinden, Pferde zu zeichnen, mit Legoklötzchen zu spielen (es gab damals nur die kleinen, rote und weisse), Rechenaufgaben und Zahlenreihen zu lösen, die mir Jany, der Freund meiner Schwester, der am Gymnasium Mathematik unterrichtete, aufgegeben hatte.
Er lehrte mich auch das griechische Alphabet, das ich noch heute problemlos herunterleiern kann – was allerdings nicht von grossem Nutzen ist, ausser wenn im Kreuzworträtsel mal nicht „eta“ der gesuchte griechische Buchstabe sein sollte.
Auch die sieben Bundesräte des Jahres 1962 konnte und kann ich immer noch aufzählen. Er hatte einen Merksatz „gebastelt“, der dabei half, sich alle Namen zu merken:
„Uf der moosige Burg schaffet der Chaudet u wähut u schpüeut mit Tschüderliwasser“ (von Moos, Bourgknecht, Schaffner, Chaudet, Wahlen, Spühler, Tschudi). Hier ist der Nutzen noch geringer...
(Beim Gedanken daran meine analoge Kreation 2020:
„Im Keller steht Berset am Herd und mauert. Er will das Filet-Sommaruga mit Parmesan bestreuen und nicht in Cassis-Sauce anbraten.“ - [Keller-Sutter / Berset / Amherd / Maurer / Sommaruga / Permelin / Cassis])
Ende der Fünfzigerjahre kamen die Hula-Hoop-Reifen auf. Überall sah man sie; jedes Kind hatte einen. Ich natürlich auch, und ich wurde nicht müde zu üben, zu üben: vom Hals in die Hüfte, in die Kniekehlen – rauf und wieder runter. Unermüdlich. - Kürzlich hab ich’s wiedermal versucht. Der Erfolg blieb aus. Gänzlich.
Federball spielen tat ich auch gern, nur musste man dazu natürlich zu zweit sein und ich fand nicht immer eine Partnerin oder einen Partner. Mein Schwager, damals der Freund meiner Schwester, biss manchmal in den sauren Apfel...
Globi-Bücher mochte ich sehr, aber lesen tat ich den Text dazu nie. Die Bilder waren ja aussagekräftig genug, die Geschichte auch ohne Worte verständlich. Die Babar-Bücher mit dem kleinen Elefanten, der zierlichen, schlanken alten Dame, Celste und Zefir liebte ich ebenfalls, jedoch dort, wo der böse „Polomoch“ erschien, konnte ich mich schon sehr fürchten.
„Zehn kleine Negerlein“ und „Der Struwwelpeter“, deren Bilder mir noch völlig präsent sind: Habe ich das richtig in Erinnerung? – Kannte zu der Zeit jedes Kind diese beiden Bücher? – Heute natürlich absolut verpönt und fern von jedem Kinderzimmer, das eine wegen „political correctness“, das andere wegen der absurden autoritären Sicht oder gar Philosophie betreffend Kindererziehung. Während „Zehn kleine …“ weichgewaschen, entschärft und mit „zulässigen Objekten“ abgeändert wurde, also noch heute in abgeschwächter Form existiert, hat sich an eine mildere Struwwlpeter -Adaption meines Wissens niemand herangewagt.
Den „Joggeli söll ga Birli schüttle“ hingegen, die Geschichte der Streikenden, beschrieben in einem Büchlein mit speziellem Format, den gibt’s noch immer. Auch die Märchen der Gebrüder Grimm sind nach wie vor im Umlauf, von denen allerdings nur diejenigen, die gut ausgehen. Schon als Kind haben mich diese fasziniert und später habe ich an der Uni Bern mal ein Seminar besucht, dessen Thema das Märchen war.
Mickey Mouse und Donald Duck waren Lesestoff erster Güte, noch lieber jedoch waren mir die Streiche von Tom und Jerry, der klugen Maus, die es immer wieder verstand, den ungeschickten Kater zu überlisten.
Vor allem bei den Mädchen war es „Mode“, Tauschbildchen zu sammeln und, wie der Name sagt, sie zu tauschen. Am beliebtesten waren diejenigen mit Silber-Glitter drauf; diese fanden wir besonders kostbar und um ein solches zu erhalten, musste man sich oft gleich von zwei oder drei der weniger glanzvollen Bildchen trennen. Figuren und Tiere waren darauf zu sehen, aus dem Märchen in erster Linie. Wohl war die ganze Angelegenheit eine Art archaische Vorstufe der Paninibildchen. – Mir ist nicht mehr im Gedächtnis geblieben, was genau nachher damit geschah. Ich glaube, man bewahrte sie in einem Album auf.
Ein anderer Brauch bestand darin, einander ein sogenanntes Poesiealbum abzugeben. Der Zweck davon war, dass man pro Seite ein Andenken an eine Klassenkameradin oder einen Klassenkameraden erhielt. Eine Zeichnung, ein Spruch und der Name der Verfasserin oder des Verfassers waren gefragt. Manchmal dauerte es wochenlang, bis man das Album wieder zurückerhielt. Die Einträge waren von unterschiedlicher Qualität, einige Kinder gaben sich grosse Mühe, ein kleines zeichnerisches Kunstwerk anzufertigen, manchmal allerdings war klar ersichtlich, dass eine Mutter ihre Hand dabei mit ihm Spiel gehabt hatte, bei einer arg verklecksten „Arbeit“ hingegen ziemlich sicher nicht. Die Sprüche waren selten von überragender Phantasie geprägt, es kam sogar vor, dass im selben Freundschaftsbuch derselbe Spruch zwei- oder gar dreimal vorhanden war. Beliebt war beispielsweise: „Froh zu sein bedarf es wenig, und wer froh ist, ist ein König.“
In dem Zusammenhang ein kurzer Blick in die Zukunft beziehungsweise in die Vergangenheit - je nach Standpunkt:
Der Brauch, sich im Andenkenalbum seiner Klassenkameradinnen und -Kameraden zu verewigen, den gab’s nicht nur in den Sechzigerjahren. Auch unser jüngster Sohn Gino kam mit so einem Album heim. Das war im Februar 1994.
Als ich es öffnete und schaute, was er soeben hineingekritzelt hatte, sah ich, dass er erstens unseren Familiennamen „Toriani“ mit nur einem „R“ geschrieben hatte, „ittigen“ mit kleinem „I“ und unter der Spalte „Was ich am meisten hasse“ stand: „lessen“.
Auch an die Silvabücher erinnere ich mich. Das waren Bildbände, die man bestellen konnte, wenn man genügend Punkte gesammelt hatte. Diese erhielt man nur, wenn man gewisse Produkte kaufte - ein wenig eine Bauernfängerei natürlich. Die Bilder wurden separat geliefert. Das Buch „Kenya“ gefiel mir besonders. Dort galt es, die Fotos der Elefanten, Löwen, Geparden, Giraffen und all der anderen wilden Tiere am richtigen Ort im Buch sorgfältig einzukleben. – Wenn ich mir nicht genug Mühe gab bei dieser Beschäftigung, erhielt ich sofort „Schimpfis“ von meiner Schwester.
Ein paarmal pro Jahr mussten wir Papiersammeln gehen. - Undenkbar heute. – Zu viert waren wir mit einem Leiterwägeli unterwegs von Tür zu Tür, luden die Zeitungsbündel auf und brachten sie zurück ins Schulhaus. Das war nicht immer nur lustig, vor allem dann nicht, wenn der Wagen überladen war und der eine oder die andere noch darauf herumturnen wollte, was nicht selten dazu führte, dass das Gefährt kippte und Kinder und Zeitungen wieder eingesammelt werden mussten. Aber das Gute daran war natürlich, dass an diesen Tagen die Schule ausfiel.
Ein anderes „Nebengeräusch“ zum Schulalltag war das Pro Juventute-Marken-Verkaufen. Wer eine bestimmte Anzahl davon Eltern, Verwandt und Nachbarn „andrehen“ konnte, erhielt zum Dank ein Kantonswappen geschenkt in einem Bilderrahmen. Diese Trophäen waren sehr begehrt und ich hatte ein paar davon. Was mir daran gefiel und wo sie geblieben sind, weiss ich nicht mehr. Nicht wissen tat man damals etwas anderes auch nicht: Was für empörende, menschenunwürdige Massnahmen unter der Ägide der Pro Juventute und mit Unterstützung der Vormundschaftsbehörde angeordnet wurden. Stichwort: „Kinder der Landstrasse“.
Manchmal durfte ich nach der Schule auch ein paar Stunden bei einer Schulfreundin verbringen. Mal bei Susi, meistens bei Marlies. Ihre Eltern nahmen mich liebevoll bei sich auf – für mich war’s fast wie ein zweites Zuhause. Ich verbrachte sehr viel Zeit dort. Allmählich befreundete ich mich mit Marlies‘ älterer Schwester Kathrin, die mir bis jetzt meine älteste und treueste Freundin geblieben ist. Auch zu ihrer Mutter hatte ich bis zum Tod von „Mummerli“ im letzten Jahr ein schönes Verhältnis.
Meine unmusikalische Mutter fand, ich solle Klavierspielen lernen. Nicht unbedingt zu meiner Freude. Von irgendjemandem kaufte sie ein ausgedientes Piano, das erst noch gestimmt werden musste. Es dauerte nicht allzu lange und die ganze Angelegenheit wurde zum Debakel.
Eine Klavierlehrerin musste her. Schlimm, schlimm: Sie war weit übers Pensionsalter hinaus und wohl auch ein wenig behindert. Offenbar hatte sie Probleme mit ihren Füssen, denn die Schuhe, die sie trug, waren ihr mindestens zwei bis drei Nummern zu gross. So klaffte zwischen ihren Fersen und dem hintersten Teil ihrer Schuhe eine grosse Lücke, die anzustarren ich mich nicht sattsehen konnte. Mit schleppendem und schlurfendem Gang bewegte sie sich vorwärts. – Eigentlich hätte sie mir ja leidtun müssen, aber von solchen mitmenschlichen Gemütsregungen war ich damals weit entfernt. Im Gegenteil. Es war mir zuwider, neben ihr sitzen zu müssen. Und was ich richtig eklig fand: Sie pflegte die Spitze des Bleistifts jeweils kurz in den Mund zu stecken und mit Speichel zu befeuchten, bevor sie aufs Notenblatt schrieb.
Kurz erzählt, ich war keine gelehrige Schülerin, das Spielen machte mir überhaupt keinen Spass, üben tat ich nie und Notenlesen war mir das Letzte vom Letzen, ein Buch mit sieben Siegeln. Allerhöchstens konnte ich eine sehr einfache Melodie aus dem Gedächtnis nachspielen, aber niemals vom Notenblatt aus. Den sogenannten Kotelett-Walzer hinzuklimpern, bedeutete das äusserste Limit meines Könnens, aber den hatte mir der Freund meiner Schwester beigebracht. – Nach kurzer Zeit schon musste meine Mutter einsehen, dass alle Mühe vergeblich war, sie besser ihr knappes Geld sparen und die Übung abbrechen würde. - Zu meiner grossen Freude! Lieber ein Ende mit Schrecken…
Meine Mutter – die Köchin
Am Mittag eilte Mam regelmässig von der Arbeit heim, um mir in ihrer kurzen Mittagspause etwas zu kochen. Noch im Mantel und mit der Handtasche am Arm stellte sie die Herdplatte an – das eines der Bilder, das ich nie vergessen werde.
Ihre Kochkünste fand ich nicht umwerfend. Sie war es gewohnt, für meinen Vater Diät zu kochen. Das war ihre Erklärung, wenn ich bemängelte, dass das Gericht, das sie mir aufgetischt hatte, nach gar nichts schmeckte. Nur wenig Salz verwendete sie, Gewürze gab’s damals halt auch nicht so viele, aber sie hat meine Kritik jeweils mit Humor aufgenommen und gekocht, was ich gern hatte, beziehungsweise was sie dachte, ich hätte gern, denn eigentlich war mir zu der Zeit Essen überhaupt nicht wichtig, ausgenommen die feinen Zvieri bei Tante Hänni oder die Pausenbrötli beim Bäcker.
Die „roten“ Spaghetti, wie sie sie nannte, die komische Sauce gleich schon untergerührt, warRAu eines der üblichen Gerichte, mit dem sie mir eine Freude machen wollte. Eigentlich waren sie gar nicht rot, sondern eher orange – keine Ahnung, wie diese Farbe zustande kam, Tomaten waren kaum verantwortlich dafür. „Sauce“ ist übrigens auch ein allzu hochtrabendes Wort – es handelte sich eher um eingefärbte Spaghetti. Vielleicht ein wenig Öl und Paprika?
Teigwaren waren sowieso nicht ihr Ding. Ihre Mutter hatte ihr eingeimpft, dass nur eine Mahlzeit mit Kartoffeln eine richtige Mahlzeit sei. Ihr Vater jedoch hatte darauf bestanden, hin und wieder Pasta auf den Teller zu kriegen, so wie er es aus seiner Zeit in der Schweiz gewohnt gewesen war. Da aber Teigwaren am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts in Deutschland kaum gekauft wurden, musste Oma diese im Kolonialwarenladen jeweils vorbestellen. Meine Mutter holte sie dort ab, was ihr den Spitznamen „Nudel“ eingebracht habe…
Auch briet sie mir dann und wann ein Schweinsplätzli, das ich eigentlich nicht wirklich gut fand, weil es so dünn war, dass es fast nur eine Seite hatte, wie ich zu scherzen pflegte. Auch zäh war’s – eben kein teures Stück Fleisch. Aber ich ass, weil ich ihr damit eine Freude machte.
Und Mam’s Rösti… Sie hat gespart mit Fett und Salz. Resultat: Erstickungsgefahr!
Den Salat fand ich gut. Auf den wurde nämlich kaffeelöffelweise Zucker gestreut. Das hatte Mam von ihrer deutschen Mutter so gelernt. Ich weiss noch genau, wie diese spezielle Kombination zwischen süss und sauer schmeckte, obwohl ich seit mehr als fünfundfünfzig Jahren keinen solchen Salat mehr gegessen habe.
Was bei mir Grauen und Entsetzen auslöste und meine Mutter zu Unverständnis und einer kummervollen Mine veranlasste, war ihr Versuch, mir Rhabarberkompott zu verabreichen, Lauchgemüse oder Porridge. Alle drei Gerichte erinnerten mich unweigerlich an Nasenschleim. Sie tun es nach wie vor…
Auch ihr Versuch, mir mal Schaffleisch unterzujubeln, misslang kläglich. Ich sehe mich noch, wie ich von der Schule heimkomme, die Küchentüre öffne und mich der Gestank fast erschlägt. - Ich dachte, sie hätte ein lebendiges Schaf in der Küche stationiert. – Es war Hammelfleisch, das in der Pfanne brutzelte, „mutton“ halt, etwas Englisches, das in ihren Augen nur gut sein konnte. - Ein ziemlich unglückliches Unterfangen, finde ich heute noch, denn seit diesem Moment kam und kommt mir Schaffleisch nie mehr auf den Teller - nicht einmal Lamm.
Sie nötigte mich nie, etwas zu essen, das mir widerstrebte. – Diesen glücklichen Umstand hatte ich sicher der Tatsache zu verdanken, dass auch sie einschlägige Erfahrungen mit solchen Zwängen gemacht hatte. Als Kind war sie zusammen mit ihrer jüngeren Schwester mal in einem Lager gewesen, wo’s zum Nachtessen Polenta gab, was beide Mädchen komplett verabscheuten. Sie durften nicht ins Bett gehen, bevor beide nicht aufgegessen hatten. So habe sie auch Wallys Portion herunterwürgen müssen…
Ferien bei meinen Verwandten in Schaffhausen
Auch meine Tante Wally, Mams Schwester, hatte mal den Versuch gemacht, mir Kutteln an Tomatensauce zu servieren – mit demselben Resultat. Ich erinnere mich heute noch an den Geruch. Muffig. Eklig. Und die Konsistenz… Unter keinen Umständen hätte ich da zugelangt und seitdem sind Magenwände auf meinem Teller Tabu.
Dort, bei meiner Tante, ging’s allerdings punkto Essen völlig anders zu als bei uns zu Hause:
Ich war oft bei ihr und ihrer Familie in Schaffhausen in den Ferien, nachdem mein Vater gestorben war. Meine Cousins waren Zwillinge, beides Buben, die dreizehn Jahre älter waren als ich. Und die langten zu. Zum Beispiel wusch meine Tante den Spinat in der Badewanne, solche Unmengen musste sie zubereiten. Und Omeletten machte sie - ein Gedicht! - Die waren fingerdick, bedeckt mit Zimtzucker und saftig mit Apfelmus obendrauf. Aber das wusste ich noch nicht, als sie mich fragte, ob ich gerne Pfannkuchen habe. „Ja“, sagte ich, „ich mag sicher etwa fünf Stück“. Die Jungs lachten mich sogleich aus, so dass ich mich richtig schämte. Ich versuchte dann, es ihnen zu zeigen, aber ja, mehr als zwei davon zu essen, war schlicht unmöglich. - Wie ich überhaupt zu dieser Aussage kam? - Fünf von meiner Mutter zubereitete Omeletten hätte ich problemlos essen können, die waren dünn und durchsichtig wie Pergamentpapier.
Ferien in Schaffhausen gefielen mir immer besonders. Mehrere Male durfte ich dorthin. In die Zwillinge war ich fast ein wenig verliebt. Ich mochte Tante Wally und Onkel Richard sehr. Sie gingen manchmal mit mir ins Strandbad, wo ich im Rhein, in der Stadt-Badi, schwimmen lernte.
Grandios war natürlich auch, dass sie bereits einen Fernseher hatten, schwarz-weiss natürlich. Meine Mutter kaufte uns erst einen, als ich etwa zehnjährig war.
Das Vorabendprogramm durfte ich mit der Familie anschauen, denn gegessen wurde in der Stube vor der „Kiste“. Normalerweise gab‘s Brot, Wurst, Gurken und Käse auf einem Holzbrettchen. – „77 Sunset Strip“ schauten wir uns an, die amerikanische Detektivserie. Diese liebte ich und später ebenso „Bonanza“.
An der Stimmerstrasse, wo die Familie Horn wohnte, kam gelegentlich auch der Migros-Wagen hin. Einmal wöchentlich gingen wir dort einkaufen. Auch dies eine ganz spezielle Kindheitserinnerung.
Einmal war ich in Herblingen in den Ferien bei Onkel Heini, dem Bruder meiner Mutter und Tante Wally. Eigentlich hätte es mir dort ganz gut gefallen mit meinem Cousin René, der ein Jahr älter und meiner Cousine Renate, die drei Jahre jünger war als ich. Der Dritte im Bunde hiess Jörg, der ungefähr einjährig war, als ich dort meine Ferien verbrachte. Es muss im Jahr 1961 gewesen sein. Sie hatten ein Haus im Grünen, wo man herrlich draussen auf der Wiese spielen konnte. - Aber ich war unglücklich. Am Abend mussten wir im Keller in einer Blechzeine baden, alle nackt. Das war ich alles andere als gewohnt, und ich schämte mich zu Tode.
Aber das Allerschlimmste war, beim Essen durfte ich nichts trinken. Mein Onkel wusste ganz genau Bescheid, dass das schlecht war für die Gesundheit, und er hielt stur daran fest (er und seine Frau waren Kettenraucher nota bene). Ich hatte Mühe, das Essen herunterzuwürgen, ass fast nichts. - Zu Hause war es normal, dass ich zu den Mahlzeiten trinken durfte. Als ich meine Mutter von meinen Leiden erzählte, hatte sie ein Einsehen. - Das war mein erster und letzter Urlaub in Herblingen.
Auch an andere Ferien erinnere ich mich. Meine Mutter war sicher froh, mal für eine Woche oder zwei die Verantwortung abgeben zu können und Zeit für sich selber zu haben. So schickte sie mich in ein Ferienlager, das nicht nur ein wenig, sondern ziemlich stark religiös angehaucht war. Sie hatte eine Bekannte, die bei den Evangelisten Mitglied war und der ich wohl dieses Lager zu verdanken hatte – sowie auch ein paar Besuche in einem Sonntagsgottesdienst. Meine einzige Erinnerung daran ist die Negerkind-Skulptur, die am Eingang zum Versammlungsraum stand und in der Hand ein Kässeli hielt, in das hinein man ein paar Almosen spenden musste.
Eigentlich seltsam, dass Mam mich dorthin schickte, hielt sie doch von der Religion und dem weltlichen Bodenpersonal der Dreifaltigkeit gar nichts mehr, seit mein Vater gestorben war und der Pfarrer sie eine Woche nach dem Begräbnis nicht einmal mehr auf der Strasse erkannte. Sie hatte sich vorgestellt, dass er sich mal bei ihr melden und sich erkundigen würde, wie es ihr gehe und ihr seine Hilfe angeboten hätte, aber das fand nie statt. So trat sie kurz darauf konsequenterweise aus der Kirche aus.
Später erzählte mir meine Schwester, dass derselbe Geistliche bei seinem ersten Besuch bei uns, als es ums Besprechen der Beerdigung ging, gleich zu Anfang des Gesprächs gesagt habe, er hätte nicht viel Zeit… Meine Mutter habe ihm daraufhin gleich die Tür gewiesen und ihn weggeschickt. – Das war vielleicht der Grund, weshalb er sie gemieden und ignoriert hatte.
Um wieder auf dieses Lager zurückzukommen - es fand irgendwo auf dem Land statt, wohl im Emmental. Jeden Morgen mussten wir ein Heiligenbild zeichnen und fromme Sprüche darunter schreiben. Das lag mir gar nicht. Aber sehr viel schlimmer war, dass man uns eine Geschichte erzählte, in Raten, jeden Tag ein neues Kapitel, und zwar von zwei Kindern aus Düsseldorf, von Gisela und ihrem Bruder, dessen Name ich vergessen habe. Die Geschichte handelte während des zweiten Weltkriegs. Die Geschwister flüchteten aus ihrer zerbombten Heimatstadt, denn sie hatten ihre Eltern verloren. Ich hatte solche Angst, so etwas könnte sich bei uns ebenso ereignen und ich würde meine Mutter auch noch verlieren. Ich war absolut terrorisiert, schlief schlecht, hatte die grässlichsten Albträume.
Wie schön, dann wieder zu Hause zu sein. Selbstverständlich erzählte ich meiner Mutter nichts von alledem, fürchtete mich aber auch später noch lange, wenn ich in der Nacht ein Flugzeug hörte, denn ich dachte, der Krieg sei ausgebrochen.
Mit meiner Verschwiegenheit übrigens muss ich erfolgreich gewesen sein. Erst im Jahr 2015 fanden wir in der Korrespondenz meiner verstorbenen Mutter einen Brief, der mich ziemlich berührte. Sie hatte ihn an den Leiter des besagten Lagers geschrieben und ihm dafür gedankt, dass ich hatte dabei sein können, überzeugt davon, dass ich eine wunderbare Woche verbracht hatte.
Sommerferien in Italien
Nachdem meine Mutter ein paar Jahre lang als Bundesbeamtin gearbeitet hatte, konnte sie sich ein lange ersehntes Auto leisten. Es war ein dunkelgrüner Occasions-VW-Käfer, der mit einem kleinen, ovalen, zweigeteilten Rückfenster ausgestattet war und mit ausklappbaren Zeigern beidseitig in der Mitte oberhalb der Türen.
Mit diesem Gefährt fuhren wir manchmal zu unseren Verwandten nach Schaffhausen. Eine Autobahn existierte damals noch nicht; es dauerte ewig lange, bis wir ankamen. – Auch die Ferienreise im Juli nach Italien wollte kein Ende nehmen, so schien es mir. Rimini war das Ziel, zwei Wochen lang blieben wir normalerweise, aber bis wir dort waren, hatten wir so gut wie jedes Mal eine Panne. Auch auf der Heimfahrt. Einmal mussten wir in einem kleinen Dorf eine Werkstatt aufsuchen und der Angestellte sagte, der Schaden könne nicht so einfach behoben werden, es brauche Ersatzteile. Wir mussten also übernachten. Als wir am nächsten Tag in die Garage kamen, hatte meine Mutter fast einen Zusammenbruch. Da stand unser VW und vornedran lag der ganze Motor in seinen Einzelteilen am Boden ausgebreitet – Schrauben, Schläuche, Metallteile. - Wundersamerweise aber gelang es dem Mechaniker trotzdem nach ein paar Stunden, unser Vehikel wieder flott zu machen, und wir konnten die Heimreise antreten.
Später kaufte sich Mam ein neueres Modell, weiss diesmal, immer noch einen VW-Käfer, dieser nun bereits mit einem „anständigen“ Heckfenster und mit Blinkern. Obwohl sie eine Schwäche für schöne Autos hatte, leistete sie sich auch später nie eines. Einen Karmann hätte sie gerne gehabt, das war ihr Traum, aber diesen Wunsch konnte oder wollte sie sich dann doch nie erfüllen.
Grosse Autos flössten ihr Respekt ein. „Wagen“ nannte sie diese. Waren wir unterwegs, sagte sie oft, in den Rückspiegel blickend: „Da hinde chunnt ä schnäue Wage“, und wenn sie am Überholen war, scherte sie rasch wieder ein, um diesem Platz zu machen.
Als sie mal in Los Angeles in den Ferien war (sie war damals etwa 70-jährig) hatte ich ihr eine Sofortkamera mitgegeben. Knapp zwanzig Fotos hatte sie geknipst, die sie uns dann präsentierte. Die meisten waren verschwommen und auf mindestens der Hälfte davon war der Porsche zu sehen, der dem Sohn ihrer Bekannten gehörte, bei denen sie zu Besuch war. Mal schräg von vorne, von hinten, Seitenansicht, beim Abfahren …
Sicher waren es mehr als fünfmal, dass wir unsere Sommerferien in Rimini verbrachten. Einmal kam auch meine Schwester mit, später nicht mehr. Strand, Sonne und Meer – die absoluten Traumferien für mich. Wir gastierten jeweils in einer billigen Pension, das Essen dort fand ich grossartig – Pasta vom Feinsten.
Auf Drängen meiner Mutter nahm ich einmal an einem Kinderschönheits-Wettbewerb in einem Hotel teil und gewann gleich den Hauptpreis, eine Bambola, eine grosse Puppe, die mir in einer Kartonschachtel überreicht wurde. Schwarze Haare hatte sie, ein weisses Kleid mit rotem Gurt. – Natürlich hatte ich Freude, einen Preis gewonnen zu haben, obwohl ich Puppen ja gar nicht mochte, und so blieb die hübsche Dame auch zu Hause in diesem Karton ihrem einsamen Schicksal, dem Verstauben und wohl später dem Entsorgen, überlassen.
Winter
Der Winter war nicht meine Jahreszeit. Wahrscheinlich hatte es zumindest teilweise mit dem zu tun, was ich mal beim Schlitteln erlebt hatte. Extrem steil war der Hang zwar nicht, den wir hinunterkurvten, lang auch nicht, aber unten, wo es wieder eben wurde, da schlängelte sich ein schmaler Bach durchs Tal. – Und genau darin fand ich mich wieder, nachdem der Junge, der hinten auf meinem Schlitten gesessen hatte, rechtzeitig abgesprungen war und mich alleine hatte weitersausen lassen. – Das gab Tränen. Ich wollte nichts wie heim, alles war nass und sogar Schlamm hing an meiner Kleidung. Ich fror jämmerlich.
Skilager in der Sportwoche waren damals nicht obligatorisch. Von Lagern hatte ich so oder so genug und war daher froh, dass ich mich stets vor der Teilnahme drücken konnte. Weder meine Mutter noch meine Schwester konnten Skifahren, und Geld für Wintersportausrüstung und –ferien war auch nicht vorhanden. Zudem hatte ich Angst vor Kälte und Beinbruch.
Vom Schlittschuhlaufen liess ich mich ebenso wenig begeistern. Probiert hatte ich es zwar schon mal, im Egelmöösli, einem kleinen See, eher einem Weiher, ganz in der Nähe unseres Schulhauses. Aber kaum hatte ich die „Fasstübeli“, wie die Vorrichtung hiess, die man an die Schuhe band, montiert, schon waren meine Finger klamm vor Kälte, bevor der Spass überhaupt begonnen hatte.
Erst kurz nach meinem sechsundvierzigsten Geburtstag nahm ich einen Anlauf und lernte Skifahren.
Die Heirat meiner Schwester
Im Juli 1963 heirate meine Schwester ihren ehemaligen Klassenlehrer aus dem Gymnasium und die beiden zogen in eine kleine Wohnung in unserer Nähe. Ich war damals zehnjährig.
Ich weiss noch, wie ich an ihrer Hochzeit die ersten paar Verse aus dem Gedicht „Die Frommen Helene“ von Wilhelm Buch rezitierte. Wer mich dazu genötigt hatte, diese auswendig zu lernen und vorzutragen, weiss ich nicht mehr. – Die Strophen, merke ich gerade, kann ich noch jetzt hersagen.
Ratsam ist und bleibt es immer
Für ein junges Frauenzimmer,
Einen Mann sich zu erwählen
und wenn möglich zu vermählen.
Erstens: will es so der Brauch.
Zweitens: will man’s selber auch.
Drittens: man bedarf der Leitung
Und der männlichen Begleitung;
Weil bekanntlich manche Sachen,
Welche grosse Freude machen,
Mädchen nicht allein verstehn;
Als da ist ins Wirtshaus gehen.
Auch erinnere ich mich an die Frisur, die mir meine Mutter am Morgen vor dem Event verpasst hatte: Nach dem Haare-Waschen traktiere sie meine Kopf mit „Bigudi“ (Lockenwicklern), so dass ich mich selber kaum mehr erkannte im Spiegel. Ich hatte jetzt lauter dunkle Locken, und das gefiel mir gar nicht. Vor allem wegen der Kommentare mehrerer Hochzeitsgäste: „Eh, wie härzig!“
Von da an wohnten nur noch meine Mutter und ich am Sonnenhofweg. Inzwischen hatte meine Schwester ihr Studium abgeschlossen und arbeitete als Sekundarlehrerin in Oberdiessbach.
Kurzer Blick in die Zukunft:
Nachdem sie zwei Jahre lang ihren Beruf ausgeübt hatte, ging sie zurück an die Uni und begann ein Studium der Rechtswissenschaften. Das hätte sie gerne von Anfang an tun wollen, aber unsere Mutter bat sie, ein kürzeres Studium zu wählen für den Fall, dass ihr etwas zustosse, so dass Doris für mich aufkommen könnte. – Das geschah glücklicherweise nicht. Sie beendete ihr Studium mit Bravur als Fürsprecherin, doktorierte, war alsdann Partnerin in einer Bürogemeinschaft, war später Mitglied im Grossen Rat, wo sie eine Zeitlang die Justizkommission präsidierte. Ihre Wahl als Richterinn ins Verwaltungsgericht war der Höhepunkt ihrer Karriere. Mit Zweiundsechzig liess sie sich vorzeitig pensionieren.
Zurück in die frühen Sechzigerjahre:
Etwa zu der Zeit kamen die Beatles auf, die „Pilzköpfe“, wie gewisse Leute sie ein wenig despektierlich nannten. Ich liebte ihre Songs, sang sie nach, schrieb sie auf und fragte meine Mutter, die ja gut Englisch konnte, was die Texte bedeuteten. Das war meine erste Begegnung mit dieser Fremdsprache, die ich sogleich liebte und später mit Freude erlernte.
Inzwischen hatte ich einen Radio erhalten, in dessen Deckel ein Plattenspieler eingebaut war. Zum Geburtstag und zu Weihnachten wünschte ich mir nun Schallplatten.
Genau aus diesem Radio hatte ich auch von Kennedys Tod erfahren. Es war der 22. November 1963. Ich stand in meinem Zimmer und konnte kaum glauben, was da Schreckliches berichtet wurde. Der Präsident, den „alle“ liebten, war erschossen worden.

Vier Jahre Progymnasium 1964 – 1968
Nach der vierten Klasse musste man sich entscheiden, wie weiter – Sekundarschule oder Progymnasium? Das war für meine Mutter keine Frage. – „Dies ist das Schulhaus, wo du dann später mal hingehen wirst“. Das hatte sie mich schon im Kindergarten wissen lassen, damals, als meine zwölf Jahre ältere Schwester das Gymnasium Kirchenfeld besuchte und wir dort vorbeispazierten.
So weit war es allerdings noch nicht. Erst gab es eine Prüfung zu absolvieren. Diese fand im Progymnasium am Waisenhausplatz statt. Eigentlich war ich ganz sorglos und hatte keine Angst zu scheitern. Im Tram nach Hause jedoch, nach getaner Arbeit, kam mir plötzlich in den Sinn, dass ich vergessen hatte, meinen Aufsatz mit einem passenden Titel zu versehen, so wie es die Aufgabe verlangt hatte. – Da wurde mir ganz mulmig zumute und ich war überzeugt, ich hätte nicht bestanden.
Dem war aber zum Glück nicht so und ich ging die nächsten paar Jahre ins Progymnasium Manuel. Wir waren der letzte Jahrgang mit dieser Regelung, anschliessend wurde umstrukturiert und ein Übertritt ins Untergymnasium war erst ab dem sechsten Schuljahr möglich. Das bescherte uns denselben Klassenlehrer für vier Jahre, der war aber ein geduldiger und freundlicher Mann und uns wohlgesinnt. Etwas langweilig waren seine Lektionen zwar schon, aber hier musste niemand leiden, weil er oder sie körperlich gezüchtigt, malträtiert oder blossgestellt worden wäre. – Nur der Mathematiklehrer war einer, der nach alter Schule noch den Schlüsselbund nach unaufmerksamen Schülerinnen und Schülern warf.
Ich erinnere mich gut, wie unser Klassenlehrer, wenn wir Geographieunterricht hatten, stundenlang die schönsten farbigen Karten an die Wandtafel zeichnete. Das war immer ein ziemlicher Stress für mich, denn, um’s ebenso schön hinzukriegen, musste ich mich enorm beeilen. Damit die Karten massstabgerecht projiziert werden konnten, legte Herr Gisy in seinem Atlas ein feines Raster aus Bleistift über das Bild, fast wie ein Spinnengewebe. Dasselbe Netz zeichnete er zu Beginn an die Tafel und so konnte er die Vorlage genauestens kopieren. – Diese Arbeit muss ihm ausserordentlich gefallen haben. Sobald er fertig war, löschte er die Hilfslinien auf der Wandtafel fein säuberlich aus, betrachtete sein Werk wohlwollend, indem er den Kopf nach rechts und nach links beugte. Makellos präsentierte sich nun seine Zeichnung. Dann ging er zur Seite und liess uns abzeichnen. - Gerne hätte ich ihm jeweils sagen wollen, er solle doch bitte, bitte den Raster auf der Tafel stehen lassen, damit auch wir das Bild mit demselben Trick beziehungsweise Hilfsmittel hätten ins Heft übertragen können. Aber ich getraute mich nie. So versuchte ich in Windeseile und möglichst gleichzeitig mit ihm, erst Raster, Lineal, dann Strich für Strich, Bleistift, Farbstift, Radiergummi...
Niemand aus meier früheren Klasse war im selben Schulhaus; ich musste neue Bekanntschaften schliessen. Damals war's noch einfach, sich die Namen zu merken. Weder Kevins noch Colins, weder Jessicas, Amélies oder Noemies hatten wir in der Klasse, schon gar keine Anasuyas, Betüls oder Thavakumaran und Kamals. - Es gab unter anderem drei Barbaras zu unterscheiden, drei Regulas ebenfalls, zwei Monikas, eine Margrit und bei den Bub den gehörten Stefan, Hanspeter, Hansruedi und Markus zu den gängigen Namen sowie Daniel 1 und 2.
Schon bald hatte ich eine allerbeste Freundin. Die Freundschaft mit ihr war in mancher Hinsicht ein Segen für mich, denn ich durfte von Montag bis Freitag bei ihr zu Mittag essen, und das jahrelang, bis zur Matur. - Eine der Barbaras war's und sie hatte die beste aller Mütter, eine herrliche und intelligente Frau, die zudem eine gute Köchin war und es nie müde wurde, mit uns über Filme und Bücher, über Politik und Gesellschaft, über Gott und die Welt zu diskutieren. Auf diese Weise machten sogar Abwaschen, Abtrocknen und Geschirr Versorgen Spass.
Dort lernte ich zum ersten Mal ein richtiges Familienleben kennen. Barbara hatte zwei jüngere Brüder und ihr Vater war ein bekannter Psychiater. Ich liebte die Gespräche am Familientisch und das feine Essen, das ihre Mutter auftischte. – Zum Beispiel wurde der Blumenkohl halt nicht nur aus dem Wasser gezogen serviert, so wie das bei uns zu Hause üblich war, sondern, wenn das weisse Kohl-Haupt den Ofen verliess, war es reich bedeckt mit Schinkenstreifen, harten, gehackten Eiern, geriebenem Käse und zur Krönung begossen mit flüssiger Butter. – Davon musste man ja Gewicht zulegen. So nahm ich innert kürzester Zeit vierzehn Pfund zu und wog dann während Jahren 51 Kilo.
Zurück zu den Anfängen in der neuen Schule: Es gefiel mir ganz gut; natürlich war ich stolz darauf, den Übertritt ins Progy geschafft zu haben. Dass wir jetzt verschiedene Lehrer hatten und nicht nur einen, gefiel mir besonders.
Neuerdings ging es darum, Französisch zu lernen. Damit hatte ich meine liebe Mühe, weil ich bisher kaum je hatte Aufgaben machen müssen, aber nun besass ich keinerlei Vorkenntnisse und wusste gar nicht recht, wie lernen. Mir all die fremden Wörter merken und dazu noch diese abstruse Schreibweise anwenden zu müssen, war nicht nach meinem Geschmack. So bekam ich zum ersten Mal schlechte Noten. Mit den anderen Fächern hatte ich nach wie vor keine Probleme, aber irgendwie gelang es Herrn Gisy nicht, mich für diese Fremdsprache zu motivieren. Leider! – Im Gymnasium wurde es nicht viel besser, ich schlug mich jedoch schlecht und recht durch, aber mein Lieblingsfach war Französisch wahrlich nicht. - Das finde ich heute enorm schade. Hätte ich mir damals doch mehr Mühe gegeben…
Anders lief’s mit dem Latein. In der siebten und achten Klasse stand dieses Fach auf dem Stundenplan. Wir hatten eine Lehrerin, die ihre Sache wirklich gut machte. Auf ihren Unterricht freute ich mich jeweils, mir kam das Übersetzen vor wie Kreuzworträtsel-Lösen und ich hatte ganz gute Noten. Ich glaube sogar, dass ihr Vorbild mich schliesslich, zumindest zum Teil, dazu bewogen hat, den Lehrerberuf zu ergreifen.
Nicht ganz alle machten immer so motiviert mit wie ich und so erinnere ich mich an einen Spruch von ihr, der mich so lustig dünkte, dass ich ihn nie vergessen habe und ihn Jahre später auch mal bei meinen eigenen Schülern angebracht habe. Sie sagte, als auf eine Frage von ihr niemand die Hand hochhielt: „Ihr könnt doch nicht auf dem Sofa sitzend durchs Leben segeln“.
Aber ich war voll und ganz dabei und daran war mein Schwager nicht ganz unschuldig. Ich erhielt nämlich von ihm für die erste Sechs bei einer Probe einen Franken, für die zweite zwei Franken, für die dritte wieder den doppelten Betrag. Das hatte er mir versprochen. Relativ rasch hätte diese Abmachung ja ins Unermessliche führen können, aber reich wurde ich leider doch nicht dadurch und er nicht arm, aber die Aussicht auf den grenzenlosen Mammon hatte mich schon sehr angetrieben zu lernen und in diesem Fach zu glänzen.
So gern ich Latein lernte damals, so sehr widerstrebte mir der Unterricht in diesem Fach später im Gymnasium. Davon aber in einem anderen Kapitel.
Eine ganz andersartige Erinnerung an meine Lateinlehrerin kommt mir eben im den Sinn:
Zu jener Zeit kamen die Minijupes in Mode. Unbedingt musste ich so eines haben. Aus hellbraunem, feinem Manchesterstoff war’s gefertigt und ich fand es hinreissend. Nicht so meine Lehrer. Eines Abends erhielt meine Mutter einen Anruf von ihr (sicher wurde sie von der Lehrerschaft dazu verknurrt). Mam wurde darum gebeten oder wohl eher dazu aufgefordert, mich nicht mehr in solch unpassender Kleidung in die Schule zu schicken. – Dabei sah man ja nur gerade knapp die Kniescheibe – von wegen „mini“… Obwohl meine Mutter diese Intervention übertrieben fand, durfte ich von da an das unschickliche Teil nur noch in der Freizeit tragen.
Mein Schulweg war jetzt ein wenig länger. Oft wartete Alex Tschäppat, der spätere Stadtpräsident von Bern, an der Ecke beim Sonnenhofschulhaus auf mich. Wir hatten denselben Schulweg und immer etwas zu plaudern. Er war zwar ein oder zwei Jahre älter als ich, aber inzwischen waren die Zeiten vorbei, wo die Jungs unter keinen Umständen etwas mit den Mädchen zu tun haben wollten.
Meine Freizeit
Die Zeit der Globi-Bücher war natürlich ebenfalls vorbei, ich widmete mich „ernsthafterem“ Lesestoff. „Das Doppelte Lottchen“ von Erich Kästner gehörte dazu, fand ich grossartig, ebenso ein Lexikon für „Wissbegierige“. Schon dieses Wort allein imponierte mir.
Mein Schwager hatte die schöne Angewohnheit, uns jeden Monat an seinem Zahltag ein Buch zu schenken. Beim ersten Mal sagte er, es sei eines, für das wir eigentlich noch zu jung seien. Mutter erhielt einen Roman von Tolstoi, mit welcher Lektüre meine Schwester beglückt wurde, weiss ich nicht mehr. Aber ich bekam den ersten Band von Karl May. – Da öffnete sich mir einen neue Welt.
So erhielt ich nach und nach eine weitere Folge aus dem Wilden Westen mit den fantastischen Indianergeschichten von Winnetou, seiner Schwester Nscho-tschi und Old Shatterhand, und ich verschlang sie allesamt. Anschliessend ebenso die Sammlung, die in der Wüste spielt, in Kleinasien. Von der Beschreibung der wunderbaren Pferde konnte ich kaum genug bekommen und mein allergrösster Wunsch war es, reiten zu lernen.
Es gab einen veritablen Karl-May-Boom zu der Zeit. Im Kino liefen die Winnetou-Filme. Was für ein Bombenerlebnis! – Die Filmmusik von Böttcher musste ich unbedingt haben. Immer und immer wieder konnte ich mir die Platten in voller Lautstärke anhören und dabei in diese einmalige Traumwelt eintauchen.
Natürlich gab’s auch Zeitschriften. Das Bravo war meine absolute Lieblingslektüre und ich konnte es kaum erwarten, bis die nächste Ausgabe am Kiosk erhältlich war, um einen weiteren Teil des Starschnitts ausschneiden und die Wände in meinem Zimmer damit tapezieren zu können. So prangten dort Lex Barker und Pierre Brice in Lebensgrösse über meinem Bett nebst vielen anderen Porträts von Stars, die ich fein säuberlich ausgeschnitten hatte: Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Brigitte Bardot, Marlon Brando, James Dean, James Stuart, Cary Grant, Jean-Paul Belmondo und so weiter. – Mit der Zeit war kaum Tapete mehr zu sehen.
Selbstverständlich bot das Bravo noch viel mehr zu jener Zeit: Aufklärung, interessante Leserbriefe, Klatsch und Tratsch über die Stars aus dem Showbusiness, die viel geliebte Rubrik, wo Leserinnen und Leser ihre Fragen zu Sex und Beziehungen stellten konnten und Fortsetzungsgeschichten, in denen es natürlich ebenfalls um nichts anderes als um Liebe ging.
Als ich in die fünfte Klasse kam, erfüllte sich mein sehnlichster Wunsch: Ich durfte reiten lernen. In Köniz wurde die Reitschule „Eldorado“ eröffnet. Jeden Mittwochnachmittag ging ich hin und hatte eine Reitstunde. Die Pferde zu pflegen, sie zu satteln und schliesslich auf deren Rücken zu sitzen, war das absolut Höchste der Gefühle. Sogar eine Voltigier-Gruppe wurde zusammengestellt, mein Stolz wuchs ins Unermessliche: Aufs Pferd aufzuspringen, auf dessen Rücken stehend ein paar Runden drehen zu können – genau wie im Zirkus - es war grandios.
Ausreiten aber war das Allerschönste. Zu Weihnachten und zum Geburtstag hatte ich nun vor allem einen Wunsch: Geld für ein Reitabonnement zu erhalten. Ein paarmal bezahlte mir meine Mutter sogar Reitferien. Im Jura gab es etliche solcher Angebote. Den ganzen Tag lang mit den Pferden zu verbringen, ein paar Stunden aneinander reiten zu gehen, über Felder zu galoppiere, in eine ganz andere Welt einzutauchen oder darin zu schweben, das war einfach nur herrlich.
Meine Reitstunde am Mittwochnachmittag dauerte etwa bis um drei. Anschliessend nahm ich den Bus zurück in die Stadt. In der Loeb-Bar, im Kaufhaus am Bahnhofplatz, kaufte ich mir von meinem Taschengeld zum Zvieri eine Cola und ein Schinkensandwich. Das leistete ich mir, weil ich es so unsagbar gut fand. Und wo ich nachher hinging, das zu erzählen, ist auch ein paar Zeilen wert.
Meine „Tante Hänni“ hatte eine Bekannte und diese hatte einen älteren Untermieter, der im Kino Central als Operateur arbeitete. Als wir einmal bei dieser Frau eingeladen waren, fragte ich, ob ich den Herrn Ackermann mal besuchen und vielleicht einen Film schauen dürfe. Er murmelte: „Ja“ (vermutlich widerwillig) und von da an stieg ich jeden Mittwoch nach meinem Schinkensandwich-Schmaus die Hintertreppe neben dem Kino hoch zu seinem engen, düsteren Arbeitsplatz. Ich glaube nicht, dass er von meinen Besuchen überaus begeistert war, aber er liess es geschehen. Ich war ja erst zwölf-, später dreizehnjährig, hätte diese Filme gar noch nicht schauen dürfen. - Er war mehr als nur wortkarg und ich erinnere mich nicht, dass wir jemals mehr als zwei, drei Worte gewechselt hätten. Das war übrigens auch kaum möglich, machte die Film-Abspielanlage doch einen solchen Lärm, dass man sich so oder so nicht hätte verständigen können. Die Filme, die ich mir durch ein schmales Fenster in der Wand oberhalb des Kinosaals ansah, es war eigentlich fast nur ein Schlitz, einer Schiessscharte ähnlich, waren entweder Western oder Heldenfilme, Herkules und Goliat, Herkules und Maciste und so weiter. Bequem war’s nicht. Ich sass auf einer Art Barhocker und musste mich ziemlich strecken, um überhaupt etwas mitzukriegen. - Schurken, Revolverhelden, Indianer, Sheriffs, Verfolgungsjagden zu Pferd, schöne Frauen, muskulöse Männer, funkelnde Schwerter, das gab’s zu sehen. Jeden Mittwoch. Hin und wieder passierte ein Filmriss, was gezwungenermassen zu einer kurzen Pause führte, bis Herr Ackermann die Filmrolle wieder im Griff hatte. Wenn der Film Untertitel hatte, bekam ich von der Handlung ein wenig etwas mit, wenn nicht, sah ich nur die bewegten Bilder – im Hintergrund ratterte und dröhnte ja die Maschinerie. Aber mir genügte das. – Ziemlich merkwürdig, wenn ich heute daran zurückdenke. - Nach dem Erlebnis fuhr ich mit dem Tram nach Hause. Meine Mutter kam erst später von der Arbeit heim; ich erzählte ihr nie etwas davon.
Ein ziemlich unrühmliches Kapitel gibt es auch noch zu erwähnen: Ich hatte begonnen zu rauchen. Mit zwölf. Ich wollte halt unbedingt schon als erwachsen gelten und Rauchen gehörte dazu.
Meine Mutter hatte lange Zeit nichts davon bemerkt. Sie selber hat nicht geraucht, meine Schwester und mein Schwager aber schon. Denen stibitzte ich ab und zu mal eine Zigarette, erst nur zum Ausprobieren. Allmählich kaufte ich von meinem Taschengeld ganze Päckli. „Select“ erkor ich zu meiner Lieblingsmarke, nachdem ich manche andere Sorte „getestet“ hatte. Eigentlich gehörte es ja zum guten Ton, „Gauloise bleu ohne Filter“ zu rauchen, da mir aber immer Tabakkrümel auf der Zunge zurückblieben, entschied ich mich für eine weniger „coole“ Marke mit Filter.
Zu Hause stand ich zum Rauchen beim offenen Fenster auf den Badewannenrad. Ich hatte erfahren, dass im unteren Teil eines geöffneten Fensters die frische Luft von draussen hereinzieht, im oberen Teil weht die alte hinaus. Und genauso war es auch. Nicht ein einziges Mal wurde ich erwischt. – Später im Gymnasium brachte ich es auf gut und gern zwei Päckli oder mehr und es gab eine Zeit, wo ich selber dachte, ich würde, sollte das so weitergehen, wohl das zwanzigste Altersjahr nicht erreichen. – Aufhören war aber schwierig, obwohl es mich selber nervte, dass ich Himmel und Hölle in Bewegung setzen musste, um Zigaretten aufzutreiben, wenn sie mir ausnahmsweise mal ausgegangen waren. Zwar hatte ich etliche Male versucht, gegen die Sucht anzukämpfen, hatte mir beispielsweise vorgenommen, nur noch zehn Zigaretten pro Tag zu rauchen. Meinen Tag verbrachte ich dann allerdings vorwiegend damit, auf die Uhr zu schauen und mir auszurechnen, wie lange ich durchhalten musste bis zum nächsten „Lungenbrötli“, wie wir es nannten - also gab ich diesen hilflosen Versuch bald wieder auf.
Erst als ich fünfundzwanzig war und vermutete, ich könnte vielleicht bald schwanger werden, gelang es mir, von einem Moment auf den andern problemlos von der Zigarette wegzukommen.
Die Ferien verbrachten wir zu der Zeit nicht mehr in Italien.
Eine Reise führte uns mal nach Hamburg, wo meine Mutter natürlich das Quartier aufsuchen wollte, wo sie aufgewachsen war. Das war eine traurige Erfahrung, denn die Bomben des Zweiten Weltkriegs hatten ganze Arbeit geleistet. Von dem, was einmal war, war nichts mehr vorhanden, neue Gebäude hatten den Trümmern Platz gemacht. - Sie hatte es zwar geahnt, aber dann dort zu sein und nichts mehr zu erkennen, keine Häuser, keine Läden, keine Strassenzüge und -kreuzungen, war für sie ein einschneidendes Erlebnis, von dem sie sich lange nicht erholte.
Als ich vierzehn war, ging die Reise in den Sommerferien nach England. Wir reisten mit dem Zug zuerst nach Paris, wo wir ein paar Tage blieben und uns „alles“ anschauten, dann ging’s weiter nach London und schliesslich aufs Land, an die Westküste, wo Mam Bekannte hatte, die wir besuchten. Zwei solche Hauptstädte zu erleben – ich war im siebten Himmel. Zu Hause dann erzählen zu können, ich sei in England und Frankreich gewesen, das war schon etwas. Heutzutage kann man mit solchen Destinationen nicht mehr auftrumpfen, damals aber schon.

Durch die Zeit im Gymnasium schlängelte ich mich schlecht und recht durch – von PG zu PG (Promotion gefährdet). Aber es reichte immer grad knapp, so dass ich nie eine Klasse wiederholen musste, denn jedes zweite Zeugnis war genügend.
Nicht alle hatten dasselbe Glück, sich ungeschoren durch die viereinhalb Jahre zu lavieren. Zu Beginn in der Quarta waren wir 24 Schülerinnen und Schüler. Im Laufe der Zeit wurden acht von uns nicht promoviert, mussten das Schuljahr wiederholen oder traten aus. Drei stiessen dazu, so waren wir bei der Matur noch 19 Übriggebliebene, die allerdings alle bestanden. Wir hatten nicht viel Zusammenhalt untereinander; unsere Lehrer sagten, wir hätten keinen sogenannten „Klassengeist“. – Das stimmte schon einigermassen, es hatten sich halt kleine Gruppen gebildet.
Aber während der Maturreise nach Budapest harmonierten wir erstaunlich gut.
Demo
Eine spezielle Erinnerung habe ich an den August 68: Kurz nach den Sommerferien geschah es, dass sowjetische Truppen in die Tschechoslowakei einfielen. - In der Zehnuhr-Pause wurden alle Schülerinnen und Schüler von den Primanern aufgefordert, an einem Protestmarsch teilzunehmen. Wir sollten alle zusammen zum Thunplatz marschieren und vor der russischen Botschaft, die sich kaum einen Kilometer von unserem Schulhaus entfernt befand, demonstrieren. Schon verliessen Dutzende von jungen Leuten den Pausenplatz und begaben sich in besagte Richtung. Wir waren damals die „Kleinen“, die Quartaner, aber die Versuchung war zu gross, sich dem Strom der Protestierenden nicht anzuschliessen. Unisono gingen wir mit. Nur ein paar ganz Brave blieben zurück, die sich von den verzweifelten Versuchen der Lehrer, welche vom Vorhaben erfahren hatten und nun mit Repressalien drohten und sich vergeblich bemühten, uns davon abzubringen, in Scharen das Areal zu verlassen, beeindrucken liessen.
So wurde der ganze Thunplatz von einer riesigen Versammlung von Gymnasiasten bevölkert, die alle aus voller Kehle „Dub%u010Dek, Svoboda“ riefen. Kein Tram konnte mehr passieren, auch kein Auto und die Demo dauerte, bis die Polizei erschien und uns mit Tränengas vertrieb.
Das alles gab natürlich zu reden und zu debattieren, aber die angedrohten Konsequenzen fanden schliesslich doch nicht statt.
Fünfwochenkurs
Bevor ich über Lehrer, Fächer und Lerninhalte berichte, hier ein paar Zeilen über den verhassten, obligatorischen „Füfwücheler“, den wir Mädchen zweimal in den Sommerferien absolvieren mussten, in der Terzia und in der Sekunda.
Drei Wochen kochen und haushalten lernen und zwei Wochen nähen. Und das mitten im Sommer! Alle andern hatten Ferien - es war die Hölle.
Meine Einstellung dazu war so miserabel, dass der Misserfolg schon vorausprogrammiert war. Kochen lernen wollte ich sowieso nicht, meine Schwester war mir da ein (nicht wirklich hilfreiches) Vorbild. Sie hatte zwölf Jahre zuvor einen ebensolchen Kurs durchlaufen müssen, mit dem Resultat, dass die ganze Mühe überhaupt nichts fruchtete. Ich glaube, sie weiss noch heute nicht einmal, wie man ein Spiegelei macht. Zu ihrem Glück hat sie einen Mann geheiratet, der mit dem Kochtopf umzugehen weiss.
Wäre ich nicht so stur gewesen, hätte ich sicher vom einen oder anderen Lerninhalt profitieren können, aber das liess ich gar nicht zu.
Wir hatten ein Haushaltsbuch zu führen. Leider habe ich es nicht mehr, denn aus dem, was wir da hineinschreiben mussten, könnte man heute eine abendfüllende Kabarettnummer gestalten.
Schlimmer noch war’s im Nähkurs. Wir wurden angewiesen, Arbeiten auszuführen, über die man heute nur noch den Kopf schütteln kann. Ich schüttelte ihn schon damals…
Die eine war: ein Leintuch wenden. - Ausgangslage: In der Mitte, dort, wo man draufliegt, ist der Stoff ganz dünn geworden, am Rand ist er wie neu. - Vorgehensweise: Leintuch in der Mitte durchschneiden, Seitennähte öffnen und zusammennähen, so dass die dünnen Seiten nun aussen sind. - Ok, ok, da war dann halt die Naht in der Mitte, dort, wo man draufliegt. –Die Prinzessin auf der Erbse ist ja nur ein Märchen… (Mein) Fazit: Schade für Zeit und Aufwand.
Eine andere Arbeit war: Männer-Hemd-Kragen wenden. – Ausgangslage: ähnlich wie beim Leintuch ist der Stoff im Bereich des Halses dünn geworden. - Vorgehensweise: Kragen sorgfältig abtrennen und als Mustervorlage verwenden. Im unteren Teil des Hemdes („Hemlistoss“) ein Stück Stoff ausschneiden und den zu einem neuen Kragen verarbeiten, inklusive Knopfloch natürlich, und ordentlich an das nun kragenlose Hemd annähen. Fertig. – (Mein) Fazit: Dafür fand ich schon damals keine Worte…
Die Unterrichtsfächer
Englisch machte mir Spass, da war ich motiviert, enthusiastisch sogar, also „eager to learn“. Ich las auch in der Freizeit ein Buch nach dem anderen, nicht nur diejenigen, die wir als Aufgabe lesen mussten. Agatha Christies Krimis zum Beispiel konnte ich kaum mehr aus der Hand legen. Die fesselnden mystischen Romane von Daphne du Mourier ebenso wenig. Alfred Hitchcock muss ebenso ein Fan von ihr gewesen sein, sonst hätte er kaum ein paar ihrer Romane und Erzählungen verfilmt. Spannung pur! - Mein absoluter Lieblingsschriftsteller aber war Somerset Maugham. Seine Kurzgeschichten faszinierten mich. Inhalt und Stil. Auch unseren Lehrer mochte ich sehr, Mr. Adam. - Mit der Englischnote konnte ich die Lateinnote im Gelichgewicht halten.
Latein war mir inzwischen zum absoluten Gräuel geworden. Ich begriff plötzlich nicht mehr, wieso man so unendlich viele Stunden dafür aufwenden musste, eine tote Sprache zu lernen, die in der Art, wie wir unterrichtet wurden, so oder so niemand je gesprochen hat.
Unser uralter Lehrer sagte mal, er könne sich nichts Schöneres im Leben vorstellen, als auf einem der sieben Hügel Roms im Schatten eines Baumes zu liegen und die Aeneis zu lesen. – Da wusste ich, wir beide sind nicht nur von einem anderen Planeten, uns trennt eine ganze Galaxie. – Rom wäre ja schon ok, unter einem Baum zu liegen ebenfalls, aber doch lieber in der Sonne. Vergil mit seinen Hexameter hingegen… Obwohl - noch heute kann ich die ersten paar Zeilen der Aeneis auswendig hersagen, und das sogar im richtigen Versrhythmus. Dafür hab ich alles andere vergessen, was ich so mühsam büffeln musste. Es gab eine Zeit (jeweils vor einem drohenden PG), da musste ich sogar Nachhilfestunden nehmen. Das reichte dann wieder für eine Drei im Zeugnis, was ich fast als Heldentat empfand. Im letzten halben Jahr ver(sch)wendete ich keine einzige Minute mehr fürs Lateinlernen; ich sass nur noch die Stunden ab. An der Matur schaffte ich in der schriftlichen Arbeit eine Zwei, in der mündlichen eine Eins. Anderthalb im Durchschnitt wurde aufgerundet zu einer Zwei, dazu die Erfahrungsnote – ebenfalls eine Zwei - also alles im Grünen.
Mich reuen auch heute noch die vielen Lateinstunden, die wir über uns ergehen lassen mussten, die zudem von ätzender Langeweile geprägt waren. Natürlich – die Erklärung dafür war, die Logik der Grammatik würde helfen, andere Sprachen besser zu lernen und deren Aufbau zu begreifen. Und wenn wir mal Medizin oder Jura studieren würden, wäre es sowieso unabdingbar, Latein gelernt zu haben.
Nun, in den sechseinhalb Jahren, in denen wir uns mit diesem Stoff abmühen mussten (ich war übrigens nicht die Einzige mit den schlechten Noten und der fehlenden Motivation), hätte ich es problemlos geschafft, Spanisch oder Italienisch oder gar beides zu lernen, und das hätte mir sehr viel mehr gebracht. Spanisch musste ich mir in späteren Jahren viel mühsamer im Selbststudium aneignen sowie mit dem Besuch etlicher Kurse in verschiedenen Schulen in Spanien und Südamerika. – Italienisch liess ich bleiben, ich war der Ansicht, die Ähnlichkeit der Sprachen würde mich nur verwirren. Was ich bestens lesen kann, ist die italienische Speisekarte, und das ist doch schon etwas.
Auch hatte ich schon lange den Verdacht, die Lateinlernerei diene in erster Linie dazu, sich vom „Plebs“ abzuheben, das heisst, das Privileg zu haben, ein wenig despektierlich auf all diejenigen hinunterzublicken, die nicht im Gymnasium waren und sogar auf diejenigen, die zwar das Gymnasium besuchten, aber „nur“ die Abteilung Wirtschaft. - Dass viele Fremdwörter in unserer Sprache aus dem Latein stammen, ist schon klar. Nur sind diese den meisten Leuten auch ohne Sprachstudium geläufig.
Jedenfalls wäre ich heute froh, ich hätte statt all der zahllosen Lateinstunden eine Anzahl davon als Wirtschaft-Unterricht geniessen können. Aber damals war das System alles andere als flexibel. Im B-Gymer, also dem sogenannt „neusprachlichen“ Gymnasium, wo Latein, Deutsch, Englisch und Französisch obligatorisch waren, konnten wir im Nebenfach nicht einmal Spanisch belegen, ein Wirtschaftsfach schon gar nicht. – Was damals unter Allgemeinbildung verstanden wurde, ist mir heute ein Rätsel.
Für mich ist und bleibt eine Sprache etwas Lebendiges, das sich logischerweise auch weiterentwickelt. Latein aber ist tot, ein Konstrukt, stehen geblieben, keine Sprache, sondern höchstens eine „Schreibe“.
Auch verstand ich nie, weshalb Latein in der Medizin so wichtig ist. All die Ausdrücke, Verben, Adverbien, Nomen, Adjektive, die wir lernen mussten, haben so gut wie nichts zu tun mit dem Vokabular, das ein Arzt braucht oder mit den Namen der Medikamente, welche zu einem eigenen Fachgebiet gehören. Auch hier eignen sich die lateinischen Ausdrücke ja besonders gut, um sich vom Wortschatz der „einfachen Leute“ zu unterscheiden. - Die Wörter in unserem Lehrbuch hatten viel mehr zu tun mit dem Krieg; es wäre ja darum gegangen, als erste Lektüre „De Bello Gallico“ zu lesen, so wie das in allen unseren Parallelklassen der Fall war. Dieses Werk zu übersetzten wäre zu Beginn zweifellos einfacher gewesen, als sich an die schwierigen Verse der Aeneis heranzuwagen, aber dazu war Herr Dr. Walther zu feinfühlig. Caesars Beschreibungen waren nicht seine Welt, die waren ihm zu vulgär; er war ausschliesslich der Ästhetik verpflichtet, der erhabenen Lektüre des Vergil. – Und das gab mir endgültig den Bogen.
Was die Logik angeht, hat mich diejenige der Mathematik viel mehr überzeugt. Die Freude an den Zahlen und das Knobeln und Rätseln mit Denkaufgaben und Zahlenreihen hatte ich ja früh schon von meinem Schwager mitbekommen, der inzwischen auch mein Klassenlehrer am Gymer war. Übrigens hatte er daneben auch eine Professur an der Uni Bern. Seine Lektionen waren ausgezeichnet aufgebaut, klar strukturiert und interessant. Zum Glück war Mathematik ein Fach, wo ich keine Angst vor ungenügenden Noten zu haben brauchte. So hatte ich auch nie das Gefühl, dass ich als seine Schwägerin Privilegien genoss; das hätte ich auch gar nicht gewollt. Kombinatorik gefiel mir vor allem, die gerade neu propagierte Mengenlehre ebenfalls. Wenn’s allerdings um irrationale Zahlen ging, verliess mich mein Vorstellungsvermögen völlig.
Zugegeben: Von Geometrie, Vektoren und Algebra habe ich heute keine Ahnung mehr, genauso wenig wie von 99 Prozent meiner ehemaligen Lateinkenntnisse, aber trotzdem denke ich, es ist die Mathematik und die Physik, die die Welt zusammenhält und nicht eine tote Sprache.
Trotzdem: Mit Physik konnte ich nicht viel anfangen. Zwar faszinierte mich diese Wissenschaft einerseits, aber sie war mir zu kompliziert. Und die weit hergeholten Aufgaben, die wir lösen mussten, fand ich, machten wenig Sinn, interessierten mich nicht. Den frischgebackenen, unbeholfenen Lehrer, der uns zugeteilt wurde, mochte ich ebenfalls nicht. Grade mal genügend waren meine Noten, und das war alles, was zählte.
Im Französisch konnte ich mich knapp über Wasser halten, eine Vier auch hier die Note, die mir reichte. Unser System sagt ja, die Vier sei genügend, also wieso sich zusätzlich anstrengen? – Das habe ich später auch häufig von meinen Schülern gehört – sie haben natürlich recht, andererseits macht auf diese Weise niemand Höhenflüge.
Gerne würde ich heute besser Französisch sprechen können. Weniger spicken, besser aufpassen im Unterricht wäre mehr gewesen. – Trotzdem ist mir die Sprache geläufig. Verstehen und Lesen sind kein Problem, nur fehlt mir manchmal das Vokabular, wenn ich etwas sagen will. Ob das damit zu tun hat, dass uns der Lehrer immer gleich korrigierte, kaum hatten wir einen Satz zu formulieren begonnen?
Eigentlich war er ja ein Lustiger, unser Monsieur De La Chaux, zumindest teilweise, vor allem, wenn er eine Probe ankündigte. Dann pflegte er seinen Stuhl aufs Lehrerpult zu stellen, sich draufzusetzen und zu sagen, auf diese Art habe er den besseren Überblick und könne sehen, wer spickt. – Allerdings las er dazu jeweils die Zeitung, was seiner Aufmerksamkeit zum Glück ziemlich abträglich war.
Geographie war todlangweilig. Eine Lektion bestand zwar oft aus lauter interessanten Fragen, die aber am Ende nie richtig beantwortet wurden. Oder ich hatte den Faden verloren, das ist natürlich auch möglich. Als der Lehrer in unser allerersten Stunde den Diaapparat hervornahm, hatten wir alle schon freudige Erwartungen auf einen spannenden Unterricht, aber als es nur drei Dias waren, über welche dreiviertel Stunden lang nachgedacht, debattiert und gerätselt wurden, war die Enttäuschung gross. - Schadenfreude herrschte allenthalben, als sich einmal in einer späteren Stunde das Dia, das Herr Mauerhofer zeigte, entzündete und nur noch ein Räuchlein vom Projektor aufstieg.
Geschichte interessierte mich sehr. Der Lehrer weniger. Er hatte nur eine Methode, und die zog er während der ganzen viereinhalb Jahre durch. Es hatte ein Heft, in dem er eine Zusammenfassung des Geschehenen handschriftlich niedergeschrieben hatte. Daraus las er uns vor, und wir mussten Notizen machen. Aus welchen Büchern er sich seine Sicht der Dinge zusammengereimt hatte, weiss ich nicht. Das hat er uns auch nie erklärt. – Ein Geschichtsbuch hatten wir keines. Natürlich sah er zwischendurch auch mal vom Heft auf, erläuterte etwas, stellte Fragen oder schreib einen Namen an die Tafel. Selten teilte er uns ein Blatt aus, einen Quellentext, den wir dann diskutieren mussten. Alles im Frontalunterricht. Nur den „Putzger“ mussten wir anschaffen, den historischen Weltatlas. Den liebte er.
Einmal mehr begann der Unterricht in der Quarta bei den Römern – gegen Ende der Oberprima hatten wir uns bis kurz vor den zweiten Weltkrieg durchgeackert.
Staatskunde hatten wir keine. Der Kalte Krieg, die Frauenbewegung und wie es schliesslich dazu kam, dass das Frauenstimmrecht in der Schweiz eingeführt wurde, darüber wurde kein Wort verloren. Dabei waren wir damals in der Prima, als das passierte; all diese Themen und viele andere mehr waren höchst aktuell und brisant, aber darüber stand halt nichts in seinem Heft.
Einmal kam er zu spät. Wir alle hofften schon… Aber er kam. Seine Entschuldigung: „Ich habe meine „Präp“ (sein Heft) zu Hause vergessen und musste zurück, um sie zu holen. Sonst hätte ich euch ja gar keinen Unterricht gegen können.“ – Ja, genau! – Und er gibt es auch noch zu… - Wie Herr Dr. Weilenmann zu seinem Doktortitel gekommen war, war uns allen schleierhaft.
Sein Gedächtnis war auch nicht mehr wirklich frisch. So hatte er ständig Mühe mit unseren Namen. All die Jahre lang. Daniel nannte er jedes Mal David, auch wenn dieser nie müde wurde, ihn zu korrigieren. Dabei war’s ja damals noch nicht schwierig mit den Namen so wie heute. Wir waren noch immer die Barbaras, Regulas, Monikas, Michaels und keinen einzigen ausländischen Namen hatte er sich merken müssen.
Chemie war interessant. Wir hatten einen jüngeren Lehrer und dieser hatte die bahnbrechende Idee, vom Frontalunterricht abzukommen. Mit einem Kollegen zusammen hatte er ein Skript ausgearbeitet für einen programmierten Unterricht mit vielen Aufgaben, die zum Unterrichtsziel führen sollten. Das Problem war, diese Unterrichtsform war damals ganz neu und er hätte bei der Verfassung des Skripts auch eine unerfahrene Person hinzuziehen sollen. Dann wäre es wohl nicht so oft vorgekommen, dass uns beim Bearbeiten der Aufgaben Zwischenschritte zum Verständnis fehlten, die für uns wesentlich gewesen wären, bei denen es aber den Experten gar nicht auffiel, dass da eine Erklärung nötig gewesen wäre, um weiterzukommen. So brüteten wir beim Hausaufgaben-Machen nicht selten stundenlang über den Blättern, bis jemand von uns die erleuchtende Idee hatte oder, weil er oder sie Nachhilfestunden hatte, erklären konnte, wie sich die Sache verhielt.
Der Musikunterricht war nicht mein Ding, jedenfalls aber eine Abwechslung im Schulalltag. Ich liebte meine Rock und Pop Songs, die ich im Radio hörte und auf meinen Tonbändern gespeichert hatte. Die Musikstile jedoch, mit denen wir uns in der Schule befassten, berührten mich nicht. Der Lehrer, Herr Götze, war allerdings ein sehr freundlicher Mann, der auch das Berner Stadtorchester leitete. Er hat mein Desinteresse nie mit einer schlechten Note bestraft und ich war und bin ihm dafür dankbar.
Auch Turnen empfanden wir in der Regel als willkommene Abwechslung, trotzdem schwänzten wir den Unterricht nicht selten, erstens weil es einfach war, eine gute (?) Ausrede zu finden und zweitens schön, sich in der gewonnenen Pause im Restaurant gegenüber dem Schulhaus zu treffen, etwas zu trinken, ein paar Zigis zu rauchen und für ein Stündchen vom Lernstress zu erholen.
Der Zeichenunterricht gefiel mir gut, obwohl ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern kann, was ich jemals gezeichnet habe. Da ist auch nie eine verstaubte Mappe in unserem Estrich aufgetaucht mit Werken von mir. Aber die Kunstgeschichte fand ich spannend und Bildbetrachtungen mochte ich sehr. Wie gross ist doch der Unterschied beim Verständnis eines Bildes, wenn man mit den Hintergrundinformationen vertraut ist und über den Maler Kenntnis hat.
Unser Zeichenlehrer wurde mit der Zeit ein guter Freund von mir. Er wohnte vis-à-vis in derselben Strasse und später wurde er der Götti unseres älteren Sohnes. Noch immer haben wir einen guten Kontakt.
Die Erinnerungen an den Deutschunterricht sind mannigfaltig. Wie wenn’s gestern gewesen wäre, sehe ich mich am ersten Schultag das Klassenzimmer betreten. Am Fenster, mit dem Rücken zu uns, stand eine Frau mit breiter Hüfte, einer schmalen Taille, einem engen Jupe, einem zierlichen Oberkörper und hellbraunen, schulterlangen Haaren. Sie hielt sich am Fenstergriff fest und schaute hinaus auf den Schulhof. Als sie sich umdrehte, hatte ich fast einen Schock. Weil sie von hinten so jung aussah, musste ich mich erst daran gewöhnen, dass sie die Fünfzig sicher schon längst überschritten hatte.
Auch sie unterrichtete nur frontal, aber ich mochte, was sie uns beibrachte, obwohl sie immer ernsthaft war und kaum je lachte. Sie sprach Bühnendeutsch, was wir von unseren anderen Lehrern überhaupt nicht gewohnt waren. Von keinem bisher. Wir mussten eine Unmenge von Büchern lesen, von Simplicissimus über Goethe, Schiller, Kleist, Lessing, Conrad Ferdinand Meyer bis hin zu Frisch und Dürrenmatt und vielen anderen mehr.
Auch häufige Theaterbesuche waren üblich. Das dicke Ende kam natürlich in der nächsten Stunde oder auch in Form von Hausaufgaben, wo wir über das besuchte Stück schreiben mussten. Wer geschwänzt hatte, musste sich an „Herrn König“ wenden; es gab ja damals noch kein Internet, wo man sich praktischerweise über alles und jedes bei Google informieren kann. So waren „Königs Erläuterungen“ die unentbehrlichen Helfer bei jedem Aufsatz über Literatur. Aber mir gefiel es, über Bücher zu schreiben und zu diskutieren. Manchmal legte ich ganze Nachtschichten ein, um eine Arbeit, die ich lange hinausgeschoben hatte, rechtzeitig abzugeben. Frau Seebohm war mir gut gesonnen und nicht selten las sie meine Aufsätze oder Teile daraus der Klasse vor. Trotzdem hatte ich jeweils ein mulmiges Gefühl, bevor sie die obligaten drei Aufsatzthemen bekanntgab. Insgeheim dachte ich, wenn’s ganz schlimm wird und ich nichts zu schreiben weiss, kann ich ja sagen, es sei mir schlecht. – Das hab ich nie gemacht, aber einmal wär’s wohl gescheiter gewesen. Das Thema, das mir zwar gar nicht passte und von dem ich wusste, dass sie sicher nicht meiner Meinung war, hiess: „Selbst musizieren – heute noch?“. Welcher Teufel mich geritten hatte, trotzdem darüber zu schreiben, ist mir ein Rätsel. Ich beschrieb das Debakel mit meinen Klavierstunden, die Tatsache, dass ich auch aus einer Flöte ausser einem Pfeifton nichts Anständiges hervorzubringen imstande war und kam zum verhängnisvollen Schluss, dass mir all das nicht leid tat und dass mir die Mainstream-Musik im Radio gefällt. – Das konnte ja nicht gut gehen. Eine Zwei erhielt ich für meine Schreibe.
Eine Deutschstunde werde ich nie vergessen, und meine Klassenkameradinnen und –kameraden auch nicht. An unserer ersten Klassenzusammenkunft nach mehr als zwanzig Jahren wurde noch immer herzlich darüber gelacht. – Die Episode war auch wirklich an Peinlichkeit kaum zu überbieten.
Wir hatten erfahren, dass Frau Seebohm wieder geheiratet hatte, und zwar einen ziemlich viel älteren Mann. Nun hatte sie offenbar den unerklärlichen Drang, uns mitzuteilen, dass da auch sexuell noch etwas laufe. Wohl wollte sie uns gleichzeitig auch mit einer Art Aufklärungslektion beglücken. So stellte sie sich einmal mehr ans Fenster, hielt sich mit der rechten Hand am Griff fest, genauso wie sie es an unserem ersten Schultag getan hatte, legte ihren Kopf etwas schief und richtete sich an uns mit ernsten Worten. Sie tat das immer, wenn’s ein wenig heikel wurde. Wie sie aufs Thema kam, daran mag ich mich nicht mehr erinnern. Aber an den tollen Vergleich, mit dem sie uns anschliessend konfrontierte, schon. Sie sprach lange und geschickt um den heissen Brei herum, liess uns aber auf Umwegen wissen, wie ihre Sicht der Dinge war. Um das zu versinnbildlichen erkläre sie uns alsdann, dass man den Sex mit einem Gewehr vergleichen könne, das so und so viele Schüsse habe. Und wenn man von denen in der Jugend zu viele verschwende, dann hätte man im Alter keine mehr übrig. – Für die meisten von uns war es unmöglich, ein Pokerface zu bewahren. Viele konnten sich kaum mehr beherrschen und versuchten gequält, ihr Lachen zu verbergen. – Später brauchte nur jemand „Gewehr“ oder gar „Maschinengewehr“ zu sagen, und schon ging das Gelächter los.
Die Geschichte war umso mehr daneben, als einige von uns bereits ein ganzes Arsenal dieser erwähnten Schüsse abgegeben hatten, waren wir ja schliesslich bereits in der Prima damals.
Eskapaden
Ich beispielsweise hatte bereits seit ich vierzehn war einen Freund gehabt, mit dem ich regelmässig schlief. Er war zwanzig, hatte seine Lehre als Grafiker bereits abgeschlossen und hatte eine eigene kleine Wohnung. – Als meine Mutter dahinter kam, war die Hölle los. Erst konnte sie es gar nicht begreifen, ich sei doch nie über Nacht weggewesen. Dass ein Liebesabenteuer auch an einem Nachmittag, speziell an einem Samstagnachmittag, stattfinden könnte, das war ihr gar nicht in den Sinn gekommen.
Es funktionierte aber tatsächlich auch in der Nacht. Wann immer es möglich war, schlich ich mich weg. Möglich war’s nur, wenn die Schule am nächsten Morgen nicht bereits um acht begann. Meine Mutter hatte nämlich die strikte Anweisung, mich an diesen Tagen keinesfalls zu wecken, und daran hielt sie sich auch. Wir erwähnt, wohnten wir inzwischen im Parterre und es war für mich einfach, aus dem Fenster zu klettern und die zwei Meter in den Garten hinunterzuspringen. Das tat ich in der Nacht, wenn ich sicher sein konnte, dass alles still war und meine Mutter schon schlief. Zu Fuss suchte ich dann die Wohnung meines Freundes auf - ein Marsch von einer guten halben Stunde. Am nächsten Morgen fuhr ich mit dem Tram zurück und es gelang mir jedes Mal, rechtzeitig daheim zu sein, wenn sie bereits unterwegs war zur Arbeit. Die Erleichterung war jeweils riesig, wenn ich die Türe öffnete, unsere Wohnung betrat und feststellte, dass alles in Ordnung und ich beziehungsweise meine Abwesenheit nicht bemerkt worden war. Dann konnte sich meine Anspannung lösen, die Schmetterlinge in meinem Magen verschwanden - ich machte mich auf den Weg zur Schule.
Die Geschichte würde ich selber kaum glauben, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Nie hat mich jemand die Wohnung verlassen sehen, nie hat meine Mutter gemerkt, dass ich nicht da war – unvorstellbar, was das alles für Konsequenzen hätte haben können.
Gemerkt hat meine Mutter ja dann trotzdem, was da lief, allerdings flog zum grossen Glück die Sache mit meinen nächtlichen „Spaziergängen“ niemals auf.
Unvorsichtigerweise hatten mein Freund und ich an einem Samstagmorgen mal ein Schäferstündchen bei uns zu Hause, als ich dachte, Mam sei weg. Sie kam aber vorzeitig zurück, fand meine Türe verschlossen vor und drohte, sie einzureissen, wenn ich nicht sofort aufmachen würde. In Panik wies ich meinen Freund an, den Fluchtweg aus dem Fenster zu nehmen. Ich hatte nur gerade Zeit, mein Nachthemd überzuziehen, öffnete die Tür, und sie stürmte herein. Dummerweise war es Winter und sie clever genug, die Fussspuren im Schnee zu entdecken, die unter meinem Fenster begannen und durch den Garten Richtung Strasse führten…
Es muss für sie eine schlimme Situation gewesen sein, ein Dilemma, zum Verzweifeln. Wenn ich heute daran denke, tut es mir sehr leid, dass ich ihr so viel Kummer bereitet habe. Verdient hätte sie alles andere. - Sie hätte ja auch angezeigt werden können. Mein Freund natürlich ebenfalls. – Aber nicht im Traum hätte ich einen Gedanken daran verschwendet; ich war bis über beide Ohren verliebt, zu keinerlei Kompromiss bereit und tat von mir aus gesehen genau das, was ich als richtig empfand.
Mein Argument war: „Seit mein Vater gestorben ist, höre ich immer wieder, ich müsse jetzt vernünftig sein und tagsüber alleine zurechtkommen. Und jetzt heisst es, ich solle mich benehmen wie ein Mädchen in meinem Alter.“
Kein Wunder verbot sie mir von da an auszugehen, meinen Freund zu sehen, mich zu schminken, wenn ich zur Schule ging (das tat ich natürlich trotzdem im Hauseingang mit einem kleinen Spiegel bewaffnet und dem Malset) und meine Schwester unterstützte sie in ihren Erziehungsmassnahmen ebenfalls. - Sie schickte mich auch zu einem Frauenarzt, der natürlich feststellte, was schon längst klar war, obwohl ich in meiner Naivität dachte, ich könne ihm eventuell etwas vormachen, und so spitzte sich die Lage zu. Als sie davon zu sprechen begann, mich in ein Internat zu schicken, rastete ich aus, drohte in meiner Verzweiflung mit Selbstmord. Auch stellte ich eine Forderung. Ich hatte von einem Kinder- und Jugendpsychiater gehört, und den wollte ich nun konsultieren. – Darauf ging sie sogleich ein; ich wurde angemeldet und fortan gab es mehrere Gespräche.
Unter anderem erinnere ich mich gut an den Rorschachtest. Der Arzt wollte wissen, was ich auf all den Blättern, die er vor mich hinlegte, erkenne. – Das war nicht einfach für mich, denn alles, was ich sah, waren Tintenflecke in verschiedenen Pastellfarben, die symmetrisch nebeneinander abgebildet waren. Dass ich genau das und nichts anderes sah, erwähnte ich natürlich, und nur mit grösster Mühe und nur um ihm quasi einen Gefallen zu tun, sagte ich, mit viel Phantasie könnte man auf einem Bild eine Maske erkennen, auf einem anderen eventuell einen Schmetterling. – Was er daraus machte, weiss ich nicht, was ich da hervorgebracht hatte, sah ja auch ohne psychologische Kenntnisse nach Sich-Verstecken und Wegfliegen aus, aber egal, wichtig war, die Besuche bei ihm endeten für mich glücklich. – Er sprach natürlich ebenfalls mit meiner Mutter und vermutlich auch mit meiner Schwester und überzeugte sie offenbar, dass ich wohl tatsächlich reifer war als in diesem Alter üblich. Von da an ging es mir sehr viel besser, die Zeit der Inhaftierung wurde ungestraft beendet und meine beiden Erzieherinnen liessen mich mehr oder weniger gewähren.
Ich weiss noch, dass ich zu meinem Retter sagte, ich würde ihm dann eine Karte schicken, wenn wir heiraten würden, mein Freund und ich. – Er lächelte nur. – Wohlweislich.
Der ganze Druck liess nach, ich konnte sogar einen (anderen) Frauenarzt aufsuchen, der mir die Pille verschreib.
Diese hatte ich zwar schon vorher genommen. Eine gute Freundin von mir arbeitete in einer Apotheke und konnte die Präparate dort abzweigen. – Zuhause hatte ich in einem dicken Buch in der Mitte ein grosses Loch ausgeschnitten, in das die runde Pillenschachtel genau hineinpasste, so dass mir meine Mutter nicht auf die Schliche kommen konnte. – Dieses Versteckspiel war nun auch nicht mehr nötig.
Es war die Zeit, als ich mir mit Wasserstoffsuperoxyd die Haare blond zu färben begann. Das gefiel mir halt. Meine Mutter gab nicht einmal einen Kommentar dazu ab.
Freizeit und Jobben
Reiten war nach wie vor meine grosse Leidenschaft. Nach ein paar Jahren wechselte unser Reitlehrer mit seiner Reitschule nach Münsingen. So musste ich vom da an den Zug nehmen. Zuweilen durfte ich mit jemandem mitfahren. Das war einfacher und ging viel schneller. Wenn das nicht möglich war, begann ich, Autostopp zu machen. Nie musste ich lange warten; ich fand das mehr als nur praktisch. Zusätzlich konnte ich das Fahrgeld sparen. Von alledem wusste meine Mutter natürlich nichts. – Lange ging das gut. Nur einmal begann ein Fahrer seine rechte Hand, statt am Steuerrad zu lassen, mir ständig auf die Knie und Oberschenkel zu legen. Zum Glück hatte ich Reithosen und Stiefel an. Das Ganze war mir mehr als nur unangenehm. Passiert war weiter nichts, am Ostring liess er mich aussteigen, aber von da an besann ich mich demütig zurück auf die SBB oder liess mich chauffieren.
Im Zusammenhang mit Reiten kommt mir beim Kramen in meinen Erinnerungen Herr Petzold in den Sinn. Kennengelernt habe ich ihn in der Reitschule. Wie und unter welchen Umständen weiss ich nicht mehr. Eine äusserst ungewöhnliche Begegnung! – Ein feingliedriger, überaus freundlicher Mann, eher klein gewachsen. Er hat mich oft zum Nachtessen eingeladen, was ich unglaublich genoss, vom Kulinarischen her war ich damals nicht verwöhnt. Ich war etwa 16 Jahre alt, er mindestens 20 bis 30 Jahre älter. Nie waren wir per Du. Nie hat er mich zu sich nach Hause eingeladen. Nie kam er mir näher, er war ganz Gentleman, hatte die besten Manieren, er nannte mich Fräulein Gehring, ich ihn Herr Petzold. Manchmal holte er mich bei mir zu Hause ab; meine Mutter hatte nichts dagegen, sie war eingenommen von seinen perfekten Umgangsformen. – Seltsam, seltsam, wenn ich jetzt dran denke. - Worüber wir gesprochen haben, ist mir auch entgangen. Ich stelle mir vor, über Pferde und Reitepisoden vorwiegend. - Ich erinnere mich nicht mehr daran, in welche Restaurants ich ausgeführt wurde, auch nicht mehr, wann diese „Beziehung“ endete. - Meine Gedächtnislücken ärgern mich sehr. – Nie mehr habe ich „nachher“ von ihm gehört, was und wann immer dieses Nachher auch war.
Am Anfang meiner Texte zitierte ich das spanische Sprichwort: „Olvidar es como no haber vivido“. – Was man vergessen hat, ist, als hätte man es nie erlebt. – Das könnte einem eigentlich egal sein oder anders gesagt, wenn man etwas nicht erlebt hat, gibt es ja auch keine Erinnerung daran. Aber in diesem Beispiel sind Fragmente vorhanden, ein Rahmen, ein Puzzle, in dem etliche Teile fehlen. Das ist äusserst unbefriedigend.
Eine andere Leidenschaft war und ist noch immer das Schwimmen in der Aare. Nach wie vor durfte ich bei der Familie meiner Freundin zu Mittag essen, aber im Sommer, wenn das Wetter es zuliess, meldeten wir uns ab, fuhren mit unseren Fahrrädern ins Muribad und verbrachten die freie Zeit dort.
Später wurde das Marzili zu meiner zweiten Heimat. Wann immer ich frei hatte, ging ich hin. Inzwischen hatte ich ein paar Freundinnen und Freunde kennengelernt, es bildete sich ein „Jasskränzli“ und jede freie Minute sozusagen wurde Karten gespielt, nur unterbrochen vom obligaten Schwimmen in der fantastischen, heiss geliebten Aare. Je nachdem, wie kalt das Wasser war, pilgerten wir zu zweit, zu dritt, zu viert oder auch in ganzen Gruppen flussaufwärts bis zum „Schönauer“, dem Eichholz oder weiter noch bis Muri. Sich im Fluss mit der Strömung hinuntertreiben zu lassen, am Dählhölzli-Tierpark entlang, an den Flamingos, Yaks und Steinböcken vorbei und durch die „Büffelwellen“ zu schwimmen, machte und macht nach wie vor enorm Spass. Auch ein Zwischenhalt wurde gelegentlich eingelegt zwecks Erwärmung und eventuell Genehmigung einer Flasche Rosé. Das vor allem im Fähribeizli oder im Eichholz-Camping.
Kurzer Exkurs in die Gegenwart: Unser Jasskränzli besteht noch immer, aber leider nicht mehr im Marzili. Unsere eine Partnerin ist inzwischen 97-jährig und die beiden anderen Jasspartner haben ihre individuellen Gründe, weshalb sie nicht mehr kommen wollen. Nun treffen wir uns hin und wieder in einem Restaurant oder bei jemandem zu Hause. Nach einem feinen Nachtessen werden die Karten verteilt und der Abend kann dauern…
Von den ehemaligen „Jassern“ bin ich also noch die Einzige, die im Marzili anzutreffen ist. Allein bin ich allerdings kaum je, denn der grosse Freundeskreis, der sich während all der Jahre um uns herum gebildet aber auch umgebildet hat, besteht noch immer.
Zurück zu den Sechzigern: Man traf sich damals auch in der Stadt. Erst im Grotto, einem dieser kleinen Restaurants an der sogenannten „Front“ zwischen Bundeshaus und Käfigturm, wo man bei schönem Wetter auch draussen sitzen und wo diejenigen Typen, welche die flotten Schlitten ihrer Väter ausfahren durften, gleich vornedran parkieren konnten, um dann lässig mit dem Autoschlüssel zu jonglieren und wichtig hin und her zu blicken. – Sehen und gesehen werden…
Im Grotto hatte es einen speziellen Kellner. Johnny hiess er, war wohl kurz vor der Pensionierung und wusste nicht, was gute Laune ist. Er war die Unfreundlichkeit in Person, und er jagte mir mit seiner finsteren Mine manchmal fast Angst ein.
Eine Stange Bier kostete damals 45 Rappen. Ein Käseküchlein ebenfalls. Bier war und ist überhaupt nicht nach meinem Geschmack, ich bestellte jeweils eine Tasse Schwarztee, die genau gleichviel kostete. Zehn Prozent Trinkgeld musste man geben, 50 Rappen hätten also genügt, ein Franken mit Käseküchlein, aber wenn man nur gerade diesen Betrag hinlegte, verlor Johnny die Fassung und geriet in grenzenlose Rage. Nicht selten geschah es, dass er uns alle aus dem Restaurant rauswarf. Und wenn er in diesem bizarren Psycho-Modus war, konnte ihn niemand bremsen. Alle mussten dran glauben und das Lokal fluchtartig verlassen, auch gleich sämtliche anderen Gäste, jüngere und ältere. Wer dieses Prozedere noch nie erlebt hatte, wusste nicht, wie ihm oder ihr geschah. Auch andere Gründe konnten ihn zu solchen Zornesausbrüchen treiben, welche auch immer - man wusste nie, wann das Hagelgewitter einsetzte. - Trotzdem gingen wir wieder und wieder hin. Wir liebten es einfach, das kellerartige Lokal mit dem dunklen Gewölbe; es war unser Treffpunkt.
Später wurde es umgebaut zu einer Art Pub. Highnoon hiess es dann. – Wirklich schade; die ganze Atmosphäre war im Eimer. - So traf man sich halt ein paar Meter weiter im nächsten Restaurant, dem Le Mazot, wo die Kellner freundlich waren und das Raclette delikat.
An der Speichergasse gab es ein Restaurant, das hiess UHU. Dort spielten Live-Bands und es ging die Post ab. „Come on Baby balla balla“, war der Song damals, der mir noch bestens in Erinnerung geblieben ist. Eigentlich war ich mit fünfzehn oder sechzehn zu jung, um in diesem Lokal zu verkehren, aber man sah mir mein Alter ja nicht an. – Genauso wenig wie im Spielsalon, wo wir hie und da zu zweit oder zu dritt hingingen, wenn wir eine Ausfallstunde hatten. Den Flipperkastenbetreibern war es offenbar egal, wie alt wir waren, Hauptsache, die Kohle stimmte.
All diese Freizeitvergnügen kosteten natürlich Geld, auch wenn diese Ausgaben heute kaum der Rede wert erscheinen. Mein Taschengeld hatte schon längst nicht mehr gereicht für all das, was ich mir gerne kaufen oder gönnen wollte. So hatte ich schon früh begonnen, nach einem geeigneten Nebenverdienst Ausschau zu halten. Bereits im Progymnasium übernahm ich das Inkasso für eine Zeitschrift, „Die Schweizerjugend“, und erhielt dafür eine bescheidene Entlöhnung. – Vom Verlag bekam ich pro Monat etwa zwanzig (?) Karten zugeschickt, auf denen die Adressen der Abonnenten und der Betrag, den sie bezahlen mussten, aufgedruckt waren. Die Karte galt gleichzeitig als Quittung. Mit dem Velo fuhr ich von Haus zu Haus, läutete an der Tür und hoffte, dass ich das Geld einziehen konnte. Mühsam war’s, wenn jemand nicht zu Hause war, grad kein Geld oder auch kein Kleingeld hatte, denn dann musste ich nochmals und nochmals hin und versuchen, den fälligen Betrag einzukassieren.
In den letzten Jahren im Gymnasium fand ich andere Möglichkeiten, mein Taschengeld aufzubessern:
Einen Ferienjob hatte mir meine Mutter organisiert, nämlich dort, wo sie arbeitete, in der Bundesverwaltung. Meine Aufgabe war es, eine Liste abzuschreiben beziehungsweise aus verschiedenen Vorlagen zu übertrage und anzupassen. Worum genau es ging, habe ich vergessen. Es handelte sich um irgendwelche Ausgaben, am linken Rand der Text, am rechten war der Betrag hinzuschreiben, dazwischen gab es Tabulatoren zu setzen. Rechts unten an der Seite kam das Total zu stehen, das natürlich stimmen musste. Das Tückische an dieser Arbeit war, dass es dafür fünf Durchschläge brauchte, also fünf Bogen Papier und dazwischen je ein schwarzes Tintenblatt. - Wie praktisch ist es doch heutzutage, eine solche Liste in den PC einzugeben, Excel die Rechnerei zu überlassen, am Schluss auszudrucken und zu kopieren. – Ein Kinderspiel! – Aber damals… Wie ein Häftlimacher musste ich aufpassen, dass mir kein Fehler unterlief, denn wenn das geschah, galt es, die ganze Beige Blätter auszuspannen und mithilfe von Tipp-Ex auf jedem Papier einzeln den Fehler zu korrigieren.
Zum Glück hatte ich in meiner Freizeit das Zehnfingersystem gelernt, so machte mir das Schreiben auf der Schreibmaschine an sich keine Mühe, aber hin und wieder liess sich ein Missgeschick eben doch nicht vermeiden.
Gelernt hatte ich das Maschinenschreiben aus folgendem Grund: Mein Schwager hatte sich eine brandneue IBM-Kugelkopfschreibmaschine gekauft. Diese bewunderte ich sehr, hatten wir doch zu Hause nur eine alte, schwarze Maschine, auf welcher der Buchstabe „E“ nicht mehr richtig funktionierte, was ziemlich mühsam war. Er sagte, ich dürfe seine erst gebrauchen, wenn ich das Zehnfingersystem blind beherrsche. Das war mir Motivation genug. Er gab mir ein Buch und im Selbststudium begann ich unermüdlich die endlosen jff, fjj, kdd, dkd etc. zu tippen, bis mein Hirn automatisch die Buchstaben dem jeweiligen Finger zuordnen konnte.
Trotzdem war die Arbeit, die ich zugewiesen bekam, nicht einfach, aber es machte mir Freude, meine Schreibfähigkeiten unter Beweis stellen zu können und am Ender der beiden Wochen sogar noch einen Lohn dafür zu erhalten.
Kinoplatzanweiserin war eine andere Quelle zum Aufbessern meiner pekuniären Situation. Das hätte ich gerne öfter gemacht, aber das Angebot war beschränkt und ich war nicht die Einzige, die sich um den begehrten Job bemühte. Die „Arbeit“ war einfach, strengte in keiner Weise an und gleichzeitig konnte man sich ungestört und gemütlich einen Film ansehen.
Ziemlich anders gestaltete sich mein Sommerferienjob, den ich mal für drei Wochen in der Konservenfabrik Véron annahm.
Denner hatte Aprikosenkonfitüre in Auftrag gegeben und da es sich um einen Grossauftrag handelte (eine Million Gläser, glaube ich), mussten zusätzliche Arbeiterinnen und Arbeiter angestellt werden. Pro Stunde verdienten wir 5.60 Fr. Neun Stunden pro Tag wurde gearbeitet, unterbrochen von einer halbe Stunde Pause am Mittag. Es gab verschiedene Arbeitsplätze. Diese wurden im Akkord ausgeführt, teilweise am Fliessband, und der Patron spazierte von Zeit zu Zeit durch die Reihen, um sicher zu gehen, dass alle fleissig ihrer Arbeit nachgingen und niemand etwa auf die Idee kam, sich auszuruhen und auf der faulen Haut zu liegen. Einen freundlichen Eindruck machte er mitnichten.
Ich weiss noch gut, dass ich am allerersten Tag, nachdem ich eine halbe Stunde lang 8er-Kartons zusammengestellt hatte, in welche die Konfitüren schliesslich verpackt werden mussten, fragte, ob ich nun etwas anders machen könne. Der Vorarbeiter belehrte mich eines Besseren. Ein paar Stunden lang hatte man dieselben Handgriffe zu verrichten. „Vielleicht dann am Nachmittag…“.
Am Fliessband ging es schliesslich darum, mit einem Holzstab auf die Deckel der vorbeitreibenden, bereits verschlossenen Konfitüren zu schlagen und, wenn der Ton nicht stimmte, das Glas also nicht richtig vakuumiert war, dieses auszusortieren. Die Maschine spuckte in gleichmässigem Rhythmus eine ganze Menge dieser Konfitüren gleichzeitig aus, man musste sich also beeilen, um keine zu verpassen. – Eine seltsame Arbeit, fand ich. Aber noch seltsamer und stressvoller ging’s auf dem danebenliegenden Fliessband zu. Dort musste jedes Glas aufgehoben und umgedreht werden. Der Zweck davon war zu erkennen, ob irgendein Fremdkörper drin war. Gemeint waren Aprikosensteine. Aber was wir nicht alles sonst noch fanden – ich ass während Jahren keine Konfitüre mehr. - Irgendwo musste ein hellblaues Stück Plastik in die Maschine geraten sein. Teile davon, kleine Splitter, fanden sich in einigen der Gläsern wieder. Das ging alles noch. Aber Wund-Pflaster… Es war ja gar nicht möglich gewesen, alle vorbeigleitenden Gläser zu prüfen und wer schon hätte erkennen können, ob sich ein Stein nicht mittendrin im Glas versteckt hatte... – Mission impossible. - Die fehlerhaften Konfitüre-Gläser mussten anschliessend geöffnet werden, ein weiterer erquickender Arbeitsprozess, und mit Löffeln wurden der Stein oder die Steine des Anstosses aus der Aprikosenmasse herausgeklaubt.
In der grossen Fabrikhalle hatte es auch riesige Maschinen, in denen Melasse hergestellt wurde. Was war das mal für eine Aufregung, als eine der Maschinen nicht mehr aufhören wollte zu produzieren! – Die Melasse lief oben aus dem Gerät heraus, wie Lava aus einem Vulkan, floss an den Metallwänden auf den Boden runter und niemand konnte sie rechtzeitig stoppen. Es dauerte nicht lange, und der ganze Boden war von der dunklen, klebrigen Masse überflutet. Sagenhaft! - Die Episode erinnerte mich an das Märchen mit dem Brei, der nicht aufhören wollte, aus dem Kochtopf zu quellen und sich schliesslich im ganzen Dorf verteilte. - Irgendjemandem gelang es schliesslich, den Apparat abzustellen, aber die Bescherung war überwältigend.
Kurz nachdem die Lieferung an Denner erfolgt war, konnte man in der Zeitung lesen, dass der Grossdetaillist die ganze Ladung Aktionskonfitüren hatte zurückziehen müssen. Offenbar war der falsche Zucker verwendet worden, was dazu geführt hatte, dass, kaum geöffnet, die Aprikosen bereits zu faulen begannen und die Kunden die Ware in den Laden zurückbrachten. – Ich hätte da auch noch ein paar andere Gründe anführen können als nur den Zucker… - Jedenfalls, wenn ich mich richtig erinnere, war dieser missglückte Grossauftrag der Gnadenstoss für Véron und führte zur Aufgabe der altehrwürdigen Konservenfabrik.
Ich jedenfalls beschloss, niemals mehr in einer Fabrik arbeiten zu gehen.
Da hingegen gefiel mir das Kellnern sehr viel besser. In verschiedenen Restaurants bekam ich Gelegenheitsjobs, mal in den Ferien für eine Woche oder zwei, mal an einem freien Nachmittag. Regelmässig während etwa zwei Jahren durfte ich in der „Schwarzen Tinte“, einem In-Lokal in der Berner Altstadt, servieren. Das machte mir grossen Spass, und das Geld zu zählen am Ende des Abends und all das Trinkgeld davon abzuziehen, noch viel mehr.
Mit dem Wirte-Ehepaar kam ich gut aus, mit den fest angestellten spanischen Kellnern ebenfalls, und wenn nichts oder nicht viel lief in der Küche, sassen wir zusammen an einem Tisch nahe der Theke und plauderten über dies und jenes, über Beziehungen, erfolgreiche und gescheitere.
Auch Dodo Hug, sie war damals noch unbekannt, war nicht selten dabei. Sie gehörte zu den Stammgästen.
Die Schwarze Tinte gibt es heute nicht mehr. Sie geriet Mitte der Siebzigerjahre in Verruf, und das war das Aus.
An der „Front“ hatte ich inzwischen eine Reihe anderer Leute kennengelernt. Die jungen Männer, mit denen ich oft zusammen war, besuchten das Technikum Burgdorf und hatten alle denselben Jahrgang: 1946, waren also sieben Jahre älter als ich. Freundinnen kamen und gingen, einige blieben, nach und nach wurde geheiratet. Auch heute noch habe ich mit mehreren von ihnen Kontakt und wir pflegen Freundschaften.
Jedenfalls war das damals eine lustige und unbeschwerte Zeit. Partys wurden jeden Samstagabend gefeiert, der Wein floss in Strömen. Wenn ich nicht arbeiten musste, war ich gern mit dabei.
Mit der Beziehung zu meinem Freund kam es, wie vorauszusehen war: Nach zwei Jahren war sie zu Ende. Was genau der Anlass dazu war, weiss ich seltsamerweise gar nicht mehr. Aber es war mein Freund, der nicht mehr mit mir zusammen sein wollte, und ich war am Boden zerstört.
Sehr lange dauerte das Tränental allerdings nicht und ich lernte an der Front Theo kennen, der ebenfalls eine Beziehung hinter sich hatte. Ich war grad siebzehn geworden, er war fünfundzwanzig, studierte an der ETH Zürich Elektroingenieur und hatte eine kleine, bescheidene Absteige in der Altstadt.
Eigentlich hatte ich ihn bereits flüchtig gekannt. Irgendjemand hatte ihn mir mal vorgestellt, das war aber zwei Jahre zuvor; er war damals in einem WK. – Meine Mutter hatte mir immer gesagt: „Wenn du jemanden kennst, der im Militär ist, dann schicken wir dem ein Päckli“. - Etliche Päckli hatten wir damals verschickt, also hatte auch Theo eines von mir erhalten. Was drin war - keine Ahnung mehr. Wohl Schokolade, Güezi, Zigaretten und ein nettes Brieflein.
So trafen wir uns also wieder an jenem Samstag im April 1970. Eine gute Freundin von mir lud uns und noch ein paar andere junge Leute zu einer Party bei sich zu Hause ein. Und da geschah es, dass ich mich zum zweiten Mal in meinem Leben bis zum Gehtnichtmehr verliebte. Morgens um zwei fuhr mich Theo heim. In einem weissen Mustang mit roten Lederpolstern… Wer wäre da nicht geschmolzen… Das Auto seines Vaters halt…
Bescheiden, wie ich erzogen worden war, sagte ich, als wir auf der Hauptstrasse vom Burgernziel zum Sonnenhof fuhren: „Ich wohne hier gleich in der Nähe, du kannst mich bei der Telefonkabine absetzen.“ – Er hielt sogleich an und liess mich raus. Den Rest des Heimwegs ging ich zu Fuss. – Ich konnte es kaum fassen! Nie hätte ich gedacht, dass er mich um diese Nachtzeit und nach diesem einmaligen Abend nicht vor die Haustüre fährt. – Man muss halt nicht so dumm sein und Dinge sagen, die man eigentlich gar nicht so meint. Das war mir eine Lehre.
Am nächsten Tag, dem Sonntag, hatten wir abgemacht. Ich konnte es kaum erwarten! Wir trafen uns in der Stadt und er sagte: „Hallo Sibylle“. – Zum zweiten Mal innert Stunden blieb mir die Spucke weg. Wie es möglich war, dass er meinen Namen vergessen oder verwechselt hatte, war jenseits meines Vorstellungsvermögens.
Während der Woche war Theo in Zürich, am Wochenende nur konnten wir uns sehen. Manchmal nicht einmal dann, weil er im Militärdienst war oder übers Wochenende in Zürich blieb, um für eine Prüfung zu lernen.
Aber unsere Treffen hatten ihre Tücken. Normalerweise machten wir am Samstagnachmittag an der Front ab. Zwar wusste er inzwischen meinen Namen, Pünktlichkeit jedoch gehörte nicht zu seinen Tugenden. Es wurde zur Gewohnheit, dass er mich eine Stunde warten liess, oft waren es gar zwei. Klar, dass dann das Feuer im Dach war. Ich konnte es nicht begreifen, hatte doch schon die ganze Woche lang sehnlichst darauf gewartet, ihn wiederzusehen. – Der Grund, weshalb er nicht rechtzeitig kam, war, dass er als Erstes zu seinen Eltern nach Hause ging, bevor er mich traf. Und sein Vater war der absolute Spezialist im Aufträge-Erteilen: Hier musste ein Nagel eingeschlagen werden, dort ein neues Bild aufgehängt, irgendetwas musste dringend repariert werden und vor allem musste der Rasen noch gemäht werden. Alle diese „Wünsche“ konnte Theo seinem Vater nicht abschlagen, und so kam es dann zu diesen Verspätungen, für die ich wenig bis gar kein Verständnis aufbringen konnte. Handys hatte man damals ja noch keine und aus diesem Grund war es doppelt mühsam, nicht genau zu wissen, was los war, wie lange die Wartezeit noch dauern würde und so weiter. - Folglich hatten wir immer wieder mal Streit und Theo sagte in seiner gelassen Art: „Wenn wir uns streiten, geht noch mehr Zeit verloren. Lass uns doch das geniessen, was wir haben.“ – Nicht eben meine Philosophie. Aber was blieb mir übrig bei meinem Grad der Verliebtheit?
Alles ausser der Warterei gefiel mir nämlich an Theo: seine Art, sein Charme, sein gutes Aussehen, seine dunklen Haare, seine schlanken Hände, seine vollen Lippen, seine Figur… Für mich war er der absolute Traummann. Und auch meiner Mutter gefiel er. Welche Erleichterung! Sie hatte nicht einmal etwas dagegen, dass er hie und da bei mir übernachtete. Im selben Zimmer, im selben Bett natürlich.
Mit seinen Eltern war das ziemlich anders. Bei meinem ersten Besuch bei ihnen fühlte ich mich eher unwohl, kam mir ziemlich ausgestellt vor - wie unter einer Lupe. Nicht so sehr vom Vater observiert – der nannte mich Brigit (er sprach es so aus: „Brischit“) – der Einfachheit halber, wie er meinte, so brauche er sich keine neuen Namen zu merken – umso mehr aber von der Mutter, die mich mit unverhohlener Neugierde betrachtete. Sie hätte es lieber gesehen, wenn ich ein „Arzttöchterli“ gewesen wäre, liess mich Theo später wissen. Beide waren zwar freundlich, die Atmosphäre hingegen war steif und künstlich. Ich erhielt Tee und Kuchen serviert und wir sahen uns irgendwas im Fernsehen an. Offenbar waren die Gesprächsthemen bereits ausgegangen.
Zwei Jahre später, kurz vor unserer Hochzeit, hatten wir im Kirchenfeldquartier eine kleine Wohnung gemietet. Dass wir bereits vor der Vermählung dort wohnen wollten, brachte meine Schwiegermutter-in-spe völlig aus dem Konzept. Sie sagte: „Wenn ihr das tut, ist das ein weiterer Nagel an meinem Sarg!“ - „Hoppla“, dachte ich, „wer hat denn da vorgängig schon die anderen geliefert?“, sagte es aber nicht.
Sicher waren wir das gleich selber, denn unsere gemeinsamen Ferien in Venedig, noch „unverheirateterweise“, waren von Theos Eltern überhaupt nicht gebilligt worden, was uns aber wenig kümmerte.
Inzwischen hatte ich Autofahren gelernt. Kaum war ich achtzehn, erwarb ich den Lehrfahrausweis und übte von da an fleissig für die theoretische und praktische Prüfung. An den Wochenenden nahm sich meine Mutter Zeit, mit mir in der Gegend herumzukurven und auch Theo war mit von der Partie. Nur gerade vier Stunden hatte ich bei einem Fahrlehrer gebucht, dann meldete er mich für die Prüfung an. Lernen war ich ja gewohnt, so machte mir das Bogen-Ausfüllen keine grosse Mühe ebenso wenig wie das Kurzzeitgedächtnis-Vollstopfen.
An der praktischen Prüfung hatte ich grosses Glück, einen mir gewogenen Experten zu erwischen. Ich war es gewohnt, dass man mir sagte, ich solle geradeaus, dann links abbiegen oder rechts oder auch in ein bestimmtes Quartier fahren. Ich kannte die Stadt sehr gut. Das alles war also kein Problem. Der Experte aber sagte, ich solle in Richtung Basel einspuren. Da kam ich ins Schwitzen, denn ich war gar nicht gewohnt, auf die Ortsschilder zu achten. – Grosse Erleichterung, als ich das Schild „Basel“ sah. In der Hitze des Gefechts dachte ich wenigstens noch dran, den Blinker nach links zu betätigen und in den Rückspiegel zu schauen, aber die Sicherheitslinie, die ich grad im Begriff war zu überqueren, beachtete ich nicht. – Da griff mir der Experte ins Steuer und sagte, wenn ich über diese Linie gefahren wäre, hätte er mich durchfallen lassen müssen… Manchmal hat man eben Glück!
Hin und wieder verbrachte ich das Wochenende bei Theo in Zürich. Ich lernte seine WG-Partnerinnen und -Partner kennen und wir verbrachten jeweils eine gute Zeit miteinander. Nicht so harmonisch war’s allerdings, wenn’s darum ging, die Küche aufzuräumen. Das lag niemandem, mir auch nicht. Alles war überstellt mit Geschirr und Gläsern, die Salatschüssel, die wohl schon seit Tagen auf dem Tisch gestanden hatte, klebte auf dem Belag so fest, dass man sie mit Gewalt wegreissen musste. Trotzdem kamen wir schliesslich überein, dass Theo und ich den Abwasch und die andern das Kochen übernahmen. Dieses Konzept funktionierte nicht schlecht, denn ich hatte ja bisher überhaupt noch nicht gelernt zu kochen und genauso wenig konnte sich Theo mit dieser Kunst brüsten. Einer der Kollegen aber schon. Das Problem war nur, er war in Pakistan aufgewachsen und gewohnt, solch scharfe Gewürze fürs Curry zu verwenden, dass es mir schlicht unmöglich war, das Gericht zu essen. Ein Biss, mir liefen die Tränen runter und mein Mund brannte wie das Fegefeuer.
Schön und unbeschwert war sie trotzdem, die Zeit in Zürich.

Zweiter Teil: 1972 – 2013

Heirat
Ein knappes Jahr nach bestandener Matur heirateten wir am 26. Juli 1973; ich war zwanzig, Theo achtundzwanzig.
Die standesamtliche Trauung fand in Köniz statt, ziemlich unromantisch, in einem Büro der Gemeindeverwaltung oberhalb des Warenhauses ABM. Während der Standesbeamte sprach, sahen wir durchs Fenster, wie sich auf der gegenüberliegenden Strassenseite grad die Barrieren senkten, um den Zug passieren zu lassen. Theo empfand dies als ein schicksalhaftes Zeichen – das Ende seines Singledaseins, wie er etwas trocken bemerkte.
Unsere Trauzeugen waren meine Schwester Doris und mein Schwager Jany. Es war übrigens ihr zehnter Hochzeitstag. Eigentlich hatten wir vorgehabt, am 19. Juli zu heiraten, aber meine Schwester überzeugte uns, eine weitere Woche noch zu warten, damit wir später den Tag jeweils gemeinsam feiern könnten. Ihr Argument war, auf diese Weise wäre es möglich, uns gegenseitig ans Datum zu erinnern; irgendjemand von uns vieren würde sicher schon daran denken. – Es war halt noch nicht die Zeit, wo man im Smartphone eine Erinnerungsfunktion aktivieren konnte… Und wie gut taten wir daran zu verschieben, denn sechs Jahre später, am 19. Juli 1979, kam unser erstes Kind zur Welt. Da hätten wir unseren Hochzeitstag bis auf weiteres auf Eis legen können. Tatsächlich trafen wir uns an besagtem Datum wenn immer möglich und feierten den Jahrestag zusammen bei einem gemeinsamen Nachtessen.
Am nächsten Tag, dem 27. Juli 1973, fuhren wir nach Bivio im Graubünden, wo meine Schwiegereltern ein altes Familienhaus besassen (gebaut 1560). Theos Familie und wir übernachteten dort. Nun war der „erfreuliche“ Zeitpunkt gekommen, dass ich Theos Halbbruder und dessen Ehefrau (Halbschwägerin???) beim Vornamen nennen durfte. – Als ich die beiden zwei Jahre zuvor kennenlernte, bestanden sie darauf, Herr und Frau Torriani genannt zu werden – was ich fast nicht glauben konnte. Natürlich ist Theos Bruder sechs Jahre älter als er, aber trotzdem… Es war kein guter Anfang.
Meine Verwandten übernachteten im Hotel Post. Hotelzimmer für sie waren dort gebucht. Ein Bild werde ich nicht mehr vergessen - meine Schwiegermutter „at her best“:
Ich sehe sie, wie wenn’s gestern gewesen wär: Sie stand auf der Strasse und erwartete die Gäste. Als diese ankamen, winkte sie sie mit hastigen Bewegungen heran und nach kurzer Begrüssung teilte sie ihnen mit, sie hätte ihre Reservation geändert. Ein Zimmer ohne Dusche und Bad sei günstiger; sie könnten ja dann im Torriani-Haus duschen. - Erste Handlung meiner Schwester nach Ankunft im Hotel: Zurück zur ursprünglichen Buchung mit en-suite-Badezimmer.
Unser Heimatort war Soglio im Bergell, ein kleiner Ort nahe der italienischen Grenze mit einem wunderschönen Blick auf die Bündner Berge, oft abgebildet in Heimatkalendern. (Inzwischen hat eine Gemeindefusion stattgefunden, daher ist Bregaglia von Amtes wegen neuerdings unser Heimatort). Dort fand die kirchliche Trauung statt. Theo wollte es so und obwohl ich mit der Kirche nichts am Hut habe, war ich einverstanden. Er ist ebenso wenig religiös wie ich, aber irgendwie fand er, es gehöre dazu.
Wir waren eine kleine Hochzeitsgesellschaft, nur Theos Eltern, sein Halbbruder und dessen Ehefrau, und von meiner Seite Mutter, Schwester und Schwager. Bei der Fahrt über den Julier schneite es ein wenig, im Bergell war das Wetter wieder sommerlich und nach der Trauung gab’s im wunderschönen historischen Gartenrestaurant des Palazzo Salis ein Zvieri. – Ein weisses Kleid wollte ich auf keinen Fall anziehen, ein Schleier kam sowieso nicht in Frage. Ich trug ein gelbes, eng anliegendes Kleid mit Spaghettiträgern, das ich dann auch später noch bei anderer Gelegenheit würde tragen können, ein weisses Bolero dazu. Nicht ganz zur Freude meiner Schwiegermutter. Heute würde man sagen: „She was not amused“.
Zurück in Bivio fand das Abendessen im Hotel Post statt. Die Blumenarrangements hatte Theos Mutter aus Köniz mitgebraucht, aus ihrem Garten. – Die waren aber bereits zwei Tage alt, als sie unseren Tisch zierten. Das passte ihnen gar nicht und alle liessen ihre Köpfe hängen. Ein eher trauriger Anblick, aber natürlich sagte niemand etwas. Ein wenig seltsam war’s schon, denn sonst war meine Schwiegermutter nicht so „gitzknäpperisch“ unterwegs... Sie hatte es ja auch nicht nötig.
Natürlich hatten wir trotzdem einen einmaligen Abend; ich war überglücklich. Die halbverdorrten Blümchen konnten den nicht trüben.
Unsere Freunde waren nicht dabei. Wir hatten sie eine Woche vorher in Bern zu einer Gartenparty eingeladen. Ein Spanferkel wurde gebraten, der Wein floss, die Sonne schien - es war ein herrliches Fest. Bilder davon hatte Theos Vater in sein Album eingeklebt und dazu geschrieben: „Verlobung Theo“.
Unsere Hochzeitsreise dauerte vier Wochen lang. Sie führte uns durch Rumänien und Bulgarien nach Istanbul und anschliessend nach Griechenland. Wir hatten auf der Halbinsel Chalkidiki mit einem befreundeten Ehepaar eine Ferienwohnung gemietet. An besagtem Datum kamen wir dort an, wussten aber nicht ganz genau, wo das Haus sich wirklich befand; es gab nämlich nur eine ungenau Skizze, die wir zur Verfügung hatten. Unsere Freunde hatten den Schlüssel und hätten bereits dort sein sollen, um uns zu empfangen. Das waren sie aber nicht. - In der Nähe, wo wir unsere Unterkunft vermuteten, gab’s ein Haus direkt am Meer und der Besitzer war daheim. Ihn sprachen wir an, aber er verstand nur Griechisch und wir kein einziges Wort, so versuchten wir mit Händen und Füssen zu erklären, was unser Problem war. Lösen konnte er es nicht, aber er war unglaublich freundlich, lud uns zum Abendessen ein. Er hatte grad frischen Oktopus gefangen – das erste Mal in unserem Leben, dass wir so etwas serviert bekamen. Ich war skeptisch und hielt mich nur ans Brot, Theo aber fand die neue Erfahrung bereichernd (es dauerte noch ein paar Jahre, bis auch ich an Meeresfrüchten Gefallen fand). Anschliessend durften wir sogar bei ihm übernachten.
Tags darauf kamen unsere Freude an. Die grosse Verspätung war darauf zurückzuführen, dass sie in Rumänien in einem Hotel übernachtet und dort ihre Pässe vergessen hatten. Als sie dies an der nächsten Grenze bemerkten, Hunderte von Kilometern später, mussten sie den ganzen Weg zurückfahren, um die Dokumente zu holen. – Ohne Smartphone gab es damals halt keine Möglichkeit, uns dies wissen zu lassen.
Aber nun war ja alles im Grünen und wir konnten in das Häuschen, das sich tatsächlich ganz in der Nähe befand, wo wir bei dem netten Herrn übernachtet hatten, einziehen.
Eine tolle Unterkunft sieht anders aus; wir hatten uns von der Beschreibung und vom Preis her schon eine etwas komfortablere Bleibe erhoffe, vielleicht sogar mit Strom, aber es war warm und wir gewöhnten uns rasch an die spartanischen Verhältnisse, an die provisorisch montierte Dusche draussen vor der Hausmauer, die nur einen spärlichen Wasserstrahl spendete, und an die harten Matratzen - ans konstante Rattern und an den Gestank des Generators hingegen nicht so sehr.
Unterwegs waren wir mit unserem geliebten weissen VW-Käfer. Wie es uns gelang, all unser Gepäck dort drin zu verstauen, kann ich mir heute kaum mehr vorstellen. Wir hatten nämlich zusätzlich ein Gummiboot mit dabei und einen recht grossen Aussenbordmotor. Mit diesem Boot machten wir einen Ausflug, den ich nie vergessen werde – ein Albtraum!
Wir fuhren ans nahe gelegene Ufer und unser Ziel war es, von dort aus in eine andere Bucht zu gelangen. Bis das Boot startklar war, der Motor montiert und einsatzbereit, dauerte es. Auch war ich nicht ganz sicher, ob das Boot nicht etwa ein Leck hatte, war es doch schon seit langer Zeit nicht mehr benutzt worden. – Nun, wir fuhren los. Unterwegs begann plötzlich der Motor zu stottern und wir verloren an Fahrt. Auch war ich nun sicher, dass tatsächlich Luft am Entweichen war. – Das Boot glitt nur noch ganz langsam dahin und urplötzlich waren wir umgeben von Scharen von tellergrossen dunklen Quallen. Es war entsetzlich. Ich hatte Panik und sah uns schon steckenbleiben inmitten der schwammigen Körper, die uns vertilgen würden.
Wie genau, weiss ich nicht mehr, aber irgendwie gelang es schliesslich mit den Paddeln, zum Ufer zurückzukehren und unversehrt zum Auto zurückzufinden. Boot und Motor wurden wieder im Kofferraum verstaut und kein zweites Mal mehr verwendet. Von solchen Ausflügen hatte ich restlos genug.
Ein paar Tage später fuhren wir weiter südwärts, besuchten erst Delphi und anschliessend Athen – die Akropolis natürlich, auf der man damals nach Herzenslust noch herumklettern konnte, bevor wir schliesslich die Heimreise antreten mussten.
Eine tolle Reise war das mit einzigartigen und unvergesslichen Erlebnissen. Nebst ein paar hübschen Erinnerungsstücken und natürlich zahlreichen Fotos hatte ich nur ein unschönes, kleines Souvenir mit nach Hause gebracht: ein paar Wanzen im Koffer als blinde Passagiere von unserer letzten Unterkunft in Osteuropa.
Die ersten paar Ehejahre
Theo hatte sein Elektroingenieur-Studium an der ETH abgeschlossen und hatte einen etwas seltsamen Job gefunden in der psychiatrischen Klinik Waldau bei einem Professor Pileri. Es handelte sich um ein Forschungs-Projekt des Nationalfonds zur Erforschung der Kommunikationsart und –weise bei Flussdelphinen. Diese sind blind und verständigen sich mit Ultraschall.
Die Tiere, sie stammten aus dem Indus, wurden in einem Becken gehalten und man versuchte, die Töne, die sie abgaben, aufzuzeichnen, um daraus Schlüsse zu ziehen. Theos Aufgabe war es, die technische Seite der Angelegenheit zu installieren und zu überwachen. Da eine solche Stelle aber nicht wirklich existierte, wurde er zu einem Sekretärinnen-Lohn angestellt, was uns in keiner Weise grosse Sprünge machen liess. 1‘500 Franken war sein Monatsgehalt; ich verdiente nichts, da ich gerade das Sekundarlehramt begonnen hatte, meine Ausbildung zur Sekundarlehrerin an der Uni Bern.
Zwischendurch allerdings konnte ich eine Stellvertretung übernehmen und dann doch ein paar Batzen damit verdienen. An die allererste erinnere ich mich gut. In Hinterfultigen vertrat ich einen Lehrer, der in den Militärdienst musste. Die Aufgabe war nicht leicht; die Klasse bestand aus ungefähr zwanzig Schülern mit verschiedenen Jahrgängen. So musste ich die Stunden jeweils drei- oder gar vierfach vorbereiten. Zwei Gruppen wurden beschäftigt, die eine hatte den Auftrag, etwas zu lesen, die andere, Aufgaben zu lösen, der Rest der Klasse musste zuhören, was ich ihnen Interessantes zu erzählen hatte... Das war ein Sprung ins kalte Wasser, aber mir gefiel es sehr, endlich praktisch arbeiten zu können.
Auch hatte ich mich im Zivilschutz angemeldet. Theo fand, ich solle dort mitmachen, denn falls irgendetwas geschehe und man einen Schutzraum beziehen müsse, hätte ich einen sicheren Platz und wäre informiert über alle Geschehnisse. Es war damals halt noch die Zeit des kalten Krieges. – Seine Argumentation leuchtete mir ein und ich meldete mich an. Es dauerte allerdings fast ein Jahr, bis ich aufgeboten wurde, was Theo dazu veranlasste, die Verantwortlichen dort zu rügen. Wenn sich eine Frau schon freiwillig melde… Nun, der Nachrichtendienst war mein Ressort. Ich besuchte verschiedene Kurse, wurde zum „Dienstchef“ ernannt und in einem Stab in Bern eingeteilt. Ich gab dann selber Kurse, bildete Kartenführer aus und mit meinen Kollegen im Stab erlebte ich viel Interessantes und auch Lustiges. Eine Episode, an die ich mich gerne erinnere, war zum Brüllen komisch. Man übte einmal mehr den Ernstfall und der eine oder andere wirkte eher gestresst:
Es ging darum, per Funk einen Namen durchzugeben. Ich hörte zu, was ein Kartenführer dem anderen mitteilen wollte:
- „Er heisst Borgert. - B wie Beat, O wie Orange, R wie Roland, G wie Schorsch …“
- „G wie was?“
- „Schorsch. - S wie Susi, C wie Claudio, H wie Housi, …“
- „Was? - I chume nüm nache!”
Einen Kartenführerkurs musste ich im Wallis geben, in Sitten. Die Walliser sind ein Völklein für sich, wie man ja weiss. Dass dies nicht nur ein Vorurteil ist, erfuhr ich rasch. Nicht extrem motiviert für den Stoff, den ich ihnen beizubringen hatte, waren die jungen Männer zwar ausnehmend freundlich und immer zu einem Spass aufgelegt, aber viel Konkretes kam bei der „Arbeit“ nicht heraus. Sie wollten mich jeweils lieber zu einem „Glesli Wysse“ einladen, als am Pult zu sitzen und zuzuhören. Und das schon am Morgen… Es war eine spezielle Woche; wir haben viel gelacht und wenig gelernt.
Später, als wir nach Ittigen umzogen, wurde ich in die Zivilschutzkommission der Gemeinde gewählt. Zwölf Jahre lang war ich Mitglied in diesem Gremium.
Unsere erste gemeinsame Wohnung
Wir wohnten im Kirchenfeldquartier in einer bescheidenen kleinen Zweizimmer-Altwohnung mit Wohnküche. Diese war aber in null Komma nichts so sehr überstellt mit Theos Laborgeräten, dass weder wohnen noch essen mehr möglich war. Kochen schon, aber das musste ich erst erlernen, denn bisher hatte ich mich erfolgreich vor dieser Arbeit drücken können. Auch Theo war nicht der geborene Koch. Büchsen öffnen konnte er zwar, und das nannte er „kochen“. – Kulinarische Höhenflüge gab es also nicht in diesen ersten Jahren unserer Ehe. Die Ravioli aus der Büchse, die, wenn sie aus dem Blech befreit waren und in die Pfanne „pflutschten“, noch immer eng zusammenhielten, kamen oft auf den Teller, aber als Leckerbissen konnte man sie nicht bezeichnen. Nicht einmal, wenn man sie „verfeinerte“, wie Theo das nannte. Das bisschen Rahm, das sich zu den verkochten Teigtaschen gesellte, vermochte keine Wunder zu bewirken. - Später erfuhr man ja mal aus einem Warentest, was tatsächlich alles für Fleisch in den Büchsenravioli steckt(e) beziehungsweise fehlt(e).
Zum Glück lernte ich allmählich doch, das eine oder andere Gericht zuzubereiten. Apfelkuchen backen war das erste.
Viel Geld zum Einrichten hatten wir nicht. Die Wohnwand in unserer Stube bestand aus Bierharassen, die wir mit dunkelbrauner Beize angestrichen hatten. Ein Teil dieser Kisten existiert übrigens immer noch: als Puppenstube für unsere Grosskinder.
Wir hatten auch eine „Polstergruppe“. Die bestand aus einem alten Bettgestell, auf dem grosse Kissen drapiert waren, die ich selber aus grobem grauem Tuch genäht und mit Schaumstoff gefüllt hatte. Den „Salontisch“ hatte Theo gefertigt: Eine etwa ein Meter lange Spanplatte mit braunem Plastikdeckblatt, an die vier schwarze Metallbeine angeschraubt waren. Nicht eben eine Augenweide, aber auf jeden Fall zweckmässig. – Um das Bild abzurunden: Was in jedem „Bünzlihaushalt“ damals nicht fehlen durfte, war ein Gummibaum. Diesen hatten wir von den beiden Damen, die unter uns wohnten, zur Hochzeit geschenkt erhalten.
Apropos Hochzeitsgeschenk: Von Theos Vater hatten wir eine Miele Abwaschmaschine erhalten, und die war ein Segen. Die mühsame Sisyphusarbeit des Abwaschens übernahm von da an unsere „Marie“.
Theo war oft im Militärdienst und daher wochenlang weg. Am Wochenende heimzukommen war nur selten möglich, fand der Dienst doch in den Bündner Südtälern statt, eine Zugreise von manchmal mehr als sieben Stunden. War er dann endlich daheim, wollte er nichts anderes als schlafen. Und schon ging’s wieder zurück nach St. Moritz oder wohin auch immer.
Als er zum ersten Mal, seit wir verheiratet waren, weg war, liess er mir 20 Franken Haushaltsgeld zurück. Auch damals langte das nicht eben weit, ich musste meine Mutter anpumpen, um zu „überleben“. – Als er das nächste Mal einrücken musste, liess er mir eine Hunderternote zurück. Ich konnte es kaum fassen. Fünfmal so viel! – Es dauerte keine zwei Tage, da besuchte mich ein Freund von uns und bat mich um die hundert Franken, die er Theo kürzlich geliehen habe...
Studium und Fremdsprachenaufenthalte
Die Fächer an der Uni, die ich belegte, waren Deutsch, Englisch, Geschichte und Französisch.
Französisch war obligatorisch, aber da ich nie wirklich viel gelernt hatte, verpatzte ich die erste Prüfung völlig. Zwar hatte ich bereits einen Welschlandaufenthalt von sechs Wochen in Lausanne hinter mir, wo ich zusammen mit einer Freundin einen Job bei der PTT gefunden hatte. Wir mussten Geld zählen, das aus den Telefonkabinen ins Büro gebracht wurde. Darunter fanden sich auch ausländische Münzen und etwas noch viel Raffinierteres: Ein paar ganz Schlaue hatten ein Loch in ihre Einfränkler gebohrt und einen Faden daran befestigt. Somit gelang es ihnen wohl, immer wieder neu den nötigen Impuls einzugeben, mit dem es möglich war, für längere Zeit zu telefonieren. Nur herausziehen funktionierte offenbar nicht, so dass wir wieder und wieder solche Kuckuckseier in den Geldkassetten fanden. Leider aber verhalf mir dieser Stage doch nicht, mein Französisch genügend aufzupolieren, um die Prüfung zu bestehen. – Ich musste mir also etwas einfallen lassen, das ungeliebte Fach zu vermeiden. Ich hatte gehört, dass man die Ausbildung zum Sekundarlehrer auch im Kanton Solothurn absolvieren konnte. Nur wenige Änderungen gab’s in den Bedingungen. Man musste drei Hauptfächer belegen, anstatt wie in Bern zwei Haupt- und zwei Nebenfächer. Das war’s! Kein Französisch mehr! Und da es in Solothurn bekanntlich keine Uni gibt, konnte ich belieben, wo ich war und in Bern weiterstudieren. Auch bei den Auslandsaufenthalten galten andere Regeln. Sie dauerten länger, nämlich ein halbes Jahr, aber man konnte sie in zwei Raten aufteilen, also in zweimal drei Monate, was ich dann auch tat.
Zwei Monate verbrachte ich in Cambridge, wo ich eine Schule besuchte. Am Ende meines Aufenthaltes holte mich Theo dort ab und wir reisten mit unserm VW-Käfer durch Schottland und schliesslich nach Wales, wo Theo Verwandte hatte, die in einem wunderschönen Cottage wohnten, abgelegen, „am Ende der Welt“. Vier Wochen später traten wir die Heimreise an, auf dem Rücksitz des VW ein antikes Davenport-Schreibpult, das noch heute in unserem Esszimmer steht, und noch sonst ein paar hübsche Einkäufe, unter anderem eine Gesamtausgabe von Shakespeares Werken in einer reich verzierten Holzkassette. Die einzelnen Bände sehr klein, mit dunkelrotem Ledereinband, Goldschnittverzierungen und einem feinen, ebenfalls goldenen Bändel als Lesezeichen. – Die Schrift heute selbst mit Lesebrille unmöglich mehr zu entziffern.
Den zweiten Teil meines „Zwangs“-Urlaubs wollte ich nicht mehr in England absolvieren, so beschloss ich, eine dreimonatige Reise durch die USA zu unternehmen. Meine Mutter kam mit und wir verbrachten eine Woche zusammen in New York. Sie flog anschliessend wieder heim und ich setzte meine Reise alleine fort mit einem Rucksack und zwei Greyhound-Tickets im Gepäck, die ich vorab in der Schweiz gekauft hatte.
So ging die Fahrt erst Richtung Florida, dann weiter durch die Südstaaten, New Orleans, San Antonio bis San Diego, Kalifornien, weiter nach San Francisco, Las Vegas, Salt Lake City und durch die Rocky Mountains via Denver, Chicago, Niagara Falls, Toronto zurück nach New York.
An den meisten dieser Orte konnte ich anklopfen beziehungsweise ein paar Tage zu Besuch bleiben.
Wie ich zu diesen Adressen gekommen war, ist eine interessante Geschichte. Meine Mutter erzählte sie uns oft:
Irgendwann in den späten Vierzigerjahren kam mein Vater an einem Sommerabend nach der Arbeit heim, im Schlepptau zwei junge Tramperinnen mit grossen Rucksäcken. Die eine, Douglas, war Kanadierin, die andere, Eleanor, Amerikanerin aus Baton Rouge. Er hatte sie dabei „ertappt“, wie sie irgendwo in der Nachbarschaft hatten in einen Garten eindringen wollen, um dort ihr Schlaflager aufzuschlagen. Er hatte ihnen angeboten, bei uns zu Hause zu übernachten, wo sie zumindest ein Dach über dem Kopf hätten, und sie hatten dankend angenommen. Meine Mutter kochte ihnen ein Nachtessen. Diese grosszügige Geste hatte langwierige Auswirkungen. Meine Eltern blieben zeitlebens mit den Tramperinnen in Verbindung.
Als meine Mutter (sie war damals ungefähr sechzig) ihre erste Amerikareise unternahm, durfte sie bei beiden je eine Zeit lang wohnen und nicht nur das: Man „reichte sie weiter“. Die beiden Freundinnen hatten inzwischen geheiratet, hatten Familie und Freunde an den verschiedensten Orten in den Staaten und Mam durfte viele von ihnen besuchen gehen. So brauchte sie nicht ein einziges Mal in einem Hotel zu übernachten. Douglas Ehemann David zum Beispiel hatte einen Geschäftspartner, der in San Francisco lebte, Lee Langan, und auch dort durfte sie „andocken“, so wie ich nun auch. - Davon aber ein wenig später.
Auch im Bus geschah es manchmal, dass ich jemanden kennenlernte und nicht selten wurde ich sogar zum Übernachten eingeladen. – Es war eine absolut einmalige Reise. Unterwegs war ich meistens allein, legte Tausende von Kilometern im Greyhound zurück, genoss das Abenteuer in vollen Zügen. Ein absoluter Höhepunkt war die Woche in Arizona und New Mexico, wo ich in Albuquerque ein Auto mietete und von Canyon zu Canyon reiste. Natürlich leistete ich mir einen „Ami-Schlitten“, ein ziemlich altes Modell zwar, günstig, aber genau richtig fürs „Grosse-weite-Welt-Amerika-Erlebnis“, so wie ich mir das vorgestellt hatte. Die Schönheit der Gegend ist unvergesslich, die Weite, die Einsamkeit. Touristen hatte es fast keine in diesem Frühjahr 1976; im atemberaubenden Monument Valley war ich ganz allein unterwegs. Im Visitor-Center des Grand Canyon hingegen nicht. Ich bestellte etwas zu essen und ein Glas Weisswein, erhielt einen Becher und ein Röhrli. - Es waren noch andere Zeiten damals...
Meine Fahrt führte auch durch ein Indianer-Reservat. Vor dem Polizeiposten stellte ich mein Auto hin und genau dort passierte es mir dummerweise, dass ich die Türe abschloss, aber den Schlüssel in der Zündung stecken liess. Der big Chief konnte mir helfen. Mit einem Kleiderbügel aus Draht gelang es ihm, durchs leicht geöffnete Fenster den Schliessmechanismus zu erreichen und die Tür zu öffnen. – Noch mal Glück gehabt.
Sehr beeindruckt hatten mich ebenfalls die höhlenartigen ehemaligen Indianer-Behausungen in Mesa Verde und im Walnut Canyon sowie das riesige Loch des Meteor Carter und die versteinerten Baumstämme im Painted Desert Nationalpark. Hunderte von Kilometern legte ich in dieser Woche zurück. Jeden Morgen startete ich um sieben Uhr und suchte erst gegen Abend wieder eine Übernachtungsmöglichkeit.
In San Antonio lernte ich eine Nichte von Eleanor kennen. Sie musste für ein paar Tage weg, liess mich aber in ihrer bescheidenen kleinen Wohnung übernachten. Ich blieb nur eine einzige Nacht, denn diese ist mir unvergesslich. Kaum hatte ich die Lichter gelöscht und war eingeschlafen, hörte ich ein seltsames Rascheln. Es wurde immer lauter und ich begann mich zu fürchten. Als ich das Licht anzündete, sah ich, was der Grund für dieses eigenartige Surren war: Der ganze Fussboden war über und über voll von schwarzen, ziemlich grossen Cockroaches, genauso wie im Film „Indiana-Johnes“. Die Viecher eilten wild durcheinander, ziellos wie es schien, es war entsetzlich. Natürlich schrie ich wie am Spiess und stellte mich in der äussersten Ecke des Bettes auf die Matratze. Niemand hörte mich, aber die ekligen Viecher waren wohl noch schreckhafter als ich, scheuten das Licht und verzogen sich überstürzt und in Scharen zurück in die Küche und dort wohl in die Abläufe, aus denen sie gekommen waren. An Schlaf war natürlich nicht mehr zu denken, aber irgendwie überstand ich diese Horror-Nacht trotzdem. Jedenfalls verliess ich am nächsten Morgen sehr früh die Unterkunft fluchtartig.
Auch eine Nacht im Josemite-Park ist mir im Gedächtnis geblieben: Ich hatte einen Zweitagesausflug im Park gebucht mit einer Übernachtung in einem Zelt. Das kostete viel weniger als ein Hotelzimmer. Aber ich bereute meinen Entscheid bald, denn die Nacht war extrem kalt, ich hatte zu wenig warme Kleider bei mir und fror jämmerlich.
Zuvor allerdings führte mich meine Reise nach Los Angeles, wo ich ein paar Tage bei einem Schweizer Ehepaar verbringen durfte, die vor längerer Zeit bereits dorthin ausgewandert waren. Mit Rahmschnitzel und Nüdeli und anderen Köstlichkeiten verwöhnten sie mich – es war grandios.
Fantastisch war’s ebenfalls in San Francisco bei Karen und Lee Langen, wo ja auch meine Mutter wenige Jahre zuvor zu Gast gewesen war. Ich blieb eine ganze Woche.
Mit ihnen und ihrer Familie (sie haben zusammen sieben Kinder – fünf aus ihren ersten Ehen, zwei gemeinsame) sind wir noch immer eng befreundet, und das nun seit sechsundvierzig Jahren. – So viel zur oft gehörten und viel zitierten Aussage, die Amerikaner seien oberflächlich, was mich immer ärgert, wenn ich es höre.
Zwei unserer Kinder verbrachten je ein Jahr in ihrer Familie, gingen dort zur Schule und erlernten die Sprache. Susan, die jüngste Tochter, ist noch immer wie eine Schwester für die beiden. Vor zwei Jahren waren sie an der Hochzeit unseres Sohnes eingeladen und verbrachten anschliessend eine Woche bei uns. Auch wir haben sie schon mehrmals besucht in ihrem wunderschönen viktorianischen Haus an der California-Street, das auf Kalendern und Postkarten zu sehen ist.
Eine lustige Episode kommt mir in den Sinn: In der Schule, die unser Sohn dort besuchte, war eines der Fächer auch Französisch. Diego war der Beste in der Klasse, denn Französisch hatte er ja schon daheim während ein paar Jahren gelernt und sprach natürlich ohne amerikanischen Akzent.
Französische Filme sind eher eine Rarität in amerikanischen Kinos und als seine Lehrerin dann doch im Kinoprogramm einen entdeckte, wollte sie der Klasse ein authentisches Erlebnis bescheren, was ihr dann auch bestens gelang. Ohne sich vorher anzusehen, wovon der Film handelte, ging sie mit der Klasse hin. – Es war ein Pornofilm...
Zurück zum Jahr 1976: Einen schlechten Tag hatte ich, an den erinnere ich mich gut: Um halb fünf morgens läutete der Telefonapparat auf meinem Nachttisch. Ich schreckte aus dem Schlaf auf, nahm den Hörer ab. Es war Theo. – Was für eine Freude! Aber wir konnten uns kaum begrüssen, schon fiel mir der Apparat zu Boden und die Leitung war tot. Ich hatte ihn in der Aufregung unglücklicherweise und natürlich ungewollt an der kurzen Schnur zu Boden gerissen. – Jetzt wusste ich nicht, was mir Theo hatte sagen wollen. Ich hoffte, er würde nochmals anrufen, das tat er aber nicht. So war ich sicher, dass sich etwas Schlimmes ereignet haben musste, denn sonst hätte er ja nicht zu dieser Unzeit zu telefonieren brauchen. Den ganzen Tag lang machte ich mir Sorgen und hatte ein ungutes Gefühl. – Erst am Abend hatten wir erneut Kontakt und es stellte sich heraus, dass er schlicht und einfach nicht daran gedacht hatte, wie viel Uhr es bei uns gerade war. So oder so wollte er nur hallo sagen. – Typisch Theo. – Skype gab’s halt noch nicht, Smartphones ebenso wenig und ein Anruf war teuer. Deshalb hatten wir nur selten Kontakt. Briefe schreiben war das einfachste Kommunikationsmittel, aber auch das langsamste, und was man in einem Brief an Neuigkeiten erfuhr, war bereits Schnee von gestern.
Natürlich hätte ich den einmaligen Aufenthalt bei der Familie Langan noch lange ausgehalten, aber ich hatte ja einen Plan, wollte weiterfahren. So fragte ich Lee, ob er mir einen Tipp geben könne, in welchem Hotel in Las Vegas ich übernachten könne, das mein Budget nicht über den Haufen werfen würde. Sein Rat war, gar kein Hotel zu suchen, es laufe dort so viel auch während der Nacht, da sei es schade, Geld dafür auszugeben. Er hatte absolut recht. Kaum angekommen, wurde man bereits mit Gutscheinbüchlein beglückt, hier ein paar Chips für fürs Casino, da vergünstigte Tickets für eine Show, hier ein Gutschein für ein Getränk oder ein Geschenk, da ein paar Quarters für die Slotmachines, die ja bereits im Busbahnhof auf Spielfreudige warteten. Es war tatsächlich kein Kunststück, sich eine Nacht um die Ohren zu schlagen. Bei einem einarmigen Banditen hatte ich sogar Glück. Der Apparat wollte nicht mehr aufhören zu klingeln und spuckte eine ansehnliche Menge an Münzen aus, so dass ich mir zwei der Shows ansehen konnte, die mich beide begeisterten. Gegen Morgen bestieg ich anschliessend den Bus und hatte sogar noch etwas von der „Kohle“ übrig.
Auf der Weiterfahrt durch die Rockys konnte ich den verpassten Schlaf im Greyhound nachholen, die Gegend sah sowieso stunden– und tagelang fast gleich oder zumindest ähnlich aus. In St. Louis, bei der Familie eines Geschäftspartners von Lee, durfte ich einen weiteren Zwischenhalt einlegen, ebenfalls in Chicago. In Toronto besuchte ich Douglas, eine der beiden Tramperinnen, denen mein Vater knapp dreissig Jahre zuvor Obdach gewährt hatte.
Eine lustige Erinnerung habe ich an Douglas. Sie hat meiner Mutter immer zu Weihnachten einen Christmaspudding geschickt, also dieses schwere, ultra-süsse und vor Zucker triefende Weihnachtsgebäck mit kandierten Früchten. Das Porto dafür kostete wohl etwa doppelt so viel wie der Inhalt. Als dies zum ersten Mal geschah, bedankte sich Mam natürlich herzlich und schrieb, wie gern sie das Gebäck habe und wie sehr sie sich darüber freue. – So erhielt sie dieselbe Bescherung Jahr für Jahr. Niemand mochte den Kuchen, sie selber inzwischen auch nicht mehr. Aber wie stellt man sowas ab? – Das geht gar nicht. Es ist ein Dilemma. Ich habe daraus gelernt, mich vorsichtig auszudrücken, und versuche, wenn ich etwas erhalte, was ich nicht unbedingt mag, wie zum Beispiel Pralinen mit weiss ich was für Früchten und Marzipan drin, den Dank so zu formulieren, dass zwischen den Zeilen klar wird, dass eine Wiederholung der Bescherung nicht unbedingt mein grösster Wunsch ist. - Nicht ganz einfach. Die Pralinen kann ich meinem Mann zwar weitergeben, der mag alle diese „Leckerbissen“, aber bei Mams Kuchen war’s schwieriger. Es wurde jeweils Frühling und das Backwerk allmählich trocken, bis sie es verzehrt (hier passt das Wort mal) hatte, denn wegwerfen hätte sie es nie und nimmer gekonnt; Esswaren darf man nicht vergeuden! – Ich erinnere mich in dem Zusammenhang an eine Episode, als ich noch ein Kind war:
Ich hatte in der Küche gespielt und verschiedene Esswaren zusammengerührt: Senf, Mehl, Milch, Konfitüre, Orangensaft, ein Ei - was ich grad so finden konnte im Kühlschrank, auch ein paar Gewürze zum Abschmecken. Das wollte ich meinen Stoffbären füttern. Mam schimpfte zwar nicht mit mir, aber sie begann, den fürchterlichen Mix zu essen, was mich selber erschütterte. - Nie mehr habe ich Bärenfutter hergestellt.
Ähnlich wie mit dem Kuchen ging’s ihr übrigens mit Cognac. Wir hatten während Jahren geglaubt, sie liebe diesen Weinbrand und so erhielt sie hin und wieder eine Flasche von uns geschenkt, bis sie sich dann doch mal ein Herz nahm und uns mitteilte, Gin wäre gut, aber Cognac möge sie eigentlich nicht...
Mein letzter Aufenthalt vor der Heimreise war in Poughkeepsie, in der Nähe von New York, wo Freunde von uns aus Bern während ein paar Jahren wohnten. Die Busstationen sind ja immer praktischerweise „downtown“, also direkt im Herzen eines Ortes angesiedelt. Ich erkundigte mich, wie ich zur angegebene Adresse komme, und man sagte mir: „It’s just accross the bridge“. Eine typisch amerikanische Antwort. Hätte ich sie nicht vorher schon mal gehört, hätte ich gedacht, ich könne mich zu Fuss dorthin begeben. Aber ich rief an und wurde abgeholt. Die Fahrt dauerte eine gute halbe Stunde.
Nach ein paar Tagen schliesslich war meine dreimonatige Reise Mitte Juni zu Ende. Im Jumbojet von NYC nach Zürich hatte ich Glück: Zufälligerweise kannte ich den Stuart, er war ein Bekannter aus dem Marzili. Er verschaffte mir ein Upgrade in der Business-Klasse, ich durfte einen Besuch im Cockpit machen und wurde wunderbar verwöhnt. So endete die Reise mit einem weiteren unvergesslichen Highlight.
Ohne Kreditkarten war ich unterwegs gewesen, ohne Laptop, Smartphone und E-Book, die vier wichtigsten Dinge in meinem Gepäck, wenn ich heute auf Reisen gehe.
Der Sommer 76 war ausnehmend schön und warm. Wir wohnten mehr im Marzili als zu Hause. – Was für ein herrliches Jahr!
Neue Wohnung – berufliche Veränderungen
Theo hatte nach etwa zwei Jahren einen neuen Job gefunden, und zwar bei der Telecom PTT. Das Forschungsprojekt mit den Delphinen war im Sande verlaufen, die armen Tiere in den engen Becken inzwischen verendet.
Nun konnten wir uns eine teurere Wohnung leisten. Diese fanden wir ganz in der Nähe, wo ich aufgewachsen war, nicht weit weg vom Sonnenhofschulhaus.
Mein Studium hatte ich abgeschlossen und verdiente nun auch endlich jeden Monat Geld. Am Untergymnasium Eisengasse in Bolligen übernahm ich für einen Kollegen, der einen einjährigen Urlaub hatte, eine Stellvertretung. Geschichte und Deutsch waren die Fächer, die ich unterrichtete. Ausnahmslos nett und freundlich waren die Schülerinnen und Schüler zu jener Zeit. Diese Anstellung machte mir grossen Spass.
Kaum war das Jahr vorbei, erhielt ich gleich zwei Angebote für Englischunterricht an zwei verschiedenen Berufsschulen in Bern, an der BMS (Berufsmaturitätsschule der GIBB) und an der bsd. (Berufsschule für den Detailhandel). Es handelte sich jeweils nur um kleine Pensen, so nahm ich beide Angebote mit Freude an. Ich hatte nur ein kurzes Gespräch mit dem jeweiligen Rektor, weder musste ich ein Zeugnis zeigen, eine Probelektion ablegen, noch ein Bewerbungsschrieben einreichen; das ging damals ohne grosses Trara - man sagte mir einfach, was ich zu tun hatte, wann und wo mit welchen Klassen der Unterricht stattfand und so begann, was in der bsd. bis ins Jahr 2010 dauerte und in der BMS bis zur vorzeitigen Pensionierung im Juli 2013.
Erst nachdem ich bereits während zehn Jahren unterrichtet hatte, wollten beide Schulen von mir einen Nachweis haben, dass ich tatsächlich ein gültiges Lehrerpatent hatte. – Meine Zeugnisse zu finden, war gar nicht so einfach; ich kam ziemlich ins Schwitzen, denn ich erinnerte mich nicht, wo ich sie aufbewahrt hatte. In einer Schuhschachtel zwischen Rezepten fand ich sie schliesslich.
Kinder
Am 19. Juli 1979 kam unsere Tochter Kay Isabella zur Welt. Sie war natürlich das schönste, liebste und bravste Kind, das man sich vorstellen kann. Sie schlief rasch durch, das grösste Geschenk für junge Eltern. - Mit genügend Schlaf gibt’s auch keinen Stress.
Wunderbar war, dass meine Mutter, die natürlich auch in die Kleine vernarrt war, gerne und oft zum Hüten kam, so dass ich ohne Unterbruch nach den Sommerferien gleich wieder unterrichten konnte. Damals gab’s so etwas wie Mutterschaftsurlaub noch nicht, in der Schweiz war das Wort noch nicht einmal erfunden worden. Aber das kümmerte mich nicht. Ich hatte ja den perfekten Beruf gewählt. Nur etwa sechs, später zehn und noch später zwölf Stunden pro Woche ging ich arbeiten, und das machte mir Spass, weil’s eine willkommene Abwechslung war.
Aber trotzdem - das Leben ändert rasch, wenn man nicht mehr nur zu zweit ist.
Und erst recht, wenn man plötzlich zu fünft ist. Am Tag nach Kays zweitem Geburtstag, am 20. Juli 1981, kamen unsere Zwillinge zur Welt, Kim Alessandra und Diego Giancarlo. Kim war 700 Gramm schwerer als Diego, wog 3210 g und der Kleine, dem seine Zwillingsschwester alles „weggefressen“ hatte, wie sich mein Arzt ausdrückte, brachte doch immerhin noch zweieinhalb Kilo auf die Waage.
Bis zum siebten Monat hatte ich nicht gewusst, dass wir zwei Kinder im Doppelpack erhalten würden, denn die Ultraschallgeräte waren zu der Zeit offenbar bereits amortisiert. Mein Arzt hielt es nicht für nötig, meinen Bauch auf Zwillinge hin zu untersuchen, obwohl ich selber das Gefühl hatte, bei dieser Schwangerschaft rasch mehr Gewicht zugelegt zu haben. Das sei normal so, fand er. Aber dann, doch argwöhnisch geworden, holte er ein zweites Herzfrequenzgerät hervor und oh je, ich hatte fast einen Schock, hörte ich laut und deutlich zwei verschiedene Herzschläge.
Bis dahin hatten wir zu Hause gespottet und uns vorgestellt, wie mühsam es wäre, wenn wir Zwillinge bekämen. Wir würden ein grösseres Auto kaufen, einen Doppelkinderwagen, zwei Tragtaschen besorgen, ja wohl sogar umziehen müssen. - Und nun war genau das Realität geworden...
Unsere Wohnung war zu klein, das heisst, die Grösse wäre nicht das Problem gewesen, aber wir hatten nur zwei abschliessbare Zimmer, was mit drei Kindern nicht besonders praktisch ist. – Durch Zufall fanden wir aber ganz in der Nähe ein Reiheneinfamilienhaus am Sonnenhofweg, dort, wo ich aufgewachsen war, und einen Monat vor der Geburt konnten wir einziehen. Unsere Freunde halfen wacker mit beim Umzug. Ich sass auf einem Stuhl im Garten und durfte dirigieren, welches Möbel wohin kommt und welche Schachtel man in welchen Stock bringen konnte.
Auch ein grösseres Auto musste her. Es war ein roter Ford Taunus.
Die beiden Neuankömmlinge machten ebenfalls keinerlei Probleme, schliefen bald schon durch und wir fünf gewöhnten uns aneinander. Drei so kleine Kinder sind allerdings schon ein Haufen Arbeit und viel Zeit für einen selber bleibt nicht. Waren die Zwillinge gefüttert, war die Reihe an Kay, die ebenfalls Zuwendung brachte. Zum Glück war meine Mutter noch immer fit genug, mir oft beizustehen und alle drei zu betreuen, wenn ich arbeiten ging. Endlich hatte sie nun nicht mehr das Gefühl, das „fünfte Rad am Wagen“ zu sein, worüber sie früher so oft geklagt hatte. Nun wurde sie gebraucht.
Mutterschaftsurlaub gab’s noch immer keinen und so musste ich in den ersten Wochen, als ich die Kinder noch stillte, einen Kollegen bitten, meine Unterrichtsstunden zu übernehmen, wenn ich für die „Fütterung“ heimeilte. Seinen Einsatz musste ich natürlich selber berappen. Aber auch jetzt noch genoss ich es sehr, einige Zeit pro Woche mit Leuten zu verbringen, die weder Windeln-Wechseln noch Babynahrung zum Thema hatten.
Meine Schwiegermutter konnte nicht verstehen, weshalb ich meinen Job nicht an den Nagel hängen wollte. Sie selber hatte nie gearbeitet, fand, eine Frau gehöre in den Haushalt. Dort war ich ja oft genug, so oder so.
Kinder Hüten war nicht ihr Ding. Da sie sich relativ kompliziert anstellte, war ich auch nicht besonders erpicht darauf, ihr unsere Kinder anzuvertrauen. Und Theos Vater war sowieso keine Hilfe. Wenn er eines der Kleinen auf dem Arm hielt, was eigentlich nur vorkam, wenn es darum ging, ein Foto zu schiessen, stellte er sich so linkisch an, dass es aussah, als ob er es mit einem Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg zu tun hätte.
Im Sommer verbrachten wir viel Zeit im Marzili, wo die Kinder schnell schwimmen lernten.
War das Wetter schlecht, lief ein anderes Programm ab. Ganze Nachmittage verbrachten wir zusammen mit einer Freundin, mal bei ihr zu Hause, mal bei uns, und die Kinder konnten zusammen spielen oder auch zanken, was halt zuweilen ebenso vorkam, selten zwar. Sie erinnern sich noch heute an unsere feinen Zvieri mit Schwarztee mit Milch und Zucker (nach englischer Art) und an die leckeren Migros-Berlinern, damals noch nach altem Rezept.
Diese Freundin hatte ich im Spital kennengelernt, als Kay zur Welt gekommen war. Ihre Tochter Claudia wurde am selben Tag geboren und Bernadettes zweites Kind, Tina, hätte zwei Jahre später auch fast denselben Tag geschafft wie unsere Zwillinge: Sie ist eine knappe Woche älter als die beiden. Kim und Tina sind noch heute gute Freundinnen.
Geburtstage waren jedes Jahr ein anstrengendes Ereignis. Wenigstens fielen sie in die Sommerferienzeit. Am Nachmittag fand das Kinderfest statt mit Kuchen, Ballonen und Spielen, am Abend dann waren Eltern, Paten und meine Schwester und mein Schwager zum Essen eingeladen. Meistens feierten wir im Garten, denn im Juli war das Wetter in der Regel schön und warm. – Kaum war alles ab- und aufgeräumt, ging die Strapaze am nächsten Tag von vorne los, und das gleich doppelt: der Geburtstag der Zwillinge. – Nicht weniger anstrengend!
Am 4. November 1985 kam unser viertes Kind zur Welt: Ein Junge war’s, wir nannten ihn Gino.
Und wieder waren wir so weit wie vor viereinhalb Jahren vor der Geburt der Zwillinge:
Ein grösseres Auto musste her. Diesmal war’s ein grauer Peugeot, ein Achtplätzer, mit drei Sitzreihen also.
Und umziehen wollten wir auch, weil wir fanden, sechs Zimmer sollten es nun mindestens sein. In Bern ein Haus zu finden, war aber nicht das Einfachste von der Welt. Bei jeder Hausbesichtigung trafen wir wieder dieselben Leute (Dutzende manchmal), die ebenfalls auf der Suche waren, minus ein Ehepaar. Ich wollte keinesfalls aus Bern wegziehen. Sagen zu müssen, ich wohne in Ostermundigen oder Bolligen oder Köniz oder Muri, fand ich absurd und unwürdig. Bern musste es sein. Meine Sturheit gab ich nach gut einem Jahre auf und der „Suchkreis“ um Bern herum wurde vergrössert. – Unter der Hand fanden wir schliesslich ein Haus in Ittigen mit genügend Zimmern, in dem wir seit dem Sommer 1986 wohnen. Einen besseren Kauf hätten wir gar nicht tätigen können. Ein ungefährlicher Kindergarten- und Schulweg, genügend Platz, tolle Aussicht auf die Berge, ein Garten, in den niemand Einsicht hat – was will man mehr?!
Damals waren die Zwillinge bereits fünf und Kay sieben Jahre alt. Da auch Gino ein „gäbiges“ Baby war, hatte ich kaum das Gefühl, viel mehr Arbeit zu haben als bisher. Die drei „Grossen“ halfen mit beim Füttern und vor allem Kim hatte ihre mütterliche Ader entdeckt und begann bereits, den Kleinen zu „erziehen“. Den ganzen Wortschatz dazu hatte sie bestens gespeichert.
Nach wie vor half mir meine Mutter im Haushalt und vor allem mit den Kindern, so dass ich noch immer meine acht Lektionen Englisch und Deutsch unterrichten konnte. Auch wohnte sie in Bolligen, in nächster Nähe.
Die Idee, ein Au-pair-Mädchen anzustellen, verlief im Sand. Es gab Freunde, die uns vor allfälligen Problemen warnten. – Das „Projekt“ könne wohl eine Hilfe sein, aber auch das Gegenteil: ein weiteres Kind zum Betreuen.
Wir entschlossen uns für eine andere Lösung: Während einiger Zeit kam am Mittwochnachmittag regelmässig ein Mädchen aus der Nachbarschaft, eine Babysitterin, die sich um die Kinder kümmerte. So war auch meine Mutter ein wenig entlastet und ich hatte meinen freien Nachmittag.
Ein paar Gedanken übers weitere Vorgehen beim Schreiben
Wenn man über sich selber schreibt, ist es nicht immer ganz einfach zu entscheiden, wie man vorgehen soll oder will. Soll ich alles chronologisch erzählen, schön der Reihe nach wie in einem Tagebuch, oder ist es besser, von den Familienmitgliedern einzeln zu berichten, das Puzzle auf diese Weise zu einem Gesamtbild werden zu lassen?
Ich habe beschlossen, in den nächsten Kapiteln, bevor ich wieder zum Bericht über mich selber zurückgehe, über die Kinder separat zu schreiben; ich glaube, es macht mehr Sinn und ist übersichtlicher. Was ich von ihnen erzählen will, sind vor allem die lustigen Dinge, die sie gesagt haben, als sie klein waren und schliesslich, was aus ihnen geworden ist.
In ihren ersten zehn Lebensjahren hatte ich mir jeweils Mühe gegeben aufzuschreiben, was ich nicht vergessen wollte. Eine Auswahl davon lese ich hier aus:
Kay
Wie bereits erwähnt, kam Kay Isabella am 19. Juli 1979 im Lindenhofspital in Bern zur Welt. Um 13 Uhr 29. Sie war ein kräftiges Baby von 3,340 kg Gewicht.
Mit ihrer übergrossen Liebe haben Mütter ja die eigenartige Angewohnheit, ihre Kinder immer wieder zu hätscheln, zu verküssen und zu drücken. Sogar die ganz Kleinen haben das nicht immer gern.
Kay war knapp zweieinhalb-jährig, als sie mir beim Schlafengehen mitteilte: „Gang jitz abe go ufrume!“ – Und mehr als einmal musste sie mich ermahnen: „Nümme schmüsele; jitzt isch fertig!“
Erheiternd, wie schon die Dreijährigen altklug sein können: Wir nenne es jedenfalls so. Es ist ja klar, von wem sie ihre Wörter und Sätzchen haben. Sie hören zu, lernen, speichern, imitieren und wenden an, was sie aufgeschnappt haben. Lustig für uns ist dann, wenn der Moment oder der Zusammenhang nicht ganz passen:
So sagte Kay nach einem Nachtessen zu mir: „Dr Papi het schön brav gässe, jitz darf är de ä Schläckschtängu ha“.
Ihre Lieblingsbemerkungen: „Das git’s haut“.
An die nervtötende „Warumphase“ („Walum lägnet’s?“ – „Walum isch das Glas gäub?“) schloss sich nahtlos die „Nein-Phase“ an, und als es mir mal zu bunt wurde, sagte ich: „Säg doch nid immer nei!“ – Ihre Anwort: „Nei danke!“
Auch Granny, meine Mutter, wurde beim Tischabräumen und Teller in die Küche Tragen ermahnt: „Aber la se de nid la gheie!“
Kritik musste ich mir nicht selten gefallen lassen: „Du tuesch ä chli soue, du chlini Mama“. Oder in unserem Schlafzimmer: „I mues grad ä chli bette. Das isch so näs Puff bi üs. Du darfsch de nid grad wieder puffe, wen-i bettet ha“.
Ob man hier einen Spruch der Grossmutter heraushört? - „Hinech cha-n-i de gut schlafe, wiu i so viu früschi Luft verwütscht ha“.
Mit Namen wurde ebenfalls experimentiert. Statt ‚Mami‘ kam irgendwann mein Vorname zum Zug: „Merci, Isabelle“ oder „Exgüse, Isabelle“ – und mal sagte sie zu mir, als ich Kuchenteig auswallte: „Guet hesch das gmacht, Isabelle, ganz guet“.
Und als Papa sie beim Essen zur Eile drängte, sagte sie: „Tue nid schtürme, Papi!“
Vielleicht hatte der Grund, dass er sie ermahnte, weil sie so unendlich langsam ass, mit der Art der Pizza zu tun, die sie vor sich auf dem Teller liegen hatte. – Sie sagte: „Das isch de nä gueti Pizza. - Aber i ha se eifach nid gärn“.
Und mit vierjährig:
Leider ist es oft nicht vermeidbar, dass Kinder auch Wörter oder Sätze aufschnappen, die überhaupt nicht in ihr Vokabular gehören.
So gab’s eine Zeit, wo Kay oft sagte: „Jesses Gott!“. – Das gefiel mir gar nicht und ich forderte sie auf, das bleiben zu lassen. Etwa zwei Sätze später sagte sei stattdessen: „Shit, Maria“. (Wo sie das herhatte, war uns allen ein Rätsel.)
Dass Papa nicht immer sofort und genau zuhörte, hatte sie schon lange bemerkt. So sagte sich manchmal zu ihm: „Du, Papi, i rede mit dir!“ - Manchmal beim Essen, wenn auch das nichts nützte und sie schon dreimal um Most gebeten hatte, sagst sie entnervt zu mir: „Du, säg du am Papi, dass i gärn Moscht wett“.
Lustig, dass Ungeduld offenbar allen Kindern eigen ist. Auch die andern drei äusserten sich später in ähnlicher Weise.
Wenn ich beim Büchli-Vorlesen nicht gerade weitererzählte, sagte sie: „Tue jitz wyterverzeue, statt nume desume hocke“.
Und hielt sie mir hier den Spiegel vor? - „I möcht z’Mami sy. Das isch luschtig, we me geng cha schimpfe, we d’Chind ä Blödsinn mache“.
Auf der Fahrt in die Stadt mit dem Tram begann sie mit einer wildfremden Frau zu plaudern. Als wir ausstiegen, sagte sie ganz wichtig zu mir: „Weisch, Mami, i ha drum mit dere Frou no öpis müesse bespräche“.
Einmal erzählte sie mir, sie habe gehört, wie ihre Grossmutter mit einer Frau telefoniert habe: „Die zwöi hei gschnäderet, das isch nid zum Gloube“.
Telefonieren wurde sowieso plötzlich zum Hit.
Dreijährig: Papa hatte ihr das Telefon in Griffnähe gestellt. Sie wusste zwar, dass sie ihren Namen nennen sollte, sie sagte jedoch nur „Tschou“ oder gar nichts. – Und mir hatte sie Verhaltensmassregeln gegeben: „Gäu, du tuesch mir de nid dr Hörer wägrisse; du bisch ja nümme meh so näs chlises Meiteli“.
Ein Gespräch mit ihrer Grossmutter Nana: Plötzlich, mitten im Gespräch, hielt sie mir den Hörer hin und sagte: „I ma nüm!“
In einem anderen Gespräch mit Nana wollte sie dieser klarmachen, dass sie nicht mehr zu ihr kommen wolle. Was genau der Grund dafür war, konnte ich nicht herausfinden. Wieso dies so sei, wollte auch meine Schwiegermutter wissen: „Eh, weisch, i ha drum eifach ä ke Zyt, wiu i dänk öppis anders z’tüe ha“. – Nana räumte daraufhin ein, sie würden sich dann plötzlich nicht mehr kennen, wenn Kay nicht mehr zu ihr käme. Darauf ging die Kleine gar nicht mehr ein, sondern sagte kurz angebunden: „Auso de vieu Vergnüege, tscho-ou“ und legte den Hörer auf.
Das lustigste Gespräch aber, das ich zwischen den beiden mithörte, war das Folgende (kurz vor Kays fünftem Geburtstag): Nana rief an und fragte, was sie sich wünsche: „Ä Schlumpf“ war die Antwort. Nana musste wohl gefragt haben, was das denn sei, denn Kay versuchte zu erklären und zu beschreiben, wie ein Schlumpf aussehe, aber offenbar half es nicht. Sie gab auf und erklärte resigniert: „Das isch z’schwierig. - Chouf lieber öpis, wo’d weisch, was äs isch“.
Umgekehrt hatte Nana Geburtstag (11. Januar 83) und Kay sagte, sie wolle ihr etwas schenken.
Ich schlug vor, etwas zu zeichnen, aber Kay meinte, dafür habe sie keine Zeit. Als ich ihr dann ins Gewissen redete und fand, für Nana könnte sie wirklich eine Zeichnung machen, sagte sie: „Auso guet, zeichne-n-i haut äs Chrüz, das längt“.
Kindergartenzeit (mit sechsjährig):
Amüsant war die folgende Episode. Es ging auf Weihnachten zu (1984): Kay erzählte mir, am Montag werde der Samichlous in den Kindergarten kommen. Sie habe ein wenig Angst vor ihm. – Ich beruhigte sie und sagte, das brauche sie nicht, der Samichlous sei ein lieber Mann, der Kinder gern habe. Da fragte sie: „Isch är eigentlich chinderlos?“
Ein andermal erzählte sie mir, sie habe im Kindergarten mit einer Freundin Memory gespielt und sie hätten so lange Kärtchen aufgedeckt, bis sie zwei gleiche gefunden hätten. Ich wandte ein, das sei doch nicht der Zweck des Spiels. Daraufhin wies sie mich zurecht: „Du bisch doch nid dr Chef, wo üs seit, wi mer müesse schpiele“.
Was den Anstoss dazu gegeben hatte, dass sie sich plötzlich dafür interessierte, wie man zu einem Mann kommt, weiss ich nicht mehr. Mit Bedauern nahm sie jedenfalls zur Kenntnis, dass sie ihren Bruder Diego nicht heiraten könne. Das wäre praktisch und naheliegend gewesen...
So fragte sie mich: „Tuet me de eifach desume schpaziere u eine sueche? Oder luegt me zum Fänschter us u wartet, bis eine dürelouft?“ – Ich erklärte ihr, wie das üblicherweise so gehe und sagte unter anderem auch, dass man sich küsse, wenn man sich lieb habe. Da platze sie einerseits verlegen, andererseits entrüstet heraus: „Nei, merci!“.
Und eine weitere Frage schloss sich in dem Zusammenhang an: (Ich hatte ihr eine Geschichte vorgelesen, in der Räuber eine Rolle spielten. Offenbar war sie davon fasziniert): „I wott de ke Röiber hürate. Wie chame’s de mache, dass me ke Röiber verwütscht?“
Den kleinen Bruder Gino liebte sie innig und half wacker mit beim Füttern. Einmal hielt ich ihn offenbar anders im Arm als sonst. Da sagte sie zu mir: „Iiih, - wi du dä häbsch – das isch ja ungloublech, Mueter!“
Kay hat jetzt selber zwei Mädchen, geboren 2010 und 2013. Es ist eine Freude, die beiden aufwachsen zu sehen, jetzt von einer anderen Warte aus, und auch ihre Sprüche zu notieren, wenn ich welche höre.
Nach der Sekundarschule hätte Kay ins Gymnasiium gehen wollen, aber ihr Lehrer fand, sie sein nicht „Material" fürs Gymi; er empfahl sie nicht. Eine absolute Fehleinschätzung! - Ich ärgere mich noch jetzt darüber!
Sie besuchte dann das zehnte Schuljahr, anschliessend das Gymnasium Kirchenfeld und begann gleich nach der Matur an der Uni Bern Veterinärmedizin zu studieren, nachdem sie problemlos den Numerus Clausus geschafft hatte. Ohne je eine Prüfung nicht zu bestehen, schloss sie ihr Studium erfolgreich ab. Ihr Spezialgebiet waren Grosstiere. Sie hatte selber ein Pferd, daher wohl diese Wahl. - Der Titel ihrer Doktorarbeit (2009) heisst: „Antibiotikaverbrauch in Tierpraxen: Analyse des Antibiotikaeinsatzes bei Gemischt- und Nutztierpraxen in der Schweiz" und ist noch immer bei Amazon erhältlich.
Schon während ihrer Studienzeit arbeitete sie bei Swissmedic und später liess sie sich dort sogar fest anstellen. - Heute arbeitet sie in einer Kleintierpraxis als Tierärztin und ist verheiratet mit einem der zwei besten Schwiegersöhne nördlich der Alpen. - Er ist Zahnarzt und ist kein Räuber.
Kim und Diego
Sie kamen kurz vor dem errechneten Geburtstermin (1. August) zur Welt, nämlich am Tag nach Kays zweitem Geburtstag, am 20. Juli 1981. Kim als Erste um 07.32, gefolgt von Diego neunzehn Minuten später um 07.51. – Der Arzt hatte gesagt, mehr als zwanzig Minuten dürften nicht verstreichen zwischen der ersten und der zweiten Geburt, sonst müsste er einen Kaiserschnitt einleiten. So musste ich mich beeilen wie gestört, dann das absolut schlimmste Szenarium für mich wäre gewesen, ein Kind normal zu gebären, das andere mit Kaiserschnitt. – Nein danke! Aber wie gesagt, ich schaffte es grad knapp vor der Deadline.
Wie froh war ich, meinen Riesenbauch los zu sein. Und wie sehr freuten wir uns über unser gesundes Zwillingspärchen!
Es gibt viel zu tun mit drei kleinen Kindern; viel Zeit für einen selber bleibt nicht. Aber darüber habe ich bereits kurz berichtet.
Was nun folgt, sind die Erinnerungen an die ersten paar Lebensjahre von Kim und Diego, die ich in einem Tagebuch niedergeschrieben habe. – Ich habe nur Begebenheiten ausgewählt ab dem zweiten Lebensjahr, als sich die Sprache zu entwickeln begann, also ab 1983, dem zweiten Lebensjahr.
Genau dieselbe Episode wie bei Kay und später bei Gino gibt es auch hier zu beschreiben: Nicht alle mögen die mütterlichen Liebkosungen bedingungslos.
Kim war mitten in der Nacht aufgewacht, weil sie Durst hatte. Ich füllte ihr Fläschchen wieder und wollte sie noch ein wenig liebkosen. Wie fast immer entzog sie sich mir sofort. Ich sagte: „Jitz darf i dir nidemau äs Müntschi gäh u di chli strichle“. Sie sagte nichts, aber da tönte es vom Nachbarbettchen von Diego: „Chasch bi mir ä chli.“
Überhaupt war Diego der „Liebesbedürftigere“, wenn man das so sagen kann. – Er hatte eine Phase, wo er seine Küsse dosiert an die Frau brachte. Ein harter, feuchter Schmatz manchmal, dann wieder nur der Hauch eines Müntschis. So nahm er mal meinen Kopf zwischen seine kleinen Händchen und sagte zu mir „Mein Bijou“ (den Ausdruck hatte er von meiner Mutter, seiner Granny).
Nächtliche Gespräche kamen hin und wieder vor, wenn eines plötzlich aufwachte oder wenn sie sich gegenseitig weckten. Bei einer solchen Gelegenheit sagte Diego mal zu mir: „Ig nid no meh schlöfle möcht i, süsch tue-n-i de fescht gränne.“
Einmal übernachtete die fünfjährige Tochter von Diegos Gotte bei uns (August 85). Kim ist sauer, dass Muriel bei Kay schlafen darf. Sie sagt: „Das regt mi uf! I wett o schnädere. Dr Diego tuet immer grad schlafe“.
Als ich den beiden erzählte, dass sie, bevor sie zur Welt kamen, in meinem Bauch gewesen seien, wollte Diego sofort wissen: „Hets de dert o Schpiuzüg gha?“
Zweieinhalbjährig: Kims neuester Tick: Dauernd wollte sie mir etwas ins Ohr flüstern. Keine Ahnung, wo sie diese Taktik herhatte. - So sagt sie manchmal: „I wott öppis säge“ und flüstert dann „Darf i bitte Schoggi ha?“ oder: „Darf i bitte Burtstag ha?“ - Kein einfach zu erfüllender Wunsch...
Immer mal wieder kam sie mit etwas Neuem daher. So wechselten auch ihre Lieblingsausdrücke von Zeit zu Zeit: „neichts“ war’s dann mal. Sollte wahrscheinlich deutsch sein und wurde gebraucht für nichts/nüt/nid/nei.
Auch Diego probierte neues Vokabular aus, die verrücktesten Ausdrücke. Jedenfalls wollte er immer das letzte Wort haben. So sagte er zu mir ganz despektierlich, als ich ihm etwas verweigerte: „Du jungi Dame“ und meinen Schwager bezeichnete er als ganz grosse „Giftnudle“. – Er konnte sich manchmal auch so extrem ärgern, dass er vergass zu atmen, blau wurde im Gesichtchen und umfiel. Kaum in der Horizontalen, kam er sofort wieder zu sich und erholte sich von Schrecken, Ärger und Zorn.
Kims Leben drehte sich zu der Zeit vor allem um Schoggi, Chätschgummi und Täfeli. Als ich sie erwischte, wie sie vor dem Nachtessen am Schoggiessen war, kam ihre Antwort wie aus der Pistole geschossen: „Dä vertrochnet süsch“.
Dreijährig: Diego war ein „Luszapfe“. Er liebte es, hin und wieder seine Schwestern ein wenig zu plagen. Wenn dann Kim zu mir angerannt kam und weinte, kam er angeschlendert, die Hände im Hosensack und sagte, halb entschuldigend, halb stolz und die Situation geniessend: „I bi haut ä chli nä Grobian“.
Oder: Kim kam weinend zu mir in die Küche und fragte: „Gäu, Mami, i überchume nid nume Brot u Wasser!“ - Im Hintergrund lachte Diego diebisch.
Normalerweise wusste sich Kim aber bestens zu wehren. Sich gegenseitig die Schuld zu geben, war auch eine Art Spiel. – So sagte sie oft, schon als sie kaum sprechen konnte: „Diego gmacht“.
Aber auch ihm mangelte es meist nicht an Selbstbewusstsein. So liebte er es zu verkünden: „Gäu, i bi dr gröscht Diego, wo’s uf dr Wäut git!“
Auch war er manchmal ein „Bhoupti“. „Nei“ u „mou“ waren seine Lieblingswörter. Zur Bestätigung seiner Behauptungen (miss)brauchte er dann oft seine Schwestern und sagte: „Äbe, d’Kim het o gseit…“
Aber nicht immer hatte er die Oberhand. So kam Diego mal weinend zu mir und sagte: „I wott o müeterle, aber die lö mi nie“. – Ich wollte ihn beruhigen und sagte: „Di Meitschi lö di doch sicher dr Papi oder vilech z’Bébé si“. – „Nei, die säge, i dörf nume z’Meersöili si!“
Auch da hatte er ein Problem: „I ha dr ganz Chopf vou Püle – (und nach kurzer Pause mit Nachdruck) – wo weh tüe!“
Zählen machte ihm Freude. Lange ging’s nur gut bis 12. Dann zählte er weiter bis 19 und weil er nicht mehr weiterwusste, sagte er dann regelmässig zu mir: „ ..18, 19, gäu, guet!“
Er hatte das Wort für Lampion vergessen. Seine Definition: „Rundum mit änärä Cherze drin“.
Auch übers Milch-Trinken machte er sich seine Gedanken: „Mami, hei si d’Chüe usegnoh u nächär iz Migros bracht u nächär hei mer d Miuch kouft?“
Kim war dreijährig, als ich sie zum ersten Mal im Einkaufszentrum „verlor“.
Nach zehn Minuten wurde sie ausgerufen. Ich fand sie bei Möbel Pfister. Drei Leute kümmerten sich um sie. Und Schoggi-Güezi essend genoss sie es. Von Tränen keine Rede. Als sie gefragt worden sei, wie sie heisse, habe sie nur gesagt, sie sei „äs Meiteli“.
Das war nicht das einzige Mal, dass wir sie aus den Augen verloren.
Im Marzili musste ich sie oft suchen gehen, aber im unserem Umkreis hatte es viele Leute, die uns kannten oder mit der Zeit kennenlernten. Die Kleine verschwand so rasch, dass ich es manchmal kaum glauben konnte. Mal hatte jemand sie beobachtet, wie sie rote Schuhe in den „Buber“ (ein Weiher) warf. Es waren Kays Schuhe, die wir dort wieder rausfischen mussten. Ein anderes Mal war es ihre eigene Unterhose, die sie im Abfalleimer entsorgte (die Gründe dafür lagen ziemlich auf der Hand beziehungsweise in der Hose). Zu dem Mann, der uns seine Beobachtung, den Verblieb unserer Tochter und ihrer Unterhose mitgeteilt hatte, sagte sie: „Du bisch ä Böse!“
In unseren Spanienferien machte es mir grosse Sorgen, als wir mit Freunden auswärts essen gingen und sie plötzlich unauffindbar war. Sie war damals sechsjährig: Wir waren zehn Erwachsene und dreizehn Kinder, da war’s gar nicht so einfach, den Überblick zu bewahren. Ich war mit dem Kinderwagen unterwegs, Gino war noch klein und wir spazierten alle zusammen durchs Städtchen in Richtung Gartenrestaurant. Erst als wir uns setzten, merkte ich, dass Kim fehlte. Zuletzt hatte ich sie mit anderen Kindern und Theo gesehen, ein Stück weiter hinten. Wenn aber Theo einen Bücherladen erspäht, ist er in Nullkommanichts drin und denkt nur noch daran, dort zu stöbern. So hatte er Kim vollkommen vergessen.
Kurz nachdem ich merkte, dass sie nicht da war, fuhr auch schon ein Polizeiauto ganz langsam vor dem Restaurant vorbei. – Die beiden Polizisten suchten die Eltern...
Sofort holten wir unsere Tochter auf dem Polizeiposten ab, wo sie Eiscrème schleckte und Coca Cola trank. Ein holländisches Ehepaar, welches Deutsch sprach, betreute sie. Kim war einmal mehr völlig unbeeindruckt. Ein Grund zum Weinen war das für sie keineswegs. Natürlich erhielten wir eine spanische Strafpredigt, die wir selbstverständlich auch verdient hatten.
Ein paar weitere Episoden aus den Ferien:
Diego kommt am Strand zu mir und berichtet ganz entrüstet und den Tränen nahe: „Mami, z’Wasser het mer Wasser aagschprützt“.
Papa: „Wenn dr nid i füf Minute im Pyjama sit, git’s kes Gschichtli“. - Diego: „I gloube, i wett hüt kes Gschichtli ha.“
Auf der Heimreise aus der Toscana (1986) übernachteten wir in Siena. Die beiden Mädchen wollten unbedingt den Dom besichtigen. Die schöne Kirche faszinierte sie. Vor dem Altar (alles schummrig beleuchtet) hatte es Bankreihen und sie wollten sich dort hinsetzen. - Also gut. - Etwa eine Minute lang sassen wir dort, als Kim plötzlich fragte: „Wenn chunt jitz da ändlech das Chaschperlitheater?“
Fünfjährig, also ebenfalls im Jahr 1986, kurz vor Weihnachten, war Diego bei seiner Gotte eingeladen. Sie hatte ihn gefragt, ob ihm eine Holzeisenbahn als Geschenk gefallen würde. Er erzählte mir das am Abend und sagte, er habe aber alles wieder vergessen, damit es dann auch wirklich eine Überraschung sei.
Und als die Kinder die Stifeli für den Samichlous hinausstellten (Dezember 85), legten sie alle auch noch eine Zeichnung dazu und ich musste nach Diktat etwas hintendrauf schreiben. Bei Diego: „Dr Diego het das fü ä lieb Samichlous gmacht. - Bei Kay: „Samichlous, I ha di gärn“. – Kim diktierte: „Liebe Samichlous, i wünsche dir“ – dann machte sie eine Pause und ich fand, das sei wirklich nett, dass sie dem Samichlaus etwas wünsche, dann fuhr sie aber weiter: „I wünsche dir, dass du mini Güezi bracht hesch“.
Einfach war es nie mit ihr. Ein süsses kleines Ding, aber schon in sehr jungen Jahren ständig bereit, alles Mögliche und Unmögliche auszuprobieren und irgendeinen Unsinn auszuhecken.
In den leeren Koffer, den ich meiner Schwester nach den Ferien zurückgeben wollte, leerte sie Wasser hinein und meine Frisiercrème. – Auf der Kellertreppe leerte sie Durgol aus. - In der Küche braute sie in einem unbewachten Moment eine Mahlzeit für ihren Bruder zusammen aus allem, was sie gerade fand: Ein wenig Schmierseife, Mehl, Zucker, Maggi, Öl, Essig und als besondere Zugabe, sozusagen zum Abschmecken, ein wenig Sigolin. Garniert wurde das „Gericht“ mit Zucker und Zimt. – Einen Löffel voll fütterte sie Diego, der glücklicherweise gleich darauf erbrach. Offenbar war ihr das, was sie angerichtet hatte, dann doch nicht mehr so geheuer. Sie ging zu Theo in den Estrich und meldete, was passiert war. So konnte ihr Vorhaben im Keime erstickt werden, bevor sie noch grösseren Schaden anrichten konnte.
Wasser in ihr Zimmer zu nehmen, hatte ich ihr streng verboten. Trotzdem fand ich, kaum war das Verbot ausgesprochen, wieder zwei Ovobüchsen voll Wasser hinter ihrem Schrank. Und kurz darauf erneut eine Wasserlache auf dem Teppich. Eine grosse Spielzeugbüchse stand darüber. Als ich Kim fragte, was da passiert sei, sagte sie ganz unschuldig: „Da ma-n-i mi nümme bsinne“.
Leider nützten weder Verbote, Bitten noch Strafen etwas. Sie tat trotzdem, was sie sich in den Kopf gesetzt hatte. – So fragte ich mich manchmal, wenn ich mit meinem Latein am Ende war, wie das wohl herauskommen werde in der Zukunft.
Die Zwillinge waren viereinhalbjährig, als ihr kleiner Bruder Gino auf die Welt kam.
Eifersucht gab es überhaupt nicht. Beide liebten ihn heiss.
Kim: „I ha-nä so furchtbar gärn, dä chli Schätzu“.
Und Diego zu Gino: „I ha di so fescht gärn, das i’s fasch nümme cha ushaute“.
Kim zur bevorstehende Taufe: „Gäu, mir gö de id Chile go säge, dä heisst Gino“.
In welchem Zusammenhang wir aufs Sterben zu sprechen kamen, daran erinnere ich mich nicht mehr. Aus eigener Erfahrung weiss ich natürlich sehr genau, dass der Tod für Kinder mehr als nur schwer verständlich ist.
Diegos Vorstellung: „Gäu, Mami, we mä gschtorbe-n-isch – das isch de blöd – da mues me immer nume desumeliege“.
Kleiner Exkurs: Als ich das in meinen Aufzeichnungen las, erinnerte es mich daran, was unsere Enkelin zu ihrem Papa sagte, als sie siebenjährig war, also etwa dreissig Jahre später:
(Am 9. September 2017 wurde im Radio gemeldet, der Hurrikan Irma sei unterwegs nach Florida.) Ella sagte: „Dä Michael Jackson het eigentlich Glück, isch er gschtorbe. - Süsch wär är jtz i dem fürchterliche Sturm!“
Zum Abschluss: Zwei Beiträge habe ich in meinen Aufzeichnungen gefunden, die zeitlich allerding zwölf Jahre auseinanderliegen: Diegos Bemerkung zu meiner Bekleidung (er war vierjährig) und Kim war sechzehnjährig, als sie mein Outfit beurteilte:
Diego ist der grösste Schmeichler, den es gibt. Er ist so lieb. So kommt er oft zu mir, küsst mich und sagt: „Du bisch eifach z’liebschte Mami vo dr ganze hundert tusig Wäut“. - Und je nachdem, was ich anziehe (er sieht fast immer, wenn etwas neu ist), sagt er: „Mami, du hesch de ne schöni Bluse (od. Nachthemmli etc.) anne“. Oder: „Du bisch de näs schöns Mami“. Das schmeichelt natürlich meinem Ego. Auch wenn er bei Tisch etwa sagt: „Du chochisch de guet“.
Und nun Kim. Ich hatte einen neuen Rock angezogen und war dabei, die passenden Schuhe dazu auszuwählen:
„Di Schueh si auso trurig – weder die einte no die andere würd i trage. – U i überlege grad, wi me das Chleid no chly chönnt ufmöble. – Dir passt’s guet, aber mir müesstisch sehr viu Gäud gä, dass i das würd aalege.
Kim hatte es fertig gebracht, sich drei Wochen vor der Matur aus dem Freien Gymnasium rausschmeissen zu lassen. Nicht wegen ungenügender Noten, nein, die waren vorzüglich. Es wäre einfach gewesen für sie, die Prüfung zu bestehen, denn sie hatte gute Erfahrungsnoten. Die Proben hatte sie nämlich jeweils geschrieben. Ihr Trick war, sich von einem Heer von Freunden helfen zu lassen. Es waren Studenten, die ihr den Stoff beibrachten – abends, wenn ihr das zeitlich besser passte. Gesperrt wurde sie wegen ihrer Abwesenheiten. Im letzten Jahr leistete sie sich pro Semester zwischen 190 und 200 unentschuldigte Absenzen. „Migräne“ hatte das arme Kind offenbar die ganze Zeit...
Als ich davon erfuhr, drehte ich fast durch. Man hatte uns nicht benachrichtigt. Kim sei erwachsen, also älter als achtzehn, in dem Fall würde man sich nicht mit den Eltern absprechen, liess man uns wissen. – Bezahlen durften wir allerdings das Schulgeld schon, damit hatte die Schule keine Probleme...
Nun, sie zog mit ihrem Freund für ein Jahr nach Lugano, wo sie Italienisch lernte und anschliessend durften wir ihr ein weiteres Jahr Schulunterricht im Feusi-Gymnasium bezahlen. Dort absolvierte sie anschliessen die eidgenössische Matur, ohne Erfahrungsnoten diesmal und wurde sogar noch ausgezeichnet.
Die beiden zogen anschliessend nach Amsterdam für drei Jahre, wo Kim Business und Economy studierte. Ein Praktikum in der Hypo Real Estate Bank in London in der „Gurke“ gefiel ihr so gut, dass sie fortan in London blieb, den Freund wechselte und auch die Stelle. Bei der amerikanischen Wachovia-Bank (später Wells Fargo) blieb sie ein paar Jahre, bevor sie zu einer Versicherung wechselte (Prudentia) und schliesslich bei Goldman Sachs „landete“. Ihr Gebiet ist das Investment Banking. Vor einem Jahr nun hat sie dort gekündet und ist jetzt selbständig.
Ihren Ehemann (unser zweiter Schwiegersohn – einen besseren hätten wir uns nicht wünschen können) hat sie bei der Arbeit kennengelernt. Er ist Spanier, ein hingebungsvoller Vater und ebenfalls im Banking-Business tätig. Die beiden haben einen Sohn mit Namen Teo (Hommage an Vater Theo), der im August 2019 zweijährig wird. Im November wird er ein Geschwisterchen erhalten. Kim und Javi sind Weltenbummler. Eigentlich wohnen sie seit zwölf Jahren in London, können aber beide auch von irgendwo aus arbeiten, so dass sie die Wintermonate am liebsten in Bivio bei Ski- und Snowboardfahren verbringen, den Sommer in Bern (sie lieben die Aare heiss - genau wie ich) und zwischendurch sind sie in der ganzen Welt unterwegs, besuchen Freunde und oft auch Javiers Eltern in Madrid.
Diego ist seit Oktober 2017 verheiratet. Er und seine Frau wohnen ganz in unserer Nähe, was uns natürlich freut. Oft kommen die beiden am Abend vorbei, wenn sie einen Spaziergang machen. Meistens bleibt es allerdings nicht bei kürzeren Spaziergängen. Zweimal an einem Tag den Niesen rauf und runter, ist für Diego keine Ausnahme. Grosse Wanderungen im Sommer, die lieben sie. Eine davon war zum Beispiel, Korsika von Süden nach Norden zu durchqueren und während der diesjährigen Sommerferien (2019) durfte es nichts weniger Anspruchsvolles sein als den GR5 in vier Wochen zu absolvieren (Wanderung über 46 Pässe von Saint Gingolph nach Nizza). Das brachte ihnen ebenfalls die Bewunderung der ganzen Familie ein. – Lieber sie als ich. Dazu würde uns sowohl die Fitness als auch die Lust fehlen. Trotzdem: Hut ab!
Diego zog früh von zu Hause aus. Mit siebzehn wohnte er zusammen mit einer Freundin in einer eigenen kleinen Wohnung in Bern. Nach seinem Amerikajahr hatte er grosse Mühe, sich in Bern im Gymnasium wieder einzuleben. Er wollte die Schule verlassen (es war ihm mühelos gelungen, fast ebenso viele unentschuldigte Absenzen anzusammeln wie seine Zwillingsschwester) und einen Beruf erlernen. „Etwas, wo man um fünf Uhr den Bleistift fallen lassen kann“, so erklärte er mir. - Nach kurzem Versuch in einem Elektrogeschäft (wenn ich mich richtig erinnere) merkte er allerdings, dass körperliche Arbeit auch nicht unbedingt ein Zuckerlecken ist und besann sich zurück an die Gymnasial-Zeit. Allerdings wurde er im Kirchenfeld nicht mehr aufgenommen, man hatte dort genug von ihm, aber der Rektor im Neufeldgymnasium gab ihm eine zweite Chance, die unser Sohn dann glücklicherweise packte.
Nach der Matur war’s Zeit für den Militärdienst. Ein Jahr lang diente er bei der KFOR SWISSCOY-Truppe in Osteuropa, ein halbes Jahr im Kosovo und die andere Hälfte in Bosnien.
Zurück in Bern begann er in Freiburg Jura zu studieren, anschliessend in Bern. Während dieser Zeit wohnte er wieder bei uns in Ittigen.
Als ich mal auf Reise war, hatte er eine Stellvertretung für mich an der GIBB übernommen. Diese gefiel ihm so gut, dass er sich in der Abteilung IET anstellen liess und seither unterrichtet er dort Technisches Englisch und gibt Recht-Weiterbildungs-Kurse für seine Kollegen.
Seine Frau ist Anwältin und zudem eine liebevolle Schwiegertochter. – Kinder wollen die beiden nicht. Es ist ihre Entscheidung, die wir voll und ganz akzeptieren können.
Gino
Er wurde am 4. November abends um 23.17 Uhr geboren – unser viertes Kind, von allen Familienmitgliedern mit Freude auf dieser Welt willkommen geheissen.
Ganz wie die anderen Kinder mochte es Gino nicht immer sehr gern, wenn ich ihn verküssen wollte.
Folgende Episode habe ich aufgeschrieben; Gino war damals grad zweieinhalb Jahre alt:
Auf die Frage, als ich ihn ins Bett brachte: „Gisch mer jitz no näs Müntschi?“ – sagte er: „Äs längt jitz!“
Und da war er bereits sechsjährig:
Theo war geschäftlich in Holland und ich fragte Gino, ob er ausnahmsweise vielleicht bei mir im grossen Bett übernachten wolle: „Das chunnt nid i Frag, mi Entschluss schteit fescht!“, erklärte er mit grosser Entschlossenheit. – Wer dann doch in meinem Bett schlief, um Mitternacht noch ein Teeli trank und sich am liebsten noch eine Geschichten hätte vorlesen lassen wollen, war Gino...
Schon mit knapp dreijährig konstatierte er immer sofort, wenn ich Lippenstift benutzte. So fragte er einmal: „Wo göh mer häre?“ und als ich sagte „Niene“, dann fragte er: „Warum hesch de d Lippe aagschmiert?“.
Und ein andermal, als er mir beim Schminken zusah, riet er mir: „Schmier nid z viu a, süsch het’s de morn kes meh“.
Auch komplizierte Wörter und Fremdwörter waren natürlich ein Thema: Als er krank war und ich ihm Essigsöckli machen wollte, lehnte er erst ab (wie üblich – das „Nein-Ja-Spiel“), dann sagte er plötzlich: „So mach mer haut di Sicherheitssöckli“.
Ganz ähnlich ging’s in Bivio an Weihnachten, als ich ihn bat, die Sonnenbrille anzuziehen, damit er nicht schneeblind werde. Nach dem obligaten „Nein“ dann kurz darauf: „Gimmer jitzt di Brüue, damit i nid wassersüchtig wirde“.
Knapp fünfjährig: Ich erinnere mich an ein Gespräch, das wir in der Küche hatten, als er vom Vorkindergarten heimkam:
„Du, d Andrea wott mi hürate“. Ich sagte: „Schön; u de du? – Wosch du o?“ – Die Antwort kam dezidiert zurück: „Nei – i wett lieber öppis Ferngschtürets!“ – Klar, Autos, Traktoren, Motorräder – das war das grosse Interessengebiet, Freundinnen damals eindeutig weniger...
Und als ich dieselbe Andrea kurze Zeit später zu uns nach Hause einlud, sagte ihre Mutter zu Gino: „Gäu, morn chunnt de d Andrea zu dir“. Er runzelte seine Stirn und sagte ganz wichtig: „Morn isch’s nid so günschtig – da han i ke Zyt“.
Auch mit knapp achtjährig waren Freundinnen für ihn noch kein Thema.
Ich hörte nämlich zu, wie er am Telefon eine Verehrerin abwimmelte. Das ging so:
Total gelangweilt lehnte er am Türrahmen, hatte den Hörer am Ohr und in kurzen Abständen sagte er zu der ihn Bedrängenden: „I wot das Gschtürm nid ha!“ - etwa dreimal, bis er schliesslich genervt den Hörer auflegte.
Erst zwei Jahre später änderte seine Einstellung. Er war gerade zehnjährig geworden, als er mir ganz stolz ein Brieflein zeigte, das er selber geschrieben hatte, wie ich selbstverständlich annahm. Darin stand: „Ich liebe dich! – Willst du mit mir gehen?“ – Barbara war die Angebetete. Ihr hatte er dieses „Schreiben“ gegeben und nun hatte er es von ihr zurückerhalten. – Zusätzlich hatte sie angekreuzt (mit multiple Choice ging das Ganze nämlich weiter): „Ja“ (die Frage war, ob sie wolle oder nicht) und sie hatte sich sogar zur Äusserung hinreissen lassen (unter der Rubrik zum Ankreuzen bei „Bemerkungen“):
„Ich finde dich süss!“
Der Clou: Was ich erst später herausfand: Er hatte diesen Brief nicht einmal selber verfasst – er hatte ihn schreiben lassen – und zwar von einem Klassenkameraden. Dieser erklärte mir, als ich ihn darauf ansprach, Gino hätte das selber gar nicht gekonnt (womit er zweifellos Recht hatte). – So weit waren wir also bereits: Er engagierte einen „Ghostwriter“, um seine Liebesbriefe zu schreiben...
Ich erwähnte dann, das sei doch nun ganz etwas Neues; er hätte doch bisher nie eine Freundin haben wollen. Das sei gewesen, als er noch achtjährig war, informierte er mich, und damit erschöpfte sich jede weitere Erklärung.
Hier eine lustige Episode aus der ersten oder zweiten Klasse: Er musste in der Schule als Aufgabe aufschreiben, was Mutter, Vater und Geschwister im Moment gerade tun. Zehn Tätigkeitswörter wurden verlangt. Bezeichnenderweise war das erste Wort vorgegeben: „putzen".
Er fuhr dann weiter und schrieb: „kochen, arbeiten, stürmen, computerspielen, schreiben" und dann verleidete ihm offensichtlich die genaue Beobachterei und er schrieb: „nehmen, geben". Dann aber war wirklich Schluss - weitere Verben könne sich die Lehrerin ja selber ausdenken, wenn es ihr Freude mache, meinte er.
Schon als Kleinkind war Gino manchmal ungeduldig. Beim Geschichtenerzählen wurde man oft von ihm gehetzt: „wyter, wyter!“, hiess es, und wenn ich eine Frage stellen oder etwas erklären wollte, zischte er “Mach jitz!“.
Im Marzili (ich lief zu wenig rasch in Richtung Schwimmbad): „I ha gar nid gwüsst, dass Müetere so lahm chöi sy“.
Oder im Shoppyland beim Einkaufen. Der Lift kam lange nicht und ich sagte zu ihm: „Muesch haut chly warte.“ – Er sahst mich konsterniert an und sagte: „Du hesch de Närve!“.
Es ging allerdings auch umgekehrt: (Sommer 93): Wir besuchten die Handarbeitsausstellung in der Sekundarschule. Als ich die Treppe ins Untergeschoss gehen wollte, rief er mir einigermassen erbost nach: „Chasch nid ämau uf di eiget Sohn warte?!“
Im selben Sommer fand auf dem Gurten, unserem Berner Hausberg, ein Festival statt. Theo wollte erst alleine oder nur mit den Zwillingen hingehen, weil er glaubte, es könnte zu lange dauern und eventuell langweilig werden für Gino. So fragten wir ihn, ob er mitgehen wolle oder nicht, und falls ja, ob er dann nicht „blöd tun“ werde. Seine Antwort: „I cha doch d Zuekunft nid vorussäge!“
Altklug sind die Kleinen ja immer wieder mal. Woher haben sie’s? - Man braucht nicht dreimal zu raten. – Episode in der Küche: „Darf ig äs Schoggolädli ha?“ – Ich sagte: „Auso guet. Ja“. – Und er: „Ig ha doch gwüsst, dass du vernünftig bisch“.
Als wir über unser Dach im Wohnzimmer sprachen, welches leckte, fragte er, wieso das so sei. Theo sagte, etwas mit den Ziegeln sei nicht in Ordnung. Dies veranlasste ihn zur Frage: „Hesch öppe öppis dran umegfingerlet?“
In unseren fünfwöchigen USA-Ferien im Sommer 95 hatte er zwei Sätze gelernt, die er alsdann bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit anwendete: „Yes, my dear“ und „Oh, my God!“.
Mit zunehmendem Alter wurden seine Sprüche immer dreister.
Die Kinder waren mit Theo in Bivio in den Ferien und ich hatte wie üblich meine Auszeit, das heisst, ich machte mit einer Freundin Ferien an einem warmen Ort im Süden. An Ostern war ich wieder daheim und fuhr nach Bivio, um die Familie zu besuchen. Ginos Begrüssung war: „Jitz hei mer ja wieder eini, wo nüs chochet“.
In einem Gespräch ging es darum, dass ich Gino klarmachen wollte, dass wir früher besser Sorge getragen hatten zu unseren Velos und nicht jedes Jahr ein neues haben konnten, so wie er offenbar fand, es sei normal. Er meinte nur trocken: „Verzeu doch nid geng Züg us de Füfzgerjahr!“
Als ich ihn wegen seines Haarschnitts hänselte (er hatte sich mit einer Schere kahle Stellen aus dem Hinterkopf geschnitten. - Nicht eben ein ungefährliches Unterfangen, das zudem auch grauenhaft aussah - wie ein gerupftes Huhn), raunte er mir zu: „Dummi Chue!“.
Ich schluckte leer, sagte aber im Moment gar nichts. Als er dann keine halbe Stunde später wollte, dass ich ihm ein Abzeichen ans Pfadi-Hemd nähe, sagte ich: „Chüe chöi nid näje!“ – Seine Antwort kam prompt: „Du scho!“.
Und wann genau (zeitlich) er auf die Idee gekommen war, über Theo das Folgende zu sagen, weiss ich nicht mehr: „Mir hei äs Usloufmodäu verwütscht.“
Gino ging nicht unbedingt ungern in die Schule, aber er war auch kein enthusiastischer Lerner. Wir dachten erst, er würde wohl die ganzen neun Jahre in der Primarschule bleiben, aber es kam anders. Im Gynmasium Muristalden in Bern bestand er 2005 die Matur, die er sogar auf Englisch abschloss. Seine Klasse war damals die erste, die diese Option wählen konnte – ein ganz neues Konzept.
Leider klappte es aber nicht nach Wunsch mit seinem Studium. Geographie interessierte ihn, dort hatte er auch gute Noten, aber BLV im Nebenfach war sein Stolperstein. Er bestand die Prüfung nicht. – Ein Lehre mochte er auch nicht anfangen. IT kam mal zur Sprache, aber er fand sich selber „zu alt“ und hatte keinerlei Lust, in die Schulstube zurückzukehren und mit Teenagern die Schulbank zu drücken.
Seine Lieblingsbeschäftigung ist das Tennisspielen. So hat er sein Hobby zum Beruf gemacht: Er ist Tennislehrer.
Theo
Ginos Bemerkung, wir hätten mit seinem Vater ein Auslaufmodell erwischt, ist ein guter Übergang, um noch ein paar Zeilen über Theo zu berichten:
Da er mir immer half mit den Kindern und auch im Haushalt, wenn er nicht gerade im Militärdienst war, was bis in die Achtzigerjahre für meinen Geschmack leider viel zu oft vorkam, hatte und hat er ein sehr gutes Verhältnis zu ihnen. Seine Stärken sind seine Geduld, seine grosszügige und hilfsbereite Art und nicht zuletzt sein grosses Können, was Zeichnen und Malen betrifft. Im Handumdrehen kann er eine Situation erfassen und sie zeichnerisch verarbeiten. Seine Comics sind einfach herrlich. Seit Jahren verfasst er auch unsere Weihnachtskarte; das tönt jetzt ein wenig prosaisch, ist es aber nicht. Im Gegenteil: Theo stellt eine humoristische Szene aus dem Familienleben dar. Minuziös wird das Dargestellte mit dem PC farbig ausgemalt, anschliessend ausgedruckt und zusammen mit meinem Jahresbericht per Email an unsere Freunde und Bekannten verschickt.
Seine Tierliebe ist ebenfalls erwähnenswert. Ich liebe Tiere ja auch, wir hatten und haben seit Jahren immer mindestens eine Katze, ein von allen geliebtes Familienmitglied, aber wenn’s um Insekten geht, sieht die Sache etwas anders aus. Auch Spinnen mag ich nicht. Keinesfalls kann ich schlafen, wenn sich eine mein Schlafzimmer als Ort ihrer neuen Niederlassung aussucht. Theo fängt sie dann ein und bringt sie irgendwohin, wo sie mich nicht mehr stört. Aber dazu kommt: Er füttert sie – die grossen jedenfalls! Wenn er eine saftige Fliege findet, bringt er sie der Arachnida ins Netz und sieht zu, wie der Leckerbissen eingewickelt und anschliessend verspiesen wird. – Es sieht also ganz so aus, als ob auch bei ihm die Tierliebe etwas mit der Grösse des Objekts zu tun hat.
Seine Grosszügigkeit will ich ebenfalls nicht vergessen zu erwähnen. Seine schönen Gutscheine, die er mir jeweils zu Weihnachten oder zum Geburtstag schenkte, sind ein Beispiel davon. Zum Teil habe ich sie aufbewahrt. Über seine Spendierfreudigkeit freute ich mich jeweils sehr, war beeindruckt und fast ein wenig gerührt. Allerdings habe ich kaum je einen eingelöst... Inzwischen lassen wir das mit den Geschenken. Wir haben ja beide „alles“.
Natürlich könnte ich seitenweise über Theos Stärken, „Heldentaten“ oder Bravourstücke berichten, aber es ist doch so, dass es halt lustiger ist, über die Schnitzer und Fettnäpfchen zu berichten, selbstverständlich ohne zu hadern oder zu spotten.
Spricht man von Stärken, ist der Gegenpol die Schwächen. Dass Theo keinen Sport betreibt, überhaupt keinen, und trotzdem aussieht, wie wenn er täglich joggen ginge, das empfindet er selber überhaupt nicht als Schwäche. Im Gegenteil: Über Sportverletzungen muss er sich nie beklagen.
So war er auch der Einzige, der, als wir (eine Gruppe von Freunden) am 2. August 2003 eine Wanderung auf den Niesen unternahmen, es vorzog, mit der Bahn den Gipfel zu erstürmen. Einzige Aufgabe: Dafür schauen, dass unser gesamtes Gepäck, dass wir unten an der Bahn deponiert hatten, nach oben kommt, denn wir hatten Zimmer gebucht und wollten auf dem Berg übernachten.
Es war ein äusserst heisser Sommertag, 35 Grad am Schatten. Aus dem Grund hatten wir eigentlich früh starten wollen, aber es wurde halb zwölf Uhr mittags, bis wir endlich ab Frutigen, wohin uns Theo mit dem Auto gebracht hatte, losmarschieren konnten. SEHR heiss der erste Aufstieg! – Aber wir nahmen’s gemütlich, legten mehrere Pausen ein, picknickten unterwegs - es war eine wunderbare Wanderung.
Als wir um halb sechs völlig erschöpft und verschwitzt oben ankamen, begrüsste uns Theo strahlend mit einem Bier in der Hand. Schon seit ein paar Stunden war er oben, hatte sich einen Liegestuhl geschnappt und den Nachmittag auf der herrlichen Terrasse mit der einmaligen Aussicht lesenderweise genossen. Für mich hatte er ein Glas Mineralwasser parat (das mehr oder weniger einzige Soft-Getränk, das ich gerne mag). So sah’s zumindest aus. Ich stürzte es hinunter, das heisst, nach ein paar Schlucken merkte ich, dass es ein Citron ist, das mir überhaupt nicht schmeckt. – Typisch Theo! – Er meint es immer gut, tappt aber von einem Fettnäpfchen ins andere. Wir kannten uns damals schon lange genug, um zu wissen, was unsere gegenseitigen Getränkevorlieben waren und sind.
Nun, das alles ginge ja noch. Zum Glück erkundigte ich mich nach dem „Schrecken“ in der Kehle nach unser aller Gepäck. Er habe unten an der Bahnstation den Auftrag erteilt, es nach oben zu transportieren, sagte er. Es war aber nirgends zu finden. – Kontrolle wäre eben manchmal auch nicht schlecht! – Mit der allerletzten Fahrt wurde es dann doch noch befördert und wir konnten es an der Bergstation in Empfang nehmen.
So ist Theo eben. Ähnliches passiert immer wieder. Ich erinnere mich an eine Episode im Tessin. Ganz anders zwar, aber ich ärgerte mich mehr als nur ein bisschen. Es muss ungefähr im Jahr 1983 gewesen sein. Wir hatten drei kleine Kinder und es war das erste Wochenende seit längerer Zeit, dass wir mal „frei“ hatten. Mit Freunden verbrachten wir ein Wochenende im Tessin und meine Mutter hütete zu Hause unsere Kleinen. Aufs endlose Ausschlafen hatte ich mich so etwas von gefreut. Einmal einfach liegen bleiben und schlafen bis zum Gehtnichtmehr, ohne die Kinder betreuen zu müssen oder in die Schule zu eilen... Um halb acht läutete Theos Wecker. Er hatte vergessen, ihn abzustellen. Wieso er ihn überhaupt mitgenommen hatte, war mir auch ein Rätsel. – Ich hätte mich ja umdrehen und weiterschlafen können. Das schlug er mir auch vor in seiner ruhigen Art, aber ich regte mich dermassen auf, dass an Schlaf nicht mehr zu denken war. Mir war zwar bewusst, dass sein Rat in dieser Situation der allerbeste war, aber ich war einfach nicht imstand, mich abzuregen. Den ganzen Tag lang war ich sauer. Auch über mich...
Es blieb nicht das einzige Mal, dass das passierte. Heute erst recht mit der Weckfunktion an seiner Smartwatch. Aber nun bin ich pensioniert...
Ein anderes Kapitel ist das Einkaufen. Wie erwähnt, hilft und half Theo immer viel mit im Haushalt. Aber einkaufen gehört nicht zu seinen Stärken. Ich habe schon so viele unmögliche Erfahrungen gemacht, dass ich es tunlichst vermeide, ihn zu bitten, etwas mitzubringen. Wenn’s unumgänglich ist, versuche ich möglichst genau zu beschreiben, was er einkaufen soll und vor allem mir vorzustellen, was er trotzdem verkehrt machen könnte dabei. So bat ich ihn grad eben, mir Aprikosen mitzubringen. Ich wollte einen Kuchen backen und war äusserst knapp an Zeit. So instruierte ich ihn, nicht etwa Büchsenaprikosen zu bringen oder gefrorene Früchte, auch lieber nicht die grossen teuren Spezialaprikosen, die sich weniger eigneten. – Diese aber erhielt ich dann. – Egal, kein Problem, aber wieder einmal: Typisch Theo.
Ein „Problem“ ist auch, dass er sagt, das oder jenes, das er hätte mitbringen sollen, habe es gar nicht mehr gehabt. Ob er denn gefragt habe? – Das macht er nicht gern...
Vor Jahren hatte ich ihn mal gebeten, mir aus der Stadt aus dem Frischfisch-Offenverkauf Flundern mitzubringen für eine Suppe, die ich bereits parat hatte, die ich nur noch mit ein paar Filetstreifen anreichern wollte. Wir hatten Besuch am Abend und ich freute mich auf unsere Vorspeise. – Was er mir mitbrachte, war ein Sack voller Gräten und sonstiger Fischabfälle. Offenbar hatte er dem Verkäufer gesagt, es gehe darum, eine Fischsuppe zu machen und dieser hatte geraten, die Abfälle gut auszukochen, damit eine schmackhafte Suppe entstehe. - In unsere Fischsuppe am Abend schwammen keine Filet-Streifen...
Seit dieser Zeit bin ich sehr vorsichtig geworden mit der Erteilung von Einkaufs-Aufträgen.
Katzenfutter zu finden, ist ja keine so schwierige Aufgabe, so dachte ich, das geht problemlos. - Kürzlich aber: Ich beschrieb das Packet genau: Ein Sack Trockenfutter, die Verpackung goldig mit dem grossen Bild einer weissen Katze drauf abgebildet, es kann unmöglich fehl gehen und ist einfach zu finden. – Ich konnte es kaum fassen: Was er auf den Tisch stellte, war ein Packet Trockenfutter, goldener Sack mit einem weissen Hund drauf abgebildet...
In diesem Frühling waren wir für zwei Wochen in München. Wir wohnten in einer Wohnung, wo wir auch die Küche benutzen konnten. Normalerweise gingen wir am Abend auswärts essen, aber am Morgen ist es jeweils angenehm, das Frühstück selber zubereiten zu können. Wenn wir tags zuvor Brot gekauft hatten, wurde es im Toaster geröstet, weil es einer meiner „Ticks“ ist, ich esse nur frisches, frisch aufgebackenes oder eben getostetes Brot. Sonst verzichte ich lieber.
Als sich Theo aber für einmal bereit erklärte, vor dem Morgenessen einkaufen zu gehen, bat ich ihn, ein frisches Brot mitzubringen. In der Umgebung hatte es drei Bäckereien. – Ich freute mich wiedermal auf ein schmackhaftes Brot, direkt aus der Backstube. – Was Theo mitbrachte, waren sechs weisse, bröckelige, trockene, papierartige Hamburgerbrötchen in einem Plastiksack ... Er war halt grad im Supermarkt.
In seinem Büro gab’s zum Glück Sekretärinnen, die sich darum kümmerten, die Flüge zu buchen, wenn er auf Geschäftsreise ging. Trotzdem schaffte er es nicht selten, den Flug zu verpassen (um einen ganzen Tag sogar mal – er dachte es sei Dienstag, es war aber bereits Mittwoch). – Typisch Theo!
Einen anderen „Theo-Schnitzer“ vergesse ich nicht so rasch. Er ereignete sich, als Berlin noch zur DDR gehörte. Geschäftlich musste er mit ein paar Kollegen dorthin. Ich wäre liebend gerne mitgegangen für die paar Tage, aber Theo sagte, das ginge leider nicht, seine Begleiter nähmen ihre Ehefrauen auch nicht mit. – Am Bahnhof Bern trafen sie sich. Die Ehefrauen seiner Mitarbeiter waren dort und Theo dachte, es sei sehr nett von ihnen, ihre Männer zum Zug zu begleiten. Er wollte sich von ihnen verabschieden, aber da hatte er etwas falsch verstanden: Alle Damen gingen selbstverständlich mit...
Beim Fliegen läuft auch jetzt noch nicht immer alles rund. Dass er bestimmt schon ein ganzes Dutzend Taschenmesser beim Securitycheck hat abgeben müssen, ist ja nicht so ungewöhnlich. Das passiert auch anderen Leuten. Ich kann mich darauf verlassen: Es ist immer sein Handkoffer, der eine Spezialbehandlung erhält.
Was uns aber mal in Amsterdam passierte, fand ich damals überhaupt nicht lustig. Wir sassen im Restaurant vor dem Schalter der Passkontrolle und tranken vor dem Abflug eine Tasse Kaffee. Es war noch Zeit genug und ich sagte zu Theo: „Pass bitte auf meinen Handkoffer auf, ich geh noch rasch in den Laden dort drüben“. Als ich zurückkam, war Theo verschwunden – bereits durch die Passkontrolle zum Gate. - Mit meinem Handkoffer, in dem ich dummerweise, ich geb’s zu, meine Reiseunterlagen im Aussenfach verstaut hatte, Pass und Boarding-Karte... Ein sehr freundlicher Grenzbeamter ging auf die Suche nach Theo und so gelang mir die Ausreise trotzdem noch rechtzeitig. – Typisch Theo...
Was er aber bewundernswert gut kann, ist es, unser Auto so zu packen, so dass jedes Ding (und es waren und sind jeweils unzählige Sachen, die mitmüssen) seinen Platz hat und gut verstaut ist. – Weshalb dies erwähnenswert ist, klärt sich gleich.
Auch auf dem Autodach fuhr jeweils ein grosser Teil unsere Habe mit, gut verpackt und verschnürt mit einer orangefarbenen Plache bedeckt gegen den Regen (einen „Sarg“ hatten wir damals noch nicht). Diese Arbeit überliess ich ihm gern, ich hatte ja sonst genug zu tun mit meinem Gepäck und dem der Kinder. So fuhren wir während Jahren in die Herbstferien. Erst ein paarmal nach Südfrankreich (Presqu'île de Giens), zweimal in die Toscana und ab 1987 nach Spanien.
In Giens, wo wir 1983 in den Ferien waren, wunderte ich mich, dass Theo so selten an den Strand kam. – Er hatte es schon immer geliebt, „Siesta“ zu machen, aber das ging dann doch zu weit. Oft war ich mit den drei Kindern und unseren Freunden „allein“ am Strand. Es dauerte nur wenige Tage, bis ich hinter das Geheimnis kam: Als ich mal unverhofft im Haus auftauchte, sah ich, wie er vor einem Bildschirm sass. Er hatte sich einen Commodore 64 gekauft und den beim Auto-Packen so gut inmitten unserer Siebentausendsachen versteckt, dass ich ihn nicht bemerkt hatte. Ich war ziemlich sauer und beklagte mich, dass er nun offenbar, statt mit den Kindern am Strand zu spielen, stundenlang bei dem schönen Wetter vor dem PC sass. Der Computer war zu der Zeit das absolut neueste „Spielzeug“, das ihn als Ingenieur natürlich faszinierte und das er unbedingt ausprobieren wollte. Meine Begeisterung hingegen hielt sich in engen Grenzen. Unbedacht liess ich mich sogar zur Bemerkung hinreissen: „Entweder ich oder diese Kiste“. – Das war vorschnell, wenn ich dran denke, wie viele Stunden in meinem Leben ich selber vor dem PC verbrachte und immer noch verbringe. Und wie viele Kurse ich später in der Schule belegte, damit ich Textverarbeitung, Informatik (in kleinem Rahmen) und Korrespondenz unterrichten konnte. – Aber damals...
Manchmal schneidet er sich aber auch ins eigene Fleisch. Wir waren mit der Queen Mary 2 unterwegs von New York nach Hamburg. Zum schwarzen Anzug, der natürlich im Gepäck mit musste, gehörten auch ein Paar schwarze Schuhe. – Schwarz waren beide Schuhe zwar schon, aber zusammenpassen taten sie überhaupt nicht. Der eine war ein Art Mokassin, der andere hatte eine Schnalle. Wenigstens waren’s zum Glück nicht zwei linke oder zwei rechte. – Im Lift zum Speisesaal hätte das Missgeschick wohl trotzdem niemand bemerkt, wenn Theo nicht ständig auf seine Füsse gestarrt und dazu einschlägige Bemerkungen zu mir gemacht hätte, bis alle Fahrgäste ebenfalls auf sein Malheur aufmerksam wurden.
Er spottet ständig über meine übergrosse Handtasche, in der ich, ich kann’s nicht verleugnen, oft lange kramen muss, bis ich finde, was ich suche. – Sie eignet sich aber auch bestens dafür, seine Siebensachen, für die es in seinem Hosensack keinen Platz hat, darin mitzutragen. Seien das Schlüssel, Kleingeld, Zeichenmaterial, Prospekte oder was auch immer. – Das ist mir zwar fast lieber, als alles aufzulesen, was er verliert, wenn ich überhaupt merke, dass dies passiert. Darüber gibt es nämlich auch zahlreiche Geschichten zu erzählen:
Zum Beispiel hat er mehr als einmal sein Notizbuch verloren, seinen Laptop ebenfalls, auch sein E-Book und seinen i-Pod; in Havanna sein Smartphone, auf Long Island (Bahamas) seinen ganzen Sportsack, in Neuseeland brachte er es sogar fertig, meinen Reiseführer (Buch) gleich zweimal zu verlieren (einmal in einem Bus, das andere Mal in einem Hotel), von Münzen nicht zu sprechen, die auf den Boden fallen, weil er sie mitsamt dem Taschentuch aus dem Hosensack zieht oder weil er sich irgendwo auf eine Bank legt, was er liebend gerne macht, worauf unverzüglich das Gesetz der Erdanziehungskraft zum Zug kommt. – Was das Erstaunlichste dabei ist, die meisten dieser Dinge kommen auf irgendeine wundersame Weise wieder zurück.
So hat eine Rangerin in einem Park in Hawaii sein Notizbuch unter einer Bank gefunden und es ihm zurück zu uns nach Hause geschickt.
Sein Laptop, den er in einer Lodge im Südosten von Botswana unter der Bettdecke liegenliess, wurde von den Eltern des jungen Verwalters drei Wochen später nach Maun, in die Hauptstadt gebracht und dort in der Lodge abgegeben, wo wir kurz darauf ankamen und ein paar Tage verbrachten. So fand auch dieses Gerät wieder zu seinem vergesslichen Besitzer zurück.
Beim Smartphone war es anders. Ich stand ein wenig abseits von der Bank, auf die sich mein Gatte gelegt hatte, hob es dann auf, gab es ihm aber erst später zurück. Sozusagen als Erziehungsmassnahme (mit geringer Aussicht auf Besserung, das war mir schon klar). Auch die beiden Reisebücher fanden den Weg zu uns. Sie wurden uns nachgeschickt. Es ist immer gut, wenn man überall seine Adresse hineinklebt oder –schreibt. Seinen Sportsack wiederzuerlangen, war nicht wirklich schwierig, da er ja wusste, wo er ihn liegenlassen hatte. Eine Stunde Fahrt Richtung Süden auf Long Island bis zu „Max‘ Conch Bar and Grill“ und Theo war wieder im Besitz seiner Habseligkeiten.
Glück hatten wir auch in Wellington. Wir hatten das Mietauto bereits gepackt, waren abfahrtbereit, schlossen die Tür zum Apartment, wo wir eine Woche lang gewohnt hatten, warfen den Schlüssel in den Briefkasten und machten uns auf den Weg zum Flughafen. – Kaum dort, merkte Theo, dass er seine Weste, in der alle seine wichtigen Habseligkeiten drin waren: Pass, Geld, Kreditkarten, Smartphone, Notiz- und Zeichenbüchlein in der Garderobe hatte hängen lassen. Ich war sprachlos – aber nicht lange. Das Auto hatten wir noch nicht abgegeben, der Flughafen war nicht weit vom Stadtzentrum weg, wo wir gewohnt hatten, und die Zeit dachte ich, würde sogar reichen, um nochmals zurückzufahren. Das tat er dann auch. Ich blieb mit all unserem Gepäck auf den Flughafen zurück, sass dort wie auf Nadeln und hoffte inständig, dass die Nachbarn daheim waren, die einen Schlüssel zur Wohnung unserer Gastgeber hatten. – Auch das klappte. So viel Glück aufs Mal ist fast nicht erträglich. Theo erschien rechtzeitig, Weste angezogen, Auto abgegeben, Flug noch nicht verpasst, Erleichterung total – alles im Grünen.
Seinem „Hobby“ (so kann man es fast nennen) frönte Theo auch in der Bretagne. Im Sommer 2015 waren wir während sieben Wochen unterwegs und ich hatte fünf Haustausche organisiert. Einen in Lancieux, einen in St. Malo, einen auf der Kanalinsel Jersey, einen in Saint-Etienne de Montluc und den letzten in St. Nazaire.
Kaum hatten wir uns in St. Malo installiert, gestand mir Theo, dass er seinen ganzen Kleidersack mit Hemden, Jacken und Hosen nicht mehr habe. Er hatte keine Ahnung, wo der geblieben war. Beim Einpacken ins Auto verschwunden vielleicht? Oder gar unterwegs irgendwo, wo wir übernachtet hatten? – Als wir nach ein paar Tagen wieder Internetverbindung hatten, fand ich in meinem Email-Briefkasten eine Nachricht von unserer Haus-Tausch-Partnerin in Lancieux. Sie habe in ihrem Schrank einen grossen schwarzen Sack voller Herrenkleider gefunden...
So fuhr mein lieber Gatte am selben Tag dorthin zurück, um seinen ganzen „Plunder“ (den er ja offenbar eigentlich gar nicht brauchte - er packt immer viel zu viel ein), abzuholen. Zum Glück war der Weg dorthin nicht weit, waren die Besitzer überhaupt zurück in ihrem Ferienhaus und hatten gemerkt, dass sich ihr Hab und Gut inzwischen vermehrt hatte.
Ganz alle verlorenen Objekte konnten leider doch nicht mehr gefunden werden. Seine schwarze Regenjacke, die Theo an der Expo 02 in Yverdon gekauft hatte, schützt heute hoffentlich noch immer einen Clochard in Paris vor Regen, denn die Jacke blieb in der Metro liegen.
Einen Kindle-E-Reader hat er in Neuseeland verloren, aber er hat ja immer zwei davon mit dabei, in weiser Vorahnung wohl.
Auch die Landkarte und seine gerade erst gekaufte Cap konnten wir während unserer Rundreise durch Tasmanien nicht mehr wiederfinden. Er hatte beide vermutlich aufs Autodach gelegt und dort blieben sie, bis wir den nächsten Aussichtspunkt erreicht hatten, natürlich nicht.
Krass, all das. Aber trotzdem (im Nachhinein) irgendwie auch liebenswert...
Viele weitere Details aber später im dritten Kapitel in den Reiseberichten.
Trotzdem schon vorweg ein paar Zeilen, die mir gerade in den Sinn kommen:
Eine Reise nach Kreta (1991)
Als Gino sechsjährig war, Kay zwölf und die Zwillinge zehn, wurde während der Sommerferien unsere Küche umgebaut. Aus diesem Grund beschloss ich, mit den Kindern nach Kreta zu fliegen und dort drei Wochen lang Ferien zu machen. Theo konnte nicht mitkommen; er musste arbeiten. – Schon im Zug nach Zürich fiel mir auf, dass Gino irgendetwas Sperriges in seinem Bauchtäschchen haben musste. Ich fragte ihn danach. Er öffnete es – lauter Steine lagen drin. Dabei hatte ich mir beim Packen solche Mühe gegeben, möglichst wenig und nichts Schweres mitzunehmen.
Aber wir fünf hatten eine lustige Zeit zusammen. Wir wohnten in einem Hotel, das Baden im Meer machte uns allen Spass und ich mietete für ein paar Tage ein offenes kleines Auto, mit dem wir Ausflüge machen konnten.
Eine Überraschung wartete zu Hause auf uns: Es war eingebrochen worden. In unserem Schlafzimmer hatten sich Diebe breitgemacht und sämtlichen Schmuck, der nicht im Safe lag, mitgehen lassen. Vielleicht waren sie überrascht worden, denn im übrigen Haus war alles in Ordnung. Das Gefühl, das man hat, wenn man weiss, jemand Fremdes war da, ist speziell. Gehört hatte ich schon oft davon, jetzt erlebte ich es selber.
Eine Weihnachtsfeier
Inzwischen habe ich noch einen weiteren Text gefunden, den ich am 25. Dezember 2001 geschrieben habe nach einer denkwürdigen Weihnachtsfeier. Ich füge ihn hier ein, weil es eine Episode in meinem Leben ist, wo alle „in Aktion“ sind, die ganze Familie also, und das über eine ganz kurze Zeitspanne. Ein spezieller Tag zwar, aber trotzdem eine Art Alltag in dieser Lebensphase.
Kay war damals 22-jährig, Kim und Diego 20 und Gino im November grad 16 geworden.
Es ist doch immer wieder schön, zusammen Weihnachten zu feiern. Alles ist gut gegangen und der Baum ist auch nicht abgebrannt.
Vorbereitungen für den Heiligen Abend:
Wir werden 14 Personen sein am Tisch, was die Kapazität unseres Esstisches hoffnungslos übersteigt. Also muss eine andere Lösung gefunden werden. In knapp zwei Stunden kommen die Gäste: Beide Gartentische werden kurzerhand enteist, getrocknet und ins Wohnzimmer getragen. Ein Tischtuch, ein paar Kerzen und schon ist die Tafel gedeckt. - Ob ich einen Braten mache, will Theo wissen. – Seit dreissig Jahren gibt es dasselbe traditionelle Weihnachtsessen: Bernerplatte. - Offenbar ist ihm das entgangen.
Gino hatte am Mittag die geniale Idee geäussert, Weihnachtsgüezli zu backen. Seit zwei Wochen hatte ich ihn gebeten, die Teige auszustechen und zu backen, die ich extra für ihn gekauft hatte. Dafür aber fehlte ihm bisher die Zeit. Genauso wie mir. Aber ich wollte den Teig ja nicht kaputt gehen lassen und zudem fand ich, Weihnachtsgebäck gehöre unweigerlich zum Fest. Also machte ich mich am Tag zuvor daran, anstatt Tennis spielen zu gehen, die lange hinausgeschobene Arbeit an die Hand zu nehmen. Und nun wollte Gino Güezli backen. - Ausgerechnet an dem Tag, wo ich die Küche selber mit Beschlag belegen wollte/musste. Ich hab’s nicht gern, wenn mich jemand in der Küche stört, vor allem dann nicht, wenn ich für 14 Personen kochen muss. Aber es war Heiliger Abend und allen Menschen ein Wohlgefallen... An Ginos Wille, Güezli zu backen, führte so oder so kein Weg vorbei. Ebenso wenig an seiner Auslegeordnung. Es ist eben nicht einfach manchmal.
So ging er denn am Mittag ins Coop Mailänderliteig einkaufen, weil ja der Teig, den ich bereits verarbeitet hatte, logischerweise nicht mehr da war.
Eigentlich hatte ich gedacht, niemand von uns müsse an diesem hektischen Tag mehr einkaufen gehen und die langen Warteschlangen an der Kasse in Kauf nehmen. Aber alles kam anders. Als ich am Morgen aufstand und mich anschickte, die Zitronencakes zuzubereiten, die ich am selben Tag noch verschenken wollte, musste ich feststellen, dass mir zwei Eier fehlten sowie Puderzucker. Acht Eier brachte ich ja für die Mousse au Chocolat, die ich fürs Dessert geplant hatte. Es war lieb von Kay, dass sie ohne Murren ins Migros ging und mir die fehlenden Zutaten brachte.
Weil ich mir vorgenommen habe, in den Ferien Fotos einzukleben, kam mir gegen Mittag in den Sinn, dass ich unbedingt Fotopapier einkaufen musste. So trat ich den Gang ins Migros selber doch nochmals an, denn nie hätte ich Kay bitten mögen, erneut etwas für mich zu besorgen. Vor allem nicht, weil sie soeben heimkam und klagte, sie sei jetzt auch noch rasch im Coop gewesen, und es hätte ihr fast ausgehängt, weil lauter ältere Leute zwischen den Regalen herumgestanden seien. Ich hielt mich nicht dafür, ihr den guten Rat zu geben, es zu machen wie ich und alles schon ein paar Tage vorher einzukaufen...
Kurz darauf kam Gino heim mit seinem Mailänderliteig.
Später an diesem Nachmittag war die Reihe dann an Theo. Er wollte Kerzen kaufen im Coop für den Weihnachtsbaum, weil ich mich letztes Jahr beklagt hatte, dass er keine Kerzen „montiert“ hatte. Es sei nicht nötig, hatte er damals gesagt, und damit war jegliche Diskussion gestorben. In letzter Zeit hat er öfter solche Anflüge, einsame Entscheidungen zu treffen, aber was soll’s? Ich sagte, was ich davon hielt und das war’s. Offenbar kam ihm dies nun kurz vor Ladenschluss doch wieder in den Sinn und „for good measure“ kaufte er gleich 100 Kerzen. Sie würden länger brennen, meinte er, wenn sie gut gelagert seien. - „Papa ante Portas“ – an diesen Film von Loriot erinnerte ich mich sogleich, die Parallelen sind frappant: Der Held, seit kurzem pensioniert und beflissentlich darauf bedacht, den Haushalt in den Griff zu bekommen, kauft im Supermarkt zwei Palette Essiggurken ein, weil sie gerade Aktion sind und man sie ja so gut aufbewahren kann. – Mit Kerzen sind wir jedenfalls eingedeckt für die nächsten zehn Jahre; ich weiss auch ganz genau, dass irgendwo im Keller noch mindestens 2-3 Schachteln Kerzen lagern müssen. – So viel also zu meinem Vorsatz, ganz sicher am letzten Tag vor Weihnachten nicht einkaufen gehen zu müssen.
Ich bin also daran, das Abendessen vorzubereiten. Mit dem Kartoffeln Schälen bin ich fast fertig, wie Kay freundlicherweise ihre Hilfe anbietet. Sehr gern - noch ein paar wenige Kartoffeln sollten es schon sein. Sie rüstet daraufhin mehr als ein Kilo, weil sie so gerne rüste, sagt sie. Das ist mir zwar neu, aber heute läuft offenbar alles ein wenig anders. Gino ist noch immer am Güezi ausstechen, überall liegen ungebackene und gebackene Güezli herum, heisse und kalte Backbleche, „Teigtröler“ (Nudelholz, wie’s so schön heisst auf Deutsch), Zucker und was es sonst noch so alles braucht. Eine Schüssel voller Eigelb für die Glasur, von der nur ein Bruchteil benötigt wird, erhalten dann wenigstens die Katzen als Festtagsschmaus. Auch diese meinen, sie müssen sich unbedingt in der Küche herumdrücken und betteln. Und jetzt, wo Kay da ist, ist natürlich auch ihr Hund im Weg, es herrscht ein Geknurre und Gefauche, Gino lässt einen Teil seiner frisch gebackenen Güezli zu Boden fallen, Kay schimpft mit dem Hund und ich versuche an meinem Arbeitsplatz nicht die Nerven und den Humor zu verlieren. - Da läutet das Telefon. Es ist Liane, unsere Nachbarin, die in einer Stunde auch zum Essen und zur Weihnachtsfeier eingeladen ist. Sie glaube, sie könne nicht kommen, sagt sie, denn ihre Spitexfrau, die ihr die Haare hätte waschen sollen, sei nicht gekommen. - Dann kommt halt jemand von uns, sage ich mit einem Blick auf die Uhr und wenig Überzeugung. Liane nimmt dankbar an. Ich erkläre Kay den Fall. Meine Tochter kriegt fast Zustände. „Das kann ich schlicht nicht“, sagt sie, „ich bin doch keine Spitexfrau. Wieso nur kommt diese Zwätschge denn nicht? Und wieso ist Kim nicht da, wenn man sie einmal brauchen könnte? Liane ist doch ihre Freundin!“ Tausend Argumente gehen ihr durch den Kopf und durch den Mund und sie gibt in ihrer Verzweiflung ihrer Meinung unverfroren Ausdruck, was man mit älteren Menschen tun sollte, die nicht mehr zu sich selber schauen können. Es ist „strub“, was ich da alles zu hören bekomme. Für mich ist es ein Vorgeschmack dessen, was mir wartet in zwanzig oder dreissig Jahren. - Gino kichert nur dumm. – „Dann gehe eben ich“, drohe ich, „ihr macht halt mit dem Essen hier weiter.“ Das hingegen ist fast noch schlimmer für Kay. Zum Kochen ist sie nämlich auch nicht geboren. Sie ist jetzt in einem grausamen Dilemma. Nein, meint sie jetzt kleinlaut, sie überlege sich den Fall. „Aber was ist dann, wenn ich Liane nicht halten kann? Ich kann sie doch nicht gleichzeitig halten und ihr die Haare waschen!“ – „Dann geht eben Gino mit“, ordne ich an. Sein Kichern hört blitzartig auf. Protest. Ich höre gar nicht hin. Kay zieht sich den Mantel an. Ich muss auf den Stockzähnen lachen. Es kommt mir vor, wie wenn sie sich parat machen würde, in eine Schlacht zu ziehen und jetzt die Rüstung anzog. Da kommt das rettende Telefon. Die Spitexfrau ist da. Ich weiss nicht, wer von uns am erleichtertsten war. Und Liane kann froh sein....
Doris und Jany (meine Schwester und mein Schwager) sind unsere ersten Gäste. Das Fest kann beginnen. Es ist mir gelungen, das Apérogebäck nicht zu verbrennen. Theo geht unsere Mütter holen im Talgut-Zentrum, dem Seniorenheim, wo sie beide in separaten Wohnungen wohnen. Meine Mutter ist nach einer Viertelstunde da. Seine hatte noch keine Kleider an, also holt er sie später. Später hat sie auch noch nichts an, nicht einmal das Gebiss, das einmal mehr nicht aufzufinden ist. Aber er steckt sie in Kleider und bringt sie mit. Es ist erstaunlich, sie sieht aus wie sechzig, sagt sogar Kay. Dabei wird sie in zwei Wochen 95. Wenn sie nur ihre Zähne tragen würde!
Diego und seine Freundin Ladina sind auch eingetroffen inzwischen. Ladina hat die süssesten Florentiner selber gemacht und beschenkt uns alle damit. Diego und Gino holen Liane, die seit Jahren unter Schwindel leidet und nicht mehr selber gehen kann. Sie tragen sie mehr als dass sie sie stützen. Es muss eine Tortur gewesen sein, die 50 Meter bis zu unserem Haus zu gehen. - Kim schwebt herein mit ihrem Freund Dominique. Wie aus dem neuesten Barbi-Film entsprungen, denke ich, aber ich sage es natürlich nicht. Goldene Stiefel mit hohen Absätzen, enge Tigerhosen wie zur Aerobicstunde, bauchfrei, passend zum Anlass. De gustibus non est disputandum; schon gar nicht am Heiligen Abend. – Alle sind da. Wunderschön. Ich bin am vierten Glas Prosecco. Wir stossen zum sechsten Mal an.
Liane hat mir ein Geschenk mitgebracht, ein grosses Pack sündhaft teurer Truffes von Tschirren. Dummerweise lasse ich das Päckli auf dem Tisch vor mir liegen, während ich in die Küche gehe, um etwas zu holen. Liane packt das Päckli, das eigentlich für mich bestimmt ist, gleich selber aus und füttert dem Hund mit meinen Pralinen. N e i n !
Kim hat auch etwas mitgebracht. Wie Ladina hat sie Güezli gebacken, aber sie hat auch genäht. Golden. Slips oder besser gesagt Strings. Nichts für den Winter! Für Beat seien diese, für Kays Freud, den Reitlehrer. Das hab ich erst falsch verstanden und versprach, dass, wenn er diese anziehe, ich auch wiedermal zum Reitunterricht gehen würde. - Gemeint hat sie natürlich für Kay – zur Freude von Beat. - Das Missverständnis wird bald geklärt.
Das Essen verläuft friedlich, alle rühmen die Bernerplatte, die fast nur aus Kartoffeln zu bestehen scheint, und Nana isst mit Appetit den Kartoffelstock, den ich speziell für sie zubereitet habe. Jemand hat eine Weihnachts-CD aufgelegt, um die Stimmung auf die Spitze zu treiben.
Nur die Kinder erhalten je ein Geschenk, so ist es abgemacht. Also ist auch diese Phase des Abends rasch vorbei. - Wie anders war das noch vor zehn Jahren: Berge von Päckli, Mütter mit Zähnen...
Nach dem Essen vermissen wir plötzlich Nana. Sie hat den Weg in unser Schlafzimmer gefunden und hat dort unter etlichen Säcken, die auf einem Stuhl lagen, einen hervorgeholt, der für die Kleidersammlung bestimmt ist. Jetzt hat sie eine Jacke über den Arm gelegt, aber wieso und weshalb und was das alles soll, weiss niemand. Auf der Toilette geht es dann auch nicht so gut. Wie sie wieder herauskommt, ist sie jedenfalls unten nur noch teilweise bekleidet. Es ist jetzt Zeit, heimzugehen und Theo bringt die Mütter einzeln zurück ins Seniorenheim. Liane schafft die 50 Meter auch nicht mit den Jungs. Theo fährt sie im Auto bis vor die Haustüre und Kim bringt sie ins Bett. Wie sie wieder heimkommt, hat sie einen Pelzmantel an, den ihr Liane geschenkt hat. Nach 50 Jahren wieder perfekt in Mode. Er steht ihr ausgezeichnet. Bisamratte, vermute ich, Kay hält den Pelz für Nerz, Ladina denkt an Kaninchen. Kay schwafelt etwas von den armen Nerzen und davon, wie sie sich schämen würde, Pelz zu tragen - das Stichwort für Theo, dieses Jammerthema aufzugreifen und mit Kay zu argumentieren. Genau wie früher sein Vater, dem es unweigerlich gelang, alle mit seinen absonderlichen Ansichten in kürzester Zeit auf die Palme zu bringen...
Theo war viel unterwegs an diesem Abend, er ist geschafft; ich bin es auch. Wir räumen gemeinsam auf. – Es ist fast Mitternacht, Zeit für uns, ins Bett zu sinken und für die Jungen, nun getrost „in den Ausgang zu gehen“ nach diesem Cabaret.
Und nun wieder zurück zu mir:

Job und Nebenjob
Bei einer Nebenbeschäftigung, die ich Ende der Achtzigerjahre annahm, handelte es sich um einen Studie des Bundesamtes für Statistik. Man wollte herausfinden, wie sich eine Gefängnisstrafe auf die Strafgefangenen auswirkt, um Rückschlüsse über die Rückfälligkeit zu ziehen. Von einer Bekannten, die dort arbeitete, wusste ich, dass Leute gesucht wurden, die bereit waren, in verschiedenen Gefängnissen der Deutschschweiz Interviews mit Strafgefangenen zu machen, und zwar kurz vor der Entlassung und dann unter Umständen nochmals kurz nach einer allfälligen Wiedereinweisung. - Verbrecher sind und waren ja nicht unbedingt Leute, mit denen ich im Normalfall zu tun hatte, also war es eine gewisse Neugierde, die mich antrieb, mich für diesen Nebenjob zu bewerben. Auch fand ich, er sei recht gut bezahlt. Interessant auf jeden Fall.
Wir waren alsdann eine Gruppe von etwa sechs Mitarbeitenden und uns war ein Psychologe zugewiesen, mit dem wir in gewissen Abständen Gespräche führen konnten, um über unsere Befindlichkeit zu sprechen, was ich eher unnötig fand, aber einige von uns nutzten das Angebot intensiv.
Es war eine äusserst interessante Aufgabe, die uns zufiel. Es galt als Erstes, einen Fragebogen auszufüllen, aber der Teil des Interviews, der viel aussagekräftiger war, waren natürlich die offenen Fragen. Das Gespräch dauerte jeweils etwa zwei Stunden. Manchmal konnte ich diese Arbeit an einem Nachmittag erledigen, wenn das Gefängnis, das ich besuchte, nicht allzu weit weg war, wie etwa Witzwil oder der Thorberg. Musste ich nach Schaffhausen oder nach Cazis fahren, brauchte ich einen ganzen Tag.
Sehr unterschiedliche Impressionen sind mir von diesen „Besuchen“ geblieben:
Eindrücklich waren sie zwar alle, aber einer im Frauengefängnis in Hindelbank ganz besonders. Wie man uns informierte, traten Frauen als Gefangene in der Statistik gar nicht in Erscheinung, weil es (damals) zu wenige waren. Ich musste trotzdem eine Ausländerin interviewen, die als Drogenkurierin unterwegs gewesen war. Völlig blauäugig und unvoreingenommen war sie offenbar in diese Aktion hineingeraten und machte einen recht gestörten Eindruck, sah gar nicht ein, wieso sie hier gefangen gehalten wurde.
Erstaunt war ich, als ich einen Auftrag im Wauwilermoos auszuführen hatte. Als ich auf die Gebäude zufuhr, dachte ich, es handle sich um eine Feriensiedlung.
In Cazis, in der Strafanstalt Realta, fand an dem Tag, wo ich mein Interview zu machen hatte, ein Picknick-Ausflug mit den Angestellten statt. Der Gefängnisdirektor lud mich dazu ebenfalls ein und ich erfuhr viel Interessantes über die Anstalt und den Strafvollzug. – Es gäbe jeden Herbst ein paar Delinquenten, die einen unbedeutenden Einbruch inszenierten, damit sie über die Wintermonate „eingelocht“ würden, um so ein warmes Bett zur Verfügung zu haben. Immer wieder die Gleichen. Man kenne die Pappenheimer inzwischen.
Zwei Befragungen in Witzwil gaben mir ziemlich zu denken. Der eine Gesetzesbrecher hatte eine Auseinandersetzung gehabt mit seiner Freundin. Sie fuhr in ihrem Auto weg und er wutentbrannt in seinem Wagen hinterher. Er hatte aber einen Gipsfuss zu der Zeit und hätte gar nicht fahren dürfen. Es kam zu einem Unfall, den er verschuldete. Im korrekt entgegenkommenden Fahrzeug starb eine Person und mein Gegenüber zeigte nicht einen Funken Reue, nur Rechtfertigung.
Der andere, mit dem ich mich unterhielt, war ein Hooligan, ein Banker im „normalen“ Leben, der mir versicherte, er würde sich ganz genau gleich wieder verhalten, wenn er hier herauskäme.
Am Skurrilsten war der Besuch im Stemmler-Museum mitten in der Stadt Schaffhausen. Der Mann, den ich befragte, war in Halbgefangenschaft und arbeitete dort tagsüber. Wir sassen uns gegenüber und die Vitrinen rund um uns herum waren voller Tierskelette, Dutzende von Katzenköpfen und Vogelgerippen. Eine seltsame Atmosphäre!
Ich bin nicht mehr ganz sicher, glaube aber, dass die Befragungen etwa zwei Jahre lang dauerten, dann wurde die Studie beendet oder abgebrochen. Was genau dabei herauskam, ist unklar. Sehr viel wohl nicht.
BMS und bsd.
Der Unterricht an „meinen“ beiden Schulen machte mir nach wie vor Spass.
Inzwischen hatte sich einiges geändert. Im Englischunterricht gab’s immer wieder mal ein neues Lehrbuch, welches meistens nach zwei, drei Jahren wieder aus der Gnade fiel, so dass bald darauf erneut evaluiert werden musste. Im Deutsch ging’s ähnlich zu und her. Arbeitsblätter verfassten wir selber, Computer waren am Anfang meiner beruflichen Zeit noch kein Thema. So sehe ich mich noch immer im Arbeitszimmer an der Kopiermaschine stehen, die grosse Trommel drehen, in die ich das Aufgabenblatt eingespannt hatte, das ich vervielfältigen wollte, sorgfältig darauf bedacht, mich nicht schmutzig zu machen an der Tinten-Matrize, was allerdings so gut wie nie gelang. So sind mir die blauen Flecke an den Händen und der Geschmack der alkoholischen Flüssigkeit, die’s für dieses Vorgehen brauchte, unvergesslich. – Später, als wir Computer hatten und Kopiergeräte, die es möglich machten, im Handumdrehen Texte zu scannen und zu vervielfältigen, fühlte zumindest ich mich wie im siebten Himmel.
So waren aus den Zimmern mit Sprachlabor gegen Ende der Neunzigerjahre allmählich Computerräume entstanden, völlig klar, dass unsere Schüler gemäss der neuen Trends geschult werden sollten. So änderte sich auch das Fach deutsche Korrespondenz, das ich während Jahren unterrichtet hatte. Die Briefe waren von Hand geschrieben worden. Das ging nun nicht mehr, was mich und meine Kolleginnen und Kollegen, die dasselbe Fach unterrichteten, zwang, Computerkurse zu besuchen und uns umschulen zu lassen. Ich war fasziniert, aber nicht alle mochten mitmachen, fanden diese Umstellungen nötig. Wenn ich daran zurückdenke, muss ich lachen. Fast archaisch kommt es mir heute vor, wie sich diese Anfänge präsentierten. Die grossen Flobby-Disks hatten ja kaum Speicherplatz, verschwanden daher auch bald wieder und machten neuen Speichermedien Platz. Rasant ging die Entwicklung vor sich.
Später unterrichtete ich auch Informatik. Man war der Ansicht, die Schüler müssten ebenfalls dahingehend geschult werden. Dieser Meinung war ich eigentlich nicht, besuchte aber trotzdem unzählige Kurse und las dicke Bücher, um mich für diese Aufgabe vorzubereiten. Wie ein Telefon funktioniert, weiss ich nämlich auch nicht genau, was mich aber nicht davon abhält, es zu benutzen. Und erst recht ein Automotor… Nun, Lehrplan ist Lehrplan und ich bemühte mich, den Stoff so einfach wie möglich darzustellen, Zusammenhänge bildlich zu gestalten. Auf grosses Interesse an diesem Fach stiess ich aber kaum und nach ein paar kurzen Jahren gab ich der Schulleitung bekannt, ich wolle dieses Fach, das inzwischen „Gesellschaft“ genannt wurde, nicht mehr unterrichten. Das hatte allerdings mehr damit zu tun, dass mir allmählich die vielen Konferenzen zuwider waren, an denen ich teilnehmen musste mit meinem kleinen Pensum. So war’s zumindest eine Fachsitzung weniger pro Monat. Mein Pensum an beiden Schulen betrug nämlich fünfzig Prozent, je halb und halb. Aber an beiden Schulen musste ich je hundert Prozent beim ganzen administrativen „Klimbim“ (Quartals-, Semester-, Gesamtlehrerkonferenzen, Fachschafts- und Qualitätssitzungen) mitmachen, wie wenn ich voll angestellt gewesen wäre. So allmählich wurde mir das zu viel, vor allem, weil ich so oft den Sinn all dieser Sitzungen, die manchmal gefühlte Ewigkeiten dauerten, nicht mehr einsah. Zeitlich fand ich den Aufwand im Verhältnis zum Kerngeschäft, dem Unterrichten, zu gross. So wäre es am einfachsten gewesen, mich nur noch an der einen Schule anstellen zu lassen, aber welche künden? – Dazu konnte ich mich lange Zeit nicht entschliessen. Ich mochte die unterschiedlichen Klassen; in der BMS unterrichtete ich vor allem junge Männer, die einen technischen Beruf erlernten und in der bsd. waren die Klassen gemischt. So entstand eine völlig andere Dynamik oder Atmosphäre, was ganz interessant war festzustellen. Auch hatte ich einen guten Draht zu den meisten meiner Kolleginnen und Kollegen. Im Laufe der Jahre waren Freundschaften entstanden, die, obwohl ich seit sechs Jahren bereits pensioniert bin, immer noch halten.
Erst im Jahr 2010 konnte ich mich dazu entschliessen, bei der bsd. zu künden und fortan nur noch in der BMS zu unterrichten. Ich erhielt dort ein paar Lektionen mehr zugeteilt, so dass mein Pensum wie vorher fünfzig Prozent betrug, aber all die schulischen Aktivitäten ausserhalb des Unterrichts waren nur noch halb so zeitaufwändig. Es kam mir fast vor wie Ferien. Einen äusserst angenehmen Stundenplan hatte ich auch erhalten: drei aufeinanderfolgende Tage Unterricht und vier Tage Wochenende…
Es hatte sich aber auch gesellschaftlich vieles verändert seit Beginn meiner Tätigkeit an den beiden Berufsschulen. Anfangs der Achtzigerjahre gab es in der „Verkäuferinnenschule“, wie sie damals genannt wurde, kaum eine Klasse, in der es nicht mindestens zwei oder drei Schülerinnen oder Schüler gab, die aus Grossfamilien stammten, meist aus ländlichen Gebieten. Acht Geschwister oder gar zehn waren gar nicht selten. Heute ist das kaum mehr so, dafür hat sich die Anzahl der Ausländerinnen und Ausländer drastisch erhöht. – Vorerst waren es vor allem Jugendliche aus der Türkei oder einem anderen osteuropäischen Land, die eine Lehre absolvierten, später vermehrt auch Tamilinnen und Tamilen. Nicht ganz einfach war es, uns die schwierigen Namen zu merken. Eine noch grössere Herausforderung war es, die andere Kultur zu verstehen, mit der wir manchmal konfrontiert wurden: Eltern verboten es ihren Töchtern, an Schulveranstaltungen teilzunehmen, beim Turnunterricht mitzumachen und dergleichen. In der Regel führten auch Gespräche nicht zum Ziel.
Furchtbar und unvergesslich war für mich der Tag im Jahr 1997, an dem ein kurdischer Vater seine Tochter mit einem Messer umbrachte. Es geschah an einem Dienstagabend nach dem Englischunterricht. Er hatte gesehen, dass Yildiz sich nach der Schule auf dem Heimweg mit einem Freund traf, einem Schweizer. – Wieso kommen Leute hierher in unser Land, die unsere westliche Lebensweise aufs Tiefste verachten? – Die junge neunzehnjährige Frau war eine äusserst hübsche, begabte und freundliche Schülerin gewesen, die mit grossem Interesse ihre Ausbildung absolvierte. – Was für ein schwarzer Tag. Unfassbar!
Aber zurück zum Unterricht und den Erlebnissen und Episoden im Schulalltag:
Nicht immer war der Umgang mit den Schülern ganz einfach, im Grossen und Ganzen aber schon. Oft waren es sogar die ausländischen Schülerinnen und Schüler, die sich grosse Mühe gaben, gute Noten zu erzielen. Ich denke, manche von ihnen hatten begriffen, dass ihre Zukunftschancen in der Schweiz besser sind als in ihren Heimatländern. Hingegen erlebte ich nicht wenige Schweizer Jugendliche, die ihre Lehre nur mit dem minimalsten Aufwand und fehlender Motivation zu Ende brachten. – Zu sehr verwöhnt?
Ein grosser Vorteil der Berufsschulen ist, dass man als Lehrerin oder Lehrer so gut wie nichts mit den Eltern zu tun. Das ist wunderbar. Oft hatten mir Kolleginnen und Kollegen, die in der Primarschule unterrichteten, berichtet, wie schwierig und zeitraubend sich zum Teil der Umgang mit den Müttern und Vätern gestalte, die ja alle selber mal in der Schule gewesen waren und sich daher ihrer Meinung nach bestens mit allem, was damit zu tun hat, auskannten.
Unsere Schüler waren in der Regel zwischen sechzehn und zwanzig Jahre alt, an der BMS II sogar von neunzehn bis achtundzwanzig. Diese Klassen waren mir die liebsten, denn wer sich dort anmeldete, hatte ein klares Ziel vor Augen und war normalerweise motiviert.
So hatte ich all die Jahre Spass an meinem Beruf, nahm mir viel Zeit beim Vorbereiten, suchte immer wieder nach neuen Texten und Ideen, um den Unterricht anregend zu gestalten, was natürlich nicht immer hundertprozentig möglich war. Wir hatten ja auch eine Weiterbildungspflicht und Kurse zu besuchen. Das war mir überhaupt kein Müssen.
Während der Ferien gab es Angebote für Lehrerfortbildungskurse in England. Solche besuchte ich, wenn immer möglich, sehr gern. Ich erinnere mich an welche in Cambridge, Torquay, Saffron Walden und Eastbourne. In einem davon machte ich eine interessante Erfahrung mit einer japanischen „Mitschülerin“. Sie war Lehrerin an einer Hochschule in Tokio. Wenn sie englisch sprach, verstanden wir sie anfangs fast gar nicht, aber wenn’s um Grammatik ging, wusste sie „alles“. Sie hatte ein unglaublich grosses Vokabular, konnte aber die Wörter kaum aussprechen. Schreiben war kein Problem.
Sie hätte auch Deutsch gelernt, erzählte sie. Sie hätten in der Schule Thomas Mann gelesen. Sie verstand aber nicht, wenn ich „guten Tag“ zu ihr sagte. – Sehr seltsam war das. Ich freundete mich ein wenig mit Haruko an und sie erklärte mir, wie’s dazu kam, dass ihre Sprachkompetenzen so unterschiedlicher Natur waren: Fragen zu stellen, ist unhöflich. So durften sie ihren Lehrer niemals fragen, wenn etwas nicht klar war. Es muss ein sehr stiller Unterricht gewesen sein, den sie genossen hatte. - Ihr Wissen schöpfte sie aus Büchern. Unendlich viele Übungen hätten sie machen müssen – alle schriftlich. - Da muss sich auch Einstein getäuscht haben, der ja fand: „Das Wichtigste ist, dass man nicht aufhört zu fragen“.
Unter den Kursen, die wir „zu Hause“ absolvieren konnten, waren mir die allerliebsten die eintägigen Veranstaltungen, die von den englischen Buchverlagen durchgeführt wurden. Diese hatten (und haben zweifellos nach wie vor) fast ausnahmslos ausgezeichnete Präsentatorinnen und Präsentatoren, die uns mit viel englischem Humor immer wieder neue methodische „Tricks“ und lustige Aktivitäten für den Unterricht verrieten. Dort ging die Zeit im Nu vorbei und wir Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten enorm profitieren.
Etliches davon liess ich in meinen Unterricht einfliessen, was schliesslich auch mir selber zu abwechslungsreichen Stunden verhalf. – So fand ich den Spruch zwar lustig, den ein Berner Politiker mal verlauten liess und ein Kollege von uns ans Schwarze Brett im Lehrerzimmer gehängt hatte:
„Lehrer haben am Morgen Recht und am Nachmittag frei“. – Wie hilfreich für unser Image solche Aussagen allerdings sind, sei dahingestellt. Das Vorurteil, mit dem Lehrerberuf sei ein Flohnerleben verbunden, ist nicht leicht auszurotten. Das Gute an diesem Beruf ist ja, dass man seine Zeit gut einteilen kann, was halt den Anschein macht, man habe nichts zu tun. Korrigieren und Vorbereiten müssen trotzdem sein. Für mich oft abends oder am Wochenende. Auch verfasst niemand lustige Sprüche über all die vielen Konferenzen am Ende eines langen Schultages, die obligatorischen Sitzungen und die manchmal tagelangen Schulveranstaltungen während den Ferien. Klar, die sogenannten schwarzen Schafe gibt es auch bei uns, wie in jedem anderen Beruf genauso.
Wie steht’s mit den schwarzen Schafen bei den Schülern? – Wenn’s ums nie enden wollende Thema der Absenzen ging und immer noch geht, dann könnte man von ganzen Herden von schwarzen Schafen sprechen. Wäre der Unterricht nicht obligatorisch, könnte man die leidige Angelegenheit vergessen, aber dem ist nun mal nicht so.
An der bsd. waren die Regeln strikter, gegen die Sünder wurde konsequenter vorgegangen als an der BMS. Dort ging’s lascher zu und her, denn nicht alle Lehrer zogen am selben Strick, was mich manchmal ziemlich ärgerte. Wenn es also vorkam, dass eine Lektion ausfiel, konnte es sehr wohl sein, dass einer oder gleich mehrere Schüler von Kopfweh überrascht wurden und daher dem Unterricht, der in der folgenden Stunde stattfand, fernbleiben mussten. Überhaupt traten seltsame Krankheiten vermehrt auch am Freitagnachmittag auf, weniger hingegen am Montagmorgen. Da zeigte sich eher ein andersartiges Problem: Es galt jeweils, gegen die Müdigkeit anzukämpfen.
So wurden Proben mit Vorteil auf die Wochenmitte verlegt, bereits im Semesterplan vermerkt, aber natürlich gab es auch dann immer wieder ein paar „Spezialisten“, die konsequent mit Abwesenheit glänzten, wenn es darum ging, eine mündliche oder schriftliche Note zu generieren. Aber daran gewöhnt man sich als Lehrer rasch. Es gab einfach mehr zu tun, denn eine zweite und dritte ähnliche Probe musste verfasst werden, damit diejenigen, die gefehlt hatten, sich nicht bei ihren Klassenkameraden informieren konnten, was genau gefragt wurde, aber doch auch dieselbe Chance erhielten, eine gute Note zu erzielen. Oft erledigte ich diese Arbeit gleich von Anfang an und hatte schon eine zweite Probe für ihr nächstes Auftauchen im Köcher.
Die Geschichten, die ich manchmal aufgetischt bekam, waren zum Teil köstlich. Die lustigsten habe ich aufbewahrt. Manche waren kurz, andere lang und nicht selten ironisch gemeint, geschwollen in der Ausdrucksweise, um mich ein wenig auf den Arm zu nehmen. - Was denen nicht alles in den Sinn kam, meinen Schülern! Den Ideenreichtum hätte ich mir oft im Unterricht gewünscht. Und Sorgen um nicht ganz adäquaten Sprachgebrauch machte sich ganz offensichtlich niemand. Aber dass nicht einmal das Rechtsschreibeprogramm zum Zuge kam, wenn ich eine Entschuldigung erhielt, die auf dem PC geschrieben wurde, das leuchtete mir beim besten Willen nicht ein. – Nun, Noten gab’s ja keine, aber immerhin mussten sie sich kurz Zeit nehmen und etwas schreiben.
Die Regel war übrigens, wenn man den ganzen Tag da war und nur gerade vor der letzten Stunde heimgehen „musste“, mir das direkt zu sagen und nicht einfach „abzuhauen“. – Hat schlecht geklappt... Eine Lüge aufzuschreiben, ist offenbar einfacher...
Eine zweite Regel war, den Grund der Abwesenheit kurz auf Englisch zu beschreiben. Klappte ebenfalls nicht immer…
Hier ein paar „Entschuldigungen“, die ich erhielt. Sie sind nicht korrigiert, sondern genauso, wie ich sie erhalten habe. Die Anrede habe ich weggelassen sowie auch all die freundlichen Grüsse.
Leider konnte ich den Unterricht am 30.01.2008, aufgrund meiner gesundheitlichen Verfassung, nicht besuchen.
Ich bitte Sie, meine Absenz zu entschuldigen.
*******************************************************************
I excuse me for the last time that I didn’t come to school. I don’t remember the date but I thing it was the 22 of may.
I was in bed and didn’t heare the noise of my natel who should make me to wake up. Or I heard it and shout it down befor I was 100% woken up.
So I styied in bed and waited that my phone ran, bat it didn’t rang, after about an houre I realized that I was late, I was too late.
I tought that you get angry if I come so much time to late an decided to stay at home. I hope it will never happen again. And sorry that it happen two weeks ago.
*******************************************************************
As I was late last Tuesday, I ask you to accept my apologies.
My coming late was absolutely not intentional as I didn’t hear the wake up call and thus got up late.
I thank you for your understanding.
*******************************************************************
Da ich in Österreich war, konnte ich nicht in Bern zur Schule kommen.
*******************************************************************
Because I suffered from a terrible headache, I wasn’t able to visit the english lesson.
If I hadn’t suffered from such a terrible headache, I would have come to school.
Please apologise my absence.
*******************************************************************
Aufgrund meiner Rückenprobleme sah ich mich, da ich solche Schmerzen hatte, gezwungen, nach Hause zu gehen um die Schmerzen zu lindern.
*******************************************************************
Am Dienstag 20.3.07 habe ich am Englischunterricht nicht teilgenommen. Leider habe ich verschlafen und somit den Weg in den Unterricht nicht gefunden.
*******************************************************************
Durch den unwissentlichen Verzehr von verdorbenen Esswaren hatte ich am Montagmorgen starke Magenprobleme. Aus diesem Grund, war es mir nicht möglich, den Unterricht zu besuchen.
*******************************************************************
In the evening of the day before I went to school with a delay of 15 minutes, I had a very thrilling occurrence. While I was doing my homework, my sister’s cat went home with a cute, small, still living sparrow.
First I had to scare away my cat and then I furnished a little nest because the sparrow had to turn upward of his jolt over the night.
In the morning, shortly after my little breakfast I got dressed. While I was hurrying out of the house to catch my train, I reminded of my cute, little sparrow…
The thought to let my sparrow the whole day alone in his little nest was absolutely beyond all bearing. So I went back into my room, put him into my hand, went out of the house and let him fly into the big, wide world.
Needless to say, that I afterwards missed my train.
I’m dreadfully sorry, but I leant of my mistake – I will kill now my sister’s cat that such an occurrence will never happen again.
*******************************************************************
Am Mittwoch dem 20.2.13 bekam ich im VBR Unterricht akute Kopfschmerzen. Aus diesem Grund ging ich nach Hause und ruhte mich aus.
******************************************************************
Excuse.
I can’t visit the last 45 minutes of this period because i have got an important hanball game.
*******************************************************************
Am Donnerstag, dem 20.3.2003 konnte ich wegen starkem Fieber (am 19.3.2003 Abends) nicht an den 2 Englischlektionen teilnehmen. Hiermit entschuldige ich diese 2 Lektionen.
Vielen Dank für euer Verständnis.
*******************************************************************
Am 06.09.06 habe ich Kopfschmerzen und deshalb bin ich nach Hause gegangen.
*******************************************************************
Excuse
On the 23. August 2006 I wasn’t present in your English lesson. I wasn’t ill, but this day I hadn’t the patience to put more stuff in my head, so I decided to go home. I’m sorry…
Yours sincerely,
*******************************************************************
Entschuldigung der Englischlektion vom 29.2.96
Ich war für dem 28.2.96 beim Zahnarzt angemeldet und habe dies irrtümlicherweise in meiner Agenda falsch eingetragen. Als ich dann am 29.2.96 wieder von der Praxis weggeschickt wurde, erwischte ich leider in der Hast den falschen Zug. Dabei musste ich bis Interlaken fahren und konnte erst dort den Weg direkt nach Bern antreten.
*******************************************************************
Explanation
Ich habe das Quiz nicht auf Educanet2 geladen weil ich den Arbeitsauftrag nicht richtig gelesen habe. Ich möchte mich hiermit für meine unsaubere Art und Weise entschuldigen. Ich werde mich bemühen in Zukunft die Aufträge genau zu lesen und sie Termin gerecht abzuschliessen. Ich hoffe, dass Ihnen dadurch nicht ein allzu grosser Mehraufwand entstand
Hochachtungsvoll
*******************************************************************
Excuse
I wasn’t able to join your lesson on the 18 of October 2006 because I had an upset stomach. The chicken I had for lunch was obviously spoilt. I would be grateful if you could excuse my absence.
Yours sincerely
*******************************************************************
Entschuldigung
Da wir am 18. Oktober kurz nach dem Mittag keine Lektion mehr hatten, sah ich es sinnvoller nach Hause zu gehen, um diverse Aufgaben zu erledigen, als in der Schule 2.5h zu warten.
Deshalb entschuldige ich mich für das fern bleiben der Englisch Stunde.
Selbstverständlich habe ich den fehlenden Schulstoff nachgearbeitet.
*******************************************************************
The apology
I like to excuse me for the homework witch I haven’t made.
Because I had a lot to learn for the other School Subjects I couldn’t find thime to do the quiz and the appending document.
*******************************************************************
Sehr geehrte Damen und Herren
Ich habe am 19.12.2002 verschlafen und erschien infolgedessen erst am Nachmittag in der Schule.
Ich möchte mich dafür entschuldigen und hoffe auf ein wenig Verständnis.
*******************************************************************
Absenz
Ich konnte leider am Mittwoch, dem 08.11.2006 Ihren Unterricht im Fach Englisch aufgrund einer Magenverstimmung, hervorgerufen durch eine grosse Portion Gorgonzola Gnocci, nicht besuchen. Ich bitte Sie deshalb freundlichst meine Absenz zu entschuldigen.
Besten Dank
*******************************************************************
Absenzen
- Am 06.09.06 habe ich ein Termin beim Arzt, ich habe Probleme mit dem Fuss.
- Am 18.10.06 habe ich Frei genommen.
- Am 01.11.06 wegen Kopfschmerzen bin ich nicht zur Schule gekommen.
*******************************************************************
Why i didn’t do the taks on the educanet2
It ditn’t do the task on the educanet2 why I forgot it. I do all task who are in the book or on a paper, but I forgot the task on the internet. At the first week I just forgot to write it in my agenda. At the second week I dond’t know why I forgot it. For the future, it is better when I do the homework on the educanet at the same evening who I have BMS.
I hope this was the last one, who I forgot the homework.
With kind regards
*******************************************************************
Entschuldigung für Verspätung
Hiermit entschuldige ich mich für meine halbstündige Verspätung im Englisch-Unterricht am 30.01.2003. Es war keine Absicht, ich musste mit dem Velo vorsichtig fahren und habe deshalb den Zug verpasst.
MFG
*******************************************************************
Excuse
Date: 22.8.2006
I was in the mood to work at home.
*******************************************************************
Entschuldigung für den Englischunterricht vom 18. Oktober 2016
Ich fühlte mich an diesem Tag nicht besonders gut. Ich hatte beim Aufstehen Kopfschmerzen und verspührte Ubelkeit. Darum kam ich am Morgen auch später in den Unterricht.
Als ich mich am Nachmittag immer noch nicht fit war, dachte ich das es keinen Sinn hat in diesem Zustand hier zu bleiben und trat meinen Heimweg an.
*******************************************************************
Aus zeitlichen Gründen konnte ich den Englischunterricht vor zwei Wochen leider nicht besuchen.
*******************************************************************
Ich entschuldige mich, dass ich in den letzten 2 Lektionen (6.11.06) bei Ihnen im Unterricht nicht anwesend war. Der Grund meines fern bleiben des Unterrichts war, dass ich verschlafen habe. Ich wäre ihnen sehr verbunden, wenn sie meine Entschuldigung akzeptieren würden.
*******************************************************************
Am 24., 25. und 31. Mai habe ich den Unterricht verpasst, da ich immer ohnmächtig werde.
*******************************************************************
Leider verfrühter Wochenendbezug.
*******************************************************************
Mit dem Aufkommen der Natels wurde manches auch nicht leichter. Was man sich da nicht alles ausgedacht hat, um dem Übel Herr zu werden… Meistens mit wenig Erfolg.
Hier eine Entschuldigung diesbezüglich, nachdem mir der Geduldfaden gerissen war:
Es war so dass Herr Beutlers Natel die ganze Zeit vibriert hat, und er euch damit Provoziert hat. Bis dahin hatte ich noch nichts damit zu tun. Als es dann zu viel wurde, hat mein Natel leider im falschen Moment ZUM ERSTEN MAL IN DIESER STUNDE vibriert hat, dachten Sie wahrscheinlich, ich hätte es schon vorher extra gemacht was jedoch nicht der Fall ist und hiermit entschuldige ich mich dafür.
Ja, manchmal erwischt man halt den Falschen...
Und nicht immer hat man den besten Tag. Einen solchen oder gleich zwei davon habe ich vor ungefähr zwanzig Jahren mal beschreiben. - Soeben habe ich ihn wieder gelesen, fast atemlos, und das mit ganz unterschiedlichen Gefühlen.
Sofort kam mir alles wieder „obsi“, wie wir im Berndeutsch sagen; ich befand mich augenblicklich zurück in der Situation von damals und konnte mich genau an diese beiden Tage erinnern. – Die Details wären mir sicher nicht mehr eingefallen, wenn ich nicht alles aufgeschrieben hätte. So freue ich mich nun darüber, dass ich mir damals die Zeit genommen habe, einen „ganz normalen“ Schulalltag zu beschreiben.
Dass ich mit all diesem Stress umgehen konnte, wundert mich heute. Ganz so zerstreut war ich normalerweise natürlich nicht und wenn es mir heute passiert, dass ich etwas vergesse, dann denke ich, das seien eben erste Anzeichen des Alters. Nach dieser Lektüre allerdings sieht alles gar nicht mehr so schwarz aus.
Zweieinhalb Tage im Leben einer vergesslichen Lehr„kraft“
Am Dienstagmorgen erschien Frederic Müller wieder einmal, ein Schüler, der sich nur hin und wieder blicken liess. Ich wusste gar nicht mehr richtig, wie er aussah, ich hatte diese Klasse erst kürzlich übernommen. Er hatte an diesem Tag massenhaft Proben nachzuschreiben, auch in anderen Fächern; es war kurz vor Notenschluss und nur eine einzige Note hatte ich von ihm - drei sollten es sein. Ich bot ihm an, am Abend um halb sechs eine der Proben nachzuschreiben, die andere bewertete ich so oder so mit einer 1, weil sie schon längst fällig gewesen war, es sich zudem um eine Aufgabe handelte, die er hätte zu Hause erledigen und mir dann schicken können. Dies hatte er genau gewusst, da ich das Datum auf dem Stoffplan vermerkt hatte, den jeder Schüler am Anfang des Semesters bekam. Er beklagte sich aber, dass ich ihn nicht noch persönlich aufgefordert hatte, sie einzureichen.
Um halb sechs war er da, ich beschäftigte meine Klasse (Freifach Englisch) für zehn Minuten, denn zwei Schülerinnen mussten ebenfalls eine Probe nachschreiben, für die ich erst noch je ein „spicksicheres“ Zimmer suchen musste. Die Pause hatte dazu nicht gereicht. Dann begleitete ich Herrn Müller ins Informatikzimmer hinunter, wies ihm einen Platz an, händigte ihm das Aufgabenblatt aus, erklärte ihm, aus welchem Verzeichnis er die Unterlage auf seine Diskette laden könne, sagte ihm, wo er mich finde, falls er Fragen habe und überliess ihn seinem Schicksal.
Nach einer halben Stunde tauchte er wieder auf, gab mir die Diskette und das Arbeitsblatt und verschwand. Erst dann merkte ich, dass er gar nichts ausgedruckt hatte.
Inzwischen hatte ich meinen Englischschülern ihre Proben, die sie eine Woche zuvor geschrieben hatten, zurückgegeben und wir besprachen sie. Sie waren überhaupt nicht zufrieden mit dem Resultat beziehungsweise mit ihren Noten - ich noch weniger.
„Wie kommt es“, fragte ich, „dass nur so wenige die Wörter auf Seite 61 gelernt haben?“ In der Probe handelte es sich um drei Aufgaben. Bei der ersten ging es darum, die Monatsnamen hinzuschreiben (da gab es wohl kaum etwas zu lernen für eine Klasse, bei der die meisten bereits mehr als zwei Jahre Englisch gehabt hatten), bei der zweiten musste man etwa zehn Wörter verschiedenen Bildern zuordnen („the moon“ und ein Bild vom Mond, etc.) und bei der dritten Aufgabe mussten ein paar Wörter übersetzt werden. Zusätzlich galt es zu unterstreichen, welche Silbe betont wird. Aus einer Liste von zwanzig Begriffen waren es zehn Wörter, die meist auf der ersten Silbe betont werden („lightning“ z.B.). Selbstverständlich hatten wir das geübt und ich hatte in der letzten Stunde gefragt, ob eines dieser Wörter nicht bekannt sei. Zwei wurden gefragt, die wurden übersetzt, die restlichen also waren offenbar klar. – Aber nein, eine Schülerin warf mir ziemlich vorwurfsvoll vor, es hätte sie viel Zeit gekostet, all diese Wörter zu Hause übersetzen zu müssen. Wieso sie in der Stunde nicht gefragt hatte, konnte sie mir auch nicht erklären.
Eine andere Schülerin übertraf alle meine Erwartungen betreffend Erklärungen, sie beklagte sich nämlich, dass es bei dieser letzten Aufgabe ja nur ums Betonen gegangen sei, ich hätte ihnen nicht gesagt, dass man auch die Bedeutung kennen müsse. – Jetzt gebe ich seit mehr als zwanzig Jahren Schule, aber das ist mir noch nie passiert. Jetzt hatte ich doch tatsächlich vergessen, ausdrücklich zu sagen, dass nicht nur die Betonung stimmen sollte, nein, unvorstellbar, man sollte auch noch die Bedeutung des Wortes kennen, das für die Probe gelernt werden musste. - Ja, das hätte ich sagen sollen. Sonst habe ich dann in einem Jahr eine Klasse voller Schüler, die wunderbar betonen können, aber keine Ahnung haben, was sie sagen. - So lernt man eben immer wieder dazu! - Vor Jahren mal (Google war damals noch unbekannt) hatte ich von einem Schüler eine ähnlich erstaunliche Antwort erhalten. Auf die Frage, weshalb er die Aufgabe nicht hatte machen können, erklärte er mir, da sei eben ein Wort drin gewesen, das er nicht verstanden habe. - Damals hatte ich auch etwas gelernt. Von da an riet ich meinen Schülern gleich von Anfang an, wenn sie schon freiwillig eine Sprache erlernen wollten, wäre es von Vorteil, sich auch ein Wörterbuch anzuschaffen. Es könnte ja immerhin sein, dass man mal ein Wort nicht versteht oder gar eines nachschlagen möchte…
Nun, nach der Englischstunde fuhr ich los in die Stadt, fand zum Glück auch einen Parkplatz und nahm dann, nach meinen eigenen sieben Lektionen Schule, an einem Teachers-Workshop in der Buchhandlung Stauffacher teil, organisiert von OUP. Gerade sechs interessierte Lehrerinnen waren wir dort. Es gab etwas zu trinken, ein paar nützliche Broschüren und Auskünfte. Anschliessend fuhr ich zu Denise, wo unser „Bookworm-Meeting“ stattfand, das ausnahmsweise von gestern auf heute verschoben worden war. Ich hätte schwören können, dass man mich über diese Verschiebung nicht informiert hatte. So war ich schon gestern dort gewesen. Bei strömendem Regen stand ich vor der Tür, alles war dunkel - ich hatte fast eine Stunde verloren.
Heute nun hatte ich das Buch, das besprochen wurde, natürlich nicht bei mir, genauso wenig wie meine Notizen, da ich ja erst im Laufe des Tages erfahren hatte, dass das Treffen an diesem Abend stattfinden würde.
(Diese Lesezirkel mochte und mag ich sehr gern. Sie finden auch jetzt noch immer etwa sechs- bis achtmal pro Jahr statt. Normalerweise sind wir ungefähr zu acht. Wir lesen einen englischen Roman und eine Kollegin, deren Muttersprache Englisch ist, bereitet einen Fragebogen vor, den wir vorab beantworten. Und so treffen wir uns jeweils im Turnus bei einem Mitglied unserer Gruppe und besprechen das Buch bei einem einfachen Nachtessen, angeregte Diskussionen inbegriffen.)
Um halb elf war ich zu Hause nach einem langen Tag, steckte Müllers Diskette ins Laufwerk A und musste feststellen, dass überhaupt gar nichts auf der Diskette war. Gopfriedli! – Statt morgen um neun in der Schule meinen Sieben-Lektionen-Tag zu beginnen, musste ich nun schon vor acht dort sein, denn vermutlich hatte er das Dokument auf irgendein anderes, falsches Laufwerk gespeichert. Was für eine Freude! - Wenn ich früh genug dort war, konnte ich vielleicht noch herausfinden, was genau da gelaufen war. Und zugleich kam mir in den Sinn, dass ich vergessen hatte, nach der Englischstunde am Abend den Informatikraum abzuschliessen und die Geräte abzustellen. Jetzt war’s dafür zu spät, aber vielleicht auch ganz gut, so hatte ich die Möglichkeit, herauszufinden, wo Herrn Müllers Probe abgespeichert war.
Um Viertel vor acht war ich in der Schule, der bsd., gerade rechtzeitig, bevor der Raum von einer anderen Klasse belegt wurde. - Letzte Dateien: Gar nichts war zu finden. Ich konnte mir keinen Reim darauf machen, was passiert war. Schliesslich hatte mir Herr Müller doch die Diskette abgegeben und sich verabschiedet. Er hätte doch sicher etwas gesagt, wenn er die Aufgabe nicht gemacht hätte. – Im Sekretariat dann erfuhr ich seine Telefonnummer - privat und Geschäft. Und sah, dass ein ganzes „Müller-File“ existierte, ein grosses Dossier mit x Verwarnungen und sogar zwei oder drei richterlichen Verzeigungen. Der muss mir ein Früchtlein sein, dachte ich mir; sein Hobby scheint es zu sein, unentschuldigte Absenzen zu sammeln. Kosten scheut er offenbar keine. Ich rief an und erreichte ihn zu Hause. Ja, er habe das nicht machen können, es sei nicht gegangen, da habe es ihn angeschissen, was hätte er sonst tun sollen? - Wieso er denn nichts gesagt habe, fragte ich ihn und erinnerte ihn daran, dass ich ihm ja mit dem Nachschreiben der Probe entgegengekommen sei und dass ich seinetwegen unnütz Zeit verloren hätte. Ich war ziemlich sauer - er überhaupt nicht interessiert – das Wort „Entschuldigung“ ganz offensichtlich in seinem Vokabular nicht existent.
Nachträglich fragte ich mich, ob das „Nicht-Machen“ der Probe eventuell damit zusammenhing, dass ich ihm eine neue Probe vorbereitet hatte und nicht dieselbe, die seine Kameraden zuvor gemacht hatten. – Mit einem gewissen niedrigen Gefühl der Befriedigung trug ich alsdann eine 2 in sein Notenblatt ein, der Durchschnitt seiner Semesterleistung.
Die vier Lektionen mit meiner eigenen Klasse verliefen daraufhin sehr erfreulich, zwar waren gleich drei Schüler nicht aufgekreuzt (war der Grund die angesagte Probe?), aber eines der Ergebnisse der Deutschstunde war zumindest, dass sich die Klasse ziemlich einstimmig auf eine Lektüre einigen konnte, die wir im nächsten Semester lesen wollten. Und was ich total gut fand: Ein Schüler sagte, er lese sonst nie, war nun aber so begeistert von den drei ersten Seiten eines der vorgestellten Bücher, dass er darum bat, es mit nach Hause nehmen und dort lesen zu dürfen. - Was für ein Erfolg!
Um Viertel nach zwölf war die Schule aus. Wo war mein Schlüsselbund? - Nach zehnminütiger Suche fand ich ihn im Kopierzimmer, Gott sei Dank - schon wieder Zeit verloren für nichts. Und eine Kollegin brachte mir den Rodel, den ich im Lehrerzimmer hatte liegen lassen. Diesen hatte ich zuvor auch gesucht, dachte aber, ich würde ihn dann zu Hause in all meinen Unterlagen, die ich vorher in der Eile in meine Mappe gestopft hatte, sicher wieder finden. - Ob ich ihr noch den Fragebogen zurückgeben könne über die Schülerbefragungen, den sie mir in mein Fächli gelegt habe, bat sie mich. Den hatte ich vollkommen vergessen; da war eine Entschuldigung fällig. Zu Hause würde ich heute Abend als Erstes danach suchen müssen. Vorerst aber fuhr ich in die Stadt, fand sogleich einen Parkplatz. Das ist meine Stärke. Ich finde immer einen. Zwar nicht immer einen legalen, aber auch Bussen habe ich selten, obwohl ich stundenlang auf gelben Feldern parkiere. Der „Verkehrsgott“, jedenfalls derjenige des stehenden Verkehrs, meint es gut mit mir. Derjenige, der für die Vergesslichkeit zuständig ist, leider weniger.
In der Buchhandlung Stauffacher kaufte ich ein Buch und merkte beim Zahlen, dass meine Postcard fehlte. Ich nervte mich ob mir selbst. Immer dieses „Gjufu“. Genauso passiert es eben; ich musste mir in Ruhe überlegen, wo ich die Karte zum letzten Mal gebraucht hatte.
Und dann war die Zeit schon wieder knapp. Weiter ging‘s in die Lorraine, in die BMS - noch drei Lektionen. Dort angekommen lief ich unserem ehemaligen Direktor in die Arme, buchstäblich fast gar. Ich konnte ihn ja nicht einfach so stehen lassen, das wäre unfreundlich gewesen, also plauderte ich ein wenig mit ihm, kam dann allerdings fünf Minuten zu spät in die Klasse. An dem Tag aber machte das gar nichts, da die Schüler im Grunde genommen gar nicht zu kommen brauchten, sie hatten die schriftlichen Prüfungen bereits abgelegt, es ging lediglich darum, fürs Mündliche zu üben mit denen, die wollten. Es wollten zwei. Aber nicht lange. Dann wollten sie bei dieser Hitze lieber baden gehen. Ich auch. So wurde aus zwei Lektionen nur knapp eine einzige. - Zwei Stunden Zeit bis zur nächsten Lektion: Das reichte grad knapp für einen Besuch im Marzili. Nach einem kurzen, kühlen Bad in der kalten Aare legte ich mich ins Gras, nahm mein Buch hervor und schlief gleich ein. Nicht lange. Mir kam nämlich in den Sinne, dass ich am nächsten Tag zum Arzt würde gehen müssen. In meiner Agenda wollte ich nachschauen, wann genau, aber die war nicht aufzufinden. Ich musste sie am Morgen in der Schule vergessen haben. Ende also der Musse. Rasch zog ich mich wieder an und raste unverzüglich in die Postgasse (durch die Matte, wo nur Zubringerdienst gestattet war - das hätte mich 120.— Fr. Busse gekostet, wenn da nicht auch der Gott des fliessenden Verkehrs ein Einsehen gehabt hätte), suchte überall nach meiner Agenda, aber sie war nirgends. Zurück in der BMS blieb für diesen Tag noch eine letzte Stunde Unterricht übrig. Trotz aller Hektik schaffte ich es rechtzeitig ins Schulzimmer – zu einer sehr erfreulichen Stunde. Es ist jeweils ein Hit, wenn die Schüler motiviert sind und die Fremdsprache auch anwenden wollen. Ich kämpfe in manchen Klassen vergeblich dagegen an, dass, sobald ich den Rücken gedreht habe, die Schüler berndeutsch weiterplappern. Hier nicht. Das war ein riesiger Aufsteller! Ich sagte es ihnen.
Um Viertel nach sechs war mein Arbeitstag zu Ende. Im Englisch-Vorbereitungszimmer stellte ich den PC an – Zeit, mich wieder um den Verbleib der Agenda und der Postcard zu kümmern. Inzwischen hatte ich mir überlegt, dass ich sie vielleicht im Migros Ostermundigen hatte liegen lassen. Ich rief an, aber dort war sie nicht aufgetaucht.
Mein nächster Anruf war nach Hause, wo mir Theo sagte, die Buchhandlung Stauffacher hätte angerufen. Sie hatten meine Agenda gefunden, ich könne sie abholen. – Was für eine Freude! - Und bei erneuter Durchsicht meiner Handtasche fand ich auch tatsächlich meine verloren geglaubte Kreditkarte wieder. Zuunterst war sie, dort, wo sie überhaupt nicht hingehört. Aber Hauptsache, sie war da. Ich hatte sie also buchstäblich in meiner Handtasche verloren… „Was bin ich nur für ein Chaot?“, dachte ich.
Ein feines Nachtessen, ein himmlischer Wein und ein Bridgeabend mit Freunden, wo ich recht gute Karten hatte, stellten mich vollends auf. Um Mitternacht war ich zu Hause.
Am nächsten Morgen nahm ich’s gemütlich. An dem Tag hatte ich frei. Zwar fand ich schon wieder den Schlüsselbund nicht, musste den Ersatzschlüssel aktivieren. Den Fragebogen fürs Sekretariat wenigstens hatte ich gefunden. Ich füllte ihn aus und brachte ihn mit den nötigen Entschuldigungen in die Schule.
Meine Agenda und auch das Etui mit meinem Fahrausweis, das ich bei Stauffacher ebenfalls beim Zahlen auf den Tresen gelegt haben musste, als ich nach der Kreditkarte suchte, das ich aber noch gar nicht vermisst hatte, waren wieder in meinem Besitz. Als ich dann am Mittag sogar noch meinen Schlüsselbund wieder fand, war die Erleichterung gross. Ich musste ihn in der Nacht zuvor, als ich heimkam, auf den Stuhl in der Garderobe gelegt haben und dort war er heruntergefallen.
Im Nachhinein kam mir alles vor wie im Märchen mit Happyend. Wie lange diese Glückssträhne anhalten würde, wusste ich natürlich nicht, konnte nur hoffen.
Ein Freund von mir, ein Spanier, hatte mir gestern Nachmittag im Marzili gesagt, diese Woche sei das eben so bei den Wassermännern. Da vergesse man alles. - Das war ausserordentlich beruhigend. Wenn’s sogar im Horoskop stand, konnte ich ja kaum selber verantwortlich sein für das ganze Chaos.
Projektwochen in den beiden Berufsschulen
Jedes Jahr wurde je eine Projektwoche organisiert. Zweck davon war es, den Schülerinnen und Schülern ein besonderes Erlebnis zu bereiten und ihnen die Möglichkeit zu bieten, sich für einmal intensiver mit einem bestimmten Thema zu befassen.
Ich konnte nur selten mitmachen, da ich ja an beiden Schulen angestellt war und somit nicht beliebig einsatzfähig war.
„Alkohol“ aber war mal ein Projekt, bei dem ich eine Kollegin unterstützen konnte. Der Kurs beinhaltete Besuche bei der Polizei, beim Blauen Kreuz, in einer Entziehungsanstalt und natürlich Internet-Recherchen.
„Eine eigene Homepage kreieren“ war ein weiteres Thema, das ich zusammen mit einem Kollegen anbot. Das ist aber sehr lange her – noch im letzten Jahrtausend war das...
Beliebt waren die BMS-Exkursionen in ein anderes Land. Diese waren in der Regel sofort ausgebucht. Nur gerade zum Vergnügen durften diese Reisen natürlich nicht sein. In den Anfängen zwar, als diese neu in den Jahreslehrplan einflossen, wurde alles von den Lehrpersonen selber organisiert. Erst später änderte sich das Prozedere. Museumsbesuche, Betriebsbesichtigungen und auch Theaterbesuche mussten von den Schülerinnen und Schülern selber organisiert werden. So lernten Sie Unterkünfte buchen, Zug- oder Flugreisen reservieren, miteinander im Team arbeiten und entscheiden, welche Vorstellungen oder Aktivitäten gemeinsam besucht werden sollten etc. Auch für mich waren diese Erkundungstouren besondere Erlebnisse. Gut erinnere ich mich an Besuche in Prag, Amsterdam, Berlin und München.
An die vier Tage in München im Mai 1996 erinnere ich mich besonders gut, weil ich dort einen Bericht schrieb, den ich hier einfüge:
Die Sonnenbrille hätte ich nicht einzupacken brauchen. Auch den Sommerrock nicht. Den Regenschirm aber schon. Auch hätte ich Handschuhe, warme Pullover und Socken sowie wetterfestes Schuhwerk brauchen können. So ausgerüstet hätte ich aller Unbill unerschrocken trotzen können. So aber nicht. lch hatte mir Mühe gegeben, meinen Koffer möglichst geschickt und effizient zu packen. Was mir lediglich gelang, war, ihn voll zu kriegen %u2011 voll mit unnützen, unbrauchbaren Utensilien wie T%u2011Shirts und dergleichen. Die T%u2011Shirts wären wenigsten sommerlich farbig gewesen, der Rock ebenso, aber die spärlichen wärmeren Sachen, die ich bei mir hatte, präsentierten sich eher eintönig, ähnlich wie das Wetter. Schwarz und Grau waren die vorherrschenden Farben. Das kommt daher, dass ich eben finde, Schwarz passt zu fast allem, vor allem zu Schwarz.
Die Reise war billig; die Pension „Diana“ dementsprechend. Der miefige Geruch im Frühstückszimmer war auch mit rund um die Uhr geöffneten Fenstern nicht wegzukriegen. Aber wir waren vorbereitet. Wir wussten, dass es pro Etage nur eine Dusche hat. Was wir nicht wussten, war, dass es nur eine einzige Etage gab, vermutlich mit rund dreissig Betten. Und ausgebucht. Es gab auch nur eine Damentoilette. Aus sicherer Quelle weiss ich, dass sie nicht nur von Damen benutzt wurde.
Dafür wurden wir reichlich entschädigt mit unseren Zimmern: Whirlpool, eine reich bestückte Minibar, ein gemütliches Cheminée und jede Menge Platz. So jedenfalls in lvos Phantasie. Einzig das gebündelte Licht des Nachttischlämpchens entsprach nicht ganz seinen Vorstellungen von ambienter Beleuchtung. Er fand, jeder Röntgenstrahl müsste vor Neid erblassen.
(In der Klasse BMSC4C war Ivo der Klassenlehrer (Deutsch); er hatte die Exkursion organisiert, ich war lediglich die Begleitung, kannte aber die Klasse, da sie bei mir Englisch hatten.)
Eines unserer „Probleme“ war, wie viel Freiheit wir unseren Schülern lassen sollten bei der Gestaltung ihres Aufenthalts. Wir kamen bald überein, diverse Programme vorzuschlagen und zu versuchen, ihnen diese schmackhaft zu machen. Die endgültige Wahl sollte dann bei ihnen liegen, und wir waren uns einig, dass wir niemanden zu seinem Glück zwingen wollten. Nur einmal übten wir einen sanften Druck auf sie aus. Um den üblichen und ausschliesslichen Besuch des „Pizza Hut“ oder des „McDonald“ zumindest einmal mit Sicherheit zu umgehen und unseren „Kids", wie lvo sie oft nannte, ein authentisches München %u2011 Erlebnis aufzuzwingen, reservierten wir kurzerhand für uns alle zwei Tische in einem echten Münchner Lokal, angeblich dem ältesten Gasthaus der Stadt. Im Merian%u2011Führer steht:
„0riginell und ,urig‘ ist es in jedem Fall!“. ,Derb' und ,deftig‘ wären meiner Meinung nach auch noch zwei passende Adjektive in diesem Zusammenhang. Nicht ganz einfach war es hingegen, auch unsere Vegetarier mit ein paar beruhigenden und aufmunternden Worten dazu zu bewegen, sich mit uns ins Abenteuer zu wagen und sich durch nichts, auch nicht durch die Lektüre der Speisekarte, abschrecken zu lassen. Dies gelang nach vereinten Anstrengungen nahezu perfekt. Alle waren dabei. Allerdings regte sich gewisser Widerstand oder eher Widerwille beim Aussuchen der schmackhaften Gerichte. So waren schliesslich eher Salat und Käsespätzle mit Zwiebelschweize gefragt; eindeutig weniger begehrt waren Spanferkel und Bratenpfannerl, süss%u2011saures Lüngerl mit Knödel, Schweinelendchen (auf die Betonung kommt es an), Ochsenbrust (oder zumindest ein Teil davon), Schweinsherz gesotten (lieblos, diese Bezeichnungen %u2011 nicht wie in Frankreich), Surhaxen und Tellerfleisch (?). Auch zu Presssack (Sülzwurst aus gepökeltem Schweinskopf) fehlte den meisten der Mut.
Bedient wurden wir von grazilem, zurückhaltendem weiblichem Servierpersonal…
Niels war am ersten Abend der Bierschwemme wohl nicht ganz gewachsen. Er versicherte am nächsten Tag glaubhaft, er habe nicht bemerkt, dass er den Polstersessel in der Pension mit dem Aschenbecher verwechselt habe. Aber eine Visitenkarte, die er in Form seiner Brille am Tatort zurückgelassen hatte, liess kaum mehr Zweifel offen. Zum Glück war der Pensions-Wirt ein Mann mit Nerven wie Drahtseile und zweifellos etliches von seinen Pensionären gewohnt. Er wies nur auf die Brandgefahr hin und liess sich auch nicht durch die blau verfärbte Dusche (siehe weiter unten) aus der Ruhe bringen. Ob er sich auch durch den absonderlichen Geschmack der Räucherstäbchen, der aus einem bestimmten Zimmer drang, nicht hat beirren lassen, wissen wir nicht. Als wir gingen, hat er sich gar noch entschuldigt, dass die Pension höheren Ansprüchen wohl nicht ganz genüge.
Nachtruhestörung wäre noch ein weiteres behandlungswürdiges Thema, aber das lasse ich jetzt besser. Am letzten Abend war es übrigens Andreas, der einschlägige Erfahrungen mit Bier machte. Zugegeben, Biergenuss ist ein absolutes „Muss" für so manchen Besucher der bayrischen Hauptstadt, aber einer gewissen Standfestigkeit bedarf es natürlich allemal. Ob er je in seinem Leben wieder mal ein Bier trinken wird, ist fraglich. Kleinlaut gab er am nächsten Morgen jedenfalls zu, dass ihm schon beim blossen Anblick dieses Gebräus fast wieder übel werde.
Auch geraucht wurde zeitweise masslos. Aber der Versuch der beiden Philipp (oder war einer der beiden Niels?), im Frühstückszimmer diesem Laster zu frönen, wurde jäh, endgültig und ohne den geringsten Zweifel an der Unanfechtbarkeit seiner Worte offen zu lassen von einem Berner Mitbewohner der Pension abgebrochen oder noch besser gesagt im Keime erstickt. Was dieser, der offenbar schon länger in München weilte und der sich die erfrischend offene unmissverständliche Sprache der Bewohner dieser Gegend bereits angeeignet hatte in ein paar wenigen Sätzen zustande brachte, war bemerkenswert. Zugegebenermassen war seine Botschaft nicht sehr diplomatisch, dafür umso effektvoller und effizienter. Um das Gleiche zu erreichen, hätte es unsererseits wohl eines längeren Gesprächs unter vier Augen bedurft. „Sou-gruusig" sei es, donnerte er, und die Wirkung seiner Worte blieb nicht aus. Augenblicklich wurden die Glimmstengel gelöscht und wir konnten von da an jeden Morgen unser Frühstück rauchfrei und bar jeglicher Diskussion sozusagen in Minne geniessen.
Zur Farbe Blau: Sie spielte bei unserer Exkursion eine nicht unerhebliche Rolle. Ich will hier nur auf einen Teilaspekt des ganzen Problemkreises eingehen. Dieser zeigte sich am zweitletzten Tag unübersehbar auf den Köpfen unserer beiden Damen Marlène und Fränzi. „Blue is beautiful“. Auch die bläulichen Hände (an Wasserleichen erinnernd) verrieten klar und deutlich, wer von den jungen Herren ohne Schutzhandschuhe den Damen beim Haarefärben (in der einzigen Etagen-Douche, wie gesagt) geholfen hatte.
Auch von kulturellen Höhepunkten kann ich berichten, von einem Theaterabend auf den Spuren Karl Valentins: Wer da freiwillig mitkam, und das waren doch immerhin Niels, Philipp B. und Andreas (da noch in makelloser Verfassung), bekam noch ein weiteres Stück münchnerischer Wirklichkeit mit. Es war ein Sprachkurs der besonderen Art, ein schrulliges Volkstheater, bei dem auch der lederhosige Präsentator mit den üblichen baarischen, damischen, depperten Sprüchen nicht fehlte. (Ein Junge ruft aus dem Badezimmer seiner Mutter zu: „Wo ist denn der Waschlappen?" - Die Mutter antwortet: „Seit einer Stunde im Büro!“)
Wir wissen jetzt auch, was 'et cetera' bedeutet: Der Bayer braucht eine Frau fürs Putzen, Kochen, Waschen etc. - Und zusätzlich wurden wir ins Bild gesetzt über weibliche und männliche Nomen, die männlichen, die das Schöne verkörpern (der Mond, der Tag, der Duft, der Frühling, der Sonnenschein und natürlich auch der Busen, obwohl der ja schon auch weiblich ist) und die weiblichen folgerichtig das Schlechte (die Lüge, die Niedertracht, die Gemeinheit und nicht zuletzt die Steuer).
Auf so viel derbe Lustigkeit folgte sogleich ein rigoroser Szenenwechsel, nämlich ein Discobesuch im Herzen Schwabings. Dorthin geführt wurden wir von Fränzi und Marlène (jetzt aus bekannten Gründen äusserlich ziemlich blau) und Michael S., die uns unbeirrt und zielsicher durch die ,Szene' an den Ort des Geschehens führten. Hier war es allerdings so, dass der Rauch eher weniger das Schöne verkörperte hingegen ‚die Lautstärke‘ natürlich schon.
Erneuter Szenenwechsel kurz vor Mitternacht; Dislozierung zur Disco „An der Tankstelle“. Da waren dann wieder fast alle mit dabei, ausser dem unzertrennlichen Trio Cornelius, Philipp Z. und Raffaele. Einmal mehr gingen sie ihre eigenen Wege. Fehlen tat auch Michael L.; bei ihm allerdings wussten wir genau, wo er war und was er dort trieb. Er lag bereits im Bett, der ständigen Übermüdung schliesslich nicht mehr gewachsen. Dafür konnten unsere Damen Peter (schon im Pyjama), der kollegialerweise seinen Freund nicht hatte im Stich lassen wollen, offenbar problemlos überreden, sich doch noch loszueisen und mitzukommen. Er schien sehr zufrieden!
Loszueisen versuchte ich auch Ivo, und zwar um drei Uhr morgens aus besagter Disco. Dies war ein eher schwieriges Unterfangen, denn er war dabei, eine nicht mehr enden wollende Tanzeinlage zum Besten zu geben, wohl inspiriert von Philipp B., der in inniger Versenkung das Ganze anschaulich vorgelebt hatte. Auch Denis war gelegentlich auf der Tanzfläche zu sehen. So gab's wenigstens zwischendurch einen freien Platz zum Sitzen. Seine Spezialität ist es nämlich, sich ohne Rücksicht auf Verluste und in liebenswerter Weise den einzigen frei verfügbaren Platz zu ergattern, sei dies im Tram, in der U-Bahn oder eben in der Disco. Naturgemäss hat jedermann dafür Verständnis; schliesslich leben wir im Zeitalter der Gleichberechtigung.
Andersartige Studien betreiben konnten wir auf den Spuren der deutschen Sprache. Da lernten wir so manches. Wir begriffen rasch, dass auf präzise klare Formulierungen und zackige Bekanntmachungen grösster Wert gelegt wird. Das wird bereits in Tram deutlich. Die „Notfallapotheke A für Kraftwagen" findet man sofort. Aber eigentlich beginnt es schon bei der gedeckten Haltestelle. Es heisst dort im Klartext: „Dies ist eine Strassenbahnhaltestelle. Der Aufenthalt zu anderen Zwecken ist nicht gestattet."
Aber erstaunlich war es doch: Die Tatsache, dass strikte Anweisungen ja bekanntlich wie nichts anderes dazu verleiten, sie zu verletzen oder zu umgehen, scheint dem U-Bahn-Management zumindest nicht ganz fremd zu sein. So hat sich ein findiger Pädagoge daran gemacht, diesem Missstand entschieden entgegenzutreten, und er hat's mit Humor versucht, und zwar mit Humor vom Feinsten. Mit einer Witzzeichnung und einem flotten Spruch in Versform (hab' ihn leider nicht aufgeschrieben, da Projekt für Reisebericht damals noch nicht geboren), im Sinne von: „... tut's dem Nachbarn in den Ohren jucken, ..." (auch der dazugehörige Reim ist leider meinem Gedächtnis entschwunden), wurde der bemerkenswerte Versuch unternommen, die Klientel dazu zu bewegen, den Walkman in angemessener Lautstärke einzustellen. Allerdings liessen sich die anfänglichen guten Vorsätze nicht ganz konsequent zu Ende führen, denn schon im zweiten Teil des Textes driftet der Verfasser in die herkömmliche Sprache ab, und es wird, ohne Umschweife diesmal, mit allfälligen Massnahmen gedroht, wenn man sich nicht vorschriftsgemäss verhält. - So nahm also ein psychologisch äusserst geschickt angelegter Versuch, gegen die Verstösse wider Zucht und Ordnung vorzugehen, ein klägliches Ende.
Bemerkenswert war auch der Hinweis neben dem Fenster im vierten Stock in unserer Pension: „Notausstiegstelle. Fenster bitte freilassen." - Von aussen war absolut nirgends eine Nottreppe auszumachen.
Überhaupt hat sich Ivo fast zu viele Gedanken gemacht über den besonderen Sprachgebrauch oder auch über die Auswüchse der Sprache; er ist ja schliesslich Deutschlehrer. Gegenstand vertiefter Betrachtungen war die Tatsache, dass man eine Fahrkarte „entwerten" soll, um sie sogenannt in Kraft zu setzen. Solche negativen Wörter könnte man doch ohne weiteres ersetzen mit „einwerten" zurn Beispiel oder mit "gültig stempeln" oder ähnlichem, man müsste sich dies schon noch genauer überlegen. Auch etwas gelernt hat Ivo. Er weiss jetzt nämlich, dass ein englisch ausgesprochenes Stück Fleisch nicht „Schtiik" heisst; er sagt jetzt lieber "Plätzli".
Noch ein paar Worte zum ZAM (Zentrum ausserordentlicher Museen), welches unsere „Kids“ leider allesamt verpassten, da sie sich nicht aus ihren Betten bewegen konnten (wollten). Dort lernten wir unter anderem in Wort und Bild die tatsächlichen Hintergründe und Ursprünge des Phänomens ,Osterhase' kennen. Offenbar handelt es sich dabei um das Endergebnis der Kopulation zwischen einem Hahn und einer Häsin. Das Produkt war ausgestopft in verschiedenen Variationen zu besichtigen. Dem Präparator ist offensichtlich seine Phantasie völlig aus den Fugen geraten; durch solche Spielereien angeregt, produzierte er nämlich noch andere ausserordentliche Tierkreuzungen, alle im Detail an Ort und Stelle zu besichtigen. Auch wissen wir jetzt, um was für einen Gegenstand es sich bei einem ,Bourdalou' handelt. Auf den ersten Blick könnte man denken, es sei so etwas wie eine Saucière. - Nachttöpfe aus aller Herren Länder, vermoderter Kram der verehrten Kaiserin Sissi und andere Sonderlichkeiten mehr machten den Besuch in diesem skurrilen Museum zum Erlebnis der besonderen Art.
Und dann das Hofbräuhaus! - Schon in dessen Einzugsbereich (mindestens 100 m im Umkreis) wusste man mit untrüglicher Sicherheit, dass man auf dem rechten Weg dorthin war. Torkelnde, bierselige, lallende, hemdsärmelige Fröhlichkeit wankte uns da entgegen – München, wie es leibt und lebt. Und um das Bild abzurunden, gesellte sich dazu noch das lustige Völklein der Fussballfans, die in ihren frohen gelbgrünen Blusen durch die Strassen grölten.
Vermutlich wird in dieser Stadt pro Tag mehr Bier als Wasser umgesetzt. Auch Cornelius schien sichtlich beeindruckt von der Aussage eines Insiders, der es in 12 Stunden auf 17 Mass gebracht haben soll (oder war es umgekehrt?).
lvos Vorschlag, am Sonntagmorgen mit ihm das Orgelkonzert und den Gottesdienst in der Frauenkirche zu besuchen, fiel auf taube Ohren. Er war der Einzige, der diesen Plan in die Tat umsetze; nicht einmal ich war dazu bereit. Zum Glück jedoch, denn sonst hätte ich seine anschauliche, pathetische Wiedergabe und Zusammenfassung des Erlebten verpasst, und die war auf jeden Fall wesentlich eindrucksvoller als es das Original je hätte sein können.
Beim letzten Frühstück war niemand mehr sehr gesprächig, auch Felix nicht. Er sass bloss da und sagte überhaupt gar nichts. Mir war's recht, denn ich wollte unbedingt noch die einzige Ansichtskarte schreiben, die ich schon frankiert hatte und seit zwei Tagen leer und mit bereits leicht lädierten Rändern mit mir herumtrug. So sass ich bei meiner Tasse Tee; aufs sonntägliche Frühstück hatte ich verzichtet, da es lediglich aus zwei Scheiben gummiartigem Brot bestand. Aber nach nur fünf Stunden Schlaf war mein Geist noch nicht sehr rege, und sämtliche brillanten Ideen waren mir ausgegangen. Da stand mir in verdankenswerter Weise Ivo einmal mehr hilfreich zur Seite mit äusserst brauchbaren Vorschlägen. Er sagte, ich solle schreiben: „Besonders beeindruckt standen wir vor dem stillen, in sich gekehrten Wesen der Bayern.“ Und noch etwas Weiteres fand er erwähnenswert: „Wie auf Flügeln trug uns der Anblick der grazil gebauten Landestöchter.“ Da war die Karte voll. Und so geht endlich auch mein Reisebericht seinem Ende entgegen.
Fazit: München ist mehr als nur eine Reise wert. Es ist immer gut, wenn man bei der Heimreise genau weiss, was mal beim nächsten Besuch noch alles planen kann. Vielleicht wird es mir ein anderes Mal sogar gelingen, hinter das Geheimnis der Verteilung der Hausnummern in dieser Stadt zu kommen. Welches System dem genau zugrunde liegt, ist mir ein Rätsel. Da gibt es beispielsweise Strassen, wo plötzlich auf ungerade Nummern gerade folgen in unwillkürlicher Anordnung; auch werden Nummern ganz einfach übersprungen oder noch verwirrender: Dieselbe Strasse ändert unvermittelt ihren Namen. Die Adresse „Im Tal 10' gibt es gegenüberliegend auf beiden Strassenseiten. Für Eingeweihte ist das sicher kein Problem, aber für Touristen kann es durchaus zu einem werden.
Einmal möchte ich gerne durch den Englischen Garten schlendern (vielleicht kommt es auch in München vor, dass die Sonne scheint), auf den Olympiaturm steigen (war zwecklos, da alles Grau in Grau), die Neue Pinakothek besuchen (lag nicht drin aus Zeitmangel; eine Schande, ich weiss), ebenso Schloss Nymphenburg und manches andere mehr - was haben wir denn eigentlich gemacht die ganze Zeit?
Erwähnen will ich zur Beruhigung aber doch noch, dass wir gleich am ersten Tag, kurz nach Ankunft, gemeinsam eine Stadtrundfahrt unternommen haben. Ebenfalls waren wir alle zusammen im Deutschen Museum, auch wenn ich nicht im Besonderen darüber berichtet habe (einige von uns sind jetzt Experten im Bergbau). Auch die Bavaria Filmstadt war für uns ein fester Programmteil unseres ,Sightseeing'. Davon blieb ein mannigfaltiger Eindruck zurück. Sicher werden wir die erfrischende Fahrt im offenen Bähnli durch das weitläufige Gelände nicht so rasch vergessen. Auch werden wir uns stets an unsere Statisten erinnern, an Ivo als angetrunkenen Kapitän, Philipp B. als Liebhaber in Not und an Philipp Z. mit einer Schönen auf dem Untier durch die unendliche Geschichte schwebend.
Bevor nun meine Geschichte auch unendlich wird, komme ich zum Schluss. - So gut auch alles gegangen war, froh war ich trotzdem, als wir schliesslich alle vollständig und unversehrt im Zugabteil sassen, bereit zur Heimfahrt. Dass mir dann die Klasse kurz vor Bern eine Rose überreichte und einen kleinen uralten Asbach, hat mich gefreut und gerührt. Ich nehme die Rose als Ausdruck dafür, dass alle mit ihrer Exkursion zufrieden waren und sie in bester Erinnerung behalten werden.
Den Bericht hatte ich in der darauffolgenden Woche geschrieben mit der Absicht, die Schülerinnen und Schüler zu ermuntern, ihre Erlebnisse ebenfalls zu Papier zu bringen. Nur wenige taten das tatsächlich, was uns ausserordentlich freute und einer schickte uns sogar einen Dankesbrief.
Witze
Witze hatte ich immer gern. Schon als Kind. Und was ich überhaupt nicht begreifen konnte, war, dass mir Erwachsene fast ausnahmslos sagten, sie kennten keine oder würden sie gleich wieder vergessen. – Ein paar Dekaden später hatte und habe ich keine Mühe mehr, das zu verstehen.
Meine Mutter berichtete mir einmal, der erste Witz, den ich erzählt habe, ging so: „Eine Mutter schickte ihr Kind in den Laden. Es sollte ein Kilo Mehl holen. Es brachte dann aber ein Kilo Zucker“. – Kinder haben eben andere Gemüter und auch einen anderen Sinn für Humor. Wie ich das lustig finden konnte, kann ich mir heute nicht mehr vorstellen, und ich weiss auch nicht, ob ich diese Überlieferung überhaupt glauben soll... – Allerdings, wenn ich sehe, was manchmal an „lustigen“ Videos und Texten übers Internet verbreitet wird, dann erscheint mir mein Kinderwitz noch fast plausibel.
Dass der Humor verschiedene Fassetten hat, ist schon klar. Nicht jeder kann über dasselbe lachen. - Nach wie vor liebe ich die Kleinkunst, Kabarett vor allem. Und das Schöne ist, man geht mit Freunden ins Kleintheater, hat sich wiedermal gesehen und einen äusserst vergnüglichen Abend zusammen verbracht. Vielleicht noch ein Nachtessen vor oder nachher – das Tüpfchen aufs i. – Weil ich einmal eine schlechte Erfahrung gemacht habe, sehe ich nun in der Regel erst auf YouTube nach, ob mir der Künstler, die Künstlerin passt oder nicht, wenn er oder sie mir unbekannt ist.
Als ich noch unterrichtete, begann ich normalerweise die Englischstunde mit einem Witz, mal kürzer, mal länger. So war garantiert, dass es zumindest einmal pro Stunde etwas zu lachen gab. - Natürlich war da zusätzlich eine unauffällige Vokabelübung mit inbegriffen.
Ein kleines Beispiel:
Clever IdeaI decided to stop worrying about my teenage son's driving and take advantage of it. I got one of those bumper stickers that say:"How's my driving?" and put a 900 number on it. At 50 cents a call, I've been making $38 a week.
Theos Job
Inzwischen arbeitete Theo bei der „Unisource“, einem Unternehmen der PTT, die am 24. April 1992 gegründet wurde und international mit den Telekommunikationsgesellschaften von Schweden, den Niederlanden, und Spanien zusammengeschlossen war. Am 1. Oktober 1997 wurde aus der Telecom PTT die Swisscom. Theo blieb der Firma treu bis er Ende 1999 das ausserordentliche Angebot erhielt, sich bereits mit 55 Jahren pensionieren zu lassen. Das liess er sich nicht zweimal sagen. Sein Grossvater hatte in Vicosoprano ein Hotel geführt und sich mit 45 Jahren in den Ruhestand versetzt. Das wäre auch Theos Ziel gewesen, das er nun um zehn Jahre verpasst hatte. Zehn Jahre vorher pensioniert zu werden, war aber auch nicht schlecht, vor allem, weil er kaum eine Lohneinbusse hatte, woran unsere vier Kinder nicht ganz unschuldig waren (Kinderzulagen).
Mit seinem Job bei der Swisscom war er allerdings immer zufrieden gewesen. Mit dem, was er ursprünglich gelernt hatte, hatte seine effektive Arbeit jedoch wenig zu tun. Es ging darum, Verträge auszuhandeln und dazu musste er auch hin und wieder in Schweden, Holland oder Spanien an Sitzungen und Verhandlungen teilnehmen.
War er aber daheim, genoss er seinen kurzen Arbeitsweg und ich war froh, dass er so gut wie immer mittags zum Essen heimkommen konnte. Das schätzte ich besonders wegen der Kinder sehr. So sahen und erlebten sie ihren Vater nicht nur am Abend und an den Wochenenden.
Auch ging er mit ihnen in den Frühlingsferien nach Bivio zum Skifahren. Sein bester Freund und dessen zwei Kinder gingen ebenfalls jeweils mit, so dass wir Frauen mal „frei“ hatten von Familie und Job und unsere Batterien in einem völligen anderen Umfeld wieder aufladen konnten. Was für ein wunderbarer Tapetenwechsel!
Da ich nicht Skifahren konnte und den Winter überhaupt nicht liebte, waren die Destinationen, die wir auslasen, immer weit im Süden, wo’s heiss und schön war. Ein paarmal führte uns die Reise nach Kenya, wunderbare Rundreisen in Indien sind mir unvergesslich, aber auch Thailand, Bali, Hongkong und Singapur waren Orte, die wir besuchten.
Reisen war schon immer etwas, das mir besonders gefiel und immer noch gefällt. Jetzt, wo auch ich pensioniert bin, erst recht.
Nach einer bestimmten Anzahl Jahren, die man im Schuldienst angestellt war, erhielten wir das Angebot, entweder eine Auszeit von zwei Wochen zu nehmen oder sich auszahlen zu lassen. In meinem Fall geschah das damals nach zwanzig Jahren zum ersten Mal. - Diejenigen von meinen Kolleginnen und Kollegen, welche die zweite Option wählten, konnte ich überhaupt nicht verstehen. Ein Drittel des Zusatzverdienstes ging ja für die Steuern weg und Zeit zu haben, ausserhalb der Schulferien eine Reise zu unternehmen – was konnte es Erstrebenswerteres geben in diesem Zusammenhang!
Mit dem Urlaub war auch die Möglichkeit verbunden, die Überstunden, die sich angesammelt hatten, abzubauen. Davon machte ich jedes Mal liebend gern Gebrauch und wählte das lange Quartal zwischen Herbst- und Winterferien, das ich überhaupt nicht liebte, für meine Auszeit. So konnte ich den grauen Herbsttagen im November, die immer kürzer, nässer und kälter wurden, entfliehen sowie auch der hektische Vorweihnachtszeit. Ich nutzte die Wochen dazu, in verschiedenen Schulen in Südamerika Spanisch zu lernen beziehungsweise meine Sprachkenntnisse, die ich mir in verschiedenen Kursen in Spanien angeeignet hatte, aufzufrischen und zu vertiefen. Auch besuchte ich Lehrerfortbildungskurse in den USA, einmal in La Holla, einen anderen in Fort Lauderdale. Den werde ich nie mehr vergessen, so intensiv und anstrengend war der. Ich beschreibe ihn später im Kapitel Reisen.
Diese langen Aufenthalte im Ausland waren natürlich nur möglich, als die Kinder schon älter waren und mich nicht mehr so sehr brauchten. Meine Mutter war ja auch immer noch da und konnte trotz ihres hohen Alters noch hie und da einspringen, wenn Not an der Frau war. Ich fand es zudem ganz gut, die Kinder und den Vater für eine Zeitlang alleine zurechtkommen zu lassen. Als ich im Jahr 1999 zum ersten Mal so lange weg war, war Kay ja bereits zwanzig und studierte, die Zwillinge achtzehn und der Jüngste lernte mit vierzehn zu kochen und seine eigene Wäsche zu waschen und zusammenzulegen (oder wohl zumindest im Schrank zu versorgen).
So konnte ich unbeschwert die Aufenthalte in Ecuador, Peru und Guatemala geniessen. In Guatemala kam mich Theo in den drei Wochen vor Weihnachten besuchen und wir unternahmen während dieser Zeit eine zehntägige Reise nach Nicaragua. Der Zweck davon war, mein „Patenkind“, das ich dort hatte (World Vision), zu besuchen.
Auch diese Reiseberichte im letzten Kapitel.
Meinen ersten langen Urlaub konnte ich sogar bis zum Ende des Semesters ausdehnen, also bis Ende Januar 2000. Am Tag vor Silvester 1999 flog ich heim und wir konnten den denkwürdigen Millennium-Übergang mit Freunden feiern.
Die erste Woche des neuen Jahres verbrachten wir anschliessend in Bivio mit der Familie. Da ich noch nicht wieder arbeiten musste, blieb ich ganz alleine dort. Für die Kinder (drei von ihnen waren bereits erwachsen) begann der Schul- und Unialltag wieder und obwohl Theo nun pensioniert war, hatte er sich anerboten, mit ihnen heimzufahren und sich dort um sie zu kümmern.
Inzwischen besassen wir seit ein paar Monaten selber ein Haus in Bivio, ein ebenso altes. Schon in den frühen Neunzigerjahren, nach Vaters Tod (1991), hatten Theo und sein Halbbruder das 450 Jahre alte Familienhaus geerbt und wir hatten einen Plan, wie es benutzt werden sollte: abwechslungsweise die eine oder die andere Familie jedes zweite Jahr. Nach den Ferien das Haus aufzuräumen und zu putzen, dass es meiner Schwägerin recht war, war ein Kunststück. Man musste das Wasser abstellen, damit es nicht gefror. Das dauerte mehrere Stunden. Putzen war dann recht schwierig. Heisses Wasser musste in Kübeln parat gestellt werden. Beispielsweise war’s auch nicht einfach, die Böden in dem alten Haus sauber zu kriegen, man sah fast gar nichts von der getanen Arbeit. Ebenfalls galt es, die ganze Bettwäsche auszutauschen. Wir hatten ja auch die vier kleinen Kinder, welche inzwischen irgendwie beschäftigt werden mussten. - Eine Putzfrau, die am nächsten Tag die Arbeit für uns erledigt hätte, wäre die Lösung des Problems gewesen, zumindest teilweise, aber meine Schwägerin und mein Schwager waren dagegen, jemandem einen Schlüssel anzuvertrauen. So ging ich nur wenige Male mit, später während Jahren aber nicht mehr, denn schon vom Anfang der Ferien an graute mir, wenn ich an den letzten Tag vor der Heimreisereise dachte. Theo nahm das gelassener. Er bot mir an, im Frühling ohne mich in die Berge zu gehen. Sein Freund ging jeweils mit und die beiden hatten sechs Kinder zu betreuen. Mir war das mehr als nur recht, ich konnte ja sowieso nicht Skifahren, und die Frühlingsferien fern der Familie in einem warmen Land zu verbringen, war zu jener Zeit das Höchste der Gefühle.
Ohne mein Zutun lernten die Kinder bald schon Skifahren. Es existieren Fotos und Videos aus jener Zeit, wo Kim im Pyjama im Skianzug steckt und ohne Strümpfe oder Socken in den Skischuhen.
Aber diese Bivio-Ferien waren im Jahr 2000 auch schon Schnee von gestern. – Nun waren die Kinder grösser, drei davon erwachsen.
Weil das Wetter strahlend schön war, es kaum Leute hatte auf der Piste, für die ich hätte eine Bedrohung sein können, und niemand von der Familie da war, der blöde Bemerkungen hätte machen können, hatte ich plötzlich die abenteuerliche Idee, doch noch Skifahren zu lernen. Und das in meinem Alter und nach all den Jahren, wo ich schon nur Panik bekam bei dem Gedanken, auf einem Brett zu stehen, das sich bewegt. Meine grösste Angst war, mich zu verletzen und im Spital zu landen. Nichtsdestotrotz nahm ich schliesslich Skiunterricht bei Nino, unserem Nachbarn.
Der Anfang war nicht einfach. Genau wie in meinen Vorstellungen machten mir schon nur die Skischuhe Mühe: eng, unbequem im höchsten Mass - keine Bewegung mehr möglich, fast wie in einem Gips. Spanische Stiefel?! – Mit war nicht einmal klar, ob es einen rechten und einen linken Ski gibt. – Aber all das lernte ich rasch. Genauso, wie mich richtig anzuziehen. Trotz blauem Himmel und Sonnenschein war es sehr kalt und aus Furcht, ich könnte mich bei dem Experiment zu Tode frieren, zog ich unter den Skihosen Manchesterhosen an, Strumpfhosen und dicke Socken, oben ein Hemd, dann zwei warme Pullis, darüber natürlich die Skijacke. – Es dauerte keine zehn Minuten und ich kam mir vor wie in einer Sauna, musste schnellstens die überflüssige Kleidung ausziehen.
Nie hätte ich gedacht, dass ich innerhalb einer Woche tatsächlich lernte, den ganzen Berg schlecht und recht hinunterzufahren von der Bergstation auf 2600 Meter zurück ins Dorf auf 1800 Meter bis vor unsere Haustüre. - Ohne Beinbruch!
Es bedurfte noch vieler Übung, bis ich einigermassen sicher auf den Brettern stand. An manchen Wochenenden übte ich das Gelernte und war fast ein wenig enttäuscht, als Ende März die Skisaison vorbei war. - Mein Stolz, dass mir das gelungen war, kannte fast keine Grenzen, und zum ersten Mal freute ich mich wie verrückt auf die Winterferien im nächsten Jahr, wo ich dann erneut Skifahren gehen konnte.
Es war im Februar 2000, als ich meine Arbeit in den beiden Schulen wieder aufnahm, und es vergingen kaum ein paar Tage, schon war ich wieder an den alten Trott gewohnt. Mit frisch aufgeladenen Batterien hatte ich zum ersten Mal fast eine volle Stelle, denn überall fehlte es an Lehrpersonal und mir war’s ganz recht, neue Überzeit anzuhäufen, die ich dann für den nächsten Urlaub nutzen konnte.
Den Kindern und mir, da ich nun Skifahren konnte, gefiel der Winter in Bivio immer besser und wir erwarben 2003 ein weiteres Haus („nur“ etwa 350 Jahre alt), so dass es uns und auch den Jungen möglich war, Freunde einzuladen und die Ferien mit ihnen zu verbringen.
Die Tatsache, dass wir an einem so schönen Ort zwei Häuser besitzen, ich aber im Sommer nicht gerne nach Bivio gehe, weil es mir am Abend dort zu kalt ist, hat dazu geführt, dass wir seit mehr als zehn Jahren unsere Ferien an wunderbaren Orten verbringen können, weil wir Häuser tauschen. Ein Kollege hatte mich auf eine Internetplattform aufmerksam gemacht, die Haustausche vermittelt – eine wunderbare Sache. Im dritten Kapitel „Reiseberichte“ werde ich darüber Näheres erzählen.
Vorerst aber noch all die „Kurzberichte“ über meine Schwiegermutter, deren Besuche mich ständig zum Schreiben animierten. Zwar nicht, weil sie das wollte, nein, ich hätte ihr meine Berichte nie zeigen können/wollen, auch wenn ich schwöre, dass sich alles genau so zugetragen hat, wie ich es damals beschrieb. – Tatsächlich fand ich manches so komisch, dass ich gar nicht anders konnte, als es niederzuschreiben, wenn ich es nicht vergessen wollte.

Kurze Begegnung der seltsamen Art (1995)
Meine Schwiegermutter ist wieder mal aufgekreuzt. Es ist eine Eigenheit von ihr, ganz plötzlich da zu sein.
Mit einem bisschen Gespür würde das drohende Herannahen allerdings voraussehbar sein - unsere Katzen beginnen nämlich, kurz vor der unausweichlichen Begegnung, unruhig zu werden. Solches Verhalten bei Tieren sei ja auch bei Erdbeben zu beobachten, sagt man, allerdings auch dort offenbar zu spät, um rechtzeitig Vorkehrungen treffen zu können.
Zwar glaube ich nicht, dass es sich in unserem Fall um eine Erschütterung der Erde handelt - oder etwa doch? Ist es die Art der Schritte, die unsere Katzen von weither erkennen? Für sie lohnt die Angelegenheit jedenfalls - ohne Frage. Was die Schwiegermutter nämlich mitbringt, sind die Fleischresten ihrer Mittagsmahlzeit aus dem noblen Seniorenheim. Das heisst mit anderen Worten: Kalbsschnitzel, Rindsfilet, Lachs, Entrecôte - wie im Schlaraffenland. Und nie handelt es sich nur um armselige Überreste, nein, ganze Portionen sind es. Aus unerfindlichen Gründen ist Mutter nämlich der unumstösslichen Überzeugung, all diese leckeren Dinge seien ihr nicht bekömmlich. - Die Katzen danken es ihr.
So war es auch heute. Aufs Mal stand sie im Esszimmer, umschmeichelt von Häxli, Zwärgli und Charlie.
Eher lustlos trennte ich mich von der Übung, die ich gerade im Begriff war, in den PC einzugeben, und begrüsste unseren Gast. - Nein, trinken wolle sie nichts, sie müsse gleich wieder gehen, sie habe zu Hause noch so viel zu tun. - Das alte Lied…
Ob ich ihr noch zeigen könne auf der Landkarte, wo ihr Sohn sich jetzt gerade befinde.
(Sie sagt immer „mein Sohn“, das ärgert mich jedes Mal!) Auf ihrer Karte könne sie kaum etwas erkennen. Kein Wunder, dachte ich, bei dem Massstab und erst noch ohne Brille. Selbst für mich ist Hong Kong auf der Europakarte schwierig auszumachen und die Städte in Rajastan, die er während der letzten zwei Wochen besucht hatte, ebenso wenig. Bereitwillig holte ich Atlas und Indienkarte hervor und zeigte ihr, wo „ihr Sohn“ wohl gerade war. Sie begriff daraufhin auch, dass es wenig wahrscheinlich sei, dass Theo die Reise von Delhi aus nach Hong Kong mit dem Auto unternommen habe. Zum besseren Verständnis legte ich ihr die Fotoalben hin, die ich nach meiner letzten Indienreise zusammengestellt hatte. Zwei dicke Alben voll sind es; die Schwiegermutter war also beschäftigt. - Da sass sie nun in Hut und Mantel (einem ausgesprochen hässlichen, der neckischen Anstecknadel längstens verlustig gegangenen Hut, allwettertauglich, der ehemals, das heisst wohl etwa in den dreissiger Jahren, als elegant gegolten haben mag, beige oder jetzt eher „a shade of grey“) und für mich war es jetzt an der Zeit, mich in die Küche zu begeben, um das Abendessen zuzubereiten. Die seltsamen Kommentare, die sie von Zeit zu Zeit zu den Fotos murmelte, kriegte ich nur zum Teil mit; ich konzentrierte mich eher auf die Nachrichten am Radio.
„Ich habe genug Rösti gemacht für uns alle“, sagte ich zu ihr und forderte sie auf: „Iss doch gleich mit uns!“ - Da war nicht einmal der Schatten eines Widerspruchs; sie zog endlich Hut und Mantel aus, und da sah ich, dass sie, offenbar bereits in Erwartung einer Einladung, ihr zweitbestes Kleid angezogen hatte. Sie weiss schliesslich, was sich gehört: Wenn man eingeladen ist, zieht man sich auch anständig an. Geflissentlich übersah sie meine Jeans.
Das Abendessen verlief in Minne. Die Kinder waren nicht so laut wie sonst manchmal, ihre Diskussionen waren ausnahmsweise recht zahm. Vermutlich waren sie alle müde vom Skilager, aus dem sie am Mittag heimgekommen waren. So verschwanden sie auch gleich nach dem Essen und überliessen mich meinem Schicksal.
Das bestand darin, mir Geschichten anhören zu müssen von Leuten, die ich von Haut und Haar nicht kenne, von deren Verwandten und Bekannten auch, die ich demzufolge noch weniger kenne - es dauerte nicht lange und ich verlor den Faden.
Aber das war nicht so wichtig; meine Zwischenbemerkungen „oh“, „sicher?“, „na ja“ etc. schienen richtig gestreut zu sein. Gedanklich glitt ich ab und dachte an die Schulstunde morgen früh, und mir kam in den Sinn, was ich noch vorbereiten musste.
Die Rede war inzwischen von einer Frau, vermutlich der Tochter einer Bekannten, die irgendwann mal an einem Ball ein offenbar fast provokativ tief ausgeschnittenes Kleid getragen haben musste. Der Blick meiner Schwiegermutter, als sie davon berichtete, war eine Mischung zwischen verschwörerisch und missbilligend, und mein Gefühl sagte mir, es sei doch bemerkenswert, dass sie mir solche Intimitäten anvertraue. Bald merkte ich jedoch, dass sich diese Angelegenheit vor etwa fünfzig Jahren zugetragen haben musste, denn die Bekannte, von deren Tochter die Rede war, ist jetzt schon mehr als neunzig, die Tochter dementsprechend gegen siebzig, der besagte Ball also in den vierziger Jahren anzusiedeln –Schnee von vorgestern also.
Zum Essen trank ich eine halbe Flasche Wein - ganz alleine. Wein kann nämlich der Gesundheit schaden, da ist sich meine Schwiegermutter absolut sicher, deshalb verzichtet sie lieber. Mir hingegen tat der Wein gut; er liess mich alles mit Gelassenheit ertragen. Normalerweise flüchte ich nicht in den Alkohol, diesmal empfand ich ihn jedoch durchaus als Wohltat.
Dann erfuhr ich auch noch von der Nachbarin, die immer so gross angegeben hatte, dabei hat sie nun ihr ganzes Geld aufgebraucht und ist jetzt gezwungen, in ein einfacheres Heim zu ziehen. Dabei habe sie eine Tochter, die scheinbar fast in einem Palast wohne - nun - in Australien irgendwo, da könne man's ja auch nicht nachprüfen. Sie (die Schwiegermutter) habe ja immer gesagt, man müsse halt ein Budget machen, aber eben, da kann man predigen und predigen...
Da war's dann doch Zeit zu gehen, und ich gebe zu, ich habe keine grossen Anstalten gemacht, sie zurückzuhalten. Meine Bemühungen gingen eher in der Richtung zu versuchen, möglichst alle Habseligkeiten als da sind Handschuhe, Tasche, Echarpe, Schirm und natürlich Schlüssel, Lese- und Weitsichtbrille, die üblicherweise auf wundersame Weise während ihrer Besuche in unseren Haushalt eingehen und anschliessend kaum mehr aufspürbar sind, einzusammeln, ihr zurückzugeben und darauf zu achten, dass nicht doch noch im letzten Moment (wie schon unzählige Male vorgekommen) erneut etwas davon unbemerkt deponiert wird und schliesslich doch noch liegen bleibt.
Und siehe da - es gelang! Sie machte sich auf den Heimweg, und ich nahm meine Arbeit am PC wieder auf.
Ein Nachtessen im Mai (1996)
Heute Abend kam wieder einmal meine Schwiegermutter zu Besuch. Ich konnte es fast nicht glauben, als mein Mann sagte, sie komme zum Essen. Normalerweise erhalte ich nämlich einen Korb, wenn ich sie frage, ob sie bei uns essen wolle. Das ist manchmal recht praktisch, so kann ich sie nämlich relativ gefahrlos einladen, habe „meine Pflicht“ erfüllt, brauche kein schlechtes Gewissen zu haben, und sie ist trotzdem nicht da. So hab' ich's, ich geb's zu, schon öfters gemacht in der guten Hoffnung, dass sie die Einladung abschlägt; und sie hat mich nur selten enttäuscht. Aber heute, wie gesagt, kam sie. Ich hatte zuerst den Verdacht, da gehe etwas nicht mit rechten Dingen zu, denn das sah ihr gar nicht ähnlich, einfach die liebe Wäsche zu Hause so sträflich zu vernachlässigen. Sonst hatte sie doch immer so viel zu tun. Wenn man nämlich alleine lebt, muss man erst recht schauen, dass man den Haushalt in Ordnung hält, die anderen könnten ja sonst denken ... Also die Bettwäsche, die darf nie länger als drei, höchstens vier Tage im Bett sein, sonst (ich hab' vergessen, was sonst ...); bei Vorhängen kann man getrost ungefähr zwei Wochen warten. Aber dann wird's höchste Zeit! - So ist meine Schwiegermutter immer vollauf mit wichtigen Dingen beschäftigt, die sie ganz und gar in Anspruch nehmen. Und das ist gut so. Sie kann dann im Seniorenheim gleich vier Waschmaschinen gleichzeitig belegen, damit die ganze Arbeit wieder mal erledigt ist. So kommt in die erste Maschine der Morgenrock. Man muss ihn schon alleine waschen; er ist so delikat, er würde sonst den Waschgang mit anderen Sachen gleichzeitig kaum überstehen. In die zweite Maschine kommt die Leibwäsche. Die muss auch separat behandelt werden, das ist ja sonst „grusig“. Dann die Küchentücher. Die muss man kochen, die werden sonst nie sauber und rein. Ja, dann braucht's noch eine Maschine für die feinen, farbigen Sachen. Auch dort ist viel Sorgfalt nötig, zu viel aufs Mal darf man nicht zusammen in dieselbe Trommel füllen. So hat's dann schon wieder Wäsche für die nächste Woche. Irgendetwas bleibt immer übrig. Die Wäsche ist eben eine Sisyphusarbeit; die nimmt nie ein Ende. Und so muss meine Schwiegermutter eine Einladung nach der andern absagen, weil sie eben nie Zeit hat.
Genau das wurde mir erst letzte Woche wieder unmissverständlich klar, als ich sie fragte, ob sie mit dem neuen CD-Spieler klar komme. Schon lange hatte sie sich ein solches Gerät gewünscht, damit sie ihre CDs mal hören könne, die sie immer bei „Das Beste“ bestellt, weil sie sich einfach nicht dafür hält, die nette, an sie persönlich gerichtete Werbung nicht zu beachten. So kaufte ich kürzlich ein solches Gerät, Theo brachte es zu ihr, und unser Sohn Gino machte ihr sogar noch eine Zeichnung, damit sie genau wisse, wie und wo sie die Disc einschieben und auf welchen Knopf sie anschliessend drücken müsse. Gemeinsam wurde die „Hightech“ installiert. Beeindruckt von so viel technischem Verständnis unseres Zehnjährigen sagte sie ihm schon eine Karriere an der ETH voraus. Das teilte sie mir am nächsten Tag am Telefon im Vertrauen mit. Darauf ging ich nicht ein, aber ich fragte sie, ob das Gerät gut funktioniere und ob sie Freude daran habe. Da lachte sie und sagte: “Wo denkst du hin, Schätzeli, ich hatte doch noch gar keine Zeit zum Musik Hören.“ Meinen Einwand, man könne ja arbeiten und Musik hören gleichzeitig, nahm sie überhaupt nicht zur Kenntnis.
Nun ja, technische Geräte sind eine Sache für sich. Auch Toaster haben ihre Tücken. Sie braucht jährlich im Minimum zwei bis drei davon. Das kommt daher, dass sie wieder und wieder versucht, mit der rohen Gewalt eines Messers oder zur Abwechslung auch mit einer Gabel abgebrochene, steckengebliebene Brotstücke aus dem Gerät zu entfernen. Das funktioniert leider nur selten, und so geht ein Toaster nach dem andern vor die Hunde. Aber daran sind wir bereits gewöhnt, und ich kaufe sie nur noch, wenn's gerade eine Aktion hat oder wenn es sich um ein Sonderangebot handelt. Alles andere hat keinen Zweck. - Nun, ob sie je dazu kommen wird, ihre CDs zu hören, wage ich zu bezweifeln. Bis sie nämlich einmal Zeit finden wird dafür, wird sie längst nicht mehr wissen, wo der Einschaltknopf ist, und die Gebrauchsanweisung wird ebenfalls schon im Altpapier gelandet sein.
Es ist auch so, dass, wenn ich anrufe und sie frage, ob sie am nächsten Mittwoch zum Beispiel zu uns zum Nachtessen kommen möchte, sie mir zuerst aufzählt, was alles los ist in der nächsten Woche. Das kostet mich immer Geduld, denn die Aufzählung dauert. Es nützt auch nichts, wenn ich versuche, sie zu unterbrechen und ihr klarzumachen, dass all das für mich nicht relevant ist. Ich möchte nur eine „Aussage“ über den kommenden Mittwoch haben. So kann ich dann den Hörer ablegen und erst mal warten, bis das „Wochenprogramm“ durch ist, das meistens etwa so beginnt: „Also am Montag komm Frau Sowieso zu Besuch am Nachmittag. Und am Dienstag habe ich Wäsche. Am Mittwochmorgen muss ich Herrn Sowieso telefonieren wegen einer bestimmten Angelegenheit, am Donnerstag bin ich beim Coiffeur angemeldet und am Freitag - da ginge es“. – „Am Freitag geht es uns leider nicht; meine Frage betraf den Mittwochabend...“
Nun, heute jedoch schien sie sich doch ein paar freie Minuten zu gönnen. Heute war alles anders. Ich dachte schon, sie sei krank. Dem war aber gar nicht so. In reger Aufmerksamkeit bemerkte sie, wie unsere Tochter ohne Manieren ihre Spaghetti ass, und sie prophezeite ihr, auf diese Weise werde sie sicher nicht so ohne weiteres durchs Leben kommen, sie werde dann schon sehen. Auch das bauchfreie T-Shirt war Gegenstand des Anstosses. Schon Doktor Sowieso habe immer gesagt, das gäbe dann eine Nierenentzündung, und auch das werde sie dann schon sehen. Im Alter dann („Bauchfrei in den frühen Vierzigerjahren...??“ dachte ich bei mir, sagte aber nichts.). - Dass unsere Tochter ungerührt blieb ob so viel Weisheit und genauso unanständig weiter ass mit erhobenem Ellenbogen, das war natürlich ein starkes Stück. - Seltsamerweise fallen Bemerkungen dieser Art nie auf fruchtbaren Boden. Es ist nicht einmal so, dass solche wertvollen Hinweise bei einem Ohr hineingehen und beim andern wieder hinaus; nein, ich glaube viel eher, sie hört sie wohl nicht einmal. Meine Rolle ist dann jeweils auch nicht vollkommen klar. Normalerweise ziehe ich es vor, das Ganze ebenfalls nicht gehört zu haben.
Dafür hörten wir einmal mehr den beliebten Ausspruch: "Arbeiten und nicht verzweifeln!" In welchen Zusammenhang er diesmal erwähnt wurde, weiss ich nicht mehr, aber er passt ja eigentlich immer. „Schon in der siebten Klasse haben wir das gelernt“ fügte sie hinzu und ich dachte mir, wenn es mir als Lehrerin einmal gelingen würde, meinen Schülern so viel Lebenserfahrung in einem einzigen Satz zu vermitteln, und sie das, genau wie meine Schwiegermutter, selbst noch nach sechsundsiebzig Jahren zitieren könnten, dann hätte ich wirklich etwas erreicht als Pädagogin.
Aber das Gespräch drehte sich noch um etwas anderes: Der Vermögensverwalter meiner Schwiegermutter hatte sie am nächsten Tag zum Mittagessen eingeladen. Ob er sich im Klaren darüber war, worauf er sich da im Begriff war einzulassen, bezweifelte ich stark. Und weshalb sie dieses Mal keine Ausrede hatte, die Einladung zurückzuweisen, kam auch einem Wunder gleich. Es konnte doch wohl nicht sein, dass alle Wäsche schon erledigt war! Und normalerweise konnte sie derartige Verabredungen sowieso nicht annehmen, wenn der Coiffeurbesuch noch in derselben Woche geplant war. Und dann hatte sie doch der Frau Hauri versprochen, mit ihr eine Tasse Tee zu trinken. - Das musste schliesslich alles erledigt sein. Aber morgen ging es. Vielleicht hatte es damit zu tun, dass der geduldige Herr Bäumlin mindestens schon drei erfolglose Versuche gestartet hatte, sich mit meiner Schwiegermutter zu treffen. Hartnäckig muss man das schon nennen. Dass sich der nette Herr trotz aller Widrigkeiten nicht von seinem Vorhaben abbringen liess, ist mehr als nur erstaunlich. Schon fast ein wenig suspekt. – „Unterschreibe nur ja nichts!“ riet meine Schwester, die ebenfalls am Tisch sass und mein Schwager raunte ihr zu: „Sag's noch mal, sie hat's vielleicht nicht ganz begriffen!“ - Da war ich hingegen ganz gelassen. In dieser Hinsicht ist hundertprozentig auf sie Verlass. Sie wird sich nichts aufschwatzen lassen; sie ist schon in Ordnung, wenn's drauf ankommt. - In der Haut des armen Herrn Bäumlin jedenfalls möchte ich ja wirklich nicht stecken. Der weiss noch gar nicht, was da alles auf ihn zukommen wird. Aber spätestens morgen nach dem Mittagessen wird er's wissen. Unterschreiben wird sie gar nichts. Aber er wird das Mittagessen bezahlt haben und mit einem ganzen Kratten voller guter Ratschläge das Restaurant verlassen. Zeitweise wird er sich vorkommen wie ein Schuljunge. Erreicht haben wird er allerdings weniger als nichts. Was er genau von ihr will, weiss ich natürlich auch nicht, aber das braucht mich auch keineswegs zu kümmern; es ist schliesslich seine Zeit, die er verlieren, und es sind seine Nerven, die er strapazieren wird. Er tut mir richtig leid. Sie wird ihn sicher auch ins Bild setzen darüber, dass schon der Vermögensverwalter ihrer Eltern selig damals gesagt hat: „Frau Torriani“, hat er gesagt, „es ist wichtig, dass Sie nie Schulden haben und ihr Geld sicher in erstklassigen Obligationen anlegen“. Und dagegen wird der liebe Herr Bäumlin keine Argumente haben. Punkt (sie wird nicht sagen: „Punkt!“; sie wird sagen: „Fertig!“; auch eines ihrer Lieblingswörter.). Wir können also geruhsam der Dinge harren, die da kommen mögen.
Schade nur, dass sie so beratungsresistent ist, dass sie unser aller Appell, ihre Schuldbriefe nicht zu lochen, bevor sie im Ordner verschwinden, in den Wind schlägt. Sie weiss es eben besser.
Es ist nicht immer einfach... (1999)
Es wird immer komplizierter. Gestern rief sie an, ich war soeben vom Einkaufen zurück. Ob ich ihr Milch bringen könne von der Migros, wollte sie wissen. Nun, ich hätte welche daheim, Vollmilch oder Milchdrink, ich würde sie ihr gleich bringen, sagte ich. Die „Milch“, die sie meinte, stellte sich aber nach einigem Hin und Her als Vollrahm heraus. „Ein halber oder ein Viertelliter?“, war meine nächste Frage. Das Paket mit den vier Ecken sei es und ob ich wisse, wo der Eingang sei beim Migros. Ich würde lieber im Coop den Rahm einkaufen, das gehe schneller, weil’s dort Parkplätze habe, gab ich zu bedenken, und der Rahm sei ja derselbe. - Nein, dann gehe sie eben selber, sie habe sich nur nicht wieder anziehen wollen. - „Schon recht, ich gehe auch ins Migros“, lenkte ich sogleich ein. Aber das war nun natürlich zu spät und der Hörer war schon aufgelegt.
Das allerdings war schon wesentlich besser als die Story mit dem Weckdienst von neulich. Weil Mutter am nächsten Tag um halb zehn eine Verabredung hatte, wollte sie, dass man sie telefonisch um sieben Uhr morgens wecke. Unser 17-jähriger Sohn Diego wollte den Auftrag übernehmen, aber nach dem dritten Versuch und jeweils ungefähr 20maligem Läuten gab er auf. Ob sie wohl den Anruf nur nicht höre oder gar plötzlich vom Tod ereilt worden war in dieser Nacht? Schliesslich ist sie 92 Jahre alt. - Ob er noch rasch vor der Schule schauen gehen solle? - „Ich kümmere mich um den Fall“, sagte ich, „geh du nur“. Mit noch grösserer Ausdauer liess ich das Telefon nochmals lange läuten. Nichts geschah, ich legte eine Pause ein von zwanzig Minuten und dann versuchte ich es nochmals. Nur wer nicht aufgibt, kommt ans Ziel. Und es klappte. – Endlich hörte ich ein Klicken in der Leitung, der Hörer wurde abgehoben, aber sie sagte nichts, sondern legte gleich wieder auf. - So also funktioniert der Weckdienst; aber vielleicht geht es ihr ja ähnlich wie mir und sie mag mit niemandem sprechen so früh am Morgen. Da gäbe es dann tatsächlich eine Gemeinsamkeit ... Trotzdem hoffe ich, dass sie sich nächstes Mal wieder auf ihren Wecker verlässt und uns verschont mit solchen Aufgaben, denn wie gesagt, ich rede ja auch nicht gerne am Morgen.
Eine weitere Episode (2000)
Mit dreiundneunzig Jahren ist nicht mehr alles ganz so einfach, zugegeben. Manchmal erwartet man eben zu viel. Wie werden wir uns benehmen, wenn wir so alt sind? Das ist die bange Frage, die ich mir immer wieder stelle, wenn ich mit meiner Schwiegermutter zu tun habe.
Am Sonntag kommt sie jeweils zum Nachtessen. Theo holt sie dann ab. Aber er muss früh genug gehen, sonst kommt sie nämlich ohne ihr Gebiss und das, ich gebe es zu, mag ich gar nicht. Es sieht schlicht schrecklich aus und dass es für sie unpraktisch ist zum Beissen, ist sowieso klar. – So plant er denn im Minimum eine Viertelstunde für die Suche der falschen Zähne ein. Mittlerweilen kennt er eine Mehrzahl von Verstecken, aber Mutter findet immer wieder neue. Das Ganze scheint für sie ein Spiel zu sein. Mit Haushaltspapier umwickelt liegt es unter dem Bett, im Apothekerschrank bei den Tabletten, in der Besteckschublade, in einer Pfanne versteckt, im Kühlschrank oder zwischen der Bettwäsche. Auch in meinem Esszimmer hab ich’s schon mal gefunden, es lag in einer silbernen Schale und hat mich zwischen Hausschlüsseln und Brillen angebleckt, unverpackt dieses Mal.
Aber auch wenn sie dann da ist, die dritten Zähne am richtigen Ort, ist nicht alles so, wie es sein sollte. Sie hat sich nämlich die unangenehme Angewohnheit angeeignet, ständig Kiefer, Mund und Zunge hin- und herzubewegen, so dass man davon ganz nervös wird. – Jany, der Mann meiner Schwester, hat schon besorgt und vorsorglich seinen Zahnarzt konsultiert um zu fragen, ob es später noch andere Lösungen gäbe, als sich ein Gebiss zu beschaffen...
Wenn sie sagt, sie dürfe dieses und jenes nicht essen, der Arzt habe es ihr verboten (vor siebzig Jahren), dann habe ich erst mit der Zeit gemerkt, dass dies lediglich eine Ausrede ist, wenn sie etwas nicht gern hat. Aber neuerdings ist sie keineswegs mehr so diskret. Als ich nämlich die „Tarte au Vin“ zum Dessert aufstellte, ihr ein Stück davon auf einem Teller servierte, sagte sie ohne Umschweife: „Was isch das für nä Pflatsch?“ – Essen wollte sie den Pflatsch unter keinen Umständen, und als sie dann begann, mit der Gabel darauf herumzustochern, habe ich das Kuchenstück rasch für uns andere gerettet.
Ginos prosaischer Kommentar dazu: „Die Frau länkt unheimlich ab bim Ässe.“
Sehen tut sie ausserordentlich gut, auch ohne Brille – nach wie vor. Die kleinsten Fasern auf dem Teppich erkennt sie ohne das geringste Problem. - Auch ihr Gehör ist phänomenal. Kürzlich sagte sie zu Theo durchs Telefon hindurch (sie war am andern Ende der Leitung), sein Natel läute, das er in seiner Jackentasche hatte und selber wie üblich nicht hörte.
Wenn sie etwas nicht hören will, hingegen, dann sagt sie einfach, sie habe es nicht verstanden, wiederholt man es, beklagt sie sich, man spreche zu laut. Man hat dann keine Chance, nicht die geringste.
Gerne bringt sie nach wie vor ihre immer gleichen Sprüche an den Mann beziehungsweise an die Familie, die da sind: „Nobel muss die Welt zu Grunde gehen“ oder „Trink Wasser wie das liebe Vieh“. Wiederholungen sind ihr einfach lieb.
Die Blumen, die letzten Rosen aus unserem Garten, die allmählich ein wenig schäbig aussahen, pries sie wieder und wieder an. „Schön, diese Blumen“, sagte sie immer und immer wieder, bis einige unserer weniger gut erzogenen Kinder es nicht lassen konnten und zu spotten begannen, die arme Nana mit Fragen hänselten, ob sie nicht auch finde, die Blumen seien wunderschön. - Mich erinnerten die Rosen ganz stark an unsere Hochzeit vor fast dreissig Jahren, als der Blumenschmuck auf unserem Tisch aus Schwiegermutters Garten stammten, halb verwelkt bereits, ein eher trauriger Anblick, dafür hatte man aber ein paar Franken sparen können.
Beim Verabschieden hatte sie während Jahren die Angewohnheit gehabt zu sagen, es könnte sehr wohl das letzte Mal sein, dass wir uns sähen. Sie sagt es jetzt nicht mehr, sie hat selber gemerkt, dass es recht seltsam wirkt; Sonntag für Sonntag derselbe Spruch.
Soeben telefoniert Theo mit ihr um ihr zu sagen, wann er sie abholen kommt. Es ist natürlich Sonntag. Es ist der zweite Anruf. Beim ersten hob sie nur den Hörer ab, sagte: „Da ist niemand!“ und hängte wieder ein. Heute will sie nicht kommen, tatsächlich nicht. Sie hat gesagt: „Ums Gottswille nid!“ und dabei bleibt es.
Aber nicht immer haben wir so viel Glück. Und so liessen wir uns ein anderes Mal wieder unheimlich ablenken beim Essen. Seltsam war’s. Ich beschloss, uns allen etwas Feines zu kochen. Dass sie den grünen Kopfsalat nicht mag, habe ich inzwischen begriffen und langsam dämmert es mir, dass sie ihre „Arztstorys“ lediglich als Ausrede braucht, wenn sie etwas nicht gern hat. Völlig überflüssig zwar, aber ich verstehe sie. Also machte ich als Vorspeise Rüeblisalat an französischer Sauce und als Hauptspeise Nudeln mit Lachs und Rahm. Ich fragte mich, ob diesmal wohl alles in Ordnung sei oder ob’s Beschwerden geben werde. – Und es gab welche: „Die Teller sind kalt“, bemerkte Nana. Ich bot ihr an, ihren Teller rasch in der Mikrowelle zu wärmen, sah allerdings nicht ein, wieso der Salatteller warm sein sollte. „Für das kleine Bisschen lohnt es sich nicht“, wurde ich belehrt. Nun, dachte ich, es ist auf alle Fälle besser, ich sage nichts. Wenigstens brachte sie diesmal nicht ihr eigenes Stück Fleisch mit, wie sie es früher manchmal tat.
„Willst du deinen Rüeblisalat nicht essen, Mutter?“, fragte ich. Auf ihre Antwort war ich nicht gefasst. Sie liess mich sprachlos. „Nein, das Essen ist kalt. - Es ist eine Frechheit, älteren Leuten kaltes Essen zu servieren.“
Besuche
Die Besuche werden von Mal zu Mal merkwürdiger.
Vor einer Woche ging’s um weiches Gebäck, das Mutter mitgebracht hatte. Zum Tee, meinte sie, wäre das. Ich rümpfte die Nase, weil sie jeweils mit untrügerischer Treffsicherheit genau das auswählt, was ich gar nicht mag. Und nicht selten ist auch das Datum abgelaufen auf den feinen Mitbringseln. Dass es diesmal tatsächlich aus unserem eigenen Haushalt stammen sollte, konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen. – Nun, so ergab es sich, dass niemand davon ass, und die Törtchen lagen während etwa drei Tagen herum. Nicht einmal Gino, unser Jüngster, nahm sich ihrer an. Ich war schon drauf und dran, alles wegzuwerfen, was mir eigentlich gegen den Strich geht, als Mutter einmal mehr zu Besuch kam. Theo machte Tee und legte das Gebäck hin. Und wieder wollte niemand davon essen. Aber dann kam Gino und sagte: „Ich nehme die mit; ich gehe mit einem Kollegen in unsere Baumhütte, da haben wir dann gerade ein Zvieri.“ Und weg war er und weg waren die Törtchen. Gerade als ich erwähnen wollte, wie froh ich sei, dass das Gebäck nun endlich doch noch einen Abnehmer gefunden habe, hörte ich eine seltsame Unterhaltung zwischen Mutter und Theo. Sie sagte: „Also das ist wieder mal ein typisches Beispiel von schlechter Erziehung. Nimmt der Kleine einfach diese teuren Törtchen. Der kann doch ein paar Güezi nehmen; so etwas, einen Fünfliber haben die gekostet; das macht man doch nicht.“ - „Du wolltest sie ja auch nicht essen,“ versuchte Theo zu argumentieren, „und zudem sind es ja diejenigen, die ich dir vor einer Woche gebracht habe.“
Ich dachte, ich höre wohl nicht recht, aber genau so war’s. Weil Mutter ihr Gebiss beim Zahnarzt hatte richten lassen müssen, hatte ihr Theo diese weichen, osterfladenartigen Kuchen mitgebracht, in der vergeblichen Hoffnung, sie würde etwas essen, denn sie scheint wirklich nur noch aus Haut und Knochen zu bestehen. - Man kann sich jetzt fragen, wie gut diese Idee tatsächlich gewesen war...
Ja, und dann war sie schon wieder da vorhin. Wir hatten verschiedene Themen. Beerdigung war eines, das Wetter wurde mehr als einmal erwähnt und ein weiteres drehte sich um die Ferien. Sie fragte, ob ich jetzt nach Bivio gehe (mindestens schon viermal habe ich ihr davon erzählt, aber ich weiss ja, man muss geduldig sein, denn auch mir passiert es immer öfter, dass ich Dinge gleich wieder vergesse und ich bin schliesslich nur halb so alt wie sie). Nur drei Tage über Ostern würde ich dort verbringen, wiederholte ich, und anschliessend für zwei Wochen nach San Francisco fliegen mit unserer Tochter Kay. Wir würden Kim besuchen, die dort für ein Jahr in eine Schule gehe und bei Freunden wohne. Daraufhin sah sie Theo an und fragte ihn, ob wir uns darauf freuen und ob das dann ein halbes Jahr dauern werde, bis wir wieder zurückkämen. „Zwei Wochen“, sagte Theo und wegen dem Freuen könne sie mich ja direkt fragen, ich sitze ja schliesslich neben ihr am Tisch ... „Weird, it’s getting really weird“, dachte ich bei mir, so habe ich sie wirklich noch nie erlebt. Und als ich sie fragte, ob sie die (trockene) Kirschtorte, das sie diesmal mitgebracht hatte und von der sie ein Stück vor sich auf dem Teller liegen hatte, nicht essen wolle, sagte sie aus heiterem Himmel und mit grösster Seelenruhe: „Ich kann nicht essen, wenn ich mich aufrege.“ - Ganz erstaunt blickten wir beide erst uns und dann sie an und fragten, worüber sie sich denn aufrege, sie machte nämlich keineswegs den Anschein, es war auch kein Anlass vorhanden. „Ich bin eben älter als ihr und sehe manches anders“, war ihre Antwort, womit aber nach wie vor nicht klar war, was es genau war, das sie anders sah oder worüber sie sich hätte aufregen müssen. Im Grunde genommen weiss ich natürlich schon, dass sie so ziemlich alles anders sieht als ich, aber darum ging es im Moment ja gar nicht und zudem war das schon längst weder für sie noch für mich ein Grund, sich aus der Ruhe bringen zu lassen.
Sie wechselte dann gleich selber das Thema und fragte mich mit einem Blick auf die Unordnung in meiner Küche, ob ich eigentlich nicht meinen Job aufgeben wolle. „Was soll das jetzt wieder?“, dachte ich bei mir. Sagen tat ich aber nur: „Nein“, und damit war auch dieses Thema endgültig erschöpft.
Ziemlich abstrakt kam mir allmählich unsere Unterhaltung vor, eine Art surreales Spiel, bei dem ich allerdings nicht dabei war, als die Regeln erklärt worden waren. So wird Mitmachen natürlich schwierig.
Die leidigen Steuern wurden dann als nächstes behandelt und Mutter meinte, sie sei schon froh, wenn ihr Vermögensverwalter Theo beim Ausfüllen der Steuererklärung helfe. Das sei keineswegs der Fall, dass der das tue, beteuerte Theo, er mache das selber, aber das war egal, sie war trotzdem froh darüber.
Kompliziert wurde es für ihn ein anderes Mal, als er sie dazu bewegen wollte, ein Formular für die Bank auszufüllen, genauer gesagt zu unterschreiben. Da hatte sie ihre Sternstunde. Sie machte sich ein Spiel daraus, so zu tun, als ob sie das nicht tun könne. So versuchte Theo nach dem Mittagessen im „Tertianum“ (der Seniorenresidenz, wo sie seit ein paar Jahren wohnte) mit ihr die Unterschrift zu üben. Auf einer Serviette. Das ging gut. Sie schrieb wieder und wieder ihren Namen. Aber auf dem Formular war’s nicht möglich. Sie weigerte sich standhaft, lächelte dazu und brachte Theo, der sonst die Ruhe in Person ist, fast zur Verzweiflung. Nach zwei Stunden gab er auf.
Und die unendliche Geschichte geht weiter:
Wenn Theo, den sie übrigens neulich vermehrt mit Antonio (ihr verstorbener Mann) anspricht oder gar mit „Papi“ (was mir dann jeweils innerlich unheimlich auf den Wecker geht) sie im Seniorenheim besucht und mit ihr zu Mittag isst, dann kann er sich einiger sehr spezieller Erlebnisse erfreuen.
Bestellt er ein Bier, wird sie nimmer müde, den Kellner gleich zu ermahnen: „Aber temperiert!“ (So wie unsere Kinder früher die Joghurts essen mussten, wenn sie bei ihr waren, was sie alle verabscheuten.)
Den unteren Rand der Serviette legt sie ihm unter den Teller, damit das Tischtuch sauber bleibt, wie sie sagt.
Und aufpassen muss er wie ein Häftlimacher, wenn Fleisch serviert wird. Sie beugt sich dann hinüber zu ihm und beginnt, sein Essen kleinzuschneiden. Theo ist eben geduldig und auch manchmal ein wenig abwesend; so kommt es vor, dass er nicht sogleich merkt, was da vor sich geht.
Was er aber wirklich nicht mag, aber jedes Mal erzwingen muss, ist der Kampf um eine Tasse Kaffee nach dem Essen in Mutters Wohnung. Es gibt nur Instantkaffee. Das wäre ja noch akzeptabel, aber die Tatsache, dass sie findet, ein halber Teelöffel Pulver sei genug und diese Meinung auf Biegen und Brechen auch durchsetzen will, ist dann doch sogar für ihn zu viel des Guten, und er wehrt sich ausnahmsweise.
Ob er wirklich als Sieger hervorgeht aus diesem Disput, vermag ich nicht zu sagen, ich kenne aber die Antworten von Mutter, wenn man nicht tut, was sie für richtig hält, aus eigenem Erleben. Ist eines von uns zu wenig warm angezogen, trinkt ein zu kaltes Getränk, isst ein grilliertes Stück Fleisch (etwa noch Rindfleisch) oder den nitrathaltigen Nüsslersalat, von dem ihr Doktor sowieso schon vor 40 Jahren abgeraten hat, dann sagt sie nur: „Du wirst dann schon sehen, wenn du älter bist ....!“
Mal sehen, was ich dann sehen werde.
Aber Befürchtungen scheinen auch ihr Schönes zu haben. Eine 89-jährige Bekannte von ihr, welcher der Arzt schon vor Jahren nur noch wenige Monate, allerhöchstens ein Jahr, zu leben prophezeit hatte, und die jetzt unbedingt eine Bluttransfusion haben sollte, verweigert diese standhaft, weil sie Angst habe vor Aids.
Ist das jetzt positives oder negatives Denken?
In der Pflegeabteilung / Spital (2002)
Ziemlich viel hat geändert seit ich zum letzten Mal über meine Schwiegermutter geschrieben habe. Sie hat im letzten Januar ihren 95sten Geburtstag gefeiert; ein richtiges Gespräch ist inzwischen nicht mehr möglich. Zwar empfand ich, dass ein „richtiges“ Gespräch zwischen uns so oder so eigentlich nie stattgefunden hat, denn wir waren und stammen seit jeher von zwei verschiedenen Planeten oder gar Galaxien.
Nana wohnt inzwischen im Pflegeheim und hat bereits vergessen, dass da noch eine 3-Zimmer Wohnung vorhanden ist im sechsten Stock, die sie gemietet hat. Es scheint ihr an nichts zu fehlen, endlich hat sie ein wenig Abwechslung, sie sieht Leute hin- und hergehen, sie ist nicht mehr so einsam wie vorher, wo sie nur aus dem Fenster schaute, stundenlang. Sie hat Satzfragmente gespeichert, Redensarten auch, die sie beliebig anwendet, egal ob sie passen oder nicht. Gerne sagt sie: „Herrgott noch mal“ und „In Gottes Namen“. Wenn man das Zimmer betritt, findet die erste automatisch Anwendung.
„Herrgott noch mal“, sagte sie, als ich vor zwei Wochen in den Speisesaal kam und zu ihrem Tisch trat. Eigentlich hatte ich die Essenszeit vermeiden wollen, aber mein Vorhaben missglückte, Nana war mit Appetit am Mittagessen. Pürierte Rübchen, Kartoffelstock und püriertes Kalbfleisch gab’s, daneben das Dessert, ein Teller mit Vanillecrème. Ich setzte mich zu ihr. „Willst du auch ein wenig?“, fragte sie und streckte mir eine Gabel voll hin. Dankend lehnte ich ab und log, ich hätte schon gegessen. Beim nächsten Bissen schaufelte sie ein wenig Fleisch auf die Gabel, dazu Kartoffelstock und schon landete die Gabel in der Vanillecrème. Ich zuckte erschrocken zusammen, wollte sofort hilfreich eingreifen und sie auf den Irrtum aufmerksam machen, gleichzeitig aber schob sie den Leckerbissen bereits in den Mund, vorbei an den goldenen Hacken, an denen eigentlich ihr Gebiss hätte verankert sein sollen, das sie nun aber schon seit Monaten so gut versteckt hat, dass nicht einmal mehr Gino im Stande ist, es zu finden. (Einmal, als es Theo beim besten Willen nicht gelang, die dritten Zähne seiner Mutter aufzuspüren, fragte er Gino, ob er Zeit hätte, danach zu suchen. Er versprach ihm einen Finderlohn von 200 Franken. – Für diese „Arbeit“ hatte er Zeit. Es dauerte keine Viertelstunde, und Gino wurde fündig. In einem „Earl Grey-Päckli“ zwischen den Teebeuteln lag der oft gesuchte Gegenstand - und unser Jüngster war um zweihundert Mäuse reicher.)
Es ist egal inzwischen; hier herrschen andere Regeln. - Auch die pürierten Rübchen mit Vanillecrème schmeckten ihr offenbar gut. Wieder bot sie mir an...
An einem anderen Tisch war eine junge Pflegerin daran, zwei Greisen im Rollstuhl das Essen klein zu schneiden und sie abwechslungsweise zu füttern. Die Szene erinnerte mich an die Fütterung unserer Zwillinge. Nur waren damals die Lätzli mit irgendwelchen lustigen Tierchen gemustert und auch sonst gab es da noch gewisse Unterschiede. Der eine Herr fragte die Pflegerin, woher sie sei. „Aus Spanien“, sagte sie. - „Dass ich einmal mit einer Spanierin esse...“, murmelte er und ich fragte mich, wie oft sich diese Szene wohl wiederholt. Die Spanierin nahm sich daraufhin einer Dame an unserem Nebentisch an, putzte ihr den Mund mit einem feuchten Tuch und schon rief ihr der Alte zu und bat oder befahl ihr, nochmals zu ihm zu kommen, er müsse ihr etwas sagen. „Sie sind eine schöne Frau“, liess er verlauten, sie lachte und ging wieder an ihre Arbeit zurück.
Nana hatte inzwischen fertig gegessen, Mund und Hände wurden ihr von der Pflegerin geputzt und sie wurde gelobt für ihren guten Appetit. Die Frau neben Nana sagte zu mir: „Ich möchte lieber sterben; wieso nur kann ich nicht?“ – Ja, wie gut ich das verstehe! Ich habe keine Antwort. - Es tut mir alles so Leid.
Zwei Wochen später: Bei der morgendlichen Zeitungslektüre lese ich auf der letzten Seite des Bund: „Unerklärliche Tat eines Demenzkranken“. In einem Altersheim hat ein 86-jähriger Bewohner seinen Zimmernachbarn mit einer Krücke erschlagen. Er kann sich offenbar nicht mehr an seine Tat erinnern. Das Motiv ist auch unbekannt. – Und so wurden mit einem Schlag zwei Betten frei im Altersheim. – Diese Nachricht ist mir lebendig vor Augen, wie ich heute durch die Tür der Pflegeabteilung trete.
Ich besuche Nana im Ess- und Aufenthaltsraum. Dieselben Leute wie immer sitzen dort. Die meisten schlafen. Nana auch. Mit weit geöffnetem Mund. Der Herr, der sich so sehr an der Spanierin ergötzt hat, ruft unaufhaltsam nach der „Serviertochter“. Es passiert nichts. Eine Frau, die alleine am Tisch sitzt, stöhnt laut und sagt, sie müsse auf die Toilette. Sie jammert, bettelt und bittet, es passiert nichts. Das Personal lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Alle sitzen im Office hinter der Glasscheibe im Kreis, sie haben eine Besprechung, die Türen sind offen, Handlungsbedarf besteht keiner. Soll ich eingreifen? Es ist kaum zum Aushalten. Eine Pflegerin kommt herein und weist die Alten an, jetzt endlich still zu sein; sie hätten Rapport und es komme dann nachher schon jemand. So geht die Bettlerei weiter. Ist dies das tägliche Brot? Hat die Frau Windeln an und die Ruferei ist ihr Ritual? Soll ich mich einmischen? Ich bin im falschen Film. Ich will nie in ein Pflegeheim. Endlich ist der Rapport zu Ende, Erlösung naht. Die Frau bedankt sich wieder und wieder, dass man sie endlich erhört.
Nana sagt, es seien ohnmächtige Leute hier. Ich kann sie fast nicht verstehen. Wie es meinem Bruder gehe, will sie wissen. Das habe ich genau verstanden. Ich habe keinen Bruder. Sie besteht darauf, weiss aber seinen Namen auch nicht. - „Hast du das verrückte Haus gesehen, das dort herumspringt?“, will sie wissen. Das „verrückte Haus“ ist ein Pfleger, der ein Tablett abräumt. Er bewegt sich nicht rascher als alle andern und worin sich seine Verrücktheit ausdrückt, ist mir auch nicht klar.
Was ich denn so mache, möchte Nana nun wissen. - Nun, immer etwa dasselbe: Arbeiten, Haushalt, wie das eben so ist. – Ob es mit den Lehrern denn gut gehe? Das könne ich ihr doch wohl genau erzählen, meint sie, ein wenig vorwurfsvoll, wenn ich ihren Tonfall richtig interpretiere. „Ich habe keine Lehrer, ich selber gebe seit 25 Jahren Schule“, erkläre ich ihr. - Das habe sie nicht gewusst, Herrgott noch mal, na ja. - „Theo lässt dich grüssen“, wechsle ich das Thema. „Welche Farbe hat er?“, ist ihre Gegenfrage, auf die ich einmal mehr nicht weiss, was ich antworten soll.
Zehn Minuten später sitze ich im Auto und fahre aus der Tiefgarage. In eine andere Welt.
Ein kalkulierbares Ereignis (12. August 2002)
Nun war es so weit. Am Montag früh starb meine Schwiegermutter. Mit 95 Jahren ist der Tod keine Überraschung mehr, eher ein kalkulierbares Ereignis. - Erstaunlicherweise starb sie auf den Tag genau elf Jahre nach ihrem Ehemann, Theos Vater.
Der Beamte des Bestattungsamtes sass im Wohnzimmer zusammen mit Theo. Es gab einiges zu organisieren. Die Behörden mussten verständigt, die Krankenkasse benachrichtigt und der Zeitpunkt für die Urnenbeisetzung bestimmt werden. Geschäftlich das Ganze.
Dass die Abschiedsworte tröstlich sein würden, war schon klar. Man konnte den Text fürs Beileidzirkular bereits festlegen. „Wollen Sie ‚in stiller Trauer’ oder ‚in Liebe’“? fragte der diskrete Herr. „Und wie steht es mir der Todesanzeige? In welchen Zeitungen soll sie erscheinen?“ – Wenn man fast ein Jahrhundert alt ist, hat man kaum mehr Bekannte, höchstens noch im Pflegeheim. Die Freunde sind alle längst gestorben. Eine Anzeige über die ganze Stadt zu streuen, schien eher absonderlich. Das Blatt, das zweimal wöchentlich in der Region erscheint, war wohl gerade richtig.
Ich war nachdenklich. „So alt sollte man gar nicht werden“, hatte Kay kürzlich gesagt und mir damit aus dem Herzen gesprochen. Das Wort Lebensqualität wurde diskutiert. Am traurigsten war, dass niemand wirklich traurig war. Würde meine Schwiegertochter später einmal gleich empfinden? Mich nicht vermissen, wenn ich nicht mehr da bin? Froh sein, dass alles „gut gegangen war“ und die Verstorbene keine Schmerzen hatte leiden müssen? - Natürlich war da eine Trauer. - Für Theo ging ein Teil seiner eigenen Geschichte zu Ende. Die Mutter, die ihn aufgezogen hatte, um die er sich in den letzten Jahren in fürsorglicher Weise gekümmert hatte, war nicht mehr.
Und ich? Der Alltag ging weiter. Ändern tat sich nichts. Keine Besuche mehr im Pflegeheim, das war alles. Was blieb, waren Erinnerungen. Erinnerungen und Fotos.
Schon drei Wochen zuvor hatten wir gedacht, die alte Frau würde sterben.
Sie war umgefallen und hatte sich ein Bein gebrochen. Die Folge war ihr erster Spitalaufenthalt seit Theo vor 57 Jahren geboren worden war. - Sie wurde gleich operiert. Am nächsten Morgen sah es schlecht für sie aus. Zwar war die Operation gut verlaufen, jedoch traten Schwierigkeiten mit dem Kreislauf auf. Alle, auch die Ärzte und Schwestern dachten, sie würde den Tag wohl nicht überleben. Die ganze Familie besuchte sie, alle machten sich ihre Gedanken, nahmen Abschied. An unzähligen Schläuchen hing sie, ein mitleiderregender Anblick, nur Haut und Knochen. Ansprechbar war sie nicht. Aber zäh. Zwei Tage späte waren alle Schläuche weg, Nana lag im Bett und sah wieder ganz passabel aus. Zwar konnte ausser Theo kaum jemand verstehen, was sie sagte, er war der Einzige, dem das Familienkauderwelsch vertraut war.
Tags darauf ging’s noch besser, sie war sogar an dem Bild interessiert, das an der Wand gegenüber ihrem Bett hing. Es stellte einen Teich mit Seerosen dar; sie allerdings bestand darauf, es seien Hühner. Es hätte zum Disput kommen können, wenn ich darauf eingegangen wäre. - Dann geht’s ihr ja tatsächlich nicht mehr so schlecht, dachte ich. – Die alte Frau sprach wie ein Buch, aber eben, das meiste davon war unverständlich, nur wenige Wortfetzen machten Sinn. Es tat mir Leid, auf Fragen nicht antworten zu können, weil sie diese nicht verstand. „Das weiss ich nicht mehr“, murmelte Nana. „Was weisst du nicht mehr?“, fragte ich und die Antwort folgte auf dem Fuss: „Ich weiss nicht.“
Ich war mir auch nicht sicher, ob meine Schwiegermutter mich überhaupt erkannte.
Sie schlief, als ich am nächsten Tag zu Besuch kam und wachte erst auf, als die Schwester hereinkam. Es dauert ziemlich lang, bis sie merkte, dass da noch jemand im Zimmer war. Endlich fokussierte Nana mich, die ich am Fussende ihres Bettes stand, deutete mit ihren langen Knochenfingern auf mich und sagte zur Schwester: „Negerfrou“ (ich war von der Sonne gebräunt). - So lange sie ihre Witzchen macht, dachte ich, erkennt sie mich schon noch. So sicher war ich dann aber nicht mehr, als Diego die Grossmutter im Spital besuchte und diese ihn fragte: „Dir kennet doch der Theo, gäuet?“
Das war zwei Wochen vorher. Jetzt ist sie tot.
Während Jahren hatte sie jeweils beim Verabschieden gesagt: „Vielleicht ist es das letzte Mal, dass wir uns sehen“, ein Satz, der mir unheimlich auf die Nerven ging. Sonntag für Sonntag. Jetzt werde ich ihn nie mehr hören; die Prophezeiung war eingetroffen.
Die Familie stand versammelt vor dem Grab, und der Pfarrer sprach die tröstenden Abschiedsworte. Es traf mich hart, als ich den Friedhofgärtner sah mit der Urne in den Händen. Das ist also das Ende, dachte ich. Nach 95 Jahren ist das alles, was übrig bleibt: Asche in einem Gefäss, das jemand mit sich herumtragen kann. - Die Endgültigkeit der Situation war schuld daran, dass ich Tränen in den Augen hatte. Es rührte mich auch zu sehen, wie meine vier Kinder weinten um eine Grossmutter, die seit je zur Familie gehört hatte, mit der sie manches Schöne und Lustige, aber auch viel Eigenartiges erlebt hatten. Zweiunddreissig Jahre lang hatte ich die Frau gekannt, die jetzt nur noch ein Häufchen Asche war, mit der mich herzlich wenige Gemeinsamkeiten verbunden hatten, deren Schrullen mir aber doch mit den Jahren fast lieb geworden waren.
Ich erinnerte mich an ein Telefongespräch mit meiner Schwiegermutter, das ungefähr neun Jahren zuvor stattgefunden hatte. Es drehte sich um Gräber, genauer gesagt um das Grab, vor dem wir jetzt standen. Nana hatte mich damals gefragt, ob meine Mutter wohl einverstanden wäre mit der Verschiebung des Grabes meines Vaters neben dasjenige von Nono, ihres zwei Jahre zuvor verstorbenen Ehemannes. – „Väter unter sich“, dachte ich und staunte nicht schlecht über diese neueste Idee aus dem Hause Torriani.
Ich wollte mehr wissen über den Zweck dieses seltsamen Vorhabens. - Mit meinem spontanen Gedanken lag ich offenbar nicht weit daneben, denn die Schwiegermutter fuhr unbeirrt fort: „Weisst du, ich werde dann auch für mich dort einen Platz reservieren lassen, ebenso für deine Mutter, so sind wir dann alle beisammen.“ - Ich war endgültig sprachlos und Nana, die offenbar merkte, dass sie dem Ganzen einen etwas plausibleren Anstrich geben musste, fuhr weiter: „Auch für die Jungen, die dann die Blumen giessen müssen, ist es einfacher, wenn wir alle am gleichen Ort sind.“
Bei dieser Vorstellung beschlich mich für den Bruchteil einer Sekunde eine Art Panik. Sich auszumalen, wie das wäre, wenn da allenfalls doch vielleicht noch etwas stattfinden könnte nach dem Ableben und dann alle wieder zusammen wären, eine Art virtuelle Party also – einfach nur makaber. Nicht, dass der Gedanke ans Zusammensein so schrecklich gewesen wäre, nein, aber... Und dann das Bild: Jemand giesst die Blumen.
„Tot ist tot“, dacht ich für mich, und „Zusammensein“ tönte in meinen Ohren nach dem gemütlichen zweiten Teil nach einer Sitzung oder einem Jassabend; auf jeden Fall nach Minne, ein Herz und eine Seele etc., etc. Dabei war unsere Familie nicht anders als andere auch, man kam zwar gut miteinander aus, aber es gab auch Meinungsverschiedenheiten und überhaupt: Das Ganze war vollkommen absurd.
Ich riet meine Schwiegermutter dringend, bevor sie etwas unternehme und eigenmächtig Gräber verschieben lasse, diese Angelegenheit unter allen Umständen zuerst mit meiner Mutter zu besprechen.
Und so geschah es. Nana hatte sich anscheinend schon sehr genaue Vorstellungen gemacht, hatte bereits die Friedhofverwaltung avisiert und auch schon eingeteilt, wer wann drankommt, wenn’s ums Sterben geht. „Die nächste bin ich“, hatte sie zu meiner Mutter gesagt, „dann bist du dran (jetzt war es an ihr, leer zu schlucken), dann kommt Jany ...“. Das war der Moment, wo meine Mutter eingriff und tapfer einzuwenden wagte, man könne unter Umständen davon ausgehen, dass die Sterberei in einer Familie nicht zwangsläufig chronologisch zu und her zu gehen habe...
Ich mischte mich nicht ein und dachte bei mir, man werde ja dann sehen, wie das alles schliesslich herauskommt. - Die Verhandlungen mit der Friedhofsverwaltung zwecks gemütlichen Zusammenseins nach dem Tod waren zu dem Zeitpunkt ja bereits eingeleitet und kurz darauf auch ausgeführt. Dazu gehörte, dass das Grab von Herrn Weder, einem ehemaligen Richter, welches damals neben demjenigen meines Schwiegervaters selig platziert war, verschoben werden musste. Ich erinnere mich noch genau an die Worte von Nana, die elf Jahre zuvor nach der Urnenbeisetzung ihres Mannes mit grosser Genugtuung gesagt hatte: „Hier liegt Nono gut. Den Herrn Weder, den habe ich gekannt. Das war ein rechtschaffener Mann. Da ist Nono in guter Gesellschaft.“
Und so liegen sie denn dort zu dritt, falls man das Liegen nennen kann, die Einigkeit sichtbar gemacht durch gemeinsame Blumenbanden, ein wenig abseits von Herrn Weder.

Tennis
Inzwischen hatte ich auch gelernt, Tennis zu spielen. Eigentlich hätte mir diese Sportart schon längst gefallen, aber ich hatte oft Rückenschmerzen und dachte, so gehe das auf keinen Fall. – Als ich im Jahr 1998 eine Woche lang alleine in der Dominikanischen Republik in den Ferien war, überredete mich dort ein Tennislehrer im Hotel, es doch mal zu probieren. Er gab mir ein paar Schuhe, einen Schläger und los ging’s. Und es machte mir solchen Spass! Zu Hause kaufte ich mir sofort eine ganze Ausrüstung, überredete eine Freundin, ebenfalls Tennisspielen zu lernen und wir meldeten uns in einem Club an und nahmen fleissig Unterricht. Rückenschmerzen waren kein Thema mehr. – In einem Doppel oder Mixed mitzuspielen, macht mir unglaublich Freude, es gibt Wochen, da bin ich fünfmal auf dem Platz anzutreffen. Auf einen richtig grünen Zweig schafft man es jedoch leider nicht mehr, wenn man diese Sportart nicht schon als Kind oder Jugendlicher gelernt hat, aber das stört mich nicht. Etwas vom Schönsten dabei ist nämlich auch, dass ich viele neue Freundinnen und Freunde gewonnen habe und wir unzählige lustige und anregende Stunden zusammen verbracht haben und immer noch verbringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, wenn's möglich ist, einen der Orte zu besuchen, wo die „richtigen" Matches stattfinden. Roger zu sehen in Gstaad oder am Davis-Cup in Bern, war ein absolutes Muss für uns Tennisfans, und mit einer Freundin die einzigartige Stimmung an einem grandiosen Tag in Wimbledon zu erleben, sowieso.
Tennisferien waren von da an immer ein Höhepunkt; gemeinsam verbrachte Wochen in der Türkei, in Sardinien, in Spanien, in Kroatien, im Brandnertal in Österreich und viele Male im Allgäu und in Zermatt sind unvergesslich.
„Auto-Geschichten“ (Karosserie-Abänderungen)
Was sich wie ein Witz erzählen lässt, mir aber tatsächlich vor ein paar Jahren passiert ist, ist Folgendes:
Mit einer Freundin war ich unterwegs im Allgäu. Wir fuhren Richtung Kempten, als von rechts, aber aus einer nicht vortrittsberechtigten Strasse ein Auto ungebremst in uns hineinfuhr. Zum Glück wurde niemand verletzt. Der fehlbare Fahrer stieg aus und entschuldigte sich. Er sei in Gedanken gewesen. Es stellte sich heraus, dass er der Pfarrer der Gemeinde war, wo der Unfall passiert war. Er gab mir seine Adresse und Telefonnummer und versprach, gleich seine Versicherung zu avisieren. Obwohl die Karosserie hinten rechts ziemlich beschädigt war, konnten wir sogar noch weiterfahren. Die Polizei brauchten wir nicht zu rufen. – Zurück im Hotel rief ich ihn am Abend an. Offenbar schon wieder in seine Seelsorge-Aufgabe vertieft, antwortete er sofort und sagte: „Guten Abend. – Haben Sie ein Problem?“ – Ich kam nicht umhin zu antworten: „Diesmal, so glaube ich, haben Sie wohl ein Problem“. – Meine Freundin, die neben mir stand, musste laut lachen.
Alles verlief bestens mit der Versicherung. Wir erhielten ein Ersatzfahrzeug und der Schaden von 10‘000 Euro wurde anstandslos bezahlt.
Auch ein anders Mal hatte ich Glück. Auf dem Parkplatz der Tennishalle fuhr ich rückwärts aus der Parklücke heraus, schaute in die Rückspiegel rechts und links, da war nichts. Genau hinter mir war aber ein Auto parkiert, dass ich völlig übersehen hatte. Der Ton verhiess nichts Gutes. Ich stieg aus und schaute mir den Schaden an. Genau unterhalb des Nummernschilds hatte ich die Anhängerkupplung ins Blech hineingerammt. Keine riesige Beule, aber immerhin. Ärgerlich, ärgerlich! - Ich liess meinen Wagen stehen und ging auf die Suche nach dem Fahrer, dessen Auto ich beschädigt hatte. Nach kurzem Suchen fand ich ihn an der Bar. Wir schauten und die Delle an und er sagte: „Da ist gar nichts passiert. Da hatte ich bereits eine Beule.“ – Gibt’s denn sowas?!
Auch Pech hat man manchmal: Meine ungebremste Fahrt in einen Findling in der Nähe, wo wir wohnten, hatte mir einen riesigen Schrecken eingejagt. Ich fuhr überhaupt nicht schnell, wollte nach rechts abbiegen, die Strasse war aber völlig vereist und der Wagen war dadurch nicht von seiner Spur abzubringen. Bremsen ging auch nicht mehr, so geschah dann das Unvermeidliche. Wenn dort zufälligerweise ein Fussgänger spaziert wäre...
Auch zwei weitere Kühlerhauben gingen auf mein Konto. – In der Kolonne stehen, anfahren bei grün, einen kurzen Moment schaue ich seitlich aus dem Fenster und bemerke zu spät, dass die Autos vor mir trotz Grünlicht wieder zum Stehen kommen. – Schon ist’s passiert. Ich schiebe den Wagen vor mir in denjenigen vor ihm. Der in der Mitte erleidet Totalschaden. Zum grossen Glück wurde niemand verletzt. – Mein Portemonnaie natürlich schon. Die Versicherung zahlte zwar den Schaden, den ich angerichtet hatte, aber da wir keine Vollkasko-Versicherung hatten, musste ich selber „bluten“.
Kühlerhaube Nummer drei: Diesmal war es nicht meine Schuld: Aus einer Stoppstrasse heraus fuhr ein Auto voll vorne links in meinen Peugeot hinein. Grad vor einer Garage. Das zumindest traf sich gut. Wieso die Autofahrerin mich nicht gesehen hatte, wusste sie selber nicht. Die Situation war übersichtlich. Verletzt wurde zum Glück auch da niemand.
Der Stufenbau, unser Eventlokal, unsere Galerie
Im Jahr 2005 ersteigerte mein Mann im Stufenbau in Ittigen (eine ehemalige Zellulosefabrik, die verschiedene Ateliers und kleinere Handwerksbetriebe beherbergt und jetzt denkmalgeschützt ist) die ehemalige Diskothek, die Konkurs gemacht hatte. Es handelte sich um die oberen beiden Stockwerke auf der linken Seite mit einer Gesamtfläche von ungefähr 300 m2. Es gab unendlich viel zu tun, bis das Lokal, in dem es drei Bars, etliche Räume und Nebenräume und einen Garten hatte, auf Vordermann gebracht war. Bis schon nur die unendlich langen Reihen von Fenstern, die mit gelber, blauer und rosaroter Farbe übermalt waren, geflickt und geputzt waren und ein Zwischenboden in der hohen Haupthalle, die fast die Ausmasse einer Kirche hatte, eingebaut war, dauerte es Monate. Aber es lohnte sich: Wir besassen nun ein wunderbares Eventlokal, das fast jedes Wochenende für Firmenanlässe, Hochzeitsfeiern und Partys gemietet wurde. Ohne die unermüdliche Hilfe unserer Söhne hätten wir es nicht geschafft.
Ebenfalls organisierten wir ungefähr dreimal pro Jahr eine Kunstaustellung. Dazu luden wir in der Regel etwa zehn verschiedene Künstlerinnen und Künstler ein, die während zwei bis drei Wochen ihre Werke ausstellten. Es war ein grosser Erfolg und wir waren mit Herz und Seele dabei. Allerdings war es ein hartes Stück Arbeit, alles zu organisieren und durchzuführen.
Ich hatte ein paar Töpferkurse besucht und besass inzwischen ein eigenes kleines Atelier und einen Brennofen. So stellte ich meine „Kunst“ ebenfalls aus, es waren vor allem eine Art Totempfähle, die ich töpferte nach dem Vorbild derjenigen in Vancouver und Vancouver Island.
Nicht viel weniger Arbeit machten auch die Events. Unsere beiden Söhne Gino und vor allem Diego knieten sich hinein und hatten mehr als ihnen lieb war damit zu tun. Es galt, fast jeden Tag etliche Emails zu beantworten, den Leuten die Lokalität zu zeigen, Verträge abzuschliessen und an den Wochenenden in der Nähe zu sein, falls etwas nicht so lief, wie es sollte. Vor allem mit dem Schräglift gab es Probleme, der sich von Zeit zu Zeit weigerte zu funktionieren. Wer von den Partygästen nicht konnte oder nicht gewillt war, die 144 Stufen hochzusteigen, den musste man per Auto auf einem riesigen Umweg zum Ort des Geschehens fahren. - Kurz gesagt, unser „Hobby“ artete sozusagen in einen Vollzeit-Job aus. Und so kam es nach sieben Jahren, wie es kommen musste: Unsere Söhne hatten genug von der Arbeit, wir selber waren nicht bereit, voll einzusteigen und all das zu übernehmen, was es brauchte, damit der Betrieb aufrechtgehalten werden konnte. Wir wollten lieber frei sein und auf Reisen gehen können, Theo war ja bereits seit zwölf Jahren pensioniert und ich würde mich mit sechzig, also im Jahr 2013 ebenfalls pensionieren lassen. Jemanden anzustellen, das wäre vielleicht eine Lösung gewesen, aber aus verschiedenen Gründen kamen wir von der Idee ab und verkauften das Business schliesslich im Herbst 2012 - schweren Herzens, aber mit gutem Gewinn.
Nur noch ein Jahr...
Nur noch ein Jahr lag vor mir bis zur vorzeitigen Pensionierung. Dieses verflog im Nu. Verbunden mit vermischten Gefühlen fand immer wieder etwas „zum letzten Mal“ statt: unser Vorbereitungskurs für den Einstieg in die BMS, die einzelnen Kapitel im Lehrbuch, das Generieren einer neuen Probe, die Korrektur derselben, die Betreuung einer Maturarbeit, der Sporttag der gesamten GIBB im Wankdorf, die Gesamtlehrekonferenz, die Fachsitzung, die schriftlichen und die mündlichen Prüfungen und schliesslich die Abschlussfeier – Am 4. Juli 2013 war mein allerletzter Einsatz in der Lorraine: mündliche Prüfungen. Er dauerte nur bis am Mittag. Der letzte Schüler, den ich mit einer externen Expertin zu prüfen hatte, erhielt eine Sechs. Er hatte seine Sache perfekt gemacht, es gab diskussionslos die Bestnote. – Was für ein fabelhafter Abschluss nach 35 Jahren im Schuldienst!
Und was für ein unvergesslicher Tag: Die Prüfungen am Morgen, ein Bad in der Aare am Mittag, Tennis am Nachmittag und am Abend lud ich einige meiner Freundinnen zum Nachtessen und Feiern in ein Gartenrestaurant ein.
Das war der Anfang meines Lebens als pensionierte Lehrerin, was in meinen Ohren übrigens ziemlich schrecklich tönt. Allerdings kann ich mich leicht mit der Terminologie abfinden, da ja ein wunderbares Stück neue Freiheit damit verbunden ist.
Im dritten Kapitel berichte ich ausschliesslich über die Reisen, die wir von da an unternahmen. Den Spätherbst in der Schweiz zu verbringen, kam für mich überhaupt nicht mehr in Betracht. – All die Tage, die immer kälter, dunkler und nasser werden und auch die Nebeldecke lassen wir gern zurück.
Meine Mutter
So gibt es nur noch eines zu berichten. Ich habe es schon am Anfang kurz erwähnt, zeitlich aber gehört das Ereignis ans Ende dieses Teils meines Berichts:
Am 28. März 2014 starb meine Mutter im hundertdritten Altersjahr.
Bis sie fast neunzig war, lebte sie im eigenen Haus, ganz in unserer Nähe. Als ihr Treppensteigen, Putzen und Gärtnern zu viel wurden, zog sie ins Tertianum um, ein Seniorenheim in unserer Gemeinde. Leider gefiel es ihr dort nicht und so nahmen wir sie für kurze Zeit in unserem Haushalt auf. Gerne hätten wir ihr das Beste geboten, was für sie möglich war, aber erneut fühlte sie sich als das fünfte Rad am Wagen. Allmählich hörte sie auch nicht mehr so gut und ihr Sehvermögen liess ebenfalls nach. So wurde alles schwieriger und schwieriger. Sie wurde pflegebedürftig, so dass wir sie nach einem halben Jahr in ein Alters- und Pflegeheim umsiedeln mussten. Dort allerdings gefiel es ihr, was wir mit grosser Erleichterung feststellten. – Zu sehen und mitzuerleben, wie es ihr aber von Jahr zu Jahr schlechter ging, war nicht leicht zu ertragen. Eine Kommunikation wurde mit der Zeit fast unmöglich. Wir verstanden nicht mehr, was sie uns sagen wollte, sie verstand uns nicht mehr und bald schon war es so weit, dass sie nur noch meine Schwester und mich erkannte, schliesslich nicht einmal mehr das. Und bald schon kam der Tag, wo sie ihren Altersbeschwerden erlag. Für uns war es ein trauriger Abschied, trotzdem auch eine Erlösung. Unsere geliebte Mutter, die immer für uns da gewesen war, musste nun nicht mehr leiden. Ihr langes Leben, das sich über ein Jahrhundert erstreckt hatte, war Geschichte; ein weiteres Kapitel in meinem Leben zu Ende.
Ihre Urne ist im Bolliger Friedhof vergraben, dort, wo auch Theos Eltern ihre letzte Ruhestätte gefunden haben – genauso, wie es meine Schwiegermutter vorausgesagt und angeordnet hatte, ein wenig abseits von Herrn Weder...

Dritter Teil: REISEN

Blick zurück: Drei Urlaube (1999 / 2004 / 2009) – und ein paar andere Reise-Erinnerungen
„Reisen macht uns zuerst sprachlos und dann zum Geschichtenerzähler“.
Dieser Satz stammt von Ibu Battuta, einem marokkanischer Autor aus dem 14. Jahrhundert.
Die Reisen, die wir oder ich bis zum Ende des zwanzigsten Jahrhunderts unternahmen, haben mir Appetit gemacht auf mehr, auf sehr viel mehr.
Leider habe ich während dieser Zeit noch keine Reiseberichte geschrieben, viele Details also vergessen, aber ich freue mich, dass ich später dann damit begonnen habe. Fotos existieren schon, aber das ist nicht das Gleiche.
Eine Episode kommt mir in den Sinn aus dem Jahr 1994: Eine lustige Reise war das! – Wir, drei Freundinnen, hatten eine kurze Kreuzfahrt gebucht nach Istanbul. Einen Tag lang hatten wir Zeit, uns Venedig anzusehen. Ich sehe uns noch, wie wir auf dem Bootssteg stehen und nicht ganz sicher sind, ob das Boot, das eben landet, das richtige ist, um zum Petersplatz zu gelangen. Wir stehen nebeneinander an der Schiffsanlegestelle, alle schwarz gekleidet. Da kommt ein Paar angelaufen mit Säcken und Taschen und er müht sich zusätzlich mit einem Koffer ab. Sie hat einen riesigen Hut auf, wie direkt aus Ascot entsprungen und auch er ist elegant gekleidet. Die beiden kommen uns vor wie aus einem Film. Sie drängt sich vor uns aufs Boot und das legt genau in dem Moment ab, sie drauf, wir noch nicht und ihr Partner auch nicht. – Sie ruft ihm etwas zu und er schreit hinüber: „I couldn’t get on the boat because of these three witches!“ – Seit dann erinnern wir uns natürlich an diese Reise als die „Drei-Hexen-Fahrt“.
In Istanbul hatten wir ein anderes Erlebnis, das uns sehr zu denken gab. Wir besuchten den Bazar und gegen Abend auf dem Weg zurück ins Hotel wurden wir aufs Gröbste von einer Gruppe von Männern angemacht und bedrängt, obwohl wir alle sehr ziemlich angezogen waren. Es war nicht sehr warm und wir hatten Hosen und Mäntel an und sogar Kapuzen übergezogen. Die Situation wurde so angespannt, dass wir uns entschlossen, einen halben Kilometer vor dem Hotel ein Taxi zu rufen, um den Weg nicht weiterhin zu Fuss zurücklegen zu müssen. - Fast vom Regen in die Traufe geraten: Der Taxifahrer war ebenso penetrant und machte mit obszönen Bemerkungen mehr oder weniger dort weiter, wo die andern, denen wir knapp entkommen waren, aufgehört hatten und wollte uns in ein „Etablissement“ fahren. – Statt irgendwo in einem hübschen Restaurant zu Abend zu essen, bleiben wir im Hotel.
Als ich Jahre zuvor mit Theo in dieser Stadt war, hatte ich keine Probleme dieser Art, aber offenbar, wenn Frauen alleine unterwegs sind...
In bester Erinnerung sind mir auch die Studienreisen, die wir in fünfjährigen Abständen mit dem Kollegium der bsd. unternahmen (Lissabon, Rom, Veneto, Aquitaine und Bordeaux, Andalusien). Interessant waren dabei die Besuche in Berufsschulen, ähnlich der unseren, und die sehr verschiedenen Betriebsbesichtigungen (Produktionsstandort Autoeuropa in Portugal, landwirtschaftliche Betriebe in Spanien und Frankreich und viele mehr).
In den Sommerferien blieben wir am liebsten zu Hause mit den Kindern, denn nach wie vor finde ich, es gibt keine schönere Destination im Juli und August, als das Ufer der Aare. All die Leute, die an die überfüllten italienischen, französischen und spanischen Strände pilgern müssen, beneiden wir nicht.
Etwas anders war das allerdings im Herbst. Die Berner Herbstferien beginnen jeweils bereits vor Ende September, also eine Woche früher als in den anderen Kantonen, so war und ist man am Strand in Spanien als Berner „unter sich“, zumindest an den Werktagen.
So reisten wir ab 1987 jedes Jahr für zwei Wochen nach Spanien (nördlich von Roses), wo uns ein Freund einen Geheimtipp anvertraut hatte, eine Terrassensiedlung direkt am Meer, ideal für Kinder und Erwachsene (Restaurant mit den Füssen im Sand). Inzwischen waren wir bereits mehr als dreissigmal dort und es ist uns noch immer nicht verleidet.
Es ist schön, irgendwo hinzukommen und sich dort gleich zu Hause zu fühlen. Genauso schön aber ist es, irgendwo hinzureisen, wo man nichts kennt, wo es gilt, alles neu zu erkunden. - Dafür war der Frühling jeweils die Zeit. Wie in Teil zwei bereits erwähnt, nutzte ich die Frühlingsferien regelmässig für eine Familienauszeit (Kenya, Indien, Singapur, Hong Kong, Malaysia, Malediven, Sri Lanka, Bali, Ägypten). Normalerweise reiste ich mit einer Freundin, später auch ein paarmal mit meiner Tochter Kay (Malaysia, Namibia, Mauritius, Thailand, Mittelmeerkreuzfahrt nach Italien und Griechenland, Tennisferien in der Türkei).
Reiseberichte habe ich damals nur wenige verfasst; es sind eher kleine Fotoreportagen mit nur wenig Text.
Das änderte sich, als ich nach zwanzig Jahren Schuldienst meinen ersten Urlaub beziehen durfte. Das wäre im Jahr 1998 gewesen, ich hatte ihn aber ins 1999 verschoben.
Die Berichte schickte ich der Familie heim und auch an einige Freunde. Ich erwähne jeweils Restaurants und Hotels, manchmal sogar mit dem dazugehörigen Link, weil ich denke, dies könnte unter Umständen nützlich sein. Und die vielen Ortsnamen, die ich nenne, helfen mit, mich später wieder an die Reise zu erinnern, sie auf Google Maps zu verfolgen und überhaupt, sie nicht zu vergessen.
Noch eine Bemerkung zu den Texten: Zum Teil sind sie im Präteritum geschrieben, dann wieder im Präsens. Das ist darauf zurückzuführen, dass ich sie manchmal erst nach ein paar Tagen geschrieben habe, oft aber am selben Abend oder am folgenden Morgen, wo das Erlebte noch absolut gegenwärtig war. – Ich will das nicht abändern, denn es würde für mein Empfinden so nicht stimmen.
Und noch etwas: Wenn ich sie durchlese, finde ich immer wieder Fehler: ein Komma hier, ein Fallfehler da, unnötige Wortwiederholungen, auch Orthographiefehler, die ich übersehe und die mir Word seltsamerweise manchmal nicht unterstreicht, „verzworgelte“ Sätze und manches mehr. „It’s a never ending story“...

Reisebericht Urlaub 1999 Florida und Ecuador
Fünfzehn Wochen Urlaub – was für eine wunderbare Perspektive! - Die wollte ich natürlich nicht auf dem Sofa sitzend verstreichen lassen. So meldete ich mich nach den obligaten zwei Familien-Ferienwochen in Spanien erst für einen Lehrerkurs in Florida an. Für die folgenden Wochen bis kurz vor Weihnachten war ein Schulbesuch in Ecuador geplant, um meine Spanischkenntnisse zu vertiefen.
CELTA
Die vier Wochen in Florida werden mir unvergesslich bleiben, weil ich, soweit ich mich erinnern kann, in meinem Leben noch nie einen solchen Stress gehabt habe. Der Kurs, den ich gebucht hatte, hätte mir erlaubt, am Nachmittag jeweils an den Strand zu gehen, ein wenig die Gegend zu erkunden (Everglades, Key West etc.), und Tennisspielen wollte ich jeden Tag eine Stunde lang. Ich hatte mir ein Apartment gemietet mit Fitnesscenter und einem Swimmingpool gleich vor der Terrassentüre. Am Pool war ich während der ganzen Zeit nur dreimal kurz, im Fitnesscenter einmal und am Strand zweimal für ungefähr zwei Stunden. Den Tennisschläger habe ich nie auch nur angerührt.
Als ich am ersten Tag in der Schule meine Eintrittstest machte, wurde mir mitgeteilt, es hätte sich niemand sonst für diesen Kurs angemeldet, ich wäre die Einzige, was mir nicht sehr behagte. Man schlug mir vor, lieber beim CELTA - Cambridge Kurs (Certificate in English Language Teaching to Adults) mitzumachen, da wären wir zu fünft. Dieser sei zwar mehr als nur streng, etliche würden aussteigen und auch dass es Tränen gäbe, sei nicht unüblich. Ebenfalls müsse man sich nicht vorstellen, viel daneben unternehmen zu können. Eigentlich sei er nur für „native speakers“ ausgeschrieben, aber sie würden eine Ausnahme machen und ich würde nicht draufzahlen müssen. - Obwohl nicht gerade begeistert, war ich einverstanden. Man sagte mir, der Kurs fange täglich um neun Uhr an, aber vermutlich sei es unerlässlich, schon um acht Uhr dort zu sein. Genau so war‘s natürlich. Bis um sechs würde es dann dauern und man müsse mit mindestens drei Stunden Hausaufgaben rechnen. Das allerdings war eine masslose Untertreibung, denn unter sechs Stunden zusätzlich hat‘s niemand von uns geschafft. Wir waren zu fünft (drei Frauen und zwei Männer) und das Ziel der Tortur war, ein Zertifikat zu erhalten, das einem ermöglicht, in jedem Land der Welt Englisch unterrichten zu können. Das brauchte ich zwar gar nicht, die bsd. und die BMS taten‘s mir allemal, aber ich dachte, es tue mir vielleicht ganz gut, mal vier Wochen lang das zu tun, was mir zu Hause ja auch warten würde mit den neuen Qualitätsansprüchen. Zudem fand ich, es würde eine wertvolle Erfahrung sein, im Schulzimmer wieder mal auf der „anderen Seite“ zu sitzen.
Nun, dem war dann nicht ganz so. Der Inhalt des Kurses war genau das, was ich eigentlich eine Zeitlang hatte vergessen wollten: Unterrichten, Stunden präpen, stundenlang vor dem Computer sitzen (zum Glück hatte ich meinen Laptop bei mir - ohne den wär das alles unmöglich gewesen).
Am Morgen wurde uns jeweils gezeigt, wie „man“ Schule gibt (auch den alten Hasen!), wir mussten hospen (nicht hopsen) und Methodik, Phonetik und Grammatik etc. lernen. Am Mittag hatten wir eine Stunde Pause, aber niemand kam je dazu, gemütlich etwas zu essen, man musste seine Stunden vorbereiten, die man am Nachmittag zu halten hatte, es gab natürlich Kopien auszudrucken, Bücher und Zeitschriften nach geeignetem Material durchzuforsten, den Proki-Schreiber, das Tonband, den TV-Apparat herzurichten, die Sitzordnung zu planen, was eben alles so dazu gehört. Dann mussten wir unsere Lektionen halten und zwar beobachtet von den vier Mitkolleginnen und Mitkollegen oder „Mitleidern“ und unseren zwei Lehrerinnen, denen wir jeweils vorher ganz genaue Lektionenpläne hatten abgeben müssen. Auf die Minute musste Rechenschaft abgelegt werden, was wir mit unseren Schülerinnen und Schülern, den Versuchskaninchen aus aller Herren Länder, vorhatten. Die Verhältnisse im Schulzimmer waren allerdings nicht ganz so wie bei uns. Zuweilen waren nur ungefähr fünf oder sechs „Students“ aus der Schweiz, Frankreich, Spanien, Italien, zum Teil aus Südamerika und wenigen anderen Ländern in unserer Versuchsklasse. Die meisten von ihnen aber waren Japanerinnen und Japaner, die einen Sprachkurs gebucht hatten und sich daher prima als „Material“ für unsere Unterrichtssequenzen eigneten. Kein anderes Wort als Englisch durfte gesprochen werden, der minuziös ausgearbeitete Unterrichtsplan musste peinlich genau eingehalten werden. Falls nicht, hatte man sich im Anschluss bei der Besprechung auf ein „Gewitter“ gefasst machen müssen. Auch musste die „TTT“ (Teacher Talking Time) auf ein Minimum beschränkt werden. Und dann kam das dicke Ende am späten Nachmittag. Alles wurde zerpflückt und beurteilt bis zum Gehtnichtmehr.
Mit manchem war ich überhaupt nicht einverstanden. Schliesslich hatte ich bereits zwanzig Jahre Erfahrung. Zudem hatte ich nämlich viel gelernt von unserem Lehrer im Gymnasium, der im Vergleich zur hier praktizierten Methode eine riesige TTT aufwies, was mir jedoch sehr gefiel. Wendungen, die er brauchte, schrieb ich oft auf. - Was mir auch nicht passte, war diese „Minuten-Vorbereiterei“. - Wo blieb Zeit, auf Fragen der Students einzugehen? Wie stand’s mit Flexibilität? – Unser Unterricht zu Hause sieht völlig anders aus und führt ja auch zum Ziel, und das überhaupt nicht schlecht. - Natürlich planen wir den Unterricht, aber nie dermassen minuziös aufgegliedert. Das fand ich absolut stumpfsinnig, aber argumentieren nutzte nicht viel, dazu war ja auch in unserem Unterricht keine Zeit eingeplant und die Struktur eines Cambridge-Kurses zu ändern, das konnte ich so oder so vergessen.
Zurück zum „CELTA-Alltag“: Am frühen Abend um sieben war ich normalerweise zu Hause. Es reichte jeweils kaum für ein Nachtessen, schon gar nicht für eines in Musse, und schon musste ich wieder die Stunde vom nächsten Tag vorbereiten. Dazu wurde täglich eine Seite Tagebuch verlangt über alles, was man im Unterricht und beim Unterrichten gelernt hatte, wie man sich fühlte und so weiter. - Und nicht genug: Zusätzlich wurde von uns verlangt, vier umfangreiche Arbeiten abzugeben über die vier Kurswochen verteilt. Eine beinhaltete etwas über Grammatik - für mich relativ einfach, für meine muttersprachigen Kolleginnen und Kollegen aber recht schwierig, weil sie nicht so sattelfest waren in ihrer eigenen, der englischen Grammatik.
Dann musste man sich eine Schülerin oder einen Schüler suchen und mit ihr oder ihm ein etwa zweistündiges Interview durchführen, zum Teil auf Tonband, ihre/seine „Geschichte“ aufschreiben, wie er oder sie Englisch gelernt hatte oder lernt, weshalb, seit wann, etc. Dann analysieren, welche Laute sie/er wie ausspricht, was dabei falsch gemacht wird, wo die Probleme liegen, was man empfehlen könnte, wie weiterfahren und so fort. Auch musste sie oder er einen Aufsatz schreiben, der korrigiert und genau nach der Art der Fehler analysiert werden musste. - Jemanden zu finden, der all das in der Freizeit auf sich nahm, war übrigens auch nicht „a piece of cake“, das Einfachste auf der Welt...
Eine andere Arbeit war, eine Stunde, die man gegeben hatte, selber zu zerpflücken und genau zu beschreiben, was man wieso anders machen würde oder nicht und das hatte 1500 Worte lang zu sein.
Natürlich bestand die vierte Arbeit aus einer ausführlichen Kursevaluation.
Und jede Woche fand ein Gespräch mit einer unserer Lehrerinnen statt, wo man sich selber beurteilen musste und von ihr auch beurteilt wurde. - So ein Stress!
Zwei Tage lang war ein Assessor aus Cambridge da, der einen dann noch zusätzlich unter die Lupe nahm. Auch die Schule wurde von ihm auf Herz und Nieren geprüft. - Ziemlich übertrieben, das Ganze, fand ich. - Ja, so war‘s und ich werde es nie vergessen, nicht den enormen Schlafmangel, nicht die Strapaze und den Druck.
Am letzten Tag wäre nach Stundenplan um 4.15 Uhr Kursende gewesen. Aber weil an einem Nachmittag wegen eines Hurrikans die Schule hatte ausfallen müssen, wurden wir dazu verdammt, unsere Stunden halt dann nachzuholen (kein Erbarmen!) und es wurde wieder sechs Uhr bis wir gehen konnten. - Einer allein glaubt‘s fast nicht: Zwei von uns mussten deshalb ihre Flüge verschieben. - Und dann fiel auch einer der Kollegen noch durch am Schluss und erhielt sein Diplom gar nicht.
Schlimm am Ganzen war auch die Tatsache, dass ich kaum dazu kam, etwas zu organisieren betreffend meiner Weiterreise. Natürlich hatten die Reisebüros schon alle geschlossen, wenn wir endlich das viel zu kalt klimatisierte Gebäude verlassen konnten. Und dabei war‘s draussen so schön warm!
Eine Freundin kam mich für zwei Wochen besuchen; sie wohnte bei mir im Apartment, aber ich hatte kaum Zeit, mit ihr etwas zu unternehmen, was mir ein ziemlich schlechtes Gewissen bescherte, denn jeweils am Nachmittag oder am Wochenende gemeinsam Ausflüge zu unternehmen, wäre ja der Zweck ihres Besuches gewesen.
Es hatte auch fast eine Woche gedauert, bis es mir endlich gelang, ein Velo zu kaufen, das mir ermöglichte, auf dem Schulweg Zeit zu sparen, denn auch der Bikeshop hatte schon geschlossen, als wir aus der „Hölle“ entlassen wurden. Eigentlich hätte ich ja eines mieten wollen, aber weil Ray, einer meiner Kollegen aus dem Kurs, sagte, er würde es später gerne noch eine Zeitlang benutzen und es dann für mich verkaufen, war ich einverstanden. – Ich würde Ray dann nach meiner Südamerikareise wieder in Miami treffen. Er nahm auch einen meiner Koffer in Gewahrsam, den ich nicht mitnehmen wollte. - Das war ein perfekter Deal.
Die Schulzeit in Fort Lauderdale hatte ich also hinter mir; jetzt waren Reisen angesagt.
Ecuador – Quito
Als ich anschliessend an diese verrückten vier Wochen glücklich in Quito ankam, kam mir alles vor wie ein kleines Paradies: kein Stress mehr, Zeit für mich, alles wunderbar. Nur wenige Tage blieb ich dort, denn Cuenca war der Ort, wo ich für ein paar Wochen bleiben wollte. Vorerst aber erkundete ich die Stadt, die in einem schmalen Becken hoch oben in den Anden gelegen ist. Dort erstreckt sie sich lang und dünn wie eine Schlange. Ihre Ausdehnung ist etwa 30 km lang, aber nur höchstens 3 km breit. Mit 2‘850 Metern Höhe über Meer und ist sie somit die höchst gelegene Hauptstadt der Welt. Ihre fantastische Altstadt gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Avenida de Chile war ein einziger, dichtgedrängter Markt. Vor Taschendieben hatte man mich gewarnt. Mehrmals. So war ich ziemlich gewappnet, merkte aber trotzdem nicht, dass mir jemand im Gedränge mein „Kitcherner-Rucksäckli“ aufgeschlitzt hatte. Erst später im Hotel fiel es mir auf. Passiert war aber nichts, das Geld hatte ich im Hosensack. – All die Menschen, die mir begegneten und mit denen ich ins Gespräch kam, fand ich sehr nett. Ausser dem Dieb natürlich. Mein Rucksäckli aus der Spar- und Leihkasse Münsingen flickte ich am nächsten Tag mit Faden aus der Kantonalbank, einem weiteren Werbegeschenk.
An einem Samstag unternahm ich einen Tagesausflug nach Otavalo. Die Stadt nördlich von Quito ist bekannt und beliebt bei den Touristen wegen ihres farbenfrohen Marktes. Der Ort ist schön gelegen, von drei Vulkanen umgeben. Ich hatte einen Taxifahrer kennengelernt, der mich dorthin führte und mit dem ich einen Pauschalbetrag vereinbart hatte. Wir verbrachten den ganzen Tag zusammen. Die Fahrt war lang und etwas mühsam, weil die Strasse schlecht und voller Löcher war, aber die Gegend gefiel mir sehr. Auf der Rückreise fuhr mich Wilson zum „Mitad del Mundo“, dem Mittelpunkt der Erde, welcher auf dem Äquator liegt, eben bei 0° 0′ 0″ N 78° 27′ 21″ W, wie’s auf einem Schild steht. Zur Versinnbildlichung ist eine gelbe Linie gezogen. Heute weiss man allerdings, dass nicht ganz exakt gemessen wurde und diese demnach nicht genau am richtigen Ort durchführt.
Cuenca
Wenige Tage später flog ich nach Cuenca und für weitere zwei Wochen besuchte ich auch dort eine Schule, diesmal als „echte“ Schülerin. Und ich genoss den Unterricht. Er war ganz so, wie ich das vom eigenen Lernen her gewohnt war: Viel Grammatik wurde gebüffelt, eine ganze Menge schriftliche und mündliche Übungen gab’s dazu - das exakte Gegenteil von CELTA. Ganz klar führen verschiedene Wege nach Rom, und der hier entsprach mir viel besser, selbst wenn diese Art Unterricht eher der Vergangenheit angehört. Am Nachmittag hatten wir jeweils frei, so kam ich dazu, das Gelernte zu vertiefen oder etwas zu unternehmen. Kurse wurden angeboten, von denen ich regen Gebrauch machte: Keramik modellieren und Kochen.
Bald schon hatte ich Kontakt zu verschiedenen Leuten, die ich in der Schule und in der Freizeit kennengelernt hatte und ich fühlte mich äusserst wohl in der Stadt, wo’s so viele gemütliche Restaurants hat, eine grosse Anzahl von Internetcafés, alle so freundlich sind und das Klima angenehm ist. Man sagt, die vier Jahreszeiten würden sich jeweils an einem Tag abspielen. Das traf ziemlich genau zu: Normalerweise war es warm oder sogar heiss, aber dann begann es plötzlich zu regnen, meist so gegen vier Uhr nachmittags, und in der Nacht war es relativ kalt. Ohne Regenschirm in der Tasche ging ich jedenfalls nirgendwo hin. Schnee war natürlich kein Thema.
Das Leben in diesem armen Land präsentierte sich nach meinem Aufenthalt in Florida wie von einem anderen Planeten. Ich hatte mitten in der Altstadt eine nette Unterkunft gefunden in einer einfachen Pension, die von einer freundlichen Dame geführt wurde (laorquidea.com.ec/">laorquidea.com.ec/). Nur 8 Dollar pro Tag kostete das Zimmer, ein Preis, von dem wir zu Hause nur träumen können. Überhaupt war das Thema Geld ein ganz besonderes:
Wenn ich am Morgen meinen Milchkaffee und ein 3 dl grosses Glas frisch gepressten Brombeersaft zahlte, legte ich eine Note von 20'000 Sucres hin. Dann erhielt ich 15‘000 Sucres zurück, also kostete mich mein Frühstück 50 Rp. (für 10'000 Sucres erhielt man damals einen Franken). Ein Brötchen beim Bäcker kostete 5 Rappen, ein Mittagessen in einem guten Restaurant rund anderthalb Franken. Mein Tennislehrer verlangte 3 Franken für die Privatstunde (einen für die Platzmiete, der Rest war sein Lohn). Eine Fahrt mit dem Taxi kostete einen Franken. Und mein Spanischlehrer in der Schule fand das angemessen...
Auf der Bank bezog ich einmal mit meiner Visa Karte 2 Mio. Sucres (200 Fr.). Ich erhielt eine Riesenbeige von 70 mal 2- und 60 mal 1-Frankennoten. Der Kunde neben mir liess sich einen viel grösseren Betrag auszahlen. Wer weiss, was er damit im Sinn hatte. Jedenfalls stand er da mit zwei grossen Zuckersäcken, die man ihm mit Noten füllte...
Vor den Banken standen Menschen stundenlang an, um ihren Lohn in Empfang zu nehmen und diesen möglichst rasch in Naturalien umzusetzen, denn die Inflation nahm immer krassere Formen an. In den wenigen Wochen, als ich dort war, erhielt ich nach kurzer Zeit bereits 30 Rappen mehr für einen Dollar. So war für die Leute dort alles extrem teuer und Luxusgüter, falls überhaupt vorhanden, waren kaum mehr erschwinglich. Eine Auslandreise zum Beispiel wurde immer utopischer (ein Professor an der Uni erhielt 220 Franken Lohn pro Monat, aber nur, wenn er mindestens zehn Jahre Erfahrung hatte. Der Lohn für eine Primarlehrerin betrug rund 150 Franken). Deshalb kam es dann auch zu Protesten und die Strassen in der Stadt waren voller schwer bewaffneter Polizisten.
Was ich sehr schätzte, waren die Ausflüge, die von der Schule organisiert wurden mit dem Zweck, Kultur, Land und Leute besser kennenzulernen.
So fuhren wir an einem Tag nach Ingapirca, Ecuadors bedeutendste präkolumbianische Inka-Ruinenstätte. Unterwegs hielten wir bei einer Käserei an. Fast wie bei uns in der Schweiz kam es mir vor: Kuhherden und landwirtschaftliche Betriebe. - Beeindruckend: Papas (Kartoffeln) werden sogar noch auf 3‘000 Metern Höhe angebaut. Kleine zwar... Auch Eukalyptusbäume wachsen dort.
Die Ruinen sind imposant. Ein gelblicher Sonnentempel gehört zu den Hauptsehenswürdigkeiten der antiken Stätte. Interessant auch die Geschichte und die geheimnisvollen Legenden, die wir zu hören bekamen. Weniger geheimnisvoll als vielmehr mühsam war der plötzliche Wolkenbruch, der die Wege fast nicht mehr begehbar machte. Teilweise rannen ganze Bäche die erdigen Pfade hinunter. Auch der Nebel mischte sogleich mit und man sah überhaupt nichts mehr. Bald sassen wir alle wieder im Bus. Klatschnass natürlich. Zweieinhalb Stunden dauerte die Reise zurück nach Cuenca.
Am nächsten Tag wollte ich zur Abwechslung mal baden gehen. Im nahe gelegenen Ort Baños hat’s Thermalquellen. Mitten auf der Strecke hielt der Bus an und musste umkehren, weil erzürnte Bürger Strassensperren errichtet hatten und brennende Pneus die Weiterfahrt versperrten. Ich stieg aus und machte ein paar Fotos. Wohl war mir dabei allerdings nicht. Jemand schimpfte auf mich ein. Auf der anderen Seite der Barrikaden hielt ich ein Taxi an und war kurze Zeit später am Ziel. Der Ausflug war’s nicht wert. Es handelte sich um einen Swimmingpool mit 30-35 Grad warmem Wasser, die Anlage sehr bescheiden, Rasen war keiner vorhanden. Das Schlimmste aber war, ich bemerkte, dass ich meine Kamera nicht mehr hatte. Wie und wo genau sie mir abhandengekommen war, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich hatte einen sehr schlechten Nachmittag, ärgerte mich über den Verlust des Fotoapparates und sträflich über mich selber. Als ich dann noch meinen Schirm irgendwo liegen liess, war klar, das war nicht mein Tag.
Ein Ausflug mit besseren Vorzeichen war derjenige in den Süden nach Vilcabamba, ins „Tal der Hunderjährigen“ oder wie der Ort auch genannt wird, ins „Tal der Langlebigkeit“. Weshalb die Einwohner dort so alt werden (bis zu 120 Jahre wird überliefert), darüber gibt es verschiedene Spekulationen, aber ein wissenschaftlicher Beweis erhärtet diese Thesen überhaupt nicht. Vielmehr wird vermutet, dass nicht ganz alle Angaben bezüglich Geburtsdaten korrekt sind.
Mit einer Kollegin, die ich in der Schule kennengelernt hatte, fuhren wir am frühen Nachmittag los, aber weil die Strasse in katastrophalem Zustand war, dauerten die hundert Kilometer bis zum ersten Zwischenhalt in Oña zweieinhalb Stunden. Manchmal hatte es überhaupt keinen Asphalt mehr auf der Fahrbahn, dafür grosse Löcher und Steine. Umso schöner präsentierte sich die gebirgige Gegend. Die Vegetation änderte alsdann stark von 3‘500 auf 1‘500 Meter hinunter. Es wurde immer wärmer. Fast sieben Stunden waren wir unterwegs. Das Hotel, das uns das Reisebüro gebucht hatte, gefiel uns nicht, wir fanden aber eines, das uns absolut begeisterte: das „Madre Tierra“ (www.madretierra.com.ec/">www.madretierra.com.ec/).
Am Hang gelegen mit einmaliger Aussicht auf das Dorf und die Berge, die es umgeben und die mich an unsere Voralpen erinnerten, ausgestattet mit speziell ansprechend eingerichteten Zimmern, fast wie in einem Palast, und einem fantastischen Tropengarten war für uns sofort klar: Dorthin ziehen wir sogleich um.
So sehr es mir in Cuenca gefiel – mitten in der Stadt zu leben, fand ich zur Abwechslung absolut grossartig – zahlreiche Restaurants, Internetcafés und Reisebüros in nächster Nähe, die Post gleich nebenan, Geschäfte, Lädeli und Apotheke um die Ecke, der Nachteil waren die stinkenden Abgase und die rücksichtslose Fahrweise der Autofahrer. Fussgänger müssen sich oft rennenderweise auf die andere Strassenseite retten, sonst werden sie mit der Hupe weggefegt. Zwar gewöhnt man sich an alles, aber umso schöner empfanden wir die Ruhe und Schönheit der Natur nun im Süden.
Am nächsten Morgen, von einem beispiellosen Vogelgezwitscher geweckt, bei dem aber auch Esel mitmischten, Hähne sowie Kühe, erhielten wir früh schon ein wunderbares Frühstück. Anschliessend fuhren wir ins Dorf, wo tatsächliche viele alte Leute unter den schattenspendenden Bäumen auf Bänken sassen und sich die Touristen ansahen, die es bis dorthin ins Dorf geschafft hatten. Gegenseitige Betrachtung sozusagen. Auch im kleinen Zoo funktionierte das ähnlich. Dort gab’s ein paar wenige Tiere zu sehen, aber das Beste an diesem Tag war der dreistündige Ausritt, den ich am Nachmittag unternahm. Im Westernsattel ging es bergauf und runter, im Schritt, im Trab und im Galopp, an einem Fluss entlang, durch enge Wege, über Weiden, an Bauernhöfen und Kuhherden vorbei und meistens mit einer „vista maravillosa“. – Eine herrlich kühle Dusche anschliessend, ein delikates Nachtessen, eine feine Flasche Wein – was kann man sich noch mehr wünschen?! - Der krönende Abschluss war beim Einnachten die Sicht auf das Dorf und die Gegend von unserer Terrasse aus. Dreifache Lichtquellen beobachteten wir: Die Lichter im Dort, die sich wie ein Hufeisen präsentierten, die unendliche Sternenpracht und die Leuchtkäferchen, die überall auf der Suche nach einem geeigneten Partner herumschwirrten.
Am nächsten Tag reisten wir wieder zurück nach Cuenca. Vorerst aber liessen wir uns noch im Spa verwöhnen, genossen ein Sprudelbad und Massagen. Auf der Rückfahrt machen wir Halt in Joja und später in Saraguro, wo wir den Markt besuchten. Dort war es mir nicht sehr wohl, Margrit und ich waren nämlich die einzigen Ausländerinnen weit und breit. Die Leute waren fast alle ihrer Tradition gemäss schwarz gekleidet, was ziemlich seltsam wirkte, denn sonst sind die Kleider der Indigenas meist farbig und das erzeugt einen sehr viel fröhlicheren Eindruck. Man begegnete uns weder freundlich noch feindlich. Die Atmosphäre befremdete mich jedenfalls; vielleicht aber liess ich mich von der ungewohnten Farbe beziehungsweise Farblosigkeit zu stark beeinflussen.
Wegen der miserablen Strasse zog sich die Fahrt wieder endlos in die Länge. Gegen Abend kamen wir „zu Hause“ an. - Auch dieser Ausflug ist unvergesslich.
An einem anderen Wochenende meldete ich mich für eine Wanderung an, die mich ziemlich schaffte. Als nicht besonders geübter Wandervogel war der Hike in der dünnen Luft für mich eine grosse Anstrengung und Herausforderung, aber wunderschön. Die Gegend dort heisst „Las Cejas Altas“ und von einem Restaurant aus, wo wir Rast machten, das 3‘500 Meter über Meer liegt, ging‘s erbarmungslos bergauf bis zum Gipfel Avicahuaycu (4‘198 m), der von weitem aussieht wie unser Stockhorn, eine Art Zuckerhut. Er flösste mir grossen Respekt ein und ich fragte mich, was wohl in mich gefahren war, so eine Exkursion überhaupt mitzumachen. Da ich die Älteste war in der Gruppe, war ich speziell stolz, dass ich mithalten konnte bis zuoberst. Fast die Hälfte unserer Gruppe gab nämlich ungefähr 200 Meter vor dem Ziel auf. Einige sogar noch früher, weil sie an starken Kopfschmerzen und an Übelkeit zu leiden begannen. Dank dem Umstand, dass ich endlich Zeit hatte, jeden Tag eine Stunde Tennis zu spielen, hatte ich mich bereits an die Höhenverhältnisse gewöhnen können (Cuenca liegt auf 2‘500 m), wohingegen den andern, die erst kurz da waren, sowohl das Klima als auch die Höhe zu schaffen machten. Unterwegs gab’s einiges zu sehen: Bis zu einer Höhe von 4‘000 Metern gibt es noch Quinoa-Bäume oder -Sträucher, die etwa ein halbes Jahrhundert alt sind, wie man uns sagte, und deren Rinden ganz faserig sind. Sie bilden sogar eine Art Wälder. Noch weiter oben wächst dann ausschliesslich hohes Gras. - Der allerletzte Aufstieg bestand hingegen nur noch aus steilen Felsen, so dass unsere Wanderung allmählich in eine „Kletterung“ ausartete und man mich die letzten paar Meter hinaufhieven musste. Die Luft wurde immer dünner und dünner. Aber als wir oben waren, war es ein erhabenes Gefühl, bis nach Cuenca hinunterschauen zu können und der Anblick des Bergpanoramas war überwältigend. Das Tüpfli auf dem „i“ war dann der Condor, der hoch über uns leicht und anmutig durch die Lüfte segelte – „El Condor pasa“. - Aber das Wildeste, was daraufhin passierte, war, dass urplötzlich das Wetter umschlug und es zu hageln begann.
Mir graute vor dem Abstieg. Über die nassen und glitschigen Felsen und Gräser herunterzurutschen, war keine begehrenswerte Perspektive. – Es war mühsam, aber wir schafften es. Wie froh war ich, als ich endlich die grosse Coca-Cola-Reklame auf dem Dach des Restaurants erblickte, von wo aus wir gestartet waren. Allerdings hatte ich mir nebst ein paar Blasen an den Füssen einen äusserst schmerzlichen Muskelkater eingehandelt, der mich noch mehr als eine Woche lang quälte. Treppensteigen rauf und vor allem runter war in den ersten Tagen fast ein Ding der Unmöglichkeit.
Galapagos
Trotzdem fuhr ich, kaum zurück, von Cuenca aus mit dem Bus nach Quito, dann nach Guayaquil, von wo aus ich einen Flug auf die Galapagos-Inseln gebucht hatte. Die fünfstündige Busfahrt war ziemlich speziell. Unterwegs stiegen ständig Leute zu, die im Gang stehen mussten. So hatte ich immer wieder mal einen Ellenbogen am Kopf. – Ein paar Reihen weiter hinten verlangte einer immer „fundas“, Papiertüten, weil er seinen Mageninhalt nicht bei sich behalten konnte.
Hielt der Bus in einem Ort an, war es üblich, dass ein paar Verkäufer zustiegen, die sich dann durch die Reihen drängten und ihre Ware feilboten: Früchte, Eis, Getränke, Hühner. Einer wollte den Passagieren homöopathische Mittel andrehen. Ausgerüstet war er mit Bildern und Bildtafeln, zeigte diese herum und er sprach von Prostata, über Frauenleiden und Sexhilfen. – So wurde es jedenfalls nie langweilig. Die Gegend jedoch zeigte sich grau in grau, denn es regnete wieder mal und war neblig. Während gut drei Stunden führte die Fahrt an Berghängen vorbei, dann endlich ging’s bergab und die Vegetation änderte frappant. Wir zogen an kilometerlangen Bananenplantagen vorbei.
Die Woche auf den Galapagos war ein einmaliges Erlebnis. Das Schiff, in dem ich eine Kajüte gemietet hatte, die ich mit jemandem teilen musste, die oder den ich vorerst noch nicht kannte, war sehr gut; es hatte gerade die richtige Grösse - mit sechzehn Passagieren aus fünf verschiedenen Ländern und sieben Mann Besatzung nicht zu gross und nicht zu klein. Wir waren eine fröhliche Gesellschaft und hatten es alle zusammen immer lustig. Zwei ausgezeichnete Köche machten uns zudem das Leben leicht. Köstliches hatten sie jedes Mal vorbereitet, wenn wir von einem Ausflug zurückkamen, auch alle übrigen Mahlzeiten waren stets schmackhaft und liebevoll präsentiert.
Die Kajüte allerdings war „etwas" eng. Zwar hatte ich mein Gepäck radikal vermindert, aber für die bestehenden Verhältnisse immer noch weit entfernt von ideal. Entweder konnte ich das Gepäck hineinstellen, dann musste ich aber draussen bleiben, oder ich war drin und das Gepäck draussen. Dazu kam, Anke, meine deutsche Mitpassagierin und ich, wir mussten uns in die enge Kabine teilen. So behielten wir beide nur das Allernotwendigste bei uns und gaben die grossen Reisetaschen und Rucksäcke in den Bauch des Schiffes, wo wir sie eine ganze Woche lang nicht mehr zu Gesicht bekamen. Gerade so gut hätten wir die Bagage gar nicht mitschleppen müssen, wieder hatte ich nämlich viel zu viel eingepackt. So trug ich fast während einer Woche mehr oder weniger dieselben Kleider, oft natürlich den Badeanzug. Den andern ging’s selbstverständlich genauso.
Das Schiff fuhr uns von Insel zu Insel (Santa Cruz, San Cristobal, Bartolomé, Baltra, Genovesa, Plaza), und jedes Mal wurden wir von neuem überrascht von der Schönheit der Natur und der einzigartigen Tierwelt. Es ist unglaublich, wie die Tiere ohne Scheu dort leben. Ich hatte mir das nicht so vorgestellt. Man musste aufpassen, dass man nicht auf sie trat. Vor allem bei den Maskentölpeln war das sonderbar. Die brüten am Boden, meist so gut getarnt, dass man sie kaum wahrnimmt. Anders hingegen die Rotfusstölpel. Sie bauen ihre Nester in den Büschen oder Bäumen. - Die drachenähnlichen Leguane hingegen konnte man ihrer Grösse wegen kaum übersehen, obwohl sie sich wie Galionsfiguren starr und bewegungslos auf den Felsen oder im schwarzen Vulkansand sonnten.
Riesige Kolonien von Seelöwen zu beobachten, war ebenfalls eindrücklich genauso wie ein Besuch bei den Riesenschildkröten. Den verspielten Delphinen zuzuschauen, die oft das Schiff begleiteten, machte sowieso Spass.
Und erst die Fregattenvögel! Ihre Taktiken mitzuverfolgen, davon konnten wir kaum genug bekommen. Sie attackieren andere Seevögel im Flug, bis die Bedrängten ihren eben gemachten Fang nicht mehr halten können und noch im Flug schnappen sie sich die fallen gelassene Beute. - Frech, aber sehr effizient! Einmalig auch, wenn die Männchen beim Balzen ihre roten Brüste bis fast zum Zerspringen aufplustern. Genauso lustig auch zu beobachten, wie die Blaufusstölpel-Männchen ihren Weibchen ihre blauen Füsse zeigen, bevor sie sie besteigen. – Da läuft etwas bei den Vögeln. – Überhaupt: Was für ein wunderbares Vogelparadies. Pinguine und Pelikane gibt es ebenfalls viele, den Austernfischern konnten wir zuschauen, wie sie mit unendlicher Geduld und ohne Unterlass mit ihren langen roten Schnäbeln im Sand nach Muscheln bohrten.
Unser letzter Abend auf dem Schiff bleibt unvergesslich. Mario, der eine Koch hatte einen Kuchen gebacken, auf dem „Adios Amigos“ stand. Nach dem Abräumen wurden CDs aufgelegt und man begann zu tanzen. Der Wein floss und anschliessend offerierte die Crew allen ein Rumgetränk. Immer wieder wurden die Gläser nachgefüllt, immer lustiger wurde die Gesellschaft. Das Boot stand völlig schief, was noch mehr Fröhlichkeit hervorrief. Auch wer kaum Alkohol getrunken hatte, torkelte herum. Der Däne, er wurde „Papa“ genannt, wollte nicht mehr mit Tanzen aufhören. Er holte blaue Flossen und machte damit vor seiner Frau, der „Mama“ ganz nach Tölpelart einen „Blue-footed-boobie-Tanz“, es war zum „Göisse“ komisch. Seine Tochter sagte zu mir, so habe sie ihren Vater noch nie gesehen... Offenbar war die Scharade ansteckend und Serge, einer der Franzosen, der sonst immer still war und kaum je ein Wort sagte, zog eine rote Rettungsweste verkehrt herum an und begann den Balztanz der Fregattenvögel zu imitieren. – Schade, dass uns nach einer Woche unsere Wege bereits wieder trennten.
Bei der Reise zurück nach Quito hatte ich ein wenig Pech. Auf Puerto Ayura wurden wir um halb sechs Uhr morgens geweckt. Um acht Uhr kamen wir in Baltra an, wo der Flug um neun Uhr hätten starten sollen. Dann jedoch wurde der Flughafen in Quito geschlossen, weil ein Vulkan ausgebrochen war, die Pisten voller Asche und weder Starten noch Landen mehr möglich war. So dauerte es neuneinhalb Stunden, bis wir endlich abheben konnten, am Abend um halb sechs. Das war obermühsam, denn es gab auf dem kleinen Flughafen, wo wir gestrandet waren, überhaupt nichts zu tun. Man wurde kaum informiert und zu essen oder zu trinken kriegte man auch nichts. Wenigstens hatte ich ein gutes Buch dabei, welches ich gleich fertig las, und mein Bikini im Handgepäck, so dass ich mich dort in die Sonne legen und auf diese Weise den ganzen Tag lesend verbringen konnte.
Landen konnten wir noch immer nicht in Quito, aber in Latacunga, etwa hundert Kilometer südlich der Hauptstadt. Eine zweistündige Busfahrt kam daher noch dazu. Müde und erschöpft kam ich kurz nach Mitternacht in der Posada Real an, wo ich sehr freundlich empfangen wurde.
La Selva
Ein paar weitere Tage verbrachte ich im Urwald, das heisst, ich buchte eine Unterkunft in der Yuturi-Lodge (www.yuturilodge.com/">www.yuturilodge.com/), wo es mir ebenfalls ausserordentlich gut gefiel. Die Unterkunft liegt mitten im Urwald von Amazonien (zwölf Stunden Fahrt mit dem Bus von Quito oder eine Stunde mit dem Flugzeug); sie war bescheiden ausgestattet, aber man hatte alles, was nötig war. Gleich nach meiner Ankunft unternahmen Marco, der Führer, der mir in den nächsten Tagen viele der Geheimnisse des Regenwaldes zeigen würde, und ich eine idyllische Bootsfahrt in einem Kanu, die wir allerdings nach einer Stunde abbrechen mussten, weil es wie aus Kübeln zu regnen begann. Zurück in der Lodge hängte ich meine Kleider zum Trocknen auf und legte mich in eine Hängematte.
Am Abend gab es nur zwischen 6 und 10 Uhr Strom, dann wurde es dunkel wie in einer Kuh und die Stille war wunderbar. Nichts als Tierlaute waren zu hören, Grillen vor allem und in der Ferne ein Donnergrollen.
Trotzdem schlug Marco vor, gleich am ersten Abend einen „Spaziergang" durch den Wald zu machen, ausgerüstet mit Taschenlampe und Gummistiefeln. Mir war’s fast zumute wie in einem Gruselkabinett und ich war nicht ganz unfroh, als unsere Exkursion zu Ende war, denn der Boden war noch immer völlig nass, sumpfig und glitschig und ich lernte sehr bald, einen Stock zu Hilfe zu nehmen, weil es keine gute Idee ist, an den Bäumen Halt zu suchen. Der Grund dafür ist, man muss überall mit grusig grossen Ameisen rechnen, genannt „La Conga“, die einem offenbar während zwölf Stunden tödliche Schmerzen verpassen können, wenn sie einen stechen.
Und dann grübelte Marco eine Tarantula aus ihrer Höhle. Ich hatte fast einen Herzstillstand, so geschockt war ich. Das Ding war faustgross und ich bin alles andere als eine Spinnen-Liebhaberin.
Aber alles, was mir Marco zeigte und erzählte, war phantastisch und spannend. Er kannte jeden Baum und jede Pflanze im Wald und wusste, wozu sie gut waren. Es gibt Kräuter gegen Fieber, Schmerzen, Serum gegen den Biss der giftigen Schlangen und und und.
Er zeigte mir einen Baum, der den Waldbewohnern als Trommel dient. Wenn man mit einem Ast an die Rinde schlägt, tönt es meilenweit, so kann man kommunizieren. Eine Art Morsecode hilft dabei. Am Baum mit den grossen Stacheln konnte man Übeltäter fesseln und foltern, die Früchte eines andern Baumes dienen als Kamm oder Bürste, gewisse Blätter haben solch scharfe Kanten, dass man sie perfekt als Feilen benutzen kann. Ritzt man die Ride eines anderen Baumes auf, treten kleine rote Tropfen aus, wie Blut. Verreibt man diese auf der Haut, wird das Sekret weisslich, wie eine Salbe also, und diese wirkt gut gegen Insektenstiche. Die kleinen Ameisen, die wie Zitronensaft schmecken sollen, und die man, von aussen nicht sichtbar, in den Zweigen eines bestimmten Baumes findet, wenn man diese aufbricht, mochte ich nicht probieren, Marco schon.
Tiere bekamen wir natürlich auch zu Gesicht: kleine Affen, Nager und Vögel, aber im Gegensatz zu den Galapagosinseln meistens nur von weitem. Es soll auch Riesenschlangen geben, Boas, Anacondas. Die kreuzten unseren Weg zum Glück jedoch nicht. Tausendfüssler in allen Grössen, giftige und harmlose, Blutegel, Spinnen, Frösche, Schnecken und anderes Kriechgetier en masse hingegen oft.
Weiter führte mich Marco in die Behausung einer indigenen Familie, mitten im Wald in einer kleinen Lichtung gelegen, wo ich freundlich begrüsst wurde. Ohne weiteres durfte ich mich in ihrem Haus, das auf Stelzen gebaut war und in dem Eltern, Grosseltern und acht Kinder wohnten, umschauen. Es ist beeindruckend, wie die Leute dort leben: Alles, was der Wald hergibt, verwenden sie zu ihrem Nutzen. So werden beispielsweise aus Palmenfasern Netze angefertigt oder schmucke Armbänder, aus Wurzeln und Holz Gefässe und Werkzeuge.
Sie hatten auch ein paar Haustiere: zwei kleine Hunde, Hühner, eine Art Riesenmeerschwein an der Leine, das kläglich quiekte, Papageien. Ums Haus herum wuchsen Kaffee, Limonen und andere Früchte.
Von einem vierzig Meter hohen Hochsitz aus, „Casa del Diabolo“, der in die Baumkrone einer Ceiba eingebaut war, hatte man einen fantastischen Blick über den endlos scheinenden Wald bis zum Rio Napo im Hintergrund.
Diesmal hatte ich gelernt und reiste mit noch leichterem Gepäck als beim Galapagos-Ausflug. Einen Koffer und meinen Laptop hatte ich bereits in Miami gelassen bei Ray, einem meiner Kollegen, ein anderer wartete auf mich in Quito. Wie ich all mein angesammeltes Hab und Gut dann schliesslich heimschaffen würde, wusste ich zwar noch nicht, aber das würde dann erst mein Problem sein, wenn die Zeit reif war.
Nun hatte ich doch fast zu wenige Kleider mitgenommen, denn schon nach der Bootsfahrt und nach einem abenteuerlichen halbtägigen Marsch am folgenden Tag waren zwei meiner drei Paar Hosen triefend nass und vollkommen verschmutzt. Denn wie Jane musste ich mich nämlich teilweise von Liane zu Liane durch den Urwald schwingen oder besser gesagt kämpfen, und wie ein Tölpel steckte ich mehr als einmal bis weit übers Knie im Sumpf und zog jeweils einen Stiefel voller Wasser und Schlamm heraus. Das Gefühl im Stiefel anschliessend war nicht von der angenehmsten Sorte. Der Ausflug war eine richtige Sumpftour; das Ding aus dem Sumpf lässt grüssen. - Die Dusche nachher war kalt, aber vom Feinsten.
Einen Tag lang war ich alleine in der Lodge, dann waren wir zu zweit und tags darauf kamen gleich vierzehn weitere Gäste. „So viel" Betrieb war fast seltsam; mir hatte es vorher besser gefallen.
Am folgenden Tag stand Piranhas-Fischen auf dem Programm. Zum Glück war ich nicht erfolgreich, ich hoffte immer, dass keiner anbeissen würde; es hätte mich „tschuderet“. Jemandem aus der Gruppe gelang es dann doch, einen an die Angel zu kriegen und wir sahen die gefürchteten Zähne. Der Raubfisch war allerdings ein Teenager, also wurde er nach eingehender Besichtigung wieder ins Wasser zurückgelassen.
Drei Nächte dort waren gerade genug. Am nächsten Morgen wurde ich nach einer anderthalbstündigen Kanufahrt auf den Flughafen nach Coca gebracht. Wieder zurück in Quito, in der Zivilisation, gefiel es mir überhaupt nicht: Überall lag Vulkanasche am Boden, einige der Arbeiter hatten einen Mundschutz übergestreift. Es war kaum zu glauben, aber noch immer waren ganze Heerscharen von Putzequippen auf dem Flugplatz unterwegs und reinigten die Pisten, bewaffnet mit Schaufeln und Besen (!). Putzmaschinen hatte es keine. Kein Wunder, dass es tagelang dauerte, bis endlich alles sauber war und der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden konnte.
Cotopaxi
In einer Reiseagentur buchte ich beim „Flying Dutchman“ eine Biketour auf den Cotopaxi, weil ich nicht in der staubigen Stadt bleiben wollte. Morgens um acht ging's los mit dem Jeep. Wir waren zu acht, der Fahrer, ein blonder Holländer mit Pferdeschwanz, war unser Guide. Ein junges Paar aus Deutschland sass hinter mir. Ich hörte, wie die Frau zu ihrem Mann sagte: „Genauso habe ich mir vorgestellt, dass man aussehen muss, wenn man so eine Tour begleitet“.
Wir wurden bis zur Schneegrenze auf 4'500 Metern Höhe gefahren. Die Fahrt mit den Mountainbikes den Berg hinunter führt über 42 km bis auf 3'200 m Höhe und dauert fünf Stunden. – Diese Abfahrt hatte ich mir sehr viel einfacher und anders vorgestellt. Bei schönem Wetter wäre der Ausflug vielleicht weniger spektakulär gewesen, aber wir hatten das Pech, dass, je weiter wir bergauf fuhren, das Wetter schlechter und schlechter wurde, der Nebel senkte sich unablässig, der Jeep hatte Mühe, auf dem Track zu bleiben. Auf dem Parkplatz oben stiegen wir aus. Man sah keine fünf Meter weit. Wir wurden mit Knie-, Ellenbogenschonern und Helmen ausgestattet. Ich zog meine Handschuhen an, über dem T-Shirt und dem Sweatshirt trug ich meine Jeansjacke und darüber die Regenjacke, unter der Kapuze Helm und eine Wollmütze. Trotzdem war mir kalt und schwindlig. Dann ging’s los. Die unebene holprige Strecke mit den tausend Löchern führt nicht geradewegs bergab; manchmal ging der Weg geradeaus, und es gab Abschnitte sogar mit Steigung. Wegen der dünnen Luft schaffte ich diese kaum, musste jeweils absteigen und das Velo stossen. Das Schlimmste waren die Spurrinnen von Fahrzeugen, die kreuz und quer über den Weg verliefen. Nach kürzester Zeit schon taten mir meine Hände vom Bremsen so weh, dass ich sie fast nicht mehr spürte und den Lenker kaum mehr fassen konnte. Dann wieder führte die Strecke steil in die Tiefe und mir wurde von der Geschwindigkeit fast übel und ich hatte grosse Angst, nicht mehr bremsen zu können. Auch hatte ich das beklemmende Gefühl, mein Hirn fahre aus dem Schädel, so sehr wurde ich geschüttelt (wohl gehörte das zum „fun“, der angepriesen wurde...). Ich sah mich nach der Qualenfahrt schon beim Zahnarzt statt auf dem Flug nach Lima, den ich für den nächsten Tag gebucht hatte. Je länger desto mehr machte mir auch die Kälte zu schaffen. Es blieb neblig und nass, die Sicht miserabel und nicht genug: Zur Krönung begann es auch noch zu hageln.
Wie froh war ich, als wir völlig durchnässt und abgekämpft endlich einen Zwischenhalt machen konnten, um uns ein wenig zu erholen. Der „nette Blonde“ begleitete uns stets mit seinem Jeep und nun packte er für unseren Lunch Sandwiches und Getränke aus. Anschliessend blieb sogar ein wenig Zeit, sich im Museum umzusehen. Sehr skurril fand ich die Ausstellung. Besucher waren keine drin. In zwei Räumen gab es ausgestopfte Tiere zu sehen, nicht etwa hinter Glas. An der einen Wand hingen Hals und Kopf eines Rehs mit weissem Hintern. So jedenfalls war’s angeschrieben. Aber eben, dieses Teil war nicht sichtbar. Dafür hatte der Fuchs nur einen halben Schwanz, der Rest war ein verrosteter Stab.
Weiter ging die wilde Fahrt. Die Bikes waren natürlich nicht die allerbesten, das machte die Sache auch nicht einfacher. Als meine Bremse hinten versagte, gab ich auf und liess mich vom Reisebegleiter die letzten paar steilen Kilometer im Jeep mitnehmen. Die vier Stunden auf dem Bike hatten mir restlos gereicht.
Peru - Lima
Am nächsten Tag flog ich nach Lima. Übernachtung im „Hostal del Parque“ für 25 $. Alles ist sehr viel teurer als in Ecuador, das wurde rasch klar. Ich machte eine Stadtbesichtigung, hielt mich zwei Stunden im prächtigen und interessanten Museo National de Arqueología auf, trank in der Bar des altehrwürdigen Hotels Bolivar einen Pisco Sour, der mich fast vom Stuhl haute und fuhr anschliessend per Taxi ins Quartier Miraflores, wo ich einen Handwerkermarkt besuchte.
Von Lima gings’s weiter per Flugzeug nach Cusco. Die Stadt begeisterte mich sofort. Die Häuser sind grösstenteils auf einer ehemaligen Inkasiedlung aufgebaut. Überall hat’s kleine Läden mit allerlei Artesanías. Die holzgeschnitzten Balkone sind wunderschön.
Mit meinem Hotel war ich nicht besonders glücklich. Es war einmal mehr eines dieser Häuser, die keine Fenster haben. Eines hatte es zwar schon, aber das führte nur in einen Schacht hinein, und wenn man die Vorhänge aufzog, konnte man seinen Nachbarn grüssen. Das war nicht so ganz mein Fall. So wechselte ich gleich am ersten Tag die Unterkunft. Ich fand ein schmuckes kleines Hostal, das mir auf Anhieb gefiel, auf einem Hügel hoch über der Stadt gelegen, von dem man eine fantastische Aussicht über die ganze Stadt hat, das Casa de Campo. Sogar einen Balkon hatte ich, ein hübsches Zimmer mit Cheminée, ein Ort, wo es mir absolut wohl war. So ein Bijou! (www.hotelcasadecampo.com/">www.hotelcasadecampo.com/). - Zwar hatte ich einen etwas längeren „Heimweg“ musste den Berg hinauf „pilgern“ und anschliessend noch 100 Stufen hinaufsteigen, was zugegebenermassen nach gar nichts tönt, mir aber fast den Atem nahm, bis ich oben war, ist doch Cusco auf fast 3‘500 Metern über Meer gelegen. Mit dem Taxi ging’s rascher, auch wenn der Weg sehr steil war und der Taxista ein ganzes Stück weit rückwärts zurückfahren musste. Aber erst schleppte er mir noch meine Koffer in die neue Unterkunft. Er kam arg ins Schwitzen und ins Schnaufen.
Ganz in der Nähe des Hotels steht die Kirche San Blás. Die berühmte Kanzel, von einem Indianer in vierjähriger Arbeit aus einem einzigen Stück Holz geschnitzt, ist eindrücklich. Nebst Engeln sind die Balken auch mit Drachen verziert: eine nette Abwechslung zur obligaten Ausstattung.
Eine City-Tour, eigentlich genauso, wie ich sie nicht mag, mit vielen Touristen, die in einem Bus von Ort zu Ort befördert werden, um ihre Fotos zu „erledigen“, machte ich am nächsten Tag mit. Aber der Ausflug lohnte sich doch. Wir besuchten drei Kirchen und die eindrücklichen Ruinen der riesigen Inka-Festung Sacsayhuamán oberhalb des Stadtzentrums. Die Aussicht von dort ist einmalig. Das finden wohl die Alpacas auch, die dort friedlich grasen. Über der Stadt erhebt sich der 6271 Meter hohe Salcantay. Weiter ging die Tour nach Puka Pukara, einer Festung aus rötlichem Stein, dann zu einem Wassertempel, Tambomachay, und zuletzt nach Kenko, wo’s eine Art Amphitheater hat und in einer Höhle einen Opferaltar.
Über Pisac, eine ehemalige Inka-Festung im Valle Sagrado, dem heiligen Tal der Inkas, durch welches der Riobamba fliesst, hatte ich im Reiseführer gelesen, der Ort sei ein beliebtes Ausflugsziel. Vor allem am Sonntag wegen des Marktes. Ich wollte aber am Samstag hin und das war ein sehr guter Entscheid, denn ich konnte fast alleine in den Ruinen und den grünen Geländeterrassen herumkraxeln und auf dem Markt war fast gar nichts los. Gringos sah ich keine, die paar wenigen Touristen, die es hatte, waren wohl Einheimische. Ich kaufte einen Teppich für zwanzig Franken, der nun in unserem Haus in Bivio an der Wand hängt und mich stets an diesen prächtigen Ausflug erinnert. Im Reisebüro hatte man mir den Trip für 40 Franken angeboten. Am Busterminal kostete mich das Ticket nur einen Franken. Sehr froh war ich, überhaupt noch einen Sitzplatz erhalten zu können. Wer nach mir kam, musste sich mit einem Stehplatz zufrieden geben. Einen Moment lang überlegte ich noch, ob ich der Frau, die neben mir stand, meinen Platz anbieten solle – ich schätzte sie ein paar Jahre älter als mich – entschied mich aber dann aus Bequemlichkeit und weil ich ja dann nicht mehr hätte zum Fenster hinausschauen können, dagegen. Kurz nach der Abfahrt wurde eine Liste herumgereicht, auf der man seinen Namen, Nationalität, Adresse und Alter angeben musste. Ich fragte, weshalb das so sei und mir wurde erklärt, die Polizei wolle das so. Es gäbe immer wieder Unfälle auf der steilen, engen Strasse und dann wisse man, wer im Bus gewesen sei. – Sehr beruhigend!
Auf der Liste sah ich auch, wie alt die Frau war, die neben mir im Gang stand. 35-jährig! – Mein leicht schlechtes Gewissen sank augenblicklich auf Null.
Am folgenden Tag, dem Sonntag unternahm ich einen weiteren Ausflug. Weil Pisac ein Zwischenhalt war während dieser Fahrt, besuchte ich den Markt dort erneut. Nun erkannte ich den Ort fast nicht mehr wieder. Überall hatte es Touristen, der berühmte Markt war nun viel grösser. Es wimmelte von Leuten, die Preise ähnelten denen vom Vortag nicht mehr.
Weiter ging die Reise durch herrliche Gegenden nach Ollantaytambo, Urubamba und schliesslich nach Chichero. Unterwegs gab’s weitere Märkte und Kolonialkirchen zu besichtigen, aber etwas vom Schönsten fand ich jeweils den Blick von einer Krete aus aufs hehre Bergpanorama.
Machu Picchu
Niemand, der von Cusco aus nicht zum Machu Picchu wandert, pilgert fährt oder fliegt. Ich nahm den Zug, welcher, um den Höhenunterschied zu bewältigen im Zick-Zack fuhr, hin und zurück. Es galt, 1000 Höhenmeter zu verlieren. Wie im Schüttelbecher kam’s mir vor. Die Fahrt führte durch eine bezaubernde Landschaft: erst durch kahle „Voralpen“, nur karg besiedelt, die schönen Schneeberge im Hintergrund, bald wird der Urubambafluss zu einem wilden Gewässer, am Ufer stehen riesige Agaven und Kakteen und schliesslich geht die Vegetation in Urwald über. Die hohen Hügel oder Berge sind von Bäumen und Sträuchern bewachsen. Unter einem solchen wurden die Ruinen im Jahr 1911 von einer Expedition der Yale Univesity unter der Leitung von Hiram Bingham durch Zufall wiederentdeckt. Die Siedlung war von dichter Vegetation überwuchert. Bingham war auf der Suche nach der geheimnisvollen Inkastadt Vilcabamba, in die sich die Inkas geflüchtet haben sollen, nachdem Pizarro 1536 Cusco eingenommen hatte.
Vier Stunden später fuhr der Zug langsam im Bahnhof von Aguas Calientes ein. Mein erster Eindruck war, der Ort bestehe nur aus Marktständen. Sie waren alle entlang der Bahnlinie aufgebaut. Die Frauen in ihren wunderbar farbigen Trachten sassen auf dem Trottoir und versuchten, ihre Waren anzubieten. „¡Señorita, por favor acercese, compreme una cosita!“ Aber auch sonst hatte es Massen von Leuten, diejenigen, die nun aus dem langen Zug ausstiegen, zu denen auch ich gehörte, und andere Touristen, die bereits vor den Bussen warteten, bis ihre Tour in die „Stadt in den Wolken“, begann.
Der Name ist sehr gut gewählt. Auf dem Berg angelangt bildete sich den Besuchern ein wunderbares Schauspiel. Zeitweise wurden die berühmten Felsen von Wolken und Nebelschwaden verdeckt – manchmal sah man sie überhaupt nicht mehr - dann wiederum schien die Sonne ein wenig und die ganze Pracht der verlassenen Inka-Stadt, die in der Hochblüte von ungefähr tausend Menschen bewohnt worden war, zeigte sich in einem besonderen Licht. Weniger wünschenswert natürlich waren die unendlich vielen Reisenden, die wie Ameisen in den Ruinen herumkletterten. Das änderte aber, als die dreistündige Tour vorbei war und die meisten von ihnen wieder die Busse bestiegen und die Rückreise antraten, wohin auch immer diese führen mochte. Da ich zwei Nächte in einem Hotel gebucht hatte, konnte ich länger oben bleiben und die überwältigenden Eindrücke noch eine Weile in Ruhe auf mich einwirken lassen. Ich suchte mir ein schönes Plätzchen inmitten der Ruinen (es hat nur solche), legte mich hin und beobachtete das Spiel der Wolken. Neben mir grasten ein paar Alpacas.
Auch am nächsten Morgen fuhr ich nochmals hoch vor dem neuen Touristenstrom, der gegen Mittag zu erwarten war und genoss zum zweiten Mal den Kraftort vor der grossartigen Kulisse, die sich auch an diesem Tag ständig in anderem Licht präsentierte, abwechslungsweise bei Sonne, Wolken, Nebel und gar Nieselregen.
Am Abend dann im Restaurant ging’s weniger mystisch zu und her; ich hatte Pech mit meiner Kreditkarte. Beim Zahlen mit der „Ritsch-ratsch-Maschine“ teilte mein Kellner die Karte kraftvoll entzwei. Sie sah traurig aus, die beiden Teile hingen nur noch am Metallfaden zusammen. Freude herrschte nicht! Zum Glück hatte ich noch ein paar Travelers-Cheques bei mir und eine Ersatzkarte, sonst wär die Weiterreise schwierig geworden.
Lago de Titicaca
Am nächsten Tag fuhr ich per Zug zurück nach Cusco und am übernächsten war mein Ziel Puno am Lago de Titicaca. Leider konnte ich keinen Flug buchen, da sich zu wenige Passagiere angemeldet hatten, so blieb nichts anderes übrig, als einmal mehr per Bus dorthin zu fahren - weitere fast zehn Stunden. Das hatte sich der Zwischenhalte wegen auf jeden Fall gelohnt. Der erste fand in Pikillaqta statt, einer grossen archäologische Stätte der Wari-Kultur, die von einer 3 km langen Steinmauer umgeben ist. Der nächste in Andahuaylillas, wo die berühmte Jesuiten-Kirche San Pedro Apóstol steht. Sie stammt aus dem Jahr 1580 und wird auch „Sixtinische Kapelle der Anden“ genannt. Ihre unauffällige Aussenfassade steht im kontrastreichen Gegensatz zu den aufwändigen Malereien und Dekorationen im Barockstil im Inneren der Kirche. - Weiter ging’s zur Präinkastätte Raqchi, wo’s einen riesigen Tempel, eine stattliche Anzahl von Speichertürmen und speziell gestaltete Säulen aus Lavastein und Lehm zu sehen gibt. Die Bauweise ist anders als bei den bisher besuchten Ruinen, viel wenige exakt. Imponierend aber auf jeden Fall.
Recht mühsam kämpfte sich der Bus zur Passhöhe des Abra la Raya auf 4350 m hoch. Es war recht kühl dort oben, es regnete auch leicht und dass die Luft sehr dünn ist, merkte man sofort, wenn man ein paar Schritte ging. Die Gegend ist kahl, in der Steppe weiden Lamas und Schafe. Der Farbtupfer sind die schönen Kleider und Trachten der Einheimischen.
Der Bus hielt in Puna direkt vor dem Hotel Colon Inn, in dem ich ein Zimmer gebucht hatte. Kaum ausgestiegen, wurde man bereits von Händlern belagert. Unzählige Frauen sassen auf dem Trottoir und alle wollten etwas verkaufen, junge Männer boten Touren an. Nach der langen Busfahrt legte ich mich aber erst mal ins Bett, weil ich seit ein paar Tagen eine Magenverstimmung hatte und mich nicht sehr gut fühlte. Ich ernährte mich von Bananen und Reis und trank Mate de Coca, dem seit Jahrhunderten weit verbreiteten und beliebten Tee mit leicht kokainhaltigen Substanzen, der gegen Hunger, Kälte, Müdigkeit und die Höhenkrankheit helfen soll. Trotzdem buchte ich schliesslich eine Bootsfahrt auf dem Titicacasee für den nächsten Tag zu den bekannten Inseln Uros und Taquile. Frühmorgens, nachdem ich ein trockenes Stück Toastbrot hinuntergewürgt und eine Tasse Tee getrunken hatte, wurde ich abgeholt und in eine Gruppe von jungen Trampern aus Israel eingeteilt, deren Kleider schon lange kein Wasser und keine Seife mehr gesehen hatten. – Was für ein Gegensatz zu den adrett gekleideten französischen Hotelgästen, die vorher in der Lobby gesessen hatten, einige mit einen Atemgerät ausgestattet, das sie herumreichten, um die Höhenverhältnisse besser zu ertragen. Mir kam’s vor, als ob ich in ein Altersheim geraten wäre.
Die Bootsfahrt zu den schwimmenden Inseln dauerte eine knappe Stunde. Eine erstaunliche Art zu wohnen. Alles ist auf Binsen gebaut. Die Bewohner sind sehr freundlich, aber was mir weniger gefiel, war der Umstand, dass dieser ausserordentliche Ort sehr touristisch ist. An jeder Ecke oder besser gesagt in jeder Nische werden Waren angeboten, kleine Körbchen aus Binsen, Puppen aus Binsen, Binsen überall. Auch die Häuser und Boote sind aus Binsen gebaut.
Die Weiterfahrt zur Isla Taquile dauerte drei Stunden. Dort bot sich uns ein ganz anderes Bild. Eine ellenlange Treppe mit mehr als 500 Tritten führt 300 Meter hinauf zum Dorfplatz auf 4‘100 m. Diese schaffte mich fast bei der Hitze, die im Moment herrschte. Schatten hatte es keinen. Die Männer, die Baumaterial nach oben schleppten, lange, schwere Stangen, beneidete ich nicht. Sie mussten immer wieder einen Zwischenhalt einlegen (ich natürlich auch, brauchte aber zum Glück nichts zu tragen); aber wenigstens versuchten sie nicht einmal mehr, uns etwas zu verkaufen...
Das Restaurant oben hatte zwar eine atemberaubende Aussicht, auf der einen Seite sah man ans andere Ufer des Sees, nach Bolivien, aber sonst war es „nothing to write home about“. Die Toiletten erst recht nicht. Mir war zwar immer noch mulmig zumute, aber ich war sehr froh, dass Verlass aufs Imodium war. Vor der Bootsreise hatte ich mich nämlich gefürchtet.
Etwas ganz Spezielles gibt es in diesem Ort zu sehen: strickende Männer. Man sah sie überall sitzen, in den Händen die langen Nadeln und die Handarbeit, im Schoss die Wollknäuel. – So was! - Sie weben auch und ihre Textilprodukte sollen zu den hochwertigsten in Peru gehören.
Auf der Rückfahrt war es kalt im Boot und als wir in Puna ankamen, begann es gleich in Strömen zu regnen. So sehr, dass ich das Hotel gar nicht mehr verliess. Hunger hatte ich ja noch immer keinen, dafür nahm ich eine heisse Dusche, trank zwei Tassen Tee und verkroch mich unter die Decke.
Fahrten zu den Grabtürmen von Sillustani wurden am Vormittag keine angeboten. Ich aber hatte mir in den Kopf gesetzt, den Ort am Morgen zu besuchen. Am frühen Nachmittag nämlich ging mein Flug zurück nach Lima. Also suchte und fand ich einen Taxifahrer, der mich zum Flughafen nach Juliaca brachte und vorher nach Sillustani. Sehr gut, dass das Tourenangebots-System in Puno dermassen unflexibel ist. So konnte ich den Ort ohne die üblichen Touristenmassen besuchen. Er übte eine besondere Faszination auf mich aus. Vielleicht gerade deshalb, weil ich ganz alleine dort war, vielleicht wegen der Ruhe, der speziellen Atmosphäre. - Eigentlich habe ich für esoterisches Gedankengut gar nichts übrig, aber da fragte ich mich doch, ob man irgendwo in einer verborgenen Schublade seines Gehirns eine Vergangenheit spüren kann, ohne konkret etwas wahrzunehmen.
Die Schönheit der Gegend ist überwältigend. Was für ein Ort, um begraben zu sein! Die Farben, der stille, tiefblaue See (Lago Umayo), die runden Steinkolosse, die wilden Meerschweinchen, die grünen Papageien, ein Fuchs, der in den Ruinen nach Essbarem schnüffelt, die Insel in der Ferne, die von weitem aussieht wie ein Sombrero, die Schneeberge im Hintergrund, die Vorstellung, wie es vor Jahrhunderten hier ausgesehen haben mag, was vor sich ging – zum Leben oder zum Sterben schön!
Da wir am Morgen früh gestartet waren, hatten wir auf dem Weg nach Juliaca genügend Zeit, noch ein kleines Museum mit ein paar wenigen Exponaten aus den Gräbern zu besuchen: Mumien, Schädel, Keramikgefässe, Schmuck. Und der Taxista führte mich auch noch aufs Land zu einer Familie, die äusserst anspruchslos lebte, so wie ich es vorher auch in Indien oder Afrika gesehen hatte. Die Frau freute sich über unseren Besuch. Stolz zeigte sie uns ihre bescheidene Behausung – eine andere Art zu leben.
Auch der Flug über die Anden, die Schneeberge, die liebliche Landschaft, begeisterte mich.
Zurück in Lima hatte ich einen weiteren Tag lang Zeit, das berühmte Museo de Oro zu besuchen. Und genau wie’s im Polyglott steht – die Schaukästen sind leider viel zu sehr überladen. Vor lauter Bäumen sieht man den Wald nicht mehr. Trotzdem lohnt sich der Besuch tausendmal. All die wunderbaren Tumis, der Schmuck, das viele Gold und die Tongefässe gefielen mir ausserordentlich, vor allem auch die Chavin-Keramikfiguren, Mischwesen zwischen Mensch und Tier, aber auch die Dutzenden von Gefässen, Töpfen und Figuren aus der Moche-Kultur, auf denen noch und noch erotische Szenen dargestellt sind.
Als das Flugzeug Richtung Quito abhob, war ich erst sehr enttäuscht, denn Lima lag versunken im Nebel. Die Wetterverhältnisse änderten jedoch allmählich und die Spitzen des Chimborazo, des Cotopaxi und all der anderen Vulkane tauchten aus dem Nebelmeer auf. Was für ein gewaltiger Anblick! Das Flugzeug flog eine Schlaufe, so dass sogar die Krater sichtbar wurden. Die Nebel lichteten sich, man sah die Ebene rund um den Cotopaxi, ich erkannte von oben die Strecke, auf der ich mich vor zwei Wochen auf dem Mountainbike dermassen abgemüht hatte. – Faszinierend!
Zurück in Ecuador : Esmeraldas
Nach zwei Tagen Quito fand ich, ich hätte „Ferien“ verdient und flog nach Esmeraldas, der Stadt an der nördlichen Pazifikküste. Es war mein letzter Ausflug in diesem Land, das ich nun in den verschiedensten Gegenden erkundet hatte. Dort herrscht ein völlig anderes Klima, es ist heiss und die afro-ecuadorianische Bevölkerung verleiht der Stadt ein karibisches Flair. Mit einem sogenannten „Tricicleta“ wurde ich in mein Hotel gefahren, wo ich sehr freundlich von zwei bewaffneten Angestellten begrüsst wurde und für 18 Franken pro Nacht ein riesiges Zimmer erhielt. Andere Gäste schien es nicht zu haben. Auch die Strandpromenade, durch die ich am nächsten Morgen spazierte, war völlig ausgestorben, ein paar Jungen schlenderten am Strand herum, Touristen sah ich keine. Ebenso wenig fand ich ein Internet-Café. Postkarten konnte man keine kaufen; ich hatte den Eindruck, sogar die Mücken seien entweder nicht vorhanden oder zu faul zum Stechen. Nur ein Restaurant hatte geöffnet, ich war der einzige Gast. Plastiktischtücher, kitschige Poster an den Wänden, der Fernseher lief und mitten im Raum stand ein riesiger kitschig geschmückter Tannenbaum. Mir kam’s vor, als wär ich im falschen Film. Aber das Essen war gut und reichlich. Und für 3 Franken absolut erschwinglich.
Ich hatte vergessen, einen Lippenstift einzupacken. Natürlich hatte ich wenig Hoffnung, in diesem Kaff einen zu finden. Aber siehe da: Im einzigen kleinen Lädeli, das offen war, kaufte ich zwei Flaschen Mineralwasser und erkundigte mich wegen des Lippenstifts. Der Verkäufer sagte, das habe er nicht, schaute dann aber trotzdem nochmal nach und wurde in dem ganzen Wirrwarr von Sachen und Sächelchen in einer verstaubten Schublade tatsächlich fündig. Auswahl und Farbe waren kein Thema, nur ein einziges Expemplar war vorhanden. Mein ganzer Einkauf kostete mich 1.50 Franken. Per Tricicleta liess ich mich ins Hotel chauffieren.
Am nächsten Morgen stellte ich fest, dass ich doch nicht der einzige Gast war. Es gab noch einen anderen. Beim Frühstück kam ich ins Gespräch mit Salvatore, einem Kakao-Einkäufer. Auf den ersten Blick dachte ich, er sei grad einer Schlägerei entronnen, auf den zweiten eigentlich immer noch. – Er bot mir an, mich später ein wenig in der Gegend herumzuführen. Das Angebot nahm ich gerne an. Ich checkte aus und kurz vor Mittag fuhren wir in seiner gelben Schüttelbüchse los, in der die eine Türe klemmte, etliches wie zum Beispiel der Rückspiegel fast abzubrechen drohte, der Auspuff ständig Fehlzündungen hatte und der Anlasser erst beim fünften Anlauf machte, was der Fahrer wollte. Auch langte ich immer wieder ins Leere, wenn ich versuchte, mich anzuschnallen. – Erst fuhren wir nach Sua, einem trostlosen Ort, wo ich mir nicht vorstellen konnte, dass sich irgendein Tourist dorthin verlaufen könnte. Weiter ging’s nach Same. Dort hatte es ein paar lustige Restaurants direkt am Strand; in einem davon assen wir zu Mittag. Der graue Strand aber war verlassen.
Unseren letzten Halt machten wir in Atacames. Dort war Salvatores Ziel. Wir verabschiedeten uns und ich bedankte mich herzlich für die Tour und die Gesellschaft.
In diesem Ort konnte ich mir gut vorstellen, dass in der Ferienzeit viel los ist; am Strand gibt es eine Bar an der anderen, dahinter reiht sich ein Restaurant ans andere, ein Lautsprecher dröhnte lauter als der andere, obwohl in dem Moment ja kaum jemand unterwegs war, der sich hätte anhören können, was alles angeboten wurde.
Es dauerte eine gute Viertelstunde, bis mir der Kellner die Piña Colada, die ich bestellt hatte, brachte. Die beste ever! Sie war reich verziert mit tropischen Früchten und Blumenblüten, fast eine Mahlzeit für sich. Für zwei Franken konnte man sich da nicht beklagen... Ein Nickerchen am Strand beendete den schönen Nachmittag. Bus und Velotaxi brachten mich anschliessend nach Tonsupa, wo ich eine Cabaña, eine Art Bungalow im Hotel Cabaplan gebucht hatte. Mein leichtes Gepäck hatte ich dabei, für die kurze Zeit brauchte ich nicht viel, das hatte ich inzwischen gelernt. Was für eine sehr spezielle Erfahrung: Der Hotelkomplex bot 180 Zimmer an, ein riesiges Schwimmbad, einen Tennisplatz. Ich glaube, das Konzept in dieser Hotelanlage war ähnlich wie dasjenige, welches dem Postpersonal in der Schweiz angeboten wird: günstige Ferien am Meer. – Ferienzeit war noch gerade nicht und so war ich einmal mehr der einzige Gast in diesem riesigen „Resort“. Das war ziemlich skurril, ich kam mir verloren vor, Erinnerungen an den Film „Shining“ drängten sich auf.
Im grossen, leeren, wenig einladenden Essraum wollte ich nicht zu Abend essen, also fuhr ich mit dem Velotaxi zurück nach Atacames. Im Garten von Marcos Restaurant bestellte ich „Spaghetti a la marinera“ und stellte mir einen schönen Teller mit Venusmuscheln vor. Was dann kam, war eine Riesenschale, gelb, mit lauter Tieren drauf, so dass man von den Teigwaren gar nichts mehr sah. Langustines, Miesmuscheln als Garnitur und zuoberst thronte ein grosser Krebs von der Sorte, wie ich sie am Nachmittag noch lebendig in Reih und Glied vor einem anderen Restaurant hatte hängen sehen und die mir total leid taten. Obwohl ich Krebsfleisch sehr gern habe, war mir nun überhaupt nicht danach, solches zu essen. Dazu servierte man mir noch ein Brett mit einer Mulde drin und einen Holzhammer, um den Krebs zu knacken. Ein Dilemma! – Zurückgeben wollte ich den Krebs auch nicht, dann wäre er für nichts gestorben. Netterweise half mir der Kellner mit der Zertrümmerung der harten Schale. Einen Bissen nahm ich, der war sehr schmackhaft, aber mir war sofort klar, dass ich wohl kaum einen Drittel von all dem würde essen können. Dasselbe Problem hatte ich auch mit all den anderen Tieren, die sich noch immer auf meinem Teller befanden. Vielleicht hätte ich vorher besser überlegen sollen, was ich bestelle. – Dann aber kam die Rettung: Ein etwa zehnjähriger Junge stand auf dem Trottoir neben mir und schaute sehnsüchtig auf mein Nachtessen. Ich fragte ihn, ob er den Krebs haben wolle. Ja, natürlich. Alles nahm er, den ganzen Teller, der noch immer ziemlich voll war. Der Kellner gab ihm alles bei der Hintertüre, wo der Junge sich auf einen Randstein setzte und gierig Teigwaren und Meerfrüchte „rübis und stübis“ aufass. – So war uns beiden gedient. Er kam dann sogar noch vorbei und bedankte sich.
Am nächsten Tag konnte ich zum ersten Mal seit langem ausschlafen.
Ein Angestellter bot mir an, mit mir Tennis zu spielen. Er trieb irgendwo in einem Lager zwei Schläger auf, aber mit den Bällen hatte er weniger Glück. Leider hatte ich alle meine Bälle in Cuenca verschenkt. So hatten wir nur noch drei Stück, von denen einer bereits keine „Haare“ mehr hatte, dafür ein Loch, ein anderer nach zwei, drei Schlägen einen Riss bekam, so dass nach kürzester Zeit nur gerade noch einer übrig blieb, der einigermassen spielbar war. Die Bälle passten zum Platz: Er war in einem dürftigen Zustand: An etlichen Orten war der Belag gespalten; es gab nicht wenige Stellen, wo bereits Pflanzen drauf wuchsen. Obwohl die Sonne nicht schien, war es heiss und wir kamen ins Schwitzen – mehr zwar vom Bälle- oder Ballauflesen als vom Spielen. Spass machte es aber sehr. Royer, so hiess mein Partner, (es war seine erste „Tennis-Erfahrung“) trug nach wie vor seine Arbeitskleidung mit langen Hosen, das Schulterhalfter mit Revolver allerdings hatte er abgelegt. Und er schloss dann auch die Tür zum Platz, nachdem er viermal den Ball dort draussen hatte holen müssen. – Eine Stunde später, nachdem auch der letzte Ball ein Loch aufwies, gaben wir notgedrungen auf. Aber die Erinnerung ist einmalig! Ein Bad im Pool daraufhin war sehr erfrischend.
In der Rezeption wurden Dekorationen zur bevorstehenden Weihnachtsfeier aufgehängt und ich half der jungen Frau, „Jingle Bells“ auf Spanisch zu übersetzten. Am Strand war nach wie vor nichts los, aber gegen vier Uhr nachmittags zeigte sich die Sonne zum ersten Mal und ich beschloss aus diesem Grund, meinen Flug um 24 Stunden zu verschieben, es hätte ja sein können, dass auch der folgende Tag sonnig sein würde.
Am Abend liess ich mich mit dem Velotaxi nach Atacames fahren und wieder kehrte ich bei Marco ein, bestellte aber diesmal eine Pizza. Der Wein war gerade ausgegangen, aber der Kellner war flexibel genug, welchen einkaufen zu gehen. Und wieder war der kleine Junge zur Stelle, bei dem ich den Teller mit den Meerfrüchten losgeworden war. Ich teilte meine Pizza mit ihm und beinahe hätte ich ihn gefragt, ob er mir einen Vorschlag machen könne, was wir am nächsten Tag zusammen essen könnten. Zurück im Hotel hatte es keinen Strom, ein Angestellter führte mich mit einer Taschenlampe zu meiner Cabaña. Und wie als Kind oder vor drei Wochen in der Wald-Lodge musste ich in der Nacht bei Kerzenlicht und mit der Taschenlampe lesen.
Leider war der letzte Tag dann doch wieder verregnet, schön warm aber immerhin. Ein Spaziergang am Strand lag trotzdem drin; ich sammelte ein paar hübsche Muscheln und las in der Hängematte mein Buch fertig.
Abends am Strand von Atacames gönnte ich mir meine letzte Piña Colada und spendierte drei Buben je einen Drink. Ich ass wieder im selben Ort wie üblich, aber diesmal war der kleine Junge nicht zur Stelle, so teile ich mein herrliches, aber viel zu grosses Nachtessen mit einem Büsi.
Weder einen Bus noch ein Velotaxi konnte ich finden für die Heimfahrt. Mit drei jungen Männern, die auf einer Bank bei der Busstation sassen, kam ich ins Gespräch und sie boten mir an, mich nach Tonsupa zu fahren. Es sei auch ihr Heimweg. Ich nahm das Angebot an. Der eine ging zum nahe gelegenen Parkplatz und holte einen grossen Bus, in den sie mich einluden mitzufahren. Erst dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass dies das Dümmste hätte sein könnte, was ich jemals gemacht hatte. Da hätte ja wer weiss was passieren können. Wie kann man nur so blöd sein, fragte ich mich, sagte aber nichts, denn die Fahrt ging schon los. Sie dauerte nur kurz, wir kamen beim Hotel an, die drei liessen mich aussteigen und verabschiedeten sich. – Alles war gut gegangen, aber trotzdem war mir auch nachher noch ganz mulmig zumute. Lange noch an diesem Abend dachte ich über Arglosigkeit, Vertrauen, Dummheit, Leichtgläubigkeit, Angst und solche Dinge nach.
Mein Flug am nächsten Morgen war ausnahmsweise mal pünktlich und noch vor dem Mittag war ich zurück in Quito, zum fünften Mal innerhalb von sieben Wochen.
Meinen letzten Tag verbrachte ich mit Einkäufen, Packen und Umpacken und im „La Chopa“ genehmigte ich mir mein letztes Nachtessen in diesem schönen Land. Nicht zum ersten Mal bestellte ich „Tamal de Mote“ und „Plato Typico“. Dazu trank ich ein Glas Wein. Der Kellner brachte mir drei, die beiden letzten als Abschiedsgeschenk.
Ich ging früh ins Bett und begann mein neues Buch zu lesen, das ich an dem Tag gekauft hatte: Mary Higgins Clarke auf Spanisch.
Zurück in die USA - Miami
Am nächsten Morgen (17. Dezember 1999) musste ich bereits um vier Uhr auf dem Flughafen sein. Erst kurz vor acht Uhr flogen wir mit grosser Verspätung ab. Der Zwischenhalt in Panama gestaltete sich ziemlich speziell. Irgendwo im Terminal war ein Brand ausgebrochen, nirgendwo hatte es mehr Strom, überall war’s dunkel, nur an wenigen Orten funktionierte die Notbeleuchtung und Hunderte von Passagieren standen auf den Pisten herum – das absolute Chaos herrschte. Irgendwann aber, vorausgesetzt man erwischte das richtige Flugzeug in dem ganzen Durcheinander, konnte man wieder einsteigen und weiterfliegen. – In Miami musste ich zwei Stunden auf mein Gepäck warten, das mit einer anderen Maschine angereist kam. Zum Glück - ich hatte schon gefürchtet, es sei verloren gegangen.
An die Preise in Land der unbegrenzten Möglichkeiten musste ich mich erst wieder gewöhnen. Das Hotel in South Beach kostete pro Nacht so viel wie meine Unterkunft in Cuenca für zehn Tage. Aber ich blieb ja nur für zwei Nächte. Ray brachte mir am nächsten Tag meinen Koffer, den er bei sich aufbewahrt hatte und den Laptop. Mein Velo hatte er für 55 $ verkaufen können, das war auch nicht schlecht. Wir machten uns einen schönen Tag und gingen zusammen essen. Natürlich erzählte ich von meiner wunderbaren Reise, aber bald driftete das Gespräch ab und wir liessen all das Revue passieren, was wir in Fort Lauderdale im CELTA-Kurs erlebt hatten. Für ihn hatte sich der Aufwand gelohnt. Er hatte einen Job gefunden in China und dorthin wollte er bald reisen, um in irgendeinem Dorf auf dem Land nach der Cambridge-Methode Englisch zu unterrichten. – Lieber er als ich.
Karibik-Kreuzfahrt
Ich hatte noch eine letzte Woche Urlaub vor mir, bevor es heimwärts ging. Weil ich über Weihnachten nicht in Florida bleiben wollte, hatte ich eine einwöchige Karibik-Kreuzfahrt mit der „Carnival Paradise“ gebucht, einem ganz neuen riesigen Schiff, auf dem es mir auf Anhieb sehr gut gefiel. Was für ein absoluter Gegensatz zu allem, was ich in den letzten Wochen in Ecuador erlebt hatte!
Schon am ersten Abend wurde mir ein Platz an einem grossen runden Tisch mit anderen elf „Singels“ zugewiesen, ausser mir alle Amerikaner. Wir wurden fast augenblicklich zu einer Art Familie, unternahmen viel zusammen und hatten es absolut fidel und gut.
Schön waren die Stunden auf See, die man lesenderweise beim Sonnenbaden und in einem der verschiedenen Pools plantschend verbringen konnte, interessant und lustig waren die Abende bei den gemeinsamen Mahlzeiten, in der Bar oder in einer der Shows, die ausnahmslos von ausgezeichneter Qualität waren. Für Unterhaltung jeglicher Art war gesorgt: Kino, Theater, Comedy-Shows, Magier-Darbietungen, Zirkus- und Tanz-Vorstellungen, Vorträge und vieles mehr konnte man täglich besuchen. Natürlich hatte es auch verschiedene Bands, Talent-Shows, Sängerinnen und Sänger, wer noch nicht genug gegessen hatte, konnte sich am schön präsentieren Mitternachtsbuffet erneut den Magen vollschlagen, das Angebot war endlos.
Spannend wurde es einmal ganz unverhofft, als wir während des Essens plötzlich merkten, dass das Schiff ein wenig schwankte und der Kapitän den Kurs änderte. Er hatte ein Boot gesichtet mir fünf kubanischen Flüchtlingen. Die nahm er auf. Wir sahen zu, wie ihr Boot, das im Vergleich zum riesigen Schiff wie eine Nussschale aussah, ganz unten, knapp über der Wasseroberfläche in einem geöffneten Tor in der Schiffswand verschwand.
Wunderbar waren die verschiedenen Ausflüge, die wir machen konnten: Erster Port of Call war Cozumel in Mexiko, wo ich an einem herrlichen Strand mit kristallklarem Wasser baden ging. Von Playa del Carmen aus brachte uns ein Bus nach Tulum, einer Maya-Stätte, die auf einem Felsen direkt am Meer gebaut ist. Der Ort ist einmalig in seiner Art, Tempel wurden in der Regel nur im Landesinnern gebaut. Aber weil es so viele Leute hatte, die dort herumwanderten und auf den Ruinen herumkletterten, machte der Besuch nicht nur eitel Freude. Und die Fahrt zurück im unterkühlten Bus noch weniger.
Der verrückteste Ausflug fand auf einer Sandbank bei der Insel Grand Cayman statt. Mit Booten wurde man zur Stingray-City-Sandbar gebracht. Dort konnte man bis zu den Hüften im warmen Wasser stehen und auf die Ankunft der grossen Rochen warten. Es dauerte nicht lang, schon näherte sich ein ganzer Schwarm in Erwartung ihrer obligaten Leckerbissen. Wie im Wind flatternde Leintücher schwammen sie auf uns zu. Wir erhielten Fischreste und Crevetten, die man den Tieren füttern konnte. Das Gefühl, das herrschte, wenn sie sich wie Samt um einen schmiegten, einen manchmal ganz umhüllten und uns wie Staubsauger die Delikatessen aus den Fingern saugten, ist unbeschreiblich. Ein riesiges Geschrei ging los unter den Touristen, niemand, der erst nicht Angst bekam, bis man merkte, dass nichts passierte, niemand verletzt wurde. Stingrays sind ja normalerweise nicht ganz so harmlos, aber diese Fische dort sind offenbar seit Jahren an die Menschen gewöhnt und daher ungefährlich. Die Sandbank war nämlich der Standort, wo die Fischerboote aus der Umgebung normalerweise ihre Netze säuberten, die Fischreste ins Wasser warfen und so gewöhnten sich die Mantas allmählich ans Schlafaffenland. Die Konsequenz davon: Was dort vor sich ging, wusste man bald schon geschickt touristisch auszunutzen.
Am herrlichen Seven Mile Beach bei George Town konnten wir uns vom Erlebnis weitere drei Stunden erholen, bis wir von den Tendern wieder abgeholt und aufs Schiff zurückgebracht wurden.
Auch auf Jamaica gefiel es mir. In Kingston besuchte ich den Markt, einen botanischen Garten und die Wasserfälle, die man allerdings vor lauter Leuten kaum mehr sah. Mit den Touristen kann man schon Geld machen. Die Amerikaner sind grosszügige Trinkgeldspender. Der Guide im Garten, der mehr oder weniger nur den Weg wies und ausser ein paar Sätzen („Jamaica-no problem, watch your steps, everybody is gonna make it, no worries – be happy“) rein gar nichts sagte, wurde jedenfalls reichlich entlohnt.
Heimreise
Zurück in Miami blieben mir zwei Tage bis zur Heimreise. Ich traf mich nochmals mit Ray. Er ist Amerikaner, hat aber gitano-hispanische Wurzeln. Ich erwähne es, weil es im Restaurant, wo wir assen, zu einer lustigen Episode führte. Als der Besitzer ihn sah, rief er aus: „Wooo, Salman Rushdie“, verschwand und versteckte sich hinter der Bar. So ein Spassvogel. Obwohl – mit der Ähnlichkeit lag er gar nicht so weit daneben.
Rechtzeitig für die grosse Silvesterparty 1999 mit Freunden war ich daheim in Bern.
Ein neues Jahrtausend nahm seinen Anfang.

Im Herbst 2004 war es das einzige Mal, wo wir unseren Spanienferien untreu wurden. Wir besuchten unsere langjährigen Freunde Denise und Jim in Toronto, verbrachten ein paar herrliche Tag mit ihnen in ihrem Cottage in Muskoka, in dieser wunderbaren Gegend, wo nicht genau klar ist, ob es sich um Inseln und Halbinseln in einem riesigen See handelt oder ob es eine Landschaft ist mit zahllosen Seen. Der eigentliche Grund, weshalb wir diesmal Kanada unseren geliebten Spanienferien vorzogen, war Gino. Er besuchte ein Semester lang eine Schule in Vancuver und wir gingen ihn anschliessend dort besuchen. Zusammen untenahmen wir im viel gelobten „Indian Summer“ eine dreiwöchige Reise durch die herrlichen Herbstwälder in British Clolumbia und Alberta, fuhren nach Lake Louise und besuchten Freunde in Whistler. Auf einer schnurgeraden Strecke ohne jeglichen Verkehr in Richtung Jasper (100 km Höchstgeschwindigkeit) wurden wir von einem Polizeiauto angehalten. Ich sah das „Unheil“ von weitem, ging sofort vom Gas weg, aber es reichte nicht mehr. Die Autopapiere wurden geprüft sowie mein Fahrausweis. Das dauerte fast eine Viertelstunde lang. Wie schnell ich gefahren sei, fragte mich der Beamte. Etwa 110, beichtete ich. Da lachte er und sagte, in dem Fall hätte er mich gar nicht angehalten. 133 km/h seien es gewesen. – Aber er würde ausnahmsweise von einer Busse absehen, wir sollten uns lieber die schöne Gegend ansehen. – Freundlich, freundlich, die Polizei in diesm Land! Da fiel mir natürlich ein Stein vom Herzen und ich hielt mich fortan brav an die Verkehrsvorschriften.
Auf der Strecke gab’s immer wieder mal einen Wegweiser, der mit einem Pfeil auf einen der Berge zeigte, an denen wir entlangfuhren. Ans „Klapperhorn“ erinnere ich mich gut. Mir gefiel der Name ganz besonders.
Das erstaunlichste Erlebnis in diesen Ferien aber geschah auf Vancouver Island. Wir schlenderten durchs Stadtzentrum in Nanaimo, ich war dabei, einen Laden zu betreten, wo ich im Schaufenster etwas gesehen hatte, das ich mir näher anschauen wollte. Im selben Moment stiess ich mit jemandem im Türrahmen zusammen – es war ein Kollege von mir aus der BMS. So ein unglaublicher Zufall. Auch jetzt, wo ich das schreibe, gibt es mir zu denken: am selben Ort, zur selben Zeit... Wir hätten ja auch beide in derselben Stadt sein können, ohne uns zu begegnen. Fünf Minuten vorher oder nachher und die Begegnung wäre nicht zustande gekommen. – Verrückt!
Wir gingen dann alle vier zusammen essen, und da geschah schon wieder etwas Lustiges: Wir bestellten Wein und die Serviererin brachte nur drei Gläser. Eines für Theo, eines für mich und das dritte für Gino. Gino war ja erst neunzehnjährig zu der Zeit und hätte in diesem Land ja noch gar keinen Alkohol trinken dürfen. Und mein Kollege war damals etwa fünfunddreissig, sah allerdings sehr jung aus. Trotzdem...

Reisebericht Guatemala - Nicaragua 2004
Zurück aus Kanada packte ich gleich die Koffer um, denn meine dritte Urlaubsreise „stand vor der Tür“. Sie führte mich einmal mehr nach Lateinamerika, allerdings erst nach San Diego, wo ich zwei Wochen lang in einer Schule mein Englisch wieder ein wenig ajour bringen wollte, neue Wörter und Redewendungen lernte und den „American way of life“ genoss. Ich konnte bei Freunden von uns wohnen, die mich sehr verwöhnten.
Der Plan war, dass ich nach dieser Zeit nach Guatemala fliegen und Theo, der ja inzwischen pensioniert war, mich dort für drei Wochen, kurz vor Weihnachten, besuchen würde.
Am Samstagabend um halb neun kam ich in Guatemala City an. Per Internet hatte ich in Antigua eine Schule gebucht, um mein Spanisch zu vertiefen, und Mario, der Direktor, holte mich am Flughafen ab. In seiner Email hatte er mir geschrieben, ich solle kein Taxi nehmen, da wisse man nie - er werde dort auf mich warten und unterschrieben hatte er mit: „Your friend Mario“. - Really sweet, fand ich!
Guatemala
Es klappte bestens. Die Fahrt nach Antigua dauerte fast eine Stunde. Mario brachte mich in eine kleine Pension, da das Hotel, in dem ich wohnen wollte, an diesem Abend kein Zimmer mehr frei hatte. Offenbar hatte er mit Buchen gewartet, bis er sicher war, dass ich wirklich kommen würde. Zwar hatte ich im Juli bereits gebucht, aber erst ein paar Tage vorher nochmals bestätigt. - Ich mit meinem Gepäck! Da ich einen Tag vor meiner Abreise nach San Diego erfahren hatte, dass nicht nur 20 kg Fluggepäck erlaubt seien (ich war schon kurz vor dem Verzweifeln beim Kofferpacken), sondern 64 kg (!!!!!), hatte ich mir keinen Zwang angetan, hatte sofort einen grösseren Koffer gekauft (meine Kinder und Theo sagten im Chor: „Schpinnsch?“) und schon zu Hause tüchtig geladen (was man eben so braucht, aber auch viele Mitbringsel und Kleider zum Weggeben, muss ich zu meiner Verteidigung erklären). Die Malls in den USA sind nicht sehr hilfreich, wenn’s darum geht, beim Einkaufen zurückhaltend zu sein, so schleppte ich dann gegen 50 kg mit mir herum, inklusive Handgepäck.
Die kleine Pension, wo ich übernachte, wurde von einer jungen Familie geführt. Alles war sauber, aber die Ausstattung eher karg, ungefähr das Gegenteil von meiner schönen Unterkunft in San Diego, wo ich die letzten drei Wochen gewohnt hatte. - Und ich weiss jetzt wenigstens, was „familiäre Atmosphäre" heisst. Das ist, wenn am Sonntagmorgen von sieben bis acht der kleine Sohn einen Hahn imitiert, der im Hof nebenan den kleinen Jungen imitiert. Die Leute sind jung, sie müssen Nerven haben wie Drahtseile. Aus der Fassung geriet der Herr des Hauses zwar trotzdem fast, als er meinen Koffer in den ersten Stock hissen musste (auf der Waage 31,5 kg).
Schule Dann kam mein erster Schultag. Die Schule ist ein wenig anders, als wir es gewohnt sind. Sie findet in einem Hof statt, im Freien. Wir sind etwa fünfzehn Schülerinnen und Schüler. Alle sitzen mit ihren Lehrerinnen oder Lehrern jeweils zu zweit an einem kleinen, schitteren Tischli auf einem noch schittereren Plastikgartenstuhl. Das sieht komisch aus. Klassen oder Gruppen gibt es keine, jeder erhält Einzelunterricht. Kosten tut’s pro Stunde 4 $. Der Lehrer erhält davon einen Viertel, der Rest geht an die Schule. Kaffee ist gratis in der Pause. Er ist wie Abwaschwasser, zubereitet in einem grossen Gefäss, wo er ständig warm gehalten wird. In Guatemala wird sehr viel Kaffee produziert, aber eine Kaffeekultur ist keine zu finden. - Viva Italia! Hin und wieder läuft eine Ameise über mein Heft. Eine Tafel hat’s natürlich auch nicht. Der Lehrer, er heisst Edgar, schreibt alles auf ein Blatt auf. Er sieht eigentlich mehr aus wie ein Bauarbeiter, aber das sind Vorurteile, ich weiss. Jedenfalls verstehe ich mich gut mit ihm. Er hat nur ein Buch, das teilen wir. Es muss schon bessere Zeiten gesehen haben. Wenn ich es berühre, habe ich unweigerlich das Bedürfnis, nachher die Hände zu waschen. Bücher sind in der Verantwortlichkeit der Lehrer. Jeder hat sein persönliches Unterrichtsmaterial. - Eines Tages bringt Edgar ein anders mit, aber da ist ihm offenbar ein Holzwurm hineingeraten, von Deckel zu Deckel ist ein grosses Loch gefressen. Aber sonst ist alles OK.
In der Schule geht es ziemlich anders zu und her als bei uns. Immer wieder stelle ich das fest. Während des Unterrichts eines Morgens kam Mario, der Direktor der Schule, vorbei und verteilte allen Lehrern je zwei Blatt Papier für ihre Notizen. - Wenn ich an unser Kopierzimmer denke in der Schule und den Verschleiss an Material...
Bisher habe ich noch alle meine Habseligkeiten, und es sind deren viele. Edgar hat mir gesagt, es sei überhaupt nicht so schlimm mit der Kriminalität in Antigua, in Guatemala Ciudad schon, dort gehe keiner freiwillig hin, aber ich solle am Abend auf jeden Fall lieber mitten in der Strasse und nicht auf dem Trottoir gehen... Es könnte sein, dass man aus einem dunklen Hausgang heraus überfallen werden könnte. Das ist zum Glück nie passiert. So oder so lässt es sich auch tagsüber besser auf der Strasse spazieren als auf den Trottoirs, die zum Teil riesige Löcher aufweisen und wenn man nicht aufpasst, man einen Beinbruch absolut in Kauf nehmen muss. „Hans-guck-in-die-Luft“ geht gar nicht, der Blick muss stets auf den Boden gerichtet sein.- Ich hab’s unfallfrei überlebt.
Antigua
Die alte Kolonialstadt, wie es deren etliche gibt in Lateinamerika, liegt auf 1‘500 m über Meer. Das Zentrum ist angeordnet wie ein Schachbrett von circa 1 km2, etwa 30'000 Einwohner leben in und um die ehemalige Hauptstadt, die umgeben ist von Hügel- beziehungsweise Bergketten. Drei davon sind Vulkane: Agua, Fuego (noch aktiv) und Acatenango; alle etwas über 3000 m hoch. In der Mitte befindet sich der Parque Central, auf der einen Seite flankiert von der Kathedrale oder was davon noch übrig ist, auf den andern Seiten die Municipalgebäude, Läden, Restaurants und Banken. Es hat unendlich viele Kirchen und Ruinen, ebenso viele Internetcafés und Mini-Reisebüros. Noch mehr Restaurants. Und eines sieht gefälliger aus als das andere. Die meisten haben einen Innenhof, es wird eine Freude sein, sie alle auszuprobieren. Das Hotel, wo mich Mario am nächsten Tag hinbringt, ist sehr geschmackvoll eingerichtet und äusserst sauber, aber das Problem ist, dass mein Zimmer keine Fenster hat. Es erinnerte mich an meine letzte Reise nach Südamerika, wo das genau so war. Das ist nicht ungewöhnlich, bedingt durch die Bauweise (Innenhöfe) und es hat sicher auch noch andere Gründe. Eine Grosszahl aller Hotelzimmer, zumindest die preisgünstigeren in den Städten, haben keine Fenster oder wenn sie welche haben, kann man sie nicht öffnen; meist sind sie klein, weit oben angebracht und oder mit Glas versehen, durch das man nicht hindurchschauen kann.
In der ersten Woche hatten wir in der Schule einen Kochkurs. Das heisst, in Ermangelung einer Küche brachte die Lehrerin die drei Desserts mit und erklärte uns, wie sie gemacht werden. Aussehen taten sie nicht besonders gut; zwei davon erinnerten mich stark an das, was wir bei uns ins Robby-dog Säckli füllen, eines eher, wie wenn es jemand bereits gegessen hätte. Aber ich habe mich tapfer „durchgebissen". Diese Desserts bereitet man nur in dieser Saison zu; sie sind für die Toten gedacht, die am 1. November zurückkommen. Die Familien bringen diese Gaben auf die Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen und essen dort wacker mit. Ebenso bringen sie deren Lieblingsgerichte auf den Friedhof. - Da kann man sich ja richtig aufs Ableben freuen.
Normalerweise kann man hier den Friedhof nicht besuchen, weil es zu gefährlich ist (Raub und Vergewaltigungen), aber in dieser heiligen Woche geht es in Ordnung, da werden alle Vorbereitungen getroffen, die Gräber neu gestrichen etc. So kann man ihn ohne Polizeibegleitung besuchen. Um auf den Hügel Cierro de la Cruz zu spazieren, ist es hingegen besser, sich vorher bei der Touristenpolizei zu melden, damit man begleitet wird. Es ist nett, unterwegs mit den Polizisten zu plaudern, und man hat einen wunderbaren Blick über die Stadt und die Vulkane.
Allerheiligen in Todos Santos
Am ersten Wochenende fuhr ich mit ein paar Schulkameraden (tönt ein wenig komisch, fast wie Gschpändli) in den Norden in die Berge. Wir organisierten die Reise selbst, das heisst, wir mieteten einen Minibus mitsamt Fahrer für drei Tage, so war’s nur halb so teuer. In Todos Santos, auf 2‘450 m Höhe, findet jedes Jahr zu dieser Zeit ein 5-tägiges Fest statt, wo die Toten geehrt werden und das mit Unmengen von Alkohol. Am ersten November, als Höhepunkt sozusagen, findet etwas absolut Abstruses statt: Ein Pferderennen mit betrunkenen Reitern (?!?!?!), die nach jeder Runde eine Glas Alkohol trinken müssen, der so stark ist, dass er einen so oder so fast vom Pferd haut. Das Rennen dauert von morgens 8 bis nachmittags um 5 Uhr und ist fertig für die Teilnehmer, wenn sie entweder tot sind oder vom Pferd gefallen und nicht mehr in der Lage sind, wieder in den Sattel zu steigen. Hotels hat´s keine in diesem Ort, jedenfalls nichts, was diesen Namen verdienen würde, nur Unterkünfte mit kaltem Wasser. Toilettenpapier und Rucksack soll man mitnehmen, hiess es. Das kann ja heiter werden, dachten wir und reservierten daraufhin ein Hotel in Huehuetenango, etwas näher an der gewohnten Zivilisation und nicht weit weg vom Ziel.
Am nächsten Morgen um sechs Uhr starteten wir und kamen um acht in Todos Santos, einem Ort mit etwa 2000 Einwohnern, an.
Die Fahrt dorthin ist wunderschön, man sieht Bergzüge, einen hinter dem andern, Felder, die fein säuberlich mit Agaven voneinander abgetrennt sind, wenige Häuser nur oder kleinere Siedlungen.
Es war total bizarr. So etwas Verrücktes habe ich noch nie erlebt. Das Fest oben in den Bergen schlägt dem Fass den Boden aus
Es war bereits allerhand los bei unserer Ankunft. Von überall her kamen Reiter in ihren bunten Trachten angeritten. Zahlreiche Besoffene lagen schon am Morgen früh herum, torkelten und lallten, aber das kümmerte niemanden, offenbar gehört es einfach dazu.
Und dann das Pferderennen. Nein, es ist nicht zum Glauben: etwa fünfzig Reiter, 150 Pferde zum Auswechseln zwischendurch, circa 5000 Zuschauer aus der ganzen Gegend (nur etwa 200 Touris) und Rum und Bier (oder was auch immer das für ein Gebräu war) à gogo. Die ganze Gruppe Reiter muss (!) schon vor dem Starten trinken, und nach jeder Runde wird nachgefüllt. Sie starten dann gemeinsam aufs Kommando und rasen los, eine Strecke von ungefähr 300 m der Strasse entlang, die ins Dorf führt, und wieder zurück. Nach jeder Strecke sind sie betrunkener und früher oder später fällt natürlich jeder mal vom Pferd, die nächsten galoppieren über die Körper hinweg. Wer am Boden liegt, kann sich manchmal kaum noch aufrappeln; von Kameraden müssen sie aus der Gefahrenzone geschleppt werden und sobald sie wieder einigermassen da sind, lassen sie sich erneut auf die völlig verängstigten Gäule hissen. Gekleidet sind sie in den neuesten Trachten, die extra für diesen Tag hergestellt werden. Manche Reiter schwenken ihre Bierflaschen während des Rennens umher und galoppieren freihändig und laut johlend. Das Ganze dauert acht Stunden lang. Am Mittag können sie sich einen Moment ausruhen. Es gibt jedes Jahr Tote, aber das wird dann als gutes Zeichen ausgelegt, dann gelingt sicher die Ernte. Absolut crazy, der ganze Spektakel!
Das Event hat einen geschichtlichen Hintergrund: Als die Spanier das Dorf vor rund 450 Jahren eroberten, seien sie total besoffen ins Dorf galoppiert. Wahrlich ein guter Grund, während Jahrhunderten dieses fatale Ereignis zu zelebrieren. - Es ist eine blutige Sache, die Reiter spucken und kotzen, ein gruuuusiges Schauen. Aber manchmal muss man trotzdem lachen, es ist fast nicht zu fassen, dass es so was gibt. Gegen Abend, sozusagen als Schlussbouquet, versuchen sie dann noch mit Säbeln, Hühner, die an einer Schnur am einen Ende der Strecke aufgehängt sind, im Galopp zu killen. Diesen Anblick haben wir uns allerdings erspart. Es war sogar so, dass es gegen Mittag zu regnen begann. Das hat uns dann gereicht. Wie die Rennstrecke aussah, konnten wir uns vorstellen; das ganze Dorf war ein einziger Morast.
Am Mittag assen wir eine Kleinigkeit in einem Restaurant und der Kellner war so zugedröhnt, dass es etwa eine Viertelstunde dauerte, bis er unsere Bestellung begriffen hatte. Sich merken, was wir wollten, lag nicht mehr drin. So musste er es sich alles aufschreiben. Ich weiss gar nicht, ob er wirklich schreiben konnte. Er zeichnete die Buchstaben aus der Speisekarte auf seinen Bestellblock ab und das dauerte. Ich wollte eine Omelette und dieses Wort kam nur einmal vor auf der Karte. Es hätte also gelangt, „Ometet“ zu schreiben. Aber er kopierte alles, mitsamt dem Druckfehler und den dazugehörigen cebollas y tomates. Meine Kollegin bestellte ein Sandwich und da ging die Abschreiberei wieder los. Was dann kam, war ein normales Sandwich und eines, in dem eine Omelette eingeklemmt war...
Gut, sind wir nicht über Nacht dort geblieben, denn was uns ein Engländer erzählte, der im Dorf übernachtet hatte, hätte mich aus der Reserve gelockt. Er hatte in einer Privatunterkunft ein Doppelzimmer gemietet. Da er es für sich allein wollte, hatte er den vollen Preis dafür bezahlt. Als er von einem kurzen Spaziergang zurückkam, hatte die Vermieterin drei weitere Gäste bei ihm einquartiert, zwei Personen im andern Bett, eine in seinem eigenen.
Dieser Ausflug wird mir unvergesslich bleiben, nicht nur, weil alles so krass komisch war, auch wegen der einmaligen Aussicht auf der Fahrt dorthin.
Auf der Heimfahrt nach Antigua besuchten wir den farbenfrohen Markt in Chichicastenango (2'000 m), die Mayaruinenstadt Zacuelu und in Huehuetenango den Friedhof am 1. November - ein Volksfest und ein Blumenmeer! Vor den Toren des Friedhofs fand eine Kilbi statt mit Schiessbuden, Musik, Essständen und einem Riesenrad. Der Friedhof sah aus wie eine Ferienkolonie. Die Häuser, die sie ihren Toten aufstellen, sind zum Teil grösser als ihre eigenen. Spaziergänger, Musiker, Marimbaspieler vor den Urnengräbern - andere Länder - andere Sitten.
Ausflüge
An einem Nachmittag der folgenden Woche machte ich bei einem Ausflug mit ins nahe gelegene Dorf Santiago Somorra. Es war sehr eindrücklich. Sechzehn Frauen, die versuchen, bessere Bedingungen für ihre Kinder (Schule) zu erreichen, haben sich dort zu einer Assoziation zusammengefunden, anfangs gegen den Willen ihrer Männer. Sie verkaufen die Dinge, die sie herstellen, ohne Zwischenhandel und zeigen einem genau, wie sie diese anfertigen. Weben (Bettdecken, Taschen, Tücher, und tausend andere Dinge) sowie Matten flechten sind ihre Hauptarbeiten. Zuerst aber führen sie einen auf einem Spaziergang zu einer ehemaligen Lagune und erzählen gemeinsam die Geschichte ihres Dorfes. Hoch oben in den Bergen sind noch immer die Fussabdrücke eines Helden zu sehen, der nach dem Erdbeben vor 400 Jahren das Dorf verlassen hatte. Die Frauen selber haben diese zwar noch nie gesehen, aber sie wissen, dass sie dort sind. – Sozusagen als Schlussbouquet kochten sie für uns Besucher am späten Nachmittag ein tolles Essen, Pepian (besser als in jedem teuren Restaurant in der Stadt); wir konnten unsere Tortillas selber formen, es war ein einprägsamer Nachmittag.
Ein anderer halbtägiger Ausflug führte uns ins Dorf San Andrés Itzapa. Die indianische Bevölkerung (und offenbar nicht nur diese) verehrt dort einen Heiligen, der zwar offiziell nicht anerkannt wird, aber man trifft auf Schritt und Tritt auf seine Spuren. Es ist San Simón Maximon, ein komischer Kauz. Er trägt einen schwarzen Anzug mit Krawatte, in der einen Hand hat er eine Flasche Rum und im Mund eine Zigarre. Vertrauenerweckend sieht er nicht aus. Vor seinem Altar steht eine Art Priester, der den Leuten, die San Simón huldigen wollen, erst mit grünen Zweigen, Münze oder etwas Ähnlichem, über den Kopf und den Rücken schlägt und sie anschliessend mit Rum begiesst. - Na ja.
Am folgenden Wochenende wurde es etwas brenzlig. Die Wahlen waren eine Riesensache. Es wurde empfohlen, nicht zu reisen. Mich hatte aber inzwischen das Reisefieber gepackt und ich wollte möglichst nicht in Antigua bleiben, sondern ein paar Tage ans Meer fahren. Einige rieten davon ab und sagen, man soll nicht einmal das Haus verlassen, andere glaubten, es könnte schon gehen, vor allem die Südachse sollte befahrbar sein. Vorsorglich meldete ich mich bei der Botschaft an, damit sie wussten, falls ich in Schwierigkeiten geraten sollte, dass ich da war und sie mich auch per e-mail über allfällige Geschehnisse oder besondere Gefahren informieren konnten.
In der Schule hatte ich viel über die Wahlen erfahren, es war unheimlich spannend. Es wäre an der Zeit, das korrupte System zu ändern.
5. November 03: Man denkt und hofft, dass Berger („Bersché“ sagen sie) oder Colóm Präsident wird, nur ja nicht wieder Montt, der ja Tausende von Indígenas auf dem Gewissen hat. Jetzt besticht er sie mit Geld und Versprechungen, man rechnet damit, dass er deshalb trotzdem eine beachtliche Stimmenzahl erhalten wird.
Gestern hat die Regierung ein Dekret erlassen, welches bestimmt, dass am Wochenende bis und mit Montag nicht gearbeitet wird, also auch keine Läden geöffnet sind, keine Gruppen grösser als zehn Menschen sich treffen dürfen, Hotels und Restaurants geschlossen bleiben müssen, und so weiter. Das heisst aber, dass gar niemand reisen kann, denn Benzin soll auch keines erhältlich sein. Und das wiederum bedeutet, dass viele Leute gar nicht zu den Wahlurnen gelangen können, denn sie müssen dort wählen, wo sie registriert sind. Die nicht abgegebenen Stimmzettel zählen dann für die Regierungspartei, die aber im Grunde genommen ganz klar keine Chance hat gemäss den Opinionpools. Es gibt jetzt grosse Opposition gegen dieses Dekret, morgen sollte herauskommen, ob es gelang, die Regierung zu zwingen, davon abzukommen.
Sitze ich tatsächlich hier fest, ist die Frage. Ich kann mir die Situation nicht vorstellen. Wo gehen all die Touristen hin? Und wo esse ich? Ab Freitag habe ich nicht einmal mehr ein Zimmer in meinem Hostal.
Soeben bin ich in ein anderes Hotel gezogen, da meines überbucht ist. Hier möchte ich am liebsten bleiben, denn es ist ein wunderschönes Haus mit zwei Innenhöfen, einem prächtigen, tropischen Garten, und ich bewohne es alleine (für 22$). Das Beste: es hat drei Fenster! Aber ich kann leider nur für zwei Nächte bleiben. mal sehen, ob's dann nächste Woche auch noch frei ist. Ich muss halt ein wenig „stürmen“.
6. November 03: Judihui! Sie haben das dumme Regierungsdekret über Bord geworfen. So kann ich nun morgen nach Monterrico ans Meer fahren. Ich freue mich sehr!
Bei den Wahlen scheint jetzt alles auf bestem Weg zu sein, so hoffe ich wenigstens. Die Regierungspartei hat keinerlei Chance, die Wahl zu gewinnen, wenn sie nicht totalen Wahlbetrug begeht. Ich möchte dem Volk den Wechsel gönnen. Man hofft allgemein, dass Berger das Rennen macht und dass es nicht einen zweiten Wahlgang geben wird, denn das kostet dieses arme Land enorm viel Geld für nichts. (Anmerkung im Januar 04: Berger wurde am 28. Dezember im zweiten Wahlgang gewählt.)
10. November 03: Es ist Montag und ich bin zurück von meinem ersten „Ferienwochenende". Bisher war ich ja ständig in der Schule und das Todos Santos-Wochenende war eher anstrengend. Also ich bin zurück mit hundert neuen Eindrücken und mindestens ebenso vielen Mückenstichen. Beeindruckend war die Fahrt von Antigua an die Pazifik-Küste. Anderthalb Stunden unterwegs und schon befand man sich in einer völlig anderen Klimazone - ein kompletter Wechsel der Vegetation. Antigua liegt ja auf über 1‘500 m über Meer; die Temperatur ist angenehm, immer so zwischen 20 und 25 Grad, in der Nacht relativ kühl, etwa 15 Grad. In Monterrico hingegen ist es sehr heiss und da der Strand schwarz ist (Vulkansand), ist es dort kaum auszuhalten. Hier sagte man mir allerdings, es sei in dieser Jahreszeit (Sommeranfang) eher ein wenig „fresco" und Mücken habe es auch nur sehr wenige.
Ich übernachtete in „Johnny's Backpacker“ in einem Sechserzimmer - nein, natürlich nicht, das waren zwei andere Girls aus der Schweiz; ich „stieg“ im besten Hotel des Ortes „ab", dem „Pez de Oro“, aber im Bett waren wir auch zu sechst - nein, auch nicht. Wir waren viel mehr. Einige Ameisenfamilien und ich. Sie hatten sich in den Kopf gesetzt, durch mein Bett zu marschieren, unaufhörlich, nicht davon abzubringen, von ihrer Route abzuweichen. Das Moskitonetz ist eben nicht zugleich ein Ameisennetz. - Die Kakerlake in der Dusche liess ich von einer mutigeren Frau entfernen, aber kaum war diese gegangen und ich parat fürs Bett, war da auch schon das Gschpänli der eben Ausgewiesenen zur Stelle.
Monterrico ist ein Kaff, in dem man nicht einmal eine Postkarte kaufen kann, geschweige denn sonst etwas. Zwar fand ich einen Postkartenständer, einen verrosteten, die Karten teilweise vergilbt und verbogen bis zur Unkenntlichkeit. Die letzte Karte habe eine Schweizerin gekauft, sagte man mir, vor etwa einem Monat. Sicher nicht um sie zu schreiben, dachte ich, eher wohl als Kuriosum. Nicht schlecht ein solches Andenken für sechzig Rappen.
Monterrico ist ein Naturreservat (ich vergesse jetzt mal den ganzen Abfall, der überall herumliegt, im Dorf, am Strand, und das in Unmengen. Es ist gruuuuuusig!!!!!!!). Aber meine Fahrt auf dem Boot bei Vollmond morgens um fünf durch den Mangrovenwald war paradiesisch.
Im Ort hat es ein Centro und dort wird versucht, die acht (von 250) übriggebliebenen Arten von Riesenschildkröten vor dem Aussterben zu retten. Die Eier werden eingesammelt und nach ein bis zwei Tagen werden die kleinen süssen Schildkröten freigelassen. In der „Eierleg-Saison" werden täglich jeweils um 5 Uhr nachmittags etwa hundert Stück Richtung Meer geschickt. Es ist eine Freude zuzusehen, wie sie den Wellen entgegentorkeln. - Wenige allerdings werden lange überleben, nur etwa ein Zehntel, so wird geschätzt.
Drinks gibt‘s gute bei „Johnny's“, riesige. La „Pura Vida“ ist mein Lieblingsdrink. Aber oh weh: Am Sonntag durfte wegen der Wahlen kein Alkohol ausgeschenkt werden. Und das fing schon am Samstagmittag an, so dass ich meinen Fisch zum Nachtessen ohne Wein trinken musste. Damit ich dann am nächsten Tag nicht herumpöble, versteht sich. - Das Essen war übrigens Spitze dort, der beste Fisch, den ich je gegessen habe. Robalo. Ja, und die Heimfahrt dann: Der Bus, der hätte kommen sollen, kam nicht. Schliesslich gelang die Heimreise doch in einem Minibus, der für acht Personen gedacht war, elf waren wir (Anmerkung am Ende meiner Reise: das ist ja zum Lachen: elf statt acht, da gibt’s noch ganz anderes!). Dass er nicht auseinanderfiel bis Antigua, ist ein Wunder, die Fensterkurbel war durch einen Nagel ersetzt worden, die Tür konnte man nur zu zweit öffnen, schliessen fast gar nicht, alles schepperte und ratterte, aber wenigstens eines funktionierte vorzüglich: die Heizung. Auf Hochtouren. Die Fahrt erinnerte mich an unseren alten Peugeot. In seinen letzten Zügen schlich auch der nur noch mit 25km/h den Berg hinauf. Aber wir haben´s geschafft und in Antigua anzukommen war wie „coming home".
Ich hab sowieso total Glück: Ich kann in der neuen Unterkunft bleiben. Sie gehört derselben Besitzerin des Hotels, in dem ich bisher war, es ist aber eigentlich ihr Ferien- beziehungsweise Wochenendhaus. Sie lässt mich für den Rest der Zeit dort wohnen, auch wenn Theo später kommt. Sogar wenn wir unterwegs sind, können wir das überflüssige Gepäck dort lassen. Soo nett von ihr! Das Haus ist mitten in der Stadt gelegen und es hat Fenster und einen Garten. - Himmlisch! - Wenn ich will, kann ich Ess- und Wohnzimmer ebenfalls benutzten wie auch die Küche (kommt mir natürlich nicht in den Sinn). Tagsüber ist eine Haushälterin da, Tina, die fürs Hotel die Wäsche macht und meine gleich damit und am Abend kommt ein junger Mann, Rojelio, dessen Job es ist, einfach da zu sein, „Security“ sozusagen. Mit ihm habe ich gestern den ganzen Abend lang die Wahlen am Fernsehen verfolgt.
Überhaupt gefällt es mir gut in Antigua. Die meisten Leute sind freundlich und grüssen, wenn man vorbeigeht. Und ich bin jetzt auch der Meinung, dass es nicht so gefährlich ist. Man muss sich eben informieren über die „Dos“ und „Don’ts“. Offenbar nicht zu vergleichen mit Guatemala City. Über die besuchenswerten Highlights in der Hauptstadt heisst es im „Lonely Planet" Guidebook kurz und bündig, das Beste sei „leaving“.
Zu Beginn meiner dritten Woche ging ich brav wieder zur Schule. Edgar war anderweitig beschäftigt, meine neue Lehrerin hiess Caroline. Sie erzählte mir viel von sich und ihrer Familie, und an meinem letzten Schultag lud sie mich sogar zu sich nach Hause ein. – Sie könnte ein Buch schreiben über ihr Leben. Die ersten siebzehn Jahre wohnte sie in einem kleinen Dorf, wo’s weder Elektrizität noch Wasser hatte. So musste sie vor Schulbeginn (Schulweg eine Stunde) erst Wasser holen gehen zum Brunnen, nach der Schule um vier Uhr nachmittags dem Vater auf dem Feld helfen und nach dem Essen konnte sie dann endlich bei Kerzenlicht ihre Hausaufgaben machen. Die Familie sei von den übrigen Dorfbewohnern stets als Aussenseiter behandelt worden, weil sie ihre Kinder in die Schule geschickt hatten. Daher hatte man sie als „reich“ eingestuft.
Das Erdbeben 1976 hatte ihre Familie zwar verschont, aber obdachlos gemacht. - Caroline ist jetzt 34-jährig, zum zweiten Mal verheiratet, hat vier eigene Kinder (das jüngste fünf Monate alt) und sie sorgt auch für ein Waisenkind, das bei ihr wohnt. Sie macht den Haushalt, muss morgens Schule unterrichten, damit sie ein wenig etwas verdient, und ihr grösster Wunsch ist es, ihr Studium abzuschliessen (Jura), von dem ihr noch zwei Jahre fehlen.
Das nächste Wochenende war der Karibikseite von Guatemala gewidmet. Mit Beatrice, die ich in der Schule kennen gelernt hatte, und ihrem Bruder Norbert reisten wir westwärts. Beatrice ist Schweizerin, lebt aber seit dreissig Jahren bereits in Kalifornien. Sie hat eine Tochter und einen Sohn im Alter meiner Kinder. Wir verstanden uns auf Anhieb sehr gut. Unterwegs war unser erster Stopp in Copán, der Maya-Ruinenstadt in Honduras. Um dorthin zu gelangen, fuhren wir um vier Uhr morgens in Antigua los. Dem Reise-Car fehlte bereits dort ein hinteres Rad. Das habe sich am Tag zuvor selbständig gemacht, wurde berichtet. - Vertrauenerweckend! - Aber das sei kein Problem, meinte der ca. 150 kg schwere Fahrer. Er fuhr noch grässlicher, als er aussah. Ständig war er mit dem grossen Bus am Überholen, am besten war´s, gar nicht hinzusehen. Wir hatten jedoch Glück: Von einer Frau, die wir später trafen, erfuhren wir, dass der Bus am folgenden Tag kurz ausserhalb von Guatemala City endgültig zusammengebrochen war, dass aber unser verwegener „Piloto“, wie man die hier nennt, es doch tatsächlich nach einer Stunde fertig gebracht habe, ihn soweit wieder zusammenzuflicken, dass er es bis zur nächsten Garage schaffte. Er (nicht der Bus) sei dann über und über von Öl verschmiert gewesen. Rio Dulce, Livingston und Lago de Izabal Nach den Ruinen in Copán besichtigten wir jene in Chiriguá, anschliessend die Migros-Bananen-Plantage Del Monte und kamen schliesslich in Rio Dulce an, einer Siedlung, etwa 30 km vom Karibischen Meer entfernt. Der Ort selber ist klein und eher unattraktiv, Ausgangsort für Ausflüge in die Umgebung. Eine riesige Brücke überquert den Rio Dulce. Im Reiseführer steht, man solle ja nicht etwa den Fehler begehen und am Südende, nach der Ortstafel, aussteigen. Es ist etwa ein halbstündiger Marsch bis zurück ins Zentrum auf die andere Seite. Und es ist heiss. Zuoberst auf der Brücke halten alle Autos an, es hat genügend Platz, man hat einen wunderbaren Blick von dort aus. Eiscrème-Verkäufer und andere Händler mit ihren kleinen fahrbaren Verkaufsläden haben sich mitten auf der Strasse etabliert. Wir übernachteten in einem hübschen Hotel am Lago de Izabal, besichtigten die Festung San Felipe und machten einen Ausflug nach Livingston, dem kleinen Hafen direkt am Meer, der nur per Boot erreichbar ist. Ein karibisch anmutender Ort, voller Leben, farbig, mit dunkelhäutigen Bewohnern, Abkömmlinge der ehemaligen Sklaven. Aber der Abfall am Strand, in und neben dem die Leute leben, ist unbeschreiblich. Dabei wäre es ein Paradies. Der Weg dorthin auf dem Fluss war einzigartig. An der breitesten Stelle ist der Rio Dulce acht Kilometer breit, und das auf einer Länge von zwölf Kilometern (el Golfete). Der Fluss frisst sich durch den Regenwald und hin und wieder hat es Behausungen am Ufer, die meisten ziemlich primitiv. Im Reiseführer habe ich von einer „Finca Tatín“ gelesen, in der ich ursprünglich ein paar Tage hätte bleiben wollen. Ich liess mich vom Boot hinfahren und schaute mir die Unterkunft an. Es war dort, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, kein Sonnenstrahl dringt durch den dichten Regenwald, nur schlechtes Licht in der offenen Hütte, kein privates Baño. Ich hätte wirklich nicht viel tun oder unternehmen können an diesem Ort. Es hiess, Spanischstunden würden angeboten, aber die Frau, die diese gab, machte das nun nicht mehr. - Und dann das Kriechgetier und die Mücken! - Im Reiseführer heisst es: „It's not a place for phobics of bugs or creeping fauna". Zu denen gehöre ich aber. Also nehme ich mir das zu Herzen und fahre mit Beatrice und ihrem Bruder zurück nach Rio Dulce. Nach einer letzten gemeinsamen Mahlzeit: „Tortilla con Carne“ für 2 Franken in einem ganz einfachen Beizli am Wasser (ich hätte glatt das Zehnfache dafür bezahlt, sie war so welts-gut) verabschiedeten wir uns. Die beiden fuhren am Sonntagabend wieder zurück nach Antigua, Beatrice hatte einen Flug nach Costa Rica gebucht; mir gefällt es, ich bleibe.In einer sogenannten Ecolodge, der Hacienda Tijax. (www.tijax.com) finde ich eine Unterkunft. Es gibt hier gutes Essen, die feinsten Drinks (mono loco), sogar einen Swimmingpool hat’s. „It truly is a great place to hang out“, meint Lonely Planet.Meine Unterkunft ist eine Cabaña für mich alleine für 25 $ pro Nacht. Sie steht auf Stelzen direkt neben dem Bootssteg, und wenn jemand dort drüber geht, schüttelt meine Behausung wie ein Schiff. Auf der andern Seite des Stegs, direkt vor meiner Tür, sind etliche Yachten stationiert, natürlich gehören sie alle Ausländern. Ausritte werden angeboten, Boot- und Kajak-Fahrten. Ich will ein paar Tage hier bleiben und dann das Terrain per Pferd auskundschaften. Es ist eine Kautschuckplantage, 36 km2 gross. In Rio Dulce funktioniert fast der gesamte Verkehr per Boot. Um zum Hotel zu gelangen, wird man abgeholt. Ich hatte Glück gestern, dass ich diese Cabaña überhaupt buchen konnte, denn an der Rezeption im Ort sagte man zuerst, es habe keine Zimmer mehr frei mit eigenem Bad und WC. Ich war trotzdem einverstanden, aber als ich dann mit der Chica, der Angestellten im Touristenbüro, ein wenig plauderte und das auf Spanisch, rief sie an (von sich aus) und ich hörte sie sagen, ich sei nett, keine Amerikanerin, sie sollen mir ein Cabaña geben. - So geht das hier. Aber ich war froh, denn in der Nacht auf den schmalen Stegen herumzuturnen, falls man auf die Toilette muss, hätte mir wenig Spass gemacht. Dazu kam, dass es die halbe Nacht lang wie aus Kübeln schüttete. Nun, wenigstens war’s schön warm.Ein dreistündiger Ausritt am nächsten Tag über Stock und Stein durch die Kautschukplantage (10'000 junge Bäume, 25'000 produktive) war sehr eindrücklich (grandiose Aussicht über das ganze Gebiet des Rio Dulce), erholsam (lieber mal im Sattel als ständig im Bus), fun (durch wildes Gestrüpp und unsere Zimmerpflanzen galoppieren) und lehrreich: Ein Arbeiter in der Plantage verdient pro Monat 220 Fr. Pro Tag muss er 500 Bäume anschneiden und den Latex einsammeln. Ein Baum kann während vierzig Jahren viermal pro Woche beschnitten werden, sobald er 45 cm Umfang hat. Das ist nach ungefähr neun Jahren der Fall, hilft man mit Chemie nach, dauert’s nur sechs bis sieben Jahre.Von Rio Dulce aus machte ich einen Ausflug an den El Paraíso Wasserfall. Erst wollte ich noch ein Mückenmittel kaufen, aber als ich sah, dass der Bus gerade kam, liess ich es, denn ich wollte ihn ja nicht verpassen. Man sagte mir, er fahre nur immer zur vollen Stunde, und es war gerade zehn Uhr. Also stieg ich ein und setzte mich auf die äusserste Kante des Kunststoffsitzes, denn es war sehr heiss und weil im Bus alles so schmutzig war, wollte ich möglichst jeglichen Hautkontakt mit der Einrichtung vermeiden. So sass ich eine Viertelstunde lang steif auf meinem Sitz und schwitzte. Es hätte längst gereicht, das Mückenmittel zu kaufen. Der Motor aber lief und ich war sicher, dass der Busfahrer jeden Moment zurückkommen und die Fahrt beginnen würde. Da war ich eben noch ein „Chickenbus-Greenhorn“. Nach einer weiteren Viertelstunde lehnte ich mich an und nahm mein Buch hervor. Der Motor lief immer noch. Nach einem Kapitel und weiteren zwanzig Minuten kam der Fahrer und endlich ging’s los. Der Bus war inzwischen gestossen voll (Körperkontakt auch mit Mitpassagieren nicht mehr zu vermeiden), Hühner reisten mit in den verschiedensten Verpackungen, in Körben, Kisten und sogar Plastiksäcken. Die Bibis schauen aus kleinen Schlitzen und gequältes Quieken war ständiger Begleiter auf der ganzen Fahrt. - Chickenbusse heissen diese öffentlichen Busse in der Touristensprache, weil, aus mir noch immer unbekannten Gründen, ständig Hühner mitfahren. Wieso die dauernd unterwegs sind, kann ich mir nicht vorstellen. Natürlich habe ich gefragt; eine Passagierin hat mir gesagt, sie sei beim Tierarzt gewesen. Diese Erklärung schien mir aber doch ein wenig fadenscheinig. - Immer hat’s Hühner. Sogar im Erstklass-Bus (später auf meiner Reise). Dort dachte ich, dies sei nun tatsächlich die erste hühnerlose Fahrt, aber weit gefehlt: Als wir bei der Ankunft in Guatemala City das Gepäck aus dem unteren Teil des Busses in Empfang nahmen, beklagte sich ein junger Amerikaner lautstark. Sein Rucksack war voll verschmiert von Hühnerscheisse. Der Ausflug gefiel mir übrigens gut. Man kann in einem Wasserloch bei ungefähr 25 Grad baden und der Wasserfall, der vom Felsen stürzt, ist mindestens 10 Grad wärmer. Ein tolles Gefühl, darunter zu stehen. Ein Guardia passt auf, dass keine bösen Räuber an diesem abgelegenen Ort auf dumme Gedanken kommen.Dort, wo ich aus dem Bus gestiegen war, ist ein Wegweiser, auf dem es heisst: „Finca Paraíso“. Ein Hotel am Ufer des Lago de Izabal. Dort wollte ich hin und ich dachte, es sei gleich auf der anderen Seite der Strasse. Ein Traktor überholte mich und hielt an. Der Bauer deutete mir aufzusteigen und ich fand das ganz locker, obwohl ich den Sinn nicht ganz begriff. Erst nachher sah ich, dass das Ufer überhaupt noch nicht in Sichtweite war und je länger die Fahrt dauerte, desto grösser wurde in meinen Gedanken das Trinkgeld, das ich ihm dann zu geben beabsichtigte. Er fuhr sogar einen Umweg für mich. Am Ufer angekommen wollte er zwar nichts, aber meinen Proviant nahm er gerne an – ein „Zvieri“ für seine beiden Söhne. Ein schöner Ort am See, ein Restaurant, günstige Cabañas zum Ausruhen, abgeschieden wie die meisten Orte in dieser Gegend. Der Rückweg zur Hauptstrasse dauerte eine gute halbe Stunde (ohne Traktor), und ich hatte Glück, ein Bus kam exakt in dem Moment, als ich die Strasse erreichte (übrigens: Eine Stunde Busfahrt kostet knapp einen Franken). Vorbei an endlosen Bananenplantagen und Rinderherden (eine Rasse gefällt mir besonders gut: Sie hat lange Lampi-Ohren, und die Tiere mit ihrem treuherzigen Blick sehen aus wie zu gross geratene Dackel) erreichten wir nach anderthalb Stunden auf Naturstrasse wieder Rio Dulce. Unterwegs hielt der Bus einmal an, weil ihm der rechte Rückspiegel abgefallen war. Der Junge, der für die Fahrkarten zuständig war, fand ihn zwar wieder, aber er lag da in tausend Splittern. Ich wunderte mich, dass er sich die Mühe genommen hatte, ihn überhaupt noch zusammenzulesen und mitzunehmen.Die nächsten zwei Tage verbrachte ich in einer Dschungel-Lodge „Casa Perico“ (www.casa-perico.com/de/start/">www.casa-perico.com/) ein paar Minuten flussaufwärts. Vier junge Schweizer wanderten vor fünf Jahren dorthin aus und haben sich dort ein kleines Paradies aufgebaut. Nicht, dass ich mich nach Cervelats und unserer wunderschönen Sprache besonders gesehnt hätte, aber jemand hatte mir diese Lodge empfohlen und da ich ja Zeit hatte... Empfehlenswert, erstaunlich, dschungelig, feines Essen, ein paar junge Giele (Gäste), die tatsächlich jassten, aber da am folgenden Morgen wegen einer (der unzähligen) Strompannen überhaupt nichts mehr funktionierte, es seit meiner Ankunft in Strömen geregnet hatte (es hatte auf der Bootsüberfahrt zu regnen begonnen wie aus Kübeln und nichts war mehr trocken), verleidete es mir dann doch (keine WC-Spülung mehr, kein Licht zum Lesen), ich packte meine nassen Kleider in den Koffer und liess mich von Bruno mit der Lancha nach Rio Dulce fahren. Dort nahm ich den Bus nach El Estor am Lago de Izabal. In den Bus konnte ich kaum einsteigen, da er mehr oder weniger auf einer Müllhalde parkiert war. Erst musste man die Hühner verscheuchen, die im Abfall nach nicht vorhandenen Körnern pickten. Dass dieser Bus noch fahrtüchtig war, war fast nicht zu glauben. Aussen verrostet und verbeult, innen fehlen mir die Worte für die Beschreibung. Dreckig ist ein viel zu sauberes Wort. Der Boden übersäht von Abfällen und wegen der Regenfälle und dadurch, dass die Strasse nicht geteert ist, brachte jeder Fahrgast seinen eigenen Anteil an Morast selber auch noch mit. Und die Ausstattung! Wie wenn man den Bus einer Horde wild gewordener Vandalen überlassen hätte zwecks Demolierung.Die Falttüre war mit einer Schnur am Türrahmen angebunden, die Scheibe fehlte, es muss Jahre her gewesen sein, seit sie sich zum letzten Mal entfalten konnte. – Aber der Motor lief und nach zweieinhalb Stunden kamen wir in El Estor an. Ich deponierte mein Gepäck in einem kleinen Hotel und machte dann einen Spaziergang durch den Ort. Das Zimmer kostete nur sechs Franken, hatte sogar ein eigenes Baño, das ich aber erst gar nicht erkannte im dunklen Loch hinter der Schranktüre, die Dusche über dem abgebrochenen WC-Sitz installiert. Es war Markt im Dorf, aber es hatte kaum Leute. Weit und breit war ich die einzige Touristin. Alle schauten mir nach. Ich fand den Ort seltsam und wusste gar nicht recht, was dort machen. Das Wetter war grau, zwar regnete es nicht, aber irgendwie fehlten doch die Farben. Am Ufer des Sees fand ich ein Restaurant, das sehr schön gelegen ist. Ich sah mir die Speisekarte an und beschloss, dort am Abend einen Robalo zu essen. Bis es so weit war, setzte ich mich auf eine Bank am Ufer und las ein wenig in meinem Roman. Auch fand ich ein besseres Hotel, das andere bereitete mir wirklich ein wenig Kopfschmerzen. Sie gaben mir sogar das Geld zurück. Lediglich zwei Franken kostete mich der Umzug. Das, fand ich, könne ich mir leisten.Das Restaurant, in dem ich hatte essen wollen, war leider abends geschlossen, meinen Robalo erhielt ich aber trotzdem, und zwar in „Hugo’s Place“. Ich war der einzige Gast und erhielt Hugos volle Aufmerksamkeit und sein Fotoalbum zum Anschauen. Cobán, Lanquín und Semuc Champay Am nächsten Morgen wollte ich weiterreisen nach Cobán. Es ist immer empfehlenswert, sich mindestens an drei bis fünf Orten zu erkundigen, wann genau ein Bus fährt. Wenn man drei übereinstimmende Auskünfte gesammelt hat, ist die Chance gut, dass es klappt. So sagte man mir, morgens um eins fahre der erste (bei Dunkelheit, ohne Licht, Naturstrasse: nein, danke). Um fünf Uhr und um sechs Uhr habe es ebenfalls einen Bus. Drei Leute waren sich sicher, dass sechs Uhr stimme, also richtete ich mich darauf ein. Sechs Stunden solle die Fahrt nach Cobán dauern. Das kann ja heiter werden, dachte ich. Und heiter hat es begonnen. Kurz vor Sonnenaufgang war ich dort, wo er abfahren sollte. Und siehe da: Er war pünktlich. Ich stieg ein, mein Köfferchen wurde zwischen dem Fahrer und dem Beifahrersitz deponiert und dort versuchte ich es immer im Blickfeld zu behalten. Und los ging’s. Der Bus fuhr kreuz und quer durchs Dorf und hielt überall an, um Passagiere einsteigen zu lassen. Eine halbe Stunde später waren wir wieder am Ausgangspunkt. Das nervte mich ein wenig. Diese Zeit hätte ich mir sparen können, vor allem, weil ich ja noch eine lange Strecke vor mir hatte. Der Bus fuhr streckenweise kaum mehr als 200 Meter weit und schon hielt er wieder an, um Leute und ihre mitgebrachten Hühner ein- und aussteigen zu lassen. Zeitweise waren wir zu sechst auf der Zweierbank (drei Erwachsene und drei Kinder), im Gang zwischen den Sitzreihen standen ebenfalls Leute und der Blick auf mein Hab und Gut war meist verdeckt. Längst schon waren andere Gepäckstücke darauf gestellt worden, gegen Schluss der Reise waren es zwei Hühnerkisten. Einen längeren Halt machte der Bus nie, nur mal ganz rasch zum Tanken (das funktioniert mit Flaschen und grossen Trichtern) und ein paar Mal wurde er in einer grösseren Ortschaft aufgehalten, weil Markt war und Fahrzeuge kreuz und quer im Weg standen. Getrunken und gegessen hatte ich nichts (so musste ich zum grossen Glück auch nicht auf die Toilette – seltsamerweise musste nie jemand) und langsam sehnte ich mich danach, gegen Mittag in Cobán zu sein. Aber da hatte ich nicht mit den Strassenverhältnissen gerechnet. Als ich um halb eins den Fahrer fragte, ob wir jetzt dann bald ankämen, sagte er, nein, erst etwa um zwei. Ich habe ja Geduld. So wurde es dann halb drei. Eigentlich hatte ich im Sinn gehabt, in Cobán zu übernachten und am nächsten Morgen nach Lanquín weiterzufahren. Aber die Stadt mochte ich nicht. Es war kühl und unfreundlich (es gibt dort einen Regen, der sogar einen eigenen Namen hat) und ich beschloss, an meine acht Stunden Chickenbusfahrt noch eine weitere Stunde anzuhängen. Jedenfalls dachte ich, dass die 60 km nach Lanquín in einer Stunde zurückgelegt werden könnten. Aber da irrte ich schon wieder. Erstens war der Bus soeben abgefahren und zweitens sagte man mir, die Strecke sei nicht sehr gut zu befahren, es daure drei Stunden, es gebe Busse und öffentliche Minibusse, der nächste fahre um drei. Uff! – Trotzdem beschloss ich, auf den Drei-Uhr-Bus zu warten. Ein Minibus kam und der Fahrer sagte mir, er sei schon ausgebucht, an diesem Tag fahre kein weiterer Bus mehr, der nächste erst wieder am frühen Morgen. Zwei andere Touristinnen (die ersten Ausländer, die ich seit 24 Stunden sah), wollten auch noch mit, sie erhielten dieselbe Antwort. Mühsam – ich wollte es nicht glauben. Ein Lastwagenfahrer hörte unsere Unterhaltung mit und bot uns an, in seinem Lastwagen hinten drin mitzufahren. Bei dieser Kälte! Und als ich dann noch sah, was er geladen hatte: nichts als Hühner. Nein, danke vielmals! Ich insistierte erneut beim Fahrer des Minibusses und versuchte ihn zu überzeugen, einen Platz könne er mir wohl noch frei machen. Es waren auch gar nicht alle Plätze besetzt. Er willigte schliesslich ein und los ging’s. Nun begann wieder die Herumkurverei im ganzen Ort, anhalten, Passagiere einladen, Gepäck aufs Dach, Plane drauf wegen des Regens, wieder anhalten, eine Gruppe Kinder einladen - langsam verstand ich, weshalb er gesagt hatte, es habe keinen Platz mehr. Schliesslich waren wir 19 Personen im kleinen Bus - mit sehr viel Körperkontakt. Die Kinder sassen teilweise auf dem Schoss der Erwachsenen, die ganz kleinen zwischen den Füssen der Passagiere am Boden.Keinen Meter geteerte Strasse gibt es zwischen Cobán und Lanquín. Die Strecke glich teilweise eher einem Flussbett, überall hatte es zudem Trucks, Raupenfahrzeuge und Strassenarbeiter, die offenbar versuchten, die Strasse zu flicken und zu verbreitern.Irgendjemand hatte Mühe, seine Verdauung im Griff zu behalten und das war dann gleich offen das Thema. Die Frau vor mir, die auf dem Vordersitz in der Mitte zwischen dem Fahrer und dem Mitfahrer eingequetscht war, hatte aber an alles gedacht. Sie hatte eine Art Notfallkoffer bei sich. Vielleicht hatte sie Erfahrung. Sie spritzte den halben Inhalt einer Duftspraydose nach hinten und machte dazu ganz eindeutige Bemerkungen. - Das fand ich auch nicht so toll, aber wenn ich’s mir jetzt nochmals überlege, muss ich sagen: Das Problem war gelöst – zumindest teilweise.Nach einer Stunde Fahrt blieben wir in einer Kolonne stecken und man sagte uns, die Strasse sei für ungefähr eine Stunde gesperrt wegen der Bauarbeiten. - Super, das hatte mir noch gerade gefehlt. Und dann stiegen meine Mitsardinen alle aus. Ich wusste genau, wie das herauskommt; der Boden glich ja schliesslich nicht gerade einem Teppich. Sie brachten feuchte Erde mit, die dann für den Rest der Reise auf dem Boden des Minibusses und auch sonst überall noch klebte (die Sardine, die über mich kletterte, streifte ihre Schuhe an meinen Hosen ab). Freude herrscht! - Und der Motor lief die ganze Zeit. - Einen Moment lang dachte ich, wir würden nie ankommen, es war auch schon stockdunkel mittlerweile, aber dann sagte jemand: „Noch zwei Kilometer und wir sind dort.“Und tatsächlich, ich war dem Glück noch selten so nah. Wunderbarerweise hatte ich mich nicht in einem Sechserzimmer, wie sie dort üblich sind, einquartieren müssen, sondern erhielt eine hübsche, freistehende Cabaña mit Baño privado für mich allein, in der ich mich sehr wohl fühlte. Eine halbe Stunde später sass ich frisch geduscht und zufrieden auf einem Rytigampfi (statt Barstühle) an der Bar in der Lodge „El Retiro“ (https://elretirolanquin.com/) und freute mich, dass mein Tag nach fast zwölf Stunden Busfahrt ein so glückliches Ende genommen hatte. Das Nachtessen, das spät am Abend am langen Tisch serviert wurde, vegetarisch, war absolut köstlich und unvergesslich. Es ist so spannend, irgendwo hinzufahren und noch nicht zu wissen, was man alles erleben wird den ganzen Tag lang und wo und wie man schliesslich schläft.
Da es dunkel war bei meiner Ankunft, hatte ich gar nicht richtig gesehen, wie die Gegend, wo ich war, eigentlich aussah. Als ich am Morgen erwachte, graste eine Kuh vor meiner Tür und etwa 100 Meter unterhalb sah ich die Aare. Der Fluss sah zumindest so aus: genauso grün, genauso schnell, genauso kalt, nur floss er in die falsche Richtung.
Lankín, das kleine Dorf in Alta Verapaz, ist ein komischer Ort. Es sieht aus wie in den Bergen, hat Hügel, Geissen, Hühner und Kühe, aber es liegt nur auf 380 m Höhe über Meer. Am Tag ist es sehr heiss und in der Nacht relativ kühl. Die Attraktion dort ist es, in Lastwagenreifen den Fluss Rio Lanquín hinunterzupaddeln. Ein Pickup brachte uns ans Ende beziehungsweise an den Anfang des Dorfes. Wir schnappten uns einen Pneu und ab in die Fluten... Aber so einfach war es nicht; der Fluss fliesst nämlich doch noch schneller als die Aare und hat viele Kurven. Ständig wurde ich wie magisch angezogen von allem, was ins Wasser hing, von Bäumen und Ästen, aber das Mühsamste war, es hatte manchmal auch Steine und Felsen mitten im Fluss, die man nicht sehen, aber am Hinterteil dann recht brutal fühlen konnte. So war das eine eher rasante 25-minütige „Reise“ zurück ins Retiro. Fun, ja, ok, aber natürlich gelang es mir auch nicht, meinen Reifen dort ans Land zu steuern, wo wir hätten auswassern sollen und mit schon fast aufkommender Panik dachte ich an die Notiz am Anschlagbrett, die davor warnte, man solle nicht weiterschwimmen, denn es habe entwurzelte Bäume unterhalb der Landestelle. Ja, und eben in einem solchen landete ich unweigerlich. Zum Glück war nichts weiter passiert, aber lustig fand ich’s einen Moment lang nicht mehr. - Am nächsten Tag nahm ich all meinen Mut zusammen und ging doch noch mal, schwimmenderweise diesmal ohne Pneu und schaffte es ganz gut.
Zehn Kilometer von Lanquín entfernt gibt es ein Naturwunder zu sehen, Semuc Champey. So etwas Schönes! Der Fluss Rio Lanquín verschwindet unter grausamem, ohrenbetäubendem Getöse unterirdisch in einer Höhle, die aussieht wie ein Höllenloch, und kommt etwa 300 Meter später wieder heraus. Seine Farbe ist beige. Oberhalb hat sich eine natürliche Brücke gebildet aus etwa zwanzig verschiedenen Wasserpools, in denen man baden kann. Das Spannende ist, dass dieses Wasser mit dem Fluss überhaupt nichts zu tun hat; es kommt aus den Bergen und hat auch eine ganz andere Farbe. Es ist dies der Río Cahabón - türkis, grün und blau. Z’Wunder!!! Und wenn man eine halbe Stunde lang den Hang hinaufklettert, sieht man die Szenerie von oben aus der Höhe, und sie ist atemberaubend. Die ganze mühsame Busfahrt hierhin hätte sich einzig nur für den Blick auf diese Naturschönheit gelohnt.
Ein Erlebnis der besonderen Art war mein Besuch in den Grotten von Lanquín. Schon der Eingang kam mir vor wie ein riesiger Schlund. Am Abend vorher spazierten wir dorthin und warteten bis zum Sonnenuntergang. Wenn die Dämmerung einsetzt, verlassen Riesenschwärme von Murcielagos (Fledermäuse) ihre Behausungen, die sie dort im Eingang der Höhle haben, und fliegen zu Tausenden in die anbrechende Nacht hinein. Um ein leichtes Grauen kommt man kaum herum. Das Höhlensystem ist 23 km lang, der erste Kilometer davon ist mehr oder weniger gut ausgeleuchtet, und es hat teilweise Geländer oder Seile, an denen man sich halten kann. Das Geländer in Semuc Champay, auf das ich mich tags zuvor gestützt hatte, hatte allerdings nachgegeben wie weiche Knie, so dass ich hier also eher skeptisch war. Der Weg war glitschig und teilweise recht steil, ich musste aufpassen wie ein Häftlimacher, um nicht auszurutschen. Manchmal kletterte ich auf allen Vieren und ich dachte ständig an Erdbeben und wie es wohl wäre, wenn plötzlich das Licht ausginge. Vorsorglich hatte ich eine Taschenlampe bei mir, trotzdem war der Spaziergang so alleine in dieser fahl beleuchteten Tropfsteinhöhle ein wenig unheimlich. Auf halbem Weg etwa kam mir ein völlig verängstigtes junges Paar entgegen. – Die beiden suchten den Ausgang und erzählten mir, dass zuhinterst plötzlich das Licht ausgegangen sei und sie dann in Panik und in absoluter Dunkelheit versucht hätten, wieder zurückzufinden. Taschenlampen hatten sie keine bei sich. Hänsel und Gretel lassen grüssen, meine Albträume auch. Mutig kletterte ich noch ein paar dutzend Meter weiter, aber dann hatte ich auch genug und kraxelte wieder zurück.
Draussen war es noch heisser als in der stickigen Höhle und die Aussicht auf den halbstündigen Weg zurück zum Dorf reizte mich nicht besonders. So machte ich Autostopp. Sogleich hielt ein kleiner Lieferwagen an, ein junges Paar war drin mit einem kleinen Jungen, und da sie nach Samuc Champey fahren wollten, konnte ich ihnen gleich den Weg erklären. Ich durfte auf dem Rücksitz mitfahren. Dort sass eine Grossmutter und die hatte einen grossen Korb auf dem Schoss: Schon wieder Hühner. Vier oder fünf Stück. Irgendwie kommt man in diesem Land an den Hühnern nicht vorbei.
Die Fahrt zurück nach Antigua war einfacher als die Reise hierhin. Sie dauerte „nur“ etwa neun Stunden, fünf davon im Erstklass-Bus „Monja Blanca“ von Cobán nach Guatemala. Erste Klasse heisst, dass man einen garantierten Sitzplatz hat und nicht damit rechnen muss, dass jemand diesen mit einem teilt. Mein Sitzplatz war allerdings der engste im Bus, hinten in der Mitte neben der Toilette. Links neben mir sass eine Amerikanerin. Entweder hatte sie den Arm unten, dann war meiner oben oder umgekehrt. Sie war zum Glück nicht dick. Aussicht hatte ich auch keine von dort, wo ich sass, aber da war ich dann nicht einmal so sehr unglücklich darüber: Nach etwa einer Stunde Fahrt wurde es einem Mitpassagier in der zweitvordersten Reihe schlecht. Er öffnete das Fenster und kurz darauf waren all die dahinter liegenden Fenster in abnehmender Weise von seinem Mageninhalt überdeckt. - Niemand hat ein Wort über den Vorfall verloren. Das an sich war schon ein Wunder. Da es wieder relativ kühl war, waren die Fenster geschlossen. Wären sie offen gewesen... Im Erstklass-Bus hat es zwar eine Toilette, wie gesagt, aber sie ist kaum begehbar, denn erstens ist sie mit kleinen Tabourettli vollgestopft, die vom Kondukteur nach und nach hervorgeholt werden, wenn ein weiterer Gast einsteigt (eigentlich hatte ich gedacht, das sei jetzt hier nicht mehr der Fall), und auf diese Weise wird der Gang allmählich so belegt, dass ein Durchkommen keinesfalls mehr möglich ist. - So viel zur Nützlichkeit einer Toilette in einem Erstklass-Bus.
Lesen konnte ich nicht während der Fahrt (zu viel Angst vor dem Schlechtwerden) und zum Fenster hinausschauen eben auch nicht, so fand ich es umso freundlicher von einem jungen amerikanischen Mitpassagier, dass er mir in selbstloser Weise seinen CD-Player für fast die Hälfte der Fahrt auslieh und Nora Johnes auflegte. Ich fragte mich nachher, ob ich so elend ausgesehen hatte, dass er auf diese Idee gekommen war.
Umsteigen in Guatemala mit allem Gepäck und sechs Blocks weit zu Fuss zur anderen Busstation gehen, erzeugte ein eher unangenehmes Gefühl. Die schlimmsten Geschichten kursieren über die Kriminalität in Guate. Wir waren sieben Ausländer; wir blieben dicht zusammen und achteten auf unser gemeinsames Gepäck. Eine weitere Stunde und ich war einmal mehr zurück in Antigua.
Zurück in Antigua
Wie schon gesagt, hat es zahllose Kirchen dort. Und viel Verkehr, der aber sehr langsam nur fliesst, weil es mühsam ist durch die unebenen Stassen zu fahren, da es überall Kopfsteinpflaster hat, Löcher sowieso und auch sonst keinen einzigen ebenen Quadratmeter. So stand ich also vor einer Kirche und wollte auf die andere Strassenseite. Da kam ein Auto gefahren, in dem drei Nonnen sassen. Autos haben immer Vortritt vor den Fussgängern, also fuhr der Wagen direkt an mir vorbei. Die drei Frauen beugten sich wie auf Kommando zu mir hin (zur Kirche, ja, ja, ich weiss schon) und bekreuzigten sich. Sie sahen aus wie Synchronschwimmerinnen. Ich dachte bei mir, was für ein Stress das für sie sein musste, durch Antigua zu fahren und sich bei jeder Kirche zu bekreuzigen. Eine Art Frühturnen vielleicht.
Komisches erlebt man allemal. Das Leben ist sehr spannend. Immer wieder wird man überrascht. Mal wollte ich mir in einem der zahlreichen kleinen Lädeli ein Mineralwasser kaufen, damit ich in der Nacht etwas zu trinken hatte. Das Wasser hier kann man aus dem Hahnen ja nicht trinken. Wie ich nach meinem Geld kramte, hatte mir der Verkäufer den Inhalt des Fläschchens bereits in einen Plastiksack geleert und ein Röhrli hineingesteckt. Nicht gerade gäbig für aufs Nachttischli! - Was denen nicht alles in den Sinn kommt!Und kurz darauf machte mir der 24-jährige Portier in meinem Hotel eine Liebeserklärung. Mein Haar gefiel ihm so gut, gestand er mir und mein Alter schätzte er auf 35!!! – Es kommt noch besser: Mein tatsächliches Alter (50) konnte ihn nicht abschrecken. Er versicherte mir, das Einzige, was ihm an mir nicht gefalle, sei, dass ich verheiratet sei. - Schön, nicht wahr! – Da kann man sich nur mit Begeisterung ins nächste Abenteuer stürzen. Lago de Atitlán Eine Agencía de Viajes habe ich gefunden, bei der ausnahmslos alles bestens und auf Anhieb klappte. „Centroamericana“ heisst sie. Cécile, die junge Frau, die dort arbeitet, ist absolut kompetent und effizient und gab mir manchen guten Tipp. Unter anderem vermittelte sie mir das für mich schönste Hotel am Lago de Atitlán (1'560 m), in San Marios. In der Woche, bevor Theo kam, reiste ich nach Panajachel (Gringotenango genannt von den Einwohnern, weil viele amerikanische Hippys dort hängen geblieben sind oder im Reiseführer bezeichnet als „Gringomagnet“). Dort nahm ich eine Lancha nach San Pedro und kurz vor der Ankunft am Fusse des Vulkans San Pedro bat ich den Bootsführer, mich gleich beim Bootssteg des Hotels Jinava abzuladen. Das sei aber in San Marios, erklärte er und alle lachten. Klar, so stand es auf meinen Notizen; ich hatte den Ort verwechselt - bei all diesen „Giele-Näme“ - kein Wunder. Es hätte gerade so gut auch Juan, Pablo, Tomás, Antonio, Andrés, Lucas oder Santiago sein können; fast alle Dörfer um den See herum haben die Namen von Aposteln. Das Lustigste sagte der Typ, ein Einheimischer, der neben mir im Boot mitgefahren und vor Müdigkeit ständig eingenickt war. Meistens hatte er den Kopf auf seinen Knien. Nur wenn er am Gestänge anschlug, sah er kurz auf und rutschte ein wenig in meine Richtung. „Das kommt eben davon“, murmelte er, „wenn man so müde ist“... Mein Lapsus war eigentlich gar kein so grosser. Ich hatte ja Zeit. Einen Spaziergang ins Dorf hinauf und den See von der andern Seite her betrachten zu können, das zumindest hatte ich mir damit eingehandelt.
Das Hotel Jinava ist ein Hit. Es gehört einem Deutschen, der sich dort ein kleines Paradies erschaffen hat. Die einzelnen Zimmer sind in den Hang gebaut, Sonne hat man von morgens neun bis abends um sechs, bis es innerhalb von wenigen Minuten Nacht wird. Jin, wie er sich nennt, ist Ché Guevara- und Jimi Hendriks-Fan, zudem aber auch ein Gartenfreak. In seinem Garten findet man verschiedene Palmenarten, Bananen, Kakteen, Kaffee, Baumwolle, allerlei blühende Pflanzen wie Lilien, Weihnachtssterne, Vergissmeinnicht und manches mehr.
Jin hat vier sehr nette einheimische Angestellte, die ihm helfen, die Gäste zu betreuen, so oder so immer, aber vor allem dann, wenn er’s selber nicht mehr so genau sieht. Auch Haustiere hat es. Zum Beispiel Mojito, der Papagei, der bellt wie ein Hund. Zu den Haustieren scheint auch die dicke Spinne zu gehören, die in meinem Zimmer an der Wand hing, die ich selbstverständlich entfernen, aber nicht töten liess und die beharrlich, jeden Tag, selbst nach drei Wochen, erneut am selben Ort an der Wand oben links auftauchte. Den Skorpion im Badezimmer jedoch musste von Theo (beim nächsten Besuch im Dezember) mehr als 100 Meter weit weggetragen werden in die Nähe eines anderen Badezimmers.
Jin hat auch einen kleinen Strand errichtet mit Kieselsteinen, wo man gut liegen und sich die Stille und Schönheit des Ortes „hereinziehen“ kann, wie Diego sagen würde. Auf dem See hat es ein paar wenige Fischer in ganz einfachen Booten, Jin nennt sie „Wasser-Cowboys“ und so sehen sie auch aus mit ihren Texas-Sombreros. Immer wieder sind sie dabei, Wasser aus ihren Booten zu schöpfen. Fangen tun sie so gut wie nichts, sagt Jin. – Die Aussicht ist atemberaubend, der See wechselt seine Farbe je nach Tageszeit, am Horizont erhebt sich der Volcan San Pedro (3'020 m). Von der Hängematte aus zuzuschauen, wie die Dämmerung einbricht und im Vordergrund die Wassercowboys immer schwärzer werden und schlechter zu erkennen sind, ist einmalig. Zwei Tage und Nächte blieb ich dort, und ich reservierte auch gleich für Mitte Dezember, denn es war sonnenklar, dass auch Theo von diesem Ort begeistert sein würde.
Theo in Guatemala
Am 30. November abends kam Theo in Guatemala City an, ich hatte ihm den Flug zu unserem dreissigsten Hochzeitstag geschenkt (Uff, tönt das uralt!). Ich holte ihn am Flugplatz ab mit einem Shuttle, denn es ist nicht ratsam, ein Taxi zu nehmen. Es gibt sehr viele nicht registrierte und die Kriminalitätsrate ist hoch. Auch vom Übernachten dort wird abgeraten, denn das Risiko, selbst in den Hotels bestohlen zu werden, wird als nicht eben gering eingestuft. Nach zweiundzwanzig Stunden unterwegs war Theo froh, endlich ins Bett sinken zu können.Als er am nächsten Morgen aufwachte und vom Bett aus den Volcan de Fuego sah,der Rauch ausspuckte, war er nicht wenig beeindruckt.An diesem ersten Tag zeigte ich ihm die Stadt. Als erstes gingen wir zu Doña Luisa, wo das beste Frühstück in town serviert wird, frisches, hausgemachtes Brot, die Omeletten (drei Eier!) gefüllt mit Avocado, Sprossen und Tomaten, frisch gepresste Fruchtsäfte und was man sich alles Feines vorstellen kann. Und das in schönster Atmosphäre, in einem zweistöckigen Kolonialhaus. Man kann entweder unten im Patio im Freien sitzen und sich von der Sonne bescheinen lassen oder im Schatten auf einer der Galerien.Den Markt besuchten wir anschiessend, ich zeigte Theo meine Lieblingsläden und am Abend nach dem Nachtessen schleppte ich ihn mit ins Kino. Das, weil es ein besonderes Erlebnis war, sicher nicht wegen des Films. Das Kino war in einem Haus untergebracht, in welchem jemand eine Wohnung gemietet hatte. Einen Teil davon verwendete der Besitzer als Restaurant und drei weitere Zimmer hatte er in Kinos „umgebaut“; Sala 1-3 hiessen sie. Vorne stand ein Fernseher, der mit einem Videogerät verbunden war, und das war eben das Kino. Die Bestuhlung war besonders geil (würden unsere Jungen sagen): Sie bestand aus drei bis vier Reihen von ausrangierten Polstergruppen (bei uns wären die nicht einmal mehr im Brockenhaus erhältlich), die in keiner Weise zusammenpassten, höchst unbequem waren, denn überall quoll der Schaumstoff heraus und hie und da guckte eine Metallfeder aus dem verschlissenen, fleckigen Stoff hervor. Als Erlebnis einzigartig. Das Vergnügen kostet auch keine drei Franken. Am nächsten Morgen liess ich Theo ausschlafen und ging alleine auf Erkundungstour. Was ich schon lange hatte tun wollen, war, den Vulkan Pacaya zu besteigen. Nach einer gut einstündigen Fahrt nach San Francisco auf 1‘900 m Höhe, begannen wir mit der Wanderung.Man sah natürlich schon von weitem, dass der Ausblick nicht grandios sein würde, denn der Gipfel (2‘550 m) war von einem Wolkenmeer umgeben. Man unternimmt den Aufstieg in Gruppen und wird von einem Führer und von Polizei begleitet (Touristen waren auch hier ausgeraubt worden). Der Weg führt durch Maisfelder, dann durch Wald, allmählich hat’s nur noch Gestrüpp und einzelne Bäume, bis man dann 200 m unter dem Gipfel auf ein riesiges Lavafeld stösst, das seit der letzten grossen Eruption im Jahr 2000 besteht. - Von dort an hüllte uns dichter Nebel ein, das heisst, Nebelschwaden kamen geflogen, ein Wind blies, der einen fast aus den Kleidern riss, so dass es unmöglich wurde, weiterzugehen. Meine Windjacke flatterte mir so sehr um die Arme, dass ich Angst hatte, sie würde zerreissen. Dazu machte sie einen solchen Lärm, dass ich mein eigenes Wort nicht mehr verstand. Sand und kleine Steinchen kamen geflogen, wie feine Nadeln fühlte es sich an auf nackter Haut, genau wie in einem Schneesturm, nur zur Abwechslung eben schwarz. Kalt war es auch. Der Guide sagte, das sei nicht ungewöhnlich, auf dem Gipfel habe es Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h. Noch vierzig Minuten hätte der Aufstieg gedauert, aber jedermann war klar, dass wir umkehren mussten. Unser Guide wählte eine andere Route und die machte enorm Spass. Wir rutschten und rannten eine steile Lava-Geröllhalde hinunter, etwa 300 Meter weit; es war wie Ski fahren ohne Skis. Teilweise versank man bis zu den Knöcheln im Sand, unten angekommen war die erste Handlung, die Schuhe vom Sand und den Steinchen zu befreien. Nicaragua Am nächsten Tag fuhren wir nach Nicaragua mit dem Tica-Bus, erst mal bis San Salvador, wo wir übernachten mussten, und das in einem ziemlich schrecklichen Hotel, in einer schlimmen Gegend der Hauptstadt, aber Hauptsache die Unterkunft war gleich beim Busterminal. Der Bus wurde in den Hof gelotst, der umgeben war von hohen Mauern, und sogleich wurde das hohe Tor geschlossen und verriegelt, damit ja nicht etwa ein Dieb sich hätte Zugang verschaffen können. Nach einer kargen Mahlzeit in einem schäbigen Lokal innerhalb der Mauern gingen wir schlafen und um vier Uhr morgens (eine gigantische Herausforderung für den lieben Theo) musste man schon wieder parat sein zur Weiterfahrt. Tica-Bus ist nun wirklich sehr komfortabel und modern. Mit Toilette, Air-Condition und Video. Nach etlichen Grenzüberquerungen (San Salvador, Honduras, Nicaragua) und noch mehr Filmen und etwa fünfmal demselben Essen (Bohnen, Reis, Huhn, gebrätelte Bananen) kamen wir nachmittags um vier Uhr in Managua an. In einem einfachen, aber zweckmässigen Hotel nahe der Busstation wohnten wir in Cabañas, die sich in einem weitläufigen parkähnlichen Garten befanden. Es gab dort eine Attraktion, die ich ganz besonders süss fand, nämlich einen kleinen Affen (zwei Monate alt und wie ein Baby), genannt Lorenzo. Beeindruckend, wie behänd sich diese Tiere bewegen können und faszinierend, wie frech sie sind.Auf meine Ohrringe hatte er es abgesehen, da musste ich unheimlich aufpassen, dass er sie nicht zu fassen kriegte, die hätte ich sonst zum letzten Mal gesehen. Seine Händchen waren samtweich und flink und es war ihm nicht zu trauen. Auf Theos Kopf sitzen und lausen, fand er auch ganz locker. - Am lustigsten war es, wenn er aus sicherer Entfernung die Frau, die das Restaurant (Essstand fast eher) führte und die ihn ständig von den Tischen scheuchen musste, ankeifte und man merkte, wie er zutiefst beleidigt war und ihr mit gefletschtem Gebiss jeden Schlämperlig nachrief. Und wehe, sie machte einen Schritt auf ihn zu, da gab's nur noch eines für den Feigling: die Flucht.Einer der Höhepunkte meiner Reise war der Besuch meines Patenkindes in Nicaragua. So besuchten wir das Projekt Xolotlan von „World Vision“ (www.worldvision.ch). Man zahlt als Gönner pro Monat einen gewissen Betrag für ein Kind, und mit diesem Geld wird dann die Familie unterstützt, dem Kind wird ermöglicht, eine Schule zu besuchen (die zwei Franken pro Monat, welche die Schule kostet, können nicht alle bezahlen) und ein Teil des Betrags kommt dem Dorf und dem Projekt als Ganzes zu Gute. Es hat mich interessiert, wie das dort so läuft, ob die Spenden dorthin kommen, wofür sie vorgesehen sind, ob die Organisation viel Geld schluckt etc, etc. Ich kann nur Gutes berichten. Es war ein tolles Erlebnis, das Kind und seine Eltern kennenzulernen. Wir reisten dafür nach San Francisco Libre, so heisst dieser Ort am Lago de Managua, ans Ende der Welt, wie es uns schien. Wir kamen nach einer zweieinhalbstündigen holprigen Fahrt mit dem Pickup an, mit welchem zwei junge Frauen von Vision Mundial uns im Hotel abgeholt hatten.Der Ort liegt am Lago de Managua, ein zwar schöner See, der aber so verschmutzt ist, dass er in keiner Weise genutzt werden kann, offenbar nicht einmal zur Schifffahrt. Die Familie wartete schon auf uns, die Mutter heisst Aura Americana, der Vater (er ist Bauer) Miguel Angelo, aber, als ich sagte, was für ein berühmter Name das sei, war ihm dies das Neueste.Das Kind heisst Maykelin, ist allerliebst, aber sehr schüchtern, was ich gut verstehen konnte. Die Kleine ist sechsjährig und geht in den Kindergarten. Die Familie ist so gut wie mittellos, sie wohnen von dort nochmals Dreiviertelstunden weiter in einem kleinen Dorf und langsam hatten wir ja eine Ahnung, wie solche Dörfer aussehen. Es ist die Gegend, wo vor drei Jahren Hurrikan Mitch alles verwüstet, Felder und Häuser wegrasiert und Tausende von Menschen getötet oder obdachlos gemacht hat. Wer überlebt hat, ist arm und das Leben ist hart.Man stellte uns die Organisation vor. Während fünf Tagen pro Woche arbeiten vierzehn Angestellte in einem einfachen Gebäude, das spartanisch eingerichtet ist. Obwohl es dort sehr heiss ist, haben sie nicht einmal klimatisierte Räume, die Küche ist dürftig eingerichtet wie überall und die Toilette ist lediglich eine Latrine. Es ist also nicht so, dass die dort „abrahmen" und mit den Spendegeldern luxuriöse Einrichtungen finanzieren. Im Gegenteil: Ich fand es gut zu sehen, dass die monatliche Einzahlung von 45.- Franken gut angelegt ist und ihren Zweck erfüllt.Das Projekt dauert voraussichtlich fünfzehn Jahre und hat zum Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“, das heisst, Kindergärtnerinnen und Lehrer werden ausgebildet, man lehrt die Leute unter anderem Hygiene, man unterrichtet sie in ihren eigenen Traditionen (Tänze, Feste feiern), damit sie diese aufrecht erhalten können und so ihre eigene Identität wieder finden; die medizinische Versorgung wird gewährleistet. Die Familie war schon dort, als wir ankamen, alle aufs Schönste gekleidet, sie hatten sich Mühe gegeben für diesen besonderen Tag. Nur wir hatten schmutzige Kleider an. Das passierte im Hotel, als wir in der Lobby warteten, bis man uns abholte. Das kleine Ungeheuer Lorenzo benutzte uns als Absprungrampen, um wie wild überall hinzuhechten. Offensichtlich musste er vorher in irgendwelcher feuchter Erde (das zumindest war unsere Hoffnung) herumgeturnt sein, und so geschah es, dass er nach einer Viertelstunde wieder sauber war, unsere Kleider hingegen leicht bräunlich. Zum Umziehen reicht die Zeit nicht mehr.Was die Familie von unserer Bekleidung hielt, kann ich nicht sagen, ich habe ihnen aber erklärt, weshalb wir so schmutzig waren.Die Geschenke und Kleider, die wir ihnen mitgebracht hatten, nahmen sie mit Freude entgegen, schade, hatten wir nicht noch viel mehr dabei. Wir assen zusammen zu Mittag und unterhielten uns. Es war ein eindrückliches, unvergessliches Erlebnis. Die Familie kam dann noch eine Strecke lang mit uns mit im Pick-Up und an irgendeinem gottverlassenen Ort trennten uns unsere Wege. Die 16-stündige Busfahrt von Antigua nach Managua hat sich gelohnt für dieses Erlebnis, ich würde die Reise wieder auf mich nehmen. Es ist speziell zu wissen, dass es an einem so abgeschiedenen, für uns bisher unbekannten Ort in der Welt eine Familie gibt, zu der wir nun eine Beziehung haben.Am nächsten Tag fuhren wir per Bus nach Granada, der ältesten Kolonialstadt in Mittelamerika. Sie ist hübsch gelegen am Lago de Nicaragua. Wir fanden eine angenehme Unterkunft und machten von da aus verschiedene Ausflüge. Unbedingt wollte ich nach Ometepe, der Insel im See. Dieser ist riesig; seine Fläche ist so gross wie ein Fünftel der Schweiz. Vor zig Jahren ist er vom Meer abgetrennt worden und ist jetzt ein Süsswassersee, auch genannt Mar Dulce. Es soll Haifische drin haben, die sich mit der Zeit an die Umstellung ans Süsswasser gewöhnt haben. Als ich in einem Reisebüro fragte, wie’s sei mit dem Baden dort, erklärte mir Christian, der Agent, er würde mir für diesen Zweck eher die Laguna de Apoyo empfehlen, denn er persönlich sehe sich lieber im Wasser, wenn er schwimme. Das war deutlich genug und er hatte Recht. Ob er uns einen Ausflug ans Meer empfehle, fragte ich ihn auch. Da stellte er mir eine Gegenfrage: „Te gusta beber?“, ob wir gerne trinken. Ja, schon, sagte ich, aber wo ist der Zusammenhang? Das sei alles, was man dort mache, meinte er. Diese Antwort war auch klar genug und wir beschlossen, an einem anderen Ort zu trinken.Ja, und dann gelang es uns auch, den windigsten Ort in Nicaragua zu finden (laut Reiseführer), obwohl wir so viel Wind eigentlich gar nicht finden wollten.Die Kellner nageln das Tischtuch kurzerhand am Tisch an, damit es nicht wegfliegt. Aber schön war es. Der See hat Wellen wie ein Meer. So viele sogar, dass es tönt wie ein Wasserfall. Und wenn man drin badet: Man sieht nicht einmal bis zum Ellenbogen. Wir leben trotzdem noch. - Mit dem Schiff dauert die Überfahrt von San Jorge zur Insel Ometepe eine Stunde. Die Insel ist wunderschön; sie besteht aus zwei Vulkanen, Conception und Madera, und sieht aus wie eine 8. Dort, wo der Gurt ist, war unser windiges Hotel. Die Strassen sind voller Löcher, es dauerte fast eine Stunde, um zwanzig Kilometer zurückzulegen. Aber eben, wir hatten ja Zeit. In der Laguna de Apoyo, einem sensationell schönen Kratersee, wieder auf dem Festland in der Nähe von Granada, badeten wir ein paar Tage später ebenfalls und tatsächlich: Bis zu den Zehenspitzen konnte man sich sehen. - Weniger gut sah man durch den Schwefelrauch des Vulkans Masaya. Mit dem Auto konnten wir bis zum Krater fahren, so hatte doch auch Theo noch sein Vulkanerlebnis, ohne eventuellen Muskelkater riskieren zu müssen.Die Heimreise nach Guatemala zog sich noch mehr in die Länge als der Hinweg, die Zollformalitäten nahmen fast kein Ende. Tikal Einen Tag ausruhen in Antigua und schon ging die Reise weiter, diesmal in entgegengesetzter Richtung, nämlich nach Norden: ein Flug nach Tikal. Der geschichtsträchtige Ort (16 km2 Fläche, davon erst etwa 15% ausgegraben - in der Blütezeit um 800 n.Ch. beherbergte die Stadt circa 90'000 Einwohner) besitzt eine besondere Magie, die verschiedenen Geräusche der Vögel, der Affen, vor allem das Gekreisch der Howler-Monkeys, die wie ungeölte Rasenmäher tönen, erzeugen eine einzigartige Atmosphäre. Die hohen Tempel aus der Mayazeit zu besteigen, machte Spass, war aber nicht immer ganz einfach, dafür aber ziemlich abenteuerlich. An zwei Tagen während je vier Stunden musste Theo mit mir den Park erforschen und auf den diversen Ruinen im Urwald herumklettern. Tempel IV war die grösste Herausforderung, Tempel V war zum Glück einen Monat zuvor geschlossen worden.Schliesslich sah ich ein, dass Theo endlich Ferien verdient hatte und so buchte ich unseren letzten Ausflug an den Atitlánsee. In Panajachel gibt es einen Naturpark und ich fand, den könnten wir eigentlich doch noch besuchen, bevor wir uns der Hängematte widmeten. Es gibt ein Mariposario dort, wie in Marin das „Papillorama“. Dorthin gingen wir zuerst, und als wir die zwei Schmetterlinge gesehen hatten (ja, ich weiss, es ist ein wenig untertrieben, aber wir waren halt zur falschen Jahreszeit dort), begannen wir den Natur-Pfad-Rundgang (Tiere, Pflanzen und zwei Wasserfälle). Nach 1,6 km Marsch (45 Minuten), je 75 Höhenmetern Auf- und Abstieg, der Besichtigung des Affen, der Aussicht auf die beiden Rinnsale, mindestens fünfzehn guten Ratschlägen von Theo, (wie es immer besser sei, einen Stock auf eine Wanderung (!) mitzunehmen – er hatte einen dabei - eine Hand solle ich mindestens immer frei lassen etc. etc.), kamen wir wieder im Besucherzentrum an. Der einzige gute Ratschlag wäre gewesen, Mückenschutzmittel einzureiben, daran hatten wir aber beide nicht gedacht. Die unzähligen Stiche (die Mücken bevorzugten natürlich mich) erinnerten mich noch an Weihnachten an unseren Spaziergang.Eine Nacht in der Casa del Mundo in Jaibalito und zwei Nächte bei Jin rundeten schliesslich unsere Erlebnisse in Guatemala ab. Zurück in Antigua – letzte Tage – Land und Leute Einen letzten Tag hatten wir noch in Antigua, den verbrachten wir verschieden, Theo und ich - er mit Ausruhen und ich hatte mir in den Kopf gesetzt, unbedingt nochmals den Volcan de Pacaya zu besteigen, nachdem das erste Mal ja „in die Hose gegangen“ war. - Es hatte mich ständig gewurmt, dass es damals nicht möglich gewesen war, zum Krater zu gelangen. Zweimal zuvor hatte ich im Sinn gehabt, nochmals dorthin zu gehen, einmal war das Wetter aber schlecht und beim zweiten Mal hörte ich meinen Wecker nicht. Somit war mein Vorhaben ins Wasser bzw. ins Bett gefallen. - Aber diesmal klappte es. Es hatte zwar Nebelschwaden und war recht kalt, aber der Krater war spektakulär. Der letzte Teil des Aufstiegs ebenfalls. Oft rutschte man zwei Schritte wieder hinunter, nachdem man sich gerade mühsam einen hinauf bewegt hatte. Zweieinhalb Stunden dauerte die Wanderung. Alle waren froh, die Krete erreicht zu haben. Ein einmaliger Ausblick war die Belohnung: links knallgelb die steile Kraterwand, rechts die pechschwarze Lava, im Hintergrund drei weitere Vulkane und die Stadt Guatemala eingebettet zwischendrin. Der Schwefelgestank war abscheulich, die Löcher im Boden, aus denen heisser Wasserdampf strömte, ein willkommenes Öfeli für die kalten Hände. Der Abstieg bzw. Abrutsch dann ein weiterer Höhepunkt. Dass der Berg nicht längst schon abgetragen ist von den vielen Touris, die dort hinunterschlittern, ist ein wahres Wunder.Das erste, was ich sah, als ich „zu Hause“ durch die Tür trat, war Theo schnarchend auf der Dachterrasse in der Sonne liegend. Noch ein paar Worte zu den Menschen, denen wir begegnet sind: Sie waren ohne Ausnahme freundlich und sehr hilfsbereit, sowohl in Guatemala als auch in Nicaragua. Sie helfen gerne, wenn’s drum geht, einen Weg zu erklären, auch wenn sie keine Ahnung haben, was genau man sucht. Im Managua sind die Strassen teilweise überhaupt nicht bezeichnet, so dass man also zur Antwort erhalten kann: „Das Haus, welches du suchst, ist einfach zu finden. Geh zwei Quadras geradeaus, zwei links und dort, wo früher mal der grüne Toyota stand, gehst du dann rechts.“Sogar der Bus-Kondukteur blieb nett, den ich „angehässelt“ hatte, weil er mein Köfferchen wegnehmen und nicht dort hinstellen wollte, wo ich es sehen konnte. Als ich ihn später fragte, ob er den Sänger kenne, der in eben jenem Moment aus dem Lautsprecher ein Lied sang, drückte er sich von zuvorderst nach zuhinterst durch die Fahrgäste hindurch und wieder nach vorne, um alle bekannten Passagiere zu fragen, ob jemand meine Frage beantworten könne. Gerne wollen die Leute wissen, woher man kommt. „Suiza“, sage ich dann und die Antwort ist immer die gleiche. Bei den Kindern: „Muy lejos, verdad? - Viniste en avion?“, bei den Erwachsenen: „Oh! - De Europa!“ Viele wissen natürlich nicht, wo Europa ist. Hauptsache, es ist nicht in Amerika, denn sie haben die „Gringos“ nicht sehr gern. Sie stehen auch offen dazu. Das manifestiert sich ebenfalls darin, dass jeder zweite Strassenhund „Gringo“ heisst. - Manchmal versuchte ich zu sagen, dass man Regierungen und Bewohner nicht in denselben Topf werfen sollte, dass viele junge Amerikaner (Europäer natürlich auch) Guatemala bereisten und nicht wenige von ihnen anschliessend für Wochen oder gar Monate freiwillige Arbeit leisteten. Es hat unzählige Hilfsorganisationen, bei denen man sich melden kann. Gesucht werden Volunteers, die in Spitälern arbeiten; es gibt Projekte, die versuchen, die Strassenkinder in Guatemala von den Schutthalden fernzuhalten, sie zu betreuen und zu sozialisieren, und und und. Diese Argumente nützen nicht viel. Dass die amerikanische Regierung sich ständig in fremde Angelegenheiten mische, das ist die vorherrschende Meinung.Die Adventszeit verbringen wir normalerweise anders. In diesem Jahr entfielen die Adventseinladungen, die Güezlibackerei, der Weihnachtseinkaufsrummel. Das alles habe ich nicht vermisst. Etwas davon spürten wir ja auch in jenem andern Teil der Welt, nur, dass ich mich dort nicht beteiligt fühlte.
Wie bei uns waren die Vorboten von Weihnachten auch hier schon im November vorhanden.
Allerdings kamen uns die vielen Plastik-Samichläuse und kitschigen Verzierungen im warmen Klima ein wenig komisch vor. All das ganze Glitzer- und Glimmerzeug, die Schneegirlanden, dann wieder Krippendarstellungen jeder Grösse überall auf den Dächern, in der Apotheke, in jeder Lobby, in jedem Laden, schienen fehl am Platz. In Granada hatte schon anfangs Dezember jeder Haushalt seinen geschmückten Tannenbaum im Wohnzimmer und den konnte man nicht übersehen, denn am Abend sassen die Bewohner in Schaukelstühlen vor ihren offenen Wohnzimmern auf dem Trottoir und genossen den Feierabend. Passanten und Autos taten der Freude keinen Abbruch, die Abgase offenbar auch nicht - sehen und gesehen werden. - Speziell, das Ganze!
Gestohlen wurde mir beziehungsweise uns nie etwas. Man muss einfach aufpassen, das ist klar, es kann einem auch in Bern passieren, dass man beraubt wird. Sicher, man kann Pech haben, aber manche Touristen, denke ich, sind vielleicht allzu unachtsam. Am Strand einschlafen und sich dann wundern, dass man nur noch den Badeanzug hat...
Ein Franzose, mit dem Beatrice ein paar Tage unterwegs war, wurde im Chickenbus gleich dreimal ausgeraubt. Ein älteres Ehepaar, das wir in Tikal begegneten, erzählte uns, ihnen sei am hellen Tag die Uhr vom Handgelenk gestohlen worden und zwar mittels eines Sprays, der sie einen Moment lang ein wenig dizzy gemacht hatte. Aber das war bis dahin die einzige schlechte Erfahrung auf ihrer monatelangen Fahrt. Gemessen an der Tatsache, dass die beiden (er ist 78 Jahre alt!) im eigenen Auto vom Maine, USA, bis nach Feuerland, der südlichsten Spitze von Chile, unterwegs waren, ist dieser Vorfall ein Detail. Ihr Motto:
„Wir müssen jetzt reisen, wo wir noch können“.
Eines meiner liebsten Fotosujets waren die Autos, die man in Guatemala herumfahren sieht. Beim ersten Wrack, das ich an einem Strassenrand parkiert gesehen hatte, dachte ich, ich könne es dann am nächsten Tag fotografieren, denn dass dieser Wagen nicht mehr fahrtüchtig war, davon war ich überzeugt. Weit gefehlt, der Fahrer stieg ein und fuhr weg. Ich gewöhnte mich allmählich daran, dass einem auch unterwegs manchmal fast nur Gestelle mit Fahrern drin entgegenkommen. Wenn ich an unsere Motorfahzeugkontrolle in der Schweiz denke, muss ich lachen. Offene Eingeweide, Kabel, die heraushängen, fehlende Hauben und Schutzbleche, Pneus so smooth wie Cervelats, herausgeschlagene Lampen und Blinker – alles an der Tagesordnung. Selbst die Polizei fährt in einem Auto herum, dessen Karosserie mal ziemlich anders ausgesehen haben muss. Solange ein Motor noch läuft, ist alles OK. Der schönste Minibus, in dem ich fuhr, datierte vom Jahr 2003, ganz neu also. Der Fahrer pflegte ihn sehr, putzte ihn auch und er hatte sogar liebevoll Stoffüberzüge auf die Sitze gelegt, aber in der Frontscheibe hatte es bereits zwei lange Spalten, der Blinker funktionierte nicht mehr und wo der Radio ursprünglich gewesen war, klaffte ein dunkles Loch, aus dem nur noch die Drähte heraushingen. Er war gestohlen worden. Kay hat mal ein Mail erhalten von einem Freund, in welchem er ihr Fotos geschickt hat aus Afrika, zum Teil ebenfalls von Autowracks. Die Aufnahmen waren zum Schreien komisch, aber das Lustigste an dieser Mail war der Kommentar des Absenders. Er schrieb nämlich: „Läck mir, si das geili Sieche!“ – So ähnlich könnte ich mir eine Randbemerkung zu meiner Guatemala-Autowrack-Picturegallery vorstellen.Keine einzige schlechte Erfahrung, nur tag- täglich neue und unvergessliche Erlebnisse sowie interessante neue Bekanntschaften – das ist das Fazit meiner Reise nach Guatemala.
In einem Ferienprospekt hiess es: „When did you last do something for the first time?“ Diese Frage kann ich hier ganz rasch beantworten: „Every day - many times.“

Reisebericht Herbst 2009 New York – Mexiko
Vor der Reise
Inzwischen war auch Theo auf den Geschmack gekommen und anders als bei meiner letzten grossen Urlaubsreise nach Mittelamerika, wo er mich ja nur während drei Wochen besucht hatte, wollte er diesmal von Anfang bis Ende mitkommen. Schliesslich war er ja auch schon seit neun Jahren pensioniert, hatte also Zeit genug, mich zu begleiten.
Inzwischen hatte mir ein Kollege von einem Internetportal erzählt, wo man in den Ferien Häuser tauschen könne. Die Idee fand ich genial und meldete mich sogleich bei „Homelink“ an. Das war im Jahr 2007 (Später meldete ich mich noch bei einer anderen Webseite an: HomeExchange).
Wir tauschten eines unserer Biviohäuser gegen eine Wohnung oder ein Haus irgendwo, wo es uns gefiel, ein paar Tage zu verbringen. So waren wir vorher bereits in London gewesen, in Amsterdam, Rom, Bibione, Paris und in den USA, an der Ost- wie auch an der Westküste.
Beim Planen dieses, meines nächsten Urlaubs, hatte ich drei verschiedene Tausche in Mexiko vereinbaren können, den ersten in Cuernavaca, den zweiten an der Pazifikküste in Guayabitos und den letzten in Puerto Vallarta. Auf der Hinreise stand ein Besuch in New York auf dem Programm, wo Dany, Kays Götti, für zwei Jahre bei der Uno arbeitete.
Angefangen hatte unsere Reise schon gut: Am Abend vorher ass ich ein Amaretti und dachte, komisch, da ist etwas Hartes drin. - Ein halber Zahn war’s, und nicht ein kleines Stück. - Neun Uhr abends und meine Koffer noch nicht fertig gepackt. – Raphael, Kays glücklichste Auswahl an Freunden, war meine Rettung. Er lachte zwar, als er von meinem Missgeschick hörte, war aber bereit, sich am nächsten Morgen um halb acht der Sache anzunehmen. So stand ich in aller Frühe auf, packte meinen Koffer fertig und musste in der Eile ohne Handschuhe die völlig vereisten Scheiben an meinem Auto notdürftig freikratzen, um rechtzeitig in der Zahnarztpraxis zu sein. Raphael machte seinen Job vorzüglich: Um acht Uhr war ich wieder unterwegs nach Hause mit einer provisorischen Füllung und einem halbtauben rechten Unterkiefer.
Das nächste Unglück erfolgte auf dem Fuss: Als ich meinen Koffer auf die Waage stellte, riss er dort, wo der Henkel ist. Hier war‘s Theo, der Abhilfe schuf mit einem Befestigungsseil vom Auto. – Ja, und dann erwischten wir das 9-Uhr-Bähnli in Ittigen und alles war im Butter. (Ursprünglich hatte Anja, meine Patentochter, die auf dem Flughafen Belp arbeitete und jeweils meine Flüge buchte, unsere Abreise um 11 Uhr geplant. – Aus irgendeiner weisen Voraussicht heraus hatte ich den Flug auf 13 Uhr verschoben...). Zweite Klammer: (Eigentlich ist der Grund ja klar: Theo steht nicht gern früh auf und wenn’s vermeidbar war/ist, wollte ich ihm diese Ungemach ersparen).
New York
In New York ging alles reibungslos, wir waren ja bereits um halb fünf dort, nahmen den Shuttle nach Manhattan und fanden Danys Apartment im 39sten Stock des Atelier Buildings im äussersten Westen der 42nd Street. Dany war noch bei der Arbeit, aber wir erhielten an der Rezeption den Schlüssel und staunten nicht schlecht, als wir in der Wohnung ankamen: eine atemberaubende Aussicht auf den Hudson River und die Skyline. Grade unter uns das Museumsschiff „Intrepit“, das Theo jedes Mal, wenn wir dort sind, wieder ansehen geht. Diesmal auch, aber sicher ohne mich.
Ja, und dann hatten wir sechs Tage Zeit, die Stadt einmal mehr zu besichtigen. Wir entdeckten viel Neues, aber es ist auch immer wieder schön, an Orte zurückzukehren, wo es einem gefallen hat. Zum Beispiel ins Guggenheim Museum, wo in dem Moment eine wunderschöne Ausstellung von Kandinsky stattfand. Und dort sagte plötzlich jemand hinter mir: „Tschou, Isabelle“. Was für eine Überraschung! - Das waren Peggy und Urs Hügli, gemeinsame Freunde von uns.
Am Samstagabend lud Dany uns alle zu sich ins Apartment ein zum Apéro und zwecks Betrachtung der Aussicht. Und gerade dann begann es wie aus Kübeln zu regnen, mein Schirm schrottreif, die Schuhe triefend nass. Und im BBQ, wo wir uns entschieden hatten hinzugehen, konnten wir nur noch in einer Ecke gedrängt stehend essen, hintereinander wie die Hühner im Stall, aber gerade das sind ja schliesslich die Erlebnisse, die man nicht so rasch vergisst.
Die Stadt ist immer wieder eine Reise wert, es gibt unendlich viel zu sehen und zu erleben. Jedoch wundere ich mich immer mehr, wie solche riesigen Zentren organisiert werden können. Wenn man schon nur an den Abfall denkt, der jeden Tag produziert wird und die riesigen Mengen an Waren, die hin-und hertransportiert werden, die unendlichen Verkehrsstaus (an manchen Kreuzungen reicht die Rotlichtanlage nicht mehr, zwei bis drei Polizisten regeln den Verkehr zusätzlich), an die Menschenmengen in den Subways und sonst überall – ja dann denkt man fast schon wieder wehmütig zurück an Bern. In Mexico City mit seinen mehr als 20 Millionen Einwohnern ist das Ganze noch absurder.
Dorthin flogen wir am nächsten Morgen bei schönstem Wetter.
Unerlässlich nach unserem kurzen Amerika-Aufenthalt: Wir mussten einen zusätzlichen Koffer kaufen, aber den konnten wir dann zum Glück in Mexico City lassen, denn die warmen Klamotten und die schweren Bücher, die Theo unbedingt hatte kaufen müssen, brauchten wir ja nicht durchs ganze Land zu schleppen.
Mexico City (2’240 m ü. M)
Mit der Homelink-Bekanntschaft, das heisst mit der Familie, mit der wir den Haustausch (Cuernavaca-Bivio) organisiert hatten, hatten wir unglaubliches Glück. Solche Gastfreundschaft trifft man nicht alle Tage.
Da wir erst gegen Mitternacht in Mexico City ankamen, war ursprünglich geplant, am Flughafen ein Hotel zu buchen, aber Patty offerierte uns, bei ihren Eltern zu übernachten. Diese wohnen in einem grossen Haus in einer vornehmen Gegend mitten in der Stadt. – Wir blieben drei Tage dort, erhielten alle erdenklichen Informationen, man verwöhnte uns mit feinen Nachtessen und wir kamen uns vor wie die Könige. So riesig diese Stadt auch ist, das Zentrum ist überblickbar. Dieses und die nächste Umgebung erkundeten wir während einer vierstündige Stadtrundfahrt im Turibus (uh, schon nur dieser Name...). So erhielten wir zumindest mal einen Eindruck eines (kleinen) Teils dieser interessanten, pulsierenden Metropole. Um neun Uhr hätte der Bus abfahren sollen, aber das nimmt man dort nicht so genau. Mit 45 Minuten Verspätung kam er dann. (Zwei Fotos zeigen mich auf den Bus wartend. Es sieht aus, als wäre inzwischen hinter mir ein ganzer Wald gewachsen. In Wahrheit kam ein Gartenarbeiter und stellte dort, wo ich sass, Grünzeug hin zur Dekoration für ein Event, das am Abend stattfinden sollte). Sich durch den Verkehr zu schlängeln dauerte ebenfalls seine Zeit; zwei religiöse Umzüge und politische Demonstrationen machten die Arbeit des Buschauffeurs nicht einfacher.
Im Museo National de Antropología verbrachten wir einen ganzen Tag. Es ist äusserst eindrücklich und wunderbar gestaltet. – So schade, was die Spanier alles zerstört haben, um dann auf den Trümmern ihre Kirchen aufzubauen. Es macht einen noch jetzt sauer! - Toll war der Blick über die riesige Stadt vom 37sten Stock des Torre Latinoamericana aus. Bei klarem Wetter, was offenbar wegen all den Abgasen (ca. 12‘000 Tonnen täglich) äusserst selten ist, konnten wir sogar den Popocatépetl (5452m) sehen.
Lunch hatten wir in einem tollen, völlig versteckten Restaurant, das uns Patty empfohlen hatte. Wir assen wir die Fürsten, wurden von drei Kellnern bedient, Touris hatte es keine anderen und bezahlt haben wir für die feine Mahlzeit fast nichts.
Am nächsten Morgen nach dem Ausschlafen hiess es wieder die Koffer packen. Wie schon erwähnt, konnten wir den einen dort lassen, so dass ja jetzt schon klar war, dass wir auch vor unserer Heimreise wieder bei Shapiros übernachten durften. „Mi casa es su casa“ ist der Leitsatz.
Von Mexico City über Xochimilco nach Cuernavaca
Patty’s Vater, Sergio, organisierte uns ein Taxi nach Cuernavaca, unserem eigentlichen Ziel. Unterwegs machten wir Halt in Xochimilco, den „Schwimmenden Gärten“. Flachkielige, blumengeschmückte Barken, alle mit einem Frauennamen versehen, gondeln dort Passagiere in den Kanälen herum. Es herrscht eine äusserst fröhliche Stimmung. Alle wollen etwas verkaufen, und alle sind auf Booten unterwegs: Mariachi-Sänger preisen ihre Lieder an (25 Pesos pro Melodie), ganze Kapellen ebenfalls, eine lauter als die andere. Tacos- und Getränke-Verkäufer versuchen, ihre Produkte an den Mann oder an die Frau zu bringen, Spielzeug- und Bäbiäden sind unterwegs, ganze Mahlzeiten oder auch nur geröstete Maiskolben kann man kaufen, Blumen, Teppiche, und und und… Was man sagen muss, trotz all dem Kommerz sind die Verkäufer überhaupt nicht aufdringlich; sagt man entschieden NEIN, zeihen sie sich zurück, oder besser gesagt, sie paddeln zurück.
Maiskolben wollten wir haben, die sahen vorzüglich aus, aber wieso der Verkäufer sie erst noch mit beiden Händen tüchtig abreiben musste, bevor er sie mit Zitrone und Salz bestrich, war mir ein Rätsel und eigentlich wäre ich sehr froh gewesen, er hätte es nicht gemacht. Bisher hatten unsere Mägen zwar noch nicht protestiert, aber ich fand, man müsse es ja nicht gerade herausfordern.
Die Boote werden wie in Cambridge von einem Paddler geführt, der mit einem langen Stock das Gefährt in die richtige Richtung steuert. - Wenn’s gelingt. Unser Bootführer war schon pensioniert (wie Theo) und er hatte die Sache nicht mehr so ganz im Griff. Immer wieder putschte er in andere Schiffe oder geriet zu nahe ans Ufer oder gar in Kanaleinfahrten, die er eigentlich hätte vermeiden wollen. Wenn das geschah, sagte er jeweils „iiii iiii“, aber niemand kümmerte sich darum, ich glaube, alle kannten ihn und seine Manövrierweise. Beim ersten Mal wollte Theo hilfsbereit aushelfen, aber der Alte deutete ihm, das sein zu lassen („iii!“). Das war sicher besser. Zwei Pensionierte am Paddel… – Ich weiss nicht, wie das herausgekommen wäre. Und das Wasser sah nicht ausgesprochen sauber aus. – Uns gefiel die Bootsfahrt jedenfalls. Allerdings konnten wir uns kaum vorstellen, wie das sein musste an den Wochenenden, wenn ganze Familien ihr Picknick mitnehmen und sich auf den Booten vergnügen, wie das offenbar der Brauch ist.
Cuernavaca
Unser Taxifahrer hatte über eine Stunde gewartet und auf unser Gepäck aufgepasst. Dann ging‘s weiter nach Cuernavaca. Das Ferienhaus von Pattys Familie ist ein Hit: Ein grosser Garten mit wunderbaren exotischen Pflanzen, etlichen verschiedene Sitzplätze, zwei grosse Terrassen, Swimmingpool und Jacuzzi, vier Schlafzimmer, aus denen wir aussuchen konnten, welches uns am besten gefiel (Pattys Mutter Susi allerdings bestand darauf, dass wir in ihrem schliefen, weil es mit zugehörigem Wohnzimmer das schönste sei). Es war wirklich alles wunderbar. Ein Caretaker-Ehepaar schaute zu Haus und Garten und auch zu den drei Hunden (Retriever), einem älteren, genannt „Horus“ und zwei jungen, „ Athos“ und „Aramis“, die bei der Begrüssung vor lauter Übermut und Freude an unseren neuen Koffer pinkelten.
Man zeigte uns alles, und wir wurden schon wieder mit einem feinen mexikanischen Nachtessen beglückt. Es hätte uns nicht besser gehen können!
Vorher gingen wir noch im nahe gelegenen Supermarkt einkaufen. Der Kofferraum des Taxis war prall gefüllt; Augustino, der Caretaker, staunte nicht schlecht, als er sah, was da nicht alles an Lebens- und Genussmitteln in die Küche gebracht wurde.
Am nächsten Tag fanden wir einen Bus, der uns ins Stadtzentrum führte und dort meldeten wir uns als Erstes in einer Sprachschule an für zwei Wochen zum Spanischlernen. Theo auch!
Vorerst jedoch geschah Theos grosses Erlebnis: Er ass Höigümper. Ui ui ui! Wir sassen in einem lustigen kleinen Restaurant am einzigen Tisch auf dem Balkon und da kam eine dicke Mexikanerin mit einem Kessel voller grillierter Grillen, wollte ich grad schreiben, aber es waren, glaube ich, Heuschrecken. Auf Spanisch „Chapulines“. Da musste ich Theo schon bewundern, dass er ohne mit der Wimper zu zucken, eine Handvoll von diesen Viechern ass und sich dann sogar noch eine zweite Handvoll aufschwatzen liess. Und das ohne noch ein Getränk zu haben. Ich winkte energisch ab, aber Theo sagte, es sei eigentlich ganz gut. – Er sagt es mindestens viermal…
(Nebenbei bemerkt: Frei nach Wikipedia, wo’s auch einschlägige Bilder dazu gibt:
Chapulines (amerikanisches Spanisch, aus Nahuatl chapolin entlehnt) sind Heuschrecken der Gattungen Sphenarium, Schistocerca, Taeniopoda, Trimerotropis, Spharagemon und Melanoplus. Sie werden im Mexiko, vor allem im Bundesstaat Oaxaca als Lebensmittel verwendet; geröstet werden sie dort von Frühjahr bis Herbst als Imbiss auf den Märkten angeboten. Zur Zubereitung werden Chapulines üblicherweise erst blanchiert, dann frittiert oder in einer Comal genannten, flachen Pfanne geröstet und mit Salz und Limetten- oder Zitronensaft gewürzt, teils auch mit Chili, Knoblauch. Die Beine und Fühler werden vor der Zubereitung oder vor dem Verzehr entfernt.
Der letzte Satz dieser Beschreibung stimmte übrigens in unserem Fall nicht. Da stachen etliche Tentakel in die Luft).
Später hatten wir Chapulines an vielen anderen Orten ebenfalls gesehen (aber nicht mehr gegessen; eigentlich seltsam, da Theo ja so sehr betont hatte, wie gut sie ihn dünkten).
In diesem Restaurant übrigens wurden wir aufs Netteste bedient vom beleibten und redseligen Chef. Das Mittagsmenu bestand aus zwei Vorspeisen, einem Hauptgang (gar nicht mal so schlecht), Dessert und Kaffee und kostete 40 Pesos, also gerade mal 3.20 Fr. Bald war klar: Das Geld wurde man fast nicht los. - Ok, ok, die zweite Vorspeise bestand aus einem Teller Reis und Theos Kaffee war eine Riesenglungge. Aber schön serviert in farbigem Geschirr aus einheimischer Produktion. Auf dem Tischtuch hatte es ein paar Flecken, aber für den Preis… Und Theo erhielt zwei Bier zum Preis von einem.
„Zu Hause“ kochten wir dann selber und ich lernte, dass und wie man den Salat erst desinfizieren muss, bevor man ihn geniesst. Wasser ist ein Problem, vor allem sauberes. Augustin hatte auch tags zuvor schon alles Gemüse gründlich mit Desinfizierungsmittel geschruppt, bevor er es im Kühlschrank versorgte. Dieser Umstand machte mir nicht eitel Freude, ich gewöhnte mich jedoch allmählich daran, das ebenfalls zu tun.
Der Samstag war ein Tag zum Ausruhen, Sonnenbaden, Lesen, Fotos sortieren, Emails Scheiben. Am Sonntag dann gingen wir mit Augustin nach Tepoztlán, einem Ort in der Nähe von Cuernavaca. Dort ist ein bekannter Markt und irgendwo in den Hügeln eine Maya-Ruine. Die älteren Einwohner sprechen noch Nahuatl, die Sprache der Azteken vor dem Einfall der Spanier. Wie auch in Cuernavaca geschieht an diesem Wochenende alles unter dem Zeichen der Tage der Toten. Ziemlich fremd, das Ganze. Schädel und Skelette aus Zucker, Plastik, Holz, Ton, was auch immer.
Eine Ausstellung mit x verschiedenen Catrinas (das Skelett einer Frau, dargestellt mit verschiedenen Kleidern und Hüten - Symbol für die Toten, die an diesen Tagen zurückkehren und ihre Angehörigen besuchen) aus allen erdenklichen Materialien wie Mais, Blechbüchsen, Blättern usw. besuchten wir am Montag, ebenso einen Friedhof. Dort war unendlich viel los. Blumen wurden gebracht, Mariachi-Sänger waren am Werk, ganze Bands gingen von Grab zu Grab beziehungsweise von Familie zu Familie und alle sangen die Lieder mit.
Unbedingt musste Theo eine Catrina aus Ton kaufen. Manchmal komme ich einfach nicht gegen ihn an. – Was ihm daran so gefiel, war, dass sie eine Zigarette in ihrer Knochen-Hand hält und ihr Décoltée nur noch ein Skelett ist. Wunderschön – zugegeben!
Sein grösstes Problem war dann allerdings: „Wie verpacke ich die zierliche Dame, damit sie die Reise übersteht?“ – Eine Flasche Tequila half: Die runde Verpackung aus Karton war wie gemacht für Theos Catrina (ich hör schon die Kinder stöhnen, wenn wir solches Zeugs mit heimbringen).
Der Montag war auch unser erster Schultag. Wieder mal auf der andern Seite im Schulzimmer zu sein, fand ich gar nicht schlecht. Theos Klasse bestand aus ihm, einer Mitschülerin und der Lehrerin; wir waren zu viert, alles ganz lernbegierige Schülerinnen und Schüler. Theo fand den Unterricht recht anstrengend. Aber er hielt sich gut, macht seine Aufgaben zu Hause, nur manchmal musste er sie auf den Morgen verschieben, weil er tags zuvor keine Zeit gehabt hatte, weil er so viel hatte nachschlafen müssen.
Theo war übrigens ebenfalls ein sehr eifriger Schüler, was das Spanischlernen anging. Immer wieder erfragt er ein Wort. Aber mit dem Hören klappte es dann manchmal nicht so ganz. – Was heisst „empezar?“, fragt er. „Aafa“, sage ich. Damit kann er nichts anfangen. Ich muss ihm’s jetzt auf Deutsch sagen, damit er’s besser versteht. „Beginnen“ – zum Glück hört uns niemand. La banqueta = der Bürgersteig (z‘ Trottoir hätte ich lieber gesagt).
Und noch ein Schwank aus der Schule, der mit exaktem Hören zusammenhängt: Von eins bis zwei am Nachmittag fand jeweils eine Spezialklasse statt, die man besuchen konnte oder nicht. Theo berichtete mir, es sei ganz lustig, dass alle drei Männer in der Klasse Miguel hiessen (er sprach den Namen mit dem „U“ aus). Seltsam, sagte ich, aber sicher betonen sie doch alle das „U“ nicht. - Es war in Tat und Wahrheit so, dass keiner Miguel hiess, mit oder ohne „U“, der eine hiess Mike, der andere Ryan und der Lehrer Daniel (später hatte ich herausgefunden, dass auch das nicht ganz stimmte und Ryan in Wahrheit Bryan hiess). – Theo wie er leibt und lebt! - Was da für ein Gestürm entstanden sein musste bei der Vorstellung, konnte ich mir kaum vorstellen. Aber das mit dem „U“ schon, schliesslich nennt er auch mich nach 40 Jahren immer noch „Isabeu“.
Unser Schultag sah so aus: Am Morgen um halb neun holte uns ein Taxi ab und nach etwa 20-minütiger Fahrt kamen wir in der Schule an, auf der anderen Seite der Stadt. Waren wir fünf bis zehn Minuten zu früh, reichte es noch, sich einen Moment auf einen Liegestuhl im Garten hinzulegen. Bis um zwei Uhr dauerte der Unterricht jeweils mit zweimal zehn Minuten Pause zwischendurch. Nachher war meistens genügend Zeit, in der Umgebung oder im Stadtzentrum etwa einkaufen oder ein Museum zu besuchen, bevor wir heimfuhren (unbändige Begrüssung der drei Retriever), uns am Pool ausruhten und/oder Aufgaben machten. Das war jeweils eine ziemlich zeitaufwändige Angelegenheit, denn ich musste jeden Tag ein mindestens zehn-minütiges Vorträgli halten und dafür war es unerlässlich, erst einen passenden Artikel in einer Zeitung oder im Internet zu suchen und den dann vorzubereiten (meinen Schülern mutete ich das nur einmal pro Semester zu). - Ja und dann gingen wir irgendwo in der Stadt essen (wieder mit dem Taxi hin und her; eine Fahrt kostete 2-3 Fr. - Da wäre man ja blöd, wenn man ein Auto mieten würde bei diesen Preisen und in diesem stressigen Verkehr).
Es gab Tage, da war ich alleine mit der Lehrerin – eine ziemliche Herausforderung. Wie die Schule so überleben konnte, war mir ein Rätsel. Es hatte kaum mehr Schüler, auch fast keine Touristen. Dies ist nur eines der zahllosen Probleme in diesem Land, wie wir inzwischen erfahren hatten. Es gibt fast nur Missstände und keine Lösungen. Arbeitslosigkeit ist eines der grössten Probleme. Einige sagen, etwa 40 % seien arbeitslos, was natürlich nicht den offiziellen Zahlen entspricht. Ein Teufelskreis ist die Folge. Wer kein Geld hat und seine Familie ernähren muss, stiehlt und landet früher oder später im Drogengeschäft. Erst von da an geht es vordergründig besser, aber es ist ein Weg ohne Rückkehr. Die grausamen Nachrichten, vor allem aus dem Norden (Entführungen, Hinrichtungen, Vergewaltigungen und andere Gräueltaten), füllen die Zeitungen. Der Staat ist machtlos. Weil er dermassen korrupt und in alles verwickelt ist, will er auch gar nichts ändern am Sysrtem, so dass, wer an der Macht ist, auch kontrolliert, was mit dem Drogenhandel und der Mafia passiert. Die Zeugenschutzprogramme sind das Schlimmste, dadurch wir alles verdeckt und niemand, der Geld hat, hat je das Pech, hinter Gitter zu kommen oder wenn doch, dann nur für kurze Zeit. Die Korruption treibt die seltsamsten Blüten ebenso wie die Bürokratie. Es muss unheimlich mühsam sein, wenn man hier in die Räder der Justiz gerät oder auch nur eine Bewilligung beispielsweise fürs Eröffnen eines Marktstandes haben möchte. Unsere Lehrer erzählen uns tagtäglich von solchen Dingen, die Haare könnten einem zu Berge stehen. Schon in unserem Reiseführer hiess es, man solle immer genügend Bargeld bei sich haben, damit man, falls man es mit der Polizei zu tun bekomme, die Angelegenheit mit Scheinen aus der Welt schaffen könne, denn Recht erhalte man so oder so nicht. Mit wem man auch sprach, alle bestätigten diese Einschätzung. Soziale Ungleichheit, Schwierigkeiten mit den Ureinwohnern, eine unglaublich hohe Armutsrate von über 50 Prozent, dies sind weitere Krisenherde. Dabei gibt’s so viele reiche Leute hier; der reichste im Land ist Carlos Slim, ihm gehört fast alles, sagt man. – Dazu kommen die Probleme in der Hauptstadt, wo täglich 1‘500-2‘000 Neuzuzüger registriert werden; die Slums ziehen sich Kilometer über Kilometer gegen Norden hin. Die entsetzliche Luftverschmutzung kommt zum Elend noch dazu. Welche Attraktion denn übt die Stadt auf die Landbewohner aus? Keine; im Gegenteil. Sie haben aber keine Wahl. Auf dem Land können sie nicht bleiben, denn sie haben ihr Land „verkauft“. Das heisst, verkaufen wollten sie eigentlich nicht, aber man hat es ihnen „abgekauft“ („Wenn du nicht kaufen willst, dann wird vielleicht deine Witwe einsichtiger sein…“).
Vieles von all dem hörten wir auf dem Weg nach Teotihuacán von Charlie, dem Direktor unserer Schule, einem Amerikaner, der seit 36 Jahren in Cuernavaca lebt. Er ist ein begnadeter Erzähler, der unglaublich viel weiss über Land und Leute, Geschichte, Ökonomie, Traditionen, Kultur, Architektur, Archäologie (diese hat er studiert) und natürlich Politik. Die Details, die er kennt, sind unglaublich, ich hätte ihm stundenlang zuhören können. Er hat auch die Gabe, die Dinge sehr bildhaft darzustellen. Schön, mit ihm die prachtvolle Stadt Teotihuacán zu besuchen. Aber auch die Reise dorthin war mehr als nur interessant. Wir legten mehrere Zwischenhalte ein und er zeigte uns unterwegs Dinge, die wir nie selber bemerkt hätten. Zum Beispiel: In einem Dorf in der Nähe von Cuernavaca ist es verboten, Boden zu erwerben. Die staatliche Ölgesellschaft setzte sich darüber hinweg und begann, dort eine Tankstelle zu bauen. – Wir fuhren daran vorbei: Sie war nicht zugänglich; die Dorfbewohner hatten Wälle aus Erde darum herum erstellt, so dass kein Auto dort hineingelangen kann.
Wir wissen jetzt auch, wieso es in Tres Marias, dem Dorf auf der Passhöhe des Passes, den man überqueren muss, wenn man nach Mexiko City gelangen will, auf der einen Strassenseite Restaurants und ein Geschäft nach dem andern gibt, in dem raue Mengen an Wasserspielsachen (Luftmatratzen, Wasserbälle etc.) angeboten werden, auf der anderen Seite jedoch nicht. Der Ort liegt nota bene auf 3‘100 Metern Höhe und es ist kalt. – Des Rätsels Lösung: Die Einwohner haben gemerkt, dass es sich lohnt, diese Dinge günstig anzubieten, denn an den Wochenenden fahren Städter ans Meer und kaufen dann lieber ihre Wasserutensilien unterwegs, wo sie billiger sind als in den Badeorten. Zudem wird ein besonderes Frühstück angeboten, und es ist zum Brauch geworden, im Dorf anzuhalten, sich zu verpflegen und einzukaufen. Bei der Rückreise braucht‘s kein Wasserspielzeug mehr, da geht’s ja wieder zurück in die Stadt. Cool, nicht wahr?! („Cool“ heisst hier auf Spanisch übrigens: „Que padre!“ - Auch cool, nicht wahr!)
Auch eine Pyramide im Süden der Stadt besuchten wir, Cuicuilco, die Geschichte drum herum bis zum heutigen Zeitpunkt wurde uns eindrücklich geschildert, der Einfluss der Vulkane und der Glaube an die Götter, die in diesen Bergen wohnten, wie auch die Geschichte der umliegenden Hochhäuser. Wieso bei der Ausgrabungsstädte ein grosses Schild hängt, auf dem eine Unzahl von Dingen aufgelistet ist, die man nicht tun oder mitbringen darf (keine Musikinstrumente {der Ort heisst übersetzt: Ort des Gesangs und der Gebete}, kein Essen, keinen Rucksack etc. etc. etc.) und wieso es dann doch niemanden interessiert, dass wir Rucksäcke bei uns haben, das hat Charlie in seiner sarkastischen Art höchst humorvoll geschildert: Die katholische Kirche hat Angst vor den weiss bekleideten New Age Angehörigen, die den gefährlichen Glauben haben, dass auch andere Religionen ihre Existenzberechtigung haben. An diesen Orten wollen sie Energie tanken, das aber soll verhindert werden. Man will sie nicht nennen, um gar nicht auf das „Problem“ aufmerksam zu machen, so ist es eben einfacher, all das, was sie mitbringen, zu verbieten und uns, die wir eben keine weissen Kleider trugen und eindeutig Ausländer waren, ohne weiteres einzulassen.
Was in den Wäldern um die Stadt herum passiert, ist weniger lustig. Noch und noch werden Bäume gefällt (strengstens verboten), nachts, man vermutet, von der Regierung unterstützt, (es sollen bestens ausgerüstet Trupps sein mit Leibwächtern und elektronischen Sägen), und wer sich getraut, eine Anzeige zu machen, dem tut das sehr bald sehr leid. Statt 20 Pesos Verdienst pro Stunde erhält der Holzfäller 1000 Pesos - ja und wer macht da nicht gerne mit bei diesem lukrativen Geschäft?! - So geschieht, was kommen muss: Der Wasserhaushalt fällt völlig ins Ungleichgewicht, es gibt Überschwemmungen, aber Hauptsache, einige verdienen sich dumm und dämlich.
Mit dem Bus fuhren wir weiter Richtung Norden, mitten durch die Stadt, und dann im Norden durch die endlosen, trostlosen Slumsiedlungen. Ganz plötzlich war diese Besiedlungsart zu Ende, es folgte eine neue: Lauter farbige Reiheneinfamilienhäuser, die auf den ersten Blick ganz hübsch aussahen. Charlie sagte: „Wenn du dein Auto vors Haus stellen willst, reicht das Heck bis in die Hälfte des Grundstücks vors Haus deines Nachbarn zur Linken, die Front in das deines Nachbarn zur Rechten.“
Teotihuacán und andere Ausflüge
Ja, und dann endlich Teotihuácan. Die antike Stadt mit ihren riesigen Pyramiden „Sonne“ und „Mond“ und der etliche Kilometer langen schnurgeraden Strasse der Toten sind mehr als nur eindrücklich, aber Details kann man im Reiseführer nachlesen. Überall hatte es Verkäufer. Sie taten mir leid, sie verkauften nicht viel, es gab auch nur wenig, was uns hätte gefallen können (keine Skelettdamen für Theo).
So war auch dies wieder ein reicher und unvergesslicher Tag. Dreizehn Stunden waren wir unterwegs gewesen, Theo und ich und andere acht Estudiantes aus unserer Schule. Wir waren übrigens nicht die einzigen älteren Semester, und das war ganz angenehm so.
Am Freitag nach der Schule unternahmen wir einen Ausflug nach Xochicalco, einer Kolonie von Teotihuácan, südlich von Mexico City, allerdings ganz anders aufgebaut: eine Stadt ohne Strassen nämlich, auf einem Hügel gelegen und mit verschiedenen Plattformen, über die man nach oben gelangen konnte. Früher allerdings kam‘s auf den sozialen Status drauf an, wie weit nach oben man sich begeben durfte. Die Stadt war ausgerüstet mit einem perfekten Wassersystem mit Kanälen, einem Observatorium, Bädern und drei Spielfeldern, wo jeweils das berühmte Teamspiel stattfand, das in ganz Mesoamerika gespielt wurde in dieser Zeit des ersten Jahrtausends n.Ch. Die Pyramide zuoberst ist teilweise sehr gut erhalten, sie ist Quezalcuatl, dem Schlangengott gewidmet. Charlie war wieder unser Reiseleiter. Drei Stunden lang waren wir mit ihm unterwegs und er rüstete uns bestens aus: Jeder / jede von uns erhielt ein Klappstüehli zum Draufsitzen, wenn er erzählte und sogar die vier netten aber schwatzhaften American Girls, die diesmal mit dabei waren, verhielten sich mäuschenstill bei seinen Schilderungen. Er erklärte uns bis ins Detail alles über die Ausgrabung des Ortes, über die Gebräuche in jener Zeit, die Verkehrs- und Handelsbeziehungen, eben übers Ballspiel, über das er eine leicht andere aber durchaus einleuchtende Theorie hat, als diejenige, die üblicherweise in den Reiseführern vertreten wird, über den Kalender, den die Mayas hatten (soooo kompliziert, aber erstaunlich genau), wieso sie Menschenopfer brachten, welches ihre Probleme waren (z.B. war‘s eine fast unlösbare Aufgabe, am richtigen Datum zu opfern, denn an einem anderen hätte man den Gott erzürnt - und den richtigen Zeitpunkt zu finden, war oft fast unmöglich). Ein bedeutender Unterschied zwischen der Götterverehrung damals und unseren Religionen heute muss offenbar gewesen sein, dass nicht nur die Menschen von den Göttern abhingen, sondern auch die Götter von den Menschen, und wenn man ihnen nicht Genüge tat, das heisst, die richtigen Opfer zum richtigen Zeitpunkt brachte und genau wusste, was sie wollten, dann hätten auch sie untergehen können.
Die Pyramidenstadt ist übrigens herrlich in die Landschaft eingebettet mit der wunderbarsten Aussicht weit übers Land, über bewaldete Hügel und Berge. Cuernavaca und die ganze Vulkankette in der Ferne, die Mexico City umgibt, sähe man bestens von hier, so wurde uns geschildert, aber da war nur eine dicke Abgaswolke, die alle Sicht verbarg.
In einem Dorf, das wir unterwegs zur Ruinenstätte durchquerten, erfuhren wir, dass fast sämtliche Einwohner zwischen 30 und 40 an unheilbaren Lungentumoren leiden, da während Jahren in der Nähe aus einer riesigen Schutthalde (Abfall aus Cuernavaca) giftige Stoffe ins Trinkwasser des Dorfes geflossen waren. Es erfolgte eine ähnliche Geschichte wie sie im Film „Erin Brockowich“ erzählt wird. – Die Grube wurde inzwischen disloziert - in die Nähe eines anderen Dorfes…
Charlie machte uns auch aufmerksam auf eine Schule, an der wir vorbeifuhren. Auf der einen Seite ist angeschrieben, dass es sich um eine Primarschule handelt, um die Ecke ist ein zweites Schild angebracht mit einem völlig anderen Namen - eine Berufsschule. Aus Platz- wahrscheinlich eher Geldmangel sind diese beiden Institutionen völlig unabhängig voneinander im selben Gebäude untergebracht; der Unterricht in der einen findet am Morgen statt, derjenige der anderen am Nachmittag in denselben Räumen. Sie haben zwei verschiedene Direktoren, zwei verschiedene Sekretariate (eben nur ein Zimmer je), und alle, die Schüler natürlich sowieso, müssen um ein Uhr und abends ihre Plätze räumen, ihre Sachen heimnehmen (Schliessfächer hat’s keine), weil ja dann die andern kommen. – Gäbig, stell ich mir das vor.
Auf dem Heimweg von der Schule mit dem Taxi gerieten wir in einen Stau, eine Stunde lang waren wir unterwegs. Der Verkehr ist grauenhaft, ich kann mir nicht vorstellen, wie das noch lange so weitergehen kann. Die ganze Stadt ist obendrein völlig konzeptlos angelegt, Strassen kreuz und quer, vielerorts sind Bodenwellen eingebaut, um den Verkehr zu verlangsamen. Obwohl fast zu jeder Tageszeit ein Riesenchaos herrscht, fliesst’s trotzdem erstaunlicherweise gar nicht schlecht, es kommt einem vor wie ein riesiger Reissverschluss, die Autos schlängeln sich von Bahn zu Bahn, jeder lässt jeden rein, aus einer Seitenstrasse drängt man sich rein, dies ist kein Problem, niemand hupt, Busse tun‘s sowieso auch. Wollte man nämlich warten, bis eine echte Lücke entsteht, würde man sowohl als Fahrer als auch als Fussgänger in alle Ewigkeit dort stehen. - Die Autos sehen auch entsprechend aus: Es gibt Vehikel, wo man sich schlicht nicht mehr vorstellen kann, dass die überhaupt noch fahrtüchtig sind. Oft sind‘s nur noch rostige Gestelle, Scheinwerfer oder Blinker sind für manche ein Fremdwort, Abgas- und Motorfahrzeugkontrollen wohl erst recht. Einen VW-Käfer sahen wir am Strassenrand stehen, der gar keine Türfalle mehr hatte, dafür innen eine Lenkradbremse (wie verschafft sich ein Dieb wohl Zugang zu einem so begehrenswerten Objekt?). Velofahrer sahen wir in den letzten zwei Wochen einen einzigen, Motorräder nur gerade zwei. Die andern hatten wohl nicht überlebt. Die Taxis sind ok, mehr oder weniger, aber wir gaben schon am zweiten Tag auf, nach funktionierenden Sitzgurten zu suchen. Man muss ja Vertrauen haben…
Am Freitagabend gab‘s wieder Fiesta, weil’s ja für einige der letzte Schultag war. Das ist auch ein sympathischer Teil an der Schule: Man lernt nicht nur die Sprache, man erfährt auch viel übers Land und macht nette Bekanntschaften. So ist immer etwas los.
Die beiden ersten Wochen unseres Aufenthalts verflogen wie nichts; schon war die Schule vorbei. Der drauffolgende Sonntag war der erste Tag, wo wir nichts vorhatten und mal ruhig zu Hause ausruhen, Garten und Pool geniessen und etwas lesen konnten, das nichts mit der Schule oder einer Exkursion zu tun hatte. Theo sagte, dies sei nun sein erster Ferientag.
Auch spielten wir ein wenig mit den Hunden, wenn man das spielen nennen kann. Vor allem die beiden jungen waren wahnsinnig liebesbedürftig und goldig, aber absolut ungestüm. Sie liessen uns keinen Moment lang in Ruhe, hauten ab mit meinem Buch und rasen durch den Garten - Seite an Seite wie Simultanschwimmerinnen. Sie klauten meine Lesebrille und das Etui, das Badetuch und natürlich die Schuhe, die ja umwerfend gut gerochen haben mussten. Alles stereo. So genossen wir den wunderschönen Tag. Das Wetter war immer gleich: Wolkenlos, etwa 26 Grad an der Sonne, im Schatten relativ kühl, die Nächte waren ebenfalls frisch, ein super Klima.
An Theos zweitem Ferientag konnte er wieder nicht ausschlafen, ich hetzte ihn in die Stadt auf den Busbahnhof Estrella Blanca. Dort fuhr der Bus nach Taxco, der Silberstadt in den Bergen. Eine Fahrt kann man dummerweise nicht vorher buchen (tolle Einrichtung), so mussten wir den ersten um 9 Uhr ziehen lassen und auf den nächsten um 10 Uhr warten. Das gab uns Zeit, die Kathedrale in Cuernavaca zu besichtigen und natürlich gegenüber einen Espresso (??? – nicht, was man bei uns unter Espresso versteht) zu trinken.
Die Busse sind gut ausgerüstet, sehr bequem und relativ sauber. Billig sowieso. 5 Fr. pro Person und Strecke mussten wir bezahlen. Musik hat‘s und ein Film wird gezeigt, allerdings kann man nicht auslesen, was man hören und sehen will, und ob überhaupt, beides läuft gleichzeitig. Der zweistündige Film ist natürlich nicht fertig, wenn man ankommt, aber das sind Details. - Die Fahrt dauerte eineinhalb Stunden und hat sich sehr gelohnt. Taxco ist ein herrlich buntes Städtchen an einem Hang gelegen, etwa auf gleicher Höhe wie die Mittelstation des Skilifts in Bivio (2‘200m), mit zahllosen verwinkelten Gässchen, ein wahres Labyrinth und totales Chaos von Verkehr und Fussgängern, mittendrin die Kathedrale, die tatsächlich ein Prunkstück ist. Was mir aber noch mehr gefiel, war, dass es auf manchen der umliegenden Gebäuden Rooftop-Restaurants hat oder Restaurants mit bezaubernden kleinen Balkonen und Terrassen. Natürlich landeten wir sogleich in einem mit Blick auf das Geschehen auf dem Zócalo (Hauptplatz einer mexikanischen Stadt). Das Lustigste in der Stadt waren die unendlich vielen Taxis, alles weisse VW-Käfer. Farbige hat‘s auch ein paar, aber die sind in der Minderzahl. Es gelang kaum, ein Foto zu machen, ohne dass im Minimum einer drauf war. Die meisten Taxistas haben den Beifahrersitz rausgenommen, so dass man „bequem“ einsteigen und hinten sitzen kann. – Ein richtiges Käferfest.
Und dann der Markt: So etwas habe ich noch nie gesehen. Es hatte hunderte von Ständen mit Silberschmuck, alles sehr billig, die Hälfte vom Preis an anderen Orten. Vor lauter Begeisterung vergass ich völlig, ein Foto zu machen. Die Stände am Hang sind so konstruiert, dass sie auf der einen Seite längere Beine haben, so dass die Verkaufsfläche doch gerade ist. Auch ohne all die Marktstände besteht die Stadt fast nur aus Läden, die Silber verkaufen. Nach wie vor gilt: Es ist sehr angenehm hier. Niemand ist aufdringlich, alle sind freundlich, ein Lächeln gehört immer dazu.
Zurück in Cuernavaca gingen wir in ein nettes Restaurant essen mit einer super Ambiente, grad wie man sie so oft auch antrifft in Guatemala: Das Gebäude war ursprünglich eine Hacienda mit einem Innenhof mit Brunnen und geschmückt mit lauter tropischen Pflanzen. In der Mitte eine Tanzfläche für Salsa-Darbietungen. Das Lokal heisst „India bonita“, schön, nicht wahr! Das kann man wenigstens aussprechen, aber manchmal sind die Namen hier schon eine Herausforderung. Aber ich liebe sie. Die meisten Ortsnamen stammen aus der Aztekensprache Nauhatl, die noch immer von ein paar Indigenas gesprochen, aber wie unsere Schweizerdialekte nicht geschrieben wird. All die Götter hiessen so exquisit, den schönsten Namen fanden wir im Palacio Cortéz, der Gott heisst Ehécatl. - Que padre!
Im selben Palast, mitten in Cuernavaca, an dessen Stelle früher mal ein Aztekentempel stand, gibt es auch eine Galerie mit Mauerbildern von Diego Riveras. Sehr eindrücklich! - Der Tempel war von den Spaniern zerstört worden und mit den Trümmern der Ruinen wurde das Gebäude, jetzt ein Museum, „neu“ aufgebaut.
Noch was zur Schweinegrippe (oder Spanische Grippe): Wie ich lese, hat sie die Schweiz erreicht, aber ich glaube nicht, dass sie schlimmer ist als unsere ’normalen‘ Grippen. Bisher wenigstens. Hier ist es überhaupt kein Thema. Was im Frühling passiert ist, davon sagt unsere Lehrerin, die Regierung habe das Ganze aufgebauscht, um Geld aus dem Ausland zu erhalten, was ja dann auch gelang. Aber sie seien eben zu geldgierig und zu dumm gewesen, um zu merken, dass dies ein Eigengoal gewesen sei, denn der Tourismus ging dadurch ja erheblich zurück und noch mehr Arbeitslosigkeit war und ist die Folge.
Leute mit Mundschutz auf der Strasse sieht man so gut wie keine, dagegen ist es in jedem Supermarkt und in jeder Bäckerei fürs Personal, welches mit unverpackten Lebensmitteln zu tun hat, Vorschrift, einen zu tragen, Haarnetzli und Handschuhe übrigens auch.
Was ich zu erzählen vergessen habe, ist, dass man hier die Schweiz sehr wohl kennt. Es gibt beispielsweise. „Enchiladas suizas“. Ich weiss zwar auch nicht, was genau damit gemeint ist. Wohl mit Käse. Den kann man im Supermercado kaufen. Greyerzer ist angeschrieben. - Er hat riesige Löcher...
Interessant kann‘s werden, wenn man eine Strassennummer sucht. Wir wohnen an der Galatea 45, am Haus vorne dran steht 38 und etwas weiter vorne 147. Die nächsten Nummern sind 50, 52, 54, 90 und so geht’s munter weiter.
Teopanzalco Pyramide
An unserem letzten Tag in Cuernavca besuchten wie noch die Teopanzalco-Pyrmide, die mitten in der Stadt steht. Nach den grossen Ruinenstädten ist dies ein ganz bescheidener Ausgrabungsort, aber uns gefiel, dass wir dort einen Tempel des Ehécatl gefunden haben und ich weiss jetzt, was er mit Vögeln zu tun hat: Er erscheint gefiedert. Sein Tempel ist rund, das hatten wir bisher noch nicht gesehen. Charlie könnte uns bestimmt ganze Bücher darüber erzählen, aber seine fantastische Reiseführung war ja nun leider vorbei. Die Tempelanlage ist aber dem Tláloc gewidmet, dem Regengott und dem Huitzilopochtli, dem Kriegsgott. So ein schöner Name und so einfach zu merken. Offenbar wurde der Bau der Pyramide unterbrochen und dann ringsum ein grösseres Gebäude erstellt: Ein Tempel im Tempel.
Rincon de Guayabitos
Inzwischen sind wie in Rincon de Guayabitos angekommen, einem kleinen Fischerdörfchen, etwa eine Autostunde nördlich von Puerto Vallarta. Der Ort ist so klein, er ist nicht mal im Lonely Planet Mexico angegeben. Hier herrscht eine völlig andere Klimazone, es hat keine Vulkane mehr, dafür die Sierra Madre. Am Tag ist es sehr heiss und auch während der Nacht sinkt die Temperatur kaum. Die Regenzeit ist vorbei, mit Niederschlägen muss niemand mehr rechnen. Alles Langärmlige bleibt im Koffer bis zu unserer Abreise. Unser erster Eindruck ist, der Ort ist ziemlich ursprünglich, eben nicht wie Acapulco und Puerto Vallarta, wo’s Hochhäuser und ein reges Touristenleben gibt. – Unser Haus haben wir gefunden (der zweite Tausch, den ich organisiert hatte), das heisst, der Taxifahrer hat uns wohlbehalten hergebracht. Schön, zur Abwechslung fast keinen Verkehr mehr zu haben. Am Flughafen will man uns sofort Taxis aufschwatzen, geht man aber über die Überführung auf die andere Strassenseite gleich beim Flughafengebäude (keine fünf Minuten zu Fuss), sind die Fahrpreise grad nur noch halb so teuer. Und unser Taxifahrer war von der intelligenteren Sorte: Unterwegs fragte er, ob wir nicht einkaufen wollten, er würde gerne bei einem Supermercado anhalten. Das tat er dann auch und Theo kaufte Schinken, Brot, Eier, Käse, Bier, Mineral und eine Flasche Wein, die einzige, die’s dort hatte. Der ganze Einkauf kostete 10 Fr. – Ich freue mich schon auf den Wein! (Theo öffnete die Flasche gestern Abend zum Nachtessen und spülte ihn sogleich den Abguss hinunter).
Im Haus angekommen, zeigte uns eine Nachbarin alles. Mit einem riesigen Schlüsselbund versehen machten wir uns daran, die Schlösser sämtliche Terrassentüren, Gartentore und der Haustüre in den Griff zu bekommen. Alles ist hier zwei- und dreifach gesichert. Mauern und Gitter ums Haus herum, Alarmanlage; man sei halt hier in Mexico, meinte sie. – Das Haus ist toll gelegen, 50 Meter vom Strand entfernt. Es ist schlicht aber geschmackvoll eingerichtet, hat eine riesige Küche mit Wohn-Esszimmer, vier grosszügige Schlafzimmer, Garten mit Sitzplatz und eine grosse Dachterrasse. Wir werden uns hier auf jeden Fall wohl fühlen.
SMS
Um ins Dorfzentrum zu gelangen, „müssen“ wir am Strand entlang einen Spaziergang von fünfzehn Minuten machen. Im Restaurant fand Theo dann, er wolle der Familie ein SMS schreiben, dass wir gut angekommen seien. Er spielt zwar ständig auf seinem iPhone herum, aber die Texterei hat er nicht so ganz im Griff. Offenbar passiert es ihm öfter, dass er jemandem schreibt, dem er gar nicht schreiben will, weil die zuletzt angekommene Meldung noch immer auf dem Display erscheint. - So weiss jetzt also Swisscom, dass wir gut angekommen sind, wie warm es hier ist, dass wir am Pizzaessen sind (die kleinste mögen wir zusammen nicht fertig essen) und dass sie diese Mitteilung weiterleiten soll. Unterschrieben hat er mit Mad. „Mad Theo???“ frage ich. „Nein, nein, sie wissen zu Hause, dass das Mom and Dad heissen soll. Ob Swisscom diese Codes auch kennt? - Hab gerade erfahren, dass Swisscom zurückgeschrieben hat. – Unpersönlicher Hinweis, dass dies wohl die falsche Nummer sei.
Nach dem Nachtessen kaufen wir ein, was Theo noch fehlt, seinen Whisky zum Beispiel und Milch. Tolle Kombination. - Dann ein Taxi: Wir sind gewohnt, dass es kaum eine Minute dauert, bis man eines heranwinken kann, in Cuernavaca waren sie ständig und überall unterwegs; hier dauert’s eine Viertelstunde, bis endlich eines kommt. Aber wir haben ja Zeit.
Kränklich
Dummerweise habe ich mich am zweitletzten Tag vor unserer Abreise erkältet. Und dazu gleich noch einen Hexenschuss eingefangen. Tolle Kombination. Und soo gäbig für unterwegs beim Koffer Herummanövrieren. Glücklicherweise hat mir Rosio, unsere liebe Housemade in Cuernavaca noch dreimal eine wohltuende, profimässige Massage mit Arnikasalbe gemacht, so dass ich den Tag ganz gut überstand. Sicher habe ich nicht die gripa porcina: Auf dem Flugplatz wird mit Wärmelampe automatisch und fast unbemerkt die Temperatur jedes Passagiers gemessen und der Bildschirm zeigte bei mir 36,1° an. Inzwischen habe ich Halsweh, Husten, Schnupfen, das ganze Programm also, und der Rücken tut mir noch immer weh, aber all das wird vergehen und jammern kann ich nicht, denn meine Stimme ist momentan weg. (Theo hat’s wohl gar nicht gemerkt, vorhin krächzte ich was und er sagte, er verstehe es nicht, er habe sein Hörgerät noch nicht montiert / fixiert / angezogen /eingesetzt / in Betrieb genommen / angeschnallt / appliziert / befestigt – wie sagt man das?).
Markt in in La Peñita
„Unser“ Haus ist am nördlichen Ende von Guayabitos gelegen, an einer Strasse, an der offenbar viele Ausländer Liegenschaften besitzen. Einige (die Häuser) sehen aus wie kleine Schlösser, venezianische Villen und ähnliche Prachtsbauten. Einzelne aber wurden wohl mitten im Bau gestoppt und zeigen bereits erste Zeichen des Zerfalls. - Ist da wohl jemandem das Geld ausgegangen? - Wenn wir die Strasse zu Ende gehen, kommen wir zu einer Hängebrücke und auf der andern Seite gelangt man nach La Peñita, dem Nachbardorf im Norden. Hier sind die Häuser fast alle am Zerfallen und es gibt auch keine Anzeichen von Ausländersiedlungen. Dafür ist das Kaff ein wenig grösser und heute ist Markt.
Theo beim Coiffeur: Eine neue Frise musste sein, beziehungsweise das Fell ein wenig stutzen. Es ist gelungen, dauerte eine Viertelstunde und kostete 3.20 Fr.
Theo hat eine Maske gekauft (die in sein Gruselkabinett passt), deren Nase eine nackte Frau darstellt. Nur war sich der Künstler wohl nicht ganz im Klaren, ob er die Frau von hinten oder von vorn darstellen sollte – er hat sich dann für beides gleichzeitig entschieden. Picasso hatte ja ganz ähnliche Ideen. Die Maske ist aus Holz und die Dame natürlich rosarot angemalt. Muss ja so sein, sie ist ja schliesslich blutt. Und sie ist ein Engel.
Rincón de Guayabitos wie gesagt ist klein, ruhig und weit weg vom üblichen Massentourismus. Es hat zwar ein paar ganz schöne Hotels, aber die sind nichts im Vergleich zu den „All Inclusive – Resorts“ an anderen Orten. Die Strassen sind nicht aus Asphalt, sondern noch nach alter Manier: Steine und Erde. Wie Bachbette. Die beiden schweren verrosteten Velos, die’s im Haus hat, wagen wir überhaupt nicht zu benutzen bei diesen holprigen Strassen, obwohl’s kaum Verkehr hat und eigentlich sehr praktisch wäre. Man hat hier schon das Gefühl, noch irgendwas vom ursprünglichen Mexico zu erleben. Das ist sehr angenehm, hat aber auch seine Tücken. Zum Beispiel kann man rein gar nichts mit Kreditkarten bezahlen.
Wetter / Kleider
Wie ich schon erwähnt habe, ist es wunderbar warm hier. Tagsüber etwas über 30 Grad, in der Nacht nie unter 26°. Obwohl es manchmal ein paar Wolken hat (fast immer über der Sierra Madre) gibt’s keinen Regen mehr nach Ende Oktober, jetzt ist ja November. Zum Glück auch (fast) keine Mücken!
Sogar Theo verzichtet jetzt auf seine Socken und er hat sich eine knallgelbe Badehose gekauft. Er sieht aus wie ein (in die Jahre gekommenes) Kanarienvögeli. Er besitzt jetzt auch einen Stroh-Sonnenhut, nicht den ursprünglichen Sombrero, davon kam er dann doch selber ab, eher so was amerikanisch Anmutendes, etwas Cowboyartiges. Er steht jetzt auf Gelb, schon in Cuernavaca erstand er sich zwei gelbe T-Shirts.
Gestern wollte ich (zur Demonstration) ein Foto von ihm in Gelb machen, aber er sagte, er habe seine neue Badehose nicht dabei, er habe unterdessen ein wenig Angst, sie könnten vielleicht durchsichtig werden im Wasser. – Am nächsten Tag bestand sie aber den Test.
Bewohner und Sprache
Es hat etliche Amerikaner aus den nördlichen Staaten der USA und Kanadier, alles Paare gesetzteren Alters, die hier Häuser besitzen und dem Winter im Norden ausweichen. „Snowbirds“ werden sie genannt. Auch wenn man nicht will, kommt man sofort mit ihnen in Kontakt, sie stellen sich sogleich mit Vornamen vor, sei das am Strand, im Strandbeizli, im Restaurant oder wo auch immer. Und alle sind dann beeindruckt, wie weit weg wir wohnen in Europa („so far away from home“). Sie sind sehr freundlich und gut gelaunt, unsere „Nachbarn“ haben wir beim Abendspaziergang am Meer kennengelernt beziehungsweise sie uns, und sie haben uns sogar eingeladen vorbeizukommen. Mal sehen, vielleicht machen wir das.
Spanisch können die Gringos in der Regel aber nicht. Wenn ich zu einem Kellner zwei Worte auf Spanisch sage, wird das schon bewundert.
Dann gibt’s auch noch Mexikaner hier. Sie sind es, die den Strand bevölkern. Sie sind sowieso immer fröhlich und hilfsbereit. Die meisten haben ein paar Worte Englisch aufgeschnappt und sind sehr stolz auf ihre Sprachkenntnisse. Wenn ich also etwas erfragen will, schliesslich will ich meine in der Schule erworbenen Kenntnisse auch anwenden, sieht unsere Unterhaltung folgendermassen aus: Ich stelle eine Frage auf Spanisch und der Mexikaner antwortet unverzüglich in gebrochenem Englisch. Aber ich bleibe stur und wenn‘s schwieriger wird und die Antwort nicht nur aus „over there“, „you guys like?“ und „yes“ oder „no“ bestehen kann, geht’s dann plötzlich und manchmal gibt’s ganz lustige Gespräche. Sie halten uns ja immer für Amerikaner. Wenn ich das dann berichtige, geht’s los. - In Cuernavaca war’s einfacher, ins Gespräch zu kommen, dort ist Amerikanisch nicht so in Mode.
In der Zeitung haben wir gestern grad gelesen, dass der Schwede Roger Federer gegen Verdasco gewonnen hat. – Auf diesem Kontinent kann niemand Schweiz und Schweden unterscheiden; und so halten sich die Vorurteile hartnäckig.
Strand und Strandverkäufer
Apropos Strand: Jeden Tag versuchen dieselben Verkäufer ihre Waren an den Mann, an die Frau zu bringen: Schmuck, Esswaren, Plastikspielzeug, Kleider, Tattoo- bzw. Bodypainting-Vorschläge und so weiter. Schon die Kleinsten sind dabei. Wir fragen uns, wie die Familien von diesen paar Pesos, die sie auf diese Weise verdienen, leben können. Ausser den Esswaren wird kaum etwas verkauft. Einer der Kanadier meinte: „Man sollte mal bei uns versuchen, Teenager und Kinder den ganzen Tag lang arbeiten zu lassen fast ohne Verdienst, vielleicht würden sie dabei etwas lernen…“
Gestern sahen wir einen jungen Mann mit einer anderen Masche. Er war weiss gekleidet wir ein Arzt, hatte auch ein Stethoskop umgehängt und ein Blutdruckmessgerät in der Hand, mit dem er herumfuchtelte und rief: „Check?“ Vielleicht hat er Erfolg damit; seine Idee find ich nämlich gar nicht so abwegig, da die weisse Rasse hier ja nicht gerade mit den jüngsten Exemplaren vertreten ist.
Am Strand tummeln sich auch haufenweise Pelikane und andere fischende Vögel. Sie haben überhaupt keine Angst vor den Menschen und es ist unterhaltsam, ihnen zuzuschauen. So sind ganze Familien von Pelikanen im Wasser, am Strand ganze Familienclans von Mexicanos.
Am Abend ist der Strand sofort leer, leider auch die Strandbeizli. Nur in einem war am letzten Samstagabend etwa los. Die Sekundarschule des Ortes wollte nicht aufhören mit ihren Darbietungen. 15 Franken Eintritt pro Person fanden wir erst ein wenig viel, aber das Billet beinhaltete nebst dem wohltätigen Zweck auch das Nachtessen und zwei Drinks. So blieben wir sitzen und sahen und hörten zu. Es gab auch eine Tombola, fast wie jeweils in Mauss bei der Theatervorführung. Wir haben nichts gewonnen; Züpfe, Cakes Weihnachtssterne und WC-Papierhalter gehörten hier allerdings nicht zu den Preisen. Gerne hätte ich ein Glas Wein gehabt zum Essen, aber die beiden Drinks waren entweder Margaritas, Tequila oder Bier. Ich entschied mich für zweimal Nummer eins. Tequila haut mich um.
Gegen Ende des Tages
Die Sonnenuntergänge hier sind unglaublich. Die ganze Bucht wird tiefrot – so eindrücklich, dünkt mich, hab ich’s noch gar nirgends gesehen. Das Dumme dran ist nur, dies findet schon kurz vor sechs Uhr abends statt und um zehn nach sechs ist’s stockdunkel und ein Sternenhimmel erscheint wie bei uns um Mitternacht. So gehen wir jeweils zu der Zeit dem Strand entlang ins Dorfzentrum zum Nachtessen. Und auch wenn wir noch ein wenig lädele, im Internetcafé unsere Mails anschauen und nach einem schönen Restaurant Ausschau halten, so sind wir doch regelmässig allerspätestens um acht Uhr fertig mit Essen. Ja, und dann – Taxi und nach Hause. So haben wir eine Art verschobene Tage. Fernsehen haben wir auch nicht im Haus, so bleibt vor allem Lesen und Schreiben. Um zehn Uhr bin ich meist im Bett, vor Müdigkeit fallen mir die Augen zu. (Daheim bin ich krank, wenn ich mal vor Mitternacht im Bett bin.) Dafür bin ich dann zwischen sechs und sieben wieder auf. Theo nicht. Er schläft und schläft und schläft. Er hat’s auch verdient nach dieser anstrengenden Zeit… Vor neun Uhr steht er nicht auf, schon das dünkt ihn unglaublich früh. – Es „jagt“ ihn aus dem Bett (so seine Ausdrucksweise), weil ihn die Hunde wecken, die in der Nachbarschaft immer in diesen frühen Morgenstunden bellen.
San Francisco
Gestern nahmen wir ein Kollektiv-Taxi und fuhren an einen Strand eine halbe Stunde südlich von hier. Der Ort hat zwei Namen, San Pancho, auf der Karte und auf dem Ortsschild heisst er San Francisco (einmal mehr - der fünfte Ort dieses Namens, den ich kenne). Es ist ein schmuckes kleines Dörfchen in einer Bucht gelegen, etwa so gross wie die Almadraba-Bucht bei Rosas, mit einem wunderschönen Strand, klarem, blauen Meer und grossen Wellen. Nur eine Handvoll Leute vergnügen sich dort, ein paar Surfer in den Wellen, alles junge Einheimische – ein kleines Paradies. - Zwei Strandrestaurants zum Chillen sind ebenfalls vorhanden und im Dorf hat’s ein paar Lädeli, viele bunte Häuser, etliche davon zu verkaufen, sogar das Historische Museum wird zum Kauf angeboten. Ich hatte den Eindruck, es ist oder war ein Ort, wo sich in besseren Zeiten mal ein paar Aussteiger niedergelassen haben; man erkennt sie an ihren farbigen Kleidern und den Sandalen.
Unfall
Auf der Heimfahrt hielt unser Bus irgendwo ausserhalb eines Dorfes an, um jemanden aussteigen zu lassen. Da passierte gleich neben uns ein Unfall. Wir hören und sahen ein Auto auf der Hauptstrasse mit pfeifenden Bremsen herankommen, aber die Kollision mit dem von rechts aus der Dorfstrasse kommenden Motorrad war unausweichlich. Ein riesiger Knall und er prallte mit voller Wucht in den Polizeipickup, auf dem hinten drei Polizisten standen. Funken sprühten, ich sah nicht mehr hin. In unserem Bus wurde es sehr ruhig. Das Polizeiauto fuhr dann an den Strassenrand und als ich wieder hinsah, standen alle beisammen und der Töff- Fahrer, den ich schon tot gewähnt hatte, fuchtelte wie wild mit den Polizisten herum, schien unverletzt. Er hatte weder ein Hemd, verschweige denn einen Helm getragen. Mir kam‘s vor wie ein Wunder.
Nochmal zur Schweinegrippe
Jetzt war doch wieder mal was in der Zeitung über die Schweinegrippe. Ein paar Zahlen nur. Das Einzige jedoch, was man hier davon merkt, ist, dass es neuerdings in einem der Strandcafés einen neuen Drink gibt für 25 Pesos: „Swine Flu Shot“. – Ich nehm‘ lieber meine Piña Colada.
Die Seuche selber hat mutiert, oder jedenfalls ihr Name: Vielleicht ist das aber nur der Kantönligeist, den’s hier auch gibt. In Morelos hiess das Ding Gripa Porcina und hier in Nyarit plötzlich Influenza Humana.
Theos Geburtstag
Er sagt, es sei sein 56ster. Es könnte ja sein, dass man Legastheniker sei, wenn man die Zahl liest (???). – Wie dem auch sei, er ist jetzt wirklich pensioniert. Seit gestern. Er hat sich für einen neuen Job umgesehen, Baywatch-Chef, am Strand posierte er in einem Hochstuhl; ich musste ein Foto davon schiessen. – Nach einem Strandtag gingen wir in einem Restaurant essen mit fantastischer Aussicht über die Bucht und den Ort. Schon um fünf Uhr waren wir dort, um die Aussicht und den Sonnenuntergang zu geniessen, weil’s, wie gesagt, um sechs ja schon Nacht ist. Die Portionen, die man hier serviert bekommt, sind mega. Meine Chiles Rellenos con Camarones hätten für eine ganze Familie gereicht. Auf dem Teller sahen sie aus wie zwei Hühnerschenkel.
Wir haben einen Taxifahrer gefunden, der die Zuverlässigkeit in Person ist. Pünktlich um acht Uhr hat er uns wieder abgeholt. Wir machen jetzt immer mit ihm ab, wenn wir irgendwo hin wollen. Er heisst Samuel und ist eigentlich Bauarbeiter. Er wird uns am Samstag nach Puerto Vallarta fahren.
Whalewatching-Bootsfahrt
Heute waren wir auf einer Bootstour und sahen tatsächlich Wale. Vor lauter Aufregung glückten mir natürlich keine guten Fotos. Ich musste auch an das Buch von Frank Schätzing „Der Schwarm“ denken und hatte fast ein wenig Angst, die Riesen könnten die Boote kentern lassen. Es waren nur etwa drei oder vier, aber sie kamen zum Teil ganz nah ran. - Auf einer vorgelagerten kleinen Koralleninsel, hat’s einen kleinen Strand mit türkisblauem Wasser und feinem weissen Sand. Wie in der Karibik. Dort blieben wir drei Stunden lang. Und kaum waren wir dort, liess ich mich auch gleich von einer obergiftigen Wespe stechen.
Dank Anjas Bemühungen hat Theo seinen Flug verschieben können. Als ich zuhause die Reise organisierte, war er ein wenig skeptisch und dachte, er habe noch so viel zu erledigen. Aber inzwischen hat er gemerkt, dass Diego und Gino das alles ebenso gut machen können (sie haben ja auch den ganzen langen und mühsamen Umbau geleitet, organisiert und selber zahllose Wände gestrichen und Teppiche rausgerissen) und zudem gefällt es ihm hier offensichtlich. Also haben wir den Aufenthalt um neun Tage verlängert, er wird also erst am 10. Dezember wieder daheim sein (ich mit meinem Miami-Abstecher erst am 17ten).
Tennis
Bälle haben wir bei uns und zwei Rackets auch. Aber Tennis gespielt haben wir noch nie. Leider.
Erst am zweitletzten Tag sah ich den Tennisplatz in Guayabitos, ganz am Rand des Dorfes. Ich wusste gar nicht, dass es hier überhaupt einen gab und ehrlich gesagt, erkundigte ich mich auch gar nicht danach, denn die einzige Zeit, wo man hätte spielen können, wäre wegen der Hitze morgens um sieben gewesen. – Und mit Theo, dem Siebenschläfer… Das wäre so oder so nicht gegangen, denn dies war die Zeit, wo er sich über die Hunde aufregen musste.
Den Platz sah ich nur ganz kurz vom Taxi aus zwischen den Bäumen hindurch. Einen sehr verlassenen Eindruck machte er. Der Belag war grün - kaum Farbe, eher Vegetation; jedenfalls war der Traum von Tennis in Mexico ausgeträumt.
San Blas
Am Freitag war das Wetter zur Abwechslung nicht ganz so schön, also unternahmen wir ein Busreisli nach San Blas, einem Ort etwa 80 km nördlich von Guayabitos. Der Bus hätte um 10 Uhr fahren sollen, bis er aber kam, war’s zehn vor elf. Die Fahrt dauerte fast zwei Stunden und führte zwischen dem Meer und der Muttersäge (Sierra Madre) durch, vorbei an Fruchtbaumplantagen, bewirtschafteten Feldern, über enge, holprige Strassen und durch kleine Ortschaften, wo der Fuchs und der Hase…
Das Schöne dort: Man kann mit der Lancha eine Fahrt durch die Mangroven unternehmen und da es keine Touristen hat, ist man ganz allein unterwegs mit dem Bootsführer und der kleinen angenehmen Brise vom Fahrtwind. Gemäss „Lonely Planet“ ist es ein Birdwatcher-Paradise und tatsächlich, wir sahen alle möglichen Arten von Vögeln, Kormorane zum Beispiel, auch Krokodile, Leguane und Wasserschildkröten. – Que padre!
Strassenküche
Bisher hat sich Theo immer geziert, wenn’s drum ging, von einer Strassenküche etwas zum Essen zu kaufen. Eine Ausnahme machten die Chapulines, aber wahrscheinlich war der Eindruck doch nachhaltiger als erwartet...
Nach der Bootsfahrt wollte ich aber einen Maiskolben haben. Maiskolben sind ja schliesslich gebraten und nicht so ein Problem – also ass Theo die Hälfte davon, was allerdings den Hunger nicht ganz stillte. Zeit, in einem Restaurant zu essen, hatten wir keine mehr.
Da trug es sich nun aber zu, dass bei der Haltestelle, wo wir auf den Bus warten mussten, eine attraktive Dame die Köchin der fahrbaren Küche war, und weg waren Theos Vorbehalte. Ich schoss ein Foto und dann kauften wir unsere Tacos-Zwischenverpflegung. So einfach ist es mit Männern… (manchmal).
Am Abend dann im Restaurant bestellte ich Pozole, eine Spezialität hier, eine Suppe aus Mais mit Huhn. Als Vorspeise bestellte ich die kleine für 2.10 Fr. Mindestens ein halbes Huhn war dreingeschnätzelt - ich übertreibe nicht. Das Gericht hätte problemlos für vier gereicht. Wahrscheinlich muss ein ganzes Huhn dran glauben, wenn man nicht die Pozole chica, sondern die normale Portion bestellt. Auf einem Nebenteller erhält man zusätzlich Salat dazu, ganz fein geschnitten, sowie eine gehackte Zwiebel. Dieses Gemüse und der Saft von zwei Limonen gehören ebenfalls in die Suppe.
Zur Sicherheit bestellten wir nur eine Portion (für beide) in Kokosteig eingebackene Shrimps und dazu Mangosauce. Himmlisch war’s, aber auch das fast zu viel.
Puerto Vallarta
Inzwischen sind wir in Puerto Vallarta angekommen. Wir wohnen in einem Apartment in einem Block, hoch über einer Bucht. Die Wohnung bietet alles, was man braucht, und ist gut und stilvoll eingerichtet. Traumhaft ist die Aussicht aus dem achten Stock aufs Meer. Sie auf dem bequemen Sofa liegend von der Terrasse aus zu geniessen, ist ein absolutes Highlight. - Also auch hier haben wir einmal mehr Glück gehabt mit dem Homelink-Exchange.
Es ist aber ganz anders als in Guayabitos. Stadt und Land. Es ist eben ein Ort wie Cancun oder Acapulco, voller Leben, Musik, Amerikanern und Kanadiern (hier gibt’s auch jüngere Vertreterinnen und Vertreter der Rasse). - Im Bus vorhin hat eine Frau zur anderen gesagt: „We’re popping from happy hour to happy hour here.“ Und am Pool meinte eine andere: „Another terrible day in paradise“. Das bringt die Stimmung gar nicht schlecht rüber. Halb Seattle ist hier; die werden dort ein trauriges Weihnachtsfest erleben in dieser ausgestorbenen Stadt.
Leider hab ich keine Chance mit meinem Spanisch; Amerikanisch scheint die ortsübliche Sprache zu sein. Alle sprechen es. Man braucht keinen halben Tag lang hier zu sein und schon ist klar, die Amis haben die Stadt voll im Griff. – Irgendjemand hat mal gesagt: „Willst du Spanisch lernen, geh nach Miami, willst du Amerikanisch lernen, geh nach Cancun.“ Könnte auch Puerto Vallarta sein. - Und alles ist doppelt so teuer. Wir nehmen jetzt den Bus, der grad unter dem Condominiumkomplex „Costa de Oro“ hält und alle fünf Minuten fährt (jeweils 92 Stufen rauf und runter). Das Taxi kostet vom Zentrum bis heim 4 Fr. und solche Wucherpreise zu zahlen, sind wir nicht mehr gewohnt; ein Busticket kostet nur 40Rp.
Jetzt sind wir seit drei Tagen da und es gefällt uns sehr gut, die Leute sind auch hier auffallend freundlich und der alte Dorfkern hat sehr wohl etwas für sich. Es gibt eine lange, sehr schön ausgebaute Strandpromenade (Malecón), gesäumt mit Palmen und Kunstskulpturen, von wo aus man einen fantastischen Blick hat auf die ganze Bucht und den Sonnenuntergang, der hier zum Glück eine Stunde später stattfindet, nämlich um sieben (andere Zeitzone). Es ist ein Leben wie im Sommer, alle scheinen zufrieden, es läuft Musik, es hat Gaukler, eben das dolce vita oder besser dulce vida. Auf manchen Häusern hat’s Restaurants mit Terrassen, von denen man das Geschehen bei feinem Essen überblicken kann oder Innenhöfe in Haciendas mit toller Atmosphäre. Wer sich lieber direkt am Strand aufhält, für den gibt‘s dort eine Menge Palapa Restaurants - teurere und weniger teure. – Die Füsse im Sand beim Nachtessen: „Que padre“ - „Big time awesome“ – „Hölle schön“! - Es hat massenhaft Läden (zwar die meisten mit ziemlich denselben Touristen-Angeboten), Restaurants, Bars und etliche Galerien mit zum Teil sehr schönen Bildern und Skulpturen. Morgen wird ein „Artwalk“ angeboten, wo die Skulpturen am Malecón von den Künstlern selber erklärt werden, dazu wird dann am Abend in einer Galerie ein Apéro serviert (Open House and Reception). Man kann auch Kochkurse besuchen (speziell für Paare…), es gibt „Evening under the stars“ (was immer das auch sein mag), „Let the Dogs Out“ (?) ist ebenso eine Veranstaltung, „Bingo is back“, natürlich gibt’s auch Bridge, x Ausflüge zum Buchen, aller Gattung Sportevents; vielleicht hat man Lust fürs „10th Annual Vallarta Yacht Club Chili Cook-Out“, „Whale-Watching“ sowieso und und und... Vom 2. – 6. Dezember gibt’s sogar ein Filmfestival (www.vallartafilmfestival.com). Alles very exhausting und eben gar nicht wie in Guayabitos und schon gar nicht wie in Cuernavaca. – Aber wie gesagt, wir geniessen es!
Essen (schon wieder)
Theo hat inzwischen gemerkt, dass die Strassenküchenmahlzeit in San Blas sehr gut verdaulich war und all die grässlichen Krankheiten, die man sich da holen kann, über die er im Reiseführer gelesen hat, nicht eingetroffen sind. – Um genau zu sein: Die absolut grüsigste Mahlzeit, die er gegessen hat in den letzte Wochen, hat er höchst persönlich zubereitet und ich weiss noch immer nicht, wie ihm das gelingen konnte.
Es waren Spaghetti. Ich wollte mal aufs Nachtessen verzichten, da wir schon zu Mittag gegessen hatten, Theo aber, der Spaghetti-Fan, bereitete sich einen Teller eben dieser Teigwaren selber zu. Ich sah schon, dass er nicht begeistert dreinschaute beim Verzehr, und als der Teller noch halb voll war, hielt er ihn mir unter die Nase und fragte: „Findest du nicht auch, dass die seltsam riechen?“ - Mir fehlten und fehlen die Worte. - Ob er ranziges Öl drübergeleert hat oder was da sonst passiert ist, irgendein seltsames Gewürz erwischt – es bleibt ein Geheimnis (vielleicht lüftet er’s dann in „seinem“ Kochbuch, von dem er ständig spricht). Er meinte, es sei vielleicht das Wasser gewesen, das er aus dem Wasserhahn verwendet hatte statt dem purifizierten aus der Ciel-Flasche. Jedenfalls ass er tapfer weiter und er hat’s ja überlebt.
Nachtruhestörung
Inzwischen hat sich Theo erholt. Zum Glück! Er hatte nämlich eine obermühsame Nacht, gleich die erste, als wir hier waren. Wenigstens waren’s zum Abwechslung mal nicht die Hunde, die ihm den Schlaf geraubt hatten! (Kurzer Exkurs: Wären wir länger in Guayabitos geblieben, hätte er sich mit der Alarmanlage gerächt, das war sein Plan, der allerdings nicht zur Ausführung gelangte, da ich strikte dagegen war).
Ich habe ja erwähnt, dass Puerto Vallarta ein Party-Ort ist, und die Disco, die gleich unterhalb unseres Wohnblocks direkt am Meer gelegen ist, hatte am Samstagabend natürlich Hochbetrieb. Eigentlich wohnen wir im südlichen Teil der Stadt in einer ruhigen Bucht (ähnlich wie jeweils in Spanien), aber der Samstag ist auch in dieser Gegend offenbar etwas ganz Besonderes). Jedenfalls wurde die ganze Umgebung mit dröhnender Musik bedient bis sicher etwa um drei Uhr morgens. Auch ein Entertainer kündete uns jeweils an, wie das nächste Stück hiess, das gespielt wurde. Wenigstens gefiel uns die Musik, Frank Sinatra, mexikanische Rhythmen und so in dem Stil, zum Glück nicht etwa Techno oder Hip Hop oder gar Hudigäggeler. Übrigens hat NIEMAND reklamiert wegen des Lärms; in der Schweiz hätte dieser Spektakel keine zwanzig Minuten gedauert, bis jemand die Polizei gerufen hätte. - Auch Feuerwerk gab’s, aber das störte ja nicht so sehr. Im Gegenteil. Jedenfalls konnten wir uns (mit oder ohne Hörgerät) überhaupt nicht mehr unterhalten, ich ging dann halt ins Bett mit meinem Buch, las zwei Seiten und schlief bei Sambarhythmen zufrieden ein, nur Theo gelang es einfach nicht, den wohlverdienten Schlaf zu finden. So hatte er eben einen ganz miesen Tag am Sonntag, war völlig schlapp und zu gar nichts mehr zu gebrauchen, so dass ich alleine an den Strand und zum Einkaufen gehen musste und ihn zu Hause zeichnen liess (so nennt er das jetzt). Die Müdigkeit ist noch immer nicht ganz vorbei, da sind noch irgendwelche Nachwehen vorhanden. Heute Morgen ging ich wieder alleine in die Stadt, um unseren Rückflug zu buchen und um die Gelegenheit zu nutzen, „ein wenig“ zu lädele. - Jetzt ist Theo wieder auf dem Damm.
Es gibt noch einen nächsten Samstag…
Art Walk
Gestern Morgen fand der Art-Walk statt mit dem Galerist Gary Thomson. Er bietet diesen Gratisspaziergang jeden Dienstag an von Oktober bis März, hat aber normalerweise rund 50 Zuhörer und Zuschauer. Diesmal waren wir nur ein sehr kleines Grüppchen, zu sechst mit ihm. Es hatte geregnet und war ein wenig kühler (nur noch 26 Grad), so dass offenbar die Kunstbegeisterten es vorzogen, in den Federn zu bleiben. Theo hätte das auch lieber gewollt (wen erstaunt‘s?) oder den Spaziergang auf den nächsten Dienstag verschoben, hat sich dann aber doch aufgerafft, als ich ihn darauf aufmerksam machte, dass wir am nächsten Dienstag bereits wieder in Mexico City sind.
Skulpturen entlang des Malecón / Millenium
Begonnen hat der Walk am nördlichen Ende des Malecón, bei der Millennium-Skulptur. Der Künstler selbst, Mathis Lidice, erklärte uns bis ins Detail, was auf dem Kunstwerk zu sehen ist, weshalb er es so konzipiert hat, all die Bedeutungen dahinter, wie’s hergestellt wurde, aus was für Materialen es besteht (Bronze und in der Mitte Eisen), dass er selber der grösste Teil davon zahlen musste mit Sponsorengeldern und was alles geschah, bis es im Jahr 2001 aufgestellt werden konnte. Im Jahr darauf wurden etliche der Statuen oder Teile davon sowie die Sockel und Beschriftungen vom Hurrikan Kenna weggerissen und -geschwemmt und konnten zum Teil nicht wiedergefunden werden. Millennium stand noch, zwei Beschriftungstafeln fand man im Swimmingpool des nahe gelegenen Hotels.
Kurz zusammengefasst besteht die Skulptur aus vier Teilen, welche die Erdgeschichte symbolisieren und den Werdegang des Menschen durch die Zeitalter: Unten sind die Wellen, das Meer und sodann die Tiere, die nach und nach entstanden, dann folgt das erste Jahrtausend mit Karl dem Grossen, die Religionen werden dargestellt und die Kriege, dann versinnbildlicht der dritte Teil das zweite Jahrtausend mit seinen Entdeckungen und Errungenschaften, die einerseits Fortschritt bedeuteten, andererseits katastrophale Auswirkungen hatten, dargestellt im Gesicht der zweituntersten männlichen Figur, dem weisen Azthekenkönig Netzahualcóyotl, das auf der einen Seite fein ausgearbeitet ist und auf der anderen nur einen Skelett-Schädel zeigt (ebenso Leben und Tod) und schliesslich die oberste Figur, eine Frau im Allgemeinen, die das Leben bringt und nach Frieden strebt (dieTaube) - die Hoffnung im neuen, erst gerade begonnenen Jahrtausend. Die ganze Skulptur ist etwa so lang und verzworgelt wie mein eben geborener Satz (den ich meinen Schülerinnen mit Wellenlinie unterstreichen würde).
Rotonda del Mar
Die Beschreibung der anderen Figuren schenke ich uns, nur noch kurz zu meiner Lieblingsgruppe, der Rotonda del Mar. Sie wurde 1997 installiert; Alejandro Colunga ist der Künstler. Die Figuren, jede repräsentiert ein anderes phantasievolles Meeresgeschöpf, bilden einen Kreis und alle laden ein zum Draufsitzen. Sie sind aus Bronze gearbeitet, dort wo schon x Füdli drauf waren, glänzen sie noch immer golden, der Rest der Figuren ist im Laufe der Zeit grün geworden, so wie unsere Bundeshauskuppel. Die würde auch prachtvoll glänzen, wenn …
Das Schöne an der Gruppe ist eben, dass sie so viele Leute anzieht, jeder macht Fotos dort, alle haben Freude an den Figuren, die mich irgendwo auch an Giger erinnern. Nicht nur Kinder, auch Erwachsene klettern darauf herum.
Galerien
Der Artwalk übrigens endete in Gary Thomsons „Galerie Pacifico“ und das hiess für uns, dass der gratis Spaziergang im Endeffekt doch recht teuer zu stehen kam. – Ich kann’s einfach nicht lassen, wenn ich Bilder sehe, die mir soooo gefallen.
Das Dumme ist, dass es in relativ geringem Umkreis etwa zwanzig Galerien gibt und dort teilweise ausserordentlich gute Bilder und Skulpturen ausgestellt sind. Theo schleppte ich dann mit, einige davon zu besuchen, bis dann glücklicherweise um 14 Uhr die Siestazeit anfing, so dass wir nur noch Window-Shopping machen konnten. Das kommt wesentlich billiger. Heute Abend aber ist Tag der offenen Tür in den Galerien, wo überall eine Art Vernissage stattfindet und einige der Künstler anwesend sind…
Bis dahin aber gibt’s einen Strandtag. Gestern, wie gesagt, hat’s während der Nacht geregnet und war erst gegen Mittag wieder schön, obwohl vorher alle behauptet hatten, im November und Dezember regne es nicht, und jetzt sagen sie halt: „Very unusual; doesn’t normally happen, – muy raro!“ Für den Artwalk war’s das perfekte Wetter. Schirm, Regenmantel oder Jacke konnte man daheim lassen.
Theo hat gestern übrigens tapfer mitgehalten, trotz Galerie-Siesta-Time sind wir erst am späten Nachmittag heimgekommen (acht volle Stunden unterwegs!). Von einem Restaurant aus sahen wir nämlich zufälligerweise das Flying-Bird-Dance-Ritual, welches äusserst eindrücklich ist.
Los Voladores de Papantla
The flying men of Papantla ist ein prä-spanisches, mexikanisches Ritual, genannt „Totonacas“, ausgeführt von Indígenas aus der Gegend von Veracruz. Fünf Männer nehmen teil, vier fliegende Vogel-Männer (hombres pajaros) und ein Priester (el sacerdote / el chaman). Mit dem Vogeltanz wird der Gott um Regen gebeten (der nota bene in der Nacht zuvor bereits im Massen herunterprasselte – der Regen natürlich). Der 25 Meter lange Pfahl symbolisiert die Verbindung zwischen Erde und Himmel, die vier Stricke die Nabelschnur zu den vier Polen Nord, Ost, Süd, West. Die Giele sind rot-weiss bekleidet, was die Sonne darstellen soll und eben auch Vögel, zudem die Samen, die auf die Erde fallen. Ihre farbigen Hüte repräsentieren den Regenbogen. Der Priester leitet den Tanz ein mit Flöten- und Trommelmusik (Vogelgezwitscher und Stimme der Götter) und die vier Vögel gleiten anschliessend kopfvoran in 13 Runden hinunter auf den Boden. Das sind 4 mal 13 Umdrehungen, das ergibt insgesamt 52. Dies die magische Zahl des aztekischen Kalenders, die Anzahl der Jahre, die’s braucht für einen Sonnendurchgang. – Wem’s davon nicht sturm wird...
Wieder was vom Essen
Anschliessend an den Spektakel spazierten wir noch ein wenig herum, dem Strand entlang, diesmal in südlicher Richtung, und ich fand einen Verkäufer mit meinen heiss geliebten Cocadas, einer Güezispezialität, die ich dann unbedingt zu Hause ausprobieren muss (Kokosnuss, Honig und Vanille), bevor ich Entzugserscheinungen kriege.
Zur Abwechslung haben wir uns zu Hause selber ein Znächtli präpariert und das bei Kerzenlicht auf der Terrasse genossen.
Am Abend vorher assen wir gleich unterhalb des Apartmentblocks, wo wir wohnen, in einem super Restaurant, ein wenig erhöht auf der Terrasse, direkt am Strand und so wild wie das Meer sich gebärdete, schlugen die Wellen manchmal fast bis zu den Tischen hoch. Von der Balustrade aus konnten wir zwei Krebsen zuschauen, gleich unterhalb, die im immer kürzer werdenden Strandabschnitt ständig ihre Löcher, in denen sie wohnten, wieder vom Meerwasser und dem eingespülten Sand befreien mussten. Sie hatten unglaublich viel zu tun, rasten im Querstep hin und her, griffen sich zwischendurch mal kurz an, und wenn das erledigt war, huschten sie wieder in ihr Apartment. Währenddessen erhielten sie von den Gästen im Restaurant stückchenweise Brötchen zugeworfen, was ihren Terminplan wohl vollends durcheinanderbrachte. Mit rasender Geschwindigkeit stürzten sie sich jeweils drauf und transportierten das Brioche in ihre Behausung. - Offenbar sind die beiden bei den Gästen im Restaurant bekannt und eine kleine Attraktion, denn sie haben schon Namen. Jemand fragte mich, wie’s denn heute Oskar und Humphrey gehe.
Wir können es sehr gut aushalten hier, wir haben’s gefunden, das Dolce Vita.
Herrliche Strände gibt es hier in pittoresken Buchten. Die Hauptbucht heisst Bahía Banderas, da muss es ja schön sein. Unsere kleine Bucht heisst Conchas Chinas und gestern und vorgestern fuhren wir mit dem Bus ein wenig weiter südwärts und „probierten“ andere Strände aus. Zuerst La Playa de Mismaloya (den Namen können wir uns gut merken, die Eselsleiter könnte etwa sein: Misbivio oder Missoglio).
In Mismaloya wurde im Jahr 1964 der Film „Die Nacht des Leguan“ gedreht. Vom Filmset sieht man nicht mehr viel, John Huston hat sich beklagt, dass er den Ort Puerto Vallarta mit seinem Film berühmt gemacht hat, aber dass man das Filmset zerfallen liess. Tatsächlich ist nur noch der Bootssteg vorhanden mit dem Pfahl, an dem der Leguan angebunden war/ist, das Restaurant ein wenig oberhalb ist nur noch eine Ruine und der Zugang gesperrt. Und wie aus dem Bilderbuch begegneten uns unterwegs dorthin zwei Leguane. Wir erschraken alle vier, sie blieben wie versteinert stehen, aber ich hatte natürlich sofort meine Kamera zur Hand.
Der Strand ist schön, Theo gefielen die Liegestühle und das Corona-Eiskübeli mit dem Bier drin, in das die hilfreichen Kellner jeweils sofort neues Eis nachfüllten, wenn das alte geschmolzen war.
Kleine Exkurse (Eselsleitern und anderes)
Wir haben über ein Wort gesprochen, das Theo sich schlecht merken kann und er erklärte mir die Eselsleiter, die ihm „hilft“ sich an dieses Wort zu erinnern. Die ist so was von kompliziert, dass ich mir unmöglich vorstellen kann, dass man in nützlicher Frist auf das kommt, was man eigentlich sucht. Nebenbei habe ich noch erfahren, dass er für meinen Namen auch eine Eselsleiter hat… (Die hilft ihm ja auch oft wenig – da gab’s eine Episode zu Hause, die ich Mühe habe zu vergessen: Theo war mit einem Freund von uns am Telefon und ich deutete ihm, ich wolle dann auch noch was sagen. – Kurz vor Ende des Gesprächs erinnerte er sich wieder daran, da ich immer noch am Fuchteln war und er sagte zu Franz: „Z Ding wott o no öppis säge.“).
Das Wort übrigens, das er sich hatte merken wollen, war „la cuchara“ = der Löffel. Am besten könne er es sich mit „Küche“ merken. - „Wie Küche?“, frage ich, „die heisst doch „cocina“. – „Nicht auf Spanisch. Küche auf Berndeutsch, Chuchi“. – „Aber in „cuchara“ kommt überhaupt kein „CH“ vor. Wie kannst du dir’s dann merken?“ – Ja, und so geht das endlos weiter. Jedenfalls versteht der Kellner nicht, dass Theo gerne einen zweiten Löffel hätte zu meinem Dessert. - Da kann ich halt auch nicht helfen.
Apropos Theo: Dass es manchmal mit seinem Gehör nicht zum Besten steht, wissen wir ja alle, aber nun das mit dem Sehen: Als wir gestern auf den Bus warteten und dabei all den scheppernden Autos, die an uns vorbeifuhren, zuschauten, sagte er zu mir: „Das Pferd kann einem schon leidtun auf der holprigen Strasse.“ - „Welches Pferd?“ fragte ich. „Das auf dem Anhänger, der soeben vorbeigefahren ist.“ – Theos Pferdeanhänger war ein Transport von vier mobilen toi-toi-Toilettenkabinen.
Andererseits hat er ganz spezielle Assoziationen manchmal. Am Strand von Guayabitos – wir waren dabei, ins Dorf zu spazieren - überholte uns eine joggende Amerikanerin. „Wie geht’s eigentlich deinem Hexenschuss?“, fragte er mich.
Zurück zum Reisebericht – PV und kleinere Ausflüge
Eigentlich hätte ich heute (Sonntag) nochmals nach Mismaloya fahren wollen, hätte dann Theo im Liegestuhl abgeliefert, dem Kellner übergeben und hätte einen dreistündigen Ritt buchen wollen in die Berge zum anderen Filmset „Predator“ (mit dem kalifornischen Gouverneur in der Hauptrolle). Leider aber regnet‘s wieder mal. Es ist trotzdem 26 Grad warm - wir finden ein anderes Programm. Zum Beispiel Packen.
Gestern fuhren wir weiter mit dem Bus nach Boca, so genannt, weil dort ein Fluss aus den Bergen ins Meer fliesst. Der Strand ist klein, aber es hat Liegestühle und „Corona“, „Pacifico“ und „XX“. Von dort aus kann man mit dem Wassertaxi nach Yelapa fahren, einem idyllischen Ort in einer Bucht ein paar Kilometer südlich, den man aber nicht per Auto, sondern nur per Boot erreichen kann. Das reizte mich mehr, also nichts wie los, das Taxi war schon bereit. Was mich ein wenig beunruhigte, war, dass sich der Bootsmann vor der Abfahrt bekreuzigte. Das Boot flog nur so über die Wellen, schlug hin und wieder hart auf dem Wasser auf, aber nach fast einer halben Stunde Fahrt kamen wir unversehrt am Ufer an. Die Liegestühle schon bereit, der freundliche Kellner Alfonso ebenso. Auch ein Typ mit einem Leguan, der einen fast nötigen wollte, mit dem armen Tier Fotos zu machen. Das mag ich eigentlich gar nicht, aber ja, irgendwie müssen die Leute ja ein wenig zu Geld kommen. - Es hat kaum Touristen, die Liegestühle sind zu zwei Prozent belegt. Der Service aber könnte nicht zuvorkommender sein. Alfonso erklärt uns alles, was man in Yelapa machen kann - nicht viel, aber man kann zum Wasserfall spazieren, Pferde mieten und irgendwo wird sogar noch Paragliding angeboten. Die Plakate sind schon ziemlich vergilbt, wer weiss, ob da überhauupt noch was läuft. Die Pferde sahen wir angebunden hinter dem Restaurant auf allfällige Reiter warten. Etwa dreissig Tiere standen parat, bereits gesattelt, niemand wollte aber reiten gehen.
Erst mal entschlossen wir uns, das Dorf anzuschauen und zum Wasserfall zu spazieren. Alfonso reservierte uns die Liegestühle (schwierig bei dem Andrang) und versprach, auf unsere Sachen aufzupassen. Der Weg schlängelt sich durch die Häuser am Hang zum Wasserfall hinauf. Erst musste aber ein kleines Flussdelta durchquert werden (keine zehn Meter breit), aber das ging nicht, ohne bis zur Hüfte nass zu werden. Ein alter Fischer war für die Passage zuständig. Er sass dort und lachte, wenn er den paar Touristen zusah, die’s ohne seine Hilfe versuchten. Erst reichte einem das Wasser bis zu den Knöcheln, dann aber wurde es eben doch ein wenig tiefer und es hatte Strömung. Mit der Kamera wollten wir die Überquerung lieber nicht riskieren und „heuerten“ gleich den Bootsmann an. Es war wirklich lustig: Er begab sich nicht mal ins Boot hinein, liess nur uns einsteigen und zog das Boot hinüber, er bis zum Bauch im Wasser. 80 Rp. kostete das Vergnügen.
Der Wasserfall ist nicht spektakulär, das hatte ich vermutet, aber mir gefiel der Walk dorthin trotzdem. Theo wusste schon von vornherein, dass es da nicht viel zu sehen geben würde, er wäre nämlich lieber gleich in Boca im Liegestuhl geblieben oder dann zumindest hier in Yelapa am Strand. Sein Argument war: „In der Schweiz haben wir viel schönere Wasserfälle.“ Dabei war’s ein hübscher Spaziergang durch das Dorf, das keine Strassen hat, weil’s ja auch gar keine Autos gibt. Wunderschöne Aussichten auf die kleine Bucht kann man immer wieder geniessen. – Unterwegs trafen wir einen älteren Mann, der uns erzählte, er gehöre zur zweiten Generation von Einwohnern, die sich hier niedergelassen hätten, und erst seit acht Jahren gäbe es Strom und eben auch Licht, und die Wege seien einigermassen gangbar gemacht worden. Auf die Frage, ob er diese Neuerungen schätze, bejahte er vehement, was mich eigentlich erstaunte. - Es gibt jetzt auch ein paar wenige Hotels im Ort, aber alle sehr einfach, gut in die Gegend eingepasst, die zum Verweilen einladen. So zwei, drei Tage könnte man es hier sehr gut aushalten, finde ich. - Auf dem Rückweg zum Strand schlugen wir eine andere Route ein, wir wateten weiter hinten durch den Fluss, der ins Meer mündet und auf der anderen Seite hatte es plötzlich eine Ansammlung von schwarzen Vögeln, es sah aus, als ob die Geier schon auf uns warteten. Die Vögel heissen Zopilotes. Im Internet hab ich gelesen, dass sie sich von Kleintieren ernähren und zu den wenigen Vögeln gehören mit ausgezeichnetem Geruchssinn. Sie hatten offenbar gemerkt, dass ein Garza Blanca (ein Fischreiher) sich eine Mahlzeit geangelt hatte, und gleich in Horden galt es nun, diesem die Beute zu entreissen.
Zurück am Strand genossen wir das Verwöhnungsprogramm im Restaurant; es ist extrem, wie nett, zuvorkommend und freundlich alle Leute hier sind. Ein feines Essen hatten wir auch - was will man mehr...
Unser Wasser-Taxi holte uns später wieder ab, pünktlich um halb vier. Es hielt mit dem Bug voran, normalerweise machen sie das umgekehrt, damit es einfacher ist zum Einsteigen. Wir waren alle schon drin, da kam ein älteres, mexikanisches Ehepaar. Er schaffte den Einstig auch, aber sie hatte Mühe. Junge, starke Männer waren gefragt. Theo in seiner spontanen hilfreichen Art stellte sich sofort zur Verfügung und auch zwei wirklich junge Männer halfen beim Hereinhieven mit. Die Dame durfte Theo den Arm um die Schulter legen, und einer der Jungen hielt sie beherzt hoch und ruck zuck schob/warf/hievte er sie wie einen Zuckersack mit Schwung über den Bootsrand ins Schiff. - Eine filmreife Szene! Ich hätte sie problemlos fotografieren können, ich sass direkt gegenüber, Kamera parat wie ein Paparazzi, aber ich hielt mich nicht dafür. Der Kommentar des Kanadiers hinter mir war: „There’s no way to do it gracefully, but at least it’s done.” – Ich dachte mir, wie wird’s wohl sein beim Aussteigen? - Das Boot landete diesmal gleich von Anfang an mit dem Heck voran, so dass das ganze Drama nicht wiederholt zu werden brauchte. Jedoch Theo, der junge Spund, blieb ganz gentlemanlike bis zuletzt im Boot, falls seine Hilfe doch noch gebraucht werden würde.
Ein Schläfchen im Liegestuhl hatte er sich danach verdient, und ich eine Piña Colada.
Ich sah die längste Zeit einem Fischer zu. Die Fischerei hier ist ziemlich anders als wie wir das von Spanien gewohnt sind, wo die ganze Rosas-Armada fast täglich ausläuft, das Meer völlig ausfischt und die eigene Existenz wohl gleich damit.
Hier scheinen die Fischer nur rauszufahren, wenn’s nötig ist. Es gibt jeden Tag frischen Fisch und feine Camarones, aber nirgends werden die Fische in Massen angeboten. Es sind nur einzelne Fischerboote, die unterwegs sind, einzelne Fischer, die vom Ufer beziehungsweise von einem Felsvorsprung aus ihre Angel ins Wasser werfen. – Der Angler, dem ich zuschaute, hatte eine andere Methode. Er war mit seinem Netz bis zu den Schultern im Wasser und warf es alle paar Minuten immer wieder in ebenmässigem Bogen vor sich hin. Er war schon dort, als wir ankamen, eine Stunde später noch immer. Sehr erfolgreich kann seine Arbeitsweise nicht sein: Wenn ich richtig beobachtete, fing er nicht einen einzigen Fisch während der ganzen Zeit. Wo hätte er ihn auch hintun wollen, er hatte ausser dem Netz nichts dabei.
Am Abend assen wir wieder in der Stadt, im Strand-Restaurant „Daiquiri Dick’s“ und so fein wie dort habe ich schon lange nicht mehr gegessen, obwohl wir eigentlich immer gute Restaurants finden. Ich kam aus dem Ah und Oh gar nicht mehr raus. Tacos mit Shrimps und grünen Spargeln, Sauce Hollandaise, Kartoffelstock und Guacamole. – Espresso, Grappa und für mich Cappuccino gab’s dann bei Michel Ferrari, einem jungen Schweizer, der seit zwei Jahren ein Restaurant in Puerto Vallarta führt. Bei ihm haben wir kürzlich mal gegessen. Sehr gut. Aber seine Preise nota bene sind nicht mexikanisch.
Vorgestern waren wir übrigens am Filmfestival. Nicht zu vergleichen mit Locarno. Die Webpage ist auch so schlecht konzipiert, dass wir den Ort, wo der Event stattfand, am ersten Abend gar nicht fanden und niemand konnte uns Auskunft geben. Auch wusste ich nicht, ob man Tickets im Vornherein kaufen musste, wo und wieviel die kosten etc. Michel konnte uns dann weiterhelfen, wir fanden den Cinépark in einem Einkaufszentrum und „zogen uns einen Film rein“. Aber es war ein ganz normaler Kinoabend, Billet lösen (4 Fr.) und das war’s dann auch. Von Festival und dergleichen war nichts zu sehen, ausser ein paar netten, adrett gekleideten Girls, die beim Eingang standen und den drei geladenen Gästen irgendwas überreichten, wohl einen freien Eintritt oder so. Offenbar findet das Drum-Herum eher in den tollen Hotels statt, wo Partys veranstaltet werden im Beisein von ein paar Filmleuten. Aber was dann am eigentlichen Ort des Geschehens läuft, nämlich dort, wo die Kinos sind, ist mehr oder weniger tote Hose. Wenn ich vorhin erwähnte ‚drei‘ Gäste, dann ist das gar nicht so sehr daneben. Es waren kaum mehr als zwanzig Personen im Saal. So schrieb ich dem Direktor des Festivals eine Email mit ein paar Tipps und Fragen. Er bedankte sich dafür und trug mir auf, wenn wir wieder in der Schweiz seien, Herrn Polanski ein paar Grüsse auszurichten…
Der nördliche Teil von Puerto Vallarta, die Hotelzone Nord, ist völlig anders als der gemütliche, lebhafte, südliche Teil von Vallarta Vieja (fast wie Empuria Brava von Rosas aus gesehen). Überhaupt nicht aamächelig. Da stehen sie alle, die Sherada, Ramaton, Holidott und Marri Inn. Dort befindet sich auch der Hafen und jeden Tag kommt ein anderes Kreuzfahrtschiff und bringt Passagiere.
Völlig anders geht’s zu und her im Städtchen. Ein riesiges Volksfest ist jeden Abend im Gang. Einige Strassen rund um die Kathedrale sind abgesperrt und zahlreiche verschiedene Essstände sind aufgestellt, ein fröhliches Miteinander findet statt (vorwiegend mexikanische Bevölkerung). Man plaudert, isst und schaut den Umzügen zu. Jetzt ist die Zeit der Prozessionen und abends während sicher etwa zwei Stunden wandern ganze Völkerscharen zur Kirche. Es sind Berufsgruppen, die dort empfangen werden. Zum Beispiel sahen wir die „Zunft“ der Spitalangestellten. Die kamen gleich mit einem Krankenwagen mit Blaulicht, der im Umzug mitfuhr. Eine Mariachiband war auch dabei und zahlreiche Krankenschwestern und -brüder. Den ganzen Spektakel konnten wir wie von einer Loge aus mitverfolgen von der Terrasse im ersten Stock des Restaurants „Omelet“ aus direkt gegenüber der Kathedrale.
Letzter Tag in Puerto Vallarta
Unser letzter Tag sah anders aus, als ich mir das vorgestellt hatte. Es war regnerisch, so machten wir einen letzten Spaziergang in die Stadt. Ein paar Tage zuvor hatten wir in einer Galerie Jim Demetro kennengelernt, einen Amerikaner, von dem eine der Skulpturen stammt, die entlang des Malecón aufgestellt sind, nämlich „Los Bailarines de Vallarta“. - Er hatte uns eingeladen, bei ihm vorbeizuschauen, falls wir Lust hätten, und genau dieses Programm hätte ich nun gerne „eingeschaltet“, da’s ja nicht unbedingt ein Strandtag war (zu viele Wolken für meinen Geschmack). Aber ich fand Jim’s Visitenkarte nicht mehr, konnte ihn also nicht erreichen. – Schade.
Wir setzten uns ein letztes Mal für längere Zeit in ein Strandrestaurant, bestellten uns etwas zu essen, was hervorragend war, und liessen uns anschliessend das eine oder andere von einem Strandverkäufer andrehen. Ich kaufte einen kleinen handgewobenen Teppich (wir haben ja noch so viel Platz im Koffer). Natürlich muss man märten und alle haben Freude, wenn man das auf Spanisch macht. Aus diesem Grund, so sagte der Verkäufer, lasse er mir den Teppich für einen sehr günstigen Preis (so hat sich wenigstens ein Teil meiner Spanisch-lern-Investitionen ausbezahlt). Zehn Minuten später kam er zurück und erzählte mir strahlend, wie zu einem Kumpel, er habe grad denselben Teppich für den dreifachen Preis einer Amerikanerin verkaufen können. - Und das Geldausgeben am Strand fand seine Fortsetzung:
Theos Tattoo
… ist ein Delphin. Ich fand, er solle sich eines machen lassen, wenn auch nur, um die Kinder zu schocken. Ok, ok, so leicht lassen sie sich nicht mehr erschrecken und natürlich ist’s nicht ein richtiges mit Nadel und Schmerz und lebenslänglich und so. Es ist eines von denen, die die Strandverkäufer anbieten, das mit hartnäckiger schwarzer Farbe auf die Haut appliziert wird und das, wenn man sich an der Stelle möglichst nicht wäscht, etwa vierzehn Tage lang bestehen bleibt. – Bis wir in Bivio sind, wird’s längstens verbleicht sein.
Noch immer sitzen wir am Strand und sehen den Wellen zu. - Und wer spaziert da am Strand entlang, vor unserem Tischchen durch, mitten in meinen Teppichverhandlungen? – Jim. – So ein Zufall. Er wohnt gerade „um die Ecke“ und so konnte also doch auch dieser Programmpunkt abgehäkelt werden. Er lud uns auf ein Glas Wein ein und zeigte uns seinen Katalog und etliche seiner Skulpturen, die in Miniatur in seiner Wohnung stehen. Eine davon steht übrigens auch in Lisas Apartment, in dem wir zurzeit wohnen, auf dem Tisch.
Ja, und da war’s Zeit zum Abreisen. Um sieben Uhr abends holte uns ein Taxi ab und brachte uns auf den Flughafen. Der späte Flug (21.45 – 23.10) brachte nur Vorteile: Wir hatten den ganzen Tag noch für uns, kaum Leute an beiden Flughäfen, rasche Abfertigung, Abflug und Landung pünktlich, und so schafften wir es, noch vor Mitternacht bei unseren lieben Gastgebern, den Shapiros, in Mexico City anzukommen.
Letzter gemeinsamer Tag in DF (Mexico City)
Gestern, an Theos letztem Tag, machten wir als Erstes einen Spaziergang durch das bunte, lebhafte Viertel Zona Rosa, entdeckten auch ein Schweizer Restaurant, in dem man nebst Fondue auch Bratwurst mit Rösti haben kann. Rossignol Skis stehen parat bei der Eingangstür, Föteli vom Matterhorn und den Bernhardinerhunden sind im Schaufenster zu sehen, so wie man sich das eben vorstellt. In Anbetracht der Tatsache, dass wir in ein paar Tagen zurück in unserem schmucken Land sein würden, wo die Skis auch schon parat stehen, konnten wir erfolgreich der Versuchung wiederstehen einzukehren und irgendetwas estilo suizo zu bestellen.
Stattdessen verleibten wir uns im Hotel Majestic auf der Terrasse im siebenten Stock ein Mittagsmenu mit vier Gängen für acht Franken ein (ich hätte auch schreiben können: verzehrten wir…; man soll ja nicht immer dieselben langweiligen Wörter gebrauchen beim Schreiben, hab ich gelernt), und das mit einmaligem Blick auf den Zócalo, den Hauptplatz der Stadt. Wir erkannten ihn kaum wieder. Als wir Ende Oktober dort waren, hatte es politische Demonstrationen, Polizei, Megafone, Menschenmassen. - Jetzt eine Kunsteisbahn für Gross und Klein zum Schlittschuhlaufen (bei 26 Grad!), eine Art Bob-Schlitten-Bahn und eine Rutschbahn aus Schnee für Kinder. In einem der Zelte können die Niños mit künstlichem Schnee Schneemänner formen. Klar, hier schneit es so gut wie nie, so muss die kalte weisse Masse eben ein Erlebnis sein (kleiner Vorgeschmack für Bivio). - Und alles gratis. - Zum Zuschauen ist’s wunderbar. - Der Energieverschleiss für diese Freude muss allerdings beachtlich sein. - Ob das Geld nicht besser ausgegeben werden könnte?
Templo Mayor
Nach den Essen besuchten wir den Templo Mayor, die grosse Tempelanlage neben der Kathedrale, im Herzen der Stadt. Die Spanier hatten, wie das offenbar ihr Hobby war, in ihrer grenzenlosen Arroganz und Unkenntnis, den Tempel zerstört und die neue Stadt an dessen Stelle erbaut. Nun ist dieser Tempel aber ein ganz spezieller Bau, eigentlich sind beziehungsweise waren es sieben Tempel, die übereinander gebaut worden waren, jeder eine Erweiterung und Vergösserung des vorhergehenden. Diese Bauweise hatte verschiedene Gründe, einer davon war, dass der Boden praktisch überall in der Stadt schlammig ist, weil vorher das ganze Plateau ein See war und etliche Gebäude daher mehr oder weniger stark einsinken (der Palacio de Bellas Artes beispielsweise sank anfangs 20stes Jahrhundert, als er erbaut wurde, gleich um vier Meter ein). – Zurück zu den Tempeln: Was die Spanier ab 1521 sahen und zerstörten, war nur der oberste, nämlich der neueste Tempel, und dass sich weitere sechs Schichten darunter verbargen, haben sie gar nicht bemerkt. Vor dreissig Jahren nun hat man mit Ausgrabungen begonnen und was da alles zum Vorschein kam, war und ist natürlich gewaltig. Allerdings wurde nur ein kleiner Teil der alten Stadt Tenochtitlan ausgegraben. Was klar ist, ist die Tatsache, dass an manchem Ort unter der heutigen Stadt weitere archäologisch hoch interessante Gebäude und Skulpturen vorhanden sind. Wollte man sie ausgraben, müsste man die halbe oberste Schicht zuerst wegräumen, wohl auch die Kathedrale.
Namen
Die Erwähnung dieser alten Funde gibt mir die Gelegenheit, nochmals ein paar Namen zu nennen, die mir ja immer so gut gefallen: Die Legende der Göttin Coyalxauhiqui wird oft erwähnt, deren Bildnis man an diversen Orten in Ausgrabungsstätte findet. Sie hatte ihre Mutter ermorden lassen wollen, fand sich dann jedoch selber in sechs Teilen wieder (Kopf ab, Arme und Beine ebenfalls) – so wird sie auch verschiedentlich dargestellt. Ihr Bruder ist der Tlaltecuhtli, und der Dios del Fuego hat auch so einen „easy to remember name“, er heisst: Xiuhtecuhtli oder Huehueteótl (fast ein wenig theoähnlich – Kommt mir grad in den Sinn: Wenn immer er mir in Zukunft „Isabeu“ sagt, könnte ich ihn Theotl nennen).
Letzter gemeinsamer Abend
Unseren letzten gemeinsamen Abend in Mexiko verbrachten wir zusammen mit der Familie Shapiro. Wir luden sie zum Essen ein in ein spitzengutes Restaurant (diesmal Schweizerpriese) und konnten uns so ein wenig für all das revanchieren, was sie uns zuliebe getan hatten. Sie schenkten uns dafür noch ein Buch über Mexiko City, das etwa 5 kg wiegt, oder so kam’s mir jedenfalls vor. Nachdem wir so oder so schon Probleme haben mit all unseren Gepäckmassen und Prospekte und auch Zettel weggeworfen haben, nur damit das Ganze ein wenig leichter wird – und jetzt auch das noch. Es ist ja eine äusserst liebenswürdige Geste, aber wenn ich dran denke, dass Theo schon so oder so viele ‚gewichtige‘ Bücher bei sich hat (er liebt Kunstkataloge, denen kann er nicht wiederstehen, je schwerer desto lieber), dann ….
Mein letzter Tag in DF (Die Mexikaner nennen ihre Stadt DF (Districto Federal), niemand spricht hier von Mexico City oder Mexico ciudad).
Ja, die schönen Tage von Mehico (wer Mexico mit „X“ ausspricht, wird von jedermann unverzüglich korrigiert) sind vorbei. Morgen geht’s weiter nach Miami. Jetzt, wo ich das schreibe, sitzt Theo im Flugzeug nach Zürich. Es war und ist ein langer Tag für ihn. Schon seit einiger Zeit hatte er gejammert in Erwartung seines unausweichlichen Schicksals. Er musste nämlich heute Morgen bereits um halb sieben aufstehen, es war noch dunkel, als der Wecker läutete. Völlig neue Erfahrung! Das Taxi war pünktlich um sieben vor der Tür und da staunte mein lieber Ehemann schon sehr, als er sah, dass die jüngere der beiden Haushälterinnen bereits dabei war, die Autos auf Hochglanz zu polieren. Um diese Zeit! - Solche Anblicke machen ziemlich kleinlaut.
Spaziergang in Coyacán / Museo Frida Kahlo
Da ich auch früh auf war, nutzte ich die Zeit und machte eine Tour in den Süden der Stadt mit Bus und Metro in einen sehr schönen und völlig ruhigen Stadtteil, Coyacán. Ich spazierte durch einen ziemlich grossen Park, genannt Viveros, der im Grunde genommen eine riesige Gärtnerei beziehungsweise Plantage ist, wo Grünpflanzen, vor allem Bäume, gezogen werden. Ein ganzes Netz von Wegen zieht sich durch den Park hindurch und dies wiederum ist ein einziger Jogging- und Vitaparcours, ein kleines Paradies für Bewegungsfreudige. Ich war die Einzige, die gemütlich spazierte, immer wieder keuchten schweisstriefende, sportlich Begabte an mir vorbei. Anders als in der Schweiz: DF-Jogger tragen nicht diese farbigen Kleider sämtlicher wichtigen Sportmarken, die bei uns üblich sind mit all dem, was da noch mit angehängt wird, sie sind bekleidet mit „normalen“ Trainern oder T-Shirts. Vielleicht ist dies der Grund, dass ich bei den meisten, die mich überholten, das Gefühl hatte, sie brechen gleich zusammen oder stehen (bzw. rennen) kurz davor. Die Nichtsportbekleidung ist halt wahrscheinlich weniger atmungsaktiv, das Fasergemisch nicht ganz so ausgeklügelt und ohne Musik, Kilometerzähler und angeschnalltes Getränk geht’s wohl nicht so ring. Die Bekleidung ist auch weniger körperbetont, aber das hat mich im Speziellen gar nicht gestört. – Auf jeden Fall war’s ein angenehmer Spaziergang, ein wenig kühler im Schatten der Bäume als auf der Strasse und vor allem hatte ich zum ersten Mal wieder das Gefühl, reine Luft zu atmen. Es ist übrigens verboten, im Park zu essen, zu trinken, Blumen und Pflanzen zu stehlen und Fotos zu machen. - Mein Weg führte mich dann weiter durch Strassen, die wie früher nur aus Steinen und dazwischen aufgeschütteter Erde bestehen, vorbei an schönen Häusern (sofern man die sehen kann, denn so gut wie alle sind hinter hohen Mauern versteckt) und immer wieder mal an kleineren Parkanlagen und farbigen In- und Outdoor-Märkten. Keine Hektik, (fast) keine verbeulten Autos.
In dieser Gegend haben Frieda Kahlo und Diego Rivera gewohnt und Trotzki hatte bei ihnen Asyl erhalten. Ihre „Casa azul“, in der sie während 25 Jahren zusammen gemalt, gelebt, geliebt und sich gestritten hatten, ist ein Museum und war mein Ziel am Vormittag. Ein wunderschönes, gemütliches, grosses Zuhause mit malerischem Garten, eine traurige Geschichte, viele Bilder, Fotos und Einrichtungsgegenstände zum Besichtigen.
Im Zentrum
Von dort aus nahm ich wieder einen Bus (Mikrobus heisst der Kleinbus hier) und dann die viel schnellere Metro ins Zentrum (eine Fahrt, wohin auch immer, kostet 15 Rp.!)
Mein zweites Ziel war der Palacio de Bellas Artes, ein einzigartiger Jugendstilbau, der als Theater dient und riesige Wandmalereien von Rivera und anderen Künstlern beherbergt. Dieser Besuch war ebenfalls ein eindrückliches Erlebnis. Gleichzeitung fand auch eine Sonderausstellung von Pedro Friedeberg statt, einem mexikanischen Künstler, Architekten und Designer, dessen Werk mir ausserordentlich gut gefällt.
Meine letzten Peseten kratzte ich dann zusammen und leistete mir in der Nähe des Zócalo für 10 Franken eine wunderbare Sushimahlzeit (japanisches Essen in Mexiko - sogar der Kellner sprach mich darauf an und ich entschuldigte mich noch fast), ein Mineral mit Blöterli und zum Dessert meine letzte Piña Colada in diesem Land, bevor ich mich ins unglaubliche Verkehrsgestürm begeben musste (es gibt grosse Kreisel, in denen plötzlich auch von links Verkehr hineinströmt und das gleich auf drei Bahnen; kein Wunder, läuft dann plötzlich gar nichts mehr), auf den Weg „nach Hause“, Lomas de Chapultepec (das heisst in der Nauatl-Sprache auf den Höigümperhügel) zu den liebenswürdigen Gastgebern, den Shapiros.
Abflug
Der nächste Morgen verlief ungefähr gleich wie derjenige von Theo am Vortag: Meine Abreise stand auf dem Programm. Die junge Dame war bereits wieder am Autoputzen, als ich das Haus um sieben verliess. Weil man nie weiss, ob die Fahrt zum Flugplatz zwanzig Minuten dauert oder zwei Stunden, ist’s eben besser, zeitig loszufahren. Um halb acht war ich bereits am Ziel, fix fertig eingechecked und reisebereit. Dreieinhalb Stunden später war Take Off. Bei Tag über die Stadt zu fliegen, ist eindrücklich: Man startet mitten im Zentrum, sieht also die riesige Ebene mit endlosen Strassen, quadratisch angelegt, am Horizont eine dichte, breite, gelb-braune Schicht aus Abgasen, darüber der wunderbare, tiefblaue Himmel.
Das Flugzeug machte eine Zwischenlandung in Cancun und sämtliche Passagiere mussten aussteigen, erneut durch zwei Gepäck-Kontrollen durch (elektronische und menschliche Handtaschendurchnuscherin), nur um wieder ins gleiche Flugi einzusteigen und sich auf denselben Platz neben dieselben Passagiere zu setzen. Das Ganze dauerte eine Stunde und niemandem hat der Sinn der Sache eingeleuchtet, Mexicana hat sich zwar für die Verspätung entschuldigt, aber eine einleuchtende Erklärung blieb sie schuldig.
Miami
Ja, und jetzt bin ich eben in den Estados Unidos, aufs herzlichste aufgenommen von Liza und Urs Lindenmann, in ihrem schönen Haus in vornehmer Gegend im südlichen Teil von Miami. Schon am ersten Abend machten sie mit mir eine Stadtrundfahrt, es gab Hamburger an einem der Yachthäfen, einen Schlummertrunk („one for the road“, für mich schon wieder eine Piña Colada; ich kann’s einfach nicht lassen) auf Key Biscayne mit herrlichem Blick auf die nächtliche Skyline von Miami downtown und heute Morgen fuhr mich Urs vorbei an prächtigen „Einfamilienhäusern“ (viele zum Verkauf angeboten) ins nächst gelegene „Dorf“ zum Frühstückeinkaufen. – Endlich gibt’s meine feinen English Muffins wieder. Dazu Philadelphia Frischkäse und Grapefruitsaft.
Übers Wochenende müssen Liza und Urs beide einen Weiterbildung in Naples besuchen, und sie haben mir Haus und Hof, nein, Haus und Auto und Swimmingpool anvertraut, mir noch alles gezeigt und erklärt, was ich tun kann, wo ich hin kann, wo welcher Strand ist, wem ich telefonieren kann, wenn ich Probleme habe, welche Shoppingcenters in der Nähe sind, in der Hoffnung, dass ich in ihrer Abwesenheit nicht etwa den Hungertod erleide oder gar an Langweile eingehe. Fürsorglicher geht’s nicht. Aber das sind wir uns ja schon von Shapiros gewohnt. Wie wird das sein, wenn ich wieder zu Hause bin?
Die letzte Woche war also der krönende Abschluss meiner Reise. Von Liza und Urs wurde ich verwöhnt nach Strich und Faden, jeder Wunsch wurde mir von den Augen abgelesen.
Liza überliess mir in ihrer Abwesenheit ihr Auto, und wenn sie Zeit hatte, fuhr sie mich von Shoppingmall zu Shoppingmall um all das, was ich noch „brauchte“, ohne Zeitverlust und sehr effizient einzukaufen. Sie brachte mir meine Kamera in den Park, die ich zu Hause vergessen hatte, sie fand, vielleicht sei der Pool zu kühl für mich (27 Grad), man könne ihn gerne ein wenig aufheizen…
Urs bereitet das Frühstück zu, während ich sein Büro und den PC mit Beschlag belege. Die beiden nehmen mich mit zu einem Empfang des argentinischen Botschafters, im Biltmore Hotel mit dem ehemals grössten Pool in den USA („the world-famous Biltmore pool“ - wahrlich riesige Ausmasse). Alles muss das Grösste sein, das Höchste, was auch immer für ein Superlativ. Einfamilienhäuser sind wie Schulhäuser, Shoppingcenter wie Dörfer, Hochhäuser wie Hochhäuser, Hotellobbys wie Turnhallen, Kaffeetassen wie Wasserkrüge während bei uns: bescheidene Auobahnen, Moccatässli, jö, der süsse, kleine Kühlschrank, Küchen wie in der Bäbistube. Und so sind auch die Steaks, die Urs für sich und „seine beiden Weiber“ an einem Abend zubereitet, von uneuropäischer Grösse. Offenbar sind auch die Rinder hier gewöhnt, grössere Steaks zu liefern als bei uns, weil sich das im Land der unbegrenzten Möglichkeiten so gehört.
Am Wochenende, als Liza und Urs in Naples waren, ging ich nach South Beach. Dort ist immer etwas los. Der Strand, die Promenade und die Cafés und Restaurants sind bevölkert; es hat Musik, tolle Schlitten kurven herum, fast wie vor Jahren bei uns am Bärenplatz vor der „Front“, am Sonntag sogar eine Militärausstellung mit Jeeps und Zelten aus dem zweiten Weltkrieg.
Am selben Tag traf ich Jim Shenkman dort zum Mittagessen, einen Freund aus Kanada, der zufälligerweise zur selben Zeit in Miami war, weil seine Eltern dort leben und sein Vater tags zuvor operiert werden musste. Vor 37 Jahren hat mich Jim im Zug zwischen Interlaken und Bern angesprochen und seit dieser Zeit sind wir befreundet. Unsere Familien haben sich immer wieder mal getroffen, in Toronto, in Südfrankreich, Ittigen oder Bivio. Ihn zu treffen, hat Spass gemacht, und gab uns Gelegenheit, Familiennews auszutauschen.
Der Strand in South Beach ist meilenlang, es hat ziemliche Wellen aber dummerweise auch Quallen. Bläuliche. So musste ich aufpassen wie eine Häftlimacherin, um ihnen nicht zu nahe zu kommen.
Apropos Nähe: Ich legte mich in den Sand und las ein wenig in meinem Buch. Ich muss dann eingedöst sein. Links von mir, nur wenige Meter entfernt, sah ich eine kleine Gruppe von Leuten herumstehen, darunter zwei spindeldürren Models, die instruiert wurden, wie sie sich im Sand hinzulegen hatten. Die Fotografen, die die beiden ablichteten, standen etwas abseits von mir, ich war also irgendwie im Weg und konnte daher den Gedanken nicht ganz loswerden, als wäre ich eventuell sogar mit auf dem Foto, sozusagen als Gegensatz zu den beiden Spargeln.
Heute war ich im Fairchild Tropical Botanic Garden, dem grössten Garten dieser Art in den USA. Er ist sehr schön angelegt, ein riesiger Park, 83 Acres gross, wie viel das auch immer ist, es hat, laut Prospekt, 28‘000 Bäume und Blumen. Auch die Kunst kommt nicht zu kurz. Skulpturen sind an manchen Stellen im Park zu sehen, Blumen aus Glas, Gorillas aus Metall, das Nessi im See und die fliegepilzartigen Ballone stammen von einer japanischen Künstlerin, die einzige lebende Künstlerin, die mehr als 5 Millionen Dollar für eines ihrer Kunstwerke erhielt.
Das Schöne am Park ist unter anderem, dass man sich nicht an die Wege halten muss, man kann überall durch den Rasen gehen, es hat zur Abwechslung mal keine Verbotsplakate. Zudem ist er gleich neben dem Grundstück von Lindenmanns gelegen, also zu Fuss erreichbar. Im Park hat’s ein Tram beziehungsweise eine Art offener Bus mit dem man eine stündige Tour machen kann.
Der Park ist ein El Dorado für Leguane und Eidechsen, die überall im Park herumflitzen, ebenso für Pensionierte, die an vielen Weggabelungen stehen und über die Pflanzen informieren; sie fahren auch die Busse. Der Buschauffeur sagte, er sei einer von 500 freiwilligen Mitarbeitern dieser Gattung.
Nachdem ich alle Bäume und Blumen fotografiert hatte, spazierte ich heim, ein kleiner Schwumm im Pool, ein letztes sommerliches Nachtessen, wunderbar zubereitet von Urs, dann brachte er mich zum Flughafen und elf Stunden später war ich zurück in der geliebten, aber kalten Schweiz.
Wieder zu Hause
Inzwischen sind wir beide wieder daheim. Den Kulturschock von Mexico nach USA könnte man symbolisch mit den Autos darstellen, die ja eines meiner Lieblingssujet waren: von schrottreif auf Hochglanz poliert. Der Wechsel von Miami nach CH von grün und blau nach weiss und grau, von 35 Grad zu minus 4 (Bivio minus 19), von Klimaanlage zu Heizungen. Nur gerade Starbucks bietet dasselbe, Cappuccino tall, grande, venti, nur nicht zum selben Preis.
Und was für eine Überraschung: Unser Haus erkennen wir kaum wieder. Diego und Gino haben in unserer Abwesenheit fast den ganzen Wohnbereich renoviert. Neuer Anstrich an Wänden und Decken, ebenso jede Türe frisch gestrichen, neue Böden im Esszimmer, im Gang, im Schlafzimmer und auf den Treppen. Es ist fantastisch. Das wieder Einräumen allerdings weniger, aber das nehmen wir gerne in Kauf.
Trotz der Kälte ist es schön, wieder daheim zu sein, Freunde zu treffen oder zumindest mit ihnen zu telefonieren, ein Stündchen Tennis zu spielen, das feine Weihnachtsapéro in der Schule nicht zu verpassen, zu erleben, dass meine 98-jährige Mutter mich noch erkennt und sich freut, mich zu sehen, vorgezogene Weihnachten zu feiern mit der Familie - am 19ten Dezember, weil ja nachher Bivio Trumpf ist und man („man“ sind vor allem Gino und ich) nicht künstlich aufs Fest warten will. Schliesslich ist ja die Hauptsache, die Familie trifft sich und verbringt einen friedlichen, schönen Abend zusammen beim traditionellen Weihnachtsessen (Bernerplatte seit Menschengedenken). Und es sind (waren) weisse Weihnachten, was alle, die am 24sten im Unterland feiern werden, wohl nicht erleben.
Inzwischen hat Theo endgültig seine gelbe Badehose mit dem blauen Skihelm ausgetauscht. Das heisst, wir sind in Bivio angekommen und haben sogar schon unsere erste Skiabfahrt hinter uns. Der Schnee ist wunderbar, das Haus schön warm, die Gedanken hängen noch dem Erlebten nach, der letzte Teil des Berichts ist zu Ende.
Das Jahr 2011
Noch zwei Jahre bis zur vorzeitigen Pensionierung. Da muss das Hobby langsam aber sicher ausgeweitet werden, damit ich dann nicht in das viel zitierte und befürchtete „Loch“ fallen würde, in das Senioren ja unweigerlich fallen, wenn sie nicht mehr ihrer gewohnten Arbeitsrutine nachgehen. - Nicht dass ich eine einzige Sekunde an diese dunkle Perspektive geglaubt hätte, aber noch ein wenig mehr reisen als bisher, dagegen hatte ich überhaupt nichts. Also: ein paar Tage ins Tennishotel im Allgäu, im April eine Studienwoche in Andalusien mit dem bsd.-Kollegium, anschliessend ein Haustausch in Paris. Im Juli eine Woche London (grosse Feier zum 30. Geburtstag der Zwillinge mit Familie und Freunden in einem Rooftop-Restaurant, „Kensington Roof Gardens“). Kurz darauf hatte ich ein verlockendes Angebot gefunden im Internet: Flug nach New York und Rückfahrt mit der „Queen Mary 2“ nach Hamburg. Kurz entschlossen buchte ich die Reise und Theo, der erst grosse Bedenken gehabt hatte (kaum Zeit zum Packen etc. etc.), willigte schliesslich ein. Nur grad drei Tage blieben uns in New York, wo wir bei Dany, Kays Götti, übernachten durften, dann fuhr der Transatlantikliner ab. – Grossartig, in dieser Riesenmetropole bei schönstem Wetter loszulegen, zu beobachten, wie die Freiheitsstatue kleiner und kleiner wird, die Insel Manhattan allmählich im Dunst verschwindet. Zehn Tage dauerte die Reise, immer auf See, nie Land in Sicht. Hin und wieder Lautsprecherdurchsagen, die über die Distanz zum Ort der Havarie der Titanic hinwiesen.
Wunderbar waren diese Tage. Keine Minute war uns langweilig. Aus unbekannten Gründen wurden wir „upgegraded“, konnten unsere Malzeiten in einem speziellen und exklusiven Raum einnehmen, wo’s nur einen Service gab und man am Abend somit kommen und gehen konnte, wann man wollte. Dort kamen wir mit sehr netten Leuten in Kontakt, mit denen wir noch immer in Verbindung stehen. Besser hätte es uns nicht gehen können.
Was mir besonders gefiel, war, dass wir einmal erleben konnten, wie gross die Distanz von Erdteil zu Erdteil tatsächlich ist. Mit dem Flugzeug ist man in sechs Stunden „drüben“, mit dem Schiff geht das gemächlich. – Was mir weniger gefiel: An jedem Tag „verloren“ wir wegen der Zeitzonen eine Stunde, und diese fehlte uns tatsächlich. 23-Stunden-Tage – weniger Schlaf für Theo – ein Riesenproblem...
Unvergesslich bleibt auch die Ankunft der Queen Mary in Hamburg. Begrüsst von einer riesigen Menge von Leuten, die den Ankömmlingen zujubelten, glitt das Riesenschiff ruhig in den Hafen. Das trieb Tränen der Rührung in manche Augen.
Im Herbst folgte sodann eine Woche Wanderferien im Montafon mit einer Freundin. Auf dem Heimweg ein letztes Highlight, nämlich eine Übernachtung in Luzern im „Jailhotel Löwengraben“, dem ehemaligen Zentralgefängnis des Kantons Luzern. Sehr lustig hatten wir’s dort.
Es war auch das Jahr, wo ich an der bsd. nach 30 Jahren Schuldienst kündete, weil mir der administrative Aufwand an zwei Schulen zu viel wurde. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wie es heisst. Genau so ging es mir.

Das Jahr 2011
Kurzfassung – „Reisebericht“ (Amsterdam) - Polen im Sommer 2012
Ende April 2012 besuchte ich mit einer Abschlussklasse Amsterdam. Wir waren zu zweit, mein Kollege und ich, mit der Aufgabe betraut, den Sack voller Flöhe unbeschadet durch die Exkursion zu führen.
Wir verbrachten ein paar lustige und interessante Tage zusammen, unternahmen einige Besichtigungen gemeinsam (vor allem tagsüber), was allerdings nicht durchwegs klappte. So kamen beispielsweise beim Besuch des erstklassigen MEMO-Museums nur etwa die Hälfte unserer „Schützlinge“ mit, die anderen hatten ein Problem zu lösen: Sie hatten Fahrräder gemietet und eines davon war in einer Gracht gelandet, unerklärlich natürlich, wie das hatte passieren können...
Und wie das so ist mit von der Leine gelassenen Schülern: die bringt man abends kaum ins Bett (war ja auch nicht unsere Aufgabe, schliesslich waren sie ja alle erwachsen) und dafür am nächsten Tag nicht aus den Federn. Aus dem Grund nahm ich an einem Morgen den Bus nach Lisse und besuchte ganz alleine den riesigen Keukenhof-Park mit seinen einzigartigen, farbigen, prächtigen Tulpenbeeten. Tulpen so weit das Auge reicht. In der Anlage gibt es auch Restaurants und verschiedene Pavillons. In einem setzte ich mich zum Ausruhen hin und sah mir einen zwanzigminütigen Werbefilm über Polen an. Bis dahin wusste ich so gut wie nichts über dieses Land, aber die Aufnahmen begeisterten mich und sogleich entstand die Idee, im kommenden Sommer dorthin zu reisen.
Theo kam mit. Wir flogen nach Warschau und mieteten dort ein Auto, mit dem wir während drei Wochen im ganzen Land herumkurvten, von Westen nach Osten, von Norden nach Süden. Durch die ausgedehnte, malerische Seenlandschaft der Masuren, ins Ermeland, von dort an die Ostsee, nach Danzig, Leba, dann über Posen, Breslau und Krakau zurück nach Warschau.
Es war eine fantastische Reise. Was für prachtvolle Landschaften und Städte, was für eindrückliche Bauten, was für ein schönes Land!
Unter vielen andern Orten, die wir besichtigten, haben uns all die geschnitzten Holzfiguren in Galindia, dem „masurischen Paradies“, enorm gut gefallen. Erholsam der Besuch der Klekotzki-Mühle, die in einer Waldlichtung an einem idyllischen See gelegen ist. Eindrücklich war auch die Besichtigung der Marienburg, des Freiluftmuseums in Olsztynek und erst recht der Spaziergang durch die Wolfschanze, Hitlers ehemaliges Führerhauptquartier. Eine seltsame Atmosphäre herrscht an diesem Ort. Die Bunker sind fast alle von Bäumen und Sträuchern be- oder überwachsen, es war feucht und heiss, Mücken begleiteten und plagten uns während der Besichtigung sowie finstere Gedanken an die dunkle Vergangenheit.
Umso vergnüglicher war die Schifffahrt durch den Elblag-Kanal (Oberlandkanal), dort, wo Schiffe über Land fahren durch grüne Auen, zeitweise durch Wasser natürlich auch.
Ebenfalls faszinierten uns die riesigen Ausmasse der Salzmine Wieliczka, UNESCO-Weltkulturerbe, und liessen uns staunen.
Einen Bericht habe ich leider nicht geschrieben während dieser Reise. Es sind daher vor allem die Fotos, die noch immer mannigfaltige Erinnerungen und Eindrücke hervorrufen.
Ein gutes Jahr später hiess es dann aber endgültig: Leinen los! - Unsere Reise in östlicher Richtung konnte beginnen.

Reisen ab 2013 (Pensionierten-Leben) - wir sind dann mal weg!
Wie schon erwähnt, fand mein allerletzter Arbeitstag am 4. Juli 2013 statt. Und sogleich machte ich mich daran, eine lange Reise zu planen, und zwar von Mitte Oktober bis Mitte März; wir würden also ungefähr fünf Monate lang unterwegs sein. Destination: Australien, Neuseeland.
Aber vorher war ja auch noch Zeit, Neues „in der Umgebung“ zu entdecken. Weil ich aus Belgien über Homelink zwei Anfragen für einen Häusertausch erhalten hatte, fand ich, das wär doch grad der ideale Einstieg in unser neues „Reiseleben“.

Reisebericht Belgien August 2013
„Was, ihr geht nach Belgien im August?“
Diesen Satz hab ich oft gehört, als ich unseren Freunden unsere Reisepläne darlegte. „Was wollt ihr denn dort?“
Ja, das wusste ich auch nicht so genau. Ausser ein paar Stichworten: Pommes Frites, Bier, Schokolade (kommt ja sicher keinesfalls an unsere heran!), des Nachts beleuchtete Autobahnen, ein bedauerlicher Sprachenstreit und eine äusserst unrühmliche Vergangenheit im Kongo kam mir nicht gerade viel über dieses Land in den Sinn. Aber es ging uns ja letztes Jahr ähnlich, als es Polen war, wo wir hin wollten. Und Polen ist eine Reise wert. Nicht nur eine!
Jetzt also Belgien dieses Jahr. Belgien ist enengalls eine Reise wert, und nicht nur eine!
Auslöser waren, wie gesagt, die zwei unabhängigen Homelink – Haustausch-Offerten, die eine in Brügge, die andere in Antwerpen, und da wir, weil wir ja nun beide pensioniert sind, nichts anderes mehr zu tun habe als zu reisen, sagten wir zu.
Nicht einmal der Eintrag in unserem „Top 10“ Reiseführer über belgische Städte, wo wir unter „Top 10 General Information“ den Eintrag fanden: “What to pack: Regarding clothing, assume the worst in weather and you’ll be fine. – Pack comfortable shoes - you will be walking“, brachte uns vom Vorhaben ab, dieses Land zu bereisen. Und wir haben es nicht bereut. Der erste Teil des Eintrags können wir nämlich in keiner Weise belegen (zwei Regentage und sonst den ganzen Monat schön und warm), den zweiten Teil schon.
Stopover in Speyer und Köln
Begonnen hat unsere Reise allerdings in Speyer, in der Nähe von Heidelberg, wo die älteste romanische Kathedrale Deutschlands steht. Im Mittelalter war sie eine der bedeutendsten Städte. Bei uns eher nicht so bekannt; das war eben im Mittelalter.
Es war so heiss (über 30 Grad), dass wir nicht viel mehr taten, als jeden Tag an einen anderen Baggersee zu fahren und zu baden. An einem Tag allerdings fuhren wir in die Pfalz, an der Weinstrasse gelegen (nördlicher Ausläufer des Elsass), mit pittoresken Orten wie zum Beispiel Neustadt und St. Martin. An einem Vormittag besuchten wir Heidelberg. - Am Abend zurück in Speyer gab’s jeweils ein feines Nachtessen in einem der schönen Biergärten, und wir wunderten uns über die mehr als nur moderaten Preise. Auch über die deftigen, riesigen Portionen und über die nicht unbedingt eleganteste Art, ein Gericht zu beschreiben. Zum Beispiel: „Pfälzer Saumagen auf Kraut mit Brot“ – Wem fliesst da nicht das Wasser im Mund zusammen?
Speyer war ein Zwischenstopp auf dem Weg nach Belgien, auch ein Homlink-Tausch. Ein hübsches Einfamilienhaus, ein schöner Garten, nette Eltern der Tauschfamilie, die uns alles zeigten und erklärten.
Nach drei Übernachtungen fuhren wir weiter nach Köln, wo wir einen Zwischenhalt bei Karin Simon machten, eine Freundin, die wir in Bivio kennengelernt hatten, vor Jahren schon. Sie lud uns (zu unseren Ehren, wie sie sagte), ihre Familie und noch sechs weitere Gäste, die wir bereits kannten, zum Weisswurst-Zmittag ein auf der grossen Terrasse in ihrem Haus direkt am Rhein. Zu den Würsten servierte Karin feine, selbst gemachte Salate, natürlich Brezel, Weisswein, Bier und Sekt. Um halb drei fuhren wir mit vollem Magen los Richtung Brügge. Drei Stunden hätte die Fahrt dauern sollen, daraus wurden allerdings fünf. In einem Stau kurz nach Aachen sassen wir eine Stunde lang fest ohne einen Meter vorwärts zu kommen. Benzin brauchten wir alsdann. Mit dem Navi geht das ja problemlos, also weg von der Autobahn, 2 km zur nächsten Tankstelle. Die war allerdings nicht zugänglich, eine Baustelle rings herum. Die nächste, wieder nichts: eine weitere Baustelle, Tankstelle geschlossen. Das Navi war langsam ratlos – wir ebenso. Irgend in einem Kaff schafften wir es dann doch noch, den Tank zu füllen für den stolzen Preis von 110 Euro.
Brügge
Um halb acht kamen wir an, in einem Aussenquartier, genannt Sint Andries. Ein hübsches Haus mit üppigem Garten erwartete uns dort, voller Blumen, die wir ja dann (Theo vor allem) würden giessen müssen. Ein freundlicher Nachbar zeigte uns alles, auch den kaputten Gartenschlauch.
In Sint Andries an einem Dienstagabend um neun Uhr ein Restaurant zu finden, das geöffnet hatte, war ein kleines Kunststück, aber es gelang uns dann doch, in einem Gartenbeizli, eher so ein Snackding für die Einheimischen, eine Lasagne für 10 Euro zu bestellen. Die war sogar ausnehmend gut. Das Beizli heisst „In de Vriendschap“ und dort hatten wir auch gleich die erste Begegnung mit der seltsamen Sprache. Auf der Speisekarte fanden wir den Hinweis, dass beim Salade kip en parmesanschiffers fritjes enkel als bijgerecht 2 Euro 50 kosten. Die poetische Suppe (Verse soep) haben wir nicht probiert. Als Überschrift auf der Speisekarte stand übrigens: „Als de maag begint te knorren... of als knabbel bij de babbel…) – einiges versteht man ja, aber…
Jedenfalls haben wir uns sehr rasch eingelebt und wohl gefühlt im „Klein Kraaienest“, wie unser Homelink-Heim hiess.
Bis ich allerdings mit dem PC und dem WLAN klar kam, dauerte es ein Weilchen. Nicht nur die unmögliche Tastatur machte mir zu schaffen, auch die freundliche Mitteilung auf dem Bildschirm: „Kann geen verbinding maken met internet“. So musste ich wieder „afsluiten“ und später nochmals versuchen.
In Brügge verbrachten wir zwölf traumhafte Tage mit perfektem Wetter durchwegs. Die Stadt ist fantastisch schön, die Bootsfahrt auf den Kanälen des „nördlichen Venedig“ trotz der vielen Touristen absolut empfehlenswert. - Weiteres kann man im Reiseführer nachlesen.
Zweimal erhielten wir Besuch, am ersten Wochenende von Barbara und Bob Ensslin, die wir auf unserer Transatlanktüberfahrt von New York nach Hamburg mit der QM2 kennen gelernt hatten. Sie sind amerikanische Diplomanten, die im Moment in Paris leben, also „ganz nah“. Wir hatten‘s sehr lustig zusammen, die beiden hatten fürs BBQ Krabbenbeine und Rindsfilet mitgebtracht, so schlemmten wir aufs Beste. Bei der Stadtbesichtigung waren sie es, die uns herumführten, weil sie Brügge bereits kannten. Am Sonntag begleiteten wir sie auf ihrem Heimweg nach Lille und hatten dort ein letztes gemeinsames Mittagessen. Moules hätten es sein sollen, das Restaurant war bekannt dafür. Die waren zwar an oberster Stelle auf der Speisekarte erwähnt, aber grad ausgegangen…
Moules mussten es sein, halt dann nicht in Frankreich, sondern in Belgien. Ich hab noch kein Restaurant gesehen, das Mosselen (in witte wijn z. B.) und fritjes nicht im Angebot hätte. Auch im August. Es muss ein gewaltiges Muschel-Massensterben herrschen in diesem Land, und das täglich.
Also assen wir Mosselen in De Haan an der Strandpromenade am nächsten Tag. Jeder von uns ein Kilo. Uns beiden langt’s jetzt für ein Weilchen: „bit tom ablujten“ (erstes Wort des Zitats korrekt, zweiter Teil meine Interpretation der Sprache). Das Tussentotaal unserer Rechnung kam auf 71 Euro, recht teuer eigentlich. Dabei war da nur eine halbe fles wijn dabei (weil Theo noch fahren musste) und zwei frisdranken.
Apropos: Spezialitäten sind natürlich Muscheln und Frites. Aber ich hab auch noch anderes gefunden, was mir sehr gut dünkt: Waterzooi und Stoofvlees. Zum Dessert dann Pofferties.
Unser zweiter Besuch kam aus Köln; es waren Karin, Angelika und Paul. Auch mit ihnen zusammen verbrachten en wir zwei schöne Tage, wieder Stadtbesichtigung, BBQ zu Hause und Streifzug ans Meer: Zeebrugge und Knokke.
Ein paar Ausflüge ans Meer unternahmen wir auch sonst noch, nämlich mal nach Blankenberge, Ostende und mal nach Dünkirchen. Theo ist ja immer sooo interessiert an den Weltkrieg-Schauplätzen (Nach Waterloo bei Brüssel mussten wir zum Glück nicht hin, da erinnert wohl nur noch der Name an die Schlacht – im Führer stehen zwar schon noch ein, zwei Sätze mehr).
Also in Dünkirchen hatten wir trotz Navi etliche Mühe, das Museum zu finden (offensichtlich nicht ein sehr touristischer Anziehungspunkt), aber als es dann endlich gelang, war Theo ganz freudig und ich fand gleich nebendran ein wirklich schönes und besuchenswertes Museum, das LAAC (museesdunkerque.voila.net/LAAC.html">museesdunkerque.voila.net/LAAC.html: bemerkenswerte Architektur, eingebettet in einem grosszügigen Skulpturengarten), in dem ich mich eine gute Stunde lang vertörlen und freuen konnte an Werken unter anderem von Tinguely und Nicki de St. Phalle.
An der Strandpromenade von Dünkirchen, da läuft was. Strandbars, massenhaft Leute, Lautsprecher, Musik, alle möglichen Attraktionen wie bei uns am Ziebelemärit, ja sogar Bungee kann man jumpen.
Zwischen unseren beiden Homelink-Swaps besuchten wir Gent, wo wir zweimal übernachteten und Brüssel - eine Übernachtung. Beide Städte haben uns ausserordentlich gut gefallen, vor allem Gent ist grossartig. Drei Museen haben wir besucht, das STAM, das Design-Museum und die Burg (vollgetextet vom Audioguide). Auch dort wieder eine Bootsfahrt auf der Schelde und viele Kilometer zu Fuss, vorwiegend durch die Altstadt.
In Brüssel musste es das Tintin-Museum (CBBD: Centre Belge de la Bande Dessinée) sein (Theos dringendster Wunsch), am nächsten Morgen dann das Magritte – Museum (mein dringendster Wunsch). Der Grand Place erschlägt einem fast vor Fassaden, Gold- und sonstigen Verzierungen und Pomp (Barockes Ensemble), der (das?) Männeken Piss vor Bedeutungslosigkeit, aber an all den wunderbaren Art Déco – Häusern und –Fassaden konnte ich mich kaum sattsehen und -fotografieren.
Auch das Atomium gefiel uns. Schön, dass man es hat erhalten können; eigentlich hätte es nach der Weltausstellung ja abgebrochen werden sollen.
Antwerpen
In Antwerpen (genauer: in einem Vorort genannt Brasschaat - wir sind nota bene beide nicht fähig, das Wort richtig auszusprechen) werden wir von unseren Homelinkpartnern, Annemie und Egbert, aufs Herzlichste begrüsst.
Annemie und Egbert sind beide „Shrinks“, sie ist Psychotherapeutin, er Psychiater. Anthroposophisch und homöopathisch. - Wie wir ankommen, läuten wir an der Tür und sogleich fragte mich Theo (wie üblich hat er sich nicht so sehr bemüht, sich zu merken, wer unsere Gastgeber sind, wie sie heissen und wo sie wohnen. Zwar hab ich’s ein paar Mal gesagt und ihm auch per E-Mail sämtliche Informationen geschickt, aber…. Erst wenn’s dann ernst wird, beginnt er sich zu kümmern. So fragt er mich (eben hat er das Schild an der Tür gesehen): „Welche Rolle sollen wir spielen?“
Das Haus ist umwerfend, es könnte ein Ferienhaus sein von Laura Ashley. Überall hat’s frische Blumensträusschen, in Violett, Hellgrün und Weiss gehalten, liebliche, englisch anmutende Details ebenfalls, alles ist rustikal – helles Holz, Rosa und Hellblau sind die vorherrschenden Farben, es duftet zart nach Lavendel und Rosenblättern, ist hell und gemütlich, hat einen schönen Wintergarten, einen gepflegten Garten und zwei Haustiere, für die wir aber nicht zu sorgen brauchen. Bei den Pets handelt es sich um zahme Poulets, die gestreichelt werden wollen und jeden Morgen um zehn Uhr dafür ein Ei legen (das Ei des dunkleren Huhns ist etwas kleiner). Diese Eier dürfen wir essen. Den ganzen Tag lang picken und gackern sie im Garten herum (die Poulets natürlich), beim Essen versuchen sie auf den Tisch zu flattern, was sie allerdings nicht tun sollten. Abends gehen sie von selbst in ihr Haus. Die Tür schliesst dann automatisch bei Sonnenuntergang mit Hilfe eines Sonnenkollektors.
In der Küche hat es unendlich viele Schubladen und alle sind aufs Akkurateste aufgeräumt (nicht grad wie bei uns). In einer Schublade hat‘s Küchenschürzen, links für die Frau, rechts für den Mann. Annemie trägt offenbar immer eine Schürze. Sollt ich mir echt auch mal überlegen.
Die beiden sind mehr als nur nett und herzlich; sie zeigen uns alles und Annemie hat bereits ein wunderbares Nachtessen für uns zubereitet: Gurkensalat und Fisch-Gemüse-Lasagne (selbst gemachter Nudelteig mit Bio-Mehl). Gekrönt wurde das Dinner von einem delikaten Pfirsichauflauf (mit Bio-Pfirsichen, ein Teigli aus besagtem Mehl, Bio-Milch und Eiern von „the grey and the blonde“. Dazu gibt’s frisdranken: je ein Glas selbstgemachter Holundersirup. - Annemie und Egbert trinken nichts.
Es gab nette Gespräche, wir erhielten zahllose Tipps und dann gingen wir schlafen. So nüchtern haben wir beide schon lange keinen Tag mehr erlebt beziehungsweise beendet. Tagsüber waren wir noch im Brüssel und hatten erst das Magritte Museum und anschliessend das Atomium besucht. Theo sagte nach der Besichtigung, wie sehr er sich dann nach der Fahrt auf ein Bier freue… Ich mag ja Bier überhaupt nicht. Ein Gläschen Wein hingegen…
(Das war dann schon ziemlich anders im „Amadeus“ in Gent, wo wir mal zum Essen gingen. Dort gab’s eine Magnum fles Roten auf den Tisch und am Schluss wurde per Zentimeter abgerechnet.)
Nach dem Essen verziehen sich unsere Gastgeber in den andern Teil des Hauses, wo sie mit zwei anderen Ärzten ihre Praxen haben, aber auch Schlafräume und eine Küche. Ihr Haus überlassen sie uns.
Unser erster Tag war sehr gemütlich. „Endlich“ regnete es mal, so dass wir uns in Ruhe unseren Mails, Fotos und Reiseunterlagen widmen konnten. Nur kurz für einen Einkaufe (nicht im Bio-Laden) verliessen wir das Haus
Unser Znacht bereiteten wir auf dem AGA Ofen zu (ein wundersames, extrem gewöhnungsbedürftiges Ding). Zur Vorspeise gab’s Ravioli mit Oesterwammen (Austernpilze), anschliessend Salat und dann Ossenhaas. (Ja, ja, ich hab auch „Osterhase“ gelesen, als ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal das Rindsfilet auf einer holländischen Menukarte entdeckte. Irgendwie muss Ostern da schon mit im Spiel sein, auch bei den Pilzen). Zum üppigen Mahl gab’s ein paar feine Zentimeter Wein.
Ein paar ruhige Tage haben wir in Antwerpen, wir geniessen den schönen Wintergarten, während das Federvieh im Garten gackernd an uns vorbeispaziert, mal im Pick-Modus, mal rasen die beiden wie gestörte Simultansprinterinnen an der Fensterfront vorbei, mal gucken sie frech zu uns rein (das dann eher im Digital-Kopf-Schwenk-Modus), mal sehen wir sie stundenlang nicht, weil sie im hinteren Teil des Gartens, einer Art Wäldchen, irgendwelche Aktivitäten pflegen, von denen wir keine Ahnung haben, und ich fahre weiter mit der Vorbereitung für die nächsten Reisen. Theo plant akribisch einen Wintergarten am Sonnenrain (er steht sogar des Nachts auf, um seine Aufzeichnungen zu ergänzen) – hoffentlich ohne Hühner als Zugabe.
Die Eierlieferung klappt übrigens vorzüglich. Gestern allerdings wollte das grau-braune Huhn unbedingt auf den Eiern sitzen bleiben und brüten. Das Ei ihrer Kollegin gleich mit. Das geht natürlich nicht, wir brauchen ja schliesslich unsere Frühstücks-Eier. So war ich gezwungen, die Eier unter der Henne hervorzuholen. Sie waren so etwas von warm. Das Huhn war so etwas von indigniert. – So nahe war ich noch nie an der Produktion und ich muss schon sagen, was da passiert, mutet wundersam an. Normalerweise kaufe ich die Eier ja im Migros. Schön in Karton verpackt.
Einkaufen ist immer interessant an fremden Orten. Man muss zwar manchmal lange suchen, bis man das gefunden hat, was man sucht, man lernt aber auch Neues kennen. Die Supermärkte sind riesig, sehr gut bestückt, man kann alles haben, was das Herz oder besser gesagt der Magen begehrt. Da gibt’s frisches Gemüse wie bei uns, die diversesten Sorten von kaas und beispielsweise auch gevogelte worst. Das Fleisch ist billig, es ist nicht zum Glauben. 100g Carpaccio kosten knapp 2 Euro, den Ossenhaas kriegt man für 26 Euro das Kilo.
Den ersten Einkauf tätigen wir mit dem Auto, einen (nur einen!) Nacheinkauf hier in Brasschaat mit dem Velo. Das Gejammer von Theo, als ich diese Art der Fortbewegung vorschlug, will ich hier nicht weiter erläutern. Als ich mich am späteren Nachmittag auf den Weg machen wollte, fand ich ihn nicht einmal mehr. Er war am Schlafen. Seine Siesta, versteht sich. Als er dann um halb sechs auftauchte, bestand ich trotzdem auf den autolosen Einkauf. Eine Ausrede nach der anderen musste ich mir anhören. Da stand nicht mehr das Fahrrad, das Annemie uns angeboten hatte, das, welches da stand, hatte kein Körbchen - wie sollten wir denn die Einkäufe transportieren? - gefährlich ist‘s! etc. etc. – Ich fuhr dann einfach los. Er hintendrein. Das Gesicht… Nur ein einsamer Jogger begegnete uns auf unserem ungefähr vier Kilometer langen Ausflug. Seiner Miene nach zu schliessen schien er unter ähnlich jämmerlichen Qualen zu leiden wie mein Göttergatte. Zudem tropfte er von Schweiss, was man von Theo nicht behaupten konnte.
Velofahren ist übrigens ein Kinderspiel. Überall hat’s fantastisch ausgebaute Fahrradwege, teilweise auf den Trottoirs, was uns als Fussgänger allerdings schon mehr als eine Schrecksekunde beschert hat. Einen Helm trägt niemand. Wie in Holland sind auch hier die Velofahrer die Könige auf der Strasse, sie haben überall Vortritt, ihre Klingeln sind allgegenwärtig, ständig bellen sie (bellen = läuten auf Holländisch), jedermann fährt (und bellt), wir fielen nicht auf.
Auch sonst ist Lädele jeweils beliebt. Bei mir jedenfalls. So ein T-Shirt oder eine broek (Hose), eine Tasse, oder sogar eine handtasse (Handtasche) sind immer willkommen. Und Theo wartet geduldig bis ich meine Einkäufe getätigt habe. Nie beklagt er sich. Er hat immer sein E-Book dabei – ich kann mir Zeit nehmen. Wenn er dann aber einen MediaMarkt erspäht, ist er es, der nicht mehr zu halten ist, und ich muss warten, denn er findet immer etwas, das er dringend braucht. Diesmal war’s (unter anderem) tatsächlich ein kleiner Drucker. – Was soll das? - Für Ellas Bäbistube? Auf der Einkaufstüte heisst’s jedenfalls: „Ik ben toch niet gek“. – Und was druckt er mir zu Hause aus? Ein Bild von ihm, in der Badehose, wie er grad aus dem Meer steigt (seinen Bauch hat er vorher im Paintshop moderiert). – gek?
Ob er diesen Drucker dann mit nach Neuseeland nehmen wird? Schon jetzt ist ein riesiges Arsenal an Steckern, Doppelsteckern, Adaptern, Kabel, Verlängerungskabel, Flashmemories und sonstigem technischem Equipment mit dabei. Natürlich auch sein Tablet, ein Laptop und sein i-Phone. - Jetzt sind wir ja mit dem Auto unterwegs, das wir auch problemlos füllen bis am Ende der Ferien, aber bei der Australien-Neuseelandreise dürfen’s ja dann nur noch 20 kg sein pro Person. Mir graut schon jetzt.
Vorläufig aber sind wir Fans von Zeeland. Dies ist die südlichste Region der Niederlande, das Vordelta der Scheldemündung. Eigentlich sind es Halbinseln und Inseln, mit Dämmen und Bücken verbunden, ellenlangen Sandstränden und riesigen Dünen, sonst aber flach, flach, flach. Die alten, ursprünglichen Windmühlen trifft man nur noch selten an, die riesigen weissen jedoch sind zahlreich. Die Inseln sind nicht gross, sie sind praktisch mit dem Velo zu befahren, wir sind natürlich mit dem Auto unterwegs. Die kleinen Städte oder eher Marktflecken sind reizend (den Ausdruck brauche ich sonst eigentlich nicht, aber hier passt er). Middelburg gefällt uns sehr und auch Zierikzee (ich les entweder „Zürichsee“ oder „Zierkerze“) ist zum Beispiel ein solcher Ort wie aus dem Bilderbuch, ein mittelalterlich anmutendes Städtchen mit Windmühle, wie der Tourist es sich wünscht (mehr als 500 historische Gebäude), einem Stadttor mit zwei Türmen und vier absolut unterschiedlichen Kirchen, einem Hafen mit historischen Schiffen, fein herausgeputzten Häusern und Gärten, einem Marktplatz mit zahlreichen Cafés zum Draussen-Sitzen, ein paar schmucken Lädeli-Strassen und –Gassen… Einfach gemütlich!
Es zieht uns fast jeden zweiten Tag in diese Gegend, die Strände sind sauber und zum grossen Teil einsam (Verklikkerduinen), das Meer noch mindestens 20 Grad warm und die Temperatur fast wie im Hochsommer. Manchmal hat’s eine kleine Brise, darüber sind wir aber froh. Abends suchen wir uns jeweils ein Vis-Restaurant (lekker uit eten in een restaurant), wo man draussen essen kann (z. B. in Bruinisse oder Yerseke oder Westenschouwen, Vlissingen oder Zoutelande an der „Zeeländischen Riviera“) und geniessen ein paar feine Meerfische oder Muscheln - mit Blick aufs Meer, auf den Hafen oder eine Promenade, wo Spaziergänger und Velos vorbeiziehen, weiter draussen Frachter und Segelschiffe. Dunkel wird’s erst gegen neun Uhr, bis dahin bleibt es auch schön warm. – Das sind Ferien! – Oft denke ich an meine Kolleginnen und Kollegen, die jetzt am Unterrichten sind...
Nebenbei bemerkt: Wie liederlich die heutzutage die Reiseführer verfassen... In Annemies Guidebook heisst es doch tatsächlich übers Wetter in Belgien: „On the whole Belgium is rather a rainy country, with Brussles experiencing constant low rainfall throughout the year“.
Belle-Epoque-Viertel und Museen
Antwerpen gefällt uns auch, nicht ganz so sehr wie Brügge oder Gent, aber ein spezielles Quartier ist absolut fantastisch: Art Déco-Häuser vom Schönsten und Verschnörkeltsten. In den 60-er Jahren hätten die alle abgebrochen werden sollen. Zum Glück gab’s von der ganzen Bevölkerung massive Proteste (Annemie war dabei), so dass man von diesen unsinnigen Plänen abkam und der einzigartige Stadtteil in Zurenborg erhalten geblieben ist. All die wunderbaren Details, Skulpturen, Symbole, Inschriften und Mosaike! Dabei sieht man ja nur die Fassaden. Was sich alles dahinter verbirgt, kann man nur erahnen.
Das M HKA – Museum gehört zu den Kunsttempeln, wo sich der Laie die üblichen Fragen stellt: „Ist das Kunst“? – „Was genau ist daran Kunst“? – Wir hatten eine Führung mit einer netten jungen Dame, die uns das eine oder andere ganz gut erklären konnte. Ideal auch die Internetlinks bei den Kunstwerken, so dass man sich in Ruhe zu Hause die Werke in Bild und Wort nochmals ansehen kann und Hintergrundinformationen über die Künstler erhält (Nur, wir haben ja keine Zeit…).
Theo hatte ein weiteres kleines Problem beim Aufsuchen der Toilette. Er war nicht sicher, welche der vier Türen (Frauen und Behinderte klar ausgeschlossen) er wählen sollte, ob MEN oder ARTISTS (auch das natürlich Kunst).
Das Rubenshuis dann wieder ein Museum ganz im gewohnten Stil, dunkel, gross, beeindruckend – klar das Haus eines Mannes, der schon zu seiner Zeit (1577 -1640) eine Berühmtheit war und dementsprechend wohlhabend.
An unserem letzen Abend luden wir unsere Gastgeber, Annemie und Egbert (gesprochen Echbert) zu einem Dim Sum - Nachtessen in der Antwerpener Chinatown ein. Die beiden haben viel Humor und wir haben uns bestens unterhalten. Sie tranken Tee, wir eine fles Roten. Bei dieser Gelegenheit fanden wir dann auch heraus, dass Annemie und Egbert keinen Alkohol trinken (als Gastgeschenk hatten wir drei Flaschen Wein mitgebracht), er keine Käse isst (ich hatte ihnen ebenfalls ein grosses Stück Gstaader Bergkäse in den Kühlschrank gelegt) und so gut wie kein Fleisch (eine Wurst aus dem Berner Oberland war auch dabei). So viel zu meiner auserlesenen und treffsicheren Auswahl an Gastgeschenken.
Es war ein ausgesprochen gemütlicher Abend, wir genossen eine vorzügliche Küche und hatten einen absolut nüchternen Chauffeur.
Am folgenden Morgen verliessen wir Brasschaat Richtung Leuven, wo wir einen Zwischenhalt machten. Den Grote Markt wollten wir uns ansehen. Ausgerechnet an dem Tag fand dort ein riesiges Volks-Fest statt (einmal im Jahr, wir hatten es also ‚gepreicht‘), die ganze Innenstadt war abgeriegelt für jeglichen Verkehr (sogar für fiets = Velos), so dass wir fast eine Stunde brauchten, bis wir zu einer Parkgarage gelangten. Überall hatte es Marktstände, Marktschreier, laute Musik, ein riesiges Gedränge - man konnte die Gebäude kaum mehr sehen.
Um die Heimfahrt zu ‚entschärfen‘, übernachteten wir in Metz. Allerdings fanden wir, nach den belgischen Städten, in denen wir uns so unglaublich wohl gefühlt hatten, seien ein paar Stunden Aufenthalt genug. Wir wollten dann am Dienstag noch das Centre Pompidou besuchen, aber das war geschlossen. In der ganzen Welt ist der Montag der Tag, wo die Museen geschlossen sind (stimmt vielleicht nicht ganz 100%-ig), in La Grande Nation ist’s der Dienstag. – Im Whatsapp-Family-Chat schrieb ich ganz enttäuscht: „CP fermé le mardi“, worauf mir Raphael sofort antwortete: „Ohhh mais non! Ou lala! Comme ci comme ça!“ –
So weit so gut. Einem Mega-Stau in Härkingen konnten wir grad noch knapp ausweichen, schon sahen wir die Alpen, heimatliche Gefilde, die Ortstafel von Ittigen, ein Monat Ferien war vorbei.
Wir sind glücklich, dass alles so gut gegangen ist, es keine Pannen gab, wir viel Spass hatten, so viel Schönes erlebt haben, gesund wieder zurück sind, das Wetter hier noch wärmer ist als im Norden, die Aare noch immer 19 Grad hat und ich somit morgen ins Marzili gehen und am Abend im Sporting Club ein Mixed Double mitspielen kann.

Reisebericht Bali – Australien – Neuseeland – Australien – Singapur
(Mitte Oktober 13 – Mitte März 14)
Wir hatten uns vorgenommen, unseren Reisebericht diesmal als Blog zu veröffentlichen. Das machte zwar Spass, es war eine Art „Joint Venture“, manchmal aber auch Stress, weil entweder Theos Zeichnungen, mein Text oder unsere Fotos nicht rechtzeitig parat waren, vor allem aber weil das Hinaufladen ins Internet nicht immer gut funktionierte (die Verbindung war oft mangelhaft, wieder und wieder stürzte das System ab).
Hier trotzdem der Link: torriani.ch/reisen1314/">torriani.ch/reisen1314/
Träume vor der Abreise
Offenbar beschäftigt mich unsere Abreise doch mehr, als ich selber wahrhaben will. Natürlich gibt es viel zu organisieren, zu packen und dran zu denken. - Aber das:
Verschiedene Träume am selben frühen Morgen:
Christine Ruder (eine gute Freundin von mir) kommt mit uns auf die Reise. Wir haben abgemacht, ihr Gepäck mitzunehmen. So fahren wir zu ihr ins Egghölzli. Mit dem Bus, nicht etwa mit dem Auto. Das dauert aber endlos lang, ich frage mich dann plötzlich, was das Ganze soll, schon anderthalb Stunden sind wir unterwegs und immer noch nicht dort. Wieso haben wir das Auto nicht genommen und was sollen wir dann mit dem Gepäck? Jetzt reicht es nicht einmal mehr, zurück nach Hause zu fahren, weil unser Zug ja schon bald abfährt. Mich beschleicht ein beklemmendes Gefühl… Aufwachen zum Glück!
Nächste Episode:
Nur noch Theo und ich: Im Bus zum Zug: Plötzlich merke ich, dass ich meinen neuen Fotoapparat, den ich extra für die Reise gekauft habe, vergessen habe einzupacken… Aufwachen zum Glück!
Nächste Episode (sehr kurz):
Wir sind zu Hause und wollen gehen, es ist Zeit, da finde ich meine Schuhe nicht, die ich glaubte, parat gestellt zu haben. Da sind nur die schwarzen, aber ich hatte mich doch entschieden, die braunen anzuziehen… Aufwachen zum Glück!
Nächste Episode (eine längere Angelegenheit):
Wir sitzen im Zug, Theo und ich. Es sind noch andere mit dabei, die zu unserer Gruppe gehören. Wir sind unterwegs zum Flughafen und haben sehr viel Gepäck bei uns. Vor mir ist eine Art Ablage aus Metall, ein Kasten, welcher oben eine Öffnung hat. Dort schaut irgend ein Stück Stoff hervor. Ich ziehe daran, es ist ein Schal. Ich greife weiter hinein, da kommen noch mehr Halstücher zum Vorschein, aber auch Taschen und Etuis. Mit uns reist zufälligerweise der Chef des Zugs und ich zeige ihm, was ich gefunden habe. Er sagt, da müsse er dann mit seinen Untergebenen ein Hühnchen rupfen, dass die all diese liegengebliebenen Sachen nicht selber gefunden hätten, aber er dankt mir, dass ich ihn darauf aufmerksam gemacht habe. – Nur ist inzwischen die Zeit sehr kurz geworden, ich sehe auf meiner Uhr, dass wir nur noch fünf Minuten haben zum Umsteigen. Alle anderen sind schon ausgestiegen. Jetzt pressiert‘s. Das Problem ist, dass der Zug, den wir erreichen müssen, gar nicht im Bahnhof abfährt, sondern irgendwo draussen auf dem Feld, mindestens 500 Meter weit entfernt. Man sieht das Gleis in der verlassenen Landschaft, ziemlich weit unterhalb von dort, wo wir uns befinden. Ein nicht asphaltierter steiler, staubiger, steiniger Weg (eher ein stillgelegtes Bachbett) führt hinunter.
Ich seh den Zug schon kommen, die anderen Mitreisenden sind bereits dort. Ich renne los. Theo irgendwo hinter mir her. Vordran versperrt mir eine Frau den Weg. Ich versuche, an ihr vorbeizueilen. Da kommen von unten her zwei Hunde auf uns zu, ein grösserer und ein kleinerer. Ich verlangsame mein Tempo, das nützt aber nichts, der kleine Hund hat mich schon in die Hand gebissen…. Aufwachen zum Glück!
In Wirklichkeit erreichen wir den Flughafen jedoch ohne Probleme und können rechtzeitig abfliegen.
Frühstück im Flugzeug
Was ist das denn? Kläglich sieht’s aus auf dem Teller, bleich und unappetitlich. Es ist das Frühstück. – Das geht gar nicht! – Nahrungsverweigerung!!!
Sonst ist alles ok mit dem Flug, weniger allerdings mit meiner Erkältung, vor allem mit meiner Nase, die meint, sie müsse, je länger der Flug dauert, desto akribischer in Produktion steigen und auch meine Augen dazu veranlassen, ohne Unterhalt zu tränen. Das führt dann auch zu nie vorher gekannten Ohrenschmerzen bei den Sinkflügen. – Bin ich froh, habe ich diesen Zwischenhalt in Indonesien geplant. Einen weiteren langen Flug hätte ich schlicht nicht mehr ertragen.
Bali
Nach dreizehnstündigem Schlaf fühlen wir uns beide sehr viel besser. Meine Erkältung ist am Abklingen, die Ohren haben den Druckausgleich mehr oder weniger geschafft, Theo klagt auch nicht mehr so sehr über seine Grippe.
Alles ist fantastisch: Die wunderbare Unterkunft, der paradiesische Garten, unsere liebenswerten englischen beziehungsweise australischen Gastgeber Anna und Steve, Wetter und Temperatur, das Meer, die Sonnenuntergänge, die freundlichen Balinesen, das feine Essen, die Tatsache, dass wir unendlich viel Zeit haben zu geniessen und dass wir erst am Anfang unserer Reise sind.
Und schon die Aussicht auf ein Tennis-Doppel. Wir waren noch keine Stunde da, schon bot mir Anna an, an einem der nächsten Tage mitzuspielen. Nicht im Traum hätte ich das erwartet. Und schon reut es mich, dass ich keine Tennisschuhe mitgenommen habe. Das Gepäck…
Ausflug nach Ubud – Vulkan – Goa Gajah
Am Dienstag buchten wir einen Ausflug, das heisst, wir mieteten ein Auto mit Chauffeur. Benzin und Essen des Fahrers alles inklusive – Kosten 50 Franken.
Um Viertel nach acht ging‘s los am Morgen (erstaunlicherweise ohne grossen Kommentar von Theo), abends um sechs waren wir wieder daheim.
Schön war’s, sich zurücklehnen und die mühsame Fahrerei jemand anderem überlassen zu können. Ständig umgeben zu sein von Motorrädern, welche die Autos umschwirren wie Motten das Licht, hätte mich überfordert. Aber unser Fahrer, Cypriano, war das natürlich gewohnt. Er liess sich durch nichts aus der Ruhe bringen und fuhr uns sicher durchs Verkehrschaos in Küstennähe, später über Landstrassen durch zahllose Dörfer entlang von Reisfeldern und Mandarinenplantagen. Alle Strassen waren gesäumt von Penjors (lange, verzierte Bambusstangen, deren Spitzen sich wie Laternen zur Strassenmitte neigen. Der Penjor, aufgestellt zur Zierde der Götter, ist ein Symbol für das Gute, das das Böse abschrecken soll. Am Tag vor Galungan werden sie in den Dörfern vor den Häusern beidseits der Strasse aufgestellt. Die Penjors baumeln im Winde und es bietet sich einem ein Bild wie eine Allee. Am Penjor selber sind verschiedene Dinge angebracht, die symbolische Bedeutungen haben. So ist beispielsweise die Kokosnuss das Symbol für Fruchtbarkeit.), einige wurden erst noch aufgestellt, die meisten standen schon parat für den Festtag am folgenden Tag, Galungan (zehn Tage später gefolgt von Kuningan - diese beiden sind die höchsten Feiertage der Balinesen. Anlass für diese Feiertage bildet ein historischer Hintergrund, die Niederlage eines Despoten aus dem 3. Jahrhundert. König Maya Danawa hatte seinen Untertanen die Anbetung der Götter und Ahnen verboten, das Volk erhob sich und besiegte ihn nach blutigen Kämpfen. - Galungan wird alle 210 Tage gefeiert und gilt als das aufwendigste Tempelfest. Das Fest symbolisiert auch den Kampf der Götter gegen das Böse. Deshalb finden zu dieser Zeit in den balinesischen Familien viele Gebete und Opferzeremonien statt). - Es war ein schöner Anblick. Die Stangen sind aufs Hübscheste verziert, offenbar werden die schönsten davon prämiert.
Die meisten Dörfer scheinen mehr aus Tempeln zu bestehen als aus Häusern, diesmal noch mehr geschmückt als wohl üblicherweise.
Unterwegs machten wir immer wieder mal Halt. Wir besuchen eine Batikwerkstatt (Legong Batik Pressing), einen Gold- und Silber- Schmied, eine Holzschnitzerei (die Balinesen sind absolute Künstler was das Holzschnitzen betrifft) und in Ubud dann eine der x Malerwerkstätten. All die vielen Bilder, die dort zum Verkauf angeboten werden… Und so viele verschiedene Stile. Für jeden (wirklich jeden) Geschmack etwas, das ist wohl die Idee. Auf meine Frage hin, ob er die alle verkaufen könne und ob auch Balinesen kaufen würden, erklärte mir der nette junge Mann, der uns alles zeigte und mir nebenbei auch von seiner Familie berichtete, dass dem sehr wohl so sei, vor allem im August seien die Touristen sehr kauflustig. Balinesen würden keine solchen Bilder kaufen, erklärte er, die könnten selber malen, wenn sie was für ihr Wohnzimmer bräuchten. - Ok, ok, kann ja sein.
Eine einstündige Theatervorführung wurde uns beim zweiten Halt geboten: „Jamba Budaya“. Es geht immer ums selbe Thema: der Kampf zwischen Gut und Böse, Barong and Kris Dance. Nach ein paar Kameraklicks in Tegallalang bei den prächtigen Reisterrassen ging‘s weiter nach Kintamani, wo wir im Gunung Sari Restaurant Halt machten und zu Mittag assen. Von der Terrasse aus hat man eine exzeptionell schöne Aussicht auf den Vulkan Gunung Batur und den See Danau Batur. Der Anblick in das friedlich daliegende Tal liess mich gar nicht mehr los. Wir selber befanden uns dort eigentlich auch auf einem Kraterrand, ein sehr viel grösserer Vulkan musste mal ausgebrochen sein und hatte die Landschaft so gestaltet. Besser und von oben sieht man’s natürlich auf Google map.
Einen weiteren Halt gibt’s in Santis‘ Gardens, einem Lehrpfad für tropische Pflanzen. Kakao, Vanille, Ginseng, Pfeffer, Kaffee, Snakefruit (Salak), Mangousteen und was es da sonst noch alles zu sehen gab.
Das Seltsamste allerdings: Animal Coffee.
Ein Tier, Civet, das aussieht wie ein Nerz, sie nennen es hier Mungo, sitzt in einem kahlen, trostlosen Käfig und sieht elendiglich aus. Es versucht verzweifelt, einen Ausgang zu finden.
Seine Aufgabe ist es, Kaffeebohnen zu fressen, sie in seinem Magen zu fermentieren und dann passiert der Prozess umgekehrt.
Im Internet gefunden unter Luwak-Kaffee:
Kopi luwak is coffee made from the beans of coffee cherries which come out from the other end of the civet cat after they’ve been eaten. Civets were long regarded as pests, but the research nowadays shows that the coffee cherries fermented internally by digestive enzymes of the civets adds a unique flavour to the beans which the resulted beans are the highest quality.
(Extrem spezielles Englisch! - “the other end of the cat“. Oder die seltsamen Bezüge: Hier wird das Tier gleich selber gefressen, von wem ist nicht ganz klar, eventuell von den Kaffeebohnen? – Aber eben, das Ganze ist in meinen Augen so oder so ein abstruser Vorgang. Wer kommt auf solche absurden Ideen? Man stelle sich das vor…Der einzigartige Geschmack – klar – comes from the other end oft he cat, also: The most expensive coffee in the world is made from animal poop.
Im Internet steht auch, wenn mehr Leute wüssten, wie schlimm die armen Tiere gehalten würden, würden wohl einige auf diesen Kaffeegenuss verzichten.
Man hat uns eine grosse Auswahl an Tees und Kaffees offeriert zum Probieren, Luwak zum Glück nicht.
Der Tempel Goa Gajah, auch genannt Elephant Cave (UNESCO Welterbe, erbaut im 9. Jhd.) war dann unser letzter Halt. Wir waren relativ spät dran, die meisten Souvenir-Lädeli hatten bereits geschlossen, sogar der Ticket-Verkäufer hatte schon Feierabend gemacht, so kamen wir in den Genuss eines völlig unbehelligten Gratisbesuchs des bekannten Heiligtums.
Mir kam sogleich die Episode in den Sinn am Flughafen Belp vor einem Jahr, als wir mit wenig Verspätung um ungefähr elf Uhr abends von London her kommend landeten. Man sagte uns, der Zollbeamte sei jetzt halt schon heimgegangen. Es tönte fast wie eine Entschuldigung. Wer also etwas zu deklarieren gehabt hätte, zu viel Booze, ein wenig Drogen oder so, hätte halt diesmal Pech gehabt. - Das kann nur in Bern passieren.
Nach diesem Exkurs zurück nach Bali:
Nach demTempelbesuch Rückfahrt nach Seminyak. Es war ein Tag mit vielen unterschiedlichen, schönen, aber auch besinnlichen Eindrücken. An diesem Abend waren wir zu müde, um noch etwas essen zu gehen. Theo machte sich ein Rührei mit Schinken, ich ass in Stück von der Wassermelone, die noch im Kühlschrank lag.
Ein paar Eindrücke (Bali)
Whisky
Am zweiten Tag hat Theo doch endlich einen Spirituosenladen gefunden und kann seinen Whisky kaufen. Allerdings keinen „Famous Grouse“. Sonst etwas Grausiges. Er ist jetzt glücklich, seine Welt ist vollkommen in Ordnung.
Money
Wir sind Millionäre. Als ich gestern nur noch etwas mehr als 500‘000 Rupien in Noten hatte, mussten wir doch noch zwei weitere Million wechseln gehen. Auch wenn (ausser dem Wein) alles relativ günstig ist, irgendwie wird man sein Geld doch schnell los.
(10 Franken sind ca. 120‘000 Rupien, also eine 1000er Note grade mal 8 Rappen)
Sydney und Buschfeuer
Kaum hatten wir unsere Reise begonnen, lasen wir auch schon von den Buschbränden in der Gegend von Sydney. Ausgerechnet! Dorthin wollen wir ja. Bald schon. Wir sehen uns im Fernsehen die Berichte an. Die Leute, die ihre Häuser verlieren, tun uns sehr leid. Die Brände sind verheerend.
Kaffee
Theo versucht’s immer wieder mit Espresso. Schwieriges Unterfangen!
Über LUWAK hab ich ja bereits berichtet. Ein mehr als nur betrübliches Kapitel.
Den besten Kaffee aber gibt’s gleich vorne an der Ecke: „illy“. Aus eigenem Anlass hätten wir den nie probiert. Steve musste uns erst darauf aufmerksam machen. Super Cappuccino und Milchkaffee. Es dauert allerdings eine ganze Weile, bis das Gebräu parat ist, die Kaffeemaschine befindet sich im hinteren Teil eines Vans und die Angelegenheit sieht sehr kompliziert aus. Die Dame, die den Kaffee braut, giesst um, schäumt auf, giesst wieder um und das Resultat ist beeindruckend. Der Preis auch. Der Kaffee kostet doppelt so viel wie eine 5-minütige Fahrt mit dem Taxi (trotzdem nur halb so viel wie bei uns). Sie seien in Facebook zu finden, sagt die nette Dame, wir sollten doch bitte „liken“ (damit hab ich ziemlich grosse Mühe, ich finde das so überaus blöd – nicht mal ihr zuliebe kann ich ausnahmsweise über meinen Schatten springen).
Packen – Reiseliste
Soeben sagt Theo zu mir: „Ich hab glaub‘ ich doch falsch gepackt; ich hab‘ drei Paar lange weisse Hosen bei mir und nur ein Paar kurze.“ – Ich sage nichts.
Das Problem ist ja immer dasselbe: Was genau nehm‘ ich mit? Was brauch‘ ich, was kann ich allenfalls kaufen? Was brauch‘ ich sicher nicht? Was fehlt mir, wenn ich’s nicht mitnehme?
Nun, da wir ja selten auf Reisen gehen, habe ich mir längstens eine Reiseliste zusammengestellt und auf dem PC gespeichert. Dort gibt’s einen allgemeinen Teil, einen Teil zusätzlich für Tennisferien, einen Teil zusätzlich für Rosasferien (inklusive Einkaufsliste für den ersten Einkauf vor Ort), und ein Teil (er wird immer länger) für Theos Dinge, die er ständig vergisst. Als da wären: Pyjama, kleines Kissen, Wäschblätz (braucht er dringend zum Rasieren am Morgen), Nagelbürstchen, Halbtaxabi, Strandschlarpen und sogar seinen Umhang mit den unendlich vielen Taschen hat er schon mal vergessen mitzunehmen.
Hingegen finde ich es gut, wenn er seine Coop-, Migros-, Globus-, etc.-Karten zu Hause lässt sowie Schweizer Bargeld und seine ganzen Bankkärtchen, die ihm in der „Fremde“ ja nicht dienen.
Also: Am Abend vor unserer Abreise gingen wir diese Liste nochmals durch, familienintern, Gino war dabei, Debo und Diego ebenfalls, alles wurde nochmal erwähnt und klargestellt.
Fazit: Der Wäschblätz fehlt. (It’s not the end of the world but anyway…)
Auf meiner Reiseliste hab ich übrigens seit neuestem eine weitere Rubrik eröffnen müssen. Sie heisst: „Dinge, die zwar auf der Liste sind, die ich aber doch nicht eingepackt habe, was mich dann sehr nervt.“ – Ich kann’s also auch, diesmal aber hab‘ ich nichts vergessen.
Theo hat jetzt übrigens inzwischen ein paar neue kurze Hosen gekauft. Rosarote!
Restaurants
Restaurants hat’s wie Sand am Meer. Gut und günstig sind die meisten. Durchschnittlich kostet ein Gericht etwa 3-8 Franken. Wie schon erwähnt, Alkohol ist teuer. Ein Drink kostet fast gleich viel wie bei uns und für eine Flasche Wein kann man gut und gern 50 Franken und viel mehr bezahlen, auch im Laden. Sogar der einheimische Wein kostet über 20 Franken und den probieren wir schon gar nicht. Theo, mutig wie er ist (er ist sich einiges gewohnt und seine Furchtlosigkeit in der Beziehung scheint mir oft keine Grenzen zu kennen), hat gleich am ersten Abend einen balinesischen Drink bestellt. Arak (arabisch %u0639%u0631%u0642, „Schweiß“ – klingelt was?) war drin, er hat ihn tatsächlich nicht fertig getrunken. Sogar er fand, er schmecke wie ein Putzmittel der übelsten Sorte.
Unsere Erfahrungen sind mannigfaltig. Anna und Steve sind natürlich Insiders und kennen die tollsten Restaurants. Gestern waren wir zusammen im „La Luccida“ - sooo schön. Wunderbare Aussicht auf Meer, Strand und Palmen. Sehr gediegenes Ambiente, freundlicher Service, wunderbares Essen, nicht ganz billig allerdings.
Am Abend dann ein völlig anderes Szenarium:
Swiss Restaurant Legian
Nein, nein, wir haben nicht bereits Heimweh. Wir sind auch nicht von einer Tarantel gestochen oder haben einen Sprung in der Schüssel. Es ist vielmehr so, dass uns Genny und Giancarlo Torriani (Hotel Solaria, Bivio), die jedes Jahr im November hier Ferien machen, ans Herz gelegt haben, unbedingt ihren Freund Jon Zürcher zu besuchen und Grüsse auszurichten. Er ist der Besitzer dieses Etablissements, führt das Restaurant seit 35 Jahren (genau so lange, wie ich Unterricht gegeben habe – also ewig), ist in St. Moritz aufgewachsen, hat nebenbei ein Reisebüro und ist Honorarkonsul für Bali. Die Grüsse richteten wir gerne aus und hatten einen netten Abend im Fonduestübli. Statt Fondue, Raclette, Ghackets oder Wurst-Käsesalat assen wir Mie Goreng, dazu nur noch Bier und Wasser, da wir mit Anna und Steve ja bereits am Mittag zwei Flaschen Wein geleert hatten.
Es ist immer wieder amüsant zu sehen, wie Schweizerisches im Ausland fast überschweizerisch wird. Der Abstand verstärkt offenbar die Beziehung. Ist das so?
Gestern war’s das „Gado Gado“. Terrasse am Meer, niederländischer Koch, der sein Handwerk versteht, ein tolles Restaurant. Das Degustationsmenu (jeder der fünf Gänge extrem delikat und schön präsentiert) ein Hit für 400‘000 Rupien (32 Franken), dafür erhält man bei uns ja kaum ein Schnipo.
Die Rechnung am Schluss kommt uns dann trotzdem sehr heimisch vor. Es ist halt wieder der Wein, der den Betrag ausmacht, die Abgabe fürs Government (gehen die dann mit unserem Geld essen?) und die überrissene Servicecharge, welche ja ok wär, aber ich kann keinen Moment lang glauben, dass sie den Kellnerinnen und Kellnern zugut kommt.
Tennis
Unsere Gastgeber sind die absolut Besten! Wir haben solches Glück, dass wir sie kennengelernt haben (Genny und Giancarlo Torriani sei Dank; sie haben uns den Haustausch vermittelt).
Gestern haben sie ein Doppel organisiert, ich war begeistert! Anna hat mir einen Schläger geliehen, meine Sneakers hab ich kurzerhand in Tennisschuhe umfunktioniert und los ging’s. Heiss war’s und meine Füsse taten mir schon bald weh, aber das sind ja für Tennisfreaks die geringsten Probleme.
Dazu gehört nach dem Spiel das Bier am Strand (für mich halt Wasser, da ich immer noch nicht gelernt habe, Bier zu trinken). Steve organisierte dann doch noch eine Flasche Weisswein, schön gekühlt, so sassen wir da und schauten dem Sonnenuntergang zu.
Julie, eine Neuseeländerin, die Vierte im Doppel, fuhr uns anschliessend nach Hause, wo uns alle und zwei weitere Gäste und Freunde von Anna und Steve, ein wunderbares balinesisches Nachtessen erwartete, das die Maid Neoman für uns vorbereitet hatte.
Ein unvergesslicher Abend in einem herrlichen Ambiente, lustige Gespräche – einfach gut!
Reisebericht Australien 1 (Sydney – Coffs Harbour - Byron Bay – Brisbane)
Sydney, 28. Oktober – 2. November 2013
Ankunft pünktlich am Morgen um 7 nach sechsstündigem Flug, obwohl sich der Abflug in Denpasar um fast eine Stunde verzögert hatte. Alles lief bestens bei der Immigration, der Beamte hiess uns willkommen in „Streilia“ und erzählte, als er unseren Namen las, seine Frau sei aus Norditalien, er kenne „unsere“ Gegend. Auch bei der Einfuhr-Kontrolle schlüpften wir problemlos durch, vor und nach uns wurden Reisende gefilzt, ihre Koffer durchleuchtet und durchsucht. Kein Brösmeli aus einem anderen Land wollen die Aussies in ihrem Kontinent dulden.
Zehn Grad kühler, ein wenig Nebel, es riecht leicht nach Verbranntem. Wir werden von unseren HomeExchange-Partnern am Flughafen abgeholt. Das Gepäck wird im Auto verstaut, eine halbe Stunde später sind wir in Lilli Pilli, wo Kerrie und Robert, drei Katzen und zwei Hunde (der kleinere davon, ein Chichiwawa – eine Miniaturausgabe von einem Hund - mit Beinchen und Pfoten wie von einer Maus) - ich musste fast die Lesebrille anziehen, um ihn überhaupt zu sehen, wohnen. Das Haus ist an einem Hang gelegen und reicht über mehrere Stockerke bis zum Bay hinunter. Von der offenen Terrasse oben hat man einen wunderschönen Blick auf die Bucht und die Schiffe, die vor Anker liegen.
Mit Robert hatte ich regen Email-Verkehr. Ich hatte ihn angefragt, ob er sich einen Haustausch mit uns vorstellen könne und er war sofort dabei. Ein Skigebiet in der Schwiz sei genau das, was ihm auf seiner Bucket-Liste noch fehlte, meinte er. Die ganze Familie liebt es offenbar, Skifahren zu gehen. Sie waren schon fast überall auf der Welt, wo’s im Winter Schnee hat. – Da hatte ich ja ins Schwarze getroffen. Und das gelich doppelt: Auf HomeExchange hatte er nämlich sein Ferienhaus auf der Südinsel in Neuseeland angeboten. Damit wollte ich tauschen. Im Laufe unserer Korrespondenz dann fragte mich Robert mal, ob wir in Sidney bereits einen Tausch gefunden hätten. Das war zu dem Zeitpunkt noch gerade nicht der Fall, also lud er uns für ein paar Tage zu sich heim ein. So ein tolles Angebot konnte ich natürlich nicht ablehen. Und einmal mehr erlebten wir unglaubliche Freundschaft im Zusammenhang mit unseren Haustausch-Erlebnissen.
Theo geht erst mal eine Runde schlafen (was sonst…), Kerrie nimmt mich mit in den Supermarket, wo wir fürs BBQ am Abend einkaufen. Ich muss mich erst ein wenig an ihren Slang gewöhnen, “bee“ höre ich, wollen wir kaufen - Bienen??? – „Bier“ meint sie...
Die Prides sind äusserst grosszügige, nette und liebenswürdige Gastgeber. Robert ist der grosse Organisator (das hat er jahrelang für die Deutsche Bank getan in Hongkong und Sydney und sich dann mit 50 pensionieren lassen). Er hat unseren 5-tägigen Aufenthalt voll durchgeplant, ich bin ganz froh, muss ich mal nicht.
Nach Theos Siesta geht’s aber jetzt als Erstes los nach Cronulla, wo wir das Auto stehen lassen und uns auf einen zehn Kilometer langen Marsch um die Halbinsel herum begeben. Nach einem Apéro am Ende unseres Walks geht’s heimzu und beim Abendessen werden unsere weiteren Pläne besprochen.
Ein feines BBQ wird vom Hausherrn zubereitet und dazu ein hervorragender Wein serviert. Robert zeigt uns seinen Weinkeller. Umwerfend! - Keller ist falsch. Es ist ein riesiger Weinschrank mit 1500 Flaschen. Alle schön geordnet, ein Computerprogramm sagt ihm, welche Flaschen wo sind, woher sie kommen, wie viel sie gekostet haben, welche getrunken werden müssten etc. Es gibt noch einen zweiten Weinschrank – kleiner mit nur 1000 Flaschen. Dieser befindet sich im Keller.
Am zweiten Tag fahren die beiden mit uns von Beach zu Beach und zeigen uns die schönsten Strände und Aussichtspunkte rund um Sydney. Erst Botany Bay, wo einst die ganze Australien-Geschichte mit der Landung der Engländer unter James Cook 1770 ihren Anfang genommen hat und die Bare Island, ebenfalls ein historischer Ort – ein Fort, gebaut zur Verteidigung der Stadt. Weiter geht‘s an den Bronte Beach. Von dort aus gibt es im Moment eine Art-Exhibition, einen Skulpturenweg entlang des Tamarama Beach, Marks Park, Hunter Park bis Bondi-Beach (4,5 km lang). – Ein Kunstwerk schöner und origineller als das andere! Ich kann mich fast nicht satt sehen. Leute hat’s wie Sand am Meer, ganze Schulklassen sind unterwegs. Ein Wind kommt plötzlich auf und wird immer stärker. Man muss aufpassen, dass es einen nicht über die Klippen bläst. - In der Zeitung lese ich am nächsten Tag, es seiner Sturmböen bis zu 95 km/h gewesen, die etliche Schäden zur Folge hatten und am Nachmittag musste die Ausstellung sogar geschlossen werden, da Teile davon gefährlich durch die Luft geflogen waren. Wir selber sind wie sandgestrahlt, überall paniert, und statt den ganzen Weg zurückzugehen, nehmen wir ein Taxi dorthin, wo das Auto parkiert ist. Mittagessen in Watsons Bay, von wo aus man einen einzigartigen Blick auf die Skyline von Sydney hat. Ein weiterer Spaziergang führt uns einem Strand und den Klippen entlang durch einen Park zum Hornby Leighthouse. Gap ist dann der Ort mit dem zweifelhaften Ruf, ein idealer Ausgangspunkt für Selbstmörder zu sein. - Immer sieht’s nach Regen aus, aber ausser ein paar Tropfen ist da nichts. – Mehr als 10 km lang war unsere Wanderung auch an diesem Tag.
Am Abend lädt uns Robert zusammen mit seiner Familie in ein Restaurant im Ort (Caringbah) ein; wir lernen die beiden Töchter und deren Partner kennen.- Gerne möchten wir zahlen, das wird aber gar nicht akzeptiert.
Am folgenden Tag haben wir „frei“, das heisst, unser Tag ist für die Besichtigung von Sydney vorgesehen. Der arme Theo muss schon wieder um acht aufstehen. Karrie bringt uns nach dem Frühstück auf den Zug. Nach 40 Minuten sind wir mitten in der Stadt, machen einen Rundgang genau nach Roberts minutiös ausgeklügelten und auf unsere Bedürfnisse angepassten Plan. Dem folgen wir getreu und haben anschliessend auch wirklich das Gefühl, recht viel von dem gesehen zu haben, was man so sehen will/sollte/muss. Die Stadt hat eine gute Atmosphäre, Neu und Alt erscheinen in einem manchmal recht anmutigen Zusammenspiel, der „englische Geist“ gut spür- und sichtbar, ein seltsames Gemisch aus altmodisch-englisch und hypermodern-amerikanisch und das teilweise ein wenig chaotisch konzipiert. Uns gefällt’s jedenfalls. Auf die Geschichte wird grossen Wert gelegt, jedenfalls auf die Geschichte der ersten Siedler; die Aborigines werden kaum erwähnt.
Das stellen wir im Hyde Parks Barracks Museum fest, wo ausführlich über die Geschichte der Stadt und die erste Besiedelung durch die Sträflinge berichtet wird.
Der Botanische Garten ist eine wunderbare grüne Oase mit exotischen und auch englischen Bäumen – in der weiten Anlage zur Mittagszeit herumzuspazieren ist allerdings ein Erlebnis der besonderen Art, schwirren da doch zahllose Jogger um einem herum wie die Motten ums Licht. Sie kommen dahergekeucht von hinten und von vorn, von links und von rechts, zum Glück nicht noch von oben und von unten, erstaunen würde es mich allerdings kaum, ich weiss schon so manchmal gar nicht mehr, wohin ausweichen. Ihre Gesichter sind verzerrt und gequält; Freude herrscht wenig, eher offenbar das Fitness-Diktat.
Das berühmte Opernhaus ist gewaltig. Ich kann‘s gar nicht genug fotografieren. Von allen Seiten.
Die Quiche, die wir im Restaurant essen wollen, müssen wir aufs Schärfste verteidigen – vor den Möwen. Die frechen Viecher sind überall und lauern auf jedes Brösmeli, das sie ergattern können. Steht jemand auf und geht, fallen sie gleich in kreischenden Scharen über das Übriggebliebene her, eine Szene wie bei Hitschkock.
Wir spazieren weiter zur Harbour Bridge, schlendern im Stadtteil ’The Rocks’ umher, gehen die St. George Street hinunter und enden schliesslich in ’Darling Harbour’, wo wir grad zur Aperitif-Zeit ankommen, happy hour. Nachtessen in Chinatown und zurück mit dem Zug. Kerrie holt uns am Bahnhof in Caringbah wieder ab. – Daheim ist Whisky-time für Theo und Robert, ich verzieh mich mal ins Bett.
Heute hat Robert wieder Zeit für uns. Kerrie hat Tennis-Interclub, kann also nicht mitkommen. (Zur Verpflegung muss sie Früchte mitbringen. Ein Blick in den Picknickkorb in ihrem Wagen sagt mir allerdings, dass sie unter Früchten wohl vor allem Trauben versteht, abgefüllt in grüne Flaschen.)
Wir fahren in südlicher Richtung durch den Royal National Park, mit ein paar herrlichen Lookouts mit Blick auf die Küste und die Stadt Wollongong. Weiter geht’s nach Illawarra. Hier nehmen wir den „Illawarra Fly Treetop Walk“ in Angriff, ein lohnenswerter Ausflug mit schöner Aussicht, die allerdings ein wenig beeinträchtigt wird von den vielen Wolken. Die Sonne zeigt sich heute kaum. Dieser Skywalk ist über den Bäumen angelegt auf einer circa 500 m langen und 25 m hohen Metallkonstruktion – man geht also quasi den Baumkronen entlang und kann auch den 45 m hohen Turm besteigen.
Lunch gibt’s am Meer im bekannten alten Scarborough Hotel (gebaut 1886). Anschliessend fahren wir über die See Cliff Bridge und gehen zu Fuss ein paar hundert Meter wieder zurück; der Spaziergang ist pittoresk, von dort aus hat man einen fantastischen Blick auf die Küste. Die Brücke wurde gebaut, weil der Hang die Küstenstrasse verschüttet hatte und diese dann während fast zweier Jahre geschlossen werden musste. - Gegen fünf geht’s dem Grand Pacific Drive entlang heimwärts.
Am Abend laden wir Kerrie und Robert zum Essen ein, vorher aber zaubert Robert noch eine Flasche Moët & Chandon aus dem Kühlschrank und wir trinken unten auf dem Bootssteg in den letzten paar Sonnenstrahlen zusammen ein Gläschen.
Am nächsten Tag spielt Robert Golf, Kerrie ist mit ihren Freundinnen unterwegs zu einem Girls-Weekend und Theo und ich haben nochmals einen Stadt-Tag vor uns. Kerrie fährt uns ins Queen-Viktoria-Building, ein renoviertes Einkaufs-Warenhaus im englischen Stil (fast wie Harrods in London), mitten in der Stadt. Von dort aus geht Theo ins Maritime Museum, wo er die „Endeavour“ anschauen geht, das Schiff, mit dem Cook damals nach Australien segelte. Ich schau mich ein wenig in der Innenstadt um (auf Berndeutsch: lädele).
Anschliessend nehmen wir die Fähre nach Manly, wo wir herumschlendern, dem Strand und der Promenade entlang spazieren bis zum Shelly Beach. Unterwegs sehen wir etliche Water Dragons (eine Art grosse Eidechsen) und essen etwas im Restaurant „The Kiosk“. Eigentlich haben wir unser Badezeug dabei und haben im Sinn gehabt, ein wenig zu schwimmen, aber dann wird es zusehends wolkiger und wir kommen von unserem Vorhaben ab. Also spazieren wir zurück zur Fähre (erst doch noch eine kurze Theo-Siesta im Rasen oberhalb des Strandes) und fahren zurück nach Circular Quai, ins Herz von Sydney.
Die Zeit reicht noch grad für den Besuch im Sydney Aquarium, das bis abends um 8 Uhr offen hat. Beeindruckend ist die Vielfalt der Meerestiere. In Unterwassertunneln erlebt man Haie, Rochen und what not (mehr als 12‘000 Exemplare von ungefähr 650 Arten). Sie schwimmen neben und über einem durch; man geht durch einen Glastunnel und kann ihnen auf diese Weise hautnah zuschauen.
Wir essen in einem Restaurant in Darling Harbour, nehmen den 10 Uhr Zug zurück und schliesslich ein Taxi nach Lilli Pilli.
Ein feines Glas Wein (Theo Whisky) und dann wollen wir schlafen gehen.
Daraus wird aber vorerst mal nichts. Am nächsten Tag soll ja unser Mietauto abgeholt werden und ich will unsere Fahrausweise sowie die internationalen Füherausweise, die wir extra beim TCS hatten ausstellen lassen (für 80 Fr. nota bene), für Theo parat machen. Die finde ich aber nicht unter all meinen Reiseunterlagen. – Eine chaotische Suche geht los, Panik kommt auf, wir telefonieren Gino in die Schweiz, er soll nachsehen, ob wir die zuhause haben liegenlassen, bis ich dann tatsächlich in einem Fach in meinem Rucksack, das ich inzwischen vergessen habe, dass es existiert, fündig werde. - Wie die Eichhörnchen mit ihren Nüssen: sammeln, irgendwohin in ein tolles Versteck vergraben und dann vergessen. - Beide Ausweise sind gefunden, klein und grau und teuer und sie sagen nichts. –Totale Erleichterung!!!
Endlich können wir schlafen. Zum Glück erinnere ich mich am Morgen an keinen meiner Träume.
Beim Frühstück erzählen wir vom nächtlichen Drama. Rob nimmt‘s gelassen und sagt, wenn’s ein Problem gewesen wäre, hätten wir ja einfach ein Auto kaufen statt mieten können. – So einfach…
Übrigens der Clou am nächsten Tag: Der Angestellt bei AVIS sagte, es wäre kein Problem gewesen, sie bräuchten die Ausweise gar nicht...
Von Sydney nach Coffs Harbour 2. - 3. November
Am Morgen fährt Robert Theo zu Taren Point, wo ich das Mietauto, um das ich mir solche Sorgen gemacht habe, für unsere Reise bestellt habe. Eine halbe Stunde später sind die beiden zurück. Mit einem Toyota geht unsere Reise nordwärts weiter, all unser Gepäck hat problemlos drin Platz.
Eine Stunde lang dauert es, um an den nördlichen Stadtrand von Sydney zu gelangen, die letzte halbe Stunde wie in tiefem Nebel, kaum 100 Meter Sicht, es handelt sich aber um den Rauch der Buschbrände. - Krass!
Die Linksfahrerei geht einigermassen gut, in der Stadt ist ja immer ein Auto vorne dran, an dem man sich orientieren kann. Nur hat Theo die Tendenz, zu weit nach links an den Strassenrand zu fahren, so hab ich hin und wieder eine kleine Schrecksekunde. Er nimmt eben die Aufforderung: „Keep left unless overtaking“ sehr wörtlich.
Dann die Sache mit dem Zeiger beziehungsweise mit dem Scheibenwischer. Die sind halt vertauscht. Ich erinnere mich, dass das in rechtsgesteuerten Autos immer das Problem ist. Will man die Richtung anzeigen, scheibenwischert man erst mal. Jedermann sieht dann gleich, dass der Fahrer wohl ein Ausländer ist.
Aus der Stadt heraus wird‘s recht langweilig auf dem Pacific Highway. Wenig Verkehr. Nach ungefähr drei Stunden sind wir im Hunter Valley. Dort wollen wir einen Halt machen; es ist ein grosses und bekanntes Weinanbaugebiet. Die Gegend ist sehr schön, ziemlich flach, aber Reben sehen wir nirgends. Wo nehmen die nur die Trauben her, fragen wir uns.
Robert hat uns genau angegeben, welche der 74 Winerys, die teilweise sehr weit auseinander liegen, wir besuchen sollen, um das Beste zu machen aus der Zeit, die wir haben. Es sind zwei kleinere, die nahe beieinander liegen und ich muss sagen, die Wahl war hervorragend (wie bei absolut allen seinen Vorschlägen). Sein erster Tipp war der Briar Ridge-Vinyard, wo wir einen Lunchhalt machen sollten. – Sehr guter Rat, weil es sonst weit und breit nirgends ein Lokal hat, wo man etwas essen könnte und ein sehr schöner Ort, wo’s uns auf Anhieb gefällt. Scheibenwischenderweise fahren wir vor. Leider liegt zum Essen nur ein Glas Wein drin, weil wir ja noch fahren müssen. Ohne zu degustieren kaufe ich einen Karton von diesem Wein, „The Trio“, Merlot, Shiraz, Cab Sauv (wie sie den Cabernet Sauvignon hier nennen – ist ja auch viel weniger mühsam auszusprechen). Dann ist Zeit für Theos 10-minütige Siesta im Schatten der grossen Fichten.
Auch das andere Weingut, das wir anschliessend besuchen, „Petersons“ (in unserem Reiseführer beschrieben als exklusiv, teuer und für ihre im Hunter Valley einzigartige Produktion von Schaumweinen bekannt), ist sehr hübsch gelegen, auf einem sanften Hügel, wo man ein wenig Aussicht hat und das doch tatsächlich auf Reben. Es ist Frühling hier, also die Trauben noch sehr grün und klein.
Weiter geht’s Richtung Forster, wo ich von zu Hause aus bereits ein Motel gemietet hatte. Unser vorläufiges Ziel ist Coffs Harbour, also suchte ich auf der Karte einen Ort, der mehr oder weniger auf halbem Weg liegt, damit wir die etwa 600 km lange Strecke nicht an einem Tag hinter uns bringen und wie blöd nur gerade der Autobahn entlang fahren müssen. - Ich übernehme für die restlichen 100 km das Steuer. Auch mich zieht‘s beim Fahren oft gegen den linken Strassenrand. Seltsam, daheim passiert das ja nicht (mit rechts natürlich).
Forster
Ein Städtchen am Meer, wunderbar gelegen mit Tuncurry als Schwesterstadt. Es hat viele Motels hier, auch Trailers, ich denke, es ist eher so ein „low-budget“ Ferienort. Das bestätigt sich, wie wir ein Restaurant suchen. Es habe eine ganze Menge zur Auswahl, versichern uns unsere freundlichen, hilfsbereiten Motelnachbarn, chinesische, italienische, Thai, what not. Ihnen hätte besonders das Seafood-Restaurant gefallen. Sie würden uns die Daumen drücken, dass es uns auch gefalle (nett, nicht?). - Keine zwei Minuten zu Fuss und schon stehen wir vor dem chinesischen Etablissement, also richtigerweise vor einer kleinen chinesischen Imbissstube mit Plastik-Tischen. Die Tischtücher sind aus demselben Material, wie man’s halt so kennt. Wir wollen ja aber ins Seafood-Restaurant. Das finden wir auch. „Beach Street Seafood“ heisst es (sogar im Tripadvisor zu finden und sehr gut beurteilt). - Restaurant? - Eine Snackbar, wo man am Counter bestellt wie bei MacDonalds. Aber ok, wir sind nicht wählerisch, es hat viele Leute dort, eine Terrasse, alles sehr sauber und die Fische sehen gut aus. Tische und Stühle auch hier natürlich aus Plastik. Aber sehr nette junge Leute, die bedienen. In der Ecke steht ein Getränkeautomat, Wein gibt’s natürlich keinen. Ob wir unseren eigenen Wein, den wir vorsorglich mitgebracht haben, trinken dürfen, frage ich. „Natürlich. Möchtet ihr einen Eiskübel und Weingläser dazu?“ – Super! So sitzen wir also auf der Terrasse, vor uns je eine Aluschale mit Fisch und Chips, daneben ein Eiskübel (aus Metall!), wo sowohl das vis-à-vis gekaufte sparkling Mineralwasser Platz hat als auch der Wein. Andere Gäste haben ihre Getränke ebenfalls mitgebracht, die Männer nebendran gleich einen grossen Karton Bier. Die Dämmerung beginnt und damit der Einzug der Mücken. Sie sind aggressiv. Im Lokal werden Spraydosen gegen die Plage herumgereicht. Theo scheint da etwas misszuverstehen. Er besprüht die Mücke, die leblos auf dem Tisch liegt, weil er sie nämlich bereits erschlagen hat, mit dem Zeug. - Mein Stück Lachs übrigens ist absolut fein zubereitet. Wenn es auf einem Teller in einem vornehmeren Restaurant läge, würde es zwar einen besseren Eindruck machen, aber delikater wäre es nicht. Die Pommes Frites übrigens genauso. – Wir finden nach dem Essen eine Cafébar, „Tartt“, die uns beiden auf Anhieb sehr gut gefällt. Gemütlich. Und guter Kaffee, sagt Theo. Dort wollen wir am nächsten Tag frühstücken. Auf dem Heimweg kommen wir an einem Ice-Cream-Parlour vorbei. Auch für mich hat der Abend so einen krönenden Abschluss gefunden.
Am nächsten Morgen sehen wir erst, wie schön der Ort ist. Nicht unbedingt die Häuser, aber die Umgebung und die Lage. Auf der einen Seite das Meer mit starker Brandung, in der Mitte das Zentrum mit Shops, Snackbars und Häusern, auf der andern Seite, keine zweihundert Meter entfernt, Seen mit türkisblauem, glasklarem Wasser, Lagunen, Sandbänke, wo sich die Leute tummeln und mindestens so viel Freude dran haben wie wir Berner am Marzili. Das Frühstück im „Tartt“ ist superb (Eggs Benedikt – mein Lieblings-Frühstück). Wenn wir in diesem Ort Ferien machen würden, wären wir hier Stammgäste.
Gegen Mittag verlassen wir die Gegend, die „Great Lakes“ heisst (auf Google Maps sehen wir, wie gross das Gebiet ist und wie viele Seen es tatsächlich hat) und fahren weiter Richtung Coffs Harbour. Noch nicht einmal aus dem Städchen Tuncurry heraus, schon sagt unsere Navi-Lady: „Bitte 249 km geradeaus fahren“. – So hat sie diesmal nicht viel zu tun. Aber über sie zu erzählen gibt es manches; sie hat streckenweise für grosse Unterhaltung gesorgt:
TomTom - GPS – unser Navigationssystem, das uns von Ort zu Ort führt
Wir fahren von Lilli Pilli weg Richtung Norden. Zum ersten Mal stellen wir das Navi ein, das uns den Weg ins Hunter Valley und anschliessend nach Forster leiten soll.
Die Dame kennen wir gut, es ist die gliche wie zu Hause. Sie spricht deutsch. Ich kann‘s aber nicht glauben: Was ist das denn? Sie liest die Wörter phonetisch ab, ein absolutes NO GO! Erst meine ich, ich hör nicht recht, wie sie sagt, wir sollen auf dem Expressweg Richtung Nius Kastele bleiben. Betonung auf dem „A“, auch das End- „E“ betont sie. Was meint sie? Sie sagt’s noch oft. Es ist jetzt klar, ich seh die Schilder: Newcastle ist’s. – Wo nimmt sie das „S“ nur her? – Das geht ja gar nicht. Aber es kommt noch strüber:
Lake Rd: Statt Lake Road sagt sie „Lake Er De“. (nicht „leik“, sondern wie deutsch „Laken“ –jeder Buchstabe betont). Die Snape St in Cessnock: Statt Snape Street ist’s die: „S n a p e Es Te“. / Mitchell Ave: „Mit Schell A We“)
Langsam seh‘ ich den Puck. Sie buchstabiert genau, was sie sieht (sieht???). Für welche deutschen Touristen tut sie das? - Unterste Schublade!
Es wird aber noch viel krasser: Hier kommt der Burner:
„John Renshaw Dr“ steht auf dem Strassenschild (John Renshaw Drive). - Sie sagt tatsächlich: John Renn Schau Doktor (den Vornamen hat sie fehlerlos hingekriegt).
Wenn sie wenigstens bei ihrem Schema geblieben wäre und D R gesagt hätte, aber nein, sie interpretiert.
So gibt’s noch viele weitere Ärzte unterwegs.
Eigentlich wollte ich schon lang auf einen englischsprachigen Herrn umschalten, aber ich muss zugeben, der Unterhaltungswert ist nicht zu verkennen, so bleiben wir der wegweisenden Dame im Moment treu. Wenn sie zu sehr nervt, können wir ja immer noch wechseln.
Der Gerechtigkeit halber muss ich allerdings erwähnen, dass sie ihren eigentlichen Job, nämlich uns an den richtigen Ort zu leiten, gut macht. Dafür haben wir sie ja auch bezahlt.
Unterwegs
Gerne möchte Theo irgendwo in einem schönen Kaff eine Tasse Kaffee trinken, aber davon kann er noch lange träumen. Wir fahren 200 km weiter, verlassen unterwegs den Pacific Highway (zwecks Kaffeesuche und Sightseeing) und fahren auf der Scenic Route 12 einem Fluss entlang, fahren an Tausenden von Rindern vorbei, an Farmhäusern, durchqueren etliche kleine Dörfer, die vorwiegend aus Trailern bestehen, vorbei an Bäumen, deren Stämme verbrannt sind, aber ein Beizli, wo es sich lohnen würde, Halt zu machen, finden wir nicht. An zwei Stränden versuchen wir unser Glück ebenfalls (dort muss doch ein hübsches Lokal sein!!), der eine ist leer, kaum jemand am Spazieren, von Restaurant keine Spur, der andere das Gegenteil, es wimmelt nur so von Besuchern. Ebenso von Picknickplätzen, aber eine Strandbar hat’s tatsächlich auch keine. Man nimmt halt seinen Eski mit, gefüllt mit Eis und Getränken, Kartons voller Food und that’s it. Wer braucht denn schon ein Restaurant am Beach? – Wir sind noch weit weg vom „Aussi way of life“.
Coffs Harbour
In Coffs Harbour, genau genommen in Sapphire Beach, finden wir das Haus, das wir für die nächsten neun Tage bewohnen werden. Wir staunen nicht schlecht: Ein Traumhaus direkt am Strand. Aussen wie innen modern und sehr geschmackvoll gestylt mit enorm viel Platz - erstklassig. Hier wird es uns wohl sein. Im Kühlschrank finden wir einen Kürbis-Pie, liebevoll vorbereitet von Leanne, damit wir heute Abend gleich zu Hause essen können, was wir mit Freude auch tun. Wein haben wir ja bei uns. Wir geniessen die feine Mahlzeit auf der Terrasse, das Meer quasi zu unseren Füssen, umschwirrt von Insektenschwärmen; es sind Ameisen, die ausgerechnet heute ihren Flugtag haben. Im Ohr also die starke Brandung, im Auge ebenfalls und um uns herum die Flugobjekte. Vor allem Theo scheinen sie zu schätzen. Ich hab eben meine Fingernägel neu lackiert, wahrscheinlich ist es das, was sie davon abhält, mich zu belästigen.
Zusätzlich zum Essen kriege ich noch eine Geschichtslektion von Theo. Exklusiv für mich. Er erzählt von den Japanern, Pearl Harbour, von den Australiern im zweiten Weltkrieg, von MacArthur (er muss wieder – mindestens zum fünften Mal – einen seiner Lieblingsromane von W.E.B. Griffin gelesen haben) – ja also für mich war’s eine Art Guet-Nacht-Gschichtli.
Wir räumen dann ab und gehen hinein. Es ist immer noch sehr warm. Urplötzlich aber kommt ein Sturm auf, er bläst und pfeift wie verrückt - wie ums Haus von Rocky Docky. Obwohl die Fenster alle zu sind, flatterten die Vorhänge entlang der langen Fensterfront; es ist fast ein wenig geisterhaft. Vielleicht wird hier doch nicht ganz so stabil gebaut wie in der Schweiz...
Trotzdem: Wir schlafen wie die Murmeltiere.
Am nächsten Morgen lese ich in der Zeitung, dass ein Kälteeinbruch stattfinden würde, von 34 hinunter auf 17 Grad. Wahrscheinlich ist’s das, was da grade passiert. Es bläst noch immer sturmmässig und die Brandung hat fast den ganzen Strand aufgefressen; heute ist wohl nichts mit Baden, das wäre mir viel zu gefährlich, aber wir haben ja einen Swimmingpool, wenn’s sein muss. Es ist sowieso nicht mehr so warm, die Wettervorhersage war also richtig.
Für uns stimmt das wunderbar; wir können’s gemütlich nehmen, ein wenig einkaufen gehen, endlich am Blog weiterschreiben, auf den Liegestühlen ins Meer gucken und schliesslich wieder einmal ein paar Zeilen im E-Book lesen. Dazu bin ich seit Bali, also seit einer Woche, nicht mehr gekommen. Das ist mir seit Jahren nicht mehr passiert, dass ich mehr als einen Tag lang nicht zum Lesen kam. So ein Stress, dieses Pensioniert-Sein. Das hab ich mir schon anders vorgestellt.
Am Abend dann werden wir essen gehen mit Leanne und John Watson, unseren hiesigen Gastgebern und HomeExchange-Partnern, die uns ihr Haus überlassen und sich in ihr Apartment - ein paar Beaches nördlich von hier - zurückgezogen haben. Sie waren im Juli bei uns in Bivio mit der ganzen Familie, acht Personen.
Meine Vorstellungen vom Tag entsprachen nicht ganz der Realität.
Es stürmt den ganzen Tag lang, ist aber herrliches Wetter. Ich mache mich parat für den Liegestuhl. Keine halbe Minute dauert mein Versuch, schon bin ich wieder im Haus. Der Wind ist eisig kalt und bläst alles weg, was nicht angekettet ist. Theo lacht mich aus.
Zusammen gehen wir einkaufen. Sogar Aldi ist vorhanden. Wer hätte das gedacht? – Uns interessieren eher Läden, die wir zu Hause nicht kennen, denn es ist immer interessant zu sehen, was ausländische Supermärkte alles zu bieten haben. Hier: eine Auswahl wie bei uns, eher noch viel grösser. Ein Espresso-Tassli möchte Theo gerne kaufen, diese jedoch gibt es nicht. Mugs schon. In der Not findet er als Ersatz eine Art Schnapsgläser.
Mit Kartons und Taschen voller Ware fahren wir nach Hause, vorher noch rasch bei der Post vorbei, um den Schlüssel aufzugeben, den wir vom Motel in Forster haben mitlaufen lassen.
Gegen Abend treffen wir Leanne und John am Beach von Woolgoolga. Theo kennt sie bereits von Bivio her. Er hat ihnen mal ein Raclette serviert (sie haben’s überlebt).
So ein sympathisches Ehepaar! Sie fahren zuerst mit uns in ihrem alten VW-Bus ein paar wenige Kilometer weit zum Safety Beach Golf Course, wo sie wissen, dass es Kängurus hat. Und ob es welche hat, eine ganze Menge. Jetzt wissen wir, dass wir in Australien sind. Die Tiere haben keine Angst vor uns, sind Menschen offenbar gewohnt. Sie spitzen zwar erst ihre Ohren und schauen in unsere Richtung, dann aber widmen sie sich wieder ihrem Futter. Die Hopserei ist allzu komisch, auch zu beobachten, wie das relativ grosse Kleine (Joey) beim Gehopse der Mutter fast aus der Bauchtasche fällt. Wenn ich die so betrachte, denke ich, da muss was falsch gelaufen sein bei der Konstruktion.
Wir fahren weitere zwei, drei Kilometer zu einem Lookout auf einer Anhöhe über der Küste. Der fantastische Ausblick von dort ist/wäre zum Verweilen, aber es bläst uns fast von den Klippen. Geplant war ein Picknick am Stand, wie man’s hier so macht, aber wegen dem Wind bleiben wir in der Fischbude, „White Salt“, und essen dort. The „Catch of the Day“ ist King- und Swordfish. Beide ausgezeichnet zubereitet, auf einem feinen Salat (viel zu viel Salat, meint Theo) mit leckeren Pommes-Frites (homemade und aus der Region) und gegrillten Pastinaken. Dazu hat John einen Eski voll Bier, Mineral, Rot- und Weisswein mitgebracht: Verwöhnung vom Feinsten.
Theo versucht zu Hause seinen Laptop an den Fernseher anzuschliessen zwecks Movie-Schauen, das gelingt aber nicht. Also geh ich ins Bett und lese noch ein bisschen.
Auch die nächsten beiden Tage sind stürmisch und eher kühl. Wir sind fast froh, so können wir am Blog weiterarbeiten. Einen Ausflügli machen wir aber doch. Ins Outback, also ins Hinterland. Nach Bellingen (nicht das bei Basel) in die Old Butter Factory, ein Art- und Craftvillage. An dem Ort haben sich offenbar etliche Künstler und Schauspieler niedergelassen. Wenn man also Russel Crowe im Postoffice begegnet, ist er es wirklich. Wir besuchen auch eine Winery, Raleigh-Winery, aber die Rotweine sind mir zu leicht, die Weissweine ein wenig zu süss; wir kaufen nur eine Flasche. Das Schönste aber ist die Fahrt am Bellinger River entlang. Es ist ländliches Gebiet mit Farmen, saftig grünen Weiden, Pferden, Rindern und Mangroven am Ufer entlang.
Im Supermarkt kaufen wir uns ein gebratenes Poulet und zusammen mit Kartoffeln und einem feinen Salat (nur ganz wenig für Theo) ergibt das ein wunderbares Znächtli.
Am nächsten Morgen ist es sehr viel wärmer, das Wetter schein neblig und wie wir die Terrassentür öffnen, schlägt uns ein rauchiger Wind entgegen. "Macht da eine äs Fürli?", fragt Theo. - "Äuä ender äs Für!", denke ich. - In den Nachrichten erfahren wir, dass zwei neue Buschbrände ausgebrochen sind, weltlich von Kempsy, etwa 100 km weit weg von hier, an dem Ort, wo wir vor drei Tagen versucht hatten, ein Beizli zu finden, wo Theo eine Expresso hätte trinken wollen ("Bushfire backburning genarating smoke haze along Coffs Coast").
11'000 Hektaren Wald sind betroffen, man glaubt, ein 10-jähriger Junge habe das Feuer extra entfacht. – Das gibt zu denken! – Was geschieht mit dem Kind? – In Sydney war’s ähnlich, der eine Brand wurde offenbar durchs Militär verursacht (sehr peinliche Angelegenheit), der andere aber absichtlich durch zwei 12-Jährige.
Gegen Mittag dreht der Wind ganz plötzlich, bläst in der entgegengesetzten Richtung und wir haben den perfekten, klaren, sonnigen Tag, den wir lesenderweise am Strand vor dem Haus verbringen. Ferien pur!
Die Tage hier gehen viel zu rasch vorbei. Wir unternehmen keine grösseren Ausflüge. Auf dem Weg nach Sewtell (hübscher Vorort von Coffs mit ein paar schmucken kleinen Geschäften und Cafés) sehen wir von einem Lookout aus einen fantastisch schönen Strand, wo der Boambee Creek in den Pazifik fliesst. Weisser Sand, das Wasser in allen verschiedenen Schattierungen von Grün und Blau, völlig ungefährlich zum Schwimmen. Dorthin gehen wir baden. Nur hin und wieder kommt jemand vorbei, ein Spaziergänger mit Hund, ein Fischer.
Am Abend gibt’s Barbecue. Theo grilliert!!! Ich kann’s nicht glauben: Er, der immer sagt, er könne (wolle!) das nicht. Er legt unsere Porterhouse Steaks auf den Grill – und zum Glück schau ich nach – da liegt er bereits wieder in der Stube auf dem Sofa und drückt an seinem i-Phone herum. „Das geht nicht!“, ermahne ich ihn (die Lehrerin in mir noch immer aktiv), „Wenn man am Grillieren ist, bleibt man dort und läuft nicht weg.“ - Tausend Ausreden, aber er geht doch hin und wir sind beide froh, denn das Fleisch ist grad genau richtig und ohne meine Intervention müssten wir Schuhsolen essen.
Schweizer gehen gerne wandern, fahren alle Ski und essen viel Schokolade. – Etwas in dieser Richtung haben wir schon oft gehört. Also das mit dem Wandern, na ja, wenn ich da an unsere Niesen-Wanderung vor zehn Jahren denke und an Theos Rolle in diesem Glanzstück, aber das ist lange her…
(Für Nicht-Eingeweihte: Wir waren etwa zu acht, alle wanderten bis auf meine bessere Hälfte; er nahm das Bähnli. Seine einzige Aufgabe war – er war ja logischerweise als Erster oben – sich um unser Gepäck zu kümmern, d. h. sicher zu stellen, dass auch wirklich alles hinaufbefördert worden war; wir wollten ja auf dem Berg übernachten. Um halb sechs kamen wir Wanderer auf dem Gipfel an. Ich stellte sogleich fest, dass wir alle zwar oben, unser aller Gepäck jedoch noch unten an der Talstation war. Zum Glück konnten wir veranlassen, dass die letzte Bahnfahrt unser Gepäck dann doch noch hochtransportierte. – Theo hatte ein paar wunderbare Erklärungen, weshalb der Auftrag nicht einmal ansatzweise hatte ausgeführt werden können - an den genauen Wortlaut kann ich mich allerdings nicht mehr erinnern, vermutlich weil sie mir nicht sehr plausibel klangen.)
Hier macht man uns immer wieder wandern, „go on a walk“, heisst’s dann, und diese Walks sind kaum je kürzer als fünf Kilometer. Meist allerdings über ebene Strecken, es hat ja keine Berge, die wir erklimmen müssen.
So ergeht es uns auch am Samstag, wie Leanne und John uns zum Lunch abholen. Dieses Mittagessen müssen wir uns aber erst noch verdienen. Die Wanderung führt durchs Gehölz, entlang der Headlands, auf einem gut präparierten Küstenweg, von dem aus man immer wieder herrliche Ausblicke auf die endlosen, menschenleeren Strände hat. Zwischendurch kommen wir dann tatsächlich mal an einem Resort vorbei, wo wir etwas trinken können, ein Gläsli Weissen für mich, die anderen drei nehmen ein Bier. An diesem herrlichen Ort wird auch eine Hochzeit gefeiert, am folgenden Strand eine Taufe. – Nachmittags um drei sind wir im „Mangroves Jack“, einem einfachen Restaurant (Plastiktische) mit hervorragender Küche (die Desserts sehen aus wie im 5*-Hotel und schmecken auch so) und einem tollen Ausblick auf den Coffs Creek. Eigentlich ist man hier mehr oder weniger mitten in der Stadt, aber weit und breit sind nur der Fluss zu sehen, der Busch und die Mangroven. Der freundliche, blauäugige (wörtlich gemeint, es fällt auf) Kellner schwärmt von einem spanischen Wein, den er grad neu bekommen habe, bringt uns dann aber einen feinen Shiraz aus Australien, weil wir hier ja nicht Wein aus Übersee trinken wollen.
Wir haben ein solches Glück mit unseren Haustausch-Partnern; es ist sagenhaft. Auch Leanne und John kommen uns vor wie langjährige Freunde; sie geben uns gute Tipps für die Weiterreise, haben Humor, kurz, wir verbringen einen mehr als nur angenehmen, interessanten und amüsanten Nachmittag zusammen. Eigentlich ist beim Homelink-oder HomeExchange Deal ja in erster Linie der Haustausch das, worum es geht, eine absolut gloriose Einrichtung, wie wir finden. Dass man die Partner dabei kennenlernt, ist nicht immer der Fall. Wir wohnen ja auch nicht in Bivio, also haben oder hatten wir mit etlichen Tauschpartnern nur per Email oder Telefon Kontakt. – Was wir aber hier in Australien an Gastfreundschaft und Grosszügigkeit erleben, ist einzigartig. Diese Begegnungen allein sind eine Reise wert.
Im Buch „Down Under“ von Bill Bryson beschreibt er unter anderem die Bewohner von Sydney folgendermassen: „Sydneysiders, as they are rather quaintly known, have an evidently unquenchable desire to show their city off to visitors…”. Das scheint auch auf andere Bewohner dieses Kontinents zuzutreffen. Wir haben es genau so erlebt und können davon nur profitieren!
Übrigens: Dieses Buch von Bill Bryson kann ich wärmstens empfehlen (und nicht nur dieses). Es liest sich flüssig wie ein Krimi, er beschreibt Orte und Begegnungen auf humorvolle Art, ohne je zu verletzen, mit sehr viel Selbstironie. Selten so gelacht! – Auch wer keine Australienreise am Planen ist, nie dort war oder dorthin gehen möchte - das Buch ist äusserst lesenswert. In der deutschen Übersetzung heisst es: „Frühstück mit Kängurus: Australische Abenteuer“.
Normalerweise steh ich relativ früh auf. So um sieben oder gar noch früher. Es ist so friedlich hier. Den unermüdlichen Wellen und Möwen zuzuhören und zuzuschauen, das haben wir ja nicht zu Hause. Und erst die Sonne zu beobachten, wie sie am Morgen um halb sechs aus dem Meer steigt („emporsteigt“, wollte ich zuerst schreiben, aber das wäre dann doch zu poetisch oder kitschig gewesen) – atemberaubend! Theo sagt auch, er stehe immer früh auf, so wie ich – um sechs. Manchmal zweifle ich an seiner Urteilsfähigkeit oder besser gesagt an seiner Zeitempfindung. Jetlag kann’s ja nicht mehr sein. Noch nie hat er’s nämlich vor halb neun geschafft (klar ist das für ihn in aller Herrgottsfrühe), in Bali war’s gut und gern zwischen zehn und elf Uhr. Den Sonnenaufgang kennt er nur von meinen Fotos.
Es gibt auch noch einen anderen Grund, der mich so früh aus dem Bett treibt. Sicher nicht schwierig zu erraten: Theos morgendliche Rasenmäh-Forstmaschinen-Häcksel-Geräusche sind‘s, die mir das Aufstehen leicht machen. Spätestens dann, wenn er auf Turbo schaltet und tönt wie ein Dampfkochtopf kurz vor der Explosion, verlasse ich das Bett.
Der Sonntag ist ein verregneter Tag. Er fängt zwar gut an, es ist schön, und, obwohl ein weiteres Buschfeuer etwa 50 km nördlich von hier ausgebrochen ist, dringt der Rauch nicht bis an die Küste. Es windet stark und beginnt zu regnen. Am Mittag ist’s wieder sonnig, wir benutzen die Gelegenheit für ein weiteres Ausflügli an die Marina und spazieren auf die Muttonbird-Island, von wo aus man einen spektakulären Blick auf Coffs, den Hafen und die verschiedenen umliegenden Strände hat. Die ganze Insel sieht aus wie „verlöchert“. Es sind Behausungen von Zugvögeln, die ihre Eier dort im Boden ablegen, brüten und dann Richtung Norden ziehen auf die Philippinen. Das Dumme ist nur, die Insel wird auch von kleinen Nagetieren bewohnt, deren Leibspeise offenbar ausgerechnet die Eier der Mutton-Birds sind. – Da greift dann halt der Mensch wieder ein und stellt den armen Rodents Fallen.
Auf dem Weg zurück nach Sapphire Beach kommt man an der „Big Banana“ vorbei, einem Themenpark vor allem für Familien. Schon von weitem sieht man die Riesenbanane aus Kunststoff beim Eingang prangen (The Banana Slip Water Park {Australia's first 3 story high inflatable waterslide – the biggest in the world}, Ice Skating Rink, Wild Toboggan Ride, Going Bananas Cafe, Gift and Souvenir shop, Candy Kitchen, Sunset Lakes Nursery, “The World of Bananas" multimedia theatre experience, plantation and packing shed tour and a state-of-the-art Laser Tag arena – “Australia’s first big thing. – It’s a whole bunch of fun“). Überall nichts als Fun, Fun, Fun. - Bryson hat dieser Banane und anderen grossartigen kulturellen Errungenschaften der Australier (Big Lobster, Big Oyster, Big Koala, Big Lawnmower und vielen weitere) in seinem Buch ein paar äusserst lesenswerte Zeilen gewidmet. Wir trinken ein Bananenfrappé (what else?!) und machen dann einen Abstecher auf den Hügel hinter der grossen Banane. Es geht recht steil bergauf und wir fahren durch riesige Bananenplantagen, die ungeheuer schwierig zu pflegen und zu pflücken seine müssen. Irgendwo hab ich gelesen oder gehört, dass dort schon seit mehr als hundert Jahren Bananen angepflanzt würden, dass es vor allem Inder seien, die in den Plantagen arbeiteten, denn die Australier würden ja nicht so gern solche harten Arbeiten verrichten. – Oben auf diesem Hügel hat’s einen weiteren Lookout (wie viele haben wir schon gesehen…) und wir fragen uns, ob wir den Walk dorthin in Angriff nehmen sollen oder nicht. Inzwischen ist es nämlich wieder ziemlich grau geworden und sieht nach Regen aus. Theos Mine nach zu urteilen (Runzeln und Donald-Duck-Lippen) ist mir sofort klar, dass er dem halbstündigen Spaziergang lieber entsagt. – Boy, oh boy, haben wir gut entschieden, dass wir verzichtet und uns in Auto zurückgezogen haben. Keine zwei Minuten später fängt es an zu schütten wie aus Kübeln.
Der nächste und letzte Tag bringt wieder viel Sonnenschein und ab Mitte Nachmittag Gewitter und Sturm. Aber das ist ok. Wir müssen langsam ans Packen denken.
Es fällt uns schwer, diesen Ort, das tolle Haus und unsere netten Gastgeber zu verlassen. Wir haben aber noch viel vor uns, worauf wir uns natürlich auch sehr freuen.
Unterwegs - Coffs Harbour – Byron Bay
Um halb elf verlassen wir „Seawash“, so heisst das Haus, in dem wir so gerne gewohnt haben.
Entlang dem Pacific Highway (unser Navi-Güezi nennt ihn Pazific Ha We Üpsilon) machen wir zum ersten Mal Halt in Grafton, „einem malerischen Städtchen aus dem 19. Jahrhundert mit eleganten Strassen und Flusspromenaden, bekannt für seine Jakaranda-Bäume, deren violetten Blüten jedes Jahr im Oktober ein Fest gewidmet ist“, so heisst es in unserem Führer.
Tatsächlich gibt’s im südlichen Teil des Städtchens eine Menge dieser „alten“ Häuser. Dieser Stadtteil erinnert mich an Orte in den USA, wo man sich noch immer im wilden Westen wähnt. Goldgräberartig. - Zwei, drei Pubs hat`s, bevölkert je mit ein paar Typen, die aussehen, als hätten sie die ganze Nacht dort verbracht. Kaufen kann man nicht viel, ausser man braucht grad einen neuen Sattel für sein Pferd oder ein paar Gummistiefel, eine Motorsäge, Anglerutensilien, ein paar Schrauben oder Werkzeuge beim Eisenwarenhändler. Eine Bücheraustausch-Börse gibt’s auch sowie zwei Läden mit Nippsachen, von denen ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand je auf den Gedanken kommen könnte, dort etwas zu kaufen. Um das Bild abzurunden, stehen vor den Geschäften Pick-Ups, die Farmer sind offenbar am Einkaufen. Im Grafton-Emporium, in dem ein unglaubliches Chaos von herumstehenden Möbeln herrscht, Krimskrams und vergilbten Fotos von einer Protestaktion der Graftoner Bürger gegen irgendetwas Umweltartiges, sind auch ein paar völlig verwahrloste Lädeli einquartiert, unter anderem ein Café, das allerdings alles andere als einladend aussieht. Es ist eine Art dunkle Höhle. Trotzdem bestellen wir bei der freundlichen Kellnerin nach kurzer Überlegung (wie weit müssen wir wieder fahren, bis wir ein „anständiges“ Café finden? – Wir haben ja einschlägige Erfahrungen gemacht) dann doch Kaffee und Kuchen und setzen uns draussen hin, wo’s ein paar Plastikstühle und Sonnenschein hat. So ein gutes Zitronechüechli wie dort habe ich überhaupt noch nie gegessen (ausgenommen die von Christine Ruder)!
Wir finden anschliessend doch noch das Zentrum des Städtchens (wir sind zu früh abgezweigt und landeten somit in Süd-Grafton), dort sieht‘s auf der Hauptstrasse nicht anders aus als in so manchem ähnlichen Ort: Läden, Supermärkte, Tankstellen, viel Verkehr etc., aber wenn man durch die Quartiere fährt, kommt man an wunderschönen, schmucken Häusern aus der Zeit um 1900 vorbei mit liebevoll gepflegten Gärten und prachtvollen Bäumen und Sträuchern.
Weiter geht die Reise auf dem Highway, der nicht mit unseren Autobahnen vergleichbar ist. Oft ist er nur zweispurig, manchmal hat’s auf der einen Seite einen dritten Track zum Überholen, so wie das bei uns früher auf der Strecke Lyss-Biel der Fall gewesen ist. Gefährlich also, fast immer mit Gegenverkehr.
Wir machen einen Abstecher nach Yamba, gemäss Führer „traditionelles Fischerdorf aus dem 19. Jahrhundert, wird wegen seiner gepflegten Strände immer beliebter.“ – Ein malerischer Ort am Meer, sicher ein beliebter Ferienort mit tollen Stränden, aber auch Seen- und Flussgebieten. Es ist friedlich hier, hat nur wenige Leute, ein paar Cafés, ein paar Läden (Theo kann wieder Whisky-Nachschub kaufen, Gott sei Dank), wir essen Lachs-Sushi und fahren dann weiter.
Gegen Byron Bay zu wird viel Strassenbau betrieben, es werden wohl Autobahnen entstehen ähnlich wie bei uns, man sieht Ansätze von Brücken und sogar ein Tunnel ist am Entstehen. Es ist sicher nötig, hier eine passable Strasse zu bauen, denn diese einzige Verbindung zwischen Sydney und Brisbane, die sich stolz Highway nennt, ist oft nicht mehr als eine holprige Drittklass-Strasse. Somit wird man wegen der Road Works immer wieder mal auf eine Ersatzbahn geleitet, was unser Navi-Güezi (ich nenn sie ab jetzt der Einfachheit halber Rösi) ziemlich aus der Fassung bringt. Uns aber nicht, die Umfahrungen sind jeweils gut beschildert.
Die Route führt nun „in die Berge“. Es ist ein schönes Gebiet im Hinterland von Byron Bay, grüne Weiden, ländlich. Jetzt müssen wir abbiegen, grad auf einer Anhöhe. Wir halten rasch an, um ein Foto zu machen. So ein schöner Ausblick: rechts am Horizont das Meer. Auf der linken Seite sieht man weit ins Land hinein – Hügelketten und Täler; in diese Richtung weist uns Rösi.
Häuser hat’s kaum mehr. Wir sind SEHR gespannt, wo wir landen werden. Das ist immer das Lustige dran, sich vorzustellen, wie’s dann sein wird, dort wo wir unseren nächsten Haus-Swap haben. Normalerweise sieht man ja im Internet, wie das Haus und die Umgebung aussehen, aber diesmal war’s nicht so. Julie und Ian Riches, unsere neuen Gastgeber, haben kein Inserat mehr bei Homelink. Sie kamen schon im Jahr 2008 nach Bivio, also vor sechs Jahren, als wir noch mit keiner Faser dran dachten, in Australien Ferien zu machen. Sie wohnten damals noch direkt in Byron Bay. Vor ein paar Jahren sind sie umgezogen, weil es ihnen im Ort zu hektisch wurde und sie lieber die Einsamkeit suchten. – Die hat man hier. - Glücklicherweise hatte ich ihre Email-Adresse aufbewahrt. So konnte ich sie kontaktieren.
Die Gegend wird immer verlassener, wir biegen in eine Einbahnstrasse ab, durch Wald und Wiesen, bis die Strasse nicht mehr weitergeht. Hier ist es, das Haus, wo sich der Fuchs und der Hase gute Nacht sagen. Eher das Possum und das Wallaby zwar. Das Anwesen liegt in einer Art Park, wir schätzen das Grundstück auf mehr als 10‘000 m2, mit den verschiedensten Bäumen und Sträuchern, mit Palmen, Franchipani, Strelizien, Banksia, Red Silk Cotton Trees und so weiter. Es ist wunderschön. Gesäumt wird der „Garten“ von einem Wald, Nachbarn sieht man keine. Wir werden herzlich begrüsst von Julie; sie zeigt uns das Haus, sagt, wo was zu finden ist, wie was funktioniert, es ist easy. Natürlich habe es an so einem Ort auch Tiere, laute zum Teil, vor allem des Nachts. Ein Possum wohne grad da in der Palme, es liebe es halt, übers Blechdach zu rennen. Schlangen habe es nur selten. Sie hätten erst viermal eine gesehen, seit sie hier wohnten. Ja, doch, ziemlich giftige. Aber no worries, no worries. Da passiere sicher nichts, man müsse halt sonst Emergency anrufen: „000“. - Sehr beruhigend zu wissen! – Die sind sicher schnell vor Ort, kann ich mir vorstellen.
Gegen sechs kommt Ian heim von der Arbeit, es gibt Apéro und Julie bereitet ein leckeres Nachtessen zu. Lachs, Spargelsalat und zum Dessert Erdbeeren. Es ist ja schliesslich Frühling. - Es wird ein vergnüglicher Abend. Sie beide sind ganz ähnlich wie unsere anderen australischen Homelink-Freude, die wir bisher haben kennen gelernt: grosszügig, nett und völlig unkompliziert und es kommt uns vor, als würden wir uns schon lange kennen (nur von den Emails, die wir damals und jetzt ausgetauscht haben. Gemeinsamkeiten: Wir haben beide Zwillinge im ähnlichen Alter, a boy and a girl). Sie erzählen uns von Bivio und wie sehr es ihnen dort gefallen hat. Julie hat damals zum ersten Mal Schnee gesehen. Unvergesslich für sie - wir sehen all die Schneefotos im Album. Ein Schnee-Bivio-Foto hängt in einem Rahmen über dem Esstisch.
Coorabell und Byron Bay
Julie und Ian fahren am nächsten Morgen sehr früh weg; wir sehen sie nicht mehr. Sie fliegen für zwei Wochen nach Tasmanien in die Ferien und überlassen uns ihr Heim. Ihre Koffer sind schon gepackt. Unsere packen wir aus.
Es wäre eine Oase der Stille in der Nacht, wären da nicht all die nachtaktiven Tiere und Theo, der mit seiner Motorsäge neben mir liegt.
Das Tosen der Brandung haben wir jetzt ausgetauscht mit dem ohrenbetäubenden Quaken der giftigen Kröten, dem Gezirp der Grillen, den anderen Lauten, die ich nicht zuordnen kann. Gegen Morgen Vogelgezwitscher und es kommt ein Specht dazu. Ich bin sicher, er hat einen Hammer oder sonst ein schweres Werkzeug dabei, um den Baumstamm zu bearbeiten. Ich hör auch das “Crybaby“, einen Vogel, der diesen Namen nicht zu Unrecht erhalten hat. Wenn mir Julie nicht davon erzählt hätte, wäre ich drauf und dran gewesen, das arme Kind im Wald zu retten.
In der Nacht hat es stark geregnet, jetzt ist der Morgen hell und klar. Nachdem Theo aufgestanden ist, machen wir eine Einkaufsliste, die wir dann allerdings zu Hause vergessen, und fahren ins nächste Dorf zum Einkaufen. Wir wohnen hier in Coorabell, so heisst es auf der Karte, aber das ist nur die Bezeichnung, eine Art Flurnamen. Hier findet man weder einen Laden noch ein Café, einen Pub oder eine Bar. Alle paar hundert Meter verbirgt sich hinter Bäumen ein Einfamilienhaus oder eine Farm. Die sehen alle ähnlich aus, mal grösser, mal kleiner, man hat den Eindruck, sie seien aus weissen Fertigelementen zusammengebaut mit einem grünen Blechdach als Abschluss. Kühe und Pferde hat’s, die Gegend erinnert uns an England. Nur vereinzelte Palmen vermasseln einem die Illusion. Ein paar Kilometer weiter weg ist Possum Creek, dort gibt’s wenigstens ein Restaurant. „Lilian’s“ (nur Breakfast und Lunch). Zum Einkaufen müssen wir nach Bangalow. Bangalow ist ein reizendes Dorf; es hat ausgesucht schöne (teure) kleine Läden dort, Restaurants und Cafés. So richtig zum Sich-wohl-Fühlen. Wir frühstücken, kaufen im Supermarkt ein und erstehen beim freundlichen Metzger – dessen Slang zu verstehen ich total Mühe habe, Theo versteht kaum ein Wort - zwei tolle Steaks für fast gar nichts. Wir dachten, es koste 40 $, auf der Quittung sind’s dann nur 14. Wie er hört, dass wir aus der Schweiz kommen (wegen unseres seltsamen Akzents), kommt er kaum mehr aus dem Schwärmen heraus, wie schön es dort sei. Die Wurst, für die sich Theo interessiert, legt er uns noch gratis dazu.
In einer der Boutiquen finde ich eine Second-hand-Abteilung. Angeschrieben steht: „Pre-loved“ – was für ein einfühlsamer Ausdruck!
Zu Hause geniessen wir den schönen Ort, an den es uns hier verschlagen hat. Ich schreibe ein bisschen, Theo liest und setzt sich mit dem Land, der Flora und Fauna auseinander. Er liest in Bill Bryson’s „Down Under“, muss oft lachen und erzählt mir immer wieder Episoden aus dem Buch, das ich ja auch gerade erst gelesen habe. Soeben fragt er mich, ob männliche Kamele auch einen Beutel hätten. ????? „Kängurus meinst du wohl?“ „Ja“ - „Nein, nur Seepferdchen…“
Zum Nachtessen am ersten Abend fahren wir nach Mullumbimbi (ich liebe den Namen). Der Slogan des Ortes lautet „The biggest little town in Australia“. Es wird davon ausgegangen, dass der Name von den Bunjalung-Aborigines stammt, welche das Gebiet ursprünglich bewohnten. Übersetzt bedeutet der Name des Ortes demnach in etwa: „kleiner, runder Hügel“ und scheint sich daher deutlich auf den Mount Chincogan zu beziehen, welcher mit einer Höhe von 308 m „über den Ort wacht“.
Wir essen in einem japanischen Restaurant, dem „Izakaya“, das uns Julie und Ian empfohlen haben. Mega gut war’s! Den japanischen Kellner können wir zwar noch schlechter verstehen als den australischen Metzger, aber seine Lieblingsfloskel, „you guys“ ist gut im Gewaschel erkennbar („hungry, you guys?“, „liked it, you guys?“).
Die Heimfahrt (ca. 20 Minuten) gestaltet sich eher harzig und beschwerlich. Kaum sitzen wir im Auto, beginnt es sintflutartig zu regnen. Die Strassenschilder sind fast nicht mehr zu lesen, und weil es wegen der Strassenbauarbeiten lauter Umleitungen hat, wird auch Rösi ganz konfus, will uns immer wieder ins Abseits lotsen und beharrt auf Ausfahrten, die schlicht nicht vorhanden sind. Wir ignorieren sie, wie sie dann aber sagt: „Biegen sie in zweihundert Metern in die Strasse Kol Amon Es-zenik Doktor“ (Coolamon Scenic Drive), wissen wir, dass wir auf dem rechten Weg sind. Jetzt geht’s nur noch 5 km bis zur Abzweigung der Lofts Er De. Jedenfalls sind wir recht froh, unversehrt zu Hause anzukommen, dort, wo es heisst: ROAD ENDS.
In Byron Bay gibt’s vor allem zwei Dinge, die man unbedingt gesehen haben muss, nämlich den Strand beziehungsweise die kilometerlangen Beaches, die man ja gar nicht nicht sehen kann und dann den Leuchtturm. Er ist besonders gefällig, weil er auf einer hohen Klippe steht, am alleröstlichsten Punkt des Kontinents.
Die Aussicht ist fantastisch, man sieht von oben her auf die unendlich langen Strände und den Küstenstrich.
Byron Bay ist ein schmuckes, lebendiges Städtchen, ganz anders als Coffs Harbour, wo wir fanden, es gäbe gar kein richtiges Zentrum.
Hier ist’s ganz hippyhaft, man sieht viele junge Leute mit farbigen Kleidern, gelb-grüne Haare sind wohl grad in Mode, schön gestylt (hatten wir das nicht schon mal?), Andreas Thiel würde hier nicht sonderlich auffallen. Eine Gitarre in der Hand macht sich auch gut, Thongs (Flip-Flops) an den Füssen gehören selbstverständlich dazu, Tatoos sowieso. Hat’s uns ins Jahr 1968 zurückversetzt? - Ein Backpacker-Ort. - Es ist eine lässige Stimmung. Viele haben noch ihr Surfboard dabei, man kommt ja schliesslich grad vom Strand. – Dort waren wir auch, klar doch, es ist trotz der Hitze angenehm, weil stets ein starker Wind weht, der die Windsurfer im Höllentempo vorbeiflitzen und uns kaum das Strandtuch positionieren lässt, weil alles, was wir nicht fest im Griff haben, weggeblasen wird.
Ein Spaziergang durch den Ort, ein Bier und Ringli (Calamares wie im Almadraba-Büchtli) im ersten Stock eines Restaurants mit Aussicht aufs pulsierende Stadtzentrum – easy life. Im Hinterland ziehen wieder dunkle Wolken auf, wir beschliessen, heimzufahren. Und wieder giesst’s wie aus Kübeln. Es dauert nur eine Viertelstunde, bis wir daheim sind. Denken wir. Da haben wir die Rechnung ohne Rösi gemacht. Sie hat sich heute etwas Besonderes für uns ausgedacht, damit wir die Sintflut noch ein wenig länger geniessen können: Sie hat eine Strecke herausgetüftelt, die gesperrt ist und wir kennen den Weg noch nicht gut genug, um sie zu ignorieren. Der Umweg, den wir daher fahren müssen, beträgt ca. 20 km auf einer engen, schlecht ausgebauten Strasse. Rösi versucht uns ständig zur Umkehr zu bewegen, sie besteht beharrlich auf der NO THROGH ROAD, der Regen prasselt aber jetzt so stark auf die Windschutzscheibe, dass wir sie gar nicht mehr hören. - Ich hab manchmal fast Zustände, weil Theo dermassen weit links fährt, dass er oft die Löcher am Pflasterrand so trifft, dass zusätzlich zum Regen riesige Wasserfontänen an die Frontscheibe spritzen, und das vor allem dann, wenn ein Auto entgegenkommt. Dort, wo der Asphalt aufhört, kann man sowieso nie sicher sein, ob nicht sogar ein Graben oder mindestens ein paar rechte Dellen vorhanden sind. Es kommt dazu, dass mir Theo kurz vor Abfahrt gesagt hat, unser Mietauto habe ziemlich schlechte Reifen, fast ohne Profil, wenn es also regne, müsse man besonders aufpassen. Kommt weiter dazu, die Strasse ist flutgefährdet, immer wieder hat es Schilder, die vor Überschwemmung warnen. Es scheint nicht, als ob er sich selber noch an seine Aussage erinnert. Er fährt meiner Meinung nach (die verkünde ich auch lautstark) viel zu schnell und manchmal noch dazu mit nur einer Hand am Steuer. – Wie wir endlich doch noch zuhause ankommen nach etwa vierzig Minuten, sagt er, ich hätte ihn an seine Mutter erinnert, die jeweils vom Hintersitz aus seine Fahrweise kritisiert hatte (sie hat nie einen Führerschein besessen, und ich erinnere mich, dass sie in jeder Kurve gesagt hat „Pass auf“ und auch sonst während der ganzen Fahrt jede Ampel, jeden sich nähernden Fussgänger und jede Querstrasse erwähnte, die sie von ihrer Position aus sehen konnte – meistens bereits im Nachhinein. Theos Gelassenheit in solchen Situationen und/oder seine Fähigkeit einfach nicht hinzuhören, habe ich damals bewundert). Sie habe aber, wenn’s richtig schwierig wurde, jeweils zur Beruhigung ein paar Tropfen Koramin eingeworfen. – Die fehlen mir!
Kein Wunder ist die Gegend hier so schön grün, wenn’s immer so stark regnet gegen Abend. Für beziehungsweis gegen Buschbrände natürlich die beste Medizin.
Am Samstagmittag haben wir mit Leanne und John Watson (unsere Haustausch-Freunde aus Coffs Harbour) in Newrybar im Restaurant „Harvest Café“ zum Mittagessen abgemacht. Sie sind auf einer Biketour in der Gegend und dachten, wir könnten uns doch hier treffen, da wir ganz in der Nähe wohnen. Sie haben einen Freund mitgebracht, der ebenfalls mit von der Partie ist beim Velofahren und wir verbringen zwei gemütliche Stunden zusammen in diesem hübschen Restaurant bei sehr feinem, aber recht teurem Essen. Marius ist Südafrikaner, wohnt mit seiner Familie in Coffs Harbour und arbeitet als Solicitor in Johns Anwaltsfirma. – Ob sich da ein neuer Haustausch anbahnt? Seine Familie hat eine grosse Farm in Südafrika und ihn würde es sehr interessieren, Ferien in Bivio zu machen. – Mal sehen…
Da ist was los, in Byron Bay am Samstagabend. Es wimmelt von jungen Leuten, gute Stimmung herrscht. Aus heiterem Himmel kommt ein orkanartiger Wind auf, alles Mögliche wirbelt durch die Luft - urplötzlich steht da eine schwarze Wolkenwand, wir können grad in den nächst besten Hauseingang flüchten (Ozy Mex-Snackbar), schon beginnt ein Hagelsturm, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Innert Sekunden prasseln die Eisstücke wie aus einem Guss mit einem Höllenlärm auf den Asphalt, der Verkehr steht still, die nussgrossen Hagelkörner bedecken die ganze Strasse und um den Kreisel fliesst ein weisser Fluss wie eine riesige Schneedecke, etwa 10 cm hoch. Wer noch nicht in Deckung ist, presst sich an die nächste Häuserwand, ein junger Mann lässt sein Sixpack Bier mitten auf der Strasse fallen, Bier und Glassplitter vermischen sich mit dem Hagelregen, die Girls im Ozy Mex vesuchen, mit Handtüchern das Wasser, das ins Lokal fliesst, zu stoppen – ein Chaos. Der Spuk dauert etwa eine Viertelstunde, dann regnet’s nur noch. Auf den Strassen liegt ein weiss-grüner Teppich, von den Fichten sind haufenweise Äste und Zweige abgebrochen, wir gehen barfuss zum Auto. Die Strassencafés, wo’s gerade eben noch so laut und lustig zuging, sind leer gefegt, nasse Gestalten drücken sich an die Hausmauern, es ist ein seltsames Schauen.
Ein kurzer Einkauf noch im Supermarkt, bei einem Stromausfall wird’s einen Moment lang stockdunkel (goldige Zeiten für Shoplifters…), dann geht’s heimwärts. Rösi legt uns nicht mehr rein dieses Mal („Los nid uf di Geiss!“, weise ich Theo an). Wie kennen nun den Weg.
Von einem der Häuser auf einem Hügel vis-à-vis in ein paar hundert Metern Entfernung dringt laute Musik zu uns rüber. Da ist wohl jemand dran, eine Riesenparty zu veranstalten. Wir kümmern uns nicht weiter, gehen gegen Mitternacht ins Bett mit den hektischen Rhythmen der heissen Musik. Bis um vier Uhr morgens dauert die Unterhaltung. Ich frage mich schon, wann die endlich zusammenbrechen dort drüben. – Und weiter geht’s um halb sieben am nächsten Morgen. Ich fasse es nicht. Sind die nie müde? Uns stört’s zwar nicht, Theo schläft sowieso, (hoffentlich stört er sie nicht…) und ich hab ja Ferien. Gegen neun stoppt die Musik, kurz darauf kommt eine Nachbarin vorbei und fragt, wie’s uns gehe, ob wir hätten schlafen können. „No worries, no worries“, sage ich, „jemand wird ja einen triftigen Grund zum Feiern gehabt haben“. - Sie habe die Polizei kommen lassen, sagt sie, jetzt gehe es ihr zu weit. Diese Festereien kämen mindestens einmal pro Monat vor und sie habe nun genug davon. – Eine halbe Stunde später ist die Musik wieder auf voller Lautstärke zu hören. Aber jetzt ist es ja Tag und tagsüber ist es kaum verboten, Musik zu machen. – Zum Glück sind Nachbarsstreitigkeiten nicht unser Problem. Es gibt sie offenbar überall, auch hier, wo man so weit auseinander wohnt. Wer hätte das gedacht…
Der Sonntag bringt wieder sonniges Wetter, jedenfalls am Anfang. Gegen Mittag fahren wir in die Stadt, wo ein allwöchentlicher Markt stattfindet, ein Handwerkermarkt, wo man aber auch Gemüse und Früchte kaufen kann, es genügend Verpflegungsstände gibt, wie sie eben so sind, diese Märkte: farbig, farbig, farbig. In den Strassen in Byron sind die Leute am Aufräumen. All die Äste müssen weg, es sieht fast wieder aus wie vor dem Sturm. Auf dem Marktgelände ist’s auch fast überall trocken, erstaunlich, wie rasch die Normalität wieder eingekehrt ist. Wir verleben zwei vergnügliche Stunden, schauen uns die bunten Stände und Leute an, essen feine Crèpes und hören zwei Bands zu, die sehr gute Musik spielen – eine davon eine südamerikanische, die andere eine Schülerband. So vergeht die Zeit rasch. Wir treffen Leanne und John nochmals, sie haben ihre Biketour hinter sich, wir gehen zusammen ins Byron Bay Hotel, wo man sich offenbar trifft und steigen ins Apéro. Da beginnt es wieder zu regnen. Allmählich sind wir’s gewohnt. Aber diesmal sieht‘s eher nach Dauerregen aus, nicht nach einem Gewitter wie bisher üblich. Die Watsons nehmen ihren 250-km Weg nach Coffs unter die VW-Bus-Räder, wir fahren nach Hause nach Coorabell. Die Musik hat aufgehört, alles ist friedlich. Zwei wild gewordene Hühner flitzen vor unserem Auto durch. Ich sehe sie jeden Tag; es scheint ihr Spiel zu sein, wie die Irren hintereinander herzurennen, fliegen können sie nur schlecht, ihr Spurt sieht völlig komisch aus. Sie erinnern mich an unsere „Haustier“-Hühner in Antwerpen. Sie drehen Kreise im Gelände und kommen immer wieder vorbei. Theo möchte sie filmen, die beiden sind aber viel zu schnell, so gelingt das nicht. Es handelt sich um ganz spezielles Federvieh, schwarz mit gelben Hälsen und roten Köpfen. Es sind Buschhühner, die zur Gattung Grossfusshühner gehören, hat mich das Internet gelehrt. Sie werden bis zu 75 cm gross.
Im Strauch neben unserem Esstisch hat sich ein anderer Vogel niedergelassen. Er hat offensichtlich keine Angst oder keinen Respekt vor uns. Er sieht prächtig aus. Nicht grösser als eine Taube, es muss ein Papagei sein: grünes Gefieder, gelber Kragen, blauer Kopf, roter Schnabel, gelbe Brust mit einem rot-orangen Lätzli. Die Farbigkeit ist fast zu viel des Guten. Was hat sich da die Natur bloss ausgedacht? Ich glaube, er weiss, dass er eine Schönheit ist, so keck und selbstbewusst schaut er in die Welt hinaus. Es ist ein „Allfarblori“, wie ich grad lese.
Von Byron Bye nach Brisbane
Die letzten 200 km auf dem ersten Teil userer Australienreise, eine herrliche Fahrt durchs Hinterland, sind geschafft. Unterwegs besuchten wir den Springbrook – Nationalpark, den Hinze-Damm und den Ort Surfers Paradise an der Gold Coast – ein völliger Szenenwechsel. Vom Land in die Stadt, von Natur pur zu Beton nur (nein, natürlich nicht ganz, nur des Reimes wegen – Beaches ohne Ende hat’s ja auch hier wie überall).
Brisbane
Kurz vor unserem Ziel kommen wir zwar in einen grossen Verkehrsstau, aber Rösi führt uns geradewegs dorthin, wo wir für die nächsten sechs Tage wohnen werden.
Die Stadt gefällt uns ausserordentlich gut, sie hat eine ganz speziell gefällige Atmosphäre. Alles ist sauber, die Leute sind sehr freundlich und hilfsbereit; so richtig zum Wohl-Fühlen. Man kann sie auf äusserst praktische Art besichtigen, der öffentliche Verkehr ist bestens ausgebaut. Rasche Fährschiffe (Katamarane), die sogenannten City Cats, verkehren regelmässig und mit hoher Frequenz von einem Anlegeplatz zum andern hin und her an beiden Seiten des breiten Brisbane River. Die eine Schiffslinie, die City Hoppers, sind sogar gratis. Dazu hat’s massenhaft Busse, die ganze Strassen und Tunnels nur für sich alleine haben, so dass sie effizient vorwärtskommen.
Es gibt haufenweise trendige Restaurants, viele davon schön am Flussufer gelegen, man könnte während Wochen jeden Tag wo anders essen, ohne dass es einem verleidet.
Wir wohnen in einem Aussenquartier, in einer ruhigen Nebenstrasse, der Heidelberg-Street (diesmal hatte Rösi keine Probleme mit der Aussprache), die Busstation ist direkt vor der Haustüre, zur Schiffsanlegestelle geht’s 400 Meter weit zu Fuss. In einer guten Viertelstunde sind wir also mitten in der Stadt. Einkaufen können wir bei „Spar“; der ist gleich um die Ecke. Ja, so haben wir auch hier ein easy Life, alles ist bestens, uns fehlt’s an nichts!
Erstaunlich, wie nett die Leute überall sind. Begegnet man jemanden beim Vorbeigehen auf der Strasse oder auch an der Bushaltestelle, wird man sehr oft gegrüsst, grad so wie das bei uns in den Dörfern noch üblich ist. Und das in einer Grossstadt - sehr sympathisch! Manchmal gibt’s sogar ein kleines Gespräch, meistens übers Wetter (Überbleibsel aus dem Englischen Erbe? - Smalltalk natürlich, aber wieso auch nicht?), an der Kasse im Supermarkt sowieso, auch sonst in den Geschäften, und dort sogar in der Innenstadt.
Unsere Homelink-Partner wohnen im selben Haus im ersten Stock, wir haben eine Wohnung für uns allein im Parterre. Kay und Lauie (Lorenz) Topping sind viel auf Reisen unterwegs, jedes Jahr für drei Monate in Europa. Gleich nach der Begrüssung liess Lorie uns wissen, dass sie beide nicht Skifahren könnten, aber SKI doch wichtig für sie sei, nämlich: „Spend (your) Kids Inheritance“. - Ja, das leuchtet ein, wir sind genauso am Üben, das Erbe unserer Kinder zu verprassen. Die beiden sind im Mai 12 bei uns in Bivio gewesen, es ist also ein weiterer Haustausch, den wir noch zugute haben, jetzt also beziehen.
Im Brisbane-Fluss kann man nicht baden (es habe kleine Flusshaifische, erzählt man uns), es gibt aber einen „man-made“ Beach im Gebiet der South Bank mit feinem weissen Sandstrand, gepflegten Wiesen und ziemlich grossen Poolanlagen - gar nicht mal so schlecht. Als ich vor sechzehn Jahren zum letzten Mal hier war, hiess der Strand „Kodak-Beach“, jetzt geht es denen nicht mehr so gut (wer kauft noch Filmrollen?), so hat der Sponsor halt gewechselt und die Anlage heisst „Streets-Beach“, genannt nach einer Eiscrème-Marke. - Mit unserer Aare und dem Marzili natürlich nicht vergleichbar. Wir Berner wissen ja, etwas Schöneres gibt es nicht. (Ich hab übrigens einen unterhaltsamen Link zum Aarebad im Internet gefunden, vielleicht interessiert’s jemanden; es war ein TV-Beitrag der BBC. Der Link: www.youtube.com/watch?v=hly8NG3y-vE">www.youtube.com/watch?v=hly8NG3y-vE).
Brücken über den Fluss hat es unzählige, so scheint mir. Und es werden noch neue gebaut. Einige sind für Fussgänger nur, andere für Autos und Busse. Mit der Fähre fahren wir von einer Endstation zur anderen (knapp anderthalb Stunden) und bestaunen vor allem auch die Gateway-Bridge, von der unser Freund Franz Fischli erzählt hat. Er war 1980 beim ersten Spatenstich dabei, seine Firma „Bouygues“ hat damals die Vorspannarbeiten zum Bauwerk geliefert. Die Brücke ist imposant, schön geschwungen, war damals die längste ihrer Art und jetzt, wenn man genau hinsieht, hat man das Gefühl, man sehe doppelt (mitten am Tag), denn gleich hintendran ist eine exakt gleiche Brücke gebaut worden (seit drei Jahren im Betrieb); die beiden verbinden jetzt stereo zwei Vorstatteile miteinander.
Das ganze Gebiet von South Bank, es wurde im Jahr 1988 für die Weltausstellung ausgebaut, mahnt mich an London, und wohl nicht nur mich. Alles ist ähnlich wie das Südufer der Themse, Theater und Museen findet man dort, lauschige Wege zum Spazieren – ja, und sogar das London-Eye fehlt nicht, das Riesenrad, von wo aus man einen sensationellen Blick über die Stadt hat. Nur wissen sie es hier nicht so effizient zu propagieren wie in England; ein „Ride“ kostet nur halb so viel und niemand steht Schlange, die Kabinen sind halb leer. In London steht man gut und gern eine Stunde an, wenn man sein Ticket nicht vorher per Internet bestellt hat. Auch so muss man mit einer halben Stunde Wartens rechnen. Hier aber nicht.
So ist das „Mutterland“ England überall noch spürbar. Auch die schachbrettartig angeordneten Strassen sind nach Königin Victoria und ihren Kindern benannt, die Nord-Südstrassen nach ihren Töchtern, die Ost-West-Tangenten nach ihren Söhnen.
Zurück zur Innenstadt: In South Bank hat’s etliche schön gelegene, trendige Restaurant mit tollem Blick auf den Fluss und die gegenüberliegende Skyline. Dort aber einen Platz zu finden an einem Samstagabend ist fast aussichtslos. Dies gelingt uns aber dennoch nach etlichen Pleiten, mit der Auflage allerdings, den Platz bereits um halb acht Uhr zu räumen. Na ja, wir sind schon lange unterwegs, haben Museen besucht, es sieht sowieso nach Regen aus und hungrig sind wir auch. – Einmal mehr muss ich sagen, wir essen super fein, Entenbrust vom Zartesten, Risotto vom Schmackhaftesten, Gemüse vom Leckersten. Ich muss bei Gelegenheit im Internet nachschauen, was das für Gemüse sind, die da auf dem Teller liegen. Nach einem kurzen Spaziergang entlang der Promenade nehmen wir die Fähre. Die Heimfahrt ist ein besonderes Erlebnis. Obwohl noch nicht sehr spät, ist es tief dunkel, die Stadt ist überall schön beleuchtet (fast kitschig teilweise), die Story Bridge wechselt alle paar Sekunden ihre Lichterketten von Gelb auf Orange, Rot, Blau, Grün, Violett, Weiss - grad wie ein Regenbogen. Auf dem Boot weht ein Wind, endlich, es ist nämlich sehr heiss und schwül und das Besondere: Rings um uns herum blitzt und wetterleuchtet es immer stärker, sekundenweise wird es taghell; es muss ein Riesengewitter im Anzug sein. Die City Cat legt bei Mowbray Park an, wir müssen aber noch rasch Weinnachschub kaufen gehen (der Bottle-Shop hat bis spät in die Nacht geöffnet). Erledigt. Wir schaffen’s grad bis zum Spar, dann fängt es an zu regnen. Nur noch einhundert Meter bis zur Haustüre. Das aber schaffen wir gerade nicht, die kurze Strecke langt und wir werden durch und durch nass. Zum Glück ist’s ein warmer Regen und schliesslich sind wir ja wasserdicht.
Zoo
Etwas vom Besten, was wir in Brisbane erlebt haben, ist „Lone Pine Koala Sanctuary“, eine Art Tierpark im Süden der Stadt, wo man all die Tiere sehen kann, die man sonst eventuell verpasst (zum Teil weil sie nachtaktiv sind und wir nicht mehr so sehr, jedenfalls nicht in ihrem Lebensraum) oder weil sie in einem andern Teil dieses „Sunburned Country“ zu Hause sind.
Die Koalas sind zum Todlachen. Es gibt im Park etwa hundert Stück davon und alle sind total müde. Unglaublich, wie die in den Baumgabeln sitzen oder darin herumhängenhängen, wie’s grad kommt, und nichts als dösen. (Wieso nur kommen mir diese Tiere so bekannt vor?) Nur ganz selten ändert eines seine Stellung, nur um gleich weiterzuschlafen. Wenigstens schnarchen sie nicht. Ein Einzige sehen wir in Bewegung. Das sieht sehr seltsam aus. Sich bewegen ist ganz offensichtlich nicht so sein Ding. Ich habe den Eindruck, es leidet an Gsüchti oder hat sich zu lange im Pub aufgehalten. Weil man so nah an sie herangehen kann, sieht man auch, dass sie ganz weiche Füdli haben. Wie ein Windelpack. Das brauchen sie – klar - einfach, sich das vorzustellen. Jedes Hinterteil ist zudem weiss gefleckt, eines mehr, eines weniger. Daran und an ihren unterschiedlichen Gesichtern würde man sie gut auseinanderhalten können, erklärte die Rangerin, namens Kerry. Nebenbei bemerkt: Jedes Tier dort hat einen Namen. Auch die Schlangen. – An Flucht denken Koalas übrigens gar nicht, nicht einmal im Traum offenbar – ihre Gehege sind nämlich nicht eingezäunt. Sie könnten sich also ohne weiteres aus dem Staub machen, aber dazu sind sie eindeutig zu faul. Und sowieso auch, was soll’s? Sie haben lauter nette junge Damen um sich herum, die ihnen täglich frische Stauden Eukalyptus servieren, frei Haus, und dazu noch den Kot wegputzen. Theo ist begeistert von ihnen (ich meine hier jetzt die Tiere). Ihn dauert es nur, dass sie möglicherweise im Schlaf gestört werden von den Rangerinnen, die zweimal am Tag mit Mikrophonen (!) den Parkbesuchern über diese putzigen Beuteltiere berichten und Auskunft geben. Ich erkenne allerdings keinerlei Anzeichen, dass irgendeiner der herumhängenden Koalas sich durch diese Aktion stören lassen würde. Wahrscheinlich sind auch ihre Ohren schlaff. - Wir vernehmen, dass die Tiere 18 – 20 Stunden pro Tag schlafen – und sind absolut beeindruckt.
Diese Schlaferei scheint ansteckend zu sein. In einem grossen Gehege, einem Park, hat’s dutzende von Kängurus. Auch die liegen herum und lassen sich streicheln und füttern.
Theo legt sich gleich dazu, schliesslich ist er schon seit ein paar Stunden auf.
Wir sehen Wombats; auch die haben so gepolsterte Hinterteile; eines der Tiere wird an der Leine von seinem Wärter spazieren geführt. Sehr komisch. Ob ihm das gefällt? – Ich glaube, so wie es unmutig hinterherschleicht - auch es möchte lieber schlafen.
Wir besuchen das Gehege der Tasmanian Devils, die gerade gefüttert werden. Es sind kleine Allesfresser; sie komme mir vor wie überdimensionierte Ratten, die ziemlich grässliche Zähne haben und ihre Beute, meistens Kadaver, mit Haut, Knochen und Haaren fressen und verdauen können. Die scheinen mir eindeutig weniger müde zu sein.
Der stolze Cassowary, ein flugunfähiger Laufvogel, ist ebenfalls ein äusserst dekoratives Fotomotiv mit seiner eigenartigen Haube auf dem Kopf, seinem blauen Hals, dem roten Kragen, dem schwarzen Gefieder und seinem selbstbewussten Gehabe. Er ist ähnlich wie ein Emu, nur wenig kleiner. Ihn allenfalls in der Wildnis zu treffen, würde jedoch nicht sehr viel Spass machen - auch wenn der Mensch natürlich nicht unbedingt auf seiner potentiellen Futterliste steht – der eigenartige Vogel hat an seinen Füssen messerscharfe giftige Kanten, mit denen er seine Beutetiere erheblich verletzen kann. So gehört es sich für Australien. Wer in der Tierwelt etwas auf sich hält, ist giftig. Von den Schlangen ganz zu schweigen. Der Inland Taipan kann seine Farbe wechseln und wird folgendermassen beschrieben: „Er ist etwa 50mal giftiger als eine Indische Kobra und 650–850 mal giftiger als eine Diamant-Klapperschlange und damit auch die giftigste bekannte Giftschlange der Welt. Die bei einem Biss durchschnittlich abgesonderte Giftmenge reicht theoretisch aus, um über 230 [bei voller Giftdrüse bis zu 250] erwachsene Menschen, 250‘000 Mäuse oder 150‘000 Ratten zu töten.) – Ziemlich effizient, scheint mir. Wieso er’s aber so übertreibt, ist schleierhaft. Er braucht ja wohl pro Mahlzeit kaum mehr als eine Ratte aufs Mal zu verspeisen.
Giftdrüsen hat auch der Platypus, das seltsamste Tier, von dem ich je gehört oder gelesen habe. Er ist ein Säugetier, Schnabeltier auf Deutsch, das Eier legt. Den in der freien Natur zu sehen, ist sehr schwierig, lebt er doch in Flüssen, teilweise unter Wasser, ist extrem agil, aber scheu und nicht viel grösser als eine ausgewachsene Forelle. Seltsamer Vergleich, aber einen Vergleich zu finden, ist nicht gerade einfach. Das Tier hat eine Art Entenschnabel, hinten sieht’s eher aus wie ein Biber, hat wie ein Delphin oder eine Fledermaus eine Sonareinrichtung, um seine Beute zu orten und (natürlich) giftige Drüsen an seinen schaufelartigen Füssen oder Flossen. Auch diesen bizarren Kreaturen kann man gut zusehen im Park. Dafür ist eigens ein verdunkeltes Aquarium eingerichtet. Sie flitzen pfeilschnell durchs Wasser und manchmal ist man nicht ganz sicher, was ist vorne und was ist hinten. – Bizarre Wesen!
Ebenfalls kann man zusehen, wie ein Schäferhund eine Schafherde zusammentreibt und bestens im Griff hat. Zweimal täglich wird zudem demonstriert, wie ein Schaf geschoren wird. – Ziemlich schlimm, finden wir. Das arme gestresste Tier, ohnmächtig seinem Peiniger (oder Wohltäter? – es ist ja heiss und wird immer heisser und mit dem Wollmantel…) ausgeliefert, wird in Minutenschnelle vom Wollknäuel in ein weisses, nacktes Etwas verwandelt.
An Theos Geburtstag muss der Arme bereits um halb acht aufstehen, weil Kay und Lorie uns eingeladen haben, mit ihnen eine Stadtbesichtigung zu machen und uns Orte zu zeigen, wo wir noch nicht waren. Anschliessend wollen sie am Fluss ein BBQ organisieren. Der Stadtbummel ist sehr informativ, wir sehen und erfahren viel Neues, was nicht im Führer steht. Gegen Mittag dann gehen Theo und Lorie das ehemalige Büro von McArthur besichtigen und wir Frauen schlendern über den Riverside-Market. Dann hat Theo offenbar die gute Idee, sich die Haare schneiden zu lassen, am Geburi kann man ja tun und lassen, was man will, so kehren Kay und ich ein wenig früher nach Hause zurück als die Männer, weil wir ja nicht warten wollen und es dann immer noch früh genug ist, Theos Coup zu besichtigen. Kaum sind wir daheim, beginnt es in Strömen zu regnen, Theo und Lorie schaffen’s zwar auch grad noch, aber weil’s zu hageln beginnt, will Theo unbedingt unser Auto mit einer Plache zudecken. Er ist so besorgt um den armen Toyota, seitdem diesem in Byron Bay vom Hagel so übel mitgespielt wurde (auf diese paar Hageldellen mehr käm‘s nun auch nicht mehr drauf an, finde ich). Jedenfalls sind die beiden „pflotschnass“ und müssen erst ihre Kleider wechseln. Mit dem River-BBQ ist’s halt dann nichts, obwohl schon kurz nachher die Sonne wieder scheint, aber der Boden ist ja immer noch nass. So gibt‘s den Geburtstags-Lunch stattdessen auf der Terrasse, auch nicht schlecht, mit der Skyline von Brisbane im Hintergrund, im Vordergrund und zum Glück in Reichweite feine Steaks, Salate und Wein aus dem Barossa-Valley.
Flughunde
Dann aber ist es Zeit für Theo, sich in die Horizontale zu begeben. – Eine halbe Stunde später finde ich, es reicht jetzt und wecke ihn. Da gibt’s noch einen Spaziergang, den wir machen wollen zu einem Flussarm in der Nähe, wo wir wohnen, Heim von Tausenden von Flying Foxes oder Fruit Bats, so genannt, weil sie beim Einnachten in Scharen ausfliegen und alles kahlfressen, was ihnen an Früchten oder Gemüsen „über den Weg läuft“. Unser Ausflügli artet in einen enorm ausgedehnten Verdauungsspaziergang aus, es dauert fast zwei Stunden, bis wir zurück sind. Was wir an diesem Creek sehen, löst gemischte Gefühle aus. Man hört und sieht die Tiere schon von weitem, sie sind bereits in Scharen unterwegs auf Nahrungssuche, alle fliegen mit ihren Batman-Mänteln weit ausgespannt in die gleiche Richtung. Erinnerungen an Horrorfilme werden wach, eine ganze Armee überliegt uns. Zudem machen sie ein erbärmliches Geschrei, ein paar Krähen halten tüchtig mit. Nur wenige Tiere hat es, die noch in den Bäumen hängen und sich erst noch für den Abflug wappnen. Auch die sind komisch anzusehen, wenn sie ihren Mantel zusammenfalten und da so herumhängen, quasi down under. Wie wir heimkommen, ist es bereits dunkel. – Theo bastelt an unserem Blog weiter, es scheint eine Never-ending-Story zu werden, aber diesmal nicht wegen der langen Texte, sondern weil’s wieder mal mit dem Heraufladen nicht klappt, irgendetwas hat er da völlig verkorkst; das System weigert sich nun konstant mitzumachen; es stürzt lieber ab.
Um neun Uhr beschliessen wir dann doch noch, etwas essen zu gehen, schliesslich ist es ja Theos Geburtstag. Auf halbem Weg (beim Spar) merke ich, dass wir vergessen haben, den Wein mitzunehmen. Also gehen wir zurück, holen ihn und unternehmen einen zweiten Versuch, in unserem Quartier ein Restaurant zu finden, das noch offen hat. Das italienische schliesst gerade, das japanische hat zwar noch viele Gäste, aber keine Stühle und Tische mehr frei und die Küche möchte nun auch lieber heim. Hundert Meter weiter gibt’s ein indisches Restaurant und die freundlichen Betreiber bedienen uns gern. Wunderbar ist’s, wir sind aber froh, haben wir den Wein noch geholt, es hat nämlich gar keinen auf der Getränkekarte (Geburi-Essen mit Wasser – das hätte sich für immer und ewig in unsere Gedächtnisse eingeprägt).
Um zwölf sind wir im Bett, zu Hause würden weitere neun Stunden zum Geburi-Feiern verbleiben, wir haben’s bereits hinter uns, es ist der 25ste.
Museen besuchen wir auch, das Goma (Gallery of Modern Art), das Museum of Brisbane gemeinsam, ich am letzten Nachmittag auch das QMA (Queensland Museum of Art).
Es gibt viel Spannendes zu sehen, mich interessieren vor allem Bilder australischer Künstler, speziell die indigene Kunst. Sogar ein Bild von Picasso ist ausgestellt, „Die schöne Holländerin“. Ich finde sie zwar nicht so schön. Auch hängt da ein Bild von Walter Sickert, einem englischen Maler aus dem 19. Jhd. Den kenn ich aus unserem Englisch-Buch in der Schule. Er gehört zu denen, die man im Verdacht hatte, Jack the Ripper zu sein. - Dass der Eintritt überall gratis ist, erstaunt mich sehr. Mehr als nur grosszügig, finde ich! - Draussen ist es sehr heiss, der Museumsbesuch bietet eine schöne Abkühlung. Aber nach anderthalb Stunden bin ich fast durchgefroren und froh, wieder nach draussen an die Wärme zu kommen. Ich treffe Theo am „Strand“, wir fahren heim und wieder mal werden die Koffer gepackt. Kay hat wunderbar für uns gekocht, es ist unser letzter Abend; wir verbringen ihn gemeinsam auf ihrer gemütlichen Terrasse.
Von Brisbane über Auckland nach Riverhead und schliesslich Tutukaka
Ende November 2013
Ein kurzer Flug war’s von Brisbane nach Auckland, nur drei Stunden dauerte er, aber auch wieder drei Zeitzonen dazwischen. Wir flogen um zwölf Uhr mittags ab und landeten um sechs. Die Airline diesmal war die „Air New Zealand“, mir bis anhin unbekannt. Interessanterweise beschäftigen sie dort ganz spezielle Stewardessen. Sie sind männlich und zwischen 50 und 70 Jahre alt. Sehr bemerkenswert. Wahrscheinlich gehört es zum Anstellungsprofil, in dieses Alterssegment zu gehören. Theo könnte es noch grad knapp schaffen, er würde keineswegs auffallen. Jedenfalls nicht vom Alter her. Allerdings muss ich sagen, dass sie alle sehr, sehr freundlich und zuvorkommend sind, these guys. Sie haben ja zwangsläufig schon viel erlebt und lassen sich nicht mehr so rasch aus der Ruhe bringen. – Ziemlich bequeme Sitze hat es übrigens in diesem Flugzeug und ein gutes, reichhaltiges Unterhaltungsangebot (bis man evaluiert hat, welchen Film man sich anschauen will, ist man schon fast angekommen).
Auch etwas anderes ist bemerkenswert bei dieser Airline. Es heisst, es gäbe keine Mahlzeiten an Bord und eine Getränke- und Snackliste mit Preisangaben findet man auf dem Bildschirm am Vordersitz. Nach einer halben Stunde Flug wird aber dann (von den netten Stewarts) munter alles Mögliche serviert. Sandwiches, Salat, Güezi, Täfeli, Getränke, alles gratis. – Ok, wir haben unsere Sandwiches halt schon gehabt, wir verzichten.
Und noch was: Die Gähn-Sicherheits-Instruktionen kurz nach dem Start bei jedem Flug werden ja kaum je beachtet. Die Air New Zealand wusste Abhilfe. Sie hat einen Spot gedreht mit echten Schauspielern (Rose aus „Golden Girls“ leitet durch den Sketch) und das sieht sich jetzt jeder an, weil‘s eben absolut lustig aufgemacht ist. Hier der Link: www.youtube.com/watch?v=O-5gjkh4r3g">www.youtube.com/watch?v=O-5gjkh4r3g
Ich freu mich schon auf die nächsten beiden Flüge mit Air New Zealand. Nun gibt’s auch noch ein zweites Video dieser Art. Protagonisten sind die Hobbits. Wen’s interessiert:
www.smh.com.au/travel/travel-news/air-nz-does-it-again-bear-grylls-stars-in-latest-comedic-safety-video-20130227-2f56h.html">www.smh.com.au/travel/travel-news/air-nz-does-it-again-bear-grylls-stars-in-latest-comedic-safety-video-20130227-2f56h.html
Eine Stunde nach Ankunft in Auckland haben wir unser Mietauto schon bezogen, einen Nissan diesmal, sehr geräumig, aber nicht das neueste Modell, mit einer ziemlich scheusslichen Farbe, eigentlich gar keiner, so was zwischen braun und beige. Aber Theo fühlt sich sofort wohl, diese Karosse gefällt ihm sehr viel besser als der neue Toyota von AVIS, den wir am gleichen Morgen ja erst grad auf dem Flughafen in Brisbane abgegeben haben. Das Nummernschild heisst: FQU 92. Kann ich mir gut merken. Ohne die „9“ wär’s allerdings noch besser gewesen…
(Das Auto übrigens hatten wir bei Apex gebucht. Dies ist ein guter Tipp für alle Neuseeland-Reisenden: Die Autos sind nicht die neuesten, sie laufen aber sehr gut, sind absolut zuverlässig, der Service ist ausgezeichnet, es spielt überhaupt keine Rolle, ob man mal einen Kratzer oder eine Delle macht oder nicht, die hat’s sowieso schon. Die Pneus sind beste Ware, das haben wir dankbar zur Kenntnis genommen, als wir auf all den unwegsamen Strassen fuhren. Unser Gefährt hatte auf dem Fahrersitz ein Zigarettenloch, aber was soll’s? Dazu kommt, Apex ist billiger als Avis und Co. - Macht ja auch nichts.
Schon als wir unsere „Reisschüssel“ in Empfang nahmen, dachte ich, die ist wohl lange nicht mehr unterwegs gewesen, weil nämlich über dem Rückspiegel auf der Beifahrerseite ein Spinnennetzt klebte. Ich liess es dabei bleiben und dachte, das geht dann schon weg durch den Fahrtwind oder falls es mal regnen sollte. – Wir sind stundenlang durch die wildesten Regenstürme gefahren, das Netz war immer noch dort. Mal machte ich es weg mit einem Stäckli und einem Blatt. Am nächsten Tag war’s wieder da.
Fazit: Eine Spinne wohnte zwischen dem Spiegel und dessen Umrandung. Sie hat die ganze Fahrt durch die Nordinsel mitgemacht. Gratis und franko.
Dreiviertelstunden dauert die Fahrt bis Riverhead, einem Vorort im Norden von Auckland, wo wir eine Nacht verbringen werden, bevor wir am nächsten Tag nach Tutukaka weiterfahren, ans Meer.
So herzlich wie wir von Kay und Lorie verabschiedet wurden, so herzlich werden wir von Gail und Stuart King begrüsst. „Kia Ora“. Ein schöner Beginn unserer Reise durch Neuseeland. - Gail sagt, sie habe das Gefühl, also ob wir uns schon lange kennen würden. Das stimmt schon, mir kommt’s ähnlich vor, obwohl wir ja nur Emails ausgetauscht haben. Während des Nachtessens kommen wir sofort ins Gespräch über alles Mögliche und es wird Mitternacht, bis wir ins Bett kommen.
Bis dahin habe ich mich schon ein bisschen an das komische Englisch gewöhnt, das hier gesprochen wird. Wie wenn eine Lautverschiebung stattgefunden hätte. „E“ wird oft als „I“ ausgesprochen, das ergibt dann statt wie üblich “Wednesday“ „Wiensday“ (ich schreib‘s jetzt mal so, wie’s Rösi aussprechen würde), „tien“ statt “ten“, “ix-husband“ und so weiter. Gewöhnungsbedürftig.
Mit den Kings haben wir einen ganz besonderen Homelink-Deal: Sie waren letztes Jahr in Paris. Das Ehepaar, dem das Pariser Apartment gehört, wollte aber keinen Tausch mit Neuseeland eingehen, so haben wir eine Art Dreieckstausch organisiert. Die Kiwis nach Paris, die Pariser nach Bivio und wir nach Neuseeland. Nicht ganz einfach zum Organisieren das Ganze, aber alles bestens, alle zufrieden, Ende gut, „all good“, wie man hier sagt. Und weil wir ja erst gegen Abend ankamen, luden sie uns zu sich zum Essen und zum Übernachten ein; sie wohnen unterwegs an die Küste, wo wir hin wollen.
Sie haben ein hübsches Haus mit viel Umschwung, zwei Schafe und zwei Ziegen. Diese sind ihre Rasenmäher. Die Ziegen heissen auch so, benannt nach der weltgrössten Rasenmähermarke Husqvarna (world‘s largest manufacturer of outdoor equipment – a Swedish company), die eine Husq, die andere Varna. – Mir gefällt das: the Kiwi sense of humour.
Es sind drollige Tiere, fast ein wenig überdimensioniert, ganz zutraulich, kommen gleich her in der grossen Hoffnung, dass es auf der andern Seite des Zauns was zu fressen gibt, was noch besser mundet. Das ist offenbar auch häufig der Fall. Gail sagt, es gäbe viele Leute in der Nachbarschaft, die beim täglichen Spaziergang etwas zum Naschen mitbringen. Man sieht es den Geissen auch an. Sie sind äusserst gut „zwäg“. Den Schafen geht’s auch gut, aber diese seien sehr dumm, erklärt man uns.
Irgendwie haben wir trotz des kurzen Fluges doch eine Art Jetlag erwischt, denn wir erwachen erst um zehn Uhr. Bei Theo wäre das ja nicht weiter erstaunlich oder erwähnenswert, bei mir aber schon, denn ich stehe ja meistens spätestens um sieben auf. – Der Tisch ist schon wieder gedeckt, die armen beiden haben sicher seit zwei Stunden mit dem Frühstück auf uns gewartet. Es ist mir sehr unangenehm, wir entschuldigen uns, aber „no worries, no worries“.
Gegen drei Uhr nachmittags endlich ziehen wir los Richtung Norden an die Küste ins Beachhouse der Kings, bewaffnet mit dem Hausschlüssel, etlichen Tipps, wo was zu finden ist, was wir unternehmen könnten, ein paar neuen Ideen betreffend Bücher, die ich herunterladen könnte (Gail ist wie ich auch in einer Lesegruppe) und zwei grossen Säcken voller Gemüse aus Gails Gemüsegarten. „Kale“ nehm ich mit, Grünkohl lese ich im Internet, ein altes, aber neu absolut trendiges Gemüse, nicht nur hier. Früher nur Viehfutter. Mit anderen Worten, wir essen jetzt den Geissen ihr Fressen weg.
Leider hat’s jetzt zu regnen begonnen, gut für die Landwirtschaft, schlecht für uns Touristen. Wir erahnen, wie schön es hier sein muss, wenn die Sonne scheint. Wir fahren durch wunderbare Gegenden mit Wäldern und saftig grünen Wiesen.
In Whangarei machen wir Halt bei der Tourist-Information. Eingedeckt mit etwa zwei Kilogramm Broschüren und Prospekten fahren wir weiter zum nächsten Supermarkt, wo wir uns für die kommende Woche mit Lebensmitteln eindecken. Mit vielen. Für 250 NZ$.
Das Haus zu finden ist gar nicht so einfach, es hat keine Hausnummer und es regnet in Strömen. Es gelingt dann doch und wir richten uns ein. Der Vogel, der drin herumfliegt und uns im ersten Moment ziemlich erschreckt, lässt sich schliesslich fangen und in die Freiheit entlassen. Drei Tage lang muss er eingesperrt gewesen sein. Gut, dass wir gekommen sind. Schön ist’s, gemütlich innen; wie’s draussen aussieht, zeigt sich dann morgen. Spaghetti gibt’s, Theo ist zufrieden.
Tutukaka 27. November – 4. Dezember
Jetzt sind wir also endgültig in Neuseeland angekommen, dem Land der Kiwis, wie sich die Neuseeländer gerne selber nennen. Nicht die Frucht ist gemeint, klar. - Wieso sie sich mit einem Vogel identifizieren, der am Aussterben ist, nicht fliegen kann und daher am Boden brütet, wo er sich nicht gegen Feinde wehren kann, wissen sie selber nicht.
Wir schlafen aus, Theo zumindest, ich erlebe den ersten Sonnenaufgang, es ist eine bezaubernde Gegend. Das Haus liegt ein wenig erhöht direkt am Meer, das heisst, aus dem Garten führt eine steile Treppe hinunter zum Sandstrand. Eine wunderbare Aussicht aufs Meer, aufs gegenüberliegende Ufer, auf Inseln am Horizont, auf einzelne Wolken und einen blauen Himmel. Zwei Boote liegen vor Anker. Es hat zwar die ganze Nacht geregnet, jetzt aber sind nur noch die Blumen, Sträucher und Bäume nass im Garten und das Wetter ist wieder so, wie wir es uns wünschen. Frühstück im Freien, es ist paradiesisch schön, absolut ruhig und friedlich.
Hier werden wir uns auch wieder wohl fühlen.
Die Tutukaka-Coast, sagte mir Gail, sei eine der schönsten Buchten der Nordinsel. Nun, das „Problem“ ist, es gibt Dutzende der schönsten Buchten in diesem Teil Neuseelands. Eine schöner als die andere. Man kann’s fast nicht glauben: Hinter jede Kurve gibt’s wieder eine neue Bay, traumhaft schöne Inselchen, Meeresarme, Strände, bizarre Felsgebilde, wunderbare Sandbänke, Natur vom Feinsten.
Aber das ist nicht alles. Im Landesinnern kommt man auch zum Schwärmen nicht raus: zart grüne Felder, so weit das Auge reicht. Hügel, Bäume, Wälder, Baumgruppen, jede Art Grün ist vorhanden. Manchmal erinnert uns die Gegend ans Emmental, ans Appenzellerland, ans Entlebuch, an den Jura - den Gurten haben wir auch schon ein paar Mal gesehen (natürlich ohne Meer und Bucht vornedran), es ist faszinierend. Wieso man immer vergleichen will – es passiert automatisch. Macht ja nichts. Es ist nie gleich, nur ähnlich. Häuser hat’s nur wenige. Ja, die sind schon anders als in der Schweiz. Immer wieder gibt’s Hinweise auf historische Gebäude, klar, hier ist Maoriland, eine geschichtsträchtige Gegend. Viel Blut wurde vergossen. Wem hat’s genützt? - Wenn die Menschen vor 160 Jahren hätten sehen können, wie die Welt hier und jetzt „tickt“, die hätten das wohl kaum geglaubt.
Das älteste noch erhaltene Haus haben wir in der Nähe von Kirikiri gesehen, das Kemphaus, erbaut 1822, eine christliche Mission. Daneben das älteste aus Stein gebaute Haus, ein Warenhaus, eben „Stone Store“, datiert anfangs der Dreissigerjahre im 19. Jhd. (Nota bene: - unser Haus in Bivio wurde 1564 gebaut).
Wir unternehmen mehrere Ausflüge, und weil die Fahrerei nicht eben sehr einfach ist, übernachten wir zweimal unterwegs, einmal in Kaitaia, einmal in Mangonui. Die Strassen sind teilweise sehr kurvenreich, manchmal recht schmal und auch die sogenannten Highways (Rösi würde sagen „Ha We Üpsilon“) sind mit unseren Strassen in keiner Weise vergleichbar. Mit wenigen Ausnahmen sind sie nur zweispurig und bei Brücken sogar nur einspurig. Macht aber nichts, weil es fast keinen Verkehr hat. Manchmal sind wir weit und breit allein auf weiter Flur.
Im Kaitaia haben wir einen eintägigen Busausflug gebucht an die nördlichste Spitze des Landes, an das Cape Reinga. Unterwegs halten wir verschiedene Male an, mal, um einen Strand zu besuchen (nicht nur einen), mal um das weltbeste Eiscrème zu konsumieren, mal für Lunch und unser Maori-Driver erklärt, informiert und erzählt pausenlos Geschichten und Witze und selber muss er am meisten drüber lachen (I love seafood. Every time I see food I want to eat it. – ha ha ha ha).
Der Spaziergang zum Leuchtturm an der Nordspitze ist mehr als nur eine Reise wert. Eine wilde Gegend, herrliche Aussicht, wunderbare Klippen und Strände und gut zu sehen im Meer die Stelle, wo der Pazifische Ozean und die Tasmanische See aufeinandertreffen, wo die Wellen nicht genau wissen, in welche Richtung sie jetzt fliessen sollen. Kein Wunder ist dieser Ort ein Heiligtum der Maori.
Wieso eine Busfahrt? Den 90-Miles-Beach, der sich vom Cape Reinga bis hinunter nach Kaitaia erstreckt, hätten wir mit unserem Auto nicht befahren dürfen, der Bus aber schon. Und wie! Durch Sand und Flussbette fährt er, dass es nur so spritzt, erst mal bis zu einer riesigen Düne und dort halten wir an, um hinaufzuklettern (total schwierig und mühsam, weil uns der starke Wind ständig entgegen bläst und obwohl wir ja instruiert worden sind, den Mund nicht zu öffnen, …) und mit den Bobs hinunterzuschlitteln. Für einmal auf Sand und nicht auf Schnee. Lustig ist‘s, aber auch sehr sandig. Erst wie ich mich am Abend ausziehe um zu duschen, merke ich, dass mein BH voller Sand und ziemlich schwer ist.
Der Bus fährt etwa eine Stunde lang dem Strand entlang, dort, wo der Sand am kompaktesten ist, etwa mit 60km/h. (In der folgenden Nacht träume ich davon, wie ich in einem Taxi versuche, einen Bus einzuholen, was nicht gelingt.)
Um fünf sind wir zurück, holen unser Auto im B&B ab, wo wir es haben stehen lassen. Alaistair, unser freundlicher südafrikanischer Gastgeber, gibt uns viele nützliche Tipps für unsere Weiterreise und so schlagen wir den Weg der Küste entlang ein, um weitere viele schöne Strände und Gegenden zu erkunden. Das aber für den nächsten Tag.
In Mangonui (Doubtless Bay) finden wir ein nettes Motel (es hat nur zwei Zimmer, diese aber sind kleine Apartments mit Küche, Bad, Schlaf- und Wohnzimmer und einem Mini-Vorgärtchen mit Blick auf die Bay). Wir essen im „World Famous Fish Shop“; tatsächlich ist das Lokal überall bekannt. Fein, was sie dort bieten, und die Preise natürlich unschlagbar.
Es ist schon erstaunlich, wenn ich denke, wir würden irgendwo in der Schweiz essen – wir gingen nach der Mahlzeit wieder heim und wären mit niemandem ins Gespräch gekommen. Ganz anders hier. Eine Dame am Nebentisch bietet uns an, ein Foto von uns zu machen und daraus entwickelt sich ein Gespräch über die Schweiz und die schöne Nordinsel. Ich glaube, unser Kauderwelsch ist der Auslöser für all die interessanten Begegnungen. Man ist hier einfach neugierig, wo die Leute herkommen. - Kaum ist die Familie gegangen, kommen zwei ganz junge Männer, nicht älter als etwa zwanzig, zu uns an den Tisch und der eine sagte „Grüezi“. Auch mit ihm haben wir ein längeres Gespräch, sein Vater sei Schweizer, aus Zürich, er selber sei auch mal dort gewesen als Kind, aber er könne nur noch ein paar wenige Worte verstehen. – Dass zwei so junge Typen uns Oldies überhaupt zur Kenntnis nehmen, finde ich ober-lässig. - Last but not least outet sich noch die Kellnerin, ebenfalls die Tochter eines Schweizers, aber auch sie kann unsere Sprache nicht mehr sprechen. Trotzdem – eigentlich wollte sie um 20 Uhr Feierabend machen, den Laden macht sie dann erst um neun Uhr dicht. – Awesome evening - indeed.
Leider ist der nächste Tag nicht sonnig, wie wir das gerne gewünscht hätten; es regnet zwar nicht, aber der Himmel zeigt sich in „different shades of grey“. Wir fahren der Küste entlang und halten dann mal an, oben auf einer Anhöhe, wo’s wieder so einen fantastischen Ausblick gibt. Dort steht ein Haus und davor ein Schrotthaufen, eine Radarstation aus dem zweiten Weltkrieg. Das erfahren wir, als eine Gestalt auf uns zukommt, die aussieht wie ein in die Jahre gekommener Rocker, grau in grau, seine langen Haare zu einem Rossschwanz „frisiert“. Er ist voller Staub. Er erklärt, er habe grad Bretter gesägt. Sofort kommen er und Theo ins Gespräch, klar, WW II ist ja ein beliebtes Gesprächsthema unter „alten Kriegern“, und schon werden wir ins Haus eingeladen. Es gibt noch mehrere Relikte aus dem Krieg zu entdecken, ein ganzes Sammelsurium an Fotos und Bildern. Auch sonst gibt’s viel zu sehen in dem Chaos. Unter anderem zwei ausgestopfte Kiwis, Mutter und Kind, in einem Glaskasten unter dem Stubentisch. Ich verzieh mich in die Küche, wo auch die Hausfrau offensichtlich Freude hat, mit jemandem zu plaudern. Freundlicherweise erhalte ich eine Zitrone aus dem Baum vor der Küche für meinen Gin and Tonic, den ich dann um vier haben werde. Ok, ok, werd ich dran denken um vier.
Die beiden leben ja wirklich sehr abgelegen und ich kann mir denken, sie warten nur drauf, ein paar Touristen abzufangen, um mit denen ins Gespräch zu kommen; mir kommt das Ganze ein wenig vor wie bei Hänsel und Gretel.
Die Aussicht aufs Landesinnere auf der einen Seite und auf die Bay auf der anderen Seite ist aber genial. Sie wollen ein B&B eröffnen, erzählen sie uns. Dafür braucht er offenbar ein paar Bretter. Das erklärt auch seine Staubigkeit. Er hat übrigens Jahrgang 41, mitten aus dem Krieg. Aber ich muss schon sagen, noch ein Business aufzubauen in diesem Alter, alle Achtung. Wenn’s funktioniert, hat er ja dann vermehrt Gesprächspartner. - Wir entkommen unbehelligt eine halbe Stunde später.
Drei Strände besuchen wir auf Geheiss von Alastair, unserem B&B-Gastgeber. Übrigens, als er hörte, dass wir in Tutukaka wohnen, sagte er, also eigentlich sei „Kaka“ etwas, das man bei ihnen in Südafrika im Klo mache. – Die Sprachen sind halt ähnlich, bei uns ja auch nicht so abwegig, erwähne ich. Aber die Maori-Sprache hat da sicher einen anderen Hintergrund. Anyway, die Strände, Buchten und Inseln sind fantastisch, leider, wie gesagt, wenn die Sonne nicht scheint, scheint alles ein bisschen weniger brillant. Wir fahren nach Kerikeri, mitten in das geschichtsträchtige Gebiet, wo die ersten Siedler und die Maori ihre kriegerischen Auseinandersetzungen hatten, wo viel Blut und Tränen flossen und 1840 der berühmte Vertrag von Waitangi unterschrieben wurde. Weiterfahrt nach Pahia, wo wir eine Fahrt auf einem zweimastigen Segelschiff buchen. Inzwischen hat sich das Wetter gebessert, der Himmel ist blau, alles in bester Ordnung. So ein eleganter Kahn. Wir geniessen die gemütliche zweistündige Fahrt ab Russell (früher Sin City und auch mal Hauptstadt von NZ) entlang der Küste, an kleinen Inseln vorbei, friedlich treibend im Meer.
Die Heimfahrt ist wieder recht mühsam, beginnt es doch erneut stark zu regnen. Was für ein Glück wir doch hatten während der Fahrt; der Himmel hatte sich extra für uns aufgetan.
Zuhause gibt’s Ravioli. Theo kann nicht recht ergründen, was genau da drin ist. Fleisch ist’s wohl nicht, da ist er sich fast sicher. Seiner Mine nach zu urteilen, merke ich, dass er mit Kürbis in den Teigtaschen nicht viel anfangen kann. – Ich schon, ich finde meine Kocherei sehr gut, hab ich doch noch Spargeln und Béchamelsauce drüber drapiert. So bin ich halt die Einzige, die mein Gericht lobt. Und vorher gab’s ja noch Salat. Mit jungen Spinatblättern und Alfalfa-Sprossen. Da hab ich seinen Geschmack halt auch nicht so „gepreicht“.
Einen wunderbaren Strandtag erleben wir als Nächstes. Nichts tun, lesen, am Strand bräteln, ein kleiner Schwumm im Meer hin und wieder. Einfach herrlich! Am Abend fahren wir ins Dorf. Dort hat’s ein Lokal, wo’s Internet gibt. Wie die Gestörten starren wir auf unsere Bildschirme, schreiben und lesen. Stereo gleich. Natel und Laptop bzw. Mac Air. Wir unterbrechen fürs Nachtessen. So grosse und feine Muscheln habe ich noch gar nie gegessen. Sie sind grün und riesig, richtig überdimensioniert. Was aus den Muschelhälften herauskommt, sieht fast aus wie halbe Cervelas. Und die exquisite exotische Sauce dazu: soooo lecker!
Der nächste Tag sieht schlecht aus. Regen. Ohne Unterlass, so schient‘s. Daheim bleiben oder etwas unternehmen? Ich bin dafür, den Waipoua Forest an der Westküste zu besuchen. Den hatte ich so oder so auf dem Programm. Zweieinhalb Stunden ein Weg, der Rückweg dann drei Stunden. So viele Kilometer fahren, um einen Wald zu sehen? Das käme uns zu Hause nie und nimmer in den Sinn. Aber hier und weil man in den Ferien ist, ist eben alles anders. Das Wetter kann ja schlechter kaum mehr werden, wir versuchen’s trotzdem.
Schon fast dort gegen Mittag, hört der Regen tatsächlich auf, die Sonne zeigt sich wieder. Wir haben ja so ein Glück! Noch ein paar Kilometer, dann sind wir dort. Dann macht uns Rösi einen Strich durch die Rechnung. Sie sagt, wir sollen links abbiegen. Es ist eine Strasse ohne Asphalt. Wir sind beide skeptisch, es ist nämlich gar nichts angeschrieben, aber sie tut so bestimmt, dass wir ihr blind vertrauen und die Strecke unter die Räder nehmen, umso mehr als es nur noch fünf Kilometer geht bis zum Ziel. Diese Strecke können wir allenfalls ja ohne weiteres wieder zurückfahren. Tun wir dann auch. Aber vorher dauert’s noch mindestens eine Viertelstunde, bis uns klar wird, sie will uns ins Abseits führen. Schon wieder besteht sie darauf, rechts abzubiegen, aber diesmal lassen wir uns nicht mehr so leicht reinlegen. Wir sehen genau, dass der Weg kaum breiter ist als unser Auto, nur noch eine Grasnarbe in der Mitte – also nein - jetzt langt’s. Wir kehren um. Etwas weiter vorne sehen wir dann, dass ein Schild am Strassenrand steht, wo’s drauf heisst, NO ACCESS – nur für Waldarbeiter. Das sind wir ja nicht gerade, also ist unser Entscheid umzukehren richtig. Theo sagt, er habe das Schild schon gesehen (ich hab’s übersehen, muss mich grad mit dem Navi oder der Karte beschäftigt haben), er habe aber gedacht, da wolle einer Honig verkaufen (??!!) An einem Ort, wo nie jemand vorbeifährt und es nicht einmal Häuser gibt?! Einzig ein Lastwagen, beladen mit Baumstämmen, ist uns mal begegnet. Nun, wir sind glücklich wieder auf der Hauptstrasse, biegen nach links und schon ein paar Kilometer weiter kommt die Abzweigung zum Visitor Center des Waipoua Forest. Dort gibt’s dann auch endlich eine Tasse Kaffee und ein Stück ober-feine Rüebli-Torte.
Wie wir da an einer Info-Tafel im Visitor Center stehen, legt plötzlich jemand von hinten die Hände auf unsere Schultern und sagt: „Can we help you guys?“
Was für eine Überraschung! Dies ist jetzt das vierte Mal innert vier Tagen (!), wo wir einem Ehepaar begegnen, Kanadiern, die mit uns auf der 90-Mile-Beach-Tour waren. Kaum zu glauben. Dreimal ginge ja noch, aber viermal! Natürlich besucht man als Tourist etliche ähnliche Orte, aber da muss ja auch das Zeitfenster genau stimmen und immerhin waren da etliche hundert Kilometer zwischen den jeweiligen Begegnungsorten. Wir finden, diese Zufälle sind sagenhaft. Leider müssen sie grad gehen, sie fliegen am nächsten Tag heim (sonst gäb’s eventuell ein fünftes Mal), und wir machen uns auf den Weg, die riesigen Kauri-Bäume zu sehen. Die vielen Kilometer zu fahren, hat sich gelohnt. Nach einem Spaziergang von zwanzig Minuten kommt man zu einer Art Lichtung im Wald und da steht er, voll beschienen im Sonnenlicht, es ist ein gigantisches Erlebnis, metaphysisch fast. Sein kahler Stamm, bevor die Krone beginnt, ist 30 Meter hoch und sein Umfang ungefähr 15 Meter. Er ist etwa 2‘300 Jahre alt und sein Name ist „Te Matua Ngahere“. Er ist nur der zweitgrösste noch lebende Baum dieser Art. Den grössten sehen wir kurz darauf an einer andern Stelle im Wald. Er heisst „Tane Mahuta“ (Lord of the Forest) und der Anblick ist ebenfalls gewaltig. Sein Stamm ist 50 Meter hoch, bevor die Krone beginnt. Allerdings ist er nicht ganz so dick wie der andere; er ist halt nur etwas über tausend Jahre alt. Man kommt sich vor wie ein Zwärgli, wenn man darunter steht oder vielleicht eher wie ein Hobbit.
Auf dem Heimweg passieren wir wieder mal Kawakawa; man kommt dort unweigerlich etliche Male vorbei, es ist eine Art Knotenpunkt. Bekannt ist der Ort wegen seiner öffentlichen Toiletten. Hundertwasser, der dort seine letzten Lebensjahre verbrachte, hat sie konzipiert. Die zu sehen ist auf jeden Fall einen Stuhlgang Wert oder zumindest eine Besichtigung. Die fand für uns allerdings bereits bei der ersten Durchquerung des Ortes statt, auf unserem ersten Ausflug gegen Norden.
In der Tourist Information Agency gibt’s die netteste Maori-Angestellte, die man sich denken kann. Sie scheut keine Mühe, uns ausgiebigst zu informieren, für uns herumzutelefonieren, B&B zu finden, Trips zu buchen, eine Telefonkarte zu organisieren, etc. etc. Das alles hätte ich auch selber machen können, aber wenn man kein Internet hat… Zwischendurch stillt sie ihren kleinen 3-jährigen Jungen, der ansonsten, wenn er nicht so hungrig ist, als Batman im Laden herumsaust. Das sieht dann so aus: Telefonhörer zwischen Schulter und Ohr eingeklemmt, Kind an der Brust, Hände auf der PC-Tastatur. Wenn das nicht Multitasking ist! - Und Kelly war auch später noch hilfreich, als wir feststellten, dass wir im Bus unseren Reiseführer vergessen hatten, das Buch, wo ich Notizen drin gemacht und mit dem ich mich auf unsere Reise vorbereitet hatte). Sie kontaktierte die Agentur und zwei Tage später schon war mein heiss geliebtes Buch im Briefkasten. Wenn das nicht Effizienz ist!
Im Ort hat’s auch einen Zug, der nur noch für touristische Zwecke eine kurze Strecke fährt und ganz offensichtlich der Lebensinhalt ein paar älterer „Eisenbähnler“ ist. Mit Leib und Seele sind sie dabei, alles über ihre Vintage Train- and Railway - History zu erzählen, und selbstverständlich fahren wir mit. Das Zügli rattert durchs Städtchen, dann ein paar Kilometer weit über Land, wo uns erzählt wird, wo welches Gebäude mal stand (jetzt sieht man nur noch Weiden), bis zu einer Brücke, die zu überqueren (zum Glück!) verboten ist. Sie ist mehr als nur schitter zwäg. Wir werden vollgetextet von vergangenen Zeiten und all den Plänen, die the old guys mit ihrer Bahn noch haben; die Brücke muss unbedingt instand gestellt werden, der Zug soll wieder Passagiere befördern.
Wir rattern zurück und weil wir so interessiert waren, dürfen wir noch die Dampflock näher anschauen, die auf dem Abstellgleis steht. Bis zu den Weihnachtsferien wollen sie auch diese wieder fahrtüchtig machen. Der kleine Bahnhof ist wirklich nett, man kommt sich vor wie in einem alten Western. John Wayne und Garry Cooper fehlen noch.
Am Mittwoch ist unser Aufenthalt in Tutukaka beendet. Einmal mehr regnet es in Strömen, was den Abschied sehr viel leichter macht. Das Haus putzen, die Koffer packen und schon sind wir unterwegs Richtung Auckland. Schade, dass man wieder kaum was von der Gegend geniessen kann, der Regen will nicht nachlassen. Einen Vorteil hat’s, man kann ein Museum besuchen ohne das Gefühl zu haben, draussen wär’s doch viel schöner. Also machen wir einen kleinen Umweg über Matakohe und besuchen das Kauri-Museum, „an excellent choice“, wie’s auf dem Prospekt heisst. Ja wirklich, das stimmt. Man lernt sehr viel über die Riesenbäume, die früher von den Pionieren gefällt und für den Häuser- und Möbelbau verwendet wurden. Jetzt sind sie bedroht durch andere Schädlinge, gegen die noch keine Abhilfe gefunden worden ist.
Um sieben Uhr kommen wir in Auckland an, herzlich begrüsst wiederum von Jay und Brian Holloway. Die beiden kennen wir bereits, wir haben vor etwa zwei Monaten einen lustigen Abend mit ihnen bei uns zu Hause verbracht, bevor sie nach Bivio fuhren. Jetzt besuchen wir sie in ihren Gefilden, die im Moment recht traurig aussehen, da’s immer noch regnet. Sie wohnen attraktiv, direkt unter der Harbour-Bridge, ein wenig erhöht mit einem schönen Garten und einem sensationellen Blick auf die Skyline. Die aber sehen wir natürlich nicht bei diesem Nebel und Regen. Wir glauben jedoch schon, dass sie dort ist.
Auckland
Hier sind wir wieder – in der Stadt, wo die restlichen Neuseeländer die Bewohner JAFA nennen. Just another ……. Aucklander. Das dritte Wort ist nicht schwer zu erraten, es heisst nicht “friendly“ und es ist auch nicht schwer zu erraten, ob es da etwa doch auch gewissen Animositäten gibt unter all diesen freundlichen Menschen in diesem Land. – Diejenigen, die wir kennengelernt haben, sind sehr hilfsbereit und mehr als nur freundlich. Unsere Gastgeber überlassen uns ihr Haus, das sich direkt unter der Brücke im Vorort Northcote Point befindet, und das, wie gesagt, eine wunderbare Aussicht hat auf die Skyline. Von der Fähre aus kann man die Glasfront „unseres“ Wohnzimmers gut sehen.
Die spektakuläre Aussicht bekommen wir am ersten Tag nicht mit, es regnet ohne Unterlass. Zwischendurch ist es ja ganz gäbig, dass man nichts Grossartiges unternehmen muss. Es ist eine Art Verschnauf- oder Siestapause, wie sie Theo so sehr liebt.
Grad den ganzen Tag zu Hause herumsitzen mag ich zwar auch nicht, so gehen wir am Nachmittag ins Kino gleich um die Ecke. „Bridgeway“ heisst es, von der Ambience her vergleichbar mit unserem „ABC“, ein wenig nostalgisch halt, aber im Unterschied dazu hat es verschiedene Säle, auch ein Restaurant und eine Bar. Und es laufen neue Filme. So sahen wir den „Butler“ – sehr guter Film, schlimme Periode der US-Geschichte. Die Tatsache, dass nur etwa zwanzig Personen im Kino sind, erinnert mich auch ans ABC, alles ältere Ehepaare, ich hab wohl den Altersdurchschnitt sogar ein wenig heruntergezogen.
Wie wir aus dem Kino kommen, hat’s tatsächlich ein paar Sonnenstrahlen.
Einkauf und anschliessend Nachtessen in einem japanischen Restaurant in Birkenhead, einem trendigen Vorort. Man merkt jetzt überall schon, dass Weihnachten vor der Tür steht, in jedem Lokal muss so ein kitschiger Baum mit blinkenden, farbigen Lichtern herumstehen, sogar im „Hayashi“.
Am zweiten Tag fahren wir auf den „One Tree Hill“, einen Hügel, von dem aus man einen prächtigen Rundblick über das ganze Stadtgebiet, die Vororte und die umgebenen Bays hat. Vom Monument aus, einem Obelisken, welcher einem Maori gewidmet ist, sieht man die Stadt für einmal „von hinten“, auch nicht schlecht zur Abwechslung. Der Hügel ist vulkanischen Ursprungs, 183 m hoch, es führt eine recht steile Strasse den „Berg“ hinauf; vereinzelte Jogger keuchen hinauf, wir nicht, wir nehmen ihn unter die Räder. Schafe grasen an den Abhängen ringsum im Cornwall Park, es ist ein idyllischer Anblick, ein gemütliches Ausflugsziel, nicht nur für Touristen.
Eine halbe Stunde Fahrt und wir befinden uns in Westauckland, an der Küste mit den schwarzen Stränden. An einem, dem Karekare-Beach, wurde der Film „The Piano“ gedreht. Es zeigt sich uns eine völlig verlassene Landschaft, eine einsame Bucht, öd, und der schwarze Sand unterstreicht diesen etwas depressiven Eindruck noch. Sogar die Möwen sind schwarz dort, so, dass ich nicht einmal eine Foto machen kann, man würde sie gar nicht sehen. Klar, es sind keine Möwen, sie sehen nur so aus; es sind Toreapango, auch Oystercatcher genannt , bewaffnet mit einem langen roten Schnabel, so dass sie ihre Austerndelikatessen viel gäbiger als wir ohne Brecheisen gleich selber öffnen können.
Der andere schwarze Strand an der Westküste ist Piah. Den hätten wir fast nicht erlebt, weil wir um Haaresbreite in einen schlimmen Unfall verwickelt worden wären. Die Küstenstrasse ist eng und kurvenreich. Wir machen Halt bei einem Lookout, um die herrliche Aussicht auf Piah, den Strand und Lion Head zu geniessen. Wir fahren wieder los, biegen um die nächste Kurve - da kommt uns ein Auto entgegen. - Zwei Europäer treffen aufeinander, wir auf der richtigen (linken) Seite, der andere auf der falschen. Was dann geschieht, spielt sich im Bruchteil einer Sekunde ab. Mein geistesgegenwärtiger Ehemann und Fahrer reisst das Steuer herum auf die rechte europäische Seite und entgeht somit dem sicheren Aufprall und dessen Folgen. Gleichzeitig flitzt an mir das Fenster vorbei mit der Beifahrerin des ausgeflippten Fahrers. Ein Gesicht wie „Der Schrei“ von Munch – das ist alles, was ich sehe. Sie muss von mir wohl den gleichen Eindruck haben. – Das ist grad nochmal gut gegangen. Das Verrückte: Ich schau natürlich zurück und sehe, dass das Auto immer noch auf der falschen Strassenseite weiterfährt… Und, die Strecke, die vor uns liegt, ist für etwa zweihundert Meter kurvenlos, also muss der Fahrer schon eine Zeitlang so gefahren sein. Die beiden müssen die Aussicht genossen haben, die, zugegebenermassen von der falschen Strassenseite her imposanter ist.
Uns sitzt der Schreck tief in den Knochen. Was hatten wir nur für ein Glück! – Dann fängt die Nachbetrachtung an: „Wenn jetzt einer entgegengekommen wäre… / Wenn jetzt einer gleich hinter uns gefahren wäre… / Wenn wir eine Minute früher oder später gestartet wären… / Wenn wir schneller gefahren wären… / Wenn der andere, im Moment, wo er seinen Fehler bemerkt hätte, auch auf die andere Seite ausgewichen wäre (dann hätte es ausgesehen, als ob wir auf der falschen Spur gefahren wären)… - und und und. Und immer wieder kommt einem von uns beiden ein „Wenn“ und „Wäre“ in den Sinn. Am Abend trinken wir einen Schluck aufs Überleben, aber vorher gibt’s noch ein wenig Sightseeing in der Gegend, im Arataski Forest Park: ein Wasserfall, Kauribäume, die einmalige Gegend im Allgemeinen.
Am Abend gehen wir mit Jay und Brian in ein italienisches Restaurant essen. – Das speziell Italienische dort war vor allem der Lärm, so dass man kaum das eigene Wort verstand. Die Kellnerin war aus Peru, der Rotwein aus Australien, das Essen: Nothing to write home about.
Stadtbesichtigung am Samstag: Die Fähre ist zwar sehr zuverlässig aber nur halb so effizient wie die in Brisbane, wo sie im Viertelstundentakt verkehrt. – Hier kommt nur jede Stunde eine vorbei und man muss sie heranwinken, sonst kommt sie gar nicht. Am Wochenende nehmen sie’s noch gemütlicher: alle drei Stunden reicht. Um 12 Uhr fährt sie, zu Fuss zwei Minuten von „unserem“ Haus entfernt. Den Nachmittag verbringen wir in der Innenstadt (Busfahrt zur Orientierung, Spaziergang durch die Queens-Street, zum Viktoria-Market und der Marina entlang). Wir werweisen, ob wir dort essen wollen oder nicht. Eigentlich gefällt es uns sehr, es herrscht ein buntes Treiben, in den attraktiven Bars sitzen viele Leute, die den freien Tag geniessen. Es wäre wohl ein kleines Kunststück, einen freien Platz zu finden. Wir haben so eine schöne Aussicht von unserer Unterkunft aus und die nächste Fähre ginge erst wieder in drei Stunden, so beschliessen wir, auf Jubel und Trubel zu verzichten und zurück nach Northcote Point zu fahren. Dort angekommen, laden uns unsere Gastgeber, die ein paar Häuser weiter weg ein Apartment haben, zum Apéro mit ein paar Freunden ein. – Nachtessen im Pub um die Ecke (ehrwürdiger, alter Pub – Ende19. Jhd.) Wenn ich nicht sicher wäre, dass wir in Neuseeland sind, ich dächte, ich sei in England.
Die Insel Whaiheke ist unser Reiseziel am letzten Tag - eine idyllische Insel, wo viele Leute ihre Ferienhäuschen am Meer haben, trendig, nicht weit von Auckland entfernt, erreichbar mit der Fähre in einer guten halben Stunde (8‘000 Einwohner, im Sommer mit den Feriengästen bis zu 40‘000). Seit dreissig Jahren wird dort Wein angebaut und einige der am besten bekannten und prämierten Weine kommen von dort. Man kann also Touren buchen, um Weingüter zu besichtigen (115 NZ $ - für Kinder ungeeignet). Wir verzichten. Unser Besuch auf der Insel ist ja nur kurz und fürs Kofferpacken heute Abend ist es wohl besser, nüchtern zu sein. So machen wir eine Erkundungsfahrt mit dem Bus, verbringen eine kurze Zeit an einem der pittoresken Strände und dann noch im Hauptort Oneroa.
Letztes Cüpli auf der Terrasse bei Sonnenuntergang. Es ist wieder sehr heiss, den ganzen Tag lang war’s abwechslungsweise regnerisch, windig, dann wieder angenehm warm und teilweise sogar heiss. Ein typisches „Auckland-4-Season-Weather“. - Zum Glück keine Schnee!
Von Auckland über Coromandel nach Tairua
Wir starten um halb zehn, nachdem wir das Haus geputzt, aufgeräumt und uns von unseren Gastgebern verabschiedet haben. Wir wählen die Küstenstrasse und fahren via Miranda und Thames nach Coromandel. Die Strasse ist oft recht mühsam, sehr kurvig und eng, manchmal geht’s rauf und wieder runter, dann wieder ganz eben an der Bay entlang. Die Gegend ist sagenhaft schön, immer wieder findet sich ein lohnenswerters Fotosujet. Die Bäume sind faszinierend in ihrer Art, ihrem Aussehen, ihrem Wuchs. Zum Teil sind sie riesig, haben knorrige Stämme und die farbigsten Blüten. Der eine Baum leuchtet wie Gold im Sonnenschein, dabei sind es „nur“ seine Blätter, die zitronengelb und auf der Unterseite der Krone hellgrün sind. Auch Blumen gibt es einzigartige, etliche ähnliche Arten wie bei uns, zum Beispiel Kapuziner-Blümchen in gelb und orange - ganze Hänge davon. Oder wilde rosarote Rosen überwuchern die Hecken. Ebenso ein gelber Strauch, der von weitem aussieht wie Forsythien, aus der Nähe eher wie kleine gelbe Finkli - eine Augenweide.
Unterwegs besuchen wir Waterworks, einen privaten Themepark. Nicht nur Kinder gönnen sich dort ein paar vergnügliche Stunden.
Wo wir übernachten heute Abend? - Wir sehen einfach, wie weit wir kommen und dort suchen wir uns eine Unterkunft. – Tairua ist’s. Der Ort liegt am Meer und umringt eine riesige Bucht. Bei Ebbe ist’s eine Sandbank, teilweise von Mangroven bewachsen. Das ganze Becken ist sicher der Kraterrand eines Vulkans. Ein bewaldeter und mit Häusern besprenkelter Hügel wie ein Zuckerstock gehört auch zum Bild. Dort finden wir ein Motel, wo wir die Nacht verbringen. Kaum angekommen, legt sich Theo gleich ins Bett und um sein Schnarchen nicht hören zu müssen und weil mich die Gegend interessiert, mache ich einen Strandspaziergang. Der Walkway führt einen Hügel hinauf, von wo aus man einen tollen Ausblick hat. Da seh‘ ich ein merkwürdiges Gefährt sich dem Ufer nähern: eine Art riesige Kiste, vollgestopft mit Kühen. Es sind etwa zwanzig Stück Vieh. Ein Boot zieht das Floss, ein anderes stösst es, zwei Männer turnen drauf herum. Der passendste Ausdruck, der mir für sie in den Sinn kommt, ist Water-Cowboys. – Ich beobachte den Transport und immer mehr Leute kommen dazu. Die „Kuhbuben“ haben Schwierigkeiten, das Gefährt an Land zu bringen, es ist Ebbe und irgendwie funktioniert das Ganze nicht. Es ist ein Hin und Her mit Booten und Seilen. Ich geh dann zurück und es dauert zwei Stunden, bis iwir einen Viehtransporter in Richtung Quai fahren sehen, der wohl die Kühe abholen wird. Wir gehen inzwischen essen ins Dorf. Es gibt wieder Muscheln und auch die sind absolute Spitze.
Von Tairua über Matamata (Hobbiton) nach Rotorua
Die Küstenstrasse geht weiter. Sie nimmt kein Ende. Es lohnt sich allemal, sie zu fahren, auch wenn’s recht mühsam ist, die Gegend ist idyllisch: waldbewachsene Hügel, saftige Weiden, Tausende von Schafen und Kühen. Für dreissig Kilometer brauchen wir fast eine Stunde. Unterwegs nehmen wir Autostopper mit, ein Paar aus Holland, noch grad nicht pensioniert. Mit dem Rucksack sind sie unterwegs. Wir tauschen Erfahrungen aus und nehmen sie mit bis in den nächsten Ort, der Minen- und Goldgräberstadt Waihi. Es ist interessant, ein ganz klein wenig von der Geschichte mitzubekommen. Es hat ein Museum (wie fast in jedem noch so kleinen Flecken), aber wir wollen weiter, haben andere Pläne. Trotzdem sehen wir uns vorher noch das ehemalige Pumphaus an, das um 300 Meter verschoben worden ist, ein Denkmal aus vergangener Zeit. Es steht dominant in der Gegend, gross, grau, halb zerfallen und sieht aus wie eine abgebrannte Kirche. Merkwürdig. Und dahinter befindet sich eine offene Mine, in welcher mit Lastwagen und Kranen gearbeitet wird. Die Grube ist so riesig, dass die Laster drin aussehen wie Spielzeugautos. Eigenartig.
Wir fahren weiter nach Matamata. Der Plan ist, uns das Filmset der „Lord oft he Rings“ – und der „Hobbit“ – Filme anzusehen. Das klappt auch wunderbar. Im Informationszentrum erleichtern sie uns um 150 NZ $, dann geht’s los mit dem Bus zum Set. – Hier also wird in einer wunderbaren Landschaft die Fantasie eines Mannes sichtbar gemacht, ein anderer hat die Idee beziehungsweise die Geschichten aufgenommen und in Filme verpackt, die Millionen einspielen. Und Millionen sind ausgegeben worden, um die Szenen so darzustellen, wie der Zuschauer sie dann in teilweise nur sekundenlangen Sequenzen sieht, genau nach Tolkiens Vorlage. Nach zwei Stunden haben wir 44 Hobbithäuser gesehen, haben einen langen Rundgang durch Hobbiton gemacht, haben etliche Episoden rund um die Dreharbeiten gehört und sind im „Green Dragon“ eingekehrt.
Um halb sechs sitzen wir in unserem Auto und fahren Richtung Rotorua. Wir erreichen den Ort eine gute Stunde später, finden auf zweiten Anhieb unsere bereits in Bern gebuchte Unterkunft, ein B&B mit Blick auf den See. Theo möchte gerne ein wenig Durchzug machen, frische Luft reinlassen; er hat noch nicht gemerkt, dass der penetrante Schwefelgeruch nicht wegzukriegen ist. Den haben wir hier gratis, er gehört quasi zum Image; im wilden Garten raucht, brodelt und dampft es aus allen Ecken und Enden.
Wir gehen essen in eines der vielen Restaurants im Touristenort (Thai) an der „Eat Street“ und gehen dann schlafen.
Den nächsten Tag, den 11. Dezember 2013, nehmen wir gemütlich. Das Wetter ist nicht wirklich fabelhaft, mehr grau als blau. Wir machen einen Rundgang im Government Garden, bemerkenswert finde ich dort die Blumenbeete: hellgrüne Bande und in der Mitte ein Meer von Petersilien. Sieht aber gut aus: - Das Museum im schönen Tudorhaus sehen wir uns nur von aussen an (langsam nervt’s uns, dass man immer und überall so viel Eintrittsgeld zahlen muss), trinken gemütlich eine Tasse Flat White, essen dazu ein Stück Lemon Pie (ich muss immer wieder probieren und vergleichen) und fahren anschliessend an den Lake Tarawera. Beim „Begrabenen Dorf“ machen wir Halt, aber heute ist nicht unser spendenfreudige Tag, Theo sagt, die hätten ja bei dem Vulkanausbruch nur ein paar Schuhe und den Hut des Pfarrers, den sie nach vier Tagen ausgegraben haben, ausgestellt… - schon wieder 50 Franken – nein! Wir fahren weiter, sehen beim nächsten Lookout die beiden Seen (gratis!), der eine ist blau, der andere grün. Am See ist es dann höchste Zeit für Theos Siesta. Wir legen unsere Standtücher in den Sand und lesen (Theo nur kurz, dann hör ich sein Schnarchen). Speziell an diesem schmalen Strand ist ein einzelner schwarzer Schwan, der ständig seine Runden dreht. Anmutig sieht er aus mit seinem langen Hals und dem roten Schnabel. Wenn er seine Flügel hebt, sieht man, dass er auch noch weisse Federn hat, die er geschickt versteckt.
Ein Lastwagen mit einem grossen Tank kommt an den Quai und da passiert etwas Spezielles: Der Fahrer steigt aus, schliesst einen Schlauch an den Tank an und spritzt und spickt Dutzende von kleinen, etwa 20 cm langen Forellen in den See. Die werden offenbar in einem Becken gezüchtet und dann, wenn sie gross genug sind, in die Freiheit ausgesetzt, um den Fischbestand zu vermehren und sicher auch zur Freude der Angler. Achtmal pro Jahr geschieht das, so ist es grad absolut ein Zufall, dass wir diesem Spektakel beiwohnen können.
Zurück in Rotorua machen wir einen Spaziergang durch das Quartier, an dessen oberem Ende wir wohnen. Ohinemuti ist die ursprüngliche Maorisiedlung, die seit 700 Jahren existiert und noch immer wohnen vor allem Maoris dort. Die meisten Behausungen sind sehr ärmlich. Es sind zwar „Einfamilienhäuser“, besser gesagt Baracken, die teilweise am Zerfallen sind oder, wenn noch jemand drin wohnt, dringender Renovation benötigten. Es hat eine Kirche dort, einen Friedhof, verschiedene Statuen und andere Orte der religiösen Verehrung, ein Gemeinschaftshaus natürlich auch. Das für uns aber am allerverwunderlichsten sind all die unzähligen Orte in den Gärten und mitten auf der Strasse oder dem Trottoir, wo es aus Löchern brodelt, raucht und grausam nach Schwefel stinkt. - Hier zu wohnen, ist schon ein wenig speziell, finden wir.
Zwischendurch gibt’s auch ganz ansehnliche Häuser. Aus einem kommt uns ein älterer Mann entgegen und fragt, wo wir herkommen. – Aus der Schweiz.- Ah, er habe einen Kaffee-Löffel aus Luzern, den wolle er uns schenken, meint er, wir sollen einen Moment warten. Ich bin ein wenig sprachlos. So eine seltsame Situation: Ein Maori (er erzählt uns später, sein Grossvater sei ein grosser Häuptling gewesen in seinem Dorf und ihm habe die ganze Gegend hier gehört) will uns einen Souvenirlöffel aus Luzern schenken. Er kommt dann tatsächlich zurück mit dem Löffel. Eine Gabel mit Zacken, die dazu da sind, Essiggurken besser aus dem Glas zu angeln, hat er auch noch dabei. Irgendwie gelingt es mir, ihm plausibel zu machen, dass wir den Löffel zwar sehr hübsch finden (kleine Lüge), ihn aber unter gar keinen Umständen annehmen wollen. Die Gabel drängt er uns auf. Ok, sie wird mir auf jeden Fall ein spezielles Andenken sein. Ich hab gar nichts dabei ausser dem Fotoapparat, nicht einmal meine Handtasche. Drum geb ich ihm dafür den rosaroten Ring aus Plastikperlen, den ich zufälligerweise anhabe, für seine Enkelin, falls er eine hat, und den nimmt er gern. – Dieser Spaziergang und die besondere Begegnung haben gar nichts gekostet. In der Tourst Information verkaufen sie für teures Geld Veranstaltungen in Maoridörfern, wo man sogenannt authentisch mit Maoris zusammenkommt, ihren Tänzen beiwohnen kann und auch aufgefordert oder gar dazu gedrängt wird mitzumachen (nicht ganz jedermanns Sache – meine ganz bestimmt nicht), und wo man Hangi (Fleischgericht, das zuvor ein paar Stunden im Boden eingegraben wird, bis es gar ist) essen kann und so weiter. Ich habe im Tripadvisor nachgeschaut und Berichte über diese Darbietungen gelesen. Neben einigen, denen diese Veranstaltungen natürlich gefallen haben, hat’s auch ein paar, die meine Skepsis solchen Angeboten gegenüber bestärkten und uns einen weiten Bogen um diese touristische Abzocke machen liessen.
In unserem Bed and Breakfast haben wir’s gut. Unser Schlafzimmer ist allerdings relativ klein, aber dafür hat’s ein grosses, sehr geschmackvoll eingerichtetes Wohnzimmer mit Küchenanteil, das wir ganz für uns alleine haben, da wir die einzigen Gäste sind. Auch die Besitzer haben wir nie zu Gesicht gekriegt, ganz seltsam eigentlich. An der Tür gibt’s ein Telefon und eine Nummer, die man wählen kann. Das war der einzige Kontakt mit der Besitzerin (vorher natürlich per Email). Sie gab mir eine Nummer, um mit dem Zahlenschloss ins Haus zu kommen, sagte, welches unser Zimmer sei, dass ein Manual mit Anweisungen und Tipps drinnen vorhanden sei und dass sie jederzeit telefonisch für Auskünfte erreichbar sei. Das Frühstück muss/kann man sich übrigens auch selber zubereiten, es hat Toastbrot, Milch, Butter und Konfitüre im Kühlschrank. Tee, Kaffee und Zucker ebenfalls. Um 10 Uhr morgens kommt jemand, um Zimmer und Bad aufzuräumen, die Betten zu machen und neue Tücher hinzulegen. Diese Person haben wir auch nie gesehen.
So ein Business zu führen – nicht schlecht. Kommt mir ein wenig vor wie die Chirurgen, die gar nicht mehr direkt am Patienten operieren, sondern aus einiger Distanz.
Wir gehen also zurück in unsere Unterkunft, vor dem Nachtessen möchte ich ein Bad nehmen im Whirlpool, der auf der Terrasse steht, aber das Wasser drin ist so heiss, dass ich nicht mal die Hand länger hineinhalten kann. Also nichts gewesen mit Baden, gehen wir essen. Indisch heute.
Von Rotorua nach Whakatane
Heute hat’s endlich keine Wolken, nur noch Sonne. Wir packen unsere Siebensachen und fahren erst mal in entgegengesetzter Richtung, nach Waimangu. Google lehrt mich: „Das Waimangu Valley oder Waimangu Volcanic Rift Valley ist ein Grabenbruch etwa 25 km südlich von Rotarua auf der Nordinsel euseelands. Es entstand am 10. Juni 1886 durch einen Ausbruch des Mount Tarawera. Durch die Eruption entstand ein 17 Kilometer langes Tal, das vom Besucherzentrum durch den heutigen Lake Rotomahana hindurch reichte. 22 Krater entlang des Grabens brachen gleichzeitig aus. Der Ausbruch verschüttete die auf dem Gebiet des Laka Rotomahana am Ende des Tales gelegenen Sinterterrassen der Pink and White Terraces, damals die bedeutendste Sehenswürdigkeit Neuseelands.
Das Tal ist das jüngste Thermalgebiet der Welt, das einzige bekannte Beispiel für ein direkt infolge eines Vulkanausbruches entstandenes, geothermales Ökosystem und das einzige Beispiel in Neuseeland für die natürliche Regeneration eines heimischen Ökosystems nach der völligen Vernichtung“.
Die farbigen Seen und Krater sehen sicher schöner aus bei Sonnenschein als wenn der Himmel bedeckt ist. - Dem ist so. Die Landschaft, die vor etwas mehr als hundert Jahren durch einen Vulkanausbruch entstanden ist, ist äusserst spektakulär. Es brodelt und zischt, der eine See hat eine unglaublich intensive Farbe, ist türkisfarbig, fast magisch anzusehen, ladet zum Bade, würde man denken, aber doch lieber nicht, das Wasser muss extrem heiss sein. Erstaunlicherweise stinkt es gar nicht so sehr nach Schwefel wie etwa in Rotorua. Wir unternehmen eine etwa zweistündige Wanderung zum Lake Rotomahana. Der Weg ist sehr gut unterhalten und ausgeschildert. Eine bizarre Landschaft reiht sich an die andere – faszinierend! Weiss, grün, blau, gelb, unfassbar, wie dünn hier die Erdrinde sein muss. Beim See angekommen, treffen wir auf eine Vielzahl von schwarzen Schwänen. Wo wir gestern nur einen einzigen gesehen haben, ist hier eine ganze Kolonie zu Hause. Wir treffen auch auf eine Vielzahl von Touristen. Wo die plötzlich alle herkommen? Wir waren meistens ganz allein auf unserer Wanderung. Sie warten alle auf den Bus. Wir auch. Das ist eine praktische Dienstleistung des Visitor Centers. Der Bus bringt alle an den Ausgangspunkt zurück.
Lustigerweise haben wir unterwegs die beiden holländischen Hitchhiker getroffen, die wir tags zuvor im Auto mitgenommen haben. Schon wieder so ein Zufall. Sie geben uns einen heissen Tipp. Ein paar Kilometer weiter gibt es einen grünen See, der ziemlich warm ist und in dem man baden kann, noch etwas weiter dann ein Bach, der ebenfalls heisses Wasser führt. Dort hat sich ein Bassin gebildet, etwa 15x15 Meter, wo man sich wie in einem Whirlpool hineinsetzen kann. Das machen wir natürlich, aber das Wasser ist so warm, dass ich am Anfang fast Mühe habe, hineinzugehen, ich denke, es sind mindestens 35°. Theo wagt es allmählich auch, er jammert ja immer über die kalte Aare, jetzt ist die Gelegenheit da zum warmen Bade, zum Klagen gibt’s keinen Anlass - oder doch? - Er murmelt etwas von „Spiegeleiern“ …
Mehr als etwa zehn Minuten bleiben wir nicht drin, obwohl man sich mit der Zeit ganz gut an die Temperatur gewöhnt. Ein paar Leute, die länger drin bleiben, kommen raus wie Lobster; das muss ich nicht haben.
Wir sind vorher an einem anderen See vorbeigefahren. Dort war keine Menschenseele, obwohl er absolut idyllisch aussah. Gehen wir zurück dorthin. Am Ufer steht ein Schild mit einer Warnung, man soll das Wasser weder trinken noch drin baden. Blau-grüne Algen treiben dort offenbar ihr Unwesen. Daher also ist niemanddort. Dann taucht doch plötzlich ein Pickup auf, der Fahrer und sein Hund steigen aus und beide gehen fröhlich schwimmen. Ich bin natürlich neugierig und frage, ob es keine Probleme gäbe für Schwimmer. Er sagt, er komme seit 32 Jahren hierher zum Baden, seine Kinder auch und noch nie sei etwas passiert. Dann geh ich halt auch. Schön, dieses kühle Wasser.
Soeben google ich blau-grüne Algen und finde Folgendes:
„Die Supernahrung: Blaugrüne Uralgen - Die Afa-Algen - Enzyme halten die chemischen Prozesse im Körper, seinen gesamten Metabolismus auf Trab. AFA-Algen verfügen über Tausende von besonders starken Enzymen. Essen wir AFA-Algen, profitieren wir von der Kraft dieser Enzyme.“
Hätte ich den See doch austrinken sollen…
Bei Wikipedia finde ich dann dieses:
„Einige Stämme von Aphanizomenon flos-aquae produzieren Anatoxine, Gifte, die entweder direkt eine permanente Stimulation der Acetylcholinrezeptoren in den Nervenzellen bewirken oder das Enzym Acetylcholinesterase hemmen und so in ihrer Wirkung vergleichbar sind mit Nervengasen wie Sarin und Tabun. Weiterhin produzieren in Deutschland gefundene Stämme von Aphanizomenon flos-aquae die Gifte Cylindrospermopsin und Saxitoxin. Diese Gifte können beim Trinken kontaminierten Wassers oder beim Schwimmen in verseuchten Gewässern für Tiere lebensbedrohlich sein. Die Universität Konstanz fand in einer Untersuchung von sechzehn als Nahrungsergänzung vertriebenen Produkten in zehn Fällen bedenklich hohe Mengen Microcystin, einem starken Lebergift.“
War vielleicht doch gut, dass ich das Wasser nicht getrunken habe…
Wir fahren weiter nach Whakatane, an etlichen Seen vorbei, sehr zügig, Theo hat gesagt, er freue sich auf ein Bier. Da kann ich lange sagen, ich möchte gerne noch ein paarmal Halt machen an einem Lookout oder sogar irgendwo verweilen, weil’s doch so schön ist. – Das Bier ruft. Geflissentlich übersieht er jeden Lookout – wie mit Scheuklappen fährt er Richtung Küste.
Heute Morgen hab ich per e-Bookers ein Motel in Whakatane reserviert für zwei Nächte, das „Pacific Coast“. So müssen wir keine Unterkunft suchen. Das kommt Theo grad recht. Das Bier ist in Reichweite.
Das Gebräu erhält er gleich bei Ankunft an der Rezeption, wir beziehen unser komfortables, grosses Zimmer und Theo legt sich aufs Bett. Ich geh erst mal in den nächsten Supermarkt, Booze-Nachschub kaufen. Mit drei Flaschen Wein komm ich zurück und finde Theo in der Horizontalen, schnarchend, das Bier steht leergetrunken auf dem Nachttisch.
Apropos Booze: Eine Flasche Wein hab ich immer bei mir in der Handtasche, wenn wir abends essen gehen, es könnte ja sein, dass es sich um ein „byo“-Restaurant handelt, (bring your own), so dass wir nur ein wenig Zapfengeld zahlen müssen und unseren eigenen Wein trinken können. Das schätze ich sehr, nicht nur wegen dem Preis. Die Neuseeländer sind vor allem spezialisiert auf Weissweine und wenn es sich um Roten handelt, dann ist das oft Pinot Noir, den ich nicht so mag.
So trinken wir auch heute Abend, nach Theos Siesta, eine Flasche australischen Cap Sauv aus meiner Handtasche mit dem klingenden Namen: „Sqeaking Gate“.
Von Whatakane nach Gisborne
Mat, der Besitzer des Motels, wird bei Tripadvisor über alle Massen gelobt. Das war natürlich mit einer der Gründe, weshalb ich gerade diese Unterkunft gewählt habe. Und ja, Mat ist wirklich mehr als nur charmant, hilfreich und nett. Für den folgenden Tag gibt er uns die besten Tipps, die wir selbstverständlich alle befolgen.
Zuerst fahren wir nach Ohope Beach, wo wir im Quay-Café (Where the gossip is as fresh as the coffee) frühstücken, dann geht’s auf eine kleine Wanderung von einer Bucht in die andere, etwa ein stündiger Spaziergang hin und zurück mit spektakulärer Aussicht und sehr vielen Treppenstufen hinauf und hinunter. Der Otarawairere Bay gilt als eine der schönsten Buchten im Bay of Plenty. Der Sand besteht aus lauter Muscheln - kleinen, die fast schon zu Sand verwaschen sind und grösseren, aber leider alle zerbrochen.
Wir legen uns ein Stündchen an den Strand und lesen ein bisschen. Dann geht’s weiter zu einem Lookout (Kohi Point Scenic Reserve), von wo aus man einen genialen Ausblick hat weit übers Land, im Hintergrund Hügel, Berge und ein Vulkan, im Vordergrund Busch, das Städtchen Whakatane, der breite Fluss, das Delta, der Hafen, Strand und Meer. Wir fahren anschliessend den Berg hinunter und „plegere“ ein wenig am Fluss, Theo schreib in sein Tagebuch und macht ein paar Zeichnungen.
Zurück im Motel starten wir einen neuen Versuch, an unserem Blog weiterzuarbeiten, was dann auch gelingt, jedenfalls kann ich einen Teil davon am nächsten Morgen abschicken.
Es ist ein schöner Abend, wir fahren nochmals in den Hafen, kaufen uns Fish and Chips (frischer geht’s nicht – der Fisch ist am selben Tag gefangen worden, das Schiff steht vor dem Shop), setzen uns an einen der Picknick-Tische am Flussufer und geniessen unser Nachtessen. Selbstverständlich ist auch die Flasche aus der Handtasche mit dabei und Weingläser aus dem Motel. Theo mag nicht alle vier Stück Fisch fertig essen und teilt sie mit den Möwen, die schon lange geduldig parat stehen, weil sie offenbar damit rechnen, irgendwann irgendwas zu kriegen. – Ein Riesengeschrei und schon ist alles weg.
Auf dem Rückweg ins Hotel möchte ich noch einen Spaziergang zum Fluss machen; es ist schon halb neun Uhr und immer noch hell. Vielleicht sehen wir den Sonnenuntergang. Wir gehen über eine Brücke und machen ein paar Fotos. Es ist immer wieder grossartig zu sehen, wie die Nacht langsam einbricht: das Wolkenspiel, die verschiedenen Farben am Horizont, die sich fast von Sekunde zu Sekunde ändern.
Das war ein sehr gemütlicher Tag, völlig ohne Hektik – Ferien eben.
Wir nehmen‘s auch am nächsten Morgen gemütlich, haben nur eine zweieinhalbstündige Fahrt vor uns. – Denken wir. Zuerst fahren wir nach Opotiki, wo wir einen Halt machen im Städtchen, um eine Tasse Kaffee zu trinken. Die Hauptstrasse ist abgesperrt und es hat einen Haufen Leute, ganze Schulklassen stehen am Strassenrand. Worauf die warten? Man erklärt uns, in fünf Minuten würde eine Christmas Parade stattfinden. - So ein lustiger Umzug, den wir da rein zufällig zu sehen bekommen! Das halbe Gewerbe der Stadt macht mit, zuerst kommt die Feuerwehr, dann der Abbruchwagen, beladen mit einem zu Schrott gefahrenen Auto, die Lebensretter, der Fussballclub, auch das Pflegeheim ist vertreten: Ein Pfleger stösst eine Greisin im Rollstuhl vorbei, ein paar Soldaten patrouillieren ebenfalls sowie zwei, drei Pferde, Batman ist dabei und alle sind geschmückt mit Weihnachtsschmuck und Bändern auf denen „Merry Christmas“ steht. Den Kindern, die dem Umzug zuschauen oder mitlaufen, werden Süssigkeiten zugeworfen, es ist eine Freude zuzuschauen. – Ein spezielles Erlebnis, wie schön, dass wir zur rechten Zeit an diesem Ort vorbeigekommen sind.
Wir fahren daraufhin weiter Richtung Gisborne, durch die Waioeka Schlucht, dem Motu-Fluss entlang. Unterwegs machen wir Halt an einer historischen Ziehbrücke, deren Aufhängung schon etwas abenteuerlich aussieht. – Irgendwo, etwa fünfzig Kilometer weiter, soll eine Strasse zum Rere Wasserfall abzweigen (Rere ausgesprochen wie unser Reissverschluss). Wir haben ja Zeit und beschliessen also, diesen Umweg unter die Räder zu nehmen. Schon nach wenigen Kilometern hört die geteerte Strasse auf und es beginnt auch noch zu regnen. Wir fragen einen Bauern, ob wir überhaupt auf dem richtigen Weg seien, was er bestätigt. Verkehr hat’s so gut wie keinen, auch kaum Siedlungen. Nach weiteren fünf Kilometern überhaupt keine Häuser mehr. Hin und wieder noch ein Wegweiser mit einer Strassenbezeichnung, die uns gar nichts sagt. Dass uns kein einziges Auto mehr begegnet, stört mich gar nicht, ist die Strasse doch sehr eng und ohne Belag; man könnte sowieso schlecht kreuzen. Endlich dann ein Wegweiser: „Rere-Falls: 36 km“. Zurück hat nun auch keinen Sinn mehr, wir fahren weiter, aber es ist mehr als nur mühsam, auf dem feuchten, rutschigen und kurvenreichen Weg vorwärtszukommen. Mehr als 30 km/h kann ich kaum je fahren, ohne zu fürchten, ins Rutschen zu geraten. Ich hoffe nur, die Pneus machen das alles mit. Hier einen „Pladi“ zu haben, stünde nicht grad auf meinem Wunschzettel. Auch könnte ja ein Auto entgegenkommen. Da kommt aber keines, zum Glück, die Pneus halten durch, wir auch und sind dann sehr froh, wie wir nach etwa anderthalb Stunden endlich wieder auf eine geteerte Strasse treffen. Die Rere-Fälle, na ja, ob sich dieser riesige, beschwerliche Umweg gelohnt hat… Zwei Kilometer weiter eine weitere Attraktion: „Rere Rockslide“. Es regnet immer noch, trotzdem hat’s etwa zehn Jugendliche, die sich deswegen nicht beirren lassen. Der Fluss bildet hier eine etwa dreissig Meter lange Rutschbahn, die in einem natürlichen Becken endet, bevor dann ein paar hundert Meter weiter unten der Wasserfall entsteht. Auf diesem Fels kann man mit einem Board oder einem Pneu hinuntergleiten. Einmal in Fahrt, ist bremsen nicht mehr möglich. Die Jungen haben enormen Spass und ich denke, das würde ich niemals wagen, mir scheint diese Rutsche viel zu gefährlich. Ich stelle mir geschundene Knie und Ellenbogen vor, zerquetschte Finger – nein, dieses Vergnügen (erstaunlicherweise verlangt hier niemand Eintrittsgeld) steht auch nicht auf meiner „To-do-Liste“, aber zuzuschauen ist amüsant. Zum Teil verlieren die „Rutscher“ ihre Boards, werden abgeworfen oder putschen ineinander, aber niemand verletzt sich; ich kann‘s fast nicht glauben. Dabei ist dort nur blank geschliffener Fels mit relativ wenig Wasser drauf. Immer wieder wandern sie den Hang hinauf und probieren‘s erneut.
Es sind jetzt nur noch wenige Kilometer bis Gisborne, auf einer richtigen Strasse. – Wunderbar! Wir beziehen ein Motel gleich beim Strand, hier ist das Wetter wieder wie wir es uns wünschen, geregnet habe es nicht. Theo legt sich ins Bett (Kopfweh, vermutlich vom vielen Kurvenmitfahren), ich mach einen Strandspaziergang, nehme ein Bad im Meer, und lese ein bisschen; es ist ein angenehmer, warmer Spätnachmittag.
Gegen acht fahren wir ins Städtchen, finden einen der letzten Zweiertische in einem der hübschen Restaurants am Hafen bei der Werft und lassen uns vom Koch, den überaus freundlichen Serviertöchtern und der schönen Aussicht verwöhnen. Es ist fast neun Uhr, die Sonne geht gleich hinter den Schiffen unter und tönt den Horizont in blaue, rosarote und graue Streifen.
Von Gisborne nach Hastings
Am nächsten Morgen machen wir eine kurze Besichtigung des Ortes, der dadurch bekannt wurde, dass Captain Cook im Jahr 1769 zum ersten Mal neuseeländischen Boden betreten hatte. Nicht nur ihm, sondern auch seinem Schiffsjungen, dem „Young Nick“, der als erster vom Schiff aus Land gesehen haben soll, ist eine Statue gewidmet.
Vorerst aber gibt’s noch Kaffee und Kuchen im „Food 4 Thought“, einem Café mitten im Ort. Zu denken gibt mir allerdings weniger deren Food als vielmehr die Tatsache, dass ich schon am Morgen früh mit einer Flasche Wein in der Handtasche im Lokal sitze (vergessen rauszunehmen – hat dort übernachtet, weil am Vorabend Wein im Lokal bestellt – kein „byo“ – also doch kein Grund, sich Sorgen zu machen).
Vom Hafen aus führt ein Weg steil den Hügel hinauf zu einem Aussichtspunkt (natürlich Captain Cook Lookout), von wo aus man einmal mehr einen herrlichen Blick über die Gegend hat. – Wie die das immer hinkriegen, diese Neuseeländer: eine hübsche Ortschaft, fantastische Strände, Bergketten im Hintergrund, ein, zwei Flüsse, die sich durch die Landschaft schlängeln und ein Hügel so platziert, dass man die bestmögliche Aussicht auf das ganze Panorama hat. - Grossartig!
Gegen Mittag fahren wir los in Richtung Hastings, etwa drei Stunden wird die Fahrt dauern. An der nächsten Tankstelle machen wir Halt (Tankstellen sind rar über Land), tanken, Theo geht in den Shop zum Zahlen und schon wieder bahnt sich so ein lustiges Gespräch an mit einem jungen Mann auf der andern Seite der Tanksäule. Er hält einen kleinen Plastiksack in der Hand, gefüllt mit Wasser und einem Fisch drin. Er zeigt mir das Exemplar von nahem. Es ist ein winzig kleiner Haifish, nicht länger als etwa sieben Zentimeter, genannt Red-Tailed-Black-Shark (laut Wikipedia: Feuerschwanz-Fransenlipper. – So ein schöner Name…). Er erzählte mir, er sei auf dem Weg, den Kleinen in die Tierhandlung zurückbringen, denn dieser sei aussergwöhnlich aggressiv und beisse alle seine andern Fische im Aquarium. – Kleinen Episoden wie diese finde ich so „witzig“. Mich dünkt, in der Schweiz würden sich kaum solche Gespräche unter Fremden ergeben, wie sie hier tag-täglich vorkommen. So oft wird man gegrüsst, rasch werden ein paar Lappalien übers Wetter ausgetauscht oder zumindest erhält man ein Lächeln beim Vorbeigehen, was wir natürlich sehr gerne erwidern. Herrlich! (Wenn ich das dann zu Hause immer noch mache, fürchte ich, die Leute denken, ich hätte einen Webfehler…)
Von Gisborne aus fahren wir gegen Süden, es gibt eine einzige Strasse, die in diese Richtung führt, die SH 2 (State Highway 2), Highway = Autobahn? – Nein, eine solche hat’s nur grad um Auckland herum. Die Strasse ist zwar ausgebaut und gut unterhalten, wie bei uns hat’s Baustellen und neu asphaltierte Abschnitte, wo man nur 30 fahren darf, aber woher der Name „Highway“ kommt, ist mir ein Rätsel. In Wairoa machen wir Halt, kaufen ein Sandwich, etwas zu trinken und ein extrem pinkes Gebäck (Theo will’s) und legen uns unter einen Pohutukawa-Baum ins Gras ans Ufer des Flusses, der uns sehr an die Aare erinnert. – Das extrem rosarote Gebäck ist extrem gut, erst wollte ich gar nicht davon probieren, dann hab ich ihm alles weggegessen. Nach einem gemütlichen Lese- beziehungsweise Siestastündchen geht’s weiter. Die nächsten hundert Kilometer fahr ich wieder mal, dann kann ich auch anhalten, wenn und wann ich will. An einem schönen See tue ich das auch, auf dem Informationschild lese ich, dass da ursprünglich eine Schaffarm war mit 35‘000 Schafen. – Offenbar gab’s früher mal insgesamt 50 Millionen Schafe in ganz Neuseeland. Diese Zeiten sind vorbei, Wolle ist kaum mehr gefragt, die Rinderzucht hat Einzug gehalten. Immerhin sollen’s noch etwa 30 Millionen Tiere sein.
Eigentlich sind es gleich zwei Seen, der Lake Tutira und der kleinere Lake Waikopiro und der Halt hat sich allemal gelohnt, weil’s so idyllisch ist dort, auch wenn Theo gar nicht aussteigen will.
Von da an geht’s nicht mehr weit bis Hastings. Wir fahren am Flughafen von Napier vorbei, dort, wo jetzt die Landebahnen sind, hat man vor 1930 Fische gefangen. Das Erdbeben hat das Land um fast zwei Meter angehoben, so fliegt man jetzt halt statt zu fischen. Auch ganze Quartiere sind entstanden auf dem gewonnenen Land.
Die Adresse in Hastings, wo Kay und Mike Whelan wohnen, findet Rösi ohne Probleme. Sie erwarten uns schon. Auch sie sind Homelink-Freunde, die wir vor vier Jahren kennengelernt haben, als sie bei uns in Ittigen Halt machten auf dem Weg nach Bivio.
Sie haben eine grosse Familie, vier verheiratete Töchter und elf Grosskinder. Bei der einen Tochter, Claire, sind wir zu einem verfrühten Christmas-BBQ, einem „real Kiwi-Xmas-Event“ eingeladen. Die junge Familie wohnt gleich um die Ecke. Sie besitzen eine grosse Gärtnerei, die ihre Eltern zuvor bewirtschaftet haben. Genug Platz also zum Feiern. Wir sind zehn Erwachsene und sehr viele Kinder, sicher etwa zwanzig. So kommt’s mir jedenfalls vor. Auch ein Hund, ein Golden Retriever, und eine Katze sind mit von der Partie. Die Männer am Grill mit einem Bier in der Hand, die Kinder baden im Pool, bevor sie wie die Heuschrecken übers Salatbuffet herfallen, aber es hat genug für alle. Irgendwo zwischen den Kleiderbergen im Türrahmen steht ein geschmückter Tannenbaum, einer mit langen Nadeln, es muss eine Fichte sein. Die Kinder sind sehr musikalisch. Klavier, Trompete, Gitarre, Gesang, ich bin beeindruckt. Zum Glück sind’s keine Weihnachtslieder, mit denen sie uns beglücken; sie spielen Michael Jackson und andere Songs dieser Art. Wirklich gut. Mir gefällt’s. Nach der Darbietung spielen die Jungs ein Kartenspiel, bei dem’s ziemlich bunt zugeht und die Mädchen vergnügen sich wieder im Pool mit dem jüngsten Familienmitglied, Ricky, der immer wieder sagt: „not yet“, wenn man ihn mahnt, es sei langsam „bedtime“. – Auch für uns wird’s Zeit zu gehen, einige der Kinder haben am nächsten Tag noch Schule, zwei von ihnen reisen in die Schweiz zu ihrem Vater, der in Orbe wohnt, und wir sind auch allmählich müde.
Eine grosse, nette Familie, ein vergnüglicher Abend - wir haben alles sehr genossen. Wirklich freundlich, dass man uns dazu eingeladen hat.
Hastings
Am Montagmorgen fahren Kay und Mike mit uns auf einen Hügel südlich von Hastings, den Te Mata Peak (400 m), von wo aus man eine atemberaubende Aussicht über die ganze Gegend von Hawke’s Bay hat. Im Westen sieht man sogar den schneebedeckten Mount Ruapehu (2797 m), den höchsten Vulkan in Neuseeland, der ziemlich zentral in der Nordinsel gelegen ist. Zum letzten Mal war er vor sechs Jahren aktiv.
Hawke’s Bay ist ein grosses Weinanbaugebiet (mehr als 40 Weingüter) und eine Früchte- und Gemüseplantage reiht sich an die andere. Drei Flüsse sieht man gut von oben, den Tutaekuri, den Ngaruroro und den Tukituki-River, viele Weingüter ebenfalls. Die wollen wir dann zwar noch aus der Nähe anschauen, ein paar davon jedenfalls. Sicher nicht nur anschauen. Sure thing! Jetzt aber gibt’s Kaffee im Peak Café.
Kay und Mike übergeben uns anschliessend ihr Haus, sie übernachten bei ihrer Tochter Kim und fliegen am folgenden Tag nach Dunedin auf die Südinsel, wo ihre vierte Tochter Paula, die einzige, die wir gestern nicht kennengelernt haben, mit ihrer Familie wohnt. Ein paar Instruktionen noch, dann sind sie weg.
Es ist heiss, ich möchte gerne an einen Fluss baden gehen. Theo möchte lieber daheim bleiben, ich merke es schon, aber er gibt klein bei. Bis wir sein Portemonnaie gefunden haben, dauert’s allerdings eine halbe Stunde. Theo sucht überall. Ich rufe schon mal im Honig-Zentrum an, wo wir uns auf dem Heimweg über die Honigproduktion haben ins Bild setzen lassen und für Ella ein paar „Biendli- Finkli“ gekauft haben. Mike wird angerufen und gefragt, wo sein Autoschlüssel ist, denn eine Vermutung ist, dass sich die Geldbörse mitsamt sämtlichen Ausweisen und Kreditkarten vielleicht im Peugeot befindet, der zum Glück in der Garage steht. Den Schlüssel haben wir, das Portemonnaie nicht. Schliesslich finden wir das Ding. Es ist ihm aus der Hosentasche gefallen, als er sich auf den Lehnstuhl gesetzt hat. Dort steckt es zwischen Armlehne und Sitz und sagt nichts. Ich sag auch nichts, bin einfach froh, dass uns eine mühsame Wiederbeschaffung erspart geblieben ist. Der Fluss läuft uns ja nicht davon. Allerdings dauert unser Badevergnügen nicht sehr lang, denn es ziehen Wolken auf und wir wollen lieber gehen. Ein Einkauf im nächstgelegenen Ort, Havelock North, und schon sind wir wieder daheim. Wir wollen draussen essen, dann aber fängt’s doch noch an zu regnen und wir machen es uns drinnen gemütlich. Salat gibt’s aus Kays Garten, Spaghetti im Hauptgang, Theos Favourite, und schon wieder ist Bedtime. – Das Haus ist aus Holz gebaut und fast pausenlos knarrt es im Gebälk. Man hat das Gefühl, da sei einer im Estrich – beinahe ein wenig geisterhaft. Den gibt es aber nicht, weder den Estrich noch den Geist; es ist ein Bungalow.
(Kleiner Exkurs zum ständigen Suchen: Diesmal war’s das Portemonnaie. Theo sucht aber fast jeden Tag irgendetwas. Kürzlich war’s der Pullover und nachdem er ihn beim Bettende unter dem Duvet gefunden hatte, war‘s am nächsten Tag gleich nochmal derselbe Pulli. Manchmal sind’s ein Paar Schuhe, manchmal auch nur einer (???). Socken sowieso. Da gibt’s nur eines: 100 gleiche Paare kaufen, dann fällt das nicht so auf. - Seine E-Zigaretten finde ich auch laufend irgendwo, zu seinem Glück meist bevor er sie überhaupt vermisst. Seltsam dünkt mich, wenn es die Unterhosen sind, die er sucht. Das ist mir jetzt noch nie passiert. Ich suche auch gelegentlich was, aber ich verliere meine Sachen meist in der Tiefe meiner unendlichen Handtasche, und wenn ich mich entschliesse, sie mal zu leeren, mache ich so manche erstaunliche Entdeckung.)
Am Dienstag machen wir einen besonders schönen Ausflug - ans Cape Kidnappers. Vögel und Geologie sind hier das Thema. Um zehn Uhr geht die Tour los, und zwar mit einem Traktor. Genau das ist das Gefährt, das bei niedrigem Wasserstand dem Strand entlang die Strecke bis zum Cape ohne grosse Probleme meistern kann. Touristen haben wir bisher nur sehr wenige gesehen, hier gibt’s zwei Traktoren mit je einem Anhänger voll davon. Die Küstenfahrt, die wir hier machen, ist etwas vom Gigantischsten, was ich je gesehen habe. Die Steinformationen, die Schichten, die sich während Jahrtausenden gebildet haben, sind gewaltig. Der Fahrer hält oft an und erklärt, wie alt das Gestein ist, wie sich die Schichten gebildet haben, er zeigt, wo man genau sehen kann, dass sich ein Erdbeben ereignet hat, weil die Verschiebung gut sichtbar ist. Faszinierend! Dass wir nicht noch einen Felssturz miterleben, dünkt mich fast ein wenig speziell, weil Sand- und Kalkstein der vordersten Schichten zum Teil aussehen, wie wenn sie grad nächstens am Abstürzen wären. Noch ein Gewitter und dann… Es macht Spass, auf dem Traktor mitzureiten. Manchmal fährt er durchs Wasser, dann spritzen die Wellen einen an, aber das ist sogar sehr willkommen, denn es ist recht heiss. Murry, der Fahrer, hält hin und wieder an, holt ein Stück Fels oder Stein und erklärt dessen Bewandtnis. Natürlich sind da auch die üblichen Witze. Am Anfang werden alle gefragt, woher sie kommen. Sicher hat’s immer Australier dabei, so auch diesmal. Murry kann seinen obligaten Scherz platzieren: „Oh, there are three Austalians on board. - I’ve got to speak slowly so they can understand - etc, etc“. Sie kommen immer wieder dran, die Aussies. - Das ist wohl die Retourkutsche, weil sich die Australier gerne lustig machen über die Aussprache der Neuseeländer. Sich gegenseitig zu necken, muss ungeheuren Spass machen. Das kennen wir ja auch in der Schweiz: die Freiburger, die Aargauer, die Basler und Zürcher...
Wir kommen nach etwa anderthalb Stunden an Felsen vorbei, wo Gannets brüten, australische Tölpel. Die lassen sich in keiner Weise beeindrucken oder stören von den beiden Traktoren und den vielen Leuten, die sie fotografieren. Sie haben überhaupt keine Scheu.
Je weiter wir fahren, desto älter werden die Gesteinsschichten. Wie Murry sagt, sind wir jetzt bei den grau-blauen Schichten angelangt, die drei Millionen Jahre alt sind. Man kann sich das ja kaum vorstellen, aber eindrücklich ist die wilde Gegend schon.
Am Cape Kidappers (so genannt, weil es ein Scharmützel gab zwischen der Mannschaft von Captain Cook und den Maoris, die dann versucht haben, einen von Cook’s tahitianischen Schiffsjungen zu entführen, was dann aber verhindert werden konnte) gibt’s einen Spazierweg zu einem Leuchtturm und zu weiteren Gannet-Kolonien. Es ist ein Walk von etwa einer Stunde hin und zurück. Sagenhaft. Eine Unmenge an Vögeln sitzt dort, brütet am Boden, (manchmal sieht man ein Junges neben beziehungsweise unter oder zwischen den Beinen seiner Mutter sitzen), nur ein paar Meter von uns entfernt. Ein gewaltiger Anblick, vom Gestank mal abgesehen. Der ist auch sagenhaft. - Ich hab gelesen, die Vögel können über dreissig Jahre alt werden und eine Flügelspannweite von bis zu zwei Metern haben. Wenn sie sich ins Wasser fallen lassen, um Fische zu fangen, können sie eine Geschwindigkeit bis zu 100 km/h entwickeln. Es muss die grösste Gannet-Kolonie der Erde sein, die hier auf verschiedenen Felsköpfen lebt und brütet; schätzungsweise 10‘000 Vögel insgesamt. Im Juni fliegen sie nach Australien, bleiben dort für gewisse Zeit, und wenn sie zurückkommen, gehen sie nie wieder dorthin zurück. – Diesen Umstand hat Murry selbstverständlich mit grosser Freude erläutert („No wonder they don’t go back. There are nothing but poisonous beasts, bushfires and Tony Abbott“).
Auf dem Rückweg vom Cape fragt Murry, ob jemand Lust hat, neben ihm auf dem Fahrersitz mitzureiten. Niemand will – ich schon. Lustig ist’s. Es spritzt gewaltig, ist ja aber nur Wasser. Stossdämpfer haben nur die Anhänger, der Traktor selber nicht, aber was soll’s, er sagt immer „hang on“, wenn’s allzu holprig wird. Die Schalterei auf diesem Gefährt ist auch erwähnenswert. Da muss man ja Schwielen haben an den Händen nach so einer Fahrt. Es hat drei unterschiedliche Schalthebel, und die in den Gang zu werfen, bedarf eines ganz besonderen Geschicks. Alles geht gut bis am Schluss, die letzte Steigung schafft der Traktor nicht mehr mit den circa dreissig Leuten am Board, seine Räder versinken immer tiefer im Kies. Macht aber nichts. Wir sind schon angekommen, alle steigen aus, der Traktor kann jetzt ohne Ballast auch die letzte Herausforderung nehmen. Es ist Nachmittag um drei.
Was hatten wir für ein Glück: Super Wetter bis genau jetzt, nun fängt’s an zu regnen.
Nachtessen zu Hause, Spargeln, Risotto und Steaks. Auch ein paar Gläschen „Squeaking Gate“ natürlich.
Der nächste Tag ist wieder mal unseren elektronischen Geräten gewidmet, denn Theo hat durchblicken lassen, dass er Ruhe braucht, das heisst, er will nirgendwo hin. Ok. Das Wetter ist nicht allzu schön, mir soll’s recht sein. Emails schreiben, Fotos ordnen, Blog fabrizieren – ja und da passiert das Unvermeidliche erneut: Totaler Absturz. Theo sitzt den ganzen Nachmittag am Computer – ein paar Stunden sind dahin ohne Resultat. Mir sind die Kommentare ausgegangen. Ich leg mich auf die Hollywoodschaukel und lese.
Wir sind zwar in Hastings, aber wir waren noch gar nicht wirklich im Stadtzentrum. Also schlage ich vor, gegen sechs Uhr die Stadt, die immerhin etwas mehr als 70‘000 Einwohner hat, zu besichtigen und dort zu essen. Theo ist einverstanden, lässt seinen Mac Mac sein und kommt mit.
Wir sollen durch die Strasse „Wildschwein Ade“ fahren, so verstehe ich Rösi. Wir haben uns eigentlich schon gut an sie gewöhnt, lassen sie ihr seltsames Zeug plappern, ignorieren ihre Fabulierereien oder Buchstabierereien meistens, aber diesmal nimmt mich schon wunder, was genau sie meint. Auf dem Strassenschild steht: Wilson Ave (Wilson Avenue).
Im Zentrum können wir kaum glauben, was wir sehen beziehungsweise nicht sehen. Kein Mensch ist zu sehen, nur hier und da biegt ein Auto um einen Kreisel. Ist da eine Seuche ausgebrochen? Szenen aus Horrorfilmen kommen mir in den Sinn. - Alle Geschäfte sind geschlossen (es ist erst Dienstag, Viertel nach sechs), ein seltsamer Ort - wie eine Geisterstadt. Da wohnt nämlich gar niemand in diesen Häusern. Sie sind alle nur einstöckig und beherbergen jeweils ein Geschäft. Da die aber bereits geschlossen sind (seit fünf Uhr), ist der Ort fast menschenleer. An der einen Strassenkreuzung steht ein Hotel. Verwahrlost, geschlossen, am Zerfallen.
Mir fallen die vielen Blumenarrangements auf, die in gleichmässigen Abständen in jeder Strasse hängen. Es müssen Hunderte sein. Auch Blumenkisten hat’s überall. Da kommt mir in den Sinn, dass Claire und ihr Mann Cam, bei denen wir eingeladen waren, uns erzählt haben, dass sie den Auftrag für die Bepflanzung von der Stadt erhalten hatten, und das mit einem vierjährigen Vertrag. - Nicht schlecht. – Lustiges Detail: Es war genau ausgerechnet, wie viele Pflanzen (Fleissige Lieschen) in die Ampeln gepflanzt werden mussten, nämlich 35 Stück. Das Ganze ging dann aber nicht auf; es hatte nicht genug. Bis Cam dahinter kam, dass der Lehrling je 47 Stück eingepflanzt hatte. Sie liessen es so bleiben, die Ampeln könnten nicht schöner sein. Sie sind übrigens alle mit einem Selbstbewässerungssystem versehen. Mal sehen, ob der Lehrling noch immer dort arbeitet.
Irgendwo steht auf dem Trottoir ein Schild mit der Aufschrift: „The sun is shining! The drinks are cold and the garden bar is open”. Nicht zu fassen! Da ist noch jemand umä Wäg - da gehen wir rein. Kleiner könnte der Garten nicht sein, drei Tische hat’s. Die angekündigte Sonne auch, alles ein bisschen handgestrickt-grün, aber eigentlich ganz originell und gemütlich. Wir nehmen einen Apéro und wollen dann ein Restaurant suchen. Könnte schwierig werden. – Auf der gegenüberliegenden Strassenseite gibt’s zumindest ein Kino, und das in einem dekorativen Art Déco-Gebäude. Was spielen die? – “Hobbit –The Desolation of Smaug“, der zweite Teil der Trilogie. Fängt in vierzig Minuten an. – Machen wir, gehen wir uns anschauen. Ich hab ja erst gerade das Buch gelesen und Hobbiton haben wir auch besucht – gute Idee also, ganz spontan. Restaurant ade, aber da hat’s ein anatolisches Fastfood-Kebab-Café vis-à-vis des Kinos, das kommt uns grad recht. Das Lokal, wenn man es denn so nennen will, ist ohne Lizenz, das heisst, ich darf nicht einmal meine Flasche aus der Handtasche aktivieren, also ein recht nüchterner Abend wird das werden.
Wir sind nur etwa zu zehnt im Kino. Der Film dauert drei Stunden, für meinen Geschmack etwa eine zu lang. Dasselbe dachte ich vom ersten Film. – Das Buch jedenfalls gefällt mir besser. Trotzdem war’s ein gelungener Abend, ziemlich ungeplant – weder die Stadt, noch das Restaurant hätten wir uns so vorgestellt, als wir losfuhren, aber gerade das war das Gute dran.
Auf der Heimfahrt spielt uns Rösi einen Streich. Sie besteht auf der Routeneinstellung „Fussgänger“, da ist nichts zu ändern. Wir finden trotzdem heim.
An unserem letzten Tag schlafen wir aus und besuchen dann nochmals Cam in der Plantation Nursery, dem Gartenhaus. Er gibt uns eine Führung und zeigt uns die Maschinen, die ihm helfen, Arbeitskräfte einzusparen. Wofür jemand früher einen Tag lang brauchte, schafft die Maschine in einer Stunde. Beeindruckend! Er hat immer noch vier Ganztagsangestellte und ein paar Hilfskräfte, die vor allem im Frühling mithelfen. Der Lehrling, den ich oben erwähnte, ist gar keiner. Es waren zwei japanische Backpacker, halt auch der Sprache nicht eben mächtig, die nur vorübergehen Arbeit gesucht und die Blumen falsch eingepflanzt hatten. Offenbar keine Gartenspezialisten. Übrigens: Die Blumenkörbe, die wir am Abend zuvor in Hastings gesehen hatten, sind 1300 an der Zahl. Pro Jahr verkaufen sie vier Millionen Pflanzen, sagt Cam, das sei ein mittelgrosser Betrieb.
Am Nachmittag haben wir eine Wein-Tour gebucht. Wir werden um zwölf Uhr abgeholt und besuchen zusammen mit anderen Gästen (sechs Frauen, Theo ist der einzige Mann) vier verschiedenen Weingüter, „Mission“ (die älteste Winery in Neuseeland; sie wurde 1851 von Mönchen gegründet), „Moana Winery“, eine sogenannte Boutique Winery¸ ein sehr kleines, aber exklusives Weingut. Ihr Produkt ist ein Wein ohne jegliche Zusätze, also mehr als nur „Bio“, und ihre speziellsten Weine (etwas mehr als 4‘000 Flaschen lediglich) verkaufen sie nur gerade dort und an exklusive Restaurants.
Die dritte Winery ist „Wgatarawa Stables“, ein sehr schönes, gepflegtes Haus, war früher ein Pferdestall. Im Garten hat Hamish, unser Tourguide und Fahrer, für uns eine schöne Käse-Platte parat gemacht.
Die vierte Visite findet im „Black Barn“ statt, sehr exklusiv und wunderbar gelegen. Restaurant, Gartenrestaurant und Openair-Kino gehören auch dazu. Die Rebstöcke sehen so geputzt und gepflegt aus, wie wenn sie gar nicht echt wären. Riesige Felder von Reben umranden das Anwesen.
Es ist halb sechs, wie wir zu Hause ankommen und es beginnt grad zu regnen. Die Temperatur ist mittlerweilen auf 17 Grad gesunken (das ist ja wie daheim). Von unserem nüchternen Fahrer vor der Haustüre abgeladen, finde auch ich zur Abwechslung, eine Siesta wär gar nicht schlecht, aber wir haben ja noch so viel zu tun: Ich muss die Bohnen rüsten für den Salat, den ich zum Nachtessen machen will, es müssen noch Emails geschrieben werden, vielleicht kommt auch unser Blog einen Schritt weiter und schliesslich müssen wir schon wieder packen.
Wir haben „quite a few“ Weine probiert heute Nachmittag. Meistens Weissweine, von denen mir die meisten sehr gut schmeckten. Aber am liebsten ist mir der Syrah, die kräftigen Rotweine liebe ich halt besonders.
Von Hastings über Lake Tapo – Turangi nach Kuratau
Nachdem wir alles gepackt und das Haus in Ordnung gebracht haben, fahren wir nach Napier, der Stadt, die für ihre Art Déco Bauten bekannt ist. Mir gefällt es dort sehr; dieser Baustil ist einer meiner liebsten. Das Wetter ist schön, die farbigen Häuser mit ihren dekorativen Ornamenten kommen wunderbar zur Geltung. Mit Hastings zusammen bilden die beiden Städte eine Art Gemeinschaft (twin cities) und offenbar ist da aber auch eine Art Rivalität im Gang. Napier ist eindeutig trendiger; ich kann mir schlecht vorstellen, dass hier so wenig läuft wie in Hastings, das dagegen den Eindruck einer Schlaftablette macht. Es hat elegante, teure Läden und Restaurants, die zum Bleiben einladen. Nach zwei Stunden Herumschlendern und Kaffee und Kuchen Geniessen in der Fussgängerzone, fahren wir weiter Richtung Lake Taupo. Die Fahrt dauert knapp zwei Stunden und führt durch die Berge, die wir vom Te Mata-Aussichtspunkt aus im Westen gesehen haben. Es ist eine wilde und einsame Gegend, während 130 km gibt es keine Tankstelle. Nichts als Hügel, rauf und runter, keine Häuser, nur Busch mit seinen verschiedenen Bäumen und Sträuchern in jeder Grünschattierung, es hat aber auch Wälder, die neu aufgeforstet worden sind – alle Bäume im genau gleichen Abstand, ganze Bezirke mit schnellwachsenden, aber leider nicht indigenen Pinien verschiedener Grössen und Alters – und weite Gebiete, wo all die Bäume abgeholzt worden sind. Das Restholz wird einfach liegen gelassen. Dort sieht‘s zum Teil recht trostlos aus.
Wir nähern uns dem See. Jetzt sieht man den Ruapehu (man könnte meinen, es sei der Fujiama) und daneben den Ngauruhoe. Für Peter Jacksons Filmtrilogie „Der Herr der Ringe“ wurde der Ngauruhoe als Vorlage für den Schicksalsberg genutzt, was ihm zu weltweiter Bekanntheit verhalf. Das ganze Gebiet ist vulkanisch, Lake Taupo selber ist ein Vulkantrichter, irgendwann wird’s hier wieder einen Supergau geben, das ist jedem Wissenschaftler klar, die Frage ist nur, wann. – Kann ja jetzt noch grad ein wenig warten, wenn wir da sind.
Im Städtchen decken wir uns in der Information mit Broschüren ein über die Gegend und dann gibt’s ein Apéro, Piña Colada und Mojito. Wir beziehen unser Motel, das Huka Falls Resort. Es ist uns sehr wohl hier, wir haben einen eigenen Bungalow, eine ganze Wohnung mit Küche und Wohnzimmer für uns, das Restaurant (Café Pinot), das dazu gehört, ist erstklassig, wir geniessen einen schönen Aufenthalt.
Am Morgen besichtigen wir die Huka Falls, die nur grad wenige Kilometer weit weg gelegen sind. Die riesigen schäumenden Wassermassen, die der Waikato River führt, sind imposant, obwohl sie nur etwa zehn Meter hoch in die Tiefe stürzen. Es hiesst, pro Sekunde seien es 200‘000 Liter Wasser, in einer Minute wäre ein Olympiabecken gefüllt. Theo bezweifelt diese Angaben natürlich sofort und beginnt zu rechnen. Mir ist das gleich. Ich bin beeindruckt.
Ein paar Kilometer weiter gelangt man zu den „Craters of the Moon“, wo man einen interessanten Spaziergang machen kann, der etwa ein Stunde lang dauert. Eine Mondlandschaft stellen wir uns zwar anders vor (wo kommen all die Bäume und Sträucher her?), aber die Gegend hat’s schon in sich. Überall raucht‘s aus diversen Löchern in der Erde hervor, es brodelt und stinkt. Wir fahren anschliessend zurück in die Stadt, wo am Samstagmorgen am Flussufer ein Markt stattfindet. Eine gute Stimmung herrscht, es gibt lustige Dinge zu sehen. Was da nicht alles ausgestellt wird: Viel Selbstgebasteltes wird dargeboten, Gehäckeltes, Getöpfertes, Gedrechseltes. Theo lässt sich die Schuhe putzen, die’s tatsächlich mehr als nur nötig haben und kauft auch noch die Crème, die aus Bienenwachs hergestellt ist. – Etwas mehr für unsere übervollen Koffer…
Anschliessend fahren wir weiter dem linken Seeufer entlang in Richtung unseres nächsten Homelink-Swaps. Irgendwo am Ufer halten wir an, legen uns in die Sonne und lesen ein bisschen. Es ist nicht mehr weit. In Turangi, dem grössten Ort in der Gegend (etwas mehr als 3‘000 Einwohner) suchen wir einen Supermarkt, denn wir wollen Verpflegungsnachschub für die nächsten Tage kaufen. Ich fürchte nämlich, dort, wo wir hinwollen, hat’s wohl nicht grad einen Laden in der Nähe. So was von ausgestorben, dieser Ort. Da ist ja Hastings ein wahrer Rummelplatz dagegen. Alle Geschäfte sind zu in der Hauptstrasse, keine Menschenseele ist unterwegs (es ist halb fünf nachmittags an einem Samstag!), aber da, der Supermarkt ist noch offen. Die Angestellten sind jedoch auch bereits am Aufräumen, leeren die Gemüse- und Früchtegestelle, nur knapp noch finden wir, was wir brauchen. Seltsamer Laden. Was Fleisch anbetrifft, so hat‘s nur Würste, Schinken oder gefrorenes Schaffleisch in der Tiefkühltruhe. Auch das Personal kommt mir merkwürdig vor, irgendwie alle ein wenig „neben den Schuhen“. Wir fahren weiter und finden die Te Puka Road, an welcher das Haus steht, wo wir die nächste Woche wohnen werden. Es liegt ganz alleine auf weiter Flur, auf einer Anhöhe über dem kleinen Dorf Kuratau. Ein einzigartiges Panorama zeigt sich uns. Ums Haus herum hat’s kilometerweite Wiesen und Schafe, die dort friedlich weiden; sie kommen bis zum Garten – weiter unten sieht man das Dorf, das direkt am See gelegen ist (wo’s weder einen Laden noch ein Restaurant hat, wie wir später erfahren – meine Vorahnung also bestätigt). Der Blick auf den tiefblauen Taupo See ist herrlich. Ringsum reihen sich Berge. Das Gebiet ist vulkanisch, an einem der Hänge auf dem Weg hierhin dampft‘s und raucht’s aus diversen Rissen und Spalten, fast wie in Rotorua.
Wir können fast nicht glauben, dass dies das Haus ist, wo wir wohnen werden. Es ist riesengross. Wir haben abgemacht, wir kommen um fünf Uhr und typisch schweizerisch – um Punkt fünf Uhr „stehen wir auf der Matte“. Vor dem Arbeitsschuppen ein wenig weiter weg steht ein Pickup und Tony (Theo hat ihn und seine Frau Kitrena bereits im Juli in Bivio kennengelernt) ist gerade dabei, auf der Ladefläche des Wagens mit einem Beil irgendwelche Knochen zu zerhacken für den Hund. Teile eines Schafs natürlich. Das fängt ja gut an…
Tony zeigt uns alles, gibt uns Instruktionen, bevor er in seine andere Farm, die Foxley Station, die eine Stunde von hier entfernt ist, fährt. Im Gemüsegarten sollen wir uns bedienen, die Him- und Brombeeren sollen wir lesen, sie gehen ja sonst kaputt, es hat mehrere Kühlschränke und Tiefkühltruhen, bis obenhin gefüllt mit Fleisch. Einfach nehmen, was wir brauchen. Er hat sogar ein Brot gebacken für uns. - Mit den Schafen haben wir zum Glück nichts zu tun. Auf diesem „kleinen“ Grundstück sind es ungefähr 2‘000 Stück, erklärt er uns, und ein paar Rinder. – Hm… Die Dimensionen hier sind eben anders. Seine andere Farm muss viel grösser sein, er hat dort 20‘000 Schafe und ich weiss nicht wie viele Rinder. Dort sind wir am 25sten eingeladen, mit der Familie Weihnachten zu feiern. – Awesome!
Tony geht, wir richten uns ein. Das Haus ist so gross, dass wir uns am Anfang drin verlaufen. Es ist grosszügig, modern und sehr geschmackvoll eingerichtet. Sogar ein geschmückter Tannenbau steht drin. Extra für uns, sie sind ja nicht da. – Unglaublich, die Gastfreundschaft und Fürsorge, die wir hier stets erleben. Wir sind einmal mehr gerührt.
Rings um den Wohnraum hat’s verschiedene Fensterfronten auf drei Seiten (ohne Vorhänge zum Glück - es hat ja schliesslich auch keine Nachbarn, nur Aussicht). Eine davon sollen wir nicht öffnen, weil die Tür verklemmt ist. – Der gewiegte Leser merkt sofort: da kommt noch was. Ich bin am Kochen (Penne) und mache vorher einen Salat, auch wenn Theo bei diesem Teil des Menus nicht besonders freudvoll dreinblickt. Er wandert ein wenig herum nach dieser Vorspeise und öffnet die hintere Tür zum Patio (er hat offenbar nicht gehört, was Tony gesagt hat und ich hab nicht gemerkt, dass er es nicht gehört hat). - Also öffnen lässt sich die Türe schon, aber schliessen… Sie steht jetzt weit offen und draussen hat’s begonnen, sturmartig zu winden. Unser erster Versuch, den Schaden wieder gut zu machen, misslingt kläglich an der Konstruktion, wie Theo sagt. Die Tür mit ihrer Schiebevorrichtung lässt sich keinen Zentimeter weit bewegen. - Nach dem Essen macht mein findiger Gatte (dem „Äscheniör ist nichts zu schwör“) einen Besuch in der Werkstatt. Mit Motorenöl, Feile und Hammer bewaffnet macht er sich an die Arbeit und mit vereinten Kräften (er von aussen, ich von innen) gelingt es uns endlich, die Tür wieder zu schliessen. - Uff, das war knapp. Die Klinke können wir zwar nach wie vor nicht bewegen, aber die Tür ist zu, und das ist die Hauptsache. Sie würden das Haus nie abschliessen, auch nicht, wenn sie weg sind, hat Tony gesagt. Also: no worries. Er kommt am nächsten Dienstag vorbei, um nach den Schafen zu sehen, dann können wir ja beichten.
KURATAU – Foxley Farm
Die Sonne geht über dem See auf. Man kriegt gar nicht genug von der fantastischen Aussicht. Es ist absolut friedlich, nur Vogelgezwitscher ist zu hören, manchmal blökt ein Schaf.
Etwas weiter unten in der Ebene sieht man Tonys Flugzeug stehen, eine einmotorige Cessna, er braucht sie hin und wieder, um von einer Farm zur anderen zu gelangen und sowieso liebt er die Fliegerei. Der Blick aus den Wolken muss umwerfend sein: Der See, die Vulkane, die grünen Weiden und Wälder…
Ich geh erst mal zu Fuss auf Erkundung den Hügel hinauf durch all die Schafweiden. Tony hat gesagt, der Blick von dort oben lohne sich. Das muss ich natürlich ausprobieren. Theo hat anderes zu tun. Wenn’s schon mal läuft mit der Weihnachtskarte, die er am Kreieren ist, dann will er dran bleiben. Sagt er. Ich denke, er nutzt meine Abwesenheit nebenbei auch gezielt für eine kleine Siesta. Das könnte schon sein.
Und ich, ich hätte lange Hosen anziehen sollen. Die vielen Disteln sind meinen Waden nicht wohlgesinnt. Es geht teilweise recht steil bergauf und dauert fast dreiviertel Stunden, bis ich ganz oben bin und auf die jetzt winzig klein erscheinende Farm hinunterblicken kann. Unterwegs begegne ich einem Kaninchen, das in grosser Panik das Weite sucht. Den Schafen geht’s ebenso. Sobald sie mich sehen – nichts wie fort und weg. - Die sollten sich ein Vorbild nehmen an den Tölpeln in Hastings, die sich durch gar nichts aus der Ruhe bringen lassen!
Zuoberst setzte ich mich auf einen Stein, der nicht gar so verschissen ist, und schaue auf die Gegend hinunter, die beiden Dörfer Kuratau und Omori, den See – ja, ich weiss, wieder die alte Leier. Aber es ist sooo schön! Und um das Bild vollständig zu machen: Dort, wo die Vulkane sind, speit doch gerade in dem Moment tatsächlich einer Asche in die Luft, ein dunkler Rauch steigt auf.
Abstieg den ausgetrampelten Pfaden entlang, durch die Absperrgatter für die Tiere, links von mir eine Herde von tiefschwarzen Rindern, von denen mich ausnahmslos alle konzentriert und argwöhnisch beobachten, rechts der Vulkan, dazwischen ich. – Zugegeben - es ist nur halb so dramatisch und abenteuerlich. Das Vieh ist relativ weit weg, der Vulkan noch viel weiter - der Apéritif ist sehr viel näher.
Theo möchte noch immer daheim bleiben, kein Wunder, das nächste Restaurant ist mindestens eine Viertelstunde Fahrt weit weg. Es gibt Spaghetti mit einer Peterlisauce, das Rezept von Pia Steiner, weil ich keine Tomaten mehr habe (die im Garten sind noch nicht reif), auch kein Fleisch, und die Schafe in der Tiefkühltruhe möchte ich lieber drin lassen. Theo sieht nicht gerade begeistert aus. „Könnte man da eventuell noch ein Ei in die Sauce rühren?“, ist seine Frage, die ich natürlich beleidigt abschmettere. Mich dünken die Spaghetti ober-lecker und ich werde sie wieder machen. Es hat ganze Petersilien-Beete im Garten, offenbar lieben diese Kräuter die vulkanische Erde. Und ich liebe die Kräuter. Noch viel weniger enthusiastisch wirkt Theo, wie er erkennen muss, dass es uns an Salat nicht mangelt.
Wir beobachten beim Essen, wie der Tag langsam zu Ende geht, und da wird Theo poetisch. „Jetzt nimmt die Nacht den See in Besitz.“ Wahrscheinlich hat ihm die grosse Portion Petersilie tatsächlich nicht so gut getan.
Der See ist ganz silbrig heute Morgen. Graue Streifen hat’s auch drin. Das sieht zwar schön aus – Sonnenaufgang genau über dem See – aber die vielen Wolken verheissen keinen schönen Tag. Ausruhen, gemütlich lesen und schreiben, am Abend 15 Minuten zum nächsten Restaurant fahren und eine halbe Stunde zurück, weil wir uns verfahren haben. Ich war dagegen, Rösi einzuschalten, sie hat sich gerächt.
Waitomo
So darf sie am nächsten Tag wieder kommentieren und uns ihre Schleichwege aufschwatzen. Wir fahren zu den Waitomo-Höhlen, nördlich von hier; die Fahrt dauert gut zwei Stunden. Da findet sie wieder eine Abkürzung (kann ja sein, dass ihre Variante zwei, drei Meter kürzer ist als die Strecke gewesen wäre, wenn wir auf der Hauptstrasse geblieben wären), Kurve um Kurve, rauf und runter, überhaupt kein Verkehr, aber schliesslich kommen wir in Waitomo an. Es ist der 24ste Dezember.
Manchmal ist es recht schwierig zu entscheiden, welche Tour man mitmachen will, welche diejenige ist, die einem am besten passt. Es gibt vier verschiedene Anbieter. Die einen organisieren abenteuerlichere, die anderen weniger abenteuerliche Höhlenbesichtigungen, teuerlich sind sie aber alle. Praktisch ist stets der Tripadvisor, da kann man bei den Bewertungen ein wenig sehen, was die Leute gut finden beziehungsweise bemängeln. Also, wir entscheiden uns für „Spellbound“, die dreieinhalbstündige Besichtigung zweier Höhlen (über hundert soll’s geben in der Gegend, nur wenige begehbar). Das Gute dran ist, die Gruppen bestehen aus höchstens zwölf Personen, wo hingegen die anderen Anbieter fünfzig Personen durch die drei bekanntesten Höhlen schleusen.
Die erste Begehung ist mehr als nur eindrücklich. Es ist die Höhle, in der Sir David Attenborough einen Teil seiner neunteiligen „Life-Series“ aufgenommen hat und ebenso entstand die BBC-Dokumentation „Planet Earth“ dort drin. Das Interessante sind die Glowworms (nicht zu verwechseln mit unseren Glühwürmchen), die an den Höhlenwänden und vor allem an der Decke dicht aneinanderkleben. In einem Gummiboot gleitet man ganz langsam und gemächlich auf einem unterirdischen Fluss durch die völlige Dunkelheit. Was man hört: das Rauschen des Wassers und eines Wasserfalls in der Ferne. - Was man sieht: etwa zwei Meter über unseren Köpfen Tausende von kleinen Lichtern wie ein extremer Sternenhimmel und das in 3D. Es ist überwältigend, märchenhaft, wie nicht von dieser Welt. Anderseits, wenn man’s genau betrachtet, ist das Ganze eigentlich eher eklig. Es sind keine Würmer, sondern weibliche Pilzmücken-Larven, ca. 2-2,5 cm lang, die an ihren Hinterteilen leuchten, wenn sie hungrig sind (das bläuliche Licht wird aus Luziferin mit Hilfe des Enzyms Luziferase erzeugt), um Mücken anzuziehen oder um zu signalisieren, dass sie sich paaren wollen. Wenn sie gestört werden, so schalten sie ab, erfahren wir. Sie lassen dünne, fast unsichtbare, klebrige Fäden herunterhängen, in denen sich die Beute dann verfängt. Wenn sie nichts zu essen haben – kurzer Prozess - fressen sie sich gegenseitig. Etwa neun Monate lang sind sie, ohne sich von der Stelle zu rühren, mit dieser Tätigkeit beschäftigt, bis sie sich anschliessend während zwei Wochen verpuppen. Dann schlüpfen sie und als „erwachsene“ Fliegen leben sie noch zwei bis drei Tage weiter, ohne Mund, mit dem einzigen Zweck, Eier zu legen, die Art zu erhalten und Touristen zu erfreuen. – Aber leuchten tun sie schön.
Auch die andere Höhle war eindrücklich - wie Höhlen eben so sind. Irgendwo liegt das Skelett eines Moa (oder zumindest Teile davon). Das war ein Riesenvogel (grösser als der Vogelstrauss; sie wurden bis zu drei Meter hoch), der vor 600 Jahren ausgestorben ist.
Norm, unser Führer, hat uns auf sehr unterhaltsame Art viel Wissenswertes, Fakten, Geschichten und Anekdoten erzählt. Begonnen hat’s mit der Beschreibung des Ortes Waitomo. Im Ort hat‘s drei Ticketoffices, einen Laden, ein Hotel, ein Motel, ein Rugbyfeld und 41 Einwohner. Auf die Frage, ob die alle verwandt seien, sagt er nur, er selber wohne nicht dort.
Die Gegend ist sehr interessant. Es gibt nichts als Hügel, nirgends eine flache Stelle (ausser dem Rugbyfeld). Die Hügel sind teilweise wie Zuckerstöcke und Pyramiden ineinandergeschoben, alle grün bedeckt mit Schaffutter, ausnahmslos alle gerillt in völlig parallel scheinenden horizontalen Linien, Trampelpfade von Tausenden von Schafen, die seit über hundertfünfzig Jahren die Weiden abgrasen. Die Gesteinsformationen sollen ungefähr 25 Millionen Jahre alt sein. Mal ein Meer, so hat es auch Fossilien in den Kalksteinablagerungen, und sehr gut sind die verschiedenen Lagen und Schichtungen in den Felsen zu sehen. Zwischendurch hat’s tiefe Löcher, die zum Teil in Höhlen enden, nicht unbedingt sehr praktisch für die Schafe.
Gute zwei Stunden Heimfahrt, unterwegs kurzer Einkauf im New World Supermarkt von Te Kuiti, der heute, am Heiligen Abend, bis um neun Uhr geöffnet hat. Wir sind aber froh, weil wir schon fürchten, nirgendwo ein Restaurant zu finden, das sich unser an diesem speziellen Abend erbarmen würde. Um halb neun sind wir zu Hause, es ist noch so hell, so dass ich ohne weiteres im Gemüsegarten Salat holen kann und eine Schüssel Him- und Brombeeren zum Dessert. Den ganzen Tag lang haben wir nebst zahllosen Glühwürmern und massenhaft Schafen auch etliche Rinder gesehen. Letztere (oder zumindest Teile davon) nun am Abend zu Hause auch noch auf unseren Tellern. Filet gibt’s und Kartoffeln, die zu verbrennen mir leider ganz gut gelingt in Unkenntnis der Pfanne und des Herds.
Theo räumt die Küche auf nach dem Essen. Das ist unser Deal: Ich koche, er übernimmt das Nachspiel. Also habe ich jetzt Musse, nach draussen zu schauen über die Ebene und zu sehen, wie’s langsam dunkel wird. Je dunkler es draussen wird umso besser sehe ich Theo, der sich beim Hantieren in der Küche hinter mir in der Scheibe spiegelt. Wie ein Geist, über dem Lake Taupo schwebend, sieht er aus.
25. Dezember – Weihnachtstag
Weihnachten feiern am Strand, bei Temperaturen um die 30 Grad, Sonne, Liegestuhl und Dolce far niente – so oder so ähnlich haben wir uns das ursprünglich vorgestellt. - Dem ist nicht so!
Der Sommer hier erinnert mich an einen Sommer in der Schweiz: Wenn die Sonne scheint, kann‘s sehr heiss sein, wenn nicht, eher kühl und unfreundlich. So ist’s heute leider.
Um elf sind wir bei unseren Gastgebern auf ihrer Farm zur Weihnachtsfeier eingeladen. Wir müssen eine gute Stunde fahren, bis wir Foxley Farm an der Ohura Road erreichen. Lieder müssen wir wieder genau die Strasse entlang fahren wie gestern und das zudem bei schlechtem Wetter. Es regnet immer wieder mal und in höheren Lagen hat’s sogar Nebel. Nichts gewesen mit Aussicht.
Wir werden herzlich empfangen von Kitrena, Tony und Edna, einer Freundin der Familie. Sohn Andrew mit Gattin Prue und Freddie, dem zweijährigen Sohn, sind auch schon dort sowie Tochter Sarah mit ihrem Ehemann Alan und den beiden Söhnen, Frazer (knapp zwei) und Thomas, fünf Monate alt. Da läuft also was. Der Gschänklisegen ist nicht anders als bei uns, er hört nicht auf und die Kleinen sind für Monate eingedeckt mit neuen Spielsachen, Trucks und Bilderbüchern.
Vor dem Festmahl nimmt uns Tony in seinem Pickup mit und zeigt uns das ehemalige Wohnhaus auf der Farm, das jetzt an seinen Manager vermietet ist, wo die Familie aber jahrelang gewohnt hat. Sogar ein Swimmingpool hat’s und einen Tennisplatz. Der hat aber schon sehr, sehr, sehr viel bessere Tage gesehen. Er dient jetzt als Spielplatz für die Kinder. Kitrena und Tony selber haben noch ein „Cottage“, wie sie es nennen, wo sie sich aufhalten, wenn sie die Farm besuchen. Mindestens einmal pro zwei Wochen ist das für wenige Tage der Fall sowie auch jetzt, wo wir ja in ihrem Haus wohnen. Wir sehen anschliessend die Scherstation, wo sechs Scherer jeweils gleichzeitig die Schafe scheren. Dazu kommen vier Frauen, welche die geschorene Wolle untersuchen, bewerten und trennen und zwei weitere Männer, die sie an zwei Maschinen weiterverarbeiten. Jedes Tier kommt zweimal im Jahr dran (ca. 20 Tausend Tiere insgesamt). Das geschieht in verschiedenen Abständen von Mai bis August, ausgenommen im Winter. Tony erklärt uns alles; für mich ist es interessant, da in den Romanen, die ich über Neuseeland gelesen habe, sehr oft die Rede ist vom Schafscheren, den Männern, die dafür angeworben wurden und dem Leben in diesen Gegenden zur Zeit der Pioniere. Geändert hat sich seit dem 19. Jahrhundert nicht sehr viel, natürlich, die Scherwerkzeuge sind jetzt elektrisch, es hat ein paar Maschinen, aber immer noch werden die Scherer angeworben, sie erhalten einen äusserst niedrigen Lohn, arbeiten im Akkord und müssen recht „strubi Giele“ sein, die sich nach der Arbeit mit Bier volllaufen lassen und was da so alles dazu gehört. Es hat Behausungen zum Übernachten für sie (da seien jeweils wüste Partys gefeiert worden), aber das hat sich auch geändert. Heute würden die Scherer zur Farm gefahren und abends wieder abgeholt.
Der Farmbesitzer hat nichts mit alledem zu tun, er überlässt und zahlt alles einem Contractor, einem Mittelsmann, der das Ganze organisiert und regelt. Der sei zwar sehr teuer, es lohne sich aber einen zu beauftragen, um Stress und Ärger zu vermeiden. Pro Schaf, das geschoren wird, muss ihm Tony ca. 2 Franken zahlen, der Scherer erhält grad mal die Hälfte davon. Die Schafe wiegen 50 – 60 kg und ein guter Scherer schaffe pro Tag 300 Stück. – Unglaublich. - Wie das geht, haben wir ja in Brisbane gesehen, im Koala Lone Sancturay: der ultimative Riesenstress für Tier und Scherer.
In der Lokalzeitung, unter der Rubrik „Farming“, lese ich ein paar Tage später, dass es grad einen Rekord gegeben hat von fünf Scherern, die in 9 Stunden 2‘638 Lämmer geschoren haben. Der Rekord einer Schererin (Emily Welch) im November 2007 waren 648 Lämmer in neun Stunden. Auch das wird im Artikel erwähnt. Bemerkenswert in mancher Hinsicht, muss ich sagen! – Ausrechnen kann, wer will...
Zurück zum Besuch auf der Foxley-Farm: Wir sehen und lernen auch über die unterschiedliche Qualität der Wolle: Die schönste ist ganz weiss und viel dichter, und nur auf der Südinsel hat’s Schafe (Merinoschafe), die solche Wolle liefern. Die Schurwolle hier wird für Teppiche gebraucht. Ballen von 200 kg stehen bereit zur Auslieferung.
Das Essen, das uns anschliessend serviert wird, ist phänomenal. Da stecken mehr als zwei Tage Vorbereitung dahinter. Meine Sorge war, dass es nur Lammfleisch gibt, das ich ja nicht besonders mag, aber es gibt auch eine riesige, fein zubereitete, mit Honig glasierte Hamme - einfach köstlich. Dazu verschiedene Salate und Saucen und natürlich auch ein Stück Gigot, zubereitet zur Perfektion während vier Tagen. Ich halte mich nicht dafür, nicht zu probieren und muss sagen, es war ausgezeichnet, butterweich. Kaitrena sagt, es sei eben ein besonders junges Lamm, eines, das man in dieser Art nicht im Laden kaufen könne…
Zum Dessert gibt’s homemade Icecream, Christmaspudding, Christmas-Mintpie, Brandy-, Rahm- und Joghurtsauce dazu, Erdbeeren, selber gemachte Meringuen – sagenhaft, wie wir verwöhnt werden – das reinste Schlaraffenland.
Zum Trinken gibt’s „Bubbles“, so nennen sie doch tatsächlich die Flasche Moët & Chandon, so dass, als verschiedene Getränke zur Auswahl stehen, ich denke, sie meinen Mineralwasser mit Kohlensäure.
Zum Essen wird Saint-Emilion serviert, es muss am heutigen Tag ja etwas Spezielles sein – es geht uns sehr gut!
Letzte Tage in Kuratau
Zu Hause sind wir recht müde von der Fahrt und dem Erlebten, es ist aber Weihnachtsmorgen in der Schweiz und ich will meine Mails noch anschauen. Dort bleib ich hängen und geh dann doch auch wieder erst gegen Mitternacht ins Bett. Essen mag ich nichts mehr, Theo schon, er macht sich eine seiner (meiner Meinung nach) grässlichen Büchsensuppen, die er so gerne mag, und sein Kommentar beim Aus-dem-Fenster-Gucken ist diesmal: „Dunkelheit und See gehen ineinander über“.
Am Stephanstag sieht’s ein wenig besser aus. Denken und hoffen wir. Wir nehmen’s sehr gemütlich, beschliessen dann aber doch, nicht den ganzen Tag daheim zu verbringen, sondern ein Ausflügli (was unter einer Stunde ist, verdient die Verkleinerungsform) zu machen. Der Tongariro-Nationalpark ist ja quasi nebenan. Dort sind die drei Vulkane, von denen ich vorher schon berichtet habe. Auf halbem Weg zum Gipfel des Ruapehu gibt’s im Whakapapa-Village (ich liebe diese Namen!) einen Sessellift, der bis auf 2020 Meter Höhe führt. Vielleicht sieht man ja doch was… Nach dreiviertelstündiger Fahrt sind wir im Village. Dichter Nebel herrscht und es beginnt gleich zu regnen. Es ist wie in den Bergen bei uns: ein Restaurant, ein Sportshop, wo man die Dinge kaufen kann, die man zu Hause vergessen hat oder die man dringend braucht wie Ski-, Regen- und Windjacken, Brillen, Hand- und Wanderschuhe, etc. etc. Das mit der Sesselbahn vergessen wir augenblicklich, die Betreiber sind offenbar gleicher Meinung, sie schliessen sie gleich. Wir trinken einen Kaffee, auf den wir eine halbe Stunde lang warten müssen und der, weil’s doch ein Feiertag ist, heute ganz exklusiv 10% mehr kostet. Der Nebel lichtet sich ein wenig, der Regen lässt nach, wir haben grad Zeit, einen kleinen Spaziergang zu machen zu der steilen Felswand, der „Mead’s Wall“, wo eine der Szenen zum Film „Lord of the Rings“ gedreht wurde. Der Vergleich mit unseren Schweizer Bergen hinkt natürlich gewaltig. Impsant sind die schwarzen Felsen und Lavabrocken, die überall herumliegen. Vegetation scheint’s keine mehr zu geben. Eine steinige Gegend. Bei näherem Hinsehen merkt man allerdings, dass die Steine, welche in jeder Grösse vorhanden sind, die verschiedensten Farben haben und dass auch vielerorts ganz winzig-kleine Bergblümchen wachsen.
Es regnet wieder, ziemlich stark sogar; wir fahren zurück Richtung Turangi. Es ist schon merkwürdig und natürlich sehr schade zu wissen, dass wir auf unserer rechten Seite eine absolut spektakuläre Aussicht auf die Vulkane hätten, falls die Sonne scheinen würde. Beim See tut sie uns netterweise den Gefallen und schaut ganz kurz aus den Wolken, so dass es uns gelingt, einen Blick auf die andere Seite, nämlich auf den Lake Taupo, den Tangariro River und Turangi zu werfen.
Rascher Einkauf im Supermarkt – Snapper ist’s diesmal – dann fahren wir nach Hause. Schon als wir losfuhren heute Mittag, sahen wir, dass sich zwei Schafe auf dem 600 Meter langen Schotterweg, der zum Haus führt, ausserhalb des Zauns aufhielten. Was tun? – Nichts, entschieden wir. Uns kam keine gute Strategie in den Sinn. Wir sahen auch nirgends ein Loch, durch das sich die beiden hindurchgezwängt haben mussten. – Jetzt ist das anders. Wir haben einen Plan. Die beiden, Mutter und Kind, also Lamm, stehen immer noch ziemlich dumm auf dem Weg, auf der anderen Seite des Zauns blökt das Geschwister ganz laut und kläglich, so dass wir wenigstens wissen, wohin die beiden Abtrünnigen gehören. Vor dem Auto flüchten sie bergauf. Das ist mal gut, so gelangen sie nicht auf die Strasse. Aber die Mutter will auch nicht zu weit weg von ihrem andern, folgsamen Kind. So bleiben die zwei nicht weit vor unserem Auto stehen. Ich steige aus, gehe ganz langsam an ihnen vorbei, so dass sie zwischen mich und das Auto geraten. Es gelingt mir dann, die Gattertür weit zu öffnen. Die anderen Schafe rennen natürlich wie von der Tarantel gestochen von mir und dem Gatter weg, was gut ist, denn so laufen nicht noch andere aus dem Gehege. Theo steigt jetzt auch aus und wir gehen beide (super, nicht wahr!) auf die beiden Schafe zu, die jetzt ebenfalls die Flucht ergreifen und durch das offene Tor auf ihre Weide rennen. Wir sind ja beide so stolz, dass wir dieses Kunststück vollbracht haben. Das Allerschönste ist es dann, zu sehen wie das Lamm, das seine Mutter wohl schon verloren geglaubt hat, mit Freudesprüngen auf diese zuspringt und wie die beiden Lämmer sogleich anfangen, am Euter der erleichterten (so denk ich mir das) Mutter zu saugen. Immerhin waren sie einen ganzen Nachmittag lang getrennt. – Aktion Schaf erfolgreich abgeschlossen, das war unsere gute Tat für heute.
„Jetzt frisst der Nebel den See“, sagt mein poetischer Gatte soeben, bevor er sich seinen Whisky einfüllt und zur Siesta ins Schlafzimmer verschwindet.
So hab ich noch ein wenig Zeit, hole mir im Garten zwei grosse Portionen wunderbaren Salat und mach mich dann allmählich ans Zubereiten des Nachtessens. Ich brauch noch ein wenig mehr Petersilie für die Sauce, kommt mir grad in den Sinn.
Etwas Grosses unternehmen wir nicht an unserem letzten Tag. Kuratau ist eine sehr kleine Siedlung. Wir sind schon vor ein paar Tagen durch ein paar Strassen gefahren und haben gleich gesehen, dass es da eigentlich nur Ferienhäuser gibt. Inzwischen sind die meisten Häuser bewohnt, endlich sind Ferien, und beim Bootanlegeplatz herrscht sogar ein Gewimmel von Leuten. Aus allen Löchern strömen sie plötzlich. Jedes Auto hat einen Anhänger mit Motorboot und alle wollen jetzt aufs Wasser. Mir kam’s schon komisch vor, dass man keine Boote sieht auf dem See. In all den Tagen seit wir hier sind, hab ich nur ein einziges Segelboot gesehen und eine Handvoll Motorboote. Dabei – soo schlecht war das Wetter nun auch wieder nicht.
In einem Weingut in der Nähe findet ein Markt statt, da gehen wir mal hin. Es sind zum Teil die gleichen Marktleute wie in Taupo, offenbar reisen sie von Markt zu Markt wie bei uns ja auch. Einzig der Helikopterfluganbieter ist neu. Einen Flug über dieses schöne Gebiet mitzumachen, das hätten wir uns überlegt, das wär schön gewesen, wenn das Wetter besser wär, aber so… Es hat ja keinen Sinn, die Wolken zusätzlich von oben zu betrachten und dafür auch noch zu zahlen. Von unten genügt.
Ganz in unserer Nähe, etwa zwei Kilometer vom Haus entfernt in der Ebene, hat’s ein weiteres kleines Weingut (Boutique Winery Floating Rock), das wir bisher völlig übersehen haben. Dem ist ein kleines Café angeschlossen, wo’s auch Pizza gibt’s und natürlich Wein. Den müssen wir allerdings vor sieben Uhr abends bestellen, so will es die Lizenz und das Gesetz. - Lustig, diese Neuseeländer.
Machen wir aber so, ist ja kein Problem, wenn man’s weiss und nicht etwa erst um Viertel nach sieben antrabt. Sogar mit ein wenig Sonne werden wir verwöhnt, wir geniessen’s. So ein schöner Ort: klein, mitten in den wohl gepflegten Reben. Der Chef erzählt uns ein wenig etwas über seinen Wein und auch über die Pflege der Reben. Wenn das Gras zu hoch wird zwischen den einzelnen Stöcken, holt er seine Schafe, die fressen dann alles glatt und am Schluss kann man die wohlgenährten Schafe essen, meint er (win-win-situation). – Billige Angestellte, finde ich. Und auch ein wenig dumm.
Von Kuratau nach Wellington
Putzen, packen, weg. Wieder mal. Und einmal mehr tut es uns leid, diesen schönen, ruhigen Ort, an dem wir uns so wohl gefühlt haben, zu verlassen, wo wir nie eine Türe schliessen mussten, wenn wir weggingen, wo die Schafe so friedlich um uns herum grasten tagein, tagaus. Der nächste Ort wird sicher hektischer werden – mitten in der Hauptstadt Wellington. Aber eben, das ist ja auch das Schöne: Abwechslung macht das Leben süss.
Wir fahren auf der anderen Seite des Tongariro-Nationalparks gegen Süden und obwohl es auch heute wieder bedeckt ist, sehen wir, mindestens teilweise, die beeindruckenden Vulkane, Ruapehu und Ngauruhoe.
In Ohakune machen wir Halt, es ist ein richtiger Höhenkurort, ähnlich wie bei uns, mit lauter Sportgeschäften und Cafés. Den absolut bittersten Kaffee gibt’s im Utopia Café. Die reinste Utopie. Tschuder!
Von dort aus gibt es zwei Wege nach Wanganui, zu unserem heutigen Ziel, wo ich heute Morgen ein Motelzimmer gebucht habe. Der eine dauert gut zwei Stunden, der andere fast nur halb so lang. Wir haben ja Zeit, also wählen wir trotzdem den ersten, der ist offenbar viel schöner. Es ist der Whanganui-River-Scenic-Drive. Auch das Wetter hat sich inzwischen eines Besseren besonnen. Jerusalem, London, Athen, Korinth – durch alle diese Orte fahren wir hindurch, Missionare haben sich dort in der Mitte des 19. Jahrhunderts niedergelassen - abgelegener geht fast nicht mehr, die Strasse ist dementsprechend. Sie ist kurvenreich und eng, schlängelt sich oberhalb des Flusses in der Höhe den Felsen entlang; man hat oft das Gefühl, den nächsten Steinschlag gibt’s gleich um die Ecke beziehungsweise nach der nächsten unübersichtlichen Kurve. Während etwa 20 km ist sie nicht einmal mehr asphaltiert, so dass ich wieder mal Angst habe um unsere Pneus. Wie durch ein Bachbett mit groben Steinen muss sich unser armer Nissan quälen, aber er schafft es. Allerdings nicht mit 70 km/h, so ist nämlich auf den Strassenschildern die Höchstgeschwindigkeit angegeben. Pikantes Detail, finden wir. Normal darf man ja überall 100 fahren, ausser innerorts oder bei Baustellen. Hier finden sie offenbar, 70 lange auch - wie wenn jemand auf diesem Pfad auch nur auf die Idee kommen könnte, mehr als 30 zu fahren…
Endlich ist die Strasse wieder gepflastert. In Matahiwi besuchen wir eine historische Mühle, ursprünglich gebaut im Jahr 1850, hundertdreissig Jahre später restauriert. Etwas später machen wir einen zweiten Halt in einer Maori-Siedlung. Es gibt dort ein Café. „Offen“, steht auf dem Schild geschrieben, aber die beiden Maori-Damen, die im Garten unter einem Sonnenschirm sitzen, erklären uns, es sei doch zu. Aber wir könnten doch etwas zu trinken haben, Tee, Kaffee oder etwas Kaltes. Nehmen wir gerne an. Offen - geschlossen – doch offen? – Die beiden haben Truthahnfedern vor sich, Wäscheklammern und Schachteln mit sonstigen Bastel-Zutaten. Auf meine Frage, was sie machen, erklärt mir die eine, sie wisse es eigentlich selber nicht so genau, es sei eben ein wenig „arti-crafty“.
Ein paar Kilometer weiter muss es Fossilien haben im Fels, denn vor Urzeiten war das ganze Gebiet hier ein Meer. Diese Versteinerungen möchte ich gerne sehen. Oft ist die Beschriftung am Wegrand nicht ganz so toll, so dass es uns schon mehr als einmal passiert ist, dass wir an etwas, das wir uns eigentlich hätten ansehen wollen, vorbeigefahren sind. So frage ich, wo genau diese Cliff Fossiles denn seien. Die Antwort ist: „You cannot not see it.“ Also bin ich beruhigt und es stimmt. Wir fahren ein paar Kilometer weiter und die Fossilien sind tatsächlich nicht zu übersehen. Faszinierend: Hier muss ein ganzes Riff gewesen sein, es hat hunderte von Muscheln, die im weissen Fels drin stecken, an dem die Strasse vorbeiführt. Alle natürlich versteinert.
Wir kommen gegen sechs in Wanganui an, finden (dank Rösi) gleich unser Motel und sind ganz zufrieden mit dem kleinen Studio. Immer hat’s einen Kühlschrank, Tee und Kaffee kann man machen, eine kleine Küche ist dabei – was will man mehr? Eigentlich eher weniger würden wir brauchen, aber was soll’s, das ist eben Standard.
Gegen acht gehen wir in die Stadt. Man könnte gut zu Fuss gehen, aber Theo möchte lieber das Auto nehmen, denn er könnte ja nass werden; es regnet nämlich wieder. – Eine Stadt von etwas mehr als 40‘000 Einwohnern – Samstagabend - kein Mensch auf der Strasse. Kaum zu glauben. Und daran ist sicher nicht nur der Regen schuld. Wie in Hastings. Wir finden ein Thai-Restaurant und essen ganz fein. Der Wein aus meiner Handtasche heisst „Odd Socks“. Ungleiche Socken – das passt ganz gut zu Theos ewiger Suche nach Socken, von denen er behauptet, die Waschmaschine fresse sie. Beim ersten Blick auf die Etikette hatte ich allerdings gelesen „Old Socks“ und hatte die Flasche gleich wieder ins Regal zurückstellen wollen. Lesebrille sei Dank, tat ich das dann doch nicht.
Am Morgen regnet es. Schon wieder oder immer noch? - Es langt allmählich!
Trotzdem bestehe ich auf den Besuch auf dem Lookout der Stadt, einem ganz besonderen diesmal. Es ist ein Lift, der „Durie Hill Elevator“, der dort hinauffährt, 1919 innerhalb des Felsens gebaut (es gibt nur zwei davon in der Welt, wird stolz berichtet – „The only earthbound elevator in New Zealand“), um den Leuten, die auf der Anhöhe wohnen, den Zugang zu Stadt und Fluss zu erleichtern. Eine Treppe hat’s auch, die nehmen wir für den Aufstieg (191 Tritte), hinunter dann, um unsere Knie zu schonen, geht’s mit dem historischen Lift („historisch“ ist eines der Lieblingswörter in den NZ- und AU-Prospekten).
Die Aussicht ist bemerkenswert: Fluss, Stadt und im Hintergrund die Vulkane, die wir nicht sehen. - Gerne hätte ich auch das Museum besucht und die Galerie, die besuchenswert sein soll, aber es ist Sonntag – sehen wir also auch nicht.
Dann Weiterfahrt Richtung Süden. Unterwegs wollen wir (Theo, ich nicht) ein Luftfahrtmuseum besuchen, das im Reiseführer erwähnt wird („Royal New Zealand Air Force Base at Ohakea, home to the No. 75 Squadron of the RNZAF and its Airforce Museum“, sogar die Öffnungszeiten sind genannt). Rösi schon, und sie dirigiert uns direkt nach Ohakea. Da ist tatsächlich militärisches Gebiet, eine Absperrung und ein aufgespiesstes Flugzeug vor dem Eingang. Aber: Niemand weiss etwas von einem Museum. Nicht auf der Air Base selber, nicht der Polizist, den Theo in seiner Not fragt, nicht der Restaurantbesitzer im nächsten Ort, in Sanson. In Interlaken war er, das hat ihm sehr gefallen, aber das Flugzeugmuseum…?
Mir macht’s nichts aus. Also Weiterfahrt. Um halb sechs kommen wir in Wellington an, nach einer kurzen Extrafahrt mit Rösi, die darauf besteht, kurz vor dem Ziel doch noch eine weitere Schlaufe auf dem Weg in unser neues Domizil einzubauen.
Die freundlichen Nachbarn erwarten uns schon, das Auto wird in der Garage versorgt, Jonathan zeigt uns alles und schon können wir es uns gemütlich machen in dem hübsch gelegenen Apartment auf drei Stöcken, das alles andere als rollstuhlgängig ist, aber das brauchen wir zum Glück ja nicht. Im obersten Stock ein grosses Wohnzimmer, ein Wintergarten und eine schöne Terrasse mit Blick aufs Häusermeer - das ist unsere neue Behausung für eine ganze Woche.
Wellington
Einmal mehr: der absolute Szenenwechsel!
Wir sind mitten in der Hauptstadt angelangt (the coolest little capital), wohnen in einer Terrassenwohnung an einem Hügel mit grossartiger Aussicht. Eine lange, steile Treppe (174 Tritte) führt mitten ins Geschehen. In 5 Minuten sind wir in der Hauptgeschäftstrasse, in zehn Minuten im Te Papa Museum, an der attraktiv gestalteten Promenade am Hafen entlang, der „Waterfront“, in einer Viertelstunde am Strand. Den Berg hinauf wär’s ein wenig mühsamer, aber da gibt’s zum Glück einen Lift vom Zentrum aus gleich ins James Cook-Hotel, welches etwa 300 Meter von unserem Apartment entfernt in der gleichen Strasse (The Terrace) steht. Sehr praktische Einrichtung!
Es ist unser zehnter Homelink- bezeihungsweise HomeExchange-Tausch seit wir unterwegs sind, es ist daher die zehnte Küche, in der wir versuchen müssen, uns zurechtzufinden. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Wo sind die Handtücher, wo die Schöpflöffel und Kellen, die Käseraffel, die Zitronenpresse, wo die Salatschleuder und die Eierbecher? Aus den Eierkartons produzieren wir Eierbecher, das geht recht gut, die Salatschleuder vergessen wir und kaufen schon gerüsteten und gewaschenen Salat. Mit den Bratpfannen ist es so eine Sache. Da gelingt es mir immer wieder, etwas anzubrennen, ich schaff’s einfach nicht. Das liegt klar an den Belägen.- Ich denke sehnsüchtig an unsere Teflonpfannen daheim am Sonnenrain.- Übrigens haben wir inzwischen Eierbecher gekauft. Das löst das Eierproblem natürlich elegant und ein für alle Mal.
Am unserem ersten Tag in Neuseelands Hauptstadt besuchten wir das Te Papa Museum, ein absolutes Muss, wie alle sagen, auch die Reiseführer. Wie besuchen nur grad den zweiten Stock vorerst, wir haben ja Zeit, können in Ruhe auch den Rest des Museums ansehen an einem anderen Tag.
Vorherrschend sind die Naturgewalten beschrieben und eindrücklich dargestellt, was passiert ist oder passieren kann, wenn ein Vulkan ausbricht oder ein Erdbeben geschieht. Die Gegend hier ist ja extrem erdbebengefährdet; es scheint zwar niemanden wirklich zu kümmern, aber dennoch stösst man überall auf Evakuierungspläne, und Tipps, was man zur Vorsorge tun soll (Schränke annageln, Bücher anbinden etc.). Diese werden sogar im Kino als Vorspann gezeigt.
Eindrücklich ist der „Colossal Squid“, ein Riesenkalamar, der in einer Formaldehydlösung in seinem gigantischen, durchsichtigen Sarg liegt. Das einzige Exemplar dieser Art worldwide! Als er gefangen wurde (es soll eine Sie sein, Teenager noch), soll er/sie 300 kg gewogen haben und 5,4 Meter lang gewesen sein, jetzt ist sie ein ganz klein wenig geschrumpft, durch die schonungslose Behandlung wahrscheinlich. Giant Squids können bis zu 10 Meter lang werden, heisst es, sie haben Augen wie Fussbälle und mit ihrem schnabelähnlichen Mund müssen sie die Beute vor dem Genuss so klein zerhacken, dass die Stücke die Gurgel gut passieren können, denn diese führt durchs Gehirn und da könnte es sonst passieren, dass das Tier einen Hirnschaden bekommt, wenn’s seine Beute zuvor nicht gut zerstückelt („So what?“, denke ich unwissenschaftlicherweise). All so was lernt man im Museum. Schnell wird klar, dass Heisshunger und Herunterschlingen also fatale Folgen haben könnten. - Dazu kann man sich einen Film anschauen, wie und wo das Tier gefangen wurde, von Wissenschaftlern betatscht, die enormen Tentakel entwirrt, untersucht und jedes Körperteil ausgemessen. Alles ein wenig gruslig, schlüpfrig, feucht und nicht sehr intim.
Weshalb Wellington als „Windy Wellington“ bezeichnet wird, hatten wir keine Mühe, sofort herauszufinden. Ich mag eigentlich Wind ganz gern, aber was die hier bieten… Ständig muss man dagegen ankämpfen. Theo hat gestern seine Finken gesucht auf dem Balkon, konnte eigentlich nicht glauben, dass es sie über die Brüstung hinauskatapultiert haben könnte (wär zwar nicht wahnsinnig schade gewesen um die Schlarpen). Hat’s auch nicht. In einer entfernten Ecke hinter dem Wasserschlauch tauchten sie dann auf, vom Winde verweht. – Heute Morgen können wir nicht einmal draussen frühstücken. Man kann ja nicht alles anbinden.
Es ist jetzt der 3. Januar, Freitag bereits. Ich glaube nicht, dass wir uns heute gross nach draussen begeben werden, wenn das so weitegeht. Eigentlich ist unser zweiter Besuch im Te Papa Museum geplant, aber es windet orkanartig und wenn ich an den Marsch dorthin denke, fühle ich mich nicht sehr motiviert. Auch ziehen oder besser gesagt rasen die Wolken vor unserer Aussicht vorbei, in einer Geschwindigkeit, wie man es selten erlebt. Auf Berndeutsch: „Äs chutet wi blöd!“ Schon in der Nacht bin ich oft erwacht, weil ich dachte, das Haus stürze jetzt dann gleich ein. Der Wind heulte und blies mit einer Stärke und mit Lärm, dass ich es fast ein wenig beängstigend fand. Sonst ist es nämlich absolut ruhig in der Nacht, obwohl wir ja im Zentrum wohnen und eine Autobahn ganz in der Nähe verläuft. Oberhalb „unserer“ Strasse verschwindet sie zum Glück in einem Tunnel. Vielleicht würde zwar auch ohne Tunnel Stille herrschen, denn hier läuft eben wirklich nichts mehr, sobald es dunkel wird. Eigentlich schon sehr viel früher. Die Läden schliessen ja auch alle schon um halb sechs, die Museen um fünf und das Restaurant im Botanischen Garten gar um halb vier. Und sowieso - was soll man bei so viel Wind in dieser Beamtenstadt schon anfangen? Draussen sitzen in den Gartenrestaurants kann man vergessen. Kino wär noch eine Option oder Theater. Ich muss mal schauen. - Tu ich: Das Internet lässt keine Zweifel offen: Die Theater haben alle Pause in dieser Jahreszeit. Nur Kino kann’s sein in dem Fall.
Jetzt beginnt‘s zu allem Überfluss auch noch zu regnen, und das mit voller Wucht an alle Scheiben, wo immer es Fenster hat. - November in der Schweiz; so kommt’s uns vor. Wir können unmöglich das Haus verlassen, nach spätestens fünf Metern wären wir durch und durch nass, an einen Schirm gar nicht zu denken. Mein kleiner Knirps kollabiert schon nur beim Gedanken an einen Einsatz. Am nächsten Tag lese ich, es seien Sturmböen gewesen bis zu 100 km/h.
Gut, sind wir gestern im Botanischen Garten gewesen. Das war sehr schön, die Vielfalt der Bäume, das Hortensienmeer, der Rosengarten – nicht auszudenken, wie das im Moment dort aussieht. Die Fahrt dort hinauf war übrigens auch ein Muss. Ein Cable Car („historisch“ natürlich) führt den steilen Berg hinauf, fast so wie unser Marzilibähnli, nur ist die Strecke ziemlich viel länger.
Am späten Nachmittag hört es auf zu regnen und der Wind hält sich in erträglichen Grenzen, Wir beschliessen, der Unbill zu trotzen und uns ins Abenteuer Kino zu stürzen („The Secret Life of Walter Mitty“). Abenteuer tatsächlich, Comedy und sehr viel schöne Landschaftsbilder (Island, Grönland, Afghanistan) werden uns geboten von Ben Stiller und unter anderen auch Sean Penn, Kristen Wiig, Adam Scott, Kathryn Hahn und wieder mal Shirley MacLaine. Die älteren Semester, so wie wir, dürfen den Film für acht Franken besuchen. Da gibt’s dann nichts mehr zu bemängeln und zu klagen.
Da, wo der Kinokomplex ist, hat’s tatsächlich mehr Leute auf der Strasse als Finger an meiner Hand. Ich kann jedoch immer noch nicht sagen: „Da läuft was“, das wäre extrem übertrieben. Aber es hat doch ein paar Restaurants, die offen sind, ein, zwei 7/24 Lädeli sogar und an den Theaterfassaden und –Entrees hat’s Leuchtreklamen, aber eben, Vorstellungen dann doch keine. Wenn ich mir vor einer Woche noch vorgestellt hatte, wie „hektisch“ es in der Hauptstadt nach unserem ländlichen Aufenthalt in Kuratau sein würde, so habe ich mich gründlich getäuscht.
Nach Ben Stillers zweistündiger Darbietung essen wir im „Dragon“, einem chinesischen Restaurant zur Abwechslung. Die kleine chinesische Kellnerin fragt uns: „You guys here to travel?“ – Ich bejahe und sie will weiter wissen, wo wir her seien. „From Switzerland“, sage ich. „Ooooh, oh, hello then!“ – Wie wir gehen, fragt sie: „Right full now?“ - Für den Heimweg, weil wir „right full“ sind, beschliessen wir, statt dem Lift die Treppe in Angriff zu nehmen. – Oben angekommen, muss ich sagen, zum ersten Mal heute habe ich wirklich sehr warm und einmal keine kalten Füsse mehr beim Ins-Bett-Gehen.
Auf den „Wellington Underground Market – every Saturday from 10am - 4pm“ habe ich mich bereits gefreut. – Ich schau im Internet nach, wann und wo der genau stattfindet. “We will be having a break after Christmas, and the market will resume weekly opening from the 18th January“. – No comment meinerseits.
Silvester
Unser Silvestererlebnis in dieser Stadt: nicht wirklich ein Erlebnis: Der Einunddreissigste lässt sich zwar gar nicht mal so schlecht an, ein schöner Tag mit sehr viel Sonne und blauem Himmel, so fahren wir nicht an den nächstgelegenen Strand, sondern ein wenig weiter weg an die Worser Bay, ein kleines Ausfährtli halt. Sünnele, lesen, Strandspaziergang – richtig perfekt zum Jahresabschluss.
Einkauf unterwegs und daheim sind wir bei unseren Nachbarn von Apartment 4 und 5, Kathy and Johathan, Jenny and John, zum Apéro eingeladen. Beide sind auch Homelink-Mitglieder und so gibt’s angeregte Gespräche und gegenseitigen Erfahrungsaustausch. Das ist eine weitere gute Seite beim Haustauschen: Man hat sofort Kontakt (wenn man will) mit Einheimischen, lernt dadurch Dinge, die nicht im Reiseführer stehen und überhaupt: So viele nette Bekanntschaften, wie wir hier bisher gemacht haben, die gibt’s nicht gratis mitgeliefert im Reisebüro-Angebot.
Wir haben feine Sachen eingekauft auf dem Nach-Hause-Weg, also beschiessen wir, daheim zu essen und dann anschliessend vielleicht in die Stadt zu pilgern. Allerdings haben wir erfahren, dass es kein Feuerwerk geben wird (den ganzen Nachmittag lang wurden Interviews mit erbosten Zuhörern gesendet, die nicht verstehen konnten, weshalb die Hauptstadt nichts, aber auch gar nichts für das Jahreswechselereignis organisieren will). Geldsorgen sind offenbar der Grund; auch sind ja viele in den Weihnachts-Sommerferien. – Na ja, wir hätten die ultimative Aussicht auf das Geschehen von unserer Terrasse aus, aber eben, nichts gewesen, nicht einmal Spesen. - Auch diese Stadt hier scheint ein wenig eine Schlaftabletten-Oase zu sein. Wir sind ja nicht gerade wild auf Nachtleben und Jubel, Trubel, aber so ein wenig Lichter und Feuerwerk am Silvester… Wir lassen uns leider anstecken:
Schon ein wenig „gchäppelet“ vom Apéro und dem zusätzlichen Wein, den wir uns natürlich zu unseren köstlichen Silvestermal gönnen, schläft Theo immer wieder vor dem Ferni ein (es war ja soo anstrengend am Strand heute Nachmittag). TV zur Abwechslung – ok, aber das Programm - ja, also ich kann meinen Gatten ausnahmsweise gut verstehen. Ich schlage vor, wir könnten uns ja mal den Maori-Channel ansehen. Nach einer Viertelstunde schon habe ich vollkommen genug davon. Da geht‘s nur ums Fischen. Nach dem dritten Fisch, der sich kläglich auf der Schlachtbank windet und schliesslich bluttriefend auf dem Boden landet, bin ich für einen Kanalwechsel. Der Film, der dort läuft, tut das bereits seit einer halben Stunde (laufen, meine ich) und ich mag’s nicht, Filme nicht von Anfang an zu sehen. Zudem hab ich ihn schon mal gesehen und nach Herz-Schmerz-Zeug ist mir sowieso nicht zumute. Ein dritter Channel bringt ebenfalls einen Film, den man nicht unbedingt sehen muss, also lass ich Theo schnarchen und geh lesen. Jussi Adler – Olsen (der fünfte Fall für Carl Moerk) macht sehr viel mehr Spass zum Lesen, aber obwohl der Roman äusserst spannen ist, passiert mir das Gleiche - ich falle in einen jahresübergreifenden Schlaf. So gehen unsere Fast-Pläne, in der Stadt ein wenig zu feiern, kläglich flöten und nur der Gedanke daran ist übrig geblieben. Unrühmlich, ja. Wir sind eben doch auch schon ein wenig in die Jahre gekommen; es ist offensichtlich. - Um eins erwache ich, weil doch ein paar Leute grölenderweise am Haus vorbeiziehen. Es müssen Ausländer sein. Ich hör immer wieder „Skol“, und den Rest versteh ich nicht. Nachher ist wieder ruhig und ich erwache erst wieder am Morgen, im Januar 2014.
Dafür feiern wir um 12 Uhr mittags mit unserer Familie in Bivio mit einer wilden WhatsApp-Bildli-hin-und-her-Schickerei, Line- und Facetime-Telefoniererei, und das macht mehr als nur Spass. Für uns jedenfalls. In der Chesa Arcadia ist leider die Waschmaschine ausgestiegen, was dort zugegebenermassen und auch verständlicherweise nicht zu Freudentänzen führt. Freude macht aber, dass es allen gut geht, sie es trotzdem lustig haben und uns berichten, dass es seit Jahren nicht mehr so viel Schnee gehabt habe wie gerade jetzt.
Wenn ich an Bivio mit seinen knapp 200 Einwohnern denke und was dort los ist in der Silvesternacht, dann sind das ganz andere Dimensionen als hier in der „coolen“ neuseeländischen Hauptstadt mit fast einer halben Million Einwohnern. In Bivio geht die Post ab: Feuerwerk, Treffen auf der verschneiten Hauptstrasse auf der Piazza San Giovanni vor dem Silvia-Sport-Geschäft, aufs neue Jahr anstossen mit allen, die sich dort versammelt haben, anschliessend kurzer Spaziergang ins Solaria und zuschauen, wie Giancarlo mit einem Sabel die Champagnerflaschen öffnet, erneut mit ein paar weiteren Gläschen „Bubbles“ auch dort wieder Genny und Giancarlo und ihren Gästen alles Gute wünschen... – Aber jetzt sind wir hier, es ist Sommer - auf der anderen Seite der Weltkugel ist eben etliches anders, nicht nur die Silvesternacht.
Zwölf Uhr mittags ist eine gute Zeit zum Silvesterfeiern, finden wir. Sollte man auch bei uns einführen. Da ist man viel besser zwäg. - Auf dem Balkon stossen wir auf die Familie und auf alle unsere Freunde an, aufs alte und aufs neue Jahr. Dazu gibt’s Lachs und Toast, wie das zu Hause auch der Fall wär – eine alte Tradition. Niemand ist zum Umfallen müde, auch Theo nicht.
Letzte Tage auf der Nordinsel
Das tönt jetzt alles ein wenig negativ, merke ich gerade. Aber wir lassen uns unsere gute Laune keineswegs verderben. Klar, es wär schon schön, wenn das Wetter schön wär. - Sehr schön wär das! Wir hatten ja Sonne am letzten Tag des Jahres, sogar am Strand waren wir – wer will sich da beklagen?! Wir haben Zeit und nehmen’s gelassen. Es hat ja sogar Vorteile: Wir können grosse Teile unserer Weihnachtsmails erledigen, am Blog weiterbasteln und Theo kann endlose Siestas einwerfen, ohne dass ich meine Bemerkungen dazu mache.
Morgen ist es so weit: Unsere Reise geht weiter, wir fliegen nach Queenstown auf die Südinsel. Es regnet im Moment schon wieder beziehungsweise immer noch, also kommt es uns grad recht, weiterzuziehen mit der Hoffnung auf besseres Wetter.
Unsern Plan, das Te Papa Museum ein weiteres Mal zu besichtigen, haben wir gestern in die Tat umgesetzt. Drei Stunden lang waren wir dort. Sie haben eine faszinierende Sammlung von Maori-Artefakten, Kanus, Schmuck, Waffen, Bildern und sonstigen Gegenständen. Um die Geschichte der Ureinwohner darzustellen, ist man hier sehr bemüht.
Wir haben sogar das Bild gesehen von Poetua, das John Webber (Johann Wäber – „Auslandberner“) auf seiner Reise mit der Discovery (Cooks dritte, verhängnisvolle Reise 1776 – 1780) gemalt hat. Das Bild ist ja zu sehen auf der Titelseite des Buches von Lukas Hartmann „Bis ans Ende der Meere: Die Reise des Malers John Webber mit Captain Cook“ und der Roman ist spannend, sehr interessant, äusserst minuziös recherchiert offenbar und wunderbar geschrieben.
Im sechsten Stock hat’s eine Aussichtsplattform. Zum Glück ist die gut verschalt mit Glasscheiben, es hätte einen sonst schlicht nicht vom Hocker, sondern von der Terrasse gerissen beziehungsweise geblasen.
Eine weitere erwähnenswerte Ausstellung, eine Sonderausstellung, ist „The WOW – Factor: 25 years in the making“ – The Worlds of Wearable Art. Was da an Ideen, Fantasie und Schneiderkunst zusammenkommt, ist wirklich sehens- und bemerkenswert.
Die Besiedelung der beiden Inseln, die unglaubliche Abholzung während all der Jahre, die ja noch immer voll im Gang ist (bad, sad, mad), die Tiere und Pflanzen, die von den Siedlern eingeführt wurden und welche die einheimische Flora und Fauna bedrohen, verdrängen und teilweise sogar zum Aussterben gebracht haben und bringen, all dies sind Themen in diesem Museum.
Viel Platz hat’s für Kinder – zum Lernen und Staunen. Alles sehr gut und mit viel Gespür gemacht, muss ich sagen. Und freier Eintritt. Sehr ungewohnt in diesem Land und enorm begrüssenswert!
Was machen wir heute, an unserem letzten Tag (ausser wieder mal packen, aufräumen, putzen)? – Theo will das Auto nehmen, um die Old St. Paul’s Kirche zu besuchen, das Parlamentsgebäude und noch ein weiteres Museum. Ich bin sogar dafür, denn es windet ohne Unterbruch und der Regen dazu – nicht zu fassen, dass ein Sommer im Südpazifik so aussieht.
Wir warten noch, bis die Waschmaschine ruft und wir den Wäschetrockner, der kurioserweise wie in Australien auch hier upside-down an der Wand hängt, füllen können. Gut so, denn inzwischen hat es aufgehört zu regnen und wir gehen zu Fuss.
Die City-Gallery begeistert uns nur in Grenzen. Im Parterre geht’s um Sound. In einem Ausstellungsraum herrscht ein derart dumpfer, aufdringlicher Dauerton, dass ich grad sofort Kehrum mache und woanders hingehe. Theo kommt mit. Mit Mühe ergattern wir grad noch je einen Sitz im zweihundertplätzigen Aditorium, wo an der Riesenleinwand eine Lichtinstallation gezeigt wird, untermalt mit Ton. – Nein, nein, stimmt natürlich NICHT! Das mit der Installation schon, eine grüne Lichtschlange tanzt hin und her, aber Platz hat’s für 198 weitere Interessierte. Wir sind die zwei Einzigen. Aber nicht lange. Wir überlassen die Installation sich selbst.
Im ersten Stock gefällt’s uns besser. In der einen Galerie zwar auch nicht so sehr, da frage ich mich wieder mal, wieso es Künstler gibt, die’s in ein Museum schaffen und andere nicht. Die alte Diskussion, ich lasse es. Man müsste sich wohl intensiver damit befassen, um sich ein Urteil zu erlauben.
Was mir hingegen sehr gefällt, sind die Bilder von Huhana Smith „Rae ki te Rae / Face to Face“ Die Liebe zu ihrem Land ist sicht- und spürbar in ihren Bildern.
Wo ist Theo? - Er hat heute den Spinner drin. Ob das mit dem Wind zu tun hat? – Er sagt, er wolle ein bisschen Farbe ins Grau bringen (???). - In einem der Säle will er, dass ich ihn fotografiere, wenn er sich auf den Boden legt. Der Raum ist riesig, es hängen nur fünf kleine Bilder drin, eines an der einen Wand neben dem Eingang, die andern vis-à-vis. - Das mag ich nun wirklich nicht machen – so peinlich! Zudem glaube ich, ich fürchte mich ein wenig vor den Aufsehern. – Also macht er es selbst, währendem ich in einem anderen Raum bin. Was genau er dort treibt, hat er in seinem Blog gleich selber erläutert beziehungsweise in einem Filmli präsentiert.
Hier meine Sicht: Er schwitzt, wie er herauskommt und ich ihn wiederfinde. Er hat sich selber gefilmt. Mehr als einmal: Beim ersten Mal hat er nur seine Jacke gefilmt, weil die Kamera falsch eingestellt war, beim zweiten Mal hat er das Gerät (i-Phone) falsch gestartet, beim dritten Mal hat’s geklappt. Die Aufsicht hat’s nicht gemerkt, auch wollte sich sonst offenbar niemand die Kunst in diesem Raum ansehen während Theos Shooting-Session.
In Hafengelände muss ich auch noch eine Foto von ihm machen, wie er sich an einer Boje festklammert, es soll aussehen, wie wenn er grad fast am Ertrinken wär oder so ähnlich. Sein Gesichtsausdruck jedenfalls lässt darauf schliessen. Hier hat’s keine Aufseher, ich mach’s also. – Wenn’s ihm doch Freude bereitet! – Der Sinn allerdings...
The „Beehive“, das neuseeländische Parlament, so genannt, weil es wie ein Bienenhaus aussieht, gehen wir uns auch noch ansehen, allerdings nur von aussen. Es gibt zwar täglich mehrmals stündliche Führungen, aber so sehr interessieren uns die Räume und Geschichten dort drin nicht.
Unterwegs zum Hafengelände steht die John’s Kirche „Old St. John’s“. Es ist eine spezielle Kirche, sehenswert, weil sie vollständig aus einheimischem Holz gebaut wurde. Eine Hochzeit wird grad gefeiert, die ganze Gesellschaft steht vor der Kirche, wir müssen einen Moment warten, können dann aber doch auch hinein. Bemerkenswert ist unter anderem, dass der Souvenirshop mit jeglichem Krimskrams auch gleich drin ist, grad neben der Kanzel.
Wir gehen ins nächste Museum: “Museum of Wellington City & Sea” (voted one of world’s top fifty museums (www.museumswellington.org.nz/">www.museumswellington.org.nz/). Eine ausgezeichnete Sammlung und Ausstellung; wir bleiben fast zwei Stunden dort.
Und wie wir rauskommen: Surprise, surprise! – Kein Wölkchen mehr am Himmel. Was ist denn da passiert? Die Sonnenbrille zu Hause, Jeans, T-Shirt (langärmlig), Pulli, Leder- und Regenjacke – so sind wir ausstaffiert. Jetzt aber wären Shorts und Sommeroutfit angesagt, denn sogleich wird’s heiss. Der Wind bläst zwar immer noch, aber der ist ausnahmsweise ganz angenehm. – Wir sind versöhnt mit Wellington: an unserem letzten Spätnachmittag und Abend doch noch schönes Wetter. Wir feiern diesen Umstand mit einem Glas Prosecco und einem Erdinger Bier in einer Kneipe am Hafen.
Apéros und Haushaltsgeräte
Kleiner Exkurs zu den Apéros, hier „nibbles“ genannt, die wir bisher hatten: Die sind immer genau gleich: Auf einem Servierbrett liegen Crackers, ein oder zwei Dips in Schälchen (Humuspaste oder etwas Derartiges, vielleicht eine „Käsesalbe“), ein bis drei Weichkäsesorten und zu jedem ein kleines Messerchen dazu. Ok, ok, das Servierbrett ist nicht in jeder Familie dasselbe, auch die Käsesorten nicht, aber annähernd. Bisher haben wir uns nur einladen und verwöhnen lassen, es gibt also gar nichts zu meckern, im Gegenteil, es ist nur so eine Feststellung.
Lustig ist doch immer, was man als Ausländer in einem anderen Land wahrnimmt. Wir haben ja auch unsere Seltsamkeiten. Wenn ich Bücher von Deutschen oder Engländern über uns lese zu diesem Thema, merke ich schnell, wie komisch einige unserer Schweizer Eigenarten auf Fremde wirken müssen. Aber über sich selber zu lachen, soll ja ganz heilsam, wohltuend und vielleicht auch horizonterweiternd sein.
So kann sich Theo zum Beispiel kaum sattsehen an den komischen upside-down aufgehängten Trocknern über den Waschmaschinen. Schon seltsam, dass es den Herstellern offenbar noch nie in den Sinn gekommen ist, die Schalter andersherum anzubringen, was ein Leichtes wäre, man könnte dann sogar lesen, was draufsteht. Dieselben Hersteller waren trotzdem innovativ und haben Geschirrspüler entwickelt, die in zwei verschiedenen Schubladen (je halb so gross wie „normal“) in der Küchenkombination untergebracht sind. Das hat für Juden den Vorteil, dass sie Gläser und Teller gleichzeitig waschen können, ohne dass die sich gegenseitig „kontaminieren“ (also das Geschirr) und für uns Normalsterblichen: Wir brauchen nicht mehr in die Knie zu gehen vor unseren Abwaschmaschinen (obwohl viele von uns - wir gehören dazu - diese Küchenhelfer ja aufs Innigste verehren).
Wenn ich schon von Haushaltsgeräten berichte: Theos Lieblingsgerät hier ist der Toaster. Perfekt für Muffins, Crumpets und Bagles ebenfalls. Ich find ihn auch gut, aber grad soo… Also: Man kann Toast oder Muffinscheiben in die Spalten legen, den Startknopf drücken und dann geht alles wie von Geisterhand. Das Gerät nimmt auf sanfte Art und Weise die Scheiben selber in seinen Schoss und röstet sie ganz vorsichtig. Von alleine werden die getoasteten Scheiben behutsam und sozusagen lautlos wieder emporgehoben – es spickt sie eben nicht aus, wie das manchmal der Fall ist bei herkömmlichen Modellen, wo man anschliessend das (verkohlte) Resultat auf dem Boden zusammenlesen kann/muss - und jetzt heisst es: „Lift and look“ (ist das nicht eine nette Aufforderung?!). Ist man nicht vollkommen zufrieden mit dem Ergebnis, kann man nun wählen: „A bit more“. - Zugegeben, diese Vorgehensweise macht den ganzen Vorgang fast ein wenig menschlich. Meine Muffins am Morgen jedenfalls lieben diesen Toaster. Sie sind genau richtig, nicht verbrannt und nicht zu wenig geröstet. Und wie gesagt, Theo ist absolut Fan. Er hat schon im Internet nachgeschaut, ob man so ein Ding auch in Europa erstehen kann. – Man kann! - Und schon hat er ein Geburtstagsgeschenk für mich… (nur zur Klärung: nicht von mir für ihn – er will das Gerät mir schenken...)
Von Wellington nach Queenstown
Es ist der 6. Januar. Die Packerei liegt mir schwer auf dem Magen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie all das viele Zeug, das wir haben, in unsere Koffer und ins Handgepäck passt. Es sind ja schliesslich noch zwei Eierbecher dazu gekommen und hie und da ein T-Shirt, ein paar Schuhe und was man sonst noch so dringend braucht. Auch Prospekte. Das alles ginge ja noch, aber die Kilos…
Um neun Uhr morgens sind wir startbereit. Es ist geglückt, alles ist gepackt, nur Weniges muss zurückbleiben, so eine von Theos grässlichen Büchsen, die er sich jeweils im Supermarkt kauft mit irgendwelchen Suppen drin, gepökeltem Fleisch, vielleicht vom Pferd oder vom Esel, wer weiss, ein bisschen Tomate, sicher einer Portion Lebensmittelfarbstoff und Konservierungsmittel. „Campbell’s Chunkey – fully loaded“ heisst‘s auf der Büchse. Da wird nichts versteckt, muss man zugeben - volle Deklaration. Wenigstens hat er noch nie die Büchsenspaghetti gekauft.
Ich bin sicher, dass mein Koffer mindestens 25 kg wiegt, mein Rucksack auf jeden Fall etwa zehn, das war schon so, als wie in Auckland ankamen (7 kg sind zugelassen). Zuoberst hab ich Dinge gepackt, die ich notfalls wegwerfen kann, Kleider, die ich sowieso nicht mehr will, aber vielleicht doch noch brauche bis zum Ende der Ferien. Übergewicht mag ich nicht zahlen.
Es ist die letzte Fahrt mit unserem inzwischen geliebten Nissan. – Denken wir. - Wir tanken ihn auf, fahren zum Flughafen, Theo lässt mich und das Gepäck aussteigen, ich warte dann auf ihn, während er das Mietauto zurückgibt. So war’s abgemacht aber so weit kommt’s vorerst noch nicht. Also, ich steige aus, hole ein Wägeli, lade alles Gepäck drauf – da sagt Theo: „Weisst du, was ich vergessen habe?“ - Weiss ich natürlich nicht, aber ich ahne Schlimmes. – Sein Umhang mit den unendlichen vielen Taschen und Reissverschlüssen, den er ja sonst fast immer und in allen Lebenslagen anhat, auch bei 30 Grad am Schatten, ist das Corpus Delicti. Aber eben nicht, wenn wir abreisen wollen und auf dem Flugplatz sind. – Ja nu, no worries. Muss er halt nochmal zurückfahren und die Weste holen gehen, die er so nachlässig über dem Treppenpfeiler im Entrée aufgehängt hat, dass es fast nicht anders ging, als sie zu übersehen. Alles war nämlich drin, Portemonnaie, Kreditkarten, Geld, seine e-Zigaretten, Täfeli, Notizbüechli, Tagebuch, was weiss ich, was noch alles, nur der Pass nicht. Nach dem hatte ich ihn nämlich bei der Abfahrt noch gefragt, den aber hatte er in Aussenfach des Koffers stecken, so hat er’s nicht gemerkt. - Theo…
Wir haben genug Zeit eingeplant, und die Fahrt zurück in die Stadt dauert nur grad zehn Minuten, also ist er in einer halben Stunde schon wieder zurück. Und Rösi darf nochmal sagen: „Biegen Sie in 200 Metern nach links ab, Richtung Eier Port“. - Ein Glück, dass die Nachbarn daheim waren, die einen Zweitschlüssel besassen. Wir hatten unseren ja in den Briefkasten geworden, nachdem wir abgeschlossen hatten. Unerreichbar also. - Noch mal gut gegangen!
Tolkien und seine Ring-Trilogie beherrschen auch den Flughafen. Gandolf rast grad vorbei und auch die Orcs sind gegenwärtig. Einige der Figuren hängen an der Decke und verbreiten Angst und Schrecken. Alle in Übergrösse.
Inzwischen habe ich eingecheckt und mit einem höchsten Gefühl der Ungemach gehe ich zum Förderband, wo die Koffer abgegeben werden. Die beiden schweren Handgepäckstücke habe ich vorsorglich etwas weiter weg hingestellt, so dass die Angestellte nicht sehen kann, dass ich die auch noch habe. Sie fragt mich, ob die Koffer mehr als 23 kg wögen. „Das sehen wir ja jetzt dann grade“, denke ich, sage aber, „Ich glaube nicht“, und sie lässt mich die Koffer aufs Band legen ohne sie zu wiegen. Das glaub ich jetzt wirklich nicht. Das ist mir noch nie passiert. Ich könnte jubeln.
Theo kommt, er hat das Auto abgegeben, hat seinen Kampfanzug an und könnte wohl auch jubeln. Zeit haben wir immer noch genug, es ist ja nur ein Inlandflug, da braucht man gar nicht so früh schon parat zu sein. Wo ist denn die Sicherheitskontrolle? Diese mühsame Prozedur „stinkt“ mir jedes Mal sehr, die ganze Auspackerei sämtlicher elektronischer Geräte, die Abtasterei, weil irgendwo vielleicht ein Druckknopf Probleme macht, Schuhe und Gurt ausziehen, das ganze Theater mit den Flüssigkeiten etc. etc. – Super Wellington! Das alles gibt’s hier nicht. Nicht zum Glauben. Keine Kontrolle, jeder könnte sein Schiessgewehr mitnehmen, auch den Patronengürtel, sogar unbehelligt Nagelscherchen und Feile. Sogar meine Mineralwasserflasche, von der ich dachte, ich müsse sie dann wegwerfen, kann ich behalten, niemand will etwas davon wissen. – So was! Das hab ich noch nie erlebt oder vielleicht mal als Kind, als es noch keine mutmasslichen Terroristen gab. Klar, dies hier ist ein kleiner Flughafen, nur wenig grösser als derjenige in Belp, aber immerhin. Und es ist „nur“ ein Inlandflug. Wie in Belp geht man auch hier zu Fuss auf die Rollbahn – es kommt mir eher vor wie eine Bus- oder Tramfahrt, nur dass das Gefährt dann eben doch abhebt und nicht rollt. - Ich bin so was von erleichtert!
Queenstown
Das Wetter ist ausnahmsweise gut und wir erhalten durchs Flugzeugfenster den ersten Eindruck von der Südinsel: grüne Hügel, Flüsse, die in einer Art mäandern, wie ich es noch nie gesehen habe, Seen, Strände, das Meer in den verschiedensten Blautönen und lauter unbesiedeltes Gebiet. Am Horizont Bergketten, die Südalpen, von Schnee bedeckt und von Wolken gesäumt. Da werden wir viele Kilometer fahren müssen für die Reise, die ich gemäss Robert Prides Angaben und Vorschlägen geplant habe.
Nach ungefähr anderthalb Stunden und achthundert Kilometern Flug kommen wir in Queenstown an, nehmen ein Taxi und fahren in die Belfast Terrace, wo uns Kathy von der Agentur mit dem schönen Namen „Relax is Done“, die mit der Vermietung betraut ist, bereits erwartet und uns alles zeigt. Das Apartment ist traumhaft schön gelegen, wieder an einem sehr steilen Hang, über drei Stockwerke gebaut, aber diesmal mit Lift. Es gehört ja Robert und Kerrie, bei denen wir in Sydney am Anfang unserer Reise fast eine Woche lang eingeladen waren. Wir sind begeistert. So viel Platz, so stylish und geschmackvoll eingerichtet, Luxus vom Feinsten. Aus den drei Doppelschlafzimmern mit en-suite-Badezimmer können wir aussuchen, welches uns am besten gefällt. Auch da wird es uns wieder sehr gefallen. Robert hat uns wissen lassen, er vermiete es normalerweise für 1000 NZ$ pro Tag (750 CHF).
Ein Mietauto brauchen wir nicht, Robert lässt uns sein Auto gratis brauchen den ganzen Monat lang. Statt dass es in der Garage stehe, hat er gesagt… Es ist ein 4x4 Holden. Wir sind sooo verwöhnt. Da hatte ich wirklich ein ausgezeichnetes Händchen beim Aussuchen dieses Homelink-Swaps – muss ich selber sagen. Wir probieren das neue Auto grad mal aus und gehen einkaufen. Hier sind die Lebensmittel noch teurer als sonst überall. Es ist schon erstaunlich. Queenstown ist halt ein Ort wie St. Moritz, Zermatt oder Gstaad und ziemlich abgelegen; da wird wohl fast alles per Flugzeug eingeflogen.
Auch vom Bett aus haben wir einen prächtigen Blick über den See und die Berge. Eigentlich sieht’s ein wenig aus wie Interlaken, nur dass hier nicht der „Thunersee“ ist, sondern der „Lake Wakatipu“ und der „Niesen“ ist oben ein bisschen abgetragen und heisst auch anders, nämlich „Cecil Peak“, fast 2‘000 Meter hoch. Wenn’s Nebel hat, sieht man aber kaum einen Unterschied. Das Dampfschiff ist auch nicht die „Blüemlisalp“, sondern die „Ernslaw“, mit anderem Namen die „Lady oft he Lake“; es ist ein Raddampfer, 100 Jahre alt. Nur einer dieser Sorte kreuzt über den See, dafür lässt er eine schwarze Dampfwolke aus dem Kamin aufsteigen, grad wie zwei Schiffe auf einmal.
Nur ein paar wenige Sonnenstunden gibt’s am Tag unserer Ankunft, nachher ist aber genug.
In der Nacht hat’s wieder stark zu regnen begonnen und die Temperaturen lassen auch zu wünschen übrig. So sehr, dass wir heizen müssen. Sommer???
Der ganze Tag ist grau und verregnet. Nun, wir haben ja eine sehr schöne Unterkunft und geniessen das Relaxen, Filme schauen, Blog bearbeiten, lesen und sogar die vernebelte Aussicht. Um halb vier finde ich, wir sollten doch noch ein Ausfährtli machen, obwohl es noch immer regnet. Wir fahren nach Arrowtown, einer ehemaligen Goldgräberstadt, die jetzt zum Touristenort mutiert ist. Kaum haben wir das Auto abgestellt, hört der Regen auf und die Sonne zeigt sich. – Wenn Engel reisen… – Das Dorf wurde restauriert und es ist klar, weshalb man dort gern hingeht. So ein charmanter Ort. All diese Restaurants, Boutiquen und Shops – Verweilen macht Freude.
Am Rand des Ortes befindet sich das historische „Chinese Settlement“, wo während des Goldrausches viele Chinesen zum Schürfen hergekommen waren, aber nicht beliebt waren bei den weissen Goldgräbern und aus dem Grund ihre eigene Siedlung bauen mussten. Primitivere Behausungen kann man sich fast nicht vorstellen. Einige davon wurden wieder mehr oder weniger restauriert, so dass man sehen kann, wie die Männer damals hausen mussten. Wenn‘s auch zu der Zeit so viele Mücken hatte wie gerade eben, dann muss das zur Einsamkeit, zum Schmutz, zur Kälte, zu den unmenschlichen Arbeitsbedingungen und zur ganzen verheerenden Lebenssituation im Allgemeinen eine zusätzliche Herausforderung gewesen sein.
Das Wetter hält, wir sind ganz erstaunt, also setzen wir uns in eines der hübschen kleinen Restaurants an die Sonne und bestellen einen Apéro. Daraus wird allmählich ein Abendessen. Wieder mal draussen essen ohne dass es zu kalt ist oder dass es einem den Salat aus dem Teller weht – wir geniessen es. Zu Hause angekommen, regnet es bereits wieder.
Auch der nächste Tag verspricht keine umwerfenden Temperaturen und höchstens sonnige Abschnitte. - Dem ist so am Morgen. Es hat sogar Schnee auf den Gipfeln, aber dann klart es auf und wir beschliessen, eine Fahrt auf dem See zu machen. – Plötzlich Sommer! Und ich sitzt da auf dem Schiff mit einer ganzen Ladung viel zu warmer Kleider und denke, wie blöd… Das Girl neben mir hat Flip Flops an und Shorts. Aber bald fiert sie, wie sich das Schiff in Bewegung setzt und der Fahrtwind eben doch recht kühl ist. Sie zieht jetzt Handschuhe an, ich zusätzlich zum T-Shirt den Pulli, die Lederjacke, die Windjacke. Nun denke ich nicht mehr, wie blöd…, sondern bin froh, dass ich in weiser Voraussicht genügend warme Sachen mitgenommen habe. Es ist eine schöne 90-minütige Fahrt mit dem „Million-Dollar-Cruise-Ship“ und Max, dem Kapitän. Er ist ein Plauderi, aber ganz lustig. Kaum sind wir abgefahren, kommen schon wieder die armen Australier daran; es geht offenbar nicht ohne: „There must be some Australians on board. Just a short announcement: - The bar is open. Jump in and go for it“. – Wir fahren am Ufer des Lake Wakatipu entlang. Die Szenerie ist bilderbuchmässig und erinnert mich an St. Moriz: der See, die steilen Hänge, die Häuser, die Tannenwälder, im Hintergrund die Bergspitzen der „Remarkables“, eines der Skigebiete, jetzt schneebedeckt, gestern noch nicht. Nur dass offenbar hier vor 200 Jahren kein einziger Baum stand, Häuser sowieso nicht. Wir sehen Hotels, endlos viele Feriensiedlungen, Luxusvillen, die einen absolut atemberaubend, die anderen weniger. – Bauvorschriften? - Von der einen Siedlung erzählt uns Max, die gehöre der staatlichen Eisenbahngesellschaft und sei als Ferienanlage für die Bahnangestellten erbaut worden. Nur habe diese Institution die strikte Regelung, dass ihre Bauten immer „face north“, also mit der Frontseite gegen Norden gebaut werden müssten. Das wurde auch hier gut sichtbar und mit absoluter sturer Konsequenz durchgezogen. Dort, wo gegen Süden die schöne Aussicht auf den See und die Berge ist, haben die Häuser nur kleine Fensterchen, Badezimmer- und WC-Fenster. Gegen Norden, wo sich die Wohnzimmer befinden, dort seien die Terrassen – mit Aussicht auf den steilen Grashang, direkt vor der Nase. Max weiss, wovon er spricht. Vom Schiff aus können wir die Vorderseiten natürlich nicht sehen, nur die kahlen Fassaden: „Loo with a view“ würde ich es nennen. Was hat sich die Bauherrschaft nur dabei gedacht? – Was machen solche abstrusen Vorschriften für Sinn? – Und wieso nur erinnert mich diese Bauweise an die Wäschetrockner in Down Under?
Die Bäume übrigens sind alle nicht einheimisch, sie sind von den Siedlern eingeführt worden. Ein Schafzüchter war der erste Siedler, der sich hier in der Gegend in den fünfziger Jahren in 19. Jhd. niedergelassen hatte. Einwohnerzahl damals:14. Dann wurde im Jahr 1862 Gold gefunden, seine Schaffarm wurde in ein Hotel umfunktioniert und die Einwohnerzahl schnellte innert eines Jahres auf 10‘000. Nach dem Goldrausch wieder drastische Senkung. Heute sind’s 15‘000 Einwohner und im Sommer und Winter mit den Kurgästen grad mal die doppelte Anzahl. Einnahmequelle ist fast zu hundert Prozent der Tourismus. Gold und Schafe hat’s keine mehr, angepflanzt wird nichts, ausser ein wenig Wein. Trotzdem ist Queenstown der Haupt-Winterkurort der Südinsel, jeden Tag gehen und kommen über 4‘000 Touristen. – Wir gehen morgen. – Das Beste aber ist: Wir kommen wieder. Anfangs Februar. So fällt der Abschied nicht so schwer.
Ein riesiges Angebot an Freizeitvergnügen, -abenteuern und -events sind die Folge dieses Booms. Man kann Paragliding, Bungeejumping und Helikopterflüge buchen, Jetboote mieten, auch Paddelboote, Wasserfahrzeuge, die ich noch nie gesehen habe, alle bekannten Arten von Wassersport, sogar „Hydro-Attack“ gibt’s, (the ultimate blend of shark and machine – world’s first tour operator), ein ganz aggressives Ding (www.hydroattack.co.nz/">www.hydroattack.co.nz/) man muss aber mindestens 8-jährig sein, um vom ultimativen Erlebnis profitieren zu können. – „Take the ride of your life for only $159“. Vom Bob’s Peak aus kann man mit der Gondel wieder hinunterfahren oder man entscheidet sich für die „Skyline Luge“, eine Art Gefährt zwischen Schlitten und Go-Kart. Ballonfahrten sind sowieso im Angebot, Mountainbike- und Quad-Rides ebenso und noch vieles mehr. Der Spass nimmt kein Ende. – Wir mit unserer gemächlichen Schiffscruise kommen uns ziemlich altbacken und wenig abenteuerlich vor.
Nach dem Ausflug noch ein Drink im Städtchen - es ist bemerkenswert, wie bei Sonnenschein alles gleich anders aussieht. Die unzähligen Strassencafés und Bars sind plötzlich belebt, es hat Musikanten, alle haben gute Laune, wir auch.
Sogar für ein kleines Einkäufli langt es noch. Theo hat wieder Unterhosen verloren (???) und alle drei Tage die restliche zu waschen, macht wenig Sinn. So werden nach längerer Diskussion neue gekauft: superschöne! Kiwis sind drauf in Orange auf schwarzem Grund; diejenigen, wo’s drauf hiess „Sweet Ass“, auf die haben wir verzichtet.
Zum Nachtessen gibt’s Menu Nr. 2: Hohrückensteaks mit Kartoffeln und Salat. Wir packen auch schon wieder, aber diesmal ist’s einfacher: Einen Koffer lassen wir nämlich da und reisen nur mit leichterem Gepäck. Dazu aber kommt eine Kühlbox. Die ist unerlässlich, gehört hier schliesslich zur Ausrüstung. Sie macht uns viel Kiwi-authentischer. Zudem haben wir noch einen Pick-Nick-Rucksack bei uns, ausstaffiert mit Tellern, Besteck und Gläsern, so dass wir wieder mal wie die Camper eine Mahlzeit im Freien einwerfen können.
On the road: Von Queenstown nach Te Anau und zum Milford Sound
Wir nehmen’s gemütlich. Um zehn pünktlich erscheint das Putzpersonal; wir fahren weg Richtung Süden. Es hat kaum Verkehr unterwegs, so alle zehn Minuten kommt uns ein Fahrzeug entgegen. Nach ungefähr zwei Stunden sind wir in Te Anau, dem Ausgangspunkt zum Fjordland. Milford Sund ist das Thema hier, alles dreht sich fast nur darum. Es gibt unzählige Anbieter, Busse der verschiedenen Gesellschaften kurven im Ort herum. Trotzdem: Sehr viele Leute hat es nicht, zu der Jahreszeit hätte ich mir das anders vorgestellt. Ich habe gestern bereits per Internet gebucht, so muss ich mich dem Entscheidungsstress heute nicht mehr aussetzen. Wir haben also Zeit, ein wenig ans Ufer des Sees zu gehen, wieder mal in die Sonne zu liegen, die sich so unendlich rar macht, und zu lesen. Lange haben wir das Vergnügen nicht, schon ist der Himmel wieder bedeckt. Ich habe ein Zimmer für zwei Nächte in einem B&B gemietet, und das bereits im April, weil hier jetzt Hochsaison ist und ich sicher sein wollte, dass wir eine Unterkunft haben. „Sheakespeare’s House“ heisst die Bleibe und unser Zimmer „Henry V“. Alles tip top, gut gelegen; Margaret, die Besitzerin, gibt uns nützliche Tipps und macht ein sagenhaft leckeres Frühstück.
Im Kino läuft ein Film übers Fjordland; er dauert eine halbe Stunde und Margaret hat uns eindringlich empfohlen, ihn zu sehen. Er wird täglich dreimal gezeigt, es kommen ja auch jeden Tag neue Touristen, so geht das schon. Den schauen wir uns an – und ja – fantastische Filmaufnahmen aus dem Helikopter, die diesen einmalig schönen und zum grössten Teil unberührten Naturpark zeigen. Anschliessend Happy-Hour in der Kinobar, auch nicht schlecht - das Leben ist doch wunderbar.
Essen im „Dolce Vita“. Richtig italienisch diesmal, wir finden’s Spitze. Zur Vorspeise die grossen, grünen Muscheln, die wir so gern haben, dann Nudeln Carbonara, eine Flasche australischen Shiraz aus meiner Handtasche, für den wir nicht einmal ein Zapfengeld bezahlen müssen, und Theo kann doch ein paar Worte Italienisch parlieren mit dem Besitzer und dem Kellner.
Grosses Problem am nächsten Morgen: Die Schifffahrt, die ich gebucht habe, beginnt bereits um elf, wir müssen um acht Uhr spätestens abfahren, um rechtzeitig dort zu sein, das heisst also, um sieben Uhr aufstehen. Das ist eine Zeit für Theo, die er nur noch aus seinen Militärtagen kennt, und die sind längst vorbei. – Erstaunlicherweise tut er sich gar nicht so schwer damit, mir fällt einfach auf, dass er kein Wort sagt. Margrets feines Frühstück und das wolkenlose Prachtswetter heben seine Lebensgeister. Wir fahren rechtzeitig los und denken, es habe dann sicher recht viel Verkehr unterwegs nach Milford Sound. Seltsamerweise ist dem überhaupt nicht so. Umso besser.
Unterwegs hat’s verschiedene Lookouts. Die meisten lassen wir links oder rechts liegen, damit wir nicht die Zeit vertrödeln. Aber den „Mirror Lake“ wollen wir uns dennoch ansehen. Unglaublich, die Spiegelwirkung dieser drei kleinen Seen. Kein Wind bläst, man hat den Eindruck, da sei nicht Wasser, sondern tatsächlich Spiegel.
Wir können fast nicht fassen, was wir mit dem Wetter für ein Glück haben. Heute ist‘s wirklich 1A. Kaum hab ich das gesagt, kommt in der Höhe plötzlich ein dichter Nebel auf. Mit dem haben wir überhaupt nicht gerechnet. Wenn’s mal nicht regnet…
Der riesige Parkplatz ist ziemlich stark belegt, aber wir finden trotzdem eine Lücke. Um elf geht unsere Tour los. Den Mitre, der höchste und bekannteste Berg, sieht man nicht, auf den Fotos, die herumhängen, schon. Er muss also da sein. Es herrscht dichter Nebel und bei den Passagieren eine Art Katerstimmung. Es ist wirklich schade, dass die Sicht so schlecht ist, die Fahrt hat ja schliesslich über 100 Fr. gekostet pro Person, da würde man schon gerne das sehen, was einem die Prospekte versprechen. Aber klar, fürs Wetter kann niemand zur Rechenschaft gezogen werden. Verschiedentlich wurde uns gesagt, auch bei Regen sei der Milford Sound sehenswert, die Wasserfälle seine dann noch spektakulärer. Aber ich denke, etwas müssen sie ja sagen, um die Besucher zu trösten und bei der Stange zu halten. Das Schiff fährt durch den Fjord, die Felsen auf beiden Seiten fallen fast senkrecht ins Wasser. Die Szenerie ist beeindruckend. Das Schiff fährt ganz nah an die Felsen heran, man sieht Seehunde und die Wasserfälle sind wie überdimensionierte Duschen. Nach 14 km erreicht das Schiff die Tasmanische See. Cook ist offenbar mehrmals am „Eingang“ des Fjords vorbeigefahren, ohne zu erkennen, welche Schönheit dahinter verborgen liegt. Könnte ja sein, dass es neblig war… Hätte er sehen können, wie viele Touristen 240 Jahre später täglich dort spazieren gefahren werden, ich weiss nicht, ob er das geglaubt und was er sich dabei gedacht hätte.
Das Schiff wendet und fährt wieder in den Fjord hinein. Und ganz langsam beginnt sich der Nebel zu lösen. Wir werden zum Conservatory gebracht, einer 10 Meter tiefen Unterwasserstation, die mit Fenstern ausgestattet ist, so dass man wie ein Taucher sehen kann, was da im Meer vor sich geht. Schwarze Korallen kommen normalerweise erst in 100 Meter tiefem Wasser vor, hier aber sind sie schon 10 Meter unter dem Meeresspiegel angesiedelt. Sie sind übrigens weiss und nicht schwarz. – Wie wir die 60 Treppenstufen wieder nach oben steigen und nach draussen gehen, hat das Wetter stark gebessert. Jetzt sieht alles ganz anders aus. Die Farben werden immer intensiver, man erkennt Berge, die vorher nicht zu sehen waren, auch Schneeberge. Jetzt kann ich mich fast nicht mehr satt sehen. Den Mitre gibt es wirklich.
Auf dem Rückweg erkennen wir, was wir am Morgen wegen des dichten Nebels verpasst haben. Die Strasse erinnert uns an den Julierpass - Felsen, Schnee, Steine, es ist eine malerische Fahrt. Wir merken erst jetzt richtig, wie hoch der Hunter-Tunnel in die Felsen eingemeisselt ist. Er wurde Ende des 19. Jhd. mit „normalen“ Werkzeugen von fünf Arbeitern erstellt. Er ist einspurig, unbeleuchtet und an beiden Enden hat’s grüne Vögel, die vor dem Eingang „herumlungern“ und die fast nicht von der Strasse wegzuscheuchen sind, weil sie sich um etwas Essbares zanken. Ich lese nachher, die Kea seien Hochland-Papageien, die nicht fliegen können und vom Aussterben bedroht sind. Kein Wunder. Wir waren das erste Auto vor dem Tunnel und ich musste aussteigen, um die Vögel dazu zu bewegen, Platz zu machen, damit sie nicht überfahren würden. Sie sind wirklich schön, wenn sie sich aufregen, flattern sie herum wie die Hühner und man sieht, dass sie unter den Flügeln ganz rote Federn haben.
Unterwegs möchte ich noch einmal die Mirror Lakes besuchen, will der Anblick so einmalig war, aber diesmal ist es ganz anders. Ein Wind weht, es hat kleine Wellen und dadurch halt keine Spiegelwirkung mehr. Man sieht auch auf den Grund, weil die Sonne anders einfällt – was am Morgen so magisch schien, ist verschwunden. Ich bin so froh, haben wir uns am Morgen die Zeit genommen, die Seen zu besuchen.
Nachtessen im Redcliff, dem besten Restaurant im Ort. Es war tatsächlich sehr gut, aber wir mussten über eine Stunde aufs Essen warten. – No worries, wir haben ja Zeit.
On the road: von Te Anou nach Dunedin und Wanaka
In der Nacht fängt es wieder an zu regnen. Am Morgen auch noch. Um zehn sind wir reisebereit und fahren der Southern Scenic Route entlang. Unterwegs gibt’s einen ersten Halt an der „Clifton Suspension Bridge“. Sie wurde 1898 erbaut, man kann sie zwar zu Fuss noch überqueren, aber der Verkehr wird über eine neuere Brücke geleitet. Gut sieht sie aus. Ich mag Brücken sehr.
In Tautapere, wo wir ein ganz charmantes Café und Museum finden, halten wir erneut an, um eine Tasse Kaffee zu trinken. Eigentlich eine Krimskrams-Ausstellung, aber irgendwie mit einer herzlichen und liebevollen Atmosphäre, gutem Kaffee und leckeren, home-made Gebäcken, besonders zu erwähnen die Rüeblitorte mit der dicken Zuckerglasur obendrauf.
Daneben ein Laden, „Art- und Crafts Centre“ steht auf dem Schild, wo lauter gestrickte und gehäkelte Baby-Kleidchen und sonst welche Handarbeitsartikel zum Kauf angeboten werden. Mir wird sofort klar, das müssen Frauen vom Dorf sein, die sich da an Strickmodellen gegenseitig überbieten. Und so ist es. Die dürre, ältere Dame, die dort sitzt, eingehüllt in einen selbstgestrickten Schal, und die fein säuberlich alle Verkäufe notiert, so es welche hat, bestätigt meine Vermutung. Es ist aber schön warm im Raum, sie hat ein Feuer gemacht im Cheminée. Ich kaufe ihr ein kleines Etui ab für Taschentücher mit Teddy Bären drauf. Vielleicht kann’s ja dann Ella gebrauchen. Jetzt hat die Lady was zum Notieren und Einkassieren. Ins Gästebuch sollen wir uns auch noch eintragen. Rührend irgendwie.
Weiterfahrt Richtung Invercargill. Es wird immer „strüber“ mit dem Wetter. Wir sind jetzt an der Südküste und der Wind bläst, so dass man kaum mehr das Auto verlassen kann, ohne dass es einem die Tür aus der Hand reisst. Ich bestehe aber darau, bei diversen Aussichtspunkten anzuhalten, Theo kann ja im Auto bleiben, und das tut er auch. Beim „McCrackens Rest“ geht’s zwar grad noch, da lassen wir uns sogar noch fotografieren. Am „Gemstone-Beach“ geb ich meine Exkursion aber auch rasch auf, es regnet von allen Seiten, ich bin innert Sekunden völlig durchnässt.
Einen weiteren kurzen Umweg fahren wir zu „Cosy Nook“, einer kleinen Fischersiedlung. Es hat nur etwa vier Häuser dort und ein paar Boote. Auch nach „Colac Bay“ gibt’s einen Abstecher. Dort hat’s einen schönen Sandstrand und sogar ein paar Surferinnen, was eher erstaunt bei dieser Witterung. Am Morgen war’s 9 Grad, jetzt nur gerade 15 und der Chillfactor…
Speziell ist der Friedhof in diesem Ort: Er sieht aus wie ein leeres Fussballfeld, und es hat genau drei Gräber dort. – Was mir besonders gefällt: die Haltestellen für den Schulbus: Ein Bus ist draufgemalt und die Passagiere sind die ganze Simson- Crew. Bei der nächsten Haltestelle ist Homer Simpson am Surfen.
In dieser wilden Gegend ist es nicht schwer zu erkennen, woher der Wind weht. Es gibt Baumgruppen, die alle in eine Richtung geneigt sind, und zwar so stark, dass sie fast am Boden liegen. Der Baum, der dem Wind direkt ausgesetzt ist (es sieht aus, wie wenn er die anderen beschützen würde), ist nicht mehr grün, sonder bereits abgestorben. Sehr speziell! Ich weiss gar nicht, wie diese Bäume heissen. Muss mich mal erkundigen. Solche Baumgruppen gibt es en masse.
In Invercargill zu bleiben, davon haben uns viele abgeraten, da gäbe es nicht viel zu sehen. Das Museum hingegen sei einen Besuch wert. Gegen zwei Uhr sind wir dort. Die Tourist Information ist im Museum untergebracht, sehr praktisch. Ich habe nämlich ausnahmsweise noch keine Unterkunft gebucht, weil ich dachte, wir wollen mal sehen, wie weit wir kommen und wo es uns gefällt, da bleiben wir dann. Jetzt wissen wir mehr und ich möchte in der Nähe von Fortrose oder Tokanui übernachten, dem Ausgangsort zu den Catlins. Die freundliche Angestellte gibt uns aber zu bedenken, dass es in dieser Gegend überhaupt keine Unterkünfte hat, nicht einmal Motels. Einzig ganz im Süden, beim Waipapa Point Lighthouse gäbe es eine Farm und die würden ein Cottage vermieten. Also, einverstanden, das nehmen wir. Der Leuchtturm ist sowieso unser erstes Ziel entlang der Küste, trifft sich bestens. Restaurants habe es aber keine in der Gegend, wir müssten uns dort selber versorgen, es sei ein voll eingerichtetes kleines Haus. Ok, wir gehen halt vorher noch einkaufen. Wir erhalten weitere gute Tipps für die Weiterreise. Es muss sehr viel zu sehen geben in den Catlins, dem südlichsten Gebiet der Südinsel. Die Wetterprognosen allerdings lassen keine übertriebenen Hoffnungen aufkommen.
Wir schauen uns das Museum an und die Galerie. Es sind zwei absolut lohnenswerte Stunden, die wir dort verbringen. In der Galerie stellt eine Frau aus, in deren Werk habe ich mich sofort verliebt: Sie stellt Geschöpfe dar aus verschiedenen Materialien, vor allem Ton und Metall, die eigentlich wenig hübsch aussehen, aber eine ganz liebevolle Ausstrahlung haben. „The boy who realised he can communicate with extraterrestrials“ oder „The girl who knittet her dream lover”. So lustig. Sie sieht schon grässlich aus, ihr gestrickter Traumgeliebter noch viel krasser.
Im Museum, wie zu erwarten, sind viele Maorischnitzereien ausgestellt, ebenfalls Steine, Muscheln, Tiere und ein ganzer Stock ist den sechs Inseln und deren Geschichte gewidmet, die zwischen der Antarktis und Neuseeland liegen, „the Roaring Forties“, absolut unwirtliche Gebiete, aber auch dort haben Menschen versucht, sich eine Existenz aufzubauen. Unverständlich! Auch gab es verschiedene Gruppen von Schiffbrüchigen, die auf den Inseln Zuflucht fanden. Einige mussten bis zu 20 Monaten dort ausharren. Kaum vorstellbar!
Wie wir das Museum verlassen, sehen wir blauen Himmel. Sehr, sehr unüblich! Dieses absonderliche Wetterphänomen lädt zu einem kurzen Bummel durch den Queens Park ein.
Eine Stunde dauert die Fahrt zu unserer ländlichen Unterkunft. Wir wollen ja erst noch einkaufen. Eigentlich haben wir alles, was es zum Überleben braucht, bei uns: Spaghetti, ein Gläschen Jamie Oliver Pesto Rosso, Toast, Butter, Orangensaft, Milch, Käse, Schinken, Wein, Mineralwasser. Nur der Salat fehlt. Da ist Theo mal ganz schnell mit seinem Vorschlag: „Wenn wir jetzt gehen und auf den Einkauf (Salat) verzichten, schaffen wir’s vielleicht noch grad, den Leuchtturm bei schönem Wetter zu sehen. Wer weiss, wie’s morgen ist…“. Ich bin einverstanden, verkneife mir sämtliche Bemerkungen und wir fahren los. Das war genau die richtige Entscheidung. Das Wetter hält, der Leuchtturm steht auf einem kleinen Hügel umgeben von grasbewachsenen Dünen, sehr abgelegen und schön anzusehen. Es ist Ebbe und wer hätte das gedacht: Da liegt doch tatsächlich ein Seelöwe am Strand. Erst denke ich, der sei vielleicht tot, aber er ruht sich nur aus, macht offenbar Siesta, lässt sich von uns auch nicht beirren. Theo überlegt einen Moment lang, ob er sich dazu legen soll (wie in Brisbane zu den Kängurus), lässt es dann doch sein, denn das Tier richtet sich auf und das macht einen gewissen Eindruck.
Das war’s dann auch schon mit dem schönen Wetter. Vorhin konnte ich eine Foto machen mit strahlend blauem Hintergrund, jetzt ist wieder alles normal: grau in grau.
Wir erreichen unsere Unterkunft. Beim Bauernhaus empfängt uns Tim, der Farmer, und zeigt uns das Cottage. Ein wirklich nettes Häuschen, eine Art Schuhschachtel eigentlich. Ringsum hat’s Schafe, Ziegen und Kälber, die uns neugierig betrachten. Wir richten uns ein, stellen die Heizung an und machen’s uns gemütlich. Teigwaren gibt’s natürlich und zu Theos Freude zur Abwechslung keinen Salat.
Wir haben den Eindruck, wir seien im nördlichsten Norden, aber wir sind ja im südlichsten Süden. Es sieht ganz so aus, als würde das keinen grossen Unterschied machen. In der Nacht bläst der Wind ums Cottage herum wie gestört, so dass ich denke, unsere Unterkunft fliegt bald davon oder sie bricht in Stücke. Es regnet in Strömen, und es ist kalt. Mir tun die Tiere leid. Einen Stall haben sie ja nicht. – Wir überleben aber alle. Theo sagt am Morgen zwar, sein linkes Auge sei eingefroren, aber das ist halt so ein „Theo-Spruch“. Unter der Dusche ist’s warm, im Wohnzimmer können wir heizen. Alles ok. Es ist ja Sommer.
Das Wetter scheint besser zu werden, die Tiere grasen emsig, die kleineren versinken fast in ihrem Futter. Es ist so wechselhaft, das Wetter. Gerade noch schön, jetzt hagelt’s und die Geissen rennen wie gehetzt ins Wäldchen unter den Schutz der Bäume. Kurz darauf, wenn ich zum Fenster herausschaue, ist der Himmel wieder blau gegen Westen, die Tiere wieder auf der Weide, auf der anderen Seite gegen Osten jedoch ist der Himmel tief schwarz. Das wird nicht lange dauern, bis die nächste Schütte kommt.
Genau so ist es. Und genau so geht’s weiter den ganzen Tag lang, am Anfang im 10-Minuten-Rhythmus, später wechselt’s jede halbe Stunde. Man kann fast die Uhr danach stellen. Um elf Uhr fahren wir los nach einer weiteren Hageleinlage. Beim Curio-Beach gibt’s den versteinerten Wald zu sehen, kaum sind wir dort, fängt’s wieder an zu regnen, und nicht zu knapp. Wir flüchten ins Auto. Die gleiche Szenerie am nächsten Strand, am Porpoise Bay. Man könnte dort Delphine, Pinguine und Surfer sehen, heisst es im Führer, von denen lässt sich bei dieser Witterung jedoch keiner blicken. Ein paar Surfer hat’s zwar, aber die sind am Zusammenpacken, am Strand ist niemand. Der Wind ist eh so stark, dass es einen fast wegbläst. Und kalt ist es: 12 Grad und dazu kommt noch der Chillfaktor.
Es regnet in Strömen und wir bleiben mit dem Auto stehen, es ändert sicher wieder. Das ist das Gute dran und lässt niemanden verzagen. Es kommt mir vor wie ein Spiel: im Auto warten, bis der Regen stoppt und sich die Sonne wieder zeigt, rasch raus und ansehen, was man ansehen will, zurück ins Auto und warten, bis die nächste Dusche vorbei ist. Wenige Kilometer weiter gibt‘s das „Niagara Falls – Café“, dort kehren wir ein. Wir setzen uns in den Wintergarten und können uns wunderbar aufwärmen. Inzwischen scheint nämlich wieder die Sonne und der Himmel ist blau, blau, blau, grad wie wenn gar nichts gewesen wär. – Den „Niagara Fall“ sehen wir uns selbstverständlich bei diesem Wetter auch noch an. Es heisst, es sei „World‘s smallest waterfall“. Und so ist es wohl. Lustig, wirklich. Die „Fluten“ „stürzen“ über ein etwa dreissig Centimeter hohes Steinmäuerchen hinunter. - Da hat einer der Pioniere Humor gehabt bei der Namensgebung.
Der nächste Wasserfall, der „McLean Fall“ ist umso spektakulärer. Da prasseln die Wassermassen ins Tal, dass es nur so dröhnt und das Spezielle dran ist zudem die Farbe des Wassers. Es ist ganz dunkelbraun. Wir lesen später, dass hier die Erde voller Torf ist und die Verfärbung daher rührt. Das Wasser sieht sehr ungesund aus. Auch ein See in der Gegend hat dieselbe Farbe. Da möchte man nicht schwimmen gehen. Übrigens hat’s in diesen Gewässern auch keine Fische. - Es regnet wieder, wir fahren zum nächsten Wasserfall, dem am meisten fotografierten in ganz Neuseeland, heisst es. Der „Purakaunui –Fall“. – Seltsame Statistik. Ok, wir tragen auch dazu bei. Wir haben das Zeitfenster wieder genau richtig getroffen, die Sonne scheint, der Wasserfall zeigt sich im besten Licht. Wie ein Vorhang fällt er über verschiedene Steinterrassen. Wie allerdings der Weg dorthin aussieht, ist fast nicht zu beschreiben: Wasserlachen, tiefer Sumpf, Gummistiefel wären das Richtige, Theos Discoschleifer eher weniger. – Gegen fünf kommen wir in Owaka (Ort des Kanus) an. Ein seltsamer Ort, gross angelegte Strassen, da könnte mal Paris draus werden, etwa 350 Einwohner nur, die begegnen sich aber wohl kaum. Eine Tankstelle, drei Hotels und Restaurants, ein Supermarkt, ein Frisör, ein paar Geschäfte, wo man nur raten kann, dass es sie mal gab, weil noch Teile ihres Namens auf den abgebröckelten Fassaden erkennbar sind.
Wir finden Unterkunft im Okawa-Lodge-Motel und sind sehr zufrieden damit. Es ist ein Studio mit Küche und Bad, wie man sie oft hier findet. Die Heizung funktioniert, das ist vom Allerwichtigsten.
Da es immer noch regnet, besichtigen wir das Dorf-Museum, das sich gleich gegenüber unserem Motel befindet. Bisher fanden wir alle diese kleinen lokalen Museen überaus besuchenswert. Sie sind mit viel Liebe gestaltet und was man da alles erfährt über die Gegend und die Geschichte, ist jeweils sehr interessant. Schon oft haben wir festgestellt, dass die Neuseeländer extrem an ihrer eigenen Familiengeschichte interessiert sind. Ahnenforschung ist absolut im Trend und so findet man zahllose Ordner, in denen akribisch aufgeführt ist, was an Wissen vorhanden ist.
Nugget Beach Lighthouse: Das gleiche Szenarium wie wir es schon gewohnt sind: Schönes Wetter bis zum Parkplatz, Regen. Wir warten, bis der Regen aufhört. Das dauert fünf Minuten. Der Spaziergang zum Leuchtturm und zurück dauert 40 Minuten. Das wird ohne Regenschauer nicht reichen, aber henusode. Wir haben unsere Regenjacken und sind waterproof. Der Walk den Klippen entlang ist wunderschön, weit unten sieht man Robben sich tummeln, und es gelingen ein paar gute Fotos, bis es wieder zu regnen beginnt.
Kaffee und Kuchen in Kaka Point, wo sich Theo sehr um eine ausrangeierte Kirche interessiert, an der angeschrieben steht: „For Sale“. – Das fehlte grade noch! Als Fotomotiv eignet sie sich allerdings bestens.
Wir fahren weiter nach Dunedin, der achtgrössten Stadt in Neuseeland, von der Einwohnerzahl her etwa gleich gross wie Bern, von der Fläche her nicht zu vergleichen.
Das B&B, das ich ausgelesen habe (in einem alten, viktorianischen Haus untergebracht, das extrem an England erinnert), ist bestens gelegen, fünf Minuten zu Fuss vom Zentrum entfernt, so dass wir ohne Auto problemlos Stadtspaziergänge machen und abends essen gehen können, einmal thailändisch, einmal italienisch.
Am 15. Januar ist das Wetter ausnahmsweise so gut und schön, dass wir den Tag am Strand von St. Clair verbringen, einem Vorort von Dunedin. Wassertemperatur 14 Grad.
Wir besuchen aber auch das „Royal Albatross Centre“ auf der Otago Halbinsel. Es ist der einzige Ort auf der ganzen Welt, wo man Albatrosse auf dem Festland brüten sehen kann. Die Vögel sind brilliante Segler; sie schwingen sich in unglaublicher Lässigkeit und Eleganz durch die Lüfte. Weniger geschickt sieht es aus, wenn sie am Boden landen. In enem seiner Trickfilme hat Disney perfekt und spassig dargestellt, wie das aussieht. Es ist tatsächlich auch in natura so: Nicht selten purzeln sie ein paar Meter weit, bis sie schliesslich zum Stillstand kommen. – Da bleibt kein Auge trocken…
Am nächsten Tag, bevor wir Richtung Wanaka weiterreisen, kurzer Besuch der Boy-School. Die haben ja Ferien, der Campus ist also ausser dem Sekretariat ziemlich verlassen. In der Eingangshalle fallen uns die Ständer auf, auf denen Plakate hängen, wo bestimmte Schüler speziell erwähnt und gepriesen werden wegen ihrer Leistungen. Solche Auszeichnungen öffentlich aufzustellen wäre bei uns absolut undenkbar, all die Bemerkungen, die da fallen würden von wegen Strebertum und Ähnlichem, das ginge gar nicht.
Ich möchte mir noch das Olveston Historic Home anschauen, in der Beschreibung heisst es, es sei eines der ältesten Privathäuser in ganz Neuseeland, gebaut anfangs des 20. Jahrhunderts, ein schönes Beispiel eduardischer Bauweise. Wir besichtigen es nur von aussen, innen hätten wir eine einstündige Führung mitmachen müssen, aber Theo hat seine Protestminute und findet es total daneben, dass wir zu Hause x Schlösser haben, die viel, viel älter sind als dieses Ding und die gehen wir nie besuchen. Übrigens regnet es gerade wider.
Also halt Weiterfahrt an die Bedford-Street, die sich rühmt, die steilste Strasse der Welt zu sein und es damit ins Guiness-Buch der Rekorde geschafft hat. Steiler noch als in San Francisco soll sie sein und mit Betonplatten belegt, da der Asphalt abrutschen könnte. Ich darf sie hinauffahren, zuoberst ober-mühsam wenden und wieder hinunterfahren.
Jetzt sind wir parat für die Weiterfahrt durch die Goldgräberstädte ins Landesinnere der Region Otago.
In Lawrence gibt’s einen Zwischenhalt mit Kaffee, Kuchen, Museum und Spaziergang den historischen Gebäuden entlang. Während des Goldrauschs stieg die Einwohnerzahl innerhalb eines Jahres von wenigen Duzend auf 11‘000 an, jetzt wohnen noch knapp 400 Leute dort. Ein Tasmanier, Thomas Gabriel Read, hat seinerzeit den Goldrausch ausgelöst in diesem Ort (ab 1861). Man kann sich gar nicht vorstellen, wie es ihm gelang, am richtigen Ort zu graben und gleich Gold zu finden. Nach ihm ist der Ort benannt: „Gabriel’s Gully“: ein Tal wie ein anders auch, und ein Jahr später sieht’s aus, wie wenn Maulwürfe Einzug gehalten hätten, überall kleine Erdhügel, abgesteckte Claims, ein Zelt am anderen. All das sieht man auf den Fotos im Museum. Am Ort selber sieht das Tal wohl wieder mehr oder weniger so aus, wie’s vor dem grossen Ansturm war.
Weiterfahrt über Alexandra. Seen, Stauseen, karge Landschaft, bizarre Gesteinsformen, es wird nicht langweilig. In Cromwell machen wir einen Halt. Um diese Stadt herum hat’s unzählige Plantagen von Früchten: Äpfel, Aprikosen, Kirschen und natürlich Trauben. Nicht mehr lang und wir erreichen Wanaka, das Interlaken der Südinsel. Was ist nur mit dem Wetter passiert? 26 Grad und kein Regen. - Nicht zu fassen. Wir beziehen unsere zwölfte Homelink-Unterkunft, erneut mit wunderbarem Blick über den Wanaka-See, die Stadt und die schneebedeckten Berge im Norden. Apéro auf dem Balkon. Wir finden’s ziemlich heiss, weil wir ja solche Temperaturen gar nicht mehr gewohnt sind. Plötzlich kommt ein Wind auf, ich muss die Gläser halten, damit sie nicht umfallen, es ist klar, Nachtessen können wir nicht mehr draussen, der Wind ist zu stark. Nach unserem BBQ schauen wir uns im Fernsehen einen Match von von Roger Federers im Australian Open in Melbourne an.
Wanaka
Mit Wind haben wir ja so allmählich unsere Erfahrungen, aber was hier passiert, ist die absolute Spitze. Die ganze Nacht lang bläst’s und heult’s ums Haus herum, es knackt im Gebälk, so dass man kaum schlafen kann. Theo steht dreimal auf – ein Jahrhundertereignis. Er träumt von schreienden Kindern (die er retten will) und Einbrechern, wie er mir am nächsten Tag erzählt. Um halb vier Uhr morgens ist’s plötzlich ruhig, aber offenbar werden wieder Kräfte gesammelt, um gegen acht mit neuer Puste und frischem Elan loszublasen. Die Stühle und der Tisch auf dem Balkon sind umgeworfen, das Wetter wär wunderschön, aber es bläst einem fast davon. Wanaka liegt auf 300 Metern über Meer, trotzdem kommt es uns vor, wie bei uns in den Bergen tausend oder tausendfünfhundert Meter höher.
Nach dem Frühstück fahren wir ins Dorf, nehmen unsere Strandtücher und Badesachen mit, aber besser hätten wir Windjacken und Daunenwesten angezogen, der Wind ist extrem. Wir finden ein Café mit Internet (dummerweise hat’s kein WIFI in „unserem“ Haus) und erledigen ein paar E-Mails. Zudem versuche ich, den Fortgang unserer Reise weiterzuplanen. Im Ort ist viel los, es wimmelt nur so von Sportlern, denn am nächsten Tag findet ein Gigathlon statt. Der Himmel ist noch immer stahlblau, niemand ist im Badeanzug, obwohl der Stand voller Leute ist. Ich bin aber sicher, wenn wir ein windgeschütztes Plätzchen fänden, können wir wunderbar sonnenbaden. Das ist aber nicht so einfach. Trotzdem werden wir auf der anderen Seite des Sees hinter einem Wäldchen fündig. Erstaunlich, in den Baumwipfeln bläst der Wind noch wie wild, am Strand beziehungsweise am Ufer kann man ohne weiteres liegen, lesen und es ist keineswegs zu kalt. Im Gegenteil, so ein laues Lüftchen wär doch ganz schön…
Ravioli gibt’s zum Nachtessen (Menu Nr. 3), Salat natürlich vorher und anschliessend verfolgen wir weitere Matches am Australian Open am Fernsehen.
Am folgenden Morgen um sechs schon ist aus und fertig mit Schlafen. Für mich jedenfalls. Der Gigathlon hat begonnen, einer brüllt durchs Megaphon Anweisungen über den See und übers ganze Gebiet. Neben mir liegt Theo mit seiner Motorsäge und dem Versuch, den Lautsprecher zu übertönen. Wie er wohl diesmal den Lärm da draussen in seinen Traum einbaut? Er wird es mir erzählen und darüber klagen, wie schlecht er geschlafen habe…
Um Viertel vor sieben kommt noch ein Helikopter dazu, der das Geschehen überwacht, fotografiert oder was auch immer. Ich hab genug und stehe auf. Von da, wo ich auf dem Sofa sitze und schreibe, habe ich Sperrsitz auf das, was da unten am See alles läuft. Es muss bitter kalt sein. Die Masse von Zuschauern und Athleten, die am Ufer stehen, sind alle warm angezogen. Jetzt werden die Schwimmerinnen und Schwimmer losgelassen, der am Megaphon flippt fast aus mit seinen Ansagen und vor lauter Ansporn. - Ich mach mir mal eine Tasse Tee.
Theo taucht auf und beklagt sich, dass er schlecht geschlafen habe… Nach dem Morgenessen haben wir etwas Grosses vor. Ich schlug gestern vor, eine Wanderung zu machen (10 km / 3-4 Std.) zum Rob Roy Glacier. Theos sah nicht gerade glücklich aus, als er merkte, dass es mir ernst war mit meiner Absicht, aber ich übersah sein Stirnrunzeln geflissentlich. Jedenfalls ging er ins Informationszentrum um zu fragen, wie steil, wie lang und breit diese Wanderung denn sei. Grosse Bedenken. Aber ok, über Nacht hat der Gedanke offenbar Fuss gefasst und es sieht aus, als ob er sich ins Unabänderliche schicken wird. Das Problem ist allerdings, dass die Strasse, die dorthin führt, bis um 12 Uhr geschlossen ist wegen der Sportveranstaltung. Das ist wirklich Pech, denn es dauert eine Stunde, bis wir dort sind und eigentlich würde ich lieber so gegen zehn Uhr spätestens starten. Ich packe meinen Rucksack, denke, für die kurze Strecke langt einer längst. Theo will seinen Sportsack auch mitnehmen (den peinlichen, wo „Swiss“ draufsteht), prall gefüllt mit fast einer Überlebenspackung. Natel-Ersatz-Akku, für den Notfall, eine halbe Biwak-Ausrüstung würde er ebenfalls gerne mitnehmen; man weiss ja nie... Nur mit Mühe kann ich ihn davon abhalten und ihn überzeugen, dass wir nur wenig brauchen und dass alles längst in einem Rucksack Platz hat. Um halb zwölf fahren wir ins Dorf, um dann parat zu sein, wenn die Strasse wieder offen ist. – da können wir noch lange warten. Immer wieder kommen Athleten angekeucht, das wird noch ewig dauern. Und jetzt beginnt es noch zu regnen. Nein, also nein: Unser Vorhaben ist ins Wasser gefallen.
Wir gehen heim und machen uns einen gemütlichen Nachmittag, sehr zu Theos Wohlgefallen.
Noch am Nachmittag um vier höre ich den Lautsprecher über den See dröhnen. Wenn der Typ nur langsam heiser würde…
Es gibt ein wunderbares, kleines Kino hier in Wanaka, das „Cinema Paradiso“, geführt von jungen Leuten. Sie backen home-made Cookies, auch ihr Eiscreme ist selbst gemacht, man kann Wein und Bier und was auch immer kaufen und mit in die Vorstellung nehmen, es hat sogar eine Pause (sehr unüblich sonst in den Kinos hier), und wenn diese beginnt, kommt eine junge Frau und fragt uns „guys“, ob uns der Film gefällt und ob es zu warm oder zu kalt sei, sie würde dann die AC an- beziehungsweise ausschalten. – So zuvorkommend. Es hat sicher etwa zwanzig verschiedene Arten von Sitzen, zusammengekauft wohl aus Secondhand-Institutionen und aus ausrangierten Kinos. Ebenfalls ein altes Auto steht im Saal und auch dort hat’s vier verschiedene Sitze drin, die hinteren leicht erhöht, so dass man sich dort wie im Drive-In-Cinema fühlen kann. Der Film war „Jack Ryan: Shadow Recruit“, Action pur, Action bis zum Gehtnichtmehr und dann geht doch noch mehr. Ernst nehmen kann man das Ganze ja nicht, aber immerhin hat der Held doch hin und wieder eine unbeduetende Wunde abgekriegt. Das waren zwei Stunden voller Unterhaltung und Spannung, bis zum Bauchweh fast. Die beiden Kritiken, die wir gelesen haben, sind sehr lustig aufgemacht, aber nicht allzu wohlmeinend. Den Titel des Films habe man wohl schon vergessen, wenn man wieder daheim sei, meint der eine Kritiker, der andere findet Kenneth Branagh (hier der Bösewicht – sonst ja eher ein Shakespeare-Darsteller) eine völlige Fehlbesetzung, er als Regisseur habe sich selber wohl als Schauspieler gewählt, damit er nicht so viel Gage bezahlen müsse. Ersterer wiederum meint, wenn der Regisseur selber mitspielt, mache es wenigster einer richtig, die anderen Hauptdarsteller hätten ja gerade mal so viel Charisma wie das, was man sich am Morgen aufs Toastbrot streiche. Na ja, bei mir ist es Butter, Theo hat gern Margarine, Emmentaler, Schinken und am Schluss dann noch Marmelade. Hat tatsächlich alles keine Ausstrahlung…
Von Wanaka nach Christchurch
Schon wieder ist es Zeit abzureisen. Diesmal geht’s nordwärts, erst mal in Richtung Mount Cook. Gesehen haben wir ihn ja bereits vom Flugzeug aus, jetzt wird’s ernst. Es ist ein strahlend schöner Tag, das sind wir nicht mehr gewohnt, aber wir freuen uns natürlich sehr darüber. Erst besuchen wir die Geisterstadt Bendigo. Stadt ist übertrieben. Das war einmal. Es ist nur noch eine halbe Ruine vorhanden und im Gebiet, wo im vorletzten Jahrhundert Zentimeter für Zentimeter nach Gold gegraben wurde, gibt es noch ein paar offene Schächte und Teile von Maschinen, aber wirklich zu sehen ist fast nichts. Unser erster Kaffeehalt ist in Twizel, einem Ort, der erst in den Sechzigerjahren errichtet wurde für die Arbeiter, die den Damm am Lake Pukaki bauten. Nach Abschluss der Bauarbeiten hätte der Ort wieder aufgehoben werden sollen, aber die Bewohner begannen sich dagegen zu wehren und inzwischen hat sich das Dorf fast zu einem Touristenzentrum gemausert wegen der Nähe zum bekannten Reiseziel Aoraki - Mount Cook.
Am Pukaki See entlang führt die SH 80 bis ins Mount Cook Village. Eine Stunde lang dauert die Fahrt. Die Farbe des Sees ist tief türkisblau, fast kitschig. Auf den Fotos wird’s aussehen, als ob wir den Photoshop ein wenig zu sehr strapaziert hätten. Man kann gar nicht glauben, dass so eine Farbe möglich ist. Der Grund dafür sind Mineralien. Kein einziges Haus steht am See, kein Boot ist irgendwo zu sehen, offenbar lebt auch kein Fisch im See. In der Schweiz wär das ganz anders. Aber hier… Es ist ein majestätischer Anblick: im Hintergrund die schneebedeckten Berge und im Vordergrund dieser fast unnatürlich wirkende See. Beinahe ein wenig gespenstig kommt er mir vor. Wir erreichen das Village und haben Glück, dass wir in der Aoraki-Backpacker-Lodge noch ein Doppelzimmer erhalten. Diesmal hab ich nämlich keine Unterkunft gebucht, weil ich dachte, wenn das Wetter schlecht ist, hat’s keinen Sinn, in die Berge zu fahren, um den Nebel zu bestaunen. So wie bei uns in Zermatt jeweils die armen Japaner, die das „Hore“ nur auf den Postkarten sehen. Aber alle beglückwünschen uns geradezu zu unserem Glück, die Bergwelt in ihrer wolkenlosen Pracht zu erleben. - Grossartig, ja. Wir geniessen es. Es ist auch endlich warm, der Anblick der Gletscher, die zum Greifen nah scheinen, grandios. Ein wunderbares Nachtessen im Restaurant und ein feines Frühstück am nächsten Morgen - uns geht’s wieder mal mehr als nur gut.
Am folgenden Morgen hat’s zwar wieder Nebel, aber wir haben sie ja gestern zur Genüge gesehen, Mount Cook (3754m) und Konsorte, The Footstool, Mount Sefton. Eigentlich dachte ich, wir würden dann noch eine Wanderung machen an diesem Tag, aber auch dieses Vorhaben scheint ins Wasser zu fallen. Wie wir allerdings fertig sind mit dem Morgenessen, wird’s wieder schön, wir schnallen unsere Wanderschuhe (eher Allround-Tennis-Sneakers) an und ziehen los, umgeben von lauter Japanern, die dasselbe Ziel haben, den Walk zum Kia-Point. Wir nehmen’s gemütlich, die Aussicht ist einmalig. Auf dem Rückweg sind wir fast allein. Die ganze Wagenladung Japaner musste wohl rasch wieder zurück zum Mittagsbuffet ins Hotel gebracht werden. Wir fahren anschliessend ins Tasman-Valley und eine weitere kurze aber steile Wanderung führt uns zu einem Aussichtspunkt, von dem aus man ein paar kleine Seen und den Tasman-Gletscher sieht. Hier geht’s wohl nicht anders als bei uns: Er hat sich zurückgezogen, das untere Ende ist braun und scheint dreckig, obwohl Abgase kaum der Grund dafür sein können. Der See unten am Gletscher ist grau-grünlich, ein paar wenige Eisblöcke sind noch zu sehen drin, das Wasser soll ein halbes Grad warm/kalt sein.
Wir fahren die SH 80 zurück, aber ich will unbedingt unterwegs mal die Füsse ins türkisfarbene Wasser halten. Es ist nicht einmal sehr kalt, aber irgendwie wage ich nicht, darin zu schwimmen, ich weiss eigentlich auch nicht, wieso. Vielleicht, weil niemand sonst das tut. – Im Nachhinein reut es mich.
Wir fahren weiter an den Lake Tekapo. Immer noch ist das Wetter herrlich, es ist Sommer – endlich (oder zumindest ein warmer Frühlingstag). Im lokalen Reisebüro finden sie uns sofort ein Motel direkt am See. Es ist ein Bijou. Der See ist genauso blau wie der Lake Pukaki, ein sensationeller Ferienort ist das. Und es ist uns sogar gelungen, die am meisten fotografierte Kirche in ganz Neuseeland ebenfalls abzulichten. Mit ein paar Japanern drauf. Wir haben uns wirklich gefragt, wie’s möglich ist, so viele Touristen anzulocken, um eine kleine Kirche zu fotografieren, die 1925 gebaut worden war. Schön gelegen ist sie zwar, sie hat keinen Altar, statt dessen ein Fenster, durch das man auf den See und die Berge im Hintergrund sehen kann. Da muss in einem Reiseführer gestanden sein, diese Kirche sei sehenswert und schon pilgern tausende von Touristen dorthin (wir ja auch...). Noch an Abend um acht, wie wir dran vorbeifahren (100 Meter von unserer Unterkunft entfernt), hat es drei Autobusse dort stehen und eine ganze Traube von Leuten mit ihren Kameras. 50 Meter nebendran steht aus Bronze ein Denkmal für einen Hund. Dank dem Collie war’s möglich, in dieser Gegend (MacKenzie) die Schafzucht einzuführen. Der Hund wird dann gleich mitfotografiert, ist wohl auch der am meisten geknipste Hund in ganz Neuseeland. Selbstverständlich hab ich auch da zur Statistik beigetragen, ich will mich doch nicht abgrenzen.
Apropos Reiseführer: „Theo, wo hast du den Reiseführer?“, fragte ich, „Ich will etwas nachschauen.“ - Den haben wir nicht mehr. Einmal mehr nicht mehr! Ich kann’s nicht fassen. Gestern noch hab ich ihn meinem lieben Ehemann aufs Bett gelegt und ihn gebeten nachzulesen, was der nächste Tag bringen wird. Er ist ihm aber irgendwie geglückt, das Buch, das nota bene fast ein Kilo wiegt, so zwischen seinem Bett und der Wand hineinzuquetschen, dass ich es nicht mal mehr bei der Nachkontrolle beim Verlassen des Zimmers gesehen habe. Dabei ging ich extra nochmal zurück (schlechte Erfahrung hat mich das gelehrt), ging auf die Knie und schaute unters Bett, ob da auch wirklich nichts mehr lag. – Ich glaub’s ja nicht. In Polen schon ist genau dasselbe passiert im letzten Sommer. In einem Hotel in Danzig gibt’s einen Reiseführer, der eigentlich uns gehört. Und der Neuseeland Reiseführer wurde uns ja auch bereits mal nachgeschickt von der nördlichsten Stadt auf der Nordinsel nach Auckland. Die Ablage in der Rückenlehne des Vordersitzes im Autobus war damals die Bleibe, die Theo für unser Buch ausgesucht hatte. – Jetzt ist es wieder weg. Im Mount Cook Village. - Am Ufer des Sees versuche ich, meinen Ärger ein wenig zu vergessen; ich lege mich in die Sonne und lese eine gute Stunde lang in meinem neuen Krimi, den ich grad angefangen habe. – Wir gehen dann ins Dorf, kaufen Fish and Chips (Fisherman’s Choice) und essen dieses Pick Nick auf unserem Balkon mit einer Flasche Roten und Blick auf den See. Das Schöne ist, bis um neun ist’s hell und wenn der Wind endlich aufhört zu blasen, ist’s ganz angenehm warm.
Am Morgen gibt’s wieder Frühstück auf unserer Terrasse. Wir haben Toastbrot gekauft, Butter, etc. haben wir noch. Milch gibt’s immer frische in den Motels, das gehört zum Service. Die erste Tätigkeit dann ist, die Dame in der Tourist-Information zu fragen, ob sie Kontakt aufnehmen könne mit dem Motel, in dem unser Reiseführer übernachtet hat. Gefunden hat ihn noch niemand, Theo muss ein remarkables Versteck für ihn gefunden haben. Jemand geht dann nochmals nachschauen ins Zimmer 552; wir warten auf den Rückruf – und ja, das Buch ist gefunden worden. Es musste ja dort sein. Ich frage dann, ob eventuell irgendjemand, der nach Christchurch fährt, das Corpus Delicti mitnehmen und es dort auf der Tourist-Information abgeben könne. Ja, das ginge, erklärte mir der nette Manager, ein Bus fahre am nächsten Morgen dorthin, er würde den Chauffeur beauftragen, das Buch mitzunehmen und dort abzugeben. – Es gibt zwar hundert Broschüren und wir haben ja auch immer wieder mal Internet-Zugang, aber der Reiseführer ist mir wichtig. Ich habe damit weitgehend unsere Reise geplant, Notizen reingeschrieben, es ist alles gut erklärt, hat Karten und ist übersichtlich gegliedert. Deshalb war ich ärgerlich, dass das Buch zum zweiten Mal verschwand und jetzt ganz glücklich, dass wir es eventuell, wenn alles gut geht, wieder erhalten werden.
Wir nehmen nicht die normale Route der Küste entlang nach Christchurch, sondern die SH 72, die Inland Scenic Route. Sie führt uns durch weites Landwirtschaftsgebiet, vorbei an Tausenden von Schafen einmal mehr, an Rindern und an ein paar Pferden. In Geraldine gibt’s einen Kaffeehalt und einen Museumsbesuch. Es ist wieder schönes Wetter und wir wollen uns ein Plätzchen suchen an einem See oder Fluss, um ein wenig an der Sonne zu liegen und zu lesen. Theos tägliche Siesta ist nach wie vor ein Muss. Wir finden einen Fluss, den Rakaia-River, einer von denen, die wir vom Flugzeug aus gesehen haben und die uns stark beeindruckt haben, weil sie so sehr mäandern und in voller Breite durch die Gegend fliessen. Wir fahren durch eine Schlucht und oberhalb des Flusses hat es einen Campingplatz. Dort halten wir mal an. Aber es reisst uns fast die Tür aus der Hand, so stark bläst der Wind. Wir pilgern zum Fluss hinunter, dort ist ebenfalls kein Bleiben. Die Bäume, die vom Sturmwind wie wild hin- und hergerissen werden, machen mir Angst. Im Windschatten einer dichten Hecke finden wir doch ein Plätzchen und die Siesta kann statfinden.
Gegen sechs sind wir in Christchurch (der englischsten Stadt in Neuseeland) und finden unsere neue Homelink-Adresse. Zuerst zwar fast nicht, es sind alles kleine Häuschen, dicht aneinander gedrängt und die Nummern sind kaum lesbar. Der Schlüssel stecke unter der Matte, hat mich Fjona wissen lassen. Nachdem ich etwa drei Matten vor fremden Haustüren gelüftet habe, werde ich endlich fündig. Ein kleines Haus ist’s diesmal, keine Aussicht, aber völlig ok für die drei Nächte, die wir hier nur verbringen werden. Unsere Homelink-Partner, Fjona und Iain, haben eine Farm etwa zwei Stunden nördlich von hier und das Haus hier ist ihre Bleibe, wenn sie in der Stadt zu tun haben. Fast zeitgleich mit uns kommen sie vorbei, zeigen uns alles und wir machen uns bekannt. Die beiden sind ein sehr sympathisches, nettes Ehepaar, sie laden uns auch ein, auf ihrer Farm vorbeizukommen und dort zu übernachten auf unserem Weg in den Norden. Mal sehen, eigentlich hab ich die Unterkünfte zum Teil schon gebucht. Sie haben uns den Kühlschrank gefüllt mit feinen Sachen, so dass wir fast nicht mehr Platz haben für all die feinen Sachen, die wir gerade eben eingekauft haben. Jetzt haben wir alles doppelt; 2 l Milch, 12 Eier, 4 l Orangensaft etc. etc. Und Gipfeli haben sie gekauft für uns zum Frühstück morgen. Nicht etwa zwei, nein gleich zehn.
Sie müssen dann gehen und überlassen uns unserem Schicksal, welches da ist, Menu Nr. 2 zuzubereiten: Angus-Filet, Bratkartoffeln und vorher eine grosse Portion Salat.
Christchurch
Ein Besuch in der Stadt lehrt uns, dass entgegen unserer Vorstellung, nach dem Erdbeben vor drei Jahren sei alles wieder aufgebaut, da noch immer ein riesiger Trümmerhaufen vorhanden ist. Unglaublich, wie das aussieht: Die Kathedrale ist eine Ruine, Häuser sind teilweise noch vorhanden, andere werden wieder aufgebaut, überall hat’s riesige Lücken, leere Grundstücke, wo wenigstens schon der Schutt weggeräumt worden ist. So hat’s überall Parkplätze, überall auch Absperrungen, überall sind Strassen blockiert, weil gearbeitet wird, überall hat’s Umleitungen, Läden sind zum Teil in Containern untergebracht. Ein trauriges Bild. - Iain, der hier aufgewachsen ist, sagt, er kenne sich gar nicht mehr aus, weil so viele Häuser, an denen man sich hatte orientieren konnte, nicht mehr vorhanden seien; das Stadtbild muss jetzt völlig anders aussehen. In einem Vorort gibt’s eine Siedlung von 20‘000 leer stehenden Einfamilienhäusern, eine Geisterstadt.
Das Haus, wo die Touristeninformation beherbergt war, ist auch so sehr beschädigt, dass es nicht mehr brauchbar ist, der Wegweiser zeigt aber nach wie vor dorthin. Wir finden den neuen Ort aber trotzdem und fragen nach unserem Reiseführer. Davon weiss allerdings niemand was. Wir wollen schon abziehen, da kommt eine Japanerin herein mit unserem Guidebook in der Hand. So sehr hab ich mich noch nie über den Anblick einer Japanerin gefreut! Sie ist die Reiseführerin und soeben mit dem Bus von Mount Cook her angereist. So ein Zufall, dass wir grad zu der Zeit da sind.
Ich hab mein Buch wieder! Judihui! In Zukunft werd ich’s Theo nicht mehr geben, so viel steht fest!
Wir machen am Nachmittag einen Ausflug nach Akaroa, einem idyllisch gelegenen Ort auf der vorgelagerten Halbinsel. Die Fahrt dorthin dauert etwa eine Stunde. Kaffeehalt in der Hilltop Tavern, von wo aus man eine einmalige Aussicht hat. Der Ort hat einen französischen Touch, die Fahne der „grand nation“ hängt an ein paar Geschäften, auch sind etliche Ortsnamen in der Gegend französischen Ursprungs. Wir besuchen den historischen Friedhof und staunen, wie wir sehen, dass eine Vielzahl der Grabsteine vom Erdbeben umgeworfen worden sind und nun mit ausgedienten Autopneus gestützt werden. Ein einziger Pneufriedhof- ziemlich gewöhnungsbedürftig.
In ihrem Ferienhaus oberhalb des Städchens treffen wir Robyn und Mike, ein Ehepaar, mit denen ich durch Homelink Kontakt hatte, aber dann kam doch kein Tausch zustande. Wir machten aber ab, dass wir sie besuchen würden. Das taten wir dann auch, gingen zusammen essen und hatten einen angenehmen, interessanten Abend in einem kleinen Restaurant am Hafen. Hier erzählen natürlich alle vom Erdbeben, es ist in aller Gedanken und Munde. Überall habe es noch Schäden und man dürfe wegen der Versicherung nichts ändern oder flicken. Fotos würden nicht akzeptiert. Sie seien auf der Schadenliste 34‘000 und etwas. - Da werden sie wohl noch ein wenig warten müssen, bis sie an der Reihe sind mit der Schadensaufnahme.
Den nächsten Tag verbringen wir am Strand, dem Sumner-Beach. Schönes Wetter, blauer Himmel, aber wieder ein Wind vom Schtrübschte. Wir finden ein geschütztes Plätzchen hinter einer Düne, wo, wenn man flach im Sand liegt, es richtig heiss ist, ich kann nicht einmal barfuss gehen. Es ist aber trotzdem nicht nötig, sich im Wasser abzukühlen. Es reicht, aufzustehen und sich vom kalten Wind abkühlen zu lassen. So extrem hab ich das noch nie erlebt.
In die Stadt zurück fahren wir über die Scenic Route, die über die Hügel führt, und von wo aus man (zum x-ten Mal) einen grandiosen Blick über die Stadt, die Berge und den Strand hat.
Im Hagley Park findet ein einwöchiges World-Busker-Festival statt und das wollen wir nun besuchen. Sehr lange halten wir es nicht aus. Es ist sooo kalt. Nicht einmal mein vierlagiges Outfit vermag den Wind abzuhalten. So essen wir nur kurz etwas, hören und schauen noch kürzer einer Performance zu und verziehen uns heimzu. Wir sind schon Weicheier, muss ich sagen. Es hat sehr viele Leute dort, die ausharren, einige immer noch im T-Shirt, Girls in Hotpants und Flip Flops. Die sind eben härter im Nehmen als wir.
Am nächsten Morgen fahren wir ab Richtung Norden. Ziel ist Blenheim für heute Abend, Zwischenhalt wollen wir in Kaikura machen. Wir beschliessen, Fjona und Iain zu besuchen, deren Farm unterwegs auf unserer Strecke liegt. Sie haben ein feines Mittagessen für uns zubereitet und wir lernen sie ein wenig besser kennen. Was uns Iain von seiner Arbeit erzählt, beeindruckt mich enorm. - Er ist Ingenieur und arbeitet in Australien in irgendwelchen Minen. Sein Arbeitsweg ist 7‘000 km lang, er arbeitet meistens während vier Wochen, dann hat er eine oder zwei Wochen frei, wieder vier Wochen Arbeit etc. Australien sei ein harter Arbeitsort, aber gut bezahlt. Er habe erlebt, dass er am Morgen um sechs wie üblich im Office erschienen sei, der Boss habe dann ihn und etwa dreissig Mitarbeiter zusammengerufen und ihnen mitgeteilt: „We have plans. You are not included in these plans. There is a bus at eight which you can all easily catch.” – Das nach zweieinhalb Jahren bei derselben Firma. „Der Boss sei eigentlich ein „nice guy“ gewesen, mit dem er ganz gut ausgekommen sei. Er habe dann in aller Eile seine Werkzeuge und persönlichen Sachen zusammengesucht, und es sei ihm nichts anderes übrig geblieben, als mit seinen Kollegen den Bus zu nehmen… Und dies sei nicht das einzige Mal gewesen, dass ihm etwas in der Art passiert sei in Australien. – Harte Sitten. Undenkbar in Neuseeland, meinte er.
Fjona und er möchten jetzt ihre beiden Häuser verkaufen und nach Europa umziehen. Pikantes Detail: Iain sagt, ihm sei es egal, ob er von Europa aus oder von Neuseeland aus nach Perth, Australien, zur Arbeit gehe. Es sei so oder so ein weiter Arbeitsweg.
Ihr Haus ist völlig abgelegen, der nächste Laden ist mindestens 20 km entfernt. Es ist aber wunderschön dort. Ums Haus herum hat Fjona einen Rosengarten angelegt, allerlei Gemüse gibt’s im Garten, drei Hunde rennen herum, Sam, der älteste, wird sechzehnjährig. Auf der Weide steht ein Pferd. Alle Kinder hätten darauf reiten gelernt, erzählt sie uns. Jetzt erhält es sein Gnadenbrot. Brot und Konfitüre liebt es besonders. Es ist unglaubliche 34 Jahre alt, sieht aber ganz gut aus für sein Alter.
Nach einstündiger Fahrt sind wir in Kaikura. Den Ort kenne ich aus den Romanen, die ich gelesen habe. Die ersten Siedler dort betrieben Walfang und das muss schrecklich zu- und hergegangen sein. Grässlich, wie die Tiere abgemetzelt wurden damals. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei.
Es herrscht grad Ebbe und die Küste ist sehr zerklüftet. Offenbar lieben die Seehunde diese Bucht. Wir sehen recht viele, die sich von den fotografierenden Touristen überhaupt nicht beirren lassen; sie räkeln sich und dösen vor sich hin. Man hat fast das Gefühl, sie geniessen es, sich so zur Schau zu stellen.
Es ist eine lange Etappe zum Fahren heute. Nach knappen zwei weiteren Stunden kommen wir in Blenheim an und sind einmal mehr sehr zufrieden mit unserer Bed and Breakfast-Unterkunft. Es ist wirklich sagenhaft, wie freundlich, nett und hilfsbereit die Leute hier alle sind. Ein indisches Restaurant wird uns empfohlen, es sei das Beste auf der ganzen Südinsel. – Schön. Da gehen wir hin. Es ist, falls ich mich richtig erinnere, das fünfte, von dem das behauptet wird. Es ist Samstagabend und wir sind es gewöhnt, dass in den Städten überhaupt nichts läuft zu dieser Tageszeit. Aber hier ist’s doch mal anders. In einem Pub gleich um die Ecke (nur gerade da, sonst scheint der Ort ebenfalls ausgestorben) läuft tatsächlich ausnahmsweise was. Live-Musik, ein junger Mann unterhält die Gäste mit seinem Ein-Mann-Orchester. Ganz gut sogar. Wir können draussen sitzen, es ist mal nicht zu kalt, auch nicht für einen eisgekühlten Drink.
Der nächste Tag ist vom Wetter her eine ziemliche Katastrophe. Aber wir haben ja keine Eile, nehmen uns am Morgen Zeit, besuchen das Omaka Aviation Heritage Centre mit etlichen Flugzeugen und Artefakten aus dem Ersten Weltkrieg. Peter Jackson, der bekannte neuseeländische Regisseur, hat sehr viel Geld in die Präsentation der Exponate gesteckt. Es sind Szenen dargestellt mit Flugzeugen und Personen, die so echt aussehen, dass man das Gefühl hat, sie bewegen sich gleich. Und ja, ich muss sagen, auch mir hat der Besuch gut gefallen, obwohl ich am Anfang eher skeptisch war und dachte, ich lese dann lieber ein bisschen in Auto und lasse Theo alleine in der Militärgeschichte schwelgen.
Es sieht nach einem Landregen aus. Kein Problem. Wir sind in Marlborough, einer Gegend, wo hektarweise Rebbau betrieben wird (vor allem Sauvignon Blanc) und es unzählige Weingüter gibt. Wir besuchen drei davon, zwei ohne zu degustieren, bei der dritten kommen wir grad recht mit ein paar anderen Besuchern und probieren uns durch die ganze Liste durch, von Sauvignon Blanc über Chardonnay zu Rosé, zu Pinot Gris und Noir, Syrah und Merlot uns schliesslich zu guter Letzt zum Dessertwein. Dazu lassen wir uns von einer netten jungen Dame volltexten. Den Wein aus der Kellerei „Villa Maria“ wird auch in die Schweiz exportiert, vertrieben durch Bataillart. Dieses Wort muss sie uns allerdings aufschreiben, weil wir unmöglich verstehen können, was sie meint. Für den Hausgebrauch beziehungsweise für meine Handtasche kauften wir zwei Flaschen; Kartons kommen natürlich nicht in Frage.
Nur eine halbe Stunde dauert die Fahrt und schon sind wir in Picton, dem Ausgangspunkt zur Nord- oder je nachdem zur Südinsel. Von da gehen alle Fähren nach Wellington. Allerdings gibt’s jetzt ein Problem: Nur eine Fährgesellschaft ist momentan noch im Geschäft, da bei der anderen der Propeller abgebrochen ist und bis der repariert ist, dauert‘s mindestens drei Monate.
In unserem B&B haben die Besitzer bereits Fähnchen hingestellt für die Gäste, die heute hier übernachten: ein englisches, ein amerikanisches und ein Schweizer Fähnchen. Lieb – wirklich. Nach wie vor regnet es in Strömen, immer heftiger. Aber rechtzeitig zum Nachtessen wird’s wieder schön, trockenen Fusses und ohne Regenschutz gehen wir die paar Schritte bis zum Zentrum und suchen uns ein Restaurant. Der Fisch wär nicht schlecht, aber wieso auf einem einzigen Teller Fisch, Sauce, Kartoffelgratin und Salat mit Sauce serviert werden muss, leuchtet mir nicht ein. Klar kommt im Magen auch alles zusammen, aber vorher auf dem Teller…
Von Picton nach Queenstown
Am nächsten Tag schlafen wir aus, erhalten ein liebevoll zubereitetes Morgenessen und machen daraufhin einen kurzen Ausflug auf einen der vielen Hügel in der Nachbarschaft. Ein Lookout wiedermal. Leider zeigt sich die Sonne nicht wirklich berauschend, so lange es jedoch nicht regnet, sind wir zufrieden. Für den Nachmittag habe ich eine Bootstour gebucht, eine ganz besondere: die Beachcomber – Mailboat-Tour. Im Charlotte Sound hat es unendlich viele kleine Bays und Inselchen, wo Leute wohnen, abgelegen, oft nur mit dem Boot erreichbar. Diese Bewohner erhalten zweimal pro Woche ihre Postsendungen per Boot geliefert. Für den Service müssen sie nicht einmal bezahlen. Das Mail-Boot fährt direkt an den Landesteg, wird bereits erwartet und flux wird der Postsack ausgetauscht. In die entlegendsten Buchten fährt das Boot und wir staunen, wie der Kapitän mit grösster Nonchalance und Selbstsicherheit die Ziele ansteuert, durchs Fenster hindurch das Tau am Bootssteg anbindet, den Postsack austauscht und schon geht’s wieder weiter. Total cool. Das Boot ist nicht etwa ein Bötchen. Es hat für mindestens achtzig Personen Platz. „Was sowieso getan werden muss, mit dem Lukrativen verbinden“ ist hier wohl die Devise, so kann man gleichzeitig zur Arbeit eine Tour anbieten und ein paar zahlende Touristen mitnehmen. Clever!
Das Mailboot wird immer schon erwartet und nicht selten ist auch ein Hund dabei, der sehnsüchtig darauf wartet, vom Kapitän ein Hundebiscuit zu erhalten. Etwa zehn Mal geht das so, zweimal halten wir auch bei einem Holiday-Ressort an und nehmen Passagiere mit. Wir haben uns sehr warm angezogen, denn auf dem Boot bläst ein kalter Wind. Einmal steigen wir aus, nämlich dort, wo Captain Cook damals gelandet ist und die Flagge für sein Vaterland gehisst hat. Fünfmal ist er schliesslich in dieser Bucht gelandet und hat mit den Maori Handel getrieben.
Die Fahrt dauert gut vier Stunden, es wird aber nie langweilig, die Gegend ist absolut idyllisch und malerisch.
Am Abend essen wir im „Le Café“, einem Restaurant, das von einem Schweizer Koch geführt wird. Unnötig zu sagen, dass unser Nachtessen Spitze war.
Das Wetter ist wunderschön heute Morgen. Eigentlich wäre ich gerne so um neun Uhr gestartet, aber das geht nicht mit Theo. Um die Zeit steht er erst auf, wenn ich Glück habe. Um halb elf starten wir. Es ist keine lange Strecke, die wir zu fahren haben, es geht westwärts zum Abel Tasman Nationalpark, etwa zweieinhalb Stunden Fahrtzeit. Wir nehmen die Strasse der Küste entlang, den Queen-Charlotte-Drive. Lookouts (Shakespeare’s Bay, Gouvernor’s Bay, Aussie Bay und wie sie alle heissen) und Briefkästen kann man auf dieser Strecke en masse bewundern. Eine Bucht ist schöner als die andere und mit den Briefkästen scheinen sich die Bewohner dieser Bays gegenseitig übertreffen zu wollen. Einer ist kreativer gestaltet als der andere. Wenn ich da an unsere Schweizer Briefkasten-Normen denke…
Unterwegs machen wir Halt in Havelock „world’s green mussels‘ capital“, trinken einen Flat White am Hafen und fahren dann weiter nach Nelson. Von dort aus geht’s weiter über Motueka nach Little Kaiteriteri. - All diese Namen. Immer wieder muss ich mir Eselsleitern merken, um noch zu wissen, wo wir gewesen sind und wie der Ort, an dem wir uns aufgehalten haben, geheissen hat. Mein Kopf ist voller Eselsleitern – ein riesen Leiterhaufen ist da drin: wai und wa, ka, nui und kai – pi, pa, po. Manchmal geht’s einfacher: aus Tapawera wird für mich „Tupperware“. Andere Eselsleitern hab ich auch noch präsent: Unsere Autonummer. So einfach wie die FQU auf der Nordinsel ist’s nicht mehr, jetzt hab ich mir gemerkt: DZJ154: die zarte Jungfrau…
Wir haben wieder ein gemütliches B&B ausgesucht, ganz nah am Strand. Martin, der Gastgeber ist ein Spassvogel. Ich will ihn fragen, wo wir essen gehen könnten, da seh ich, wie er sich grad selber ein Znächtli zubereitet. Eine Büchse Spaghetti ist er im Begriff zu öffnen. Ich sag ihm, was ich davon halte und er meint, das sei eben „a boy’s meal“. – Den Inhalt der Büchse drapiert er auf ein Stück Toast und darüber noch ein Ei. - Auf seine Restaurant – Empfehlungen gebe ich nicht viel. Wir essen in Kaiteriteri, das wir nach einer kurzen Wanderung über den bewaldeten Hügel (mit Lookout am höchsten Punkt) am nächsten Strand erreichen. Schön, dass wir wieder mal draussen essen können. – Risotto und Ravioli.
Beim Frühstück tags darauf unterhalten wir uns mit Martin und seiner Frau Diane über dieses und jenes und auch über die hohen Preise, die man hier überall für Touren bezahlen muss (unsere Wassertaxifahrt hat auch schon wieder hundert Franken gekostet). Ich sage, wir würden uns dann rächen, wenn sie mal in die Schweiz kämen und unsere SBB benutzten. Das sei schon geschehen, meinte Martin, er habe sich überlegt, eine Hypothek aufzunehmen, als er mit dem Zug von Freiburg nach Basel reisen wollte.
Heute nehmen wir das Wassertaxi und fahren eine knappe Stunde nordwärts in den Abel Tasman – Park, an die Torrent Bay, was eigentlich nichts anderes ist als die über-über-über-übernächste Bucht. Es ist nicht möglich, mit dem Auto dorthin zu gelangen; der Park ist nur zu Fuss oder per Boot erreichbar. Am Strand werden wir ausgeladen. Es ist das erste Mal, dass ich meinen Rucksack mit dabei habe, weil‘s diesmal einen Hike gibt, der länger ist als „Theos-höchstens-zwanzig-Minuten-Spaziergänge“. Durch den Busch geht’s rauf und runter, und das während zwei Stunden, zurück zur vorherigen Bucht, Ancorage. Dort legen wir uns zwei Stunden lang an den Strand und freuen uns am klaren Wasser, dem gold-gelben Sand, lesen und warten dann wieder aufs Wasser-Taxi, das uns abholt. Am Strand hat’s nur wenige Leute, aber für hiesige Verhältnisse sind das recht viele, sonst sind die Stände ja menschenleer. Auch eine Ente wackelt mit ihren sechs Jungen zwischen den Touristen herum, Angst kennt sie keine. Zwei Stingrays schwimmen am Boot vorbei, mir kommt‘s vor wie in der Karibik.
Zurück im B&B duschen wir und fahren nach Motueka. Dort haben wir ein Kino entdeckt, in dem heute Abend „La cage doré“ – „The Gilded Cage“ läuft, den wir uns gerne ansehen möchten. Wir essen im „Hot Mama’s“, ich Laksa, Theo eine Lasagne, die leider mehr gross als gut ist, serviert mit einem Haufen Pommes-Frites, Catch-up und Salat, alles auf dem gleichen Teller. Sicher würde diese Mahlzeit Martin sehr gefallen.
Das Kino ist wieder so hübsch wie in Wanaka. Lauter verschiedene Sessel hat’s. Eigentlich sind es Sofas, was Theo sehr gelegen kommt. Es hat nämlich auch Hocker, auf denen man die Beine ausstrecken und kleine Tischchen, auf die man sein Getränk hinstellen kann. So kann Theo den Film liegend geniessen, in seiner Lieblingsstellung. Das geht problemlos, wir sind nämlich nur zu acht im Kino, der Film wird in der französischen Originalsprache mit englischen Untertiteln gezeigt. Er war Publikumsliebling bei den neuseeländischen Filmtagen und auch uns hat er sehr gefallen.
Westküste
Am folgenden Tag Weiterfahrt an die Westküste Richtung Süden. Wir haben mindestens fünf Stunden im Auto vor uns. Es ist richtig warm, 24 Grad zeigt das Thermometer, was ziemlich ungewöhnlich ist. Wir sind froh über die Klimaanlage. Es ist eine malerische Fahrt vorbei an Früchteplantagen, Weideland, unzähligen Hügeln. Kaffeehalt in Murchison und dann geht’s durch die Bullergorge, wo wir aussteigen und auf einer Hängebrücke den Buller-River überqueren. Passieren kann ja nichts, aber die Schaukelei, die Höhe, der Fluss, die steilen Felsen am Ufer und das Jetboot, das unten vorbeirast, beeindrucken mich schon. Unsere Unternehmung kommt mir jedenfalls sehr abenteuerlich vor.
Die Küste erreichen wir gegen vier Uhr nachmittags und obwohl wir inzwischen ja zahllose Strände, Buchten und Felsformationen gesehen haben, finde ich das, was sich uns hier zeigt, atemberaubend. Die wildesten und verrücktesten Gesteinsformationen sehen wir in Punakakei, nämlich die Pancake Rocks, wo die Kalksteinlagen wie Pfannkuchenberge aufeinander liegen, wo’s sogenannte Blowholes hat in den Felsen, so dass die Wellen wie wild hineinpreschen und mächtige Fontänen erzeugen. Man kann sich gar nicht sattsehen und auch –hören an diesen Naturschönheiten.
In Greymouth finden wir ein gutes Motel und gleich nebendran ein feines Restaurant. Ich probiere zum ersten Mal die Spezialität Whitebait. Das sind ganz kleine Fischchen, die man in Olivenöl anbrät, ein Ei dazu schlägt, Salz und Pfeffer beifügt und fertig. Die Omelette, die daraus resultiert, sieht nicht aus, wie wenn Fische drin wären. Zitrone drüber träufeln - köstlich.
An der Hafeneinfahrt von Greymouth sind etliche Schiffe gekentert, 35 Menschen bisher umgekommen. So nah am Ziel, fast nicht vorstellbar. Das Meer muss extreme Strömungen haben an diesem Ort. Eine Gedenktafel steht an der Fluss-Mündung.
In Hokitika (the cool little town) gibt’s Kaffee, ein Sockenmuseum- und Verkaufsladen und das nationale Kiwi-Zentrum. Kaffee trinken wir, Socken kaufen wir, Kiwis sehen wir. Endlich! – Zumindest einen. Mir wird immer schleierhafter, weshalb die Neuseeländer sich so sehr mit diesen unbeholfenen Vögeln identifizieren. In diesem Kiwizenturm gibt’s nur grad zwei Exemplare, ein Männchen, das so schüchtern ist, dass man’s gar nicht zu Gesicht bekommt und ein Weibchen, das wenigstens in die Nähe der Besucher kommt, so dass man es bei dem schwachen Licht bewundern kann, wenn auch nur schlecht. Es pickt mit seinem langen Schnabel im Boden herum und macht seltsame Sprünge fast wie ein Känguru. Man darf keinen Mucks machen, um die Tiere nicht zu erschrecken, Fotografieren geht gar nicht, wär auch gar nicht möglich bei der Dunkelheit, es dauert so oder so mindestens zehn Minuten, bis man sich ein bisschen an die dunkle Umgebung gewöhnt hat. – Seltsame Lebewesen, diese Kiwis!
Die Neuseeländer hätten sich lieber die Possums als Nationaltier gewählt, das wär viel einfacher. Jetzt aber setzen sie alles daran, diese Räuber mit Gift und Fallen um die Ecke zu bringen, um die raren Kiwis zu schützen. Pikantes Detail: In Australien sind die Possums geschützt.
Dann gibt’s noch Aale in einem grossen Wassertank zu sehen. Vierzig Weibchen sind’s. Sie werden zur Freude der Besucher dreimal täglich gefüttert. Irgendwie erinnern sie mich an die Koalas in Brisbane. Die meisten der Tiere bewegen sich kaum, ein paar nur kommen zur Fütterung, die andern liegen planlos nebeneinander herum beziehungsweise flauten reglos irgendwo im Wasser, wie’s grad kommt, und sind zu müde für die Nahrungsaufnahme. Das weckt noch andere Erinnerungen…
Den einen Aal nennen sie „die Grossmutter“. Er soll zwischen 120 und 140 Jahre alt sein (normal werden sie zwischen 80 und 100 Jahre alt). Sie sind auch ellenlang und dick, etliches grösser als sie in der Natur in Neuseeland vorkommen. Offenbar gefällt ihnen das Nichtstun in ihrem Gefängnis, in dem sie seit 18 Jahren herumhängen.
Genau an diesem Ort, dem Kiwizentrum, verliere ich Theo. Eben hab ich ihn noch gesehen, schon ist er nirgends mehr. Ich warte draussen, auch die beiden Angestellten am Eingang haben ihn nicht gesehen. Müsste er also noch drin sein. Bei den Aalen ist er nicht. Auch nicht bei den Kiwis. Ich rufe ihn, erhalte viele fragende Blicke von Besuchern, aber keine Antwort von Theo. Beim Auto ist er auch nicht. Ein Bücherladen ist keiner in der Nähe, das ist sonst jeweils ein Ort, wo ich ihn in solchen Situationen schon gefunden habe. Ich geh dorthin zurück, wo wir Kaffee getrunken haben, kein Erfolg. Erinnerungen an Filme kommen auf, einer mit Harrison Ford, wo er in Paris mit seiner Frau ankommt und diese plötzlich von der Bildfläche verschwindet. Im normalen Leben allerdings ist’s nicht ganz so ereignisreich. Eine Angestellte, die grad vom Lunch zurückkommt, findet ihn auf einer Bank liegend, seine Siesta machend. Er habe gedacht, dort sei ein Ausgang und da würde ich dann dran vorbeikommen und ihn sehen, entschuldigt er sich. – Der Ausgang ist aber dort, wo der Eingang ist und ich zwanzig Minuten auf ihn gewartet habe.
Übrigens könnte man auch ein historisches Gebäude kaufen in Hokitika, ein beachtliches. Wir lassen’s mal.
Nächster Halt an einem malerischen See, dem Lake Mahinapua, der mich an den Lac de Joux im Jura erinnert. Siesta wird eingeschaltet, Sonnenbaden, Lesestündchen. Weiterfahrt zu den Gletschern. In Franz Josef finden wir ein Motel, den Gletscher sehen wir nicht, es hat Nebel. Vielleicht morgen. Hier hat’s jetzt zur Abwechslung mal wieder ziemlich viele Leute. Vor allem sind es Junge, die in den Backpacker-Unterkünften logieren. Alle hoffen auf besseres Wetter am nächsten Tag.
Dem ist aber nicht so. Der Nebel hängt am Morgen bis ins Dorf hinunter. Wir nehmen’s gelassen und gemütlich, trinken im Dorf eine Tasse Flat White und warten im Gartenrestaurant bei angenehmer Musik und eingehüllt in Decken darauf, dass sich der Nebel lichtet. Das tut er dann netterweise auch, und zwar grad am richtigen Ort. Dort, wo der Franz Josef Gletscher ist, öffnet sich eine Lücke. Man sieht das Eis, den Berg, die Helikopter, die grad losdüsen, und wir begeben uns auch in besagte Richtung. Vom Parkplatz aus führt ein Weg zu einem Lookout; den schlagen wir ein. Eine gute halbe Stunde dauert der Spaziergang. Schön ist, dass wirklich nur genau das Stück Berg und der Gletscher zu sehen sind, welche alle gerne sehen möchten; die umliegenden mit dichtem Busch bewachsenen Hügel sind vom Nebel verhangen und nur bis zur Hälfte sichtbar.
Wir fahren eine halbe Stunde weiter nach Fox Glacier. Auch hier dreht sich alles um den Gletscher, speziell natürlich die Helikopter-Rotoren. Der Nebel hängt hier noch tiefer und wenn man nicht wüsste, dass der Mount Cook und der Fox Gletscher tatsächlich dort sind, würde man es kaum glauben.
Erst fahren wir ein paar wenige Kilometer weiter an den Lake Matheson, wo’s einen See hat, in dem sich Mt Cook und seine Kollegen spiegeln. Wenn sie im Nebel sind, natürlich nicht. So trinken wir nur etwas und obwohl es recht heiss geworden ist und der Himmel blau abseits der Berge gegen das Meer zu, mag sich das Gewölk über den Alpen nicht zu lichten. Wir lassen also den Spiegelsee See sein und fahren weiter zum Parkplatz, von dem aus die Wanderwege zum Gletscher beginnen. Eine Stunde soll’s dauern, steht auf dem Schild. Nach zehn Minuten erreichen wir eine Stelle auf dem Weg, von wo aus man eine Gesamtaussicht auf den Gletscher hat. Theo möchte lieber umkehren, er hat ja gesehen, was es zu sehen gibt. Er macht ein relativ säuerliches Gesicht, als er erkennt, dass ich den ganzen Weg zu Ende gehen will und mich von ihm davon nicht abhalten lasse. Nach weiteren zwanzig Minuten geht’s nicht mehr weiter, man ist aber bereits recht nah am Gletscher und kann die Strukturen, Spalten und Farben gut sehen. Es ist sehr eindrücklich und Theo gibt zu, er sei ganz froh, dass er doch auch bis hierher mitgekommen sei. – Was für ein Kompliment!!!
Wir fahren weiter der Küste entlang Richtung Süden. Ausser über den Bergen ist der Himmel blau und wolkenlos. Es ist eine lange Fahrt durch weite unbewohnte Gegenden. An einem Küstenabschnitt steigen wir aus. Bruce Bay. Der Strand ist voller Schwemmholz und Steine. Es wäre ein Paradies für Steinesammlerinnen und –Sammler, aber das geht ja nun leider gar nicht. Ich kann‘s zwar nicht lassen, sammle trotzdem ein paar schöne Exemplare, die ich dann in Queenstown im Garten deponieren werde. Es ist ein besonderer Anblick, noch bemerkenswerter in mancherlei Hinsicht ist aber die Tatsache, dass es überall lauter Sand- oder Black-Flies hat, gleich wie im Milford Sound. Diese kleinen, schwarzen, elenden, stechwütigen Biester sind eine absolute Pest. Man sieht sie kaum, aber sie sind all überall. Wir flüchten ins Auto. Aber dort hat es sich eine Hundertschaft der Quälgeister auch bereits bequem gemacht und sich eingerichtet, mit der Absicht, uns bis aufs Blut zu peinigen. An den Scheiben hängen sie herum, in der Mittelkonsole wollen sie eine Siedlung gründen, an meinen Füssen tun sie sich gütlich. Diese Invasion ist das Schlimmste, was uns auf unserer Reise bisher passiert ist (abgesehen vom zweimaligen „Verlieren“ unseres Guide-Books), also können wir uns eigentlich ganz glücklich schätzen. Trotzdem sind die Blutsauger eine Qual, und ich weiss genau, wir werden noch tagelang an sie denken. Wir versuchen unsererseits, sie zu plagen beziehungsweise zu liquidieren, aber ganz so gut funktioniert das nicht, immer wieder findet eine den Weg auf unsere Haut. Zum Glück hab ich den Insektenspray in Griffnähe und spraye damit alles voll, so in der Not und Eile auch mein Smartphone. Dem macht’s zum Glück nichts, den Mücken leider auch nicht so viel. Schon wieder schwirrt eine herum. Auch beim nächsten Lookout sind sie sofort zur Stelle, eine neue Crew diesmal, total motiviert fliegen sie ihren Einsatz und treten sogleich in Aktion. Theo steigt schon gar nicht aus. Er ist voll damit beschäftigt, die Viecher im Auto zu vernichten, die neu hereingekommen sind, weil ich die Autotür geöffnet habe. Die wollen jetzt ihre Kollegen besuchen und haben ja Aussicht auf frische Opfer.
Eigentlich wollen wir in Haast übernachten. Aber wenn das dort so eine Sandfly-Hochburg ist… Wir müssen aber dort übernachten, es geht nicht anders, weil der Haast-Pass in der Nacht geschlossen wird, wie wir später erfahren. Es hat ein paar ganz schlimme Unfälle gegeben in der letzten Zeit; es gibt halt immer wieder Felsstürze und wenn es regnet und stürmt, ist die Strecke mehr als nur gefährlich. Man erzählt uns, dass im September ein Campervan mit einem jungen Paar drin von der Strasse gefegt worden sei und man sie erst eine Woche später im Tobel gefunden habe.
Einen Umweg nach Wanaka gibt’s nicht, also doch, schon, über den Arthur Pass, das wären an die tausend Kilometer.
Haast Beach: Ein Motel, ein Mini-Supermarkt, eine Tankstelle. Es ist noch ein Zimmer frei, das Motel heisst „Erehwon“. Der Name kommt mir sehr bekannt vor. Der Besitzer hilft mir auf die Sprünge: Es gibt ein Buch von Samuel Butler, das so heisst. Ich hab’s vor mehr als vierzig Jahren gelesen (Maturlektüre sogar). Es ist eine Satire, den Namen muss man rückwärts lesen, dann heisst es eben „Nowhere“. Ja, und das passt. Wir haben das Gefühl, wir seien hier im Nirgendwo gelandet. Zum Glück hab ich meinen Mückenstecker mitgenommen. Das ist so ungefähr das Erste, was ich aus dem Koffer hole und montiere.
Ein kurzer Weg führt zum Strand. So weit das Auge reicht, zieht er sich über die Küste hinweg, keine Bucht, nichts als Sand und Meer. Und natürlich Mücken wie gestört. So halte ich mich nicht eben lange dort auf, sondern gehe zurück ins Nirgendwo.
Haast Junction ist 4 km weiter weg an der Hauptstrasse gelegen: eine Tankstelle, ein sehr gutes Visitor Center (interessante Informationen über die Gegend, eine Art Museum auch), ein Motel und doch zumindest ein Restaurant. Dort gehen wir essen. Wie wir eintreten, nicke ich dem Koch zu und grüsse ihn. Da sehe ich, wie der gleich die Arme verrührt. Offenbar hat er wenig Freude, zwei weitere Gäste zu sehen. – Das fängt ja gut an, denke ich. Es könnte natürlich sein, dass ich mich getäuscht habe und er nur ein paar Mücken verjagt hat, ich also seine Geste missdeute. Wir müssen sehr lange warten, bis wir unsere feinen grünen, riesigen Muscheln erhalten, anschliessend das Pouletbrüstchen. Aber gut war’s. Nach dem Essen unterhalte ich mich kurz mit dem Koch und er gibt zu, dass er nicht grad Freude hatte an den vielen Gästen (viel = ungefähr zwanzig), da er alleine war in der Küche. Aber er freut sich sehr über unser wohlwollendes Feedback. Er entschuldigt sich, dass es so lange gedauert hat, bis das Essen parat war. Wir haben ja Ferien und geniessen den Sonnenuntergang während des Wartens sehr. Er ist erleichtert zu hören, dass wir nicht sauer sind. Theos Bier jedenfalls ist gratis. Auf der Terrasse zu sitzen so fern ab von allem, war ganz wunderbar. Auch war‘s amüsant, den Gesprächen der anderen Gäste zuzuhören. Die drei beleibten Typen am Tisch vor uns sind schon in die Jahre gekommene Töff-Giele; sie haben gleich zweimal eine röhrende Show geboten, bevor sie ihre heissen Stühle vor dem Restaurant parkiert und auf der Terrasse ihr Bier in sich hineingekippt haben. – Links von uns sitzen vier ähnliche Typen. Sie sind Strassenarbeiter, angestellt, um die Strasse über den Haast-Pass, die vor kurzem an einer Stelle wieder verschüttet wurde, von den Felsbrocken zu befreien. Auch diese Männer sind nicht eben vom elegantesten Schlag und mit der edelsten Sprache begnadet.
Wir schlafen ruhig und ohne Mücken im Zimmer, aber ich wache ein paar Mal auf, weil mich die Juckerei an den Füssen fast zum Wahnsinn treibt. Ich habe mindestens fünfzig Stiche an jedem Bein und tue mir selber leid.
Am nächsten Morgen um zehn Uhr fahren wir los. Mal sehen, wie viele unserer Freunde im Auto die Nacht überlebt haben. Hoffentlich keine. Ein, zwei Exemplare hat’s doch noch. Ich zermalme sie an der Scheibe. Übrig bleibt ein Blutgeschmier.
Es ist der 2. Februar. Blauer Himmel, etwa 25 Grad – ein prächtiger Tag und eine wunderschöne Fahrt über den Haast-Pass (564 m über Meer, etwa grad so hoch wie Ittigen), dem teilweise breiten Haast-Fluss entlang, der oft fast nur aus einem Bachbett aus Steinen besteht und sich zwischendurch in eine tiefe Schlucht gegraben hat. Zwei Wasserfälle gibt’s unterwegs zu sehen (Thunder Creek Falls, Fantail Falls. - Roaring Billy Falls haben wir nicht gesehen, aber mit gefällt der Name). Fast verpasst hätten wir die Blue Pools, weil der Walk dorthin und zurück eine halbe Stunde dauert und das knapp an der Grenze des für Theo Zumutbaren liegt. Ich bestehe aber auf dem Spaziergang, denn Zeit genug haben wir ja. Zwei Hängebrücken müssen wir überqueren, gratis diesmal, und der fantastische Anblick des klaren, türkisblauen Wassers der verschiedenen Poole oder Becken, die der Haast Fluss dort bildet, hat den Aufwand allemal gelohnt. Das muss auch Theo zugeben.
Die Tracks sind immer gut beschildert und meistens gibt’s zudem Informationen über Flora und Fauna. Hier ein wenig Hintergrund zu den Sandflies, den mir Theo mit Freuden vorliest: Es seien nur die Weibchen, die sich so unangenehm und hartnäckig verhalten. Sie brauchen Blut für ihre Eier. - Der Mann, der neben uns steht und mitliest, sagt: „Nothing new“. – Weiter heisst es, die Mücken lassen sich besonders von der Farbe Schwarz und Rot anziehen. Ich hab heute ein schwarzes T-Shirt angezogen…
In Makarora machen wir Halt, Rüeblitorte hat’s und kein Gingerbier. Also ein Cola Zero.
In Wanaka wird der Tank gefüllt; Theo hat die letzten zwanzig km bereits Angst, dass uns das Benzin ausgeht, aber das tut es schon nicht. Der Clutha River, kurz vor Wanaka, erinnert uns an die Aare. Er ist prächtig, etwa gleich kühl, türkisfarben, aber nicht ein Hundertstel so viele Leute wie bei uns im Sommer baden und vergnügen sich drin. Wir legen uns ans Ufer, baden und lesen ein wenig. Während dieser knapp zwei Stunden sehe ich grad mal vier Gummibote und etwa zehn Schwimmer. Nicht unbedingt wie im Marzili. Über die Cardrona Valley Road oder Crown Range Highway (von wegen Highway…) fahren wir nach Queenstown. So eine schöne Strecke. Mitten drin gibt’s den kleinen Ort Cardrona (kaum mehr als 100 Einwohner), ein ehemaliges Goldgräberstädtchen (damals 5‘000 Einwohner), jetzt ein Winter Skiort. Kurz vorher entlang der Strasse entdecke ich eine ganze Reihe Büstenhalter auf etwa hundert Metern Länge an einen Zaun geheftet. Das sieht mehr als nur cool aus. Und Theo hat’s gar nicht bemerkt. Er muss umkehren. – Wie ich später im Internet lese, hängen die nicht einfach so dort. Hintergrund ist offenbar Brustkrebs (Cardrona Bra-Fence: www.tagblatt.de/Home/nachrichten/ueberregional/blick-in-die-welt_artikel,-Aerger-mit-Dessous-Ein-mit-BH-behaengter-Zaun-ist-in-Neuseeland-eine-beliebte-Attraktion-_arid,244335.html">www.tagblatt.de/Home/nachrichten/ueberregional/blick-in-die-welt_artikel,-Aerger-mit-Dessous-Ein-mit-BH-behaengter-Zaun-ist-in-Neuseeland-eine-beliebte-Attraktion-_arid,244335.html).
In Queenstown waren wir schon, es ist ganz schön, wieder an diesen pittoresken Ort zurückzukehren, obwohl er ja den Endpunkt unserer Neuseeland-Reise bedeutet. Noch drei Übernachtungen, dann fliegen wir nach Melbourne.
Anders als bei unserem ersten Besuch hier müssen wir aber nicht mehr heizen, im Gegenteil, es ist noch am Abend um sieben 26 Grad warm. Wir essen Spaghetti auf dem Balkon und geniessen die wolkenlose, traumhafte Aussicht auf die kleine Stadt und schauen zu, wie nach neun Uhr langsam die Nacht einbricht und die Berge immer dunkler werden.
Unseren zweitletzten Tag in Neuseeland nehmen wir sehr gemütlich. Auf einer der Halbinseln, die in den Wakatipusee hineinragen, finden wir ein schönes Plätzchen zum Sonnenbaden, Lesen, den Booten Zuschauen, die über den See treiben oder rasen. Am Abend fahren wir mit der Gondel auf den Bob’s Peak, einen der umliegenden Berge, von wo aus man die perfekte Aussicht auf Queenstown hat. Im Preis inbegriffen ist das Nachtessen im Restaurant. Es ist ein herrliches Buffet mit vielen feinen Sachen, Seefood, eine grosse Auswahl an Hauptspeisen und Desserts. Alles ist schön zubereitet, alles sehr gepflegt, der Service ausgezeichnet.
Es hat mindestens zweihundert Gäste im Restaurant, ungefähr 5% Weisse, alle anderen sind Chinesen und Japaner. „Little China Town auf dem Gurten“, sagt Theo. Das chinesische Neujahr wird gefeiert, daher die vielen Gäste aus dem Reich der Mitte. Aus dem Grund sagte man uns auch, als wir tags zuvor an Ort und Stelle reservieren wollten, es sei alles ausverkauft, hoffnungslos, in den nächsten drei Tagen noch einen Platz reservieren zu können. Es gäbe auch keine Warteliste.
Mit dieser Aussage gab ich mich nicht zufrieden. Schon zu Hause in Bern hatte ich eine App über Neuseeland heruntergeladen und dort sind sämtliche Angebote des ganzen Landes aufgeführt. Also sah ich nach, fand das Queenstown-Gondel-Dinner-Angebot und reservierte für uns zwei die Fahrt und das Abendessen. Problemlos und noch ein wenig billiger.
Es war ein super Abend, den wir total genossen haben. Die Gondeln frequentieren ohne Unterbruch; etwa um zehn fahren wir wieder talwärts und eine Viertelstunde später schon sind wir daheim. Inzwischen ist es ganz dunkel geworden. Das Sternenmeer und die Milchstrasse sieht man zum Greifen nah. So klar haben wir den Sternenhimmel noch selten gesehen. Ein hehrer Anblick.
Unser letzter Tag ist dem Packen gewidmet und dem Autoputzen. Nicht so schön, aber notwendig. Den Wagen lassen wir putzen, dies ist uns die 60 $ wert.
Wie wir all unser Zeug in die beiden Koffer und ins Handgepäck bringen, weiss ich am Anfang noch nicht, aber es geht. Ich lasse einige Kleider von mir zurück, das war so geplant. Ein letztes Nachtessen auf der Terrasse mit der traumhaften Aussicht – was für ein Abschluss!
Reisebericht Australien 2 (Melbourne, Tasmanien, Lorne) Februar 2014
Wir sind zurück im Land der giftigen Tiere, der emsigen Pick-Nicker, der unermüdlichen Surfer, der upside-down-montierten Wäschetrockner.
Noch ein knapper Monat, dann geht’s heimwärts. Aber vorerst wollen wir wieder mal eine lebendige Stadt geniessen, nämlich Melbourne, weiter sind zehn Tage in Tasmanien geplant und zuletzt genehmigen wir uns eine letzte ruhige Woche in Lorne, einem Beachresort, zwei Stunden südlich von Melbourne. Dort wollen wir zum vorläufigen Abschluss noch ein wenig den Strand geniessen, bevor wir über Singapur nach Zürich fliegen, in Ittigen die Koffer umpacken, um dann in Bivio die Skis anzuschnallen.
Von Qweenstown nach Melbourne 5. Feburar 2014
Unsere Neuseelandreise ist vorbei. Erst noch, und das scheint lange her, hab ich sie geplant, hab nachgelesen über all die Orte und was es dort zu sehen gibt, und jetzt ist das alles schon passé.
Wir sitzen im Flugzeug, die Koffer sind abgegeben (ich bin jeweils sooo froh, wenn’s so weit ist); wir schauen uns wieder mit Freude das Sicherheitsvideo der New Zealand Air an. Es gibt inzwischen ein neues. Auch das wieder super gemacht mit Hobbits und Peter Jackson (www.youtube.com/watch?v=cBlRbrB_Gnc">www.youtube.com/watch?v=cBlRbrB_Gnc).
Für die Flugdauer waren 3 Stunden 40 Minuten geplant, in zwei Stunden 55 Minuten sind wir schon da. Da hatte es jemand pressant.
Kurz vor Melbourne sehen wir von oben weite Ebenen, alles gelben Felder, kein Gräschen ist mehr grün. Es ist einfach, sich vorzustellen, dass es nicht viel braucht, um ein Feuer und damit einen Buschbrand zu entfachen.
Für den Zoll in Australien hab ich alles schön aufgeschrieben, was wir an suspekten Dingen mitbringen, alles, was aus Holz ist, Bienenprodukte (in der Gesichtscreme und Schuhcreme sind die ebenfalls vorhanden), Schuhe, die im Wald herumgelaufen sind, Anhänger aus Muscheln, Senf in der Büchse, ein paar Teebeutel, Salz, etc. etc. Diesmal mag der Beamte nicht mit mir diskutieren, ein kleines Wunder, er lässt uns durch, wir müssen auch die Koffer nicht nochmal durchleuchten lassen. So geht’s natürlich rasch und wir sind froh. Daher warten wir fast eine Stunde lang auf Marg Mackie, unsere hiesige Homelink-Partnerin, die uns abholen kommt. Sie fährt uns nach Brighton Beach, wo sie wohnt, das ist ein hübscher Vorort von Melbourne, 25 Minuten mit der Metro zum Zentrum, fünf Minuten zu Fuss zum Strand.
Sie fährt uns in der Gegend herum, zeigt uns, wo man einkaufen kann, wo’s Restaurants hat, wo der Zug fährt. Wir essen in Hampton, in einem japanischen Restaurant und laden Marg selbstverständlich ein. Es ist sehr laut im Lokal, Theo versteht so gut wie kein Wort von dem, was Marg uns fast ohne Unterbruch erzählt.
Bei den Buschfeuern im Jahr 2009 (Black Saturday Bushfires) haben sie und ihr Mann ihren Laden, das Lager dazu und ihr Ferienhaus in Marysville verloren, eine mehr als nur tragische Geschichte. 86 Menschen haben bei der Katastrophe ihr Leben verloren, darunter Freunde und Nachbarn. Dass ihr das noch immer nachgeht, ist verständlich. Wir haben auch von ihren Kindern und Grosskindern erfahren. Der Sohn wohnt in Singapur (sie hat mir mal geschrieben, sie sei sehr froh, dass die Familie jetzt nicht mehr so weit weg wohne – nur noch 7 Stunden Flugzeit, zuvor lebten sie in London). Sie geht manchmal die Kinder hüten… Da haben wir’s in Ittigen ein wenig näher.
Jetzt zieht die Familie nach Shanghai um. Marg geht nächste Woche wieder Kinder hüten und mit dem Umzug helfen. – Ja, da haben wir mehr nur zugehört und nicht so sehr viel gesagt.
Marg fährt uns anschliessend nach Hause. Es ist ein geräumiges, schönes, grosszügig gestaltetes, doppelstöckiges Haus mit Garten; es wird uns sehr wohl sein hier. Der Kühlschrank ist bis oben gefüllt mit Dingen für uns, da müssen wir kaum einkaufen gehen. Auch im Vorratsraum dürfen wir alles nehmen, was wir wollen. Das reicht für ein paar Monate.
Oben am Fenster bei der Eingangstür sitzt eine Spinne. Mich trifft fast der Schlag. Schwarz ist sie und für meine Begriffe riesig. Theo muss sofort her und etwas dagegen unternehmen. Leider gelingt das nicht auf Anhieb, sie entwischt. – Zum Glück ist unser Schlafzimmer im oberen Stock. Wir sind recht müde, für uns ist es zwei Uhr morgens nach NZ-Zeit, hier ist es erst Mitternacht, wir haben zwei Stunden gewonnen, sind also schon wieder auf dem Heimweg. Etwas mehr als 16‘000 km trennen uns von Ittigen und von unseren Lieben.
Bevor ich ins Bett gehe und mich meinen süssen Spinnenalbträumen hingebe, prüfe ich zur Sicherheit alle Storen und Fenster.
Melbourne, Sonntag, 9. Februar
An unserem ersten Tag unternehmen wir nicht viel. Es ist heiss, etwa 30 Grad; baden gehen ist das Vernünftigste, finden wir. Fünf Minuten zu Fuss und schon sind wir dort. Der Strand ist breit; es hat viele Muscheln und Steine, die mich natürlich grad wieder zum Sammeln anregen. Wenige Wellen, das Wasser ist klar, etwa 23 Grad, wunderbar zum Schwimmen. Lesen, abkühlen, Muscheln sammeln, lesen, abkühlen etc. Theo geht sogar ins Wasser und plötzlich ruft er mir. Neben ihm ist ein grosser schwarzer Fleck im Wasser, sieht aus wie einer der Steine, die’s dort hat, es ist aber ein Stingray. - Ja, klar, wir sind ja wieder in Australien, wo’s all diese giftigen Viecher hat. Auch wenn die Rochen nicht unbedingt aggressiv sind, können sie doch sehr schmerzhafte Stiche austeilen, sogar tödliche, also fänd ich es besser, wenn Theo sich aus dem Wasser begäbe. Das tut er. Inzwischen haben sich ein paar Leute am Strand versammelt, um den Manta zu begutachten. Er kommt ganz nah ans Ufer – erstaunlich. Ich behalte ihn und die Leute im Auge und will mich wieder abkühlen. Was ich erst als meinen eigenen Schatten einschätze, ist der Kollege des anderen. So rasch war ich noch nie aus dem Wasser wieder raus. Jetzt sind‘s also zwei, und das macht nicht sonderlich Spass. Die Idee vom Schwimmen ein wenig weiter draussen ist vorbei. – Jemand sagt uns später, es sei sehr selten, dass man Stingrays am Strand sähe…
Es hat ein Restaurant grad vis-à-vis der Promenade und da gehen wir am Abend essen, nach der Dusche natürlich. Wir sehen ein Senioren-Menu auf der Speisekarte. Das nehmen wir. Drei Gänge für 17$, das kann ja keine exorbitante Sache sein. – Erst kommt ein grosser Teller Kürbissuppe. Der gegrillten Barramundi, der anschliessend serviert wird, hängt über den Tellerrand hinaus. Die Pommes Frites kann ich nicht alle essen, und Theo mag nicht so viel Salat. Dann noch das Dessert. Nächstes Mal bestellen wir besser nur das Donald-Duck-Menu.
Schön ist es, den Sonnenuntergang zu beobachten.
Zu Hause macht mir Theo Angst wegen der Spinne. Er empfiehlt mir, den Koffer, der im Entrée steht, besser zu schliessen. – Jetzt macht mir auch mein Koffer noch Angst.
Am zweiten Tag (7. Februar) machen wir eine Stadtbesichtigung. Die öffentlichen Verkehrsbetriebe sind sehr effizient und einfach zu benutzen. Wir kaufen je eine Wochenkarte für 5 Fr. pro Tag. Damit kann man sämtliche Trams (250 km Tramlinien), Busse und die Metro benutzen. Gäbig!
Der Metrobahnhof ist keine fünf Minuten von unserem Haus entfernt, in 25 Minuten sind wir im Zentrum. Es ist jetzt richtig heiss. 35 Grad. Im Zug war’s schön kühl.
Als erstes decken wir uns in der Tourist Information mit Prospekten ein, dann machen wir ein Rundfährtli mit dem Tram und erhalten so ein wenig einen Überblick. Im Tram hat’s keine Aircondition, dafür sehr viele Leute. Wenigstens haben wir einen Fensterplatz. Wieder am Ausgangspunkt unserer Tramreise angekommen, steigen wir aus, Theo hat den Vodafone-Laden entdeckt, bei dem er unsere Simkarte neu laden lässt. Wir gehen durch eine enge Gasse, die uns an einen orientalischen Markt erinnert. Auf beiden Seiten hat’s kleine und kleinste Läden und Restaurants, davor meistens nur grad ein oder zwei Tische; es ist eine gemütliche Ambience, die ich hier nicht erwartet hätte.
Ein anderes Tram bringt uns zum Victoria Market, einem riesigen Markt, wo man so circa alles kaufen kann, was man braucht oder nicht braucht. Ähnlich wie in der Markthalle in Rosas hat’s ein Geschäft am anderen mit frischem Fisch und Fleisch, und ausserhalb des Gebäudes gibt‘s Duzende von Ständen mit Früchten und Gemüsen. Ebenfalls Kleider kann man kaufen, Souvenirs, Schuhe, hunderterlei Krimskrams, wie das so üblich ist auf solchen Märkten überall in der Welt.
Wir fahren mit der Metro heim, das heisst, wir steigen eine Station vorher aus, in Middle Brighton und machen dort unseren ersten mehr oder weniger Grosseinkauf, grad so, dass wir alles noch tragen können, ein Auto haben wir ja nicht mehr. Viel brauchen wir eigentlich nicht, Marg hat ja schon vorgesorgt, aber Wein natürlich, Orangensaft, Theo kann sein Konserven-Grusel-Kabinett wieder aufforsten: Spam-Büchsen (es gab sie grad zum halben Preis), Salat, Steak und meine English Muffins.
Zu Hause beschliessen wir, nun doch nicht zu kochen und fahren wieder zurück nach Middle Brighton, wo wir im indischen Restaurant ganz fein essen. Es ist Freitagabend und da geht eine Fuhr ab. Überall wird die Tatsache gefeiert, dass heute Freitag ist. Es ist so anders hier als in Neuseeland. Dort war’s fast immer tote Hose und hier läuft etwas, die Restaurants sind voll, die Leute draussen vor den Pubs am Bier trinken und Plaudern. Alles erinnert mich an London.
Grad kurz vor neun Uhr schaffen wir’s noch, einen weiteren Einkauf zu tätigen (Wein und Mineral), bevor der Laden schliesst. Im selben Komplex ist auch ein Kino untergebracht. Um neun beginnt ein Film – wieso nicht? – „Her“ heisst der Streifen (romantisches US-SF-Drama von Spike Jonze mit Joaquín Phoenix in der Hauptrolle) und er ist mindestens eine halbe Stunde zu lang. – Die Idee ist nicht uninteressant, läuft sich aber nach einer Stunde zu Tode. Es geht um einen geschiedenen Angestellten, der sich in das OS seines Computers verliebt. Das Betriebssystem heisst „Samantha“ und wird durch die Stimme von Scarlett Johansson „verkörpert“.
Der Samstag ist der heisseste Tag bisher. Das Thermometer zeigt 41 Grad. Wir gehen erst gegen Mittag los, entlang der Brunswick Street, auf der Schattenseite. Es ist eine trendige Gegend mit vielen kleinen Läden und Cafés, das Studentenviertel. Die Leute sitzen nicht draussen in den Strassencafés, sondern drinnen, wo die Airconditions für angenehmere Temperaturen sorgen.
Mit dem Tram geht’s anschliessend zurück in die Innenstadt, wo sich Theo bei einem Coiffeur die Haare schneiden lässt, dann fahren wir zu den Docklands. Ein wenig lädele (das ist angenehm, denn in den Läden ist es nicht so heiss) und der Marina entlang wandern, das sind unsere nächsten „Tätigkeiten“.
Es gefällt uns so gut dort, dass wir beschliessen, nicht zu Hause zu essen, sondern an der Waterfront zu bleiben. Drinnen sind die Restaurants ausgebucht, draussen findet man problemlos Platz, es ist noch immer 33 Grad warm.
Zuhause ist’s dann auch nicht kühler, die Dusche bringt nur kurze Linderung. Vor dem Schlafengehen haben wir noch eine kurze Facetime-Session mit Kay und Familie. Es macht immer sehr viel Spass, die Girls zu sehen und mit allen zu plaudern.
Und wieder bin ich der Spinne begegnet. Sie hat sich gegens Wohnzimmer verschoben und an der Wand eingerichtet. Diesmal gelingt es Theo, sie mit einem Glas zu fangen und auf meine Anweisung hin draussen, sehr weit weg, wieder auszusetzen. Sie sitzt jetzt im Baum in Nachbars Garten und ich hoffe, es gefällt ihr dort mindestens ebenso gut. Und was ich vor allem hoffe, dass sie nicht noch Kolleginnen hat in unserem Haus.
9. Februar: Es ist wieder extrem heiss, aber heute weht ein starker Wind dazu. Theo möchte lüften am Morgen, aber merkt dann selber, wie er das Fenster öffnet, dass da nichts als schwüle Luft hereinströmt, wie von einem heissen Fön. Gegen Mittag ziehen wir wieder los. Mit dem Zug fahren wir zur Station Parliament und dort nehmen wir das Tram bis St. Kilda.
Wann immer wir in einem Tram oder im Zug sind, kommen wir mit Leuten ins Gespräch. Ich finde das super. Kaum nimmt man einen Stadtplan hervor oder den Reiseführer, wollen alle helfen. Sie geben uns Tipps und wollen wissen, wo wir her kommen und erzählen von ihren Reisen in die ferne alte Welt. Vorgestern war’s Evan, ein Geschäftsmann, gestern plauderten wir mit einem Schweizer, der seit acht Jahren hier wohnt und einen Optikerladen in der City führt, und seinem australischen Partner. Vielleicht besuchen wir sie mal. - Hier im Trämli sind‘s drei junge Damen, mit denen wir uns unterhalten.
Die Fahrt zur Destination dauert gut zwanzig Minuten, das Tram ist vollgestopft mit Leuten, die dorthin wollen. Am Sonntag findet ein Markt statt. Heute aber nicht nur, wie wir sogleich merken. Es ist wie bei uns am Ziebelemärit, allerdings ungefähr 40 Grad wärmer. Seit anderthalb Wochen ist das St. Kilda Festival im Gang, heute ist der letzte Tag. In einem Pub kaufen wir ein Bier und ein Glas Cidre. Dazu gibt’s einen Sonnenhut gratis (Werbung für ein tasmanisches Bier). Die Security-Leute, die’s überall hat, machen uns darauf aufmerksam, dass wir uns setzten müssen, wenn wir Alkohol trinken. ??? Lustige Sitten gibt’s in diesem Land. Setzen wir uns halt auf die Harassen, die herumstehen, und wo zwei grad frei sind.
Den Durst gelöscht, kämpfen wir uns weiter durchs Gedränge an Marktständen vorbei; Theo findet eine Wiese, wo er sich hinlegen kann, andere sitzen auch und hören der südamerikanischen Band zu, die vorne spielt. Überall hört man Bands, eine spielt lauter als das andere, sie übertönen sich gegenseitig. Auch am Strand entlang ist viel los, Musik, Busker, Beachvolleyball. Wir bleiben dort etwa zwei Stunden lang. Hier hat es viel mehr Wellen und natürlich auch Leute als in Brighton, dafür keine Rochen, das ist mir lieber so.
Gegen fünf packen wir zusammen und setzen uns in eines der zahllosen Strassen-Restaurants in der Acland Street – es ist Apérozeit. Heute gibt’s alles nur in Plastikbechern, auch den Prosecco, ist ja klar bei diesem Andrang. Amüsant ist es, den Leuten zuzuschauen. Was man da nicht alles sieht an Outfits, Farben, Frisuren und Tatoos. - Köstlich!
Heute Abend essen wir daheim. Nach dem Salat haben wir bereits genug - ganz schön, mal nur wenig zu essen. Es ist auch angenehm, draussen zu sitzen, erstaunlicherweise hat’s einen Kälteeinbruch von etwa 15 Grad gegeben. Im Moment ist es noch 24 Grad warm.
Geburtstag und so…
Der 10. Februar: Ausschlafen, mich an all den Geburi-SMS, Whatsapps und Emails erfreuen, einige bereits beantworten, dann ab an den Strand, zurück unter die Dusche, um halb sieben mit dem Zügli in die City fahren, an der Southbank ein Restaurant suchen, das „geburi-genehm“ ist – das ist die Zusammenfassung dieses Tages.
Theo steht ausnahmsweise (ziemlich zerknittert) schon um halb neun Uhr morgens auf der Matte – ob das ein Geburtstagsgeschenk für mich sein soll? Ich drücke mein Erstaunen aus und bedaure zutiefst, dass er ganz offensichtlich zu wenig Schlaf erhalten hat. Eine ganze Weile höre ich dann nichts mehr von ihm, bis er eine Stunde später wieder erscheint. Tatsächlich ging er zurück ins Bett und schlief noch eine Runde, weil er fand, ich hätte wirklich Recht gehabt...
Unser Abendessen ist wunderbar, im Restaurant „Sake“ landen wir schliesslich, direkt am Yarra-River, mit Blick auf die Skyline, fein zubereitete japanische Köstlichkeiten werden uns serviert, und den Wein geniessen wir selbstverständlich auch. – Schön, meinen Geburtstag mal nicht im Schnee zu feiern, sondern in einem Land, wo’s Sommer ist.
Die restlichen Tage vergehen schnell, am Anfang hatten wir das Gefühl, wir seien ja ewig hier, viel zu lang. Aber jetzt möchten wir gerne noch länger bleiben.
Wir besuchen Thomas, den Schweizer, den wir in der Metro kennen gelernt haben, in seinem Optikergeschäft, und Theo kauft ihm gleich zwei Brillen ab. Diese sind hier viel billiger, sie kosten beide zusammen knapp halb so viel wie seine, die er daheim hat machen lassen. Zusätzlich erhält er noch 15 % Rabatt. Wirklich cool! Jetzt hat er endlich Ersatzbrillen, die Hoffnung herrscht, dass er weniger suchen muss. Es ist auch nicht so schlimm, wenn er eine veliert…
Am nächsten Tag schon können wir die Brillen abholen. Theo ist sehr zufrieden mit seinem Kauf.
Am Mittwochabend verpflegen wir uns auf dem Victoria Night Market. Er findet (ausser im Winter) jeden Mittwoch statt. Da würde ich jede Woche hingehen, wenn ich hier leben würde. Es herrscht zwar ein unglaubliches Gedränge, aber auch eine super Stimmung, es hat Bands, die spielen, Busker, x verschiedene Food-Stalls aus x verschiedenen Ländern, bis man sich da durch alle durchgegessen hätte, wär man grad ein paar Jährchen älter. Vor lauter Auswahl kann man sich kaum entscheiden. Sollen wir anatolisch, philippinisch, indisch, indonesisch, chinesisch, spanisch, japanisch, amerikanisch, afrikanisch essen? - Wir bleiben am türkischen Stand „hängen“, zum Dessert gibt‘s eine französische Crèpe. Deutsche Brezel, holländische Proffertjes hätte es auch noch gehabt. Keine Cervelats hingegen, auch kein Fondue oder Raclette. Aber Eiscreme und Kaffee und Wein und Bier und Marktstände mit Kleidern und allem Möglichen und Unmöglichen.
Wir haben Tickets fürs Musical Grease. Es ist ein Geburtstagsgeschenk von Theo an mich. Die Vorstellung fängt um acht Uhr abends an, wir haben genug Zeit mit dem Tram an die Exhibition Road zu fahren, die öffentlichen Verkehrsmittel sind sehr effizient und praktisch zum Benutzen. - Das Tram kommt aber nicht. Wir warten fast eine Viertelstunde. Aus der Gegenrichtung sind bereits fünf Trams vorbeigefahren. Da muss ein Unfall passiert sein oder sonst etwas, das ist nicht normal. Wir geben auf, haben noch knapp zwanzig Minuten Zeit. Zu Fuss mag ich nicht gehen, es ist doch noch recht weit. In der übernächsten Parallelstrasse könnte es Busse haben. Der erste, den wir sehen, ist „Out of Service“. Wir eilen weiter, es ist fast schon zehn vor acht. Jetzt kommt ein Bus, hätten wir doch an der vorderen Haltestelle gewartet, ich glaube, wir verpassen ihn, er fährt an uns vorbei. Wir erreichen ihn dann doch noch – er hält sogar ein paar Minuten. Nach uns steigen noch viele Fahrgäste ein. Wie er endlich losfährt, bin ich doch sehr froh, er hält fast vor dem Theater, alle Leute stehen noch draussen mit einem Drink in der Hand, wir sind keineswegs zu spät.
Die Vorstellung gefällt uns sehr: Die Musik führt uns geistig zurück in die Fünfzigerjahre, alles ist farbig, ein wenig kitschig halt, die amerikanischen Highschoolgirls kreischen, singen aber auch, die Männer mit ihren Grease-Frisuren sind alle kleine Elvis und das Bühnenbild ist Spitze. Zwei australische Popstars sind im Musical dabei; sie werden von den Zuschauern und vor allem von den Zuschauerinnen frenetisch jubelnd beklatscht - wir kennen sie nicht.
Der Heimweg ist problemlos. Wir nehmen zwei verschiedenen Trams und dann unser Zügli, keine zwei Minuten müssen wir jeweils auf die Verbindung warten.
Die NGV (National Gallery Victoria) besuchen wir an unserem letzten Tag, sie ist in zwei verschiedenen Gebäuden untergebracht und wie das so ist in Museen, die Zeit vergeht im Flug und schon ist ein ganzer Nachmittag vorbei. Mir hat vor allem die Ian Potter Gallery sehr gut gefallen, wo australische Kunst ausgestellt wird.
Ursprünglich wollten wir die Stadt vom Eureka-Tower aus anschauen, das war unser Plan. Dummerweise haben wir das verschoben, weil wir dachten, am nächsten Tag sei’s vielleicht noch schöner, das sagte jedenfalls die Wettervorhersage, und genau das soll man ja nicht tun: „Verschiebe nie auf morgen, was du heute kannst besorgen.“ Das Pech war, dass es im Norden erneut Wald- oder Buschbrände gab und der Rauch die ganze Stadt dermassen einnebelte, dass man überhaupt nicht viel gesehen hätte. Alles war grau in grau, die Farben fehlten vollständig, die Sichtweite kaum weiter als etwa 200 Meter. Vom 300 Meter hohen Turm aus hätten wir wohl nicht mal auf den Boden gesehen. So verzichteten wir und ich ärgerte mich über mich selbst. – So muss es ein Nächstes Mal geben, ein Grund mehr, ein anderes Mal nach Melbourne zu reisen.
(Erfreulicherweise, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, galt diesmal das Sprichwort: „Verschiebe nie auf morgen, was du auch übermorgen kannst besorgen“.)
Vorerst aber müssen wir packen. Mit unserem netten Nachbarn haben wir abgemacht, dass wir einen Koffer bei ihm in seinem Haus lassen können. Marg und Alistair sind am 2. März in China, deshalb können wir den Koffer nicht bei ihnen lassen. Wir hätten ihn auch im Flughafen abgeben können bei der Gepäckaufbewahrung, aber das hätte mehr als 200 Fr. gekostet, dafür gehen wir lieber zweimal fein essen.
Hunderterlei Krimskrams, Dinge, die wir in den letzten vier Monaten erstanden haben, Kleider, die wir in den nächsten zwei Wochen nicht brauchen, packen wir in einen unserer Koffer und geben ihn Larry ab. Zum Dank, dass er unser Gepäckstück aufbewahren darf, lädt er uns zum Apéro ein und das ist ein netter Abschluss zu unserem Melbourne-Aufenthalt.
Im Haus nebenan, 31 Werestreet, drehen sie heute und morgen einen Film, Teil der Serie „House Husbands“, eine australische Produktion als Gegenstück zu „Desperate Housewives“. Überall stehen Kameras, Abschrankungen, Arbeiter und Helfer herum. Die Serie will ich mir dann mal anschauen, wenn ich wieder zu Hause bin.
Ankunft in Tasmanien, 15. Februar 2014
14. Februar: Diesmal haben wir kein Problem mit zu vielen Kilos für den kurzen Flug nach Hobart, aber trotzdem war es beim Packen nicht einfach, den ganzen Rest unserer Habe auf die verbleibenden Gepäckstücke zu verteilen. Aber es gelang. Nur wird es uns nicht möglich sein, ein einziges Blatt Papier mehr im Koffer zu verstauen; er ist zum Bersten voll. – „No more shopping“ heisst das im Klartext.
Um Viertel vor neun kommt uns Marg abholen. So lieb von ihr, uns zum Flughafen zu bringen. Wir sind eine gute Stunde vorher dort, alles bestens, Inlandflüge sind problemlos. Um halb eins kommen wir in Hobart an und werden schon erwartet von Lyn und Biran Muir, mit denen ich im Vornherein viele E-Mails gewechselt habe. Ich hatte sie angefragt, ob sie mit uns tauschen wollten und im Laufe der Hin- und Herschreibereien fanden wir heraus, dass wir gemeinsame Homelink-Bekannte haben, Kay und Mike Whealan in Hastings, mit denen wir beide einen Tausch gehabt hatten. – So klein ist die Welt. Auch Kay und Laurie Topping aus Brisbane sind gemeinsame Homelink-Swap-Partner, nicht zu glauben! - Weiter kam heraus, dass sie Bern kennen, „schlimmer“ noch, sie kennen Jegenstorf und waren schon öfter dort bei Heinz und Ingrid Vollenweider. Heinz hatte in den Siebzigern während ein paar Jahren mit Brian in Hobart zusammengearbeitet. Als ich das erfuhr, luden wir die beiden kurz vor unserer Abreise auf ein Plauderstündchen ein. – Alle zusammen werden wir im kommenden Juli eine Woche in Bivio verbringen.
Lyn und Brian wohnen in Hobart, haben aber ein Ferienhaus an einer anderen Bay, anderthalb Stunden von ihrem Haus entfernt. Wir haben abgemacht, dass wir erst ein paar Tage gemeinsam dort verbringen werden und sie uns die Gegend, die sie aus dem FF kennen, zeigen. Auf dieses Angebot sind wir gerne eingegangen. Auf dem Heimweg vom Flughafen nach „Eagleshawk Neck“ halten wir in einem Fischerdörfchen an und essen eine Kleinigkeit. Dunalley hat kaum mehr als etwa 300 Einwohner. Die Leute sind dabei, das Dorf wieder aufzubauen, die meisten Häuser wurden bei den verheerenden Waldbränden im letzten Jahr zerstört. Das Feuer wütete über viele Hektaren und Kilometer, übersprang Flüsse und Kanäle und breitete sich bis ganz in die Nähe von Muirs Ferienhaus aus. Ihre Tochter und deren Familie mussten evakuiert werden.
Überall sieht man die schwarzen, verbrannten Bäume noch, die Natur übernimmt aber wieder fleissig, und um die meisten schwarzen Stämme herum wachsen grüne Kletterpflanzen.
Unser nächster Halt unterwegs ist ein Lookout beim Pirates Bay. Leider ist das Wetter nicht sehr schön, es regnet zwar nicht, ist aber völlig bewölkt. Das Thermometer zeigt nur noch 18 Grad, etwa zehn weniger als in Melbourne. Hier bietet sich wieder ein Anblick vom Fantastischsten: Die Klippen, zu denen ein kurzer Wanderweg führt, sind wie von einem Lineal zerschnitten und in Blöcke zerteilt, „tessellated pavement“. Auf einer Tafel wird erklärt, wie dieses seltene Naturphänomen entstanden ist. Wenn man nicht wüsste, dass die Blöcke nicht von Menschenhand entstanden sind, man würde es nicht glauben.
Ein paar wenige Kilometer weiter gibt es weitere Sehenswürdigkeiten zu bestaunen: „The Blowhol“ und „Tasman Arch“: ein Bogen und ein riesiges Loch in den Felsen, durch das die Wellen peitschen und in welches man das Berner Münster so hineinstellen könnte, das man darauf hinunterschauen müsste.
Dann „Devil’s Kitchen“. Auch hier wieder Felsfomationen vom Unglaublichsten und Beeindruckendsten. Ringsherum sind Lookouts eingerichtet, so dass man, wenn man nicht allzu grosse Höhenangst hat, wunderbar hineinschauen kann. Ein halbstündiger Walk zu Waterfall Bay ist auch Teil unserer Besichtigung.
Mit Lyn und Brian haben wir die perfekten Reiseführer gefunden. Wir erreichen schliesslich ihr Ferienhaus, 20 km von Port Arthur entfernt, dem Reiseziel aller Touristen in Tasmanien. Es ist ein schmuckes, kleines Holzhaus, einfach eingerichtet, schön gelegen, alles ist da, was man braucht. Im Garten kann man die verschiedensten Vögel beobachten; es gefällt uns gut. Wir erhalten ein hübsches Zimmer mit Blick aufs Meer. Unsere Gastgeber verwöhnen uns mit einem feinen Apéro (wir sind wieder im Land der Crackers-und Käsehäppchen angelangt) und einem Glas Bubbles; ich weiss ja inzwischen, was damit gemeint ist.
Zum Znacht gibt’s eine wunderbare Scheibe Lachs mariniert mit Limetten-Teriyaky-Sauce und Knoblauch, dazu Kartoffeln und Salat.
Nach dem Essen dann das Schönste: Wir gehen an den Strand, bewaffnet mit einer grossen Taschenlampe mit roter Folie umspannt und einer Plache. Es ist am Einnachten, neun Uhr abends. Wir setzen uns hin und harren der Dinge, die da kommen werden. Es ist die Zeit, wo die Pinguine aus dem Wasser auftauchen, an Land torkeln (das scheint der richtige Ausdruck), über den Strand wackeln und ihre Nester aufsuchen, wo sie tagsüber die Jungen zurückgelassen haben (in Obhut eines Partners oder Nachbarn). Wir sitzen dort in der (fast völligen) Dunkelheit, machen keinen Mucks, die Taschenlampe auf die Wasserkante gerichtet und ich denke, da passiert sicher nichts. Es dauert aber keine fünf Minuten, schon sehen wir einen weissen Punkt am Ufer auftauchen, dann einen zweiten, einen dritten. Sie tauchen aus dem Meer auf und finden ihren Weg zwei Meter an uns vorbei, das Bord hinauf zu ihren Nestern. Sie scheinen uns überhaupt nicht wahrzunehmen. - Ihnen zuzuschauen ist ein Mix aus verschiedenen Gefühlen: ihre (vermeintliche?) Hilflosigkeit rührt einen, ihre Scheu; man muss lachen, wie sie sich das Bord heraufkämpfen, manchmal fallen sie wieder zurück und straucheln, dann geht’s ein Stück weit ganz gut. Sie sind relativ klein, die Fairy Penguins, eben Zwergpinguine. Sie haben sich entschieden, ihre Nester auf der anderen Seite der Strasse zu bauen, weshalb, wissen sie wohl selber nicht. Das ist nämlich sehr beschwerlich und auch gefährlich. Vielleicht sind sie einfach nur stur oder speziell gepolt wie zum Beispiel Bienen oder Ameisen und können nicht anders. Jedenfalls sind sie putzig anzuschauen. Man hat eine Unterführung für sie gebaut, aber die scheint ihnen auch nicht so ganz geheuer, sie stehen vor der Abschrankung und wissen nicht, ob sie sie benutzen sollen oder nicht. Eine weitere Gruppe von drei Pinguinen kommt nach, sie sind noch weniger zielstrebig, aber sie schaffen den beschwerlichen Weg schliesslich trotzdem.
Offenbar waren wir müder als ich dachte, ich erwache erst um zehn vor zehn am nächsten Morgen, was Theo natürlich sehr freut.
Nach unserem Morgenessen um halb zwölf fahren wir los, Lyn und Brian wollen uns die Halbinsel zeigen. Leider ist es sehr neblig, man sieht nicht weit, ich nehme jedenfalls mal warme Kleider und meinen Regenjacke mit. Brian sagt aber, es sei gut möglich, dass 20 km weiter weg das Wetter ganz anders sein könne. Wie bei uns nördlich und südlich der Alpen, nur dass es hier keine hat. Und tatsächlich, zwar ist das noch nicht so beim ersten Strand, den wir besuchen, Fordescue Bay, aber beim zweiten ist plötzlich der Himmel blau, die Sonne scheint, die Regenjacke und die warmen Kleider bleiben im Auto. Leider bleibt aber Theos Mütze und die detaillierte laminierte Strassenkarte, die uns Brian gegeben hat, und auf der wir nachsehen konnten, wo wir genau sind, ausserhalb des Autos. Bei irgendeinem Lookout müssen die beiden beim Ein- oder Aussteigen herausgefallen sein. Sooo ärgerlich! Theo bringt‘s immer wieder fertig, etwas irgendwo liegen zu lassen. Sogar jetzt, wo wir fast gar nichts bei uns haben. Von Queenstown habe ich vorgestern eine Email erhalten, man habe seinen rosaroten i-Pod gefunden. Der wird uns jetzt nachgeschickt. – Ich bin nur froh, dass wir auf unsere Ausfahrt unseren Reiseführer nicht mitgenommen haben. Sonst wären wir den sicher auch wieder los. Zum dritten Mal. Den hüte ich jetzt allerdings wie meinen Augapfel.
Stewarts Bay war unser zweiter Halt, ein wunderschöner Strand mit weissem Sand und sogar ein paar Leuten beim Baden.
Das Verrückteste und Schönste war die „Remarkable Cave“, ein riesiger Bogen im Fels, eine Höhle mit zwei Ausgängen. Wenn man von der einen Seite hineinblickt, sieht die andere aus wie die Landkarte von Tasmanien. Die Felsen sind zufällig so geschnitten. Erstaunlich. Wir klettern über die Abschrankung (obwohl Lyn das gar nicht gutheisst, es aber denn trotzdem auch selber tut) und gehen in die Höhle hinein. Der Anblick ist überwältigend. Es kommt mir vor wie in einer Kathedrale. Alle paar Sekunden flutet eine Welle mehr oder weniger stark hinein.
Weiter geht’s zum Shelly Beach, einem hübschen Strand, wo wir unsere von Lyn liebevoll zubereiteten Sandwiches essen und den schönen Blick geniessen.
Ein kurzer Spaziergang führt zur nächsten Bucht. Dort lesen wir Muscheln von den Felsen ab, Brian will sie später für uns BBQen. – Fein sind sie zu einem Gläschen Wein, sie sind zwar nur etwa einen Sechstel so gross wie die grünen, die wir in Neuseeland gegessen haben, aber mit einer delikaten Sauce gar nicht zu verachten. Wie gestern auch schon werden wir mit einem feinen Nachtessen verwöhnt, zubereitet von Lyn. Fünf Gemüsesorten gibt es, da wird Theo wieder Gelenkschmerzen bekommen vom „Schtrübschte“.
Port Arthur
Nach dem Morgenessen am nächsten Tag, dem Sonntag, überlässt uns Brian sein Auto und wir fahren nach Port Arthur, dem berühmten historischen Gefängniskomplex in Tasmanien, der von 1830 bis 1877 in Betrieb war, wohin die Engländer alle ihre Sträflinge hinschickten beziehungsweise wo sie sie los wurden. Als wir wegfuhren, regnete es immer noch, dort angekommen, fing grad die Sonnen an zu scheinen. Es hat mal wirklich viele Touristen für hiesige Verhältnisse. Alles ist aber sehr gut organisiert, man steht sich nicht auf den Füssen herum und das ganze Areal ist sehr viel grösser, als ich mir das vorgestellt hatte. Man könnte gut und gern mindestens einen Tag hier verbringen.
In unserem Ticket ist eine Schifffahrt mit inbegriffen zur Island of the Dead, dort, wo Sträflinge und auch Soldaten, Offiziere und deren Familien begraben sind. Was die armen Convicts im Straflager alles haben erdulden müssen, ist fast nicht vorstellbar. Ich habe vorher viel darüber gelesen, es gab mir mehr als nur zu denken, wie unglaublich streng und menschenverachtend die Gesetze damals waren, wenn man bedenkt, dass diese ganze grauenhafte Geschichte eigentlich noch nicht sehr lange her ist. Wenn man sich ein wenig auf die Einzelschicksale der Gefangenen einlässt, packt einen das Grauen. Was da für Ansichten vertreten wurden von der Obrigkeit und den Psychiatern - es wird einem schlecht. Tiefstes Mittelalter. Das Durchschnittsalter der jugendlichen Straftäter war 14; die jüngsten Inhaftierten waren 9-jährig. Das heisst, die wurden in England, Irland oder Schottland aus ihren Familien fortgerissen, in ein Schiff verfrachtet, unter abscheulichsten Bedingungen dauerte die Überfahrt mehr als drei Monate und an eine Rückkehr war sowieso nicht zu denken. Die Delikte (auch diese der Männer) waren manchmal lächerlicher Art: Zum Beispiel gab’s schon nur für einen Ladendiebstahl (getätigt aus Hunger) mindestens sieben Jahre Verbannung. Ein Sträfling, so wurde erzählt, erhielt 14 Jahre Straflager, weil er ein Taschentuch gestohlen hatte. Härteste Arbeit mit Fussfesseln, die 18 kg wogen, waren ebenfalls Gang und Gäbe sowie monatelange Einzelhaft mit Sprechverbot. Wer dagegen aufmuckte oder gar einen Fluchtversuch wagte, wurde ausgepeitscht und aufs Strengste bestraft.
Der Ort ist so schön gelegen, es ist ein eklatanter Gegensatz zwischen der Geschichte, also dem, was damals geschah und der schönen Landschaft, der Bucht, dem Meer. Auch zeitlich. Jetzt sind so viele Touristen da, sie fotografieren die Gebäude, die zum grossen Teil nur noch als Ruinen vorhanden sind, schiessen Selfies von sich vor den Zellen und Gebäuden, in denen Menschen vor nicht allzu langer Zeit die grössten seelischen und körperlichsten Qualen ausstehen mussten, Dinge, die wir uns gar nicht richtig vorstellen können. Die Japaner haben auf all ihren Fotos zusätzlich das „V“ als Siegeszeichen, das sie mit Mittel- und Zeigefinger machen, wenn sie geknipst werden, es geht offenbar nicht anders. – Ich frag mich immer wieder, was das soll. – Zeigen sie damit, dass sie da waren, alles gesehen und begriffen haben oder was? – Wenn sie’s nur selber wissen…
Fast sechs Stunden verbringen wir auf dem Areal, dann fahren wir wieder zurück nach Eaglehawks Neck, wo uns Lyn und Brian bereits erwarten.
Gepackt haben wir schon vorher, alles wird ins Auto verladen und wir fahren nach Hobart beziehungsweise nach Kingston oder Blackmans Bay, wo sie wohnen, einem Vorort von Hobart an der Little Oyster Bay gelegen. Nach einer kurzen Stadtrundfahrt kommen wir zu Hause an. Die Muirs wohnen auch hier sehr schön mit Blick auf die Bucht, fünf Minuten zum Strand. Wir laden sie in ein Thai-Restaurant ein, so dass Lyn mal nicht kochen muss. Wir besprechen unsere weiteren Ferien- und Reisepläne. – Morgen geht’s weiter Richtung Norden, wir dürfen Lyns Auto haben für unsere dreitägige Exkursion. Wenn ich da an Leute denke, die ich kenne, die fast überbeissen, wenn sie sich nur vorstellen, dass jemand anderes als sie selbst ihr Auto fahren würde…
Nach Norden im Süden der Insel 17. Februar 2014
Am Morgen stehen wir relativ früh auf, so gegen acht, („Morgengrauen“, nennt das Theo) und nach dem Frühstück geht’s los. Wir fahren nach Triabunna, wo wir möglicherweise die Fähre zur Maria Island nehmen wollen, es kommt noch aufs Wetter an. Wir sind grad ein wenig zu spät, aber eigentlich sind wir so oder so nicht so versessen drauf, hinüberzufahren, weil es eben doch nicht so schön ist, ein bisschen neblig leider, man bis um vier Uhr bleiben muss, weil nur eine Fähre in Betrieb ist und die angebotene Tour für uns beide fast 300 Fr. kosten würde. Bei dem Preis sollte wenigstens das Wetter stimmen, finde ich. Nun, die Fähre ist soeben abgefahren (um 10.30 Uhr), eine zweite fährt heute nicht mehr, Plätz hätte es sowieso keine gehabt, man hätte vorher buchen müssen. – Ok, der Fall ist geklärt und gelaufen, können wir „abhäkeln“. Sollen die Kängurus, Wombats, seltenen Vögel und was es noch alles dort zu sehen gibt, halt ohne uns in den Tag hinein leben.
Wir machen einen kurzen Halt bei der Spikes-Bridge, einer Brücke, die in den 1830er-Jahren von den Sträflingen mit vielen Spickeln, aber ohne Mörtel gebaut wurde.
Wir fahren weiter nach Swansea, an die Great Oyster Bay, wo’s wieder mal einen Flat White gibt und dazu ein Zitronentörtchen mit Doppelrahm (!).
Anschliessend geht’s nach Bicheno, einem weiteren einsamen Fischerdorf an der Ostküste von Tassie. Das Blowhole (Rösi sagt „Blof Hole“), das man dort sehen kann, hat uns mächtig beeindruckt. Es ist absolut spektakulär zuzuschauen und auch zuzuhören, wie die Wellen in diese von ihnen selber geformte Höhle hineinpreschen und dann meterhoch in die Höhe spritzen.
Die Felsen darum herum sind gelblich, grünlich und rötlich gefärbt; das kommt von verschiedenen Algen, die sich dort eingenistet beziehungsweise niedergelassen haben. Etwas weiter weg davon, am Safe Beach, finden wir ein schönes Plätzchen am Strand, wo Theo seine Siesta machen und ich mein Buch fertiglesen kann. Der Himmel weist inzwischen ein paar blaue Flecken auf und manchmal scheint sogar die Sonne ein wenig.
Zurück in Swansea beziehen wir unser Hotel (Waterloo Inn), das wir am Abend zuvor per Internet gebucht haben. Wir essen auch dort, es ist ganz gut. Die blutjunge Kellnerin (offenbar die Tochter der Besitzer, die wir nicht zu Gesicht bekommen haben) könnte eventuell besser Fussball spielen als Servieren, was zwar im Moment auch nicht hilfreich wäre, aber der Typ, der alles sonst machen muss, Gäste empfangen, Bar bedienen, kochen und auch servieren, schon. Er ist so vielseitig wie sein Aussehen: Rossschwanz, der hinten aus dem weissen Baseball-Cap heraushängt, Kochkittel und schwarz-weiss karierte Hosen, beide Arme tätowiert (hier absolut alltäglich allerdings) und gesegnet mit einem ausgedehnten Aussie-Slang. Den Wein, den wir bestellt haben, hole ich selber an der Bar, die Serviertochter sagt, sie sei zu jung und dürfe ihn nicht bringen. - Ja, solche Gesetze haben sie in Australien zum Jugendschutz. Das nützt sicher. Die minderjährige „Kellnerin“ muss davor geschützt werden, eine Weinflasche anzurühren und sie fünf Meter weiter an den Tisch der Kunden zu tragen. Recht so! Wenn man bedenkt, wie sehr sie in dem Fall geschädigt werden könnte – nicht auszudenken! Man kann nur hoffen, dass ihr der Anblick der vielen Flaschen in der Bar nicht allzu viel Schaden zufügt. Vielleicht wären Scheuklappen in dem Moment das Richtige.
Der 18. Februar ist ein wunderbarer Tag! Wir fahren nach Coles Beach und das Wetter ist einmalig. Und so ist die Gegend. – Erst aber gibt’s für mich noch ein paar Schrecksekunden; die erste, wie ich im Dorf zum Auto aussteigen will und sehe, wie eine Spinne im Strassenrand auf meinen Fuss zusteuert. Das geht für mich gar nicht. Spinnen ekeln mich bis ins Mark, und so grosse sowieso.
Auf der Weiterfahrt überquert eine schwarze, etwa anderthalb Meter lange Schlange die Strasse, Theo hat sie um Haaresbreite verfehlt. – Es ist die erste, die wir sehen, zum Glück gut geschützt aus dem Auto heraus und nicht etwa auf einer Wanderung.
Coles Beach ist eine Halbinsel, die wir von Swansea in etwa einer Stunde erreichen. Unterwegs fahren wir an sechs Weingütern vorbei, alle aufs Schönste gepflegt. Sie laden zur Degustation ein. Dafür haben wir heute allerdings keine Zeit.
Im Freycinet Nationalpark angekommen, unternehmen wir als Erstes den Walk zum Wineglass Bay Lookout. Dieser Strand wurde als einer der zehn schönsten in der Welt eingestuft. Der Weg ist teilweise steil, er führt aber meistens im Halbschatten durch den Busch, vorbei an riesigen Felsbrocken, die irgendwann mal von den Bergen (ursprünglich Vulkane) heruntergerollt sind. Der ganze Walk dauert etwa anderthalb Stunden. Der Blick, der sich dann bietet, wenn man oben ist, ist absolut grossartig.
Die Wineglass Bay bei diesem Wetter zu sehen, ist wahrlich ein Geschenk, fast zu schön, um wahr zu sein.
Wir besuchen auch den Tourville Leuchtturm, von dem aus man ebenfalls grandiose Ausblicke hat auf die Klippen, den Regenwald und das Meer. Noch schöner ist die Sleepy Bay. - Rote Felsen, riesige Felsbrocken, türkisfarbige See, grünes Gebüsch, tiefblauer Himmel - mir fehlen die Worte.
Honeymoon Bay: Die verschiedenen Farben in dieser wunderbaren Bucht setzen uns erneut in Erstaunen. Eine Küstenlandschaft ist schöner als die andere. Hier bleiben wir ein wenig und genehmigen uns ein Bad im glasklaren, türkisfarbigen Wasser. Es ist etwa 23 Grad warm, würde ich schätzen. Was für eine schöne Abkühlung an diesem heissen Tag. Das Meer hier muss sehr salzig sein, es trägt mich auf dem Rücken, ich bewege mich kaum.
Auf dem Weg zum Auto begegnet uns ein Wallaby. Es sitzt dort völlig unbekümmert und isst etwas – egal, wer zuschaut. Auch das noch; was für ein Bilderbuchtag!
In der Freycinet Lodge gibt’s anschliessend Apéro. Das wär der perfekte Ort, um Ferien zu machen. Wir aber nehmen den Heimweg unter die Räder, zurück nach Swansea zu unserem Waterloo Inn Motel, wo wir eine weitere Nacht bleiben.
Nachtessen im Ort, im „Saltshaker“, dann Kollaps ins Bett und gute Nacht.
Es regnet am Morgen, macht nichts, wir nehmen’s gemütlich. Frühstück in der „Saw Mill Backery“ und Fahrt nach Campbell Town, von dort aus Richtung Süden nach Ross, Oatlands und Richmond, alles geschichtsträchtige Orte am sogenannten Heritage Highway (früher Midland Highway), der Verbindung zwischen Hobart und Launceston.
Es ist inzwischen fast wolkenlos und sehr warm.
In Richmond steht die älteste Brücke des Landes (von den Sträflingen 1823 gebaut, in Ross gibt’s ebenfalls eine zu besichtigen, die nur wenig „neuer“ ist, ebenfalls von Sträflingen gebaut, und erstaunliche, fein gemeisselte Strukturen aufweist. Die Queen begnadigte damals die beiden talentierten Verurteilten, die diese Baumeisterarbeiten geschaffen hatten. Eigentlich hätten sie lebenslange Strafen zu verbüssen gehabt.
Es gab zu der Zeit auch ein Frauengefängnis; davon steht nur noch ein Gebäude mitten in der Landschaft. Sehr eindrücklich wird geschildert, wie die Frauen leben mussten und was Gefangenschaft für sie und ihre bemitleidenswerten Kinder bedeutete.
Um halb sieben sind wir daheim in Hobart beziehungsweise in Kingston – Blackmans Bay, wo die Muirs wohnen. Wir werden herzlich empfangen, ein Apéro wird gleich serviert und es gibt ein Seafood-BBQ mit Salat. Wir können draussen essen; das geniessen wir sehr. Brian zeigt uns anschliessend drei Filme aus seinen Ferien mit Lyn, den ersten von der Westküste, wo sie mit ihrem Boot auf dem Fluss durch die bezauberndsten Landschaften fuhren, den zweiten von Bern (auch Jegenstorf) und der Schweiz, wo sie schon dreimal waren, den letzten von Island und seiner überaus beeindruckende Landschaft. - Interessante Filme, gut gemacht, schön anzusehen.
Es beginnt wieder stark zu regnen, wir gehen ins Bett.
Donnerstag, der 20. Februar. Theo taucht schon um halb neun fertig angezogen im Wohnzimmer auf. Ein Wunder ist geschehen! – Was für eines, weiss ich zwar nicht, aber ich frag auch nicht lange nach. Jedenfalls können wir uns also nach dem Frühstück bereits um Viertel nach neun (in aller Herrgottsfrühe) auf dem Weg machen zu einer Fahrt rings um die Halbinsel – wieder mit Lyns Auto. Wir fahren durch verschiedene Orte, kleine Ansiedelungen, wo‘s oft nicht einmal ein Restaurant gibt, durch Kettering, Woodbridge, Peppermint Bay und wie sie alle heissen.
Auch schöne Strände hat’s, zum Beispiel Randalls Bay oder Egg and Bacon Bay.
Huonville und Cygnet sind etwas grössere Orte, da machen wir Halt und kehren ein.
Um drei Uhr sind wir wieder daheim, das Wetter ist nicht schlecht, aber auch nicht grossartig, so haben wir grad ein wenig Zeit noch, an unserem Blog weiterzubasteln und Emails zu beantworten. Nur noch drei Tage, dann geht’s wieder zurück nach Melbourne.
Theo hat inzwischen seinen i-Pod per Express erhalten. Die Sendung hat 40 Dollar gekostet und da steckt eine ganze Geschichte dahinter. Verloren hat er ihn ja in Queenstown. Die Gäste, die nach uns dort waren, haben ihn gefunden und der Agentur gemeldet. Diese brachten das Gerät (ca. 4X5 cm gross) auf die Post, aber die wollte es nicht annehmen, weil eine Batterie drin war/ist. Diese kann man nicht herausnehmen. Also musste das Ding mit Sonderpost und Express befördert werden. – Die Agentur wollte Theo’s Kreditkartennummer, aber die hat er falsch angegeben, also ging wieder Zeit verloren und es wurde erneut hin- und hergeschrieben. Ich glaube fast, die müssen jemanden zusätzlich anstellen bei der Agentur „Relax – it’s done“. Die werden Freude haben an Gästen wie uns. Theo stört das wenig, im Gegenteil, er habe mit drei Girls Kontakt, berichtet er (Wahrscheinlich gibt eine entnervt seine Emails der anderen weiter). – Übrigens hat er auch sein e-Book verloren, wie er gestern gebeichtet hat. Zum Glück hat er zwei bei sich, so kann er den Verlust gut verkraften. Vorsorge ist die Mutter der Porzellankiste oder wie heisst das genau? – Nein, das ist Vorsicht und hat mit dem nichts zu tun. Aber irgendein Sprichwort wird sicher passen. Etwa: Vorsorge ist der Vater des Notvorrats oder ähnlich. – Kaum hat Theo seinen i-Pod wieder in Händen, klingelte das Telefon. Es ist Marg aus Melbourne. Ihr Mann hat Theos e-Zigarette zwischen den Sofakissen gefunden… Von denen hat (hatte) er drei bei sich… - Ich glaube, es wird langsam Zeit, mit dem, was wir noch haben, den Rückzug anzutreten.
Am Freitag fahren Lyn und Brian mit uns in den Mount Field National Park. Wir nehmen warme Kleider mit, in den Bergen sei es kalt, sagen sie.
Die Fahrt führt dem schönen Dermont River entlang. Im Visitorcentre des Parks gibt’s erst mal eine Tasse Kaffee, dann geht’s los mit dem ersten Walk zu den „Russell Falls“. Sie plätschern über verschiedene Stufen in die Tiefe, es ist wunderschön zu schauen, obwohl sie im Moment nicht sehr viel Wasser führen.
Ein weiterer Spaziergang heisst „Tall Trees Walk“. Die Bäume (eine Art Eukalyptus) sind sehr beeindruckend. Sie sind bis zu 90 Meter hoch und haben schlanke Stämme ohne Rinde und Geäst (bis etwa auf zehn Meter Höhe). Die Kronen oben wirken fast lächerlich klein, wir Menschen unten wie Zwerge.
Nach einem kurzen Lunch geht’s weiter den Berg hinauf durch den Wald bis zu einer Lichtung. Wir sind auf 1040 m Höhe und es ist 6 Grad „warm“. Dazu bläst ein kalter Wind. Zum Glück hat mir Lyn eine Skijacke geliehen, ohne die wär’s schwierig geworden. Der Walk führt um einen kleinen See herum, den Lake Dobson, auf dem man ganz andersartige Bäume und Pflanzen sieht als in tieferen Lagen. Die Pencil Pines zum Beispiel wachsen nur hier und sind schon 1000 Jahre alt. Am interessantesten finde ich den Pendani-Forest. Er besteht aus Bäumen, die’s nur hier in Tasmanien gibt. Sie sehen aus wie „Strubelibuebe“. Wie in einem Märchenwald kommt es mir vor.
Es muss auch Platypus haben in diesem Gewässer, die sehen wir aber nicht, das Wasser ist durch den Wind zu sehr bewegt. Ausser zwei kleinen Kängurus (Pandemelons) sind keine anderen Tiere zu sehen.
Wie wir am späteren Nachmittag wieder gegen Hobart zu fahren, beschliessen wir, auch noch gleich den Mount Wellington, den Hobarter Hausberg „abzuhäkeln“. Das Wetter war den ganzen Tag lang nicht schlecht, es hatte immer wieder ein paar sonnige Abschnitte und blauen Himmel zwischendurch, jetzt aber ist es fast wolkenlos. Die Fahrt führt durch den Wald steil hinauf bis auf 1‘200 Meter. Die Aussicht ist sagenhaft schön, wie vom Flugzeug aus, leider ein wenig dunstig, also für die Fotos nicht vom Besten, fürs Auge aber schon.
Zum Nachtessen gibt’s Lachs und Salat. Lyn hat einen Freund eingeladen, der ebenfalls Homelink-Mitglied ist und wir haben einen vergnüglichen Abend.
Hobart
Am 22. Februar geht’s nach Salamanca. Dies ist ein Quartier direkt am Hafen gelegen, wo an jedem Samstag ein Markt stattfindet. Der Markt ist sehr gross, ausgebreitet über verschiedene Strassen, und es geht sehr gesittet zu. Es ist auch nicht so laut wie etwa in einem spanischen Markt, niemand schreit herum, aber alle sind sofort bereit zu einem kleinen Schwatz, auch ohne dass man sich gedrängt fühlt, etwas zu kaufen. Die angebotene Ware ist sehr sorgfältig präsentiert und ausgesucht. Zum grössten Teil werden Produkte verkauft „made in Tasmania“, nicht Massenware aus China, Thailand oder Indien. Küchenutensilien aus einheimischem Holz, Merino-Woll-Produkte, Honig und Konfitüre, Früchte, Gemüse werden feilgeboten und so weiter und so fort. Es hat viele hübsche Strassencafés und auch Buskers sind zur Stelle, eine richtig gemütliche Atmosphäre herrscht.
Brian hat uns in die Stadt gefahren, direkt zum Markt, es ist unglaublich, wie wir von den Muirs verwöhnt werden. – Das Wetter ist seltsam, man weiss manchmal gar nicht recht, was anziehen. Es ist nur 14 Grad am Morgen und ich überlege mir fast, ob ich einen Pullover kaufen soll. Aber in welchen Koffer pack ich den?
Kurze Zeit später muss ich zwei Schichten Kleider ausziehen und hab so noch fast zu heiss im T-Shirt. – So ist es eben in Tasmanien. Es gibt einen Spruch, der heisst:
„You don’t like the weather in Hobart? Come again – in five minutes.” Das ist gar nicht so übertrieben. So ähnlich haben wir’s in diesen paar Tagen schon mehrmals erlebt. Gestern zum Beispiel war’s sechs Grad und zwei Stunden später zweiundzwanzig.
Um halb drei nehmen wir die Fähre nach MONA, dem neuen Museum auf einer Halbinsel gelegen, ein paar Kilometer weiter flussaufwärts. Hervorragende Kunst ist dort ausgestellt, wie immer natürlich auch Werke, über die man diskutieren kann, aber gerade darum geht’s ja wohl.
Nicht nur die Kunst ist kontrovers, auch der Museumsshop. Auf dem Prospekt heisst es dazu: „Come and visit us. We have a lot of shit to sell.“ – Tatsächlich, das stimmt sogar. – Sie haben schon einen eigenartigen Sinn von Humor, die Aussies.
Um halb sieben sind wir zurück in Hobart am Hafen. Es ist Apérozeit am Elisabeth Pier. Free WIFI ist immer gefragt, da können wir ein wenig Whatsapplen und unsere Mails checken.
Lyn und Brian holen uns dort ab um Viertel vor acht und wir gehen zusammen in einem schönen, am Meer gelegenen Restaurant in Sandy Bay essen. Fisch, Austern, Jakobsmuscheln – eine feine Schlemmerei erwartet uns dort.
Selbstverständlich laden wir die beiden ein. Was sie für uns alles getan haben, ist mehr als nur aussergewöhnlich. Ich kann nicht genug rühmen: Sie haben uns vom Flughafen abgeholt (auch wieder hingebracht), sind unzählige Kilometer und Stunden mit uns herumgefahren und mit ihrem Boot herumgekurvt, um uns die Gegend zu zeigen; haben uns tagelang ihr Zweitauto benutzen lassen, haben uns irgendwo hingebracht und später woanders wieder abgeholt, haben für uns Apéros zubereitet, gekocht, Tipps gegeben, Brian hat unseren Koffer, der beim Flug so malträtiert wurde, dass er fast ein Rad verlor, so professionell geflickt, dass es bestimmt auch nach hundert Jahren noch hält und und und. - Es war schön mit ihnen zusammen zu sein, wir werden sie vermissen.
Die Muirs sind pensioniert und jetzt in diverse Wohltätigkeitsprojekte engagiert (unter anderem spricht Lyn am Radio und liest Zeitungsartikel und Bücher vor für Leute, die nicht oder nicht mehr lesen können. – Wenn sie nicht zu Hause war, konnten wir sie manchmal trotzdem aus der Küche hören). Die zehn Tage, die wir in Tassie waren, glaube ich, waren wir ihr Wohltätigkeitsprojekt…
Und schon ist wieder Zeit zum Schlafen.
Unser letzter Tag ist over the top. Brian holt sein Boot aus der Garage und wir fahren mit „Bluey“ auf dem Angänger nach Margate. Es ist ein kleines Motorboot, aber oho! Super, wie’s über die Wellen fliegt.
Wir fahren von einer Bay in die andere: Tinderbox Beach, Denn’s Point, Killora Bay - wenn’s Leute hat an einem Strand, fährt man eben zum nächsten… Das ist in unserem Fall Barns‘ Bay – dort gibt’s Kaffee und Kuchen (wir bleiben auf dem Boot und ankern). Weiter geht’s nach Ducks‘ Pond – dort gibt’s Lunch, Sandwiches, Rotwein – ein Vergnügen. Diese Bay sollte eigentlich eher Oyster Bay heissen, denn so viele Austern an einem Ort habe ich noch gar nie gesehen. Und so riesig grosse schon gar nicht.
Was für ein schöner Ort: ein einsamer Strand, der nur mit dem Boot erreicht werden kann. Niemand ist dort ausser uns. Ein Bad im klaren Wasser ist das Highlight.
Wir fahren weiter nach Quarantene Bay, wo seit einem Monat erst die historische Quarantene Station besichtigt werden kann, ein Camp, wo die Kriegsheimkehrer (erster Weltkrieg), bevor sie entlassen wurden, eine Woche lang in Quarantäne bleiben mussten, bevor sie heimkehren konnten. Die Barracken sind relativ gut erhalten. In dieser Bay treffen wir verschiedene befreundete Ehepaare der Muirs, und die einen laden uns anschliessend auf ihre Yacht zu einer Tasse Tee oder Kaffee ein.
In Cunningham Beach halten wir nicht an, es hat so viele Leute dort, dass das gar niemandem in den Sinn kommt (viele Leute = etwa dreissig).
Unterwegs sehen wir mitten in der Bay einen Seehund, der am Schlafen ist (Theo- Seal?). Lustig, wie er seine Flossen in der Luft baumeln lässt. Brian fährt ganz nah an ihn heran. Plötzlich sieht oder hört er uns – und weg ist er.
Nach 43 km Fahrt sind wir zurück in Margate. Schade, ist die Reise schon zu Ende. Ich werde sie nicht vergessen. „One more day in paradise“.
Zu Hause wird das Boot in der Garage verstaut, alles ausgeladen und wir machen uns ans Packen. Lyn hat einmal mehr nach einem feinen Apéro ein leckeres Nachtessen für uns zubereitet, und das ist dann mehr oder weniger das Ende unseres Tasmanien-Trips.
Schön war’s!!!
Lorne
24. Februar: Brian bringt uns zum Flughafen (Muir-Shuttle-Service), wir verabschieden uns herzlich; im Juli werden wir uns in der Schweiz wiedersehen.
Nach einstündigem Flug landen wir in Melbourne, wo wir unser Mietauto in Empfang nehmen. Ein weisser Toyota Corolla ist es diesmal, ohne Spinne im Aussenspiegel. Übrigens: Nicht nur unser Apex-Auto in Neuseeland, auch Lyns Auto war mit einer solchen gesegnet – es muss eine Spinnenart geben, die sich auf Aussenspiegel spezialisiert hat und offenbar gerne reist.
Die Fahrt führt uns über Geelong, wo wir an der Marina einen Halt machen, Kaffee trinken, und ein riesiges Stück Zitronentorte mit Meringue-Garnitur verzehren (fast schon eine Mahlzeit – hab vor lauter Schreck, dass das Ding so gross war, vergessen, eine Foto zu machen), über Torquay, Anglesea nach Lorne.
Unsere sechzehnte Unterkunft finden wir sofort und sehen gleich, dass wir wieder einen ausgezeichneten Tausch eingegangen sind. Paula und John Hayden sind ein sehr nettes Ehepaar, sie haben wie wir vier Kinder, etwa im gleichen Alter, und vier Enkelkinder. Ihr Haus ist grosszügig und modern gebaut und eingerichtet und nur durch eine Strasse, die Grand Ocean Road, vom Meer getrennt. Wir können auslesen, welches Zimmer wir wollen. Wir entscheiden uns für eines mit riesiger Terrasse und schöner Aussicht.
Sie zeigen uns gleich den Ort, fahren uns herum und am Strand trinken wir einen Apéro. Das fängt sehr gut an. Zu Hause gibt’s ein BBQ und dazu einen feinen Wein aus der Gegend. In Johns Weinkeller hängt ein Plakat, das zeigt, dass Humor in diesem Haus nicht zu kurz kommt:
My wife said: “Watcha doin‘ today?“
I said: “Nothing”.
She said, “You did that yesterday.”
I said: “I wasn’t finished”.
Das würde allerdings eher zu Theo und mir passen. Die Haydens sind sehr sportlich: John hat sich grad ein neues Bike gekauft; er trainiert für eine einwöchige Biketour in den Dolomiten. Auch Tennis und Golf werden gespielt, gesurft wird sowieso.
Es bleiben uns nicht sehr viele Tage hier, aber wir geniessen sie. Baden, am Strand liegen und lesen, die feinen Restaurants besuchen (es hat unzählige), la Dolce Vita, wie’s im Buch steht.
Im Fischrestaurant am Pier haben wir eine Paella gegessen, da könnten die Spanier davon lernen. Überhaupt sind die vielen Fischgerichte ein Genuss. Im Beach Pavillion, unserem liebsten Restaurant direkt am Strand, gibt’s ein Kilo Muscheln für 10 AU$. Wer könnte da widerstehen?
Auch viel Kunst gibt es zu sehen in Lorne: am Strand, in Galerien und in Restaurants. Im nächsten Monat findet eine Biennale statt; leider sind wir dann nicht mehr da.
Wir gehen auch mal ins Kino und sehen uns den viel gerühmten italienischen Film „The Great Beauty“ an. Rom – Fellini – italienisch, italienisch, italienisch – laut aber auch leise, skurril zum Teil; ich muss zugeben, ich hab etliches nicht verstanden und eine Zeitlang dachte ich auch, der Film nimmt nie mehr ein Ende. Fast wie bei Kafka. Als er dann doch eines nahm, war ich nicht ganz unfroh.
Entlang der Grand Ocean Road zu fahren, ist ein Erlebnis. Auf der kurvenreichen Strasse hat’s einen Lookout am anderen; die Küste, die zahllosen Strände und die Felsformationen sind grossartig anzusehen und obwohl wir ja schon etliche spektakuläre Küstenabschnitte gesehen haben, sind wir immer wieder begeistert.
Unterwegs hat’s auch Regen- und Eukalyptuswälder und in einem davon haben wir Koalas gesehen, wie sie in den Bäumen herumhängen. Diesmal in der Wildnis und nicht in einem Park. - Sie sind unschlagbar, diese Faulenzer, wie sie da müde in den Astgabeln kleben; ich kann mich nicht sattsehen.
Am selben Ort hat’s bunte Papageien, mit roten und blauen Federn, die ganz zahm sind und sich netterweise gut fotografieren lassen.
Auch Kakadus gibt’s. Sie sind allgegenwärtig und sehr schön anzusehen, diese grossen, weissen Papageien mit ihren gelben Hauben. In Lorne hat’s ganze Schwärme von ihnen, die vor allem gegen Abend herumfliegen und bei der Suche nach ihrem Nachtessen einen ziemlichen Lärm veranstalten. Sie haben den Ort fest im Griff. Sie lieben die Abfallstellen und sind clever und frech genug, die Deckel der grossen schwarzen Abfalleimer zu heben. Das tun sie zu zweit (einer zieht, der andere hebt), um sich dann an den Essresten satt zu fressen. John sagt, man muss aufpassen, wenn man ein BBQ zubereitet, dass sie einem nicht das Fleisch vom Grill wegstehlen.
Die letzten zwei Tage sind wir nicht mehr sehr aktiv, wir lieben den Strand und der genügt uns vollauf. Ich hatte gedacht, wir hätten langsam genug davon nach unserer langen Reise, aber das Strandleben kam zwar nicht zu kurz, war aber doch weniger ein Thema, als ich ursprünglich bei der Planung gedacht hatte.
Die Haydens sind nicht mehr da, wir haben das Haus für uns. Schade eigentlich, wir hatten’s sehr gut zusammen.
Morgen werden wir zurück nach Melbourne fahren, unterwegs auf dem Golfplatz in Anglesea Kaffee trinken und den Kängurus zuschauen, die dort ihren Wohnsitz haben. Eine Population von circa tausend Tieren ist’s, die dort leben und oft im Weg stehen, unbeeindruckt von den Golfern und deren Geschossen, so hat man uns erzählt.
In Brighton Beach werden wir unseren Koffer abholen, den wir bei Margs Nachbarn Larry deponiert haben, und dann ins Motel fahren beim Flugplatz, das ich schon vor einem halben Jahre reserviert habe.
Falls das Wetter gut ist und wir genügend Zeit haben, möchte ich das nachholen, was wir beim letzten Besuch in Melbourne verpasst haben, nämlich auf den Eureka-Tower steigen beziehungsweise „liften“, und einen letzten Blick auf die Stadt werfen, die uns so gut gefallen hat.
Das Packen macht mir diesmal weniger Sorgen, mit der Singapur Airline können wir 30 kg pro Person mitschleppen.
Farewell in Melbourne 2. März 2014
Eigentlich wären wir sehr gerne noch ein paar Tage länger in Lorne geblieben, aber auch die längste Reise hat mal ein Ende. Da der Montag regnerisch begann, fiel uns der Abschied dann aber weniger schwer. So ähnlich wie ich mir den Tag vorgestellt hatte, war er dann auch, nur noch viel schöner. Als Erstes fuhren wir auf den Golfplatz in Anglesea, um noch ein letztes Mal ein paar Kängurus zu sehen. Interessant, wie die ganze Kolonie dort lebt, quasi mitten unter den Golfern. Ohne Scheu hüpfen sie herum als wäre diese Symbiose das Allernatürlichste der Welt.
Immer noch regnete es leicht, der Himmel ganz farblos. Ohne einen weiteren Halt fuhren wir weiter nach Melbourne, wo wir gegen Mittag ankamen. Und die Sonne schien und der Himmel war blau. Wenn Engel reisen…
Und einen super Parkplatz fanden wir auch gleich, genau dort, wo wir hinwollten, gratis weil Sonntag. Wir machten nochmals einen Spaziergang durchs Stadtzentrum, welches sehr einfach konzipiert ist: ein Schachbrett wie in Amerika.
Theo kaufte sich bei Mayer in der Haushaltsabteilung seine viel bewunderten Servierzangen (zehnmal teurer als im Supermarkt), von denen er behauptet, es gäbe sie nicht in Europa (!) - Ich habe mindestens zwei davon in der Küchenschublade. - Mit diesen Dingern kann man Gemüse zielgerecht von der Servierplatte auf den Teller befördern, Grilliertes ohne sich die Finger zu verbrennen vom Grill entfernen (Theo weigert sich zwar zu grillieren) und Brotscheiben problemlos aus dem Toaster angeln (werden wir nicht mehr brauchen, wenn er den Toaster kauft, der ihn in Wellington dermassen fasziniert hat).
Wir wandelten durch die Hosier Lane, eine Strasse, die voller Graffitis ist und Touristen, die diese fotografieren.
Ja, und dann machten wir uns auf, den Eureka-Tower (fast 300 Meter hoch, circa 300 Millionen Baukosten) zu besteigen, ein Vorhaben, das wir ja schon vor fast einem Monat geplant, dann verschoben und endlich davon abgesehen hatten, weil die Fernsicht wegen der Buschbrände alles andere als optimal war. Ich hatte mich noch geärgert, dass wir diese „Must-Do-Attraction“ verpasst hatten. Jetzt muss ich sagen: zum Glück, denn einen schöneren Tag mit besserer Sicht hätten wir fast nicht finden können.
Von ‚Besteigung‘ kann man zwar nicht reden, es hat einen Lift, der einen in 40 Sekunden in den 88 Stock hochbringt (285 Meter Höhe). Wir erfahren: Dies ist der schnellste Aufzug der südlichen Hemisphäre (über 9 Meter pro Sekunde). Die Sicht von der Aussichtsplattform auf die CBD, die Vororte, das Meer ist atemberaubend.
Anschliessend fuhren wir nach Brighton Beach und machten einen letzten Strandspaziergang.
Dort hatten wir unseren Koffer deponiert bei Margs Nachbarn, mit all den Sachen drin, die wir für die letzten Wochen nicht mehr benötigten und auch all den Sachen, die wir gar nie gebraucht hatten wie zum Beispiel Theos weisse Jeans, die er gleich in dreifacher Ausführung mitgenommen hat (wahrscheinlich dachte er, Waschmaschinen seien inexistent oder zumindest sehr rar in Down Under) oder einen erstaunlich schweren Kleiderbügel, der dafür vorgesehen war, das schönste Paar Hosen, die er gar nie anhatte, ordentlich aufzuhängen. Wahrscheinlich dachte mein lieber Gatte, auch Kleiderbügel könnten Mangelware sein. – Immer diese Abwägerei mit den Kilos und dann das… Auch eine Büchse SPAM war im Koffer, mehr als nur überflüssig, fand ich, und auch diese ein zusätzliches Pfund in unserem Gepäck.
Unsere letzte Fahrt an diesem Tag führte uns ins Best Western Airportmotel, das ich schon vor Monaten gebucht hatte. Dort sortierten wir unser Gepäck neu und gingen danach zum Abendessen. Die freundliche Serviertochter brachte uns gleich Wasser und die Menukarte, dann aber vergass sie uns völlig. Wie es uns endlich gelang, ihre Aufmerksamkeit zu wecken, entschuldigte sie sich aufs Höchste und sagte, die Flasche Wein, die wir bestellt hatten, ginge aufs Haus. – Nicht schlecht. Da hat sich das bisschen Warten bestens gelohnt.
Singapur, 6. März 2014
Am nächsten Morgen hatten wir sogar Zeit, bis um neun zu schlafen. Kaffee und Tee tranken wir gleich im Zimmer und ab ging’s auf den Flughafen, eine Fahrt von fünf Minuten. Mietauto abgeben, einchecken, alles klar. Der Flug dauerte etwa siebeneinhalb Stunden, wir gewannen drei Stunden und landeten ungefähr um vier Uhr nachmittags in Singapur. Ich war sehr froh, dass ich diesen Zwischenhalt eingeplant hatte, denn anschliessend noch weitere dreizehn Stunden in einem Flugzeug zu verbringen, wäre nicht mein Ding gewesen.
Auf die Zollabfertigung sind die Singapurer stolz, und das mit Recht. Es dauerte keine 20 Minuten, bis alles erledigt war. Kein Anstehen, kein Fingerabdrucktheater wie in den USA, freundlich, effizient, die Koffer schon abholbereit, keine Probleme am Zoll; es geht also auch so.
Taxis sind billig in Singapur, der Fahrer war nett und freundlich und brachte uns in etwa 20 Minuten mitten ins Zentrum, zum Riverside Gate. An das Englisch des Fahrers musste ich mich erst wieder gewöhnen, man nennt den „Dialekt“ hier „Singlish“.
Ich war vor etwa zwanzig Jahren zum letzten Mal in dieser Stadt, hätte sie aber kaum wiedererkannt. Es hat zahllose neue Wolkenkratzer und andere Gebäude, nur das Raffels Hotel ist noch immer dasselbe.
Wir wurden sehr herzlich willkommen geheissen von Wenche und Even, unseren norwegischen Homelink-Partnern; es war dies der siebzehnte und letzte Tausch auf unserer Reise. Wir blieben vier Tage lang. Sie hatten uns angeboten, bei und mit ihnen in ihrem Apartment zu wohnen in einem der Riverside Towers im 32sten Stock mit toller Aussicht auf den Fluss und aufs Zentrum.
Am ersten Abend bereitete Wenche uns ein super feines japanisches Nachtessen zu, das wir zu fünft genossen. Ihr siebzehnjähriger Sohn Lars war ebenfalls dabei.
Even hatte mir schon zuvor eine Liste geschickt mit „Things to do in Singapur“, für die wir gut und gern einen Monat lang mindestens Zeit gebraucht hätten. So aber mussten wir aussuchen, was wir unternehmen wollten.
Am ersten und zweiten Tag kauften wir ein Ticket für den Sightseeing-Bus, hop on hop off, so verbrachten wir eine sehr lange Fahrt durch die Stadt im Doppeldeckerbus, und das gab einen fabelhaften Eindruck.
Ausserordentlich gut haben uns die beiden Dome in den „Gardens by the Bay“ gefallen. Die sensationell ausgeklügelte Bepflanzung mit Blumen, Bäumen und Sträuchern aus aller Welt ist beachtlich (speziell die Baobab) und wir verbweilten etwa drei Stunden an diesem schönen Ort.
Auch genossen wir die Fahrt durch Little India, den Spaziergang durch den Botanische Garten, im Besonderen durch den Orchideengarten und vorbei am Lotusteich sowie den „Stroll“ durch Chinatown, welche ihren asiatischen Charakter gut beibehalten hat.
Ebenso fanden wir einen Bummel durch die Geschäftsstrasse Orchard Road ganz amüsant, wo sich ein Shoppingcenter ans andere reiht und es ein Restaurant am anderen gibt. Da hat man die Qual der Wahl.
Die uneingeschränkte Gastfreundschaft, die wir auch hier wieder erleben durften, beeindruckte uns sehr: Jeden Morgen bereitete uns Wenche ein anderes Frühstück zu mit lauter feinen Sachen: Eiern, Früchten, verschiedenen (norwegischen) Käsesorten, Fleisch und Lachs. Und das Tüpfli auf dem i: Sie hat extra für uns in der Schweizer Bäckerei frisches Brot gekauft. So lieb! Sicher hätten wir ja diese drei letzten Tage noch warten können…
Das letzte Attraktionen – Multipack 6. März 2014
An unserem letzten Tag hatte ich drei Programmpunkte vor, und da hätte es fast unsere erste ernsthafte Auseinandersetzung gegeben. Am Morgen wollte ich in den Jurong Bird Park (highly recommended, world's largest) besuchen, aber so viel Programm fand Theo dann doch zu viel. Er hatte sich vorgestellt, er könne packen und den ganzen Tag am Swimmingpool liegen…
Erst am Abend um elf mussten wir zum Flughafen fahren, also war da genügend Zeit, noch etliches zu „erledigen“. – Ich also blieb hart: „Sicher nicht! – Unser letzter Tag; du kannst die ganzen nächsten Wochen ausruhen und tun, was du willst. Heute nicht!“ – Zum Glück waren meine Argumente überzeugend genug, wir schnappten uns ein Taxi und fuhren nach Jurong. Vom Taxifahrer erfuhr ich, wie das so läuft mit den vielen Taxis in der Stadt. Als Fahrer mietet man bei einem Taxiunternehmen ein Auto und muss dann pro Tag mindestens 250 km mit Gästen fahren, sonst gibt’s eine Busse. So angeordnet von der Regierung. Harte Sitten! Ferien kann der arme Kerl nicht machen, er arbeitet etwa zwölf Stunden am Tag inklusive sonntags.
Wieso der Verkehr relativ flüssig ist und es gar nicht sooo viele Autos hat, erfuhren wir auch: Wer in Singapur ein neues Auto kaufen will, muss fast 100 % Einfuhrsteuer bezahlen. Dazu kommt das Road Pricing, das offenbar gut und gern bis zu 500 S$ (ca. 350 Fr.) pro Monat kosten kann und die dritte Schikane: Man muss für ein Fahrzeug eine Lizenz kaufen. Die kann bis zu 60‘000 S$ kosten und läuft nach 10 Jahren aus. – Das ist nichts für Sparer und Geizkragen.
So ein Stündchen hätte Theo im Vogelpark bleiben wollen. Wir waren um zehn Uhr dort und um halb vier wieder zurück. Es gab viele interessante Vögel zu sehen und auch Shows konnte man beiwohnen, so dass die Zeit im Nu verflog.
Dann war da doch noch Musse für einen Schwumm und eine ausgiebige Siesta am Pool unten an „unserem“ Hochhaus.
Zwei Tennisplätze hat es dort übrigens auch, gleich vor der Haustür, und unsere Gastgeber luden mich sogar zu einem Spiel ein; das war mir aber dann doch auch zu viel am letzten Tag.
Um halb sechs waren wir parat für Programmpunkt Nummer zwei: eine Schifffahrt flussabwärts. Die Anlegestelle ist grad vor der Haustür, aber wir mussten etwa 20 Minuten aufs nächste Boot warten. Kein Problem, wir hatten ja Zeit. Die halbstündige Fahrt war sehr schön und geruhsam; vom Fluss aus zeigt sich eine ganz andere Perspektive als wenn man mit dem Bus durch die Gegend fährt.
Bei der Oper sollten wir bei den Food-Stalls essen, hat uns Wenche gesagt. Das taten wir. Sehr leckter und sehr billig war unser Abschiedsdinner.
Dann wurde es allmählich dunkler und Programmpunkt drei nahte: die Lightshow (the free outdoor Wonder Full sound and laser show at Marina Bay Sands). Der Spaziergang über die beleuchtete Brücke vorbei an der neuen Art Gallery und der Marina Bay war an sich schon fantastisch – der Himmel wurde immer dunkler, immer mehr Lichter konnte man erkennen – eindrücklich und überwältigend!
Für die Lichtschau hatte sich alsdann eine grosse Menge Leute versammelt, um dem Spektakel zuzusehen, ähnlich wie in Bern bei der Bundeshaus-Lichtshow. Hier aber wird keine Fassade angestrahlt, es werden in der Bay zwei Wasserfontänen beziehungsweise Wasserwände hochgespritzt und an diese werden Bilder und Lichtspiele projiziert. Ein Millionenprojekt offenbar, ganz imposant anzusehen, aber auch ein wenig kitschig. Uns hat’s trotzdem gut gefallen. Dazu kam die tolle Temperatur, etwa 25 Grad am Abend, kein Gedanke an eine Jacke. T-Shirt und Hemd mit kurzen Ärmeln waren angesagt.
Was war das für ein schöner Abend! Sogar Theo musste zugeben, dass es mehr als nur schade gewesen wäre, wenn wir uns „mein“ Abendprogramm hätten entgehen lassen. Für den Heimweg wär‘s am praktischsten gewesen, wieder das Boot zu nehmen, aber da hätten wir zu lange warten müssen. Ein Taxi zu finden, war allerdings auch gar nicht so einfach, alle waren besetzt. Endlich gelang es doch und kurz nach neun waren wir daheim. Nach einer guten Stunde Packen war auch das zum letzten Mal geglückt; ein zusätzliches Gepäckstück hatten wir tags zuvor in der Stadt gekauft.
Home, sweet home 7. März 2014
Wenche und Even begleiteten uns hinunter, wir bestiegen ein letztes Mal ein Taxi und waren eine halbe Stunde später schon am Flughafen. Unseren deponierten Koffer bei der Gepäckaufbewahrung holen, einchecken, Koffer abgeben (vier Gepäckstücke unterdessen - 58,5 kg), warten bis zur Boardingtime - um halb zwei Uhr morgens startete unser 13-stündiger Flug. – Das war‘s. - Eine ewig lange Nacht, nur wenig Schlaf, mehrere Filme, ein paar Mahlzeiten, und schon landeten wir morgens um acht bei minus 2 Grad und schönstem Wetter in Zürich. Theo kann endlich seinen Famous Grouse Whiskey in der Tax Free Zone kaufen.
In Bern holt uns Gino am Bahnhof ab. Zu Hause wartet uns einmal mehr eine Überraschung: Diego und Gino haben die Renovation unseres Wohnzimmers geplant, organisiert und überwacht. Alles wunderbar. Nur unsere Katze Maxi will nichts mehr mit uns zu tun haben. Wie sie uns sieht und hört, nimmt sie entsetzt Reissaus.
Unsere grosse Reise ist eigentlich zu Ende, aber doch noch nicht ganz. Wenige Tage daheim (bei schönstem Wetter), schon geht‘s weiter nach Bivio; schliesslich wollen wir ja doch noch das Skisaison-Ende in Graubünden miterleben. Und wieder darf ich schreiben: „Wenn Engel reisen...“: blauer Himmel, strahlender Sonnenschein und Schneemassen, wie wir sie selten zuvor erlebt haben. So erwartet uns die Perle am Julier.

Reisebericht Vietnam – Kambodscha – Thailand
Neue Reisepläne im selben Jahr 2014 - Nach der Reise ist vor der Reise
Eigentlich ist’s ja noch nicht lange her, seit wir von unserer 5-monatigen Reise zurück sind. Aber nach einem schönen Sommer in der Heimat wird ja auch der Herbst wieder Einzug halten und eines ist sicher: Solange wir gesund sind und reisen können, will ich keinen November mehr in der Schweiz verbringen. Es wird kalt und kälter, neblig und nebliger, die Tage werden kurz und kürzer, es wird dunkel und dunkler, Schnee kann schon fallen. „Herbst-Schweiz-Flucht-Ferien“ sind es, die von nun an zu unserem Jahres-Programm gehören. Schon Mitte Oktober werden die beginnen und nicht vor Mitte Dezember zu Ende sein. - So auch in diesem Jahr.
Normalerweise planen wir individuelle Ferien, diesmal aber habe ich ausnahmsweise eine Gruppenreise gebucht. In einem Prospekt wurden Asienreisen angeboten, die mir auf Anhieb zusagten (eine Besichtigung der Tempelanlage Angkor Wat stach mir besonders ins Auge), und ich fand es auch ganz angenehm, mich für einmal führen zu lassen und nicht alles selber organisieren zu müssen. Das in einem Land, in dem ich der Sprache nicht mächtig bin und Englisch oder Deutsch vielleicht nicht überall gut verstanden werden. Man kann unglaublich viel Zeit verlieren, wenn man sich nur schlecht verständigen kann. Aber zweiwöchige Reisen kommen für uns glückliche Pensionierte natürlich keinesfalls in Frage. So buchte ich gleich zwei solche Reisen, die erste (Vietnam) nur mit Hinflug, die zweite (Vietnam, Kambodscha, Thailand) ohne Flüge. Zwischendrin ist’s mir gelungen, einen HomeExchange-Tausch zu organisieren und am Ende der zweiten Tour noch zehn Tage in Thailand „anzuhängen“. Den Heimflug buchte ich individuell.
Reisebericht Rundreise Vietnam 1:
Hanoi – Halong Bucht - Da Nang – Hoi An – Hue – Saigon – Mekongdelta – (Phan Tiet) Mui Ne
Vietnam ist mir in Erinnerung geblieben, weil jeden Tag davon die Rede war. In den Nachrichten. Vom Vietnamkrieg in den Sechziger- und Siebzigerjahren: Nord- und Südvietnam, Hanoi, Saigon, Hue, Da Nang, Demarkationslinie, 17ter Breitengrad, Napalm, Entlaubung, Entmilitarisierte Zone, Vietkong, Tet-Offensive, Ho Chi Minh-Pfad etc. etc.
Jetzt sind wir hier und an den Krieg erinnern ein paar Bunker, Museen, Berichte von Reiseführern, die uns versichern, man komme mit allen Touristen gut aus, aber im Innersten seien es noch immer die Franzosen, Amerikaner und Japaner, die man hasse.
Als Tourist merkt man vom Sozialismus in Vietnam wenig bis gar nichts. Dass das Internet rigorosen Zensuren unterworfen ist, stellt man auch nicht auf Anhieb fest, aber dass die Partei nach wie vor empfindlich auf Systemkritik jeglicher Art reagiert und die Kluft zwischen Arm und Reich, zwischen Stadt und Land immer grösser wird, kann man sich gut vorstellen. Das BIP liegt bei 1‘400 $. Wer mehr als zwei Kinder hat, verliert seinen Job.
Unsere Reise beginnt am 21. Oktober
Um halb acht steigen wir in Ittigen ins Bähnli ein – eine ziemliche Herausforderung für Theo. Am Bahnhof Bern kommt er gar nicht aus dem Staunen heraus, wie viele Leute da bereits wach sind und zielstrebig irgendwohin eilen.
Seinen ersten Adrenalinstoss hat er bereits im Zug nach Zürich, wo er plötzlich merkt, dass er seine Halbtaxkarte vermisst. Er ist jetzt ganz wach. – Nicht im Portemonnaie ist sie – nein, in den Koffer hat er sie eingepackt. Klar, es ist ja alles so rasch gegangen mit dem Packen. Wir hatten nur fast zwei Wochen Zeit gehabt dafür.
Der Flug nach Singapur dauert zwölfeinhalb Stunden und vier Filme lang. Wir haben eine Viererreihe für uns allein, so dass Theo doch recht viel zum Schlafen kommt. Nach fast drei Stunden Aufenthalt geht die Reise weiter und gut drei Stunden später landen wir in Hanoi. - Wir haben ein spezielles Visum, durch ein Reisebüro in Vietnam ausgestellt; aus diesem Grund müssen wir vor den Zollformalitäten im Einreisebüro unseren Pass abgeben zwecks Stempeleingabe, Foto- und Dollarabgabe. Das dauert. Es ist Mittag und da macht man halt Pause. Im Büro hat’s sechs Arbeitsplätze und haufenweise Pässe zum Bearbeiten. Unsere roten Dokumente werden abgelegt und dann passiert gar nichts mehr. Fünf Angestellte sitzen vor dem Büro brav nebeneinander auf Plastikstühlen und essen ihren Lunch. Zwanzig einreisewillige Touristen schauen ihnen dabei zu.
Ich bin wie auf Kohlen, denn gleich werden wir unsere Reisegruppe treffen, deren Teilnehmerinnen und Teilnehmer alle ihre Stempel im Pass schon haben. Die werden auf uns warten müssen und sich wohl unbekannterweise schon eine abschätzige Meinung von uns gebildet haben.
Nach einer halben Stunde ist die Pause vorbei, gemächlich macht sich der eine und die andere Zollbeamte an die Arbeit. Unsere Pässe sind weit unten. Endlich sind wir dran. 90 Dollar kostet das Vergnügen, zwei Passfotos geben wir ab, dann sind wir entlassen ins Land der freundlichen Menschen, der Motorradfahrer, der Nudelsuppen-Esser, der fantastischen Landschaften.
Wir sind zwar die Letzten, die zur Reisegruppe stossen, aber niemand sieht uns schräg an; die andern haben sich auch gerade erst getroffen, denn sie hatten sehr lange auf ihre Koffer warten müssen. – Für uns ist dieser Teil des Ablaufs easy: Beide Koffer stehen allein und verlassen vor dem Rollband; keine Sekunde haben wir mit Warten verloren.
Schon geht ‘s los mit der Stadtbesichtigung. Ein freundlicher Vietnamese stellt sich vor, Hang ist sein Name, und obwohl er Deutsch spricht, haben wir anfänglich Mühe, ihn gut zu verstehen. Seine Aussprache ist gewöhnungsbedürftig und wir müssen uns sehr konzentrieren, um zu begreifen, was er meint. Wir sind alle müde und seiner netten Bitte, ihm doch Fragen zu stellen, kommt niemand nach. Er hatte zehn Jahre lang in der DDR gelebt, dort Deutsch gelernt und hat einen riesigen Wortschatz. Deutsch ist eine schwierige Sprache zum Lernen, er kann’s wirklich gut – Respekt! - Aber die Aussprache… Wie ich dann begriffen habe, dass er das „sch“ nicht aussprechen kann, geht’s schon besser. Der „Swissenhalt“ hat nichts mit uns Schweizern zu tun, ist einfach ein Zwischenhalt. – Und was es in dieser Stadt nicht alles zum „Ansauen gibt“!
Auf der Stadtrundfahrt besichtigen wir den Präsidentenpalast, das Wohnhaus des Ho Chi Minh, die Ein-Säulen-Pagode, den Literaturtempel und den Hoam Kiem See. Als Erstes fallen uns jedoch die unendlich vielen Motorradfahrer auf, die wie die Motten ums Licht in der Stadt herumschwirren. Sagenhaft. 5% Autos, würd ich mal schätzen, und 95% Mofas. Wenige Fahrräder, dafür eine ganze Menge Rikschas, die meine Prozentrechnung in Frage stellen. Das Verrückte ist, alle fahren kreuz und quer, manchmal kommt einer oder auch eine ganze Gruppe in der falschen Richtung entgegen, das stört aber offenbar niemanden. Geschickt wird ausgewichen und umfahren. Transportiert wird, was irgendwie Platz hat auf dem Gefährt, Kisten, Fässer, TV-Apparate, zusätzliche Passagiere - einer hatte gar ein anderes Motorrad, quer liegend, hinten auf dem Gepäckträger aufgeschnallt.
Kameradschaft ist: Wenn man selber auf dem Motorrad sitzt und einem Kollegen, der auf dem Velo zwei 5 Meter lange Stangen transportiert, insofern hilft, als dass man den linken Fuss hinten in dessen Velosattel einklinkt und ihn mit mehr Power als durch seine eigene Kraft durch den Verkehr stösst.
Gehupt wird ständig. Das sei Vorschrift hier. Beim Überholen müsse man die Hupe betätigen. Das erfahren wir von Hang.
Rotlichter werden teilweise befolgt, von den wenigen Autos und Bussen schon, allerdings entspricht die Situation, die auf einem T-Shirt beschrieben wird, eher der Realität, jedenfalls für sämtliche Zweiräder: Eine Verkehrsampel ist abgebildet. Bei grün: „I can go“ – Bei orange: „I can go” – bei rot: „I still can go”.
Fast alle tragen bunte Helme. Auch das sei Vorschrift, wird uns gesagt. Pikantes Detail: Die Kinder brauchen keine Helme. Bei mehr als einem Töff war eine Art Hochstuhl aus Bambus fabriziert worden und zwischen Lenkrad und Fahrersitz montiert. Dort drauf sitzt das Kind und hat beste Aussicht auf den Verkehr und lernt schon früh, wie der gehandhabt wird. Fast alle Fahrerinnen und Fahrer tragen eine Gesichtsmaske. Klar, die Abgase würden sie ja sonst fast ersticken. Farbig sind ihre Kleider. Ob Muster und Farben zueinander passen, spielt keine Rolle. Hauptsache, bunt.
Das grösste Problem ist, durch diesen Verkehr hindurch über die Strasse zu gelangen. Wir erhielten eine Art Kurs von Hang. Man geht zielstrebig los und bleibt keinesfalls stehen oder verändert sein Tempo. Das braucht Mut! Aber es funktioniert bestens, wenn man die Sache beherzt angeht. Mir ist’s nur einmal passiert, dass ich stehenblieb, weil mich angesichts des nahenden und heftig hupenden Mofas plötzlich der Mut verliess. Das wäre beinahe schief gegangen. Die Fahrerin musste bremsen und fiel fast vom Sattel. Wäre ich weitergegangen, hätte sie problemlos an mir vorbeigekurvt. Die haben eine Art Ortungssystem in ihrem Hirn, habe ich das Gefühl. Wie Fledermäuse, Fische oder Vögel in einem Schwarm.
Kein Wunder dürfen Ausländer in Vietnam keine Autos fahren. Motorräder schon.
Fasziniert beobachten wir später den Verkehrsfluss auch vom Restaurant aus, wo wir am ersten Abend essen gehen. Wir suchten es aus, weil’s vom fünften Stock aus eine sensationelle Aussicht hat auf einen belebten Platz in der Nähe des Sees. Wir werden nicht müde, dem Spektakel im Kreisverkehr zuzuschauen.
Der Verkehr läuft bestens und die Fussgänger überqueren den Platz nicht etwa an der engsten Stelle, nein, etliche schlendern gemütlich mitten durchs Verkehrschaos quer hindurch, wo der Weg am längsten ist, so dass sie möglichst etwas davon haben. So wenigstens scheint es uns.
Natürlich haben wir uns auf unser erstes echt vietnamesisches Essen gefreut. Leider geht das ein wenig schief, weil ein Restaurant mit solcher Aussicht wohl eher etwas für Touristen ist. Vietnamesen essen auf dem Trottoir, auf ihren obligaten roten Plastik(kinder)stühlen oder sie hocken auf dem Boden.
Jedenfalls machen wir dort unsere ersten einschlägigen Erfahrungen mit der Sprache. Auf der Karte hat es auch eine vietnamesische Ecke. Sehr vietnamesisch scheint mir der dort angepriesene Hamburger allerdings nicht zu sein. Wir bestellen ihn dann doch, aber wollen keine French Fries, sondern Reis dazu. Unsere Kellnerin versteht beim besten Willen nicht, was wir meinen (ist NO mit entsprechenden Gebärden sooo schwierig zu verstehen?). Es wird ein Kollege hinzugezogen und schliesslich noch ein dritter Kellner, bis wir endlich das Gefühl haben, jetzt hat’s geklappt, denn es wird heftig genickt. - Was wir dann erhalten, sind unsere Hamburger mit ZWEI Portionen Pommes Frites. – Na ja. – Schlacht verloren. So viel zu unserem ersten Abendessen in Hanoi. Gerne würde ich ein Trinkgeld hinlegen, aber nicht grad 100‘000 Dong, einen Fünfliber. An der Kasse kann sie mir diese Note aber nicht wechseln.
Einen weiteren Spiessrutenlauf durch den Verkehr ertrage ich nicht mehr; ein Rikschafahrer bringt uns ins Hotel zurück, wo ich sofort einschlafe und nicht mal mehr Theos Schnarchen höre.
Früh geht’s los am nächsten Morgen. Die Halong Bucht, UNESCO Weltnaturerbe seit 1994, ist das Ziel. Um acht Uhr sind wir alle parat und stehen vor dem Hotel. Auch das Gepäck steht bereit am Strassenrand. Die Polizei auch. Die Beamten händigen dem Busfahrer, der dort eben ein paar Passagiere aufnimmt, grad eine Busse aus, denn vor dem Hotel darf man nicht anhalten. Und was ist mit unserem Bus? Der darf auch nicht anhalten. Was tun? Er wäre auch parat, der Fahrer hat aber offensichtlich keine Lust, eine Busse zu riskieren. Also dreht er Runden in der Hoffnung, die Polizisten verschwinden irgendwann mal. Aber denen verleidet’s vorerst noch nicht. Kein Wunder. Die sehen ja genau, was da abgeht: Neunzehn Touristen, über zwanzig Gepäckstücke und ein Reiseleiter stehen da und wollen abgeholt werden. Völlig klare Situation. Warten bringt’s. Also machen wir noch ein Spaziergängli. Der Bus dreht weiterhin Runden und der Reiseleiter gibt dem Buschauffeur per Handy laufend die Lage durch. Nach zwanzig Minuten ziehen die Beamten ab, vielleicht sind sie zu einem lukrativeren Ort abgezogen worden, vielleicht verlangt ihre Dienstvorschrift eine bestimmte Patrouille oder die Lust zu warten ist ihnen schliesslich doch vergangen. Wer weiss? Kaum sind sie weg, schon ist der Bus da, die rote Flanke des Fahrzeugs wird geöffnet, die Koffer werden in Windeseile in dessen Bauch einverlebt und los geht’s.
Unterwegs gibt’s immer wieder mal einen Halt zwecks Besichtigung eines Tempels und dessen Toilettenanlage oder es bietet sich ein schöner Lookout oder der Reiseführer sichtet schon von weitem einen BMW (Bauer mit Wasserbüffel).
Tags zuvor bereitet uns Hang bereits auf das bevorstehende Erlebnis vor. Er ist mehr als nur besorgt um unser Wohlergehen. Rührend! - Er sagt, es wäre wohl einfacher, für die einzige Übernachtung nicht das ganze Gepäck auf die Dschunke mitzunehmen, es sei überhaupt kein Problem, die grossen Koffer im Bus zu lassen, die seien dort vom Fahrer und vom Beifahrer bestens gehütet. Aber natürlich, wer gerne sein ganzes Gepäck dabei habe, das sei auch kein Problem, es habe in der Kabine genügend Platz, aber man könne die Koffer wirklich ohne Weiteres im Bus lassen etc. etc. Auf dem Weg an die Küste erklärte er nochmals alles ganz genau, wie das sei mit und/oder ohne Koffer. Wenn er Berndeutsch gekonnt hätte, hätte er nur zu sagen brauchen: „Machet doch mit dene Gofere, was dr weit!“
Hangs Art und Weise sich auszudrücken, ist äusserst freundlich. Er will es uns immer recht machen, versucht aber, wie bei den Koffern, durch die Blume mitzuteilen, was er gerne möchte.
So erklärt er bei einem kurzen Swissenstop: „Hier können Sie 15 Minuten Pause machen, also sagen wir lieber 13“. Nett war auch seine Aussage zum Stromverbrauch des Landes: „Wir bauen Atomkraftwerke. Ein bisschen (sein Lieblingswort) gefährlich, aber es muss sein“.
Auch hat’s manchmal Neukreationen in seiner Sprache, was ich allerding sehr charmant finde, wenn’s dann auch manchmal mit dem Verständnis leicht hapert. Und ja, wieso heisst’s eigentlich nicht „Einpflanzerung“? – könnte ja sein.
Immer schaut er wie ein Border Collie, dass er seine Herde beieinander hat. Wie Theo mal grad nicht neben mir geht, was ja doch öfter mal vorkommt, fragte er mich sogleich: „Haben Sie Ihren Mann verloren?“ - Auch beim Frühstück, mit Blick auf Theos leeren Stuhl, will er wissen: „Schläft er noch?“ - So viel Fürsorge. Wirklich nett!
Halong
Für unsere Gruppe ganz allein wurde ein sehr schönes und gemütliches Schiff ausgewählt, die „Garden Bay“. Eine äusserst freundliche Crew verwöhnt uns mit Speis und Trank. Wir lernen, wie man frische Frühlingsrollen zubereitet, erhalten Unterricht im Gemüse-Schnitzeln und eine hübsche Kabine erwartet uns zur vorerst nur kurzen Siesta. Per Boot (zu zweit oder zu viert - wir werden von einer Vietnamesin gerudert) machen wir nach dem Mittagessen eine Rundfahrt durch einen kleinen Teil der Tonkin Bay entlang der beeindruckenden Kalkfelsen, die hoch aus dem Meer herausragen und vorbei an Fischerdörfern beziehungsweise -siedlungen, die auf dem Wasser schwimmen.
Ein reger Handel findet statt, alles Mögliche wird auf den Booten angeboten, nicht nur Lebensmittel. Ein spezielles Leben muss das sein für die Menschen dort.
Etwas vom Schönsten an diesem Tag aber war dann vor dem Apéro das Schwimmen um unser Schiff herum im warmen Meer. Was für eine herrliche Abkühlung trotzdem.
Am nächsten Morgen besichtigen wir eine Höhle – Stalaktiten und Stalagmiten – riesig, gut ausgebaut und beleuchtet.
Leider ist das Wetter nicht ganz so wunderbar, so dass auf unseren Fotos der blaue Himmel fehlt. Wir haben die beiden Tage auf dem Schiff aber trotzdem sehr genossen und das Gute dabei war auch, dass wir, unsere Reisegruppe, sich ein wenig hat kennenlernen können.
Wir haben grosses Glück: Alles nette Leute aus verschiedenen Teilen der Deutschschweiz. 19 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir hatten‘s durchwegs bis am Ende der Reise sehr gut zusammen, hatten viel Spass und die meisten gingen jeweils zusammen essen. – Eine typisch schweizerische Gruppe: Niemand kam je zu spät, niemand hat sich beschwert, alle waren „easy drauf“. Wunderbar. Tan war einer der Teilnehmer (wie „Tannenbaum“, aber nach dem ersten „N“ kannst du’s sein lassen). Er wohnt in der Schweiz, hat aber keine schweizerischen Wurzeln, wurde in einem Dorf im Norden von Hanoi geboren, lebte dort während sieben Jahren und besuchte nun sein Heimatland nach 49 Jahren zum ersten Mal. Wenn er dabei war, ging’s einfach, er sprach und verstand die schwierige Sprache.
Apropos Sprache: Die ist wirklich nicht einfach zu lernen. Wie Hang erzählt, ist die Grammatik einfach, alle Verben werden in der Grundform verwendet und wenn etwas in der Vergangenheit passierte, ergänzt man den Satz einfach mit einem Wort ähnlich wie „schon“. Das wär dann also etwa so: „Ich schon essen.“ – Ein Kinderspiel! Aber dann die Aussprache! Dort wird’s unüberblickbar: Dasselbe Wort hat verschiedenen Bedeutungen, je nachdem wie man es ausspricht. So gibt’s nur ein Wort für langes Kleid und Büstenhalter sowie für drei verschiedene Früchte. Ebenfalls werden Schwiegermutter und Hexe gleich geschrieben aber anders ausgesprochen. Ist’s ein Zufall? Da muss man ja höllisch aufpassen.
Geschrieben wird die Sprache mit einer Unmenge an verschiedenen Sonderzeichen, ähnlich wie im Französischen, aber viel komplizierter. Das Cédille kommt auch oben am Buchstaben vor, manchmal sind Buchstaben gleich mit zwei oder gar drei Zeichen verziert, eines unten, zwei oben – auch auf der Seite gibt es welche. Und wie das dann tönt! Nicht so, wie wir das lesen. Der Ort, wo wir jetzt sind, wird so geschrieben: Phan Tiet. Das Girl an der Rezeption hat mich gelehrt, wie man das ausspricht. Ganz zufrieden war sie zwar nicht (vielleicht Berndeutscher Accent?): Fan Tiiii (letzte Silbe ganz hoch betonen!)
Bisher hab ich nur zwei Wörter gelernt: Eines geht ganz einfach: „Xin chào“ („Sin tschau“ - schreib ich jetzt mal so, wie’s für mich tönt). Hallo. Guten Tag, guten Morgen, Abend oder was auch immer.Das andere ist noch einfacher: „C%u1EA3m %u01A1n“ („Cam on“). Da muss ich immer an Roger Federer denken. Das Wort heisst „danke“. – Ich hab dann noch gefragt, was „bitte“ heisst. Das komme sehr auf die Situation und auf die Aussprache an. – Dann vergess ich’s lieber und sag einfach „please“. Wer’s nicht begreift, würde mich wohl so oder so nicht verstehen. Es geht mir ja gleich beim Soda-Wasser, das ich im Restaurant jeweils gerne bestelle. Wenn ich Glück habe, versteht mich der Kellner oder die Kellnerin, strahlt dann und sagt: „Sodaa“. Der Unterschied macht’s eben aus. Vielleicht hab ich das A am Ende nicht ganz hoch und lang genug ausgesprochen. „With ice“ will ich’s dann noch. “Ah, Ei“, sagen sie. Das geht sehr viel besser. Ein riesiger Klumpen Eis kommt jeweils, der fast das ganze Glas ausfüllt.
Hang hat ein grosses Wissen und er erzählt viel und gern. Auch von den Toten. Vom „Zwei-Mann-Begräbnis“. So hab ich’s jedenfalls verstanden, und nicht nur ich. In meiner Phantasie hab ich mir gleich vorgestellt, man müsse noch einen zweiten Toten suchen, wenn jemand stirbt. – Dem ist nicht so. Richtig wär: „Zweimal-Begräbnis“. Also das geht so (sehr kurze Kurzversion): Wenn jemand stirbt, wird er in der Wohnung während dreier Tage aufgebahrt. Die Idee dahinter ist (gemäss Hang), dass man sicher ist, dass er oder sie auch wirklich tot ist. Dann wird der Leichnam in einem weissen Tuch begraben. Nach frühestens einem Jahr werden in einem religiösen Zeremoniell, das noch wichtiger ist als die Erstbestattung, die Knochen aus der Erde geholt, gereinigt, und für die Ewigkeit im Familientempel aufbewahrt. Der liegt oft auf dem Reisfeld der Familie. - Es müssen wirklich alle Knochen sein, sonst wird das nichts.
Der Totenkult ist extrem wichtig in diesem Land. Geburtstagsdaten kann man getrost vergessen, aber nicht das Datum des Todes. Bis drei Generationen vorher müssen die Ahnen verehrt werden und das ist vor allem auch Sache der Schwiegertochter, all diese Daten zu kennen und zu verwalten.
Es scheint eine ziemliche Bürde zu sein, aber wer da nicht mitmacht, wird verachtet. Eine Zeitlang war dieser Kult von der Regierung verboten worden, jetzt ist er wieder erlaubt.
Kranksein scheint auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei: Hang erzählt, dass wegen Platzmangels in den Spitälern die Betten normalerweise doppelt belegt werden. Die Verpflegung der Patienten ist auch nicht gewährleistet, die muss von den Angehörigen bestritten werden. – Ich hab vergessen zu fragen, wie’s denn mit dem Spitalkäfer sei…
Hoi An
Am Freitag Flug nach Da Nang. Auf dem Programm sind zwei Übernachtungen in Hoi An, einer alten, ausgesprochen hübschen kleinen Handelsstadt (75‘000 Ew.) in Zentralvietnam, UNESCO-Weltkulturerbe seit 1999. Die Altstadt ist erhalten geblieben; es ist die einzige in Vietnam, die nicht im Krieg zerstört wurde.
Des Nachts, wenn alle Laternen leuchten und ein reges Leben herrscht rund um den Fluss Sông Thu B%u1ED3n herum, bei der japanischen Brücke, auf den Strassen und in all den netten Restaurants entlang der Promenade, ist’s besonders gemütlich. Wenn dann allerdings der Regen sintflutartig einsetzt, nicht mehr so. Zum Glück gibt’s Taxis. Es ist deren liebste Zeit; sie haben Hochbetrieb.
Hoi An hat einen malerischen, lebendigen lokalen Markt, viele Cafés, Restaurants und eine ganze Menge Geschäfte. Unser hiesiger Reiseführer Noggi (oder wie auch immer – er hat uns den Namen erklärt: Das war eine längere Episode und die Quintessenz, weil die Touristen das immer falsch aussprechen würden, bot er uns eben dieses „Noggi“ an) führte uns in ein Schneideratelier, wo sie Seidenraupen züchten und Kundenwünsche. Unsere Reisegruppe hat kräftig zugeschlagen. Ganze Anzüge, Winterjacken, Hosen, Hemden, Blusen wurden bestellt, alles auf Mass, gefertigt aus auserlesenen Stoffen und für unsere Verhältnisse spottbillig. Unglaublich, wie die Schneider rasch arbeiten. Alles war am Abend bereits parat, fünf Stunden nachdem die zahlreichen Aufträge erteilt worden waren. Allfällige Änderungen wurden während der Nacht erledigt und am Morgen früh ins Hotel geliefert. Alles passte bestens, alle waren zufrieden.
Es geht nicht nur um Shopping und Essen in Hoi An, nein, wir besuchen auch das ehemalige Wohnhaus einer Kaufmannsfamilie und die Versammlungshalle der chinesischen Gemeinschaft, ein Tempel, wo wir mit einer neuen Art von Räucherstäbchen konfrontiert werden. Eigentlich sind’s nicht Stäbchen, sondern Riesenspiralen, die zu Dutzenden an der Decke hängen. Man kann einen Wunsch aufschreiben und diesen Zettel (gelb muss er sein) in deren Mitte hängen. Dann wird die Spirale angezündet. Das Geniale dabei ist, sie brennt während dreier Monate, so dass also der Wunsch sehr viel grössere Chancen hat, erfüllt zu werden als bei einem lächerlichen Räucherstäbchen, das nur grad einen Tag lang brennt. Selbstverständlich muss man sich das aber etwas kosten lassen. Die Spirale kommt auf umgerechnet 25 Franken zu stehen.
Da Nang und Hue
Am folgenden Tag fahren wir über die Drachenbrücke nach Da Nang. Dort besichtigen wir zuerst das Cham-Museum, wo wir ausführlich über die Gegend und die Geschichte der Region informiert werden. Anschliessend gibt’s einen kurzen Halt am Strand in Da Nang (ehemals China Beach, wo sich die amerikanischen Soldaten ausgeruht und vergnügt haben und wo jetzt Luxushotels die Promenade säumen) und gleich geht’s weiter über den Wolkenpass (496 m). Guter Name: Man sieht schon von weitem, dass auf dem Gipfel Nebel herrscht.
Hue ist unser nächstes Ziel. Wir besuchen zuerst das Wahrzeichen, die Thien Mu-Pagode (Pagode der himmlischen Frau), ebenfalls UNESCO Weltkulturerbe seit 1993 und machen anschliessend auf dem Perfume River, dem Fluss der Wohlgerüche (Song Hurong), eine Flussfahrt in einem Drachenschiff. Eindrücklich und sehr schön die Pagode, erholsam die Bootsfahrt, obwohl nicht alle von uns grad begeistert sind von der jungen Frau, die uns aus einem nicht mehr enden wollenden Arsenal von Souvenir-Angeboten irgendetwas andrehen will, egal was. Darunter zum Beispiel einen ca. 20 cm langen, am Boden herumrobbenden, wild um sich schiessenden amerikanischen Plastik-Soldaten, ausgerüstet mit rotem Blitzlicht. Unnötig zu erwähnen: Den will niemand kaufen.
Der Kaiserpalast in Hue ist am nächsten Tag auf dem Programm, nachdem unsere ganze Reise-Gruppe per Rikscha dorthin gefahren wird. Mitten durch all den Verkehr, der allerdings nicht halb so wild ist wie in Hanoi. Trotzdem: Was für ein Anblick - all die herumgekäreleten Touris. Und urplötzlich, wie aus dem Nichts, taucht auch ein Fotograf vor uns auf, der, breit lächelnd, ein paar einschlägige Fotos schiesst, immer mal wieder, ich weiss nicht, wie er das schafft. Und 20 Minuten später, wir sind grad erst am Ziel angekommen, schon wieder im Grüppchen um Noggi herum, aufmerksam seinen weitschweifenden Ausführungen lauschend, kommt er bereits mit den Abzügen daher. - Jeder versucht eben auf seine Weise, zu einem Verdienst zu kommen. Wenigstens hat die Zeit nicht gereicht, die Fotos auf die obligaten in Asien üblichen grässlichen weissen Plastikteller zu applizieren. Die Fotos kaufen wir ihm natürlich ab. Unterbelichtet, mega-dünnes Fotopapier, aber eben… Mein Souvenir zerlege ich im Hotel später kurzerhand in kleine Fötzeli und versorge es im Rundordner. Theo, wie immer, war zwar sogar da recht fotogen drauf.
Lange lässt sich Noggi Zeit, uns im Kaiserpalast und in der verbotenen Stadt alles zu erklären. Und das ist viel. Viele Kaiser, viele Konkubinen (bei einem waren’s 142), viele Kaisermütter und –gemahlinnen, viele Anekdoten, viel Geschichte, viel, viel, viel. Sein Wissen erscheint unerschöpflich, sein Stehvermögen auch. Interessant ist’s alleweil, aber manchmal, so lange in der Sonne bei mehr als 30 Grad um ihn herumzustehen und vollgetextet zu werden…
Auch Noggi hat in der DDR Deutsch gelernt. Er ist enorm eloquent und hat wie Hang einen grossen Wortschatz. Anfänglich haben wir das Gefühl, wir verstünden ihn besser als Hang, aber das ist wohl eher, weil wir inzwischen weniger müde und allmählich an die Lautverschiebungen gewohnt sind. Irgendwas erzählte er tags zuvor im Bus mal von einem „Krapp“, wahrscheinlich etwas mit Krabben dachte ich, aber es stellte sich später heraus, er sprach von der Grab-Anlage des Kaisers Tu Duc (de.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B1_%C4%90%E1%BB%A9c">T%u1EF1 %u0110%u1EE9c), die wir besichtigen würden. Den Namen des Kaisers sprach er auch (für meine Ohren) seltsam aus, eben vietnamesisch. Es tönte wie eine einzige Silbe „Tdc“ etwa, und er spuckte den Namen mehr aus als dass er ihn sprach. Das bereitete mir ebenfalls ein wenig Mühe. Dank Wikipedia kam ich dann aber doch dahinter, worum es ging.
Dieser Kaiser hatte vorher bereits 16 Jahre lang in dieser Anlage gelebt, schön mit Teehaus, See und kleiner Insel, wo er, wie uns erzählt wurde, vom Ufer aus auf Kaninchen schoss. Auch lebte er dort mit etlichen Konkubinen, zwei davon mussten offenbar jeweils morgens in der Früh den Tau von den Blättern einsammeln, damit er sich Tee aus Morgentau zubereiten lassen konnte. Ja, die Herrscher damals hatten tolle Ideen. Heute ja auch, wenn man zum Beispiel an Nordkorea und „unser“ in Köniz ausgebildetes, im Moment hinkendes Staatsoberhaupt denkt…
Der Sarkophag in der Anlage war allerdings leer, liess uns Noggi wissen, aus Angst vor Grabräubern habe man den Kaiser irgendwo verscharrt, man wisse jetzt aber nicht mehr, wo. Na ja… Das Ganze erinnert mich ein wenig an die Eichhörnchen, die ja auch ihre Nüsse vergrabe und dann nicht mehr wissen, wo. – Vielleicht hinkt der Vergleich zwar ein wenig…
Dort, in der Krapp-Anlage, haben wir, Theo und ich, es fotografierenderweise fertig gebracht, die Gruppe zu verlieren. Wie wir sie wiedergefunden haben, hat uns Edgar zurück zu den sehenswerten Orten geführt und zusammengefasst, was Noggi den anderen wortreich mitgeteilt hat. Was für eine angenehme Erfahrung: Alle Informationen auf Schweizerdeutsch, deutlich und konzis.
In dem Zusammenhang: Eine von Noggis Eigenheiten ist es, etwas zu erzählen und dann in die Runde zu fragen: „Wissen Sie warum?“ – Manchmal lässt sich jemand auf eine Spekulation ein, aber meistens stehen wir nur dumm da. Er hat sein Erfolgserlebnis und kann’s dann erklären. Er lüftet sozusagen das Geheimnis, lässt die Katze aus dem Sack. – So wird die Geschichte spannend! Vielleicht hat er das in einem Lehrerfortbildungskurs gelernt…
Bevor wir ins Hotel zurückkutschiert werden, besuchen wir noch eine kleine Räucherstäbchen-Werkstatt. Auch die all überall beliebten Sonnenhüte werden dort geflochten.
Zudem findet Theo hier mit Noggis Hilfe auch seinen originalen Vietnam-Coffee-Filter, ein kleines Gefäss aus Aluminium, eine Art Mini-Löchersieb, das auf die Tasse gestellt wird. Durch dieses Ding rinnt der Kaffee in zäher Langsamkeit ins Glas. Das ergibt eine Art Ristretto. Der Vietnam Coffee wurde in der Gruppe immer beliebter, wird aber nicht überall gleich serviert. Hauptsache: starker vietnamesischer Kaffee und am Boden der Tasse eine Lage gezuckerte Kondensmilch – nichts für Leute, die an Decaf gewöhnt sind. Detail: Wenn man nicht sagt, man möchte einen heissen Kaffee, wird einem oft ein kalter serviert in einem Glas mit Röhrli und zehn Eiswürfeln. Monica hat von der besseren Geschirr-Ausführung gleich zehn Stück mit nach Hause genommen inklusive zwei kg vietnamesischen Kaffee. – Da bin ich also glücklich zu einer Neuanschaffung in unserem Haushalt gekommen, welche genauso herumstehen wird wie die Schöpfzange, die auf unserer vorletzten Reise in Melbourne unbedingt hatte gekauft werden müssen, obwohl sie in zweifacher Ausführung bereits vorhanden ist. Zuhause wird ja dann Herrn Clooneys Kaffeemaschine wieder Trumpf sein.
Monica ist übrigens noch der grössere Kaffeefan als Theo. Sie hat ein ganzes Glas Nescafé von zu Hause mitgenommen und zwei Tuben gezuckerte Kondensmilch. Da sie nun all das gar nicht braucht und es nicht wieder mit heimnehmen will, „erbt“ Theo beides und ist glücklich. Die Kondensmilch überlebt die nächste Woche nicht.
Um halb sechs wird’s fast von einer Minute auf die andere stockfinster. Also bringt uns der Bus zurück ins Hotel. Nach einer kurzen Siesta lassen wir uns in einem hübschen Gartenrestaurant kulinarisch verwöhnen. Grad bevor der nächste Regenguss kommt, sind wir zurück.
Saigon oder Ho-Chi-Minh-Stadt
Am Dienstag, dem 28. Oktober, fliegen wir von Hue nach Saigon. Nur eine Stunde dauert der Flug.
Wieder ein neuer Reiseleiter, wieder mit einem u-komplizierten Namen, der sich schliesslich auf Don reduzieren lässt. Stadtrundfahrt und Spaziergang durch die ehemalige Hauptstadt: Historisches Museum (Ho-Chí-Minh-Museum), Kathedrale Notre Dame (von den Franzosen dem Pariser Vorbild „nachgebaut“), altes Postgebäude, Opernhaus, Rathaus. Den Ben Thanh Market mitten in der Stadt besuchen wir ebenfalls. Stickig ist’s dort drin und heiss. Die gedeckte Markthalle ist ein riesiges Labyrinth mit Dutzenden von kleinen und kleinsten Shops, die alle etwa dasselbe verkaufen, nämlich T-Shirts, Stoffe, Hüte und immer wieder T-Shirts. Theos neues Tommy-Hilfiger-Shirt stammt auch von dort.
Unser Hotel, das Signature Hotel, ist dort ganz in der Nähe, und am Abend essen wir in einem Strassen-„Restaurant“ neben dem Markt. Wir setzen uns, obwohl wir die ersten dort sind, was ja immer ein wenig suspekt ist. Es dauert jedoch keine zehn Minuten und die Bude ist voll. Ungefähr hundert Gäste sind’s mindestens. Der Service ist rapid und sehr freundlich. Die Strassenküche mit ihren etwa fünfzehn Köchen arbeitet auf Hochtouren. Es hat auch Angestellte, die den Gästen die Crevetten und anderes Meergetier schälen und hübsch wieder präsentieren. Wer hätte das gedacht! Schliesslich ist’s ja nicht grad ein 5-Stern-Lokal. Wein gibt’s jedenfalls keinen. Bier schon. In rauen Mengen.
Mekong-Delta
Am nächsten Tag fahren wir ins Mekong-Delta. In der Stadt My Tho besteigen wir ein Schiff und fahren entlang von Inseln, durch Kanäle, an Fischerdörfern vorbei. Eine Fahrt mit einem kleineren Boot durch einen engeren Kanal wird uns auch geboten, sogar eine kurze Fahrt auf einer Pferdekutsche. Darauf hätt‘ ich zwar fast lieber verzichtet, denn die Tiere tun mir jeweils leid bei solchen Unternehmungen.
In einem Fischerdorf werden uns Honigtee und Früchte serviert. Wir können bei der Täfeli-Produktion zusehen. Diese werden unter anderem aus Kokosmilch und Erdnüssen hergestellt, und das Resultat ist eine Art Karamell. Der Teig wird ausgewallt, in keine Quadrate geschnitten, mit einem feinen Reispapier umwickelt, das man mitsamt dem Bonbon essen kann, und schliesslich in ein Papier verpackt. Die ganze Produktion (vier Leute sind an der Arbeit) geht rasend schnell vonstatten und der Kauf danach ist selbst für mich ein Muss. Sie kleben so herrlich an und zwischen den Zähnen und haben ein absolutes Abhängigkeits-Potenzial.
Im Verkaufslädeli wird auch Schlangenschnaps angeboten. Theo probiert freiwillig davon aus der 5l Flasche, gefüllt mit Reptilien – mit wird fast schlecht.
In einem idyllischen Restaurant erhalten wir ein fabelhaftes, liebevoll präsentiertes Mittagessen. Elefantenohr-Fisch gibt’s unter anderem, schön zubereitet vom Personal (Plastik-Handschuhe!) und in frischen Frühlingsrollen serviert.
Zurück in Saigon
Wir haben noch ein wenig Zeit. Theos Siesta ist immer einmal mehr zu kurz gekommen, aber bald gibt’s ja Ferien. Ab morgen…
Da sich an meinem Laptop der Cursor via Touchpad nicht mehr bewegen lässt, will ich eine Maus kaufen, um den Schaden zu umgehen. Don hat uns gesagt, wo ein solches Geschäft zu finden ist. Wir machen uns also auf zum Mauskauf. Das wird ein Erlebnis der besonderen Art. Es beginnt zu regnen, grad wie wir beim Laden ankommen. Nguyenkim ist so etwas zwischen Interdiscount und Mediamarkt.
Wir finden die Maus; sie kostet umgerechnet vier Franken. Aber wir dürfen sie nicht einfach so nehmen und damit zur Kasse gehen. Nein, da braucht’s zuerst einen Verkäufer, der ein Formular ausfüllt, hinschreibt, was ich kaufen will und mein Name muss auch vermerkt werden. Mit diesem Zettel dann geh ich zur Kasse. Vor mir ist nur eine Kundin, die am Zahlen ist, aber ich nehm’s jetzt vorweg: Es dauert geschlagene zwanzig Minuten, bis ich auf meinem Beleg den Stempel habe, der beweist, dass ich bezahlt habe. Das Girl an der Kasse muss nämlich alles in eine Tastatur eintippen und das dauert. Hinter mir hat sich eine ganze Schlange von Kunden gebildet, die auch bereits ihr Formular und die Geldscheine abgeben. Das ganze Prozedere erinnert mich an die Zoll- bzw. Visum-Formalitäten in Hanoi. Kompliziert muss es sein. Erst wenn alles fein säuberlich erledigt ist, kann ich „meinen“ Verkäufer wieder suchen und er gibt mir endlich, was ich kaufen will.
Ja, und jetzt kann ich eben auch wieder meinen Bericht schreiben, den zu verfassen ich vorher so oder so gar keine Zeit gehabt hätte.
Es hätte auch noch länger dauern können an jener Kasse. Das wär ziemlich egal gewesen, denn inzwischen ist der Regen so stark geworden, dass an ein Weitergehen nicht zu denken ist. Es giesst wie aus Kübeln. Wir setzen uns vor den Laden auf die Treppe und warten auf bessere Zeiten. Inzwischen fragt (Gebärdensprache) der Wachtmann, ob er mal Theos e-Zigarette ausprobieren dürfe. Er zieht, hustet und gibt sie ihm unergründlich lächelnd zurück.
Alle zehn Minuten findet Theo, es regne jetzt weniger und wir könnten doch nun endlich gehen. Aber erst nach einer halben Stunde willige ich ein. Noch immer tropft es von den Dächern und Bäumen und gegen die riesigen Wasserlachen auf den Strassen gibt’s auch kein Mittel.
Wir finden schliesslich eine nette Grill-Bar, ganz trendig, wo wir ein feines Nachtessen erhalten, wieder mal ein Stück Fleisch mit Kartoffeln für Theo, ganz unasiatisch. Der Buddha auf dem Tisch schaut zu.
Eine weiter unasiatische Mahlzeit hat Theo später in Mui Ne gegessen: Spaghetti Carbonara. Leicht süsslich. Wurde wohl mit gesüsster Kondensmilch verfeinert. – Selber schuld!
Phan Thiet / Mui Ne
Am nächsten Morgen geht’s bereits um acht Uhr los. Per Bus nach Phan Thiet. Die Strecke ist ca. 200 km lang, aber Don hat uns gedanklich auf eine mindestens fünfstündige Busfahrt vorbereitet. Sechs Stunden dauert sie dann tatsächlich mit zwei kurzen Halten zwischendurch. Vorbei an Hunderten von Reisfeldern führt sie. Erst gegen Süden wechselt der Anbau und es sind Dragon-Fruit-Plantagen, die kein Ende nehmen.
Vorbei an den Fischerhäfen von Phan Tiet und Mui Ne mit ihren zahllosen farbigen Fischerbooten und -körben erreichen wir endlich am frühen Nachmittag unser Hotel, „Sailing Bay“. Dort nun beginnen unsere Bade- und Erholungs-Ferien von der Rund- und Stress-Reise. Theo kann endlich wieder ausschlafen, allerdings nicht zu lang: Frühstücksbuffet gibt’s nur bis halb zehn.
Das Hotel ist sehr schön ausgestattet mit modernen, grosszügig konzipierten Zimmern, mit tropischem Garten und riesigem Swimmingpool – hier kann es uns wohl sein. Leider ist es ein wenig weit weg vom Geschehen; das nächste Dorf, Mui Ne, mit vielen Restaurants und Lädeli ist etwa 20 Minuten Fahrt weit weg. Es gibt aber einen Shuttle-Service und Taxis.
Was wir alle ein wenig seltsam fanden, ist die Tatsache, dass man nach zehn Uhr abends nichts mehr zu trinken bekommt. Keine Bar - man ist quasi dazu verdammt, aufs Zimmer zu gehen und dort eventuell einen Tee zu trinken, wenn man nicht vorgesorgt und wie Theo immer eine Flasche Whisky dabei hat.
Besonders gefallen hat uns aber das jeweilige nachmittägliche Spektakel am Strand: Da kommen im Abstand von etwa einer Viertelstunde drei bis fünf Fischerboote ziemlich nah ans Ufer heran, wenden und vom Heck des Schiffes aus springen etwa zwanzig junge Männer ins Meer mit Säcken und Netzen voller Muscheln, die sie vorher gesammelt haben. Damit die Säcke nicht zu schwer zu tragen sind, binden sie aufgeblasene Plastik-Handschuhe an die Netze und schwimmen damit durch die stürmische Brandung ans Land. Das sieht recht komisch aus: Wie Fabelwesen und wie aus dem Nichts tauchen die Muschelgiele mit den seltsamen rosaroten Plastikbällen, die aussehen wie Kuheuter, aus dem Meer auf und entsteigen den Wogen. - Aber dann geht’s los. Händlerinnen haben sich bereits am Strand versammelt, bewaffnet mit Waagen und Geldscheinen, gleich bündelweise. Auch Grillvorrichtungen haben sie dabei, um anschliessend an Ort und Stelle einen Teil der gekauften Ware mit der Familie zu verspeisen. Der Handel blüht. Muscheln werden gewogen, Preise in den nassen Sand geschrieben, Geldscheine wechseln den Besitzer. Die jungen Männer haben auch Kleidung bei sich, die sie in Plastiksäcken mitgebracht haben (ähnlich wie das gewisse Aareschwimmer im Marzili tun). Sie ziehen sich an, essen mit und begeben sich dann Richtung Dorf.
Tan kauft zwei Kilo Muscheln und lässt sie auf dem Grill zubereiten. Zum Apéro. Für einen knappen Fünfliber. Netterweise lädt er uns zu diesem Schmaus mit ein.
Vier Übernachtungen waren‘s im Sailing Bay und wir alle haben die Musse genossen. Ausruhen, ein wenig baden im Meer, die Sonne geniessen, dem Muschelhandel zusehen, die letzten paar Mal zusammen essen gehen – ein gediegener Abschluss.
Am 3. November ist dieser Teil unserer Ferienreise vorbei. Wir verabschieden uns herzlich von den anderen Reiseteilnehmerinnen und - teilnehmern und werden von Christina und Shina Fullerlove abgeholt, einem jungen Ehepaar, das hier in der Gegend wohnt (10 km weiter) und mit denen wir über die Plattform HomeExchange einen Haustausch (mit Bivio) vereinbart haben. Sie sind mit dem Motorrad unterwegs, wir fahren mit dem Taxi hinterher.
Zwischen-Reisebericht Mui Ne 3. – 20. November 2014
Adressen sind, wie wir erfahren, so oder so eine Sache für sich in diesem Land, erst recht, wenn man der Sprache nicht mächtig ist. Da hapert es schon bei der Übermittlung. Also ist es für die beiden viel einfacher, uns abzuholen. Wir fahren eine kurze Strecke, dann sind wir dort, wo wir für die nächsten elf Tage und Nächte bleiben werden. Auf dem Land, könnte man sagen. Auf einer schmalen Landstrasse halten wir an. Die Gegend scheint unbewohnt. Wie wir sehr bald merken, ist dem aber doch nicht ganz so. Entlang der Strasse hat’s immer wieder mal ein Haus oder auch nur eine Hütte, ein wenig im Gebüsch versteckt, so dass man gar nicht sieht, dass dort jemand wohnt. Es dauert allerdings nicht lange, bis wir unmissverständlich merken, dass wir Nachbarn haben, unsichtbare sozusagen. Auch deren Hunde sehen wir nicht, aber wir hören sie. Vor allem nachts. Ganze Rudel, dünkt es uns. Hühner und Güggel bevölkern die Umgebung ebenso. Die hören wir auch. Nicht nur morgens in der Früh. Die Kräherei nimmt Formen an, die Theos empfindlichen Schlaf durchaus stören könnte. Dann auch die Lastwagen, die um sechs Uhr morgens wie bei einem Downhill-Rennen vorbeidonnern. Wer hätte gedacht, dass an diesem Ort so viel Verkehr herrscht. Vielleicht wird irgendwo gebaut und die liefern den Zement und die Baumaterialien ab. Egal, wir haben Ferien. Mich stört das nicht und tagsüber hört man ausser den obligaten Mofas und deren ständigem, nervtötenden Gehupe nicht viel. Im Haus sind wir allein; es ist ein Bijou inmitten eines tropischen Gartens, mit einem Swimmingpool, drei geschmackvoll eingerichteten Schlafzimmern, einer gut ausgerüsteten Küche (wir finden sogar Eierbecher und Espresso-Tassen – Theo hat ja aus Frust wegen früherer einschlägiger Erfahrungen immer eine im Gepäck mit dabei) und einem gemütlichen Wohnzimmer. Wasch- und Abwaschmaschine natürlich auch.
Unsere Gastgeber erklären uns alles und ziehen dann in ihr anderes Haus am Strand um.
Im Kühlschrank entdecken wir einen Notvorrat bestehend aus etwa zehn Flaschen Bier und auf dem Küchentisch steht ein riesiger Korb voller Früchte. Nun ist es so, dass ich kein Bier-Aficionado bin und Theo hat ein wenig Angst vor Früchten. Er ist überzeugt, die bewirken Gelenkschmerzen und allenfalls auch Haarausfall, genauso wie es ja auch das Gemüse tut. Also müssen wir als Erstes einkaufen gehen, wenn wir hier überleben wollen.
Etwa hundert Meter weiter vorn hat’s ein Lädeli, ja eigentlich sogar ein Restaurant. Ein paar wenige Tische sind vorhanden. Die einen bestehen aus auf Hochglanz poliertem Metall, aus Plastik die anderen. Ein Supermarkt ist es gerade nicht; die Auswahl ist weit weg von atemberaubend. Trotzdem können wir 8 Eier erstehen, 1 Säckli UP-Milch (2,5 dl), 5 Büchsen Cola, 4 Pack Nudelgerichte, 8 Flaschen Süssgetränke, 2 Päckli Güezi (für Theo) und für all das haben wir nur gerade 137‘000 VND bezahlt, das sind knapp sieben Franken. – Brot gibt’s nicht, mein Soda-Wasser ebenso wenig, an Wein ist nicht zu denken - aber wir haben ja Mui Ne ganz in der Nähe und all die netten Restaurants.
Um halb sechs wird’s von einem Augenblick auf den andern dunkle Nacht. Wir geniessen ein karges, weinloses Mahl; Theo muss sich mit der Nudelsuppe und den Güezis zufriedengeben (Whisky hat’s ja dann auch noch); ich halte mich an die Früchte. Es ist aber schön, draussen zu essen bei der romantischen Gartenbeleuchtung.
Eine zwei auf drei Meter hohe Leinwand kann man beim Terrassenfenster herunterlassen und von Hunderten von Filmen, die Fullerloves gespeichert haben, aussuchen, welchen wir uns ansehen wollen. Wir habe ebenfalls eine ganze Menge Filme bei uns, Gino hat uns etliche auf einen Stick geladen und mitgegeben, damit es uns nicht etwa langweilig wird. Theo hat sogar eine DVD-Serie dabei, die wir uns dann mal anschauen wollen: „Homeland“. Er hat aber bemerkenswerterweise nur die Season 2 mitgenommen. Das gibt Rüge. Klar. Man nimmt doch nicht einfach nur den zweiten Teil einer Serie mit, beginnt die ganze Geschichte also in der Mitte. Wir tun’s doch. – Kurz bevor wir die zwölf Episoden hinter uns haben, findet Theo im Gepäck Season 1. Na also, beginnen wir die Serie doch von Anfang an. Wir wissen ja jetzt, dass die Helden wenigstens ein Stück weit überleben.
So gibt’s also gar nicht viel zu erzählen von diesen stillen Tagen in Clichy. Wir geniessen beide vor allem das Nichtstun, lesen viel, erholen uns von der Rundreise und lassen diese mit Fotos-Bearbeiten und -Sortieren sowie Reisebericht-Schreiben Revue passieren. Etwa jeden zweiten Abend lassen wir uns ein Taxi kommen (wir haben von unseren Gastgebern ein pre-paid Natel erhalten mit den Taxi-Telefonnummern von Herrn Dung und Herrn Phi drauf, die ein bisschen Englisch können und wissen, wo wir wohnen, so dass sie uns immer wieder wohlbehalten nach Hause fahren können. Erschwerend für uns kommt allerdings dazu, dass wir die Herren beim besten Willen nicht auseinanderhalten können (das alte Vorurteil - einmal mehr bestätigt), so dass wir mehr als einmal ins falsche Taxi einsteigen und erst realisieren, dass es sich um den falschen Fahrer handelt, wenn er kein einziges Wort Englisch spricht. Wir merken dann aber bald, dass die Taxi-Zentrale das Problem fest im Griff hat und die Fahrer sich entsprechend gegenseitig orientiert haben, was sie mit uns anfangen beziehungsweise wohin sie uns bringen sollen. Wir werden immer auf direktem Weg an den richtigen Ort geführt. Es gelingt sogar, ein Taxi auf den Freitag unserer Abreise zu bestellen, um elf Uhr morgens. Datum und Uhrzeit notiert sich der Fahrer, und wer hätte das gedacht: Pünktlich steht das Taxi da und bringt uns ans nächste Ziel unserer Reise. Ob es derselbe Fahrer ist, kann ich halt nicht sagen.
Es dauert noch fast eine Woche bis unsere zweite Gruppenreise beginnt. Fullerloves haben neue Gäste, wir ziehen für weitere sechs Tage in ein Hotel um.
Nach einer fünfminütigen Taxifahrt kommen wir im Sunshine Beach Hotel an, wo wir einen Bungalow direkt am Strand gemietet haben; uns trennt nur unsere leicht erhöhte Terrasse vom Geschehen. So haben wir auf unseren Liegestühlen quasi Sperrsitz zu allem, was dort geschieht. Auch vom Bett aus. Es ist herrlich hier: ein gemütliches kleines Hotel mit nur wenigen Gästen, einem lauschigen, tropischem Garten, einem hübschen Swimmingpool, der von hohen Kokospalmen umgeben ist und der zum Glück, im Gegensatz zum überwarmen Meerwasser, mit frischem und fast ein wenig kühlem Wasser gefüllt ist. Sehr freundliches, hilfsbereites und aufmerksames Personal gehört ebenfalls zum Service. Ein Wachmann dreht seine Runden Tag und Nacht (natürlich nicht immer der gleiche), so dass niemandem etwas Schlimmes passieren kann. Weil’s aber so friedlich ist, ist’s für ihn auch langweilig. Man sieht’s gut, wenn er wieder mal an seiner Krawatte herumkaut.
Wir geniessen den Aufenthalt aufs Beste. Chillen und nicht viel tun - das ist die Devise. Tagsüber findet es Theo wunderbar, dass es vom Bett aus nur gerade sechs Meter sind bis zur nächsten Liege auf der Terrasse. So jagt dann eine Siesta die andere.
An Strand ist sehr viel los. Es wimmelt nur so von Kite-Surfern. Ein ständiger starker Wind bläst, ein Paradies für all diejenigen, die diesen Sport ausüben oder lernen wollen. Man könnte stundenlang zusehen. Tun wir oft auch. Es ist faszinierend, wie diejenigen, welche die Technik beherrschen, über die Wellen sausen, sich hoch in die Lüfte ziehen lassen, zum Teil das Brett zum Zwirbeln bringen und dann gleich wieder mit der nächsten Welle mitreiten oder sie quer dazu durchkreuzen. Vor allem die jungen Einheimischen sind absolute Profis. Es gibt zwar auch Europäer, die diesen Sport gar nicht mal so schlecht beherrschen, aber die bärenartigen Russen, die sich in dieser Kunst versuchen, haben oft Mühe, zu Schwung zu kommen. Das sieht dann nicht mehr so beflügelnd und elegant aus.
Kite-Surfen sollte eine neue Olympia-Disziplin werden, finde ich. Ok, ok, wie man das Meer und den Wind dann an die einschlägigen Orte bringen könnte, darüber müsste man sich schon noch ein wenig den Kopf zerbrechen.
Ehrlich gesagt, würde es mich auch gelüsten zu versuchen, in dieser Höllen-Geschwindigkeit über die Wellen zu flitzen, so wie all diese vietnamesischen Jungs. Es sieht so einfach aus. Da ich aber keine Grossmütter sehe, die das tun, lass ich’s lieber.
Ein Kochkurs ist da wohl eher angebracht. Den buche ich für Montag.
Zwar fühle ich mich gar nicht so alt. Das hat vielleicht auch mit unserem Badzimmer hier zu tun. Es ist im hinteren Teil des Bungalows platziert, ziemlich gross, aber die Beleuchtung würd ich nicht grad als optimal bezeichnen. Schummrig kommt der Sache schon näher. Das Gute dabei ist, wann immer ich in den Spiegel schaue, sehe ich keine Falten mehr. - Ich muss mir ernsthaft überlegen, bei uns zu Hause im Badezimmer eine ähnliche Beleuchtung installieren zu lassen.
(Nachtrag: Erst am allerletzten Tag sehe ich, dass es da einen Schalter gibt, der eine Neonröhre direkt oberhalb des Spiegels in Gang setzt. – Jetzt sieht alle etwas anders aus…)
Übrigens hab ich neulich, seit wir hier an der Küste sind, meine Parfum-Marke gewechselt. Sie heisst jetzt „Autan – Active“ (Repelente de Insectos; hab’s mal in Spanien gekauft).
Des Nachts ist Mückenschutz natürlich nicht nötig, wir haben ja ein Moskitonetz. Wenn es aber gelingt, wie gehabt, sich mit einer Mücke dort drin einzuquartieren, gereicht das nur gerade dem Insekt zu eitel Freude und Entzücken. Nicht dass Theo das stören würde; die Biester lieben ausschliesslich mich.
Mui Ne ist ein spezieller Ferienort. Er besteht eigentlich nur aus einer einzigen Hauptstrasse, die während 15 km Nguyen Dinh Chieu heisst und dann den Namen für weitere 10 km in Huynh Thuc Khang wechselt. Auf der Meerseite der Strasse ist ein Resort ans andere gebaut, dazwischen reiht sich Kite-Surf-Schule an Kite-Surf-Schule. Auf der gegenüberliegenden Strassenseite gibt’s kleine Shops am Laufkilometer, Bars, Massagelokale, Guest-Houses, ATM-Maschinen in kleinen Kabinen, in denen man vor lauter schlechter Luft beinahe erstickt oder wenn’s ganz chic geht, fast erfriert, weil drinnen ein Klima herrscht wie in einer Tiefkühltruhe und man froh ist, wenn man die Kohle endlich hat, so dass man wieder nach draussen in die frische, 30-grädige Luft entfliehen kann. So geschah es auch, dass ich vor lauter Pressieren nur 200‘000 Dong eingab statt zwei Millionen (immer diese endlosen Nullen) und also wohl einen Fünfliber bezahlt habe für die zehn Franken, die mir der Automat schliesslich ausgespuckt hat. – Selber schuld!
Aber eigentlich bin ich noch immer dabei, die Strasse zu beschreiben. Neben den bereits erwähnten Annehmlichkeiten gibt es natürlich auch Reise-„Büros“. Etliche bieten zusätzlich noch Massage- und Tattoo-Service an. Es hat Mofa-Miet-Stellen, Mofa-Tanksäulen, Garküchen und Restaurants, alle mit einem ganzen Arsenal von Tanks beziehungsweise Aquarien vornedran, wo die bemitleidenswerten Fische, Frösche, Krebse, Muscheln, Hummer und anderes Meergetier ihre letzten Atemzüge tun, bevor sie von Touristen fotografiert und anschliessend (von wem auch immer) verspeist werden. Sogar kleine Krokodile haben wir ausgestellt gesehen, wie ein Partybrot von hinten her in Tranchen geschnitten, bereit zum Verzehr.
Eigentlich heisst dieser Strip gar nicht wirklich Mui Ne, obwohl alles so angeschrieben ist. Der Ort selber befindet sich am östlichen Ende der langen Bucht, dort, wo der Hafen ist.
Wie dem auch sei: Es handelt sich hier vor allem um ein Kite-Surfer- und Backpacker- Paradies, ist aber ganz offensichtlich auch besonders bei den Russen beliebt. In der Hauptsaison soll‘s auch viele Pauschal-Touristen haben. Klar, da gibt’s dann zwangsläufig Schnittmengen.
Überall ist alles in zwei Sprachen angeschrieben: vietnamesisch und russisch. Das gilt für ausnahmslos alle Speisekarten. Manchmal steht da sogar auf Englisch, was man bestellen kann, oft auch mit einem Bild, was die Auswahl doch wesentlich erleichtert. Nicht immer sind die Speisekarten sehr einladend, nicht nur von der Gestaltung her, nein, es kommt vor, dass ich das Gefühl habe, nach der Lektüre möchte ich mir am liebsten die Hände desinfizieren. Auch sind die Fotos eher selten appetitanregend. - Auf den letzten paar Seiten wird’s meist recht abenteuerlich, für unsere mitteleuropäischen Geschmäcker jedenfalls. Da gibt’s Aal, Froschschenkel, Schlange, Krokodil und all die dazugehörigen leckeren Zubereitungsarten, eben das Tagesangebot, das vor den Restaurants zur Schau gestellt wird.
Gut ist das Essen allemal. Sehr sogar! Im Reiseführer lese ich, die Vietnamesen seien Philosophen, was die Nahrung anbetreffe. Jedes Lebensmittel habe eine bestimmt Wirkung oder sei für etwas gut. Das eine gegen die Hitze, das andere gegen die Kälte, eines helfe, irgendwelche Schmerzen zu vertreiben, das andere fördere die Libido oder spende Energie.
Und natürlich sind die Mahlzeiten preiswert. In unserem Hotel kann man beispielsweise kein einziges Gericht bestellen, das teurer ist als fünf Franken. Eine Flasche Bier kostet 70 Rappen, ebenso eine Büchse Schweppes Soda. Vietnamesischen Wein gibt’s auch. Grade mal zwei Sorten, Dalat und Dalat Export. Die zweite Variante ist sehr viel besser als die erste, die immer ein wenig nach Zapfen riecht und vorwiegend bei Zimmertemperatur (30 Grad) serviert wird. Kosten tut so eine Flasche im Restaurant fünf Franken – gleichviel wie im Laden, der edlere Tropfen sechs Franken fünfzig. Geht man in ein Etablissement, das von einem Europäer geführt wird, sieht alles schon ein wenig anders aus. Die müssen ja schliesslich was verdienen; der arme Franzose akzeptiert nicht einmal Kreditkarten, weil er ja so einen kleinen Betrieb nur hat. Dafür ist an solchen Orten die Auswahl an Weinen um ein Mehrfaches grösser, die Preise dementsprechend fast wie bei uns. Trotzdem gibt’s ausnahmsweise eine Abwechslung – für Magen und Portemonnaie.
Mit Christina und Shina sind wir auch mal essen gegangen. Es war interessant zu erfahren, wie es sich hier als Einheimische lebt. Sie ist Schweizerin, er Australier; Ihr Business ist eine Kombination aus Reiseagentur und Kite-N-Surf – Schule.
Fishing Village
Am Sonntag machen wir einen Ausflug ins Fishing Village, eben in den Hafen von Mui Ne, wo täglich das gleiche Prozedere stattfindet: Die Fischer kommen heim, ihre Ware wird verhökert, dann wird aufgeräumt. Dieses Spektakel findet am frühen Morgen statt; allerorts wird empfohlen, dass man um halb acht Uhr dort ist. – Also das geht natürlich nicht mit Theo, da kann ich mir den Atem und sämtliche Argumente sparen. Entweder gehe ich alleine oder ich lass ihn ausschlafen, wir gehen zusammen und verpassen dann halt den Hauptteil der Show. Genau so ist’s dann auch. Nach dem Frühstück (gemächlich!) machen wir uns auf zur Bushaltestelle. Wir haben Glück: Der Bus kommt grad, aber irgendwas machen wir wohl falsch, er hält jedenfalls nicht an. – Wir haben ja Ferien, also warten wir ein Weilchen. Dieses dauert eine halbe Stunde. Man muss höllisch aufpassen, im richtigen Moment aufzuspringen, sonst ist er wieder weg. Es gelingt. An der Rezeption hat uns die zierliche Angestellte ein Zettelchen parat gemacht mit dem Satz: „Sie wollen ins Fishing Village“, natürlich auf Vietnamesisch. Das hilft sehr. Wir bezahlen 45 Rappen pro Person und erhalten dafür unsere Tickets. Mit beiden Händen müssen wir uns an den Sitzen festhalten (so könnte ich es mir auf einem Rodeo-Pferd vorstellen), denn der Fahrer fährt wie vom leibhaftigen Teufel gehetzt. Herrscht hier tatsächlich Rechtsverkehr? Und hat er eine Brille, welche die Mofa-Fahrer ausblendet? Oder sind’s einfach nur Scheuklappen? - Immer wieder mal wird beim Überholen wild gehupt und so legt er die Strecke in einer Rekord-Viertelstunde zurück. Irgendwo unterwegs steigt ein junger Mann dazu (springt auf, besser gesagt) und verlangt, die Tickets zu sehen. Nein, so was: ein Kontrolleur. Das hätte ich hier nun gar nicht erwartet. – Christina hat uns vor den Bussen gewarnt, nur - wir haben nicht hören wollen. Sie wohnt seit sechs Jahren hier und hat noch kein einziges Mal den Bus genommen, wie sie berichtet. Sie findet es zu gefährlich.
Die Rückfahrt gestaltet sich dann ziemlich anders, davon aber später.
Wie ja nicht anders zu erwarten war, ist der ganze Fisch- und Muschelhandel am Hafen bereits vorbei. Nicht ein einziger Tourist ist mehr zu sehen. Die waren wohl alle um halb acht da und sind sich gegenseitig auf die Nerven gefallen, weil auf all ihren schönen Foto-Schnappschüssen immer wieder andere Touris oder Teile davon zu sehen sind. Uns passiert das nicht – Theo sei Dank. Wir bekommen halt nur die Aufräumete zu sehen, aber die hat’s auch in sich. Netze werden aufgerollt, Schiffen wird ein neuer Anstrich verliehen, das Fischer-Gerätzeug wird gereinigt und parat gemacht für den nächsten Einsatz. Die grösste Arbeit aber ist es, all die Tausenden von Muscheln zu öffnen oder zu zerstampfen, deren Fleisch oder die darin versteckten Krebse aus den Schalen zu klauben und in Becken zu sammeln. Es sind die Frauen, die zu Dutzenden am Strand sitzen, in der prallen Sonne, und sich damit beschäftigen. Der ganze Strand (etwa zwei Kilometer lang) ist voller zerschlagener Muschel-Schalen. - Ein unheimliches Massensterben muss da jeden Tag vor sich gehen. Abschreckend und faszinierend zugleich, finde ich.
Auch die Kulisse mit den unzähligen fröhlich farbigen Fischerbooten ist gewaltig. Es ist eine ganze Armada, die jeden Tag aufs Meer hinaus fährt. Von unserem Hotel aus sehen wir sie jeden Morgen, ebenso gegen Abend. Beim Frühstück ziehen die grösseren Schiffe am Horizont vorbei, die kleineren ganz in der Nähe. Diese sind besonders sehenswert. Von weitem scheinen sie wie zu gross geratene Waschbecken. Kreisrund und aus Polyester. Absolut einzigartig! - Genau ein Mann hat Platz darin. Nach getaner Arbeit ketten sie sich aneinander und einer von ihnen, derjenige mit einem Motor (oder eher Motörli) zieht die anderen zurück in den Hafen. Manchmal sind’s nur zwei oder drei, manchmal kommt eine ganze Kolonne solcher Becken daher. Wie im Gänsemarsch, auch wenn das vielleicht nicht das passendste aller Bilder ist. Bis zu zehn Stück hab ich gezählt. Die älteren Boote dieser Art sind Körbe, gefertigt aus Bambus und Palmenblättern. - Heute Morgen hat einer wohl den Anschluss verpasst oder sie hatten eine Auseinandersetzung oder was auch immer der Grund dafür sein mochte, dass er ganz alleine gegen die Wellen paddeln und gegen die Strömung ankämpfen musste, um die vielen Kilometer bis zum Hafen zu schaffen. Das sah nach einer gewaltigen Anstrengung aus.
Auf dem Rückweg vom Hafen zur Hauptstrasse und zur Bushaltestelle kommen wir an einem Coiffeur-Geschäft vorbei. Eigentlich hätt‘ ich’s ja nötig, mir langsam wieder mal einen „anständigen“ Schnitt verpassen zu lassen. Wieso auch nicht? - Zeit haben wir ja und viel verderben kann sie wohl auch nicht. Es gelingt mir, der netten jungen Coiffeuse mit Handzeichen begreiflich zu machen, was ich gerne möchte und sie nimmt die Arbeit in Angriff. Haare Waschen ist gar nicht nötig. Mein Haar ist vom vielen Schwitzen sowieso schon tropfnass. Also beginnt sie gleich. Und ich muss sagen, ich finde, sie macht das ganz gut. Die Schere ist scharf, für mich sieht’s absolut profimässig aus, und ich bin mit dem Resultat zufrieden. Ob Bürste und Kamm jeweils gereinigt werden nach Gebrauch?
Es ist wohl besser, solche Gedanken zu verdrängen. - Sie reinigt auch meinen Haaransatz am Nacken mit einer Rasierklinge. Da halte ich extrem still. - Zwei Franken will sie für den Schnitt. Sie strahlt, wie sie 100 % Trinkgeld erhält.
Oben im Dorf angekommen, sehen wir den Bus schon stehen. Bei dieser Hitze mögen wir uns aber nicht beeilen, wir können ja irgendwo was trinken, falls er uns durch die Lappen geht. Das tut er aber nicht. Im Gegenteil. Der Busfahrer sitzt auf einem der hinteren Sitze und hat die Beine auf die Lehne des Vordersitzes gelegt. Er schläft (Siesta?). Wir steigen dann trotzdem ein, er erwacht und wir können unsere Billets kaufen. Nach zehn Minuten spekulieren wir, ob das vielleicht so ist wie bei uns in der Schweiz, wo die Busfahrer sich beeilen, dass sie an der Endstation etwas länger Zeit haben für eine Zigarettenpause. Jetzt lässt er den Motor an. Fünf Minuten später stellt er ihn wieder ab und legt sich wieder hin. Es ist ziemlich warm im Bus, aber wenigstens sind die Fenster offen – und ja, genau, wir haben ja Ferien. Ich nutze die Zeit und mache ein paar Fotos vom vorbeihastenden Verkehr. An all diesen Mofas kann man sich schlicht nicht satt sehen. Riesige Eisblöcke werden transportiert und Blumenkränze, WC-Papier (XXL-Packungen), einer hat eine ganze Fensterscheibe (ohne Rahmen) hinter seinen Sitz geklemmt, Kisten, Fässer, Baumaterial, Kinder, Babys und so weiter und so fort. Und alles ist farbig, farbig, farbig: die Motorräder, die Helme, Kleidung und der Mundschutz der Fahrer.
Jetzt tut sich was in unserem immer noch kaum besetzten Bus: Tatsächlich kommt der Fahrer nun doch, stellt den Motor an uns setzt sich erst mal hin – so ein Fortschritt. Inzwischen sind schon mehrere Busse an uns vorbeigefahren. Uns mangelt’s an einer plausiblen Erklärung. Was genau geht da ab? Wieder sind fünf Minuten vergangen. Plötzlich fährt er los. Völlig unmotiviert - natürlich braucht er keinen Zeiger, um sich in den Verkehr einzugliedern. – Aber was ist das denn? Er fährt nicht schneller als höchstens 20 km/h. Ist er krank? Oder kann es sein, dass wir unter all den hektischen Fahrern das eine seltene Exemplar erwischt haben, das nicht wie die anderen tickt (Specie Rara)? – Es muss so sein. In einer Gemütsruhe fährt er der Strasse entlang; manchmal hält er einen Arm hinter den Sitz an die Kopfstütze, manchmal auch beide, das heisst, er fährt dann freihändig. So wie wir als Kinder auf den Velos. Ich erinnere mich: Da war ich voller Stolz, als mir das zum ersten Mal gelang. – Aber hier – ob das der Sache dient? Wenigstens vergisst er das Hupen nicht, so ist zumindest teilweise gewährleistet, dass er die Hand hin und wieder mal ans Steuer hält. Nach einer halben Stunde Trödelfahrt kommen wir beim Hotel an, er verlangsamt und wir springen ab. Wir haben unverletzt überlebt - beide Fahrten, die ja unterschiedlicher nicht hätten sein können.
So hat sich also unser Exkursiönli dreifach gelohnt: Wir sind um ein Busfahrt-Erlebnis reicher (oder eigentlich um zwei), haben die farbenfrohen Fischerboote gesehen im Hafen von Mui Ne und ich komme mit einer neuen Frisur zurück ins Hotel.
Der Kochkurs
Um neun Uhr morgens bin ich parat, nachdem ich bereits gefrühstückt habe, ein grosser Fehler, wie sich im Nachhinein herausstellt. Nur ein paar Schritt von unserem Bungalow entfernt, gleich hinter dem Restaurant, sind im Sand drei Tische aufgestellt, zwölf rote Plastik-Stühle stehen darum herum und unter dem Palmendach ist eine gut ausgebaute Show-Küche eingerichtet mit einem grossen Spiegel, der zum Zweck hat, dass man von überall her sieht, was da vorne auf dem Tresen geschieht. Eine zierliche, hübsch gekleidete Vietnamesin mit Namen Han empfängt mich und gibt mir erst mal Tee. Die Kanne ist in einer Kokosnuss-Schale gut eingepackt, damit die Brühe auch schön warm bleibt. Ingwer-Tee ist es und Han schenkt mir grosszügig in das Mini-Schnapsglas ein, das vor mir steht. Es daure nur zwei Minuten, sagt sie, dann sei sie parat. Die zwei Schluck Tee sind auch rasch getrunken und ich bin ebenfalls parat.
„Wo sind die anderen Teilnehmerinnen?“, will ich wissen. Die gibt’s heute nicht. Ich bin die einzige Schülerin. – Auch gut. Wieso nicht… Ein wenig seltsam zwar… Ob sich all der Aufwand lohnt, frage ich mich. - Han ist aber guter Dinge, das scheint sie in keiner Weise zu stören.
Der Kurs beginnt damit, dass wir auf den Markt gehen und dort einkaufen, was wir brauchen. Han winkt ein Taxi heran und wir fahren zum Ham Tien Markt. Unterwegs werde ich interviewt. Wo ich herkomme, will sie wissen, wie viele Kinder ich habe (sie macht grosse Augen, wie ich sage vier). „You very lucky“, ist ihr Kommentar. Dann kommt die unweigerliche Frage nach meinem Alter. Ich schummle ein ganz klein wenig, eigentlich eher, weil ich denke, „sechzig“ ist einfacher zu verstehen für sie als „einundsechzig“. – Kaum habe ich die Zahl genannt, nimmt sie wie elektrisiert ihre Hand von meinem Arm, schaut mich entsetzt und ungläubig an, wie wenn ich sie zutiefst erschreckt hätte. Was hab ich bloss gesagt, frage ich mich. „Sixty???“, wiederholt sie. “No. Fifty. You so fresh and strong!“ – Hm. Natürlich fühle ich mich ein wenig geschmeichelt. Wirklich nur ein wenig. - Sie ist vierundzwanzig.
Wir erreichen den Markt nach kurzer Fahrt; ein reges Treiben herrscht in der überdachten Halle. Vor allem Händlerinnen bieten ihre Waren an, Männer hat es fast keine. Der Eindruck ist farbig, aromatisch, exotisch. Es ist sicher kein Touristenmarkt. Hier kaufen die Einheimischen ein. Der „Duft“, der in der Luft liegt, ist ein Mix aus all den verschiedenen Nahrungsangeboten: Fisch, Fleisch, Früchten, Gemüse, Gewürzen. Auch bunte Kinderkleider und Spielwaren gibt’s zu kaufen, wenig Handwerkszeug ebenfalls – wie das eben so ist in solchen Ländern.
Han textet mich voll; ich muss mich enorm konzentrieren, damit ich verstehe, was sie meint, denn ihre Beschreibungen von Früchten und Lebensmitteln und was man wie, woraus und warum herstellt, sind recht kompliziert. Ihr Englisch, obwohl enorm fliessend, ist nur teilweise verständlich und gespickt mit vietnamesischen Wörtern, eben mit den Bezeichnungen der verschiedenen Gerichte und Gewürze, deren Übersetzung sie nicht kennt. Zum besseren Verständnis braucht sie dann oft treffende Vergleiche. Sie sagt, ein Gericht sei wie jenes, das sie gerade beschrieben habe, nur ein wenig anders („same, same – but different“).
Als Erstes nimmt sie mich mit zur „Pancake-Lady“. Diese Dame sitzt oder beziehungsweise kauert direkt vor uns auf einem Podest, so dass sie grad gleich gross ist wie wir, die wir vor ihr stehen. Neben ihr ist ein kleiner Herd installiert und in vier Crèpe-Pfännchen gleichzeitig bereitet sie eine Art Omelette zu, in die sie kleine Tintenfisch-Stücke hineingibt, Gewürze, Nudeln und was weiss ich noch alles, diese dann in eine Styropor-Schale bettet und mit scharfer Chili-Sauce grosszügig übergiesst. – Das muss ich essen; es ist mein Frühstück. Ich leiste keinen Widerstand, auch nicht sprachlicher Natur, setze mich auf das angebotene rote (Kinder-) Plastik-Stühlchen und muss sagen, sehr schmackhaft ist die Speise! - Beide Frauen schauen mir wohlwollend lächelnd zu – ich komme mir fast ein wenig ausgestellt vor. Die Omeletten-Frau sei dreiundsechzig Jahre alt, erzählt Han, drei Jahre älter als ich. Sie sei jeden Tag hier und verkaufe diese Spezialität – seit sie sechsundzwanzig sei. – Grosses Staunen meinerseits.
Auf Han‘s Anweisung hin muss ich mich auf Vietnamesisch bedanken, „Cam on“, sage ich, dann gehen wir weiter. Bei einer Verkäuferin in der Nähe gibt’s eine Art Cup-Cakes zu probieren, in der Grösse einer Clementine. Grünliche und weisse. Ich rate richtig. Hier handelt es sich sicher um Kokosnuss. Han ist begeistert ob meiner raschen Auffassungsgabe. Allerdings prophezeit sie: „You not like very much.“ – Doch, doch, die sind überhaupt nicht schlecht. Ich nehm noch einen Bissen. „You full now?“. Da hat sie allerdings nicht ganz unrecht. Wenn das so weitergeht – wie soll ich dann all das essen, was im Kochkurs noch auf mich zukommen wird? - Die nächste Lady (sie ist sechsundsechzig Jahre alt (Han vergleicht jetzt laufend mit mir) stellt Desserts her, Bananen in Teig und kleine süsse Bälle, in Puderzucker gewendet, die absolut wunderbar schmecken. Sie sehen aus wie Mini-Berliner oder wie die Quark-Kugeln, die’s in Bern bei Reinhard gibt. Nur sind diese hier zehnmal besser und dreissigmal billiger.
Anschliessend gehen wir Jackfruit kosten (gut für die Haut und gibt Energie), Poulet-Teile kaufen wir ein und etwas, das aussieht wie kleine geschnetzelte Hühnerlebern. Ich schaue und höre beim Verhandeln zu. - Und dann, als besonderes Highlight gegen den Durst, gibt’s den Zuckerrohrsaft, den wir bereits unterwegs auf unserer Rundreise kennengelernt und getrunken haben. Sugarcane sei ebenfalls gut für die Haut und mache einen jünger. - Super! Da nehm ich doch glatt noch einen Becher mehr.
Eine Paste aus vorwiegend Zitronenessenz könne man auch noch drein tun (tut sie auch gleich, einen ganzen Kaffeelöffel voll), das sei besonders empfehlenswert, wenn man unter Kopfschmerzen leide. Sie erklärt mir, wie die Paste hergestellt wird. Vier Monate lang müsse man die Zutaten an der Sonne trocknen lassen oder so ähnlich, wenn ich das richtig verstanden habe, und das könne ich ja dann zu Hause auch herstellen. – Ich verzichte darauf, ihr begreiflich zu machen, dass so viel Sonne eher eine Rarität sei in unseren Breiten und dass aus dem Grund voraussichtlich ein paar Probleme auftauchen könnten beim Versuch, diese Essenz zu produzieren.
Nach einer knappen Stunde ist genug gekauft, probiert und erläutert; Han fordert mich dazu auf, dem Markt good bye zu sagen. - Tu ich.
Mit dem Taxi zurück zur Openair-Küche.
Han weist mich an, mir die Hände zu waschen, und wenn das erledigt sei (zwei Minuten), könne ich kommen und IT geniessen. – IT??? IT hab ich mal unterrichtet. Was aber hat Informationstechnologie hier in dieser Küche zu suchen und was bitte, soll ich dabei geniessen (denk ich nur, sag ich aber nicht)? - Das Geheimnis löst sich rasch. IT steht auf dem Tisch. An meiner immer noch mangelnden Fähigkeit, Vietnam-Englisch zu verstehen, ist das Verständnis gescheitert. Ice Tea ist gemeint. - Da bin ich aber froh!
Zwei weitere Köchinnen sind jetzt dort bereit (langsam erscheint mir das Verhältnis Lehrerinnen – Schülerinnen ein bisschen speziell) und die drei hübschen Girls, alle in der gleichen seidenglänzenden Bluse gekleidet, stehen hinter der Theke vor dem Spiegel, ich vor ihnen. Sie erinnern mich an Simultanschwimmerinnen, obwohl sie ja nicht schwimmen, sondern kochen. Sie lächeln süss und wie auf Kommando sagen sie zu mir: „Hello, everybody“.
Zuerst erhalte ich eine Schürze…
Jetzt geht’s los. Han gibt das Zepter ab an Voi. Voi erklärt mir, was ich machen muss. Für sie ist wichtig, dass ich jeden Handgriff selber ausführe, sozusagen aus eigener Kraft (learning by doing). So zeigt sie mir zu Beginn, wie man den kleinen Tischherd anstellt. Sie stellt ihn wieder ab, ich muss ihn selber in Gang bringen (damit ich das zu Hause dann auch tun kann?). Es gelingt mir tatsächlich. Lauter kleine Schälchen mit Gewürzen, geschnippelten Zwiebeln und anderen Zutaten, Nudeln und was ich sonst noch alles brauchen werde, stehen bereits parat. Manches ist schon vorbereitet worden, so dass wir sofort starten, uns also gleich in medias res begeben können. - Offenbar traut sie mir zu, dass ich weiss, wie man Zwiebeln schneidet.
Das erste Gericht ist die Nudelsuppe.
Aus einem Topf muss ich ihr („please do that for me“, sagt sie immer) eine Schale voll Bouillon bringen (ich nenn das jetzt mal so), denn dort schwimmt ein Kniegelenk (einer Kuh) seit einer Stunde in einer Brühe. Auf meinem kleinen Herd muss ich nun zwei Löffel Öl in eine Wok-Pfanne giessen, Knoblauch und Zwiebeln darin anbraten und nach Vois Anweisungen erst die Brühe und nach und nach dieses und jenes Gewürz dazugeben, das hauchdünn geschnittene Fleisch und die Nudeln. Und immer ist meine Lehrerin drauf bedacht, dass ich das mit dem Löffel, den sie mir hinhält, auch selbständig bewerkstellige. Nach kurzer Zeit ist die Suppe fertig und ich darf sie essen. „Enjoy“, sagt Voi.
Mega gut, was ich da zusammengebraut habe! Theo ist zum Glück in der Nähe, in unserem Bungalow, nur etwa hundert Meter entfernt vom Geschehen. Ich kann ihn holen gehen und er hilft mir beim Essen; ich selber wär mit dieser riesigen Portion nie fertig geworden. Er hat zwar nicht bezahlt, gehört ja auch gar nicht zum Koch-Team (mit seinen viel gepriesenen Allerhöchstens-Viertelstunden-Büchsen-Mahlzeiten wäre er in einem derartigen Kochkurs sowieso völlig fehl am Platz), aber die Girls freuen sich, dass er kommt - eine Person mehr, die sie und ihre Kochkünste lobt.
Jetzt muss ich mit einem scharfen Messer eine Tomate schälen. Die würd ich daheim doch ins kochende Wasser werfen und nicht einen solchen Aufwand betreiben, denke ich. – Naiv! - Um die Tomate geht’s gar nicht. Es geht um die Schale, die ich abziehen muss, so dass sie wie eine Schlange aussieht, um sie dann wieder aufzurollen und eine Rose daraus entstehen zu lassen. - Genial! - Wichtig ist eben auch, dass das Gericht schön präsentiert wird. Ich erhalte viel Lob, weil mir die Rosen-Herstellung auf Anhieb gelingt.
Frische Frühlingsrollen, verschiedene Saucen, eine Omelette (ähnlich derjenigen, die ich auf dem Markt gegessen habe: „same, same but different“) und schliesslich ein Meerfrüchte-Salat sind anschliessend auf dem Programm. – Mit Theo kann ich alles teilen. Wir sind beide völlig erledigt nach all den feinen Dingen, die wir serviert bekommen haben. Rambutan gibt’s zum Nachtisch und eine kleine Ansprache. Diese beinhaltet Dank und die Bitte, auf Facebook und Tripadvisor ein gutes Wort für die Kochschule einzulegen. Ein hübsches, recht professionelles kleines Rezeptbüchlein erhalte ich zum Abschluss, ich gebe die Schürze zurück, bedanke mich ebenfalls, dann bin ich entlassen.
Ich freue mich jetzt schon darauf, zu gegebener Zeit zumindest die Tomatenrose mal „nachzukochen“.
Ausflüge
Ein Ausflug ist geplant für Dienstag. Zu den Cham Türmen in Phu Hai und zum Ta Cu - Mountain, wo der grösste liegende Buddha in ganz Vietnam zu sehen ist. Um acht Uhr wäre es am besten loszufahren. „Neun Uhr tut’s auch“, sagt Theo.
Um neun Uhr erwartet uns der Fahrer vor der Hotelrezeption mit einem kleinen Bus. Eigentlich hätte es ein Fahrer mit Englischkenntnissen sein sollen, das hat aber leider nicht geklappt. Nur ein Wort kann er sagen, nämlich „ok“. Sagt er aber nicht zu mir, weil er ja nicht versteht, was ich gerne möchte. Also kommuniziere ich mit ihm via Handy. Wenn ich etwas will oder eine Frage habe, ruft er seinen Chef an, dem ich dann meine Wünsche mitteile und der gibt sie weiter. Unser Dreiecksgespräch funktioniert ausgezeichnet; ich höre ihn „ok“ sagen und er fährt dorthin, wohin ich gerne möchte.
Das sind zuerst die Cham Türme, Ruinen aus der Zeit der Cham-Dynastie (Ende 8. Jahrhundert). Die Cham sind heute nur noch eine ethnische Minderheit, ein Volksstamm, der in den Bergen lebt. Die Türme sind aus roten Sandsteinziegeln gebaut. Sie sind sehr eindrücklich, und vom Hügel aus, worauf sie gebaut sind, hat man eine herrliche Aussicht auf die Hafenstadt Phan Tiet (ausgesprochen wie Fanta, aber eben mit „I“ am Schluss und den muss man betonen, also: „Fantii“).
Wir sind die einzigen Besucher an diesem schönen Ort. Der Weg zu den Türmen ist bestens ausgebaut und am Wegrand hat’s im Abstand von etwa 20 Metern jeweils Lautsprecher, aus denen eine Frauenstimme auf Englisch erzählt, was es da zu sehen gibt. Das ist gar keine schlechte Idee. Neu für mich. Man spaziert den Weg entlang und hat das Gefühl, eine Reiseleiterin gehe mit.
In einem der Shops kaufen wir einen zusammenfaltbaren Rucksack. Den Stoff, aus dem er gefertigt ist, weben die Frauen dort an Ort und Stelle. Eigentlich will ich ja gar nichts kaufen (Koffergewicht auf dem Rückflug!), und einen Rucksack brauche ich schon gar nicht, aber die Frauen tun mir leid. Niemand ist da, der etwas kaufen will. Freundlich laden sie uns ein einzutreten und die Aufforderung tönt überall gleich, nämlich wie ein einziges Wort: „Youcancomeandlooknoproblem“. Der Rucksack ist doppelt so teuer wie im Touristenort, aber die dreizehn Franken ist er auf jeden Fall wert. Bei uns wären schon die beiden Reissverschlüsse teurer, die eingenäht sind. - Es braucht einen Tag, um ein Band von einem Meter Stoff zu weben.
Unser nächster Halt ist der Fischmarkt in Phan Tiet. Ein spezielles Erlebnis auch hier: Wir sehen die Fischerboote aus nächster Nähe. Von weitem sehen die farbenprächtigen Kähne ja so anmutig aus. Aber wir wundern uns, dass die überhaupt noch fahrtüchtig sind, denn sie sind restlos alle derart heruntergewirtschaftet, dass es eine seltsame Gattung macht.
Am Quai sind Männer damit beschäftigt, riesige Eisblöcke mit Maschinen zu Eiswürfeln zu zerstückeln. Körbe über Körbe gefüllt mit Fischen werden von Frauen verarbeitet und schliesslich auf Lastwagen verfrachtet.
Nächster Halt: Van Thui Thu Tempel. Der Tempel ist ein Heiligtum für die Schifffahrer und in ihm sind hinter etwelchen Altären Wal-Skelette ausgestellt. Wie es im Reiseführer heisst, auch ein 22 Meter langes Wal-Skelett, das einzige in dieser Grösse in Asien. Pech ist nur, dass die Knochen schön sortiert und zusammengestellt hinter Glas in einem Schrank stehen, so dass man die 22 Meter nur erahnen kann. Es könnten gut auch nur 21 sein. Ich will die Schuhe ausziehen, wie es normalerweise üblich ist bei einem Tempelbesuch, um mir das alles anzusehen, aber die Männer, die dort sitzen, bedeuten mir, die Schuhe anzubehalten. Ok, no problem. Einer führt mich zu einem Altar, wo ich ein Räucherstäbchen anzünden muss. Er deutet auf die Spende-Box. Das musste ja kommen. Ist aber auch kein Problem – non-verbal läuft hier alles wie am Schnürchen. Theo durchläuft dasselbe Prozedere. Der Alte lässt sich fotografieren (mit den Wal-Rippenknochen im Hintergrund), will dann jedoch einen Obolus. Das war ebenfalls vorauszusehen. Den kassiert er und steckt ihn in seine Hosentasche - hat ihn ja schliesslich verdient.
Wir fahren weiter zum Ta Cu - Mountain. Da steht ein Berg (rund 700 Meter hoch) mitten in der Ebene. Mit einer Gondel (Schweizer Fabrikat, von österreichischer Firma moniert) kann man hochfahren zu einem Restaurant, in dem es aber gar keine Gäste hat. Seltsam - Touristen hat’s so gut wie keine. Was ist denn da los? - Eigentlich hat die Hauptsaison doch bereits begonnen. Kein Mensch in den Souvenirläden, nur Verkaufspersonal.
Dafür hat’s Aussicht. Vom Restaurant aus führen ein Weg und dann eine steile, sehr lange Treppe zu einem Tempel hinauf. Nochmal hundert Meter weiter bergwärts erreicht man schliesslich den grössten liegenden Buddha in Vietnam oder gar Asien? – Er ist 49 Meter lang und 11 Meter hoch, sieht aus wie frisch poliert, strahlend weiss im Sonnenlicht. Ein friedliches Lächeln umspielt seine Lippen, die so gross sind wie Gullivers Sofa.
Zwei Stunden dauert dieses Vergnügen (Gondelfahrt, Spaziergang, Buddha-Besichtigung, Kurzbesuch im Restaurant zwecks Kauf eines Erfrischungsgetränks und Gondelfahrt andere Richtung), bis wir wieder unten beim Taxi sind. Unser Fahrer, der auf einer Hängematte Siesta gemacht hat, schrickt auf und wir fahren weiter durch den wilden Verkehr entlang der Küstenstrasse, vorbei an endlosen Drachenfruchtplantagen sowie an roten und weissen Dünen, zurück zu unserem Hotel.
Am Donnerstagmittag laden wir unser Gepäck ins Taxi und fahren nach Phan Tiet zum Bahnhof. Dort werden wir den Zug nehmen und nach Saigon fahren.
Reisebericht Vietnam – Kambodscha – Thailand 20. November – 2. Dezember 2014
Saigon
Es ist immer lustig, in einer Stadt anzukommen, in der man schon mal war. Bei uns war‘s ja erst gerade (vor drei Wochen) und auch nur für drei Tage. Trotzdem ist es anders, als wenn man’s gar nicht kennt. Diesmal kommen wir mit dem Zug an. Zugfahren ist sehr viel angenehmer als mit dem Bus die mühsame Strecke zurückzulegen (5-6 Stunden für 200 km). Der Zug braucht viereinhalb Stunden und die Fahrt ist sehr viel weniger gefährlich. Man ist zwar ziemlich eingepfercht, noch schlimmer als in der Economy-Class im Flugzeug, aber das nehmen wir gerne in Kauf.
Erster Abend: Sushi-Bar. Wunderbar!
Am nächsten Tag nehmen wir’s gemütlich. Einfach ein wenig durch die Stadt schlendern, darum geht’s und um nicht viel mehr. In der bekannten Backpackerstrasse, Bui Vien, die sich grad hinter unserem Hotel befindet, hat’s neben all den Shops und Restaurants auch ein paar Bilderhändler, die ab Fotos Bilder herstellen oder Werke bekannter Künstler nachmalen. Ein Bild gefällt uns so sehr, dass wir überlegen, es uns zu kaufen. Wir gehen aber vorerst weiter, können ja später immer noch zurückkommen.
Nach einer Stunde, 30 Fotos und nur einem relativ kurzen Spaziergang um den Block sind wir völlig schweissgebadet, und da meine Kamera mir mitteilt, sie hätte auf der Speicherkarte keinen Platz mehr, gehen wir zurück ins Hotel, um eine neue zu holen.
Per Taxi fahren wir anschliessend zum Bitexco-Tower, einem ziemlich neu erstellten Wolkenkratzer, von dessen Sky Deck im 49sten Stock aus man eine fantastische Aussicht über die ganze Stadt hat. - Cafépause in einem heruntergekühlten, überteuerten Café, dann geht’s weiter zu Fuss durch die Strassen und Gassen, durch den wilden Verkehr, an den ich mich wohl nie gewöhnen könnte. Wie ein Spiessrutenlauf gestaltet sich eine Strassenüberquerung. Ich bin jedes Mal froh, wenn wir heil auf der anderen Seite ankommen. Dessen bin ich aber nie so sicher. Theo hat nachgelesen und gesagt, es habe in Vietnam 2 Millionen Autos, 27 Millionen Motorräder und 90 Millionen Einwohner.
Am späten Nachmittag, zurück von unserer Tour, kommt es wie es kommen muss: Ein Bild ist zwar das Allerletzte, was wir brauchen, aber irgendwie ist unsere Bilderkauflust übermächtig und lässt mich sogar den Transport nach Hause vergessen. Mit der Zahlung ist’s nicht ganz so einfach, weil der Maler kein einziges Wort Englisch sprechen kann, sein Gehilfe ebenso wenig. Ein völlig verstaubtes Kreditkarten-Gerät hat’s dort zwar zwischen all dem Plunder, der herumliegt, aber beide wissen nicht, wie es funktioniert. So probiere ich halt, ob’s mir gelingt, die Transaktion zu bewerkstelligen. Erschwerend kommt dazu, dass alles auf dem Display in Vietnamesisch geschrieben steht. Nach Gutdünken probier ich, drücke ein paar Tasten und habe tatsächlich Erfolg. Ein Zettel wird ausgedruckt, den unterschreibe ich. Die beiden diskutieren und rufen die Bank an. Der eine beginnt, das Bild vom Rahmen zu nehmen, aufzurollen und in eine Kartonhülle zu verpacken. Mehre Telefonate mit der Bank werden zwischendurch getätigt, aber dann ist alle in Ordnung, und wir können die Rolle mitnehmen.
Am Abend gehen wir ins Opernhaus und sehen uns die AO Vorstellung an, die uns der nette junge Mann im Hotel aufs Wärmste empfohlen hat. Super war’s. Was diese jungen Leute für eine tolle Show bieten, ist bemerkenswert und hat grossen Spass gemacht.
Mit nur wenigen, aber eindrücklichen Mitteln (Körben, Stöcken) erleben wir eine Darbietung, die ihresgleichen sucht: anmutig, sehr lustig, auch exotisch, aber nicht fremd, mit grösster Leichtigkeit auf die Bühne gezaubert - Lebensfreude pur.
Trommeln und fein auf das Geschehen abgestimmte Musik untermalen das Ganze. Es ist ideenreich, vielfältig, hervorragend, nichts geht schief. Sehr artistisch, gute Choreographie. Breakdance-Elemente hat’s ebenfalls. Die Stunde ist leider im Nu vorbei. Das Geld ist es wert. Sehr grosser Beifall am Schluss; ganz klar: allen hat die Darbietung gefallen.
In der Lobby kann man nach der Vorstellung das ganze Ensemble auf der Treppe fotografieren mit oder ohne sich selber.
Anschliessend wollen wir essen gehen. Das hat weniger Spass gemacht. Obwohl wir ja das Gefühl haben, nach einem Monat Vietnam seien wir gegen das Schlimmste gewappnet, merken wir, dass wir noch sehr viel lernen müssen. Sehr oft hat‘s mit der Sprache zu tun, wenn man nicht kommunizieren kann, ist alles so viel schwieriger. Langsam sollten wir begriffen haben, dass es besser ist, im Restaurant ein Gericht nach dem anderen zu bestellen. Das Servierpersonal möchte nämlich alles besonders gut machen und grad alles auf einmal bringen. Auch sollten wir wissen, dass man die Kreditkarte der Kellnerin nicht einfach mitgibt, ohne vorher die Rechnung gesehen zu haben. Auch sollte man die Karte nicht aus den Augen lassen. Gut, das war wohl kein Problem, aber man tut es einfach nicht (man = Theo).
Bestellt haben wir einen Salat, der auf der Karte zwar angeboten wurde, den es aber nicht mehr hatte. Den wollten wir zur Vorspeise und ihn dann teilen. Die Kellnerin empfahl mir einen anderen, der sehr gut sei. Ok, nehm ich. Theo wollte wieder mal Fleisch mit Pommes Frites. – Das Getränk kam, dann die Pommes Frites. Dazu ein Stück Butter und ein kleines Schälchen Salz. Dachten wir… Theo sprenkelte ein wenig davon über unsere „Vorspeise“, merkte dann aber, dass es Zucker war. Wir bestellten eine zweite Portion. Dann kam das Fleisch - erst mal ohne Pommes Frites. Zwei Gabeln lagen da zur Auswahl, auch Stäbchen. Das Messer fehlte. Dann kam die Beilage endlich, nachdem das Steak schon fast gegessen war. Wir möchten gerne ein wenig Salz. Ein Kellner bringt ein Salzgefäss. Es ist leer. Ein zweites. Ebenso leer (das alles dauert natürlich länger als dass es sich jetzt liest). So kommt jetzt ein bekanntes Schälchen mit etwas Weissem drin. Diesmal probieren wir erst (gebrannte Kinder).
Ok, diesmal ist es Salz. Jetzt hat doch tatsächlich auch der Salat den Weg auf unseren Tisch gefunden. Er ist schmackhaft, muss ich sagen, aber so scharf, dass ich ihn kaum essen kann. - Manchmal geht eben alles schief. Zu guter Letzt kommt die Rechnung. Natürlich müssen wir zwei Portionen Pommes Frites bezahlen, wir haben schliesslich zwei bestellt. Ja, unsere europäischen Seelen haben schon ein wenig Mühe damit, obwohl der „Schaden“ ja an einem kleinen Ort und eigentlich vernachlässigbar ist. Unsere Prinzipien halt… Auf der Rechnung sehe ich dann, dass wir sogar für die Servietten bezahlen müssen. Das ist wirklich absurd. - Aber in diesem Land darf man ja nur lächeln. Das sagt uns der Reiseführer (Buch). Tun wir. Wir bezahlen schön brav alles, schnappen uns ein Taxi und kehren zurück ins Hotel. Es ist eine Fahrerin dieses Mal, die erste Frau, die wir am Steuer eines Taxis sehen. Sie ist auch die erste, die geradewegs ohne Umweg zum Hotel fährt (wir kennen mittlerweile die Strecke) und die erste, die uns direkt vor dem Hotel absetzt.
Cu Chi Tunnel
Im Hotel treffen wir unsere neue Reisegruppe und machen uns bekannt.
Am nächsten Tag sind die Cu Chi Tunnel auf dem Programm (meine Eselsbrücke: Armani).
Die Car-Reise für die etwa 50 km dauert fast zwei Stunden. Der Besuch der Tunnelanlage ist äusserst eindrücklich. Es ist dort, wo die Partisanen eine Art unterirdische Stadt gebaut haben und es dann zu entsetzlichen Kämpfen kam zwischen den Vietnamesen und den Amerikanern. Das ganze Tunnelsystem soll ca. 200 km lang gewesen sein, zum Teil bis zu drei Stockwerke hoch beziehungsweise tief. Was wir von unserem Führer (er heisst Long – meine Eselsbrücke „short“) über die Geschichte hören, ist natürlich sehr einseitig, ebenso der Film, der als Einstieg dort gezeigt wird. Die Tunnel sind schmal und eng und dunkel; einige davon sind ein bisschen vergrössert worden, so dass auch für den Durchschnittseuropäer im Kauer-Gang ein Sich-Durchdrängen möglich wird, jedenfalls für die nicht übersättigten Exemplare. Nicht einmal die Hälfte unserer Reisegruppe macht mit. Und nur drei „unserer“ Männer riskieren sogar eine Strecke, wo man nur grad auf allen Vieren vorwärts kommt. Die müssen da durch, sagt ihnen wohl ihr Ego. - Wie Theo, der Held, nach dreissig Metern wieder aus dem Boden auftaucht, bin ich echt froh, dass er es geschafft hat. Man stelle sich vor, wenn er stecken geblieben wäre… Jetzt beklagt er zum ersten Mal, dass es mit seiner Fitness doch nicht mehr so ganz zum Besten steht. Er ist total verschwitzt, aber glücklich, dass das Unterfangen gelungen ist. Ich meinerseits habe auf diesen weiteren Teil der Strecke gern verzichtet, weil ich vorher von Fledermäusen umflattert worden bin, was eindeutig nicht nach meinem Geschmack ist. Und überhaupt, man soll ja nicht übertreiben. (Nachtrag: Der unerklärliche Muskelkater, über den Theo am nächsten Tag klagt, ist zweifellos auf die 30m-Tunnel-Kriecherei zurückzuführen.)
Im Gelände werden uns auch all die verschiedenen Arten von Fallen gezeigt, die im Dschungel in den Boden eingegraben wurden – es ist grauenhaft!!!
Mit dem Bus geht’s zurück in die Stadt. Unterwegs fängt es heftig an zu regnen. Die uns umschwirrenden Motorradfahrer lassen sich dadurch nicht heftig stören; sie tragen jetzt bunte Pelerinen.
Unterwegs nach Kambodscha
Am folgenden Tag heisst’s wieder Koffer packen und früh los. Wo wir schon vor drei Wochen waren, gehen wir nun wieder hin: ins Mekong Delta. Besuch der Obst- und Kokosnussplantagen, Bootfahrt entlang der Nipapalmen (stehen im Wasser und haben keinen Stamm, aus dem Saft der Frucht wird Zuckersirup und Alkohol gewonnen). Der Tag verläuft ähnlich wie mit der ersten Reisegruppe, obwohl wir nicht dieselben Orte besuchen, an denen wir schon waren, nur, dass wir anschliessend weiterfahren Richtung Westen. Unterwegs Besichtigung des Cao Dai Tempels, von dem sogar unser Guide sagt, er sei „ein wenig kitschig“. Es ist der Tempel einer hinduistisch-buddhistisch-christlichen Sekte (Trinh Do Ku Si).
In Can Tho (Eselsleiter: El Canto) übernachten wir. Hier ist die Kommunikation noch schwieriger als in Saigon. Die englische Sprache scheint noch nicht bis hierhin vorgedrungen zu sein. So gestaltet es sich recht schwierig, in einem Restaurant etwas zu bestellen. Wir finden eines, das gar nicht mal so schlecht aussieht. Das Personal ist ober-freundlich, legt uns die Speisekarte hin und zu dritt stehen sie hinter meinem Rücken und schauen zu, was ich mit der Karte anstelle. Es hat schlecht gezeichnete Bilder drin. Auf der ersten Seite beginnt’s mit Aal, Spatzen, Tauben und Schlangen. Nein, also so doch nicht. Wir stehen auf, entschuldigen uns und suchen ein anderes Restaurant. Theo wieder mal mit seinen Pommes Frites. – Und hier machen wir eine Entdeckung: Pommes Frites, serviert mit Butter und Zucker, sind offenbar normal. Ein kulturelles Missverständnis also. Wer wieso auf die Zucker-Idee kam, nähme mich schon wunder, aber fragen kann man hier ja niemanden.
Der nächste Tag ist Theos 70ster Geburtstag. Schon um halb sechs läutet der Wecker (und tags drauf um fünf Uhr). Man stelle sich den lieben Theo vor! - Ziemlich speziell: Einen so langen Geburi-Tag hat er wohl noch nie im Leben gehabt.
Eine Bootfahrt ist’s, die uns so früh aus den Federn lockt. Wir fahren nach Cai Rang zum schwimmenden Markt. Käufer und Verkäufer aus den umliegenden Provinzen betreiben einen regen Handel von Boot zu Boot. Wunderbar zu schauen.
Nach der Bootsfahrt ein weiterer Markt, diesmal an Land. Theo kauft sich zum Geburtstag eine neue Baseball-Cap für drei Franken. Unterwegs zum Tagesziel Chau Doc, dem Grenzort zwischen Vietnam und Kambodscha, machen wir in einer Krokodilfarm einen Mittagshalt. 40‘000 Tiere hat’s dort, Exemplare in jeder Grösse. Wie bei Hänsel und Gretel warten sie alle darauf, bis sie dick genug sind, so dass man ihr Fleisch essen und aus dem, was drum herum vorhanden ist, Taschen, Schuhe Gürtel und Portemonnaies machen kann. Frühlingsrollen aus Krokodilfleisch ist die Spezialität. Mein Mut verlässt mich, ich bestelle welche aus Schweinefleisch, probiere aber ein Stück geschnetzeltes Krokodilfleisch von einem anderen Teller. So schlecht schmeckt es nicht, etwas gummig zwar, ein wenig wie zu zäh gekochtes Schweinefleisch.
Wieder unterwegs fahren wir, einmal mehr, an zahllosen Reisfeldern vorbei, an BMWs (Bauer mit Wasserbüffel) und etwas ganz Besonderes sehen wir in den abgeernteten Feldern: eine riesige Schar von Gänsen, die, eng zusammengepfercht, in eine Richtung marschieren. Ein Gänsejunge treibt sie an. Ein Bild wie eine Schafherde, die von einem Border Collie getrieben wird. Nur braucht es hier gar keinen Hund, sie bleiben alle schön zusammen und trippeln in die gewünschte Richtung. - Gegen vier Uhr, Theo wird schon ganz quengelig und möchte endlich ins Hotel gebracht werden (zwecks Siesta), macht der Bus einen Abstecher in ein Naturschutzgebiet, den Tran Su Kajeput Wald. Diese Bootsfahrt verpasst zu haben, wäre sünd und schad gewesen. Die Bäume stehen im Wasser, es sind eine Art Süsswasser-Mangroven. Dazwischen hat sich ein grüner Teppich gebildet aus Wasserpflanzen, durch den man mit kleinen Booten hindurch fährt. Es herrscht eine Stille, die nur vom Plätschern der Ruder und von Vogelschreien durchbrochen wird, eine sagenhaft betörende Gegend. - Weiter geht die Fahrt durch einen Lotus-See; ein Sonnenuntergang wird zusätzlich geboten. Märchenhaft.
Das Hotel in dieser kleinen Provinzstadt ist dann weniger märchenhaft. Von aussen ganz flott, innen lässt manches zu wünschen übrig. Sogar der Manager sagt, es wär vermutlich besser, man würde es niederreissen und neu bauen. Was sich die Architekten da wohl gedacht haben (nur ein Beispiel): Es gibt keinen Lift, und die armen Angestellten müssen jeweils all die schweren Koffer zwei Stockwerke hochschleppen und am nächsten Morgen wieder runter. Es ist übrigens nicht das erste Hotel mit diesem personalfreundlichen Konzept.
In der Mitte hat es einen Pool, der ist ganz in Ordnung, aber jetzt ist es zu spät, um den zu nutzen, obwohl eine Abkühlung sehr willkommen gewesen wäre. Wir essen im Hotel, weil der Ort so klein ist und Long, unser Reiseführer, sagt, es habe keine akzeptablen Restaurants in der Nähe. Das Buffet, das am Pool aufgestellt wird, ist aber sehr lecker, und es gelingt mir sogar, eine Flasche Rotwein aufzutreiben (die einzige, die es noch hat), die allerdings in einem Eiskübel auf Normaltemperatur herunter gekühlt werden muss, damit man nicht denkt, es handle sich um Glühwein. So ist also Theos Geburtstagsessen doch noch ganz „nett“ ausgefallen. Wir sitzen am Pool an einem Zweiertischchen gleich neben der lauten Wasserpumpe und sind sicher, dass wir diesen Ehrentag nicht so rasch wieder vergessen werden.
Grenzübertritt und Phnom Penh
Am nächsten Tag geht’s, wie schon erwähnt, sehr früh zur Sache. Tagwacht um fünf, um Viertel vor sieben sind wir mit Sack und Pack am Bootssteg und besteigen das Schnellboot nach Phnom Penh. Nach einer Stunde Fahrt erreichen wir die Grenze. Alle müssen aussteigen und warten. Die beiden Boys, die das Schiff managen, sind so etwas von effizient und freundlich; es ist unglaublich. Geschickt werden alle Koffer verstaut und wir kriegen Schwimmwesten, die wir nur tragen müssen, so erklären sie uns, bis wir die ersten Polizeikontrollen unterwegs passiert haben. Schon am Vorabend kamen sie ins Hotel, haben unsere Pässe, das ausgefüllte Aus- und Einreiseformular und die Kohle (34$ pro Person) eingesammelt und haben für uns alle Ausreiseformalitäten erledigt. Wir können wieder einsteigen und weiter geht’s zum kambodschanischen Zoll. Dort müssen wir selber Schlange stehen bei 35 Grad ohne Sonnendach. Bis wir am Schalter den Pass gezeigt, ein paar Stempel drein gedrückt bekommen haben und dann endlich wieder das Schiff besteigen können, ist eine knappe Stunde vergangen. Jetzt geht’s weiter mit Vollspeed Richtung Hauptstadt. Auch wie die beiden Boys das Schiff im Griff haben, ist bemerkenswert. Es fliegt flussaufwärts. Wie im Flugzeug wird uns sogar ein Mittagessen serviert, ein paar Sandwiches, Früchte, Getränke. Nach weiteren drei Stunden kommen wir in Phnom Penh an und werden von unserem nächsten deutschsprachigen Reiseführer empfangen. Er heisst Daviin und ist sehr eloquent, intelligent und gebildet. Er macht so gut wie keine Deutschfehler und hat einen riesigen Wortschatz. Er ist ein Freelancer und auch recht kritisch gegenüber allem, was Politik und Geschichte betrifft. Sehr interessant, was er uns alles erzählt. Mit ihm machen wir eine Stadtrundfahrt (zur Abwechslung wiedermal ein Tempel, die königliche Residenz mit der Silberpagode und das Nationalmuseum), dann geht’s zum Hotel. Wir sind zu müde, um gross ins Zentrum zu fahren und beschliessen, gleich am Ende der Strasse etwas zu essen, wo’s zwei Restaurants hat. Einheimische. Von Daviin nicht empfohlen. Von diversen Mitreisenden als zu scheusslich eingestuft, als dass man es dort wagen könnte zu essen. Wir gehen trotzdem hin. Wir sind zu acht und bestellen irgendwelche Dinge, Fleisch, Reis, Nudeln, Fisch – wie’s grad geht mit unseren nicht existenten Sprachkenntnissen. Natürlich - man isst aus Plastiktellern und das Auge isst nicht mit, aber alles ist super gut, wunderbar gewürzt und inklusive Getränke kostet unser üppiges Nachtessen 4$ pro Person. Wir haben brav, wie sich das für Schweizer gehört, die Teller zusammengestellt und die Servietten hineingelegt - nicht so die anderen Gäste, alles Einheimische. Es scheint üblich, nach dem Essen alles auf den Boden zu schmeissen und so eine unermessliche Sauerei zu hinterlassen. Auch dieses Abendessen eine Erfahrung mehr.
Erwähnenswert ist auch: Niemand hatte irgendwelche Magenprobleme am nächsten Tag. Ebenfalls das Eis, das ich mit meinem Soda bestellt hatte, war einwandfrei.
Fahrt nach Siem Reap und Angkor Wat
Am nächsten Tag, dem Mittwoch, 26. November, haben wir eine lange Busfahrt vor uns. Ziel ist Siem Reap (man spricht‘s aus, wie’s geschrieben steht), und dort werden wir (endlich!) drei Nächte lang bleiben können. Angkor Wat zu besuchen, war schon seit jeher mein Wunsch und genau dieser Ort ist der Grund, weshalb ich diese Reise (und alles drum herum) überhaupt gebucht habe. Nach Angabe des Reisebüros sollte die Fahrt etwa sieben Stunden dauern (400 km), wir kommen nach neun Stunden an. Unterwegs begibt es sich nämlich, dass der Bus-Chauffeur mal unter dem Bus liegt, statt auf seinem Sessel sitzend durch die Gegend zu fahren, denn beim Passieren des tausend-und-x-ten Schlaglochs ertönt ein lauter Knall - ein Luftkissen ist geplatzt. Etwa eine Stunde dauert die Reparatur. Der Fahrer tut mir leid. Niemand hilft ihm. Ganz allein muss er den riesigen Bus hinten hochkurbeln und den Schaden flicken. Wir müssen natürlich alle aussteigen und warten. Es ist sehr heiss. Nach getaner Arbeit geht er sich im Kanal, der sich zwischen der Strasse und dem Reisfeld befindet, waschen und abkühlen. Er zieht ein neues Hemd an und weiter geht die Fahrt.
Eigentlich habe ich im Sinn gehabt, auf der langen Reise ein wenig zu lesen, aber ich komme gar nicht dazu, weil es so spannend ist, hinauszuschauen, all die Reisfelder zu sehen, die bunten, zum Teil schwer beladenen Motorradfahrer, die wir überholen und die Orte, die wir durchqueren. In einem Städtchen halten wir an, wo’s einen ganz besonderen Markt hat. Weniger zum Einkaufen für Ausländer, aber zum (gruselige) Fotos Machen schon. Es sind vor allem Insekten und Spinnen, die dort zum Verzehr verkauft werden. Grillen in rauen Mengen, schön aufgetürmt, auch Eier mit halb ausgebrüteten Hühnern drin werden angeboten. Theo ist fasziniert. Ein kleiner Junge kommt mit einer noch lebenden Vogelspinne und legt sie ihm auf den Arm. Theo meint erst, das Ding sei aus Plastik. Ist es aber nicht. Der Bub hat ein Zahnbürstchen dabei, mit dem er dem Tier hin und wieder über den Kopf streicht, damit es sich bewegt. Ein Mädchen bringt eine zweite Spinne, so tummeln sich jetzt zwei auf dem Vorderarm meines Gatten. Die armen Dinger sind wohl irgendwie sediert, sie bleiben schön brav sitzen. Sicher sind auch sie dem Tode geweiht. Theo kauft auch eine Grille, die er dann essen will. Sie ist noch jetzt in einem Plastiksäckchen in seinem Gepäck. Das Happening, das zu inszenieren er vorhatte, ist aus Zeitmangel (zum Glück) nicht zustande gekommen.
Apropos Grillen: Auf den Reisfeldern sieht man vielerorts Fallen, in denen sich die Tiere zuhauf fangen lassen. Dies zur grossen Freude der Schädlinge auf den Reisfeldern, denn wenn ihre Feinde tot sind, von den Menschen gefressen, können sie ihnen ja nichts mehr anhaben und sich wieder ungestört an die Reiskörner heranmachen. Allerdings ist die Freude nicht von langer Dauer, weil die natürlichen Feinde fehlen, werden sie jetzt mit Insektenvertilgungsmittel um die Ecke gebracht. So läuft das.
Angkor Wat und Angkor Thom (wir verstehen beide immer: Onkel Tom) sind mehr als nur eine Reise wert. Das riesige Gebiet der Ausgrabungen ist UNESCO Weltkulturerbe und ich hatte immer Angst, irgendwann würde man vielleicht wegen des Massentourismus nicht mehr hingehen können. Im Moment aber ist das noch überhaupt kein Thema. Touristen hat’s zwar wie Sand am Meer (wir gehören auch dazu, ich weiss schon), die überall herum kraxeln (der höchste Turm der Tempelanlage ist 65 Meter hoch). Das Business blüht. Als Erstes muss man eine Ticket lösen, 20$ pro Tag, und man wird fotografiert. Dieses Föteli kommt aufs Eintrittsbillet, das man immer mit sich herumtragen muss. Durchorganisiert. Toiletten hat’s auch. Unser Führer, ein anderer wieder mit Namen Dopi, sagt zu uns Frauen, es habe dort sogar „schöne Stühle“. Was man unter „schön“ nicht alles verstehen kann. Ich beschreibe die schönen Stühle jetzt mal lieber nicht. Die Löcher nebendran auch nicht. Es hat auch Lavabos dort (und auch die beschreibe ich lieber nicht), um sich die Hände zu waschen, aber leider fehlt das Wasser; es könnte sein, dass es gebraucht wird, um den Boden unter und neben den schönen Stühle zu schwemmen.
Sonst gibt’s nichts auszusetzen. Was man sehen, fotografieren, beklettern und bestaunen kann, ist einmalig. Grossartig. Die Grösse der Tempelanlagen ist mehr als nur eindrücklich. Das ganze Gebiet erstreckt sich über 400 km2. Noch längst ist nicht alles ausgegraben. Während 700 Jahren wurden an diesem Ort etwa sieben Hauptstädte gebaut und unzählige Tempel. Mehr als eine Million Einwohner sollen dort gewohnt haben. Nur noch die Tempel sind übrig geblieben, die Behausungen der Einwohner waren aus Holz gebaut und sind daher nicht mehr vorhanden.
Neben Angkor Wat ist auch Angkor Thom imposant wegen der rund 200 bis zu 7 Meter hohen Gesichtern, die aus Stein in über 40 Türme gehauen sind.
Am besten gefiel mir der Jungle-Temple-Bezirk, der Ta Prohm. Einfach gewaltig, wie die Natur die von Menschen erschaffenen Bauten zurückerobert. Mit ihren riesigen Wurzeln umgarnen und durchdringen die Bäume (Silk-Cotton-Tree and Strangler Fig = Würgefeigen) wie Schlangen die Ruinen und lassen sie zerfallen. Dieser Mix zwischen Natur und Bauwerk ist einzigartig. Ich könnte mir einen Zeitlupen-Horror-Film vorstellen, der zeigt, wie die Tempelanlage entstanden beziehungsweise zerstört wurde und wohl auch weiterhin zermalmt werden wird. Die Wurzeln scheinen zu leben, Medusa kommt mir in den Sinn. - Creepy!
Mehr als 12‘000 Mönche sollen damals (im 12. / 13. Jhd.) dort gelebt haben.
Die Stadt Siem Reap lebt natürlich vom Tourismus. Da ist immer etwas los. Laden reiht sich an Laden, oft wird dieselbe Ware an jeder Ecke verkauft: T-Shirts, Kleider, Stoffe, Etuis und Taschen jeglicher Art und Grösse, Souvenirs, Buddha-Köpfe und -Statuen, Gewürze, Früchte etc. etc. Und Duzende von Restaurants, die Gerichte aus aller Welt anbieten. Wir bevorzugen die Khmer-Küche. Es sind fein gewürzte Gerichte, ähnlich wie die Thai-Küche sie kennt, aber (fast) ohne Chili. Amok hab ich am liebsten.
Theo entdeckt einen Coiffeur und beschliesst, sich die Haare schneiden zu lassen. Vor mir sehe ich folgendes Bild: Im Geschäft, vor dem ich stehe, hat’s auf der Strasse zwei pinkfarbene Sofas und davor Aquarien mit Fischen drin, wo man sich die Füsse und Waden abknabbern lassen kann (seit wenigen Jahren vielerorts der neueste Gag - die armen Fische!). Hinter diesen Tanks eine Mutter, die ihr Kleinkind mit Nudeln füttert, dann eine Reihe rosaroter Massagestühle und zuhinterst der Coiffeur-Stuhl. Dort thront Theo, zugedeckt mit einer rosaroten Frisier-Schürze (nur sein Kopf schaut heraus) und lässt sich von einem jungen Kambodschaner eine neue Frise verpassen. Sehr zufrieden ist er, fünf Franken hat’s gekostet.
Tonle Sap See und Grenzübertritt nach Thailand
Am nächsten Tag machen wir einen Ausflug auf den Tonle-Sap-See. Er ist der grösste Binnensee in Südost-Asien. In der Regenzeit wird er bis zu viermal grösser (25.000 km²) als in der Trockenzeit und fünfmal tiefer. Im Moment sieht er aus wie ein Meer; man sieht das gegenüberliegende Ufer nicht. Ein Naturphänomen findet in November statt, wenn der Tonle-Sap-Zufluss zum Mekong hin seine Fliessrichtung ändert. Entlang des Ufers haben sich Hausboote einquartiert. Vietnamesen seien es, erklärt uns Dopi. Diese dürfen kein Land kaufen in Kambodscha, aber auf den Booten leben, ist erlaubt. Sie sind Fischer, arbeiten tagsüber aber nicht, nur des Nachts. Für die Touristen hat’s auch Restaurants und Verkaufsläden auf Flossen mit Lookouts, so dass man, wenn man dort in den zweiten Stock hinaufsteigt, einen schönen Blick über die Gegend und die Hausboote hat. Entlang der Strasse zum See stehen Häuser auf Pfählen, und viele der Restaurants (für die Einheimischen eher) sind versehen mit mehr Hängematten als Stühlen, wo nach dem Essen geruht wird. Theo gefällt dieses Detail besonders gut.
Wieder haben wir eine längere Bus-Reise vor uns. 420 km sind’s diesmal. Wir werden an die kambodschanisch-thailändische Grenze gebracht. Dort herrscht ein geschäftiges, buntes und lautes Treiben, ein Hin und Her mit Schubkarren, Waren und Menschen, die von drüben kommen oder, wie wir, hinüber wollen. Die Ausreise dauert eine knappe halbe Stunde, Anstehen, Pass zeigen, tief in die Augen schauen, Passfoto mit Lebendobjekt vergleichen, wie das eben so ist. Als besonderes Gadget hat der Beamte ein kleines Gerät vor sich stehen und wir müssen unsere Fingerabdrücke abgeben. Wie in Amerika bei der Einreise. Was das hier aber bei der Ausreise soll? Das Apparätli sieht auch eher aus wie ein Spielzeugtruckli, das grün aufleuchtet, wenn alles ok ist. Na ja. Auf Theos Fingerabdrücke verzichten sie. Ich versteh’s heut noch nicht, glaube aber stark, dass gar nichts dahinter steckt. Es sieht einfach ziemlich wichtig aus.
Das alles war erst der Anfang.
Bis zum Zoll auf der anderen Seite sind‘s etwa 500 Meter. Dorthin muss man seine Koffer selber schleppen. Seltsamerweise hat’s niemanden, der sich einem anbietet, dies zu tun. Meine einzige Erklärung dafür ist, dass das strikte verboten ist. Sonst wird ja immer und überall versucht, ein wenig Geld zu verdienen.
Weshalb dem Erfinder der Rollen am Reisegepäck noch kein Denkmal gesetzt wurde, ist mir ein Rätsel. Rollkoffer sind ein Segen (genauso wie die Erfindung des Reissverschlusses, der Wasch- und Geschirrspülmaschine, des Staubsaugers, des Kühlschranks etc. etc.), vor allem auch diejenigen mit vier Rollen, die man mit zwei Fingern stossen kann, Gewicht egal.
Wenn allerdings der Boden so beschaffen ist wie das Niemandsland zwischen Kambodscha und Thailand… Luftkissen-Springfedern oder etwas Ähnliches wären allenfalls eine Folge-Erfindung wert.
Die letzten hundert Meter bis zum Zoll führen durch eine enge Passage, in der sich zahlreiche Bettler niedergelassen haben, die einem den Weg halb versperren. Da mit einem grossen Koffer und einem Handgepäckstück durch zu zirkeln, ist nicht das Einfachste vom Einfachen. Aber gleich haben wir‘s ja geschafft. Denke ich. Jetzt wird einem ein Einreiseformular ausgehändigt, und weiter geht’s zum Zollgebäude. Dieses ist nicht ebenerdig. Es hat auch keinen Lift, dafür mindestens zwanzig Stufen bis zum Eingang. Dort hinauf muss jetzt jeder sein Gepäck selber hinaufbefördern. Wer nicht vorher schon völlig verschwitzt und abgekämpft war, ist es spätestens jetzt. - Endlich gelangt man in die Zollabfertigungs-Halle. Die ist bereits voller Leute, die Schlange stehen. Hin und zurück, hin und zurück, hin und zurück, immer dem gespannten Band entlang. Hinter all den Leuten sieht man (von fern), dass es sechs Schalter hat. Zwei sind den Einheimischen vorbehalten, von den anderen vier ist nur einer besetzt. Etwas später dann noch ein zweiter. Nach der Mittagspause alle vier. Niemand muckst. Das macht man einfach nicht beim Zoll, das scheinen alle zu wissen. Aber einer aus unserer Gruppe fällt um. Er ist achtzig und das alles ist dann doch zu viel für ihn. Er erhält nun das Privileg, ganz vorne bei den Schaltern auf einen Stuhl sitzen zu dürfen.
Immer mehr Leute stehen an, die Halle ist nicht gross genug, viele müssen vor und auf besagter Treppe in der brütenden Sonne warten. Bis wir dran sind, dauert es anderthalb Stunden. Gut, dass wir beide unsere e-Books dabei haben. So wird die Warterei erträglicher. - Endlich! – Stempel etc. Als Nächstes müssen die Koffer natürlich auf der anderen Seite wieder die Treppe hinuntergeschafft werden, Lift hat’s auch da keinen, Helfer ebenso wenig. Wieso dieses Gebäude nicht ebenerdig ist, frage ich mich. Sind Touristen hier überhaupt willkommen?
Der Bus nach Bangkok wartet bereits und wir fahren los. In Vietnam und Kambodscha war immer ein Bus-Beifahrer dabei, der dafür besorgt war, dass es den Gästen gut ging. Hier hätte ich nach all den Strapazen auch erwartet, dass man uns ein Feuchttüchlein reicht und eine Flasche gekühltes Wasser. Aber nein. Der Bus fährt fast zwei Stunden lang bis zu einer Tankstelle, wo’s Toiletten und einen 7/11-Laden hat. Weitere fast drei Stunden dauert die Fahrt bis zum Hotel. Von dort an ist alles gut. Sehr sogar (bis für zwei aus unserer Gruppe, die bei der Tankstelle offenbar etwas gekauft und gegessen haben, was ihren Mägen nicht wirklich hold war).
Von der Reiseleitung erhalten wir ein Schreiben, das uns vor terroristischen Anschlägen warnt. Orte mit Menschenansammlungen soll man vermeiden. Ok, ok, dann ist halt nichts mit Sightseeing, Metrostationen kommen wohl auch nicht in Frage - da bleibt man wohl am besten im Hotel, was sicherlich keine Strafe wäre. - Obwohl, in diesen grossen Hotels könnte es ja auch gefährlich werden…
Bangkok
Zwei Tage in Bangkok - ich hätte die Stadt nicht wieder erkannt, es ist aber auch schon etliche Jahre her, seit ich zum letzten Mal hier war. Jetzt hat’s einen Sky-Train, mit dem man sich bequem und schnell von Ort zu Ort begeben kann. Auch eine Metro. Es hat massenhaft neue Gebäude, Hochhäuser und im Gegensatz zu den beiden anderen Ländern, wo wir bis anhin waren, kriegt man fast einen Kulturschock. Lauter teure Autos fahren herum, der Verkehr ist grauenhaft, die Abgase dementsprechend. Motorräder hat’s kaum mehr, Velos schon gar nicht; es ist wie bei uns, die Strassen und die vielen über- und untereinander gebauten Autobahnen sind oft verstopft. Tuc-Tucs gibt‘s zwar noch, vor allem im Zentrum, aber deren Zahl ist deutlich kleiner geworden.
Wir schieben eine ruhige Kugel. Theo kann endlich wieder einmal länger ausschlafen. Acht Uhr kommt ihm neuerdings schon spät vor - wer hätte das gedacht! Das Frühstücksbuffet im Hotel ist eine Bombe. Da gibt’s alles von Nudelsuppe über Sushi, Dim Sum, Eierspeisen, Früchten und und und bis zu Birchermüesli und Fotzelschnitten. Und alles prächtig und aufwändig präsentiert.
Dann ziehen wir los, kaufen uns ein Tagesticket für den Sky-Train, unternehmen eine Bootsfahrt durch die Klongs, nur wir zwei, sicher total überbezahlt, aber sehr erholsam, interessant und beschaulich. An x Tempeln und Wohnhäusern gondeln wir gemütlich vorbei; die Fahrt dauert eine Stunde.
Abends schlendern wir durch den Night-Market von Patpong. Meine Ausbeute: ein Bikini. Abendessen in einem Strassenrestaurant mit sehr freundlicher Bedienung, zähem Hühnerfleisch und dröhnendem Strassenverkehr.
Für 60 Euro pro Person wird von der dortigen Reiseleitung ein Trip angeboten zu einem Markt, ein wenig ausserhalb der Stadt. Das Spezielle daran ist, ein Zug fährt ein paarmal täglich mitten durch den Markt hindurch und die Händler müssen jeweils rasch ihre Ware von den Schienen wegnehmen und die Storen zurückziehen. Das muss mal was anderes sein zur Abwechslung. Märkte haben wir ja inzwischen genug gesehen, aber wieso nicht? Nur nicht mit Reisecar und Gruppe.
Im Tripadvisor hat jemand geschrieben, dass man einen Minibus dorthin nehmen muss, aber er hat nicht erwähnt, wie weit die Strecke ist. Sonst hätten wir uns den Fall vielleicht doch noch überlegt. Und vielleicht hätte ich diesen Ausflug im Vorfeld doch etwas besser recherchieren sollen… Den Minibusbahnhof finden wir relativ rasch, ein Bus ist gleich startbereit, die Tickets kosten zwei Franken pro Person. Der Bus ist voll besetzt; wir sind ziemlich eingepfercht – wie Sardinen in einer Büchse. Niemand spricht ein Wort Englisch, auch die zwei Japanern nicht, die mit uns die einzigen ausländischen Passagiere sind.
Nach einer halben Stunde Fahrt kommen mir leise Zweifel, ob wir wirklich im richtigen Bus sind, wir rasen über Stadtautobahnen, fahren über Land und durch Dörfer, die nicht enden wollen. Zehn Minuten später hält der Bus an, aber nur, um eine Sardine herauszulassen. Weiter geht’s. Nach fünfzig Minuten biegt er ab. Endlich! - Nein, er geht nur tanken.
Nach einer guten Stunde kommen wir dann doch noch an. Wir sind am richtigen Ort, in Mae Klong, und mithilfe des freundlichen Ortspolizisten finden wir auch den riesigen Markt. Und tatsächlich: Eine Eisenbahnlinie zieht sich durch den Markt, sogar eine Haltestelle ist dort. Wir schauen zu, wie das oben beschriebene Spektakel vor sich geht: Ein dumpfes Hupen ertönt, dann kommt unter den Händlern eine rege Tätigkeit in Gang. Sie schieben ihre Ware von den Schienen weg, klappen die Vordächer hoch und schon erscheint der Zug. Lustig, lustig! Ich finde, die lange Reise hat sich gelohnt, es war zwar ein kurzes Vergnügen letztlich, aber schon ziemlich speziell. Zehn Franken hat der Ausflug gekostet für uns beide, zwei Getränke inbegriffen. Nicht 120 Euro, wie offeriert.
Gut gefällt uns das Abendessen zurück in der Stadt in einem sehr speziellen Restaurant, dem „Cabbages and Condoms“. (Wohltätigkeits-Projekt um die Überbevölkerung in den Griff zu bekommen und Aids zu stoppen). Lebensgrosse Figuren sind ausgestellt (jetzt unter anderen der Sankt Nikolaus) - wenn man näher hinsieht, alle aus Kondomen angefertigt. Ebenso sind die Lampen aus diesen Gummis gebastelt und wenn man zahlt, erhält man mit der Rechnung statt eines Bonbons ein Kondom. Das Restaurant befindet sich in einem schönen Garten, ist hübsch beleuchtet, aber wenn man nicht weiss, dass es dort ist, würde man den Spaziergang durch diese dunkle Gasse wohl eher nicht in Betracht ziehen. Das Essen ist wunderbar, wir würden wieder dorthin gehen.
Noch ein Abschnitt zu unserer Reisegruppe im Nachhinein:
Diese zweite Reisegruppe war ein wenig seltsam. Und viel zu gross. Wir waren 15 Schweizerinnen und Schweizer. Dazu kam eine Gruppe aus Deutschland - zusätzlich zwölf Leute. Eine weitere Gruppe aus Österreich machte dieselbe Reise; wir sahen sie aber immer nur am Abend im Hotel. Sie reisten mit einem anderen Führer und in einem anderen Bus.
In unserer ersten Gruppe in Vietnam hatten alle gleich Kontakt zueinander. Es war unterhaltsam und man ging oft zusammen essen, auch wenn man „frei“ hatte.
Hier war fast das Gegenteil der Fall. Seltsamerweise kamen wir mit den deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer so gut wie nicht ins Gespräch. Einige von ihnen vergassen gar zu grüssten jeweils am Morgen. Nach ein paar hilflosen Versuchen, ein Gespräch in Gang zu bringen, gab ich’s auf. Auch am Ende der Reise wussten wir deren Namen nicht einmal. – In Kambodscha wurde unsere Gruppe geteilt. Keine Ahnung, wieso. Die Deutschen waren nun mit den Österreichern zusammen, wir Schweizer allein, nur noch zu sechzehnt, weil doch einer aus der deutschen Gruppe nicht wechseln wollte. Auch er hat so gut wie nie etwas gesagt, aber offenbar war’s ihm bei den Schweizern wohler.
Mit der kleineren Gruppe war’s dann viel angenehmer, das Durchschnittsalter hatte sich trotz unserer Anwesenheit erheblich gesenkt, und wir hatten mit mindestens sieben Reiseteilnehmerinnen und -teilnehmern guten Kontakt. So gut, dass uns zwei davon sogar überflüssige Kilos Gepäck mit nach Hause nahmen. So sind wir also unser allgegenwärtiges Problem mit dem Übergewicht los, weil sie bei ihrem Rückflug 30 kg Freigepäck und wir dann nur 20 kg haben. Mit anderen Worten: Wir können erneut wieder ein bisschen was einkaufen. – Was für ein Segen!
Kleines Detail: Ich habe ihnen Theos roten, relativ schweren Schweizer-Sportsack mitgegeben, den er so gerne als Badetasche benutzt. Als ich ihn leerte um zu sehen, ob da doch noch etwas drin war, was er eventuell brauchen möchte, hab ich unter anderem eine Windel von Amy gefunden. Eine ungebrauchte zum Glück.
So wird am zweiten Dezember die Schweizergruppe bereits um halb sieben abgeholt und zum Flughafen gebracht. Wir hingegen können ausschlafen, fein, gemütlich und lang frühstücken, packen, zwei Stunden am Pool verbringen und uns schliesslich per Taxi an den Flughafen fahren lassen (halbe Stunde Fahrzeit - 12 Franken). Alles easy, easy, easy, so wie’s Theo richtig gerne mag.
Koh Samui 2. – 16. Dezember
Nach einem einstündigen Flug kommen wir auf der Insel Koh Samui an. Wenn’s in Bangkok bedeckt war, so reissen hier die Wolken auf und das Wetter ist prächtig. Heiss sowieso. Eine Viertelstunde nachdem wir unser (jetzt etwas leichteres) Gepäck in Empfang genommen haben, sind wir bereits im Hotel angelangt, im „Peace Resort“ in Bo Phut.
Schön ist’s hier, es gibt kein Haupthaus, nur einzelne Bungalows in einem dschungelartigen Garten angelegt – Ruhe pur. Nur Vogelgezwitscher weckt mich manchmal schon vor sechs Uhr morgens. Restaurant und Bar direkt am Strand gehören natürlich auch dazu, genauso wie ein Pool, Souvenirshops, Schneider (mit einer Anzahl Musterbüchern aus dem vorigen Jahrhundert), Bibliothek sogar (brauchen wir mit unseren e-Books nicht mehr) und so weiter. Hier lassen wir uns zwei Wochen lang verwöhnen.
Am Strand ist’s angenehm, es hat auch Schatten, und im Meer zu baden macht Spass. Es ist mir zwar zu warm, aber man kann gut schwimmen, was in Mui Ne wegen der hohen Wellen weniger der Fall war.
Ein Strandtag sieht etwa folgendermassen aus: Nach dem ausgiebigen Frühstück Liegestuhl suchen und beziehen, Sudoku lösen und ein wenig lesen (Theo macht inzwischen Siesta), Strandspaziergang und dazwischen immer wieder mal ein warmes Bad nehmen. Wieder im Liegestuhl kommen schon die ersten Strandverkäuferinnen und -verkäufer. Sie sind überaus nett, plaudern gerne ein wenig, sind aber nie aufdringlich oder gar frech, wie das in arabischen oder afrikanischen Ländern manchmal leider der Fall ist. Immer ein Lächeln, immer freundlich, kein Problem, wenn man nichts kaufen will. Vielleicht ja dann „tomorrow“ (Gleich geht’s übrigens mit den zahllosen Massageangeboten - am Strand und im Ort selber. Wer einen da nicht alles massieren will…).
Dann ist schon Zeit fürs Mittagessen, das per Boot angeschwommen kommt. Ein junges thailändisches Paar macht ein grossartiges Geschäft: Er bringt auf seinem kleinen Boot einen Grill mit und lauter leckere Sachen, seine Frau im zweiten Kanu Nachschub: Frühlingsrollen, Fisch, Maiskolben, Früchte, Crevetten- und Poulet-Spiesse, die sie gleich am Strand zubereiten. Von den hungrigen Hotelgästen werden sie während mindestens zwei Stunden teilweise fast belagert.
Oft kaufe ich einen Maiskolben und die Reste davon sind nicht für die Katz, sondern für die Vögel, welche die übriggebliebenen Körner mit grosser Freude picken. Zum Dank für die feine Mahlzeit plustern sie sich auf und trällern uns ein Lied. Es sind zwei Vögel (weiss nicht, wie sie heissen und ob’s immer dieselben sind, kann sie so wenig auseinanderhalten wie die asiatischen Menschen), die mir sogar aus der Hand fressen, wenn ich ihnen zusätzlich ein paar Brotkrümel anbiete.
Fast jeden Tag regnet’s - oft in der Nacht. Ist’s am Tag, dann dauert der Segen kaum eine halbe Stunde und schon ist man zurück am Strand. Der Regen bringt aber keine Abkühlung; er putzt die Wolken weg und macht der Sonne wieder Platz.
Restaurants hat’s in der Umgebung in Hülle und Fülle; das absolut feinste ist das 69-Café. Ein überaus netter Besitzer (Vivian) und gleichzeitig begnadeter Koch treibt dort sein Wesen. Die schönsten Kreationen der thailändischen Küche zaubert er auf den Tisch, alle ein wenig nach seinen einfallsreichen Ideen abgeändert, also nicht so, wie man die Gerichte sonst überall erhält.
Einmal aber wollten wir doch wieder mal ein Stück Fleisch auf dem Teller, das man mit einem Messer behandeln muss. „Churrasco Steak House“ ist angeschrieben. Ziemlich teuer für die Gegend. Leute hat’s zwar keine drin, das Lokal hat Aussensitzplätze an der stark befahrenen Hauptstrasse und drinnen die ungeliebte Air Condition. Theos Lust auf ein Steak ist aber stärker als alle meine negativen Argumente, also gehen wir hinein beziehungsweise hinaus auf die lärmige Terrasse. Ich stelle mich auf Brasilianisch ein. Aber surprise, surprise: Die Bude ist schweizerisch, Besitzer ist ein Schweizer namens Jürg Frei, der bereits seit neunzehn Jahren hier lebt und arbeitet. Wie er auf den Namen Churrasco gekommen ist, hab ich vor lauter Erstaunen vergessen zu fragen. Und er ist ein vorzüglicher Koch. Das Filet ist absolute Spitze. Perfekt gekocht, wunderbar zart und fein im Geschmack. Auch Theos Cordon Bleu ist wie nicht von dieser Welt. Lecker auch die wilden grünen Spargeln mit Bechamel-Sauce zur Vorspeise. Zwar komme ich mir schon ein wenig komisch vor: Fliegen wir den weiten Weg nach Thailand und gehen dann schweizerisch essen. Ich glaube aber trotzdem, wir wiederholen den Besuch. Man muss ja nicht alles so eng sehen. Es gibt dort nämlich auch Spaghetti, das könnt‘ ich wagen, die werden keinen süsslichen Geschmack haben wie die in Vietnam. Und Teigwaren westlicher Art habe ich seit langer Zeit nicht mehr gegessen.
Wir blieben den ganzen Abend lang die einzigen Gäste und ich glaube, der Jürg hatte ziemliche Freude an unserem schweizerdeutschen Plauderstündchen, Theo ebenfalls an seinem Espresso und Grappa zur Abrundung.
Theo hat sich beim Schneider zwei Paar weisse Hosen machen lassen. Auf unserer letzten Reise hatten wir ja deswegen gewisse Differenzen, weil er drei Paar weisse Jeans mitgenommen und von denen nur gerade ein Paar ein einziges Mal angezogen hatte. – Diesmal hab ich mich durchgesetzt: In seinem Koffer waren also keine weissen Hosen mehr drin bei unserer Abreise. Jetzt sind‘s wieder drei (weisse Hose Nummer eins hat er sich in Hoi An machen lassen). Nicht dass ich etwas gegen Hosen hätte, und in den Ferien schon gar nicht gegen weisse. Aber es muss einen Sinn dahinter geben, so viele eizupacken, bemühe ich mich doch immer, die Kilos in Bezug auf unser Gepäck nicht aus den Augen zu verlieren.
Die Insel ist klein, man hat rasch alle Sehenswürdigkeiten gesehen, die angepriesen werden. Auf einer 6-stündigen Fahrt in einem Minibus haben wir uns diese zeigen lassen: den mumifizierten Mönch, den Big Buddha, die Monkey Show, den View Point, die beiden Grandmother and Grandfather Rocks, den Joa Mae Kuan Im, eine eindrückliche Tempelanlage im nördlichen Teil der Insel. Vom Schönsten jedoch war das Bad in einem natürlichen Becken, das sich unterhalb eines der grossen Wasserfälle gebildet hat, in dem wir uns ein wenig abkühlen konnten. Als Schlussbouquet eine bisschen Shopping in der Hauptstadt Nathon Town, wo sich auch der Fährhafen aufs Festland befindet.
Essen an der stark befahrenen Hauptstrasse - na, ich weiss nicht. – Heute lieber nicht. Inzwischen haben wir das Fisherman‘s Village Bo Phut entdeckt, ungefähr zehn Minuten zu Fuss von unserem Hotel entfernt. Da könnte man wochenlang jeden Tag in einem anderen Restaurant essen - direkt am Strand, die Füsse im Sand, oder auf einer der gemütlichen und hübsch eingerichteten und dezent beleuchteten Terrassen mit diskreter Musik und Blick aufs Meer. Dazu noch Vollmond. Paradiesisch. Romantisch. Ein kühler Drink, Fisch und Meerfrüchte vom Feinsten, Currys jeglicher Art, ein freundlicher, zuvorkommender Service; ich frage mich, wie wir es verdient haben, so verwöhnt zu werden.
Einmal gehen wir zu acht essen, zwei Schweizer Ehepaare, ein russisches und ein Deutscher mit seiner thailändischen Frau. Eine ziemlich zusammengewürfelte Gesellschaft. Olga spricht etwa fünf Wörter Englisch und Mitri kann ein wenig Deutsch. Theo benutzt die einmalige Gelegenheit, den armen Russen völlig vollzutexten. Er erklärt ihm unser politisches System (zum besseren Verständnis zeichnet er dazu auf die Serviette), was die Nato macht, gewisse Ansichten über die Probleme in der Ukraine und äussert sich zu anderen weltbewegenden Ereignissen und Fragestellungen. Ich höre nur mit einem Viertelohr zu, staune aber doch und frage mich, wie viel Mitri von all dem mitbekommen hat. Olga auf jeden Fall gar nichts.
Eigentlich hätte ich im Sinn gehabt, noch eine Schifffahrt rund um die Insel oder eine Fahrt zu ein paar nördlich gelegenen Inseln zu unternehmen. Das Problem ist, die starten schon so früh am Morgen… Ja, und leider ist mein Vorhaben schliesslich an eben dem gescheitert.
Am Montag fliegen wir nach Bangkok, dort übernachten wir in einem Flughafenhotel und anschliessend geht’s am nächsten Tag gegen Mittag (gemütlich, gemütlich) weiter gegen Westen, vom Backofen in die Tiefkühltruhe.

Reiseberichte ab 2015
Sommerferien im Ausland, etwa noch im Norden – das gab’s für mich seit Jahren nicht mehr. Aber wenn man pensioniert ist, kann man ja mal eine Ausnahme machen. Kaum aus dem Schuldienst entlassen, sah das daher ganz anders aus und wir liessen uns dazu verleiten, zwei HomeExchange-Tausche in Belgien zu akzeptieren. Mit dem Wissen, dass der Sommer im November und Dezember anderswo stattfindet, also problemlos an einem warmen Ort nachgeholt werden kann, öffneten sich völlig neue Perspektiven. Und so auch in diesem Sommer 2015.
Ich erhielt eine Anfrage, ob wir unser Ferienhaus in den Alpen mit einer Familie aus Jersey tauschen möchten. Dort hat’s ja schöne Strände und vielleicht, vielleicht, wenn das Wetter mitmacht, könnte die Kanalinsel doch eine Reise wert sein. – Mit den Auto? – Aber sicher. Und wenn schon die lange Fahrt, dann auch die Bretagne besuchen. So gelang es mir, vier weitere Tausche einfädeln zu können, was natürlich bedeutete, sieben Wochen unterwegs zu sein, genau zu der Zeit, wo die Aare am wärmsten ist und das Marzili am schönsten.
Aber ich hatte unsere Herbst-Flucht-Ferien ja bereits geplant – Hawaii war diesmal auf unserer Bucket-Liste, also beschlossen wir, eventuell Regen und kältere Temperaturen im Nordwesten von Frankreich in Kauf zu nehmen.
Die verschiedenen Kriminalromane von Jean-Luc Bannalec, alias Jörg Bong, (Bretonische Verhältnisse, Bretonisches Gold etc.), animierten mich sehr, diese Gegend kennenzulernen. In seinen Bestsellern geht es nämlich nicht nur um Mord und Totschlag, sondern auch Ort- und Landschaften werden beschrieben. Sein charmanter Kommissar und dessen Vorliebe für gute Restaurants und exquisite Menus verleiten erst recht zu einem Besuch.
Reisebericht Bretagne – Jersey 7. Juli – 16. August 2015
Wie wir losfahren, ist es extrem heiss. 38 Grad am Schatten.
Dreimal übernachten wir auf dem Weg in den Norden, einmal in der Gegend von Beaune bei Freunden, die dort ein Bauernhaus gekauft haben und nun ein „Table d’Hôtes“ betreiben, wo alle Gäste gemeinsam zu Abend essen, eine Einrichtung, die wir ganz erstklassig finden. Schon öfter haben wir an einem solchen Ort auf dem Weg nach Spanien logiert und sind nicht selten mit interessanten Leuten ins Gespräch gekommen.
Nach einem angenehmen Bad im Pool wird uns ein feines Nachtessen serviert und zum Dessert sozusagen beginnt es zu hageln, dass es kein Sagen hat. Innert Sekunden bedeckt ein dicker Teppich, weiss wie Schnee, die ganze Umgebung und alle flüchten ins Haus.
Der nächste Tag bringt einen extremen Wetterumschwung. Es ist nur noch knapp 20 Grad warm.
Nach dem Frühstück fahren wir los in nordwestlicher Richtung durch liebliche landwirtschaftliche Gebiete nach Avallon. Unterwegs kommen wir immer wieder an Feldern vorbei mit Strohballen. Sie sind eine Augenweide. Wie bei Breughel.
Avallon ist sehr hübsch. In der Nähe des Tour d’Horloge essen wir in einem charmanten Restaurant eine Kleinigkeit zu Mittag. Auch in Auxerre lohnt es sich, eine Zeitlang durch die schöne Altstadt zu schlendern. Beides sind Städte, die wir bis anhin überhaupt nicht kannten. Unsere nächste Unterkunft hatte ich in Fontenailles (20 km südwestlich) gebucht, auch wieder in einem Table d’Hôtes. – Diese befindet sich in einem munzigen Dörfchen am Ende der Welt. Auch hier übernachten wir in einem äusserst gepflegten Haus mit schöne Park, der „nie“ aufzuhören scheint und in endlose Felder übergeht. Zypressen, Lavendel, was in dieser Gegend so dazu gehört. Am Horizont ein paar Windräder. Leider können wir den Pool nicht benutzen, denn heute ladet die Temperatur überhaupt nicht mehr zum Bade. – Wir sind die einzigen Gäste und trotzdem wird uns vom Gastgeber ein absolut exquisites Menu zubereitet.
Am nächsten Morgen ist es nur noch 8 Grad „warm“, und das im Juli!
Nach einem ausgiebigen Frühstück fahren wir los in Richtung Orléans. Unterwegs machen wir einen äusserst lohnenswerten Abstechen nach Guédelon, wo eine mittelalterliche Burg mit den Mitteln der damaligen Zeit aufgebaut wird. Eine interessante Führung bringt uns das Geschehen und die Geschichte näher. Etwa zwei Stunden verbringen wir dort. So „verpassen“ wir Orléans, weil wir gleich weiterfahren zum „Château La Touanne“ in Baccon. Um vier sind wir dort und werden vom Schlossherrn freundlich begrüsst. Er erklärt uns alles und gibt Ratschläge für den nächsten Tag. An diese halten wir uns und besuchen nicht Orléans, sondern den kleinen Ort Beaugency. Das hübsche kleine Städtchen ist idyllisch gelegen an der Loire; es hat einen seltsamen viereckigen Turm, einen Glockenturm auch und schönen Fachwerkhäuser.
Welche der unzähligen Schlösser besuchen, wenn man an der Loire unterwegs ist? Auf zwei wollen wir uns beschränken. Diese Frage habe ich „unserem“ Schlossherrn auch gestellt und er riet uns, Château Chambord und Château Cherny zu besuchen. Chambord ist unglaublich eindrücklich mit seinen x Türmen und Kaminen – ein Märchenschloss schlechthin. Cheverny ist ganz anders, viel kleiner, aber ebenfalls sehenswert. Es ist der Palast, welcher Hergé als Vorlage für Kapitän Hadock’s Schloss bei „Tim und Struppi“ diente. Man kann einen Rundgang machen durch die Innengemächer. Auch die Tintin-Ausstellung hat uns gefallen.
Von da aus nehmen wir die Autobahn nach Le Mans. Inzwischen ist es wieder sehr heiss geworden, 29 Grad. Diesmal übernachten wir in einem hübschen B&B am Rande der Altstadt. Nach einer wohlverdienten Dusche gehen wir zu Fuss ins Zentrum. Eine lange steile Treppe führt durch die Stadtmauer hinauf zur Kathedrale. Im Tripadvisor habe ich mich über die Restaurants informiert. Nr. 1 ist: „La Baraque de Boef“. Wir haben Glück und finden grad die letzten zwei Plätze draussen, gegenüber dem Rathaus am Place de la Mairie. Essen vom Allerfeinsten. Die Vorspeise bereits: Theo hatte einen Camembert gefüllt mit Nüssen und Honig auf Toast, absolut Spitze, ich Tsatsiki vom Lachs. Dann aber die Pavé de Beouf Emincé. Mit einem Kartoffelstock nicht von dieser Welt. Himmlisch! Dorthin würde ich jederzeit wieder essen gehen.
Auf dem Spaziergang heimwärts bleiben wir erst vor der Kathedrale, dann vor der Stadtmauer sitzen und bewundern die fantasiereichen, farbigen Lichtspielereinen von „Son et Lumière“. Wie im November beim Bundeshaus. – Einfach schön!
Unterwegs nach Lancieux, unserem Ziel am folgenden Tag, besuchen wir Vitré, eine hübsche Stadt mit gut erhaltenem (nie eingenommenem) Schloss und schöner Altstadt, anschliessend Rennes.
Erster Haustausch in Lancieux
Nach einem „Gross“-Einkauf in Dinan kommen wir kurz nach sechs in Lancieux an. Catherine, unsere Haustauschpartnerin, zeigt uns das hübsche Haus, wo wir uns sicher wohl fühlen werden eine Woche lang. Ein Seemannshaus, gross und gemütlich mit gepflegtem Garten. – Auf der anderen Strassenseite eine alte Mühle wie in Holland.
Es ist schön und warm; wir fahren zum Nachtessen nach Dinard. Dort gibt’s Moules marinière mit Frites und Fish and Chips direkt am Strand – ein genussvoller Anfang unserer „sesshaften“ Ferien.
Das Wetter ist mehr oder weniger so, wie wir’s erwartet haben: manchmal regnerisch, eher kühl, eben Bretagne-Klima. Den Strand besuchen wir daher eher selten, dafür machen wir ein paar schöne Ausflüge in die Umgebung. Wir besuchen das hübsche Hafenstädtchen St-Cast-le-Guildo, Fort la Latte und Cap Fréhel (Côte d‘Emeraude). Wie’s im Führer steht: wilde Klippen, Blumen und Sträucher, Seevögel en masse. Typisch Bretagne – idyllisch, so wie’s angepriesen wird.
Sehr bald schon lernen wir, dass die Menschen, die in diesem Landesteil leben, sich in erster Linie als „Bretonen“ bezeichnen und sich auch so fühlen - und erst in zweiter Linie als Franzosen.
Finistère
Ein Zweitagesausflug führt uns an die Côte de Goëlo, an die Côte de Granit Rose und anschliessend ins „Landes“innere. Den ersten Halt machen wir in St. Brieuc, einem kleinen Städchen mit einer prächtigen Altstadt. Es gibt in dieser Gegend wohl gar keine anderen... Es ist Nationalfeiertag, der 14. Juli, und das erste Anzeichen dafür ist ein älterer Päpu, der eine offensichtlich schwere Fahne irgendwohin schleppt. Kurz darauf sehen wir auf einem Platz, dass sich dort eine ganze Menge älterer und weniger älterer Leute versammeln. Alle haben Fahnen mitgebracht. Da wird’s dann wohl abgehen später.
Wir fahren durch enge Landstrassen, weil Theo wieder mal in rasanter Fahrt die richtige Ausfahrt verpasst hat. Aber wir haben ja Zeit und auf den Nebenstrassen gibt’s sowieso mehr zu sehen. Fast in jedem auch noch so kleinen Dorf hat es einen Trödlermarkt. Und immer viele Besucher. Vor allem Einheimische nehme ich an.
An der Küste spazieren wir an der Promenade von St-Quai-Portrieux entlang. Dies ist ein hübsches Seebad mit grossen Hauptstrand. Die Temperatur ist mir zu kalt zum Baden, nur knapp 20 Grad (in der Schweiz 35 Grad); es ist bedeckt. Nur ein paar Verwegene suchen das Meer, das sich im Moment bei Ebbe ziemlich stark zurückgezogen hat. Wir fahren weiter nach Paimpol, das mich fast ein wenig an St. Tropez erinnert, das Hafenviertel zumindest, die zahllosen Restaurants, die vielen Leute. Aber Yachten hat’s keine mondänen, Schiffe beziehungsweise Boote schon eine ganze Menge.
Weiterfahrt zu den rosaroten Granitsteinen an der Côte de Granit Rose. Wir machen Fotos vom Lookout aus, Theo will nicht richtig nah ran. Zu viele Spaziergänger sind unterwegs für seinen Geschmack.
In Morlaix gibt’s den nächsten Halt zum Apéro. Auch hier finden wir eine besuchenswerte Altstadt mit Fachwerkhäusern, besonders zu erwähnen das Laternen-Haus von Königin Anne. Die geschnitzte Holztreppe im Innenhof ist einzigartig.
Unser Ziel heute ist Huelgoat. Unmöglich, den Namen auszusprechen. Wir übernachten in einem hübschen B&B, bei Suzie. (Double Locks). Es ist dort so etwas von englisch… Ein delikates Nachtessen gibt’s gleich nebenan mit Blick auf den See: „Le Mirabelle“. Ein älteres Ehepaar macht einen richtig guten Job dort. Sie serviert, er kocht. - Vom „Quatroze Juillet“ ist rein gar nichts zu sehen und zu hören. Seltsam! Das Feuerwerk hätte am Tag zuvor stattgefunden, liess man uns wissen.
Nach dem Frühstück machen wir eine kurze Wanderung entlang der riesigen Chempe, für die das Städtchen bekannt ist. Sie sind gewaltig, absolut beeindruckend! Die Legende besagt, dass ein Riese wütend war und sie herumgeworfen habe. Richtigerweise waren sie durch die Gletscher der Eiszeit dorthin transportiert worden. In der Umgebung steht auch ein Menhir – wir sind im Land von Asterix und Obelix angekommen.
Weiter geht die Reise in die „Mitte“ des Finistère, wo’s Christliches zu sehen gibt. Auch wenn wir dem nicht besonders angetan sind, sind wir doch beeindruckt von den Kalvarienbergen in St-Thégonnec und Guimiliau, von den Figuren, die aus dem frühen 17. Jahrhundert stammen. Die meisten sind gut erhalten und wenn man sie genau betrachten, entdeckt man so einiges…
Hier erhält Theo auch seinen lange gesuchten „Lambig“ (bretonischer Calvados) und bei einem Holzschnitzer finden wir eine umgekehrte Sirene, eine Meerjungfrau mit Fischkopf und Frauenunterkörper, die Theo unbedingt haben muss. Geld haben wir nicht mehr genug, die Karte kann der Künstler nicht akzeptieren, also fahren wir ins nahe gelegene Städtchen Landivisiau, wo wieder ein Markt stattfindet, ich natürlich wieder Verschiedenes finde und 500 Euro abheben kann. Zurück in Guimiliau werden wir 200 € los und sind stolze Besitzer der Holzsirene.
Einen Strandtag erleben wir doch noch gegen Ende der Woche. Mit dem Schwimmen im Meer ist es allerdings so eine Sache: Es ist Ebbe wieder mal, also weit weg und bis man sich wenigstens in knietiefem Wasser ein wenig abkühlen kann, muss man Dutzende von Metern weit wandern, vorbei an Booten, die im Sand stecken.
Gestern Abend hat Theo den Abfall-Container auf die Strasse gestellt. Er ist noch immer dort, obwohl man uns gesagt hat, er werde am Freitagmorgen sehr früh geleert. – Eine Nachbarin klärt dann auf: Es könnte sehr wohl sein, dass sie ihn erst am Samstag abholen kommen oder auch erst am Montag. Aber ganz sicher: sehr früh!
Erst sieht das Wetter gut aus, dann wieder ist es bedeckt. Im Fernsehen zeigt die Wetterkarte für ganz Frankreich schön, Paris 30 Grad, hier: einzige Region mit zum Teil sogar Regen… Wir bleiben im Garten uns lesen. Wenn die Sonne durch die Wolken bricht, ist es von einem Moment auf den anderen richtig heiss, aber schon kurz darauf beginnt es wieder zu regnen. Wir beschiessen trotzdem, etwas zu unternehmen und fahren nach Dinand. Ein Spaziergang über die Stadtmauer bietet fantastische Ausblicke über die Dächer der Altstadt und den Hafen.
Zurück zu Hause heisst es packen, denn am nächsten Tag beginnt unser zweiter Haustausch.
St. Malo
Der Weg dorthin ist nicht weit, es dauert nur eine knappe halbe Stunde. Hätte es gedauert, wenn Theo nicht schon wieder die richtige Ausfahrt verpasst hätte. Unbedingt musste er noch überholen und dann waren die Abstände zu klein…
An unserer Destination angekommen, treffen wir Sylvie und Jean-François, die uns in ihrem kleinen Ferien-Apartment, das uns vorzüglich passt und welches in Saint-Servan quasi vor den Toren der alten Stadt bestens gelegen ist, alles zeigen. Auch auf einem kurzen Spaziergang erhalten wir Hinweise, wo einzukaufen, wo essen und wie „Intra Muros“ zu gelangen. Der Strand ist 50 Meter von der Wohnung entfernt, Restaurants hat’s genügend in nächster Nähe und ins alte Zentrum von St-Malo zu spazieren, dauert etwa zwanzig Minuten.
Nach dieser Riesenanstrengung muss sich Theo natürlich ein wenig hinlegen und er fällt in einen zweistündigen Schlaf (Siesta nennt er das).
Später am Nachmittag machen wir uns auf, St-Malo auszukundschaften. Wir erreichen die Stadt durch die Porte St-Louis.
Touristen, so weit das Auge reicht. Aber eine gute Stimmung herrscht. Ein wenig Shopping muss sein. Zwei T-Shirts mehr besitze ich jetzt. Um sieben treibt uns der Hunger in ein Restaurant. „La Bisquine“. Gerade in dem Augenblick beginnt es zu regnen. Wir haben einen Fensterplatz im Wintergarten und es ist lustig, all den verregneten Gestalten zuzusehen, die auf der Suche nach einem Restaurant und/oder Obdach umherirren. Eine Art eigenartige Modeschau präsentiert sich uns. Einige tun, als wenn sie den Regen gar nichts anginge, andere versuchen, mit irgendwas (Prospekten, Kleidungsstücken) wenigstens die Frisur zu schützen. – Das Essen ist so so la la, es reisst uns nicht aus den Socken, aber wir verbringen trotzdem einen schönen Abend in unserer neuen Umgebung. Auf dem Nachhauseweg entlang des Ufers bietet sich uns ein atemberaubender Sonnenuntergang.
19. Juli (Kays Geburtstag) Normandie: D-Day-Ausflug
Das Wetter ist nicht eben wunderbar, es nieselt sogar ein bisschen. Ich kann Theo davon überzeugen, seinen Trip an die Invasionsstrände der Normandie heute zu „erledigen“, ein idealer Tag für diesen Ausflug. Wir fahren also gegen zehn Uhr los und sind etwa zwei Stunden später in Caen. Dort hat’s einen riesigen Markt, Theo setzt sich in ein Café und stellt die Exkursion anhand der Prospekte zusammen, die wir im Tourist Office erhalten haben. Ich schau mich auf dem Markt um. Er ist riesig, aber ich finde wirklich nichts zu kaufen. Theo schon. Eine Weste mehr zum Umhängen mit 1000 Taschen, in die er alles hineintun kann (Schlüssel, Brille, Pfeife, Tabak, Geld, Prospekte, e-Book), aber dann nichts mehr findet ausser zu einem späteren Zeitpunkt etwa verschiedene Münzen.
In Ouisteham am Sword Beach besuchen wir das Museum im „Grand Bunker“. Weiterfahrt der Küste entlang auf der D 514 durch eine Ortschaft an der andern. Alles D-Day-Schauplätze, jetzt Seebäder, wo’s massenhaft Autos und Touristen hat: Juno Beach, Gold Beach bis zum Omaha Beach. Inzwischen zeigt sich auch der Himmel teilweise blau und es ist angenehm warm. Theo besucht zwei Museen, das Omaha-Memorial Museum und ein weiteres in St-Laurent-sur-Mer. Ich geh in beide nicht hinein, sehe mir aber den Strand und die eindrücklichen Memorials dort an. Es ist so traurig, wenn man denkt, wie viele junge Männer da sterben mussten. Dieser schreckliche Krieg…
Den Tag lassen wir mit einem Rundgang in Point du Hoc ausklingen (Küste mit vielen Bunkern und Einschlaglöchern, wo jetzt zum Teil Schafe grasen). - Um halb elf sind wir daheim.
20. Juli (Geburtstag der Zwillinge)
Ich gehe eine Baghette einkaufen und die Zeitung Ouest France im kleinen Lädeli etwas weiter oben bei der Kirche. Es ist vollgestopft mit Waren und daher können kaum drei Personen gleichzeitig drin sein.
Nach dem Frühstück machen wir einen Spaziergang um die Halbinsel Cité d’Alet herum, an deren „Eingang“ wir in Saint-Servan wohnen. Ein Kreuzfahrtschiff hat inzwischen angelegt und das Meer ist „voll“. Es gibt viele Fotos, die Boote, die vor Anker liegen, stehen jetzt tatsächlich im Wasser. Fast gegen Ende unseres Erkundungs-Spaziergangs finden wir eine Bar (L’Atterrage), trinken dort Kaffee und haben endlich besten Internet-Empfang. – 101 WhatsApp-Meldungen kündigen sich an und jede Menge Emails.
Gestern hat mir Theo gestanden, dass er seinen ganzen Sack mit Hemden und Jacken nicht mehr hat. Er hat keine Ahnung, wo sich die Habe befindet. – Nun lese ich in der Email von Catherine, dass er den Sack in ihrem Haus in einen Schrank gehängt hat…
Ich habe bereits zuvor von diesem Missgeschick berichtet. Dass er immer Glück hat und in den meisten Fällen sein Eigentum, mit dem er so nachlässig umgeht, wieder zurückerhält, kommt einem kleinen Wunder gleich. So auch diesmal. Nur eine Stunde kostete ihn die Hin- und Zurückfahrt – ging halt von der Siestazeit ab – Strafe genug...
Um sieben Uhr treffen wir uns auf dem Bänkli vor dem Haus am Strand und schauen, wie’s jetzt ganz anders aussieht bei Ebbe: all die gestrandeten Schiffe und der ellenlange braune Strand. An Schwimmen ist nicht zu denken.
Am Abend des nächsten Tages treffen wir unsere Freunde Katharina und Hanspeter Intra Muros. Sie sind ebenfalls unterwegs in der Bretagne und wir haben abgemacht, dass wir uns in St. Malo treffen und die Woche in Jersey gemeinsam verbringen.
Wir gehen zusammen essen. Einen wahrlich spektakulären Sonnenuntergang sehen wir von der Mauer aus Richtung Fort und Petit Bé. Jetzt ist Flut und das grosse Wasserbecken, wo sich vor kurzen noch viele Schwimmer vergnügt haben, ist nicht mehr zu sehen. Es ist überschwemmt und nur noch der obere Teil des Sprungturms ist im Gegenlicht zu sehen. Das sieht sehr gut aus!
Auf dem Nachhauseweg können wir den Damm vorerst nicht überqueren, weil ein riesiges Frachtschiff durch den Kanal geschleust wird (Bahrein St. John’s). Es dauert etwa 20 Minuten, bis der Spektakel vorbei ist und die Brücke zurückgeschoben wird, so dass Autos und Fussgänger passieren können.
Am nächsten Mittag wollen wir nach Cancale fahren, aber die Strasse, die dorthin führt, ist von Traktoren versperrt. Die Bauern streiken.
Wir fahren stattdessen nach Rothéneuf, wo ein Einsiedlermönch, der Abbé Fouré, während 25 Jahren 300 Gesichter und Figuren in die Klippen am Meer eingemeisselt hat. Ganz spannend zu sehen - ein ruhiger und friedlicher Ort. Wir fahren weiter zur Pointe du Grouin, von wo aus man eine schöne Aussicht auf den Leuchtturm hat und von weitem den Mont St. Michel sehen kann, der sich wie eine Pyramide aus dem Dunst erhebt. Von dort aus entlang der Küste nach Cancale zu gelangen, ist dann kein Problem; es hat auf dieser Seite keine Sperren.
Im „Grain de Vanille“ (Marco-Polo-Tipp) essen wir die beiden letzten köstlichen Crèmeschnitten, also Millefeuilles, die noch übrig sind, bevor wir am Hafen von Cancale bei Ebbe die riesigen Austernfelder sehen. Günstig werden sie auf dem Markt angeboten, hunderte von Austern.
Auch am nächsten Tag macht das Wetter nicht eitel Freude: starker Wind, etwa 18 Grad, bewölkt.
An unserem zweitletzten Tag in dieser Gegend wollten wir den Mont St. Michel besuchen, aber das geht leider nicht, weil die Bauern noch immer streikten und mit ihren Traktoren die Zufahrtsstrassen versperrten. An unserem letzten Tag jedoch ist’s den Bauern wohl verleidet und wir können unser Vorhaben in die Tat umsetzen.
Das Wetter lässt zu wünschen übrig, wen wundert’s, aber so schlecht ist es doch nicht. Auf dem Mont gibt’s zweimal mitten aus dem Nichts eine halbminütige Riesen-Schütte, sehr komisch. Alle Besucher hasten ins Innere des Gebäudes. Zum Öffnen eines Schirms reicht es in keiner Weise. Es ist wie wenn jemand grad aufs Mal Riesenkübel voller Wasser ausschütten würde.
Der Hügel ist wirklich sehr beeindruckend, die Aussicht aufs Wattenmeer atemberaubend. Was für ein fantastischer Ort, um eine Kirche zu bauen. Das ganze Lädeli-Gschtürm, die Unmengen an kitschigen Souvenirs und die vielen Touristen, zu denen wir ja auch gehören, unvermeidlich. In der Kirche aber ist man oft allein und es herrscht Ruhe.
Nach der Besichtigung fahren wir zurück nach St. Malo, parkieren ausserhalb der Mauer und finden eine ganz nette Crêperie. –Natürlich fängt‘s grad wieder an zu regnen – in Strömen. Ein ganzer Männerchor hat sich vor dem Restaurant aufgestellt und grad, wie sie zu singen beginnen, regnet es wieder Bindfäden. Sie lassen sich jedoch nicht beirren, suchen kurz Unterschlupf und lassen dann erst recht los.
25. Juli, Samstag - Überfahrt nach Jersey
Aufstehen um 20 vor 6! – Packen und dann ab auf den Port du Naye zur Fähre. Um sieben sind wir dort, unsere Freunde ebenfalls, gleich im Auto neben uns. Um 10 vor acht fahren wir los. Es ist kühl aber schön.
Anderthalb Stunden später sind wir dort – eine Stunde Zeitverschiebung, für uns wär‘s 20 nach neun.
Unsere GPS-Dame führt uns nach Gorey und St. Martin, wo wir das Haus von Naomie und James Mews, unseren HomeExchange-Partnern gleich finden.
Sie sind sehr nett, zeigen uns alles und überlassen uns dann ihr Haus. Sie selber ziehen mit ihren beiden Söhnen nebenan ins Cottage.
Naomie hat uns Brot und Kuchen gebacken. Das essen wir gleich draussen im Garten. Das Wetter zeigt sich von der besten Seite; diese Gelegenheit muss man packen: Wir gehen gemeinsam an den Strand. Der Blick auf das Orgueil Castle, die Hafenpromenade und die Küste ist bezaubernd. Das Wetter hält, es hat aber immer wieder ein paar Wolken und dann wird’s grad empfindlich kühl. Ins Wasser gehen wir nicht und geben den Strandsonntag bald auf. Programmänderung in dem Fall: Ein Weingut könnten wir besuchen, also Fahrt der Nordküste entlang zum „Vinyard La Mare“, das zwar einladend aussieht, aber um sechs geschlossen ist. Dafür finden wir ganz in der Nähe einen Lookout, von wo aus man die zerklüftete Küste, das weite Meer, Frankreich im Hintergrund und den stahlblauen Himmel sieht.
An der Westküste hat’s riesige Strände. Wir möchten irgendwo etwas essen. „El Tico“ wurde uns empfohlen. Da hätten wir eine halbe Stunde auf einen freien Tisch warten müssen und es war sowieso sehr laut und eher eine Surfer-Bude. Ein weiteres Restaurant finden wir an der Küste, direkt am Meer. Garten ganz passabel mit schöner Sicht, aber um draussen zu essen ist’s bereits zu kalt und innen: Wer würde es für möglich halten: Keine Fenster mit Meerblick. Nicht zu fassen. Dabei ist „La Braye“ das einzige Haus weit und breit und das direkt am Strand gelegen…
Wir halten bei einem weiteren Pub an. Fast eine Stunde hätten wir dort warten müssen. Erfrierungsängste kommen auf. – Wir fahren weiter und finden das non plus ultra am Point de Corbière: Südwestspitze der Insel mit Klippen und Leuchtturm. Apéro draussen und feines Nachtessen drinnen. Perfekt! - Todmüde kommen wir nach halbstündiger Fahrt zu Hause an.
Die Insel ist 9 Meilen lang und 5 Meilen breit. Es dauert aber etwa 35 Minuten von einem „Ende“ zum anderen. Die Strassen sind extrem schmal, Kreuzen ist oft schwierig. Zudem sind sie total verschlängelt und verästelt, ein richtiges Chaos, schwer also, ohne Insiderkenntnisse oder GPS irgendwohin zu finden. Weil man zwischen hohen Hecken durchfahren muss, sieht man auch kaum je etwas vom der Gegend, was die Orientierung erheblich erschwert. Höchstgeschwindigkeit ist 40 Meilen pro Stunde. Und nicht selten lauert eine Polizeipatrouille um die Ecke mit einem Radargerät. - Auf einer ganz kurzen Strecke darf sogar 60 Meilen pro Stunde gefahren werden, das ist dann aber das allerhöchste der Gefühle. Was muss das für ein Frust sein für all die Leute, und das sind nicht wenige (die Bankgeschäfte blühen ja auf dieser Insel), die Luxuskarossen fahren, schnelle Porsches, BMWs und Mercedes, wenn sie deren Potenz gar nie ausleben können. Kein Wunder begegnen wir Dutzenden von denen nach der Überfahrt mit der Fähre auf französischem Boden. Dort stehen sie am Sonntagabend Schlange auf dem Weg nach Hause. Am Wochenende fahren sie offenbar ihre „Schlitten“ auf dem Kontinent und können dort zumindest ein wenig auf die Tube drücken.
An einem regnerischen Nachmittag besuchen wir das eindrückliche War-Tunnel-Museum. Die Geschichte der Kanalinseln im zweiten Weltkrieg ist eindrücklich dargestellt.
Es ist der 26. Juli, unser zweiundvierzigster Hochzeitstag. Das muss gefeiert werden, und zwar in St. Aubin im schönen „Old Court Inn“ am Hafen. Es nieselt zur Abwechslung wieder mal. Der viele Regen schlägt allmählich aufs Gemüt.
Trotzdem können wir ab und zu im Garten frühstücken, wenn sich die Sonne wieder mal zeigt. Gegen Ende der Woche erleben wir sogar noch einen Tag am Strand, an einem schönen Ort im Norden der Insel, der nur bei Ebbe zugänglich ist. Wie die Flut allmählich einsetzt, wird der Strand kleiner und kleiner, so packen wir zusammen und starten einen neuen Versuch im „La Mare Vineyard“, ein Gläschen zu trinken. Diesmal ist das Weingut offen, aber leider schmeckt uns allen der Wein nicht sehr. – Könnte es eventuell sein, dass die Trauben nicht genügend Sonne erhalten dort oben im Norden?
An diesem Abend haben wir mit unseren Gastgebern Naomie und James Mews abgemacht. Zusammen mit ihren beiden Buben spazieren wir nach Gorey und geniessen im Crab Shack ein schmackhaftes Nachtessen.
Leider müssen sich Katharina und Hanspeter bereits auf den Heimweg machen, für die beiden ruft die Arbeit. - Theo und ich, wir bleiben noch zwei Tage länger. Wir besuchen den schmalen Strand in Rozel, den kleinen Markt in St. Aubin und machen einen Spaziergang durch den hübschen Hauptort St. Hélier. Zur Abwechslung scheint die Sonne und das macht einen gewaltigen Unterschied.
Ein letztes Nachtessen in Gory im Crab Shack und ein fantastischer nächtlicher Spaziergang zurück ins Haus, wo ein riesiger orangefarbiger Mond tief unten am Himmel hängt und das Schloss ganz fahl beleuchtet, beenden unseren Aufenthalt auf der pittoresken Kanalinsel.
Zurück auf dem Kontinent
Am Sonntag, 2. August, sind wir zurück in St. Malo. Wunderbar warm ist es heute: 29 Grad.
Unterwegs besichtigen wir die schönen Altstadthäuser in Rennes und fahren dann weiter Richtung magischer Wald, le Forêt Brocéliande. In Iffendic habe ich ein B&B gebucht. Es ist super gut und originell und wir freuen uns über den Pool. Dort liegen und entspannen ist das Einzige, was wir noch tun mögen. Nachtessen im 15 km entfernten Les Fourges de Paimpont (Jadghaus).
Tags darauf fahren wir durch den Wald nach Paimpoint. Porte de Secret, Abbaye de Paimpoint, weiter dann nach Tréhorenteuc ins „Val sans Retour“, wo wir nach einem wunderbaren einstündigen Spaziergang (Arbre d‘Ore und Miroir aux Fées), den Weg „retour“ zum Glück doch noch finden. Von dort geht’s weiter nach Monteneuf, wo eine eindrückliche Megalithen Sammlung zu sehen ist (Les Menhirs de Monteneuf). Dass es hier fast keine Touristen hat, kann ich kaum glauben. Die Steinblöcke sind äusserst imposant und es hat haufenweise davon in dieser Umgebung.
Auf den Heimweg in La Gacilly (Yves Rocher), wo eine tolle Fotoausstellung stattfindet, halten wir an und schauen uns um. Touristen hat’s en masse, aber das ist kein Wunder. Das Dorf ist ein Bijou: überall geschmückt mit Blumen, zahlreiche Art Ateliers hat’s an jeder Ecke und gemütliche Bistros, guter Stimmung herrscht – ein wunderbarer Stopp.
Saint-Etienne de Montluc
Hier befindet sich unsere neue HomeExchange-Unterkunft, die zweitletzte. Wir finden ein schönes, teilweise renoviertes Bauernhaus vor, mitten in ländlichem Gebiet mit riesigem Garten. Es gefällt uns auf Anhieb.
Der nächste Tag ist dem Ausruhen gewidmet. Das braucht Theo! Sagt er.- Der einzige „Ausflug“ ist derjenige zum Supermarkt, wo wir Verpflegung für die nächste Zeit einkaufen müssen. Ein gemütliches Nachtessen im Garten beschliesst diesen Teil der Reise.
Jetzt ist aber genug geruht! – Am nächsten Tag steht Menhir-Besichtigung in Carnac auf dem Programm. – Schon gegen acht Uhr morgens fahren wir los ins Morbihan.
Erst mit einem kleinen Zug, der die Touristen durchs ganze „steinige“ Gebiet führt, anschliessend mit dem eigenen Auto und auch zu Fuss, lassen wir uns von der riesigen Menge der Steinkolosse beeindrucken.
In Locmariaquer hat’s noch mehr Steineblöcke, der grösste liegt umgefallen auf dem Boden. Den sogenannten „Table du Marchand“ und etliche weitere Dolmen kann man ebenfalls besichtigen - schlicht überwältigend die riesigen Ausmasse!
Auf dem Weg zurück machen wir Halt in Auray. Der Spaziergang durch die hübsche Altstadt lohnt sich für Theo sehr. Eine Frau, die in der Fussgängerzone vor ihrem Nähatelier den Passanten ihre Nähmaschine vorführt, flickt ihm sein Gilet Nummer eins, was ich schon längst hätte tun sollen, aber entweder nicht das richtige Werkzeug dafür hatte oder es mir einfach an mangelnder Lust dazu fehlte.
Erst abends um acht sind wir zurück in Saint-Etienne de Montluc. Die Sonne scheint noch immer. Theo isst draussen irgendwas Seltsames (Spaghetti 1,5 Minuten); ich mag nichts mehr, lese nur noch ein bisschen im Liegestuhl und plane die nächsten Tage.
Es ist schön und warm. Heute geht’s an die Loire. Um halb zehn geht’s los. Dem Château de Montreuil-Bellay gilt unser erster Besuch. Das zweite ist das Château de Brézé. Was für ein Gebäude! Ein Schloss unter einem Schloss, eine riesige unterirdische Festung und der höchste Schlossgraben (28 Meter) in Frankreich. Mehr als nur eindrücklich. Es ist sehr heiss; die Besichtigung der Keller-und Festungsanlagen dort unten ist eine Wohltat.
Weiter nach Saumur und anschliessend Angers. Die Schlösser dort besichtigen wir nur noch von aussen. Beide Städte haben sehr schöne Altstadtbauten. Crêpe essen, Apéro trinken und gegen halb acht Uhr heimwärts.
Am folgenden Tag besichtigen wir Nantes. Auch diese Stadt gefällt uns sehr. Vor allem der elektrische Elefant auf der Ile de Nantes. – Nachtessen im „La Cigale“. Wir genissen es, draussen sitzen zu können.
Nun ist aber wieder ein Theo-Schlaftag vonnöten. Nicht nur schlafen natürlich kann es sein. Nein, er hat noch eine andere Aktivität in Angriff genommen: Beim Hantieren mit seinen Fotos auf seinem i-Phone hat er es fertig gebracht, sie alle zu löschen. Von Jersey bis gestern Abend. ???!!!
St. Nazaire
Am Sonntag, dem 9. August, erreichen wir am Nachmittag unsere letzte Destination, wo wir eine knappe Woche lang bleiben werden: St. Nazaire.
Diesmal ist es eine 4-Zimmer-Wohnung mit schöner Aussicht auf die Hafenanlage. - Heute ist es heiss, um die 30 Grad. Ab an den Strand, der sich grad vor der Haustür befindet. Auch am nächsten Tag ist es uns an der Plage am wohlsten. Diesmal am 8 Kilometer langen Sandstrand in Le Baule. Wieder mal ein Moules-Menu gibt’s später in Le Croisic.
An einem der weniger schönen Tage besuchen wir den Markt in St. Nazaire, die überdimensionierte Hafenanlage, welche die Nazis ausgebaut hatten. Gut gefallen haben uns auch unsere Ausflüge nach Guérland ins Salzland und nach Batz sur Mer, wo’s einen Turm hat, von dem aus man einen tollen Blick über das Städtchen und den Marché nocturne hat.
Eine zweitägige Kurzreise bringt uns nach Vannes, eine weitere wunderbare Stadt, dann nach Pont Aven, Pointe de Trévignon und Raguénez Plage. Wir übernachten in Forêt Fuesnant im „Manouir du Stang“, einem reizenden kleinen Schloss.
Ein leckeres Fisch-Menu in Vieux Port im „Café du Port“ beschliesst diesen schönen Tag.
Weiter geht’s am folgenden Morgen über Quimper nach Pont Croix (schöne Kirche in dem kleinen Dorf). Gut, dass ein Markt stattfindet, denn ein Schirm-Kauf drängt sich auf. Es regnet und ist neblig.
Die Pointe du Raz, den westlichsten Punkt Frankreichs, wollen wir heute besuchen. Erst sieht man von der Küste und dem Felsen gar nichts, dichte Nebelschwaden verhindern die Sicht (in ganz Frankreich ausser gerade in der Bretagne herrscht schönes und sonniges Wetter...). Wie wir auf den Klippen herumklettern, Theo in seinen „Discoschleifern“ – er hätte auch seine Regenjacke nicht mitgenommen, wenn ich nicht drauf bestanden hätte, löst sich der Nebel und man sieht zumindest teilweise, wie die Gegend aussieht.
Auf der Rückfahrt wollen wir in Quimper Halt machen. Das geht aber nicht, denn wir finden keinen Parkplatz. Wegen eines Festes ist es überall gesperrt und es herrscht ein riesiges Chaos, man steht im Stau, alle suchen Parkplätze, die aber ausnahmslos gesperrt sind. Wir entschliessen uns daher, nach Concarneau weiterzufahren.
Auch dort ist’s schwierig zu parkieren, weil ebenfalls Festivitäten stattfinden: das Fête des Bleus. Endlich gelingt es. So viele Touris wie hier haben wir auf unserer Reise noch nirgends gesehen. Vor allem in der Ville Close, wo wir einen Rundgang auf der Stadtmauer machen, kommt es uns vor wie in Bern am Ziebelemärit. Wieso hier so viele Touristen herumschwärmen - der Grund dafür ist Jean-Luc Bannalec, der mit seinen Büchern verschiedene Ort in der Bretagne bekanntgemacht hat, so dass nun alle auf seinen Spuren dieselben Köstlichkeiten versuchen wollen wie sein Kommissar Dupin. Wir ja auch, hatten uns den Andrang aber nicht in dieser Art vorgestellt. Im „L’Admiral“, Dupins Stammlokal, versuchen wir einen Tisch zu reservieren, das hätten wir aber schon viel vorher tun müssen. Seit Tagen ausgebucht. – Nur gerade ein Apéro wurde uns gewährt.
Zweistündige Heimfahrt nach St. Nazair, wo wir um halb zehn noch eine Brasserie finden, die offen hat. Eine ganze Stunde lang warten wir aufs Essen. Wenigstens hat sich das Ausharren gelohnt. Sie sind gut, die Elsässer-Spezialitäten, auch kurz vor Mitternacht. Theo isst Sauerkraut und ich Flammenküch.
An unserem letzten Tag sind wir bei Anne-Gaëlles Eltern in 222 Kerbourg, Saint-Lyphard, mitten im Parc de Brière zu einem Apéro eingeladen. Mit Anne haben wir den Haustausch vereinbart. Wie und wo die Eltern wohnen, ist einzigartig. Es sieht aus wie in Südengland, überall aus Beste gepflegte Cottages mit Strohdächern. In einem solchen werden wir empfangen, werden reichlich verwöhnt und dürfen das ganze Haus besichtigen. Und der Weg dorthin und zurück durch die Gegend, wo das wunderbare Salz gewonnen wird, ist ebenfalls eindrucksvoll. Am Menhir de Kerbourg kommen wir vorbei, ein weiterer Steingigant, der einfach so in der Landschaft steht.
Nochmal Nantes auf dem Nachhauseweg
Auf dem Weg zurück in die Schweiz möchte ich noch einmal in Nantes anhalten.
Gerne wäre ich der Aussicht wegen auf den LU-Turm gestiegen, aber dieser ist leider das ganze Jahr geschlossen, was im Internet nicht vermerkt war. Aber es gibt noch mehr zu sehen in Nantes: Der „Grüne Weg“, eine Ausstellung, die grad zu der Zeit stattfindet (Le voyage à Nantes). Teile davon haben wir schon bei unserem letzten Besuch vor ein paar Tagen gesehen. Originell und einzigartig. Auch am Place du Buffay gibt‘s eine total lustige Installation mit farbigen Gartenstühlen zu bestaunen, die zum grünen Weg gehört. Dort nehmen wir „un petit café“ und fahren dann weiter Richtung Tour.
Unterwegs von der Autobahn zweigen wir ab zum Château Ussée. Ganze Trauben von Besuchern stehen an der Kasse an, wir verzichten und besichtigen es nur von aussen. Weiter geht die Fahrt nach Tours, aber eine Stadtbesichtigung lassen wir ebenfalls aus (von der Schlacht, die 732 stattgefunden hat, sehen wir wohl keine Blutspuren oder zerbrochene Speere mehr). Um halb sechs kommen wir in Orléans an, wo ich ein Hotel gebucht habe. Hotel Marguerite, zweckmässig, komfortabel, ein schönes Zimmer und sogar ruhig in der Nacht. Dazu kommt, es ist absolut gut gelegen, direkt am Eingang zur Altstadt und hat eine Tiefgarage, die ausnahmsweise mal nicht so eng ist wie sonst üblich, sondern viel Platz hat und hell ist. Und das für nur 3 € pro Tag.
Wir unternehmen einen langen Spaziergang durch die schöne Altstadt, die voller Leben ist. Draussen sitzen und den letzten Abend in Frankreich geniessen, das haben wir im Sinn.
Aber drei Restaurants, die ich im Tripadvisor ausgesucht habe, sind zu (Ferien), bei fünf weiteren hätte man reservierten müssen. Endlich finden wir die letzten beiden Plätze im „Un Faim en Soi“. Wir haben keine grossen Erwartungen, aber das Essen ist ausgezeichnet.
Wir schlafen herrlich aus und fahren nach dem Frühstück die restlichen sieben Stunden zurück nach Hause in Ittigen. Es ist Sonntag, der 16. August 2015.
Zwei Monate lang haben wir nun Zeit, den letzten Teil des Sommers in Bern zu verbringen, die Koffer neu zu packen und uns auf die bevorstehende Reise vorzubereiten.

Reisebericht San Francisco – Hawaii – Florida
San Francisco
Pünktlich um Viertel nach vier, nach einem eindrücklichen Flug über das weite Meer, über Grönland, Kanada und über die Rocky Mountains, landet unser Flugzeug in San Francisco. Es dauert eine Stunde, bis wir durch den Zoll sind. Lee holt uns ab und sogleich fühlen wir uns wieder daheim im schönen Haus der Langans an der California Street, wo wir sieben Tag lang bleiben werden.
Währen dieser Zeit suchen wir viele Orte auf in der Stadt, wo wir schon waren, Fisherman’s Warf am Pier 39 zum Beispiel, unternehmen eine Bootsrundfahrt unter der Golden Gate Bridge durch und rund um die ehemalige Gefängnisinsel Alcatraz, gehen zu Fuss die Lombardstreet rauf und runter (cruckedest Street in the world) und verzichten auch nicht auf einen Einkaufsbummel in der Unionstreet und in Chinatown. Aber auch neue Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel das Science Museum im Golden Gate Park (Regenwald-Komplex mit vielen exotischen Pflanzen und Schmetterlingen) besuchen wir und natürlich das De Young Museum von Herzog-De Meron, von dessen Turm aus man einen herrlichen Blick auf die SF-Halbinsel hat.
Mit unseren Freunden essen wir jeden Abend in einem anderen Restaurant. Ich will nicht, dass Karine für uns kochen muss, wenn wir schon zum x-ten Mal bei ihnen wohnen dürfen, deshalb laden wir sie jeweils gerne ein. Es gibt ja das chinesische Sprichwort, das etwa so lautet: „Fische und Gäste stinken nach drei Tagen“ und wir bleiben ja mehr als doppelt so lang.
Erwähnenswert in diesen Zusammenhang sind die Restaurants „SPQR“ (teuer, aber jedes Gericht ist kreativ angerichtet und ausserordentlich schmackhaft), „Joe’s“ am Washington Square, wo wir draussen essen (wunderbare Burger, riesengross).
Eine Show am North Point sehen wir uns an: „Babylon” (super unterhaltsam – selten so gelacht).
An einem Abend jedoch laden die Langens uns ein: zu einem Vortrag über Kartographie im Explorer Club, in dem Lee im Vorstand ist. Nach dem Buffet-Dinner (Der Koch hat eine Mutter aus der welschen Schweiz; er spricht gut Französisch) hören wir und ungefähr weitere 50 Besucher mit grossem Interesse einem interessanten Vortrag zu, der mit einer Karte über Zermatt beginnt, die als exemplarisches Vorbild gilt. Dann wird uns im Gegensatz dazu amerikanisches Kartenmaterial gezeigt, in dem ein absolutes Chaos herrscht, Orts-, Flur-, Fluss- und Städtenamen sind in jeder Richtung geschrieben, und das in unterschiedlicher Schriftart und -grösse. Ausrichtung nach Norden eher selten.
Ein für uns völlig neues Erlebnis ist an einem Abend unser Ausflug nach Stanford, wo wir erst den Campus besuchen, wo Lee früher studiert hat, ein wenig im riesigen Bookshop stöbern, dann bei einem der Stände ein grosses BLT Sandwich essen, damit wir nicht mit leerem Magen den eigentlichen Spektakel, für den wir hergekommen sind, anschauen müssen, nämlich den Football-Match Stanford-Washington, der um halb acht beginnt. Es hat 60‘000 Zuschauer und ist eine Riesenshow. Stanford gewinnt 34:14. Eine tolle Stimmung herrscht und obwohl Lee geduldig versucht hat, uns die Regeln beizubringen, begreifen wir kaum, worum es geht und weshalb wann und wieso gejubelt oder gepfiffen wird. Aber Hauptsache, Stanford hat gewonnen.
An einem anderen Tag kommt Oliver, der jüngste Sohn der Langans, den ich erstmals vor 39 Jahren kennengelernt habe, als er sechs-jährig war, mit seiner chinesischen Frau Snow, den beiden Söhnen Teo und Filas und Snows Verwandten zu Besuch. Er ist dabei, Snows Eltern und ihre Tante auf den Flugplatz zu bringen, die fast zwei Monate lang bei der jungen Familie gewohnt haben. Snow scheint froh zu sein, ihre Gäste „los“ zu werden, denn sie klagt, alle drei verstünden kein Wort Englisch und könnten nicht Autofahren. So war sie ständig Chauffeuse, Übersetzerin, Köchin und Unterhalterin.
Wir dürfen Karines Auto für einen zweitägigen Ausflug brauchen und fahren der herrlichen Küste entlang nach Monterey, wo wir in der Stage Coach Lodge übernachten. Einen halben Tag lang verbringen wir im grossartigen Monterey Bay Aquarium. Es ist wunderbar, die Fischschwärme, die Quallen, die Kraken und all die anderen Meerestiere zu beobachten.
Auf dem Heimweg machen wir in Cupertino Halt, wo wir Oliver treffen, der am Apple-Hauptsitz arbeitet. Er lädt uns ein, mit ihm in der riesigen Kantine (Infinite Loop) zu Abend zu essen.
An unserem letzten Tag in SF besuchen wir wiedermal das Exploratorium, das inzwischen an den Pier 15 umgezogen ist. Es ist immer wieder einen Besuch wert. Stundenlang könnte man drin verbringen. Das tun wir auch, einen ganzen Nachmittag lang. Begeisternd, interessant, lehrreich, erstaunlich, aber auch ermüdend.
Am Abend gehen wir mit Karine und Lee in einem mexikanisches Quartierrestaurant essen, dem „Tia Margarita“. Ja, und die Margaritas sind köstlich, die Burritos wie Babyoberarme so gross. Ich liebe die Tamales und Flautas.
Oahu - Honolulu
Am Mittwoch, dem 28. Oktober, bringt uns Lee auf den Flughafen und fünf Stunden später kommen wir auf der Insel Oahu an. Wir nehmen unser Mietauto in Empfang; ein kleiner weisser Nissan ist es diesmal. Mein Navi führt uns in die Berge. Das dauert nur kurz, eine Fahrt von circa zwanzig Minuten, aber dass hier eine ganz andere Klimazone herrscht, ist eindeutig. Es ist warm und feucht. Die Strecke führt steil den Hang hinauf zum Haus, wo wir zehn Tage lang wohnen werden.
Sue erwartet uns. Sie stammt ursprünglich aus Vietnam, ist fünfzig, sieht aber aus wie dreissig. Sie hat unseren Kühlschrank völlig vollgefüllt, wir brauchen so gut wie gar nichts mehr einzukaufen. Zum Nachtessen sind wir eingeladen und verbringen einen sehr netten Abend mit unseren neuen Gastgebern Sue und Greg Hansen und ihrem elfjährigen Sohn Jacob. Die beiden sind unendlich gastfreundlich. Uns kommt es vor, als wären wir schon seit Jahren befreundet.
Wir wohnen im Parterre ihres Hauses, haben eine elegante Wohnung mit riesiger Küche für uns allein, die wir dann aber kaum je brauchen, weil Sue uns ständig bekocht oder uns leckere Speisen bringt. Auch den grossen, gepflegten Garten dürfen wir benutzen.
Unsere ersten Unternehmungen in der näheren Umgebung führen uns zum Pali Lookout (einer der 10 Sterne im Marco Polo Reiseführer), von wo aus man einen spektakulären Blick auf die nördliche Seite der Insel hat. – Die Krieger, die dort der Geschichte oder der Legende nach von ihren Feinden über die hohen Felsen in den sicheren Tod gestürzt wurden, hatten vermutlich andere Probleme, als sich die Schönheit der Gegend anzusehen. – In Kailua geniessen wir das Strandleben und besuchen den fröhlichen Markt, wo’s allerlei zu kaufen gibt, vor allem wunderbare Leckerbissen aus aller Herren Länder.
Die verschiedenen Surfer-Strände lernen wir im Norden der Insel kennen: den Sunside Beach, den Bonzai Beach. Stundenlang schauen wir den unerschrockenen Surfern zu. Unglaublich, wie diese mit grossem Geschick in und auf den Wellen reiten. Am Pipeline Beach ist grad ein Wettkampf im Gange, an dem nur die besten teilnehmen.
Unterwegs gibt’s viele leckere Dinge zu probieren: zum Beispiel Shave-Ice in Kahuku-Sugercane, und die weltbesten Coconut-Shrimps in Wahi.
In der Nacht regnet es so stark, dass ich im Schlummern denke, wenn ich rausgehen würde, würde es mich grad in Scheiben trennen.
Wir stehen um acht schon auf. Nach einem feinen Frühstück, das Sue uns bringt (Papaya mit Lime und Bananen), fahren wir an den Strand mit Greg. So wie man sich das vorstellt: ein Riesen-Pick-Up mit Surfbrettern oben drauf. Theo möchte versuchen, SUP (Stand-up-paddle) zu üben. Greg gibt ihm die ersten Anweisungen. Wie wir uns am Strand einrichten (ich auf einem Klappsessel schaue lieber nur zu) und die beiden losgehen (Theo steht schon mal auf auf dem Board) beginnt es wie aus Kübeln zu regnen. Ich kann mich fast nicht halten vor Lachen. Es ist soo komisch! Die Übung muss abgebrochen werden, wir fliehen zurück ins Auto, platschnass ist ausnahmslos alles. Ich habe Angst, dass meine Kamera das Zeitliche gesegnet hat. Wir sitzen im Auto, völlig durchnässt und sandig und Greg sagt, er habe seit Jahren keinen solchen Regen mehr erlebt und sein Freund Alan, der ihm für den Morgen eine günstige Wettervorhersage gemacht hatte, solle sich vielleicht lieber nicht als Wetterfrosch bewerben.
Nach etwa zwanzig Minuten stoppt der Regen plötzlich, wir gehen zurück an den Strand, es wird richtig heiss, die beiden Männer setzen ihre sportlichen Tätigkeiten fort. – Ich bin mehr als nur erstaunt, dass mein völlig unsportlicher Ehemann die Sache recht gut begreift und mit Greg in Richtung Waikiki davonpaddelt.
Eine gute halbe Stunde später kommen die beiden zurück. Theo, der Held, völlig erledigt.
Time for lunch. Wir fahren in ein chinesisches Einkaufzentrum mit Restaurant „Nice Day“, wo wir Sue treffen zu einer exquisiten Dim Sum-Mahlzeit mitten in mindestens hundert Asiaten - wir drei die einzigen Weissen beziehungsweise Nicht-Asiaten.
Zu Hause ist dann Zeit für Siesta. Muss ja sein! - Aber am späten Nachmittag brechen wir wieder auf nach Waikiki, wo wir grad noch den Sonnenuntergang miterlebten. Halloween! Es ist wie bei uns am Ziebelemärit, ohne Kälte und Käsekuchen zwar. Es herrscht eine ausgesprochen lockere, fröhliche Stimmung – ein Riesenfest. Ich mache zig Fotos von all den wunderbar originell verkleideten Menschen, gross und klein, die so viel Spass haben und sich gerne zur Schau stellen. Schwierig ist, irgendwo einen Drink zu kriegen, alle Bars und Restaurants sind übervoll. Dies gelingt dann doch noch und wir freuen uns über eine überdimensionale Margarita. Grad, wie wir gegen zehn ins Auto steigen, beginnt es wieder leicht zu regnen.
Essen mögen wir nichts mehr daheim, denn Sue hat uns, grad bevor wir gingen, einen Teller voll Fleisch Teriaki und gegrillte Ananas-Würste gebracht – mehr als nur eine volle Mahlzeit. Sie verwöhnt uns nach Noten! (Im Restaurant gelang es mir auch nicht zu zahlen…)
Ich lese im Internet, welche Auswirkungen Halloween in der Schweiz zum Teil hatte. Vandalismus wieder mal… Und überhaupt, wieso man auf Biegen und Brechen seit wenigen Jahren auch bei uns versucht, dieses Fest, mit dem wir so gar keine Geschichte und auch sonst nichts gemeinsam haben, zu lancieren, will mir auch nicht in den Kopf. Ich vermute stark, es geht um Kommerz. Ob’s damit klappt auch in Zukunft? Wer weiss? – Im Migros werden all die dümmlichen „Zutaten“ anschliessend zum Viertelpreis angeboten.
Ganz anders ist das in den Staaten: Dort gehört der Brauch hin und man kann sich kaum satt sehen an den grusligen aber lustigen Dekorationen überall: Hauseingänge und Fenster sind schon im Vorfeld überspannt mit Spinnennetzen, Riesenspinnen hängen an den Wänden und Mauern, Skelette bevölkern die Gärten - fast wie mit den Weihnachtsdekos. Jeder versucht den Nachbarn zu übertreffen. Schon in SF konnten wir uns in der vorigen Woche daran erfreuen.
Am Sonntag, dem 1. November, schlafen wir lange aus. Greg bringt uns zum Frühstück ein von Sue selber hergestelltes Mango-Smoothie. Sie kann’s nicht lassen, uns zu verwöhnen.
Hansens nehmen uns mit in ihren Club, wo’s einen privaten Strand hat zum Schwimmen und Sonnenbaden. Ich geh ins Wasser, aber bald auch wieder raus, denn der Lifeguard sagt, man habe einen drei-Meter langen Hai gesichtet. Dem sein Nachtessen möchte ich lieber nicht sein. Da gehen wir dann anschliessend lieber zum Pick-Nick im Park mit Hansens Freunden. Es ist eine Vorfeier für Rob’s kleines Töchterchen (erster Geburtstag), das er zusammen mit seiner „neuen“ Frau Jane hat. Sie ist 30, Kambodschanerin, und er 63, lebt seit Jahren in Hawaii, hat sich mit 35 pensionieren lassen, denn er verkaufte sein Business für etliche Millionen und musste dann nicht mehr arbeiten. Er besass alle US-Payphones. Kein schlechter Deal, finden wir. Vor allem, weil fünf Jahre später niemand mehr eines brauchte… Jetzt unterhält er Schulen in Kambodscha.
Regen wieder mal am nächsten Tag. Das stört uns gar nicht mal so sehr. Wir erledigen Emails, machen Zahlungen und gehen dann downtown Honolulu ins Art State Museum, das uns ausserordentlich gut gefällt und machen eine kleine Stadtbesichtigung.
Ein Ausflug in Richtung süd-osten entlang der Küstenstrasse führt uns anderntags zur Hanauma Bay Nature Preserve – ein Krater eigentlich. Die Bucht sieht fast aus wie die Wineglass-Bay in Tasmanien – wie mit dem Zirkel geformt, ein Strand vom Schönsten, umgeben von Palmen - wie aus dem Ferien-Prospekt. - Hier im Hintergrund der Koko Crater. Sue und Greg haben uns mit Schnorchel-Ausrüstung ausstaffiert. Wir sehen die farbigsten Fische schon nur wenige Meter vom Ufer entfernt.
Zu Hause bringt uns Sue eine selber gemachte Suppe und zwei feine Margaritas.
Am 4. November ist Ginos Geburtstag. Wir telefonieren mit ihm. Zu Hause läuft alles bestens. Das ist immer gut zu wissen.
Rund ums Aloha-Stadium besuchen wir einen riesigen Flohmarkt. Er scheint kein Ende zu nehmen. Ums ganze Stadium herum sind die Stände verteilt. Die meisten verkaufen allerdings das Gleiche: farbige Hawaii-Klamotten.
Unterwegs gibt’s beim Pagoden-Friedhof einen Lookout. Den lass ich mir nicht entgehen. - Was für wunderbare Aussicht vielerorts die Toten doch haben. Auch in unserem Heimatort Soglio ist das zum Beispiel so.
Nächste Station: Pearl Harbour. Theo macht eine zweistündige Tour mit; ich schaue mich ein wenig um, lege mich irgendwo in den Rasen und lese ein bisschen in meinem E-Books (Adler Olsen).
Zuhause, kaum ausgestiegen, fragt Sue, ob wir Spaghetti wollen. So kommen wir schon wieder zu einer feinen Mahlzeit ohne dass wir selber kochen müssen.
Es regnet in Strömen am folgenden Tag. Theo bleibt zu Hause, ich fahre mit Sue zum Shopping in den Supermarkt Costco. Wer eine Kleinigkeit kaufen möchte, ist dort fehl am Platz. Nur palettweise kann man einkaufen, die Waren sind bis zur hohen Decke hoch gestapelt. Dem Teddybär beim Eingang reiche ich bis zur Hüfte. Unser Abendessen kaufen wir lieber in Restaurant ein; Laulau kann man dort portionenweise beziehen.
Mitten am Nachmittag machen wir uns auf zum Diamond Head. Bei uns in den Bergen regnet’s zwar noch immer heftig, aber an der Küste ist’s klar. Bald kommen wir mitten im Krater auf dem Parkplatz an. Der Aufstieg beginnt. Weil wir relativ spät dran sind, hat’s nicht so viele Leute, was eine Wohltat ist, denn der Weg ist schmal und steil. Auch ist es nicht extrem heiss; es weht immer wieder ein Wind, der Abkühlung bringt. – Über den Bergen bilden sich immer wieder neue Regenbogen. Die Lookouts unterwegs sind atemberaubend und erst recht der Blick zuoberst vom Kraterrand aus auf Waikiki, Honolulu und die Berge. Der Abstieg dauert etwa eine halbe Stunde, dann fahren wir zur Diamond Head Küstenstrasse und gehen dem Sonnenuntergang entgegen bis zum Leuchtturm. Es wimmelt nur so von Surfern.
Auch der nächste ist ein schöner Tag. Wie immer hat’s in der Nacht geregnet und am Morgen werden wir wie üblich geweckt von wohl stets demselben „crazy“ Bird, der seinen Kopf an unserer Fensterscheibe schlägt, weil er sich vermutlich durch das spiegelnde Glas angezogen fühlt… Mein Versuch, das Fenster mit Karton abzudecken, hat allerdings nichts gebracht. Der Vogel muss einen harten, aber unbelehrbaren Schädel haben.
Nach dem Frühstück (Sue bringt wieder das herrliche Smoothie) fahren wir auf den Friedhof im Punchbowl-Crater und geniessen die herrliche Aussicht rings um den Kraterrand. Es ist sehr heiss. Weiter geht der Ausflug anschliessend entlang des Tantalits Drive und Round Top Drive fast 500 Meter durch den Jungel bergauf und immer wieder hat’s zwischendurch die schönsten Lookouts auf die Stadt, das Meer und die Berge.
Unser nächstes Ziel ist Waikiki. Theo möchte gerne dort mal am Strand liegen – ein Muss schliesslich, wenn man schon da ist. Das tun wir dann während fast drei Stunden. Um sechs geht Theo für drei weitere Stunden die Parkuhr füttern und wir nehmen eine Piña Colada in der überfüllten Duke’s Bar vom Outrigger Hotel.
Etwa 500 Meter weiter am Strand gibt’s um Viertel vor acht ein Feuerwerk zu bestaunen und zu Hause, wen wundert’s – ich wollte eigentlich nichts mehr essen – bringt Sue eine Platte voller exquisiter chinesischer Köstlichkeiten.
Dies ist unser letzter Tag hier. Traurig, traurig! Wir schlafen aus und packen. Zu beeilen brauchen wir uns nicht. Unser nächster HomeExchange ist nur ein paar Kilometer weit weg auf der anderen Seite der Berge an der nördlichen Küste der Insel. Sue und Greg schlagen vor, den Nachmittag im Kino zu verbringen, denn es regnet seit Stunden in Strömen. Das ist ein guter Plan. Lustig finde ich, dass im Kino offenbar auch sogenannte „Crybaby-Matinées“ angeboten werden. Das sind Vorstellungen, die speziell für Mütter (vielleicht auf für Väter) gedacht sind, die sich mit ihren Kindern einen Film anschauen wollen, sich dabei aber nicht über allfälliges Kindergeschrei beschweren dürfen.
Anschliessend führen uns Hansens in ein ganz spezielles hawaiianische Restaurant, in den „La Mariana Sailing Club“ (one of the few remaining original Tiki bars / 50 Sand Island Access Rd, Honolulu) in einem Industriequartier, wo’s kaum Touristen hat. Die Bar ist dann doch perfekt gelegen, nämlich direkt an einem kleinen Hafen, ein richtiges Juwel. Kam im Elvis-Film vor, meint Greg. Burgers isst man dort – what else?!
Zu Hause sind wir erst gegen sechs, laden unser Auto mit unserem Hab und Gut und fahren nach Kahaluu zum nächsten Häusertausch. Dank dem Navi finden wir’s und lassen uns nieder. Von der Umgebung sehen wir nichts, weil’s halt schon dunkel ist.
Kailua
Sonntag, 8. November: Wir schlafen aus und sehen dann, wo wir sind. Das Apartment ist ok, nicht mehr ganz neu zwar, man könnte einiges bemängeln, aber die Aussicht aufs Meer ist wunderschön und der Garten eine Dschungel-Wildnis.
Den Tag verbringen wir am Strand, wo’s sehr viel Wind und Wellen hat.
Bereits vermissen wir Sue, die uns mit ihren Köstlichkeiten stets überhäuft und verwöhnt hat. – Jetzt müssen wir wieder selber kochen.
An den Regen in der Nacht sind wir bereits gewohnt. Der gehört offenbar einfach dazu, aber am Morgen scheint wieder die Sonne. Eigentlich hatten wir vorgehabt, nochmals in den Norden der Insel zu fahren, wir fahren aber nur ein Stück weit und verbringen den Tag am Strand beziehungsweise im Gras im malerischen Kualoa-Park. Auf der einen Seite das Meer, Palmen, Strand, Rasen und Blick auf die hübsche Insel Mokolii, auch genannt Chinaman’s Hat. Auf der anderen Seite, 180° gegenüber: hohe Felsen, grün und längs gefaltet wie ein geschlossener Fächer. Das Wetter ist ebenso abwechslungsreich: Es wechselt von Minute zu Minute von grau zu blau und Sonne, dann gibt’s sogar ein paar Regentropfen und schon fängt das Karussell wieder von vorne an.
Am Abend treffen wir Sue und Greg zum Nachtessen in einem japanischen Restaurant. Und wieder gelingt es mir nicht zu zahlen.
Während der nächsten Tage machen wir verschiedene Ausflüge, mal nach Norden, mal nach Süden. Die Wellen am Sandy Beach sind beeindruckend. Sie sind riesig und kommen bis ans Ufer. An Schwimmen ist nicht zu denken. Und immer wieder können wir uns kaum sattsehen an den zerklüfteten Küsten, am Meer mit all seinen verschiedenen blau-grün-türkis-weissen Farben, an den vorgelagerten Inselchen und den sagenhaft pittoresken Stränden.
Die Wellen vielerorts sind unberechenbar; ich werde noch weit oben am Strand von einer erwischt mit beiden Smartphones in der Hand. Es ist heiss und stets windig. Wir bleiben etwa eine halbe Stunde, dann sehen wir uns das sagenhafte Halona Blowhole an. Meterhoch spritzt das Wasser durch die Löcher im Fels. Tafeln warnen die Besucher vor gewagten Kletterpartien. Von weitem sehen wir, wie ein paar Touristen, die trotzdem auf den Felsen herumkraxeln, fast von den Wellen hinuntergespült werden. Das war knapp!
Am folgenden Morgen schaffen wir es ausnahmsweise, ungefähr um zehn morgens loszufahren. Richtung Norden diesmal. Das Meer ist jetzt zum Teil ganz rostbraun, bevor es in blau und türkis übergeht. Wir machen unterwegs Halt im Kahuku-Grill. Ich will unbedingt die Kokos-Makademia-coated Shrimps nochmals essen. Sie sind himmlisch! Best ever!
Weiter zum Turtle Beach. Wir schauen uns um, machen ein paar Fotos. Zurück im Auto kommt wieder mal ein Regenguss vom Schönsten.
Nächster Halt: Pupukea Beach. Es regnet immer noch. Die Leute, die dort in den Felsen im Wasser herumklettern, stört das nicht. Waimea Valley. Das ist ein gut gepflasterter, etwa ein Kilometer langer Trail zum Waimea Wasserfall. Unterwegs sind Bäume und Pflanzen angeschrieben, es ist gleichzeitig ein botanischer Garten. Immer wieder regnet’s ein wenig. Das stört niemanden. Es ist 29 Grad am Schatten. Der Wasserfall ist keine Wucht, wenn man andere schon gesehen hat. Unterhalb ist ein Wasserloch, wo man schwimmen kann. Es hat viele Leute und Lifeguards. Man muss Schwimmwesten anziehen. Das kommt gar nicht in Frage! - Das Wasser ist auch nicht sooo aamächelig. Die bräunliche Farbe stammt vom Eisen in den Felsen; das jedenfalls ist die Erklärung (Waimea heisst: rötlich). Wir verzichten also, spazieren zurück zum Auto und fahren zum Waimea Beach, wo wir zum ersten Mal nicht grad sofort einen Parkplatz finden, sondern etwa zehn Minuten warten müssen, bis jemand alle seine Surfbretter, nassen Tücher, Eisboxen etc. verpackt hat. Dann geht’s an den breiten Strand, wo, oh Wunder, die Wellen nicht so giftig sind und man sehr gut schwimmen kann. Was für eine Freude! - Fast wie am Almadraba-Strand in Spanien: erst ein paar Meter flach, dann abfallend, aber immer noch sandig – eine tolle Abkühlung. Natürlich hat’s auch mehr Leute als an anderen Stränden, wo Schwimmen nur für Profis empfehlenswert ist. - Schon bald geht die Sonne unter. Wir machen uns auf den Heimweg. Es wird bereits dunkel gegen sechs, dann geht’s sehr schnell und es ist Nacht. Nach einer Stunde und 53 km sind wir daheim.
Der Regen ist auch am nächsten Morgen pünktlich zur Stelle. Inzwischen wissen wir ja, dass das kein Problem ist. Trotzdem bleiben wir am Morgen daheim. Regen, Sonne, Regenbogen, Regen wieder und so weiter.
Wir besuchen am Nachmittag das Valley of the Temples, ein Friedhof für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen: Chinesen, Japaner, Hawaiianer, Christen… Im schönen Haiko-Park, der zum Haleiwa-Joe’s Restaurant gehört, essen wir eine Kleinigkeit und lesen ein wenig im gedeckten Pavillon währendem es regnet. – Kein Wunder, ist diese Insel so grün!
Freitag, 13. November: unser letzter Tag auf Oahu. Wir bleiben daheim.
Im Fernsehen erfahren wir von den furchtbaren Terroranschlägen in Paris. Menschenleben werden geopfert für fatalistische Ideen – so viel Leid geschieht für nichts und wieder nichts. Was sind das nur für irregeleitete Typen, die zu so etwas fähig sind?
Am Nachmittag besuchen wir Sue und geben ihr die Standsachen zurück, die sie uns geliehen hat. Bei der Heimfahrt leisten wir und ein „Verfahren“. Mein Fehler: Ich hab die falsche Route eingegeben und wir geraten auf die H3 in Richtung Pearl Harbour. Dummerweise hat gerade diese Autobahn, die durch einen langen Tunnel führt, während fast 20 Kilometern keine Ausfahrt. Zudem ist das Benzin am Ausgehen. Endlich kommt eine Doppelausfahrt. Theo möchte tanken gehen. Dummerweise verpassen wir den richtigen Exit von neuem und gelangen auf die falsche Bahn - zwar direkt zurück aber eben wieder auf die fast 20 km lange Strecke durch den Tunnel und der Tank steht schon seit einiger Zeit auf Reserve. Wir schaffen die Ausfahrt knapp - lauter Ameisen im Bauch. Dort müssen wir for ever am Rotlicht stehen, am zweiten auch, wir sind beide wie auf Nadeln und wissen nicht, ob’s besser ist, den Motor abzustellen oder nicht. Wenn er in diesem Stau nicht mehr anspringt… Ich weiss, es hat in der nächsten Strasse ein paar Tankstellen, aber noch grad nicht. - Eine weitere Ampel, sie wechselt auf orange. Ich dränge Theo, er soll zufahren, was er zum Glück auch macht. Und endlich: da ist die Garage, mit den letzten Tropfen im Tank stehen wir vor der heiss ersehnten Säule.
Am Samstag, dem 14. November, stehen wir um halb sieben auf, zu früh für Theo, das schon, aber trotzdem schön ohne Stress. Heute fliegen wir nach Hawaii, der Haupinsel des fünfzigsten US-Bundesstaates, wo unser nächster Haustausch stattfindet. Eine knappe Stunde später landen wir in einem riesigen Lavafeld auf Big Island.
Big Island - Hawaii
Auto beziehen, dann Fahrt an den Ali’i Drive, wo wir auch gleich das Windham Resort finden, unseren dritten Haustausch auf dieser Reise. Das Apartment lässt keine Wünsche offen, es ist grosszügig konzipiert und sehr gut ausgestattet. Die Betten ganz offensichtlich für jegliche Eventualität gewappnet: “The beds have a 400 (four hundred!) pound total weight limit, recommended by manufacturer”.
Im hübschen Restaurant Lava Java essen wir am Abend. Den Wein können wir selber mitbringen; wir finden im ABC-shop sogar eine Flasche „Hess Select“.
Am nächsten Morgen findet im Hotelkomplex eine Präsentation der verschiedenen Sightseeing-Angebote statt. Sie dauert fast zwei Stunden, ein wenig lang, finden wir. Wir buchen einen Helikopterflug für den 25. November (an Theos Geburtstag, dem Tag zuvor sind die Wetterprognosen leider schlecht).
Am Nachmittag fahren wir Richtung Norden. Wir nehmen die Abzweigung in den Lava-State-Park. Die Strasse ist die reinste Katastrophe. Es schüttelt gewaltig. Wir fürchten um die Pneus unseres Mietautos. Später lese ich, dass man dorthin nur zu Fuss oder per 4-wheel-drive gelangen kann…
Der Ausflug hat sich aber gelohnt. Wir gelangen an einen schönen, schwarz-weissen Strand, wo’s kaum Leute hat. In der Nähe gelegen ist das exklusive 4-Season-Resort inmitten eines gediegenen Golfplatzes (700$ pro Nacht).
Zu Hause gibt’s Rib Eye Stake und Gemüse, das Theo auf dem Gartengrill zubereiten muss. – Freude seinerseits herrscht nicht ob der Zuteilung dieser Aufgabe, aber ich bestehe darauf. Die Kartoffeln bereite ich in der Bratpfanne zu.
Auch diese Insel, die jüngste aber grösste des Archipels, wollen wir erkunden. Das Erstaunliche ist, dass es auf diesem doch relativ kleinen Gebiet 11 der möglichen 13 Klimazonen gibt, die auf der Welt existieren.
Ich erwache vor acht und sehe im Internet, dass das Wetter heute besser ist in Hilo als in den nächsten Tagen, so wecke ich Theo und nach dem Frühstück machen wir uns um neun auf den Weg dorthin. Wir wählen die Bergroute und sind knapp zwei Stunden später dort. Unser vorläufiges Ziel sind die Akaka-Fälle. Es regnet immer wieder mal ein wenig (es soll jeden Tag regnen an der Ostküste – Hilo ist der Ort mit der höchsten Niederschlagsrate weltweit), aber das ist ja hier nicht so ein riesiges Problem. Erstens ist’s warm, zweitens dauert die Traufe nie lang.
Ein schöner Rundgang führt durch eine herrliche Vegetation mit riesigen Bäumen, Bambus zum Teil und dann sieht man neben anderen Fällen den Akaka-Fall, der 135 Meter in die Tiefe stürzt. Ein eindrucksvoller Anblick.
Unterwegs halten wir immer wieder mal an in einem der hübschen kleinen Orte, schliesslich auch in Hilo. Nach eine Spaziergang und ein paar Einkäufen machen wir uns auf den Heimweg. Um sechs wird’s dunkel, so muss Theo die Hälfte der Strecke in der Dunkelheit heimfahren.
Was für ein weiterer schöner Tag, der nächste: Wir fahren um Viertel vor acht los. Ziemlich viel Verkehr hat’s schon so früh. Trotzdem kommen wir rechtzeitig in Waimea an. Um 9 Uhr treffen wir im Starbucks, im Parker Center, Christopher Langan, Lees ältesten Sohn, der seit Jahren in Hawaii lebt. Er hat sich anerboten, uns „seine“ Insel zu zeigen. Unser „Wägeli“ lassen wir auf dem Parkplatz stehen und wechseln in seine Riesenkarosse, einem Pickup, wie es sich hier gehört, mit dem wir dann den ganzen Tag lang auf den abenteuerlichsten Strassen unterwegs sind.
Erst fahren wir an die Ostküste nach Honokaa, einem malerischen kleinen Ort mit Holzhäusern im Westernstil. Von einem bekannten Aussichtspunkt aus eröffnet sich uns ein grandioser Blick hinunter ins Waipio-Valley. Noch ein paar andere Touristen stehen dort, staunen und knipsen Fotos. Genau dort hinunter, wo’s wilde Pferde hat und grüne Taro-Felder, dort wollen wir hin. Die steile, um 25% abfallende Strasse ist voller Löcher und nur mit einen 4X4-Gefährt passierbar. Das haben wir ja, aber trotzdem: einfach ist die Fahrt hinunter ins Tal überhaupt nicht. Die Landschaft ist spektakulär. Die hohen Felswände werden wir in ein paar Tagen auch von oben sehen können, vom Helikopter aus. Unten im Tal angekommen, sind die Pfade keineswegs besser befahrbar. Wo die Strecke durchführt, ist kaum sichtbar. Es hat riesige Pfützen, Löcher und wir müssen den Fluss mehrere Male überqueren. An einem pechschwarzen Strand halten wir an und vertreten uns die Beine, essen die Starfruits, die wir unterwegs an einem Stand gekauft haben und schauen den wilden Pferden zu.
Anschliessend fahren wir zurück nach Waimea.
Unser nächstes Ziel ist das auf 4‘200 Metern gelegene Observatorium auf dem Mauna Kea. Das Wetter wechselt von Minute zu Minute. Nebel, Wolken, man sieht gar nichts mehr, dann wieder blauer Himmel und Sonnenschein. Dazu ist es sehr windig und kalt. Kein Wunder bei dieser Höhe. In knapp drei Stunden einen solchen Höhenunterschied zu erleben, von null auf über viertausend Meter, ist auch für den Organismus kein Kinderspiel. Hier herrscht ein völlig anderes Klima als unten im warmen Tal. Gegen die Kälte aber hat Christopher vorgesorgt: Er hat Daunenjacken und Handschuhe für uns mitgebracht. Einen besseren Guide hätten wir uns nicht wünschen können!
Ich bin erstaunt über die vielen Observatorien dort oben. Ich wusste gar nichts davon. Sie sind riesig und natürlich an einem Ort stationiert, wo kaum ein Lichteinfall die Beobachtungen stören kann.
Zurück in Waimea gehen wir Nachtessen im „Red Waters“, einem originellen Schuppen. - Das war ein super Abschluss für einen genialen Tag. - Theo muss noch eine Stunde ans Steuer, dann sind wir daheim.
Nur kurze Ausflüge unternehmen wir während der nächsten paar Tage; wir besuchen Dörfer in der Nähe und finden immer wieder mal einen Strand, der zum Baden und zum Ruhen einlädt.
Nach einer Woche ist es Zeit, unser Apartment im Windham Resort zu verlassen und zu unserem nächsten Haustausch zu wechseln, einem hübschen Haus, das mitten in ein Lavafeld hineingebaut ist. Nur wenige Pflanzen ragen aus dem schwarzen Gestein hervor. Echsen und anders Kriechgetier lieben den Ort. Auch wir haben keine Mühe, uns gleich wieder einzunisten. – Von einem luxuriösen Sitzplatz mit Bar und Grillstelle aus hat man einen tollen Blick aufs Meer und in der Nacht auf die Sternenpracht. Die Mücken finden’s ebenfalls ganz angenehm, von dort aus mit uns die Dämmerung zu erleben.
Ein Ausflug bringt uns in den Süden. Bei „Coffee Joe’s“ machen wir den ersten Halt, wo’s Kaffee-Tasting gibt und zusätzlich eine herrliche Aussicht auf die Kaffeeplantage und die Küste. An Captain Cook vorbei (das Monument finden wir nicht, lesen später, dass es nur vom Meer aus sicht- und erreichbar ist) geht’s weiter Richtung „Place of Refuge“. Unterwegs besuchen wir das hübsche kleine Kirchlein „Painted Church St. Thomas“ und fahren dann weiter zur ältesten Siedlung der Insel, wo sich früher Flüchtlinge, die ein Tabu verletzt hatten, begnadigen lassen konnten. War wohl nicht so leicht, weil sie nur schwimmend dorthin gelangen konnten. Es ist ein einmalig schöner Ort; das Schattenspiel der hohen Kokospalmenwedel im weissen Sand erinnert an Ferienprospekte. Wir unternehmen einen Spaziergang in der Hitze und hören anschliessend einer Rangerin zu, die uns Legenden erzählt und über die Geschichte informiert.
Grad nebenan gibt’s einen Strand, an dem man sehr gut schnorcheln kann. Wir probieren’s. „Two Steps“, heisst er; von den vorgelagerten Felsen aus kann man über zwei Stufen mehr oder weniger gäbig „beschnorchelt“ ins tiefe Wasser losschwimmen. Wir versuchen‘s, sind aber keine Profis und tun uns ein bisschen schwer damit. Auch wage ich mich nicht sehr weit ins Meer hinaus, denn vor etwaigen Strömungen habe ich grossen Respekt. Trotzdem sehen wir viele Fische.
Auf dem Heimweg kaufen wir ein und daheim mach ich einen Salat, der offenbar so riesig ist, dass Theo sein eben gekauftes Fertigmenu gar nicht mehr mag und schon aufgetaut, wieder im Kühlschrank versorgt. – Er sagt nichts, aber ich merke, was er denkt.
Das war ein schöner Ausflug mit vielen Highlights.
Wieder ein Beach-Tag, der nächste. Eine Fahrt durchs Gelände führt uns am Hilton, Marriott, und deren Golfplätzen vorbei. Diese Resorts sind äusserst weitläufig, zwei grosse Shoppingmalls gehören dazu, aber dort Ferien zu machen, würde mir nicht gefallen, obwohl alles perfekt und total gepflegt aussieht. Für mein Dafürhalten macht die Anlage aber einen unpersönlichen Eindruck. Die Gäste werden mit Bussen in herumtransportiert, denn bis zum Strand ist der Weg weit. Gemütliche Bistros fehlen völlig. Hier war nie ein gewachsener Ort, ein Fischerdorf oder so. Mitten im Lavafeld wurde eine künstliche Hotelanlage hingestellt, schön gelegen zwar, aber eben, die Seele fehlt völlig.
Der Hapuna-Beach ist recht gross, es hat genügend Parkplätze und man kann gut schwimmen. Wir halten es recht lange dort aus, von Mittag bis halb fünf, dann brechen wir auf und fahren zurück in die „Stadt“, wo wir im „Citizen Pub“ grad rechtzeitig zur Happy Hour ankommen und super feine Pouletflügeli geniessen. Eine charmante junge Kellnerin, die von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, bedient uns. Es ist ihr erster Tag in diesem Restaurant, erzählt sie uns; ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch ihr letzter ist.
Ich mag dann gar nichts mehr essen daheim, Theo wärmt sein Fertiggericht auf, das er gestern nicht mehr mochte (weil viel zu viel Salat).
Dienstag, 24. November – Theos Geburtstag
Wir starten früh, das wird ein langer Tag, der uns zu den Vulkanen führt.
Um acht geht’s los. Theo bemerkt ganz poetisch: „Jetzt fahren wir in den Morgen hinein…“.
Leider wird das Wetter nach circa einer halben Stunde Fahrt ganz neblig und so beschliessen wir, nicht nach South Point zu fahren und auch auf einen Halt am Green Beach zu verzichten. Schade, aber bei Regen macht das keinen Spass. Auch die Sicht wird schlecht sein und den Fotos wird der Glanzprospekt-Effekt fehlen.
Wir fahren weiter und machen erst nach anderthalb Stunden Halt beim Black Beach. So ein schöner Anblick: Kohlenrabenschwarz ist der Sand. - Wenigstens hat’s aufgehört zu regnen, aber berauschend ist die Wetterlage nicht. Im Visitor Center des Volcano National Parks wird man informiert; Kaffee gibt’s im Volcano House.
Ein ungefähr dreiviertelstündiger Walk führt uns durch ein Gebiet, das uns stark an Rotarua, NZ, erinnert, wo’s auch überall aus allen Ritzen qualmt und vom Schwefel die farbigsten Stellen zu sehen sind. Eindrücklich! Den Rückweg schlagen wir entlang des Kraterrands ein.
Theo trägt übrigens seine hellen Discoschleifer, weil er die Turnschuhe daheim vergessen hat. – Es ist ja sein Geburtstag – ich sag mal nichts…
Nächster Halt: Jagger-Museum. Von dort hat man einen wunderbaren Blick über den Kilauea-Krater – wenn’s denn keinen Nebel hätte. Hat’s aber und man sieht nichts. Nach einem kurzen Museumsbesuch lösen sich die Wolken ein wenig auf und man erkennt den Krater. Er ist riesengross (17 km2?).
Als Nächstes gibt’s einen etwa hundert Meter langen unterirdischen Lavatunnel zu durchschreiten, ein eindrücklicher „Spaziergang“.
Weiter zum nächsten Krater. Ich wage mich aufs Lavafeld hinaus und mache ganz schöne Fotos. Theo schläft im Wagen. Dann kommt der Nebel und es hat keinen Sinn mehr, bei den anderen Kratern anzuhalten. Sicht gleich null. Wir fahren doch die 20 Meilen lange Crater Rim Road zum Meer hinunter und dort hört dann der Nebel auf und wir sehen, wo die Lava ins Meer fliesst oder geflossen ist. Spektakulär. Es haben sich Bögen und Brücken gebildet, die bis ins Meer reichen. Die Insel wächst also stetig.
Zurück in Kona schaffen wir’s grad um acht, bei „Huggo’s“ on the rocks über dem Meer bei einem feinen Essen auf Theos Geburtstag anzustossen.
Helikoper-Flug
Dieser findet am nächsten Tag statt (Geburtstagsgeschenk für Theo). Es hat die ganze Nacht geregnet, eigentlich denke ich, der Flug würde verschoben werden. Dann bessert das Wetter, kurz nach neun werden wir abgeholt und auf den Flughafen in Kona gebracht. Um halb elf geht’s los. Dass ich neben dem Piloten sitzen darf, freut mich sehr. Nun sehen wir aus der Vogelperspektive, wo wir überall bereits waren, durch welche Strassen wir gefahren sind.
Wir kreisen über den Lavafeldern des Mauna Loa, dann geht’s runter über den Kilauea, wo wir gestern waren, den Kratern entlang und nun ist die rotglühende Lava gut erkennbar. Es ist gewaltig. Weiter überfliegt der Heli die ganze Vulkanebene, die zum Teil glänzt wie Quecksilber. Wälder sind überflossen worden, abgestorbene Bäume ragen aus der schwarzen Landschaft heraus, überall hat’s tiefe Krater. Immer wieder ziehen Wolken vorbei, aber das macht die grossartigen Bilder, die sich einem bieten, noch attraktiver. Nebel- und Rauchschwaden gehören dazu.
Weiter über Hilo, dann zum Waipio-Valley, wo wir mit Christopher waren. Die grünen zerklüfteten Täler, in die wir hineinfliegen, sind unendlich schön, aus nächster Nähe die Wasserfälle zu sehen, die an vielen Orten aus den Felsen sprudeln und tief hinunter ins Tal stürzen, ist spektakulär. Man kann sich kaum satt sehen. Der Heli geht so nah ran und macht Kurven, dass es einem fast Angst werden könnte. Die Gegenden auf dieser Seite der Insel sind völlig unbewohnt. Der Heli macht einen Schwenker aufs Meer hinaus. In dem Moment schickt mir die SOS-App in meinem Smartphone eine Meldung: „Sind Sie noch in den USA?“ – Da wird mein Standort also auf Schritt und Tritt überwacht. Ich bin beeindruckt. - Weiter nördlich geht’s über die satt-grünen Felder von Kohala, man erkennt ein paar wenige Rinderherden. An der Ostküste sind die Farben prächtig: von türkis bis tiefblau präsentiert sich das Meer entlang der schneeweissen Strände und rund um die Korallenriffe. All die mondänen Resorts sind an dieser Küste gelegen. – Zwei Stunden später landen wir auf dem Flugplatz. - Das war ein einmaliges und unvergessliches Erlebnis.
Am Abend fahren wir ins Sheraton Kona. Dort hat es eine Art Kanal, der sich bis ins Areal des Hotels erstreckt, wo es Mantas zu sehen gibt. Gesehen haben wir zwar keine, aber die Bar ist schick, gute Musik, Aloha-Stimmung, kühler Weisswein und Burger vom Feinsten.
Donnerstag, 26. Dezember – Thanksgiving-day
Wir beschliessen, an den Strand hinter dem alten Hafen zu gehen. Der Zugang mit unserm Auto über das Lavafeld gestaltet sich ziemlich schwierig; ich hatte grosse Angst um unsere Pneus. – Wir hätten uns die Mühe, dorthin zu gelangen, auch sparen könnten, denn kaum dort, textet uns Christopher, er wäre unterwegs Richtung Norden, wir könnten uns treffen. So packen wir sogleich zusammen, fahren die holperige, mühsame Strecke wieder zurück zur Hauptstrasse und treffen Christopher eine halbe Stunde später am Napuna Beach im Norden. Nach einem Bad im stürmischen Meer nimmt er uns mit nach Kohala und zeigt uns auch andere kleine Orte. Es folgt ein Besuch auf seiner Farm, 800 Meter über Meer, in einer wunderbaren grünen Gegend. Genau darüber sind wir gestern geflogen. - Wir staunen! Das Anwesen befindet sich völlig allein auf weiter Flur, besteht aus zwei Häusern. Vier Autos stehen herum, eines davon ein massiges Schneegefährt. Von zwei Schäferhunde werden wir stürmisch begrüsst. - Es wird noch viel zu tun geben, bis das Haus ganz ausgebaut ist.
Ein kühler Wind weht hier oben, nur noch etwa 15 Grad zeigt das Thermometer an. Knapp nach sieben Uhr abends sind wir daheim, duschen rasch und fahren zurück in die Stadt, wo wir für ein Thanksgiving-Dinner einen Tisch auf der Terrasse eines Restaurants mit Blick übers Meer reserviert haben.
Tags darauf besuchen wir einen Strand in einem Nationalpark, an dem wir bisher noch nicht waren. Paradiesisch ist es hier, es hat kaum Leute, aber ganz speziell: viele Riesenschildkröten sonnen sich auf den Felsen und am Strand. Theo legt sich ebenfalls hin und ich geh ein wenig rekognoszieren. Nicht weit weg davon gibt es einen kurzen Trail mit Petroglyphen, die von den Ureinwohner Hawaiis stammen und die viele Jahrhunderte als sein sollen. Diesem Pfad gehe ich entlang. Er ist bestens beschildert und die einzelnen Felszeichnungen sind gut kommentiert.
Später, auf dem Weg zum Auto, begegnen wir einem Paar und kommen mit ihnen ins Gespräch; er ist Schweizer, sie von hier (Anjani und Eric). Sie wohnen in der Gegend und besitzen ein grosses Boot. Wir machen mit ihnen ab, am Montag mit den Delfinen schwimmen zu gehen.
Unser Haustausch dauert nur bis am Samstag, dem 28. November. Wir bleiben allerdings noch ein paar Tage länger auf der Insel und ziehen um, mitten in den Ort, ins Royal Kona Hotel.
Während dieser Zeit machen wir keine „grossen Sprünge“ mehr. An einem Abend laden wir Christopher zum Abschied noch zum Essen ein, an einem anderen haben wir eine weitere komische Begegnung mit einer Kellnerin. Lehren, wie sie bei uns üblich sind, kennt man in Amerika halt nicht, die Amis legen mehr Wert auf „learning by doing“. Aber wie das Beispiel zeigt, klappt das nicht immer auf Anhieb vorzüglich. Jedenfalls auch nicht bei Cindy, wie sie sich uns vorstellt: Was sie bietet, ist unglaublich. Sie ist noch sehr jung und auch sie erzählt uns, es sei ihr erster Tag. Sie will’s sooo gut machen, bringt drei Teller aufs Mal, dann fällt allerdings die Hälfte der Pommes Frites vor uns auf den Boden, das Ketchup im Töpfli grad dazu. Zum Glück haben wir Hochsitze, so dass wir mit unseren Füssen nicht auf den Frites herumstehen müssen. Sie wischt sie nämlich nicht weg. Sie ist überfreundlich und überschwänglich, wie man das von Ami-Frauen oft gewöhnt ist („oh my God, oh my God“ – „Enjoy your food, you guys“…). Sie betatscht mich auch dauernd, am Oberarm und tätschelt mir auf den Rücken. Irgendwie kommt sie mir vor, als ob sie ein wenig high wäre. Vielleicht hat sie sich tatsächlich ein bisschen gedopt für ihr Debut. Mit der Zeit würde sie mir so was von auf die Nerven gehen… Ich könnte mir gut vorstellen, dass es ihrem Chef bald ähnlich geht und er auf ihre Dienste verzichtet.
Zu Hause bin ich todmüde und schlafe schon um halb neun. Wie ein Baby. Sonnenuntergang ist halt bereits vor sechs Uhr abends und so verschiebt sich alles. Um neun sind die Restaurants so gut wie leer, schliessen sodann und irgendwie hat man das Gefühl, der Abend sei gelaufen.
„Swimming with the Dolphins“
Wie abgemacht, sind wie am Montag früh parat fürs nächste „Abenteuer“. Anjani holt uns ab und bringt uns zum Hafen. Eric macht das Boot startklar - Leinen los. Kaum aus dem Hafen heraus – ich glaub’s ja nicht - schon umschwärmt eine ganze Reihe von Spinning-Dolphins unser Boot. Sie schwimmen unter dem Schiff durch und mit uns mit.
Wir fahren weiter Richtung Norden. Auf der Höhe des Flughafens hat’s wieder eine ganze Kolonie. Wir legen Flossen, Taucherbrillen und Schnorchel an und Anjani zeigt uns genau, wie’s geht. Ich bin froh um ihre Hilfe, mir ist die Sache schon nicht so geheuer mit den um mich herumpfeilenden langen Fischen. Aber es ist grossartig.
Leider ist es Theo schon bald schlecht vom Schaukeln auf dem Boot, aber im Wasser geht’s einigermassen. Wir fahren weiter, gehen wieder schwimmen, fahren weiter und so fort. Verrückt, wie nah man den Tieren ist, wie behänd sie sich fortbewegen. Es ist aber auch schön, ihnen nur vom Boot aus zuzuschauen, wie sie in Fünferkolonen zum Teil Pas-de-Cinqs vollführen, nebeneinander wie Synchronschwimmer auf- und wieder abtauchen. Auch Babys sieht man. Sie sind völlig verspielt, noch mehr als ihre erwachsenen Artgenossen. Sie fliegen oder besser gesagt schiessen in die Luft und drehen sich bis zu sieben Mal, bevor sie wieder kopfvoran ins Wasser tauchen. Daher der Name Spinning Dolphins.
Nach etwa viereinhalb Stunden peilen wir den Hafen an und Anjani bringt uns zurück ins Hotel. - Das war ein wunderbares Erlebnis, ein wenig teuer zwar (160$ pro Person). Aber es hat sich gelohnt, wir waren auch die einzigen Gäste.
Den Nachmittag verbringen wir am Strand im Hotel und am Abend essen wir in einem Thai-Restaurant. Die Portionen sind riesig. Die Tom Ka Suppe hätte für vier gereicht. Zum Dessert finden wir ein lustiges Frozen Joghurt Lädeli, wo man, ausser die Kasse bedienen, alles selber machen muss. Man füllt das Softice seiner Wahl in einen Becher, toppt mit einer riesigen Auswahl an Schoggi-Bitzli oder Nüssli-Bitzli oder Täfeli-Bitzli oder was auch immer für Bitzli, stellt den Becher anschliessend auf die Waage und bezahlt den Schaden. – Gar nicht schlecht. Weder die Idee noch die Glace.
Inzwischen ist es bereits Dezember. Der erste – für uns ein Tag am Strand. Bewaffnet mit Schnorchel-Ausrüstung nehmen wir den lustigen offenen Bus (der nur alle zwei Stunden fährt) Richtung Süden und gehen an die Kahaluu-Beach. Es hat recht viele Leute dort und das Schnorcheln macht Spass. Man sieht die buntesten Fische. Am besten gefällt mir der kleine zitronenfarbige, der lächelt.
Im gemütlichen „Huggo’s“ gibt’s unser letztes Abendessen auf dieser wunderbaren Insel: Ravioli mit Hummer, Shrimps und grünen Böhnchen vom Feinsten. – Theo bestellt Teryaki-Steak.
Zurück aufs Festland
Am 2. Dezember abends fliegen wir zurück auf den Kontinent, das Zwischenziel ist Los Angeles. Schlafen konnte ich kaum im Flugzeug, Theo schon, er hatte zwei Plätze für sich. Um halb sieben sind wir in LA. Der Anflug in der Morgendämmerung ist spektakulär: Im Hintergrund dringt ein heller Schein über die schwarze Bergkette, rote und gelbe Streifen sind zu sehen, weiter oben erahnt man schon den blauen Himmel und ein paar wenige Wolkenschleier. Im Vordergrund all die Lichter der Stadt wie in der Nacht aber nun eben nicht mehr ganz dunkel. Ein Anblick für Götter. Und unser Flugzeug kreist wie ein Adler ein paar Mal über der Riesenstadt, ziemlich tief unten, der Horizont steht schief - manchmal wird mir fast Angst.
Umsteigen. - Eine Stunde später sitzen wir schon wieder in der zweiten Maschine und fliegen über Wüstengebiete, den Golf von Mexiko, dringen erst über, durch und unter dichten Wolken hindurch und landen schliesslich in Florida.
Drei Tage Regen werden’s dann... Fünf Stunden haben wir „verloren“; es ist bereits später Nachmittag, wie wir im Hotel, das ich zu Hause bereits gebucht hatte, mit unserem neuen Mietauto ankommen. Später treffen wir unsere Freunde Liza und Urs Lindenmann und bleiben zum Nachtessen gleich im Hotel, weil’s in Strömen regnet. Nach einem gemütlichen und wie immer lustigen Abend mit den beiden sinken wir müde ins Bett und schlafen am nächsten Morgen lange aus.
Gegen Mittag treffen wir Jim aus Kanada. Er ist zufälligerweise in Miami, wie schon letztes Mal, als ich da war und wir zusammen essen gingen. Solche Zufälle gibt es eben. - Na ja, seine Eltern wohnen in Miami in einer Alterssiedlung, also ist es doch nicht so abwegig, dass er sie zur selben Zeit, wie wir da sind, besucht. In einem gemütlichen Restaurant am Hafen geniessen wir zusammen einen leichten Lunch. Neuigkeiten werden ausgetauscht und Fotos und schon ist’s Zeit für Jim, zum Flughafen zu fahren und zurück nach Toronto zu fliegen. Unsere Reise führt ebenfalls in Richtung Norden zur Adresse, wo wir unseren letzten Haustausch in diesem Jahr vereinbart haben, nach Hutchinson Island.
Letzter Haustausch – Hutchinson Island
Am späten Nachmittag kommen wir an. Nach kurzem Suchen finden wir das hübsche Condo im Mariatt Hotel-Komplex. Alles, was wir brauchen, ist vorhanden.
Wir sind zwar müde, aber gehen trotzdem noch einkaufen. Das dauert mehr als eine Stunde. Alles hier ist nun billiger als in Hawaii und mich dünkt, wir haben uns für mindestens einen Monat eingedeckt mit Waren…
Am nächsten Tag regnet es nach wie vor in Strömen. „Büro machen“, emailen und dann schau ich mal, was es so für Malls und Kinos gibt in der Gegend. In Jesper hat’s grad beides, und das ist nicht weit. Also verbringen wir den Nachmittag in der Mall, dann gehen wir ins Kino und sehen uns den Film „Secret in your Eyes“ an mit Nicole Kidman und Julia Robert, Remake des argentinischen Thrillers „El secreto de sus ojos“, der mich damals so sehr beeindruckt hat. Das Original hat mir allerdings noch besser gefallen, trotz der dramatischen und tragischen Geschichte war nämlich auch noch ein wenig Humor drin eingepackt.
Auf CNN läuft immer und immer wieder, was in Paris passiert ist vor drei Wochen. Wie eine Endlosschlaufe… Haben sie nichts anderes zu senden? – Mir scheint, sie warten aufs nächste „school-shooting“, das ist ja auf jeden Fall schon vorprogrammiert und wird gleich „um die Ecke“ stattfinden.
Sonntag, 6. Dezember: Nichts von Grittibänze und Samichlöisen weit und breit. - Leider. - Aber wenigstens ist das Wetter besser. Theo will daheim bleiben und das „Danke-Mail“ zu seinem Geburtstag fertig kreieren. Ich glaube, damit hat er die seiner Ansicht nach perfekte Ausrede gefunden, um ungestört Siesta ad Infinitum machen zu können. - Zimmerpflanze! – Ich bleib sicher nicht daheim. Vorher telefonieren wir noch mit Kay und Familie. Kay fragt Ella, ob sie auch mit uns reden möchte; sie sagt, sie müsse noch überlegen…
Ich nehme dann das Auto und fahre an den Strand. Das Meer ist wild, der Strand ellenlang, besser gesagt kilometerlang. Beim Refuge House (das einzige noch vorhandene in Florida; dort hat man früher Schiffsbrüchigen Unterkunft gewährt) lege ich mich in den Sand und lese ein gutes Stündchen. Die Wolken kommen wieder und ich will gehen. Da wird’s wieder schöner. Auf der andern Seite der Strasse (die Insel ist ja eigentlich ein Damm), setze ich mich nochmals hin aufs Gras, lese und schaue den Fischen zu, die aus dem stillen Indian River hoch aus dem Wasser springen – fast wie die Delphine am letzten Montag.
Zu Hause ist Theo dann doch nicht; er hat sich tatsächlich ins Swimmingpool begeben.
Am 7. Dezember machen wir einen Zweitagesausflug nach Orlando. Da wir nicht den Florida Turnpike nehmen (Toll-Road), dauert die Fahrt fast drei Stunden.
Unser Hotel ist perfekt gelegen. Der Zufall will es, dass der Universal Studio Theme Park in nächster Nähe ist. „Across the street“, wie es hier heisst. Es dauerte dann doch fast eine halbe Stunde zu Fuss, bis wir bei den Kassen sind. 315$ kostet das Vergnügen für uns beide für beide Parks. Die Unterkunft habe ich über „hotwire.com“ gebucht, eine Webseite, die nicht genau preisgibt, wo das Hotel ist, nur in welcher Gegend ungefähr und man kann gewisse Vorgaben wählen (wie viele Sterne, Pool oder nicht, am Strand gelegen etc). Dafür gibt es geniale Preise. Wir sind jedenfalls sehr zufrieden damit. Es entspricht zwar nicht dem modernsten Standard, aber wir haben alles, was wir brauchen: Ein grosses Bett, kleine Küche sogar, Wohnzimmer und Bad, und das alles für 105$ für zwei Nächte.
Auch eine feines japanisches Restaurant ist gleich um die Ecke: „Kobé“. Dort gib’t die weltbesten Nudeln und wunderfeine Sushis. Dazu eine Flasche Malbec, was wollen wir mehr!
Wir stehen früh auf am nächsten Morgen. Nach dem „Grab and Go-Frühstück“ marschieren wir um halb neun los.
Alles, was mit Harry Potter zu tun hat, ist schlicht unsagbare Spitze. Sogar die Mauer, durch welche die Passagiere am Bahnhof durchgehen, ist vorhanden. Die Reise im Zug nach Hogwarts, die der Besucher dann miterlebt, ist unglaublich gut gemacht und aufs Beste inszeniert, genauso wie auch Diagon Alley. Wie es gelungen ist, all die vielen Zaubereien in „Realität“ umzusetzen, geht über mein Fassungsvermögen. Wir haben enorm Spass und finden schliesslich nicht einmal den Eintrittspreis mehr exorbitant. Schön ist auch, dass es nicht allzu viele Besucher hat - es ist halt kurz vor Weihnachten - wir müssen kaum irgendwo Schlange stehen.
Am Ende des Tages sind wir pflotschnass (Popeye), es geht nichts ohne Wasser auf den Bahnen. Die aufregendsten Attraktionen sind die 3-D-Attractions, auf einer ist mir fast schlecht geworden.
Ein super Tag war das. Nachtessen wieder im „Kobé“.
Cape Canaveral
Mittwoch, 9. Dezember. - Zu Hause: Bundesratswahlen. Guy Parmelin wird gewählt. – Endlich ein Ende dieses Vor-Wahlen-Theaters!
Wir fahren Richtung Osten und sind kurz vor Mittag im Kennedy Space Center. Letztes Mal war ich vor 39 Jahren dort. Da hat sich viel geändert unterdessen. Ich hätte den Komplex nicht wiedererkannt. Nur die grosse Halle noch. Eine Busfahrt führt die Besucher durchs Gelände und man wird mit unzähligen Informationen eingedeckt, auch I-MAX-Filme gibt’s zu sehen. Einen weiteren sehr interessanten Tag haben wir verbracht.
Letzte Tage vor der Heimreise
Nach einem Regentag (zum Glück nicht die beiden vorher) können wir wieder ein paar Stunden am Strand verbringen und besuchen anschliessend das kleine hübsche Städtchen Stuart. Am besten gefällt uns der River-Walk. Wir essen in einem netten Restaurant, wo wir wie überall sehr freundlich und aufmerksam bedient werden.
Auch der folgende Tag bringt schönes Wetter, aber auch einen starken Wind.
Wir fahren vor dem Mittag Richtung Süden. In Jupiter finden wir einen schönen Strand, wo wir ein paar Stunden verweilen. Mit Schwimmen ist allerdings nicht; das Meer ist zu stürmisch. Es hat zwar einen „Lifeguard on Duty“, aber niemand ist im Wasser. - Theo kann seinen Strand-Stuhl nicht zuklappen; statt zu helfen, muss ich lachen. Ich kann’s auch nicht. Zum Glück hat das Teil im Auto auch so Platz. Zu Hause gelingt uns dann das Unterfangen des Zusammenklappens gemeinsam.
Wir haben in Stuart fürs Abendessen im Riverwalk-Café einen Tisch reserviert. Es hat überall viele Leute, eine tolle Stimmung herrscht, offenbar sind die Boote auf Weihnachte getrimmt worden.
Der 15. Dezember ist unser letzter Strandtag. Es ist schön und warm und die Wellen sind grad so, dass ich es wage, schwimmen zu gehen.
Am Abend gehen wir essen in einem gemütlichen Restaurant direkt am Wasser, die Schiffe vor der Nase, Livemusik, feiner Fisch, der krönende Abschluss, bevor‘s zurück geht in den Kühlschrank in der Schweiz.
30 Grad warm ist es an unserem Abreisetag, dem Mittwoch, 16. Dezember 2015.
Wir besuchen Liza und Urs in ihrem neuen Heim, erhalten einen köstlichen Lunch und machen uns gegen Abend auf in Richtung Flughafen. Die Autoabgabe ist kein Problem, auch nicht das Einchecken und Koffer abgeben. Wie froh bin ich jeweils, wenn das alles erledigt ist! Eine Stunde nur hat’s gedauert. Der Flug hat ein wenig Verspätung, kurz nach acht Uhr abends ist es dann aber so weit und früh am nächsten Morgen landen wir in Zürich. – Schönes Wetter, 6 Grad, alles ok. Wir nehmen den Zug nach Bern, Gino holt uns am Bahnhof ab, unsere Reise ist Geschichte.

Reisebericht Südafrika 11. Oktober – 16. Dezember 2016
Der Dienstag, unser erster Reisetag, war reich befrachtet. Unsere beiden zuckersüssen (diesen Ausdruck hätte meine Mutter gebraucht) Grosskinder, Ella und Amy, wurden gegen Mittag von ihren Eltern, Kay und Raphael, abgeholt, nachdem sie eine Woche lang bei uns in den Ferien gewesen waren. So eine schöne Woche war das mit den Girls und daher auch ein wenig traurig, sie wieder „abgeben“ zu müssen. Aber schliesslich mussten wir ja langsam ans Packen denken, unser Flug ging um Viertel vor elf Uhr abends, der Zug um sieben. Natürlich hatten wir vorher schon ein bisschen was zusammengetragen, was mit sollte, aber Packen mit Amy im Schlepptau ist nicht ganz einfach. Sie will alles ganz genau anschauen, und Auspacken macht ihr besonderen Spass.
Gino brachte uns zum Bähnli und los ging’s.
Mit den Kindern hatte sich Theo ein neues Spiel ausgedacht, an dem alle drei grosse Freude hatten: „Frag Siri“. Immer wieder hörte ich ihn sein i-Phone befragen: „Siri, wie alt ist Ella?“ oder „Wann hat Amy Geburtstag?“ und Siri gab jeweils schlagfertig die richtige Antwort. Da konnten die Kleinen gigele und wollten’s immer wieder hören.
Als wir nun am Bahnhof Bern noch ein wenig Zeit hatten und beim Treffpunkt standen, nahm Theo sein Smartphone hervor und fragte doch tatsächlich: „Siri, wo bin ich?“ … Kann ja nicht wahr sein, dachte ich, sagte es wohl auch. Das fängt ja gut an…
Diesmal hatte Theo seine Halbtax-Karte dabei, nicht zu Hause zurückgelassen und auch nicht im Koffer zuunterst verstaut. Wegen meiner grossen Erfahrung diesbezüglich hatte ich darauf geachtet, dass wir diese Anfangsklippe umschiffen konnten. So ging alles gut bis zur Security am Flughafen, wo Theo es fertigbrachte, eine Angestellte mindestens 20 Minuten für sich alleine in Anspruch zu nehmen. Alle seine vier Gepäckschalen wurden beanstandet. Da waren unerklärliche Metallteile im Handgepäck, deren Terrorunverdächtigkeit erst festgestellt werden musste, Flüssigkeiten fanden sich in jeder Tasche und Jacke, die durch die Scanner-Maschine geschleust wurden; es war ein einziges langes Warten. Er habe halt am Schluss alles noch in den Handgepäck-Koffer geworfen, entschuldigte er sich. – Ja, so geht’s halt, wenn man zum ersten Mal mit einem Flugzeug unterwegs ist…
Der Flug war dann, wie lange Flüge eben so sind, viel zu lang. Bevor ich nach dem Nachtessen, das um Mitternacht serviert wurde, etwas zu schlafen versuchte, dachte ich, es wäre gut, noch einen Film zu schauen. Aus dem riesigen Angebot an Movies wählte ich schliesslich den „Schellen-Ursli“, den ich zu Hause verpasst hatte - sozusagen als Einstimmung auf Südafrika.
12. Oktober
Pünktlich um Viertel nach neun Uhr landeten wir in Johannesburg. Eine gute Stunde später standen wir mit all unserem Gepäck am Ausgang und sahen uns für eine Fahrgelegenheit um. – Ein Schwarzer mit offizieller Weste und Namensbatch sprach uns an und bot seine Dienste an: Door-to-door-Transport in seinem eigenen Fahrzeug, eben ohne den nervig tickenden Zählkasten. Er verlangte 550 Rand (ca. 40 Fr.) für eine dreiviertelstündige Fahrt nach Dainfern, wo wir hinwollten. Ein fairer Deal; wir nahmen an. Seit morgens um halb sechs sei er bereits am Flughafen gestanden und habe auf Fahrgäste gewartet. Wir seien seine ersten; er war glücklich, wir waren glücklich.
Steve erzählte auf der Fahrt von seiner Heimat und seiner Familie und bot uns auch weiterhin seine Dienste an. Wir machten gleich ab mit ihm am nächsten Tag für eine ganztägige Erkundungsfahrt nach Soweto und Johannesburg.
Am Zielort wurden wir begrüsst von Richard, dem Caretaker, der uns alles im Haus zeigte, uns die Schlüssel aushändigte und sich dann in seine angrenzende Wohnung verzog. Eva und Ken, die Home Exchange-Partner, mit denen wir den Tausch Bivio-Johannesburg vereinbart haben, sind beide im Ausland, das Haus „gehört“ uns also ganz allein.
Wir richteten uns ein und am Abend freuten wir uns auf unser erstes Abendessen in Afrika. Im Tripadvisor sah ich mal nach, was für Restaurants es in der Nähe gibt.
Da stand zum Beispiel:
„Gut ist schön, der Service ist gut Restaurant etwas einfach hungrig Portionen sind nicht für Personen. Wir kommen wieder %uD83D%uDE03“
Was mach ich mit dieser Beurteilung? Am ehesten mal lachen. Aber noch komischer war die Frage von Tripadvisor unter diesen Zeilen: „Wie hilfreich fanden Sie diese Übersetzung?“
Wir fuhren dann einfach mal los, kauften unterwegs noch was zum Frühstück ein und fanden in der Nähe einen Square mit ein paar hübschen Restaurants, „Jonny‘s“ wählten wir, hatten auf der Terrasse ein feines Znacht mit Riesenportionen (zum Glück teilten wir uns in den Salat. Er hätte problemlos für vier Personen gereicht) und zahlten am Schluss mit Dessert und Wein nur grad 40 Franken.
Die erste Nacht nach einem langen Flug in einem grossen, schönen Bett zu verbringen, ist immer ein Highlight. Wir schliefen selig bis in den Donnerstag hinein, wo uns Steve pünktlich um zehn Uhr abholte.
Während der Nacht war’s kühl, aber gegen Mittag bereits wieder gegen dreissig Grad warm.
Dritter Reisetag: 13. Oktober
Den Ausflug beginnen wir mit einem Besuch im geschichtsträchtigen Soweto, wo im Hector Pieterson-Museum auf eindrückliche Art und Weise die Vorkommnisse des 16. Juni 1976 beschrieben und mit unzähligen Fotos belegt werden. Das Foto, das den 13-jährigen Jungen zeigt, der von der Polizei erschossen wurde, von einem Passanten getragen und von der entsetzten Schwester begleitet, ging damals um die ganze Welt und war wohl einer der Steine, der das Rad ins Rollen brachte, die Apartheit schliesslich abzuschaffen. - Touristen hat’s wenige, dafür umso mehr Schulklassen, die das Museum besuchen. Ein tolles Pflaster für Selfies…
Steve fährt uns auch am Haus der Minnie Mandela vorbei, und anschliessend besichtigen wir das Mandela-Haus, sicher ein Muss für jeden Township-Besucher.
Nach einem kurzen Lunch geht die Fahrt weiter entlang einer riesigen Shanty-Siedlung (es ist unmöglich sich vorzustellen, wie so viele Menschen so dicht gedrängt in solch armseligen Hütten hausen können) zur bekannten Kirche Regina Mundi und weiter nach Johannesburg Downtown. Auf dem Carlton Hotel hat’s im fünfzigsten Stock eine Aussichtsplattform. Da muss ich unbedingt hinauf, eine Stadt oder eine Gegend aus der Vogelperspektive zu sehen, ist für mich immer ein Highlight.
Letzter Fixpunkt des Tages: Old Fort. Dort wurde Mandela (man kommt nicht an ihm vorbei, alles dreht sich um ihn) während 27 Jahren gefangen gehalten. Die Führung verpassen wir grad um 10 Minuten, was mich sehr reut, aber den Ort zu besuchen, lohnt sich trotzdem. Da ist noch das ältere Gefängnis, in dem er ebenfalls einsass und auf den Erdwällen, die das Fort umrunden, kann man gut spazieren, hat einen schönen Ausblick und kann sich die ehemaligen Wärterhäuschen, die ganz schief in der Gegend stehen, ansehen.
Auf der Heimfahrt schlägt Steve vor, auch am nächsten Tag einen Ausflug zu machen. Da gäbe es einen riesigen afrikanischen Markt in Rosebank, den zu sehen es sich lohne. Zudem könnten wir nochmals zum Old Fort, um die Führung im Gefängnis doch noch zu erleben. - Ich liebe Märkte, also gefällt mir der Vorschlag ganz gut und wir sagen zu.
Wir essen zu Hause.
14. Oktober
Um elf Uhr holt uns Steve ab. Nach zweimaligem Überlegen bin ich dafür, das Programm zu ändern. Wenn ich mir vorstelle, ein paar Stunden über einen Markt zu schlendern und nichts kaufen zu können, wird mir ganz mulmig zumute. Unsere Koffer sind so voll, dass sie keine weiteren Einkäufe vertragen. Die Kleider, die ich mitgenommen habe, werde ich fast alle da lassen, aber nicht schon am zweiten Tag. Und wir werden ja noch etliche Märkte besuchen können, stelle ich mir vor.
Pretoria, die Hauptstadt von Südafrika interessiert mich. Sie wird auch Jacaranda-City genannt wegen der ungefähr 80‘000 Jacaranda-Bäume, die in der ganzen Stadt und der Agglomeration vorhanden sind. Diese Bäume mit ihrem intensiven Violett haben mich schon in Australien fasziniert, aber in der Menge, wie sie sich in Pretoria präsentieren, gibt es sie dort nicht. Man kann sich nicht satt sehen. Die wunderbaren Bäume säumen die unzähligen Alleen und auch die Strassen sind violett von all den Blüten, die bereits zu Boden gefallen sind. Und es ist genau der richtige Zeitpunkt dafür; sie blühen nur im Frühling, nur einen Monat lang, irgendwann zwischen Oktober und November.
Also fahren wir nach Pretoria. Erst Besichtigung des Voortrekker-Momuments, das sich auf einem Hügel ausserhalb der Stadt erhebt, dem Monument Hill. Es ist ein kolossaler, 40 Meter hoher Bau ohne Fenster, der ein Museum beherbergt (27 Marmorfresken, die den Grosser Treck der Buren nach Norden darstellen und den Sieg über die Zulu bei der Schlacht am Blood River 1838). Von der Aussichtsplattform hat man einen herrlichen Blick über die Ebene und die darin eingebettete Stadt.
Anschliessend fahren wir durch die Jacaranda-Alleen. Einfach überwältigend! Wir besuchen das Melrose House, ein elegantes, viktorianisches Stadthaus mit einem schönen Park und einem grob vernachlässigten Tennisplatz. Das Haus war während des Krieges 1899 – 1902 (Buren gegen Briten) britisches Hauptquartier. Drei Angestellte hat’s dort an der Rezeption; für Pensionierte kostet der Eintritt achtzig Rappen (das Doppelte für Verdiener). Wir sind die einzigen Besucher.
Steve fährt uns an den Church Square, dort, wo sich die erste Siedlung entwickelte. In unserem Führer heisst es, man könne dort in historischen Café Riche einen ausgesprochen angenehmen Halt machen. Machen wir doch.
Zweitletzter Programmpunkt vor der Rückreise ist das Pretoria Art Museum. Nicht alle Säle sind zugänglich, deshalb kostet auch hier der Eintritt nur achtzig Rappen. Das vermögen wir gerade noch. Der Saal mit der afrikanischen Kunst ist offen und genau das ist es ja, was ich sehen will. Erstaunlich ist: Wir sind auch hier wieder die einzigen Besucher.
Zu allerletzt fährt uns Steve zu den eindrucksvollen Unionbuildings. Man kann sie nur von aussen betrachten, aber man kann in den gepflegten Gärten mit Aussicht auf die Stadt verweilen und sich die riesige Mandela-Statue anschauen. Es ist dies der Ort, wo er als Präsident seine erste Rede hielt. 1994.
15. Oktober
Diesen Teil des Reiseberichts möchte ich lieber nicht schreiben. Aber manchmal kommt es halt anders als geplant.
Wir wurden von Rudolf abgeholt in seinem Safari-Jeep und machten einen Ausflug zur Wiege der Menschheit. (Immer, wenn ich Rudolf höre, denke ich an Weihnachten und an Rudolph, the red-nosed raindeer und muss lachen.) In Sterkfontein wurden Fossilien und Knochen gefunden von den ersten Menschen, z. B. Little Foot und Mrs. Ples, ihr Schädel soll 2-3 Millionen Jahre alt sein. Man wandert und kriecht durch eine Höhle (60 Meter tief, an der tiefsten Stelle), lässt sich die verschiedenen Fundstellen zeigen. Ein paar Kilometer weiter weg in Maropeng besichtigt man das Museum, wo auf eindrückliche Art die Geschichte der Menschheit dargestellt wird.
Lunch dann in einem ganz speziellen Garten-Restaurant, oben im ersten Stock auf Augenhöhe mit einer Giraffe. Ringsum ein Park für Tiere, die aus irgendeinem Grund aus dem Zoo oder Park entlassen wurden.
Wir gehen am späten Nachmittag kurz einkaufen und essen am Abend eine Kleinigkeit zu Hause. Anschliessend sehen wir uns einen Film an. Gerade, wie ich ins Bett gehen will, beginnt Theo über ein Engegefühl im Brustraum zu klagen. Dasselbe war schon am Freitagabend passiert, besserte sich aber dann rasch wieder. Nun ist’s wieder das Gleiche und wir beschliessen, ins Spital zu fahren zwecks Kontrolle. Zum Glück finden wir, dank GPS, das nächstgelegene Spital, Life Fourways Hospital fast auf Anhieb. Um halb zwölf sind wir da. Alles ist dunkel, aber wenigstens ist die Rezeption besetzt. Bis alles geregelt, unterschreiben und alle Papiere ausgefüllt sind, dauert es eine gute halbe Stunde. Schwierig wurde es mit der Anzahlung. Meine Kreditkarte fiel in Angst und Schrecken, als sie den Betrag sah und verweigerte ihre Unterstützung, was dem administrativen Angestellten an der Rezeption Stirnrunzeln und Ungemach verursachte. So ohne diese Kohle könne er keine Patienten aufnehmen, versicherte er mir. Einen zweiten Versuch startete ich anschliessend mit Theos Kreditkarte. Die wunderte sich nicht und liess die 8'000 Franken zu, was den Angestellten dazu veranlasste, einen Seufzer der Erleichterung auszustossen und zu sagen: „God bless!“. Mich dünkte, er hätte eher sagen sollen: „UBS und Kreditlimite bless“. Von da an begannen die Mühlen zu mahlen: Blutdruckmessung, Blutentnahme, Röntgen und sogleich war dem Arzt klar, Theo geht nicht mehr heim heute. Ein Wert (Cardiac Marker / Tropinin T), der normalerweise zwischen 0 und 14 liegt, zeigte bei ihm 159! - Also Intensivstation.
16. Oktober 2016
Um zwei Uhr morgens war der Kardiologe, Dr. A. Dalby an Ort und Stelle und erklärte uns, er werde am nächsten Morgen einen Eingriff machen, um eventuell einen Stent zu fixieren. Theo wurde still gelegt, fünf schwarze Schwestern standen um ihn und um sein Bett herum, schlossen ihn an Schläuche an, stellten nochmals dieselben Fragen, die wir schon zuvor beantwortet hatten. Sie nahmen ihm alles ab, was er bei sich hatte, Schuhe, Kleider, Uhr, Ehering, sämtliche e-Books und Natels, sein ganzes mit allerlei Karsumpel bestücktes Gilet. Endlich war alles erledigt und ich war bereit zu gehen, nachdem ich wieder an x Orten unterschrieben hatte. - Das Einzige, was er hätte bei sich behalten können, waren Zahnbürste und Zahnpasta. Wir hatten ein Notfall-Übernachtungs-Köfferli mitgenommen, mit Unmengen an Elektronik drin, Zeitung, E-Book, E-Zigarette, Pillen à gogo, Pyjama, etc. etc. Aber was drin fehlte, waren Zahnbürstli und Zahnpasta.
Es war drei Uhr morgens. Das Auto wollte ich mitten in der Nacht nicht nehmen, also bestellte ich ein Taxi. Da aber fragte mich eine Nacht-Schwester, ob ich nicht lieber im Spital übernachten wolle und bot mir ein Zimmer an. Ich fragte mich, ob diese Übernachtung dann auf der Rechnung erscheinen würde. Ich hatte eher das Gefühl, sie hatte Mitleid mit mir. Ihr Angebot nahm ich jedenfalls dankend an und kam somit zu etwa drei Stunden Schlaf.
Am Morgen um halb neun war der Ops parat für Theo. Eine Stunde später etwa erklärte mir Dr. Dalby, dass es schlimmer sei als angenommen mit Theos Herz und eine Bypass-Operation gemacht werden müsse. Das allerdings erst am Mittwoch wegen der vielen Medikamente, die er hatte schlucken müssen. Dr. G. Dragne (ausgesprochen: Drachne) werde die viereinhalb-stündige Operation vornehmen. Eine Verschiebung zurück in die Schweiz komme nicht in Frage.
In der Intensivstation sind die Besuchszeiten streng geregelt, so ging ich um halb zwölf nach Hause und besuchte den Patienten von drei bis vier wieder.
Erste Handlung auf der Fahrt nach Hause: Halt im Einkaufszentrum. Dort kaufte ich mir bei Vodacom ein Handy, damit ich hier im Kontakt sein kann mit der ICU (Intensive Care Unit) und unseren Exchange-Partnern, in deren Haus wir wohnen. Eva und Ken sind äusserst grosszügig und gastfreundlich und lassen mich, so lange ich will, in ihrem Haus bleiben. Auch ihr Auto darf ich brauchen. Sie kommen übers Wochenende heim, aber das Haus ist gross genug für mehr als eine Familie. Ich bin froh, muss ich nicht in ein Hotel wechseln, wo ich viel weniger Platz hätte für die kommende Zeit. Auch wohnt ja Richard gleich nebenan, der Haushalt und Garten besorgt und mir hilft, wenn ich etwas brauche (z. B. mein neues Natel in Betrieb nehmen). So langsam aber sicher werden mir die vielen elektronischen Helfer fast zu viel. Dazu kommt die Aufladerei jeden Tag und der ewige Kampf mit den tausenden von Kabeln, die Theo dabei hat, um die ich mich normalerweise nicht kümmern muss. Nun habe ich nebst dem kleinen Gerät, mit dem ich die Garage öffnen und schliessen kann, vier Handys in meiner Tasche: mein Schweizerisches, das neue Vodacom, Theos i-Phone und noch dasjenige, das ich brauche, um aus dem Ghetto hier hinaus und wieder hereinzukommen. Ghetto ist schon nicht das richtige Wort. Trotzdem kommt es uns fast vor, als wären wir irgendwie eingesperrt. Die Siedlung, in der wir wohnen, ist völlig abgesichert. Niemand kommt rein, ohne sich auszuweisen. Auch Kofferraumkontrollen werden gemacht und ohne Bestätigung der Gastgeber geht gar nichts. Vom Gate aus wird am Checkpoint angerufen, ob jemand erwartet werde und wenn ja, wer. Deshalb darf ich nie vergessen, dieses Ding bei mir zu tragen, man lässt mich sonst nicht rein. Ich antworte dann jeweils selber, wenn bei unserer Adresse (1157 Aspen Drive) angerufen wird. Erst dann geht die Barriere hoch und die gelben Zacken, die im Boden eingemacht sind, um bei Flucht die Pneus zu zerfetzen, werden eingerollt. - Natürlich merkt man nicht, dass das ganze Gebiet abgeschlossen ist, wenn man drin ist. Man sieht keine Mauern, nur Golfplätze, Villen und Vorgärten. Es ist ein riesiges Dorf ohne Zentrum, ich nenne es weisse Township. Shopping Mall und Restaurants sind ausserhalb des Gates. Nur der Country Club befindet sich innerhalb.
Gerade eben, als ich dem Security-Menschen schon meinen Fahrausweis zeigen wollte, sagte er freundlich zu mir: „I know you, you don’t need to talk to me“ und öffnete mir die Barriere. Schon ein Fortschritt also.
Das Herumkurven mit Evas Mercedes geht ganz gut, es macht mir nichts aus, auf der „falschen“ Seite fahren zu müssen. Es braucht lediglich grosse Konzentration, die mir beim Einsteigen zwar die ersten paarmal gefehlt hat. Ich muss dann über mich selber lachen, wenn ich die Tür öffne, die Tasche auf den Beifahrersitz knalle, mich setzte und dann merke, dass da gar kein Steuerrad ist.
17. Oktober
Heute hätte unsere Safari beginnen sollen. Der Tag gestaltete sich aber anders. Am Morgen hatte ich ein einstündiges Gespräch mit der Versicherung, und später ein fast so langes mit dem TCS, wo wir mit dem Eti-Schutzbrief versichert sind. Es ist eine grosse Entlastung zu wissen, dass zumindest das Finanzielle gesichert ist und dass von beiden Seiten gut gesorgt wird. Die Sorgen um Theo, um seine Gesundheit und die bevorstehende Operation sind so schon gross genug. Viel zu tun zu haben, lenkt aber ab.
Zweimal fuhr ich heute ins Spital. Beim ersten Mal wär das fast schief gegangen. Ich war dabei, das Auto aus der Garage zu manövrieren, als ich im Rückspiegel sah, dass hinter mir mindestens zehn Arbeiter aufgeregt mit den Händen fuchtelten. Sie hatten einen langen Graben ausgehoben, in den hinein sie Telefonkabel verlegen wollten. Alles war abgesperrt und es war fast schon elf, ich hätte bereits im Spital sein sollen. Der Vorarbeiter entschuldigte sich hundertmal und wies seine Untergebenen an, den Graben wieder zuzuschütten, die Steine wegzutragen und die Absperrung wegzunehmen, damit ich wegfahren konnte. Wie auf einer Galeere kam’s mir vor: Mindestens zwanzig schwarze Hände schaufelten in grosser Geschwindigkeit die Erdhaufen wieder zurück in die Grube und bald schon konnte ich losfahren. Erst war ich fast ein wenig verzweifelt und auch ärgerlich, als ich die Bescherung sah, dann kamen mir aber die Witze in den Sinn, die ich mal meinen Schülern gezeigt hatte mit dem Titel: „Nur in Afrika…“. Genau so. Nur in Afrika… (Leider finde ich die nun gerade nicht auf meinem Laptop, aber irgendwann werde ich sie vielleicht nachliefern.) Lochen die doch den Boden vor der Garage auf, ohne dies vorher anzukündigen. - Es war ur-komisch.
Als ich wieder heimkam vom Spital, sassen und lagen einige der Arbeiter im Vorgarten im Schatten der Palmen. Ich holte ihnen aus dem Kühlschrank ein paar Fläschchen Mineralwasser, die sie gerne annahmen. Es war über dreissig Grad am Mittag.
Theo geht es so weit gar nicht allzu schlecht bisher; er kann mal lange liegen, was er ja so gerne tut (sein „Indian walking“: Wär nid louft, ligt). Und er ist zuversichtlich, dass alles gut kommt. Ich natürlich auch. Das ist wichtig.
Gerne schaut er zu, was da so alles läuft in der Intensivstation. Ungefähr 30 Betten hat’s und fast alle sind besetzt. Dementsprechend hat’s eine ganze Menge Angestellte. Es ist ein Kommen und Gehen. Auch in der Nacht, sagt er. Sie sprechen miteinander und lassen Dinge fallen, es ist immer etwas los. Nicht alle nehmen’s gleich streng wie seine gestrige Tagesschwester Gladys. Wohl ein wenig anders als bei uns geht’s schon zu und her, denke ich mir. Ich habe bemerkt, dass man sich nicht allzu streng an die Besuchszeiten hält und auch die Vorschrift: „Nur zwei Besucher pro Patient“ wird kaum beachtet (von mir schon). Der Typ neben Theo hatte heute sieben Besucher um sein Bett herum stehen. Dazu schaute er Fernsehen.
Der Bildschirm ist so eine Sache für sich. Er ist klein und befindet sich weit oberhalb des Bettes. Das Flimmern alleine könnte einen krank machen. Und die Programme, die angeboten werden, na ja – erst recht. Auf etlichen Kanälen laufen Trickfilme. Tom und Jerry, meine Lieblingsfiguren als ich ein Kind war, kann man sich dort beispielsweise anschauen. Ein Kochprogramm hat’s auch. Tolle Sache für Theo. Vielleicht zeigen sie, dass man noch anders kochen kann als nur, indem man Büchsen öffnet.
Ein Programm mit Nachrichten – oh Wunder. - In Bantu oder Zulu oder was auch immer.
Leider gibt’s kein CNN. Da wird Theo sehr darunter leiden. In letzter Zeit war dies sein Lieblingssender und er konnte kaum genug bekommen von seinem Freund Trump und dessen dreisten Entgleisungen. Ich fürchte, dies könnte demnächst zu Entzugserscheinungen führen. Zusätzlich.
Ich freue mich sehr über all die Whatsapps, die ich von unserer Familie bekomme (nur sie wissen bisher, was passiert ist), die Verbundenheit und ihr Mitfühlen tun mir gut. Obwohl wir etliche tausend Kilometer voneinander entfernt sind, empfinde ich eine grosse Nähe. Nicht nur Trost, Zureden und Unterstützungsangebote helfen mir. Gerade auch Banalitäten, die wir die ganze Zeit austauschen, „do the trick“.
Wann genau die Operation stattfindet, weiss ich noch immer nicht, ich hoffe, morgen mehr zu erfahren. Und wie’s weitergeht, steht ebenfalls noch in den Sternen. Es könnte gut sein, dass wir wieder mal einen November in der Schweiz verbringen werden.
Dienstag, 18. Oktober
Bei unserer Visite am Morgen hatten wir die Gelegenheit, mit dem Ärzteteam zu sprechen und jeder hat uns genau erklärt, was er machen wird, wie was funktioniert und was die Risiken dabei sind. Eugene, der Kardio-Techniker zeichnete auf, was er mit seinen Maschinen zu tun gedenkt (wenn das Herz für ungefähr 40 Minuten nicht mehr schlägt, sorgt er dafür, dass da trotzdem noch was läuft) und George, der Chirurg, hat so bluming oder vielleicht blutig berichtet, dass mir beim Zuhören mulmig und mulmiger wurde. Ich spürte, wie mir langsam das Blut aus dem Kopf rieselte und konnte mich grad noch rechtzeitig auf das zum Glück freie Bett neben Theo legen, bevor mir ganz schwarz wurde.
Für kurze Zeit war ich dann der Mittelpunkt des Geschehens: Zwei Schwestern massen mir den Blutdruck, den Puls und der Herzchirurg hielt meine Beine in die Höhe, damit das Blut wieder dorthin zurückfloss, wo es hingehört. – Irgendwie fand ich das Ganze zum Schreien komisch. – Filmreife Szene! - Ein paar Minuten später hatte ich mich erholt und war wieder funktionstüchtig.
Kim
Sehr froh war und bin ich, dass Kim hier bei uns ist. Sie war bei all den Gesprächen dabei, hat Fragen gestellt und wirkt sehr positiv auf Theo. Und ich bin nicht allein. Es hätte mir nichts ausgemacht, „I’m a big girl“, liess alle wissen, ich brauche keine Unterstützung an Ort und Stelle, aber jetzt, wo sie da ist, bin ich total froh.
Als ich die Kinder anrief am Sonntag, waren alle natürlich entsetzt und konnten kaum glauben, was ich ihnen mitteilen musste. Kim rastete völlig aus, sagte, sie könne so nicht arbeiten, liess alles stehen und liegen und setzte sich in London mehr oder weniger ins nächste Flugzeug.
Ihre Firma, Goldman Sachs hat sie in vorbildlicher Weise aufs Beste unterstützt. Ihre Chefs haben ihr Mails geschickt und gesagt, die Familie sei jetzt wichtig, sie solle die Arbeit vergessen und nach Südafrika fliegen. Nicht einmal den Flug musste sie selber buchen. Sie kam am Dienstagmorgen um acht Uhr in Johannesburg an. Steve, „mein“ Taxifahrer, holte sie ab und brachte sie ins Hotel, das zwischen dem Spital und meinem hiesigen Zuhause liegt. Gemeinsam gingen wir dann Theo besuchen, der völlig überrascht und gerührt war, als er sie sah.
Am Nachmittag besuchten wir ihn zum zweiten Mal, aber am Abend war ich so erschöpft, dass ich nicht nochmals ins Spital fahren wollte. Ohnehin fahre ich hier lieber nicht in der Nacht, denn der Verkehr ist teilweise hektisch, die Strassen schlecht beleuchtet, es hat Fussgänge, die in jeder Verkehrslage die Strasse überqueren und Strassenverkäufer, die an jeder Kreuzung stehen und den Fahrern irgendetwas dringend Notwendiges andrehen wollen. Einige Lenker sind absolut rücksichtslos und sowieso wird davon abgeraten, in den Städten des Nachts herumzukurven.
Kim nahm sich dann ein Taxi und besuchte Theo nochmals für eine Stunde bis um neun Uhr. Anschliessend kam sie zu mir und wir tranken zusammen eine Flasche Wein ins Elend hinein. – Essen mochten wir beide nichts.
Mittwoch, 19. Oktober 2016
Um fünf Uhr bin ich wach. Langsam wird es Tag. Ein trüber Tag, es regnet leicht. Entspricht absolut meiner Stimmung. Vielleicht wird es schöner werden gegen Mittag oder zumindest gegen Abend. Es regnet hier nie lang.
Heute ist es so weit. Theo wird am offenen Herzen operiert. Um halb zehn. Viereinhalb bis fünf Stunden soll es dauern (es dauerte sechs). Irgendwie kann ich’s fast nicht fassen. Erst noch sind wir von zu Hause abgefahren, voller Pläne, was da alles auf uns zukommen würde und jetzt…. Ja, wer eine Reise tut…
Trotzdem ist alles sehr real. Um halb neun hole ich Kim in ihrem Hotel ab, es herrscht stockender Verkehr, aber wir sind um neun im Spital. Theo schläft tief; wir lassen ihn. Kim hat ihm aus London ein Gerät mitgebracht, von dem er total begeistert ist: Ohrhörer, die machen, dass man überhaupt nichts von den Umgebungsgeräuschen mehr hört, so kam er auch während der Nacht zu mehr Schlaf als in den Nächten zuvor. (Das Gerät, „noise blocker“ muss etwas ganz Spezielles sein. Kosten: 280£!)
Kim hat mich enorm aufgestellt mit ihrer positiven Art. Sie hat mir immer wieder gesagt: „positiv denken!“ und auch Javi, ihr Partner, mit dem sie ständig am Texten ist, schreibt immer wieder, wie er an uns denkt und wie wir ja nicht weinen sollen, wenn wir in Theos Nähe sind. Das ist nicht ganz einfach, aber wir schaffen das vorbildlich. Wie er schliesslich aufwacht, witzeln wir mit ihm, Kim rät ihm, er solle den Drogen-Flash geniessen und er sei ja dann morgen wieder „fit as a fiddle“.
Die Operationsschwester (eine Zulu-Frau) kommt hinzu und erklärt, was ihre Aufgabe sei und wir sollten nicht erschrecken, wenn wir ihn nach der Operation sehen würden. Er sehe dann aus „like a Christmastree“. Sie hatte damit nicht ganz unrecht, wie wir zu gegebener Zeit feststellen konnten. Er war an x Apparate angeschlossen, Schläuche hingen aus seinem Oberkörper heraus, eine Unzahl von Monitoren, in allen Farben, leuchteten und blinkten um ihn herum.
Dr. Zoran, der Anästhesist, ein sehr sympathischer Typ, kommt anschliessend vorbei und auch er erklärt uns genau, was er tun werde, dass alles für das Team „business as usual“ sei, dass wir uns aber bewusst sein sollten, dies sei „major, major operation, not serious but very serious“. Er versichert uns aber auch, dass Theo sehr gute Werte habe, eine gute Kondition und alles sicher bestens über die Bühne gehen werde. Er verabreichte ihm dann ein Dormicum, und diese Schlaftablette wirkte relativ rasch, so dass er bald dizzy wurde und kaum mehr reagierte. Dann lösten die Schwestern die Bremsen an seinem Bett und er wurde in den Operationssaal gefahren. Dies war dann doch der Moment, wo unsere Tränen flossen, aber das sah er ja nicht mehr. Es war halb elf.
Alle Ärzte hatten uns zuvor dringend davon abgeraten, im Spital zu warten, wir sollten unbedingt etwas unternehmen. Das taten wir. Autofahren wollte ich auf keine Fall, so hatte ich vorsorglich schon ein Taxi bestellt. Steve konnte nicht kommen, schickte aber einen Kollegen, der uns den ganzen Tag herumführte beziehungsweise stundenlang auf uns wartete. Das dann bei der Shopping-Mall in Rosebank. Er lachte und sagte, es mache ihm nichts aus, drei Stunden lang zu warten: „When ladies go shopping, they are very slowly”.
Aber vorerst fuhr er uns ins Old Fort, wo wir das Gefängnis besuchten, in dem Mandela lange Jahre verbracht hatte. Ich war mit Theo am letzten Freitag ja bereits einmal dort gewesen, aber damals hatten wir die Tour grad um zehn Minuten verpasst. Nun konnten Kim und ich die Tour buchen und was wir erfuhren und sahen, war äusserst eindrücklich und bedrückend. Es liess uns Theo zwar nicht vergessen, aber wir wurden abgelenkt. Die Zustände in diesem Gefängnis waren grauenhaft, ähnlich wie in den deutschen und polnischen Konzentrationslagern. Unvorstellbar, wie Menschen dieses Grauen hatten überleben können. Eingesperrt waren viele wegen lächerlicher Vergehen (die Schwarzen, weil sie keinen Pass bei sich trugen oder gegen andere Regeln der Apartheit verstiessen, eine Grosszahl von ihnen waren politische Gefangene), und das teilweise jahrelang.
Im Anschluss daran besichtigten wir das Verfassungsgericht, ein Gebäude, das grad neben dem Gefängnis und mit Teilen aus dessen Ziegelsteinen neu erbaut wurde. Auch dieser Bau ist eindrücklich in seiner Architektur; er drückt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aus. Man hat eher das Gefühl, es sei ein Kunstmuseum. Betont werden jetzt die neuen Grundpfeiler der Verfassung. Hinter den Sitzen der Richter sind zum Beispiel Tierfelle aufgehängt, in Schwarz und Weiss. Eine dünne Fensterschicht schlängelt sich um den Saal herum, so dass man auch von aussen in den Gerichtssaal sehen kann, was Transparenz versinnbildlichen soll.
Die Sonne zeigt sich noch immer nicht und ein sehr kühler Wind weht, so dass uns richtig kalt ist. Trotzdem machen wir noch den Spaziergang zu den Wachtürmen und schauen uns das Frauengefängnis an, in dem weisse und schwarze Frauen getrennt inhaftiert waren. Im Gegensatz zu dem, was wir bisher gesehen haben, ist der „weisse Teil“ grad komfortabel.
Nachdem Jerry, unser Taxifahrer, anderthalb Stunden auf uns gewartet hat, fährt er uns nach Roseberg in die Shoppingmall, wo wir erst mal zu Mittag essen und dann eben „slowly“ einen Einkaufsbummel machen. Grad auf Anhieb finde ich ein Kleid, das ich nächstes Jahr zu Kims Hochzeit tragen werde. Es wird von ihr gebilligt und für gut befunden. – Ein Problem weniger!
Um fünf Uhr läutet das Telefon in meiner Hosentasche. Es ist Dr. Zoran, der uns mitteilt, die OP sei vorbei, alles sei gut gegangen, wir könnten Theo besuchen kommen. – Was für eine Erleichterung! Sofort steigen wir ins Taxi und Jerry bring uns durch den dichten Verkehr in vierzig Minuten heil zurück ins Spital.
Die beiden Ärzte sitzen in der Cafeteria und laden uns ein, etwas mit ihnen zu trinken. Sie wirken überhaupt nicht abgekämpft, berichteten uns von der Operation und von ihnen selbst und ihren Familien. Die Operation sei nach Wunsch verlaufen, es sei „einfach“ gewesen, der Rolls Roice einer Bypass-Operation, erklärte George, weil er nicht Theos Beine hatte aufschneiden müssen, um dort Venen zu entnehmen, sondern weil es ihm gelungen sei, die „Mammary-Arteries“ für die beiden Bypasse zu verwenden, die eine sehr viel längere Lebensdauer hätten. - Ui ui ui, was man da nicht alles lernt, wenn der Tag lang ist. – Der morgige Tag mache ihnen wesentlich viel mehr Kopfzerbrechen, meinen die beiden. Da hätten sie es mit einer sehr viel komplizierteren Arbeit zu tun. Was genau, sagten sie nicht; ich vermute, es war eine Herztransplantation. - Beide kommen anschliessend mit uns mit zu Theo, checkten und erklären nochmals Facts zu seinen Werten, machen sogar noch Fotos von Theo, dem tief schlafenden Weihnachtsbaum, und uns zweien. – Die nächsten sechs Stunden seien noch kritisch, aber dann sei alles auf besten Wegen. - Er werde schlafen bis am nächsten Morgen, versicherte man uns. Da könnten wir ihn um neun Uhr besuchen kommen, und er werde ansprechbar sein.
Wir lassen den Patienten in der Obhut zweier Krankenschwestern zurück, die fleissig wie Ameisen alle Monitore überwachen und Schläuche kontrollierten. Während zwei Stunden würden sie nicht von seiner Seite weichen.
Beide sind wir wie ausgelaugt, glücklich aber total müde. Ich fahre Kim ins Hotel und mich heimzu, giesse mir ein Glas Wein ein, lasse Freunde und Familie wissen, wie’s gegangen ist und sinke dann völlig erschöpft ins Bett.
Übrigens hatte das Wetter gegen Abend gebessert und es gab sogar ein wenig Sonne. Seltsam, dieser Tag. Graue Stimmung am Morgen, kalter Wind und nichts als Wolken, Sonnenschein gegen Abend.
Donnerstag, 20. Oktober
Um neun Uhr pünktlich sind wir im Spital. Gespannt natürlich, was uns da erwartet. Theo ist wach, zwar nicht grad fit as a fiddle, aber doch recht gut ansprechbar gemessen an den Verhältnissen. Schmerzen habe er keine und aussehen tut er nicht mal so schlecht. Es ist ihm sogar schon ein wenig zum Scherzen zumute. Wie die Schwester ihn fragt, ob er etwas anderes zum Trinken wolle als Wasser, sagt er: „Jägermeister“ (erwartet hätte ich „Famous Grouse“. - Da muss doch noch etwas nicht ganz in Ordnung sein mit ihm!). – Beide Ärzte kommen auch grad vorbei, der Kardiologe und der Chirurg. Beide versichern uns, der Patient habe die Nacht sehr gut überstanden; sein Zustand sei ausserordentlich, besser als dies im Durchschnitt der Fall sei; man könne mehr als nur zufrieden sein. - Wir sind natürlich MEGA froh über diesen Bericht. Theo sei eben in guter Konstitution (bei dem vielen Sport, den er treibt, ja kein Wunder…). Und sie hätten ihn sehr viel jünger eingeschätzt.
George ist ein eher trockener Typ, aber sogar er erlaubte sich einen Scherz, indem er zu Theo sagte: „You look like you were hit by a train, but you won.“
Ein erster Trend, wie’s weitergeht: Drei Tage Intensivstation (morgen kommen die äusseren beiden Schläuche weg, übermorgen die inneren, die zum Herzen führen), anschliessend eine Woche Spitalaufenthalt. Dann wieder einigermassen mobil. AutoMITfahen ab zwei Wochen (und ich dachte, ich hätte einen Fahrer…) und fliegen erst ab drei Wochen von jetzt an gerechnet.
Erst in sechs Monaten wird der Brustkasten ausgeheilt sein. Das erfordert Geduld, ich hoffe, er hat sie.
Wir werden sehen, machen Pläne erst, wenn’s Sinn macht.
Wir müssen dann gehen, kommen aber wieder zurück zur regulären Besuchszeit um elf.
Theo sitzt bereits im Sofa neben dem Bett, was uns schon sehr erstaunt. Das müsse so sein, damit das Blut abfliessen könne, das noch in seinem Brustkasten sei. Das passt ihm gar nicht; er liegt ja lieber. Er sei sehr müde und wolle schlafen, aber nicht im Sitzen, so macht er seine Absicht klar. - Ein kleiner Schweissausbruch, ein wenig jammern und schon legen ihn drei Schwestern gemeinsam wieder aufs Bett. Er sieht tatsächlich sofort besser aus. Die Verantwortliche aber sagte uns, sie müsse ihn bald wieder auf den Stuhl setzen, sonst erhalte sie vom Arzt einen Rüffel. Wir gehen dann, weil wir ihn schlafen lassen wollen. Drei Stunden später fahren wir wieder hin.
Er sieht den Umständen entsprechend gut aus, gar nicht etwa bleich, aber natürlich ist es noch ein sehr langer Weg bis zur Genesung.
Er hat jetzt auch ein wenig Schmerzen, sie geben ihm Mittel dagegen, aber alles mit Mass, wie George sagt. Ich bin sicher, dass diese Ärzte alles bestens im Griff haben. Dafür bin ich sehr dankbar.
So ist also Theo gerade noch rechtzeitig und erfolgreich dem Sensenmann entgangen. Was hatten wir doch für ein Glück! Wäre das Ganze drei Tage später auf der Safari passiert… Oder vor einem Monat in Spanien… Auch nicht die Erheiterndste aller Vorstellungen.
Aber hier in Südafrika, wo die besten Herzchirurgen der Welt tätig sind und das Team hier mehr als nur überzeugt hat, waren und sind wir in besten Händen. Was uns auch beeindruckt, wie locker der Umgang mit den Ärzten ist, wie nett und freundlich alle sind – wir haben genau den richtigen Ort gewählt, um dieses Drama zu überstehen.
Zwischen Spital und „zu Hause“
„Hallo, Mami, the door is open for you!“, so werde ich nun oft begrüsst von den Angestellten am Gate. Die meisten kennen mich und so hab ich freie Fahrt durchs „Pre-cleared-visitors-door“ und muss nicht mehr in der oft langen Kolonne anstehen und die ganzen Ein- und Ausfahrtskontrollen über mich ergehen lassen. Mama oder Mami (Koseform) werde ich hier oft genannt, etwa gewohnheitsbedürftig zwar, aber doch irgendwie rührend.
Als wir gestern Morgen (21. Oktober) ins Spital kamen, ging’s Theo nicht so gut. Er hatte die ganze Nacht nicht schlafen können, hatte Gespräche zwischen Krankenschwestern mitbekommen, die hinter seinem Rücken Meinungsverschiedenheiten ausgetauscht hatten über die Handhabung irgendwelcher Geräte, hörte später auch, wie ein Arzt zu einer Krankenschwester sagte, er traue ihr nicht, beklagte sich über zwei Schwestern, die die ganze Nacht in seiner Nähe laut zusammen geschwatzt hatten. Auf Berndeutsch sogar, habe er das Gefühl gehabt. All das regte ihn auf, und das ist ja nicht gut für ihn. (Später hat er selber gemerkt, dass diese „Wahrnehmungen“ offenbar zumindest teilweise nicht real, sondern irgendwelche Hirngespinste gewesen sein müssen – zurückzuführen auf seinen Zustand und die Medikamente.)
Jedenfalls erhielt er inzwischen ein paar Schläuche mehr und zwei Blutkonserven, was nicht vorgesehen war. Im Gegenteil, der Chirurg hatte uns nach der Operation gesagt, er habe überhaupt kein Blut gebaucht. Wenn es ohne funktioniere, sei das ein äusserst gutes Zeichen. – Man beruhigte uns aber, es sei trotzdem alles in Ordnung.
Als wir am Nachmittag wiederkamen, ging es ihm bereits erheblich besser.
Aus seinem Brustkasten hängen vier Schläuche (Pipelines kommt den Tatsachen näher, finde ich), die natürlich seine Beweglichkeit stark einschränken. Die sind da, um Blutreste und andere Flüssigkeiten aus dem Herzen und der Lunge zu pumpen. Zwei davon hatten sie ihn nach unserem Besuch weggenommen. Das sei eine grosse Erleichterung gewesen, meinte er.
Ich hab ihm auch sein i-Phone und den i-Pad gebracht, was die Schwester zwar ausdrücklich nicht haben will, er aber schon. – Ich misch‘ mich nicht mehr ein.
Ein paarmal waren wir dabei, als Thabela Ramban kam (so steht’s auf ihrem Namensschild), um die Mahlzeiten-Bestellung aufzunehmen. Bei uns erhält man im Spital einen Zettel, den man studieren, ausfüllen und schliesslich abgeben kann. Das ist hier nicht so. Es gibt nur ein Blatt Papier, und das sieht kläglich aus. „Wie wes ä Chue hät i dr Schnure gha“, wie man im Berndeutsch sagt. Die Hostess, so steht’s auf dem Batch neben Thabelas Namenschild geschrieben, geht von Patient zu Patient, jeder nimmt den Zettel in die Hand (Hilfe-Bakterien!), versucht mühsam die kaum lesbare kleine Schrift zu entziffern und teilt ihr dann seine Wahl mit. Dann geht sie weiter zum nächsten Patienten. Auch mit der Lesebrille gelingt es mir nicht, zu entziffern, was dort steht. Zudem ist der Zettel immer „verchrümelet“ und oben rechts ist ein Teil ausgerissen, was Theo am ersten Tag dazu veranlasste zu fragen, ob es Mäuse habe im Spital. – Kim wollte gestern das Corpus Delicti fotografieren, aber Thabela sagte, sei bringe morgen eine neuen Liste. Wohl wurde ihr zum ersten Mal bewusst, dass die aktuelle nicht gerade photogen ist. – Mal sehen. Bis sie ihren Rundgang gemacht hat, dauert’s.
Wenigsten ein Job mehr. 27 % Arbeitslose hat’s in diesem Land.
Kim regt sich ein wenig auf über den Menuplan. „Ein leichtes Menu für Dad“, da kommt nur ein Schulterzucken. Die Hostess weiss nicht, was „leicht“ in diesem Zusammenhang bedeutet, verspricht aber, sich zu erkundigen. Am Mittag Spaghetti, am Abend Makkaroni, tags darauf Meetballs mit „creamy“ Sauce – na ja… Vegi-Menu- Angebot gibt’s übrigens auch keine. Nicht, dass Theo sich das wünschen würde, „unerstaunlicherweise“ findet er das Essen gar nicht schlecht.
Überraschung
Nach dem Spitalbesuch fahren wie zu einem Geschäft, das Hochzeitskleider anbietet: Pronovias „De La Vida Bridle Couture“, eine spanische Brand, das Geschäft gibt’s auch in London, aber Kim sagt, man müsse sich dort einen Monat vorher anmelden. Vielleicht ist es hier nicht so. Wir erfahren‘s nicht, denn das Geschäft ist geschlossen. Ein neuer Anlauf wird gemacht werden müssen. In der Nähe, wo Kim wohnt, hat es eine Einkaufs- und Restaurant-Meile. Wir nehmen einen Apéro dort (ich ein Coke Zero, weil ich ja noch Auto fahren muss) und essen auch gleich im „Brazen Head“. In jedem Restaurant, in dem wir bisher waren, hat’s mehr oder weniger dieselbe Karte, und das sogar im mehr oder weniger gediegenen Country Club mit Blick auf den Golfcourse in unserem „Ghetto“. Pizza, Wraps und Burger fehlen auf keiner.
Nach dem Essen fahre ich Kim in ihr Hotel zurück und mich nach Dainfern.
Inzwischen ist Ken, unser HomeExchange-Gastgeber, heimgekommen. Zum ersten Mal begegnen wir uns; bisher waren wir nur mit Emails in Verbindung gewesen. Er versichert mir erneut, ich könne im Haus bleiben, so lange ich wolle, später auch wieder mit Theo, und Richard, der Caretaker, sei die ganze Zeit zu unserer Verfügung. Er selber und seine Frau würden am nächsten Mittwoch wieder abreisen, das Haus sei dann so oder so wieder leer. Ursprünglich hatten wir ja abgemacht, das wie vier Tag und Nächte im Haus bleiben und anschliessend auf Safari gehen würden. Nun also wird aus dieser kurzen Zeit ein ganzer Monat. Und mein Angebot, zumindest etwas fürs Auto zu zahlen, das ich täglich brauche, lehnt er kategorisch ab.
Diese Gastfreundschaft ist überwältigend. Wie gesagt, eigentlich kennen wir uns ja nicht einmal.
Wir trinken ein Glas Wein und ich gehe dann schlafen, (Richard hat inzwischen Zimmer und Bad sauber gemacht und das Bett frisch angezogen – wunderbar!) lösche ab, werde aber gleich wieder geweckt vom Surren meines Telefons, das ich hier auch des Nachts nicht ausschalte.
In Whatsapp erscheint ein Bild von Theo im Bett, daneben Diegos Kopf. Ich schreibe zurück: „Photoshop?“ Javi reagiert aus London fast gleichzeitig mit derselben Vermutung.
Nein, real! – Ich kann‘s nicht fassen: Diego ist ebenfalls nach Johannesburg geflogen, Debo bestätigt es. Er fuhr offenbar gleich ins Spital und hat anschliessend ein Zimmer gebucht in derselben Lodge wie Kim. – Was für eine Riesenüberraschung muss das gewesen sein für Theo! Eine Mega-Überraschung natürlich auch für uns. Kim ist fast ausgeflippt, ihren Zwilling bei sich zu haben. Leider bleibt er nur zwei Nächte, aber daraus wollen wir alle vier zusammen das Beste machen. – Ich kann mir gut vorstellen, dass die beiden in diese Nacht nicht zu sehr viel Schlaf gekommen sind.
22. Oktober
Weil er so kurzfristig keinen Direktflug finden konnte, flog Diego hierher mit Stopover in Abu Dhabi. 18 Stunden dauerte das „Vergnügen“. Er sagt, das mache ihm nichts aus, er habe die ganze Woche nicht richtig schlafen können, er wolle Theo sehen und sich vor Ort überzeugen, dass alles gut läuft.
Wir haben natürlich grosse Freude, ein weiteres Familienmitglied hier zu haben, sei’s auch nur für sehr kurze Zeit. Den Rückflug hat Diego am Sonntagabend.
Gemeinsam fahren wir um elf Uhr ins Spital zu Theo. Er habe eine gute Nacht gehabt und schlafen können. Wir sind erleichtert. Er sieht auch besser aus. Obwohl mit dem Blut, das noch immer aus seiner Lunge tropft, etwas nicht ganz in Ordnung ist, ist er nicht einmal sehr besorgt. Ich will mich auch nicht stressen lassen und denke, die Ärzte hier haben’s im Griff. Kim macht sich grosse Sorgen, möchte den Arzt sehen, der allerdings im Wochenende ist. Sie schreibt Emails und bittet um eine Besprechung. Die Schwester beruhigt, der Stellvertreter sei vorher da gewesen, alles sei im grünen Bereich.
Vor der Eingangstür zur Intensivstation sitzt ein Security-Guard. Er hat und macht immer ein finsteres Gesicht, ich grüsse ihn jeweils freundlich, er schaut konstant an mir vorbei und sagt kein Wort. Nun aber kommt er herein und weist uns darauf hin, es seien nur zwei Besucher pro Patient erlaubt. – Jetzt ist es an mir, auszuflippen. Natürlich steht das so geschrieben, nur, niemand hält sich daran. Diego ist nur einen Tag lang hier, er hat einen langen Flug hinter sich, um Theo zu sehen. Bei den anderen Patienten, vor allem den schwarzen, hat’s jeweils ganze Trauben ums Bett herumstehen. Auf nicht mehr sehr höfliche Art lasse ich ihn wissen, was ich von seiner Intervention halte. – Er verzieht sich.
Am Mittag gehen wir drei essen. Auch wenn die Menu-Karten eher fastfoodmässig daherkommen, ist das, was schliesslich serviert wird, in der Regel sehr schmackhaft und gut. Diego hat Hunger und von den grossen Portionen, die wir bestellen, bleibt nichts übrig.
Wir fahren anschliessend heim zu mir, damit ich auch Diego zeigen kann, wie und wo ich wohne, und Ken lernt unsere Zwillinge kennen.
An jeder Kreuzung, an jedem Rotlicht, ich hab’s schon erwähnt, hat’s Bettler und Verkäufer, die einem rasch etwas andrehen wollen, wenn man anhalten muss: Zeitungen, Rosen, Früchte, Getränke, Sonnenbrillen, Kopfhörer und so weiter. Natürlich lehne ich immer ab, jedoch muss ich sagen, dass sie alle freundlich bleiben und nie einer frech wird, wie ich das in anderen Ländern schon erlebt habe. Nein, diese hier lachen oft, grüssen, wenn sie einen wiedererkennen (ich fahre ja immer dieselbe Strecke) und lassen einen Spruch fallen. Diesmal war’s ein Typ mit einer Menge Sonnenhüten. Er war ganz originell drauf und sagte: „This is my outdoor-business and I’m the CEO”. - Der nächste wollte uns Handtaschen andrehen. Diego lehnte sich zum Fenster hinaus und sagte, auf uns deutend: „These are ladies. They don’t need any bags. They have tons of them at home.” – Das zu begreifen hatte der Verkäufer keine Mühe. Er zog ab.
Um zwanzig vor drei ist es wieder Zeit, ins Spital zu fahren. Wieder geht’s Theo ein wenig besser, haben wir den Eindruck. Er ist ganz guter Dinge. Er braucht im Moment auch keinen weiteren Blutbeutel, die beiden Schläuche, die noch immer in seiner Lunge stecken und die heute hätten entfernt werden sollen, ist er aber noch immer nicht los. Vielleicht dann morgen. Theo möchte so oder so lieber noch einen Tag länge in der Intensivstation bleiben. Da wird er halt während 24 Stunden überwacht, in einem Spitalzimmer dann nicht mehr.
Schwierig ist für ihn einfach die Kommunikation mit den Schwestern, die alle kein deutliches, korrektes Englisch sprechen. Mit Raten kommt man oft weiter. Fantasie hilft manchmal auch. „Schüschca too“ wurde von Diego endlich verstanden als „Surgical 2“.
Nachdem die Besuchszeit abgelaufen ist, fahren wir drei zusammen in die nächstgelegene Mall. Diego kauft ein Aufladekabel für Theos iPhone, das ich dummerweise nicht bei mir hatte; Kim und ich erkunden noch ein paar Läden.
Am Abend gehen die beiden nochmals Theo besuchen und holen mich dann um neun Uhr ab. Wir gehen in den Country Club, der sich hier im „Ghetto“ befindet, Nachtessen. Diego hat ja ein Auto gemietet und er bietet an, dass er fährt und Kim und ich uns einer Flasche Wein widmen können. Das nehmen wir gerne an.
Wir essen draussen, es ist recht warm. In der Ferne muss ein kräftiges Gewitter toben, Wetterleuchten und Blitze zeugen davon. Plötzlich kommt auch bei uns ein heftiger Wind auf. Mit Tellern, Gläsern und Besteck verziehen wir uns fluchtartig in die Bar, und es dauert keine Minute, schon setzt ein starker Regen ein. – Glück gehabt! – Eine halbe Stunde später ist es Zeit zu gehen. Wir brauchen keinen Schirm mehr, der Regen hat bereits wieder aufgehört und Diego fährt mich heim.
Sonntag, 23. Oktober
Ich habe zum ersten Mal seit Tagen recht gut geschlafen. Wir treffen uns um elf im Spital. Zu dritt. Der Security-Guard macht keinen Mucks. Der hätte sich sonst wieder „a piece of my mind” anhören müssen.
Dummerweise habe ich mein Telefon heute Morgen nicht gehört. Eva, Kens Frau, ist inzwischen ebenfalls angekommen und wir tranken zusammen eine Tasse Tee im Garten. Kim und Diego versuchten, mich zu kontaktieren, aber eben leider vergeblich. Das Spital hatte sie angerufen, der Chirurg sei vor Ort und würde gerne unsere Fragen beantworten. So war‘s dann halt nur ein Gespräch zu dritt, aber ich wurde von den Zwillingen bis ins kleinste Detail informiert. – Erfreulicherweise gibt’s nur Gutes zu berichten. Alles laufe bestens und Theo könne nach unserem Besuch am Mittag in ein Spitalbett überführt werden. Und genau so ist es dann auch. Er erhält sogar ein Einzelzimmer, ebenerdig mit Blick ins Freie. Zwei Perlhühner wackeln grad vorbei. - Nach einer Woche in der Intensivstation endlich ein wenig Privatsphäre – Judihui! – Und nur noch wenige Schläuche; diejenigen in den Armen und Händen sind endlich weg. Wir sind glücklich! Eine hübsche Physiotherapeutin ist schon zur Stelle – wir gehen, uns braucht’s jetzt nicht mehr.
Über Mittag fahren wir heim, holen Theos Laptop inklusive Maus und Auflade-Kabel, Brille und Uhr und gehen nochmals ins Clubhaus essen. Jetzt sieht‘s anders aus als gestern Abend, wo es kaum Gäste hatte und natürlich dunkel war. Es ist ein schöner Ort. Mit Blick auf den Golfplatz kann man in Ruhe seine Mahlzeit geniessen. Mit knapper Not erhalten wir noch einen Tisch im Garten, denn es hat eine Menge Besucher heute, an diesem herrlichen Tag. Es wird auch Buffet angeboten, ein Schwein am Spiess gebraten, wir essen à la carte. - Die Gäste sind weiss, das Servierpersonal schwarz.
Essen im Spital
Darüber hab ich bereits berichtet, hier kommen aber der zweite und der dritte Streich:
Einer kommt ins Zimmer mit einem Servierboy voller kleiner Säckli mit Chips, Nüssli, Schokoladeperlen und anderen Süssigkeiten. Wie die Tamilen mit dem Büffet-Wägeli in der SBB. Er geht bei allen vorbei, auch bei den Diabetikern??? !!! - Eben wurde gesagt, Zucker, also auch Schokolade und Fett seien Gift und müssten unbedingt vermieden werden…
Zum Mittagessen gibt’s zwei grosse, fette Bratwürste. Ein wenig Kartoffelstock noch dazu…
Also wirklich! - Klar hat er das bei Thabela bestellt (Lunch - Menu Nr. 2), aber nein.
Ob sie da schon mal was gehört haben von Diäten, abgestimmt auf die jeweiligen Patienten? – „Huere ungsundi Ernährig“, sagt Kim.
Die Ärzte sind absolut top. Sie sind hier gar nicht angestellt, arbeiten auf eigene Rechnung, sind Freelancer. Sie sagen selber, der Betrieb hier sei nicht immer ganz über alle Zweifel erhaben, aber das sei eben Afrika. Theo kann ein Liedchen davon singen, wenn seine Stimme dann wieder normal tönt. Bei der Anstellung gebe es viele Bedingungen und Vorgaben, und diese seien nicht unbedingt der Sache (Pflege der Patienten) förderlich. - Ausbildung und Standard sind nicht wie in der Schweiz. So viel ist klar.
Zurück im Spital hat Diego nur noch kurz Zeit, sich von Theo und uns zu verabschieden, dann muss er los, Destination R. O. Tambo-Flughafen, Abu Dhabi, Genf, Ittigen.
Es war eine schöne Zeit mit ihm, wenn auch nur kurz. Wir haben sie genossen und sind ein wenig traurig, dass er geht. Er aber sagt, es sei ok für ihn, seine „Mission“ erfüllt, alles im Lot, er könne beruhigt heimkehren.
Alle diese Tage werden wir wohl nicht so schnell wieder vergessen.
23. Oktober
Am Sonntagabend gibt’s Besuch im Haus in Dainfern. Ein Ehepaar aus Alaska, Kathy und Mike, sind soeben angekommen. Genau wie wir haben sie den Weg hierher durch Home Exchange gefunden und genau wie wir haben sie mit Eva und Ken abgemacht, erst ein paar Tage in Johannesburg zu verbringen und anschliessend mit Ken, der Jurist und Besitzer eines Safari-Reisebüros (www.barefoot-safaris.com/">www.barefoot-safaris.com/) ist, eine zweiwöchige Safari zu unternehmen. Im Unterschied zu uns sind Eva und Ken letzten Sommer bereits für drei Wochen in Alaska gewesen, Bivio haben sie noch zugut. Und im Unterschied zu uns treten sie am Mittwoch diese Safari auch wirklich an.
Die beiden Neuankömmlinge sind todmüde, Eva hat aber gekocht; wir essen alle zusammen. Gesprächsthema ist vor allem Theo. Mike ist Arzt und Kathy hat als Schwester im Spital in der Aufwachstation gearbeitet, so wissen beide bestens Bescheid drüber, was genau passiert ist und weiterhin passieren wird.
Sie nehmen regen Anteil an unserer traurigen Geschichte.
Wir gehen alle früh schlafen.
Diego ist wieder abgereist, inzwischen ist er angekommen nach seinem langen Flug. Alles ist gut gegangen, wir sind froh, vermissen ihn aber bereits.
Montag, 24. Oktober
Die Schwestern haben uns gesagt, dass auch im Spitaltrakt dieselben Regeln gelten wie in der Intensivstation, nämlich Besuchszeiten nur von elf bis halb zwölf, von drei bis vier nachmittags und abends noch von halb acht bis halb neun. Daran haben wir uns gestern gehalten, bis uns der Arzt sagte, das stimme überhaupt nicht, für uns sowieso nicht; wir könnten kommen und gehen, wie es uns beliebe. - Darüber sind wie sehr froh; es ist einfacher. Davon hätte übrigens auch Diego gestern profitieren können, aber wir hielten uns ja an die Regeln.
Heute nun sind wir wieder gegen Mittag im Spital. Theo geht es merklich besser. Was uns Sorgen macht, sind immer noch die beiden Pipelines, die in seinen Oberkörper eingelassen sind und aus denen nach wie vor ständig Flüssigkeiten in zwei Glasbehälter tropfen, die aussehen wie überdimensionierte Konfitüre Gläser (Himbeergelée könnte es sein). Um zu sehen, wie’s aussieht mit dem Zuwachs, knien die Schwestern jeweils auf den Boden, machen einen Strich am Glas und anschliessend eine Notiz im Journal. Einfacher wäre es wohl, die Behälter aufzuheben und auf den Tisch zu stellen, aber vielleicht sehe ich das falsch.
Kim und ich, wir möchten nochmals mit Dr. Dalby, dem Kardiologen, über das weitere Vorgehen sprechen. Er ist in seiner Praxis im Nebentrakt und wir warten dreiviertel Stunden, bis er uns empfängt. Er beruhigt uns bezüglich dieser Drainage, das könne vorkommen, sei eben eine der zuvor als möglich beschriebenen Komplikationen, weiter aber nicht bedenklich, wenn man sie im Auge behalte. Er rechne, Theo könne in wenigen Tagen entlassen werden und zwei Wochen nach der Operation könnten daraufhin die Fäden beziehungsweise Klammern entfernt werden. – Wir bedanken uns und gehen in die Cafeteria, um draussen eine Kleinigkeit zu Mittag zu essen. Da kommt zufälligerweise Dr. Zoran, der Anästhesist, vorbei, sieht uns und setzt sich an unseren Tisch. Er trinkt mit uns eine Tasse Kaffee und eine geschlagene Stunde lang sprechen wir über Theo, die Zustände in afrikanischen Spitälern, über seine Heimat und die Welt. Er ist Jugoslawe, sein Kollege George, mit dem er seit Jahren zusammenarbeitet, Rumäne und beide wollen zurück nach Europa, sobald sie pensioniert sind. Er ist so charmant und sympathisch, man muss ihn einfach gern haben. Dann muss er gehen, ein weiter Herzpatient wartet im Operationssaal.
Zum „Dreamteam“ (Theo nennt sie die „Balkanmafia“) gehört übrigens auch noch Eugen, der Kardio-Techniker. Er ist Serbe. – Ich habe mir ernsthaft vorgenommen, nie mehr Witze zu machen über unsere östlichen Nachbarn in Europa.
Zurück bei Theo ist wieder nicht ganz klar, ob die Schläuche endlich entfernt werden können oder nicht. Die Schwestern sagen ja, sind sich aber nicht sicher, ob beide und wenn nicht, derjenige rechts oder derjenige links. Grosse Verunsicherung einmal mehr. Kim und Theo beharren darauf, erst nochmals die Meinung des Arztes abzuwarten, womit sie eindeutig Recht haben. Ich denke jeweils, die Schwestern wissen schon, was sie zu tun haben, man muss ein wenig Vertrauen haben, aber allmählich kommen mir doch auch Zweifel.
Die Schläuche bleiben schliesslich, wir fahren heim und treffen uns wieder um sieben Uhr bei uns. Gemeinsam fahren wir einmal mehr in den Country Club, wo wir sechs zusammen essen. Ich lade die ganze Gruppe ein, so kann ich mich ein ganz kleines Bisschen erkenntlich zeigen für all die grossartige Gastfreundschaft, die mir hier widerfährt.
Dienstag, 25. Oktober
Es war ein langer Tag heute. Um halb elf sind wir im Spital, wieder sind wir einen Schritt weiter, ein paar Kanülen sind weniger und das ganze Gesteck an Theos Hals ist ebenfalls weg.
Grad rechtzeitig kommen wir an, denn Dr. Dalby hat eine Ernährungsberaterin hinbestellt, mit der wir nun zu viert das weitere Vorgehen punkto Ernährung besprechen können. Gut sind wir dort, so kann Theo keine Lügen erzählen oder netter gesagt, nicht seine Witzchen machen, die sie so oder so nicht verstehen würde. Kim hat ihn mehrmals ermahnt, er solle sagen, wie’s wirklich ist, was er isst beziehungsweise nicht isst. – Im Klartext!
Die junge Frau erklärt uns, was gut ist, was schlecht, und wo man selten mal auch einen Ausnahme machen kann. Speziell auf diese Ausnahmen wird sich Theo konzentrieren. – Ich kenne ihn!
Nachdem Debbie gegangen ist, kommt die Physiotherapeutin und lädt ihn auf einen Spaziergang ein. Ein spezielles Schauen ist das mit seinen beiden Flaschen, die mitspazieren müssen. Wie Hanteln sehen sie aus. Eine rechtes, eine links. Aus den Schläuchen kommt nach wie vor zu viel Flüssigkeit. Wäre das nicht der Fall, hätte er gestern oder vorgestern bereits das Spital verlassen können. Wir setzten uns in die Cafeteria; es ist das erste Mal seit zehn Tagen für Theo, dass er draussen an der frischen Luft ist. Er geniesst es, mich aber erinnert die Szene irgendwie an Drakula, der sich soeben mit genügend frischen Blutkonserven eingedeckt hat.
Theo bestellt sich, dreimal dürft ihr raten: a) einen Fruchtsalat b) einen Gemüseteller c) Einen Kaffee mit weisser Schokolade. - Und das, nachdem Debbie grad erklärt hat, wie schlecht Zucker sei. Natürlich hat sie auch gesagt, ein kleines Dreieck Toblerone hin und wieder sei ok. – Da fangen wir doch gleich mal damit an…
Apropos Fruchtsalat: Den bestellt er nun immer, um sein Gewissen zu beruhigen, vermute ich. So stehen jetzt bereits ein Teller und eine Schale mit Früchten, die er aus dem Menu ausgelagert hat, auf der Ablage, „für später“, wie er sagt.
Übrigens ist nun doch noch eine Menu-Karte mit leichter Kost aufgetaucht. Es gibt sie also doch. Die bekommen wir allerdings erst zu Gesicht, seit wir uns bei Dr. Dalby beklagt haben. (Anmerkung einen Tag später: Das Wort „diet“ ist wohl nur zur Dekoration da.)
Zurück im Spitalbett ist Theo ziemlich erschöpft. – Ruhen kann er aber nicht lange. George, der Chirurg, kommt auf Visite, untersucht Theo und sieht sich im Protokoll an, was gelaufen ist. Mit den Schwestern ist er gar nicht zufrieden und liest ihnen die Leviten. Deutlich! - Offenbar haben sie selber etwas an den Medikamenten geändert und auch eines unterschlagen, das sie ihm hätten geben sollen. – Jetzt kommt Leben in die Bude. Sieben Schwestern, inklusive Stationsschwester (Trine, „the skinny one“, wie Dr. Dalby sagt) kommen ins Zimmer und jetzt geht offenbar alles nach Buch. Sie legen sogar Plastikschürzen an. Was genau sie an ihm herummachen, sehe ich nicht, denn ich verlasse mal besser den Ort des Geschehens.
Wie der ganze Spuk nach etwa zwanzig Minuten zu Ende ist, sind die beiden roten Flaschen ersetzt und er hat ein weiteres Pflaster auf dem Handrücken, wo sie ihm zum x-ten Mal Blut genommen haben.
Ich bin ziemlich müde, die ganze Geschichte hier ist anstrengend. Für Kim auch. Aus dem Grund hat sie sich zwei Stunden Fitness gegönnt in einem Spa ganz in der Nähe. Sehr gute Idee! – Jetzt kommt sie zurück, wir bleiben noch ein wenig, gehen dann heim.
Alle sechs (Eva, Ken, Kathy, Mike, Kim und ich) gehen wir auch heute Abend wieder zusammen essen. Diesmal im Montecasino, einem absolut speziellen Ort. Der ganze Komplex ist riesengross, hat die Ausmasse eines Dorfes. In der Mitte gibt’s ein Kasino mit unzähligen Geldspielautomaten wie in Las Vegas, darum herum ist ein italienisches Dorf gebaut mit Plätzen, Häusern, Brunnen, sogar ein Bach ist da, eine Wäscheleine hängt über der Strasse zwischen den Häusern – man wähnt sich in der Toskana. – Absoluter Kitsch natürlich; es ist zum Schreien. Trotzdem ist dieses Make-Believe-Dorf, das da aufgebaut wurde mitten in Johannesburg, echt sehens- und besuchenswert. Und man fühlt sich wohl in diesem seltsamen Italien. Wir essen draussen auf einer Piazza. Der Salat, den Kim und ich bestellt haben und den wir teilen wollen, reicht reichlich für uns alle sechs und wir lassen den Rest noch einpacken als Doggie-Bag. Das Essen ist sehr fein, der Service ausgezeichnet.
Drei Theater beherbergt der Komplex zusätzlich und fünfzehn Kinos. Offenbar hat’s auch noch eine Menge Läden, eine ganz Mall, die ebenfalls zu Montecasino gehören, die wir aber nicht gesehen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass Kim und ich…
Morgen geht für Kathy, Mike und Ken die Safari los. Spätestens um sechs wollen sie starten. Eva fliegt geschäftlich nach Kenia, sie muss auch früh raus, also fahren wir gleich nach dem Essen nach Hause und verabschieden uns. Nur Eva werde ich noch sehen, sie kommt am Freitag wieder heim.
Mittwoch, 26. Oktober – „Klammertag“
Heute vor einer Woche wurde Theo operiert. Was für ereignisreiche Tage seither!
Um halb elf sind wir im Spital. Sie haben Theo das Pflaster auf der Brust weggenommen, eine lange, blutverkrustete Narbe ist zu sehen, die schön gleichmässig mit lauter Klammern zusammengeheftet ist. 32 an der Zahl! - Kim wagt einen Blick darauf aus nächster Nähe, ich bin nicht so tapfer.
Aber da sind immer noch die Schläuche… George kommt, wie immer in seiner Strassenkleidung, und sagt genau das Gleiche. Eine Schwester ist beauftragt, diese Tubes zu entfernen. Es geht ihm aber zu lang, bis sie da ist, so legt er gleich selber Hand an, krempelt seine Hemdsärmel rauf, desinfiziert sich die Hände und legt los. Kim und ich, wir machen uns schleunigst aus dem Staub.
Nach fünf Minuten ist die Sache erledigt. Von ihm aus könne Theo am nächsten Tag heim, sagt er. Kim fällt ihm um den Hals. Er lacht, herzt sie auch und sagt, zu mir gewandt: „I like her“.
Am Mittag haben wir einen Brautkleid-Anprobe-Termin, bei dem spanischen Designer, wo wir vor kurzem bereits einmal waren. Erste Triage: Wir kämpfen uns durch zwei dicke Kataloge hindurch. Dann geht’s zur Anprobe. Eine weitere Stunde dauert die Modeschau, dann weiss Kim ziemlich genau, womit sie Javi im nächsten Juni überraschen will.
An verschiedenen Kleidern hat’s hinten am Rücken eine ganze Reihe von Knöpfen. Spontan erinnern mich diese an die Klammern auf Theos Brust, die ich vor kaum zwei Stunden gesehen habe. Ok, ok, schon ein vielleicht allzu weit hergeholter Vergleich, aber trotzdem… Und nochmals Klammern: Die Kleider, die Kim anprobiert, werden auf ihrem Rücken mit solchen zusammengeheftet.
Das alles macht Hunger und wie gehen eine Kleinigkeit essen in einem nahegelegenen Restaurant, bevor wir wieder ins Spital zurückfahren.
Wir begleiten Theo in die Cafeteria. Er ist jetzt ohne seine beiden Konserven unterwegs, aber immer noch im Spitalnachthemd. Morgen wird er auch das los sein.
Zurück im Zimmer warten wir auf Dr. Dalby. Er ist sehr zufrieden mit Theos Genesung und bestätigt, dass Theo morgen heimgehen kann. Um zehn sollen wir ihn abholen kommen. Sehr aufgestellt verlassen wir das Spital und den Patienten und fahren nochmal ins Montecasino, wo wir uns ein paar Einkäufen widmen, uns ein Sushi-Nachtessen gönnen und anschliessend ins Kino gehen. Einen Psychokrimi schauen wir uns an („The Girl on the Train“. - 3 Fr. kostet das Ticket), grad so als ob wir noch gar nicht genug vom Psychokrimi der letzten Woche hätten.
Um zehn Uhr fahren wir bei Blitz und Donner und Regenguss zurück zu unseren Unterkünften. Ich muss Kim whatsappeln, dass ich gut angekommen bin. Schon kürzlich hat sie mir gesagt, dies sage zwar normalerweise nur eine Mutter zum Kind, aber jetzt sei’s eben umgekehrt, sie wolle es einfach wissen.
Inzwischen habe ich mich auch daran gewöhnt, des Nachts heimzufahren, dort, wo ich den Weg gut kenne. Wenn’s regnet, ist es allerdings doppelt unangenehm mit der schlechten Beleuchtung. Aber einen Vorteil hat es doch: Der Regen hat all die Bettler und Verkäufer von den Kreuzungen vertrieben, man muss nicht mehr damit rechnen, dass einer unverhofft vor oder neben dem Auto auftaucht.
Donnerstag, 27. Oktober – Entlassung aus dem Spital
Letzte Fahrt zum Spital vorläufig. Leider finden wir keinen Parkplatz am Schatten. Das wird eine Sauna werden, bis wir hier wegfahren können. - Das Köfferchen mit Theos Kleidern ist im Kofferraum. Nur bringe ich den nicht auf. Das wär ein Anfang… Theo dann doch noch im Spitalnachthemd auf der Heimreise… - Ein netter Herr hilft uns. Alles bestens!
Bevor wir Theo um zehn abholen können, gibt uns Dr. Dalby noch ein Rezept, mit dem wir in der Spitalapotheke die Medis abholen können. Das dauert. Ich muss sie gleich bezahlen, denke, das kostet sicher ein Vermögen, aber nein, mit umgerechnet 80 CHF bin ich dabei. Acht Schachteln sind’s (mir kommt’s vor wie an der Pharma-Prüfung, wo die Kandidatinnen jeweils drei Medis aus einer ganzen Menge Verpackungen heraussuchen und beschreiben müssen; ich muss alle mitnehmen). - Die Schwester wirft einen Blick auf die Liste, auf die Medikamente und sagt, sie sehe da ein Problem, die Liste der beiden Ärzte stimme nicht überein. Sie wolle das abklären.
Theo und Kim warten inzwischen in der Cafeteria. Theo wieder in Hose und T-Shirt, so wie er vor zehn Tagen eingerückt ist. - Eine halbe Stunde später kommt die Schwester endlich wieder und geht mit mir zurück in die Apotheke. Dort geben wir zwei Medikamente zurück, eines soll ausgetauscht werden. Das dauert eine knappe weitere Stunde, bis die ganze Abrechnerei erledigt ist. Ich erhalte 15 Franken zurück. Inzwischen hat Kim nochmals Dr. Dalby aufgesucht um zu fragen, wie sich die Angelegenheit erklären lasse. - Es ist schon so, die beiden Ärzte sind sich in dieser Frage nicht einig. George will keinesfalls Antibiotika verabreichen, Dr. Dalby schon, nur für ein paar Tage. Er hat das Sagen, ist nicht sehr zufrieden über die Änderung, aber die Medikamente sind ja jetzt wieder weg von der Liste, also bleibt’s dabei, nur noch sechs Medis sind übrig, von denen eines Schmerztabletten sind und das andere ein Schlafmittel, also nur bei Bedarf zu nehmen. So bleiben genau vier übrig, und das dünkt mich eigentlich gar nicht schlecht. Ich hätte mit einem ganzen Drogen-Cocktail gerechnet.
Das Herz sei in einwandfreiem Zustand, Reha nicht notwendig, Theo brauche nun einfach Erholung, solle sich viel bewegen (!), Zucker vermeiden und weniger Fett essen, dann habe er noch viele sorglose Jahre vor sich. Herz mit Garantie…– Das sagen alle drei Ärzte. – Wir sind entlassen.
Mittlerweilen ist es zwölf Uhr mittags.
Vor dem Spital möchte Kim noch eine Foto machen lassen von und dreien von diesem denkwürdigen Augenblick. Sie fragt einen Mann, der dort am Schatten sitzt, ob er ein Bild von uns machen könne. – Sie hat sich nicht grad einen Ausbund an Intelligenz ausgesucht. Er stellt sich neben Theo und mich hin, lächelt und denkt offensichtlich, Kim habe ihn gefragt, ob er mit uns aufs Foto wolle. – Ein zweiter Versuch mit einem Passanten verspricht mehr Erfolg.
Es ist über 30 Grad heiss und im Auto noch ein bisschen wärmer. Ich verbrenne mir fast die Hände am Steuerrad, auf den Sitz lege ich Zeitungen.
Um die Klammern zu entfernen, muss Theo in einer Woche zurück ins Spital, dann seien wir frei, unsere Reise fortzusetzen, meinten die Ärzte. Fliegen allerdings erst in zwei Wochen ab jetzt, selber Auto fahren in sechs Wochen, mitfahren in einer Woche. Brustkasten wieder ganz zusammengewachsen: sechs Monate, Skifahren ab Januar kein Problem, wenn’s keine schwarzen Pisten seien (die sind in Bivio so oder so eher rar).
Das sind ja verlockende Aussichten. – Wir warten ab, wie sich die Genesung entwickelt und entscheiden in einer Woche, wie’s weitergeht.
Auch für mich wird jetzt die Phase der Erholung anfangen, ich bin mehr als nur froh!
Der Albtraum ist also vorbei. Ich kann noch immer kaum fassen, was passiert ist, dass das überhaupt passiert ist, und dass es jetzt vorbei ist: das Herz geflickt, alle Knochen wieder an Ort und Stelle, der Brustkasten fein säuberlich zugenäht (da kommt mir der böse Wolf im Märchen in den Sinn – natürlich ohne die Szene mit den Steinen und anschliessend dem Brunnen) - Theo wie neu.
Wir sind dankbar, dass wir solches Glück im Unglück hatten. Theo hat Zeitpunkt und Ort des Dramas perfekt gewählt – wir waren rechtzeitig in Spital – es war genau das richtige Spital (es war nicht fünf vor zwölf; es war ein paar Sekunden vor zwölf), wir haben eine Unterkunft, die keine Wünsche offen lässt und dass schliesslich, wie im Märchen, alles gut herausgekommen ist und Theo eine zweite Chance erhalten hat, ist das Beste, was wir erhoffen konnten. - … and they lived happily ever after.
Theo richtet sich ein im Haus, legt sich hin; er ist ober-happy. Kim und ich fahren in den nächsten Supermarkt und kaufen ein. – Jetzt geht’s aber bunt: Schon bald ist das Wägeli bis obenhin beladen mit Gemüse und Früchten, Kim ist sehr darauf bedacht, dass nur das Beste vom Besten gekauft wird. Und gesund muss es sein! - Das schlägt sich schliesslich auch auf die Rechnung nieder und ich denke, wir haben genug gekauft für mindestens einen Monat. Wenn wir nur genügend Platz haben im Kühlschrank…
Kim fährt zurück in ihre Lodge, ich fahr heim und schlafe ein bisschen im Garten; der Tag hat mich sehr müde gemacht.
Es ist unser letzter gemeinsamer Abend, morgen fliegt Kim zurück nach London. Wir feiern mit Champagner den glücklichen Ausgang dieser dramatischen Woche, sie kocht uns ein feines Nachtessen (Stirfry chicken) und verlässt und gegen elf.
Freitag, 28. Oktober – Kim reist ab
Mit Hilfe einer Schlaftablette hat Theo einigermassen schlafen können.
Es ist Kims letzter Tag heute, sie hat einen Flug um 20.20 Uhr. Am Mittag hole ich sie im Dainfern Shopping Center ab, wo sie einen Coiffeur Besuch abgemacht hat.
Zu Hause verwöhnt sie uns schon wieder; sie macht uns einen feinen orientalischen Salat nach Javis Rezept. – An ihre Küche könnte ich mich gewöhnen.
Gegen halb fünf kommt ihr Taxi, wir versabschieden uns und schon wieder ist ein Kapitel abgeschlossen.
Ich muss jetzt schauen, wie ich mich als Krankenschwester eigne. Ich habe da so meine Zweifel…
Inzwischen ist Kim gut zu Hause angekommen. Am Samstagmorgen kurz nach sechs Landung in Heathrow. Wir haben ihren Flug mit der „Flightrader 24“- App verfolgt und sind froh, dass alles gut gegangen ist.
Kurze „REHA“ in Dainfern
Auch bei uns geht’s gut. Super sogar. Es ist erstaunlich, wie schnell sich Theo erholt. Jeden Tag geht’s ein wenig bergauf. Aussehen tut er wie vor der Operation. Als Eva heimkam am letzten Freitag, dachte sie wohl, sie finde einen schwer angeschlagenen, tief darniederliegenden bleichen Patienten in ihrem Haus vor. – Alles andere; sie konnte es kaum glauben. Als sie dann den Reissverschluss an seiner Brust sah…
Er selber kann’s auch fast nicht fassen, dass ihm nichts weh tut. Schmerztabletten braucht er keine zu nehmen, aber jetzt nimmt er doch tatsächlich Schlaftabletten. Ausgerechnet Theo! Noch mehr Siesta…
Er fühlt sich sehr wohl in diesem hellen grossen Haus mit den vielen Fenstern und dem genialen Parcours, den er täglich mehrmals zurücklegt. Es ist so gebaut, dass alle Zimmer im Parterre und im ersten Stock rings um ein Atrium herum angelegt sind. So kann er treppauf, treppab so viele Umgänge machen, wie es ihm beliebt. Zudem hängt und steht überall schöne afrikanische Kunst, die er bewundern kann, wenn ein Halt nötig ist, ein lohnender Spaziergang also.
Auch ist es absolut ruhig hier. Strassenlärm gibt’s keinen. Nur Vögel hört man; es ist fast wie in einem Bird-Sanctuary, so viele verschiedene Arten hat’s. Gezwitscher und Gekeife hört man tagein tagaus, unermüdlich. – Höchstens diejenigen, welche nebelhornartig miteinander kommunizieren, können manchmal ein wenig nerven. Nur in der Nacht für wenige Stunden, wenn sie endlich ihre Schnäbel halten, übernehmen Grillen und Frösche.
Einer von Theos Lieblingsplätzen ist im Garten auf dem Sofa am Schatten mit Blick ins Grüne. Ein weiterer Lieblingsplatz, wenn’s dunkel ist: auf dem Liegesofa vor dem Bildschirm mit Aussicht auf Trump und Hillary.
Nochmals zu den Spaziergängen: Sie werden mit jedem Tag ausgedehnter. Es ist ein tolles Gebiet zum Herumschlendern oder –wandern. Das allerdings nur morgens oder kurz vor Sonnenuntergang, wenn’s noch nicht oder nicht mehr so heiss ist. Erste Rundgänge fanden entlang der Strasse statt, an prächtigen und auch weniger prächtigen Villen vorbei, 10 Minuten. Dann wurden es 20 Minuten durchs Green des angrenzenden Golfplatzes. „Dank“ Regenmangels ist’s inzwischen teilweise zwar mehr ein Yellow oder Brown. Der Rasen wird fleissig bewässert, aber ich bin nicht sicher, ob das Rechtens ist, denn durch die Medien und auf Plakaten wird man aufgefordert, Wasser zu sparen.
Schon 30 Minuten! Bis zum Zaun und Entlang der Umzäunung im „Ghetto“. Es ist sehr merkwürdig: hohe Mauer, Stromkabel, Stacheldraht, Videoüberwachung – ist man hier auf der richtigen Seite? Gefängnis oder Paradies?
Dazu und auch zur Pipeline die sich durch die Gegend zieht (von weitem könnte man meinen, ein silberner Zug überquere eine Brücke - so ist es aber überhaupt nicht) habe ich einen sehr aufschlussreichen und interessanten Artikel gefunden:
www.theguardian.com/world/2005/feb/28/southafrica.features11">www.theguardian.com11/world/2005/feb/28/southafrica.features
Vor zwei Tagen war ich zum ersten Mal, seit wir da sind, im Swimmingpool, das zu einem Gemeinschaftszentrum gehört, fünf Minuten zu Fuss von hier. Es hat dort auch ein Clubhaus, einen Fussballplatz, eine Beach-Volley-Anlage, drei Tennisplätze, Grillstellen; man kann Basketball spielen und vieles mehr. Für Unterhaltung ist gesorgt. Am Wochenende profitieren viele vom Angebot, durch die Woche ist fast niemand dort.
Ich hatte ziemliche Bedenken, was meine neue Rolle als Krankenschwester und Health-Food-Köchin anbetrifft, aber es ist weniger schlimm als vermutet. Der Patient ist recht genügsam, schickt mich zwar manchmal herum, Dinge zu holen, die er selber auch holen könnte (er soll sich ja bewegen!), aber im Grossen und Ganzen kommen wir gut über die Runden. Da ihm nichts weh tut, braucht er auch nicht zu jammern. – Den Salat isst er bereits ohne Murren und auch seine Bedenken und Bemerkungen, dass Salt- und Gemüseessen nur zu Haarausfall und Gelenkschmerzen führten, hat er in letzter Zeit nicht mehr erwähnt.
Administratives
Übrigens hat alles bestens geklappt mit der Versicherung und dem TCS. Das möchte ich erwähnen, denn Versicherungen zahlt man zwar ungern, ist aber froh, wenn man sie nicht braucht. Wenn aber doch, war es für uns eine grosse Erleichterung zu erleben, wie gut, professionell und trotzdem einfühlsam die Unterstützung ist.
Die Kosten belaufen sich bis jetzt auf 54‘000 Franken. Eine riesige Summe. Ich frage mich aber, wie viel das Ganze in der Schweiz gekostet hätte.
Farben
Manchmal muss man ja auch eine Wäsche machen. – Gelb ist jetzt das neue Weiss. Nach Jahren ist es mir wieder mal gelungen, eine ganze Trommel Wäsche so zu verfärben, dass alles, was zuvor weiss war, nun gelb ist. Wenigstens gleichmässig.
Theo war froh, dass er vergessen hatte, zwei seiner Hemden mitwaschen zu lassen. Das erledigten wir allerdings unverzüglich tags darauf. - Violett ist jetzt ebenfalls das neue Weiss.
Und ich glaub’s ja nicht: Wieder hat er vergessen, das eine weisse Hemd mit in die Trommel zu geben. – Da drängt sich allenfalls ein dritter Versuch auf. Vielleicht rosarot zur Abwechslung.
Am Montag habe ich ein Auto gemietet. Eva ist ja wieder zu Hause, so braucht sie ihres und ich fühle mich sehr eingesperrt, wenn ich nicht mobil bin. Zudem haben wir noch ein paar Arzt-Besuche im Spital vor uns, und einkaufen muss ich schliesslich auch. So war auch der Montag der erste Tag, an dem wir abends auswärts essen gingen. Wir haben’s beide sehr genossen, Theo natürlich erst recht nach diesen zwei langen Wochen.
Mit dem königsblauen VW-Polo fallen wir überall auf. - Wie ein roter Hund. - In der ganzen Zeit hier habe ich kein Auto gesehen mit solch auffälliger Farbe.
Inzwischen hab ich Auto und Farbe gewechselt. Service und Ölwechsel wären in 1000 km nötig gewesen, dem mag ich allerdings nicht „nachrennen“ und zudem fand ich den Laderaum ein wenig eng. - Goldbraun ist das neue Gefährt.
Weiterreise – Pläne
Ich glaube nicht, dass wir bald den Heimflug antreten werden. Theo möchte gerne die nächsten Wochen in diesem Land verbringen (ich natürlich auch), so sind wir vorsichtig am Planen, wie’s weitergehen könnte. Das Auto hab ich ja vorsorglich schon gemietet und nach den Arztvisiten vom Mittwoch und Donnerstag wissen wir sicher mehr.
Meine Idee ist es, von hier nach Port Elizabeth beziehungsweise Sedgefield (unsere nächste HomeExchange-Destination) zu fahren und dabei etwa vier- bis fünfmal zu übernachten. – Soeben erhielt ich eine Mail von diesen Tauschpartnern mit dem grosszügigen Angebot, dass wir mit Werner Frei (ein Schweizer – unschwer zu erraten) in seinem Auto mitfahren könnten. Er ist momentan geschäftlich in Johannesburg beschäftigt und fährt am Freitag, 11. November, heim. Das also eine Option, die es zu überdenken gilt. Er würde die 1‘200 km in zwei Tagen fahren, je sechs Stunden im Auto. Mal überlegen, ob das gut ist für Theo. - Mein Vorschlag mit den vielen Zwischenhalten hat den Vorteil, dass die Reise weniger anstrengend ist, und wir würden etwas vom Land sehen, was vermutlich nicht in jedem Reiseführer steht. Werners Vorschlag hingegen würde bedeuten, dass ich nicht die ganze Strecke alleine fahren müsste.
Wir trinken Tee und warten ab.
Ich staune übrigens immer wieder, wie fantastisch diese „HomeExchange-Familie“ funktioniert. Noch nie haben wir schlechte Erfahrungen damit gemacht (wir hatten bisher rund 50 Tausche), genau das Gegenteil ist der Fall. Man kennt den Tauschpartner nur per Email und von den Angaben auf der jeweiligen Webseite und macht dann die genialsten Erfahrungen, wenn man die Gastgeber kennenlernt. Mit manchen haben wir nach Jahren noch Kontakt.
Mittwoch, 2. November - Spitalaustritt
Was für ein Tag!
Es ist jetzt genau zwei Wochen her seit der Operation. Um zehn Uhr sind wir im Spital und nach knapp sechs Stunden und zwei Kilometern Durch-x-Gänge-Gehen verlassen wir es wieder.
Inzwischen gab es zwei Ärztekonsultationen in deren Praxen. Sowohl George als auch Dr. Dalby waren höchst erfreut über Theos Zustand, alle Werte bestens, Herz wie neu (20 Jahre Garantie), Lunge tut ihre Dienste, Patient entlassen. Beide ermunterten uns, gleich morgen schon unsere Reise fortzusetzen. – Übermorgen wird’s schon werden.
Eine halbe Stunde lang dauerte es, die 32 Klammern zu entfernen. Die Schwester, die das machte, war auch des Lobes voll und sagte, sie habe noch nie einen Patienten gehabt, der nach einer solchen Operation nicht auch Klammern an den Beinen gehabt habe, da man normalerweise dort die Venen für die Bypässe „holt“.
Ich wartete in der Cafeteria auf Theo, wollte bei der „Entzipperei“ nicht dabei sein. Dort, wie kürzlich auch schon, traf ich George beim Kaffee an und auch Dr. Zoran setzte sich wieder zu mir an den Tisch. Beide warteten auf einen Kollegen, die nächste Operation schon in den Startlöchern. Von beiden erhielt ich Tipps bezüglich Weinsorten und Orte, die wir besuchen sollten auf dem Weg nach Cape Town. Theo kam eine halbe Stunde später dazu mit seiner neu gestalteten Brust: der Reissverschluss weg, die Narbe ein wenig „äs Gschnurpf“.
Was mich dann fast aus der Fassung brachte, war, was George beim Abschied sagte. Er lud uns am selben Abend zu sich nach Hause zum Nachtessen ein. – Also so was!!!!!
„You guys are so far away from home and had such an experience. I want you to have a good impression of South Africa!” – (We certainly do…)
Ich hatte mich erkundigt, was wir den Schwestern als Abschiedsgeschenk geben könnten. Dabei hatte ich an einen gemeinsamen Fond oder so gedacht, aber Leigh, die Dame, die das Administrative im Spital regelt, sagte, sie hätten schlechte Erfahrungen gemacht mit Geld, besser sei, beiden Abteilungen ein Kilo Güezi zu bringen. – Nein also nein, dachte ich, aber was soll’s? So kaufte ich die von ihr vorgeschlagenen Bakers Assorted Cookies, die wir alsdann den Schwestern in die ICU und Ward G brachten. Sie freuten sich über das Abschiedsgeschenk und Trini (the skinny one) ermahnte Theo noch, das Rauchen total aufzugeben. „Dream on“, dachte ich, sagte es aber nicht.
Die Ärzte übrigens bedachten wir mit Wein, nicht mit Güezi.
Erstaunlicherweise war die Intensivstation fast leer. So kannten wir sie fast nicht mehr. Theos Bett verweist… Im Dezember und Januar würde sie sich dann schon wieder füllen, meinte eine Schwester zuversichtlich.
Es folgte ein weiterer Besuch in der Apotheke: Theo setzte sich hin und ich beobachtete, wie er grad dabei war, ein Selfie von seiner Narbe zu machen. - Dann endlich konnten wir das Spital verlassen.
Zu Hause war dann Siesta-Time. Wohlverdient für Theo nach diesem langen „Ausgang“.
Kurz nach sechs rief George an, gab uns seine Adresse bekannt. Wir wurden gegen acht erwartet.
Ein heftiges Gewitter brach los gegen sieben, so mochte ich nicht Auto fahren. Wir nahmen ein Taxi beziehungsweise Uber und kamen rechtzeitig bei Livia und George Dragne an.
Ein tolles Haus haben sie mit einem Garten ähnlich wie in einem französischen Landhaus. Ein ganzer Teil davon nur Gemüsegarten, den die sympathische Livia offenbar liebevoll pflegt.
Zwei Hunde und zwei Katzen sind die andern vier Bewohner.
Ein Braai (BBQ) im Garten hätte es sein sollen, aber das Wetter hatte das schliesslich verhindert. Stattdessen stellte uns Livia eine Platte mit lauter feinem Finger-Food auf (Samosas, Fleisch-Spiesschen, gefüllte Omeletten, Crackers mit Humussauce etc.), dazu gab es Wein (nicht zu knapp) und zu den Häppchen eine spassige Bemerkung von George, all dies nun seine Dinge, die zu essen man eigentlich eher vermeiden sollte. - Am Morgen noch hatte er gesagt, zwei Gläser Wein pro Tag seien ok, sogar gut; Theo und ich, wir leerten eine Flasche Rotwein, George eine Flasche Weisswein fast allein. (Wenn man hier in einem Restaurant ein Glas Wein bestellt, dann kommt eine kleine Karaffe mit 2,5 dl Inhalt. Zwei Gläser wären also ein halber Liter. - Vielleicht hatte er so gerechnet, dann wären wir ja im grünen Bereich gewesen, noch ein wenig drunter sogar…). – Über Gott und die Welt wurde geplaudert, es war ein unvergesslicher Abend, eine herrliche Abwechslung.
Nun wurde es Zeit zu gehen. Ich wollte Uber bestellen, aber Livia bestand darauf, uns heimzufahren. Es war elf Uhr, stockdunkel. Beide kamen mit und Livia fuhr uns in ihrem schnittigen weissen Jaguar pfeilschnell auf den fast leeren Strassen heim, wo wir im Nullkommanichts Dainfern erreichten nach einer Fahrt, die mir vorkam wie auf einer Achterbahn.
Was für ein Tag!
Und jetzt geht’s schleunigst ans Planen: Am Freitag Abfahrt Richtung Port Elizabeth, erster Halt, wie schon erwähnt, in Clarens. – Wir haben uns also entschieden, selber zu fahren, damit die Reise für Theo weniger stressig wird.
Freitag, 4. November - Abfahrt Richtung Süden
Alles ist gepackt und parat. Noch frühstücken, anschliessend „Take-off“. Wir sind dann mal weg!
Wir verabschieden uns von Eva und ihrer Tochter Anna, die inzwischen aus Amsterdam angereist ist, um ihrer Mutter zu helfen, ein Inventar fürs Haus, das im Dezember verkauft werden soll, zusammenzustellen. Es wird Mittag, bis wir losfahren. Clarens ist unser Ziel für heute.„On the Road again“, tönt es aus dem Radio; der Song von Willy Nelson begleitet uns aus Johannesburg hinaus. Der Verkehr auf der vierspurigen Autobahn ist dicht und hektisch, ständig werden die Spuren gewechselt, überholen darf man rechts und links. Wir haben noch etwas Mühe, das Navi richtig einzustellen, ich verpasse daher ein paar Ausfahrten, die wir hätten nehmen sollen, denke, wir fahren im Kreis herum, aber dann, nach etwa einer Stunde, sind wir aus dem Gröbsten raus. Die Autobahnen werden drei- und schliesslich zweispurig, dann allmählich sind wir auf der Landstrasse in Richtung Heidelberg.
Ab hier ist die Gegend kaum mehr besiedelt, die Route führt zwar noch an einzelnen erbärmlichen Hüttendörfern vorbei, aber vorwiegend durch weite Ebenen, bestehend aus Grasland, durchsetzt mit ein paar Bäumen hin und wieder. Die beachtliche Zahl der Rinder, an denen wir vorbeifahren, schätze ich auf etwa gleich gross wie die Anzahl der Schlaglöcher in der Strasse, die ich möglichst umfahre, aber die immer genau dann am tiefsten sind, wenn’s Gegenverkehr hat und ich nicht ausweichen kann. Das Verkehrsschild mit der Aufschrift: „Potholes next 5 km“ steht ständig von neuem am Strassenrand, wenn die fünf Kilometer vorbei sind. Bald schon bemerke ich, dass, je schneller man über sie hinwegfährt, desto weniger fallen sie ins Gewicht. Wichtig dabei ist, sich am Steuerrad festzuklammern, bis die Hände ganz klamm sind.
Geschwindigkeitsbeschränkung ist meist 100 km/h, manchmal sogar 120. Immer öfter fahre ich 20 km schneller, denn sonst kommen wir ja nirgends hin. Das ist normal hier auf diesen ewig langen Strecken - selbst so werde ich nicht selten überholt, auch von Lastwagen, deren Limit 80 wäre, so zumindest steht’s hinten neben dem Nummernschild.
Trotzdem wird recht gesittet gefahren und der Umgang ist freundlich. Weicht man ein wenig aus, wenn man überholt wird, dankt der Fahrer mit der Warnblinke und das Betätigen der Lichthupe heisst dann: „Bitte, gern geschehen“.
Ein Streckenabschnitt ist brandneu gepflastert. Ohne Schlaglöcher noch. Da lohnt es sich sogar, eine Mautstelle einzubauen. Ich halte an, sehe, dass ich 42 Rand zahlen muss, gebe eine 100er-Note und der Typ am Schalter gibt mir 8 Rand zurück. Die Barriere geht hoch, er fragt uns, weshalb wir nicht fahren. – Ich warte auf die restlichen 50 Rand, sage ich. – Ah, ich hätte ihm hundert Rand gegeben, tut er unschuldig, wie wenn er es nicht genau wüsste. Hinter mir wird bereits gehupt. Er lenkt ein und gibt mir die Kohle zurück. – Das ist das erste Mal in diesem Land, dass jemand versucht hat, uns zu betrügen. Oder ich hätte es nur nicht bemerkt. Dreieinhalb Franken wären es zwar lediglich gewesen, aber trotzdem… (Zum Vergleich: Richard, der Houseboy in Dainfern, verdient pro Tag für seine Arbeit rund 15 Fr.).
Der nächste grössere Ort auf der Strecke, den wir passieren, ist Frankfort, Heilbron lassen wir rechts liegen, Reitz kommt etwas später, dann Betlehem, wo wir nach vier Stunden Fahrt den ersten Halt machen, um in der Mall etwas zu trinken und uns ein wenig die Beine zu vertreten. - Theo geht’s erstaunlich gut; er sagt sogar, die feine „Massage“ am Rücken über die holprige Strasse habe seiner Lunge gut getan. – In dem Fall ist ja alles bestens - morgen wird’s wohl nicht viel anders sein mit der Beschaffenheit der Strasse. Der nächste Streckenabschnitt ist 400 km lang und führt entlang der Westgrenze von Lesotho.
Nur noch 26 km bis Clarens! Die Gegend verändert sich, es wird gebirgig. Gegen fünf sind wir dort.
Der Ort wurde 1912 gegründet, liegt auf 1891 Meter und hat etwas mehr als 6‘000 Einwohner. Bei booking.com habe ich ein Zimmer im Guesthouse Lake Clarens gebucht. Mit Blick auf den See. Das Bild im Internet sah so schön aus mit den Pappeln, die sich im glasklaren Wasser spiegeln. – Wir kommen an, die Enten, Gänse, Esel und Ponys (ebenfalls auf den Bildern zum Hotelbeschrieb) sind da, die Pappeln auch, aber wo ist der See? – Es habe seit ungefähr zwei Jahren nicht mehr richtig geregnet, erklärt man uns, also habe er sich verabschiedet. – Angelina Jolie habe auch schon mal hier übernachtet, heisst es weiter. - Ob sie den See gesehen hat?
Wir haben ein hübsches Zimmer, ebenerdig, und das ist gut so, dann muss ich nicht so viel „schleppen“. Zusätzlich zur Chauffeuse bin ich ja nun auch noch die Gepäckträgerin. Das liest sich jetzt viel schlimmer als es ist; wir haben so gepackt, dass wir nur je ein Übernachtungsgepäckstück brauchen (und natürlich Theos 10-kg schwere Elektrokabel und –Apparate-Tasche). Die grossen Koffer sind und bleiben schön verstaut im Kofferraum, der zum Glück so gross ist, dass alles bestens darin Platz hat.
An den Toyota Etios (nie vorher gehört) habe ich mich übrigens inzwischen gar nicht schlecht gewöhnt. Leider hat er kein automatisches Getriebe. Das wäre einfacher gewesen, aber dort, wo ich ihn gemietet habe, hatte es so kurzfristig kein solches Auto mehr im Angebot. Nun mach ich halt alles mit links! - Einzig das, was man zu Hause mit links macht, nämlich den Zeiger bedienen, macht noch immer Mühe manchmal - dort ist eben der Scheibenwischer…
Einsteigen tue ich nie mehr von der falschen Seite her, das habe ich gelernt, nur hin und wieder passiert es mir doch noch, dass ich die Sitzgurten aus der Luft ergreifen will.
Nach einer kurzen Siesta machen wir einen Spaziergang durchs Dorf. So ein hübscher ländlicher Ort ist das! Interessant ist, woher der Name stammt: von Clarens, einem Quartier von Montreux in der Schweiz (nie gehört), wo Paul Krüger, der erste Präsident und Held der Südafrikaner, der die Unabhängigkeit von Grossbritannien erwirkt hat, seine letzten Tage verbracht hatte und dort starb.
Es ist friedlich hier, endlich keine Zäune mehr, ein ganz anderes Afrika. Die Strassen sind nicht gepflastert;, wenn ein Auto vorbeifährt, hinterlässt es eine Staubwolke. Läden hat’s wie im wilden Westen und hübsche Restaurants. Wir essen in „Clementines“ - nach Tripadvisor die Nummer 1 am Ort. Eigentlich wollten wir draussen essen im schönen Garten, aber da kommt aufs Mal ein Sturmwind auf, der dieses Vorhaben zunichtemacht. Auch drinnen ist es gemütlich; wir erhalten einen Tisch im Wintergarten. Eine wunderbare Forelle wird mir serviert (wohl kaum aus dem Lake Clarens – wie ich aber später lese, ist dies das Gebiet mit den meisten Forellenbächen und -zuchten in SA), Theo bestellt sich Nudeln mit Pesto, die Serviertochter versteht nicht gut und fragt: „Vegetables?“, das wiederum versteht Theo nicht so gut und sagt „Ja“. – Ich verstehe es schon, entscheide mich aber, nicht einzugreifen, schliesslich soll er ja gesünder essen (und wie wär’s mit dem Hörgerät, das friedlich verstaut im Koffer liegt und dort keinesfalls gestört werden will?). – Seine Miene, wie er den Teller vor sich sieht, kann ich jedoch nicht als heiter beschreiben. Ich hätte mich wohl doch einmischen sollen. Er isst nämlich nur die Hälfte (das sind die Nudeln) und sagt, so viel Gemüse stelle ihm einfach ab.
In der Nacht regnet es. Ob der See…
Am Morgen hat’s Nebel. Ich glaub’s ja nicht. Wenn ich zum Fenster rausschaue, denke ich, es könnte November sein - irgendwo in der Schweiz.
Nach einem ausgiebigen Frühstück gehen wir tanken. Zum Glück haben wir uns zuvor bei unserem Gastgeber erkundigt, ob es ok sei, in der Garage zu tanken, die nur etwa 200 Meter vom Hotel entfernt ist. Sie sah mir nämlich ein wenig suspekt aus. Davon rät er uns dringend ab. Es passiere oft, dass im Benzin noch ein wenig Wasser drin sei, vor allem, wenn’s vorher geregnet habe. – Oben im Dorf hat’s eine andere Tankstelle. Ohne lange zu zögern, berücksichtigen wir diese.
Das Dorf oder Städtchen, eine Art Kurort zum Wandern offenbar und Fliegenfischen, ist jetzt voller Leben. Es hat aufgehört zu regnen, die Sonne zeigt sich, die Temperatur ist angenehm. Erstaunlich viele Touristen stöbern in den hübschen Boutiquen und Art-Shops herum und lassen sich in den Restaurants bewirten.
Kurz vor zwölf fahren wir los. Die Gegend ab hier ist atemberaubend schön und so gut wie menschenleer. Es ist, wie wenn man durchs Monument Valley fahren würde, das nie aufhört. Immer wieder tauchen erodierte Hügel auf aus Sandstein oder Basalt mit den krassesten Felsenformationen, Tafelberge manchmal auch. Weite farbige Ebenen tun sich vor uns auf, grünes Grasland, dunkelrote Erde, gelbe Felder, braune Felsen, rost- und dunkelbraune Kühe und Rinder und die schwarze Strasse führt geradeaus direkt zum endlosen Horizont, dorthin, wo die Welt aufhört. Im Rückspiegel aus der gegensätzlichen Perspektive dasselbe Bild - und wir sind mitten drin. Es geht rauf und runter und wenn wir den Horizont geschafft haben, geht alles von vorne los. Dasselbe Bild immer und immer wieder.
Ende des Philosophierens! - Verkehr hat’s spärlich, nicht selten dauert es zehn Minuten, bis einem ein Fahrzeug entgegenkommt. Verfahren kann man sich auch kaum mehr. Das Tom Tom zeigt zuverlässig an, wann die nächste Abzweigung kommt. – In 105 km. Das heisst, erst in etwa einer Stunde muss ich wieder in einen niedrigeren Gang schalten…
Etwas weiter südlich windet sich die Strasse durchs Gebirge, führt uns über Ficksburg (!), Ladybrand und Wepener schliesslich nach Zastro, wo wir nach dreistündiger Fahrt einen Halt machen. Ein ziemlich heruntergekommenen Ort ist das, wo zu wohnen ich mir überhaupt nicht vorstellen könnte. Nicht einmal ein Restaurant finden wir, wo man etwas hätte trinken können. Die meisten Läden sind geschlossen, dabei ist es Samstagnachmittag um drei. Eine Cola kaufen wir im Supermarkt, machen einen kurzen Spaziergang um den Block und verlassen das ungastliche Dorf. Eine halbe Stunde später passieren wir eine Brücke, welche die Provinz Freistaat mit der Provinz East Cape verbindet. Ab dort fahren wir durch Sterkspruit, eine Ortschaft, die auf der Karte ganz klein aussieht, die sich aber über ein ausgedehntes Gebiet erstreckt, das über viele Kilometer hinweg erst locker, dann dicht besiedelt ist. Nur Schwarze sehen wir. In der Ortsmitte läuft etwas: Es ist ein Durcheinander von Kühen, Ziegen, Schafen und Menschen, die alle irgendwohin wollen. Am Strassenrand hat’s lauter Marktstände und auf der Strasse selber alle paar dutzend Meter Bodenschwellen, die einen zwingen, nicht mehr als 20 km/h zu fahren.
Um halb fünf, nach gut vier Stunden Fahrt, sind wir in Lady Gray (1‘600 m über Meer). Auf dem Weg hierhin war’s stets ziemlich bedeckt, was wir schätzten, denn es war dadurch nicht so heiss und die Wolkenbilder zeigten die Landschaft immer wieder im neuen Licht. Zeitweise sah man immerhin den blauen Himmel zwischen den Wolken durchschimmern, aber endlich ist klar, dass wir dem Regen nicht würden entkommen können. - Kaum sind wir bei der Comfrey Lodge angekommen, beginnt es wie aus Kübeln zu giessen. Müsste ja nicht gerade jetzt sein, denke ich, doch hier sieht man das anders: Man ist über jeden Regentropfen froh.
Wir erhalten ein ganzes Cottage mit Küche, Schlaf-, Wohn- und Esszimmer, was wir zwar gar nicht brauchen, denn morgen geht’s schon wieder weiter. Wir sind die einzigen Gäste. Man kümmert sich rührend um uns, George, gediegen gekleidet in weisser zweireihiger Koch-Montur, kocht ein feines Dreigang-Menu, eine Flasche „Allesverloren“ Shiraz trinken wir dazu und freuen uns anschliessend aufs Bett und den nächsten Tag.
Zum Guesthaus gehört ein Park, in dem sieben Alpaccas frei herumlaufen. Sie sind grad kürzlich geschoren worden, erzählt man uns. Daher sehen sie auch seltsam aus: wie Pudel nach dem Hundecoiffeur-Besuch. Noch komischer ist’s am nächsten Morgen. Wie apathisch stehen sie in der Gegend herum, wie Statuen, völlig durchnässt und schauen bewegungslos stur in eine Richtung - jetzt eben wie begossene Pudel.
Sonntag, 6. November
Wir haben beide wunderbar geschlafen, obwohl es die ganze Nacht ohne Unterbruch geregnet hat. Das monotone Geräusch im Hintergrund hat wohl einschläfernd gewirkt.
Gegen halb zwölf mittags brechen wir auf. Das Dorf ist wie ausgestorben; es ist Sonntag. Wenigstens hat es endlich aufgehört zu regnen, die Temperatur ist angenehm. Ich möchte gerne tanken, denn irgendwo im Nirgendwo steckenzubleiben, wär nicht grad das höchste der Gefühle. Aber die Garage ist zu. Das macht mir ein wenig Sorgen, doch zum Glück finden wir schliesslich doch noch eine zweite Tankstelle, die bedient ist und wo wir den Tank wieder füllen lassen können.
Weiter geht’s durch die herrliche Landschaft. Es hat kaum mehr Verkehr, über weite Strecken sehen wir weder Menschen noch Kühe. Nur knapp 300 km ist der heutige Streckenabschnitt. Ständige Begleiter über all die Hunderten von Kilometern sind die Telefonmasten, die abwechslungsweise mal links, mal rechts der Strasse in Reih und Glied stehen.
Unterwegs machen wir dreimal Halt und wundern uns über die ausgestorbenen und heruntergekommenen Dörfer, durch die der Weg uns führt. Die Kirche ist jeweils das einzige gepflegte Gebäude, so scheint es uns. Gerne hätten wir irgendwo eine Tasse Kaffee getrunken. Das war nicht möglich. Alles zu. Und sogar, wenn das nicht so gewesen wäre, hätte es uns nirgends animiert zu verweilen. Rund um solche Ortschaften hat es schwarze Townships. Hütte reiht sich an Hütte, eine meist verlotterter als die andere. Abfall liegt überall herum, Ziegen und Menschen kümmert das offenbar wenig.
Wir fahren durch Aliwal North, Burgersdorp, Steynsburg, Hofmeyr und kommen schliesslich in Cradock an.
Gesten Abend habe ich „Annie’s House“ gebucht und die Unterkunft ist eine sehr gute Wahl. Wir haben ein kleines Cottage mitten im Garten mit einem himmlischen Bett, modernem Badezimmer und bestens funktionierendem Wi-Fi.
Theo erklärt Peter, unserem netten Gastgeber, dass er mir mit dem Gepäck nicht helfen könne, er dürfe nichts Schweres tragen wegen der Operation. – Da haben sich aber zwei gefunden! Vor vier Jahren hatte Peter dieselbe Operation (tripple Bypass sogar) und so ist das Thema fürs Erste gegeben: Erfahrungen und gute Ratschläge wurden ausgetauscht; jeder erzählte seine Geschichte.
Cradock macht auf den ersten Blick einen sehr viel besseren und saubereren Eindruck als die Orte, durch die wie heute gefahren sind. Es hat zum Teil gepflegte, schöne Häuser, aber auch hier ist alles wie ausgestorben. Auf einem fast dreiviertelstündigen Spaziergang sehen wir, dass auch im Ortskern manche Häuser stark zerfallen sind und Strassen und Trottoirs sind in so miserablen Zustand, dass es gar keine Geschwindigkeitsschwellen braucht, um den Verkehr zu beruhigen.
Kein einziges Restaurant ist offen. Wimpy nur bis fünf Uhr nachmittags und KFC drive-in ist die einzige Bude, die auch am Sonntagabend bis elf ihre Chicken an die Frau oder den Mann bringt. - Zum Glück hat Peter Bedauern mit uns und unseren trüben Nachtessens-Aussichten, so dass er eine Bekannte anruft und sie fragt, ob sie nicht für uns kochen kommen könne. Geneviève erbarmt sich unser ebenfalls, kommt und serviert uns Suppe, einen gut gehäuften Teller voller Fleisch, Reis, Kartoffeln und Gemüse, zum Schluss ein Dessert – wir sind gerettet.
Montag, 7. November
Nur zwei Stunden Fahrt haben wir heute vor uns. Ich bin sehr froh, dass wir die langen Strecken bereits hinter uns haben. Beim Losfahren sagt Tom Tom: „In 200 m rechts abbiegen“. Machen wir. Auf dem Display sehe ich anschliessend: in 175 Metern rechts abbiegen. Dazu kommt aber kein Ton, bis ich merke, gemeint sind nicht Meter, sondern Kilometer. Also gut, los in Richtung Port Elizabeth - im fünften Gang.
Unterwegs gibt’s doch mal ein Strassenschild, das 80 km angibt, und eines, das zeigt, dass eine Rechtskurve zu erwarten ist. Dazu eine Warnung für Lastwagen, dass die Strasse abschüssig wird. – Ja, und genau da sehen wir den ersten Unfall. Polizei und Krankenwagen sind zum Glück schon zur Stelle. Ein Lastwagen konnte nicht mehr bremsen, ist durch die Leitplanken gebrochen und hat sich im Gelände überschlagen. Wir sehen nur die Räder, die gegen den Himmel zeigen. Überall liegen Heuballen herum, er muss mit denen vollbeladen gewesen sein. – Man kriegt Gänsehaut und geht vom Gas. Ob der Fahrer das überlebt hat? – Kurz darauf begegnen wir einem grossen Tross mit etwa zehn Lastern, von Pilotfahrzeugen angekündigt. Sie transportieren je einen Windmühlenflügel, diese grossen, weissen Dinger. Jetzt, wo man sie aus der Nähe sieht, erkennt man erst, wie riesig die sind.
Je südlicher wir fahren, desto öfter sieht man grüne Felder, die mit überdimensionierten Wassersprinkler-Anlagen bewässert werden. Weizen wird angepflanzt, aber auch Gras für die riesigen Rinderherden. Ebenfalls erkennt man Obstplantagen von der Strasse aus. Die Farmen, von denen aus all dies bewirtschaftet wird, müssen enorm gross sein.
Wir machen auch heute wieder ein paarmal Halt auf offener Strecke. Mich faszinieren die Eisenbahnlinien, sowohl die vergammelten, die nicht mehr im Betrieb sind, still vor sich hin rosten und auf denen Büsche wachsen, als auch jene, wo doch täglich immer wieder mal ein Zug durchfährt. Sie sind ein vorzügliches Fotomotiv, so wie ebenfalls die Wind- und Wasserräder bei den Brunnen, die wilden Pflanzen, die Kühe und Schafe, vor allem, wenn sie dabei sind, selenruhig vor uns die Strasse zu überqueren.
Endlich kommt nach 175 km die Abzweigung. Jetzt geht’s nicht mehr weit und wir sind in Addo, dem Ort in der Nähe des Addo-Elephant-Parks. Dort wollen wir zwei Nächte lang bleiben, Theo kann ausspannen, ich geh einen Tag lang auf Safari und hoffe, die Big Five halt hier zu sehen, statt, wie ursprünglich geplant, im Krügerpark. Theo möchte lieber nicht mitkommen, was ich gut verstehen kann, denn ungepflasterte Strassen tun seinem zusammengeflickten Brustkorb nicht gut.
Abends gehen wir in einem sehr gepflegten Restaurant auswärts essen und erhalten viel zu grosse Portionen. 300 g Filet (vom Feinsten!) – kleiner gibt es das nicht. Theo isst (zum Teil zumindest) Pasta mit Huhn. Mit zwei Vorspeisen, einer Flasche Wein und einem Liter Mineralwasser zahlen wir am Schluss, Trinkgeld inklusive, knapp 40 Franken.
Dienstag, 8. November 16 – Addi –Elephantpark
Mein Tag: Safari von morgens bis abends. Wir sind zu siebt im halboffenen Jeep, Emanuel, der Fahrer, drei Israeli, zwei Holländer und ich. Viele Tiere sehen wir, allerdings nur zwei der Big Five: Büffel und Elefanten. Die dafür in rauen Mengen. Und Warzenschweine. Die sind so lustig, wenn sie mit ihren Schwänzen, die sie wie Antennen hoch in die Luft strecken, über die Strasse in den Busch hineinwackeln. Mit ihren knackigen, prallen Hintern kann ich mir gut vorstellen, dass sie für jeden Löwen ein Leckerbissen sind. Sie selber schmausen auch nach Gaumenfreuden am Boden herum, und damit sie diese Köstlichkeiten mit ihren viereckigen Mäulern besser erreichen können, gehen sie auf die Knie. Das sieht echt komisch aus.
Wie uns Emanuel erklärt, hatte es in dieser Gegend ursprünglich etwa 150 Elefanten. Sie wurden bis auf 11 Stück von den Bauern und Wilderern eliminiert, bis 1931 der Park gegründet wurde. Jetzt sind’s wieder ungefähr 700 Stück. Man sieht sie von sehr nahe, fast zu nahe für meinen Geschmack, und sie tummeln sich am Wasserloch in Scharen, was wunderbar ist zum Beobachten.
Der Park dehnt sich über eine Fläche von 1‘640 km2 aus; geplant ist, dass er doppelt so gross wird. Er ist der drittgrösste in SA. Nur gerade zehn Löwen hat’s auf diesem Gebiet, also kaum ein Wunder, dass wir weder einen von ihnen noch die Nadel im Heuhaufen gefunden haben. - Giraffen hat’s übrigens auch keine, das aber wegen der Vegetation. Hohe Bäume fehlen, die armen Tiere hätten sonst „Äkegschtabi“ und / oder würden verhungern. - Das kann’s ja wirklich nicht sein. - Dafür fühlen sich die Zebras, Büffel, Strausse, Vögel, Kudus und all andern Antilopenarten sehr wohl in den Ebenen und dem niedrigen Gebüsch. Genauso wie die Leoparden-Schildkröten, wobei ich lieber Schildkröten-Leoparden sähe, obwohl ich Mühe habe, mir genau vorzustellen, wie die dann aussehen würden.
Am Mittag werden wir von Emanuel mit einem vorzüglichen Braai verwöhnt. Er macht aus Orangenholz ein Feuer und wie nach einer halben Stunde eine ausgezeichnete Glut entstanden ist, legt er Spiesse aus Poulet und eine lange Wurst aus Antilopenfleisch auf den Grill. Dazu gibt’s Kartoffelsalat und Griechischen Salat sowie Toastsandwiches, gefüllt mit Käse und Tomaten, die er ebenfalls auf dem Grill röstet. Die Israelis möchten lieber Fisch…
Neun Stunden sind wir unterwegs, dann sind alle müde aber zufrieden, auch wenn wir keine Löwen gesehen haben.
Theo hat inzwischen den ganzen Tag lang „frei“ gehabt, und vielleicht erzählt er mal in seinem eigenen Blog, was er so getrieben hat. – Mir hat er erzählt, er sei dreimal ins Dorf gewandert und wieder zurück: neue Tagesbestleistung!
Mich nähme auch wunder, wie seine Kommunikation mit den Leuten im Dorf und im Hotel so vor sich gegangen ist. Er hat nämlich grosse Mühe, den Slang der Schwarzen zu verstehen. Seltsam, was er manchmal antwortet auf Fragen, die gar nicht gestellt wurden. – Mir fällt das weniger schwer, allerdings habe ich mich heute auf der Safari auch gefragt, was Emanuel genau meinte, als er von den „national beds“, den „Indwe“ sprach. Erst als er mit den Armen Flugbewegungen machte, wurde mir klar, er meinte „national birds“, die Blue Crane.
Wir essen im Pub des „Kraal“, unserer Lodge, ein Ehepaar aus St. Gallen leistet und Gesellschaft, anschliessend gehen wir früh schlafen.
Mittwoch, 9. November – Port Elizabeth
Heute ist es genau drei Wochen her, seit Theo operiert wurde. Das Ganze kommt mir immer noch völlig unwirklich vor, so als hätten wir es gar nicht erlebt.
Nur eine Stunde Fahrt liegt vor uns, ein „Nasenwasser“.
Unterwegs gibt‘s nur ein Thema: der neue amerikanische Präsident. Nicht zu fassen! - An 9/11 reiht sich 11/9 – die schwärzesten Tage der neueren amerikanischen Geschichte. - „If Trump is the answer, how stupid is the question?”
Kurz nach elf erreichen wir Port Elizabeth.
So sind wir die Strecke von Johannesburg hierhin halt gefahren, statt geflogen, wie ursprünglich geplant. Dafür haben wir eindrücklich erlebt, wie riesig die Distanzen sind, sind durch wunderschöne Landschaften gefahren, haben nette Leute kennengelernt in den Lodges, wo wir übernachtet haben, haben in Betten geschlafen mit hundert Decken je und zweihundert Kissen, so wie das hier üblich ist (die Prinzessin auf der Erbse hätte besagte Hülsenfrüchte unter ihrem zarten Körper nie und nimmer gespürt) und sind mehr als nur froh, dass wir das alles überhaupt tun können.
Jetzt beziehen wir unser Hotel und fragen, was man uns empfehlen würde anzuschauen in der drittgrössten Stadt vom Südafrika. – Nein, eine Mall hatten wir uns nicht vorgestellt, die gibt’s schliesslich auf der ganzen Welt. Sonst etwas Sightseeing-mässiges? Die beiden jungen Männer an der Rezeption sind ziemlich ratlos, aber wenigstens können sie uns ein Restaurant empfehlen.
Schon bei der Planung unserer Reise hatte ich im Internet nachgeschaut, was es hier Sehenswertes gibt, aber auch dort werden fast ausschliesslich Wildtier-Parks erwähnt, sonst nicht viel. - Ein Museum gibt’s, das mich interessiert, aber Theo ist eingeschlafen (Siesta!) und ich will ihn nicht wecken. Wie wir um vier schliesslich doch dort vor der goldenen Türe stehen, ist es bereits geschlossen. – Macht nichts. Morgen um zehn ist’s wieder offen, vielleicht können wir’s dann besuchen, das Schöne ist, wir haben ja Zeit.
Stattdessen fahren wir ans Meer, machen einen Spaziergang den Dünen entlang und trinken in einem Strandrestaurant einen Apéro. – Einem Strassenverkäufer kaufen wir zwei Bilder ab, die zwar ein wenig kitschig sind, uns aber doch gar nicht schlecht gefallen. In seine farbige Malerei hat er noch Teile von Blechbüchsen appliziert. – Er ist überglücklich, Käufer gefunden zu haben.
Endlich am Meer: Das müssen wir geniessen, auch vom Kulinarischen her. Im Restaurant „Ocean Basket“ mit herrlichem Blick auf die Promenade, den Strand und die Stadt im Hintergrund bestellen wir eine Fisch- und Meerfrüchteplatte für zwei.
Donnerstag, 10. November – Unterwegs ins Gamtoos Valley
Nach dem Frühstück besuchen wir die Art-Galerie, in der wir eine gute Stunde verbringen. Nebst einer zeitlich begrenzten, gibt’s auch eine Dauerausstellung, die uns begeistert. Ein lokaler Künstler, R. Belling, hat die verschiedensten Flugzeugtypen gemalt, und zwar gestochen scharf, wie fotografiert. Ebenso ist das Art-Deco-Haus, in dem die Bilder ausgestellt sind, sehenswert: weiss, schlicht – mit wunderbaren glänzenden Holz-Riemenböden, einer ansprechenden Architektur, einem Park ringsum. Der Besuch hat sich mehr als nur gelohnt.
Weiter geht’s in Richtung Westen. Es ist keine lange Fahrt in die Kouga – Region, ins Gamtoos Valley. Beeindruckend ist der Loerie-Damm, der Port Elizabeth mit Wasser versorgt. Er ist zwar halb leer und keine Menschenseele ist in der Umgebung…
In Loerie machen wir Halt, vielleicht gibt’s eine Tasse Kaffee. Ja, die gibt’s. Eine gut unterhaltene Kirche steht dort, daneben eine weniger gut unterhaltene „Einkaufsmeile“, mitten in der Landschaft, ein wenig abseits der Strasse nur, bestehend aus drei „Geschäften“, einem MINI-Supermarket, einem Secondhand-Shop sowie einem Coffee-Shop. Wie wir ankommen (die Parksituation erinnert mich stark an diejenige an der „Front“ in Bern damals, als man seinen Schlitten schnittig direkt vor dem „Grotto“, dem „Highnoon“, dem „Mazot“ oder dem „Fedi“ parkieren konnte, die Autoschlüssel lässig klimpernd in der Hand…), schliesst die Fundgrube grad die Tür, was ich ein wenig bedauere, denn manchmal kann man in so einem Etablissement schon noch eine überraschende Trouvaille finden oder sich zumindest wundern... – Kaum sind wir im Coffee-Shop verschwunden, öffnet die Besitzerin den Laden wieder, wohl in freudiger Erwartung, vielleicht doch ein Geschäft machen zu können. – Es bleibt allerdings beim Wundern. Zwar kann man allerlei Nützliches kaufen, unter anderem völlig verkratzte Bratpfannen für eine Fünflieber, ausgelatschte Schuhe, gebrauchte Kleider aus der Modekollektion 1950, schätze ich, ausgediente Kühlschränke und viel „Aamächeliges“ mehr, aber es fällt mir trotzdem nicht schwer, für einmal auf einen Erwerb zu verzichten.
Auch in der Cafeteria kann man seine Shopping-Gelüste aufs Beste befriedigen, wenn man Fan ist von religiösen Sprüchen auf Karton- oder Blech-Plakaten. - Theo jedenfalls findet den Kaffee ganz in Ordnung.
Die erschöpfende Shopping-Meile ist höchstens etwa fünfzig Meter lang, man ist also relativ rasch durch. Und sollte die Kohle beim Grosseinkauf doch nicht reichen, hat’s noch eine ATM-Maschine, wo man Bargeld beziehen kann.
Der Ort ist offenbar auch Treffpunkt der örtlichen Polizei, grad drei Polizeiwagen parkieren vornedran.
Ich aber sehe etwas anderes, was mich völlig fasziniert: Loerie hat einen Bahnhof beziehungsweise hatte mal einen. Er ist stillgelegt seit ungefähr fünfzehn Jahren, wie wir später erfahren. Zwischen den Gleisen wachsen Büsche und Sträucher, eine ganze Güterzug-Kombination steht noch dort, verweist, ausgehöhlt, ein Relikt aus einer anderen Zeit. – Was für ein Ort! Das Bahnhofgebäude ein Wrack, das Ortsschild noch knapp zu lesen: „LOERIE – 29 m über Meer“. Unweigerlich stellt man sich vor, wie das hier vor hundert Jahren ausgesehen haben mag. – Natürlich knipse ich viele Fotos.
Ein leichter Regen setzt ein, fast eine Wohltat, denn es ist recht warm geworden.
Inzwischen ist Theo in ein Gespräch mit zwei Cops vertieft. Beim Kaffee-Holen hat er offenbar seine Kamera draussen auf dem Tisch liegen lassen und das Auto ist auch nicht abgeschlossen - den Schlüssel hab ich in meiner Hosentasche. Die Polizisten ermahnen ihn, nicht so fahrlässig zu sein; wir seien hier nicht in der Schweiz, sondern in Südafrika und da seien auch die Polizisten korrupt…
Wir fahren ein paar Kilometer weiter nach Hankey, einem grösseren Ort, schön in der Ebene gelegen im grünen Gamtoos-Valley. Ein paar meiner Lieblingsbäume, die violetten Jakaranda-Trees, säumen die Strasse. Die grösste Sonnenuhr Südafrikas soll’s dort geben, die sehen wir aber nicht, weil die Zufahrt gesperrt ist. Der „weisse“ Stadtteil ist klein, besteht fast nur aus dem SPAR-Supermarkt, der Caltex-Tankstelle und sonst noch ein paar Häusern; die schwarze Township darum herum ist allumfassend. Grad ist die Schule aus, hunderte von Schulkindern sind auf dem Nachhauseweg.
Es beginnt in Strömen zu regnen. Wir fahren zurück Richtung Süden gegen Jeffrey’s Bay. Bei der Mündung des Gamtoos-Rivers habe ich vor etwa einem Monat ein Hotelzimmer gebucht, das ich dann allerdings wieder stornieren musste. Mir hat die Idee gefallen, zur Abwechslung an einem Fluss zu übernachten; im Internet hiess es, man könne am Abend dort auch an romantischen (!) Flussfahrten teilnehmen. - Nun denke ich, es wäre grad gut, die nächste Nacht dort zu verbringen, auch ohne Reservation. Allerdings ist es nicht ganz einfach, das Haus zu finden, aber schliesslich, kurz vor der Brücke, steht der Wegweiser zur Lodge und wir sehen von oben her auf den Hotel-Komplex hinunter. - Sie haben noch ein Zimmer. – Kein Wunder. Wer verirrt sich bei diesem Wetter schon hierhin? - Eigentlich wäre die ganze Anlage wunderschön gelegen, direkt am Fluss, der recht breit ist, fast doppelt so breit wie die Aare, und erstaunlicherweise auch viel Wasser führt. Ebenfalls gehört ein Campingplatz dazu. Nur ist alles völlig ausgestorben, die Nebengebäude des Hotels teilweise in desolatem Zustand, aber das Zimmer, das wir erhalten, ist gemütlich und wir fühlen uns sehr wohl. Wir sind die einzigen Gäste, müssen schon um sechs essen gehen, weil nachher die Küche bereits schliesst. Im Speisesaal hätten gut und gern einige Dutzend Gäste Platz, wir essen aber lieber in der Bar, da fühlen wir uns nicht so verloren. Zudem ist es kalt geworden und ungemütlich. Die Angestellten tragen Wollkappen und warme Jacken mit Kapuzen. Eine ganze Küchenmannschaft und drei Service-Angestellte sind nur für uns da, die Szene wirkt ein wenig skurril. Aber jetzt – alles ok, wir sind sehr froh, dass wir eine Unterkunft haben, ein feines Nachtessen bekommen, ohne dass wir zwecks Nahrungsaufnahme bei diesem Dauerregen in den nächsten Ort zu fahren brauchen. Leider müssen wir auch auf die „River-Cruise“ verzichten; sie fällt buchstäblich ins Wasser.
Wir hoffen sehr, dass es am nächsten Tag trocken ist und wir zumindest einen Spaziergang machen können in dieser schönen grünen Gegend.
Freitag, 11. November – Plettenberg Bay
Wir haben gut (früh) geschlafen und bekommen ein feines Frühstück serviert. Die vielen Mitarbeiter sind emsig am Vorbereiten: Am nächsten Tag findet eine Hochzeit statt, siebzig Personen werden erwartet.
Es hat fast die ganze Nacht durchgeregnet und ist nicht wärmer als etwa 15 Grad, dazu bläst ein kühler Wind. Erstaunlicherweise ist das weiche Gras so gut wie trocken und wir machen einen Spaziergang durch den Park zum Fluss hinunter. Das kleine Fährschiff steht ganz verlassen da, im Supermarkt ist auch nichts los – morgen, wenn die Hochzeitsgäste da sind, wird’s wohl anders aussehen…
Theo trägt ein Hemd, darüber sein Allerwelts-Holdall-Gilet, darüber eine Windjacke. – Jetzt übertreibt er aber. Sooo kalt ist es nun auch wieder nicht heute Morgen.
Gegen elf Uhr fahren wir los in Richtung Plettenberg Bay. Unterwegs gibt’s zwei Zwischenhalte, den ersten bei der Storm River Bridge (Paul Sauer Bridge) im Tsitsikamma Coastal National Park, wo wir einen feinen Cappuccino trinken und anschliessend von der Brücke aus einen atemberaubenden Blick in ein tiefes Canyon haben.
Der zweite Halt bietet ebenfalls den Blick auf eine Brücke, von der aus man einen spektakulären Adrenalin-Sprung machen kann („The world's highest bridge bungee jump“ - Bloukrans Bridge, South Africa - 216 Meter), wenn’s einem gefällt. - Uns gefällt nur das Zuschauen.
In Plettenberg Bay finden wir ein Hotel im Zentrum, mitten in der Mainstreet - mal zur Abwechslung ein wenig Leben um uns herum. Hier wiederum erfahren wir erneut ein völlig anders Afrika, sehr westlich. Es hat Läden, Restaurants und Verkehr, so wie wir das bei uns gewohnt sind. Und Tripadvisor sei Dank finden wir ein schönes, gemütliches Restaurant, das „Look Out“, direkt am Meer gelegen mit einer phänomenalen Aussicht auf den Strand und die Lagune.
Ich bestelle ein Thunfisch-Steak, Theo versucht’s wieder mal mit Tagliatelle Pesto. Und wieder versinken die Nudeln im Gemüse und er hat seine liebe Mühe, dieses säuberlich auszusondern. Ein Broccoli-Stück hat sich trotzdem auf seine Gabel verirrt. Das ist nur möglich, weil, kaum haben wir unser Essen vor uns, es einen Kurzschluss gibt, das Licht geht aus und kommt nicht wieder. Die Kellner bringen sogleich Kerzen. Niemand reklamiert. Im Gegenteil: alle Gäste geniessen ihr Candle-Light-Dinner.
Theo mag den steilen Hang zum Hotel hinauf nicht gehen, also nehmen wir ein Taxi und verkriechen uns alsdann im warmen Märchenbett.
Samstag, 12. November – Unterwegs nach Sedgefield
Im Hotel ist das Frühstück nicht inbegriffen. Aber da wir mitten im Ort sind, haben wir ganz in der Nähe eine grosse Auswahl an Lokalen, also suchen wir ein nettes Café.
Dummerweise kommen wir dabei an einem Haushaltsgeschäft vorbei und ober-dummerweise führen die die sogenannten Breville-Toaster. Trotz all meiner heftigen Protesten und Gegenargumente kann ich meinen Ehemann nicht davon abhalten, einen solchen zu kaufen. – Ich ärgere mich total!!! - Da gebe ich mir eine solche Mühe, unsere Koffer nicht zu überladen (nur 23 kg sind erlaubt), möchte doch auch das eine oder andere noch „gänggele“ vor der Heimreise und Theo kauft sich einen Toaster!
Ein solches Gerät hatte er in Wellington kennengelernt auf unserer Neuseeland-Reise vor zwei Jahren. Er war fasziniert von der effizienten und schonenden Art und Weise, wie dieser mit den Brotscheiben umging. Zu Hause wollte er dann einen ebensolchen kaufen (und mir zum Geburtstag schenken...). Das war allerdings nicht möglich, europäische Normen verhinderten den Erwerb, auch online wurde er nicht fündig. – Aber jetzt hat er ja einen…
Wir checken aus dem Bay View - Hotel aus und fahren weiter in Richtung Westen. Unterwegs machen wir in einem Farmers-Market Halt, es ist Samstag, da sind solche bunten Märkte an vielen Orten zu finden. Allerlei Kunsthandwerkliches, frische Farm-Produkte und auch Kleider sowie Schmuck werden angeboten. Ich kaufe Gemüse und frische Kräuter, schliesslich haben wir von heute Abend an wieder eine Küche zur Verfügung und können selber kochen.
Auch in Knysna gibt’s einen Stopp. Theo trinkt eine Tasse Kaffee; ich erleichtere eine ATM-Maschine mit Knete-Nachschub.
Es regnet immer wieder mal, die Landschaft zeigt sich grau in grau. Eine halbe Stunde später sind wir in Sedgefield und finden dank Navi unsere neue HomeExchange-Unterkunft auf Anhieb.
Werner hat die Fahrt von Johannesburg aus in nur zwei Tagen geschafft und ist bereits kurz vor uns zu Hause angekommen. – Mit einem Glas Wein werden wir von ihm und seiner Frau Cheryl herzlich begrüsst. Anschliessend beziehen wir ihr hübsches Cottage, das mit separatem Garten neben ihrem Haupthaus steht und bestens bestückt ist mit allem, was wir brauchen.
Endlich können wir nach acht Tagen mal alles aus dem Auto ausladen und uns gemütlich einrichten.
Ein Einkauf bei Pick n‘ Pay, ein gesundes Nachtessen mit Salat, Gemüse und Poulet-Fleisch, dazu die Hoffnung, morgen etwas Sonne zu sehen, beschliessen unseren Tag.
Sedgefield
Theo geht’s gut! - Wären wir heimgeflogen, wär er jetzt eventuell in Heiligenschwändi zur Kur oder an einem ähnlichen Ort. Kalt wär’s draussen, Nebel und Regen... – Wir finden es hier viel schöner!
Die Woche in Sedgefield ging rasch vorbei, obwohl wir gar nicht sehr viel unternommen haben. Ausruhen war schliesslich angesagt, und das haben wir ausgiebig getan. Leider war’s die ersten paar Tage ziemlich regnerisch und recht kühl, aber eigentlich hat uns das gar nicht gross gestört; wir haben ja Zeit.
Sedgefield ist ein seltsamer Ort. Die N2, die Strasse, die durch die Garden Route führt, teilt den Ortskern, wenn man so sagen kann, in zwei Teile. Beidseitig auf der Länge eines Kilometers etwa hat es Läden, aber alle machen einen mehr oder weniger heruntergekommenen Eindruck. „Nothing to write home about“, für Touristen kein Paradies. – Nur die Apotheke macht einen guten Eindruck und auch der Autohändler am Eingang des Dorfes mit seinen Oldtimern. – Über den Schuhmacher sind wir froh; der schwarze Angestellte flickt unsere Schuhe, bei denen sich vom vielen Spazieren (!) die Sohlen gelöst haben, perfekt in Rekordzeit für einen Pappenstiel und das in einem Mini-Ladenlokal von nicht grösser als 3m2.
Der „Rest“ des Ortes besteht aus unzähligen Einfamilienhäusern, einige wohl nur als Ferienhäuser bewohnt, bis hinunter zum Meer. Sicher war nicht nur ein Architekt am Werk. Trotzdem: Am beliebtesten sind die dreieckigen Häuser, nach holländischem Vorbild. Sie sind, wir sehen das auch bei unseren Gastgebern, speziell einfach zum Möblieren...
Schön ist die Ruhe, die dort herrscht und es ist ein tolles Gebiet für Spaziergänge im Goukamma Naturschutzgebiet. Zweihundert Meter entfernt von wo wir wohnen, ist man bereits am Wasser. Flussarme und Meeresbuchten fliessen ineinander über, und hinter den hohen Dünen findet sich das weite Meer.
Wie erwartet hält sich Theo kaum an die Nahrungsvorschriften, die ihm im Spital gemacht wurden, aber zumindest versucht er die Ermahnung, sich viel zu bewegen, mehr oder weniger zu beherzigen. So macht er jeden Tag seinen Spaziergang.
Spaziergänger anderer Art haben wir auch im Garten unseres Cottage.
Schildkröten kriechen vorbei. Kleinere und grössere. Sie gehören niemandem, sind also wild. Obwohl „wild“ im Zusammenhang mit Schildkröten eine etwa seltsame Bezeichnung ist.
Ein Perlhuhn Ehepaar wandert am liebsten auf der Mauer, die das Grundstück umgibt, da haben die beiden einen schönen Ausblick.
Zum Glück hat’s so gut wie keine Mücken, und auch „the creepy and crawly“ verschonen uns fast gänzlich.
Das Nachbarsbüsi kommt vorbei, wenn ich Wäsche aufhänge auf der Stewi-Libelle (auch so eine Nostalgie-Erinnerung und wohl etwas typisch Schweizerisches). - Es muss grauenhaft jammern, weil es überall Vogelgezwitscher hört, aber zu träge ist, einen zu fangen.
Ja, Vögel hat’s unendlich viele. Demnach auch ein unaufhörliches Gezwitscher, Geschnatter und Gekeife. Vor allem der eine Typ regt ziemlich auf, der nur gerade ein Sechs-Ton-Lied beherrscht, das er immer und immer wieder vor sich hin flötet. Ich glaube, der sucht eine Gespielin, aber bei dem Gesang… Ich gönnte ihm zwar gerne zwei oder gar drei davon, wenn er doch nur endlich den Schnabel hielte!
Zu Sedgefield gehört auch der grösste salzhaltige Binnensee Südafrikas, der Swartvlei. Die Gegend um den See herum erinnert an die Schweiz, nur dass da keine Häuser zu sehen sind. Es hat aber einzelne exquisite Lodges; in der Lake View Lodge kann man Wein degustieren oder auch nur eine Flasche zum Apéro trinken, dazu lassen wir uns an einem schönen Spätnachmittag sehr gerne verleiten.
Auf unserer Reise haben wir ja jeden Abend auswärts gegessen, so sind wir nun ganz froh, gemütlich „zu Hause“ tafeln zu können. Es gibt nur einen Supermarkt in Sedgefield, den Pick n‘ Pay, aber die Auswahl, die er anbietet, ist nicht umwerfend. Nicht einmal Fisch ist im Angebot. Da muss man schon 20 km nach Knysna fahren, um welchen zu kaufen oder in die andere Richtung nach George, 35km. - Seltsam, ein Ort direkt am Meer… Einmal sind wir bei unseren Gastgebern eingeladen mit einem weiteren Ehepaar aus der Schweiz, also eine Art Schweizerabend, zum Glück aber ohne Fondue und dergleichen. Cheryl hat ein herrliches Gericht zubereitet aus Ente (aus Knysna), Nudeln und Salat. Cheryl ist übrigens Südafrikanerin, aber sie spricht, soweit ich das beurteilen kann, ein lupenreines Züridütsch; Werner hat’s ihr beigebracht.
Restaurant direkt am Meer hat’s keine in Sedgefield. Hinter den Dünen schon. Im Pili Pili, die Füsse im Sand, am wärmenden Feuer, gibt’s feine Pizzas, nette Bedienung und eine gemütliche Atmosphäre.
Samstag ist Markttag – Farmers-Market - rain or shine. Sehr bekannt offenbar in der ganzen Gegend. Fein frühstücken kann man dort, es gibt guten Kaffee und so einiges zum Gänggele.
Ausflüge
An einem grauen Nachmittag fahren wir nach George, mit circa 250‘000 Einwohnern eine der grösseren Städte des Western Cape und das Herz der Garden Route. Viel Sehenswertes gibt’s nicht, den Ort selber kann man sich sparen, aber es hat ein tolles Transportmuseum (und ein Museumsbesuch ist bei diesem Regen genau das Richtige), wo all die Züge ausgestellt sind, die einst in dieser Gegend Passagiere und Güter von Ort zu Ort gebracht haben. Jetzt stehen sie in einer riesigen Halle und man kann sie zum Teil auch von innen besichtigen und bewundern. – Ebenfalls bietet das Museum Platz für eine Vintage-Car-Ausstellung. – Sogar den Borgward Isabella hat’s dort. An den erinnere ich mich gut…
Zum Coiffeur hätten wir beide schon längst mal gehen sollen. Auch dafür ist das Wetter ideal. Die drei Damen im Haarsalon haben nichts zu tun und freuen sich über unseren Besuch. Sie machen’s richtig gut; wir sind sehr zufrieden. 18 Fr. für beide neuen Coupes - reichlich Trinkgeld inbegriffen – nicht schlecht!
Am Dienstagabend, dem ersten schönen Tag in dieser Woche, laden wir Cheryl und Werner zum Nachtessen ein. In Wilderness, dem Nachbarort, kehren wir in einem Restaurant ein mit Terrasse und Blick direkt aufs Meer und den Sonnenuntergang.
Die beiden und auch Theo, der Wild gerne mag, bestellen Springbok-Shanks, was der Kellner als Today’s Special anbietet. Ich bleib lieber beim Fisch. – Und bin froh! – Es kommen sechs Schenkel daher (der Springbock - eine Antilopenart - kann zwei Meter hohe Sprünge machen und seinen Feinden mit Geschwindigkeiten bis zu 90 km/h entfliehen. – Diesen hier auf den Tellern ist das offensichtlich nicht gelungen). - Ich kann mir nicht vorstellen, wie man all das essen kann. Aber es geht. Nur Werner lässt sich einen Doggie-Bag geben.
Einen Tag verbringen wir doch am Strand. Das Wetter ist jetzt besser. Allerdings hat es einen so starken und kühlen Wind, dass er uns fast wegbläst. Die Kite-Surfer freut’s – auch die Gleitschirmflieger; wir finden ein geschütztes Plätzchen in den Dünen.
Ein paar Kilometer weiter westlich hat’s ein sogenanntes „Organic Village“, „Timberlake“, also ein Bio-Dorf mit verschiedenen kleinen Geschäften, die allerlei Alternatives und Hausgemachtes anbieten, aber man kann dort auch Tree-Top-Climbing buchen und Reiten. – Da kann ich nicht widerstehen. Auf dem Pferderücken eine Gegend zu erkunden hat mir immer schon gut gefallen, speziell in den Ferien; man kommt oft an Orten vorbei, die man weder zu Fuss noch mit dem Auto erreichen kann. Und zudem macht es Spass. Schon seit längerer Zeit hab ich das nicht mehr gemacht, aber jetzt und hier - an einem schönen Nachmittag lass ich mir die Gelegenheit nicht entgehen.
Wir sind zu dritt, zwei Girls aus Holland, die dort einen Freiwilligeneinsatz leisten und ich. Wir reiten durch dichte Vegetation, es geht zum Teil steil bergauf und von einer Krete aus haben wir einen herrlichen Blick auf ein stilles Tal mit verschiedenen Seen. Weit und breit sind keine Häuser in Sicht.
Ein weiterer Ausflug bringt uns nach Knysna (ausgesprochen: Naiss-na), einer Feriendestination mit netten Läden und Restaurants an der Waterfront. Dort essen wir am Abend in einem Fischrestaurant und geniessen den Blick auf den Hafen und die untergehende Sonne.
Vorher aber, am Nachmittag, besuchen wir den Nachbarort Brenton-on-Sea, von wo aus man einen fantastischen Blick hat auf Küste und Felsen. Ein Weg führt hinunter zum Strand und wir machen einen langen Spaziergang. Ein Schild sagt, man solle lieber dort nicht schwimmen, und damit auch Deutsche das gut verstehen, hat einer wohl den Google-Translator bemüht – es heisst „Höre auf zu schwimmen“. - Ok, ok, wir haben zwar noch gar nicht angefangen, aber machen wir doch. - So viele Quallen wurden angeschwemmt, dass einem die Lust zum Schwimmen so oder so vergeht, bevor sie sich überhaupt einstellen kann.
George – Choo Tjoe-Fahrt
Am Tag, an dem wir Sedgefield in Richtung Mossel Bay verlassen, kommen wir wieder in George vorbei. Das Transport Museum bietet eine Zugfahrt in die Berge an, auf die wir beim letzten Besuch wegen des Regens gerne verzichteten, aber jetzt, wo’s zwar wieder nicht strahlend schön ist aber doch einigermassen passabel, entschliessen wir uns, die zweieinhalb-stündige Fahrt mitzumachen. Ursprünglich gab’s einen Zug, der von George bis Port Elizabeth fuhr, aber weil bei Überschwemmungen vor zehn Jahren ganze Teile des Bahn-Trassees weggespült und nicht wieder aufgebaut worden waren, ist diese „Outeniqua-Powervan“-Fahrt das einzige Überbleibsel dieser Strecke, die nur noch etwa 30 km lang ist.
In den beiden Powervans haben je ungefähr zehn Personen Platz. Diese dienten ursprünglich dazu, die Züge anzustossen, jetzt stossen sie Touristen den Berg hinauf. – Aber der Ausflug hat sich gelohnt. Was für eine spannende kleine Reise in die wunderbare Gegend der Outeniqua-Mountains, durch weite Fynbos-Landschaften und Wälder, durch sechs Tunnels. Immer wieder mal überqueren Affen und Bush-Böcke die Gleise vor uns. An der „Endstation“, wo der Zug wendet, schauen wir auf den Montague-Pass hinunter (745 m hoch, anno 1847 nach drei Jahren Arbeit durch 250 Häftlinge fertiggestellt, die älteste unveränderte Passstrasse in Südafrika) und bei einem Pick-nick-Halt gibt’s einen Panorama-Ausblick auf George und Umgebung.
Bis Mossel Bay ist’s nur noch eine gute halbe Stunde Fahrt, das schaffen wir in Nu. – Wieder mit dem Auto natürlich.
Mossel Bay
Vom 21. bis am 30. November wohnen wir in einem Apartment im sechsten Stock mit Blick auf die Diaz Bay. Wir unternehmen etliche Strandspaziergänge und besuchen auch gerne das Städtchen. Lieblings-Coffee-Shop: Blue Shed / Lieblings-Restaurant: La Peron.
An Theos Geburtstag, dem 24. November: Wir frühstücken bei herrlichem Wetter in einem Restaurant am „Point“, der Strandpromenade, spazieren anschliessend zum Leuchtturm (St. Blaize Trail) und besuchen am Nachmittag die verschiedenen Museen im Barthalomeu Diaz-Museum-Komplex. Drinnen und draussen gibt es manches zu sehen: Historische Gebäude, Schiffe und Teile davon, Muscheln, Meergetier, den alten Postbaum und und und.
Am Abend essen wir im Kaai4. - Das Restaurant am Hafen mit toller Aussicht und „Füsse im Sand“ wurde uns empfohlen und auch im Tripadvisor ist’s die Nummer 2 am Ort.
So günstig haben wir noch nie gegessen (15 Fr. alles inklusive). Aber schön war’s und gut. Wein gab’s keinen; zum Glück hatte ich eine Flasche bei mir, weil ich noch fast befürchtet hatte, dass es dort keinen gibt, denn der Beschreibung nach handelte es sich nicht um ein Fünfsterne-Etablissement, eher ein gemütliches Backpacker-Lokal. Was ich nicht wusste, war, dass dort alles nur in Blechgeschirr serviert wird. Gläser gibt’s nämlich auch keine, für den Wein erhielten wir an der Bar, wo man bestellen muss, zwei ziemlich fragwürdig aussehende Blechtassen. Als der Barkeeper mein entsetztes Gesicht sah, hatte er Bedauern und schliesslich, nachdem er sich mein Gejammer angehört hatte, auch ein Einsehen. Jemand ging uns zwei Gläser holen, irgendwoher – ein Weisswein- und ein Rotwein-Glas.
Es war ein unvergesslicher Abend, ich möchte ihn nicht missen.
An einem Nachmittag überlasse ich Theo seinem Schicksal und geh auf Safari im Botelierskop-Game-Park. Der Name stammt von dem speziellen Felsen, der irgendwann mal kippen könnte, wenn’s dumm geht.
Am lustigsten finde ich die gut getarnten Straussen-Küken, die im Gänse- oder eben im Straussenmarsch aufs Beste bewacht von ihren Eltern, brav durchs hohe Gras hinter ihnen herwackeln.
Die Augen der Strausse seien grösser als ihr Hirn, erzählte der Guide. Daher seien sie mehr aufs Sehen als aufs Denken fokussiert. Sie sehen sehr gut, so dass, wenn sich etwas Verdächtiges bewegt 300 Meter weiter weg, ihr Auge ihnen sagt, hau lieber ab, solang noch Zeit ist. So sind sie oft auf der Flucht auch ohne tatsächliche Not. - Sogar der „national bed“ zeigt sich diesmal, der Blue Crane.
Unterwegs von Mossel Bay nach Cape Town 30. November – 4. Dezember
Ziemlich schwer tat ich mir mit der Auswahl des Übernachtungsorts am ersten Abend. Da gibt es so viel zu sehen unterwegs, so schöne Orte zu besuchen – das alte Lied von Wahl und Qual.
Ich erwähne die Orte, die ich im Auge hatte, dann aber nicht gewählt habe, trotzdem, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, wieder mal in dieser Gegend Ferien zu machen, und dann würde ich mich daran zurückerinnern, ohne lange suchen zu müssen.
Erstens: bei Heidelberg („Skeiding Guest Farm“, eine Schaf- und Strauss-Farm) / zweitens: Witsand / drittens: Barrydale, „Karoo Moon Hotel“ und viertens: Still Bay „Anchoridge“).
Das Letzte haben wir schliesslich gewählt, das fabelhafte Guest House liegt am Goukou River, der nicht weit davon ins Meer fliesst. Je nach den Gezeiten aber ist es genau umgekehrt und das Meer fliesst in den Fluss, so dass dieser die Richtung ändert. Man kann im Fluss schwimmen und ich stellte es mir ganz interessant vor, wenn es der Aare mal in den Sinn käme, in die andere Richtung zu fliessen.
An der Mündung, wo der Goukon ins Meer fliesst, kann man wunderbar spazieren, dem Strand entlang – kilometerweit, wenn man möchte. Still Bay ist auch bekannt unter dem Namen „The Bay of the Sleeping Beauty“, das ist eine Bergkette, die mit viel Fantasie eben aussieht wie eine schlafende Frau – man sieht die Dame, wenn man gegen Norden schaut.
In der Nähe des Hafens kann man bei Ebbe die sogenannten „Fish-Traps“ erkennen, Fallen, mit denen schon die Khoisan (Hottentotten und Buschmänner) vor Jahrhunderten Fische gefangen haben. Es sind runde Steinkreise, die Pools bilden, aus denen es kein Entrinnen mehr gab.
Heute fängt man die Fische anders und zwei dieser Exemplare essen wir zum Znacht am „Fisch-Kiosk“ im Restaurant „Viking Fishing Anchor Restaurant“ – direkt aus dem Kutter auf den Teller.
Von der N2, die von Osten nach Westen und natürlich auch umgekehrt durch die Garden Route führt, gibt es an manchen Abzweigungen Abstecher ans Meer. Nicht immer führt an der Küste eine Strasse entlang, so muss man also, wenn man einen solchen Ort wählt, dieselbe Strecke gegen Süden und wieder zurück zur N2 fahren, was manchmal doch einen Umweg von 30 oder noch mehr km mal zwei bedeutet. Für Still Bay hat sich dies gelohnt. Und wir hatten Glück: Während etwa zehn Kilometern ist die Strasse nur einspurig befahrbar, weil der Belag erneuert wird. Da kann es vorkommen, dass man sehr lang warten muss, bis die Ampel wieder auf grün schaltet beziehungsweise bis man von den Arbeitern das Schild „GO“ zu sehen bekommt und durchgewinkt wird. Aber eben – wir konnten beide Male ohne Verzug fahren. Überhaupt hat es unterwegs etliche Baustellen, fast wie bei uns auf den Autobahnen. Die Strassen werden in diesem Teil des Landes also bestens unterhalten; Schlaglöcher hat’s so gut wie keine mehr.
Auf dem Rückweg zur N2 machen wir einen kurzen Halt in der exklusiven Gin-Distillery „Inverroche“, wo Theo drei verschiedene Gin degustieren kann und eine Flasche dann natürlich auch kauft. Ich halte mich zurück.
Richtung Norden kommt die Sleeping Beauty immer näher und die Route führt zu ihren Füssen über den Garcia Pass. Vor dem Anstieg ist die Landschaft prächtig grün, dann sieht’s fast aus wie auf dem Julier bei uns in Graubünden auf über 2000 Metern, wo’s keine Bäume mehr hat, nur noch Weiden, dann Felsen und Geröllhalden. Aber hier sind wir ja nur wenige Meter über Meer. Die Passhöhe ist 550 m hoch. Auf der anderen Seite, wo’s wieder bergab geht, ändert das Klima völlig. Es ist der Beginn der kleinen Karoo, einer Art Vorwüste. Die Temperatur ändert, es ist jetzt viel wärmer als drüben. Auch die Vegetation ist karger, nur wenn eine Farm in der Nähe ist, gibt es grüne Flecken in der braunen Landschaft.
Mitten auf der Strecke steht „Ronnie‘s Sex-Shop“. - Da hat einer ein glückliches Händchen gehabt in der Wahl seiner Geschäftsidee. – Wohl jeder Touristenbus hält dort an, jedes Auto ebenfalls. Wir natürlich auch. Es ist sowieso Zeit für einen Drink. In der dunklen Bude sind alle Wände vollgeschrieben mit Adressen, Visitenkarten sind überall angeklebt, Büstenhalter in rauen Mengen hängen von der Decke herab sowie T-Shirts oder Caps (was sollen die armen männlichen Besucher auch anderes beitragen zum Zirkus, Unterhosen können’s ja lieber nicht sein).
Wir fahren weiter nach Barrydale. Man hat das Gefühl, es sei ein Bergdorf, es macht zum Wandern an. Was für ein lustiges Hotel ist dann das Karoo Moon Hotel, das ich fast für eine Nacht gebucht hätte. Hier hat man das Gefühl, man sei in den USA. „Route 62“ heisst’s auf dem Schild, grad gleich wie die berühmte „66“. Der Besitzer hat ein riesiges Sammelsurium an Oldtimer-Kotflügeln, -Stossstangen und sonstigen Wrack-Teilen, ausgedienten Benzinzapfsäulen, Plakaten, Krimskrams jeglicher Art und Weise, alles überfüllt und überhäuft mit Karsumpel, aber originell und zum Teil wirklich sehenswert. Wie der Besitzer merkt, dass es mir hier gefällt und ich Fotos mache, zeigt er mir die Herrentoilette mit all dem Schnickschnack, der dort drin ist und holt dann noch den Schlüssel zum Hotel, zeigt mir alle Zimmer und erzählt mir vom Werdegang dieses speziellen Ortes. - Lustig, lustig!
Anschliessend führt uns die Route über den Tradow-Pass. Und wieder hat man das Gefühl, man sei im Hochgebirge (Passhöhe 348 m) mit schroffen Felswänden, fast wie in einem amerikanischen Cañon, und tiefen Einschnitten.
Nach 50 Kilometern erreichen wir Swellendam. Je nachdem, welche Broschüre man liest, ist der Ort der zweit-, dritt- oder viertälteste in Südafrika.
Ich habe eine Nacht gebucht in der Marula-Lodge und wir hatten ein für hiesige Verhältnisse ober-teures Nachtessen im Koornlands Restaurant. Eine wunderbare Küche (ein Springbock mehr hat dran glauben müssen und so auch ein Strauss - ich erfreute mich an seinem zarten Filet) und ein gediegener Rahmen rechtfertigen den Preis (die teuerste Flasche Wein 22 Fr., die Gesamtrechnung 70 Fr.).
Tags darauf besuchen wir das Droste-Museum (verschiedene Gebäude aus alter Zeit – Gefängnis, Herrenhaus, Handwerkerschuppen und -utensilien sowie viele Beiträge zur Geschichte der Sklaverei) und werfen einen Blick auf die Kirche, die nicht genau wusste, welchen Stil sie denn wählen sollte.
Die Fahrt geht anschliessend weiter Richtung Süden nach Bredasdorp und von dort aus an die südlichste Spitze des Kontinents, ans Cap L’Aghulas. Auch wenn man dorthin fahren will, muss man es auf sich nehmen, etwa 40 km unter die Räder zu nehmen und dieselbe Streck wieder zurückzufahren, aber wir finden, es hat sich gelohnt. Die Küste ist zerklüftet und es hat wunderbare Spazierwege entlang der Felsen, mitten durch die Fynbos-Vegetation, Holzstege, über die man fast endlos wandern kann.
Gegen sechs kommen wir in Hermanus an, wo ich für zwei Nächte im charmanten „16 Main“ ein Zimmer gebucht habe.
Hermanus
Wenn man zwei Nächte am selben Ort bleibt, kann man’s am Morgen gemütlich nehmen. Es ist Samstag, also wieder Markttag. Sie gefallen mir einfach, diese Farmers‘ Markets. Und immer kommt man mit Leuten ins Gespräch. So auch jetzt mit Leon und Natalie. Sie geben uns viele nützliche Tipps.
Da wird dann Theo auch seine Geschichte los und allmählich bitte ich ihn, sich davon eine Kurzfassung zu überlegen, so dass das Drama auch im Gespräch mal ein Ende findet.
Ein Spaziergang durch Hermanus, welches direkt an den Klippen gelegen ist, zeigt uns die zahlreichen malerischen Ecken des Ortes. Es ist kein Wunder, dass es hier so viele Touristen hat.
Theo möchte sich am Pool ein wenig erholen vom Stress (!), klar, machen wir doch.
Schliesslich haben wir am Abend noch was vor: eine Fahrt nach Fisherhaven in ein Schweizer Restaurant, das uns von Cheryl und Werner aus Höchste empfohlen wurde. „Le Châlet“ heisst es und so sieht es auch aus. Auf dem Weg dorthin machen wir Halt auf einem Hügel, der einen schönen Blick auf die Bay bietet und fahren dann weiter nach Fisherhaven, einem verschlafenen Örtchen am Ende einer Lagune. Wir sind ein wenig früh, also bin ich für einen Spaziergang dem Wasser entlang. Ich muss vorgehen – es könnte eventuell Schlangen haben… Auch ein Hochzeitspaar hat diesen idyllischen Ort ausgewählt zu einem Fotostopp.
Was uns Marianne und ihr Mann Leo, der Gourmet-Koch, dann servieren, ist Spitze. Unter anderem endlich seit Wochen zum ersten Mal ein feines Brot. Perlhuhn-Patée, Springbock einmal mehr, Filet vom Bio-Rind mit liebevoll zubereiteten Zutaten, alles frisch aus dem Garten, Mozzarella home-made - Freude herrscht!
Der Abstecher dorthin sehr lohnenswert, nicht nur, um die Schweizerfahne in einem Garten flattern zu sehen.
Am nächsten Tag geht’s zuerst ins „Hemel-en-Aarde“-Tal (Himmel und Erde), wo’s im Weingut „La Vierge“ den ersten Cappuccino gibt mit Zugabe einer herrlichen Aussicht über die Weinberge im Tal, das Gebirge im Hintergrund und die Bay am Horizont.
Via Kleinmond (toll ausgebauter Wanderweg entlang der Küste) geht’s weiter nach Betty’s Bay, wo Tausende von Brillen-Pinguinen ihr Zuhause haben. – Man sieht sie nicht nur, man hört und vor allem riecht sie auch, könnte ihnen aber trotzdem stundenlang zuschauen, wie sie in ihren Fräcken herumstehen wie an einer Veranstaltung, die noch nicht begonnen hat. Einige wackeln herum, andere balgen sich mit den Kormoranen, die ebenfalls Gefallen finden an den Felsen in dieser Bucht, sich dort tummeln und brüten.
Weiter geht die Fahrt der Küste entlang und bald schon hat man eine atemberaubende Sicht über die False Bay, die Klippen, die Strände und das Meer.
Am späteren Nachmittag erreichen wir unser neues Ziel – fast wie wir begonnen haben in Dainfern - ist es ein Golf Estate (Greenways), eingezäunt und auf allen Seiten bewacht mit Gates, Stacheldraht, Mauern und Security. 24 Stunden am Tag.
Strand ist ein Vorort von Cape Town, etwa 50 km vom Zentrum entfernt. – Dazu später mehr.
Cape Town
Schon an unserem ersten Tag machen wir einen Ausflug auf den Tafelberg. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen, und das heisst , man muss es ausnützen, wenn die Sicht gut und die Tafel nicht mit einem Tischtuch in Form von Wolken bedeckt ist. Ist’s dazu noch ein Wochentag und nicht das Wochenende, wo man offenbar lange anstehen muss, dann heisst es: Nichts wie los!
Nicht wenige Leute haben dieselbe Idee wie wir, aber wir finden einen Parkplatz in nächster Nähe der Talstation der Gondelbahn, müssen nicht Schlange stehen und sind im Nu oben (mit der neuen grossen Schweizer-Gondel), wo’s eine Aussicht hat vom Feinsten.
Nach einem Rundgang und 100 Fotos im Kasten, geht’s wieder hinunter, diesmal zur Marina, von wo aus wir den berühmten Berg auch von unten sehen. – Das Gebiet am Hafen ist ebenfalls ein Anziehungspunkt für Touristen, aber auch für Einheimische. Die Restaurants sind voll, alle wollen den milden Abend und den schönen Ausblick geniessen. Wir machen sogar eine halbstündige Hafenrundfahrt und essen dann in einen feinen Restaurant – mit Blick auf den Tafelberg natürlich – z’Nacht.
Die fast einstündige Heimfahrt über die Autobahn bei Nacht macht dann weniger Spass, aber da müssen wir halt durch.
In Strand (Ortsname) selber gibt‘s „nothing much to write home about“, deshalb lass ich’s auch bleiben. Die Unterkunft aber, die wir durch Home Exchange gefunden haben, ist sehr schön, es ist auch dieses Mal wieder eine Wohnung. Sie liegt im zweiten Stock eines Mehrfamilien-Hauses, direkt am Strand.
Auch hier gibt’s Vögel en masse, denen es auf dem Green gefällt; Herr und Frau Perlhuhn mit ihren Kindern sind ebenfalls da. Verschiedene Familien sogar, und wenn sie nicht grad am Fressen sind, ist es ihre Lieblingsbeschäftigung, über den Rasen zu rasen.
Dass es hier stunden- und tagelang fast orkanartig winden kann, wussten wir nicht, aber es stört uns auch wenig, denn wir sind ja immer unterwegs und lassen die Winde in Strand zurück. Schon ein paar hundert Meter weiter weg am Strand in Strand bläst der Wind nur noch mässig. – Dass jedoch die hohen Palmen dieses ständige Gebläse aushalten, ist kaum vorstellbar. Die Vögel stört’s jedenfalls nicht, sie sind’s wohl gewohnt, aber ihre Flugbahnen sind seltsam.
Was das Beste ist bei unserem neuen Exchange: Steffi und Bert, mit denen wir den Tausch vereinbart haben (sie wohnen seit 35 Jahren in SA und die Wohnung hier ist ihr Feriendomizil), gehören einmal mehr zu den nettesten Gastgebern, die man sich vorstellen kann.
An einem Tag besuchen wir mit ihnen zwei Weingüter in Constantia, ganz in der Nähe, wo sie wohnen.
Im „Cape Point Vineyards“ hat Steffi zum Lunch einen Tisch reserviert. Der Ausblick über die Ebene, die Reben, die Berge, den Strand und das Meer ist vom Schönsten, was ich je gesehen habe.
Eine zweites Weingut besuchen wir nachher, „Buitenverwachtig“, auch das ein wunderbarer Ort zum Pick-nicken, Weine Probieren, Chillen.
Am späteren Nachmittag laden die beiden uns zu sich nach Hause ein zu Kaffee und Kuchen.
Und wieder eine Stunde Heimfahrt…
Eigentlich wollten wir heute (8. Dezember) ans Kap der Guten Hoffnung fahren, aber es scheint, der Himmel ist nicht ganz so blau, es könnte sein, dass man nicht allzu viel sieht. Im letzten Sommer an der Pointe du Raz in der Bretagne hatten wir ja bereits so ein Erlebnis: Regen, Nebel und Sicht fast gleich Null; darauf können wir verzichten; die Fahrt dorthin dauert ja etwa anderthalb Stunden, ist also nicht grad nur „accross the bridge“.
Neues Programm also: Besuch in Kirstenbosch, dem nationalen botanischen Garten. Bei einer geführten Wanderung lernen wir viel Neues und Erstaunliches über die Bäume, Blumen und Sträucher, die hier heimisch sind.
Lunch dann im 330 Jahre alten Weingut „Groot Constantia“. Auch hiervon könnte ich mindestens eine Seite lang nur schwärmen, ich lass es jetzt aber. Habe sowieso gemerkt, dass ich wieder ins Plaudern geraten bin…
Gegen fünf fahren wir weiter nach Hout Bay, wo wir uns erst verfahren und durch die Township fahren, eher noch durch einen „noblen“ Teil. Dennoch sind wir einmal mehr erstaunt, wie viel Abfall dort herumliegt, den man ohne grosse Mühe wegräumen könnte, wenn er einen denn störte… Aber die Leute hier sind fröhlich, sie grüssen und die Kinder spielen zufrieden miteinander mit dem wenigen, was sie haben.
Am Hafen gefällt es uns dann sehr. Im Restaurant „The Wharfside Grill“, das wie ein Schiff gebaut ist und dessen Servierpersonal gekleidet ist wie Matrosen, essen wir Fisch und Meerfrüchte und machen uns dann wieder auf die einstündige Heimfahrt, wo wir grad knapp vor Beginn der Dunkelheit um halb neun ankommen.
Der Freitag ist ein Regentag. Alle sind froh: wer hier lebt, weil Wasserknappheit herrscht und Regen dringend nötig ist und wir, weil Theo eine „Pause einschalten“ muss/will. Ich benutze die Zeit zum neu Planen, Emails schreiben, aber dann machen wir am Nachmittag doch noch einen „Ausflug“ ins nahe gelegene Einkaufszentrum, die Somerset Mall. Theo hat nämlich seine Brille fallen lassen – Splitter über Splitter - am besten, er lässt sich gleich einen neue machen. In der Zeit, wo er sich beim Optiker beraten lässt, lasse ich meine Füsse pflegen. In einem kleinen Shop „Pedinail“ throne ich also auf einem Sessel, vor mir am Boden kniend die junge Dame, die sich über einen Stunde lang an meinen Füssen zu schaffen macht. Links von mir eine andere Kundin, eine Schwarze, die mit ihrem Umfang fast zwei Sitze braucht, rechts neben mir eine Weisse, mit der ich dann ins Gespräch komme. Eigentlich hatte ich ja lesen wollen…
Die Szene kommt mir vor wie in einem schlechten amerikanischen Film – wir drei Frauen (zwei zusammen am Chatten) auf unseren erhöhten Stühlen, drei schwarze junge Angestellte am Füsse-Baden, Massieren, Raspeln, Nägel-Schneiden, -Feilen und -Lackieren.
Ja, und eine Stunde später hat mir Petra ihre halbe Lebensgeschichte erzählt, die ich hier natürlich nicht wiederholen will. Aber trotzdem muss ich lachen, wie ich erfahre, dass sie mit ihrem zweiten Mann auf einer Schaffarm mitten im Karoo lebt, ihr Mann züchte die Tiere und beide sind Vegetarier… Wenn ich das nächste Mal in dieser Gegend sein sollte, müsse ich sie unbedingt besuchen, sagt sie.
Theos Brille ist bestellt, wir kaufen ein und essen am Abend wieder mal daheim.
Der Samstag ist dann ein wolkenloser Tag, nicht zu heiss und nicht zu kalt. Jetzt brechen wir auf Richtung Kap. Unterwegs sehen wir die pittoresken farbigen Standhäuser von St. James, in Kalk Bay gibt’s einen Kaffee-Halt. Der Ort gefällt uns sehr gut. Es hat viele Touristen, vor allem junge, aber es herrscht eine ausgelassene, fröhliche, mediterrane Stimmung, ein Ferienort, wo man sich wohl fühlen kann, wo’s nette kleine Geschäfte, Antiquitäten- und Kurios-Shops und viele gemütliche Cafés und –Restaurants hat’s, zum Teil mit Sicht direkt aufs Meer. Vor lauter Auswahl weiss man kaum, wo man nun den Cappuccino trinken will. Ganz ähnlich ist’s in der nächsten Ortschaft, Simons Town. Auch diese macht einen bunten Eindruck. Ein Markt findet statt, neben Ständen mit afrikanischen Souvenirs bieten weisse Händler ihre Produkte an, oft auch selbst Gestricktes und Geschnitztes, home-made Konfitüren, Kunst und Kitsch, ein lebendiger Markt. Jedenfalls macht es einen an, herumzuschlendern, mit den Händlern zu plaudern, am Hafen die Schiffe zu fotografieren, einfach zu chillen.
Am Parkeingang zum Cape-National-Park dauert’s schliesslich eine ganze Weile, bis sich die Schranke öffnet und man hineinfahren kann. Wenn’s halt jedes Mal pro Auto fast fünf Minuten braucht, bis der Kreditkartentürk abgelaufen ist mit Pin Eingeben und Unterschreiben (ein fast mittelalterliches Vorgehen, wenn man an die französischen Mautstellen auf der Autobahn denkt), dann ist das nicht erstaunlich. Ein Vorteil hat das gemächliche Vorgehen doch: Man ist dann alleine auf weiter Flur, denn der Fahrer im Wagen hintendran muss ja auch erst das ganze Prozedere über sich ergehen lassen.
Eine schöne Fahrt durch die wunderbare Fynbos-Vegetation führt zum Parkplatz, wo ziemlich viel los ist. Man muss sich jetzt überlegen, ob man zum Leuchtturm marschieren, das Bähnli dort hinauf nehmen oder zu Fuss zum viel besagten Cape of Good Hope wandern will. Theo muss sich ja bewegen, wir wählen den Weg zum Kap. Den wählen auch ein paar Pavian-Familien, was nicht sehr Spass macht, denn die Tiere können sehr aggressiv sein. Ich hoffe, Theo hat nichts zum Essen im Rucksack (den ich tragen muss). Die Affen lassen uns in Ruhe, alles bestens. Den Weg kann man nicht als eben beschreiben, ich bewundere Theo, dass er während dieser anderthalb Stunden in seinen Discoschleifern über Stock und Stein mithalten kann.
Auf dem Rückweg (Westseite der Kaphalbinsel) machen wir Halt in einer Straussenfarm und fahren dann die berühmte Chapman’s Peak Road entlang. Kein Wunder, wird gesagt, dies sei die schönste Route in ganz Südafrika. Die Aussicht von den unzählligen Lookouts aus ist atemberaubend. Die Strasse ist in den Felsen gehauen und fantastisch ausgebaut. – sie endet in Hout Bay, wir essen diesmal in einem italienischen Restaurant und treten dann wieder den einstündigen Heimweg über die M63, dann die N2 an.
Sonntag und Montag sind dem Wein gewidmet. Stellenbosch, Paarl, Franschhoek – das sind unsere Ziele. Von da, wo wir wohnen, dauerts nur gerade eine halbe Stunde nach Stellenbosch. Bei der riesigen Auswahl an Weingütern ist es fast nicht möglich, sich zu entscheiden, welche man besuchen will und welche nicht. Der Reiseführer, das Internet und die Tipps von Bekannten helfen weiter.
Wir beginnen bei Blaauwklippen, dann Vrendenheim und essen fein zu Mittag im Neethlingshof. Kaffee bei Asara.
Die Gegend ist grün und wie viele Rebstöcke es hier gibt, nähme mich echt wunder. Überall am Horizont erheben sich Berge, wo immer man ist, das Panorama ist einmalig.
Ein Weingut ist schöner als das andere; es ist sagenhaft. Oft sind es Herrenhäuser aus der kapholländischen Epoche, einige wurden bereits im 17. Jahrhundert gegründet, andere im 18ten und 19ten. Jedes Einzelne hat seinen eigenen Charakter, restlos alle sind aufs Aufwändigste gepflegt, Blumengärten gehören dazu, Garten- und Parkanlagen mit idyllischen Bächlein und Brücken, der Rasen sieht aus wie mit der Nagelschere geschnitten. Man fährt durch Alleen mit altem Baumbestand oder durch endlose Rebenhaine. Die meisten Güter haben luxuriöse Keller oder stiylische Bereiche, wo man den Wein degustieren und kaufen kann, bei etlichen kann man auch essen, bei manchen ist es einfach nur gemütlich. Zum Bleiben laden alle.
Freundlich empfangen wird man überall, für lediglich etwas drei Franken kann man fünf Weine probieren, die Qualität ist fantastisch, die Preise unglaublich tief.
Wir übernachten in Paarl und zum Nachtessen habe ich ein Restaurant ausgesucht, das wir bequem zu Fuss von unserer Unterkunft aus erreichen können (Bosman’s). Und was für ein Festessen erwartet uns da. Zwar nähern wir uns jetzt den Schweizerpreisen und auch der Wein ist nicht mehr billig, aber was der Koch zustande bringt, ist absolute Spitze. Unvergesslich! Wir hätten das 7-Gang-Menu nehmen sollen. Leider hatten wir nur drei Gänge, aber wie gesagt, die waren sensationell. – Wieder mal in Paarl – keine Frage, wo wir einkehren werden.
Am nächsten Morgen fahren wir weiter nach Franschhoek, wo alles an die Hugenotten, die im Jahr 1688 hier angesiedelt wurden, erinnert. Sogar die Gegend. Man könnte sich vorstellen, irgendwo in den französischen Alpen zu sein.
Wir besuchen La Motte, Môreson, Rickety Bridge und Haute Cabrière. Eigentlich hatte ich mir vorgestellt, dort zu Mittag zu essen, aber leider (Montag) ist das Restaurant geschlossen. Gibt’s halt nur Tasting. Wir fahren zurück in den Ort und essen dort etwas. Dann geht die Fahrt weiter über drei Pässe zurück nach Strand.
Der Signal Hill fehlt noch im Programm, dann bummeln wir im farbige Zentrum herum: Bo-Kaap, Long Street, Company’s Garden und zum Nachtessen fahren wir noch einmal an die Waterfront, wo auch heute eine fröhliche und ausgelassene Stimmung herrscht.
Museumsbesuche lassen wir aus, es ist zu heiss (über 30 Grad seit ein paar Tagen) und ich finde es immer schön zu wissen, was man nächstes Mal, wenn man dort ist, noch alles unternehmen kann.
An unserem zweitletzten Tag besuchen wir Eva und Ken, die uns zu einem Braai
eingeladen haben in ihrem Haus in Rooi Els, in das sie mittlerweile umgezogen sind. Es ist ein Traumhaus, direkt am Meer, in einen Felsengarten hineingebaut. Auch das Braai ist die kurze Reise dorthin wert, Bananen mit Speck umwickelt zum Apéro, Elan-Filet, Kudu-Wurst, Lamm-Kotletts, Maiskolben, Salat und Garlic-Bread. Wir sind nur zu viert, für zehn Personen hätte die Mahlzeit allemal gereicht.
Den letzten Tag verbringen wir am Strand in Gordon’s Bay – wir wollen ja schliesslich nicht als Bleichmäuse heimatlichen Boden betreten.
Noch ein Znächtli in Stellenbosch auf dem Eikendal-Weingut („Man sitzt dort so schön und das Essen ist fein“, sagt Steffi), dann aber ist es Zeit zum Kofferpacken.
Am 16. Dezember kommen wir glücklich, zufrieden und gesund zu Hause an. Wir sind zurück von einer Reise, die auch einen völlig anderen Ausgang hätte haben können.
Nun war ich an der Reihe: Nicht halb so dramatisch allerdings. Kaum zu Hause, hatte ich mich einem kurzen, geplanten Spitalaufenthalt unterziehen müssen (Fussoperation) und war dann für mehrere Wochen ein armes Hinkebein.
Aber das zählte nicht. Ich freute mich, dass es uns trotz allem so unendlich gut ging, dass es Theo, flink wie ein Wiesel, in letzter Sekunde gelungen war, dem Sensenmann von der Karre zu springen, dass wir trotz allem ein fabelhaftes Jahr hatten und unendlich viele wunderbare Beweise von Freundschaft erfahren durften.
Neue Pläne
Schon wieder ruft die Ferne. Ich habe durch HomeExchange eine Anfrage erhalten, ob wir mit einem Paar aus Mexiko, aus der Provinz Quintana Roo, im Juni gerne einen Tausch vereinbaren würden. – Wieso auch nicht? – Einen Tausch auf den Bahamas, Long Island, haben wir auch noch zugut und diese Destination zu besuchen ist im Herbst wegen der Hurrikane wenig empfehlenswert, die beste Zeit für eine Reise dorthin sind April und Mai. Lässt sich gut kombinieren, finde ich. Kuba liegt ja auch in jener „Gegend“, kommt mir in den Sinn. Diese Insel figuriert sowieso schon längst auf meiner „To-do-Liste“. Lässt sich ebenfalls gut kombinieren genauso wie ein Zwischenhalt in Miami, wo wir die Gelegenheit packen und unsere Freunde, die Lindenmanns, besuchen können. – Gedacht – geplant.

Reisebericht Kuba 11. – 29. April 2017
Neue Pläne
Schon wieder ruft die Ferne. Ich habe durch HomeExchange eine Anfrage erhalten, ob wir mit einem Paar aus Mexiko, aus der Provinz Quintana Roo, im Juni gerne einen Tausch vereinbaren würden. – Wieso auch nicht? – Einen Tausch auf den Bahamas, Long Island, haben wir auch noch zugut und diese Destination zu besuchen ist im Herbst wegen der Hurrikane wenig empfehlenswert, die beste Zeit für eine Reise dorthin sind April und Mai. Lässt sich gut kombinieren, finde ich. Kuba liegt ja auch in jener „Gegend“, kommt mir in den Sinn. Diese Insel figuriert sowieso schon längst auf meiner „To-do-Liste“. Lässt sich ebenfalls gut kombinieren genauso wie ein Zwischenhalt in Miami, wo wir die Gelegenheit packen und unsere Freunde, die Lindenmanns, besuchen können. – Gedacht – geplant.
Es ist so weit: Unsere Frühlingsreise hat begonnen.
Beim Zwischenhalt in Paris kauft sich Theo tatsächlich ein Stück Brie und eine Terrine. Diese zumindest im Glas. Der Käse allerdings wird seinen ganzen Handgepäck-Koffer verstinken; ich kann’s nicht fassen, dass er sich sowas kauft.
Nach langer Reise kommen wir in Havanna an. Als Erstes geht’s wieder durch den Security-Check, Handgepäck aufs Band, elektronische Geräte separat, Jacke ausziehen, Uhr und Gurt ebenso – wieso das alles, ist mir nicht klar. Es hätte ja gar niemand das Flugzeug besteigen können, der nicht genau diese Prozedur bereits hinter sich gebracht hatte am Einstiegsort. – Arbeitsbeschaffung? - Ich frage lieber nicht, sonst mache mich noch unbeliebt. Am Zoll ist nicht zu spassen.
Trotz der vielen Leute, die soeben angekommen sind, geht das Einreiseprozedere erstaunlich schnell über die Bühne. Auch unsere Koffer sind rasch da, wir laden sie auf einen Trolley und damit dem Ausgang entgegen. – Ich bin gespannt, ob das, was ich mit Maria Elena abgemacht habe, klappt. Sie und ihr Mann Abel bieten eine Unterkunft an (Casa Particular) und mit ihr habe ich etliche EmMails ausgetauscht. Ihre Adresse habe ich von unseren Haustausch-Partnern auf den Bahamas, deren Tochter Maria Elena kennt. Maria Elena hat versprochen, uns am Flughafen José Martí abzuholen. Das klappt wunderbar. Ich hab ihr auch ein Bild geschickt von uns beiden, so dass sie uns erkennt.
Aufs Herzlichste werden wir begrüsst. Die beiden haben auch einen Freund mitgebracht, der uns dann mit seinem Oldtimer Chevrolet nach Hause bringt. – Das ist ein guter Anfang: Der Chevi ist gleich alt wie ich, Jahrgang 1953. Von aussen strahlt er schön gelb – bei näherem Hinsehen allerdings ist schon nicht mehr alles Gold, was glänzt. So ist das eben bei diesen Jahrgängen. Das Chassis…
Das Haus, in dem wir in den nächsten Tagen wohnen werden, ist bescheiden, wir erhalten aber eine ganz nett zurechtgemachte kleine Wohnung für uns allein, ein Mini-Wohnzimmer, ein Schlafzimmer mit zwei Schränken und einem Doppelbett, eine Küche und ein Badezimmer. Dieses ist neu gemacht mit glänzenden Kacheln, die Dusche funktioniert mit einer Art Tauchsieder (geht aber gut), die blaue Toilette hat weder Brille noch Deckel. (Erst später stellen wir fest, dass auch in Hotels teilweise diese Zutaten fehlen – warum, das wissen die Götter oder vielleicht Fidel).
Doch - Abel weiss es auch: WCs werden nicht als Ganzes verkauft, Deckel und Brille sind separat und da kauft man eben nur, was unbedingt nötig ist.
Wir haben sogar einen Fernseher. Nur kubanische Sender sind zu sehen. Für ausländische bräuchte man Kabel, aber das gibt es gar nicht, nur für die Botschaften, erklärt man uns. „No hay…“. (Gibt es nicht… ist hier das geflügelte Wort, das wir noch oft zu hören bekommen werden.
Ich öffne den Kühlschrank in der Küche – 24 Eier lagern darin, zwei Fläschchen Wasser. Nun, wir gehen ja dann morgen einkaufen, da wird das ja dann anders aussehen.
Todmüde sinken wir ins Bett. Inzwischen ist es halb elf geworden (um acht Uhr abends kamen wir an). Nach unserer Zeit wär’s ja bereits halb fünf Uhr morgens.
Am nächsten Morgen macht uns Maria Elena Frühstück. Ich denke, eine Tortilla wär nicht schlecht, sie macht uns je zwei Spiegeleier. Erst später merke ich, das Mehl und Milch fehlen.
Der Kaffee scheint mir zu stark, ich möchte lieber Tee. Zufälligerweise findet sich ein einziger Beutel in der Schublade. Rum, Bier und Kaffee gäbe es in Kuba vorwiegend zu trinken, Tee sei unüblich. Das lernen wir. – Dafür erhalte ich eine ganze Schüssel voll Mangos, der Baum steht im Garten, zwei Kübel mit Früchte drin auf der Küchenablage.
Aufs Brot verzichte ich. Gern sogar. Es ist Weissbrot, sieht aus wie Karton und schmeckt auch so.
Theo tut sich an seiner Terrine und dem stinkigen Brie genüsslich. Er gibt unseren Gastgebern zum Probieren. – Schlimm finden sie den Geschmack und rümpfen die Nase; Weichkäse kennen sie nicht.
Gabel und Messer passen nicht zueinander. Das Messer ist riesig, fast wie ein Brotmesser. Auf der Klinge heisst es: „Nura Hotel“.
Havanna
Maria Elena und Abel nehmen sich den ganzen Tag Zeit, mit uns nach Havanna zu fahren und uns dort herumzuführen. An Zeit mangelt es ihnen nicht, das gehört zum Service.
Mein erster Eindruck von der Stadt: Sie erinnert sehr an spanische Städte, wen wundert’s!
Weniger dann die fantastischen Oldtimer. Jeder Fünfte, der in Havanna herumfährt, sei so einer. Die ergeben die herrlichsten Fotos. Welcher Tourist würde da nicht schwelgen!
Es hat massenhaft prächtige, herrschaftliche Häuser im Kolonialstil, reich an Ornamenten, wunderbaren Details und farbigen Fassaden, aber die allerwenigsten davon sind in gutem Zustand. Im Gegenteil, die meisten sind baufällig, bei einigen sind weder Dach noch Fenster mehr vorhanden, Ruinen über Ruinen, überall liegt Schutt herum. Bäume wachsen aus dem Stein, Töpfe sind gar nicht nötig. - So schade, wenn man sieht, was da alles vor die Hunde geht. Und erstaunlicherweise sieht man doch immer wieder mal auf einer Terrasse eine Wäscheleine gespannt; offensichtlich gibt es Personen, die dort wohnen – gefährlich wohnen, da gibt es keine Zweifel. Die Hausgänge, an denen wir vorbei gehen, sind teilweise so schmal, dass sich wohl nur Magersüchtige durchzwängen können und für gewisse abenteuerliche Treppenkonstruktionen müsste man athletisch veranlagt sein, um zur Wohnung zu gelangen.
Aber die Leute sind fröhlich, es herrscht ein guter Geist in dieser Stadt, aus fast allen Restaurants tönt live Musik, man tanzt und scheint zufrieden.
Auf der Plaza Vieja trinken wir Mojito und Bier und bei meinem Gang auf die Toilette merke ich bald, dass wir nicht in Europa mehr sind. Eigentlich macht das Etablissement einen eher gediegenen Eindruck, aber die Toiletten… Vor dem Eingang sitzt eine Dame, die mir ein paar Blatt Toilettenpapier reicht und natürlich auf ein Trinkgeld hofft. Klar erhält sie das. Drei Toiletten hat’s, die Türen, die nicht bis zum Boden reichen, schliessen nicht alle, aus den beiden Lavabos im Vorraum kommt kein Wasser (in den Toiletten schon gar nicht). Wenigstens ein Wasserkanister steht auf der einen Ablage, so dass man sich doch mehr schlecht als recht die Hände waschen kann.
Wir spazieren weiter durch die Strassen und Gassen und gehen am späten Nachmittag im „El Guajarito“ essen, einem attraktiven Restaurant im zweiten Stock, wo später am Abend dann „Buena Vista Social Club“ aufspielen wird. Die hübschen jungen Serviertöchter mit ihren adretten, engen, weissen Kleidchen und den kecken Hütchen sind sehr nett aber auch ein wenig vergesslich. Für den Wassernachschub braucht’s mehr als zwei Anläufe.
Theo bestellt Rindfleisch, ich „Ropa Vieja“, eine Spezialität der Cocina Criollo. Altes Tuch ist gar keine schlechte Bezeichnung für das, was ich dann auf dem Teller habe. Es sieht tatsächlich aus wie ein Haufen Fasern von einem alten braunen Mantel. – Schmackhaft aber und fein. – Kubanischen Wein gibt’s keinen (Tabak und Zuckerrohr wird angepflanzt – also kein Platz mehr für Trauben), eine Flasche Wein aus Chile tut’s aber auch.
Nach dem Festmahl spazieren wir weiter über die Plaza de la Revolution, entlang des Paseo Prado, eine Art Rambla, bis zum Meer und dem Beginn des Malecón. Viele Spaziergänger sind unterwegs. Wir beobachten, wie’s langsam Nacht wird, die Wellen sich schwarz wiegen, die Lichter angehen.
Der Weg zurück mit dem Taxi kostet erneut 25 CUC (1 CUC = 1 US$); die Taxifahrerei kommt langsam teuer…
Die Fahrt ist speziell. Es ist wieder einer dieser wunderbaren alten Schlitten, dunkelgrün metallisiert aus den Fünfzigern. Die Polster zerschlissen, die Türen schliessen zwar noch, aber passen nicht mehr optimal in den Rahmen. Es regnet ja nicht oft, also, was soll’s? – Die Ampel wechselt auf Grün – unser Chauffeur rührt in der Kupplung herum, es ist ein Graus; eine gefühlte Minute lang passiert gar nichts ausser einem ohrenbetäubenden Geheul, bis die Kutsche einen Ruck macht, der Gang endlich drin ist und die Fahrt weitergeht. – Unweigerlich stelle ich mir ein Zahnrad vor, das bald nur noch ein Rad ist…
Unterwegs halten wir bei einem Supermarket an, schliesslich wollen wir morgen in unserer Küche frühstücken. Der Laden schliesst erst um neun. Er ist hell erleuchtet, sieht auf den ersten Blick gar nicht schlecht aus. Drei Kassen hat’s, dem ersten Gestell an der linken Wand gehört unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Es ist auf der ganzen Länge des Ladens bestückt mit Rum, Schnaps und Wein.
Rum und Wein gehen in den Einkaufskorb. Nun möchte ich Orangensaft kaufen. „No hay“. Ok. Milch fehlt uns auch. „No hay“. Was? Keine Milch? – Ok. Tee brauche ich auch noch. „No hay“. – Dasselbe mit Pfeffer. „Brauchen wir hier nicht“, sagt Maria Elena. Teigwaren hat’s. Ganze Gestelle davon, allerdings nur eine Sorte. Ich hab’s jetzt auch gemerkt. Es ist hier nicht wie bei uns im Migros.
Früchte und Gemüse fehlen gänzlich; die kann man ja auf dem Markt kaufen.
Zwei Joghurts finden wir dann doch. Eier haben wir genug, also zurück ins Taxi mit fast leeren Händen und heim ins Bett.
13. April
Fürs Frühstück landen wir wieder in Maria Elenas Küche. Unser Kühlschrank ist ja noch immer fast gänzlich leer ausser der Eierschwemme, und er wird es wohl auch bleiben. Theo ist froh, hat er seinen Käse und auch ich muss jetzt kleinlaut zugeben, dass sein Kauf auf dem Pariser Flughafen gar nicht so daneben war. So muss ich zumindest während der ersten paar Tage, solange der Brie noch nicht aufgegessen ist, kein Gejammer mit anhören, wenn der Käse auf dem Frühstückstisch fehlt.
Im Haus wohnen übrigens Abel und Maria Elena, Abels Mutter, Marias jüngster Sohn Daniel und zwei Hunde. Zusammen haben die beiden sieben Kinder - eine Patchwork-Familie. Die eine Tochter ist tagsüber auch zu Hause, schlafen tut sie anderswo. Immer wieder kommen Freunde und Bekannte vorbei, so läuft immer mal wieder etwas.
Ein anderes Thema ist die Verständigung. Sie ist nicht ganz einfach. Im Führer, den ich gelesen habe, stand, dass die Kubaner gerne den Buchstaben „S“ vermeiden würden. Daran muss man sich erst gewöhnen. So heisst es etwa: „Etoemacaro“. „Esto es más caro“ hätte ich verstanden. – Wie’s zu dieser „S-Aversion“ gekommen ist, ist mir nicht klar. Natürlich geht’s noch schneller, wenn man ein paar Buchstaben beim Sprechen auslassen kann, das dürfte ein Grund sein, aber wirklich…
Wie mir Maria Elena erzählt, Abel gehe jeden Morgen sündigen, komme ich überhaupt nicht nach, habe grosse Zweifel, ob ich richtig verstanden habe und erst, wie sie zum besseren Verständnis Angelbewegungen dazu macht, kommt mir die „S-Sache“ in den Sinn. - Ich begreife, dass „pecar“ eigentlich „pescar“ heissen sollte…
Dazu kommt, dass alle Wörter zusammengehängt werden, so dass es scheint, ein Satz bestehe fast nur aus einem einzigen Wort. Man kann so in kürzerer Zeit wesentlich mehr sagen. Darum geht es wohl. Zudem sind diese Einwortsätze oft sehr laut, so dass nicht selten der Verdacht aufkommt, da seien zwei Typen im Streit, dabei ist es nur ganz einfache Konversation.
Ein komischer Tag war es dann. Kuba wohl in Reinkultur. Ich hatte ja vorgehabt, ein paar Tage in Havanna zu bleiben und dann eine Rundreise durch die Insel zu unternehmen. Das hatte ich Maria Elena so mitgeteilt und sie hat mir geantwortet, ich solle mir keine Gedanken machen, das würden wir alles organisieren, wenn wir da wären. Ihr Mann sei Taxifahrer, er habe ein Auto und wir könnten dann mit ihm auf Reisen gehen. Im Kuba-Führer hatte ich zwar gelesen, die Kubaner seien sehr hilfsbereit, würden einem das Blaue vom Himmel versprechen, aber bei der Ausführung würde es dann öfters dennoch hapern, was sie aber charmant zu verniedlichen wüssten.
Nun, Abels Auto ist gerade in der Reparatur und man hoffe, hoffe inständig, so versichert er uns, dass die Garage bis zum Wochenende alle Arbeiten erledigt hätte, aber eben, die Garagen…, man wisse ja. Zudem kann er mit seinem Taxi die Provinzgrenze nicht überqueren, dazu hat er keine Genehmigung. Also ist so oder so nichts mit einer Rundfahrt um die Insel.
Um es vorweg zu nehmen: Am Freitag schon steht das Auto da, ein schwarzer Chevi mit Jahrgang ziemlich alt. Wie Abel ihn vor die Haustüre gefahren hat, ist mir ein Rätsel: Der Wagen ist völlig leer. Leer heisst: Keine Sessel sind drin. - Ich glaube, er hat auf einer Harasse gesessen bei der Heimfahrt.
Ja, dann würden wir gerne eine Rundreise buchen bei einem Reisebüro, schlage ich vor. Bei drei Reiseagenturen versuchen wir unser Glück. Die erste bietet nur Eintages-Reisen an, das höchste der Gefühle eine zweitägige Reise mit einer Übernachtung und vier Städtebesichtigungen in dieser Zeit. Das ist nicht eben, was ich im Sinn habe, ich hatte mir mindestens eine zehntägige Rundreise vorgestellt. Auch wollte ich die Reise lieber in Kuba selber organisieren, das Geld also dort ausgeben und nicht einen europäischen Zwischenhändler am Verdienst beteiligen. – Ein wenig naiv, wie’s mir jetzt scheint.
Bei der dritten Agentur im Hotel La Habana (ich will dort noch Geld wechseln, der Schalter wird aber grad geschlossen), warten wir eine halbe Stunde, bis die Reihe an uns ist. Wie wir endlich hätten bedient werden sollen, teilt uns die Angestellte mit, es tue ihr leid, aber sie müsse jetzt etwas essen gehen, wir müssten halt warten. – Mehrtägige Reisen gäbe es sowieso nicht, erwähnt sie noch en passant und erspart uns damit zumindest ein weiteres vergebliches Warten auf Godo.
Heute habe ich darauf bestanden, den Bus zu nehmen, denn erstens gefällt es mir, eine Stadt per Bus zu erkunden und zweitens bin ich nicht mehr gewillt, jedes Mal pro Fahrt 25 Franken auszugeben. Der Kuba-Führer (Buch) hat bereits vorgewarnt, dass in den Augen der Kubaner alle Ausländer reich sind, was von ihrer Warte aus sicher nicht ganz an den Haaren herbeigezogen ist. Ein Monatslohn von 10 – 12 CUC ist hier normal. Wie man damit über die Runden kommt… Kellner haben dazu noch ein Trinkgeld, das sie aber abgeben und am Monatsende mit allen Angestellten teilen müssen. Denen geht’s also relativ gut. Ebenso den Taxifahrern, die allerdings dem Staat eine hohe Steuer zahlen müssen. Der Unterhalt ihrer Autos ist wohl auch nicht unbedingt billig.
Wer eine Casa Particular, also eine Privatunterkunft für Touristen betreibt, zahlt (in Varadero) 150 CUC pro Monat Steuern, ob er Gäste hat oder nicht. Zusätzlich muss pro Gast 10 % Abgabe geleistet werden.
So stehen wir also am Strassenrand und warten auf den Bus Nr. 179. Eine Stunde lang. Endlich kommt er. Klar ist nach dieser Zeit die Schlange so lang, dass er so oder so schon aus allen Nähten quillt. Wir vier letzten Möchte-gern-Passagiere haben einfach keinen Platz mehr; er fährt los und lässt uns am Strassenrand stehen. – Dann halt eben doch wieder ein Taxi.
Das führt uns auf einer längeren Reise zum Busbahnhof der Überlandbusse Víazul. Langsam ist mir egal, wohin die Reise geht, wenn ich nur ein Ticket ergattern kann, das uns irgendwo hin bringt. Nach Trinidad und von da aus werden wir weitersehen. Ok. Morgen, in dem Fall. – Das geht nicht. Alle Busse sind bereits voll, der nächste, den wir buchen können, fährt erst am Montag um sieben Uhr morgens. – Was bleibt mir anderes übrig? Ich nehm das Billet und hab nun die schöne Aufgabe, Theo beizubringen, dass wir am Montagmorgen schon um halb sieben am Busbahnhof sein müssen…
Wir essen am Abend bei Maria Elena. Sie kocht für uns Fisch, Tostones (gebratene Gemüsebananen-Scheiben), frittierte Malangas (eine Art Kartoffeln – wie Kroketten zubereitet) und dazu gibt’s einen Salat aus Kohl (Kabis) und ein paar wenigen, fast farblosen Tomatenscheiben. Ein feines Essen. Dazu trinken wir die Flasche Wein, die wir im Supermarkt gekauft haben.
14. April, Karfreitag
Mein rechtes Auge hat wohl eine Entzündung eingefangen. Es weint die ganze Zeit; ich muss unbedingt in einer Apotheke Tropfen kaufen.
Wir fahren in die Stadt (per Bus) und finden die einzige Apotheke weit und breit in der Calle Obisbo, aber sie ist heute geschlossen. So wird halt weitergeweint.
Wir wollen das Museo de Bellas Artes besuchen. - Heute geschlossen…
Auf der Dachterrasse, von wo aus man eine schöne Aussicht über die Stadt hat, im sechsten Stock des Hotels „Ambos Mundos“, wo Hemingway im fünften Stock während ein paar Jahren gelebt und „To Whom the Bell Tolls“ geschrieben hat, essen wir eine Kleinigkeit zu Mittag. Theo die Sopa Hemingway, ich einen Hühnersalat. Zu beiden Gerichten wird ein Salat serviert…
Mit einem wunderbar alten Lift sind wir hochgefahren, die Fahrt hinunter geht bereits nicht mehr, der Lift hat grad den Geist aufgegeben.
(Doch noch kurz zu den Toiletten in diesem berühmten Hotel: Kein Wasser! Nicht einmal einen Plastikeimer diesmal…).
Wir spazieren entlang der Calle Ignacio und wundern uns immer wieder über den absolut desolaten Zustand der einst prachtvollen Häuser. In einem alten Hafengebäude ist ein grosser Markt untergebracht mit Bildern und Souvenirs. Farbig, farbig! Und immer mehr oder weniger das Gleiche. Dieselben Sujets tausendmal, Ché und wieder Ché, die Strassenschlucht mit der Bodega del Medio, dem Oldtimer vornedran und dem Kapitol im Hintergrund.
Dem Ufer entlang geht’s zurück zur Plaza San Francisco. Dort findet der erste Apéro statt, der zweite dann in der Colchón 162, einem Strassencafé, wo’s den absolut feinsten Daiquiri gibt.
Inzwischen ist’s schon Zeit fürs Nachtessen. An der Plaza de la Catedral finden wir ein Restaurant, wo man hübsch draussen sitzen kann, und bestellen Fisch (ich) und Theo glaubt, sein Fleisch sei Huhn, es ist aber vom Schwein. Dazu bestellt er sich eine ganze Portion schwarze Bohnen, weil er findet, die gehören hier dazu.
Von dort aus, wo wir sitzen, haben wir den Überblick über den Platz. Es ist ja Karfreitag, aber es läuft nicht viel in Sachen Prozessionen. Nicht wie in Spanien. Nur ein einziger violett angezogener Jesus mit schwarzem Kreuz wird herumgetragen, dazu tönt aus einem Lautsprecher eine Stimme, die etwas Tragisches herunterbetet: „Misericordia etc.“
Eine Strassenverkäuferin bietet kleine weisse Tüten an (mana, mana ruft sie) und wir kommen ins Gespräch mit ihr. Theo vermutet Haschisch, aber es sind spanische Nüsschen drin – nicht viel mehr als etwa zehn. Aber sie ist nett, sehr gut gelaunt, sehr grün angezogen und wir kaufen ihr für einen Franken (1 CUC) drei dieser Tüten ab. Kurz darauf erschient eine zweite Verkäuferin, pink angezogen.
Sie sieht unsere Flasche Wein (nur noch ein kleiner Rest ist drin) und sagt, sie habe sooo gerne Wein. Wie viele ihrer weissen Tüten sie dafür denn anbiete, frage ich. Eine nur. - Dann halt keinen Handel, sage ich. – Sie aber schnappt sich die Weinflasche und trinkt rasch einen Schluck daraus. Wir müssen lachen, da hat sie uns schön reingelegt. – Natürlich kann sie die Flasche haben, wir sind Besitzer einer weiteren Tüte.
Mit dem Taxi geht’s nach Hause. 18 CUC, wenigstens nicht grad 25.
15. April, Karsamstag
Ich muss heute dringend eine Apotheke suchen. Maria Elena weiss, wo’s eine hat: im Hotel Comodoro. – Wir warten eine Ewigkeit auf den Bus, Taxis halten auch grad keine an. Wie er dann endlich kommt, ist er so vollgestopft, dass man sich vorkommt wie eine Sardine in einer Büchse. Wie wir schliesslich am Ziel sind, uns durchgefragt haben, wo genau das Hotel und wo die Apotheke sei, ist mehr als eine Stunde vergangen. Aber endlich hab ich Tropfen gegen mein tropfendes Auge erhalten; ich bin sehr froh!
Endlich möchten wir auch eine Karte für Internetzugang kaufen, die’s ja nur in wenigen Hotels gibt, aber die Dame am Schalter sagt einmal mehr: „No hay. – Ni hoy y ni mañana.“ Sie schickt uns in ein anderes Hotel. Wieder durch Gänge pilgern (mein armer Fuss tut mir mehr und mehr weh vom vielen Gehen) und wie wir das Centro de Commercio endlich gefunden haben, will man dort 10 CUC für eine Stunde Internet. Das nervt, wir verzichten. – Nicht einmal die Gäste können das Internet gratis benutzen (die Zimmer in diesem Laden, der natürlich dem Staat gehört, kosten zwischen 500 – 800 Fr.) Mit dem Geld könnten doch ein paar Häuser in der Altstadt renoviert werden, finde ich.
Wir fahren heim per Taxi und können nicht hinein. Wir läuten an der Tür, aber die Nonna hört nichts. Sie ist wohl am TV Schauen. Theo, der scharfe Beobachter, entdeckt eine Schnur, die man durch die Verzierung an der Mauer erreichen kann und die mit der Türklinke verbunden ist. Dran zieht er und schon öffnet sich die Tür. – Da bin ich aber froh. Das hätte noch gefehlt, dass wir draussen in der Hitze hätten warten müssen, bis jemand heimkommt.
Wir ziehen uns um und gehen an den Strand. Das dauert ungefähr zehn Minuten zu Fuss, vorbei an heruntergewirtschafteten Häusern, in denen zum Teil trotzdem noch Leute wohnen. Der Strand macht ebenfalls einen nicht eben lieblichen Eindruck. Zwar hat’s Sonnenschirme aus Palmenblättern, dort aber Abfall wie überall. Ein paar Jugendliche spielen Ball und baden. Dazu weht ein Wind, der uns völlig sandstrahlt und keinesfalls zum Baden einlädt. Wir legen uns trotzdem eine Stunde in die Sonne, gehen dann aber wieder zurück ins Haus, duschen und ruhen uns aus.
Nachtessen im Fisch-Restaurant „Santi“, keine fünf Minuten zu Fuss von unserer Wohnung. Es ist das einzige Restaurant in der ganzen Umgebung, wo auch Touristen hingehen. Absolut schön gelegen mit seinen zwei Terrassen am Fluss mit Sicht auf die Boote – jedoch sind auch die in mehr als nur lamentablem Zustand. – Teuer sei es dort, sagt Maria Elena. – Alles sieht sehr einfach aus, ich kann mir kaum vorstellen, dass man dort gut isst. Aber eben – es ist nichts so, wie es scheint.
Offenbar haben sie einen japanischen Koch. Die Sushis sind delikat, genauso wie auch der Fisch, den ich bestelle, und Theos Spaghetti à la Marinera. Dazu gibt’s Weisswein, Roten haben sie keinen. 50 Franken mit Trinkgeld für ein herrliches Abendessen zu zweit.
16. April, Ostern
Nach dem Frühstück fahren wir per Bus in die Stadt, kommen an der Plaza Curita an und fahren per Rikscha weiter zum Museo de Bellas Artes (Cubano contemporano). Es bleibt uns grad eine Stunde für die Besichtigung. Wie das so ist in diesen Museen: Einige Kunststücke gefallen einem ausserordentlich gut, mit andern kann man nichts oder nur wenig anfangen. Der Eindruck ist aber gut. Das Museo de la Revolution ist gleich gegenüber. Aber dort stehen so viele Leute an, dass es uns verleidet und wir auf den Besuch verzichten. Stattdessen essen wir eine Kleinigkeit in einem hübschen kleinen Strassencafé. Weiter spazieren wir durch die Altstadt wie tags zuvor und machen wieder Halt im Hotel „Ambos Mundos“. Wir kaufen Internetkarten, aber nur Theo gelingt es, eine Verbindung zu kriegen. Wenigstens kurz kann er Verbindung mit der Familie aufnehmen und mitteilen, dass es uns noch gibt.
Zurück in unserer Unterkunft packen wir unsere Koffer für die Reise, von der wir noch nicht genau wissen, wohin sie uns führt. Einen Koffer, den Handgepäck-Koffer und meinen Rucksack lassen wir zurück. Ein Koffer für zwei muss genügen.
Maria Elena kocht für uns; wir gehen früh schlafen.
17. April, Ostermontag – Start zur Rundreise
Um halb sechs stehen wir auf, packen unsere Siebensachen. Um sechs wartet das Taxi schon. Es ist wieder Jasmin, der Nachbar, der uns schon vom Flughafen abgeholt hat mit seinem gelben Chevi 53. Es ist noch Nacht, Verkehr hat es kaum. Wir rasen durch die fast leeren Strassen, offene Fenster, was sehr angenehm ist, und die Musik läuft auf voller Lautstärke. „Corazon, amor eterna etc.“ hören wir mit. Sehen wir doch hin und wieder ein Auto, klärt uns Jasmin über die Automarke und den Jahrgang auf.
Um halb sieben sind wir an der Busstation, checken und steigen ein.
Zum Glück habe ich in dem Buch, das ich zu Hause über Kuba gelesen habe („Kulturschock Kuba“) gelernt, dass die Überland-Busse mit voll aufgedrehter Air Condition fahren, es sich also lohnt, einen Pullover dabei zu haben. So trage ich nun eine lange Hose, Socken und mein einziges Woll-Jäckchen, das ich mitgenommen habe. Auch den Regenschutz ziehe ich an. Nach einer Viertelstunde auch die Kapuze, denn die AC lässt sich nicht regulieren und bläst mir direkt ins Gesicht. – Schon bevor wir losfahren, denke ich, die Reise überstehe ich nicht. Mit Theos Windjacke zusätzlich geht’s dann besser.
Unser vorläufiges Ziel heute ist Trinidad. Nach zwei Stunden Fahrt gibt’s den ersten Halt in Australia Township. Ein wundersam feines Cappuccino gibt’s dort zu haben und ein ebenso feines getoastetes Sandwich. Es geht also doch!
Zwei Fahrer sind im Bus, die sich abwechseln; sie machen ihren Job sehr gut. - Die Fahrt geht zum Teil über die dreispurige Autobahn, dann wieder durch Landstrassen und Dörfer, durch Gegenden mit wenig Landwirtschaft. Kurzer Halt in Playa Girón, wo sich ein berühmtes Museum befindet (Revolution – wen wundert’s?). In Cienfuegos gibt’s ebenfalls einen Halt, viele Leute steigen aus, viele steigen ein.
Unterwegs stehen immer wieder Plakate, die den Sozialismus und die Revolution verherrlichen.
Trinidad
Pünktlich um Viertel nach eins, also nach fast sechseinhalbstündiger Fahrt, kommen wir in Trinidad an. Kaum ausgestiegen werden die Angekommenen von einer ganzen Horde Einheimischer belagert, die auf einen losstürmen wie die Motten aufs Licht. Sie bieten Taxis an und wollen einem Unterkünfte aufschwatzen. Zum Glück hat die Busgesellschaft eine Schnur gespannt aus Metall, so dass man nicht schon beim Beziehen des Gepäcks überrannt wird.
Internet hatte ich ja keines. Normalerweise bin ich gewohnt, Hotels im Voraus zu reservieren, das geht hier ja nicht. So war ich ein wenig besorgt, wie und wo wir landen würden, ob wir überhaupt eine Unterkunft finden würden und und und. Gut, dass ich zumindest eine Offline-App heruntergeladen hatte, die ein paar Tipps über Hotels anbietet. Casa Meyer hat eine gute Bewertung und ist nur 100 Meter vom Busbahnhof entfernt. Ideal also. Die finden wir auch sofort, die beiden Zimmer sind aber bereits ausgebucht. Netterweise telefoniert die Besitzerin einem Kollegen, der uns gleich darauf abholt. Sein Hostal ist nur 50 Meter vom Busbahnhof entfernt, es heisst El Mirador – Fernando y Laidys. Fernando ist ein ziemlicher Bär von einem Mann, sehr nett und hilfsbereit. Er zeigt uns zwei Zimmer, die noch zu haben sind. Wir sind mehr als nur zufrieden. (Ich dachte schon, wir müssten vielleicht von Tür zu Tür wandern und es könnte uns ergehen wie Maria und Josef, ohne die Details natürlich mit dem Heiligen Geist.) – Aber da ist alles, was man braucht, sogar die Toilette hat eine Brille und einen Deckel, das Wasser fliesst bestens, AC und Ventilator sind neu und funktionieren nach einem Batteriewechsel prima. Es ist ein hübsches Haus, das Zimmer im Eingang ist bestückt mit sehr vielen Antiquitäten, Möbeln, Geschirr und Nippsachen. Verschiedene Treppen führen je zu einem Zimmer, alles ist verwinkelt. Zuoberst hat’s eine entzückende Terrasse, von der aus man über die Dächer von Trinidad sieht und sich wunderbar verweilen kann. Das Frühstück wird auch dort serviert.
Wir richten uns ein und machen anschliessend einen Spaziergang durch das Städtchen, das uns ausserordentlich gut gefällt. Nicht nur uns. Alles hier ist SEHR touristisch, aber eben, das hat auch Vorteile und nicht nur einen Grund. Die Häuser sind viel besser erhalten als in der Altstadt in Havanna, man hat das Gefühl, man werde in vergangene Zeit versetzt. Karren, von kleinen Pferden gezogen, rattern durch die Gassen, Autos hat es wenige, denn die Strassen sind mit Pflastersteinen verschiedenster Grösse ausgelegt. Stöckelschuhe sind kein Thema, mein Problem zum Glück schon lange nicht mehr. – Eine Gaststätte an der andern säumt die Strassen, Hostals gibt’s in Massen, ebenso kleine Läden aller Art, Musik tönt von überall her; es herrscht eine pulsierende, lebhafte Atmosphäre. Marktstände mit all den hundertmal gleichen Souvenirs für die ausländischen Gäste gibt’s an jeder zweiten Ecke. Wie auch in der Hauptstadt ist Ché allgegenwärtig. In jeder Form: auf Bildern, T-Shirts, Tabakdosen, Postkarten, Taschen, Geldbörsen, Magneten - man kommt nicht um ihn herum. Zum Glück sieht er gut aus und nicht etwa wie Trump…
Bei der Plaza Mayor, in einem absolut pittoresken kleinen Restaurant (Los Conspiradores) im Garten unter einem riesigen Bougainvillea-Strauch gibt’s ein feines Crevetten Cocktail und dazu zwei eisgekühlte Daiquiris. Es könnte uns nicht besser gehen!
Zurück im Hostal ist eine Dusche nötig, wir ruhen uns ein wenig aus (Theos Siesta muss sein) und suchen und dann ein nettes Restaurant. Die Auswahl ist gross, die Entscheidung schwierig. Im „Nueva Era“ gefällt’s uns gut; es ist ein typisches Kolonialhaus mit Patio und luftigen Terrassen mit Blick auf die Dächer, den Hof, die Band, die natürlich auch dort aufspielt. Es ist ein Paladar, also ein Lokal, das ausnahmsweise mal nicht der Regierung gehört. Die Bedienung ist nett wie überall, aber auch ein wenig langsam. Das Essen – na ja, sie haben sich Mühe gegeben. Theos Paella Marinera ist etwas seltsam: Auf einer grossen Portion Reis thront eine Krabbe, die zu öffnen aber ein Ding der Unmöglichkeit ist. Theo lässt das Tier in der Küche „behandeln“, es kommt zerschlagen zurück, aber Fleisch gib’s so gut wie keines…
Zum Dessert eine Piña Colada. Daran gibt’s dann nichts auszusetzen.
18. April
Wir nehmen’s gemütlich. An den Strand gehen steht heute auf dem Programm. Die Busse dorthin fahren aber nur um elf und um 14 Uhr. Erst muss ich aber noch Geld holen gehen. Fernando erklärt mir, wo die Bank ist. – Eine Riesenschlange von Leuten steht am Schalter an. Das geht mindestens eine Stunde, bis ich drankomme, denke ich. Aber da hat’s auch zwei Bancomaten. Einer davon ist sogar frei. Ich glaub’s ja nicht. Und er spuckt mir problemlos und bereitwillig 500 CUC aus.
Als Nächstes muss ich bei Viazul das Ticket für unsere Weiterfahrt kaufen. Ein Schalter ist offen. Wie ich nach zehn Minuten an der Reihe bin, sagt mir die Dame, hier würden Tickets nur an Cubanos verkauft, Viazul sei nebenan. Dort steht an der Tür, das Büro sei bedient von halb zehn bis halb vier Uhr nachmittags. Jetzt ist es fast elf, aber geschlossen. Jemand sagt mir, der Schalter sei nur geöffnet, wenn ein Bus ankomme. Das sei heute Mittag um eins. – Was, nebst der Tatsache, dass der Schalter auch zu den angegebenen Öffnungszeiten geschlossen ist, die Planung der Reise zusätzlich schwierig macht und zeitraubend ist, ist der Umstand, dass es nirgends einen Fahrplan hat, auch keine Landkarte, auf der man sich orientieren könnte.
Auf unserer schönen Terrasse warte ich also, lese ein wenig, Theo brätelt in der heissen Sonne, und gegen eins bin ich wieder am Busbahnhof. Es gelingt mir, ein Ticket zu kaufen für übermorgen mit Destination Sancti Spiritus. Ein Gesamtticket zurück nach Havanna, wo man zwischendurch Aufenthalte einlegen könnte, ist leider nicht zu haben.
In einem kleinen Reisebüro reservieren wir für morgen eine Zugfahrt ins Valle de los Ingenieros. Dort sind stillgelegte Zuckerfabriken zu besichtigen.
Playa de Acona
Bis wir genau wissen, wo der Bus hält, der uns an den Strand bringt, braucht es mindestens vier verschiedene Auskünfte. Jeder will hilfreich sein und auch wenn er oder sie überhaupt nicht weiss, wo der Bus hält – macht nichts, man zeigt in eine bestimmte Richtung und sagt, dort sei der Bus-Stopp. Eine Passantin wollte uns gleich weismachen, es gäbe keinen Bus, der um zwei Uhr fahre, sie wollte uns gleich ein Taxi vermitteln. Von solchen Hilfeleistungen haben wir aber vorgängig gelesen. Darauf fallen wir nicht herein!
Der Bus kommt dann doch, aber die Fahrt kostet 10 CUC und man muss retour lösen, was uns nicht gefällt, denn der letzte fährt bereits um sechs wieder zurück und wir möchten eventuell dort essen und uns nicht auf eine Rückfahrtzeit festlegten.
Einem jungen Paar geht es gleich. So nehmen wir zusammen schliesslich doch ein Taxi und das kommt sogar noch billiger. Die beiden sind Türken und arbeiten in London. Von ihnen erfahren wir, wie die Wahlen in der Türkei ausgegangen sind, dass nachgezählt werden muss. Sie hoffen auch, dass Erdogan nicht durchkommt mit seinen diktatorischen Gelüsten. - Hier sind wir ja ohne Internet und ohne ausländische Zeitungen völlig vom Weltgeschehen abgeschottet, daher ganz froh, wenigstens etwas zu erfahren.
Der Strand ist gut besucht, aber wir finden doch noch einen Schattenplatz. Das Meer ist warm, trotzdem eine Wohltat, eine schöne Abkühlung. – Lesen, an der Sonne liegen, Daiquiri trinken – so macht’s Spass. Wir beschliessen nun doch, gegen sechs Uhr wieder zurückzufahren, denn das Strandrestaurant lockt nicht unbedingt so sehr zum Verbleib am Abend. Auch das türkische Paar sieht das so. Wir nehmen zusammen ein Taxi und die Fahrt in der kleinen Klapperkiste ist unvergesslich. Das Chassis besteht aus mehr Rost als etwas anderem, Fensterscheiben hatte das Auto sicher mal, jetzt aber wohl schon seit längerer Zeit nicht mehr. Die Frontscheibe ist von Spalten übersäht, deren Tage sind auf jeden Fall gezählt. Ein Scheibenwischer ist abgebrochen, der andere mitten in der Scheibe steckengeblieben. Keine Anzeige funktioniert, der Rückspiegel ist abgebrochen.
Der Fahrer knallt die Türen von aussen zu, anders schliessen sie nicht. Zu dritt sitzen wir auf dem zerschlissenen Rücksitz zusammengepfercht, Theo, der vorne sitzt, hält seinen Rucksack vor den Bauch. Er sagt, das wäre dann so etwas wie ein Airbag, falls ein abrupter Stopp stattfinden werde. Träfe das allerdings ein, würde sicher der ganze Boden durchbrechen, fürchte ich. Aber ok, es ist im Moment das einzige Taxi, das zur Verfügung steht, und wir beten alle insgeheim, die Fahrt zu überleben und gut in Trinidad anzukommen.
Beim Einschalten macht der Motor ein Geräusch, wie wenn er am Sterben wäre, aber der Fahrer bringt ihn schliesslich doch noch auf Touren. Er holt aus der Karre heraus, was möglich ist und wir rasen mit Höllenlärm zurück in die Stadt. – Es ist nochmal alles gut gegangen, Gott sei Dank!
Gleich um die Ecke, wo wir wohnen, gibt es ein sehr hübsches kleines Restaurant mit Namen Lis. Dorthin gehen wir zum Nachtessen. So eine schöne Ambience. Das Essen ist ok, der Wein ebenfalls, der Service ist aufmerksam, die Preise unschlagbar (mein Fischgericht mit Salat als Vorspeise und viele Zutaten nur 7 CUC). Der obligate Sänger (wenigstens nur einer) unterhält uns den ganzen Abend lang. Zum x-ten Mal hören wir „Guantanamera“ und „Besa me mucho“, dann „Chan Chan“ und „Comandante Ché Guevara“ („Cuando salí de Cuba“ ist verboten, darf er nicht singen). – Diese Lieder gehören einfach dazu. Es geht nicht ohne. Wir kaufen ihm eine CD ab.
19. April
Nach dem Frühstück fahren wir an den Bahnhof per Rikscha. Der Zug, der uns ins Tal der Zuckerrohr-Fabriken bringen wird, funktioniert nur noch für Touristen und fährt genau einmal am Tag. Sogar ein Fahrplan ist angeschlagen; das ist ja ganz was Neues. – Erst auf der Fahrt merken wir, dass dieser hinten und vorne nicht stimmt. Dabei wär’s nicht schwierig…
Die Fahrt ist lang, laut und „ratterig“, aber wir geniessen sie. Es ist eine angenehme Abwechslung. Wir kommen vorbei an Bauernhöfen (meist schäbige Hütten), Bananenplantagen, Busch- und Weideland, auf dem ein paar wenige ausgemergelte Rinder und Pferde das spärliche Gras suchen. Landwirtschaft wird kaum betrieben. Hier muss mal überall Zuckerrohr angepflanzt worden sein, von dem ist gar nichts mehr zu sehen.
In Iznaga, nach einer Stunde Fahrt etwa, werden der Zug beziehungsweise seine Fahrgäste schon erwartet. Es hat dort einen etwa 30 Meter hohen Turm, der natürlich von jedem Besucher erklettert werden muss nach Abgabe eines Obolus von einem CUC. – Der Weg dorthin ist wie ein Spiessrutenlauf durch all die Verkaufsstände hindurch. Alle wollen etwas verkaufen: gestickte Decken, Strohhüte, Puppen und Blusen. Es scheint, das ganze Dorf stehe dort Spalier.
Sehr steile Treppen führen zur Turmspitze. Sie zu erklimmen ist nicht ganz einfach, da immer wieder Gegenverkehr herrscht und man warten muss, bis die nächste Touristengruppe sich hinauf- oder hinuntergequält hat. Zur Belohnung gibt’s schliesslich einen wunderbaren Ausblick aufs Dorf, übers Tal, auf die Hügel und Berge am Horizont.
Weiter fährt der Zug in eine stillgelegte Zuckermine. Sie ist riesengross, aber nur noch eine Ruine. Nachdem die privaten Besitzer nach der Revolution enteignet worden waren, ging sie vor die Hunde. Das wird natürlich nicht so dargestellt. Geschrieben steht, man habe sie aufgegeben, weil es besser Standorte gegeben habe…
Zurück am Bahnhof in Trinidad beginnt es in Strömen zu regnen. Ein Rikscha-Fahrer bietet sich aber trotzdem an, uns zum Hotel zu fahren für 4 CUC. Regen töte einen ja nicht, meint er. Trotzdem – die Fahrt für ihn ist sehr mühsam; erstens geht’s bergauf und zweitens fliessen innerhalb kürzester Zeit ganze Flüsse die Strassen hinunter, die nun wie Bachbette aussehen. Genau zum Zeitpunkt des heftigsten Regens kommt uns ein Trauerzug entgegen, alle tragen sie dieselben Kränze, alle und alles wird tropfnass.
Unsere durchnässten Kleider hängen wir im Zimmer auf und legen uns ein wenig hin. Ich hätte gedacht, der Regen würde bald wieder aufhören, dem ist aber nicht so, also gibt’s eine längere Siesta.
Nach zwei Stunden wird’s erst wieder freundlich und die Strassen sind trocken. Wir spazieren zwei Quadras bergauf zum Convento de San Francisco de Asis. Auf den Turm kann man steigen und man hat von oben neben den Glocken durch einen herrlichen Blick auf die Stadt. Das ehemalige Kloster beherbergt auch ein Museum: Museo de la Lucha Contra Bandidos. Viele vergilbte Fotos und Bilder sind an den Wänden zu sehen und in Vitrinen, die sicher schon bessere Tage gesehen haben; alles handelt von den Helden der Revolution.
Zeit zum Nachtessen. Draussen, aber wie in einem grossen Wohnzimmer mit sehr hoher Decke und riesigen Fenstern und Türen, gedeckt also, weil’s doch immer wieder ein paar Tropfen gibt, landen wir im Restaurant Shango. Dort gibt’s für wenig Geld ein gar nicht mal so schlechtes Essen. Wären die Tomaten in der Tomatensuppe geschält und wäre nur halb so viel Wasser für die Brühe verwendet worden, wär diese Vorspeise sogar richtig gut.
20. April – Sancti Spiritus
Um neun sind wir an der Bushaltestelle, die ja grad nebenan ist. Nun ist auch ein Typ am zweiten Pult und bei dem kann man sogar Tickets bestellen für die Weiterfahrt. Toll! So kann ich bereits für die Weiterreise für morgen und übermorgen ein Billet kaufen und muss nicht wieder so viel Zeit dafür verlieren.
Die Fahrt nach Sancti Spiritus dauert nur etwa eine Stunde. Die Busstation befindet sich nicht im Zentrum. Wir nehmen ein Taxi und der Fahrer ist sehr hilfreich. Seine Klapperkiste (Chevi mit Jahrgang 1948) fällt fast auseinander und um den Motor auszuschalten, muss er erst die Kühlerhaube öffnen und dort drin irgendwo die Zündung unterbrechen. Er führt uns in ein ganz nettes Hostal, mitten in der Stadt und schleppt uns den schweren Koffer zwei enge Treppen in den ersten Stock hinauf.
Ein super Zimmer für 25 Fr. erhalten wir. Alles ist vorhanden, was man braucht, sogar ein Safe ist in der Wand eingelassen und eine Waage steht im Badezimmer - eine nette: Sie zeigt fünf Kilo zu wenig an. Auch hier hat’s wieder eine Terrasse, von der aus man über die Dächer der Stadt sieht.
Sancti Spiritus ist ganz anders als Trinidad. Es hat kaum Touristen, ist aber ein absolut sehenswertes Städtchen. Alle Leute sind freundlich und grüssen, oft wird man in ein kleines Gespräch verwickelt. In der Bank hat’s überhaupt keine Kunden, ich werde gleich sehr freundlich bedient. Die Angestellte prüft meine Hunderternoten sehr genau – mindestens vier Mal. Dann zählt sie die Pesos ab. Das ebenfalls viermal. Und einmal noch lässt sie sie durch eine Zählmaschine laufen. Sie sucht mir die schöneren Noten aus, schaubt die schmutzigen aus.
Auch hier hat’s eine hübsche Kirche aus dem 17. Jahrhundert mit einem Glockenturm, den man besteigen kann. Eine einmalige Aussicht mehr. Die Kirche ist blau angestrichen und heisst Iglesia Parroquial Mayordel Espiritu Santo. In einer Galerie sehen wir ein Bild, das wir gerne kaufen möchten, wir überlegen noch, aber wie wir zwei Stunden später zurückkommen, ist die Galerie schon zu. – Morgen ist auch noch ein Tag. Dafür haben wir drei Autos aus Pappmaché gekauft. Die sind zum Glück sehr leicht.
Eine Sehenswürdigkeit der Stadt ist die Ponte Yayabo, eine alte Brücke über den Yayabo Fluss.
In einem Restaurant, von dem aus man einen schönen Blick auf die Brücke hat, trinken wir unsere Daiquiri und Mojito und essen ein wirklich feines Sandwich. Der junge Kellner ist äusserst zuvorkommend. Er ist nur für uns da; wir sind die einzigen Gäste.
Gleich neben der Bar hat’s ein etwas seltsames Museum. In einem Zimmer sind alte Telefonapparate ausgestellt, im anderen Hemden mit vier Taschen, offenbar ein spezielles Design hier.
Im Telecom-Shop muss ich draussen anstehen, um eine Internet-Access-Karte zu kaufen. Die lassen die Kunden draussen vor der Türe stehen und nur einzeln wird Einlass gewährt.
Um die Karte zu beziehen, brauche ich meinen Pass. Die Verkäuferin tippt alles ab; ich habe das Gefühl, sie schreibt den ganzen Text ab. Anschliessend schreibt sie die Nummern der Karten auf, die sie mir endlich übergibt. 1.50 CUC kostet die Karte nur. In Havanna im Hotel hab ich für die gleiche Karte 4.50 zahlen müssen, in einem andern Hotel haben sie 10 CUC verlangt…
Natürlich versuch ich gleich, mit dem Laptop ins Internet zu gelangen. Was für eine Geduldsprobe! – Nach etwa einer Viertelstunde kann ich wenigstens meine Mails sehen, das heisst, die erste Zeile nur, öffnen kann ich keines, beantworten schon gar nicht. Whatsapp ist verschwunden, die Information über unsere Flüge kann ich nicht öffnen, ein Hotel buchen geht schon gar nicht. Zum Verzweifeln!!!
Wir kommen mit einem Ehepaar ins Gespräch, die ebenfalls ein Zimmer vermieten. Auch sie sind sehr gerne behilflich, geben uns einen Rat, wo wir gut essen können (gleich gegenüber vom Park bei einer Freundin von ihnen). Wir erwähnen, dass wir morgen nach Santa Clara fahren werden und auch dort wieder ein Zimmer brauchen. Dort hat Aracelio auch eine Freundin, die eine Casa Particular hat, also Zimmer vermietet. - Mitten im Zentrum. Er reicht mir sein Telefon und ich kann bei der Dame ein Zimmer reservieren. Sie wird uns ein Taxi an die Busstation schicken. Das lässt sich ja fabelhaft an; für einmal alles schon organisiert!
Im Gegensatz zum touristischen Trinidad hat’s hier nicht an jeder Ecke ein Restaurant, das zum Verweilen lädt. Die paar, an denen wir vorbeikommen, machen einen erbärmlichen Eindruck. Wir versuchen’s mit demjenigen, das uns empfohlen wurde. Die teuerste Flasche Wein kostet 9 CUC – wir bestellen sie, die Kellnerin aber sagt, sie habe nur noch zwei Gläser davon übrig. – Nehmen wir halt die. Ok, ok - das hätte ich mir besser überlegen sollen. Die beiden Gläser kommen ja aus einer angebrochenen Flasche und wann die angebrochen wurde… Bestellt ist bestellt, wir beissen in den sauren Apfel beziehungsweise …
Der Fisch, den ich bestellt habe, wär gar nicht mal so schlecht, wäre er nicht versalzen. Der Salat ist so, wie er überall ist: viel Kabis, ein paar wenige geschmacklose Bohnen und ebensolche dünne Tomatenscheiben. Theo klagt nicht, aber der Anblick seines Fleisches reisst mich auch nicht vom Hocker. Mineralwasser hat’s übrigens auch keins. Bier für Theo schon.
21. April
Nach einem reichlichen Frühstück gehen wir nochmals auf die Walz. Es regnet in Strömen, wir erhalten einen Regenschirm. Nackte Frauen sind drauf abgebildet. Wir suchen erneut die Galerie auf, in der wir das Bild gesehen haben, das uns gefällt. Statt für erst 150 CUC erhalten wir es für 120 CUC. Der Galeriebesitzer lässt den Künstler kommen und der stellt uns dann eine Quittung und eine Bescheinigung aus, damit wir am Zoll keine Schwierigkeiten bekommen.
Auch möchte er uns eine Kiste Cohiba Zigarren (25 Stück) für 40 CUC verkaufen, von einem Freund, der in der Fabrik arbeitet. „Alles echt und kein Problem mit dem Zoll“. Theo liebäugelt schon sehr mit dem Angebot, aber wir haben uns ja vorher informiert und gelesen, dass man nur in Geschäften, die der Regierung gehören, kaufen soll, keinesfalls auf der Strasse. – Wir lassen’s also.
Das eine Museum, das wir besuchen möchten, ist geschlossen. Wahrscheinlich wegen des Regens, denken wir. Wir versuchen ein anderes, ein schmuckes Stadthaus eines reichen Mannes aus dem neunzehnten Jahrhundert. Das ist offen und wir sind die einzigen Besucher. Man darf keine Fotos machen, da wird aufgepasst. Eine Angestellte kommt mit uns mit von Zimmer zu Zimmer, zündet vor uns das Licht an und wenn wir durch sind, löscht sie es wieder aus. – Wirklich gelohnt hat sich der Besuch ja nicht, aber für einen CUC…
Wir haben Zeit und es regnet noch immer, daher: Noch ein Drink in einem schönen kolonialen Haus mit bequemen Sesseln. – Eigentlich wollte ich ja nicht mehr über die Toiletten schreiben, aber hier „lohnt“ es sich doch noch fast: Nebst dem, was üblicherweise fehlt, fehlen hier auch die Toilettentüren…
Langsam wird’s Zeit, zum Busbahnhof aufzubrechen. Ein Taxi bringt uns hin. Der Bus hat über eine halbe Stunde Verspätung. Nach einer guten Stunde Fahrt kommen wir um halb sechs in Santa Clara an.
Santa Clara
Der aufgebotene Taxifahrer hat brav gewartet. Er ist mit einem Kollegen dort. Sofort hat er uns erspäht, die Beschreibung (Frau mit weissen Haaren) hat dabei geholfen. Zum ganz sicher sein, hat er sich meinen Namen auf die Handfläche geschrieben; das fand ich sehr lustig!
Nach knapp zehnminütiger Fahrt kommen wir in unserer neuen Unterkunft an. Wir werden von der ganzen Familie herzlich begrüsst und ein Zimmer mit allem, was man braucht, ist unsere Bleibe für die nächste Nacht. Auch hier hat’s einen Safe, Seife und warmes Wasser. 25 CUC kostet die Übernachtung für uns beide.
Auf einem Spaziergang um die Plaza Vidal kommen wir am Palacio de la Musica vorbei. Eine freundliche schwarze Frau lädt uns ein, den Palast zu besichtigen. Das Gebäude hat schon sehr viel bessere Zeiten erlebt, aber immerhin ist es noch nicht ganz dem Zerfall erlegen. In einem Zimmer werden Tänze eingeübt, in einem andern findet Gitarrenunterricht statt und zwei Chicos üben Breakdance. Sie zeigt uns den Tanzsaal und gibt uns beiden ein Ständchen auf dem Klavier (R. Cleidermann und „Haleluja“). Sie spielt gut und wir geben ihr am Schluss des Rundgangs ein Trinkgeld, obschon sie sagt, die Besichtigung sei gratis. Nach zwei Daiquiris in einem staatlichen Restaurant am Platz verköstigen wir uns in einem Restaurant ganz in der Nähe unseres Hostals. Gerade mal 20 CUC (eine Flasche Wein inklusive) stehen auf der Rechnung; das wird ja immer billiger.
Wir wohnen zwar mitten im Zentrum, aber in der Nacht ist es absolut ruhig bis auf einen Hahn, der ab zwei Uhr im Zweistundentakt unbedingt krähen muss und den Zug, der im Dreistundentakt das ganze Quartier aufweckt mit seinem Gehupe. – Es gibt keine Barrieren an den Bahnübergängen, daher der Lärm.
22. April
Nach einem reichlichen und mit viel Liebe von der Grossmutter zubereiteten Frühstück geht‘s zum Sightseeing.
Die Revolution ist hier in Santa Clara das Thema. Nur ein paar Blocks weiter stehen die fünf Eisenbahnwagen, die von Ché im Jahr 1958 mit einem Bulldozer zum Entgleisen gebracht worden waren. Die Wagen dienen heute als Museum.
Ein Velotaxi bringt uns an den andern Ort des Geschehens, das Mausoleum, wo Chés Gebeine und die seiner Kumpane begraben sind beziehungsweise nach 30 Jahren aus Bolivien übersiedelt wurden. Unterwegs will Theo eine Zigarre kaufen. Der junge Fahrer ist gerne behilflich, hält an drei verschiedenen Orten an, geht fragen, ob Zigarren dort verkauft werden und beim dritten Mal klappt’s dann. Theo kann für einen CUC einen billigen Glimmstengel erstehen. – Vor lauter Kaufeifer lässt er seine Sonnenbrille dort liegen. – Der freundliche Velotaxifahrer hat fast eine Stunde auf uns gewartet, bis wir die Ché-Besichtigung hinter uns haben und fährt uns anschliessend zurück ins besagte Geschäft. Er selber kann die Zigarren viel billiger kaufen. Für einen CUC erhält er gleich fünf Stück derselben Marke. Theo strahlt. – Natürlich ist die Ware eine Katastrophe, aber das tut Theos Freude keinen Abbruch.
Zurück im Zentrum spazieren wir durch den Boulevard, das ist (wie auch in Santi Spritus) die Fussgängerzone mit all den Einkaufsläden. Es hat viele Leute, aber einkaufen kann man nichts, was einen gelüsten würde. Es hat auch kaum Schaufenster, nicht zu vergleichen mit einer Einkaufsstrasse in Europa.
Wir haben noch Zeit, gehen zurück in das Restaurant, wo wir am Abend zuvor unseren Apéro hatten und bestellen nochmals dasselbe am selben Tisch: zwei Daiquiris. „No hay“, ist die Information. Kann doch nicht sein… Doch, inzwischen hat die Eiszertümmerungsmaschine das Zeitliche gesegnet.
In einem anderen staatlichen Restaurant bestellen wir eine Pizza. Die Kellnerinnen sind so etwas von abgestellt, es ist kaum zu glauben. Das Wasser, das wir bestellen, kommt nicht. Das hat sie bereits wieder vergessen. Die Pizza sieht nicht besonders italienisch aus. Man kann sie aber essen, vor allem, wenn man Hunger hat. Zum Glück suche ich erst nachher die Toilette auf (kein Wasser, kein Lavabo, kein Papier – wen wundert’s?!). Auf dem Weg dorthin komme ich an der Küche vorbei. Der Anblick – keiner für die Götter! Ein paar Pizzas liegen auf dem Boden unter dem Wachbecken. Da hat’s aber wenigstens Wasser…
Schon wieder ist Zeit zum Weiterreisen. Ein Taxi bringt uns an den Busbahnhof und diesmal fährt der Bus zehn Minuten zu früh los, alle Fahrgäste sind offenbar schon da. Unser nächstes Ziel ist Varadero, der Ort, an dem in unseren Reisebroschüren mit „All-inclusive-Resorts“ geworben wird. Wir sind ja gespannt... Solche Hotels allerdings sind nicht unser „Ding“. Wir bevorzugen die Privatunterkünfte. Diese sind sehr viel authentischer als die anonymen Hotelkästen und man hat einen besseren Einblick in die Lebensweise der Kubaner. Unsere nächste Unterkunft dort konnten wir bereits telefonisch buchen; unsere hiesigen Gastgeber besorgten uns die Adresse. Man kennt sich eben...
Varadero
Unterwegs regnet es in Strömen. Der Bus erreicht Varadero in knapp drei Stunden, zwanzig Minuten früher als vorgesehen. Auch gut so. Und gerade in dem Moment hört’s zum Glück auf zu regnen. Taxis hat’s keine oder nur solche, die bereits besetzt sind. Zwei Typen bringen uns aber in unsere nächste Unterkunft. Sie haben ein Privatfahrzeug, das mal endlich ein wenig besser aussieht als die üblichen Bruch-Vehikel. Kaum dort angekommen, beginnt es wieder zu giessen wie aus Kübeln, fast sintflutartig.
Unsere Gastgeberin hier heisst auch Maria und sie ist äusserst nett und sympathisch. Wir erhalten ein Zimmer mit Bad und einer kleinen Küche, die wir aber wiederum nicht brauchen werden.
Wir haben aber noch nichts gegessen. Mit zwei Schirmen bewaffnet suchen wir das nächstgelegene Restaurant gleich um die Ecke auf. Beim Überqueren der Strasse treten wir unweigerlich in die tiefsten Wasserlachen, nasse Schuhe und Füsse sind einfach nicht zu vermeiden. Der Kellner dort will grad schliessen, hat eine Schnur gespannt vor den Eingang des Gartenrestaurants; der Regen hat die Gäste offenbar vertrieben und es ist schon nach neun. Er hat dann doch noch ein Einsehen. Es habe nur noch Fisch oder Filet Mignon, wenn das ok sei, könnten wir kommen. - Sehr ok, je eins der Gerichte bestellen wir und eine Flasche Wein. Aber die könnten wir nicht in Ruhe fertig trinken, lässt er uns wissen, er wolle nachher schliessen und heim. – So geht das hier…
23. April
Als wir gestern ankamen, war’s dunkel und wir sahen gar nicht so genau, wo wir eigentlich „gelandet“ sind. Jetzt merken wir, wie gut die Casa, in der wir wohnen, gelegen ist. 50 Meter zum Supermarkt (sieht zwar „gut“ aus, hat aber doch auch hier kaum etwas Kaufenswertes), 100 Meter zum Meer, zum Centro Commercial, wo’s einen Bancomat hat, ist’s kaum fünf Minuten zu Fuss. – Wir sind mitten im Zentrum, Calle 41. – Da haben wir wieder grosses Glück gehabt mit der Unterkunft.
Den Nachmittag verbringen wir am Strand. Wie’s im Büchlein steht: Palmen, weisser Sand und das bis weit hinaus klare kristallblaue und türkisfarbene Wasser des Meeres ist eine Augenweide. Und warm ist das Wasser; es ist eine Freude.
Unseren inzwischen üblichen Daiquiri trinken wir zur Apérozeit in einem Restaurant gegenüber. Wir verwickeln uns in ein Gespräch mit einem Amerikaner, der Trump gewählt hat… Das gibt zu diskutieren! Aber es geht friedlich zu.
Eine Casa Habana gibt’s auch gleich um die Ecke. Da kann man jetzt die teuren originalen Zigarren kaufen. Theo ist im siebten Himmel. Hier wird zum ersten Mal mit der Kreditkarte bezahlt – das Kleingeld reicht nicht.
Dusche und Siesta „zu Hause“, Nachtessen in einem Restaurant ein wenig weiter weg als das gestrige. Sie sehen übrigens alle ähnlich aus, diese Lokale: Man isst draussen unter grossen ausladenden Palmendächern, ähnlich wie in Afrika.
La Viscaria ist auch wieder ein Restaurant, das der Regierung gehört. Man merkt’s – das Übliche: gelangweilte, uninteressierte Kellnerinnen, die ziemlich vergesslich sind. Langsam frage ich mich, ob diese Eigenschaft Voraussetzung ist, um in einem staatlichen Lokal zu arbeiten, niedergeschrieben im Pflichtenheft. - Statt des Crevetten Cocktails bringt sie uns etwas, das aussieht wie ein Spaghetti-Köpfchen und nach gar nichts schmeckt. Ich denke erst, da habe sich der Koch vielleicht etwas Spezielles einfallen lassen mit den Crevetten. – Nein, ein Poulet-Salat sei das, klärt sie uns auf. Also doch etwas Spezielles: Wo ist das Poulet?
Apropos: Theo bestellt sich ein Poulet-Cordon-Bleu. Er findet, es sei etwas dünn und ich denke, es hätte gut sein können, dass das Huhn, wäre es nicht geschlachtet worden, an Hunger gestorben wäre. – Mein Fisch ist ein wenig zäh, der Rotwein ein wenig viel zu warm.
24. April
Es gibt einen Touristenbus, Hop on – hop off, so wie in den meisten europäischen Städten auch. Er kostet nur 5 CUC pro Person und fährt den ganzen Tag im Viertelstundentakt der Halbinsel Varadero entlang, die wie ein 18 km langer und etwa fünfhundert Meter breiter Blinddarm in den Atlantik hineinreicht - hin und zurück, hin und zurück. So können wir die ganze Halbinsel erkunden, die teuren All-Inclusive-Hotel-Ghettos ganz oben an der Spitze und die zahllosen Souvenir-Märkte und Restaurants in der Mitte, wo sich das Zentrum des Ortes befindet. Alle bieten das Gleich an, und trotzdem können wir’s nicht lassen, das eine oder andere zu kaufen. Mal sehen, was unser Koffer dann dazu meint.
Unterwegs kommen wir an einem „Reisebüro“ vorbei (ein Tischchen und ein Stuhl draussen vor einem Geschäft und eine verbleichte Auslage mit Ausflugs-Angeboten. Wir buchen für den Mittwochabend „Buena Vista Social Club“, die bekannte Show in einem der Hotels am Ende der Halbinsel. Wir werden von einem Oldtimer-Cabriolet abgeholt werden, es gibt einen Apéro, man wird mit den Sängern und Musikern ein paar Worte wechseln können und dann beginnt die Show um zehn und dauert anderthalb Stunden. Das Vergnügen kostet 120 CUC; glücklicherweise kann man das mit der Karte zahlen. Es ist ein horrender Preis gemessen an den Verhältnissen hier. Die Angestellte plaudert ein wenig mit uns und erzählt, sie sei vorher Lehrerin gewesen. Ihr Gehalt damals 10 – 12 CUC pro Monat, jetzt sei’s besser – 15 CUC. Und wir zahlen so mir nichts dir nichts für eine Abendunterhaltung das Zehnfache…
Essen am Abend dann in einem wirklich schmucken kleinen privaten Restaurant (Paladar). Maria hat es uns empfohlen, wir selber hätten es wohl nicht gefunden: „Casola del Arte“. Das Essen ist mindestens um eine Klasse besser als in den offiziellen Restaurants (Beilagen wie überall).
25. April
Nach dem Frühstück gehen wir in die Casa de la Musica, wo’s einen Internet Hot Spot hat. Und wieder dauert’s eine gefühlte halbe Stunde, bis die Verbindung klappt. Aber endlich kann ich wenigstens zwei wichtige Emails schreiben. Das ist schon mal was wert.
Bei Maria habe ich einen ganzen Sack voll Wäsche abgegeben, ich habe gesehen, dass sie eine Waschmaschine hat. Ich würde warten und die Wäsche dann aufhängen, bot ich an. Nein, nein, das komme gar nicht in Frage, meint sie. – Ich sehe dann, wie ihre Mutter alle unsere Wäschestücke von Hand vorwäscht, bevor sie sie in die Maschine legt. Wie wir am Abend heimkommen, finden wir die Wäsche schön zusammengelegt auf unserem Bett vor. Sie wollte kein Geld für die Dienstleistung, natürlich ist’s jetzt an mir zu sagen, das komme nicht in Frage.
Den Tag verbringen wir alsdann am herrlichen Strand in Liegestühlen am Halbschatten unter Palmen.
Am Abend Nachtessen im Caney, wo wir am ersten Abend waren. Eine richtig gute Pouletbrust gibt’s (Pollo Supreme), so zart, ich kann fast nicht glauben, dass wir in Kuba sind.
26. April
Etwa gleich wie der Vortag:
Nach dem Frühstück gehen wir ins Centro Commercial. Theo hat sich erkältet, das ist ein wenig mühsam. In der Apotheke kaufen wir Tabletten gegen die Erkältung. Die Verkäuferin gibt uns aus zwei Schachteln je eine Folie mit zehn Stück drin und eine Rechnung dazu von 23 CUC. Die Schachteln und die Beschreibung dazu erhalten wir nicht, sie gibt sie uns zwar zuvor zum Lesen. Erst wie wir draussen sind, wird mir klar, dass sie uns übers Ohr gehauen hat. Sicher hat sie die Hälfte der Tabletten behalten und gibt sie mit dem Rest der Medis an jemanden Gescheiteres weiter, der oder die dann zwar auch nur die Hälfte der Medis erhält, aber mit Schachteln und Packungsbeilag. So hat sie dann recht verdient. Eigentlich will ich zurück und die Sache in Ordnung bringen. Theo aber will nicht…
In der Casa de la Musica dann gibt‘s wiederum ein Internetstündchen und zwei Cappuccinos.
Liegestühle und Strand am Nachmittag. Der Sand ist so heiss, dass man ohne Flip-Flops gar nicht drauf gehen kann. Sowieso ist es heute noch heisser als gestern. Abkühlung bringt das Meer.
Aber Theo will nicht baden gehen, auch ein Spaziergang, zu dem ich ihn mehrmals auffordere (was ihn nervt), ist offenbar nicht auf seinem Programm. Er will lieber auf dem Liegestuhl schwitzen, lesen und schlafen, und das stundenlang. – Erst am späten Nachmittag macht er sich dann doch noch auf, ein paar Schritte am Strand entlang zu gehen und ins nicht so ganz kühle Nass zu steigen. Und da merkt er, dass ihm sein Fuss weh tut. Er hat ihn beim langen Liegen irgendwie verknackst. Jetzt humpelt er. – Ja, die Strafe folgt manchmal halt auf dem Fuss.
Humpeln tut er auch am nächsten und übernächsten Tag noch. Er fragt sogar Kay an, was sie meint, was er habe und erklärt ihr seine Beschwerden im Detail. Dazu muss er nochmals ins Internetcafé hinken… Grad amputieren muss man den Fuss wohl nicht, sage ich, aber er goutiert Bemerkungen dieser Art nicht sehr. Ebenso wenig wie meine Nicht-Anteilnahme an seinem Gebrechen.
Es ist unser letzter Abend in Varadero. Maria hat uns ein tolles Restaurant empfohlen in der 31sten Strasse. Es ist ein Paladar („Salsa Sanchez“), also ein privates Unternehmen. Das merkt man sofort an der sehr gediegenen Einrichtung, der Art, wie die Kellnerinnen gekleidet und ausgebildet sind. Das Essen ist exzellent, die Drinks ebenso und das Dessert einzigartig. Die Rechnung natürlich auch für hiesige Verhältnisse.
Pünktlich um halb neun sind wir beim Hotel Delphino, wo wir von einem Oldtimer (Chevi Convertible 54) abgeholt werden und uns ins Hotel Paradiso chauffieren lassen. Dort gibt’s einen Drink und um zehn Uhr beginnt die Vorstellung der Band: „Cuban Soneros All Stars“. Elf Männer und zwei Frauen machen gute Unterhaltung, kubanische Musik eben. Die eine Frau ist eine hervorragende Sängerin. Der Clou aber ist schon der Älteste der Gruppe, ein kleiner, dürrer Kubaner mit weissem Schnurrbart, gegen die neunzig Jahre alt. Er sieht nicht aus, wie wenn er noch grosse Sprünge machen würde, (seine kleinen Schrittchen, die er im Takt zur (lauten) Musik macht, sind fast ein wenig unbeholfen), aber seine Stimme ist unglaublich. Wie die eines jungen Mannes. Und schalkhaft ist er auch. „I love you“ haucht er zwischendurch ins Mikrophon.
Der alte Chevi bringt uns wieder heim und um zwölf sind wir im Bett. Ein schöner Abend war’s, nicht ganz billig, aber wir gönnen uns ja sonst nichts…
27. April
Wir frühstücken gemütlich. Wie jeden Morgen macht uns Maria einen grossen Teller voller Früchte parat. Sie erwähnt, dass die Bananen aus dem Hotel seien, wo ihre Schwester arbeite. Aus dem Grund seien sie auch so gut und süss. Diese Bananen seien nur für die Touristen, Kubaner könnten nur schlechtere Qualitäten kaufen.
Auch die Löhne sind nochmals ein Thema und sie bestätigt, dass ein normales Gehalt nicht mehr als 20 CUC pro Monat beträgt.
Wir packen wieder mal unseren Koffer und unsere Taschen und begeben uns gemütlich zum Viazul Busbahnhof. Unterwegs sehe ich eine Bank, die offen hat und mir kommt in den Sinn, dass ich noch eine 3-Peso-National-Banknote kaufen möchte mit dem Gesicht von Ché drauf. Diese Noten sind sehr gefragt bei Touristen, die dafür, wie ich gelesen habe, oft ein paar Franken ausgeben. Auf der Bank kosten sie jedoch nur, was sie wirklich wert sind, nämlich etwa 15 Rappen. – So kann ich mir ja gleich drei davon leisten…
Beim Eingang zur Bank steht jeweils ein Typ, bei dem man sich anmelden und erklären muss, was man will. – Er geht sofort von Schalter zu Schalter und wie er einen gefunden hat, wo solche Noten vorhanden sind, weist er mich gleich dorthin. Alle andern Bankkunden (es sind ausschliesslich Kubaner), die dort warten, warten noch ein Weilchen länger. Das ist mir natürlich nicht recht, aber so werden hier die Touristen halt behandelt.
Zurück in Havanna
Der Bus nach Havanna fährt mit geringer Verspätung kurz nach zwölf Uhr mittags ab. Es gibt einen kurzen Zwischenhalt auf der Strecke, eine Kaffeepause. Nach gut drei Stunden hält er mitten in der Hauptstadt an, noch zwei weitere Haltestellen gibt’s, dann sind wir an der Endstation, dort, wo unsere Reise begonnen hat. Ich sitze noch im Bus, als schon eine Horde Taxifahrer durchs Fenster andeuten, dass sie gerne ihre Dienste zur Verfügung stellen würden.
Paolo hat das Rennen gemacht. Sein Auto ist zwar nicht gerade ein Traum, aber all unser Gepäck und wir selber haben Platz und er ist sehr sympathisch. Der Preis ist abgemacht, er fährt uns aber nicht ganz auf direktem Weg zum Ziel. Er fährt durch Quartiere, die wir nicht kennen und erklärt uns, welche Gebäude zu sehen sind. Er wäre der perfekte Gide, um mit ihm eine Stadtrundfahrt zu machen. Auch klärt er uns über die Nationalblume (Mariposa), den Nationalbaum (Palma Real) und den Nationalvogel (Tocororo - rot, weiss, blau wie die Farbe der kubanischen Flagge) auf. Auf seinem Handy hat er Bilder davon, die er uns zeigt.
Sogar auf der Tripadvisor-App sei er zu finden und er bittet uns, dort eine gute Beurteilung für ihn abzugeben. Das mache ich auf jeden Fall. Sobald wir wieder mal Internet haben. Ich habe noch zwei Tafeln Schokolade, die gebe ich ihm als Trinkgeld.
Und wieder eine Überraschung bei unseren Gastgebern: Abels Bruder aus Schweden, der für einen Monat zu Besuch kommt, wird bereits morgen erwartet und nicht übermorgen, wie Maria Elena uns versichert hat. Wir könnten also nur eine Nacht noch bei ihnen bleiben und müssten dann eine andere Bleibe suchen. Das macht für mich keinen Sinn, da will ich lieber gleich für unsere beiden letzten Tage eine andere Unterkunft suchen. – So landen wir bei Nachbarn, und dort ist es mindestens ebenso gut.
Abel schwärmt von einem wunderschönen Restaurant mit Blick aufs Meer und auf einen prächtigen Sonnenuntergang. Er reserviert uns einen Tisch und sagt, er bringt uns hin. Sein Auto ist inzwischen Strahl und Glanz. Er hat neue grüne Sitzbänke eingebaut; edel sieht es aus. Die werden für Classic-Cars in den USA hergestellt, nach Mexiko verkauft, von wo aus sie den Kubanern geliefert werden können. Direkt aus den USA kann noch immer keine Ware bezogen werden.
Wir duschen und um halb sieben werden wir von Abel und Maria Elena abgeholt. Das Restaurant, ein Paladar, sieht wirklich gut aus. Es hat sogar einen Swimmingpool und ringsum kleine romantische Zweiertische, von denen aus man die versprochene Sicht hat. Rechts vom Gebäude aber sieht es grauenhaft aus. Es hat zwei Häuser, die wohl früher mal genau gleich ausgesehen haben, beide ebenfalls mit je einem Swimmingpool. Der eine ist leer, im andern ist noch Wasser drin, dunkelgrün, voller Algen. Die Häuser sind unbewohnbar, sie sind zerfallen, nur noch Ruinen. Sie gehören dem Staat…
Wir laden Maria Elena und Abel ein, mit uns zu essen. Erst wollen sie nicht so recht, es sind nur Touristen in diesem Lokal, aber dann nehmen sie die Einladung doch an.
Das Essen ist delikat, die Rechnung am Schluss auch. 125 CUC sind sehr viel Geld für kubanische Verhältnisse.
Unsere beiden Gäste geniessen den Abend offensichtlich und statt heimzufahren gibt’s einen Abstecher ins Hotel National, ein Gebäude mit viel Geschichte, gebaut 1930. Wir sehen uns die Hall of Fame an, eine grosse Bar, wo Fotos all der illustreren Gäste hängen, die dort abgestiegen sind, Filmstars und Politiker. Ein Spaziergang durch den schönen Garten, vorbei an den riesigen Kanonen bildet schon fast den Abschluss unseres speziellen „Ausgangs“.
Kurz vor der Strasse, wo wir wohnen, gibt’s einen Park beziehungsweise ein Quartier, genannt „Fusterlandia“, wo ein reicher Ausländer, José Fuster, alle Häuser mit Mosaiken hat verzieren lassen. „Homage a Gaudí“ ist das Motto. Dorthin führen uns die beiden noch und ich muss sagen, wir waren begeistert; die Häuser sind absolut sehenswert. Einen solchen Ort in dieser Stadt hätte ich nicht erwartet. Und der Touristenbus fährt nicht mal hin.
28. April
Raquel möchte lieber kein Frühstück machen, sie hat weder Früchte noch Fruchtsaft noch Brot; uns ist es grad recht. – Es ist unser letzter Tag in La Habana, wir haben vor, mit dem Touristenbus Hop on Hop off eine Rundfahrt durch die Stadt zu machen und uns noch ein paar Sehenswürdigkeiten „reinzuziehen“, wie man heute so sagt. Wir gehen als Erstes nochmals in das schöne Quartier und machen dort ein paar Fotos, jetzt am Tag. Mit einem Taxi fahren wir zur Haltestelle Cecilia, dorthin, wo der Touri-Bus hält. Nach zwanzig Minuten ist er da und wir steigen ein. Es ist sehr heiss heute, auf dem Dach des Doppeldeckers ist der Fahrtwind ganz angenehm. Seinen Hut allerdings muss man festhalten, sonst ist er weg.
Wir fahren vorbei am Cementerio Colon, einem riesigen Friedhof, dem bedeutendsten in Lateinamerika. Weiter geht’s zum Platz der Revolution, wo ein Standbild von José Martí (kubanischer Nationalheld) steht, Chés Konterfei einmal mehr an einer Hausmauer verewigt ist und wo in drei Tagen der Erste Mai gefeiert werden wird.
Man ist schon am Einrichten: Beleuchtung, Lautsprecher, WC-Kästen, Tribünen. – Theo macht wieder mal „sein Ding“; er legt sich auf einen der im Moment noch leeren Bänke und lässt sich von mir fotografieren. Wir gehen weiter. Er hat nicht gemerkt, dass ihm sein i-Phone aus der Hosentasche gerutscht ist und nun dort unter der Tribüne liegt. So hat er schon soo viel verloren, sein e-Book oder in Hawaii zum Beispiel sein Sketchbuch, das ihm dann glücklicherweise eine nette Rangerin in die Schweiz geschickt hat. Und soooo oft hab ich ihm gesagt, er solle nichts in diese Hosentaschen stecken. - To no avail. – Es nützt einfach nichts. Am nächsten Tag passiert ihm übrigens dasselbe nochmals. Es ist sein Fotoapparat, der ihm in Abels Auto aus der Hose rutscht. Abel hat’s zum Glück noch grad rechtzeitig bemerkt, bevor wir uns verabschieden.
Noch einmal machen wir einen letzten Spaziergang durch die Altstadt, essen eine Kleinigkeit zu Mittag in einem netten Restaurant im ersten Stock mit schönem Blick auf die Plaza Vieja. Per Rikscha geht’s zum Museo de la Revolution, das wir uns letztes Mal nicht angesehen haben. – Fotos über Fotos von den Heldentaten sind im ehemaligen Palast zu sehen und so langsam aber sicher geht es mir gleich wie Maria Elena, die sagt, die Revolution gehe ihr bis dahin – und sie zeigt mit der Hand bis zum Hals.
Den besten Daiquiri, den wir in diesen achtzehn Tagen in Kuba getrunken haben, gibt’s meiner Meinung nach im Chacón 162. Das Café ist ganz in der Nähe des Museums, also nichts wie hin.
Ein weiterer Bici-Taxi-Fahrer bringt uns anschiessend zur Bushaltestelle an der Plaza Central, wo wir grad rechtzeitig den Bus erreichen, der uns zurück nach Cecilia fährt. Ein Taxi für die kurze Strecke von dort aus heim nach Jaymanita finden wir nicht auf Anhieb; wir sind nicht bereit, die überhöhten Touristenpreise, die sie für die kurze Strecke haben wollen, zu bezahlen. Wir gehen ein paar Schritte – es beginnt zu regnen. Ein Bus hält an und ich frage den Fahrer, ob er in Richtung Marina Hemingway fahre. Es ist kein „normaler“ Bus. Er fährt mit seinen Gästen zu einem bestimmten Ziel, ein Band auf dem „Primer de Mayo“ steht, schmückt die Kühlerhaube, aber wie die Leute hören, wo wir hinwollen, sagen sie, wir sollten nur einsteigen. Ein Gejohle im Bus, laute Musik, Gelächter und Salven von Gesprächsfetzen begleiten unsere Fahrt. Ich habe den Eindruck, da ist ziemlich viel Rum mit im Spiel. Wie wir bei der Marina Hemingway ankommen, hält der Bus an und wir steigen aus. Der Fahrer hupt mehrmals und alle winken noch, bis das Vehikel um die nächste Ecke biegt. So lustig war das. Und das Vergnügen hat nur einen CUC gekostet. Auch hat’s während der Fahrt geregnet, wie wir aussteigen, hört’s grad auf.
Schon vor Tagen hat uns Maria Elena gesagt, wir sollen doch mal zur Marina Hemingway spazieren, nicht weit von ihrem Haus entfernt. Es habe dort ein paar Geschäfte und Restaurants. Bisher haben wir’s nicht geschafft, jetzt aber schon. Man sieht ein paar Yachten, aber laufen tut überhaupt nichts. Im Supermarkt will ich Mineralwasser kaufen; „no hay!“.
Eine Bar hat’s. Eher ein trauriges Lokal. Laute Musik dröhnt aus dem Lautsprecher, Theo ist wenig begeistert. Ich will aber was trinken. Es gibt nur Bier und Mojito. Also, das ist ja genau, was wir brauchen. Auch in meinem Mojito fehlt irgendwie das Mineralwasser. Ich glaube, er besteht nur aus Rum, ein paar Eiswürfeln und einem dürren Blättchen Minze. In einem Plastikbecher. Ist aber ok. Und so nett sind die Männer alle. Ich mache ein paar Fotos und sofort setzen sie sich in Pose, prosten uns zu. - Das ist, was wir oft hier erlebt haben, diese heitere Fröhlichkeit und Freundlichkeit. Dann beginnt einer ein Lied zu singen und die Welt ist in Ordnung.
Auf dem Heimweg gehen wir bei Maria Elena und Abel vorbei, um uns zu verabschieden. Der Bruder aus Schweden ist inzwischen angekommen. Verrückt, wie sich die Brüder gleichen, obwohl sie nicht Zwillinge sind. Beide sind ziemlich beleibt. Wir sitzen alle beieinander, Abel, sein Bruder und die Mutter der beiden, Maria Elena, ihr Sohn Daniel und dessen Freundin. Gebannt hören sie zu, wie der Bruder mit uns Englisch spricht.
Zu Hause dann die dringend nötige Dusche und schliesslich gehen wir ins einzige Restaurant weit und breit, ins „Santy“, wo wir vor etwa zehn Tagen so feine Sushis hatten und Fisch. Ins Restaurant am Fluss, das so schön sein könnte, wär da nicht die Umgebung mit den vergammelten Booten und dem verschmutzten Wasser. Das sieht man allerdings nicht bei Nacht und so ist das Lokal trotzdem sehr romantisch. – Die Sushis sind wiederum Spitze, Fisch und Spaghetti ebenfalls; wir essen dasselbe wie beim ersten Mal. – Heute hat’s sehr viele Leute, es ist Freitagabend, man feiert, singt, isst, trinkt und freut sich. Die meisten Gäste scheinen mir Kubaner zu sein. Dass sie sich das leisten können? Es müssen Leute sein, die im Tourismus ein wenig Geld machen können, was Raoul ja neuerdings in gewissem Masse zurlässt.

Reisebericht Bahamas, Long Island - 29. April – 17. Mai 2017
Um sieben steh ich auf. Unsere Koffer habe ich beide total geleert, jetzt geht’s drum, sie geschickt zu packen, so dass wir nur einen davon nach Long Island mitnehmen müssen und einen in Nassau zurücklassen können. Mit dem Resort auf Stella Maris, welches Flüge für siene Gäste auf der Insel anbieten, hatte ich mehrfach per Email Kontakt und Alissa liess mich wissen, dass pro Person nicht mehr als 15 kg mitfliegen sollten/dürften.
Die Kofferpackung gelingt, auf den schwarzen Koffer können wir verzichten, der graue und das Handgepäck sind genug.
Von Theos Brie und der Terrine, die er auf dem Flugplatz in Paris gekauft hat, ist noch immer etwas übrig. Die beiden Nahrungsmittel haben jetzt bereits zwei Kühlschränke verpestet, jetzt muss man sie endlich wegwerfen, und zwar bald. Ich erkläre das Rahel, unserer Vermieterin, damit sie sich nicht wundert… Sie beruhigt mich und sagt, das sei kein Thema. Die Hunde und Katzen würden es sicher gerne fressen. – Da bin ich gar nicht so sicher, aber Hauptsache, das Problem ist gelöst.
Um zehn Uhr holen uns Maria Elena und Abel ab. Sie fahren uns auf den Flugplatz. Unterwegs kommen wir an der Residenz von Raoul vorbei, an einer der Universitäten, an Spitälern und Abel erklärt wortreich und mit vielen Gesten, so wie ein Italiener, was wo ist. Fast jeden Satz beginnt er mit „Isabel, mira…“. Dazu schaut er zu mir nach hinten statt auf die Strasse. Ich schwitze so schon genug und hoffe einfach, dass wir gut am Flughafen ankommen. – Es gelingt, wir steigen aus, verabschieden uns und stehen am Check-in-Schalter Schlange. – Die letzten Pesos, die wir noch haben, geben wir aus für zwei Getränke, ein T-Shirt für Theo und eine Flasche Rum.
Pünktlich um Viertel nach eins starten wir Richtung Bahamas – in eine völlig andere Welt.
29. April 2017 – Unterwegs nach Stella Maris
Der Flug von Havanna nach Nassau dauert eine gute Stunde. Theo freut sich, endlich wieder mal eine nicht-kubanische Zeitung lesen zu können. Das Gelbe vom Ei ist der Bahamas Guardian zwar nicht gerade, aber immerhin, etwas von Trump darin zu finden, und sei es nur eine Karikatur, erfreut Theos Herz, das schon längst unter Entzugserscheinungen leidet, sehr.
Für die Immigration braucht’s Geduld, aber irgendwann ist auch die erledigt, die Koffer sind ebenfalls angekommen, wir gehen durch den Zoll, wo beide grossen Koffer, die ich so schön gepackt habe, durchwühlt werden, aber dann sind wir durch. Ein Taxi bringt uns zu einem andern Ort am Flughafen, wo Joël (lässig in Shorts und T-Shirt) und sein kleines Flugzeug schon auf uns warten. Unser Handgepäck wird in einem der Flügel verstaut, unser grosser Koffer hinter zuhinterst hinter unseren beiden Sitzen –Alle Plätze sind besetzt: acht Passagiere und Joël, der Pilot. Los geht‘s. Es ist schon ein seltsames Gefühl, mit einer so kleinen Maschine zu fliegen. Zwar ist’s ein wenig lärmig, aber es macht Spass. Schön, das türkisblaue Meer zu sehen, die Wolken, ein paar wenige der 700 Inseln der Bahamasgruppe. – Eine gute Stunde dauert auch hier der Flug und schon landen wir in Stella Maris auf Long Island, der langen, schlanken, grünen Insel.
Long Island
Rolf holt uns ab. Keine fünf Minuten dauert die Fahrt über die Holperpiste von der Landebahn zu „unserem“ Haus, wo wir während zwei Wochen wohnen werden. Es ist sechseckig, hat im Parterre vier grosse, weiss getünchte Schlafzimmer. Eine Wendeltreppe führt in den oberen Stock, der aus dem Busch herausragt. Dort befinden sich Küche und Wohnzimmer und eine schöne, grosse Terrasse, von der aus man sowohl den Sonnenaufgang über dem Atlantik wie auch den Sonnenuntergang über dem karibischen Meer sehen kann.
Erst aber lädt uns Rolf in sein Haus ein, welches nur ein paar Minuten zu Fuss nebendran gelegen ist. Wir trinken zusammen eine Flasche Weisswein und erhalten erste Informationen über die Insel und alles Wissenswerte, was unseren Urlaub hier betrifft.
Wir haben Rolf und seine Partnerin Susan bereits in Bivio kennengelernt beim Haustausch. Sie waren schon zweimal dort; nun sind wir dran. Er ist Schweizer, wohnt aber seit über vierzig Jahren auf dieser Insel, kennt alles und jeden, besitzt etliche Grundstücke hier und handelt mit Immobilien. Susan ist Amerikanerin. Diese Wochen besucht sie noch ihrer Tochter in Florida; sie wird am Sonntag zurückkommen.
Um halb acht gehen wir zusammen im Stella Maris Resort essen. – Es ist eine andere Welt als auf Kuba. Das Essen kostet 200 $ für uns drei. Die Steaks sind gut, mein Fisch ein wenig trocken. Aber wenigstens gibt’s mal wieder einen Salat, der diesen Namen auch verdient.
30. April
Wir haben wunderbar geschlafen, die Temperatur ist angenehm in der Nacht, viel kühler als während der letzten beiden Wochen.
Rolf holt uns um halb zehn ab und wir gehen zusammen einkaufen in einem Lädeli in „Burnt Ground“, das etwa fünf Meilen entfernt ist. Dort kommt es uns vor wie im Schlaraffenland nach den Erfahrungen, die wir in Kuba mit Supermärkten gemacht haben. Der Laden ist zwar mehr eine Hütte, relativ klein, aber wie auch in Bivio bekommt man hier fast alles, was man braucht. Das Schiff aus den USA kommt nur zweimal pro Woche (gut koordiniert: am Dienstag und am Mittwoch); heute ist Sonntag, nicht der ideale Tag für den Einkauf. Trotzdem finden wir fast alles, was wir gerne hätten. Teuer ist es allerdings; ein Liter Milch zum Beispiel kostet 4 $ (sie stammt aus Frankreich…). Für 100 $ kaufen wir ein. Gerne hätte ich eine Foto gemacht von der Dame, die hinter der Theke sitzt, aber ich fürchte, nicht einmal mit meinem Weitwinkelobjekt würde ich sie ganz erfassen können.
In Rolfs Haus hat’s unten drin ein kleines Apartment, das immer offen ist und wo wir WIFI haben, also mehr oder weniger jederzeit das Internet benutzen können. Endlich! – Wir verbringen mindestens eine Stunde dort. Ich kann ein paar Rechnungen bezahlen, mit der Familie und mit Freunden Kontakt aufnehmen, Dinge nachschauen, die mich interessieren - es ist wunderbar.
Heute machen wir keine grossen Sprünge mehr, richten uns ein, liegen ein wenig auf der Terrasse in den bequemen Liegestühlen, lesen und schon ist‘s Zeit fürs Nachtessen.
Bald merken wir: Nicht ganz alles ist Gold, was glänzt, auch hier nicht.
Die Waschmaschine funktioniert nicht. So langsam wär‘s wieder mal an der Zeit, ein paar Kleidungsstücke zu waschen. Bei genauerer Inspektion findet Theo heraus, dass sie verrostet ist. So geht’s auch in der Küche. Die Messer halten das salzige Klima sichtlich schlecht aus und sind voller Rostflecken. Wie ich versuche, sie mal wenigstens gründlich zu waschen, stelle ich fest, dass gar kein Wasser aus der Röhre kommt. Kein einziger Tropfen. Das ist ziemlich mühsam, ich kann den Salat nicht waschen, die Teller nachher auch nicht. – Eigentlich sollte Regenwasser aus der Leitung kommen. Den Tank haben wir am Nachmittag gesehen; er ist voll und am Rand sitzen drei Frösche, Mutter, Teenager und Baby. Theo ist entzückt, er mag solche Viecher, füttert ja zu Hause jeweils „unsere“ Spinnen. Meine Begeisterung allerdings, wenn’s um solche Mitbewohner geht, hält sich in engen Grenzen. – Es muss an der Pumpe liegen. – Morgen muss was passieren, jetzt ist es zu spät dazu.
Eine Tomate schneide ich auf, etwas Zwiebeln dazu und ein paar Scheibchen Rüben, das ist unser Salat; das Steak, das wir vorhin gekauft haben, ist köstlich.
Im unteren Stock hat’s wenigstens noch grad genügend Wasser zum Zähneputzen, fürs Duschen reicht der Vorrat auch noch knapp.
1. Mai – unterwegs in der Umgebung
Rolf kommt um halb zehn vorbei. Wir klagen ihm unser Leid.
Die Wäsche bringen wir in sein Haus, waschen sie dort und hängen sie anschliessend bei uns an einer Wäscheleine auf, die zwischen zwei Bäumen angebracht ist. Bei dem Wind, der hier herrscht, ist sie schnell trocken.
Die Sache mit dem Wasser ist schon schwieriger. Da muss er jemanden kommen lassen. Das passiert dann am Nachmittag.
Wir fahren ans Nordende der Insel. Theo fährt mit Rolf, der ihm auf der Strecke erklärt, wo was zu finden und zu sehen ist. Ich fahre hinterher. Susan hat uns ihr Auto überlassen, einen kleinen schwarzen Jeep, der einfach zu schalten und zu lenken ist und mit dem herumzukurven mir grossen Spass macht. Hinten auf dem Reserverad heiss es: „Life is good!“ – Sehr einverstanden!
Speziell ist, dass auf den Bahamas Linksverkehr herrscht, aber alle Autos kommen aus den USA, sind also wie bei uns auch links gesteuert. – Nicht extrem praktisch, aber man gewöhnt sich an alles…
Die Strassen hier sind zum Teil die grösste Katastrophe; es hat Schlaglöcher vom Gröbsten. Wie ein Emmentaler sieht der Belag aus, Löcher hat’s in allen Variationen und Tiefen. Fast am schlimmsten ist die Strasse dort, wo noch ein wenig Asphalt vorhanden ist. Die armen Pneus tun mir richtig leid. - Zweigt man von der Hauptstrasse ab, wird’s erst recht zur Herausforderung. Es geht über Stock und Stein, wie durch Bachbette manchmal - Theo klagt schon nach wenigen Minuten, er habe jetzt dann Kopfschmerzen. Aber Rolf will uns zeigen, wo er fünf Grundstücke hat, auf denen man bauen könnte („Kingdom Project“), wo er einen Hochstand aufgebaut hat mit toller Aussicht, wo’s die herrlichsten Strände hat. Die Lagunen, die Strände, die kleinen Buchten, das klare türkisblaue Wasser – all das ist traumhaft schön, besser noch als in den Glanzprospekten.
Im Santa Maria Resort kehren wir ein, trinken etwas und essen eine Kleinigkeit. Das Resort ist märchenhaft gelegen.
Rolf fährt anschliessend zurück und wir suchen uns einen Platz am kilometerlangen weissen Sandstrand, wo keine Menschenseele zu sehen ist. Nur zwei Boote ankern weiter draussen. Das Meer ist phantastisch: schön warm, kristallklar, ruhig und ideal zum Schwimmen.
Gegen sechs fahren wir zurück, machen noch rasch Halt im Laden und sind gespannt, wie die Lage ist im Haus, ob’s Wasser hat zum Duschen und in der Küche. – Etwas muss offenbar ersetzt werden, aber für diesen Abend funktioniert beides, wenigstens mal provisorisch. Ohne zu duschen ins Bett gehen zu müssen, wär nicht grad nach meinem Geschmack. – Eddy (schwarz wie die Nacht) hat’s gerichtet. Zumindest für heute Abend, morgen muss er nochmals dahinter.
2. Mai 2017
Eddy hat’s gerichtet, aber da der Kühlschrank mit der Pumpe verbunden ist, hat er den ausgeschaltet, den Tiefkühler auch. Die Milch, die Butter, das Eiscrème, das Steak…
Eddy kommt wieder und bringt einen Kumpel mit, Kevin (cafébraun). Die beiden reparieren die Pumpe, aber da gibt’s noch einen Rohrbruch zu beklagen – warmes Wasser wird wohl erst nächste Woche ein Thema sein. Nun, das ist das kleinste Übel. Fürs Rasieren muss Theo das Wasser in der Pfanne aufheizen. Auch für den Abwasch. Zum Duschen ist uns kaltes Wasser sowieso viel lieber.
All das fasst Rolf zusammen unter dem Titel: „Bahamas Inselleben“.
Er fährt mit uns zu einem weiteren seiner Häuser, dem Lake House. Es steht völlig allein mitten im Busch, direkt an einem See, wo’s Riesenschildkröten drin hat. Zwei davon sehen wir sogar im Wasser paddeln. Leider ist das Haus ein wenig verwahrlost; es wohnt nur selten jemand drin, aber es würde nicht viel brauchen, es wieder flott zu machen. Wir fahren noch an anderen Häusern vorbei, zum Teil prächtigen Villen, zum Teil aber nur Ruinen, gar nicht fertig gebaut oder erst seit kurzem verlassen. Wie es aussieht, ist auf dieser Insel sehr viel spekuliert worden, grosse Mengen an Geld stecken in zahllosen Projekten, die abgebrochen worden sind.
Im Garten eines Hauses von Bekannten von Rolf hat’s wunderbare Papayas (Er ist es gewohnt, sich bei Nachbarn zu bedienen, sich mit Früchten und Blumen einzudecken. Das sei so hier, das mache man so…). Die beiden Männer schlagen zwei der reifen Früchte vom Baum. Theo fängt sie auf, bevor sie am Boden zerbersten. Er ist ganz stolz auf seine Ernte und Reaktion.
Am Nachmittag machen wir einen Ausflug zu den Love Beaches, einer Reihe von sieben oder acht einsamen Stränden. Oberhalb des ersten steht eine verlassene Siedlung, mehrere teuer gebaute Bungalows mit künstlichen Strohdächern, die noch immer absolut perfekt im Stand sind, ein attraktiver grosser Pool, der jetzt natürlich leer ist - auch dies hätte ein Resort werden sollen, ein Millionen-Projekt, das offenbar aus Geldmangel in die Hose ging. Es wäre ein Paradies. Jetzt dehnt sich der Busch wieder aus und beginnt, alles zu überwachsen. Es wird kaum mehr lange dauern, bis die Parzelle nicht mehr zugänglich sein wird.
Eigentlich wollten wir baden, aber nun machen wir eine langen Spaziergang am Strand entlang oder besser gesagt geht die Route über die schwarzen, zackigen Korallen-Felsen bis hin zum nächsten Strand, wo vor etwa sieben Jahren ein Schiff gekentert ist: ein Frachter aus der Dominikanischen Republik. Ein Teil davon, das Heck, steht verrostet am Ufer. Das gibt wunderbare Fotos. Auch für den Kilometer langen Rückweg mit unseren Flip Flops über die spitzen Felsen brauchen wir eine gute halbe Stunde. Man muss höllisch aufpassen, dass man sich nicht verletzt. Theo gelingt dies leider nicht ganz, aber die paar Kratzer sind sicher schnell verheilt.
Jetzt haben wir einen Drink verdient. Im Resort an der Moonlight-Strandbar gibt’s einen Erdbeer-Daiquiri, der so gross ist, dass man damit grad gegessen hat. In der Schale, die mir Sue, die Barkeeperin, bringt, sieht’s aus wie fünf Kugeln Erdbeer-Sorbet.
3. Mai 2017 Ausflug in den Süden der Insel
Rolf holt uns um neun Uhr ab. Los geht’s Richtung Süden. Es gibt eine einzige Hauptstrasse entlang der etwa 130 km langen Insel. Diese ist einigermassen im Stand, eine Wohltat verglichen mit den Nebenstrassen. Wir fahren durch mehrere Dörfer oder besser gesagt Siedlungen; die meisten bestehen nur aus ein paar Häusern. Die Ortsschilder sind grün, oft kann man sie kaum mehr lesen, weil sie halb abgerissen oder verbleicht sind. Die Ortsnamen sind auch bemerkenswert; sie gehen zurück auf die Sklavenzeit, einige sind Namen der damaligen Gutsbesitzer: Millers, Mckanns, O’Neills, Doctor’s Creek, Scrub Hill, Burnt Ground, Hard Bargain, Cabbage Point etc.
Rolf weiss überall was zu erzählen. In Simms zum Beispiel stehen ein paar schmucke Häuser gleich an der Hauptstrasse nebeneinander: das Gemeindehaus, das Gericht, das Gefängnis, die Polizeiwache und die Post. Aber auch das „Amt“ für die Motorfahrzeug-Kontrolle ist dort. Eine solche Kontrolle dauere zwischen 30 und im schlechtesten Fall 60 Sekunden… Gebe man ein Trinkgeld, falle sie auch weg.
Auf Long Island leben etwa 3000 Menschen, etwa ebenso viele Autos habe es.
In Petty wohnten fast nur Griechen, die auch untereinander heirateten…
In Clarence Town hat’s zwei Kirchen – vom selben Architekten erbaut. Diejenige links eine anglikanische – diejenige rechts eine katholische. – Nach dem Bau der ersten habe der Architekt konvertiert…
Am Hafen in Clarence Town trinken wir etwas. Es ist nicht viel los, die meisten Schiffe sind auf See am Fische Fangen.
Wir fahren wieder gegen Norden und machen Halt bei Dean’s Blue Hole, der Attraktion auf Long Island. Das „Loch“ ist 200 Meter tief (world’s deepest) und es ist dort, wo die Weltmeisterschaften im Tauchen ohne Sauerstoffgeräte stattfinden. 102 Meter Tiefe wurden letztes Jahr als Weltrekord erreicht, 124 Meter mit Flossen.
In ein paar Tagen findet wieder ein Event statt, Vorbereitungen sind bereits im Gang.
Rolf fährt uns zu einem anderen Strand, der absolut superb ist. Rund wie eine Riesen-Wanne mit fünfzig Metern Durchmesser kann man wunderbar drin baden. Nur durch einen schmalen Streifen zwischen den Felsen strömt das Meerwasser in das Becken hinein.
Zurück beim Auto beginnt’s grad zu regnen. Das dauert aber nicht lang, schon ist es wieder trocken. Heute ist‘s meistens bedeckt, aber dadurch ist die Temperatur sehr angenehm. Kommt die Sonne durch, gibt man fast den Geist auf.
Der nächste Halt ist bei „Max‘ Conch Bar and Grill“. Eigentlich heisst der Besitzer ja Gerry und er macht den besten Conch Salad (ausgesprochen: „Konk“) der Insel, sagt Rolf. Es ist ein lustiges, kleines, farbiges Garten-Restaurant, und ja, der Muschelsalat ist wirklich exquisit - etwa wie Ceviche, aber halt mit Muscheln statt mit Fisch. Gerry sucht die Tiere selber und man kann zuschauen, wie er sie aus der Schale holt, wenn man will. – Ich will nicht. Theo isst eine Minestrone, die er auch sehr mag. – Die Flasche Chardonnay dazu ist fein und kühl, aber sie macht mich richtig schläfrig.
Im Supermarkt ein paar Kilometer weiter nördlich in Salt Point wird nochmals kräftig eingekauft, dann geht’s heimzu. Dort angekommen, merkt Theo, dass er seinen Sportsack im Restaurant hat liegen lassen. Dabei hab ich ihn noch gefragt, weshalb er ihn nicht im Auto lasse… Ich hätte meine Tasche, sagte er - er seinen Sportsack. – (Nur, dass ich meine Tasche normalerweise nicht im Restaurant liegen lasse…)
4. Mai
Heute ist nicht der Tag der grossen Unternehmungen. Theo braucht ja immer wieder mal einen zum Ausspannen, wie er sagt. Also spannen wir aus.
So gegen fünf aber finde ich dann doch, wir könnten uns zumindest im Resort an der Strandbar einen Drink genehmigen. Er ist einverstanden. Es ist aber so schön dort, dass wir noch ein bisschen am Strand verweilen. Zu lange, wie sich herausstellt – die Bar hat um sechs bereits die Schotten dicht gemacht.
So gibt’s den Cuba Libre halt daheim. Inzwischen habe ich auch ein Abtropfsieb gekauft, so kann ich den Salat waschen. Mit Trinkwasser aus dem blauen Gallonen-Behälter. Das Frosch-Regen-Trinkwasser kommt dafür nicht in den Einsatz. Kommt überhaupt nicht in Frage - ganz sicher nicht!
Also gibt’s Salat zum Nachtessen, frische grüne Spargeln, Bratkartoffeln und Steak. – Lecker!
5. Mai – Ausflug in den Norden der Insel
Um halb zehn holt uns Rolf ab. Er will uns einen seiner Lieblingsplätze auf der Insel zeigen. Wir fahren zur Kolumbus-Bucht. Ein sehr unwegsamer Pfad führt dorthin. Dass die Pneus da noch mitmachen…
Vor dem Monument zweigen wir rechts ab und Rolf lässt den Wagen mitten im Busch stehen. Den Rest bis zum Strand gehen wir zu Fuss weiter. – Was für ein paradiesischer Ort! Es ist eine weite Lagune, die jetzt, bei Ebbe, nur teilweise mit Wasser durchflutet ist. In allen Schattierungen von Türkisblau schimmert das Wasser. Wir deponieren unsere Sachen am Strand im Schatten. Vor uns fliesst eine Art Fluss in Richtung Meer. Wie wir später nach zwei Stunden wieder an diesen Ort zurückkommen, hat die Richtung durch die Flut gewechselt – er fliesst landeinwärts.
Nur noch mit einem Badetuch bewaffnet, mit Sonnenhut, Schnorchel-Ausrüstung und Kamera, waten wir durch diese stille, menschenleere, atemberaubend schöne Landschaft. Manchmal geht’s durch hüfthohes Wasser, dann wieder über Sandbänke, vorbei an Mangroven und deren Tausenden von kleinen und grösseren Sprösslingen. Nach etwa einem Kilometer sind wir da, wo Rolf hin will, es ist eine Art Muschelfriedhof. Das Wasser ist hier viel tiefer und hat eine ziemliche Strömung. Wir ziehen Taucherbrille und Schnorchel an und lassen uns ans andere Ufer treiben. Und tatsächlich: Da liegen Dutzende von zersplitterten Conchs auf dem Boden; es empfiehlt sich dringend, nicht draufzustehen.
Auch am Strand finden wir Muscheln, Sanddollars und diese riesigen, schweren Dinger, von denen auch die leeren Schalen mehr als zwei Kilo wiegen. Sie sind hier auf der Insel eines der Hauptnahrungsmittel.
Eine mittelgrosse Conch hebe ich auf. Sie ist wunderschön rot, orange, gelb, pink und weiss gefärbt. Das Tier drin lebt noch und wie ich genau hinsehe, sehen wir uns in die Augen. Da werden zwei Stilaugen herausgestreckt, wie von einer Schnecke. Aber damit hat sich’s noch nicht. Das schleimige Tier schiebt einen grösseren Teil seines Körpers aus der Schale heraus, jetzt noch so eine wurmfortsatzartige Spitze, die sich gegen meine Finger hin bewegt, so dass mir gerade in dem Moment, wo Theo fotografieren will, Angst und Bang wird und ich die Muschel vor lauter Schreck fallen lasse. – „Z, z, z“, sagt Theo, hebt sie wieder auf, nimmt noch zwei andere dazu und wir tauschen die Rollen. Ich fotografiere, er gibt sich mit den Tierchen ab.
Erst jetzt wird mir bewusst, dass diese Conchs ja tatsächlich Schnecken sind und gar keine Muscheln. Ich habe vorgestern also Schneckensalat gegessen…
Wir wandern zurück an die Stelle, wo wir unsere Sachen haben liegen lassen. Der „Fluss“, der, wie bereits erwähnt, jetzt die Richtung gewechselt hat, ist auch tiefer geworden; das Wasser reicht mir fast bis zu den Schultern. Theo muss den Sack mit der Kamera drin auf dem Kopf tragen, damit sie nicht nass wird.
Und jetzt hat Rolf eine Überraschung parat: Er hat in der Kühlbox eine Flasche Chardonnay mitgebracht. Das hört sich nicht schlecht an! – Aber oh weh, er hat die Gläser dazu vergessen. – Wir sind jedoch erfinderisch: Die Schweizer Thermosflasche, die wir auch dabei haben, hat einen Deckel. Der dient mir als Glas. Das Wasser in der Flasche wird ausgeschüttet und wird zu Theos Trinkgefäss, Rolf trinkt seinen Drittel aus der Flasche. – Zum Essen gibt’s Orangen.
Mindestens eine halbe Stunde lass ich mich anschliessend im warmen Wasser treiben, es ist am angenehmsten dort; die beiden Männer liegen am Strand im Schatten und unterhalten sich über Trump und den Unterschied zwischen digital und analog. - Siesta dann.
Gegen drei brechen wir auf und wandern doch noch den Hügel hinauf zum Kolumbus-Monument, von wo aus man einen fantastischen Blick hat auf die Lagune und die Stelle, wo der Seefahrer am 17. Oktober 1492, vor 525 Jahren also, gelandet ist. In seinem Logbuch habe es geheissen, das sei die schönste Insel, die er bisher gesehen habe.
Um vier Uhr nachmittags sind wir daheim. – Wunderbar, die kalte Dusche.
Zwei Stunden später hab ich die Idee, statt selber zu kochen, wieder loszufahren und in einem der einheimischen Restaurants zu Abend zu essen. Das machen wir, aber die Sache stellt sich als nicht allzu einfach heraus. Unterwegs kommt mir in den Sinn, dass die dort wohl keinen Wein anbieten, also gehen wir erst noch in den Liquor-Store und kaufen eine Flasche Cabernet Sauvignon. – Das Restaurant vis-à-vis des Ladens ist zwar offen, aber heute haben sie keine Zeit zu kochen. Morgen besucht der Premierminister der Bahamas die Insel und da muss vorbereitet werden. Die Männer in ihren gelben T-Shirts, die für die (ober-korrupte – wie Rolf sagt) Regierungspartei werben, sind beschäftigt wie die Bienen, und bringen überall an den Strassenrändern ihre Parteiplakate an.
Sie werden übrigens nicht gewinnen. Völlig überraschend gewinnt die FNM (Free National Movement) statt wie erwartet die PLP (People‘s Liberal Party), und das sogar haushoch mit umgekehrter Sitzverteilung - Rolf ist begeistert.
Nur eine Kurve weiter gibt es eine Abzweigung zum Restaurant „Two Sisters“. An der Eingangstür ist ein kitschiges, farbig blinkendes Schild angebracht, auf dem steht OPEN, aber die Köchin sagt, sie müsse grad an einer Vorstandssitzung teilnehmen, es tue ihr sehr leid, aber sie müsse schliessen.
Zwei Hütten weiter vorne jedoch gibt’s „Rose’s Takeaway“, ein sehr einfaches kleines „Restaurant“, wo man sogar draussen sitzen kann. Es hat zwei Tische und je eine schmale Bank ohne Lehne, welche wohl eher dazu dient, aufs Essen zu warten als darauf, bequem zu tafeln. Melvin, der Besitzer und Partner von Rose, ist sehr liebenswürdig. Er sagt, was er uns anbieten kann und wir bestellen Pouletschenkel mit Salat und Pommes Frites. Der Laden läuft. Immer wieder kommt jemand vorbei und bestellt ein Gericht zum Mitnehmen. Alle Kunden sind tiefschwarz; wir sind die einzigen Weissen. Immer wieder ergibt sich ein kurzes Gespräch und ich merke, dass ich den einen oder anderen bereits „kenne“, weil Rolf von ihm erzählt hat. Der Typ zum Beispiel, der verschiedene Frauen geschwängert hat – unter anderem eine Deutsche und der jetzt zwei schokoladebraune Kinder von ihr hat. Er erzählt uns von seinen Jungs, die Deutsch sprechen. Er selber gibt auch ein, zwei teutonische Wortfetzen zum Besten.
Und ich hatte recht: Sie haben keine Lizenz, Alkohol auszuschenken, aber wir dürfen selbstverständlich unseren mitgebrachten Wein trinken. Die Suche nach zwei Gläsern gestaltet sich zuerst zwar als problematisch, aber dann wird Melvin doch noch fündig. Eine halbe Stunde später ist unser Essen parat. Theo füttert einen Teil seines Poulets den wilden Katzen, die sich inzwischen zu uns gesellt haben. Mir gefällt das Essen. Auch die Stimmung und der Ort. Es macht mir viel mehr Spass hier zu essen als in dem teuren, steifen Restaurant im Resort mit den nicht sehr freundlichen Service-Angestellten. Die Flasche ist leer, wir zahlen. 30 $ kostet unser Essen, ich lege 35$ hin. Zwei Zehnernoten kleben ein wenig aneinander, Melvin sieht daher nur fünfundzwanzig und macht mich auf das „fehlende“ Geld aufmerksam. Wie er seinen Fehler bemerkt, ist es ihm echt peinlich, er entschuldigt sich und küsst mich auf die Schulter (bin ich nicht gewohnt, ha, ha, ist noch speziell…).
Übrigens sind alle Menschen hier äusserst liebenswürdig und freundlich. Man grüsst sich, winkt sich zu. Susan ist auf der ganzen Insel bekannt und ihr Auto auch. So denken wohl die meisten Leute, ich sei sie, wenn wir an ihnen vorbeifahren.
Wir treten den Heimweg an - zurück über die holprige Strasse, vorbei an pechschwarzen Velofahrern, die ohne Licht unterwegs sind.
Etwa um zehn Uhr beginnt es zu regnen, und nicht zu knapp. Wir schliessen rasch alle Fenster und stellen die Ventilatoren an. Ein kurzer Stromausfall. Ich versuche, mein Natel zu finden, merke aber, dass es fehlt. Die letzten Fotos hab ich bei Rose und Melvin gemacht. Ich muss es dort auf dem Tisch liegen gelassen haben. – Fang ich das jetzt auch noch an…
Ja, und dann beginnt es, in mein Schlafzimmer zu regnen. Auch im Nebenzimmer findet das Wasser seinen Weg durch die Decke. Ich stelle Kübel unter und lege Badetücher hin. Das Bett zeihe ich in die Mitte des Zimmers, den Stecker zur Lampe aus, denn es tropft heftig auf die Steckdose. So prasselt der Regen die halbe Nacht lang; erst gegen Morgen hört er auf.
6. Mai
… und geht dann doch gleich weiter mit voller Kraft den ganzen Morgen lang. Heute wird’s kaum Sonne geben. Warm ist es trotzdem.
Wie’s einen Moment lang aufhört zu regnen, fahren wir zu Rose’s Takeaway, um mein Natel zu suchen. Wie Melvin mich sieht, strahlt er und ruft: „Madam, I know why you’re here. I wanted to come and search you today.” – Ich bin natürlich sehr froh, dass ich das Gerät wieder habe. So dumm von mir, dass ich das einfach auf dem Tisch habe liegen lassen. – Wäre das Theo passiert…
Auf dem Rückweg machen wir Halt im „Bonafide Fishing Shop“, wo sich Theo Mütze Nummer zehn (mindestens) kauft und ein paar Hosen (mit meiner Kreditkarte – seine hat er praktischerweise daheim vergessen). Es ist ein teurer Laden, aber er hat ein ganz interessantes Sortiment.
Nächster Halt im „New Watering Hole“ zwecks Weineinkauf, und anschliessend trinken wir in der Strandbar einen Daiquiri. Diesmal vorsichtshalber nur einen für uns beide. Er hätte glatt für vier Personen gereicht, so gross ist er. Und Sue hat viel zu viel zubereitet. Den Rest aus dem Mixer giesst sie in ein grosses Glas, schüttet noch ein wenig mehr Rum dazu und stellt uns das auch noch hin. – Theo mag nicht mal mehr eine Suppe essen zu Hause, so gesättigt ist er.
Auch unser Auto mag nicht mehr. Es raucht zur Motorhaube raus, dass ich denke, nächstens explodiert es grad. – Das tut es dann glücklicherweise nicht. Nach ein paar Minuten schütten wir Wasser nach und hoffen, dass damit das Problem gelöst ist. Aber schmutzig ist der Jeep, verspritzt bis aufs Dach hinauf von den riesigen Wasserlachen, die sich in den zahllosen Schlaglöchern gebildet haben.
Ein Internetstündchen gibt’s, dann braucht Theo seine Siesta, ich schreibe und lese ein wenig und schon wieder wird es Abend. Die Tage vergehen rasch.
Mückenstiche und andere Brästen
Jetzt sind sie hier, die bösen Biester, vor denen uns Susan schon mehr als einmal vorgängig per Email gewarnt hat. Es sind die gefürchteten Sandflies, mit denen wir auch in andern Ländern schon einschlägige Erfahrungen gesammelt haben. Sie kommen nur, wenn’s keinen Wind hat und jetzt, nach dem Regentag ist es so weit. Es ist windstill. Die Plagegeister haben die nette Eigenschaft, dass sie problemlos auch durch die Mückengitter in die Häuser eindringen können, so klein sind sie. Man sieht sie kaum, man spürt sie im Moment auch fast gar nicht, aber später dann ist man übersäht mit Stichen. Zum Leidwesen der armen Opfer lieben sie es offensichtlich, gleich mehrere Saugstellen nebeneinander anzubringen. Frauen werden für diese Behandlung bevorzugt (ein Unterfangen von Frau zu Frau sozusagen). Deren Blutqualität ist wohl besser geeignet fürs Wachstum der Eier als die der Männer.
Vorgewarnt, wie ich war, hatte ich mich vorsorglich mit Antibrumm eingerieben und den Mückenstecker aktiviert; Theo machte die Fenster dicht (leider eben nicht alle gleich dicht) und liess die Ventilatoren laufen. Trotzdem blieb ich nicht verschont, ich habe mindestens hundert Stiche gefasst, überall, vom Scheitel bis zur Sohle. Theo hat dreissig Stiche an der einen Wade. Er hat sie gezählt. Wundersamerweise aber jucken sie ihn nicht.
Dafür geht es meinem Fuss etwas besser, seitdem ich ihn weniger anstrengen muss und mehr schonen kann. Am liebsten gehe ich im Sand, da merke ich gar nicht, dass etwas nicht gleich ist wie mit dem anderen Fuss.
Mein rechtes Auge hingegen weint noch immer ohne Grund. Die Augentropfen, die so mühsam zu beschaffen waren, haben kein bisschen geholfen und die homöopathischen Tropfen, die ich später in der Not in Sancti Spiritus erstanden habe (bei leerem Magen einmal täglich fünf Tropfen unter die Zunge), schon gar nicht. Ok, ok, ich würde ja gerne dran glauben, aber mein Auge hat da offenbar seine Zweifel.
Apropos Brästen: Da hatte ich grad etwas sehr Seltsames: Beide Oberarme taten mir während Tagen so weh, dass ich kaum was tragen oder aufheben konnte, nur unter grösster Pein eine Bluse anziehen oder die Arme nach hinten bewegen. Wie wenn sich ein Messer im Muskeln drehen würde, verspürte ich einen ständigen Schmerz, egal in welcher Lage. Woher der kam, habe ich keine Ahnung. Einzig möglich wäre, dass ich mal in der Nacht komisch drauf gelegen bin – zu müde, es zu merken (das Alter, das Alter…).
Seit gestern geht es mir besser; ich habe begonnen, Voltaren zu schlucken.
Und jetzt, oh Wunder, hat auch mein Auge die Tränerei endlich aufgegeben. Nach vier Wochen! - Ich bin schön froh, denn obwohl das wenigstens nicht schmerzte, war es enorm lästig. Ständig musste ich die Tränen abputzen. – Wieso grad jetzt die Besserung eingetreten ist? Ob das ganze Gift der Quälgeister genau das richtige Gegenmittel war? Seltsam, seltsam…
Dafür hab ich mir was Neues zugelegt: ein sogenannter Schnappfinger. – Ich kann’s so erklären: Mein Daumen an der rechten Hand bewegt sich digital.
Im Internet hab ich dann nachgeschaut, was es darüber zu berichten gibt:
Kommt häufig vor. Vor allem bei Frauen über sechzig. Es ist meist der Daumen…
7. Mai
Es regnet nicht mehr, aber das Wetter ist nicht besonders schön, auch heute nicht. Macht wirklich nichts. Wenn man so lange unterwegs ist, geniesst man das süsse Nichtstun und ein paar Regentage stören überhaupt nicht.
Ich lese im Führer und im Internet über Yucatan und versuche, die bevorstehende Reise ein wenig zu planen.
Am Nachmittag ist’s wieder sonnig. Theo mag nichts unternehmen, die Terrasse ist angesagt. Mir wird’s zu heiss, ich schlage vor, ins Resort zu dislozieren, dort ein wenig an den Strand zu liegen und eventuell im Meer zu schwimmen. Etwas trinken wär auch nicht schlecht. Ok. Nichts dagegen. Wir brechen auf; im Auto ist die Hitze fast unerträglich, aber am Strand weht ein Wind, der mir mit der Zeit fast zu kühl wird. Theo liegt auf einer Hängematte, auf dem Bauch das i-Phone, das seine Musik trällert, er am Schlafen – seine Welt ist in Ordnung.
Jetzt ist’s aber Zeit für einen Drink, bevor die Bar wieder schliesst. Wir bestellen dazu einen Snack (Mahi-Mahi-Wrap) und zahlen für unsere Konsumation schliesslich fast 50 $. Zumindest ist in meinem Drink (Buccaneer diesmal) so viel Alkohol drin, dass ich Theo fast doppelt sehe (ui ui ui!!!).
Ich koche dann nichts mehr an diesem Tag. Der Kühlschrank ist voll und Theo kann sich zur Not ja selber verpflegen; er hat genügend Büchsen gekauft für diese Eventualität.
Die Schotten sind dicht, der Ventilator läuft, der Mückenstecker ist moniert – ich lege mich Schlafen.
Mitten in der Nacht allerdings wache ich auf, ein verräterisches Sausen hat mich geweckt – eine Mücke ist am Werk! Sonst ist es extrem ruhig, heiss ist es auch. – Kein Wunder – der Ventilator läuft nicht mehr, der Mückenstecker auch nicht – Stromausfall.
8. Mai
Meine Haut fühlt sich stellenweise an, wie eine Bircherraffel; die Mücken haben ganze Arbeit geleistet. Äs bisst wi gschtört!
Es gibt einen gemütlichen Tag. Wir fahren rüber zu Rolfs Haus und begrüssen Susan, die inzwischen heimgekommen ist. – Am Abend sind wir zum Essen eingeladen.
Den Nachmittag verbringen wir am Strand in Cape Santa Maria, wo wir bereits einmal waren. Es gefällt uns dort ausserordentlich gut. Es hat keine Leute und das Meer ist wunderbar zum Baden. Das Türkis des Wassers mutet fast kitschig an, man sieht bis auf den Grund, der Sand ist weiss und fein wie Mehl. Palmen hat es keine, dafür Fichten, die willkommenen Schatten spenden, ohne dass man Angst haben muss, von einer Kokosnuss getroffen zu werden.
Um halb sechs Uhr pünktlich, wie sich das für uns Schweizer schliesslich gehört, stehen wir bei Susan und Rolf „auf der Matte“. Erst gibt’s Apéro (selbstgemachte Savoury Cheese Dollars {das Rezept hab ich!} und eine Flasche Weisswein) anschliessend werden wir exquisit bewirtet mit Sparerips, Kartoffelsalat uns feinem homemade Brot. – Es ist ein einmaliger Abend. Zum Dessert gibt’s einerseits Papayasorbet (von den Früchten aus Nachbars Garten) mit gerösteten Kokosraspeln und andererseits einen Sonnenuntergang vom Feinsten. Das Spezielle: Auf der anderen Seite der Terrasse, über dem Atlantik, steht jetzt der Vollmond in seiner ganzen Pracht.
9. Mai – „Down North“
Wir machen eine Wäsche. Wegen Stromausfalls während des Waschvorgangs dauert es etwas länger, bis alles erledigt ist. Egal, wenn wir nach dem Ausflug heimkommen, wird alles trocken sein. Auf Sonne und Wind ist Verlass.
Susan und Rolf holen uns ab und wir fahren nordwärts bis die Strasse aufhört. Dort hat’s eine Brücke, die durch einen Hurrikan zerstört worden ist. Zu Fuss überqueren wir sie und nach einem Spaziergang durch den Busch erreichen wir einmal mehr eine grosse Bucht mit einem langen Sandstrand. Diesem gehen wir entlang, durchqueren die Lagune durchs knietiefe Wasser bis wir zu einer Insel kommen, wo wir unsere Siebensachen deponieren. Einmal mehr ist die Aussicht atemberaubend. Rolf zieht Taucherbrille und Flossen an und macht sich auf die „Jagd“ nach Conchs. Wir anderen lassen uns ein wenig im seichten Wasser treiben, spazieren dem Ufer entlang und geniessen den wunderschönen Ort.
Nach einer Stunde etwa kommt Rolf zurück. Im Schleppnetz hat er fünf Conchs, drei davon riesengross und je etwa zwei Kilo schwer. – Der Fall ist klar: Zum Nachtessen gibt’s Schneckensalat. Wir sind auch heute Abend wieder dazu eingeladen. Auf dem Heimweg halten wir bei einem Freund von Rolf an, der die Tiere dann präpariert, also schlachtet, wenn man dem so sagen kann. Ich habe etliche Mühe mit der Idee, dass denen ihr letztes Stündchen nun geschlagen hat, aber so geht das halt. Solange ich nicht zuschauen muss, wie das Prozedere vor sich geht… In einer Broschüre über diese Queens Conchs habe ich gelesen, dass sie sechsmal pro Saison zwischen 250‘000 bis 750‘000 Eier legen. Wenn da also die eine oder andere ermordet wird, hat’s noch immer ein paar übrig. Trotzdem…
Inzwischen habe ich die ganze Broschüre gelesen. Unglaubliche Tiere sind diese Mollusken – faszinierend! Und sie sind tatsächlich gefährdet, weil von den vielen Eiern, die gelegt werden, nur ein kleiner Teil überlebt und viel zu viele von ihnen „geerntet“ werden. Nur die erwachsenen darf man konsumieren, was aber ganz offensichtlich nicht von allen respektiert wird. Immer wieder entdeckt man am Strand oder im Gebüsch ganze Haufen von aufgeschlagenen, viel zu kleinen Muschel-Schalen.
Nun, der Salat, den Susan zubereitet, ist köstlich. Sie serviert dazu Zopf, selber gemachten natürlich. Wer hätte das gedacht, eine Schweizer Züpfe auf den Bahamas – gebacken von einer Amerikanerin! Nur eine Schnecke brauchte es für den Salat, und es war mehr als genug; die andern wurden tiefgefroren.
Übrigens sieht man auf Schritt und Tritt die leeren Schalen als Dekoration bei Hauseingängen, in Gärten, im Haus, als Türstopper. Die Vielfalt an Farben, Formen und Strukturen ist grandios.
10. Mai 2017
Es gibt nicht viel Neues zu erzählen heute. Wir probieren mal einen anderen Strand aus, nur etwa fünf Minuten zu Fuss von unserem Haus entfernt. Diesmal auf der Atlantikseite. Das Meer ist hier ganz anders, ein wenig stürmisch und viel dunkler in den Blautönen. Baden können wir nicht gut, denn es hat Felsen, die einem gefährlich werden könnten. Es hat keinen Schatten, so bleiben wir nur etwa zwei Stunden und dislozieren dann ins Resort, wo wir uns eine feine Piña Colada genehmigen und am Strand liegen bleiben bis fast um halb sieben.
Inzwischen war Eddy wieder im Einsatz. Wir haben nun sogar warmes Wasser und der Kühlschrank läuft auch.
Allerdings stellen wir erst später fest, dass man das Wasser nicht mischen kann. Der Hahn ist locker und lässt sich nicht arretieren. So duschen wir jetzt heiss, was bei der Hitze draussen und auch im Haus nur wenig Freude macht.
11. Mai 17 – „Up South“
Heute wird die Südinsel erkundet. Es geht also „up south“, wie das hier heisst. Die seltsame Ausdrucksweise kommt von den Schiffen, die gegen den Wind fuhren, wenn sie nach Süden wollten. Und dementsprechend heisst es „down north“, aber da waren wir ja schon.
Um neun Uhr holen uns Susan und Rolf ab. Es ist eine unterhaltsame Fahrt mit Zwischenhalten verschiedenster Art. Erst geht’s nach Simms, wo die Post abgeholt werden muss. – Heute ist niemand im Gefängnis, nur Theo sitzt davor.
Das Auto macht Zicken: Aus dem Motor dringt Rauch und sämtliche Anzeigen tun keinen Wank. – Das ist kein guter Anfang für die Reise. Rolf sieht, dass der Deckel des Wassertanks nicht mehr dort ist, wo er sein sollte. Theo findet ihn zum Glück und Wasser wird nachgefüllt. Es kann weitergehen. Nächster Halt in Deadman’s Cay nahe der Tankstelle, wo das Postboot grad ankommt. Da man nicht feststellen kann, wie viel Benzin noch im Tank ist, scheint es besser, sicher mal vollzutanken. Die Insel ist ja 130 km lang, also reicht das auf alle Fälle.
Bei der Bank werden Dollars getankt und ein paar Kilometer weiter gibt’s einen Halt beim Schiffsbauer. Ein Boot für die nächste Regatta ist am Entstehen.
Bei „Max’s Grill and Bar“ halten wir ebenfalls an, weil Theo dort ja seinen Badesack hat liegen lassen. Er ist glücklich, ihn wiederzuhaben.
Susan trifft überall Freunde. David Dean begrüsst uns. Er ist ziemlich dunkelhäutig und hat hell-türkisblaue Augen, wie die Farbe des Meeres. Das sieht seltsam aus, ist aber nicht selten bei einigen der Einheimischen hier.
Wir fahren wieder und wieder an Kirchen vorbei. Es hat mindestens etwa fünfzig davon auf der Insel; sie sind alle entlang der Hauptstrasse gebaut oder zumindest von dort aus zu sehen. Zum Teil hätten sie weniger als zehn Anhänger, erzählt Rolf, aber eine Kirche muss trotzdem sein. So würden sich die Kirchen und die Bars regelmässig darum streiten, wovon es mehr gibt. - Ein amüsantes Detail auch dieses: In einem Prospekt haben wir gelesen, was man auf der Insel alles unternehmen kann. Natürlich ein Tauchversuch im Blue Hole. Aber nebst etlichen Angeboten, welche die Fischerei betreffen, wird beispielsweise auch „Church-Hopping“ offeriert…
Im Oktober 2015 gab es einen gigantischen Hurrikan, der enorme Schäden angerichtet hat, vor allem im Süden. Noch immer sieht man zertrümmerte Häuser, Bäume, die kein Laub mehr tragen und etliche Autofriedhöfe, wo all die Autos lagern, die damals kaputt gingen. Auch an Salinen kommen wir vorbei, ähnlich wie diejenigen in der Bretagne; die wurden aber ebenfalls vom Hurrikan zerstört.
Ab Clarence Town geht’s dann nochmals etwa 30 km weiter bis Gordon’s Settlement, vorbei an der letzten Bar, bis die Strasse am Ende der Insel plötzlich aufhört. Dass dort ein Stopp-Zeichen steht, ist fast ein Witz.
Ein langer Strand mit weissem Sand erstreckt sich bis zum wirklichen Ende von Long Island. Immer wieder mal liegen Kleiderfetzen im Sand oder im angrenzenden Gestrüpp. Dahinter verbirgt sich eine traurige Geschichte. Susan erzählt, diese würden von Haitianern stammen, die in Booten ihr Land verlassen, um auf den Bahamas Zuflucht zu finden. - Nicht alle schaffen die Überfahrt.
Etwa drei Kilometer lang wandern wir bis zu einer Stelle, wo zwei Schiffe gekentert sind. Das eine muss schon seit Jahrzehnten dort liegen, nur noch ein Gerippe und ein Teil des Motors ragen aus dem Sand, das andere, ein privates Segelschiff, wohl kaum länger als ein paar Monate. Beide müssen auf Sand aufgelaufen sein, das Meer ist sehr seicht an dieser Stelle.
Wir sammeln Muscheln, Schmetterlingsmuscheln hat’s vor allem, und irgendwo unterwegs ist auch ein rostiger Kubus im Wasser, der uns sehr an denjenigen von Jean Nouvel erinnert, damals bei der Expo in Murten.
Eine der südlichsten Siedlungen heisst „Roses“ (wie der Ort in Spanien, wo wir seit über dreissig Jahren unsere Herbstferien verbringen). Da muss ich natürlich ein Foto vom Dorfschild machen. Beim Hinweg hatte es keines, es muss vom Sturm weggerissen worden sein, aber auf dem Heimweg „down north“ finden wir es und halten davor an, um es zu fotografieren. Auf dem Schild sonnt sich eine Schlange! Das ist natürlich doppelt fotogen!
In Clarence Town kehren wir ein bei „Rowdy Boy‘s Bar and Grill“, trinken etwas und teilen uns Conch-Fritters, eine weitere Schnecken-Spezialität. Sie sehen aus wie Hack-Bällchen und sind köstlich.
Über der Theke in der Bar läuft ein Fernseher. Tennismatches werden gezeigt. Nadal und Thiem gewinnen in Madrid, Murrey kriegt aufs Dach.
Weiter geht die Reise nordwärts. Einkaufen steht als nächstes auf dem Programm. Wir brauchen fast nichts mehr, aber Susan schlägt zu; ich glaube, sie deckt sich gleich für die nächsten zwei Wochen ein.
Zeit fürs Nachtessen bei Tiny’s. Dies ist ein hübsches kleines Restaurant direkt am Meer, ein offenes Holzhaus auf Stelzen. Das Essen ist sehr fein, die Drinks ebenso, die Atmosphäre einzigartig: Füsse im Sand, Palmen spenden Schatten, Hängematten sind auch vorhanden. Wir sind die einzigen Gäste und erhalten so die ungeteilte Aufmerksamkeit von Michelle, der Besitzerin.
Es ist schon dunkel auf der Heimfahrt, die etwa eine halbe Stunde dauert, aber wenigstens hat’s so gut wie keinen Verkehr. Drei Autos begegnen uns.
12. Mai
Theo möchte heute die Sonne ein wenig meiden, sagt er. Also bleiben wir in der Nähe. Beim Stella Maris Resort hat’s Liegestühle am Strand und Schatten. Da gehen wir hin.
Am Abend sind wir schon wieder zum Nachtessen eingeladen von Susan und Rolf. Wunderbar, da brauch ich nicht zu kochen beziehungsweise Theo braucht keine Büchse zu öffnen. – Freunde von ihnen sind grad angekommen am Nachmittag und die werden ebenfalls dabei sein. Randy und Liza sind oft mit Susan und Rolf auf Reisen, und so waren sie auch schon mal zusammen in Bivio.
Liza fühlt sich aber nicht gut, so kommt nur Randy. Das Nachtessen ist absolute Spitze. Es gibt Sirloin-Steak vom Feinsten, perfekt auf dem Grill zubereitet von Susan. Dazu hat sie einen Teigwarensalat gemacht mit Rucola und zum Dessert homemade Brownies.
Das Essen findet statt im Garten-Pavillon neben ihrem Haus mit Aussicht aufs Meer - der perfekte Ort fürs Zusammensein mit Gästen.
Wie könnte es anders sein: Das Hauptthema des Abends ist Präsident Trump.
Seit wir wieder Internet haben, kann Theo jeden Tag von dessen neuesten Eskapaden lesen und sich daran freuen und/oder darüber ärgern.
Noch eine Bemerkung zum Rucola: Im Garten von Susan und Rolfs Haus wächst kaum etwas „Vernünftiges“, der Boden ist steinig und hart. Weder Blumen noch Fruchtbäume mögen das. Im einzigen Beet hat Susan ein wenig Basilikum angepflanzt und jemand hat mal eine Handvoll Rucola-Samen mitgebracht. – Denen gefällt’s erfreulicherweise besonders gut. Sie haben sich über dem Rasen ausgebreitet, er besteht fast nur noch aus Salat.
13. Mai 2017
Diese Nacht träume ich von Schnecken, Reisekoffern und meiner Handtasche, die ich nicht mehr finde. – Gut ist endlich Morgen!
Rolf kommt vorbei. Nun ist sein Auto völlig kollabiert. Es steht nicht weit von unserem Haus entfernt am Strassenrand und ist unter keinen Umständen mehr bereit, sich von der Stelle zu rühren. Das automatische Getriebe ist blockiert und das Auto muss aufgeladen und abtransportiert werden. – Was weiter geschieht, wissen wir noch nicht. Eigentlich wollten wir zusammen an einen weiteren Strand fahren, den wir noch nicht kennen, so aber fahren Theo und ich wieder ans Cape Santa Maria, wo’s uns so gut gefällt. Es ist so heiss, dass man sich immer wieder abkühlen muss im klaren Wasser. Theo hat seine „Bewegungstherapie“ in letzter Zeit ein wenig vernachlässigt, nun macht er sogar einen fast einstündigen Strandspaziergang.
Gegen halb sechs kehren wir im Santa Maria Resort ein und bestellen zwei Drinks, dazu gibt es gratis Conch-Fritters.
Zu Hause essen wir nur noch einen Salat; auf Wein verzichten wir für einmal, wir hatten gestern mehr als genug. – Aber auf den Sonnenuntergang, auf den verzichten wir nicht.
14. Mai
Zweitletzter Tag, letzte Wäsche, ein neuer Strand.
Wir fahren eine gute halbe Stunde lang up south, wo’s bei Simms einmal mehr einen gut versteckten menschenleeren Strand hat, O‘Neill’s Beach, an der Atlantik-Seite diesmal. Die letzten acht Kilometer sind mühsam, der Holper-Pfad geht über Stock und Stein durch den Busch. Mir tun die beiden Jeeps leid; es ist eine Strapaze. Rolfs Auto ist ja im Moment ausser Kurs, Randy und Liza, der es jetzt zum Glück wieder besser geht, nehmen Susan und Rolf mit, Theo und ich fahren in unserem kleinen schwarzen Jeep hinterher. Unterwegs gibt’s einen kurzen Zwischenhalt. Rolf will wieder mal was ernten gehen (diesmal nicht in Nachbars Garten), und zwar die süssesten Früchte, die es gibt, „Dillies“ (Sapodilla) heissen sie. Er weiss genau, wo es mitten im Busch einen solchen Baum hat. Er hat einen langen Stab mitgebracht, um sie in der Baumkrone zu erreichen. – Allerdings fällt die Ernte mager aus. Es habe zwar mindestens hundert Früchte dort, berichtet er, aber kaum eine davon sei reif. – Er wird in einem Monat oder so nochmals einen Versuch starten müssen.
Wir erreichen anschliessend den Strand. Es ist der erste hier, an dem es viele Abfälle hat. Sehr schade! Die sind allerdings nicht von den Strandbesuchern, sondern angespült vom Meer. Überall liegen kaputte Plastikbehälter herum, Flaschen, Teile von Schiffen. Mit den angeschwemmten Schuhen könnte man fast einen Laden aufmachen – jedenfalls für Einbeinige.
Rolf ist sofort wieder mit der Schnorchel-Ausrüstung unterwegs. Er findet ein Meer-Güezi (see biscuit), ein Getier, das sehr dem Sanddollar ähnelt, aber viel grösser ist. Theo „vergnügt“ sich mit einer Conch, die Liza gefunden hat. Die Schnecke lässt sich teilweise aus ihrer Schale heraus, aber das mit dem „Schau mir in die Augen, Kleines“ funktioniert nicht. Sie will ihre Augenfühler einfach nicht ausfahren. Er legt sie zurück ins Wasser.
Auf solche Exkursionen kommt auch immer eine Kühlbox mit. Bier gibt’s, Wasser, Heidelbeeren und Peperoni. Eine relativ seltsame Auswahl an Picknick-Drinks und –Snacks finde ich, aber jedem das Seine.
Zum Schwimmen ist es ausgezeichnet, man könnte sich stundenlang im warmen Wasser treiben lassen. Nach etwa drei Stunden fahren wir zurück.
Unsere Wäsche ist trocken, aber ich muss mich beeilen mit Einsammeln; die Mücken sind schon in den Startlöchern.
Leider ist das Restaurant, in das wir heute Abend gerne gehen würden, zu. So gibt’s halt Salat (mit Rucola) und Spaghetti daheim.
15. Mai 17 – Der letzte Tag
Es regnet – grad gäbig zum Kofferpacken. So verpasst man wenigstens nichts.
Wir müssen noch unsere Rechnung zahlen im Resort, den Jeep wieder volltanken, den Kühlschrank ausräumen und den Abfall entsorgen.
Gegen Mittag haben wir unser obligates Internetstündchen (Hotels buchen in Yucatan, Rechnungen zahlen). Es hat aufgehört zu regnen und wir beschliessen, noch rasch einen kleinen Ausflug zu machen in die „Adderly Plantation Ruin“. Ruinen haben mich schon immer fasziniert und eigentlich hätten wir die Plantage schon längst besuchen können, denn sie ist sehr nah von hier und wir sind x-mal an der Abzweigung vorbeigefahren. – Im Grunde genommen ist es ja eine Schnapsidee, bei diesem feuchten Wetter dorthin zu pilgern, aber jetzt muss es sein. Die Mücken werden einen „field day“ haben.
Zur Vorbeugung ziehe ich lange Hosen an und eine Bluse mit langen Ärmeln. Doppelt einreiben und einsprühen mit Anti Brumm ist ebenso eine Vorsichtsmassnahme, bis ich mich selber fast nicht mehr riechen kann, und los geht die Expedition.
Wir begleichen erst unsere Rechnung im Stella Maris Resort, fahren dann der Hauptstrasse entlang bis zur Abzweigung mit dem Schild zu den Ruinen. Von dort aus führt ein etwa zwei Kilometer langer Weg bis zu einem Strand, wo es nicht mehr weitergeht. Die Strecke dorthin durch den Busch ist die absolute Katastrophe, der kleine Jeep quält sich über Stock und Stein, durch die Löcher und Wasserlachen – es ist wie auf einem wild gewordenen Karussell. Und zudem regnet es wieder. In Strömen! – Das haben wir wirklich gut gemacht: Während mindestens vier Stunden hat’s nicht geregnet und jetzt, wo’s wieder anfängt…
Die Mücken sind auch schon einsatzbereit; sie riechen den Braten sofort. Erst schicken sie ein Begrüssungs-Komitee, dann eine ganze Kohorte hinterher. – Jetzt aufgeben, wo wir schon da sind? Der Gedanke wird verworfen, wir „stürzen“ uns ins Abenteuer. Wegweiser hat es keine. Dem Strand entlang links oder rechts? Wir entscheiden uns für rechts. Das ist richtig. Nach etwa zweihundert Metern führt ein Pfad ins Gestrüpp, gekennzeichnet mit Muscheln. – Inzwischen sind wir beide triefend nass, Theo trägt zumindest seine Regenjacke, ich habe meine im Koffer in Nassau gelassen. Meine weisse Bluse klebt an mir wie eine zweite Haut; sie ist jetzt ganz durchsichtig. Ein Schild steht da – endlich – so wissen wir zumindest, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Nach etwa einem halben Kilometer kommt eine Treppe in Sicht und dann die Ruinen. Da ist nicht mehr viel vorhanden: Stützmauer-Überreste von zwei Häusern, ein Kamin und ein paar zerbröckelte Treppenstufen. Der grösste Teil des Grundstücks ist völlig überwachsen. Wenigstens hat’s eine Tafel, auf der die Geschichte der Plantage beschrieben ist. Im Jahr 1790 wurde sie errichtet, man baute Baumwolle an, später Sisal, und lebte auch von der Viehzucht. Eine tragische Familiengeschichte, Erbschaftsstreitigkeiten und Besitzerwechsel führten zum Niedergang und schliesslich erledigte 1927 ein Hurrikan die Angelegenheit noch vollständig. Vor etwa neunzig Jahren also wurde das Gut verlassen und seither dem Zerfall preisgegeben. – Mich erstaunt, dass in so relativ kurzer Zeit kaum mehr etwas davon zu sehen ist.
Wir gehen alle zusammen (Theo und ich und eine Armada von Blutsaugerinnen, die uns ständig auf den Fersen sind und uns umschwirren) den Weg zurück zum Strand und zum Auto. Froh, heil auf der Hauptstrasse angekommen zu sein (ein geplatzter Reifen hätte noch gefehlt!), biegen wir nach links ab und fahren nach Burnt Ground, wo’s eine Tankstelle hat. Einige unserer Begleiterinnen haben es mit uns bis ins Auto und zur Tankstelle geschafft und versuchen weiterhin, uns zu peinigen. Theo ist ziemlich erfolgreich und erlegt ein paar von ihnen mit viel Geschick. Trotzdem hat’s Nachschub gegeben – mindestens zehn Stiche mehr, aber das ist eigentlich recht bescheiden.
Es hat noch nicht aufgehört zu regnen und unterwegs spritzen ganze Wasserfontänen übers Auto. Ich hoffe, dass es dadurch gerade ein wenig gewaschen wird, denn es ist über und über voller Sand und Dreck. – Der Tank ist wieder voll und wir beratschlagen, was wir machen wollen heute Abend. Wir haben vorgehabt, auswärts essen zu gehen in einem einheimischen Restaurant, wo man draussen sitzen kann/muss. – Das kommt natürlich nicht in Frage wegen des Regens und der Mücken.
Wir beschliessen, im Laden nochmals ein Steak zu kaufen und halt wieder daheim zu essen. Eine Flasche Wein, Kartoffeln und ein wenig Salat hab ich noch. – Steaks hat’s erst wieder, wenn das nächste Schiff kommt. Aber es hat Schweinekoteletts. In einem Packet sind sechs Stück, einzeln kann man sie nicht kaufen. Sie kosten alle zusammen 6 $. – Diesen lächerlichen Preis für so viel Fleisch finde ich gar nicht gut, aber die drei, die wir essen, sind wenigstens schmackhaft.
16. Mai
Um vier in der Nacht wache ich auf. Die Mikrowelle im oberen Stock hat sich selbständig gemacht und piepst die ganze Zeit. - So nervig! Theo stellt sie ab und ich versuche anschliessend wieder einzuschlafen. Das funktioniert so aber nicht, denn jetzt ist’s ein anderes Geräusch, das mich wach hält, ein bekanntes... Zwei Mücken erwische und erschlage ich, und immer wenn ich denke, es sei jetzt erledigt, taucht eine neue auf. – Und es regnet wieder. Hoffentlich dann nicht beim Abflug!
Irgendwann wird’s doch Morgen, wir stehen auf, essen kurz etwas zum Frühstück und machen uns parat zum Gehen. Der Regen hat aufgehört, das Gepäck ist im Auto, es ist Viertel vor neun, wir fahren rüber zu Rolf und Susan, bedanken und verabschieden uns. Rolf fährt mit zum Flughafen, um neun sind wir dort, eine Viertelstunde später werden wir starten.
Der Schwarze, der sich unserer Koffer annimmt, stellt sich vor. Er heisst Greg und ist auch gleich der Pilot. Ich darf vorne neben ihm im Cockpit sitzen. Das macht Spass! Greg hat offenbar nicht viel zu tun. Er schreibt die ganze Zeit – etwa eine Reisebericht?
Wir fliegen genau über den Norden der Insel und die Orte, wo wir waren, sind jetzt aus einem anderen Winkel sichtbar. Ich geniesse den Flug durch die Wolken und den spektakulären Blick aufs Meer und die vielen Inseln.
Eine Stunde später sind wir in Nassau; wir erhalten unseren dort deponierten Koffer, nehmen ein Taxi zum International Airport und können ohne Schlange zu stehen grad einchecken für den Flug um drei.
Die Zeit bis dahin möchten wir nicht auf dem Flughafen verbringen, so verhandeln wir mit einem Taxifahrer, dass er uns Nassau zeigt, eine kurze Sightseeing-Tour also, und uns zu einem Restaurant führt, wo wir etwas essen können. Drei Stunden haben wir Zeit dafür. Erst will er 70 $ pro Stunde, dann aber einigen wir uns auf 110 $ für drei Stunden. Er fährt uns durch die prächtigen Villenviertel der Reichen, am Golfplatz und den grossen Hotels vorbei, Downtown und an den Hafen, wo die riesigen Kreuzfahrtschiffe ankern und es ebenso viele Touristen hat wie Luxus- und Souvenirläden. Weiter geht die Fahrt dem Strand entlang, vorbei am Bob Marley-Hotel, am Haus von Sean Connery und vom Ufer aus ist die Privat-Insel von Michael Jordan, Paradise Island, zu erkennen. Als Nächstes geht’s weiter zum Fort Charlotte und zu „The Queen’s Staircase“, einer steilen Treppe mit 66 Stufen, die von Sklaven am Ende des 18. Jahrhunderts in mühsamster Arbeit in den Stein gehauen wurde. Schliesslich landen wir in einem lustigen kleinen Restaurant, wo wir etwas zu Mittag essen. Unser Fahrer sagt, er würde im Auto warten, aber das lassen wir natürlich nicht zu und laden ihn ein. Er erzählt, er habe vier Söhne, der jüngste noch ein Baby, und achtzehn Geschwister, alle vom selben Vater, aber von fünf Müttern. Und er kann das noch toppen: Einer seiner Kollegen, auch ein Taxifahrer, habe 53 Kinder! – Zustände sind das!
Er bringt uns zurück zum Flughafen. Wir sind gut drin mit der Zeit, die Koffer sind wir ja schon los. Dann geht’s zur Sicherheitskontrolle. Theo, Theo, Theo! Es ist zum Verzweifeln mit ihm. Jedes Mal, aber auch wirklich jedes Mal irgendein „Gestürm“. Sein Handkoffer wird gescannt, gleich zwei Beamte sehen sich den geröntgten Inhalt an, ein weiterer wird dazu geholt. Eine Dame durchsucht seine Habe und da kommt wieder mal ein Messer zum Vorschein. Ich glaub’s ja nicht! Gestern noch hab ich ihm gesagt, er solle alle seine Fläschchen und Messer und die andern terrorismusverdächtigen Utensilien in den grossen Koffer packen… Das geht offenbar einfach nicht. Wie mich das nervt!
Wie wir endlich durch sind, (sein Messer hat er einem Beamten geschenkt) wurde unser Flug schon zweimal aufgerufen. Theo ist immer noch bei den Spirituosen und hört nicht auf die Lautsprecher. – Last call! Ich hole ihn und wir eilen zum Gate. Wir sind die letzten Passagiere. – Ab geht’s.
Eine Stunde später landen wir in Miami. Da das Immigrationsprozedere bereits in Nassau stattgefunden hat, geht hier alles sehr einfach vor sich, kein Zoll, keine Kontrolle; es ist wie ein Inlandflug. Im Flughafen selbst hat es ein Hotel, in dem ich für eine Nacht ein Zimmer gebucht habe. Das ist äusserst praktisch, morgen können wir quasi vom Bett zum Check-in.
Zum Nachtessen treffen wir uns mit Liza und Urs Lindenmann im „Monty’s“ an der Marina, und zum Dessert fahren wir nach Key Biscane in den „Rusty Pelican“, von wo aus man einen grossartigen Blick auf die nächtliche Skyline von Miami hat. Anschliessend fahren sie uns zurück ins Hotel.
Es war sehr schön, die beiden wieder mal zu sehen und einen gemütlichen und lustigen Abend zusammen zu verbringen.

Reisebericht Mexico - Playa del Carmen - 17. – 31. Mai 2017
Wir haben sehr gut geschlafen. Mal keine Mücken - was für paradiesische Zustände!
Gemächlich stehen wir auf und fahren mit dem Lift hinunter in die Lobby. Von dort aus sind es keine hundert Meter zum Check-in. So ober-gäbig! Es steht auch niemand an; im Nu ist alles erledigt.
Dann die Sicherheitskontrolle: Diesmal können wir ja keine Probleme mit dem Handgepäck haben, denn Theo ist sein Messer inzwischen los und er hat auch sonst nichts mehr, womit er die Beamten beschäftigen könnte. – Viele Leute stehen an, aber es geht so rasch, wie ich das noch gar nie erlebt habe. Man kann schon fast von „Windeseile“ sprechen, wie das vor sich geht. Niemand muss seine Schuhe ausziehen, auch den Gurt darf man lassen, wo er ist, die elektronischen Geräte braucht man nicht separat auszupacken und aufs Band zu legen – kein Wunder geht es so schnell. So haben sie auch keine Plastik-Becken, in die man seine Habe einzeln hineinlegen muss. Die einzigen Behälter, die’s hat, sind bestimmt für kleinere Handtaschen. Sie sind schwarz, rund und sehen aus wie Fressnäpfe für mittelgrosse Hunde. Auch das hab ich noch nie gesehen auf einem Flugplatz. Und das in den USA – kaum zu glauben. Sonst sind die da so pingelig und kompliziert…
Der Flug dauert knapp zwei Stunden und kommt fast eine halbe Stunde früher an als vorgesehen.
Der dritte Teil unserer Reise beginnt. Wieder eine andere Welt – so ziemlich das Gegenteil von dem, was wir bisher erlebt haben und noch ein wenig heisser; es sind schwüle dreiunddreissig Grad.
Leider habe ich während dieses Teils der Reise keinen Bericht geschrieben. Es lief ziemlich viel, und ich hatte keine Zeit oder wollte mir keine Zeit nehmen zum Schreiben. – Das ärgert mich nun ein bisschen, weil ich soeben feststelle, dass ich einiges bereits vergessen habe, an das ich mich gerne erinnern würde. Anhand des Fotoalbums, das ich gemacht habe, muss ich nun wieder all die Namen nachschauen.
So skizziere ich nur kurz, wo wir waren und was wir gesehen haben.
Unser HomeExchange fand in Playa de Carmen statt in einem modernen, grossen Apartment im obersten Stock eines Wohnblocks in einem grossen luxuriösen Hotelkomplex, direkt am Meer gelegen, genannt „The Azul Fives Beach Resort Hotel & Residences“ („Where your new life begins“, wie’s im Prospekt beschrieben wird. Was auch immer damit gemeint sein mag).
Wir verbrachten dort ein paar gemütliche Tage im Liegestuhl am Strand, liessen uns in den verschiedenen exquisiten Restaurants im Resort verwöhnen und genossen das Dolce far niente. – Allerdings wollten wir nicht die ganze Zeit nur mit Nichtstun „vergeuden“. Bereits zu Hause schon hatte ich eine einwöchige Reise durch Yucatán geplant.
Erste Übernachtung war in einem Hotel ganz in der Nähe von Chichén Itzá. Die weltberühmte Ruinenstätte der Maya-Kultur zu besuchen, war ein „Muss“. Weil wir gleich dort wohnten, hatten wir den Vorteil lange vor all den Touristenbussen in der Anlage zu sein und die eindrucksvollen Bauten in Ruhe bestaunen zu können. Zusätzlich war’s interessant den Händlern zuzusehen, wie sie ihre unzähligen Souvenirstände für den kommenden Ansturm ins Gelände schleppten und aufbauten.
Am Abend wohnten wir der Ton- und Lichtshow bei, welche die ausgeklügelte Geometrie der Anlage eindrücklich und sehr farbig in Szene setzt.
Grad gegenüber von unserem Hotel befand sich der Cenote Ik Kil. Dieses „Wasserloch“, wenn man so will, hat mich fast noch mehr fasziniert.
Laut Wikipedia sind die Cenotes („heilige Quelle“ in der Sprache der Maya) tiefe Höhlen. Sie entstehen in Karstgebieten. Durch die Auflösung des Kalkgesteins bilden sich Höhlen und unterirdische Wasserläufe. Brechen die Decken dieser Höhlen ein, so entstehen Tagöffnungen, die in der Fachsprache Dolinen genannt werden und bis zum Grundwasser reichen können. Die Maya betrachteten sie als Eingänge zur Unterwelt und nutzten sie häufig als religiöse Opferstätten. Die gewaltigen Höhlen galten als Sitz von Göttern der Unterwelt. Insgesamt wird die Zahl der Cenotes auf über 10.000 geschätzt. Sie besitzen im Durchschnitt eine Tiefe von etwa 15 Metern, vereinzelt auch von über 100 Metern.
Auf unserer Reise haben wir einige davon besucht, sind in ihnen baden gegangen. Die grösseren sind viel besucht, wie eben diejenige von Ik Kil. Das kreisrunde Loch im Boden ist fast 20 Meter tief, unter dem Wasserspiegel geht es noch einmal 46 Meter in die Tiefe. Jeden Tag planschen hunderte Menschen unter der atemberaubenden Kulisse des natürlichen Pools im etwa 22 Grad warmen Wasser. Sogar ein Sprungturm ist eingerichtet für die Wagemutigen. In den mit Hängepflanzen bewachsenen Höhlenwänden nisten farbige Vögel.
In den kleineren hat’s dann kaum Touristen, sie sind abgelegen, weit weg vom üblichen Trampelpfad und sind oft recht abenteuerlich und gruselig zu begehen.
Den Abstecher zu den drei Cenotes de Chunkanan, Chelentun, Tzapakal und Santa Cruz jedenfalls bleibt unvergesslich. Erst fanden wir den abgelegenen Ort fast nicht, dann fuhr ich einen Nagel ein im Pneu, wobei ich den Verdacht nicht ganz loswurde, dass es sich hierbei nicht um einen echten Zufall handelte. Sofort waren drei junge Männer zur Stelle, die halfen, das Reserverad zu montieren. Natürlich erhielten sie ein gutes Trinkgeld und ein paar Pullover, die ich so oder so hatte verschenken wollen. Es war 40 Grad am Schatten und urplötzlich begann es wie aus Kübeln zu regnen. Trotzdem wollten wir uns die Cenotes ansehen. Für die Tour dorthin wurden einfachste Pferdekutschen, eher Schlitten zwar, angeboten, die auf engspurigen Geleisen fuhren und von einem mageren Pferd gezogen wurden. Dies war die einzige Art und Weise, wie man zu den Höhlen gelangen konnte. Theo zog seine Regenjacke an, ich nur den Badeanzug, nass waren wir ja so oder so schon bis auf die Haut. Ganze Bäche stürzten aus seinen Jackenärmeln. Das wäre ja alles noch gegangen, aber plötzlich gab’s einen markanten Temperatursturz, innert einer Stunde war’s nur noch gerade 20 Grad warm und ich begann zu frieren. Nun empfand ich das Wasser in der Höhle noch fast als warm; Theo setzte sich mit all seinen Kleidern in den Teich. Was für ein Anblick!
Der Abstieg in die kleinste Höhle unternahm ich allein, aber ich schaffte es auch nicht bis ganz nach unten. Mir wurde ganz unheimlich zumute in dem dunklen, engen Schacht mit den glitschigen, behelfsmässige Stufen, die in den tiefschwarzen Schlund bis zur Wasseroberfläche führten. Manchmal konnte ich die nächsten Tritte kaum sehen, so weit auseinander lagen sie. Auch traute ich der Konstruktion nicht besonders. Alles sah recht unprofessionell aus, auch die Seile, die als Handgriffe dienen sollten. – Auf jeden Fall nichts für Menschen, die an Klaustrophobie leiden.
Die Übernachtung in der Hacienda Viva Sotuta de Peón, einem grossen landwirtschaftlichen Gut, entschädigte uns für alle „Ungemach“. – Was für ein schönes Hotel (Cabaña mit eigenem Pool) ich da ausgelesen hatte! - Ein Bijou.
Dort sagte man uns auch, wo wir den kaputten Pneu würden reparieren lassen können. Weit wollte ich damit nicht mehr fahren. In Ticul fanden wir eine Werkstätte. Theo hatte Bedenken und fand, wir sollten lieber eine andere suchen. Ich war anderer Meinung und fuhr in den Hof hinein, in dem überall Pneus herumlagen. Sein Bauchgefühl war nicht richtig. So ein rascher, professioneller und überaus freundlicher Service würde ich mich auch zu Hause wünschen. Zudem hat die Arbeit kaum was gekostet.
Sehr viel weniger Besucher begegneten wir auf der Ruta Puuc. Diese Rundreise führt durch Maní, Loltún (ähnliche Grotten wie die Beatushöhlen), Labna, Xlapak, Sayil, Kabah, Uxmal entlang von einzigartigen Ruinenstätten. Nicht ganz so gross wie Chichén Itzá, aber nicht minder beeindrucken. In jeder trifft man auf einen anderen architektonischen Stil. Wunderbar, durch die Anlagen zu spazieren, zu klettern, sie zu erforschen. Und das Schöne eben: Es hat kaum andere Besucher.
Auf dem Weg nach Mérida machten wir Halt in Santa Elena und besuchten einen weiteren Cenote, nämlich den von San Antonio Mulix, wo sich wieder mehrere „Badegäste“ tummelten.
Mérida gefiel uns sehr gut, wir übernachteten zweimal in dieser farbigen Stadt, in welcher eine fröhliche Stimmung herrschte, besuchten das fantastische Museo Regional de Atropología Yucatàn und fanden ein paar behagliche Restaurants.
Auf dem Rückweg an die Küste in die Provinz Quintana Roo besuchten wir die historisch bedeutende „gelbe Stadt“ Izamal, wo grade ein riesiges Volksfest rund um den Convento de Izamal stattfand. Laute Bands untermalten das ausgelassene Treiben und auf dem Platz vor dem Kloster drängten sich die Besucher um die Marktstände herum. Der Klosterkomplex wurde 1561 fertiggestellt. Dadurch, dass für den Bau das unterliegende Pyramidenfundament verwendet wurde, hat das Kloster einen Kirchhof mit einer Ausdehnung, die nur noch vom Vatikan übertroffen wird. Zum Bau des Klosters und der umliegenden Stadtgebäude wurden Izamals Pyramiden als Steinbruch missbraucht.
Die Stadt erhielt übrigens die touristische Auszeichnung „Pueblo Mágico“. Berühmt ist die gigantische Pyramide Kinich Kak Moo mit Seitenlängen von 200 m und einer Höhe der Plattform von 36 m, sie stammt aus dem Mittleren Klassikum und war dem Sonnengott geweiht. Theo legte sich an ihrem Fusse in den Schatten der Bäume (zwecks Siesta) während ich die zahlreichen Stufen hochkraxelte bis zuoberst, wo sich mir eine grandiose Aussicht bot.
Zurück in Playa del Carmen verlebten wir noch ein paar weitere gemütliche, schöne Tage bei bestem Wetter im Azul Fives Resort.
Im Städtchen selber waren wir etliche Male. Der hübsche Ort am Meer ist beliebt bei Touristen und Einheimischen gleichermassen. Die vielen Restaurants, Bars und Läden laden zum Bummeln, zum Verweilen und zum Geld-Ausgeben ein.
Zwei Kurzausflüge auf die vorgelagerten Inseln Cozumel und Isla Mujeres (mit einem Katamaran) waren weitere Highlights unserer Ferien in Mexiko – auf der Atlantikseite diesmal.
Anfangs Juni waren wir zurück und konnten den Sommer in der Schweiz verbringen, oft in der Aare baden, was ich so sehr liebe. - Mitte Juni reiste die ganze Familie nach London. – Am 17. Juni, an einem der heissesten Tage im Jahr, heiratete Kim ihren Partner Javier, mit dem sie schon zehn Jahre lang zusammengelebt hatte.
Dann der absolute Höhepunkt des Jahres: Zwei Monate später brachte Kim einen kleinen Jungen zur Welt: Teo Jaxx Torriani Villanueva. Alles ging gut – die Familie war glücklich.
Zurück zu Hause hiess es aber wieder Kofferpacken, denn am 5. Oktober war’s höchste Zeit, unsere „Schweiz-Herbst-Flucht-Ferien“ in Angriff zu nehmen
Die Reise begann in Myanmar, wo wir drei Wochen lang einen Teil dieses wunderschönen Landes erkundeten. Diesmal hatten wir einen Fahrer engagiert, dem es ein Anliegen war, uns (nebst den obligaten „Must-sees“) sein Land möglichst abseits der Touristenströme zu zeigen. Es war fabelhaft. Während Tagen sahen wir kaum andere Reisende und entdeckten die schönsten Orte und Landschaften.

Reisebericht Myanmar 5. – 24. Oktober 17
Wieder sind wir unterwegs. Wie praktisch, erst am Abend abreisen zu müssen. Gino bringt uns um sechs nach Bern an den Bahnhof. Der Zug nach Zürich hat Verspätung und wie er endlich kommt, merken wir sofort, dass wir froh sein müssen, wenn wir überhaupt noch einen Platz finden. – Es gelingt – in zwei verschiedenen Wagen. Die Passagiere sitzen sogar auf den Treppen; es herrschen sardinenbüchsenartige Zustände.
Check-in habe ich schon online erledigt. Nur die Koffer müssen wir noch abgeben. Grosse Mühe haben wir uns gegeben beim Packen. Einen Koffer wollen wir nämlich gleich in Yangon lassen. Der nützt uns nicht auf der Rundreise, da sind Dinge drin, die wir erst in Australien brauchen werden.
Am Baggage-Drop-Schalter aber müssen wir unser Handgepäck wägen lassen und oh weh – beides darf nur 7 kg schwer sein, unseres wiegt je 10 kg. Wir müssen also umpacken in die grossen Koffer. Mühsam, mühsam. Aber ok, wir schaffen’s. Zum Glück erlaubt Emirates je 30 kg beim Abgabegepäck, so müssen wir nicht draufzahlen. Das hätte noch gefehlt – schon zu Beginn der Reise.
Eine 380-er Boing bringt uns nach Dubai, wo wir drei Stunden Aufenthalt haben. Mit grosser Freude stelle ich fest, dass Theo es diesmal unterlassen hat, irgendwelche seltsamen und unnützen Dinge zu kaufen und ebenso erfreulich ist es, dass er ausnahmsweise beim Security-Check kein Messer hat abgeben müssen. Das ist doch mal ein Anfang! – Kurz nach neun geht’s weiter nach Yangon, wo wir am folgenden Tag pünktlich um 17.25 ankommen.
Geschlafen haben wir nicht viel in dieser kurzen Nacht – viereinhalb Stunden sind „verloren“ gegangen. Wir freuen uns aufs Hotel und aufs Bett.
Yangon
Die Zollkontrolle geht reibungslos, der erste Koffer kommt gleich auf dem Rollband daher. Das geht ja rasch, freue ich mich. Aber der zweite Koffer – auf den müssen wir eine geschlagene Stunde warten. Wir sind nicht die Einzigen, die dort herumstehen und sehnlichst aufs Gepäck warten. Niemand weiss, wieso es so lange dauert. Aber endlich: Es ist jetzt fast sieben und bereits dunkel, wie wir auch die Zollabfertigung hinter uns haben.
Ob Tunlin da ist, um uns abzuholen? – Ich zweifle nicht. Tunlin habe ich im Internet gefunden, er bietet Rundreisen an durch Myanmar in seinem Auto. Eine Deutsche hat ihn in ihrem Reisebericht empfohlen und seine Email-Adresse erwähnt. So haben wir während Wochen zusammen kommuniziert. Er hat Vorschläge gemacht in Bezug auf die Route und ich habe Hotels gebucht, wieder storniert, wenn er andere empfohlen hat, neu gebucht etc. etc.
Ein Foto von uns hab ich ihm geschickt, damit er uns am Flughafen erkennt, und das hat bestens geklappt. Von weitem schon hat er uns zugerufen und gewinkt.
Ich glaube, wie haben Glück. Er ist ein sympathischer Mann Mitte dreissig, schlank und freundlich. Er ist ein Jahr jünger als unsere Zwillinge, wie wir später erfahren.
Etwa 40 Minuten dauert die Fahrt zum Hotel Chatrium. Wegen der Dunkelheit haben wir kaum etwas von der Stadt gesehen, no problem, wir werden sie ja morgen erkunden.
Tunlins Auto, mit dem wir reisen werden, ist ein Toyota-Bus mit acht Plätzen. Theo frohlockt schon und sieht, dass er genügend Platz hat, so dass er sich ab und zu auf einer Dreierbank seiner Lieblingsbeschäftigung wird hingeben können.
Im Hotel hat’s drei Restaurants. Wir wählen das japanische, können ja dann noch lange burmesisch essen auf der Rundreise. – Ein feines Büffet hat’s; wir essen mehr als wir eigentlich wollten, geniessen’s aber sehr. Und noch mehr die Dusche und das weiche Bett.
Nach einem achtstündigen dornröschenähnlichen Schlaf starten wir nach dem Frühstück mit Tunlin zur Stadtrundfahrt.
Erst aber gibt’s noch eine „Thanaka-Behandlung“. In der Lobby steht parat, was man dazu braucht: das richtig Stück Holz (besagter Baum wächst nur in Myanmar), dessen Rinde man auf einem Stein zu feinem Puder reiben muss. Mit etwas Wasser vermengt entsteht eine feine gelbliche Paste, die man sich ins Gesicht streicht. Sie schützt vor der Sonne und sieht „gut aus“. Tunlin appliziert mir welche. Sie fühlt sich nass und kühl an. Mal schauen. Jedenfalls freuen sich Frauen, die uns begegnen, dass ich es ihnen gleich tue – mir kommt’s allerdings ein bisschen blöd vor. Sie deuten wohlwollend auf ihre beziehungsweise auf meine Wange. Theo jedoch ist eher irritiert. Er will mir den „Fleck“ auf der Nase wegwischen. Das funktioniert hingegen nicht gut; er erscheint immer wieder.
Wir fahren zur Sule-Pagode, die mitten in der Stadt steht, schauen sie aber nur von aussen an. Es sei zu heiss dort, meint Tunlin, und er wolle uns nicht schon am ersten Tag mit Buddhas und Pagoden überfüttern. Es scheint, er hat seine Erfahrungen mit Touristen schon gemacht.
Wir gehen zu Fuss durch die Strassen rund um den Platz, sehen, dass es auch eine Moschee dort hat, eine Kirche und einen Hindutempel ebenso. Verlotterte Kolonialbauten gibt’s zuhauf, fast wie in Havanna. Einige sind im Begriff, restauriert zu werden, andere scheinen kurz vor dem Zerfall zu sein.
Überall hat’s Garküchen, Fleisch und Gemüse werden gebraten und angeboten. Die kleinen blauen und roten Plastikstühle sind allgegenwärtig und sehen aus, als wären sie für eine Kindergarten- oder Zwergenparty bereitgestellt worden, die jeden Moment stattfinden könnte. Sie erinnern mich an Vietnam.
Anders als zum Beispiel in Hanoi aber geht’s im Verkehr zu und her. Motorroller sind in dieser Stadt verboten. So sind’s halt die Autos, die das Strassenbild dominieren. Hupend verscheuchen sie die Fussgänger, die auf die andere Seite wollen, egal, ob die sich grad auf dem Zebrastreifen befinden oder nicht. Daran ändert auch das Grünlicht nicht das Geringste. Sie sind Quantité négligable. Wo bleibt der vielzitierte Respekt gegenüber den Mitmenschen? – Ok, ok, alles hat ja etwas Positives, man muss es nur sehen: das tägliche Keep-Fit-Training ist kostenlos.
Einen liegenden Buddha besuchen wir anschliessend in der Kyau-htat-gyi-Pagode. Besonders sehenswert sind seine Füsse beziehungsweise seine Fusssohlen. 108 Bilder oder fast eher Piktogramme sind dort eingemeisselt.
Am Fluss herrscht ein reges Treiben. Seit einem Tag erst gibt es neu ein Wasser-Taxi, das 85 Passagiere gleichzeitig ans andere Ufer bringen kann. Aber man müsste dazu lange anstehen. Wir verzichten und gehen lieber Mittagessen. „Monsoon“ heisst das Restaurant, wohin Tunlin uns führt. Es ist „sicher“ für Touristen und ja, tatsächlich, netter Service, gutes Essen und eine saubere Toilette.
Anschliessend besuchen wir die grösste katholische Kirche der Stadt, St. Mary’s. Die Pfeiler sind aus weissen und roten Ziegeln gebaut, das sieht ganz gut aus. Ein holländischer Architekt hat sie 1895 entworfen.
Es regnet in Strömen, ist feucht und heiss und Tunlin bringt uns zurück ins Hotel zum Ausruhen. Siesta! Das kommt Theo gerade recht. Um halb sechs werden wir wieder abgeholt. Den Besuch der Shwegadon Pagode empfiehlt Tunlin erst um diese Zeit, weil die Pagode am schönsten ist beim Einnachten und man sich die Fusssohlen nicht mehr verbrennt.
Wir essen anschliessend wieder im Hotel. Chinesisch diesmal. Auf der Karte steht zu jeder Speise S M L, wie bei T-Shirts. Ich denke, M wird wohl richtig sein und wir bestellen drei Gerichte. S ist besser, belehrt man uns. M ist für vier Personen, L für zehn. – S war ok, aber zwei Gerichte hätten mehr als nur gereicht. Eigentlich würde ich ja gerne ein, zwei Kilos abnehmen, daraus wird so aber gar nichts.
Sonntag, 8. Oktober – Beginn der Rundreise mit Tun Lin
Um exakt 9 Uhr fahren wir los Richtung Süden. Den ersten Halt gibt’s bereits nach einer Stunde, und zwar beim Militärfriedhof Toukkyant, wo über sechstausend Gräber an die gefallenen britischen Soldaten im zweiten Weltkrieg erinnern. Die Anlage ist wunderbar gepflegt und ein Spaziergang entlang der endlosen Gräberreihen führt einem einmal mehr die Unsinnigkeit des Krieges vor Augen. So viele junge Männer mussten sterben, grad kurz vor Ende des Krieges – sinnlos verschwendete Menschenleben. Beeindruckend, traurig, bitter, unverständlich!
Weiterfahrt nach Bago. Wir hätten sehen wollen, wie die Mönche im Kloster Kya Chat Wine ihr Essen erhalten. Wir kommen aber grad ein wenig zu spät, sahen nur noch, wie sie mit ihrer Gamelle (ich nenn‘ das Gefäss jetzt mal so – Reisschalen wär richtig) im Gänsemarsch hintereinander an uns vorbei aus dem Essenstrakt in ihre Unterkunft abmarschieren. Eine schier nicht enden wollende Kolonne von jungen Männern, alle kahl geschoren, alle gleich gekleidet in ihrem dunkelroten Tuch, alle mit zum Boden gesenktem Blick - das physische Gruseln könnte einen packen beim Anblick dieser Identitätslosigkeit…
2000 Mönche leben übrigens in diesem Kloster.
Weiter geht die Fahrt zu einem Tempel (Hin Taw Hill), wo grad ein Fest im Gang ist. Ein sehr lautes! Trommeln, Lautsprechergesang und Tanz – recht ungewöhnlich für europäische Augen und Ohren - ohne Ende auch hier.
Überall liegt Abfall herum. Schade! Das sieht nicht gut aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es den Leuten, die in und um diesen Dreck herum leben, wohl sein kann.
Vor dem Mittagessen machen wir noch kurz Halt beim Schlangentempel. Recht skurril geht es dort zu und her und gar nicht etwa buddhistisch, wie Tunlin betont haben will: Anbeten kann man dort einen 9 Meter langen Python, der 114 Jahre alt und die Verkörperung eines verstorbenen Abtes sein soll. Es brauche 5 Mönche, um ihn hochzuheben. – Ob ihm das gefällt? – Nun, er liegt lethargisch dort, zusammengerollt, und neben ihm sitzt ein Typ, der die Besucher singenderweise dazu animiert, Geld fürs Futter zu spenden (für seines vielleicht auch). Die Scheine legt er der Schlange auf den Leib. Im Zimmer dieser Schlange, es ist eher ein Zimmer als ein Tempel, sind auch zwei Typen dargestellt (aus Plastik wohl), die Geldscheine in ihren Händen halten und grässlich dreinschauen. Auch vor denen knien Gläubige, die durch ihre Andacht hoffen, zu Geld zu kommen.
Apropos Geld: Dollars werden an manchen Orten gerne angenommen, aber nur ganz neue, saubere Noten, die noch nie gefaltet worden sind und keinen einzigen Fleck aufweisen. Gut, das vor der Reise bereits zu wissen. Was man dann allerdings beim Wechseln zurückerhält, sind ihre Kyats (ausgesprochen „Tschats“) – meist dreckig, und das so sehr, dass man jedes Mal, wenn man sie berührt, das Gefühl hat, man müsse sogleich die Hände waschen.
Übernachtung ist in Kyaikto, in einem hübschen Hotel mit Aussicht auf die „Berge“ (Thuwunna Bomi Mountain View Hotel). Eigentlich sind’s eher Hügel, aber der weite Blick übers Land ist herrlich. Vor allem vom Pool aus. Ein kleiner „Schwumm“ nach der langen Fahrt in der Hitze tut gut.
Wir essen draussen, warten aber eine ganze Stunde lang auf unsere Bestellung. Das Restaurant ist sehr gut besetzt; alle Gäste sind einheimische Touristen. Ok, wir haben ja Ferien. Es beginnt stark zu regnen und so warten wir eine weitere Stunde, bis wir unter dem Schutz des Regenschirms den Aufstieg zu unserem Bungalow unter die Füsse nehmen.
Montag, 9. Oktober 2017
Wie gestern auch, fahren wir um neun Uhr los. Der Regen hat aufgehört. Es ist wieder heiss und schwül. Tunlin will uns irgendwo hinführen, wo’s keine Touristen hat und auch in keinem Führer etwas drüber steht. – Mal schauen… Es handelt sich um ein Fort aus dem 4. Jahrhundert (Zoke Thoke). (Wenn ich diesen Ortsnamen google, erscheinen Schuhe: „Nike Khaki“ – nicht, was ich suche…) Tunlin hat nicht zu viel versprochen: Eine der Mauern ist noch erstaunlich gut erhalten und ist mit prächtigen Reliefs verziert, mit Pferden, Tempelwächtern, Krokodilen, Affen etc. Dass hier keine Touristen sind, wundert mich. Die Kinder im Dorf begleiten uns, von Betteln keine Spur. Sie sind Besucher tatsächlich nicht gewohnt.
Auch im Fischerdorf, das wir anschliessend besuchen (Zok Kali), werden wir freundlich begrüsst. Kaum hält unser Auto an, versammelt sich wie aus dem Nichts eine ganze Gruppe Frauen um uns herum. Sie fassen mich an, wollen meine (weisse) Haut spüren. Nur allzu gern lassen sie sich mit mir fotografieren.
Beim anschliessenden Spaziergang durchs Dorf zieht Theo einen ganzen Schuh voller Lehm und Dreck aus dem Sumpf. Es braucht etliche Kacheln Wasser, die uns eine Dorfbewohnerin bringt, bis er wieder passabel aussieht. Tunlin kugelt sich vor Lachen.
Noch ein paar Worte zur Verständigung mit Tunlin: Diese ist nicht immer sehr einfach. Er hat zwar einen ausserordentlich grossen Wortschatz und ein umfangreiches Wissen, kann auch alles flüssig erklären, aber bei der Grammatik und vor allem bei der Betonung – da happert’s gewaltig. Gewisse Lautverschiebungen erkenne ich nach ein paar Tagen, aber immer klappt auch das nicht. Wenn ich ihn mit lauter Fragezeichen anschaue, dann buchstabiert er mir das Wort, das ich nicht verstanden habe in rasender Geschwindigkeit, was dann allerdings ebenfalls selten zum Erfolg führt. – Was zum Beispiel heisst „Lassía“? – Ich hab’s: „Last year“.
Sehr gut hingegen verstehe ich seine manchmal ziemlich sec zusammengefassten Inhalte wie „no like“ und „no have“ oder wie er mir auf meine Frage, was denn passiere, wenn jemand sterbe, antwortete, der Körper werde verbrannt und irgendwo im Wind zerstreut. „No use!“. Damit hat er ja nicht ganz unrecht.
Wir fahren an Plantagen vorbei und er erklärt, da würden neben Papayas, Erdnüssen und Mais auch „Papa“ angepflanzt. Ich denke, da handle es sich tatsächlich um eine exotische Frucht oder Pflanze, die vielleicht nur in Burma heimisch sei, die ich nicht kenne. Als ich „Papa“ dann zu Gesicht bekam, war mir klar, er meinte „Pepper“.
Mittagessen in Thatou (Two Lakes Resort)
Wir sind die einzigen Gäste. Wie unser Auto vorfährt, werden wir von drei Kellnern mit Schirmen begrüsst und abgeholt. Die zehn Meter ohne Sonnenschirm hätte ich ohne weiteres geschafft – sooo heiss war’s nun doch nicht. Aber die Angestellten haben im Moment ja sonst nichts zu tun und sind sehr beflissen, alles richtig zu machen, wenn sie es mit Touristen zu tun haben. Jetzt aber gibt’s Arbeit: Einer weist uns den Platz am Tisch an, den ich aber wechselte, weil ich wie ein Zwärgli hätte sitzen müssen. Ich entschied mich für einen Stuhl mit Aussicht auf den Tisch. – Einer bringt die Menu-Karte, einer springt herum, ohne genauen Plan, einer bringt eine Serviette, die so klein ist, dass ich sie zwar zumindest ohne Lesebrille sehen kann, aber das ist’s dann auch schon, einer holt noch zwei andere Kellner, damit es an nichts und niemandem mangelt, einer von denen merkt, dass die Serviette schon ein wenig klein ist, bringt also noch eine zweite, die er hübsch neben die anderen hinlegt, einer stellt die restlichen Servietten in die Mitte des Tisches, ein anderer kommt sogleich und schiebt sie wieder an den Rand, ein weiterer stellt uns diskret einen kleinen Plastik-Papierkorb zu Füssen zwecks Entsorgung der gebrauchten Servietten, eine dritte Serviette wird gebracht, und schliesslich versucht sich einer auf Englisch, um unsere Wünschen zu ergründen. Ja, und so bestellten wir das Mittagsmenu; Tunlin hilft beim Übersetzen. Das Essen wird gebracht, es ist sehr fein, wir stehen aber die ganze Zeit unter schärfster Beobachtung. Die ganze Kellnerschar reiht sich in nicht allzu grossem Abstand um uns herum und alle schauen uns beim Essen zu, ohne je „to miss a beat“; es könnte ja sein, dass irgendjemand noch einen Wunsch hegt. Vor allem beim Nudel-Suppen-Schmaus ist das etwas gewöhnungsbedürftig. Die Szene ist teils rührend, teils ein wenig peinlich.
Die Rechnung kommt, von Hand geschrieben in der wunderbaren Schrift, welche die Burmesen haben, und mit zwei hübschen Stempeln versehen. Knapp zwölf Franken, Trinkgeld inbegriffen, kostet die Mahlzeit für uns drei.
Wieder werden wir mit Schirmen zum Auto begleitet, damit wir ja nicht etwa einen Sonnenstich erleiden auf dem Weg dorthin, und ein Kellner rennt mir sogar noch nach, um darauf aufmerksam zu machen, dass ich das Retourgeld nicht eingepackt habe…
Genau so geht es uns, um das vorweg zu nehmen, beim Abendessen. Da sind wir nur zu zweit im Restaurant. Der zuständige Kellner lässt kein Auge von uns. Ich gäbe viel darum zu wissen, was der sich beim Zuschauen denkt. Und Theo wieder mit seiner Nudelsuppe… Und eine ganze Flasche Wein (aus Myanmar - sehr gut übrigens!), verarbeiten wir zu zweit…
Höhlen
Am Nachmittag stehen zwei Höhlen auf dem Programm:
Die erste (Cave Ba Yin Nyi) ist am Fusse eines dieser für die Gegend typischen Karstberge gelegen. Schon von weitem sieht man die goldenen Spitzen der Pagoden im Sonnenlicht glänzen. Die Höhle ist offenbar tief, aber man besichtigt nur einen kleinen Teil davon. Buddhas sitzen dort geduldig in Reih und Glied, sie spiegeln sich im „Teich“, der sich durchs herabtropfende Wasser gebildet hat. Das sieht schön und würdevoll aus. Durch diese Pfütze muss man waten, wenn man das dringende Bedürfnis hat, auch die Buddhas in den hinteren Gewölben zu begutachten. Das kühle Nass an den Füssen zu spüren ist ganz angenehm. Sauber kann das Wasser zwar nicht gerade sein, hunderte von Füssen haben die Stelle schon passiert, aber es ist so dunkel, dass man das nicht sieht. Lieber nicht dran denken…
Die zweite Höhle (Kaw Gion) ist gar keine richtige Höhle. Eigentlich handelt es sich mehr um eine Ausbuchtung an einem dieser Karstfelsen, in die unzählige Reihen von kleinen und kleinsten Buddhas in den Felsen eingraviert respektive angebracht worden sind. Aus dem Grund heisst es in der Übersetzung die „Grotte der 10’000 Buddhas“, und das ist wohl nicht einmal übertrieben. Die kleineren Reliefs stammen aus dem 7. Jhd. und es ist nicht vorstellbar, wie die Menschen damals diese in die überhängenden, steilen und hohen Felswände haben einmeisseln können. Später, vor etwa hundert Jahren, sind die grossen Buddhas dazu gekommen, welche unterhalb und nebeneinander in verschiedenen Reihen sitzen, auf Augenhöhe, entlang des Weges, den die Besucher gehen. – Es ist ein fantastischer Ort. Eindrücklich und einmalig.
Die Gegend (Bee Lin Township) hier ist ebenfalls grossartig: Reisfelder wechseln sich ab mit Kautschukplantagen und –wäldern - am Horizont die Berge und die einzelnen alleinstehenden Felsen, ähnlich wie im Monument Valley in den USA, aber anders als dort sind sie dicht bewaldet. Die Gräser, die im Vordergrund und am Strassenrand silbern glänzen, wiegen sich sanft im Wind.
Auf dem Weg ins Hotel müssen wir etliche Strassenposten passieren. Immer wieder muss Tunlin anhalten und Kohle abladen. Es ist zwar nicht viel (manchmal sogar weniger als vierzig Rappen), aber immerhin. Auch Militärkontrollen sind vorhanden – es ist die Strasse nach Thailand; Autos werden auf Drogen kontrolliert. Wir nicht. Wenn sie sehen, dass wir Touristen sind, lassen sie uns durch.
Zurück im Hotel: Bad im Pool, welches viel zu warm ist und mich die Aare aufs Schlimmste vermissen lässt. Trotzdem tut es gut, sich nach dem langen Tag ein wenig im Wasser zu bewegen.
Abendessen schon erwähnt.
Dienstag, 10. Oktober
Das Frühstück hier ist „nothing to write home about”. Ich halte mich an die Früchte, denn das asiatische Buffet, das es hier gibt, ist am Morgen nicht so mein Ding. Theo hingegen langt kräftig zu: Nudelsuppe und sonstige Köstlichkeiten. Für die wenigen europäischen Touristen, die sich hierhin verlaufen, genügen ein paar trockene Toastscheiben, Butter und Konfitüre (welche beide mehr als nur suspekt aussehen) vollauf. Mir läuft jedenfalls nicht das Wasser im Mund zusammen. Auch den Orangensaft würde man nicht zwingend als solchen erkennen, selbst wenn ein paar dünne Orangen-Rädchen drin baden. - Tee in dem Fall: Im 1-Liter-Thermoskrug schwimmen 10 Beutel Lipton’s Tea. Kohlrabenschwarz wie Kaffee, bitter wie Galle - wen wundert’s?
Um neun geht’s los; Tunlin wartet bereits in der Lobby auf uns. Wir fahren zur Saddha Cave. Unterwegs besuchen wir eine Kautschukplantage. Vater, Tochter und Schwiegersohn sind dort die Angestellten. Vier Tage pro Woche arbeiten sie, ein Tag frei, dann wieder vier Tage Arbeit und so weiter. Morgens um vier Uhr fängt für die drei der Tag an. Bei 3‘000 Bäumen gilt es täglich, die weisse, zähe Flüssigkeit zu gewinnen. Sie arbeiten dann bis gegen Mittag und gehen anschliessend schlafen. Ein einfach eingerichtetes Häuschen mit zwei Zimmern ist ihre Wohnung. Zwei Bastmatten dienen dem Ehepaar als Bett, daneben stehen Geschirr und Kochutensilien am Boden. Dies ist ihre Küche. 25$ pro Tag verdienen sie alle zusammen. Schon während zwölf Jahren haben sie diesen Beruf ausgeübt - in Thailand; jetzt sind sie hier angestellt.
Ich hab noch eine Tafel Cailler’s – Schokolade bei mir; die gebe ich ihnen. Eine Mütze für den jungen Mann werden wir auch noch los.
Die Fahrt geht weiter an einem Kanal entlang auf einer mehr als nur schwierigen Buckelpiste. Im Auto kommt es einem vor, als nähme man an einem Rodeo teil.
Rechts und links der „Strasse“ hat es Reisfelder, auch Weiher, in denen Fischer mit grossem Geschick ihre Netze auswerfen. Was für ein Anblick! Im Hintergrund die Karstfelsen, die wie Löffelbiskuits aus einer flach gestrichenen Quarktorte aus der Ebene ragen. – Der Vergleich ist ein wenig sehr weit hergeholt; ich weiss. Es kommt mir einfach nichts Passenderes in den Sinn. Meinen Englischschülern habe ich zur Auflockerung mal ein Blatt ausgeteilt mit den schlimmsten Analogien (Worst analogies ever). Mein Tortenbespiel würde gut dort hineinpassen.
Die Höhle ist mit Buddhas ausgestattet, ist ja klar, mit kleinen und grossen, mit liegenden, sitzenden und stehenden. Es tropft überall und das Geschrei der Fledermäuse hallt an den Wänden wider. Wir kommen an Stalagmiten und Stalaktiten vorbei, wie sich das so gehört in einer Höhle.
Nach vielleicht eine halben Stunde sind wir beim Ausgang auf der anderen Seite des Felsens. Was für ein grandioser Anblick auch hier: Ein See, in dem sich die steilen Hügel im Hintergrund und die Wolken spiegeln. Im Vordergrund ein paar farbige Boote. Eines davon bringt uns rund um den Felsen auf die andere Seite. Erst aber geht’s etwa hundert Meter durch eine andere Höhle hindurch. Das Wasser drin ist schwarz und klar wie Glas und wie in einem Spiegel bildet sich auf der dunklen Oberfläche die Decke der Höhle ab. Man muss sich ducken, damit man mit dem Kopf nicht anstösst.
Unser Bootsführer, der uns äusserst geschickt navigiert, ist etwa zehn Jahre alt. Am Ausgang der Höhle – wieder ein Bild für Götter: ein See voller Lotusblätter und –blüten. Absolut friedlich zieht das Boot still dahin, der Junge steht hinten und steuert mit einer langen Stange das wackelige Gefährt. Er ist ein Künstler. Ein paar Fischer sind am Werk, diesmal sind es allerdings Fischerinnen, die mit Reusen kleine Fischchen fangen, die sich, wenn sie aus dem Wasser gezogen werden, wie kleine weisse Kugeln aufblähen oder aufblasen. Sowas hab ich noch nie gesehen. Wirft man sie zurück ins Wasser, lassen sie die Luft raus und sehen wieder aus, wie Fische eben so aussehen. Mit bemerkenswerter Präzision legt der „Kapitän“ an einem Felsen an, wir klettern aus dem Boot, Tunlin bezahlt die Fahrt und wir machen uns zu Fuss zurück zum Auto.
Drei Girls kommen auf mich zu und bitten darum, mit mir eine Befragung machen zu dürfen. Sie lernen Englisch und haben in der Schule den Auftrag bekommen, Touristen zu interviewen. „What’s your name?“ - „Where are you from?“ und so weiter. Die eine ist flinker im Fragen stellen, die andere macht sich Notizen, die Dritte schaut zu. Was mir in der Gegend hier am besten gefällt oder gefallen hat, wollen sie wissen (die netten, freundlichen Leute und die wunderbare Landschaft – strahlend wird diese Antwort entgegengenommen), und was ich ändern würde, wenn ich hier leben würde. Da kommt mir spontan schon was in den Sinn: Ich würde dafür sorgen, dass überall der Abfall weggeräumt wird und versuchen, den Leuten beizubringen, dass man nicht sorglos alles wegwirft, wo’s einem grad passt. – Die drei schauen perplex, haben wohl erwartet, ich würde sagen „nichts“, aber das lässt meine immer noch intakte Lehrerseele natürlich nicht zu. – Ich hege die Hoffnung, dass dieser Gedanke zumindest ansatzweise zur Erleuchtung führt. Ihr Lächeln finden sie rasch wieder, denn jetzt wollen sie mit mir Fotos machen – eine Schweizer Grossmutter mit drei jungen burmesischen Girls…
Auch in der Höhle haben mich junge Leute angesprochen und gefragt, ob sie von mir mit ihnen ein Foto machen dürften. Sie scheinen allgemein sehr interessiert zu sein an Touristen, welche hier im Süden zumindest sowieso recht dünn gesät sind, eine Specie Rara sozusagen. - Sie winken einem zu, freuen sich, wenn man sie fotografieren will und setzen sich sogleich in Pose. Und ich mit meinen weissen Haaren bin offensichtlich eines der begehrteren Objekte dieser Art. – Es nähme mich aber schon wunder, was genau so interessant dabei ist. – Vielleicht findet mich irgendjemand mal „dank“ Gesichtserkennungsprogramm auf Facebook und übersetzt mir den allfälligen Kommentar.
Auf der Rückfahrt Blick auf den 732 m hohen Mount Zwe Ka Bin, der höchste in der Gegend. Ein Kloster befindet sich zuoberst. Man kann es besuchen, aber der Aufstieg dauert mindestens sechs Stunden, wir lassen’s mal. – Am Morgen war der Berg in Wolken gehüllt, jetzt präsentiert er sich majestätisch.
Mittagessen im Veranda Youth Community Coffee (ein Projekt, das von der EU und Helvetas unterstützt wird. Junge Leute sollen eine Perspektive erhalten und lernen, einen Betrieb zu führen). Die feinsten Getränke machen sie dort, Säfte aus frischen Zutaten. Auch alles andere ist gut. Sitzen tut man draussen auf Bambusstühlen, es ist eine angenehme, lockere Atmosphäre, ein wenig „backpackerisch“.
Unser nächstes Ziel ist der Fels mit der Pagode oben drauf, der Kyauk Kalat. Ganz offensichtlich haben die Mönche die skurrilsten Orte gesucht und gefunden, um zu meditieren und die Erleuchtung zu erlangen. Am liebsten sind ihnen offenbar hohe Felsen, die möglichst bizarr in der Landschaft stehen. Bis dort, wo der Fels seine Taille hat, darf der Plebs hinaufklettern, was höher liegt, ist nur den Mönchen vorbehalten.
Das Heiligtum sieht gut aus: Im Hintergrund ist der Himmel schwarz. Der Regen kommt immer näher; vorne scheint aber noch die Sonne.
Wir verlassen den Ort und Tunlin fährt uns in einen „Garten“ am Fuss des Mount Zwe Ka Bin, der mit 1‘000 Buddhas „angereichert“ ist. Sie sitzen in nicht enden wollenden Reihen, etwa so, wie die Bäume angeordnet sind in den Kautschuk-Plantagen.
Jetzt aber lässt der Regen nicht mehr mit sich spassen. Monsunartig setzt er ein. Tunlin bringt uns ins Hotel. Zwei Stunden später holt er uns wieder ab und wir gehen zusammen essen – nochmals ins gleiche sympathische Restaurant zu den jungen Leuten, die so gut kochen. Wein und Bier haben sie zwar nicht und der Tee ist auch grad ausgegangen. Ein Stromausfall in der halben Stadt macht’s auch unmöglich, den frisch gebrauten Kaffee zu servieren.
Mittwoch, 11. Oktober 17 - Golden Rock
9 Uhr: Wie jeden Morgen steht Tunlin bereit, das Auto ist geputzt, alles bestens. Wir sind startbereit.
Es hat die ganze Nacht lang geregnet und es hat noch immer nicht aufgehört. Eigentlich war geplant, am Thanlwin Fluss den schönen Ausblick auf die Berge zu geniessen, aber leider ist alles verhangen; dieser Programmpunkt wird also gestrichen. Wir fahren zur nächsten Destination, dem Goldenen Felsen (Kyaikhtiyoe oder eben Golden Rock), einem der wichtigsten buddhistischen Wallfahrtsort. Nach zwei Stunden kommen wir im „Base-Camp“ an. Es wimmelt nur so von Besuchern und Pilgern, alle mit dem Ziel, den mehr oder weniger runden Felsbrocken, der aussieht als ob er nächstens herunterfallen würde, zu besuchen. Die Männer dürfen ihn sogar berühren und mit einem Goldplättli versehen, den Frauen ist das vergönnt.
Wir müssen in Pick-Ups umsteigen, die Platz bieten für 42 Personen, in unseren Truck werden 50 gequetscht. Dagegen war die Besetzung im Zug Bern-Zürich im Nachhinein gesehen ein Nasenwasser. Mir kommt’s vor wie eine Fuhre mit Schlachtvieh. Es sieht auch ähnlich aus. Dann geht die Höllenfahrt los. Der Fahrer gibt Gas wie ein Berserker, muss dann allerdings zwischendurch immer wieder mal anhalten und warten, bis herunterfahrende Trucks an uns vorbeigerauscht sind, denn Kreuzen geht nicht. Die Fahrt dauert so fast dreiviertel Stunden und kommt mir vor wie ein Achterbahn-Trip auf den Gotthard –mit anderer Flora am Strassenrand zwar. Es regnet nicht mehr, aber es ist neblig und ich bin heilfroh, wie wir oben auf 1‘100 Metern Höhe unfallfrei ankommen.
Souvenirstände und die allgegenwärtigen Garküchen säumen den ganzen Weg entlang bis zum Fels. Der Spaziergang dauert etwa eine Viertelstunde. Einmal mehr müssen wir die Schuhe abgeben und einen Obolus entrichten (nur für Touristen). Es hat zwar massenhaft Besucher, aber weisse sehen wir nur gerade sechs – alles Schweizer… So kommt nicht grad viel Geld in die Kasse.
Vom Pick-Up-Parkplatz zum Fels wird vieles herumgeschleppt, in grossen Hutten auf dem Rücken oder zum Teil auf dem Kopf: Bambusstangen, Baumaterialien, Koffer und Gepäck zu den drei Hotels, sie’s dort oben gibt. Sänftenträger hat’s auch; für 8 Fr. pro Weg kann man sich tragen lassen. Zu tun haben die Sänftenträger zwar nicht viel, aber immerhin, eine Japanerin macht Gebrauch vom Angebot. Theo wär natürlich voll dafür – ich bin dagegen…
Den Fels sehen wir erst gar nicht vor lauter Nebel. Wie wir aber vor ihm stehen, sind wir schon beeindruckt. Dass und wieso sich der riesige Felsbrocken festhält auf dem unteren Stein und nicht schon längst abgestürzt ist, ist mir ein Rätsel. Absolut imponierend! - Aber er steht ja schliesslich auf einem Haar Buddhas…
Frauen dürfen ihn nicht berühren. – Das macht mir jetzt echt nicht viel aus. – Theo darf, und er tut es auch. Nur klebt er nicht wie seine Mitberührer Goldplättchen an den Brocken, er drückt nur ein paar lose wieder an und lässt sich von mir, aus sicherer Distanz, fotografieren.
Wir treten den Rückweg an. Wieder wird der Truck vollgepfercht, erst dann geht’s los. Der Weg zurück ist noch abenteuerlicher als derjenige nach oben. Wie ein wildes Pferd schnaubt der Wagen vor jeder steilen Kurve und Theo fragt sich (und mich) mehr als einmal, was wohl wäre, wenn die Motorbremsen versagen würden. – Nicht sehr hilfreich diese Überlegungen in dem Moment, denn die Antwort ist klar: Das Gefährt würde in den Abgrund stürzen mitsamt der ganzen Ladung.
Das passiert zum Glück nicht, wir und alle anderen überleben die Fahrt heil und ganz. Auch ist es mir gelungen, mich aus der Spucklinie des Typs vor mir und des Typs hinter mir herauszuhalten, die beide während der ganzen Fahrt ihre Betelnüsse gekaut und im Fünfminutentakt die rötliche Sauce auf den Boden gespuckt haben (Sougruuusig, das ständige Kchoder!).
Nach einem feinen Mittagessen im Dorf Kyaikhtiyoe bringt uns Tunlin ins Hotel im „Base Camp“, das er uns empfohlen hat (Golden Sunrise Hotel). Es ist relativ bescheiden, trotzdem ist alles bestens organisiert, die Angestellten sind wie überall überaus freundlich, und wir sind sehr zufrieden. Die Bungalows sowie die Rezeption und das Restaurant sind aus Bambus und Holz gefertigt; der Garten ist gepflegt und die ganze Anlage sieht hübsch aus. Stromausfall herrscht zwar, und das während Stunden. WIFI funktioniert auch nicht, aber ein Tag ohne ist kein Drama und ein Dinner bei Kerzenlicht.... Wir essen im Restaurant, sind wieder mal die einzigen Gäste und werden demnach aufs Aufmerksamste bedient. Sogar Spezialwünsche werden erfüllt und am Schluss, wie ich zahlen will, sagt der Chef, wir seien eingeladen, er würde sich so für den Stromausfall entschuldigen (für den er ja gar nichts dafür kann). – So nett! Daran gibt’s nichts zu rütteln, wir akzeptieren und bedanken uns herzlich.
Donnerstag, 12. Oktober 17 - Autofahren in Myanmar
Um neun Uhr sind wir parat. Herzliche Verabschiedung und los geht’s nordwärts. Die Strecke kennen wir schon, wir sind sie schon auf dem Hinweg gefahren. Langweilig wird’s trotzdem nicht. All die mit Menschen und Material vollbepackten Pick-Ups und die Motorräder mit ihren Lasten zu beobachten, macht Spass. Oft kann man sich kaum vorstellen, dass ein Vehikel mit all dem Gepäck überhaupt noch fahrtüchtig ist. Gefährlich sieht das aus. Babys fahren auf den Motorrollern mit, eingequetscht zwischen Lenker und Mitfahrer, bei Regen sieht alles noch viel verwegener aus. - Wenn ich da an die Schweiz und unsere Verkehrsvorschriften denke…
An die hiesigen Verhältnisse müssen wir uns aber erst noch gewöhnen. Mit recht grosser Geschwindigkeit braust Tunlin durch die Dörfer. Ausgezogene Linien sind reine Dekoration. – Wäre ja lachhaft, wenn man sich von denen irritieren lassen würde! Das Gleiche gilt auch für ausgezogene doppelte gelbe Mittelstreifen. Die kann man ebenso getrost ignorieren. Auch das Telefonieren während der Fahrt ist weiter nicht der Rede wert. Wenn ich ein paar schüchterne Anstalten mache, ihm zu erläutern, wie der Verkehr bei uns so läuft, hat er nur ein müdes Lächeln dafür übrig. – Schon gut, meint er, dass Touristen in Myanmar nicht Autofahren dürfen. Die wüssten ja eh nicht, wie das geht.
Oft weicht er im letzten Moment erst aus, wenn jemand die Strasse überqueren will. Manchmal denke ich, er muss eine Art Radar eingebaut haben in seinem Hirn oder es gibt eine telepathische Erklärung dafür, dass sich die streunenden Hunde immer im richtigen und letzten Moment aus der Gefahrenzone begeben. - Ich hab dann jeweils einen Mini-Schock. Auch nach Tagen noch geht es mir gegen den Strich, dass er beim Überholen ja kaum etwas sieht, weil er rechts sitzt und ich als Beifahrerin links.
Alle Autos sind nämlich falsch gesteuert. Das kommt daher, dass im Jahr 1975 die Militärregierung von einem Tag auf den anderen beschlossen hat, vom Linksverkehr auf den Rechtsverkehr zu wechseln. – Man stelle sich vor… Und so sind die Autos noch immer falsch gesteuert. Auch die seit diesem Zeitpunkt importierten. Wieso das so ist, leuchtet mir nicht ein, muss es wohl auch nicht. Nicht alles in diesem Land ist einfach zu verstehen. Tunlins Kommentar dazu: Das sei überhaupt kein Problem; er könne beides gut.
Nun sitze ich also da, eigentlich an der richtigen Stelle, angespannt und machtlos, mir fehlen einzig Pedale und Steuerrad. Abenteuerlich wird’s, wenn auf beiden Strassenseiten je einer überholt, also vier Fahrzeuge kurzfristig nebeneinander auf der ein- oder zweispurigen Strasse Platz haben müssen. Ich habe mir angewöhnt, dann lieber zum Seitenfenster hinauszuschauen und die Situation zu ignorieren, vor allem dann, wenn von meiner Warte aus die Situation eher unübersichtlich ist oder das Überholmanöver mit nur wenigen Zentimetern Abstand zum nächsten Fahrzeug eingeleitet wird . Falls mir das mal doch nicht ganz gelingt und mir reflexartig ein „Uh“ herausrutscht, lacht Tunlin und sagt, diese Reaktion sei es, die ihn erschrecke, alles andere sei überblickbar. (Vielleicht ist „U“ halt noch von einem anderen Standpunt aus merkwürdig für ihn: „U“ heisst in der burmesischen Sprache „Herr“ [ich erinnere mich an U Thant]).
Und wenn’s dunkel wird und wir immer noch unterwegs sind, erscheint alles noch viel Schlimmer. Licht schaltet man erst im allerletzten Moment ein, falls man überhaupt welches hat. – Der Entgegenkommende könnte ja denken, man habe einen Webfehler oder einen Sprung in der Schüssel, wenn man mitten am heiterhellen Tag (= Dämmerung oder Regen) mit Beleuchtung herumfährt. – Tunlin erklärt mir auch, dass, wenn neuere Autos importiert würden, die mit automatischer Lichteinschaltsteuerung ausgestattet seien, diese sofort ausgebaut werde.
Nach etwa zweieinhalb Stunden Fahrt erreichen wir die Autobahn. Da wird’s doch dann monoton – zum allerersten Mal. Sie führt durch fast vollständig unbesiedeltes Gebiet, durch eine grüne Landschaft. Verkehr hat’s fast keinen mehr. Wie in Frankreich oder Spanien hat’s aber Mautstellen, ganz ähnlich ausgebaut wie dort. Sehr selten gibt’s eine Ausfahrt, eine Wendestelle sehe ich auch keine. Einmal, nach weiteren zwei Stunden Fahrt, erreichen wir eine Art Raststätte, wo wir etwas essen, trinken, tanken und die Füsse ein wenig vertreten. Unterwegs regnet es teilweise wie aus Kübeln. Mal nur eine Minute lang, dann ist’s wieder trocken, fünf Minuten Schütte und wieder trocken, eine halbe Stunde lang, so dass es riesige Wasserfontänen gibt auf der Fahrbahn – seltsam dieses Ende der Regenzeit. Weiter geht’s anschliessend nochmals anderthalb Stunden, bis wir zu unserem Hotel kommen, dem Nga Laik Kan Tha Eco Resort. Es liegt an einem künstlichen See, bei einem Damm.
Inzwischen hat es aufgehört zu regnen. Wir ruhen uns ein Stündchen aus, dann gibt’s von dort aus eine etwa zehnminütige Bootsfahrt zu einem Elefantencamp. Eintritt für Einheimische 75 Rappen, für Ausländer 15 Franken. Zehn Elefanten „wohnen“ dort und ebenso eine Familie, die zu ihnen schaut und sie zu Arbeitstieren erzieht.
Ein Ritt ist im Preis inbegriffen, er führt uns durchs Dickicht. Zu viert reiten wir mit, ein etwas seltsames Gestell ist das schon, in dem wir uns befinden. Fast wie ein Embryo muss ich mich verbiegen, damit ich in den Kasten hineinpasse. Theo, der auf der anderen Seite des Halses hängt, sehe ich gar nicht. Mitten zwischen uns thront Tunlin, vor ihm auf dem Nacken des Tieres der Elefantentreiber.
Die 14-jährige Elefantendame versucht, wo’s geht, ein paar leckere Bambusstangen zu ergattern. Sie wird weitergetrieben; sie hat ja etwas zu tun.
Mit dem Boot geht’s anschliessend wieder zurück ins Hotel. Wir essen mit Tunlin, das ist praktisch; er kann uns beraten mit der Speisekarte, wenn die Verständigung zur Herausforderung wird. Drei gebackene Fische aus dem See, ganz frisch, werden aufgetischt, Nudeln, Reis und Brunnenkresse-Salat mit frittiertem Poulet. Dazu wieder mal eine Flasche Wein. Tunlin hält kräftig mit.
Freitag, 13. Oktober - Nay Pyi Taw
Geht da etwas schief? Wenn man abergläubisch ist, schon. Sind wir aber nicht. Und dennoch…
Frühstück, Koffer packen und ab. Eigentlich hatte ich gedacht, am gestrigen Tag hätten wir die längste Strecke unserer Reise zurücklegen müssen. – Nein, heute werden es siebeneinhalb Stunden sein, sagt Tunlin. Zwar viel weniger Meilen, dafür aber Kurven ohne Ende.
Es wird ein „buddha- und pagodenloser“ Tag werden heute. Tunlin will uns nicht überfordern. Er hat Erfahrungen gemacht mit seinen Gästen. Das erzählt er auch gern: „First day: Oh, Buddha, oh! – second day: very nice Buddha – third day: Buddha again – fourth day: oh no, not Buddha again!”
Übrigens fährt ein Buddha auch mit. Er baumelt in einem tropfenförmigen, etwa fünf Zentimeter hohen Glaskästchen am Rückspiegel und meint, er müsse ständig glöckeln. Daran muss ich mich erst gewöhnen. Wenn wir durch Schlaglöcher fahren, überschlägt er sich jeweils – ich bin sicher, es wird ihm schlecht.
So fahren wir zuerst nach Nay Pyi Taw, der Hauptstadt von Myanmar im Kayah State. Bis 2007 war Yangon der Regierungssitz, dann aber wurde dieser von der Militärregierung ins Landesinnere verschoben beziehungsweise neu dort gebaut. Offenbar hatten die Generäle die Idee, dass eine Stadt an diesem Ort im Kriegsfall weniger gut angegriffen werden könne. Das war auch die Meinung der Astrologen, so erzählt man sich.
Nun, es ist kaum zu glauben, was man da zu sehen bekommt. Wir fahren über eine achtspurige Strasse (je vier Spuren auf beiden Seiten) und merken sofort, dass da etwas seltsam ist. Es hat kaum Verkehr. Die Strasse ist schön angelegt, mit bepflanztem, äusserst gepflegtem Mittelstreifen. Vielerorts hat’s Gärtner an der Arbeit. Um riesige Kreisel fährt man und immer breiter wird die Strasse, am Schluss sage und schreibe 22-spurig, auf beiden Seiten elf Spuren. Kaum ein Auto ist unterwegs. Ein Jumbo könnte leicht auf dieser Bahn landen. Nach etwa einer Viertelstunde Fahrt sehen wir linkerhand die protzigen Regierungsgebäude. Wenn keine Session ist, steht alles leer. Und auch die vielen Villen, an denen wir anschliessend während vieler Kilometer vorbeifahren, sind unbewohnt. Eine ganze Reihe von Plattenbauten steht ebenfalls leer. Sie wären für die weniger Begüterten gedacht gewesen. Aber auch die zieht es nicht in dieses künstliche, seelenlose Konstrukt. Vor einem Einkaufszentrum sind zwei Autos parkiert. Es ist eine riesige Geisterstadt, niemand lebt hier, auch ein Zentrum ist nicht vorhanden. - Ein krasses Beispiel von Fehlplanung der damaligen Militärregierung, meint Tunlin. Er regt sich auf, sagt, 14 Milliarden seien verbaut worden, und das nur um zu imponieren. Dabei hätte es viele arme Leute in diesem Land. Schön gelegen ist die Stadt; im Hintergrund sieht man die Berge, in die wir gleich fahren werden.
Die vielen Stunden Fahrt lohnen sich. Die Strasse führt durch eine grossartige Landschaft, abwechslungsreich und voller Überraschungen. Erst ist das Gelände eben. Am Strassenrand steht ein Gemüse- und Früchtestand am anderen. Die Hunderten von Pomelos sind hübsch in kleinen Pyramiden aufgetürmt. Dann geht’s bergauf. Die enge Strasse windet sich steil den Berg hinauf durch den Dschungel, es gibt Kurven über Kurven und immer wieder mal kann man einen Blick in ein tiefes Tobel werfen. Man fährt an steilen Abhängen vorbei, hat oft die wunderbarste Aussicht und hin und wieder ist sogar eine Hütte oder gar eine kleine Siedlung zu sehen. Wer hier oben wohnt…
Dass die Menschen hier Angehörige anderer Ethnien sind, sieht man an ihren unterschiedlichen Kopfbedeckungen. Sie winken uns freundlich zu.
Die Temperatur ist jetzt sehr angenehm, wir stellen die Klimaanlage ab und öffnen die Fenster.
Bei Gegenverkehr auf dieser kurvenreichen Strasse macht mein Magen immer wieder ein wenig einen Hüpfer. Aber Tunlin hat seinen Toyota fest im Griff. Trotzdem kommt es mir oft vor, wir würden nur um Haaresbreite an entgegenkommenden Vehikeln vorbeiflitzen. Wie dann an einer der engsten und steilsten Stellen ein Wagentross mit etwa zehn Geländewagen aus Thailand bergab dahergerast kommt, einer schneller als der andere, zuvorderst ein Polizeiauto, das die Ralley pilotiert, fürchte ich, mein letztes Stündchen habe geschlagen. Tunlin denkt nicht daran zu stoppen, um die Meute durchzulassen, im Gegenteil, ihm passt das und er steuert sein Gefährt im Garacho den Berg hinauf, immer hart am Gegner dran, mit zwei Rädern abseits der Strasse im Schotter. – Wir überleben. Kein Kratzer, aber das war knapp!
Auf der Passhöhe werden wir mit einem herrlichen Blick hinab ins Tal auf einen idyllischen See beglückt. Nach fünfzehn Haarnadel- und etliche andere Kurven weiter unten erreichen wir den See und machen einen verdienten Mittagshalt im Städtchen Pin Long.
Weiterfahrt. Eine Vorspannbrücke (Lane Lee Suspension-Bridge) gilt es zu überqueren. Tunlin lädt uns aus, wir wandern über die Brücke und auf der anderen Seite steigen wir wieder ein. Es hat gut getan, ein paar Schritte zu Fuss zu gehen, auch wenn die Hitze drückt.
Umzugstag bei einer Burmesischen Familie. Ihr Laster ist voll bepackt. Sie winken uns fröhlich zu. Zwei Kilometer weiter sehen wir sie am Strassenrand. Ihr Vehikel hat den Geist aufgegeben und ist kollabiert. – Es tut mir so leid für sie, aber ich wüsste nicht, wie wir helfen könnten.
Ein zweites Mal müssen wir eine Bergkette überqueren. Es geht wieder hinauf auf 1‘500 Meter, die Gegend ist immer noch grün, Mais wird angepflanzt und tonnenweise Bananen.
Wie im Märchen sehen wir plötzlich vor uns ein paar hohe schwarze Felsen, die bizarr aus der Ebene ragen. Obendrauf eine Pagode (Taung Htlvwar Village) mit verschiedenen Stupas, die golden in der Sonne leuchten. Was für ein Anblick! – Auch auf der anderen Strassenseite ein ähnliches Bild. Sieht ganz aus nach Konkurrenz.
Endlich unten im Tal. Es ist flach, wir fahren dem See entlang. Man sieht jetzt ein paar Kirchen. Tunlin sagt, in dieser Gegend seien etwa fünfzig Prozent der Einwohner Christen.- Und immer noch dauert die Fahrt bis zum Hotel eine gute Stunde. Und genau nach siebeneinhalb Stunden, um halb fünf, so wie er gesagt hat, fahren wir bei unserem Hotel vor (Famous Hotel Loikaw) - die Strapazen haben ein Ende.
Erstaunlich auch hier, wie er sich auskennt. Nie fährt er falsch, nie konsultiert er eine Karte, oft wählt er eine Nebenstrasse, von der er weiss, dass dort weniger Verkehr herrscht, ein Navi hat er sowieso nicht.
Beim Hotel angelangt wird’s ernst: Beim Gepäck-Ausladen stellt Theo mit grossem Schrecken fest, dass er seinen Whisky im letzten Hotel vergessen hat. – Was hätte Schlimmeres passieren können an diesem Freitag, dem Dreizehnten?!
Ich denke dann, so hat er wenigstens was getan für seine Gesundheit, weniger allerdings für seinen Seelenfrieden.
Im Hotel mögen wir nicht essen, es hat wieder so einen „schönen“, für asiatische Verhältnisse geschmackvoll ausgestatteten Ess-Saal. Um halb sieben ist es schon dunkel. Innert weniger Minuten ist es tiefste Nacht. Wir spazieren dem See entlang über die zum Teil kitschig LED beleuchtete, farbig blinkende Fussgängerbrücke und finden dort ein Restaurant, das uns passt. Ein feines Nachtessen mit verschiedenen Gerichten und Wein kostet fünfzehn Franken. Der Rückweg über die Brücke führt uns vorbei an Fischern, die mit kleinen Leuchtlämpchen an ihren Angeln Fische fangen oder dies zumindest versuchen und ebenso an etlichen Liebespärchen, die in den dunklen Nischen die laue Nacht geniessen.
Samstag, 14. Oktober – Long-Neck-Women – Lost in translation - Loikaw
Heute geht’s in aller Herrgottsfrühe schon um acht Uhr los – eine ziemliche Herausforderung für Theo, aber er schafft’s - sogar ohne zu murren. Und um’s gleich vorweg zu nehmen, er geht sozusagen als Held von der Bühne, so unausgeschlafen, wie er ist. Dazu aber später mehr.
Wir besuchen den lebhaften Markt von Loikaw. Uns präsentiert sich ein buntes Gemisch aus Waren und Menschen aus verschiedenen ethnischen Gruppen. Tunlin freut sich und sagt einmal mehr: „Where are the tourist? – Only you!“ – Das freut uns natürlich auch. Nicht zu vergleichen mit dem Markt in Rosas, wo man ausser Berndeutsch und Französisch kaum eine andere Sprache hört. Auch ist das Warenangebot recht unterschiedlicher Natur. Zwar werden auch Kleider angeboten, die beliebten Fussball-T-Shirts, Gemüse und Früchte, Chillys, aber dann auch frische Fische, die noch zappeln, getrocknete Frösche, Blumen, Nägel und Schrauben in jeder Grösse, Kinderspielzeug – man kann alles haben.
Hier sehen wir zum ersten Mal ein paar „Langhals-Freuen“, die ihre Ware anbieten. Es sind vor allem Shawls, die sie selber aus Baumwolle spinnen, die Fäden färben und dann verweben. Ein solches fein gewobenes Tuch kaufe ich. Ich bin ganz perplex, wie ich weiter hinten im Markt eine andere Verkäuferin sehe, die die Zwillingsschwester der ersten sein könnte. Und dann noch eine dritte… Es ist ja eigentlich kein Wunder, wenn man aus seinem kleinen Dorf nicht rauskommt und dann ähnlich aussieht wie die Nachbarin…
Nach dem Marktbesuch geht’s in die Berge zu den Long-Neck-Women. Wir besuchen in einem Dorf (Panpat) zwei Familien. Wir müssen einen Dolmetscher mitnehmen. Ein junger Mann, der beide Sprachen spricht, die der Einwohner und Burmesisch, kommt mit uns. Die Grossmutter, die wir zuerst besuchen, lässt sich gerne fotografieren, zeigt ihren Schmuck und ihr Haus, Küche, Schlaf- und Wohnzimmer, ist sehr freundlich und bietet uns Tee und Wein an. Der Wein wird selber hergestellt aus den Millet-Pflanzen (eine etwa zwei Meter hohe Reissorte), die praktischerweise gleich vor dem Dorf in grossen Mengen wachsen. Die Körner dieser Pflanze werden in Wasser, Reisbrei und Hefe eingelegt, das Gebräu ist dann 15 %-ig und wird warm aus einem Tonkrug getrunken. Tunlin erklärt uns, dass bei diesem Tribe die Männer, wenn sie sich verheiraten wollen, sich die Frauen nicht nach dem Aussehen aussuchen, sondern diejenige wählen, die den besten Wein herstellt.
Lost in translation: Lustig ist unsere Konversation mit der Dame: Sie fragt etwas, der Junge übersetzt ins Burmesische, Tunlin erklärt mir’s auf Englisch, und ich sag’s Theo, der ja ein wenig schwerhörig ist, auf Berndeutsch. Bis die Übersetzung bei mir angekommen ist, dünkt mich fast, ist sie ziemlich viel kürzer geworden – grad wie im Film mit Bill Murray. Wir bekommen aber mit, dass sie 63 Jahre alt ist, sieben Kinder hat und vierundzwanzig Grosskinder. Zwei bis dreimal war sie in der Stadt, in Loikaw, das etwa 20 km weiter nördlich liegt. Ich kaufe ihr ebenfalls einen Shawl ab und – pikantes Detail – sie steckt das Geld oben in ihren überlangen goldenen Halsschmuck, gleich unter dem Kinn.
Um dieses Dorf überhaupt besuchen zu können, muss man erst eine Bewilligung bei der Regierung einholen. Tunlin zeigt uns das Dokument. Alles bestens mit Stempel versehen und bewilligt. Unsere Passnummern sind vermerkt und unsere Vornamen. Der Nachname scheint uninteressant, der ist gar nicht erwähnt.
Es leben neun verschiedene Stämme in der Gegend um Loikaw, sieben davon darf man nicht besuchen. Untereinander haben sie Fehden.
Der Weg zu den Kaya-Stämmen ist eindrücklich. Man fährt durch eine seltsame Landschaft, die voller stark bewaldeter Berge ist; wie grüne Zuckerhüte sind sie überall verstreut.
Mu Er (oder so) heisst unsere Gastgeberin. Sie ist eine Lustige. Mit ihr kann man lachen, obwohl wir uns ja nicht verstehen, und sie erklärt uns bereitwillig, wie man den schweren Messingschmuck, den sie um den Hals trägt, anzieht. Die Prozedur dauert einen Tag lang und wenn man die Ringe wieder loswerden will, was eher utopisch ist, braucht man während dreier Wochen eine Stütze, sonst würde man den Eingriff nicht überleben. - Da verzichte ich lieber.
Die zweite Frau, die wir besuchen, zeigt uns, wie man aus Baumwolle einen Faden spinnt. Sie weist uns Plätze an in einem Halbkreis vis-à-vis von ihr auf ganz kleinen niedrigen Bänklein, unbequemer geht’s gar nicht. Auch sie ist sehr freundlich und beantwortet unsere Fragen bereitwillig. – Von uns möchte sie nur gerne wissen, wo wir herkommen und ob wir auch Reis essen.
Mit einem kurzen Besuch auf dem langen künstlichen Damm endet unser Vormittag.
In einem sehr hübschen Restaurant mit faszinierender Aussicht auf die Reisfelder und die Berge, „Marco Polo“, essen wir eine kleine Mahlzeit und anschliessend geht die Fahrt in den Südwesten zu einem anderen Dorf, zu einer anderen Ethnie, nach Hta Nee Lar Lae. Ein älteres Ehepaar (in unserem Alter) spielt uns Musik vor auf einem selbstgemachten Instrument aus Bambus und einer einfachen Geige aus Holz. Er singt sogar dazu und sie hat sich zu Ehren ihrer Gäste in die traditionelle Kleidung gezwängt. Was sie sich über Knie und Oberschenkel gezogen hat, sind meterweist Baumwoll-Schnüre oder Bändel, schwarz lackiert, die aussehen wie die Lakritze-Spaghetti, die wir als Kind manchmal hatten.
Auch das ist nicht das bequemste aller Outfits, man kann sich nur wundern, weshalb und wieso man sich solche Beinkleider freiwillig anzieht.
Die Frau spielt zuerst alleine, ihr Mann kommt von der Jagd zurück, wie er sagt. Bewaffnet ist er mit einem Pfeilbogen. Das macht natürlich Eindruck! (Eine Beute sehe ich allerdings nicht.) Um zu beweisen, was für ein guter Jäger er ist, schiesst er auf ungefähr zehn Meter Entfernung mit dem Ding auf einen Baum, an dem eine kleine weisse Zielscheibe aus Papier hängt, etwa 10 cm im Durchmesser. Der Pfeil trifft in die Mitte. – Grosse Bewunderung allerseits. Ein paar Dorfjungen schauen zu.
Jetzt ist Theo gefragt. Ob er das auch kann? In allen Gesichtern steht schon eine Art „Vor-Schadenfreude“ geschrieben. Der weisse Touri… Und siehe da: Ich kann’s selber kaum glauben: Theo legt an und trifft ebenso mitten in den weissen Kreis! – Einen Moment lang herrscht betretenes Schweigen. Niemand hätte das erwartet. Theo, der grosse Held!!! Ich bin natürlich stolz. Er aber, bescheiden, wie er ist, erklärt, dass die Armbrust halt sozusagen unsere „National-Waffe“ sei seit dem 12. Jahrhundert, für Schweizer also ein Nasenwasser (das hat er zwar nicht ganz so gesagt, aber in etwa so gemeint) und er fügt hinzu, schon unser Nationalheld, der Wilhelm Tell, habe damit auf den Landvogt geschossen, sei also eigentlich ein Terrorist gewesen. – Ich glaube nicht, dass irgendjemand ausser mir von dieser Geschichtsstudie etwas mitbekommen hat, Tunlin hat jedenfalls nichts übersetzt.
Auf der Rückfahrt nach Loikaw besuchen wir die Town Quell Pagode, das Wahrzeichen der Kayah Region, die entweder mit einem angebauten Lift (Schindler), eine architektonische Scheusslichkeit, oder mit einer nicht enden wollenden Treppe hoch oben auf dem Hügel erreichbar ist. Endlich wieder mal etwas Buddhistisches, dünkt uns fast. Sie ist mehr als nur sehenswert. Oh und ah!!! Sie ist auf neun Felsen gebaut in etwas mehr als hundert Metern Höhe. Sagenhaft. Und sagenhaft ist auch der Ausblick von dort oben über die Stadt. Dazu kommt im Moment noch die ausnehmend schöne Stimmung: Im Norden ist der Himmel schwarz, man sieht, es regnet, und auf der andern Seite leuchten die grünen Reisfelder in der Sonne.
Am Abend möchten wir uns gerne einen Apéro genehmigen; das ist aber schwierig. Im Restaurant auf der andern Seite unseres Hotels sagen sie, sie hätten keinen Alkohol. Über dem Tresen allerdings sehen wir Flaschen stehen – ein Missverständnis also. Aber Cocktails können sie keine machen. Wir gehen weiter und landen schliesslich wieder im selben Restaurant wie gestern. Wir essen gut, es gibt ein Bier für Theo und eine Flasche Wein für uns beide, dann machen wir uns auf den „Heimweg“. Unterwegs bei der Brücke treffen sich die Jungen; es sind noch viele mehr als gestern. Schliesslich ist es Samstagabend. Einige grüssen, kichern dann, wenn sie „Hallo“ sagen, einer sucht das Gespräch (ich glaube, er wollte mit seinen paar Brocken Englisch seinen Kameraden imponieren) und sagt: „Excuse me, where are you from?“ – „From Switzerland“, entgegne ich. Seine Antwort: „Oh, my God!“. Ich fand’s lustig, weiss aber nicht, was ihn zu diesem ausserordentlichen Ausruf bewogen hat.
Sonntag, 15. Oktober 17
Im Speisesaal sind wir die einzigen Gäste. Sechs runde Tische mit goldenen Tischtüchern und zehn Stühlen drum herum laden zum Frühstück ein. Eine Atmosphäre wie im Eisschrank. Lange dauert unser Aufenthalt dort nicht.
Es ist wieder mal neun Uhr. Tunlin holt uns ab und mit ihm kommt ein Bekannter, ein zweiter Fahrer, denn auf dem Programm steht eine Bootsfahrt über den Pékon-See zum Inle Sanctuary Resort, wo wie übernachten werden. Der andere Fahrer übernimmt den Toyota und bringt ihn in drei Tagen wieder dorthin, wo wir mit dem Schiff ankommen werden.
Wir sind hier im Gebiet der Shan, der grössten ethnischen Minderheit in Myanmar.
Erst machen wir kurz Halt beim Kayan-Community-Center. Es ist Sonntag, man trifft sich dort, die Jungen lassen ihre selbst gebastelten Drachen fliegen. Auf dem Feld gibt es eine ganze Anzahl hoher Totem-Pfähle mit Ornamenten aus Metall obendrauf: Mond und Sonne, Reiskorn, Hühnerknochen und so weiter. Die Kayans, auch wenn sie vielleicht Buddhisten oder Christen sind, sind auch Animisten. Das haben wir schon in den Dörfern gesehen, die wir am Vortag besucht haben. Vor den Hauseingängen sind Verzierungen aus Hühnerfedern und –knochen angebracht. Jedes Dorf hat auch seinen Schamanen.
Paradiesische Bootsfahrten
Wir fahren weiter nach Phe Khon zur Bootanlegestelle. (Fast jeder Ortsname hat mindestens eine zweite Schreibweise, dann auch noch eine auf Englisch, was der Orientierung auf der Karte nicht unbedingt förderlich ist).
Es ist Markt und der Toyota muss sich durch die Menge drängen. Unser Gepäck wird aufs Boot verladen, wir dann ebenfalls. Hübsch: Die drei Sitze sind mit roten Plüschkissen ausgestattet. Wir sind startklar - diesmal geht’s mit Motor zur Sache. Das Boot flitzt über den stillen dunklen See, der kaum Wellen aufweist. Die Berge, das Ufer und die riesigen Kumuluswolken spiegeln sich darin – eine einzigartige und faszinierende Fahrt. Tunlin freut sich wieder und sagt: „That’s what I told you: only one boat on the lake“. Sein Stolz ist es, uns sein Land „off the beaten track” zu präsentieren, nicht nur, aber doch zum grössten Teil. - Ja, und das gelingt ihm gut. Was wir in den letzten Tagen erlebt haben, steht in unserem sonst ausführlichen Führer nicht drin. Zum Inle-See, der wohl im Programm jedes Myanmar-Reisenden steht, will er uns über zwei andere Seen führen – eben per Boot.
Und erneut ist unser heutiges Ziel ein einmaliger Ort: das „Inle Sanctuary“, in Pha Yar Tawng. Nach einer wunderschönen, fast anderthalbstündigen Fahrt durch Seegras und See-Hyazinthen erreichen wir den paradiesischen Ort. Das Hotel ist gerade mal ein Jahr alt und hat nur sechs Zimmer. Es sind Bungalows, die auf hohen Stelzen im Wasser stehen. Sie sind geräumig, schön und grosszügig aus Holz gebaut, eine Terrasse mit zwei Liegestühlen lädt zum Verweilen. Aber das Beste: Im See, in dem die Hotelanlage steht, kann man schwimmen. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Wie gut, bei dieser Hitze ein Bad zu nehmen. Oben ist die Wasserfläche warm, weiter unten schwimmt man in kälteren Schichten.
Zurück im Zimmer sehen wir, wie die umliegenden Berge immer mehr im Nebel verschwinden. Dann beginnt es zu regnen. Macht nichts. Es ist immer noch warm und wir essen auf dem Deck im Restaurant mit Tunlin zu Mittag.
So langsam aber sicher geht mir das burmesische Geld aus, die roten, blauen und grünen Noten. – Das ist aber kein Problem, Tunlin sei Dank. Er ist meine Bank und hat immer genügend Reserve dabei.
Ein Ruhestündchen. Um fünf treffen wir uns wieder und machen einen etwa zwanzigminütigen Spaziergang zum Kloster. Es wird von dreizehn Mönchen geführt; 1‘200 Kinder werden dort betreut. Sie sind entweder Weisen oder haben arme Eltern, die die Ausbildung nicht bezahlen können. Die meisten Kinder sind grad beim Essen, einige spielen Fussball, wie wir unseren Rundgang beginnen. Man hat den Eindruck, es gehe sehr fröhlich zu und her. Alle haben eine Gamelle, die sie nach der Mahlzeit selber wieder abwaschen. Gleich ist Gebetsstunde, dann wird gelernt bis um neun und anschliessend ist Feierabend. Der nächste Tag beginnt für alle wieder um fünf Uhr morgens. – Mit Gebetsstunde.
Der „Vize-CEO“ gesellt sich zu uns und stellt sich vor. Er führt uns herum, Tunlin übersetzt. Inzwischen ist es dunkel geworden. Wir werden auch vom Chef empfangen, dürfen uns auf Stühle setzen, Tunlin kniet auf einer Bastmatte vor ihm hin und verneigt sich. Zwei Girls sitzen in gebührendem Abstand ihm gegenüber und warten untertänigst auf Order. Tee und Papaya bringen sie für uns.
Ich gebe dem Boss eine „Donation“. Das Problem ist, er darf Geld nicht von mir direkt annehmen. Also wird ein goldener Kelch als Go-Between benutzt. Ich lege die Kohle hinein und dann ist die Schose perfekt. Tunlin spendet ein Buch – das kommt auch in die goldene Schale. – Während einer geschlagenen Stunde trinken wir Tee und „unterhalten“ uns. Wie in einem fremdsprachigen Film ohne Untertitel läuft’s ab. Zur Abwechslung geht’s mal nicht darum zu erfahren, wie viele Kinder wer hat.- Er will wissen, wie die Schule und das Ausbildungssystem in der Schweiz funktioniert. Bereitwillig geben wir Auskunft, wie viel aber herüberkommt mit der Übersetzung, weiss ich nicht. Manchmal wird genickt, manchmal nachgefragt. Die beiden Girls hängen an unseren Lippen, obwohl sie nichts verstehen. Noch mehr Tee wird angeboten, auch ein Abendessen. Aber das haben wir ja bereits im Hotel bestellt (zum Glück).
Wir bedanken uns (chesuba) und verabschieden uns. Weils im Moment wieder zu regnen begonnen hat, bestellt uns der Mönch ein Auto, um uns zurück ins Hotel zu bringen. Wir sind natürlich froh, denn mit unseren Flip Flops bei Dunkelheit den Weg zurückzulegen, wäre tatsächlich eine Herausforderung gewesen. – Wir werden herzlich verabschiedet und beide erhalten wir eine Papaya mit auf den Weg. – Im Auto stinkt’s gewaltig. Es ist ja nur ein kurzer Weg; wir werden keinen Schaden davontragen. – Im Hotel warten sie schon auf uns. Mit Schirmen. So bedacht werden wir zu unserem Häuschen begleitet. Jetzt hab ich eine Dusche nötig. – Ein feines Nachtessen erwartet uns. Wir sind ja die einzigen Gäste; alle Aufmerksamkeit der Welt konzentriert sich auf uns, wir konnten sogar zuvor beraten, was wir zum Essen haben möchten. „This is your home“, sagt Aung Min. Die Herzlichkeit dieser Leute ist einmalig, wie gerne würden wir eine weitere Nacht hier an diesem stillen, friedlichen Ort verweilen.
Am nächsten Morgen werden wir mit einem köstlichen Frühstück überrascht. Das Toastbrot, das ich sonst überall verschmähe, ist ausnehmend gut. Die Omelette ebenso und erst die Guacamole und der frisch gepresste Limejuice! – Schade, geht die Reise schon wieder weiter.
Um neun sind sowohl Tunlin als auch unser Bootsführer (Cruise-Captain, wie Tunlin ihn nennt) pünktlich zur Stelle. – Es gibt eine herzliche Verabschiedung (wir versprechen, per Whatsapp in Kontakt zu bleiben) und schon fährt das Boot los Richtung Norden.
Mit grossem Geschick steuert Tin das schmale Gefährt durch den stillen See, in dem sich die ganze Gegend spiegelt; man hat das Gefühl, man segle durch eine doppelte Welt, immer schön unterhalb der Schnittstelle entlang. Am meisten mag’s der Captain, wenn er durch Schilf- und Wasserhyazinthen–Pfade hindurchdonnert. Uns macht’s auch Spass; es scheint, als ob das Schiff über Land dahinsause. Wahrscheinlich ist die Geschwindigkeit etwa 30 km/h, mir kommt’s aber oft schneller vor. Nur hin und wieder begegnet uns ein Fischer in einem Boot wie dem unseren, ein paar Enten sehen wir und eben all die schwimmenden Pflanzeninseln, Seerosen manchmal auch, und Lotus. – Es ist atemberaubend schön.
Von weitem erkennt man am Ufer die Spitzen von Stupas. Nicht golden, aber rötlich und grau. Wir kommen näher und halten an. Samkar heisst das Dorf, nach dem der See benannt ist (oder umgekehrt). Bis zum Wasser reicht der Stupa-Friedhof, den wir schon von weitem gesehen haben (Das Wort Stupa heisst übrigens Friedhof, wie mir Tunlin erklärt. In jedem dieser Türme ist eine Reliquie begraben). Der Anblick ist gewaltig und treibt mir fast die Tränen in die Augen. Die Pagode stammt aus dem 15. Jahrhundert. Einige der Stupas aber werden renoviert; es sind Arbeiter dort, die viel zu tun haben, denn die etwa siebzig Bauwerke sind arg zerfallen oder stark von Bäumen bewachsen. Was für ein bezaubernder Ort!
Weiter geht die Bootsfahrt. Auf einem Kleinstinselchen steht ein grosser Baum. Oder ist es ein Stupa? - Beides. Völlig ineinander verflochten. Und ein wenig weiter weg gleiten wir erneut an ein paar zerfallenen Stupas vorbei, diesmal sind’s nur etwa ein Dutzend. Ein Tempel steht dort, gerade noch; wie der schiefe Turm von Pisa hat er Schlagseite und ist stark beschädigt. – Alle diese Bauten spiegeln sich im Wasser, was das Bild noch viel erhabener macht.
Etwas weiter nördlich erneut eine Pagode. Sie ist riesig im Vergleich zu den anderen und ist gut erhalten. Umgeben von rot blühenden Blumen (eine Art Gladiolen) ist auch dieser Anblick einer für Götter und sicher auch für Touristen, nur hat’s davon keine. Viele der über hundert Türme sind mit Reliefs geschmückt, auch kleine Tempel sind vorhanden, in die man eintreten kann. Drinnen dann, wen wundert’s - Buddhas, Buddhas, Buddhas.
Mindestens eine halbe Stunde lang spazieren und fotografieren wir im Gelände herum und staunen ob der Vielfalt und der stillen Schönheit der Anlage.
Vom oberen Ende des Sees führt ein Fluss zum Inle-See. An dessen Ufer halten wir bei einer Töpferei an und die Töpferin offeriert uns Tee. Ihr Können demonstriert sie uns mit einer einfachen Drehscheibe, die sie von Hand betreibt. In etwa zwanzig Minuten entstehen ein mittelgrosser Krug und fünf kleine Gefässe. Wir dürfen auch probieren, wie das geht. Ich verzichte, Theo aber formt einen Aschenbecher, so wie er schon früher welche produziert hat: Am Rand der Schale hält eine Lippe eine Zigarette. - Ob sie das Teil je färben, glasieren und brennen wird…
Die Bootsfahrt dauert weitere zwei Stunden. Ich geniesse jede Minute davon. In der Sonne sitzen und sich durch die schönste Gegend steuern lassen, das angenehme Fahrtwindchen geniessen – wie phantastisch ist das denn?
Inle-See
Durch Dörfer, die alle im Wasser stehen, tuckern wir hindurch, der Bootsverkehr nimmt jetzt zu, da wird reger Handel getrieben. Ohne Boote geht hier gar nichts, denn mit dem Auto sind die Pfahlbauer-Dörfer nicht erreichbar. Wie wir in Ywama im Inle-See ankommen, ändert alles komplett. Jetzt sind es nicht nur Boote der Einwohner, die Waren transportieren, oder Fischer, jetzt hat es auch Boote, die Touristen herumkutschieren. Der Lärm von den vielen Motoren lässt den Zauber der stillen Landschaft, durch die wir in den letzten vier Stunden gefahren sind, verschwinden. Innerhalb von fünf Minuten sehen wir so viele Touristen, wie während der ganzen letzten fünf Tage nicht. Es hat viele Restaurants und Hotels, die Gegend boomt. Tunlin sagt, als er vor fünf Jahren hier gewesen sei, habe es nur gerade drei Hotels gegeben am ganzen See. Jetzt sind es unzählige. Und die Farbe des Wassers ist braun. Wie ich im Internet lese, dass dieses Paradies hier in Gefahr ist, wundere ich mich nicht.
Das Boot hält vor einem eleganten Restaurant, dem Golden Moon, an dem angeschrieben steht, es gäbe Espresso. Wir staunen auch über die Menu-Karte. Europäische Speisen kann man bestellen, in verschiedenen Sprachen steht geschrieben, was es alles gibt – ganz klar: hier ist man auf Touristen eingestellt. An den Bootsstegen wird man erwartet, beim Aussteigen wird geholfen, es gibt hier sogar eine Art Valet-Service: Ein Angestellter parkiert das Boot irgendwo anders und bringt es wieder hin, wenn man gehen will. Das alles funktioniert reibungslos; es ist das tägliche Brot der Bewohner, die mit den langen, hübschen Booten so vertraut sind wie die Holländer mit ihren Fahrrädern.
Die Inthas (Kinder des Sees), wie sich der Volksstamm hier nennt, sind offenbar vor etwa 200 Jahren vor den Thailändern aus dem Süden ins Innere des Landes geflohen, und weil man sie nicht ansiedeln lassen wollte, bezogen sie das Land im See, auf das niemand Anspruch erhob, und seitdem haben sie ihr Leben dort angepasst.
Um vier sind wir im Hotel Shwe Inn Tha Floating Resort. Alle Bungalows sind schön ausgestattet mit Holz und stehen natürlich im Wasser. Es ist sehr gemütlich hier. Eigentlich wollten wir noch eine Weile den anmutig angelegten Pool geniessen, aber es beginnt zu regnen. Fast jeden Tag regnet es gegen Abend. Mal länger, mal kürzer.
Hier gibt’s auch eine Bar. Schön, wieder mal einen Cocktail zu trinken und zuzusehen, wie die Nacht den Tag ablöst. – Die Mücken interessiert dieses Bild wenig. Sie tun sich gütlich an meinen Füssen, was ich leider erst spüre, wie der Schmaus schon vorbei ist und sie längst abgezogen sind.
Dienstag, 17. Oktober - Handwerkerbetriebe
Neun Uhr: Tunlin wartet bereits am Bootssteg, Tin ebenfalls; wir können einsteigen und unsere beiden Handgepäckskoffer werden verstaut.
Heute ist ein Werkstatt-Besuchs- und Shopping-Tag. Zuerst geht’s in die Weberei. Schon von weitem hört man das Ritsch-Ratsch der Webstühle. Es ist eine Fabrik, die wir besuchen, aus Bambus gebaut und natürlich auf Stelzen. Mindestens fünfzig Frauen verrichten all die verschiedenen Arbeiten, die es braucht, um die wertvollen Stoffe herzustellen. Erst müssen die langen Stängel der Lotusblumen und -blätter aus dem Teich gefischt, angeschnitten und gebrochen werden, um die Fasern zu gewinnen. Anschliessend werden die feinen weissen Fäden aufgewickelt, getrocknet, zu Zwirn verarbeitet, gefärbt und schliesslich verwoben. Aus Seide und diesen Lotusfäden entstehen schliesslich am Webstuhl hübsche Stoffe. Die Frauen arbeiten in Windeseile, lassen die Schiffe durch die gespannten Kettfäden gleiten, treten mit den Füssen die richtigen Pedale und mit grösster Konzentration und Geschicklichkeit entstehen so Stoffe mit Mustern, die sie ohne Vorlage aus dem Kopf hinzaubern.
Ich kaufe mir einen Schal und eine Bluse.
Beim Schmied schauen wir zu, wie zu fünft gearbeitet wird. Ein Messer entsteht. Eine Frau betreibt die Blasbalgvorrichtung, der Schmied hält ein Stück Eisen in die Glut, das legt er dann auf den Amboss und drei Jungen, fast noch Kinder, schlagen im Takt in immer gleichem Rhythmus auf das glühend rote Eisen ein und hämmern es nach und nach platt. Ein paarmal wird dieser Vorgang wiederholt. Die Präzision ist unglaublich, die Konzentration meint man fast zu spüren; es sieht so einfach aus - der Tanz der Hämmer... Ich versuche, eines dieser Werkzeuge hochzuheben. Die sind so schwer, es gelingt mir kaum. Wie die Jungen, die so mager und kraftlos aussehen, diese schwere Arbeit schaffen, ist mir schleierhaft. Und noch dazu bei dieser Hitze.
Einen weiteren Besuch statten wir bei einem Bootsbauer ab. Schön, wie das Holz gesägt, gebogen und zusammengeleimt wird, so dass schliesslich eines dieser eleganten, schmalen, langen Boote entsteht, wie sie in dieser Gegend Gang und Gäbe sind.
In einem Nebenraum dieser Handwerksstädte werden Zigarren gedreht. Drei Frauen sitzen am Boden und wir können zuschauen, wie genau das geht. Sie sind äusserst geschickt; wie im Traum geht das Drehen vonstatten. Den Handgriff haben sie sicher schon mehr als x-zehntausend Mal ausgeführt.
Jetzt ist wieder Zeit für eine Tempelbesichtigung. Es ist der wichtigste Tempel in dieser Gegend. Sein Name: Phaung-Daw-U-Pagode. Das ganze Drum und Dran kommt uns natürlich ein wenig (sehr) kitschig vor. Aber die Leute sind bei der Sache. Die Frauen sitzen vor dem Altar herum, die Männer sind mitten auf dem Podest, wo fünf Buddhas stehen, die man auf Anhieb niemals als solche erkennen würde. Ich, als Banause, dachte erst, was Komisches das sein soll, die fünf Figuren sehen aus wie überdimensionierte Eiscreme-Scoops in je einem Becher. Goldenes Eiscreme halt. Gar nicht so daneben eigentlich, denn auf einem Bildschirm, der an einem Balken hängt, kann man in Echtzeit zusehen, was genau da oben abläuft, also grad genauso wie in einer Schauküche. – Peinlich, peinlich dann meine Fragen. Tunlin erklärt mir, die Figuren (Eiscremes) seien die fünf Buddhas, die von den anwesenden (Köchen) seit Jahrzehnten Tag für Tag mit kleinen Goldblättchen bedeckt und beklebt würden (genauso wie beim Golden Rock) bis sie eben gar nicht mehr zu erkennen seien.
Frauen dürfen übrigens auch hier nicht mitmachen bei der Goldankleberei (Ladies prohibited). - Ok, kleb ich halt nicht. Aber ich geh auch nicht vor der Szene auf die Knie und bete. Das besorgen andere. Touristen hat es nämlich viele, die meisten allerdings aus dem eigenen Land.
Vor dem Mittagessen liegt noch eine Handwerkstätte drin: eine Gold- und Silberschmiede. Das gefällt mir gut, denn was man da kaufen kann, macht keine Probleme im Koffer. – Also gönn ich mir etwas.
Beeindruckend auch hier, wie die paar Männer, die an ihren Pulten sitzen, mit äusserster Geduld, Geschicklichkeit und Präzision die minuziöse Arbeit mit den Silberfäden und –plättchen und –kügelchen erledigen. Eine enorme Herausforderung für die Augen im Halbdunkel. Auch hier dürfen wir zuschauen, fotografieren, niemand lässt sich bei der Arbeit stören.
Tin bringt uns wieder ins „Golden Moon“, wo das Essen wirklich hervorragend ist.
Anschliessend werden wir zur Inthein-Pagode gefahren, einem weiteren Stupa-Ruinen-Feld. Über tausend Stupas kann man besichtigen. Viele Boote haben bereits angelegt, aber wo sind die Touristen? Tunlin geht mit uns einen Weg, den sonst offenbar niemand einschlägt. Er führt uns durch den untersten und ältesten Teil der Anlage, wo’s Stupas hat, die aus dem 15. Jahrhundert stammen. Sie sind teilweise fast völlig überwachsen, was den Bauwerken meiner Meinung nach einen besonderen Scharm und Reiz verleiht. Hier wie auch in Samkar sieht man wie die Gebäude mit Ziegensteinen aufgebaut wurden, dann mit Stuckatur verziert. Und später hat die Natur begonnen, sie in Besitz zu nehmen – Gras, ganze Büsche und sogar Bäume wachsen auf ihnen und durch sie hindurch. Einer dieser Tempel ist besonders schön und reich verziert. Bis zur Hälfte war er offenbar bereits im Boden verwachsen, jetzt wurde der Erdhügel abgetragen und das Bauwerk renoviert. Wir folgen Tunlin und erreichen den Hauptteil der Tempelanlage (18. Jhd.) von einer anderen Seite her, als das offenbar üblich ist. Mit gutem Grund, wie wir bald schon merken. Eine Touristengruppe kreuzen wir, die gehen aber einen anderen Weg und wir sind wieder alleine mitten im dichten Stupa-Wald. Einige der Bauwerke sind bereits renoviert, an anderen wird gearbeitet; sie werden neu aufgebaut, so wie sie vermutlich einmal waren. Diese gefallen mir aber viel weniger gut als diejenigen, die von der Zeit gezeichnet sind. Ich bin nicht sicher, ob das viele Geld, das man in diese Renovationsarbeiten steckt, so gut angelegt ist. Es ist jedenfalls eine Riesenarbeit, ein monströses Projekt.
Wir sind jetzt zuoberst auf der Tempelanlage angelangt. Von unten, von der Bootsanlegestelle bis hierhin führt der Zugang zum Heiligtum, so wie das überall üblich ist (teils Treppe, teils eben), nur ist dieser hier der längste, den es gibt in diesem Land. Er ist 700 Meter lang und mir erscheint er noch sehr viel länger. Er will nicht enden. Und gesäumt ist er beidseitig mit Souvenir-Ständen der Einheimischen. Zum Glück sind die Dutzenden von Händlern bereits am Abräumen und Zusammenpacken. Sie behelligen uns kaum mehr. - Ich stelle mir jetzt vor, wenn wir vor einer Stunde den umgekehrten Weg genommen hätten, vom Bootssteg bis oben an all den Verkäufern vorbei, das wäre ein Spiessrutenlauf geworden. Auch hier hat Tunlin unsere Besichtigungstour zeitlich gut gewählt und einmal mehr äusserst geschickt geplant. Wir drei sind nämlich wieder mal die Einzigen, die noch unterwegs sind. – Es ist jetzt fast schon fünf Uhr; die Boote sind alle weg, wir werden zum Hotel gefahren und haben vor dem Apéro in der Bar noch Zeit, ein wenig im Pool zu baden und uns auszuruhen.
Theo ist der vielen Nudeln doch bereits überdrüssig. Reis ist auch ein wenig suspekt, ist ja schon fast wie Gemüse, wächst ja auch in der Erde. Und wenn schon, dann Risotto. Also: Er will eine Pizza Hawaii. Ich rate ihm ab, aber nein, es muss sein. Sie sieht schon ein wenig seltsam aus – mit einer käseartigen Masse ist sie überbedeckt, die Ananasstücke sieht man nicht, die sind irgendwie darunter versteckt, den Schinken sieht man ebenso wenig - kein Wunder, er ist gar nicht vorhanden. – Ich will nicht probieren.
Nach der Hälfte gibt mein Gatte auf. Im Reiseführer stand, man müsse sich nicht sorgen, wenn man seinen Teller nicht ausesse. Da gäbe es immer jemanden, der oder die sich gerne mit den Resten begnügen würden. Nicht wie bei uns, wo alles weggeworfen und nicht einmal den Schweinen gegönnt wird. – So darf sich also jemand anderes an der andern Hälfte einer köstlichen Pizza Hawaii erfreuen.
(Die Pizza kostet übrigens ein Vermögen für hiesige Verhältnisse: 10 US$. – Für weniger als diesen Betrag haben wir unterwegs zu dritt zu Mittag gegessen, Getränke und Trinkgeld inbegriffen.)
Mittwoch, 18. Oktober - Unterwegs nach Bagan
Es wird ein langer Tag werden heute. Wir sind im ganzen neuneinhalb Stunden unterwegs.
Um acht Uhr holt uns Tin ab und fährt uns quer über den Inle-See bis nach Nyaung Shwe. Er lässt nichts anbrennen, das Boot speedet geradewegs zum Nordende des Sees. Dort verlangsamt er, so dass wir den Fischern zuschauen können, die ihre Kunststücke vorzeigen, die in jedem Reiseführer stehen und die man einfach im Kasten haben muss: Die Männer stehen mit einem Fuss hinten auf dem wackligen Boot, mit dem anderen und der einen Hand balancieren sie die Reuse hoch in der Luft und mit der anderen Hand halten sie sich am Paddel fest. „Einbeinruderer“ werden sie genannt. Das sieht sehr graziös aus und ist natürlich mehr als nur ein Foto wert. Das wissen sie ganz genau und bitten dann auch um einen Obolus. - Es ist das erste Mal, dass jemand Geld haben will, aber für diese tolle artistische Vorführung ist so eine grüne Note à 1000 Kyat (75 Rp.) nicht zu viel verlangt. – Bei den zahllosen Touri-Booten, die hier herumkurven, werden die Fischer bald ein Vermögen verdient haben.
Von nun an geht’s durch den Kanal, der nach Nyaung Shwe führt, wo’s wieder Strassen und Autos hat. Noch sechs Kilometer weiter, dann sind wir am Ziel, am Bootssteg, wo Tunlin und sein Toyota bereits auf uns warten. Eine Stunde hat die Überfahrt gedauert.
Leider ist das Wetter für einmal nicht strahlend schön, es ist bedeckt und sieht stark nach Regen aus. Kaum sind die Koffer und wir im Auto verladen, fallen auch schon die ersten Tropfen. So ein Glück! Auf dem Boot wär das nicht ganz so angenehm gewesen. – Nach einer kurzen Fahrt halten wir an beim Kloster Shwe Yaunghwe Kyaung und wer hätte es gedacht: Der Regen hat schon wieder aufgehört. So nett von ihm!
Im Kloster werden grad ein paar Novizen unterrichtet. Sie sitzen im Halbdunkel am Boden und schreiben in ihr Heft. Nicht eben eine praktische und gesunde Körperhaltung. Sie tun mir leid, die kahlgeschorenen Kleinen. Im Chor singen sie nach, was ihnen ihr Lehrer vorgibt. Absolute Disziplin herrscht.
Im Tempel nebenan gibt es eine Art Kreuzgang. Buddhas über Buddhas sind dort in kleinen Nischen untergebracht, die meisten sind in ein kitschiges rotes Tuch gehüllt. Darunter steht der Name der Person, die eine Schenkung gemacht hat. Auch Schweizer sind dabei.
Die Fahrt geht weiter; eine Bergkette haben wir zu überqueren. Tunlin hält unterwegs bei einer Familie an, die eine kleine Werkstatt hat, in der chinesische Sonnenschirme hergestellt werden. Alles wird von Hand fabriziert und wenn ich nicht gesehen hätte, wie all diese minuziösen Arbeiten tatsächlich ohne elektrische Maschinen ausgeführt werden, ich hätte es nicht geglaubt. Die Präzision ist einmalig. Und in welcher Geschwindigkeit gearbeitet wird, ebenfalls. Exakt passt alles ineinander, sogar die Vorrichtung, die beim Schirm das Gestell festhält, funktioniert tadellos. Stolz wird uns präsentiert, wie das gemacht wird. Ich bin tief beeindruckt. Und die Girls zeigen, wie das Papier geschöpft wird, das für die Bespannung benötigt wird. Am Ende wird der „Stoff“ imprägniert; er ist dann absolut wasserdicht. Leider kommt ein Kauf nicht infrage, Holz und Bambus nach Australien einzuführen, ist strikte verboten. Zwei kleine Bilderrahmen aus dem hübschen mit Blumen verzierten Papier aber kaufen wir doch, dann heisst es, sich zu verabschieden. Wir haben einen weiten Weg vor uns bis nach Bagan. Achteinhalb Stunden dauert es noch mit einem kurzen Halt um ein Uhr zum Mittagessen. Erst geht es durch die Berge, über einen Pass – durch eine unwegsame grün bewaldete Landschaft, wo nur am Rande der Strasse hin und wieder ein paar Hütten stehen. Etwa auf 1‘500 Meter erreichen wir die Passhöhe. Kurven bis ins Tal, wo’s wieder saftig grüne Reisfelder hat und Bananenplantagen. Dort, wo die Felder bereits dunkelgelb sind, sind die Bauern gerade dabei, den Reis zu ernten. Es muss stark geregnet haben; unterwegs dirigiert die Polizei die Autos am äussersten Rand der Strasse entlang. Der Damm ist überlaufen, die Strasse überflutet, die Helfer stehen alle bis zu den Knien im Wasser. Wir kommen durch; ich bin sehr froh. Weiter geht’s durch landwirtschaftliches Gebiet, durch Dörfer und Städte.
Wo immer wir bisher durchgefahren sind, werden die Strassen erneuert und verbreitert. Neue Tankstellen werden errichtet, obwohl es bereits sehr viele davon hat. Strassenarbeiter sehen wir fast so viele wie Buddhas und Mönche. Aber jetzt, auf den letzten hundert Kilometern vor Bagan, wo die Strasse in einem katastrophalen Zustand ist, ist kein einziger Arbeiter zu sehen, keine Vorkehrungen sind getroffen, um die Strasse zu flicken. Tiefe Schlaglöcher hat’s und manchmal fehlt sogar der Belag.
Tunlin fährt rassig dem Ziel entgegen, er hupt sich durch, könnte man sagen. Manchmal kann ich fast nicht mehr hinschauen, wenn streunende Hunde, Kühe oder Fussgänger unterwegs sind. Ich lerne es wohl nie. Und immer diese Mofa-Fahrer, voll beladen und mit Babys unterwegs. Diesen Mut oder besser gesagt diese uneingeschränkte Sorglosigkeit hätte ich nicht. - Voll beladen sind auch die Pick-Ups, nicht selten steht einer am Strassenrand, weil das arme überladene Gefährt sich weigert weiterzufahren.
Bagan
Jetzt endlich erreichen wir Bagan. Links und rechts der Strasse sind die herrlichsten Bauten zu sehen, Stupas und Tempel. Sicher sind auch unter den Hotelkomplexen und unter der Strasse welche begraben. Es kann anders nicht sein. Sie geht nämlich schnurgerade durch das ganze Gebiet dieser ehemaligen Hauptstadt hindurch und wie man im Reiseführer nachlesen kann, hatte es ursprünglich 10‘000 solcher Gebäude. Heute existieren „nur“ noch rund 2‘000. Die meisten sind recht gut erhalten, einige werden renoviert. Die Blütezeit war zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert.
Um halb sechs Uhr kommen wir endlich beim Hotel Thande in Old Bagan an. Zeit für ein Bad im Pool und dann ein Nachtessen im feinen Restaurant. – Wie’s genau aussieht, sehen wir dann morgen bei Tageslicht.
Donnerstag, 19. Oktober
Heute genau vor einem Jahr wurde Theo in Johannesburg am Herzen operiert und erhielt zwei Bypässe. Für ihn ist das wie ein Geburtstag, den es zu feiern gilt. Ja, was für ein Tag damals, was für ein Jahr.
Eigentlich geht es ihm ja seit Monaten wieder bestens, aber leider ausgerechnet heute nicht. Er hat sich das Essen von gestern in der Nacht nochmals durch den Kopf gehen lassen. Zum Frühstück gibt’s nun halt nur Tee und ein Stück Toast und wir hoffen beide, dass es bald wieder besser geht. Trotzdem rafft er sich am Morgen auf und kommt mit auf Entdeckungstour. Es ist sehr heiss und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 97%; man kommt zum Schwitzen gar nicht mehr raus. Während der Nacht und bis am Morgen um sieben hat es stark geregnet und dementsprechend sehen auch die Strassen aus, die im ganzen Gebiet nicht asphaltiert sind. Aber im Moment ist es schön und wir geniessen unsere Tour. Die Tempel sind grandios und die Tatsache, dass es überall welche davon gibt, ist schon beeindruckend. Nur noch auf wenige kann man hinaufsteigen. Enge, schmale, dunkle Treppen führen im Innern auf eine höhere Terrasse und von dort aus hat man eine prächtige Aussicht über die weite Ebene mit ihren Feldern und Bäumen, aus denen so weit das Auge reicht, immer wieder ein Stupa guckt. Es ist ein überwältigender Anblick. In die meisten Tempel kann man reingehen und sie besichtigen. Erst aber gilt es, sich durch die Scharen von Händlern durchzukämpfen, die überall ihre Waren anbieten. Ist man dann im Tempel drin, begegnet man Buddhas in jeder Grösse, riesige, zehn Meter hohe im Eingangsbereich, solche, die in Nischen stehen (Nischen sind SEHR buddha-anfällig), mal sind sie an den Wänden gemalt, mal als Reliefs in Stein gemeisselt. Die Wandmalereinen sind einmalig. Zum Teil gut erhalten, zum Teil leider kaum mehr zu erkennen. Sie sind überall, an den Wänden und an den hohen Decken. Wie vor all den Jahren die Menschen diese Massen von Zeichnungen applizieren konnten, ist unvorstellbar. Meist ist es auch so dunkel, dass man nur mit einer Taschenlampe erkennt, was dargestellt wird. Erahnen kann man’s allerdings allemal: Szenen aus dem Leben von Buddha.
Damit wir nicht völlig „over-buddhad“, „out-pagodad“ und „templed-out“ sind, was allmählich tatsächlich bald zutrifft, schlägt Tunlin einen Besuch eines Lackfabrikations-Betriebs vor. In der Tat: Eine wohltuende Abwechslung. Auch hier sind wieder gut zwanzig Arbeiterinnen und Arbeiter am Werk, mindestens eine Person für jeden Arbeitsgang. Man kann zusehen und es wird einem erklärt, was genau passiert vom einfachen Bambusschälchen bis hin zur vierfarbig bemalten und lackierten Schale. Es ist eine aufwändige Arbeit, kein Wunder, sind diese echten Produkte so teuer.
Es ist Mittag. Wir machen eine Pause. Theo legt sich hin im Hotelzimmer, ich besuche noch zwei Tempel, die gleich neben dem Hotel stehen. Einer ist riesengross mit vielen Nischen, also vielen goldenen Buddhas drin. Auf den anderen kann man hinaufsteigen. Eine Frau, die dort Kleider und Souvenirs verkauft, hilft mir mit ihrer Taschenlampe, die steilen Stufen bis zur ersten Terrasse hinaufzuklettern. Man hat von dort aus einen tollen Ausblick. – Ich bin alleine dort, eben nicht einmal mit Theo, und bei den vielen Touristen, die hier in Bagan „herumschwirren“, ist das eigentlich schon erstaunlich. Aber die Besucher verteilen sich eben gut auf die vielen Tempel in einem Bereich von 50 km2. Bei den grossen hat’s manchmal ganze Wagenladungen von einheimischen und „ausheimischen“ Touristen, bei kleineren kaum jemand, und die ganz kleinen Stupas schaut schon gar niemand an. Aber es herrscht ein reges Treiben in den Strassen. Einige Besucher sind mit den Pferdekutschen unterwegs (die kleinen mageren Pferde tun mir so leid in dieser Hitze), andere mit Fahrrädern und die allermeisten mit Bussen oder Motorrädern, die man überall für wenig Geld mieten kann.
Jetzt ist’s Zeit für einen kühlen Drink. Ich setze mich im Gartenrestaurant des Hotels mit Blick auf den breiten Irrawaddy an einen Tisch und trinke ein Sodawasser.
Danach bleiben mir noch anderthalb Stunden, bis Tunlin mich wieder abholt zwecks weiterer Besichtigungen, also ist ein Bad im Pool ein Genuss und ein wenig Zeit zum Lesen bleibt mir auch. Theo liegt im Bett, tief unter der Bettdecke und „tötelt“. Besser, er ruht sich aus und ist dann morgen wieder fit.
Um halb vier geht’s los und ich wundere mich zum x-ten Mal, über Tunlin und seine Fähigkeit, überall daheim zu sein. Er weiss immer genau, wo er abzweigen muss, kennt offenbar alle Tempel und weiss, wo was zu sehen ist. Auch von welcher Ecke aus man die beste Foto schiessen kann, wo er parkieren kann, wo’s kaum andere Fahrzeuge hat, ist für ihn völlig klar; er weiss Bescheid über Details der Geschichte und Legenden und überhaupt, es ist erstaunlich, wie er sich auch in all den Städten, wo wir waren, auskennt. Ohne Navi wohlverstanden. Immer zielsicher führt er uns in unser Hotel.
Er zweigt in einen Feldweg ab und zu Fuss geht’s an einem Maisfeld entlang zu einem Turm, von dem aus man den Sonnenaufgang sehen kann, wenn’s denn überhaupt einen gibt. Es sind noch andere Leute dort, alle bewaffnet mit Kameras, zum Teil mit professionellen Vorrichtungen. – Es ist schön von dort oben – man sieht über die Felder, die mit Erdnüsschen, Sesam und Mais bepflanzt sind.
Ein Sonnenuntergang im eigentlichen Sinn findet zwar nicht statt, aber es ist trotzdem ein Erlebnis, von dort oben die ganze Gegend mit ihren endlosen Türmen und Türmchen überblicken zu können.
Zurück im Hotel geht es Theo ein wenig besser. Seine „drop-dead“-Siesta scheint ihm gut getan zu haben. Wir gehen essen, er verzichtet auf ein Bier, bleibt ganz spartanisch beim Mineralwasser (da scheint tatsächlich etwas noch nicht ganz im Lot zu sein) und isst nur eine halbe Portion Nudelsuppe.
Freitag, 20 Oktober – Unterwegs nach Mandalay
Die letzte Etappe unserer Reise mit Tunlin führt nach Mandalay („Mändely“, wie die Burmesen die Stadt liebevoll nennen). Vier Stunden dauert die Fahrt. Einen Zwischenalt aber gibt’s in Natogyi, wo wir uns einen Betrieb anschauen, der versteinertes Holz verarbeitet.
Grad massenhaft muss es in dieser Gegend solche Bäume geben. Es ist faszinieren, wie die Natur das Holz während Jahrmillionen Zelle für Zelle in Stein verwandelt hat. Die Steine werden zu Schmuck und Skulpturen verarbeitet, die mir allerdings nicht sehr gefallen, weil sie so lange poliert werden, bis sie ganz glänzend sind. Trotzdem kaufe ich mir ein Armband. – Wir essen auch dort; angeschlossen ist ein nettes kleines Restaurant.
Dann geht’s weiter über die Autobahn zur Abwechslung nach Inwa, ehemals Ana, der alten Hauptstadt. Pagoden über Pagoden gibt es dort, auch Klöster. Drei davon sehen wir uns an. Es sind grandiose Bauten, das erste Kloster, (Htat Gyi Kyaung) beeindruckt mich am meisten. Es wurde im Jahr 1838 teilweise von einem Erdbeben zerstört, seine verbleibenden Mauern sind mit faszinierenden Stuckaturen verziert. Das zweite (The Queen’s Brick Monastery – Maha Aung Mye Bon Zan) wird grad von einer grossen Gruppe von Mönchen aus Mandalay besucht, mit zwei von ihnen komme ich ins Gespräch.
Das jüngste Kloster (Bagaya Kyaung,18. Jahrhundert) ist aus Holz gebaut. Theo ist für einmal gar nicht begeistert, er meckert über die Nägel, die nicht säuberlich im Holzboden verankert sind. Mit nackten Füssen muss man halt ein wenig aufpassen. Den ganzen Bau findet er demzufolge nicht sehr sehenswert; ich dagegen schon. Das Kloster ist mit prachtvollen Schnitzereien ausgestattet. - Einmal mehr bin ich erstaunt über die Dunkelheit in diesen Gebäuden. Die Mönche tun mir leid.
Als letzte Sehenswürdigkeit besuchen wir heute die U-Bein-Brücke. Sie wurde 1850 erbaut, überquert den Taungthaman-See in der Nähe von Amarapura und ist mit 1,2 km Länge die älteste und längste Teakholzbrücke der Welt. Sie fehlt in keinem Touristenprogramm. Das wird deutlich klar, wie wir dort ankommen. So viele Touris auf einem Haufen sieht man nur vor dem Louvre oder am Times-Square.
Ganze Touristengruppen mit Fähnchen und Namensschildchen versehen werden losgeschickt, ganze Altersheime sind unterwegs – die Brücke muss man offenbar einfach gesehen haben. – Wir ja schliesslich auch. Es ist nicht so wie im Reiseführer, wo man ein wunderbares Foto sehen kann mit zwei Fahrradfahrerinnen hoch oben auf dem Holzsteg. – Nein, vor lauter Besuchern sieht man die Brücke kaum mehr. Man kann froh sein, dass man nicht hinuntergestossen wird, es wimmelt nur so von Menschen. Aber eines muss man sagen: Den Sonnenuntergang von dort aus zu geniessen, ist trotz allem ein schönes Erlebnis.
Eine Stunde dauert es dann noch, bis wir unser Hotel erreichen und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass wir unversehrt dort angekommen sind, mitten in Mandalay. – Es war ja bereits dunkle Nacht und Verkehr herrschte vom Schlimmsten. Motorräder drängten sich überall zwischen den Autos hindurch, beleuchtet waren einige überhaupt nicht oder nur teilweise. Auch dunkle Gestalten, Fussgänger und Hunde, überquerten die Strasse. – Woher die Menschen die Zuversicht hernehmen, dass ihnen nichts passiert, ist mir unverständlich.
Um sieben Uhr sind wir im Hotel Yadanar Oo. Ich biete Tunlin an, ein Zimmer im selben Hotel zu nehmen, er winkt dankend ab. Das kommt für ihn nicht in Frage. Er sucht sich ein Gästehaus, das seinen Vorstellungen entspricht. – Morgen ist unser letzter Tag mit ihm. Er wird wieder pünktlich da sein mit frischen Kleidern, geputztem Auto und einem strahlenden Lächeln. Ich freue mich!
Samstag, 21. Oktober – Letzter Tag der Rundreise
Unser letzter Tag. Buddhas, Pagoden, Klöster. Und das nicht zu knapp. Mindestens zweihundert Buddhas mehr haben wir am Ende des Tages auf unserem Konto. – So allmählich langt’s, aber diese ziehen wir uns nun doch noch rein. In vier Tagen sind wir ja in Australien, konfrontiert mit einer völlig anderen Kultur.
Die Fahrt durch die lebendige Stadt alleine ist schon interessant mitzuerleben und es ist erfreulich, im Nachhinein erleichtert sagen zu können, dass wir sie überlebt haben. Man sieht einmal mehr die verrücktesten Dinge. - Der Verkehr ist absolut chaotisch. Nur in Hanoi geht es ähnlich zu und her mit all den Scooters und Autos, die hier wie wild gewordene Insekten herumschwirren.
In Mingun besuchen wir einen weiss getünchten Tempel (Settawya-Pagode). Ein Treppengang, geschmückt mit weissen Tempelwächtern, führt bis zum Irrawaddy-Fluss hinunter. Dort sind ein paar Frauen dabei, ihre Wäsche zu waschen. Offenbar werden Kleider sauber, auch wenn sie in hellbraunem Wasser gebadet werden.
Besuch Nummer zwei ist ein gigantischer Bau - nur noch eine Ruine aus rotem Backstein, die Mingun Pagode. Im Jahre 1790 veranlasste der etwas grössenwahnsinnige König Bodawpaya den Bau der dieses Bauwerks. Mit einer Höhe von 150 m auf einer Fläche von 150 m² sollte es die grösste Pagode der Welt werden. Vollendet wurde sie allerdings nie. Der König starb nach zwanzig Jahren und sein Nachfolger trieb den Bau nicht weiter voran, so dass nur der Sockel errichtet wurde - immerhin aber auch 50 Meter hoch. Ein Erdbeben im Jahre 1838 zerstörte den bis dahin errichteten Teil. Jetzt ist es wahrscheinlich der grösste Ziegelhaufen der Welt. Die riesigen Risse im Gemäuer beeindrucken vor allem von ihrer Grösse her. Eine Treppe kann man hinaufsteigen, über hundert Stufen, und dort oben findet man sich vor monströsen Gesteinsbrocken, die aus dem Tempel herausgerissen wurden. Oben hat man eine schöne Aussicht auf den Fluss, die zig Souvenirläden und die Autos, Motorräder und Pferdekutschen, welche Touristen herbringen.
Die grösste Glocke des Landes (die zweitgrösste noch funktionierende der Welt) gibt es als Nächstes zu bestaunen. Sie ist 3,7 Meter hoch, 87 Tonnen schwer und wurde trotz ihrem Sturz beim Erdbeben im Jahr 1838 nur schwach beschädigt.
Weiterfahrt zum „Taj Mahal“. Der Tempel heisst natürlich nicht so, Hintergrund dazu ist aber eine ganz ähnliche traurige Geschichte. König Bagyidaw liess sie 1817 errichten zur Verehrung und zur Erinnerung an seine Frau, die im Kindsbett gestorben war. Die Hsinbyume Pagode ist eine absolute Augenweide. Sie bildet den buddhistischen Kosmos nach - den Berg Meru und die sieben Meere. Weiss getüncht scheint sie wie ein Palast im Märchen. Man kann hinaufsteigen und hat von da aus ein weiteres Mal eine einmalige Aussicht. Natürlich im Innern auch auf einen Buddha oder zwei…
Noch nicht genug: Tunlin fährt uns zu Pagode Nummer x2 (x=unendlich) in Sagaing, die Soon U Ponya Shin-Pagode, die ursprünglich im Jahr 1312 gebaut wurde. Gold und nochmals Gold, farbig auch – für uns der Inbegriff von Kitsch. Da das Heiligtum auf einem Hügel gelegen ist, hat man auch hier wieder Aussicht auf den Irrawaddy und die zahllosen, im Übermass vorhandenen Klöster, Stupas und Pagoden, die aus den grünen Baumwipfeln ragen.
Eine Pagode will uns Tunlin unbedingt noch zeigen, bevor wir etwas essen gehen. – Huch! - Aber auch diese Tempelanlage ist bemerkens- und besuchenswert. In der U Min Thounzeh Pagode sitzen in einem halbkreisförmigen, in den Fels eingetriebenen Gang 45 Buddhas nebeneinander, einer goldiger als der andere, einer lächelt weiser und herablassender als sein Nachbar.
Nach dem Lunch fahren wir zurück nach Mandalay. Jetzt gilt es, den Königspalast zu besichtigen. Dieser wurde zwar im zweiten Weltkrieg zerstört, aber man hat ihn originalgetreu wieder aufgebaut. Der Komplex ist riesig und umgeben von einer roten, relativ niedrigen Stadtmauer. Nur einer der Wachtürme steht noch, der Nan-Myin-Wachturm, welcher als Einziger verschont wurde. Man kann ihn besteigen. Das mache ich natürlich. Genau 121 Stufen winden sich um den Turm herum hinauf bis zum Dach. Von dort aus sehe ich Klein-Theo wie eine Ameise unten seine Siesta machen.
Und zum Dessert noch ein Kloster. Auch das zu besichtigen lohnt sich unbedingt. Der Bau stammt aus dem späten neunzehnten Jahrhundert und ist völlig aus Holz konstruiert. Die Schnitzereien an Türen und Fenstern sind einmalig. Im Innern ist es auch hier wieder sehr dunkel, so wie das offenbar in all den Klöstern üblich ist. Trotz der vielen Touristen ist’s immer wieder mal möglich, ein Foto zu schiessen ohne mindestens einen Mitfotografen vor der Linse zu haben.
Und noch zu einer weiteren Sehenswürdigkeit führt uns Tunlin, nämlich zur Kuthodaw-Pagode. Die Anlage wurde 1868 fertiggestellt. Sie besteht aus 729 pavillonartigen Tempeln, in denen je eine weisse Marmorplatte steht. Auf jeder davon ist eine Seite des Pali-Kanons niedergelegt, der das Leben und die Lehren Buddhas beinhaltet. Die ursprünglich vergoldeten Lettern sind heute nur noch schwarz eingefärbt. Die Pagode wird wegen dieser umfangreichen Darstellung auch als „Das grösste Buch der Welt“ bezeichnet. Vor der Erschaffung dieser Anlage waren die Texte ausschliesslich auf Pergament niedergeschrieben. Die Inschriften wurden von der UNESCO in die Liste des Weltdokumentenerbes aufgenommen.
Jetzt ist aber genug. Es ist schon kurz nach fünf. Tunlin bringt uns zurück ins Hotel. Es ist unser letzter Abend mit ihm, wir laden ihn also ein, mit uns zu essen, was er diesmal ausnahmsweise auch annimmt. Es ist angenehm, draussen auf dem gut besuchten Roof-top-Restaurant (Brolly Sky-Bar) in Ruhe ein feines Znächtli und anderthalb Flaschen Wein zu geniessen – Tunlin hält damit nicht zurück.
Sonntag, 22. Oktober – Zurück nach Yangon
Heute werden wir erst um elf Uhr abgeholt. Judihui! Da bleibt mal Zeit, auszuschlafen, zu frühstücken, dann aber heisst es, Koffer packen, denn um halb drei geht unser Flug zurück nach Yangon.
Offenbar beschäftigt mich die Packerei schon im Traum. Da war Theo dabei, auf einem Trottoir unsere drei Koffer vor sich hin zu rollen beziehungsweise hinter sich herzuziehen. Kurz darauf waren’s nur noch zwei. – Und dann gibt er dem einen mit dem Fuss einen Stoss, so dass der auf die Fahrbahn rollt. Ein Auto und ein Bus überrollen den Koffer (zum Glück ist es der kleinere), aber er ist unbeschädigt. Ich ärgere mich sehr, aber dann gibt’s einen Filmriss; wir sind in einem Saal und da wird wild auf uns geschossen. Ich erinnere mich noch daran, dass mich dies eher wenig kümmert, dann ist auch diese Szene zu Ende. - Gut so, vielleicht…
Wir fädeln uns erneut durch den Verkehr. Es ist Sonntag, also geht’s recht zahm zu und her. Trotzdem, gearbeitet wird vielerorts und manche sind unterwegs. Und immer wieder diese Babys, eingeklemmt zwischen zwei Erwachsenen. „Sometimes brest-feeding“, sagt Tunlin. Genau! Da ist es auch schon, dieses Bild, das ich eigentlich lieber gar nicht sehen möchte: Die Mutter auf dem Scooter, die rechte Hand am Lenkrad, mit der linken hält sie ihr Kind fest uns stillt es gleichzeitig. Geht’s eigentlich noch??? – Ich bin so schockiert, dass ich vollkomme vergesse, die Kamera zu starten. An all die absurd überladenen Trucks, Mofas und Taxis haben wir uns allmählich gewöhnt – aber das...
Die Fahrt zum Flughafen dauert eine Stunde, aber ohne Zwischenhalt mit Besichtigung geht’s einfach nicht. Tunlin führt uns in eine Goldplättchen-Werkstatt. Aus einem feinen Streifen 22-Karat Gold werden hauchdünne kleine und grössere, meist quadratische Plättchen auf traditionelle Art hergestellt, die dann dazu dienen, den Buddha zu bekleben, damit – ja, weshalb eigentlich? Damit er dick und feiss wird und man ihn unter dem Goldmantel gar nicht mehr erkennt. Er freut sich sicher über jeden Kleber sehr. Die jungen Männer, die wie in der Schmiede im Takt auf das Metall einhämmern, damit es dünner wird als Pergament, arbeiten wie Sklaven.
Die Autobahn ist halb leer. Sie kostet halt. Da macht’s auch nichts, wenn mal ein Mofa-Fahrer entgegenkommt oder eine Kuh-Herde über die Fahrbahn getrieben wird. Wen kümmert das denn schon?
Um halb zwei sind wir am Ziel. Herzliche Verabschiedung natürlich. Immerhin waren wir achtzehn Tage lang mit Tunlin zusammen. Er hat sein Bestes gegeben und uns, seine Familie, wie er sagt, für besagte Zeit grossartig betreut. Sein Karma muss unheimlich gewachsen sein in den letzten zwei Wochen. Er fährt jetzt zurück nach Yangon, besucht aber unterwegs seine Eltern, bleibt dort ein paar Tage, bevor er zu Frau und Kind nach Hause fährt.
Security und Check-In verlaufen problemlos. Keine Minute müssen wir anstehen.
Mit fast einstündiger Verspätung fliegen wir in ungefähr neunzig Minuten zurück in die ehemalige Hauptstadt, die im Herzen der Burmesen noch immer die Hauptstadt geblieben ist.
Es regnet in Strömen, wie wir ankommen. Beim Aussteigen allerdings hört der Regen grad auf und wir gelangen trockenen Fusses (der „Rest“ bleibt auch trocken – seltsame Redenswendung eigentlich) ins Flughafengebäude. – Dort werden wir bereits erwartet von einem Taxifahrer, der von Tunlin engagiert und auch bereits bezahlt wurde. Dieser fährt uns ins Chatrium Hotel, wo wir schon nach unserer Ankunft in Myanmar zwei Tage lang gewohnt haben. Unser Koffer, den wir nicht auf die Rundreise mitgenommen haben, wird uns gebracht und ich denke einmal mehr, wir haben viel zu viel eingepackt und mitgebracht. Eigentlich hätte auch die Hälfte gereicht.
Wie vor drei Wochen essen wir im japanischen Restaurant, das zum Hotel gehört, ein feines Buffet ist aufgestellt, und gehen dann satt und zufrieden in die Klappe.
Montag, 23. Oktober
Der Hotel-Shuttle-Bus bringt uns ins Stadtzentrum, wo wir bereits mit Tunlin waren.
Schon wollte ich schreiben: „Es ist unser letzter Tag in Myanmar und trotz der gewöhnungsbedürftigen und abenteuerlichen Fahrweise der Burmesen haben wir nie einen Unfall gesehen“. Nur einmal beinahe. Aber jetzt liegt doch ein Kleinbus auf der Seite am Strassenrand. Hoffentlich haben’s die Insassen überlebt. Die Polizei ist zur Stelle und regelt den Verkehr.
Im zwanzigsten Stock des Sakura-Towers hat’s eine Sky-Bar. Von dort aus hat man eine herrliche Aussicht über die Stadt. Wir sind die einzigen Gäste. Wir bestellen Kaffee; von vier Kellnern werden wir bedient.
Ganz in der Nähe befindet sich auch ein grosses Shoppingcenter. Mich nimmt wunder, wie ein solches in einer Stadt wie Yangon aussieht (gute Ausrede...). – Modern, aufwändig dekoriert, grosszügig ausgebaut, mit unter anderem den üblichen Markengeschäften – so wie überall. Trotzdem kommt es mir wie ein Fremdkörper vor. Allerdings läuft nicht viel, obwohl die Waren viel günstiger sind als bei uns. Aber Kleider kaufen (abgesehen davon, dass unsere Koffer strikte dagegen sind) könnte ein schwieriges Unterfangen werden - die Asiaten lieben es SEHR bunt, und Blusen ohne Fledermausärmel sind im Moment offenbar nicht in Mode.
Ich kaufe mir im Markt nebenan dann doch noch eine Bluse, obwohl Theo sie „fast ein wenig zu lebendig“ findet. – Muss er’s halt in Kauf nehmen, mit mir und der farbenprächtigen Bluse „in den Ausgang zu gehen“, um es so zu formulieren, wie sich meine Schülerinnen und Schüler jeweils ausgedrückt haben. (Gegen meine Korrektur dieser Ausdrucksweise waren sie allesamt konstant und einhellig beratungsresistent.)
Auch weckt die Episode in mir die Erinnerung an meine Mutter. - Sie hätte dazu wohl in ihrem Hamburgerdialekt gesagt: „Bunt wie Schümann’s Mutter ihr Unterrock“.
Mit „lebendig“ versuchte mir Theo vermutlich durch die Blume mitzuteilen, dass er das Kleidungsstück abscheulich findet. Ich habe meine Lesebrille grad nicht auf und sehe nicht, was auf dem Stoff abgebildet ist. Theo erwähnt etwas von „Langusten oder Hummern“ auf grünem Grund (jetzt, wo ich’s schreibe, kommt es mir auch ein wenig speziell vor…). Später sehe ich dann, dass es rote Papageien sind, die der Schneider oder die Schneiderin wohl unabsichtlich auf der Vorderseite verkehrt herum zusammengenäht hat. Sie hängen alle auf dem Kopf. Am Ärmel allerdings nicht, das ist doch wenigstens schon etwas. Auch die Rückseite ist gut geglückt. – Nun, sie ist total bequem, hat so wenig gekostet, dass ich gegen meine Gewohnheit nicht im Traum an Märten gedacht habe. - Und ich liebe sie jetzt schon.
Wir nehmen ein Taxi und fahren zurück ins Hotel. Ein wenig am Pool auszuruhen, ist jetzt gerade das, was wir brauchen.
In einem Reiseführer habe ich gelesen, ein schönes Erlebnis sei es, sich in der Belmond Governor’s Residence einen Drink (Sun-Downer) zu genehmigen. Mit dem Taxi fahren wir hin, grad bei Sonnenuntergang. Und ja, das ist eine gute Empfehlung. Die Drinks sind speziell gut, und wir beschliessen, dort zu essen. Exquisit präsentiert und zusammengestellt ist das Dinner ein absoluter Höhepunkt vom Kulinarischen her gesehen. – Sehr aufmerksamer Service und Schweizer Preise, aber das ist nicht weiter erstaunlich.
Das Hotel selber ist eine herrliche Oase, friedlich und ruhig, und man hat das Gefühl, in die Kolonialzeit zurückversetzt zu sein. – Ein gediegener letzter Abend.
Morgen müssen wir dieses schöne Land mit seinen freundlichen, liebenswerten Menschen verlassen, die von ihren Buddhas, Stupas, Pagoden und Klöstern nie genug bekommen können und deren Lieblingsfarbe – da besteht kein Zweifel - Gold sein muss.
Dienstag, 24. Oktober 17 - Abreise
In einer Stunde sind wir am Flughafen. Alles geht reibungslos, aber bei der dritten Sicherheitskontrolle innerhalb einer Zone von nicht mehr als hundert Metern, die immer genau gleich abläuft, auch mit Leibesvisitation, frage ich dann doch die hübsche junge Beamtin, was das eigentlich soll. Eine Antwort erhalte ich zwar nicht, Englisch ist eindeutig nicht eine ihrer Stärken, dafür schenkt sie mir ein entwaffnendes Lächeln. Jetzt ist Theo am Ball. In seinem Handgepäck befindet sich zur Abwechslung wieder mal etwas, das laut Vorschrift nicht dort hineingehört. – Ein Feuerzeug ist es diesmal, das allerdings bereits seit Zürich mit uns gereist ist. Es ist nota bene keines dieser ganz billigen. Ein erfahrener burmesischer Sicherheitsbeamter ist der stolze Finder. Theo zeigt, dass es gar nicht funktioniert, wird aber gnadenlos angewiesen, den Stein des Anstosses in einen Container zu werfen. Ich stehe ein paar Meter weiter weg, schaue dem Geschehen mit finsterer Miene zu, und murmle ein paar unmissverständliche Worte auf Berndeutsch vor mich hin.
Wir setzen uns auf die Sessel im Gate und warten, bis unser Flug aufgerufen wird. Keine fünf Minuten dauert es, da sehen wir die beiden Sicherheitsbeamten, die uns vom oberen Stock her zuwinken und zurufen, Theo solle nochmals zu ihnen raufkommen. – Und oh Wunder! – Sie geben ihm sein Feuerzeug zurück. – Ich fasse es ja nicht… Meine Version ist, dass sie nicht wollten, dass unser allerletztes Erlebnis in Myanmar ein negatives bleibt. – Möglicherweise hat mein Kopfschütteln zu diesem Umdenken beigetragen. Oder hat jemand eine bessere Erklärung?
Drei Stunden dauert der Flug bis nach Kuala Lumpur. Weitere neunzig Minuten haben wir „verloren“. Jetzt also beträgt der Zeitunterschied zur Schweiz sechs Stunden. Wir müssen weitere dreieinhalb Stunden auf den Anschlussflug nach Perth warten. Ich nutze die Zeit, um ein wenig an diesem Reisebericht herumzubasteln. Und ihn dann auch zu beenden.
Pünktlich fliegen wir ab. Die Bestuhlung ist sehr eng gehalten, mir tun schon nach kurzer Zeit die Kniescheiben weh. Wie wird’s nur Leuten gehen, die viel grösser sind als ich? Auch gibt’s kein Board-Entertainment-Programm (Theos Schnarchen kann man ja nicht als solches bezeichnen). Vergeblich suche ich den Bildschirm, der üblicherweise im Vordersitze angebracht ist. Ich hatte mich schon auf einen Film gefreut. Nun, es ist ja ein Nachtflug und er dauert nur sechs Stunden. Ein Nachtessen wird serviert, dann lese ich ein wenig (zum zweiten Mal und zur Einstimmung den absolut amüsanten Reisebericht „Down Under“ von Bill Bryson) und schlafe dann tatsächlich ein. Wenigsten etwa für ein Stündchen.

Perth - Fremantle – Pinnacles – Wave Rock – Margaret River – Baldivis
Als wir kurz nach ein Uhr morgens in Perth ankamen, musste ich als Erstes meine Woll- und die Regenjacke hervorkramen, denn es war so kalt, dass ich fand, eigentlich hätten wir bei den Temperaturen grad so gut zu Hause bleiben können. - 12 Grad nur.
Fremantle
Autobezug und Fahrt zum ersten Haustausch in South Fremantle, wo wir um drei Uhr morgens trotz der frühen Stunde herzlich von unseren Gastgebern, Jan und Russell Candy, begrüsst wurden. - Am nächsten Morgen machten wir mit ihnen einen Spaziergang durchs Quartier und gingen fein frühstücken. Am Mittag fuhren sie mit ihrem Camper in die Ferien und überliessen uns ihr Haus.
Leider war’s die ersten paar Tage nicht sommerlich warm und schön, wie wir es erwartet hatten, aber zum Ausspannen, den Reisebericht fertig schreiben, die Fotos dazu aussuchen, war mir’s gerade recht. Wir nahmen‘s also wesentlich gemütlicher als während der drei Wochen zuvor. – Ferien endlich!
Fremantle ist der Hafen von Perth und einer der zahllosen Vororte. Schön am Meer gelegen, gefiel uns der Aufenthalt dort sehr: breite, gepflegte Strände und nette Restaurants mehr oder weniger vor der Haustüre.
An den „Fremantle-Doctor“ mussten wir uns allerdings erst gewöhnen. Dies ist ein kühler Südwind, der jeweils am frühen Nachmittag aufkommt und einem den Strandbesuch vorzeitig verleiden lässt. – Schnell haben wir gelernt, dass wir bereits am späteren Morgen Baden gehen müssen und nicht erst nach dem Mittag.
Ein Art-Festival fand grad statt und auf einem Entdeckungsspaziergang durch den Ort hörten wir den Vortrag eines Schweizer Künstlers (Felice Varini), der sein Werk erklärte, nämlich, wieso er die Hauptstrasse in der Stadt mit gelben Kreisen versehen hatte (optical illusion artwork). Auch wenn mir sowohl die Idee als auch das Produkt gefallen hat, weiss ich leider auch nicht mehr, was genau für künstlerische Überlegungen dahinterstecken. Es könnte sein, dass mir die Erklärung nicht einleuchtete oder aber sie war mir zu hoch. Einerseits fand ich die Idee nämlich genial, andererseits war mir nicht ganz klar, was sie bringt. - Von genau einem Ort aus, dem Roundhouse, dem ältesten Gebäude in Westaustralien (dort befand sich das erste Gefängnis, das 1830 errichtet wurde), sieht man die Kreise perfekt, und wenn man anschliessend durch die Highstreet geht, erkennt man an jedem Haus, sogar an der Kirche, wie und wo gelbe Farbe angebracht worden war, um diesen speziellen Eindruck zu vermitteln. Manchmal wurde ein Teil einer Fassade eingefärbt und manchmal brauchte es nur einen kleinen Farbfleck. Die Planung mit den Behörden und anschliessend die Ausführung stelle ich mir relativ schwierig vor.
Die zehn Tage dort vergingen im Flug. An einem Tag besuchten wir Perth – eine hübsche Stadt, schön gelegen am Swan River. Vor zwanzig Jahren war ich zum ersten Mal dort, wiedererkannt hätte ich die Metropole mit fast zwei Millionen Einwohnern aber überhaupt nicht mehr. Überall wird gebaut; nur ein paar Häuser gibt es noch, die an die Kolonialzeit erinnern. Im Zentrum stehen jetzt mehrere Wolkenkratzer und am Flussufer ist die Esplanade entstanden zum Flanieren und Verweilen. Erst vor etwa zwölf Jahren wurde mit der Ausebnung des Gebietes und dem Bau begonnen.
Und schon sehr speziell: Die nächstgelegene Grossstadt ist knappe 2'000 km entfernt. Die Distanzen sind gewaltig. Sehr praktisch sind die Bus- und Zugverbindungen, Busse in der Innenstadt, auch in Fremantle, sind gratis und verkehren alle zehn Minuten. Das wär‘ doch was für Bern…
Ein paar eindrückliche Museumsbesuche liessen wir uns nicht entgehen. Was uns auch immer gefällt ist die Street- oder Graffiti-Art.
Pinnacle-Destert
Das Auto, das wir gemietet hatten, musste aber auch bewegt werden und so planten wir einen Ausflug zur Pinnacle-Desert im Nambung-Nationalpark. Drei Stunden hin, drei wieder zurück, aber das Reisli in die Wüste hat sich gelohnt: Man fährt in den Park hinein, muss beim Gate seine Tantiemen fürs Parkieren abladen, fährt ein paar Meter weiter und schon ist man, wie aus dem Nichts, mitten in einer unglaublichen Landschaft voller dunkelgelber Felsformationen, die wie die Menhire in der Bretagne aus der Erde ragen - hier aus dem Sand. Und überall sind sie, so weit das Auge reicht, kleine und grosse, teilweise dicht aneinandergedrängt oder in losen Gruppen, keine gleich wie die andere. Im Hintergrund weisse Dünen, darüber der tiefblaue Himmel; der Anblick ist atemberaubend.
Ein Abstecher an den Lake Thesis war ebenfalls interessant. Nur an wenigen Orten in der Welt findet man noch Stromatolithen. Was das sind, wusste ich auch nicht, aber jetzt natürlich schon, mehr oder weniger zumindest. Um genau zu begreifen, was die „Steine“ für eine Bewandtnis haben, müsste man Erdforscher sein. Es sind Fossilien und sie werden als die ersten erkennbar durch Organismen aufgebauten Gebilde, also die erste Form von Leben auf unserem Planeten angesehen. Vor mehr als 3,5 Milliarden Jahre haben sie begonnen zu existieren, so wird geschätzt. Sie befinden sich im Wasser nahe am Ufer und sehen aus wie eine unbewegliche Wasserschildkröten-Kolonie.
Noch etwas weiter nördlich assen wir in einem Pub eine Kleinigkeit zu Mittag. Das Kaff (Fischerdorf) heisst Cervantes und alle Strassen im Ort haben spanische Namen (García-Road, Cadiz Street, Cordoba Way etc.). Spanier waren allerdings nie dort, aber ein Schiff, das so hiess, versank 1844 vor der Küste. Das Dorf ist erst etwa sechzig Jahre alt und hat gemäss Wikipedia eine Einwohnerzahl von 461 (im Jahr 2011).
Wie man dort leben kann/will, so weit weg von allem, ist mir ein Rätsel. Aber das gehört ja ein wenig zu Australien. Ziemlich alles ist ziemlich abgelegen…
Wave Rock
Das fanden wir auch, als wir eine Woche später nach Hyden fuhren. Wie man dort leben kann…
Um halb acht schon (!) ging die Reise los. Einen Umweg machten wir, zwecks Frühstück-Einverleibung, über das historische Städtchen York. Um halb zehn waren wir dort. Diesen Abstecher hatte man uns empfohlen. Eine gute halbe Stunde lang mussten wir auf unseren Kaffee und auf die Eggs Benedict warten (Zeit spielt in so einem verlassenen Flecken Erde wohl keine grosse Rolle), was meine Laune momentan nicht gerade hob, denn wir hatten ja noch immer knappe drei Stunden Fahrt vor uns. Trotzdem – ein hübscher Ort, der uns an die Dörfer im Wilden Westen erinnerte.
Weiter auf dem Weg zur grossen Welle gab’s ausser Strasse, Eukalyptusbäumen und Busch nicht viel zu sehen. Ah doch, da wird der Hundefriedhof in Corrigin im Reiseführer erwähnt. – Wenn’s sonst nichts hat in dieser einsamen, trockenen Gegend, sehen wir uns den halt an.
Nur aus wenigen Häusern besteht Hyden (281 Einwohner), eines davon zum Glück ein Hotel/Motel. Dort übernachteten wir und hatten ein feines Znacht. Man sucht sich das Fleisch aus, das man gerne essen möchte, zahlt und bereitet es sich dann selbst zu auf dem grossen Grill im Restaurant. Gewürze und Saucen sind vorhandene, ein Salat- und Gemüsebuffet ebenfalls sowie andere Gäste, mit denen man eventuell ins Gespräch kommt. Sein Steak selber zubereiten – eine ziemliche Herausforderung für Theo. Manchmal ist das Leben einfach hart.
Wieso wir aber so weit gefahren sind, bis zum viel zitierten Outback, durch den sogenannten Weizengürtel, der jetzt gegen den Sommer hin immer gelber und gelber wird, immer dürrer und dürrer, hat folgende Bewandtnis: Es gibt einen Felsen, den Wave Rock, der aussieht wie eine riesige Welle und den wollte ich unbedingt sehen. – Irgendwie ist es schon erstaunlich, was einen anzieht und wieso. - Und auch hier fand ich, die fünf Stunden Fahrt dorthin auf endlosen Strassen fast ohne Verkehr hat sich gelohnt. Man kann gar nicht nicht beeindruckt sein. Die Welle ist riesig, 110 Meter lang, 15 Meter hoch und 2,7 Millionen Jahre alt.
Wenn man oben draufsteht, hat man eine herrliche Aussicht über das weite Land.
Wir waren nicht die Einzigen, die sich von diesem Naturwunder angezogen fühlten. Ein paar Japaner waren auch mit ihren Fotoapparaten zur Stelle, eine Schweizer Familie ebenfalls. Das Motel war ziemlich gut belegt.
Ganz in der Nähe gab‘s auch eine Höhle (Mulka’s Cave) zu besichtigen, in welcher der Legende nach ein Aborigine gelebt haben soll (eine Art Romeo- und Julia-Geschichte, die dann in eine Kindlifresser- und Motherkiller-Story abdriftet). Diese (die Höhle) besuchten wir ebenfalls. Speziell sind die Handabdrücke, die man an den Wänden erkennen konnte, welche Hunderte von Jahren alt sein sollen.
Speziell auch die vielen Fliegen, die dort herumschwirrten auf der Suche nach Flüssigkeit. Die Quellen vermuteten sie in den Gesichtern der Touristen. – In erster Linie könnten sie in den Nasenlöchern, dem Mund, in den Augen und Ohren fündig werden, so dachten sie sicher. Wenn man nicht ständig herumfuchteln und dabei fast verrück werden wollte, tat man gut daran, einen Mücken-Gesichts-Schleier zu tragen. Damit hatten uns unsere Gastgeber glücklicherweise ausgerüstet.
Ein schöner, fast einstündiger Spaziergang (Bush-Walk) war ausgeschildert und führte durch die felsige, trockene und verlassene Landschaft. Die Blumen, die wild dort wachsen, waren eine Pracht.
Die Fahrt zurück am nächsten Tag war dann noch länger - 500 km, für die wir sechseinhalb Stunden brauchten – neun Stunden, wenn man die Aufenthalte mitrechnet. Wir fuhren aber nicht direkt nach Perth; etwa dreihundert Kilometer südlich der Stadt hatten wir noch zwei Nächte gebucht in Margaret River, einem bekannten Weingebiet.
Die Strecke führte an einem sehr eindrücklichen Salzsee (Lake Grace) vorbei, wo’s den ersten Kaffee-Halt gab, und dann hiess es wieder Kilometer für Kilometer unter die Räder nehmen, erneut durch den Wheat-Belt, durch Farmgebiete, die zum Teil grösser sind als ein mittelgrosser Kanton in der Schweiz.
Die Strasse ist zweispurig, meistens schnurgerade, man kann fast immer 110 km/h fahren, nur selten begegnet einem ein anderes Auto oder ein „Road-Train“, ein ellenlanger Lastwagen, der oft Benzin, Tiere oder sonst irgendwelche Waren transportiert. Wenn ein solcher an einem vorbeibraust, tut man gut daran, die Fahrt zu verlangsamen und auszuweichen, wenn man vom Windsog hinterher nicht in den Busch transferiert werden will.
An einem idyllischen See, dem Dumbleyung Lake, machten wir einen kurzen Abstecher und in Wagin den nächsten Halt. „Sehenswert“ in diesem Ort ist der „Giant Ram“, ein fast zehn Meter hoher Schafsbock aus Polyester (glaube ich wenigstens). Wert gelegt wird auf der Webseite der Stadt, dass der Bock anatomisch korrekt dargestellt ist… Keine Ahnung, wieso die Australier eine derartig wundersame Vorliebe haben für solche absurden Riesendarstellungen von irgendwas. - Ein sehr lustiger Abschnitt ist in Bill Brysons Buch „Down Under“ oder auf Deutsch „Frühstück mit Kängurus“ nachzulesen. Auch er kann nicht verstehen, was es mit dem „Big Lobster“ oder der „Big Banana“ (die wir vor vier Jahren in Bayron Bay gesehen haben) genau auf sich hat. - Ziemlich skurril das Ganze, aber natürlich und gerade deswegen eine Foto wert.
Der nächste Halt in Collie: Diesmal, weil Theo Siesta machen musste (d. h. sich 20 Minuten im Schatten eines Baumes ins Gras legen mit dem Baseball-Cap über dem Gesicht [und eventuell dazu ein wenig schnarchen]), weil er als Beifahrer ja so müde wird, und ich lieber mal einen Kaffee trinke, damit mich die monotone Fahrerei nicht einschläfert.
Weingebiet im Südwesten – Margret River
So gab’s doch immer wieder mal einen Unterbruch während der langen Reise. – Ich war froh, als wir endlich gegen fünf Uhr nachmittags in Margret River ankamen und unser Motelzimmer beziehen konnten.
Wenn ich jetzt auf der Karte nachschaue, wo wir überall durchgefahren sind, so ist das eine beinahe lächerlich kurze Strecke im Verhältnis zu diesem riesigen Land.
Margaret River sieht sehr touristisch aus, es gibt viele kleine Läden und auch Cafés, aber die allermeisten schliessen bereits um fünf und so war es dann fast ein wenig schwierig, irgendwo essen zu gehen. Die Dame an der Rezeption, die ich gefragt hatte, ob sie uns ein Restaurant empfehlen könne, sagte, das sei wirklich schwierig, weil es sooo viele habe. Aber eben: Weder McDonald noch Subway waren was wir suchten. Ein Pub war offen und der natürlich „packed“ - Biertrinker in erster Linie.
Erst am nächsten Abend fanden wir ein Lokal, das uns sehr gefallen hat mit guten Drinks und vorzüglicher Küche: „Morries“ (benannt nach dem Buch von Mitch Albom, das ich vor Jahren mal gelesen habe: „Tuesdays with Morrie“).
Die Gegend dort im Süden ist sehr belebt und viel besucht. Es gibt den Bussell-Highway, der von Augusta bis nach Bunbury führt, im südlichen Teil durchs Weingebiet. Schöner und mit viel weniger Verkehr aber fährt man entlang der Cave Road durch Eukalyptus-Wälder und landwirtschaftliches Gebiet bis nach Yallingup. Überall gibt es Wegweiser zu den unzähligen Weingütern, eines schöner gelegen als das andere. Jedes aufs Raffinierteste gepflegt, man hat das Gefühl, ein Heer von Gärtnern sei täglich damit beschäftigt, Rosen zu giessen und mit der Nagelschere den Rasen zu pflegen. Einige Winerys sind ganz versteckt – ohne Landkarte würde man sie überhaupt nicht finden. – Die Weine haben zum Teil stolze Preise, sie sind ja schliesslich auch oft „award-winning“. Im Pub zum Beispiel, wo wir am ersten Abend waren, konnte man ein Glas speziellen Weins bestellen – 1 dl zu 45 AU$, also etwa 35 Franken… Ich liess es.
In den Wäldern gibt es Kängurus; meine grosse Angst war (und ist es immer noch), mal eines anzufahren, aber zum Glück ist das nicht passiert. Nur fast. Zwei Tiere wollten grad die Strasse überqueren. Eines blieb am Strassenrand stehen und das andere drehte sich um, konnte grad noch rechtzeitig die Flucht ergreifen und in den Wald hineinhopsen. Theo rief ihm nach: „Gumpi-Tante“. – Das brachte mich sehr zum Lachen.
Auch eine Höhle besichtigen wir, „Jewel Cave“ - die grösste in Westaustralien. Sie ist eindrücklich, der Besuch eine gelungene Abwechslung. Die Rangerin führte uns während einer Stunde durch die gut ausgebauten Pfade, treppauf, treppab und erklärte, was es eben zu erzählen und zu erklären gibt, ganz in der Manier der Amerikaner und Australier – sie sprach zu uns wie zu einer Kindergartengruppe.
Wunderbare Strände, beeindruckende Felsformationen, Blumen und Bäume vom Schönsten, nette kleine Cafés, Eis-Stuben, Kunstgalerien – das alles findet man ebenfalls in dieser Gegend.
Erholung für Theo nach „all dem Stress“ muss auch immer wieder sein. Ein vorzüglicher Ort, dies zu „erledigen“, bot sich an in Augusta, an der Flinders Bay, wo der Blackwood River in den Indischen Ozean mündet.
Was für ein Unterschied zwischen den drei Wochen in Myanmar und der Zeit nun in Australien:
Hier Städte, die sich über Dutzende von Quadratkilometern erstrecken, ein Bungalow neben dem andern, alles neue Quartiere - dort kleine Dörfer mit zum Teil armseligen Hütten. Hier „alte“ Bauten aus der Kolonialzeit, keine zweihundert Jahre alt und dort Tempel, Pagoden und Stupas aus längst vergangenen Jahrhunderten.
Die Verkehrssituation könnte unterschiedlicher nicht sein. Niemand fährt hier schneller als vorgeschrieben, gesitteter geht’s gar nicht. Und in Myanmar scheint’s überhaupt keine Vorschriften zu geben.
In beiden Ländern aber sind die Menschen überaus nett und freundlich. Das ist eine Gemeinsamkeit.
Die Australier sind ein „Völklein“ für sich, eine Art Mischung zwischen Engländern und Amerikanern.
„No worries“ ist eine ihrer Lieblingsredensarten. Auch wenn man weit davon entfernt ist, sich irgendwelche Sorgen zu machen, kommt diese beschwichtigende Bemerkung stets daher. – Frage ich im Supermarkt, wo’s Eier hat - „no worries“ und man zeigt mir, wo. - Da bin ich natürlich schon froh, dass meine Sorgen ein Ende haben, hatte ich doch schon befürchtet, dass es in diesem Laden eventuell gar keine Eier vorrätig hat. Ich bedanke mich. – „No worries“, kriege ich zur Antwort.
Auffällig ist auch das Adjektiv „award-winning“, das so oft gebraucht wird, dass es schon gar keine Auszeichnung mehr sein kann. Weine und Weingüter sind „award-winning“, Restaurants sowieso, jedes zweite Info-Zentrum ebenfalls. Es müssen wohl landauf, landab fast monatlich solche Auszeichnungen vergeben werden, so viele davon hat es.
An den australischen Slang muss man sich erst wieder gewöhnen. Ob ich „Chaise“ haben wolle in meinem Burger? – Da muss ich erst mal überlegen. - Käse, natürlich, aber nein, „please no cheese“. – „No worries“. - Sorgen natürlich auch lieber keine im Burger.
Was mir unter anderem an ihnen sehr gefällt, ist, sie haben Humor.
In dem Zusammenhang kommt mir der Witz in den Sinn, wo einer bei der Einreise nach Australien vom Zöllner gefragt wird: „Did you come today? (ausgesprochen „to die“ (zum Sterben) – Die Antwort: „No, I’ve just come for a holiday“.
Aber immerhin: Mit „Heloi“ als Begrüssung ist man dabei.
Und dass ich hier mit „Honey“ oder „Darling“ angesprochen werde (im Supermarkt an der Kasse zum Beispiel), kenne ich bereits aus England. - Ist doch schön, dass diese guten, alten britischen Sitten auch in Down Under erhalten geblieben sind.
An einem Tag besuchten wir das Swan Valley, eines der schönsten und bekanntesten Weingebiete in Australien. Von Perth aus ist es nur gerade eine knappe Stunde Fahrt mit dem Auto. Weil es so viele Weingüter hat und wir nur etwa vier besuchen wollten, dachte ich, es wäre von Vorteil, im „award-winning“ Informations-Center in Guildford eine Karte der Region und ein paar Ratschläge zu holen.
Wir wollten auch irgendwo zu Mittag essen – möglichst an einem schönen Ort. Nicht alle Weingüter haben Restaurants, so dachte ich, wir lassen uns beraten. Oft eine gute Idee, diesmal – na ja… Da war ein pensionierter Herr, ein freiwilliger Mitarbeiter, wie es sie in manchen dieser Info-Stellen gibt. Bereitwillig erklärte er uns, was es im Valley, das er wie seine Hosentasche kennt, alles zu sehen gibt. Auf der Karte zeichnete er ein, wo wir als Erstes mal einen Kaffee trinken könnten (etwa sieben Empfehlungen), wo eine Winery besuchen, ein Pfeil folgte dem anderen, bis die Karte voller Pfeile, Striche und Kreise war - die Beratung nahm kein Ende, zwanzig Minuten bereits vergangen. – Und waren so klug als wie zuvor…
Nicht nur Wein, sondern auch Käse wird angeboten:
Zum Glück ist das Tal nicht allzu lang. Anhand einer jungfräulichen Karte, die ich dort aus einem Regal nahm, fanden wir ein paar schöne Orte zum Degustieren, zum Verweilen, zum Spazieren und schliesslich auch zum Lunchen in einem idyllischen Weingut. Gegen vier Uhr fuhren wir durch die Perth Hills zurück nach Fremantle.
Baldivis
Unser zweiter Haustausch war in Baldivis, einem Vorort von Perth, etwa 50 km südlich des Zentrums.
Kareen und Stuart Dunlop, unsere Gastgeber (sie waren im Sommer ein paar Tage in Bivio), sind äusserst liebenswerte Tauschpartner. Sie haben uns nach Strich und Faden verwöhnt, uns bekocht vom Feinsten und uns herumgeführt an Orte, die wir ohne sie vermutlich nie gefunden hätten. Zur Abwechslung musste ich mal nicht Autofahren; das kam mir sehr gelegen.
Stuart zeigte uns die besten Strände (mit und ohne Wind). Strandstühle, Kühlbox und Sonnenschirm kamen selbstverständlich mit und in Rockingham gab’s als Zugabe eine Kunstausstellung am Strand – alle Werke aus natürlichen oder rezyklierbaren Materialien. – Dort, an der Strandpromenade war es auch, wo wir am zweiten Abend essen gingen und als weitere Zugabe zuschauen konnten, wie die Sonne langsam im Meer versank.
Manchmal waren wir auch allein unterwegs und machten Tagesausflüge. Zum Beispiel an die Serpentine Falls, wo man zur Abwechslung in einem Süsswasserbecken unterhalb eines Wasserfalls baden kann. - Oder nach Jarrahdale, einem Ort, der früher für den Holzabbau bekannt war. Weingütern begegnet man sozusagen auf Schritt und Tritt, in dieser Gegend ebenfalls, so kommt man kaum darum herum, auch dort ein Auge hinzuwerfen und ein Gläschen zu trinken. Das funktionierte sehr gut in der Millbrook Winery. – Auch den Kängurus gefällt es, in den Weinbergen zwischen den Reben herumzuhopsen.
Am unserem letzten Tag fuhren wir gemeinsam nach Mandurah, einer Trabantenstadt, 70 km südlich von Perth. Die Stadt liegt am Meer, ist rasant gewachsen, besteht fast nur aus neuen Häusern, viele davon liegen an Kanälen, so dass man sein Boot oder seine Yacht grad gäbig vor der Haustür stationieren kann. Kleine Brücken und der Stil der Bauten erinnern fast ein wenig an die Toskana, was sicher auch die Absicht der Architekten war. An den Wochenenden, so hab ich gelesen, hat der Ort mit 300‘000 Gästen fast dreimal so viele Bewohner wie während der Woche.
Ein Spaziergang am Lake Clifton führte uns zu den sogenannten Thromboliten, die ähnlich wie die Stomatholiten im Lake Thetis ebenfalls lebende Fossilien sind. So nennt man sie auch „lebende Steine“. Zusammen bildeten diese Einzeller vor Jahrmilliarden die erste Sauerstoff-Atmosphäre auf der Erde. Auch sie sehen aus wie runde Steine, sind aber eine fürs Auge nicht sichtbare Anhäufung von Mikroorganismen, meistens bestehend aus feinen Schichten von Kalkstein - die früheste Form von Leben auf der Erde. Diese hier sind zwar „nur“ ungefähr 2000 Jahre alt, aber ihr Anblick fasziniert, auch wenn man kein Erdgeschichte-Freak ist. Schlicht und einfach beeindruckend!
Am selben Nachmittag, währendem Kareen zu Hause diverse Sorten von Pizzas für unser letztes gemeinsames Abendessen vorbereitete, fuhr Stu mit uns nach Perth in den Kings Park, einen der schönsten botanischen Gärten des Kontinents. – Wie gut, dass wir den Park nicht schon früher auf eigene Faust besucht hatten, denn Stu weiss über alle Bäume, Sträucher und Blumen bis ins kleinste Detail Bescheid, kennt ihre Namen, auch die lateinischen (australisch ausgesprochen zwar, was recht seltsam klingt); er weiss, in welcher Weise die Aborigines von ihnen Gebrauch gemacht haben - es war ein interessanter und äusserst lehrreicher Nachmittag.
Eine herrliche Aussicht auf die Skyline der City hat man von dort aus, das kommt noch dazu.
Und schon waren auch weitere zehn Tage unserer Reise vorbei.
P.S. Hier noch ein kleiner Exkurs: Ich schaue ja immer gerne bei Tripadvisor nach, welche Restaurants in der näheren Umgebung, wo wir uns gerade aufhalten, empfehlenswert sind. – Die Bewertungen sind teilweise recht aufschlussreich.
Am schönsten sind die, die mit Google-Translator aus dem Englischen ins Deutsch übersetzt wurden. - Ich frage mich, wie viele Jahre es noch dauern wird, bis sie tatsächlich dem ursprünglichen Text entsprechen. – Nett ist ja dann immer noch am Schluss die Frage: „War die Übersetzung hilfreich?“
Über Frühstück in York wollte ich Informationen. – Sehr nützlich das folgende Feedback:
Terrace Fruit Veg And Cafe
Sehr zufriedenstellend
Ich entschied mich schreien, um dies Morgen Frühstück und froh, dass ich das gemacht habe. Reizend Speck, Eier und Hash Brown. An was ich kalt nicht beenden. Noch besser war meine sehr heiß, heiße Schokolade.
Und Dinner – ein Restaurant in Adelaide:
Wir nur für das Abendessen an einem Donnerstag Abend. Wir hatten das "Futtermittel mich" Menü Option. Keiner von uns waren besonders beeindruckt von der Mahlzeit insgesamt. Herausragende waren die Austern, die ganz offensichtlich frisch geknackte - sehr lecker. Und das Gemüse Teller, oh mein Gott, atemberaubend, das erste Mal, dass ich Brokkoli oder Rosenkohl genossen haben.
Das wär‘ dann doch mal was für Theo. In dem Restaurant könnte er vielleicht auch atemberaubendes Gemüse essen, ohne zu befürchten, schwere gesundheitliche Beschwerden oder Haarausfall davontragen zu müssen… Oh, mein Gott!
Adelaide 12. – 27. November
Am Sonntag, 12. November, brachte uns ein dreistündiger Inlandflug nach Adelaide in den Süden des Landes. Der Zeitunterschied zur Schweiz betrug dann, 1‘800 km östlich, neuneinhalb Stunden. Wir hatten den Tag also fast schon „erledigt“, wenn Bern aufstand.
Daryl Burton und seine Partnerin Christiane Niess waren im Sommer ein paar Tage in Bivio; jetzt ist unser Gegenbesuch an der Reihe, unser dritter Haustausch während dieser Reise. Sie leben hier seit mehreren Jahren und wollen nicht mehr zurück nach Europa. Nur noch während unseres Sommers besuchen sie manchmal ihre ursprüngliche Heimat (GB und Deutschland), weil es dann im Süden von Australien recht kalt ist.
Einmal mehr hatten wir wunderbare Gastgeber gefunden. Sie luden uns ein paarmal zum Essen ein und wir bekamen von ihnen eine ganze Menge nützlicher Tipps.
Die beiden haben ein schönes Haus oben auf dem Mount Lofty (727 m), dem Hausberg hier, mit einem prachtvollen Garten, der in Wald übergeht, und den Christiane vorzüglich pflegt. Wenn’s nicht gerade regnet und neblig ist, was leider öfter der Fall war, hat man auch vom Wohnzimmer unserer hübschen Einliegerwohnung aus eine tolle Aussicht auf die Stadt, sozusagen durch die Blumen.
Kürzlich, als wir heimkamen, raschelte es neben uns im Gebüsch und ein Känguru hopste davon, blieb aber ein paar Meter weiter weg wieder stehen. Wir sahen uns in die Augen, ich sagte ein paar Worte auf Berndeutsch zu ihm, aber die verstand es offensichtlich nicht. Wahrscheinlich schätzte es die Lage ab, ob es einen Rückzug in Erwägung ziehen solle oder nicht. Irgendein Gewächs im Garten schien ihm besonders zu munden. Zwei Stunden später war es immer noch da. Und wieder klappte die Unterhaltung nicht. Es starrte mich nur unentwegt an, bereit zur Flucht. – Gegen Ende unseres Aufenthalts sahen wir es noch oft. Es machte dann auch Siesta und war ganz furchtlos. Weil’s im Garten so schön war, brachte es sogar ein „Gschpänli“ mit.
Ein Känguru (oder gar zwei) im Garten – das war schon ein besonderes Erlebnis.
Alles lief wie am Schnürchen: Eine gute Woche blieben wir bei Christiane und Daryl, dann war eine Woche „Ferien“ beziehungsweise Rundreise im Roten Zentrum geplant. Und nach unserer Rückreise am 27. November durften wir für weitere acht Tage bei unseren Gastgebern wohnen.
Unser erster Eindruck von Adelaide: Sooo grün! Überall hat’s Bäume, Büsche, Blumen, Parkanlagen – gar nicht, wie man sich Australien vorstellt.
Gleich zu Beginn unseres Aufenthalts machte Daryl mit uns eine Stadtrundfahrt. Im Zentrum selber waren wir anschliessend nur ein paar Mal. Ein paar lohnende Museumsbesuche waren der Grund dafür und Einkäufe.
Der Verkehr ist eher mühsam, man verbringt gefühlte Ewigkeiten vor den Verkehrsampeln – die perfekte rote Welle wird hier gepflegt.
Für die Fussgänger ist es noch mühsamer. Und wenn dann endlich grün wird, wird man mit rotem Blinklicht auf die andere Strassenseite gehetzt. – Sonst aber macht Adelaide eher einen gemütlichen Eindruck. Das Zentrum ist gar nicht mal so gross, es hat auch kaum Hochhäuser - viele Pubs dafür, und die werden rege genutzt fürs Feierabend- oder Wochenendbier.
Biertrinken und Wochenend-Feiern sind gross im Trend in Australien, klar, nicht nur hier, aber hier besonders, so scheint mir, und daher auch der Spruch: „The five days after a weekend are the hardest.”
Ausflüge in die Umgebung liebten wir besonders. Und deren gibt es unzählige. Rings um Adelaide gibt es ein Weingebiet am anderen und die galt es natürlich auszukundschaften: Barossa ist ja weltbekannt; was wir allerdings weniger kannten, waren Adelaide Hills (bei uns sozusagen vor der Haustür), McLaren Vale, Fleurieu, Clare Valley und Coonawarra.
Den Ausflug ins Barossa-Valley sparten wir uns für die zweite Woche. In unserer ersten machten wir, wie gesagt, keine grossen Sprünge; an einem heissen Tag klapperten wir ein paar Strände ab und erkundeten die Gegend in den Adelaide Hills. Zum Beispiel besuchten wir Hahndorf, ein deutsches Dorf, zehn Kilometer weiter östlich vom Mount Lofty, in den Adelaide Hills. 1838 gründeten deutsche Siedler (Lutheraner auf der Flucht vor Verfolgung) den Ort, der heute fast 2‘000 Einwohner zählt und eine Touristenattraktion geworden ist. Die deutschen Wurzeln sind unschwer erkennbar in den Beschriftungen der Läden, der Strassennamen und der Art und Weise, wie gepflegt das Dorf aussieht. Der deutsche Bäcker, die deutsche Wurst, der deutsche Pub (da gibt es schon Annäherungen ans Englische).
Dort (man kommt sich vor wie in einer Kneipe im Schwarzwald) nahmen wir einen Apéro. Theo bekam plötzlich einen unheimlichen Appetit auf Sauerkraut. Das musste aber noch warten. Ein Bayer kam hereinspaziert in seiner Tracht - ich traute meinen Augen nicht. Wir kamen ins Gespräch mit ihm (Reinhard). Jeden Donnerstagabend würde er und seine „Truppe“, eine halbstündige Vorstellung geben in einem der Restaurants im Ort. Es war grad Donnerstag und sie waren zu viert. – SEHR speziell, aber diese Vorstellung interessierte mich schon: Da fliegen wir um die halbe Welt und sehen im Süden von Australien einen Schuhplattler. - Deutscher geht’s gar nicht. Wie im falschen Film. Lauter Japaner und Chinesen wohnten dem Spektakel ebenfalls bei - wie wir - bewaffnet mit Kameras.
Reinhard stellte den Zuschauern ein Ehepaar vor. Die beiden feierten an diesem Tag ihren goldenen Hochzeitstag. Das gab’s dann ein „ Hoch soll’n sie leben, holdrio etc…“ und ich dachte mir, ob Theo und ich unseren 50sten Hochzeitstag (schon in fünfeinhalb Jahren) dann auch irgendwo in ähnlicher Weise feiern könnten. – Wär doch eine Option!
Anschliessend hatte auch ich Hunger. Zum Glück bestellten wir nur ein Wienerschnitzel mit Kartoffelsalat plus eine Portion Sauerkraut. Das Fleisch hätte für drei gereicht und die Hälfte des Krauts nahmen wir im Doggie-Bag mit nach Hause.
Acht Tage ins Innere des Kontinents: The GHAN Train – Alice Springs – Uluru – Kata Tjuta – King’s Canyon – Mereenie-Loop – Glen Helen – Alice Springs
Sonntag, 19. November 2017 – Zugfahrt nach Alice Springs mit dem GHAN
Um halb elf brachten wir unser Auto zurück ins Zentrum von Adelaide; die Hertz-Autovermietung ist keine zweihundert Meter vom GHAN-Bahnhof entfernt.
Dort geht’s zu wie am Flughafen, zumindest fast. Die Security-Kontrolle fällt weg, was für eine Wohltat. So bleiben uns diesmal Theos Sackmesser, Schraubenzieher und sonstigen gefährlichen Werkzeuge auf Sicher. Man wird freundlich begrüsst und zum Check-in-Schalter begleitet. Dort zeigt man den Pass, erhält eine Boarding-Card und mit dem Gepäck geht’s gleich wie auf dem Flughafen, es wird gewogen, erhält eine Etikette und rauscht dann übers Rollband irgendwohin in den Hintergrund, hoffentlich auf Wiedersehen.
Anschliessend darf man sich in der Lounge mit Getränken bedienen, soviel man will: Wein, Sparkling, Bier oder alkoholfreie Getränke, was (Letzteres) natürlich nicht in Frage kam.
Wenn wir in die Runde schauten, mussten wir eindeutig feststellen, dass wir das Durchschnittsalter eher herunterdrückten. Es musste sich um eine Art Seniorentransport handeln. Kinder hatte es keine, aber ein paar Rollatoren fuhren mit.
Unser Abteil war klein, klar – keine Suite, aber alles vorhanden, was man braucht, inklusive Bade“zimmer“ mit Dusche und WC. Während man abends am Essen ist, wird die Kabine bereit gemacht zum Schlafen (zwei sehr bequeme Kajüten-Betten mit wohligen Duvets und Kissen) und am nächsten Morgen wird das obere Bett versorgt und man kann sich wieder setzen.
Die Mahlzeiten sind Spitze; so fein und schön serviert hätte ich sie mir nicht vorgestellt. Wein, Bier und auch sonst alle Getränke sind inklusive; Verwöhnung vom Allerbesten.
Der Zug fährt zweimal pro Woche. „Heute“ misst er 972 Meter, es sind 276 Passagiere zugestiegen, die Fahrt nach Alice Springs dauert etwa 27 Stunden (wovon er während etwa vier Stunden in Marla hält). Die Strecke ist 1‘559 km lang. Durchschnittsgeschwindigkeit 85 km/h, Höchstgeschwindigkeit 115 km/h.
Die lange Fahrt kam mir „interweilig“ vor. Langweilig, weil man stundenlang an derselben Kulisse vorbeifährt, interessant, weil gerade diese Eintönigkeit faszinierend ist. Kurz nach Adelaide fährt man an zahllosen Weizenfeldern vorbei, dann allmählich ändert die Landschaft und die Halbwüste beginnt, wo nichts mehr wächst ausser Salzbüschen und ein paar hartgesottene Akazien. Menschen und Tiere sahen wir keine.
Absoluter Höhepunkt war in Marla, wo der Zug gut vier Stunden lang hielt, man aussteigen und Fotos vom Sonnenaufgang machen konnte. Um Viertel vor sechs wurden wir geweckt, um Viertel nach sechs wurden die Türen geöffnet und man konnte aussteigen. Theo aus dem Bett zu kriegen, war eine Tortur, die ich lieber nicht nochmals mitmachen möchte.
Was für ein atemberaubendes Bild sich einem bot! Die von den ersten Sonnenstrahlen beleuchteten Wolken, die sich in den Fenstern des silbernen Zugs spiegelten – umwerfend!
Der „Bahnhof“ in Marla besteht nur gerade aus einer Wellblechhütte, ein Dorf oder Häuser sieht man nicht. Was man aber sieht, sind die beiden Feuer, die das Zugspersonal für all die Passagiere entfacht hatten. Tische und Bänke wurden aufgestellt, ein Frühstücksbuffet mit Getränken, Bacon and Egg – Sliders (eine Art Burger, in dem Speck und ein Spiegelei eingeklemmt sind), frische Früchte, schön in mundgerechte Stücke geschnitten und Gebäck. So hätte ich das nicht erwartet. Es mutete schon ein wenig seltsam an, Mitten im Nichts ein solches Gelage zu veranstalten und so viele Menschen zu sehen, die herumstanden, assen, tranken, spazierten und Fotos schossen.
Schön war auch, den Zug in seiner ganzen Länge zu sehen. Stimmt zwar nicht ganz, denn von dort aus, wo wir standen, sah man weder den Anfang noch sein Ende. Beide Teile verschwanden je im Horizont.
Freude an unserem frühmorgendlichen Besuch hatten auf jeden Fall auch die Mücken. Wahrscheinlich sind der Montag- und der Donnerstagmorgen jeweils ihre Festtage. So eine grosse Auswahl an köstlichen Stech-Gelegenheiten wie zu dem Zeitpunkt, wo der Ghan anhält, werden sie sonst kaum je haben.
Um halb zwei am Montagnachmittag fuhr der Zug in Alice Springs ein. Schade, ich wäre sehr gerne noch viel weiter gefahren.
Nach all den langen Stunden im Zug, wo man durch die endlos scheinende immer gleiche Gegend fährt, kann man fast nicht glauben, dass da plötzlich Häuser stehen, Autos auf befestigten Strassen fahren, man sich in der Zivilisation zurückfindet. – K-Mart, McDonalds (geöffnet sieben Tage pro Woche, denn: „Hunger never sleeps“) – also irgendwie scheint das alles schon ziemlich schräg. Bill Bryson muss es ähnlich vorgekommen sein. Er drückt es so aus: „Alice Springs attracts thousands of visitors to see how remote it no longer is.”
Aber die Stadt, die im Jahr 1954 4'000 Einwohner zählte, jetzt auf 28‘000 angewachsen ist (zusätzlich 6‘000 Aborigines – die zählt man offenbar nicht dazu), war ja schliesslich unser Ziel im Moment, zwei Übernachtungen hatte ich gebucht, ein Auto ebenfalls und einen Flug am kommenden Montag, also in einer Woche.
Den einen Tag in Alice Springs verbrachten wir recht geruhsam: Besichtigung des Desert-Parks (Was – die haben in der Wüste eine Wüsten-Park errichtet???). Sehr sehenswert und lehrreich allerdings. Über 40 Grad am Schatten – unser Hitze-Gewöhnungs-Ausflug. Durch drei Arten von Wüsten kann man wandern und immer wieder gibt’s es Tafeln, die Erklärungen zu Flora und Fauna liefern. Interessant ist auch das Noctarium. Sobald sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, entdeckt man die erstaunlichsten nachtaktiven Tiere wie Schlangen, Spinnen und kleine Säugetiere.
Am Nachmittag dann besuchten wir drei Galerien. Dort wurde ich den Eindruck nicht ganz los dass nicht ganz alles, was einem als Kunst angeboten wird, auch wirklich welche ist. Ich vermute, dass manches, was man in den Galerien kaufen kann, ganz rasch produziert wurde, und jetzt, wo viele Leute auf Aborigines-Kunst „abfahren“, viele sogenannte Künstler auf diesen Zug aufspringen, rasch was auf die Leinwand tüpfeln und das dann als Kunst verkaufen. Interessant war unser Besuch anschliessend in einer Heilsarmee-Werkstatt, wo man zuschauen kann, wie Aborigines (vor allem ältere Semester) Leinwände bemalen. Ein Werk haben wir erstanden.
Auch das historische Alice Springs besuchten wir. Es hiess früher Stuart, bestand nur aus wenigen Häusern und war lediglich eine Repeater-Station zwischen Darwin und Adelaide.
Das Rote Zentrum
Jede und jeder kennt den Uluru oder wie er früher hiess, der Ayers Rock. Man hat ihn hundertmal gesehen in Bildbänden, auf Prospekten, Reisepostern etc. Und doch kommt man um die seltsame Faszination nicht herum, die dieser Monolith, der aus der kargen, aber farbigen Ebene fast 350 Meter hoch herausragt, auf einen ausübt. Das Farbenspiel ist gewaltig: braun, rot, schwarz, gelb, fast rötlich-blau von weitem am frühen Morgen. Dass er teilweise aussieht, wie ein Schweizer Käse, war mir weniger bewusst. – Ich freue mich, dass wir diesen mystischen Ort besuchen konnten. Wir übernachteten zweimal in Yulara, dem Retortenresort, das etwa 20 km vom Fels entfernt errichtet wurde, mit verschiedenen Arten von Unterkunftsmöglichkeiten (vom Backpacker zum Camper, zur Lodge und zum 5-Stern-Hotel), einem Shoppingcenter, Souvenirläden, Poststelle, Cafés, Restaurants, Galerien, einer Tankstelle und so weiter.
Mit dem 3-Tages-Pass machten wir ausgiebig Gebrauch von mehreren Eintritten in den viel besuchten Nationalpark.
Nicht weniger eindrücklich fanden wir die Kata Tjuta, ehemals The Olgas, übersetzt „Die Köpfe“. Die Felsformation besteht aus 36 abgerundeten Felsbrocken, der höchste ist über 1000 Meter hoch, ragt 564 Meter aus der Ebene hinaus, also höher als sein berühmter Bruder. Es sieht so aus, als ob dieses Massiv eine Art Zwilling des Uluru hätte gewesen sein können, aber irgendwann vor langer Zeit in sich zusammengesackt ist. Beide sind schliesslich etwa zur gleichen Zeit entstanden, vor 550 Millionen Jahren. Das könnte dem Uluru auch passieren, denke ich. Wer weiss, vielleicht in ein paar hundert Millionen Jahren? Und dann sehen die Touristen eine ganz andere Landschaft. Mal abwarten...
Jedenfalls – der Besuch der Köpfe war ebenfalls einmalig. Wir machten zwei verschiedene Wanderungen, die eine (Valley of the Winds) war eine rechte Herausforderung bei der Hitze. Wir wussten, dass der Trail um elf geschlossen wird, wenn’s mehr als 36 Grad heiss ist, also starteten wir früh. In aller (Theo)-Herrgottsfrühe, um zehn Uhr, waren wir schon abmarschbereit vor Ort, ausgestattet mit Wasser, Sonnenschutz und Sonnenhut. Drei Stunden später waren wir ziemlich erschöpft, ausgeschwitzt und mit tollen Eindrücken zurück auf dem Parkplatz. Zwischen den roten Felsköpfen waren wir gewandert, hatten fantastische Lookouts erstiegen mit Blick auf die grünen Landschaften, die von weitem wie saftige Berg-Wiesen aussehen, in Wahrheit aber die überall wachsenden Spinifex-Gräser sind, welche wenig Wasser brauchen.
Die zweite Wanderung, den Walpa-Gorge-Walk, musste ich alleine unternehmen. Theo hatte genug und ich wollte mir nichts entgehen lassen. Der Spaziergang dauerte nur etwa eine Stunde. Einmal verlief ich mich, weil irgendwer wohl die Richtungspfeile entfernt hatte, aber als der Pfad zu extrem wurde, merkte ich, dass dies so nicht sein konnte und ging zurück. Am Ende des Trails befand sich ein halb ausgetrocknetes Wasserloch, in dem eine Menge Kaulquappen ums Überleben kämpften. – Hätte ich nicht meinen Fliegenschutz-Kopfschleier übergezogen, hätte ich wohl auch ums Überleben gekämpft. Die Viecher sind schlicht eine Pest.
Theos Geburtstag
Meinen Wecker stellte ich auf 05.05 Uhr, zog mich an, schlich mich aus dem Schlafzimmer und fuhr nochmals zum Lookout, wo man den Sonnenaufgang hinter dem berühmten Felsen sehen kann.
Theo liess ich schlafen, um diese Zeit aufzustehen, und das noch an seinem Geburtstag, kommt schlicht nicht in Frage! Und schon gar nicht wegen eines Felsens. Und die Sonne geht jeden Tag auf; also was soll’s…
So machte ich mich eben allein auf den Weg. Es war bereits ein wenig hell, als ich losfuhr, und ich wählte den Parkplatz, den mir ein Ranger empfohlen hatte, wo’s nicht Hunderte von Leuten hat, sondern nur wenige. Logischerweise kann man sich das Spektakel von Osten oder von Westen her ansehen. Mal wird der Uluru beleuchtet, mal ist er im Vordergrund schwarz und die Sonne steigt hintendran auf. Um Viertel vor sechs war’s so weit und ich wurde nicht enttäuscht: ein Anblick für Götter – still und schön…
Ich fuhr dann noch zur anderen Stelle, wo Dutzende von Reisecars und Auto parkiert waren und die meisten Besucher schon wieder abzogen. Auch schön von dort. Man sieht gleich auch noch die Olgas in der Ferne. Aber der ganze Rummelplatz... Ich blieb, bis niemand mehr dort war und nur noch ein einziges Auto auf dem Parkplatz stand.
Kurz nach sieben war ich zurück im Motel und das Geburtstagskind kam nun allmählich auch zu sich.
Es war wieder mal Zeit zum Packen, wir holten uns im Supermarkt etwas zum Frühstück und fuhren dann los Richtung King’s Canyon, eine Fahrt von 304 Kilometern. – Unser Navi beharrte darauf, dass wir sechseinhalb Stunden unterwegs sein würden, aber das konnte ja nicht sein. Die Strasse ist sehr gut ausgebaut, Verkehr hat es so gut wie keinen und man kann auf dem grössten Teil der Strecke 110 km/h fahren (unsere Navi-Dame rechnete mit 50 km/h, da hat sie wohl eine Angabe aus dem letzten Jahrhundert).
Nach knapp vier Stunden und einem Zwischenhalt in Curtin Springs kamen wir an. Das Resort besteht aus einer Reihe von Bungalows für die Gäste, einem Pool, einer Tankstelle, einer Bar, zwei Restaurants (eines davon geschlossen) und einem Camping-Platz.
Schon bei der Planung hatte ich mich gefragt, ob das wohl der geeignete Ort sei für Theos Geburtstagsfeier, aber im Nachhinein hätte ich kaum besser wählen können.
Ein Helikopterflugplatz gehört nämlich auch noch zum Resort und da musste ich ja nicht mehr lange überlegen, was ich Theo schenken könnte. Wir flogen also, pilotiert von einer jungen Dame, eine halbe Stunde lang über den Canyon und das ganze Massiv (George Gill Range), das 400 Millionen Jahre alt ist. – Spektakulär und wunderschön war’s.
Begleitet von einer Unzahl von Fliegen machten wir anschliessend eine kurze Wanderung ins Canyon hinein zum Wasserloch, das wir grad eben noch von oben gesehen hatten.
Die längere, steile und sehr anstrengende Wanderung kam nicht in Frage, weil der Weg ab neun Uhr morgens wegen der grossen Hitze geschlossen wird. – Da war jemand sehr froh, dass diese Option bereits ausser Kraft war – ganz ohne vorhergehende Diskussion. Und die Wanderung auf den nächsten Tag vor neun Uhr zu verschieben, na ja… Für die unermüdlichen Wandervögel gibt’s allerdings schon ab fünf Uhr Frühstück im Restaurant, aber ich gebe zu, ich war auch nicht ganz unglücklich, am nächsten Morgen ein wenig länger schlafen zu können, hatten wir auch noch den Mereenie-Loop vor uns, eine Strecke von 155 km, die man nur mit 4x4-angetriebenen Auto befahren darf, denn sie ist nicht asphaltiert. – So fahren die meisten Besucher wieder die ganze Strecke über den Lasseter- und den Stanley-Highway zurück nach Alice Springs. – Mir passte das nicht recht, aus dem Grund hatte ich einen entsprechenden Wagen gemietet und hoffte, dass die Strasse dann tatsächlich offen sei an diesem 25. November. Sobald es nämlich regnet, ist diese Route gesperrt und man muss tatsächlich 500 Kilometer dieselbe Strecke zurückfahren, woher man gekommen ist.
Nun, nach der Canyon-Wanderung gab’s noch ein Stündchen Ausruhen und Baden am Pool, sicher einer der Höhepunkte an diesem Tag…
Duschen und zum Sonnenuntergang-Lookout pilgern (fünf Minuten zu Fuss) waren als Nächstes auf meiner Liste, wobei es Theo nicht unendlich gestört hätte, wenn auch dieser Programmpunkt ins Wasser gefallen und stattdessen ein Schläflein drin gelegen wäre. – Er hatte ja bereits den Sonnenaufgang verpasst, den Sonnenuntergang aber zwang ich ihm auf… Und er (so sagt er wenigstens) hat es nicht bereut. – Diese Sonnenspektakel kann man sich ja anschauen, wo man will; sie sind immer eindrucksvoll.
Ja, und dann das Nachtessen. Da stellte ich mir eine Art Fastfood-Auswahl vor. Aber nein, ganz im Gegenteil. Ein ausgezeichnetes Abendessen wurde uns serviert, eine feine Flasche Wein dazu – was will man mehr!?
Wie man an einem so abgelegenen Ort mit so feinen Zutaten so wunderbar kochen kann, das konnte ich mir kaum vorstellen. Der nächst gelegene Supermarkt ist nämlich 300 km weit weg. – Ich fragte dann, wie das mit den Lebensmitteln funktioniere und man erklärte mir, alle zwei Wochen käme ein 80-Tönner vorbei mit allem drin für die nächsten Tage. – Ich bestellte einen Barramundi, denn ich esse sehr gerne Fisch. Erst nachher kam mir in den Sinn, dass es wohl nicht sehr viele Orte gibt auf der Welt, wo man Fisch weiter entfernt vom Meer essen kann als hier. – Vielleicht hätte ich doch besser Känguru bestellt…
Dann gab’s einen weiteren Höhepunkt an diesem Abend: Wir hörten, wie in hinteren Teil des Restaurants „Happy Birthday“ gesungen wurde. Da musste Theo natürlich nach dem „Gschpänli“ sehen. – Es war Liza, die junge, hübsche Dame aus der Rezeption, die mit Kollegen (wo hat sie die wohl hergenommen?) ihren Geburtstag feierte.
Diese Begegnung führte dazu, dass nun auch die Küche Bescheid wusste über unser Freudenfest und man uns ein Stück Geburtstagstorte offerierte. Und dann: Die kleine chinesische Kellnerin stellte sich zu uns an den Tisch und begann mit ihrem dünnen Stimmchen für Theo „Happy Bilthday“ zu singen. – Mir gab’s fast was…
Aber ich nahm mich zusammen und lächelte tapfer. – Zwei Strophen lang ging das Ständchen.
Rührend! – So ging der 24. November 2017 zu Ende und Theo geht nun in seinem 74sten…
Die letzten Tage im Herzen des Kontinents
Die 155 km Mereenie-Loop schafften wir in drei Stunden. Anfangs hatte ich ein wenig ein fahles Gefühl, als die asphaltieren Strasse zu Ende war und die Naturstrasse begann. „Reduce Speed“ hiess es – aber gleichzeitig zeigte die Geschwindigkeitsbegrenzungstafel 110 km/h Speed Limit an. Ein Witz wohl! Im ersten Drittel war die Strasse recht mühsam zu befahren, Bodenwellen und Unebenheiten à gogo – die totale Kopfweh-Piste. Ohne 4x4 wären wir kaum vorwärts gekommen. Später allerdings konnte man teilweise gar mit 80 km/h dahinbrettern, die Strecke war breit und ziemlich eben. Verkehr hatte es ja so oder so keinen. Das einzige Fahrzeug, das wir überholten, war ein am Strassenrand stehengelassenes, verwaistes Wrack. - Erst nach zweieinhalb Stunden begegnete uns ein entgegenkommendes Fahrzeug. Trotzdem: Wenn wir da ein Panne gehabt hätten… Oder wenn ein Pneu geplatzt wäre… 35 Grad am Schatten… Schatten??? – Nun, unser Mitsubishi war zuverlässig. Schon schön, wie man sich auf die Technik verlassen kann. – Oft denke ich an die Pioniere, die vor allem im vorletzten Jahrhundert diese und andere Gegenden in diesem weiten Land erkundet haben. Ohne Mitsubishi und ohne Strassen, bei Trockenheit und enormer Hitze.
Wir hielten Ausschau nach Kamelen. 200‘000 Stück soll es geben, die frei in diesem Gebiet leben. Gesehen haben wir gerade eines davon (ausser diejenigen in der Kamel-Farm auf dem Weg nach Yulara) und wir sind nicht sicher, ob es nicht doch ein domestiziertes war. Hingegen sahen wir viele wilde Pferde und das Seltsame war, auf der Strasse lag immer wieder Pferdemist, Kameldung auch, und wir fragten uns, weshalb die Tiere so unheimlich gern auf die Piste scheissen, wenn es doch unendlich viel Land gibt, wo das Toilettieren sicher auch eine Option wäre.
Toll war auch unsere nächste Unterkunft: Glen Helen. Auf Anhieb machten die paar Gebäude, die das Resort ausmachten, keinen einladenden Eindruck. Alles schien ein wenig verwahrlost, höchstens „back-packerisch“, hat aber zumindest eine einsame Tanksäule, und unser Zimmer war ganz ok, einfach, aber zweckmässig, die Betten richtig bequem. - Und fantanstisch gelegen: direkt am Finke-Fluss, der – wer hätte das gedacht – sogar Wasser führt. Zehn Minuten dem Ufer entlang – in der Glen-Gorge konnte man sogar baden. Was für eine schöne Abkühlung bei der Hitze! Die liessen wir uns natürlich nicht entgehen.
Glen Helen ist ebenfalls weit abgelegen, weit und breit gibt’s keine Nachbarn, nirgends, wo man übernachten oder etwas kaufen könnte. Die Wasserquelle, die dort zwar vorhanden ist, ist zu salzig, als dass man sie brauchen könnte; das Wasser muss per Lastwagen hertransportiert werden. – Und wie staunten wir, was für ein wunderbares Essen uns im hübschen (award-winning) Restaurant serviert wurde. – Erstaunlich, wie eine so feine Küche so weit weg von jeglicher Zivilisation so fabelhaft funktioniert.
Das war unsere letzte Übernachtung vor Alice Springs. Unterwegs, es waren noch etwa 150 km zum Fahren, machten wir noch drei Abstecher, die uns ebenfalls eindrücklich in Erinnerung bleiben werden: Ormiston Gorge, Ellery Creek und Standley Chasam. Bei allen dreien ist ein angenehmer Walk ausgeschildert und in den ersten beiden kann man sich auch im Wasserloch abkühlen. Besonders Ellery Creek eignete sich gut zum Schwimmen. Wir verweilten dort fast zwei Stunden.
Standley Creek hingegen führt kein Wasser. Das Territorium wird von Aborigines verwaltet – man muss Eintritt zahlen. Ein schöner Weg entlang von Palmen und Ghost-Gum-Trees führt vorbei an imponierenden Felsformationen und endet schliesslich in einer Klus mit achtzig Meter hohen Steilwänden. Ein beeindruckender Ort – fast beängstigend!
Die letzten paar Kilometer zurück nach Alice Springs führen entlang der MacDonnell-Ranges, die gerade in dem Moment in besonderem Licht erschienen. Ein riesiges Gewitter mit Blitz und Donner kündigte sich an. Wie gut, dass dies nicht ein Tag früher geschehen war. Wir hätten den Mereenie-Drive nicht befahren können.
Auf der ganzen fast 1‘300 Kilometer langen Strecke gab es immer wieder Schilder, die vor überfluteten Strassen warnten (Floodway). Das konnten wir uns kaum vorstellen, fuhren wir doch an zahllosen Flussbeeten vorbei oder spazierten hindurch, die schon seit langem keinen Tropfen Wasser mehr gesehen hatten. Aber am folgenden Tag sahen wir im Fernsehen einen Live-Bericht aus der Gegend, wo Sturzbäche über die Felsen flossen und Strassen und Flussläufe überflutet waren.
Als wir in Alice Springs ankamen, war der Sturm gerade vorbei; es hatte aufgehört zu regnen. Riesige Wasserlachen überall und abgebrochene Äste, die auf den Strassen herumlagen, zeugten von einem starken Unwetter.
Uns reichte die Zeit noch gerade, das Aviatik-Museum zu besuchen, von dem Bill Bryson in seinem Buch berichtet, und die Galerie, die eine bemerkenswerte Sammlung von einheimischer Kunst beherbergt.
Am nächsten Morgen nahmen wir’s gemütlich. Wir packten unsere Koffer und hatten grad auf die Sekunde Zeit, sie im Auto zu verstauen, als es wieder zu regnen begann, und das in Strömen. - Aber no worries, in gut anderthalb Stunden hatten wir ja einen Flug in sonnigere Gefilde. Zum Flugplatz dauert es nur etwa eine Viertelstunde, wir dachten, wir könnten dort dann noch frühstücken. Unterwegs war noch Zeit, ein letztes Foto vom Monument „Welcome in Alice Springs“ zu schiessen, dann Einfahrt zum Terminal. - In dem Moment kam mir in den Sinn, dass wir vergessen hatten, das Auto vollzutanken. – Der Tank war fast leer und ich hatte gelesen, dass sie 3,5 $ pro Liter verlangen, wenn man den Wagen nicht vollgetankt zurückgibt. – Ein bisschen viel, fanden wir. Nun kam ich doch ein wenig ins Schwitzen. Zum Glück ist der Flughafen „Belp-ähnlich“, also klein aber fein, so dass es vielleicht reichen würde, nochmals zurück in die Stadt zu fahren zum Tanken (ein bisschen Abenteuer muss ja sein…). Es war jetzt zwanzig vor neun, Abflug in einer Stunde. - Ich parkierte also auf dem Kurzzeitparkplatz, wir gingen zum Check-In, wo günstigerweise gerade niemand vor dem Schalter stand, gaben unsere Koffer auf, erkundigten uns, wo die nächste Tankstelle war, ich holte das Auto wieder und wir fuhren zurück nach Alice. – Der Weg schien lang, die Zeit kurz, wir fanden eine Tankstelle, ich parkte vor der ersten Säule. Dort hiess es „out of order“. Kann ja nicht anders sein, wenn’s pressiert… Ummanövrieren, vor die nächste Säule, die war ok. Theo füllte den Tank, ich drehte Däumchen, es war inzwischen fünf nach neun, endlich konnte Theo bezahlen, kam zurück ins Auto und los ging’s Richtung Flughafen. Diesmal ohne Fototermin unterwegs. – Auto parkieren, am Hertz-Schalter Schlüssel abgeben, zur Sicherheitskontrolle. Wir sind die Einzigen, judihui! – zum Gate Nummer 3 - und da war‘s grad Zeit zum Einsteigen. In aller Selenruhe zeigten wir unsere Boarding-Cards und spazierten mit den anderen Passagieren im Regen zum Flugzeug.
Abflug wie geplant um 09.40 – Torrianis mit on board - No worries at all!
Zwei Stunden später kamen wir in Adelaide an – schönes Wetter, 35 Grad.
Zurück in Adelaide 27. November – 5. Dezember
Die Wetterprognosen machten Sorgen – alles andere als no worries! Die nächsten zwei Tage sollte es weit über dreissig Grad sein, dann die Katastrophe – ein Kälteeinbruch vom Gröbsten. Das hiess für uns, schleunigst einen weiteren Strand-Tag einbauen. Einer genügte aber vorerst. Unsere Gastgeber gaben uns alles mit, was man so braucht am Strand: Stühle, Strandtücher und einen Windschutz, der so zusammengefaltet war, dass er sich wie von Geisterhand öffnete, wenn man das richtig anstellt. – Das war relativ einfach, aber das Schliessen… Wir übten zwar noch vorher, aber dann am Strand gelang das Kunststück des Zusammenfaltens überhaupt nicht mehr und wir mussten das sperrige zeltartige Gebilde hinten ins Auto hineinzwängen und so heimfahren. Peinlich, wirklich. Trotz Anleitung mit Bildern (fold like this: / twist your hands 180° / …). Daryl wusste dann wieder, wie.
Für den Mittwoch bot sich Christiane an, uns einen ganzen Tag lang herumzukutschieren, um uns die Schönheiten von Süd-Australien zu zeigen und uns zu Weingütern zu begleiten, so dass wir degustieren konnten, ohne anschliessend selber fahren zu müssen. – Was für ein wunderbares Angebot! Wer könnte dazu schon nein sagen?!
Es war ein herrlicher Tag. Ein wenig warm zwar (das Thermometer pendelte zwischen 39 und 41 Grad), aber wir genossen jede Minute. Einmal hatte ich allerdings fast das Gefühl, meine Füsse schmelzten mir aus den Schuhen weg, aber da hatte ich mich geirrt; sie steckten doch noch drin.
Im Deep Creek Canyon Conservation Park hat man grandiose Ausblicke auf Strände und sanfte Hügelketten. Kängurus hopsen herum, allerdings nur die argwöhnischen, die vielleicht wissen, dass hin und wieder mal das eine oder andere Exemplar von ihnen auf der Speisekarte und im Teller landet. Andere sind zu faul sich zu bewegen, liegen im Schatten der Bäume und sind intensiv mit Siesta beschäftigt.
Die Fahrt dorthin durch landwirtschaftliches Gebiet mit Kühen, Weiden, Weizenfeldern, Weinbergen, Kirschenplantagen, vorbei an idyllischen Gewässern und Häusern mit den wunderbarsten Blumengärten liess beinahe den Eindruck entstehen, man sei hier in England oder gar in der Schweiz, wären da nicht die Eukalyptuswälder und –alleen.
Wir besuchten Blowhole Beach, Victor Harbour, Port Elliot, Myponga Beach, Port Noarlunga und am absolut Eindrücklichsten war Hallett Cove. Vor 270 Millionen Jahren war die ganze Gegend dort von einer dicken Eisschicht überdeckt und noch heute sieht man „Überbleibsel“ aus jener Zeit, als sich die Gletscher zurückgezogen hatten. Der „Sugarloaf“ ist am Imposantesten. Erst denkt man, da hat sich jemand einen Spass geleistet und einen Berg aus Polyester errichtet, der kann doch nicht natürlich sein, aber dann liest man, wie diese Felsformation entstanden ist. Erstaunlich! - Verschiedene Schichten von Sand und Kalk haben durch Erosion eine Art Zuckerstock gebildet – eine sonderbare farbige Landschaft ist erhalten geblieben. Ein „Boardwalk“, ein bestens ausgebauter und befestigter Holzpfad, führt darum herum und anschliessend für drei Kilometer auf den Felsen dem Meer entlang, der sogenannte „Hallett Cove Glacier Hike“.
Wir haben uns mit einem Kilometer begnügt, denn die Hitze…
Kühler war’s beim Wein Degustieren in den McLaren Vale Wineries.
Von morgens neun bis abends um sieben war Christiane unsere Reiseleiterin. Sie kennt sich bestens aus in der Gegend, ist eine ausgezeichnete Fahrerin und wir erlebten einmal mehr einen unvergesslichen Tag.
Im Barossa-Valley übernachteten wir einmal, obwohl der Hauptort Tanunda nur eine knappe Stunde weit weg ist von da, wo wir wohnen. Aber wir nahmen’s gemütlich, besuchten eine ganze Menge Winerys und liessen es uns gut gehen. Ich war die arme Fahrerin, konnte nicht ganz so viel degustieren wie Theo, aber ich hab’s überlebt. Die schöne Gegend, das perfekte Wetter am ersten Tag (33 Grad) und die gepflegten Gärten, Felder und Weingüter waren Entschädigung genug.
Ein paar Zeilen wert ist auch unsere Unterkunft, die ich am Morgen unseres Reisetags kurzfristig bei Booking.com gebucht hatte.
Ich suchte ein Hotel- oder Motelzimmer im Ort Tanunda selber, so dass wir am Abend nicht mehr würden fahren müssen und uns ein Restaurant in der Nähe aussuchen konnten. In der Beschreibung hiess es, schöne Unterkunft (Suite) in historischem Haus für zwei Personen, drei Schlafzimmer (?) und dann seltsamerweise 11 m2. Da konnte irgendwas nicht stimmen, aber Lage und Preis waren ok, ich reservierte.
Das Haus war 1890 gebaut worden, einstöckig und sehr gross, mit Rosengarten zur Strasse hin und Swimmingpool hintendran (wohl kaum historisch). – Eigenartig, was ich da gebucht hatte. Erst kamen wir in ein Entree, dann war rechterhand ein Wohnzimmer, ein langer Gang (15 Meter – hab mit Riesenschritten gemessen) führte nach hinten, an dem entlang es linkerhand tatsächlich drei Schlafzimmer hatte (sieben Betten im Ganzen), dann ein Esszimmer, eine gut ausgebaute Küche und noch ein Badezimmer (Dusche aus Messing oben an der Badewanne, die auf goldenen Füssen steht, angebracht), das ich erst gar nicht fand, weil alles so weit verzweigt war. Eine ganze Wohnung war das mit 110 m2 Wohnfläche. Irgendwer hatte wohl bei der Beschreibung das Gefühl gehabt, diese Angabe könne nicht stimmen und hatte kurzerhand die Null gestrichen. – Wir zwei kamen uns ziemlich verloren vor in der alten Wohnung, die mit den Möbeln aus Grossmutterzeiten ausgestattet war (ausser dem Breitwand-Bildschirm und den Klimaanlagen). Mir kam‘s vor wie das „Haunted Mansion“ im Disney-Land: ziemlich düster und fast ein wenig unheimlich. Schöne Holzböden gab es überall, aber die knarrten, wenn man umherging und bei jedem Schritt wackelte auch die Tür im Schlafzimmerschrank. Dieses Geräusch wiederum erinnerte mich an etwas aus meiner Kindheit, von dem ich aber nicht mehr genau weiss, wo und wann es genauso tönte.
SEHR speziell also das Ganze, aber nach kurzer Eingewöhnungszeit waren wir ganz zufrieden mit diesem wunderlichen Übernachtungsort. Wir konnten uns sogar ein wenig abkühlen im Pool; das war herrlich. Ja, und eigentlich war alles da, was man braucht, sauber war’s auch und wir schliefen wunderbar.
In der Nacht dann kam der Regen und der kühle Wind aus der Antarktis. Das Thermometer sank auf 19 Grad hinunter. Am Abend zuvor hatten wir noch fein im Freien zu Abend essen können in einem hübschen Restaurant, genannt „1918“.
Bevor‘s am nächsten Morgen mit der Weintour weiterging, machten wir (jetzt eingepackt in Jacken und Regenschutz) einen Spaziergang durchs Dorf.
Kirchen hat’s nicht wenige und wie überall eine ganze Menge von kleinen Boutiquen, die Nippsachen verkaufen, die niemand braucht, die aber offenbar doch mit Vorliebe gekauft werden. Besonders jetzt, in der Adventszeit, boomt das Geschäft. Auch kleine Weihnachtsmärkte findet man; hinter jedem Stand eine Granny, die ihr Selbstgestricktes anbietet. Auch der Samichlaus fehlt nicht.
Was uns gut gefallen hat, sind die überaus freundlichen Angestellten, die uns ihre Weine beschrieben und zum Kosten reichten. Mit ausnahmslos allen gab’s interessante Gespräche, man fühlte sich überall willkommen, auch wenn man nichts kaufte. „No worries“, hiess es ganz natürlich. Wir kündigten jeweils zum Voraus an, dass wir leider keinen Wein mit nach Hause nehmen könnten, gern aber fürs Probieren zahlen würden, aber das kam gar nicht in Frage und trotzdem durften wir von den teuren Weinen probieren, bei „Peter Lehmann“ sogar einen Shiraz für 100 AU$.
Am besten hat es Theo aber bei „Jacob’s Creek“ gefallen. Die haben tolle Liegestühle im Garten…
St Hugos war jedoch auch nicht schlecht:
Das war aber am Tag zuvor. Wieder zurück auf dem Mount Lofty war’s am späten Nachmittag grad nur noch 10 Grad kalt. Die riesigen Temperaturunterschiede waren zwar angekündigt worden; sie sind aber kaum zu glauben.
Einen schönen Abend verbrachten wir zum Abschied mit unseren Gastgebern in einem Pub in den Hills, „The Scenic @ Norton Summit“, wo Theo doch noch zu seinem Känguru-Filet-Menu kam (35 ½ pancetta wrapped kangaroo fillet, hand cut potato wedges, green beans & chimichurri), mich hingegen nahm wunder, was ein „deconstructed“ chicken sei (30 ½ deconstructed chicken cordon bleu with brie & pancetta on grilled asparagus and fried spinach & ricotta gnocchi). – Keine Knochen mehr drin – ich fragte mich allerdings, ob das Wort nicht eher in den Bereich des Bauwesens gehöre… Und „Chimichurri“ habe ich nachgeschaut - ist eine argentinische Sauce, ähnlich wie Pesto.
Essen und Wein waren vorzüglich. Der Shiraz auf der Getränkekarte hiess „Kay Brothers“, keine Frage – den mussten wir bestellen, und wir haben es nicht bereut.
Am allerletzten Tag war’s wieder kalt und regnerisch und wir beschlossen, zwar nicht mehr viel zu unternehmen, aber doch noch unser letztes Kleingeld loszuwerden. Nicht weit von da, wo wir wohnten, gibt’s die Bridgewater Mill, ein Weingut mit feinem Restaurant. – Ein vorzügliches Essen wurde uns serviert, ein Dessert vom Feinsten und das Beste: Es hatte dort ein Cheminée, so dass man schön warm hatte. Schliesslich ist es ja Dezember… - Und lustig: Die Kellnerin, eine Australierin, hat eine Saison lang in Savognin gearbeitet. Sie spricht ausgezeichnet deutsch.
So gingen auch unsere letzten Tage im schönen Süden des Landes viel zu rasch vorbei und bald hiess es wieder Koffer packen und die Heimreise antreten - mit zehn Tagen Aufenthalt in Bali vorerst noch, damit der Flug nicht so endlos lang wird.
Kleiner Exkurs: Theo im Duty-free-Shop. Er musste seine Boardingkarte zeigen und die Verkäuferin fragte ihn beim Bezahlen seiner obligaten Flasche Famous Grouse:
“Is that your final destination?” Er anwortete: “Hopefully not!!!” – Ihre humorvolle Antwort war dann: “Bali is a nice place to die.” – Solche Spassvögel, die Australier!

Lange wussten wir nicht, ob die australische Airline Jetstar fliegt oder nicht, denn am Sonntag war der Flughafen in Denpasar noch geschlossen. Der Vulkan Agung war ausgebrochen und Tausende von Menschen mussten evakuiert werden. Am Montag dann erfuhren wir, dass unserer Reise nichts mehr im Weg stehen würde, sich der Vulkan inzwischen beruhigt hatte.
5. Dezember: Um halb zehn Uhr abends kamen wir an. Eine Stunde später sassen wir im Taxi, das uns zu unserem vierten Haustausch führte, in Seminyak. Ein Angestellter begrüsste uns, ein bequemes Bett und ein riesiger Fruchtkorb standen schon parat.
Ein schönes Haus, einmal mehr: Nur das geräumige Schlafzimmer hat eine Türe zum Schliessen, alle anderen Räume sind offen, sowohl das elegante Badezimmer als auch die Dusche. Von der Küche/Esszimmer/Wohnzimmer aus kann man direkt in den Swimmingpool steigen, ebenso führt die Terrassentür aus dem Schlafzimmer schnurstracks dorthin: eine willkommene Abkühlung bei 28 – 33 Grad im Schatten und der hohen Luftfeuchtigkeit.
Am ersten Tag schon „versumpften“ wir, wenn man dem so sagen kann. (Polo Hofer hat eine ähnliche Situation mal so beschrieben: „Lieber über Nacht versumpfen als im Sumpf übernachten….“). Anna und Steve luden uns zum Apéro in ihr Haus ein, dorthin, wo wir vor vier Jahren gewohnt hatten. Der Vorabend war dann relativ weinselig, Steve brachte eine Flasche Weisswein nach der anderen und auch Wodka, den er selber herstellt, aber nicht trinkt (!).
Zwei Freunde der beiden, Rose (eine junge Engländerin, deren Eltern in Bali ein Haus haben) und Graham (ein etwas älteres Semester, ein Engländer, der jetzt in Australien wohnt), waren auch dort und halfen tüchtig mit, den Alkohol zu vernichten (NB später erfuhr ich, dass Graham zwei Jahre jünger ist als Theo...). Schon nach kurzer Zeit lud uns Graham alle zu sich nach Melbourne ein, um dort die Australien Open zu besuchen. - Na ja, ob er sich am nächsten Tag noch daran erinnert und ob’s soweit je kommen wird - wer weiss. Hört sich aber gut an und ich wär‘ auf jeden Fall dabei. Das dann frühestens im Januar 2019. – Da könnt ich doch glatt ein Reisli darum herum basteln…
Also so gegen acht Uhr fand Anna, wir sollten etwas essen gehen. Alle waren sofort einverstanden. Per Taxi ging’s ins „Made‘s“, wo während des Dinners balinesische Tänze gezeigt wurden und anschliessend eine Live-Band spielte. Uns wurde ein feines Abendessen (Babur Ayam) seviert und dazu drei Flaschen Wein. Es dauerte dann nicht lang und sowohl Graham als auch Steve standen auf der Bühne und sangen mit (Theo zum Glück nicht!). Und es war überhaupt nicht peinlich, denn beide haben eine sonore Stimme und es tönte echt sehr gut. So jedenfalls empfand ich das. Ob bei totaler Nüchternheit… – Und wir tanzten auch alle, bis es aus Kübeln zu regnen begann. Da sich die Tanzfläche unter freiem Himmel befindet, war damit unserem fröhlichen Beisammensein ein jähes Ende beschert.
Ein Taxi brachte uns „heim“. Dort angekommen: Nichts wie los in den Pool. Herrlich war das!
Anna versprach, ein Tennis Double-Mixed in ihrem Club zu organisieren. Am Montag um ein Uhr mittags. Darauf freue ich mich mehr als nur ein bisschen. – Bei dieser Temperatur; muss dann eine Eisbox mitnehmen, dachte ich… Schon als wir letztes Jahr hier waren, spielten wir ein paarmal Tennis. Aus dem Grund hatte ich auch meine Tennisschuhe seit zwei Monaten um die halbe Welt mitgeschleppt. Ich erinnerte mich nur allzu gut an meine wunden Füsse, die ich damals hatte…
Elf Tage lang sind wir in Bali. Immer wieder mal gibt’s einen Theo-Tag, das ist ein Tag, wo man eigentlich gar nichts macht ausser immer mal wieder Siesta. - Ok, ok, am Abend gehen wir irgendwo essen.
Was es nicht alles Wunderbares und Leckeres hat hier auf den Speisekarten, auch zum Frühstück – eine endlose Schlemmerei für wenig Geld noch dazu. – Und an einem solchen Tag gehen wir beide und lassen uns die Haare schneiden bei Nike, einem hübschen kleinen Salon ein paar Minuten zu Fuss von wo wir wohnen.
Theos Schnitt kostet 3 Fr. 20 Rp., meiner ganze 4 Franken. Schon lange habe ich nicht mehr das Gefühl gehabt, so gut und kompetent bedient worden zu sein. Intensive Kopfmassage inklusive. Abgezogen vom Preis waren 20% Rabatt. Wegen des Vulkans gibt’s vielerorts Spezialangebote und Rabatte.
Mit dem Trinkgeld tue ich mich ein wenig schwer. Wie viel gibt man bei solchen Preisen? Ich weiss es wirklich nicht. Das Doppelte ist ja vielleicht ein wenig überheblich, aber ich hab’s dann trotzdem so gemacht.
An einem Nicht-Theo-Tag buchten wir ein Taxi mit Fahrer. Schon um halb neun Uhr ging’s los.
Frengky, ein sehr sympathischer junger Mann im gleichen Alter wie Gino, war zeitig parat und er fuhr uns überall dort hin, wo ich vorher recherchiert hatte. Auch auf einige seiner Vorschläge gingen wir ein. In Celek (dort wird Silber und Gold verarbeitet) machten wir unseren ersten Halt. Entlang der Hauptstrasse hat es einen Shop nach dem anderen, grössere und kleinere, wo man den Handwerkern bei der Arbeit zuschauen kann, dann in den Laden geführt wird, wo die vielen herumstehenden Verkäuferinnen und Verkäufer anschliessend auf ein gutes Geschäft hoffen. So haben wir es vor vier Jahren erlebt. Jetzt ist es sehr befremdlich: Auf den riesigen Parkplätzen steht kaum ein Bus, die Verkäufer sitzen herum und haben nichts zu tun. - Der Vulkan, der doch ein heiliger Berg ist und daher auch verehrt wird, weiss gar nicht, was er der ganzen Bevölkerung und vor allem den Menschen, die in den Dörfern um ihn herum leben, antut. Mehr als 100‘000 Bewohner mussten evakuiert werden und wir hörten, dass die Belegung in den Hotels höchstens 10 % beträgt. Viele Unterkünfte mussten schliessen, die Restaurants, wo man normalerweise Mühe hat, einen Platz zu finden, sind leer. Oft sind wir die einzigen Gäste, fast nur Einheimische sind anzutreffen.
So sieht’s auch in den Verkaufsläden und -werkstätten aus, wo Batik hergestellt wird. Der stolze Besitzer der Galerie, in welcher 100 Künstler aus Ubud ihre Bilder ausstellen, sieht ziemlich niedergeschlagen aus. Seine Geschäfte sind im Eimer. Die ganze Reisebranche blutet, es braucht auch keine Fahrer mehr, keine Tourguides, keine Tourenverkäufer. - Und ob sich zu Weihnachten doch noch alles ändern wird, ist fraglich. Zu viele Australier (sie machen die grosse Mehrzahl der Bali-Touristen aus) sind vor wenigen Tagen am Flughafen gestrandet, zu viele Gäste haben ihre Reisen abgesagt und umgebucht, zu viele Touristen haben Angst, dass das noch einmal passiert und sie dann das grosse Fest mit Turky, Tannenbaum, Glitter und Glanz zu Hause verpassen.
Wir haben unsere Reise schon im März gebucht und hoffen nun einfach, dass wir auch wieder ausreisen können. Sonst bleiben wir halt noch ein Weilchen…
Diesmal wollen wir uns ein wenig mehr Zeit nehmen in Ubud als beim letzten Besuch. Als Erstes war der Monkey-Forest auf dem Programm. Eine gute Stunde spazierten wir auf den gut ausgebauten Wegen durch den eindrücklichen Regenwald und freuten uns über das Spiel der kleinen Langschwanz-Makaken, die den ganzen Wald für sich beanspruchen, überall herumturnen – auch auf den Köpfen der Touristen, wenn man nicht aufpasst. Hier hatte es doch eine recht grosse Anzahl Touris, fanden wir. - wie das wohl gewesen wäre, wenn Mount Agung sich nicht so schlecht benommen hätte…
Den Affen ist der Vulkan sicher egal, sie sind überhaupt nicht scheu, lassen aber die Besucher im Grossen und Ganzen in Ruhe, wenn man nicht gerade Esswaren bei sich trägt. Sie sind mit der Aufzucht und nicht selten auch mit der „Herstellung“ ihrer Jungen beschäftigt. Untereinander scheinen sie oft recht aggressiv. Lustig, wie die eine Affenmutter ihr Junges am Schwanz zieht – wie an einer Leine lässt sie ihm nur einen bestimmten Radius.
Zeit fürs Mittagessen. Frengky führte uns in ein sehr hübsches Restaurant im balinesischen Stil mit gedeckter Terrasse und Blick auf endlose Reisfelder. Das Restaurant war alles andere als voll, aber trotzdem, ein paar Gäste hatte es schon. Die Spezialität: Ente. - Also bestellte ich Crispy Duck. Das arme Tier wäre wohl von selber gestorben, an Hunger, hätte man es nicht geschlachtet. Eine halbe Ente hatte ich auf dem Teller, etwa drei Bissen Fleisch konnte ich ausfindig machen, der Rest war Knochen. Aber eben, wenigstens die Aussicht war schön.
Unser nächster Besuch galt dem „Antonio Blanco – Museum“, dem Dalí von Bali. Die Bilder selber (meist Tempeltänzerinnen) fand ich nicht sehr berauschend, aber die Bilderrahmen schon. Dort lässt der Maler seinen Phantasien freien Lauf: protzige Holzrahmen mit den wildesten Ornamenten drauf, auch Samt und Seide kommen zum Einsatz. Leider durfte man nicht fotografieren. Das Museum selber und vor allem der pompöse, über drei Stockwerke offene Innenraum wirken ein wenig deplatziert - nicht der Grösse wegen, sondern wegen seiner Architektur, die ebenfalls an Dalí erinnert. Auf dem Dach hat’s zwar keine goldenen Eier, dafür aber goldene Tempeltänzerinnen.
Die Familie Blanco liebt offenbar bunte Vögel, so hat es Volieren im Garten, Papageien und ein Hornbill fliegen frei herum und quieken die Besucher an, wenn sie vorbeigehen.
Die Reis-Terrassen, die wir schon vor vier Jahren besichtigt haben, wollten wir uns nochmals anschauen. Der Blick von Tegalalang aus ist einmalig. Und jetzt, im Dezember, ist Erntezeit; man sieht Bauern bei der Arbeit.
In den Reisplantagen verstecken sich auch verschiedene Tempel. Wir fuhren zum Gunung Kawi, das ist nicht nur eine Tempelanlage, sondern es sind Königsgräber aus dem elften Jahrhundert. Ein sehr eindrücklicher Ort, aber mindestens ebenso eindrücklich ist die lange Treppe, über 300 Stufen, die steil entlang der Reis-Terrassen zu einem schmalen Fluss und der ganzen Anlage herunterführt. Schweisstriefend bei der Hitze war nicht nur der Abstieg, sondern auch der Spiessrutenlauf zwischen all den unzähligen kleinen Souvenirläden vorbei, die mehr oder weniger dasselbe verkaufen und im Moment ja keine Käufer haben. Fast wie die Motten das Licht umschwärmten einen die „ausgehungerten“ Händlerinnen und Händler, die wohl den ganzen Tag lang kaum ein lohnenswertes Geschäft hatten machen können. So besitzt Theo nach unserem Besuch ein neues Hemd und einen Sarong, („only one dollar“) - umgerechnet dann doch drei.
Die Treppe wieder hinauf – absolut geschafft. Es war halb fünf und obwohl Frengky noch ein paar Ideen hatte, was wir machen und wo wir hingehen könnten, war uns am liebsten zurück nach Hause. Auch ohne Touristen herrschte eine Riesenmenge Verkehr. Die Motorräder schwirrten links und rechts an unserem Auto vorbei; ich kam mir vor wie in einem Bienenhaus und war sofort wieder in Myanmar-Stimmung: Ich sass links neben dem Driver und schaute zum Seitenfenster hinaus, damit ich all die knappen Überholmanöver und Fast-Kollisionen mit Hunden, Fussgängern und sonstigen Verkehrsteilnehmern möglichst ignorieren konnte. Gut zwei Stunden dauerte die Fahrt zurück nach Seminyak. Frengkie ist ein sehr guter und ruhiger Fahrer, er war vorher Lastwagenfahrer. Mühelos und wie wenn’s für ihn ein Kinderspiel wär, manövrierte er uns durchs Chaos und lieferte uns schliesslich unversehrt um sieben in unserer Villa, wie die hier heissen, ab. – Wir buchten ihn nochmals für einen zweiten Tag.
Im Haus war alles schön aufgeräumt, geputzt, versorgt. Man braucht keinen Finger zu rühren; drei freundliche junge Frauen sind angestellt, jeden Tag alles in Ordnung zu halten, das Geschirr zu waschen, frische Tücher hinzulegen. Die zwei jungen Männer, die Tag und Nacht Security-Dienst haben, sind fürs „Grobe“ verantwortlich, und falls etwas nicht funktioniert oder etwas geflickt werden muss, sind sie unverzüglich zur Stelle. Sie rufen uns ein Taxi, wenn wir eines brauchen. – OMG - da werden wir schön ins Leben B hineinplumpsen, wenn wir wieder in Ittigen sind.
Tennis fand am Montag statt, aber in der Halle zum Glück, wo’s zwar auch nicht gerade kühl war, aber einem zumindest die Sonne nicht direkt auf den Deckel brannte. Anna hatte zwei junge Balinesen engagiert, damit wir ein Mixed spielen konnten. Wir hatten viel Spass; die beiden liefen wie die Wiesel, wir zwei eher nicht wie Wiesel, gaben aber dennoch unser Bestes. Mein Outfit jedenfalls war triefend nass nach dem Spiel.
Der Club ist exklusiv, members only, ein Schwimmbad gehört dazu, ein Restaurant mit Bar und auch eine zweite Anlage am Meer mit einem weiteren Pool, Restaurant und Disco. Dorthin fuhren wir anschliessend mit dem Taxi, hatten Lunch und liessen es uns gut gehen.
Anna machte den Vorschlag, am nächsten Tag gemeinsam einen Ausflug zu unternehmen. Gede, der Taxifahrer, den sie normalerweise beschäftigt, hatte natürlich Zeit und Ideen, wohin es gehen solle. Er wollte mit uns in sein Dorf fahren und uns seine Familie vorstellen. Diese wohnt knapp ausserhalb der Sperrzone um den Mount Agung herum.
Unterwegs gab’s einen ersten Halt in Samarapura, der Hauptstadt der Provinz Klungkung, wo sich der hübsche Tempel Taman Wisata Kertha (Kerta Gosa) befindet. Das Dach ist aufwändig bemalt mit Geschichten aus alter Zeit.
Die Fahrt wurde allmählich kurvenreich und führte uns vorbei an Reisfeldern, durch Regenwald, bis zu einem Lookout auf fast 1000 Metern Höhe, von dem aus man über die grüne Landschaft sehen konnte bis zum Meer (Bukit Jambul). Rund um den Vulkan herum ging’s weiter, an Lagern vorbei, wohin man vor zwei Wochen die mehr als 100‘000 Menschen evakuiert hatte, die innerhalb der 10-km-Zone am Fusse des Berges wohnten. Wie lange sie dort bleiben müssen, weiss niemand. Das stelle ich mir ziemlich schrecklich vor.
Es war ein einigermassen bedeckter Tag und nur ganz selten konnten wir einen Blick auf den Bösewicht werfen, der sich hinter dichten Wolken versteckte. Zwischendurch regnete es sogar und hatte Nebel. Was aber sichtbar ist, ist die frische Lava, die er vor wenigen Wochen hinterlassen hat.
Von Gedes Familie wurden wir herzlich empfangen. Im abgelegenen Bauerndorf, wo sie leben, hätte ich mir eine einfache Behausung vorgestellt, aber das war überhaupt nicht so. Nebst dem Familientempel stehen vier Häuser auf dem Grundstück, eines davon die Küche, die andern drei sind Wohnhäuser (dasjenige des Bruders modern und fast zu nobel für die Gegend). Sie erzählten uns, dass der Vater das Stück Land (700x700 Meter) damals für 150$ gekauft hätte, jetzt sei es mehr wert.
Die Mutter bereitete Tee und Kaffee zu, Gedes Bruder las ein paar Mangos ab vom Baum im Hof und rüstete sie für uns. Der Vater kam ebenfalls noch dazu und die eine Schwester brauste aus dem Nachbardorf mit dem Roller an, um den ausländischen Besuch zu begrüssen und zu begutachten.
Gemeinsam machten wir einen kurzen Spaziergang durchs Dorf und besuchten den Stall, wo’s sechs Kühe hat und drei Schweine. Kampfhähne halten sie auch; die sind in Einzel-Käfigen eingesperrt.
Im Haus unten an der Strasse ist das Büro untergebracht, von wo aus der Berg beobachtet wird. Interessant wäre es gewesen, mit den Seismologen zu sprechen, leider waren die aber grad abwesend, genauso wie auch der Agung hinter den Wolken.
Die weitere Strecke führte uns am Meer entlang über Kubu zu einem schwarzen Strand mit weissen Booten – ein schönes Bild - und schliesslich zum Wassertempel Tirta Gangga, wo es Usus ist, die Fische zu füttern. Auch diese, so glaube ich, leiden im Moment unter Touristenmangel und haben daher Hungeräste vom Schlimmsten; sie führten jedenfalls ein Theater auf sondergleichen, als wir ihnen die leckeren Fischkörner ins Wasser streuten, die’s dort für sie zu kaufen gibt. Auch dieser Tempel lädt zum Spazieren ein. Es ist ein geruhsamer Ort.
In Tenganan machten wir zum letzten Mal Halt vor der langen Rückreise. Ein seltsames Dorf: Den Nachkommen der Ureinwohner Balis, als die sie sich bezeichnen, ist es gelungen, die prähistorische Kultur der Insel lebendig zu behalten. Durch strikte Abschottung über Jahrhunderte hinweg haben sie ihre kulturellen und religiösen Traditionen bewahren können. Heiraten werden nur unter Dorfbewohnern toleriert, wer sich daran nicht hält, darf nur noch als Gast das Dorf besuchen. – Das alles erinnert mich an die Amischen in den Staaten.
Eine spezielle Art zu weben ist Ikat. Stoffe dieser Art sollen angeblich nur dort noch hergestellt werden. Ein solches Tuch habe ich dann erstanden.
Die Fahrt zurück nach Seminyak war mühsam und dauerte lang. Der Verkehr und die halsbrecherische Fahrweise zerrten an den Nerven, vor allem, als es noch zu regnen begann und dunkel wurde. Müde kamen wir zu Hause an; Theo „töipelet“ und will am nächsten Tag, wo ich doch mit Frengkie abgemacht habe, nicht mehr so lange Auto fahren.
So geht’s erst um neun Uhr los. Nach einer knappen Stunde Fahrt kommen wir in Mengwi an und besichtigen den Pura Taman Ayun, einen Tempel, der ins UNESCO Welterbe aufgenommen worden ist. Keine Souvenirläden ringsum, das ist ganz was Neues. Den Tempel selber kann man nicht betreten, aber ringsum führt ein Weg, von dem aus man die beste Aussicht hat und touristenlose Fotos schiessen kann.
Es ist ein idyllischer Ort. Ein Park schliesst sich an, der zwischen zwei Flüssen angelegt ist - friedlich und schattig.
Unterwegs zum Tanah Lot bleiben wir im Verkehr stecken. Eine Prozession ist im Gang, die kein Ende nehmen will. Erst denken wir, es sei eine Hochzeit, Frengkie aber meint, es gehe darum, Opfergaben zu spenden und dadurch den Berg zu besänftigen. – Grossartig und schön, all die vielen Menschen in ihren traditionellen Kleidern zu beobachten.
Ein Highlight ist auch Tanah Lot, der Meerestempel. Wunderprächtig gelegen, von Wellen umspült, ein fast mystischer Ort. Dort hat es nun doch mal viele Touristen - finden wir. Aber Frengkie lacht und sagt, das seien höchstens etwa zehn Prozent der „Normalbesetzung“. Der riesige Parkplatz sei sonst voller Busse und Autos, was tatsächlich nicht der Fall ist.
Wie in Myanmar werden wir auch hier mehr als einmal darum gebeten, auf Fotos mitzuposieren. – Specie Rara…
Unterwegs gibt es die absolut wunderbarsten Reisfelder zu fotografieren und auch den Lunch nehmen wir in einem hübschen Restaurant mitten im Grünen.
Anschliessend fährt uns Frengkie heimzu mit kurzem Zwischenhalt in einem Supermarkt, da wieder mal Nachschub von Nöten ist.
Um vier Uhr ist unsere Tour vorbei, Theo glücklich, dass er im Liegestuhl vor dem Pool in tiefe Siesta versinken kann.
Drittletzter Tag: Shoppingtour mit Anna. Anschliessend wollten wir doch noch mal an den Strand. Bisher hatten wir keine Zeit (!) oder das Wetter lud nicht zum Bade. Auch an dem Nachmittag war’s nicht strahlend schön, warm aber allemal. Nach dem erschöpfenden Herumschlendern vom Shop zu Shop (Theo suchte dieselben pinkfarbenen Bermuda-Shorts, die er vor vier Jahren hier gekauft hatte und die wir inzwischen hatten entsorgen müssen. Gewisse Kriterien mussten dabei erfüllt sein: Pink eben möglichst, bis über die Knie reichend und ganz wichtig: Viele Taschen links und rechts, vorne und hinten, oben und unten! – Nein, natürlich nicht, das gibt’s ja gar nicht… – Nun hat aber die Mode zwischenzeitlich geändert, Rosarot ist nicht mehr „in“, überknielang ebenso wenig; unsere Hosen-Such-Aktion war also von Anfang an zum Scheitern verurteilt. In der Verzweiflung wurden wir dann doch noch fündig, nicht ganz dem Ideal entsprechend zwar, aber immerhin: Viele Taschen hat die Hose. Mit Klebverschlüssen und einem Reissverschluss ist sie ausgestattet! – Sogar die Länge stimmt fast – wohl ein Ladenhüter - und die Farbe: Schwarz…Nach dem Shopping-Stress gab’s nur noch Eines: Zusammenbruch auf dem bequemen Liegestuhl am Double-Six-Beach und zweistündige Siesta mit gelegentlichen Schnarchphasen - weg vom Fenster - tief in der Traumwelt.
Ja, und der Strand: Eine traurige Angelegenheit! Man kann sich kaum vorstellen, wie viel Abfall dort herumliegt. Es gibt nur einen Ausdruck dafür: grauenhaft! – Zwar wurden alle paar Meter Haufen von Kehricht zusammengerecht, aber diese Berge stehen nun einfach dort und weiter geschieht nichts – jedenfalls nicht während der drei Stunden, als wir dort waren. Auch wenn sie abgeholt würden – ich mag mir gar nicht vorstellen, wohin sie gebracht werden…
Und im Meer baden gehen: Unter keinen Umständen! Man müsste sich durch all die Plastikschnipsel und den sonstigen ekligen Müll, der unaufhörlich angeschwemmt wird, durcharbeiten; da kommt keine Freude auf. Als Erklärung dient die Meeresströmung, aber die allein ist auf keinen Fall schuld.
Bali ist eine so fantastisch schöne Insel, aber wenn das Abfallproblem nicht in Kürze angegangen wird, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass auch der Tourismus bald darunter leidet. Der Vulkan ist das eine, den kriegt man nicht in den Griff, die Verunreinigung der Dörfer und der Strände das andere. Da müsste etwas unternommen werden. Aufklärung in den Schulen zum Beispiel; Aufräumkampagnen wären auch hilfreich. - Ich verstehe nicht, wie diese freundlichen Menschen, die sich gerne schön kleiden und ihre Kinder in adretten Uniformen in die Schule schicken, einfach wegschauen, wenn’s mancherorts elendiglich aussieht und riecht wie in einer Kloake. – Auf einer unserer Touren, wir standen auf einer Brücke mitten in der schönen Landschaft, sah ich einen Mann mit einem grossen Plastikeimer voller Müll und ich dachte: „Super, der hat’s begriffen, ist ein Vorbild und sammelt all den Abfall ein. – Was er dann aber tat, war Folgendes: Er schüttete seinen Eimer übers Brückengeländer in die Tiefe. Mir blieb die Spucke weg und ich vergass sogar zu fotografieren.
In dem kleinen Salon, wo wir uns die Haare schneiden liessen, bieten sie auch Massagen aller Art an, Maniküre und Pediküre. So eine Pediküre und Fussmassage wollte ich mir gönnen. Um Viertel vor sechs war ich dort, um Viertel vor acht verliess ich das Lokal mit rot lackierten Fussnägeln und Samtpfoten. Keine zehn Franken kostete der zweistündige professionelle Service. - Wie die bei diesen Preisen überleben können, ist mir ein Rätsel. Die beiden Girls aber freuten sich über ein für sie wohl fürstliches Trinkgeld.
Anschliessend war Zeit zum Abendessen.
Die letzten beiden Tage waren/sind Theo-Tage - nichts Nennenswertes mehr wird unternommen; zum letzten Mal müssen die Koffer gepackt werden und dann geht die lange Reise um Mitternacht los. Neuneinhalb Stunden bis Dubai, dort drei Stunden Aufenthalt und weitere sieben Stunden bis nach Zürich.

Zwischenbemerkung
Eigentlich, wie schon oft erwähnt, bleiben wir im Sommer am liebsten daheim, aber das Angebot, das wir diesmal erhielten, konnten wir nicht abschlagen, das ging einfach nicht.
Denn Ken sagte, er möchte unbedingt eine längere Reise machen durch das südliche Afrika mit seiner Frau Eva und wir sollten doch mitkommen.
Eva und Ken lernten wir bei unserer letzten Reise nach Südafrika kennen, im Herbst 2016. Es handelte sich dabei um einen unserer HomeExchange-Haustausche. Wir hatten abgemacht, dass wir vier Tag lang bei ihnen in Johannesburg wohnen und anschliessend eine zwei-wöchige Safari machen würden, die Ken für uns organisierte hatte.
Manchmal kommt’s eben nicht so, wie man es plant und es sich vorstellt. Theo hat es zwei Tage vor Beginn der Safari vorgezogen, lieber mal zu erkunden, wie die Spitäler im Lande von Christiaan Barnard so aussehen und hat dann beschlossen, gleich zwei Wochen lang in einem davon zu verbringen... - So wurde aus dem 4-tägigen Aufenthalt im Haus unserer Tauschpartner ein Besuch von einem Monat.
Ken ist Südafrikaner, ist ursprünglich Jurist und hat in späteren Jahren eine Safariagentur gegründet. Sie heisst Barefoot-Safaris und existiert seit 1992. Er kennt sein Land wie den eigenen Hosensack, ist somit der beste Guide, den man sich vorstellen kann und ein wandelndes Lexikon, was wir allerdings erst während unserer Reise in Extremis erfahren durften. Dass wir von seinen Spezialpreisen für die Unterkünfte profitieren konnten, war ein weiteres Plus.
Eva ist Ungarin und reist für die UNO in der ganzen Welt herum, vor allem aber in afrikanischen Staaten; sie ist für die Weltbank tätig. Sie gehört zu den liebenswertesten Menschen, denen ich je begegnet bin. – Die beiden sind seit zehn Jahren verheiratet.
Der Tausch mit unserem Haus in den Bergen fand dann im Januar 2018 statt. Es gefiel ihnen sehr. Die ersten paar Tage waren wir gemeinsam dort, anschliessend die beiden alleine. Eva berichtete, ihr Mann habe sich im Schnee benommen wie ein sechsjähriger Junge...
Dort war es, wo Ken den Vorschlag machte, wir könnten doch zusammen auf Safari gehen, er habe ja das Know-How, das Safari-Gefährt und die ganze Ausrüstung - zu viert wär’s lustiger. Gleich begann er mit Hilfe seiner Sekretärin in Cape Town die Reise zu planen und kaum gesagt, schon getan, ein erster Entwurf stand bald schon fest. – Mir passte zwar der Zeitpunkt nicht so ganz, denn auf den Sommer in Bern zu verzichten, ist für mich nicht das Höchste der Gefühle. Schon gar nicht, wenn die Reise in ein Land führt, wo’s grad Winter ist. Aber Eva mag die Hitze nicht besonders und die Tiere sind in dieser Jahreszeit offenbar besser zu sehen, weil’s nicht regnet und daher das Gras nicht so hoch ist. Wir konnten Ken in seinem Planungseifer fast nicht stoppen. Aus seinen vorgeschlagenen neun Wochen wurden schliesslich sieben. Wir einigten uns, beschlossen aber, Malawi (wo er selber während 27 Jahren gewohnt hatte) auszulassen und von Windhoek aus direkt heimzufliegen, also die Reise von dort zurück nach Cape Town, wo die beiden jetzt wohnen, nicht mehr mitzumachen.
Nun ist also Zeit, einen neuen Safari-Versuch zu starten, in der Hoffnung, Theo lässt diesmal seine Eskapaden.

Reisebericht Südafrika-Sommer bzw. Winter-Trip mit Eva und Ken (Juli – 26. August 2018)
Rooiels / Sutherland – 8. – 16.Juli
Die Koffer sind gepackt, es kann losgehen. Genauso wie Ken empfohlen hat, hab ich’s gemacht: Mal packen, dann die Hälfte wieder aus dem Koffer nehmen und dafür das Geld, das ich mitnehme, verdoppeln.
Los geht’s allerdings erst heute Abend um zwanzig vor elf. Gino bringt uns um halb sieben auf den Bahnhof in Bern.
Bis dahin aber ist noch viel Zeit. Die Aare ist jetzt schon über 19 Grad warm um 10 Uhr morgens; noch mindestens einmal vom Schönauerli ins Marzili schwimmen, kann ich mir also nicht entgehen lassen. Um halb fünf geh ich heim.
Alles läuft problemlos, Theo hat seinen Swisspass für den Zug dabei (nicht im Koffer, sondern zur Hand!), bei seinem Handgepäck gibt es ausnahmsweise nichts zu beanstanden, der Flug startet pünktlich, zehneinhalb Stunden später sind wir in Johannesburg. Es ist nur gerade fünf Grad warm morgens um neun, aber die vierstündige Wartezeit bis zum Weiterflug nach Kapstadt verbringen wir ja im Flughafengebäude. Die Zeit vergeht recht schnell – lesen, Sim-Karte kaufen, etwas essen und trinken. Nur der Toilettenbesuch ist ziemlich gewöhnungsbedürftig: Es kommt kein Wasser aus den Hähnen, man kann also die Hände gar nicht waschen. Nur ein paar Hand-Sanitizers sind an der Wand angebracht - eine Folge der monatelangen Wasserknappheit hier wie auch im Kap-Gebiet.
In Kapstadt werden wir von Tinashe abgeholt. Eva hat ihn für uns organisiert. Die einstündige Taxi-Fahrt nach Rooiels, wo Eva und Ken seit zwei Jahren wohnen, kostet 40 Franken. Der Ort ist nur schwach besiedelt, ein paar Häuser sind entlang der Küste verstreut, wilde Baboons rennen in der Gegend herum.
Das Piano-Zimmer, wo wir wohnen können, ist sehr grosszügig konzipiert, ein Klavier ist zwar nirgends zu sehen, dafür hat’s eine Einbauküche, in der nichts fehlt, eine Bar in der Mitte, TV, ein breites, gemütliches Bett, und alle Möbel und Einrichtungsgegenstände, wie auch diejenigen im ganzen übrigen Haus, sind in Weiss gehalten, nur die Stühle und Tische sind aus Plexiglas. Sehr stylish. - Die Aussicht – gewaltig!
Es ist 25 Grad warm, ein sommerlicher Wintertag also. Der Apéro steht auch schon bereit auf der Terrasse. Wir geniessen den milden Spätnachmittag und die wunderbare Aussicht auf die Stein- und Felsbrocken im wilden Garten, der sich bis ans Meer erstreckt, bis hin zu den tobenden Wellen. Nach einem Sonnenuntergang vom Feinsten kurz nach sechs wird’s kühl, im Haus verbreiten die Öfen eine angenehme Wärme. Mit einem feinen Nachtessen werden wir verwöhnt und endlich geht’s ab ins Bett.
Die paar Tage, die wir in Rooiels verbringen, geniessen wir sehr. Die ersten drei sind sommerlich warm, dann kommt der Regen und die Temperaturen sinken. Stundenlang kann ich den Wellen zusehen, es ist ein gewaltiges Schauspiel.
Eva gibt uns ihr Auto und wir fahren einmal mehr auf der inzwischen aufs Beste ausgebauten Küstenstrasse entlang der False Bay mit ihren atemberaubenden Lookouts. In Summerset West gibt’s eine grosse Mall, wo Theo sich vor gut anderthalb Jahren eine Brille hat machen lassen. Die ist inzwischen geschlissen (er hat sich beim Siesta-Machen draufgelegt). Sie ersetzen ihm die Bügel (Garantie) und ein unglaubliches Angebot kann er nicht ausschlagen: Zusätzlich wird eine neue Brille für 35 Franken offeriert. Eine mit stärkeren Bügeln diesmal (auf der man vielleicht sogar ausruhen kann). Und drei Tage später kann er sie abholen, was auch tatsächlich so geklappt hat.
Bei ManiPedi verwöhnen wir uns beide mit einer angenehmen einstündigen Pedicure und auf Samtpfötchen fahren wir wieder zurück nach Rooiels, wo wir uns im Fernsehen noch grad noch den dritten Satz Federer-Mannarino ansehen.
Am letzten schönen Tag fahren wir nach Stellenbosch, wo wir Steffi und Bert treffen, in deren Ferienwohnung wir letztes Mal wohnten, als wir in Cape Town waren. Eva und Ken sind auch dabei. Das Mittagessen im schönen Garten des Babylonstoren (grosse Wein-, Früchte- und Tierfarm mit verschiedenen Restaurants und Hofläden und etwa 200 Parkplätzen) ist ausgezeichnet.
Ebenso geniessen wir am Donnerstag, dem ersten kühlen und regnerischen Tag seit wir da sind, ein köstliches Fischdinner im „SeaBreeze, Fish & Shell“, einem ausgezeichneten Restaurant in gediegener aber gemütlicher Atmosphäre im schönen und farbigen Bo-Kaap-Viertel.
Anschliessend besuchen wir ein Konzert im Artscape-Theatre mit Joseph Clark und seiner Band, „featuring the Queens and Freddie Mercury“. Auch das hat uns begeistert. Nie hätte ich den Unterschied zu den echten Queens gehört. – Beim Verlassen des Theaters hat es grad aufgehört zu regnen. Wir frohlocken schon. 50 Meter - und los geht der Wolkenbruch von neuem. Knapp können wir uns ins Auto retten.
Ansonsten kann sich Theo seinem grössten Hobby, dem Ausruhen, widmen. Er muss aber auch helfen, das Auto zu packen, eine nicht ganz einfache Arbeit, weil wir eben wieder zu viel bei uns haben. Und Ken hat einen neuen Wagenheber kaufen müssen. Das Ding ist so riesig, dass es einen grossen Teil des Kofferraums versperrt.
Auch Eva hat eingekauft: Ein halber Gemischtwarenladen wird mitfahren, Trockenfrüchte, Nüsse, Teigwaren, Reis, Milch, x verschiedene Büchsen und Gläser mit was auch immer drin. Ich traue meinen Augen nicht, was alles zum Mitnehmen bereitsteht. In einer grossen Box sind nur Gewürze drin, mehr als wir zu Hause haben. Zusätzlich reist eine Bücherkiste mit, eine Kaffeemaschine, Campingmaterial, eine kleine Bibliothek mit Vögel- und Tierbüchern, Reiseführern und Kartenmaterial und was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht weiss: mehrere Kolonien von Mehlwürmern.
Ob da auch unser restliches Hab und Gut noch Platz hat? Heute Abend kommt’s aus. Ken will alles jetzt schon packen, damit wir um sieben Uhr morgens gleich losfahren können.
Auch zwei Angelruten sind im Kofferraum. Die wurden im „Men‘s Cave“, einem Secondhandladen für Camping-Freaks, gekauft. Ken findet, Theo soll sich mal mit Fischen versuchen. – Ich staune ein wenig, denke aber, das ist ja nicht eine allzu anstrengende Betätigung; die wird ihn nicht gleich aus der Bahn werfen. Eva und ich allerdings haben gleich kundgetan, dass Fischen für uns keinesfalls eine Option sein wird.
Schon am Vorabend ist das Auto gepackt, kein Quadratzentimeter Raum scheint mehr frei - wir können also in Ruhe erst um acht Uhr losfahren. Ken scheint unendlich erleichtert. Er hatte Angst, wir hätten nicht für alles Platz. Und auch Theo ist froh, dass er nicht schon um Viertel nach sechs aufstehen muss.
Samstag, 14. Juli:
Um fünf vor sieben stehe ich auf und höre mir die 7-Uhr-Nachrichten auf SRF1 an. Der Moderator wünscht seinen Zuhörern einen guten Start in den fantastischen Tag. 28-32 Grad soll es heute werden. – Ich stehe neben dem Ofen, bin warm angezogen, draussen ist es 13 Grad „warm“ und es regnet leicht. In Sutherland, wo wir hinwollen, wird’s in der Nacht 0 Grad werden. – Ich hab’s ja so gewollt, denke aber trotzdem sehnsüchtig an die Aare…
Mein Job ist es jeweils, die sogenannte Nachkontrolle zu machen, wenn wir weggehen, das heisst schauen, ob wir alles bei uns haben, nichts vergessen einzupacken. Das ist dann fast wie bei Hänsel und Gretel: Ich seh‘ genau, wo Theo seine Spur hinterlassen hat. Am Boden liegt dies und das: ein Kugelschreiber, dann ein paar Münzen, meistens Schweizergeld (das uns ja hier sehr viel nützt), auch sein i-Phone hab ich schon mal aufgehoben, sein Notizbüchlein ebenfalls. – Seine Whisky-Flasche jedoch hab ich mal übersehen, die hatte er im Zimmer in eine dunkle Ecke gestellt – was für ein Drama!
Aber diesmal hält es sich in Grenzen. Die paar Geldstücke, die ihm aus der Hosentasche gefallen sind, lese ich auf und stecke sie ein. – Wir sind parat zum Losfahren.
Wie schön, dass ich diesmal weder fahren noch irgendetwas organisieren muss. Reiseführer lesen, einmal mehr einen Thriller von Deon Meyer und auf jeden Fall die Bücher von Alexander McCall Smith lesen, das schon; Theo hat zur Vorbereitung den Film „Crocodile Dundee“ geschaut – sag er selber...
„Hi guys“, ruft Ken. „Hallelujah, praise the Lord - we are ready to rock and roll“.
Nach einer Stunde gibt’s einen Kaffeehalt. Die Fahrt führt anschliessend durch Wein- und Obstanbaugebiet, dann durch eine grüne hügelige und bergige Landschaft, wo lange Zeit keine Siedlung mehr zu sehen ist. Es sieht aus wie bei uns, wenn man über den Julier fährt: eine Art Steinwüste mit niedrigen Gestrüpp.
Kurz vor Mittag sind wir in Matjiesfontain, wo Eva Mittagessen für uns reserviert hat im Hotel Milner, der ehemaligen Residenz eines englischen Gouverneurs. Fast ein kleines Schloss steht da in der kargen Gegend, daneben ein paar hübsche kleine Läden, die Post, eine Bar, ein Museum. Auch ein Zug hält dort, der Blue Train nach Cape Town. Very English all das. Was die Engländer nicht alles hertransportiert haben, nur damit sie sich in der Fremde wie zu Hause fühlen konnten. Ein solches Gebäude hätte ich hier nicht erwartet. Im dunklen englischen Pub essen wir zu Mittag. Ein Feuer brennt im Cheminée, so ist die Temperatur drinnen wenigstens einigermassen angenehm (9 Grad draussen).
Und dann Sutherland: Der Ort liegt in der Karoo-Wüste auf 1450 m Höhe, ist 350 km von Cape Town entfernt, lebt vor allem von der Schafzucht und ist der kälteste Ort in Afrika. Fast 3000 Einwohner hat’s, ein paar Restaurants und B&Bs. Die Hauptattraktion ist der Schnee im Winter, also jetzt, und das SALT Teleskop, das drittgrösste auf der Welt.
In einem hübschen B&B (Skitterland) sind wir untergebracht: alt englisch, ein Wohnzimmer mit Cheminée und ein Schlafzimmer, beide mit all den schweren, dunklen kolonialen Möbeln ausgestattet. Das Badezimmer ist neu und sehr gross. – Eva und Ken haben ihre Unterkunft im Annex. Hier ist alles neu und modern: ein stylishes, geräumiges Wohnzimmer mit eingebauter Küche und daneben ein grosses Bad. Und das Beste: Der Esstisch steht mitten im Badezimmer, umgeben von Toilette, Bad und Dusche. Zum Todlachen! Der Raum ruft Erinnerungen wach an den italienisch-französischen Film von Luis Buñuel (Le Fantôme de la liberté) aus dem Jahr 1974, wo die Gäste auf den Toiletten sitzen und sich von Zeit zu Zeit verschämt in einen kleinen Raum begeben, um dort etwas zu essen.
Gut eingepackt in unsere Jacken haben wir noch Zeit, an der kraftlosen Sonne zu sitzen und ein wenig zu lesen. Wenigstens schneit‘s nicht. Um sechs Uhr geht’s zum Sternegucken. Es ist jetzt nur noch gerade 0°C und ein chilliger Wind weht. Wie froh bin ich, dass wir Handschuhe, Kappe und warme Jacken bei uns haben. Trotzdem frieren wir. „It’s fucking winter“, sagt Ken. Und weil es zu viele Wolken hat, sehen wir auch so gut wie nichts von den Sternen und dem Mond.
Wir brechen die Übung vorzeitig ab und fahren zurück ins Dorf. Der Tisch im Restaurant Cluster d’Hote ist noch nicht parat – also Apéro in einer Bar. Dort ist’s wenigstens ein bisschen wärmer, die haben die Gas-Heizstrahler, die’s sonst in Gartenrestaurants hat, in die Stube gestellt (wohl nicht ganz ungefährlich), aber eben, man ist froh um die Wärme.
Zurück im Restaurant (nur grad ein Wohnzimmer mit ein paar wenigen Tischen) ist unser Tisch jetzt parat. Der alte Besitzer und gleichzeitig Kellner erinnert mich an den Butler James im „Dinner for One“. Hier heisst er Johannes. Mit gemächlicher Langsamkeit schlendert er herum, er bringt uns die Karte, auf der’s etwa sechs Hauptspeisen hat, von denen drei bereits ausverkauft sind. Aufs Essen warten wir dreiviertel Stunden lang. Dann kommt mal die Suppe. Die ist sehr gut und wärmt uns auf, denn hier gibt’s keinen Wärmestrahler und im Cheminée brennt nur ein ganz kleines Flämmchen, eher zur Dekoration. Eine halbe Stunde später kommt dann doch noch der Hauptgang, sehr fein, das muss ich sagen (Bobotie für mich und Lamm für die andern). Ein Dessert wage ich nicht zu bestellen, wer weiss, wie lange wir würden warten müssen.
Zurück in unserer Unterkunft gehen wir sofort ins Bett. Ein kleiner Heizkörper an der Wand im Schlafzimmer mag überhaupt nicht zu wärmen, aber ich freue mich über die Heizdecke, die ich sogleich in Betrieb nehme.
Kalt ist’s am Morgen. Draussen 2 Grad. Im Frühstücksraum wird’s wohl wärmer sein. – Weiterträumen! – In dem kleinen Zimmer sitzt eine Familie, alle in ihren Wintermänteln und Daunenjacken. Eine Feuerstelle hat’s, aber dort ist kein Holz drin, Feuer schon gar nicht. Wir vier sitzen auch in unseren warmen Jacken am Tisch, die Besitzerin bedient uns in Stiefeln und Kamelhaarmantel. – Wie man hier leben kann - ich kann’s mir nicht vorstellen. Die Fenster sind nur einfachverglast, und der warme Tee, den wir bestellen, ist fast ein Schock für den Magen. - Und in Bern zeigt das Thermometer 30 Grad...
Das englische Frühstück ist aber mit Liebe zubereitet, der Tisch hübsch gedeckt, feine frische Früchte gibt’s, und wir hätten auch Lamm-Koteletts bestellen können (Ken tut’s). Alles im Preis inbegriffen.
XAm Mittag machen wir einen längeren Spaziergang durch und ums Dorf herum. Ein stahlblauer Himmel über dem etwas trostlosen Ort bringt wenigstens ein wenig Farbe in die Gegend. Nur gerade die Hauptstrasse ist gepflastert, alle andern Strassen sind ohne Asphalt. Es gibt nicht viel zu sehen. In der Mitte des Ortes steht die Kirche, die geschlossen ist, die meisten Häuser sehen eher verwahrlost aus. Kaum jemand ist unterwegs, ein paar Hunde kläffen, wie wir vorbeispazieren. Es ist Sonntag, ausser einem Supermarkt sind alle Läden zu. Der OK-Markt ist aber ganz gut bestückt, sehr sauber sind alle Produkte präsentiert, sogar Aromat kann man kaufen.
Dort, wo die Siedlung endet, beginnt, wie in all diesen Städten und Dörfern, die Black Township, die Slums der schwarzen oder farbigen Bevölkerung.
Es wird nun doch wieder wärmer (9 Grad) und wir können auf der Terrasse in Liegestühlen eine Zeit lang ohne Wintermantel liegen und lesen.
Abendessen gibt’s diesmal im „Blue Moon“.
Auch das ist ein Erlebnis der besonderen Art. Wir sind die einzigen Gäste. Das Restaurant ist bar jeglichen Stils. Ziemlich schlimm. Fast schon gut wieder. Über jedem Stuhl hat’s eine Wolldecke. So muss man wenigstens nur partiell frieren. Auf den Sets sind verschiedene Gebäude aus dem Dorf aufgedruckt. Unser B&B ebenfalls. Wie gestern geht es uns auch heute: Die meisten Gerichte, die auf der Karte angeboten werden, sind ausverkauft. Es gibt als Vorspeise noch genau eine Suppe. – Ken möchte gerne einen Whisky. – Hat’s keinen. Wir bekommen aber eine Flasche Rotwein. Zimmertemperatur, fast gefroren also. Wie wir später eine zweite Flasche bestellen, müssen wir erfahren, dass es nur noch Weisswein hat. Da ist aber noch eine halbe Flasche Cap Sauv übrig vom Vortag. Den schenken sie uns. – Passiert bei uns auch nicht gerade häufig. Wir sind dankbar!
Ich bestelle Pizza – na ja, Theo Lasagne – auch na ja – sieht überhaupt nicht aus wie Lasagne, aber ok, etwas müssen wir ja essen. Die Bedienung ist sehr nett, Stiefel, Mantel und Kappe gehören zur Ausrüstung.
So eine Wärmedecke im Bett ist zweifellos das Höchste der Gefühle! – Theo merkt erst jetzt, am zweiten Abend, dass auch er eine hat…
Der nächste Tag bringt uns eine Strecke von etwa 600 km - sieben Stunden Fahrt mindestens. Besser, wir schlafen jetzt mal.
Sutherland – Mokolodi - Tuli Block 16. – 22. Juli /
Um halb neun sind wir parat. „Halleluja, off we go“. Ken wählt eine nicht in Google vorgesehene Route, die zweieinhalb Stunden über nicht asphaltierte Strassen führt, mitten durch die Karoo. Dafür ist sie kürzer. Nur ganz selten begegnen wir einem entgegenkommenden Fahrzeug. Alle hundert Kilometer hat’s eine Siedlung (Fraserburg, Viktoria West, Britstown, Hopetown). Wer da nur wohnen mag…
Bäume wachsen keine. Was aussieht wie eine grüne Ebene, sind nur niedrige, trockene Grasbüschel, die im sandigen Boden offenbar doch überleben. Hin und wieder sieht man irgendwelche Tiere: Affen, Springböcke, mal sogar zwei Pferde in der Nähe einer Siedlung, auch Vögel auf der Suche nach Nahrung. Die Strecke führt grösstenteils durch eine Hochebene, am Horizont und auf beiden Seiten ist’s gebirgig, oft sind es Tafelberge. Da die Sonne heute nicht scheint, ist alles mehr oder weniger grau in grau.
Der Bordcomputer meldet: Etwas stimmt nicht mit dem Reifen hinten links. Er verliert Luft. Das hat noch grad gefehlt. – Unser Glück ist, wir sind nur fünf Kilometer entfernt von Loxton, wo’s auf jeden Fall eine Garage hat. Und so ist es. Ken setzt uns in einem hübschen Café-Shop ab und fährt dorthin. Eine halbe Stunde später ist er zurück und er strahlt. Ein recht grosser Stein hatte sich in den Reifen gebohrt. Dieses Missgeschick ist hier allerdings an der Tagesordnung; der Schaden konnte behoben werden, der Pneu ist geflickt. – Wäre das fünfzig Kilometer früher passiert - hätten wir das Reserverad montieren müssen - alles Gepäck ausladen - den Wagenheber in Betrieb nehmen - ich darf gar nicht dran denken…
Wir drei anderen hatten inzwischen einen Cappuccino und konnten uns ein wenig am Cheminée wärmen. Es ist hier übrigens zehn Grad wärmer als in Sutherland – immer noch kalt.
Loxton ist notabene der Ort, wo Deon Meyers stets betrunkener Detektiv Lemmer sein Zuhause hat. Die Bücher kann man dort alle kaufen. Ich hab sie auf meinem Kindle. Gelesen habe ich etwa vier davon.
Ab Loxton ist die Strasse wieder asphaltiert. Ein paar Kilometer nördlich von Britstown machen wir Halt, essen eine Kleinigkeit und nehmen anschliessend den Rest der Etappe in Angriff. Um halb fünf sind wir in Kimberley. 560 km waren es bis hierhin.
Im ehrwürdigen und historischen Kimberley Club, wo jetzt auch Frauen logieren dürfen, bleiben wir für zwei Nächte. Das Nachtessen ist ausserordentlich gut (Filet vom Feinsten), das Zimmer wäre auch nicht schlecht („Executive-Suite“ - drei Räume), aber es ist wieder mal saukalt und einen Fön hat’s auch nicht. Das merke ich allerdings erst, wie ich meine Haare schon gewaschen habe… Und beim Ins-Bett-Gehen: „A kingdom for an electric blanket“!
Dienstag, 17. Juli 18
Im Frühstücksraum sind wir die einzigen Gäste, vier Bedienstete stehen herum.
Ken möchte gerne Porridge. Das gehe nicht, sagt man ihm. Diese Aussage jedoch geht für Ken gar nicht. Er macht klar, dass er in dem Fall selber in die Küche gehe und sich sein Porridge zubereite. – Da geht’s dann plötzlich doch. – Er kennt eben seine Pappenheimer.
Es ist wieder ein schöner, sonniger, wolkenloser Tag, etwas kühl zwar, 14 Grad auch am Mittag nur. Wir fahren fünf Minuten zum Big Hole, einem Riesenloch, das von den Edelsteinsuchern am Stadtrand von Hand gegraben wurde. Ich kann nicht glauben, dass beim Aushub keine Maschinen mit im Spiel waren. Die Ausmasse sind enorm, das Loch mehr als nur beeindruckend. Details erklärt man uns bei einer Führung. Ken, der hier in der Gegend aufgewachsen ist, weiss selber allerdings viel mehr zu erzählen, zu ergänzen und zu berichtigen. Seine Ausführungen sind auch beim Besuch des angrenzenden Museums sehr interessant, wo Häuser und Strassen aufgebaut sind, so wie Kimberley zur Zeit der Edelsteinförderung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts offenbar ausgesehen hat. Die Stadt war damals die absolut reichste in der ganzen Welt. Jetzt hat sie an Bedeutung verloren. Es gibt auch kaum Touristen in dieser Gegend; man geht in den Krüger-Park, in die Kap-Gegend und allenfalls fährt man entlang der Garden-Route. Ken sieht keine Zukunft für Kimberley.
Gleich in der Nähe befindet sich das Art Museum, wo’s ebenfalls keine Besucher hat. Das bescheidene Eintrittsgeld beträgt 5 Rand für Erwachsene (ca. 40 Rp.). Das Museum gehört jetzt der Stadt, ist also nicht mehr privat. Der Mann an der Rezeption freut sich sehr, dass wir kommen, er fragt, ob wir das Museum besuchen wollen (!?) und in dem Fall sei’s doch gleich gratis für uns. – Lustiges Afrika…
Ein paar ganz gute Bilder, Keramiken und Skulpturen sind ausgestellt und in einem angrenzenden hübschen Garten hat’s ein kleines Restaurant. Dort essen wir eine Kleinigkeit zum Zvieri; Ken bestellt sich einen Teller voller Schafs-Koteletts.
Wir essen wieder im Club. Es war so fein gestern, dass wir ein anderes Restaurant gar nicht ausprobieren wollen. Diesmal bestellen alle Filets, denn der Fisch, den Eva gestern hatte (Ken hatte sie davor gewarnt, im Landesinnern Fisch zu bestellen), riss sie nicht vom Hocker.
Jetzt ist’s übrigens warm im Zimmer; ein Angestellter hat uns gezeigt, wie man die Aircondition auf Heizung stellt.
Mittwoch, 18. Juli 16
Porridge ist heute Morgen kein Thema.
Um Viertel vor neun starten wir – noch immer Richtung Norden. Die Landschaft hat geändert, es gibt auch Bäume und viel mehr Siedlungen.
Kaffee- und Benzinhalt in Vryburg und nach viereinhalb Stunden Fahrt sind wir an der Grenze zu Botswana. Ken ist ein wenig nervös, er hat schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht bei Grenzübertritten in Afrika. Er weist uns an, unser Vokabular aufs Nötigste zu beschränken. „Yes, Sir“ würde genügen.
Es geht jedoch alles wie am Schnürchen. Wir haben Glück; wir sind die ersten Reisenden am Schalter, hinter uns muss wohl ein Bus angekommen sein, denn jetzt stehen viele Menschen Schlange. - Das ist so bei der Ausreise aus Südafrika wie auch bei der Einreise nach Botswana.
In Lobatse gehen wir einkaufen. Unsere Unterkunft für die nächsten drei Tage befindet sich im Busch, self-catering Chalets sind für uns gebucht, also müssen wir unsere Mahlzeiten selber zubereiten.
Zwei Wägeli voller Waren legen wir auf den Counter, kosten tut das alles etwas mehr als 30 Franken. – Was Eva und Ken alles einkaufen, würde für uns zu Hause für zwei Wochen reichen, hier sind’s nur grad mal zwei Tage. Und dabei haben wir doch schon sooo viel Ess- und Trinkbares im Auto mitgebracht. Aber unsere Freunde sehen das anders. Die zwei 1-kg schweren Rindsfilets sind für heute und morgen Abend geplant. Ein Kilogramm kostet übrigens knapp sieben Franken… Ich mache mir Sorgen, wo wir all die Einkäufe im Auto verstauen wollen. Wir nehmen sie auf den Schoss; es ist ja nicht mehr weit.
Nach einer weiteren Stunde Fahrt kommen wir in Mokolodi an, der Lodge, die Ken für uns reserviert hat. An der Rezeption erhalten wir die Schlüssel. Weitere zwanzig Minuten Fahrt durch den Busch über Wege wie Bachbeete führen uns endlich zu den Chalets. Es gibt vier davon; wir sind die einzigen Gäste.
Die Bungalows sind runde Häuser mit Strohdächern, „Rondavel“, wie bei „Globi im Kongo“. Es sind einfache, aber funktionell eingerichtete Unterkünfte mit Schlafzimmer, Bad mit Dusche und einer Küche, die vom Wohnbereich abgetrennt ist. Wir werden instruiert, beide Türen immer abzuschliessen und nichts auf der Terrasse liegen zu lassen. Nicht, weil’s Diebe hat an diesem abgelegenen Ort, sondern ganze Affenhorden, mindestens fünfzig Tiere, die wir auch gleich zu sehen und zu hören bekommen. Sie sind so laut, dass sie einem fast Angst einjagen. Es sind Baboons, also Paviane. Ganze Familien rasen wie die Wilden (wie auch sonst…) in alle Richtungen um die Häuser herum, den Hügel hinauf und wieder hinunter. Dazu machen sie einen Heidenlärm.
An einem schönen Ort sind wir gelandet. Die vier Chalets sind direkt an einem Wasserloch gelegen. Wenn die Affen still sind, ist es herrlich ruhig, man hört nur Frösche und Vogelgezwitscher.
Wir packen unsere sieben Sachen aus und versuchen uns ein wenig einzurichten. Es ist sehr kalt im Haus. Wir haben beschlossen, nur eine unserer beiden Küchen zu benutzen, so treffen wir kurz vor Sonnenuntergang Eva und Ken in ihrem Chalet. Ken hat bereits zwei Feuer angefacht, eines fürs Braai (BBQ würde man bei uns sagen) und eines zum Ums-Feuer-Herumsitzen-und-sich-Wärmen. Bis alles parat ist, dauert‘s eine gute Stunde, Eva deckt den Tisch und bereitet Süsskartoffeln vor, ich mache den Salat. Ken fragt Theo, ob er ein wenig Holz ins Feuer schieben könne. Das gehe schlecht, erwidert mein Gatte, es habe Dornen am Holz. – Das sei für ihn nicht anders, meint Ken… Theo versucht dann doch noch einen nützlichen Beitrag zu leisten, nämlich Feuerholz zu holen, aber das wird ein kleines Desaster, kommt er doch zurück mit einem dürren Baumstamm im Schlepptau - am Kopf blutend, ebenfalls am Ohr und auch an der einen Hand hat er sich verletzt.
Wie kurz darauf zwei Angestellte Feuerholz bringen, sehen sie, was Theo angeschleppt hat und werfen seine Trophäe kurzerhand zurück in den Busch. - Wir anderen drei finden das sehr lustig!
Ken weiss, wie grillen; das Filet ist wunderbar, alles andere auch. Wein, Whisky und Brandy sowieso. Das ganze Kilo Fleisch ist verschwunden. Ken hat etwa die Hälfte davon gegessen, wir anderen drei haben uns den Rest geteilt.
Wie kalt es genau ist, weiss ich nicht, wir haben keinen Internetempfang, können also nicht Google befragen. Es wird knapp über null Grad sein. Alle warmen Kleider, die wir haben, ziehen wir an. Bei mir sind’s fünf Schichten und Handschuhe und wir Frauen wickeln uns zusätzlich in je eine dicke Wolldecke ein. So hält man es aus. Jedenfalls nahe an der Feuerstelle.
Früh gehen wir ins bequeme Bett und schlafen recht gut, auch ohne Heizdecke. Während der ganzen Nacht hören wir Tiere, vor allem die Affen, und diese ganz besonders. Morgens um sechs geht die wilde Jagd auf unserer Terrasse los. Eine Schar Affen-Teenagers rasen hin und her, reissen die schweren Stühle um, schreien wie gestört und wie ich den Vorhang von innen ein wenig bewege, nehmen sie, wie von der Tarantel gestochen, Reissaus.
Donnerstag, 19. Juli (Kays 39. Geburtstag)
Nach einem feinen von Eva zubereiteten Frühstück gehen wir auf einen Erkundungsspaziergang in die Umgebung. Es gibt keinen Baum und keinen Strauch, über den Ken nichts zu erzählen wüsste. Welches Holz sich als Brennholz eignet, welches weniger, weil es zu wenig hart und dicht ist und welches nicht, weil der Rauch am Bratgut Durchfall auslöst (Tambuti-wood), all das gehört ebenfalls zu dem, was wir jetzt lernen. Er kennt alle Namen und auch die der Vögel, deren Gesang natürlich auch. Zum Beispiel hören wir den „Work-har-der – Vogel“, der am Abend allerdings „Drink La-ger“ singt.
Spuren kann er lesen - ich erinnere mich an die Winnetou-Bücher und Old Shatterhand. Auch von welchem Tier die Exkremente sind, erklärt er uns, wie sie ihre Reviere damit abgrenzen und welches Tier was frisst. – Da haben wir einen extrem kundigen Guide bei uns, ein wandelndes Lexikon sozusagen. Und zudem ein exzellenter Koch: Zurück am Wasserloch macht er uns eine feine Suppe und wir können beim Essen bequem den Tieren zuschauen, die inzwischen die gegenüberliegende Seite des Teichs aufgesucht haben: eine ganze Familie von Warzenschweinen, sechs Zebras, zwei Kudus und ein paar Impalas. Verschiedene Wasservögel ebenfalls.
Den restlichen Nachmittag verbringen wir an der Sonne sitzend vor unserer Behausung, lesen und geniessen den schönen Tag. Es ist wohl um die 20 Grad warm, aber bald schon wird die Temperatur wieder gegen null Grad sinken. – Schliesslich ist es immer noch Winter.
Es wird doch nicht ganz so kalt. Es ist wohl etwa um die 5 Grad. Ken hat wieder zwei Feuer gemacht, das zweite Kilo Filet wird gebraten, same procedure as yesterday. Eva bereitet ein marokkanisches Gemüsegericht zu, ihre endlose Gewürzbox beinhaltet sämtliche exotischen Zutaten, die dazu nötig sind. Ich mache wieder den Salat – Öl, Essig, Salz und Pfeffer - alles wie gehabt.
Der Blick auf das Wasserloch ist wunderschön. Langsam geht die Sonne unter und da kommt eine Giraffe vorbei. Graziös steht sie am anderen Ufer, senkt ihren Kopf, um Wasser zu trinken und das Allerschönste: wegen dem Zwielicht sieht man sie kaum noch, aber sie spiegelt sich schwarz im Wasser. Was für ein Anblick!
Dann wird es immer dunkler und der Sternenhimmel stiehlt den Tieren die Show.
Freitag, 20. Juli 18 (Kim und Diegos Geburtstag)
Um acht Uhr hätten wir starten wollen. Theo sagt, er habe den Wecker gestellt. Um zwanzig vor acht weckt uns Ken. Theo hat den Wecker eine Stunde zu spät gestellt… Jetzt gibt’s ein Gjufu. Alles rasch packen, Theo kann nicht einmal mehr rasieren (was ihn von da an gleich dazu verleitet, einen Bart wachsen zu lassen) und dann muss er wieder helfen, das Auto zu laden. Das ist alles andere als einfach. Mich dünkt, wir bringen überhaupt nicht mehr alles hinein, was vorher drin war. Zusätzliches Gepäck haben wir ja nicht. Mit Müh und Not gelingt es schliesslich und da ist überhaupt kein freier Platz mehr im Kofferraum.
Nach kurzer Fahrt sind wir in Mokolodi. Wir halten bei einer Shoppingmall. Dort wird erst mal gefrühstückt und dann geht’s zum Einkaufen. Ich kann’s nicht fassen: Was die beiden in den Trolley füllen, würde den Kofferraum meines Autos füllen ohne weiteres Gepäck. Säcke voller Früchte und Gemüse, Wein (sehr einverstanden!), mehrere Kartons Eier, drei Brote, ein Knoblauchbrot, verschiedene Beeren und gut fünf Kilo Fleisch sind im Einkaufswägeli. – Auch drei neue Gläser Gewürze – Gewürz Nummer 35, 36 und 37. Wohin damit, frage ich mich, und das im doppelten Sinn: Erst mal - wo im Auto kann die ganze Ware verstaut werden und dann, wann wollen wir das alles essen???
Eva hat gesehen, dass es in der Mall noch einen Woolworth Food gibt. - Eine weitere Einkaufstasche voller Köstlichkeiten findet den Weg zu uns.
So muss der Land Rover erstmal wieder ausgeräumt werden, zumindest grösstenteils. Dann wird neu geladen. Das Fleisch wird keinen weiteren Platz einnehmen, denn eine grosse Kühlbox, die bisher leer war, fasst auch noch gleich Butter und all die übrigen Produkte, die gekühlt werden müssen.
Früchte und Gemüse werden einzeln zwischen dem Gepäck verteilt – eine Melone da, ein Sack Tomaten hier. Die Gurke hineindrillen, geht ganz einfach, der Wein gehört unter den Beifahrersessel und was wirklich keinen Platz mehr hat, nehmen wir in die Mitte zwischen uns auf den Rücksitz. Hoch aufgetürmt.
Und so geht’s weitere fünf Stunden über Land, der A1 entlang immer noch in nördlicher Richtung, durch Gaborone hindurch (wo Alexander McCall Smith‘s Mma Ramotzwe, aus seinen überaus amüsanten und herzerwärmenden „Nr. 1 Ladies‘ Detective Agency“ - Romanen „wohnt und agiert“) und dann in den Tuli Block, wo wir gegen vier Uhr „Stevensford Game Reserve“ erreichen. Dort werden wir dreimal übernachten.
Die Farm wird von einem jungen Paar geführt. Sie ist extrem abgelegen. Wie in Mokolodi sind wir auch hier die einzigen Gäste. Ein hübsches Doppelchalet wird uns zugewiesen, alles ist sauber und einladend. Auf der Fahrt vom Parkeingang zur Rezeption sehen wir verschiedene Impalas, auch Affen, Bushbock und Eichhörnchen. Im Park hat’s keine Raubkatzen, man kann also problemlos auf Wanderschaft gehen. Viele andere Tiere jedoch sind hier heimisch und die Liste der Vögel, die man beobachten kann, nimmt kein Ende.
Vor unserem Bungalow ist separat eine offene Küche eingerichtet mit Kühlschrank, Mikrowelle, Bar, Grill, Feuerstelle und einem Esstisch, der bereits für uns gedeckt ist.
Es dauert eine halbe Stunde, bis alle Esswaren affensicher versorgt sind und unser Gepäck in den Zimmern verstaut ist.
Theo und ich, wir gehen auf einen Erkundungsspaziergang. Die Pfade durch den Busch sind über und über besäht mit Huf- und Pfotenabdrücken der Tiere. Die Farm endet am Limpopo-Fluss (er ist etwas doppelt so breit wie die Aare im Marzili, zieht aber eher gemächlich gegen Süden und ist der Grenzfluss zwischen Botswana und Südafrika), der ebenfalls oft erwähnt wird bei McCall Smith sowie die Krokodile, die’s dort hat. Ich wage mich nicht sehr nah ans Ufer – aus diesem Grund eben. Auch Nilpferde soll’s haben im Park, denen möchte ich ebenfalls nicht unbedingt begegnen.
Ken hat bereits wieder beide Feuer vorbereitet und das Nachtessen auch schon. Das Fleisch ist mariniert und steht bereit. Zur Abwechslung gibt’s heute nicht Filet, sondern Rump-Steak. Ein Kilo aber schon. Ich mach den Salat dazu, Eva kocht Reis.
Erst aber gibt’s ein stündiges Apéro, bis fast alles Holz fürs Braai verbrannt ist.
Wir sind verwöhnt, wir brauchen nicht abzuwaschen. Die Angestellten hier regeln alles. Es ist ihr Job. Wenn wir morgen früh aufstehen, ist alles sauber versorgt, blitzblank und der Tisch schon wieder gedeckt für die nächste Mahlzeit – mit Blumen und frischen Stoffservietten.
Nach dem Essen setzen wir uns ums Feuer. Es ist zum ersten Mal auf unserer Reise nicht schon beim Dinner kalt wie blöd, aber nun ist die Wärme des Feuers doch willkommen. Eva, sie ist Ungarin, singt ein Lied in ihrer Sprache. Ken hat dafür nur ein einziges Wort übrig als Kommentar: „Awful!“. Er singt dann selber eines: „Bobby McGee“ und das tönt mit seiner sonoren Stimme auch ohne Instrumente zugegebenermassen Spitze. Theo und ich, wir verzichten auf einen Beitrag aus der Schweiz.
In der Nacht ist’s wieder kalt, und trotz Duvet und dicker Wolldecke muss ich aufstehen, einen zusätzlichen Pullover anziehen und Socken.
Samstag, 21. Juli 18
Heute geht’s geruhsam zu. Morgenessen (inbegriffen) um neun in der Lobby. Es dauert recht lang, bis das englische Frühstück auf dem Tisch steht. Ich frage mich schon, ob sie die Hühner nicht gefunden haben oder ob die ihre Eier noch nicht gelegt haben. Wie’s dann serviert wird, ist es sehr lecker. – Auf meine Frage, wie der Einkauf hier funktioniere, erklärt mir Sean, er gehe etwa einmal im Monat mit einer grossen Liste ins nächste Dort und bringe mit, was nötig sei. Der Weg dorthin dauert anderthalb Stunden.
Ich mach eine Wäsche. Vor dem Haus hat’s einen Dornenstrauch. Der eignet sich bestens als Stewi-Libelle.
Ken ist es ernst mit seinem Vorhaben, Theo das Fischen beizubringen. Die beiden ziehen los mit ihren Angelruten - ein aussergewöhnlicher Anblick. Eva schaut ihnen nach und meint, Männer würden eben nie erwachsen. Ken gebe ein Vermögen aus für Zubehör und Utensilien und werfe die Fische, wenn er überhaupt einen fange, wieder zurück ins Wasser, denn er esse keinen Fisch.
Eine halbe Stunde später suchen wir die beiden Fischer am Limpoporiver auf. Erst finden wir sie gar nicht, aber dann sehen wir ihre Fussspuren im Sand und folgen denen. - Theo und Fischen... Ich find’s schon ober-speziell! – Also gefangen haben sie noch nichts, aber damit haben wir auch nicht gerechnet. Sie haben jedoch bereits herausgefunden, dass die Fische Würmer mögen – Eva meint daher, sie würden ja gar nicht fischen, sondern nur die Fische füttern.
Wir gehen zurück ins Camp, Spaghetti gibt’s zum Mittagessen. Ich mache den Salat…
Eva und ich, wir bleiben daheim, ziehen unsere Liegestühle an ein sonniges Plätzchen und lesen. Die beiden unermüdlichen Fischer ziehen wieder los.
Nebst den Würmern, die übrigens immer wieder mal versuchen zu fliehen, hat Ken noch eine andere Idee, was den Fischen eventuell munden würde: Maiskörner eingelegt in Whisky. Theo muss dafür von seinem Whisky opfern, was ihm ganz und gar nicht behagt, aber Ken besteht darauf.
Gegen Abend kommen sie heim – müde, zufrieden, aber ohne Fische. Schon ist wieder Zeit, das Nachtessen zuzubereiten. Heute gibt’s mal was ganz anderes: ein vegetarisches Menu soll es diesmal sein. Mit Poulet. - Huhn, so findet Ken, ist kein Fleisch.
Er zündet das Feuer an, ich mache den Salat und Eva bereitet mit tausend Gewürzen und unendlich vielen Zutaten ein Spitzen-Curry zu. Es könnte problemlos für sechs Personen reichen; wir essen alles fertig.
Am Lagerfeuer erzählt Ken von Theos Fisch-Fang-Versuchen. Er beschreibt alles sehr farbig, so wie es seine Gewohnheit ist. „If your fishing-line gets tangled in the tree behind you, it takes a hell of a time till you get back in the fishing-game“.
Wir erfahren auch, dass er ihn mit der Fischrute in der Hand liegend vorgefunden habe, was mich überhaupt nicht erstaunt.
Heute sind alle müde und gehen schon um neun Uhr zu Bett. Schliesslich war’s ein anstrengender Tag.
Sonntag, 22. Juli 18
Fischen ist wieder angesagt. Ich glaube allerdings nicht, dass wir zum Nachtessen von einem Fang werden profitieren können, aber warten wir‘s mal ab und trinken Rooibos-Tee.
Wir fahren an einen schönen Ort im Park, wo der Limpopo ziemlich breit ist und es Überreste eines Damms hat. Heute gehe es zur Sache, meint Ken. Gestern wär nur Instruktions-Fischen gewesen. – Ich bin ja gespannt. Eva und ich, wir legen uns auf eine Decke auf den trockenen Boden, lesen ein bisschen, lassen uns von der Sonne verwöhnen und schauen den fischenden Männern zu. Theo steht erst am Ufer, dann sitzt er, anschliessend liegt er. Passieren tut sonst nichts. Eine Stunde später allerdings – wer hätte es gedacht – kommt Ken daher mit einem Fisch an der Angel, einem Fischchen eher, kaum geeignet fürs Nachtessen. Er freut sich aber sehr. - Das Fischchen auch, wie es wieder ins Wasser geworfen wird.
Wir fahren zurück ins Camp, wo Eva schon wieder in der Pfanne rührt. – Ich verzichte diesmal auf ein Mittagessen, es wird mir langsam zu viel.
Der Nachmittag verläuft ruhig, Eva und Ken gehen auf die Pirsch, ich schreibe an meinem Reisebericht, Theo ruht sich aus.
Am Abend werden wieder zwei Feuer und ein Filet vorbereitet. Bevor das Essen allerdings parat ist, gibt Theo noch eine Sondereinlage. Er nimmt den direkten Weg zur Bar, wie ein junger Springbock steigt er über eine niedrige Mauer, statt den normalen Eingang zum Esstisch zu benutzen, rutscht auf einem Tierfell, das am Boden liegt, aus (Erinnerungen an Butler James kommen hoch, nur dass der sich jeweils wieder fangen konnte) und landet der Länge nach auf dem Bauch. Die Pfeife, die er im Mund hatte, ist gebrochen, seine Nase blutet, ist aber hoffentlich nicht auch gebrochen. An beiden Schienbeinen ist er verletzt – Merfen und unser Pflastervorrat kommen zum Zug. – Es ist grad nochmal gut gegangen; mehr oder weniger jedenfalls. Schmerzen, sagt er, empfinde er keine. Kein Wunder. Bei dem Whisky-Konsum zum Apéro. - Nun kann man Witze drüber machen. Ken dankt ihm, dass er uns mit so einer spektakulären Vorstellung unterhalten habe und bietet an, die Blutlachen am Boden aufzuwischen.
An der Stirne und am Ohr die Kratzer der Dorne, in die er hineingelaufen ist, als er Feuerholz sammeln wollte, die aufgeschlagene Nase, das blutunterlaufene linke Auge, das er seit vorgestern hat, die malträtierten Schienbeine, die weiteren Verletzungen an Händen und Armen, deren Ursache ich gar nicht kenne (ah ja, doch, eine stammt noch von einem Angelhaken) – er sieht langsam aus wie ein Zombie, mein lieber Ehemann.
Morgen werden wir die Grenze zu Zimbabwe passieren. Ich hoffe, sie werden ihn auf seinem Passfoto erkennen…
Montag, 23. Juli 18
Frühstück gibt’s um acht; vorher wird das Auto schon gepackt, wir sind also um Viertel vor neun bereit zur Abfahrt.
Ken, der sonst immer guter Laune ist, wirkt heute Morgen etwas griesgrämig. – Ich weiss schon: Es hat mit dem Grenzübertritt zu tun.
Und dass wir nach halbstündiger Fahrt auf schnurgerader, fast verkehrsloser Überland-Nebenstrasse geblitzt werden (109 statt 80 km) macht die Sache momentan auch nicht besser. Aber er hat wieder mal alles im Griff. Vom Auto aus sehen wir, wie er mit den beiden Polizisten verhandelt, die uns angehalten haben. Wie er nach einer Viertelstunde zurück ins Auto humpelt (schauspielerisches Talent), ist die Sache erledigt. Irgendwie hat er die beiden beschwatzt, uns ohne die 1000 Pula (100 Fr.), die die Busse gekostet hätte, ziehen zu lassen.
Etwa drei Stunden später sind wir in Francistown, der zweitgrössten Stadt in Botswana. Mich dünkt, die Stadt bestehe nur aus Einkaufszentren – wo das eine aufhört, fängt das andere an.
Vorräte Ergänzen ist wieder angesagt. Whisky und Wein stehen zuoberst auf der Liste.
Ich muss unbedingt versuchen, Internet-Zugang zu erhalten, gewisse Emails erledigen, sehen, wie’s der Familie geht. Im „Wimpy“ gibt’s nebst matschigen Hamburgern (ich verzichte) auch WIFI. Das Internet ist allerdings sooo langsam, dass man dabei fast verzweifelt. Eva und Ken gehen derweil selber einkaufen. Wo sie die Ware verstauen wollen, überlassen wir ihnen. Irgendwie funktioniert‘s ja wundersam doch immer wieder.
Weiter geht die Fahrt. Um zehn vor drei sind wir an der Grenze und knapp zwei Stunden später sind alle Formalitäten erledigt. Wir haben zwar wieder das Glück, grad vor einem Bus anzukommen, aber dann ist da eine Azubi, die unsere Pässe mit Stempeln und Klebern versehen und irgendwelche Papiere mit unseren exotischen Namen und Adressen abschreiben muss - und das tut sie mit aufreizender Langsamkeit.
Ken hat ebenfalls ein Problem: Sein Führerschein sei nicht mehr gültig, lassen sie ihn wissen, und sie rufen sogar Interpool an. Dort sei man derselben Meinung, heisst es. Das alles dauert seine Zeit. Wie unser Schweizer Führerschien hat auch sein südafrikanischer kein Verfallsdatum, aber das ist hier kein Argument. – Fazit: Eva muss ihren Fahrausweis zeigen. Der wird akzeptiert und sie muss über die Grenze fahren. Nach 100 Metern übernimmt Ken wieder das Steuer. - Immer wieder würden sie eine neue Schikane erfinden, regt er sich auf.
Angst hat er auch davor, dass sie uns am nächsten Posten das ganze Auto auseinandernehmen werden, wir alles auspacken müssen… Genau das passiert bei einem grossen Bus, der dort steht. Alle Passagiere mussten aussteigen und die ganze Bagage wurde ausgeräumt. Massen von Gepäckstücken stehen um das Fahrzeug herum - ich frage mich, wie lange die Inspektion wohl dauern mag. – Wir werden glücklich verschont und können endlich weiterfahren.
Nun ist’s schon fünf und wir haben noch immer einen langen Weg vor uns. Um sechs beginnt es einzunachten und Ken fürchtet, dass das Gate zum Matobo Nationalpark um sechs bereits schliesst. Unsere nächste Unterkunft ist mitten im Park und wenn wir nicht rechtzeitig ankommen… Zudem fährt er nicht gern bei Dunkelheit, was auch verständlich und tatsächlich nicht ratsam ist. Die Nebenstrassen sind nicht alle sehr gut ausgebaut und man muss mit Tieren oder Menschen rechnen, die unverhofft die Strasse überqueren. – Die A1 führt nach Bulawayo, aber irgendwo vorher müssen wir abzweigen, nur ist nicht ganz klar, wo. Ken misstraut unseren Navis, was die Sache nicht einfacher macht. Wir fahren am „Road-View-Motel“ vorbei. Falls wir zu spät ankommen, kann es sehr gut sein, dass wir halt so irgendwo übernachten müssen. – Netter Name übrigens – da weiss man wenigstens, was man zu erwarten hat. - Nun, wir erreichen das Tor um halb sieben, es ist schon Nacht, aber zum Glück sind noch zwei Angestellte dort, die erst noch unsere Pässe sehen wollen, sonstige Papiere ebenfalls und die Kens Nerven damit noch mehr strapazieren. Endlich lassen sie uns durch. Bis zu den Chalets sind’s weitere zwanzig Kilometer, aber dann ist’s geschafft. Es ist jetzt sieben und bereits stockdunkel. Genau zehn Stunden waren wir unterwegs. – Wir beziehen unsere Unterkünfte und beschliessen wieder, nur eine Küche zu brauchen, nämlich nicht unsere.
Wie’s genau aussieht, wo wir jetzt sind, ist schwer zu sagen. Es ist eine steinige Umgebung, das ist klar. Am Morgen, wenn’s hell ist, wird es sich ja zeigen. Die Bungalows sind ok, aber eben - wir sind in Afrika: Die Küche seht auf den ersten Blick ganz gut aus. In einer Schublade liegt eine lange Liste mit Dingen, die vorhanden sein sollten, aber die kontrolliert wohl niemand. Kein einziges Glas können wir finden, keine Schüssel, dafür sieben Pfannen, lauter leere Küchenschränke und -Schubladen, kein Geschirrtuch, kein Rüstmesser, keine Teelöffel, zwei Gabeln nur und zwei Eierbecher. Genau die vermissen wir sonst an fast allen Orten – hier aber hat es sie. Ein Schwamm zum Geschirrspülen, der wohl aus den Anfängen der Vortrekkerzeit stammt, dazu kein Abwaschmittel.
Auch das Badezimmer ist neueren Datums und macht einen ersten guten Eindruck. Über dem Bassin gibt’s jedoch keinen Spiegel, dafür ist die Eingangstür beidseitig verspiegelt (sehr praktisch zum Schminken und Rasieren), in der Lampe ist eine 25er-Birne drin, beim Händewaschen muss man aufpassen, dass man den Wasserhahn nicht aus der Verankerung löst. Man kann nirgendwo etwas abstellen und die Tür hat eine so enge Klinke, dass sich Theo gleich mal die Finge einklemmt und dann erklärt, dass man jemanden, der so etwas konzipiere, bei uns sofort entlassen würde…
Aber das Bett ist gemütlich und das ist uns im Moment das Wichtigste. Nachttischlämpchen hat’s keine, aber wir sind ja mit Taschenlampen ausgerüstet. Lediglich die grosse Spinne, die an der Decke lauert, kann dort nicht bleiben. Sie mag Moskitos lieben und daher sehr nützlich sein, aber das kann sie gerne überall tun, nur nicht dort, wo ich schlafe. Da kommt Theo zum Einsatz mit einem improvisierten Glas, das er aus einer Plastikflasche geschnitten hat und einem Karton. Er ist erfolgreich; sie lässt sich übertölpeln und wird irgendwo draussen, weit weg von unserer Behausung, ausgesetzt. Drei andere Spinnen kleinerer Art erhalten eine andersartige Behandlung.
Vor dem Zubettgehen aber hat Eva rasch ein Nachtessen für uns zubereitet: Spaghetti mit Kichererbsen-Tomatensauce. Seit dem Frühstück haben wir nichts mehr gegessen. - Ich rüste den Salat mit dem Brotmesser und aus Mangel an einer Schüssel serviere ich ihn in einer Pfanne. In Eva und Kens Chalet hat’s zwei Gläser, die erhalten wir netterweise. Sie trinken den Wein aus den Teetassen.
Den Wasserkocher, der bei ihnen fehlt, bringe ich mit, stelle aber bald fest, dass das keine gute Idee war, denn der Stecker ist nicht derselbe. – Englische Stecker – rund und eckig… Was die Engländer nicht alles Nützliches ins Land gebracht haben…
Dienstag, 24. Juli 18
Bei Tageslicht sehen wir, wo wir gelandet sind. Es ist eine fantastische Landschaft. Die Chalets sind zwischen riesigen Felsbrocken eingebettet. Man kommt sich vor wie auf einem anderen Planeten.
Eva bereitet ein feines Frühstück vor. Leider ist es unmöglich, es draussen zu essen, denn es sind ganze Horden von Affen unterwegs, die nur darauf warten, etwas Essbares zu erhaschen.
Anschliessend gibt’s eine Fahrt durch den Nationalpark. Die Felsformationen sind spektakulär. Wie wenn ein Volk von Riesen hier gelebt hätte. Ganz ähnlich sieht’s aus in Huelgoat, in der Bretagne. Von manchen der gigantischen Felsbrocken hat man das Gefühl, als ob sie gleich herunterfallen würden („Welcome to the Home of Balancing Rocks“ heisst’s beim Eingang zur Lodge). Die meisten von ihnen sind rund und abgeschliffen. - In Myanmar wird der Goldene Felsen als Heiligtum verehrt und man pilgert hin; hier hat’s haufenweise solches Gestein und kaum Touristen. Ein einziges Paar haben wir gesehen.
Wir fahren über einen Damm. Auf der einen Seite hat’s fast kein Wasser, auf der anderen gar keines und man hat Aussicht auf ein grandioses Flussbett, bestehend aus überdimensionierten, rund abgeschliffenen, dunkelbraunen Riesenmarmeln oder Bowlingkegeln. Man kommt sich vor wie ein Zwerg.
Einzigartig schön ist diese Gegend. Eine kurze Wanderung bringt uns auf einen der Felsen und zu einem Ort, wo Höhlenzeichnungen aus längst vergangener Zeit noch knapp zu sehen sind. Sie sollen von Buschmännern stammen.
Fischen kommt für Ken und Theo hier weniger in Frage. Der eine Fluss ist ausgetrocknet (Dry-Fishing?) und am idyllischen See, an dem wir vorbeikommen, sonnt sich eine Nilpferdfamilie. Zudem es hat Schilder, die vor Krokodilen warnen. – Müssen die Würmer halt noch ein wenig warten…
Wir brauchen unbedingt Benzin. Wir verlassen den Park und fahren ins nächste Dorf zum Tanken. Das hätte fast schief laufen können. Bei der ersten Garage sagt man, sie hätten kein Benzin mehr, es gäbe im ganzen Land Knappheit. Bei der nächsten Garage jedoch klappt’s glücklicherweise dann doch, und der Tank ist wieder voll.
In einem für hiesige Verhältnisse gediegenen Restaurant essen wir etwas zu Mittag. Dort hat es auch WIFI und Theo öffnet seine Emails. Eine stammt vom Manager der Unterkunft in Botswana: Sie hätten seinen iPad im Zimmer gefunden… Ich fasse es nicht: Es ist schon wieder passiert! Wo er den diesmal versteckt hat? - Keine Ahnung. Unter dem Kissen vielleicht? Dort habe ich tatsächlich nicht nachgeschaut. Keine Reise vergeht, ohne dass es ihm gelingt, etwas zu verlieren, und zwar keine Kleinigkeit. – Erkenntnis: Ganz offensichtlich eigne ich mich nicht besonders gut als Endkontrollöse. – „Clusterfuck“, sagt Ken…
Am Abend hat Ken das Feuer bereits wieder entfacht und es gibt einmal mehr ein perfekt grilliertes Filet. Ein Riesenteil. Eva serviert ein schmackhaftes Gemüsecurry dazu und Theo findet Kerzen für ein Candle-light-dinner. – Schon längst hat Ken seine gute Laune wieder gefunden und er macht seine üblichen Witze. Wir haben einen sehr lustigen Abend.
Mittwoch, 25. Juli 18
Vor dem Morgenessen erkunden wir die Gegend. Es hat eine ganze Reihe solcher Chalets wie das unsere, schön eingegliedert zwischen den Felskolossen. Auch einen Tennisplatz. Eigentlich ein Multi-Funktions-Platz - Basketball kann man darauf auch spielen, Fussball sowieso. Es ist aber niemand dort. Im Sommer dann wohl erst recht nicht. Auch ein Pool-Table steht dort, auf den jemand gekritzelt hat: „Pull-Table“.
Die Dame im Office, die für die ganze Anlage beziehungsweise Lodge verantwortlich ist, ist sehenswert. Sie ist eine „extremely big Mama“. Genauso stelle ich mir Mma Ramotze vor, McCall-Smith’s „traditionally built“ Detektivin. Ihr Umfang ist einfach enorm. Sie kann sich zwar kaum von Ort zu Ort bewegen, hat aber alles fest im Griff: Ihre Angestellten dirigiert sie herum, gibt Anweisungen und löst jedes Problem (lässt lösen) und ausser der Kontrolle in den Chalets funktioniert’s eigentlich bestens.
Nach Evas feinem Frühstück fahren wir wieder auf Pirsch. Es ist ein wunderbar schöner, wolkenloser Tag – etwa 15 Grad warm am Mittag, aber ganz angenehm an der Sonne. Unterwegs sehen wir Mungos, viele Vögel und immer wieder Affen. – Ich staune von neuem, was Ken alles weiss. Er kennt jeden Vogel und kann schon von weitem sagen, was für einer das ist, welche Gewohnheiten er hat, was er frisst.
In diesem Park allerdings sind die Hauptattraktion nicht unbedingt die Tiere, sondern die einzigartige Gegend mit diesen mächtigen Felsbrocken, die oft in Gruppen die eigenartigsten Gebilde darstellen – man kann alles Mögliche in ihnen sehen. „Giants‘ Playground“ – diese Bezeichnung trifft sehr gut zu auf diese märchenhafte Landschaft. Schön ist aber auch die Vegetation: Vorherrschend ist überall das hohe Gras. Majestätische Euphorbien, Akazien und Paperbark-Bäume wechseln sich ab mit einer Art lichtem Wald aus Laubbäumen, deren Blätter verwelkt sind, teilweise aber noch an den Zweigen hängen und im Sonnenlicht farbig wirken.
Bei einem Stausee machen wir Halt und picknicken. Eva hat alles aufs Beste vorbereitet. Ken macht ein Feuer, wir alle helfen mit beim Feuerholz Sammeln, und über der Glut rösten wir das Brot für unsere Sandwiches. Eine Flasche Rosé rundet das Bild ab – ein Picknick für Götter (und Göttinnen). Anschliessend legt sich Theo unter einen schattigen Baum und schläft, Eva liest in ihrem Buch, Ken und ich gehen auf Entdeckungsreise. Es hat Plakate, die vor Krokodilen warnen, aber gesehen haben wir keines und auch keine Spuren von diesen Biestern. Dass es aber Nilpferde und Nashörner hat, wird allenthalben klar, ihre Dung-Hinterlassenschaften sind weit verbreitet. Keines dieser Tiere zu sehen, macht mir gar nichts aus, im Gegenteil, wir sind zu Fuss unterwegs und daher ist’s mir lieber, sie bleiben, wo sie sind.
Die Spezies Homo Sapiens aber sieht man ab und zu. Es sind Dutzende von schwarzen Arbeiterinnen und Arbeitern, die Gräser schneiden und diese zu Büscheln zusammenbinden zwecks Bau von Dächern und Häusern. Wie bei uns Holzhaufen am Strassenrand in Waldgebieten sieht man hier immer wieder mal eine ganze Ansammlung und Aufhäufung solcher hübscher Strohgarben. – Mir tun nur die Leute leid, die diese mühsame Arbeit machen müssen. Mit Sicheln und Messern sind sie unterwegs, von morgens bis abends. Sicher werden sie kaum dafür bezahlt. Es ist aber eindrücklich, wie sie immer lachen, freundlich grüssen und einen fröhlichen Eindruck machen, wenn wir vorbeifahren.
Evas Mutter lebt in Budapest und ist momentan im Spital. Sie ist krank und Eva will sie unbedingt mindestens einmal pro Tag anrufen, aber das ist nicht so einfach. Wir fahren einen Umweg von fünfzig Kilometern, um endlich ein Telefonsignal zu erhalten, so dass eine Verbindung möglich ist.
Zurück im Camp wollen wir duschen, aber da fliesst nur kaltes Wasser. Das geht gar nicht; das ist mir eindeutig zu kalt. Wir erhalten den Schlüssel für ein anderes, leeres Chalet – das ist zwar ein wenig umständlich, aber lieber so als unter der „eigenen“ Dusche zu erfrieren.
Es ist Zeit zum Nachtessen. Was gibt’s wohl? - Wen wundert’s? - Filet Nummer sechs oder sieben; ich habe den Überblick verloren. Ab morgen sind wir vorwiegend in Hotels untergebracht, was Ken gar nicht so mag. Er möchte lieber jeden Abend ein Feuer machen und unter freiem Himmel zu Abend essen – egal wie kalt es ist. Er meint, falls sich Gelegenheit biete, doch draussen statt im Restaurant zu essen: „I’m your man!“.
Ok, ok, aber wieder mal drinnen essen und nicht draussen frieren, könnt ich mir jetzt zur Abwechslung doch auch vorstellen.
Heute Abend freue ich mich jedenfalls wieder, ins warme Bett zu kommen, denn die Temperaturen sind ziemlich gesunken.
Und wieder wird gepackt am nächsten Morgen.
Chinhoyi – Siavonga - Lower Zambezi 26. Juli – 3. August 018
Donnerstag, 26. Juli (unser 45ster Hochzeitstag)
Ein wunderschöner wolkenloser Morgen mit blauem Himmel – 9 Grad. Ab acht Uhr wird das Auto geladen. Das ist immer ein riesiges Unternehmen und alle sind froh, wenn endlich die letzte Tasche im Innern des Fahrzeugs verschwunden ist.
Ohne Frühstück fahren wir los. In Bulawayo wollen wir was essen. Das scheint erst keine gute Idee, denn ein Restaurant, wo’s ein gutes Morgenessen gibt, ist nicht ganz so leicht zu finden. Jemand gibt uns dann einen Typ, wo Weisse hingehen (nur ein Prozent der Bevölkerung in Zimbabwe sind Weisse, hab ich gelesen) und ja, das ist ein wirklich super schöner Ort - idyllisch unter Palmen, das „Earth Café“. Einen wunderbaren Kaffee und ein feines Frühstück erhalten wir in dieser sehr gepflegten Oase. Ein wenig teuer zwar, aber absolut empfehlenswert. Und ein schnelles Internet haben sie auch. So können wir uns über Whatsapp mit Kim unterhalten und das macht uns sehr viel Freude. Was wir da nicht alles an News erfahren…
Eine lange Fahrt bringt uns weitere 500 km nordwärts. Die Strecke führt über Gweru, Kwekwe, Chegutu bis schliesslich Chinhoyi.
Jetzt stimmt etwas nicht mehr mit dem Auto. Es muss die Aufhängung sein. Ken hält an, startet den Motor erneut und dann geht’s wieder gut für die nächsten etwa zwanzig Kilometer. So geht das immer weiter, wir halten x-mal an während der letzten Stunde bis nach Chinhoyi, im Norden des Landes, wo unsere nächste Station ist. Wir hoffen natürlich, dass der Land Rover es bis dorthin schafft, und das tut er. Wenigstens ist hier im Cave Motel ein Aufenthalt von zwei Nächten für uns geplant.
Ein Anruf bei der Land Rover Vertretung in Harare bringt vorerst keine Lösung des Problems. Am nächsten Tag muss weiter geplant werden.
Das Motel hat schon sehr viele bessere Zeiten gesehen, aber es ist die einzige passable Unterkunft in der Gegend und liegt auf halber Strecke zu Zambia, wo wir übermorgen hin wollen. Sogar einen Fernseher hat’s im Zimmer, der allerdings führt ein etwas seltsames Eigenleben. Plötzlich springt er von selber an.
Unser Hochzeitstags-Dinner ist nicht halb so idyllisch wie’s während der letzten Abende war. Das Restaurant im Motel ist „nothing to write home about“. Eine Atmosphäre wie in einem Abstellraum. Die Beleuchtung ist ziemlich schlimm, lila, rosarot und weiss - an der einen Wand steht ein verstaubter, ausgestopfter Springbock vor einer dunklen Holzwand, welche bei genauem Hinsehen die Höhle, deren Eingang gleich neben dem Motel gelegen ist und die wir morgen besuchen werden, als geschnitztes Relief darstellt. Daneben hängt der Kopf einer Antilope an der Wand. - Ui, ui, ui! – Zudem werden wir aus irgendwelchen Nebenräumen von drei verschiedenen Lautsprechern mit unterschiedlicher Musik bedudelt. Zudem riecht‘s auch nicht besonders gut im Speisesaal.
Aber wir müssen mal nicht frieren und haben eine Abwechslung im Speisezettel. Der Fisch ist ausgezeichnet, stammt aus einem der Flüsse hier (Bream = Brasse). Theo bestellt sich aus Übermut ein halbes Poulet, von dem er aber nur grad die Hälfte isst. – Den Wein kann man trinken.
Freitag, 27. Juli 18
Wir schlafen ein wenig länger als gewöhnlich und sind beim Frühstück allein. Eva schickt uns eine Whatsapp-Meldung, sie seien unterwegs nach Harare, um das Auto flicken zu lassen. O weh, ein Weg von 130 km – wie von Bern nach Zürich. - Offenbar hat’s in der Gegend hier keine Autowerkstatt, die den Rover flicken könnte
Wir frühstücken erst mal, dann machen wir es uns gemütlich. Es ist kalt am Morgen, wird aber tagsüber 26 Grad warm. Jetzt steht die Besichtigung der Höhle auf dem Programm. Steile Treppen führen zu einem riesigen Loch im Gelände und unten hat man einen Blick auf einen tiefblauen See, in dem sogar ein paar Taucher schwimmen. Ein weiterer Weg führt unterirdisch durch einen engen Gang zu einem anderen See. Wieder im Freien begegnet uns eine junge Familie mit drei Kindern und sie bitten uns, ob sie mit und von uns Fotos machen könnten. Klar doch; das sind wir gewohnt. Schon in Myanmar wollten alle ständig mit uns fotografiert werden. Irgendetwas an uns muss dran sein…
Im Motel hat’s einen recht grossen, gepflegten Garten und einen Swimmingpool. Der ist natürlich leer in der Winterzeit, obwohl‘s ja heute gar nicht so daneben wäre, sich ein Bad zu genehmigen. So legen wir uns im Badeanzug auf den Liegestuhl. Das sieht doch endlich mal wie Ferien aus.
Auch finde ich Zeit, an meinem Reisebericht weiterzuschreiben. Das Internet funktioniert einigermassen gut und das Passwort kann ich mir leicht merken: „buy2beers“.
Eva und Ken sind zurück. Sie brauchten drei Stunden bis in die Hauptstadt, schlimm sei’s gewesen, berichten sie, weil sie ständig hätten anhalten müssen und nicht mehr als 50 km hätten fahren können. Dann ein einstündiger Stau im Stossverkehr.
Innerhalb von einer Viertelstunde sei das Auto repariert worden, ein winzig kleines Stückchen durchgescheuerter Schlauch war die Ursache der Panne gewesen. Gekostet habe die Reparatur nichts. Die Fahrt zurück dauerte anschliessend nur eine Stunde.
Wir sind natürlich froh, dass alles so rasch und gut hat erledigt werden können und wir morgen, ganz nach Plan, nach Zambia weiterreisen können.
Nachtessen im Motel, wie gehabt – nochmals den Fisch bestellt. – Theo Curry, weder Fisch noch Vogel.
Samstag, 28. Juli 18
Um neun ist Abfahrt. Ken kennt die Gegend aufs Beste. Sein Onkel hatte eine Farm in dieser Gegend. Als Junge hat er die meisten seiner Sommerferien hier verbracht und hat bei der Tabakernte mitgeholfen. Er erklärt uns genau, wie die mühsame Arbeit der Saat und der Ernte abläuft. – So sehr ins Detail geht er mit seiner Beschreibung, dass Eva fragt, ob wir am Ende der Reise einen Test würden absolvieren müssen...
Auch hat er uns bereits darauf vorbereitet, dass es unterwegs eine speziell gute Metzgerei gäbe, die er besuchen wolle. Und ja, so viele Weisse, wie dort am Einkaufen sind, haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Wir halten also an im „Lyon’s Den“ und ich sehe gleich, das ist genau die Art Laden, die Ken liebt. Wurmbüchsen kann man kaufen (Chinhoyi ist bekannt dafür, besonders feine Würmer anzubieten) und jede Art von Angelhaken. Alles ist absolut sauber und gepflegt, auch ein Restaurant ist angeschlossen. Und dann in der Metzgerei: Biltong muss es sein. Sowieso. – Und was kaufen wir sonst noch ein, was? – Wir hatten ja schon seit zwei Tagen kein Filet mehr, also liegt es auf der Hand, dass wieder eines gekauft werden muss. Wir leiden doch alle schon an massiven Entzugserscheinungen.
Die Fahrt geht weiter in Richtung Karoi. Früher war hier eine Farm nach der anderen und seit die weissen Farmer vertrieben oder ermordet worden sind, läuft nicht mehr viel. Die Felder sind grösstenteils verwahrlost. Ken zweigt ab, um uns zu zeigen, wo die 6000 ha grosse Farm seines Onkels gewesen war. Es ist eine sehr traurige Exkursion. Schon das Tor zur Einfahrt ist halb zerstört und vom ehemaligen Farmhaus sind kaum mehr Mauern vorhanden; die Anlage für die Tabak-Verarbeitung ist noch grösstenteils sichtbar, aber nur in Ruinen. Dort, wo die Pferde gehalten wurden und dort, wo all die Ziegen und das Vieh gegrast hatten, ist nichts mehr. Nur noch Gestrüpp und hohes Gras. – 250 Arbeiter mit ihren Familien sollen hier gelebt und gearbeitet haben. Wo sind sie geblieben? Jobs hat’s keine mehr, der Bevölkerung geht es schlechter denn je. Da ist offensichtlich alles völlig falsch gelaufen.
Eva meint, die Arbeiter seien wohl nicht genügend gut bezahlt und behandelt worden, sonst wär’s vielleicht nicht so weit gekommen. Diese Ansicht kann Ken nicht akzeptieren. – Die Diskussion bringt nichts.
Zimbabwe (früher ein Teil Rhodesiens) muss ein sehr fruchtbares Land gewesen sein, der Brotkorb von Afrika, bevor Mugabe es wirtschaftlich zugrunde gerichtet hat. Jetzt ist es ein armes Land, zwar landschaftlich wunderschön, muss Nahrungsmittel aus dem Ausland einführen, hat viele Arbeitslose und es besteht kaum Aussicht auf Besserung. Überall, wo man hinkommt, scheint die Gegend heruntergekommen und verwahrlost. Das Geld hat keinen Wert mehr, seit 2009 zahlt man mit Dollars. Weltrekord war eine 100-Billionen-Zimbabwe-Dollar-Note, mit der man so gut wie gar nichts kaufen konnte.
In zwei Tagen, am 30. Juli, sind Wahlen. Überall sind Wahlplakate angebracht und es wird mit einer Wahlniederlage der amtierenden Partei gerechnet. Nur wird wohl doch nichts ändern, denn alles ist abgekartet, wie befürchtet wird, und die Regierung wird wohl kaum einen Wechsel tolerieren. – Wir werden ja sehen. Jedenfalls sind wir froh, dass wir am Montag nicht mehr da sind; es könnte Ausschreitungen geben.
Im Cave-Motel hat mich der junge Mann, der unser Zimmer aufgeräumt hat, angesprochen. Sein Englisch ist nicht sehr gut; ich hab nur was von Zimbabwe verstanden und hab geantwortet, was für ein schönes Land es sei. Da hat er vehement den Kopf geschüttelt und gesagt: „Not nice, Zimbabwe. No cash!“ Er hat dann noch was gemurmelt von Adresse geben, aber auf diese Idee bin ich nicht eingestiegen.
Nach Karoli ändert sich die Landschaft. Wir fahren durch einen Nationalpark. Soweit das Auge reicht, sieht man Büsche und Bäume. Die Gegend erinnert an einen lichten Herbstwald in Kanada ohne rote Blätter jedoch. Der Boden ist nicht mehr fruchtbar. Es ist hügelig, hat viele Kurven. Verkehr hat’s keinen, Siedlungen auch nicht; die sind verboten. An mehreren Orten sind zwischen den Bäumen eine Art schwarz-blaue Leintücher aufgehängt. Es sind Tse-Tse-Fliegen-Fallen.
Ken erzählt, früher habe es sehr viele Tiere gehabt in diesem Park, Elefanten, Zebras, Antilopen und auch Giraffen habe man nicht selten sehen können. Der Grund? Wilderer haben die Tiere bis zum Aussterben gejagt und vertrieben. Die Regierung ist an dieser Misere nicht unbeteiligt. Das schwarze Nashorn ist hier bereits ausgestorben. - Wir sehen lediglich ein paar Baboons.
Bis auf 1200 Meter führt die Strasse bergauf, dann geht’s hinunter ins Zambezi-Valley. Immer wieder sieht man talwärts auf den riesigen Lake Kariba, den Stausee, der nach einer Bauzeit von sechs Jahren 1960 eingeweiht wurde. Er ist 280 km lang und 40 km breit, zehnmal so gross wie der Bodensee. Knapp sieht man im Dunst das gegenüberliegende Ufer. Ansonsten hat man das Gefühl, es handle sich um ein Meer.
Italienische Arbeiter haben mitgeholfen, den Damm zu bauen. Für sie wurde ein Dorf errichtet (Kariba Heights), wo sie wohnen konnten. Von dort aus hat man eine wunderschöne Aussicht auf den See und so war das auch ein viel besuchter Touristenort nach dem Bau des Damms.
Ken erzählt, wie jeweils die grossen Busse auf dem Parkplatz mitten im Ort parkiert und die Reisenden vom Restaurant aus die Aussicht bewundert hätten. – Jetzt, seit der Machtübernahme, ist alles heruntergewirtschaftet. Niemand geht mehr hin, im Restaurant gibt’s nichts mehr zu essen, überall liegt Abfall herum, von den Toiletten schreibe ich lieber nichts. Nur ein paar vergilbte Schilder stehen noch da. Einzig die Kirche ist gut unterhalten und an der Aussicht hat sich nichts geändert.
Auch einen zweiten Aussichtspunkt besuchen wir. Von dort aus sieht man auf den Zambezi-River hinunter, auf die Schlucht und auf die beeindruckende Staumauer. Auf der anderen Seite der Mauer beginnt Zambia – dorthin wollen wir nun.
Bis wir aber dort sind, dauert es noch ein paar Stunden. Die Zoll- und Grenzformalitäten in Zimbabwe sind rasch erledigt, aber dann… Wir fahren über den Damm, Theo und ich gehen vorerst mal zu Fuss und schiessen ein paar Fotos, bis uns Ken wieder auflädt.
Nach kurzer Fahrt erreichen wir den Grenzposten. Ken schwitzt bereits. Er hat uns vorher schon erzählt, wie es dort meistens zugehe, dass sie einem das Leben schwer machen würden mit x verschiedenen Papieren, die man vorweisen müsse, die gar niemand bei sich hat, weil sie weder nötig sind noch existieren.
Die Passkontrolle läuft ohne Zwischenfälle ab, eine junge Angestellte stempelt unseren Pass, knöpft uns je 50$ ab für unser Visum und dann scheint alles in Ordnung. Ken, weil er der Fahrer ist, wird mit seiner ganzen Aktenmappe voller Papiere von Schalter zu Schalter geschickt und muss als letzte Anlaufstelle noch bei der Polizei vorsprechen. Da ist aber im Moment keiner im Büro. Der hat uns, Theo und mich, entdeckt, die wir im Schatten auf einem Treppenabsatz sitzen, lesen und warten. Er macht ein finsteres Gesicht und schnauzt uns an. Ich kann gar nicht verstehen, was er will. Theo soll kommen! – Es stellt sich dann heraus, dass er meinte, Theo sei der Fahrer. Ken hat er gesucht und er ist äusserst schlecht gelaunt. – Und jetzt geht genau das los, was Ken uns vorher beschrieben hat. Er will eine Bestätigung, dass das Auto nicht gestohlen ist, also einen Fahrzeugausweis. Selbstverständlich ist der vorhanden. Das Auto gehört Eva und der Ausweis ist mit ihrem Foto versehen, farbig und laminiert. – Er will ein anderes Papier. Auch geht er jetzt ums Fahrzeug herum und prüft jede Nummer und weiss ich was. Ken regt sich auf, Eva besänftigt ihn, denn es hat keinen Sinn, den Typen noch mehr zu reizen. Alle wissen wir genau, was er will. Die grüne Seite im Pass fehlt (100$-Note), aber Ken sagt, er wolle diesem Idioten (er braucht einen ziemlich viel stärkeren Ausdruck, den ich hier lieber nicht hinschreibe) kein Bestechungsgeld bezahlen. Eva zeigt nochmals ihre Papiere und auch ihren Diplomatenpass. Der Polizist lässt sich aber in keiner Weise beeindrucken und schliesslich muss Ken ihm zähneknirschend die Kohle geben. Wir würden sonst noch immer am Zoll stehen oder wir hätten den Wagen dort lassen müssen. Es hätte auch gut sein können, dass er noch mit anderen Forderungen herausgerückt wäre. Eva erzählt von allerhand Erfahrungen, die sie gemacht haben, immer und immer wieder. So hatten sie vor ein paar Jahren in Namibia zwei Wochen Ferien gebucht, alles bereits bezahlt und man liess sie nicht ins Land einreisen.
Endlich können wir losfahren – wer hätte gedacht, dass wir das Tor schliesslich doch noch passieren können mitsamt dem Land Rover.
Ken schäumt vor Wut. Während 27 Jahren organisiere er Safaris, schimpft er, und genau wegen diesem ewig gleichen Theater möge er das nun nicht mehr machen. – Er wünscht dem Beamten, dass er Durchfall kriege. Da kommt ihn noch eine schlimmere Strafe in den Sinn: Möge er doch mit unseren Dollars heute Abend zu einer Prostituierten gehen, die Aids habe…
Theo kann’s auch nicht fassen. Man müsste dem Konsulat schreiben, man müsste etc. etc. – Es ist Afrika. So ist das hier halt. Gehört habe ich schon oft von solchen Zwischenfällen, erlebt hab ich’s aber nie. Nun sehen wir selber an einem kleinen Beispiel, wie’s so läuft, wenn ein Land korrupt ist. – Ich denke, die paar Beamten haben sich den „Lohn“ geteilt und machen sich einen schönen Abend damit. Mit oder ohne Prostituierte…
Nur etwa fünf Kilometer müssen wir fahren, bis wir in Siavonga sind, wo Ken für uns zwei Bungalows in der „Eagles Rest - Lodge“ gebucht hat. Er war schon mehrmals da, kennt die Besitzer und wie immer hat er uns an einen herrlichen Ort geführt. Die Lodge liegt direkt am Wasser, ein kleiner Sandstrand und eine Bar laden zum Verweilen ein. Baden wird leider nicht empfohlen, da’s Krokodile hat und Nilpferde. Nicht in Massen zwar, aber immerhin. Schon mehr als einmal, so erzählt man uns, seien Menschen hier von Croks angegriffen und sogar gefressen worden. – Da verzichte ich gern und überlege mir allenfalls, ob ich doch den Pool vorziehen soll. Warm genug ist es; 28 Grad macht Freude nach all der Kälte, die wir bisher „erleiden“ mussten.
Es ist Winter und trotzdem erscheint die Vegetation hier wie im Sommer. Besonders gefallen mir die riesigen Mangobäume, die in Blüte sind.
Gestern gab’s das „Mond-Spektakel“ mit dem roten Mond, eine Jahrhundert-Finsternis. Wir haben’s verspasst. - Heute Abend aber sitzen wir im Strandrestaurant beim Abendessen, die Füsse im Sand und sehen den Mond ebenfalls ganz orangefarbig und riesig. Leider ist es uns nicht gelungen, gute Fotos davon zu schiessen. Nur die Spur im Wasser (the stairway to heaven) sieht man einigermassen.
Es ist noch immer knapp 20 Grad – das sind wir nicht mehr gewohnt. Wir geniessen den warmen Abend sehr. Sogar Ken hat sich beruhigt nach drei doppelten Whiskys.
Sonntag, 29. Juli 18
Alles easy, so wie wir’s gern haben. Kein Stress. Um neun frühstücken wir und packen dann die Dinge ein, die wir für drei Tage und zwei Nächte auf dem Hausboot brauchen, das Ken gemietet hat, die „Buccaneer“. Den Rest des Gepäcks lassen wir in der Lodge, wo wir anschliessend eine weitere Nacht verbringen werden. Eva, fürsorglich wie sie ist, packt noch zusätzlich ein paar Lebensmittel ein, die wir eventuell während der nächsten zwei Tage vermissen würden, falls wie sie nicht dabei hätten: Kens Honig, den er jeweils reichlich in den schwarzen Kaffee träufelt, Theos Orangen-Marmelade, braunes Toastbrot und Butter, mein Schwarztee und was noch mehr.
Um halb zwölf sind wir auf dem Boot. Es ist einfach super. Konzipiert ist es für zehn Leute. Wir sind die einzigen vier Passagiere. Zwei schöne Kabinen werden uns zugewiesen.
Der Kapitän heisst Pete; er ist ein Südafrikaner, der auch deutsch spricht. Die weitere Crew besteht aus Raymond und Gerard. Sie kochen und putzen für uns, erledigen alles, was nötig ist, um ein solche Schiff zu betreiben und machen das Beiboot parat, wenn’s gebraucht wird.
ch kann sie schlecht auseinanderhalten, sie sind beide etwa 25-jährig, hübsche junge Männer und sehr schwarz. Der eine hat ein weisses Hemd an, der andere ein blaues. Eva geht es gleich; sie hat eine hilfreiche Idee: „Blueray“ ist die Eselsleiter. Der blau angezogene ist also Raymond. – Dumm nur, dass am nächsten Tag auch Gerard ein blaues Hemd anhat…
Es ist eine fabelhafte Reise: ein bisschen lesen, ein bisschen sonnenbaden, ein bisschen schlafen. Dazu tuckern wir der Küste entlang. Kurz nach der Abfahrt wird ein feines Mittagessen serviert (Salate, Samosas, Pizza). Nach ungefähr 40 Kilometern legt das Boot in einer schönen Bucht (Eagles Bay) an, von drei Seiten her geschützt. Das sei wichtig, sagt Pete, denn hier könnten die hohen Wellen dem Boot nichts anhaben, falls des Nachts plötzlich ein Sturm aufkäme. - Da werden wir also auch übernachten. Auf Google-Map sehe ich, wo wir sind. Weit sind wir noch nicht gekommen, wenn man die Läge des Sees in Betracht zieht.
Die Männer wollen fischen. Es geht nicht lang und Ken hat einen Fisch an der Angel. Der ist noch kleiner als derjenige, den er aus dem Limpopo gezogen hat. Bald hat er Nr. 2 und 3 an der Angel. Immer kleiner werden sie. Ich muss langsam meine Lesebrille anziehen, um die Trophäen zu erkennen. Die Würmer, an denen sie hangen, sind besser sichtbar. Aber immerhin – ein erster Erfolg. Auch Theo versucht sein Glück weiterhin, gibt aber bald auf und widmet sich seinem Zeichenblock. Zeichnen kann er eindeutig besser als Fischen.
Zum Abendessen gibt’s ein feines Rinds-Goulasch mit Reis und anschliessend einen Fruchtsalat. – Um neun gehen wir schlafen.
Was für eine Idylle. Die Motoren sind abgestellt, nur das laute Quaken der Frösche hört man noch bis weit in die Nacht hinein.
Montag, 30. Juli 18
Um neun Uhr haben wir das Frühstück bestellt, um zehn ist es parat. Wir sind ja in den Ferien, nicht auf der Flucht – niemand hat ein Problem damit. Ken ist bereits wieder am Fischen, Theo am Zeichnen, Eva und ich sind am Schwatzen und am Lesen.
Das ganze Morgenessen wird von unseren beiden blauangezogenen Stewarts auf dem Grill zubereitet (Eier, Würste, Schinken, Speck, Tomaten, Zwiebeln und das feine, hausgemachte Brot). – Auch Pete hat jetzt übrigens ein blaues Hemd an, aber den zu erkennen oder besser gesagt zu unterscheiden, ist ja nicht das Problem.
Das Schiff verlässt die Bucht und fährt weiter durch eine enge Passage zu einer Nebenbucht des Sees. Bei einer Lodge wird es vertäut. Gerard und ein Typ, der dort am Ufer steht und auf seinem T-Shirt eine Ente abgebildet hat, was ein wenig lächerlich wirkt, helfen, das Boot an Bäumen anzubinden. Da werden wir übernachten.
Erst gibt’s schon wieder zu essen. Wunderbares haben sie hingezaubert, die beiden Stewarts. Sie haben sich umgezogen – der eine hat ein weisses Hemd an, der andere ein orangefarbenes…
Eigentlich ist’s nur eine Camp-Site und auch die Lodge ist keine richtige Hotel-Unterkunft, privat also. Sie gehört offenbar einem Mann, der hier nur für seine Familie und Freunde ein Ferienresort gebaut hat. Weit und breit gibt’s keine Siedlung und ich kann mir nicht vorstellen, wie man an einem so abgelegenen Ort wohnen will.
Trotzdem ist da der junge Mann (mit der Ente am Bauch), der unser Boot eingewiesen hat, der den Rasen sprengt und die absolut saubere WC- und Duschanlage pflegt. Sonst nirgends eine Menschenseele. Das Ganze ist richtig absurd. Und ungefähr 50 Meter im See vor dem Ufer ist eine Art Insel eingebaut mit einem krokodilsicheren Swimmingpool drauf und einem Sonnendach.
Überhaupt sieht man währen der ganzen Fahrt ausser diesem etwas seltsamen Camp nirgendwo am Ufer eine Siedlung. Auch keine anderen Boote sind unterwegs. Nur gerade hier, in dieser Bucht, hat’s ein paar Fischerboote. Pete sagt, die würden mit Netzen fischen und das sei absolut verboten. Sie machen’s trotzdem.
Auch über unsere Fischer gibt’s was zu erzählen: Ken ist es doch noch gelungen, einen ansehnlichen Fisch aus dem Wasser zu ziehen. Wir alle schauen natürlich zu und befürchten, die Rute würde gleich brechen, aber dem ist nicht so. Nach einem kurzen Kampf ist der Fisch an Bord gezogen und windet sich im Netz. Etwa zwei bis drei Kilo schwer und knapp ein Meter lang ist er, so schätzen wir. Es ist ein Wels, den sicher niemand essen will, also wird er wieder ins Wasser befördert. Gruuusig finden wir, (Eva und ich). Die Männer allerdings sind ganz aus dem Häuschen…
Nach einem feinen Nachtessen (Braai) sind wir früh schon müde und gehen schlafen. In der Nacht soll ein Flusspferd ums Boot „herumgeschlichen“ sein, erzählen uns Pete und Ken am Morgen - ich hab’s verschlafen…
Dienstag, 31. Juli 18
Schon früh am Morgen ist Raymond dabei, das Deck zu schruppen. Überall wird säuberlich geputzt. Dann gibt’s wieder ein üppiges Frühstück. Es ist schon richtig heiss an der Sonne um neun Uhr. Ich geniesse es und denke ans Marzili, an die Aare und an alle unsere Freude, die den aussergewöhnlich heissen Sommer zu Hause geniessen können. Theo und ich, wir nehmen ein Bad im Swimmingpool. Pool ist zwar richtig, „Swimming“ eher nicht. Die Temperatur ist wohl etwa die gleiche wie heute in der Aare – ungefähr 23 Grad.
Langsam fahren wir zurück nach Siavonga. Kurz nach ein Uhr mittags kommen wir an und nach einer weiteren Mahlzeit beziehen wir wieder unsere Bungalows.
Ich geh baden im Pool und mach ein paar Fotos vom schönen Garten. Etwas bewegt sich im Bild, von dem ich eigentlich dachte, es sei ein abgeschliffener Felsbrocken. Aber nein, es ist ein Flusspferd. Es grast gemütlich genau auf dem Weg, den wir vorher vom Boot gekommen sind. – Ich glaub’s ja nicht. Ich hatte nämlich leise vermutet, dass die Warntafeln mehr zur Freude der Touristen da seien und Krokodile und Hippos kaum so nah an die Siedlung herankommen würden. – Fehl gedacht. Fürs Personal ist’s jetzt schwierig, unbehelligt zum Boot zu gelangen, welches für die neuen Gäste parat gemacht werden muss. Alle sind zu einem Umweg gezwungen.
Auf unser Nachtessen warten wir heute Abend sehr lang. Es sind neue Gäste angekommen, eine ganze Gruppe Irländer. Da bricht der Service halt zusammen.
Erst um halb zehn sind wir im Bett – ungewöhnlich spät für unsere hiesigen Verhältnisse.
Mittwoch, 1. August (CHs Geburtstag)
Wir hören, dass es gestern in der Schweiz sehr warm war, 37 Grad in Oerlikon. Ist ja krass. Und Feuer kann man auch keine machen heute, hab ich gelesen. Das wird mir ja ein Nationalfeiertag ohne all die Pyromanen.
Da haben wir’s besser. Endlich warm, schön warm, Ende der Kälte. Kühl in der Nacht aber sommerlich am Tag. So langsam fängt der afrikanische Winter an, mir zu gefallen.
Heute haben wir nur eine relativ kurze Fahrt vor uns. Die Kiambi-Lodge im Lower Zambezi ist das Ziel. Unterwegs halten wir an, um einen kleinen versteinerten „Wald“ zu besichtigen. Nur wenige „Baumstücke“ liegen herum. Ich denke, im Hügel drin sind noch sehr viele mehr versteckt.
Schon nach drei Stunden kommen wir an. Eine tolle Lodge ist das mit einzelnen Cabins aus Holz und Zeltplachen. Alles ist sehr gepflegt und man hat einen einmalig schönen Blick auf den Zambezi River, der dort grad eine Kurve macht. Ein feines Mittagessen wird serviert und anschliessend haben wir Zeit für Siesta (Theo!) und eine Abkühlung im Pool (ich). Auf dem Weg dorthin zieht sich Theo allerdings Verletzung Nummer 7 oder 8 (?) zu. Er kommt daher gehumpelt, hat nicht aufgepasst, wo er hintritt. Die Dornenbüsche hier sind nicht „Micky Mouse“, wie sich Ken ausdrücken würde. – Drei Dornen haben einen seiner Flip-Flops durchstochen und eine davon hat sich erfolgreich in Theos grosse Zehe gebohrt. Ich zieh sie raus und es blutet einmal mehr Bedauern erweckend.
Ab vier Uhr nachmittags beginnt schon die „Sundowner-Cruise“. Mit dem Motorboot geht’s flussaufwärts und am Ufer entlang sehen wir viele Vögel. Am besten gefallen mir die farbigen White-Fronted-Bee-Eaters, die zu Duzenden an den Böschungen herumfliegen, wo sie in kreisrunden Löchern ihre Nester gebaut haben und nun ihre Jungen versorgen. Auch der Nationalvogel von Zambia und Zimbabwe, der African Fish Eagle ist unterwegs sowie zwei Elefanten, die grad dabei sind, einen seichten Flussarm zu durchqueren, um auf die Insel zu gelangen, auf der wohl noch bessere Kräutchen wachsen – ein fantastisches Bild, die beiden im Zwielicht zu beobachten. Und der Sonnenuntergang auf dem langsam dahinfliessenden Fluss ist unvergesslich.
Der Fluss wimmle nur so von Hippos, hat man uns gesagt. Das stimmt. Ganze Familien tummeln sich im Wasser, vier, sechs, zehn Köpfe gucken aus den Wellen, schauen in unsere Richtung, tauchen wieder ab, und das an etlichen Stellen. Sie machen mir Angst. Die Töne, die sie dabei ausstossen und die man auch des Nachts immer wieder mal hört, sind unheimlich. Erst ist’s eine Art dumpfes Schnorcheln, dann folgen ein paar Geräusche, die sich anhören, wie wenn jemand ein schweres Sofa ruckweise über einen Steinboden schleifen würde - ein gespenstischer Chor. Manchmal ist‘s auch nur ein einzelner Ton, grad wie aus einer Posaune geblasen. - Das macht Eindruck. Einige der Kolosse heben sich aus der Strömung hoch. Ob das Drohgebärden sind? - Wenn das Boot übers Wasser schiesst, hab ich die Befürchtung, es rase in eine solche Herde hinein. Der Steuermann ist aber sehr geschickt; er scheint den Fluss gut zu kennen.
Wie wir zurückkommen, ist der Tisch für uns bereits gedeckt. Auch das Kerzenlicht fehlt nicht. Draussen im Freien mit Aussicht auf den Fluss und aufs Lagerfeuer werden wir aufs Beste bedient und verwöhnt.
Für morgen ist für uns eine Kanufahrt gebucht. Wir fahren auf eine Insel und dort werden wir in Zelten übernachten. Richtig abenteuerlich. - Ich bin nicht sehr begeistert. Wie wir an all diesen Flusspferden vorbeisteuern wollen, kann ich mir noch nicht vorstellen. Krokodile hat’s ja schliesslich auch. Wir haben ein paar von ihnen gesehen auf unserem Ausflug, Exemplare in jeder Grösse. – Am liebsten würde ich passen.
Dazu kommt noch, dass wir für die Kanufahrt ein Notfallblatt ausfüllen mussten mit sämtlichen Personalien, Passangaben, wer im Notfall zu erreichen wäre, Nummer der Versicherung und des Arztes… All das trägt nicht dazu bei, dass ich denke, es sei „Micky Mouse“. – Jedenfalls habe ich in der Nacht bereits Albträume.
Donnerstag, 2. August 18
Frühstück um sieben, anschliessend Packen, Instruktionen um acht, Abfahrt um neun.
Ins Kanu sollen wir möglichst nichts mitnehmen. Sollte es kentern, sei Hab und Gut verloren, heisst es…
Mit dem Motorboot fahren wir flussaufwärts an eine Stelle, wo vier grüne Kanus bereits auf uns warten. Wir sind zu zehnt. Vier von uns werden nur bis zu dem Ort mitreisen, wo’s Lunch gibt; wir andern sechs (ein junges Paar aus England ist mit dabei) paddeln weiter bis zur Insel, wo wir übernachten werden.
Bevor wir einsteigen, werden wir nochmals genau instruiert und für mich wird unser Vorhaben immer unheimlicher. Eva geht es gleich. Sie nimmt vorher noch eine Schmerztablette, nimmt einen tiefen Schluck aus ihrer Wasserflasche, merkt dann aber, dass das ja die Flasche ist, in die sie ihren Gin abgefüllt hat, den sie mitnehmen will. – Das sei vielleicht gar nicht das Dümmste gewesen, meint sie, sie habe jetzt gar nicht mehr so grosse Bedenken.
Unser Guide erklärt, wie wir uns zu verhalten haben. Er fährt voraus, die andern müssen hinter ihm bleiben und Abstand halten. Sollte ein Hippo das Boot von links angreifen (es sei sehr selten und wenn, dann würde es das nur zur Verteidigung tun – wie wenn mir in dem Moment seine Gemütslage interessieren würde), dann solle man auf der rechten Seite des Bootes ins Wasser springen und zur nächsten Insel schwimmen. Mit der Hand zeigt er aber nach links. Ui, ui, ui – was jetzt? Wie Theo – der verwechselt auch oft links mit rechts. Die Tiere würden wenn schon eher das Boot angreifen und nicht die Menschen… Diesen Job könnte dann aber ein anderer übernehmen, überlege ich mir, denn wie Ken jeweils sagt: „If there is a hippo, his friend Mr. crocodile is not far“. - Mir wird immer mulmiger zumute. - Und nicht zu nah am Ufer paddeln, da habe es oft Hippo-Mütter mit ihren Jungen, und mit denen sei nicht zu spassen. Ebenfalls aus der Herde ausgestossene Männchen. - Und ja nicht etwa einen Fuss oder eine Hand ins Wasser halten. - Und ob jemand noch eine Frage habe…
Er erklärt weiter, dass wir je zu dritt in einem Kanu sitzen müssten, derjenige hinten habe 80% Arbeit zu leisten mit Rudern und derjenige vorne etwa 20%. – Eva bringt es auf den Punkt und sagt: „In this case the one in the middle is the useless person“. Genau so ist es!
Die Boote werden zugeteilt und mir fallen etwa fünfzig Steine vom Herzen, als Morat sagt, er werde unser Kanu steuern, Theo könne vorne sitzen. Ich bin also the useless person und sitze in der Mitte.
Wir fahren los, es schaukelt, die Hippos schauen bereits zu und stossen ihre seltsamen Laute aus. Es geht nicht schnell, der Zambezi fliesst gemächlich, Theo hält zwar das Paddel in der Hand, aber er tut nichts. – Kein Problem, „hakuna matata“ – Morat steuert uns geschickt an den Flusspferden vorbei, weist auf Vögel hin und Krokodile, die an der Sonne liegen und so geht’s gemächlich flussabwärts. Der Zambezi ist unterschiedlich breit, zeitweise sind‘s zwei bis sogar drei Kilometer. Wir gleiten manchmal mitten drin, manchmal eher am linken Ufer entlang, nicht zu nah natürlich, nie am rechten, denn dort drüben ist Zimbabwe. Etliche Inseln umfahren wir, auf der einen steigen wir kurz aus, um uns ein wenig die Füsse zu vertreten.
Drei Stunden lang sind wir unterwegs, bis wir an den Ort gelangen, wo’s Mittagessen gibt. Dort werden vier von uns mit dem Schnellboot abgeholt; für uns andere geht die Reise bald schon weiter. Aber erst erwartet uns ein feines Picknick und wir sind alle froh, dass bis hierhin alles gut gelaufen ist und niemand einen Sprung ins krokodilverseuchte Nass tun musste.
Etwa hundert Meter weiter vorne liegt ein Flusspferd im Gras. Es ist genügend weit weg, sagt Morat, kein Problem. Theo liegt nach dem Essen auch im Gras; nach der schweren Arbeit ist es Zeit für Siesta.
Er ist jetzt aber gestärkt und hilft wacker mit zu paddeln, es ist nämlich ein Wind aufgekommen und der bläst in die falschen Richtung. Will man nicht nur schrittweis vorwärtskommen, muss man an die Paddel. Nach weiteren drei Stunden kommen wir auf der Insel an, wo wir über Nacht bleiben werden. – Die Kanureise war sehr schön, ein tolles Erlebnis, aber trotzdem bin ich froh, dass sie zu Ende ist und nichts passiert ist. Nach sechs Stunden im Kanu sitzen, tut einem auf jeden Fall das Hinterteil weh. Und Ken hat sich die Knie an der Sonne verbrannt. Kein Wunder in seinen Shorts.
Wir landen am östlichen Ende einer langen Insel. Auf diesem schmalen Streifen Strand, nur knapp 50 Meter breit, werden wir uns fünfzehn Stunden lang aufhalten. Es ist jetzt fast schon halb fünf. Das Motorboot mit unserem Übernachtungsgepäck, den Zelten, Küchenutensilien etc. ist bereits da und die drei Angestellten beginnen sofort mit der Arbeit. Morat ist der Chef. Es hat weder Strom noch irgendwelche Infrastruktur, also muss alles von Grund auf erstellt werden. Erst werden zwei Feuer gemacht, eines zum Kochen, eines als Lagerfeuer und schliessend werden eine Latrine, eine Waschstelle und fünf Zelte aufgestellt. Dort hinein legen sie Matratzen (dünne) und warmes Bettzeug, eine Art Schlafsack und Wolldecken. Der Tisch wird gedeckt, Stühle aufgestellt und sobald all das fertig ist, gibt’s Spaghetti Bolognese mit Rapskäse sogar und zum Dessert Pfirsiche mit Rahm. Was wir dazu trinken, haben wir vorher schon bestellt – auch das ist in der Kühltruhe im Schnellboot mitgereist.
Wie die drei Männer arbeiten, ist sagenhaft. Ich bewundere sie zutiefst. Alles klappt wie am Schnürchen, jeder weiss, was er zu tun hat, alles tadellos.
So heiss wie’s tagsüber im Kanu war (grad wie in Bern, also etwa 32 Grad), so kalt wird’s in der Nacht wieder werden. Ein einmaliger Sternenhimmel ist bald schon zu sehen. Nach dem Essen und einem Plauderstündchen am Feuer ziehen wir uns warm an und verschwinden in unseren Zelten. Trotz der Matratzen und dem Sand darunter ist es ein wenig hart, aber zumindest ganz schön warm. Trotzdem habe ich Mühe einzuschlafen. Ich glaube, es geht allen etwa gleich, wie am nächsten Morgen erzählt wird (Ken meint, sein Rücken gehöre nicht mehr zu ihm). Immer wieder werden wir nämlich auch von den unheimlichen Lauten der Flusspferde geweckt, die keine Nachtruhe kennen. Fängt auf der einen Seite eines damit an, antwortet ein anderes und so geht das Geschnorchel im Kreis um uns herum los.
Freitag, 3. August 18
Wie’s um sechs Uhr hell wird, bin ich jedenfalls wach und sehe, wie unsere drei Guides bereits wieder am Arbeiten sind: Feuer machen, Kaffee und Tee kochen und ein wenig etwas zum Frühstück parat stellen. Es ist sehr kalt und ich bin froh um die warmen Jacken, die ich bei mir habe und die Kappe. Essen mag ich nichts. Um sieben Uhr fahren wir mit dem Motorboot zurück zur Lodge, wo wir kurz vor acht Uhr ankommen, halb tiefgefroren. Es war eine Fahrt wie in der Arktis. Wie Morat mit seinem kurzärmligen Hemd überlebt hat, ist mir ein Rätsel. Kens Shorts sind wohl im Moment ebenfalls nicht unbedingt das geeignetste aller Beinkleider.
In der Lodge gibt’s nochmals Frühstück und bald schon sind unsere Zimmer parat. Die warme Dusche ist einfach wunderbar!
Ein wenig Reisebericht schreiben, am Pool an der Sonne liegen und lesen, das ist genau das, was jetzt Freude macht. Jedenfalls für Eva und mich. Die Männer haben beschlossen, Angeln zu gehen. Sie nehmen ein Lunchpaket mit und wir Frauen geniessen unser Mittagessen in der Lodge.
Eine weitere „Sundowner-Cruise“ erleben wir alle am späteren Nachmittag, wie die Männer wieder zurück sind - ohne Beute. Ob alles, was sie erzählen, auch stimmt, weiss ich nicht genau.
Kiambi Lodge / Livingstone / Kasane / Gweta 4. – 14. August 18
Samstag, 4. August 18
Eine lange Reise haben wir erneut vor uns – nicht kilometer-, aber stundenmässig.
Wir starten früh, schon vor acht Uhr, gleich nach dem Morgenessen. Erst geht’s zurück nach Chirundu über eine Schotterstrasse, anschliessend während 140 km über eine bestens ausgebaute neue Strasse, die offenbar von den Chinesen erbaut wurde (gegen was auch immer für Zusicherungen) und welche auf Kens Road Atlas noch gar nicht vermerkt ist. Sie ist so gut wie überhaupt nicht befahren, obwohl wir an unzähligen Dörfern vorbeikommen. Hier hat man das Gefühl das „echte“ Afrika zu erleben, weit weg von jeglicher Zivilisation. Bescheidener kann man kaum leben. Die Menschen hausen in den einfachsten Lehmhütten, leben von der Ziegenzucht - Landwirtschaft hat’s so gut wie keine. Es sind die Frauen, die grosse Lasten auf ihren Köpfen tragen. Ihre farbigen Kleider tragen sie stolz zur Schau.
Die Vegetation ist ebenfalls bemerkenswert. Während mindestens einer Stunde lang fahren wir an den knorrigsten Baobab-Bäumen vorbei. Sie wachsen nur auf basalthaltigen Böden. Plötzlich hat’s keine mehr, nur noch Mopani-Trees und Euphorbien. Dann wieder wechseln sich Grasland mit hohen Bäume ab und mit verschiedenen Arten von Akazien. So geht das bis Gwembe. Weitere 50 km führt die Strecke über eine nicht asphaltierte Strasse über Chomo, Kalomo und Zimba, bis sie in die Schnellstrasse nach Livingstone mündet, wo’s wieder mehr Verkehr hat, vor allem viele Lastwagen.
Schnurgerade und langweilig geht’s weiter, bis wir endlich ziemlich müde, steif und gerädert, nach fast acht Stunden Fahrt, mit nur zwei fünfminütigen Zwischenhalten, in der Maramba River Lodge in Livingstone ankommen.
Schön ist es hier. Die Lodge ist direkt am Maramba-River gelegen, der an der Stelle etwa halb so breit ist wie die Aare im Marzili und sozusagen keine Strömung hat, fast ein stehendes Gewässer also. Daher spiegelt sich auch das gegenüberliegende Ufer prächtig auf der grünen Oberfläche. Es ist ein idyllischer Ort. Vom Swimmingpool aus, der von hohen Palmen und Kakteen umgeben ist, wie von der Bar aus und auch beim Nachtessen hat man Aussicht auf eine spektakuläre Show, die die Hippos im Fluss abziehen. Eines sperrt den Rachen auf, was ich bisher so noch nicht gesehen habe und alle Zuschauer knipsen wie wild drauflos. - Ich bin zu spät. Dass diese riesigen Tiere mit ihren überdimensionierten Mäulern Vegetarier sind, ist kaum zu glauben. Feines Gras wächst in der Lodge, denn die ganze Zeit wird der Rasen besprengt. Kein Wunder, dass das eine oder andere immer wieder mal auf den Geschmack kommt, sich am diesseitigen Ufer zu verköstigen.
Fünf Nächte lang bleiben wir hier. Das macht Freude! Endlich müssen wir nicht schon wieder packen und können es gemütlich nehmen. Die „En-Suite-Luxury-Tents“, in denen wir wohnen, sind komfortabel, wenn sie von aussen auch nicht gerade nach grossem Luxus aussehen. Aber innen sind sie sehr gut eingerichtet, ziemlich geräumig sogar.
Das Bett ist bequem und warm (4 Lagen Wolldecken und Duvets), was wichtig ist, denn am Morgen ist es wieder extrem kalt, nicht viel mehr als fünf Grad zeigt das Thermometer.
Sonntag, 5. August 18
Erst um neun gehen wir zum Frühstück, wenn’s viel wärmer ist. Grad gegenüber am anderen Ufer steigt ein Krokodil gemächlich aus dem Wasser und legt sich an ein sonniges Plätzchen. Auch es hat ja eine kalte Nacht hinter sich.
Heute nehmen wir’s gemütlich nach der langen Fahrt gestern. Die Viktoriafälle, die hier die Hauptaktion sind, wollen wir erst am nächsten oder übernächsten Tag besuchen, wenn wir ausgeruht sind.
Am Mittag gehen wir einkaufen, Theo bleibt „daheim“. Ken will heute Abend sein Filet braaien, das wir unterwegs eingekauft und inzwischen tiefgefroren haben, und dazu braucht’s wieder Zutaten. Ein Rieseneinkauf wird’s einmal mehr; ein weiteres Filet inbegriffen. Noch was Feines für die Fische: Ken hat erfahren, dass sie geil auf Hühnerlebern sind…
Ich lege mich anschliessend am Pool auf einen Liegestuhl und schreibe an meinem Reisebericht, Theo schläft im Zelt, Eva und Ken haben den halben Nachmittag lang Massagen gebucht.
Kaum ist die Sonne kurz vor sechs untergegangen, beginnt Ken, ein Feuer fürs Braai anzufachen. Das Holz, das wir haben, ist relativ frisch und hart und so dauert es zwei Stunden, bis die Glut parat ist. Konsequenterweise zieht sich der Apéro ziemlich in die Länge und eine Flasche Wein ist bereits Geschichte, bevor etwas auf dem Teller liegt. Wir haben hier keine Küche, also gibt’s ausnahmsweise keine Zutaten ausser Salat. Auch fehlen Stühle und ein Tisch, aber das ist kein Problem, sind unsere Zelte doch grad neben dem Campingplatz gelegen, wo‘s Tische und Bänke hat. Evas Tischtuch ist inzwischen frisch gewaschen worden und kommt nun wieder zum Einsatz. Da es ziemlich dunkel ist, haben wir unsere Stirnlampen angezogen, damit wir sehen, was wir essen. Ziemlich schräg sieht das aus (wir – nicht das Menu).
Montag, 6. August 18
Ausschlafen. Wunderbar! Nur die ewigen Helis und Mikrolights, die ständig über dem Wasserfall kreisen, wecken uns (mich) schon früh morgens. Theo hat seine Earplugs montiert – er schläft wie ein Baby. – Aber es ist ihm trotzdem nicht ganz wohl. Eigentlich hätten wir heute „Fall-Besichtigung“ auf dem Programm, aber Theo möchte zur Abwechslung lieber einen weiteren Tag lang ausspannen und gar nichts tun. – Wir haben ja Zeit. Und die Fälle laufen nicht davon. Sie sind auch noch übermorgen da (obwohl in meinem Reiseführer steht, irgendwann in Tausenden von Jahren werde es sie nicht mehr geben - kümmert uns aber nicht im Moment).
Nach dem Morgenessen geht’s daher geruhsam weiter. Nachdem das Internet während einer Stunde lang nicht funktioniert hat, gibt’s nun keine Probleme mehr und ich kann meinen Reisebericht 2 abschicken. – Es ist schon einmalig, in einer Bar zu sitzen, vor sich den Laptop auf dem Tisch und keine zwanzig Meter entfernt eine Hippo-Familie zu beobachten, die noch die viel grössere Ahnung hat von Siesta-Machen als mein lieber Gatte. Vögel versammeln sich auf den Dickhäutern, picken Parasiten und die Algen ab, die sich in deren Haut angesammelt haben – eine bemerkenswerte Symbiose.
Anstatt nur herumzusitzen, hab ich beschlossen, reiten zu gehen.
Ich werde von einem Kleinbus abgeholt, im dem mindestens zehn Personen Platz haben. Niemand ausser mir har offenbar dasselbe Bedürfnis. Zuerst fährt mich der Driver ins Batoka-Zentrum, wo erst mal Kohle abgeladen werden muss, bevor die Fahrt weitergeht. Der Stall befindet sich im fünf-Sterne-Hotel „Royal Livingstone“, welches am Zambezi gelegen und von einem Park umgeben ist, in dem’s Zebras hat, vier Giraffen und etliche Impalas.
Likwita ist mein Guide; er weiss viel zu erzählen über Flora und Fauna und seine Heimat Zambia. - „Night Delight“ heisst mein Pferd, und es ist ein sehr braves. Nur vor den Monkeys hat es Angst; es muss wohl mal eine schlechte Erfahrung gemacht haben.
Wir reiten durch den Hotelkomplex und anschliessend überqueren wir die Strasse und die Bahnlinie. Dort beginnt der Nationalpark. Elefanten hat’s, ihre Spuren sind überall zu sehen: Dung sowie abgebrochene und ausgerissene Bäume und Äste. Aber sehen tun wir sie nicht. Unser Ritt dauert zwei Stunden und führt durch den Busch, vorbei an einem ausgetrockneten Fluss, an einzelnen Büschen und Bäumen. Die Weaver-Birds sind eifrig am Nesterbauen. Über die Ebene ist die Gischt der Viktoria Fälle zu sehen. Gewaltig! – Einen Moment lang reiten wir am Ufer des Zambezi entlang, bevor‘s zurück zum Stall geht. Absteigen ist mühsamer als Aufsteigen. Ich bin ziemlich steif, denn seit mehr als einem Jahr sass ich nicht mehr auf einem Pferderücken. - Und zwanzig bin ich auch nicht mehr… Es war ein sehr schönes Erlebnis, den teuren Preis sicher wert.
Heiss war’s und ziemlich mühsam, die vielen Fliegen abzuwehren. Aber lieber natürlich als die Moskitos, vor denen wir uns alle fürchten. Wir nehmen brav unsere Malariaprophylaxe und versuchen auch, möglichst zu vermeiden, dass die elenden Biester sich an uns gütlich tun, aber einfach ist das nicht, obwohl „Peaceful Sleep“, der Anti-Mücken-Spray, genau das verspricht.
Ein weiteres Nachtessen im Restaurant und anschliessend eine traumlose, kühle Nacht in unserem bequemen Zelt.
Dienstag, 7. August 18
Heute ist Vic-Fall-Besucher-Tag. Absolut grandios, obwohl momentan bei weitem nicht am meisten Wasser fliesst. Das wird erst in der Regenzeit soweit sein, aber dann kann man offenbar die Fälle kaum mehr sehen, weil der Sprühnebel so riesig ist.
Hier ein paar Zahlen (im Durchschnitt je nach Jahreszeit): 10‘000 Liter Wasser pro Sekunde / 550 – 700 Mio. Liter Wasser pro Minute. Grösste Falltiefe 108 Meter. Breite: 1688 Meter!
Wenn ich mir vorstelle, wie das gewesen sein muss für Livingstone, als er 1855 dieses gewaltige Naturschauspiel zum ersten Mal sah… Sagenhaft!
Zu meiner grossen Freude gibt es viele Lookouts, von wo aus man einen Blick auf die tosenden Fälle werfen kann, zumindest stückweise. Die Gischt verhindert oft die Sicht. Ohne Pelerine wird man durch und durch nass. Aber bei der Hitze ist das ganz angenehm.
Eindrücklich ist es auch, an der Abbruch-Kante zu stehen und zu sehen, wie der Fluss, der langsam und ruhig durch die Ebene fliesst, urplötzlich mit wildem Getöse in den Abgrund stürzt.
Wir haben noch ein Filet im Tiefkühler, das muss heute gegessen werden. Weil wir nur das harte Feuerholz haben, das so lange braucht, bis eine Glut entsteht, hat Ken die Idee, dem Chef im Restaurant den Fleischzubereitungs-Job zu übertragen. In der Schweiz würde sein Vorhaben wohl eher nicht von Erfolg gekrönt sein, hier aber schon. Er erhält fast immer, was er will. So geht er gleich selber in die Küche und gibt Anweisungen, wie das Fleisch zu braten sei. Und er erklärt dem Koch zudem, was falsch gelaufen sei bei der Suppe, die dieser am Vorabend serviert habe. Da gehöre weder Butter noch Milch hinein. Er macht sich gleich selber an den Kochtopf und würzt nach seinem Gutdünken. Man lässt ihn gewähren und alles wird so serviert, wie er es wünscht. Die Suppe ist ziemlich „hot“, das Filet 1A. - Nummer zehn oder elf?
Immer wieder lustig finden wir, wie der Kellner dann kommt, um uns unsere Bestellungen unterschreiben zu lassen. Zwei grosse Bücher bringt er an den Tisch, eines fürs Getränk, das andere fürs Essen. Die dunkelblauen Kopierfolien (drei Durchschläge), mit denen wir uns ebenfalls bis in die Achtzigerjahre herumschlagen mussten, werden hier noch immer gebraucht; Kopierer hat’s keine - auch keine Waschmaschine, Waschservice aber schon. Das fanden wir allerdings erst heraus, als Ken sein iPhone verloren hatte. Er suchte es überall und dachte, es könnte vielleicht in einer Hosentasche gewesen und in der Waschmaschinentrommel stecken geblieben sein. Lucy, die Verantwortliche für die Wäsche, habe aber gelacht und gesagt, das sei unmöglich – sie selber sei die Waschmaschine…
Ken hat sein iPhone dann wieder gefunden. Vor dem Zelt lag’s im Busch; es muss ihm aus der Hemdtasche gerutscht sein beim Feuerholzsammeln.
Mittwoch, 8. August 18
Unsere erste „Tätigkeit“ heute beginnt um vier Uhr nachmittags. Wir haben eine Fahrt mit dem Nostalgiezug „Royal Livingston Express“ gebucht. Die kurze Reise führt auf die berühmte Brücke, von wo aus man auf der einen Seite einen einmaligen Blick auf die Fälle hat, auf der anderen in die Schlucht sieht, in welche die gewaltigen Wassermassen des Zambezi hinunterstürzen und anschliessend ihren Weg weiter landeinwärts gegraben haben. Der höchste Bungee-Jump der Welt wird von der Mitte der 125 Meter hohen Brücke aus angeboten, über dem „Boiling Pot“. 111 Meter weit geht’s am Gummiseil in die Tiefe. – Nicht mein Ding.
Der Zug tuckert gemächlich dahin. Wein und kleine, feine Apérohäppchen werden serviert, gediegen, gediegen. - Es kommt bald noch besser, andere Köstlichkeiten sind später ebenfalls im stolzen Preis inbegriffen.
An der Stirnseite des Zugs hat’s einen offenen Wagen; die Lok ist hinten. Von da aus hat man eine schöne Aussicht auf den Busch, durch den wir fahren. Der Fahrtwind ist willkommen in der Hitze, die auch heute wieder herrscht. Im Abteil drin hat’s eine Klimaanlage, die zur Nostalgie zwar nicht ganz passt, aber dennoch angenehm ist.
Grad richtig zum Sonnenuntergang hält der Zug mitten auf der Brücke an, wo die Grenze zwischen Zimbabwe und Zambia durchführt. Da gibt’s massenhaft zu fotografieren, viele Händler bieten ihre Waren an, bestürmen die Touristen, Souvenirs zu kaufen. Ein reger Verkehr herrscht auch sonst, die Brücke ist ebenfalls für Fussgänger, Velos und Autos begeh- beziehungsweise befahrbar. Der Zug hält für zwanzig Minuten; wir dürfen aussteigen und zu unserem grossen Erstaunen treffen wir dort genau zu diesem Zeitpunkt das junge Paar aus England, das bei unserem Insel-Übernachtungs-Ausflug dabei war. Die beiden sind mit ihren Fahrrädern unterwegs. Es ist kaum zu glauben, was für eine Reise sie bereits hinter sich und auch noch vor sich haben (von Tanzania bis Namibia). Stundenlang über diese mühsamen Strassen radeln… All die Lastwagen…
Erst jetzt bemerken wir, dass nicht nur weisse Touristen im Zug mitreisen. In einem Wagen weiter hinten steigen eine ganze Menge Schwarze aus – eher seltsam, diese Zweiteilung.
Wie die Sonne untergegangen ist und die tausend Fotos im Kasten sind, fährt der Zug wieder zurück Richtung Livingstone. Auf der Höhe des „Royal Livingstone Hotel“ hält er an und aus dessen Küche wird uns ein feines 5-gängiges Gourmet-Menu serviert. Man kommt sich vor wie in der Kolonialzeit, in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts, die Kellner sind livriert, die Tische im Speisewagen hübsch gedeckt, eine Ambience vom Feinsten. – So hatte es sich Cecil Rhodes vorgestellt, als er die Brücke bauen liess. Er starb aber, bevor sie fertig gestellt war, und er hat auch die Fälle nie gesehen.
Um neun Uhr werden wir zurückgefahren in unsere Zelte in der Maramba River Lodge. – Ein schönes Erlebnis war das, absolut empfehlenswert!
Donnerstag, 9. August 18
Früh geht’s los, Ken macht sich jetzt schon Sorgen wegen des Grenzübertritts. Es ist zwar nur eine kurze Strecke, die wir heute zurücklegen müssen, etwa 70 Kilometer. Unser Ziel ist Kasane in Botswana, gleich nach der Grenze. Er beschreibt uns, wie es vor sich gehe: Ausreise und Zoll in Kazungula, dann würden wir über den Zambezi mit der Fähre übersetzen und drüben wieder die Einreiseformalitäten über uns ergehen lassen müssen.
Es wird gute vier Stunden dauern, bis das alles erledigt ist, und das nicht, weil die Strassen schlecht sind. – So weit sind wir aber noch gar nicht. Auf der ganzen Reise hat’s immer wieder mal Roadblocks, an denen man anhalten und der Verkehrspolizei irgendwelche Papiere zeigen muss. Ken weiss von den meisten, wo sie sich befinden. Dieses Wissen bringt allerdings nicht viel, denn Umwege gibt es kaum. Bisher hatten wir fast immer Glück und wurden selten aufgehalten, manchmal durchgewinkt, manchmal sah man die Ordnungshüter im Schatten sitzen und schlafen, die Barriere offen.
Nicht so heute: Kaum aus Livingstone raus, schon steht da eine Dame in Uniform, die ihren Auftrag sehr ernst nimmt. Sie will die Versicherungspapiere sehen. Mit denen, die Ken ihr zeigt, ist sie nicht zufrieden. Die Registrierungsnummer stimmt nicht. Eva kann aber anhand eines Emails ihrer Versicherung belegen, dass alles vorschriftsgemäss bezahlt ist. Das genügte der Beamtin aber nicht und sie weist uns an, ihr auf den Polizeiposten zu folgen. Das hiess: wieder zurück nach Livingstone – ihr Kollege steht schon bereit im Polizeiauto, dem wir nun folgen müssen.
Ich bewundere Eva. Sie ist die Ruhe selbst, lässt sich nicht aus dem Konzept bringen, zeigt keinerlei Nervosität. Ken sagt auch nicht viel, aber dass er innerlich kocht, ist völlig klar.
Theo und ich, wir warten im Auto, lesen ein wenig und harren der Dinge, die da kommen werden. Wie viel kostet’s wohl diesmal? - Es dauerte mehr als eine Stunde, bis Eva und Ken aus dem Büro herauskommen. Passiert war Folgendes: Eva hatte inzwischen ihre Versicherungsgesellschaft angerufen und gebeten, dass jemand eine Mail mit dem heutigen Datum schicken würde mit der Bestätigung, dass die Versicherung bezahlt worden sei. Das ging blitzschnell, aber die Polizistin war noch nicht zufrieden. Sie wollte ein Datum sehen, wann die Versicherung auslaufen würde, ein Dokument also, welches das belegt. – Genau das gibt es aber nicht, weil die Versicherung gar kein Ablaufdatum hat. Eva rief erneut bei der Versicherung an und die Dame am andern Ende sprach direkt mit der zambischen Ordnungshüterin und erklärte ihr das. – Daraufhin kam dieser etwas Neues in den Sinn: Sie wolle noch eine Bestätigung haben, dass Schäden an Personen gedeckt seien. Das sei inbegriffen und ebenfalls gedeckt, erklärte Eva, dafür gäbe es kein spezielles Formular. Drei weitere Telefonate mit der Versicherung wurden organisiert, aber auch die nützten nichts. - Es gäbe ein Gesetz aus dem Jahr 2002, das besage, sie müsse sich ein solches Formular zeigen lassen. Worauf Ken offenbar fragte, ob dieses Gesetz ein Auslaufdatum habe. Die Beamtin merkte die Ironie nicht und sagte, es gäbe keines… Nun sei es eben so, dass er halt die Busse bezahlen und sich schuldig bekennen müsse. Es blieb ihm nichts anderes übrig. Dollars nähmen sie nicht, er müsse Geld wechseln gehen, den Pass bei ihr lassen. Das ging ihm aber zu weit und er liess sie unmissverständlich wissen, das komme überhaupt nicht in Frage – sicher nicht in Afrika! Da wenigstens lenkte sie ein. Wieder fahren wir dem Polizeiauto hinterher zur Wechselstube. 450 Kwetchas, umgerechnet etwa 50 Dollar, wechseln den Besitzer, also halb so viel Bestechungsgeld wie beim letzten Mal. Und Ken muss unterschreiben, dass er sich eines Vergehens schuldig gemacht habe. „I’m now officially a criminal“, sagt er, wie er wieder ins Auto steigt.
Diesmal erhält er ein sehr offiziell aussehendes Dokument mit Stempel und auch Unterschrift eines Zeugen. – Sehr beeindruckend.
Wir fahren erneut in Richtung Grenze. Der Roadblock ist geöffnet, niemand ist mehr dort – sie haben ihr Geschäft für heute im Kasten, können sich der Siesta hingeben.
Pikantes Detail noch: Kurz nach der Barriere ist am Strassenrand ein grosses Plakat angebracht, auf dem steht, dass alle mithelfen sollten, gegen Korruption vorzugehen und melden sollten, wenn Unregelmässigkeiten dieser Art vorgefallen sein sollten… Wir wissen jetzt, wo’s einen Polizeiposten hat; vielleicht könnten wir uns ja dort beschweren.
Am Grenzposten auf der Zam-Seite ist sehr viel los. Es ist heiss, 35 Grad. Dutzende von Lastwagen stehen herum, Leute überall, es ist ein Kommen und Gehen. Trotzdem dauert’s fast nur eine halbe Stunde, bis wir unsere Stempel im Pass haben und gehen können. Wie jedes Mal geht’s aber länger bei der Zolldeklaration fürs Auto. Eine lange Schlange von Fahrern steht vor dem Schalter und wartet, bis die Beamtin Buchstabe für Buchstabe vom Dokument in ihr Buch übertragen hat. Sie muss halt zwischendurch immer wieder ihr Phone checken. Und bis der Beamte gefunden wird, der das Tor öffnet, geht eine weitere Viertelstunde vorbei. Aber dann sind wir durch und da ist auch gleich eine Fähre, auf der’s hinter zwei Lastwagen noch grad Platz hat für den Land Rover. Wir sind froh, dass wir hier überhaupt nicht warten müssen. Während der kurzen Überfahrt dürfen wir nicht im Auto bleiben.
Eine Brücke wird gebaut über den Zambezi. Wenn die in ein bis zwei Jahren fertiggestellt ist, werden manche Leute froh sein, stelle ich mir vor.
Die Zollformalitäten auf der Botswana-Seite sind relativ rasch erledigt. Das Visum ist ja noch gültig. Nur einen letzten Posten müssen wir überstehen, dann ist alles, was verlangt wird, erledigt. Ken muss bestätigen, dass wir keine Lebensmittel an Bord haben, was grösstenteils tatsächlich stimmt. Auch hier hätten sie uns schikanieren können, aber zum Glück bleiben wir verschont. Einzig einen kurzen Spaziergang müssen wir unternehmen zu einem ungefähr 1 m2 grossen, niedrigen Becken, das in den Boden eingelassen ist. Dort liegt ein schmutziger, nasser Teppich drin, getränkt mit irgendwelchen Chemikalien. Auf den müssen wir in unseren Schuhen draufstehen, dann können wir gehen. Schutz gegen Maul- und Klauenseuche heisst es. – Und unsere anderen Schuhe im Auto?
Aber wir sind durch und alles ist wunderbar. Die Lodge ist nicht mal zehn Kilometer von der Grenze entfernt; das ist praktisch. Wir haben ein sehr luxuriöses Chalet, so kommt es uns wenigstens vor – mit TV, Kühlschrank, Klimaanlage und sogar einem Fön (den ich hier sicher nicht brauchen werde). Vor Hippos und Croks braucht man sich nicht zu fürchten, für einmal ist unsere Unterkunft nicht am Wasser gelegen. Dafür hat’s Mungos, die wie vom Teufel gehetzt durch den Garten rasen. Es sind mindestens fünfzig Tiere - putzig sehen sie aus.
Theo und ich, wir verbringen den Nachmittag am Swimmingpool und wundern uns, weshalb Eva nicht auch kommt. – Ken hatte nach unserer Ankunft den Wagen in den Schatten manövriert und musste feststellen, dass schon wieder etwas nicht stimmt. Diesmal mit der Hydraulik – das Chassis berührt fast die Reifen. So fuhren er und Eva in die nächste Garage nach Kasane, wo man allerdings im Moment auch keinen Rat wusste. Ein Diagnostikgerät besitzen sie nicht in der kleinen afrikanischen Werkstatt, die ich mir übrigens vorstelle wie diejenige von Mr. J. L. B. Matekoni’s „Tlokweng Road Speedy Motors“ in McCall Smith’s „Nr. 1 Ladies‘ Detective Agency“.
Morgen werden wir weitersehen. (Solange nicht Charlie Hand anlegt…).
Das Nachtessen ist nicht besonders fein, Theo versucht’s wiedermal mit Spaghetti (eine Kinderportion diesmal), Eva bestellt Fisch (kaum was dran ausser Gräten), ich ein chinesisches Gericht (wo sind die chinesischen Gewürze geblieben?), Ken bestellt ein Rumpsteak, 300 Gramm, will es dann gewogen haben, wie es schliesslich kommt. Auch ohne Waage ist klar, dass nicht viel mehr als 150 Gramm auf dem Teller sind. Und ein Rumpsteak sei es auch nicht, davon ist er überzeugt. Genau so würden sie es hier machen, die Hälfte abschneiden und selber essen, regt er sich auf. Auf die Zucchetti, die dazu serviert werden, sei er allergisch, lässt er den ratlose Kellner wissen, er müsse mehr Fleisch bringen, so gehe das überhaupt nicht. Ein weiteres Stück Fleisch wird gebracht, aber auch das sei kein Rumpsteak, ärgert er sich. Die Sache mit dem Auto schlägt ihm aufs Gemüt und die Sache mit dem Fleisch macht die Situation auch nicht besser.
Theo erklärt nach italienischer Manier etwas Dramatisches, fuchtelt mit den Händen herum und schlägt mein Weinglas um. – Ein sehr gemütlicher Abend. – Morgen ist ein neuer Tag.
Freitag, 10. August 18
Ken ist sehr wortkarg heute Morgen, die Angelegenheit mit dem Auto liegt ihm auf dem Magen. Er fährt dann nochmals nach Kasane, wo man soweit helfen konnte, dass ein Diagnosegerät bestellt wurde, das morgen ankommen soll. Erst wenn das Problem erkannt ist, kann man damit beginnen, etwas zu unternehmen. – Er ruft von der „Garage“ aus an. Er muss aufhängen – da kommt grad ein Elefant daher, alle sind in grosser Aufregung, das Tier soll erschossen werden (später erfahren wir, dass der Eindringling hatte vertrieben werden können).
Sehr speziell ist aber, dass Ken auch meldet, das Auto habe wieder ganz normal reagiert und auch der Computer habe nichts Besonderes angezeigt. - Eva denkt, der Land Rover habe eine Seele für sich selbst…
So heisst es also abwarten. – Am Nachmittag gehen wir auf eine dreistündige Bootsfahrt auf dem Chobe-River. Erst bin ich ein wenig erstaunt, dass es da sooo viel Touristen hat. Dutzende von Booten, kleinere und grössere mit Hunderten von Menschen an Bord, kreisen auf dem weitverzweigten Fluss im Chobe-Nationalpark herum. Bald merke ich: Es ist kein Wunder, dass dieser Park so begehrt ist. Es hat eine Unmenge an Tieren, die man hier beobachten und fotografieren kann. Sie alle sind an die Schiffe gewohnt; sie scheinen sie überhaupt nicht zu beachten. So kann das Boot auch in nächster Nähe „parkieren“, ohne dass ein Tier flüchtet oder auch nur hinschaut. Bis auf fünf Meter Distanz an ein Krokodil heranzufahren und es quasi auf Augenhöhe abzulichten – das macht mir fast ein wenig Angst, denn so träge wie sie scheinen, so schnell können die Biester sein.
Mehrere Elefanten- und Büffelherden sehen wir, Kudu- und Impala-Familien am Grasen und Wassertrinken, Giraffen ebenso. Für die ist es ein schwieriges Unterfangen, sich bis zur Wasseroberfläche zu beugen. Ihre unbedarften Grätschen sehen sehr komisch aus. Irgendwas ist da wohl ziemlich schiefgelaufen beim Designen der Art. - Affen, die miteinander spielen und streiten und Vögel, die sich durch nichts stören lassen, können wir ebenfalls gemächlich beobachten.
Es ist eine wunderbare Sunset-Bootsfahrt, und ja, gegen sechs wiederholt sich einmal mehr das prächtige Schauspiel des Sonnenuntergangs mit der farbigen Licht-Leiter auf den Wellen des Chobe.
Ob beim Nachtessen ein anderer Koch am Werk war oder ob Kens Beschwerde beim Manager geholfen hat – heute Abend sind alle zufrieden mit dem, was sie bestellt haben. Kens Rumpsteak ist ein Rumpsteak und die 300 Gramm sieht man ihm an; Evas ¼ Huhn ist ebenfalls schmackhaft und so sind Theos Sirloin Steak, seine Spaghetti und mein Fisch (ohne Gräten).
Samstag, 11. August 18
Eva, Theo und ich frühstücken gemeinsam; Ken ist schon früher mit dem Auto nach Kasane in die Werkstatt gefahren. – Die Vermutung liegt nahe, dass es dem Land Rover stinkt, immer so viel Last zu befördern und er daher streikt. Ist alles Gepäck raus und wir Passagiere ebenfalls, pumpt sich die Hydraulik brav wieder auf. Bisher ist ja alles gut gegangen, vielleicht liegt das Problem darin, dass wir zu viele Filets gegessen haben in letzter Zeit, die Grenze, was er an Ballast ertragen kann, überschritten ist und wir so seine Geduld strapaziert haben. Grad wie bei einem Esel, stelle ich mir das vor; der soll ja auch seine Schmerzgrenze haben und sich dann strikte weigern weiterzugehen.
Ken ist zurück und wir beraten, was zu tun ist. Ein Auto mieten ist eine Option, Gweta sein lassen und nach Maun fliegen eine andere – wir warten vorerst mal ab.
Der Rover macht heute Morgen einen aufgestellten (!) Eindruck, also findet Ken, wir könnten gut zusammen eine Pirschfahrt in den Park unternehmen, unser ganzes Gepäck ist ja nicht im Auto.
Das geht mehr als eine Stunde lang gut, der Land Rover kämpft sich über holprige Pfade mit riesigen Löchern, durch Sandpisten vorbei an Herden von Impalas, zum Ufer des Chobe. Wir sehen wieder Krokodile, Flusspferde, Wasser- und andere Vögel, Warzenschweine, Giraffen, Kudus und Buschböcke - da verleidet es unserem Vehikel erneut. Wir hören ein Zischen, das Chassis senkt sich, die Hydraulik gibt auf. – Kein guter Ort zum Aussteigen. Schliesslich gibt’s Löwen und Leoparden im Park, auch wenn wir die noch nicht gesehen haben. Ebenso wenig sind die Elefanten hier Zootiere. – Aber es bleibt uns nichts anderes übrig, als mal auszusteigen. Eva denkt, wenn wir drei draussen sind (gut 200 kg weniger) und nur noch der Fahrer drinnen, erholt sich das eigensinnige Gefährt vielleicht wieder.
Das tut es aber nicht. Ein paar Safarifahrzeuge fahren an uns vorbei. Einer hat Erbarmen mit uns und nimmt uns drei mit zum Parkeingang. Ken versucht, alleine weiterzufahren. Erst sehen wir ihn noch hinter uns in der Ferne, dann aber nicht mehr. Am Gate warten wir und etwa eine halbe Stunde später hat auch er’s geschafft. Die Räder hatten sich tief in den Sand vergraben und alleine hatte er keine Chance rauszukommen. Zum Glück hat ihm schliesslich jemand geholfen, sich und sein Fahrzeug aus der misslichen Lage zu befreien.
Wir steigen wieder ein und ganz langsam geht’s auf der Teerstrasse zurück zur Lodge.
Ken will unbedingt, dass wir unsere Reise so wie geplant weiterführen können. Er hat für uns einen Driver organisiert, der uns morgen nach Gweta, zu unserer nächsten Lodge fahren wird. – Wir hätten gern auch warten können, bis das Auto geflickt ist, aber das will er nicht. Er war ja schon oft dort, kennt die Gegend bestens und will auf keinen Fall, dass wir etwas verpassen.
Sonntag, 12. August 18
Nach dem Frühstück und herzlicher Verabschiedung fahren wir um neun Uhr los. Eva und Ken sollen nachkommen, sobald ihr Gefährt wieder instand gestellt ist, eventuell morgen oder übermorgen.
Zwei Fahrer sind gekommen. Sie sind beide Mechaniker und arbeiten in der Werkstatt, wo der Land Rover jetzt steht. - Charlie und Fanwell? – Sie heissen Kabelo und Fikile. Im Toyota ihres Chefs fahren wir los. Kabelo, der Fahrer, ist ein kleiner dünner junger Mann mit ganz spitzigen Knien, den ich etwa 15-jährig schätze. Später erfahre ich, dass ich mich arg getäuscht habe. Sein Fahrausweis beweist, dass er 1992 geboren wurde.
Bevor wir uns auf den Weg machen, gibt’s einen Abstecher in die Werkstatt. Wir haben ein paar Sachen im Land Rover, die wir mitnehmen möchten und ich würde mir die Garage gerne ansehen.
Dort steht er, total staubig und dreckig. Ein Rad ist weg, man sieht teilweise in sein Inneres. – Ob dieser Wagen irgendwann wieder fahrtüchtig sein wird – ich bezweifle es stark. Wir werden ja sehen.
Die Strecke bis Nata ist 300 km lang und schnurgerade. Nur ein einziges Mal gibt’s eine Kurve. Das ist so aussergewöhnlich, dass die beiden uns darauf aufmerksam machen. Sie halten auch ein paarmal an, wenn sie Elefanten oder Giraffen sehen, damit wir ein Foto machen können.
Kabelo fährt schnell. 150 sehe ich mal auf dem Tacho. Gut 100 hat er drauf, wie eine Radarkontrolle hinter einem Baum auftaucht. Glücklicherweise haben die Polizisten schon zwei Autos angehalten, sie haben keine Kapazitäten mehr für uns; sie winken uns durch.
Weiter geht’s wie der Blitz, die beiden möchten die Strecke in mindestens fünf Stunden schaffen. Die erste Stunde fahren wir auf einer gut ausgebauten Strasse durch den Busch entlang eines Nationalparks, dann gibt’s eine lange landwirtschaftliche Zone, wo sich eine Farm an die andere reiht. Es sind riesige Ländereien, die Furchen in den Feldern ziehen sich gerade hin bis an den Horizont. Mais wird angebaut und etwas Grünes; ich werde dann Ken fragen müssen, was das ist. Siedlungen sieht man so gut wie keine, obwohl ein paar Landarbeiter auf den Feldern sind. Auch das hohe Gras wird hier geschnitten zum Bau von Dächern, grad so wie wir es im Matopo-Nationalpark gesehen haben. Die Leute, die diese Arbeit betreiben, wohnen in farbigen Zelten entlang der Hauptstrasse.
In Nata, nach vier Stunden Fahrt, fragen wir die beiden Jungs, ob sie mal anhalten und etwas essen oder trinken möchten. „I’m still fresh“, antwortet Kabelo. Uns ist es recht; wir sind froh, wenn wir endlich am Ziel sind, denn es ist sehr heiss im Auto und die Chance, in diesem Ort ein Restaurant zu finden, das uns passt, sehr gering. Jetzt gibt‘s zum ersten Mal eine Abzweigung nach rechts. Gweta 99 Kilometer. Das können wir wohl in einer knappen Stunde schaffen, denke ich. Dann aber ist die Strasse voller Schlaglöcher, und das nicht zu knapp. Die meisten umfährt Kabelo ganz geschickt, aber sehr schnell kommen wir doch nicht mehr voran. – Trotzdem, um Viertel nach zwei kommen wir in der Gweta Lodge an.
Hier gibt’s endlich was zu essen für uns alle vier und dann verabschieden wir uns. Bevor die beiden gehen, wollen sie noch ein Foto machen von sich mit uns. – Lustig finde ich das immer. - Mir tut es unendlich leid, dass sie nun genau diese lange Strecke, 408 km, wieder zurück nach Kasane fahren müssen. Es wird Nacht sein, bis sie ankommen. Fikile meint, es sei nicht so schlimm, sie würden jetzt viel schneller fahren können, 180 km/h denke er. – Ich weiss darauf nichts zu sagen.
Eine so hübsche Lodge zu finden „in the middle of nowhere“, hätte ich nicht gedacht. Es ist die einzige Unterkunft weit und breit (ausser dem „Planet Baobab“, vor dem uns Ken gewarnt hat – vorausgesetzt wir seien nicht an Drogen interessiert). - Auch diesmal „hippolos“; Affen hat’s ausnahmsweise ebenfalls keine.
Hierhin kommt man nicht wegen der „Big Five“, sondern wegen der Meerkats, den Erdmännchen, den Baobab-„Wäldern“ und der Salt-Pans. – Morgen oder übermorgen werden wir Ausflüge dorthin buchen.
Die Lodge ist ausgebucht, etwa vierzig Leute sind beim Nachtessen dabei; es gibt Buffet mit Braai, Rindsfilet wieder mal, dazu feine Salate, Reis, Lasagne, selbst gebackenes Brot und wie immer und überall Nzima oder Pap, wie die Beilage hier heisst (eine weisse Paste aus fein geriebenem Mais).
Der Sternenhimmel ist überwältigend; es hat keinerlei Lichteinfluss von irgendwoher aus der Gegend.
Montag, 13. August 18
Schon früh erwache ich und denke, ich sei auf einem Bauernhof. Ein Hahn kräht, ich höre Kühe muhen, Esel wiehern und Ziegenglocken bimmeln.
Der Strom ist ausgefallen, das Frühstück wird trotzdem serviert, Holz und Gas funktionieren allemal.
Um halb drei beginnt unser Ausflug. In drei Safarifahrzeugen sind wir unterwegs. Lesh, unser Guide, prescht durch den Busch, was das Zeug hält. Auf einem Rodeo-Pferd könnt’s kaum stürmischer schütteln. Es hat Pfade, die verlässt er aber nur allzu gern; wir müssen uns festhalten und den Dornbüschen ausweichen, an denen wir vorbeipfeilen. Die Gegend sieht aus wie ein lichter Herbstwald. Auf dem sandigen Boden (Kalahari sandveld) liegen braune welke Blätter. Dann hat’s plötzlich keine Bäume mehr, nur noch das dürre goldgelbe Gras. Vereinzelt grasen Kühe und Ziegen, ein paar Esel und Pferde ebenfalls.
Bei einem Termitenhügel hält Lesh an und erklärt, wie der Bau funktioniert. Millionen von Termiten hausen in einem solchen Hügel. Die Königin ist streng bewacht und soll 30 Tausend Eier pro Tag legen. Eine Frage kommt: „Schläft die je? – Falls nicht, legt sie alle drei Sekunden ein Ei“, rechnet einer unserer Mitreisenden aus.
Der nächste Halt ist bei einem alleinstehenden riesigen Baobab-Baum, der etwa 1‘500 Jahre alt ist. Seine Ausmasse sind gewaltig; wir kommen uns vor wie Ameisen.
Und weiter geht die wilde Jagd. Wir erreichen eine weite Ebene. Nur wenige niedrige Grasbüschel wachsen auf dem Sand. Hier gibt’s etliche Erdmännchen-Kolonien. Aber die zu finden…
Dafür ist aber gesorgt. Die Lodge hat einen jungen Mann angestellt, der jeden Tag den Auftrag hat, die Safarifahrzeuge an den richtigen Ort zu leiten. Er winkt von weitem, steigt in unser Geführt ein und führt uns mitten in der Ebene dorthin, wo die putzigen Tierchen heute anzutreffen sind. Ein, zwei sehen wir auf wilder Flucht in riesigen Sprüngen davonrasen und ich denke schon, das wird schwierig werden, die zu fotografieren. Sie sind auch relativ klein. Dann aber schaltet Lesh den Motor aus und wir können aussteigen. Wir werden angewiesen, einen Kreis zu bilden und ruhig zu sein. Und siehe da: Schon strecken einige Vorwitzige den Kopf aus ihren Höhlen hervor und schauen sich um. Und dann kommt eines ums andere hervor, es ist kaum zu glauben. Sie scheinen keine Angst zu haben. In gewohnter Manier stehen sie auf ihre Hinterbeine, die „Arme“ lustig vor dem Bauch gefaltet oder verschränkt und wie Späher drehen sie sich ruckartig in alle Richtungen. - So unglaublich drollig, die Kleinen. Wir alle können kaum aufhören zu fotografieren. Wir sollen ruhig ein wenig näher treten, sagen die Guides, die Meerkats würden den Ort nicht verlassen. Sie sind offenbar an den jungen Mann gewöhnt, der sie jeweils sucht, und daher sind sie nun ganz zutraulich. Und nicht nur das - sie scheinen genauso neugierig an uns interessiert zu sein wie wir an ihnen. – Das ist ein absolut schönes Erlebnis, besser noch als eine Elefantenherde zu beobachten. Wir können uns kaum losreissen von diesem Ort, aber jetzt geht’s weiter zum oder besser gesagt auf den Salzsee, die Ntwetwe Pan. Es gibt drei solcher Seen beziehungsweise „Pfannen“ in dieser Gegend, dem Makgadikgadi Nationalpark; zusammen sind sie so gross wie die ganze Schweiz. – „kgadi“ heisst übrigens „trocken“ – „kgadikgadi“ sehr trocken oder doppelt trocken und „ma“ ist der Verstärker = wahnsinnig trocken.
Schon von weitem sieht man die weisse Ebene und mit den Autos fahren wir ein paar hundert Meter in den „See“ hinein, wo nun wirklich nicht ein einziges Kräutchen wächst. Dort steigen wieder alle aus und das ist die nächste Fotogelegenheit. Die Schatten sind inzwischen länger geworden – das sieht gut aus durch die Linse. Lesh und seine beiden Kollegen stellen einen Tisch auf, nun gibt’s Apéro, eben den „Sundowner“.
Wir schauen der Sonne zu, wie sie untergeht – ein herrlicher Blick bietet sich einmal mehr. Um vier Minuten nach sechs ist sie hinter dem Busch am Horizont verschwunden und wir treten die Rückreise an. Es wird bald kühler und ein Wind beginnt zu blasen. – Noch wilder als vorher scheint mir die Fahrt zurück durch den Busch zu sein. Wie in einem Schüttelbecher. Und sie hört nicht auf. Kreuz und quer jagt Lesh den Toyota durch die Steppe, ich hab schon längst die Orientierung verloren. Dass das Gefährt nicht zusammenbricht, ist kaum zu glauben. Es rattert und scheppert, dass man das eigene Wort nicht versteht. – Und wo sind die Stossdämpfer? - Nach einer halben Stunde finde ich, es genüge allmählich, es wird langsam ungemütlich, denn es ist bereits dunkel und die Scheinwerfer des Toyota sind nicht sehr lichtstark. Lesh rast durch die Gegend, ich muss mich festhalten wie auf einem wilden Pferd. Wie er den Weg durch diese Gegend, die immer ähnlich aussieht und wo’s keine Wegweiser hat, findet, ist mir das grösste Rätsel. Er sagt, er sei hier aufgewachsen, also kenne er jedes Grasbüschel und jeden Dornenstrauch…
Nach einer Stunde Fahrt denke ich noch immer, eigentlich hätte ich genug, aber es dauert eine weitere halbe Stunde, bis wir ein paar Lichter sehen, die zur Lodge gehören.
Auch die beiden anderen Fahrer sind gleich weit. Jeder hat eine andere Route gewählt, sie fahren nicht hintereinanderher, und schliesslich kommen doch alle so gut wie gleichzeitig an.
Gerädert, steif, ziemlich kalt, völlig sandgestrahlt und mit Haaren, die sich anfühlen wie Stroh, steigen wir vom Fahrzeug. - Die Dusche macht dann manches wieder gut und das feine Nachtessen ebenfalls.
Dienstag, 14. August 18
Eva schreibt ganz früh am Morgen, der Land Rover sei geflickt, sie seien auf dem Weg zu uns. – Ich kann’s kaum glauben. – Darüber freuen wir uns sehr.
Nach dem Frühstück um neun nimmt Lesh uns beide mit auf einen Spaziergang durchs Dorf. Als wir vorgestern ankamen, hatte ich den Eindruck, der Ort sei ziemlich klein, dem ist aber überhaupt nicht so. Etwas mehr als 7‘000 Menschen wohnen in Gweta; sie leben hauptsächlich von der Viehzucht. Die Siedlung ist weit verstreut, der grösste Teil der Behausungen besteht aus Lehmhütten und neben der Hauptstrasse, die geteert ist, geht man wie auf einem grossen Sandstrand. Nur das Meer fehlt.
Erst geht’s aufs Postamt, wo Theo Marken kaufen will. Da ist ziemlich was los, offenbar ist man mit der Welt verbunden. Es hat ein paar Sitzgelegenheiten vor dem Schalter. Dort setzt man sich hin und wartet, bis man an der Reihe ist. „That’s the procedure“, sagt Lesh.
Anschliessend zeigt er uns die Bibliothek. Dieser Bau ist ganz neu und könnte auch in einem Dorf bei uns stehen. Von der Regierung gesponsert. In einem Nebenzimmer wird eine Kindergartenklasse unterrichtet. Sie singen und sind dabei vollkommen bei der Sache.
In einer einfachen Lehmhütte ist der Frisör-Shop untergebracht. Man kann ihn nicht verfehlen, an der Wand draussen steht geschrieben: „Larona Haircut Salon“. Wer das angeschrieben hat, hat nicht sehr gut geplant, die Mauer ist zu kurz für den Schriftzug. Zudem ging dem Künstler offensichtlich mitten während der Arbeit fast die Farbe aus.
Die beiden Damen, die drin auf Kundschaft warten, freuen sich über unseren Besuch, aber sie sehen natürlich sofort, dass da wohl nichts zu holen ist. Eine übersichtliche Preisliste, die schief an der Wand hängt, gibt Auskunft über all die möglichen Frisuren, die man sich machen lassen kann und was die kosten. So erhält man beispielsweise einen „Fishtail-Cut“ für 30 Pula, also umgerechnet drei Franken. Gleich teuer kommt „Iron Hair“, „Pineapple“ ist dann schon mehr als das Doppelte wert, nämlich 75 Pula.
Der nächste Besuch gilt der Primarschule. 650 Schüler werden dort unterrichtet, eine recht grosse Anlage. Die Vorsteherin führt uns gern herum und beklagt, dass es an allem fehle, an Kopierern, Druckern, aber auch an ganz normalem Schulmaterial wie Büchern und Heften.
Sie erinnert mich an Mma Makuzi, die Partnerin von Mma Ramotzwe, vor allem wenn sie die Brille mit den grossen Gläsern trägt.
Unsere bescheidene Spende wird verdankt und in einem Heft notiert. Anschliessend besuchen wir eine Klasse von Erstklässlern. Auch sie singen uns was vor und rezitieren voller Eifer englische Kinderreime. Sieben Unterrichtsfächer gibt’s. Nebst ihrer eignen Sprache wird Englisch gelehrt, Motorik wird geübt, Zeichnen, Hygiene und soziales Zusammenleben. Fünfzehn Mädchen sind in der Klasse und fünfzehn Jungen. Sie sind kaum zu unterscheiden in ihren Uniformen und mit ihren gleichen kurzgeschnittenen Frisuren. Sie sind voller Energie, aber folgen der Lehrerin aufs Wort.
Lesh führt uns anschliessend zu einer Frau, die Körbe und Untersätze bastelt. Sie sitzt in einer völlig verwahrlosten Behausung am Boden, vor sich ein Feuer, auf dem ein Topf mit einem merkwürdigen brauen Brei brodelt, in dem sie von Zeit zu Zeit herumrührt. Neben ihr sitzt ihre 88-jährige Mutter, ebenfalls am Boden. Die Tochter, die unter starken Rückenschmerzen leidet, zeigt uns, wie sie arbeitet. Mit einer Art Nadel fügt sie die Palmenfasern, die sie teilweise mit einer Mischung aus Wasser und altem Rost schwarz färbt, zusammen und es entsteht Reihe an Reihe ein schönes Muster. Sie ist gleich alt wie ich, erfahren wir…
Die ärmlichen Verhältnisse, in denen die beiden Frauen leben, geben zu denken. Lesh übersetzt: Von den drei Kindern, die die Frau gehabt habe, lebe nur noch eines, so habe sie niemanden wirklich, der für die beiden aufkomme. Wir kaufen ein kleines Körbchen und gehen dann weiter.
Der Wahrsager und Medizinmann ist gleich um die Ecke anzutreffen. Er ist ein sehr interessanter Mann. Sein altes, zerfurchtes Gesicht wirkt sympathisch. Er freut sich über unseren Besuch. Wir dürfen ihn fragen, was wir wollen.
Offenbar kann er Schlangen- und Skorpionbisse mit seinen natürlichen Heilmitteln kurieren. Ich frage ihn, wie denn sie Sterberate seiner Patienten sei - also so hab ich natürlich nicht gefragt, sondern politisch korrekt - ob er immer Erfolg habe mit der Heilung. Diese Frage beantwortet er mit ja.
Die 50 Pula, die Lesh vor ihn auf den Boden in den Sand legt, lockern seine Zunge. Er nimmt vier Holzklötzchen hervor, die er schüttelt und in den Kreis im Sand wirft, den er zuvor mit Wasser befeuchtet hat. Lesh muss alles übersetzen, was er sagt, und dann ist es an ihm, das Hölzli-Programm zu zelebrieren. Er will wissen, ob sein Team (irgendein Ballspiel) morgen gewinnen wird und der Alte sagt, es werde ein sehr hartes Spiel sein, aber sie würden gewinnen.
Der Dorfbesuch sollte eine bis anderthalb Stunden dauern, es ist jetzt schon Mittag, also seit drei Stunden sind wir unterwegs – langsam Zeit, zurück zur Lodge zu gehen und uns ein wenig im Pool abzukühlen.
Inzwischen sind Eva und Ken angekommen. Ohne Probleme. Nicht einmal ein Ersatzteil war nötig gewesen für den Land Rover; an unserem Gewicht ist’s auch nicht gelegen, er war einfach so stark verschmutzt und versandet, dass er sich weigerte weiterzufahren. - Nun also, Kapitel Panne hoffentlich abgeschlossen.
Wir essen zusammen eine Kleinigkeit zu Mittag und um vier haben Theo und ich den „Baobab-Sundowner“ - Ausflug gebucht. Wir sind wieder die einzigen beiden Teilnehmer, was uns natürlich sehr passt und Lesh ist unser Guide. Er mag uns gut, hat grosse Freude, dass wir die McCall – Bücher gelesen haben und erzählt, er selber komme in der Serien-Verfilmung auch vor. So werde ich mir diese Filme nun auch ansehen, wenn wir wieder zu Hause sind. Das hab ich bisher nicht getan, weil ich meine eigenen Vorstellungen, die ich von den Protagonisten habe, nicht verderben wollte.
Im achtsitzigen offenen Safari-Toyota-Cruiser geht die Fahrt wieder los. Theo sitzt diesmal vorne neben Lesh, ich wieder oben wie der Kutscher auf dem Bock und muss höllisch aufpassen, dass mich die Dornenbüsche nicht streifen. Leider gelingt mir das nicht ganz so gut diesmal, ein Ast erwischt mich am Unterarm, es blutet und tut weh. – Jetzt hab ich doch auch endlich etwas zu klagen.
Lesh erzählt, dass er mit einem Freund, einem Engländer, zusammen selber eine Lodge für Camper und Backpacker am Aufbauen sei, und dorthin führt er uns als Erstes. Das Gelände ist gross und alles sieht sehr gut und gepflegt aus. Zwei Baobab-Bäume bieten das gewisse Etwas. Unter einem wunderschönen Strohdach ist bereits eine gemütliche Bar eingerichtet, ein paar Sofas stehen drin und ein Pool-Tisch, ein Swimmingpool ist bereit, zwar noch ohne Wasser, sehr schön gestaltete Toiletten- und Dusch-Anlagen hat’s ebenfalls und sein Freund und dessen Verlobte sind grad dabei, ein Haus einzurichten, in dem Reisende, die ohne Zelt unterwegs sind, allenfalls ein Bett mieten können. – Wir wünschen den jungen Unternehmern, dass alles bestens klappt. Am nächsten Tag sollen sie endlich die Genehmigung bekommen, die Anlage eröffnen zu können.
Wir fahren weiter. Unser Ziel ist die kleine Lichtung vor den grossen Baobab-Bäumen, wo Lesh ein kleines Tischchen (mit Tischtuch!) aufstellt und uns ein feines Apéro zelebriert mit Frühlingsrollen, Chips und dem Getränk, das wir vorher in unserer Lodge ausgewählt haben. Gin Tonic ist’s diesmal. Die Bäume sind absolut phänomenal. Man kommt sich vor wie in einer anderen Welt. Wenn ich drunter stehe, machen sie mir fast Angst; sie haben etwas Magisches an sich. Auch das Wissen, dass sie zwei- bis dreitausend Jahre alt sind, Wurzeln haben, die sich bis zu einem Kilometer weit ausbreiten können, trägt zu diesem besonderen Gefühl wohl bei. Die Rinde ist hart wie Stein. Sie stehen absolut still, kein Zweig bewegt sich, sie sind im Moment ohne Blätter, nur ein paar Vogelnester sind zu sehen.
Den Beginn des Sonnenuntergangs sehen wir durch die Baumkrone hindurch. Wir packen zusammen und auf der Heimreise fahren wir der tiefroten, untergehenden Sonne entgegen.
Zum Nachtessen sind wir wieder zu viert.
Maun (Jump Street Chalets) / Ghanzi (Thakadu Lodge) / Zelda Lodge (Namibia) / AUAS Lodge
Mittwoch, 15. August 18
Nach dem Frühstück wird gepackt und das Auto geladen. So langsam aber sicher wird’s zur Routine.
Die Fahrt heute ist kurz, nur grad 200 km sind es bis Maun. Google sieht dafür 3 Stunden vor. Das ist so, weil nach der Hälfte der Route die Strasse, die bis dahin sehr gut war, auf einer langen Strecke ziemlich schlimme Schlaglöcher aufweist, welche die Reisegeschwindigkeit wesentlich vermindern. Schlangenlinienartig muss ausgewichen werden - neben der Strasse oder auf der falschen Strassenseite fahren, ist oft besser.
Auch sonst ist es eine kurzweilige Reise. Esel auf der Strasse sind stur, es kommt ihnen nicht in den Sinn auszuweichen. Ken sagt, „That is the Botswana stop-street“. Und später gibt’s noch „Zebra-Crossing“. Wirklich lustig anzusehen, wie eine ganze Menge dieser schön gestreiften Tiere die Strasse im Trab oder im Galopp überquert. Auch Pferde finden, sie möchten lieber auf der andern Seite grasen, Kühe und Ziegen ebenso. So muss Ken oft bremsen, um eine Kollision zu vermeiden. - Elefanten sind ebenfalls unterwegs, aber sie bleiben, wo sie sind.
Ganz speziell ist ein Honey-Badger, der über die Strasse pfeilt. Dass es ein solches Tier überhaupt gibt, hab ich bisher gar nicht gewusst. Die deutsche Übersetzung ist Honig-Dachs – nie gehört. Er ist schwarz, knapp einen Meter lang und muss ein ganz besonderer Geselle sein. Ken sagt, den zu sehen, käme höchstens „once in a lifetime“ vor. Der aggressive Räuber habe eine ganz spezielle Haut, die, wenn ein Löwe ihn angreife, dieser den Kürzeren ziehe, weil er ihn gar nicht richtig fassen könne. Auch sei er völlig resistent gegen Schlangenbisse und Bienenstiche, er könne in aller Seelenruhe ein Bienennest ausrauben (daher der Name) – kein Problem. Und wenn er in einen Hühnerstall eindringe, dann töte er alle Hühner, einfach nur, weil er das könne, fressen täte er vielleicht höchstes eines. – Den haben wir also gesehen, aber er war zu schnell, fotografieren ging nicht.
Nach dreistündiger Fahrt kommen wir in Maun an, finden nach kurzem Suchen unsere neue Unterkunft, die Jump Street Lodge. Sie ist am Stadtrand gelegen, weit weg von der Hauptstrasse, also bereits wieder im Busch, ruhig und klein, nur aus ein paar hübschen Häuschen bestehend. Ein offenes Restaurant unter einem Strohdach und ein Mini-Swimmingpool gehören dazu. Affen hat’s keine, aber ein paar Hauskatzen. Und nicht weit weg muss ein Fluss sein, denn die Hippos hört man deutlich.
Fünf Nächte werden wir da verbringen; ich freue mich. Ein rotgestrichenes, rundes Häuschen, den afrikanischen Rondavels nachempfunden, wird uns zugewiesen. Sogar eine kleine Küche gehört dazu und ein winziges Badezimmer. – Hier kann es uns wohl sein.
Und das Beste: Theo hat seinen iPad wieder! – Die Eltern der jungen Frau, welche die Stevensford Game Lodge in Sherwood betreibt, reisten vor einer Woche nach Maun und haben Theos vernachlässigtes und liegengelassenes elektronisches Gadget mitgebracht und abgegeben. So hat er doch immer wieder Glück…
Ken hat sofort ausgekundschaftet, ob eine Braai-Möglichkeit bestehe und ob es Feuerholz habe.
Und ob wir die Küche in der Lodge brauchen dürften (unsere ist sooo klein und bei genauerem Hinsehen merke ich, dass es gar keinen Herd hat, nur einen Kühlschrank, ein Spülbecken und ein Tischchen) und ob es ok sei, dass wir den Wein, den sie hier anbieten und der ihm nicht passt, selber mitbringen könnten.
Niemand schlägt ihm einen Wunsch ab. So ist der nächste Schritt: einkaufen gehen. Eva geht mit. Die beiden kommen zurück mit Feuerholz, einem Filet (1 ½ kg diesmal), vier Flaschen Wein, sechs Büchsen Cola light für Theo, Salat, Früchten, Mineralwasser und Eva hat Frühlingsrollen gefunden, die ich so gerne habe. Der Köchin könne die uns dann als Vorspeise servieren. – Die wird sich freuen!
Ein tolles Feuer zaubert Ken her, das Filet ist erneut Spitze, der Salat fein und frisch, der Reis aus dem Woolworth-Beutel in 90 Sekunden in der Mikrowelle erwärmt – alles wie gehabt.
Donnerstag, 16. August 18
Wir nehmen’s gemütlich. Erst mal erkundigen wir uns, was man in der Gegend alles unternehmen kann. Ken erklärt: Kanufahrten (Mokoro day trip), Motorbootfahrten, Flüge übers Delta, Übernachten auf einer Insel, reiten, fischen natürlich! – Wir beschliessen, schön eines nach dem anderen anzugehen, aber die Insel-Übernachtung haben wir ja bereits abgehäkelt, die lassen wir. So beginnen wir mal mit der Motorboot-Exkursion. Um halb vier nachmittags werden wir abgeholt. Gut dreissig Minuten dauert die Fahrt bis zur Bootanlegestelle. Wir vier sind alleine auf dem Boot, das ist gut so. Die Fluss-Landschaft, durch die wir geführt werden, ist einmalig schön. Das Wasser zeigt kaum Bewegung und aus diesem Grund reflektieren die Büsche, Bäume, Termitenhügel und die Kühe, Esel und Pferde, die im Wasser stehen, wie in einem Spiegel.
Das Okavango-Delta ist ein Nationalpark, ein Binnen-Feuchtgebiet und UNESCO-Welterbe. Es wird auch „Okavango-Grassland“ genannt, was meiner Meinung nach fast besser passt. Es besteht aus Sümpfen, Seen, natürlichen Kanälen und Inseln. Speziell ist, dass alles Wasser, welches das Delta vom Okovango-River aus erreicht, im Kalahari-Becken versickert oder evaporiert und nirgends in ein Meer fliesst. Das ganze Gebiet ist etwa 20‘000 km2 gross.
Vor allem Vögel können wir beobachten. Ken kennt sie alle, weiss genau, wie sie aussehen im Flug und im Stehen und weiss manches mehr über sie zu berichten. Er kennt auch die „Unterabteilungen“, die neuen und die alten Namen - es ist sagenhaft.
Drei Eier liegen im Nest zweier „Blacksmith Lapwing“ oder „Blacksmith Plover“ (auf deutsch „Waffenkiebitz“ – ich kann zwar nichts damit anfangen), die ihrem Namen alle Ehre machen. Wie Samson unser Boot ganz nah ans Nest heranmanövriert, erkennen wir das sofort: Ihr Warnruf gleicht dem eines Schmieds, der auf den Ambos schlägt.
Auch Krokodile hat’s – wir sehen allerdings nur eines. – Zwei Stunden lang dauert die gemütliche, friedliche Fahrt, dann geht’s wieder zurück zur Lodge.
Eva ist dafür, auswärts essen zu gehen – mal eine Abwechslung: indisch. – Ken fährt uns in ein bekanntes Lokal, das „Tandoori“, das zusätzlich auch chinesische Speisen anbietet. Es gefällt uns gut dort unter dem ausladenden, gewaltigen Strohdach und den kitschigen farbigen Lämpchen. Und die Speisen sind ausgezeichnet – riesige Portionen. Theo lässt sich einen Doggie-Bag geben.
Freitag, 17. August 18
Heute ist Kanu-Tag. Anders als beim letzten Mal sind die Kanus auch ungleich ausgestattet, nämlich gar nicht. Jetzt sind sie aus Kunststoff, früher waren sie aus Holz gefertigt. Zwei Schalensitze aus Hartplastik werden hineingelegt, in die wir uns setzen können. Sie sehen extrem unbequem aus, sind aber erstaunlicherweise gar nicht so übel.
Aber erst mal müssen wir dorthin gebracht werden, wo die Kanus stationiert sind. Das dauert über eine Stunde. Kurz nach acht Uhr fahren wir los. Nach einer halben Stunde auf der geteerten Hauptstrasse zweigen wir in den Busch ab, wo sich der Safari-Cruiser mühsam durch die Sandpisten quält. Ähnlich wie in Gweta ist’s eine Schüttel- und Ratterfahrt. Langsam denke ich, bei diesen Fahrzeugen werden wohl die Stossdämpfer serienmässig gar nicht eingebaut. – Die Strecke führt über einfach konstruierte Holzbrücken, durch Wasserläufe, vorbei an Kühen und Eseln - wir haben das Gefühl, weit weg von jeglicher Zivilisation zu sein. Doch da tauchen armselige Lehmhütten auf, ein Kraal, und urplötzlich finden wir uns mitten in Dutzenden von Touristen wieder. Dort ist die Anlegestelle für Motorboote und all die Kanus.
Unsere zwei Mokoros sind bereit. Lukas stellt sich uns vor; er ist unser Guide und wird das Boot von Eva und Ken übernehmen. Unser „Kapitän“ heisst Titi und ich muss lachen: So heissen nämlich zwei von Diegos besten Freunden. Unsere beiden jungen Guides stehen hinten auf den Kanus und mit ihren langen Stangen steuern sie uns während zweier Stunden durch das seichte Gewässer hin zu einer Insel, wo wir Lunch haben werden. Wir müssen uns erst daran gewöhnen, wie es ist, in diesem wackligen Gefährt zu sitzen. Möglichst nicht bewegen, lautet die Devise. Manchmal schaukelt‘s ein bisschen, aber schon bald ist klar, dass Lukas und Titi absolut geübt sind im Kanufahren; sie machen diesen Job seit Jahren. Und sie sind nicht die Einzigen. Wir begegnen einer ganzen Menge von Frauen und Männern, die völlig selbstverständlich diese Art von Kanus steuern, sei es mit Touristen an Bord oder Waren, die sie transportieren.
Gleich beim Losfahren sehen wir ein paar Elefanten im Wasser stehen, etliche Motorboote kreisen um sie herum. Aber bald schon sind wir weit weg vom Motorenlärm, es ist absolut friedlich, die einzigen Laute, die wir noch hören, sind ein paar Kuhglocken von fern und das leise Plätschern der beiden Stäbe, die ins Wasser tauchen, mit denen wir vorwärts gesteuert werden. Idyllischer geht’s nicht mehr. Ganz nahe an der Wasseroberfläche gleiten unsere Boote durchs Seegras dahin, es ist schlicht und ergreifend paradiesisch schön.
Nach einer Stunde machen wir Halt auf einer Insel. Lukas und Titi stellen ein „Znüni“ für uns auf, Güezi und Kaffee. – Ken sagt: „You can choose: There is coffee, coffee or coffee“.
Die gemächliche Fahrt geht weiter durch die grüne Ebene, vorbei an moosartigen Wasserpflanzen und an vereinzelten Seerosen. Ein ganz kleiner Frosch (reef-frog – Schilf-Frosch) hängt an einem Grashalm. Er ist weiss, kann aber seine Farbe wechseln wie ein Chamäleon – lila und pink. Dass Lukas den erspäht hat, ist schon bemerkenswert. Beide Kanus werden ganz nah heranmanövriert, so dass wir den Winzling perfekt vor die Linse kriegen.
Schon denke ich: „Wie gemütlich und lauschig ist es hier - keine Flusspferde.“ – Kaum gedacht. schon gehört und gleich darauf auch gesehen. – Aber überlebt. - Unsere Steuermänner machen einen grossen Umweg um die Kolosse und wir hören sie nur noch aus der Ferne.
Nun sind wie auf der Insel angekommen, wo wir zwei Stunden Aufenthalt haben. Wir machen einen einstündigen Spaziergang. Tiere sehen wir keine, aber massenhaft Spuren und Dung. Die grossen Löcher in der Erde stammen von Ameisenbären, die Verwüstungen an Bäumen und Sträuchern von Elefanten, die abgenagte Baumrinde von einem Borkenkäfer. Anhand von Fussabdrücken und Exkrementen erklärt uns Ken alles Wissenswerte über die Dickhäuter. Wie ihre Füsse geformt sind, wie sie gehen und warum das alles so ist - wir erhalten eine Unterrichtsstunde – pfannenfertig.
Die beiden Guides hören ebenfalls aufmerksam zu. Für sie scheint auch manches neu, sie geben den Job des Erklärens gern ab. - Speziell ist auch die Lektion über all den Dung, dem wir auf Schritt und Tritt begegnen. Die riesigen Haufen von Shitkugeln gehören natürlich zu den Elefanten, relativ kleine Bällchen stammen von Giraffen - seltsam, man würde denken, die wären grösser… Dung von Zebras, Impalas, Kudus kriegen wir zu sehen, und das aus nächster Nähe. Ken liest die Dinger nämlich auf („It’s a shit story“, sag er, „but there you go…“), bricht sie entzwei und erklärt, was besagtes Tier gegessen hat, ob’s von einem Graser oder einem Browser stamme, sehe man ganz genau – Struktur, Dichte, Farbe, Inhalt. Elefanten müssten sehr viel fressen, weil sie etwa 70% davon nicht verdauen könnten. - Und ja, da sind in den Strohballen Palmkerne vorhanden und ganze Mopani-Blätter unverdaut nachweisbar. – Theo muss dann natürlich das Zeugs auch anrühren, was nicht zu meiner grossen Freude beiträgt.
Eva schaut all dem ebenso skeptisch zu wie ich uns sagt, so wie sie das empfinde, seien wir auf einem „shit-photographic-trip“. Die ganze Insel, auf der wir nun Mittagessen würden, sei also eine Toiletten-Insel. – Ich bin ganz ihrer Meinung.
Ich frage Lukas, der unsere kleine Expedition anführt, ob er ein Foto von uns machen könne. Da sagt Ken zu ihm, er solle ihn möglichst schlank erscheinen lassen auf der Aufnahme. Er macht immer wieder Witze mit Kellnern, Guides, Tankstellenangestellten und allen möglichen Leuten, die uns begegnen, und freut sich dann an deren Reaktion. Viele verstehen den Witz nicht ganz, sind nicht sicher, ob’s ernst gemeint ist oder nicht oder sind zu schüchtern für eine Entgegnung. – Daher muss er jetzt lachen, wie Lukas spontan sagt: „It’s impossible!“
Wie wir zurück bei den Booten sind, hat Titi bereits den Lunch vorbereitet, der von der Lodge früh am Morgen bereitgestellt und mitgegeben wurde. Es gibt Kartoffelsalat und Sandwiches, Chips und Wasser.
Er hat noch was anders ausgebreitet auf einem Plastiksack: ein paar handgeflochtene Körbchen und Armbänder. Lukas Freundin hat die hergestellt. - So versucht doch jeder noch ein kleines Nebengeschäft zu tätigen…
Nach dem Essen haben wir eine halbe Stunde lang Zeit zum Nichtstun und die absolute Ruhe dieser friedlichen Landschaft zu geniessen. Für Theo heisst das natürlich: Siesta. Kaum angekommen, hat er sich schon ein gäbiges Plätzchen im Schatten eines Baumes ausgesucht. Dort schnarcht er jetzt, den Kopf aufgestützt auf seinen roten Sportsack mit dem weissen Schweizerkreuz drauf.
Anderthalb Stunden dauert die stille, gemütliche Rückfahrt zur Bootanlegestelle. Genau im dem Moment, wo wir ankommen, ist auch gleich unser Safari Land Cruiser an Ort und Stelle, der uns in rasanter Fahrt, so ziemlich im Gegenteil von dem, was wir auf dem Wasser erlebt haben, wieder zurück zur Lodge bringt.
Wie essen heute Abend dort; wir sind die einzigen Gäste.
Samstag, 18. August 18 (Teos erster Geburtstag)
Gemütlich, gemütlich!
Um drei werden wir abgeholt und auf den Flugplatz gefahren (Maun – International Airport – tönt beeindruckend!). Um vier soll unser Flug starten. – Security check wie überall und anschliessend werden wir zum fünfsitzigen Flugzeug gefahren. Der Pilot stellt sich vor. „Wing“, verstehe ich, ist sein Name und ich finde, das passt eigentlich ganz gut. „Wayne“ ist es allerdings, wie ich später realisiere. Wir sitzen zu fünft eingeengt in der kleinen Cessna. Heiss ist es. - Der Pilot startet den Motor, der stirbt ab, er versucht es erneut, jedoch die Geschichte wiederholt sich zehnfach. Schwache Erinnerungen an unseren Land Rover steigen in mir auf. Er/sie mag einfach nicht. Auf Berndeutsch würde man sagen, der Motor ist „versoffe“. Nach dem zwanzigsten Versuch fragt Eva schüchtern, ob das in der Luft dann auch passiere. – Und Ken, der sonst keine Bedenken kennt, findet’s auch nicht mehr so gemütlich.
Eine andere Cessna kommt an, wir steigen in diese um, erst aber muss sie noch aufgetankt werden. Aber dann, mit einer halben Stunde Verspätung, starten wir. Es ist ein wunderbarer Flug über das Delta. Es lohnt sich, aus der Vogelperspektive diese einmalige, prächtige Landschaft zu betrachten. Die Farben sind einzigartig.- Ebenfalls ist es ein Erlebnis, die riesigen Büffelherden zu sehen, die Elefanten, einzelne Flusspferde und sogar Vögel.
Der Flug dauert dreiviertel Stunden und wir fliegen meistens in circa 150 Metern Höhe über die fantastische Landschaft. Nur so kann man die gewaltigen Ausmasse erahnen.
Auch heute Abend ist das „Tandoori“ wieder gefragt. Chinesisch diesmal. Vier Doggie-Bags nehmen wir mit „heim“ – die Portionen sind selbst für Ken zu gross.
Ken ist sehr gut aufgelegt und wir erhalten eine ausführliche Lektion Rugby- oder Cricketregeln erteilt, ich weiss nicht mehr genau, welches, weil mein Interesse an diesen Sportarten sich in Grenzen hält. Eva fragt, ob wir am nächsten Tag ein Quiz zu bestehen hätten…
Sonntag, 19. August 18
Am Sonntag soll man ruhen… Theo passt das gut. Eva und Ken gehen einkaufen, Theo ist, nebst Siesta selbstverständlich, den ganzen Tag damit beschäftigt, sein Projekt Kinderbuch für die Enkel: „Nani and Nono go Safari“ weiterzutreiben.
Fischen wär ja auch ein Thema. Ken hat sich natürlich schon erkundigt und einen Spaziergang zum Fluss unternommen zwecks Rekognoszierung. Leider (!) eignet sich dieses Gewässer wenig zum Fischen, das Buschwerk ist zu dicht, Theo würde vermutlich wieder ein Chaos anrichten mit der Angelrute und überhaupt – keine nennenswerten Fische gäbe es zu fangen (oder nicht zu fangen), schon gar keinen Tigerfisch, der muss das A und O sein für einen Angler.
Andere Flüsse hat’s auch in der Umgebung, aber dort ist das Problem, dass sie alle ausgetrocknet sind und unsere beiden Ehemänner einfach nicht auf „dry – fishing“ spezialisiert sind.
Ich habe mich für einen Ritt angemeldet. Wann genau ich abgeholt werde, ist Gegenstand mehrerer Befragungen, Telefonate und Vermutungen, die gestern während des ganzen Nachmittags andauerten. 06.30 hiess es einmal, was mich zwar nicht gleich aus der Bahn geworfen, aber Theo dazu verleitet hat, mir nahezulegen, ich solle gleich draussen vor dem Rondavel schlafen, damit ich ihn dann nicht wecke. Auch acht Uhr war eine Option, 09.30 war’s schliesslich - also kann ich doch drinnen schlafen und sogar noch frühstücken, bevor’s losgeht.
Eine gute halbe Stunde dauert die holprige Fahrt über Sandpisten durch den Busch bis zur Royal Tree Lodge. Unterwegs kommen wir an verschiedenen Behausungen vorbei, die Leute winken uns zu, was mich immer ein wenig seltsam dünkt. - Die Touris, die auf den Safari-Vehikeln herumkutschiert werden….
Ein Schild an der Strasse zeigt den Weg zum Vorschul-Kindergarten. Bei uns hiess diese Institution, die unsere Kinder damals besucht haben, „Strubelimutz“. Hier: „Precious Jewels Academy – (Preschool)“.
Und wieder hab ich das Gefühl, irgendwo im Nirgendwo zu sein, wie wir in der Lodge ankommen, wo’s Stallungen für zwanzig Pferde hat. Das hätte ich hier nicht erwartet. Es ist eine Farm, eine Game Reserve.
Mein Pferd ist eine Schimmelstute namens „Janie“ und mein Begleiter ein liebenswerter Guide aus dem Stamm der „Bayei“. Er heisse „Flood“, stellt er sich vor. - Seltsamer Name, finde ich. Wir reiten los und schon begegnen wir Zebras, Giraffen mit ihren Jungen, Elands, die grösste Antilopenart, die es gibt, Blessbock, Springbock, Gemsbock und Strausse. Eine Straussendame sitzt brav auf ihren Eiern, an einem anderen Nest kommen wir vorbei, auf dem niemand sitzt. Flood denkt, die Straussin ist vielleicht zu jung oder zu dumm, um sich richtig um die Aufzucht zu kümmern. In der Hitze gibt das grad Spiegeleier, wenn die Temperatur nicht stimmt.
Wie bei Ken erhalte ich auch hier eine weitere Lektion Vogelkunde. – Den „Crimson-Breasted Shrike“ sehen wir ein paar Mal; sein tiefrotes Brüstchen ist prächtig. Auch der „African Long Tailed Shrike“, oder genannt „Magpie-Shrike“, der zwölf verschiedene Vogelstimmen nachahmen kann, ist unterwegs sowie der „Fork Tailed Drango“. Eine ganze Menge von „Marabu-Storks“ bevölkert das Flussufer des Thamalakane-River, und einmal mehr ist der „Black Smith Plover“ zu hören.
Wie die Vögel heissen, die ihre Nester am liebsten auf den Telefonmasten bauen, habe ich vergessen, wir haben sie ja auch nicht gesehen (Sie heissen „Social Weavers“, wie Ken mir später erklärt. Fast eine Art Mehrfamilienhaus würden sie bauen mit verschiedenen Eingängen, der richtige Zugang gut versteckt, die anderen zum Teil mit Dornen ausgelegt, so dass es einer Schlange verleiden würde, die Eier zu suchen). - Ja und immer und immer wieder ruft die „Cape Turtle Dove“, die mir mit ihrem Gesang langsam aber sicher auf den Wecker geht. Sie ist überall zu hören, wohin man auch geht. Seit Beginn unserer Reise „verfolgt“ sie uns auf Schritt und Tritt. - Eine ganz ähnliche Taubenart ist die „Red-Eyed-Dove“ und ihr „Song“ geht so: „I’m red-eyed dove, I’m red-eyed dove“. – Lustig, wie es mit diesen Eselsleitern tatsächlich einfach ist, die Vögel zu erkennen - wenigstens vom Gesang her. Auch die „Emerald oder Green Spotted Wood Dove“ singt ein besonderes Lied: „My mother is dead; my father is dead. – What shall I do do do…“
Es soll im südlichen Afrika 740 verschiedene Vogelarten geben, sagt Ken; da bin ich mit meinem Latein natürlich erst am Anfang.
Aber zurück zum Ausritt. – Erstaunlich ist, dass der Ritt durch drei völlig verschiedene Vegetationszonen führt: erst durchs sandige Buschland mit den vielen Dornensträuchern, vor denen mich Flood jeweils warnt, dann durch eine Art Wald mit dicht aneinander stehenden, hohen Bäumen und schliesslich durch ein sumpfiges Gebiet mit hohem Gras, dort, wo der Fluss jeweils übers Ufer tritt.
Nach zwei Stunden sind wir zurück bei den Stallungen. Schön war’s, wirklich schön!
Den Nachmittag verbringe ich vorwiegend am Pool mit Lesen und Faulenzen. Auch schön!
Wie schon erwähnt sind Eva und Ken inzwischen einkaufen gegangen. Sie kommen zurück mit Mineralwasser, Salat und vier grossen Stück Lachs. Eva dachte, das wäre genug für uns alle vier zum Nachtessen, aber da fehlt halt das Fleisch. Ken hat sich vom Metzer zusätzlich zwei riesige Rumpsteaks frisch zuschneiden lassen (abgepackt kommt nicht in Frage), eines für sich und eines für seinen „Fisherman friend“. – Dieser mag dann allerdings nicht das ganze Steak – Ken springt in die Bresche, während wir beiden Frauen (wife number one and wife number two) den Fisch essen. Ken hat für diesen Abend die Küche in der Lodge grad selber übernommen, denn sowohl das Fleisch wie auch der Fisch müssen zur Perfektion gebraten sein, was er den beiden Köchinnen nicht zutraut. Sie dürfen aber unseren Tisch decken und den Salat rüsten.
Zum Glück haben wir noch eine Flasche Wein vorrätig, am Sonntag kann man im Einkaufszentrum nämlich keinen kaufen. Ken habe gefragt, wieso. Die Antwort sei gewesen: „Because……“
Montag, 20. August 18
Es ist wieder ein Reisetag, Ken will früh losfahren. Es wird dann doch halb neun. Eine Strecke von 300 km haben wir vor uns; ausser zweimaligem Aussteigen an einem Roadblock der Seuchenpolizei, um unsere Schuhe wegen der Maul- und Klauenseuche zu „waschen“, ist sie ziemlich ereignislos. Hin und wieder überqueren Ziegen und Kühe die Strasse, aber daran sind wir inzwischen gewohnt. Seit Kasane ist das Land völlig eben (Kalahari Sandveld), nur grad kurz vor unserem Ziel findet sich eine Art sanfter Hügel, fast eine Sensation. Dann wird’s wieder flach. Nach knapp vier Stunden kommen wir in Ghanzi an; die Lodge befindet sich ausserhalb des Dorfes und ist nur erreichbar über einen mühsamen drei Kilometer langen Sandpfad, den man nur im Schritttempo befahren kann. Auch hier muss ich wieder staunen, wer auf die Idee kommt, an diesem Ort eine Unterkunft hinzubauen.
Wir erhalten ein feines Mittagessen. Theo bestellt eine Spinatsuppe und erst eine halbe Stunde später merkt man in der Küche, dass es gar keinen Spinat hat (wir sind die einzigen Gäste). Wir teilen uns in den Poulet-Salat, der so oder so zu gross ist für mich. Anschliessend beziehen wir unsere Cabins. Sie sehen auf Stelzen, die Aussenwände bestehen aus einer Art dicker Zeltplache, innen sind sie mit kartonartigen Platten isoliert und überdeckt ist das Ganze mit einem Strohdach. Sie sind ganz ok, kein Luxus, aber zweckmässig eingerichtet und das Wichtigste: ein bequemes Bett erwartet uns. Unsere „Reisegruppe“ hat keine Lust auf Aktivitäten an diesem Nachmittag, es ist auch sehr heiss, also ist der Fall für Theo klar: Siesta und für mich: Pool. Der ist allerdings eher auf der kälteren Seite, auf keinen Fall mehr als etwa 18 Grad, was mich nicht stört, ich denke wieder mal an die Aare, die allerdings viel wärmer ist im Moment.
Gegen Abend genehmigen wir uns wiedermal einen Apéro. So gut wie nirgends auf unserer Reise scheint dieser schöne Brauch im schwarzen Kontinent angekommen zu sein. Wenn’s eine Bar hat, dann gibt’s dort verschiedene Sorten von Whisky, und wenn’s hoch kommt, steht da eine Flasche Gin. Damit hat es sich.
Für Ken und seinen ebenfalls Whisky-liebenden Fisherman Friend oder „my partner in crime“, wie Theo auch genannt wird, ist das ja kein Problem. Eva liebt Gin und ich fange den Abend halt mit einem Glas Rotwein an. Auch nicht schlecht eigentlich.
Was die für ein Geld machen könnten mit all den schönen Drinks, die die Touristen doch so lieben, Piña Colada, Caipirinha, Mojito, Sex on the Beach, Margarita und wie sie alle heissen. Aber wir sind hier in Afrika, da ist eben manches anders.
Nun – eine Flasche Malibu ist vorhanden, ein kleiner Rest von Martini Rosso und natürlich Jägermeister - schliesslich sind wir ganz nah an der Grenze von Namibia, und dieses Gesöff ist dort das Nationalgetränk.
Im „Garten“ der Lodge, grad vor dem offenen Restaurant hat’s ein Wasserloch. Gegen Abend strömen Tiere herbei, die ebenfalls Lust haben auf einen Sundowner. Es sind Gnus, Impalas, Kudus und später, wie’s fast dunkel ist, sehen wir auch noch Warzenschweine und einen Schakal.
Ein sehr feines Nachtessen wird serviert. Theo isst drei Spiesse mit verschiedenem Antilopen-Fleisch, Eva Eland-Potjie, mir ist nicht abenteuerlich zumute, verzichte daher auf Zebra-Steak und Kudu-Leber und begnüge mich mit Rindsfilet. Ken bestellt ein T-Bone-Steak (man-size) - so ein grosses hab ich noch gar nie gesehen. Es könnte von einem Elefanten stammen.
Dienstag, 21. August 18
Nach dem Frühstück ziehen wir zu Fuss los – „Bushman-Walk“ nennt sich der Spaziergang. Unser Guide heisst „Narongi“. Er führt uns ein kurzes Stück weit in den Busch und schon stehen wir vor zwei jungen Männern und einer jungen Frau im „Buschmann-Outfit“. Sie sind von der Lodge angestellt, das erfahren wir allerdings erst später. Ken weiss es natürlich. Aber ja, die drei gehören tatsächlich zum Stamm der Buschmänner oder San, aber das Tragische an der Geschichte ist, man hat diese Menschen aus ihren ehemaligen Revieren vertrieben. Die Regierung hat sie umgesiedelt, hat ihnen Unterkünfte bereitgestellt, sogar fliessendes Wasser und Nahrung erhalten sie. Allerdings ist das alles nicht, was sie wollen, aber gegen diese Neuerungen können sie sich nicht wehren. So sind jetzt zwei Familien-Clans hier ganz in der Nähe angesiedelt und die Lodge versucht sie zu unterstützen, indem sie ihnen eine Art „Arbeit“ zuweist. Sie seien wie Kinder, sagt Narongi, es sei nicht immer einfach mit ihnen. Auf einem Bush-Walk zeigen sie, wie sie noch vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich gelebt haben, wie sie gekleidet waren, wie sie sich vom kargen Boden und den Sträuchern und Bäumen ernährt haben. So kommen sie mit uns (barfuss) und zeigen, wie sie Wurzeln finden, die für allerlei Beschwerden gut sind, zum Beispiel gegen Kopf- oder Rückenschmerzen, sogar eine Art Anti-Baby-Pille stellt der Busch bereit. Sie wollen uns zeigen, wie sie ein Feuer machen, aber heute ist nicht ihr „lucky day“, da helfen alle Gebete nichts, denn es hat sehr viel Wind und wenn auch immer wieder mal ein Räuchlein aufsteigt, ein richtiges Feuer kommt nicht zustande. Sie tun mir leid – ihre Hände müssen völlig wund sein nach der langen Prozedur. Der Versuch erinnert mich an den Flugzeugstart vor zwei Tagen, der auch nicht gelingen wollte…
Wir verabschieden uns, geben aber kein Geld. Sie würden am Abend für uns tanzen und wenn sie jetzt schon ein Trinkgeld erhielten, könne es sehr wohl sein, dass sie überhaupt nicht mehr auftauchen würden, erklärt Ken, denn offenbar haben sie ein Alkoholproblem. Grad wie die Aborigines in Australien und die Indianer in den US. – Was haben wir Weissen nur angerichtet, denke ich. – Zurück in der Lodge erhalten wir von Ken eine ausgedehnte Lektion über die afrikanischen Stämme und deren Geschichte.
Ein Tisch ist schön gedeckt für uns beim Lagerfeuer und wir beobachten wieder zwei Springböcke, die ganz nah ans Restaurant herankommen, völlig ohne Furcht. Ein wirklich super gutes Nachtessen wird serviert mit erstklassigem Filet. Ken hat es so für uns bestellt. Ein Hintergrundkonzert von verliebten „Bull-Frogs“ müssen wir über uns ergehen lassen. Ich denke, es sind etwa 37 Frösche, die am Balzen sind, Ken meint, es seien nur etwa drei („The one with the nicest voice gets all the girls“.).
Nach dem Essen freuen wir uns auf die Tänze. Am selben Ort im Busch, wo wir heute Morgen waren, finden diese statt. Ken hat ein Auto bestellt, das uns dorthin führt, er denkt, dass der Spaziergang im Dunkeln um diese Zeit zu mühsam für uns sein würde. Eine sehr holprige Strecke legen wir zurück, aber die kurze Fahrt dauert kaum fünf Minuten. Schon sehen wir die beiden Buschmänner und ihre drei Frauen (Buschmänninnen / Buschmannfrauen / Buschfrauen???) rund ums Feuer stehen. Vier Stühle stehen dort für uns. Wir setzen uns, die Vorführung kann beginnen.
Leider ist es ein ziemliches Debakel; wir merken bald, dass die eine Frau und einer der Männer stockbetrunken sind. Die Frau verbrennt sich zweimal fast die Füsse im Feuer. Ken sagt zu unserem Guide, dass er nicht bezahlen werde, wenn nicht das geboten werde, was abgemacht sei. Ein ziemliches Tohuwabohu geht los, aber die Gruppe ist leider nicht imstande, sich zusammenzuraufen. Eva möchte lieber gehen. Wir steigen ins Auto und fahren zurück in die Lodge. Schade! Mir tun die Leute leid, sie haben wenige Perspektiven, ich weiss selber nicht recht, was ich von all dem halten soll. – Was sie zeigen wollten, ist ein Stück vergangener Geschichte, was passiert ist, ist die Realität.
Heute Nachmittag habe ich ein Buch zu Ende gelesen, das mir Ken empfohlen hat: „Hold my hand; I am dying“ (by John Gordon Davis). Es handelt vom Bau des Staudamms am Zambezi-River bei Kariba, ist auch eine leidenschaftliche Liebesgeschichte und zugleich eine absolut schreckliche Beschreibung der grauenhaften Zustände, die bei der Machtübernahme der Schwarzen in Zimbabwe herrschten. – Ein faszinierender Roman, gleichzeitig ein Stück schrecklicher Geschichte der Gebiete, durch die wir in den letzten Wochen gereist sind. - Das wird mir Albträume geben…
Mittwoch, 22. August 18
In fünf Minuten ist der Land Rover gepackt. Inzwischen wissen die beiden Männer genau, was wo hineingehört.
Beim Frühstück erfahren wir, dass das gestrige Drama der fünf Buschmänner völlig ausgeartet sei. Sie hätten ihre Hütte angezündet und es sei ein Glück, dass sie bei dem trockenen Wetter nicht gleich die ganze Farm abgefackelt hätten. – Wie’s dort jetzt weitergeht, wir werden es wohl nicht erfahren.
Um neun Uhr starten wir in Richtung Namibia. – Wieder ein Grenzübertritt. – Keine freudige Erwartung. Kurz vor der Grenze tanken wir. Es dauert fast eine Viertelstunde, bis die langsame Pumpe 60 Liter Benzin ins Auto gefüllt hat. Ken mag nicht mehr warten, bis der Tank voll ist. Wir fahren weiter. – Bei der Tankstelle steht übrigens angeschrieben: „Quick Stop“.
Ausreise aus Botswana ist kein Problem, wir kommen mühelos durch. – Am Grenzübergang in Namibia sitzt ein Beamter am Schalter, dem man grad ansieht, dass er heute Morgen mit dem linken Fuss aufgestanden ist. „Schikane“ steht auf seiner Stirn geschrieben. Ken kommt zuerst dran, dann ist ein Deutscher an der Reihe, der einen schweren Rucksack am Rücken trägt. Der Beamte will von ihm wissen, wann er das Land verlasse, wann sein Rückflug sei. – Er habe keinen gebucht, reise seit zwei Jahren im Afrika herum. – Das kann nicht gut gehen. Diese Antwort ist die falsche. Woher er sein Geld habe, ob er gearbeitet habe. Ja, aber ohne Lohn, er sei pensioniert und erhalte jede Woche seine Rente aus Deutschland. – Schon wieder falsch. – Es gäbe niemanden auf dieser Welt, der ohne Lohn arbeite, sowas könne er ihm nicht weismachen. Ich stehe direkt neben ihm und höre die ganze Unterhaltung mit. - Wer denn seine Übernachtungen bezahle, ist die nächste Frage. – Eben, das Geld aus Deutschland. – Dafür würde das Geld niemals langen... Und er sei doch noch zu jung, um Rente zu kriegen. – Er sei sehr krank gewesen, versucht der Deutsche zu erklären… – Und so geht das weiter und weiter, ich bin ziemlich sicher, dass diesem Typ die Einreise schliesslich verweigert wurde.
Ken wird ungeduldig, unterbricht mal und fragt, wir seien eine Gruppe zu viert, ob wir andern drei nicht vorher drankommen könnten. Eva, die beim letzten Mal nicht reingelassen wurde (eine lange, unglaubliche und schikanöse Geschichte), hat diesmal kein Problem, ihr Visum ist in Ordnung. Wir Schweizer brauchen keines und ich bin eigentlich ganz froh, dass der mürrische Beamte sich auf den Deutschen fokussiert, den er sicher nicht aus seinen Klauen lassen wird. Bevor er mir meinen Pass zurückgibt, will er wissen, weshalb wir mit dem Südafrikaner unterwegs seien. – Ich erklärte ihm, wir seien Freunde und zusammen auf einer siebenwöchigen Reise. – Wo wir uns denn kennengelernt hätten. – Im Internet. – Wie genau? – Wir würden Häuser tauschen, sie seien bei uns gewesen, wir bei ihnen; jetzt seien wir befreundet. – Das sei unmöglich, erwidert der allwissende, lebenserfahrene Staatsdiener, so mache man keine Freunde. „Tell me if I’m wrong“. – Ich antworte darauf nichts, denke, es ist wohl besser, mit diesem Kerl nicht zu argumentieren. Er wirft mir daraufhin meinen Pass hin und wendet sich wieder dem Deutschen zu. Sehr gut. Wir können also gehen.
„Was sollte das alles?“, frage ich Ken. Seine Erklärung ist, er hätte aus mir herausbringen wollen, dass wir mit dem „Südafrikaner“ auf Safari seien, ihn also für seine Dienste bezahlen würden, was ja nicht den Tatsachen entspricht, und Ken somit eine Arbeitsbewilligung hätte vorweisen müssen. Dann wäre die Sache erst richtig losgegangen. – Was für ein Glück, dass er ein anderes Opfer bereits an der Angel hat.
Nur noch wenige Kilometer weiter müssen wir fahren und schon sind wir in der Lodge angekommen, wo wir einmal übernachten werden. 14‘000 ha gross ist die Zelda Guest- and Game Farm.
Schöne grosse Zimmer hat’s, die hübsche parkähnliche Anlage mit den riesigen Euphorbien und Palmen ist sehr gut unterhalten, der Pool ist sauber, die Bar gut bestückt und aufgefüllt, ein Weinschrank vorhanden, mehrere lauschige Plätze hat’s zum Sich-wohl-Fühlen und alles funktioniert bestens – in Namibia ist eben manches ein wenig anders – deutsches Erbe...
Um halb sechs ist Tierfütterung angesagt. Der Leopard erhält seine fünf Kilogramm Zebrasteaks. Wie er in der Nähe zwei Hunde sieht, rührt er seinen Bissen nicht an, sondern lässt die beiden nicht mehr aus den Augen. – Natürlich ist da ein Zaun dazwischen - dumm gelaufen…
Lustig ist das Stachelschwein. Es ist ein grosses mit langen Stacheln – fast wie Federn sehen sie aus. Es mag seinen Wärter sehr, das merkt man gleich. Es lässt sich von ihm streicheln und folgt ihm wie ein Hündchen zum Futtertopf.
Zwei Emus erhalten ebenfalls ihre abendlichen Leckerbissen. Man darf ins Gehege hinein und ihnen Futter reichen. Ich verzichte…
Nun ist’s sieben Uhr und auch für die Touristen Zeit, zum Buffet zu schreiten. Zur Unterhaltung singt und spielt ein älterer Typ allerlei Musik, Country and Western, Rock and Pop (nicht vom Neuesten) und deutsche Schlager.
Donnerstag, 23. August 18 (Debos Geburtstag)
Es ist wieder mal sehr kalt heute Morgen, 10 Grad. Wir ziehen alle unsere warmen Sachen an, denn man isst draussen unter einem grossen Strohdach; es gibt kein geschlossenes Restaurant. Wir verlassen Zelda gegen neun und fahren zu unserer allerletzten Destination, einer Game Farm ausserhalb von Windhoek. Dort werden wir zweimal übernachten und von dort aus zum Flughafen fahren, wo wir am Samstagnachmittag um vier Uhr unsere Heimreise via Johannesburg antreten werden.
Ja, unsere letzte Fahrt auf dem Rücksitz im Land Rover. Zum letzten Mal profitieren wir von Evas kleinen Dienstleistungen: „Glas-Cleaning-Service“, damit Fahrer und Mitfahrer besser sehen. Dann kommt „Accounting“ dran. Sie schreibt in ihr Büchlein, wer wann was bezahlt hat, wie‘s jetzt aussieht mit dem „Kitty“, unserem gemeinsamen Portemonnaie, wer wieder Kohle nachliefern muss. – Ich werde das vermissen – den Brillen-Putz-Service jedenfalls. Und Eva und Ken sowieso, mit denen wir so viel Schönes und Lustiges erlebt haben. Eine weitere Reise wird folgen. – Vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr…
Wir machen einen kurzen Kaffeehalt in einem witzigen kleinen Shop zwecks Kauf von Biltong, alsdann passieren wir Gobabis, wo wir kurz anhalten zum Tanken.
Um eins erreichen wir die AUAS-Farm – sie liegt fast auf den Meter genau so hoch wie Bivio, an einem Ort, wo sich Fuchs und Hase, beziehungsweise Kudu und Gnu gute Nacht sagen. Wie man auf die Idee kommt, so weit im Nirgendwo eine luxuriöses Anlage dieser Art zu bauen, ist schwer zu begreifen. Es ist schön warm an der Sonne heute Nachmittag, aber relativ kühl im Schatten. In der Nacht wird es kalt werden, aber es hat zu meiner grossen Freude flauschig weiche Bettflaschen und einen Ofen im Zimmer mit genügend Holz, der von einem Angestellten eingefeuert werden wird.
Und in drei Tagen sind wir zu Hause, im Sommer – die kalten Nächte des afrikanischen Winters werden Geschichte sein.
Vom Liegestuhl aus hat man eine fantastische Aussicht aufs Wasserloch und über die Savanne auf die 56 km lange AUAS-Bergkette am Horizont, die höchste in Namibia (höchster Peak fast 2‘500 Meter hoch).
Zum Nachtessen gibt’s Gnu-Stroganoff mit Teigwaren und Gemüse. Überaus lecker – muss ich zugeben.
Freitag, 24. August 18
Ein äusserst feines Frühstück wird serviert. Und auch ein Impala namens „Boky“ und ein Straussenehepaar (Bonny and Clyde) kommen zur Lodge und wollen ihr Futter haben. Sie sind es gewohnt, das Frühstück gleichzeitig mit den Touris serviert zu bekommen. Mit vollem Magen ziehen sie weiter in den Busch. Die obligaten Perlhühner sind ebenfalls zur Stelle und rennen kreuz und quer in der Gegend herum, darauf bedacht, ebenfalls ein kleines Bisschen Etwas zu erhaschen.
Wie seit Wochen ist es schön, wolkenlos, und es wäre angenehm warm, wäre da nicht dieser penetrante Wind. Aber eben – Windhoek – auf Berndeutsch würden wir sagen: „Ä zügige Egge“.
Wie ich über Mittag im Liegestuhl liege, kommt Boky wieder, steht minutenlang boky-still und findet dann, sie könne sich doch auch hinlegen, das sehe doch super entspannt aus. – Gemütlich finde ich das: im Liegestuhl liegen, den achtzehnten Band McCall Smith am Lesen und eine Antilope (ohne Buch) keine fünf Meter entfernt von mir ebenfalls am Chillen.
Heute Nachmittag werde ich einen Game-Drive mitmachen, den letzten für einige Zeit. Theo macht lieber Siesta und Eva und Ken haben Massage gebucht.
Genau sieben Wochen waren wir unterwegs. Eine Strecke von ungefähr 5‘500 km haben wir zurückgelegt, an sechzehn verschiedenen Orten übernachtet.
Eva und Ken werden morgen sehr früh weiterreisen, heimwärts nach Cape Town – weitere knapp 2‘000 km. Theo und ich, wir werden erst kurz nach Mittag mit einem Shuttle zum Flugplatz fahren.
Kein Tag war wie der andere. – An jedem haben wir etwas anderes erlebt, neue Erfahrungen gemacht. – Und was für ein Glück: Gesundheitliche Probleme hatten wir keine, nur ein paar vernachlässigbare Schrammen, die bereits wieder verheilt sind; Theo hat uns also verschont mit weiteren Eskapaden.
Diese einmalige Reise werden wir niemals vergessen.
Den heissen Sommer in der Schweiz haben wir verpasst, aber auch Ende August ist es noch immer Zeit, ein paar Mal in der Aare schwimmen zu gehen, bevor die Koffer für Spanien erneut gepackt werden müssen. Und nach diesen zwei „chilligen“ Wochen gibt’s anschliessend eine Lücke von acht Tagen, um umzupacken und uns auf die zweimonatige Endjahres-Reise vorzubereiten.

Miami – Südamerika – Bonita Springs (18. Oktober – 17. Dezember 2018)
Miami 18. – 29. Oktober 2018
Wir waren ja schon im Sommer unterwegs, und das nicht zu knapp, aber wie gesagt, den Spätherbst in der Schweiz zu erleben, muss nicht sein, jedenfalls nicht, so lange wir noch gesund und „rüstig“ sind.
Der Anfang einer Reise ist immer aufregend – man hat noch so viel vor sich. Und nicht aller Anfang ist schwer. Überhaupt nicht - vor allem dann nicht, wenn die Koffer noch immer halb gepackt sind von der vorigen Reise, wenn Theo seinen Swisspass im Zug bei sich hat, wenn er zum ersten Mal in unserer Reisegeschichte keine Probleme hat bei der Security am Flughafen, seinen Handkoffer nicht öffnen, sein(e) Sackmesser nicht abgeben, sich keiner Leibesvisitation unterziehen muss und am Ende der vorläufigen Reise noch all sein Hab und Gut bei sich hat.
Natürlich ist man froh, wenn dieser nicht unbedingt angenehme Teil der Reise vorbei ist, das lange Warten am Flughafen und der fast zehnstündige Flug. Aber dann kann’s beginnen.
Die ersten zehn Tage in Miami sind bereits Geschichte. Es hat uns gefallen; wir haben einmal mehr von einem Haustausch profitieren können. Diana und Bill verbrachten bereits ein paar Tage im letzten Sommer bei uns in Bivio; nun bewohnten wir ihre Wohnung im sechsten Stock eines sogenannten Kondominiums, von denen es in Miami Beach zahllose gibt. Sie reihen sich nebeneinander an der Uferpromenade entlang und je nach Höhe werfen sie früher oder später am Nachmittag Schatten auf den Strand. Alle haben „ä fürnämi“ Lobby mit Concierge, und per Lift kommt man zu seinem Apartment, nachdem man durch unpersönliche, karge Gänge gewandelt ist, die an den Film „Shining“ erinnern. Die Gänsehaut in diesen langen Korridoren stammt aber ebenso von der Kälte, die im ganzen Gebäude herrscht – wie in einem Kühlschrank.
In der kleinen Wohnung finden wir aber alles, was man so braucht; sie ist gut ausgestattet und das Beste: Die Aussicht vom Balkon aus ist wunderschön; man sieht auf den breiten, meilenlangen Strand und aufs Meer mit seinen satten Farben und sanften Wellen. Wir sitzen gerne dort gegen Abend und schauen zu, wie’s dunkel und dunkler wird, wie der Mond sich zeigt; wir spielen mal Karten, essen feine Sachen, die wir zuvor im Publix eingekauft haben, schauen den Kreuzfahrtschiffen zu, die Richtung Bahamas ziehen und den Flugzeugen, die Kurs auf Europa eingeschlagen haben.
Manchmal essen wir auswärts. Es habe unzählige Restaurants gleich in nächster Nähe, hat uns Bill gesagt. – Mit denen ist es aber so eine Sache: Man sieht sie nicht und nirgends steht ein Schild am Strassenrand, so dass man sie finden könnte. Seltsam! – Ich kann nur anhand des Internets mit Tripadvisor ihre Adressen finden, die dann bei Google Maps eingeben und so machen wir uns schliesslich zu Fuss auf den Weg. Tatsächlich wurden wir in der näheren Umgebung nach einigem Suchen fündig. Diese Restaurants sind alle in diesen anonymen Kondominium-Komplexen untergebracht, versteckt besser gesagt, denn auch dort drin findet man sie schlecht. Wieso kein Schild vorhanden sei, fragten wir natürlich. Es sei verboten, erklärte man uns. – Die Amis und ihre seltsamen Gesetze – wenn da einer drauskommt?? – „It’s the law“ – so steht es an vielen Orten, wo man per Schild darauf hingewiesen wird, was man tun muss oder ja nicht tun darf. Das lässt keinerlei Fragen offen. Wenn dann noch Bussen angedroht werden bei Widerhandlung – da lässt man seine „kriminellen Absichten“ lieber bleiben. Seine Knarre hingegen kann man ja bei Walmart und Co. kaufen. Das ist nicht verboten.
Speziell ist auch, dass diese Restaurants zum Teil als Beach Bar bezeichnet werden. Am ersten Tag versuchten wir naiverweise bei einem Strandspaziergang ein solches Chiringuito aufzusuchen, aber da konnten wir lange suchen. Der Zugang vom Strand ist nicht möglich; man sieht sie ja auch gar nicht, weil sie eben bestens in den Gedärmen der Hochhäuser versteckt sind.
Weiter südlich in South Beach ist das ganz anders. Da pulsiert das Leben, ein Restaurant reiht sich ans andere, die Häuser in ihrem wunderbaren Art Deco–Stil sind eine Freude anzusehen.
Sehr viel haben wir nicht unternommen in den zehn Tagen, wo wir dort waren. Oft verbrachten wir die Nachmittage am Strand, wo der Wind manchmal so stark blies, dass es zwecklos war, den Sonnenschirm zu öffnen, aber immer war es heiss und das Wasser schätzte ich auf mindestens etwa 25 Grad.
Einmal machten wir ein kleines Reisli auf die Keys, aber nicht bis nach Key West hinunter, nur grad bis Islamorada.
Ein feines Mittagessen hatten wir im „Marker 88“. Dieses Restaurant wurde uns von Liza und Urs Lindenmann empfohlen. Schön war’s, in einer Strand-Schaukel bedient zu werden, die Füsse im Sand, den Blick aufs Meer und die Bootsstege. In einem kleinen Motel am Strand ganz in der Nähe blieben wir über Nacht.
Vorerst aber zeigte sich uns ein märchenhaft schöner Sonnenuntergang der unser Apéro und Abendessen begleitete. Die Kamera konnte die Farben leider nicht entsprechend wiedergeben.
Auf der Heimfahrt am nächsten Tag sahen wir uns in Miami Downtown die „Wynwood Walls“ an, eine Ausstellung mit Strassenkunst. Ähnlich wie in Shoreditch, in London, wo Kim wohnt, ist auch das ganze Quartier mit Graffitis und Wandmalereien vollbemalt. – Mir gefällt das. Viele dieser Maler sind grossartige Künstler. Schmierereien sind zum Glück selten. Ein anderer Ausflug brachte uns nördlich bis fast nach Boca Raton, wohin Javis Schwester und Kims Schwägerin Natalia mit ihrer sechsköpfigen Familie vor zwei Monaten übersiedelt sind. Sie sind von Seattle dorthin gezogen, wo es ihnen nun besser gefällt. Sie wohnen in einer neuen Einfamilienhaus-Überbauung am Rande der Everglades.
Schon in der Gegend, buchten wir auf dem Heimweg eine einstündige Everglades-Adventure-Bootsfahrt. Die Landschaft ist herrlich, aber die Boote, die durch dieses Grasland speeden, eher weniger. - Wie anders war das vor zwei Monaten, als wir in Botswana im Okavango-Delta waren. Ich musste unweigerlich an die ruhige, idyllische Kanufahrt dort denken, wo man nur das Eintauchen der langen Stangen, mit denen unsere Boys uns durchs seichte Gewässer führten, das sanfte Gleiten des Bootes durchs Wasser und Vogellaute hörte.
Hier aber geht’s laut und amerikanisch zu: In einer Touristengruppe kommt man sich immer ein wenig vor wie im Kindergarten. Der „Kapitän“ reisst seine Sprüche (seit 50 Jahren, so erklärte er uns, mache er diesen Job, auch an den Wochenenden, ohne je Ferien gemacht zu haben), stellt Fragen, die keiner so richtig beantworten kann und mit seiner Antwort ist er dann der King. Wie öd muss es sein, tagtäglich dasselbe zu erzählen und auf dieselben Lacher zu warten. – Dann kommt, was kommen muss: „Would you guys like to go speeding?“ – Natürlich rufen die Passagiere wie aus einem Munde: „ Yeah!!!“. Lauter will er es, also nochmals. Wir Schweizer sind halt im Allgemeinen ein wenig zurückhaltender und brüllen nicht mit. Ich vermute, es fehlt uns an Temperament. Hätte ich „no“ gerufen, wär ich wohl nicht besonders gut angekommen, falls man mich überhaupt gehört hätte. – Und ab geht die Post. Das Boot braust durch die Flusslandschaft, durch den grünen Teppich der Wasserpflanzen hindurch mit riesiger Geschwindigkeit. Und dazu dröhnt der Motor, so dass wir uns die Ohren zuhalten müssen.
Andere Boote sausen und lärmen ebenso. Manchmal bleibt eines stehen, weil der Kapitän einen Alligator gesichtet hat. Dorthin gleitet unser Boot dann auch, damit wir alle den „Gator“ sehen und fotografieren können. – Nach einer Stunde sind wir zurück und erhalten noch eine Alligator-Show vorgeführt, die im Preis inbegriffen ist sowie auch das fürchterliche Foto, das man von uns beim Einsteigen ins Boot gemacht hat – etwas fürs „Familien-Grusel-Album“.
Die Show hat mir allerdings gefallen, vielleicht weil der junge Typ sehr attraktiv aussah, seine Sprüche und sein Humor Niveau hatten und gut ankamen und die Art und Weise, wie er mit den grossen Echsen umging, schon beachtlich war. 40 Zähne im Oberkiefer und 40 unten sollten ja genügen, um mal mindestens einen Finger oder zwei oder eine ganze Hand abzubeissen. Das geschieht allerdings nicht. Der Tierbändiger geht unversehrt aus der Show heraus. - Wie gern diese Tiere allerdings den ganzen Zirkus mitmachen, ist fraglich. Sie schienen mir sehr lethargisch.
Unser Flug nach Buenos Aires dann war am frühen Abend des 29. Oktober geplant. Wir fahren früh genug los, um rechtzeitig am Flughafen zu sein. Schon als wir letztes Mal in Miami waren, hatten wir die grösste Mühe, die richtige Einfahrt zum Mietwagen-Verleih zu finden. Davor graut mir auch diesmal. Ebenso vor dem vielen Verkehr, der pausenlos auf den mehrspurigen Highways kursiert, die spaghettiartig in und um die ganze Stadt und den Flughafen geschwungen sind, und den Staus, die’s nicht selten gibt. Es wird immer aggressiver gefahren, so habe ich den Eindruck. Schon bei der Fahrt gegen Fort Lauderdale kamen wir an einen Unfall vorbei, wo ein Auto am Rand der Autobahn auf dem Dach lag. Dies war grad eben geschehen, Polizei und Feuerwehr erst angekommen. Auf dem Rückweg eine lange Auffahrtskollision, Krankenwagen und Co. - alle bereits vor Ort – Sirenengeheul - eine Riesensache.
Nun, am Anfang geht alles recht gut und flüssig, dann gibt’s den ersten Stau. Aber wir haben ja genügend Zeit eingeplant. Theo mit dem Navi in der Hand weist die Route, ich fahre und muss aufpassen wie ein Häftlimacher, nicht etwa auf eine der Toll-Roads zu geraten, denn wir haben keinen Transponder und die Bussen für wiederrechtliches Fahren auf einer dieser Mautstrassen sind beachtlich (it’s the law). Bei der Autovermietung (Dollar) hätten wir uns für 10 Dollar pro Tag dagegen versichern können, aber das ist eindeutig das Geld herausgeschmissen. Bei anderen Anbietern zahlt man nur die Hälfte, was immer noch viel ist, finde ich. Im Vergleich zu unserer Schweizer 40ig-fränkigen Vignette, die ein ganzes Jahr lang gültig ist…
Nach nur einmaligem Falschfahren, was fast eine Viertelstunde gekostet hat, gelangen wir endlich in die Nähe des Flughafens. Jetzt heisst es tanken. Tankstellen hat es genug in der Nähe, wir finden eine, bei der die Tanksäule nicht funktioniert. Bis das klar ist, vergehen ein paar lange Minuten. Und weiter sitze ich eine gefühlte halbe Stunde im Auto bei der Hitze, während Theo ich weiss nicht was alles mit dem Tankwart besprechen muss. Irgendein Problem gibt’s mit der Kreditkarte. Allmählich wird die Zeit knapp.
Noch fünf Kilometer bis zum Flughafen. Die Navi-Dame sagt, wir müssen rechts abbiegen. Diese Strasse ist aber gesperrt, wir fahren geradeaus. Sie denkt wohl, wir hätten nicht gut zugehört und will uns wieder dorthin zurückführen. Das sind die Sternstunden des Autofahrens mit dem Navi. Jetzt wird’s chaotisch. Hören wir auf sie, kommt’s nicht gut, höre ich auf Theo…
Ein Schild weist in Richtung Mietauto-Center. Diese Strasse nehme ich, allerdings fehlen dann weiterhin die Hinweisschilder (oder wir übersehen eines), also fahre ich wieder falsch und finde die Einfahrt nicht. So geht’s rund um den Flughafen herum, an all den Terminals, Taxis und Bussen vorbei; es ist zum Verzweifeln. – Wir sind wieder am Anfang und gliedern uns erneut in den Verkehr ein. Wieder finden wir uns auf einer Autobahn, wieder steht Toll-Road, die Strasse führt vom Flugplatz weg. Es ist ein riesiges Labyrinth. Ich nehm‘ die nächste Ausfahrt. Nach rechts ist’s wohl richtig, angeschrieben steht nichts. Jedenfalls kann ich grad noch vor einer Barriere anhalten, die auf einen Langzeit-Parkplatz führt. Theo steigt aus, um den Parkwärter um Rat zu fragen. Das funktioniert dann ENDlich. Er erklärt, wo’s lang geht. Auf dieser Strasse waren wir noch nicht, die ist ganz neu. Selten hab ich mich so über ein Strassen-Schild gefreut. Darauf steht: „Car Rental Center“. Dort geht’s dann rasch, das Auto können wir hinstellen, das Gepäck ausladen und die lange Reise bis zum Check-in mit Zug und ellenlangen Moving Walkways (Personenförderband auf Deutsch – was für ein Wort…) antreten. Erstaunlicherweise hat es wenige Passagiere, so dass uns die verbleibende Zeit bestens reicht, um alles Nötige zu erledigen, einzuchecken, die Koffer abzugeben (wir hätten problemlos je zwei Gepäckstücke à 23 kg abgeben und 10 kg als Handgepäck mitnehmen können) und die Security hinter uns zu bringen.
Wir kommen im Dezember wieder nach Miami. Ich freue mich jetzt schon auf das fröhliche Um-den-Flughafen-Kreisen…
Argentinien 1 30. Oktober – 9. November 2018
Córdoba / Villa Carlos Paz / La Cubrecita / Villa General Belgrano
Mitten in der Nacht kommen wir in Buenos Aires an. Der Blick aus dem Flugzeug auf das endlose Lichtermeer ist grandios. Nach Erledigung der Zoll- und Einreiseformalitäten, einem Terminalwechsel und zweieinhalb Stunden Aufenthalt besteigen wir das Flugzeug nach Córdoba. Es regnet - der erste Regen seit Wochen. Wie wir nach einem anderthalbstündigen Flug aussteigen, hat sich das Wetter beruhigt und die Temperatur ist angenehm warm, wenig über zwanzig Grad.
Unser zweiter Haustausch findet in Villa Carlos Paz statt, einem kleinen Städtchen, etwa fünfzig Kilometer westlich von Córdoba. Der Ort hat mit der Agglomeration ungefähr 80‘000 Einwohner und ist beliebt bei Touristen, aber wie wir bald feststellen eher bei einheimischen Touristen und Wochenendbesuchern aus Córdoba. Ich glaube nicht, dass diese Destination in einem europäischen, asiatischen oder amerikanischen Reisebüro angeboten wird. Obwohl – die Stadt ist hübsch gelegen am Rande einer Sierra und an einem stattlichen See, dem Lago San Roque, in dem man aber nicht baden kann, weil er kontaminiert ist.
Wieder haben wir ein Auto gemietet. Eigentlich hätten wir nach einer Stunde Fahrt dort ankommen sollen, aber ich glaub’s ja nicht: Jetzt geht die chaotische Fahrerei von neuem los.
Das Navi ist eingestellt, die Dame, wir nennen sie Rösi, ist parat und will uns in ihrer kühlen, unaufdringlichen und unpersönlichen Art den Weg zu unserem Ziel weisen. Aber das ist nicht so einfach, weil die Ringstrasse um Córdoba (ca. 1,5 Millionen Einwohner) herum auf Dutzenden von Kilometern eine einzige Baustelle ist. Wie wir später erfahren, waren zwei Bauphasen geplant. Die erste fand nicht statt, und nun werden beide gleichzeitig ausgeführt in und um die Stadt. – Dort also, wo Rösi hinwill, ist die Strasse entweder gesperrt oder überhaupt nicht mehr vorhanden. Man wird über Schotterpisten geleitet, manchmal nur einspurige, und die Hinweisschilder sind karg. Wir stellen Rösi ab, sie bleibt zwar cool, macht uns aber völlig konfus. Gefahren wird wie im Wilden Westen - dort wurde zwar eher geritten, wenn ich mir’s richtig überlege. - Rechts und links wird vorgefahren und die einzige Überlebenschance ist es, mitzuhalten und auch auf die Tube zu drücken. Das heisst, all die vielen Tempolimiten-Schilder, 40 und manchmal nur 30, gilt es geflissentlich zu übersehen und mit dem Strom zu fliessen, also mit möglichst 80 km durch die Gegend zu preschen, sonst wird man von Lastwagen überholt und so erst recht zum Verkehrshindernis. Daher passiert es uns auch hier mehr als einmal, dass wir ein Schild, auf dem Carlos Paz steht, zu spät sehen und ergo einmal mehr im Kreis herumfahren. Mein Orientierungssinn ist normalerweise recht gut, aber hier versagt er völlig. Es nervt gewaltig, wenn man wieder am selben Rotlicht anhält, an dem man eine Viertelstunde vorher bereits auf Grün gewartet hat.
Nach langer Irrfahrt sind wir endlich aus dem Gröbsten raus. Rösi darf wieder mitreden - wir sind auf dem rechten Weg. Wenn man endlich den Baustellenbereich verlassen hat, gibt’s nur eine direkte Strecke nach Carlos Paz, nämlich über eine gebührenpflichtige Autobahn. Aber kurz vor der Zahlstelle heisst es: rechts abbiegen. Fromm wie ein Lamm folge ich Rösis Anweisungen. - Zu spät kommt mir in den Sinn, dass ich dummerweise vergessen habe, im Navi auf meinem Smartphone die Mautstrassensperre aufzuheben, die ich vorher in Florida aktiviert hatte. – Auch das noch; ich könnte mich ohrfeigen. Wir geraten in eine militärische Sperrzone, müssen wenden und wieder in Richtung Baustellen zurückfahren, bis wir endlich auf der richtigen Strecke sind. – Völlig dumm gelaufen!
Aber damit nicht genug: Jetzt kommt das nächste Problem: Wir haben noch gar keine Pesos gewechselt. Wir hoffen, mit der Kreditkarte zahlen zu können. Geht nicht! - Zum grossen Glück aber wird der 1$-Schein akzeptiert, den ich im Hosensack habe; ich erhalte 2 Pesos zurück (etwa 5 Rappen); so geht die seltsame Reise weiter.
Zum dritten Mal innerhalb der letzten 24 Stunden fahren wir im Kreis herum im Quartier, wo das Haus, in dem wir die nächsten sechs Tage lang wohnen werden, zu finden sein muss. Rösi kommt selber nicht mehr draus, ist völlig verwirrt, will uns durch gesperrte Strassen locken, schickt uns steile Hänge hinunter, die noch nie etwas von Asphalt gehört haben und wo man, unten angelangt, kaum mehr wenden kann – es macht keinen Spass. Mit Hilfe der Google Offlinekarten schaffen wir das Kunststück schliesslich doch und erreichen Donatello 102 (Kein Wunder, gestaltete sich die Suche so tückisch: das Haus gegenüber hat eine völlig andere Adresse und Hausnummer). Eine halbe Stunde müssen wir warten, bis Sonia kommt und uns einlässt. Ihr Sohn, der auf uns gewartet hat, musste gehen, er hat viel früher mit uns gerechnet. Wir warten im Auto, das ist im Moment besser, denn es beginnt gerade in Strömen zu regnen und dann auch noch gleich zu hageln. Mir ist es „Wurst“, ich bin einfach froh, dass wir angekommen sind.
Die Tage in Villa Carlos Paz vergehen rasch. Das Wetter ist launisch. Manchmal regnet’s, dann wieder hat’s starken Wind, der die Wolken dann jedoch vertreibt und gleich darauf wird es ziemlich heiss.
An einem Tag erkunden wir das hübsche Tal, durch das der Rio San Antonio fliesst, ein Zufluss zum Lago San Roque. Man kann es sich am Ufer bequem machen, nur an wenigen Stellen ist das Wasser allerdings tief genug, so dass man sich zumindest liegenderweise ein wenig abkühlen kann.
Zu „unserem“ Haus gehört ein Swimmingpool. Den benutzen wir manchmal auch, aber die Idee, so nah an einem schönen See zu wohnen und nicht darin baden zu können, ist für mich fast unfassbar.
An unserem dritten Tag machen wir einen Ausflug nach Córdoba, obwohl mir die Fahrerei dorthin ein wenig zuwider ist. Aber die Hinfahrt lässt sich gut an, die Baustellen in dieser Richtung sind besser beschildert, und so dauert es nur grad eine Stunde bis ins Zentrum. Ein Parkhaus in bester Lage finden wir auch gleich.
Als Erstes müssen wir jetzt Geld wechseln. Theo findet einen Coiffeur, lässt sich die Haare schneiden und ich versuch mein Glück bei der Bank. In der ersten geb‘ ich sofort auf, wie ich sehe, dass dort so viele Menschen herumsitzen und Schlange stehen, dass es wohl Stunden dauern würde, bis die Reihe an mir ist. In der zweiten erklärt mir ein Polizist, ich könne hier so oder so kein Geld wechseln, die Banken würden nur Dollars von Einheimischen akzeptieren. Aber er gibt mir den Tipp mit den öffentlichen Geldwechselbüros. Davon gibt es zwei in nächster Nähe. Und das klappt dann endlich. Wie mühsam ist es, sich in einem Land ohne die entsprechende Art Cash zu bewegen. In Villa Carlos Paz haben wir natürlich auch versucht zu wechseln, aber dort fanden wir nur Geldautomaten, keine Wechselstuben, und die meisten von denen wechseln nur für einen Betrag von umgerechnet höchstens 50 Franken. Versuchte ich 300 Dollar einzutippen, haben mich die Geräte grad ausgelacht, so zumindest kam es mir vor, und sogleich meine Karte höhnisch wieder ausgespuckt. Ich hab dann trotzdem einen Kasten gefunden, der ein wenig grosszügiger war, was die Ausgabe betrifft, so dass das höchste der Gefühle war, 3000 Pesos (ca. 100 CHF) beziehen zu können. Eigentlich hätte dieser Betrag an jenem Tag tatsächlich einen Wert von etwa 80 Franken gehabt, aber bezahlen musste ich dafür 100 Franken, wie ich bei der Kontrolle meines Kontos am Abend feststellte. 20 % Kommission und Gebühren – das ist ja kompletter Wucher!
Für zwei 100-$-Noten erhalten wir schliesslich eine riesige Beige schmutziger 20-Pesos-Scheine zu einem angemessenen Wechselkurs und sind froh, dass wir endlich Kleingeld haben.
Wir schlendern durch die Strassen, sehen uns die alten Bauten der Jesuiten an, die Kathedrale, die Uni (eine der ältesten und grössten in Lateinamerika) und etliche andere Gebäude, die unter UNESCO Welterbe stehen. Die Stadt ist sehr belebt, hat einen ähnlichen Charakter wie die meisten südamerikanischen Städte, die wir bisher besucht haben - mit dem zentralen Platz im Kern, der Plaza de Armas oder dem Zócalo, um die oder den herum sich die Hauptkirche und die meisten der historischen Gebäude gruppieren.
Viele der Fussgängerzonen sind hübsch angelegt, die Läden allerdings nicht besonders vielfältig und einladend. Wieder und wieder trifft man auf dieselben Schuh- und Kleiderläden, das Angebot ist eher langweilig, die Qualität „nothing to write home about“. – Gerne hätte ich irgendwelche handwerklichen Artikel gekauft oder zumindest angeschaut, aber der Handwerkermarkt findet nur an den Wochenenden statt und Läden dieser Art haben wir keine gefunden. Wie immer bei einer Stadtbesichtigung legt man fast unbemerkt viele Kilometer zu Fuss zurück, so auch hier; wir kehren mehr als einmal ein und nehmen anschliessend gegen fünf den Weg zurück nach Carlos Paz unter die Räder, Theo mit einer neuen „Frise“ und ich mit leeren Einkaufstüten. Es ist Hauptverkehrszeit und mir schwant schon Fürchterliches.
Rösi gibt ihr Bestes, weist uns rechts und links und wieder rechts und wieder links und nach einer Stunde chaotischer Odyssee sind wir endlich am Stadtrand angelangt. Durch den Baustellengürtel werden wir diesmal besser geschleust; wir erreichen die Mautstelle, die Autobahn und sind nach insgesamt zwei Stunden Fahrtzeit um sieben Uhr zurück in Carlos Paz.
Auch dort hat’s natürlich ein Stadtzentrum, ohne Plaza de Armas allerdings, der Ort wurde erst im Jahr 1914 gegründet. Aber es gibt eine Ladenstrasse, wo ziemlich viel läuft, jedenfalls gegen Abend. Vor allem junge Leute sind unterwegs. Am oberen Ende dieser Avenida steht auf einem kleinen Platz eine grosse Kuckucksuhr. Echt jetzt? - Oh je, wie kitschig. Sagenhaft!
Die Läden geben leider auch nicht viel her, ich wüsste nicht, was ich wo kaufen möchte. Ebenso wenig laden die vereinzelten Restaurants in dieser Gegend zum Verbleiben ein. – Was mich allerdings beeindruckt hat: Wenn man mit Leuten ins Gespräch kommt, merkt man sogleich: Alle lieben diesen Ort!
Eine andere Sehenswürdigkeit ist die Puente Uruguay, eine Brücke über den südlichen Teil des Sees. In der Nacht wird sie illuminiert – abwechslungsweise lila, türkis, hellblau, weiss und pink. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, muss ich zugeben.
Von der Uferpromenade aus kann man dieses „Spektakel“ sehr schön beobachten. Jener Teil der Stadt hat mir am besten gefallen. Man kann gemütlich spazieren und es hat etliche Restaurants, die schön gelegen sind, hübsch eingerichtet und feine Speisen servieren. Fleisch, Fleisch und nochmals Fleisch muss es ja sein in Argentinien. Mit der echten Parillada jedoch können wir uns leider nicht besonders anfreunden, denn sie besteht aus vielen Fleischstücken, die ich eher als Schlachtabfälle bezeichnen würde, so dass mir schon vom Anblick schlecht wird. Blutwürste, Magenwände, Eingeweide liegen auf dem Grill - da sind mir die köstlichen Empanadas Criollas doch viel lieber, auch das Provolone (eine Art Raclette vom Grill mit Tomatenscheiben drauf). – Qualitativ bessere Fleischstücke kann man natürlich auch bestellen. Sie sind schmackhaft, aber oft mit relativ viel Fett versetzt. Die richtig guten und zarten Stücke, so haben wir gelesen und auch gehört, sind für den Export bestimmt…
Der Wein ist ein anderes Thema. Wir lieben ja den Malbec, und Argentinien produziert bekanntlich eine Unmenge davon. Auch die Preise machen Freude. Für sechs bis zehn Franken findet man in der Regel eine grosse Auswahl an Rot- und Weissweinen auf der Speisekarte.
Wie ich bei unserem ersten Abendessen in diesem Land den Kellner frage, welchen er empfehlen würde, bringt er uns einen besonders guten, der nicht auf der Karte aufgeführt ist. Natürlich hat er sofort bemerkt, dass wir Ausländer sind und vielleicht auch einen teureren Tropfen bezahlen können. - Ja, das können wir verantworten. Die zwanzig Franken lohnen sich…
Ein anderes Weinerlebnis haben wir in einem japanischen Restaurant, wo wir zur Abwechslung statt Carne mal Sushi essen gehen. Wir haben beschlossen, diesmal vernünftigerweise nicht eine ganze Flasche Wein zu bestellen, sondern nur je ein Glas (in einem solchen seltenen Fall bestellt sich Theo zuvor ein Bier, damit nicht etwa Entzugserscheinungen auftreten); ich muss ja dann auch immer noch die zehn Kilometer heimfahren in die Calle Donatello 102.
Die Kellnerin öffnet die Flasche und schenkt in die beiden grossen Copas ein - mehr und mehr (nicht wie daheim…). Ich wundere mich schon über ihre Grosszügigkeit. Sie dann plötzlich auch, wie sie merkt, dass nur noch knapp ein Deziliter Wein in der Flasche zurückbleibt. Diese „Fast-Flasche“ fungiert auf der Rechnung mit knapp fünf Franken.
Übrigens waren wir die einzigen Gäste in dem Lokal, weil wir bereits um halb neun auf der Matte standen. Zu dieser frühen Stunde geht ja niemand zum Abendessen - ausser Touristen mit ihren seltsamen Essensgewohnheiten. – Einen Vorteil hat das aber trotzdem: Man hat die ganze Kellnerschar und Küchencrew für sich alleine. Volle Aufmerksamkeit und bester Service!
Zweimal essen wir zu Hause. Das Stück Fleisch, ein Quadril, vom Metzger empfohlen, reicht für zwei Mahlzeiten. Es ist schön zart, wiegt mehr als ein Pfund und hat vier Franken gekostet.
An unserem letzten Abend in Carlos Paz laden uns Sonia und Carlos zum Essen auswärts ein. Sie wohnen in Córdoba, scheuen den Weg zu uns nicht, tun sich offenbar auch mit dem Baustellengewirr nicht schwer und holen uns ab. Neun Uhr abends ist es, noch etwas früh fürs Nachtessen, aber bis wir am Sonntagabend ein passendes Restaurant gefunden haben, ist es halb zehn geworden. Es wird ein gemütlicher Abend und wir freuen uns natürlich, unsere HomeExchange-Tauschpartner nun auch persönlich kennenzulernen. Die beiden sind ein liebenswürdiges Ehepaar, seit dreissig Jahren verheiratet und haben drei erwachsene Kinder.
Mit Carlos habe ich unseren Tausch per Email organisiert, jetzt sehen wir uns also zum ersten Mal. Er ist Bauingenieur und arbeitet momentan in Iguazu (Umbau des Hotels Melia). Wir fliegen im Dezember dorthin und werden ihn erneut treffen.
Das ist eine der vielen absolut fantastischen Seiten unserer Haustausche: Man lernt Einheimische kennen und erfährt von ihnen viel über Land und Leute, Gebräuche und den Alltag. Mit manchen unserer Tauschpartner sind wir nach wie vor im Kontakt und es sind sogar Freundschaften entstanden. Einige von ihnen haben wir mehr als einmal getroffen; mit Eva und Ken beispielsweise waren wir im Sommer auf einer siebenwöchigen Safari im südlichen Afrika.
Da wir nicht nur Städte und Strände erleben, sondern auch ein kleines Bisschen vom Landesinnern sehen wollen, habe ich uns eine kurze, viertägige Rundreise zusammengestellt, die am 9. November in Córdoba endet, von wo aus wir nach Uruguay fliegen werden, nach Punta del Este.
Im Internet habe ich recherchiert und fand im Norden von Córdoba das Mar Chiquita (ist auf die Fläche bezogen der grösste See Argentiniens und der zweitgrösste See Südamerikas nach dem Titicaca-See. Er ist zudem der fünftgrösste abflusslose See der Welt. Sein Wasser ist salzhaltig).
Dorthin sollte unsere Reise führen und Hotels hatte ich bereits gebucht. Als ich Carlos meine Pläne mitteilte, meinte er, wir sollten eher einen Ausflug nach Süden in die Berge unternehmen, in die Gebiete der Schweizer- und der deutschen Siedler, das sei sehr viel interessanter und schöner. – Seinem Rat folgend hab ich umgebucht. Mich nahm ja auch wunder, wie die europäischen Auswanderer dort leben, wie’s aussieht und was daraus geworden ist. – Ja, und da haben wir nun eine Nase voll davon gekriegt. In der Gegend des Mar Chiquito hätten wir während dieser Tage schönes, warmes Wetter angetroffen, bei uns im Süden hingegen, in Calamuchita und in der Sierra, hatten wir es mehr mit Regen und Nebel zu tun und mit Temperaturen von nur knapp zwanzig Grad. – Ganz kurz nur zeigte sich die Sonne am blauen Himmel, dann verleidete es ihr. Vom Wetter her hätten wir gerade so gut daheim bleiben können, aber eine lustige Erfahrung war unsere „Exkursion“ trotzdem.
Die Fahrt nach La Cumbrecita (vor allem Schweizer Auswanderer haben sich dort niedergelassen) sollte gemäss Google etwa zweieinhalb Stunden dauern. Sie führt durch die Sierras de Córdoba und auf halber Strecke etwa befindet sich ein Ort namens San Clemente. Dort, hatte ich vorgeschlagen, könnten wir einen Halt machen und einen Cappuccino trinken. Kaum haben wir Carlos Paz und seine Vororte verlassen, steigt die Strasse an, es geht bergauf, man ist urplötzlich ganz alleine unterwegs und fährt durch schönes, wildes und völlig unbewohntes Gebiet.
Weit über die Hügelketten hinaus blickt man auf eine grüne, liebliche Landschaft. Wir staunen über die gut ausgebaute Strasse, die durch diese menschenleere Gegend führt. Unser Navi wollte uns unbedingt eine andere Strecke aufschwatzen, Google beim ersten Versuch ebenfalls – ich vermute, dass diese Landstrasse völlig neu gebaut wurde und auf den Karten noch nicht verzeichnet ist. Natürlich haben wir uns zuvor über den Zustand der Route erkundigt, denn unbefestigte Strassen will ich unserem kleinen Mietauto nicht zumuten. – Nur an einem Ort, kurz vor San Clemente, denke ich, nun ist’s so weit, es gibt nichts anderes, wir müssen umkehren und den ganzen Weg zurückfahren. Da schlängelt sich die Strassen steil zu einem Fluss, dem Rio San José hinunter, und die Brücke, die darüber führt, steht völlig unter Wasser. Verschiedene Schilder warnen am Strassenrand: „Atencion! – Vado profundo peligro!“ Daneben, ziemlich erhöht, sind mehrere Arbeiter dabei, eine neue Brücke zu bauen. Ich halte an, kurble (ja, das Auto ist noch mit der guten alten Handkurbel ausgestattet) das Fenster herunter und rufe den Männern zu, ob man durch die Fluten durchkomme. Ja, meinen sie, erst mehr rechts fahren, dann eher nach links; so sollte es gehen. Ich kann’s mir nicht vorstellen, habe in Sekundenschnelle Visionen vom steckengebliebenen oder gar weggeschwemmten kleinen Ford, der mitsamt uns und unserem Gepäck in die Tiefe saust. Theo ist da zuversichtlicher und die Arbeiter schauen jetzt ja alle zu („Frau am Steuer“)… Ich nehme also all meinen Mut zusammen und fahre im ersten Gang durch die reissenden Fluten. - Ok, ok, so kommt’s mir jedenfalls vor, in Wirklichkeit war’s wohl nicht ganz so dramatisch, denn wir kommen heil und ganz auf der anderen Seite an und fahren ungeschoren den Hügel hinauf. Eine Kaffeepause hätten wir nun verdient, aber daraus wird nichts. Die Siedlung San Clemente hat gar keinen richtigen Dorfkern, besteht nur aus einer Reihe von alleinstehenden Häusern, an den meisten von denen zudem ein Plakat angebracht ist, auf dem VENDO steht. Kein Wunder – wer will schon in einem so abgelegenen Kaff wohnen?! Irgendwo stehen zwei gesattelte Pferde herum und einen Mini-Supermarkt gibt’s auch. Dort erkundigen wir uns, ob man irgendwo Kaffee haben könne. Der Mann lacht und sagt, es gäbe wohl ein Restaurant, das sei aber nur am Wochenende offen. Erst in vierzig Kilometern befinde sich die nächste Gaststätte. – Was will man da machen? – Weiterfahren natürlich. In Rearte angekommen, finden wir sogar auf Anhieb die Touristeninformation. Diese aufzuspüren war allerdings nicht schwer, ist das kleine Dorf doch kaum mehr als 500 Meter lang. Die junge Frau gibt uns Auskunft, wo wir ein Restaurant finden würden, das am Montag offen hat - nur eines, alle anderen seien geschlossen und im ehemaligen (historischen) Krämerladen, der Pulpería, einzukehren, käme sowieso nicht in Frage, da würden nur Männer verkehren… Aber den Tio Edmundo fänden wir direkt ausserhalb der Altstadt (etwa zwanzig Häuser aus dem Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts rechts und links der einzigen Strasse, die durch den alten Dorfteil führt). Wir kehren ein. Wohl wären wir nie dort „gelandet“, hätten die anderen Lokale offen gehabt. Aber wir haben den (erzwungenen) Entscheid nicht bereut. Der witzige Besitzer, eben der Tio Edmundo, begrüsst uns mit der Frage, ob wir reserviert hätten. Das Lokal ist absolut leer nota bene. Und so fährt er weiter mit seinen Spässen. Er kommt an unseren Tisch, kniet sich neben uns nieder wie ein untertäniger Diener und beschreibt, was er zum Essen anbieten könne. Ich frage ihn, ob diese Stellung bequem sei oder ob er nicht lieber einen Stuhl nehmen wolle. Er erklärt daraufhin, dass, so lange er auch wieder aufstehen könne, seine Knie noch in Ordnung seien, er also noch nicht alt und gebrechlich sei. – Ich denke an meine bevorstehende Knieoperation…
Tatsächlich kommen bald noch andere Gäste in die gute Stube, die durchs gleiche Prozedere durchmüssen. Für die hat er sich zusätzlich etwas Spezielles einfallen lassen: Er zieht sich eine pinkfarbene Perücke über, während er ihre Bestellungen aufnimmt – ein richtig lustiger Onkel! - Wir teilen uns einen Teller Noquís. Das sind hausgemachte Gnocchi an einer feinen Sauce. Brot und Leberwurst gibt’s vorher gratis.
Auf dem kurzen Spaziergang zurück zum Auto sehen wir, dass in einem der Häuser die Erziehungsdirektion untergebracht ist. – Ein Minihaus und ganz in Gelb. Einstöckig. Das finde ich richtig cool. Verglichen mit derjenigen in Bern…
Wir fahren weiter nach La Cumbrecita. Der Ort befindet sich auf 1400 Metern über Meer, liegt in einem Talkessel, umgeben von Hügeln und einer lieblichen Landschaft mit Tannen und Fichten, ähnlich wie in der Schweiz oder in Bayern. Das Hotel, das ich gewählt habe, ist am Hang gelegen mit schönem Blick über die Gegend. – Bis man aber oben ist… Der steile und enge Weg dorthin führt über eine katastrophale, steinige Strasse, die gespickt ist mit tiefen Löchern oder besser gesagt Spalten und Furchen, und weil es geregnet hat, ist sie zudem noch glitschig. Mit unserem kleinen Ford Ka gelingt es mir in dieser Situation problemlos, den Motor abzumurksen. Wie es eigentlich nicht seine Eigenart ist, kommentiert Theo augenblicklich meine Fahrweise (without missing a beat), ich nerve mich und es passiert gleich wieder. – Klar steige ich aus und lasse ihn ans Steuer. – Und er schafft‘s natürlich auf Anhieb…
Leider zeigt sich das Wetter nicht von der besten Seite, es regnet leicht und Nebel ist ebenfalls ein Thema.
Nur etwa zwanzig Minuten lang zeigt sich die Sonne; es reicht grad zu einem kurzen Spaziergang in der Hotelanlage und zu ein paar einschlägigen Fotos, dann zieht der Nebel über die Hügel hinunter und das Dorf ist nicht mehr zu sehen.
Wir nehmen’s aber gemütlich. Es gefällt uns sehr hier, von unserem grossen, behaglichen Zimmer im Châlet-Stil aus geniessen wir die Aussicht trotzdem, man kommt sich vor wie in einem Wolkenpalast; wir spielen Karten, lesen ein wenig und gehen dann um halb neun zum Nachtessen. Theo bestellt Spätzle mit Hirschgoulasch, ich entscheide mich für eine Forelle, die ihr kurzes Leben in einem der nahegelegenen Seen gefristet hat, um sich schliesslich auf meinem Teller wiederzufinden (diese Wendung ist wohl ein bisschen daneben, ich denke ja nicht, dass ihrerseits Absicht dahinter steckte).
Um fünf Uhr früh wecken uns die Vögel, die fröhlich ihr Frühlingsgezwitscher vom Stapel lassen. Ein Fuchs schleicht ums Haus. Der Nebel hat sich nicht verzogen; wir schlafen weiter.
Nach dem Frühstück checken wir aus und besichtigen den verkehrsfreien Ort, wo es, obwohl nicht Hauptsaison, etliche Touristen hat. Ich glaube, die meisten sind Einheimische, denn ausser dem seltsamen Spanisch, das man hier in Argentinien spricht, haben wir keine andere Sprache gehört.
Ganz sicher haben die Menschen hier einen ausgesprochen ausgeprägten Sinn für ausgesprochen ausgeprägten Kitsch. Kein Haus, Châlet richtigerweise, wo’s nicht irgendwelche lustigen Trolle, farbenfrohe Zwerge, herrliche Blumenverzierungen oder was auch immer für Figuren hat. - Es könnte einem schlecht werden!
Das allererste Restaurant, an dem man vorbeikommt, wenn man die autofreie Zone betritt, heisst „Prosit Biergarten“. – In dem Stil geht’s weiter.
Vor allem Schweizer und Deutsche haben sich hier niedergelassen und so findet man auf Schritt und Tritt Hunderte von übelsten Souvenirs, in die Schweizer- und deutschen Wappen eingeprägt sind (oder Fliegenpilze und Zwerge in Anlehnung an die Gebrüder Grimm. Wenn die wüssten…). Wer nur kauft all das Zeug? - Ich kann’s mir nicht vorstellen, denn ein Laden verkauft denselben Ramsch wie der nächste.
Schweizerisch scheinen vor allem Bierhumpen zu sein und Kuckucksuhren. – Wusste ich gar nicht. – Lederhosen auch.
Aber eine Tasse mit dem Berner Wappen drauf müssen wir natürlich doch auch kaufen, das schon. Eine solche würden wir zu Hause ja wohl kaum finden.
Der Verkäufer freut sich, wie er merkt, dass wir Schweizer sind. Sein Vater sei aus dem Thurgau, lässt er uns wissen. Aber kein einziges Wort Schweizerdeutsch spricht er. Es fehle ihm die Praxis, meint er.
Unser nächstes Ziel, wo wir zwei Nächte gebucht haben, ist Villa General Belgrano (VGB), auch dies ein putziger Ort, den man gesehen haben muss, fand Carlos.
Vorher aber machen wir noch einen kurzen Abstecher nach Villa Berna, einer Siedlung, die nur ein paar wenige Kilometer weit weg von La Cumbrecita gelegen ist. Laut Wikipedia soll es dort nur gerade 135 Einwohner haben. Trotzdem - ich hätte mir vorgestellt, dort einen Kaffee zu trinken oder zumindest einen kurzen Spaziergang zu machen, aber es gibt überhaupt keinen Dorfkern, kein Restaurant, einfach nichts. Wir erinnern uns an San Clemente - allmählich sollten wir ja wissen, wie solche Dörfer „ticken“. Zwei-, dreimal zeigt ein Wegweiser zu einer abgelegenen Unterkunft, ein paar Häuser sieht man von der Strasse aus versteckt hinter irgendwelchem Dickicht. – Das ist alles.
Weiter geht’s; wir überqueren eine Brücke. In der steilen Kurve danach wird auf mehreren Schildern angepriesen, dass es unten beim Fluss einen „Mirador“ gäbe, einen Aussichtspunkt mit Blick auf einen Wasserfall. Getränke, Eiscremes, und so weiter.
Wir fahren auf den verlassenen Parkplatz und treffen eine Art Geisterort an. Überall Schutt und Dreck und ein paar verwahrloste Hütten in übelstem Zustand sind alles, was übrig geblieben ist sowie eine Reihe von einstöckigen Hütten, die aussehen, als ob die Bauleute mitten in der Arbeit abgehauen wären. Werkzeuge und Baumaterial liegen herum. Die kleine Aussichtsplattform steht zwar noch, aber der Blick von dort ist nicht überwältigend. Kaputte Grillstellen, Abfall und dann doch noch der „Wasserfall“, der nur wenige Meter über ein paar grosse Felsbrocken „stürzt“. Oben die Brücke, über die wir soeben gefahren sind. - Was wohl die kleine Jungfrau Maria aus Plastik von all dem hält, die in der Nähe auf einem bescheidenen Holzpodest fixiert das Chaos überblickt?
Die Fahrt nach Villa General Belgrano dauert nicht lang. Leider herrscht noch immer dichter Nebel und die Landschaft zeigt sich grau in grau. Wir finden unser Hotel und ruhen uns erst mal aus. Wenigstens ist es nicht kalt, das hätte sonst den Eindruck erweckt, viel anders als zu Hause sei es nicht.
Ein Spaziergang durchs Dorf macht klar, dass wir in einem Städtchen gelandet sind, wo vor allem deutsche Einwanderer ihr (Un)wesen getrieben haben. So deutsch findet man’s nirgends in Deutschland. Alles dreht sich ums Bier, vor den Kneipen stehen lebensgrosse, farbige Figuren aus Kunststoff mit Bierbäuchen und Bierhumpen in der Hand.
Die Speisekarten sind überall mehr oder weniger die gleichen. Sauerkraut kann man haben, Knackwürste, Frankfurter, Spätzle, Strudel zum Dessert und so weiter. In den zahlreichen Läden gibt’s Souvenirs „vom Feinsten“, ich zähl sie nicht auf.
Mitten im Zentrum gibt’s einen Turm, von dem aus man eine prächtige Rundum-Aussicht hat aufs Dorf und die Sierra im Hintergrund. Den besteigen wir an unserem zweiten Tag und kaum sind wir oben an der langen Wendeltreppe angelangt, beginnt die Sonne zu scheinen. Endlich wieder mal! – Ein kurzer Spaziergang entlang des Baches liegt daher auch noch drin und sogar eine Siesta und ein Lesestündchen an der Sonne im Garten unseres Hotels („Blumig“ heisst es übrigens).
Bei schönstem Wetter treten wir nach zwei Übernachtungen die Rückfahrt nach Córdoba an. Die Strecke führt an einem See entlang. Bei einem Campingplatz halten wir an, um uns die Füsse ein wenig zu vertreten. Ein friedlicher Ort, idyllisch, im See kann man baden, er scheint sauber und klar. Ausser einem Gärtner und einer jungen Frau mit Kind, die offenbar zum Rechten schaut, ist niemand dort. Sie erklärt uns, man könne hier auch Unterkünfte mieten. Ich verzichte gern. Die angebotenen Camper laden in keiner Weise zum Verweilen ein. Am Wochenende sei alles immer voll besetzt und in der Hauptsaison (Januar und Februar) sowieso.
Weiter führt die kurvenreiche Route in die Hügel hinauf und man hat einen grossartigen Blick auf den See. Leider hat’s auch viel Verkehr. Trotzdem gelingt es zwei-, dreimal anzuhalten und die Aussicht zu geniessen. Inzwischen ist es sommerlich heiss geworden. Wir lieben es!
Ein Zwischenziel erreichen wir in Alta Gracia. Auch dort gibt es eine „Manzana Jesuítica“, ein ganzer Gebäudekomplex mit Kirche, Turm und Museum, den die Jesuiten im 17ten und 18ten Jahrhundert erbaut haben. Das kommt uns spanisch vor. Weniger das Eiscreme, das an ein Mövenpick-Cornet erinnert, nur viel grösser ist und dafür wesentlich billiger.
Bevor wir uns auf den vorläufig letzten Abschnitt unserer Reise machen, besuchen wir das Che-Museum, das Haus in dem Che Guevara aufwuchs. Es ist ein hübsches Gebäude in einem Aussenquartier der Stadt und ich finde, der Besuch hat sich gelohnt. Zwar kennen wir die Fotos von unserer Kubareise zur Genüge, aber trotzdem, die Stätte hat einen besonderen Charme.
Eine weitere Stunde dauert’s, bis wir in Córdoba, mitten in der Stadt ankommen, wo ich ein kleines Apartment gemietet habe, gross genug, so dass wir genügend Platz haben, unsere Koffer aus- und umzupacken. Die Wohnung befindet sich im neuen Teil der Metropole und diesmal kommt es uns vor, als ob wir in einer völlig anderen Stadt gelandet wären als beim letzten Besuch, wo wir vor allem in der Altstadt herumschlenderten. Hier herrscht reges Leben, massenhaft Verkehr, ein Mini-Supermercado neben dem anderen bietet 24/7 Waren an, Restaurants hat’s an jeder Ecke und in jeder Art, die meisten nur kleinste Imbissstuben oder Take-Aways. Eng aneinandergereiht sind moderne mehrstöckige Wohnblöcke und genau in so einem sind wir untergebracht. Gebucht hab ich bei Booking.com, aber die Vermietung erinnert eher an Airbnb. Kurz vor dem Hauseingang, wo wir unsere Unterkunft vermuten, finde ich glücklicherweise am Randstein eine Parklücke, wo wir aus dem Verkehrsgewühl ausscheren und kurz anhalten können. Wir stehen vor Haus Nr. 651. Die Adresse, die wir suchen, ist 625, sollte also ein paar Häuser weiter weg sein. Das ist jedoch nicht so. - Gleich nebenan steht Diego, der überaus freundliche Besitzer, schon parat, (so funktioniert das mit den Hausnummern – nicht eben praktisch), weist uns ein und wir zirkeln übers viel begangene Trottoir hinunter in die enge Tiefgarage. Er zeigt uns die Wohnung und übergibt uns die Schlüssel. Eine kleine Küche ist vorhanden, ein Wohn-, Schlaf- und Badezimmer. Alles ist sauber, zweckmässig, sogar ganz nett eingerichtet, es fehlt an nichts – ich bin zufrieden mit meiner Wahl.
Zu Fuss, es ist überhaupt nicht weit, spazieren wir am Faro vorbei ins MEC (Museum Emilio Caraffa) und schauen uns auf vier Ebenen Werke südameikanischer Künstler an. Der Eintritt ist gratis, denn der Lift funktioniert nicht.
Ein Weg führt durch den Bicentario Park, vorbei an grossen, farbigen Ringen, dann entlang des Parque Sarmento zurück in die Häuserschluchten.
Nach einer kurzen Siesta (die muss einfach sein, wenn man mit Theo unterwegs ist), machen wir einen Spaziergang durch unser Quartier by night und suchen ein passendes Restaurant in der Nähe. Im „Ciento Volando“ werden wir fündig. Auch diese Bar ist in einem Hochhaus untergebracht. Sie ist zweistöckig und oben auf einem Mini-Balkon hat’s noch einen freien Tisch mit zwei Stühlen – wie gemacht für uns. So können wir auf die Strasse hinunterblicken und auf das gegenüberliegende Restaurant, sehen Gäste und Autos kommen und gehen, den Pizzakurier zirkulieren und halten uns die Ohren zu, wenn ein wildgewordener Motorrad-Fahrer nach dem anderen durch die Gegend rast. Von diesem Tisch aus wir’s nicht langweilig. Wir sind froh, nicht irgendwo drinnen sitzen zu müssen, denn es ist noch immer fast 30 Grad warm. Ein sehr netter junger Kellner bedient uns, wir bestellen beide Pasta und dazu eine Flasche Wein – ein perfekter letzter Tag und Abend in Córdoba.
Der nächste Tag wird anstrengend: Flug nach Buenos Aires, mehr als sechs Stunden auf dem Flughafen warten bis zum Weiterflug nach Uruguay. - Zu dem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, dass es noch viel mühsamer werden wird als angenommen.
Am Freitag, 9. November, reisen wir frühzeitig ab. Die schlechten Erfahrungen, die wir mit den zahllosen Baustellen gemacht haben, hoffen wir, nicht nochmal erleben zu müssen, aber man weiss ja nie. Diesmal geht’s aber recht zügig voran, obwohl die Art und Weise, wie gefahren wird, extrem anstrengend ist. Viele Autos fahren mit so geringem Abstand einander hinterher, wie wenn sie zusammengebunden wären. Kein Wunder, gibt es zahlreiche Unfälle. Grad ist die Polizei vor Ort und kümmert sich um das, was noch aufzuräumen und zu erledigen ist: Ein Wagen steht auf dem Dach, der andere ist total zerquetscht und wohl nur noch etwa halb so gross wie kurz vorher. Ein paar Kilometer später können wir einer Auffahrtskollision ausweichen. Aber wir schaffen die Strecke zum Flughafen in einer knappen Stunde, ohne uns ein einziges Mal zu verfahren.
Der Flug nach Buenos Aires ist nur kurz, die Wartezeit auf die Verbindung nach Punta del Este umso länger. Wir kommen sogar fast eine halbe Stunde früher an als geplant, somit stehen uns sechseinhalb lange Stunden zur Verfügung, das Gate zu wechseln, etwas zu essen und zu trinken und ansonsten die Zeit totzuschlagen. Um halb zehn Uhr hätte es weitergehen sollen - die Abflugzeit wird jedoch um eine Stunde verschoben. Dabei aber bleibt es nicht. Die Putzequipe macht schon langsam Feierabend, das Restaurant schliesst wohl auch bald, auf der Info-Tafel steht, man solle sich beim Personal melden. Das verheisst nichts Gutes. Das mühsame Herumstehen und auf Informationen Warten nimmt erst ein Ende, wie neue Boarding-Cards ausgestellt werden und wir um Mitternacht endlich einsteigen und weiterfliegen können. Somit waren wir genau neun Stunden lang am Warten für einen knapp einstündigen Flug. – Ein langer Tag. - Kurz vor ein Uhr morgens kommen wir an.
Uruguay 10. – 22. November
Punta del Este / Montevideo / Colonia del Sacramento / Nueva Helvetia / Florída / 25 de Agosto / Minas / Villa Serrana / Garzon / Punta Bellena
Nach diesem mühsamen Freitag, wo wir das Warten gelernt haben, kommen wir kurz vor ein Uhr morgens in Punta del Este an. Der wortkarge Zollbeamte scheint nicht sehr angetan von der Tatsache, dass er um diese Zeit seinen Job noch machen muss. Zumindest macht er ihn schnell, so dass die lange Schlange vor dem Schalter relativ rasch passieren kann. Das ganze Personal im Duty-Free-Shop durfte offenbar ebenfalls noch nicht heim. Sie stehen alle erwartungsvoll herum, kein einziger Passagier allerdings interessiert sich für einen Kauf. Nicht einmal Theo zieht’s zum Whisky-Gestell. Erstaunlich! - Und der Typ vom Autoverleih hat auch ausgeharrt. Er hatte ja die Flugnummer und zudem hab ich ihm eine Mail geschrieben, sobald wir von der Verspätung wussten. Auch ins Hotel rief ich an, um zu sagen, dass wir wohl nicht vor zwei Uhr auftauchen würden. Zum Glück hatte ich in weiser Voraussicht zu Hause schon ein Hotel gebucht, das einen 24-Stunden-Service anbietet und nur ein paar Kilometer vom Flughafen entfernt ist.
Wir finden es auch relativ rasch, obwohl unsere beiden Navi-Güezis (Sygic und Google) entweder streiken oder einfach zu müde sind, um uns einwandfrei den Weg zu weisen. Auf Google sehen wir wenigstens, wo wir sind, und stumm läuft der blaue Punkt auf dem Display mit uns zum eingegebenen Ziel auf der Karte mit. Sehr froh bin ich, wie wir endlich ankommen und uns eine junge Dame gleich entgegenkommt, uns freundlich begrüsst und mit den Koffern hilft. Einchecken sollen wir dann am Morgen früh, meint sie, jetzt aber vorerst mal gut schlafen. – Das tun wir.
Nach einem kargen Frühstück machen wir uns auf zum nächsten Haustausch. Nach nur wenigen Kilometern sind wir dort. Das Google-Rösi hat auch gut geschlafen und ist wieder bereit, uns zum Haus zu führen, das keine Adresse hat, nur eine Koordinate. Ein Punkt auf der Karte genügt, uns richtig zu leiten. Das Haus mit seinem Strohdach gefällt uns gut. Marisol, die Frau, die sich um alles kümmert, wenn die Besitzer nicht da sind, kommt auf ihrem Scooter dahergebraust, öffnet Tor und Türen und zeigt uns alles.
Auf den ersten Blick scheint alles gut eingerichtet zu sein, aber wir sind es gewohnt bei unseren Haustauschen, dass gerade bei Ferienhäusern, die nicht allzu oft bewohnt werden, einiges ansteht, das man flicken oder ersetzen sollte.
So kann man hier die Waschmaschine nicht benutzen, weil die Schliessvorrichtung abgebrochen ist, die Birne vom Nachttischlämpchen funktioniert nicht, Abwaschmittel ist keines vorhanden (Abwaschmaschine leider auch nicht), die Gläserauswahl ist eher beschränkt und so weiter. Aber das sind alles Kleinigkeiten. Der Einkaufzettel, den ich auf dem Smartphone immer schon parat habe, wird um ein paar Posten ergänzt (frische Abwaschlappen, Servietten, Salz, Öl und Essig, Rüstmesser etc.), und schon lässt es sich wunderbar hantieren. Die Waschmaschine natürlich…
Was sehr oft „ein Stein des Anstosses“ ist, sind die Bratpfannen. Sie sind in vielen Küchen so sehr verkratzt und verbeult, dass ein Braten darin nicht mehr in Frage kommt. Sie wären lediglich noch dafür geeignet, einem eines über den Schädel zu ziehen (wahrscheinlich lese ich zu viele Krimis, merke ich gerade, dass mir so eine Anwendungsweise überhaupt in den Sinn kommt), aber darum geht es ja nicht. – So kommt es nicht selten vor, dass bei unserem ersten Einkauf am neuen Ort nebst allem Ess- und Trinkbaren auch eine Bratpfanne im Wägeli landet.
Der Einkauf macht immer Spass und wir lassen uns Zeit dazu. Es ist spannend zu sehen, welche Produkte die gleichen sind wie bei uns und welche völlig anders. Zum Beispiel Greyerzer, der aussieht wie Emmentaler, aber in Holland hergestellt wurde … Für ein bis zwei Abendessen „zu Hause“ decken wir uns ein, lassen uns beraten, welches Fleisch besonders zart, welcher Fisch frisch und welcher Wein zu empfehlen ist.
Gestern gab’s Ravioli oder Sorrentinos, wie sie hier heissen. Theo tut sich meistens schwer damit, meine Kochkünste zu rühmen; oft hat er einfach viel zu viel anders im Kopf als sich aufs Essen zu konzentrieren. Gestern aber war das nicht so. Was ihm am Menu besonders gefallen hat, war die Abwesenheit von Salat.
Leider haben wir mit dem Wetter ziemlich Pech. Es ist zwar nicht kalt, aber regnerisch, extrem feucht und neblig. Der Vorteil: es ist wunderbar ruhig, es hat wenig Verkehr und kaum Touristen.
Trotzdem haben wir jeden Tag ein Programm. Am ersten Sonntag war’s ein Besuch im Museo Ralli. Dort hat es uns sehr gefallen; wir haben mindestens zwei Stunden damit verbracht, Bilder und Skulpturen südamerikanischer Künstler zu betrachten.
Ein anders Mal war’s ein Besuch im Fünfstern-Hotel L’Auberge, wo’s Mode ist, Tee und Waffeln mit Dulce de Leche zum Zvieri zu bestellen. Statt Tee war’s für uns Cappuccino. Ein wunderschönes Ambiente und tatsächlich ausgezeichnete Waffeln zu einem nicht ganz günstigen Preis wurden uns serviert – der Besuch absolut wert.
Den Tipp haben wir von Hernán erhalten, einem jungen Anwalt, mit dem wir in Buenos Aires beim gemeinsamen Warten auf unseren verspäteten Flug vor dem geschlossenen Gate ins Gespräch gekommen sind. Ich „whatsapple“ im Moment täglich mit ihm und er gibt mir wertvolle Tipps, was zu unternehmen, wo gut essen zu gehen. – So hatte die mühsame Warterei auf dem Flughafen doch noch einen positiven Aspekt.
Ein Ausflug an die Südspitze der Halbinsel Punta del Este und zu „Los Dedos“, einem Kunstwerk am Strand (fünf gigantische Finger einer Hand ragen hoch aus dem Sand heraus) ist vor allem erwähnenswert, weil es uns vor lauter Wind fast weggeweht hat.
Die grauen Finger sind ein beliebtes Fotomotiv für Touristen. Selbstverständlich schossen auch wir ein paar Erinnerungsbilder.
Am Hafen dann war etwas los. Zwar nicht, weil es so viele Besucher hatte – kaum jemand war dort, und die wenigen Fischbuden, die geöffnet hatten, warteten vergeblich auf Käufer. Aber die Fischabfälle, die die Verkäuferin übers Geländer ins Hafenbecken warf, lockten Seelöwen und Möwen gleichermassen an. Lautstark stritten sie sich gegenseitig ums Futter.
Nach drei Regentagen wurde das Wetter endlich doch noch schön. Erst zwar nur zögerlich mit starkem Wind, aber dann gab’s nichts mehr zu klagen.
Wir machten einen Ausflug nach José Ignazio, einem kleinen, malerischen Dorf an der Küste mit einem viel besuchten Leuchtturm. Auf dem Weg dorthin ging’s über die Puente Leonel Viera in La Barras. Sie erinnert an eine zweispurige Achterbahn oder an den DNA-Bauplan. Oder dem Erbauer der Brücke muss es ganz einfach „sturm“ im Kopf gewesen sein, als er sie entwarf.
Es ist eindeutig Zwischensaison, die paar Restaurants, die’s hat, waren fast alle geschlossen. Nur mit Mühe fanden wir schliesslich eines, wo wir etwas essen konnten. Mehr als einmal wurden wir drauf aufmerksam gemacht, dass es jetzt eben Winter sei und der Sommer erst Mitte Dezember beginne. Nun – inzwischen war die Temperatur auf 30 Grad gestiegen… Schön so! - Im Sommer muss es grauenhaft sein, nur so von Touristen wimmeln, wie man uns versichert - alle Restaurants überfüllt, die Strände ebenso. Ich kann's mir kaum vorstellen.
Gegessen haben wir vorzüglich während unseres Aufenthalts. Tripadvisor hat uns gut geleitet:
Lo de Ruben / Nuestra Mesa / Las Pavas Resto.
Der Wein ist ebenfalls erwähnenswert: Was für Chile der Carménère, für Argentinien der Malbec – ist für Uruguay der Tannat, den ich bisher nicht kannte. Er mundet, dieser farbintensive, kräftige Wein.
Im Zentrum von Maldonado gibt’s eine Kathedrale mit einem, laut Wikipedia, berühmten Altarbild. Allerdings steht in der Kirche selbst nirgends etwas darüber geschrieben.
Der Markt hingegen, an dem wir per Zufall vorbeikamen (endlich schönes Wetter zwar, aber kalter Wind – wir hatten grad gar nichts anderes zu tun) – über den steht nicht einmal im Web etwas. Wen wundert‘s? Er war unterste Schublade, und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass irgendjemand irgendetwas Brauchbares dort finden könnte. - Wir schon! - Erste Trophäe: ein Nummernschild, auf dem MAD 2171 steht. Da wir, wenn wir an unsere „Kinder“ schreiben, oft mit „MAD“ unterschreiben (Mom and Dad), musste das natürlich unverzüglich in unseren Besitz übergehen.
Und Theo fand ein langärmliges, weisses Hemd, das er inzwischen schon ganz ins Herz geschlossen hat. – Tatsächlich ist die Qualität wirklich gut und ich frage mich, wo das wohl herkommt. – Nicht einmal fünf Franken hat’s gekostet.
Trophäe Nummer drei: ein Trinkröhrchen für den Mate-Tee, Bombilla, das in Theos Kuriositäten-Kabinett in der Vitrine in Bivio seinen Platz finden wird.
Am Ende jenes „Sightseeing-Tags“ in Maldonado war es erst halb sieben, also noch viel zu früh für einen Restaurantbesuch. Aber vielleicht ein Apéro? - Wir schauten bei einem Restaurant zum Fenster rein, die Vorhänge waren zwar noch zugezogen, aber trotzdem sah uns der Kellner offenbar. Er öffnete die Tür und sagte, wir sollten in einer Stunde wiederkommen. Grad wollten wir zum Auto zurück, als der Besitzer uns rief und sagte, es sei ok, wir sollten nur kommen. Was für eine Ausnahme – mitten am Nachmittag – um sieben Uhr schon essen! Das Feuer für die Parilla brannte bereits und der Koch war dabei, etliche Fleischstücke vorzubereiten. Ein dickes Stück Fleisch mit Knochen wurde uns angeboten, ebenso ein halbes Lamm-Gigot. Wir entschieden uns fürs Ojo de Bife. Nur eine Portion, zwei hätten wir niemals geschafft. Gegen acht erschien dann die Kellnerin, die nun den Job übernahm, uns noch ein Dessert zu servieren. Als wir gingen, begann sich das Lokal zu füllen. Paare kamen mit ihren Babys im Kinderwagen. – Da hatten wir’s ja vorher richtig gemütlich. Kein Kindergeschrei und die volle Aufmerksamkeit des Personals.
An unserem letzten Tag waren wir sogar noch ein paar Stunden am Strand, bevor wieder mal Packen auf dem Programm stand.
Ich hatte uns eine Rundreise zusammengestellt mit sechs Übernachtungen. Einen Koffer konnten wir bei Nachbarn lassen, damit wir für diese kurze Zeit nicht so viel Gepäck mitnehmen mussten, so oder so eine grosse Herausforderung für unser kleines Auto.
So ging’s am Donnerstag, dem 16. November, los. Kaffee in einem pittoresken Hotel mit toller Aussicht über die Lagune und das Meer - noch ganz in der Nähe von Maldonado: „Las Cumbres“ – ein Tipp von Hernán.
Weiter ging’s nach Piriapolis, wo grad ein Heer von Angestellten dabei war, die Balustraden an der kilometerlangen Uferpromenade weiss zu tünchen – Vorbereitung auf den Touristenstrom, der ab Mitte Dezember erwartet wird.
In Montevideo führte uns unser Google-Rösi mitten ins Zentrum, wo ich ein Hotel für eine Nacht gebucht hatte. Wir waren sehr früh am Nachmittag schon dort, so hatten wir mehrere Stunden Zeit, einen Spaziergang durchs Zentrum zu machen, die Gegend am Hafen zu erkunden, und es reichte sogar noch für eine kurze Siesta, bevor wir ein Taxi nahmen und zu einer Show aufbrachen mit Tango und Nachtessen, die uns von der Rezeptionistin im Hotel empfohlen worden war.
Der Abend war unterhaltsam, verschiedene Show-Blöcke wurden gezeigt: Nebst den hinreissenden Tangoeinlagen wurden auch Milonga (laut Wikipedia die fröhliche Schwester und Vorgängerin des Tango Argentino) und Candombe (folkloristische Tanzeinlage mit Afro-Lateinamerikanischem Hintergrund) gezeigt. Im Lokal hatte es 12er-Tische – wir zwei Schweizer unter lauter Brasilianern, die kaum Englisch oder Spanisch sprechen konnten. Trotzdem kam eine Art Gespräch zustande.
Das Essen jedoch war nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Gelb sowieso nicht, weil nämlich die Beleuchtung im Saal so speziell war, dass der Salat, den man uns als Vorspeise reichte, grau in grau daherkam. Die Hühnerpastete ebenfalls. Dafür erschien das Grau unserer Haare eher grünlich. – Kurz gesagt, beleuchtungstechnisch der totale Flopp.
Eigentlich war die Vorspeise gar nicht so schlecht, hätte man sie mit verbundenen Augen gegessen. Bei den Ravioli allerdings hätte auch das nichts genützt; ihnen fehlte das Salz. Al dente schon, aber völlig ohne Geschmack. Theos Poulet war in Ordnung, fand er, einfach die Farbe… Dass wir Fleisch nicht bestellen sollten, hatte ich vorher im Tripadvisor bei den verschiedenen Feedbacks und Bewertungen gelesen, und das leuchtete ein. Mindestens zweihundert Personen waren in dem Lokal und individuelle Fleischbestellungen wohl eher nicht an der Tagesordnung. Die Dame neben Theo klagte jedenfalls über die Schuhsole auf ihrem Teller und liess sie dort auch liegen.
Aber wie gesagt, die Show war gut, einige der Sängerinnen und Tänzerinnen zwar schon etwas in die Jahre gekommen, dafür aber sehr redegewandt und farbig angezogen.
Apropos Rede: Kaum öffne ich den Mund, rühmen mich die freundlichen „Uruguaschos“ und sagen, wie gut ich Spanisch spreche. Da muss ich dann immer lachen und sagen, ich hätte ja gerade eben nur drei Wörter gesagt… Es hätte ja gut sein können, dass gar nichts mehr folgt. So wie bei dem Angestellten der Aerolineas Argentinas in Punta del Este beim Einchecken nach Buenos Aires. Er hatte offenbar gehört, dass wir deutsch oder wenigstens so was Ähnliches sprachen. Er sah mich an und sagte: „Was machen wir jetzt? – Wir trinken ein Bier!“ – Ich musste ihn wohl ein wenig eigentümlich angesehen haben, denn er erklärte sogleich, er habe einen Freund in Deutschland, und der habe ihm diese beiden Sätze beigebracht. Sonst könne er nichts sagen auf Deutsch. - Das fand ich wirklich lustig und pflichtete ihm bei, dies seien in Deutschland tatsächlich die beiden wichtigsten Sätze, die es brauche, um sich überall durchzuschlagen.
Sie sind einfach höflich, die Menschen hier, und hilfsbereit und es macht Spass, mit ihnen zu plaudern. Immer wollen sie wissen, wo wir herkommen. „De Suiza“ löst bei ausnahmslos allen ein Lächeln aus und weiter geht’s mit „Oh! - Que hermoso!“ oder alternativ „Que lindo!“. - Dabei zweifle ich stark, dass allgemein bekannt ist, wo dieses Land sich befindet, und ob’s nicht etwa zu Skandinavien gehört. Einige allerdings erwähnen gleich die Schokolade; die sind offenbar bestens im Bild.
An die seltsame Angewohnheit der Uruguayer, Mate-Tee immer und überall zu trinken, konnte ich mich kaum gewöhnen. In kleinen tassenähnlichen Gefässen aus Mate-Holz oder Metall, innen beschichtet mit Glas oder Keramik, stopfen sie eine eigene Mischung aus verschiedenen Teesorten hinein. Diese werden aufgegossen mit heissem Wasser und von morgens bis abends mit den Bombillas (eine Art Trinkröhrchen aus Metall) in kleinen Schlucken getrunken oder besser gesagt aus dem Röhrchen gesaugt. Was mich einerseits befremdet, andererseits belustigt, ist, dass diese Trinkgefässe überall hin mitgenommen werden. Genauso wichtig ist der Thermoskrug mit heissem Wasser. Auch der muss mit, damit die Teekräuter jederzeit befeuchtet werden können. Es ist absolut normal, jeder hat seine Utensilien dabei, sei das im Bus, im Laden, auf der Strasse, beim Spazieren – unglaublich!
Wenn ich mir vorstelle, dass ich neben meiner Handtasche (meinem Notfallkoffer, wie Theo meint) immer noch einen Thermoskrug unter den Arm geklemmt und eine Kalabasse mit Bombilla mit mir herumtragen müsste – oh je. Nicht auszudenken!
Zurück zur Reise: In Montevideo blieben wir nur gerade 24 Stunden, denn das „Stadterlebnis“ würden wir ja in Buenos Aires, wo wir zwei Wochen bleiben werden, noch genügend erhalten, also interessierten mich eher kleinere Orte und Dörfer.
Die nächsten zwei Tage verbrachten wir in Colonia del Sacramento, einer kleinen am Rio de la Plata gelegen Stadt (die älteste Stadt in Uruguay), seit 1995 zum UNESCO Welterbe erklärt. Und sicher nicht zu unrecht. Colonia liegt fast vis-à-vis von Buenos Aires (eine gute Stunde mit der Fähre), ist ein hübscher, gepflegter Ort, sehr touristisch zwar, aber wunderschön gelegen, umgeben vom Wasser und voller kleiner Restaurants, eines einladender und gemütlicher als das andere. Auf die urigen Kopfsteinpflasterstrassen sind die Einwohner sehr stolz und der Leuchtturm ist ihr Wahrzeichen. Die prächtigen Bougainvilleas, die weissgetünchten Häuser, der blaue Himmel – fast könnte man denken, man sei auf einer griechischen Insel gelandet.
Einzig die Farbe des Wassers mutet merkwürdig an. Es ist ganz braun, und das kommt vom Schlamm und dem lehmigen Boden, der der Rio de la Plata mitbringt. Dort, wo er ins Meer fliesst, sieht man deutlich den Wechsel der Farbe - wirklich eindrücklich!
Auf der knapp dreistündigen Fahrt dorthin regnete es wie aus Kübeln, aber kurz vor unserer Ankunft (wenn Engel reisen…) „öffneten sich die Himmel“, die Sonne zeigte sich und so blieb es die nächsten Tage bis zu unserer Abreise eine knappe Woche später.
Das Hotel, das ich gebucht hatte, war eine absolut glückliche Wahl. Etwa zehn Kilometer vom Ort entfernt und nur über eine holprige, nicht asphaltierte Strasse mit riesigen Schlaglöchern erreichbar, übernachteten wir zweimal in der idyllischen „Casa de los Limoneros“. Umgeben von einem Hain mit 1200 Zitronenbäumen steht das alte Herrschaftshaus, das voll von Efeus bewachsen ist, inmitten eines wunderbar gepflegten Parks mit exotischen Bäumen, zwei Teichen und einem Swimmingpool. Ein wahres Bijou. Ein ähnliches Konzept wie in Frankreich die „Table d’Hôtes“ – so gibt’s auch hier ein Nachtessen, wo man mit anderen Gästen an einem grossen Tisch sitzen kann. Das köstliche Frühstück ist ebenfalls erwähnenswert. Beim Gespräch lernten wir nette Leute kennen und erhielten etliche gute Tipps für die Weiterreise.
Diese führte erst nach Villa Helvetia, wiedermal eine Schweizersiedlung, wo allerdings ausser den Strassennamen, dem Hotel Swizo und der Speisekarte dort nicht mehr viel an die ehemalige Heimat der dortigen Dorfbewohner erinnert.
Aber es war lustig, durch die Calle Guillermo Tell zu fahren, bei der Calle Frau Vogel eine Foto zu schiessen, zu sehen, dass bei der Calle Haberli mit den Jahren wohl das „Ä“ abhandengekommen ist.
In Florída hatte ich unsere nächste Unterkunft gebucht. Aber bis wir dort waren, galt es noch, etliche Kilometer zurückzulegen. Ohne Google-Rösi hätten wir die abgelegene Farm niemals gefunden. Die „Estancia de Ceibo“ ist etwa zwanzig Kilometer vom Ort entfernt, steht alleine, und weit und breit sind keine Nachbarn zu sehen. Genauso hatte ich es geplant, mal zu erfahren, wie die Leute auf dem Land leben und vielleicht sogar zum Reiten zu kommen – nach alter Gaucho-Manier. Und siehe da: Endlich am Ziel angelangt, wurde unser Auto bereits von zwei bellenden Hunden stürmisch umringt und eine Reihe von Hühnern kam ebenso neugierig herbeigeeilt. Von Joselo, dem attraktiven und charmanten Besitzer der Ranch wurden wir herzlich empfangen. Er führte uns herum, bot uns Kaffee und Kuchen an, zeigte und erklärte uns alles und… hatte bereits zwei gesattelte Pferde bereit zum Ausritt!
Der Ritt durch die herrliche Landschaft war ein absolutes Highlight. Bis zum Einnachten waren wir unterwegs, ritten über die saftig grünen Felder, vorbei an Kühen, Pferden, Schafen, sahen Vögel und Hasen, eine Eule auch, und die beiden Hunde begleiteten uns vergnügt auf Schritt und Tritt.
Inzwischen war Carmen heimgekommen, Joselos Ehefrau. Auch sie erzählte vom Leben auf der Farm, von ihrer Familie und den Sorgen, die sie haben. Als Gast auf dieser Estancia fühlt man sich wie zu Hause. - Um neun wurde uns von einer Angestellten ein feines Nachtessen serviert, bevor wir müde und zufrieden ins bequeme Bett sanken.
Um neun gab’s Frühstück. Wir machten nochmals einen Rundgang um die Farm und die Gebäude. Am absolut grossartigsten fand ich die Glyzinie, die zwischen zwei der Wirtschaftshäuser steht. Der Baum ist 120 Jahre alt, dehnt sich über 14 Meter über ein Metallgestell aus, und dient so als ein 4 Meter breites Sonnendach, das im Sommer wohl wunderbaren Schatten spendet und sich im Frühling mit Blühen selbst übertrifft. Diese Fülle zu sehen, waren wir leider zu spät dran, aber das prallvolle grüne Blätterdach ist auch so überwältigend. Carmen schickte mir am nächsten Tag per Whatsapp ein Bild von der violetten Blütenpracht.
Bevor wir gehen mussten, führt uns Joselo mit seiner Camionetta (Pick-Up) noch durchs Gelände an einen kleinen Fluss, in dem man baden kann und zeigte uns die schöne Gegend. Die beiden Hunde rannten wiederum mit Begeisterung vor dem Auto her. Sie wussten genau, wo’s lang geht und es war eine Freude zuzusehen, wie sie voller Wonne ihr Bad im kühlen Nass genossen. – Ein absolutes Paradies für die Hunde muss das sein und auch für die andern Tiere auf der Ranch.
Schade, dass ich hier nur eine einzige Nacht gebucht hatte. Ich wäre gerne länger geblieben.
Vier Stunden Fahrt hatten wir am nächsten Tag vor uns. Es hätte einen kürzeren Weg gegeben bis zur nächsten Destination, die Ruta 12, aber Carmen empfahl uns, die längere Strecke in Angriff zu nehmen, weil dort die Strasse besser sei.
Einen Abstecher machten wir nach dem Bauerndorf „25 de Agosto“, einem kleinen schachbrettartig angelegten Ort, wo’s Wandbilder hat, die zu sehen man uns empfohlen hatte. Bis wir sie gefunden hatten, dauerte es allerdings eine gewisse Zeit. Fragten wir nach dem Weg, hiess es: drei Quadras nach links und dann rechts und wieder links etc. Die Fahrt ging einmal mehr im Kreis, bis wir endlich, fast hätten wir die Suche aufgegeben, den zentralen Platz fanden, wo es auch eine ganz interessante, verlassene Eisenbahnstation zu besichtigen gab.
Über siebzig Wandbilder kann man sehen. Eine französische Künstlerin hat sie gemalt. Sie wollte dem verschlafenen, vergessenen, grauen Dorf Farbe verleihen, was ihr sehr gut gelungen ist. Wir empfanden das Dorf nach wie vor als sehr verschlafen, aber offenbar hat’s im Sommer etliche Touristen, die den Weg zum/nach 25. August jeweils finden.
An der Tür des Dorfladens hiess es „abierto“, dennoch war sie geschlossen. Doch eine Frau hatte uns gehört und öffnete. Ein paar wenige Stühle und Tische waren vorhanden – alles sehr einfach und zweckmässig eingerichtet. - Ein Bier und zwei Gipfeli für Theo, ein Eiscreme für mich – das war unser Mittagessen.
Weiter ging die Fahrt auf den endlos langen, geraden Strassen Richtung Osten gegen Minas in „die Berge“. Seit Tagen waren das die einzigen Erhebungen oder Hügel, die wir zu sehen bekamen. Dort war das nächste Ziel: erneut eine völlig andere Unterkunft als bisher: ein Hotel in der Sierra mit Blick übers weite Land, mit Swimmingpool und einem Restaurant. Auf knapp 200 Metern über Meer. Und auch hier wurden wir nicht enttäuscht. Die kleine Siedlung, wo’s grad nur ein paar Ferienhäuser hat, welche über die Hügel verstreut sind, hat nur knapp einhundert Einwohner und heisst Villa Serrana. Einen Dorfkern gibt es nicht. Wer sich hier in dieser verlassenen Gegend ein Hotel baut, dachte ich bei mir…
Auf der Strecke dorthin hatten wir eine Begegnung: Eine Spinne lief uns von links nach rechts vor dem Auto über den Weg. Wenn man die sieht (ohne Lesebrille), kann sie nicht sehr klein sein. So sehr ich mich vor diesen Tieren ekle, so sehr war ich fasziniert. Jedenfalls hielt ich an und ging hin, um sie zu fotografieren. Sie lief langsam auf die andere Strassenseite, ich mit dem Smartphone hinterher, bis mir Theo zurief, die könne sicher springen. Zwei Fotos der Tarantel hatte ich bereits im Kasten, also beschloss ich, lieber Fersengeld zu zahlen, denn ich war nicht ganz so sicher, ob mein lieber Ehemann es ernst meinte oder nicht.
Später im Hotel passte ich sehr gut auf, wo im Garten ich hintrat, denn wo eine ist…
Einer zweiten begegnete ich zum Glück nicht, dafür aber einem Leguan, der allerdings Reissaus nahm, als er mich sah.
Friedlich war’s dort im „Meson de las Cañas“, völlig ruhig und erholsam. Nur ganz wenige Gäste hatten den Weg dorthin gefunden.
Noch zwei Stunden konnten wir bei schönstem Wetter am Pool ausruhen (längst fällige Siesta!), ein wenig lesen und dösen, auf der Terrasse einen Apéro geniessen und später nach dem Nachtessen in die Federn sinken, in der Hoffnung, nicht von Spinnen träumen zu müssen.
Am nächsten Tag, unserem letzten in Uruguay, ging die Fahrt zurück Richtung Süden ans Meer. Bis zum nächsten Hotel hätte es laut Google anderthalb Stunden gedauert, aber weil wir ja genügend Zeit hatten und weil uns verschiedentlich zu einem Besuch der Bodega Garzon geraten wurde, dachte ich, der Umweg dorthin würde sich lohnen, mehr als doppelte Fahrtzeit halt. Wir konnten nicht genau herausfinden, wie die Strasse dorthin beschaffen ist, aber viel schlimmer als das, was wir bereits hinter uns hatten, konnte es wohl nicht sein. Dachte ich. – Die Rutas 8, 13 und 39 sind bestens ausgebaut, schon frohlockten wir, da schickte uns Rösi gnadenlos von der Strasse ab auf einen Schotterweg, der nichts Gutes verhiess. Aber wir hatten uns ja dafür entschieden, also zogen wir es durch. Für die knapp 30 km brauchten wir eine Stunde bis zur Bodega, eine Stunde durch eine Gegend, wo zwar manchmal Kühe und Pferde zu sehen waren, aber weder Häuser noch Menschen, Strassenschilder schon gar nicht. Dafür viele Steine und Löcher. Meine ständige Angst, unser kleines Auto würde den Geist aufgeben oder zumindest einen Pneu (ob wir einen Reservereifen dabei hatten, hatte ich überhaupt nicht kontrolliert), fuhr die ganze Strecke mit. Ohne Google-Rösi wären wir vermutlich nie angekommen.
Dann endlich tauchte auf einem Hügel mitten im Nichts ein Gebäude auf, von dem wir erst dachten, es habe vielleicht mit Wasserkraft oder Elektrizität zu tun. Eine hohe Mauer, ganz modern, zwei Barrieren und ein Wärterhaus. „Bodega Garzon“ in kaum leserlichen Lettern stand an der Wand. – Welche Erleichterung, endlich am Ziel zu sein! Der Angestellte kam aus seinem Karbäuschen heraus und teilte uns mit, die Bodega sei heute leider geschlossen. - Und wir sind den ganzen mühsamen Weg hierhin gefahren. Ich konnte es kaum fassen. Laut Tripadvisor hätte sie geöffnet sein sollen.
(Mit den Bodegas hatten wir wirklich Pech: Die erste, die wir besuchen wollten kurz nach unserer Abfahrt in Montevideo (Bodega Bouza), war so überfüllt mit Besuchern, dass uns nichts anderes übrig blieb, als gleich weiterzufahren. Da gab’s ja noch die Bodega Establecimiento Junico zum Beispiel. Den Umweg von zwanzig Kilometern und die Suche nach dem Standort nahmen wir in Kauf. - Dort angekommen, liess man uns wissen, das Restaurant sei geschlossen, die Bodega ebenfalls...)
Weitere zehn Kilometer auf nicht asphaltierter Strasse und dann endlich wieder Belag für die restliche Strecke brachte uns nach Garzon, einem mini kleinen Dorf (etwa 200 Einwohner). Dort hat’s das Hotel Garzon, das dem bekanntesten Chef in Uruguay gehört, Francis Mallmann. Ich habe den Michelin Führer nicht konsultiert, aber das Restaurant hat sicher drei Sterne oder zumindest wird es im Buch heissen: „ist einen Umweg wert“. Nun, den hatten wir ja bereits hinter uns und das Gefühl, ein Drei-Stern-Mittagessen verdient zu haben nach dieser langen Fahrt auf jeden Fall. Zudem gab es kein anderes Lokal weit und breit.
Vor dem Hotel stand ein Bentley. Im Restaurant gab’s zwar keine Besucher, aber alle Tische waren schön gedeckt. Um zwölf Uhr isst ja auch noch niemand. Ein bezaubernder Garten lud zum Verbleiben ein und eine noch bezauberndere Getränke- und Menu-Karte liess uns fast den Atem rauben. Aber wir beschlossen trotzdem zu bleiben und uns diesen Exzess ausnahmsweise zu leisten.
Die billigste Flasche Wein kostet dort 120 Fr. (genau dieselbe Flasche mit demselben Jahrgang kauften wir später im Laden für 15 Fr.). Ein Glas Wein ist für zwanzig Franken zu haben, der günstigste Salat zur Vorspeise für 40 Fr. Etwa 55 Fr. muss man für einen Teller Teigwaren aufwerfen und schon das Gedeck wird mit 10 Fr. pro Person berechnet. Aber da muss ich sagen, die drei hausgemachten Brote, die uns der Kellner brachte, waren absolut Spitze. Dazu gab’s Humus und einen etwa zwanzig Zentimeter langen aufgeschnittenen Knochen mit feinstem Mark drin. - Also ein Anblick für Götter war das ja nicht gerade, und ich kam nicht umhin, an meine bevorstehende Knieoperation zu denken…
Weil ich dem Brot überhaupt nicht widerstehen konnte, hätte ich eigentlich nach dieser Vorspeise bereits genug gehabt, aber wir hatten ja noch Fisch bestellt (ich) und Theo ein New York Steak. Beide Gerichte waren absolut delikat, der Lachs rosa und zart, das Fleisch perfekt grilliert, die Beilagen fein, nur Theo fand, für den horrenden Preis, den wir schliesslich bezahlen mussten für dieses „einfache“ Mittagessen, hätte die Präsentation einfallsreicher sein können. Er hatte ja recht, da könnten sie noch dazulernen; eine Augenweide sieht anders aus. Aber es war ein unvergessliches Erlebnis auf jeden Fall. - Theo wollte mich zur Abwechslung mal einladen, aber seine Karte wurde nicht akzeptiert…
Am frühen Nachmittag kamen wir im Hotel Casapueblo an. Das nun ist eines der schönsten und speziellsten Hotels, wo wir je waren. Gebaut von Carlos Paéz Vilaró, einem äusserst vielseitigen uruguayischen Künstler (Maler, Architekt, Bildhauer, Schriftsteller, Komponist), der dieses fantastische Gebäude als Hommage an seinen Sohn gebaut hat, einem der sechzehn Überlebenden des entsetzlichen Flugzeugabsturzes in den Anden im Jahr 1972.
Hier muss es einem einfach wohl sein. Die Zimmer sind gross; keines hat eine Nummer, dafür einen Namen (cubiertos). Jedes ist anders, die weiss getünchten Nischen, Terrassen und Erker geben einem das Gefühl, eher auf Santorini zu sein als in einer Bucht in Uruguay.
Das Hotel ist in einen Hang hineingebaut mit einer fantastischen Aussicht aufs Meer – Sonnenuntergang vom Feinsten inklusive. Und wir hatten solches Glück: Es war heiss an diesem Tag, kein Wölkchen war zu sehen, wir konnten Pool und Garten ausgiebig geniessen. Freundliches Personal, ein gutes Restaurant, ein bequemes Bett – was will man mehr?!
Nach dem Frühstück am nächsten Morgen besichtigten wir vorerst noch das Museum, das in einem separaten Teil des Gebäudes untergebracht ist. Anschliessend holten wir unseren Koffer bei der Nachbarin ab und fuhren zum nahe gelegenen Flughafen. Ähnlich wie in Belp kam es mir dort vor: klein und praktisch. Kein Stress, keine Warteschlangen, kaum Passagiere – alles sehr sympathisch.
Nach einem kurzen aber turbulenten Flug kamen wir in Buenos Aires an, unserem Ziel für die nächsten zwei Wochen.
Buenos Aires 22. November – 5. Dezember 2018
Vierzehn Tage Grossstadt – wie ich meinen eigenen Reiseplan anschaue, finde ich plötzlich selber, das ist doch fast des Guten zu viel. Aber dann, als wir dort waren, gefiel uns dieses Leben mitten im pulsierenden Zentrum ganz gut und das Beste daran war: Wir hatten genügend Zeit, uns in Ruhe das anzusehen, was auf meiner Liste stand und zwischendurch auch mal gar nichts zu unternehmen, was besonders während des G20-Gipfels gezwungenermassen sehr gut gelang.
So wird mein Bericht diesmal eher eine Aufzählung sein von Orten, wo wir waren, von Restaurants, die uns gefielen, so dass ich mich bei einem nächsten Besuch in dieser Stadt (was ich mir sehr gut vorstellen kann) wieder daran erinnere.
Buenos Aires ist eine sehr westliche Stadt, mit vielen Grünzonen. Etliche Strassen und Häuser erinnern an Paris, was auch nicht weiter verwunderlich ist, denn nicht wenige französische Architekten waren beim Aufbau der weiten Avenidas, der Hotels, Palacios und sonstiger Prunkbauten entlang der Hauptverkehrsachsen beteiligt. All die verspielten Türmchen verleiten zum Fotografieren. Nicht immer ist die Verbindung zwischen Alt und Neu gut gelungen. Wie überall waren auch hier nicht immer nur Stararchitekten am Werk.
In einem ehemaligen Hotel an der Avenida de Mayo, das inzwischen zu Wohnungen umgebaut wurde, waren wir im obersten, fünften Stock einquartiert, mitten im Zentrum, 200 Meter von der berühmten Plaza de Mayo entfernt.
Diesmal fand unser Haustausch mit einem Ehepaar statt (Mimí und José Louis), das im Sommer in Bivio war, wo es ihnen sehr gefallen hat. Nun stellten sie uns ihre Stadtwohnung zur Verfügung, ein Loft, also ein einziges grosses Zimmer mit einer Galerie. Sehr gemütlich war’s dort und wir hätten es problemlos noch länger als zwei Wochen ausgehalten.
Die „Küche“ (Anführungszeichen unumgänglich) liess uns keine riesigen Menus zubereiten, war da doch nur eine einzige mobile Herdplatte vorhanden und nur ein einziger Kochtopf, in dem man zum Beispiel eine Suppe oder Ravioli kochen konnte. Wie froh war ich, dass ich die Bratpfanne, die ich in Villa Carlos Paz bereits gekauft hatte, in Uruguay einige Male im Einsatz hatte, wieder auspacken konnte; so gab’s wenigstens eine Sauce zu den Teigwaren.
Nun - man isst ja dort auch nicht daheim, man geht ins Restaurant, die Preise sind so niedrig, dass dies fast günstiger kommt, als sich die Kocherei zu Hause anzutun. Die Empanadas (de carne, de pollo, de jamon y cheso), die man an jeder Ecke kaufen kann, sind ja so etwas von gut und billig (pro Stück zwischen 50 Rappen und 1 Franken) - von denen könnte ich leben. Zwei Tomaten aufgeschnitten, ein paar Zwiebelringe drauf (ja kein Salat, denn Theo mag das grüne Zeug einfach nicht), Salz, Pfeffer, Olivenöl und Aceto Balsamico drüber träufeln, und schon ist eine wunderbare Mahlzeit fertig, die nach keiner Kochplatte verlangt.
Restaurants, die uns empfohlen wurden und die wir unbedingt wieder besuchen würden:
„Napoles“ in San Telmo = absolutes Lieblingslokal.
Der Besitzer muss während Jahren alles Mögliche zusammengekauft haben, und als er in diesem grossen Raum an der Avenida Caseros 449 sein Restaurant eröffnete, gleichzeitig eine Art Museum eingerichtet haben. Da sind alte Autos ausgestellt, Motorräder, Statuen und Büsten aus Bronze, Holz und Ton, grosse Schiffsmodelle in noch grösseren Vitrinen (etwa zwei bis drei Meter lang, ein bis zwei Meter hoch), jegliche Art von Stühlen und Tischen. Diese sind hübsch gedeckt und es ist schwierig zu entscheiden, an welchem man am liebsten seine Mahlzeit geniessen möchte. Vielleicht oben auf der einen Galerie auf Barstühlen mit Blick auf das Geschehen im unteren Teil des Restaurants oder doch lieber in einer Sitzgruppe im indischen Stil, an einem runden Tisch neben einem ausgestopften Raubvogel oder gar auf den bequemen Coiffeur- oder Zahnarztsesseln? - Und geniessen kann man. Gleich wenn man das Lokal betritt, ist links an einem Tisch ein Angestellter damit beschäftigt, frische Teigwaren herzustellen und mit feinen Zutaten zu füllen. Beim Eintreten wird einem ein erfrischender Drink gereicht, das Rezept musste ich gleich erfragen (Cinzano, Apérol Spritz, Orangen- und Zitronensaft, ein paar Blätter Minze).
Gefallen hat uns auch die „Florería Atlantico“, ein Lokal im Quartier Recoleta. Speziell ist, dass man erst einen Blumenladen betreten muss, um in die Bar zu gelangen. Durch eine schmale Tür gelangt man zu einer Treppe, die in den Keller führt, wo „das Geschehen“ dann stattfindet. Das Lokal befindet sich in einem schmalen, etwa zwanzig Meter langen Gang, ausgestattet mit einer ebenso langen Bar, hinter der die Küche versteckt ist. Wir waren früh dort, bereits um halb acht und dachten, wie üblich seien wir die einzigen Gäste. Dem war überhaupt nicht so. Wir hätten reservieren sollen, alle Tische waren bereits besetzt oder reserviert. Noch gerade zwei Plätze an der Bar waren frei, und dort konnten wir essen – mit Blick auf die geschäftigen Köche. Das Lokal ist bekannt für seine ungewöhnlichen Drinks, einer komplizierter als der andere. Wir haben sehr gut und originell gegessen und auch der Wein entsprach unserer Erwartung.
Im „Sagardi“ in San Telmo waren wir dann doch wieder mal die ersten Gäste. Dies ist ein Lokal im spanischen Stil. Vorne an der Bar gibt’s die köstlichsten Tapas und im hinteren Teil ist das Restaurant, das erst später am Abend öffnet. Das Sagardi und seine Tapas sind beliebt, gegen neun war das Lokal nicht wiederzuerkennen – ein einziges Gedränge vor den Köstlichkeiten in der Auslage.
„El Obrero“ in La Boca war nicht ganz leicht zu finden, am Schild sind wir vorbeigegangen, so unscheinbar und unbeleuchtet präsentiert sich das Restaurant von aussen.
Hausmannskost gibt’s dort, und kein Zentimeter an den Wänden ist nicht von Fotos oder Bildern bedeckt, vor allem im Zusammenhang mit Fussball. Das Stadion der La Boca Juniors ist ja nur ein paar Blöcke von dort entfernt. An der Decke hängen Dutzende von Fussballerleibchen (oder sagt man Tricots?).
Am 8. November hätte ja der Fussballmatch zwischen den beiden rivalisierenden Fussballclubs La Boca Juniors und River Plate stattfinden sollen, aber der ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden, weil ein paar Hooligans den Bus der Juniors angegriffen und ein paar Spieler verletzt hatten. Alle waren in grosser Erwartungshaltung an jenem Nachmittag, Fan-Umzüge zogen durch die ganze Stadt und in La Boca wurden auf den umliegenden Strassen Riesenmengen von Fleisch auf der Parilla vorbereitet für das grosse Fest und blau-gelb angezogene Fans waren überall zu sehen. Aber eben, es kam nicht zur grossen Show.
Die andere grosse Show jedoch fand statt, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit, der G20-Gipfel. Dafür war ein riesiges Aufgebot von Polizistinnen und Polizisten vor Ort. Eine Unzahl von Schutzschildern zierten die Strassen, Blockaden gab’s überall. Und die breiten Avenidas waren leer. Keine Autos durften mehr fahren, keine Busse, auch die Untergrundbahn hatte zwei Tage lang „frei“ und der Staat machte den Freitag effektiv zum Freitag für die Porteños („Buenos Airer“, wie Theo sagt) und umging auf diese Weise ein Chaos in der 2km-Sperrzone, da die Metro ja auch ausserhalb nicht in Betrieb war). Die Metropole wurde zur Geisterstadt.
Man konnte mitten in den Strassen promenieren oder diese überqueren, wo man grad wollte, das Rotlicht war nur noch zur Dekoration vorhanden. Erst hatte ich versucht, für uns eine Kurzreise zu organisieren ausserhalb der Stadt, aber da auch keine Züge verkehrten und der Flughafen geschlossen wurde, liess ich es; es war mir zu kompliziert. Wir fanden in unserer Umgebung doch ein paar Restaurants, die geöffnet hatten, so war es einfach zu überleben.
Dass die Politiker eine Grossstadt wählten, um sich zu treffen und nicht eine einsame Insel, geht über mein Begriffsvermögen. Was das die Stadt gekostet haben muss, geht in die Millionen. Das ist Geld, das sehr viel vernünftiger hätte ausgegeben werden können, wenn man an die Probleme denkt, die vorhanden sind.
Einkaufen war ein Kinderspiel. In der Strasse, wo wir wohnten, hat’s überall Restaurants, kleine Geschäfte und Supermercados, so dass wir jedes Mal beim Heimkommen ein paar Flaschen Mineralwasser und Bier einkaufen konnten, ohne einen Grosseinkauf machen zu müssen. Speziell der Carrefour, ein paar Blocks weiter, hat eine grosse Auswahl an Waren. Da fand Theo auch weisse Schokolade und Biscuits, die immer auch noch mit aufs Waren-Förderband müssen. Eine 400g schwere Büchse mit Dulce de Leche, die ebenfalls Richtung Kasse steuerte, fand jedoch meine Zustimmung überhaupt nicht (man kann doch nicht immer sagen, man wolle abnehmen und dann solches Zeug einkaufen!). Ich hielt mit meiner Meinung nicht zurück und diesmal, oh Wunder, stiessen meine Argumente ausnahmsweise auf fruchtbaren Boden. – Ein paar Meter neben dem Ausgang des Geschäfts sass eine Bettlerin mit ihrem Kleinkind auf dem Boden. Die nahm die Dose mit der Zuckermasse sehr gern entgegen, strahlte und wünschte meinem Gatten Gottes Segen.
Überhaupt: Bettler, Obdachlose, Kartonsammler und andere arme Leute sind überall unterwegs. Vor allem am Abend sieht man welche, die in den Abfallkübeln nach Ess- und Brauchbarem suchen. Es gibt ein ganzes Quartier, das Barrio 31, welches ein grosses Problem darstellt. Viele tausend Menschen, und es werden immer mehr, leben dort in diesem Elendsviertel in erbärmlichen Unterkünften, die sie wie Legoklötze übereinander bauen; das sieht nicht nur gefährlich aus, es ist es auch. Die Bahnlinie trennt das Viertel von der neuen Stadt; die Autobahn zum Flugplatz fährt oben drüber.
Mit den 30% Arbeitslosen und der Inflation kommt die Regierung nicht klar.
Vor unserer Abreise haben wir zu Hause in der Tagesschau einen Bericht gesehen, der zeigte, dass sich neuerdings viele Märkte spontan bilden, wo Waren getauscht werden, so wie das früher im Mittelalter auch bei uns Gang und Gäbe war.
Mehr als einmal haben wir gehört und gelesen, die Argentinier seien die am wenigsten liebenswürdigen Südamerikaner, eher arrogant und unfreundlich. - Nicht eine einzige Begegnung hatten wir, die dieses Vorurteil bestätigen könnte. Ganz im Gegenteil. Hernán, der Anwalt, den wir auf dem Flughafen Aeroparke kennengelernt hatten während unserer neunstündigen Warterei auf den Anschlussflug, und der mir von da an fast täglich Tipps per Whatsapp schickte, lud uns zusammen mit seiner Frau Julieta in ein feines Restaurant zum Abendessen ein. Gerne hätte ich bezahlt, das kam aber überhaupt nicht in Frage.
Ebenso luden uns Mimí und José Louis zum Brunch ins historische Café Tortoni ein, das grad gegenüber unserer Wohnung gelegen ist und vor dem ständig lange Schlangen von Einheimischen und Touristen stehen und auf Einlass warten, da das Lokal, in dem abends auch Tango-Darbietungen stattfinden, in jedem Führer zu finden ist.
Aber auch Leute auf der Strasse sprachen uns an, wenn sie sahen, dass wir den Stadtplan konsultierten oder auf dem Handy etwas suchten und boten ihre Hilfe an. Unweigerlich kam auch hier immer wieder die Frage, woher wir kämen. Und genau wie in Uruguay die stereotype Antwort: „Oh, que lindo!“.
Am lustigsten fand ich den Buschauffeur, der vor uns am Rotlicht anhalten musste (wir standen am Strassenrand und mussten ebenfalls auf Grün warten). Er liess die Scheibe hinunter und rief uns dieselbe Frage zu. Woran er gesehen hat, dass wir Ausländer sind, ist mir ein Rätsel, denn wir hatten weder einen Fotoapparat umgehängt, noch einen Stadtplan in der Hand. Seine Antwort auf unser „De Suiza“ hat uns allerdings überhaupt nicht erstaunt. – Dann winkte er uns zu und fuhr los.
Apropos lustig: Ich liess mir die Haare schneiden, was zwar normalerweise nicht naturgemäss ein amüsantes Erlebnis ist, aber der Coiffeur, der sich an dieses Unternehmen heranmachte, schon. Er weigerte sich, mit mir Spanisch zu sprechen, er wollte unbedingt sein Englisch an den Mann beziehungsweise an die Frau bringen. – Er wusch mir die Haare und dann dauerte es eine kleine Weile, bis er sich ein Sätzchen zusammengereimt hatte. Urplötzlich sagte er (die Sache mit unserer Herkunft hatten wir bereits hinter uns): „Why you not bring me chocolate?“ – Wir mussten beide lachen. Er führte mich dann zum Coiffeur-Stuhl und jetzt ging’s mit Befehlen los: „Sit down!“ – Er legte mir eine Schürze um, dann sagte er: „Stand up!“ – Das kam mir schon ein wenig komisch vor, aber brav, wie ich bin, gehorchte ich sofort. Wahrscheinlich war ich nicht seine erste Kundin, die erstaunt auf seine Aufforderung reagierte. Er liess mich wissen: „This is my technique“ und schon begann er, rings um mich herum, meine Haare abzuschnipseln.
Seltsam, seltsam! Eine seiner anderen Techniken (ich durfte wieder sitzen) lernte ich dann beim Föhnen kennen: Ohne Bürste fuhr er mit der Hand wie wild auf meinem Kopf herum; es muss ausgesehen haben, wie wenn er mich Ohr- oder eben Haarfeigen würde. – Aber tatsächlich – nach einer halben Stunde hatte ich eine perfekte neue Frisur, mit der ich ganz zufrieden war/bin.
Noch ein Wort zu Mate:
Auch in Argentinien ist Mate ein Thema, allerdings nur am Rand. Zwar kann man vielerorts die entsprechenden Gefässe und Bombillas kaufen, aber man sieht kaum jemanden damit herumspazieren. Und wenn, dann denke ich, er oder sie stammt sicher aus Uruguay.
Museen:
Diese beiden haben uns besonders gefallen:
MALBA
Hier ist lateinamerikanische Kunst ab dem Jahr 1900 ausgestellt. Nebst anderen uns bekannten und unbekannten Künstlern ist ein ganzer Stock Pablo Suárez gewidmet. Der hat einen ausgeprägten Sinn für skurrilen Humor.
www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g312741-d12048647-Reviews-Museo_Benito_Quinquela_Martin-Buenos_Aires_Capital_Federal_District.html">Museo Benito Quinquela Martin
Malereien eines italienischen Einwanderers (letztes Jahrhundert), ausgestellt in seinem Haus, das er später bewohnte. Eindrückliche Szenen am Hafen in La Boca. Auch interessante Galionsfiguren kann man bestauenen.
Gefallen hat uns auch der Wasserpalast (Palacio de Aguas Corrientes), eine architektonisch bedeutende Wasserpunpstation mit einer aufwändigen Fassade aus Terrakotta-Verzierungen und –Ornamenten, die aus England eingeführt wurden. 1894 eröffnet, diente er lange Jahre der Wasserversorgung der Stadt.
Eine faszinierende Buchhandlung ist „El Ateneo Grand Splendid“. Ehemals ein Theater mit über 1000 Sitzplätzen wurde sie im Jahr 1920 zum Kino umfunktioniert und später in einen Buchladen umgewandelt. Sie befindet sich an der Avenida Santa Fe 1860 im Stadtteil Recoleta. Dort, wo mal die Bühne war, befindet sich jetzt ein Café.
In einer Stadt legt man ja immer viele Kilometer zu Fuss zurück, auch wenn’s eine U-Bahn und Busse hat. Mit der SUBTE-Karte ist es sehr einfach, von Ort zu Ort zu gelangen; eine einfache Fahrt kostet nur etwa fünfzig Rappen. Die App „Cómo llego“ ist eine geniale Hilfe, das am besten geeignete Verkehrsmittel am richtigen Standort zur rechten Zeit zu finden. – So haben wir verschiedene Stadtteile ausgekundschaftet, besuchten am ersten Sonntag den schönen Handwerkermarkt im Recoleta-Quartier und den Friedhof dort, der in jedem Führer als sehenswert beschrieben wird und wo auch Evita Peron begraben ist. Die zum Teil riesigen Mausoleen sind eindrücklich, aber auch ein wenig unheimlich und schauerlich anzusehen, und mir kommen sogleich die armseligen Behausungen der (noch lebenden) Menschen im Elendsviertel nicht weit weg von diesem Ort in den Sinn. Dort ist nichts in Marmor gebaut und es schweben auch keine Engel aus Stein über den Gebäuden.
Vitalität und Lebensfreude strahlt das Viertel La Boca aus. Jeder mag die farbigen Häuser. Auch dieser Stadtteil war vormals ein Armenquartier. Was von den Schiffsfarben übrig blieb, so erklärte man uns, verwendeten die Bewohner ursprünglich, um ihre Häuser oder Baracken farbig zu bemalten. - Vor allem am Wochenende ist viel los. Touristen hat’s zuhauf, die Restaurants sind voll, auf den Strassen wird Tango getanzt.
Auch in Palermo macht es Spass, die verschiedenen Restaurants auszuprobieren und die unzähligen Graffitis zu betrachten.
San Telmo, das älteste Quartier der Stadt, ist ebenfalls sehenswert. Ruhig durch die Woche und am Wochenende wie am Zibelemärit in Bern: Hunderte von Touristen sind unterwegs. Auf der Plaza Dorrego und entlang der ganzen Avenida Defensa, über eine Strecke von 2,5 km vom Parque Lezama bis zur Plaza de Mayo, steht ein Marktstand neben dem anderen mit Antiquitäten, Handwerksartikeln, und all den tausend Dingen, die niemand braucht.
Apropos Tango: An dem kommt man nirgends vorbei in Buenos Aires; und das ist auch sehr schön so. Es gibt unzählige Tangolokale und -veranstaltungen, unterschiedlich auch im Preis, und einige davon sind sehr touristisch. Welche wählen? – Da gab uns wieder Hernán einen Tipp und der war ausgezeichnet:
An Theos Geburtstag, dem 24. November, besuchten wir „Esquina Homero Manzi“. Mit Dinner. Und diesmal war das Essen vorzüglich, nicht so wie in Montevideo. – Einmal mehr waren wir die ersten Gäste im Lokal (kurz vor halb neun) und sahen von oben (wir hatten einen schönen Platz auf der Galerie mit bestem Blick auf die Bühne), wie sich der Saal allmählich füllte. Dem Treiben der Kellner zuzusehen, war sehr unterhaltsam. Mir fiel eine Gabel herunter und landete unten auf einem Tisch grad neben einem Sektkübel. Sie hätte sehr wohl auch die Glatze des Kellners, der danebenstand, treffen können. Theo hat sich das Szenarium unverzüglich bildlich vorgestellt. – Ich war natürlich froh, dass sich die Angelegenheit nur in seiner Phantasie so abgespielt hatte.
Elegant und anmutig alsdann die Vorstellung auf der Bühne. - Sicher ein Tag zum Erinnern.
Nicht zu vergessen Puerto Madero, ein wiederbelebtes Hafengebiet. In umgestalteten Backsteingebäuden sind gehobene Steakhäuser zu finden. Schicke Wolkenkratzer beherbergen multinationale Unternehmen und Luxusapartments. Elegant überspannt die Puente de la Mujer das Hafenbecken.
Eine Stadt aus der Adlerperspektive zu betrachten, falls das von irgendeinem Turm aus geht, ist für mich ein Muss. Die Galerie Güemes macht’s möglich. Mit dem Lift in den 14. Stock und schon sehen alle Häuser aus wie Zündholzschachteln.
Iguazú 5. – 9. Dezember 2018
Am Mittwoch, dem 5. Dezember, kamen Mimí und José Louis vorbei, um uns zu verabschieden. Kein Problem war es, ein Taxi zu finden; die sind ständig überall unterwegs, nur nicht dann, wenn’s regnet, wie José Louis sagt. Aber das war ja nicht der Fall. In einer knappen halben Stunde erreichten wir den Flugplatz.
Um vier Uhr nachmittags bereits lagen wir im Hotel Saint George auf den bequemen Liegestühlen am Pool und genossen den restlichen Teil des heissen Nachmittags.
Am nächsten Tag besuchten wir die Iguazú-Fälle von der argentinischen Seite her, am folgenden Tag von der brasilianischen. Welche Seite schöner oder spektakulärer ist zum Besuchen, ist schwer zu sagen. Absolut eindrücklich sind die donnernden Wasser auf jeden Fall. Wer dort war, schwärmt davon, wir haben’s zigmal gehört und jetzt auch selber erlebt. Die bestens ausgebauten Wege ermöglichen es den Besuchern, die Fluten von allen Seiten her zu sehen, von vorne, von oben und von unten.
Und wir beiden Glückspilze: Gleich zwei der grössten Fälle der Erde konnten wir in diesem Jahr besuchen, die Viktoria-Fälle im August und die Cataratas de Iguazú im Dezember.
Was uns auf der brasilianischen Seite zusätzlich sehr gefallenFreude bereitet hat, war der der Besuch im Parque das Aves, einem sensationeller Vogelpark, gleich gegenüber dem Eingang zu den Wasserfällen. Flamingos und andere wunderbar farbige Vögel fliegen und stolzieren dort herum, exotische Blumen und Schmetterlinge gibt’s zu sehen, Papageien, die mit lautem Geschrei im Sturzflug an einem vorbeipfeilen, Krokodile und furchtlose Schildkröten. Die eine hatte sich einem Krokodil auf den Rücken gesetzt, welches aber offenbar grad am Siesta-Machen war und daher zu müde, um etwas gegen den aufdringlichen Schulterhocker zu unternehmen.
An einem Abend gab’s Tacos und Burritos, am zweiten trafen wir Carlos, in dessen Ferienhaus in Villa Carlos Paz wir vor ein paar Wochen gewohnt hatten. Er und seine Tochter sind beide Bauingenieure, die im Hotel Melia seit einem Jahr damit beauftragt sind, Umbauten vorzunehmen. Es war ein interessanter Abend, wir sassen im Restaurant Doña Maria, das zum Hotel gehört, in dem wir wohnten, auf der Terrasse und genossen das feine, viel zu üppige Essen und die milden Temperaturen.
Das waren zwei wunderbare Tage! Am dritten und letzten fand unser Flug über Buenos Aires nach Miami erst um halb sieben Uhr abends statt, so hatten wir nochmals Gelegenheit, bis um vier am Pool zu liegen, zu lesen, ebenfalls Siesta zu machen und das warme Wetter zu geniessen – ähnlich wie das Krokodil im Teich im Vogelpark.
Florida 9. – 17. Dezember
Schön ging’s gleich weiter in Miami. Sehr früh am Morgen kamen wir an, holten unser Mietauto ab und schon zwanzig Minuten später (es war Sonntag - sonst braucht man mehr als die doppelte Zeit) kamen wir bei Liza und Urs Lindenmann an, Freunden, die seit 40 Jahren in Miami leben. Eigentlich hatten wir mit HomeExchange-Partnern einen weiteren Haustausch in Bonita Springs vereinbart, aber wir waren sehr froh, dass wir nach dem neunstündigen Flug (vorher zusätzlich zwei Stunden zurück bis BA und zweieinhalb Aufenthalt im Flughafen) nicht noch bis an die Westküste fahren mussten.
Die beiden hatten uns angeboten, bei ihnen zu übernachten und erst am nächsten Morgen weiterzufahren. - Mit einem feinen Frühstück wurden wir verwöhnt und dann konnten wir uns im weichen, warmen Bett vom langen Flug erholen. So mühsam die Fliegerei jeweils, so fantastisch ein bequemes Bett, wo man sich anschliessend ausstrecken und murmeltierartig schlafen kann.
Ein paar Stunden später nach dem Auftauchen aus Abrahams Schoss, machte Liza den Vorschlag, einen Spaziergang durch die nahe gelegenen Pinecrest-Gardens zu machen. Da war ich sofort dabei. Karen, eine Freundin von Liza, die ich vor ein paar Jahren schon kennengelernt hatte, kam ebenfalls mit. - Theos Siesta-Zeit hingegen zog sich den ganzen Tag hin, nur unterbrochen von gelegentlichem „Trump-Watching“ am Fernseh-Bildschirm.
Wir drei Frauen aber genossen den Bummel durch den schönen Park bei milden Temperaturen.
Am Abend waren wir bei Lindenmanns Nachbarn zu einer Christmas-Party eingeladen. – Von da an ging’s amerikanisch zu, amerikanischer geht’s nicht. Für uns ein ziemlicher Kultur-Schock. Bob, den Gastgeber, trafen wir eine Stunde vor Beginn des Geschehens völlig gestresst vor der Haustüre an. – Kein Wunder!
Was da alles hatte organisiert werden müssen, damit es den vielen illustren Gästen wohl ist: Valet-Service (betreut von zwei Angestellten), damit niemand Parkplatzsorgen hat, eine Sängerin, die von der Galerie aus die Gäste beschallt und zum Tanzen animiert, damit sowohl weihnachtliche wie auch Party-Stimmung aufkommt, eine Bar mit dem dazugehörigen Barkeeper und allen Alkoholika, die das Herz und die Leber begehren, damit niemand Durst leiden muss, eine Handvoll weitere Angestellte vom Caterer-Service, die die Gäste mit Champagner empfangen und mit feinen Häppchen versorgen, damit gleich von Anfang an alles glatt läuft, und die zu gegebener Zeit alle diese Köstlichkeiten wieder abräumen und das Buffet für den Hauptgang parat machen, danach auch das alles wieder ver- und entsorgen, damit das Dessertbuffet aufgestellt werden kann, damit niemand Hunger leiden muss.
Hui. Und das ist noch nicht alles. Die ganzen Weihnachtsdekorationen… Glitzer und Glimmer, Lämpchen, Lichter und Farben, der obligate Tannenbaum draussen und drinnen, Kränze und Schleifen. – Der arme Bob. Wie froh muss der gewesen sein, als er alle Gäste wieder los war.
Und was alles vom Buffet übrig blieb, hätte für eine weitere Party problemlos gereicht: Silvia und Bob würden für die nächsten Wochen sicher nichts mehr einzukaufen brauchen.
Mit vollem Magen und interessanten Eindrücken verliessen auch wir das gastliche Haus gegen elf und legten uns im wunderbar kahlen und stylishen Haus unserer Freunde erneut ins bequeme Bett.
Am nächsten Morgen wollten wir um elf spätestens weiterfahren, aber ausschlafen, ein weiteres feines Frühstück gemeinsam geniessen und angeregte Gespräche liessen uns fast bis um zwei Uhr nachmittags in der gemütlichen Stube sitzen.
Die Fahrt an die Westküste auf der Route 41 durch die Everglades dauerte zweieinhalb Stunden, begleitet im Radio von Weihnachtsrock und –pop ohne Ende. Ein Unterbruch in „Joanie’s Blue Crab Cafe“ (was für ein Schuppen!) liess keine Zweifel mehr aufkommen: Jetzt sind wir in Amerika angekommen! - Die Wirtin in ihren viel zu engen, viel zu kurzen Shorts, dem viel zu engen T-Shirt (wer weiss, ob es ihr vor zwanzig Jahren besser gestanden hätte) und dem kleinen Schürzchen mit dem amerikanischen Wappen drauf, unter dem sie das Portemonnaie verbarg, begrüsste uns überschwänglich und lud uns ein, etwas zu essen und zu trinken. „My darling, let me know, what I can do for you”, auch mit „honey“ und „my love” sprach sie mich an. Das ist hier ja alles völlig normal, aber dass sie mich einmal (sie ist sicher mindestens zehn Jahre jünger als ich) mit „my daughter” ansprach, kam mir schon etwas merkwürdig und „over the top” vor. – Nun, die Crab-Soup, die sie Theo servierte, war tatsächlich ausgezeichnet. Alles könne ich von ihr haben, liess sie mich (her daughter) wissen, nur nicht ihren Koch. – Auf ihn mit seiner dreckigen Schürze hätte ich trotz der Suppe verzichten können; das sagte ich aber nicht, dachte es nur.
Wir fuhren weiter, immer noch den Weihnachtssound im Ohr.
Das Haus, das wir in Bonita Spring antrafen, hat unsere Erwartungen übertroffen: grosszügig und geschmackvoll eingerichtet, eine riesige Küche, erstaunlicherweise sehr gut ausgerüstet, unzerkratzte Bratpfannen, scharfe Rüstmesser, zehn Betten, drei Badezimmer, ein Swimmingpool und sogar ein geschmückter Tannenbaum – all das erwartete uns.
Schön, hier ein paar Tage lang zu wohnen und zu haushalten.
Das Wetter allerdings könnte etwas wärmer sein, Jacke statt Badehose war angesagt bei unserem Spaziergang am Strand entlang. Die unzähligen Muscheln, die dort liegen (250 verschiedene Arten soll’s in dieser Gegend geben, hab ich gelesen), lassen mein Muschelsammler-Herz höher schlagen, aber wenn ich dann an unsere Koffer und an die damit verbundene Gewichtsbeschränkung denke…
Naples ist eine halbe Stunde von hier entfernt. Ein Spaziergang auf dem Pier am späten Nachmittag ist sehr erhol- und unterhaltsam. Fischer, Surfer, Pelikane und anderes Gefieder kann man beobachten und anschliessend durch die historische Altstadt (!!!!) zu schlendern, ist ein Vergnügen. Alles ist äusserst gepflegt und macht einen gemütlichen Eindruck. Bei Nacht sind sämtliche Palmen mit zahllosen Lämpchen beleuchtet (es weihachtet SEHR). Es hat verschiedenste Shops, Galerien und so viele einladende Restaurants, dass man vor lauter Auswahl gar nicht weiss, in welchem man essen soll. Wir wählen zur Abwechslung ein thailändisches. Dessert dann bei Tommy Bahama, ein Muss, wie alle meinen.
Noch immer ist es von der Temperatur her möglich, draussen zu sitzen. – Wir geniessen es!
Fort Myers ist ein wenig anders. Der Charme von Naples fehlt, es hat dort zwar ebenfalls eine Art Flaniermaile, aber die ist überhaupt nicht vergleichbar mit der von Naples.
Und was ganz anders ist als in Argentinien: Bereits vor sechs Uhr sind die Restaurants gut besetzt. Um neun schliessen die meisten bereits. Das ist dann, wenn weiter südlich das Geschehen erst beginnt.
Am Freitag endlich stieg die Temperatur wieder auf 28 Grad, aber leider war’s bedeckt und regnerisch. Ein Einkaufsbummel in den wohligen „Outlet-Kühlschränken“ kam grad gelegen. Man findet ja immer was, um den Koffer noch eine bisschen mehr zu belasten.
Farmers-Market-Besuch war am Samstag auf dem Programm. Da geh ich immer gern hin.
In der Nacht hatte es stark geregnet, aber nun war es einigermassen schön, also beschlossen wir, auf Sanibel-Captiva-Island zu fahren. Die Fahrt dorthin dem Meer entlang dauerte nur etwa eine Stunde. - Im Visitors‘-Center sind Spassvögel angestellt: Wir erhielten von ihnen einen Schneeschaber, der uns bei gelegentlichem Gebrauch zurück an die schöne Insel erinnern soll. Den haben sie offenbar parat, um ihn den „Snowbirds“ zu überreichen, den Besuchern aus den kälteren Landesgegenden, Kanada und Europa, die den Winter in Florida verbringen.
Auf Captiva fanden wir ein Restaurant direkt am Meer gelegen, einen englischen Pub, und dort verbrachten wir ein Zeitlang mit Mittagessen, Theo mit Siesta-Machen im Liegestuhl und ich mit Muschelsammeln am Strand.
Der Sonntag, unser zweitletzter Tag in Florida, brachte uns doch noch einen Strandtag. Etwa vier Stunden lang liessen wir uns von der Sonne bräteln. Ein gutes Kilo Muscheln fand auch noch den Weg zurück an die Springs Lane 4021, nur ein kleiner Teil davon, die allerschönsten, allerdings in meinen Koffer.
Unser letztes Nachtessen verbrachten wir in einem hübschen Restaurant am Estuary.
Am nächsten Morgen, dem 17. Dezember, machten wir keine grossen Sprünge mehr, sondern begannen, langsam unsere Zelte abzubrechen. Mit Betonung auf langsam, denn unser Flug ging erst am Abend gegen acht Uhr, so hatten wir viel Zeit zum Packen - das letzte Mal während dieser Reise. Für die Rückfahrt nach Miami planten wir genügend Zeit ein, so dass wir ohne Stress die Heimreise antreten konnten. Und oh Wunder: Diesmal gelang es uns auf Anhieb, die Einfahrt für die Mietwagen-Rückgabe zu finden, so dass wir das fröhliche „Um-den-Flughafen-Herumkreisen“ für einmal vermeiden konnten.
So schön eine Reise auch war, der letzte Höhepunkt ist es, gesund wieder zu Hause anzukommen, mit vollem Koffer, unvergesslichen Eindrücken und Erinnerungen vom Besten.
Reisen 2019
Um Ostern herum verbrachten wir vierzehn sehr schöne Tage in München und Umgebung. Wir hatten zwei HomeExchange-Tausche, den einen in der Stadt selbst, den anderen am Starnberger See. Das Wetter war sommerlich warm, so richtig zum Biergarten-Erforschen geeignet.
Genau umgekehrt war unser Besuch im Piemont im Mai. Es regnete nur einmal. Aber der Zweck der Reise war vor allem, Eva und Ken zu besuchen, die dort ein Haus gekauft haben. Sie wollen in Zukunft einen Teil des Jahres in dieser einzigartigen Gegend in Italien verbringen. So werden wir sie wohl noch einige Male besuchen können. – Keine schlechte Perspektive...
So konnten wir dieses Jahr endlich den ganzen Sommer in Bern geniessen, im Marzili in meiner zweiten Heimat sozusagen.
Und bereits ist es Oktober, Zeit nach den Spanienferien die nächste Herbstreise anzutreten. Diese wird wie üblich zwei Monate dauern. Sie bringt uns mit einem Kreuzfahrtschiff von Genua aus nach Durban, Südafrika. - Einmal mehr. In der zweiten Hälfte der Reise wollen wir die Safari machen, die wir vor drei Jahren verpasst haben, weil Theo statt wilder Tiere nette Krankenschwestern um sich scharte...
Und auch diese Reise ist bereits Schnee von gestern, denn jetzt, wo ich das schreibe, ist es bereits Mitte Februar 2020.

Reisebericht Kreuzfahrt von Genua nach Durban / Rundreise in KwaZulu-Natal /
Safari Durban-Krüger Park-Johannesburg (18. Oktober bis 16. Dezember 2019)
Um vier Uhr morgens holt uns Diego ab und bringt uns ins Neufeld zum Busterminal, von wo aus wir um halb fünf nach Genua losfahren werden. Terminal ist ein stolzes Wort für die zwei Bruchbuden, an denen „Snackbar“ und „WC“ angeschrieben steht, beide um die Zeit natürlich geschlossen. – Ist das wirklich der richtige Ort? – Es regnet leicht und unter dem einzigen schmalen Unterstand warten bereits ein paar Leute, für uns und unser Gepäck hat’s dort keinen Platz mehr.
Pünktlich kommt ein Bus, allerdings nur ein kleiner und es sieht lange so aus, als ob wir gar nicht alle mit dem ganzen Gepäck dort drin Platz fänden. Die Bus-Chauffeuse tut ihr Bestes und versucht, die schweren Koffer hinten reinzuquetschen. Das funktioniert aber nur teilweise; auch die hinteren zwei Sitzreihen müssen belegt werden. Sie tut mir leid, kaum jemand hilft ihr; niemand begreift, weshalb nur so ein kleiner Bus zur Verfügung steht. Für die Passagiere hat’s grad noch knapp Platz. Wie wir hören, in Luzern würden noch fünf weitere Gäste zusteigen, ist klar, dass eine andere Lösung gefunden werden muss.
Das fängt ja gut an, unser Senioren-Reisli…
Unterwegs hält unsere Fahrerin an und organisiert einen zweiten Bus, der die „Luzerner“ abholt. So wird uns der Umweg über die Stadt erspart und wir fahren direkt Richtung Gotthard, wo’s vor dem Tunnel einen Kaffeehalt gibt.
In Bellinzona steigen wir in einen grösseren Bus um, wo wir nicht mehr so zusammengepfercht sind wie die Sardinen. Auch die Passagiere aus Luzern und eine ganze Busladung aus Basel und St. Gallen fahren mit.
Nach dreieinhalb Stunden kommen wir in Genua an und es dauert eine halbe Stunde, bis der Busfahrer den Hafen findet. Das verhilft uns zu einer Art Stadtrundfahrt. – Am Hafen geht die Warterei weiter. Irgendwas schient schief gelaufen zu sein, denn es dauert weitere drei Stunden, bis wir unsere Kabine betreten können.
Ab jetzt geht’s problemlos weiter. Mit einer halben Stunde Verspätung läuft die MSC Orchestra aus, aber das ist unsere Sorge ja nicht. Wir haben genügend Zeit, den Inhalt unserer Koffer zu versorgen und es reicht sogar für eine Siesta für Theo, bevor das erste Nachtessen ruft.
Wir haben uns für die zweite Belegung angemeldet, um halb neun, können uns also in Ruhe einem ersten Apéro widmen. Jetzt fangen die Ferien an!
Eine kleine Sorge war noch, mit wem wir wohl am Tisch sitzen werden, denn einige der Passagiere, die mit uns im Bus gereist sind, wären ganz sicher nicht meine Wahl. – Aber wir haben Glück: Mit dem Paar aus Basel verstehen wir uns sehr gut; uns wurde ein Vierertisch zugewiesen. – Und nie ging uns das Gesprächsthema aus. Bis zum letzten Abend nicht.
Am nächsten Morgen wachen wir in Civitavecchia auf. Einen Ausflug nach Rom unternehmen wir ganz sicher nicht. So ein Stress. Aber es gibt Leute, denen das passt. Wir machen lediglich einen Spaziergang in der Nähe des Hafens, finden ein Café, wo’s Internetzugang hat, kaufen die Nagelschere, die wir beide vergessen haben einzupacken und gehen zeitig zurück aufs Schiff.
Bisher hat Theo übrigens noch nichts verloren. Nur fast. Aber – wie jedes Mal – findet er wieder was in seinem Rucksack, den er dabei hat: Münzen, die wir hier nicht gebrauchen können und Prospekte von früheren Reisen. Auch Medikamente, die er ja in weiser Voraussicht überall vorsorglich versteckt. Das heisst, jetzt hat er nicht nur eine Dreifach-, sondern sogar eine Vierfachration mit dabei.
Tags darauf gibt’s den nächsten Halt: in Chania, auf Kreta. Hier funktioniert der Landgang nicht besonders gut. Eine Busfahrt hin und zurück ins Zentrum wird für zehn Euro pro Person angeboten. Da stehen wir nun im Hafengelände und warten an der prallen Sonne eine halbe Stunde lang, aber kein Bus fährt. – Das stimmt so zwar nicht ganz. Die City-Busse, die auch gleich dort stationiert sind, fahren alle paar Minuten und die Retourfahrt in die Stadt kostet 3 Euro 40. – Das sorgt natürlich für Unmut. - Auch die Rückfahrt lässt zu wünschen übrig. Erst langes Warten an der Bushaltestelle im Zentrum, dann dauerte es vierzig Minuten, bis die lange Schlange vor dem Schiff abgefertigt werden kann und wir endlich wieder im kühlen Bauch des Riesenkahns „zu Hause“ sind.
Die Durchfahrt durch den Suezkanal gefällt uns sehr. Zwar gibt es stundenlang nicht viel zu sehen, aber trotzdem finden wir das eher langsame Gleiten durch den Kanal interessant. Erst gibt es vor Port Said eine lange Wartezeit, bis schliesslich die Erlaubnis zur Durchfahrt erteilt wird. Dann geht es im Konvoi voran, immer etwa fünfzehn Schiffe erhalten hintereinander Einlass, begleitet von Pilotbooten. – Sehr viel Sand und Wüste gibt’s zu sehen, Wachtürme auf der ägyptischen Seite, hin und wieder eine kleine Siedlung, zwei Brücken, die beide nicht gebraucht werden (niemand will auf die andere Seite), dann Ismail, eine grössere Stadt.
In der Bittersee angekommen, blockierte ein Frachter die Ausfahrt, so dass unser Schiff während ein paar Stunden an Ort und Stelle bleiben muss. Alle merken natürlich, dass da etwas nicht stimmt, aber informiert wird man nicht.
Aus dem Grund gibt es dann grosse Probleme, als das Schiff mit ziemlicher Verspätung in Eilat ankommt. Erst wird die Erlaubnis zum Landen nicht erteilt, so bleiben wir erneut die längste Zeit vor dem Hafen stecken, und wie es dann endlich so weit ist, ist es für etliche bereits gebuchte Ausflüge zu spät. Alle Passagiere, die eine Busfahrt oder einen Flug nach Jerusalem gebucht haben, müssen darauf verzichten. – Und bis überhaupt jemand aussteigen kann, dauert es geschlagene zwei Stunden. Statt am Morgen losfahren zu können, wird es zwei Uhr nachmittags.
Wir hatten eine Besichtigung der „King Salomon’s Cupper Mines“ gebucht und einen Besuch in einem Kibbuz. Die Kupferminen können wir besichtigen. Ein Schweizer, der seit fünfzig Jahren dort lebt und als Geologe und Archäologe in diesem Gebiet tätig war, ist unser ausgezeichneter Führer. Natürlich kann er alles aufs Beste erklären. Für den Kibbutzbesuch reicht die Zeit nicht mehr. – Wir hatten also Glück, viele andere Gäste nicht. Von manchen hörten wir anschliessend, dass sie nicht einmal mehr an Land gehen konnten. MSC kann wohl nichts dafür, die Einwanderungsbehörden wollten nur noch je 50 Passagiere pro Stunde abfertigen, was bei den über 2000 Passagieren, die sich zumindest gerne Eilat angesehen hätten, nichts anderes als eine Schikane war. Zwar wurde für die Gestrandeten eine gratis Stadtrundfahrt angeboten, aber, wie gesagt, dazu kam’s für die meisten überhaupt nicht. Grosse Enttäuschung und riesiger Unmut waren die Folge davon. - Natürlich erhielten sie ihr Geld zurück. Auch uns wurde ein Teil des Betrags, den wir für den Ausflug hatten zahlen müssen, gutgeschrieben.
Die Felsenstadt Petra in Jordanien war dann ein absolutes Highlight. Ein Grund, weshalb ich die Kreuzfahrt gebucht hatte, war der Ausflug, der dorthin angeboten wurde. Akaba liegt gleich gegenüber von Eilat, so ankerte das Schiff schon früh am Morgen im Hafen und wir konnten zeitig losfahren in die Berge. Eine zweistündige Fahrt brachte uns auf ungefähr 1‘400 Meter Höhe über Meer und zweimal gab es einen kurzen Halt. Die Aussicht über die kahlen Berge, von denen die dunklen ungefähr 950 Millionen Jahre alt sein sollen und die helleren Sandsteingebirge „nur“ 100 Millionen Jahre, war eindrücklich. Von weitem sah man die Stelle, wo Aaron’s Grab (angeblich) liegt.
Im neuen Petra herrscht ein grosses Gedränge. Es ist Freitag und die Männer versammeln sich zum Freitagsgebet. Frauen sieht man keine. Bis wir endlich auf dem Busparkplatz ankommen, dauert es, die Strassen sind völlig verstopft. – All die vielen Busse dort! Nicht Hunderte von Touristen wollen gerade heute die berühmte Felsenstadt sehen, nein Tausende. Zu Fuss geht’s etwa zwei Kilometer weit durch eine schmale rötliche Felsenschlucht, die an der engsten Stelle nur gerade zwei Meter breit ist. Massen von Touristen drängen sich ihrem Ziel entgegen, dem Eingang zu Petra. Immer wieder rasen Pferde und kleine Pferdekutschen an uns vorbei, aus denen jeweils ein grässlicher Gestank dringt, eine Mischung von Mist und Schweiss - es ist ein mühsamer und unebener Weg, den wir auf uns nehmen müssen. Nicht ganz so wie bei Indiana Johnes (wir hatten uns zu Hause den Film quasi als Einstig nochmals angesehen) erblicken wir schliesslich das riesige Tor, das vor über zweitausend Jahren in den Fels geschlagen worden war. Trotz der vielen Leute dort ein einmaliger und erhabener Anblick. Etwa zwei Stunden lang schlendern wir in den Ruinen herum und lassen uns von der grossartigen Baukunst faszinieren.
Nach vier Tagen auf See gibt’s einen nächsten Halt im Oman, in Salalah. Einen Ausflug wollte ich dort nicht buchen, denn die paar Ruinen, die’s zu sehen gibt, können wohl kaum beeindrucken nach dem Besuch von Petra. Also Stadtbesichtigung auf eigene Faust.
Ein Shuttlebus der Rederei bringt uns bis zum Ausgang des Hafens. Kaum ausgestiegen, werden sämtliche Gäste von den aufdringlichen Taxifahrern bedrängt. Es ist mühsam. Zwar ist dort ein Schild angebracht, auf dem steht, wie viel die Taxifahrt in die Stadt, die eine knappe halbe Stunde dauert, kostet. Davor haben sich aber ein paar Araber positioniert, damit man die Preise gar nicht sehen kann. Auch ist nicht klar, wohin genau die Fahrt führt. 20 Dollar wollen sie bis ins Stadtzentrum. Pro Person. Wie gut sie rechnen können, ist auch nicht ganz klar. 100 Dollar für und vier (wir sind zusammen mit Trudi und Fredy unterwegs, mit denen wir jeweils am selben Tisch sitzen beim Abendessen). - Das geht ja schon gar nicht. Also 80 Dollar, ok, für uns vier. – Diese Männer gehen mir sowas von auf die Nerven! – Man kann ihnen noch so höflich fünfmal und öfter sagen, dass wir das nicht akzeptieren, sie geben nicht auf, fassen einen noch an mit ihren schmutzigen Händen. – Es gibt einen Bus. Zum Glück! Den nehmen wir. Pro Person kostet die Fahr damit 1 Dollar. – Wie blöd müssen die Typen sein… Nun stehen sie dort und haben gar nichts verdient. Aber sicher wird sich das Ganze beim nächsten Schiff genau gleich abspielen.
Über die Stadt, zumindest über den Teil, wo wir herumspazierten, gibt es nicht wirklich viel „to write home about“. Ein Häuserblock reiht sich an den anderen, dazwischen leere Parzellen und staubige Strassen. Leute sind so gut wie keine unterwegs und wenn, dann nur Männer. Einzig die eine Moschee ist schön gelegen, umgeben von einem Park.
Eigentlich wollen wir einen Markt besuchen, aber es ist nicht ganz klar, wo sich der befindet. Einen kleinen einheimischen Markt finden wir, aber dort gibt’s für uns nichts zu kaufen. Eine Schlachterei, ein Herrenfrisör und ein paar trostlose Baracken sind alles, was der Ort zu bieten hat. Eine Moschee natürlich auch. Dutzende von schmutzigen Schuhen liegen achtlos vornedran auf dem Boden, Männer eilen in die Predigt.
Wir gehen weiter; es ist heiss, wir sehen einen Komplex, wo’s vielleicht etwas zu kaufen gibt. Es ist ein grosses Geschäft prall gefüllt mit nichts anderem als Kosmetika und Parfums. Kunden hat es keine drin, aber etwa ein Duzend Verkäuferinnen. – Gleich nebenan ist ein Hotel. Wir beschliessen, dort vorerst mal etwas zu trinken und uns zu erkundigen, wo der Markt ist, den wir besuchen wollen. Die Preise fürs Mineralwasser und für Kaffee sind etwa die gleichen wie bei uns. Theo kauft einen Muffin und verlangt dazu ein Messer, um ihn in mundgerechte Stücke zerschneiden zu können. Erst erhält er nur fragende Blicke, dann bringt ihm der Kellner, der keinen Plan hat, weshalb ein solches Werkzeug verlangt wird, ein Fleischermesser, das er zuunterst in einer Schublade gefunden hat. Erst wie er sieht, dass Theo damit sein Törtchen verschneiden will, findet sich ein passendes Plastikmesser.
An der Rezeption ist eine schwarz verschleierte Dame, die nun an unseren Tisch kommt und fragt, wo wir herkommen. Sie spricht gut Englisch und wir können sie fragen, wo’s hin geht zum Markt. Der sei geschlossen und erst um vier wieder offen. Da sind wir aber schon wieder auf dem Schiff. Es gäbe noch einen Markt am Strand, wo man etwas kaufen könne, erklärt sie uns und bietet an, ein Taxi zu bestellen. Natürlich erkundigen wir uns erst über den Preis. Wir sind einverstanden. Es dauert einen Moment und das „Taxi“ kommt. Es ist nicht als solches angeschrieben. Ich glaube, sie hat einen Verwandten engagiert, uns herumkutschieren. In seinem Auto haben wir genügend Platz, ich sitze vorne neben dem Fahrer, die andern drei hinten. Am liebsten würde ich mir die Nase zuhalten. - Wann er zum letzten Mal geduscht hat, möchte ich lieber gar nicht wissen. Und die Decke, auf der er sitzt, hat wohl noch nie im Leben Wasser erlebt. Aber alles ist bestens. Er fährt uns ein ganzes Stück durch etliche Strassen bis zum Strand. Dort gab es tatsächlich einen Markt und ein paar Stände sind offen. Er hält ein wenig ausserhalb an und verspricht, auf uns zu warten. Grad so, dass ihn die anderen Taxifahrer nicht sehen können. Wir kaufen ein paar wenige Sachen (Weihrauch, ist fast obligatorisch hier, zwei Schals und Theo muss unbedingt eine Araber-Mütze kaufen, die er ja dann nie im Leben irgendwo anziehen wird) und gehen zurück zum Wagen. Unser Pseudo-Taxi bringt uns anschliessend die ganze Strecke zurück zum Hafen und zahlen müssen wir ihm nur gerade 25 Dollar für den ganzen Ausflug. – Ich glaube, wir hatten mit viel Glück die absolut günstigste Salalah-Exkursion, die irgendjemand auf unserem Schiff an dem Tag erlebt hat.
Nach nochmals drei Tagen auf See kommt die MSC Orchestra auf den Malediven in Malé an. Es wurden Ausflüge angeboten, aber die beinhalteten eine Bootsfahrt auf eine der umliegenden Inseln in ein privates Resort zum Schnorcheln und am Strand liegen. Knapp ein halber Tag für mehr als 150 Franken pro Person. – Ist’s mir dann doch nicht wert. Wenn schon lohnt es sich, ein paar Tage an so einem paradiesischen Ort zu verbringen, aber auch wenn’s schon lange her ist - das kann ich bereits von meiner „To-Do-Liste“ abhäkeln.
Wir schauen mal, wie’s in der Hauptstadt dieser Inselgruppe aussieht, einem der am dichtesten besiedelten Orte der Welt, streng islamisch. Bucht man eine Reise in die Malediven, bleibt man hier sicher nicht. Ankunft auf dem Flughafen und nichts wie weg. - Tenderboote bringen die Passagiere an Land, direkt in die Stadt. Dort herrscht ein Riesengedränge in den engen Gassen, vor allem am Hafen, wo gerade der Fischmarkt stattfindet. Mehrstöckige Häuser stehen eng aneinander gedrängt, nur um die Moschee herum ist eine Art Park angelegt. Wie sind diesmal mit Amelia und Jürg Wyss zusammen unterwegs, die wir bereits im Bus nach Genua kennengelernt haben. Jürg hat ein paar Jahre lang in Johannesburg gearbeitet, hat dann Amelia kennengelernt, eine Xhosa-Frau. Zusammen sind sie in den frühen Achtzigerjahren wegen der Gesetze der Apartheit in die Schweiz geflüchtet, wo sie seit damals zusammen leben. Sie haben noch immer ein Haus in Jo’burg, und dort verbringen sie jeweils unseren Winter. Sie haben uns eingeladen, sie zu besuchen, bevor wir zurückfliegen. Mal sehen, vielleicht liegt das sogar drin.
Auch Walter ist mit uns unterwegs, ihn haben wir auf dem Schiff kennengelernt. Er fällt auf, denn am Gala-Abend erscheint er in einer eleganten Zürcher-Oberländer-Tracht. - Wir schlendern zum Strand, aber baden will niemand von uns. Man müsste als Frau in der ganzen Montur ins Wasser steigen – nein danke!
Es ist auch schwierig, ein Restaurant zu finden; diese sind sehr rar. Es gelingt dann doch noch. Nur Männer bevölkern das Lokal, nun halt noch eine schwarze und eine weisse Touristin. Wir werden sehr freundlich bedient und erhalten einen Cappuccino, der sich tatsächlich sehen lässt.
Kurz darauf besteigen wir das Tenderboot und lassen uns zurück zur MSC fahren in eine völlig andere Welt.
Zwei Tage auf See.
Seychellen: Hier bleiben wir zwei Tage lang; wir können also mal wo anders Nachtessen gehen als auf dem Schiff und uns am ersten Tag auch Zeit nehmen, die Insel auf eigene Faust zu erkunden, ohne zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder zurück sein zu müssen. Einen halbtägigen Ausflug hatte ich schon zu Hause gebucht: „Wilder Süden“. Das war ganz gut so, denn bei Ankunft in Port Victoria regnet es und während der Fahrt im Bus gegen Süden wird das Wetter immer schöner. Ein fantastischer Ausblick bietet sich uns von einem Hügel aus auf die Küste und den Hafen, wo die MSC vor Anker liegt. Man sieht einige der fantastischen Resorts und denkt, es ist kein Wunder, dass ein Aufenthalt dort so teuer ist.
In einer Handwerksstätte machen wir Halt und sehen unter anderem, wie Stoffe bearbeitet werden. – An einem wunderbaren weissen Strand, so wie er in den Glanzprospekten angeboten wird, machen wir Halt und können im lauwarmen, türkisfarbigen Meer eine Stunde lang baden und Spaziergänge machen. – Toll ist das!
In einem weiteren Handwerkerzentrum werden Schiffsmodelle hergestellt. Sagenhaft, wie minuziös die Schiffe gearbeitet werden. Unter anderem sind es Replikate berühmter Schiffe in verschiedenen Grössen und man kann sie sich auch nach Hause schicken lassen. Sie sind gefertigt aus Teak- und Mahagoniholz. Die Seychellen sind seit etwa fünfzig Jahren berühmt für dieses Kunsthandwerk, es ist allmählich eine ganze Industrie daraus entstanden.
Am Nachmittag packen wir unsere Badesachen und gehen zurück in die Stadt. Ich habe mich erkundigt, wo’s einen schönen Strand hat nicht allzu weit weg von Port Victoria. Die Busse, die gleich vor der Hafenanlage stationiert sind, sind mit „Beau Vallon“ angeschrieben, aber der ziemlich unfreundliche Chauffeur sagt, er nehme nur einheimisches Geld. So spazieren wir weiter ins belebte Zentrum, wo mitten in einem Kreisel eine Nachbildung des Londoner Big-Ben steht. Bei einem ATM-Automaten wechsle ich hundert Franken in Rupien und nun sind wir frei, einen Bus zu besteigen. Schon sehen wir einen, der mit „Beau Vallon“ angeschrieben ist. Da ist zwar keine Haltestelle, aber er hält trotzdem mitten im Verkehr an und lässt und einsteigen. Es ist eine Art Höllenfahrt, die uns auf die andere Seite des Hügels bringt an einen feinsandigen Strand mit einer Bar, ähnlich wie diejenigen in Hawaii. – Wir lassen es uns gut gehen und beobachten mit der Piña Colada in der Hand den fantastischen Sonnenuntergang vom Barstuhl aus.
An der Bushaltestelle treffen wir auf ein Paar aus Zug, das auf demselben Schiff mitreist. Sie haben keine Rupien, da kann ich natürlich brillieren mit meinem Münz. Die Fahrt kostet umgerechnet kaum einen Franken pro Person, das Taxi mindestens zwanzig.
Wir fahren also zurück und suchen uns gemeinsam ein Restaurant fürs Abendessen, wo man draussen sitzen kann. Das finden wir in der Nähe des Hafens mit Blick auf die beleuchtete MSC. Es ist der Yacht-Club (for members only), aber sie machen eine Ausnahme… Im selben Lokal sind auch Amelia, Jürg und Walter bereits am Essen. So klein ist die Welt und halt auch die Insel.
Auch am nächsten Tag fahren wir wieder an die Beau Vallon Beach. Der Strand auf der Seite, wo wir heute aus dem Bus steigen, haben wir gestern gar nicht gesehen. Er ist viel grösser und es hat viele Touristen. Wir treffen Trudi und Fredy, unsere Tischnachbarn. Wir beschliessen, im grossen Strandrestaurant etwas trinken zu gehen. Wir warten die längste Zeit und werden nicht bedient. Da lassen wir’s halt, kaufen ein Getränk in einer der Hütten am Strand und gehen zusammen schwimmen. Inzwischen hat es aber zu regnen begonnen. Warmer Regen, aber trotzdem – es ist nicht angenehm, wenn alles nass ist. Wir nehmen den Bus zurück nach Port Viktoria und zum Schiff. In der Kabine gibt’s eine höchst willkommene Dusche und wir ziehen uns trockene Kleider an. – Und schon heisst es wieder Leinen los, die MSC sticht in See. Für weitere zwei Tage.
Mauritius: Zwei Tage Aufenthalt haben wir hier, genau wie auf den Seychellen. Aber ich habe keinen Ausflug gebucht. Vor Jahren war ich ja mal mit Kay auf dieser Insel und wir hatten mit dem Mietauto die Insel von Norden nach Süden und von Osten nach Westen mehrmals abgefahren, ich erinnere mich, dass ich damals sagte, unser Fährtli komme mir vor wie mit der Nähmaschine gewiefelt.
Zu Fuss pilgern wir also ins Stadtzentrum von Port Louis. Der Spaziergang dauert eine knappe halbe Stunde und Taxis, die an uns vorbeifahren, bieten ihren Service bis ins Zentrum für 20 Dollar an. – Das können sie vergessen…
Es ist Sonntag und wie man uns auf dem Schiff mitteilte, seien alle Läden und der Markt geschlossen. – So ein riesiges Getümmel in den Gassen vor der Markthalle wie dort, habe ich aber selten gesehen. Auf dem grossen Busbahnhof herrscht ebenfalls ein Gedränge und grosse Hektik. Bei einem Buschauffeur erkundige ich mich nach Orten und Preisen, aber auch hier kann man nicht mit Dollar oder Euro zahlen und ich mag nicht schon wieder Geld wechseln. –– Wir beschliessen also, es diesmal gemütlich zu nehmen und uns nur gerade in Port Louis umzuschauen.
An der Hafenpromenade geht es dann ganz anders zu. Sie ist modern und scheint noch nicht lange in dieser Art zu bestehen. Dort trifft man Restaurants und teure Läden an, die mit dem Leben auf dem nahen Markt gar nichts gemeinsam zu haben scheinen. Und diese sind tatsächlich zu.
Wir essen eine Kleinigkeit und finden dann das Wassertaxi, das uns für nur zwei Euro pro Person zurück zum Schiff bringt. Die Fahrt dauerte kaum fünf Minuten.
An diesen beiden Tagen, wo die MSC im Hafen ankert, so scheint es, haben alle Fischer und Besitzer von was auch immer von knapp noch seetüchtigen Wassergefährten diese hervorgeholt und für den Touri-Transport vom Hafen zum Schiff flottgemacht. Wie die Sardinen… - Einer der wartenden Passagiere sagte, als er den Kutter sah: „It reminds me of a movie I once saw. It was called Titanic“.
Auch am nächsten Tag besuchen wir die Stadt per Wassertaxi ein weiteres Mal. Vor lauter Geld für die Überfahrt einsammeln stösst unser „Kapitän“ beinahe mit einem andern Boot zusammen. Wir spazieren durch die nicht wirklich spektakuläre Chinatown, sehen uns auf einem anderen Markt um und geniessen die Ruhe in einem Park, der mit den wunderbaren Banyan-Trees mit ihren riesigen Luftwurzeln zum Verweilen einlädt.
Drei Tage auf See. Die Wellen sind höher als auch schon. Einschlägige Säcke werden verteilt, einige Passagiere sieht man nicht mehr. Nicht alle vertragen das Schaukeln. Es hat mehr Platz an den Pools als üblich.
La Réunion: Von den verschiedenen Ausflugs-Angeboten finde ich es schwierig auszusuchen, welches mir am besten zusagt. Ich entscheide mich schliesslich für einen Tagesausflug in den Cirque de Salazie, in den grössten der drei Talkessel um den Piton des Neiges. Er gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe, ist etwa sechs Kilometer lang und sieben Kilometer breit, gleichzeitig auch der grünste und bewachsen mit dichter und üppiger Natur. Hier regnet es häufig und das Tal ist durchzogen von Bächen und Wasserfällen.
Vorerst besuchen wir aber eine Vanilleplantage, wo wir im Detail über die teure Pflanze und die aufwändige Hege und Pflege derselben informiert werden.
In Salazie gibt’s ein feines, üppiges kreolisches Mittagessen (der Rotwein leider nicht trinkbar, der Rosé dagegen schon), bevor wir in das hübsche Dorf Hell-Bourg (viertschönster Ort in Frankreich…!) weiterfahren. Bezaubernde Häuser gibt es zu besichtigen, es ist ein Ort, an dem besser Betuchte ihre Ferienwohnungen gebaut haben. Kein Wunder bei der grossartigen Aussicht auf die Berge und ins Tal. - Unterwegs zurück zum Schiff halten wir kurz in einem farbigen Handwerkermarkt in St. Denis an, wo manches, was wir auf den anderen Inseln in den Souvenirläden gesehen haben, sehr viel günstiger zu haben ist. – Die Zeit riecht leider (zum Glück) nicht für ausgiebige Einkäufe, schon gar nicht mit dem Gedanken an unser Gepäck im Hinterkopf.
Den Ausflug zu buchen, war genau das Richtige. - Es gab nämlich fast einen Aufruhr unter den Leuten, die auf eigene Faust an Land gehen wollten. MSC hatte zwar einen Shuttle-Service bis zum Ausgang des Hafens organisiert, aber von dort an ging alles schief. Die einen erzählten, die wenigen Taxis, die zur Verfügung standen, hätten 100 Euros verlangt für die Strecke bis St. Denis (zwanzig Minuten Fahrzeit höchstens), andere fanden überhaupt keine Taxis vor. Unseren Tischnachbarn gelang es, einen Bus zu ergattern, der in den Hauptort hätte fahren sollen, aber sehr bald hätten sie gemerkt, dass der erstens gar nicht bis dorthin fuhr, wo sie hinwollten und sich an keinen Fahrplan hielt, also nur ganz selten fuhr. Hielt einer doch an, war er bereits übervoll mit Gästen und wollte keine weiteren aufnehmen. So weigerten sich Trudi und Fredy auszusteigen aus Angst, nicht mehr rechtzeitig zum Schiff zu gelangen, denn Taxis waren ja auch eine Specie Rara. – Diejenigen Leute, die an der Busstation gestanden hatten und seit 40 Minuten gewartet hätten, seien drauf und dran gewesen, den Buschauffeur zu lynchen.
Das Leben an Bord gefiel uns sehr. Das reinste Schlaraffenland war das. Wer nicht zunahm, hatte etwas falsch gemacht. Der Service war ausgezeichnet, die Kellner aufs Höchste bemüht, den Gästen alle Wünsche zu erfüllen. Das Personal stammte aus aller Herren Länder, die meisten aus Indonesien - allesamt äusserst freundlich und hilfsbereit.
Und zu essen gab’s genug – im Speisesaal - hübsch angerichtete und nicht allzu grosse Portionen wurden serviert, jeden Tag konnte man aus fünf verschiedenen Vorspeisen und fünf verschiedenen Hauptgängen und Desserts auslesen, was immer man wollte - Nachbestellen bei Bedarf sowieso. Ebenso im Buffet-Restaurant. Auch dort war alles stets in grosser Auswahl vorhanden, schön präsentiert, immer wurde gleich nachgefüllt, nie fehlte etwas.
Auch für Unterhaltung war gesorgt. Gymnastik wurde angeboten, Tai-Chi, Tanzlektionen, Spiele, Basteln, Tischtennis, und fast täglich gab’s einen Vortrag über den nächsten Landausflug. – Diese Vorträge besuchte ich gerne, Bridge spielte ich nur dreimal, denn um Viertel nach neun dafür bereits auf der Matte zu stehen, war mir meistens viel zu früh.
In der Bibliothek konnte man sich Bücher ausleihen in verschiedenen Sprachen, ein Puzzle machen, Sudoku und Kreuzworträtsel lösen, und das zu jeder Zeit.
Jeden Tag gab’s die Bordzeitung mit dem Tagesprogramm. Nach etwa einer Woche ging in der Druckerei offenbar die Farbe aus, also wurde sie von da an nur noch in schwarz-weiss geliefert. – Kein Problem, sich auch so zu orientieren. Für „Muskulöses Erwachen mit Ihrem Tanzlehrer“ hätte sich Theo schon interessiert, aber um neun Uhr ist ja für ihn noch nicht Zeit zum Erwachen. Diesen Programmpunkt musste er also auslassen. Auch aufs „Bier-Pong-Turnier“ verzichtete er; das wäre zwar zeitlich zu schaffen gewesen, aber vielleicht doch zu anstrengend… – Mir empfahl er „Reisen und kreativ sein: Weihnachtsschuhe basteln“. – Dafür fehlen mir auch jetzt noch die Worte. - Lesen und auf Deck 13 an der Sonne liegen, das war schon eher mein Stil. – Im Pool baden ist ja nicht so sehr mein Ding, aber in Ermangelung der schönen Aare und bei einer durchschnittlichen Temperatur von 30 Grad am Schatten, fand ich’s dann gar nicht mal so übel, vor allem nicht, wenn bei hohem Wellengang das Wasser im Becken hin und her schwappte, so wie mir das noch von der Ka-We-De in Erinnerung ist.
Die Passagiere waren vor allem Schweizer und Deutsche, Engländer, Südafrikaner und wenige Chinesen, Italiener und Spanier. Einige von ihnen sah man immer wieder, andere bis zum Schluss der Reise zum ersten Mal.
Langweilig wurde es also nicht. Es gab auch ohne Programm viel zu sehen: Eine Vielfalt von Outfits jeder Art und Abart jedenfalls. So viele „umfangreiche“ Leute wie hier sieht man selten auf so relativ kleinem Raum. – Auf Réunion wurde ein Helikopterflug angeboten. Die Information, wie viele Kilos Lebendgewicht der Hubschrauber verkraften kann, verleitete Theo zur Vermutung, dass dieser Ausflug wohl für etwa drei Viertel der Passagiere nicht in Frage käme.
Erstaunlich, wie vielen Leuten es offenbar egal ist, wie sie daherkommen. Nicht selten wäre es fürs Auge eine Wohltat gewesen, wäre etwas mehr Stoff bei der Wahl der Garderobe verwendet worden. – Was sich die Dame, die mir kürzlich entgegenkam, wohl gedacht hat, als sie das T-Shirt kaufte, auf dem vorne drauf ein Elefant abgebildet war, kann ich mir kaum vorstellen. Aber wenigstens hatte das Tier genügend Platz auf dem Stoff.
Auf all den Märkten, die man besuchen kann, wo unter anderem Kleider verkauft werden, gibt es ja immer auch Männerunterhosen zu kaufen. Aber ich muss sagen, so grosse, wie hier gebraucht werden, habe ich noch nie gesehen. Ob das alles Spezialanfertigungen sind?
Frisuren sind auch ein Thema. Wieso es Männer gibt (nicht wenige), die eine Glatze haben, die dann mit den spärlichen Strähnen hinten einen kläglichen Rossschwanz über den Hemdkragen baumeln lassen, bleibt meinem Kleingeist auch ein Rätsel. – Aber ja, über Geschmack lässt sich nicht streiten, das ist klar. Aber wundern darf man sich schon.
Im Schiff hat es etliche Bildschirme. Oben vor der Brücke einen ganz grossen, der für alle, die sich auf Deck 13 zum Sonnenbaden aufhalten, gut sichtbar ist. Den ganzen Tag lang wird dasselbe Video abgespielt. Es ist ein Werbefilm fürs Essen an Bord. Der Sternekoch Harald Wohlfahrt erklärt und zeigt, wie er für MSC feine Steaks zubereitet, Saucen dazu kreiert und den Teller anschliessend anhand einer Pinzette mit feinem Grünzeug garniert (Wielding classic techniques with modern creative flair he aims to “create a perfect starting position for a succession of taste experiences to unfold in every dish” using sauces “like a painter uses paint”). – Immer und immer wieder. Tagein – tagaus. Mit Untertiteln in verschiedenen Sprachen. Die Produktion erinnert stark an den Film mit Bill Murray „Und täglich grüsst das Murmeltier“. – Kürzlich, abends in einer der vielen Bars nach dem Nachtessen spielte wie jeden Abend eine Live-Band, die Tanzfläche vornedran war voller Leute und im Hintergrund auf dem Bildschirm kochte Herr Wohlfahrt immer noch.
Die Organisation hinter so einem grossen Schiff ist riesig. Ich kann mir kaum vorstellen, wie das alles funktionieren kann. – Leider wurde wenig darüber berichtet, wenig informiert. Gerne hätte ich gewusst, wie viel Leute genau an Bord waren (ca. 2500 – alle Kabinen waren besetzt / ca. 1500 Mann Besatzung) und aus welchen Ländern sie kamen. Wie viele Tonnen Lebensmittel jeweils beschafft werden müssen, wie viele Eier pro Tag verwendet werden, wie viele Liter … etc. etc.
Einmal hiess es in der Bordzeitung, es habe:
120 Reinigungsteams
110 Klempner
80 Elektriker
54 Tischler
100 Feuerwehrleute
50 medizinische Fachkräfte
Beachtlich! – Als Fredy mal beim Arzt war, weil er einen Kreislaufkollaps hatte, erzählte er, in der Stunde, die er dort gelegen habe, hätte er fast zwanzig andere Patienten gesehen, wohl würden etwa fünfzig Leute pro Tag die Praxis aufsuchen, die nota bene sogar mit einem Röntgenapparat ausgestattet ist.
Am letzten Tag vor Ankunft in Durban gab’s eine herbe Überraschung. Die Spülung in der Toilette funktionierte nicht. – Und nicht nur unsere. Auf dem halben Schiff bestand dasselbe Problem. – Nun waren viele Passagiere unterwegs auf der Suche nach stillen Örtchen mit Wasser. – Wie in einem Ameisenhaufen kam’s mir vor.
Gut, dass nicht nur ein Klempner an Bord war; das Team der 110 kam zum Einsatz und innert relativ kurzer Zeit war das Problem gelöst.
Wie die Einschiffung so dauerte auch die Ausschiffung eine gefühlte Ewigkeit. Eine Stadtrundfahrt in Durban und ein Besuch in einem Zulu-Dorf mit anschliessendem Transfer zum Flughafen waren ebenfalls in unserem Reiseprogramm einbegriffen. Der Bus hätte um halb zehn Uhr abfahren sollen; um halb zwölf ging’s los.
Ein obermühsamer Mitreisender aus St. Gallen (ein ehemaliger Lehrer!), der mir bereits im Bus auf der Fahrt von Bellinzona nach Genua unangenehm aufgefallen war (er plapperte unaufhörlich, ohne Luft zu holen, so schien es mir, drauflos und sass unglücklicherweise gleich hinter uns), tat sich erneut auf lästige Weise hervor.
Kaum hatte uns der Coop-Reiseführer nach der Zollkontrolle gefunden, begann er diesen bereits vollzutexten. Er bestehe darauf, schon eine halbe Stunde früher auf dem Flugplatz zu sein, und das betonte er mindestens zehnmal. Die totale Nervensäge. Und seine Frau stand dümmlich lächelnd daneben. - Im Bus ging’s dann weiter und im Zulu-Dorf nochmal. Auch versuchte er für seine Forderung noch andere Mitreisende aufzuwiegeln. Da war er bei uns natürlich an der falschen Adresse. Mindestens eine Viertelstunde ging das Gelaber und Gejammer auch dort wieder los, er quatschte so lange auf den armen Reiseführer ein, dass wir dann tatsächlich seinetwegen die Zulu-Tanzvorstellung verpassten. Dabei hätte es zeitlich bestens gereicht. Am Flughafen kamen wir nämlich sogar eine Viertelstunde früher an, als im Programm beschrieben. – In der folgenden Nacht träumte ich noch von diesem unmöglichen Typen. Absoluter Albtraum!
Und Bestärkung: Keine Busreisen – es muss ja nicht sein, dass solche Passagiere mitreisen, wenn aber, dann kann einem das die ganze Reise vergällen.
(Exkurs: Die Zulu-Tanzvorstellung verpasst zu haben, war ja nicht das Ende der Welt, aber trotzdem… Diese Vorstellungen gibt’s an manchen Orten und sie haben unter anderem zum Zweck, Geld von den Touristen zu erhalten. Da steht dann ein Kessel mit Münzen und Noten drin, ein paar Tänzer umzingeln ihn und wenn jemand etwas einwirft, wird gejubelt, geklatscht und getanzt. Und noch später ziehen sie sich wieder um…
Rudolf hat mal berichtet, er habe in einem abgelegenen Dorf mit Touristen eine Hütte besuchen können, wo man mit den Bewohnern habe sprechen können. Es habe einen Dolmetscher gebraucht, um sich mit dem Häuptling und seinen Begleitern zu unterhalten. – Dummerweise habe dann das Handy im Fellumhang des Chiefs zu läuten begonnen. Dieser sei hinter die Hütte getreten und habe ins Gerät gesagt: „Hello, how can I help you?“)
Das war also das Ende des ersten Teils unserer Herbstreise 2019.
Und der zweite folgt sogleich:
Beim Mietauto-Beziehen im Flughafen von Durban dauert es eine gute halbe Stunde, bis wir losfahren können. Das Internet funktioniert grad nicht.
Unser Hotel finden wir nach einer weiteren halben Stunde Fahrt - etwas nördlich des Stadtzentrums gelegen. Es beginnt schon dunkel zu werden. - Das Linksfahren macht mir nichts aus, irgendwie gelingt es mir problemlos, mich wieder umzustellen. Nur noch ein paarmal scheibenwischern statt blinken und schon ist alles wieder im Grünen.
Das Goble Palm Guesthouse ist ein hübsches Haus im Kolonialstil mit gepflegtem Garten und einem kleinen Swimmingpool, die Angestellten sind sehr freundlich, es ist uns sehr wohl hier. Nachtessen gibt’s gleich um die Ecke in einem indischen Restaurant: delikate Nans und Chicken Tikka, dazu feiner südafrikanischer Wein – mal wieder ein Nachtessen in anderer Umgebung.
Im riesigen Bett schlafen wir vorzüglich und ein grosszügiges, delikates Frühstück ruft am nächsten Morgen.
Der Besitzer nimmt sich Zeit, mir ein paar Tipps zu geben, was wir in den nächsten beiden Tagen unterwegs nach Underberg unternehmen könnten. Er gibt uns Prospekte und Strassenkarten. - Über die Art Gallery in Durban weiss er nicht gut Bescheid, er sagt, er sei seit Jahren nicht mehr in der Stadt gewesen. Das kann ich mir gut vorstellen. Nach der Stadtrundfahrt am Tag zuvor wurde ziemlich deutlich, dass die Innenstadt wohl eher nicht ein Pflaster für die Weissen ist.
Wir fahren trotzdem in die Stadt, es ist Sonntag, es hat wenig Verkehr. Unser Navi leitet uns zwar in die richtige Strasse, in der das Museum ist, aber die Hausnummer stimmt nicht. Wir steigen mal aus und gehen ein Stück zu Fuss. – Das ist keine gute Gegend. Da liegen lauter schwarze Obdachlose auf dem Trottoir herum, es ist schmutzig und gegenüber vor einem Lokal beginnt gleich ein Streit. Schon ist die Polizei an Ort und Stelle. Rasch zurück zum Auto – hier sind wir falsch. Wir fragen ein paar Polizisten nach dem Museum und sie geben gerne Auskunft. Die obligate Frage, wo wir herkommen, ist schnell beantwortet ebenso wie die Frage, weshalb wir ihnen keine Schokolade mitgebracht hätten.
In der City Hall sind gleich zwei Museen untergebracht, im ersten Stock das Natural Science Museum, welches ganz ähnliche Exponate ausstellt wie unser naturhistorisches Museum in Bern. – Kein Wunder eigentlich. All die afrikanischen Tiere mussten ja nicht so weit transportiert werden wie bei uns zu Hause.
Die Art Gallery im zweiten Stock beherbergt moderne Kunst aus Südafrika und ganz klar steht die Auseinandersetzung mit der schwierigen Vergangenheit im Vordergrund.
Eine breite, kilometerlange Promenade führt in Durban am Strand entlang. Diese lädt zum Schlendern und Verweilen ein. Am Sonntag sowieso. Nur wenige Leute sind jedoch am Baden, denn der Himmel ist völlig bedeckt.
Um sechs Uhr bereits haben wir im Suncoast-Casino zum Essen abgemacht mit dem Paar aus Zug, das wir an Beau Vallon Beach an der Bushaltestelle kennengelernt hatten und mit dem wir anschliessend in Port Victoria essen gingen. - Genau wie wir haben auch sie ein Auto gemietet, bleiben zwei Tage in Durban und reisen anschliessend bis kurz vor Weihnachten weiter. – So früh schon, weil das Restaurant (Havana Grill), das uns empfohlen wurde, bereits um acht Uhr schliesst. – Grad wie wir gehen wollen, beginnt es in Strömen zu regnen – gut für die Natur, schlecht für die Touristen. Nichts desto trotz: Die Filets sind von bester Qualität, der Service freundlich, obwohl etwas unbeholfen, aber wir haben einen vergnüglichen Abend.
Am nächsten Tag verlassen wir Durban, machen aber einen ersten Halt im Musgrave-Center, einer Mall, wo ich mir beim Optiker eine Sonnenbrille anfertigen lasse nach „Rezept“. In neun Tagen werde ich sie abholen können, so wird mir versprochen. Der Preis ist nicht vergleichbar mit dem, den ich zu Hause dafür zahlen müsste.
Die Reise führt uns in die Midlands, wo wir als Erstes die Mandela-Skulptur besuchen. Sie steht dort, Mitten im Gelände, wo Mandela damals verhaftet wurde. - Was der Künstler geschaffen hat, ist mehr als nur eindrücklich: Mitten in einem Feld stehen einzelne Pfähle (man kann durch sie hindurchspazieren), die sich, von einem gewissen Winkel aus betrachtet, aus ca. 50 Metern Entfernung zu einem Konterfei von Mandelas Kopf entwickeln.
Auch der Weg dorthin ist beeindruckend. Auf der linken Seite sind in einem Abstand von etwa vier Metern 27 Pfähle aufgestellt, welche die 27 Jahre versinnbildlichen, in denen Mandela im Gefängnis sass, also „The Long Way to Freedom“. Rechts vom Gehweg sind Tafeln aufgestellt, auf denen steht beziehungsweise ausgestanzt ist, was in welchem Jahr geschah, von seiner Geburt bis zum Tod.
In dieser Gegend hat es eine Menge kleiner, lustiger Geschäfte, Restaurants, Shops, Kunstgalerien etc. - Es geht nicht anders: Eine Bronzeskulptur müssen wir einfach kaufen. Klein natürlich (Koffer!). Und in einem dieser gemütlichen Coffee-shops müssen wir einfach zwei Cappuccinos trinken und ein Stück Carrot-Cake essen. Wir würden gerne nur ein halbes Stück bestellen, das geht aber nicht. – Das Teil ist so riesig, dass es eine ganze Mahlzeit ersetzt.
Es ist eine herrliche Gegend - landwirtschaftliches Gebiet: idyllische Flüsse und kleine Seen, grüne Weiden, Kühe, die friedlich grasen, einfach schön. Eine unbefestigte Strasse führt zu einem grossen, sehr gepflegten Anwesen (Hof und Stallungen), von dem uns der Besitzer im Guesthaus in Durban sagte, wir sollten unbedingt hin, falls wie Freude an Keramik hätten. Haben wir. „Ardmore“ heisst der Betrieb, ist ein Museum und Verkaufsladen. Wir sind zu spät. Um vier wurde bereits geschlossen, jetzt ist es halb fünf. Da kommt aber eine junge Frau auf uns zu, gerade von einem Ritt zurück und sie bietet an, uns alles zu zeigen, sie sei die Tochter der Besitzerin. Kaum zu glauben, wie freundlich die Leute hier sind (das gilt auch ganz allgemein). Sie nimmt sich eine gute halbe Stunde Zeit, uns herumzuführen und alles zu erklären. Sogar Tee oder Kaffee wird uns angeboten, was wir natürlich dankend ablehnen. - Was wir zu sehen bekommen, ist äusserst eindrücklich. Ich weiss ja selber, wie schwierig es ist, Ton zu verarbeiten, zu bemalen, zu glasieren, so dass nichts bricht. Aber was die Künstler dort zustande bringen, ist sagenhaft. Riesige, grosse und kleinere Werke sind ausgestellt und zum Teil kann man sie kaufen, Vasen, Krüge, Schalen, Nippsachen mit den verschiedensten Sujets, vor allem afrikanische Tiere sind dargestellt. Kleinste Details sind ausgearbeitet, es gibt offenbar nichts, was man nicht herstellen kann. Und das alles von Hand. Mich dünkt es fast nicht menschenmöglich, all diese delikaten Kunstwerke herstellen zu können. Man kann sich kaum sattsehen. Die Besitzerin lehrt die Künstler (alles Schwarze – mindestens etwa 50 Männer und Frauen) auf minuziöse Weise die Töpferkunst und gibt ihnen so einen Verdienst.
Wir kaufen nichts. Und das nicht nur wegen der Koffer. Das Unternehmen ist offenbar in der ganzen Welt bekannt, es gibt Ausstellungen im Ausland und auch Verschiffen ist kein Problem. Aber die Preise natürlich... Sie gehen in die Tausende. – Kein Wunder und auch verständlich.
Wir bedanken uns herzlich und werden aufs Freundlichste verabschiedet. – Ein unvergesslicher Ausflug war das in mehr als einer Hinsicht.
In der Nähe von Pietermaritzburg übernachten wir in einem netten B&B, dem „Tancredi“. Auch hier wieder: freundlicher Service, riesiges, bequemes Bett, tolles Frühstück.
Die drei Übernachtungen in Underberg vergehen rasch. Es gefällt uns dort ausserordentlich gut. In der „Sani Window“ Lodge haben wir ein hübsches, gemütliches, grosses Zimmer, ein feines Frühstück und vom Garten beziehungsweise vom Park aus erstreckt sich der Blick auf einen Weiher, über den Golfplatz und bis zu den Drakensberg Mountains hin. Man sieht den Sani-Pass, die einzige Verbindung, die nach Lesotho führt, wo wir am nächsten Tag hin wollen.
Aber vorerst essen wir am Abend in einem hübschen kleinen Lokal. Sensationell gute Gerichte gibt’s im „Lemon Tree“. Von der Forelle mit Kartoffelstock schwärme ich noch jetzt und das Springbock-Carpaccio war ebenfalls vom Feinsten.
Dann ein Tagesausflug. Eine ziemlich abenteuerliche Fahrt in einem offenen Safari-Fahrzeug bringt uns bis auf die Passhöhe, dorthin, wo der höchste Pub in Südafrika steht, auf 2874 Meter über Meer. Unterwegs gilt es vorerst jedoch die Grenze zu passieren. Das geht recht einfach, sie sind es sich dort gewohnt, die Tagestouristen „abzufertigen“. Die unbefestigte Strasse ist eine riesige Herausforderung für den Fahrer, sie gleicht oft eher einem engen, steilen Flussbett, aber er ist sich das gewohnt. Er nimmt auch die letzte, die „Oh-my-God“-Kurve, wie sie offenbar genannt wird, mit Links und führt uns nach der Passkontrolle sicher in eines der ersten Dörfer im Bergstaat Lesotho. – Dort hören wir etwas über die Sitten und Gebräuche der Bewohner und in einer runden Hütte, eine Art Jurte, können wir ein Brot probieren, das die alte Frau, die wir besuchen, gebacken hat. Erst versuchen alle nur zögerlich, aus Höflichkeit ein Stück abzubrechen, aber dann langen alle nochmals zu, denn das Hefegebäck ist einzigartig gut und schmackhaft. – In der Hoffnung auf kauffreudige Abnehmer werden auch Körbchen und weitere Souvenirs angeboten. Ich kaufe einen kleinen Besen. Erstaunlich, wie ein solcher Alltagsgegenstand in solchen Ländern kunstvoll angefertigt wird. Wunderschöne Exemplare konnte ich auch in Kambodscha und in Thailand kaufen. Zur Dekoration natürlich, nicht wirklich als Haushaltshilfe. Das kleine Kunstwerk zu verschmutzen, würde mir fast wehtun.
Im höchsten Pub geht’s bunt und lustig zu. Nicht nur eine Gruppe von Touristen hat’s. All die Fahrzeuge, die sich mühsam den Pass hinaufgequält haben, bringen ihre Passagiere hierhin. Nach einem wirklich feinen Mittagessen (Theo hat sich ursprünglich auf eine Suppe gefreut, aber da’s auf der Speisekarte Spaghetti hat, wechselt er seine Meinung im Handumdrehen. Allerdings mag er die Riesenportion nur gerade zur Hälfte). Ich bin sehr zufrieden mit meinem Sandwich mit Salat.
Am Abend essen wir vorzüglich in Himeville, dem Nachbardorf von Underberg im Moorcroft Manor Restaurant, einem sehr gediegenen Etablissement mit Hotel. Die hübschen kleinen Lämpchen für Teelichter gefallen mir sehr. Im zugehörigen Shop könnte man sie kaufen, der ist aber am Abend zu. – Gut so. Am nächsten Morgen finde ich sie in einem Laden in Underberg zu zwei Drittel des Preises...
Auch noch etwas anderes geschieht an diesem Morgen im „Städtchen“: ein Banküberfall.
Die Diebe sind offenbar durchs Dach der Sparkasse eingedrungen. Die Polizei ist vor Ort und hat alles abgesperrt. – Fast wie im Film...
Am späten Morgen fahren wir dreissig Kilometer in nördlicher Richtung zum Garden Castle, Maloti Drakensberg Park (World Heritage Site). Von dort aus kann man verschiedene Wanderungen in die Berge unternehmen. Wir entscheiden uns für den Pillar Cave Rhino Peak-Walk. Eine Herde von Elands (die grösste Antilope – wiegt bis zu 900 kg und kann 165 cm hoch werden) weidet jenseits des Flusses, die bizarren Felsformationen und die grün bewachsenen Hügel sind grandios anzuschauen. - Einfach nur fantastisch war unser dreistündiger Hike. Wir begegnen unterwegs einem Ehepaar und auf dem Rückweg einem einzelnen Wanderer, mit dem wir kurz ins Gespräch kommen.
Ein schöner Tag war das, den wir mit einem weiteren Besuch im „Lemon Tree“ abschliessen, denn ich muss unbedingt nochmals die wunderbare Forelle geniessen.
Drei Stunden dauert die Fahrt zurück an die Küste nach Margate. Unterwegs machen wir Halt in Kokstad, wo ich gerne einen Cappuccino trinken würde, aber da finden wir nur Take-away-Lokale, wir verzichten also. Auf einer Macademia-Plantage etwas weiter erhalten wir, was wir uns wünschen und dazu noch eine Kleinigkeit zum Mittagessen.
In Margate haben wir anfangs etwas Mühe unser Apartment zu finden, das ich über HomeExchange „gemietet“ beziehungsweise getauscht habe. Die Wohnung ist geräumig, stylisch möbliert und mit Blick aufs Meer. Der Strand ist durch den Garten gleich vor dem Haus erreichbar. Allerdings ist er nicht zum Baden geeignet. Das Meer ist sehr stürmisch und es hat Felsbrocken, an denen sich die Brandung zerschlägt.
Fünf Tage und Nächte verbrachten wir dort. Zeit zum Ausruhen und nicht viel tun. Das Wetter war schön, so machten wir ein paar Ausflüge an sogenannte Blue-Flag-Strände, wo man baden kann, wo’s Badeaufsicht hat. Das sieht dann jeweils recht seltsam aus, denn nur gerade an einem etwa fünfzig Meter breiten Strandabschnitt ist das Schwimmen erlaubt, so vergnügen sich Dutzende von Leuten, vor allem schwarze Kinder und Jugendliche auf einem Haufen quasi am selben Ort.
Kochen mochten wir nicht selbst, denn die Küche war zwar gut ausgerüstet, aber überhaupt keine Vorräte waren vorhanden, nicht einmal Salz und Pfeffer, und all das einzukaufen für diese kurze Zeit machte ja keinen Sinn. Zudem sind die Gerichte in den Restaurants so günstig für unsere Verhältnisse, dass man sich die Kocherei tatsächlich schenken kann. „Zuhause“ zu frühstücken hingegen ist ganz angenehm.
Theos Geburtstag, der 24. November, war ein Strandtag. Aber vor dem Bad im Meer und chillen am Strand kehrten wir im bekannten Waffel-House ein – Frühstück mal anders. – Wie der Name sagt, erhält man dort sehr gute Waffeln mit x-welchen Zutaten, geöffnet ist das Lokal jedoch nur bis am späten Nachmittag. So gab’s am Abend Fisch im nebenan gelegenen Restaurant am Meer. Wir waren fast die einzigen Gäste. Tagsüber läuft viel, am Abend dann kaum mehr etwas.
Das absolut beste Restaurant ist das „Flavours“ in Ramsgate (www.flavoursbykumar.co.uk/">www.flavoursbykumar.co.uk/). Das fanden wir erst an unserem letzten Abend. Dorthin würde ich wieder gehen...
Am 27. November fuhren wir der Küste entlang zurück nach Durban, wo wir am späten Nachmittag beim „Gobles-Palm-Guesthouse“ ankamen, wo wir vor zwei Wochen bereits waren und wo wir einen unserer Koffer hatten deponieren können.
Den nächsten Tag verbrachten wir erst mit Koffer-Umpacken. Wir hatten inzwischen eine grosse Reisetasche mit Rädern gekauft, etwas leichter als mein Koffer, der inzwischen leicht beschädigt war und schon fünf Jahre Reisen hinter sich hatte. Ich fragte Goodman, den Angestellten, der sich bestens um alles kümmert, was die Gäste betrifft, wo ich das Ding entsorgen könne und er war überglücklich, das Gepäckstück gleich selber zu übernehmen; er könne seine Siebensachen gut darin verstauen, meinte er.
Über Mittag fuhren wir in die Stadt und besuchten eine Kunstwerkstätte am Hafen, das BAT-Center. Wir waren die einzigen Besucher. Ganz interessant, was da alles hergestellt wird: Schuhe, Körbchen, Tontöpfe, lebensgrosse Modelle von Sportlern und Politikern. Grandios, wirklich! Nebst den verschiedenen Handwerkstätten ist das Kultur-Zentrum auch mit einem bescheidenen Restaurant ausgestattet, einem Saal, wo eine Band spielen kann und Galerien. Einem Künstler kauften wir sogar Bild ab, einen Linolschnitt. Um das Werk zu bezahlen, mussten wir mit ihm erst einen ATM-Maschine suchen gehen, denn Kreditkarten waren keine Option.
Am Nachmittag fuhr ich (während Theo Siesta machte) ins Musgrave Einkaufszentrum, um meine Brille, die ich bestellt und bereits bezahlt hatte, abzuholen. Sie hatten vergessen, dass ich eine Sonnenbrille wollte, diejenige, die sie mir präsentierten, war nur ganz leicht getönt. Also war ich nicht zufrieden damit. Aber ich muss sagen: Der Deal, der mir schliesslich angeboten wurde, war grosszügig: Eine Brille, so wie bestellt gratis dazu. Lieferbar in einer Woche nach Johannesburg, wo wir an unserem letzten Ferientag übernachten würden.
Nachtessen im indischen Restaurant an der Ecke wie vor zwei Wochen bei unserer Ankunft.
So endete also der zweite Teil unserer Reise.
Vor dem dritten Teil noch ein paar wenige allgemeine Gedanken über
Afrika
Alles, was schief läuft, nicht funktioniert oder in irgendeiner Weise auf uns Europäer seltsam wirkt, dafür gibt’s eine einfache und einleuchtende Erklärung: „It’s Africa“. Das lässt keine Fragen mehr offen.
Dass die Strassen über und über voller Potholes sind, mir das wieder in Erinnerung zu rufen, dauerte nicht lang. Manchmal steht ein Schild am Strassenrand, das vor den Schlaglöchern warnt, dann muss man mit gewaltig grossen rechnen. Nicht immer kann man ihnen ausweichen, aber um vorzugreifen, die Pneus haben die Tortur ausgehalten. Nach 1120 km konnten wir den Wagen heil und ohne Beulen abliefern.
Es gibt Autobahnen, auf denen man wie in Frankreich oder Spanien eine Maut zahlen muss. Wie genau das funktioniert, habe ich nicht begriffen. In Margate fädelt man ein, zahlt bescheidene zwei Franken, und damit hat’s sich. Es gibt keine weitere Stelle mehr, wo man zahlen muss. Wäre man bei einer späteren Einfahrt auf die Autobahn gefahren, hätte man nichts zahlen müssen. Seltsam. Seltsam ist auch, dass Fussgänger auf diesen Strassen erlaubt sind. Sie überqueren auch oft die Fahrbahn. – Tiere natürlich ebenso.
Woran ich mich auch sofort wieder erinnere, sind die Parkier-Boys. Sie sind allgegenwärtig, wo man ein Auto parkieren kann. Sie tragen gelbe Westen, schauen sehr wichtig drein und zeigen einen, wo und wie man parkieren kann. Niemand braucht sie wirklich. Im Gegenteil. Mich nerven sie meistens sehr, wenn sie beim Herausparkieren hinter dem Auto stehen und ich beim Herausmanövrieren zusätzlich darauf bedacht sein muss, den Typen nicht anzufahren. Der fuchtelt nämlich irgendwie in der Gegend herum und nur wenn man Glück hat, ist die Strasse tatsächlich frei. Natürlich wollen sie für die grandiose Dienstleistung ein Trinkgeld. Nur zu diesem Zweck findet das ganze Theater statt. – Oft sind es junge Männer, teilweise aus dem angrenzenden Ausland offenbar, die dann stunden- und wahrscheinlich tagelang am selben Ort stehen und ihren „Job“ erledigen.
Gross ist die Angst vor Kriminalität. Die Weissen leben fast alle in irgendwelchen Ghettos. Ganze Quartiere, oft luxuriös innerhalb eines Golfplatzes gelegen, sind eingezäunt mit Mauern und Gittern, versehen mit Stacheldraht, video-überwacht während 24 Stunden, aber so gut getarnt, dass man nicht gleich merkt, wo die Grenzen des Gefängnisses sind. Am Eingang kann man das Wächterhaus mit Barriere nur mit ausdrücklicher Erlaubnis passieren. Trotzdem muss man manchmal zusätzlich den Kofferraum öffnen und mit einer Kamera wird der Boden unter dem Auto gescannt. Nicht nur hier in diesem Land versucht man sich so vor Dieben zu schützen, aber es gibt zu Denken. – Ich möchte so nicht leben müssen; ich käme mir eingesperrt vor. – Umso mehr lehrt es mich unsere mehr oder weniger sorglose Lebensqualität in der Schweiz zu schätzen, die uns allen ja so selbstverständlich scheint.
Auch einfachere Behausungen sind gut gegen Einbruch gesichert. So erreichten wir unser Apartment in Margate, das in einem einstöckigen Wohnblock gelegen war, nur durch fünf verschiedene Gittertüren. An jeder war ein Schloss angebracht, das man erst mit dem Schlüssel öffnen und wieder schliessen musste. Da diese Schlösser allesamt verrostet waren, war das nicht ganz einfach. So dauerte es also fast zehn Minuten, bis wir die 50 Meter von der Haustüre bis zur Garage, wo unser Auto geparkt war, erreicht hatten - eine äusserst mühsame Angelegenheit.
Zum Lachen brachte mich mein Besuch in der Apotheke. Diese Läden sehen normalerweise ähnlich aus wie bei uns der „Müller“: im vorderen Teil Selbstbedienung mit Kosmetika, Drogerieartikel und auch Lebensmittel, im hinteren Teil die eigentliche Apotheke, wo man bedient wird. Dort holte ich Hustenbonbons und etwas gegen Grippe, nur zur Vorsorge, unser Pretuval war inzwischen aufgebraucht. Die beiden Medikamente kosteten übrigens zusammen nur gerade acht Franken. Sie wurden in einen Plastiksack gelegt, mit dem Preisetikett zugeklebt, und dann kommt das Beste: Sie wurden in ein Metallkörbchen gelegt und das wurde so verschlossen, dass es nur gerade an der Kasse wieder geöffnet werden kann. Ich traute meinen Augen kaum und musste laut lachen, als ich mit dem Körbchen bewaffnet nach vorne zur Kasse spazierte.
Mit Theo zu reisen, hat seine Tücken. Es ist nicht immer ganz einfach, oft lustig, manchmal ein wenig nervig, nie langweilig auf jeden Fall.
Kauft er eine neue Badehose, dann taugt diese nur, wenn sie mindestens zwei Taschen hat, die dann mit Münzen, Noten oder manchmal sogar mit Schlüsseln gefüllt werden können. Das zu verhindern habe ich mich oft schon vergeblich bemüht. Geht er baden, vergisst er nämlich auf jeden Fall, seine Taschen zu leeren. Das mit dem Geld ginge ja noch…
Erst vor wenigen Tagen hat er mir gebeichtet, dass er in Rosas am Strand den Wohnungsschlüssel verloren hatte. Als es ihm (im Halbschlaf offenbar) in den Sinn kam, ging er frühmorgens (!), bevor der Traktor den Sand umpflügte, dorthin, wo wir uns am Tag zuvor aufgehalten hatten. Und – wer kann’s glauben? – er fand den Schlüssel, der mit dem blauen Anhänger aus dem Sand herausragte.
Auch liebt er es, mit der Sonnenbrille schwimmen zu gehen. Bei den riesigen Wellen hier ist es eine Frage von Minuten, bis er sie los ist. – Wie ich sehe, dass er sie anhat, rufe ich ihm zu, aber es ist bereits zu spät, er versteht es ja sowieso nicht bei dem Lärm, den die Wellen machen. Und schon ist es passiert. – Aber dann hat er immer wieder Glück; es ist nicht zu fassen: Er spürt sie an seinen Füssen und kann sie aus der Gischt herausfischen. – Ich hab’s auf Video drauf.
Vor drei Jahren hat Theo eine neue Nikon-Kamera gekauft mit einen starken Zoom, damit wir auf der Safari schöne Fotos schiessen können. – Die kam ja dann logischerweise nicht zum Einsatz, Zoom im Spital war unnötig, aber diesmal schon. – Das zumindest ist der Plan. - Man kann sie aber auch im Hotelzimmer lassen während der ersten Pirschfahrt. Dort ist sie bestens aufgehoben, ist sicher und wird auch nicht staubig.
Wenn wir unterwegs sind zur nächsten Unterkunft, ist sie ja zwangsläufig mit im Auto dabei, aber nach ein paar Fotos und etlichen Videos, die sich ja niemals jemand ansehen wird, ist der Akku im Eimer und die hübschen farbigen Vögel und der Wasserbock, der nicht grad am Strassenrand steht, können nicht auf Bild gebannt werden.
Dritter und letzter Teil unserer Herbstreise 2019: die Safari
Freitag, der 29. November 2019
Kurz nach sieben stehen wir auf, gepackt ist bereits und nach dem reichlichen und feinen Frühstück, das im Guesthouse serviert wird, geht’s pünktlich los. Um Viertel vor neun möchte ich abfahren, hab ich gesagt, rechtzeitig hat Goodman unsere Koffer im Auto verstaut und genau wie geplant können wir abfahren. Über die Autobahn (hier Freeway genannt) dauert die Fahrt bis zum Flughafen (nur einmal verfahren) eine halbe Stunde.
Tanken müssen wir noch, bevor wir den Mietwagen abgeben. Eine Sasol-Garage befindet sich auf dem Flughafengelände und ich wundere mich schon, wieso die Angestellten uns nicht zur Tanksäule winken. Das machen sie sonst überall mit grossem Eifer. Jeder möchte ja gerne ein Trinkgeld erhalten. – Diesmal sitzen sie nur herum. – Kein Wunder. Es hat kein Benzin, sie warten auf die Lieferung. In drei Stunden vielleicht… Ok, ok, geben wir das Auto halt mit halbleerem Tank ab, das können wir nun auch nicht mehr ändern.
Wie üblich geht alles rasch, ich kann den Schlüssel abgeben, alles in Ordnung. Rudolf, unser Safari-Guide, mit dem ich um halb zehn am Flughafen abgemacht habe, ist auch schon zur Stelle. Er bringt einen Trolley, auf den wir unser Gepäck laden.
Auf dem Weg zum Parkplatz springt uns der Angestellte der Mietwagenfirma nach und bringt Theos Sonnenbrille mit Etui, die er im Auto hat liegenlassen. – Das fängt ja schon wiedermal gut an…
Rudolf arbeitete ursprünglich für Ken. Da Ken altershalber langsam aus dem Business aussteigt, hat Rudolf übernommen. Wir haben ihn vor drei Jahren bereits kennengelernt. Er hätte unser Fahrer sein sollen auf der Safari, die wir damals gebucht hatten und die wegen Theos Eskapaden oder Vorliebe für südafrikanische Spitäler ins Wasser gefallen ist. Wir waren bereits einen Tag lang mit ihm in der Umgebung von Johannesburg unterwegs gewesen und hätten dann am übernächsten Tag unsere Safari beginnen sollen, als Theo plötzlich krank wurde.
Aber das ist ja nun zum Glück Schnee von gestern und die Reise kann beginnen.
Während drei Stunden fahren wir an Rohrzuckerfeldern vorbei, so weit das Auge reicht, und später an unzähligen Eukalyptusplantagen. Die Bäume stehen wie Soldaten im immer gleichen Abstand mit ihren dünnen schlanken Stämmen in Reih und Glied, sind ehemals aus Australien eingeführt worden und erst viel später erkannte man, dass sie den Boden völlig austrocknen. In Massen werden sie trotzdem angepflanzt, weil sie schnell wachsen und so viel Geld gemacht werden kann. Mit Papiergewinnung in erster Linie.
An einer Titan-Mine kommen wir vorbei und mein neues Knie frohlockt; es kann ja sein, dass es ursprünglich von hier kommt.
Santa Lucia ist ganz anders als all die Orte, an denen wir bisher vorbeigekommen sind. Alles ist extrem auf Touristen ausgerichtet. Entlang der Hauptstrasse, der Mckenzie-Street, passiert das Wesentliche: Hotels, Restaurants, Reiseagenturen, afrikanische Souvenir-Märkte und natürlich der allgegenwärtige „Spar“ darf auch nicht fehlen.
Der Ort ist beliebt, weil im St. Lucia-See, der ursprünglich eine Lagune war, viele Flusspferde leben, Krokodile und bunte Vögel. Auch wir gehen auf eine zweistündige Bootsfahrt, nachdem wir uns ein wenig am Pool ausgeruht haben. Flusspferde gibt’s tatsächlich zuhauf, ganze Familien tummeln sich im seichten Wasser, Krokodile machen sich rar.
Nachtessen im „John Dory’s“ – zur Abwechslung kein Filet, aber dafür köstliche Sushi.
Den Wein können wir so nicht trinken. Er wird – wie üblich – mit Zimmertemperatur serviert. Da’s aber heute den ganzen Tag lang 36 Grad warm war…
Den nächsten Tag verbringen wir gemütlich. Rudolf führt uns in den Cape Vidal Park, wo wir eine ganze Menge Tiere sehen, zum Teil aus nächster Nähe, was gut war, denn Theo hatte ja seine Kamera nicht mit dabei. Zebras kümmern sich nicht um die Autos, die sind offenbar so daran gewöhnt, dass sie sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Auch die beiden Nashörner nicht, sie grasen selenruhig am Strassenrand. Die Hörner sind ihnen abgenommen worden, das Problem besteht ja, dass die Tiere rücksichtslos gejagt werden ihrer Hörner wegen, die inzwischen teurer gehandelt werden als Gold. Dass die Tiere dadurch am Aussterben sind, kümmert die Wilderer nicht. – Weitere Flusspferde sehen wir, Antilopen, Nyalas vor allem, Vögel natürlich und Affen. Die kleinen frechen Vervet Monkeys turnen überall herum, aber wir sehen auch zwei grössere Tiere, Samango-Monkeys, die nur gerade in dieser Gegend vorkommen. Auch die Red-Duiker, eine sehr kleine Antilopen-Gattung, ist hauptsächlich in dieser Gegend anzutreffen.
Nach zweistündiger Fahrt erreichen wir einen Strand, wo wir Mittagspause machen und sogar ein wenig im Meer baden können. – Theo steigt übrigens ohne Sonnenbrille „in die Fluten“. Unser Sandwich müssen wir gegen die Affen verteidigen, die natürlich sofort gemerkt haben, dass eine Futterquelle vorhanden ist. So rasch hab ich ein Sandwich noch nie hinuntergeschlungen. – Futterneid…
Zurück im Hotel (Elephant Lake Hotel) geniessen wir noch einige Zeit am Pool (im Hotel hängt ein Foto, auf dem zu sehen ist, dass sich ein Flusspferd Einlass in den Garten geschafft hat und am Pool Wasser trinkt) und gehen anschliessend früh essen, zu „Alfredo“ diesmal (Theo will wiedermal Spaghetti), aber aus gutem Grund lassen wir den Wein für uns in den Kühlschrank stellen und gehen inzwischen spazieren.
Die Pasta ist authentisch; Alfredo parliert ein wenig Italienisch mit Theo und das resultiert in einem Gläschen speziellen Grappas, frei aufs Haus für meinen Gatten. Ich erhalte beim Abschied drei Küsse (er weiss, dass das in der Schweiz so üblich ist…).
Um halb neun sind wir parat in der Lobby für einen Night-Drive. Dieser soll etwa fünf Stunden dauern und uns an einen einsamen Strand führen, wo wir sehen können, wie die Riesen-See-Schildkröten ihre Eier legen. – Im offenen Safarigefährt geht’s los, wir sind zu siebt, die andern Passagiere aber sehen wir den ganzen Abend lang nicht direkt, weil’s eben dunkel ist. Ich kann vorne neben dem Fahrer sitzen, neben Tombe. Wie schon am Morgen mit Rudolf fahren wir erneut in den Cape Vidal Nationalpark Richtung Norden. Tombe hält mit der einen Hand das Steuerrad, mit der anderen einen zusätzlichen Scheinwerfer, mit welchem er in der Gegend herumzündet. – Unglaublich, was er sogleich für Tiere erspäht: Hippos ganz nahe am Strassenrand, Zebras ebenfalls, eine Hyäne, die vor uns über die Strasse rast und im Dschungel verschwindet, einen Adler sogar auf einer Telefonstange, ein Spottet Ganet (hübsche, kleine Raubkatze) und bei der Heimfahrt später – wer hätte das gedacht - sogar einen Leoparden.
Bei der Stelle, wo wir am Mittag unser Sandwich vor den Vervet-Affen verteidigen mussten, machen wir Halt und Tombe lässt bei allen Pneus ein wenig Luft raus, damit er besser auf dem nassen Sand weiterfahren kann. Nun geht’s nämlich noch zwanzig Kilometer weiter nordwärts immer dicht am Wasser entlang, wo nun Ebbe herrscht. Dass wir eine dieser Schildkröten sehen werden, kann nicht garantiert werden, aber wir haben Glück. Mit dem Scheinwerfer hält Tombe ständig Ausschau nach Spuren, die aus dem Wasser gegen die Düne hinaufführen. Wir halten an und es ist klar: Es ist die Spur einer Loggerhead-Sea-Turtle-Dame.
Bis die den Platz gefunden hat, wo sie ihr Nest bauen will, ihr Loch gegraben hat (ca. 50 cm tief) und dann ihre Eier hineingelegt hat, wird es dauern. – So zaubert unser Fahrer aus dem Gefährt einen Tisch, belegt ihn mit einem Tischtuch, drauf stellt er Thermosflaschen mit heissem Wasser für Tee oder Kaffee, Tassen, Teller, Plasik-Gefässe gefüllt mit verschiedenen Sandwiches, Samosas, und Ananasscheiben zum Dessert. Leider hatten wir alle ja bereits gegessen, schade, wir hatten nicht gewusst, was da mitten in der Nacht, mitten in der Wildnis auf uns wartet. Beleuchtet wird das „Buffet“ nur mit Tombos rot scheinender Kopflampe. Inzwischen ist es halb zwölf geworden. Der Sternenhimmel ist einmalig anzusehen - ohne fremde Lichtquellen betörend schön. - Ausführlich erzählt uns Tombo alles Wissenswerte über die Loggerheads und mit einer Rotlichtlampe ausgerüstet begeben wir uns zum Ort des Geschehens. Da liegt sie, die Riesenschildkröte. Sie ist knapp einen Meter lang und sie bewegt sich kaum, so wie man das von dieser Tierart ja erwartet. Mit ihren Hinterbeinen schaufelt sie von Zeit zu Zeit Sand auf die Seite und es dauert fast eine Stunde, bis dann endlich die Eierablage beginnt. Fotos werden gemacht, gestaunt wird und endlich treten wir den Rückweg an. Zufrieden sind alle und sandgestrahlt, denn ein ziemlich starker Wind hat eingesetzt.
Unterwegs sehen wir eine weitere Spur einer Schildkröte. Diese deute auf eine Leatherhead hin, sagte Tombo, aber sie muss aus dem Wasser gekrochen sein und ihren Job erledigt haben, nachdem wir bereits vorbeigefahren waren. – Schade. Diese Art ist nämlich noch grösser (die Männchen werden bis zu 700 kg schwer). Und eine weitere Loggerhead begegnen wir, die grad aus den Wellen steigt. - Verrückt, das alles beobachten zu können. Märchenhaft! – Um ein Uhr morgens sind wir an der Stelle, wo die Pneus wieder aufgepumpt werden müssen. Es ist noch immer sehr warm, aber ich bin doch froh über meine Jacke, denn der Fahrtwind zu dieser Nachtzeit ist doch schon etwas kühler geworden. Um zwei Uhr sind wir am Parkausgang und um halb drei, nach einer ausgiebigen Dusche müde aber zufrieden im Bett.
Abfahrt am nächsten Morgen um neun. Gegen Mittag sind wir in der Hluhluwe (Umfolozi Game Reserve). In der Unterkunft werden wir erst um vier Uhr erwartet, bis dann aber führt uns Rudolf im Park herum. Es ist einer der ältesten Parks in Südafrika und einer der schönsten. Grün, so weit das Auge reicht und hügelig. Eine fabelhafte Weitsicht über die Ebene und die Hügel hat man vom Hill-Camp aus.
Kaum durchs Gate in den Park gefahren, schon können wir einem Warzenschwein mit seinen vier Jungen zuschauen, höchstens zwei Wochen alt, schätzt Rudolf. Noch lustiger sind die vielen Dung-Beetles, die sich grob abmühen, aus dem frisch entstandenen Elefanten-Dung grosse Kugeln zu formen und diese in lockere Erde zu vergraben, was sehr oft einen langen und gefährlichen Weg über die Strasse beinhaltet. Der Plan ist, unterwegs während des Transports eine Dung-Beetle-Dame dazu zu bewegen, ihr Ei in das Kunstwerk einzuflechten – man sieht dann zwei Käfer auf der Kugel herumturnen. Es gibt faule und fleissige Käfer, erzählt uns Rudolf. Die faulen warten, bis das ganze Eierleg-Prozedere erledigt ist und probieren dann, dem schwerarbeitenden Kollegen die Kugel wegzustehlen, was zwangsweise in einen Kampf mit unsicherem Ausgang ausartet.
Zebras sind immer ein anmutiges Fotosujet, der Büffel natürlich ebenso, auch wenn er keine Streifen hat. Wir sehen auch Breitmaul-Nashörner; ihnen wurden die Hörner nicht abgenommen, im Park sei man sehr gut gegen Wilderer eingerichtet.
An einem Picknick-Platz, wo’s Tische und Bänke hat sowie auch Einrichtungen zum braaien (BBQ-en, der Südafrikaner liebstes Hobby), weiden friedlich ein paar Nyala-Antilopen. Es ist ganz seltsam: die Weibchen sehen völlig anders aus als die Männchen. Sie sind hellbraun und haben feine weisse Streifen, die Männchen hingegen sind eher grau, ziemlich viel grösser und haben beeindruckende geschwungene Hörner. Diese hier sind überhaupt nicht scheu und lassen sich durch die Picknicker nicht stören. Genauso wie die verspielten Vervet Monkeys, die zur Spezies der Meerkatzen gehören. Wir haben’s ja schon erfahren: Gerne würden sie die mitgebrachten Köstlichkeiten für sich ergattern. Sie toben herum wie die Wilden. Von uns erhalten sie aber nichts, wir freuen uns am Picknick, das Rudolf mitgebacht hat. Wir übernachten in einer kleinen aber fabelhaften und absolut stylischen Lodge, dem Amazulu Guesthouse, wo wir die Honeymoon Suite erhalten! – (www.amazuluguesthouse.co.za/">www.amazuluguesthouse.co.za/)
Eine eher kurze Fahrt von etwa zwei Stunden bringt uns am nächsten Tag nach Kosi Bay. Unterwegs fahren wir durch mehrere Dörfer, in denen gerade ein Markt stattfindet, es ist Montag, also eher seltsam, aber vielleicht ist hier ja jeder Tag ein Markttag. Jedenfalls schiesse ich immer gerne ein paar Fotos durchs Fenster, wenn wir durch ein Dorf oder eine Stadt fahren. Unglaublich, was man da nicht alles zu sehen bekommt. Die Märkte sind farbenfroh, die Leute geschäftig, jeder scheint irgendwo hineilen zu müssen. – Sehr viele Coiffeur-Geschäfte hat es, die Frauen haben ja auch alle die wunderprächtigsten Frisuren, eine schöner als die andere; das Business muss rentieren. – Oft seh‘ ich erst, wenn wir schon vorbeigefahren sind, dass ein lohnenswertes Foto-Sujet bereits hinter uns liegt. So hätte ich zum Beispiel gerne das „Eating House” fotografiert und den „Future Fashion-Shop“. Sagenhafte Etablissements; beide laden nicht wirklich ein zum Bleiben…
In Kosi Bay haben wir etwas Mühe, unsere neue Unterkunft zu finden, die Wegweiser zur Eco-Lodge „Chinderera“ (chindereraecolodge.com/">chindereraecolodge.com/) sind nur spärlich vorhanden. Der Weg wird immer mühsamer; es ist eine Sandstrasse und wir fürchten schon, dass Rudolfs Merz, der leider kein 4x4 ist, die Herausforderung nicht schaffen wird. Aber es klappt, wir kommen nach etwa zehn km ab der Hauptstrasse in der Wildnis an. – Was uns da erwartet, ist einmalig. Was für ein Bijou, was für ein kleines Paradies mitten im Dschungel. Pam und Bill, ein älteres Ehepaar, begrüssen uns. Sie haben diese Lodge vor drei Jahren selber aus verschiedenen Holzarten aufgebaut und all ihre gesammelten Artefakte sind irgendwie und irgendwo verwendet worden. Wunderbare Details. Die Türklinken zum Beispiel sind Hörner von Springböcken, Masken aller Art dekorieren Zimmer und Essraum, eine hübsche Bar ist vorhanden, es ist ein Traum. Dass sogar WIFI-Anschluss besteht, ist fast nicht zu glauben. Das Licht wird um 9 Uhr abends abgestellt, aber auch das ist kein Problem.
Pam ist eine ausgezeichnete Köchin. Sie zaubert wunderbare Abendessen auf den Tisch, alles auch aufs Schönste angerichtet. – Wie das hier alles funktioniert, ist mir schleierhaft. Einkaufen ist nämlich nicht einfach. Der nächste Supermarkt befindet sich in Manguzi und dafür muss man diese mühsame Strecke zurücklegen. „Richtig“ einkaufen ist nur in St. Lucia möglich, und das ist eine Fahrt von ungefähr zwei Stunden.
Nach einem ausgiebigen Frühstück holt uns Patrick, ein Guide, der mit der Lodge zusammenarbeitet, mit seinem 4x4 Pickup zu einem Ausflug ab. Er fährt mit uns zum „Kosi Mouth“, dorthin, wo See Nummer eins ins Meer fliesst. Vier Seen hintereinander bilden den Abschluss des grossen Wetland-Naturschutz-Gebiets (Kosi-Lake, Kuhlange), das bei Santa Lucia anfängt und hier an der Grenze zu Mozambik aufhört. Der Ausblick auf den See und die Dünen ist atemberaubend. Das Wasser ist nicht sehr tief und der See ist übersäht mit Reusen. Seit Jahrhunderten offenbar ist dies die Art und Weise, wie die Tsongas ihre Fische fangen. Die Pfähle sind so ins Wasser gesteckt, dass die grossen Fische wohl rein-, aber nicht mehr herausschwimmen können.
Patrick führt uns anschliessend an den See Nummer eins, der in den Ozean mündet und dort können wir spazieren, uns ausruhen und baden. Es ist ein fantastischer Ort. Das Wasser in der Lagune ist völlig klar und man kann herrlich drin liegen. Das tue ich fast eine Stunde lang. Bei einer Temperatur von ca. 35 Grad ist das kein Kunststück. Theo liegt inzwischen am Strand, schnarcht ein wenig und macht dann eine Zeichnung.
Zurück in der Lodge hat uns Pat bereits einen Thunfischsalat und feine Babykartoffeln parat gemacht. Obwohl ich eigentlich lieber gar nichts hätte essen wollen, lassen wir kein Brösmeli davon zurück.
Am Nachmittag kommt ein starker Wind auf. Wir gehen trotzdem auf die Bootsfahrt, die durch drei der vier Seen führt. Nur Rudolf und ich. Das wäre nichts gewesen für Theo: Schon vom Ufer aus ist klar, dass die stürmischen Wellen nicht „Micky Mouse“ sind, wie Ken sagen würde. Der junge Typ, der uns ins Boot hilft, warnt schon im Voraus: „You guys will get completely wet“. Aus dem Grund entscheide ich, mein Smartphone lieber im Auto zu lassen, damit, falls wir die Fahrt nicht überleben, zumindest mein Galaxy noch da ist. Ein paar Camper am Strand sind erstaunt, dass wir bei dem Wind rausfahren wollen. Ein Schiff mit Touristen, das etwas weiter weg gestartet ist, kehrt grad wieder um und bricht die Tour ab. – Ich lass mir meine Bedenken nicht anmerken, will mich ja nicht blöd anstellen. Bis zum Boot müssen wir durchs Wasser waten, da sind meine Hosen bereits bis zum Gürtel nass. Ist ja kein Problem. Luft und Wasser sind beide weit über dreissig Grad warm. Trotzdem ziehe ich die Regenjacke mit Kapuze über. Chad, unser Kapitän, startet die beiden Motoren und los saust das Boot. Innert Sekunden sind wir beide von Kopf bis Fuss völlig nass, nur festhalten ist jetzt gefragt, sehen können wir nichts, das Wasser spritzt uns wie aus Kübeln ins Gesicht. Chad macht das ganz offensichtlich Spass, er geht aber ein wenig vom Gas und fragt, ob alles ok sei, er könne auch umkehren, wenn wir Angst hätten. – Kommt natürlich nicht in Frage, aber ich ziehe vorsorglich mal die Schwimmweste an. Man kann nie wissen… Weiter geht die wilde Fahrt, das Boot peitscht durch die Wellen, die immer höher daher kommen. Es schaukelt und schlägt hart auf. Einerseits macht’s natürlich tatsächlich Spass…
Wir erreichen den Kanal, da geht’s völlig ruhig zu und her. Friedlich sogar. Das Boot gleitet sanft durch die enge Wasserstrasse entlang dem Schilfkorridor, und wir sehen verschiedene Vögel, denen es dort genauso gefällt wie uns jetzt auch. Nach einer halben Stunde ungefähr erreichen wir den dritten See und dort geht’s wieder wie auf dem vierten See, wo wir eingestiegen sind. Es ist das Gebiet mit den zahllosen Reusen, die wir heute Morgen vom Ufer aus gesehen haben. Wir gondeln jetzt durch diese hindurch in einer weiteren Art Wasserstrasse, die vom dritten in den zweiten See führt. Und dort sehen wir von weitem Flamingos und von nicht so weitem zwei Hippo-Familien, die sich im Wasser vergnügen und uns im Visier haben. Vor denen habe ich grossen Respekt, die Fahrt im Kanu im Zambezi-River vor anderthalb Jahren werde ich nicht so schnell vergessen. - Sie sehen einfach lächerlich aus mit ihren riesigen Mündern und den kleinen Öhrchen. Riesige Körper und doch Vegetarier... Aber gefährlich sind sie, das ist ja altbekannt. Und die Töne, die sie von sich geben...
Der Wind hat zugenommen, die Wellen ebenso. Es ist Zeit umzukehren; die Bootsfahrt insgesamt soll ja zwei Stunden dauern. Durch die beiden Kanäle zurück geht’s nun zügiger, der Himmel ist inzwischen bedeckt und wenn die Sonne nicht scheint, erscheint auch die Landschaft nicht so farbintensiv wie zuvor. Der letzte Teil zurück zur Landestelle gibt Chat nochmal sein Bestes: „Hold on, guys“, ruft er und ab geht die Post. 60 km/h mache sein Boot, erklärt er uns nachher. Und er hat alles aus ihm rausgeholt. Triefend nass steigen wir anschliessen ins Auto und fahren zurück in die Lodge. Wunderbar – die Dusche anschliessend! Und auch die Siesta-Zeit bis hin zum feinen Nachtessen, das Pat für uns zubereitet hat.
Der Wind heult und die Äste stossen gegen das Zelt-Dach unserer Hütte. Ein Riesenlärm macht das, wie wenn eine Horde Wildgewordener unser Obdach stürmen würde. Dann beginnt es noch zu regnen. Die ganze Nacht lang geht das so, man hört nicht mal mehr die Grillen, deren Gezirpe uns in der Nacht zuvor ohne Unterlass in den Ohren lag. In Böen prasselt der Regen aufs Dach. Zwischendurch lässt er ganz wenig nach, um dann umso stärker erneut zuzuschlagen. Scheiben hat es keine an den Fenstern, nur Mückengitter, Plastikrollos und innen Bambusstoren. Was nicht gut verankert ist, flattert im Wind und weckt mich immer wieder. - Nur Theo schläft den Schlaf des Gerechten.
Auch am nächsten Morgen (4. Dezember) regnet es weiter. Ein Temperatursturz hat stattgefunden; es ist nur noch 18 Grad, genau 18 Grad weniger als tags zuvor. Unsere nassen Kleider haben nicht getrocknet und auch alles Trockene ist inzwischen leicht feucht. Ebenso das Bettzeug. Im Haupthaus gibt’s um halb neun ein feines Frühstück und Bill hat ein Feuer angefacht. – Damit hätten wir nun wirklich nicht gerechnet. Er sagt, eine solche Kälte im Winter habe er in SA noch gar nie erlebt.
Um zehn ist alles gepackt, Hab und Gut im Auto verladen; wir sind startklar für die kurze Reise in den Tembe-Elefant-Park. Bereits um elf Uhr kommen wir dort an. Unterwegs fahren wir durch Manguzi, den Ort, den wir vor zwei Tagen passiert hatten, wo grad Markt gewesen war. Das sieht nun anders aus. Immer noch sind viele Leute unterwegs, zum Teil mit Schirmen, aber die Marktstände sind leer, überall hat es Wasserlachen. Es regnet noch immer. – So auch in der Tembe-Lodge, wo wir zur Abwechslung in einem Zelt wohnen. Es ist gross und gut eingerichtet. Es mangelt an nichts.
Nachmittags um drei geht die Pirschfahrt los. Dies ist fast der einzige Park, wo man noch Elefanten sehen kann mit riesigen Stosszähnen. Wir sehen ein paar dieser Dickhäuter aus nächster Nähe; sie sind einfach gewaltig, diese Tiere. Impalas gibt es ebenfalls viele im Park, und auch Zebras und Giraffen.
Zum Nachtessen gibt es eine ausgesprochen gute Tomatensuppe, anschliessend können wir wählen zwischen Poulet-Schenkel und Impala. Nach dem Dessert gehen wir früh schlafen. In der Nacht höre ich mehrmals einen Löwen. Er scheint so nah am Zelt, dass mir fast Angst wird. Natürlich ist da noch der Zaun dazwischen. An die Töne neben mir hingegen bin ich gewöhnt, die höre ich jede Nacht.
Es regnet noch immer. Um sechs stehen wir auf, es gibt nur ein einfaches Frühstück, denn um sieben fahren wir los. Rudolf möchte um neun an der Grenze zu Eswatini sein. In die Lodge, in der wir übernachten werden, kann man mit dem privaten Fahrzeug nicht hineinfahren, man muss am Gate abgeholt werden und das wird nur um 10 Uhr morgens und um 4 Uhr nachmittags angeboten. Also sollten wir um 10 Uhr dort sein. – Das gelingt nicht ganz. Es wird fast halb eins… Die Strasse gegen Nordwesten in Richtung Swaziland wird neu gemacht, so dass streckenweise Einbahnverkehr herrscht, man ewig warten muss und nur beschwerlich vorwärtskommt. Die Strasse wird immer schlimmer und wie wir nahe der Grenze bei Big Bend sind, erfahren wir, dass besagter Grenzübergang geschlossen ist. Es bleibt nichts anderes übrig als umzukehren, erst wieder durch die lange Strecke mit den Baustellen hindurchzuzirkeln, um dann einen weiten Weg zum südlichen Grenzübertritt unter die Räder zu nehmen. In der Stadt Jozini herrscht ein solches Verkehrschaos, dass es aussieht, als ob überhaupt kein Durchkommen ist. Wir vermuten, es sei ein Unfall passiert, weil alle in der Schlange stehen und nicht weiterkommen. Aber offenbar ist das dort immer so. Also haben wir erneut viel Zeit verloren. Der Grenzübergang nach Eswatini geht kurz und reibungslos, wir haben Glück und müssen nicht sehr lange warten. Weitere 90 km sind zu fahren bis zum Gate der Mykhaya Game Reserve. Kurz nach zwölf kommen wir an. Dort steht ein Schild auf dem steht, Einlass „striktly only at 10am and 4pm“. Zum Glück wird „stricktly“ dann doch nicht so strikt befolgt, Rudolf ruft an und ein Driver kommt uns abholen. Ui ui ui, er kommt mit einem elf-plätzigen Safari-Land-Rover ohne Dach. Es regnet und wir müssen ja all unser Gepäck, das wir für zwei Tage brauchen, in dieses Fahrzeug umladen. Der Fahrer heisst übrigens „Africa“. Nett, nicht?! – Er hat aber für uns alle Pelerinen mitgebracht und das Gepäck wird in Plastiksäcke verpackt. Unser Auto fahren wir auf ein Grundstück, wo es hinter einem hoffentlich sicheren Gatter zurückgelassen werden muss, mit all unserem restlichen Gepäck noch drin. – Kein Wunder, sind Privatfahrzeugen nicht zugelassen. Auch ein „normaler“ 4x4 hätte Mühe, sich durch diese steinigen, überfluteten und holperigen Pfade zu kämpfen. Kaum im Park, schon sehen wir zwei Nashörner, die sich freudvoll, wie es scheint, im Sumpf hin- und herwälzen. Es dauert etwa eine halbe Stunde, bis wir bei der Lodge angekommen sind. Wir werden mit einem feuchten, warmen, wohlriechenden Lavettli begrüsst, ähnlich, wie das in manchen Flugzeugen der Brauch ist, wenn die Passagiere am Morgen geweckt werden. Unsere Koffer werden ausgeladen und zwei Angestellte tragen diese auf dem Kopf in unser „Chalet“. Die Lodge ist eine ganz besondere. Sie steht mitten in der Wildnis, die Pfade zu den einzelnen weit auseinanderliegenden Behausungen führen durch Gebüsch, vorbei an vielen hohen Bäumen. Man wohnt in einem der vielen alleinstehenden, grossen, runden Gebäuden, die von allen Seiten her völlig offen sind und keine Fenster haben. Zu keinem Nachbarn hat man Blickkontakt. Im Innern sind die verschiedenen „Zimmer“ wie WC und Dusche nur von niedrigen Mauern aus grossen Steinen abgetrennt. Man sitzt also auch auf der Toilette quasi im Freien mit Blick in den Busch. Schränke hat es keine, möbliert ist die „Wohnung“ mit zwei Campingstühlen und drei einfach gezimmerten Tischchen. Aber in der einen Mauer ist tatsächlich ein Safe eingebaut; man will sich offensichtlich nicht verantwortlich fühlen, wenn jemandem etwas abhandenkommt. Trotzdem: Die Dusche funktioniert bestens, das Wasser kommt warm aus der Röhre. Fehlen tut nichts. Über den ganzen Wohnbereich stülpt sich ein sehr hohes afrikanisches Dach aus Stroh, das vor Regen schützt und rundherum von etwa zehn Baumstämmen gestützt wird. Schlüssel gibt’s keinen, es ist ja auch keine Tür vorhanden, die man schliessen könnte, nur ein hüfthohes Gitter aus Metall schützt beim Eingang vor Hyänen, die offenbar nicht höher als einen halben Meter springen können. Affen allerdings haben jederzeit freien Zugang. Sie seien vor allem an kleineren glänzenden Gegenständen interessiert, an Uhren und Schmuck. An Essbarem sowieso. Aus diesem Grund werden Theos Nüsschen und die Schokolade, die er immer wieder kaufen muss, wenn wir an einer Tankstelle anhalten, gleich im Safe versorgt.
Unsere Smartphones aufladen können wir nicht, denn es hat keine Steckdosen. Strom wird mit Solar erzeugt und da die Sonne seit zwei Tagen nicht scheint, ist auch an der Rezeption der Strom rar geworden.
Ein ausgiebiges, delikates Mittagessen wird uns serviert, zwei verschiedene Salate und dazu Brot vom Feinsten, obwohl es keine krosse Kruste hat. Es sieht eher aus wie Cake und ist etwas süsslich. Das wär genug gewesen, aber dann kommt ein Teller mit Huhn und Impala, Reis und Gemüse und ein leckeres Dessert zum Abschluss.
Unser Tisch steht mitten unter dem riesigen Strohdach, in welchem sich oben in der Spitze eine ganze Schar von Fruit-Bats versammelt hat. Sie hängen, wie sich das für Fledermäuse gehört, kopfüber nach unten und wer weiss, ob sie uns beim Essen zuschauen. Ich hoffe einfach, keine lässt sich fallen oder ist unpässlich.
Wir gehen von vier bis sechs am Nachmittag nochmals auf Pirsch. Theo will nicht mehr mitkommen.
Breitmaul- und Spitzmaulnashörner sehen wir, eines mit einem Jungen, ein Warzenschwein, eine Schildkröte, Dung-Beatles, ein Krokodil, viele Vögel, eine Giraffe, Fussspuren von Hyänen, Nashörnern und Büffel.
Es hat grad aufgehört zu regnen. Zum Glück! Sogar ganz wenig Sonne und ein kleines Bisschen blauer Himmel wird sichtbar.
Wieder ein Viergänger zum Abendessen. Super gute Vorspeise, Suppe, dann Nyala oder Schweinsplätzli mit Gemüse und Couscous, Dessert. Dazu eine Flasche Pinotage aus Stellenbosch. - Theo schaufelt sein Gemüse grad von Anfang an auf den Brotteller ins Abseits.
Beim Abräumen stellen die beiden Damen, die uns bedient haben, das Geschirr und die Gläser auf ein Tablet. - Auf den Kopf damit und so tragen sie alles in die Küche.
Wir gehen sehr früh schlafen. Der Weg zum „Chalet“ ist mit Petroleumlampen beleuchtet. Das Bett ist schon gemacht, das heisst, das Moskitonetz heruntergelassen. Rings herum nichts als Natur. Eigentlich schlafen wir im Freien, denn Fenster hat es ja keine.
Man schläft sehr gut in diesem Bett trotz der unaufhörlichen Geräusche der Grillen und Frösche. Dass wir allerdings zu dritt im Bett sind, merke ich erst mitten in der Nacht, wie ich eine Mücke höre, die offenbar doch den Weg zu uns gefunden hat. Sie streift mich zweimal im Gesicht und da ist vorerst natürlich nichts mehr mit Schlafen.
Nach dem Frühstück warten wir auf Africa, unseren Fahrer. Nach einer dreistündigen Pirschfahrt sind wir zurück zum Mittagessen.
Gesehen haben wir: Viele, viele Dung-Beatles. Es hat auch riesige Plätze voller Nashorn-Dung, wo die fleissigen Käfer tagein, tagaus massenhaft zu tun haben. Der Park ist spezialisiert auf Nashörner, es gibt Breitmaul- und Spitzhornnashörner. Weil sie ihrer Hörner wegen rücksichtslos gewildert werden, sind sie am Aussterben, vor allem das Black Rhino. Hier im Park versucht man, sie zu hegen und zu pflegen. „Was unternimmt man denn hier gegen die Wilderer?“, fragt Rudolf. „We shoot them“, lacht Africa.
Erst am nächsten Tag erfahre ich, dass dies kein Witz war, sondern ernst. 25 Männer mit Militärausbildung sind angestellt, um die Nashörner zu bewachen und mit allfälligen Wilderern kurzen Prozess zu machen. Sie sind mit automatischen Gewehren ausgerüstet.
Wir sehen eine ganze Menge Nashörner, an einem Ort mindestens ein Dutzend Giraffen, ein Warzenschwein, das seine Jungen säugt und daher nicht grad sofort die Flucht vor uns ergreift, Aasgeier, ein Krokodil, eine Schildkröte, einen Leguan und eine ganze Familie von Flusspferden. Africa lenkt sein Gefährt behände über die mühsame, steinige, schlammige und teilweise steile Piste, durch Wasserlachen, Löcher, rauf und runter; es kommt uns manchmal vor wie auf der Achterbahn und ich habe auch ein, zweimal Angst, das Gefährt könnte kippen, aber dem ist zum Glück nicht so. Arica ist ein Experte, es ist ja sein Job, täglich Touristen im Park herumzufahren. Er kann auch gut erklären, kennt nebst den Tieren alle Pflanzen und Bäume; langweilig wird es nie. Die Vögel erkennt er auf Anhieb, sowohl von weitem wie auch nach ihrem Gesang, den er erstaunlich gut imitieren kann.
Um halb eins sind wir zurück. Vorsorglich haben wir nur ein kleines Mittagsmenu bestellt. – Dann gibt’s Siesta bis um vier, die Theo leider gleich bis zum Nachtessen durchzieht. Rudolf und ich, wir gehen mit Africa auf die Nachmittagspirsch. Giraffen und Zebras begegnen wir, eine ganze Büffelherde kommt daher und wir können ein Nashorn streicheln. Wer hätte das gedacht?! – Es ist eines, das von Hand aufgezogen wurde und also an den Menschen gewohnt ist. Africa erkennt es sofort. Im Schlepptau hat es ein Junges. Aus dem Dickicht nähert es sich seitlich an unser Fahrzeug, aber in dem Moment wusste ich noch nicht, dass keine Gefahr besteht. Die Situation sieht bedrohlich aus; es kommt direkt auf uns zu. Beim Auto angekommen, senkt es seinen Kopf und Rudolfs trockener Kommentar ist: „There goes the tyre“. Africa erklärt, man könne es streicheln. Eine eigenartige Situation! - Die Haut ist ledrig und mit vielen Parasiten bedeckt. – Es zottelt davon, wir fahren weiter. Impalas sieht man immer wieder mal, auch Nyalas und wenige Halfmoon-Antilopen (Tsessebe, zu Deutsch Leierantilope), wie Africa erklärt, das zweitschnellste Tier nach dem Gepard (kann bis zu 70km/h hinlegen). Endlich auch ein Warzenschweinmännchen, das mal ausnahmsweise nicht gleich die Flucht ergreift, wenn es unser Gefährt im Visier hat. Wahrscheinlich ist das Gras an dieser Stelle einfach zu gut, um wegzurennen. Auf den Knien herumkriechend, frisst es eifrig, was sich Feines vor ihm präsentiert. Lustig sieht das aus. Rudolf meint, es sei das einzige Tier, das betet, bevor es frisst. – Was uns auch gut gefällt, sind die kleinen, gelben Weaver Birds. Wir haben sie schon oft gesehen und beobachtet. Sehr gerne bauen sie ihre orangengrossen Nesterkugeln im Schilf oder befestigen sie in niedrigen Baumkronen. Gelb sind nur die Männchen. Sie sind geschickte Nestbauer und wenn sie mit ihrer Arbeit fertig sind, lassen sie ein riesiges Theater und Gezeter los, um ein Weibchen anzulocken und die Dame zum Eierlegen einzuladen. Aber da haben sie oft die Rechnung ohne den Wirt respektive die Wirtin gemacht. Wenn ein Weibchen das Nest nicht schön oder gut oder geeignet empfindet, zwickt sie’s kurzerhand vom Ast ab und lässt es auf den Boden sausen. – Und der arme Kerl schaut zu. Rudolf meint, es könne auch sein, dass sie noch nicht parat ist zum Eierlegen und ihren Künftigen so zwingt, sich weiter zu beschäftigen, also am Ball zu bleiben. Jedenfalls liegt unter jedem Baum, an dem die Webervögel-Nester hängen, eine ganze Reihe davon achtlos im Gras.
Gegen Ende der Fahrt fängt es wieder an zu regnen. Langsam wissen wir, was es heisst, in der Regenzeit zu reisen. Aber das Schöne ist, alles ist wunderbar grün. Die Natur liebt diese Jahreszeit. Wenigstens ist es nicht mehr so kalt wie noch tags zuvor. Es wird wenig über zwanzig Grad sein.
Nach einem Viergänger geht’s um neun schon wieder ins bequeme Bett unters Moskitonetz und diesmal schauen wir genau, dass wir drin und die Mücken draussen sind.
Endlich Sonnenschein. Kurz nach fünf schon dringen die ersten Strahlen durch die Wipfel der Bäume. Frühstück um acht, um neun fahren wir zurück zum Gate und zu unserem dort parkierten Auto. Die Fahrt dauert eine halbe Stunde und unterwegs rennen zwei Nashörner über die Strasse, ein paar Warzenschweine und etliche Impalas. – Auch wenn wir inzwischen viele Tiere gesehen haben, ist dies immer wieder ein Erlebnis. – Passiert ja nicht grad häufig in unserer Gegend.
Eine etwas längere Fahrt bringt uns durch die Stadt Manzini nach Kalkerns in eine Kerzenfabrik, eigentlich eher eine Werkstatt, ein Ort für Touristen, aber uns gefällt’s auch. Man kann zuschauen, wie aus den farbigen Paraffin-Kugeln Elefanten und Nashörner entstehen und viel andere hübsche Sujets ebenso. Erstaunlich, wie geschickt der junge Mann ist, dem wir zuschauen. Kleine Verkaufsläden hat’s, Boutiquen auch und Stände, wo der übliche Krimskrams zum Verkauf angeboten wird. Ich freue mich, dass ich in einem der Läden das Buch von Trevor Noah „Born a Crime“ finde, von dem ich Rudolf erzählt habe. Er hat nichts zum Lesen dabei, also ist dies das perfekte Geschenk. – Wir essen und trinken eine Kleinigkeit und da’s dort WIFI gibt, sind wir ganz froh, dass wir für einen kurzen Moment wieder Kontakt mit Familie und Freunden pflegen können.
Nach etwa zwei Stunden Fahrt kommen wir an unserem nächsten Ziel an, dem „Hluwe-National-Royal-Park“. Wir beziehen unsere Unterkunft, ein einfaches rundes Haus diesmal.
Vor der Tür liegt eine Schlange: dünn und grün, etwa ein Meter lang. Rudolf sagt, es sei die grüne Buschviper, harmlos; ich behaupte, es sei die Grüne Mamba, das tönt viel abenteuerlicher. – Er lacht mich aus - sie verschwindet im Gebüsch.
Anders ist dieses Rondavel als das offene Haus im Mkhaya-Park. Auch hier gibt es keinen Strom, immerhin aber Fenster mit Mückengittern. Alles funktioniert mit Solarstrom – wenn denn die Sonne scheint… Sofort nehmen wir eine Dusche, denn kein Windchen weht, es ist 30 Grad heiss, schwül und absolut schweisstreibend. Und einmal mehr beginnt es zu nieseln. Der Wetterbericht sagt, auch morgen sei es regnerisch…
Kurz vor Einnachten kommt eine Angestellte vorbei, zündet drei Paraffin-Lampen an, stellt uns eine ins Badezimmer, eine vor die Tür und die dritte „erhellt“ unseren Wohn-Schlafraum.
Apérotime! - Es hat eine ganze Reihe von Stühlen vor dem Restaurant, von wo aus man einen tollen Blick auf den kleinen See hat, um den herum nun Antilopen ihren Schlaftrunk nehmen, zwei Hippos schleppen sich an Land und pirschen Richtung Busch, wir trinken Whisky und Weisswein. Nachtessen und ab ins Bett. Schon um neun. Es ist dunkel, nicht einmal lesen mögen wir mehr.
Am nächsten Morgen (8. Dezember) regnet es tatsächlich, und es ist relativ kühl, kaum mehr als 20 Grad. Nach dem Frühstück bietet sich uns ein toller Anblick: Zwei Elefanten vergnügen sich im kleinen See vor dem Restaurant. Es muss das reinste Vergnügen sein für sie, sie wollen nicht aufhören, vor- und rückwärts ins Wasser zu plumpsen. Eine halbe Stunde lang dauert die Vorstellung, es ist imposant, erstaunlich, einfach grossartig.
Um elf geht’s auf Pirsch – einmal mehr. Diesmal sind wir drei leider nicht allein mit dem Fahrer. Eine ganze Wagenladung Franzosen fährt mit. Oh la la. – Erstaunlich viele Breitmaulnashörner sehen wir, der Fahrer lädt uns zweimal ein auszusteigen und sie aus der Nähe zu betrachten. - Bei dem Sumpf kommt das natürlich gar nicht in Frage. Niemand will. Die Schuhe sind eine wirklich gute Ausrede.
In der Ferne sehen wir etwa zwanzig Zentimeter von einem Elefantenrücken. Ich lass es jetzt mal, ein Foto zu machen. Ein Gnu kreuzt unseren Weg und wieder und wieder grasen Nyalas und Impalas friedlich in der Nähe. Im Moment müssen sie sich vorkommen wie im Schlaraffenland, denn alles ist grün, die feinsten Gräser, Büsche und Sträucher stehen zum Schlemmen zur Auswahl.
Eigentlich sind wir schon längst in der Gegend angekommen, wo ich mein Eau de Toilette gegen „Peaceful Sleep“ beziehungsweise Anti Brumm tauschen müsste. – Ausser dem einen dreisten Biest, das sich in unser Moskitonetz Eintritt verschafft hat, waren Mücken bisher kein Thema; sie sind es auch jetzt noch nicht. Kein Wunder bei dem Regen und der Kälte. Da mögen die ja auch nicht aus dem Haus.
Nach dem Nachtessen werden wir von den zwei Angestellten, die uns vorher bedient hatten (nebst einem anderen Ehepaar waren wir die einzigen Gäste), mit Schirmen zu unserer Hütte gebracht. Es ist eine glitschige Angelegenheit, man muss aufpassen wie ein Häftlimacher, dass man nicht hinfällt. Zudem ist es stockdunkel, die beiden Frauen gehen voraus und leuchten den Weg mit einer Paraffin-Lampe. Sie tragen Gummistiefel, das einzig richtige Schuhwerk (wer hätte gedacht, dass wir noch Gummistiefel hätten mitnehmen müssen auf unsere Reise nebst dem langen Abendkleid fürs Gala-Dinner), unsere Schuhe sind nass und braun, wie wir endlich am Ziel sind.
Wir schlafen gut, während der Nacht hören wir die Löwen brüllen.
9. Dezember:
Es hat die ganze Nacht geregnet, und es sieht nicht danach aus, als ob es je aufhört. Alle unsere nassen und schmutzigen Kleider und Schuhe, die wir zum Teil seit Tagen versuchen, trocken zu kriegen, sind natürlich noch feuchter geworden als vorher.
Nach dem Frühstück um neun kommt uns Rudolf abholen und wir wollen losfahren. Das geht aber nicht, weil der Merz im Sumpf stecken bleibt. Es ist halt kein 4x4. Hilfe wird geholt. Zu dritt kommen sie mit einem ebenfalls nur zweiradangetriebenen Auto und versuchen, unser Gefährt aus dem Morast zu ziehen. Typisch Afrika! – Natürlich funktioniert das nicht, die Räder auch dieses Fahrzeugs spulen hilflos im Dreck und bilden ein immer tiefer werdendes Loch. Ein Safari-Truck muss her, dann kann die Fahrt losgehen. - Bis zur Grenze dauert es circa eine Stunde, dort geht alles reibungslos. Im Gebäude, wo die Pässe abgestempelt werden, läuft die Air-Condition auf Hochtouren. 30 Grad zeigt das Gerät an. Es ist super schön warm dort drin, ein warmer Wind weht vom weissen Apparat herunter, genauso, wie die Angestellten es wohl mögen. – Draussen ist es 18 Grad.
Nach einer Stunde Fahrt sind wir schon fast im Krügerpark. Kurz vorher machen wir Halt in Komatipoort, einem Ort ganz anders als andere südafrikanische Städte, ein grosses Einkaufszentrum mit all den bekannten Läden ist vorhanden, hier deckt man sich ein, wenn man im Park campiert. Wir wollen uns ja nicht selber versorgen, kaufen aber in der Apotheke was ein, im Liquor-Shop Whisky für Theo und Rudolf und im Wimpy gibt’s Kaffee, WIFI und schrecklich gute und klebrige Zimtdonuts mit einer dicken Schokoladensauce und Vanilleeiscreme.
Bei der Crocodile Bridge ist das Park-Gate. Kaum ein paar Meter gefahren, schon sehen wir Gnus, Impalas in Massen, Elefanten unterwegs die Strasse überquerend und sogar eine Hyäne will auf die andere Seite wechseln. Und – was für ein Wunder: Rudolf erspäht weit weg im Busch unter einem Baum einen Leopard. – Kaum da und schon sowas…
An einem Wasserloch sind Dutzende von Krokodilen an Siesta-Machen, Sattelstörche stolzieren herum und ein paar Flusspferde liegen im River Sabie und lassen sich besprudeln wie in einem Jacuzzy.
Gegen vier kommen wir in unserer Unterkunft an, wo wir zwei Nächte lang bleiben werden: in Lower Sabie. Waren wir bisher fast immer alleine in den Camps, wo wir übernachteten - hier wimmelt es von Touristen. Es ist ein schöner Ort, von der Terrasse des grossen Restaurants aus hat man eine tolle Aussicht auf den Fluss. Ein paar Antilopen grasen am Ufer.
Hier wohnen wir in einem Haus mit rechteckigem Grundriss, gemauert, eine kleine Küche gehört dazu (self-catering), sogar Licht und Strom sind vorhanden, aber diese unsinnigen englischen Riesenstecker verunmöglichen es uns, unsere Laptops und Smartphones aufzuladen. - Einmal mehr.
Um halb sieben kommt Rudolf vorbei und die beiden Männer trinken ihren Famous Grouse Whisky on the rocks zum Apéro. – Ich begnüge mich ganz bescheiden mit Mineralwasser.
Anschliessend gehen wir essen. Kaum im Restaurant angekommen, geht das Licht aus, und zwar im ganzen Camp. Generator hat’s keinen und von Kerzen hat man hier auch noch nie etwas gehört. Mit den Taschenlampen aus dem Smartphones gelingt es zumindest, die Karte zu lesen und schliesslich mal eine Flasche Wein zu bestellen. Das Licht geht wieder an, alles jubelt, es reicht grad dafür, die Bestellung fürs Abendessen aufzugeben, dann ist wieder dunkel. – Wir haben ja unseren Wein, alles bestens. Zwei, dreimal wird’s ganz kurz wieder hell, das war’s dann aber. Unser Essen geniessen wir in Dunkelheit, wie zu Hause im Restaurant „Blinde Kuh“.
Unser Kellner heisst übrigens „Advice“. - Weil die Schwarzen Namen haben, die für die Weissen nicht leicht zu merken und auszusprechen sind, haben sie meistens zwei Namen. Da kommt alles Mögliche und Unmögliche zusammen. Von Goodman und Africa habe ich bereits berichtet. Hier kommt nun noch Advice dazu. Innocent hat uns auch mal bedient. Million gibt’s ebenso wie Given, Errance, Princess und wohl Hunderte mehr oder weniger absonderliche Namen mehr.
Vom Manager erhalten wir einen Stecker, der in die dumme Steckdose passt und einen Ausgang hat für Normalsterbliche. Ich bin sehr froh, so können wir unsere Geräte nun doch noch aufladen. Ich könnte nicht mehr auf dem Laptop schreiben und die mitgebrachten Filme schauen, Theo keine Musik mehr hören, unsere Fotoapparate könnten nicht mehr geladen werden, es wäre keine Freude. – Erst am nächsten Morgen ist der Shop wieder offen und Theo kann einen eigenen Stecker kaufen. Eigentlich dünkt mich, eine Lodge, die seit Jahren so fleissig besucht wird von Menschen aus aller Welt, sollte ausgerüstet sein mit brauchbaren Steckdosen. Aber ja, it's Africa.
Um neun sind wir schon wieder im Bett, das Stromproblem haben sie inzwischen wieder im Griff, wir haben Power für unsere Geräte und im Schlaf- und Badezimmer sogar ein bescheidenes Licht.
Die ganze Nacht lang regnet es. Ohne Unterbruch. Vor lauter Prasseln sind nicht einmal die Grillen mehr zu hören, nur schwach tönt hin und wieder das Grunzen der Flusspferde an mein Ohr, Theos Geschnarche natürlich wie gehabt.
Auch am Morgen hört der Regen nicht auf, so langsam schlägt er aufs Gemüt. Die Temperatur macht auch keine Freude; meine App zeigt 19 Grad, die von Rudolf 16. Bereist werden Witze gemacht im Netz über das Wetter hier. Zum Beispiel: „Today’s weather forecast: cloudy with a chance of electricity“. Nach einem feinen Frühstück fahren wir trotzdem los auf Pirsch, aber so ergiebig wie gestern sind unsere Sichtungen nicht. Impalas sieht man noch immer am meisten. Sie stehen wie bestellt und nicht abgeholt in kleinen Gruppen zusammengedrängt unter irgendwelchen Bäumen. Pudelnass. Einen Honey-Badger sehen wir eilig die Strassenseite überqueren. Nur sehr selten kann man diese beobachten, sie sind eigentlich eher in der Nacht aktiv. Eine Schnecke, faustgross, steht am Strassenrand. Sie lebt gefährlich. Antilopen fotografieren wir keine mehr. Erstens haben wir schon genügend Bilder gemacht und zweitens werden die Fotos heute von den Farben her kaum befriedigen. Ein paar Geier und auch Adler sehen wir. Diese grossen Vögel sitzen trostlos auf den Spitzen der toten Bäume herum und warten darauf, dass es aufhört zu regnen. Das passiert aber nicht. Im Gegenteil. Es wird immer schlimmer. Es bilden sich ganze Bäche auf den Strassen, dort, wo kein Asphalt ist, wird der Morast immer grösser. Wo all das Wasser herkommt? – Das Meer muss langsam leer sein.
Wir essen eine Kleinigkeit im Skukuza-Camp, dem ältesten Camp im Park und fahren dann zurück nach Lower Sabie. Tatsächlich sehen wir kaum mehr Tiere unterwegs – völlig unüblich für den Krüger Park. Ein paar Paviane überqueren noch die Strasse, ein Gelbschnabel-Storch stolziert herum. Ihn stört die Witterung offenbar nicht, er ist fleissig dabei, irgendwelche leckeren Dinge vom Boden aufzupicken.
Wir sind ganz froh, endlich gegen vier ins Trockene zu kommen; Rudolf bringt uns vor die Haustüre.
Um halb sieben kommt er wieder zum Apéro – wenn das so weitergeht, muss er bald schwimmen…
Genau wie gestern, so geht auch der Strom wieder baden, grad im Moment, wo wir das Restaurant betreten. Wie’s für einen Moment wieder hell wird, können wir bestellen, die Rechnung bringt die Kellnerin (Kaffee und Dessert schon vorbestellt) bei der nächsten „Lichtlücke“ und wir bezahlen auch gleich, denn sonst funktioniert ja auch die Verbindung zur Kreditkartenzentrale nicht. Der Wein kommt sofort, die Temperatur ist seit ein paar Tagen kein Thema mehr, er ist 18 Grad, wie er sein soll. Das Essen ist sehr gut – das Restaurant ist ein M&B (Mugg and Bean), das ich auch von London her kenne. Die Karte ist mehr oder weniger dieselbe. – Es herrscht wieder Dunkelheit und wir fragen, ob’s keine Kerze hat. Da bringt sie doch tatsächlich eine. Man muss sie also verlangen, von selber kommt es dem Personal nicht in den Sinn, sofort Kerzen zu verteilen auf den ungefähr fünfzig Tischen. – Africa…
Zurück in unserem Häuschen ist es dann doch ganz gemütlich, das Bett ist sehr warm und wir schlafen gut beim konstanten Geräusch der Tropfen.
Es regnet durch. Am Morgen ist’s nicht anders. Der eine Vogel schimpft und ein anderer singt ein Lied, das ziemlich jämmerlich tönt, finde ich. Den Tieren wird’s wohl auch langsam zu viel.
Um halb neun wird uns Rudolf abholen, denn Checkout-time ist bereits um neun. Die wenigen Meter bis zum Auto werden sowohl unser Gepäck wie auch wir wieder tropfnass sein. Frühstück gibt’s erst anschliessend: wie gestern feine Eggs Benedikt für mich, Cappuccino und ein eiskaltes, köstliches Spinat-Minzen-Bananen-Smoothy (die beiden Männer rümpfen die Nase...).
Wir fahren los und endlich, endlich hört der Regen auf. Sogar ein paar Sonnenstrahlen dringen durch die Wolken durch und sogleich steigt die Temperatur auf 25 Grad.
Am Sabie-Fluss beobachten wir einen Fish-Eagle, der dabei ist, Termiten zu fressen. Ein Krokodil sonnt sich am Ufer mit weit aufgesperrtem Maul, ein zweites gleitet nebenan im Wasser. – Impalas sehen wir ständig, in Gruppen stehen sie herum und sind am Grasen. Die wären ja tolles Löwenfutter, aber die Raubkatzen machen sich rar. Es sieht nicht aus, als ob wir welchen begegnen werden. Dafür immer wieder mal Warzenschweine, Gnus und eine Hyäne. Diese drei gehören übrigens zu den „Ugly Five“, die zwei fehlenden sind Marabu und Geier. Alle fünf sind tatsächlich nicht mit Schönheit gesegnet.
Anmutig hingegen präsentieren sich die beiden grossen Hornbills. Sie sind schwarz und ums Auge herum knallrot. Die Gurgel ist ebenfalls rot und wenn sie ihre Flügel aufspannen, was diese nun gerade tun, wohl um ihr Gefieder in der Sonne zu trocknen, erkennt man braune und beige Federn unter dem schwarzen Mantel. Sie sind vom Aussterben bedroht. Viele andere Vögel wie Geier zum Beispiel und riesige Schwalbenschwärme bekommen wir auch zu Gesicht; es scheint, als seien sie alle froh, dass der Niederschlag aufgehört hat. Perl- und andere Hühner gackern oft am Strassenrand herum, einige rennen kopf- und planlos vor dem Auto her; es kommt ihnen schlicht nicht in den Sinn, dass es eine gute Idee wäre, sich in den Busch zu verdrücken.
Von weitem sehen wir eine riesige Büffelherde. Es sind mindestens hundert Tiere, wohl eher noch mehr. Sie grasen friedlich und kommen ganz langsam in unsere Richtung. Rudolf stellt den Motor ab und wir warten, bis wir mitten in der Herde drin sind. Sie überqueren vor und hinter uns die Strasse, es ist ein seltsames Gefühl. Einmalig! Natürlich ideal zum Fotos-Schiessen.
Auf einer kleinen Anhöhe, der einzigen weit und breit, halten wir an. Es ist ein Aussichtspunkt vom Schönsten. Man blickt von oben auf die endlos weite Ebene. Ganz am Horizont ist die Lebombo Bergkette zu erkennen, die Grenze zu Mozambique. Man erhält eine Idee von der Grösse des Krügerparks. Er ist immens – halb so gross wie die Schweiz.
Einen Kaffeehalt machen wir am Mittag in Tshokwane, dann geht die Pirschfahrt weiter. - Elefanten überqueren die Strasse, auch zur Abwechslung mal Giraffen. Zebras, Kudus, Wasserböcke sind nicht rar, Löwen haben wir noch immer keine entdeckt.
Bald darauf erreichen wir Satara, das nächste Camp, wo wir zwei Nächte lang bleiben werden. Es ist ziemlich gross. Die einzelnen Häuser sind in fünf weitläufigen Kreisen nebeneinander gebaut. Es sind Rundhäuser mit Strohdächern, wie gehabt. Jedes hat seine eigene kleine Küche und vor der Terrasse steht ein Grill, ohne zu „braaien“ geht’s halt einfach nicht. Etliche unserer Nachbarn sind bereits dabei, ein Feuer anzufachen. – Die Vervet-Affen sind sofort zur Stelle. Sie rechnen bereits damit, etwas Futter zu erhaschen. Natürlich ist es strengstens verboten, sie zu füttern, was die flinken Tiere keineswegs stört, sie können ja schliesslich nicht lesen. Auch ein paar kleinere Vögel sind alles andere als scheu und versuchen, zumindest ein paar Brotkrumen zu ergattern. Es sind die kleineren Hornbills und die frechen Starlings mit ihrem schönen blauschwarz glänzenden Gefieder, etwa so gross wie die Amseln bei uns.
Am späten Nachmittag gehen wir erneut auf „Katzensuche“, wieder ohne Erfolg; Elefanten, Vögel oder Bäume sollte man suchen, das wär kein Problem. Aber etwas vom Schönsten heute ist der blaue Himmel und die Wolkenbilder über der weiten Steppe. Jetzt, wo die Sonne wieder scheint, sieht man buchstäblich alles in anderem Licht, nicht mehr nur grau in grau. Das Gras ist grün, die Impalas hübsch gestreift am Hinterteil, die Warzenschweine sind dunkelbraun, denn sie haben sich im Dreck gesuhlt.
Und wieder mal ein Sonnenuntergang und sozusagen vis-à-vis ein Vollmondaufgang. Herrlich!
Im Restaurant gibt’s Rumpsteak und Pommes-Frites. Riesenportionen. Das kleinste Stück, das man bestellen kann, wiegt 250 Gramm. Wie üblich sitzen wir draussen. Kalt ist es nicht. Um die Lampen schwirren Dutzende von Termiten, welche momentan mit langen Flügeln unterwegs sind, also grad im Flugmodus, und die nur dann Ruhe geben, wenn wieder mal der Strom ausfällt, was natürlich prompt geschieht.
12. Dezember:
Schon um zwanzig vor sieben machen wir uns auf zur ersten Pirschfahrt. Theo muckst nicht einmal. Gut, wir sind ja auch schon um zehn Uhr schlafen gegangen letzte Nacht.
Einmal mehr geht also die Suche nach Simba los, aber der lässt sich auch frühmorgens nicht sehen. – Aber er war sicher da. Er oder der Leopard, denn auf der Strasse liegt das Bein einer Impala-Antilope. Da ist etwas schief gelaufen für die Arme. „Z Bethli het’s verwütscht“, sage ich. Aber die Katze muss ja schliesslich auch von etwas leben.
Um halb zehn sind wir zurück, essen ein karges Frühstück (Stromausfall – Kaffeemaschine funktioniert nicht, ebenso wenig der Herd) und um 12 Uhr geht’s wieder los. Theo hat genug, will seine Fotos sortieren, also gehen nur Rudolf und ich auf die Suche. – Ein Baby-Zebra kommt uns vor die Linse sowie eine ganze Schar Impala-Zöglinge. Schon nur um denen zuzuschauen, hat sich die zweistündige Fahrt gelohnt. In einem Wasserloch ragen die Köpfe einer ganzen Hippo-Familie aus der Oberfläche, Zebras, Giraffen und immer wieder mal Elefanten, Gnus und Vögel bekommen wir ebenfalls zu Gesicht. Es gibt mehr als 500 Vogelarten im Park, von denen einige allerdings vom Aussterben bedroht sind. Die kleinen, farbigen kann man schlecht fotografieren, aber die grösseren, die oben auf den Baumwipfeln sitzen, schon. Sie halten Ausschau nach Essbaren und halten sich daher ganz still. So auch die weltgrösste Eule, die „Giant Eagle Owl“, welche bis zu 70 cm gross werden kann.
Für die Impalas halten wir schon gar nicht mehr an, es kommt mir vor wie in Myanmar mit den Buddhas. – Irgendwann hat man sie gesehen… Obwohl, ich könnte all diesen Tieren stundenlang zuschauen, wie sie sich bewegen, wie die Grazer in Ruhe grasen oder die Browser an den Büschen knabbern. Dass die Elefanten nicht überall in der Welt sehr beliebt sind, wird rasch deutlich. Sie benehmen sich sehr rüpelhaft. Die Verheerungen, die sie anrichten, sind enorm. Sie reissen Bäume aus, entwurzeln sie, brechen Äste ab und lassen die manchmal einfach liegen. In der ganzen Gegend, wo’s Elefanten hat, gibt’s massenhaft tote Bäume, die herumliegen oder kahl und einsam aus dem Busch emporstechen. Wenigstens die Geier lieben diese, die Adler auch. – Und wir lieben die Elefanten, diese kraftprotzigen Dickhäuter, eben trotzdem.
Um halb drei sind wir zurück. Da das Wetter endlich mal wieder schön ist, 30 Grad am Schatten, genehmigen wir uns zwei Stündchen am Swimmingpool – schwimmen, lesen, dösen.
Nach einem frühen Nachtessen geht’s um acht Uhr auf eine abendliche Pirschfahrt. Drei Hyänen präsentieren sich uns im Scheinwerferlicht der Lampen, die beidseits des Fahrzeugs während der Fahrt in den Busch zünden – wie gehabt bei der Sea-Turtle-Suche. Wie dort sehen wir auch ein Spotted Ganet, eine Ginsterkatze, wie die deutsche Übersetzung sagt, nur dass offenbar neuerdings die Tiergattung nicht mehr den Katzen zugeordnet wird, denn die Tiere essen auch Beeren und Grünzeugs. – Omnivores. Ein Stachelschwein und ein Chamäleon sieht Loyd, unser Fahrer, aber die beiden sind weit weg und man könnte mir viel erzählen….
Auf dem Weg zurück zum Camp ist’s nicht mehr so ergiebig, alle sind sowieso müde, ich schlafe sozusagen in jeder Kurve ein.
Freitag, der 13te: Weiter geht die Reise. Gemütlich fahren wir Richtung Westen und sind nach zwei Stunden beim Ausgang des Krüger Parks, dem Orpen Gate. Leider macht das Wetter wieder keine grosse Freude. Der Himmel ist grau, die Sonne zeigt sich nicht. Unterwegs gibt’s nach wie vor manches zu sehen, Zebras und Elefanten spazieren vor uns über die Strasse, aber an den Gnus ist niemand mehr interessiert. An den Löwen wären wir schon, aber die ganz offensichtlich nicht an uns.
Kaum aus dem Gate wechselt das Landschaftsbild. Farmen, so weit man sehen kann. Orangen, Mangos und alles Mögliche wird angepflanzt. Rudolf sagt, es seinen kleine Farmen, also rund 3000 ha gross (!) In der Ferne sieht man die imposanten Berge: die Transval Drakensberg-Mountains. Diese müssen wir überqueren. Die Strasse führt von Limpopo nach Mpumalanga. Es ist eine wunderschöne Fahrt entlang dieser Panorama Route. Der www.tripadvisor.com/Tourism-g471857-Klaserie_Private_Game_Reserve_Kruger_National_Park-Vacations.html">Klaserie-Abel Erasmus Pass führt auf fast 2000 Meter Höhe. Die schroffen Felsformen sind absolut beeindruckend. Am Strassenrand sind etliche Stände aufgebaut, wo Souvenirs verkauft werden, und wo die Verkäufer versuchen, die Autos zum Anhalten zu bewegen, aber Rudolf will das auf keinen Fall. - Gut so!
Ein Pionierwerk der Ingenieurskunst (so Wikipedia) ist der 134 Meter lange JG Strydom Tunnel, durch den wir nun fahren. Auf der anderen Seite ändert die Szenerie erneut. Nun sind es Graslandschaften und teilweise wieder die Pinien- und Eukalyptuswälder, die überhaupt nicht hierher gehören.
Kurz nach Mittag essen wir eine Kleinigkeit in einem gemütlichen, hübschen Café mit Lebensmittel-Laden und Curios-Shop, wo ich nicht umhin kann, etwas zu kaufen. Ans Packen morgen will ich noch gar nicht denken. – Auch hier wieder Stromausfall, wir haben aber Glück, unsere Quiche hat’s grad vorher noch aus dem Ofen geschafft, ist warm und da ich noch genug Cash habe, brauchen wir auch die Kreditkarte nicht zu bemühen.
Weiter geht’s bergauf. Der nächste Halt ist bei den drei Rondavels, einer tollen Felsformation, die an die afrikanischen Hütten erinnert. Rudolf kennt einen Ort, wo man die beste Aussicht hat. Das ist aber in einem Resort, wo man eventuell nur Einlass erhält, wenn man dort übernachtet. – Sie haben am Gate jedoch ein Einsehen und wir dürfen passieren. Wir sind die einzigen Personen auf dem sehr kurzen Hike. Die Aussicht, die sich uns bietet, ist grandios. Wir stehen auf einem Felsenkopf gegenüber der drei Rondavels, zwischen uns ein Abgrund. Gitter hat’s keine. Sonne übrigens auch nicht, aber das Bild, das sich einem präsentiert, ist trotzdem gewaltig.
Und noch ein atemberaubender Halt auf der Panorama-Route: Die Burke‘s Luck Potholes, wo der Blyde River und der Treur River zusammenfliessen. Dort hat sich ein riesiges Canyon gebildet und Löcher im Gestein, genau wie bei uns die Gletschermühlen, nur sehr viel grösser im Ausmass. Es ist ein unbeschreiblicher Anblick. Hier sind Brücken über die Abgründe gebaut und überall hat’s massive Geländer, auf die man sich verlassen kann. So scheint es jedenfalls.
Das waren spektakuläre View Points. Ein weiterer folgt ein paar Kilometer weiter: „God’s Window“. Von einer Anhöhe aus hat man einen unerhörten Blick auf die unendliche Land- und Graslandschaft. Sie scheint weder Anfang noch Ende zu haben. Man sieht bei den Wäldern genau, welche einheimisch sind und welche nicht - diejenigen, die in engen Reihen gleichmässig angeordnet sind... Nur schade, dass der Himmel nicht blau ist, die Aussicht wäre noch beeindruckender.
Um fünf ungefähr kommen wir in Graskop an. Ein lustiges kleines Städtchen. An einer Hauptstrasse vor allem findet das Wesentliche statt, kleine Curios-Shops, Restaurants, eine Bank und was eben sonst noch so dazu gehört. Das Graskop-Hotel bietet offenbar die einzige passable Unterkunft für Touristen in diesem Ort, also da werden wir die Nacht verbringen. – Nach all den Nächten in den einfachen Unterkünften im Krügerpark und in Eswatini, kommt uns das hübsche Zimmer in diesem gepflegten Hotel wie Luxus vor.
Ich mache vorerst mal einen Rundgang im Städtchen und muss halt schon wieder irgendwas Kleines kaufen, es geht nicht anders. In einem Laden sehe ich eine wunderschöne Maske, aber die passt nun leider wirklich nicht in meinen Koffer. Schade, wirklich schade!
Kurz vor sieben treffe ich die „Boys“, Theo und Rudolf, im Pub gegenüber zum Apéro. Ein Glas Weisswein für mich, und die beiden möchten gerne – wie jeden Abend – einen doppelten Jameson-Whisky. Aber der steht nur auf der Karte, nicht im Gestell. Sie begnügen sich daraufhin mit je einem doppelten Brandy.
Das Nachtessen im Hotel ist fabelhaft, statt nochmals die feine afrikanische Küche zu geniessen, muss Theo unbedingt Pasta haben. Das Gejammer: Er hat seit einer Woche keine Pasta mehr gegessen… Der Chef muss her und wird instruiert, dass Pasta al dente sein muss (wie wenn der das nicht selber wüsste…). Im Angebot stehen Tagliatelle, Penne oder Spaghetti. Letzteres muss es sein. – Ich freue mich über die feine Forelle aus der Gegend.
In der Nacht regnet’s wieder und am Morgen herrscht dichter Nebel wie bei uns im November. 12 Grad! – Oh nein!
Um neun fahren wir los, im Ort gibt’s seit kurzer Zeit einen Lift, der ca. 50 Meter in die Tiefe fährt, bis hinunter ins Canyon. Stolze zwanzig Franken wollen sie für die Benutzung. Da verzichten wir gerne, denn man sieht kaum die Hand vor den Augen. Den Wasserfall, der den Lift - man könnte sagen - nach unten begleitet, den hören wir mehr, als dass wir ihn sehen.
Rudolf kann nur langsam fahren, der Nebel wird immer dichter. Wir fahren den Long Tom Pass hoch und dort beginnt er sich zu lichten. Es ist wunderbar zu sehen, wie der stahlblaue Himmel plötzlich Überhand bekommt. Nun sind die Matten wieder saftig grün, die Temperatur steigt auf 20, später auf 25 und später in Johannesburg sogar wieder auf 28 Grad. Wir erreichen den Freeway und machen gegen ein Uhr Halt in einer ganz speziellen Autobahnraststätte. Auf den ersten Blick hat man das Gefühl, es sei nur eine Tankstelle und vielleicht ein Restaurant. Zwei Restaurants hat’s tatsächlich, einen sehr schönen und grossen Verkaufsladen ebenfalls, aber hinter diesen Gebäuden erstreckt sich ein riesiges eingezäuntes Gelände. Es ist ein Sanctuary für Nashörner. Auch eine ganze Herde von Eland-Antilopen wandern friedlich herum, Strausse auch und ein paar andere Tiere. Lustiges Detail: Vom WC-Karbäuschen aus kann man den Nashörnern zuschauen… Die Raststätte ist bekannt, es hat Hunderte von Besuchern dort.
Rudolf möchte uns seine Verlobte Gerda vorstellen. Wir holen sie ab in Pretoria und fahren gemeinsam nach Kempten Town, wo er für uns ein Zimmer in einem hübschen Guesthouse reserviert hat. Freunde von ihm führen es (Malikana: www.malikanaguesthouse.com/">www.malikanaguesthouse.com/). Man fühlt sich gleich zu Hause. Soukie und Ben sind die perfekten Gastgeber, absolut liebenswürdig. - Uns bleiben zwei Stunden, um unser ganzes Gepäck neu zu organisieren, umzupacken – wir sind völlig geschafft nach Erledigung des vorerst unlösbar geglaubten Jobs. Wir haben einfach viel zu viel bei uns. Den einen Koffer haben wir einen ganzen Monat lang nicht mehr gebraucht, da drin waren die Kleider und Schuhe, die wir im Schiff gebraucht hatten und Geschenke (vor allem für uns).
Soukie kocht für uns eine vorzügliche Lasagne. Dazu gibt’s ein feines weisses Brot, Teigwarensalat (!), gemischten Salat und einen speziellen Randensalat, dessen Rezept sie mit uns teilt. – Ihre Lodge hat elf Zimmer, besteht aus mehreren Parzellen und in einer davon grasen ein paar Hühner und zwei Springböcke. In einem Gemeinschaftsraum steht ein Pool-Tisch, zugedeckt mit zwei Gnu-Fellen, und eine Bar. Die Wände sind geschmückt mit mindestens zwanzig „Trophies“, Köpfen von diversen Antilopen, einem Büffel auch und einem Warzenschwein. – Jägerfamilie… Zu sechst verbringen wir einen vergnüglichen Abend zusammen, unseren letzten.
Am nächsten Tag nach einem ausgiebigen Frühstück bringt uns Rudolf zu Amelia und Jürg Wyss, die wir auf der Schiffsreise kennengelernt haben. Sie haben ein Haus etwas südwestlich von Johannesburg und verbringen normalerweise ihren Sommer – unseren Winter dort. Sie haben uns eingeladen, den Tag mit ihnen zu verbringen.
So gehen wir zu fünft (Amelies Neffe, … der in ihrer Abwesenheit zum Haus schaut, kommt auch mit) in ihrem Pick-Up nach Soweto, aber diesmal nicht dorthin, wo all die Touristen sind, das „erledigten“ wir schon vor drei Jahren, sondern auf den Markt. Dort ist auch ein riesiger Minibusbahnhof, mindestens ein Kilometer lang, der grösste in Afrika. Von dort fahren sie los in alle Richtungen bis rauf nach Malawi. Jürg sagt, er habe noch nie einen Weissen dort gesehen, ausser jetzt grad uns. Er kauft aber das beste Bier dort ein und weiss, wo’s die leckersten Eiscrèmes gibt. Das Cornet für 35 Rappen. – Es ist ein farbiger Markt, Früchte werden verkauft, Kleider und all das Mögliche und Unmögliche, das es auf solchen Märkten zu kaufen gibt. Auch Garküchen gibt’s natürlich, ganze Tierabfälle, Knochen und Schädel, liegen blutig noch am Strassenrand herum. - Chly gruusig!
Zum Teil ist es schmutzig, zum Teil nicht. Männer spielen irgendwelche verbotenen Geldspiele, an jedem dritten Stand kann man sich eine tolle Frisur machen lassen. Theo hätte sich gerne die Haare schneiden lassen, aber ich bin froh, hat er es dann doch nicht dort gewagt.
Nach einer guten Stunde Herumschlendern kehren wir heim, in Wysses schönes Haus und verbringen einen sehr vergnüglichen Nachmittag am und im Pool.
Um fünf gibt’s ein Braai. Jürg grillt feine Filets und Hühnerfleisch, Amelia bereitet Reis mit Sauce zu und drei verschiedene Salate – genug wär’s für eine ganz Kompanie Soldaten. Kurz nach sechs kommt uns Rudolf abholen. Auch er bekommt gleich noch eine Riesenportion vom leckeren Abendessen. Dann ist es endgültig Zeit zu gehen. Wir verabschieden uns herzlich und Rudolf bringt uns zum Flughafen. Auch da halt wieder ein Abschied. Wir hatten eine tolle, gute und auch lustige Zeit zusammen, haben viel gesehen, viel gelacht, viel erlebt.

Reisebericht Malawi – April 2020 (Corona Zeit ab Frühling 2020)
Diese Überschrift ist natürlich ein Witz. Kein lustiger allerdings; die Reise ist ins Wasser beziehungsweise dem Corona-Virus zum Opfer gefallen.
Es ist der dritte April 2020. Schon ein Drittel des Jahres ist vorbei. Kaum vorstellbar, wie rasch die Tage, Wochen und Monate vergehen. Und was für eine Zeit war und ist das – zumindest der März. Nichts läuft mehr, nichts ist mehr, wie es war. Und nun scheint alles stehen zu bleiben. – Leere Städte, niemand mehr auf den Strassen... Wer hätte jemals gedacht, dass so etwas möglich ist?
Corona ist das Zauberwort. – Von Zauber kann jedoch nicht die Rede sein. Horror würde besser passen.
Wenigstens ist „Corona“ ein schönes Wort. Man stelle sich vor, unser unsichtbarer Feind hiesse Schleimpfropfen oder ähnlich und wir müssten den Ausdruck tausendmal am Tag hören...
Und schön sieht das Ding zu allem Elend auch noch aus. Man sieht das Bild in wohl tausend- oder millionenfacher Vergrösserung beim Beginn der Tagesschau, auf den Informationsseiten im Internet, in den Zeitungen, auf Plakaten. - Dass diese kleinen, roten, hübschen Auswüchse, die aussehen wie Verzierungen auf einer Krone, von der das Ding seinen Namen hat, solche Übeltäter, ja Massenmörder sind, ist fast nicht vorstellbar.
Überhaupt, ich weiss ja schon, dass Viren gar nicht als Lebewesen gelten im Gegensatz zu Bakterien, die einen Zellkern haben. Aber müsste man nicht vielleicht über die Bücher gehen und die Definition von Leben neu überdenken? Denn ein so kleines Etwas, das imstande ist, sich bedingungslos verbreiten und fortpflanzen zu lassen, das töten kann, soll nicht lebendig sein? Wie Stein oder Papier oder Glas zum Beispiel... Das geht mir nicht in den Kopf. – Es wird ja auch davon gesprochen, wie lange das Virus auf verschiedenen Materialien „überleben“ kann...
Uns geht’s ja gut; wir sind privilegiert, haben einen schönen, grossen Garten, genug Platz, wir haben Wasser und Nahrung; es mangelt uns an nichts. Wir sind uns dessen auch bewusst und sind dankbar. Diego kauft für uns ein, aber natürlich würde ich sehr gerne selber wiedermal in einem Laden selber auswählen, was wir essen wollen. Seit dem 20. März leben wir zu Hause in Isolation.
Was in den Flüchtlingslagern passieren wird in nächster Zeit, ist nicht auszudenken. Und in all den Slums in Afrika, Asien und anderen Teilen der Welt... Man möchte lieber gar nicht dran denken. – Die Welt wird eine andere sein nach der Krise.
Das Wetter ist wunderbar. Seit Tagen. Die Vögel pfeifen, alles ist wie im Glanzprospekt. Fast ein Hohn. Trotzdem schätz man die schönen Tage. Wäre alles grau in grau, würde wohl manchem erst recht die Decke auf den Kopf fallen. All die Menschen, die in kleinen Wohnungen leben müssen, sind nicht zu beneiden. Am Radio spricht man von häuslicher Gewalt. Aber wir hier in der Schweiz dürfen zumindest noch die Wohnung für einen Spaziergang verlassen im Gegensatz zu Menschen in anderen Ländern, die das nur noch zu gewissen Zeiten tun dürfen oder überhaupt nicht mehr.
Jeden Tag vergleicht man die Zahlen der neu Angesteckten und der Toten. Das Entsetzen wird immer grösser. Am 5. März wurde der erste Todesfall in der Schweiz gemeldet – ein paar Tage später sind es bereits 100.
In kurzer Zeit schnellten die Zahlen in schwindelerregender Geschwindigkeit hinauf. Innerhalb von vier Tagen verdoppelte sich die Zahl der Angesteckten, die das BAG verbreitete, von 4'000 auf mehr als das Doppelte (ab 2. März). – an Ostern (12. April) werden rund 25‘000 Infizierte gemeldet und knapp 1‘000 Todesfälle. Dass hierbei alle diejenigen nicht mitgezählt sind, die nicht getestet sind, also die ganze Dunkelziffer fehlt, stellt auch nicht auf. – Vergleicht man mit der Spanischen Grippe kurz nach dem ersten Weltkrieg, dann sind wir noch in den „Kinderschuhen“, was wenig zum Optimismus beiträgt. Es sollen damals zwischen 25 und 50 Millionen Menschen umgekommen sein, gewisse Quellen gehen sogar von doppelt so vielen Todesfällen aus.
Am 28. Februar erklärte der Bundesrat die „Besondere Lage“; das heisst, er erhielt dadurch mehr Kompetenzen, um Massnahmen, die ihm unerlässlich erschienen, nicht mehr den Kantonen zu überlassen, sondern selbst anzuordnen.
Darunter fiel unter anderem die Verfügung, Anlässe mit mehr als 1000 Personen zu verbieten.
Wenige Tage später wurde die „Ausserordentliche Lage“ ausgerufen. Schulen wurden geschlossen, sämtliche Sportveranstaltungen und auch kulturelle Anlässe abgesagt, Restaurants und die meisten Hotels ebenfalls geschlossen, nur noch Lebensmittelläden durften geöffnet bleiben, „Sociale Distancing“ war angesagt (man darf sich nicht auf mehr als 2 Meter an andere Personen nähern. Höchstens fünf Personen dürfen sich treffen (mit dem gebührenden Abstand natürlich). - Die Landesgrenzen wurden geschlossen (ausser für Nahrungsmittellieferungen und Grenzgänger).
Man wird angehalten, zu Hause zu bleiben. „Bleiben Sie zu Hause“ wird zu einem Mantra, das man x-mal täglich am Radio hört. Wenigstens tönt es aus dem Mund von Bundesrat Berset sehr charmant, muss man sagen. Gelten tut das in erster Linie für die Risikogruppen, wozu die Über-65-Jährigen gehören und alle Menschen mit Vorerkrankungen. Treffen tut es aber die Jungen ganz empfindlich, die sich nicht mehr verabreden können, nicht mehr zusammen „abhängen“; ich hätte es wohl kaum ausgehalten im Teenageralter.
Städte sehen bald darauf aus wie Geisterstädte, kaum mehr Verkehr, menschenleere Parks und Landschaften, alle Geschäfte zu (ausser den Lebensmittelläden), New York mit leeren Strassenschluchten – wer hätte sich das je vorstellen können? – Höchstens in einem Science Fiction Film denkbar, aber da sitzt man ja auf den Sofa und kann den Horror von weitem betrachten, wenn’s gut geht mit Popcorn oder Chips auf dem Schoss.
Während der ersten zwei Wochen hatte ich manchmal einen Gedankenflash, der mir vorgaukelte, ich würde gleich erwachen und merken, dass alles nur ein Albtraum gewesen war. - Dem ist nicht so. Was wir erleben, ist die brutale Wirklichkeit.
Das Jahr 2020 wird eines sein zum Vergessen. Aber ich bin sicher, unsere Enkel werden sich trotzdem noch lange daran erinnern und ihren Kindern später davon erzählen.
Wird sich etwas ändern an unserer exzessiven Lebensweise oder geht’s weiter wie vorher? – Wird sich die viel zitierte und tatsächlich immer grösser werdende Schere zwischen Arm und Reich weiter öffnen oder dämmert die Erkenntnis oder zumindest die Ahnung, dass es so nicht weitergehen kann?
Was genau wird sich ändern? – Das zu erfahren, ist mehr als nur spannend. Man kann höchstens spekulieren, aber eigentlich ist es im Moment noch zu früh, Vermutungen anzustellen. Die könnten gründlich daneben gehen. Was geschieht mit der Wirtschaft? – Was geschieht mit der Psyche der Menschen, die vor dem Konkurs stehen, die sich eingesperrt fühlen, die in den Pflegeheimen und Spitälern keinen Besuch mehr empfangen dürfen? - Das ganze Ausmass der Misere und des Elends aber auch die daraus entstandenen Auswirkungen und Erkenntnisse werden uns erst viel später vor Augen geführt werden.
Bei allem Negativen soll es auch Positives geben. Auch bei einer Pandemie. Alles ist ruhiger geworden, die Erde kann sich vom übermässigen CO2-Ausstoss erholen, Gewässer werden sichtbar klarer, am Himmel hat’s keine Kondensstreifen mehr, Menschen gehen mehr aufeinander zu, man wird bescheidener.
Es bleibt zu hoffen, dass die altbekannte Weisheit, dass das Einzige, was man aus der Geschichte lernen kann, ist, dass man daraus nichts lernt, diesmal nicht zutrifft.
Karfreitag, 10. April 2020
Uns geht’s gut, wie bereits erwähnt. Immer noch. Wir sind jetzt seit drei Wochen in Isolation, beginnen die vierte Woche. Das heisst, wir sind seit dem 19. März, als wir von Bivio heimkamen, nicht mehr einkaufen gewesen, haben keine Freunde und Bekannte mehr gesehen, auswärts essen ist ein No-Go, unsere Kinder und Enkel sehen wir nicht mehr. Höchstens noch am Telefon oder durchs Smartphone auf dem Bildschirm. Da gibt’s wenigstens etwas Lustiges zu berichten:
Ich telefoniere mit der fast siebenjährigen Amy. Sie findet das Homeschooling mit Mama gehe sehr gut. Sie ist ja immer aufgestellt und lacht viel, und wie ihre Mutter Kay mir sagt, lässt sie sich von der jetzigen Situation überhaupt nicht beeindrucken. Dann aber hat sie offenbar irgendwo einen Satz aufgeschnappt, den sie an mir ausprobiert: "Äs isch haut schwierig z verchrafte."
Diego, der nahe bei uns wohnt, geht für uns einkaufen, läutet und stellt die Taschen vor die Tür. Ich zahle ihm per Twint.
Unser Tag ist einerseits nicht sehr strukturiert, wir tun uns keine fixen Zeiten an, andererseits besteht auch wenig Abwechslung. Wir schlafen gerne aus, dann gibt’s irgendwann Frühstück oder eher Brunch, kaum je vor zehn Uhr.
Normalerweise setzte ich mich anschliessend an den PC (Rechnungen bezahlen, Kommunikation mit Freunden und Bekannten aus nah und fern), Telefonate, die kaum je kürzer als eine halbe Stunde dauern.
Ständig ist also PC-und Radio-Zeit – Information über alles, was in der Welt passiert (eigentlich ausser Corona nicht mehr viel). Es ist übrigens schon bemerkenswert, wie nun der kleine, unsichtbare Virus die Menschen und die Medien in seinen Bann gekriegt hat. Soweit ich zurückdenken kann: Welcher Krieg, Unglücksfall, welche Katastrophe, Überschwemmung, Hungersnot, Busch- und Waldbrände, welcher Zunami, Atomunfall, welches Erdbeben, Lawinen- oder Minenunglück, welches Verbrechen an Klima- und Umwelt hatte je solche Medienpräsenz? - Nach spätestens einer Woche ist davon in der Regel nur noch wenig zu lesen und zu hören. Oder immer wieder mal. Aber hier ist das Thema gegeben, endlos und überall.
Man liest und hört täglich und stündlich kaum mehr etwas anderes. Wem hängt’s nach ein paar Wochen noch nicht zum Hals heraus?
Das Wetter ist schön, ein Tag wie der andere. Keine Wolken, nur Sonne, und das seit einem Monat. Also heisst das „Liegestuhl im Garten“. Ein paar Stunden lang am Nachmittag. Lesen (Romane im Ebook, Zeitungen), Radio hören, Sudoku lösen, nie langweilig, aber immer dasselbe.
Ist es einmal doch nicht ganz so schön, schaue ich eine Serie auf dem Laptop oder krame in meiner Rezepte-Sammlung, um neue beziehungsweise alte Rezepte neu aufleben zu lassen.
Hin und wieder machen wir einen Spaziergang durch die Gegend (am Wochenende lassen wir das). Unterwegs begegnet man hier kaum jemandem.
Weil’s Frühling ist, ist die Natur daran, sich selber zu übertreffen mit der Blumen- und Farbenvielfalt. Es ist grossartig.
Auch in unserem Garten, wo wir uns jeden Tag aufhalten, sieht man, wie die Pflanzen wachsten, Blüten aufgehen, die Tulpen schon wieder verwelken, der Rasen voller kleiner Blumen sich zu einem farbigen Teppich entwickelt. So ist es mir noch nie aufgefallen. Und natürlich ist der Gesang der Vögel im Ohr. Unaufhörlich. Auf den drei grossen Birken wohnen zwei Tauben und zwei Krähen. Die Elstern werden verjagt. Unser Kater Larry rennt den Eidechsen nach, was mir nicht besonders gefällt. Ich versuche ihn mit mehr oder weniger Erfolg davon abzuhalten, eine zu erwischen. – Flugzeuge hört und sieht man keine.
Gegen Abend spielen wir Joker oder Gin Rummy zusammen, Theo und ich. Etwa eine Stunde lang. Darauf freue ich mich immer besonders. Theo ärgert sich zwar oft, wenn er nicht gewinnt (ein wenig kindisch, finde ich), aber auch er mag diese gemeinsame Spiel-Stunde sehr. Er hat begonnen, aufzuschreiben, wer in welchem Spiel wie viele Joker hat. Er behauptet nämlich, ich hätte im Schnitt viele mehr.
Es ist dann Zeit, die Küche aufzusuchen. Ich war mir gar nicht mehr gewohnt, so oft zu kochen, ich esse ja normalerweise sehr oft auswärts, nach dem Tennis, beim Kartenspielen, Treffen mit Freunden, Einladungen. – Aber jetzt lese ich wieder meine alten Rezepte durch, suche welche im Internet und schreibe dann den Einkaufszettel für Diego. Manche vergessene Rezepte kommen mir wieder in den Sinn. Eigentlich macht es mir ziemlich Spass, wieder öfter zu kochen. Theo ist mein Casserolier, das heisst, er hat den Job des Küchen-Aufräumens übernommen.
Ein Gutes hat unser Znächtli auch: Wir leeren langsam unseren Weinkeller. Das heisst, wir räumen allmählich mit den Einzelflaschen auf. Wenn wir jeweils Besuch hatten, wurde normalerweise ein neuer Karton geöffnet, was dazu führte, dass oft ein bis zwei Flaschen übrigblieben. So sind wir inzwischen etlichen alkoholischen Gastgeschenken ebenfalls zu einem schönen Teil Meister geworden. Das war langsam auch Zeit: Jahrgänge von 2003 an fand ich im Keller.
Nach dem Essen (auf dem Balkon – wie jeweils im Sommer) sehen wir uns die Tagesschau an, nicht in Echtzeit, sondern ganz praktisch, wann man will, zeitlich unabhängig. Ich erinnere mich an die Dienstagkrimis (Derik zum Beispiel), die ich früher immer schaute, die um fünf nach acht begannen. Pünktlich musste ich damals vor der Kiste sitzen und wehe, jemand wollte mich stören... Heute kann man einen Film auch unterbrechen, was damals in den Achtzigern und Neunzigern noch undenkbar gewesen wäre. – Schöne, neue Welt!
Sehr gerne schaue ich mir im Internet auch die Daily Show von Trevor Noah an. Seine Sicht der Dinge ist absolut amüsant. Laut lachen tut gut. Trump ist sein favorisiertes Objekt des Spotts und das hat der egomane amerikanische Präsident mehr als nur verdient. Es ist ja so einfach, dessen Lügen und lächerlichen Dummheiten aufzuzeigen, er braucht nur Sequenzen aus seinen Reden vorzuspielen, und schon ist alles klar. – Wie es kommt, dass Herr Trump noch immer so viele Fans und Gefolgsleute hat, ist ein Rätsel. – Was ist los mit den Amerikanern?
Ich mag ebenfalls Bill Maher, Seth Meyers und Jimmy Kimmel. Auch auf deren Schirm ist Trump zu finden, und das nicht zu knapp.
Netflix ist ebenfalls ein Thema. Wenn wir einen Film oder eine Serie finden, welche uns beiden gefällt, schauen wir gemeinsam bis manchmal spät in die Nacht.
Also ist unser Tag doch eigentlich strukturiert. Mehr oder weniger jedenfalls.
16. April 2020
Es ist der Tag, an dem der Bundesrat mitteilen wird, wie er sich den Beginn des Ausstiegs aus der Krise vorstellt, welche Regeln gelockert werden sollen, welche Geschäfte vielleicht wieder geöffnet werden können, wie die Zukunft aussehen könnte. – Man ist SEHR gespannt.
Auch in anderen Ländern wird über den „Exit“ gesprochen. Seit drei Tagen sind in Österreich zum Beispiel wieder die Geschäfte offen. Wird es eine zweite Welle von Ansteckungen geben? – Man fragt sich, ob es noch zu früh ist...
Auch bei uns scheint mir, der Bundesrat ist stark unter Druck geraten durch die Kantone, Parteien und Wirtschaftsverbände. Klar wollen alle Lockerungen, die Wirtschaft leidet sehr, viele kleine KMUs kämpfen ums Überleben. Aber ist es nicht zu früh...
17. April 2020
Raphael kann ab dem 26. April wieder in seiner Zahnarztpraxis arbeiten. Was für eine Erleichterung! Auch gewisse Geschäfte (Blumenläden, Gartencenter, Coiffeure) dürfen wieder öffnen. Coiffeure und Sexarbeiterinnen (?) – da ist man ja so nah... Aber ok. Die sind glücklich.
Grundschulen öffnen am 8. Mai, Berufsschulen etc. am 11. Juni (Diego). Also drei Stufen der Öffnung. – Restaurants und Bars, Tennis? – Darüber wurde überhaupt nichts bekanntgegeben. Viele machen die Faust im Sack. Ja, genau das wünscht man sich: wiedermal ausgehen, wiedermal Freunde treffen, nicht selber kochen müssen...
25. April 2020
Fast 29‘000 Personen positiv getestet, 1‘300 Tote sind im Moment zu beklagen. Aber zum Glück flacht die Kurve ab.
Gestern wurde Romeo halbjährig. Schon! Die Familie ist in Bivio und es geht ihnen sehr gut. Sie bleiben voraussichtlich noch eine ganze Zeit lang dort.
Zweimal bereits sind wir mit Kay und den Mädchen spazieren gegangen. Mit Abstand natürlich! – Es ist wunderschön in der Umgebung. Die knall-gelben Rapsfelder sind eine Augenweide. Der Wald ist still – keine Menschenseele zu sehen, nur einen Fuchs sahen wir von weitem in einem der Felder verschwinden.
Immer schönes Wetter, blauer Himmel; es ist wie im Sommer. Aber die Bauern machen sich Sorgen: kein Regen in Sicht.
Auch mit einer meiner Freundinnen, Katharina Seewer, ging ich (mit Abstand) spazieren. Bei dem fantastischen Wetter kann man fast nicht zu Hause bleiben, auch wenn der Garten und die Blumen eine Pracht sind. Mal nicht nur am Telefon mit Freunden zu sprechen, schätze ich nun besonders.
Gestern Abend waren wir bei Diego und Debo zum Nachtessen eingeladen. Auch Gino war dabei. Das erste Mal seit mehr als einem Monat nicht zu Hause essen, sondern im Garten unseres Sohnes und unserer Schwiegertochter. Nicht allein. Es war wunderbar. Habe mich selten so auf ein Essen gefreut. Es war Spitze: feiner Wein und ein absolut leckeres Hohrückensteak vom Grill. Gute Saucen dazu, Salat, frisches Brot vom Beck, Maiskolben, neue Kartoffeln. – Schlaraffenland!
Heute zieht Gino um. Nach Bolligen an die Flugbrunnenstrasse 15, in eine Wohnung meiner Schwester. Er hat Glück gehabt, dass er diese Wohnung beziehen kann. Doris „streicht sich fast die Hälfte des Mitzinses ans Bein“.
(Anmerkung Mitte November: Wir haben im Sommer die Wohnung meiner Schwester abgekauft, damit das nicht mehr der Fall sein muss.)
10. Mai 2020
Schon fast zwei Monate... Uff!
Es „schnäggelet“ langsam aa!
Aber am Freitag waren wir in Worb bei Fräne und Thomas Hauser eingeladen zu einem Apéro Riche im Garten. Urs Keller war auch dabei. Mit dieser Einladung haben sie uns eine Riesenfreude gemacht. Nach tage-und wochenlanger „Freunde-Seh-Abstinenz“ so einen gemütlicher Abend zusammen mit meinen ehemaligen Lehrerkollegen verbringen zu können, geht in die Annalen ein. Einfach schön war’s!
Unserem Schwager Jany geht es nicht gut. Seit zwei Wochen fühlt er sich sehr schwach. Vorgestern wurde er zum zweiten Mal in dieser Zeit ins Spital eingeliefert. Er schaffte die obersten drei Treppenstufen nicht mehr und sogar mit Theos Hilfe konnte er nicht ins Bett gebracht werden. Doris muss eine Lösung finden – es wird nicht einfach werden.
Ab morgen gibt es schweizweite Lockerungen. Judihui!!! - Allerdings ist fast die Hälfte der Bevölkerung nicht ganz sicher, ob all das nicht zu früh kommt. Im Gegenzug gibt es Leute, die trotz Versammlungsverbots gestern auf dem Bundesplatz für die Abschaffungen der engen Vorgaben des Bundes demonstriert haben. – Unbegreiflich!
Ab morgen sind die Grundschulen wieder geöffnet. Auch die Restaurants, die meisten Läden, Schwimmbäder, Fitness-Einrichtungen, Tennisclubs etc. - Ob das gut kommt?
Die Kurve beginnt abzuflachen und auch die Zahl der Angesteckten verringert sich. Hoffentlich bleibt’s dabei. Nochmals so lange „eingesperrt“ zu sein, falls eine zweite Welle kommen sollte, wäre das Allerletzte.
Die Zahlen heute:
Angesteckte: etwas mehr als 30‘000.
Gestorben sind bisher 1‘830 Menschen.
In Amerika sieht es ganz schlimm aus. America first!
1‘310‘000 Angesteckte ungefähr und fast 80‘000 Tote. Viele davon in New York.
Und Herr Trump macht von Tag zu Tag eine dümmere Falle, hat aber noch immer Millionen von Anhängern. Was ist mit denen los?
15. Mai 2020
Acht Wochen hat der Horror bisher gedauert. Seit Montag hat sich ja vieles geändert und doch ist das Virus natürlich bei weitem nicht verschwunden. Es ist noch immer Hauptgespräch und Tagesthema im Radio und im Fernsehen.
Verschwörungstheorien grassieren und nicht wenige wissen alles besser als der Bundesrat und die Gesundheitsexperten.
Stefan Büsser (Kabarettist) hat geschrieben: „Mir ist ein Wissenschaftler lieber, der sich irrt, als ein Irrer, der glaubt, er sei Wissenschaftler“. – Mir geht das genauso.
Nach wie vor bleiben wir vorwiegend zu Hause.
Bisher hatte ich überhaupt keine Lust darauf, etwas aufzuräumen, obwohl es dringend notwendig wäre. Theo hat schon viel Schmutziges geputzt (Balkon, Terrasse, Küchentablare, Böden) und er ist fleissig dabei, seinen unüberschaubaren und unergründlichen Schatz an elektronischem Material, das höchstens je zu etwa 10 % gebraucht worden ist, zu ordnen. Aber ich glaube, was er macht, ist eher, die endlosen Kabel, Stecker, Geräte, ausgedienten Festplatten etc. zu verschieben - geordnet in Plastikbehälter, das schon.
Nun, ich kann nichts sagen, ich hab bisher überhaupt nichts gemacht.
All die fleissigen Menschen, die im Radio erzählen, was sie alles unternehmen, um die Zeit totzuschlagen, Gymnastik zu Hause, tolle Tipps wie man was effizienter putzen kann, singen auf dem Balkon - sind für mich leider keine Motivation. Im Gegenteil. Vor allem die Seelsorgetätigkeit (so nenn ich es zumindest), welche die Moderatoren am Radio täglich zu absolvieren haben, nerven mich ziemlich. Sobald Vreni Meier oder Peter Gerber über ihre Probleme, guten Ratschlägen, ängstlichen Fragen zu plappern beginnen und die ganze Schweiz daran teilhaben lassen, muss ich den Sender wechseln. Schön, dass es am Radio einen Knopf gibt, wo man abschalten oder auf Swiss Pop umschalten kann.
Vor ein paar Tagen jedoch hat mich das schlechte Gewissen gepackt und ich habe damit begonnen, Briefe, Unterlagen aus der Zeit, wo ich noch unterrichtete, Notizen aus der Zeit, wo die Kinder noch zu Hause waren, zig aufbewahrte Zeitungsausschnitte, durchzusehen. Das aber hat seine Tücken. Man kann sich stundenlang damit „vertörlen“ und am Ende sieht niemand, dass etwas erledigt wurde. Zwar hat man so ein paar interessante und lustige Momente verbracht, ist teilweise tief in die Vergangenheit eingetaucht, die Briefe sind sortiert, Massen von alten Grussbotschaften, Geburtstags- und Weihnachtskarten sind im Altpapier gelandet, trotzdem aber gibt es kaum Schubladen, die leer geworden sind.
7. Juni 2020
Locker, locker jetzt. Vor lauter locker bin ich gar nicht mehr zum Schreiben gekommen. Wir sind mit Freunden und Familie schon ein paarmal wieder in Gartenrestaurants auswärts essen gegangen, bereits zweimal hat sich unsere Lesegruppe getroffen, unser Joker-Abend hat stattgefunden, Jassen und Bridge spielen auch. Alles wunderbar. Und sogar Tennis spielen kann ich wieder. Seit zwei Wochen fast täglich. Es gibt ja schliesslich viel auf- oder nachzuholen. Es ist, wie die Entlassung aus dem Gefängnis.
Sogar das Marzili ist seit gestern wieder offen. Wie das mit dem Zählen der Gäste dann genau gehen soll, weiss ich auch nicht. Man kann ja schliesslich auch „reinschwimmen“. Warten wir mal ab. Meine Kabine jedenfalls ist bereits wieder eingerichtet und bezahlt.
Ich freue mich auf den ersten Aareschwumm in diesem Jahr. Ich werde ihn allerdings im Bikini „absolvieren“ und nicht wie Herr Koch im Anzug mit Krawatte und darunter Neopren-Swimsuit.
Wie’s mit Ferien steht, das steht noch in den Sternen. In einer Woche gehen die Grenzen wieder auf; ich hoffe, unsere Spanienferien im Herbst werden möglich sein. Und Laos im Oktober und November?
Immer noch steht die Frage im Raum, wie’s um unsere Herbstferien steht.
Antworten auf diese Fragen weiss ich nun; heute ist nämlich der 10. Oktober 2020.
Unsere „Schweiz-Herbst-Flucht-Ferien nach Asien“ können wir vergessen. In fünf Tagen würden wir unsere Reise beginnen. Das Kofferpacken bleibt uns erspart. Man muss ja alles positiv sehen.
Der Sommer war eine Freude vom Wetter her, trotzdem nicht ganz so wie eh und je – Abstand war gefragt, Hände Schütteln, Umarmungen und Küssen musste man vergessen. Aber wie bereits erwähnt, gingen wir nun mehr oder weniger gelassen unseren üblichen Beschäftigungen nach, besuchten und luden wieder Freunde ein, sogar ein Besuch in der Fondation Beyeler lag drin (Edward-Hopper-Ausstellung). Das war anfangs September. In dem Zusammenhang übernachteten wir in Weil und unsere neuen Bekannten, Trudi und Fredy aus Basel, die wir vor knapp einem Jahr auf der Kreuzfahrt nach Südafrika kennengelernt hatten, luden uns dort zum Nachtessen ein. – Schön war das!
Und natürlich waren das Marzili und die Aare wieder zu meiner zweiten Heimat geworden.
Ja, und kurz nach der Lockerung im Juni entschieden wir uns, Kim, Javi und die beiden Buben in Bivio zu besuchen. Sie wohnten ja dort seit Dezember 19, wollten nach der Skisaison heim nach London gehen, aber wegen der Corona-Geschichte zogen sie es vor, im kleinen Dorf zu bleiben.
Mir kam in den Sinn, nachdem ich am Fernsehen ein Gespräch (Grädig direkt) mit Andrea Caminada gehört hatte, dass wir von unseren Töchtern noch einen Gutschein für ein Nachtessen im Schloss Schauenstein hatten. Seit gut sieben Jahren war ich in dessen Besitz. An meinem 60sten Geburtstag hatte ich die ganze Familie ins Allgäu eingeladen für ein Wellness-Tennis- und Schlemmer-Wochenende. Oft vergisst man ja solche Gutscheine, aber nun erinnerte ich mich. Thusis ist auf dem Weg nach Bivio, also...
Als ich Kim von meinen Plänen berichtete, war sie Feuer und Flamme und sie organisierte alles, dass auch sie und Javi mit dabei sein konnten. Es kam dazu, dass der 17. Juni ihr dritter Hochzeitstag war. – Alles klappte aufs Beste, wir hatten einen einmalig schönen Abend mit einem sensationellen Dinner, das zwar teuer, aber seinen Preis wert war. Unglaublich, was für eine vortreffliche, innovative und kreative Küche wir kennenlernen durften. Ein Schmaus für Auge, Gaumen und Magen.
Wir übernachteten dort und am nächsten Tag, einem prächtig sonnigen Spätfrühlingstag, nach einem feinen Frühstück und bevor wir weiter nach Bivio fuhren, machten wir einen Ausflug an ein paar Orte unterwegs, die wir bisher noch nie besucht hatten; normalerweise wollen wir ja so rasch als möglich Bivio erreichen: zwei Schluchten, Viamala- und Roffla-Schlucht und ein Zvieri in Juf, im Averstal, dem höchsten Dorf in Europa (2126 m ü M.).
(Einschub am 19. November 20: Unser Aufenthalt im Hause Caminada hatte unerwartete, aber sehr erfreuliche Auswirkungen. - Anderthalb Monate später liess und Kim wissen, dass sie schwanger war. Zum dritten Mal. Was für eine Freude! – Nach einem Arztbesuch in Chur im Mai hatte man ihr nämlich mitgeteilt, dass sie mit 90%-iger Chance nicht mehr schwanger werden könne. Und nun wissen wir, dass sie ein Mädchen erwartet, ein Schwesterchen für die beiden Buben. – Manchmal meint es das Leben über gut mit einem.
Und noch etwas Lustiges: Als Kim ihrer Schwester davon erzählte, sagte Kay, ihre Amy sei ebenfalls bei einem Besuch im Schloss Schauenstein „entstanden“).
Ob wir nach Spanien reisen würden, war lange Zeit ein grosses Fragezeichen, erhöhte sich doch die Ansteckungszahlen mehr und mehr. Inzwischen gab es vom BAG eine Liste mit Risikogebieten, das heisst, Länder und Regionen, aus denen man sich bei der Heimkehr zehn Tage lang in Quarantäne begeben muss. – Nun, wir sind pensioniert, müssen also nicht mehr arbeiten und waren ja schon anfangs Jahr zwei Monate lang an den Lockdown gewöhnt; wir beschlossen also, uns das Vergnügen, den Sommer in Rosas zu verlängern, nicht nehmen zu lassen.
Schön waren unsere Strandferien am Meer! – Man hätte sich fast Mühe geben müssen, sich anstecken zu lassen. Von den Freunden, die normalerweise dort sind, kam niemand. Nur mit Webers, die eine Ferienwohnung in einer nahe gelegenen Siedlung haben, sind wir ein paarmal essen gegangen und haben uns am Strand getroffen. Sonst hatte es keine Schweizer und Deutsche, so wie das sonst üblich ist. Spanier und Franzosen nur, und das vor allem an den Wochenenden.
Auf der Heimreise übernachteten wir zweimal im Château de Candie, in Chambéry, einer Gegend, die nach Definition nicht zu den Risikogebieten gehört. So wurden uns diese beiden Tage von der 10-tägigen Quarantäne abgezogen. – Kaum zu Hause, hab ich uns brav beim Kantonsarztamt angemeldet und brav haben wir uns strikte an die Vorgaben gehalten. Wieder ging Diego für uns einkaufen, keinen Schritt machten wir vor die Haustüre - Garten natürlich schon. Die acht Tage waren rasch vorbei und schon konnten wir wieder auswärts essen gehen, ich konnte Tennis und Karten spielen, Freunde sehen... Aber nicht lange. Bereits stiegen die Zahlen der Ansteckungen und der Spitaleintritte wieder und das BAG und der Bundesrat warnten, dass der Beginn der zweiten Welle drohe.
29. Oktober 2020
Genauso ist es nun. Die Zahlen sind erschreckend hoch. Viel höher als im Frühling. Gegen 10'000 Fälle pro Tag – in der Schweiz schlimmer als in den umliegenden Ländern. Das hat zur Folge, dass die lange Liste der Länder, aus denen man, wenn man von dort heimkommt, in Quarantäne gehen muss, auf nur noch vier geschrumpft ist.
Eine erweiterte Maskenpflicht ist nun auch in Läden (im ÖV schon lange), Restaurants (bis man sitzt) und in öffentlichen Gebäuden befohlen. Fitnesszentren, Schwimmbäder, Tanklokale und Clubs sind wieder geschlossen, Bars und Restaurants zwar noch offen, aber schlecht besucht; man hat nun wirklich Angst, angesteckt zu werden. Draussen kann man ja nicht mehr zu Abend essen, es ist zu kalt. Drastische Einschränkungen für öffentliche und private Veranstaltungen sind angeordnet. Die Kantone haben zum Teil noch striktere Massnahmen verfügt als der Bundesrat. Das passt nicht allen. – Eigentlich ist es ähnlich wie der Lockdown im Frühling und wieder hat es Menschen, die gegen die Regeln protestieren und demonstrieren, die keine Masken anziehen wollen, die auf „Selbstverantwortung“ setzen, was auch immer sie darunter verstehen.
Wir hatten ein Familientreffen vereinbart an einem Samstagabend Ende Oktober, aber daraus wurde nichts. Wir wären dreizehn Personen gewesen, das geht nun gar nicht mehr. Die Ansteckungen finden offenbar vorwiegend in den Familien statt.
Auch meine Schwester und meinen Schwager sehen wir kaum noch, laden sie nicht mehr zu uns ein. Jany, er ist bereits 92-jährig, geht es sowieso nicht gut; er war inzwischen im Spital, hatte eine OP am Herzen, kann seitdem allerdings wieder ein wenig besser atmen. Da er sich nur wenig bewegt, wird er sich trotzdem kaum erholen können, die Treppe kann er nicht mehr hoch, er schläft jetzt auf einem Notbett im Wohnzimmer. Auch essen die beiden fast nichts, und wenn, dann höchstens etwas aus einer Büchse, ein Stück Brot, mal ein Joghurt, Gemüse und Früchte sind tabu. Doris hat sich ja zeitlebens geweigert zu kochen, sie scheint noch immer eine Art „stolz“ zu sein auf diese Weigerung. Wenn ich ihr mal was mitgeben will, winkt sie jeweils ab. Es ist zum Verzweifeln. Gute Ratschläge sind nicht erwünscht, ich sag lieber nichts mehr. Reizwörter sind für sie beispielsweise: Kochen, Computer, Smartphone, E-Banking und Ähnliches in dieser Art.
Kim, Javi und die beiden Buben sind seit Mitte Oktober zurück aus Bivio und wohnen bei uns in Ittigen. Kim ist ja schwanger und sehr vorsichtig, möchte sich auf keinen Fall anstecken. Sie will auch ihre Geschwister nicht mehr sehen oder nur kurz im Garten mit ihnen plaudern. - Traurig ist das alles.
Kim möchte ihr Kind in London auf die Welt bringen, so wie die andern. Nun hat die Familie Angst, keinen Flug zurück nach London zu bekommen; ein Lockdown in England droht bald erneut stattzufinden und dann wird auch kein Flugverkehr mehr stattfinden. – So entschlossen sie sich bereits am Montag, dem 2. November, uns zu verlassen. Drei Tage später war der Lockdown in London Tatsache. Ihre 2-wöchige Quarantäne ging dabei in dieser Ausgangssperre quasi unter. Einen Tag vor der Abreise bereitete ich unser traditionelles Weihnachtsessen zu, eine Bernerplatte. Kim hatte sich dies gewünscht, weil es ja kaum ein Familientreffen geben wird am 24sten.
Inzwischen hat sich neben Corona auch ein zweites Thema in den Medien durchgesetzt: die Wahlen in den USA. – Was dort abläuft, ist unterste Schublade. Trump wird paranoider mit jedem Tag und das Schlimmste: Er stachelt seine Anhänger, die ihm ungefiltert alles glauben, an, die dümmsten und gefährlichsten Aussagen zu machen. Sie benehmen sich wie im Kindergarten, Massenhysterie, Gehirnwäsche – solche Begriffe kommen mir in dem Zusammenhang in den Sinn. Er versteht es, das Volk zu spalten und aufzuwiegeln, es sind nicht mehr die „vereinigten“ Staaten, von denen man spricht, es sind zwei feindliche Lager. Er nennt sie „Patrioten“ und die Art und Weise, wie er von seinen Gegenspielern spricht, ist respektlos, eines Präsidenten nicht würdig. – Was für ein seltsames Licht wirft das Verhalten dieses Menschen auf diese Nation?! – Er habe sich mit dem Virus angesteckt, hiess es vor ein paar Wochen. Eine grosse Show wurde abgezogen, nach drei Tagen war er geheilt. – Wer’s glaubt... „Ein von Gott Gesandter“ war in manchen Kommentaren zu lesen.
Wir schauen oft CNN und BBC, was man dort sieht und hört, macht einen sprachlos. Wir hoffen, dass er gehen muss, aber das scheint im Moment noch ziemlich offen.
8. November 2020
Was war das für ein Wahlkrimi! – Unglaublich und einzigartig! Aber Biden hat’s geschafft. Gestern kurz vor 18 Uhr wurde er als Sieger der Schlammschlacht ausgerufen. Was für eine Erleichterung!
Trump, der nun „töipelet“ und sich benimmt wie Rumpelstilzchen, kann - wer hätte es nicht so erwartet – Biden nicht zur Wahl gratulieren. Das lässt sein übersteigertes Ego nie und nimmer zu. Im Gegenteil. Er hat schon eine Reihe von Anwälten losgeschickt, die Wahlvergehen aufdecken sollen. Ohne jegliche Beweise spricht er schon längst davon, dass es massiven Wahlbetrug gebe und gegeben habe - zu seinen Ungunsten natürlich. Falls es so weit kommt, dass irgendwo nachgezählt wird, könnt ich mir vorstellen, dass mindestens ebenso viele „falsche“ Wahlzettel von seinen Fans gefunden werden könnten.
Erschreckend einfach, wie viele Anhänger ihn gewählt haben. Das wirft ein seltsames Licht auf die Amerikaner. Vermutlich lesen sie nur seine Tweets, in denen er nun ständig davon spricht, die Demokraten hätten ihm den Sieg gestohlen. – Vermutlich lesen sie die Gegendarstellungen in all den anderen Medien (sogar Fox-News) nicht, die keinen Zweifel an Bidens Sieg lassen und die Gerichte zitieren, welche nirgends den geringsten Wahlbetrug aufgedeckt haben.
Selber hat er sich schon am 3. November, am effektiven Wahltag, als Sieger ausgerufen und gefordert, man solle die Stimmenzählungen abbrechen. Die Briefwahl hat er schon seit Wochen verteufelt. – Mal sehen, wie weit er kommt und was noch alles auf uns (die Amerikaner, die Welt) zukommt in den nächsten zwei Monaten, bis der neue Präsident vereidigt wird. - Ich hoffe, es wird keine Toten geben. Mir kommt es im Moment vor wie die Ruhe vor dem Sturm.
Sonntag, 15. November 2020
Corona:
Die Zahlen in der Schweiz haben ein kleines bisschen abgenommen, es gibt noch rund 7‘000 Ansteckungen pro Tag, aber vor allem in der Romandie klagen die Spitäler über Personal- und Spitalbettenmangel.
Für die Pflegerinnen und Pfleger wird die Situation langsam aber sicher untragbar. Zwar wurden sie von den Balkonen aus beklatscht bei der ersten Welle und man zollte ihnen die gebührende Anerkennung, aber danach geschah so gut wie nichts, um ihre Lage zu verbessern. Lange Arbeitstage fast ohne Pausen, physische und psychische Herausforderungen und zum Dank ein kleiner Lohn, so sieht es aus. – Kein Wunder, dass viele von ihnen den Beruf vorzeitig verlassen. Es bleibt zu hoffen, dass sich diesbezüglich bald etwas ändert.
Unmut in der Bevölkerung macht sich breit. Der Bundesrat wird kritisiert, das BAG und die Corona Task Force des Bundes ebenso. Viele Anordnungen werden nicht verstanden, in den Kantonen gelten unterschiedliche Regeln (z. B. sind in Basel Stadt die Restaurants sowie die Sportzentren geschlossen, in Basel Land nicht. So fahren die Basler ein paar Kilometer weiter, um dort zu Abend zu essen oder Tennis zu spielen. – Wer will ihnen das verdenken? – Aber das passt nicht allen. Logisch, gibt es Kontroversen. In den Berner Gassen hört man vermehrt Französisch; die Romands haben den Röstigraben übersprungen. - Der Kantönligeist lässt grüssen.
Das Virus hat es also zustande gebracht, auch hier die Bevölkerung zu spalten in Leute, die gegen die strikten Regeln sind und solche, die einen zweiten Lockdown verordnet haben möchten.
Manchmal lese ich die Kommentare in den Social Media. Da könnten einem die Haare zu Berge stehen, was man da steht. Jeder Depp kann seine ungefilterte Meinung sagen beziehungsweise schreiben, manchmal kommt man vor lauter Fehlern gar nicht nach, was eigentlich gemeint ist. Orthographie ist kein Thema und je trostloser das Geschriebene daherkommt, desto primitiver die Aussage. – Ich schäme mich fremd.
In den USA (330 Mio. Einwohner) gibt es im Moment 185‘000 Ansteckungen täglich, 244‘000 Menschen sind bereits an der Pandemie gestorben. – Trump wischt die Gefährlichkeit des Virus nach wie vor unter den Tisch. Und immer noch anerkennt er Bidens Sieg nicht. Seine Anwälte haben bisher nichts ausrichten können, er versucht es mit neuen Ränkespielen. Inzwischen haben gestern Tausende seiner Anhänger in Washington für eine weitere Amtsperiode von vier Jahren demonstriert. Die Interviews lassen einem die Haare zu Berge stehen. Von „Ich habe die Waffen schon dabei“ zu „Was ist das für ein Sumpf – die Lügen der Demokraten sollen endlich ans Licht kommen“ zu „Ich liebe Trump; er ist der Einzige, der die Wahrheit sagt“ und so weiter.
Gerade lese ich (Bericht einer amerikanischen Pflegerin), dass es Menschen gibt, die am Sterben und nach wie vor Corona-Leugner sind. Sie seien überzeugt, sie würden an einer anderen Krankheit leiden. Der Virus sei „not true“. – Hat man da noch Worte?

Schlussbemerkung
Das Puzzle ist noch nicht zu Ende. Das Bild erkennt man zwar, aber es gibt noch etliche offene Stellen.
Inzwischen sind wir älter geworden. Das sieht man gut daran, dass unsere Kinder auch bereits um die Vierzig sind und sich das Gespräch bei Einladungen mit Freunden mindestens eine Stunde lang nur um Krankheiten dreht, obwohl alle sagen, darüber möchten sie sicher nicht berichten.
Auch bei mir haben schon gewisse Ersatzteile montiert werden müssen. Im rechten Fuss halten ein paar Nägel und eine kleine Metallplatte meine Knochen zusammen. Auch bin ich Besitzerin eines neuen Kniegelenks. Aber trotzdem beziehungsweise gerade deswegen kann ich fast wieder herumspringen wie ein junges Reh.
„In der Kürze liegt die Würze“ – das ist mir mit dem Rückblick auf mein Leben überhaupt nicht gelungen. Aber schliesslich bin ich ja bereits siebenundsechzig Jahre alt, da hat man halt einiges schon erlebt, obwohl, wie Udo Jürgens uns wissen liess, mit 66 das Leben erst anfängt. - Es wird sich zeigen...
Wir haben und hatten also bisher ein formidables, erfülltes und überaus glückliches Leben. Unserer ganzen Familie geht es gut und das Wichtigste: alle sind gesund und auch Corona ist es bisher nicht gelungen, uns anzustecken.
Ich denke oft, unsere Generation hat die absolut beste Epoche in der vergangenen aber auch in der kommenden Weltgeschichte „erwischt“. Und in der Schweiz geboren zu sein, einem Land, wo Frieden und Freiheit herrscht, auch als Frau tun und lassen zu können, was man gerne möchte, gesund zu sein, weiss zu sein, keinen Krieg erlebt zu haben, keine Not, welcher Art auch immer, erleiden zu müssen, sich alles Erdenkliche leisten zu können, das sind Privilegien, die auf dieser Erde nicht überall gang und gäbe sind und die man nicht genug schätzen kann.
Es werden noch mehr Reisen folgen, wir hoffen es jedenfalls. So lange wir „zwäg“ sind, sind wir unterwegs und neugierig darauf, andere Menschen und Lebensarten kennenzulernen, fantastische Landschaften zu besuchen, Neues zu sehen und zu erleben. - In dem Sinn:
Carpe Diem.