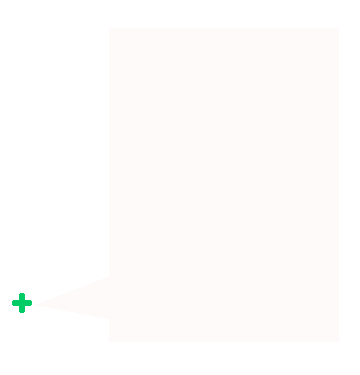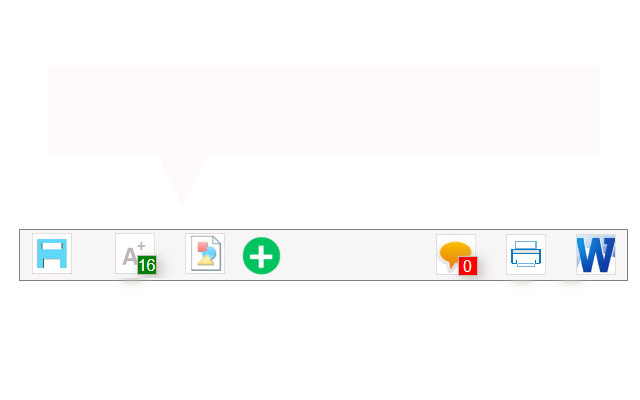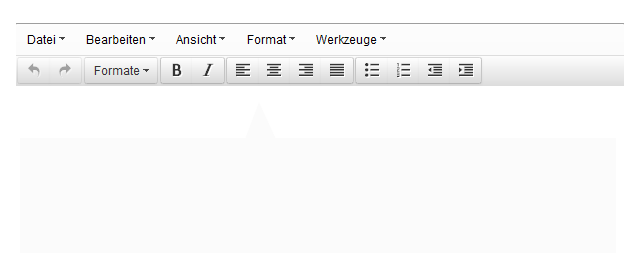Zurzeit sind 552 Biographien in Arbeit und davon 313 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 191


Geboren wurde ich am 28. Februar 1942 in Gettnau LU. Ich erblickte zuhause das Licht der Welt. Schon 8 Jahre vorher war meine Schwester geboren worden, und 15 Monate vor meiner Geburt kam mein Bruder zur Welt. Meine Eltern wussten also, was vorzukehren war: Hebamme anrufen – sie kam aus dem Nachbardorf mit ihrem Roller Lambretta – heisses Wasser aufbrühen, Tücher bereithalten und was es halt sonst noch zu einer Geburt zuhause brauchte. So erblickte ich um die Mittagszeit das Licht der Welt. Die Geburt verlief, soweit ich weiss, reibungslos, ja für meine Mutter und die Hebamme war es scheinbar schon fast Routine. Einen Namen hatten meine Eltern bereits bestimmt: Heinrich Anton. Mein Götti hiess Anton, also gleich wie der Bruder meiner Mutter. 
(1)
Die Hebamme kam zu meiner Geburt mit der Lambretta angebraust


Wenn ich mich vorstellte, musste ich später immer wieder hören: "Dä Heiri hätt äs Chalb verchauft", in Anlehnung an die Kleine Niederdorfoper. Jeder meinte dann, es haue mich vom Stängeli wegen dieses Witzes. Aber wenn man das über Jahre hinweg immer wieder hört, ist es nicht mehr besonders lustig.
Wenn jemand meinen Namen "Heinrich" liest, kann es sein, dass er den Spruch fallen lässt: "Heinrich mir grauts vor dir". zu sagen. Je nachdem, wen ich vor mir habe, antworte ich dann: "Mir auch, aber vor dir." Dieses Zitat stammt aus Goethes Tragödie Faust, 1. Teil. In der Kerkerszene widersteht Gretchen der Versuchung, mit Fausts und Mephistos Hilfe zu entfliehen und damit ihrer Hinrichtung zu entgehen. Sie will so ihre Schuld büssen und wendet sich von Faust mit den Worten ab: "Heinrich! Mir grauts vor dir."
Auch dies finde ich inzwischen nicht mehr so originell. Aber man gewöhnt sich daran. Oft ist es im Laufe meines Lebens schon passiert, dass Leute, vor allem Deutsche, gesagt haben: "Bei uns heisst das Heinz, oder Heini". Und weigerten sich "Heiri" zu sagen. Es gibt zwei, drei Menschen, die mich spontan "Henry" nennen mit der Begründung, dieser Name passe besser zu mir. Das ist mir inzwischen egal.

(1)
Das Familienwappen Zihlmann

Mein Vater, Jahrgang 1888, wurde auf einem Bauernhof als jüngstes von 5 Kindern in Hergiswil LU geboren. Auf diesem Hof, auf dem ich in meiner Primarschulzeit in den Herbstferien jeweils das Vieh hütete, gab es noch Gegenstände, die aus Napoleons Zeiten stammten. Beispielsweise hing an der Wand in der Stube noch ein langer Säbel aus dem Napoleon-Krieg. Auch viele Redensarten aus dieser Zeit wurden immer noch verwendet. Ein "Näppel" (Napoleon) war eine 20er Note. Bei einer Verletzung sagten meine Vorfahren "blessiert" (= verletzt).
Aber zurück zu meinem Vater. Zusammen mit seinem ältesten Bruder, Jahrgang 1877 und seiner Schwester kaufte er Anfang der 1930er Jahre ein grosses Haus mit viel Umschwung in Gettnau LU. Der Quadratmeterpreis betrug 2 Franken. Auch 3 verschiedene Parzellen Wald gehörten dazu. Das Anwesen bestand aus mehreren Gebäuden, und ein Lebensmittelladen und ein Magazin mit Landesprodukten waren vorhanden. Er heiratete erst mit 45 Jahren Louise Ambühl aus Ohmstal. Sie war 19 Jahre jünger. Zusammen hatten sie 7 Kinder (ich war der Drittälteste). Mein Vater war ziemlich introvertiert und etwas "dünnhäutig". Als Folge davon war ein Magengeschwür. Er ging deswegen nicht zum Arzt. Eine 2wöchige Kur zuhause im Bett – ausschliesslich mit Fruchtsäften aus rohen Kartoffeln, Karotten und Randen – liessen ihn wieder gesunden. Er litt zeitlebens mehr oder weniger an Asthma, aber er trank nie Alkohol und war Nichtraucher. Gerne wäre er Kirchenrat geworden. Aber man wählte ihn in stattdessen in die Schulpflege (Schulrat). Das passte ihm gar nicht. Er nahm an keiner Sitzung teil. Nach einer Weile ging einfach meine Mutter, obwohl nicht gewählt, als erste Frau in der Geschichte des Dorfes, in diese Behörde. Das wurde allgemein akzeptiert. Nach den abendlichen Abwesenheiten meiner Mutter war er eine Zeitlang wortkarg. Sonst aber war er sehr fürsorglich und hat uns Kinder nie geschlagen, was zu dieser Zeit nicht selbstverständlich war. Mein Vater erahnte spontane und nicht spontanen Phänomene, die mit "normalem" Empfinden nicht erklärbar sind. Vor allem spürte er Todesfälle in seinem Umfeld vielfach voraus. An einem Sonntag sagte er zu mir: "Komm, wir besuchen meinen drittältesten Bruder, deinen Onkel Josef." Wir hatten den Kontakt zu ihm jahrelang verloren. Mit dem Velo fuhren wir in das 8 km entfernte Hergiswil. Dort angekommen, wunderte sich der Onkel über unseren unerwarteten Besuch. 2 Tage später starb er plötzlich. Hatte mein Vater dessen Tod vorausgeahnt? Ein weiteres Phänomen war der Umstand, dass unser Familienoberhaupt keine Uhr am Handgelenk tragen konnte, das heisst, tragen konnte er Armbanduhren, aber sie blieben einfach stehen. Egal, ob es mechanische oder automatische Zeitmesser waren.
Es war sein Wunsch, dass einer seiner 4 Söhne das Geschäft übernehmen würde. Alle vier besuchten die Mittelschule, heute Kantonsschule Willisau, die 3 Mädchen die Sekundarschule. Seine Söhne hatten kein Geschäftsinteresse: der erste studierte Theologie, der zweite (ich) lernte Schriftsetzer, der dritte machte das KV, wollte aber nicht ins väterlichen Geschäft einsteigen, und der vierte machte eine Lehre als Flexograf. Auf dem zweiten Bildungsweg wurde er später Lehrer. So verkaufte unser Vater mit 74 Jahren das Geschäft und baute ein Einfamilienhaus. Leider konnte er nur noch 3 Jahre den Ruhestand geniessen. Er war sehr stolz, dass er 1966 die Priesterweihe und Primiz seines ältesten Sohnes erleben durfte. Sein Erstgeborener war es dann auch, der die Beerdigung und Trauerfeier abhielt.Meine Mutter
Meine Mutter, Jahrgang 1917, wuchs zusammenm mit 4 Brüdern und 2 Schwestern auf einem Bauernhof in Ohmstal LU auf. Da sie nach der Geburt scheinbar leblos war und nicht mehr atmete, schob man den Kinderwagen in den Gang hinaus und dachte, sie sei gestorben. Doch kurz darauf hörten die Eltern ein Wimmern, der Säugling lebte doch und erholte sich rasch. Nach der Primarschule in Ohmstal besuchte sie die Sekundarschule im benachbarten Schötz. Nachher trat sie in das das von Baldegger-Schwestern geführte Mädcheninstitut in Hertenstein ein. Nach verschiedenen Arbeitsstellen heiratete sie mit 26 Jahren den 19 Jahre älteren Alois. Die Hochzeitsreise führte sie nach Rom, und 9 Monate später kam meine älteste Schwester zur Welt. Es sollte dann 6 Jahre dauern bis im Jahresabstand 4 Knaben und 2 Mädchen geboren wurden. Meine Mutter war sehr extravertiert. Sei es als Geschäfts- oder Hausfrau, überall fand sie schnell Kontakt. Den Altersunterschied zu ihrem Ehegatten merkte man allerdings schon. Immerhin trennte sie fast eine Generation. Uns Kindern war sie eine fürsorgliche Erzieherin. In der Schulzeit waren wir manchmal ihre Verbündete, wenn der Vater allzu altmodische Ansichten vertrat oder wenn es um finanzielle oder schulische Belange ging. Ausser dem Amt als Schulrätin wurde sie auch Präsidentin des Müttervereins. Diese Aktivitäten der Mutter führten in der Ehe zu Spannungen. Die Mutter litt darunter. Da die Einkommensverhältnisse alles andere als rosig waren, musste die Mutter sehr haushälterisch umgehen. Aber sie fand immer einen Weg, dass wir ordentlich gekleidet waren und wir trotz manchmal kargen Mahlzeiten nicht hungern mussten.
Wir schätzten es auch sehr, dass sie uns altersgerechte Märchen vorlas. Sie war auch darauf bedacht, dass wir täglich beteten, sei es vor dem Essen oder dass wir regelmässig in die Gottesdienste gingen. Wir Buben wurden auch Messdiener (die Mädchen waren damals von diesem Amt ausgeschlossen). Im allgemeinen waren unsere Eltern sehr fürsorglich. Keiner von uns wurde geschlagen oder erhielt je eine Ohrfeige. Damals waren körperliche Züchtigungen noch gang und gäbe.
Nach einem geplatzten Blinddarm schwebte sie in Lebensgefahr, die Ärzte hatten sie schon aufgegeben. Doch wie ein Wunder überstand sie den Eingriff. – Nach der fünften Niederkunft, es war eine Frühgeburt im 7. Monat im Spital, riet man ihr dringend von einer weiteren Schwangerschaft ab. Es könnten ernsthafte Komplikationen auftreten. Wenige Monate später kündigte sich wieder ein Baby an. Mit Gottvertrauen meisterte sie auch diesmal die 9 Monate und sah von einem Spitalaufenthalt ab. Es gab wieder eine Hausgeburt, ein von der ältesten Schwester sehnlichst erwartetes Mädchen. Die Geburt verlief ohne Komplikationen. Als Baby wurde sie einige Wochen später, eingebettet in eine Zaine (Wäschekorb), oben auf dem Kachelofen plaziert und schlief selig ein. Unsere Tante heizte von der Küche aus kräftig ein. Sie wusste ja nicht, dass in der Zaine das Kind schlief. Irgendwann wurde es oben auf dem Kachelofen sehr heiss, und bis das Baby zu weinen begann, hatte es schon Verbrennungen. Natürlich wurden Sofortmassnahmen ergriffen um das schreiende, von Schmerzen geplagte Kind zu pflegen. Statt einen Arzt zu rufen, bat man den Pfarrer ins Haus, der für eine Heilung betete. Und tatsächlich heilten die Wunden bald. Die jüngste Schwester war 1949 ein "Nachzügerli", ebenfalls zuhause geboren. Zu diesem Zeitpunkt war die Mutter 42jährig, der Vater schon 61.
Nach der Geburt der jüngsten Tochter begann meine Mutter zu rauchen. Mehrmals am Tag zog sie sich in den Garten zurück. Dort, von Gebüschen umgeben, von aussen unsichtbar, rauchte sie Zigaretten. Wir Buben – ich war damals 7jährig – standen Schmiere, denn der Vater durfte das keinesfalls sehen. Nach knapp 3 Monaten hatte sie plötzlich keine Lust mehr auf Raucherwaren. Des Rätsels Lösung: eine reiche Kirschenernte war schuld daran. Irgendwie hatte sie einen Mangel, der durch das Kirschenessen scheinbar behoben wurde. Von diesem Zeitpunkt an wurde sie wieder Nichtraucherin.
Auto besassen meine Eltern keines. Aber weil für meine Mutter Verwandtenbesuche oder Besorgungen im Städtchen Willisau manchmal etwas mühsam waren, kaufte sie sich ein Velosolex, also quasi ein Velo mit Motorantrieb. Vor allem im Winter war es eine Herausforderung, dieses Vehikel mit dem schweren Motor auf schneebedeckten Strassen zu meistern.
(1)
Das Velosolex – damals ein geniales Fortbewegungsmittel


(1)
Luftbild des Gebäudekomplexes, in dem ich aufgewachsen bin
Ich wuchs im elterlichen Haus in Gettnau, einer kleinen Gemeinde des Luzerner Hinterlandes auf.
Ich konnte mit 18 Monaten noch nicht laufen. Ich kroch nur auf allen Vieren. Es stellte sich heraus, dass ich zu weiche Knochen hatte. Die Diagnose: Rachitis, das heisst, ein akuter Vitamin D-Mangel. In den Kriegsjahren war die Ernährung sehr einseitig. Meinen Eltern muss ich es aber hoch anrechnen, dass sie alles unternahmen, diesen Mangel zu beheben. So fuhr mich meine Mutter mehrmals mit dem Velo nach Willisau. Ich wurde dort mit einer Höhensonne „bestrahlt“. Die Wirkung liess nicht lange auf sich warten. Schon bald konnte ich endlich lazfen.
In den 40er-, 50er- und 60er Jahren gab es oftmals sehr kalte Winter. Wochenlange Minustemperaturen bis zu 20 Grad waren keine Seltenheit. Meistens hatten wir nur Schuhe mit einer Holzsohle. Wir kleideten sie mit Zeitungspapier aus. Trotzdem kämpfte ich im Vorschulalter mit Frostbeulen (Gfrörni). Die Zehen schmerzten, vor allem die kleinen Zehen waren wund fast bis auf die Knochen. Als „Therapie“ musste ich mich jeweils barfuss für einige Minuten in den Schnee begeben. Wenn ich danach in die Küche kam, schoss das Blut in die Zehen, und es fühlte sich an wie tausend Nadelstiche. Ein wenig half diese Prozedur, aber erst eine Spezialsalbe aus der Apotheke linderte die Schmerzen. Mit der Zeit besserte sich dieses Leiden gottseidank.
Zum Frühstück gab es jeweils alternierend Hafersuppe mit einem Stück Brot oder Kartoffelrösti. Nur am Sonntag erhielten wir 2 Brotschnitten, durften aber lediglich Margarine oder Konfitüre draufstreichen. So belegten wir das eine mit Margarine, das andere mit Konfitüre. Damit hatten wir ein Sandwich. Da wir eine Zeitlang auch 2-3 Ziegen hatten, mussten wir deren Milch trinken, obwohl sie uns gar nicht schmeckte. Halbe-halbe mit Kuhmilch war sie dann einigermassen geniessbar.
Auf der Oberfläche der Kuhmilch, die im Keller gekühlt wurde, bildete sich eine Rahmschicht. Diese
wurde in ein Buttergefäss mit Handkurbel abgefüllt.
(2)
Je nach Rahmtemperatur des Rahms musste man 5 bis 15 Minuten kurbeln bis daraus Butter entstand.
In den Schlafzimmern gab es keine Heizung. Eine warme Bettflasche aus Blech oder Gummi erwärmte in den strengen Wintern das eiskalte Bett. Wir Buben hatten kein eigenes Bett. Mein älterer Bruder und ich teilten uns eines, die beiden jüngeren Brüder schliefen in einem anderen Bett. Zusammen waren wir zu viert in einem Zimmer. Als einer von uns die Masern bekam, waren die andern 3 schon bald ebenfalls knallrot. In den kalten Wintern bildeten sich an den Fenstern Eisblumen. 
(3)
Wir konnten uns dann auch nicht waschen, da das Wasser im Waschbecken ebenfalls gefroren war. Der Nachttopf war unser nächtlicher Begleiter.
Unser Haus wies noch 3 weitere, aber nur teilweise beheizbare Kachelöfen auf. Es gab lediglich in der Küche einen Kaltwasseranschluss. Selbst die Topflappen am Herd waren jeweils am Morgen gefroren. Gebadet wurde einmal in der Woche, samstags, in einem Zuber in der Küche: zuerst die Mädchen und nach und nach wir Buben. Die Toilette war ausserhalb des Hauses, ein primitives Klumpsklo. Wir lebten also sehr einfach, hatten aber dafür viel Auslauf und Freiraum.An einem schwülheissen Sommertag im Jahre 1950 zog ein heftiges Gewitter auf. Die Kirchenglocken läuteten Sturm. Meine Mutter zündete eine Kerze an, und wir beteten Es begann zu hageln, und ein Grossteil der Ziegel zersplitterte. Da das Haus kein Unterdach hatte, regnete es in den Estrich hinein. Es dauerte einige Tage bis die Reparaturen ausgeführt waren, denn wir waren ja nicht die einzigen Geschädigten.

In der Küche gab es nur einen Kaltwasseranschluss. Der Kochherd war sehr primitiv: 2 Kochplatten und 1 Wasserbehälter mussten reichen. Eingefeuert wurde mit Holz, und je nach Wetterlage wollte es manchmal nur schwer brennen. Der Backofen verdiente seinen Namen nicht, denn wirklich backen konnte man darin kaum etwas. Bestenfalls diente er zum Speisen warm halten. Die Küche war im Winter kalt. Die Temperatur fiel nachts manchmal unter null Grad, selbst die Topflappen am Herd waren jeweils am Morgen gefroren. Vor Weihnachten stellte meine Mutter Lebkuchen und Birnenweggen her, das heisst, sie machte sie backfertig. Die nahegelegene Bäckerei buk dann diese Köstlichkeiten. Für uns war es immer ein vorzügliche kulinarische Abwechslung, aber leider nur für kurze Zeit, denn wegen der Vielzahl an Essern waren die Köstlichkeiten bald vertilgt.

(1)
Primitiver Kochherd mit Holzfeuerung

Unsere Stube diente auch als Vaters Büro. Auf einem Schreibtisch war sogar eine Schreibmaschine vorhanden, und zwar eine, bei der man mit einem Zeiger den gewünschten Buchstaben anwählte und dann diesen per Tastendruck aufs Papier tippte. Eine langsame, aber für uns Kinder beeindruckende Tätigkeit. Gerne tippten wir darauf, wenn es die Eltern nicht merkten.
(1)
Buchstaben anwählen und Taste hinunterdrücken, langsam und mühselig
An der Wand hing ein schwarzes Telefon, eines der wenigen, welche es in unserem Dorf damals gab. So kamen auch viele Ladenbesucher – auch sonntags – in unsere gute Stube um zu telefonieren. Ganz am Anfang, so erzählte unser Vater, hatte er die Telefonnummer 6. Mit der Wahlscheibe konnte man das Postbüro unseres Dorfes anrufen und die gewünschte Nummer mitteilen. Die Posthalterin stöpselte dann die gewünschteVerbindung. Da sie neugierig war, hörte sie die Gespräche via Kopfhörer meistens mit. 
(2)
Das Wandtelefon, die Verbindung zur Aussenwelt

Als ich einmal allein den Laden hütete, kam ein Knecht herein und wünschte ein Paket Tabak für seine Pfeife, und zwar einen leichten. Ich nahm ein Paket Tabak und legte es auf die Waage. "Das meinte ich nicht", erwiderte er und schmunzelte. Wir einigten uns dann auf den "Sämi"-Tabak.

(1)
Der "leichte" Sämi-Pfeifentabak
Angegliedert an den Laden war auch ein grosses Gebäude, das Magazin, mit Landesprodukten. Dort verkaufte mein Vater den Bauern Stroh, Mehl, Saatgut, Saatkartoffeln und Dünger. Die Bauern der weiteren und näheren Umgebung kamen mit dem Fuhrwerk und holten die Ware ab. Traktoren gab es nur wenige, Benzin war knapp. Es gab Autos und Traktoren mit Holzvergaser. An einen solchen kann ich mich noch gut erinnern. Es war so um 1948 herum, als ein Landwirt mit einem rauchenden Traktor bei uns vorfuhr. Es war ein Traktor mit Holzvergaser, das heisst, unten im Zylinder wurde mit Holz eingeheizt. Diese Gefährt faszinierte mich, denn ich hatte noch nie sowas gesehen.
(2)
Alter Traktor mit Holzvergaser
Mein Vater handelte im Herbst auch mit Obst, kaufte an und verkaufte dieses. Äpfel und Birnen landeten in der Obstpresse. Der Most wurde sterilisiert und in grosse Korbflaschen abgefüllt. Dadurch war dieser längere Zeit haltbar. Der Vater kaufte aus Frankreich grosse gebrauchte Cognac-Fässer. Cognac reift ausschließlich in neuen, noch nicht benutzten Fässern, die speziell dafür hergestellt wurden. Nach deren Benutzung dienten sie als Obsttrester-Fässer. Sie beinhalteten bis zu tausend Litern und wurden in Eisenbahnwagen angeliefert. Der anfallende Obsttrester landete in diesen Fässern. Wir Knaben krochen oben hinein und stampften mit nackten Füssen den Trester. Unter Anleitung des Vaters restaurierten wir diejenigen Fässer, die wie verkaufen wollten. Wir Buben schliffen die Fassreifen ab und strichen sie mit schwarzer Farbe an. Die Gebinde sahen danach recht ordentlich aus und wurden an die Bauern weiterverkauft.

(3)
Schnapsbrennerei
Hin und wieder kam der Schnapsbrenner für einige Tage auf die Stör und brannte den Obsttrester. Den Schnaps verkauften wir im Laden. Wenn jemand diese Spirituose kaufen wollte, vermied er das Wort "Schnaps" und verlangte nach "Weihwasser". Denn der Verkauf war nicht ganz legal.
Da meine Eltern auch Waldbesitzer waren, wurde Holz nicht nur zum Heizen geschlagen, sondern auch als sogenanntes Papierholz aufbereitet. Wir Buben mussten die Tannen abrinden und mit einer grossen Säge auf einen Meter Länge zuschneiden. Bahnwagenweise wurde das Holz in die Papierfabriken verschickt.
Unser Vater erzählte uns, dass er im Jahre 1944 zwei internierte Italiener beschäftigte. Das waren günstige Tagelöhner. Vor allem wurden sie im Wald beschäftigt. Sie fällten Tannen und sägten sie zu Brennholz. Schöne Tannen wurden zu Brettern und sonstigem Bauholz aufbereitet. Beim ersten Mal zeigte mein Vater, welche Sie umzulegen hatten. Als er am Abend im Wald ankam, staunte er nicht schlecht: die schönsten Tannen waren auf einer Höhe von etwa 1,5 Metern abgesägt worden. Die cleveren Migranten hatten die Stämme bequem stehend abgeschnitten, statt sie bodeneben zu sägen. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Und der Schaden war sehr gross, war doch das schöne Holz für die Dorfsägerei vorgesehen. 
(4)
Mit einer solchen Säge wurden Tannen umgesägt und "Papierholz" zugeschnitten

Witterten die Ratten eine Gefahr, verschwanden sie schnell in Löchern, Zwischenräumen oder hinter Strohballen. Wir Kinder ekelten uns von diesen Tieren mit ihren langen Schwänzen und flinken Beinen. Es kam auch schon mal vor, dass sich unsere Katzen einen Kampf mit den Nagetieren lieferten und verloren. Sie zogen sich dann zurück. Oft waren sie verletzt. Aber mit Katzen ging man nicht zum Tierarzt, es gab ja so viele herumstreunende Büsis. Kastrationen kannte man nicht, das wäre zu teuer gewesen Deshalb vermehrten sie sich und bekamen im Mai und im August ständig Nachwuchs, wobei die Meinung vorherrschte, dass sich nur Maikätzchen widerstandsfähig sind.
Der Dorfbach floss unter dem Vorplatz unseres Hauses vorbei. Lediglich ein Teil des Baches zwischen unserem und Nachbars Haus war nicht in Röhren gelegt, also frei einsichtbar. Hin und wieder habe ich darin Wasserratten entdeckt, für mich ebenso eklig, flink und unheimlich. Noch heute bekomme ich Gänsehaut beim Anblick solcher Tiere. Auch Mäuse, die es ja überall gibt, rufen bei mir Ekel hervor, ich habe eine Ratten- und Mäusephobie.

(1)
Wurden zu einer richtigen Plage: Hausratten

Gegenüber unserem Haus war die Dorfkäserei. Die Bauern brachten die Milch teilweise mit dem Pferd und einem Zweiradwagen. Andere spannten den Hund vor den Milchkarren. Eines Tages scheute ein Pferd und brannte durch, quer über die Strasse direkt in unseren Brunnen und verfing sich schwer verletzt im Lebhag dahinter. Man musste es notschlachten. Der Brunnen war derart beschädigt, dass er ganz abgebrochen werden und durch einen neuen ersetzt werden musste. Kurz zuvor stand ich vor dem Brunnen und planschte im Wasser. Nicht auszudenken, wenn das Pferd mich getroffen hätte. Dieses Ereignis, ich war mit einigen Metern Abstand Augenzeuge, beschäftigte mich noch lange.

(1)
So in etwa sah der Brunnen auf unserem Hausplatz aus
Es kam auch vor, dass der Bauer oberhalb der Brunnenstube Jauche ausführte und das Wasser deshalb verseucht war. Man musste dann das Wasser abkochen, aber wir haben es irgendwie überlebt. Keimfrei war es jedenfalls kaum. Als etwa 5jähriger hatte ich ständig Hunger, der einfach nicht zu stillen war. Meine Mutter vermutete, ich hätte vielleicht Würmer. In der Apotheke erhielt kaufte sie ein Entwurmungsmittel, und ich wurde dann schnell "wurmfrei".
Schon in früher Kindheit war ich sehr neugierig. Alles, was mir in die Finger kam, wollte ich ausprobieren, wenn nötig im Mund testen, zerbrechen, verbiegen oder – falls für mich wertvoll – verstecken. Als mir eine Stricknadel in die Hände kam, steckte ich sie in eine 220-V-Steckdose. Der Stromschlag schleuderte mich zu Boden. Ob ich einen Kurzschluss ausgelöst habe, weiss ich nicht mehr, aber der Schreck sass mir noch tagelang in den Knochen. Ich trug, soweit man feststellen konnte, keine bleibenden Schäden davon, aber ab diesem Zeitpunkt hatte ich grossen Respekt vor dem „Elektrischen“. Hinter dem Haus gab es auch eine 380-Volt-Steckdose. Die Holzfräse brauchte Starkstrom, um das Holz zu zersägen, damit es in der Küche zum Kochen und Heizen in den Kochherd passte.

(2)
Mit ihr wurde das Holz zugeschnitten, das fürs Kochen und Heizen nötig war


(1)
So in etwa hat mein "Gefängnis" ausgesehen: Ein Kachelofen mit Türchen
Ein anderes Erlebnis blieb mir bis heute in Erinnerung. Streichhölzer faszinierten mich schon sehr früh (einen Kindergarten gab es damals in unserem Dorf nicht, man ging als Siebenjähriger gleich in die erste Klasse). Wie gesagt, das Spiel mit der Flamme zog mich unwiderstehlich an. Ich spielte zusammen mit meinem jüngeren Bruder mit Zündhölzern im Schuppen. Wir testeten, ob Stroh leicht entflammbar sei. In der Tat, es fing schnell an zu brennen. Natürlich erschraken wir sehr. Zum Glück kam unser Vater noch rechtzeitig dazu und konnte es ersticken. Es setzte ein gewaltiges Donnerwetter ab. Sofort nahm er die Streichholzschachtel in sichere Verwahrung. Wieso wir den Brand gelegt haben? Wir hatten gehört, dass die Versicherung bei Brandschäden bezahlen würde. Und da der Vater oft davon gesprochen hatte, dass wir zu wenig Geld hätten für die vielen Rechnungen, die ins Haus flatterten, könnte ja ein Geldsegen der Versicherung nicht schaden.

Traditionsgemäss feierte man auch in unserem Dorf den 1. August. Dazu gehörten natürlich Raketen. Wir führten in unserem Laden auch welche. Normalerweise steckte man sie in eine Flasche, bevor man sie entzündete. Aber ein Nachbarsbub streckte meinem älteren, etwa 6jährigem Bruder, eine in die Hand und entzündete sie. Mein Bruder umklammerte sie fest und liess sie nicht los. Der Feuerschleif und ein ohrenbetäubender Knall waren die Folge. Zum Glück trug er weder Verbrennungen noch einen Gehörschaden davon.
Auch Fackeln gehörten zu einer 1.-August-Feier. Da kam mir – ich glaube, ich war knapp sieben Jahre alt – die Idee, Rohrkolbenschilf zu beschaffen. Wenn man es zuvor eine Woche lang in einem mit Petrol gefüllten Blechkübel mit dem Kolben nach unten hineinstellte, saugten sie das Petroleum auf und würden dann stundenlang brennen. Ich hatte gehört, dass solches Schilf im Sumpfgebiet des Fabrikweihers, etwa zwei Kilometer ausserhalb des Dorfes, wächst.
(1)
Die Objekte unserer Begierde: Rohrkolben
Zusammen machten sich mein jüngerer Bruder und ich, bewaffnet mit einem Messer, auf den Weg. Noch nie hatten wir es gewagt, ohne Begleitung von zuhause so weit weg zu gehen. Wir sagten niemandem was und marschierten ans Ufer des besagten Weihers. Natürlich wuchs das schönste Schilf im sumpfigen Gelände. Schon bald sanken wir im schlammigen Boden ein. Immer schwerer war der Gang, und immer tiefer sanken wir ein. Mein Bruder – er war gut ein Jahr jünger als ich – sank bald knietief in den Schlamm. Ich versuchte ihn herauszuziehen. Aber das war leichter gesagt als getan. Nun sank auch ich ein, konnte mich aber doch irgendwie wieder befreien. Mein Begleiter sank tiefer und tiefer. Schon bald stak er bis zur Hüfte im Schlamm. Zum Glück sah ich ein, dass ich Hilfe brauchte. Ich sprach ihm zu, er solle sich möglichst nicht bewegen, er werde sicher bald gerettet. Völlig verdreckt rannte ich nach Hause und schilderte meinem Vater was geschehen war. Ich sagte, mein Bruder sei im Fabrikweiher. Natürlich dachte er, dass mein kleiner Bruder im Wasser ertrunken sei. Zusammen mit einigen Helfern, bewaffnet mit Stangen und Leitern, machte man sich schleunigst auf den Weg. Zum Glück fand ich die „Unglücksstelle“ wieder. Der arme Knabe war inzwischen noch weiter hinabgesunken. Nur die beiden Arme verhinderten, dass er ganz versank. Mit Hilfe der Leitern und tatkräftigem Anpacken konnte man den Unglücksraben befreien. Wir hatten einen Schutzengel, denn wenn auch ich tiefer eingesunken wäre, dann hätte uns der Schlamm wahrscheinlich auf Nimmerwiedersehen verschluckt. Schreien hätte auch nichts genützt, denn weit und breit war keine Menschenseele, die uns gehört hätte. Wir wären wohl auf Nimmerwiedersehen untergetaucht, und niemand hätte gewusst, wo man die Ausreisser finden könnte. Noch heute schaudert es mich bei diesem Gedanken.


(1)
Nachbars Huhn in Geiselhaft: täglich ein Ei


(1)
Das alte Schulhaus in Gettnau LU
Unser Schulhaus hatte 6 Klassenzimmer und eine Turnhalle. Zuunterst, hinten im Gang, gab es eine Türe, die stets verschlossen war. Über der Türe stand "Dusche". Was bedeutete das? In all den Jahren blieb sie immer verschlossen. Wahrscheinlich wurde sie nie benützt. Im Erdgeschoss gab es eine kleine Turnhalle, die aber nur bei schlechtem Wetter benützt wurde, sonst fanden die Turnstunden im Freien statt. Fast jedes Jahr war die Turnhalle während 3 Wochen durch WK-Soldaten belegt. Die Halle, ausgestattet mit Stroh, diente den Wehrmännern als Schlafstätte. Bei Regen fielen dann halt unsere die Turnstunden aus. Auch hatte das Schulhaus Sonnenstoren. Diese aber funktionierten längst nicht mehr. Heute gibt es doch einen geflügelten Satz: "Hattest du in der Schule einen Fensterplatz?", wenn einer in gewissen Fächern nicht sattelfest ist. Vielleicht hat er ja auch ein wenig zuviel Sonne erwischt.
Während eines eines Gottesdienstes, den ich in der 1. Klasse besuchte, habe ich mal geschwatzt, den Nachbarbuben geboxt (der natürlich zurückboxte), aber nur während des Orgelspiels. Denn ich wusste, dass unser Lehrer als Organist oben auf der Empore seines Amtes waltete. In der Schule rief er mich dann nach vorne, und zur Strafe musste ich im Schulzimmer in der Ecke niederknien. Wie lange, das weiss ich nicht mehr. Jedenfalls kam es mir sehr lange vor. Was mich aber erstaunte, wieso wusste der Lehrer, dass ich mich ungebührlich aufgeführt hatte?! Nur während des Orgelspiels war ich unartig. Des Rätsels Lösung: an der Orgel war ein Rückspiegel befestigt. So sah der Organist jederzeit, was sich unten in den Bänken abspielte. Aber erst ein paar Monate später, als ich mir die Orgel mal anschaute, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich stand mit dem Unterstufenlehrer ohnehin des öftern auf Kriegsfuss, denn ich fühlte mich von ihm ungerecht behandelt. Beispielsweise, als ich mal einen Schluckauf „Hitzgi“ hatte. Er schimpfte mich, ich solle sofort aufhören damit, ich störe den Unterricht. Aber je mehr ich mich bemühte, ruhig zu sein, desto häufiger gluckste ich. Der Lehrer schickte mich vor die Türe mit der Bemerkung, ich könne dann wieder reinkommen, wenn ich ruhig sei. Später – bei einer Klassenzusammenkunft – habe ich ihm das damalige Erlebnis vorgehalten, an das er sich natürlich nicht mehr erinnern konnte.
In unserer Klasse gab es einen Schüler, der schwachbegabt war. Vor allem das Lesen und Schreiben machte ihm grosse Mühe. Trotz aller Anstrengungen des Lehrers, ihm das Lesen und Schreiben beizubringen: Buchstaben waren für diesen Schüler ein Buch mit sieben Siegeln. Statt Lesbares zu schreiben, kritzelte er undefinierbare Zeichen ins Heft. Der Lehrer konnte das Gekritzel nicht entziffern, wollte aber den Schüler nicht entmutigen und fragte ihn. „Was heisst das?“ „Channsch jo läse“, antwortete der erstaunte Schreiber. Er verstand die Welt nicht mehr. Ein Lehrer, der nicht mal lesen konnte?!
Viel besser gefiel es mir dann in der 3. und 4. Klasse bei einem andern Lehrer. Der akzeptierte mich so, wie ich war. Bei ihm lernte ich fleissig. Ich glaube, dass ich der einzige war, der in den 2 Schuljahren bei ihm keine Ohrfeige oder "Tatze" bekam. Dieser Lehrer war auch sehr begabt im Zeichnen und Malen. So gestaltete er einige grosse Plakate für unsere Schaufenster-Dekoration. In der der 3. Klasse hatte ich in den Hauptfächern eine Zeugnisdurchschnittsnote von 6,0, das Jahr darauf 5,8.
Bei diesem Lehrer durften wir auch mit Lehm modellieren. Unter seiner kundigen Anleitung entstanden Aschenbecher, kleine Blumenvasen und Figürchen verschiedenster Art. Zum Brennen brachte er sie in die Ziegelei ausserhalb unseres Dorfes. Dort kamen sie, zusammen mit den Ziegeln, in einen riesigen Brennofen. Dieser wurde dann zugemauert. Nach etwa 2 Tagen und bei einer Hitze von über 1000 Grad wurde die Mauer aufgebrochen. Gross war dann jeweils die Spannung und Freude wenn wir die gebrannten Ton-Kunstwerke in Empfang nehmen konnten. Wir durften sie dann bunt bemalen und glasieren.

(2) Darauf war ich stolz: Alles Sechser in den Hauptfächern

Meine älteste Schwester war eine Zeitlang im Laden als Verkäuferin tätig. So kam sie mit vielen Kunden in Kontakt. Von einem Ladenbesucher erfuhr sie, dass er ein Grammophon besass. Es war ein Gerät, das man mit einer Handkurbel aufziehen musste. Der Ton von 78-Touren-Schallplatten kam via Nadel über einen Trichter. Da meine Schwester von irgendwem einen Englisch-Schallplattenkurs bekommen hatte, fragte sie, ob der Kunde ihr diesen eine Zeitlang leihen könne. Aber der Vater durfte nichts davon wissen, denn er hätte dies sicher als Zeitverschwendung empfunden. So brachte sie sich klammheimlich in ihrem Zimmer einige Grundkenntnisse der englischen Sprache bei. (In der Sekundarschule gab es damals kein Englisch- sondern nur das Französischfach). Uns Buben weihte sie in das Geheimnis ein, und wir waren von diesem Wundergerät fasziniert. Irgendwie kamen wir in den Besitz einer Ländler-Musikscheibe und hörten das Musikstück immer und immer wieder. Später erwarben wir dann ein Tonbandgerät, mit dem man aus dem Radio beliebige Musikstücke herunterladen und aufnehmen konnte. Und noch etwas später kam der Walkman auf, mit dem man sogar über ein Mikrophon unsere Stimmen aufnehmen und Sprache und Musik über einen Kopfhörer mobil Musik hören konnte.
(1)
Ab 78-Touren-Grammophonplatten gab's Musik und sogar einen Englischkurs

Ab der dritten Klasse durfte man in der Bibliothek jeweils am schulfreien Donnerstagnachmittag Bücher aussuchen. Dazu muss man wissen, dass sich die Bibliothek im Pfarrhaus befand. Und kein geringerer als der Pfarrer himself beurteilte, welche Literatur altersgemäss für die Schüler „richtig“ war. Ich benötigte manchmal zwei Bücher. So teilte er mir immer ein religiös gefärbtes Buch zu. Dazu durfte ich auch ein neutrales, beispielsweise ein Sachbuch, einen Krimi oder sonst eine Abenteuerliteratur auswählen. Ein Buch ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. An einem regnerischen Sonntag zog ich mich nach dem Gottesdienst zuhause auf den oberen Teil des Kachelofens zurück und las „Trotzli der Lausbub“, ein altersgerechtes Jugendbuch, 150 Seiten stark. Also verschlang ich es, nur unterbrochen durch das Mittagessen. Bis zum Nachtessen hatte ich es fertig gelesen.
Es gab damals noch kein Fernsehen, geschweige denn Handys oder Tablets. Da waren die Bücher ein wertvoller Begleiter in der Freizeit und regten die Fantasie an. Auch "SJW"- Heftchen (Schweizerische Jugendschriftenwerk) gab es damals. Wir durften alle Jahre eines über die Lehrer bestellen. Natürlich tauschten wir sie untereinander aus.

(1)
Eines meiner ersten Bücher aus der Bibliothek
Als ich älter war interessierte mich auch anspruchsvollere Literatur querbeet: Gottfried Keller, Conrad Ferdinand Meyer, Jeremias Gotthelf, Wilhelm Busch, Carl Zuckmayer, Leo Tolstoi, Johann Wolfgang von Goethe um nur einige zu nennen. Irgendwann kaufte ich mir ein Aufklärungsbuch, da wir weder in der Schule noch zuhause aufgeklärt wurden.
Meines Wissens erschien Ende der 50er Jahre die Jugendzeitschrift "Bravo". Sie behandelte allgemeine Jugendthemen und vor allem auch die Sexualität und leistete so grosse Aufklärungsarbeit. Unser Pfarrer wetterte gegen diese"Schundhefte". Als Respektsperson mischte er sich in alle Belange der Dorfbevölkerung ein. Früher oder später waren wir dann doch aufgeklärt, aber zuhause war es kein Thema.

Ein Ereignis, das ich selber miterlebt habe, blieb mir bis heute haften: Da wollte ein Kunde im Bäckersladen Mehl kaufen. Dieses befand sich aber in einem Regal das die Bäckersfrau nicht erreichen konnte. Deshalb nahm sie einen 5-Kilo-4-Frucht-Konfitüre-Kessel und stand mit einem Bein darauf, um das Mehl-Paket herunterzuholen. Das gelang ihr zwar, aber der Deckel des Kessels gab nach. Der Schuh brach ein, so dass er und ein Teil des Unterschenkels eine klebrige Masse abbekam. Deckel drauf, ein wenig zurecht gebogen, war die Konfitüre wieder verkaufsbereit.
Unsere Dorfstrasse war Teil des Strassennetzes Luzern-Bern. Es gab ja noch keine Autobahnen und sehr wenig Verkehr. Im Winter, wenn sich Eis auf der Fahrbahn gebildet hatte, konnten wir darauf Schlittschuhlaufen. Und den wenigen Autos wichen wir halt aus.
An einem Sommer-Sonntagnachmittag nahm ein Sohn des Bäckers das grosse Portemonnaie, das fürs Brotaustragen diente, band eine Schnur daran fest und legte es auf die Strasse. Wir versteckten uns hinter einem Gebüsch und harrten der Dinge, die da kommen sollten. Tatsächlich näherte sich schon bald ein Auto mit Berner Kennzeichen, der Fahrer stoppte vor dem Geldbeutel und stieg aus. Er bückte sich. In diesem Moment wollte der Bäckersjunge an der Schnur ziehen und das Portemonnaie zurückziehen. Aber der Berner war schneller, stampfte mit dem Schuh darauf, und die Schnur riss. Vonwegen langsame Berner! Er stieg ins Auto und brauste davon. Für den Bäckerjunior setzte es eine Tracht Prügel ab, denn der Geldsäckel war ein täglich benutzter lederner und daher wertvoller Gebrauchsgegenstand, der bei der täglichen Tour beim Brotaustragen gebraucht wurde.

(1)
Geldsäckel für die Brottour

Da unser Haus 4 Kachelöfen hatte, war der Kamin entsprechend gross. Ich konnte bequem darauf sitzen und liegen. Vom Estrich aus gelang ich jeweils über die Mansarde auf das Dach. Der Kamin war hin und wieder mein bevorzugter Lieblingsort, wenn ich allein sein wollte. Hier störte mich niemand, und die Eltern konnten mich nicht finden. Es entstanden einige Aufsätze, sitzend oder liegend auf dem Kamin. Zwar waren meine Kleider dann ein wenig verrusst, aber das war mir egal. Hauptsache, ich war ungestört und konnte schreiben und träumen. Manchmal braucht man einen Rückzugsort. Dass es gerade das Hausdach war, könnte vielleicht gefährlich wirken. Aber bei nassem Wetter ging ich natürlich nicht aufs Dach. Turnschuhe wären von Vorteil gewesen, aber das hatten wir nicht. Am besten gings barfuss.
(1)
Auf einem solchen Kamin konnte ich sitzen und liegend schreiben
Mit einem Schulkollegen – ich glaube es war im Jahr 1953 – schlenderte ich einmal die Dorfstrasse hinauf. Trottoirs gab es noch keine, und so wich man an den Strassenrand aus, wenn halt mal ein Auto daherkam. Und diesmal kam eines, nein sogar zwei. Das vordere Auto wollte nach links abbiegen, denn es hatte den Zeiger ausgeschwenkt. Blinker gab es damals noch nicht. Man musste im Auto bei einer Richtungsänderung der Zeiger von Hand betätigen.

(2)
Die Autos hatten Zeiger statt Blinker
Also, das hintere Auto setzte zum Überholen an, dann krachte es. Der Fahrer des vorderen Autos fragte uns, ob wir gesehen haben, dass er nach links abbiegen wolle. Wir bejahten. Er bat uns, vor Gericht als Augenzeugen aufzutreten, denn er zeigte den fehlbaren Autofahrer an. Einige Zeit später mussten wir unsere Aussagen bezeugen und erhielten einen Zeugenlohn von einigen Franken. Wir fanden, das war leicht verdientes Geld.

Viel später, in der Kantonsschule mussten wir im Musikunterricht die verschiedenen Tonleitern lernen. Auch hier war ich völlig unbegabt. Ich schrieb mir die Tonleitern auf den rechten Zeigefinger, und wenn ich an der Wandtafeln beispielsweise die C-Dur-Tonleiter aufschreiben musste, konnte ich sie bequem ablesen. Die halbe Klasse wusste es, aber der Musiklehrer hat es nicht bemerkt. Wenn wir ein Lied singen mussten, bei dem beispielsweise der Rektor oder Inspektor anwesend waren hiess es, ich solle bitte nicht mitsingen, sondern nur so tun als ob, also den Mund lautlos bewege. Das war schon in der Primarschule so. In der Kirche habe ich trotzdem mal lauthals mitgesungen und mir dabei beide Ohren zugehalten. Am Schluss des Liedes war ich es dann, der die 2 letzten Töne herauspresste, als das Lied bereits zu Ende war. Natürlich lief ich rot an, als mich alle anstarrten.

(1)

Da in unserem Haus nur in der Küche ein Kaltwasseranschluss und ein Steintrog vorhanden waren, wurde lediglich die Handwäsche dort erledigt. Zweimal im Jahr gabs dann eine Grosswäsche mit heissem oder warmem Wasser. Dazu musste am Brunnen vor dem Haus eine Kaltwasserleitung angeschlossen werden. Die Leitung bestand aus mehreren 2 Meter langen Röhren, die ineinander geschraubt und das Wasser zu einem Schuppen geführt wurde. In einem mit Holz befeuerbaren Waschherd wusch man Leintücher, sonstige Bett- und Unterwäsche und Kleider. Mühsam wurde die Wäsche von Hand ausgewunden und dann auf einem gespannten Seil im Freien aufgehängt. Dieses führte von Baum zu Baum, dazwischen mit Stickeln gestützt (Holzträger). Wenn die Sonne schien, trocknete die Wäsche gut, aber falls es regnete, und das kam öfters vor, blieb sie hängen bis es trockeneres Wetter gab. Wetterprognosen gab es zu dieser Zeit höchstens für einen Tag. Da schaute man eher auf Bauernweisheiten und Naturereignisse. Unglücklicherweise kam es hin und wieder vor, dass ein Bauer in der der Nähe Jauche ausführte, was dem Frischgewaschenen nicht unbedingt zuträglich war.
(1)
In einer solchen "Waschmaschine" wurde die Kochwäsche gewaschen.


(1)
Alles, was ein Schwein hergibt: Hausmetzgete

Auch die 2 Franken, die ich beim Kartoffelauflesen im Herbst bei einem Bauern pro Tag erhielt, vertraute ich meinem Kässeli an. Wenn dieses dann einen genug grossen Inhalt Münzen beherbergte, ging ich zur Kantonalbank, allwo der Bankbeamte das Kässeli öffnete, genau zählte und den entsprechenden Betrag handschriftlich ins Sparbüchlein eintrug.


(1)
Was damals ein 5er-Mocken war, kostet heute 20 Rappen
Eine weitere Möglichkeit, etwas Geld zu verdienen, bot sich durch das Einfangen von Maikäfern, und zwar wie folgt: In den 50er Jahren gab es alle paar Jahre eine Maikäferplage. Die gefrässigen Tiere richteten vor allem an den Bäumen grosse Schäden an. Später werden daraus Engerlinge, die vor allem die Wurzeln von Pflanzen fressen und in grosser Zahl ganze Wiesen vernichten. Mit etwas Geschick konnte man sie leicht fangen. Einer meiner Mitschüler besserte sein Taschengeld damit auf, indem er den lebendigen Maikäfern den Hinterteil abbiss. Aber nur wer bereit war, ihm 10 Rappen zu zahlen, durfte dabei zuschauen.
(2)
Unsere Gemeinde setzten eine „Kopfprämie“ für das Einsammeln dieser Insekten aus. Millionenfach traten die Plaggeister auf und überfielen die Laubbäume, die bald blattlos dastanden. Frühmorgens, sobald es das Tageslicht erlaubte, schwärmten wir Kinder – bewaffnet mit Leitern, Kesseln und Tüchern – in die mit Bäumen bewachsenen Gegenden aus. Unter den mit tausenden von Maikäfern befallenen Bäumen breiteten wir die Tücher aus. Der mutigste Maikäfer-Jäger kletterte hoch und schüttelte an den Ästen bis die Käfer herunterfielen. Da sie noch schliefen, konnte man sie einsammeln und in die Kessel legen. Damit sie nicht herauskriechen konnten, legten wir einen Deckel drauf. Wir brachten die für uns kostbare Fracht zum Gemeindehaus. Dort wurde das Gewicht ermittelt (pro Kilo gab es glaub ich 20 Rappen). Mit kochendem Wasser wurden die Maikäfer verbrüht. Ein bestialischer Gestank war die Folge. Ich glaube, sie wurden dann als Tierfutter verwendet, denn sie waren sehr eiweissreich. Mit den Jahren nahm der Bestand ab, und die Biester traten dann nur noch in den sogenannten „Maikäferjahren“ auf, meines Wissens alle vier Jahre.

Im Unterdorf steht eine spätgotische Kapelle aus dem Jahre 1504. Das Bauwerk mit dem steilen Dach und dem nadelschlanken Türmchen hat eine Länge von 10.2 m und eine Breite von 4.7 m. Gleich neben der Kapelle wohnte ein Huf- und Wagenschmied. Er und seine Frau waren kinderlos und adoptierten einen Knaben, Aurelio. Dieser war jederzeit für einen Streich zu haben und war unser Anführer. So weihte er mich und einige andere Buben in einen Geheimplan ein. Er hatte es auf das Türmchen respektive auf die darin aufgehängte Glocke abgesehen. Der Sigrist dieser Kapelle wohnte in einem Haus gegenüber im dritten Stock. Immer wieder kam es vor, dass Lausbuben am Glockenstrang zogen und kurz läuteten. Dann stürmte der betagte Sigrist herunter, konnte aber die Missetäter nie fassen.
Aurelio kletterte in der Kapelle in den Dachstuhl hinauf, befestigte eine Schnur an der Glocke und warf sie über das Dach. Wir packten sie, versteckten uns hinter dem nahegelegenen Hühnerhaus und zogen, bis es läutete. Natürlich dauerte es nicht lange, bis der Sigrist in die Kapelle stürmte. Man kann sich vorstellen, dass er die Welt nicht mehr verstand. Wie von Geisterhand ging der Strang in der Kapelle auf und ab. Bald flüchteten wir, und er erwischte uns nicht. Man kann sich vorstellen, dass das Geläute zum Dorfgespräch wurde.
(1)
Mysteriöses Glockengeläut in der altehrwürdigen Kapelle
Zurück zum Schmied. Dieser reparierte in seiner Werkstatt alle Arten von defekten landwirtschaftlichen Fahrzeugen. An einer Esse schmiedete er glühende Eisen. Den Pferden, die zu ihm geführt wurden, verpasste er neue Hufe. Ausserdem schweisste und lötete er Werkzeuge und Maschinen. Auch hölzerne Wagenräder zu bereifen war seine Spezialität. So legte er Metallreifen in die Esse bis sie glühten. Er presste sie darauf auf die Holzräder bis sie satt sassen. Das Holz fing dann an zu brennen. Schwupps eilte er mit dem Rad zum nahegelegenen Dorfbach, so dass das Feuer erlosch. Für mich war es immer wieder ein Erlebnis, diesem Ereignis zuzuschauen.
Eines Tages gab es in der Schmiede eine heftige Explosion, die Scheiben der Werkstatt klirrten und der Meister lag blutüberströmt bewusstlos am Boden. Er hatte mehrere Verletzungen und blutete stark. Als Erster kam Aurelio dazu, sah dass aus einem Bein stossweise Blut herausspritze. Geistesgegenwärtig nahm er seinen Gurt und band das Bein ab. Die Ambulanz brachte den Verletzten ins Spital. Wahrscheinlich wäre er verblutet, wenn Aurelio nicht rechtzeitig zur Stelle gewesen wäre. Der Verunfallte erholte sich, hinkte aber zeitlebens, war aber gesund und konnte auch seinen Betrieb wieder weiterführen.

Anderntags, kurz vor Mittag, beichtete ich den Eltern den Vorfall. Mit dem Zug fuhr ich in die Nachbargemeinde, da es in unserem Dorf keinen Arzt gab. Dieser stellte ein Armbruch fest und gipste ihn ein. Eine Zeitlang musste ich den Arm in einer weissen Schlinge tragen, bis mich der Arzt nach einigen Wochen von diesem Fremdkörper befreite. Die weisse Schlinge und der Verband über dem Gips waren übrigens schon nach wenigen Tagen nicht mehr weiss, sondern unansehnlich verdreckt. So bekam ich eine neue Schlinge – in schwarz. Diese war viel schmutzunempfindlicher, aber ich schämte mich dafür.

(1)
Armbruch tut weh, solange er nicht eingegipst wird


(1) Nicht ohne meine Mütze


(1)
Transport von Lehm auf dem Schienenweg in die Ziegelei

(2)


(1)
Prozession mit Kreuz, Fahne und berittener Musik


(1)
Von einem solchen modernen Velo konnten wir nur träumen



(1)
Aalglatt: der Fisch, kaum zu fassen

Damit man Briefe, die ich mit meinem Freund austauschte, nicht entziffern konnte, wandte ich eine andere Taktik an. Wohl schrieb ich mit gewöhnlicher Schnürlischrift, verwendete aber dabei eine unsichtbare Geheimtinte. So konnte niemand sehen, was ich schrieb. Beim Freund angekommen, nahm dieser ein „Gegenmittel“, will heissen, einen mit einer speziellen Tinktur getränkten Wattebausch, der dann das Geschriebene sichtbar machte. Umgekehrt besass auch ich die entsprechende Tinktur, um die an mich geschriebenen Briefe lesen zu können.

Ein anderer Professor – ein Neffe meiner Mutter – gab uns Deutschunterricht. Um zu zeigen, dass er seinen Cousin nicht bevorzuge, nahm er mich mehr als die andern "dran", das heisst, oft musste ich Gedichte rezitieren. So zum Beispiel die Ballade "Der Glockenguss zu Breslau" oder "Nis Randers", welche ich heute noch auswendig kann. Er lockerte die Lektionen auch mal mit einem Witz auf. Er sagte mal: "Wisst Ihr wie man Willisauer Ringli macht?" Pause. "Man nimmt ein Loch und tut Teig drumumen." Früher gingen die Bäcker zum Stadtbrunnen und hielten das Blech mit dem Ringli-Teig unter das Wasser. Es gab zwei Hersteller: der eine pries seine Ringli "Ursprungshaus der Willisauer Ringli" an, der andere "Urechte Willisauer Ringli".

(1)
Willisauer Ringli vor dem Backen
An die ersten elektronischen Lichtschranken kann ich mich auch noch gut erinnern. Die Städtchen-Metzgerei hatte als automatische Türöffner Lichtschranken. Wenn wir Schüler an der Metzgerei vorbeigingen, konnten wir es uns oft nicht verkneifen, kurz die Hand an den Lichtwerfer zu halten. Dadurch wurde der Lichtstrahl unterbrochen, und die Glastüren öffneten sich. Sehr zum Missfallen des Ladenpersonals. Aber es war für uns einfach fasziniert, wie sich das Ganze wie von Geisterhand abspielte. Kindsköpfe?

Um unsere Zahnhygiene stand es schlecht. Bis zur Oberstufe kannten wir weder Zahnpasta noch Zahnbürste. Die Gattin des Unterstufenlehrers brachte – da sie aus Basel stammte und Beziehungen zur dortigen Pharmaindustrie hatte – Zahnpasta-Müsterchen in die Schule. Inzwischen hatte ich schon einige Zähne mit Löchern. Von Zahnschmerzen geplagt, ging ich kurzfristig nach Willisau zum Zahnarzt. Der Assistent, ein Ungar, untersuchte die Zähne und stellte an der linken Seite des Unterkiefers zwei Zähne mit Löchern fest, die mir diesen unglaublichen Schmerz bereiteten. Da es kurz vor Mittag war, schaute er auf die Uhr und sagte, er müsse die beiden nebeneinander stehenden Zähne ausreissen. Und bevor ich es richtig realisierte, waren sie – ausgerissen. Somit kam er noch rechtzeitig zum Mittagessen. Nicht nur dass ich dann noch längere Zeit Lochweh hatte, von da an konnte ich nur noch auf der rechten Seite kauen. Diese grosse Zahnlücke sollte mich später noch viele tausend Franken kosten.
(1)
Unsere erste Zahnpasta

In den 50er-Jahre, hiess es, es gebe Geräte, mit denen man Geschehnisse, die in weiter Ferne passieren, von zuhause aus verfolgen könne. Und tatsächlich: ich erfuhr, dass im nahen Städtchen so ein Gerät installiert sei. Ein Kollege und ich radelten an einem Sonntagnachmittag dorthin, ins Restaurant Bahnhof. Es lief ein Windhunderennen, natürlich in Schwarzweiss. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich ein Orangina bestellte. Wir starrten etwa eine Stunde lang auf den Bildschirm. Nicht, dass mich Hunderennen interessiert hätten, aber das Wissen, dass dort in einer Ortschaft weit weg, so was live passierte, faszinierte mich.
Ich glaube, es war um 1958 herum, hätten wir uns zuhause auch so einen Fernseher gewünscht. Ich fuhr nach Luzern und fand in einem Geschäft ein Occasions-Gerät, das nicht allzuviel kostete. Es war an einem Samstagnachmittag, und da der Ladenbesitzer das Geschäft nach meinem Kauf ohnehin schloss, anerbot er sich, das Gerät mit dem Auto zu liefern – 35 Kilometer Autofahrt. Er installierte bei uns zuhause eine provisorische Antenne, setzte sich in unserer Stube aufs Sofa und prüfte den Schweizer-Sender und stellte ihn ein. Es wurde gerade ein Fussballmatch übertragen. Der Verkäufer harrte etwa eine Stunde bis zum Schlusspfiff aus. Natürlich gab es noch kein Farbfernsehen. In der Zeitung tauchte einmal die Frage auf ob man eigentlich schwarzweiss oder farbig träume. Ich hatte dann mal einen Traum, in dem ich von einem Farbfernseher träumte, der Traum war natürlich – farbig.
(1)
Radio und Fernseher kombiniert in einem Gerät.

In den 50er Jahren galt für die Druckereien noch eine Preisbindung, das heisst, die Drucksachen kosteten überall gleich viel, es herrschte also praktisch kein Wettbewerb. Als dann so um 1958 herum der sogenannte Offsetdruck aufkam, konnte man viel schneller drucken. Bei diesem indirekten Druckverfahren kommen die Druckplatte und der Druckträger nicht miteinander in Berührung. Die Farbe wird erst auf einen Gummizylinder und dann auf das Papier übertragen. So wird die Druckplatte geschont. Betrug die Druckgeschwindigkeit beim Buchdruck so um die 4000 Stück in der Stunde, so erreichte man im Offsetdruck 8000 Exemplare. Die findigen Druckereibesitzer wandten aber den Buchdrucktarif an, was einen höheren Gewinn bedeutete. Irgendwann fiel dann die Preisbindung, und damit spielte der Wettbewerb.


(1)
Winkelhaken mit Bleibuchstaben vor einem Setzkasten

An den ersten Tag kann ich mich noch sehr gut erinnern. Es war der 1. Mai 1957, ein frischer Morgen. Frohgemut radelte ich durch die Dörfer, stellte fest, dass der Arbeitsweg doch einigermassen anstrengend wird und kam rechtzeitig um halbacht an meiner künftigen Lehrstelle an. Ungewohnt war, dass ich den ganzen Tag stehen oder gehen musste, nicht wie bisher in der Schule. Das Mittagessen nahm ich jeweils in einer Konditorei ein: eine Apfel- und eine Aprikosenwähe, je nach Saison auch je eine Apfel- und Kirschenwähe. Kostenpunkt Fr.1.80. Am Mittwoch gab es dann eine Wurstwegge mit Salat. Nach 2 Jahren hatte ich die Wähen sowas von satt. Ich suchte mir eine günstige Beiz mit abwechslungsreicherer Kost. Abends kam ich um halb sieben meist todmüde zuhause an. Vier lange Jahre standen mir bevor. Ob ich das verkrafte (mit meinen blonden Haaren)? Im ersten Jahr betrug mein Lehrlingslohn 20 Franken in der Woche und steigerte sich jährlich um 5 Franken.
Einmal wöchentlich besuchte ich die Gewerbeschule in Luzern. 2 Franken kostete mich das Essen: Fr. 1.80 das günstigste Menü an der Stehbar im Warenhaus Epa. Zur Znüni- und Zvieripause gönnte ich mir je 1 Mutschli zu 10 Rappen. Sparsamer gehts nicht.
An den Gewerbe-Schultagen musste ich bereits auf den 6.30-Uhr-Zug. Als ich einmal knapp dran war und den Schienen entlang Richtung Bahnhof eilte, kam mir der VHB-Zug (Vereinigte Huttwil-Bahnen) entgegen und verlangsamte die Fahrt. Der Lokführer schob das Fenster herunter und fragte mich: „Weit Ihr o no riite?“ (Wollen Sie auch noch mitfahren?) und stoppte den Zug kurzerhand, damit ich noch einsteigen konnte.

(1)
Die Vereinigten Huttwil-Bahnen existieren heute nicht mehr
Ein Mitschüler kaufte sich im Jahr 1960 vor dem Gewerbeschul-Besuch in Luzern am Kiosk den "Playboy" für schätzungsweise 3 Franken, was damals viel Geld für eine Zeitschrift bedeutete. Wir durften dann auch ein paar Seiten anschauen, so dass sich die Investition doch noch gelohnt hat.

(2)
Eigentlich recht harmlos, aber Ende der 50er Jahre ein Skandal, wer sowas anschaute.
Bei der theoretischen Lehrabschlussprüfung gab es auch das Fach "Manuskriptlesen". Dabei wurde geprüft, ob man die deutsche Schrift lesen könne. Diese wurde zwar im Jahre 1941 abgeschafft, aber viele ältere Leute schrieben sie damals noch, auch mein Vater.
(3) Alphabet der deutschen Schrift
Wer hätte gedacht, dass an einer Lehrabschlussprüfung für Schriftsetzer folgende Fragen beantwortet werden müssten: Was ist ein Hurenkind und ein Waisenkind? Es bedeutet, dass die letzte Zeile eines Absatzes, die fehlerhaft alleine am Anfang einer neuen Kolumne, also am Anfang einer neuen Seite steht. Hurenkinder stören den Lesefluss und gelten als unvorteilhaft für die Ästhetik eines Schriftsatzes. Und der Begriff Waisenkind bedeutet: die letzte Zeile eines Absatzes darf niemals am Anfang einer neuen Kolumne stehen.


Sobald ich jeweils in der Bude ankam, gehörte es im ersten Lehrjahr zu meinen Aufgaben im Keller den Ofen einheizen, der das ganze Haus mit Wärme versorgte. Nachdem ich das Feuer jeweils entfacht hatte, musste ich in gewissen Abständen wieder Kohle einfüllen. Später wurde dann eine Zentralheizung installiert. Diesem winterlichen Einfeuern trauerte ich keine Minute nach.
Dass man als Schriftsetzer mit Bleibuchstaben zu tun hatte, war mir klar. Aber dass alles seitenverkehrt in Spiegelschrift daherkam, war anfänglich doch eine Herausforderung. Ich musste die aus Blei gegossene Buchstaben in einen so genannten Winkelhaken legen, den ich in der linken Hand hielt, während ich mit den Fingern der rechten Hand die einzelnen Buchstaben/Zeichen aus dem Setzkasten griff. Auch gab es nicht das Dezimalmass, sondern eine 12er-Einheit, genannt Cicero.
Im Hinblick auf die Zwischenprüfung, die nach 2 Jahren anstand, musste ich viel üben, galt es doch, in einer Stunde 1500 Buchstaben zu liefern. Bis dahin war noch ein weiter Weg. Zudem mussten im Alltag eigentlich nur die Titel von Hand gesetzt werden, der eigentliche Text bestand aus Maschinensatz, auf der Setzmaschine hergestellten Bleizeilen. Um beim Handsatz mehr Routine zu bekommen, nahm ich einen Holzsetzkasten mit nach Hause. Täglich kam nach und nach ein ganzes Alphabet Bleibuchstaben samt Interpunktionen dazu. Auf einem selbstgebastelten Holzgestell, schräg aufgestellt, montierte ich den Setzkasten und übte schnelleres Setzen, da ich in der Bude kaum Gelegenheit dazu hatte. 
(1)
Holzsetzkasten mit Bleibuchstaben. Die Grossbuchstaben sind alphabetisch angeordnet, die Kleinbuchstaben und Interpunktionen nach der Häufigkeit des Gebrauchs.
Ich musste bald produktiv schaffen, das heisst, Inserate für die Wochenzeitung zusammensetzen und sogenannte Akzidenzen (Geschäftsdrucksachen aller Art) ausführen. Schon bald machte ich den Umbruch – das Zusammenstellen der Zeitungsseiten – weitgehend selbständig. Für den Druck auf der Schnellpresse, ein Druckungetüm der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, Jahrgang 1922, musste ich das Zeitungspapier aus dem Keller zur Maschine hoch schleppen. Das Papier war dann wegen des Temperaturunterschieds elektrisch geladen. Dadurch erfassten die Greifer der Druckmaschine manchmal mehrere Bogen, was natürlich zu Druckunterbrüchen führte. Die Elektrizität der Zeitungsbogen entlud sich aber meistens am aufgehängten Christbaumschmuck. Auch der Versand oblag mir, das heisst, ich musste die druckfrischen Zeitungen abzählen und bündeln gemäss einer Abonenntentenliste je nach Ortschaft und Poststelle. Mit einem Anhänger brachte ich sie jeweils am Freitag zur Bahn. Wenn aber die Druckmaschine wieder mal streikte, musste ich wegen der Verspätung mit dem Veloanhänger alle Poststellen in einem Umkreis von etwa 10 Kilometern bedienen, damit die Abonnenten ihre Wochenzeitung noch gleichentags oder am Samstagmorgen erhielten. Die Druckformen musste ich nach Druckende auseinandernehmen. Die Bleizeilen landeten in einem Kübel. Diesen schweren Kessel schleppte ich die Stufen hinab in den Keller allwo, die Bleizeilen in einem 220 Grad heissen Ofen landeten. Das flüssige Blei floss dann über einen Hahnen in eine Stangenform. Diese Bleistangen wurden in der Setzmaschine aufgehängt und dort in einem Metallkübel verflüssigt und wieder zu Zeilen gegossen. Einmal hatte ich wegen der schlechten Durchlüftung des Kellers eine leichte Bleivergiftung mit Magen-Darmkrämpfen. In der Gewerbeschule lernten wir, in einem solchen Fall viel Milch zu trinken, damit das Blei im Körper gebunden wird?! Jedenfalls war ich nach einem schmerzreichen Tag wieder geheilt.

In den 50er und 60er Jahren war es Brauch, dass die Angehörigen eines Toten sogenannte Leidbildchen machen liessen. Die Vorderseite bestand aus einem Foto des Verstorbenen, die Rückseite enthielt nebst dem Namen und dem Geburts- und Todesdatum meist einen frommen Spruch. Aus der Zeitung konnte man dank der publizierten Todesanzeigen erfahren, wer das Zeitlich gesegnet hat. Wenn aus dem Einzugsgebiet des Lehrbetriebes einige Zeit nach der Beerdigung der genannten Personen keine Bestellung in der Druckerei eintraf, „durfte“ ich am Abend auf dem Heimweg die Trauerfamilien besuchen und die Kollektion mit Mustern an möglichen Trauerbildchen aquirieren. Zuerst solle ich der Trauerfamilie kondolieren und dann höflich fragen, welches Sujet sie möchten. Pro erfolgreichem Abschluss erhielt ich dann ein Trinkgeld. Mit den Fotos der Verstorbenen musste ein Cliché hergestellt werden, damit das Bildchen gedruckt werden konnte. Vielfach war mir kein Erfolg beschieden, sei es, weil mir ein anderer zuvorgekommen war oder ganz einfach kein passendes Foto des Verstorbenen vorhanden war. Einmal, als ich mich in einem Dorf nach einer entsprechenden Adresse erkundigt hatte, hiess es, der Bauernhof sei sehr abgelegen, ich solle mich im nächsten Weiler wieder nach dem Weg erkundigen, was ich dann auch tat. An der gesuchten Adresse endlich angekommen hiess es, der Hof sei vor einiger Zeit abgebrannt und damit auch ein Foto des Verblichenen. Etwa um 8 Uhr abends kam ich dann frustriert zuhause an.
Für eine Pharmafirma produzierten wir in der Druckerei Beipackzettel. Diese auf speziell dünnem Papier hergestellten Patienteninformationen mussten mehrmals gefalzen werden damit sie in die Tablettepackungen passten. Diese Handarbeit lagerte man in ein nahegeleges Gefängnis aus. Eines Tages meldete die Pharmafirma, es fehlen einige hundert Anweisungen. Intensive Nachforschungen ergaben dann, dass ein Häftling diese beiseite geschafft hatte. Frischfröhlich drehten einige Insassen daraus Zigaretten!
Im Jahr 1960 fiel der 1. April auf einen Freitag, also auf einen Tag, an dem die Wochenzeitung erschien. Wir hatten uns einen besonderen Gag ausgedacht, um die Leser in den April zu schicken. Wir kündigten in der Vorwoche in der Zeitung an, am 1. April lande im Gelände ausserhalb des Dorfes nachmittags um 3 Uhr ein Helikopter, was zur damaligen Zeit noch ein aussergewöhnliches Ereignis bedeutete. Man bitte die werte Bevölkerung, die Abschrankung zu beachten. Zur angekündigten Zeit fanden sich dann einige Dutzend Leute ein. Anstatt eines Helikopters sahen sie aber nur ein Plakat, auf dem mit grossen Lettern stand: April, April!
In meiner Freizeit lernte ich trommeln. Unmusikalisch wie ich war, aber der Rhythmus lag mir immerhin im Blut. Und so war ich einige Jahre Mitglied der Musikgesellschaft Gettnau.
(1)

R.I.P.

Als erste Autobahn der Schweiz gilt die am 11. Juni 1955 eröffnete Ausfallstrassae Luzern Süd. Diese erstmals kreuzungsfrei ausgeführte vierspurige Strasse diente der Umfahrung von Horw und sollte die Stadt Luzern schneller mit den Innerschweizer und den Berner Touristenorten verbinden. Sie führte vom heutigen Anschluss Luzern-Kriens nach Ennethorw und dient heute noch als vierspurige Umfahrung der Gemeinde Horw. 1958 konnte mein Freund, der Automechanker lernte, bereits mit 16 Jahren die Fahrprüfung ablegen. Sein Vater besass einen Citroen ID, ein für damalige Verhältnisse futuristisches Auto. So galt es für uns, dieses auf der oben erwähnten Autobahn zu testen. Es gab damals noch keine Geschwindigkeitsbeschränkungen, weder innerorts, ausserorts noch auf Autobahnen. Sicherheitsgurten kannte man nicht. Es war eindrücklich zu erleben, wie man mit Vollgas, ohne Gegenverkehr befürchten zu müssen, losbrausen konnte. Mein Freund drückte das Gaspedal kräftig nach unten bis zur zur Marke 150 km/h. Dazu muss man wissen, dass die Autobahn nicht etwa schnurgerade aus ging, sondern eine weiträumige Kurve beschrieb. Aber die sensationelle Marke Citroen, die damit Reklame machte, dass ein gefüllter Becher auch in einer Kurve keinen Tropfen verliere, machte dieser Aussage alle Ehre. Es war wirklich, wie man auf Wolken schweben würde. Glücklich landeten wir wieder in unserem Dorf, und ich muss heute noch staunen, dass der Vater meines Freundes ein so grosses Zutrauen zu seinem Sohn hatte.
(1)
Mit 150 Sachen über die erste Autobahn: Citroen


(1)
Auf einem solchen Opel mit Steuerradschaltung lernte ich Auto fahren und fuhr mit ihm an die Fahrprüfung

Im Jahr darauf wurde ich zur militärischen Inspektion aufgeboten. Natürlich war ich der Jüngste. Die meisten Mitkameraden, die inzwischen erst einen WK mit dem Sturmgewehr absolviert hatten, kamen nach dem Auseinandernehmen und anschliessendem Zusammensetzen schlecht zu Schlage. Ich half, wo ich konnte, denn Bolzen und Federn flogen nur so durch die Luft der Turnhalle, in der die Inspektion stattfand.

(1)
Das Sturmgewehr Stg57


(1)
Un litro die latte

Gleichzeitig besuchte ich abends eine Handelsschule. Um von einem System zum andern zu wechseln brauchte es einige Übung. Ein kurzes Antippen der Buchstaben reichte bei der Klaviatur der Setzmaschine. Bei der mechanischen Schreibmaschine hingegen musste man relativ kräftig drücken.

(1)
Klaviatur einer Linotype-Setzmaschine
Die Berufskollegen fragten mich, ob ich schon gegautscht sei. "Natürlich", antwortete ich. "Dann bring uns mal den Gautschbief." Da ich diesen nicht vorweisen konnte, packten sie mich eines Tages während der Arbeit mit den Worten des Gautschmeisters: "Packt an Gesellen!" Schon langten kräftige Setzerhände zu. Lediglich das Portemonnaie konnte ich abgeben. In die Zange genommen schleppten sie mich in einen nahegelegenen Brunnen mit der Aufschrift "Kein Trinkwasser". Es war die Tränke, in dem am Viehmarkt jeweils die Kühe ihren Durst stillten. Zuerst landete ich auf einem Stuhl. Unter meinem Wertesten war ein nasser Schwamm plaziert. "Ein Sturzbad gebt obendrauf, das ist dem Sohne Gutenbergs die allerbeste Tauf", zitierte der Gautschmeister aus seinem Buch. Nicht genug damit, befahl er mich in den Brunnen zu werfen. Ich landete nicht sehr in diesem und wurde mehrmals hinuntergedrückt. Völlig durchnässt gingen wir in die nächste Beiz zu einem Umtrunk. Zum Glück hatte ich noch Reservekleider dabei, denn ich hatte geahnt, dass ich mal gepackt würde. Ein paar Tage später musste ich die ganze Abteilung zur Gautschfeier einladen, wo auf meine Kosten kräftig gebechert wurde.

(2)
Mehrmaliges Untertauchen ins kühle Nass

(3)
Nass, aber endlich "getauft".

Wir reisten dann nach Sizilien weiter und logierten in Catania in einer Jugendherberge. Schon am ersten Abend kam ein etwa 40jähriger Sizilianer zu uns und stellte sich als Arzt vor. Er würde uns gerne kostenlos sein schönes Sizilien zeigen, und zwar mit seinem Auto. Wir waren zuerst etwas skeptisch. Jedenfalls holte er uns am andern Morgen ab. Wir fuhren zum Ätna hoch und reisten in den kommenden Tagen in der ganzen Insel herum. Gegen Ende Mai erfuhren wir, dass der Papst im Sterben liege. Wir kauften von nun an in Catania täglich den „Blick“. Vor den Schaufenstern, in denen Fernseher über das lange Dahinsterben des Papstes berichteten, bildeten sich lange Menschenschlangen. In der Nacht am 31. Mai glaubte man, er werde den 1. Juni nicht überleben. Der „Blick“, so konnte man nachträglich erfahren, hatte 2 verschiedene Druckplatten vorbereitet. Auf der einen wurde über das langsame Sterben berichtet, auf der andern stand in grossen Lettern, der Papst sei gestorben. Kurz vor Druckbeginn erkundigte man sich in der Druckerei in Zofingen anscheinend noch, wie der Stand sei. Der angefragte Reporter in Rom sagte, man könne den Tod melden, der Papst werde die Nacht nicht überleben. So prangten am 1. Juni 1963 auf der Titelseite des „Blick“ in grossen Lettern "Ein grosser Papst ist gestorben".

(1)
Dabei sahen wir im italienischen Staatsfernsehen, dass er noch lebte. Mit dem Zug fuhren wir am 1. Juni mit besagtem „Blick“ in den Händen von Catania südwärts nach Siracusa. Die Zugspassagiere rissen uns die Zeitung aus den Händen und starrten mit ungläubigen Augen auf die Titelseite. Erst 2 Tage später, am 3. Juni 1963, schlief der Papst ein. Wir änderten unsere Reisepläne und machten auf dem Rückweg wieder einen Zwischenhalt in Rom. Eine riesige Menschenmenge erwies im Petersdom dem aufgebahrten Papst die letzte Ehre. Wir reihten uns in die lange Kolonne ein und zogen langsam am Leichnam vorbei. Da war keine Pesonenkontrolle, man musste keinen Ausweis zeigen. Ganz nah konnte man am aufgebahrten Leichnam vorbeiziehen. Es war, als würde er friedlich schlafen, eingekleidet in festlichen Gewändern. Das Ganze machte einen grossen Eindruck auf mich. Ungewollt waren wir – ungeplant – Zeugen eines historischen Ereignisses geworden.

(2)
Papst Johannes XXIII. am 5. Mai 1963, aufgebahrt im Petersdom in Rom


(1)
Ein schönes Hobby: Schwarzweissfotos selber herstellen


(1)
Opel 1954: Zusammen mit meinem Bruder kauften wir unser erstes Auto