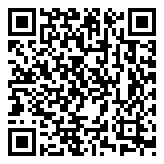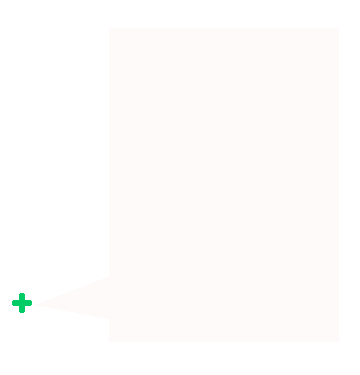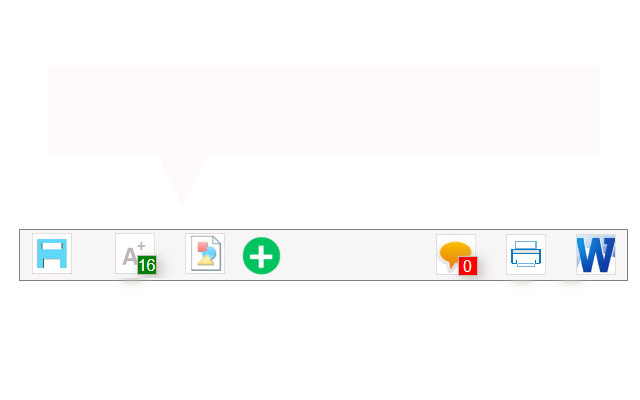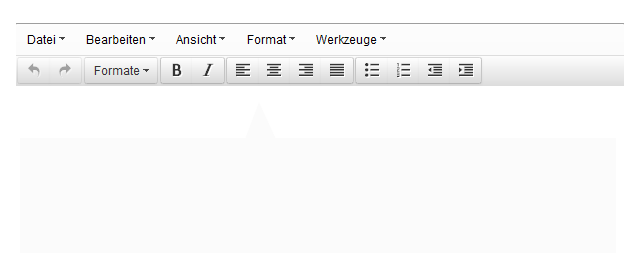Zurzeit sind 552 Biographien in Arbeit und davon 313 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 191

Es war, als hätt der Himmel die Erde still geküsst,
dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst.
Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht,
es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht.
Ich wünsche Ihnen Freude beim Lesen. Trage Sie sorge zu sich.
Maja Brenner

Meine „grosse“ Welt, Teil 3 und das Jahr 2019
Jahreswechsel – Spurenwechsel – Hört wie es mir geschah
1. 2019 - Wie begann das neue Jahr ? Ein Wunsch ging in Erfüllung
2. Ein zweiter Wunsch ging auch ein wenig in Erfüllung
3. Der kürzeste Leserbrief
3. 1966 - Die Tage nach der Diplomierung, ta, ta, ta, tate
4. Wie waren die Jahre vergangen? Der Teenie-Vogel
5. Wie bereitetest du dich für den neuen Lebensabschnitt vor?
6. Der erste Besuch im Schulhaus
7. 2019, 28. Januar, Kongo: Eine zweite Broschüre – La parole à nous, les congolais 2019
8. Der 4. Februar 2019 wieder ein Dia-Tag
9. Das Drei-Generationen-Meeting
10. Hört, wie es geschah
11. Die Hausaufgabe auf den 25. Januar 2019: Langeweile
1. Wie begann das neue Jahr? Ein Wunsch ging in Erfüllung
2019 – Neujahrstag – „Ein Stern ist erschienen“, ein Wunsch war in Erfüllung gegangen. Nach einem Monat Schreibferien beginne ich bei guter Gesundheit Teil 3 meiner Lebensgeschichte zu tippen. Ob ich noch lange genug klaren Kopfes bin, um alle geplanten Teile meiner Erinnerungen geordnet in der Cloud unterzubringen? Mehrere Altersgenossen und Altersgenossinnen stellen trocken fest, ihr Alltag sei anstrengend, da könne Vergessenes vergessen bleiben. Hoffentlich gelingt es mir, meine kurze Zeit als Primarlehrerin in einer für Sie, meine Lesenden, attraktiven Form einzufangen. Ich verrate Ihnen schon jetzt: Es war eine Herausforderung. Eine Primarlehrerin war damals eine kleine Königin. -- Neben dem längst Vergangenen, den Jahren 1966 und folgende, will ich der Aktualität, dem nun beginnenden Jahr 2019 und den letzten, eben entgleitenden Tagen des Jahres 2018 Priorität einräumen. Am Silvester hatte mein Mann Teil 2 meiner „grossen“ Welt in der Word-Fassung fertig korrigiert, ausgedruckt, in einem Ordner abgelegt und auf eine CD gebrannt. Danke. So bin ich nun bereit, mit Teil 3 zu beginnen.
„Ein Stern ist erschienen ...“, das Lied haben wir am dritten Advent in einer reformierten Dorfkirche gesungen. Zu einem Konzert in der Weihnachtszeit hatten wir eingeladen. Wir, das war ein stattlicher katholischer Kirchenchor, ein kleiner gemischter Chor, unser Pro Senectute Chor, eine Jodlergruppe sowie, als Instrumentalisten, der Sohn, die Tochter, und zwei Enkelinnen der Dirigentin, unserer Dirigentin. Es regnete und es windete in jenen Tagen. Am frühen Nachmittag brachte uns das Postauto hin: Treffpunkt halb drei in der Kirche. Die Dirigentin platzierte uns nach ihrer Vorstellungen auf den Holzpodesten im Chor der Kirche und verteilte die Notenhefte. Wir besprachen den Ablauf und die Hauptprobe begann. Es klappte gut. Draussen regnete es weiter. Um vier Uhr erfrischten wir uns mit Mineralwasser und Weihnachtsgebäck. Die Dirigentin war guten Mutes. Wie abgesprochen nahmen wir unsere Plätze im Chor der Kirche wieder ein, als die ersten Besucher zögernd die Kirche betraten: „Wir sind etwas früh, aber bei diesem Sudelwetter … ,“ entschuldigten sie sich. Die Mesmerin nahm die nassen Schirme entgegen und hiess die Gäste willkommen. „Sudelwetter,“ das Eis war gebrochen. Es ging allen Besuchern ähnlich. Sie hatten ein gemeinsames Thema und ein Wort gab das andere. Ein fröhliches Geplauder füllte die Kirche. Die Mesmerin brachte zusätzliche Stühle. Die Leute rückten näher zusammen und luden späte Gäste zum Sitzen ein.
Dann – die letzten Besucher, die nach Plätzen Ausschau hielten, wichen zur Seite – gerade aufgerichtet in der Festtagstracht betrat unsere Dirigentin durch eben diese hintere Türe, das Hauptportal die Kirche. Sie stand da und wartete. Die Mesmerin gab den umstehenden Besucher ein sachtes Zeichen. Sie drängten zur Seite. Es bildete sich ein kleine Gasse, die Leute drehten die Köpfe und streckten die Hälse. Alle wollten unsere Dirigentin, die doch eine der ihren war, sehen. Diese hatte Geduld und grüsste mit dem Kopf höflich nach links und nach rechts. Sie war jetzt die Chorleiterin und nicht die Bäuerin, die mit den Enkelkindern Äpfel einsammelte. - Ruhe und Stille erfüllten das Gotteshaus. Die Dirigentin, in ihrer Appenzeller Festtagstracht, trat auf den Schemel, drehte sich den Gästen zu und verneigte sich leicht. Uns zugewandt schlug sie das Notenheft auf. Ihr Handzeichen liess uns aufstehen und der Organist gab den Ton. Sie machte das Kreuzzeichen, hob die Arme, schaute uns an und auf ihr Handzeichen hin sangen wir: „Ein Stern ist erschienen in finsterer Nacht, hat Freude und Hoffnung und Liebe gebracht.“ - Wir sangen und musizierten ca. 50 Minuten. Bei der Dreingabe war das Publikum eingeladen mitzusingen. Viel Applaus, Blumen für die Chorleiterin. Die Kirche füllte sich wieder mit fröhlichem Geplauder. Geteilte Freude ist doppelte Freude. An diesem Konzert mitsingen zu können, das war mein Weihnachtsgeschenk.
Selbst Ende Januar begleitet mich dieser Liedtext beim Einschlafen. Bleibe ich stecken, stehe ich auf und suche die Fortsetzung im Ordner. Seit dem Herbst hatten wir jeden Montag geübt. Es war schön und mein Wunsch an einem Konzert mitzuwirken, hatte sich unerwartet erfüllt.
2. Ein zweiter Wunsch ging ein wenig in Erfüllung
Statt Reisen in die weite Welt, weil ich mir Kontakt zu Teenagern wünschte, als Ersatz für Spenden für den Kongo, aus Interesse und weil sich die Gelegenheit im Nachbarhaus anbot, arbeitete ich als Aushilfe im Boarding-Haus der Internationalen Schule Schaffhausen (ISSH). Da wohnte eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Kantonsschülern, die sich in englisch auf die international anerkannte Maturität vorbereiteten. 2018 stammten sie aus Albanien, Montenegro, Russland, China und Afrika.
Zu Beginn der freien Tage noch vor den Jahreswechsel, nachdem alle Studierenden bereits in ihre Heimatländer zurück geflogen waren, hatte ich in deren Zimmern die Heizkörper zurückgeschaltet und die angestellten Fenster geschlossen. Da sah ich die grossen, dicken Schulbücher auf den verlassenen Arbeitsplätzen liegen. Warum die Studierenden mir diese nie ein Stündchen zum Anschauen ausliehen, verstand ich nicht. Da musste sich irgendwo, irgend ein interkulturelles Missverständnis verstecken. Das Haus war leer und ich konnte mir Zeit nehmen, um darin zu blättern. Schliesslich trug ich zwei dicke, didaktisch abwechslungsreich gestaltete Geschichtsbücher mit total 600 Seiten heim. -- Und ich hatte es geschafft, diese während und zwischen den Feiertagen zu überfliegen. Um sie wirklich zu lesen, dafür fehlten mir sowohl die erforderlichen Englischkenntnisse wie auch das nötige Interesse für die vielen aufgelisteten Einzelheiten. Zu meinem Erstaunen hatte ich mein Ziel noch im alten Jahr erreicht. Ich war erschüttert, ob all dem Leid, das sich die Weissen gegenseitig zugefügt hatten. Von Nichtweissen gab es nur ein paar kleine Bilder. Die Kolonisatoren liessen sie mitkämpfen und wollten ihnen trotzdem nachher die Unabhängigkeit ihrer Staaten nicht geben … . Am 9. Februar 2019 begann meine 11. Reise in den Kongo. Nachdenklich und müde schaute ich zu, wie der Computer hinunterfuhr. Durch die Wolken schimmerte blass die Sichel des abnehmenden Mondes. Kein Stern war zu sehen.
Von meinem Mann wusste ich, dass nach dem Ersten Weltkrieg von 13 Millionen Kriegstoten und 1918 von 20 bis 25 Millionen Opfer der spanischen Grippe gesprochen wurde. Der Zweite Weltkrieg soll das Leben von 55 Millionen gekostet haben, davon allein gegen 20 Millionen in Russland. Wir sassen gemeinsam am Stubentisch und suchten auf einer Weltkarte die grössten Kriegsschauplätze im Pazifik. Ungeduldig verwies mich mein Mann immer wieder aufs Internet. Aus der Primarschulzeit wusste ich, dass der Erste und der Zweite Weltkrieg immense technische Entwicklungen ausgelöst hatten. Welche? Ich wollte nicht ins Internet, sondern plante einen Besuch im lokalen Museum im Zeughaus. Hastig und ohne Gewähr für Richtigkeit tippte ich für den Ersten Weltkrieg eine Liste: Panzer (= Tanks), Flugzeuge, Schiffe, U-Boote, Maschinengewehre, Revolver – Giftgas – Schützengräben, Bunker, Befestigungen. Dann sollte eine Liste für den Zweiten Weltkrieg folgen. Ob es da viel neues gab? Sicher wurde alles grösser und besser und es gab von allem viel mehr. Bitte Radar, Flugzeugträger, Raketen und Propaganda nicht vergessen! ... Zwei Atombomben wurden abgeworfen. … Im Verlauf des Krieges wurde alles Material in Serien fabriziert. Mein Mann kam aus dem Gemüsegarten zurück. Er brachte Rosenkohl und Feldsalat für das Mittagessen. Meine Bekannten nahmen das Festnetz-Telefon nicht ab. So erreichten sie meine Neujahrswünsche per Band. Dann zurück zur Waffenindustrie: Während dem Zweiten Weltkrieg sollen auf beiden Seiten Milliarden von Dollars investiert worden sein. Die Quellennachweise zu den Zahlen, die ich in den beiden modernen Büchern fand, waren unvollständig. Sie schienen mir vage. Deshalb unterliess ich es, die Investitionskosten per Totem „auszurechnen“. Mein Ziel war einzig noch, die Bücher vor dem Mittagessen auf die verlassenen Arbeitsplätze zurückzulegen. Erst nach dem Mittagsschläfchen fiel mir ein, dass ich mir damit den Wunsch nach mehr Wissen zu den Entwicklungen im 20ten Jahrhundert teilweise erfüllt hatte.
3. Der kürzeste Leserbrief
2019 – Ich schrieb immer gelegentlich Leserbriefe. Die meisten wurden veröffentlicht. Regelmässig trafen positive und negative Reaktionen ein. Anfangs Jahr erlebte ich eine Überraschung. Unsere lokale Zeitung veröffentlichte die spannendsten und die kürzesten Leserbriefe des vergangenen Jahres. Einer der meinigen gehörte zur Gruppe der kürzesten. Er lautet: „Ich habe mich geschämt, als ich erfuhr, dass in Schaffhausen einem Rapperduo, das Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit, Schwulenhass und Gewalt verherrlicht, der Hof gemacht wird. Wir müssen uns klar für die in unserer Verfassung verankerten Werte einsetzen.“ Andere Leser schrieben auch und die Veranstalter luden schliesslich die Skandalrapper Farid Bang und Kollegah wieder aus.
4. 1966 - Die Tage nach der Diplomierung, ta, ta, ta, tate
Jetzt war es vorbei. Es kam das Dazwischen. Dann begann ein neuer Lebensabschnitt. – Wir sind im Frühling 1966. Der erste Tag nach der Diplomierung ist angebrochen. Mitternacht ist eben erst vorbei. Es ist Nacht. Es ist dunkel. Es ist noch sehr früh. Ich will gar nicht wissen, welche Zeit es ist. Die Strassen sind leer. Ich bin auf dem Heimweg vom Abschlussfest. „Jetzt ist es vorbei,“ mit dieser simplen Feststellung lenkte ich mich ab. Ich wollte gar nicht heim. Ich hatte gar kein Daheim mehr. Ich wohnte in einem Zimmer in Untermiete. Zu jedem Schritt lallte ich eine Silbe in der Taktsprache: „Ta, ta, ta, tate“, und wieder „ta, ta, ta, tate“ – „jetzt, ist, es, vor-bei“. Ich machte Umwege. Ich ging durch mir unbekannte Strassen: „Jetzt, ist, es, vor-bei.“ Ich wollte nicht allein heimgehen. Ich hatte es nicht geschafft. Ein neuer Lebensabschnitt sollte beginnen, aber wie? Warum hatte sich kein passabler junger Mann für mich interessiert? Ein paar Burschen aus der ländlichen Gegend, in der ich aufgewachsen war, hatten mich zu einem Glas Wein eingeladen. Alle hatten nur die Abschlussklasse besucht. Mit so jemandem in einer Gartenwirtschaft oder einem düsteren Lokal sitzend, von Bekannten gesehen zu werden, das wäre mir peinlich gewesen. Ich wollte keinen Studierten. Mit einem jungen Mann mit abgeschlossener Berufslehre einen eigenen Betrieb aufzubauen, das schien mir erstrebenswert. Ich ging weiter durch fremde Strassen. Müdigkeit schlich sich in meine Beine. Schliesslich stand ich vor dem Haus, in dem ich ein Zimmer gemietet hatte. Leise, leise, jetzt nur kein Lärm gemacht! Ich wollte nicht vom Schlummervater im Nachtgewand begrüsst werden. Mit dem Pyjama in der Hand verschwand ich im Badezimmer. Erst hier schaltete ich das Licht ein. In Kürze war ich Bett bereit. Achtung, alles fassen, nichts liegen lassen, Licht ausschalten und lautlos durch den dunkeln Flur in mein Zimmer und im Bett verschwinden. Langsam und tief atmete ich aus. Das Federbett umhüllte mich. Die Hände glitten zwischen meine Schenkel. Wohlige Wärme durchströmte den ganzen Körper. Ich schlief ein.
Einschub: 24. April 2019, 10.30: Eben hatte ich meine Schreibarbeit nach drei Monaten Unterbruch, nach meiner elfte Reise in den Kongo wieder aufgenommen. Die anfangs Jahr getippten Texte gefielen mir nicht mehr. Ich tat mir schwer. Zum Glück unterbrach mich der Rückruf von Müller. Er hatte mir den Dokumentarfilm „das Salz der Erde, eine Reise mit Sabastião Salgado“ geschickt. Beeindruckend! Ich wollte ihm spontan danken: Oh, dauernd diese Telefonbeantworter. Der Film liess sich auch in einer französischen Version anschauen. Mein Gedankenblitz: „Ist der Film für meine Kontaktpersonen im Kongo geeignet?“ Diese Frage wollte ich u.a. mit Müller besprechen. Mit seiner sanften Stimme verwies er mich auf die verschiedenen Realitäten und Handlungsweisen von Menschen. Zur Verdeutlichung erzählte er mir eine Begebenheit aus dem lokalen Spital, wo er in der vergangenen Woche den „Pechvogel“ besucht hatte. Ich kannte den erwähnten Bekannten nur unter der Bezeichnung „Pechvogel“. Also Pechvogel war in einem Zweierzimmer untergebracht gewesen. Zu jedem Bett gehörte ein Kasten für die persönlichen Kleider, im dritten Kasten lag das Pflegematerial. Bald konnte der Zimmerkamerad des Pechvogels das Krankenhaus verlassen. Bei der Verabschiedung von der Pflegefachkraft bestätigte und betonte er mehrmals, er habe alles eingepackt. Wenig später sollte dem Pechvogel der Verband gewechselt werden. Alles Pflegematerial war weg. Der Zimmerkamerad hatte alles mitgenommen. Kein Problem, es gab genug Material im Vorratszimmer. „Doch, unterschiedliche Sichtweisen! Wie von der Pflegefachkraft ermahnt, hatte er alles mitgenommen,“ lachte Müller. Der Film, „das Salz der Erde“ zeige solch verschiedene Realitäten, betonte er. Er könne ein Kontrastprogramm zu den im Kongo regelmässig angesehenen Unterhaltungsfilmen aus Bollywood sein, zu den Liebesgeschichten, den Varianten von „ein reicher Pascha liebt armes Mädchen“. - Vor dem Fenster wirbelte der am Radio angesagte Föhnsturm Blütenblätter wie Schneeflocken durch die Luft. Das Mittagessen stand bereit. Einschub Ende.
Mein Fähigkeitszeugnis für Primarlehrer ist mit dem 30. März 1966 datiert. Ergänzend wird darin in kleiner Schrift daraufhin gewiesen, dass Bürger des Kantons Zürich und andere Schweizerbürger, die seit mehr als fünf Jahren im Kanton niedergelassen sind, zwei Jahre nach Bestehen der Fähigkeitsprüfung das Zeugnis der Wählbarkeit als Lehrer der staatlichen Primarschule erhalten, sofern sie – in der Regel während eines Jahres – Schuldienst geleistet haben (§ 8 des Gesetzes über die Ausbildung von Lehrkräften für die Primarschule vom 3. Juli 1938). 1966 waren mehr als Hälfte der frisch diplomierten Primarlehrer weiblichen Geschlechts. Lehrer war die Berufsbezeichnung. Ich kannte die Befürchtung, dass der Beruf durch die Verweiblichung an Ansehen verlieren würde. Mir war einzig wichtig, dass Frauen und Männer gleichviel verdienten, und dem war so.
Bereits nach den Sportferien hiess es, sich für eine Verweserstelle anzumelden. Dies mehrere Wochen vor der Diplomierung! Es herrschte arger Lehrermangel. Selbstverständlich erhielten alle den Fähigkeitsausweis. Wir konnten einen Wunschbezirk angeben. Zum Verdruss meiner Eltern wollte ich in der grossen Stadt bleiben. Mit einem Formbrief wurde mir mitgeteilt, dass ich meine erste Arbeitsstelle als Lehrer am 21. April im Schulhaus Hirzenbach an einer zweiten Klasse anzutreten hatte. Ich spürte, meine Kameradinnen freuten sich. Sie schmiedeten Pläne und tauschten sich aus. Lachend, ernsthaft, immer sehr kompetent! Sie schienen sich ihrer Sache sicher. Ich wusste nicht, was sagen. Ich fühlte mich unsicher. Ich besuchte weiterhin regelmässig den freiwilligen Turnunterricht über Mittag. Da kamen bereits ein paar Seminaristinnen des nachfolgenden Jahres. Die Turnlehrer freuten sich, dass ich weiter übte und sie machten mir Mut. Wir verabschiedeten uns nach der letzten Übungsstunde per Handschlag und sie begrüssten mich als Berufskollegin. Eine Klasse Zweitklässler wartete auf mich. Alle Kinder sollten in etwa das gleiche lernen. Wie sollte das möglich sein? Für das Fach Turnen hatte ich ein klares Minimalziel: Füsse vor und nach der Turnstunde waschen, Rolle vorwärts und rückwärts, den Handstand gegen die Wand, hüpfen und laufen mit dem Springseil, die Kletterstange hoch senkrecht und schräg, kleine und grosse Bälle werfen und fangen sowie die Namen aller Geräte kennen und schreiben können. Ich freute mich auf den Turnunterricht.
4. Wie waren die Jahre vergangen? Der Teenie-Vogel
1966: Ich schüttelte den Kopf und lächelte erstaunt über die ahnungslose kleine Schülerin, die in den 50er Jahren einen grossen Traum zu träumen gewagt hatte. Sie wollte diesen wahr machen, wenn gleich ihr sechs Jahre Ausbildung eine Ewigkeit schienen. Fünf mal so alt war Mama, zehn mal so alt war die Grossmutter. Unvorstellbar! Sie träumte von einem Lohn wie ein Mann. – Als ich dann tatsächlich in jener ersehnten Ausbildung steckte und oft nicht wusste, ob ich es je schaffen würde, ob ich es überhaupt schaffen wollte, da schienen mir sechs Jahre eine Ewigkeit. – Auch jetzt als die sechs Jahre vorbei waren, und ich es geschafft hatte, schien es mir eine lange Zeit. All die Jahre gab es daheim kein Verständnis für meine Sorgen und Nöte im Schulalltag. Niemand teile meine Freuden. Richtig, ich hatte es so gewollt, und die ganze Familie war dagegen gewesen. Hohn, Desinteresse oder einfach „Nicht-zu-hören“ waren die Antworten auf mein Jammern und mein Glück. Richtig, ich hätte abbrechen können. Ich hatte nach andren Wege gesucht, aber das war nicht so einfach. Ich hatte keinen andern Weg gefunden. Schliesslich hatte ich die Ausbildung erfolgreich beendet. Das dachte ich wieder und wieder. Ich war allein. Ich war immer zu allein gewesen. Ich dachte an Ide. Mit ihr hatte ich plaudern können, wenn es ihr nützte. Mir einzugestehen, dass ich Luft oder bestenfalls ihr Schutzschild war, wenn sie mich nicht brauchte, das konnte ich lange nicht. Wir hatten uns schliesslich grusslos getrennte. Das tat weh. Da blieben mir noch Alfi und Gott. Wenn ich eines der beiden erwähnte, wurde ich bestenfalls mitleidig belächelt. Doch sie waren mir treu geblieben. Wie sollte es weiter gehen! - Nur noch Schritte von einen Jahr sollten es in Zukunft sein. Zu hart, zu lange und zu andauernd hatte ich mit Hindernissen (Legasthenie), meinen mangelnden Begabungen in Sport und Musik und meiner Einsamkeit gekämpft. Nun wollte ich meiner grossen Schar kleiner Zweitklässler ein Jahr eine gute Lehrerin werden mit ... -- das weitere dachte ich nur und das schreibe ich nun nicht. Meine Lesenden, Sie können erraten womit, die frisch gewählten Bundesräte sagen es. - Im Stillen war ich stolz und dankbar.
Ende Mai werde ich im Stadthaus, am Stadthausquai meinen ersten Lohn abholen können. Die Eltern wussten das. Doch sie betonten bei den Besuchen an den Wochenenden bis Ende Mai: „Du weisst, wo das Geld ist. Nimm genug.“ Ich durfte immer ungefragt Geld aus der Kartonschachtel nehmen, die mit den laufenden Einnahmen aus den Direkt-Verkauf unserer landwirtschaftlichen Produkten gespiessen wurde. Ich brauchte nie eine Abrechnung zu machen. Erwähnte ich grössere Anschaffungen oder günstige Angebote, legten mir der Vater und die Mutter spontan je einen Hunderter neben mein Schulmaterial. Ich war ihr kleiner Vogel, der ihrem Nest entwichen war, den wollten sie wenigsten füttern. Ich ahnte, beide waren sehr enttäuscht. Der Mutter war ich nicht die erträumte treue Magd. Vom Vater hielt ich Distanz, obwohl die Mutter meinte, ich könnte etwas lieber zu ihm sein, er gebe mir doch immer Geld, und er würde mir noch mehr geben, wenn … . War meine Mutter zu naiv, um zu wissen, was sie sagte?
Ich war nicht aus dem Nest gefallen, nicht hinaus geworfen oder hinaus gestossen worden. In Teil 1, den Erinnerungen an meine Kinderjahre auf dem Bauernhof, im 100-Seelen-Dörfchen ohne Wirtshaus, mit einer Gesamtschule, schildere ich wie der kleine Vogel kämpfte, um die Sekundarschulprüfung zu bestehen. In Teil 2 schaffte es der Teenie-Vogel, dank glücklicher Umstände aus dem schützenden Nest zu hüpfen. Er überlebte die rauen Stürme, die zwischen Kantonsschule und Elternhaus bliesen. Mein Blick schweifte wieder und wieder liebe- und freudvoll über die braune Broschüre mit der Aufschrift „Fähigkeitsausweis für Primarlehrer“.
Wie ich nun 2019 diesen Text tippte, sah ich den etwas steifen Teenie-Vogel von damals vor mir. Verloren klammerte er sich an einen Zweig und hüpfte von Ast zu Ast. Er suchte Schutz neben dem dicken Mitteltrieb. Was hatte er doch für ein zerzaustes, dünnes Gefieder! Ich spürte, wie sein Herz klopfte, als ich ihn streichelte. Meine Hand glättete sachte seine Flügel. Der Teenie-Vogel zitterte, das war er sich nicht gewohnt. Er sass ganz still und versuchte sich klein zu machen. Mein Teenie-Vogel war mager und müde, aber kräftig, denn er war bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Er hatte nichts zu fürchten. Dies dachte ich am frühen Morgen, mich noch unter der Bettdecke räkelnd. Stellvertretend streichelte ich meinen Körper und schickte dem Teenie-Vogel liebe Gedanken. Das tat mir wohl. 2019, nach seinen Wünschen gefragt, wusste der zwischenzeitlich alte Teenie-Vogel sofort, endlich die wöchentlich erscheinende Arbeiterzeitung AZ abonnieren. Die AZ servierte mir in angenehmer und illustrativer Form viel ergänzende Information zur Tageszeitung.– Weiter: Aus einer Schachtel „zu verschenken“ hatte ich heimlich den Teenager-Roman „Beste Freundinnen für immer“ mitgenommen, den die in New York geborene und in New York lebende Autorin Claudia Gabel, im Alter von 22 Jahren veröffentlicht hatte. Diesen Roman wollte ich genüsslich lesen, denn er schilderte Episoden, die ich verpasst hatte. Ich hatte damals zu abgelegen gewohnt. – Schliesslich wünschte ich dem struppigen Teenie-Vogel jeden Abend eine gute Nacht.
5. Wie bereitetest du dich für den neuen Lebensabschnitt vor?
Ich sann über die vergangen Jahre nach. Im Oberseminar wie in der Kantonsschule hatte ich den Gemeinschaftsgeist vermisst. Wir als Familie wurden von der Vision „eine Siedlung für den Stammhalter“ getragen. Unser Tun war auf dieses Ziel gerichtet. Alle Bewohner des kleinen Dorfes glaubten an bessere Tage. Jeder wollte die gute Zeit nützen, und all setzten sich, jeder wollte auf seine Art am Fortschritt teilhaben. Wir arbeiten mit Freude. Ich spürte, meine Eltern waren dankbar, dass sich ihr Einsatz lohnte. Sie konnten alle Rechnungen sofort bezahlen und niemand blieb ihnen etwas schuldig. Die schwierigen Jahre der Krise und des Krieges mit der Anbauschlacht waren auch in den Amtsstuben nicht vergessen. Der Landwirtschaft musste Sorge getragen werden. Der Bund verordnete Minimalpreise mit Abnahmegarantien. Die Bauern verdienten gut. Um die Ernten zu vergrössern – man hatte nun ja etwas Geld – , kauften sie Kunstdünger und Spritzmittel. Saatgut von Sorten, die einen höheren Ertrag in Aussicht stellten, wurden angepriesen. Unausgesprochen herrschte zwischen den verschiedenen Bauern ein Wettkampf. Jeder wollte mehr ernten. Wer einen zu kleinen Hof hatte und nicht mithalten konnte, verpachtete sein Land. Die Pachtzinse stiegen und Land war gesucht. Als ehemaliger Bauer fand man in der Stadt leicht eine Anstellung, die mehr ein brachte als ein zu kleiner Hof. Einheimische Arbeitskräfte waren gesucht. Sie konnten leichter angelernt werden als sprachlich unkundige Gastarbeiter.
Für das Empfinden unsere Familie musste ich eine Verräterin, ein Familienmitglied gewesen sein, das ausscherte. Eine, die dazu noch die Unverschämtheit besass, sie zu reizen, indem sie ihnen in den Sommerferien und in jeder freien Minute vorführte, wie tüchtig und gekonnt – und dazu noch immer frohgemut – sie in Haus und auf dem Feld Hand anlegen konnte. Eine, die, wenn Not am Mann war, den Zangenaufzug, den Traktor oder die Melkmaschine selbständig zu bedienen wusste. Ich arbeitete gerne auf dem Bauernhof, denn dann gehörte ich zu ihnen und das tat mir gut. Sie erzählten allerlei von Haus und Hof, und ich war informiert. Das war gut so. Wagte ich die Schule zu erwähnen, hiess es, geh heim, falte die Wäsche und bereite das Abendessen vor. Ich nannte das „Wegschicken“ und dieses „Wegschicken“ traf mich immer wieder. Nahm ich ein Buch in die Hand, so war ich ihrer Blicke nicht mehr würdig. Sofort litt die Mutter unter Kopfschmerzen. Sie musste sich hinlegen. Sie konnte sich darauf verlassen, dass die gute Tochter mit dem schlechten Gewissen einsprang und ihre Arbeit übernahm. Der Vater wusste, dass ich sehr gerne Auto fuhr. Er nutzte die Gelegenheit und gab mir den Autoschlüssel. Ich durfte im Nachbardorf Spritzmittel gegen Mehltau und Milchersatzpulver für die Kälber holen. Schliesslich die Grossmutter, sie wünschte auf den Friedhof chauffiert zu werden. Ich verstand, all das diente ihrer Vision – nur? Ich hatte meine eigenen Ziele und diese mussten neben dem Aufbau einer Siedlung gleichberechtigt Platz haben. Das nannte ich „Sowohl als auch“. Für meine Familie galt „entweder oder“. In ihren Augen hatte ich gewählt. Ich gehörte nicht mehr dazu und da gab es kein zurück. – Weder die Kantonsschule noch das Oberseminar ersetzten mir die dörfliche Gemeinschaft.
Ende Mai 1966 erhielt ich den ersten Lohn. Damit war ich erwachsen und finanziell unabhängig. Die Wochenenden und die Ferien verbrachte ich weiterhin auf dem Bauernhof. Mich auch in der Freizeit von der Familie zu trennen, daran verlor ich keinen Gedanken. Jeden Sonntagabend sagte der Vater: „Es würde genügen, wenn du mit dem Arbeiterzug am Montag Morgen nach Zürich fahren würdest.“ Und er fragte: „Wann kommst du am Samstag? Ginge es nicht etwas früher?“ Mit solchen und ähnlichen Gedanken breite ich mich auf den neuen Lebensabschnitt vor.
6. Der erste Besuch im Schulhaus
Ich hatte meine erste Arbeitsstelle am 21. April im Schulhaus Hirzenbach an einer zweiten Klasse anzutreten. Was hiess das? Es wurde kein Ansprechpartner erwähnt! Dem Stadtplan zu Folge lag das Schulhaus in einem Neubauquartier, hinter dem Milchbuck, Richtung Winterthur. Um einen ersten Blick auf und in „mein“ Schulhaus werfen zu können, rief ich an. Der Hauswart meldete sich und erklärte, ich solle während der grossen Pause anrufen. Dort meldete sich eine Lehrerin, ich solle am Freitag anrufen, dann sei der Vorsteher da. Sie dürfe keine Auskunft geben. Am Freitag meldete sich ein Lehrer, der Vorsteher sei krank, ich solle die kommende Woche anrufen. Es gab damals keine Handys, nur eine Telefonkabine für alle Seminaristen, und diese war immer besetzt. Man musste anstehen und warten. Und dann, bevor der Telefonanruf erledigt war, läutete es „Ende Pause“. - Nebenan in der Portiersloge im Kantonsspital sass morgens immer derselbe freundliche alte Herr. Wir waren uns mehrmals im Tram begegnet. Er erinnerte mich mit seinen weissen Haaren an meinen Primarlehrer. Wir wechselten ein paar Worte. Da er glaubte, ich sei verschwiegen anerbot er mir, gelegentlich „sein“ Telefon zu benutzen. Telefonanrufe waren also für mich kein Problem. Der Vorsteher des Hirzenbachs war erstaunt, aber er erklärte mir freundlich, meine Vorgängerin, neu Frau Meier, habe im Herbst geheiratet und sie ziehe nun zu ihrem Mann in einen andern Kanton. Sie freue sich. Er bedauere ihren Wegzug. Er informiere sie gerne. Ich solle am Samstag wieder anrufen. Frau Meier freute sich. Sie war gerne bereit, mir das Schulzimmer zu zeigen und von ihren Schülern zu erzählen.
Nun konkret zum Besuch im Schulhaus Hirzenbach. Frau Meier und ich hatten uns kurz nach vier Uhr vor dem Haupteingang des Schulhauses verabredet. Sie hatte mir den Weg erklärt, Tram 9 brachte mich vom Oberseminar zur Endstation Irchel, Bus 31 vom Irchel zum Zehntenhausplatz. Bus 62 hatte ich bei der Endstation zu verlassen. Weder der Kondukteur, der hinten im Bus Billette verkaufte, noch der Chauffeur, kannten das Schulhaus Hirzenbach. Zwei alte Frauen stiegen auch aus. Sie behaupteten, es gäb hier kein Schulhaus. Ich sei in den falschen Bus gestiegen. Der andere Bus habe seinen Wendeplatz neben einem Schulhaus. Ihre Aufforderung, sofort wieder in den Bus einzusteigen und zurückzufahren, beherzigte ich nicht. Eine Ausländerin verstand meine Frage nicht. Eine Mutter mit einem Kinderwagen wohnte neu im Quartier. Doch sie zeigte mir den Kinderhort. Mein Problem war gelöst. Vom Hort aus hatte ich freie Sicht auf mein Schulhaus. Der Eingang liege auf der gegenüberliegenden Seite. Die Schule sei bald aus, wurde mir erklärt. Richtig, da hüpften die ersten kleinen Schüler heimwärts. Etwas weiter vorn sah ich den Schulplatz und die offenen Flügeltüren. Da drängten weitere Kinder lärmende hinaus. Ich beobachtete ihr Treiben. Die grösseren Schüler verliessen das Gebäude geordnet in Gruppen. Eine Hand winkte mir. Ich war erleichtert, ich war richtig.
Frau Meier begann gleich zu erzählen, viele kinderreiche Familien, viele Ausländer seien in den neuen Wohnblöcken eingezogen. Deshalb sei es nötig geworden in jedes Schulzimmer eine zusätzliche Reihe Tische und Stühle zu stellen. -- „Nun aber fort mich euch,“ der Abwart rasselte mit dem Schlüssel. „Machen Sie uns doch Beine,“ lachten die Nachzügler. Frau Meier weiter: “Der Abwart ist Gold wert. Mit viel Freundlichkeit sorgt er für Ordnung. Er ist hilfsbereit und weiss immer Rat.“ -- Mit 33 Kindern sei ihre Klasse klein, doch seien auf den Klassenwechsel im Frühjahr mindestens vier Zuzügler und drei Repetenten zu erwarten. Gespannt lauschend folgte ich ihr. Wir stiegen eine Treppe hoch und ehe ich es mir versah, sass ich mit zwei Beigen Heften auf einem Schülerstühlchen. Sie gab mir Zeit, diese in Ruhe anzuschauen, während sie im einem dritten Stoss Hefte „kleine o“ in Schnürlischrift (= Schweizer Schulschrift) vorschrieb. Die Klasse sei sehr lernwillig. Deshalb habe sie bereits mit dem Stoff der zweiten Klasse begonnen, lieber einen Vorsprung geniessen als mit Rückstand zu kämpfen. Das Einmaleins fordere viel Übung. „In allen Heften dieselben Rechnungen und Texte. Wie ist das möglich? Warum war das während der Ausbildung kein Thema gewesen?“ Frau Meier verstand meine Frage und erklärte mir, während eines Praktikums habe sie beobachtet, wie selbst kleine Schüler mit Freude neben einem Übungsheft ein Reinheft führen würden. Das habe sie übernommen. Sie habe ein weiteres Heft für die verbundene Schrift verteilt. Das zugeteilte Material reiche den Lehrern kaum. „Doch schauen sie“, sie war aufgestanden und öffnete den hintersten Kasten. „das sind die Vorräte, die zu diesem Zimmer gehören. Einiges hatte ich von der Vorgängerin übernommen und von mir kommt weiteres dazu. Für jede Bank stehen ein neuer Wasserfarbkasten und eine Tube Leim bereit.“ Frau Meier freute sich immer wieder, dass sie mich persönlich kennen lernen konnte. Sie anerbot sich, vor ihrem Wegzug, die Bücher für die zweite Klasse zu holen und alles Material, das sie für die erste Klasse gebraucht habe, zurückzugeben. Sie forderte mich auf, den für den Lehrer reservierte Satz Bücher gleich mitzunehmen. Das erleichtere die Vorbereitung für die ersten Tags. Sie erklärte mir den Stundenplan und bedauerte, dass ich an vier Nachmittagen zu unterrichten hatte. Umsonst habe sie sich für einen zusätzliche freien Nachmittag eingesetzt. An zwei Nachmittagen mit je nur die halbe Klasse zu arbeiten, das sei jedoch auch sehr angenehm. Einen kleinen Ausflug mit der halben Klasse zu unternehmen, sei ein Vergnügen für alle. Wir brachen unsere Unterhaltung erst ab, als es nötig wurde, das Licht einzuschalten. Mit Bedauern muss ich rückblickend sagen, ich kann mich an keinen weiteren so ausgedehnten, wohlwollenden Gedankenaustausch mit einem Lehrer erinnern.
7. 2019 28. Januar zum Thema Kongo Ziel: Eine zweite Broschüre – La parole à nous, les congolais 2019
Im Sommer, Herbst und Winter 2016 / 2017 hatten wir als Gemeinschaftswerk die Broschüre „La parole à nous, les congolais 2016“ erstellt. Ein Kraftakt, der sich rückblickend gelohnt hatte. Im Februar 2018 waren Makabu, meine lokale Partnerin und ich mit 120 solcher Broschüren in den abgelegenen Dörfern im Hinterland von Kikwit, Kongo Kinshasa unterwegs. Sollten wir sie verschenken? Nein, was nichts kostet, ist auch nichts wert! Die Lehrer in Kinshasa hatten viel Liebe, Zeit und Mühe in diese Broschüre gesteckt. Sollte ihre Leistung von den Dorfbewohnern nicht anerkannt werden? Sicher, aber die Dorfbewohner hatten doch kein Geld! Sie hatten Maniok, Mais und Erdnüsschen. Meiner Idee, die Broschüre „La parole à nous, les Congolais 2016“ gegen Erdnüsschen zu tauschen, wurde in der Stadt mit Schmunzeln und Misstrauen begegnet. Falls das möglich sein sollte, sehr gut, aber die Dörfler würden die Broschüre nehmen und vergessen, die Gegenleistung zu bringen, das war die allgemeine Meinung. Dem wird nicht so sein, ich war entschlossen, die Reihenfolge «Erdnüsschen oder Mais gegen Broschüre» war genau einzuhalten. Ich kannte das Spiel: «Die Leute nehmen die Broschüre mit und vertrösten mich auf später.» Mit dem Vorwurf kleinlich und misstrauisch zu sein, versuchten sie mich zu erpressen. Freundlich blieb ich auf meinem Standpunkt. Nach mehr oder weniger Heucheln, Falttieren oder Schimpfen klappte das Tauschgeschäft. Wer die entsprechende Menge Nüsschen brachte, bekam selbstverständlich die Broschüre. Für die doppelte Menge, zwei Broschüren. Die Dörfler hatten verstanden und erklärten mir: „Was nichts kostet, ist nichts wert.“ Sie gaben ihre Waren und trugen die Broschüre sorgfältig heim. Zu einer Gratis-Broschüre hätten sie doch nicht Sorge getragen. Damit hätten Mütter die drängelnden Kinder ruhigstellen können. Voll Freude meldeten mir die Besitzerin später, sie hätten ihr Photo gesehen. Sie hätten den Text dazu gelesen. Es brauche zwar viel Zeit, aber sie würden malembe, malembe (langsam, langsam) alles lesen. Das war ja Sinn und Zweck der Broschüren. Analphabetinnen, die Kikongo sprachen und nur oui, oui und non, non auf französisch sagen konnten, schauten die Bilder an. Alle freuten sich, wenn sie jemanden auf den Photos erkannten. Alle 120 Broschüren fanden eine Abnehmerin oder einen Abnehmer. Wir hatten 120 kg Erdnüsschen gesammelt. Diese wurden in vier Säcke verpackt und traten einen mühsamen und beschwerlichen Weg an. Sie machten folgende Hauptstationen: Makabus kleines Haus, Lastschiff, Jeep, Bus, Taxi, meine Unterkunft in Kinshasa. Die Lehrer waren überrascht und erfreut. Sie hatten von Dorfbewohnern die gewünschte Anerkennung erhalten. -- In der Schule in Kinshasa gab es ein neues Thema. Alle behaupteten, vor meinem Besuch in den Dörfern hätte mir die ganze Schule das Tauschgeschäft vorgeschlagen. Erst nach langem Zögern wäre ich dazu bereit gewesen. Schliesslich hätte ich verstanden, dass die Dorfbewohner zwar kein Geld aber Nüsschen hätten, und dass diese in der Grossstadt Kinshasa viel Wert seien. Zwei Lehrer gestanden mir so nebenbei, dass sie diese Tauschgeschäfte nicht für möglich gehalten hätten. Und ich? Ich freute mich auch: Stadt und Land waren sich ein wenig näher gekommen.
Im Februar 2019 warteten erneut 120 Broschüren „La parole à nous, les Congolais 2016“ auf die Reise in die abgelegenen Dörfer. Eigentlich langweilig, 120 mal das gleiche wie im vergangenen Jahr. Trotzdem, denn ich war sicher, dass die Broschüren im Laufe des Jahres durch viele Hände gegangen waren. Sie waren abgenützt, zerschlissen und schmutzig, vielleicht sogar abhanden gekommen. Ein paar Analphabetinnen hatten gezögert und die Gelegenheit verpasst. Plötzlich dachte ich, für eine spätere Reise sollte eine zweite Broschüre entstehen. Doch wie? Ich telefonierte mit Jean-Pierre Sorg, meinem welschen Kollaborateur. Meine Idee gefiel ihm, und er anerbot sich, mir einen Vorschlag zu machen. Eine Woche später erreichte mich sein Mail mit Anhang: Kurz und knapp eine Seite, ein mögliches Inhaltsverzeichnis aus zehn Punkten zum Thema Aufforstung. Ich leitete die Mail spontan weiter. Es ging an verschiedene, mögliche Textspender im Kongo und zur Besprechung an Jürg Masson, meinen Unternehmensberater.
Ich wartete ein paar Tage. Niemand meldete sich. Ich rief Jürg Masson an. „Zu geschlossen, zu eng gefasst! Das darfst du nicht tun“, lautete seine Antwort. Ich merkte, Masson fehlte die Musse, um sich mit mir über die geplante zweite Broschüre zu unterhalten. Er hatte sein Haus unerwartet rasch verkaufen können, und er und seine Frau waren im Begriffe, in eine 5-Zimmer-Wohnung zu ziehen. „Wie geht es mit der Vorbereitung eurer Hausräumung? Hast du etwas von der Renovation eurer Mietwohnung gehört?“ Nun sprudelte es nur so: „Der Architekt der Käuferschaft unseres Hauses kam gestern für eine Besichtigung vorbei. Ich war in der Mietwohnung. Meine Frau war daheim und hat ihn empfangen. Er sei sehr leutselig gewesen. Alle Entwürfe habe er ihr gezeigt und ihr die geplante Neuorientierung der Liegenschaft erklärt,“ Jürg schwieg und atmete tief durch. „Als wir das 3-Familien-Haus meiner Eltern vor 30 Jahren in ein Einfamilienhaus umbauten, war das ein grosser Eingriff. Doch was nun geplant wird, ist ebenso durchgreifend.“ „Jürg, euer Haus ist doch ein Traum,“ unterbrach ich. „Kann ein Haus noch schöner sein?“ ... „Die neuen Eigentümer haben 20 Jahre in den USA gelebt und sind viel gereist. Sie haben andere Vorstellungen,“ fuhr Jürg Masson weiter. „Das Erdgeschoss wird gegen den Garten auf den Teich zu geöffnet. Es entsteht ein Gross-Wohnraum mit einer Kochinsel und einem Wohlfühlbereich mit Sicht auf das Biotop.“ Schön, dass Masson mir Zeit liess, mir das Ganze vorzustellen. „Den ersten Stock teilen die Teenies. Die beide halbwüchsigen Töchter erhalten je ein Zimmer mit grosszügiger Nasszelle. Die Eltern residieren im zweiten Stock in einem Grossraum, leicht unterteilt in Schlaf- und IT-Bereich, dazu zwei Badezimmer, nein zwei Wellnessoasen mit Regenduschen.“ Ich wollte etwas sagen, aber er referierte weiter: „Höre, die Zeiten von „WC, Brünneli und Badewanne“ sind vorbei.“ Masson blieb in Fahrt: „Im Treppenhaus: Holzstufen statt dem Teppichbelag und die Treppe wir vom Keller nach oben durchgezogen. Das gedrechselte Treppengeländer aus Holz wird hell gestrichen.“ Es entstand eine Pause. Ich lachte: „Jürg, das darf nicht wahr sein, das Holz wird angemalt. Vor bald vierzig Jahren war unser Treppengeländer auch gestrichen. Damals habe ich mit viel Einsatz unsere beiden kleinen Kinder gehütet und das braun angemalte Treppengeländer ab gelaugt. Wir wollten, dass das Holz sichtbar wurde. Schön ist es geworden, schön wie bei euch. Die Besucher sind immer noch des Lobes voll.“ Stille … .
Themenwechsel: „Jürg, hast du meine zweite Mail gelesen? Was hältst du von meinen ergänzenden Bemerkungen zum Vorschlag von Jean-Pierre Sorg?“ „Besser. Es scheint mir wichtig, dass die Kongolesen schreiben können, was ihnen wichtig ist, was sie bewegt. Maile ihnen deine Ergänzungen als zusätzliche Anregung.“ Wir wünschten uns gegenseitig eine ruhige Nacht. Das Mail in den Kongo konnte auf den kommenden Morgen warten. Mit viel Anstrengung erreichten wir das Ziel. Die Kongolesen liessen im Spätherbst die zweite Broschüre mit dem Titel „La parole à nous, les congolais 2019“ drucken.
8. Der 4. Februar 2019 wieder ein Dia-Tag
Dia-Tag nannte ich gute Tage, an denen Schlag auf Schlag Thema auf Thema folgte. Ein Hauptthemen? Nein, mein Haupt-Thema war das „Älter werden“ und das begleitete mich auf leisen Sohlen immer, leise und beharrlich immer. Die andern Themen verwoben sich zu einem Raster und hatten wenig gemeinsam ausser mich als Person. Ich schob sie an solchen Tagen nicht weg und, hätte ich sie überhaupt wegschieben können, wenn ich gewollt hätte? Nein. Fangen wir an:
Klick - ich hatte im Internat der ISSH Piquet geschlafen. Früh am Morgen, um 5 Uhr war ich wach. Also las ich als Vorbereitung auf meine elfte Kongo Reise einen Text von Jean-François Bernardini zum Thema „Tu peux prendre la laine du mouton plusieurs fois, mais la peau, tu ne la prendras qu‘une fois“. Ich brauchte viele Wörter nachzusuchen. Ich scannte und mailte den Text Jean-Pierre Sorg. Er erklärte mir später, der Text habe literarische Qualität, er verstehe, dass ich mir schwer damit tue. Ich solle ihn nicht in den Kongo mitnehmen, er führe zu Missverständnissen.
Klick - 8 Uhr, alle Schüler waren schliesslich rechtzeitig mit dem Schulbus weggefahren.
Klick - 9 Uhr, ich war überrascht. Es hatte zu schneien begonnen und innert kurzer Zeit war die Welt verzaubert.
Klick - Nach zehn Jahren hatte mein Photoapparat den Dienst eingestellt. Was blieb mir, als mit einem andern alten Kasten zu üben? Überall wurden neue Handys mit Kamera angeboten, doch es machte mir Freude, zunächst Altes aufzubrauchen. Also knipste ich aus dem Küchenfenster die Schnee bedeckte Tanne in Nachbars Garten. Ein schönes Bild, das nächste Woche meine Bekannten in Kinshasa mit erstaunen ansehen können. Meine Lesenden, bitte googeln Sie Kinshasa. Ja, es liegt in der Nähe des Äquators. Weiter, weiter, weiter...
Klick - 10 Uhr bequem sitze ich mit einer Tasse Leber-Gallen-Tee auf dem Sofa. Ich wähle, nein tippe die Nummer einer Bekannten ein, ich wollte sie nach einer Veranstaltung im Museum fragen. Meine Frage blieb offen, denn sie referierte sofort zum Thema „Menschenrechte“ und sie konnte es nicht lassen, alles zu erwähnen, um mich betreffend Menschenrechte auf eine härtere Linie zu bringen. Doch sachte, sachte, es gelingt mir, ihr sanft zu antworten, ohne meine Meinung zu verleugnen.
Klick: Zugfahrten geniesse ich wie damals als Kind und heute, die Fahrt nach Zürich durch die verschneite Welt. Traumhaft. Dazu feines getrocknetes Brot und Tee. Ich schaue und schaue und wundere mich, wie Leute mit grossen, schweren Koffern unterwegs sind. Nein, heute helfe ich dicken alten Frauen, die wohl gegen zehn Jahre jünger sind als ich, nicht.
Klick: Mein Plan war, Hefte und Stifte in Papierlädeli der ETH zu kaufen und die Sportanlagen anzuschauen. Ah, es gibt auch einen Eingang von unten. Der Hausdienst half mir. Mein Ziel hiess neu Paper-Shop. Er war rechts neben der oberen Mensa und nicht mehr im Hauptgebäude. Links waren noch immer die neuen Turnhallen. Der Hausdienst klärte mich auf, eine Totalrenovation sei geplant: „Ihre neuen Turnhallen entsprechen nicht mehr den heutigen Bedürfnissen. Es gib keinen Lift.“ Amüsiert stieg ich die breiten Treppen hoch und schaute ich mich vergnügt um.
Klick: Piano, piano - in Erinnerungen badend, erreicht ich kurz nach 13 Uhr die Aula der Universität Zürich. Die Veranstaltung hiess: Schweizer Autobiographie-Award 2019 by meet-my-life.net. Ein gepflegtes und, das hatte sich zwei Stunden später wieder bestätigt, ein ausgesprochen Kultur bewusstes Publikum, die Herren im Anzug, die Frauen frisch vom Coiffeur, Männchen und Weibchen mit gefärbten, mindestens getönten Haaren.
Klick: - Neben dem Eingang zur Aula die Erinnerungstafel an die berühmte Rede von Churchill, die er 1946 in Zürich hielt. Ich sann über jene Zeit nach. Dazu ist ein Besuch im Internet ratsam.
Klick: - Professor Sandro Zanetti hielt die Laudatio für die vier von Meet-my-life ausgezeichneten „Schriftsteller“. Dann unterhielt sich Prof. Dr. Messerli und Franz Hohler über Stationen in dessen Leben. Dr. Erich Bohli, der Initiator verdankte die vielen Gönner, hauptsächlich Coop und Swisscom. Ein Erfolg, die Aula war voll. Klick, klick, klick, zum Abschluss der Apéro im Lichthof. Erinnerungen sind Perlen auf einer Schnur.
Klick, klick: Erholungspausen, die Zugfahrt zurück, das Nachtessen mit meinem Mann, die Nachrichten, das Sprachtraining mit TV Suisse Romande, dazu ein wenig stricken.
Klick: Darf das Sein! Hätte ich mir etwas besseres wünschen können? Es folgt der Film „Die Göttliche Ordnung“ auf französisch. Ich kenne den Film bereits: Die Frauen aus einem kleinen Bauerndorf kämpften ums Frauenstimmrecht, das wir seit 1971 haben. Meine Mutter hatte sich geweigert, stimmen zu gehen.
Klick: Im Pyjama mit einem Glas Wein in der Küche und staunen über Gott und die Welt.
Klick: Unter der Bettdecke gehe ich nochmals von Bild zu Bild und schlafe ein. Es war ein guter Tag gewesen.
In vier Tagen fliege ich in den Kongo.
9. Das Drei-Generationen-Meeting
Anfangs September 2019 ein Drei-Generationen-Meetings auf einem Spielplatz in der Stadt am See. Mein Mann und ich durften als Grosseltern in der Halle des Hauptbahnhofs unsere beiden Enkelinnen mit ihrer Mutter erwarten. Wir waren früh dran und schauten uns um. Die Hallenwände wurden renoviert, d.h. das Ornamentband und die Rahmen der Oberlichter wurden von einer Hebebühne aus geputzt und frisch gestrichen. Wir unterhielten uns über die Probleme der Deutschen Bahn. Kurz vor elf Uhr kamen sie, die Mama mit Kinderwagen, zwei Trottinett und zwei Mädels, drei und fast fünf Jahre alt. Für eine Begrüssung hatten die beiden kaum Zeit, denn sie wollten Roller fahren. Ah, Roller hiessen die Trottinett nun, wir hatten es verstanden. Die Bahnfahrt sei mühsam gewesen, sehr enttäuschend, denn der Zug mit dem Spielwagen sei ausgefallen. Die Mädels seinen ohnehin müde, da sei es gut, die Zeit auf der nahen Josefswiese zu verbringen. Die „grossen“ Mädchen wollten sich nicht von den Grosseltern führen lassen, sie wollten Roller fahren. Wir hielten uns zurück. Keine Gefahr, wir waren in einer verkehrsfreien Zone, nur die Grosseltern sahen überall Fussgänger mit und ohne Gepäck, Fussgänger mit und ohne Gehhilfen. Die Mutter wollte den Kinderwagen selber schieben und sie musste selber auf die Kinder achten. Mama, Mama, nein Mama, nicht du, Mama, quittierten sie unsere angebotene und gutgemeinte Unterstützung.
Bald sassen wir für kurze Zeit im Tram und schon bald rollten sie durch eine Fussgängerzone zur Spielwiese, einem modernen Spielplatz mit alter Bezeichnung. Die Mutter stiess ihre auf der Schaukel sitzenden Töchter abwechselnd kräftig an, nur Mama durfte. Wir tuschelten. Trotz allem es war schön und eine gute Form, um mit den „drei Frauen“ Zeit zu verbringen. Wir assen gemeinsam im Restaurant, das an den Spielplatz grenzte. Mit etwas Geschick war es mir gelungen, im Freien den Tisch in der Ecke zu reservieren. Das war gut, denn so konnten die Mädels in den Wartezeiten gefahrlos kommen und gehen. Sie blieben in unserem Blickfeld. Auf Anfrage hin erzählte die Mutter von ihrem ersten Kindergarten-Elternabend, viel zu langfädig sei er gewesen. Zusätzlich zum freien Spiel, in der Puppenecke, am Zeichnungstisch, bei den Bauklötzen und anderem würden neu Lernposten angeboten. Im ersten Jahr könnten die Kinder frei wählen, im zweiten Jahr sei der Besuch aller Posten obligatorisch und die Kindergärtnerin unterstütze die Kinder dabei. Die Hauptstadt habe noch nicht auf den Lehrplan 21 umgestellt, aber es sei alles vorbereitet. Fast drei Stunden und immer wieder ähnliche Fragen, sie könne nur wiederholen mühsam, mühsam. Die beiden Mädchen spielten vergnügt, sie kamen immer wieder an den Tisch zurück und fragten nach ihrem Essen. Sie gingen willig mit Mama zur Toilette, um die Hände zu waschen. Später, wir hatten noch viel Zeit, spazierten wir, geleitet vom GPS des Smartphones, durch breite verkehrsberuhigte Strassen zum Bahnhof, links und rechts Parkplätze und grossen, von einem Grasring umgebenen Bäumen. Die Mädels fuhren Roller und entdeckten immer wieder interessante Ding. Da sie bereits wieder Hunger hatten, verschwand die Mama in einem Laden und kam mit einer vollen Tüte zurück: „Schnell nun, wir dürfen den Spielwagen nicht verpassen. Nicht jetzt, ich gebe euch etwas im Zug.“ Wir hatten Glück, im Untergeschoss am Ende der Rolltreppe stand der Spielwagen bereit. Die beiden verschwanden, ich winkte der Mutter kurz. Der Zug fuhr weg.
Die Mutter der Mädels, nach ihrer Kindergartenzeit gefragt, erzählte, gab es keinen Elternabend. Die Mütter mit Kleinen beobachteten die Kindergartenkinder und informierten sich bei deren Mütter. Wir hatten Dreiradvelos, sicher nicht mehr. Damit fuhren wir in der Quartierstrasse. Wir spielten Familie und gelegentlich mit dem Vater mit einem Ball. Wir hatten Farbstifte und allerhand Märchenbücher mit Bildern. Ihre grössere Tochter interessiere sich für Höhlenbewohner, sie hätten in der Bibliothek entsprechende Bilderbücher ausgeliehen. -- Unser Sohn wollte in jenem Alter die Schöpfungs-, die Weihnachtsgeschichte und die Erzählungen vom Leben und Sterben Jesus wieder und wieder hören. Adam und Eva wurden aus dem Paradies vertrieben. Wie lebten sie? Die Leute hatten damals keine Häuser wie wir. Kain und Abel machten Feuer. Im unserem Museum wurde eine Höhle mit richtigen Höhlenbewohner im Halbdunkel ausgestellt. Hoffentlich können wir diese unseren Enkeltöchtern gelegentlich zeigen. Unser Sohn brachte die Formulierung avanti, avanti Mama vom Kindergarten heim. Er war stolz, dass er dank seiner Deutschen Oma „Deutsch“ und nicht nur „Schweizerisch“ sprechen konnte. -- Mein Grossvater und ich, wir verbrannten alles, was verbrannt werden durfte. Er lernte mich, ein Streichholz anzuzünden. Umsonst, es erlosch, bevor die Zeitung brannte! Bald konnte ich es. Ich war dabei, wenn er die Kartoffelstauden oder Unkraut einsammelte und damit das Feuer vorbereitete. Er zeigte mir, wie feines Holz zum Anfeuern bereit zulegen war. Ich konnte selbständig Feuer machen. Ich konnte mir meinem kleinen Beil dünne Äste zerhacken und Scheiter ohne Astansätze zu Anfeuerholz spalten. Ich machte alles langsam und gab gut Acht. Ein Dreiradvelo und eine Schaukel hatten wir nicht, aber ich hatte eine weiche gestrickte Puppe, der ich alles erzählen konnte. Meine ersten Ferien war einen bei meiner Patin, mit unseren Kindern reisten wir in die Berge und die Enkelinnen fliegen jedes Jahr ins Ausland.
Wir hatte sich doch das Leben der vorschulpflichtigen Kinder seit dem Zweiten Weltkrieg verändert! Animiert durch diese Träumereien, besuchte ich ein Podiumsgespräch zum Thema “die Veränderungen in der Maschinenbauindustrie nach dem Zweiten Weltkrieg“. Ich wusste, das Vorkommen von Bohnerz, die grossen Wälder und das Wasser des Rheins hatten in den 150 Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg das Entstehen einer starken Maschinenindustrie begünstigt. Die Krisenjahre und der Krieg schüttelten Europa durch. Nach dem Waffenstillstand lösten die intakte Infrastruktur, die günstigen Arbeitskräfte, die harte Währung, die stabilen politischen Verhältnisse und der Nachholbedarf in den kriegszerstörten Nachbarländern die als „Wirtschaftswunder“ bezeichnete Zeit aus. Für die Arbeiter wurden günstige Wohnungen und eine betriebseigene Krankenkasse aufgebaut. Die Gewerkschaften handelten immer bessere Löhne aus und das Land entwickelte sich unmerklich von einem Billiglohnland in eine Hochlohninsel. Der Arbeitsfriede von 1937 und seine Erneuerung 1950 wurden bis in die 1960er Jahre hinein glorifiziert. Dank viel Eigenkapital konnten die Firmen im Ausland Fabriken zukaufen, aber es gelang ihnen nicht, die Betriebe zu koordinieren. Die Schwerindustrie wurde langsam zu einem Klumpenrisiko ähnlich wie die Banken anfangs der 2000er Jahre. Zusätzlich begann sich in den Jahren nach 1968 das Verhältnis zwischen den Arbeitnehmer und den Arbeitgeber zu ändern. Trotz guter Bezahlung wollte niemand mehr die harte, schmutzige Arbeit in den Giessereien auf sich nehmen. Die Arbeit auf dem Bau wurde vorgezogen. Man brauchte und wollte nicht mehr lebenslänglich im selben Betrieb arbeiten. Der Ölschock 1973 und der steigende Frankenkurs begünstigten die schleichende Deindustrialisierung zusätzlich. Zwischen 1970 und 1995 wurden ein Drittel der Arbeitsplätze abgebaut. Dies führte nicht zu massiven Problemen, da die Arbeitslosen exportiert oder altershalber pensioniert werden konnten. Aus Angst vor neuem Schmutz lehnte der Souverain 1984 den Bau einer Glasfaserfabrik ab. Der Dienstleistungsbereich öffnete der folgenden Generation neue Perspektiven. Verlies die Schwerindustrie die Schweiz oder kehrte die Schweizer Bevölkerung der Industrie den Rücken zu? Wahrscheinlich spielten beide Aspekte mit. 1992 wurde sie Stahlgiesserei im Mühlental geschlossen. Die langsame Umstellung auf Qualitäts- und Luxusgüter sowie der Innovationsschub mit neuen Produkten erleichterten die Neustrukturierung der Gesellschaft.
10. Hört wie es geschah
Mein Bruder begann das Diktat in seinem besten Stil, mit dem er die Stämme dazu zwang, an seinen Lippen zu hängen. „Am Anfang,“ sagte er, “vor fünfzehn Milliarden Jahren, gab es einen grossen Knall, und das Universum begann.“ Ich hatte schon aufgehört zu schreiben. „Vor fünfzehn Milliarden Jahren?“ fragte ich ungläubig. „Absolut, ich bin inspiriert,“gab er zurück. „Ich hinterfrage deine Inspiration nicht,“ sagte ich, „aber möchtest du die Geschichte der Schöpfung über einen Zeitraum von fünfzehn Milliarden Jahren erzählt haben?“ „Das muss so sein, denn die Schöpfung hat so lange gedauert. Ich habe alles in meinem Kopf. Es wurde mir von höchster Stelle eingegeben.“ Ich hatte mein Schreibzeug weggelegt und fragte: „Weisst du was Papyrus kostet?“ Trotz seiner Eingebungen hatte er keine Ahnung von so weltlichen Dingen. Ich begann: „Nehmen wir einmal an, du brauchst für die Beschreibung der Ereignisse von einer Million Jahre je eine Rolle Papyrus. Dann brauchst du für die ganze Schöpfungsgeschichte fünfzehntausend Rollen. Du wirst lange reden müssen und ich muss schreiben, bis mir die Finger abfallen. Selbst wenn wir uns diese Menge Papyrus leisten könnten, und ich die Kraft hätte, dein Diktat durchzuhalten, wer macht die Kopien unsere Arbeit. Wir brauchen hundert Exemplare, damit es rentiert.“ Mein Bruder dachte eine Weile nach, dann fragte er, ob er die Schöpfungsgeschichte wohl etwas kürzen sollte. „Erheblich“, erwiderte ich, “wenn du damit das Publikum erreichen willst.“ „Wie wäre es mit hundert Jahren?“ fragte er. „Wie wäre es mit sechs Tagen?“ fragte ich. Er sagte entsetzt. „Du kannst die Schöpfung unmöglich in sechs Tage hineinpressen.“ „Ich habe aber nur Papyrus für sechs Tage“, erwiderte ich. „Ach so“, sagte er und begann wieder zu diktieren. „Am Anfang ... Müssen es unbedingt sechs Tage sein, Aaron?“ Ich blieb hart: „Sechs Tage, Moses.“
11. Die Hausaufgabe auf den 25. Januar 2019: Langeweile
2018: Ein Plädoyer für die Langeweile oder eine Hängematte für die Seele! Meine Lesenden überspringen Sie diesen Text bitte. Für mein Empfinden stimmt der Gedankengang, aber ich bin mit dessen stilistischer Umsetzung nicht zufrieden.
2018 – Einladung des Fördervereins der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen zu einem öffentliche Vortragsabend: Emotionen im Klassenzimmer – Referat und Gespräch. Der Referent, Thomas Götz, sagte viel interessantes. Er erwähnte u.a. und das faszinierte mich: „Langeweile ist die spannendste Emotion. Es ist die einzige Emotion, die sich abschwächt, wenn die Situation wichtiger wird.“ - Der Vortrag war für mich zu schnell. Ich war müde und blieb oft an einem Gedanken hängen oder nickte ein. - Ich war hingegangen, weil ich in der Einladung die Frage: "Hat Langeweile auch positive Seiten"? entdeckt hatte. Rückblickend kann ich sagen, ich werde den Vortrag nicht vergessen, denn der "Langeweile" wurde endlich die Ehre erwiesen, die ihr geziemt. Langeweile ist verpönt! Niemand langweilt sich gerne. Langeweile ist und war aber das schönste meiner Gefühle. Langeweile, Zeit zum Verweilen, einfach sein, frei sein, nichts müssen, träumen, sich wohl fühlen, warten und sehen, wie ein Vogel vorbeifliegt. Vor diesem Vortrag hätte ich nie gewagt anzudeuten, dass ich Langeweile geniesse. Immer die abgedroschenen Routine-Fragen: Wie geht es dir? Was hast du gemacht? Wo bist du gewesen? Was planst du? Fragen, die ich in Momenten der Langeweile nicht beantworten kann und beantworten will. Die Langeweile gehört mir. Langeweile kann ich nicht teilen, sonst verschwindet sie. Ich brauche sie, um mich zu erholen, um Kraft zu sammeln, um das Ziel des nächsten Schrittes zu finden. Ich hebe den Fuss - und - schon ist die Langeweile verschwunden, ich weiss nicht wie – ich mache den nächsten Schritt und sie ist vergessen. Ich vermisse sie nicht und ich kann sie nicht suchen. Ich kann einplanen, sie zu finden. In jenem Moment, Mitten im Tippen hatte ich einen Gedankenblitz. Ich fand eine Erklärung für die mir negativ angelastete Langsamkeit, für meinen angeblich mangelnden Willen, schneller zu werden. Der Gedankenblitz: Ich gebe und nehme mir Langeweile und bleibe dran. In einem andern Worting, ich plane genügend Zeit ein, um meine Sachen in Ruhe zu erledigen. Der Referent gab mir die Erlaubnis, Langeweile mit Freude als spannend zu erleben. Dafür bedanke ich mich bei ihm an dieser Stelle. Es lebe die Langeweile, die Quelle der Kreativität. - Mein Mann hatte auch diesen Text freundlicherweise korrigiert, aber er teilte meine Meinung nicht.
Nachtrag 1: Passend zu Langeweile gibt es auch Tote Punkte, zwecklos scheinende Pausen, unbestelltes Land, Zwischenräume, den Stillstand, die Ruhe vor dem Sturm, die Totenstarre. – Meine Lesenden verstehen Sie mich bitte richtig. Ich atme ein, Luft strömt in meine Lunge (1). Ich atme aus, ich blase die Luft aus der Lunge (2). Meines Erachtens liegt zwischen (1) und (2) ein Toter Punkt, ein Wendepunkt ähnlich wie bei einer Schaukel oder einem Pendel. – Der Dirigent hebt die Arme, die Musiker achten auf und warten auf den Einsatz. Die Zuschauer werden ruhig. Nach einem Moment voller Konzentration, auf das Zeichen des Dirigenten setzen die Musiker ein. – Die Ernte ist eingefahren und das Feld liegt unbestellt vor uns. Was wird wohl angepflanzt? Ist eine Brache, eine lange Ruhe- und Regenerationsphase geplant? Kurzweilig - langweilig. Eine kurze Weile, eine lange Weile?
Nachtrag 2: Dank dieser Hausaufgabe habe ich gelernt zu sagen: Ich bin eine langweilige Frau und das ist gut so. Liebe Lesende, ich lasse Sie mit diesem Statement im Moment allein, doch es kommt, es kommt. Ich habe mir eine Notiz gemacht, denn ich will nächstes Jahr, 2020 über dieses Thema schreiben.

Das erste Jahr im Schulzimmer 1966 / 67
1. Wie bereitetest du dich auf die neue Aufgabe vor?
2. Nun noch drei Episoden, ein paar Sätze als Überleitung und weg!
1. Wie bereitetest du dich auf die neue Aufgabe vor?
1966: Ich hatte Artikel 27, Absatz 2 und 3 der Bundesverfassung von 1874 abgeschrieben. Sie lauten, „2die Kantone sorgen für genügenden Primarunterricht, welcher ausschliesslich unter staatlicher Leitung stehen soll. Derselbe ist obligatorisch und in den öffentlichen Schulen unentgeltlich. 3Die öffentlichen Schulen sollen von den Angehörigen aller Bekenntnisse ohne Beeinträchtigung ihrer Glaubens- und Gewissensfreiheit besucht werden können“. Diese Bestimmungen schienen mir sinnvoll, denn sie erlaubten den Kanton, ihr Schulwesen den lokalen Gegebenheiten anzupassen. In der Prüfung zum Fach Schulgesetzeskunde schrieb ich jedoch dem Trend gehorchend, diese Bestimmung sei längst überholt, denn sie erschwere den Kindern den Schulwechsel, wenn die Eltern den Wohnort von einem Kanton in den andern verlegen würden. Wie viele Kinder betraf das? Mir waren Umverteilungen innerhalb der Stadt bekannt, Schulhauswechsel, weil Klassen überfüllt waren, aber nicht von einem Kanton zum andern. Vereinzelt kamen Kinder aus dem Ausland.
Ich hatte den Lehrplan der Volksschule des Kantons Zürich (Erziehungsratsbeschluss vom 15. Februar 1905, unveränderter Neudruck 1960), in dem meine Abschrift von Art. 27 Abs. 2 und 3 BV als Buchzeichen diente, auf dem halbhohen Bettzeugkasten am Kopfende meines Bettes gelegt. So konnte ich immer wieder ein wenig darin herumblättern. I. Allgemeines (Seiten 1 -14) galt für alle Primarlehrer. Das gefiel mir gut. Er löste in mir ein lange vermisstes Gemeinschaftsgefühl aus. Es hiess u.a., „das Elternhaus und die Primarschule sorgen für die harmonische körperliche und geistige Ausbildung des Kindes zu einer möglichst einheitlichen lebenskräftigen Persönlichkeit“. In langen, schönen Sätze waren hehre Ziele zu lesen. Was versteckte sich hinter den einzelnen abstrakten Wörtern? Was bedeuten sie konkret? Wie war das in meiner mir längst vergangenen erscheinenden Primarschulzeit gewesen? Der Lehrplan hatte zwei Weltkriegen mit all den damit verbundenen Umwälzungen getrotzt! – Dann folgte II. Der Lehrplan der Primarschule (Seiten 15 - 49). Unter A. Der Unterrichtsstoff nach Ziel und Umfang: 1. Biblische Geschichte und Sittenlehre, 2. Deutsch Sprache, 3. Rechnen und Geometrie, 4. Realien, 5. Schreiben, 6. Zeichnen, 7. Gesang, 8. Turnen, 9. Handarbeit für Mädchen und Hauswirtschaft und schliesslich 10. Handarbeit für Knaben (fakultativ). Zu jeden Fach weitere knappe Grundsätze gefolgt von einer Stoffaufteilung nach Schulklasse. Ich suchte nach den Angaben zur 2. Klasse und las, was ich schon wusste, immer wieder langsam durch und versuchte, die Wörter mit Bildern zu füllen. Überhaupt, ich war entschlossen, mich stur an die vorgegeben Bücher zu halten, und diese orientierten sich am Lehrplan. Keine Experimente!
Das Rechnungsbuch kannte ich gut, denn es war lediglich eine Neuauflage unseres Buches von damals. Viel zu wenig Übungsaufgaben, dafür viele nicht brauchbare Erklärungen, hatte unser Lehrer vor Jahren geschimpft. Wir mussten mit der Zahlentabelle üben. Nein, nein, das müssen meine kleinen Schüler nicht! Matrizen werde ich für sie schreiben und diese im Lehrerzimmer vervielfältigen. Das war verpönt wegen des Geschmiers. Nach vier Uhr war das Lehrerzimmer frei, und ich konnte mich langsam und sorgfältig ans Werk machen. Der gute Geist des Hauses, der Abwart, half mir spontan. Er füllte sachte Flüssigkeit nach, spannte meine Matrize ein, drehte und es klappte. Nein, zu wenig Papier! Er holte Nachschub. „Getrocknet über Nacht, verschmieren sie nicht,“ wusste der Abwart. „Nie am Morgen, in letzter Minute durchdrehen, dann tauchen plötzlich manch Hindernisse auf. Ich kann ihnen nicht helfen, wenn das Lehrerzimmer voller geschäftiger Lehrer ist.“ 100 Kopien für zwei Klassensätze à 40 Exemplare und ein paar als Reserve. Wozu? Für Missgeschicke, als freiwillige Arbeiten oder – für Strafaufgaben. Ich zerschnitt die A4-Blätter in drei Streifen und so hatte ich viele kleine Übungsblätter für kleine Schüler. Sie liebten diese Zettel und verlangten an regnerischen Tagen zusätzliche Exemplare. Ich zeigte ihnen, wie ich die Matrizen sorgfältig Zahl um Zahl schrieb und verlangte von ihnen ebenfalls schöne mit Bleistift geschriebene Zahlen. Radieren war erlaubt, und das durfte auch Mama machen. Üben war das Ziel, warum sollte Papa da nicht korrigieren? Der winzige Albert mit den borstigen Haaren war ein problematisches Kind, besonders daheim, weil er sich mit dem Stiefvater nicht verstand. Einmal hatte der Knabe zufällig zwei Streifen bekommen. Auf besonderen Wunsch der Mutter gab ich ihm in der Folge immer zwei Streifen. Auf den einen schnell, schnell die Ergebnisse schreiben. Das konnte Albert, denn er war ein guter Rechner. Mit Unterstützung der Mutter verbesserte er dann die hässlich geschriebenen Zahlen. Sie berichtete mir: „Ein Geschmier, nicht zu glauben. Er drückt zu stark und seine Hände werden feucht. Ich kann kaum radieren, und er will es doch gut machen. Der zweite Streifen gibt ihm eine zweite Chance. Er liebt die Streifen. Nach dem Nachtessen zeigt der böse Bub dann seinem bösen Stiefvater, wie schön er schreiben kann. Mit dem sauberen Streifen darf er an dessen Schreibtisch sitzen, und er kann, kaum zu glauben, das Blatt langsam und schön ausfüllen.“ Einmal verlangte das Igelchen – er strahlte, wenn ich ihn so ansprach – viele Streifen und er streckte diese mir am Montagmorgen ausgefüllt hin, er habe damit Papa am Geburtstag überrascht. Alle Gäste hätten sich gefreut und sie hätten beschlossen, diese mir zu schenken. Ich bedankte mich per Handschlag bei ihm. Seither machte Igelchen daheim keine Schwierigkeiten mehr, und in der Schule schaute er mich nur noch gelegentlich mit seinen kecken Augen lustig an, bis ich lachen musste. – Ein trauriges Gegenbeispiel war Anita. Ihr strahlendes Gesicht erfreute mich zu beginn des Schuljahres täglich mehrmals. Sie wollte vorne mithalten, doch sie schaffte das nur mit Anstrengung. Sie wurde zu müde zum Strahlen. Ich sprach mit ihr. Sie erzählte mir, sie hüte nach der Schule ihre beiden kleinen Schwestern, damit die Mutter etwas dazu verdienen könne. Sie tue das gerne. Alle Grosseltern seien in Ungarn zurückgeblieben und sie wollten ihnen etwas schicken. Erst wenn der Vater heimkäme, könne sie sich hinter die Hausaufgaben setzen. Als ich sie fragte, ob ich etwas für sie tun könne, strahlte sie. Sie wünschte viele zusätzliche Rechnungszettel. Am Wochenende würde Dada gerne mit ihr üben, aber sie hätten keine Zettel. Sie meldete mir immer wieder, es sei viel besser geworden. Die kleinen Schwestern würden nun auch „schreiben“, und sie könne mit den Rechnungen anfangen, bevor der Vater komme. – Die scheue Alice, die den Hort besuchte, erbat auch leere Blätter. Auf meine Frage wozu antwortete sie: Ich erzähle es ihnen später. Ich war gespannt. Alice meldete mir, ging nicht, wir musste Brettspiele machen. Nochmals, ging nicht, wir mussten spazieren gehen. Dann sprang mir Alice am frühen Morgen bei der Eingangstüre entgegen: „Diesmal durfte ich die Lehrerin sein, ich durfte die Lehrerin sein. Meine Schüler haben Zettel gelöst. Wer fertig war, durfte auf der Rückseite zeichnen. Ich war die beste Lehrerin.“ – Carlo aus Italien schenkte die Rechnungen seinem Nono, und sie lösten diese gemeinsam in italienischer Sprache. Carlo musste acht geben, denn der Nono machte oft Fehler. - Alle Streifen wurden genützt. Mein Vorgehen freute nicht alle im Lehrerzimmer. Von den einen wurde behauptet, ich gäbe über das Wochenende Hausaufgaben! Für andere Lehrerkollegen durfte ich zusätzliche Kopien machen. Das ging ja in einem!
Ach, nun hatte mich mein Erinnerungsstrom weg von der Chronologie geschwemmt. Wie hatte ich etwas über meine kleinen Schüler tippen können, ich steckte doch noch in der Zeit, bevor ich den Schlüssel zu meinem Schulzimmer besass und bevor ich im Schulhaus ein- und ausging!
Meine Sorge galt dem Lesen. Ein schwerer Atemzug und meine schwierige Lesekarriere begann sich auszubreiten. Mit einem Faustschlag stiess ich sie in die Versenkung zurück. – Mir war klar, ich musste die Texte, die ich den kleinen Schülern vorlesen wollte, gut üben, um sie mit dem Inhalt zu fesseln. Ich dachte an ein Missgeschick im Praktikum: Eine Schülerschar hatte aus Spass, in Anlehnung an die vorhergehende Rechnungsstunde meine Lesefehler gezählt, statt dem Inhalt zu folgen. „Kopfrechnen, das können sie! Lesen, es war schon besser,“ war der freundliche Kommentar des Praktikumslehrers.-- Mein grösstes Ziel war eine Schar kleiner Leseratten. Wie konnte ich meine Schüler zum Lesen verleiten? Ratten ducken sich ruhig. Sie schnuppern, äugen und erfassen neugierig die Umgebung. Sehen sie etwas Fressbares? Ähnlich sollten die Kinder nach Buchstaben Ausschau halten. Ruhig sitzen oder still stehen und mit den Augen Buchstaben suchen. – Natürlich, wir hatten die Ratten auf dem Bauernhof verjagt und vergiftet. Sie hatten einen schlechten Ruf. Sie rupften und zupften an allem, machten eine Unordnung und brachten Seuchen. Den kleinen Ratten ging es an den Kragen, wenn sie sich nicht an die Regeln der grossen Welt hielten. „Ihr seid alles wohlerzogene Kinder, doch oft ist es langweilig. Das ist der Moment, in dem eure Augen die Umgebung ruhig und langsam nach Buchstaben absuchen könnt“, erklärte ich ihnen. Die Betonung lag auf ruhig und langsam. Wir übten als Gruppe im Schulzimmer. -- Zwischen durch ein wenig Bewegung, das macht das Lernen leichter: „Aufstehen, Fingerspitzen auf den Boden, Fingerspitzen an die Diele, hoch, hoch. Nach unten, noch oben, unten, oben, schnell, schnell, den Körper schütteln, absitzen und Arme verschränken. Alle keuchten. -- Die Schüler suchten und schüttelten die Köpfe: Die Frontwand ohne Buchstaben, denn die Wandtafel war frisch geputzt. Auf der linken Seite nur Fenster, rechts die Materialkästen und die Rückwand ohnehin leer. Die Kinder waren sich einig: Nirgends ein Buchstabe. Dann kam mein Versuch: Unter der Wandtafel standen zwei Schachteln. Darauf war zu lesen, Kreide weiss, Kreide farbig. Ich schaute nach links, Richtung Fenster. Die Kinder riefen: „Unser Wald.“ Richtig, ich hatte das Buch „Unser Wald“ am Morgen die Fensterbank gelegt. Eine Schiebetüre des hintersten Materialkasten rechts stand einen Spalt offen. Blaue und grüne Bücher waren aufgeschichtet. Thomas meldete sich: „Auf den Büchern steht etwas, zu klein zum Lesen“. Die Schüler hatten sich gedreht. Die Rückwand war leer. Kein Widerspruch. Durch solche vielen Spielchen sollte aus meinen Schüler in kleine Leseratten werden. Zu meiner Freude übten manchmal gute Schüler mit schwächeren, denn am Freitag in der Lesestunde addierten wir die Fehler aller Schüler auf, es zählte nicht die Einzelleistung. Wer Mühe hatte, durfte die Stelle im voraus auswählen und vorbereiten. Die Guten lasen den ganzen Text und ich rief sie auf. So erzielten wir eine tiefe Fehlerquote und wir freuten uns. Generell tiefe Fehlerquoten gehörte auch zu meinen Zielen.
Fürs Lesen gab es neu drei schmale Bändchen (ca. 60 Seiten) mit Thematischen Schwerpunkten: Güggerüggu s‘sch morge am drü! Der Wind, der Wind, das himmlische Kind und als drittes Kuckuck, Kuckuck, rufts aus dem Wald. Um meinem Gedächtnis 2019 nachzuhelfen, hatte ich die drei Bücher in der Forschungsbibliothek der Pädagogischen Hochschule Zürich ausgeliehen. Alice Hugelshofer hatte die Teste zusammengestellt, humorvoll illustriert von Hans Fischer. Zu beiden Persönlichkeiten finden sich Angaben in Google. Marie Meierhofer war die Dritte im Bund. Ich blätterte immer wieder hastig in den kleinen Büchern. Ich gab mir einen Ruck. Ich musste vorwärts machen, denn ich hatte für 2019 ein grosses Schreib-Programm. Sie wissen ja alle, wie es in der Schule so zu und her geht. Ich, als Lehrerin fühlte mich wie eine kleine Königin. Nun es war nicht Sinn und Zweck des Meet-my-Life-Programms, mich ein Didaktikbuch schreiben zu lassen. Ich beschränke ich mich auf drei Episoden.
2. Nun die drei Episoden, ein paar Sätze als Überleitung und weg!
Vorweg, in Sachen Schule waren wir alle Experten! Welche Erst-Lese-Methode war die beste? Alle konnten ihre Meinung begründen. Ich hielt mich in diesen Diskussionen zurück. Während der Ausbildung hatte ich bemerkt, dass bereits mein Primarlehrer die verschiedenen Erst-Lese-Methode gekannt und, nach seinem Gutdünken den Schülern anpasst, eingesetzt hatte. Von unsere Sechs-Klassen-Schule her wusste ich um all dieses verschiedene Schülermaterial. Nochmals Jahre später verstand ich, was mein Primarlehrer gemeint hatte, wenn er kopfschüttelnd meinte, wieder so ein gut gemeinter praxisferner Probedruck. Er war in der Entwicklung neuer Schulmittel engagiert. Unbewusst imitierte ich seine vorsichtige Haltung. Er war zu alt und ich zu jung, um gehört zu werden. – Ende Mai konnte ich im Stadthaus den ersten Lohn abholen. Vierzehn Hunderter und je eine fünfziger und eine zwanziger Note. Das Geld wurde uns in die Hand gezählt und wir unterschrieben. Der Kassier bestätigte mir, dass Männer und Frauen den selben Lohn erhielten. Das war mir sehr, sehr wichtig. 1‘470 Franken hatte unser erfahrener Primarlehrer 1956 als letzten Lohn erhalten. Nun erhielt ich als sog. Junglehrerin bereits den selben Betrag wie er. Das überraschte mich. Die Geldentwertung liess grüssen. – 700 Franken für die laufenden Monats-Ausgaben schien mir reichlich. Wozu wanderten 770 Franken auf das Sparbüchlein? Das verriet ich niemandem. Sie will ein Auto kaufen, hiess es. Ich schüttelte den Kopf und schwieg. Das war mein Geheimnis.
Als zweites: Das hätte ich nicht für möglich gehalten! Ich hielt während dem Tippen inne und verschränkte die Arme – die Freude, das Glück von damals erfüllte mich neu. Es war still im Schulzimmer gewesen. Mit geschlossenen Augen konnte ich die leisen Geräusche der tüchtig arbeitenden Kinder hören. Sie halfen sich sogar gegenseitig, ohne zu sprechen. Ich nickte ihnen zu, wenn sie den Blickkontakt suchten. Leise ging ich zu ihnen, wenn sie mit verschränkten Armen oder einem andern Zeichen Hilfe anforderten. An jenem Tag wurde das Leben schön und schöner. Die kleinen Schüler begannen zu summen. Sie sangen leise. Sie sangen. – Nun der lange Weg zu diesem schönen Erlebnis: Meine Unterstufen Schüler wussten, dass erst in der Mittelstufe und dort nur selten mit Wasserfarbe (Deckfarbe, umgangssprachlich Wasserfarbe genannt) gemalt werden durfte. Warum lagen dann zwanzig Farbkästen im Schrank? Wie sahen sie überhaupt aus? „Ich schaue sie nach vier Uhr an,“ bemerkte ich leichthin. Während der stillen Beschäftigung schwatzte niemand. Warum? Als ob sie meine Gedanken hätte lesen können, meldete sich Regula, sie wollte beim Anschauen dabei sein. Alle wollten dabei sein. Ich spürte, alle wollten dringend dabei sein. Wir unterbrachen die Arbeit, und ich gab den Tarif durch: «Wenn es läutet, packt ihr den Tornister, stellt diesen in den Gang, bewegt euch kurz tüchtig und wartet vor der Türe. Während des lege ich auf jede Bank einen Kasten.» Ein Geschrei und Gewühl im Gang! Nein, dem war ich nicht gewachsen. Ich schickte die enttäuschten Kinder heim. Im Lehrerzimmer wurde mir vom Benutzen der Farbkasten dringend abgeraten. Ein paar Kinder hatten daheim einen Versuch gemacht. „Nur Schwierigkeiten und Streit mit der Mutter beim Malen in der Küche,“ erklärten sie mir, das sei in der Schule nicht möglich. Hielt ich mich schon im Rechnen und im Sprachunterricht genau an die Lehrmittel, so wollte ich im Zeichnen dieses Experiment wagen. Mit vereinten Kräften schafften wir es – Schritt für Schritt! Die Schüler lernten gleichzeitig Schriftdeutsch verstehen und mit Wasserfarbe malen. „Wir malen, wir malen,“ versprach ich immer wieder und zeigte auf die Farbkästen, die gut sichtbar auf dem Schrank bereit standen. Ich verlegte das Zeichnen auf die Nachmittage mit der halben Klasse. Die Schüler sprachen gerne über den Umgang mit der Wasserfarbe. Ich notierte die Tätigkeiten und die «Gefahren» sowie das erforderliche Material detailliert auf die Wandtafel. Die Schüler lasen die Texte und schrieben sie emsig ab. Gleichzeitig beobachteten sie, wie ich einen Farbkasten herunter nahm, ihn leise öffnete, betrachtete, wieder schloss und auf dem Schrank verräumte. „Unterbrechen und zuhören. Es klappt heute alles gut. Sicher habt ihr gesehen, was ich gemacht habe. Ihr schreibt weiter und ich verteilte jetzt die Farbkasten das erste Mal. Wenn er vor euch liegt, könnt ihr ihn öffnen, anschauen, schliessen, weiter schreiben, wieder anschauen, wie es gut ist für euch. Bald, bald dürft ihr malen,“ versprach ich. Sie hielten den Kasten dann in den Händen, drehten, wendeten und beschnupperten ihn. „Ganz neu, ganz neu,“ hörte ich flüstern. Am Ende der Stunde verschwanden sie wieder auf dem Schrank. – Aus meiner eigenen Schulzeit fehlte mir die Erfahrungen mit Wasser- oder Deckfarbe, aber ich hatte oft meinem Vater geholfen, Landmaschinen zu revidieren und frisch zu streichen. Ich malte die kleinen Teile und die schwierigen Ecken. Ich malte alles, was nicht mit dem grossen Pinsel gestrichen werden konnte. Ich wusste, was man brauchte. Vor allem reichlich Hilfsmaterial, um für Missgeschicke gewappnet zu sein. – Die Schüler und ich sammelten weiche Lappen, leere Jogurtgläschen, Zeitungen, flache, kleine Teller … . Meine Lesenden, hier unterbreche ich nun den Didaktikunterricht. … Nur noch eine Aufzählung: Auf Ausschusspapier einer Druckerei malten wir Skizze um Skizze: einfarbig, Wolken, Gras, Blumen, kahle Sträucher und schliesslich jedes auf ein Blatt von guter Qualität einen Kirschbaum ohne Blätter und ohne Kirschen. Jede Woche malten wir die letzte halbe Stunde am Nachmittag. Zunächst malten die Kinder zehn Minuten nach Diktat, d.h. nach meiner Anleitung, dann frei. Es gab höchstens drei Blätter pro Kind und Stunde. Heim nehmen oder in den Papierkorb werfen, das war ihnen freigestellt. Um vier war die Schule aus und eine halbe Stunde später konnte ich das Zimmer abschliessen. Alles war in Ordnung. Die Heinzelmännchen durften kommen und über die Bänke hüpfen. – Unsere kahlen Kirschbäume! Aus Papierstreifen schnitten wir kleine rote Kirschen und grüne Blättchen und – wie schön – wir klebten diese an die kahlen Äste. Ich traute meinen Ohren nicht, ein Kinder summte, bald summten alle. Sie sangen: „Chum mir wänd go Chrieseli günge …. „Gestern war es so schön, wir mussten einfach singen,“ erzählten meine kleinen Schüler am nächsten Morgen. „Wir können mit Wasserfarbe malen.“ Wir malten noch oft.
Schliesslich die Besuche im Zoo: Das erforderliche Training in Selbstverantwortung war mir eine Herausforderung, wie das Malen mit Wasserfarbe, aber das wollen wir überspringen. In der Stadt wurde gespart, doch sie stellte Gratiskarten für Bus, Tram und den Zoo zur Verfügung. Davon gab es genug, denn wenig Lehrer liebten den Zoo wie ich. Die Schüler hatten verstanden, wenn alles klappte und der Ausflug auch für ein Vergnügen war, so ging ich gerne in den Zoo. Wir brachen jeweils um elf Uhr auf und verbrachten den Mittag im Zoo. Wir machten ein Picknick und sie lösten in Gruppen Arbeitsblätter. Über dem Ausgang des Zoos hing eine Uhr. In Sichtdistanz konnten die Elefanten beobachtet werden, und Elefanten sind meine Lieblingstiere. In Kleingruppen erkundeten meine „grossen“ Schüler den Zoo selbständig. Sie kamen zur vereinbarten Zeit zu mir, zu den Elefanten zurück. Alle waren pünktlich. Wir wurden von einem Asiaten beobachtet. Sie durften erneut ausschwärmen. Der Asiat nutzte die Gelegenheit und sprach mich auf englisch an. Trotz fünf Jahren englisch Unterricht tat ich mir schwer. Er gab mir seine Visitenkarte und vereinbarte schriftlich ein Treffen um sechs Uhr am Hauptbahnhof. Den Schülern spendete er Mineralwasser. Die Verkäuferin am Kiosk verstand englisch und verhandelte mit den Kindern. Es gab viel zu tuscheln. Die Eltern der Kinder warnten mich. Doch er wurde, obwohl er nicht meinen Vorstellungen entsprach, mein erster Freund.
Das Jahr verging schnell. Zur Enttäuschung der Eltern meiner Schüler verlängerte ich meine Anstellung als Verweserin nicht. Der Asiat entführte mich nicht. Er unterstützte meinen Entschluss, meine Fremdsprachenkenntnisse aufzubessern. Also machte ich, wie geplant, ein Zwischenjahr.

1. Paris, Paris – Ankunft
2. Paris, das Häusermeer
3. Musste es auf der Rückfahrt von Paris regnen?
1. Paris, Paris – die Ankunft, mein Herz hüpfte vor Freude
Einschub: Meine Lesenden, mein Herz hüpfte im Jahr 1967. Damals war es nicht hinterwäldlerisch, von Hand zu schreiben. Computer, Smartphones, Internet und Gips waren unbekannt. 2019, als ich diesen Text tippte, nutzte ich selbstverständlich diese technischen Mittel teilweise. Deshalb habe ich Ortsbeschreibungen weggelassen. Falls Sie die erwähnten Orte nicht schon längst kennen, bitte ich Sie höflich, diese via Google anzuschauen. Einschub Ende.
Ich hatte es geschafft. Die Lehrerkollegen hatten sich für meine Pläne nicht interessiert. Mein Schlummervater war dagegen. Der Asiat hatte bedauert, dass ich ihn allein zurückliess. Doch ich, ich hatte es geschafft. Es war Frühling. In meinem kleinen Bauerndorf wurden die Felder frisch bestellt, und ich fuhr nach Paris. Die Klubschule Migros hatte mir die Adresse des Hotels und der Schule schriftlich mitgeteilt. In Basel stieg ich in den Nachtzug um. Nach der Grenzkontrolle schlief ich im Couchet oben links tief und traumlos. Erst der Lärm im Gare d‘Ouest weckte mich. Fantastisch, ich war in Paris. Eigentlich sollte ich mit der Metro an den Place de la Concorde fahren, doch das wagte ich nicht. Kopfschüttelnd stand ich da. Ich mit meinen Gepäck, des französisch unkundig, das erste Mal Metro fahren, nein! Eine Afrikanerin zeigte mir einen Bus, der mit Place de la Concorde angeschrieben war. Ein Geschiebe, ein Gedränge, wir blieben im Stossverkehr stecken. Fantastisch. Ich hatte dem Buschauffeur mein Blatt mit der Adresse gezeigt, und er fuhr am Place de la Concorde eine Extrarunde. Er hielt an, zeigte auf das Schild „Rue Boissy d‘Anglas“ und schob mich mit meinem Gepäck auf die Strasse. Ich war da, fantastisch. Ich setzte mich auf den Koffer und wartete, bis der Sicherheitsdienst mich in mein Hotel spedierte. Das kam so: Zwei Männer sprachen mich an. Da sie keine Uniformen trugen, wies ich sie freundlich und klar ab. Sie zeigten mir ihre Ausweise und ich reichte ihnen meinen Pass und den Brief mit der Hoteladresse. Sie wechselten ein paar Worte, lachten und fassten mein Gepäck. Nach ein paar Schritten traten sie in ein Haus. Das war mein Hotel und die beiden Männer konnten mein Papier verifizieren. Kein Problem, ich war in der Gästeliste eingetragen. Ich wohnte im Zimmer 521. Der Garçon schaffte meinen Koffer über die ausgetretene Treppe hoch in den fünften Stock und erhielt kein Trinkgeld. Die Mademoiselle, eine kleine runde Frau brachte mir sofort das Frühstück aufs Zimmer: Milchkaffee, zwei Röllchen Butter, ein winziges Schälchen Aprikosenkonfitüre, ein Croissant und zwei Stücke von einem Bagette. Fantastisch. Die anderen Gäste quälten sich selber mit ihrem Gepäck durch das enge, düstere Treppenhaus nach oben. Erst viel später erfuhr ich, dass der Sicherheitsdienst diesen Service für mich angeordnet hatte. Er verlangte zusätzlich, dass ich mich beim Verlassen des Hotels abmeldete und bei meiner Rückkehr kurz grüsste. Lange durfte ich den Schlüssel nicht einfach hinlegen und später wieder selbständig abhängen. Ich wurde überwacht. Fantastisch. Ich war das verwöhnte Kind.
Jeden Tag sollte ich nun so ein feines Frühstück in meinem Zimmer serviert erhalten. Ein Anruf genügte. - Den Koffer hatte ich unter das Bett geschoben. Ich sass im Schneidersitz auf dem Bett. Ich war in Paris. Bald machte ich mich auf den ersten Erkundungsgang. Das Gässchen Boissy d‘Anglas begann in einer Ecke des Place de la Concorde, einem riesigen Platz voller Autos und einem Obelisken. Dann links und rechts Häuserfronten und nach ca. 500 m am andere Ende, ein grosser Platz mit einem antiken Säulentempel. Ehrfürchtig spazierte ich zwischen den Säulen durch. Vorsichtig öffnete ich das Portal des grossen Gebäudes eine Spalte. Nein, da konnte ich nicht hinein. Doch eine Hand winkte und forderte mich auf einzutreten. Mit einem Buch in der Hand wurde ich auf die hinterste Bank gesetzt. Ein katholischer Gottesdienst am frühen Abend. Der Chor sang. Ich verstand nichts. Ich sass dort und schaute mich scheu im grossen Innenraum um. Schliesslich fühlte ich mich bemüssigt, ein Dankesgebet zu denken. Es war das Gotteshaus „de la Madeleine“. – Am Sonntag zeigte mir der Garçon den Weg zur Schule und den Weg wieder zurück zum Hotelchen. Fantastisch. Was die braven Töchter doch alles verpassten!
Im Hotel erhielt ich einen gebrauchten Plan von der Innenstadt. Die Chefin machte sich Sorgen. Sie wollte nicht, dass ich gleich in den ersten Tagen in der grossen Stadt „verloren ging“. Und wir sorgten uns gemeinsam um ihre Mademoiselle. Diese kränkliche, schwere Frau brauchte dringend mehr Bewegung und Sonne. Sie wollte nicht allein „herumgehen“. Schliesslich verkoppelte uns die Chefin. Ich war bereit, mit der ortskundigen Kleinen Dicken spazieren zu gehen. Wir machten allerhand Erkundigungen:. Strassen, Alleen, Gässchen, Fussgängerzonen, Abkürzungen, das Ufer der Seine, Parkanlagen, die Notre Dame und andere Kirchen, verschiedenste Märkte. Mademoiselle war nicht trainiert. Wir mussten mit dem Bus oder Metro zurückfahren. Doch bald konnten sie besser gehen und wollte mehr sehen. Wir suchten nach Orten, die die sie fast vergessen hatte. Sie war im Quatier Latin geboren worden und hatte die Stadt nie verlassen, erklärte mir die Chefin.„ Le Bois de Boulogne! Rien que la nature“ ich spürte, da wollte sie hin und auch ich wollte den wunderbaren Ort sehen. Wir fuhren mit der Metro hin. Sie hüpfte und sprang die Treppen hoch und rief: „Bois de Boulogne, Bois de Boulogne!“ sie sprach auf mich ein. Was sollte ich sehen? Eine weiträumig, parkähnliche Gegend. Autos fuhren da herum. Meine Lesenden, bitte schauen Sie im Internet die entsprechende Photogalerie. Ich besuchte damals die fremden Städte nicht, um Bäume, Blumen und Parkanlagen zu sehen. Ich brauchte Bäume, um mich zu beruhigen. Die Bäume im Bois de Boulogne in Paris, im High-Park in London oder im Central-Park in New York taten mir wohl, es war mir, als sähe ich wie die Bäume in unserem kleinen Bauerndorf.
Nach unserem Ausflug in den Bois de Boulogne wechselte das Wetter, ich hatte viele Hausaufgaben zu machen, und Mademoiselle fuhr erstmals für zwei Wochen aufs Land in die Ferien. Anfangs Juni 1967 war der Sechstagekrieg zwischen Ägypten und Israel, 1956 die Krise um den Suezkanal, 1948 die Unabhängigkeitskrieg und vorher die Konzentrationslager. Warum wurden die Juden von solchen Kriegen und Unruhen verfolgt? Moshe Dayan, der Mann mit der Armbinde, war immer beteiligt. Meine Lesenden, all dies können sie Googeln.
2. Paris, das Häusermeer
Mit Mühe hatte ich als Kind eine gekürzte Ausgabe der beiden Heidibücher (1880 und 1881) von Johanna Spyri (1827-1901) gelesen. Dabei hatte mir meine Mutter geholfen, die fremde und alte Geschichte zu verstehen. Wir unterhielten uns sogar am Mittagstisch über Frankfurt, wohin Heidi vorübergehend gebracht wurde. Dabei tauchte das Wort „Häusermeer“ auf. Heidi war mit dem Kirchdiener auf den Münsterturm gestiegen und konnte von dort nur Häuser sehen. Niemand aus unserem Bekanntenkreis hatte in den 1950er Jahren das Meer je gesehen, aber wir ahnten, wie das Meer aussah: Wasser und Wasser bis an den Horizont, nichts als Wasser. Als Heidi mit dem Kirchendiener auf dem Münsterturm stand, sah es Häuser und Häuser bis an den Horizont, nichts als Häuser. Wenn ich jeweils mit meinem Vater auf der Anhöhe hinter unserem kleinen Dorf stand und wir die schönen Felder anschauten, so bestätigte er meine Vermutung, dass es wohl richtig ist, sich für eine grosse ausländische Stadt die ganze Gegend voller Häuser vorzustellen. Meine Phantasievorstellung wurde später durch den Film „Buddenbrooks, der Verfall einer Familie“ nach dem gleichnamigen 1901 erschienen Roman von Thomas Mann genährt und durch meine Eskapade nach Hamburg bestätigt.
Paris hatte mich überflutet, und ich liess mich gern überfluten. Ich schwamm im Häusermeer. Ich bewunderte den Eiffelturm aus der Distanz. Mehrmals stand ich darunter. Vor der Basilika Sacré-Coeur auf dem Montmartre breitete sich ein Häusermeer aus, und das sollte nur ein Teil sein? Mir war das zu viel. Ich konnte es nicht fassen. – Als der Asiat mich dann in Paris traf, und wir Hand in Hand durch die Stadt marschierten, gab es keine Diskussion. Wir fuhren mit dem Lift nach oben, hinauf auf den Eiffelturm. Wir schauten in alle vier Himmelsrichtungen. Auf meinen Wunsch machten wir eine zweite Runde. Es gab sehr viele Schaulustige. Er küsste mich, wir fuhren mit dem Lift nach unter und ich tauchte wieder ins Häusermeer. Dies Art einer Besichtigung empfand ich als äusserst brutal. – Ich hatte keine Zeit mir vorstellen, dass in all den vielen Häusern Menschen lebten. Versuchte ich es, begann ich zu verstehen, warum Busse und Metro immer überfüllt waren. Ich bekam und bekomme Angst. Diese Angst blieb mir erhalten. Ich mache mir Sorgen, wenn ich von der dauernden Bevölkerungszunahme höre. Ich muss mich immer wieder durch die Massenmedien überfluten lassen und ich lasse mich gerne überfluten, denn ich werde in die Jugend zurückgetragen.
3. Musste es auf der Rückfahrt von Paris regnen?
Eine Bekannte bat mich gestern, am 20. Mai 2019, ihren Briefkasten zu leeren, denn sie würden ein paar Tage nach Besançon fahren. Als ob sie meine Gedanken hätte lesen können, fügte sie an, per Zug, Greta Thunberg lasse grüssen. Ob ich Besonçon kenne? Ich lachte, ich sei vor mehr als fünfzig Jahren nach meinem Sprachaufenthalt in Paris mit dem Velosolex bis nach Besonçon gefahren. Dort hätten mich die Eltern mit dem Auto abgeholt. Ja, in so jungen Jahren, mit dreiundzwanzig. Sie fragte und fragte und ich erzählte. Ich könne mich an keine Details der Stadt Besonçon erinnern. Es habe am Morgen des Vortages gewindet und kräftig geregnet. Was tun? Ich hätte an Autostopp gedacht. Doch mit dem Solex? Noch sehe ich die Szene vor mir. Unschlüssig stand ich unter einem Vordach. Leute mit Schirmen warteten auf den öffentlichen Bus. Ein Lastwagen hielt an. Der Chauffeur war verspätet, er sollte verschiedene Paket abliefen. Er schimpfte über den unerwarteten Regen. Ich unterstützte ihn, indem ich ihm aus dem Bestellbuch die Angaben zu den einzelnen Lieferung vorlas. Wir kamen ins Gespräch. Schliesslich verstauten wir meinen Velosolex neben den Paketen unter der Plane. Er war bereit, mich nach Besonçon zu bringen, falls ich den ganzen Tag sein Handlanger sei. War das nicht gefährlich? Ich hatte keine andere Wahl. Es regnete den ganzen Tag. Dank unserer Zusammenarbeit, konnten alle Bestellung rechtzeitig ausgeführt werden. Wir nahmen in der Kantine eines Kunden gemeinsam das Mittagessen ein. Da er noch bei der Mutter wohnte, konnte er mich einladen. Er brachte mich in eine günstige Unterkunft für Fernfahrer. Das war für uns beide gut, denn die sexuelle Attraktivität fehlte. Um 11 elf Uhr hatte ich in Becançon an einer Kreuzung von zwei Hauptstrassen Rendez-vous mit meinen Eltern. Es war leicht bewölkt und die Sonnen schien. Ich traf 10:30 an der vereinbarten Strassenkreuzung ein. Fünf Minuten später hielten meine Eltern und versuchten sich anhand einer Karte zu orientieren. Da entdeckte mich der Vater. Er hatte Werkzeug mitgebracht, um den Velosolex zu zerlegen, damit wir ihn im Kofferraum verstauen konnten. Die Mutter erzählt von der bevorstehenden Ernte. Wir trafen rechtzeitig für die Fütterung der Tiere daheim ein. 32 Kühe waren zu melken.
Bus und Metro schienen mir in Paris sehr teuer. Sie waren häufig überfüllt. Unangenehm! Was tun? Ich wollte unabhängig sein und möglichst viel von der Stadt sehen. Den Sprachkurs für zwölf Wochen inkl. Unterkunft mit Frühstück hatte ich bereits in der Schweiz bezahlt. Das laufendes Budget konnte ich leicht einhalten. Das Geld reichte für alle von der Schule organisierten Exkursionen, für die Eintritte in die Museen sowie für Theater- und Konzertbesuche. Einer unserer Lehrer kam mit einen Velosolex in die Schule. Das schnellste Fahrzeug in den verstopften Strassen von Paris und ohne Parkplatzprobleme, lobte er sein Vehikel. Mein Notgroschen und mein ausländischer (schweizerischen) Führerschein machten es möglich. Nach ein paar Probefahrten gehörte der Solex mir. Als Dreingabe erhielt ich einen Reservetank mit drei Liter Spezialbenzin und ein Gummiband, um diesen auf dem Gepäckträger zu befestigen. Mit dem Solex durch Paris, das war fantastisch. Bald schlängelte ich mit Leichtigkeit zwischen den kriechenden oder stehenden Autos durch. Ich scheute das Gedränge auf dem Place d‘Étoile nicht. Immer gut aufgepasst, die Handtasche sorgfältig unter der Windjacke versteckt. Nur in Hosen und Halbschuhen fahren, um bei Schiebereien die Beine spreizen und das Gleichgewicht halten zu können. Mit dem Stadtplan besuchte ich systematisch alle Quartiere. Mein französisch hatte sich verbessert, ich hatte jedenfalls auf der Heimfahrt den Lastwagenchauffeur davon überzeugen können, mich mitzunehmen.
Der Asiat war neben Zürich, auch in Frankfurt, London und Paris geschäftlich unterwegs. Er besass meine Adresse von Paris und seine Sekretärin holte mich per Auto ab. Sie verlangte, dass ich meine besten Kleider anzog, und sie begleitete mich zum Coiffeur. Dann empfing der Asiat seine Bekannte aus der Schweiz in der Hotellounge. Die Besprechung war fertig. Er stellte mich kurz vor und wir verabschiedeten uns. Alle freuten sich auf das Wochenende. Er entliess den Geschäftschauffeur. Entsprechend seinem Motto „Städte werden zu Fuss erobert“, marschierten wir stundenlang Hand in Hand durch Paris. Die Monalisa und der Eiffelturm waren Pflicht. Für den Abend besass er zwei Karten für den Besuch in einem Nachtclub inkl. mehrgängiges Nachtessen ohne Alkohol. Er war Mohammedaner. Ich kannte damals die Bezeichnung „Muslim“ nicht. Wie so oft erzählte er mir von Pakistan, von seiner Religion und die geplante Wallfahrt nach Mekka. Seine Eltern hätten Gandhi persönlich gekannt. Mit Hochachtung sprach er von seiner Mutter, einer gebildeten Frau, obwohl sie Analphabetin war. Betreffend die Europäerinnen schüttelte er den Kopf und ermahnte mich, eine anständige Frau zu werden. Wir unterhielten uns auch über Hitler, er sprach und ich hörte zu, denn mein Englisch war zu schwach für eine Diskussion. Er wusste mehr und hatte als Asiat eine andere Sicht der Dinge. Wie Hitler Deutschland aus der Krise geführt hatte, fand er bemerkenswert. Die Endlösung verurteilte er. Doch es dürfe darüber gesprochen werden. Hitler habe die Gaskammern nicht erfunden. Es gebe noch ganz andere Formen von Grausamkeiten und Massenvernichtungen. Niemand spreche darüber, was sein Volk vor der Unabhängigkeit erlitten habe. – Er bedauerte, dass er nicht in der Lage war, in Europa einen passenden Partner für mich zu finden. Heimweh! Heimweh! Mich mit zunehmen, wäre zwar leicht, doch seine Familie würde mich verstossen. Das würde mein und sein Leben zerstören. Sein Lebensziel war, sich für den Aufbau von Pakistan einzusetzen. Ende August schifften wir unser Auto, einen grossen Opel mit einer ovalen Diplomatennummer, in Marseille ein. Er brachte mich zum Zug und macht auf dem Rückflug einen Zwischenhalt in Mekka.

London
1. Anfangs Oktober plante ich nach London fliegen
2. Anfangs Oktober flog ich nach London
1. Anfangs Oktober plante ich nach London fliegen
Paris, das interessierte die Leute in meinem kleinen Bauerndorf kaum. Die Dorfbewohner stellten lediglich fest: „Ah, du bist zurück!“ oder „Froh sollten sie sein, gemeint waren die Eltern, dass du jetzt wieder hilfst!“ Für mich waren Erntearbeiten Wellness und Fitness (Worte, die ich damals nicht kannte) in der frischen Luft nach den Wochen in Paris, an der engen Rue Boissy d‘Anglas, im engen Hotel Boissy d‘Anglas in Gehdistanz von der Champs-Elysées, vom Place de la Concorde, von der Madeleine et cetera. Willig schaffte ich Gras aus dem Schatten der Bäumen an die Sonne zum Trocknen. Eine nötige, aber unbeliebte Arbeit, die mir Zeit zum Träumen gab. Ich schwamm in einem Strom von Bilder aus Paris, von Geräuschen, von Stimmen vermischt mit Musik und Motoren, von exotischen Düften und dicker Luft in der Metro, von verschwitzten, müden Menschen oder gelangweilten jungen Männer, die sich im Gedränge amüsierten, von Gewürzen und Esswaren, deren Namen und Herkunft ich nicht kannte. – Chinesisch ist nicht gleich chinesisch. Ein Austauschstudent aus China zeigte mir, wie Suppe mich Stäbchen zu essen ist. In Hinterhof- und Kellerlokalen trafen wir seine Landsleute, Chinesen unter Chinesen und ich. -- Neben meinem in die Jahre gekommenen, schmalen Hotel, Boissy d‘Anglas ein ebenso schmaler Tante-Emma-Laden, hinten mit einer Stehbar, ein Mittagstisch für alte, echte Pariser Nachbarn. Ich hatte ein Dachzimmer mit einer Schwedin geteilt, einer Krankenschwester, die nach fünf Jahren Einsatz für das Rote Kreuz im Fernen Osten ein halbes Jahr bezahlten Heimaturlaub hinter sich bringen musste. Freiwillig wäre sie nicht nach Europa zurückgekommen. Ein paar Wörter „en français“ wären manchmal hilfreich. Darum hatte sie den Kurs gebucht. Sie teilte das Geld ein, wie ich es tat, nur ganz anders. Manchmal assen wir gemeinsam in der Tante-Emma-Stehbar. Die alten, echten Pariser freute das und sie luden uns oft zu einer Tasse Kaffee ein. -- „Bist du bald fertig,“ die Stimme der Mutter, sie holte mich in die Realität zurück. Die Getreideernte ging schnell vorbei. Trotz dem nass kühlen Sommer ein guter Ertrag. Ein Sprachkurs in London war mein nächstes Ziel. Das schien teuer und schwierig zu werden.
Einschub: Alles schien anders in England, auf der andern Seite des Ärmelkanals . Der Asiat kannte London, er hatte mir vieles erklärt. Es war für ihn kaum fassbar gewesen, wie schwer ich mir tat, mir seine Informationen zu merken. Da half nur wiederholen. Er schüttelte den Kopf. Wir mussten ins Freie. Wir marschierten, und er lernte auf Deutsch zu sagen: „Ein Pfund Sterling wird in 20 Schilling und jeder Schilling in 12 Pence unterteilt, ein Pfund entspricht 240 Pence. Die Abkürzung für Schilling ist ein s und diejenige für Pence ein d. Das englische Pfund hat einen Wechselkurs von 12.13 Schweizer Franken.“ Wir marschierten. Nach einem Stossgebet in seiner Muttersprache versuchte er voll konzentriert, diese Sätze auf Deutsch zu wiederholen. Dann ich auf englisch. Wir zählten die Fehler und lachten. In England ist Linksverkehr. Wasser gefriert bei uns bei Null Grad Celsius, in England bei plus 32 Grad Fahrenheit. Dann die Masseinheiten für Distanzen, für Flüssigkeiten und Gewichte! Wir hatten sie vor Jahren in der Schule gelernt und vergessen, wozu auch erinnern. Der Asiat schrieb mir all das auf ein Blatt. Meine Lesenden, an dieser Stelle habe ich 482 Wörter gelöscht und verweise Sie statt dessen aufs Internet, auf Google. Wir waren mit der Zahnradbahn auf die Rigi gefahren, und er hatte das Wort „Zahnradstange“ gelernt. Wie war er wohl nach der Pilgerfahrt nach Mekka in seiner Heimat empfangen worden. Einschub Ende.
Wir hatten mit der Kartoffelernte begonnen. Trotz oder gerade wegen des Vollernters war daraus eine harte Arbeit geworden! Das Förderband diktierte den Rhythmus. Es brachte ununterbrochen Steine, Erdschollen, Erdschöllchen und Kartoffeln. Vom Anfang der Furche bis zu deren Ende sortierten wir pausenlos. Alles musste weg, nur die Kartoffeln wurden in Säcke abgefüllt. Fliessbandarbeit, meinte der Vater und zündete den Stumpen an. Er stellte die vollen Säcke weg und überwachte die Maschine. Warum warf ich Steine und Erdschollen weg, bis ich zum Umfallen müde war? War es die neue Zeit, die Maschine, die uns zu diesem Tempo zwang? Wollte ich mich vor der Familie beweisen? Hatte ich Schuldgefühle? Ich konnte mit niemandem über meine Situation sprechen. „Jetzt hast du, was du gewollt hast,“ diese Aussage, die ich als Vorwurf empfand, hing während Jahrzehnten in der Luft. – Für das Jahr 2019 war mein Hauptziel, mit den Mitmenschen über mein Leben zu sprechen. Das war mir eine Herausforderung. Ich interessierte mich für die Freuden, die Erfolge, für die Sorgen und Nöte der andern. Ich war gewohnt zuzuhören und verpasste es, Fragen zu stellen oder selber etwas zu erzählen. Kaum hatte ich diesen Vorsatz hier, in diesem Text klar festgeschrieben, schaffte ich es leichter von meinem Gemüsegarten, meiner letzten Reise in den Kongo und meinen Enkelkindern zu sprechen. – Nun zurück in den Herbst 1967. Wir hatten bereits mit der Kartoffelernte begonnen und ich hatte den Englischkurs bei der Klubschule Migros in London noch nicht gebucht. Der Flug, der Flug! Wir hörten und beobachteten bei schönen Wetter viele Flugzeuge. Manchmal brummte eines am Morgen und eines am Nachmittage über den Himmel. Das hatten wir damals viel genannt! Bevor die Mechanisierung der Feldarbeit eingesetzt hatte, unterbrachen wir die Arbeit kurz und schauten wir den Fliegern nach. Wir waren uns einig: In den Flugzeugen gibt es viel Platz. Das Essen ist ausgezeichnet. Getränke nach Wunsch. Alles sauber. Die Air-Hostessen sind nicht nur freundlich, nein, nein auch schön! Wir kannten alle Lena von der Anhöhe. Sie arbeitete am Flugplatz, sie hatte schon ein Flugzeug von innen gesehen. Alle andern redeten nur vom hören sagen. Viele hatten in einem schönen Prospekt Angebote für Flug- und Schiffsreisen gesehen. Ich plante drei Flugreisen: Eine nach England, um aus eigener Erfahrung zu wissen, wie das so war. Sobald wie möglich in die USA. … und später, wenn ich viel Geld hatte eine nach Afrika, in den Kongo, um Frauen wie Alfis Mutter zu unterstützen.
2. Anfangs Oktober flog ich nach London
Dank schönen Wetter kamen wir mit den Feldarbeiten gut voran. Zu meiner Beruhigung hatten wir vereinbart, am nächsten Regentag mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Die Grossmutter brauchte dringend Tee, die Mutter musste persönlich auf der Bank vorsprechen und ich? Ich war die Chauffeuse. Endlich regnete es. Bei Wind und Regen hatten wir Mitten in der Stadt ganz in der Nähe des „Milchhüsli“ einen Parkplatz gefunden. Im Milchhüsli, heute würde man wohl sagen in einer Milchbar mit einer beschränkten Anzahl Sitzplätzen, hatten wir immer unseren Treffpunkt für die Heimfahrt. Wie meist war die Grossmutter zuerst dort. Sie reservierte immer sofort Sitzplätze für uns. Nur mit Mühe konnte sie diese jeweils freihalten. Das Geldgeschäft der Mutter war in nur fünf Minuten erledigt, in der Eisenwarenhandlung und im Sämereiladen gab es wenig Kunden. Die beiden Frauen warteten auf mich! Sie mussten warten. Wo blieb da mein ihnen geschuldeter Respekt? Sie verlangten, dass ich sie vor der Türe des „Milchhüsli“ abholte. Ob das verboten war oder nicht, das interessierte sie nicht, denn es regnete. Ich erwähnte, ich würde am ersten Freitag im Oktober nach London fliegen. Flug und Sprachkurs waren gebucht. Alles hatte auf Anhieb geklappt. Ich war erleichtert. Ich brauchte nichts weiter zu kaufen. Der Asiat hatte mir für den Flug nach London seinen Koffer geschenkt. Der Flug, mein erster Flug. Ich hatte mir alles wunderbar vorgestellt und war schliesslich enttäuscht. Das erste Mal ist doch alles schwierig und ganz anders als man erwartet, nicht wahr. Einschub: Seit 2009 fliege ich jedes Jahr für einen Monat in den Kongo und ich erlebe diese Flugreisen als wunderbar, so schön wie ich es mit damals ausgemalt hatte.
Mit London verbinden mich viele ruhige gute Gefühle. Ich erholte mich von den Anstrengungen der vergangenen Jahre, von Paris, von den Erntearbeiten und vom Abschied vom Asiaten. Ich wohnte bei einer Familie in einem der vielen Klinkerhäuser, lernte englisch und nahm an allen Aktivitäten der Schule teil. Für mein Empfinden war es kalt. In der Schule, einem umfunktionierten, stattlichen Wohnhaus waren nur die Schulzimmer an einer Zentralheizung angeschlossen. Zum Lüften brauchten die Fenster nicht geöffnet werden, denn von überall her strömte kalte Luft in die Räume. Ich fühlte mich in meine Kindheit zurückversetzt, ins Bauernhaus mit dem Kachelofen in der Stube als einziger Heizung. Im Haus unserer Gastfamilie, bei Margerite und Paul gab es im Wohnzimmer ein Feuer im offenen Kamin. Die Zimmer waren kalt. Für die beiden Studenten aus Paris war das unzumutbar. Sie brachen den Kurs ab. So war ich allein mit Margerite und Paul. Ich fühlt mich wie ihre Tochter. Jeden Abend machte ich am Familientisch mit dem offenen Kamin im Rücken die Hausaufgaben. Das empfand ich als romantisch. Margerite und Paul interessierten sich für meine Schreibereien und halfen mir. Das gefiel mir. Durch diese Plaudereien verbesserte ich mein Englisch. Paul korrigierte mich geduldig und liess mich das Gelernte am nächsten Tag wiederholen. Mit einer Bettflasche im Arm verschwand ich in meinen Zimmer. Als es kälter war, gab es eine Überraschung. Mein Bett war vorgewärmt. Bereits vor dem Gute-Nacht-Tee hatte Margerite unbemerkt eine erst Bettflasche unter meine Bettdecke geschoben. Am Morgen stellte sie im Badezimmer den Strahler ein, bevor sie mich freundlich weckte. Sie tat dies gern. Pauls erste Handlung war das Feuer im Kamin anzuzünden. Erst dann las er die Morgenzeitung. Beim Morgenessen fragte ich ihn nach den Neuigkeiten und Margerite steckte mir ein Lunchpaket zu. Paul erzählte mir vom Krieg und vom Königshaus. Wir sprachen von den Internatsschulen, vom Gesundheitssystem und von der erste Herztransplantation, die anfangs Dezember in Südafrika gelungen war. Sie drängten mich, meine Zähne kontrollieren und meine Erkältung kurieren zu lassen. All das gratis! Samstags besuchte ich die Innenstadt, Kirchen, Musen, Märkte und vieles mehr. Am Sonntag gingen wir gemeinsam in die Kirche. Das freute die beiden besonders. Nachher führten sie mich aus. Ich war ihre Tochter.
Meine Lesenden bitte stellen Sie sich via Internet eine Sight-Seeing-Tour nach ihrem Geschmack zusammen. Es gibt viel zu sehen. Nicht nur Paris, auch London ist eine fantastische Stadt.

Barcelona
1. Von London nach Barcelona
2. In Barcelona wurde kein spanisch gesprochen
3. Wir waren eine Geldquelle
4. Wie war Euer Alltag in Barcelona?
5. Spezielles aus Spanien
1. Von London nach Barcelona
Meine Lesenden, die Zeit verflog. Anfangs Januar 1968 brauste ich im Nachtzug Richtung Barcelona. Alles lief nach Plan. Ich staunte. Im September hatte ich ein Doppelpack gebucht: Für anfangs Oktober den Englisch Kurs und den Flug nach London und gleichzeitig für anfangs Jahr einen Spanisch Kurs in Barcelona und im Nachtzug einen Liegeplatz. Die Kundenberaterin hatte im ersten Moment gezögert. Sie wurde freundlich, als sie das Geld sah, denn damals war alles bar zu bezahlen. Rechtzeitig hatte ich den grossen Betrag auf der Bank gekündigt sowie Pfund Sterling und Peseten bestellt. Oh, du mein armes Bankkonto! Das Geld reichte, und es herrschte Lehrermangel. Eine Stelle war mir sicher, wenn ich mich in der Weihnachtszeit für eine Verweserstelle in Zürich anmeldete. Die Zeit verflog. Es klappte alles. Zunächst der Rückflug von London via Paris nach Kloten, so hiess der Flugplatz damals. Nach Auskunft des Reisebüros war es möglich, in Paris einen Zwischenhalt zu machen. Ich wollte die fantastische Stadt so oft wie möglich besuchen, doch die Reise dorthin schien mir teuer und weit. Nun kam das kleine Extra: Ich unterbrach den Flug in Paris für zwei Tage. Die Leute im kleinen Hotel freuten sich, als ich kam, und sie luden mich ein, bei ihnen als Privatgast zu übernachten. Wir erzählten aus unserem Leben und sprachen mehr als während den drei Monaten Sprachkurs. Sie wieder zu besuchen, schaffte ich später nicht. Dann folgte die Weihnachtszeit im kleinen Bauerndorf. Es wartete keine Feldarbeit. Am Familientisch waren meine Flüge kein Thema, zu fliegen, das gehörte sich für unsereins nicht. Doch jedes Familienmitglied fand eine Gelegenheit, mit mir alleine darüber zu sprechen. Die Grossmutter lud mich wieder und wieder zu einer Tasse Tee in ihr Stübchen ein. Sie hatte immer neue Fragen zur Fliegerei: Wie steigt man ein? Wo verstaut man das Gepäck? Wie findet man einen Platz? Wie sind die Sitze? Ist rauchen erlaubt? Gibt es ein Restaurant? Kann man durch die Fenster hinausschauen? Sie bedauerte, dass sie nicht mehr Geld hatte. Es reichte leider nicht für einen kleinen gemeinsamen Flug. Später, als ich sie zu einem Alpenrundflug einlud, fühlte sie sich zu alt für ein solches Abenteuer. Zudem hatte sie keine passenden Kleider. Der Vater liess mich wissen, er plane nach Amerika zu fliegen, wenn die Siedlung gebaut sei. Die Mutter wollte festen Boden unter den Füssen haben. Zugfahren ja, aber bereits auf einem Schiff fühlte sie sich nicht wohl. Ein Flug würde ihrem schwachen Herz schaden. Brüderchen und Schwesterchen hatten noch Zeit.
Keine drei Wochen nach London sass ich im Nachtzug nach Barcelona. Alle Liegeplätze waren besetzt und im Korridor kein Durchkommen: Koffer, Taschen, Pfannen mit vorgekochtem Essen, rauchende Männer. Eine fröhliche Stimmung und angeregte Unterhaltungen, ich mochte die Fremdarbeiter. Von Anfangs bis Ende Januar war Zwischensaison! Die Zeit reichte, um ihre Familien zu besuchen, bevor in den Bergen die Hauptsaison begann. Ich verstand kein Wort. All das wusste man damals einfach. Die Spanier galten als gute Arbeitskräfte in der Gastronomie. Sie bedienten die Deutschen in den vornehmen Berghotels. Es fiel der Name James Schwarzenbach. Den verstand ich. Schwarzenbach gehörte zur „Nationalen Aktion gegen die Überfremdung“, er war ein Gegner der mir sympathischen Spanier. Ohne ein Ort spanisch zu sprechen, reiste ich also nach Barcelona. Eigentlich hätte ich die Hauptstadt Madrid vorgezogen, aber man riet mir bei der Clubschule Migros dringend davon ab, in Madrid sei der Winter zu kalt. Ich befolgte den Rat, auch in Barcelona war es kalt. Viele sprachen vom Beginn einer neuen Eiszeit.
Wir brausten dahin. Ich lag im Couchette (aufklappbare Liegeplätze in dreier Etagen). Die Abteiltüre war zu. Erinnerungen stiegen hoch. In der Primarschule hatten wir gelernt, dass Klimaänderungen erst im Rückblick auf mehrere Jahrhunderte, ja Jahrtausende festgestellt werden könnten, Klimaschwankungen grössere und kleiner gebe es immer. Auf sieben fette Jahre würden sieben magere folgen. So sei der Weltlauf. In London war es kalt gewesen und in Spanien sollte es im Winter noch kälter sein. Das Problem schien mir eher bei der Art des Heizen oder des Nicht-Heizens zu liegen. Ich hatte Wollkleider im Koffer. Ich träumte weiter von der Primarschule. Wir hatten auch etwas über die verschiedenen Spurbreiten bei Zügen gelernten: Die normalen Züge der SBB, die Schmalspurbahnen in den Bergen und die breiteren Züge in Spanien und vieles mehr. An der Grenze zwischen Frankreich und Spanien sei der Wechsel von der Normalspurbreite und die Breitspurbreite. Ich hatte Portbou auf meiner Europakarte gefunden. Glücklich und in den warmen Wintermantel eingehüllt, fuhr ich dösend durch die Nacht. Doch, was war nun los? Warum sollte ich aufzustehen? Es war noch Nacht, aber Mann und Maus drängte mit Sack und Pack hinaus auf den Perron. Dort standen wir dann ruhig nebeneinander. Mir war unheimlich. General Franco fiel mir ein. Ja, ich reiste in das Land von General Franco. Deshalb sollte es keine Problem geben, obwohl mich einige Dorfbewohner gewarnt hatten. Ich werde mich als Ausländerin nicht politisch betätigen. Wir standen eine Stunde schlaftrunken herum. Dann begann sich eine Kolonne zu formieren. Schliesslich verstand ich die Situation: Die Grenzkontrolle! Ein Engpass. Zwei Zöllner kontrollierten den Ausweis und das Gepäck jedes Passagiers. Sie waren bewacht von zwei Uniformierten mit Gewehr bei Fuss. Ich, die einzige Fremde wurde durchgewunken. Das Interesse galt den Säcken und Taschen der Heimkehrer. Ein rauer Wind blies. Auf der andern Seite des Bahnsteigs, weit, weit vorn wartete ein kalter Zug auf uns. Richtig, in Portbou war der Wechsel von der Normal- auf die Breitspur. Nun wusste ich, was das bedeutete. Es wurde mir ein Sitzplatz am Fenster angeboten. Ich verstaute mein Schweizer Geld in der Tiefe des Rucksacks neben den französischen Franken. Dann kramte ich die Peseten hervor und merkte mir den Wechselkurs: 100 Peseten 65 Rappen, 1'000 Peseten 6.75 CHF, 10‘000 Peseten 67.40 CHF. Es hiess, in Spanien sei alles preiswert. Im Zug wurde uns nichts angeboten, so trank ich den Rest meines Tees und ass das letzte Stück von Mamas Bauernbrot. Der Morgen begann sich anzumelden und irgendwann fuhr der Zug langsam ab. Zunächst hielt er in einer Stadt im Landesinnen und nachher folgte er der Küstenlinie. Das Meer schäumte und die Wellen schlugen gegen die steile Küste. Eindrücklich. Um 10.30 trafen wir in Barcelona ein. Ich ging, wie schriftlich aufgefordert, ans Ende des Bahnsteiges und zog mein Namensschild aus der Tasche. Eine für mein damaliges empfinden alte Frau wartete auf mich. Für mein Gepäck hatte sie einem Veloanhänger dabei. Ich verstand nicht, was sie sagte. Nach einer Viertel Stunde fuhren wir in einem romantischen Lift in den fünften Stock. Ein Ehepaar begrüsste mich und ich wurde in mein Zimmer geführt. Die Frau brachte mir einen Krug heissen Tee. Irgendwie verstand ich, dass ich um 18 Uhr das Nachtessen bekam. Es war kalt. Ich machte es mir im Bett gemütlich und liess mir Zeit, um anzukommen. Ich war in Barcelona.
2. In Barcelona wurde kein spanisch gesprochen
In Barcelona wurde kein spanisch gesprochen! Die Schulleiterin, eine waschechte Katalanin erklärte uns dies in gutem Deutsch. Sie hatte als Sekretärin in der Schweiz gearbeitet und, wie sie sich auszudrücken pflegte, mehr als gut verdient. Das Heimweh hatte sie zurück getrieben. Heimweh war für sie ein Fluchwort. Heimweh flüsterte sie, wenn das Geschäft nicht lief, wie sie es sich wünschte, wie es nötig gewesen wäre, um ihre Träume zu realisieren: Heimweh – Heimweh. Ihr Geschäft, die Sprachschule, hatte sie in Zusammenarbeit mit der Clubschule Migros in der Schweiz, mit Universitäten in Frankreich und Privatschulen in den USA aufgebaut. Sie wusste, für die Franzosen waren die Kurse zu teuer und nur wenig Amerikaner interessierten sich für Fremdsprachen. Heimweh. Es blieben die Deutschen, ein paar Nordländer und viele Schweizer. Wir sprachen in den Pausen deutsch, wenn nicht ein Lehrer Polizist spielte und Spass mit uns machte.
Sie hatte uns erklärt, dass … . Meine lieben Lesenden geben Sie in Google „Katalonien“ ein und Sie wissen mehr, als uns die Schulleiterin erklärte. Was mir in Erinnerung blieb, war die Erkenntnis, dass in Spanien mehrere Sprachen gesprochen werden und das Gefühl, endlich etwas gelernt zu haben, was der Primarlehrer nie erwähnt hatte. Ich hatte mir bis anhin eingebildet, wir seien das einzige mehrsprachige Land. Natürlich hatte ich im Radio von den Unruhestifter in den Bergen, die Basken gehört, die wie die Kurden ein eigens Land wollten. Ich kannte ja unsere Jurassier, die sich vom Kanton Bern trennen wollten. Trotzdem ich wollte in Katalonien spanisch lernen. Wörter und Grammatik waren zu büffeln. Ich lernte eine kaufmännische Angestellte, Gerda, aus der Schweiz kennen. Die Arbeitgeberfirma hatte den Sprachkurs bezahlte. Sie fühlte sich gezwungen, ihr bestes zu geben. Wir wurden ein gutes Team. Sie wohnte bei einer Gastfamilie in einer Blocksiedlung am Stadtrand.
3. Wir waren eine Geldquelle
Die Gastarbeiter aus Spanien kamen nicht aus Freude an den Bergen zu uns. Nein, sie brauchten Arbeit und Geld. Materielle Not hatte auch die Schulleiterin ins Ausland getrieben, und das Heimweh hatte sie wieder in Heimat zurück gehetzt. Aus Not hatte sie die Sprachschule gegründet. Das hatte Mut gebraucht, aber es machte ihr Freude. Viele waren unzufrieden mit ihr. Oder waren sie neidisch? Die Putzfrau war dankbar, dass sie eine Arbeit gefunden hatte. Die Schulleiterin nannte sie Perle. Was gehörte zu einer Privatschule? Der Gedanke daran löste in meinem Kopf ein Wirrwarr aus. Ich dachte an den Bauernhof. Als Hausaufgabe hatten der Lehrling und Papa verschiedene Planskizzen gemacht. Das versuchte ich nun auch. Auf der Rückseite eines einseitig genutzten Blattes zeichnete ich ein kleines Häuschen. Das symbolisierte die Residenz der Privatschule. Sie bestand aus zwei Mietwohnungen im dritten Stock eines umgebauten Altstadthauses. Links die Kolonne mit den Einnahmen, das waren einzig unsere Schulgelder. Diese schienen mir tatsächlich hoch, bis ich rechts die Ausgaben aufzulisten begann. Mit zurecht geschusterten Sätzen stellte ich der Schulleiterin immer wieder Fragen und zwar wie verlangt auf spanisch. Von meinem Interesse überrascht, gab sie mir Privataudienzen in ihrem Büro, das immer abgeschlossen war. Wir unterhielten uns auf Hochdeutsch. Sie schenkte mir Vertrauen, und wir sprachen offen über Miete, Personalkosten, Einrichtungsgegenstände, Unvorhergesehenes, Büromaterial, Versicherungen, Strom, Wasser, Steuern, Reserven, Rückstellungen, Werbung, Kost und Logis für die Schüler, Schulbücher in Kommission u.a. mehr. Das Risiko trug einzig sie.
Im Laufe meines Aufenthaltes in Barcelona begriff ich langsam, dass Schülerinnen wie Gerda und ich Geldquellen war. Wir finanzierten die Privatprivatschule, wir brachten Arbeit und Geld, wir waren das Wasser. Ich liebte das Bild mit der Quelle. Die Sprachschule was das Reservoir. Sie war eine Geldquelle für viele. Früher, in der Primarschule und am Familientisch hatten wir uns oft über den wunderbaren Kreislauf des Wassers unterhalten. Vieles floss durch kleine und grössere Bäche weg. Doch ein Teil des Wassers wurde im Reservoir gesammelt und über ein Leitungssystem bis zum Wasserhahn in unsere Küche und unseren Stall gebracht. Dort konnten wir bequem soviel nehmen, wie wir brauchten. Die Bewunderung für diesen Vorgang begleitete mich bis ins hohe Alter. Was mir während Jahrzehnten als Selbstverständlichkeit erschien, begann ich zunehmend zu hinterfragen. - Nun aber zurück nach Barcelona 1968. Ich machte weitere Planskizzen. Ich zeichnete das Leitungssystem des Reservoirs, der Privatschule. Das Geld floss als Lohn zu den Lehrern und von dort zu deren Frauen, zum Bäcker, zum Müller usw. Plötzlich gab es überall Geld. Ich begann den Grund zu verstehen, warum Gerdas Gastfamilie dringend wollte, dass ich zu ihnen zog. Es gab zu wenig Schüler und sie brauchten das Geld, weil sie einen kleinen Roller gekauft hatten. Wenn Gerda und ich in der Mittagszeit über die Ramblas spazierten und nachher unsere Tasse Kaffee tranken, floss auch Geld. Der Kellner freute sich über unseren Besuch, denn es gab wenig Gäste.
Das Geld von Gerda kam von ihrem Arbeitgeber, denn sie war eine gute Sekretärin. Mein Geld hatte ich verdient und für diesen Kurs beiseite gelegt. Wir hatten beide eine Arbeitsstelle und einen guten Lohn. Das war uns eine Selbstverständlichkeit. Dem war aber in Spanien nicht so, darum mussten viele im Ausland Arbeit suchen. Die Schulleiterin verwandelte unsere Schulgelder wieder in Arbeit, in Löhne, in Einnahmen. Warum gab es in Spanien nicht genügend Arbeit? Auf diese Frage konnte mir die Schulleiterin keine abschliessende Antwort geben. Wir seien in Barcelona, um spanisch zu lernen, meinte sie.
Die Gastarbeiter aus dem Süden kamen nicht zu uns, um Deutsch zu lernen. Wie schafften sie es überhaupt, ohne jegliche Sprachkenntnisse bei uns zu arbeiten? Der Arbeitsmarkt sei ausgetrocknet, niemand wolle als Bauarbeiter, Kellner oder Knecht in der Landwirtschaft arbeiten, hiess es. Meine Eltern sahen das Problem frühzeitig auftauchen. Es gelang ihnen immer wieder, ein weiteres Stück Land zu pachten und den Viehbestand zu vergrössern. Doch wer machte all die zusätzliche Arbeit? Der Grossvater hatte sich von seinem Schlaganfall nicht mehr erholt. Er sagte, er sei noch recht, um mein Kindermädchen zu sein. Er zeigte mir, wie Feuer zu machen war, und wir erledigten viele kleine Arbeiten zusammen. Ich liebte ihn. Als ich in den Kindergarten marschierte, zweimal täglich 2.2 Km, kauften wir ein zweites, ein junges Pferd. Das sollte bald kräftig ziehen können. Ich war zwar gross, aber doch für viele Arbeiten noch zu klein und wegen dem Kindergarten zu müde. Wer machte all die Arbeit, die immer mehr wurde? Die Mutter schimpfte. Der Vater fiel zusätzlich aus, denn während vielen Monaten besuchte er am ersten Samstag einen Kurs. Er machte die Meisterprüfung und wir konnten einen Lehrling anstellen. Wir brauchten uns nicht beim Bauernverband anzumelden, damit uns irgend ein Italiener oder später ein Spanier zugeteilt wurde, der von der Bauernarbeit keine Ahnung hatte. Man wusste, dass der Bund mit Italien und Spanien Abkommen abgeschlossen hatte und Arbeitskräfte suchte. Gastarbeiter, Saisonniers wurden sie genannt. Sie arbeiteten neun Monate hier und mussten darnach wieder drei Monate in die Heimat zurück. Hie und da fragte ich mich kurz nach dem wie und warum. Dann war ich wieder von meinem eigenen kleinen Alltag überlastet. Es ging wohl noch vielen Zeitgenossen so. Die Gastarbeiter waren uns ähnlich, und sie gingen wieder zurück. Genaue Erinnerungen fehlen mir. Meine Lesenden, das Internet hilft Ihnen aus. Einschub: Erst in den 1990er Jahren kamen sie aus andern Kulturkreisen, aus Jugoslawien und der Türkei, auch sie gingen zurück. Dann kamen Flüchtlinge aus Ex-Jugoslawien und Sri Lanka, sie blieben. 2015 löste die Deutsch Bundeskanzlerin mit einer grosszügigen Geste und dem Satz: Wir schaffen das, seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa nicht mehr gesehene Flüchtlingsströme aus.
4. Wie war Euer Alltag in Barcelona?
Was machten wir ohne Handys, Smartphones, Facebook, Twitter, ohne Internet, Google und Mails? Gerda schrieb ihrem Schatz in die Schweiz täglich einen Brief. Und ich? Ich dachte über Geldflüsse und Menschenströme nach und lernte Wörter, die Gerda nicht wichtig fand.
«Büffel», war das Schlüsselwort, mit dem ich sie zum gemeinsamen Lernen, zum Zweikampf aufforderten. Das Wort «Büffel» weckte mich. Vorwärts, du Büffel, sagte ich in Gedanken, du willst doch nicht hinter der gescheiten, tüchtigen Gerda nachstehen. Ein Blick zur Seite genügte, ich konnte leichten Fusses neben ihr gehen. Die Arbeitgeberfirma hatte Gerda mit diesem Kurs ausgezeichnet, weil sie gescheit und tüchtig war. Darauf verwies sie immer wieder gerne. Das machte Eindruck. Meine zusammen geschusterten Erklärungen, den Kurs selber zu bezahlen, in der Hoffnung später die von Europa kolonialisierten Länder zu besuchen, interessierte kaum. Die Erzählung von «Alfi» wurde als abstrus abgetan. Und doch war Alfi bei mir. Sie war mit mir erwachsen geworden. Alfis gab es zu tausenden. Sie lebten nicht nur in Afrika, nein auch in Südamerika, in Indien und selbst in Australien. Nicht zum Plaudern oder um über unterschiedliche Meinungen zu streiten, war ich zu Gerda an den Stadtrand gezogen, sondern wir wollten unser Lernen rationeller gestalten. Wir waren beide auf schnell und viel arbeiten trainiert. In der Mittagszeit spazierten auf der Ramblas bis zu einem Kaffeehaus, das wir Altmänner-Café nannten, denn wir hatten darin niemand jemanden ausser ein paar alten Männern mit kleinen oder grösseren Bäuchlein gesehen, die an einem Glas nippten. Ramblas heisst die rund 1.2 Kilometer lange Flaniermeile im Zentrum von Barcelona, die den Plaça Calalunya mit dem Alten Hafen verbindet. Die breite Promenade in der Strassenmitte wird beidseits von Marktständen gesäumt. Dass es daneben noch Fahrbahnen mit ungeduldigen Fahrzeuglenkern und wendigen Motorradfahrer gab, und dann noch eine fast geschlossene Front Häuser, teils historische Gebäude, vergass ich immer wieder. Ich war in Ferienstimmung, hängte Gerda ein, lachte und forderte sie auf spanisch auf: »Erzähl mir, Du lieber Büffel, was hast du in der ersten Stunde heute Morgen gelernt? Und was in der zweiten und in der dritten?» Schau die schönen Blumen! Wer wird sie kaufen? Staunend liessen wir uns ablenken und plauderten in Mundart. Bald machte es den beiden Büffeln aber Spass, solch kleine Sätze auf spanisch zu sagen. Das war dann ok. Später, am Ende der Ramblas, wo der frische, Salz getränkte Meerwind die schwere Luft der Altstadt und die russigen Auspuffgase wegblies, dort wärmten wir uns im Altmänner-Café mit einer Tasse Kaffee. Wir sassen geschützt hinter dem grossen Fenster in der Sonne und konjugierten Verben. Wir büffelten alle unregelmässigen Verben in allen Zeiten und allen Formen und bildeten kleine Sätze. Wir zählten zu den Stammgästen. Der Kellner reservierte uns den immer selben Tisch und brachte uns spontan den Kaffee. Er hätte gerne ein paar Worte mit uns gewechselt, aber er, der stolze Katalane zögerte spanisch zu sprechen. Als ob er unsere Gedanken hätte verstehen können, setzte er sich mit seiner Zeitung an unseren Tisch und begann uns vorzulesen. Er war kein Analphabet, wie ich vermutet hatte.
2019: «büffeln» ist das ein schriftdeutsches Wort? Die https://synonyme.woxikon.de half. Es wurde mir folgende Gruppe angeboten: lernen, wiederholen, ochsen, büffeln, arbeiten, pauken, ackern, schuften, abmühen, einbläuen, durchkauen, speichern und einprägen.
Sonntags lief das Büffel-Programm weiter, doch wir waren unterwegs. Zunächst gehörten wir zu den Schaulustigen, die frierend vor der gotischen Kathedrale den «Eingeborenen» zuschauten, wie sie sich zu Livemusik in langen Reihen in nicht ganz einfachen Schrittfolgen wiegten. Sie tanzten Sardana, den katalanischen Nationaltanz. Die Kathedrale Santa Maria del Mar stammte aus dem vierzehnten Jahrhundert. Waren die Tanzenden dann plötzlich in der Kirche verschwunden, stöberten wir durch die kleinen Läden in der Altstadt, bevor wir den Sonntag an der Theke in einem vornehmen Restaurant mit einer Paella zelebrierten. Die Gäste, meist ältere Ehepaare sassen an weiss gedeckten Tischchen und besprachen die Menükarte in katalanisch. Viele bestellten wie wir kurz entschlossen Paella. Der Kellner deckte uns auf der rechten Seite der Theke auch weiss. Bei unseren ersten beiden Besuchen sprach er englisch. Zwei junge schöne Mädchen vorne zu haben, gefiel ihm. Er wollte nicht, dass wir an ein Tischchen wechselten. Vorne das sei gut, das sei eine Abwechslung für die Stammgäste. Und ich konnte seine Stammgäste beobachten. Einige der Frauen präsentierten sich in der lokalen Tracht mit prächtigem Kopfschmuck. – Zur Paella gehörte als Aperitif ein Gläschen Weisser mit Oliven. In den nüchtern Magen Wein, das fuhr ein und ich begann zu lachen. Wollte ich wie Gerda Mineralwasser trinken, wehrten der Kellner und Gerda ab, mein Lachen gefalle doch allen. Das gehe vorbei. Zum Abrunden gebe es Kaffee, ich könne auch zwei haben. Bald erfüllte er meinen Wunsch, spanisch zu sprechen, gerne. Ich hatte Vokabular vorbereitet, um etwas vom Bauernhof in der Schweiz erzählten zu können. Es klappte recht gut. Gerda machte mit. Das war unser Alltag.
5. Spezielles aus Spanien
Ich wurde langsam müde. Spezielles? Es gab vieles. Ich nahm, was mir am Wegrand begegnete. Anstrengen? Nein, das ging nicht mehr. – Als wir 1968 dort waren, wurde nicht über „ihn“ gesprochen. Doch er war präsent. Sein Bild hing in allen öffentlichen Gebäuden, Schulen und Restaurant. Er gehörte dazu, er, General Franco. Ich war zu müde, um nachzufragen. In Madrid wartete der Prado und in Granada die Alhambra. Im achten Jahrhundert, das hiess im meinem Gedächtnis Siebenhundert und etwas, hatten die Mauren grosse Teile Spaniens und Südfrankreichs erobert. Von deren Kultur zeugte u.a. die Alhambra in Granada. Ich wollte keine weiteren Reisen planen. Die Basken sollen den Mauren widerstanden haben. Ich habe die Basken und unsere Jurassier immer irgendwie bewundert. 1453 standen die Mohammedaner vor den Toren Wiens. Meine Lesenden, sie können mein Gedächtnis via Google überprüfen. Im Moment bin ich des Tippens müde, müde wie so häufig in meinem Leben. Zu jedem Stichwort fällt mir viel ein, aber ich will die versteckte Welt nicht schriftlich festschreiben. Wollen Sie mehr wissen? Klar, Google würde gerne helfen. Warum wird in Südamerika spanisch und portugiesisch gesprochen und nicht englisch wie im Norden? Das ist nur eine rhetorische Frage. Darüber habe ich bereits damals nachgedacht.
Die farbenfrohen Mosaike im Park Güell, die Basilika Sagrada Família beides von Antoni Gaudí, die gotische Kathedrale, schön, aber ich war «voll». Mein «Programm» war mir zu viel geworden. Gerda und ich waren in Barcelona, um spanisch zu lernen. Die definitive Zusage für eine Verweserstelle hatten mir meine Eltern nachgeschickt. Nun brauchte ich noch ein Zimmer in der grossen, vertrauten Stadt am See. Ich freute mich, ich brauchte als Abwechslung den Alltag in einem Schulzimmers.
Für mich völlig unerwartet, wurde Gerda am Ende des Kurses von ihren Eltern abgeholt. Sie planten mit ihr, eine kulturelle Rundreise durch Spanien zu machen. Da ich noch genug Geld hatte, überschwatzten sie mich mitzureisen. Wir hasteten drei Wochen von einem Höhepunkt zum andern. Das war zu viel für mich. Das blieb meine einzige kulturelle Reise. Gerda blieb weitere drei Monate in Barcelona und ihre Eltern boten mir an, nach der Rückkehr in Gerdas freiem Zimmer zu wohnen.
Mein Zwischenjahr ging zu Ende. Es wäre nötig gewesen, nochmals darüber nachzudenken. Dazu gab ich mir keine Zeit. Warum nicht?

Das zweite Jahr im Schulzimmer 1968 – 69
Ein paar Details und Summerhill
Mit einer kleinen Notiz aus Spanien hatte ich mit der Schulhausvorsteherin Kontakt aufgenommen. Sie teilte mir freundlich mit, die Lese- und Rechnungsbücher würden bereit gelegt und die Schüler brächten die angefangenen Hefte aus der zweiten Klasse mit. Sie beglückwünschte mich zu meinem Auslandsaufenthalt.
2019: Um die quirlige Erinnerungsfülle zu ordnen, hatte ich in der Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Zürich die vier Lesebändchen für das dritte Schuljahr, erste Auflage 1958, ausgeliehen. Ich erschrak. Wie war mir jene Zeit fremd geworden. Ich hatte die Texte in guter Erinnerung, doch nun, nein, so etwas konnte ich kaum lesen. Ich nahm die kleinen Bücher immer wieder in die Hand, ich blätterte darin und hatte Mühe, auch nur eine Erzählung vollständig zu lesen. Ich sprang von Seite zu Seite. Eine Fülle von Verniedlichungen, schablonenhafte Bilder einer heilen Welt. Das galt als Kind gerechte Sprache? – Gleichzeitig überschwemmten mich die Erinnerungen mit vielen kleinen Details. „Nein, nein,“ ich hielt mich zurück, „ du darfst kein Didaktik-Buch schreiben, Ausrufezeichen.“ Es machte mir Spass «Ausrufezeichen» als Wort und nicht als Satzzeichen zu schreiben. Das passte in jene Zeit, denn ich liess die Schüler manchmal die Satzzeichen laut lesen, um ihr Empfinden für die Sätze zu stärken. Doch wie fasse ich ein munteres Schuljahr mit rund vierzig Kindern zusammen? Diese Zahl war nicht fix, ein paar Schüler zogen weg, andere kamen dazu, viel Verschieberei innerhalb der Stadt. Ich träumte nach dem Tippen von meinen Schülern. Ich sah den Klassenspiegel vor mir.
Und die Aufregungen mit den Kaulquappen! Bis wir nur ein paar in einem kleinen Sumpf entdeckt hatten. Viel zu gefährlich, um sie gemeinsam zu fangen! Ich ging später allein zum Teich. Ich rutschte mit den Stiefeln aus. Endlich erhaschte eins der kleinen Dinger, noch eins und noch eins. Schliesslich hatte ich mehr als wollte. In einem Aquarium auf dem Tisch neben der Eingangstüre beobachteten wir die Entwicklung dunkeln herum schwänzelnden Klümpchen. Zu zweit, zu dritt oder auch allein durften die Schüler die Tierchen aus der Nähe anschauen. Innert zwei Wochen hatten es alle Schüler geschafft, mit jemandem am Ufer eines kleinen Baches zu spazieren. Das Wort «schaffen» ist richtig, wenn ich an Julius denke, der mir strahlend erzählte, er habe die Eltern nicht für einen Ausflug an den nahen Bach begeistern können. Die Grossmutter und er hätten beschlossen, allein zu gehen. Dann, zu seiner Freude standen die Mutter und auch der Vater unerwartet in Werktragkleidern und Gummistiefel da, und sie gingen gemeinsam. Selbst der kleine Bruder sei tüchtig marschiert. Was es da nicht alles entdeckten gab! Blumen, Gräser, Holzstücke, Sträucher, Insekten, alle Sachen wollten einen Namen haben. Wir machten Listen und bildeten mit den Wörtern Sätzchen. Da war der Diminutiv jener Zeit. Die Kaulquappen bekamen zwei, dann vier Beinchen. Sie schnappten nach Luft und verlangten nach immer mehr Fischfutter. Kleine Holzstücke dienten als Inseln. Viele sassen darauf, der Platz wurde knapp. Wir legten mehr Holz ins Wasser. Und dann! Als ich eines Morgens ins Schulzimmer trat, entdeckte ich ein Fröschchen auf der Tischfläche. Nein, sie hüpften am Boden herum. Welch eine Nachlässigkeit, dass ich das Abdeckgitter nicht auf das Aquarium gelegt hatte. Voller Freude halfen die Schüler beim Einfangen. Am Nachmittag brachte Ruth den Kinderwagen der kleinen Schwester. Nach der Schule luden wir das Aquarium auf und fuhren damit zum Weiher. Wer wollte, durfte einen kleinen Frosch auf die Hand nehmen und beobachten, wie er atmete und hüpfte. Wir wünschten ihnen eine gute Reise hinaus in der gefährlichen Welt.
Zum Thema Vögel machten wir ein Plakat. Die Kinder schnitten daheim aus Zeitung Bilder von Vögeln aus und wir klebten sie auf ein grosses Blatt an der Rückwand des Zimmers. Sie brachten leere Nestchen und allerhand Federn und Eierschalenreste. Welch ein Glück, und später welche Enttäuschung: Zum Thema passend hatte hinter dem Fensterladen im Lehrerinnen-WC, ganz hinten – man sah es nur, wenn man es wusste – eine Amsel ein Nest gebaut. Bald lagen fünf kleine Eier darin. Wenn wir allein auf der Etage waren, durften die Kinder mit meiner Erlaubnis auf Beobachtungstour gehen. Die Jungen schlüpften, und wir konnten zuschauen, wie die Eltern Futter brachten. Ganz leise, leise. Wir staunten und freuten uns gemeinsam. Bald wollten sie fliegen lernen. Sie ruderten wild mit den Flügeln im Nest herum und hüpften auf das Fenstersims. Dann war das Nest weg! Die Putzfrauen hatten gemeldet, der Türgriff sei immer verschmiert. Der Hausabwart kontrollierte und putzte persönlich gründlich. In der nächsten grossen Pause informierte er die Lehrerschaft von seiner schrecklichen Entdeckung: Wie leicht hätte jemand mit einer von Vögeln übertragbaren Krankheit angesteckt werden können. Das Nest war weg.
In jener Zeit wurde viel Wert auf Bewegung gelegt. Freude am Turnen war wichtig. Nicht ich, sondern die Kinder sollten sich bewegen. Dieses Ziel erreichten wir durch gut organisierten Postenlauf. Der Turnexperte hatte uns besucht und den Einsatz und das Können der Kinder gelobt: Kletterstange, Reck, Handstand u.a. wurde im Rundlauf geübt. Nach meinen Fertigkeiten gefragt, schüttelte ich den Kopf. Alles, was ich Oberseminar hart antrainiert hatte, war weg.
Summerhill, Summerhill, der Begriff begleitete mich und löste beim Tippten 2019 einen Erinnerungsflut aus. An einem regnerischen Maitag 1968 hatte ich eher gelangweilt in einer Buchhandlunge Erziehungsbücher angeschaut. Mit einem blieb ich stehen und las und musste es kaufen. Es hiess: „Erziehung in Summerhill. Das revolutionäre Beispiel einer freien Schule“ von Alexander S. Neill. Niemand sprach davon, obwohl es in den USA und in England ein Bestseller war. Einschub: 1969 erschien dasselbe Buch in einem anderen Verlag unter dem Titel „Theorie und Praxis der antiautoritären Erziehung, das Beispiel Summerhill“. Nun verkaufte es sich gut und viele schimpften über die sog. antiautoritäre Erziehung. Einschub Ende. Was brachte mir Summerhill, warum war ich so fasziniert? Als erstes verstand ich, es sei wichtig, Gelerntes sofort umzusetzen. Das versuche ich seither. Auch wenn ich oft scheitere, so kann ich sagen, schade, doch ich habe einen Versuch gemacht. Weiter blieb mir die Aufforderung, als Lehrer jeden an die Schüler gerichteten Satz so zu formulieren, dass der Schüler diesen in gleicher Form an mich richten kann. Erwarte ich ein Lächeln und ein Dankeschön, soll ich lächelnd Danke sagen. Am nächsten Morgen hatte Julius meine Verhaltensänderung sofort bemerkt. Er war auf mich zu gehüpft und lachte mir ein „guten Tag“ entgegen. „Einen guten Tag wünsche ich dir auch,“ sagte ich und schaute ihm in die Augen. Er strahlte zurück: „Sie sind guter Laune!“ Angeregt durch Neill konnte ich alle meine Schüler anlachen und schon die erste Stunde begann in guter Stimmung, genau so wie ich es wünschte. „Es regnet draussen und wir sind guter Laune,“ ich konnte meine Freunde mit den Schülern teilen, wie Neill das anregte. Nach einem Moment der Ruhe und der Konzentration zu Beginn der Stunden, spürte ich, wie die positive Welle einsetzte. Alle arbeiteten tüchtig. Während der Abschiedsphase von meiner Grossmutter hatte ich einen ihrer Leitsätze ins Schulzimmer gebracht. Er lautete: „Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem anderen zu.“ Regula kam am nächsten Tag zu mir und erklärte: „Ich habe über den Spruch ihrer Grossmutter nachgedacht, wir können auch sagen: Was du möchtest, das man für Dich tut, das mache du für die andern.“ Ich staunte und fragte Regula: „Was möchtest du?“ „Sofort lesen und viele Hausaufgaben bei diesem Regenwetter.“ Roland schlug zwei Hausaufgaben vor. Sie riefen Diktat vorbereiten und Lesen. Gut, wir waren schon mitten in Summerhill: Den Kindern war soviel Freiheit zu geben wie möglich, doch sie hatten sich dabei an Regeln halten. Der Lehrer hat das Recht und die Pflicht, sich zu schützen. Die Schüler und ich, wir mussten lernen, Rücksicht zu nehmen. Ich musste lernen, rechtzeitig Rücksicht zu fordern. Ich musste den Mut haben zu sagen: Mit fällt nichts ein, ich weiss nicht, wie man das macht, oder ich kann mir nicht vorstellen, wie wir das gemeinsam tun. Dazu gibt ein schönes Beispiel: Es war mehrere Tage sehr heiss gewesen, und es war nicht möglich, uns kurzfristig für einen Schwimmbadbesuch anzumelden. Unser Termin war erst in zwei Wochen. Die Gartenanlage litt unter Trockenheit. Vor unseren Fenstern lief der Sprinkler, was angeblich störte, weil Kinder immer wieder nass ins Schulzimmer kamen. Ich sprach ein ernstes Wort mit meinen Schülern. Nach der Pause machten sie mir einen lustigen Vorschlag. Sie versprachen ruhig zu rechnen, damit ich den Hausabwart fragen konnte. Es war möglich, und es klappte gut. Am Nachmittag kamen die Schüler mit einem Badetuch in die Schule und die Badehosen trugen sie unter den Kleidern. Der Sprinkler stand hinter der Turnhalle bereit. Sie zogen sich im Zimmer aus und los gings zum Sprinkler. Die Tücher lagen unter dem grossen Baum, und ich drehte das Wasser an: Ein Gekreisch und Geschrei, kalt, kalt. Wasser abstellen? Nein, nein, ich schlug ihnen kleine Spielchen vor. Dann trockneten sie sich ab, legten sich an die Sonne und hörten zu: Ich las ihnen vor. Nach einer weiteren Runde Sprinkler, Kopfrechnen und dann zurück ins Schulzimmer. Die Kinder waren sich einig, das war lustiger als ein Besuch im überfüllten Schwimmbad. Mir war klar, das war möglich, weil ich Neill las. Ich erwähnte meine neue Lektüre im Lehrerzimmer. Sofort wurde über antiautoritäre Erziehung geschimpft, obwohl keiner das Buch nur in der Hand gehalten hatte.
Nach den Herbstferien hatten wir ein wirklich neues Thema. In der Kinderstunde, am Freitag zwischen 17:30 und 18 Uhr begannen Jeanette und Martin Plattner, zwei Programmgestalter von Radio DRS eine neue Kinder- und Jugendsendung: Eine Sammelaktion, mit deren Erlös behinderten Kindern Freizeit- und vielleicht auch Ferienträume erfüllen werden sollten. Schulklassen und Pfadfinder wurden zum Mitwirken aufgefordert. Meine Klasse war sofort voll dabei. Mir graute vor so vielen Bastelarbeiten, Staubfängern. Ich bremste den Elan nicht, sondern liess die Kinder daheim basteln, was und soviel oder so wenig sie wollten. Wir sammelten die Sachen in Schachteln für einen Verkauf. Vom Bauernhof brachte ich zwei kleine Säcke Kartoffeln, eine Haarrasse Äpfel und frischgebackenes Bauernbrot, einen ganzen Ofen voll. «Wenn wir früh sind, und der Platz noch frei ist, dürfen wir am Samstagmorgen unsere Sachen unter dem Vordach der nahe Apotheke anbieten,» diese Abmachung war mein Beitrag. Es klappte gut. Als ich halb sieben mit dem Auto und dem warmen Brot vorfuhr, wurde ich bereits von ein paar Eltern und Kinder erwartet. Wir verkauften gut und lösten 135 Franken 60 Rappen. Die Kinder durften das Geld zählen, so oft sie Lust dazu hatten. Schliesslich füllten wir zwei Einzahlungsscheine aus und ich ging mit jeder Halbklasse zur Post.
Meine befreienden Erfahrungen mit den Ideen von Summerhill waren das wichtigste diese Jahres. Dann folgte eine Weile Bauernhof, bevor ich in die UAS flog.

Meine Reise durch die USA Herbst 1969 bis Sommer 1979
1. Die Ankunft in New York
2 .Amity-Institute 1968, was war das?
3. New York
4. Eine Mondlandung
5. Getippt am 22. Juli 2019, nach dem Text zur „Mondlandung“
6. America the Beautiful
7. 99 Tage im Greyhound unterwegs
1. Die Ankunft in New York
Vor der Reise in die USA hatte ich ernsthaft mit der Idee gespielt, dort zu bleiben und ich hatte mir deshalb beglaubigte Kopien aller Dokumente machen lassen. Ah, Sie wollen einen Amerikaner heiraten, lachten die Beamten immer wieder. Ich hatte von vielen Schweizern gehört, die in die USA ausgewandert waren und denen es gut gefiel. Eine Ehe würde die Probleme mit der Migrationsbehörde lösen.Warum nicht, in Europa hatte sich ja niemand ernsthaft für mich interessiert. Nur so schnell im einem Hotelzimmer die Beine spreizen, das wollte ich nicht. Nicht den Traualtar, doch eine ernsthaften Beziehung wünschte ich mir vor der Nacht meiner Träume. Das hatte mir das Leben noch nicht geschenkt, und es liessen sich diesbezüglich keine Fortschritte erkennen. Ich hatte mich verschiedentlich auf Heiratsinserate hin gemeldet. Wenn ich Glück hatte, wurde mir das Photo dankend zurückgeschickt. Was tun? Ich hatte noch Zeit und sparte nach dem bewährten System. Nach dem ersten Zwischenjahr in Europa hatte ich mich für ein Jahr USA entschlossen. Doch wie? – An der ETH studierten damals mehrheitlich junge Männer. Alle zwei Wochen machte ich mich schön und spazierte durch die ETH. Ich mochte das altehrwürdige Gebäude. Auf den Anschlagbretter gab es viel interessantes zu lesen, und ich hörte gerne die Antrittsvorlesungen charmanter Professoren. Nach den Sommerferien brachte ich von einem dieser «Ausflüge» einen Prospekt des Amity-Instituts heim. Amerikanische Highschools (= Mittelschulen) suchten Nativspeaker. Ich meldete mich an, und es klappte.
7th Street, Block 23, Manhattan war die Adresse des Hotels, das ich irgendwie von der Schweiz aus in in New York ausfindig gemacht hatte. Auf einem Notizzettel, von Hand geschrieben, wurde meine Reservation bestätigt. Es hiess, ich erinnere mich deutlich: Reservation 7th / b 23, room 7/23, in der Nähe des Greyhound -Terminals. Nicht per air-mail sondern per sea-mail war der Briefumschlag gekommen. Es musste etwas passiert sein. Das Papier schien vom Trocknen ausgefranst und die Tinte zerflossen. Ich hatte den Brief immer wieder angeschaut. Er passte so gar nicht zu meinem Traum vom fantastischen Amerika. Leise Zweifel stiegen in mir auf. Ich hatte mit niemandem über meinen Traum sprechen können. Lange hatte sich nichts getan. Gegen den Herbst zu klappte plötzlich alles, und es traf der zerknitterte Briefumschlag ein. Ich konnte mit niemandem über meine bevorstehende Reise sprechen.
Im Sommer 1968 hatte ich mit meiner dritten Klasse ein volles Arbeitsprogramm und ich war voller wilder Träume. Ich war entschlossen zu packen, was sich bot. So hatte ich in den Sommerferien einen Kurzaufenthalt in Moskau, hinter dem Eisernen Vorhang, gemacht. Wie kam es dazu? An einem Anschlagbrett in der ETH hatte ich vom einem zweiwöchigen Sprachkurs in Moskau gelesen, Reiseleitung und Anmeldung durch die Slawistik-Professorin der Universität Zürich. Ich sprach mit der Frau. Sie bedauerte, mangels Interesse könne der Kurs wohl nicht durchgeführt werden. Doch sie notierte meine Adresse, gab mir einen Prospekt und forderte mich auf, sofort an ihrem Anfängerkurs in russisch teilzunehmen, Mittwoch von 14 bis 16 Uhr. Das passte gut. Ich war am Mittwoch ohnehin im Stadtzentrum. Ich besuchte um 16 Uhr im Heilpädagogischen Seminar einen Kurs zum Thema: Das körperlich behinderte, normal begabte Kind in der Regelklasse. Ein Stossgebet. Das war eine einmalige Gelegenheit. Nie hätte ich gewagt, von einer Reise hinter den Eisernen Vorhang, nach Russland zu träumen, ich hatte es mir nur heimlich und sehnlichst gewünscht. Nun drängte sich mir diese Möglichkeit auf. Ich musste sie packen. Das war doch grandios, an diesem kommunistischen Land zu schnuppern, bevor ich nach Amerika reiste. Solche Ferienpläne! Darüber musste ich schweigen, um nicht als verrückt zu gelten. Einmal hatte ich Russland im Lehrerzimmer erwähnte und erschrak, wie alle über das Land herfuhren. Russland war tabu. Also verbrachte ich meine Ferien wie gewohnt auf dem Bauernhof, und das war nicht der Rede wert. Auf dem Bauernhof durfte auch nicht von meiner Russlandreise gesprochen werden, aber sie fand statt.
Die Professorin sammelte unsere Pässe ein und reichte diese gemeinsam ein. Wir erhielten ein Gruppenvisa. Sie erklärte, die Pässe würden mehrmals photokopiert und diese Kopien russischerseits beglaubigt. Im Bedarfsfall, zum Beispiel zur der Einreise in Berlin, werde sie uns das persönliche Exemplar verteilen, und die Grenzkontrolle würde diese von uns vorgelegten Kopien mit den Pässen vergleichen. Sie bat uns, ähnliche Kleider und die gleiche Frisur zu tragen, wie auf unserem Passbild. Viele Teilnehmer befürchteten einen Eintrag in den Pass, weil dies das Reisen diesseits des Eisernen Vorhang erschweren würde. Die USA hatten sogar eine Einreisesperre verhängt. Die Professorin plante im folgenden Sommer ein Semester in Kalifornien zu studieren, deshalb war sie besonders vorsichtig. Das beruhigte mich. Geduldig zerstreute sie allfällige Bedenken zu Beginn jeder Stunde. Wenn ich mich richtig erinnere, so gab es damals zwei Linienflüge Zürich-Berlin-Moskau und zurück und sie waren regelmässig ausgebucht. Diese Information beruhigte mich zusätzlich. Vor dem Kommunismus fürchtete ich mich ohnehin nicht. Wichtig war, sich ruhig zu verhalten und allenfalls freundlich zuzuhören. Ich hatte in der Primarschule gelernt, durch die Planwirtschaft sei die Kornkammer Russlands, die Ukraine, heruntergewirtschaftet worden. Die Bauernzeitung brachte regelmässig Artikel zum Thema Ernteausfälle als Folge der Planwirtschaft. Warum brauchte im August 1961 eine Mauer durch Berlin gebaut zu werden, wenn Hammer und Sichel für das erfolgreichere System standen? Warum hatte 1963 das Statement von Präsident Kennedys «ich bin ein Berliner», einen solchen Widerhall?
Im Herbst 1969 landeten wir mit fünf Stunden Verspätung in New York. Mit dem Bus fuhr ich nach Manhattan zum Greyhound-Terminal. Afro-Amerikan (= damals noch Neger) begannen zum Alltag zu gehören. Ich dachte an Alfi. Ich fand mein Hotel. Meine leisen Zweifel stiegen wieder auf.
2 .Amity-Institute 1968, was war das?
2019: An der Jahreskonferenz der Schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit 2017 hatte ich Franziska kennengelernt. Sie ist die Gründerin von Solarafrique, einem privaten Hilfswerk, das sich für die Installation von lokalen Solaranlagen in Burkina Faso einsetzt. Nach den monatlichen Treffen von MML an der Universität Zürich empfängt sie mich regelmässig zu einem Imbiss in ihrem romantischen Erker in einer Villa auf dem Zürichberg. Sie schildert mir dann Freud und Leid beim Aufbau von Solaranlagen. Ich erzähle vom Kongo. Sie kennt mich gut, denn sie hat Teil I und II meiner «meiner grossen Welt» gelesen. Fragen nach ihrem Lebensweg beantwortet sie ohne Zögern. Die Tatsache, dass sie nicht verheiratet ist, scheint ihr keine Mühe zu machen, es habe sich einfach nicht ergeben. Beim Aufbrechen nach unserem Plauderstündchen im Juni 2019 erfuhr ich, dass sie auch mit Amity in den USA war. Einschub Ende.
2019 kaum zu glauben, aber eine Tatsache: Sie können zum Stichwort Amity-Institute im Internet viele Informationen finden. So steht: « Im Jahr 1962 gründeten Dr. Ernest und Emily Stowell von Eau Claire, Wisconsin, das Amity Institute, um den Bedürfnissen amerikanischer Fremdsprachenlehrer und -schüler nach direktem persönlichem Kontakt mit den Sprachen und Kulturen der Welt gerecht zu werden.»
2019 Juli: Ich hatte mit Franziska geplaudert. Wir trafen uns seit zwei Jahren gelegentlich, denn auch sie war von Afrikavirus befallen. Erstmals fragte ich sie zu Details nach ihrem Woher, nach ihrem persönlichen Weg durchs Leben, nach dem Warum und dem Wohin. Natürlich kommen wir in den Himmel, aber wie? Resultat: Gleicher Jahrgang, beide eine Ausbildung zur Primarlehrerin, beide waren wir Ende der 1960er Jahre in den USA, und – kaum zu glauben, sie erwähnte das «Amity-Institute», «The Experiment in International Living" und das Anschauungsmaterial von Schweizerischen Touristenbüro. Statt ein Tagebuch zu führen, hatte sie ihrer Mutter regelmässig Briefe aus den USA geschrieben, mit der Bitte diese aufzubewahren. «Ich habe diese Schachtel noch, im Schlafzimmer, auf den Büchergestell, nach Jahren geordnet, ja, ja,» sie war ins Schwärmen gekommen. «Man schrieb damals noch richtig lange Briefe, ohne Internet, ohne Handys, Telefonieren war teuer, und es klappte trotzdem. Die ganze Organisiererei hatte viel Zeit in Anspruch genommen.» Am 4. August am Telephon, Franziska überhäufte mich mit Alltagsärger. Dann machte ich einen abrupten Themawechsel zu den USA: Sie hatte es genossen, mehrere Verehrer zu haben, aber sie wollte nicht in den USA bleiben, es sei ihr zu viel von «Safety» (= Sicherheit) gesprochen worden. – Bereits nach den ersten Tagen in den USA wusste ich klar: Wenn nicht ein Wunder geschieht, gehe ich wieder heim. Das Gespräch mit Franziska brachte mir nicht die erhofften Informationen, die ich sofort wollte. Später, später. Nein jetzt, denn am 11. August, will ich meine Tipperei zum Thema USA abschliessen. Wir wünschten uns gegenseitig einen guten Nachtschlaf.
Wie geschah mir 1968 ? Auf einem meiner Erkundungsgänge durch das ehrwürdige Gebäude der ETH Zürich entdeckte ich auf einem Anschlagbrett einen Hinweis, dass Lehrer mit deutscher und französischer Muttersprache die Möglichkeit hätten, am Kultur-Programm von «Amity-Institute USA» teilzunehmen. Ziel war damals staatliche Mittelschulen in ländlichen Gegenden aufzuwerten, indem ein Lehrer aus Europa fünfzehn Stunden pro Woche die Fremdsprachenlehrer unterstützte. Als Gegenleistung wurde freie Kost und Logis bei einer Familie offeriert und die Möglichkeit, während zehn Stunden am regulären Unterricht, z.B. Englisch teilzunehmen. Ich holte im Sekretariat die angebotenen Unterlagen, die es nur auf Englisch gab. Mein Sprachkurs in England, den viele als überflüssig taxiert hatten, fand Anwendung. Nur schade, dass ich nicht besser Englisch konnte. Viel Papierkrieg, Ungewissheit und wenig bis kein Verständnis bei meinen Bekannten. Es klappte. Neben den Reiseunterlagen erhielt ich die Broschüre «The Experiment in International Living". Als ehrenamtliche Mitarbeiterin vom Amity-Institute hatte ich die Möglichkeit, in zehn Grossstädten während drei Tagen die Gastfreundschaft einer Familie zu geniessen. Fantastisch, nicht wahr.
Zum Glück hatte ich, wie dringend geraten, beim schweizerischen Touristenbüro Werbematerial angefordert. Neben farbigen Hochglanz - Prospekten wurde mir eine Diaschau zur Verfügung gestellt. Meine Vorträge waren in den USA sehr beliebt. Sie erleichterten mir den Kontakt zu verschieden Gruppen und sie förderten das Gespräch zwischen den Leuten. Ein Beispiel: Es begab sich, dass ein kleiner Junge bei einem langweiligen Besuch im Altersheim von mir erzählte. Was ich nicht für möglich gehalten hätte, schaffte er. Die Heimleiterin lud mich ein. Ich hielt den Vortrag dreimal. Ein Fest für die Heimbewohner, denn sie wurden schön gemacht. Manche liessen sich davon überzeugen, nach Tagen das Bett wieder einmal zu verlassen und sie freuten sich, im Rollstuhl in den Speisesaal geführt zu werden. Viele kamen, um ein paar Worte in Deutsch zu hören oder sogar um selber zu sprechen. Selbstverständlich folgte ein zweiter Vortrag, mit der Möglichkeit Fragen zu stellen, für das Personal, und schliesslich machten wir eine Einladung für die Angehörigen.
Ich war vier Schulen zugeteilt worden in:
Kentucky
Wisconsin
North Carolina
Pennsylvania
Gut so, leider fehlte eine Schule an der Westküste.
– Start in Kentucky: Für die frisch eröffnete, abgelegene Internatsschule Lincoln , wo begabten Kindern aus zerrütteten Familien in schlechten Wohngegenden (broken home and slum) eine zweite Chance gegeben werden sollte, wurde dringend eine Lehrerin mit Muttersprache deutsch gesucht. Das war ich. Weit mehr als die Hälfte der Schüler waren Mischlinge, hauptsächlich afrikanischen Ursprungs. Die Lehrerschaft, die Betreuungspersonen und das Küchenpersonal war gemischt. Rückblickend liess sich diese Schule nicht mit den andern vergleichen. Ich hatte viel Kontakt zu schwarzen Amerikanern. Die Segregation war allgegenwärtig, und gerade weil mir jegliches Gefühl dafür fehlte, wurde sie sichtbar. Ich interessierte mich für die Schwarzen und ging spontan auf sie zu. Das fanden alle gut. Doch ich spürte, wie überrascht sowohl die Schwarzen wie die Weissen von meinem Verhalten waren. Schwarze Frauen, deren Wunsch es war, sich unter Weisse zu mischen, hatten Spass, mit mir ausschliesslich Schwarze Quartiere, Kirchen von Schwarzen oder deren Konzerte zu besuchen. Ich erlaubte ihnen, mich anzufassen und meine Haare zu berührten. Scheu kamen sie auf mich zu, ich streckte ihnen die Hand entgegen und wir begrüssten uns. Sie schauten ihre schwarzen Hände an und ich zeigte ihnen meine weissen Hände. Manche fuhren auch über meine Arme. Wir lachten, warum nicht? Niemals hätte ich eine so weitgehende Segregation für möglich gehalten.
– Wisconsin: Eine ehrgeizige, rein weisse Schule. Die Bevölkerung der lockeren Streusiedlung stammte aus Mittel- und Nordeuropa. Sauerkraut war bekannt und geschätzt. Die Männer erzählten aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich spürte, sie waren Helden. Die Frauen der Veteranen meinten: Man erinnere nur das Gute.
– North Carolina: Die Häuser liessen mich erkennen, dass der Staat, die kleine Stadt in der ich lebte, bessere Zeiten gekannt hatten. Die kleinen Handwerksbetriebe rentierten nicht mehr. Alles war in den grossen Einkaufszentren billiger zu haben, selbst das Brot. Die wenigen schwarzen Schüler schienen gut integriert.
– Pennsylvania: Eine rein weisse Schule eine Stunde ausserhalb Harrisburg, wo wir regelmässig am Kernkraftwerk «Three Mile Iland» vorbeifuhren. Die Leute in jener Gegend war extrem strebsam, denn alle hatten mehrere Jobs. Die Schule hatte einen Schüleraustausch mit einer schwarzen Schule geplant, doch niemand interessierte sich für dieses Programm. Schliesslich wurden gemeinsame Sporttage durchgeführt.
Alle vier Schulen pflegten den Chorgesang und waren stolz auf ihren Chor. Sie hatten Sportplätze und stellten den Schülern Freihandbibliotheken zur Verfügung. Dort fand ich interessante Informationen zur Besiedlung und zur Industrialisierung des Landes. Ich las beispielsweise, wie die Autoindustrie systematisch den Zugverkehr an den Rand gedrängt und den öffentlichen Verkehr zum Erliegen gebracht hatte. Es gab Sachbücher für Schüler über private, kirchliche und öffentliche Schulen und Universitäten, über den teilweise brutalen Vormarsch nach Westen, über Kriege und Kämpfe innerhalb der USA, über den Goldrausch, über den Zerfall der Innenstädte und die Vernachlässigung der Infrastruktur. All dies konnte ich recht gut lesen, auch wenn mir vieles sehr fremd war, und ich erst später die volle Bedeutung schrittweise verstand. Dank dem Amity-Institut lernte ich, dass nicht alles Gold ist, was glänzt.
3. New York
Ich war in den USA angekommen. Ich stand in meinem Hotelzimmer in New York, in Manhattan. Diese Tatsache war gewöhnungsbedürftig. Nach einer Weile «Nichts» setzte ich mich auf den Bettrand. Aus Zürich hatte ich ein paar Prospekte und einen kleinen Reiseführer mitgebracht. Als Einstieg würde sich eine Schifffahrt, eine Fahrt rund um Manhattan eignen, hiess es. Als ich dann auf dem Schiff sass, kniff mich immer wieder in den Arm, um zu wissen, ob ich wach war oder träumte. Wir fuhren mehrere Stunden durch trübes Wasser, links und rechts mächtige Häuser, Wolkenkratzer, Brücken, Autos, Menschen. Plötzlich fiel mir ein, dass einer der Brückenbauer aus der Schweiz stammte. Mein Englisch genügte nicht, um meine Frage so zu formulieren, dass ich die gesuchte Antwort erhielt. Ich wurde auf die Brücken hingewiesen. Ich sah sie schon. Es hiess, sie seien mehrstöckig und breit. Das sah ich auch.
2019: Jener Brückenbauer, Othmar Ammann war 1879 in Schaffhausen geboren. Nach dem Studium an der ETH war er in die USA ausgewandert, und er baute dort Brücke um Brücke. Es gibt einen sehr eindrücklichen Film zu diesem Thema. – Das Internet unterbrach oder änderte meinen Gedankenstrom. Es schützte mich vor Überschwemmungen bestehend aus Erinnerungen und Selbstzweifel. Ich durfte damals, 1969, sagen, nur weil ich immer mein Bestes getan hatte, schaffte ich es in die USA und zu diesem Aufenthalt. Auch in den USA und danach bis 2019 tat ich mein Bestes und ich hoffe, mich bis an mein Lebensende um dieses «mein Bestes» zu bemühen. Doch was war, was ist «mein Bestes»?
2019: Meine Erinnerungen an die USA glichen einem üppigen, nur mit einem Haumesser begehbaren Dickicht. Zusätzlich rufen auch nur kurze Internet-Recherchen viele schlafende Bilder wieder wach. Es wird mir fast Angst dabei, dies besonders, da der Leiter des Autobiografie-Projektes uns immer wieder ermuntert, «nahe an die Sachen heranzugehen». – Wie unterscheide ich Wichtiges und Nebensächlichem? Meine Gedanken fliehen in Kriegsgebiete. Dort ist für Mütter und Frauen wie Du und ich, der Friede das Wichtigste. – Das Internet entlastet mich auch, denn ich will nicht Sachen schreiben, die allgemein zugänglich sind. Für mein Empfinden vermischen sich einerseits Wissen und Meinungen zunehmend, und anderseits saugt das Internet die Geheimnisse des Wissens auf, wie dies während Jahrhunderten der Klerus und die Zünftler taten. Ich weiss nicht, was im Internet mit meinen Daten geschieht. Mein Mann und ich benützen den selben Browsertyp, aber er bietet ihm und mir ganz unterschiedliche Werbungen an. Es wird mit Daten gehandelt, sonst müsste nicht immer wieder darauf verwiesen werden, dass die Daten nicht an Dritte weiter gegeben würden.
Harlem, Bronx, Central-Park, das Museum of Modern Art, Greenwich Village, Chinatown, und, und … ich versuchte alles anzuschauen, was in meinem kleinen Führer erwähnt war. Zusätzlich fuhr ich an die Endstationen der acht Untergrundbahnlinien, die meist oberirdisch oder sogar, ich staunte, als Hochbahnstrecken geführt wurden. An den Endstationen machte ich zu Fuss einen Rundgang. Vieles von dem, was ich sah, passte nicht zu meinem Traum von America the beautiful. Stundenlang ging ich durch Strassenschluchten, über Brücken und weiter, bis mir Angst wurde. Ich war an der Südspitze von Manhattan, wo eine riesige Fähre alle zehn Minuten wohl tausend Männer und Frauen vom Festland abholte und zur Arbeit auf die Insel brachte und andere heimwärts beförderte. Ich fuhr mehrmals auf dieser Fähre hin und her. Es kostete ungerechnet 15 Rappen. Der Billettverkäufer freute sich und meinte, das sei auch New York. Dort standen Jahre später die Twintowers. Ich bin dann 1976 mit den Lift in diesen hochgefahren und stand über dem Häusermeer. Ich liess mir das Gebäude der United Nations und das Rockefeller Center zeigen. Ich entdeckte das Empire State Building und die Freiheitsstatue. In der Ferne schienen sich der Himmel und die Aussenquartiere der Megacity zu berühren. Ein leichter Wind - der Turm begann zur Freude der Besucher leicht zu schwanken. Später wurde der offene Steg rund um die Aussichtsterrasse verglast. Mir war unheimlich. Zu Fuss hinunter zu steigen, war nicht vorgesehen und nicht möglich. Zweimal wurde ich vom Sicherheitsdienst hinausgeschafft und ermahnt, dies tue man nicht. Beim Attentat von 9. September 2001 arbeitete ich auf der Steuerverwaltung. Als vor der Kaffee-Pause die Meldung von Büro zu Büro erzählt wurde, hielt ich das Furchtbare für Amerikanischen Humor.
4. Eine Mondlandung
«Hammer und Sichel», Kommunismus – tief in mir drin stand fest: Die Russen sind unsere Feinde. Oh Schreck, musste das sein, anfangs Oktober 1957 kreiste ein russischer Sputnik um unsere Erde. Ich war erschüttert. Für mein Empfinden hatte diese Meldung die ganze westliche Welt durchgerüttelt. Es hiess, die Amerikaner würden sofort mehr Geld in die Schulen und Unsummen in die Universitäten investieren. Hoffentlich auch! Hoffentlich taten auch wir dies! Mein Misstrauen und meine Angst vor der Militärmacht, die 1956 den ungarischen Aufstand niedergeschlagen hatte, war wieder hell wach. Ruhten sich die Amerikaner auf ihren Lorbeeren aus? Bald meldete Radio Beromünster, ein russischer Hund umkreise die Erde. Im April 1961 folgte dem Tier ein Mensch, Juri Gagarin. Mir war das unheimlich. Wurde Gagarin nicht übel? Es war mir eine liebe Gewohnheit gewesen, vor dem ins Bett gehen nach der Milchstrasse Ausschau zu halten. Doch damit war es nun vorbei. Dort waren die Russen. Es hiess, die Amerikaner, d.h. John F. Kennedy würde noch vor Ende des Jahrzehntes eine Mondlandung planen. Hoffentlich waren sie schneller als die Russen!
Die Jahre temperten dahin. Ich habe nur verschwommene Erinnerung an die Weltraumprogramme der beiden Grossmächte. Doch dann folgt eine klare Sequenz: Ich schlief und träumte fern vom kleinen Dorf in einem fremden Bett. Es ging mir gut, ich ruhte mich aus. Doch was war da los? Ah, es klopfte an der Türe. Ich verhielt mich ruhig. Wo war ich? Schnell die Decke über die Ohren gezogen! Natürlich, ich war irgendwo, irgendwo im Hinterland von Kentucky. Zwei Gestalten wagten, die Türe zu öffnen. Es waren schwarze Frauen, sie sprachen auf mich ein. Schliesslich verstand ich, dass ich mich anziehen solle. Was war los? Sie banden mir die Schuhe und kämmten meine kurz geschnittenen Haare. Sie drängten. Eine zog links, die andere rechts. Es war dunkel. Im Esssaal gab es ein wenig Licht. Alle drängten nach vorn und schauten in Richtung eines kleinen Kastens. Dort flimmerte ein Bild. Alle freuten sich: Sie kommt noch rechtzeitig! Man machte mir Platz. Ich war müde. Ich hatte geträumt: Vom Jetlag, vom langen unruhigen Flug über den atlantischen Ozean, von meinem Aufenthalt in New York. Während den 24 Stunden im Greyhound-Bus, von New York nach Kentucky hatte ich mir vier riesige Äpfel gekauft. Solche Äpfel hatte ich nie gesehen! Ich biss in den ersten. Die Mitfahrenden schauten erstaunt. Alle assen die gleichen riesig grossen Sandwich und schliefen darnach ein. Ich schaute durchs Fenster, dort war «Amerika» zu sehen. Dann banges Warten in der Busstation von Louisville, Kentucky, bis ich freundlich empfangen wurde. Ich wusste, die Leute sprachen englisch, aber zu viel und zu schnell. Ich verstand sie nicht. Sie holten mich ab. Sie brachten mich an den Ort, der auf einem Blatt angegeben war. Ich wollte schlafen. Es war noch hell, es wurde dunkel, es war Nacht. Jetzt mitten unter Fremde gesetzt, spähte ich auch auf den Kasten. Alle klatschen, ich klatschte auch. Ich nickte ein. Die Leute verteilten sich. Eine schwarze Frau half mir, mein Zimmer wieder zu finden. Sie zog mir die Schuhe aus und gab mir ein Glas Wasser. Erst später verstand ich: Die Amerikaner hatten das Wettrennen um die Vorherrschaft im Weltraum gegen die Sowjetunion gewonnen und ich war in der Lincoln-School irgendwo in Hinterland von Kentucky angekommen. Ich habe viele solch verschwommene Erinnerungen an meinen Aufenthalt in den USA, doch fehlt mir die örtliche und zeitliche Orientierung. Oft kann ich auch Träume, Realität, Erinnerungen und Phantasien nicht klar trennen.
Meine Lesenden, es war mir jahrelang wichtig zu wissen, dass die Amerikaner von 1969 bis 1972 sechs bemannte Mondlandungen durchführten, dass zwölf weisse Amerikaner den Mond betraten und dass nachher das Programm eingestellt wurde. Sich so etwas zu merken, scheint heute in der Internetzeit lächerlich. Erst 2019, fünfzig Jahre später schien der Mond für die Medien erneut interessant zu werden. – 1969 begann ich zu verstehen, dass Friede eine Aufgabe ist, die uns alle angeht, aber erst 2019 begann ich zu verstehen, dass wir gemeinsam Pfade zum Frieden suchen und finden müssen.
5. Getippt am 22. Juli 2019, nach dem Text zur „Mondlandung“
Weg mit diesem Text! Was soll der? Meine Lesenden, überspringen Sie diesen Abschnitt. Dieser Text dient mir. Er beschreibt den 22. Juli 2019, aber es könnte ein anderer der vielen Tage sein, an denen ich mich am Abend frage, wo sind die vielen Stunden geblieben.Ich versuche Fetzen meines täglichen Lebens-Chaos einzufangen. Deshalb ist er wichtig für mich. Ich will gerade das später , wenn ich noch viel, viel älter bin, lesen können.
Ganz bieder hatte ich jenen heissen Tag zwischen Haus und Garten verbracht, und doch fühlte ich mich verbraucht. Es war Abend und ich sass mit meinem Mann und einem Glas Wein still im Garten. Es fiel mir nichts ein. Was dachten die Vorübergehenden von so einem stumm dasitzenden alten Ehepaar? In Wirklichkeit gab es die erwähnten Vorübergehenden gar nicht. Die Strassen waren leer. Mein Kopf war nicht leer. Ein Gewühl überfüllt ihn. Wie werde ich so einen Tag wie den 22. Juli 2019 in zwanzig Jahren erinnern? Diese Frage schlüpfte mit mir unter die Bettdecke. Wie ein Kleinkind störte sie meine Nachtruhe, und als es hell wurde, standen wir gemeinsam auf.
Was tun? Eine Liste der Eindrücke, der Ereignisse tippen, damit sie aufgehoben und versorgt sind, das war meine Lösung. Ich habe die Einträge nachträglich nummeriert, um Ordnung zu schaffen. Also: 1. Auf der Titelseite der lokalen Tageszeitung stand, der Gönnerverein der Pfadfinder bekomme nach zehn Jahren Rechtsstreit keine Ausnahmebewilligung, um auf seinem Grundstück im Brandtobel eine neue Pfadfinderhütte zu bauen. 2. Ursula von der Leyen sei äusserst knapp zur neuen Präsidentin der EU-Kommission gewählt worden. 3. Im «Le Courrier»: Enseignant, une vocation: Semer des graines, pour l'avenier (Lehrer, eine Berufung: Sähen für die Zukunft). Die Zeitungen müssen vor dem Frühstück fertig durchgeblättert sein. – 4. lesen, dazu gehört zunächst die Meldung an meinen Kongopartner, ich hätte im Roman von Barbara Kingsolver, «Les Yeux dans les arbres» Seite 600 erreicht. Es sei heiß draussen, und ich würde den ganzen Tag lesen. Es würden noch 70 Seiten verbleiben. 5. Ich will weiter lesen, werde aber immer wieder unterbrochen. Bis am Abend schaffe ich nur die Seiten 602 bis 628, die Schilderung dessen, was die drei zwischenzeitlich erwachsenen Töchter auf ihrer Fahrt mit einem Landrover von Gibraltar nach Brazzaville erlebten, was sie austauschten oder für sich behielten. Mit vielem bleiben sie allein. – 6. Die Liste geht weiter: Ebola? Die Praxis für Tropenmedizin ist bis Mitte August geschlossen. Macht nichts, ich reise erst nächstes Jahr im Februar. – 7. Ein paar Zeilen später: Die Telefonklingel! Der ausgezogene Mieter erlaubt mir, mit dem Passepartout die Wohnung allfälligen Mietinteressenten zu zeigen. Aus Weiterlesen wird nichts. 8. Die Wohnungsglocke läutet: Der Chauffeur eines kleinen Lieferwagens meldet, er habe die Körbe mit dem Grünabfall angefahren. Wir gehen nach unten. Es betrifft nicht uns, aber ich bin bereit, die Sache zu erledigen. Er gibt mir zwei Nötli und notiert seine Adresse auf einen Fresszettel. 9. Nach ein paar weiteren Seiten, wieder das Telefon, ich erkenne die Stimme des ehemaligen Pflegesohnes sofort. Er lädt mich zum Kongress der Narcotics Anonymous (NA) Schweiz ein. Das freut mich. Er ist nun zehn Jahre älter als ich damals, als ich seine Pflegemutter war. 10. Er mailt mir später die Unterlagen. Es klappt zeitlich nicht, denn ich habe andere Prioritäten. 11. Kurz vor dem Mittagessen ein lange erwarteter Rückruf: Die Töchter sind in der Lage, am Wochenende ihre Mutter am Flughafen abzuholen. Mein Engagement ist nicht nötig. Es war bereits Mittagszeit. Ich musste mich kurz halten, obwohl ich gerne mit der jungen Frau über ihre zweiwöchige Reise nach Kinshasa gesprochen hätte. Sie war dort aufgewachsen und lebte nun seit vielen Jahren in der Schweiz. Sie hatte dem Besuch in die Stadt ihrer Kindheit mit gemischten Gefühlen entgegengesehen. Sie hatte sich darauf gefreut, auch wenn man nur negatives aus dem Kongo hört. Nun tönte sie begeistert. Ich musste das Gespräch abbrechen, denn das Mittagessen war bereit. – 12. Nachher am Radio die Sommerserie, diese Woche mit dem Schwerpunkt «Moskau», an jenem Tag wurde über die Gastarbeiter aus Zentralasien gesprochen. 13. Das Telefon klingelte, einer Frau ist mein Plakat am Gartenzaun aufgefallen und sie möchte die angebotene Wohnung gerne ansehen, wenn möglich sofort. Ich kann sie vor den andern Interessenten, die sich auf 14 Uhr angemeldet haben, empfangen. Es bleibt mir eine halbe Stunde. Ich treffe eine gediegen angezogene Frau, fast eine Dame. Die Wohnung scheint ihr zu gefallen, doch sie gibt sich, sie nimmt sich drei Tage Bedenkzeit. Es hat zeitlich knapp gereicht. 14. Schon kommt das Ehepaar: Ein runder, sich behende bewegender Mann mit seiner Frau. Sie brächten zwei Teenager mit. Der Mann ist begeistert und freut sich auf das Schwimmen im Fluss. Ich gab ihnen ein Mietinteressentenformular mit. 15. Nach einer Tasse Tee überarbeite ich den Text «die Mondlandung», ein schwieriges Unterfangen. 16. Ich suche nach einem «Bild», das meinen USA-Aufenthalt veranschaulichen könnte? Ein aufziehendes Gewitter in einer heissen Sommernacht, Blitz und Donner und anschliessend viel sanfter Regen. Das könnte passen.
Einschub: Anfangs der 1970er Jahre, für den Umzug aus dem alten Bauernhaus in die neue Siedlung hatte meine Mutter meine Sachen in Apfelkisten gepackt. Bei jedem Besuch wachte sie darüber, dass ich eine Kiste ordnete, d.h. den Inhalt kurz anschaute und mich davon trennte. «Weg, weg! Stopp, das nehme ich, das könnte dem Hof noch dienen. Weg, weg,» um meiner Mutter eine Freude zu machen, warf ich zu viel weg. Ich erinnere mich klar, wie ich u.a. wehmütig durch einen grossen Ordner blätterten wollte. Die Mutter drängte, weg damit, weg, das ist vorbei. Sie war nicht bereit, mit mir die Bilder darin anzuschauen. Ich spürte, dass ich einen Fehler machte, doch ich war zu schwach, um ihr zu widerstehen. Den Ordner, eine Art Tagebuch, das ich während meiner USA-Reise mit viel Mühe geführt hatte, liess ich sachte in den Abfall-Container gleiten. Ich spürte die Genugtuung der Mutter. Endlich war sie die Siegerin, und ich verstand, sie wird um diese Stellung kämpfen. Ich spürte ihre Kraft. Mit dem Einzug in die neue Siedlung hatte sie ihr Ziel erreicht. Einschub Ende.
Die Nummerierung geht weiter: 17. Es folgten Kleinigkeiten und 18. nach den Abendnachrichten eine TV-Sendung von Schweizern in den USA. 19. Ich schlief dabei ein. 20. Später sassen mein Mann und ich mit einem Glas Wein still im Garten. 21. Ich spürte, wie mein Gedächtnis arbeitete. Hastig wurde weiter nach Erinnerungen gewühlt. Immer die alten Sachen! 22. Ich ärgerte mich und entschloss mich, die folgende immer wiederkehrenden Episode einzutippen: Das Resultat eines Versuches: Ein Stück Holz wird verbrannt, und es ist nachher schwerer! Dieser Unsinn stimmt. All die vielen Male, wenn mir etwas begegnet ist, das ich nicht verstehe, denke ich: Wenn ein Stück Holz verbrannt wird, ist es nachher schwerer. Der Sekundarlehrer hatte uns diesen Satz bewiesen. Eine grosse Waage stand auf seinem Pult. In der einen Schale lag ein Gewichtstein von 1 Gramm und die Schale auf der Gegenseite war mit ca. 15 abgebrannten Streichhölzern gefüllt. Die beiden Seiten waren gleich schwer, sie hielten sich die Waage. Ein kleiner Stoss und die Schalen schaukelten, bis sie sich langsam wieder im Gleichgewicht einbalanzierten. Die grosse Frage des Lehrers: Wird das Holz schwerer oder leichter, wenn wir es verbrennen? Die Schüler lachten: Leichter, leichter. Der Lehrer schützte den Tisch mit einem Wachstuch und hob die Waage sorgfältig vom Pult auf den Tisch. Die schaukelnde Schalen beruhigte sich wieder. Schaut nun zu! Er zündete die Hölzchen an und die Schale mit den brennenden Hölzchen bewegte sich sachte, kaum zu glauben, nach unten, mehr und mehr nach unten. Da stimmte etwas nicht! Wir wollten den Versuch wiederholen. Diesmal legten wir in beide Waagschalen abgebrannte Hölzchen. Die rechte Seite wurde angezündet und die linke bewegte sich sachte nach oben. Der Lehrer erklärte: Um verbrennen zu können, nimmt das Holz Sauerstoff aus der Luft auf und wird dadurch schwerer. Ohne Sauerstoff kein Feuer, das wussten wir bereits. Der Lehrer hatte eine kleine Kerze angezündet, ein grosses Glas darüber gestellt und - die Flamme wurde tatsächlich kleiner und kleiner, der Docht glühte, begann zu rauchen, verfärbte sich weiss und löschte aus. Das Glas war mit Qualm gefüllt. Unterbrachen wir den Vorgang rechtzeitig, flackerte das Feuer wir auf. Wenn Holz verbrannt wird, ist es nachher schwerer. -
23. Erinnern ist der schnellste Vorgang, den ich kenne, doch auch er braucht Zeit. Er erfordert viel Mut, um Selbst-Überforderung, Langeweile, Ärger, Missachtung u.a. wieder zu erleben. 24. Der gewöhnlich Tag fand eine schöne Abrundung. Wir unterhielten uns über die Mietinteressenten und tranken den Wein fertig. 25. Man merke sich, unendlich vieles kann ja gar nicht geschrieben werden!
6. America the Beautiful
America the Beautiful, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, vom Tellerwäscher zum Millionär, die neue Heimat der Pilgerväter, der Siedler und von Verfolgten jeglicher Couleur, Abgeschobene, Verarmte aus dem Bauernstand u.a. – die Engländer waren die Herren. Gemäss Internet soll es auch viele Rückkehrer gegeben haben. Meine beglaubigten Dokumente verschwanden während der Reise langsam, langsam in einem nicht gebrauchten Nebenfächlein meines Koffers.
Durch meinen Aufenthalt in den USA änderte sich mein Weltbild. Vorher war ich der Mittelpunkt meines Leben, neu erlebte ich mich als ich Teil der Menschheit. Ich war ein Menschlein, das seinen Beitrag zu bringen hatte und dies auch wollte. Ich lernte neue Wörter und allerhand Bekanntes wurde in einen andern Rahmen gestellt. Beispiele: die Schweinefüsschen, die Geschichte vom frühen Tod der Ente, das Bankgeheimnis und die Nummernkonti, Umweltverschmutzung, zurück zur Natur, 24 Stunden / 7 sieben Tage die Woche, Take away und drive-in, Einkaufszentren, Abfall, Konsum, Fertignahrung, Fitnesscentern, Drogen, Alkoholverbot, Frieden, Krieg, verschiedene Meinungen, Religionen …
Als lächerliches und unverfängliches Beispiel «für unterschiedliche Sichtweisen» erwähnte ich bereits in den USA den Umgang mit «Schweinefüsschen». Auf dem Bauernhof legten wir diese in Salzwasser ein, kochten sie mit Sauerkraut und assen mit Messer und Gabel, was wir daran an Essbarem fanden. Als Ergänzung gab es Würstchen. Die Grossmutter und der Vater nagten die Füsschen sorgfältig und mit Vergnügen ab. Die Katzen schätzten die Reste. Es musste zu Beginn meinem Aufenthaltes in Kentucky gewesen sein, als mir ein Picknick mit Schweinefüsschen vorgeschlagen wurde. Es bestehe Essenspflicht. Es gebe einen Wettkampf! Warum nicht. Unter einem gedeckten Vorplatz wurden die bereits vorgekochten Schweinefüsschen geröstet und den Anwesenden auf einem Pappteller mit einem Brötchen serviert. Ich beobachtete und los ging die Nagerei. Erstaunte Blicken, Lachen und Applaus. Es schmeckte mir besser als daheim. Trotzdem verzichtete ich auf die Teilnahme am Wettkampf. Wir übernachteten bei den Eltern der Bekannten, die mich scherzhafterweise eingeladen hatte. Sie erlebte den Abend auch als lustig, denn sie war keine ganz konsequente Vegetarierin wie ihre Eltern. Wir erwähnten die Schweinefüsschen nicht und hatten ein nettes Gespräch über Tierschutz. Das traf sich gut, denn ich war in der Schweiz Mitglied des Vogelschutzvereins. Auf einem Teller begegneten mir Schweinefüsschen nicht mehr, sie galten als billiges Futter für Wildtiere, nein, nicht für Katzen oder Hunde. Bald verstand ich es, diese Episode als Kuriosität zum Besten zu geben. Die Teenager amüsierten sich köstlich daran, und ich merkte, auf welch unterschiedliche Arten man sich amüsieren konnte.
Eine alte Frau, eine Grossmutter, eine Secondo aus Deutschland las mir voller Stolz die Geschichte „vom frühen Tod einer Ente“ vor. Ihre Eltern hätten diese aus Deutschland mitgebracht, die Mutter habe ihr diese aufgeschrieben und nun wolle sie niemand hören: Es war einmal eine Ente, die hatte vier Eier gelegt. Während sie noch brütete, schlich sich ein Fuchs ans Nest heran und tötete die Ente. Bevor er die Eier auffressen konnte, wurde er gestört und suchte das Weite. Die Eier blieben allein im Nest zurück. Eine Bruthenne kam traurig gackernd des Wegs, denn der Marder hatte ihre Eier gefressen. Sie setzte ich instinktiv auf das verlassene Gelege brütete die Eier aus. Bald schlüpften die Entenküken. Sie hielten das Huhn selbstverständlich für ihre Mutter und spazierten in einer Reihe hinter ihr her auf den Bauernhof. Mama Huhn scharrte im Boden, doch den Entlein gelang es nicht, es ihr gleichzutun. Sie hatten grosse weiche Schwimmfüsse. Die Mutter versorgte sämtliche Küken mit Nahrung. Sie teilte jeden Regenwurm in kleine Stücke und steckte diese ihren Kindern in die breiten Schnäble. Sie konnten nichts aufpicken. Einmal spazierten sie in Reih und Glied am Weiher vorbei. Die Entlein warfen sich ins kühle Nass, als hätten sie nie etwas anderes getan. Mutter Henne flatterte nervös mit den Flügeln und heulte aus Angst, ihre Kinder könnten ertrinken. Vom Gegacker der Henne angelockt, erschien der Hahn und erfasste die Situation mit einem Blick: «Auf die Jugend ist kein Verlass, leichtsinnig, wie sie nun einmal ist.» Ein Entenkind hatte den Hahn gehört, schwamm ans Ufer und sagte: «Gebt uns nicht die Schuld an eurem eigenen Unvermögen.» – Keiner ist im Irrtum. Alle haben recht, sie betrachten die Realität von unterschiedlichen Standpunkten her. Der einzige Fehler ist meist, zu glauben, Dein Standpunkt sei der einzige, von dem aus man die Wahrheit sehen könne. Ende der Geschichte. Ausnahmsweise hatten die Enkel zugehört, weil ich mich für die Geschichte interessierte. Ja, es gab hier verschiedenen Standpunkte. Die Grossmutter war mit Hühnern und Enten in Deutschland aufgewachsen. Diese Zeit war längst vorbei, ihre Enkel liebten wohl «Kentucky fried chicken with french fries», aber ein Huhn, eine Ente oder ein Küken hatten sie nur auf Photos gesehen. Wie sollten sie sich da für die Geschichte «vom frühen Tod der Ente» interessieren. Auf Deutsch kannten sie nur «Guten Tag, gute Abend, und wie geht es ihnen». Auch meine Übersetzungsversuche liessen sie kalt. Die wehmütigen Gedanken der Grossmutter waren allen fremd, auch dem Grossvater, einem echten Amerikaner mit Vorfahren aus ... , das wusste er nicht. Ja, es gab verschiedene Standpunkte. Es gab Micky Mouse, Donald Duck und Barbie-Puppen, Zeichnungen auf Papier und allerliebste Spielsachen aus Stoff mit liebevollen Blicken. Mit wenigen Strichen verstand es Walt Disney die unterschiedlichsten Gemütslagen darzustellen. Ich verstand die Kinder gut, die ihr Herz an eine weiche Spielzeugpuppe verloren hatten.
Ich war der Überzeugung, dass das Bankgeheimnis und die Nummernkonti, wie ich sie aus meiner Heimat kannte, nur ausländische Vermögenswerte vor unrechtmässigen Zugriffen schützen würden. Das schien mir legitim. Trotz beschränkter Sprachkenntnisse begriff ich aber schnell, das mein gutes Land durch die Steuereinnahmen auf diesen Vermögenswerten profitierte, und diese meist enormen Summen dem Fiskus der USA entzogen wurden. Ich zuckte die Schultern und tat, als ob ich nicht verstehen würde. Wenn ich allein war, stellte ich plötzlich auch «Schwarzgeld» und «Zahlungen unter dem Tisch» in Frage, obwohl mein Vater auf beides stolz war. Was war eigentlich Korruption? Einschub 2019: Zu diesem ganzen Themenbereich und zur Verflechtungen von Korruption, Geldwäscherei, Vetternwirtschaft, Whistleblower, Bankgeheimnis und zu unserem naiven «Saubermann-Image» schüttle ich unwillkürlich den Kopf. Ich masste mir kein Urteil an. Stellvertretend zitiere ich dazu Martin Hilti, Geschäftsführer von Transperancy International Schweiz, SN vom 3. Juni 2019, Seite 2., Hintergrund: «Es gibt keinen internationalen Korruptionsskandal, in den nicht Schweizer Akteure involviert sind.» -- Nachtrag: Am 1. September 2019 entdeckte ich in der Bibliothek drei Neuanschaffungen: vom Verein für Finanzgeschichte Hefte 2, Werner de Capitani, Bankgeheimnis und historische Forschung, ISBN 3-9522017-7-4 und Heft 7, Robert U. Vogler, Das Schweizer Bankgeheimnis: Entstehung, Bedeutung, Mythos, ISBN 3-9522717-6-4 sowie Brandley C. Birkenfeld, des Teufels Banker, wie ich das Schweizer Bankgeheimnis zu Fall brachte, ISBN 978-3-95972-077-9. Ich las drei Tage und halte nun zu jedem der drei Bücher ein Stichworte fest: „1) Als Bänker war es meine Aufgabe, den Kunden Zugang zu soliden und attraktiven Anlagemöglichkeiten zu verschaffen und dabei Diskretion zu gewährleisten. Es war nicht meine Aufgabe, mich um deren Steuererklärung zu kümmern. 2) War es richtig von unseren Kunden, sich vor ihren Steuerpflichten zu drücken, so dass weniger raffinierte und weniger wohlhabende Menschen einen grösseren Teil der Steuerlast tragen mussten? 3) Für reiche und mächtige Menschen gelten, in und ausserhalb der USA, eindeutig andere Regeln als für die meisten anderen.“ Der ganze Themenbereich blieb mir unheimlich und zu komplex.
Habt ihr grosse «Pollution»-Probleme in der Schweiz? Was tut ihr dagegen? «Pollution» was ist das? Laut Wörterbuch «Verschmutzung». Nancy, eine schwarze Schülerin schrieb eine Arbeit über Pollution. Dazu machte sie mit zehn Lehrpersonen ein Interview. Es war ihr wichtig, mich als Europäerin zu befragen. Sie hatte noch nie zu jemandem Kontakt gehabt, der nicht im Staate Kentucky lebte. Da ich sie nicht verstand, lieh sie mir ein Buch zu diesem Thema. Ich sollte im besonderen die Seiten 150 bis 200 lesen. Da stand u.a. etwas über die mangelhafte Abfallbewirtschaftung und die Rattenplage in Louisville. Ich kannte nur die Abfalleimer Patent Ochsner, die zweimal pro Woche gelehrt wurden. Zigarettenstummel ja, weggeworfene Getränkedosen, nein. Ich musste Nancy enttäuschen. Gerne erzählt ich ihr ein wenig von meiner Grossmutter, welche die Welt sauberer und besser zu verlassen wollte, als diese bei ihrer Geburt war. Das hiess konkret, zum Wald sorge tragen und Abfall vermeiden oder getrennt sammeln, speziell Papier, Glas und Blech. – Ein paar Monate später baten mich zwei Pfadfinderinnen, an einer konkreten Aktion gegen Pollution teilzunehmen. Es ging um die Laschen von Getränkedosen. Ich kannte diese Dosen mit den Laschen nicht. Ich packte die Chance, auch wenn ich meine Aufgabe nicht ganz verstand. Ich hatte während zwei Stunden auf einem Spielplatz Metallteilchen, eben diese Laschen zu sammeln. Gemäss der Erklärung konnten mit diesen Laschen die Getränkedosen bequem geöffnet werden. Das Problem entstand, weil diese Laschen und später die leeren Dosen einfach weggeworfen wurden. Verwahrloste suchten nach den Dosen, denn sie bekamen dafür ein paar Centime. Die scharfkantigen Laschen blieben liegen und auf dem Spielplatz, auch im Sandkasten musste die sog. Schuhpflicht eingeführt werden. Solche Laschen sollte ich nun einsammeln. Was ich von Auge sehen konnte, war schnell in meinem Kessel verschwunden. Mit einem Stecken durchsuchte ich das Gras und dann durchwühlte ich den Sand von Hand. Die Kinder halfen mir. Wir arbeiteten alles mehrmals bis zum Boden des Sandkastens durch. Als Belohnung erlaubte ich den Kindern, die Schuhe auszuziehen und mit den Füssen den lockeren Sand zu geniessen und wenn möglich, nochmals irgend eine versteckte Lasche zu finden. Die Pfadfinderinnen waren überrascht und begeistert. Die Eltern wollten nun den überfüllten Papierkorb täglich leeren, und die Kinder wollten nichts mehr einfach fallen lassen. Was sie nicht mehr brauchten, gehörte in den Papierkorb. Alle unterschrieben den Brief der Pfadfinderinnen an die Dosenfabrik, indem sie verlangten, dass die Laschen fest mit den Dosen verbunden bleiben müssen. Es unterschrieben auch Leute, die dies für technisch nicht möglich hielten. Ich begann zu ahnen, was «Pollution» war.
Mehrere Familien machten im Frühjahr und Herbst gemeinsam die Life-Aktion «back to nature» (= zurück zur Natur), d.h. sie wanderten an einem Wochenende in die Wildnis hinaus und schlugen in freier Natur die Zelte auf. Zwei von der Aktion begeisterte Teenager wollten mich dabei haben. Das war nicht ganz einfach. Die Eltern hatten nichts gegen mich, aber sie wollten mir solche Strapazen nicht zumuten. Sie dachten, ich wäre überfordert. Am Abend beim Lagerfeuer erzählten die beiden Mädchen, wie sie für mich gekämpft hatten. Schliesslich hätten sie sich mit den Eltern auf einen Probemarsch mit mir geeignet: Drei Stunden in den Wanderschuhen. Als Verpflegung nur ein kleines Sandwich, Dörrobst und Wasser. Ich hatte den Test ohne Mühe bestanden. Ich ging den Mädchen sogar zu schnell. Am vereinbarten Tag fuhren wir mit den Autos hinaus in die Natur. Wie geplant, trafen sich alle um zehn Uhr auf einem Bauernhof, wo wir die Autos, von einem Hund bewacht, parkieren konnten. Die Eltern, die drei Wanderleiter und der Sanitäter trugen die Rucksäcke mit dem Gepäck. Ich durfte meinen Rucksack nicht mitnehmen, das sei zu schwer für mich. Meine Sachen wurden verteilt. Die Aktion begann. Um uns auf die Natur einzustellen, gingen wir die erst halbe Stunde in einer Kolonne schweigend und langsam auf einem schmalen, sandigen Weg dahin. Dann kamen wir auf einen freien Platz und tauschten uns aus. Wir hatten den Alltag hinter uns gelassen. Nun bogen wir in einen Mischwald. Unsere Aufmerksamkeit galt gezielt den Bäumen. Wir begrüssten einzelne Bäume und liessen unsern Blick vom Wurzelstock bis in die Krone gleiten. Schneller als mir lieb war, stiessen wir auf eine Trinkwasserquelle. Wir wuschen die Hände und genossen das kühle Wasser. Die nächste halbe Stunde achteten wir auf Geräusche. Das Plätschern des kleinen Baches war bald leiser, bald lauter und dann so laut, dass wir die verschiedenen Vogelstimmen nicht mehr hörten. Ein Frosch quakte, summende Insekten gab es kaum. Nach einer weiteren Rast widmeten uns eine Weile den Blütenpflanzen und Gräsern bevor wir kräftig auszogen. Der Weg stieg an. Ich trug nun den Rucksack einer Mutter, die Mühe mit ihrem kleinen Sohn hatte. Die Steine auf dem Weg waren ihm zu gross, er wollte getragen werden. Am frühen Abend trafen wir auf dem Zeltplatz ein. Die einen schlugen die Zelte auf, andere machten ein Feuer, die Teenager und ich ruhten uns mit den Kinder aus. Sie kamen mir ganz nah, denn sie wollten hören, wie ich sprach. Wir zählten gemeinsam die Finger der Hand auf Deutsch und französisch und mit Gesten spielten wir «Sandmännchen sucht Schlafläuse», eine Geschichte, die ich erfand. Als es eingedunkelt hatte, merkte ich, dass das Sandmännchen genügend Schlafläuse gefunden hatte und nun Kinder suchte, die schlafen wollten. Ich wusste auch, dass das Sandmännchen nur ruhige Kinder besucht, um seine Schlafläuse zu verteilen. Bald breitete sich der Nachtfriede über dem Zeltlager aus. Das war die erste Nacht, die ich in einem Zelt schlief und meine Erinnerung an die Life-Aktion verlieren sich hier, doch sie begleiten mich bis heute. Wanderungen sind seither mit einem neuen Gehalt gefüllt, denn in jedem Ding steckt ein Geheimnis.
Ist «24 / 7» (auf englisch gesprochen) verbreitet bei euch? Wird mit Karte bezahlt? Ich verstand nicht und wusste nicht, was das sein könnte, bis Nancy und ich das erste Mal nachts um halb elf zum Einkauf fuhren. Das Geschäftshaus war dunkel. Nur zwei grosse Reklametafeln leuchteten immer wieder auf. Das Treppenhaus war schummrig hell. Wir hielten bei der Klingelanlage, und ich durfte zwei Mal läuten. Im Erdgeschoss wurde Licht. Wir fuhren rechts dem Gebäude entlang und hielten dich neben einer Türe. Die Verkäuferin öffnete mir die Wagentüre und schon stand ich im Laden. Nancy stieg aus und folgte mir. Wir waren die einzigen Kunden und brauchten nicht zum ordentlichen Parkplatz zu fahren. Für weitere Kunden standen zwei andere Türen zur Verfügung. Das genüge, wurde mir erklärt, nachts würden nur Lebensmittel verkauft und es seien noch nie mehr als zwei Autos gleichzeitig vorgefahren. Tags sei der Haupteingang auf der andern Seite offen. Die Verkäuferin drehte den Schlüssel und legte sich wieder auf den Liegestuhl. Nancy nutzte die Gelegenheit, um ihre Vorräte aufzustocken, der Laden sei zwar eng, aber da wir allein seien, habe der Einkaufswagen freie Fahrt. Von allen Spezialangeboten kauften wir zwei. Ferner Mineralwasser in grossen Plastikflaschen, Dosengetränke, Pappteller und Pappbecher, Plastikbesteck, verschiedene Sorten Haushaltspapier, … als unser Wagen hoffnungslos überfüllt war, drückten wir einen Knopf neben der Kasse. Die Verkäuferin stand auf, schüttelte sich und tippte ein. Nancy bezahlte mit der Karte. Ich staunte. Vier volle Riesentaschen für vier Arme, kein Problem, wir brauchten den Einkaufswagen nicht zum Auto zu nehmen. Geduldig erklärte mir Nancy alles. «Aber Nancy, wann braucht du all diese Sachen?» «Man weiss nie, von Angeboten müsse man immer profitieren.»
Take-Away und Drive-In: Ich liebte Autos und fuhr gerne Auto. Plötzlich hatte ich es geschätzt, in einem kleinen Dorf aufgewachsen zu sein, denn das gab mir die Möglichkeit, d a s Auto zu benutzen. In der Stadt war ein Vorwärtskommen mit Fahrrad oder Autobus viel bequemer, keine Staus, keine Sucherei nach einem Parkplatz. Auf dem Bauernhof hatten wir einen Ford-Consul, ein Familienauto mit einem grossen Kofferraum. Zu dritt hatten wir d a s Auto zu teilen, der Vater, der Bruder und ich. Der Diskussionen und Händeleien müde, hatte ich noch vor den Sommerferien 1968 bei meinem Onkel einen R-Vier gekauft und geplant, ihn meinem Vater zu schenken. Wie hätte es anders sein können, es gab ein grosses Geschrei und Vorwürfe wegen Geldverschwendung. Der Vater verweigerte die Annahme, das Auto müsse verschwinden. Die Mutter war vorbereitet. Sie bat mich in die Küche und gab mir 2000 Franken, sie wolle sagen können, d a s Auto gehöre ihr, sie habe es bezahlt. Der Onkel hatte ihr den Gesamtpreis verraten. Ich parkierte es in ihrem Auftrag im Schuppen neben den Landmaschinen und brachte ihr die Unterlagen und die Schlüssel. Nach der Stallarbeit machten der Bruder und sie eine Runde, nein mehrere Runden. Eine Begeisterung! Der Vater fuhr schliesslich bis sein Lebensende nur R-4. – Wie wurden die Autos in den USA benutzt? Ich wusste, das Auto ist das Transportmittel. Was das hiess, erfuhr ich in Hartford Wisconsin, einem Städtchen mit ca. 2000 Einwohnern. Ich wohnte bei einer Familie mit einer deutschstämmigen Grossmutter, in der siebenten Strasse im Haus 9. Nach dem Frühstück verschwand Bob, der Vater sofort in der kalten Garage und schaltete den Motor ein. Sassen die drei Kinder und ich bei ihm im Auto, öffnete die Mutter das Tor und wir fuhren zu Haus 5. Dort wurden wir erwartet. Die Mutter öffnete das Garagentor, wir fuhren hinein und die Tochter stieg zu. So wurden wir jeden Morgen aus der Garage zur Schulhaustüre gebracht und gegen Abend wieder gemeinsam abgeholt. Von Haus 5 nach Haus 9 zu gehen, war nicht möglich, denn die Strecke konnte leicht mit dem Auto gefahren werden. Es gab zwar keine Trottoirs, doch der Weg zur Schule schien mir problemlos, wenig befahrene Nebenstrassen, Distanz zwei Meilen. Mir fehlte es an regelmässiger Bewegung, doch zu Fuss von der Schule heim zu spazieren, lag fern jeder Vorstellungsmöglichkeit. Selbst der kleine Jan wusste das. Er erklärte mir, wer im Auto allein sitzen kann, darf in die Schule. Ersatzweise kaufte die Familie einen Hometrainer, den alle mit Freude benutzten. Trotzdem, der günstige Moment kam und ungeplant geschah es. Nach mehreren kalten, unfreundlichen Tagen lag ein Hauch von Schnee auf den Vorgärten. Die Sonne schien und ich hatte am Nachmittag keine Verpflichtung in der Schule. Ich wollte nur ein wenig ins Freie, ein paar Schritte machen, über den Parkplatz zur Strasse gehen, … und dann marschierte ich zügig heim. Was für eine Wohltat! Alle waren erstaunt, dass ich das geschafft hatte. Wie im Krieg in Deutschland, meinte Bob der Familienvater. Wie war es möglich, dass ich die angebotenen Mitfahrgelegenheiten ablehnen konnte. Am Sonntag, wir hatten vor dem Brunch die Frühmesse besucht, schlug Bob eine Besichtigung der ersten Häuser von Hartford vor. Das ging nur zu Fuss. Die Kinder wollten sofort mit und die Mutter freute sich auf den ruhigen Nachmittag. Alles klappte gut. Es war kalt. Alle besassen Handschuhe und sie konnten diese nun endlich nützen. Es wurde von einer kommenden Eiszeit gesprochen. Die Warenhäuser hatten ihr Sortiment an Winterkleidern ergänzt. Da ich in dieser Frage unsicher war, luden mich zwei Kollegen von Bob zu einer Schnee-Scooterfahrt ein. Nach drei Stunden auf der Schnell-Autobahn trafen wir in einem Sportzentrum ein. Dort, am nahen See verbrachten viele ihre Sommerferien. Neu konnten im Winter nun Schnee-Scooter gemietet werden. Es machte Spass, über die schneebedeckten Ebenen zu sausen. Um nicht unfreundlich zu sein, teilte ich ihr Meinung, dass Schnee-Scooter im Winter wohl bald das Auto teilweise ersetzten könnten.
Einschub: 5. August 2019, es wird in allen Zeitungen von einer kommenden Warmzeit gewarnt.Ich entschied mich, einen Leserbrief zu schreiben: «Gemäss SN vom 27. Juli 2019 plant die Europäische Investitionsbank (EIB) per Ende 2020 keine Kredite mehr an Energieprojekte zu vergeben, die auf fossile Brennstoffe angewiesen sind. Es ist damit zu rechnen, dass wie in Australien asiatische Banken in die Bresche springen. Hoffentlich wird der Strom dadurch nicht teurer. Hoffentlich haben wir weiterhin eine regelmässige geordnete Stromversorgung. Mein Mann und ich brauchen pro Jahr 1800 kWh Strom, inkl. Waschmaschine und Tiefkühltruhe. Wer kennt seinen eigenen Stromverbrauch?“
In ihren Ausgaben vom 27. und 29. Juli 2019 informieren die SN ihre Leserschaft über die Ziele des 4. Nationalen Klimagipfels der «Bewegung Klimastreik Schweiz», der am vergangenen Wochenende im Kirchgemeindehaus Johannes in Bern stattfand. Unterstützt würde die Bewegung von einem «wissenschaftlichen Rat», dem etwa der WWF (kein «W» steht dort für Wissenschaft) angehört. Zwei professionelle Dolmetscherinnen sorgten dafür, dass sich Tessinerinnen, Romands und Deutschschweizerinnen verstanden. Ziel der Bewegung ist es, «die Wahlen unparteiisch zu beeinflussen, null Treibhausgasemissionen bis 2030 zu erreichen, Klimagerechtigkeit und ein Systemwechsel, falls die Forderungen im aktuellen System nicht erfüllt werden». Was heisst Systemwechsel? Verhältnisse wie z.B. in Russland? Bitte werfen Sie einen Blick auf Seite 3, ebenfalls in der SN vom 29. Juli 2019, wo vom Umgang der russischen Staatsmacht mit Demonstrationen der Opposition berichtet wird. Zurück in die Schweiz: Wie wird die «Bewegung Klimastreik Schweiz» finanziert? Wer hat die Fäden im Hintergrund in den Händen? Was bringt sie den Geldgebern? Ich höre regelmässig, dass nach 2030 grosse Teile des Stroms durch Windräder und Solarzellen produziert werden sollen. Womit werden Bedarfsspitzen im Winter überbrückt? Gibt es Schätzungen zur Entwicklung des Strompreises bis 2030? Ich bin erstaunt, dass einzig die SVP einen teilweise andern Standpunkt vertritt als die «Bewegung Klimastreik Schweiz». 1974 wies der «Spiegel» auf die Gefahren einer neuen Eiszeit hin, siehe Spiegel Nr. 33/1974: «Katastrophe auf Raten – Neue Eiszeit -» . Wie haben sich doch die Wissenschaftler damals getäuscht – und heute? Das muss sich erst noch weisen.
Nicht mit Handzeichen, sondern mit einem frenetischen Applaus begrüssten die 150 Teilnehmer des Klimagipfels am Abend den Koch. Er hatte ein veganes und glutenfreies Nachtessen vorbereitet: Humus, Tofu, Salate, Gemüse und Bratkartoffeln aus dem Ofen. Entsprachen die Zutaten den Forderungen nach lokaler und saisonaler Ernte? Wie wurde das Essen serviert? Wie viel Abfall gab es? Was wurde vorher und nachher gegessen und getrunken? Hatten die Teilnehmer Smartphones dabei? Wie hoch ist ihr persönlicher Stromverbrauch? Wo arbeiten die Teilnehmer? Wo verbringen sie ihre Ferien? Es wird jedes Jahr mehr Strom (Elektroautos, Wärmepumpen, Digitalisierung etc.) gebraucht. Die Flughäfen melden weiterhin steigende Passagierzahlen für Ferienreisende – wir gehören nicht dazu.» Einschub Ende.
Früher kauften wir mit Vorliebe in den Selbstbedienungsläden von Migros ein. Keine Warterei, ich füllte das Wenige, das ich brauchte, hauptsächlich Teigwaren und reduzierte Käse in meinen Korb und schon stand ich an der Kasse. In der Marktgasse gab es Geschäfte aller Art. Man traf sich dort und plauderte. Man konnte alles finden und wurde freundlich bedient. An Cafés mit feiner Patisserie, die zum Verweilen einluden, fehlte es nicht. Im Freien wurden an verschiedenen Ständen Getränke und Snacks für das kleine Portemonnaie und für Leute mit wenig Zeit anboten. Auch ein Blumenstrauss, für den geplanten Besuch im nahen Altersheim konnte gekauft werden. Hätte zur Marktgasse nicht die moderne Bezeichnung «Einkaufszentrum» gepasst? – Ich fuhr mit Clara das erste Mal in ein Einkaufszentrum, das um acht geöffnet und um Mitternacht geschlossen wurde . Sie wolle Viertel vor acht dort sein, um noch in der Nähe des Eingangs im Schatten von den Bäumen einen Gratisparkplatz zu finden. Wir würden den ganzen Tag dort verbringen. Ich solle Sport- und Duschsachen mitbringen. Clara wollte lange im Buchladen verweilen, ich könne auf eigene Faust auf Erkundung gehen. Ich staunte ob der Grösse des Gebäudes. Wir vereinbarten, uns alle zwei Stunden in der Eingangshalle bei den Bänken zwischen den Palmen zu treffen. Schon war sie weg. Ich schaute mich um. Bereits in der Eingangshalle gab es viel zu sehen. Sie schien mir nur wenig kleiner als die Bahnhofshalle Zürich, reich dekoriert mit viel Plastik in natürlichem Look. Verschiedene Rolltreppen führten in die oberen Etagen, nur eine nach unten. Es gab mehrere Warenlifte, die nur mit Schlüssel bedient werden konnten. Die kleinen Kinder konnten sich im eingezäunten Kinderparadies verweilen, in der Krabbelecke, im Puppenhaus, im Sandkasten oder mit Tretautos auf der Rundbahn. Die grösseren schauten sich in einem Robinsonspielplatz um oder entschieden sich für einen Film. Für Senioren gab es eine bequeme Zone mit Bedienung und auf Wunsch Rollstühle. Clara erklärte mir, diese vielen Annehmlichkeiten würden ein gehobeneres Publikum anziehen, auch Familien mit einen hohen Konsumbedarf. Es gäbe keine Billigprodukte, dafür eine Wellness-Zone und eine Fahrschule mit einem Flugsimulator. Dort würden samstags um 11 am und 5 pm Gratisstunden angeboten, sie habe uns angemeldet. – Meine Lesenden, ich könnte nun, 2019 auf das Sofa sitzen und stundenlang durch meine Erinnerungen gleiten und diese mit Phantasien anreichern. Ich muss mich losreissen, denn ich will und darf nicht all das Fantastische beschreiben, das ich bis heute niemanden erzählen konnte. Neu bin ich jedoch in der Lage, Erinnerungsfetzen im Alltag assoziativ zu erhaschen und ich vermute, bald den Dreh zu finden, um sie verbunden mit Aktuellem neckisch erzählen zu können.
Fitness, Wellness, Beauty-case: Ich marschierte durch die Welt. Die Beine waren mein Transportmittel. Was brauchte ich da zusätzlich Fitness? Sind Gartenarbeit, Handarbeit und unter einem Baum sitzen nicht gleichzeitig Wellness? Beauty-case, mit der Schönheit hatte ich es nie. Die Welt der Töpfchen und Tübchen blieb mir verschlossen, denn, selbst wenn ich gewollt hätte, so reagierte ich auf Schönheitsmittel aus Warenhäusern mit Allergien, mit verschwollen Augenlidern, mit Rötungen beliebig verteilt über das ganze Gesicht und heftigem Niesen. Produkte aus Parfümerien? Schlechtes Preis-Leistung-Verhältnis: Sehr teuer, Resultat bescheiden. Mein Sohn sagte Jahre später: Mama, du willst einfach nicht. Mama, du bist zu faul. Mama, du liest lieber die Zeitung. Mama, ich habe dich gern.
Religion: «Behüte dich Gott - Gott sei Dank - Dein Segen komme - Gott hilf - Schutzengel her - wo bist du - muss das sein -». Ich hatte und habe einen sportlichen, intelligenten Gott, der mir einiges zumutet. Oft war und ist er frech und ungeduldig und ich habe Mühe mit ihm. Doch Gott ist und bleibt Gott. Er will weder beweihräuchert noch angehimmelt werden, wir begegneten uns auf Augenhöhe. – In den USA habe ich an Gottesdiensten mitgewirkt, an kirchlichen Podiumsgesprächen teilgenommen und sogar mehrere Predigten gehalten zu Texten aus der Bergpredigt. Beten ist Teil meines täglichen Brotes, es fällt mir leicht und in Amerika gehörte es zum Leben wie das Autofahren. Sie taten es oft und spontan: Vor und nach einer Autofahrt, vor Sportanlässen, vor oder während geselligen Stunden, vor dem Essen, für Kranke, für Kinder u.a. mehr. Meine Kurzformeln und meine Direktheit Gott gegenüber, die ich von meiner Grossmutter übernommen hatte, erstaunten und führten zu teils mühsamen, oft auch lustigen Diskussionen. – Ich begegnete strenggläubigen Southern Baptisten und offen ernsthaften kleinen Gemeinschaften von Frauen ohne Gelübde. Sie bezeichneten sich als Ordensfrauen, trugen schlichte Alltagskleider mit einem kleinen Kreuz, wohnten gemeinsam, praktizierten Gebetsstunden und finanzierten mit ihren zum Teil sehr guten Einkommen soziale Institutionen für die schwarze Wohnbevölkerung. Auf ihren Wunsch teilten wir gelegentlich das Abendbrot. Da ich ohne Entgelt für Amity Institute arbeitete, luden sie mich ein, ihrem Konvent beizutreten, Gemeinschaft im Gebet genüge. Sie wollten meinen Wunsch, später in meinem Leben in irgend welchen abgelegenen Bauerndörfer im Kongo etwas aufbauen zu helfen, mit Gebeten unterstützen und nahmen meinen Plan, den sie «Lebenswerk von Maja» nannten, in die Liste ihrer Dauer-Anliegen auf. Sie kannten mein Schlüsselerlebnis (1949) mit Alfi in der Sonntagsschule und ermuntern mich (1969) bis ins hohe Alter durchzuhalten. Ich konnte damals nicht ahnen, selbst wenn ich immer entschlossen blieb, dass ich 2009 den Verein Bauerndörfer im Kongo gründen und die Frauen im Hinterland von Kikwit RDC jährlich während zwei Wochen besuchen würde. Es freut mich, dass ich dem Mut habe, dies jetzt 2019 in meine Lebensgeschichte einzutippen. – Der Vollständigkeit möchte ich noch erwähnen, dass ich auch Gemeinschaften, sie nannten sich «Konvente», von Ehepaaren mit Kindern kennen gelernt hatte, die sich im Stillen um verwahrloste Kinder und Jugendliche kümmerten. Gemeinsam teilten diese Gruppen die Gewissheit, am Plane Gottes teilzuhaben und Jesus Christus treulich nachzufolgen.
Konsum, Abfall: Solange ich auf dem Bauernhof lebte, wusste ich nicht, dass es Lebensmittelabfälle gibt. Was am Mittag auf den Tisch kam, assen wir spätesten am Abend fertig oder es wurde am kommenden Tag weiterverarbeitet. Ein wenig gaben wir den Katzen, die es nicht schafften, ihren Hunger mit Mäusen zu stillen. Die Schweine und das Vieh verzehrten die Rüstabfälle und Faules wanderte auf den Mist. Meine Lesenden, Sie wissen zweifelsohne, dass heute die Hälfte der weltweit produzierten Nahrungsmittel nicht konsumiert wird. – In den USA galt es damals als unhöflich, wenn ein Gast, und ich galt immer als Gast, vor einem leeren Teller sass, selbst wenn das Besteck manierlich darin lag. Ich begriff schnell, es sei immer, wie in guten Häuser ein Anstandsrestchen gut sichtbar liegen zu lassen, wenn man bedient sei. Davon will ich hier nicht schreiben. Ich möchte nur auf die grossen Mengen hinweisen, die eingekauft wurden, weil sich dafür eine günstige Gelegenheit bot. Man kaufte, ohne zu wissen wofür, als ob eine Hungersnot drohen würde. Im Themenbereich „Einkauf, Konsum und Abfall“ wurde ich in den USA initiiert und bin es geblieben. Ich weiche diesbezüglichen Gesprächen aus.. Ich lebe nach meinen eigenen Regeln. Ich esse, was ich im Garten pflanze und kaufe erst, wenn es nichts mehr gibt. Seit dem 15. September 1995 kaufe ich keine neuen Kleider mehr, ich trage aus, was ich habe und von meiner Mutter und Schwiegermutter habe ich in den 2000er Jahren viel Schönes geerbt. Ich schlafe daheim, ausser wenn ich im Kongo unterwegs bin. Ich höre oft: «Das können nicht alle!» «Wo würde das hinführen, wenn das alle täten!» «Ich bin kulturell interessiert, das erfordert reisen.» «Reisen bildet.» Ich verzichte auf nichts. Kofferpacken, wegfahren und heimkommen sind nicht meins. Ich freue mich, dass es mir seit kurzem hie und da gelingt, meine Ansichten dritten amüsiert zu schildern. Nochmals, ich verzichte auf nichts, ich schreibe mit MML meine Lebensgeschichte, das ist oft mühevoll und macht mir gleichzeitig Spass.
Fertignahrung: Als kleines Kind wünschte ich mir immer „fertiges Brot“ von einem Laden statt unserem Brot aus unserem Kachelofen. Dann kamen die Zeit der Tütensuppen von Maggi, von Nescafé, von Trockenfutter für die Katzen, von Ravioli mit Apfelmus aus den Büchsen. All dies stand schnell auf dem Tisch. In den grossen Einkaufszentren in den USA gab es bereits 1969 alle Herrlichkeiten, die man bei uns heute auch finden kann. – Die Bemerkung «Ihr mit eurem Garten!“ überhöre ich. Ich habe es gut, mein Mann kocht täglich, was an Gemüse anfällt und der Rest wandert in den Tiefkühler für den Winter. – In den USA gab es vollständige, speziell gesundheitsfördernde Menüs aus Tüten. Das habe ich seither nicht mehr gesehen. Musste es schnell und noch schneller gehen, wurden mir als Gast gelegentlich ein solches Tütenmenü angeboten. Für den regelmässigen Gebrauch zu teuer, schnell ein Hamburger, zwar ungesund, genügte auch und kostete keinen Viertel davon. Man konnte wählen zwischen Poulet und Vegi. Beim Kauf von sechs Tüten gab es dazu gratis die passende Flasche. Zunächst war ein wenig kaltes Wasser, dann sachte das Menü in Pulverform einzufüllen, gut verschliessen und zwei Minuten kräftig schütteln. Nach belieben mit Wasser, kalter oder warmer Milch ergänzen und nochmals schütteln. Probieren! Falls zu scharf, etwas Milch nachgiessen. Das tranken wir unterwegs im Auto. Eine Portion deckte den Tagesbedarf. Eigentlich mochte ich es nicht, aber ich war beeindruckt, wie sich für den Rest des Tages kein Hungergefühl mehr einstellte.
Alkohol und Drogen, der Umgang damit war anders. Waren die Probleme kleiner oder grösser? In den ersten Tagen in New York fuhr ich in einem Bus durch Harlem. Ich wusste, dass Harlem als ein gefährlicher Ort galt, aber in einem Bus glaubte ich, gut aufgehoben zu sein. Bald war mir etwas unheimlich zu Mute. Ich sass ruhig da und hatte meine Dokumente unter dem Arm festgeklemmt. Dann stand der schwarze Buschauffeur auf und warf einen Blick auf die Fahrgäste. Er schimpfte, als er mich entdeckte. Er packte mich und setzte mich dicht hinter die Führerkabine. Fuhren wir durch eine vom Krieg zerstörte Gegend? Hochhäuser ohne Scheiben, teilweise ausgebrannt und drin schwarze Menschen. Die Strassen waren holprig. An den Bushaltestellen hockten Menschen am Boden. Es hiess, Harlem sei eine Stadt in der Stadt, das grösste Ghetto von Schwarzen. Es schien mir gefährlich, aber ich fühlte mich vom Buschauffeur beschützt. Ich war dankbar, so etwas gesehen und gerochen zu haben. Eine ähnliche Not sah ich Jahre später wieder in Bildern von Biafra am Fernsehen. Stimmte überhaupt, was ich glaubte, live gesehen zu haben? 1978, auf der Hochzeitsreise bekam ich den Beweis. Die Air Canada streikte. Für Toronto wurde uns ein Ersatzflug über New York angeboten. Ich freute mich: Nochmals kurz New York und dies mit meinem Mann gemeinsam! Unser Jumbo landete im Kennedy-Airport, und mit einem Taxi fuhren wir nach Authority-Station. Da waren sie wieder, die Hochhäuser mit Löchern statt Fenstern. Mein Mann konnte es bezeugen, ich brauchte nicht mehr an meinem Gedächtnis zu zweifeln. Der Greyhound-Bus brachte uns nach Toronto, wo wir einen Camper reserviert hatten. Unterwegs hatten Gelegenheit, einen Blick auf die Niagarafälle zu werfen. Der Bus machte auch in Buffalo halt, von wo die berühmte klassische Ballade von Theodor Fontane «John Maynard» erzählt: 'John Maynard war unser Steuermann, aus hielt er, bis er das Ufer gewann'. Wer kennt sie heute noch? Sie gibt Einblick in die Heldenverehrung des 19-Jahrhunderts, eine längst vergangene Zeit. – Doch vorwärts, vorwärts in die USA zurück: Wie mir bekannt war, hatte es in den USA bis in die 30er Jahre ein generelles Alkoholverbot gegeben, das nicht durchgesetzt werden konnte. Alkohol in der Öffentlichkeit war Tabu, der Verkauf von Staat zu Staat anders geregelt und von Seiten der Kirchen sehr verpönt. Er konnte nur in speziellen Läden gekauft werden. Wurde das Thema angesprochen, gab ich mich vorsichtshalber als strenge Abstinenzlerin aus, die leicht tolerierten konnte, wenn jemand ein Gläschen trank. Doch viel Leid und Elend lauerte in den Flaschen. Und Drogen irgendwelcher Art waren immer in der Nähe. Auch in den guten Stuben wusste man um diese ungelösten Probleme, aber sie durften nicht angesprochen werden.
Kommunismus, Unruhen, Krieg und Frieden: Martin Luther King kämpfte mit friedlichen Mitteln gegen die Rassentrennung. In den Nachrichten hatte ich von seinen Aufrufen, von den Sittings und den Märschen für die Gleichstellung gehört. Im Frühling 1968 war er ermordet worden. Ich hatte seine Rede «I have a dream» gelesen. Ein paar Wochen später folgte ihm Bobby Kennedy. 1969: Auf Lindon Johnson folgte Richard Nixon. Die Mondlandung, Demonstrationen für und gegen den Krieg in Vietnam, Woodstock, die Hippies und die Flower People mit ihrem Aufruf für den Frieden. Meine Lesenden, es waren bewegte Zeiten, das Internet kann Ihnen weiterhelfen. – Die kommunistische Partei war in den USA verboten. Es hiess und es wurde geglaubt, die USA müsste und könnte dem Krebsgeschwür «Kommunismus» die Stirne bieten. Das war der Grund für die militärische Präsenz der Amerikaner in Vietnam, die schleichend zu einem grausamen Krieg anwuchs, dem viele Söhne zum Opfer fielen. Dave gehörte dazu. Wir hatten uns nicht gekannt, aber wir hatten uns verliebt, an einem Hamburgerstand, wo viel los war. Dave und ich standen in der Menge. Er fragte mich, ob ich schon in Hawaii gewesen sei. Ich schüttelte den Kopf. Er fragte: «Willst du hin gehen?» Ich nickte und schaute in seine blaugrünen Augen. Wir waren verliebt. Wir durften keine Zeit verlieren. Dave wurde abgeholt. Er musste auf die Basis zurück. Vietnam rief. Er konnte kaum sprechen vor Aufregung. Er fasste meine Hände. Dann machte er ein Photo von mir und schrieb meine Adresse auf. Er streckte mir ein Paket hin: «Das ist meine Fahne. Ich habe sie als Auszeichnung erhalten, denn ich konnte nicht nach Hawaii, weil niemand auf mich wartete. Jetzt ist alles anders» Er schaute auf das Blatt: «Sie werden dich benachrichtigen. Er legte den Arm sachte um mich. In einem Monat treffen wir uns in Hawaii. Schön dass es dich gibt. Wir standen in der Warteschlange vor der Telefonkabine. Er sagte immer wieder meinen Namen «MAJA» und schaute mich an. Plötzlich waren wir an der Reihe. Er wählte die Nummer seiner Mutter. Er gab mir sofort den Hörer und ich sagte etwas und sie sagte auch etwas und schluchzte. Dave sagte: «I'm so happy,» und hängte auf. Wir umarmten uns. Er hatte Tränen in den Augen: Maja wartet auf mich. Wir waren glücklich. Glück kennt keine Zeit. Ein Auto fuhr vor. Tschüss, dann in Hawaii. Dann in Hawaii. Alle winkten. Eine Stimme sagte leise: »Viele kommen nicht zurück.» Wir waren glücklich. Ich wurde benachrichtigt, Dave kam nicht zurück. Der Krieg war brutale Realität geworden.
Ich schaute seine Fahne immer wieder an, ich drückte sie an mich und entschloss mich, etwas für den Frieden zu tun. Was? Ich begann wieder Deutsch zu denken. Ich glaubte zu wissen, dass wir eine starke speziell organisierte Milizarmee hatten. Jeder Soldat hatte seine Ausrüstung daheim und innert vier Tagen war eine Mobilmachung möglich. Meine Lesenden, es kam mir viel in den Sinn. Wir hatten seit 100 Jahren keinen Krieg gehabt. Ich wurde stolz auf unsere Verteidigungsarmee. Das nannte sich bewaffnete Neutralität. Es fehlte mir die Sprache, um über das Gebiet von Krieg und Frieden nachzudenken oder zu sprechen und doch beschäftigte mich diese Fragen so sehr, dass ich mich sogar auf englisch abmühte, darüber zu sprechen. Ich wurde sogar von einem amerikanischen Offiziersverein zu einem Kaffee-Gespräch eingeladen. Es dauere etwa fünf maximal zehn Minuten, wurde mir gesagt, um mir die Angst zu nehmen. In einem kecken Dialog von mehr als einer Stunde gelang es mir, den Herren unser Land so gut zu erklären, dass der Vorsitzende mich spontan fragte, ob ich eine ausserordentliche Einbürgerung akzeptieren würde. Das Wort „Heimweh“ wurde mit Bedauern als Antwort akzeptiert. Später brachten mich Mitglieder des Offiziersverein zu einem Treffen mit Quäkern, die sich seit langen für den Frieden einsetzen würden. Meine Lesenden, es war schwierig, denn ich dachte anders, doch da hilft Ihnen das Internet gerne weiter. Am 18. September 2020 feiern wir das Jubiläum «25 Jahre Abendgebet für den Frieden».
America the beautiful. Es geschah kein Wunder. Ich fuhr mit einem Schiff, ich glaube es hiess Rotterdam, nach Europa zurück.
7. 99 Tage im Greyhound unterwegs
«Die Reise mit Charley: Auf der Suche nach Amerika» (im englischen Original: Travels with Charley: In Search of America) ist ein 1962 erschienener Reisebericht des amerikanischen Schriftstellers John Steinbeck, in dem er von einer Rundreise durch die Vereinigten Staaten erzählt, die er im Herbst 1960 in einem eigens dazu angefertigten Pickup-Camper allein mit seinem französischen Pudel Charley unternommen hatte. Wie der Untertitel «Auf der Suche nach Amerika» andeutet, geht es darin nicht bloss um die Reise, sondern auch um eine Reflexion des Autors über sein Verhältnis zu Amerika.
Ein halbes Jahr nach der Geburt unseres Sohnes, 1981, litt ich unter diffusen Schmerzen. Glücklicherweise verschrieb mir unser Hausarzt fünf Ganzkörpermassagen. Vor jeder Behandlung erzählten die Physiotherapeutin und ich uns wichtige Episoden aus unserem Leben. Dabei erwähnte ich meine Rundreise durch die USA und bedauerte, an wie wenig Einzelheiten ich mich erinnern könnte. Sie zog sich kurz in ihre Privatwohnung zurück und brachte mir das Buch «Die Reise mit Charley: Auf der Suche nach Amerika». Dieses Buch war d a s grosse Geschenk. Es machte mich glücklich. Es trug mich zurück, zurück in den Greyhound, auf meine Reise von damals. Ich erlebte meine USA-Rundreise nochmals, denn Steinbecks Texte deckten sich stimmungsmässig mit meinem Erleben im Greyhound. Es brachte mir zudem Gegenden der Vereinigten Staaten nahe, die ich nicht kannte wie Maine oder Seattle, sie kamen mir so nahe, dass ich glaubte, diese Gegenden selber zu entdecken und den Menschen persönlich zu begegnen. Das Buch begleitete mich lange in der Handtasche und überbrückte leere Mutter-Momente. Ich erzählte andern Leuten von meiner beglückenden Lektüre und empfahl ihnen, es selber zu lesen. Drei Mal überreichte ich es als Geburtstagsgeschenk.
Meine Lesenden, ich bin mit meinem Arbeitsplan im Rückstand und ich bilde mir nicht ein, in der Schnelle einen lesenswerten Reisebericht tippen zu können, dies besonders, weil ich immer wieder neu fasziniert an Steinbecks Rundreise denke. Erwähnen möchte ich zusätzlich nur drei Punkte. Zunächst Florida, Miami, weil in der Woche, in der ich diesen Text abschliesse, Radio SRF I in der Sommerserie «Rendez-vous mit der Welt» von Miami berichtet. Ich war vor 50 Jahren drei Tage in Florida. Wir machten eine wunderschöne Fahrt auf dem Highway in Richtung der Spitze der Halbinsel: Ein paar Villen, kaum berührte Natur und das Meer. Am zweiten Tag fuhren wir in einem kleinen Boot durch die Everglades. Mit abgestelltem Motor glitten wir dahin: Ringsum Tiere und Pflanzen, Töne und Gerüche. Wir hatten Glück, selbst die Gasteltern waren überrascht. Am dritten Tag machten wir eine Radtour durch unendlich scheinende Ebenen. Und, um mir auch einen Eindruck von Floridas Glamour zu geben, lud mich meine Gastfamilie am letzten Abend in ein Nobelrestaurant am Strand zum Eis essen ein. Ein voller Erfolg, hätten wir nicht auf der Fahrt dort hin ein Elendsquartier mit Flüchtlingen aus Kuba durchquert. Mit Muskelkater in den Beinen und Muskelkater im Kopf reiste ich am nächsten Tage weiter Richtung New Orleans. – Als zweites: Vor der Ankunft der Weissen hatten die Indios Nordamerika besiedelt. Wo waren sie geblieben? Wo sind sie geblieben? Ich habe mit einigen von ihnen gesprochen. Dass ich mich in angemessener Weise für die Taten meiner Rasse entschuldigen konnte, machte eine gute beidseitige Begegnungen erst möglich. – Schliesslich meine Fahrt durch den Mittlern Westen, durch die Einzugsgebiete des Missouri und das Mississippi: Die riesigen Getreidefelder, von denen mein Vater träumte, fand ich nicht. Viele Gegenden schienen mir eher verarmt. Überrascht sah ich jedoch Bisonherden in der Ferne grasen. Der Buschauffeur erklärte mir, die Bisons seien geschützt. Sie würden sich schnell vermehren und es gebe wieder gegen 30 Tausend. Für die Zeit, als die Siedler angekommen seien, würde deren Zahl auf 30 Millionen geschätzt.
99 Tage im Greyhound unterwegs. Ich war sicher, dass viele diese Chance nützen würden. Ich traf niemanden. America the Beautiful, ich habe viel erlebt, danke. America the Beautiful, meine Welt ist durch dich eine andere geworden. America the Beautiful: Globalisierung, Internet, Social Medias, Klimawandel … und ich bin nun 75 Jahre alt. Danke.

Auszüge aus dem Tagebuch der elften Reise vom 9. Februar bis 10. März 2019 in den Kongo
1. Wie entstand dieses Tagebuch?
2. Ankunft und erste Tage in Kinshasa
3. Aufbruch und Aufenthalt in Kikwit
4. Auf der Reise in die Dörfer entlang dem Fluss Kwenge
1. Wie entstand dieses Tagebuch?
Alle zehn vorher gehenden Reise begann ich mit dem Vorsatz, ein Tagebuch zu schreiben. Es klappte nie. Kaum vor Ort wurde ich von Unbekanntem und Ungewissem überschwemmt. Und dann - das Sprachgewirr! Diesmal gelang es mir, dank einem Minicomputer und trotz dessen mir fremder Tastatur. Täglich tippte ich unterwegs Texte auf französisch, so wie es sich ergab. Die Batterie hielt durch. Diese Schreiberei, bestehend aus vielen kleinen und kleinsten Eindrücken, gab mir viel Kraft. Ich hüpfte vor und zurück. Jede Notiz war getrennt von der nächsten zu lesen. Die zeitliche Abfolge ordnete ich in der Schweiz. Vieles löschte ich. Wie jede Reise war auch diese wieder ganz anders als die vorangehenden. Gemeinsam allen Reisen war, dass sie mich mit Freude und Dankbarkeit erfüllten.
J.-P. Sorg war bilingue und beruflich auf Aufforstung in den Tropen spezialisiert. Er hatte den französischen Text korrigiert. Seit Ende März 2019 war dieser auf die Homepage zu lesen. Herzlichen Dank. Ankommen in Kinshasa fiel mir leicht, aber zurückkommen in die Schweiz, erlebte ich immer als Ernüchterung. Das Ordnen der getippten Notizen hatte mir diesmal das Heimkommen erleichtert. Nach langem Zögern entschloss ich mich am 20. August 2019 dieses Tagebuch der elften Reise nach Deutsch zu übersetzen und in Teil 3 «meiner grossen Welt» einzufügen. Ich gab mir eine Woche Zeit. Ob ich das schaffe? Am 27. August stellte ich fest: Teilweise geschafft und ich brach die Übung ab. Meine Lesenden, vielleicht, falls die Homepage www.bauerndoerfer-im-Kongo.ch/">www.bauerndoerfer-im-kongo.ch noch existiert, können Sie das Reststück dort lesen.
2. Ankunft und erste Tage in Kinshasa
Samstag, 9. Februar, die Reise
Ich verliesse die Wohnung in Schaffhausen um 4:45 und traf um 20:30 an der Rue Gerberas 72, in Limete, Kinshasa, ein. Im Flugzeug schlief ich und sprach einzig kurz mit meinem Platznachbar, Monsieur Nufm von Lausanne und Kinshasa. Er machte diese Reise drei Mal jährlich und exportierte ausgemustertes Material der Schweizer Armee nach Kinshasa. Dies soll bis vor wenigen Jahren ein sehr lukratives Geschäft gewesen sein. Ich erzählte ihm von meiner Tätigkeit in der Gegend von Kikwit, Bandundu. Da er aus Bandundu stammte, gab er mir seine Telefonnummern. Monsieur Nufm ging an zwei Stöcken, konnte trotz Brille kaum lesen und hörte schwer. Ich staunte. Ein Kontakt zu ihm kam nicht zustand, da er im Laufe des Sommers 2019 mehrmals Spitalpflege brauchte.
Sonntag, 10. Februar 2019 mein erster Tag in Kinshasa
Givien, Els, Charlie, Boyi, der Préfet der Schule „Les Gazelles“ und andere kamen vorbei, um mich zu begrüssen. Ich fühlte mich müde und elend. Obwohl ich bereits schlechte Erfahrungen mit Safous gemacht hatte, liess ich mich dazu überreden, eine zum Frühstück zu essen. Safous werden vor Ort wie Äpfel bei uns gegessen, aber ich ertrage sie nicht. Ich ruhte und kurierte mich den ganzen Tag aus.
Nach zehn Reisen, war ich entschlossen, mich über die Gegebenheit vor Ort etwas besser zu informieren. Deshalb bat ich Els, eine Lehrerin aus der Schweiz, die seit 40 Jahren mehrheitlich in Kinshasa lebt, mir von ihren Erfahrungen mit den lokalen Kirchen und derer Situation zu erzählen. Sie schätzte 60% Katholiken, 30% Protestanten, 10% christlich-evangelikale Bewegungen und mehr und mehr Muslime. Die Katholische Kirche habe grosse Anstrengungen gemacht, um mit den Wahlen einen Präsidentenwechsel zu realisieren. Zu den Protestanten: Ihre erste Kirche sei 1878 gebaut worden. 1978 sei eine Kathedrale mit dem Namen Die 100-Jährige in der Gemeinde Lingwala, neben dem nationalen Radio- und Fernsehstudio und dem Palast des Volkes gebaut worden. Eine erfolgreiche Universität wurde auf dem selben Grundstück eröffnet, «l'Université Protestante au Congo». Sie führe alle Fakultäten und stehe in Partnerschaft mit andern Universitäten der Welt. Die katholische Kirche sei länger aktiv im Congo als die Protestanten. Sie hat die erste Universität des Landes gegründet, «l'Université Lovanium». Nach Auseinandersetzungen mit den Regierenden, welche die gesamte Ausbildungen verstaatlicht und alle privaten Universitäten konfisziert hatten, sah sich die Katholische Kirche gezwungen, eine neue «katholische Universität im Congo» zu gründen, dies mit einer Aussenstelle in der Gemeinde Mont-Ngafula, die immer noch im Bau ist, aber wo bereits mehrere Fakultäten eröffnet sind. Die Protestantische und die Katholische Mission hätten neben der Religion eine allgemeine Entwicklung und eine Entwicklung der Menschen im speziellen gebracht, zum Schutz der Gesundheit (mit der Einrichtung von Spitälern, Krankenstationen und Gesundheitszentren), für das soziale Leben (Stadien und Sportplätzen, Herbergen und Zentren für die schwächsten der Gesellschaft), und den Unterhalt der Infrastruktur jeglicher Art: Strassen, Strände, usw. Betreffend die Politik sagte Els: «Am 10. Januar 2019 sei Félix Antoine Tshisekedi gewählt und am 24. Januar 2019 im Rahmen einer sehr friedlichen und herzlichen Zeremonie als Präsident der Republik eingesetzt worden. Man habe dies aus der Haltung und der in grosser Zahl von Menschen gespürt, die zur Machtübergabe erschienen waren. Die ganze Bevölkerung erlebte das Ereignis in fröhlicher Atmosphäre. Keine Unruhen und keine Polizei, keine Militär-Präsenz, kein Tränengas und keine Tanklastwagen gefüllt mit heissem Wasser. Eine grosse Staatsausgabe weniger und eine gute Schonung der Polizeikräfte. Die Stadt war ruhig und friedlich, die Strassen waren leer. Alle wohnten dem Ereignis am Fernsehen oder am Radio bei.» Das war die Informationen von Els, die bald 40 Jahre im Kongo lebte. Viele teilten die Meinung von Els nicht, aber alle wollten dem dem neuen Präsidenten eine Chance geben.
Montag, 11. Februar 2019, ein Besuch in der Schule «Les Gazelles
Ein sehr «zerhackter» Tag beginnt. Bereits in der Schweiz hatte ich mich entschlossen, die Leute zu motivieren, eine zweite Broschüre mit dem Thema «Baum» zu schreiben. Ich hatte ihnen diesen Vorschlag per Mail und am Telefon gemacht. Musu, der Hauptverantwortliche und Hauptautor der ersten Broschüre war begeistert vom Thema «Baum». Er erinnerte sich, wie in seiner Jugend der Wald mit seinen Tieren Kinshasa umgeben hatte, was ich mir Angesicht der heutigen Situation nicht vorstellen konnte. Er plante, einen Text zu schreiben, der Vergangenheit und Gegenwart vergleicht. – Früh am Morgen bat ich Ndakka und Givien, die beiden Wächter von Gerberas 72, in einem kleinen Text zu beschreiben, was sich in ihrem Leben durch den Wegzug aus den Dörfern und dem Leben in der Stadt verändert hatte. Dann begleitete Ndakka mich in die Schule. Während ich mit verschiedenen Leuten ein paar Wort wechselte und musste feststellen, dass sie kaum etwas von unserer Broschüre «La paroles à nous les Congolais, 2016» gehört hatten. Ich plante mit dem Schulleiter, BOYI darüber zu sprechen.
Bereits in der Schweiz hatte ich bei Bitulu, dem Verantwortlichen für den Internet-Bereich, zwei kleine Laptop bestellt. Bitulu galt als wenig zuverlässig, doch als er mich sah, übergab er mir die beiden Laptop. Um seine Leistung anzuerkennen und um mich selber zu motivieren, begann ich sofort zu schreiben. Wie macht man einen neuen Abschnitt? Wie macht man dies? Wie macht am jenes? Bitulu half mit freundlich und geduldig. Er übertrug den Text von Els. Da es für die beiden Laptop nur eine Tasche gab, war er auch bereit, mir für 10$ eine zweite zu kaufen. – Ich traf auch Jacqueline, die Sängerin. Sie besuchte «Les Gazelles» jedes Jahr und leitete den Chor. Sie kehrte erst im April nach Frankreich zurück. – Alle Kleinbusse, alle Taxi und die «taxis chinois» waren neuerdings gelb. Das brachte Farbe auf die Strassen und in die Gassen. Die taxi chinois waren neu. Das waren umgebaute Motorräder mit drei Rädern, einer Sitzbank und einer Abdeckung.
Mittagessen bei BOYI. Er war im Begriff sein Haus zu vergrössern, d.h. er liess eine zweite Etage bauen. Am Sonntag war er bei einer «Dot» bei Pauline. Die beiden jungen Leute studierten in Europa und interessierten sich kaum für die Dot. Das betraft nur die Familien hier im Kongo. Die Dot ist das Heiratsgeld, das die Brauteltern erhalten. – BOYI wünschte, dass ich ihm den Film «l'ordre éternel» besorge, den er auf der Schweizerischer Botschaft in Kinshasa bereits gesehen hatte. – Eine gemeinsame Bekannte hatte ihm von meinem Projekt «meet-my-life» erzählt. Ich gab ihm die Adresse, und er plante, meinen Text auf französisch zu lesen. – Weiter erinnerte es sich an meine kleine Schere, die ich den Schülern 2009 am Wochenende in N'Djili Brasserie zum Thema «Achtsamkeit»gezeigt hatte. Ich hatte jene Schere zu meinem siebten Geburtstag erhalten und hatte immer gut auf sie geachtet. Nun musste ich ihm jedoch gestehen, dass ich sie in der Zwischenzeit verloren hatte. – Woher kommt der Strom in Kinshasa? Die Schule hat eine Fotovoltaikanlage bestehend aus zehn Modulen und Batterien. Die Stadt bekommt den Strom aus zwei Wasserkraftwerken: INGA (am Fluss Congo, in 360 km Entfernung) und ZONGO (am Fluss Zongo, in 120 km Entfernung). Im Senegal und in Mosambik gebe es viele Fotovoltaikanlagen. BOYI befürchtete, dass Europa noch lange von fossiler Energie abhängig sei. – Um das Schreiben der Texte für die zweite Broschüre zu erleichtern, wollte er Fragen zum Thema «Baum und Aufforstung» auf französisch und in Kikongo zusammenstellen. – Musu war weiterhin begeistert. Er wollte auch die Geschichte eines Krokodils aufschreiben, das verlangte: Zuerst die Arbeit dann der Lohn.
Dienstag, 12. Februar 2019, Besuch auf dem Hof von Pauline, Besichtigung ihrer Aufforstung
Eigentlich wollten wir vor 7 Uhr aufbrechen, um dem morgendlichen Verkehrsstau auszuweichen, aber wegen starken Regens in der Nacht war das nicht möglich. Das gab mir die Möglichkeit, mit dem kleinen Laptop in Ruhe zu üben. Kurz vor neun brachen wir auf, viel Betrieb und viele Schlaglöcher. Pauline schimpfte über den Verkehr. Plötzlich hielt uns die Polizei an. Es entbrannte eine laute und heftige Diskussion in der lokalen Sprache Lingala. Sie verlangten die Dokumente des Chauffeurs und des Autos. Viele Schaulustige drängten sich vor. Ein Polizist schob den Chauffeur auf den Beifahrersitz und fuhr mit uns weg. Nach zirka einem Kilometer hielt er an. Sofort umzingelten uns viele Polizisten. Sie verlangten Geld. Für 20'000 FC (knapp 20 CHF) liessen sie uns ziehen. Pauline meint, das sei wegen meiner weissen Haut. Am Strassenrand viele Menschen, manche waren unterwegs, andere versuchen etwas zu verkaufen. Alle waren auf der Jagd nach Geld. Pauline machte Einkäufe: 30 kleine Brote (30 cm), Milchpulver, Zucker, frische Fische, getrocknete Bohnen, Chili und viel Schweinefutter. Dann bogen wir von der Hauptstrasse ab und unser Weg wurde immer holpriger und löcheriger. An günstigen Stellen überquerte der Chauffeur den Bach. Nach ca. drei Stunden erreichten schliesslich den Hof von Pauline.
Der Tierarzt war bereits anwesend. Er war gekommen, um die acht Ferkel zu impfen. Zusätzlich überwachte er die Arbeiter beim Mischen des Schweinefutters. Er offerierte mir einen Rundgang durch den Hof. Wir begannen bei den Schweinen: Platz für ca. 20 Tiere in Stallhaltung, vier Buchten für Mutterschweine mit Jungen und viele frei herumlaufende Hühner, ein paar Enten und Ziegen. Eine kleine Ölpresse, mehrere Häuschen für Arbeiter, ein Gemüsegarten, eine kleine Baumschule, eine gefasste Trinkwasserquelle mit einer Handpumpe, ein Materiallager, eine offene Küche, ein Brennholzschuppen, viele Erwachsene und schulpflichtige Kinder, für die niemand das Schulgeld bezahlen konnte, Mütter mit Kleinkindern, ein ruhiges Kommen und Gehen und Geplauder in Lingala. Auf der andern Wegseite gab es ein richtiges Zentrum, ca. zwanzig vom Freien zugängliche, mit Schlüsseln abschliessbaren Zimmer, Duschen und Toiletten ausserhalb, ein grosser Konferenzsaal, mehre gedeckte Sitzplätze und viel Land, das Pauline besser nutzen wollte. Entlang dem Bach und den kahlen Hang auf der Gegenseite plante sie aufzuforsten. Der Tierarzt verbrachte den ganzen Tag mit uns. Er war Vater von zwei Kindern, 5 und 10 Jahre alt. Er wartete auf den Besuch anderer Kunden. – Eine Gruppe von vier, sechs oder mehr Frauen bereitete auf offenen Herdstellen in grossen Pfannen das Essen zu: Maniokmus (Fufu), eine Art Spinat aus Maniokblättern (Bundu) und Fisch. Pauline verteilte das Gekochte auf verschiedenen Platten und gab diese den Gruppen, die zum Essen eingeladen waren. Alle sassen ruhig im Kreis um eine Platte und gaben die Schüssel zum Waschen die Hände herum. Pauline hielt den Überblick. Zwei platzierte sie um. Sie betete und wir assen. Zu viert hatten wir Einzelteller. Die andern bedienten sich sorgfältig mit der rechten Hand aus der Schüssel in der Mitte ihres Kreises. – Vieles lief gleichzeitig. Eine Gruppe Jugendliche, waren es vier, acht oder zehn, waren sie 14 oder bereits 18 Jahre alt? ich blieb im Ungewissen, sie machten Palmöl. Viele unterschiedlichste Arbeitsgänge. Resultat: 4 Kanister à 5 Liter und genug für die Küche. Ein Liter war ein Dollar wert. Eine andere Gruppe machte Backsteine und legte diese unter einen gedeckten Sitzplatz zum Trocknen. Sie mussten sorgfältig eingezäunt, geschützt werden, sie waren kein neuer Spielplatz für Tiere oder kleine Kinder, auch kein Platz zum Schlafen.
Zwei Arbeiter besserten mit Stämmen die Brücke über den Bach aus. Dann, für Kongolesen schon um vier Uhr, für mich als Schweizerin endlich um vier der grosse Moment: Madame Pauline und ihre Frauengruppe zeigten mir ihre Aufforstung. Einschub: Pauline war der Überzeugung, ich hätte ihr vor mehreren Jahren versprochen, mit 7'000$ eine Wasserabfüllanlage für ihr Quellwasser zu finanzieren. Sie wollte mit dem Verkauf von Trinkwasser den vielen arbeitslosen Müttern ihrer Frauengruppe eine kleine Verdienstmöglichkeit geben. Wie es zu diesem Versprechen gekommen sein soll, konnte ich mir nur schwer erklären, aber ich konnte es schliesslich mit Aufforstungsbemühungen koppeln. Da sie dies bis anhin nur geplant hatten und nicht zur Tat schritten, hatte ich den Hof nicht besucht. Doch diesmal erzählten mir die Lehrer von «Les Gazelles» bereits am ersten Tag von Paulines Erfolg. Deshalb entschloss ich mich zu diesen Besuch. Einschub Ende. Ca. zu zehnt versammelten wir uns vor der ausgebesserten Brücke. Sachte, sachte marschierten wir im Gänsemarsch über die Brücke und dann ging's aufwärts durch brusthohes Gras und Gestrüpp: Später, nach einem kleinen Hügel eine flache Mulde mit mehr als hundert jungen Bäumen, von denen viele höher waren als ich gross. Das sah ich sofort. Doch die Frauen eilten zu den Jungbäumen, stellten sich daneben und fassten sie an. Sie riefen und zeigten voller Stolz auf die Pflanze, die sie überragte. Ich bereitete ihnen die Freude und eilte von Baum zu Baum und die schwarzen Mamas konnten mir und ihren Mitkämpferinnen beweisen, dass die Jungpflanzen auch mich überragten. Es war ein Kampf gewesen. Während der Trockenzeit mussten sie regelmässig Wasser zu den Pflänzchen tragen. Und, oh Schreck, Wanderheuschrecken, Grashüpfer, Grillen und Insekten aller Art begannen die jungen Bäumchen kahl zu fressen, aber sie schafften es. Ich war überrascht. Hundert junge Akazien und Eukalyptus hatten sie mit Erfolg gepflegt. Hüpfend und singen zogen wir ins Zentrum zurück. Wir verbrachten einen ruhigen Abend. Die Mädchen staunten, wie ich ein schreiendes Bebe beruhigen konnte, und es den ganzen Abend in meinen Armen schlief. Die Knaben machten Jagd auf einen Enterich, der von Dach zu Dach flatterte und stutzten ihm mit einem Fleischmesser die Flügel. Die Feuerstellen erloschen langsam. Während dem Eindunkeln wurden der Fernsehapparat, Kabellampen und der Generator geholt. Ein paar Kinder sprangen schreiend auf, und zwei Knaben töten mit Stecken eine Schlange, die aufgetaucht war. Das Bebe schlief in meinem Arm. Wir schauten gemeinsam einen Liebesfilm aus Indien. Die Kinder imitierten die Schauspieler. Pauline gab mir für die Nacht eine Solarlampe, und in meinem Zimmer warteten zwei Kessel Wasser für die Abenddusche.
Mittwoch, 13. Februar 2019, verschiedene Enttäuschungen
Es regnete. Alles war ruhig und ich mühte mich mit wenig Erfolg mit meinem kleinen Laptop ab. Grenzstreitigkeiten gehörten in dieser Gegend zum Alltag. Ein paar Frauen waren deshalb am frühen Morgen zu einem Schlichtungstermin aufgeboten worden. Alle waren sich einig, wer nicht zum Termin erscheint, hat verloren. Sie mussten hin. Andere hatten begonnen ein weiteres Stück Land zu säubern, um die Aufforstung weiterzuführen. Der Regen zwang sie, die Arbeit zu unterbrechen. Ich wollte ihnen mein Laptop vorführen und fragte sie nach ihren Namen, aber keine interessierte sich für meine Tipperei. Gemäss Pauline soll keine von ihnen in der Lage sei, ihren Namen zu schreiben. Sie wollten Geld, sie hatten gespürt, dass ich zufrieden war. Und Pauline hatte ihnen erklärt, dass ich nun die Wasserabfüllanlage finanzieren würde. Pauline behauptete, dass der versprochene Betrag nicht reiche. Sie forderte mehr. Die Mamas wollten Geld in die Hand. Sie glaubten Pauline nicht. Es folgte eine lange teilweise heftige Diskussion. Es wurde hin und her übersetzt. Schliesslich beruhigten wir uns wieder. Alle hatten ihren Standpunkt gewahrt und gut verteidigt, und wir schienen uns gegenseitig etwas besser zu verstehen. Wir wollten und brauchten alle mehr Geld, auch ich.
Schliesslich noch eine erstaunlich Neuigkeit von Pauline, die ich trotz viel Bemühen nicht verstehen konnte. Sie erklärte mir voller Stolz: «Unsere Tochter Valerie hat in Irland ihr Studium als Umweltwissenschaftlerin abgeschlossen. Jetzt organisiert sie mit ihrer Gruppe Konferenzen zum Thema «Schutz der Umgebung». Sie reisen von Land zu Land und sprechen über Mittel und Weg, um der Klimaerwärmung zu begegnen. Im April werde die Gruppe für diese Aufgabe in den Kongo kommen. Sie, Pauline Mokansue, die Mutter von Valerie, mache grosse Anstrengungen, um mit ihrer Frauengruppe Akazien und Eukalyptus zu pflanzen. Sie wolle ihrer Tochter ihre Arbeit zeigen. Sie sollten auch sehen, wie sie damit alleinerziehenden Müttern und Witwen und deren Kinder eine Arbeit gebe.» Die Gruppe von Valerie werde auch sie besuchen, wiederholte sie immer wieder.
3. Aufbruch und Aufenthalt in Kikwit
Donnerstag 14. Februar 2019 Aufbruch nach Kikwit
Ein neuer Tag lag vor mir: Was wird er wohl bringen? Ich ging ihm voller Zögern entgegen. Pauline holte das versprochene Geld. Natürlich, viel zu wenig, was ich bedauerte, wie es sich gehörte. Sie brachte mir zwei neue Jutesäcke. Givien wählte zwei Brillen aus meinem Sack mit den gebrauchten Brillen aus der Schweiz. Dann rüstete er mit Paulines Säcken mein Gepäck für den Bustransport. BOYI brachte die Liste der Fragen für die zweite Broschüre auf französisch und in kikongo. Mit viel Mühe schickten Charly und ich meine ersten Texte meinem Mann in die Schweiz. Die Zeit verflog. Stromausfall, Wasserunterbruch. Zum Glück hatte ich früh am Morgen geduscht. Givien servierte mir das Mittagessen und legte mir ein Sandwich für die Busreise bereit. Um 13 Uhr wurde Adeline, die Frau von Jean Mupepe gebracht. Mupepe war der Gründer der Schule Banatee in Kikwit und er beantragte die Unterlagen für meine Einreise in den Kongo. Nun schnell, schnell alles in einem Taxi verstaut: Für den Kiosk in der Schule ein Popcorn-Automat, zwei grosse Säcke kleine Spielsachen und ein Sack voller Papierservietten, Kartonbecher, Kartonteller, Plastikbesteck und grosse Vorräte an Plastiktüten aller Grössen, meine rote Reisetasche, den Sack für die Dorfbewohner und allerhand weitere Säcke und Tüten. Wegen zu vielen technischen Problemen mit den Bussen hatten wir die Busgesellschaft gewechselt. Wie gewohnt, vor der verspäteten Abfahrt viele und lange Wartungsarbeiten am Bus der neuen Gesellschaft und dann eine lange, mühsame Nacht.
Freitag, 15. Februar 2019 Ankunft in Kikwit
Ich erwachte, ein heftiges Gewitter. Die Strasse glich einem Fluss. Ein kurzer Unterbruch der Reise, viele beteten halblaut. Der Zustand der 2011 neu wieder eröffneten Strasse war streckenweise miserabel. Wie lange kann sie noch befahren werden? Meine Frage interessierte niemanden. Wir sollten um 2 Uhr nachts ankommen, trafen aber erst um 6 Uhr ein. Makabu, meine Partnerin aus KongoKuku wartete und umarmte mich freudvoll. Plaudernd warteten wir auf die Gepäckausgabe. Adeline rief Mupepe an und der Chauffeur holte uns ab. Sie hatten zwischenzeitlich ein grösseres Haus mit einer Fotovoltaikanlage und Batterien gemietet. Während wir uns erfrischten und Kaffee tranken traf Soeur Annie ein. Soeur Annie Ikwala leitete den Konvent der Schwester der «divine providence» in Kikwit. Seit dem Rückzug der Ordensschwestern nach Frankreich finanzierte sich dieser Konvent mit Rindermast. Um die Probleme mit der Brandmarkierung zu verhindern, hatte ich Soeur Annie 2013 und 2017 Ohrmarken aus der Schweiz gebracht. Ähnlich wie Makabu, jedoch später hatte sie 2017 mit Alphabethisierungs-Gruppen und 2018 mit Aufforstung begonnen. Ich hatte 2018 gewünscht, einmal vor der Reise in die Dörfer hinter Kikwit eine Nacht in der Siedlung bei der Viehherde zu verbringen. Wir machten ein Plan: Soeur Annie holte Makabu und mich am Samstag um 15 Uhr bei Familie Mupepe ab und ihr Chauffeur führte uns anschliessend zur Herde. – Dann unterhielt ich mich mit Makabu allein. Wie immer hüllte sie sich in Geheimnisse. Ich gab ihr Geld für ihre Einkäufe. Da es Freitag war, musste sie bis 11Uhr warten. Ich hätte es wissen sollen: Alle Geschäfte sind geschlossen, denn die Stadt verlangt, dass am Freitag vor 11 alle Geschäfte inklusive Umgebung gereinigt werden, was die Polizei kontrolliert. – In der Mittagszeit kam Jean Mupepe heim, um mich zu begrüssen. Animiert durch meinen Plan, einen Reisetagebuch zu tippen, begann er sofort mit einer Zusammenfassung meiner Aktivitäten im Kongo unter dem Titel « die Epoche von Mme Makabu nach den Pionieren des Projekts von Maja im Kongo». Er schrieb: «Maja kam das erste Mal 2009 nach Kikwit, mit dem Flugzeug, ganz allein. Monsieur Romain NGOMA holte sie am Flugplatz ab. Sie war bei Riza, einem Logierhaus für Reisende untergebracht. Auf Wunsch von M. Ngoma kümmerte sich Familie Mupepe um ihre Verpflegung. Auf ihrer ersten Reise ins Hinterland kam sie bis nach KongoKuku. Dort lernte sie Simon Kilangalinga, den Préfet und Kutowa, den Direktor der Primarschule kennen. In Kinshasa war sie von Mme Kabangu und der Lehrerschaft von «Les Gazelles» empfangen worden. Auf der vierten und fünften Reise wurde Maja von Mme Odette Mupepe begleitet. Beim Hinauffahren besuchten sie die Dörfer bis nach Kimbi. Auf diesen Reisen lernte sie Mme Makabu Célestine und M. Ndungi Robert kennen. Die Dorfbewohner erhoben sich gegen Odette, denn sie ertrugen keine Städterin an der Seite von Maja. Makabu überzeugte daraufhin Maja, mit ihr allein zu reisen und sie anerbot sich, sie in Kikwit abzuholen.» Hier unterbrach M. Mupepe seinen Bericht, denn er hatte noch anderes zu erledigen. Er wollte später weiterschreiben, aber dieses Später traf nie ein.
Samstag, 16. Februar 2019 der Besuch von Papa Baudouin
Während ich auf Soeur Annie wartete, besuchte mich Papa Baudouin, Mitglied im Leitungskomitee des Schule Banatée. Er brachte mir zwei Neuigkeiten. Baudouin war neben anderem auch Viehzüchter. Doch wegen einer Tierseuche verblieben ihm von seinen 80 Tieren nur noch 17. Der Rest war gestorben oder wurde notgeschlachtet. Das Fleisch der kranken Tiere konnte von Menschen ohne Probleme gegessen werde. Trotz diesem Rückschlag wollte er mit der Viehzucht weiterfahren. 2006 hatte er mit 1000 Dollar begonnen. Zur Zeit unserer Begegnung hatte ein Tier einen Wert von 600$. Er hatte 15 Tiere für 7500 Dollar verkauft. Die Tiere bezahlten die Studien seiner sechs Kinder. – Dann machte er in seiner Erzählung einen Sprung: «Um die Bevölkerung ruhig zu halten, hatte die Regierung vor den Wahlen am 31. Dezember 2018 mehr als 200 Soldaten nach Kikwit geschickt. Überall in der Stadt gab es Unruhen. 20 oder 30 Personen wurden Opfer dieser Unruhen. Statt diese ordentlich zu bestatten, wurden die toten Körper einfach in den Fluss Kwilu geworfen. Papa Baudouin beherbergte zu jenen Zeitpunkt weiterhin sechs Militär gratis, denn durch ein Wunder waren seine Kinder gerettet worden. «Sie hatten alle getötet, aber meine beiden Kinder blieben bewahrt, denn eines kannte den Namen des Hauptmanns «Papa Alex». Alex hatte dann behauptet, die beiden Knaben seien die Kinder eines hohen Generals. Deshalb brachten sie die beiden Söhne von Baudouin, begleitet von einem Motorrad und vier Jeeps, nach Hause zurück. Aus diesem Grund beherbergt er die Militär nun auf seine Kosten. Am 15. Februar habe er 70000 FC für Maniok, Zucker, Reis, Milchpulver usw. ausgegeben. Es war der Bon Dieu, der seine Kinder gerettet hatte.
Samstag und Sonntag, 16. und 17. Februar Besuch auf dem Hof von Soeur Annie
Pünktlich wie vereinbarten fuhren wir um 15 Uhr ab. Viele Leute waren zu Fuss oder auf Motorrädern unterwegs. Motorräder waren mit ganzen Familien beladen. Es regnete ganz sachte. Wir fuhren ca. 100 kam in Richtung Kinshasa, dann bogen wir nach links ins offene Gelände. Ich erlebte die Reise als sehr angenehm. Die Tiere waren schon im Gehege. Eine düstere Stimmung lag auf der Gegend. Soeur Annie erzählte, seit Mai 2018 habe sie wegen einer Seuche einen grossen Teil ihre Herde von 375 Tieren verloren. Nur 146 hätten überlebt. Für die Behandlung der Tiere habe sie ihre ganze Reserve von mehr als 13'000 Dollar ausgegeben. Sie brauche dringend Hilfe. – Makabu war einverstanden, aber gleichzeitig forderte sie Geld für ein Haus in Kikwit. Sie hatte keine Ahnung, was ein Haus in Kikwit kostete, aber seit Jahren verlangte sie Geld dafür. In jenen Zeitpunkt begann ich langsam zu begreifen, dass sie ein Haus für ihre Tochter wollte, die mit ihren vier Kindern in Kongo-Kayukuta lebte. – Soeur Annie machte mir einen Kostenvoranschlag. Sie brauchte 8'000Dollar. Sie sprach über die grossen Sorgen wegen der Tiere und entschuldigte sich, dass sie mit der Aufforstung keine grösseren Fortschritte gemacht hätten. Sie und ihre Frauengruppe hatten begonnen, und sie hatten den Willen weiter zufahren. Ich erklärte ihr erneut, dass sie die Baumsetzlinge eng, mit einem Abstand von weniger als einem Metern setzen sollten, denn die Bäumchen bräuchten Zeit und nur wenige würden zu den prächtigen Bäumen, von denen wir träumen würden. Wichtig sei, die Pflanzung gut zu warten, den Boden regelmässig zu lockern, das Unkraut zu entfernen und im Notfall Wasser zu bringen. – Angesprochen auf die Moscheen, die wir immer wieder sahen, erklärte sie, ihr Orden und auch sie persönlich seien sehr beunruhigt, denn seit 2015 seien zwischen Kinshasa und Kikwit 41 Moscheen gebaut worden. Die Muslime hätten auch Geld für Schulen und Krankenstationen. Woher das komme, wisse niemand. – Am Montag brachte mir Soeur den Kostenvoranschlag und ihren Text für die Broschüre 2019.
Einschub: Wir hatten zwischenzeitlich den 22. August. Ich tat mir schwer mit dem Übersetzen meines Reiseberichtes. Ich hatte am frühen Nachmittag ein Gespräch mit Jean Pierre Sorg. Seine fröhliche Art machte mir Mut.
Einschub 23. August 2019: Treffen mit der Meet-my-life-Gruppe
Hausaufgabe: Die Geschichte von Abraham und seinem Sohne Isaak war neu zu erzählen! Aus der Sicht des Täters, des Opfer oder in die Neuzeit transformiert. Ich übertrug die Erzählung in meine Gegenwart und tippte folgenden Vorschlag:
„Das Opfer auf Moria, 1. Mose 22, 1-14. Der Text liest sich einfach und klar: «Gott sprach zu Abraham: «Nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, den Isaak und opfere ihn.» Ich staune und sage zu Abraham: «Wenn ich den Text 1. Mose 22, 1-14 lese, erfahre ich, dass du Gott gehört hast und, dass du ihm gehorcht hast. Das war ein schwieriger Weg, aber Gott stand euch bei. (Bitte lesen Sie den gestrichen Text. Die Erklärung folgt anschliessend) Ich sage: «Abraham, ich bin mir nicht sicher, ob ich Gott höre. Was soll ich tun?» Abraham sagt: « Bitte Gott um ein Zeichen.» Ich antworte Abraham: «Das habe ich gemacht.» Und? Ich antworte Abraham: «Er hat mir Ruhe und Zuversicht geschickt.» Das ist gut so. Ich antworte Abraham: «Diese Erfahrung kann ich nicht weiter sagen. Sie wird belächelt.» Abraham schweigt. «Abraham höre mich, ich bitte dich um einen Rat.» Abraham fordert mich auf, Gott direkt zu fragen. Ich antworte: «Das habe ich getan, und Gott spricht trotzdem nicht zu mir. Abraham, ich danke Gott für seine Fürsorge und Gnade. Er sorgt besser für mich, als ich es selber kann und er gibt mir mehr, als brauche. Er will, dass ich noch eine Weile lebe, obwohl ich bereit wäre, das Zepter abzugeben.» Abraham schweigt. Ich antworte ihm: «Leben im Überfluss ist nicht einfach. Jeden Tag stehe ich in den Geschäften vor grossen Gestellen mit einem riesigen Angebot aus aller Herren Länder und flüstere: In 1. Mose 1, 28 steht geschrieben: Macht euch die Erde untertan.» Abraham sagt: «Gott führt dich in Versuchung!» Ich antworte: «Gott offeriert mir mehr als ich brauche. Was tue ich mit dem Überfluss?» Abraham sagt: «Gott führt dich in Versuchung!» Ich antworte: «Meine Grossmutter sagte, trage zu Gottes Welt Sorge, nimm nicht mehr als du brauchst.» Abraham sagt: «Mache dir den Überfluss untertan!» Ich antworte: «In 1. Moses 3, 19 steht geschrieben «im Schweisse deines Angesichts sollst du dein Brot essen». Abraham sagt: «Im Schweisse deines Angesichts sollst du dein Brot essen.» Ich antworte: «Den Supermarkt frohen Mutes mit nur dem täglichen Brot zu verlassen, ist harte Arbeit.» Abraham lacht:«So ist es, denn im Schweisse deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Kämpfe mit dem Überfluss und esse, was du hast, bevor du wieder kaufst. Vermeide Abfälle.» -- Schweigen. Nach meiner Ansicht war es mir die Übertragung in die Gegenwart gut gelungen, und ich hatten meinen Text der Gruppe langsam und klar vorgelesen. Ich war zufrieden, doch ich löste Schweigen aus. Der Gruppenleiter stellte fest, ich hätte die Aufgabe verfehlt. Ich anerbot den Text zu kürzen und alles nach „Das war ein schwieriger Weg, aber Gott stand euch bei.“ zu streichen. Richtig, war seine Antwort und ich tat dies sofort. Ich strich alles, aber ich löschte den Text nicht. So können Sie, meine Lesenden meinen verfehlten Textvorschlag trotzdem noch lesen. Er ist mir wichtig. Dann bemühte ich mich, der Gruppe zu erklären, dass ich diese Geschichte von Isaak in der Sonntagschule gehört hätte. Rückblickend könne ich sagen, dass ich bereits damals leicht mit ihr hätte umgehen können, denn ich hatte in meinem Kopf drei Schachteln, die eine hiess, „der gute Gott“, die andere „der böse Gott“ und die dritte „der Gott, den die Menschen nicht verstehen können“. Ich hatte früh gelernt, dass Gott gut für uns sorgt, dass aber seine Wege nicht unsere Wege sind und dass wir seine Wege nicht verstehen können. All dies und vieles mehr wurde und wird in der Schachtel mit der Aufschrift „der Gott, den die Menschen nicht verstehen können“ verstaut, und ich wende mich meinen aktuellen Problemen zu wie z.B. die Hälfte der geernteten Nahrungsmittel findet nie den Weg auf einen Teller. Mein Mann und ich unterhielten uns später auch über das Thema „Abraham und Isaak“, dann über Gott und die Welt und er meinte, betreffend Religion müsste er alles in die Schachtel mit der Aufschrift „der Gott, den die Menschen nicht verstehen können“ werfen. Einschub Ende.
Montag 18. Februar 2019, in der Schule Banatée
Ein langer Tag, der für alle um 5.30 oder noch früher begann. Mupepe war um diese Zeit bereits in die Schule marschiert. Seine Frau Adele und ihre Kollegin bereiteten Schulstunden vor. Eine Händlerin brachte frisches Brot. Alle kämpften um ein Einkommen, und dazwischen war ich. Leonie, das Hausmädchen, Claude, der Hausbursche und Dépaul, der Chauffeur kamen. Um sieben Uhr führte Dépaul die drei Kinder frisch gewaschen in sauberen blau-weissen Uniformen in die Schule. Um acht Uhr brachte Soeur Annie den Kostenvoranschlag für ihre Tiere und ich versuchte sie zu überzeugen, ihre Kindheitserinnerungen für die Broschüre 2019 aufzuschreiben. Um 10 Uhr traf ich Makabu in der Schule Banatée. Sie versuchte, einen Reiseplan für unsern Besuch in den Dörfern zu machen. Eigentlich wäre sie gerne gemeinsam mit mir mit unserem Lastschiff bis nach Mungulu gefahren, aber Mupepe hielt dies für zu anstrengend für mich. Ich hatte mir auch eine Schifffahrt gewünscht, und wollte mit Mupepe darüber sprechen. Aber für Makabu war klar, Mupepes Plan war umzusetzen. Es war heiss und es wurde noch heisser. Warten, warten, zum Glück hatte ich das kleine Laptop und konnte ein wenig tippen. Ich wurde mehrmals aufgefordert, das Laptop abzustellen. Warum? Schliesslich sagte Makabu, wir würden den Besitzer des Jeeps, Papa Durha Mayele erwarten und der habe wenig Zeit. Ich tippte weiter. Mayele war ein Bekannter von Mupepe, seine Kinder besuchten die Schule von Banatee. Mayele kam. Malembe, malembe, langsam, langsam. Er führte mit Mupepe ein langes Gespräch im Schulhof, dann kaufte er sich am Kiosk ein Mineralwasser und unterhielt sich mit zwei Lehrerinnen. Die Sonne schien. Ich war müde und stellte das Laptop ab. Wir warten weiter. Schliesslich machten Mayele und ich einen Vertrag, den er von Hand aufsetzte: 432'500 FC für den Jeep und 1'350$ für das Benzin, Motorenöl, Werkzeug, den Chauffeur ... davon 600 $ sofort zahlbar. Ich hat nur wenig Geld bei mir, aber Makabu hatte ich bereits reichlich FC für ihre weitere Einkäufe gegeben, und sie konnte Mayele leicht die 600$ entsprechende Summe in FC Mayele geben. Unverständlich, sie zögerte und zögerte, obwohl ich ihr versprach, ihr das Geld zu ersetzen. Gleichzeitig wollte niemand mich zurück ins Haus von Mupepe begleiten, um Geld zu holen. Warum liess uns Mayele nicht mit seinem Chauffeur hinfahren? Ich verstand später, dass er Benzin sparen wollte. Zu dritt, zu viert, zu fünft verhandelten sie in Kikongo. Mupepe ärgerte sich, dass ich nach soviel Jahren noch nicht in der Lage war, ihren Gesprächen zu folgen. Er schickte ein Kind zum Kiosk, um Wasser zu holen. Dann, für mich unerwartet, gab Makabu Mayele das Geld. Nach einem Moment der Ruhe fragte ich in die Runde: „Wann fahren wir los? Wer ist unser Chauffeur?“ Nach Makabus und meinem Plan holte mich der Chauffeur am Mittwoch um 8 im Haus von Mupepe ab. Ich hatte mit all meinen Sachen bereit zu sein. Makabu schlosst ihre Einkäufe am Dienstag ab.“ Allen ausser mir war klar, Mayele gibt den Jeep und Mupepe seinen Chauffeur Dépaul. Mupepe zerstreute meine Zweifel, er erklärte, Dépaul sei ein erfahrener Chauffeur. Er verstehe sich auf Überlandfahrten und habe viele Jahre für die Chinesen gearbeitet. Makabu plante 10 Tage unterwegs zu sein. Ein Tage kostete 200$ . Mayele behauptete, das sei ein Freundschaftspreis. Wir hatten nun alles erledigt, also gingen wir heim, dass hiess „warten, warten“. Ich wollte heim gehen. Wir warteten. Mupepe hatte viele Gedichte geschrieben und er druckte uns zwei aus, die zum Thema „Baum“, zur Broschüre 2019 passten. Wir warteten, weil – und diese Erklärung vergass ich immer wieder -- weil man nicht zu Fuss gehen durfte, wenn Aussicht auf eine Mitfahrgelegenheit bestand. -- Jean-Paul kam vorbei. Er hatte vor drei Jahren das Arztstudium abgeschlossen und er wartete weiterhin auf die Unterschriften des Ministeriums. Erst dann durfte er als Arzt arbeiten. Zur Behandlung meiner Mückenstiche empfahl er mir, ein Antibiotika zu kaufen. -- Mupepe hatte mich mit meinem Pass und einer Kopie seiner Einladung ordnungsgemäss bei der Stadtverwaltung angemeldet und der städtische Vorsteher der „Fremdenpolizei“, Gautier Nzadi, hatte ihm seine beiden Telefonnummern, die dienstliche und die private gegeben und mir sagen lassen, bei irgendwelchen Schwierigkeiten solle ich nicht zögern ihm anzurufen, damit er sich persönlich um die Sache kümmere. Der Tag ging langsam und heiss weiter. Ich hatte auf Durchzug geschaltet.
Dienstag, 19. Februar 2019, ein Besuch bei der ersten Klasse in der Schule BanantéeFür den Besuch in der Klasse von Elisée, der Schwester von Adele verliessen wir das Haus um sechs Uhr zu Fuss. Es war ihr wichtig, vor den Schülern dort zu sein und das Unterrichtsmaterial zu ordnen. Um 7 Uhr wurde das Tor zum Schulareal geöffnet und langsam füllte sich der Innenhof mit emsig plaudernden, hüpfenden und tanzenden Kinder. Wenig später traten die Lehrer und Lehrerinnen auch in den Hof und die Kinder brachten ihnen den Gruss. Sie bildeten Gruppen und stellten sich langsam klassenweise in Kolonnen auf. Sie begannen zu klatschen und marschierten an Ort. Ein Gongschlag brachte Stille. Ein Lehrer trat in die Mitte der Platzes und sprach ein Gebet, das sie mit dem gemeinsamen Unservater (Tata na betu) abschlossen. Wieder marschierten sie an Ort, bis sich eine Klasse nach der andern, von ihrem Lehrer geleitet, geordnet in ihr Klassenzimmer zurückzog. Wegen Zimmer- und Lehrermangels unterrichtete Elisée eine Doppelklasse mit über 70 Kindern. Zu dritt oder zu viert teilten sie sich eine Bank. In weissen Hemden, knielangen, dunkelblauen Hosen, teils barfuss und mit kurzem krausem Haar die Knaben, die Mädchen in weissen Blusen, dunkelblauen Röcken und teils mit kunstvoll geflochtenen Zöpfchen oder mit einem Band zusammen gehaltener Haartracht. Ein paar hatten den noch müden Kopf auf die Bankklappe gelegt. Der Blicke der Lehrerin glitt durch die Schülerreihen. Sie suchte die Aufmerksamkeit der Kinder und begann ein Lied zu singen. Mein Kopf war voller Fragen: „Wie wird sie das schaffen? Kann sie jedem Kind etwas neues auf den Weg geben? Wie holt sie die Schwachen ab, Kinder, die zu früh oder zu spät eingeschult wurden, oder Kinder mit grossen Absenzen, weil ihre Eltern das Schulgeld nicht regelmässig bezahlen konnten? Und ihre guten und die besten Schüler?“ Die Rechenstunde begann. Die Lehrerin zeigte vor, was zu tun war: Die eigenen zehn Finger, dann zehn grosse Gegenstände, zehn kleine, auf einem Bild, zehn Tiere. Die eigenen Körperteile, die Teile der Hand, die Teile beider Hände zählen. Wie viele Vögel hat es auf dem Bild? Wie viele Affen, wie viel Fische und wie viele Vögel und Affen zusammen? Wer will mir noch eine Rechnung sagen? Wer eine Kreide erhielt, schrieb gleichzeitig die Zahlen und Rechnungen auf die Wandtafel. Dann wurde addiert: Schülergruppen, Bankreihen im Zahlenraum, 10 bis 100 inkl. Zehnerübergang. Mit aufgesteckten Armen, Händen und Fingern wurde multipliziert. Wer will uns noch eine Rechnung sagen? Wen habe ich vergessen? Sie wandte sich liebevoll an ruhige Kinder und verteilte die Hefte. Ein Kind hatte bereits das Datum an der Wandtafel notiert und sie begannen ruhig Rechnungen aufzuschreiben. Während dem mündlichen Unterricht, war genügend Material an die Wandtafel geschrieben worden. Erst als die Sprachstunde begann, merkte ich, dass sich die Kinder in der Rechenstunde bemüht hatten, französisch zu sprechen. Der Buchstabe „R“ wurde auf Kikongo eingeführt und auch die kleine Geschichte, welche die Lehrerin vorlas, verstand ich nicht. Wieder wurden Hefte ausgeteilt und sofort emsig gezeichnet, geschrieben und getuschelt. Die Lehrerin sammelte die Rechenheft ein. Um es mir, dem Besuch leicht zu machen, beschlossen die Kinder per Handerheben, in Lebenskunde wieder französisch zu sprechen, links, rechts, oben, unten, hinten, vorn, Norden, Süden, Osten, Westen. Schliesslich lernte ich sie auf Deutsch von eins bis fünf zu zählen. Dann brachten sie der Lehrerin die Hefte und sprangen eins, zwei, drei und vier, fünf in die Pause. Die Lehrerin rückte die Bänke zurecht und stecke die beiden Heftberge in ihre Tasche. Sie brauchte eine Pause und ich träumte von meiner Zeit als Lehrerin. Wir kauften eine Kleinigkeit am Kiosk, ich bedankte mich, und es gelang mir, ihr meine Bewunderung für ihre grosse Leistung zu zeigen. Ich zog mich ins Büro von Mupepe zurück. Die neuen Eindrücke wechselten sich mit warten und warten ab. Ich floh hinter mein Laptop. Was sollte ich eintippen? Adele hatte es geschafft, für mich in der Stadt eine Ananas zu finden. Geschält und in mundgrosse Stücke geschnitten, servierte sie mir die Frucht. Eine Delikatesse! Am Abend schauten wir immer auf dem Sender „Zeemagic, bollywood“ Filme, die zeigten, wie man sich verhalten musste, um eine angesehene, elegante und reiche Persönlichkeit zu werden. Meine Lesenden, ich schaffte es nun nicht, all die weiteren Details meines Kongo-Tagebuches ins Deutsche zu übersetzen. Zur Entspannung arbeitete ich ein wenig im Garten.
Einschub 25. August 2019: Ständeratskandidat Roger Köppel sprach gestern in Flurlingen
Nach einer unruhigen Nacht fiel mir beim Zähneputzen ein, Roger Köppel hatte dasselbe Gedankengut vertreten wie mein verehrter Primarlehrer von mehr als als sechzig Jahren. Ich vertraute ihm damals, in den 1950er Jahren und ich konnte jetzt, was ich in der Primarschule gelernt hatte, nicht ablehnen, nur weil Roger Köppel, Historiker, Publizist und ein von vielen verschriener politischer Quereinsteiger, es sagte. Ich schrieb meine Lebensgeschichte und darin sollte das Gedankengut von Köppel und meinem Primarlehrer erwähnt sein: „Wir verdanken den Wohlstand unseres Landes drei Säulen, das sind: 1. Direkte Demokratie, d.h. Volksnähe und Volksbefragungen; 2. Föderalismus d.h. Aufbau von unten: Gemeinde, Kanton, Bund; 3. bewaffnete Neutralität als Schlüssel zu Weltoffenheit, zu Kontakten zu allen, freundlich, distanziert, ohne Einmischung, Friede und Sicherheit dank einer starken Verteidigungsarmee, „wir blieben verschont“. Ich hatte gelernt, unser Land werde vom Volk regiert und dies sei eine langsame, anstrengende Staatsform, die vielen nicht passe. -- Was dann folgte, hatte ich damals nicht verstanden und vergessen. Köppel sprach von Notstandsrecht. Vor dem zweiten Weltkrieg wurde der Notstand ausgerufen. Es bestand anerkanntermassen ein echter Notstand und der Bundesrat erhielt das Recht, ohne Volksbefragungen auf dem Verordnungsweg in eigener Kompetenz zu regieren. Dank der Initiative von Gottlieb Duttweiler (Duti) wurde der Notstand 1948 wieder aufgehoben. Während Köppels Vortrag erinnerte ich mich an meine Eselsbrücke von damals „Duti hatte mit den Migros-Verkaufwagen den Notstand aufgehoben“. Beide, der Primarlehrer und Duti sagten damals wie Köppel 2019, das Volk müsse seine Rechte verteidigen. Weiter habe ich in den 1950er Jahren gelernt, dass sich das Klima immer geändert habe und sich immer ändern werde und dass man nicht genau wisse „warum und wie“. Köppel betonte mehrmals, wir müssten zur Umwelt Sorge tragen und weiter das Klima habe sich immer geändert und es werde sich weiter ändern. 2019 waren Köppel und ich Klimaleugner. Leute, die einen Vortrag von Köppel anhörten, waren zu meiden, denn Köppel durfte ungestraft Nazi genannt werden. Ergänzend wurde das Sonderheft der Weltwoche vom 11. Juli 2019 „Klimawandel für die Schule“ mit Greta Thurnberg als Titelbild verteilt. Meine Lesenden, im Internet finden Sie Einzelheiten und die „Wahrheit“ zu diesen Fragen. -- 2019 riefen verschiedene Gemeinden, Kantone und Länder den Klimanotstand aus. Was hiess das? Bestand die Gefahr, dass wir bald per Notrecht regiert wurden? Einschub Ende.
Mittwoch, 20. Februar 2019, Abreise in die Dörfer
Ich erwachte mit bangen Fragen: „Was wird mich erwarten? Werden wir sehr früh abfahren? Was heisst das? Werden sich meine Vermutungen bestätigen?“ Der Chauffeur sollte Makabu um 7 Uhr abholen, um den Jeep in der Stadt zu tanken und um mehrere Kanister mit Diesel für unterwegs zu kaufen. Ich hatte um 8:30 bereit zu sein, nicht später und es war bereits 10 Uhr. Adele war sicher, dass sie nun bald kämen. Ich begann Fragezeichen zu sehen. Léonie, das Hausmädchen hatte alle Böden feucht aufgezogen und ging dann einkaufen. Mein Telefon war aufgeladen. Mupepe hatte mein Laptop in die Schule mitgenommen, um seinen Text für die Broschüre 2019 von seinem PC darauf zu kopieren. Es klappte.
Hier sein Text auf französisch: Traditions et développement
En Afrique comme au Congo, plusieurs projets de développement échouent malgré de gros moyens y investis. Parmi les nombreuse causes d'échec, on peut sans hésiter retenir l'homme. L'homme se trouve au centre de toute action de développement. Il peut le conduire vers la réussite ou l'échec. Sa tradition, ses coutumes, sa mentalité peuvent devenir un freine pour tout projet de développement.
Je l'ai compris un jour quand j'ai entendu raconter l'histoire de Mbala, un cousin ma mère. Il était domestique chez un européen. Arrivé à la fin de son mandat au Congo, le blanc demanda à Mbala ce qu'il souhaitait obtenir comme cadeau pour de loyaux services rendus à son patron. Mbala demanda à réfléchir pour donner sa réponse. Il consulta les membres de sa famille pour un bon conseil. Certains des frères de Mbala étaient contents de sa chance, beaucoup de noirs qui travaillaient à Kinshasa avec des blancs se plaignaient des conditions de travail très dur dans lesquels ils œuvraient. D'autres trouvaient leurs patrons sans cœurs et à leur égard, ils ne recevaient aucune récompense ni une reconnaissance. Mbala disait à tous que son patron était un blanc différent des autres. Il expliquait pour lui et ses frères, son patron était un de leurs oncles mort depuis longtemps. D'ailleurs, Mbala trouvait des traits de ressemblance avec son oncle défunt.
La pensée de Mbala se justifie par le fait que ne peut faire du bien à une personne qu'un parent ou celui qui lui est très proche. Un étranger ne peut vouloir que le mal de l'autre. Mbala fait entrer son patron blanc dans sa famille. ll dit que son patron ressemble à son oncle. C'est donc un revenant. Un noir mort qui est revenu dans son clan sous la peau du blanc. C'est ce qui explique sa générosité et même le fait qu'il supporte les erreurs de son employé qu'il regarde comme son neveu. Si on considère cette façon de voir les choses, on comprendra pourquoi celui qui reçoit des moyens à gérer pour la communauté cherche à exclure ceux qui ne sont pas de sa famille. Celui qui donne les moyens est membre de sa famille. Les moyens qu'il donne ne peuvent profiter qu'à la famille de celui qui reçoit. Ce phénomène s'est observé même dans la vie des confessions religieuses congolaises. Les religieux africains, catholiques ou protestants ont longtemps considéré que les congrégations qui ont choisi de s'implanter dans leurs contrées étaient leurs propriétés. Les supérieurs ne pouvaient venir que de chez eux, les services de ces communautés ne pouvaient être dirigés que par des personnes originaires de leurs villages. On se rappelle à ce propos le terme "tumuzey" (nous le connaissons) entendu lors des délibérations pour l'affectation ou l'engagement d'un nouveau membre du personnel.
Or, une personne qui fait le développement est comme celui qui plante un arbre. Il ne doit pas s'imaginer qu'il sera le seul à manger les fruits de son arbre. Il doit savoir que l'arbre peut atteindre sa maturité après sa mort. Et donc, ce sont d'autres qui consommeront ses fruits. Et même si son arbre donne des fruits avant sa mort, il sera pas seul à les manger. Un arbre, même planté dans sa propre parcelle verra racines pousser sous le sol dans les parcelles voisines. Ses branches et feuilles s'étendront en envahiront l'espace des terres des voisins. Et donc, un tel arbre laissera tomber, quelques fruits pour les autres même si celui qui l'a planté ne le veut pas. Jean MUPEPE.
Meine Lesenden, es wird mir zunehmend peinlicher zu erkennen, wie sehr ich Erinnerungsfetzen nachhänge. Für mein Empfinden endete der Text von Papa Mupepe wieder mit einem Bild aus der Sonntagschule, mit den Hunden, die wenigstens die Brocken bekommen sollen, die vom Tisch ihres Herren fallen.
Dann folgten Telephongespräche mit meinen Bekannten in Kinshasa mit Boyi, Musu und Hortense, meiner Gewährsfrau. Es wurde immer heisser und ich warte und schaute Löcher in die Luft. Die grüne Polstergruppe im Wohnzimmer war sehr abgenutzt und teilweise defekt, aber sie war sehr gross und aus Samt. Claude holte Wasser, ein, zwei, drei, vier Kanister zu 25 Liter. Das Laptop war irgendwann voll aufgeladen. Es hatte alle Energie der beiden Module der Fotovoltaikanlage gebraucht. Die Batterien des Tonbandgerätes von Claude waren leer, und er konnte beim Wasserholen keine Musik hören. Nachmittags wurden die Batterien für den Abend gefüllt. Die Hoftüre war geschlossen. Ich sah nur die Füsse der Passanten. Die Strasse vor dem Haus war sehr schmal, Autos konnten nur mit Mühe passieren. Cléophase, der Chauffeur vom letzten Jahr kam vorbei. Er war krank und erzählte, Jango, der beste Matrose unseres Lastschiff sei an Aids gestorben, das ihm seine schöne Frau aus Kikwit mitgebracht hatte. Ich bat Gott um ein Zeichen und er schickte mir Ruhe und Zuversicht. Dann schlief ich eine Weile und ass etwas. Warten, warten, Diskussionen, alle versuchten Geld zu verdienen und alle fühlten sich schnell in ihrer Ehre verletzt. Dann fuhren wir ab. Eine überfüllte, löchrige Strasse in Richtung Kasamba und dort wieder ein Unterbruch: Diskussionen, Streitereien, ein Lärm in Kikongo wegen meines Passes in Mitten einer immer grösser und grösser werdenden Menschenansammlung. Ich konnte Gautier Nzadi, den Vorsteher der städtischen „Fremdenpolizei“ nicht erreichen, denn, und das stellte sich zwei Stunden später in seinem Büro in der Stadt heraus, Gautier nahm persönlich an der Streiterei teil und hatte verärgert sein Handy abgestellt. Waaaarten. Ich bat Gott um ein Zeichen und er schickte mir Ruhe und Zuversicht. Der Chef der Verkehrspolizei schaffte es schliesslich, dass wir uns in sein Büro zurückzogen. Dort weiter eine laute Diskussionen und schliesslich zurück in der Stadt. Dort stellte Gautier Nyadi beschämt fest, dass er vor wenigen Tagen meinen Pass persönlich kontrolliert und alle Unterlagen auf dem Markt kopiert hatte. Er stand auf, trat auf mich zu und entschuldigte sich per Handschlag. Wir konnten aufbrechen. Gott schickte mir Ruhe und Zuversicht. Beim Eindunkeln erreichten wir nicht, wie geplant, das Haus von Makabu, sondern wir blieben in der Savanne stecken.
4. Auf der Reise in die Dörfer entlang dem Fluss Kwenge
Donnerstag 21. Februar 2019 um 10.49
... . Gott schickte mir Ruhe und Zuversicht. Gemäss unserm Plan verbrachten Makabu und ich den 21. Februar in und um ihr kleines Haus herum in KongoKuku. Es sollte unser freie Tag, unser Ruhetag sein. Statt dessen hatten wir die Nacht in der offenen Savanne verbracht. Hatte ich mir nicht immer gewünscht, ein Mal unter freiem Himmel weit weg von aller Zivilisation zu übernachten? Auch dieser Wunsch hatte sich nun erfüllt. Ich atmete tief durch und begann die Situation zu geniessen. Über mir der Sternenhimmel. Meine Augen schweiften über das Firmament. Ich schwebte zurück in meine Kindheit und glaubte die Stimme der Mutter zu hören, wie sie sich bemühte, uns den kleinen und den grossen Wagen zu zeigen. Die Mitreisenden, Dépaul der Chauffeur, Isaac, der Schwiegersohn von Makabu und ein Kommilitone von Isaac verstanden mich nicht. Sie blieben tuschelnd im Auto, stiegen ein und aus, kontrollierten das Gepäck und machten es sich schliesslich auf den Sitzen bequem. Ich schlief in meiner Notfalldecke des Roten Kreuzes unter freiem Himmel im weichen, feinen Sand. Was wollte ich noch mehr? -- Doch dann: Sachte begann es zu regnen. Makabu verlangte, dass ich nun im Auto Schutz suchte. Sie legte mit Dépaul die gelbe Plane über unser stecken gebliebenes Gefährt. Ich schlief weiter. Es war bereits wieder Tag, als ich an Papa Mupepe und Kikwit dachte. Hatte Mupepe schon jemals eine Reise durch die Savanne gemacht? Warum wusste er, dass Reisen im Jeep bequemer und schneller war als eine Fahrt auf unserem Lastschiff auf dem Fluss Kwenge? War er je auf einem Lastschiff gereist? Wir waren gestern schliesslich um 13 Uhr mit grosser Hektik beim Haus von Mupepe weggefahren. Ich war erschrocken, als ich das Auto von Mayele sah. War das ein Jeep? Alle versicherten mir, das sei ein Jeep, ein Savannen taugliches Fahrzeug. Auf der Hauptstrasse Richtung Kasamba kamen uns Gruppen von skandierenden, stramm marschierenden junger Männer entgegen. Am Strassenrand drängten sich Menschenmassen. Ah, ich verstand, die Ankunft von Martin Fayulu, dem unterlegenen Päsidentschaftskanditaten wurde vorbereitet. Die Bevölkerung von Kikwit wollte den Wahlausgang nicht akzeptieren. Fayulu war ihr Favorit, und alle sprachen von Wahlbetrug. Per Buschtelefon hatten wir unterwegs erfahren, dass Fayulu später den Besuch abgesagt hatte. -- Kurz nach neun Uhr regnete es nicht mehr. Meine Mitreisenden warteten, bis die Plane trocken war. Dann ein emsiges Tun. Wo war der Dépaul, der Chauffeur? Um 10.49 schaltete ich das Laptop ein. Um 11.08 kam Dépaul zurück. Er war, wie man mir sagte, trotz Regen früh aufgebrochen und zurückgeeilt. Er war erfolgreich gewesen, er hatte den vermissten, in zwei Stücke gebrochenen Auspuff gefunden. Die Männer schaufelten den Jeep frei und mit viel Mühe fuhren wir weiter. Immer wieder musste ich Gott um ein Zeichen bitten, und er schickte mir Ruhe und Zuversicht. Wenn die Fahrerei zu mühsam wurde, marschierten Makabu und ich voraus. Eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Die Sandpiste war nun festgefahren und das Gehen fiel uns leichter als im lockeren Sand. Wir horchten auf. Ein Jeep näherte sich und fuhr vorbei. Wieder ein Motorengeräusch in der Ferne, und -- es war nicht unser Fahrzeug. Endlich kam dann unser Jeep. Wir fuhren gemeinsam weiter.
Freitag, 22. Februar 2019, die Fahrt ging weiter
Mein Tag begann mit einem Zeichen von Gott. Wir hatten die Nacht in einem lokalen Hotel in Kaputi, einem Dorf zwischen Kikwit und KongoKuku verbracht, 5'000 FC pro Person inklusive Wasser, um sich zu waschen. Mein Magen nutzte die Gelegenheit für eine kurz Störung. Er beruhigte sich aber vor dem Morgengrauen wieder. Seit Mittwoch Nachmittag hatten uns ein paar Bananen und je eine Handvoll Erdnüsschen genügt. Ich hatte in Kikwit ein Sechser-Pack Mineralwasser gekauft. Ich trank davon, die Mitfahrenden interessierten sich nicht dafür, sie würden am Abend trinken. 16'000 FC bezahlte Makabu für das Nachtessen für alle fünf: Fufu (Maniokmus), Bundu (gekochte Maniokblätter) und viande d'une grande bête (Rindfleisch). Bevor das Hotel Frühstück anbot, fuhren wir weiter. Der Chauffeur hatte den Jeep bereits gewartet. Wir beteten gemeinsam. Immer wieder blieben wir stecken. Dann schien es plötzlich besser zu gehen. Die Sandpiste verzweigte sich. Pech, der Landrover, der uns entgegen kam, bog nicht ab. Unser Fahrzeug frass ich wieder im Sand fest. Wie gewohnt stiegen wir aus. An ein Kreuzen war nicht zu denken. Und -- wie vom blauen Himmel herab, durchfuhren mich zwei Blitze.
Die MML-Gruppe war weit weg. Und doch, wie sich im April 2019 herausstellte, ganz nah, denn das Thema der Hausaufgabe für das Treffen der MML-Gruppe am 3. Mai 2019 lautete: Beschreibe einen intensiven, emotionalen Moment deines Lebens, Ausdehnung 0.
Einschub 1 Montag 26. August 2019
Nun konkret zur Beschreibung jener Begebenheit: „ Es geschah am Freitag den 22. Februar 2019 um 10.30. Wir waren um 8 Uhr morgens in Kaputi aufgebrochen und zum X-den-Mal sass unser Jeep im Sand der Savanne fest. Der Chauffeur und die beiden Mitfahrer kamen zum Einsatz. Sofort mühte sich der erste ab. Wild warf er den lockeren Sand weg. Keuchend gab er die Schaufel dem nächsten. Dieser machte sich mit gleichem Einsatz hinter die Aufgabe. Ausgepumpt reichte er die Schaufel dem Dritten. Sie wechselten sich ab. Meine Begleiterin und ich schauten zu. Ich hätte gerne mitgehalten, aber das entsprach nicht der Sitte der Gegend. Unser Vehikel versperrte den Weg. Die Pousseure, Männer, die auf ihren Velos zwei oder drei schwere Säcke durch den Sand schieben, um etwas zu verdienen, wollten in der letzten Kühle der Nacht weiter. Statt einfach dort zu stehen, halfen wir ihnen, ihre schwer beladenen Velos um unser Hindernis herum zuschieben. Musste das sein! Nun kam aus der Gegenrichtung noch ein Landrover. Er schien abzubiegen. Nein, er hielt an! Der Chauffeur sprang aus dem Wagen und gab mir die Hand. Er begrüsste mich mit dem Namen und stellte sich vor: „Ich bin der Chauffeur von Kingandu. Vor fünf Jahren sind Sie mit uns von Kikwit nach KongoKuku gefahren.“ Das stimmte, aber ich erinnerte nicht mich an sein Aussehen. Er gab seinen beiden Begleitern ein Handzeichen. Ein sportlicher, gutaussehender Mann, kaum vierzig begrüsste mich. Ich war erstaunt. Er erklärte: „Ja, ich kenne sie. Ich weiss, dass sie jedes Jahr in diese abgelegene Gegend kommen. Was ist ihre Auftrag?“ Ich verstand, zögerte aber. Auf deutsch hätte ich spontan gesagt: Transport, Alphabetisierung und Aufforstung. Doch auf französisch schien mir das zu grossmäulig. Er verstand mein Gestotter und fragte lachend: „Beten Sie auch?“ „Natürlich, ohne Gott in einer solchen Situation lachen, wie könnte ich das.“ Er stellte sich vor: „Ich bin der Prior von Kingandu und besuche im Laufe des Kirchenjahres, vor jedem der Festtage jedes Dorf. So kenne ich die Gegend und auch ihre Begleiterin mit ihren vielen Alphabetisierung-Gruppen.“ Ich erkundigte mich, ob er Hagen Müller, den Missionar aus Frankfurt, der 39 Jahre in Kingandu gewirkt hatte, gekannt habe. Er schüttelte den Kopf und erklärte: „Ich trat ein Jahr nach Müllers Abreise als Novize den den Orden ein.“ Er habe von Müllers Viehherden gehört und wünsche sich auch ein paar Rinder. Dann fuhr er weiter: „Wir haben vorhin auf unserer Fahrt nach Kikwit von ihnen gesprochen und da stehen sie nun vor mir. Das ist Gebetserhörung.“ Dann trat der zweite näher. Er hatte das Wort Aufforstung gehört. Empört erzählte er von seinem Schock wegen des gefällten grossen alten Mangobaumes: „Dieser musste geschlagen werden, weil wir kein Brennholz mehr hatten! Soviel hat es gebraucht, bis wir aufgewacht sind! Es muss etwas geschehen! Wir müssen Aufforsten! Wie? Wir sind für jede Hilfe dankbar.“ Die beiden hatten kein Papier zur Hand. Deshalb schrieben sie ihre E-Mail-Adresse in mein Notizbuch. Sie hatten es eilig. Sie drehten sich um und stiegen in den Landrover. Das war der Moment, in dem mir ein als Teenager geträumter, alternativer Lebensentwurf wieder voll präsent wurde. Sie fuhren weg und ich wusste, ich hatte damals während dem Hauswirtschaftskurs im Kloster Ilanz richtig entschieden. … . Ich war nicht Ordensfrau geworden, obwohl ich in der von mir so sehr gewünschten Kantonsschule mit mir unüberwindbar scheinenden Hindernissen kämpfte.
Wieder daheim mailte ich den beiden Männern unsere beiden Anleitungen zum Setzen von Jungbäumen und die Aufforderung, am Wettbewerb teilzunehmen. Per Mail bat ich auch meine Partnerin, den Kontakt zu den beiden zu suchen. Dann hiess es warten. Das fiel mir schwer, denn es hatte mich ja noch ein zweiter Blitz getroffen. -- Ich hatte mich in den Prior von Kingandu verliebt. Er weckte Schmetterlinge in meinem Bauch und ich genoss dies. Einschub 1 Ende.
Einschub 2 vom 26.08.2019
Ein grosser Tag, eine grossmäulig Formulierung für das, was es war. Ich hätte es schon lange gerne gemacht, aber ich wusste nicht wie, und wie macht am etwas, wenn man nicht weiss wie? Darshi, die Mutter der zweijährigen Harsha war meine Tamilin und ihr Leben war nicht ganz einfach. Djiyan, die Mutter der vierjährigen Ruhib war eine Syrerin und ihr Leben war nicht ganz einfach. Beide hatten dringend jemanden gesucht, um Deutsch Konversation zu üben, und beide hatten mich gefunden. Es entstanden zwei spezielle, von Unsicherheiten geprägte Beziehungen. Das Anfänger-Deutschbuch gestaltete unsere Gespräche. Nach jenem Abend wusste ich: Ich kannte die beiden trotz der vielen gemeinsamen Deutsch-Stunden nicht und ich hatte mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. -- Ich hatte schon lange geplant, diese beiden fremden Frauen, die doch in einer so ähnlichen ihnen fremden Welt lebten, gemeinsam einzuladen. Wie? Am 26. August war mir das passiert. Ich hatte Darshi nach dem Treffen mit den alten SVP-Mitgliedern abgeholt und Dijyan hatte ihre Tochter im Spielhaus abgeholt und mein Mann hatte ein Abendessen im Garten für uns vorbereitet. Schnell, schnell. Darshi hatte unerwartet noch eine Einladung zu einem Geburtstagsfest bei Landsleuten erhalten, die sie nicht wagte abzusagen. Sie hatte wenig Zeit. Dijyan musste bald heim, weil Ruhib nach dem Besuch im Kindergarten und dem Hütedienst im Spielhaus sehr müde war. Schnell, schnell. Und ich dazwischen, wie immer irgendwie untätig. Meine Lesenden, diese Formulierungen war alle richtig. Die Kinder spielten miteinander. Harsha, die jüngere bestimmte. Sie packte Ruhib am Arm und bespritzte sie mit Wasser. Darshi ärgerte sich, dass Harsha das machte. Djiyan ärgerte sich, dass Ruhib sich nicht wehrte. Harsha begann zu schreien, als Darshi sie ermahnte. Mein Mann brachte die beiden heim. Ruhib blieb ruhig auf ihrem Stuhl sitzen, als Djiyan sie ermunterte sich zu wehren. Ruhib was müde, sie wollte heim gehen und schlafen. -- Trotzdem war es für uns drei Frauen eine gute neue Erfahrung. Das nächste Mal werde ich mehr von mir, von meinem kleinen Bauerndorf und von jetzt als Grossmutter erzählen, und ihnen so die Möglichkeit anbieten, von ihren Land, ihrem Dorf oder ihrer Stadt zu erzählen. Einschub 2 Ende.
Einschub 3 vom 27.08.2019
Oma Heidi war Ende Juli sehr geschwächt vom Besuch in ihrer Schule „Les Gazelles“ in Kinshasa, Kongo, heim gekommen. Ich hatte sie besucht und war erschrocken, wie konnte sie noch allein in ihrem geliebten Haus wohnen. Ich hatte sie zwei Wochen später angerufen. Sie konnte mir nur hustend erklären, sie müsse im Bett liegen, denn sie habe eine Rippe gebrochen. Wir brachen das Gespräch nach zwei Minuten ab. Eine Woche später, am 27.08., brachte ich ihr eine Sonnenblume und sie erklärte mir mit zwar schwacher, aber klarer Stimme, sie sei am Sterben und sterben ist schwierig. Diese Aussage traf mich noch tiefer als die beiden Blitze in der Savanne am 22. Februar 2019. Eine Woche später schien es Oma Heidi wieder etwas besser zu gehen. Dass Bitulu auf meine Anregung hin für verschiedenen Leute Briefe gescannt und gemailt hatte freute sie sehr. Einschub 3 Ende.
Nach dem kurzen Gespräch mit den beiden Geistlichen aus Kingandu marschierten Makabu und ich Stunde um Stunde bis nach Kasendji, wo wir warteten und warteten. Unser Jeep kam schliesslich. Später schafften es der Chauffeur und die Bevölkerung von Kasendji nicht mehr, das Vehikel nochmals zu starten. Makabu und ich erreichten beim Einbrechen der Dunkelheit ihr kleines Haus in KongoKuku. Isaac blieb noch eine Weile beim Auto, dann nahm er den Sack mit den Fussbällen und marschierte durch die Nacht heim zu seiner Familie.
Die Woche, die ich mir zum Übersetzen des Tagebuchs meiner elften Kongoreise gegeben hatte, war vorbei. Den Streit mit meinem ehemaligen Partner, Masuta, die langen Wanderungen von Dorf zu Dorf, all das Warten und Hoffen, das frohe und erstaunliche Treffen mit den Leitern und Leiterinnen der Alphabetisierungsgruppen, meine vielen Bitten um ein Zeichen und noch vieles mehr mussten wegfallen. Ich schloss mit einem guten Gefühl und der Hoffnung und Sorge auf die nächste Reise 2020.

1970 Ich war entschloss, etwas gegen den Krieg zu tun. ... ...
Dave war nicht zurückgekommen. Was konnte ich gegen den Krieg tun? Die Frage lähmte mich. Als Lehrerin hatte ich oft guten Erfolg, wenn ich statt mehr des Gleichen das Gegenteil vorschlug. Also kehrte ich die Frage „Was kann ich gegen den Krieg tun?“ um. Neu lautete als Satz: „Ich tue etwas für den Frieden.“ Ich stellte den Satz neben meinen Plan, „die Alfis“ in den abgelegenen Dörfern des Kongos zu besuchen. Seither begleiten mich beide. Das Leben hatte mich gelernt, beharrlich stand zu halten und wenn möglich in kleinen, kleinsten Schritten vorwärts zu gehen. Mit meinen Bitten um Frieden blieb ich mir treu. Ich bemühe mich, das Wort „Frieden“ jeden Tag anzuwenden oder wenigstens laut auszusprechen. So gebe ich dem Frieden, entsprechend meiner Überzeugung, eine winzige Existenz, ähnlich dem Flügelschlag eines Schmetterlings der angeblich die Welt verändern soll.
Einschub: 2019 in der Zeit der Game-Industrie, der neuen Medien und von Internet mit all den Möglichkeiten scheint „mein Tun“ noch lächerlicher zu werden. Es wird injoriert. Bestenfalls wird mir geraten, auf die neuen Medien umzusteigen. Das schaffe ich nicht. So bleibe ich dabei. Es tut mir gut. Einschub Ende.
Zurück in der Schweiz -- ich war überrascht, dass es das gab -- besuchte ich im September 1970 in einer kirchlichen Heimstätte ein Wochenende zum Thema „Frieden“. Informativ, aber meine Frage nach einem persönlichen, täglichen Betrag zum Frieden blieb ungehört, oder bestenfalls belächelt. Vergebens versuchte ich den Anwesenden die Bedeutung des Satzes „Dave kam nicht zurück“ zu erklären. Es ging mir nicht um einen Toten, dessen Namen sich kannte. Es ging mir um die vielen Frauen, um die Mütter mit Kindern, die täglich erfahren, dass ihr Sohn, ihr Mann, ihr Vater nicht aus dem Krieg zurückkommt. Ich wollte über Formen, Möglichkeiten meines persönlichen täglichen Beitrags zum Thema Frieden sprechen. Einen zickezacken kleinen Auftrag, den ich jeden Tag erfüllen kann in der Hoffnung, dass dadurch vor dem Ende meiner Tage einer weniger auf dem Schlachtfeld tot liegen bleibt. Solche Bemühungen sind nicht lächerlich, wenn sie von vielen mitgetragen würden, aber sie werden es nicht. Da sitzt die Krux. Ich habe als kleines Kind von meinem Grossvater gelernt, dass jeder Flügelschlag eines Schmetterlings die Welt verändert. Mein Grossvater hatte mir gezeigt, dass wir mit Tieren sorgsam umgehen müssen. Tiere könnten sonst aussterben, hat er gesagt. Auch das soll ein lächerlich nutzloser Satz sein. 2019 werden ohne Rücksicht auf Verluste lautstark schnelle strukturelle Veränderungen verlangt. Ich mache weiterhin täglich einen leisen Flügelschlag eines Schmetterlings.

b. Zurückkommen aus Amerika, Sommer 1970
Zurückzukommen ins kleine Dorf auf den in der Zwischenzeit gross gewordenen Bauernhof, das war einfach, wenn man sich in den Alltag einfügte, als käme man vom Einkaufen in der Stadt. Man setzte sich den Familientisch zum Abendbrot und hörte zu, was die andern Familienmitglieder auf dem Feld erledigt hatten und erzählte kurz von seinen Erfahrungen in der Stadt. Zurückkommen von Paris, von London und von Barcelona hatte sich nach demselben Schema abgespielt. Ich stieg jeweils auf unserer Bahnstation aus, stellte mein Gepäck ein und marschierte heim. Ich grüsste, setzte mich an den Familientisch, und die Mutter schob mir den Gästeteller zu. Sie bediente mich und unterbrach mich, wenn ich etwas sagen wollte: „Iss zuerst.“ Ich schluckte und hörte zu. Seit 1966 war die Güterzusammenlegung im vollem Gange. Es gab täglich andere Gerüchte, Meinungen und Vermutungen. Alle Grundstücke wurden nochmals vermessen und punktiert. Das Land wurde neu eingeteilt und viele Flurwege aufgehoben oder verschoben. Wer satt war, stand vom Familientisch auf und ging nochmals an die Arbeit zurück. Im Laufe des Abends begrüsste ich jedes Familienmitglied per Hand. Auf meine Frage: Wie geht es dir? erhielt ich die Antwort: „Gut, schön, dass du gesund zurückkommen bist. Ich bin müde und will fertig machen.“ Ich verstand es nicht, was mir im Ausland leicht fiel, ein Gespräch anzufangen. Die alte Routine und ich konnte sie nicht ändern. -- Ich konnte sie nicht ändern. Alle, hauptsächlich die Mutter, waren froh zwei Hände mehr auf dem Hof zu haben. Das freute mich, und ich hörte gerne Neuigkeiten aus dem Dorf. Diese war wichtig und ich interessierte mich dafür, doch ich hätte gerne auch erzählt.
2019, ich sass vor dem Laptop und wollte etwas zum Thema „zurückkommen aus Amerika“ tippen. Doch da gab es nichts zu schreiben. Ich hatte immer sofort tüchtig Hand angelegt und wurde dabei mit Alltagskram überschüttet und gleichzeitig musste mich selber organisieren. Es war Juli 1970, eine strenge Zeit für Bauernleute. Trotzdem hatte ich mich damals immer wieder gefragt, ob es überhaupt nötig war, dass ich mit arbeitete. Ich wandte mich schliesslich an die Mutter, und sie antwortete kurz: Wenn du schon da bist, kannst du auch etwas tun. War ich allein, atmete ich oft kräftig aus und langsam fand ich den Mut, mir einzugestehen, es wäre vielleicht besser gewesen, erst im September heimzukommen. Hatte ich einen Fehler gemacht? Nein, es war nicht anders gegangen. Ich musste weg und nun steckte ich wieder in der Routine und war nicht in der Lage, besser für mich selber zu sorgen. Ich verräumte meine Sachen. Ich liess mir Zeit. Schliesslich lag da noch die amerikanische Fahne von Dave. Wir hatten uns nur zehn Minuten gekannt und er hatte mir diese zum Abschied geschenkt. Wir hatten vereinbart, uns einen Monat später auf Hawaii zu treffen. Wir freuten uns beide. Dann hornte der Kleinbus. Er drückte mich sachte, stieg ein und winkte. Noch in jener Nacht flogen die GIs nach Vietnam zurück. Es kam keine Einladung nach Hawaii. Zwei Männer überbrachten mir die Nachricht: Dave ist tot. „Ich werde etwas für den Frieden tun“, war meine Antwort. Ich wollte heim. Das liess sich noch gut per Juli organisieren. Mein Vorsatz lautete: „Ich tue etwas für den Frieden, selbst wenn ich nur das Wort täglich laut ausspreche“. Ein paar Wochen später hielt die Fahne von Dave daheim wieder in den Händen. Ich wollte sie der Mutter zeigen. Doch sie schob mich weg und sagte harsch: „Geh, pack aus!“ Wie gut hätte es mir getan, wenn ich meiner Mutter die Geschichte von Dave hätte erzählen können. Darüber sann ich 2019 beim Tippen nach.
Ich hatte die Geschichte am Tag zuvor während den Abendgebet für den Frieden das erste Mal erzählt. Ich staunte, welche Kraft mir das gab. Wir, die Kerngruppe waren daran, per 18. September 2020 unser Jubiläum 25 Jahre "Abendgebet für den Frieden" gemeinsam mit der Arbeitsgruppe "interreligiöer Dialog" vorzubereiten. Wir hofften, es im Rahmen des ökomenischen Bodensee-Kirchentages zu begehen.
1970 hatte ich mich beim Schulamt angemeldet. Auf meinen Wunsch wurde mir eine Sonderklasse für schwache Schüler zugeteilt.

Lehrplan 21, was ist das?
Ich schaute mich mit einem verzeilichen Blick schräg an und wartete lächelnd. Ich wusste noch immer nicht, was der Lehrplan 21 "neues" bringen sollte.
Im Jahr 2010 begannen die 21 Deutschschweizer und mehrsprachigen Kantone mit der Ausarbeitung des ersten gemeinsamen Lehrplans. Er bringt ein neues strukturelles Konzept der Volksschule. Er unterteilt nicht mehr in Kindergarten, Primarschule Unterstufe, Primarschule Mittelstufe und Sekundarstufe 1. Neu werden die elf Schuljahre in drei Zyklen eingeteilt. Der erste Zyklus umfasst die beiden Kindergarten- und die ersten beiden Primarschuljahre, der zweite Zyklus die Klassen 3 bis 6 der Primarschule und der dritte Zyklus die Sekundarstufe 1. Am Ende eines Zyklus müssen die Schülerinnen und Schüler gewisse Grundansprüche erreichen – eben jene im Lehrplan 21 (LP 21) für den jeweiligen Zyklus definierten Kompetenzen. Ich bemühte mich immer wieder, die Neuerung zu verstehen. Es hiess da: «Die Bedingungen für das Arbeiten und Zusammenleben in unserer Gesellschaft haben sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Die Anforderungen sind komplexer und gleichzeitig ist das Tempo der Veränderungen schneller geworden. Diese Herausforderungen verlangen flexibles, eigenständiges und verantwortungsvolles Handeln. Mit dem neuen Lehrplan 21 Kanton Schaffhausen wird den veränderten Bedingungen Rechnung getragen, indem der Fokus verstärkt auf das Können der Schülerinnen und Schüler gerichtet wird. Der Lehrplan 21 Kanton Schaffhausen soll sie unterstützen, systematisch Kompetenzen aufzubauen, um ihr Wissen und Können in neuen Situationen anwenden zu können. Kompetenzen werden dabei als Zusammenspiel von Wissen, Können und Wollen gesehen.»
Montag 12. August 2019: Neues Schuljahr, neuer Lehrplan, die verschiedenen Medien orientieren.Mein letzter Versuch. Ich bemühe mich nochmals, das ganze lein ganz klein wenig zu verstehen und lese, was die Zeitungen melden. Für weitere Informationen werde ich immer wieder auf www.Lp21.schule.sh.ch/">www.Lp21.schule.sh.ch verwiesen. Schön und gut, ich habe nochmals lange und viel auf der angegebenen Webseite gelesen. Es machte mir Spass, aber was bedeutet dies für den Alltag mit kleinen unternehmungslustigen Schülern. Exemplarisch wählte ich das Wort «Noten» als Kompetenz, denn ich war und bin an Noten interessiert. Meine kleinen Schüler Ende der 1960er Jahre und die mir Ende der 1980er Jahre anvertrauten Kinder freuten sich an guten Noten. Neu soll es angeblich es keine Noten mehr geben, doch die zwei Mädels, die mich im Juli 2019 im Garten besuchten, erzählten mir von ihren guten Noten. – Noten sind für mich der Schlüssel zu Geld. Ich habe gelernt, dass das nicht stimme, dass das zu wenig differenziert sei. Doch verlassen wir mein Thema «follow the money» und gehen zurück zu den Noten. Ich suchte das Wort «Noten»: Ich skrollte hinauf und hinunter, ich tippte es ins Suchfenster ein und öffnete weiterführende Links. Ich las viel Interessantes, … . Dann fand ich es schliesslich und las deshalb den vorgeschlagenen langen, übersichtlich gestalteten Text mit der Überschrift «Das lernziel- und förderorientierte Beurteilungsverfahren». Zitat «Darin wird versucht, die Eckpfeiler eines zeitgemässen Beurteilungsverfahrens voneinander unabhängig auf jeweils einer Seite plakativ darzustellen.» Zitat Ende. Auf das Vorwort und die Leitgedanken folgt die ganzheitliche, die formative, die summative und die prognostische Beurteilung, dann werden achte weitere Kriterien darunter die Noten angeführt und schliesslich das Beurteilungsgespräch. Ich lernte, Noten sind eine Nebensächlichkeit.
Es fällt mir leicht, die folgenden Fähigkeiten als Lernziel zu anerkennen: Kreativität, Empathie, Selbstachtsamkeit, vernetztes Denken und das Gegensatzprogramm: Einerseits Natur Klima andereseits digitales Lernen die intelligent Maschine. -- Ich will das Thema weiter verfolgen.

2019 eine Revolution in der Schule?
Auf der Frontseite der NZZ am Sonntag vom 18. August 2019 lautete die Headline «Ade, Stundenplan: Jetzt sollen die Schüler sagen, wie sie lernen wollen». Vier Seiten waren im Bund «Hintergrund» dem Thema gewidmet. Auf Seite 16-17 wurde nach der Überschrift «Lernen nach dem Lustprinzip» im Vorspann ausgeführt: «Eine Revolution der Schule kündigt sich an: Nicht mehr Lehrer, sondern die Schüler sollen bestimmen, was sie wann lernen wollen. Stundenpläne würden verschwinden. Die Idee findet immer mehr Anhänger – auch aus der Wirtschaft. Nun entsteht die erste Lehrerausbildung dieser Art» gezeichnet von Anja Burri. Auf Seite 18 -19 folgt ein Interview das Michael Furger mit dem deutschen Philosophen Richard David Precht geführt hat. Nach der Überschrift: «Algebra braucht kaum jemand im Leben. Das ist verschwendete Zeit» wird im Vorspann erklärt: «Die Schule bereite unsere Kinder schlecht auf die Zukunft vor, sagt der Philosoph und Bestsellerautor Richard David Precht und fordert eine Bildungsrevolution. Er erklärt, wieso Lehrer ihre Schüler nicht mögen müssen und weshalb man auf Goethes «Werther» verzichten sollte.» Ich las alles sorgfältig und versorgte die Zeitung. Ich war müde und viele Fragezeichen schwirrten um meinen Kopf. Mir war kalt. Wo soll das hinführen? Was passiert in China? Geknickt und verängstigt schlüpfte ich unter das Federbett (die Klimahysteriker sprachen von einem Hitzesommer) und erwachte in der Nacht mehrmals, weil mir fröstelte - Summerhill,Summerhill -
Ich träumte von meiner Schulpraxis Ende der 1960er Jahre. Ich versuchte die Schüler damals zu fesseln. Meine Lesenden stellen Sie sich bitte Ihre Nachbarskinder als «gefesselte Schüler und Schülerinnen» vor. – Ich träumte von meinen 40 Drittklässlern und dem Monatsthema «Vögel». Ich erinnere mich genau. An einem Montagnachmittag, kurz vor Schulschluss verteilte ich ihnen je ein kleines Stück Abfallpapier und erklärte: «Als Hausaufgabe bitte ich euch, über Vögel nachzudenken und über Vögel zu sprechen.» Dann forderte sie auf, vor dem Verlassen des Zimmers noch schnell alle ihnen bekannte Vögel aufzuschreiben. Sie konnten mir das Blatt mit oder ohne Namen beim Verabschieden geben. Das ging schnell, denn sie kannten kaum Vögel oder waren neugierig zu hören, welche Vogelnamen ihre Kameraden wussten. Sie schimpften. Die einen hatten die Spatzen, andere die Schwäne oder die dritten die Tauben vergessen. Kein Kind hatte mehr als fünf Vögel aufgeschrieben. Jetzt waren die Kinder von der Idee «Vögel kennen» gefesselt. Am nächsten Tag kamen sie mit Notizblättern voller Vogelnamen gestürmt, nein gerannt ist das richtig Wort. Sie hatten sich sich auf dem Pausenplatz ausgetauscht. Ich erinnere mich gut, die andern Lehrer sahen das nicht gern. Ich wusste, dass Schulmaterial nur im Schulzimmer gebraucht werden darf. Die Kinder wussten das auch, aber sie brachten Papier und Stift von daheim und liessen nichts liegen. Regula, ihr Vater war Schulvorsteher in einem andern Schulhaus, achtete auf Ordnung. Alle wussten, Regula musste die letzte, die ins Schulzimmer kam und alle wussten, Regula sammelte unsere Papierfetzen ein. Viele halfen ihr. Manchmal ärgerten sie sich gegenseitig. Es gab Streit. Hörte ich ihr Geschrei im Zimmer, war ich sofort vor Ort und sie verstummten. Sie liebten dieses Spiel, sie waren gefesselt. Ich träumte weiter.
Die Glocke läutete. Die Schüler durften ins Schulhaus, ins Zimmer. Ich begrüsste sie per Handschlag an der Türe und mahnte sie mit Handzeichen zur Ruhe. Während sie sich vorbereiteten, spazierte ich durchs Zimmer und warf einen Blick auf ihre Blätter. Ich erklärte: «Die Hausaufgabe lautete: Über Vögel nachzudenken und über Vögel sprechen. Es freut mich, dass viele von euch Vogelnamen aufgeschrieben habt. Ich weiss, dass einige von euch einen Wettkampf machen, das ist gut so, aber bedrängt eure Eltern nicht zu sehr.» Ein freies mehr oder weniger geordnetes Gespräch begann. Mario zeigte sein Blatt, mit der Nonna hatte er Vögel auf italienisch aufgeschrieben und als er schlief, hatte Papa die Namen auf Deutsch übersetzt. Ich achtete darauf, dass wir schriftdeutsch sprachen und dass jedes Kind zu Wort kam. Nach einer Viertelstunde brachen wir das Gespräch ab. Es war uns allen klar, wir mussten doch lesen und schreiben lernen. Willig nahmen sie die Bücher und lasen leise einzeln den vorgeschlagenen Text. Dann lasen die Banknachbarn gemeinsam im Flüsterton, sie wechselten sich ab. Gelegentlich lasen wir auch alle gemeinsam, die Mädchen einen Abschnitt, dann die Knaben den nächsten. Ein Mal pro Woche während der stillen Beschäftigung las mir jedes Kind allein am Pult vor und ich notierte, was sie Noten nannten: Gut, mittel, mässig. Auf Wunsch gab ich ihnen an einem andern Tag einen zweiten Versuch. Es war auch erlaubt, einen Text daheim vorzubereiten. Davon profitierte Mario sehr. Der Wecker läutete. Der 19. August 2019 begann.
Meine Lesenden, hier brach ich meine Pädagogikstunde wehmütig ab, und schob all das schöne weg, das ich mit den Kindern hatte erleben dürfen. -- Eine Revolution in der Schule? Wo bleibt da die Ruhe. Mir wird Angst -- bin ich eine alte Frau?

Meine Visitationsberichte aus den 60er Jahren – Lehrpersonenbeurteilung 2019
Der Visitator, ein Laie, besuchte die ihm zugeteilten Klassen zweimal jährlich. Die Schüler und ich, wir waren in unsere Arbeit vertieft. Es klopfte. Wer konnte das sein? Ich öffnete, ein ältere Herr, er stellte sich als Visitator vor. Wie ich wisse, komme er vorbei, um meinen Unterricht zu beobachten und zu beurteilen. Ich stellte ihn den Schülern kurz vor, gab ihm einen Stuhl und er setzte sich hinten ins Schulzimmer. Die Schüler hatte ich anfangs Jahr informiert, hastig ordneten sie ihre Sachen etwas besser und setzten sich gerade hin. Der Unterricht ging weiter. Der Visitator hörte zu und blätterte durch die vorgelegten Hefte. In der Pause unterhielten wir uns, er machte ein paar Notizen und besuchte die nächste Lehrerin. Am Ende des Schuljahres erhielt ich den Visitationsbericht zugestellt: «Schuljahr 1968 / 1969: Ernsthaftes und gewissenhaftes Schaffen sind die Grundlagen, mit welchen Fräulein Meier ihre Schüler unterrichtet. Die interessante und anregende Gestaltung des Unterrichtstoffes hat sich in erspriesslicher und freudiger Schularbeit ausgewirkt. Ich möchte an dieser Stelle Fräulein Meier für die innere Bereitschaft und den guten Willen, mit allen Kindern das Lehrziel zu erreichen, ganz herzlich danken.»
Während dem Schuljahr 1968 / 1969 besuchte ich den Abendkurs des Heilpädagogischen Seminars Zürich, denn die sorgfältige Korrektur der Schülerarbeiten belastete mich sehr: Vierzig kleine Diktate, vierzig kleine Aufsätze und Schüler, die mit Spass darnach suchten, ob ihre Lehrerin vielleicht einen Fehler übersehen hätte. Und sie hatte regelmässig nicht alle Fehler entdeckt. Im Klassenverband und in der Pause führten wir viele interessante Gespräche über Fehler, Versehen, Nachlässigkeiten, Schwächen und Stärken, Grosszügigkeit andern und sich selber gegenüber, Verständnis und gegenseitig Unterstützung. Erfüllt und angeregt trugen die Schüler diese Themen heim, und die Eltern zeigten Verständnis für meine Probleme. Viele waren lobten für meine offenen Gespräche mit den Kindern und bedankten sich für die Anregungen durch meinen Unterricht. Ich erlebte dies auch als bereichernd, aber es konnte nicht so weiter gehen, denn die andern Lehrer nahmen Anstoss an meiner «Unfähigkeit». Die Tatsache, dass neu pro Schulbezirk eine Sonder- oder Förderklasse zu führen war, kam mir entgegen. Zwar war ich noch keine Lehrerin mit langjähriger Erfahrung, aber ich hatte einen Ausweis, ein Testat des Heilpädagogischen Seminars Zürich über den Besuch von 8 Vorlesungsstunden pro Woche während 2 Semestern. Dieser Ausweis war kein Diplom und kein Fähigkeitsausweis, aber er ermächtigte mich zur Führung einer Sonder- oder Förderklasse. Zusätzlich hatte ich mich während meinem Aufenthalt in den Vereinigten Staaten immer wieder gezielt für den Umgang und die Förderung von schwierigen oder langsamen Kindern interessiert. Da ein Mangel an Fachkräften bestand, wurde mir ohne Zögern eine Sonder- und nachher eine Förderklasse anvertraut.
Visitationsbericht: Schuljahr 1971 / 1972: „Fräulein Meier führte die Förderklasse 3b mit Geschick und sehr viel Geduld und Ausdauer. Es ist nicht selbstverständlich, dass eine noch junge Lehrerin diese Eigenschaften besitzt. Mit ihren Methoden, die für den Laien oft unverständlich waren, hatte sie Erfolg bei ihren Schülern. Diese verdankten es mit reger Mitarbeit. Hübsche Handarbeiten, Hefte und Zeichnungen zeigten dem Besucher, dass auch in dieser Schulstufe von den Kindern Leistungen gefordert werden. Reine Knabenklasse: 15 Schüler.“ Eine Förderklasse hatten damals normal begabte, leistungsschwache Kinder zu besuchen, und dies galt als Schmach. Schule war für sie und ihre Eltern eine Pein und die Kinder wollten nicht in die Schule. Meine "unverständlichen" Methoden, das waren neben anderem Arbeits-Posten, welche die Schüler parallel zum Unterricht im Klassenverband zu zweit oder allein besuchen und lösen „mussten“. Vorweg, alle 15 Knaben waren schwach im Lesen, aber sie machten gerne etwas mit den Händen. Deshalb schrieb ich ihnen Anleitungen zu den Posten. In der Pause wollten sie mich immer wieder davon überzeugen, dass es besser wäre, ihnen die Aufgabe mündlich zu erklären. Natürlich half ich ihnen gerne beim Lesen, aber sie sollten es allein versuchen, sie konnten es doch. In kleinen Gruppen lasen wir Wort um Wort und setzten den Satz dann zusammen. Bald gab es ein paar Knaben, welche die Texte lesen, vielleicht einfach erraten konnten, das hiess, sie führten die gestellte Aufgabe richtig aus. Wie dem auch sei, sie lösten die Posten gerne und kamen bald mit Freude in die Schule. Keine Abwesenheiten, keine grösseren disziplinarischen Schwierigkeiten, kein „Schlafen“, wenn ich das 2019 nun so tippe, wundere ich mich selber. Die Eltern waren überrascht, dass ihr Sohn plötzlich noch etwas länger in der Schule bleiben wollte, um einen Posten zu lösen, dass er freiwillig etwas von der Schule erzählte. Nun ein paar Beispiele der beliebtesten Aufgaben. Alle Aufgaben, die mit „Verlasse das Schulzimmer und gehe ...“ begannen, fanden sie ungewöhnlich, beispielsweise gehe zum Lehrerparkplatz. Welche Farbe hat das Auto mit der Nummer ZH 3612? Es brauchte viel Mut, auf das Lösungsblatt zu schreiben: Das gibt es nicht, aber es machte Spass. Sie zählten auch gerne Geld und ordneten die Münzen nach meiner Anweisung. Wie viele Rappen, wie viele Zehner, wie viele Hunderter (=Franken), wie viele Tausender (= Zehner Noten) liegen in der Schachtel? Sie lernten messen: Wie lange, breit und hoch ist die Schachtel? Wie viele Sechser Häufchen konnten sie mit den Steinen im kleinen Korb legen. Wie viele blieben übrig? Sie lernten die Lösungen aufzuschreiben. Sie begannen auch mir Aufgaben zu stellen. Sie machten Fortschritte, das war mein Ziel. Zwei Schüler konnten mit Erfolg wieder in die Normalklasse zurück. Die Arbeit mit den Kindern und den Eltern machte mir Freude, aber meine Situation im Lehrerzimmer? Das war schwierig.
2019: Eine Bekannte, eine erfahrene Lehrerin im dritten Zyklus, stellte mit wenig Begeisterung fest, dass sie zur Beurteilung ihrer Arbeit jedes Jahr mehr Unterlagen einzureichen hätte. Ich fragte sie nach Details, und sie verwies mich lachend für genauere Informationen aufs Internet und meinte:. «Nein, nein, warte. Ich unterbreche meine Gartenarbeit und hole dir meine Druckversion. Ich wollte etwas in den Händen haben. Du wirst staunen.» Wenig später sass ich damit am Stubentisch. Vor mir lag die «Wegleitung für die Beurteilung der Lehrpersonen an Kindergärten, Primar- und Sekundarschulen» 25 Seiten inklusive zwei Seiten Orientierungshilfe zum Unterrichtsbeobachtungsbogen und drei Seiten Formulierungshilfen für die Beurteilung von Lehrpersonen. Alle Dokumente sind online unter www.schule.sh.ch/">www.schule.sh.ch zu finden. Fragen von mir: «Wer wählt die zur Beurteilung der Lehrpersonen bestimmten Personen aus? Wie sind sie ausgebildet? Wer überwacht deren Qualität?» ... Schliesslich zitiere ich nun noch die ersten drei Sätze der Einleitung zu dieser Wegleitung: «Die Qualität in der Schule basiert auf dem professionellen Handeln der Lehrperson. Die fachliche, didaktische und pädagogische Tätigkeit lässt sich nicht standardisieren. Das adäquate Handeln der Lehrpersonen ist deshalb ein Schlüsselelement der Schulqualität.» Drei akademischen Sätze, die sagen: Gute Lehrer sind das A und das O. Alles weitere erlaube ich mir «Papiertiger zu nennen.»

Wie soll es weiter gehen?
Diese Frage hatte ich mir schon in der geliebten Kantonsschule gestellt. Ich brachte die für eine Lehrerin erforderlichen Begabungen nicht mit, das war mir klar, obwohl ich nie gewagt hätte, dies laut zuzugeben. Ich konnte weder singen noch turnen. Ich wurde auch nie darnach gefragt. Das war eine schwere Last, die ich täglich allein zu tragen hatte. Zusätzlich: Ich brachte die für die Kantonsschule erforderlichen Begabungen auch nicht mit. Ich tat mir schwer mit Lesen und Schreiben. Das wurde von meinem Klassenlehrer, der Deutsch unterrichtete, bestritten und wir trugen diese Last gemeinsam. Schliesslich hatte ich nicht verstanden, dass ich aus einem andern Milieu stammte. Ich wusste nicht, dass ich entwurzelt, zu schwach und zu wenig mutig war, um mir selber einen Platz zu erschaffen. Diese Last hiess Einsamkeit. Der Kopf kannte sie nicht, meine Sprache kannte sie auch nicht, Alfi und Gott waren bei mir, und erst nach der Pensionierung hatte ich Zeit und lernte die Einsamkeit, meinen Mangel an Gesprächspartnern benennen. Meet-my-life begleitet mich auf diesem harten Weg. -- Trotz alle dem konnte ich 2019 noch sagen, die Formulierung „in der geliebten Kantonsschule“ war richtig, denn ich liebte jene Schule wie andere Menschen vielleicht ihr Elternhaus oder später ihr Auto mögen.
Wie soll es weiter gehen? Warum sollte mich eigentlich nicht jemand heiraten? neben dieser Frage stand der Ausspruch meiner Mutter: So eine wie dich nimmt niemand. Sollte sie recht haben? Wie sollte es weiter gehen? Das Thema Auslandsaufenthalt war abgearbeitet. Wie sollte es weiter gehen? Ich stellte mir diese Frage am Morgen vor dem Aufstehen und am Abend vor dem Einschlagen. Es wird weitergehen. -- Trotz meiner Schwierigkeiten entschloss ich mich zu einer Flucht nach vorn. Sollte ich es wagen, mich an die akademische Studienberatung zu wenden? Ja, ich sprach vor und bat um ein Gespräch. Sie schickten mich mit einem Buch weg, obwohl ich mehrmals um ein Gespräch ersuchte hatte. Ich nahm das Buch, las das Inhaltsverzeichnis und den Vorspann zu den einzelnen Kapiteln. Ich wusste, ich wollte Kunstgeschichte, eventuell Altgermanistik studieren, aber beides liess sich nicht mit meinem Ziel vereinbaren, das da war, viel Geld für einen Besuch bei Alfi in Afrika zu verdienen. Wie viel kostete ein Studium und wie standen überhaupt meine Erfolgschancen? Im Buch fand ich eine Tabelle, gemäss der ich eine potentielle Studienabbrecherin war: Weiblich, ältestes Kind der Familie, Zweitausbildung, kein Akademischer Hintergrund, Herkunft aus ländlicher Gegend, kantonale Maturität mit mässigen Noten. In der juristische Fakultät waren die Abschlussquote am höchsten und die Aussicht auf eine Anstellung am besten. Also entschloss ich mich, als potenzielle Studienabbrecherin für Jura, das Studium mit der höchsten Abschlussquote. Ich wollte mich erneut für ein Gespräch anmelden und man riet mir, das Buch gründlicher zu lesen. Lesen? Ich hatte da meine eigene Methode in Sachen „lesen“. Ich las, überlegte, schaute mich um, arbeitete für die Schule und stellte meine Fragen schriftlich zusammen. Ich war überrascht, denn meine Fragen, meine Probleme glichen den Fragen, welche die Eltern meiner Förderklassen-Schüler an mich stellten. Sie waren unsicher, voll guten Willens, enttäuscht und hofften auf Verständnis und Beratung. Sie schätzten die Gespräche mit mir. Meine Schüler, die Elterngespräche fürchten gelernt hatten, wünschten, dass ich ihre Eltern zu einem Besuch einlud. Manche Knaben brachten mir ein Blatt mit einer Telefonnummer und Zeitangaben, damit ich die Eltern leicht und schnell für eine Rückfrage erreichen konnte. Sie waren unsicher und fürchteten im Voraus, dass ich ihre Aussagen nicht glauben würde. Dem wollten sie entgegen wirken. Viele Anrufe machte ich einzig um dem Schüler und der Mutter eine Freude, einen kleinen Erfolg zu bereiten. Diese in den Augen meiner Kollegen übertriebene Fürsorglichkeit und Zeitverschwendung machte sich regelmässig mehrfach bezahlt. Zusätzlich gab sie mir u.a. viel Kraft und Mut, um an meiner Zukunft zu arbeiten. Niemand wusste, dass ich am Donnerstagabend zusätzlich eine Elternsprechstunde anbot, die rege benutzt wurde.
Wie ich für meine Auslandsaufenthalte Fahrkarten und Stadtpläne gekauft hatte, so bereitete ich mich nun frühzeitig konkret auf mein Jurastudium vor. Ich wusste, wo die Vorlesungsverzeichnisse aufgelegt wurden und kannte den Schaukasten, in dem sich Studienanfänger informieren konnten. Ich holte eine neues Testtatheft, und auf jeden kleinen Umweg folgte ein nächster. Ich konnte mit niemandem sprechen. Wollte ich wirklich Jura studieren? Nein, ich konnte nicht Jura studieren, denn ich hatte eine Matura ohne Latein, und an Hand des Buches der Studienberatung hatte ich ausgerechnet, dass meine Erfolgsaussichten bei 27% lagen. Es reizte mich, mit diesen 27% zu spielen. Warum sollte ich nicht zu den 27% Erfolgreichen gehören? Ich freute mich an meiner Unternehmungslust. Bereits bevor ich die Förderklasse übernommen hatte, immatrikulierte ich mich und begann sofort Latein zu „büffeln“.
2019 – Einschub: Ich tippte diesen Text am 17. September. Wünsche erfüllen sich oft ohne grosses Dazutun! Neben mir lag die Verlagsbeilage der NZZ am Sonntag vom 1. September 2019: 50 Jahre EPFL, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne – gestern, heute, morgen, Tage der offenen Türe 14. -15. September 2019 Campus Lausanne. Wie es Ihnen, meine Lesenden bekannt sein mag, spazierte ich in den 1960er Jahren immer wieder durch die ehrwürdigen Gebäude der ETH und der Universität Zürich, um die verschiedenen Anschlagsbretter und Aushängekasten anzuschauen. Daher wusste ich, dass 1969 in Lausanne eine zweite Eidgenössische Technische Hochschule gegründet wurde. Sicher, ich wollte hingehen und schauen, aber ich ging nie hin und vergass es. Jetzt 50 Jahre später bot sich wieder eine Gelegenheit. „Wir machen aus unseren Studierenden Bürger, die sich für das Wohl der Gesellschaft einsetzen“ lautete die Überschrift des Leitartikels des seit 2017 amtierenden Präsidenten, Martin Vetterli. Um 6:15 verliess ich das Haus und erreichte kurz nach 10 Uhr den Campus. Was dann? Ich hörte u.a. ein Podiumsgespräch zum Thema „künstliche Intelligenz“. Das tat mir gut. Ich verstehe weiterhin wenig, aber die Aussage,“hinter allem steht letztlich der Mensch“ nahm mir die Angst. -- In Fächern wie Sozial- und Geisteswissenschaften sollen sich die Studierenden Überlegungen zu den möglichen Auswirkungen ihrer Arbeit auf die Gesellschaft machen, stand in grossen Lettern auf einem Anschlagbrett. Weiter sah ich vieles, vieles, u.a. winzige Drohnen, die heruntersausten, und einen vierbeinigen Roboter, gross wie ein Hund, der sich erstaunlich gut bewegen konnte.
Und später -- traf in am Bahnhof Pauline. Pauline ist seit bald 40 Jahren mit einem Kongolesen verheiratet, der in den 1960er Jahren von einem Schweizer Ehepaar adoptiert wurde. Obwohl es aus verschiedensten Gründen zeitlich eng geworden war, hatte sie es geschafft, für mich, das heisst für den Verein Bauerndörfer im Kongo, in der Bibliothek de la Jeunesse Lausanne 22 Kilogramm ausgemusterte Bücher zu holen. Bei einem Glas Coca Cola gab sie ihrer Freude Ausdruck, wie gerne sie das für mich getan hatte und, das war mir noch nie passiert, sie dankte mir für meinen Dienst an ihrer Heimat. -- In völlig überfüllten Zügen, ich hörte kaum französisch oder deutsch, fuhr ich glücklich heim. Einschub Ende.
Wie soll es weitergehen? Ich wage die Frage oft nicht zu stellen. Was wartet auf mich? Ein kurzes Gebet und Gott schickt mir Ruhe und Zuversicht.

Tchang Kai-chek und Mao Tsé-toung, 30 Jahre nach der Wende,
Oktober 2019: 70 Jahre Volksrepublik China. Was für ein Ärger? Die lokale Zeitung und das Fernsehen verweigerten mir Nachhilfestunden in Sachen China. Es blieb mir die welsche Zeitung Le Courrier, deren eintreffen mich beharrlich ermahnt, etwas für meine Französisch Kenntnisse zu tun. Sie brachte auf Seite 8 ein grosse Brustbild des Präsidenten Xi Jinping, formell westlich gekleidet, mit einem Glas der Welt zuprostend und daneben zwei Spalten Text. Immerhin konnte ich die Namen von Tchang Kaï-chek und Mao Tsé-toung korrekt abschreiben. Was da genau war, das verstand ich nicht, meine französisch Kenntnisse reichten nicht, und mich im Internet schlau zu machen, dazu hatte ich keine Lust. Das überlasse ich gerne Ihnen meine Lesenden, wenn Sie es denn schaffen, mit Ihrer Leserei bis hierher zu kommen. Ich danke Ihnen für die Ehre, die Sie mir erweisen. Es sei die grösste Parade gewesen, die in einem kommunistisch Staat je durchgeführt werden sei, stand weiter im Le Courrier: 15'000 Soldaten, 160 Flugzeuge, 500 schwere Geschütze und, das wird nicht erwähnt, aber ich vermute es, viele Schaulustigen und eine unzählbare Masse von Sicherheitsleuten. Die Spannungen mit Hong Kong wurden am Rande kurz erwähnt. Seit Monaten füllen sich jene Strassen täglich mit Menschen, die sich bemühen, ruhig für die Wahrung ihrer Freiheit zu demonstrieren. All diese Menschen brauchen Nahrung und haben ein Recht, zu fliegen wie wir. Wo führt das hin?
Ich bin beeindruckt von China. Wir haben in der Primarschule darüber gesprochen. Ich erinnere mich an einen Satz, ein Phantasiebild, das ich mir machte, China könne leicht immer siegen, denn sie hätten mehr Soldaten als ihre Feind Munition. Während dem Studium habe ich mehrere Vorlesungen über China besucht und in den 1990er Jahren eine Ringvorlesen. Ich horche auf, wenn ich das Wort „China“ höre. Lange plante ich eine Fahrt mit der Transsibirischen Bahn, doch es blieb bei einer TV-Serie. Ich habe über japanisch-chinesischen Krieg gelesen, über China und Tibet, über die Chinesen in Afrika. Sie bauen laufend Atomkraftwerke, kaufen unsere Firmen auf und besuchen bei ihren Kurzreisen durch Europa auch die Schweiz.
Wie soll das weiter gehen?
November 2019: 30 Jahr nach der Wende, nach dem Mauerfall in Berlin? Werden sozialistische Rezepte wieder aufgewärmt? Haben wir genügend "Solarenergie" für die Bitcoins-Revolution?
Wie wird es weiter gehen? Jetzt am 11. November 2019, 11:45 schliesse ich Teil 3 und das Jahr 2019 ab. Ich werde nur noch da und dort ein wenig an den Texten herumzupfen. Am 6. Februar 2020 fliege ich nach Kongo Kinshasa, reise zum zwölften Mal nach Kikwit und hinaus in die Dörfer am Fluss Kwenge. Ich fühle mich in einer Sackgasse und tigere in einem Hamsterrad herum. Ich habe Angst. Was könnte ich besseres tun, als beten und wieder Ruhe und Zuversicht finden?
Wie sah 2019 deine Gegenwart aus?

Mache ich doch einen Rundumschlag: Unser Sohn und seine Frau sind bei der Arbeit. Meine Enkeltöcher, drei und fünf, sind merklich älter geworden. Voller Stolz sitzen sie am Tisch vor dem vollen Teller und teilen mir mit: "Wir warten, bis alle bedient sind und sitzen." Halstuch, Windjacke und Winterstiefel, selbständig bereiten sie sich später auf den Spaziergang in den Tierpark vor. Im nuh gehts los, sie springen und freuen sich, dass sie auf die Oma warten müssen. Sie raten mir, schneller zu gehen. Danke, dieser Rat ist angebracht. Schneller, schneller scheint das Moto der Zeit zu sein. Viele Berufstätige sind gestresst oder arbeitslos. Und ich? Ich bin schon elf Jahre pensionniert und werde immer langsamer. Achtung: Ich kann noch schnell, wenn ich ermahnt werde.
Es läutet. Ein Unterbruch beim Tippen. Ich eile die Treppen hinunter. Schnell, dem Rat der Enkeltöchter folgend. Der Kaminfeger, ich wundere mich. Er steht mit einem grossen Staubsauger und dem Werkzeugkoffer vor der Türe. Ich staune. Er meint, er habe sich mit einer Karte angemeldet. Er mache keinen Staub. Er kommt auf mich zu. Ich weiche zurück und schon stehen wir im Keller. Ich fühle mich geschoben. Im Heizungsraum hängt viel Wäsche zum Trocknen. Er mache keinen Staub, wiederholt er und fügt an, danke, dass er seinen Routine durchführen dürfe. Schon schraubt er den Brenner auf. Er öffne nachher das Fenster und läute beim Gehen. Er mache keinen Staub. Warum soll ich ihm glauben? Warum soll ich ihm nicht glauben? Kommt die Karte noch? Was nützt es, wenn sie noch kommt? Sie kam nicht mehr. Der heutige "Besuch" des Kaminfegers enthält viele kleine Veränderungen, zu denen ich ja-sagen will. Ich will mich auf die neue Zeit einstellen. Achtsamkeit kann ich mir als alte Frau leisten. Überrascht spüre ich jetzt, gegen Ende 2019 immer wieder, wie meine Fähigkeit und Bereitschaft zu achtsamem Umgang mit mir und meiner Umwelt grösser wird. Das freut mich. Ich staune auch, wir leicht es mir fällt, wie im vergangenen Januar geplant, den Tag mit ein paar Übungen zu beginnen: Entspannen und dehnen unter der Bettdecke, ein Vater-unser-lang auf einen Stuhl steigen auf-ab-auf-ab, in kikongo auf hundert zählend mich auf dem Teppich ausstrecken, drehen und wieder aufstehen, die Zeitung holen und auf den Sofa lesend verschnaufen. Meine Lesenden, das tut gut, versuchen Sie es einmal. Rufen Sie mich an, ich gebe Ihnen gerne Anleitung. Ihnen ein solches Angebot zu machen, daran hätte ich vor einem Jahr nicht zu denken gewagt. Das Alter, ein Aufbruch in ein neues Land?
Es war ein nasskalter November Sonntag. Ich überarbeitete eben diesen Text. Mein Mann sass vor seinem PS und rief: "Komm und höre. Ich habe eine Aufnahme der "Forelle" aus dem Jahr 1969 gefunden. Ich erinnere mich klar: Metha Zubin, Kontrabass, Itzhak Permann, Violine, Pinchas Zukermann, Viola, Jaqueline DuPre, Cello und Daniel Barenboim, Klavier." Ich, Papas Brummerli staunte. Wir hörten die Musik gemeinsam. Mein Mann war begeistert und ich sass dabei.
Ein grosser Lichtblick: "La parole à nous, les Congolais 2019" ist fertig, wir habe es geschafft. Ich erwarte am 30. November 50 Exemplare.
Am 30. November 2019 um 24.00 Uhr ist Redaktionsschluss für den Schweizer Autobiographie Award vom 3. Februar 2020. Ich habe mein Ziel erreicht und gleichzeitig bin ich erstaunt, wie meine Leben jetzt, ein Jahr nach dem 30. November 2018 ganz anders aussieht. Bedenke ich das, beginne ich Verständnis für meine wachsende Unsicherheit zu haben. Ich denke an den zitterneden Tiennievogel.
Welche Hypotheke der Vergangenheit beunruhigte Dich 2019?

2019 spüre ich, wie sich der Islam in meiner Umgebung ausbreitete. Ich sagte zu einer Frau mit Kopftuch: "Ah, du bist eine Mohamedanerin." Wir waren uns wohlgesinnt. Sie korrigierte mich: "Ich bin eine Muslima. Das andere Wort hören wir nicht gern."
2016 bewunderte ich auf der Fahrt von Kongo-Kinshasa nach Kikwit am Stadtrand eine grosse pärchtige Moschee. Niemand konnte mir zum "Wer und Wie" etwas sagen. 2019, wieder im Kongo zählte ich auf der Fahrt von Kinshasa nach Kikwit über vierzig kleine neue blaue Moscheen. Niemand interessierte sich, niemand konnte mir zum "Wer und Wie" etwas sagen. Eine Ordensfrau fragte leise, beunruhigt: "Boko Haram?" Sie schaute mich an und wechselte das Thema.
In unserer Stadt ist eine grosse Moschee im Bau. Sie soll vom Ausland finanziert werden. Für die Kinder soll in den Schulen muslimischer Religionsunterricht eingeführt werden. -- "Wir dürfen nicht über die grosse Welt sprechen. Vor meiner Flucht in die Schweiz gab es in meiner Heimatstadt keine Muslime. Jetzt sollen es viele sein. Auch in der Schweiz werde ich als Hindu immer häufiger angesprochen und eingeladen," mein Bekannter schüttelte den Kopf und schloss das Gespräch mit "nein, nein". Meine Lesenden, ich brauche nichts über den Islamischen Staat zu tippen. Er soll zerschlagen sein. Im Internet finden sie alles. Ich vermutete, die Strenggläubigen, die Rechtgläubigen organisieren sich neu, denn sie haben einen Auftrag und sind bereit dafür zu sterben. Ich sehe, der Islam breitet sich aus.
1979 war der Shah aus Persien vertrieben worden und unter Beifall grosser Teile der Bevölkerung rief Ayatollah Khomeini den Gottesstaat aus, eine islamische Republik schiitischer Prägung. Uns ist die Trennung von Staat und Kirche wichtig, und wir legen Wert auf die Glaubens- und Gewissensfreiheit (Art. 15 BV). 1973, nach der Ölkriese schwammen die saudische Königsfamilie und Oberschicht in Petro-Dollars. Diese mussten verprasst werden. Wo blieb die Religion? Wen wundert es, dass im November 1979 fanatische, militante Beduinen in die Grosse Moschee von Mekka eindrangen, die Sicherheitskräfte töten und die Pilger und die Geistlichen mit Waffengewalt unter ihre Kontolle brachten? Sie forderten die Abwendung vom Westen und die Rückkehr zu einem strengen, puristischen Islam. -- Seit dem Einmarsch der sowjetischen Armee in der afghanischen Hauptstadt Kabul im Dezember 1979 kamen Afghanistan und die ganze Region nicht mehr zur Ruhe. Man hört, ein militante Islam breite sich aus.
1979 zur Zeit des Kalten Krieges, war der Kommunismus der grosse Feind der USA. Seit dem Fall der Berliner Mauer 1989 sieht die Welt anders aus. Der Zweite Weltkriege liegt in der fernen Vergangenheit. Meine Enkeltöchter sind 2014 und 2016 geboren.
Wie sah 2019 deine Zukunft aus?

2020 möchte ich mich weiterhin an den Naturgesetzen orientieren und im Kontakt zu den Mitmenschen sorgsam und nachhaltig zu dieser Überzeugungen stehen. Meinungen, -- mögen sie mit noch so vielen Likes und Hinweisen auf Wissenschaftler hochgejubelt werden --, die den physikalischen Grundgesetzen wiedersprechen, möchte ich freundlich stehen lassen, wenn ich mit "glauben" und "meinen" keinen netten Umgang finde. Weiter bemühe ich mich vermehrt, den Grundsätzen meiner Grossmutter treu zu bleiben, und mich nicht von den Angeboten dieser Welt verführen und ersäufen zu lassen. Nichts sagend, zu allgemein, zu vage, ich höre Ihre Stimme. Schon gut, ich kann nicht immer bei Adam und Eva beginnen.
2020 hoffe ich, dass meine technischen Geräte, wie z.B. das Telefon funktionieren. Ich hoffe, dass wir zu einer vernünftigen Energiepolitik zurückfinden und Bewegungen wie Fridays for Future und Exition Rebellion verebben. Ich hoffe, dass in Hongkong, Chile, Bolivien, im Iran, in Algerien, im Sudan, in Syrien und an den vielen Orten, die in den Medien nicht erwähnt werden, die Menschen bald in Würde Ruhe finden und sich die Schere zwischen arm und reich nicht weiter öffnet.
Danke fürs Lesen. Tragen Sie sich Sorge.

Am 20. Oktober 2020 konnte ich mich nach mehreren Monaten Unterbruch nur mit Mühe einloggen, doch ich habe es geschafft. Danke Erich, denn nur wegen Deiner grosszügigen Spende an den Verein Bauerndörfer im Kongo habe ich mich entschlossen, weiter zu tippen, das heisst, schon geschriebenes zu überlesen und hinüber mach meet-mylife zu kopieren.
2020 war eine Herausforderung. Ich wollte über meine Studienjahre schreiben. Jeder Monatsanfang gab mir die Chance für einen Start. Erfolg mässig. Mitte November erklärte die Arbeit als fertig.
Am 12. Januar 2021 hatte ich "Onkel Toms Hütte" fertig gelesen. Dies ist ein Roman, in den 1850er Jahren ein Bestseller der den Kampf gegen die Sklaverein in den USA schildert. -- Der Himmel ist verhangen grau. Ob es schneien wird? -- Corona, was planst Du? Die Ausgangsbeschränkungen werden immer strenger. Ich nutze die Zeit um meine 2020 geschriebenen Texte nochmals zu überfliegen.
Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad

31.12.2019 Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad 31.12.2019
Vor Jahren hatte ich ein Karte bekommen mit dem Text: „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, meine Oma ist 'ne ganz moderne Frau“. Ich mochte den Text und hängte ihn für eine Weile an unserer Kühlschranktüre. Er half mir über kleine Hindernisse hinweg. Kam ich beispielsweise beim Erledigen der Alltagsarbeiten ins Stocken, und tauchte dann vor meinem inneren Auge die Oma auf dem Motorrad auf, richtete ich mich auf, gab Vollgas und alle Hindernisse wurden überwunden.
Kaum zu glauben, was nun zwischen Weihnachten und Silvester 2019 geschah. Ich hatte Mühe zu verstehen, dass die „hehren Ziele“ der Klima-Jugend jegliches Verhalten zu rechtfertigen scheinen. Doch ich schüttelte mich und dachte, die leben weit weg von mir, in virtuellen Welten. Die sollten sich häufiger bewegen. Seit vergangenem Frühjahr gehen sie nun freitags auf die Strassen und schwänzen die Schule, um die Welt zu retten. Mein Kopf schüttelte sich und die Lippen wurden zusammengepresst. Noch waren sie weit weg. Doch zwischen Weihnachten und Silvester 2019 kamen sie mir zu nah. Ich wollte nicht glauben, wie mir geschah. Es wurde mir erzählt ... . Lesen Sie selber, ich habe die Geschehnisse für Sie und für mich als Gedächtnisstütze für meine sehr alten Tage eingetippt: Eine Gruppe von dreissig Mädchen des Kinderchors des Westdeutschen Rundfunks soll in dessen Auftrag das Lied von der Oma neu einstudiert haben. Der Text sei aktualisiert worden und laute nun: „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Das sind tausend Liter Super jeden Monat. Meine Oma ist 'ne alte Umweltsau!“ Oder als Variante „meine Oma ist 'ne alte Nazisau!“ Beide Texte sollen laut einem begeisterten Blogger vom Verfassungsschutz toleriert werden. Ich bin empört. Wohin führt das? Pikant zusätzlich: Die Mädchen seien alle von der Organisation „Plant for the Planet“ zu sogenannten „Botschaftern für Klimagerechtigkeit“ ausgebildet worden – sie waren anscheinend davon überzeugt, für eine gute Sache zu singen. Wie passt dann aber die Südkorea-Tournee des Chores zu dem martialischen Aufruf, das „Klima zu schonen“?
21.10.2020 die "hehren Ziele" sind noch hehrer geworden! Da passt die Geschichte von der Orange aus dem 19-Jahrundert gut dazu. Mir jedenfalls gefällt sie.
Das Studium

Die Apfelsine das Waisenknaben

Zwischen Weihnachten und Silvester 2019 bin ich in Kirchenblatt Beringen auf diese Geschichte gestossen. Ich habe sie flüchtig überflogen und gestaunt. Ich erzählte sie meinem Mann, er hielt sie für realistisch. Für mich bleibt sie ein Wunder und ich will sie nicht vergessen und weitergeben.
Erst beim Abtippen las ich, dass sie von Charles Dickens geschrieben worden war. Der gute Dickens lebte 1812 – 1870. Wie sah seine Welt aus? Schnell in die Küche, mein Mann wusste, dass Bertha Benz 1888 per Auto von Manheim nach Pforzheim gefahren war. Die ersten Eisenbahnen gab es nach den 1830 Jahren. Der elektrische Strom war erfunden. Allerlei Revolutionen und 1848 die Gründung der Schweiz.
Nun die bittersüsse Erzählung von Dickens: Schon als kleiner Junge hatte ich meine Eltern verloren und kam in ein Waisenhaus in der Nähe von London. Es war mehr ein Gefängnis. Wir mussten 14 Stunden täglich arbeiten – im Garten, in der Küche, im Stall, auf dem Felde. Kein Tag brachte eine Abwechslung, und im ganzen Jahr gab es für uns nur einen einzigen Ruhetag. Das was der Weihnachtstag. Dann bekam jeder Junge eine Apfelsine zum Christfest. Das war alles, keine Süssigkeit, kein Spielzeug. Aber auch diese eine Apfelsine bekam nur derjenige, der sich im Laufe des Jahres nichts hatte zu schulden kommen lassen und immer folgsam war. Die Apfelsine an Weihnachten verkörperte die Sehnsucht eines ganzen Jahres.
So war wieder einmal das Christfest herangekommen. Aber es bedeutete für mein Knabenherz fast das Ende der Welt. Während die anderen Jungen am Waisenvater vorbei schritten und jeder seine Apfelsine in Empfang nahm, musste ich in einer Zimmerecke stehen und zusehen. Das war die Strafe dafür, dass ich eines Tages im Sommer hatte aus dem Waisenhaus weglaufen wollen. Als die Geschenkverteilung vorüber war, durften die anderen Knaben im Hofe spielen. Ich aber musste in den Schlafraum gehen und dort den ganzen Tag über im Bett liegen bleiben. Ich war tieftraurig und beschämt. Ich weinte und wollte nicht länger leben.
Nach einer Weile hörte ich Schritte im Zimmer. Eine Hand zog die Bettdecke weg, unter der ich mich verkrochen hatte. Ich blickte auf. Ein kleiner Junge namens William stand vor meinem Bett, hatte eine Apfelsine in der rechten Hand und hielt sie mir entgegen. Ich wusste nicht, wie mir geschah. Wo sollte eine überzählige Apfelsine hergekommen sein? Ich sah abwechselnd auf William und auf die Frucht und fühlte dumpf in mir, dass es mit der Apfelsine eine besondere Bewandtnis haben müsse. Auf einmal kam mir zu Bewusstsein, dass die Apfelsine bereits geschält war, und als ich näher hinblickte, wurde mir alles klar, und Tränen kamen in meine Augen. Als ich die Hand ausstreckte, um die Frucht entgegenzunehmen, da wusste ich, dass ich fest zupacken musste, damit sie nicht auseinander fiel.
Was war geschehen? Zehn Knaben hatten sich im Hof zusammengetan und beschlossen, dass auch ich zu Weihnachten meine Apfelsine haben müsse. So hatte jeder die seine geschält und eine Scheibe abgetrennt, und die zehn abgetrennten Scheiben hatten sie sorgfältig zu einer neuen, schönen runden Apfelsine zusammengesetzt. Diese Apfelsine was das schönste Weihnachtsgeschenk in meinem Leben. Sie lehrte mich, wie trostvoll echte Kameradschaft sein kann.
Danke Mühleberg! Danke Philippsburg!

Danke Mühleberg! Danke Philippsburg!
Danke Kernkraftwerk Mühleberg, danke, danke. 1972 hast du den Betrieb aufgenommen und vor Weihnachten 2019 haben sie dich ausgeschaltet. Entschuldigung, ich interessiere mich wenig für technische Daten, aber ich weiss, dass du Tag und Nacht, Sommer und Winter im Einsatz gestanden bist. Richtig, du musstest sorgfältig gewartet werden. Das verlangen ein Strassentunnel und die technischen Anlagen eines Spital auch. Dann wurdest du ausgeschaltet und die Medien haben mit Vergnügen darüber berichtet. Du hast 380 Megawatt geliefert. Nun ist damit vorbei. Wer ersetzt deinen Strom? Ich habe gehört, wir hätten genügend alternative Energie und wir könnten leicht Strom aus Deutschland oder Frankreich importieren. Aus deutschen Kohlekraftwerken? Aus französischen Kernkraftwerken? Richtig, im Sommer haben wir an schönen Tagen soviel Solar- und Windstrom, dass die altgedienten Wasserkraftwerke herunter gefahren werden können. Wie steht es im Winter bei Hochnebel? Es heisst immer, wir hätten genügend Strom, wir könnten sogar exportieren.
Ersetzen wir die 380 Megawatt von Mühleberg mit Windrädern. Wie gross müssen die Speicher sein, damit die reichlichen Mengen von Sommerstrom in den Wintermonaten zur Verfügung stehen? Wie viel kosten diese Speicher? Ah, ich höre, die Technik mache grosse Fortschritte in Sachen Speicher und die Preise würden sinken. Die Schweiz hat zur Zeit 37 Grosswindräder auf den Jurahöhen, unseren am bestgeeigneten Standorten. Wie viele Windräder brauchen wir, um die 380 Megawatt von Mühleberg zu ersetzten? Ich höre, das sein kein Problem, man müsse nur endlich die Subventionen anpassen. Zunächst braucht es riesige Speicher um den im Sommer anfallenden Strom für die langen, dunkeln, kalten Winternächte aufzuheben. Ich höre, das sei kein Problem. Meine Lesenden, meine Zweifel und Bedenken blockieren mich. -- Ich habe gehört, dass die 380 Megawatt von Mühleberg mit 700 Grosswindräder oder 2.7 km2 Solaranlagen ersetzt werden können. 2'700'000 m2 entspricht 266 Fussballfeldern (80m X 120 m ~ 10'000m2 = 10 Aren). Es wird gefordert, die beiden alten, kleinen Kernkraftwerke von Betznau auch umgehend auszuschalten. Das sei kein Problem.
Einschub: Philippsburg in Deutschland mit 1'400 Megawatt Leistung wurde am 29. Dezember 2019 ebenfalls ausgeschaltet. Ein grosses Fest! Es kann ersetzt werden mit 2'600 Grosswindrädern oder Solaranlagen, die ~ 980 Fussballfeldern entsprechen. In der Übergangszeit könne Strom aus Kernkraftwerken in Frankreich oder von Kohlekraftwerken in Polen importiert werden. Wo bleibt das Einsparen von CO2, zur Verbesserung der Energiebilanz Deutschlands. Wird das Problem einfach exportiert?
Wir kamen und gingen auch

Hausaufgabe auf den 20. Dezember 2019
Fritz lachend: „Wir kamen und gingen auch.“
Wir sassen in seiner Attikawohnung oben am Zürichberg mit Aussicht auf die Stadt, den See und den Uetliberg. Keine Fernsicht an jenem Tag, Hochnebel. Ich erzählte Fritz von unserer Hausaufgabe: „Wir sollten während einer Stunde eine Menschenmenge auf einen Bahnhof, in einem Einkaufszentrum oder einem Restaurant beobachten und das Geschehen protokollieren. Da ich mich nicht wohl fühlte, sah ich vom geplanten Besuch im Kunsthaus ab und ging in den Lichthof. Wie eine junge Studentin setzte ich mich, gegen die Wand gelehnt, auf den Boden und zog mein Sandwich aus der Tasche. Ich hatte es in gewohnter Weise am Abend zuvor vorbereitet. Es war 12:15 und es blieb mir eine Stunde. Eine Menschenmenge, die Studentenmenge hatte alle Tische besetzt. Es war ein Kommen und Gehen,“ Fritz hörte zu. „Wir sollten zunächst ein Beobachtungsprotokoll schreiben und in einem zweiten Arbeitsgang eine Besonderheit herausgreifen und beschreiben.“
Ich schwieg, wir schwiegen beide und nach einer kurzen Pause meinte Fritz: „Ja, sie kommen und gehen, wir kamen und gingen auch.“ Was sollte ich sagen? Fritz wiederholte: „Wir kamen und gingen auch.“ und nochmals: „Wir kamen und gingen auch.“ Wie konnte er das so gelassen sagen? Mich hatte die simple Szene im Lichthof leicht wehmütig gestimmt, obwohl ich doch noch problemlos durch den Lichthof gehen konnte. Lachend wiederholte Fritz erneut: „Wir kamen und gingen auch.“ Was konnte ich sagen? Auch später fragte ich mich, wie hätte ich das Gespräch nach seinen freundlichen Feststellungen weiterführen können. Fritz schien meine nicht ausgesprochene Frage zu verstehen, und er wollte wissen: „Was ist anders als damals?“ und er antwortete gleich selbst: „Vermutlich weniger Gedränge, kurz nach unserer Zeit wurde die grosse neue Mensa eröffnet und wenig später eine zweite. Wie mein Sohn mir erzählt hat, war auch der Lichthof auf Selbstbedienung umgestellt worden. Kann noch mit Geld oder nur noch mit Karte bezahlt werden? Hast du etwas gekauft?“ Ich nickte und er fuhr weiter: „Dann ist der bargeldlose Betrieb noch nicht vollständig eingeführt. Ich habe neben der Karte auch noch Bargeld. Sag, was ist anders als damals, als wir kamen und gingen?“
Ich nahm mein Spiralheft aus der Tasche und riss die Seiten mit dem Protokoll heraus. Das unterstrichene Wort „Christbaum“ kam mir zu Hilfe. „Sie knipsten Selfies mit dem Christbaum als Hintergrund und liessen die Geräte mit den Aufnahmen die Runde machen. Sie waren offensichtlich nicht zufrieden, denn sie fotografierten sich dann gegenseitig und in Gruppen mit ihren Handies. Wer von den Beobachteten gesagt hatte, «so ist's nun gut, ich schicke es meiner Mutter,» sah ich nicht. Ich hörte nur mehrfach, das mache ich auch, und jedes Gruppenmitglied fuhr konzentriert mit den Fingern über sein Gerät. Ich habe es auch der Grossmutter geschickt, sie muss üben, sonst schafft sie es nicht mehr, ihr neues Smartphone zu bedienen. Ich lachte: „Wir haben noch mit Schreibmaschinen geschrieben, Arbeiten konnten selbst in schöner Handschrift abgeben werden.“ Die Studentin, die neben mir auf dem Boden sass, füllte mit Hilfe ihres Smartphones in ihrem Notebook eine Tabelle aus. Zwei Studenten hockten zu ihr und diktierten ihr weitere Zahlen aus ihren Smartphones. „Das sollte nun genügen! Du kannst es als Gruppenarbeit hochstellen“, beschlossen die beiden Burschen und standen auf. Das Mädchen schloss das Notebook, schob es in seine Tasche, stand auf, schüttelte sich und das Trio verliess mich. Ich hörte noch, wie das Mädchen einen Salatteller für die zusätzlich geleisteten Dienste einforderte. Sie lachten und schienen sichtlich froh, dass sie ihre Pflicht getan hatten. Fritz griff das Wort „Mädchen“ auf: „Es gibt viel mehr Studentinnen als früher, nicht wahr?“ Seine Vermutung stimmte: „Junge Frauen in engen Hosen und Turnschuhen mit wirren langen offenen oder streng zusammen gebundenen Haaren. Manche in kurzen Kleidchen, für meinen Geschmack nicht alle hübsch. Doch die Frauen waren in der Überzahl. – Pause – Später habe ich einen Rundgang gemacht. Auch im Lichthof gab es ein breites, nach den eigenen Vorlieben zusammenstellbares Selbstbedienungsangebot. Ich meinte, es sollte Stosszeit sein - ich hatte meine Beobachtungen zwischen 12:15 und 13:15 gemacht – doch, wo war das erwartete Gedränge? Erstaunlich viel Einweggeschirr und riesige Teller mit mir klein scheinenden Portionen. Besteck aus Metall oder Plastik. Auf allen Tabletts zwischen Getränkebechern und dem Essen elektronische Geräte. Ich hörte: „Hilfe, wo gibt es eine Abstellfläche? Die lang erwartete Meldung ist eingetroffen.“ - Pause - Fritz erklärte: „Ich kontrolliere die Mails einmal täglich.“ Ja, er konnte mit den Bewegungen des Kinns das Laptop bedienen und die Tageszeitungen lesen. Er kam und ging nicht mehr. Die Spitexleute hoben ihn jeden Morgen zu zweit in den Rollstuhl. Und zwischen 21 und 22 Uhr kam erneut jemand vorbei und half seiner Frau, ihn wieder ins Bett zu legen. Ich wollte den Zug 17:05 erreichen: „Schön, dass du immer noch kommst und gehst. Beeile dich, und trag dir Sorge.“ Ich packte seinen schlaff auf der Schiene liegenden Arm und verschwand im Lift.
Die Krise wird überschätzt

Die «Krise» wird überschätzt. Wir haben allen Grund für Zuversicht.
So SN-Chefredaktor Robin Blanck in seinem Leitartikel zum Jahreswechsel (SN, 31.12.2019)
Zitatanfang“ Die «Krise» ist überall: Das gilt für das zu Ende gehende Jahr in besonderem Masse, inzwischen leben wir in der Dauerkrise: Neben der omnipräsenten «Klimakrise» trugen weitere Ereignisse zur öffentliche Wahrnehmung einer Ausnahmesituation bei: Während die USA unter Donald Trump weitere Schritte weg von ihrer Rolle als Weltpolizist unternommen haben, diagnostiziert der französische Präsidenten den «Hirntod» der Nato. Aber nicht nur das: Die Türkei droht offen mit der Fortsetzung der etwas in den Hintergrund getretenen «Flüchtlingskrise» und lehnt sich trotz Nato-Mitgliedschaft bedenklich an Russland an, das seinerseits mit neuer Grossmachtspolitik und Militäreinsätzen im Nahen Osten auftritt. Auf wirtschaftlicher Ebene schwelen Handelskonflikte und mischen sich mit den ersten Anzeichen einer sich abkühlenden Weltwirtschaft. Bei Wahlen in europäischen Ländern erhalten Polparteien Auftrieb, und die Volksparteien, die über Jahrzehnte für Stabilität standen, büssen Macht ein. Das diktatorisch geführte China strebt an die Weltspitze und braucht dabei keine Rücksicht auf demokratische Prozesse zu nehmen. Die mit Kraft voranschreitende Globalisierung hat mit der Digitalisierung ein druckvolles Triebwerk erhalten, bringt Geschäftsmodelle ins Wanken und gefährdet Arbeitsplätze. «Krise» so weit das Auge reicht.
Nun die gute Nachricht: Mit der Welt geht es nicht bergab, im Gegenteil. Nur droht das in der Aufregung aus den Augen verloren zu gehen.
Das ist aber nicht neu: Das gehörte über grosse Teile der modernen Menschheitsgeschichte zum Courant normal, und seit das «Ende der Geschichte» mit dem Fall der Berliner Mauer nicht eingetreten ist, dürfte klar sein, dass Veränderung uns als Konstante weiterhin begleiten wird.
Wir sollten aber nicht, wie dies derzeit auf breiter Front zu beobachten ist, in den Chor der Weltuntergangspropheten einstimmen und in übertriebenem Aktionismus alte Sicherheiten und Werte über Bord werfen.
Gerade der Westen hat in seiner langen Geschichte zahlreiche Krisen – Kriege, politische Auseinandersetzungen, Katastrophen und Rückschläge – überwunden und bewiesen, dass er mit seinen über Jahrhunderte entwickelten Werten die Erde zu einem lebenswerteren Ort machen kann. Nichts vermag das klarer zu belegen als ein Blick zurück.
Aufklärung, Freiheit und Demokratie als Fundament
Bereits im christlichen Monotheismus ist die Trennung von religiöser und weltlicher Macht angelegt, welche den Weg hin zur späteren Gewaltenteilung ebnete. So bildete die Religion selbst die Grundlage für Säkularisierung und war entscheidend für das Entstehen einer pluralistischen Gesellschaft und einer freiheitlichen Ordnung. Dennoch wirkt die Religion nach: Auch die erst viel später postulierte «Gleichheit aller Menschen» vor dem Gesetz wäre ohne die biblische Gleichheit aller Menschen vor Gott kaum denkbar geworden.
In der Aufklärung wurde schliesslich die Vernunft zum Primat erhoben und der Wissenschaft der Vorzug gegeben vor Aberglaube und Dogmatismus – eine zentrale Weichenstellung.
Dennoch hat das Konzept einer freiheitlichen, sozialen, offenen und aufgeklärten Gesellschaft überdauert und die Welt wie kein anderes geprägt.
Der Westen ist auf diesem Weg der Vernunft vorangeschritten, nicht gradlinig, sondern mit Pausen, Umwegen zuweilen. Dennoch hat das Konzept einer freiheitlichen, sozialen, offenen und aufgeklärten Gesellschaft überdauert und die Welt wie kein anderes geprägt. Das Ergebnis ist eine imposante Verbesserung der menschlichen Existenz: Von der Erklärung der Menschenrechte über die Erfindung des Penicilins bis hin zu demokratischer Mitbestimmung reicht die Liste der Erfolge, die unmittelbar oder mittelbar auf dem westlichen Fundament stehen.
Ergänzt werden kann diese kurze Reihe mit ausgewählten Beispielen, die der schwedische Arzt und Autor Hans Rosling 2018 in Buchform zusammengetragen und publiziert hat: Lag die Kindersterblichkeit während des 19. Jahrhunderts bei 44 Prozent, so ist sie im 20. Jahrhundert massiv zurückgegangen, sodass heute weltweit vier Prozent der Kinder vor dem 5. Lebensjahr sterben – noch immer zu viele, aber die Verbesserung ist gewaltig. Die Zahl der Menschen, die an Unterernährung leiden, konnte seit den 1970er-Jahren von 28 Prozent auf heute rund elf reduziert werden. Katastrophen oder Krankheiten fordern heute – Technologie sei Dank – ungleich weniger Menschenleben als noch vor 100 Jahren, gleichzeitig hat die Alphabetisierung der erwachsenen Weltbevölkerung sich in den letzten 200 Jahren von zehn auf über 86 Prozent erhöht, allein in den letzten fünf Jahrzehnten wurde die Lebensqualität für Hunderte von Millionen Menschen deutlich angehoben.
Während die wissenschaftlich-technologische Entwicklung also über Jahrhunderte ihre Wirksamkeit in der Praxis bewiesen hat, wird ihr Wert in diesen Tagen wieder vermehrt infrage gestellt: Die Wahrnehmung der «Krise» wird sowohl von konservativer, als neuerdings auch von eher progressiver Seite als Folge des Fortschritts eingestuft – gerade auch, weil die Globalisierung durch technologische Entwicklungen vorangetrieben wird. Diese Skepsis – es sei hier die Angst vor 5G, die Ablehnung von Impfungen, der Widerstand gegen Freihandel oder der Aufschwung der Naturmedizin genannt – macht sich in vielen Bereichen bemerkbar, sie schwingt auch in der Klimadebatte massgeblich mit, deren Forderungen nicht selten mit einem «Systemwechsel» verbunden werden. Technologie ist gerade in Fragen des Umweltschutzes aber nicht der Feind, sondern die Lösung und das demokratische System des Ausgleichs die richtige politische Antwort.
Auch im Hinblick auf die aktuellen politischen Veränderungen haben die westlichen Werte ihre Gültigkeit nicht verloren: Die Verwerfungen zwischen Europa und den USA, welche durch die Präsidentschaft von Trump entstanden sind, stellen die transatlantischen Verbindungen nicht grundsätzlich in Frage – wie könnte diese Episode das auch: Die Verfassung der noch jungen Vereinigten Staaten war Vorbild für die Revolutionen und den Aufbruch auf dem alten Kontinent und prägend für die Ausgestaltung der Bürgerrechte. Dieses historische Band aus gemeinsamen Werten wird zwar strapaziert, aber es wird Trump überdauern. Und dass über die Auslegung der gemeinsamen Werte diskutiert wird, ist üblich und nicht schädlich, gleichzeitig dürfte klar sein, dass die Nato ein unverzichtbares Sicherheitsnetz darstellt, auf das weder dies- noch jenseits des Atlantiks verzichten werden kann.
Unter Experten als ausgemacht gilt, dass sich mit den Ambitionen Chinas eine neue globale Bipolarität abzeichnet. Wir sollten uns von den Wachstumszahlen nicht blenden lassen: Regime, welche ihre Bevölkerung unterdrücken, überwachen und in ihrer Freiheit massiv einschränken, gab es viele; sie sind aber kein Modell für die Zukunft – und scheitern früher oder später.
Kein Grund für Krise, aber für Zuversicht
Fazit: Die grösste Aussicht auf Glück und Prosperität bieten nach wie vor die offenen, westlichen Demokratien, die sich durch Mitbestimmung und die Fähigkeit zu Veränderungen auszeichnen.Es sind die bewährten westlichen Werte, die wir als Massstab für die humane Gestaltung der Globalisierung anlegen und die wir auch in krisenhaft empfundenen Zeiten verteidigen müssen.
Die «Krise» wird überschätzt. Wir haben allen Grund für Zuversicht.“ Zitat Ende.
Die Zahnreinigung

Mittwoch 21. Oktober 2020. Kein Text, also Zeit zum Träumen von einer Lebensgeschichte, welche anhand der Erfahrungen mit "Zähnen" erzählt wird.
Wie verschafft man sich einen Überblick? Wie kann ich mein Erleben weiter geben? Ein Versuch

Notizen zur zwölften Reise (Abflug in Zürich 06.02.20, 07:35, Rückkehr nach Zürich 10.03.20, 07:55 statt 09:55), geschrieben 20.03.20
Eine Reise, wie jede vorhergehende. Ich brach geschwächt auf. Meine brüchigen und abgenützten Zähne verlangten Ende Januar eine operative Zahn- und Kieferkorrektur: Zwei Stunden Vorbereitung, zwei Operationen von je vier Stunden und zwei Stunden Nachbereitung. Innerlich hatte ich die Reise verschoben und flog dann trotzdem. Rückblickend kann ich sagen, es war richtig, auch wenn ich heute, zehn Tage später, noch ausgelaugt zuhause herumhänge. Ja, wegen dem Coronavirus, nein dank dem Coronavirus fühle ich mich zu keinen Aktivitäten verpflichtet und habe Zeit, mich auszuruhen.
Wir sind mit dem Lastschiff hinaus in die Dörfer gereist und sind wie immer von Dorf zu Dorf marschiert. Davon gibt es nichts neues zu berichten. Ungewöhnlich heftige Regengüssen unterbrachen die grosse Hitze immer wieder. Trotz meiner Schwäche habe ich es geschafft, alle Strapazen zu meistern, mich immer wieder auszuruhen und meine «kleinen» Ziele zu erreichen. Dann gab es Überraschungen: – (1) gemeinsam mit den verschiedenen Partnern haben ich es geschafft, dass unsere Ausgaben schriftlich festgehalten werden konnten. Die Dorfbewohner schrieben mir ihre Ausgaben auf. Mein Notizheft bildet Teil der Reiseabrechnung. – (2) Ich traf Innocent und Moïse, zwei Männer der ersten Stunde wieder. Ich lernte Innocent, den Chauffeur und Eigentümer des Landrovers kennen - er hatte mich im Januar 2009 erstmals mit Romain Ngoma und dessen Frau von Kikwit nach Bumba gebracht. 2020 dankte er mir immer wieder und führte Makabus und mein Gepäck gratis nach Bumba. Er wollte damit einen kleinen Beitrag an die von mir gemachte Arbeit leisten und freute sich, dass ich das akzeptierte. Vermutlich sehen nur er und ich, wie sehr sich Bumba seit meinem ersten Besuch entwickelt hat. Ich wage zu sagen, dass niemand so sehr profitiert hat wie Innocent. Für Moïse gilt das Gegenteil. Er wurde von M. Ngoma ausgenützt und ich konnte dem keinen Einhalt gebieten. Ich traf ihn auch immer wieder, aber eine kleine Wiedergutmachung gelang mir nie, auch diesmal nicht. – (3) Gemäss Deogratias Niyonkuru, POUR LA DIGNITÉ PAYSANNE, éditions GRIP, 2018 braucht es mindestens zehn bis zwölf Jahre bis ein wirklicher Kontakt zur ländlichen Bevölkerung möglich ist. Ich kann diese Erfahrung in dem Sinne bestätigen, dass ich erst jetzt langsam zu erahnen glaube, wie fremd wir uns sind. – (4) Im Sommer 2015 verteilten Ndungi Masuta und Makabu Mankenda das erste FICHE technique, in dem das Pflanzen von jungen Bäumen beschrieben wird. 2017 folgte das zweite FICHE technique, indem die Pflege der Jungpflanzen beschrieben wird. Heute am 20. März 2020 habe ich die Blätter selber erneut gelesen und gestaunt, wie sorgfältig wir die Arbeit beschrieben haben, und ich muss mir trotzdem eingestehen, dass die Dorfbewohner die Anweisungen der beiden Blätter nicht befolgen. Erst langsam beginnen sie zu begreifen, dass Bäume nicht mehr von selbst wachsen und dass Ziegen, Schweine oder Schafe sie abfressen. Erst langsam beginne ich zu verstehen, dass Menschen, die kaum lesen können und deren Muttersprache kikong ist, unsere beiden Pflanzanleitungen (FICHE technique un et deux) nicht verstehen. Doch ein Anfang ist gemacht: Etwa 120 Leute haben für ihre Gruppe von 9 Pflanzen eine Belohnung, den Trostpreis von 20 Dollar erhalten. Das ist gut, doch das sollen nächstes Jahr noch mehr werden. Der erste Preis wartet noch.
Aufforstung ist das grosse Thema. Natürlich, die grossen Organisationen setzen sich seit Jahren dafür ein, sie fahren in Autos vor, bringen viel Geld und ziehen sich nachher wieder zurück. Doch wo bleiben ihre Bäume? Ich sehe nur, dass weiter abgeholzt wird. Das beunruhigt mich. Die Bäume müssen den Dorfbewohnern gehören, damit sie Sorge tragen zu ihnen.
Wir haben etwa 200 Broschüren «La parole à nous les Congolais 2019» gedruckt und «für einen symbolischen Preis» verkauft. Unsere Kosten: Druckerei 5'000$, Autoren und Layout 3'000$. Alle sind begeistert. Für mich überraschend und zu meiner Freude, wollen sie eine Broschüre 2020 schreiben.
Was sollte ein angehende Lehrerin als Abschlussarbeit schreiben, wenn nicht ein Märchen?

Die Geschichte vom Hasen, welcher der Sonne begegnen wollte
von Anne Masengu Katana, Kinshasa RDC
übersetzt von Maja Brenner, Schaffhausen CH
Einschub: Wer in der Schule „Les Gazelles“ in Kinshasa eine Ausbildung zur Lehrkraft macht, hat ein Kinderbuch zu schreiben und zu illustrieren. Dies ist ein Beispiel. Zu jedem der sieben Textteile gibt es eine Zeichnung. Bist Du, der gerade jetzt liest, die Person, die mir helfen kann die Bilder hochzustellen? Melde Dich. Einschub Ende.
1) An einem schönen Tag, als der kleine Hase auf die Wiese vor den Wald hüpfte, überraschte ihn das helle Licht der Sonne. Er schaute hinauf und sah die Sonne.
Oh, wie bist du schön, ich muss die kennen lernen. Sie muss meine Freundin werden. Vielleicht verrät sie mir das Geheimnis ihrer Schönheit und und ihrer Ausstrahlung.
2) Unser kleiner Hase blieb den ganzen Tag auf der Wiese und bewunderte die Sonne.
Aber als es Abend wurde, verschwand die Sonne und machte Platz für etwas weniger strahlendes, für den Mond. Der kleine Hase wartete lange, aber die Sonne war weg. Müde fing er an zu weinen.
3) Am nächsten Tag, hatte unser kleiner Hase eine grosse Freude, denn die Sonne schien wieder. Er wollte immer bei ihr bleiben. Er wollte sie besuchen. « Ich muss jemanden finden, der mir den Weg zeigt,» sagte er.
Zunächst begegnete er dem Igel und fragte: «Könntest du mir bitte den Weg zur Sonne zeigen?» Der Igel antwortete: «Was willst du bei der Sonne machen? Die Sonne wohnt sehr weit weg. Ich weiss nicht, wie man zu ihr kommt. Du musst jemand andern fragen.»
4) Eine Weile später, begegnete der kleine Hase einem Hirsch und stellte ihm die gleiche Frage. Als Antwort sagte der Hirsch: «Ich kann dir nicht helfen. Suche den Giraffen. Wenn du auf den Giraffen kletterst, kommst du zur Sonne.» Voll Freude antwortete der kleine Hase: «Danke vielmals für deine Hilfe. Ich werde sicher eine Giraffe finden.»
5) Nach mehreren Stunden fand der kleine Hase die Giraffe: «Guten Tag mein lieber Freund. Jetzt nach zwei Stunden habe ich dich gefunden.» – Warum hast du mich so sehr gesucht? Was kann ich für dich Tun? – Gut. Ich möchte der Sonne begegnen. Darum dachte ich, ich könnte auf dich hinauf klettern. – Es tut mir sehr leid, das nützt nichts. Ich weiss, dass mein Hals sehr lange ist, aber er reicht nicht bis zur Sonne. Suche einen Adler. Mit ihm kannst du bis zur Sonne fliegen. Guten Erfolg.
6) Der kleine Hase fand einen Adler und stellte ihm seine Frage. Der Adler war bereit ihm zu helfen. Der kleine Hase kletterte auf den Rücken des Adlers und sie flogen davon.
7) Es war dunkel, als der kleine Hase im Himmel ankam. Welche Enttäuschung, er fand nur den Mond und die Sterne. Er fragte den Mond: «Könntest du mir sagen, wo die Sonne ist. Ich bin hier, um sie zu treffen.» Der Mond lachte: »Mein guter kleiner Hase, das ist unmöglich. Du kannst nicht zur Sonne gehen. Ihr Licht ist zu stark. Sie macht dich zu Staub. Darum erscheine ich erst am Himmel, wenn sie schon schläft. Das ist unmöglich. Ich kann dir nur raten, gehe heim. – Folge seien Rat, riefen alle Stern, gehe heim, geh heim.
Enttäuscht ging unser kleiner Hase wieder heim in den Wald ohne der Sonne begegnet zu sein. Aber jeden Tag verliess er den Wald und begrüsste seine beste Freundin, die Sonne.
Ob es dieses Mal klappt? Gelingt es mir den Lebenslauf von Innocent zu übertragen?

Überzeugung und persönliche Leistung
(der Lebenslauf von Innocent Mboma)
Originaltext in Französisch, von Innocent Mboma, Kikwit, 28. Februar 2020 Übersetzung von Maja Brenner, 15. Mai 2020. Einschub: 21. Oktober 2020. Ich denke immer wieder, die Menschen im Kongo sind anderes, und es braucht Generationen, bis sie die Last der Vergangenheit nicht mehr drückt. Das spüre ich selbst bei Innocent, den ich immerhin ein Stück weit verstehen kann. Gebe mir Gott Ruhe und Zuversicht, dass ich wage meine Arbeit fortzusetzen. Gebe mir Gott auch genügend Zuwendungen, denn im Kongo ist alles sehr teuer. Solche Gedanken lassen mich Covid vergessen. Ich bleibe daheim. Mir macht der Lebenslauf von Innocent in seiner Ganzheit Freude. Einschub Ende. Mein Name ist Innocent Mboma Ekor-Kadisi, geboren am 25. Mai 1964 in Kikwit in eine Familie mit sieben Kindern: vier Jungen und drei Mädchen. Mein Vater hiess Mboma Arthur und meine Mutter war Awinaya Virginie. Beide stammten aus dem Dorf Thiangobo im Sektor Nkara-Bulungu. Meine Eltern beteten in einer protestantischen Baptistenkirche. Sehr oft folgen Kinder der elterlichen Religion. Deshalb bin auch ich protestantisch baptistischer Christ geworden.
Meine Mutter war Bäuerin, und schon in meiner frühen Kindheit fand sie es schön, wenn ich sie auf das Feld begleitete. Ich hatte eine schwierige Jugend, weil meine Eltern nicht genug Geld hatten. Trotz dieser Situation konnte ich in die Schule gehen. Nach der Matura im geisteswissenschaftlichen Gymnasium machte ich 1985 eine zweitägige Retraite, um mich der Herausforderung von Armut und Elend zu stellen. Am Ende der Retraite haben zwei Überlegungen meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen:
1. Das Leben als Grundschullehrer mit seinem bescheidenen Lohn bot keine Möglichkeit, um genügend für den Lebensunterhalt zu verdienen. Nur Universitätsprofessoren leben gut, da sie besser bezahlt sind als andere Lehrer. Jedoch die Bedingungen erlaubten mir nicht, ein Universitätsstudium zu absolvieren.
2. Dann habe ich das Leben von Händlern und von Leuten, welche im tertiären Sektor arbeiten, beobachtet. Denen schien es ein wenig besser zu gehen.
Ich erinnere mich, wie ich beschloss, ein tüchtiger Händler zu werden. Aber auch hier eine Schlüsselfrage: Wo finde ich das notwendige Geld (Startkapital), um mit dem Handel zu beginnen? Die Analysen, um diesen Traum zu verwirklichen, habe ich mit Entschlossenheit und Überzeugung fortgesetzt. Schliesslich nahm ich meinen Mut zusammen und bewarb mich als Beifahrer auf einem Lastwagen. Trotz Matura war ich mit der Arbeit als Hilfsfahrer zufrieden. Um die Jahre 1985 gab es in Kikwit ein Transportsystem namens "Fula-fula" (grosse Lastwagen, die als öffentliche Verkehrsmittel dienten). Es gab keine Autos. Zu jener Zeit bestand Kikwit aus zwei Teilen: Kikwit 1, genannt Cité, und Kikwit 2, das sich bis zum Denkmal erstreckte.
Nach zwei Monaten Dienst als Hilfschauffeur hatte ich trotz des geringen Lohnes so viel Geld gespart, dass ich zwei Karton MPiodi (Meerfisch) kaufen und 1985 auf dem Markt von Kikwit 2 ein kleines Unternehmen gründen konnte. Nachdem ich drei Jahre lang Meerfisch auf dem Markt verkauft hatte, begann ich 1988 mit Meerfisch zu handeln. Ich praktizierte mein Geschäft an der Grenze zu Angola, in den Dörfern in Kahemba, Kulindji und Kingwangala. Es war jedoch nicht einfach, mit den Fischen von Kikwit bis zur Grenze nach Angola zukommen. Denn die Fahrzeugbesitzer hatten immer Angst vor einer Panne, einem technischen Problem unterwegs, und es bestand die Gefahr, dass der frische Fisch verderben könnte.
Dieses Problem veranlasste mich 1994, einen 4 x 4 Jeep zu kaufen und meinen Fisch selbst zu transportieren. Dieser Jeep ist bis heute im Einsatz. Leider bombardierte im folgenden Jahr die angolanische Armee Kamachilu, die Ortschaft, in der die Angolaner die Grenze in Richtung R.D.C. leicht passieren konnten. Seit diesem unglücklichen Ereignis sind alle Aktivitäten an der Grenze eingestellt und zwischen den beiden Ländern findet kein Austausch mehr statt. Da die Grenze seit 1995 blockiert ist, gibt es auch keinen Handel mit Fischen mehr. Deshalb wandte ich mich der Strecke Kikwit – Bumba zu, um hauptsächlich landwirtschaftliche Produkte, die mit Flossen auf dem Wasserweg, dem Fluss Kwenge aus den entlegenen Dörfern nach Bumba gebracht werden, nach Kikwit zu transportieren.
In den Jahren 2008 - 2009 traf ich in der Gegend von Bumba Herrn Ngoma Romain. Er erzählte mir von seinem Projekt für die abgelegenen Bauerndörfer, welches er mit Maja Brenner aufbauen wolle. Herr Ngoma anerbot mir, mich, mit meinem Jeep, für seine Reisen von Kikwit nach Bumba und umgekehrt zu engagieren. Ich war gerne bereit, diesen Service für ihn zu erbringen. Bei der ersten Reise, 2009 fuhr ich mit dem Jeep zum Hotel Riza auf dem Plateau, wo Maja Brenner wohnte, um ihr Gepäck und das gesamte Team abzuholen und nach Bumba zu führen. All die Jahre traf ich Maja Brenner während jedem ihrer Arbeitsaufenthalte in Kikwit. Doch die Zusammenarbeit mit Mr. Ngoma war nicht einfach. Er hielt seine Versprechungen bezüglich der Menge Treibstoff, die er mir liefern würde, nicht ein. Er versprach mir auch Geld für Abschreibungen auf dem Fahrzeug. Er versprach nur! Trotz alledem blieb ich im Dienst, denn ich hatte den Eindruck, dass Maja Brenner uns, die Landbevölkerung liebt. Sie verliess ihr Land und akzeptierte, mit uns in unseren schwierigen Verhältnissen zu leben, um uns zu helfen, das hat mich sehr beeindruckt und meine Bewunderung geweckt.
Später war Herr Ngoma nicht mehr da. Frau Makabu aus dem Dorf Kongo-Kuku holt seither Maja Brenner in Kikwit ab. Sie bat mich um meine Dienste, und seither begleite ich sie und Maja Brenner. Mit der Gnade Gottes werden wir dies entschlossen und gewissenhaft tun, im Wissen darum, dass dieses Projekt dem Wohl unseres Volkes und damit auch uns selbst dient. Wir streuen Blumen vor die Füsse von Madame Makabu für ihren Mut und ihr Know-how, mit dem sie Madame Maja Brenner bei der Erreichung ihrer Ziele unermüdlich unterstützt und begleitet. Sie initiierten unter anderem das Wiederaufforstungsprojekt und die Alphabetisierung. Die Mütter von Kongo Kuku, Kongo Kayu-Mulumbu und Mungulu, sind keine Analphabetinnen mehr. Heute können sie dank Frau Makabu lesen und schreiben.
Ich hoffe, dass Frau Maja Brenner meine Dienste auch zukünftig in Anspruch nehmen wird und ich sie bei der Erreichung ihrer Entwicklungsziele vor Ort begleiten kann. Wir sagen zu ihr: "Danke, Frau Maja. Wir werden Sie mit Hingabe, Bescheidenheit und Ausdauer begleiten, bis Ihre Ziele vollständig erreicht sind.“
Möge die Gnade Gottes, unseres Vaters, Sie begleiten.
Ihr ergebener Diener,
Innocent Mboma
Telefon. 243-81-589-91-88
Das Studium

Innocent hatte auch keine Möglichkeit doch wie ich mit Studium so erkämpfte er sich einen Weg ohne Studium.
Wie lernt man sich kennen? Welchen Felsen liegen auf dem Weg zum Erfolg?

Unsere Wege kreuzten sich immer wieder
1.1 Unser erstes Treffen 2009
Unsere Wege, das heisst die Wege von Innocent Mboma und mir kreuzten sich bereits auf meiner ersten Reise in den Kongo, im Februar 2009. Ich war allein im Flugzeug von Kinshasa nach Kikwit geflogen. Es windete und regnete und unser kleines Flugzeug war nicht mehr ganz neu. Ein Mann hatte mir einen Karton unter die Schuhe geschoben. Deshalb hatte ich realisiert, dass der Boden undicht war. Kein Problem. Schon sah ich vom weitem meinen Partner. Er war per Motorrad gekommen, um mich abzuholen. Kein Zögern, aufsteigen! Schon fuhr ich eingeklemmt zwischen dem Chauffeur und meinem Partner über einen löchrigen Weg! – Unglaublich! – Ich hatte Mühe beim Atmen. – Unglaublich aber wahr: Auf diese Art begann der Traum meines Lebens, der Traum, den ich während Jahren gehätschelt hatte, Realität zu werden. … . Wo war ich? ... Kurz vor dem Einnachten holte uns Innocent mit seinem alten Jeep ab und wir fuhren Richtung Bumba. Holprig, holprig! Einschub: Meine Lesenden „rocombolesque“ und „abracdabrantesque“ sind zwei Wörter, die ich Internet-Übersetzer für „holprig“ gefunden habe, ich lasse sie hier stehen, denn sie können Ihnen ein Gefühl für unsere „Strasse“ geben, auf der wir nach Bumba fuhren. Einschub Ende. Wir fuhren auf einer Sandpiste aus Löchern und feuchtem glitschigen Sand. Als Schweizerin war ich an asphaltierte, gut unterhaltene Strassen gewohnt.
1.2 Unser Treffen 2020
Sonntag, 16. Februar 2020: Makabu, meine Partnerin und ich trafen Innocent um zehn Uhr, um nach Bumba zu fahren. Makabu kannte meine Vorbehalte gegen Innocent, doch sie erklärte mir, mit ihm sei die Fahrt am billigsten. Ich wollte vor der Abfahrt bezahlen, aber er wies mein Geld zurück. Als ich neben ihm in der Fahrerkabine sass, erklärte er mir: „Die Fahrt ist gratis. Ich will etwas zu deinem Projekt beitragen. Du hast Bumba verändert. Alles ist gut vorbereitet für deine Abfahrt, für deine Reise.“ Flink startete er mit dem Boy Chauffeur (Hilfskraft) den Motor: „Das ist der ewig gleiche Jeep, ich habe alle Bestandteile ausgewechselt. Der Boy hilft mir beim Starten des Motors, aber unterwegs kenne ich keine Pannen“. Der Zustand der Sandpiste war schlecht, sogar noch schlechter als vor zwölf Jahren. Innocent fuhr sorgfältig und flüsterte: „Ich muss etwas beisteuern.“ Nach einer halben Stunde hielt er an und liess uns warten. Bald kam er mit einer Flache Palmwein zurück: „Er ist ganz frisch. Trink! Er enthält keinen Alkohol. Makabu hat mir gesagt, es gehe dir nicht gut. Das ist ein Medikament. Das gibt Kraft. Wir geben es den Müttern nach der Geburt.“ Er nahm einen tüchtigen Schluck und gab die Flasche Makabu. Beide ermutigten mich. Der Palmwein mundete mir sehr und sie liessen mir Zeit, um mehr von dem leckeren Saft zu kosten. Er gab mir Kraft. Ich spürte die neue Kraft sofort.
2. Der Hafen von Bumba
2.1 Rückblick
Der kleine eine Hafen von Bumba, er war nicht mehr zu erkennen. Innocent half mir. Er brachte zwei blaue Plastikstühle und drückte mir die Flasche mit dem Palmwein in die Hände. Das war gut so. 2009 waren wir bei Dunkelheit angekommen, und ich verbrachte die ersten Nächte und Tage in der Villa des ehemaligen Besitzers der Palmölfabrik. Das Gelände war von einer Mauer umgeben und unbewohnt. Am nächsten Tag erklärten mir meine ersten Partner, das Ehepaar Ngoma von der Terrasse aus die Umgebung. Eine Mauer umgab mehrere kleine vernachlässigte Schuppen und in ca. hundert Metern Entfernung, so sagten sie, unterhalb des Hanges sei der Fluss Kwenge. Man konnte ihn nicht sehen und meine Partner verboten mir, die Terrasse allein zu verlassen. – Das alles eine Woche nach meiner Pensionierung und mit meinen bescheidenen Französischkenntnissen. Ich war neugierig, ich wollte weiter, aber meine Partner verlangten mit Strenge, dass ich mich zunächst ausruhen müsse. Sie verboten mir, jemandem die Hand zu geben, denn die Dorfbewohner seien schmutzig und voller Krankheiten. Sie verboten mir, etwas anzunehmen oder mit ihnen zu sprechen, ausser mit dem Chef du Terre (Eigentümer des Boden). Es gab immer jemanden, der mich überwachte. Ich wollte mein Lastschiff sehen, das Lastschiff, das ich 2006 und 2007 finanziert hatte. Durch einen Mittelsmann hatte mir Herr Ngoma, mein Partner 2008 Photos geschickt. Und dann, 2009 war ich vor Ort, in einer Zwangspause und das Lastschiff nicht in Sicht. Erst eine Woche später gingen wir zum Fluss. Mit einem schweren Schlüssel öffnete der Chef, Herr Ngoma das Tor zum Gelände der ehemaligen Palmölfabrik und zum Hafen: Zwei kleine ausrangierte Dampfschiffe, zwei Einbäume und ein paar Bambusstangen. Kein Mensch. Herr Ngoma erklärte mir, dass die Schiffe aus der Zeit stammten, als die Fabrik noch Öl produziert habe. Mit den Bambusstangen würden die armen und primitiven Dorfbewohner Flosse für den Transport ihrer Waren bauen. Er jagte ein paar Neugierige weg. Und mein Schiff? Es war weit weg, in den abgelegenen Dörfern und wurde mit landwirtschaftlichen Produkten beladen. Es könnte jeden Tag kommen.
2.2 2020, neue Aktivitäten im Hafen
Elf Jahre später waren wir an der alten Villa vorbei, direkt in den Hafen gefahren. Die beiden alten Dampfschiffe waren weg. Fünf oder sechs Lastschiffe lagen am Quai, mehrere Einbäume auf dem Quai oder halb im Wasser, Berge von weggeworfenen Bambusstangen. Auf dem Quai war Hochbetrieb: Stände mit lauter Tonband-Musik. Alle boten Esswaren und Gemischt-Waren an. Überall Fahrräder, Motorräder, zwei Lastwagen, einer defekt und der andere wurde gerade beladen. Viele Leute, die Handel trieben, die arbeiteten, kauften, verkauften, diskutierten, warteten, beobachten, zuschauten, zuhörten und – ich, ich sass im Schatten eines grossen Bambusbusches auf einem blauen Plastikstuhl mit einer halb leeren Flasche Palmwein in den Händen. Innocent kam zurück: „Das Lastschiff kommt.“ Der ganze Quai war besetzt mit halbvollen Lastschiffen, um sich niemand kümmerte. Innocent nahm einen grossen Schluck Palmwein und erzählte, der blaue Lastwagen, der eben beladen werde, gehöre ihm. Das sei der vernachlässigte und schlecht verwaltete Lastwagen von Robert Masuta. Als er nicht mehr funktionierte, habe er ihn 2019 für 8‘000$ gekauft. Mit vier neuen Pneus und komplett revidiertem Motor zirkuliere er nun zwischen Bumba und Kikwit, wie ich es gewollt habe. Ich muss sehr überrascht geschaut haben, denn Innocent zeigte auf die halbvollen Lastschiffe, auf die Berge von Waren auf dem Quai und in der alten Palmölfabrik. Es fehlte ein Transportmittel zwischen Bumba und Kikwit. „Velos und Motorräder gibt es viele, aber sie können nicht all die Waren nach Kikwit bringen. Einige Säcke, ja, aber nicht diese Mengen“. Es gab einen Engpass und statt seine Ersparnisse von 6‘000 $ in sein altes Lastschiff zu investieren, kaufte er den ruinierten Lastwagen von Masuta. Er wiederholte, das sei die beste Entscheidung meines Lebens. Makabu hatte ihm noch den Chauffeur vermittelt, den Masuta fortgejagt hatte und die zwei Männer sind nun ein Power-Duo. Herzlichen Glückwunsch, begossen mit Palmwein. Jetzt nutzte ich die Gelegenheit, um ihm von der geplanten Broschüre 2020 zu erzählen. Spontan anerbot er, einen Text zu schreiben. Das sei kein Problem, er habe das Gymnasium besucht und seine Frau sei Leiterin einer grossen Primarschule in Kikwit.
3. Die Reise mit dem Lastschiff
Schliesslich kam unser Lastschiff, wir kletterten über die Bambushaufen und sprangen ins Schiff. Keine leichte Sache für eine Frau im Alter einer Grossmutter. Kräftig junge Männer halfen mir. Mit Winken und lauten Glückwünschen verliessen wir den Hafen. Wir waren etwa zwanzig Passagiere mit Gepäck und ich auf dem blauen Plastikstuhl. Das Lastschiff fuhr ruhig dahin. Das war angenehmer als die vergangenen Jahre in einem Land Rover. Gut vorbereitet, dauerte diese Fahrt im Lastschiff weniger lange als die Reise in einem überladenen Land Rover der ein- über das andere Mal im feinen und trockenen Sand stecken blieb, bis es dunkelte und wir die Nacht irgendwo in der Savanne verbringen mussten.
Ich schaute die Landschaft an. Wie sah sie aus? Im Vorwort zur Broschüre „La parole à nous, les Congolais, 2019 » hatte ich gelesen, dass die Ufern des Flusses Kwenge von üppigen Waldstreifen mit grossem Artenreichtum gesäumt würden. Wo waren diese Waldstreifen? Waren die Abhänge nicht steil, und das war selten der Fall, so erreichte die Savanne das Ufer. Ich war schockiert.
2020 verbrachten wir die Nacht auf dem Wasser im Schiff. Wie von Innocent angekündigt, war meine Reise gut vorbereitet und die Matrosen wussten, dass sie uns helfen mussten. Ich genoss eine Nacht in einem schwimmenden Hotel unter einem Fliegennetz auf einer weichen Matratze. Es war ganz ruhig. Das Wasser floss vorbei und die Wellen berührten die Seitenwände. Die Matrosen schlossen die Luken in den Seitenwänden und deckten das ganze Schiff mit einer Plane zu, als ob sie einen Sturm erwartet hätten. Damit schützten sie uns gegen die Insekten der Nacht. Innocent blieb in meinen Gedanken, sogar in meinen Träumen. Er hatte von unseren Aktivitäten profitiert ohne je einen Rappen erhalten zu haben. Der Initiant des Projektes, Herr Ngoma war nicht zufrieden mit ihm, er war auch nicht zufrieden mit mir. Innocent verlangte zu viel für seine Dienstleistungen und ich brachte ihm, Ngoma nicht genügend Geld. Innocent und ich, wir kannten uns vom Sehen. Während jeder Reise winkten wir uns zu. Wir hatten nie gesprochen, bis an jenem Tag im Februar 2020. Innocent transportierte immer Lebensmittel von Bumba nach Kikwt und der brachte Diesel, Motorenöl, Kerzen und Verschiedenes von Kikwit nach Bumba. Er arbeitete hart und sparte. 2013 war er Eigentümer des zweiten Lastschiffes auf dem Fluss Kwenge. Er arbeitete weiter hart, um der Lieblinge der Kunden zu sein. Ich wurde eifersüchtig und erwiderte seine Zeichen nicht mehr. Selbstverständlich hatte er mehr Erfolg als die Besatzung unseres Schiffes mit Herrn Ngoma, der mehr und mehr Geld von mir verlangte. In Bumba lagen unsere Produkte herum, aber der Jeep wartete auf Innocent und er brachte die Waren seiner Kunden bis zu deren Türe. Er machte sogar Fahrten bis nach Kinshasa, aber sein Jeep war zu klein, sein Lastschiff alt und in Bumba gab es zu viel Ware, die auf den Transport nach Kikwit wartete. Und dann, welch ein Glück! Der Lastwagen von Masuta funktionierte nicht mehr und Innocent hatte ein wenig Geld. Er liess sein Lastschiff liegen und kaufte den Lastwagen. Er verstand es ihn wieder Fahrt tüchtig zu machen. Sein Erfolg ging weiter.
4. Das Ziel von Innocent
Als wir am 28.Februar aus den Dörfern zurückkamen, holte Innocent uns ab. In einem Umschlag gab er mir den versprochenen Text, seinen Lebenslauf. 1985, nach dem Abschluss des Gymnasiums hatte er eine Retraite gemacht, um einem Weg aus der Armut zu finden. Die Familienverhältnisse erlaubten kein Studium an einer Universität. Der bescheidene Lohn eines Primarlehrers reichte nicht weit. Aber er hatte beobachtet, dass es Händler gab, die besser lebten. So beschloss er, ein aufgeweckter und mutiger Händler zu werden. 1985 begann er mit viel Einsatz seinen Plan umzusetzen. 1994 machte er einen Sprung, er kaufte einen Jeep, den Jeep, der bis heute im Einsatz ist. 2013 machte er den zweiten Sprung. Er baute mit seinen Bekannten ein Lastschiff. 2019 hatte er erneut den Mut zu springen. Er kaufte den defekten Lastwagen von Robert Masuta, um seinen Traum von 1985 weiter zu realisieren. Mit Vergnügen habe ich festgestellt, dass er weiter machen wollte, denn mit seinem schriftlichen Lebenslauf gab er mir zu verstehen, dass ich alle Vorhaben umgesetzt hätte, ausser der Lagerhalle in Kikwit. Dieses Projekt aus dem Jahr 2016 schien vergessen zu sein. Das stimmte. Da Robert Masuta nicht wie geplant die Lebensmittel von Bumba nach Kikwit transportierte, verzichtete ich auf das Warenlager in Kikwit. Als ich den Text von Innocent las, wusste ich sofort, dass das neue Power-Duo die Lagerhalle nun brauchte.
5. Die Träume der Dorfbewohner und meine Träume
Ich bin glücklich zu sehen, wie unser Projekt Innocent half, seine Träume umzusetzen. Darin bestand ja gerade die Umsetzung meines Traumes: Die Eltern und die Kinder müssen sich ein realistisches Ziel setzen, um ihren Weg zu finden. – Der Lebenslauf von Innocent zeigte mir, dass den Dorfbewohnern solch realistische Ziele fehlen. Sie haben grosse Pläne, die ihnen die Flucht aus der harten Realität in schöne Träume erlaubten. Der ewige Traum von einem besseren Leben, den sie schliesslich nicht umsetzten können. Die Burschen wünschen sich eine schöne Frau, und die Mädchen wünschen sich Kinder, und die beiden heiraten, ohne zu überlegen, was das bedeutet. Die grosse Liebe lässt sie vergessen, auf die kleine innere Stimme zu hören, die ihnen sagt, dass es im Leben andere Möglichkeiten gibt, als sofort Kinder zu haben. Mit ihren grossen Träumen nimmt ihr Leben einen Lauf wie dasjenige ihrer Vorfahren, selbst wenn sich seit der Unabhängigkeit ihres Landes, seit 1960 viel geändert hat. – Im Kontakt zu mir sind sie dann von der Idee gefangen, dass ich von einer grossen Organisation komme und ihnen viel Geld bringen würde. Und – in der Tiefe ihrer Herzen denken sie, ich sei unehrlich und würde das Geld für meine eigenen Bedürfnisse verbrauchen.
Nun zu meinen Träumen von meinen Aktivitäten in Afrika: Ich wollte als junge Frau und als Erwachsene nie etwas anderes, als den Aufbau eines Transportunternehmen beginnen. Ich hatte bei uns in der Schweiz beobachtet, dass Gegenden, die gut mit den Städten verbunden sind, aufblühen. In einer ländlichen, abgelegenen Gegend geben Transportmittel allen die Chance, davon zu profitieren. Es ist dann nur noch eine Frage der persönlichen Initiative, und die bildet das A und das O jeder Entwicklung.
Einschub: Traum, Theorie ist nicht gleich Praxis. Noch verstehe ich vieles nicht, aber ich ahne, dass es richtig ist, immer die gleichen Dörfer zu besuchen, und entsprechend den finanziellen Mitteln verschiedenes in Angriff zu nehmen. Was tun gegen den Mangel an Brennholz? Einschub Ende.
6. Bäume pflanzen!
6.1 Die Hindernisse
Schon 2011 bemerkte ich, dass in und um die Dörfer herum kaum Bäume wuchsen, seien dies nun Fruchtbäume als Bereicherung des Speisezettels oder Bäume als Brennholz zum Kochen. Die Hütten und Schulen stehen an der prallen Sonne und die Frauen müssen nicht nur Wasser in einer weit entfernten Quelle holen, sondern sie haben auch noch Mühe, Holz für die Küche zu finden. Hauptsächlich vermisste ich junge Bäume. Bis heute erklären mir die Dorfbewohner, das sei kein Problem. Ob an einem bestimmten Ort Bäume wachsen, Büsche, Stauden mit Dornen, Schlingpflanzen oder nur ein paar Grasbüschel, das sei Zufall. Sie bemühten sich sehr, mir zu erklären, die Bäume würden spontan wachsen, seit Urzeiten würden die Bäume in grosser Zahl wachsen. Sie erklären mir immer von neuem, der Kongo habe neben Brasilien die grössten Urwälder. Sie erzählen mir von den Wildtieren und von der Jagd auf Tiere, die wir Europäer nicht kennen würden. Für sie Traditionen, Realitäten, für mich Träume!
In der Primarschule haben wir gelernt, die Wälder seien die Grundlage unseres Lebens. Erst seit meinen Reisen in die abgelegenen Dörfer des Kongo beginne ich die tiefe Wahrheit dieser Aussage unseres längst verstorbenen Primarlehrers zu verstehen. Was tun, wenn die ortsansässige Bevölkerung der Savanne erlaubt, sich auszudehnen? Zu Beginn dachte ich, Aufforstung sei eine zu grosse „Kiste“ für uns und bemühte mich um den Kontakt zu einer grossen in Aufforstung spezialisierten NGO. Umsonst, ich bin enttäuscht. Man erklärte mir wiederholt, wir seien zu klein, um professionelle zu arbeiten und man riet mir, unser Geld ihnen zu geben. Eine Organisation gab uns hunderte von farbigen Prospekten. Diese Papiere freuten die Leute vor Ort und weckten bei vielen Schulen die Idee, sie bekämen Geld, wenn sie einen detaillierten Antrag stellen würden. Das Resultat, nichts, nichts als viel Mühe für ohnehin benachteiligte Lehrer. Eine andere Organisation hatte selbst den Mut zu behaupten, der Kongo mit seinen grossen Urwäldern brauche keine Unterstützung und die Dorfbewohner wurden eingeladen, sich für die Aktionen von plante-for-the-planet zu engagieren. Nichts als Missverständnisse. Versuchen wir es selber!
6.2 VorbereitungenZunächst dachte ich, eine Informationskampagne durch einen lokalen Förster würde genügen. Also organisierte ich 2012 und 2013 eine Versammlung der Schulleiter, der Dorfvorsteher und der Grundbesitzer. Dazu lud ich einen lokal bekannten Spezialisten ein, um einen Vortrag zu halten und Fragen zu beantworten. Gegen hundert Leute interessierten sich. Um die Sache leichter zu machen, wurde Kikongo gesprochen und ein Lehrer übersetzte für mich. Sie hörten aufmerksam zu, diskutierten in Kleingruppen und stellten darnach rege Fragen im Plenum. Sie sprachen auf dem Heimweg davon und erzählten das Gehörte in den Dörfern. Es wurde mir mehrfach bestätigt, sie hätten alles gut verstanden – aber sie pflanzten keine Bäume.
6.3 Pflanzanleitung 1 und 2
Im Frühjahr 2015 hatte ich die Gelegenheit mit einer Gruppe Schweizer Forstleute selber Bäumchen zu pflanzen. Mit ihrer Unterstützung schrieb ich eine Pflanzanleitung 1 (fiche technique 1: Le reboisement dans le Payi ongila, instruction, 07.07.2015) Noch im Sommer 2015 konnte ich meine Partner Robert Masuta und Makabu Mankenda davon überzeugen, die Pflanzanleitung zu verteilen.
Einschub
Fiche technique 1
Le reboisement dans le Payi Kongila (INSTRUCTION) 07.07.2015
Ce reboisement par les écoles et par les habitants de la contrée a été initié par Robert NDUNGI MASUTA et Makabu MANKENDA KUBANSUKAMI.
Dans le domaine du reboisement il vaut la peine d’investir dans la qualité du travail pour assurer le résultat à long terme. Chaque étape doit être réalisée avec prudence.
«Gardez les jeunes arbres comme vos enfants»
La sélection des semences
Semences locales, adaptées à la contrée: arbres fruitiers, arbres à chenilles, plantes médicinales, palmiers. Choisissez suivant votre préférence.
Prenez les semences seulement sur des arbres avec les qualités demandées:
un arbre mère en bonne santé qui porte beaucoup de fruits de bonne qualité; pensez aux marchés en ville
un arbre mère qui pousse vite et donne beaucoup de bois à brûler ou de bois de construction
des graines grandes, sèches et de bonne qualité; pas de graines petites ou moisies ou attaquées par des insectes.
Le semis dans les sachets le plus vite possible avant le début de la saison des pluies, avant le 20 septembre. Il faut arroser les sachets chaque jour soit le matin tôt, soit le soir, les mettre dans l'ombrage et les protéger contre les animaux.
Prévoir une petite pépinière pour le semis sur le terrain de la plantation, car transporter les sachets sur la moto est nuisible pour les jeunes plantes.
La plantation sur terrain
Pendant la saison de la pluie, avant Noël, quand les jeunes plantes ont plus de 20 cm de hauteur. Les jeunes plantes ont besoin plus de trois mois pour bien s’enraciner et résister à la prochaine saison sèche.
Les détails :
Faites un grand trou (longueur 30 cm, largeur 30 cm, profondeur 30 à 40 cm)
Ameublissez la terre
Enlevez les racines d’autres plantes et les déchets
Mouillez la terre dans le sachet, placez le sachet dans le trou et coupez le sachet en morceaux pour faciliter l’enracinement
Replacez la terre en trois couches et tassez chaque couche
Pour terminer, ajoutez 5 litres d’eau dans chaque trou de plantation
Désherbez au début
Bon succès et beaucoup de plaisir.
Einschub Ende
2016 sah ich viele Tütchen mit Pflänzchen, winzigen Pflänzchen. Sie hatten alle meine Anleitung gesehen, aber vermutlich hatte sie niemand mit der nötigen Sorgfalt gelesen, denn Dorfbewohner wissen doch von Geburt an, wir Pflanzen zu ziehen sind.
2017: Der fehlende Erfolg veranlasste mich 2017, die Pflanzanleitung 2 zu schreiben (fiche technique 2: Entertenir et surveiller ma plantation) . Kein Erfolg, aber viele Erklärungen: Trockenheit, Unkraut, heftige Regengüsse, die Kinder, böse Nachbarn … Meine Hartnäckigkeit und die grossen Sorge, die mir die Abholzung machte, liessen mich weiterfahren.
Fiche technique 2
Entretenir et surveiller ma plantation 2017 Septembre
2014 MASUTA NDUNGI Robert a fondé le Centre de Reboisement et de Protection de l’Environnement des Paysans de Mungulu-Kisalu Pay Kongila. Il a fait une grande pépinière.
Pour devenir des arbres, les jeunes plants doivent pousser et grandir pendant deux, trois, quatre, cinq ans et même plus!
Le grand malentendu
Les gens ont bien fait leur travail, chacun a planté année après année des centaines de jeunes arbres. Mais pour devenir une forêt et produire du bois, les jeunes arbres doivent pousser et grandir pendant deux, trois, quatre, cinq ans et même beaucoup plus longtemps! Planter ne suffit pas.
Il est absolument nécessaire de faire la plantation sur le terrain avant Noël et d’utiliser seulement des jeunes plants de plus de 20 cm de hauteur.
Quelques conseils pour que la plantation réussisse:
faites un grand trou (longueur 30 cm, largeur 30 cm, profondeur 30 à 40 cm)
ameublissez la terre
enlevez les racines d’autres plantes et les déchets
mouillez la terre dans le sachet, placez le sachet dans le trou et coupez le sachet en morceaux pour faciliter l’enracinement
replacez la terre en trois couches et tassez chaque couche
pour terminer, ajoutez 5 litres d’eau dans chaque trou de plantation
désherbez au début.
Après la plantation, la clé de la réussite c’est de bien soigner et de protéger votre plantation. Le but est d’avoir une plantation petite et bien soignée!
- Ne faites que de carrés de 3 x 3, 4 x 4, au maximum 5 m x 5 m. Vous aurez ainsi un carré de 9, 16 ou 25 plants que vous pourrez protéger et soigner.
- La plantation est un choc pour chaque plante. C'est pourquoi durant les deux premières semaines, vous devez jeter chaque jour un coup d’œil à vos nouveaux plants. Il est important de protéger soigneusement chaque petit arbre ou de construire une clôture stable pour toute votre plantation.
- Après deux semaines remplacez les plantes faibles, en train de dépérir.
Ensuite contrôlez chaque semaine la plantation jusqu'à la fin de l'année scolaire, désherbez, réparez la protection.
- Pendant la première saison sèche après la plantation, protégez vos 9 ou 16 ou 25 plants contre le soleil piquant et apportez-leur chaque semaine de l'eau.
- Grâce à votre persévérance et à votre patience, votre carré de jeunes arbres va bien avancer. Durant la deuxième saison des pluies, il faudra encore désherber et protéger.
- A ce moment, vous pouvez commencer votre deuxième carré.
Bon succès !
Einschub Ende
2018 Nachdem Charly Mbenzu seinen Musikunterricht in der Schule „Les Gazelles“ beendet hatte, marschierten wir gemeinsam heim. Ich klagte über meine Sorgen wegen der Abholzung und dem fehlenden Verständnis der Dorfbewohner. Wenig später brachte er mir die Idee mit dem Wettbewerb. Das klappt langsam, langsam.
Wettbewerb 2019: Drei Teilnehmer
Wettbewerb 2020: 150 Teilnehmer
Wettbewerb 2021: Ich stellte mir diese Frage 2020 vor Ort.
7. Auswertung
Durch meine Gespräche mit Innocent im Februar 2020 in Buma und meine Erfahrungen mit den Leitern der Alphabetisierungsgruppen beginne ich langsam die Felsen, die Schwierigkeiten auf meinem Weg, welche zu den Missverständnissen führen, zu sehen. Ich kann zwei Beispiele nennen: Das erste: Ich bin in einer Umgebung voller bedrucktem Papier aufgewachsen: Zeitungen, Bücher, Gebrauchsanweisungen, Prospekte, … In den abgelegenen Dörfern? Nichts, fast nichts davon, ausser den kleinen Heften für die Alphabetisierung. Dann bringe ich zwei Pflanzanleitungen in Französisch, einer Sprache, die sie nur mit Mühe verstehen. Das zweite Beispiel: Durch die Bundesverfassungen von 1874 und 1999 werden unsere Wälder geschützt. Wir müssen zu den Bäumen Sorge tragen. Für die Kongolesen ist es eine neue Erfahrung, dass die Wälder langsam verschwinden. Sie müssen erst lernen, dass Bäume gepflanzt werden können, dass Bäume gepflanzt werden müssen.
Hoffentlich bleibe ich gesund
2018 Nachdem Charly Mbenzu seinen Musikunterricht in der Schule „Les Gazelles“ beendet hatte, marschierten wir gemeinsam heim. Ich klagte über meine Sorgen wegen der Abholzung und dem fehlenden Verständnis der Dorfbewohner. Wenig später brachte er mir die Idee mit dem Wettbewerb. Das klappt langsam, langsam.
Wettbewerb 2019: Drei Teilnehmer
Wettbewerb 2020: 150 Teilnehmer
Wettbewerb 2021: ??? ich schloss diesen Text Ende 2020 ab.
7. Auswertung
Durch meine Gespräche mit Innocent im Februar 2020 in Buma und meine Erfahrungen mit den Leitern der Alphabetisierungsgruppen beginne ich langsam die Felsen, ja, die Felsen nicht einfach nur die Steine, die mich auf meinem Weg zum Erfolg behindern, zu sehen. Ich kann zwei Beispiele nennen: Das erste: Ich bin in einer Umgebung voller bedrucktem Papier aufgewachsen: Zeitungen, Bücher, Gebrauchsanweisungen, Prospekte, … In den abgelegenen Dörfern? Nichts, fast nichts davon, ausser den kleinen Heften für die Alphabetisierung. Dann bringe ich zwei Pflanzanleitungen in Französisch, einer Sprache, die sie nur mit Mühe verstehen. Das zweite Beispiel: Durch die Bundesverfassungen von 1874 und 1999 werden unsere Wälder geschützt. Wir müssen zu den Bäumen Sorge tragen. Für die Kongolesen ist es eine neue Erfahrung, dass die Wälder langsam verschwinden. Sie müssen erst lernen, dass Bäume gepflanzt werden können, dass Bäume gepflanzt werden müssen.
Hoffentlich bleibe ich gesund und kann noch zwei, drei weitere Reisen machen.
Eins

Teil 1, nach dem 16. April 2020 getippt, Anfang und Ende
«2020 werde ich es nicht schaffen, meine Lebensgeschichte weiter zu tippen» das war meine Befürchtung nach der Rückkehr aus dem Kongo am 10. März, und dann sass ich am 16. April doch vor den Laptop und tippte. Das letzte Textfragment stammte vom 16. Januar 2020. Damals schrieb ich mit dem gewohnten Betriebssystem Windows und mit der Software Microsoft 2003, deren Support nicht weiterhin garantiert wurde. Damals war ich gesund und breitete mich auf meine zwölfte Reise in den Kongo vor. Während meiner Abwesenheit stellte mein Mann meinen PC auf Ubuntu und LibreOffice um. Da ich kurz nach meiner Rückkehr krank wurde, fühlte ich mich von der Umstellung überfordert.
Mitte April schien die Welt eine andere geworden zu sein. Nichts Vertrautes: Anderes Betriebssystem, andere Software. Mein Körper seit Wochen krank. Ich funktionierte nicht mehr in gewohnter Weise. Der Coronavirus grassierte und ich, leicht schaden freudig, fühlte mich dadurch entlastet. Ich brauchte nichts zu müssen. Die ganze Welt schien in Panik. Viele fühlten sich einsam. – Andere riefen dazu auf, diese sogenannte Coronakrise zu nützen: Der Umbau des bösen Kapitalismus in eine bessere Welt sollte beschleunigt werden. – Ich war krank und hatte gleichzeitig das Gefühl, der Coronavirus könne mir nichts anhaben. Das durfte doch nicht wahr sein! Nach einer erneuten Telefonsprechstunde mit meinem Arzt hatte ich verschiedene Medikamente geholt. Hoffentlich helfen sie etwas! Es graute mir, wenn ich an Mutters Pillenschachtel dachte. Sie war 2009, mit Morphin ruhig gestellt, eingeschlafen. Sie hatte ihr letztes Lebensjahrzehnt im Alters- und Pflegeheim Rosengarten verbracht und täglich über zwanzig Pillen und Pülverchen geschluckt und zusätzlich noch irgendwelche Tränklein gebraucht. Ich besuchte sie sonntags mit dem Fahrrad und nach einer Stunde radeln, legte ich mich jeweils müde neben sie aufs Bett. Sie ärgerte sich: «Du solltest dir endlich etwas verschreiben lassen gegen diese Müdigkeit.» Konnte sie jetzt 2020 mit Genugtuung vom Himmel herab sehen, dass ihren Rat befolgte? Nein, meine Mutter glaubte an «nichts». Sie schätzte zwar die Gespräche mit dem diensttuenden Pfarrer, weil diese die Rechnung nicht belasteten wie die Plaudereien mit den Pflegefachleuten. «Ihrer Mutter weiss immer etwas Interessantes zu erzählen, das schätzen wir alle», lobten sie die Pflegenden, und sie blieben länger bei ihr als bei irgendwelchen Dementen. Unter «Psychologischer Betreuung» wurde die «unnötig» verbrauchte Zeit abgebucht. Das wollte meine Mutter nicht und reagierte hernach kurz und rüde auf freundliche Routinefragen.
Zurück zum Thema Coronakrise: Ich verfolgte die Problematik in den Medien. Peter und ich gehörten zur Risikogruppe. Gerne hätten verschiedene Bekannte für uns eingekauft, doch für Peter war einmal Einkaufen pro Woche ein Stück Lebensqualität. Wochentags um acht Uhr morgens war wenig los und das verlangte Sozial Distancing auch in den Lebensmittelgeschäften leicht einzuhalten. Mich drängte es hinaus in die Natur. Dazu nützten wir unsere mobile Quarantänebox, das Auto. Ich fühlte mich zu krank, um hinter das Steuer zu sitzen. Doch ich wollte weit gefahren werden. Das kam Peters Freude am Autofahren entgegen. Die Grenzen waren geschlossen, aber er konnte mir trotzdem immer wieder neue Wandervorschläge machen. Nicht zu weit! Ich bin krank und mag nicht. Wir gehen soweit du magst und dann auf dem selben Weg zur Box zurück. Kleine Spaziergänge, meiner Krankheit angepasst, das waren Märsche von zwei bis drei Stunden. Einkehren keine Option, alle Gastrobetriebe waren geschlossen. Peter fuhr gerne heim und kochte Kaffee. Schön was es, auf dem Sofa ein Tässchen Kaffee trinken und ein bisschen Musikhören.
Alle hatten Angst vor überfüllten Spitälern. Die Pflege der Conora-Patienten war eine Herausforderung. Inkubiert und medikamentös ruhig gestellt, mussten die Erkrankten alle paar Stunden umgelagert werden. Ich hatte diese Pflegehandlungen im Fernsehen verfolgt. Auf einer Intensivstation, zwischen Maschinen und Verkabelungen wurde ein sichtlich alter, übergewichtiger Körper von mehreren maskierten Fachkräften in gelben Schutzmänteln sorgfältig gedreht. – … – Nein, das will ich nicht. Peter graute es, er wollte nichts davon hören. Wir hatten doch beide letztes Jahr unsere Patientenverfügungen von Exit erneuert. In der Tageszeitung war zusätzlich eine ärztliche Notfallanordnung (ÄNO) angeboten worden. Diese druckten und füllten sie aus. Wir waren uns überraschend einig: Wir wünschten beide keine Herz-Lungen-Wiederbelebung, keine invasive Beatmung und keine Behandlung auf einer Intensivstation. Zur Verbesserung der Lebensqualität wünschten wir nur uneingeschränkte lindernde / palliative Behandlung / Pflege im Spital. Unser Sohn war von unserem Entscheid überrascht. Er sagte leichthin: «Wir und die Enkelkinder brauchen euch noch». Wozu? Mit vierzig Jahren seid ihr Erwachsen. «Richtig, ich respektiere euren Entscheid, aber ich bin nicht damit einverstanden. Morgen habe ich einen strengen Tag mit Homeoffice und Kinderbetreuung», Ende des Telefongesprächs. Seine nun regelmässigen Anrufe freuten mich. – Wenn mein letztes Stündchen naht, will ich mit Schmerzmitteln vollgepumpt ruhig einschlafen. Ich erinnerte mich daran, wie ich zweimal unter grössten Schmerzen viel Blut verloren hatte und schliesslich nichts mehr spürte. Dann kam eine warme Wolke und trug mich weg. Ich weiss, dass diese Wolke mich ein drittes Mal abholt, selbst wenn starke Schmerzmittel den Blutverlust ersetzen. Dies Mal soll sich niemand verpflichtet fühlen, mich zu retten. Anfang und Ende liegen in seinen Händen.
Zwei

Teil 2, nach dem 16. April 2020 getippt, Covit-19
Die Coronakrise, ein Ameisenhaufen oder ein Bienenschwarm in Aufregung? Ein Spinnennetz, das erzittert, weil ein Virus hineingefallen ist? Ich mag diese Bilder, sie zeigen mir meine Ohnmacht und mahnen mich zu Bescheidenheit und Demut.
Woher stammt Covit-19? Meine tüchtigen Leser und Leserinnen, lassen Sie uns gemeinsam mit all den Informationsfetzen aus den Massenmedien, kombiniert mit den Bildern, die unserer Fantasie entstammen und den persönlich gefärbten Erfahrungen den Anfang eines Märchen erfinden. Ich mag die Vorstellung, dass Covit-19 im Dichtestress der zunehmenden Überbevölkerung in einer engen Gasse auf einem Markt im fernen Osten von einer Fledermaus auf einen Menschen hinunter gefallen ist. Covit-19 hatte sein Leben während Jahrzehnten mit Fledermäusem im Urwald geteilt. Gemeinsam jagten sie nachts durch die Lüfte und gemeinsam verschliefen sie den Tag kopfüber in einer Felsspalte hängend. Dann wurde die Fledermauskolonie ausgeräuchert, die meisten Tiere gefangen und in ein Netz geschoben. Eine schreckliche Reise begann. Ziel war ein Markt in einer engen Gasse im Slum einer Grossstadt. Was tun? Covit-19, der blinde Passagier schlief.
Im Slums ein Gedränge und Geschiebe! Umfallen wäre nur schwer möglich gewesen. Junge Leute, Kinder und Jugendliche. Alle kauften und verkauften und mühten sich ab, um etwas zu verdienen: Geld, Geld. Ich mied diese Märkte, deren Anfang und Ende niemand kannte. – Ich wollte auch nicht an unsere kleinen Wochenmärkte denken, wo Grauköpfe und gebrechlichen Weissköpfe Blumensträusschen, ein wenig Gemüse oder selbst gebackenes Brot anboten oder kauften. Diese, meine Generation hatte das Geld. Bis zum Eintritt in ein Alters- und Pflegeheim konnten wir uns etwas leisten. Nach einem arbeitsreichen Leben hatte man ein Recht auf Kreuzfahrten. – Womit stillten die Menschenmengen in den Slums ihren Hunger? Die Verkäufer achteten genau darauf, dass nichts unbezahlt verschwand. Meine weisse Haut machte mich zur beliebten Kundin. Die Preise wurden sofort höher. Eine Hand zeigte auf die gegenüberliegende Seite, auf einen Stand vor einer Garage. Nur teure Sachen gab es dort, z.B. lebendige Fledermäuse. Eine gesuchte Delikatesse für besser Verdienende. Ihr Fleisch sei unübertroffen. Covit-19 führte eine Lebensgemeinschaft mit einer der gesuchten fliegenden Mäuse. Er erwachte auf dem turbulenten Markt. Aus Verzweiflung liess er sich auf den Verkäufer fallen. Er fiel auf dessen Hand und wurde sofort auf die Hand eines hübschen Mädchens übertragen. Dort gefiel es ihm. Er vermehrte sich schnell. Unbemerkt und munter breitete er sich in der jungen Bevölkerung aus. Viele folgsame Kinder wurden Träger und verteilten ihn grosszügig. Einige schienen eine Erkältung oder eine leichte Grippe zu haben, das gehörte zur Tagesordnung.
Unterernährte, Kränkliche, Dicke und Alte starben wie bis anhin. Dann brachten die Kinder die Viren via eine Hausangestellte in ein besseres Quartier. Dort erkrankte eine alte Urgrossmutter und starb mit hohem Fieber an einer Lungenentzündung. Eine grosse Trauerfeier, viele Leute, überwiegend Ältere trafen sich zum Abschied. Einig mussten fernbleiben, denn sie litten an Malaria, Tuberkulose, Diabetes, Übergewicht u.ä. Weitere Todesfälle, schliesslich wurde ein erster Erkrankter professionell behandelt. – Viele Kinder spielten vor den engen Hütten «Familie». Neben Heirat und Geburt waren eine schrecklich Krankheit und Beerdigungen neue Themen. Die Jugendlichen spielten Fussball und hielten nach hübschen Mädchen Ausschau. Dass sie irgend einen Virus mit sich herumtrugen und verteilten, das ahnten sie nicht. Sie wollten einen richtigen Fussball und später in einem bekannten Club spielen. – Liebe Lesende, voller Freude erwachte ich an jenem frühen Morgen mir der Idee, einen Text zur Reise von Covit-19 in die Schweiz zu tippen. Doch dann fiel es mir echt schwer. Alles lief mühsam. Auf meine sog. dringenden Telefonanrufe antwortete die Stimme im Tonbandgerät : Bitte rufen sie später an. Die Internetverbindung konnte nicht hergestellt werden und noch dauerte es 30 Minuten bis zum Mittagessen. Ich war festgefahren.
Zum Glück konnte ich am frühen Nachmittag im Garten die neu angesäten Beete giessen. Nach 37 Tagen ohne Regen wäre sonst die frisch aufgegangene Saat vertrocknet. Ob ich an Teil zwei weiter tippen soll? Wenn ja, wie? Meine Lesenden, Sie waren mir nicht die erwartete grosse Hilfe? Was tun? Ich gönnte mir ein Nickerchen in der Hängematte und später eine Tasse süssen Kaffee. Dann ging es weiter. – Der Enkel der verstorbenen Urgrossmutter hatte in Wuhan, einer damals noch unbekannten Stadt zu tun (meine Lieben, im Internet, bei Google finden Sie weitere Angaben zu Wuhan). Er traf einen Geschäftsfreund und dessen dicke Frau, die wegen Diabetes in ärztlicher Behandlung stand. Zwei Wochen später war sie tot. Ihr Arzt, Dr. Li Wenliang und seine Kollegen hatten eine Vermutung. Die Zeit verstrich. Einige wenige erkrankten und einige wenige starben trotz Antibiotika aus ungeklärten Gründen an einer Lungenentzündung. Dr. Li Wenliang, geboren 1986, (meine Lieben, ich wiederhole mich, im Internet, bei Google finden Sie weitere Angaben zu Dr. Li Wenliang. Er war ein sympathischer, wahrscheinlich überarbeiteter junger Mann) war schliesslich in seinem Labor auf einen unbekannten Virus gestossen. Dieser wurde Covit-19 genannt, 19 da er 2019 entdeckt worden war und Corona in Anlehnung an seine Form. Wieder verstrich Zeit. In den jungen, gesunden Bevölkerungsgruppen gab er keine unerwarteten, unerklärbare Todesfälle. Alte und Kranke starben wie bis anhin trotz Antibiotika oft an einer Lungenentzündung. Doch Covit 19 war entdeckt. Es gab eine Erklärung warum die Antibiotika bei vielen Kranken nicht wirkte. Die Coronakrise hatte begonnen und Dr. Li Wenliang, er gehörte persönlich zu den ersten Opfern, hatte sie öffentlich gemacht. Er hatte von einem heimtückischen Virus gesprochen. … .
… Es gab weitere Opfer. Viele! In den Medien kursierten Zahlen. Hätten Sie mich gefragt, was ich von den angeblich genauen Zahlen hielt, so hätte ich antworten müssen, weltweit waren viele, sehr viele gestorben. Weltweit sterben viele, sehr viele. Von einer allfälligen Dunkelziffer wurde nicht gesprochen.
Der 5. März 2020, das erste Coronaopfer in der Schweiz. Via Google fand ich das vielfach erwähnte Epidemiengesetz {818.101 Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz, EpG) (Stand am 1. Januar 2017)}. Gemäss Art. 4 Abs. 1 legt der Bundesrat unter Einbezug der Kantone die Ziele und Strategien der Erkennung, Überwachung, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten fest. Es war 2012 erlassen worden, weil sich in Wellen aus Osten kommend, immer neue gefährliche Viren ausbreiteten. Waren der Bundesrat und die Verwaltung der ihnen durch das Epidemiengesetz übertragenen Aufgabe nachgekommen? Standen Sie vielleicht, verführt von Fryday for Futur, zu sehr im Banne der zu erwartenden Klimakrise? Fragen stellen ist zulässig, urteilen sollen andere.
Das Studium: Es blieb beim Vorsatz

Drei

Teil 3, nach dem 16. April 2020 getippt, Blackout
Konnte in der Coronakrise eine gross angelegte Hauptübung für einen zu erwartenden Blackout gesehen werden? Mit dieser Frage war ich erwacht. Extinction Rebellion und Fridays for Future hatten ihren grossen Streiktag vom 15. Mai 2020 auf den Herbst verschoben. Aus dem weltweiten Lockout, den Ausgangssperren und dem Grounding vieler Flugzeugflotten hatten sie geschlossen, dass die Regierungen, genügend unter Druck gesetzt, in der Lage wären, die Wirtschaft still zu legen und Gesellschaft umzubauen.
Fridays for Future (FFF), die Klimajugend 2019 war eine globale soziale Bewegung ausgehend von Schülern und Studierenden, welche sich für möglichst umfassende, schnelle und effiziente Klimaschutz-Maßnahmen einsetzten, um das auf der Weltklimakonferenz in Paris 2015 (COP 21) im Weltklimaabkommen beschlossene 1,5-Grad-Ziel der Vereinten Nationen noch einhalten zu können. «Man brauche nicht für eine Zukunft zu lernen, die nicht mehr lebenswert sei.» Diesen Anforderungen wurde seitens FFF mehr Wert beigemessen als dem freitäglichen Schulbesuch. «Der Klimawandel warte nicht auf Studien- oder Schulabschlüsse.» Die Kernforderung lautete: „Handelt endlich – damit wir eine Zukunft haben!“ Die Bewegung sah sich als die letzte Generation, die noch etwas gegen den Klimawandel ausrichten und katastrophale Folgen verhindern konnte. Die Initiatorin Greta Thunberg beschuldigte die Politiker beim UN Klimagipfel am 23. September 2019 in New York, sie hätten ihr durch die mangelnde Klimapolitik die Kindheit gestohlen. Sie warnte, dass wir am Anfang eines Massensterbens stehen würden und die Politik trotzdem nur über Geld und wirtschaftliches Wachstum spreche.
Unsere Gesellschaft «musste» sich entwickeln. Unsere Abfallberge, die schwimmenden Inseln weggeworfener Plastikverpackungen in den Weltmeeren, die Enge in den Slums der Megacitys, die weiten Ferienreisen, so durfte und konnte es nicht weiter gehen. Doch «die Formulierung «die Gesellschaft sei umzubauen» erinnerte mich zu sehr an die Ostblockstaaten, an Kuba, an die Roten Ghmer, an Angola u.ä.. Ich stellte mich gegen einen sozialistischen Umbau. Ich war und bin von unserer Basisdemokratie überzeugt. Auch wenn der Umbau demokratisch erfolgen sollte, gutgeheissen von Stimmenden mit Sand in den Augen, würde ich zur Opposition gehören, die sich mit pazifistischen Mitteln sichtbar macht. Im günstigsten Fall würde ich belächelt und übersehen. Wie sähen gefährlichere Varianten der Diskriminierung aus? Leute, die meine Lebenseinstellung teilen, würden gemieden, gemobbt, ausgegrenzt, verhöhnt, bespuckt, bedroht … Als rechtspopulistisch, rechtsradikal, NeoNatiz verschriern. Die Arbeitsstellen, die Wohnungen und die Bankkonti würden ihnen unter Druck der Antifa gekündigt. Einschub: Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages der BRD definierte den Begriff „Antifa“ 2018 als „Oberbegriff für verschiedene, im Regelfall eher locker strukturierte, ephemere autonome Strömungen der linken bis linksextremen Szene“. Er stellte dar, dass aufgrund des Fehlens klarer organisatorischer Strukturen, eine Bewertung, ob es sich hierbei um terroristische Vereinigungen handelt, durch die Strafverfolgungsbehörden, nach aktuellem Stand, nur im Einzelfall erfolgen könne. Meine Lesenden, es musste ja kommen. Weitere Informationen zur Antifia, zu Extinction Rebellion und Fridays for Future finden Sie im Internet. Einschub Ende.
Der Umbau der Gesellschaft ist das grosse Ziel. Womit soll er beginnen? Mit einem Blackout? Ich hoffe auf Mässigung, auf kleine, lokale Stromausfälle als Vorübung vor einem europaweiten Zusammenbruch des Versorgungsnetzes. Die von vielen Bewunderten, die aus Angst vor einer Klimakatastrophe die Schule schwänzten, fordern u.a. die sofortiger Stilllegung aller Kernreaktoren und die Umstellung auf Elektromobilität. kommte der Strom dafür her??
Vier

Teil vier, nach dem 16. April getippt, lockdown
Die Kurve der Neuansteckung mit dem Coronavirus war seit einiger Zeit am abflachen. Wann und wie würden der Lockdown und die Ausgehbeschränkungen gelockert? Dies bestimmte der Bundesrat in Zusammenarbeit mit der Verwaltung und seinem Gremium von Fachleuten. Ich durfte trotzdem meine eigene Meinung haben, nicht wahr? Ich befolgte die Anordnungen unserer Regierung: Distanz von zwei Metern einhalten, Hände desinfizieren, Handschuhe tragen, in den eigenen vier Wänden und im privaten Garten bleiben, Maske als Mund- und Nasenschutz. Ich wollte niemanden gefährden. Ich wollte nicht, dass jemand meinetwegen sog. vorzeigt sterben sollte. Doch was hiess das in der aktuellen Situation? Die durchschnittliche Lebenserwartung lag in Deutschland bei 80 Jahren, für Coronatote bei 83. Starben diese Menschen mit 83 Jahren vorzeitig?
Wie viele Lockdown-Tote gab es? Davon sprach niemand. Lockdown war keine tödliche Krankheit, und der Bund war keine Vollkaskoversicherung, nicht wahr? Doch was hiess das für eine weltweit vernetzte Wirtschaft, die auf "just in Time" und Shareholdervalue getrimmt war? Dienten professionell und wissenschaftlich tönende Begriffe einer Vernebelungs-, Neid-, Rachegefühletaktik … ? Waren sie ein Schutz vor den brutalen Wahrheiten der realen Welt? Schlummerte dahinter der Traum, auch einmal zu den Habenden zu gehören? – Einschub: Meine Lesenden ein Beispiel, das mir mein Mann oft erzählte, soll Ihnen dies erläutern. Es geschah in Deutschland, in der Zeit nach dem Zweiten. 1958 war Regina 10 Jahre alt. Ihre Mutter war vor der vorrückenden russischen Armee aus Ostpreussen geflohen. Ihr Vater hatte den Russlandfeldzug und Rückzug der Deutschen überlebt. Sie standen am Kriegsende vor dem Nichts. Nein, sie hatten Glück. Sie konnten eine billige Einzimmer-Dachwohnung mit irgend welchen Altmöbeln herrichten und heiraten. Der Vater Techniker, die Mutter Verkäuferin, beide fanden Arbeit und sie sparten. Ihr Ziel, die Grossmutter in Ostpreussen per Auto zu besuchen, hatten sie im Sommer 1958 erreicht. Sie besassen einen Renaut Dauphine. Später, von den Nachbarn auf die Reiseerlebnisse angesprochen, strahlte Regina, sie konnte vor lauter Glück kaum sprechen: «Stell dir vor, wir sind im Stau gestanden.» Welch ein Glück. Im Stau stehen, das war das einzig erwähnenswerte Erlebnis des Mädchens. Der gleichaltrige Nachbarknabe staunte. Für ihn hatte Regina gesagt: «Wir haben es geschafft. Wir gehören zu den reichen Leuten.» Der Junge verstand die Welt nicht mehr. Er wohnte mit seinen Eltern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, der Vater war Bankangestellter, die Mutter besorgte den Haushalt und liess sich Hüte machen. Ein Auto schien ausser Reichweite. Waren sie arme Leute? Zählte Regina aus der alten, engen, schäbig eingerichteten Dachwohnung zu den Reichen? Ja, denn sie hatten ein Auto. Einschub Ende. – Zu Beginn des 21. Jahrhunderts erfüllten Billigflüge, Kreuzfahrtschiffe mit Platz für mehrere Tausend Gäste, Pauschalreisen nach Asien oder auf ferne Inseln solche Träume. Wer bezahlte die Rechnung? Die Fledermäuse? Als Rache brachten sie Covit-19? Ich liebte und hasste solche Gedankenketten.
Was brauchte es, um sich zu schützen? Desinfektionsmittel, Wegwerfhandschuhe, Masken. Was brauchte es, um diese Artikel herzustellen? Eine Maske konnte behelfsweise durch ein Halstuch ersetzt werden und Halstücher gab es damals in allen Haushalten in grosser Zahl. Doch für den Handel war die serielle Produktion dieser Artikel nötig. Hatten wir das Knowhow, das Kapital, die Energie, eine gute Infrastruktur, die Zuglieferanten, ausgebildete Manpower, Rohstoffe, funktionierende Fabriken, eine Finanzverwaltung, Unterhalt, Kantinen und vieles mehr. Hinter all diesen Aufgaben standen einzelne Männer und Frauen mit Familienpflichten. Diese brauchten Geld. Durch Ausgaben für Ferienreisen, Fitness, modische Kleider, Weiterbildung und, und war ihr Budget eng geworden. Reserven für Unvorhergesehenes gab es kaum.
Der Vermieter konnte nicht, auch nicht nur auf einen Teil des Mietzinses verzichten, denn er hatte noch offenen Handwerkerrechnungen und die Handwerker hatten ihrerseits in der Zeit des Coronavirus die Krankenkassenprämien noch nicht bezahlt. Was tun? Der gewohnte Geldfluss war unterbrochen. Für gegen 2 Mio. der 5 Mio. Arbeitnehmenden war Kurzarbeit beantragt worden. Bund, Kanton und Städte konnten die wirtschaftlichen Folgen des Lockdown für kurze Zeit abfedern. Wie sollte es weiter gehen? Die Nerven lagen blank. Es kam zu Unfällen und Erkrankungen. Anträge an Versicherungen waren auszufüllen. In Extremfällen kam es zu psychischen Erkrankungen, zu häuslicher Gewalt oder zu Selbstmord. Es traf Menschen, welche die durchschnittliche Lebenserwartung von 80 Jahren bei weitem nicht erreicht hatten.
Selbständig Erwerbende, KMUS, der Tourismus, Restaurants, die Flugbranche, … die Wirtschaft in ihrer Gesamtheit machte Millionen von Verlusten. Alle wollten und mussten Geld verdienen. Wer konnte sich den Lockdown leisten? Dank der umstrittenen Schuldenbremse konnte der Bundesrat die Wirtschaft mit X Millionen unterstützen. Schon gut, aber es musste wieder Geld verdient werden. Am 16. April hatte der Bundesrat die ersten drei Stufen seines Lockerungsplan veröffentlicht.
Fünf

Teil 5, getippt nach dem 16. April, der blaue Fleck
Gestern huschten zwei Buschtelefonate, zwei Aufregungen durch die Familiengärten, zunächst die Meldung, die Schwester unserer Nachbarin, sie sei noch keine sechzig, liege im Spital. Und weiter, der Vater von zwei kleinen Kindern sei in Quarantäne. – Ich wusste, eine Mieterin mied es, ihren Vorgarten zu verlassen. Sie betonte immer wieder, sie seinen besonders achtsam, da sie den Erstickungstod ihres Vater miterlebt hätte. Dann wagte sich die Witwe doch uns wieder zu nähern, grausam, grausam, ihr Mann sei an Lungenkrebs gestorben. Beim Erstickungstod bringe nichts als der Tod Erleichterung. Kein Morphium, nichts helfe. Die beiden Damen liessen sich alles ins Haus liefern.
Beim Abendessen erzählte mein Mann, er sei vermutlich vor ein paar Wochen dem ersten Coronatoten unserer Stadt begegnet. Dieser war gemäss Zeitungsmeldung mit erst 54 Jahren verstorben. Ich war erstaunt. Mein Mann weiter, er könne sich klar erinnern, weil der Mann zu Fuss unterwegs gewesen war und verzweifelt nach dem Weg zum Kantonsspital gefragt habe. Dann sei er verschwunden. Er denke immer wieder an dieses spezielle Episode. – Themawechsel, er streckte mir seinen rechten Fuss entgegen: «Schau diesen blauen Fleck an der grossen Zehe. Er tut nicht weh. Heute Morgen war noch nichts zu sehen. Um vier Uhr wechselte ich die Socken, und da war er, der Fleck. Ich weiss nicht, woher er kommt. Gemäss Internet könnte es ein Anzeichen einer Carona-Infektion sein.» Wir machten ein Photo, um damit am nächsten Tag Veränderungen feststellen zu können und beide Bilder in der Folge unserem Hausarzt zu mailen.
Nach einer Informationssendung von SRF zum Thema «Mobilmachung und Einsatz der Sanitätstruppen zur Entlastung der Spitäler» tippe ich am Teil vier weiter und schlief nach einem Glas Wein glücklich ein. Trotz «meinem sog. Kranksein» hatte ich wieder einen vollgepackten Tag hinter mir. Im Schlaf wurde in meinem Innern Ordnung geschaffen. Verschiedene Todesfälle tauchten auf und verschwanden wieder. Dann bereitete das Innere unseren persönlich Ernstfall vor. Es brach keine Panik aus. Ausser unserem Sohn wollte ich niemandem das positive Testergebnis und den Spitaleintritt meines Mannes melden. – Um fünf Uhr erwachte ich und bereitete meinen Haferbrei vor. Auf Stufe eins konnte er nicht überkochen. In eine Wolldecke eingehüllt, setzte ich mich in der Stube aufs Sofa. – Einschub, schmunzelnd bei der Überarbeitung des Textes getippte: Ja, ja korrekterweise hiess der Raum, den ich Stube nannte, Wohnzimmer, aber für diese Bezeichnung war unsere Stube zu eng und zu altmodisch. Ich wusste wohl, Polstermöbel war die zeitgemäss Bezeichnung der Liege, die ich als Sofa bezeichnete. Doch die beiden alten gewohnten Worte schenkten mir Wohlbefinden und Geborgenheit in der Coronazeit. Einschub Ende. – Es war noch dunkel. Ich war dankbar, dass ich in Musse über die kommenden Tage nachdenken konnte. Ich wollte mich der neuen Aufgabe widmen, ohne das Buschtelefon zu bedienen. Vieles wollte ich noch vor dem Spitaleintritt mit meinem Mann besprechen. In Gedanken begann ich eine Liste zu schreiben. Das Köfferchen würde Peter selbständig packen. Unsere Streitfrage, ob ich einen zweiten Familiengarten pachten sollte, hatte sich in Luft aufgelöst. Wie würde ich den Haushalt allein bewältigen? Als erstes wollte ich eine Putzfrau engagieren und statt dem vielen Gemüse Schnittblumen für den Verkauf pflanzen. Die Idee gefiel mir. Dann musste ich eine Weile ein gedöst sein. Wie konnte ich Peter am besten beistehen? Um das Prozedere zu vereinfachen, wollte ich den Coronatest gleichzeitig mit ihm machen und nach Erhalt der Ergebnisse unser Verhalten mit Peter und dem medizinischen Personal besprechen. Peter sollte bestimmen, wen ich wann und wie informieren sollte. Ich wünschte mir Ruhe und Zeit, denn es kam viel auf mich zu. Mit einer Kombination von Todesanzeige und Danksagung wollte ich Klarheit schaffen. Der Text sollte in etwa lauten: Heute befreite die Pandemie Peter von seiner grossen Angst vor einem Blackout. Er schlief ruhig ein. Wir danken allen, die ihm Gutes erwiesen haben, im speziellen seinen Weggefährten, die seine Sorge teilten. In stiller Trauer seine Frau, sein Sohn mit Familie, sowie Verwandte und Bekannte. Die Urnenbeisetzung findet später statt. – Die Zeit war verflogen. Ich hörte, dass Peter aufgestanden war. Ich wusste, dass er beim Erwachen nicht gestört werden wollte. Also wartete ich, bis er mir den Gruss bracht. Der blaue Fleck war grösser geworden.
Nach dem Mail mit den beiden Photos erkundigte sich der Arzt nach der Wärme der blauen Stelle. Wir betasteten die Füsse. Alle Zehen waren kalt. Wir hatten doch einen Kontakt-Thermometer! Dieses bestätigte mit 28.2 Grad unserer Empfinden. Der Arzt gelangte zur Überzeugung, es handle sich um einen Bluterguss. Ein solcher könne nicht nur durch einen Schlag ausgelöst werden, sondern sich auch nach einer grossen Anstrengung, z.B. einer langen Wanderung einstellen. Natürlich, es hatte seit dem 10. März nicht mehr geregnet. Der Boden war hart und trocken und Peter hatte in den vergangenen Tagen im Garten umgegraben. Mit dem linken Vorderfuss hatte er die Grabgabel in die harte Erde gestossen. Wir hatten des Rätsels Lösung. Das war die grosse, lange Anstrengung, die am folgenden Tag den Bluterguss ausgelöst hatte.
Auf einem Spaziergang am Nachmittag erzählte ich Peter von meinem Traum. Er war erstaunt, wie ich die Beerdigung spontan in seinem Sinne organisiert hatte. Ich machte keine Meldungen ans Buschtelefon.
Sechs

Teil 6, getippt nach dem 16. April 2020
Als der «Schwarze Tod» umging.
Wie konnte ich etwas zur Bereicherung des Buschtelefons in den Familiengärten beitragen? Etwas Unverfängliches, Informatives musste es sein. Ich dachte an meine Grossmutter, sie hatte während der Grippe 1918 in einer Woche drei Kinder verloren. Wie war das früher, in der Zeit vor Internet? In ihrer Ausgabe vom 24. April beantwortete die lokale Zeitung meine Frage.
Es folgt nun eine Abschrift der Zeitungsnotiz: «Kaum eine andere Bedrohung, weder Krieg, Erdbeben noch Feuersbrünste, vermochten die Menschen im Mittelalter und der frühen Neuzeit dermassen in Angst und Schrecken zu versetzen, wie der «Schwarze Tod». Auslöser der sogenannten Beulenpest war das Bakterium Yersina pestis, das von Rattenflöhen übertragen wurde. Infizierte verspürten als erste Krankheitssymptome Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen sowie Bewusstseinsstörungen. Später zeigten sich im Bereich der Leisten, am Hals oder in den Achselhöhlen pflaumengrosse Pestbeulen, so genannte Bubonen.
Die schlimmsten Pestepidemien in der Stadt Schaffhausen ereigneten sich zwischen 1517 und 1593, vor allem aber 1611 und 1629. Laut dem Chronisten Hans Im Thurm raffte die Pest damals jeden zweiten Einwohner, also mehr als 2500 Personen, dahin. Ein Epitaph im Kreuzgang des Klosters Allerheiligen erinnert an den Tod der vier Geschwister von Waldkirch. Dort steht zu lesen: »Grausam die Pest in dieser Stadt mehr dann ein Jahr gewütet hat, allein im Augsten starben daran, 900 Kinder, Weib und Mann.» Auch im Rat schlug die Pest damals grosse Lücken: Am 4. September mussten gleich 38 neue Mitglieder vereidigt werden. Für der Pflege von Pestkranken wurden vor allem die Frauen von Nicht-Bürgern herangezogen. Wer sich weigerte, wurde aus der Stadt ausgewiesen.
Später sorgten einschneidende behördliche Massnahmen, insbesondere das Verbot öffentlicher Veranstaltungen, die Schliessung von Schulen und konsequente Abriegelung der Stadt für eine Eindämmung der Pest. Personen, die von auswärts kamen, erhielten erst nach achttägiger Quarantäne Einlass und Güter aus infizierten oder gefährdeten Gegenden durften erst nach einer Frist von sechs Wochen in die Stadt eingeführt werden.» Ende der Abschrift.
Ratschläge meiner Grossmutter selig: «Ratten und Hausmäuse müssen ausgerottet werden, denn sie tragen die Pest von Haus zu Haus. Händewaschen, Händewaschen.» Meine Lesenden, keine Angst das Bakterium lässt sich mit Antibiotika bekämpfen und des weiteren ab ins Internet. Meine Lieben, seien wir nicht zu wehleidig, seinen wir realistisch, die Opfer von Covit-19 sind hauptsächlich Menschen mit Vorerkrankungen, die das durchschnittliche Sterbealter von 83 Jahren schon erreicht haben. Die folgend Frage darf ich nur tippen: Wie viele Kinder sterben an Malaria oder Unterernährung?
Sieben

Teil 7, getippt nach dem 16. April 2020, die Tiere und das Alter
Angeblich litten während dem Aktivdienst von Covit-19 viele Artgenossen unter Einsamkeit und Langeweile. Beide trafen mich nicht zuhause, denn ich war im Internet unterwegs, das mir, ergänzt mit dem Telefon, ein guter Kamerad war. Gerne hätte ich als junges Kind mehr über Tiere gewusst, aber niemand in meiner Umgebung half mir. Ich wusste, es gibt viele Zugvögel, aber welche Vögel waren Zugvögel?
Die ausgestorbenen Störche flogen im Hebst nach Südafrika. Die Enten, die Schwäne, die Schwalben – wie fanden sie den Weg weit weg, in die Ferne und wieder zurück zu uns. Ich hatte damals Angst vor der Fahrt in die Stadt. – 2020 galt eine Küstenseeschwalbe mit 90'000 Jahres-Kilometer als Rekordhalterin. Sie brütet in der Arktis und überwintert in der Antarktis. – Der Europäische Flussaal wandert zum Laichen in die Sargassosee östlich von von Florida. Seine Reise dauert bis zu anderthalb Jahre. – Die Distelfalter, das sind zarte Sommervögelchen, sie fliegen von ihren Heimatgebieten im Süden durch die Schweiz und stossen im Mai, Juni bis in den Norden Europas vor. In der Serengeti lebt irgend so eine Gnuart, die zieht am Ende der Regenzeit aus der Serengeti über den Mara-Fluss nach Kenya.
Themenwechsel: Meine Lieben, ob ich wollte oder nicht, aber es blieb mir nichts anderes übrig, als mich langsam mit meinem Älterwerden anzufreunden. Ich musste zu mir sagen: «Du hast eine gute Internetverbindung, aber es fehlt Dir an Beweglichkeit und Kraft, um nach den digitalen Spuren dieser Tiere zu suchen. Als Strafe weisst du eben nichts über die Gnu, die Serengeti und den Mara-fluss.» Der Rücken tat mir weh, und auf dem Sofa zu liegen, war schöner als digitale Entdeckungsreisen zu unternehmen. – Mit hoch gelagerten Beinen suchten meine Gedanken weiter nach Tieren: Seit dem Fall des Eisern-Vorhanges tauchten viele als ausgestorben geltende Arten wieder auf, sie wanderten aus dem Osten ein: Der Wolf, der Bär, die Biber und Luchs, Fischotter, Goldschakal und allerhand andere kleine Raubtiere und Nager.
Oh, wie schön schien die Sonne. Sie wärmte meinen Rücken. Sie holte mich zurück aus dem Traumland auf das Sofa und ich erinnerte mich an den Zirtonenfalter, den ich am Tag zuvor beobachtet hatte. Auf einer Wanderung hatten wir im Halbschatten auf einer Bank einen Zwischenhalt gemacht. Peter drehte sich eine Zigarette und ich hatte gesehen, wie ein munter gaukelnder Zitronen-Falter auftauchte und wieder verschwand. Er erzählte mir vom Frühling und von der Zerbrechlichkeit, der Vergänglichkeit des Lebens. Ich dachte an den Bébé-Sohn einer Bekannten. In einem Jahr wird er marschieren. Die Bébé-Tochter einer andern Bekannten wird die ersten Schrittchen wagen. Wer wird nächstes Jahr einen Kinderwagen schieben? Die Mamas in den abgelegenen Dörfern am Fluss Kwenge im Kongo binden ihre Kinder auf den Rücken. In meinen Gedanken rief ich ihnen entgegen: «Stopp, keine weiteren Kinder, Familienplanung.» – Ehe ich es mir versah, sass ich wieder vor dem PC. Familienplanung. Noch fehlten mir die Formulierungen der Schlüsselsätze in französisch und deren Übersetzung nach Kikongo. Pauline unterrichtete in Kinshasa Lebenskunde und im Rahmen dieses Faches sprach sie mit den Burschen und Mädchen über Familienplanung. Sie unterstützte meine Idee, dieses Thema während der nächsten Reise aufzugreifen. Keine Details, aber ein paar Hinweise sollte ich dringend machen. Was sollte ich wie sagen? Das Privat-Taxi von Pauline wartete draussen, und trotzdem nahm sich Zeit, mir vier Stichworte zu diktieren. Du musst die Männer und die Frauen ansprechen. Werden sie dich verstehen, die Leute, die einzig Kikongo oder einen Dialekt von Kikongo sprechen? Ich machte einen Sprung nach vorn. Ich ratterte das Vaterunser auf Kikongo herunter. Die Anwesenden waren überrascht. Ich wollte «das neue Thema» nicht besprechen. Es sollte lediglich ins Bewusstsein gerufen werden. Um das zu erreichen, wollte ich vier kleine stereotype Sätze auf Kikongo auswendig lernen und dann immer wieder hersagen. Ich war überzeugt, dass sie aus Freude und Spass über meine Fortschritte in ihrer Sprache, meine Botschaft per Buschtelefon weitergetragen würden. Sie würden sich bemühen, bei der Feldarbeit meine Aussprache und meinen Tonfall nachzuahmen, ohne sich um den Inhalt zu kümmern. Und – ich vertraute auf Wunder – nach vielen Wiederholungen würden sie den Inhalt meiner Botschaft Tröpfchen um Tröpfchen verstehen. Nun hatte ich den Faden verloren. Wie sollte ich weiterschreiben? –
Auf der gegenüberliegenden Strassenseite steckte der Zeitungsverträger die neuste Ausgabe der Tageszeitung in den Briefkasten. Drei Stockwerke nach unten, drei Stockwerke hinauf und schon sass ich damit auf den Sofa. Als Hauptüberschrift des Regionalteils stand: «Grosse Hilfe für viele kleine Lebewesen» «Wildbienen sind als Bestäuber wichtig für das Ökosystem. Sie werden aber immer seltener, da der Lebensraum der solitär lebenden Tierchen immer intensiver genutzt wird.» Um dem Entgegenzuwirken wurden interessante Vorschläge gemacht wie Insektenpyramieden und Steinhaufen. – Es heisst, aller Anfang ist schwer. Der ersten Schritt soll der schwerste sein. Mutig entschloss ich mich, den Artikel auszuschneiden und an jüngere weiterzugeben. Ich werde älter.
Das Studium: Es blieb beim Vorsatz

Acht

Neun

Teil 9, getippt nach dem 16. April, alt!
Ich war alt geworden. Vor Covit-19 wusste ich im Kopf, ich war Jahrgang 1945, das hiesst alt. Am 15. Mai 2020 hatte ich mich nach dem Frühstück nicht nur kurz hingelegt, sondern ich war erstmals nochmals unter die Bettdecke geschlüpft. Ich lag warm, wohlig, weich und glücklich. Ich war alt. Covit-19 konnte mir kein Leid antun, er könnte mich doch abholen. Ja, bitte, schnell und schmerzlos. Draussen, 10 Grad, windig und bewölkt. Hoffentlich regnete es bald, denn ich war wetterfühlig geworden.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Spitälern, sie waren bereit, Sondereinsätze zu leisten, Routinen umzustellen, in Schutzanzügen zu arbeiten und (trotzdem) Risiken in Kauf zu nehmen. In Pflege-, Psychiatrie- und Asylzentren, in Kindertagesstätten, in Gefängnissen, auf Beratungsstellen mit Telefonhörern am Ohr, überall standen Menschen im Dienst und dies – besonders, wenn ich ans Putzpersonal dachte – oft zu tiefen Löhnen. Meine AHV-Rente und Pension trafen wie gewohnt auf meinem Bankkonto ein. Ja, und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Banken, welche für finanzielle Hilfeleistungen, die Gesuche zugunsten der Unternehmen zu bearbeiten hatten, und das waren sehr, sehr viele, hatten viel zu tun. Die finanziellen Mittel sollten schnell gesprochen werden, und dazu waren Gesuchsverfahren abgekürzt und effizient aufzubauen. Es handelt sich um hunderttausende von Antragstellern und es warteten 68 Billiarden auf Abruf. Wie viel kostete uns Covid-19? Meine Stirn war feucht geworden – Wie viele Nullen hatte eine Billiarde? Ich tippte die Zahl CHF 68'000'000'000.00 und staunte, soviel Steuergeld hatte der Bundesrat gesprochen. Grob gerechnet 68'000'000'000 Franken verteilt auf 8'000'000 Einwohner, das gab 8'500 Franken pro Einwohner. Also weit mehr als eine Putzkraft pro Monat verdiente. Natürlich waren der Grossteil dieses Geldes nur vom Bund abgesicherte Darlehen. Und welch grosse Freude und Beruhigung zu hören, dass Mitte Mai 80% noch nicht abgeholt waren. Ich dachte an die Spar-DNA der Schweizer. Weiter liessen Kantone, Städte und Gemeinden auch Geld verteilen. Die Glückskette hatte 37'000'000.00 gesammelt und lokale Stiftungen machten einiges locker.
«Bitte, Covid-19, wie hoch ist dein Preis? Höre, "follow the money" nenne ich das nach dem Fall der Berliner Mauer eingeführte Wirtschaftsprinzip. Auf ein paar Nullen komme es nicht an und Nullen gebe es überall.» Covids Rachen stand auch Ende 2020 noch offen. Er wollte Fleisch sehen. Zum Glück gab er sich zu Beginn mit alten Knochen zufrieden. Die per 15. Mai erhobenen 1'876 Opfer, sollen durchschnittlich 81 Jahre alt geworden sein und somit das durchschnittliche Lebensalter von 81 Jahren erreicht haben. Meine Lesenden, falls sie zart besaitet sind, so überspringen Sie nun die folgenden Zeilen, denn ich machte wieder eine Überschlagsrechnung und zwar eine sogenannt taktlose. Die vom Bundesrat gesprochen 68'000'000'000 Franken verteile ich auf die 1'876 Todesopfer, das gab 36'247'000 Franken pro Todesopfer.
Mir wurde schwindlig und eng. Ich ging auf die Toilette und holte nachher im Garten Spinat. Wie weiter? Die Grenzen waren geschlossen. Die Flotten der Airlines wurden am Boden gewartet. Die Fahrpläne der öffentlichen Betriebe waren ausgedünnt. Ferien wurden annulliert. Die Lehrerinnen und Lehrer hatten auf webbasierten Fernunterricht umgestellt. Während der Schulfrühlingsferien hatten sie die Kantonalen Betreuungsdienste die Kinder übernommen. Seit dem 12. Mai hüpften die Kinder wieder in die Schule. Nie hatten wir Strom, Gas oder Wasser zu vermissen. Das Abwasser wurde gereinigt und der Abfall, wo immer er anfiel, entsorgt. Die Ordnungskräfte waren auf ihre unerwarteten Zusatzaufgaben, Distanzhalten, Auflösung von Menschenansammlung von über fünf Personen, vorbereitet worden. Es fehlte uns an nichts im täglichen Leben. Die Verwaltung hatte schnell die notwendigen Hintergrundabklärungen getroffen, um die Entscheide der Exekutiven in Form von Notverordnungsrecht, Weisungen und Empfehlungen bereitzustellen.
Ein Drittel aller Arbeitskräfte, knapp 2'000'000 waren von Kurzarbeit betroffen. Die Aufträge der Firmen blieben aus. Wie teuer kam uns die sich abzeichnende Rezession zu stehen? Doch Krisen lösen bekanntlich Entwicklungsschübe aus. Die Mitmenschen wurden solidarischer, junge kauften für alte ein. Väter in HomeOffice machten mit ihren Kindern webbasierte Hausaufgaben. Der Stromverbrauch ging zurück, da viele Produktionsbetriebe eingestellt waren. Folglich wäre damals der Zeitpunkt gewesen, um auf die billige Solar- und Windenergie umzustellen und auf den unnötigen und teuren Verbrauch von fossiler Energien und die defizitären Atomkraftwerke zu verzichten. ???? Ich war alt.
Seit zehn Jahren bekam ich AHV und Pension. Ich meinte der Gesamtbetrag sei hoch, aber er blieb weit hinter dem vom Bundesrat gesprochenen Betrag von 8'500 Franken pro Einwohner zurück. Ich war alt und dankbar, dass alles gut klappte.
Frieden, was hat die CH-Armee damit zu tun?

Meine Geschichte mit der Schweizer Armee
Mit einer gewissen Scheu gestehe ich: «Ich war immer stolz, ich will stolz auf die Schweizer Armee sein können.» Wenn ich damals, mit 75 Jahren an den Vorbereitungen für unser Jubiläum «25 Jahre Abendgebet für den Frieden» arbeitete, tauchten meine Gedanken ab und es entstanden in meiner Phantasie Texte mit ungewöhnlichen Titeln wie: «Meine Geschichte mit der Schweizer Armee». Wann begann diese? Da tauchte der «Ausdruck» Soldatenkind wieder auf. Passte uns das Essen nicht, sagte die Mutter Ende der 1940er Jahre: «Denkt an die Kriegskindern, die müssen oft mit Hunger ins Bett.» Ich war sicher kein Kriegskind, denn wir waren ja verschont geblieben.
Wie sollte ich damals, als die grösste von drei kleinen Kindern die Frage nach meinem Alter beantworten? Das wusste ich doch nicht! "Grosse", die ich nur vom sehen kannte, antworteten für mich: «Sie ist das letzte Soldatenkind in unserem Dorf.» Ich wunderte mich, was dies sei, aber ich wagte nicht zurückzufragen. Wandte ich mich an den Grossvater, so begann er von etwas schönen zu sprechen. Meine Mutter erklärte mir einmal, und dies für immer knapp: «Ja, dein Vater war häufig im Aktivdienst. Zu deiner Geburt kam er einen Tag zu spät oder du einen Tag zu früh. Ich will das Wort nicht mehr hören.» So blieb mir eine kurz Zeitspanne für Phantasien. Ich war ein Soldatenkind, das gefiel mir. Doch zu schnell begannen meine eigenen Sorgen. Ich sollte auf die kleinen Geschwister achten, … , ich sollte gerne in den Kindergarten gehen, … , ich wollte meiner Mutter eine Hilfe sein, … . Kein Raum mehr für Phantasien.
Hinter dem Kachelofen, in der Ecke versteckt, stand der Karabiner. Der beste Ort, immer trocken, sodass der Lauf keinen Rost ansetzte. Waren wir ruhig, durften wir dabei sein, wenn der Vater ihn frisch fettete. Der Karabiner, die Dienstwaffe unseres Vaters hatte einen brauen Holzschaft und einen braunen Tragriemen. Er war grösser als ich, aber ich konnte ihn doch tragen. Für den Nahkampf hätte vorn das Bajonett aufgesetzt werden können. Mir graute. Eine der immer gleichen Erzählung der Mutter liess mich das Schreckliche des Krieges erahnen. Der Grossvater und die Grossmutter wollten nicht darüber sprechen. Wir waren verschont geblieben, hiess es. Bei der Feldarbeit mit den Pferden sang der Vater Soldatenlieder: «Was rasselt i de Strassen, was kommt so flott daher … .» – Die Schweizer Variante dieses Liedes, deckt sich nicht vollständig mit dem im Internet gefundenen Text. – Mehrmals rasselten Tanks (= Panzer) durchs kleine Dorf und beschädigten den Belag unsere asphaltierten Strasse. Ich war stolz auf unsere Armee. Ich hatte Angst vor diesen dröhnenden Riesen und wollte sie doch sehen. «Wir sind gerüstet,» stellten die alten Dorfbewohner fest. Zum Scherz sagten sie: «Pass auf, wenn dich einer überfährt, bist du Brei». Das löste bei mir Alpträume aus, denn die Lasten und Sorgen des Alltags liessen mir schon damals nur Raum für Angst. Später lernte ich, dass diese Panzer damals schon veraltet waren und dingend durch moderne hätten ersetzt werden müssen. Ich habe sie im Sommer 2019 in Museum im Zeughaus bewundert, wo die technische Entwicklung der Ausrüstung und Bewaffnung der Schweizer Armee im 19. und 20. Jahrhundert gezeigt wird.
Ich bewunderte unsere Armee. Kriege schien es immer zu geben. Kampfhandlungen konnte ich mir vorstellen, aber wie wurde Frieden geschlossen? War das überhaupt möglich? Wenn die Mutter und die Grossmutter sich aus dem Weg gingen, konnten sie das Streiten lassen. Gab es dann Frieden zwischen den beiden Frauen? Ist Ausweichen der Anfang von Frieden? – Der Koreakrieg: Die Kämpfe zwischen Nord- und Südkorea wurden nach dem Waffenstillstandsabkommen 1953 eingestellt. Ich ging in die zweite Klasse. Eine entmilitarisierte Zone bildete die Grenze zwischen den Kampfgebieten. Diese wurde durch Militärs aus neutralen Staaten überwacht. Die Schweiz gehörte dazu. Das führte in unserem kleinen Dorf zu Diskussionen und Aufregung. Wieder so eine Dummheit des Bundesrates, hiess es. Ich hatte zu diesem Thema zu schweigen, denn ich verstand nichts. Doch ich begriff, der Krieg, die Tötereien sollten in einem fernen Land, das Korea hiess, wie kurz nach meiner Geburt in Europa, gestoppt und unterbrochen werden. Das nannte man Waffenstillstand. Es wurden viele Vereinbarungen getroffen. Soldaten aus Schweden und der Schweiz sollten diese Abmachungen überwachen. Der Sohn unseres Pfarrers gehörte dazu. Ich war stolz auf unsere Armee, die für den Dienst am Frieden aufgeboten wurde. Ich freute mich, wenn Flugstaffeln über unserer Schulhaus hinweg sausten . – Im Juni 2019 trafen sich Donald Trump und Kim Jong-un an dieser Demarkationslinie von damals. 2020 waren gemäss Internet immer noch fünf Schweizer Militär dort stationiert.
Als Mädchen war ich entschlossen, eine Soldatin zu werden, und nicht wie unsere Nähschullehrerin dem Frauenhilfsdienst beitreten. Blödsinn nannte die Mutter meinen Ansinnen. «Du kannst meinen Karabiner benützen, daran soll dein Plan nicht scheitern,» unterstützte mich der Vater kopfschüttelnd. Er schenkte mir ein echtes Militärtaschenmesser. Wie die Burschen wollte ich zwischen Volksschule und Rekrutenschule die Schiesskurse des Vorunterrichtes besuchen. Mich mit dem Hinweis, «Du hast kein Gewehr» lachend abzuweisen, akzeptiert ich so wenig wie den Hinweis «das gehört sich für ein Mädchen nicht». «Ja, ich wollte Militärdienst leisten, stimmen und wählen können, dies besonders nach dem Aufstand in Ungarn», ich galt als mühsam, denn ich nahm mir das Recht auf das letzte Wort. Dem Frauenhilfsdienst trat ich schliesslich nicht bei, weil die Mutter meine Anmeldung nicht abgeschickt hatte.
Die Debatten um die Anschaffung von Kampfflugzeugen (Hunter, Mirage, Tiger, usw.) verfolgte ich. Ich wollte immer eine starke Armee, aber wozu braucht eine reine Verteidigungsarmee Luftjäger? «Viele flinke kleine Flugzeuge von den Pilatus-Werken in Stans, die verteilt auf all unseren kleinen Flugplätzen Einsatz bereit stehen, wäre das nicht eine gute Sache? Starke Helikopter mit hoher Transport-Kapazität und Drohnen, Siber-Abwehr, eine sichere Stromversorgung usw., all das wollte ich», aber ich hatte nicht mitzureden. Ich will nicht in einem Vakuum, einem Leerraum leben, der zur Besetzung einlädt. Doch was brauchen wir? U.a. Kämpfer, die als Durchdiener an der ETH ausgebildet wurden, die in Freizeitkleidung in Videokonferenzen für neuralgische Punkte nach Lösungen suchen.
2020 ist alles anders als 1945 und doch trügerisch ähnlich. Die Menschenmassen, die Wasser und Brot brauchen und sich nach Frieden sehnen, werden immer grösser. Soldatenkinder ja, Kriegskinder nein. Ich will stolz sein können auf unsere Armee, denn sie beteiligt sich aktiv an einer geordneten Weiterentwicklung der Gesellschaft.
Krieg 1

Meine «Kriegsgeschichte», Teil eins
Anlass zu diesem Text sind meine Überlegungen für mein Statement anlässlich unserem Jubiläum «25 Jahre Abendgebet für den Frieden» im Münster zu Schaffhausen. Die Überschrift mag überraschen, doch ich habe eine persönliche Geschichte mit Kriegen. Lassen Sie mich vorne anfangen.
Ich wurde am 4. Januar 1945 geboren. – Als kleines Mädchen pirschte ich am Sonntagnachmittag gelegentlich leise ins Elternschlafzimmer und schaute meine schlafende Mutter an. Die beiden kleinen Geschwister schliefen und der Vater war mit dem Motorroller unterwegs, um die Felder zu besichtigen. Ich stand da. Sie lag ruhig und atmete gleichmässig. Nach einer Weile öffnete sich mein Mund und begann leise zu betteln: «Muetti, erzähl mir etwas von früher.» Ihre Hand hob die Bettdecke ein wenig und ich durfte zu ihr schlüpften. Sie kannte die Sätze, die sie zu sagen hatte, damit ich Ruhe gab und wieder verschwand, um mit meinen Puppen zu spielen: «Ja damals, du hast in meinem Bauch gestrampelt und dein Vater war Soldat. Wie oft hörte ich das dumpfe Dröhnen von Motoren. Die Amerikaner flogen über unser Haus. Ihr Ziel war Friedrichshafen. Dort warfen sie viele Bomben ab. Die Häuser brannten. Die Kinder wären dankbar gewesen, wenn sie in einer warmen Stube hätten spielen können.» Mama schlief wieder und ich war ein dankbares Kind, das sich in die Stube zurückzog. Zusammen mit meinen Holz-Puppen spielte ich Krieg und betete für Frieden.
Mein Grossvater starb im Sommer 1950. Er erzählte mir viel Schönes, das ich vergessen habe, und er erzählte mir vom Krieg – vom Hunger und der Kälte während dem ersten Welt Krieg – von den Niederlagen der Indianer und von Abraham Lincoln. Ich erahnte nur, wovon er sprach: «Das hätte nicht geschehen dürfen. Fluch den Weissen ihren letzten Spuren.» Wir sagten diesen Satz gemeinsam, das war schön. Viel später, – meine Vater hatte aufgehört Soldatenlieder zu singen – , wenn die Arbeit ihm die letzte Kraft abverlangte, schimpfte er: «Fluch den Weissen ihren letzten Spuren.» Fragte ich ihn in einem ruhigen Moment, wiederholte er zum Thema Indianern und Sklaven stereotyp: «Kind, die wurden zugrunde geschunden, die konnten nicht aufhören. Du und ich, wir bestimmen selber, wann wir aufhören, dann ist nichts schlimm.» Für weitere Informationen verwies er mich an den Herrn Pfarrer. – Ausser den Geschichten rund um Wilhelm Tell lernte ich in der Schule nur viele Jahreszahlen von Schlachten. Das fiel mir leicht, aber … . Die Unruhen in Berlin, der Aufstand in Ungarn, die Ermordung Kennedys, der Widerstand von Steve Biko in einem Slum von Südafrika und vom Martin Luther King den USA, der Krieg in Biafra, all das wollte ich nicht wahrhaben, denn ich glaubte an eine besser werdende Welt.
In diesem Zusammenhang fehlt noch das Gespräch, das ich nachts heimlich, auf dem Kachelofen versteckt, mitangehörte hatte. Der Gesprächspartner meiner Eltern war ein Deutscher, der zwei Monaten vor dieser Episode aus der Internierung in Russland zurückgekehrt war. Seine Tochter war für ein zweimonatiges Familienpraktikum bei uns angemeldet, als der Vater zurückkam. Sie hatte ihn seit acht Jahren nicht mehr gesehen und wollte in seiner Nähe bleiben. Doch er verlangte, dass sie zu uns in die Schweiz kam, denn die Schweiz war das Land seiner Träume. Meine Eltern luden ihn und seine Frau deshalb ein. Ihr Geld reichte nur für ein altes Fahrrad. Damit radelte er zu uns. Er war glücklich und staunte und wollte alles sehen. Zwischen durch half er tüchtig bei der Kartoffelernte und die Gespräche wurden auf den Abend, die Nacht verlegt, wenn alle schliefen. Seine Erzählungen war nicht für Kinderohren bestimmt. Ich stellte mich schlafend, als Mama einen letzten Blick ins Kinderzimmer warf. Hatte sie unsere Schlafzimmertüre leise geschlossen, öffnete ich die Luke im Zimmerboden und kletterte auf den Kachelofen hinunter, bevor die Erwachsenen am Stubentisch Platz nahmen. Sie sind ruhig, bestätigte die Mutter. «Ich wollte nicht vor den Kindern über Russland reden. Stellen sie mir Fragen, denn ich weiss nicht, wie beginnen. Sie müssen nicht zögern,» begann er das Gespräch. Die Eltern fragten und er erzählte und ich hörte mit. Ich kann mich an keine Einzelheiten erinnern. Ein Gefühl von derartiger Grausamkeit musste mich erfasst haben, denn plötzlich floh ins Bett zurück. Dabei knallte der Lukendeckel laut zu und die Mutter kam in den oberen Stock gerannt. «Mama, ein böser Traum hat mich geweckt,» stotterte ich. Die Männer waren nicht Opfer einer momentanen Entgleisung, sondern eines systematischen jahrelangen Quälens!
Nun ein Sprung ins Jahr 1970 in die USA, nach Vietnam und zu Dave. Es hiess und es wurde damals geglaubt, die USA müsste und könnte dem Krebsgeschwür «Kommunismus» die Stirne bieten. Das war der Grund für ihre militärische Präsenz in Vietnam, die schleichend zu einem grausamen Krieg anwuchs, dem viele Söhne zum Opfer fielen. Dave gehörte dazu. Wir hatten uns nicht gekannt, aber wir hatten uns verliebt, an einem Hamburgerstand, wo viel los war. Dave und ich standen in der Menge. Er fragte mich, ob ich schon in Hawaii gewesen sei. Ich schüttelte den Kopf. Er fragte: «Willst du hin gehen?» Ich nickte und schaute in seine blaugrünen Augen. Wir waren verliebt. Wir durften keine Zeit verlieren. Dave wurde abgeholt. Er musste auf die Basis zurück. Vietnam rief. Er konnte kaum sprechen vor Aufregung. Er fasste meine Hände. Dann machte er ein Photo von mir und schrieb meine Adresse auf. Er streckte mir ein Paket hin: «Das ist meine Fahne. Ich habe sie als Auszeichnung erhalten, denn ich konnte nicht nach Hawaii, weil niemand auf mich wartete. Jetzt ist alles anders» Er schaute auf das Blatt: «Sie werden dich benachrichtigen. Er legte den Arm sachte um mich. In einem Monat treffen wir uns in Hawaii. Schön, dass es dich gibt.» Wir standen in der Warteschlange vor der Telefonkabine. Er sagte immer wieder meinen Namen «MAJA» und schaute mich an. Plötzlich waren wir an der Reihe. Er wählte die Nummer seiner Mutter. Er gab mir sofort den Hörer, und ich sagte etwas, und sie sagte auch etwas und schluchzte. Dave sagte: «I'm so happy,» und hängte auf. Wir umarmten uns. Er hatte Tränen in den Augen: Maja wartet auf mich. Wir waren glücklich. Glück kennt keine Zeit. Ein Auto fuhr vor. Tschüss, dann in Hawaii. Dann in Hawaii. Alle winkten. Eine Stimme sagte leise: »Viele kommen nicht zurück.» Wir waren glücklich. Ich wurde benachrichtigt, Dave kam nicht zurück. Der Krieg war für mich brutale Realität geworden.
Ich entschloss mich, etwas für den Frieden zu tun. Was? Sofort, immer, was? Jeden Tag ein kurzes Gebet für den «Frieden» und jeden Tag das Wort «Frieden» einmal laut aussprechen.
Meine Grossmutter hatte immer, wenn sie die Arbeit unterbrach, halblaut, mit einem Blick nach oben, gesagt: «Gott segne diese Arbeit, Gott gebe uns seinen Frieden.» Ich tue das seit dem Tod von Dave auch oft. Unser Abendgebet für den Frieden ist für mich eine Fortsetzung der Gebetsreihe meiner Grossmutter. Die alten Frauen, die für den Frieden beteten, wurden vom alten Pfarrer einmal jährlich zu Kaffee und Kuchen ins Pfarrhaus zum Plaudern eingeladen. Das war früher.
Das Studium: Es blieb beim Vorsatz

Ende August "Pius hat angerufen. Erinnerst du dich nicht an ihn. Sie haben doch vor vielen Jahren mit uns im Garten Kaffee getrunken. Ich, der radikale Gegner der Energiewende habe eine halbe Stunde mit ihm über Ernergiefragen gesprochen. Er wohne im Schatten der AKWs und sie würden ähnlich denken. Hier ist seine Nummer. Am nächsten Tag rief ich Pius an. Eine Frauenstimme antwortete, Regula, spontan war mir der Name eingefallen. Pius komme erst am Abend von der Baustelle zurück. Zwei Besuchstermin passten nicht, obwohl die beiden an den Wochenenden immer zuhause sind. Dann klappte es spontan. Im Zug nach Bern zu meinen Enkelinnen, dachte ich, den ganzen Tag mit meinem Sohn, das wird mir zu fiel. Achtung, um einem Sohn zu gefallen, hatte ich das Handy bei mir und rief Pius an.
Nach viel Hin und Her zwischen Regula und mir klappte es. Ein alter Pius holte mich alte Frau ab auf dem Bahnhof ab. Wir kannten uns spontan. Auf meine Frage nach der Studienzeit, er habe das Studium genossen. Das sei seine beste Zeit gewesen. Zwei Jahre Paris, ein Jahr Zürich, ein Jahr Florenz und dann der Abschluss in Zürich. Die Stelle hier in Aarau habe sofort erhalten, da er hier durch Vertretungen bekannt gewesen sei. Das sei die beste Zeit gewesen, ohne zu sprechen schwelgte er sichtlich in seinen Erinnerungen. Dann weiter, Aarau habe immer noch 20'000 Einwohner wie damals, aber die Verwaltung und die Schulen im Zentrum seinen durch Neu- und Erweiterungsbauten modernisiert worden. Dann Kaffee im Garten, Tee im Stübchen und der stichworthafte Austausch der Lebensgeschichten. Er gab mir die Telefonnummern von drei Kollegen und ich lud die beiden zu einem Besuch in Schaffhausen ein. Seine Antwort, gerne, aber nicht sofort, erst wenn sein Umbau fertig sei. Dank Corona haben wir wieder "Hausarrest" und ich habe die Chance das Jahr 2020 fertig zu tippen.
Krieg 2

Meine «Kriegsgeschichte», Teil zwei
Das bisschen beten war mir zu wenig. Die besuchten Wochenend-Seminare zum Thema Frieden waren mir zu vortragslastig. Die beiden Friedenswochen in Holland empfand ich als zu theoretisch und zu «schön». Nie war jemand da, der im Krieg gekämpft, oder wenigstens jemanden im Krieg verloren hatte. Ich wollte über töten und sterben im Feld nachdenken. «Eine Kugel kam geflogen, gilt sie dir oder mir? Ihn hat sie hingerissen, er lag zu meinen Füssen, derweil ich eben ladt (genauen Text siehe Internet).» Der Vater hatte dieses Lied oft bei der Feldarbeit gesungen. Auf meine Fragen antwortete er nur: «Schweig, mein liebes Plappermaul, wir sind verschont geblieben."
Ich beteiligte mich an einem von PAX CHRISTI (siehe Internet: internationale katholische Friedensbewegung) organisierten Sternmarsch für Frieden und Menschenrechte in Spanien unter General Franko und an einem zweiten im geteilten, kriegerischen Irland. Es war nicht ganz einfach. PAX CHRISTI war damals noch eine sehr katholische Jugendbewegung. Doch schweigend von Ort zu Ort zu wandern, gefiel mir sehr gut. Von Kirchgemeinden empfangen zu werden, gemeinsam zu essen und von Gemeindemitgliedern für eine Nacht eingeladen zu werden, erstaunte mich immer wieder neu. Unser Besuch soll ihnen Hoffnung gebracht haben. Das berührte und beglückte mich nachhaltig. Meine Besuche im Kongo bringen angeblich auch Hoffnung.
Aus Spanien brachte ich eine warme Schafwolljacke mit, die mir eine alte Frau schenkte, weil sie mich in ihr Herz geschlossen hatte. Ich trage sie bis heute jeden Winter und sie wird mich überdauern. In Nordirland, in Belfast hatte ich mich der ersten Körpervisitation durch Männer zu stellen. Als der zweite festgestellt hatte, dass eine der anwesenden Personen eine Frau ist, stoppte ich den dritten sofort freundlich und klar. Richtig, zur Gruppe der sieben Besucher gehörte ich, eine Frau. Ich wünsche allen Menschen, dass sie stopp sagen können.
Dann die Flüchtlinge aus Ungarn, Tibet, Zentralamerika, der Tschechoslowakei, … von überall her. Sie aufzunehmen schien mir einseitig. Ich dachte an die vielen, die ihr Daheim nicht verlassen wollten, nicht verlassen konnten. Ihnen wollte ich beistehen.
Im Frühling 1993 oder 1994 schloss ich mich einer Gruppe Freiwilliger an, die im zerstörten Pakraz (Kroatien) beim Wiederaufbau halfen. Wir waren vor der Abreise in Zürich schriftlich ermahnt worden: Wegen Sprengbombengefahr in Kroatien nichts zu berühren, auch in Zagreb nicht. Verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei zu melden. – Wir waren in der Frühe mit dem Nachtbus von Zürich kommend in Zagreb angereist. Um 9 Uhr wurden wir abgeholt. Der Zug nach Pakraz fuhr erst zweit Tage später. Wir hatten vor unserem Einsatz, den Vorbereitungskurs zu besuchen. Ich schaute mich mit meinem Gepäck auf dem Rücken zaghaft um: «Alltag, gewöhnlicher Alltag». Die Strasse war gesäumt von abholbreitem Mühl. Viele hastige Passanten. Eine junge Frau steckte etwas in einen Abfalleimer neben mir. Zufällig patrouillierten zwei Uniformierte vorbei. Sie bedankten sich für meinen Hinweis und zeigten mir ihren Fund: Eine Sprengbombe! Zagreb im Krieg, ich hatte verstanden. Von der Vorbereitung, wir sassen ca. 20 Leute an einem ovalen Tisch. 2020 erinnerte ich nur, dass in Pakraz eine gemischte Bevölkerung während Jahren friedlich zusammengelebt hatte, und dass erst durch die Kampfhandlungen Angst und Misstrauen zwischen den verschiedenen Ethnien geschürt worden seien. Das Dorf sei teilweise vermint. Wir sollten nur die Ashpaltstrassen benutzen und keine Umwege scheuen. Unsere Aufgabe sei, den Dorfbewohnern beim Wiederaufbau ihrer zerstörten Häuser zu helfen. – Nach kurzer Zeit leerten zwei Frauen einen Sack mit meist angebrochenen Medikamenten auf den Tisch. Es waren Spenden, die nicht gebraucht werden konnten. Unsere Aufgabe war es, diese zu sortieren: Lose Pillen und Tabletten für die Giftentsorgung in einen Eimer, dazu kamen die angebrochenen Blistern entnommenen Medikamente; Fläschen und Salben in eine Holzkiste, Verpackungen und Patienteninformationen zum Papier, der Rest übriger Abfall. Ich schämte mich für die Spendenden. Was dachten sie?
Pakraz: Die Arbeit vor Ort gefiel mir. Ich wurde geschätzt, weil ich zupacken konnte. Häufig machte ich auf Wunsch der Dorfbewohner freiwillig eine Abendschicht. Dann kamen wir ins plaudern. Einige kannten ein paar Brocken Deutsch, da sie als Gastarbeiter in Deutschland Geld verdient hatten. Furchtbar müssen die Kämpfe gewesen sei. Schiessen oder erschossen werden, das war die Devise. Der erste Schuss sei der schwierigste. Ein Mann, dem all mit Respekt und Hochachtung begegneten, sprach nie. Er wollte mit mir allein etwas trinken. Ich zögerte, aber ich wurde dazu ermutigt. Wir tranken in einem halb zerstörten Restaurant heissen Tee. Meine Wahl erleichterte ihn. Er lud mich auf den nächsten Abend wieder zum Tee ein, sonst schwieg er und ich schwieg auch. Wieder Tee am nächsten Abend. Ich verspürte, dass er mir etwas anvertrauen wollte. Wieder Tee, wieder Tee, dann unerwartet unseres letztes Rendez-vous. Er erklärte mir, am folgenden Tag müsse sein Knabe für unbestimmte Zeit nach Zagreb ins Spital. Sein rechtes Bein brauche dringend operiert zu werden. Der Knabe gehe nur, weil er ihm versprochen habe, ihn jeden Tag zu besuchen. Ob ich einverstanden sei, dass er mir nun alles erzähle. Ich nickte. Er wechselte die Sprache und hauchte Wort für Wort vor sich hin und starrte auf den Boden. Ich verstand seine Worte nicht. Er fasste nach meinen Händen. Tränen rollten über seine Wangen. Ich setzte mich neben ihn auf die Bank. Sein Körper sank in meine Arme. Er weinte und sprach. Es durchschüttelte seinen Körper. Ich umfasste ihn kräftig. Er schwitzte und zitterte. Ich hielt ihn, bis er sich beruhigt hatte. Wir sassen ruhig da, bis ich ihm mit einem leichten Stoss zurückholte. Er hauchte Danke und nochmals Danke. Dann lächelte er verlegen und verabschiedete sich. Nach einer Weile verliess ich die zerstörte Gaststätte auch. Die Bedienung sagte: «Er ist ein Held.»
Wegen Bombendrohungen wurden wir anfangs der dritten Woche nachts um 11 Uhr mit einem Bus evakuiert: «Hastig etwas Warmes anziehen, euren Besitz auf den Esstisch legen und weg.» Wir hörten in der Ferne Bomben einschlagen. Die Nacht verbrachten wir in einer abgelegenen Villa. Viele blieben im Salon sitzen und diskutierten leise. Ich war zu müde, legte mich auf ein fremdes Bett und schlief. Am folgenden Tag wurden wir auf Umwegen nach Zagreb in einen grossen überfüllten Luftschutzkeller gebracht. Am folgenden Morgen wurden wir aufgefordert, in unsere Heimatländer zurückzureisen. Ein Zug nach Wien stand bereit.
Am 31. August 1995 fand in Schaffhausen die Demonstration «Stopp dem Völkermord in Bosnien» statt. Darnach wurden verschiedene Aktions-Gruppen gebildet, so von Pfarrer Leu die Gruppe Abendgebet für den Frieden, die sich seither jeden dritten Donnerstag um 18.45 im Münster in Schaffhausen trifft.
Krieg 3

Meine Kriegsgeschichte, 1998, Teil drei
Es hatte geklappt, unser Sohn konnte 1998 ein Austauschjahr in Australien in einer Stadt am Meer machen. Und dies in einer Schule, die ihm die Möglichkeit bot, Fussball zu spielen. Er staunte, wie alle seine Wünsche in Erfüllung gingen. Warum? Ich hatte ihn am letzten Tag per Telefon angemeldet. Dies gelang, da die Telefonistin das Formular innert weniger Minuten persönlich vollständig ausgefüllt hatte. Ich war in der Lage, die Wünsche unseres Sohnes ohne Zögen anzugeben. Das war am Montag Morgen und am Mittwochnachmittag um 14 Uhr hatte er das Vorstellungsgespräch. Auch dies klappte. Anfangs Januar 1998 flog er nach Australien. Zum Abschied sagte er: «Mama, no news is good news.» Ich wünschte mir jeden Monat eine Postkarte, und so war es dann.
Einschub: Die Kunst der kleinen Schritte von Antoine de Saint Exupéry
Ich bitte nicht um Wunder und Visionen, Herr, sondern um die Kraft für den Alltag. Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte. Mach mich erfinderisch, um im täglichen Vielerlei und Allerlei meine Lektionen zu erkennen, von denen ich betroffen bin. Mach mich griffsicher in der richtigen Zeiteinteilung. Schenke mir das Fingerspitzengefühl im Herausfinden, was erstrangig und zweitrangig ist.
Lass mich erkennen, dass Träume nicht weiterhelfen weder über die Vergangenheit noch über die Zukunft. Hilf mir das Nächste so gut wie möglich zu tun und die jetzige Stunde als die wichtigste zu erkennen. Bewahre mich vor dem naiven Glauben, es müsste im Leben alles glatt gehen. Schenke mir die nüchterne Erkenntnis, dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge und Rückschläge eine selbstverständliche Zugabe zum Leben sind, durch die wir wachsen und reifen. Erinnere mich daran, dass das Herz oft gegen den Verstand streikt. Schicke mir im rechten Augenblick jemand, der den Mut hat, mir die Wahrheit in Liebe zu sagen. Ich möchte Dich immer aussprechen lassen. Die Wahrheit sagt man nicht sich selbst, sie wird einem gesagt.
Verleihe mir die nötige Phantasie, im rechten Augenblick ein Päckchen Güte mit oder ohne Worte an der richtigen Stelle abzugeben. Mach aus mir einen Menschen, der einem Schiff mit Tiefgang gleicht, um auch die zu erreichen, die unten sind. Bewahre mich vor der Angst, ich könnte das Leben versäumen. Gib mir nicht, was ich wünsche, sondern was ich brauche. Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte. Einschub Ende.
Im Februar 1998 reiste ich nach Indien, um die Schwestern unserer weggelaufenen Adoptivtochter aus Tibet zu besuchen. Am 15. September 1995 hatte ich sie das letzte Mal gesehen. Am 15. September 1995 war das erste Abendgebet für den Frieden und am 17. September 2020 feierten wir das Jubiläum 25 Jahre Abendgebet für den Frieden. Sie, meine geehrten Lesenden können nun erahnen, warum mich dieses Jubiläum besonders nachdenklich stimmte. Vor 25 Jahren hatte ich unsere Tochter das letzte Mal gesehen, das Mädchen, das nicht unsere Tochter sein wollte. Vielleicht schreibe ich später mehr darüber. Zur Frage nach dem Schicksal der unterdrückten Völker, wie z.B. der Tibetischen Völker will und kann ich nichts sagen.
Im Mai 1998 reist ich mit Peace Watch Switzerland ins Menschenrechtszentrum von Samuel Ruis in San Cristobal in Chiapas in Süden von Mexiko. Unsere Aufgabe hiess «Schutz durch sehen und gesehen werden». Als neutrale Beobachter durften wir uns nicht einmischen. Wir hatten zu beobachten und unsere Beobachtungen nachher im Menschenrechtszentrum zu melden. Wir hatten z.B. die motorisierten Strassenpatrouillen und Patrouillen zu Fuss zu zählen und zu notieren: Mindestens Tag, Zeit, Anzahl, Ausrüstung. Nur schon durch unsere Präsenz soll die Lage ruhiger geworden sein. Die Leute sagten: Wenn ihr da seid, passiert nichts und wir können ruhig schlafen. Mein erster Einsatz war in Acteal, wo am 22. Dezember 1997 während einem Gottesdienst 42 Menschen, hauptsächlich Frauen und Kinder ermordet wurden. Die Kirche, in der jener Gottesdienst gefeiert worden war, ein schmuckloser grosser Bretterverschlag mit einem Wellblechdach. Ich empfing einen grossen Schlüssel, um die Türe von innen abzuschliessen. Das war meine Unterkunft. Zwei Tische, auf dem einen schlief ich, auf dem andern lag mein Rucksack. Die mir zugeteilte Begleitfrau reiste an unserem Ankunftstag weiter. Ich blieb. Ich dachte an Antoine de Saint Exupéry und schlief am Ort des Massakers gut. Die Leute kamen mir nah, sie brachten Wasser und Nahrung. Wir hatten keine gemeinsame Sprache. Nach zwei Wochen und drei Tagen hielt ein Lastwagen und bot mir eine Rückreise nach San Cristobal an, und es war für alle richtig, dass ich die Fahrt akzeptierte. Ein paar Frauen in farbigen Kleidern mit ihren Kindern sangen mir ein Segenslied. Vom zweiten Einsatzgebiet habe ich keine klaren Erinnerungen, ich weiss nur noch, dass wir mehrere Stunden von einer Bushaltestelle ins Hinterland wanderten. Wir waren zu Dritt. Zwei ganz junge Europäerinnen, deren Sprache ich nicht verstand, – ich fühlte mich einsamer als, wenn ich allein gewesen wäre. Schnell, schnell reiste ich nachher in die Schweiz, denn ich war ja berufstätig. Zur Frage nach dem Schicksal der unterdrückten Völker will und kann ich nichts sagen.
Im Oktober 1998 machte ich die erste Erkundungsreise in den Kongo. Heidi Kabangu-Stahel aus Hallau hatte mich eingeladen ihre vor mehr als zwanzig Jahren gegründete Schule «Les Gazelles» zu besuchen. Der erste Kongo Krieg tobte nur noch im Osten. Kinshasa war ruhig und Frau Kabangu hatte gewagt, nach drei Jahren «Zwangsurlaub» in der Heimat, die Leitung ihrer Schule wieder zu übernehmen. Die Regenzeit hatte eingesetzt. Die Fussgänger bewegten sich am «Strassenrand» und suchten feste Stellen für ihre Füsse. Ich dachte an Antoine de Saint Exupéry. In der Innenstadt gab es ein paar asphaltierte Strassen, wir hatten mich dort bei der Schweizer Botschaft anzumelden und meinen Rückflug zu bestätigen. Es hiess, der Kongo sei ein reiches Land, trotzdem «zur Frage nach dem Schicksal der unterdrückten Völker will und kann ich nichts sagen». Zum Glück musste, durfte ich nach einer Woche wieder heim fliegen. Dies ist das Ende meiner praktischen Kriegserfahrungen.
Kurz vor Weihnachten 1998 kam unser Sohn aus Australien zurück. Ich kenne Krieg seither nur noch aus Berichten in den Massenmedien.
Jubiläum "25 Jahre Abendgebet für den Frieden" , viel Arbeit

Viel Arbeit
Als ich begann, den Abschnitt Jubiläum «25 Jahre Abendgebet für den Frieden» zusammenzustellen, umfasst der entsprechende Ordner 325 Objekte mit einer Gesamtgrösse von 124.9 MG (Megabytes). Viele Dokumente fehlten, denn ich hatte vieles laufend gelöscht. Der Abschlussorder hat nun 17 Objekte mit einer Grösse von 820.7 kB (Kilobytes). Beide Ordner enthalten keine Bilder. Unzählige Telefonate, nicht gezählte Mails, besuchte Veranstaltungen, persönliche Besprechungen, viel suchen und lesen im Internet, in Zeitungen und Büchern. Zusagen, Absagen, …. Viel Arbeit
Das Studium

Jubiläum "25 Jahre Abendgebet für den Frieden", Kommentare von Dritten

Kommentare vor, während und nach dem Jubiläum
Covid-19: Anfangs 2020 hatte ich noch mehr Fragen als sonst, und ich fühlte mich krank. Doch auch in den schwierigsten Phasen haben mich die Anstrengungen für das Jubiläum “25 Jahre Abendgebet für den Frieden“ mit einem Glücksgefühl erfüllt.
Mag sich um meinen Glauben sorgen, wer will, mein Gott hat es nicht nötig, dass ich ihn öffentlich lobe und bekenne. Er gab und gibt mir Ruhe und Gelassenheit und mit diesen Geschenken kann ich weitermachen. Für den Frieden zu beten, ist meine wichtigste Aufgabe. Die Engel sangen zur Geburt von Jesus Christus: „Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.“ Diese Worte sagte mein Mund vor, während und nach dem Jubiläum. Meine Sprechwerkzeuge formten sie, die Worte blieben nicht in den Gedanken, in den Träumen hängen. Sie waren, sind und werden durch das Aussprechen Realität.
VOR dem Jubiläum: Lesen Sie nun den Projektbeschrieb, entstanden während meiner Kongoreise, dann Abschiedsworte und Worte des Bedenkens:
Projektbeschrieb Friedenspfahl auf dem Areal des Münsters an Mattias Eichrodt, Pfarrer der Kirchgemeinde St. Johann-Münster
Ziel/Absicht des Friedenspfahls:
Unsere Absicht: Am 18. September 2020 begeht die Gruppe Abendgebet für den Frieden das 25-jährige Bestehen des Abendgebets für den Frieden. Damals war es der Bosnienkrieg, der die Menschen aufrüttelte und zum regelmässigen Bitten um Frieden führte. 25 Jahre später ist die Welt leider nicht friedlicher geworden – im Gegenteil. Der Pfahl soll an die 25 Jahre des Abendgebets erinnern und daran, dass wir in unserer Friedensarbeit weiterfahren, um für Frieden auf Erden zu bitten.
Allgemeine Absicht: Frieden liegt in unser aller Verantwortung. Deshalb soll der Pfahl den Betrachtenden einen Impuls geben, ein Merk-Mal sein.
Grösse und Aussehen des Pfahls: Der Friedenspfahl ist ein genormter Pfahl von einer Grösse von 2,5 m, hergestellt aus Lärchenholz. Auf Acrylglas-Schildern trägt er die Aufschrift: Möge Friede auf Erden sein. Der Pfahl kann roh oder weiss bemalt sein. Wir möchten einen weissen Pfahl, der die Aufschrift in allen vier Landessprachen trägt sowie zusätzlich auf Englisch.
Zusätzliche Tafel: Eine Tafel in der Grösse von XX x XX cm aus Metall soll folgende Aufschrift tragen: «Black Elk zum Frieden: Der erste, der wichtigste, ist der, welcher in den Seelen der Menschen einzieht, wenn sie ihre Verwandtschaft, ihre Harmonie mit dem Universum einsehen und wissen, dass im Mittelpunkt der Welt das grosse Geheimnis wohnt und dass diese Mitte tatsächlich überall ist. Sie ist in jedem von uns – dies ist der wirkliche Friede. Der zweite Friede ist der, welcher zwischen Einzelnen geschlossen wird, und der dritte ist der zwischen den Völkern. Aber vor allem sollt ihr sehen, dass es nie Frieden zwischen Völkern geben kann, wenn nicht der erste Friede vorhanden ist, der – wie ich schon sagte – innerhalb der Menschenseele wohnt!» Dazu die englische Version: «The first peace, which is the most important, is that which comes within the souls of people when they realize their relationship, their oneness, with the universe and all its powers, and when they realize that at the center of the universe dwells the Great Spirit, and that this center is really everywhere, it is within each of us. This is the real peace, and the others are but reflections of this. The second peace is that which is made between two individuals, and the third is that which is made between two nations. But above all you should understand that there can never be peace between nations until there is known that true peace, which, as I have often said, is within the souls of men.» Darunter folgende Zeile: 25 Jahre Abendgebet für den Frieden, Schaffhauser Münster, 18. September 2020
Finanzierung: Gruppe Abendgebet für den Frieden
Unterhalt: Gruppe Abendgebet für den Frieden
Standort: Siehe beigelegte Fotomontage
Mail gesendet: Sonntag, 21. Juni 2020 um 17:12 Uhr
Betreff: Ein jegliches Ding hat seine Zeit
Liebe Maja, liebe , liebe
Diese Mail liegt seit gestern Morgen in meinem Entwürfe-Ordner. Ich hatte sie geschrieben, nachdem ich durch Margrits Antwort auf Majas Bitte, den Spruch von Black Elk noch einmal zu überdenken, überhaupt erfahren habe. Maja hat mir ihre Bitte nicht geschickt.
Ich wollte im Laufe des gestrigen Tages noch einmal überprüfen, ob der Inhalt noch stimmt für mich. Mittlerweile wurde ich mit weiteren Mails überhäuft, die zum Teil zu weiteren Stressreaktionen geführt haben. Ich schlafe nach wie vor schlecht, und mittlerweile raubt mir die Angelegenheit auch den Atem und beim Gedanken daran zittere ich. Kurz: Mein vegetatives Nervensystem ist vollkommen überreizt.
Nach allem, was in den letzten Tagen gelaufen ist und was ich im Januar/Februar erlebt habe, und nach der Reaktion meines Körpers darauf, ist es für mich Zeit, Abschied zu nehmen von der Gruppe Abendgebet für den Frieden. Und zwar ab sofort.
Natürlich hat jede von uns das Recht, ihren Gefühlen nachzugeben. Aber genau so habe ich das Recht, nun meine Verantwortung mir und meinem Körper resp. meiner Gesundheit gegenüber wahrzunehmen. Ich war vor meinen Ferien ziemlich am Anschlag, mittlerweile geht es mir noch schlechter. Das darf einfach nicht sein. Meine Aufgabe besteht nun darin, den von Black Elk angesprochenen ersten Frieden wieder herzustellen. Ich bitte euch deshalb, mich mit weiteren Mails rund um das Jubiläum und den Friedenspfahl/Text für die Tafel zu verschonen. Ich habe noch eine Woche, um mich zu erholen, und diese benötige ich dringend.
Ich danke euch für all die Erlebnisse und Erfahrungen in den letzten fast 12 Jahren. Es gibt gewisse Highlights, die einfach nicht zu übertreffen sind, beispielsweise das Friedensgebet mit den Indern oder das Abschiedsessen mit Martin Bühler im Haberhaus. Peter und Maja möchte ich noch einmal herzlich danken für die Gastfreundschaft, die ich immer wieder geniessen durfte. Susi danke ich dafür, dass sie jedes Mal so fleissig die Stühle und Kerzen aufgestellt hat, ich war meistens zu spät, um ihr zu helfen. Margrit danke ich für all die wunderbaren Texte, die sie immer so trefflich zu finden wusste, gepaart mit eigenen Gedanken. Sie haben mich immer zur Ruhe gebracht, war der Tag noch so anstrengend.
Nun ist es Zeit fürs Aufhören. Ich wünsche euch von ganzem Herzen alles Gute
Béatrice
Mail gesendet: Sonntag, 28. Juni 2020 um 11:33
Re: Unsere Erwartungen an die Grussworte der Pfarrherren
Danke, liebe Maja, ...aus Abend wird Morgen...
Hier meine Gedanken:
Wir Menschen müssen zunehmend in einer Welt mit grosser global vernetzter Komplexität zurechtkommen. Weltweite Notsituationen, ausgelöst durch Gewalt, Ausbeutung von Mensch und Natur, sowie durch Hungersnot oder auch durch Naturktastrophen, erschütternd jegliches gesellschaftliche Gefüge. In immer grösserem Masse verschieben sich Machtverhältnisse, angetrieben durch rücksichtslose Profitgier. Die Überschaubarkeit löst sich in beängstigendem Weise auf.
Was kann uns angesichts dessen im alltäglichen Leben Halt und Zuversicht geben? Wir sind hier in unserem Alltag zunehmend mit Fremdem konfrontiert - Menschen aus kriegs- und krisengeschüttelten Ländern, fremde Sprachen sprechend, aufgewachsen in meist völlig anderem sozialem Kontext und geprägt durch fremde Kulturen, suchen hier eine neue, menschenwürdige Existenz.
Diese Tatsachen fordern uns Einheimische sehr persönlich heraus, weil Unsicherheit, Ohnmacht oder auch Ängste allem so sehr Fremden gegenüber in unseren Gefühlen auftauchen. In unserem verletzlichen Menschsein sind wir so sehr so Vielem ausgesetzt.
Welche greifbar hilfreichen Botschaften aus der Bibel können uns jetzt hierbei helfen mit den z.T. wiedersprüchlichen Empfindungen wie Mitgefühl und Unsicherheit, Unverständnis und Erbarmen zu Recht zu kommen?
Was kann mir als einzelner Betroffenen, mit meinem Bedürfnis nach überschaubarer Sicherheit und in meinem Inneren mit den gegensätzlichen Gefühlen ringend, den nötigen, mich stärkenden und vertrauensbildenden Halt geben? Was kann uns - als biblische Ermunterung - helfen, damit wir uns durch den fremden Nächsten in unserem Umfeld nicht bedroht fühlen?
Welche aufbauenden, verheissungsvollen Bibelworte unterstützen mich/uns im suchenden Streben nach friedvollem Umgang mit der Unruhe in mir selbst und im Kollektiven um mich herum? In Sinne von "Frieden bilden in mir, Frieden schaffen um mich".
Soweit, liebe Maja, mein Gedankenbeitrag. Du musst den Text nicht 1:1 übernehmen, kannst wenn's dir wichtig erscheint noch Eigenes hinzufügen.
Lieben Gruss und schönen Sonntag! Margrit
Mail gesendet: Dienstag, 21. Juli 2020 um 22:59 Uhr
Betreff: Re: TREFFEn
Liebe Maja,
danke für deine Antwort. Schade, dass du dich nicht eher gemeldet hast. Dein Schweigen - besonders auch bei unserem Treffen im Manor Restaurant, wo du dich leider nicht dazu geäussert hast, welche Wünsche und Bedürfnisse du bezüglich Zusammenarbeit & gemeinsamer Vorgehensweise beim Organisieren der Jubifeier hast - das ist seltsam und unerklärlich für mich. Und irgendwie belastend, weil ich, als Teil von unserem Grüppchen, somit nicht weiss, woran ich bin. Mein Eindruck ist, dass du auch nicht daran interessiert warst, auf meine - für unser gutes Zusammenarbeiten und -organisieren wichtigen Fragen, welche ich, mit Herzensengagement vorbereitend, auf unser Treffen an alle schrieb, zu antworten. Es scheint zu wenig Vertrauen vorhanden zu sein, um dich uns im Gespräch offen mitzuteilen. Ohne Offenheit gelingt keine gute Zusammenarbeit. Ich vermisse seit geraumer Zeit zunehmend ein ehrliches aufrichtiges sich äussern, eine verbindliche wohlwollende Klarheit und fühle mich, so wie sich unser Miteinander entwickelt hat, sehr unbehaglich. Dass Béatrice zurück getreten ist, empfinde ich als grossen Verlust.
Heute traf ich mich mit Susi zusammen, und ich teilte ihr meine, nach wochenlangem Ringen, getroffene Entscheidung mit: Mich von euch zu trennen und zwar per sofort. Mein Körper zeigte seit 14 Tagen heftige Rückenschmerzen, dazu noch ein blockiertes Verdauung-System, wie seit langem nicht mehr. "Trage dir Sorge und werde gesund. Trage keine zu grossen Lasten..." wünschst du mir! Ja, es ist leider so, dass mein Mitengagiertsein im Abendgebet zur Belastung geworden ist! Die Motivation ist (wie ich bereits im Mail vor dem Treffen im Manor schrieb) durch die sich wiederholenden Kompliziertheiten gänzlich verloren gegangen. Damit ich mich in einem Team motiviert und wohlfühle, braucht's gegenseitige vertrauensvolle Offenheit und Verlässlichkeit (z.B. besprochene Beschlüsse haben zu gelten).
Von Susi konnte ich mich heute persönlich verabschieden - von dir tue ich das halt nun per Mail.
All die Jahre meines - in dieser Art - besonderen Engagements gehören zu einem wertvollen Teil meines Lebens. "Der erste Friede, der wichtigste, ist der, welcher in die Seelen der Menschen einzieht..." Manchmal heisst "Frieden finden" etwas loszulassen - wie ein Kleid, das nicht mehr passt und wo ein Zurechtschneidern nicht möglich ist. Ich bin in meinem Privatleben mit ernsten Zukunftsfragen bis auf weiteres sehr intensiv gefordert. Hier brauche ich vor allem anderen meine inneren und äusseren Kräfte. Komplikationen in einem weiteren Lebensbereich strapazieren mich zu sehr. Eine weitere Unruhe bringt inneren Unfrieden.
DANKE für das jahrelange in guter Weise miteinander für ein grösseres Ganzes besorgt sein - und nochmals Danke auch für alle deine Gaben aus eurem Garten! Der unserige ist leider vom häufig, in naher Umgebung gespritzten Rebengift betroffen! Ich wünsche dir einen gefreuten Erfolg beim Realisieren der Jubiläumsfeier, für welche Du mit Anderen den Grundstein gelegt hast. Und möge dein Körper heilende Besserung finden! Schöne Ferien und lieben Gruss,
Margrit
Betreff: AW: Friedenspfahl
Liebe Maja
Nicht alles, was sich Religion nennt und Spiritualität und Frieden ist neutral und gut – dem nachzugehen ist Aufgabe der Fachstelle Religionen und Weltanschauungen, die ich betreue. Auch wenn sie von der Kirche finanziert ist, macht sie vor unserer und anderen Kirchen nicht Halt, das nur nebenbei.
Ich wollte darauf hinweisen, dass die Aktion Friedenspfähle nicht einfach neutral ist, sondern einen weltanschaulichen Hintergrund hat. Der zumindest bedacht werden sollte. Friedenswege und Friedensbrücken errichtet z.B. auch die Organisation des verstorbenen indischen Gurus Sri Chinmoy und mit einer Akkreditierung bei einer der UNO-Unterorganisationen machen auch noch andere umstrittene spirituelle Organisationen Werbung – das ist also kein Qualitätsausweis.
Masahisa Goi (1916-1980) lebte als junger Mensch im faschistisch geprägten Japan und kam nach dem Krieg mit dem Kriegstrauma nur schwer zurecht. Er wurde zunächst Mitglied bei Seicho-no-ie, einer religiösen Gemeinschaft, deren Lehre und Praxis Elemente aus Shintoismus, Buddhismus, Christentum und der New-Thought-Bewegung vereint. Der Mensch soll seine eigene Gottnatur entdecken und so zu sich selbst finden. Sünde gibt es nicht, nur Schuldgefühle. (Meine Meinung dazu: Auch so kann man versuchen, mit der Schuld an Kriegsverbrechen umzugehen.)
Das modernste Element aus der westlichen Esoterik ist dabei, dass man nur richtig denken muss, um Probleme zu lösen. Das entnahm Seicho-no-Ie der «Christian Science», eine Gruppierung, laut der man Krankheit einfach wegdenken kann.
Diese Art des Denkens liegt auch der Idee von Byakko Shinkokai zugrunde, der «Gesellschaft des weissen Lichts», mit der sich Masahisa Goi später selbständig machte. Die göttliche Natur des Menschen soll geweckt werden, Empfangsantennen für die universale Energie sollen gebildet werden. Dazu dienen Atemtechniken, Bewegungen, das Malen von Mandalas, kalligrafisches Schreiben und eben positives Denken (als mechanisches Werkzeug verstanden). Byakko Shinkokai ist wiederum die Grundlage der World Peace Prayer Society und mit dieser personell eng verflochten. Präsidentin ist derzeit Masami Saionji, die Adoptivtochter von Masahisa Goi.
Natürlich ist ein Pfahl, auf dem eine Bitte um Frieden steht, an sich nichts Schlechtes. Und von daher habe ich auch nichts gegen die Aktion. Ich möchte sie aus meiner Sicht nur nicht verbunden sehen mit der Idee, dass, wenn wir nur genug Friedenspfähle auf der Erde als Antennen für die universale Energie aufstellen, der Friede dann schon kommen werde. Genauso wenig kann man die Schuld von Menschen (gerade auch von Kriegsverbrechern) zu einem reinen Problem von Schuldgefühlen erklären, die man halt «wegdenken» muss. Genauso wenig, wie ich die Covid-Sars-II-Erkrankung einfach mit positivem Denken heilen kann.
Daneben sind die Friedenspfähle bei dem Vernehmen nach 250'000 Exemplaren auf der Welt langsam auch von kommerziellem Interesse und sie sind für die Organisation ein Beweis ihres Erfolges. Auch die Sri Chinmoy-Organisationen brüsten sich mit ihren Friedensbrücken, Friedenswegen und Friedensmarathons und leiten daraus Anerkennung ab – übrigens genauso wie die Ahmadiyya mit ihren Friedensbäumen. Ich möchte das einfach zu bedenken geben, damit wir uns bewusst sind, was wir tun und wo wir allenfalls eingespannt werden.
Wir können dann immer noch sagen, «doch, das nehmen wir in Kauf».
Herzliche Grüsse
Joachim
Das Jubiläum, die Feier am 17. September im Münster:
Sie war ein Selbstläufer. Lesen Sie den Ablaufsplan. Er hiess eigentlich immer „Ablauf im Entstehen“, weil er nicht fertig war und dann war es soweit. Die Feier begann. Alle Mitwirkenden waren erfahrener als ich, und mit dem Plan in der Hand, kannten sie den Zeitpunkt ihres Einsatzes. Es klappte gut. Die Gäste sassen in Covid-Distanz. Ich hatte ein persönliches Mikrophon. Die Sprechenden empfingen von der Messmerin ein frisch desinfiziertes und nach jedem Einsatz holte sie es sich sofort zurück zur erneuten Desinfektion. Die Kirche war covidvoll. Statt Geschenken, durften sich alle im Voraus ein Lied wünschen. So entstand eine Fülle von Dankesliedern, Friedensliedern. Eine Bekannte hatte für jede Sängerin ein Säckchen Guetzli gebacken. Selbst gemachte Marmelade und eingelegte Zucchetti warteten auf in der Planung Vergessene. Für die Organistin, die Dirigentin, die Mesmerin und die Sprecherin der Interreligiösen Dialoges gab es in einem kleinen Kessel mit von einer Nachbarin arrangierten Blumen. Frieden bringt allen etwas.
Der Ablaufplan
Ankommen bei leiser Orgelmusik (im Sinne eines Eröffnungsapéro)
Chor Lied zur Begrüssung.
Begrüssung mit Worten zu den Kultur-Türen, Lied für die Helfer
Rohner, Stadtrat, Lied
Mehala Pathamananthan, Interreligiöser Dialoge, Lied
Evangelische Allianz, Samuel Walzer,
BAHAI, Silvia Müller, mit Lied
Buddhisten, tibetische Gemeinschaft, Yeshi Chodon Hepp
Islamische Gemeinschaft Mekka SH, Nimetulla Vesseli
Türkische Aska Moschee, Ibrahim Tas
Die Vertreterin der tibetischen Gemeinschaft und der Imam der Aksa Moschee sagten zu Beginn der Feier ab.
Thomas Binotto, röm. kath. Kirche, Publizist, Lied
Wolfram Kötter, Kirchenratspräsident, Lied
Grusswort aus dem Kongo: Puisse la paix régner dans le monde. Lied für den Congo «debout Congolais, unis par le sort (l'hymne national de la R.D.Congo)
Abschluss mit Worten zum Friedenspfahl, Lied für den Initianen
Verdankung, Einladung die Kulturtüren, den Friedenspfahl und frühere Unterlagen anzuschauen. Danken fürs Kommen. Möge Frieden sein auf Erden.
DONA NOBIS PACEM für alle am Friedengebet Mitwirkenden
Blumen für die Frauen
Orgelmusik statt einem Apéro
Susi und ich bekamen von der Frau, die uns immer die schönen Texte gebracht hatte, Blumen. Friede dient allen.
NACH dem Jubiläum: Ich war glücklich. Der Münsterpfarrer, der Hausherr – er hatte sich vorgängig entschuldigt – war zu meinem Erstaunen doch da – er kam kurz nach vorn, rief mir zu: „Viel zu lang“ und verschwand. Gleich lautete der Kommentar des Kirchenratspräsidenten und der professionellen Chorleiterin. Sie ergänzte: „Es war liebevoll und interessant“. Die Redner verschwanden schnell, was ich gar nicht gemerkt hatte. Per Mail erfuhr ich, dass sie andere Verpflichtungen hatten und ohnehin länger geblieben waren, als geplant. Die beiden Hobby-Photographen fühlten sich positiv herausgefordert. Sie genossen, wie sie es nannten, „die Narrenfreiheit“. Der aus der Türkei stammende Gartennachbar, ein ehemaliger Gruppenleiter auf Grossbaustellen war erfreut. Viele waren beeindruckt. Ich war glücklich.
Einschub: Ich hatte das Zimmer kurz zu verlassen und hörte den Nachrichtensprecher sagen: „Dreissig Jahre Deutsche Einheit, Kommentare“. Interessant, doch ich wollte diesen Text an jenem Tag noch abschliessen. Einschub Ende.
Es war gut, dass die Kantonale Wirtschaftsförderung, der Fussball Club und andere freundlich abgesagt hatten. Dass ich sie angefragt und erwähnt hatte, war mir wichtig, weil Arbeit und körperliche Tüchtigkeit viel zu Frieden beitragen. Ich hatte förmich gespürt, wie die Zuhörer meiner kurzen Bemerkung zustimmten. Und -- an einem reich gedeckten Tisch lässt sich leichter über Friede sprechen, als wenn Armut, Hunger, Überschwemmungen, Krieg, Ungeziefer, sich ausbreitende Savannen die Tischgefährten sind. Deshalb erwähnte ich den Kongo.
Gesendet: Dienstag, 22. September 2020 um 15:23 Uhr
Betreff: Re: Re: adresser un mot de salutation
Bonjour Maja et Peter,
Grande est notre joie de savoir que le Jubilé s'est bien passé. Tenir aux engagements faits à Dieu durant 25 ans, ce n'est pas une mince affaire. Beaucoup tombent en chemin et ne peuvent parcourir les 14 stations du chemin de la croix vécu par le Christ. Vous méritez une profonde admiration. Nous savons ce que cela signifie pour un homme de consacrer quelques minutes de sa vie à Dieu à travers un acte concret de don de soi.
Merci de faire parvenir toutes nos félicitations à ces artisans de paix que vous représentez et les résultats de votre consécration, Dieu seul sait les mesurer à la hauteur de vos sacrifices innombrables.
Soyez bénis du Tout-Puissant !
Couple Bitulu
Nachher: Ich hüte dann Freitag bis Sonntag-Abend im Münster die Kulturtüren und den Friedenspfahl. Am Sonntag war Bettag, der eidgenössisch festgelegte Festtag – kein Gottesdienst im Münster. Das gab mir Zeit zum Nachsinnen. Ich las Auszüge aus dem Buch eines Kongolesen, der seine Weltsicht als Mitglied einer Kultur, deren Tisch während Jahrhunderten reich gedeckt war, beschreibt: Wozu Vorräte anlegen, wenn das ganze Jahr reichlich wächst und Wälder und Flüsse voller Tiere sind? Jeder Fremde ist ein Gast, mit dem man teilt. -- Dem stellt er verständnisvoll und entschuldigend die Sorge eines Bewohners des kalten Nordens gegenüber, wo meist nichts wächst. Solche Menschen leben in Sorge um ihr Überleben, in Sorge um ihre Kinder. In jedem Fremden ist ein Feind zu sehen, der etwas will. Am Samstag kam eine Bettlerin vorbei, eine SansPapier aus Osteuropa. Ich habe ihr u.a. viel Geld gegeben. Sollte ich ihr die Adressen der Pfarrherren geben? Ja, Seelsorge sei ihre Hauptaufgabe. Am Bettag besuchte mich die Mesmerin mit ihrer Familie. Ihr Sohn war durch die Konfirmation zum vollen Kirchenmitglied geworden. Er war überrascht und erfreut, dass ich ihm eine Dokumentation zu den Kultur-Türen schenkte. Das Hüten war eine gute Zeit.
Zehn Tage später traf ich Stadtrat Rohner bei einer andern Veranstaltung. Er kam spontan auf mich zu und sagte: „Super, so etwas muss du wieder machen. Ich bin dabei. Warum haben die Zeitung nichts gebracht?“ „Das Jubiläum wurde nicht von grossen Namen organisiert.“ „Das darf nicht wahr sein.“
Das Jubiläum: Die Liedtexte, eine Durcheinander

Jubiläum 25 Jahre Abendgebet für den Frieden
Texte und Lieder
Einschub: Ich habe dieses Dokument in Bezug auf die Abstände zwischen den Texten geändert. Im weiteren habe ich die Texte und Lieder in der Form übernommen, wie die Dirigentin Vreni Winzeler sie mir zustellte. Diese Liedtexte sind mir fremd, sie erreichen mich nicht. Ich kann nur wiederholen, diese Liedtexte erreichen mich nicht. Einschub Ende.
Dieses Dokument konnte ich technisch nicht "besiegen". Es trug den Virus der "Wiederholung", der auch Erich Bohli bekannt ist. Verängstigt arbeitete ich weiter. Ich hatte Glück der Virus breitete sich nicht aus. Wir leben aktuell in der Corona-Zeit. Die Unberechenbarkeit von Viren ist allgemein bekannt.
FrauenChorFrauen
Manuel Zolliker, Klavier
Elias Winzeler, Tenor
Christian Dreo:
Tråg mi Wind (Text: Brigitte Hubmann)
Trågt da Wind mi gach hoam zua in a ruhign Stund.
Kånnst nix måchn, muasstas nehma, håt jå ålls an Grund.
Tråg mi, tråg mi, Wind, tråg mi übers Lånd.
Tråg mi, tråg mi, Wind, übers Lånd, übers Meer.
Wia a Blattl, wia a Traum, fliag i hin, fliag i her.
Tråg mi, tråg mi, Wind, tråg mi übers Lånd,
tråg mi, tråg mi, Wind, übers Lånd, übers Meer.
Tråg mi, tråg mi, tråg mi….
Sting: Fragile (Deutsche Übersetzung)
Wenn Blut fliesst und Fleisch und Stahl eins werden, trocknen zwar die Farben in der Abendsonne, und wenn es Morgen regnet, wird der Regen die Flecken wegwaschen.
Aber in unseren Köpfen wird immer eine Erinnerung bleiben.
Vielleicht braucht es diesen letzten Akt, damit wir allen, die unter einem schlechten Stern geboren wurden, erklären können, dass Gewalt niemals zu einer Lösung führt.
Damit wir niemals vergessen, wie zerbrechlich wir sind.
Es wird immer wieder regnen. Es sind Tränen von einem anderen Stern.
Und Immer wieder wird uns der Regen sagen, wie zerbrechlich wir sind
Cat Stevens: Morning has broken
Morning has broken like the first morning
Blackbird has spoken like the first bird
Praise for the singing, praise for the morning
Praise for them springing fresh from the Word.
Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven
Like the first dew fall on the first grass
Praise for the sweetness of the wet garden
Sprung in completeness where His feet pass
Mine is the sunlight, mine is the morning
Born of the One Light Eden saw play
Praise with elation, praise every morning,
Praise for them springing fresh from the Word.
CH Traditional: Alles ei Ding
'S isch mir alles ei Ding,
ob i lach oder sing.
Ha-n-es Härzeli wie-n-es Vögeli
darum liebe-n-i so ring.
Und mis Härzli isch zue.
'S cha mers niemert uftue,
als es einzigs schlaus Bürschteli
het es Schlüsseli derzue.
Und du bruchsch mir nid z'trotze
jo susch trotz i dir au.
So-n-es Bürschteli wie du eis bisch
So-n-es Meiteli bin i au.
Peter Gabriel: Solsbury Hill (deutsche Übersetzung)
Beim Aufstieg auf den Solsbury Hill konnte ich die Lichter der Stadt sehen.
Wind wehte, die Zeit stand still, ein Adler flog auf in die Nacht.
Etwas kam näher und ich hörte eine Stimme.
Ich stand da, alle Nerven angespannt, musste zuhören, hatte keine Wahl.
Ich glaubte diese Nachricht nicht.
Es musste eine Einbildung sein…
Mein Herz schlug Bum Bum Bum,
"Sohn," sprach die Stimme, "pack Deine Sachen,
ich bin gekommen, dich nach Hause zu bringen."
Ich zog ich mich zurück um zur Ruhe zu kommen.
Meine Freunde würden glauben, ich sei verrückt geworden,
wenn ich versuchte, Wasser in Wein zu verwandeln.
Ich befürchtete, dass offene Türen bald zufallen würden.
So lebte ich von Tag zu Tag,
obwohl mein Leben wie auf einem Gleis rollte.
Doch ich fragte mich, was ich sagen sollte und
welche Verbindungen ich kappen müsste.
Ich fühlte mich wie einen Teil der Kulisse.
Und dann marschierte einfach raus raus.
Mein Herz schlug Bum Bum Bum,
"Hey," sprach die Stimme, "pack Deine Sachen,
ich bin gekommen dich nach Hause zu bringen."
Wenn Illusion ihre Netze spinnt,
bin ich nie da, wo ich gern wäre.
Die Freiheit tanzt immer dann eine Pirouette
wenn ich glaube, ich sei frei.
Und ich fühle mich beobachtet von leeren Silhouetten,
die ihre Augen schließen und trotzdem sehen können.
Niemand hat sie Anstand gelehrt.
Ich werde ein anderes Ich zeigen.
Heute brauch ich keinen Ersatzmann,
Ich werde Ihnen sagen, was das Lächeln in meinem Gesicht bedeutet.
Mein Herz schlug Bum Bum Bum,
"Hey", sagte ich, "behalt' meine Sachen,
Sie sind gekommen mich nach Hause zu bringen."
Michael Jackson: We are the world
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one.
There are people dying and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all.
We can't go on pretending day by day, that someone, somewhere will soon make a change.
We are all a part of God's great big family and the truth - you know, love is all we need:
We are t
Jubiläum 25 Jahre Abendgebet für den Frieden
Texte und Lieder
Einschub: Ich habe dieses Dokument nicht geändert, sondern die Texte und Lieder in der Form übernommen, wie die Dirigentin Vreni Winzeler sie mir zustellte. Einschub Ende
FrauenChorFrauen
Manuel Zolliker, Klavier
Elias Winzeler, Tenor
Christian Dreo: Tråg mi Wind (Text: Brigitte Hubmann)
Trågt da Wind mi gach hoam zua in a ruhign Stund.
Kånnst nix måchn, muasstas nehma, håt jå ålls an Grund.
Tråg mi, tråg mi, Wind, tråg mi übers Lånd.
Tråg mi, tråg mi, Wind, übers Lånd, übers Meer.
Wia a Blattl, wia a Traum, fliag i hin, fliag i her.
Tråg mi, tråg mi, Wind, tråg mi übers Lånd,
tråg mi, tråg mi, Wind, übers Lånd, übers Meer.
Tråg mi, tråg mi, tråg mi….
Sting: Fragile (Deutsche Übersetzung)
Wenn Blut fliesst und Fleisch und Stahl eins werden, trocknen zwar die Farben in der Abendsonne, und wenn es Morgen regnet, wird der Regen die Flecken wegwaschen.
Aber in unseren Köpfen wird immer eine Erinnerung bleiben.
Vielleicht braucht es diesen letzten Akt, damit wir allen, die unter einem schlechten Stern geboren wurden, erklären können, dass Gewalt niemals zu einer Lösung führt.
Damit wir niemals vergessen, wie zerbrechlich wir sind.
Es wird immer wieder regnen. Es sind Tränen von einem anderen Stern.
Und Immer wieder wird uns der Regen sagen, wie zerbrechlich wir sind
Cat Stevens: Morning has broken
Morning has broken like the first morning
Blackbird has spoken like the first bird
Praise for the singing, praise for the morning
Praise for them springing fresh from the Word.
Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven
Like the first dew fall on the first grass
Praise for the sweetness of the wet garden
Sprung in completeness where His feet pass
Mine is the sunlight, mine is the morning
Born of the One Light Eden saw play
Praise with elation, praise every morning,
Praise for them springing fresh from the Word.
CH Traditional: Alles ei Ding
'S isch mir alles ei Ding,
ob i lach oder sing.
Ha-n-es Härzeli wie-n-es Vögeli
darum liebe-n-i so ring.
Und mis Härzli isch zue.
'S cha mers niemert uftue,
als es einzigs schlaus Bürschteli
het es Schlüsseli derzue.
Und du bruchsch mir nid z'trotze
jo susch trotz i dir au.
So-n-es Bürschteli wie du eis bisch
So-n-es Meiteli bin i au.
Peter Gabriel: Solsbury Hill (deutsche Übersetzung)
Beim Aufstieg auf den Solsbury Hill konnte ich die Lichter der Stadt sehen.
Wind wehte, die Zeit stand still, ein Adler flog auf in die Nacht.
Etwas kam näher und ich hörte eine Stimme.
Ich stand da, alle Nerven angespannt, musste zuhören, hatte keine Wahl.
Ich glaubte diese Nachricht nicht.
Es musste eine Einbildung sein…
Mein Herz schlug Bum Bum Bum,
"Sohn," sprach die Stimme, "pack Deine Sachen,
ich bin gekommen, dich nach Hause zu bringen."
Ich zog ich mich zurück um zur Ruhe zu kommen.
Meine Freunde würden glauben, ich sei verrückt geworden,
wenn ich versuchte, Wasser in Wein zu verwandeln.
Ich befürchtete, dass offene Türen bald zufallen würden.
So lebte ich von Tag zu Tag,
obwohl mein Leben wie auf einem Gleis rollte.
Doch ich fragte mich, was ich sagen sollte und
welche Verbindungen ich kappen müsste.
Ich fühlte mich wie einen Teil der Kulisse.
Und dann marschierte einfach raus raus.
Mein Herz schlug Bum Bum Bum,
"Hey," sprach die Stimme, "pack Deine Sachen,
ich bin gekommen dich nach Hause zu bringen."
Wenn Illusion ihre Netze spinnt,
bin ich nie da, wo ich gern wäre.
Die Freiheit tanzt immer dann eine Pirouette
wenn ich glaube, ich sei frei.
Und ich fühle mich beobachtet von leeren Silhouetten,
die ihre Augen schließen und trotzdem sehen können.
Niemand hat sie Anstand gelehrt.
Ich werde ein anderes Ich zeigen.
Heute brauch ich keinen Ersatzmann,
Ich werde Ihnen sagen, was das Lächeln in meinem Gesicht bedeutet.
Mein Herz schlug Bum Bum Bum,
"Hey", sagte ich, "behalt' meine Sachen,
Sie sind gekommen mich nach Hause zu bringen."
Michael Jackson: We are the world
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one.
There are people dying and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all.
We can't go on pretending day by day, that someone, somewhere will soon make a change.
We are all a part of God's great big family and the truth - you know, love is all we need:
We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day,
so let's start giving!
There's a choice we're making, we're saving our own lives,
it's true we'll make a better day just you and me.
Send them you your heart, so they know that someone cares and their lives will be stronger and free. As God has shown us by turning stone to bread, so we all must lend a helping hand.
We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day,
so let's start giving!
There's a choice we're making, we're saving our own lives,
it's true we'll make a better day just you and me.
When you're down and out, there seems no hope at all, but if you just believe there's no way we can fall. Let us realize that a change can only come when we stand together as one.
We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day,
so let's start giving!
There's a choice we're making, we're saving our own lives,
it's true we'll make a better day just you and me.
Mia Makaroff: Butterfly
Der Klang meiner neu geformten Flügel ist süss, ich strecke sie aus und lasse sie trocknen.
Ich habe diese Welt noch nie zuvor gesehen. Ich bin ein Schmetterling.
Die Berührung mit den neugeborenen Flügeln ist süss. Wir fliegen im Kreis und spielen mit der Sonne. Wir haben diese Welt noch nie gesehen. So schön, so hell, so blau der Himmel.
Liebe mich, bevor wir uns verabschieden. Liebe mich, küsse mich mit deinem Flügelschlag.
Du wirst mein Schlaflied sein. Morgen werde ich sterben. Der Wind weht sanft. Der Tag ist vorbei, und die Nacht kommt. Die Stille zeigt uns grosse Wunder. Ich schlafe ein, und ich träume von der Sonne.
Spiritual: Ev´ry Time I feel the Spirit
Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray
Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray.
Upon the mountain my Lord spoke
Out of His mouth came fire and smoke
Looked all around me, it looked so fine
Till I asked my Lord if all was mine.
There's a choice we're making, we're saving our own lives,
it's true we'll make a better day just you and me.
When you're down and out, there seems no hope at all, but if you just believe there's no way we can fall. Let us realize that a change can only come when we stand together as one.
We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day,
so let's start giving!
There's a choice we're making, we're saving our own lives,
it's true we'll make a better day just you and me.
Mia Makaroff: Butterfly
Der Klang meiner neu geformten Flügel ist süss, ich strecke sie aus und lasse sie trocknen.
Ich habe diese Welt noch nie zuvor gesehen. Ich bin ein Schmetterling.
Die Berührung mit den neugeborenen Flügeln ist süss. Wir fliegen im Kreis und spielen mit der Sonne. Wir haben diese Welt noch nie gesehen. So schön, so hell, so blau der Himmel.
Liebe mich, bevor wir uns verabschieden. Liebe mich, küsse mich mit deinem Flügelschlag.
Du wirst mein Schlaflied sein. Morgen werde ich sterben. Der Wind weht sanft. Der Tag ist vorbei, und die Nacht kommt. Die Stille zeigt uns grosse Wunder. Ich schlafe ein, und ich träume von der Sonne.
Spiritual: Ev´ry Time I feel the Spirit
Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray
Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray.
Upon the mountain my Lord spoke
Out of His mouth came fire and smoke
Looked all around me, it looked so fine
Till I asked my Lord if all was mine.
he world, we are the children, we are the ones who make a brighter day,
so let's start giving!
There's a choice we're making, we're saving our own lives,
it's true we'll make a better day just you and me.
Send them you your heart, so they know that someone cares and their lives will be stronger and free. As God has shown us by turning stone to bread, so we all must lend a helping hand.
We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day,
so let's start giving!
Jubiläum 25 Jahre Abendgebet für den Frieden
Texte und Lieder
Einschub: Ich habe diese Dokument nicht geändert, sondern die Texte und Lieder in der Form übernommen, wie die Dirigentin Vreni Winzeler sie mir zustellte. Einschub Ende.
FrauenChorFrauen
Manuel Zolliker, Klavier
Elias Winzeler, Tenor
Christian Dreo: Tråg mi Wind (Text: Brigitte Hubmann)
Trågt da Wind mi gach hoam zua in a ruhign Stund.
Kånnst nix måchn, muasstas nehma, håt jå ålls an Grund.
Tråg mi, tråg mi, Wind, tråg mi übers Lånd.
Tråg mi, tråg mi, Wind, übers Lånd, übers Meer.
Wia a Blattl, wia a Traum, fliag i hin, fliag i her.
Tråg mi, tråg mi, Wind, tråg mi übers Lånd,
tråg mi, tråg mi, Wind, übers Lånd, übers Meer.
Tråg mi, tråg mi, tråg mi….
Sting: Fragile (Deutsche Übersetzung)
Wenn Blut fliesst und Fleisch und Stahl eins werden, trocknen zwar die Farben in der Abendsonne, und wenn es Morgen regnet, wird der Regen die Flecken wegwaschen.
Aber in unseren Köpfen wird immer eine Erinnerung bleiben.
Vielleicht braucht es diesen letzten Akt, damit wir allen, die unter einem schlechten Stern geboren wurden, erklären können, dass Gewalt niemals zu einer Lösung führt.
Damit wir niemals vergessen, wie zerbrechlich wir sind.
Es wird immer wieder regnen. Es sind Tränen von einem anderen Stern.
Und Immer wieder wird uns der Regen sagen, wie zerbrechlich wir sind
Cat Stevens: Morning has broken
Morning has broken like the first morning
Blackbird has spoken like the first bird
Praise for the singing, praise for the morning
Praise for them springing fresh from the Word.
Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven
Like the first dew fall on the first grass
Praise for the sweetness of the wet garden
Sprung in completeness where His feet pass
Mine is the sunlight, mine is the morning
Born of the One Light Eden saw play
Praise with elation, praise every morning,
Praise for them springing fresh from the Word.
CH Traditional: Alles ei Ding
'S isch mir alles ei Ding,
ob i lach oder sing.
Ha-n-es Härzeli wie-n-es Vögeli
darum liebe-n-i so ring.
Und mis Härzli isch zue.
'S cha mers niemert uftue,
als es einzigs schlaus Bürschteli
het es Schlüsseli derzue.
Und du bruchsch mir nid z'trotze
jo susch trotz i dir au.
So-n-es Bürschteli wie du eis bisch
So-n-es Meiteli bin i au.
Peter Gabriel: Solsbury Hill (deutsche Übersetzung)
Beim Aufstieg auf den Solsbury Hill konnte ich die Lichter der Stadt sehen.
Wind wehte, die Zeit stand still, ein Adler flog auf in die Nacht.
Etwas kam näher und ich hörte eine Stimme.
Ich stand da, alle Nerven angespannt, musste zuhören, hatte keine Wahl.
Ich glaubte diese Nachricht nicht.
Es musste eine Einbildung sein…
Mein Herz schlug Bum Bum Bum,
"Sohn," sprach die Stimme, "pack Deine Sachen,
ich bin gekommen, dich nach Hause zu bringen."
Ich zog ich mich zurück um zur Ruhe zu kommen.
Meine Freunde würden glauben, ich sei verrückt geworden,
wenn ich versuchte, Wasser in Wein zu verwandeln.
Ich befürchtete, dass offene Türen bald zufallen würden.
So lebte ich von Tag zu Tag,
obwohl mein Leben wie auf einem Gleis rollte.
Doch ich fragte mich, was ich sagen sollte und
welche Verbindungen ich kappen müsste.
Ich fühlte mich wie einen Teil der Kulisse.
Und dann marschierte einfach raus raus.
Mein Herz schlug Bum Bum Bum,
"Hey," sprach die Stimme, "pack Deine Sachen,
ich bin gekommen dich nach Hause zu bringen."
Wenn Illusion ihre Netze spinnt,
bin ich nie da, wo ich gern wäre.
Die Freiheit tanzt immer dann eine Pirouette
wenn ich glaube, ich sei frei.
Und ich fühle mich beobachtet von leeren Silhouetten,
die ihre Augen schließen und trotzdem sehen können.
Niemand hat sie Anstand gelehrt.
Ich werde ein anderes Ich zeigen.
Heute brauch ich keinen Ersatzmann,
Ich werde Ihnen sagen, was das Lächeln in meinem Gesicht bedeutet.
Mein Herz schlug Bum Bum Bum,
"Hey", sagte ich, "behalt' meine Sachen,
Sie sind gekommen mich nach Hause zu bringen."
Michael Jackson: We are the world
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one.
There are people dying and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all.
We can't go on pretending day by day, that someone, somewhere will soon make a change.
We are all a part of God's great big family and the truth - you know, love is all we need:
We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day,
so let's start giving!
There's a choice we're making, we're saving our own lives,
it's true we'll make a better day just you and me.
Send them you your heart, so they know that someone cares and their lives will be stronger and free. As God has shown us by turning stone to bread, so we all must lend a helping hand.
We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day,
so let's start giving!
There's a choice we're making, we're saving our own lives,
it's true we'll make a better day just you and me.
When you're down and out, there seems no hope at all, but if you just believe there's no way we can fall. Let us realize that a change can only come when we stand together as one.
We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day,
so let's start giving!
There's a choice we're making, we're saving our own lives,
it's true we'll make a better day just you and me.
Mia Makaroff: Butterfly
Der Klang meiner neu geformten Flügel ist süss, ich strecke sie aus und lasse sie trocknen.
Ich habe diese Welt noch nie zuvor gesehen. Ich bin ein Schmetterling.
Die Berührung mit den neugeborenen Flügeln ist süss. Wir fliegen im Kreis und spielen mit der Sonne. Wir haben diese Welt noch nie gesehen. So schön, so hell, so blau der Himmel.
Liebe mich, bevor wir uns verabschieden. Liebe mich, küsse mich mit deinem Flügelschlag.
Du wirst mein Schlaflied sein. Morgen werde ich sterben. Der Wind weht sanft. Der Tag ist vorbei, und die Nacht kommt. Die Stille zeigt uns grosse Wunder. Ich schlafe ein, und ich träume von der Sonne.
Spiritual: Ev´ry Time I feel the Spirit
Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray
Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray.
Upon the mountain my Lord spoke
Out of His mouth came fire and smoke
Looked all around me, it looked so fine
Till I asked my Lord if all was mine.
There's a choice we're making, we're saving our own lives,
it's true we'll make a better day just you and me.
When you're down and out, there seems no hope at all, but if you just believe there's no way we can fall. Let us realize that a change can only come when we stand together as one.
We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day,
so let's start giving!
There's a choice we're making, we're saving our own lives,
it's true we'll make a better day just you and me.
Spiritual: Ev´ry Time I feel the Spirit
Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray
Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray.
Upon the mountain my Lord spoke
Out of His mouth came fire and smoke
Looked all around me, it looked so fine
Till I asked my Lord if all was mine.
Einschübchen 22. Oktober 2020: Eine andere Welt, eine andere Welt.
Jubiläum: Ablauf

Feier zum Jubiläum 25 Jahre „Abendgebet für den Frieden“ Do. 17.09.20, 18.45
Ankommen bei leiser Orgelmusik (im Sinne eines Eröffnungsapéro)
Schluss in F-Dur
- Chor: Trag mi Wind
- Begrüssung mit Worten zu den Kultur-Türen Chor: Fragile
- Rohner, Stadtrat Chor & Solo: Morning has broken
- Mehala Pathamananthan, Interreligiöser Dialoge Chor: Alles ei Ding
Evangelische Allianz, Samuel Walzer,
BAHAI, Silvia Müller Chor: Count the stars
Buddhisten, tibetische Gemeinschaft, Yeshi Chodon Hepp
Islamische Gemeinschaft Mekka SH, Nimetulla Veseli
vielleicht weitere Gäste - Thomas Binotto, röm. kath. Kirche Solo: Solsbury Hill
- Wolfram Kötter, Kirchenratspräsident Chor & Solo: We are the World
- Grusswort aus dem Kongo: Puisse la paix régner dans le monde. Lied für den Congo «debout Congolais, unis par le sort (l'hymne national de la R.D.Congo) Impro & Lesung L%u02D9Hymne nationale
- Abschluss mit Worten zum Friedenspfahl, Lied für Max Leu
Chor: Butterfly oder The Storm is passing over
- Verdankung Einladung die Kulturtüren, den Friedenspfahl und frühere Unterlagen anzuschauen. Danken fürs Kommen. Möge Frieden sein auf Erden.
- DONA NOBIS PACEM für alle am Friedengebet Mitwirkenden
- Chor zum Abschluss: Ev’ry Time I feel the spirit
- Orgelmusik begleitet die Menschen statt einem Apéro
Das Studium

Die ersten Blätter werden gelb und die Dahlien sind voller leuchtender Blühten.
Jubiläum: Begrüssung mit Kulturtüren

Begrüssung mit den Kulturtüren von Stefan Röhricht Endfassung
Einschub: Ich kämpfte mit meinen Texten. Ich ergänzte, kürzte, stellte um und änderte wieder. In den folgenden Texten stossen Sie auf gestrichene Passagen. Die sollen Ihnen mein Abmühen zeigen. Warum, warum nicht, als laufende Fragen. Für mich oft ein Krieg. Ja, das Wort scheint übertrieben, aber … Einschub Ende.
Durch die Münstertüre haben wir dieses Gebäude betreten. Für Touristen ist es eine Sehenswürdigkeit, für Historiker ein geschichtsträchtiger Ort und für die Christen schlicht eine reformierte Kirche. Leise Orgelmusik und der Chor haben sie willkommen geheissen. Nun begrüsse auch ich Sie im Namen der Gruppe Abendgebet für den Frieden herzlich. Mein Name ist Maja Brenner.
Danke, dass Sie gekommen sind. Ich hoffe, Sie sitzen bequem. Ihre Füsse ruhen auf einem Boden, letztmals erneuert 1958. Der erste wurde vor mehr als 1000 Jahren gelegt. Schauen Sie sich einen Moment um, die Säulen rechts und links, vorn der Chor die Diele. Vieles davon ist über 1000 Jahre alt.
Ich begrüsse Sie mit den Türen, die Sie hier sehen.
Der aus Deutschland stammende Grafiker Stefan Röhricht lebte von 1955 bis 2015. Er hat diese «Kulturtüren» geschaffen, um unterschiedlichste Lebens-Welten nebeneinander zu stellen. Nicht Papier oder Karton, sondern gebrauchte, handelsübliche Türen, durch die Menschen bereits unzählige Male gegangen waren, hatte er als Malgrund gewählt. Diese alten Holztüren strukturierte er mit einer Paste. Dann trug er Acrylfarbe auf und übermalte diese wieder und wieder, bis die Farbmischung seinen Vorstellungen entsprach. So unterscheiden sich die Türen in ihren Grundtönungen. Auf diese Oberfläche schrieb er, ich möchte lieber sagen, malte er, die Originaltexte in der Originalschrift. Schliesslich folgte in zügiger Handschrift mit Goldbronze die deutsche Übersetzung. Sie sind eingeladen, diese Türen bis Sonntagabend näher anzuschauen. Es liegen Kataloge mit Details aus.
Die von Stefan Röhricht ausgewählten Texte sind kurze Abschnitte aus Schriften verschiedener Kulturen, unter anderem von Konfuzius, den indischen Veden, aus der Thora, dem Neuen Testament, dem Koran oder der Matthäus-Passion von J.S Bach. Hinter jeder Türe ist eine andere Kultur verborgen. Für Stefan Röhricht repräsentieren sie gemeinsam eine Geisteshaltung: Die Beziehung des Menschen zu einem transzendenten Ursprung, die Hochachtung des Menschen vor einem höchsten Wesen, dem er seine Existenz verdankt oder die Suche des Menschen nach dem Sinn und dem Weg durch das irdische Leben.
Die Kulturtüren wurden von Stefan Röhricht auf vielen Ausstellungen gezeigt. Nach seinem Tod hat sein Freund, Pfarrer Matthias Stahlmann auf Bitte der Erben die Kulturtüren unter seine Obhut genommen. In seiner Eigenschaft als Kurator zeigt er die Türen in wechselnden Ausstellungen in seiner Dorfkirche in Büsingen. Herr Stahlmann bedauert sehr, dass er heute nicht persönlich hier sein und zu Ihnen sprechen kann.
Die Kulturtüren, die hier nebeneinander stehen, sollen ein Symbol für das Ziel dieses Jubiläums sein. Wir sind hier zusammengekommen. Wir stammen aus verschiedenen Kulturen, aus verschiedenen Vaterländern mit unterschiedlichen Muttersprachen. Viele kamen aus Not. Sie suchen ein besseres Leben und finden hoffentlich langsam ein Stück neue Heimat. Im Alltag gehen wir oft aneinander vorbei und scheinen uns kaum zu sehen. Diese Türen können uns auf unsere neue Vielfalt hinweisen. Hoffentlich können wir unserem Gegenüber manchmal ein Lächeln schenken oder ein Handzeichen schenken. Wir sind nicht stumm, wir können uns gegenseitig einen guten Tag wünschen. Später können wir vielleicht nach dem Namen, dem Ursprungsland und den Zielen fragen. und unsere Türe ein wenig öffnen.
Lassen Sie mich einen Anfang machen: Meine Vorfahren lebten alle in der Gegend von Winterthur gelebt. Dort wurde ich am Ende des Zweiten Weltkrieges geboren, dort wurde ich getauft. Im Rahmen des Religionsunterrichtes besuchten wir in Winterthur die Katholische Kirche. Mit Erzählungen und Bildern erfuhren wir etwas von den andern Weltreligionen. Dort wurde ich konfirmiert.
Mit 14 Jahren besuchte ich einen Abendkurs, in dem uns die grossen Religionen dieser Welt vorgestellt wurden. Vor mehr als 50 Jahren kannte ich einen Pakistani, der nach seinem Arbeitsaufenthalt in der Schweiz, eine Wahlfahrt nach Mekka machte. Seine tolerante und grosszügige Haltung prägen mich heute noch.
Nun mit zügigen Schritten weiter:
Turbulentes Ende der Kolonialzeit
1961 Bau der Berliner Mauer
1963 Ermordung des USA-Präsidenten Kennedy
Apartheid in Südafrika
Beginn der Vietnam-Kriege
1968 Ermordung von Martin Luther King
1973 erste Ölkrise
1979 Sturz des Schah von Persien
1983 Beginn des Bürgerkrieges in Sri Lanka zwischen Singalesen und den Tamilen
1989 Fall der Berliner Mauer, Beginn der Globalisierung
1991 Beginn der Jugoslawischen Kriege
Genozid in Ruanda
Nun zur Sache: Erschüttert von der Grausamkeit der Jugoslawien Kriege fand am Donnerstag, 31. August 1995 auf dem Fronwagplatz die Kundgebung: Stopp dem Völkermord statt.
Ich habe den Flyer von damals noch. – Wie kam es dazu? Eine Unbekannte schlug mir Mitte Juli 1995 vor, gemeinsam eine Kundgebung gegen den Krieg zu organisieren. Sie würde alles erledigen, ich solle mich lediglich um die Polizei-Erlaubnis kümmern. Nach etlichen Schwierigkeiten wurde das Ganze zu einem Selbstläufer.
Den Flyer von damals und die Pressemeldungen habe ich hinten aufgehängt. In der Folge bildeten sich mehrere Aktionsgruppen. Unter der Leitung von Pfarrer Heinz Leu die Gruppe «Abendgebet für den Frieden», die sich seither jeden dritten Donnerstag im Monat um 18:45 im Münster trifft. Susi Leu und ich gehören dazu.
Meine Damen und Herren: Friede fällt nicht vom Himmel. Friede ist eine Anstrengung. Friede ist fragil und braucht eine tolerante und grosszügige Haltung und Zeit und Liebe. Jede der Türen steht für Frieden. Sie stehen für den respektvollen Austausch zwischen den Völkern.
Das nächste Lied ist den Freiwilligen gewidmet, die mit den Türen zu schafften hatten und haben.
Jubiläum: Rohner

25 Jahre Abendgebet für den Frieden vom 17. September 2020 im Münster zu Schaffhausen
Dr. iur. Raphaël Rohner wurde 1958 in Schaffhausen geboren. Er ist verheiratet, römisch-katholischen, Fourier und bilingual (deutsch / fanzösisch). Er kennt den Kanton besser als die meisten, denn als Jurist hat er in den verschiedensten Abteilungen von Stadt und Kanton gearbeitet. Seit 1998 er gehört dem grossen Stadtrat an. Kaum zu glauben, du bist oder warst Mitglied von weit über 20 Vereinen und Verbänden. Wann hast du noch Zeit für deine Hobbies wie Ski- und Wassersport, Gartenarbeit (Rosen), Literatur, Theater und Konzerte? Oder träumst Du mehr davon? Alles Süsse siehst Du gerne in keinen Portionen auf Deinem Teller. - 2013 wurdest du in den Stadtrat gewählt. Zunächst warst du Baureferent Seit 2017 ist er Bildungsreferent. Dein Leitspruch lautet: «Eine gute Bildung ist Grundlage für eine demokratische und entwicklungsfähige Gesellschaft». Was tut der Bildungsreferent für den Frieden? Raphaël Rohner du hast das Wort.
Grusswort von Dr. Raphaël Rohner, Stadtrat und Bildungsreferent
Liebe Gläubige aller Religionen und Konfessionen
Liebe Gäste ohne religiöse Einbindung
Meine Damen und Herren
Klein und bescheiden, in einfacher Schriftart, aber klar im Ausdruck und in der Aussage, steht unter Ihrer Einladung zum heutigen Gedenkanlass geschrieben:
„Dona nobis pacem“ … Schenk uns (deinen) Frieden!
Dieser Wunsch, ob ganz im Stillen für sich allein, in kleinem familiären Kreis, unter Freunden, oder gar mit deutlicher Stimme sonor in einem Kirchenschiff unter Gläubigen vorgetragen, bringt zum Ausdruck, was die Menschen seit Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden als essenziell für ein glückliches Leben erachten. Wir wollen Frieden!
Dem werden Sie, meine Damen und Herren, kaum widersprechen. Der Wunsch nach Frieden ist allgegenwärtig, zeitlos und dennoch stets zu wiederholen.
Auch in einer Welt und in Zivilisationen, die ein friedliches Zusammenleben als ihr höchstes Gut bezeichnen, ist diese Wiederholung stets von Nöten gewesen, ist es heute noch, wie wir nur zu gut wissen. Leider!
Denn der Wunsch nach Frieden steht im argen Widerspruch zur Gewalt und Aggression, die das menschliche Wesen ebenfalls seit Jahrtausenden zeichnet … nicht auszeichnet, wohl verstanden. Friede und friedliches Verhalten zeichnet uns aus, während dem Gewalt und Aggression uns zeichnet … in jeder Hinsicht, nur zu oft ein Leben lang.
Ein Widerspruch für Wahr zwischen dem Wunsch und Streben nach Frieden einerseits und aggressivem Verhalten andererseits. Wir werden täglich, ja stündlich daran erinnert, wenn wir Nachrichten aus unserem Land, aus aller Welt, zur Kenntnis nehmen müssen, die den traurigen Tatbeweis erbringen, dass Aggression und Gewalt nach wie vor unberechenbare Begleiter unserer Gesellschaft sind.
Umso wichtiger ist denn der von uns erhoffte Frieden. Der Wunsch nach ihm soll im gemeinsamen Ruf des Gebetes zum Ausdruck kommen, als unser ebenso gemeinsames Anliegen für eine wirklich bessere Welt.
Meine Damen und Herren
Mutige Menschen haben vor 25 Jahren, unter dem Eindruck der dramatischen kriegerischen Ereignisse im Balkan, die Initiative ergriffen, den Wunsch im Gebet formuliert und als Ruf in die Öffentlichkeit getragen … im Abendgebet für den Frieden. Dieses Verhalten soll uns Vorbild sein, soll uns dazu animieren, ebenfalls kraftvoll und überzeugend ein Wort und damit unser Bekenntnis für den Frieden einzulegen.
Meine Damen und Herren
Als Mitglied des Stadtrates und lang erfahrender Politiker stelle ich seit einiger Zeit mit steigender Besorgnis fest, dass Gewalt, zwar nicht brachiale, so doch verbale, schleichend Einzug hält in unserem Land. Auch unsere von Konkordanz und Kompromissbereitschaft geprägte demokratische Kultur wird damit unterwandert, in Frage gestellt. Respekt und Vertrauen, Anstand und Sachlichkeit, weichen zu oft persönlichen Angriffen auf andersdenkende Menschen.Verantwortungsbewusst haben wir hier nicht wegzuschauen, sondern darauf hinzuweisen und mit Beharrlichkeit diesen Friedensgedanken, der unser Land nicht erst seit der Begründung des Bundesstaates begleitet hat, zu vertreten und entsprechend zu handeln.
Friede ist essenziell, meine Damen und Herren, der Wunsch nach Frieden so alt wie die Menschheit. Wir alle sind aufgefordert und eingeladen, ihn in unserem Gebet, aber auch in unserem Alltag, immer wieder kraftvoll zu erwähnen und zu leben.
In seinem Segensgebet für „unsere Kinder“ schreibt Antoine der Saint-Exupery
Wir bitten dich, Gott, für unsere Kinder:
Nicht um Wunder und Visionen,
sondern um Kraft für den Alltag:
Lehre sie die Kunst der kleinen Schritte.
Möge diese Fürbitte auch für unseren Wunsch nach Frieden gelten, der weder Wunder noch Vision, sondern Realität sein soll … auch für unsere Kinder … aller Völker dieser Erde!
Ich danke Ihnenn
Dr. Raphaël Rohner, Stadtrat
Jubiläum: Interreligiöser Dialog SH, Frau Mehala Pathmanathan

Mehela Pathamanathan
Mehala Pathamanathan vertritt im Interreligiösen Dialog Schaffhausen den Hinduismus. Danke Frau Pathamanathan, dass Sie zu unserem Jubiläum das Kleid ihrer Heimat tragen. Einschub: Ich trug Hosen, ich trug immer Hosen. Als Schülerin war es mir erlaubt, in Hosen mit dem Fahrrad in der Stadt zur Schule zu fahren. Ich trug an jenem Tag die Jeans, die ich 1993 gekauft hatte. Ich wusste dies so klar, weil es die einzigen Marken Jeans (BOSS) waren, die ich mir je kaufte. Und, nach dem ersten Abendgebet für den Frieden verabschiedete sich unsere Adoptivtochter. Damals hatte ich den Entschluss gefasst, keine Kleider mehr zu kaufen, bis die Situation geklärt ist. So zehre ich seither von meinen Vorräten aus der Zeit vor 1995 und dazu von den Vorräten im Nachlass meiner Mutter, meiner Schwiegermutter und meiner Patin. Am Sonntag plante ich als Kleid meiner Heimat, die Arbeitstracht meiner Grossmutter zu tragen. Doch nach vielen warmen Tagen, war es unerwartet kalt geworden, und ich trug sogar den Wintermantel, um mir in der Kirche keinen Schnupfen zu holen. Einschub Ende.
Kommen Sie Frau Pathamanathan, begrüsste ich die junge schöne Frau freundschaftlich. Ich sage zunächst ein paar Wort zur Situation, die ihre Eltern in die Flucht trieb: Der Hinduismus, der Islam und das Christentum sind gemäss Internet die drei grössten Religionsgruppen, die drei grössten Religionskomplex der Welt. Die Hindus sind hauptsächlich im indischen Subkontinent beheimatet.
Auf dem Inselstaat Sri Lanka, bis 1972 Ceylon genannt, wütete zwischen 1983 und 2009 ein blutiger Krieg zwischen den tamilischen Separatisten und den Singhalesen, der grössten Bevölkerungsgruppe. In jenen Jahren konnten viele Männer ihr Leben nur durch Flucht retten. Ca. 70'000 kamen nach Europa. Einige wurden in der Schweiz als politische Asylanten anerkannt. So auch der Vater von Frau Pathamanathan. Er fand Arbeit und eine passende Wohnung und konnte den Familiennachzug beantragen. Frau Pathamanathan kam mit 8 Jahren mit ihrer Mutter in die Schweiz. Eigentlich planten die Eltern mit ihren beiden Kindern wieder in die Heimat zurückzukehren, aber sie und die Kinder hatten sich bis zum Ende des Krieges so gut eingelebt, dass sie sich entschlossen, hierzubleiben.
Als die 8 jährige Mehala 1999 in die Schweiz kam, gab es noch keine Deutschklassen. Sie wurde praktisch ins kalte Wasser geworfen. Als 8-Jährige besuchte sie zunächst den Kindergarten. Sie erinnert sich, dass sie mit viel Hilfsbereitschaft und gutem Willen empfangen wurde. Dank viel Einsatzfreude konnte sie bald in den Regelklassen folgen. Sie hat einen Bachelor in Marketing und plant den Master zu machen.
Der Chor singt anschliessend für Frau Pathamanathan ein Schweizer Lied. Sie erklärte, ein tamilisches Lied könne man nicht in so kurzer Zeit lernen. Die Melodie und ihre Muttersprache seinen für Europäer zu schwierig. Nun lassen wir uns überraschen.
Ich habe Frau Pathamanathan gebeten, zunächst ein paar Wort in ihrer Muttersprache an uns zu richten. Darf ich Sie bitten. Frau Pathamanathan kam meinen Wunsch nach und begrüsste die Anwesenden in ihrer Muttersprache, tamilisch. Dann stellte sie den Interreligiösen Dialog Schaffhausen vor und nachher machte sie ein paar Angaben zum Hinduismus.
Im Rahmen des Interreligiösen Dialoges Schaffhausen treffen sich Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Religionen regelmässig. Ein Meilenstein sei die Zusammenarbeit mit der Regierung des Kantons Schaffhausen gewesen, der zur gemeinsamen Unterzeichnung der „Schaffhauser Erklärung zum interreligiösen Dialog“ am 3. November 2016 geführt habe. Sie las dann die 5 Leitsätze dieser Erklärung vor und ich kopierte sie aus dem Internet hierher.
Die 5 Leitsätze:
- Wir sind dankbar, hier in Schaffhausen zu leben und schätzen die Religionsfreiheit, die allen das Recht zugesteht, ihre Religion auszuüben.
- Wir anerkennen die Verfassung, die freiheitlich demokratische Rechtsordnung, wir achten die Traditionen und beteiligen uns am Aufbau der Gesellschaft.
- Wir respektieren die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Meinungen. Wir sehen darin eine Bereicherung und sind offen für Kontakte mit anderen.
- Wir sind bereit, am Dialog teilzunehmen und leisten so unsern Beitrag zu einem Zusammenleben in gegenseitigem Respekt.
- Wir setzen uns ein gegen jede Gewalt im Namen der Religion und fördern im Rahmen unserer Möglichkeiten alles, was dem Frieden dient.
Schaffhausen, 3. November 2016
Diese Leitsätze wurden in mehr als sechs Sprachen übersetzt und von der Regierung und von Vertretern der verschiedenen Religionen akzeptiert und unterschrieben.
Frau Pathamanathan erklärte: „Für mich ist Frieden nur möglich, wenn sich alle Religionen akzeptieren und respektieren. Auch das Kennenlernen von verschiedenen Religionen und die Teilnahme an ihren Feiern sind sehr wichtig, nur so ist ein friedliches Zusammenleben möglich. Das fördern wir im Rahmen des Interreligiösen Dialoges. Alle Religionen haben die Möglichkeit, ihre Feste und ihre Feiertage vorzustellen. Wir nehmen auch daran teil und unterstützen uns gegenseitig. Ein Beispiel das uns Hindu betriff: Vor vier Jahren hatten wir ein grosses Problem. Wir mussten unser Tempelgebäude in den Gruben in Schaffhausen innert drei Monaten räumen. Der Interreligiöse Dialog war uns eine grosse Hilfe. Es wurde ein Artikel in der Zeitung geschrieben und gemeinsam fanden wir ein Lokal in Neuhausen. -- Im April 2020 durften wir die im Bau befindliche Moschee an der Schalterstrasse besichtigen. In November 2020 feiern wir die Woche der Religionen: 1) Ein Podiumsgespräch zu Krankheit: Patientenfragen und Gebete der Religionen. 2) Wie beten Hindus? Eine öffentliche Puja mit dem Priester der tamilischen Hindu-Gemeinschaft. 3) Wie beten Muslime mit dem Imam in der albanisch-mazedonischen Mekka Moschee. Diese Veranstaltungen sind öffentlich und alle sind herzlich eingeladen. Nutzen sie die Gelegenheit, damit wir uns gegenseitig besser kennen lernen können. Die Einladung zu diesem Jubiläum passt gut zu unseren Bemühungen. Einschub: Wegen dem Ausbruch der zweiten Welle des Corona-Virus mussten diese Veranstaltungen bedauerlicherweise abgesagt werden. Einschub Ende.
Nun zum Hinduismus: Es gibt viele Götter, sehr viele. Wenn sie mich nach einer Zahl fragen, weiss ich keine Antwort. Ich weiss nicht, ob das jemand weiss. Jede Familie hat einen andern Familiengott, das macht das zählen schwer. Unser Vatergott ist Shiva. Bei der begrenzten Zeit, verlassen wir das Thema. Im Hinduismus kennen wir kein Verbot, einen andern Tempel oder eine Kirche oder eine Moschee zu besuchen. Es ist keine Sünde für Jesus zu fasten oder eine Pilgerfahr zur Klosterkirche Einsiedeln zu machen. Wir können auch am Bairam (Fest am Ende der Fastenzeit der Muslime) teilnehmen. Um in einem Hindu-Tempel zu beten, muss man nicht Hindu sein, alle Religionen sind willkommen. Vor Gott gibt es keinen Unterschied und wenn Gott keinen Unterschied sieht, dürfen wir Menschen auch keine Unterschiede machen. Dies ist die Grundeinstellung der Hindus. Shiva ist nicht böse, wenn ich zu Jesus, Allah oder Buddha bete. Ein Christ, ein Muslim oder Buddhist kann auch zu Shiva beten. Ich danke ihnen für ihre Aufmerksamkeit und wünsche allen weiterhin einen schönen Abend.
Einschub: Obwohl Frau Pathamanathan einen Bachelor in Marketing besitzt, hat sie mir ihre Unterlagen für ihr Grusswort handschriftlich auf liniertem, vorgelochtem Papier gebracht.
Interreligiöser Dialog: Evangelische Allianz

Sammy Walzer, geboren 1971 ist verheiratet und hat 2 erwachsene Töchter. Zusammen mit seiner Frau leitet er seit 2017 die Heilsarmee-Gemeinde in Schaffhausen.
Er spricht heute in seiner Funktion als Präsident der Evangelischen Allianz Schaffhausen und Umgebung – ein Zusammenschluss von zur Zeit 9 freikirchlichen Gemeinden, die das Ziel haben, den Menschen in unserer Region Jesus Christus als unser Erlöser bekannt zu machen.
Sein Lieblingsessen ist Pizza Calzone und Spaghetti Carbonara (nicht gleichzeitig).
Guten Abend. Ja, Pizza ist mein Lieblingsessen, aber ich bin nicht so verrückt, dass ich sogar zu diesem Anlass eine Pizza mitgenommen hätte. Dafür gehe ich anschliessend mit meiner Frau eine Pizza essen, falls jemand mitkommen möchte… Aber stellt euch einmal vor, es gäbe eine Friedens-Pizza. Wir alle könnten sie bekommen, sie würde nichts kosten. Die einzige Bedingung wäre: Wir müssten sie so nehmen, wie sie kommt. Und das ist bei Pizza ja so eine Sache: Manche mögen keine Oliven oder keine Zwiebeln, wieder andere kein Schweinefleisch, ich habe lieber keine Meeresfrüchte, usw.
Also wenn Friede eine Pizza wäre, dann würde wahrscheinlich jeder seine eigene machen wollen. Und ich vermute, dass dies auch der Grund ist, weshalb sich auf unserer Welt zwar immer mehr Menschen um Frieden bemühen, aber es doch immer mehr Kriege und Konflikte gibt. Alle wollen zwar Frieden, aber jeder nach seinem Geschmack und nach seinen Bedingungen. Friede kann eben nicht wie eine Pizza gemacht werden. Auch wenn wir uns heute Abend auf eine Friedens-Pizza einigen könnten, mit der wir alle einigermassen einverstanden wären, würde diese garantiert nicht allen Menschen auf der Welt schmecken. Also wir merken: Wir Menschen können keinen Frieden schaffen – sonst hätten wir es ja schon längst getan.
Und doch bin ich überzeugt, dass es Frieden gibt. Friede existiert. Nicht als Pizza, auch nicht als Gefühl oder Stimmung, und schon gar nicht als Waffenstillstand. Ich möchte sagen: Friede ist eine Person – aber kein Mensch. Die Bibel spricht vom "Fürst des Friedens". Und sie sagt, dass wahrer Friede von Gott kommt, so wie alles Gute und Vollkommene von Gott ist. Dieser Friede Gottes ist höher als unser menschliches Verstehen. Wir können ihn nicht machen – egal, wie viele Friedens-Gespräche, -Verhandlungen, -Abkommen und -Verträge es noch geben wird. Wir können ihn nicht machen, sondern wir müssen zuerst einmal persönlich in den Frieden Gottes kommen. Der Fürst des Friedens macht dies möglich.
Ich und die Mitglieder der Evangelischen Allianz glauben, dass Jesus Christus dieser Friedefürst ist. Er ist kein Mensch, sondern in ihm hat sich Gott uns Menschen gezeigt. Und als er zu uns Menschen kam, haben Engel gesungen: "Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden." In Jesus ist also der Friede Gottes in die Welt gekommen. Deshalb sagte ich: Friede existiert bereits. Der wahre Friede, der Friedefürst, Jesus Christus ist uns Menschen gegeben. Wir alle können ihn haben, gratis.
Die einzige Bedingung ist: Wir müssen ihn so nehmen, wie er kommt – als den, der er ist. In diesem Sinne wünsche ich uns allen und unserer Welt den Frieden Gottes!
Interreligiöser Dialog: Baha'i

Friedensfeier 17.9.2020 im Münster
Baha'i, Silvia Müller
Als nächstes hören wir Jugendliche und Erwachsene, die sich in einem Nachbarschaftsprojekt in Schaffhausen gemeinsam engagieren. Dieses Projekt wurde von den Baha’i ins Leben gerufen und es arbeiten Menschen aus verschiedenen Religionen und Kulturen mit. Nach dem Baha’i Glaube schöpfen alle Religionsstifter aus derselben göttlichen Quelle. Das Ziel des Baha’i-Glaubens ist die Einheit der Menschheit und ein weltweiter Friede. Wir hören einige kurze Texte aus den Heiligen Schriften der Baha’i Religion und anschliessend ein Lied über die Verbundenheit von Herz zu Herz.
Wenn ein Kriegsgedanke kommt, so widersteht ihm mit einem stärkeren Gedanken des Friedens.
Ein Hassgedanke muss durch einen mächtigeren Gedanken der Liebe vernichtet werden.
Kriegsgedanken zerstören alle Eintracht und Wohlfahrt, Ruhe und Freude.
Gedanken der Liebe schaffen Kameradschaftlichkeit, Frieden, Freundschaft und Glückseligkeit.
O du unser Versorger!
Es ist dieses Dieners Herzenswunsch an Deiner Schwelle die Freunde des Westens und des Ostens in fester Umarmung zu schauen; alle Glieder der Gesellschaft voll Liebe in einer grossen Gemeinde vereint zu sehen, wie die in einem mächtigen Meer versammelten Tropfen, wie die Vögel eines einzigen Rosengartens, die Perlen eines Ozeans, die Blätter eines Baumes, die Strahlen einer Sonne.
Du bist der Mächtige, der Gewaltige, und Du bist der Gott der Stärke, der Allmächtige, der Allsehende.
Das bedeutet, dass es bei der Erziehung von Mann und Frau keinen Unterschied geben darf, damit die Frauen in Gesellschaft und Wirtschaft gleiche Fähigkeiten und Bedeutung wie der Mann erlangen. Dann wird die Welt zu Einheit und Eintracht finden. In vergangenen Zeiten war die Menschheit mangelhaft und unzulänglich, weil sie unausgewogen war. Der Krieg und seine Verheerungen haben die Welt verwüstet.
Die Erziehung der Frau wird ein gewaltiger Schritt zur endgültigen Abschaffung des Krieges sein, denn die Frau wird ihren ganzen Einfluss gegen den Krieg geltend machen. Sie wird sich weigern, ihre Söhne auf dem Schlachtfeld zu opfern…….Sicherlich wird die Frau den Krieg unter den Menschen abschaffen.
Die Religion sollte alle Herzen vereinen und Krieg und Streitigkeiten auf der Erde vergehen lassen, Geistigkeit hervorrufen und jedem Herzen Licht und Leben bringen. Wenn eine Religion die Ursache von Abneigung, Hass und Spaltung wird, so wäre es besser, ohne sie zu sein. Denn es ist klar, dass der Zweck des Heilmittels die Heilung ist, wenn aber das Heilmittel die Beschwerden noch verschlimmert so sollte man es lieber fortlassen…..
O Du gütiger Herr! Vereinige alle. Gib, dass die Religionen in Einklang kommen unnd einige die Völker, auf dass sie einander ansehen wie eine Familie und die ganze Erde wie ein Heim. O dass sie doch in vollkommener Harmonie zusammenlebten
O Gott! Erhebe das Banner der Einheit der Menschheit!
O Gott! Errichte den grössten Frieden!
Schmiede du, o Gott, die Herzen zusammen.
O du gütiger Vater, Gott! Erfreue unsere Herzen durch den Duft Deiner Liebe. Erhelle unsere Augen durch das Licht Deiner Führung! Erquicke unsere Ohren mit dem Wohlklang Deines Wortes und beschütze uns alle in der Feste Deiner Vorsehung.
Du bist der Mächtige und der Kraftvolle. Du bist der Vergebende und du bist der, welcher die Mängel der ganzen Menschheit übersieht.
Interreligiöser Dialog: Buddhisten, tibetische Gemeinschaft

Interreligiöser Dialog: Imam, Veseli

Gesendet: Dienstag, 22. September 2020 um 12:45 Uhr
Von: "
An: "
Betreff: Re: Re: Herzlichen Danke für Ihre Grussworte
Esselamu alaykum we rahmetullah
Paqa mëshira e Zotit qoftë mbi të gjithë ju
Liebe Gläubige, sehr geehrte Damen und Herren,
Ich bin Nimetulla Veseli am 04.09.1987 in Mazedonia geboren, Grund Schule und Gymnasium in Mazedonien besucht, von 2008 bis 2013 in Jordanien Islam studiert. Verheiratet keine Kinder.
Ab 2015 fest Imam in der Islamische Gemeinschaft Mekka Schaffhausen.
Ich bin zufrieden, dass ich heute hier sein darf, wo wir über Friede reden. Ich bedanke mich herzlich bei Frau Brenner für die Einladung.
Frieden ist der gemeinsame Nenner jeder Religion, aber er wird abstrakt bleiben, solange er nicht in der Welt vorhanden ist! Je mehr Kommunikation, Liebe, Verständnis, Toleranz auf der Welt herrscht, desto mehr Frieden verbreitet sich zwischen den Menschen verschiedener Kulturen und Religionen.
Am Ende ich bete zu Gott um mehr Frieden und mehr Liebe!
Danke an alle.
Am Ende ich bete zu Gott um mehr Frieden und Liebe zwischen die Menschen.
Jubiläum: Thomas Binotto

Thomas Binotto lebt in Schaffhausen und ist Vater von vier erwachsenen Kindern und Grossvater eines selbstverständlich über süssen Enkels. Als Katholik, vor allem aber als Autor und Journalist, schreibt er seit bald dreissig Jahren über die katholische Kirche. Thomas Binotto ist Chefredaktor beim formum in Zürich - dem grössten katholischen Magazin der Schweiz.
Sein Grusswort:
Ein Schiff, das sich Menschheit nennt...
Sind Sie sich bewusst, dass Sie in diesem Augenblick, hier und jetzt, Passagiere auf einem Schiff sind? Bereits als das Münster Allerheiligen gebaut wurde, war das gebräuchliche Wort für diesen Teil der Architektur «Kirchenschiff». Und noch viel länger, bereits seit Anbeginn des Christentums, ist das Schiff ein beliebtes Bild für Kirche.Dieses Bild greift zurück auf die Bibel, beispielsweise auf das Boot mit den Jüngern, die im See Genezareth in einen Sturm geraten.
Und so singen wir Christinnen und Christen vom Schiff «geladen bis an sein höchsten Bord» und von einem Schiff, «das sich Gemeinde nennt». Wir vergleichen Jesus mit einem Anker, den Mast mit dem Heiligen Geist und das Segel mit der Liebe. Es sind wunderschöne Lieder, die wir da singen. Gehaltvolle Bilder, in die wir uns andächtig vertiefen.Glorreiche Absichten, die wir damit ausdrücken. Und dennoch müssen wir uns immer wieder fragen: Wie ernst meinen wir es mit dieser Symbolik. Ist das Schiff mehr als bloss schöne Rede?
Ich habe nicht selten den Eindruck, gerade wir als Römisch-katholische Kirche hegen und pflegen unser Kirchenschiff etwas gar sorgfältig. So umsichtig, dass wir meinen, die Fahrt aufs Meer sei zu schade für unseren altehrwürdigen Kahn.Lieber vertauen wir ihn sicher im Hafen, damit ihm weder Sturm noch Winde etwas anhaben können. Hier bietet es Schutz vor dem lauten Getriebe der Welt.
Der oft beschworene Reformstau in der katholischen Kirche ist vor allem eine Scheu vor dem Wagnis, dem Abenteuer, dem Risiko. Wir sind wasserscheu geworden, haben unsere nautischen Fähigkeiten einrosten lassen und trauen uns nicht mehr in offene Gewässer.
Ist die Ewigkeit des Heimathafens wirklich der Ort, an dem ein Schiff ruhen soll? Ist «Ruhe in Frieden!» tatsächlich die Friedensbotschaft unserer Kirche. Ich bin überzeugt: ein Schiff, das nicht hinaus darf in die Weite des Wassers, ein solches Schiff verfehlt seine Bestimmung, ein solches Schiff wird schlicht und einfach daran gehindert Schiff zu sein. Und deshalb muss unser Kirchenschiff, müssen all unsere Kirchenschiffe egal welcher Konfession raus aufs Wasser. Dort allerdings erwartet sie Unsicherheit und Unstetigkeit. Dort werden sie zerbrechlich und unkomfortabel. Dort warten Seekrankheit und Irrfahrten. Und vielleicht, vielleicht sogar der Untergang.
Und die Besatzung dieses Kirchenschiffs? Die ist nicht dazu berufen, sich auf dem Luxusdeck zu sonnen. Die Besatzung des Kirchenschiffs, das sollen Seeleute sein: Seefrauen und Seemänner. Diese Seeleute sind nirgends und überall zu Hause. Ihren Heimathafen sehen sie nur ganz selten. Sie gehören nicht zur etablierten Gesellschaft. Sie sind sich bewusst, dass sich die See nicht zähmen lässt. Und dass manchmal nur noch Beten hilft. Wenn Kirchenschiffe in See stechen, dann gelten für sie die universellen Regeln der Seefahrt. Einem Schiff in Not eilt man zu Hilfe, egal wie verlockend das eigene Ziel gerade ist. Man hilft allen Menschen in Seenot, ohne sie danach zu fragen, woher sie kommen und wohin sie gehören. Das gilt auch für die Religion, denn wer einen Menschen aus dem Wasser fischt, der sieht ihm ins Gesicht und nicht in den Pass.
Während ich das behaupte, muss ich eingestehen, dass ich zwar katholisch von Herkunft bin, und christlich aus Überzeugung, aber vor allem bin ich ein Mensch von Geburt. Ich kann es in der Bibel nachlesen: Gott hat mich nicht als Christen geschaffen und schon gar nicht als Katholiken. Er hat mich als Menschen erschaffen. Und auf dem Weltmeer des Lebens geht es genau darum: um Menschlichkeit.Es geht um intermenschlichen Frieden!
Wenn wir also hier Münster zu Allerheiligen im Kirchenschiff sitzen, dann kann unser Schiff nur ein Friedensschiff sein, denn wie heisst es im Lied: «Sein Segel ist die Liebe».
Ich bin dankbar, dass vor 25 Jahren drei Menschen dieses Segel der Liebe hier im Münster gehisst haben. – Ich bin beeindruckt, dass sie unverzagt an die Kraft des Gebets glauben. – Ich bin begeistert, wie standhaft sie an Bord ausgehalten haben. – Und ich wünsche Ihnen von Herzen «Allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel».
Lassen Sie mich ganz zum Schluss eine persönliche Randbemerkung machen, allerdings eine ganz zentrale: Während ich an dieser Ansprache gearbeitet habe, musste ich ständig an die Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer denken. Und es war mir dabei nie ganz wohl mit all meinen sorgfältig gedrechselten Sätzen, denn im Mittelmeer wird aus der Metapher vom Kirchenschiff ein Imperativ. Selten hatte das Wort «Menschenfischer» einen so schmerzlichen, aber auch einen so dringenden Klang.
Ich bin deshalb zutiefst dankbar, dass es Menschen gibt, die jetzt in diesem Augenblick im Mittelmeer für die Geschöpfe Gottes all ihre Kraft, ihre Freiheit und ihr Leben einsetzen.
Jubiläum: Kötter

Herzlichen Dank für die Einladung am heutigen Abend und für die Möglichkeit, ein paar Worte sagen zu dürfen.
Liebe und Frieden sind wohl die beiden Lebensumstände, die sich ein jeder und
eine jede für sich und sein und ihr Leben wünscht – und die dennoch wie oft
auch unerreichbar sind. Dies betrifft das eigene, persönliche Leben. Dies
betrifft das Leben in einer Gesellschaft; das Leben im Kanton, im Land, weltweit.
25 Jahre Abendgebet für den Frieden. Wir alle wissen, dass Frieden weit mehr
ist als die Abwesenheit von Krieg. Und dass auch wir immer wieder daran
erinnert werden müssen oder eben auch Gott zu bitten haben, dass er unsere
Füsse richte auf die Strasse des Friedens.
Ich möchte gerne in diesen paar Minuten Sprechzeit, die mir zur Verfügung
stehen, einen Bogen spannen vom ersten Tag der Schöpfung bis zum letzten
Tag oder eben bis zum endgültigen, ewigen Anbruch des Gottesreiches, um
versuchen darzustellen, wie bedeutungsvoll dieses Wort «Frieden» für die
biblischen Traditionen ist.
Am ersten Tag der Schöpfung herrscht Chaos, das berühmte Tohuwabohu. Aus
diesem ordnet Gott die Welt an in sechs Tagen und dieses Schöpfungswerk
mündet ein in den sabbatlichen Frieden, in den göttlichen Ruhetag, der nicht
nur den Menschen sich selbst und den Menschen untereinander Frieden geben
soll, sondern der vor allem auch steht für den Frieden Gottes mit seiner ins
Leben gerufenen Schöpfung und damit eben auch für den Frieden Gottes mit
uns Menschen.
Dieser erste Schöpfungsbericht weiss aber auch um die Hinfälligkeit dieses
göttlichen Friedens durch die Hand des Menschen. Immer wieder wird dieser
Friede durch Feindschaft, Hass und Gewalt missachtet. Und für die den Frieden
suchenden Menschen erwächst am Horizont eine Vision. Eine Vision ist ein
Hoffnungsbild, das darauf wartet, Wirklichkeit und Wahrheit zu werden. Eine
Vision ist keine Utopie, sondern in der Tat ein Leuchtturm am Horizont. Ein
Licht in der Dunkelheit. Der Vogel, der singt, auch wenn die Nacht noch dunkel
ist. Aber dieses Leuchtfeuer, das zu brennen beginnt, beschreibt der Prophet
Jesaja mit den folgenden Worten: Am Ende der Tage wird es geschehen: Der Berg des Hauses des HERRN steht fest gegründet als höchster der Berge; er überragt alle Hügel. Zu ihm strömen alle Nationen. Viele Völker gehen und sagen: Auf, wir ziehen hinauf zum Berg des HERRN und zum Haus des Gottes Jakobs. Er unterweise uns in seinen
Wegen, auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn vom Zion zieht Weisung aus
und das Wort des HERRN von Jerusalem. Er wird Recht schaffen zwischen den
Nationen und viele Völker zurechtweisen. Dann werden sie ihre Schwerter zu
Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu Winzermessern. Sie erheben
nicht das Schwert, Nation gegen Nation, und sie erlernen nicht mehr den Krieg.
Doch auch dieses Bild war noch nicht stark genug, um den Menschen davon zu
überzeugen, dass es lohnt, diesen Weg des Friedens zu gehen. Ein neues Bild,
ein neues Lied wurde angestimmt. Ein Lied, in das wir immer gerne einstimmen
in den Weihnachtstagen: «Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden» -
so singt es der Chor der himmlischen Heerscharen zur Geburt Gottes an
Weihnachten. Und dieser weihnachtliche Frieden ist immer noch auf dem Weg,
immer noch nicht bei den Menschen angekommen. Zwar kann der Apostel
Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus behaupten: «Er, Christus, ist
unser Friede», doch solange dieser Friedefürst von Menschen nicht anerkannt
und gelebt wird, bleibt auch er eine Vision. Und von dieser Vision berichtet das
letzte Buch der Bibel, die Offenbarung des Johannes und wir merken, dass wir
vom ersten bis zum letzten Buch der Bibel einen Bogen geschlagen haben,
denn dort sieht der Seher Johannes ein Bild, das geradezu unglaublich ist. Er
hört eine Stimme aus dem Himmel, die ihm zuruft:
»Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen! Gott wird in ihrer Mitte
wohnen; sie werden sein Volk sein – ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst,
ihr Gott, wird immer` bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es
wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen, und es werden
keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen.«
Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: »Seht, ich mache alles neu.«
Auf diese neue Erde und diesen neuen Himmel warten wir. Und solange wir
warten, bleibt uns nichts anders zu tun als Frieden zu säen, wo immer wir eine
andere Wirklichkeit vorfinden. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere
an die folgende Geschichte:
Ein junger Mann betrat im Traum einen Laden. Hinter der Theke stand ein
Engel. Hastig fragt er ihn: „Was verkaufen Sie in Ihrem Laden?“ Der Engel
antwortete freundlich: „Alles, was sie wollen.“ Der junge Mann begann
aufzuzählen: „Dann hätte ich gerne das Ende aller Kriege in der Welt, bessere Bedingungen für die Randgruppen der Gesellschaft, Beseitigung der Elendsviertel in Lateinamerika, Arbeit für die Arbeitslosen, mehr Gemeinschaft und Liebe und...., und....“ Da fiel ihm der Engel ins Wort: „Entschuldigen Sie, junger Mann, Sie haben mich falsch verstanden. Wir verkaufen keine Früchte, wir verkaufen nur den Samen.“
25 Jahre tragt Ihr nun diesen Friedenssamen in die Welt. Hier in Schaffhausen.
Danken wir Gott dafür, dass es solche Menschen gibt, die den Friedenssamen
aufs Land und in die Stadt bringen.
Jubiläum: Die Zwingli Kirche

Die Gemeinde der Zwingli-Kirche und Wolfram Kötter, 1960
In Schaffhausen im besonderen im Quartier Hochstrasse Geissberg wurde nach dem 2WK viel gebaut und es wuchs der Wunsch, eine unabhängig Kirchgemeinde zu bilden. Dies wurde bald Realität. Die evangelisch-reformierte Zwinglikirche Schaffhausen wurde 1959 eingeweiht.
1982 zog wir mit unseren beiden kleinen Kindern an die Finsterwaldstrasse und wurden somit Mitglieder der Zwingli-Kirche: Zwei Pfarrer, eine Gemeindehelferin, ein Mesmer, Kinderhüeti, Sonntagsschule, ein grosser Adventsbasar, Altersferien, jedes Jahr eine Gemeindewochenende in Rüdlingen, und, ich weiss nicht was noch.
2020: In den vergangenen 40 Jahren wurde viel neues Denken von mir verlangt und es war und ist von vielem Abschied zunehmen.
2020 nicht mehr zwei Pfarrherren sondern eine Teilzeitstelle von 75 %. Ich wünschte Herr Pfarrer Kötter als Vertreter der ev.-ref. Kirche einzuladen, denn ich bin tief beeindruckt von der Entwicklung dieser, meiner Kirchgemeinde.
Auf dem Weg zu meiner Kirche, der Zwinglikirche konnte ich beobachten, wie das alte Einfamilienhaus an der Schalterstrasse abgebrochen wurde und wie eine beeindruckende Mochee gebaut wird, die voraussichtlich 2021 eröffnet wird. Das Gebäude passt gut in die Umgebung.
Hoffentlich haben wir die Grösse um auf der Basis unserer Bundesverfassung in Respekt nebeneinander zu leben.
Nun zu unserm Gast Wolfram Kötter
Er 1960 wuchs im Nord-Westen Deutschlands auf. Er ist verheiratet und Vater von vier erwachsenen Kindern. Er ist seit 1988 im Pfarrdienst und seit 2010 in der Schweiz tätig. Zunächst in der Kirchgemeinde Zwingli und später in der Seelsorge im Pflegezentrum und im Spital. Er ist Beauftragter für Palliative Care der Kantonalkirche. Seit 2019 hat er eine 50% Stelle in der Kirchgemeinde Neuhausen und ebenfalls seit 2019 ist er Kirchenratspräsident.
Jubiläum: Weitere Grussworte, u.a. aus dem Kongo

Die Gemeinde der Zwingli-Kirche und Wolfram Kötter, 1960
In Schaffhausen im besonderen im Quartier Hochstrasse Geissberg wurde nach dem 2WK viel gebaut und es wuchs der Wunsch, eine unabhängig Kirchgemeinde zu bilden. Dies wurde bald Realität. Die evangelisch-reformierte Zwinglikirche Schaffhausen wurde 1959 eingeweiht.
1982 zog wir mit unseren beiden kleinen Kindern an die Finsterwaldstrasse und wurden somit Mitglieder der Zwingli-Kirche: Zwei Pfarrer, eine Gemeindehelferin, ein Mesmer, Kinderhüeti, Sonntagsschule, ein grosser Adventsbasar, Altersferien, jedes Jahr eine Gemeindewochenende in Rüdlingen, und, ich weiss nicht was noch.
2020: In den vergangenen 40 Jahren wurde viel neues Denken von mir verlangt und es war und ist von vielem Abschied zunehmen.
2020 nicht mehr zwei Pfarrherren sondern eine Teilzeitstelle von 75 %. Ich wünschte Herr Pfarrer Kötter als Vertreter der ev.-ref. Kirche einzuladen, denn ich bin tief beeindruckt von der Entwicklung dieser, meiner Kirchgemeinde.
Auf dem Weg zu meiner Kirche, der Zwinglikirche konnte ich beobachten, wie das alte Einfamilienhaus an der Schalterstrasse abgebrochen wurde und wie eine beeindruckende Mochee gebaut wird, die voraussichtlich 2021 eröffnet wird. Das Gebäude passt gut in die Umgebung.
Hoffentlich haben wir die Grösse um auf der Basis unserer Bundesverfassung in Respekt nebeneinander zu leben.
Nun zu unserm Gast Wolfram Kötter
Er 1960 wuchs im Nord-Westen Deutschlands auf. Er ist verheiratet und Vater von vier erwachsenen Kindern. Er ist seit 1988 im Pfarrdienst und seit 2010 in der Schweiz tätig. Zunächst in der Kirchgemeinde Zwingli und später in der Seelsorge im Pflegezentrum und im Spital. Er ist Beauftragter für Palliative Care der Kantonalkirche. Seit 2019 hat er eine 50% Stelle in der Kirchgemeinde Neuhausen und ebenfalls seit 2019 ist er Kirchenratspräsident.
Jubiläum: Begrüssung des Friedenspfahls

Begrüssung des Friedenspfahls, Endfassung
Friedenspfähle sind Mahnmal, stummes Gebet und internationales Friedenssymbol in einem. Sie sollen rufen uns im grossen Stress des kleinen Alltags das Wort FRIEDEN zu. daran erinnern, dass Frieden möglich ist, wenn wir den Alltag im Geiste der Worte MÖGE FRIEDE AUF ERDEN SEIN leben.
Der Philosoph und Dichter Masahisa Goi gehört zu den Väter der Friedenspfähle. Er lebte von 1916 bis 1980 in Japan und war von der Kraft des Wortes überzeugt. Tief bewegt von den Zerstörungen des 2. Weltkrieges, insbesondere in Hiroshima, suchten sie eine Friedensbotschaft, auf die sich Menschen aller Nationalitäten, aller Kulturen und aller Religionen einigen konnten beziehen können. Diese fanden sie in den Worten MÖGE FRIEDEN SEIN AUF ERDEN. Die Idee verbreiteten sie mit Plakaten oder befestigten sie auf Pfählen. Um der Sache mehr Schwung zu geben, wurde 1955 in Japan eine NGO gegründet. Heute trägt sie den Namen «May Peace Prevail on Earth International» mit Sitz in New York. Sie ist von der UNO anerkannt. Das Projekt Friedenspfähle wurde von ihr übernommen. Der erste wurde 1976 offiziell in Japan aufgestellt. Es soll mittlerweile weltweit ungefähr 250'000 Pfähle in 196 Ländern der Welt geben.
Diese grosse Zahl erstaunte mich. Darum wandte ich an Frau Dagmar Berkenberg, die Ansprechperson «May Peace Prevail on Earth International» in Deutschland. Sie ist überzeugt, dass es sehr viele sind. Sie arbeitet zur Zeit an einem Verzeichnis für Deutschland. Sie hat mir ihre Liste zur Verfügung gestellt. Sie finden diese auf der Pinnwand neben den Listen von Italien und der Schweiz. In New York wird zur Zeit an einer Webseite mit einem weltumfassenden Verzeichnis gearbeitet.Wie mir von New York mitgeteilt wurde, gibt es selbst im Kongo zwei Friedenspfähle.
Man findet die Pfähle in Tempeln, Kirchen, Klöstern, Stadtzentren, Universitäten, Schulen, öffentlichen Parkanlagen, privaten Gärten und an unzähligen internationalen Orten.
Unter anderem: Vereinte Nationen, New York; Internationale Atomenergiebehörde, Wien; Mauerpark, Berlin; See Genezareth, Israel; Machu Picchu, Peru; Weltbank, Washington; UNO Besucherzentrum, New York; UNO Umweltschutzprogramm, Nairobi; Pyramiden El Gizas, Ägypten; Weltgesundheitsorganisation, Genf; Arabische Liga, Kairo
und seit 2008 einer neben dem Munot in Schaffhausen.
Jener Friedenspfahl wurde von einem besorgten Bürger gestiftet. Er hatte von den Friedespfählen gehört, die Idee umgesetzt und damit ein Zeichen gesetzt. Wir wollten das selbe tun. Wir wünschten uns einen Friedenspfahl in der Stadt. Ein interessanter Weg begann. Diesen Friedenspfahl (englisch „Peace Pole“) haben wir in Degersheim bei St. Gallen gekauft und geholt. Es ist ein Balken von 2.50 Meter Länge und einem quadratischen Querschnitt von 9 auf 9 Zentimetern. Er wiegt ca. 17 Kilogramm. Unser Pfahl ist aus imprägniertem, weiss gestrichenem Lärchenholz, damit er wetterfest ist. An den Seiten trägt er in vier verschiedenen Sprachen die Aufschrift:«Möge Friede sein auf Erden. Puisse la paix régner dans le monde. Che la pace regni sulla terra. May peace prevail on earth.“ Wir wissen, rätoromanisch unsere vierte Landessprache fehlt, aber wir haben bewusst englisch als internationaler Sprache den Vorzug gegeben.
Mit der Bewilligung der Kirchgemeinde St. Johann / Münster und der Bewilligung der Stadt wird er anfangs Oktober von der Stadtgärtnerei Richtung Mosergarten aufgestellt. Was heisst das? Es ist ein Loch zu schaufeln und der Pfahl ist senkrecht einzubetonieren. Nach ein paar Tagen, wenn der Beton trocken ist, kann das Loch wieder verschlossen werden. Am 15. Oktober um 17 Uhr werden wir ihn wie ein Kunstwerk enthüllen. Sie sind herzlich dazu eingeladen.
Dann stand Frau Leu neben mir und sagte leise: "Es ist mir nicht sehr wichtig, den Text, der auf der Informationstafel neben dem Friedenspfahl stehen wird, vorzulesen."– Ich war ihr dankbar für das Verzichten.
Text auf der Tafel zum Friedenspfahl

Text der Tafel, Kopie
"Gott fragt nicht, wer wir sind, ob zum Beispiel Christen, Muslime oder Hindus. Es kommt darauf an, ob wir den Hungrigen Nahrung, den Durstigen Wasser und ob wir Frieden stiften (nach Matthäus 25, 35)"
"Der erste Friede, der wichtigste, ist der, welcher in die Seele der Menschen einzieht, wenn sie ihre Verwandschaft, ihre Harmonie mit dem Universum einsehen und wissen, dass im Mittelpunkt der Welt das grosse Geheimnis wohnt und dass diese Mitte tatsächlich überall ist. Sie ist in jedem von uns -- dies ist der wirkliche Friede, alle anderen sind lediglich Spiegelungen davon. Der zweite Friede ist der welcher zwischen Einzelnen geschlossen wird, und der dritte ist der zwischen zwei Völkern. Aber vor allem sollt ihr sehen, dass es nie Frieden zwischen Völkern geben kann, wenn nicht der erste Friede vorhanden ist, der -- wie ich schon sagte -- innerhalb der Menschenseelen wohnt." Zitat von Black Elk, Medizinmann der Lakota-Indiander"
Gruppe "Abendgebet für den Frieden" im Münster -- zum 25-jährigen Jubiläum 2020
Ende des Textes der Tafel.
Nun ich brauchte zehn Minuten zum Eintippen, und dabei las ich den Text nochmals. Es gelang mir, die "Streiteren" rund um diesen Text beiseite zu schieben.
Jubiläum: Verdankungen

Verdankung der Frauen
In den Tagen vor dem Jubiläum verschenkte ich keine Blumen. So stand dann ein grosser Strauss von Sonnenblumen vor der Kanzel und eine Nachbarin hatte mir viel Budgets gesteckt.
"Diese vier Blumenbudgets gehen an vier Frauen, die ich Ihnen nun kurz vorstelle." Diese Vorstellung entfiel, aber der Text soll hier erhalten bleiben.
Die Organistin, Frau Stefanie Senn hat uns mit ihren Improvisationen begrüsst hat. Sie wurde in Schaffhausen geboren, wo sie auch mit ihrem Partner und ihrem Sohn lebt. Nach Abschluss der Diplommittelschule 1992 erwarb sie 1997 das Klavierlehrerdiplom am Konservatorium in Winterthur und 1999 den Fähigkeitsausweis als Organistin bei Peter Leu in Schaffhausen. Musik ist ihr Leben und sie kann damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Dank ihrem breiten musikalischen Erfahrungsschatz kann sie intuitiv Jazzharmonien, Rockrhythmen, klassische und fremdländische Elemente und Volksmusik miteinander verbinden.
Stefanie Senn hat mit ihren Improvisationen schon mehrere klassische Musikwettbewerbe gewonnen. Obwohl ihre Musik spontan entsteht, klingt sie zuweilen wie komponiert. Jedes ihrer Konzerte ist einmalig. Bei ihren Improvisationen kann sie sich auf ihr Gespür verlassen.
Frau Vreni Winzeler: Geboren, aufgewachsen und wohnhaft in Schaffhausen. Karrierestart mit Blockflöte, Klavier, Klarinette und Orgel. Mit dem Chorvirus infiziert (und seither hoffnungslos der Chormusik verfallen) im Kammerchor der Kantonsschule und im Kirchenchor des Vaters. Nach der Matura Ausbildung zur Primarlehrerin und Studium am Konservatorium Schaffhausen (Klarinette, Orgel), an der Zürcher Hochschule der Künste (Kirchenmusik, Chorleitung, Dirigieren) und an der Musikhochschule Luzern (Schulmusik). Vreni Winzeler unterrichtete lange Jahre an der Kantonsschule Schaffhausen und an der Realschule Neuhausen Schulmusik, bevor sie am 1. August 2020 die Leitung der Primarschule Stein am Rhein übernahem. Sie leitet derzeit die FrauenChorFrauen und den Seniorenchor Rundadinella. Als Präsidentin des Vereins SKJF (Schweizerische Kinder- und Jugendchorförderung - www.skjf.ch/">www.skjf.ch) sorgt sie unter Mithilfe von engagierten Menschen dafür, dass Kinder- und Jugendchöre gefördert und gefordert werde.
Frau Pathamanathan hat ein Lied bekommen, wie unsere wie Hauptredner und sie empfängt nun das Budget für all die vielen Frauen, die kaum jemals Blumen bekommen, für die Frauen, die in den Dörfern im Kongo bleiben.
Nun Frau Duvoisin: Frage die Mesmerin, das weiss die Mesmerin, die Mesmerin am Anfang und am Ende. Man ist mir ihr vertraut, dabei weiss am kaum Ihren Namen. Viele freuen sich, sie zu sehen. Frau Duvoisin hat mir das Berufsbild der Mesmer geschickt: Sechs Seiten. Ich habe es ausgedruckt. Ohne die Mesmerin hätten wir diesen Anlass nicht geschafft. Danke Frau Duvoisin. Dann geht unser Dank an die Frauen, die Frau Duvoisin helfen, an die Frauen, die die Guetzlich für die Sängerinnen machten, die Frau, die Blumenbudget machte.
DONA NOBIS PACEM als Dank an alle, die jahrelang regelmässig am Abendgebet mitwirkten, an die Blumen-Frau, an die Feen für die Gutzlisäckli, und meinem Mann, der mich mit Wanderungen fit hält und mir die Tagesneuigkeiten erzählt.
DONA NOBIS PACEM
Wir haben es geschafft: Noch das Schluss-Lied und statt einem Apéro Musik auf der kleinen Orgel hier vorn. Tragen Sie sich Sorge und verweilen Sie noch eine Weile in diesem über 1000 Jahre alten Gebäude. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Wie geht es weiter

Wie geht es weiter?
Ende September las ich Teile des Buchs von Brittany Kaiser: DIE DATEN-DIKTATUR 2020 und schloss damit die Arbeit mit dem Jubiläum ab.
Einschub: Epilog, Das Ende der Datenkriege
Eleanor Roosevelt: «Wir müssen den Frieden tatsächlich wollen, ihn so sehr wollen, dass wir dafür zu bezahlen bereit sind, mit unserem Verhalten ebenso wie in materieller Hinsicht. Unser Wille zum Frieden muss stark genug sein, um unsere Lethargie abzuschütteln und uns in anderen Ländern auf die Suche nach all denen zu machen, die ihn ebenso sehr wollen wie wir."
Albert Einstein: «Ich bin nicht nur Pazifist, ich bin ein militanter Pazifist. Ich will für den Frieden kämpfen. Nichts wird Kriege abschaffen, wenn nicht die Menschen selbst den Kriegsdienst verweigern.»
Den Text von Eleanor Roosevelt und Albert Einstein zitiert Frau Kaiser in ihrem Epilog. Weitere Zitate: «Bei genauer Betrachtung ist das Thema Datenrecht das zentrale Problem unserer Zeit. Daten, mit anderen Worten unsere immateriellen digitalen Aktiva, sind die einzige Klasse von Aktiva, auf deren Wert die Produzenten von Rechts wegen ebenso wenig Anspruch haben, wie sie über deren Erfassung, Speicherung, Kauf und Verkauf entscheiden oder von ihrer Produktion profitieren können. Mit Verachtung blicken wir zurück auf die Art und Weise, in der die kolonialen Eroberer die Einheimischen um Land, Wasser, später um Öl betrogen, nur weil diese weniger mächtig waren als diejenigen, die ihnen ihre wertvollen Güter wegnahmen, und wir betrachten das heute als Schandfleck unserer Geschichte. Mit den Daten geschieht uns dasselbe.»
«Werden Sie digital kompetent! Es wird Zeit, dass wir Verstehen, was mit unseren Daten passiert. Wie werden sie erfasst, wohin gehen sie, wo werden sie gespeichert, wie lassen sie sich gegen uns einsetzen?"
www.dqinstitute.org/">www.dqinstitute.org
Wie nehmen wir unsere Daten in Besitz? Wie schützen wir unser digitales Leben?
www.ownyourdata.foundation/">www.ownyourdata.foundation
Wenden Sie sich an die Gesetzgeber
hppt:// www.bundestag.de/abgeordnete">www.bundestag.de/abgeordnete ;
Wir können das nur gemeinsam.
Vergessen Sie nie: Sie können etwas tun! Es ist nicht nur an Big Tech und unserem Staat, etwas für unseren Schutz zu tun. Wir müssen auch selbst für uns eintreten. Sie kommen auch ohne die nächste wirale Facebook-App aus, und Sie müssen nicht bei jedem Quiz mitmachen. Sie müssen auch Ihre wertvollen Gesichtserkennungsdaten nicht verschenken, nur um zu erfahren, wie sie im Alter aussehen werden. Einschub Ende.
„Es geht weiter, Frau Leu war auch entschlossen.“ Als nächstes enthüllten wir am 15. Oktober 2020 den Friedenspfahl. In der Folge lasen wir bei jedem Treffen, den Text der auf der Tafel zum Friedenspfahl steht, einen der Texte vom Jubiläum, ein gutes Wort, aus der Schachtel der guten Worte einer andern Kirche, und etwas aus der Bibel. Vielleicht finden wir auch neue Weggefährten, die Bettlerin vom Bettag, den schizophrenen Musiker und andere mehr.
Das Studium

Darnach: Wir hatten es geschafft

Ich war glücklich. Wir hatten es geschafft.
Ich dachte immer, wir haben es geschafft und das ist gut so.
Ich bat die Redner um ihre Texte und stellte sie digital zusammen, um sie bei Bedarf ausdrucken zu können.
Parallel drei Abschiede: Sie hatten es geschafft.
1. Erich Tanner: Drei Todesanzeigen: Unterzeichnet die Belegschaft der Auto-Garage Tanner, die Blasmusik, der Gemeinderat. Herr Tanner war nach einer Herzoperation nicht mehr erwacht. Er hatte die Garage aufgebaut, in der wir seit bald vierzig Jahren Kunden sind. Mein Mann hatte sich immer wieder mit ihm unterhalten. Er kannte die Geschichte von unserer Tochter. Wir hatten Anteil genommen an der immer wieder neuen Hoffnung während den vielen Krebsbehandlungen seines Sohnes, der schliesslich nach einer Operation nicht mehr erwachte.
2.Eine Woche später Hans: Zwei Todesanzeigen: Eine von der Internationalen Schule Schaffhausen (ISSH) und eines von den Angehörigen. Er hatte in der unmittelbaren Nachbarschaft der Garage Tanner gewohnt. Hans, der liebenswürdige Chauffeur des Schulbusses der ISSH. Ich hatte mehrere Jahre in der Morgenfrühe ein Kind in seinem Bus zur Schule begleitet. Zunächst sass ich mitten in der Kindergruppe, dann neben Hans auf der Fahrerbank und schliesslich winkte ich ade. Das Kind hatte Vertrauen zu Hans gefunden.
3.Eine Woche später Silvia Pfeiffer, Visionärin mit Herz, beharrlich, klug und witzig. Die dezidierte Sozialpolitikerin war im Altre von 75 Jahren gestorben. Vier Todesanzeigen in der Arbeiterzeitung im Auftrage der Evangelisch reformierte Kirche der Schweiz, der evangelisch reformierte Kirche des Kantons Schaffhausen, der evangelisch reformierte Kirchgemeinde Schaffhausen-Buchthalen und dem Verein für Jugendfragen, Prävention und Suchthilfe (VJPS).
Die drei Verstorbenen waren nach mir geboren und hatten es bereits geschafft. Ich spürte, wie ich durch das Jubiläum meinem Ziel auch ein gutes Stück näher gerutscht war, und das war gut so.
Ich war glücklich und zufrieden und ging Schritt um Schritt weiter. Die Schritte wollten kürzer werden, und ich hatte zu spüren, dass dafür noch nicht der Zeitpunkt war. Also voran. Als ich mich ein wenig ausgeruht hatte, tauchten neue Erinnerungen auf.
Darnach: Gedanken zu den Liedern

Auf Anfrage hin schickte die Dirigentin mir die Liedtexte. Ich bemühte mich, diese zu lesen und zu verstehen. Das Eröffnungslied in Dialekt. Die beiden letzten Zeile lauten:“ Trage mich Wind, trage mich über das Land, trage mich über das Meer, trage mich, trage mich.“ Das zweite Lied, die deutsche Übersetzung von „String: Fragile“. Zehn Zeilen, die beiden letzten kann ich teilweise verstehen: „Es wird immer wieder regnen. Es sind Tränen von einem anderen Stern. Und immer wieder wird der Regen uns sagen, wie zerbrechlich wir sind.“ Dann englische Texte: Viele Wörter verstehe ich, nicht aber deren Inhalt, deren Aussage. Die Gesamtheit der von Teilnehmenden für unser Jubiläum ausgewählten Texte, lassen mich bange werden. Ich habe den Eindruck, als wollten sie tief in mir drin ein Gefühl der Heimatlosigkeit und der Ohnmacht wecken, das ich gar nicht in mir trage. Sie scheinen etwas zu fordern, das ich nicht leisten kann. Ich schlief mit dem Textblatt in den Händen ein. Später löschte ich das Licht und kraulte mich unter der Bettdecke zusammen.
Dann weckte mich ein Traumfetzen. Wir sangen: “So nimm denn meine Hände und führe mich, bis an meine selig Ende … “ Hier blieben wir stecken und ich wachte ärgerlich auf. Hastig suchte ich das Lied im Kirchengesangbuch und schlüpfte fröstelnd unter die Bettdecke zurück. Vor mehr als sechzig Jahren hatten wir dieses Lied bei der Beerdigung des Nachbarmädchens Hanne in der Kirche gesungen. Wir hatten den Text auswendig gelernt, durften aber in der Kirche zur Sicherheit die Büchlein trotzdem benutzen. Ich dachte auch an die Grossmutter väterlicherseits. Sie will in diesem Lied viel Trost gefunden haben, nachdem die 18-Grippe drei ihrer Kinder zurückgeholt hatte, zurück in den Himmel. -- Später erwachte ich mit dem Lied „der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen … „ Dieses Lied kannte die Grossmutter mütterlicherseits gut und wir hatten es in der Schule auswendig zu lernen. Auch diesen Text fand ich problemlos im Gesangbuch. Später noch „Weisst du wie viel Sternlein stehen, an dem hohen Himmelszelt, weisst du wie viel Wolken ziehen weit hinüber alle Welt … „ Wieder ein kurzer Blick ins Kirchengesangbuch und schon schlief ich ruhig weiter. Beim Frühstück wollte ich meinem Mann von meinen Träumen erzählen. Er hörte zu. Verbunden mit kurzen Überleitungen, erzählte ich nicht nur, sondern sagte ihm alle drei Texte auf. Diese Art des Durchzuhalten hatte ich während dem Jubiläum gelernt. Er wollte nicht mit mir über die am Jubiläum gesungenen Lieder sprechen, das sei nicht seine Art von Musik. Wieder einmal bedauerte ich, dass Musik nicht meine Welt war.
Die Sendung „Sternstunde Musik“ von SRF 1 vom 11. Oktober 2020 trug den Titel: «Steve Lee – die sanfte Stimme des Rock.“ Das kam mir entgegen. Steve Lee war sehr erfolgreich gewesen. Er war 2005 im Hallenstadion und 2011 in der Tonhalle ZH aufgetreten. Er schrie und das Publikum brüllte. Er saugte die Kraft der Zuhörer auf und warf sie ihnen zurück, die Atmosphäre steigerte sich. Ich hatte solche Wechselspiele im Volkshaus beobachtet, aber ich wollte nicht mitmachen. Steve Lee hatte es geschafft, und viele blieben auf der Strecke. Schreiend und brüllend gehörten sie dazu. Arbeit und eine gute Stimme, viel Arbeit, Anstrengung und Kampf, er wollte es allen recht machen. Dann die Scheidung: „Ich nehme deine Fotos von der Wand und suche ein anderes Mädchen.“ Dieser Satz gefällt mir in seiner einfachen Ehrlichkeit. „Wir sind alle mehr, als du siehst“. Für mein Empfinden suchte Lee auf einem nostalgischen Hintergrund noch nach etwas anderem. Auf diese Suche brauchte ich mich nicht zu begegnen. 2012 wurde er nach einem tragischen Verkehrsunfall in den Bergen zurückgeholt.
Theoretisch liebte und liebe ich Musik über alles, doch bereits als Teenager hörte ich eher die Nachrichten Sendung „Echo der Zeit“, als dass ich am Radio noch einer Musiksendung gesucht hätte. So konnte ich mit den Gleichaltrigen nicht mitreden. Die Fächer Gesang und Musikunterricht machten mir Sorge. Ich wurde nie für einen Chor ausgewählt. Ich besuchte schön brav alle Konzerte, welche die Schule anbot. Zufällig kannte ich die Namen Elvis Presley und Louis Armstrong und liebte Negro Spirituals, aus Mitgefühl für die schreckliche Vergangenheit der schwarzen Amerikaner. Einschub: Wie sollte ich diesen Satz, nun in der Zeit von „black lives matter“ korrekt formulieren? Einschub Ende. Und, wurde ich nach meiner Lieblingsmusik gefragt, so war dies Jazz, weil er damals als moderne Krach-Pum-Musik verpönt war und zu keinen Gesprächen führte. – 1967 hatte ich ein Konzert der Rollings Stones im Hallenstadion erlebt. Es hiess nachher, in einem Begeistungstaumel sei alles kurz und klein geschlagen worden. Ich hatte die Szene mit Befremden von meinem Platz aus beobachtet. Wozu das? 1976 wieder im Hallenstadion John Cash. Dazwischen verschiedene Konzerte in der Tonhalle, im Volkshaus und und … . Später einiges in Schaffhausen. Wir waren zwei Mal in der KKL in Luzern und 1991 sahen „Cats“ in der Messe Halle Oerlikon. Seit ich pensioniert bin höre ich beinahe jeden Tag das Ende der Sendung „Klassik Telephon“ doch analog zu früher, hat das Tagesgespräch, die aktuelle Politsendung um 13 Uhr den Vorrang. Seit anfangs Oktober besitze ich ein neues Radio mit vorprogrammierten Sendern, das erleichtert das Wechseln zwischen SRF 1 und SRF 2.
Dona Nobis Pacem, als Kanon gesungen war seit langem meine Vorgabe für das Jubiläum. Ich war glücklich, dass ich dank der Corona-Krise die FrauenChorFrauen mit Vreni Winzeler als Dirigentin für unser Jubiläum hatte gewinnen können. Die Frauen von den FrauenChorFrauen gelten als ausgezeichnet und ich habe schon mit mehreren Frauen gesprochen, die als Sängerinnen abgelehnt wurden. Vreni soll einsame Spitze sein. Sie fand es eine gute Idee, dass ich die Redner statt eines symbolischen Dankgeschenks ein Lied auswählen liess und Frau Winzeler die weiteren Lieder bestimmte. Der Chor fand guten Anklang und auch der Wechsel zwischen Rede und Lied wurde geschätzt. Bei so viel Zufriedenheit, sei mir erlaubt von der Liedauswahl nicht begeistert zu sein. Ich bleibe bei „dona nobis pacem“ im Kanon gesungen, doch das war für mich wenig überzeugend, weil in moderner Art die Gäste mitsingen sollten.
Darnach: Dieses Jubiläum konnte nicht verschoben werden

Dieses Jubiläum konnte nicht verschoben werden
Unsere Adoptivtochter Dolma hatte sich damals, als ich nach dem ersten Abendgebet für den Frieden am 15. September 1995 um 19.45 heim kam, von uns verabschiedet. Gemäss meiner Erinnerung tat sie dies mit wenig schmeichelhaften Worten in verächtlichem Ton und verachtender Gestik. Für mein Empfinden drückte ihre Haltung mehr Verachtung aus, als dies Greta Thunberg bei ihren Vorwürfen vor den vereinigten Nationen schaffte. Sie gab mir zu verstehen, dass ich sie nie mehr sehen würde. Ich habe sie nie mehr gesehen. Richtig ist, dass wir nicht in der Lage gewesen waren, ihre Erwartungen und Anforderungen zu erfüllen, und sie deshalb nicht unsere Adoptivtochter sein wollte.
1982, sie war wenig länger als eine Woche bei uns, da wollte ich die beiden Kinder, wie es sich regelmässig ergeben hatte, gemeinsam baden, spielten sie doch munter und friedlich gemeinsam im Wasser. Ich sass dabei auf der WC-Schüssel und schaute ihnen vergnügt zu. Ohne einen für mich erkenntlich Grund gab sie mir jenem Abend klar zu verstehen, dass sie die Wanne nicht mit unserem Sohn teilen wolle. Ihrem Wunsch entsprechend badete sie allein. Unser Sohn stand daneben und ich sass bei ihnen. Ich spürte, dass unser Sohn gerne mit ihr gebadet hätte, aber er wartete geduldig. Abwechselnd schaute er sie und mich mit traurigen Augen an. Wir hatten noch keine gemeinsame Sprache. Sie bemühte sich, mir die Dinge zu erklären, aber ich verstand ihre fremden Wörter nicht. Unser Sohn sprach erst einzelne Wörter. Was tun? Sie war schnell fertig und gab uns zu verstehen, dass nun der Kleine an der Reihe war. So wechselten die beiden Kinder die Stellung: Neu er im Wasser und sie daneben. Mit Handzeichen erklärte sie mir nun, dass er in meinem Bauch gewesen war, sie aber nicht. Ich stimmte ihr bereitwillig zu, was sie sichtlich freute und beruhigte. Schnell zog sie das Pyjama wieder aus und stieg zum Kleinen in die Wanne. Dieser freute sich sehr und packte sie am Arm. Sie schaute mich fragend an, und ich bestätigte ihr Handzeichen, er ja, du nein. Dann spielten die beiden vergnüglich. Sie war die grosse Schwester und er, der kleine Bruder.
Nach der Geburt unseres Sohnes war sofort klar, dass er allein bleiben würde. Das wollte ich nicht, und ich teilte diese Sorge mit meinen Bekannten. Eine der informierten Frauen streute meinen Wunsch in ihrem Bekanntenkreis. Unser Sohn marschierte noch auf wackligen Beinen, als mich ein Anruf aus Lausanne erreichte. Ein Arzt im Pensionsalter, der sich während Jahren für das Wohl des tibetischen Volkes eingesetzt hatte, war am Apparat. Er erklärte mir, dass ihm eine gemeinsame Bekannte unsere Telefonnummer gegeben hätte. Er vermute, dass wir gemeinsam sein Problem und unser Problem lösen könnten. Er habe sich vor langer Zeit bereit erklärt, ein Kind aus Tibet zu adoptieren. Nun wäre es bald soweit, aber nun als Witwer in seinem Alter fühle er sich nun überfordert. Natürlich waren wir interessiert. Verschiedene Versuche, ein Adoptivkind zu finden, hatten bereits fehlgeschlagen. Ich war zudem in der Lage, noch in der laufenden Woche die Schwester des Dalaih Lama in Bern zu treffen, denn sie wolle künftige Adoptiveltern persönlich auswählen. Nach meinem Besuch in Bern, nach einem kurzen freundlichen Gespräch, waren wir in Erwartung auf eine drei jährige Schwester für unsern Sohn. Nach viel Papierkram wurde sie uns dann doch überraschend schnell nach Zürich-Kloten gebracht. Ich hatte unserem Sohn erklärt, nun würden wir seine Schwester holen. Als die beiden erwarteten kleinen tibetanischen Mädchen in Begleitung einer Besucherin die Passkontrolle passiert hatten, hastete unser Sohn auf die fremdländisch gekleideten Menschen zu, fasste das eine Mädchen an der Hand und zog es auf uns zu. Er hatte richtig gewählt. Gemäss den Dokumenten war uns dieses hübsche Mädchen namens Dolma zugeteilt. Was nun? Wir verabschiedeten uns und fuhren heim. Dort tranken wir etwas und zeigten dem neuen Kind sein Zimmer und die vorbereiteten Sachen. Kleider ja, aber das Mädchen interessierte sich hauptsächlich für Unterhemdchen und Unterhöschen. Sie nahm beide Häufchen mit sich ins Bett und schlief damit in den Armen ein. Unser Sohn hatte auch Schlaf nötig. Wir waren nun Eltern von zwei Kindern und ich hatte für zwei Jahre meine Erwerbstätigkeit aufzugeben und Vollzeit Mutter und Hausfrau zu sein. Mein Mann war in Sorge, was mich nicht unvorbereitet traf. Ich war bereit, vieles auf mich zu nehmen, doch mit einem Bruch, wie wir ihn im Herbst 1995 erlebten, hatte ich nicht gerechnet.
Die akuten Probleme begannen, nachdem unsere Tochter im Frühjahr 1994 die Aufnahmeprüfung in die dreijährige Berufsmittelschule nicht bestanden hatte. Dafür machte sie mich verantwortlich. Aus ihrer Sicht hatte ich mich zu wenig für ihre Prüfung engagiert. Das war aus ihrer Perspektive richtig, denn sie hatte von mir volle Unterstützung erwartet. Das hiess: Ich sollte meine Teilzeit Arbeit, den Haushalt, unsern Sohn und Peter, meinen Mann immer und vollständig hintan stellen. Ich sollte das Fräulein dauernd bitten, mit mir zu lernen, und sollte Verständnis für ihre Bemühungen zeigen, sich vor der gemeinsamen Lernerei zu drücken. Ich hatte ihr erklärt, es sei ihr Wunsch, die Berufsmittelschule als Vorbereitung für das Kindergärtnerinnen-Seminar zu besuchen. Ich würde sie bei den Prüfungsvorbereitungen unterstützen, aber die Initiative müsse von ihrer Seite kommen. Ich war nicht bereit, sie weiterhin zu bitten und zu betteln, um mit ihr Hausaufgaben machen zu dürfen, mich neben sie zu setzen und ihr vorzurechnen. Um die Fertigkeit zu erwerben, die Rechnungen selbständig lösen zu können, musste sie diese selbständig lösen lernen, ohne dass ich ihr den Lösungsweg Schritt für Schritt vorzusagen hatte. Ich hatte in ihren Augen versagt, weil es mir gelang, mich ihren Verweigerungen zu entziehen.
Weil sie sich schon seit langem eine weite Reise ohne unseren Sohn gewünscht hatte, schenkten wir ihr zur Konfirmation eine Reise nach Israel. Zunächst freute sie sich darauf, unterwegs erfuhr ich dann aber in einer gehässigen Auseinandersetzung, dass sie das Geld auf die Hand einer Reise vorgezogen hätte. Sie interessierte sich mehr für den Chauffeur des Reisebusses als für die historischen Sehenswürdigkeiten oder Städte wie Bethlehem und Jerusalem. Bei der Durchfahrt von Haifa waren wir um Minuten einem Sprengstoffanschlag entgangen, der 32 Tote und ebenso viele Schwerverletzte gefordert hatte. Mich interessierten die Hintergründe einer solchen Tat. Ich nahm dies zudem als Anlass für einen erneuten Versuch, um mit ihr über ihre Heimat Tibet zu sprechen. Umsonst. Sie wolle das Buch „Sieben Jahre in Tibet“ von Heinrich Harrer nicht, war ihre Antwort.
Da sie wegen dem Misserfolg bei der Prüfung keine Anschlusslösung hatte, besuchte sie die vierte Sek. Damit begann eine sehr herausfordernde Zeit. Sie hätte gerne die Schule abgebrochen und irgendeine Arbeit gesucht, um ihr eigenes Geld zu verdienen. Wir Eltern verlangten, dass sie eine Lehrstelle suchte. Mit ihrem guten Zeugnis und ihren freundlichen Umgangsformen fand sie bald eine Stelle als Verwaltungslehrtochter. Da ihr angehender Lehrmeister es zwar ungewöhnlich, aber gut fand, wenn sie die Schule nun abbrach und bis zum Lehrbeginn als Au Pair ins Welschland ging, stimmten wir diesem Plan zu. Ob das ein guter Entscheid war, kann offen bleiben, er brachte mir jedenfalls eine Verschnaufpause. Nach der verfehlten Prüfung war nämlich aus unserer braven Tochter eine freche Teenagergöre geworden. Plötzlich sah sie nur noch Männer. Zunächst hatte sie einen netten Freund, der bereit war, uns kennen zu lernen. Überraschend schnell trennten sich die beiden, und sie begann einen Umgang zu pflegen, der unseren Gepflogenheiten nicht entsprach. Wir wollten wissen, wer in unserer Wohnung ein und ausging. Junge Männer, die wir noch nie gesehen hatten, konnten nicht bei uns übernachten. Sie war entsetzt, weil ich an dieser Vorgabe fest hielt. Ausserdem fühlte sich unser Sohn durch den nächtlichen Lärm im Nebenzimmer gestört.
Aus dem Welschland zurück, hatte sie die Lehre zu beginnen. Nach der ersten Woche brachte sie mein Mann mit dem Auto zur Lehrstelle, weil sich der Lehrmeister wegen ihrem verspäteten und regelmässigen Erscheinen gemeldet hatte. Dann kam sie nicht mehr heim. Wo sie Unterschlupf gefunden hatte, wussten wir nicht. Sie hatte eine eigene Wohnung verlangt und gedroht, sonst käme sie nie mehr heim, sie könne jederzeit bei ihrer Freundin Lana übernachten. Die hätten eine vornehme Wohnung und genug Platz. Nach drei Wochen meldete uns eine Sozialarbeiterin der Stadt, unsere Tochter hätte nun eine Wohnung gefunden, ich solle vorbeikommen, um den Mietvertrag zu unterschreiben, da das Mädchen noch nicht volljährig sei. Ich verweigerte die Unterschrift, doch die Behörde mietete ihr die Wohnung ohne unsere Zustimmung. Ich verlangte ein geordnetes Budget und war nicht bereit, Rechnungen, die mir direkt zugestellt würden „einfach“ zu bezahlen. Die städtischen Behörden meldeten mir zudem, dass sie unserer Tochter den Abbruch der Lehre verboten hatten. Sie teilten mir auch mit, die junge gut erzogene Frau sei ohne Mühe in der Lage, selbständig einen Haushalt zu führen. Weiter mit uns zu leben, sei ihr nicht zumutbar. Ich staunte, von meinem Mann war nie die Rede, obwohl auch er hätte unterschreiben können. Während dieser Phase bekam sie von dritter Seite für all ihre Ansprüche massive Unterstützung.
Nun begann ein mühsames, Jahre dauerndes Rechtsverfahren. Wir wurden schliesslich verpflichtet die Differenz zwischen den von der Stadt bezahlten Unterhaltskosten und ihrem Lehrlingslohn zu bezahlen. Dank guter Vornoten bestand sie die Abschlussprüfung und wir waren von weiteren Zahlungsverpflichtungen befreit. Der Rechtsstreit drehte sich zunächst um die Frage, ob es sich um einen rechtmässigen oder einen unrechtmässigen Kindesentzug handle. Friedensrichter, Bezirksgericht, Kantonsgericht, Bundesgericht, europäischer Gerichtshof in Strassburg. Mein Mann konnte nicht akzeptieren, dass der behördliche Entzug unserer Tochter rechtens sein sollte. Dann begann es nochmals von vorne. Es ging nicht mehr um die Sachfrage, sondern das Verfahren drehte sich ausschliesslich um Rechtsfragen, um Fristen und die Frage nach der Legitimation. Mein Mann verfasste die Rechtsschriften, weil er der Meinung war, die Situation am besten zu kennen.
Unser Sohn bestand die Probezeit in die Kantonsschule und ging jeden Abend zum Fussballtraining. Er wollte den Namen seiner geliebten Schwester nicht hören. Deshalb besprachen mein Mann und ich unser Vorgehen auf langen Nachtspaziergängen. Er stellte mir wieder und wieder dieselben Fragen, die ich beim gemeinsamen Gehen geduldig immer wieder beantwortete. Gesprächen am Tisch konnte ich nicht standhalten. Aus Rücksicht auf unseren Sohn drängte er auf die Märsche, und das gemeinsame entschlossene Gehen tat mir gut.
Jahre später, begegnete mir der Vorsteher des Jugendamtes bei einer Weiterbildungsveranstaltung von Angesicht zu Angesicht. Ich kannte ihn, er kannte mich nur aus dem schriftlichen Verfahren rund um unsere Tochter. Er hatte sich damals geweigert, mir oder meinem Mann eine mündliche Aussprache zu gewähren. Durch das Buschtelefon hatte ich jedoch erfahren, dass später Eltern, oder Elternteile bei Verfahren um Minderjährige immer anzuhören seien, um einvernehmliche Lösungen zu suchen. Eine solche Aussprache hatte man uns verweigert, weil ich zu allem imstande gewesen wäre und so ein Treffen mit mir deshalb zu gefährlich. Zusätzlich hatte unsere Tochter mit Selbstmord gedroht, falls der direkt Kontakt zu uns gesucht würde.
An jenem Tag fand ich einen Vorwand, um den Vorsteher persönlich anzusprechen. Er fragte nach meinem Namen und ich antwortete freundlich, der sei für seine Antwort ohne Bedeutung. Die Frau neben mir sagte: „Das ist Frau Brenner, bei ihr kann man mit Fragen aller Art vorbeigehen. Sie hat etwas gegen seitenlange Briefe.“ Ich bat die Sprechende, neben mir zu bleiben, da der Vorsteher vermutlich Bedenken hätte, mit mir allein zu sprechen und Polizeischutz mir übertrieben scheine. Pause. Der Vorsteher wusste sofort, worauf ich mich bezog. Die Frau neben mir musste auf den Zug. Ja, so hätte es nicht laufen dürfen. Unsere Tochter hätte sich mit ihrem Erfolg gebrüstet und sofort hätten andere minderjährige Frauen Wohnungen beansprucht. So hätte es nicht laufen dürfen, er bedauere das Verhalten der Behörden.
Wir respekieren den Entscheid unserer Adoptivtochter. Diese Erfahrung gehört zu unserem Leben. Die Verletzungen der Behörden haben Narben hinterlassen. Für mich ist gut zu wissen, dass es so gehen kann, auch wenn man sein bestes gibt. Bekannte erkundigten sich gelegentlich nach ihrem Verbleib und nahmen dies als Anlass, uns ihre Erklärungen und neue Informationen zu bringen. Eine Weile beschäftigte mich die wiederholt gestellte Frage, wie ich reagieren würde, wenn die Wohnungsglocke läuten und unsere Tochter vor der Türe stehen würde? Ich empfand diese Frage als zu hypothetisch und dachte doch darüber nach. Ja, ich würde sie bitten, im Bahnhofbuffet auf mich zu warten und mir Zeit zum Umziehen einzuräumen. Ich hätte Angst, sie in unserer Wohnung zu empfangen. Am 15. September 2020 waren es 25 Jahre, seit sie uns verlassen hatte. Wir hatten sie mit Liebe und Freude aufgenommen und uns bemüht, ihr unser Bestes zu geben. Sie hatte unseres Erachtens nie hinter unserem Sohn nachzustehen.
Und unser Sohn? Er hat seine Schwester geliebt. Seine Kindergärtnerin erzählte mir, als sie mit den Kindern über Freundschaften gesprochen habe, hätte er erklärt, er sei dankbar, eine Schwester zu haben. Auch später wurde mir zugetragen, er betone immer, dankbar zu sein, eine Schwester zu haben. Er teilte alles mit ihr, nicht aber das Taschengeld, das er für den Kauf von „Landmaschinen“ sparte. Er hatte Mühe zu verstehen, dass sie immer alles für Süssigkeiten ausgab und sich beschwerte, nicht jeden Tag Taschengeld zu bekommen. Auf seinen Wunsch hin gab ich ihr eine Weile jeden Tag den entsprechenden Betrag. Ich weiss auch, dass er ihr ohne Erfolg eine Belohnung versprach, wenn sie Geld für etwas „rechtes“ sparen würde. Es gelang ihm immerhin den Grossvater regelmässig für einen grosszügigen Zustupf an sie zu gewinnen, obwohl ihr Sparkässeli leer war. Für kleine Hausarbeiten und pro gelesem Buch gab es zusätzlich Geld. Er machte die Hausaufgaben mit möglichst wenig Unterstützung und forderte mich auf, seiner lieben Schwester zu helfen. Zwar zwei Jahre jünger, bemühte er sich bald, mit ihr das Einmaleins zu üben, das er besser konnte als sie. Er freute sich dann sehr und lange, als sie die Prüfung in die Sekundarschule bestanden hatte. Dann begann er sich Sorgen zu machen, und er forderte sie auf, ihre Hausaufgaben selbständig zu erledigen, da sie nun ein grosses Mädchen sei. Er litt, als sie die Prüfung in die Berufsmittelschule nicht bestanden hatte. Ich hatte gehört, wie er sie zuvor aufgefordert hatte, tüchtig zu üben. Als sich seine liebe Schwester dann plötzlich in eine freche Teenagergöre verwandelte, begann er zu leiden. Er wollte nicht, dass ich wusste, dass er schlaflose Nächte hatte. Um ihn abzulenken, zeigte ich vermehrt Interesse für seinen Fussball und erlaubte ihm im Keller zu üben. Wir sprachen von seiner Prüfung in die Kantonsschule. Er hatte sich auf seinen eigenen Weg zu konzentrieren und seine liebe Schwester verlor etwas an Wichtigkeit. Er freute sich, dass sie schnell eine Lehrstelle fand und den Rest des Schuljahres im Welschland verbringen durfte. Er fand das für alle eine gute Lösung. Wir waren nun eine nette kleine Familie. Auf ihre Rückkehr freute er sich. Er bedauerte, kaum Zeit zu haben, weil er plante, auch während der Probezeit in der Kantonsschule den Fussball nicht aufzugeben. Ich unterstützte seine Pläne, denn ich sah im Fussball eine gute Ergänzung zur Schule. Dann kam die liebe Schwester zurück. Er litt. Zu meiner Erleichterung sah ich, dass es ihm gelang, sich auf die Schule und den Fussball zu konzentrieren. Trotzdem, er litt. Er wollte rechtzeitig in der Schule sein, und sie blockierte das Badezimmer. So nahm er schon am Abend eine Schüssel Wasser ins Zimmer und wusch sich am Fenster. Das gebrauchte Wasser schüttete er in die Dachrinne. Er war dankbar, dass der Vater sie zur Lehrstelle führte, selber schaffte er den Weg zu Fuss. Dann kam sie nicht mehr heim. Er hatte einen losen Kontakt zu ihr und gab mir zu verstehen, dass es keinen Grund zu grosser Sorge gebe, obwohl wir sehr traurig waren und nicht wussten, wie es weitergehen würde. Mein Mann trat zwischenzeitlich seine neue Stelle in einem andern Kanton an. Am 15. September 1995 verabschiedete sie sich von uns. Unser Sohn war auch verschwunden. Seine Bettdeckte bewegte sich. Er wollte nichts von mir wissen und stiess mich weg. Viele Abende verschwand er mit Brot in seinem Zimmer und später unter der Decke. Er wollte allein sein. Er wollte nicht auf seine liebe Schwester angesprochen werden. Er wollte auch nicht, dass sein Vater sie in seiner Gegenwart erwähnte. Er war dankbar, dass wir am Abend die Wohnung verliessen. Vereinbarungsgemäss stellte ich ihm kein Essen bereit, und er durfte nach Gutdünken naschen. Nun lagen regelmässig frische Semmeln und Brötchen im Kasten. Es hatte nun immer Bananen und Früchte, nicht nur Äpfel vom Garten. Einmal teilte er mir mit: “Mama, ich bleibe bei dir. Dolma will, das ich zu ihr ziehe. Sie hat mir alles versprochen. Mama, wir haben genug, ich bleibe bei dir. Sage das nicht Papa, sonst beginnt er mich zu fragen.“ Ausser an den Wochenenden ass er allein. Selber bereitete ich mir häufig kleine mundgerechte Stücke vor, die ich mit einem Zahnstocher bequem und sauber beim Zeitungslesen essen konnte. Plötzlich begann er sich für diese Zahnstocherbrötchen zu interessieren und verschwand mit meinem Teller strahlend hinter den Hausaufgaben. Dies wurde nun zu unserer Gewohnheit. Brachte er mir den leeren Teller zurück, so hiess dies, bitte noch eine Lieferung. Die Zeit verging. Leistungs-Fussball und Schule klappten gut, obwohl mir die Schule dringend von so viel Sport abriet. Ich unterstützte unsern Sohn. Ich wollte nicht, dass er mir weiterhin im Haushalt half. Ich bereitete ihm zusätzlich einen Znüni und einen Zvieri vor. „Mama, das geht schneller als kaufen“, war seine Begründung. „Mama, zuhause essen ist besser als in Mensa, hier kann ich nachher aufs Bett liegen noch etwas trinken, Wörtchen repetieren und in der Küche etwas zum Dessert suchen, bevor ich schnell, schnell in die Schule zurückeile. Bewegung, frische Luft und Ruhe, das tut gut. Später erzählte er mir, dass sich seine Klassenkameraden nun für das Auslandjahr anmelden würden, aber das komme nicht für ihn nicht in Frage, da er gerne bei uns wohne. Dies wolle er zeigen, weil seine Schwester nicht mehr da sei. Er könne nicht gehen, aber wir sprachen doch über seine Wünsche. Nicht USA, vielleicht Australien, eine Stadt am Meer, eine Schule mit einem Fussballverein. Der Anmeldetermin endete an einem Montag. Ich sagte zu ihm: „Ist es gut, wenn ich dich heute anmelde?“ „Ja, aber wir sind zu spät. Die Anmeldung muss heute eintreffen“, strahlend hastete er in die Schule. Er kam noch schneller heim als gewohnt heim. „Es klappt, es klappt, am Mittwoch um 14 Uhr hast du in Bern das Anmeldeinterview“, rief ich ihm entgegen. „Was wird Papa sagen“? „Er wird denken, wir seien zu spät, aber ich hätte gebetet und deshalb habe geklappt.“ Dem war so. Anfangsjahr flog unser Sohn nach Adelade, einer Stadt am Meer in Südaustralien. Wir sprachen nie mehr über seine Schwester. Er litt kurz unter einer Jugenddepression und bestand die Maturaprüfung als Zweitbester. Er studierte in Bern und sucht sich eine Freundin. Schliesslich fand er Katrin. Die beiden machten gemeinsam ein Nachdiplomstudium in Monterey Kalifornien. Später schenkte uns das Paar zwei Enkeltöchter. Als wir am 9. Oktober 2020, bevor die zweite Coronawelle begann, gemeinsam das Bimano in Bern besuchten, wies er mich so nebenbei darauf hin, seiner 5jährigen sei Dolma im Fotoalbum aus seiner Kindheit aufgefallen. Sie werde mich gelegentlich nach ihr fragen. Ich solle mir überlegen, was ich ihr sagen wolle. Ich fragte ihn, was er sich vorstelle. „Beantworte ihre Fragen und sage nicht mehr. Bedenke, dass sie erst fünf Jahre alt ist und versuche nichts zu erklären, was wir als Erwachsene nicht verstehen“, so sein Wunsch. Und weiter, er habe sie 2005 mit dem Bub ihm Zug letztmals getroffen. Sie hätten sich freundlich unterhalten. Er war erstaunt, dass wir ihr nie zufällig begegnet waren. Ich empfand seinen Ton versöhnlich, was mich entlastete.
Das Gerichtsverfahren hatte Peter, meinen Mann in seiner Ehre verletzt. Koste es, was es wolle, es war ihm wichtig alles zu unternehmen, um seine Ehre wieder herzustellen. Es gelang ihm nicht. Doch Zeit heilt Wunden. Noch immer sucht er gelegentlich im Internet nach ihr. Sie hatte geheiratet und wurde 1999 Mutter eines Sohnes.
Ihre Familie in Indien? Sie hatte drei Schwestern und einen Bruder. Sie schickten jährlich einen Kartengruss, wofür Dolma sich nicht interessierte. Der Verein Freunde Tibets riet uns, der Familie keine Geschenke oder Geld zu schicken und stattdessen eine Patenschaft für ein Kind in Indien zu übernehmen. 1998, als unser Sohn in Australien war, besuchte ich ihre Geschwister. Das Treffen war herzlich. Einschub: Im Moment des Tippens dieses Textes wurde ich von Erinnerungen überschwemmt, die ich wegwischte, analog zum Weiter- und Wegwischen auf einem modernen Handy. Ich beschloss nur ein paar Stichworte zu erwähnen. Einschub Ende. Zunächst erzählten die Schwestern von Dolmas Besuch im vergangenen Jahr. Sie hatten nicht verstanden, warum Dolma sie mit einer fremden Frau besucht hatte. Da Dolma noch keine Englischkenntnisse gehabt hätte, seien Gespräche nicht möglich gewesen. Die Fremde habe ihnen keine Auskunft gegeben. Dolma habe dann einen Freund gefunden und sei, sie wagten es kaum zu sagen, bald wieder mit der Fremden weggereist. Warum ich nicht mitgekommen sei? Ich bemühte mich, ihnen alles zu erklären. Ich erzählte von den guten gemeinsamen Jahren und fragte nach ihren Erinnerungen. Sie erzählten mir, wie sie damals im Baby-Home von Dolma Abschied gefeiert und ihr beim Wegfahren nachgewinkt hätten. Es seien immer wieder Kinder verreist, so auch ihre jüngste Schwester. Das sei nicht ungewöhnlich gewesen. Man habe ihnen erklärt, sie würde in ein fernes Land zu freundlichen Menschen reisen. Sie hätten keine Karten geschrieben und erst später englisch gelernt.
Und ich? Heute sage ich zynisch, sie hätte eine alternative Karriere gemacht, und füge bei, dass ich die Erfahrung nicht missen möchte. Nun aber ein paar Schritte zurück. Als Dolma nach langen Jahren nicht mehr Familienthema war, kam für mich eine schwierige Phase. Jetzt hatten meine Verletzungen und mein Schmerz Platz und sie wurden für mich unausweichlich wichtig. Ich konnte mit kaum jemandem darüber sprechen. Ich wollte nicht hören, was die andern dachten. Ja, vielen war wichtig, mir zu sagen, dass sie nie ein Kind adoptiert hätten, und dass ich selber schuld sei. Ich fand Trost bei der Erinnerung an meine Grossmutter. Sie hatte 1918 drei Kinder verloren. Fragte ich sie als grosses Kind darnach, sagte sie mild: „Der Herr hat sie uns gegeben, der Herr hat sie geholt, der Name des Herrn sei gelobt“,
Am 17. Oktober 2020 machten mein Mann und ich eine Standortbestimmung. Mein Mann erwähnte zunächst die Geburtsanzeige von ihrem Sohn Oussman Diop 1999. Nach einigem Hin-und-her hatten wir mit einer vorgedruckten Karte geantwortet. Mit spärlichen Angaben im Internet folgte „der Grossvater der Entwicklung seines Enkels“. Für mich war das Kind nie Realität. Er soll später sogar eine Sportschule besucht haben. Am 17. Oktober 2020 fanden wir keine Angaben zu ihm. Mein Mann berichtet mir seine Internet-Funde betreffend Dolma regelmässig. Ich nahm diese zur Kenntnis. Eine ihrer Schwestern ist mit einem Schweizer verheiratet. Von ihr haben wir erfahren, dass sie zurzeit für ein Hilfswerk in Nepal arbeitet. Sie organisierte vor Weihnachten eine Fundraising Kampagne für Turnschuhe.
Der folgende Text soll von ihr stammen. Erstellt am 19. November 2019, habe ich aus dem Internet kopiert.
„Namaste/Namaskar liebe Freunde, Verwandte und Bekannte!
Nun bin ich schon über drei Monate in Nepal und Weihnachten rückt näher. Für die Kinder hier in diesem Heim (HORAC) ist Weihnachten auch etwas Besonderes, da sie christlich erzogen werden. Deshalb habe ich mir Gedanken darüber gemacht, ob und was ich organisieren soll/kann. So kam mir die Idee mit den Schuhen. Sie sind nützlich und sinnvoll, da Kinderfüsse stetig wachsen und viele Kinder oftmals zu kleine und ausgetragene Schuhe tragen und bald wieder neue nötig wären. Und wer freut sich nicht über ein paar nigelnagelneue Treter. Ich kann Euch versichern, die Kinderaugen werden leuchten. Hier im Heim sind es ca. 32 Kinder/Jugendliche und ein Turnschuh kostet zwischen 1000 – 3000 NPL, also 10 – 30 CHF. Da ich noch vor Weihnachten alles organisieren möchte, wäre ich sehr froh, wenn wir die gewünschte Summe von 800 – 1000 CHF so bis Anfang Dezember 2019 zusammen hätten. Falls Ihr das auch eine gute Idee findet, freue ich mich über jede Spende, es muss nicht viel sein. Herzlichen Dank! Dhanyabad.
Ich freue mich, Euch alle bald wieder zu sehen((:https://horac.org/
Liebe Grüsse aus Nepal“
Wenn ich nun tippe, so schicke dir liebe Grüsse. 25 Jahre sind vergangen und ich zünde immer noch gelegentlich in der Kirche eine Kerze für dich an. Behüte dich Gott.
Darnach: Was hat sich seit 1995 geändert?

Da gab es den technischen Fortschritt: Internet, Smartphones verbunden mit den sozialen Medien. Beliebig viele Fernsehprogramme, jederzeit abrufbar. Autos mit GPS und Navy, Airbags und Lenkhilfen. Einschub: Das moderne Kind trug Pampers, fuhr Roller und Velo und konnte mit dem Handy ruhig gestellt werden. Pampers aus Erdöl? Und die Umwelt? Einschub Ende. Ferienreisen mit den ÖV, mit Auto, Flugzeug oder Luxusdampfer. Alles, jederzeit, für alle, schnell.
„Was hat sich seit 1995 geändert?“ diese Frage hatte ich allen am Jubiläum Mitwirkenden gestellt und fühlte mich damit allein gelassen. Alle wussten, dass ich mich um die Mitwirkung des Interreligiösen Dialoges Schaffhausen bemüht hatte. Von so etwas hatte ich in den 1990 Jahren noch nichts gehört. Der Interreligiöse Dialog ist für mich der Inbegriff von Veränderung. Ich will, dass unsere Bundesverfassung von allen geachtet wird, auch von den Leuten wie Fridays for Future.
Finanzskandale, Missbrauchsfälle, Pornographie, die Unterstützung von Schlepperbanden, der Sozialstaat, die Konsumgesellschaft – was hatte da die Kirche noch zu bieten? Neue Lieder, die niemand kennt? Flexible Gottesdienstzeiten? Kontakt via E-Mail und Telefonbeantworter oder mit Umleitung auf die Zentrale? Soziale Nähe durch Duzen? Geregelte Arbeitszeiten für alle Angestellten der Kirche und beliebige Stellvertretungen? Was hielt die Kirche der Konsumgesellschaft entgegen?
Ich wünschte mir von den Rednern nicht Originalität oder eine umfassende Kurzfassung der Bibel. Die christliche Religion hat es nicht nötig, sich anzubiedern. Es war unser Jubiläum: 25 Jahre Abendgebet für den Frieden. Was hat sich seit 1995 geändert? Meine Frage wurde von keinem Redner angesprochen.
Die Anwesenheit von Mitgliedern des Interreligiösen Dialoges Schaffhausen war für mich das äusserliche Zeichen der Veränderung.
Ich brauchte Ruhe und Zeit. Am 15. Oktober 2020 weihten wir den Friedenspfahl um 17Uhr ein (ca. 10 Anwesende). Um 18:45 feierten wir wie gewohnt das Abendgebet. In der Vierung des Münsters war das Labyrinth von Chartre als Kunststoffteppich ausgelegt. Statt vieler Worte schritten wir es gemeinsam ab, was jedem der vier Anwesenden "etwas brachte". Was hiess das? Ich fragte zurück. Als Antwort ein wohlwollendes Nicken und Lächeln, keine verbale Äusserung. Gut.
Darnach: Was kann ich zum Frieden beitragen? Was ist "meine Apfelsine für den Waisenknaben"

Seit dem Tod von Dave wollte ich konkret etwas für den Frieden tun. Darüber nachzudenken und zu diskutieren genügt mir nicht. Seit anfangs 2020 hatte ich ein Symbol dafür, ich suchte "meine Apfelsine für den Waisenknaben".
Sind dies die Menschen, die mich anlächeln, wenn ich bewusst friedlich durch die Stadt gehe? Ist es Frau Schwarz, die mir für die gute Zusammenarbeit dankte? Oder Mann, der mich für die Blumen in meinem Garten lobte? Er sagte: "Nein, nein, nicht abschneiden. Ich will sie hier anschauen und denken, dass viele andere sich auch daran freuen." Eigentlich sollte, möchte ich nun über mein Studium schreiben. Sanftes Mulittasking passiert, denn mein Hinterkopf will auch noch Kikongo-Wörtchen wiederholen. Ich gewähre mir dies. Ich will verzeihend und friedvoll mit mir sein.
Ja, seit dem Jubiläum denke ich häufiger und anders über den Frieden nach. Es fällt mir leicht vom Jubiläum und meinen verschiedenen Enttäuschungen zu sprechen. Das Wort "Enttäuschung" löst Interesse aus. Kamen viele? Während dem Jubiläum war ich dankbar zu sehen, dass die Besucher Abstand hielten. Ob ich mir mehr gewünscht hätte, das wusste ich nicht. Ich war dankbar und gab diesen Dank mit einem Leserbrief an die Besuchern zurück und lenkte damit die Aufmerksamkeit nochmals auf das Thema. Selbst mein Bankberater hatte ihn gelesen und mich darauf angesprochen. Ich bat ihn sanft, um einen Beitrag der Bank an unser Defizit von rund CHF 2'000. Er hatte meinen indirekten Hinweis verstanden, lenkte aber ab, er würde mir die neue Formulare betreffend unseren Verein "Bauernörfer im Kongo" per Post zur Unterschrift zustellen. Bei Fragen solle ich ihm aus Rücksicht auf die Coronalage anrufen. Ich erklärte ihm, wo seit dem 15. Oktober unser Friedenspfahl steht und verabschiedete ihn mit dem Friedensgruss "Möge Frieden sein auf Erden". Nein, nein, keine weiteren Erklärungen. Er werde mit seinen Kindern vorbeigehen.
Wo ist meine Apfelsine für den Waisenknaben?
Darnach: Das, was man "meine Streitereien" nannte

Meine Lesenden, ich verzichte auf mühsame Details, aber ich wische diese Seite von mir nicht unter den Teppich. Ich bin ein "Sowohl-als-auch-Mensch", das heisst für viele, dass ich keine klare Meinung hätte. Dem ist nicht so, aber ich muss vor meiner eigenen Türe kehren, bevor ich auf den Schmutz auf dem Spielplatz hinweise. Deshalb verlasse ich das Haus mit einer kleinen Plastiktüte im Hosensack und kann so die Papierabfälle und Zigarettenstummel auf dem Weg zu unserer Bushaltestelle einsammeln. Viele haben das beobachtet oder mich sogar darauf angesprochen. Einige haben mich beschimpft, wenn ich ihre Hinterlassenschaften sofort wegschaffte. Ich erklärte ihnen, wenn sie sich die Freiheit nehmen, Papiertaschentücher fallen lassen, so würde ich mir erlauben, diese einsammeln, weil ich in einer sauberen Umgebung wohnen möchte. "Achtung, da kommt die Böse," hörte ich kleine Kinder flüstern und schnell, schnell verschwand allerhand Papier in ihren Säcken. Zu mir sagten sie, ich hätte schöne Blumen im Garten. Das Quartier ist im Laufe der Jahre sauberer geworden, weil die Reinigungsequipe mit ihrem grossen Putzautomat regelässig Runden macht, das mich freut.
Darnach: Meine Auseinandersetzungen mit der Kirche und rund um die Kirche

Dass unser alter Pfarrer spitze war, verstand ich erst, als ich aus Bequemlichkeit ersatzweise den freiwilligen Religionsunterricht in der Kanti besuchte. Der Religonsunterricht glich Grammatikstunden. Der Buchstabe war entscheidend. Um mir Ärger mit der Familie zu ersparen, liess ich mich konfirmieren wie all die Heiden, die laut herum prahlten: "Konfirmation, nur wegen der Geschenke. Wer bekommt am meisten?" Ich tat es für Dich und für mich, denn ich brauchte Deinen Schutz. Ich vertraute Deinen Engeln.
Gott, ich bin ein Mensch mit Behinderungen. Ich bin legastenisch, kann nicht schwimmen und bin starrköpfig. Wenn ich glaube und glaubte in Deinem Sinne zu handeln, war mir wohl. Du gabst mir das Recht auf eine gute Ausbildung, eine Ausbildung wie für einen Mann. Du machst keinen Unterschied zwischen Männer und Frauen. Alle sind wir Deine Kinder, ob schwarz, gelb, rot oder weiss, jung und alt, dünn und dich, dumm und pfiffig. Unverständlich, aber war. Beten heisst sich Zeit nehmen für sich selber, sich eine Verschnaufpause gönnen und über die sanfte Gewalt und den Überfluss in deiner Natur staunen.
Weil ich mich zu Dir bekenne, nahm ich im Elternhaus vieles auf mich, um meinen Glauben unter Beweis zu stellen. Dann gab es noch die guten Christen, denen passte nicht, dass ich mich nicht verpflichtet fühlte, Dich öffentlich anzunehmen, Dich in freien Worten zu loben und zu preisen, Dir zu danken und Dich um Verzeihung meiner Sünden zu bitten. Dein Vaterunser genügt mir, daran habe ich nichts zu flicken.
Ich gab keine Sonntagsschule, fehlte in der Jugendgruppe regelmässig und besuchte den Gottesdienst, um Ruhe zu haben, um nichts zu müssen und Kraft für die kommende Woche zu sammeln. Ich wollte beim Austeilen des Abendmahls helfen. Deine Worte sind mir Synomym zu allem Positiven, doch nun will ich ein Gläschen Roten trinken und ab ins Bett, es war Donnerstag, der 22. Oktober 2020 um 22.11.
Wie weiter? Einen Tag später entschloss ich mich für eine Zusammenfassung: Ich nehme mir das Gegenrecht: Wie die Kirche das Recht hat, nicht zu wollen, wie ich gerne möchte, so wenig muss ich nach ihren Lieder tanzen.
Nie hatte ein bezahlter Theologe unser monatliches Abendgebet für den Frieden besucht. Mein schriftlich beim obesten Gremium eingereichter Wunsch, das Thema "Frieden" auf die Traktandenliste zu setzen, wurde nicht beantwortet. -- Nach dem Pfarrwechsel ums Jahr 2010, besetzte ein Pfarrehepaar mit vier unmündigen Kindern aus dem nördlichen Nachbarland die Stelle. Damals wie heute beziehe ich jede Woche zwei Brote von meinem Hausbäcker, was gelegentlich zuviel ist. Nun, mit vier Kindern braucht man einiges an Brot. So entschloss ich mich jeden dritten Donnerstag im Monate das zuviel, gratis ins Pfarrhaus liefern zu lassen. Nach ein paar Jahren brach ich die Lieferung ab, weil mein Bäcker Angst vor dem Hund im Pfarrhaus hatte. Nie ein Kommentar! -- Am Bettag, dem 20. September 2020 fand keine Gottesdienst im Münster in SH statt. Obwohl die Kulturtüren, der Friedenspfahl und weitere Materialen noch auf Besucher warteten, wurde der Gottesdienst zusammen mit Menschen mit einer Hörbehinderung in der Kirche St. Johann gefeiert. Unser Ende Juni schriftlich gemachtes Angebot wurde freundlich verdankt. Auf Wunsch können pikante Details nachgeliefert werden. Gott sei dank, dass ich nicht alles zu schreiben brauche.
Das Studium, 27% ohne Latein

Ich wage es, dann habe ich es gewagt. Nur nicht zu ernsthaft, aber mit viel Einsatz. Lernen, als nützte kein beten. -- Und beten als nützte keine lernen. Das kleine Lateinum fehlre mir. Ich machte mich ohne zögern dahinter. Vakabeln, Konjugationen, Übersetzungen. Vom Morgen bis am Abend, abwechselnd mit Ursula, Annemarie, Margrit und vielen andern mehr. Ich mochte den Professor und er machte mich auch. Dann Übersetzen, trainieren mit Hilfe von HP und Joe. Ich hatte eine Sammlung von möglichen Prüfungstexten. Dann die Prüfung. Am Montag um 10 Uhr das Aufgebot per Telefon: Prüfung um 13 Uhr. Mit Achselzucken stellte ich nachher fest: Katastrophal. Viel schafften es nicht. Ein junger Mann beschwerte sich, er sei zu angespannt gewesen, denn er sei um 9 Uhr geweckt worden und hätte um 13 Uhr die Prüfung schreiben müssen. Ohne mentale Vorbereitung habe er keine Chance gehabt. Die Beschwerde wurde gutgeheissen und auch mir wurde eine zweite Chance gegeben. Der junge Mann hatte als Termin neu, Freitag um 14 Uhr vorgeschlagen. Danke, geht für mich. - Ich übte jeden Morgen von 10 bis 12 mit HP und am Nachmittag mit Joe. Blind zog ich ein Übungsblatt und los. Am Donnerstag- und am Freitagmorgen zog ich dieselbe Aufgabe und wir lachten, wir lachten zu recht -- denn am Nachmittag wurde dem jungen Mann und mir genau dieser gut geübte Text zum Übersetzen vorgelegt. Ich staunte. Der Professor entschuldigte sich wegen dem Stress am Montag. Er hatte von mir eine gute Arbeit erwartet und dann der Durchfall. Ich war schnell fertig und wollte die Arbeit nochmal durchlesen. Der Professor hatte mir über die Schulter geschaut und sagte: "Ich gratuliere, sie haben bestanden. Die Arbeit ist nicht fehlerfrei, aber es gibt nur bestanden und nicht bestanden." Er füllte mir den Ausweis aus. Meine beiden Privarlehrer staunten: "Glück gehabt." 27% war mein Kommentar.
Das Studium, Antrittsvorlesung

Unsicher - besser rechtzeitig, hatte ich einen Platz in der Mitte erhascht. Ich setzte mich neben eine aufgeschlagene Zeitung. Das Inserat einer Abendschule für Soziale Arbeit war markiert. Es gebe nur noch wenig freie Plätze. Am folgenden Tag war die letzte Informationsveranstaltung. Ich notierte die Adresse. Hingehen konnte ich ja allemal. Ich erfüllte die Voraussetzungen: Eintrittsalter 24, abgeschlossene Berufsausbildung, zwei Jahre Berufserfahrung. Interesse für soziale Fragen. -- Corona. Zweite Welle. Einiges war schon wieder abgesagt worden, schade auch der Vortrag des am rechten Rand stehenden SVP-Politikers, Herrn Glarner zur Migrationspolitikam am 26. Oktber 2020. Ich hatte geplant, von ihm Unterstützung für unseren Verein "Bauerndörfer im Kongo" zu fordern. Ersatzweise packte ich Gläser mit eingelegtem Gemüse ein, um es nach dem Singen bei Pro Senektute anzubieten. Corona. -- Die Info-Veranstaltung fand damals, 1972 in einer alten Villa in einem Park statt. Es war dunkel und regnete. Mir war unbehaglich. Dann die Vorstellungsrunde. Ich sass neben einem Fluglotsen. Was war seine Aufgabe? Ah, so etwas wie ein Verkehrspolizist für die Flugzeuge. Die meisten der Anwesenden hatten ein kaufmännische Lehre abgeschlossen und fühlten sich administrativen Arbeiten gewachsen. Und ich kam mit meiner schwachen Ausbildung von der Kantonsschule, deren Hautthemen Lehrermangel und Raumnot gewesen waren. Unsere Lehrer waren meist Studenten gewesen. Nur der Klassenlehrer blieb uns treu. -- Der Vater hatte für den Stammhalter den Lehrgang "das moderne Büro" beim Institut Mössinger bestellt und bezahlt. Statt den Kurs verfallen zu lassen, hatte ich ihn durchgearbeitet, abgeschlossen und dabei manch praktisch Ding gelernt, das in der Kanti zu kurz kam. Ich schloss später auch die Abendschule für Soziale Arbeit ab und hatte wieder viel praktisches gelernt.
Studium, Wörter

1972: Ich hatte also, im Frühling das Jura-Studium und im Herbst die berufsbegleitende Abendschule (Montag- und Dienstagabend drei Stunden, am Samstagmorgen vier Stunden und pro Semester ein Wochenende) für Soziale Arbeit begonnen. Gleich zu beginn hatten wir drei Stunden Recht in der Abendschule. Wir lasen das Zivilgesetzbuch und besprachen Artikel um Artikel. Das schien mir einfach, denn ich lernte Artikel um Artikel mit den entsprechenden Erklärungen auswendig und konnte mir so die Zusammenhänge leicht merken.
An der Universität hatten wir Montag bis Donnerstag um 8 Uhr je eine Stunde Einführung ins Jurastudium und dann viele weitere Vorlesungen. Wohl kannte ich alle Wörter der Einführungsvorlesung, aber ich hätte die einzelnen Ausdücke nicht erklären können. Ich machte mir Notizen und überflog sie in der Mittagszeit. Am Morgen sass ich früh im Hörsaal, und blätterte durch mein Heft. Langsam füllte sich Saal. Wer spät kam, durfte sich auf die Stufen setzen. Enge und Platznot gehörten für mich zur Normalität, so dass ich den vom Professor wiederholt gehörten Ärger über den Platzmangel nicht verstand. Was meinte er? Bereits in der Kanti fehlte es angeblich an Zimmern. Deshalb gab es keine sog. festen Klassenzimmer mehr. In den Zwischenstunden konnten wir in die Baracken gehen, um zu arbeiten, und dort war tatsächlich Raum und Ruhe, weil uns der Weg zu weit war und wir lieber in den Gängen herumhingen. Das Oberseminar war in Baracken untergebracht und als Lehrerin unterrichtete ich während zwei Jahren im Souterrain (Tiefparterre). Überall war der Ausbau geplant. Schon auf dem Bauernhof wurde laufend ausgebaut. Ein Grund zur Freude, nur für den Professor ein vorübergehender Anlass zu Ärger. Vorübergehend, weil sich die Reihen bald lichteten. Er erklärte dies mit den prekären Raumverhältnissen. Wie konnte er so weltfremd sein?
Meine Lesenden, woran denken Sie, wenn Sie das Wort "eng" hören? Auf dem Bauernhof hiess "eng", eine gute Ernte ist einzubringen. Keller und Scheune waren voll, und das Herz voll Genugtunung und Dankbarkeit für den guten Sommer. "Platznot", das war zu verhindern! Der Überfluss meldete sich an. Das Kartoffelfeld war etwas grösser als geplant und das Wetter war günstig. Um Platz und Zeit zu sparen, wurden frühzeitig Kunden gesucht und gefunden, denen ein Teil der Ernte direkt vom Feld geliefert werden konnte. Dank offenen Augen entdeckte der wache Bauer beim Kunden einen Hinterraum, der auch noch gefüllt werden konnte. Die Hausfrauen halfen gerne beim Einsammeln Kartoffeln und mit den Hände ihrer Kinder liessen sich nach der Schule zusätzliche Rappen verdienen. Die alten Gerätschaften im hintern Schopfteil waren nach der Getreideernte endlich weggeschafft worden, so gab es dort Platz, man wusste ja nicht, die Kartoffeln schienen gut zu geraten. Platznot meldete sich immer an und bedeutete Wachstum und Wohlstand.
Es brauchte lange, bis ich begriff, dass "Enge und Platznot" erklärungsbedürftig sind und je nach Kontext positiv oder negativ besetzt werden. Vergeleiche Bauer und Professor.
Corona?

Die Tochter einer Bekannten war nach einem langen Leidensweg, einem heroisch geführten Überlebenskampf am 27. Oktober 2020 in einem Pflegeheim sanft eingeschlafen. 43 Jahre alt und schon von den Metastasen ihrer Krebserkrankung aufgefressen! Nichts war ihr erspart geblieben.
Das durchschnittliche Alter der Corona-Toten lag bei 86 Jahren und die durchschnittliche Lebenserwartung der Bevölkerung betrug 82 Jahre. Ich schien die einzige zu sein, welche für die Tragik der überdurchschnittlich alten Corona-Opfer kaum Verständnis hatte.
Donald Trump wurde für die Corona-Toten in den USA verantwortlich gemacht. Die Infektionsrate lag in der Schweiz höher als in den USA. Alain Berset, unser Gesundheitsminister lobte die gute Zusammenarbeit zwischen den Kantonen und dem Bund und ermahnte die Bevölkerung mit energischen Wort, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen.
Der Flughafen war am 9. November leer. Aus den Lautsprechern ertönte immer wieder die Aufforderung "Abstand halten" und "Masken tragen". Ein Schweizer Ehepaar, wir pflegten zu ihnen einen losen Kontakt, der Mann 48 und die Frau 45, sie kehrten nach 8 Jahren mit ihren drei Söhnen, 16, 14 und 8 am 9. November aus Kanada in die Heimat zurück. Conora hatte kurzfristig das sorgfältig geplante Empfangsszenario der Frauenseite ausgebremst. Nach drei Tagen Aufenthalt in Flughäfen und Flugzeugen sollten sie nun mit den öffentlichen Verkehrsmittel ins Luzerner Hinterland, mit fünf Koffern, fünf Rucksäcken, das konnte es nicht sein. Die Quarantänefrist des Bruders war abgelaufen. Er mit seinem Kombi und wir mit unserem 20jährigen Volvo, all in Masken und mit Abstand, wir schafften das. Nach einer Fahrt durch den Nebel trafen uns wieder im Haus dreier alleinstehenden Frauen. Es waren nur zwei! Die Mutter des Mannes, wo war sie? Im Spital mit Darmverschluss. Trotz allem genossen wir schliesslich im grosszügigen Partieraum Kaffee und Gipfeli. Langsam lichtete sich der Nebel. Die Familienmutter, die Mutter der drei Jünglinge holte bei ihren corona kranken Eltern ein Auto. Voller Sonnenschein, schliesslich war alles gut, und Peter und ich brachen zu unserer geplanten Herbstwanderung auf.
Das Studium: ein Telefonat mit Finna

2020: Seit mehr als vierzig Jahren leben wir nun in derselben Stadt, wir winkten uns gelegentlich freundlich zu und eilten weiter. Nun sind wir pensionniert. Eine Tasse Kaffee haben wir nie mehr miteinander getrunken. Eben habe ich aber eine halbe Stunde mit ihr am Telefon gesprochen. Finna, du hast dein frohes Lachen bewahrt. Gleichzeitig sagten wir beide: Wir hatten eine gute Zeit zusammen. Weisst du noch, wir haben Lammvoressen, das billigste Fleisch das es gab, gekauft und sind mit den Büchern unter dem Arm im Bähnli auf den Zürichberg gefahren. Bei der schönen Feuerstelle mit dem Unterstand machten wir eine grosse Glut. Wir warteten nicht, bis all das Holz verbrannt war, wir lasen in unseren Büchern weiter. Wann war es soweit? Wir hatten Hunger und das auf der Glut gebratene Fleisch schmeckte so lecker. Dann ein Verdauungsspazierung und zurück ins Zimmer von Finna. Sie kochte Kaffee und wir lasen weiter. Schön diese gemeinsamen Erinnerungen, wir hatten wie damals ein paar gute Minuten miteinander geplaudert. Ich roch das zischend, verbrennende Fett wieder. Wir hatten nach einem festen Plan tüchtig gelernt, d.h. wir hatten die Bücher abschnittsweise, abwechselnd laut gelesen und nach Absprache je das wichtigste unterstrichen. Keine wollte von Plan abweichen, und eine hatte immer den Willen zum Durchhalten.
Finna, du warst eine Werkstudentin. Du hast an den Wochenenden Nachtdienst im Spital gemacht. - Ja, ich habe den Maschinenpark überwacht, an den die frisch operierten Patienten nach einer Nieren- oder einer Herztranplation angeschlossen waren. Du hast dich bemüht, mir zu erklären, wie es im Spital, im Operationssaal, in der Aufwach-, auf der Intenivstation und in den Einzelzimmern zu- und herging. Dass all dies später via Fernsehsendungen einem breiten Publikum gezeigt werden könnte, daran dachten wir nicht. Einzelne Koryphäen gaben Radiointviews oder man sah ihre Bilder auf den an Kiosken ausgehängten Zeitschrift. Ja, sie sind längst abgelöst worden. Der Schwesternsilo ragte in Sichtweite von der Uni gegen den Himmel. Dort logierten die Schwestern spitalnah und preisgünstig. Pro Stockwerk gab es eine Teeküche und eine Badewanne, im Erdgeschoss Waschmaschinen, Trocknungs- und Veloraum. Männerbesuche waren baulich nicht eingeplant. Wenn Hildegard, Finnas voll im Dienst stehende Kameradin getrennte Spätschicht und deshalb gegen Abend eine lange Pause hatte, lud sie Finna gelegentlich ein, und ich gehörte dazu. Die Zimmer waren zweckdienlich und doch schön möbliert, inkl. Nasszelle.
Wir lasen all die dicken Bücher gemeinsam. Vieles vergassen wir bald wieder, besonders schwer verständliche und uns fremde Sacherhalte, aber wir hatten unsere Pflicht erfüllt. Wir hatten beide viel zu tun und tauschten die Notizen von verpassten Vorlesungen aus. Dann schlossen wir ab. Finna etwas vor mir. Wally war ihre Nachfolgerin. Durch einen Rechtsanwalt fand Finna den Weg nach Schaffhausen. Er hatte ihr eine Stelle als Praktikantin angeboten. Weil Stellen für Leute ohne Berufserfahrung im Kanton Zürich rar waren, schlug sie mir vor, mich am Gericht in Schaffhausen als Akzessistin zu bewerben. Das klappte. Dann ging alles schnell. Vermittelt durch eine Gerichtsschreiberin fand mein Schatz eine Stelle in der Industrie. Um die Formalitäten für die Einwanderung von Deutschland in die Schweiz zu vereinfachten, heirateten wir. Später heiratete auch Finna und es begann, wie sie es nannte, die Zeit, in der sie mit den Kindern und im Geschäft ihres Mannes wie eine Machine funktionierte. Die Juristerei sei in den Hintergrund gerückt. Dem widme sich nun ihre Tochter um so intensiver. Ich solle sie googeln. Damals waren die Pflichten und Arbeiten nie fertig. Jetzt nehme sie es ruhiger und lese all die Bücher, die sie früher aufgeschoben habe. Sie lese deutsch und finnisch, englisch sei zu mühsam geworden, nach so vielen Jahren ohne Übung. Es gehe ihr gut, hoher Blutdruck, zwei Hüftoperationen und so allerlei. Enkel habe sie keine, aber die Schwägerin, die im selben Haus wohne, habe drei Buben, 9, 7 und 4. Vor Corona seien sie bei ihnen ein und aus gegangen.
Für mich war die Trennung von Finna schwierig, aber ich verstand, sie hatte einen Clan geheiratet und wollte den neuen Erwarungen nachkommen. Zudem starb ihr erstes Kind kurz nach der Geburt und sie zog sich zurück, bis sie 1980 glückliche Mutter eines Knaben war. Uns wurde auch ein kleiner Junge geschenkt, aber ich gab die Arbeit nicht erwartungsgemäss auf. Niemand verstand das, doch ich freute mich: Ich hatte ein Kind.
Am folgenden Tag sprach ich nochmals mit Finna. Wir waren uns einig, wir hatten die Mitstudierenden kaum gekannt. Umsonst suchten wir nach deren Namen. Wir kamen, hörten zu, gingen, lernten und, wie damals schloss sie unser Gespräch schnell ab. Ich stellte das Telefon in die Ladestation zurück, was 2020 altmodisch und energiesparend war. Wir hatten als Studentinnen keine Telefone und waren beim Radio Schwarzhörerinnen.
Oft verschwanden wir im neuen juristischen Seminar oder in die Zentralbibliothek. Wir hatten die Bände der Bundesgerichtspraxis zu bestellen und zu warten, bis sie geholt waren und wir gerufen wurden. Während Stunden lasen wir die in den Vorlesungen erwähnten Bundesgerichtsentscheide, um uns das Juristen-Deutsch anzueignen. Lesen, lesen und nochmals lesen. Achtsam, denn oft versteckte sich hinter einem kleinen Wort ein entscheidender Unterschied im Sachverhalt. Solche Differenzen hatte man zu erkennen, um die Rechtszuordnung korrekt vorzunehmen. Zitate waren genau zu kopieren, d.h. abzuschreiben, denn es standen uns keine Kopierapperate zur Verfügung. Es wurde regelmässig betont, Zitate wortgetreu anführen, als solche kennzeichnen und die Quelle genau angeben. Nach vorgegebenen Themen hatten wir Arbeiten zu schreiben und zur Korrektur einzureichen. Bitte per Maschine, handschriftlich, wenn es sein muss, aber nur gut leserlich. "Schöne Handschrift, Inhalt knapp genügend" stand unter meiner ersten Arbeit. Ich schrieb alle zwei Wochen eine Arbeit, denn dabei eignete ich mir den mir sehr fremden Stoff leichter an. Übung macht den Meister, befriedigend, gut, knapp sehr gut. Sehr gut schaffte ich nicht. Ich stappelte alles in Ringordnern. Für die Abschlussprüfung waren drei gute Arbeiten einzureichen.
Das Studium, ein Kraftakt dessen Energie ich 2020 noch spüre und die mir hilft, in MML weiter zu tippen. Die Paralellen sind gross, die Hindernisse und die Arbeitsmethode ähnlich. Der Preis war hoch und er ist heute hoch. Er heisst angeblich "Einsamkeit". Jetzt während der zweiten Welle von Corona sollen viele, gerade ältere Menschen unter Einsamkeit leiden. Doch keiner, der von mir angesprochenen, ist betroffen. Es sind immer die Andern, vielleicht die Uralten, denen unsere Kultur den Segen des Todes nicht gönnt. War ich einsam? Bin ich einsam? Ist eine Person, die ein Jubiläum 25 Jahre "Abendgebet für den Frieden" orgnisiert, einsam? Einsam ist das falsche Wort. Viel Beharrlichkeit und manch ein Abfallsack war nötig, um den laufend anfallenden "Unrat" wegzuschaffen und in der Dunkelheit den Schein aus einer andern Welt erkennen zu können. Ich bemühe mich, mir die Zeit zu nehmen, um über unser Jubiläum nachzudenken und darüber zu sprechen. Es ist meine Realität.
Dazu habe den Kontakt zu den Phil. I aus der Studienzeit gesucht.
Darnach: Rückfrage an Hanspeter, was hat sich seit 1995 geändert?

Was ist seit 1995 passiert?
Die Söhne werden älter
1995 waren beide unsere Söhne noch mitten in ihrer Ausbildung, der eine im Lehrerseminar, der andere in der Wirtschaftsmittelschule. Beide haben sie diese Ausbildung abgeschlossen und mit ihrer Berufstätigkeit begonnen. Der eine bei einer Bank, er hat sich im Laufe der Zeit auf die Bekämpfung der Geldwäscherei beschränkt; der andere Sohn hat nach dem Seminar als Primarlehrer begonnen; als Primarlehrer ist er mit seiner Frau zusammen für 3 Jahre in der Schweizerschule in Rom tätig gewesen. Erst vor kurzer Zeit hat er seine Weiterbildung als Berufsschullehrer abgeschlossen; er ist jetzt Berufslehrer für Allgemeinbildung. Seine Familie ist gewachsen; es sind nur vier Enkelkinder, von denen das älteste auch schon wieder 19 Jahre alt ist.
Schulpsychologie an Berufsschulen
Beruflich haben sich seit 1995 verschiedene Dinge verändert. Für einige Jahre war ich als Schulpsychologe an einer Berufsschule in St. Gallen tätig; streng genommen stellte diese Tätigkeit eine Kombination von Schulpsychologie und Sozialarbeit dar.
Dann aber hat sich die Möglichkeit ergeben, die Schulpsychologie auf alle Berufsschulen des Kantons auszuweiten. Damit hat sich auch das Tätigkeitfeld geändert: Wenn bei Berufsschülern ernsthafte Schulprobleme auftragen, hatte ich die zwei Fragen zu klären – nämlich erstens, wie es zu diesen Schulproblemen kommt und, zweitens, was angesichts der Schulprobleme unternommen werden soll. Für die St.Galler Bildungslandschaft ist die Schulpsychologie an Berufsschulen neu; sie stellt eine wesentliche Veränderung seit 1995 dar. Und ebenso neu für die Schullandschaft ist die Tatsache, dass heute jede Berufsschule im Kanton eine Sozialarbeiterin oder einen Sozialarbeiter hat – nicht überall ist die Zusammenarbeit zwischen Schulsozialarbeit und Schulpsychologie unproblematisch; an den Berufsschulen im Kanton St.Gallen hat diese Zusammenarbeit jedoch von Beginn weg überraschend gut geklappt.
Seminare verschwinden
Berufliche Veränderungen sind auch bei meiner Nebentätigkeit zu beobachten gewesen: Für einige Jahre erteilte ich Psychologieunterricht an einem Kindergärtnerinnenseminar. Doch Kindergärtnerinnenseminare gibt es heute nicht mehr: Die Ausbildung findet an den Pädagogischen Hochschulen statt. Dieser Wandel zu den Pädagogischen Hochschulen hin ist ein Ausdruck dafür, dass sich die Einstellung zu den Lehrberufen geändert hat: Bis ungefähr zum Jahre 1995 hin liess man sich bei den Lehrberufen von der Annahme leiten, dass deren Ausbildung letzten Endes eine Berufsausbildung darstellt. Nach und nach hat sich dann aber die Ansicht durchgesetzt, dass diese Gleichsetzung unstatthaft ist: Man war allgemein der Meinung, dass die Lehrerbildung und auch die Kindergärtnerinnenausbildung nur über ein Studium Sinn macht.
Einer der Gründe, warum man zu dieser Meinung gekommen ist, hat mit dem sogenannten ‘Sackgassenproblem’ der Kindergärtnerinnen zu tun: Immer wieder wurde beklagt, dass Kindergärtnerinnen auf der Basis ihrer Ausbildung nicht zum Studium an einer Universität zugelassen sind; die Schaffung von Pädagogischen Hochschulen sollte dieses Problem lösen.
Die einjährige Berufsmatur macht Fachhochschulen attraktiv. Interessant an der Entwicklung seit 1995 ist die Beobachtung, dass sich dieses Sackgassenproblem auch ohne die Schaffung Pädagogischer Hochschulen gelöst hätte. Zurückzuführen ist dies auf den Ausbau der Berufsmatur und der Fachhochschulen: In den vergangenen Jahren hat man den sogenannten Jahreskurs eingeführt. Dies ist ein einjähriger Kurs, im Rahmen dessen die Interessentinnen und Interessenten zur Berufsmatur geführt werden und anschliessen ein Studium an einer Fachhochschule beginnen können. Auch Kindergärtnerinnen konnten diesen Jahreskurs besuchen – und verlassen damit die Sackgasse: Sie können an einer Hochschule studieren.
Die Ausbildungszeit wird immer länger
Blickt man auf die Schaffung der Pädagogischen Hochschulen und auf die Entwicklung der Fachhochschulen zurück, steht man vor einer Veränderung, die sich ebenfalls in den letzten 25 Jahren abgespielt hat: Die Zahl der Berufsmaturandinnen und Berufsmaturanden hat beträchtlich zugenommen. Zugenommen hat damit aber auch die Zahl jener, die an den Fachhochschulen studieren, und zugenommen hat nicht zuletzt auch der Druck, der auf die jüngeren Erwachsenen entstanden ist: Junge Erwachsene merken, dass eine Berufslehre heute nicht mehr genügt; diese muss mit einer weiteren Ausbildung ergänzt werden – unter anderen halt eben auch durch einen Fachhochschulabschluss. So ist es denn kein Zufall, dass die durchschnittliche Schul- und Ausbildungszeit der Schweizerinnen und Schweizer in den letzten 25 Jahren zugenommen hat und heutigentags stolze 16 Jahre oder mehr beträgt.
Psychologinnen und Psychologen
Und dann ist noch von einer weiteren Entwicklung zu berichten: Die Psychologinnen und Psychologen erhalten den lang ersehnten Titelschutz: Mit der Einführung des Psychologengesetz darf sich nur noch Psychologin oder Psychologe nennen, wer an einer Fachhochschule oder Hochschule Psychologie studiert hat. Bedenkt man, dass es rund 50 Jahre gedauert hat, bis es soweit war, ist dies ein wichtiger Schritt.
Der PC und das Internet
Alle diese Veränderungen im Bildungswesen sind natürlich gekoppelt mit den Veränderungen, die durch das Aufkommen der PC und des Internets entstanden sind. Diese Veränderung betrifft den Alltag und auch den Beruf und erfasst eigentlich alle beruflichen Tätigkeiten – die Art und Weise, in der man Zugang zu beruflichem Wissen hat und auch die Art und Weise, wie man schriftlich kommuniziert: Mitteilungen und Informationsaustausch mit Kolleginnen und Kollegen erfolgen heute in einem Tempo und mit einer Leichtigkeit, wie man sie vor 25 Jahren noch nicht für möglich gehalten hätte.
Im Gegensatz zu den zum Jubiläum eingeladenen Referenten hat HP meine Frage verstanden und beantwortet. Ergänzung: Die 16 Jahre Ausbildungszeit: 2 Jahre Kindergartenobligatorium, 10 Jahre Schule, 4 Jahre Berufsausbildung. In der 1950er Jahren betrug die obligatorische Schulzeit 8 Jahre und viele Berufslehren dauerten ein oder zwei Jahre. Was kostete das?
Darnach: Ernst, was hat sich seit 1995 verändert?

Auf Anfrage hin schickte Ernst mir den untenstehenden Text, der genau meinen Vorstellungen entsprach. Ich war begeistert. Ich rief ihn wieder an. Vor über vierzig Jahren hatten wir aus den Augen verloren. Was hatte er studiert? Wie hatte er das tägliche Brot verdient? Er war Appenzeller und an einem Fest spielte er mit Familienmitgliedern Appenzeller-Musik. Wir konnten uns am Telefon locker unterhalten. Er spiele immer noch. Du warst schon weg, als ich abschloss, und -- Ernst erzählte, er habe politische Philosophie studiert und nach meiner Zeit mit einem Thema zu Marx abgeschlossen. Zum Broterwerb habe er seine beiden Nebenfächer ergänzt und bis zu seiner Pensionnierung 2014 an einem Gymnasium Deutsch und zunehmend öfter, was ihn sehr gefreut habe, Philisophie unterrichtet. Nun unterstütze er noch Migrantinnen mit zusätzlichen Deutschstunden. Eine gemeinsame Wanderung lehnte ich wegen Corona und aus Rücksicht auf meinen Mann ab. Nun sein Text und als nächstes die Frage nach dem Pfrundhaus.
1995 – 2020 in friedenspolitischer Sicht
Manches von dem, was in den letzten 25 Jahren geschehen ist und heute noch andauert oder sich sogar intensiviert, ist nicht eigentlich neu, sondern eine Fortsetzung von dem, was mit dem Umbruch von 1989 begonnen hat.
Vor 89 herrschte der Kalte Krieg. Es bestand eine feste Ordnung der Welt, der sich nur wenige Länder halbwegs entziehen konnten und einigen Führern der sogenannten «blockfreien Länder» eine Spielwiese boten (Tito, Nehru). Nicht zuletzt die Drohung mit der Atombombe gewährleistete den Frieden zwischen den grossen Mächten. Der Zusammenbruch des Kommunismus eröffnete einen Raum für neue Konflikte – allerdings nicht, wie es der amerikanische Politologe Samuel Huntington vorauszusehen glaubte, als Kampf oder Krieg der Zivilisationen, und auch nicht als sogenannt konventionelle Konflikte zwischen Armeen feindlicher Staaten, sondern vielmehr als vielerlei Varianten von internen Konflikten: Bürgerkriege (Jugoslawien, Libyen, Ägypten, Ukraine, Syrien), ethnische Konflikte (Georgien, Tschetschenien, Armenien, Irak, Syrien), religiöse Aufstände (Islamisten gegen Monarchien, Schiiten in Bahrein, Terror der Al Kaida und des IS). Diese Konflikte haben seit 1995 noch massiv zugenommen.
Mit China ist eine neue Weltmacht entstanden, wobei mit dem Machtwechsel zu Präsident Xi Jinping eine zunehmende Repression im Innern und ein aggressiveres Auftreten nach Aussen einhergeht.
Die Globalisierung hat sich – bis zum Corona-Einbruch – beschleunigt. Sie ist insgesamt eine Erfolgsgeschichte. Trotz der Kriege ist z.B. der Prozentsatz der Unterernährten stark zurück gegangen. Die Alphabetisierungsquote steigt; die zunehmende Bildung der Mädchen ist der wichtigste Faktor für den Rückgang der Geburtenrate, und dieser Prozess ist seinerseits eine wichtige Voraussetzung für die wirtschaftliche Entwicklung. In vielen Ländern vor allem Asiens ist eine Mittelschicht herangewachsen, welche die Bedeutung der westlichen Mittelschichten relativiert und deshalb dort Abstiegsängste auslöst. - Diese positive Einschätzung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass in manchen gescheiterten Staaten (Republik Kongo oder Haiti beispielsweise) furchtbare Zustände herrschen, dass die Gegensätze zwischen Besitzlosen und Reichen vielerorts noch wachsen oder dass die Globalisierung auch in reicheren Ländern ständig neue Verlierer produziert, die unterstützt werden müssten (das betrifft z.B. auch einen Teil der Wählerschaft von Trump).
In Europa kam es zur Ost- und Süd-Erweiterung der Europäischen Union und zugleich zur erweiterten Integration. Zwei Thesen, die Hermann Lübbe 1994 äusserte, haben heute erst recht ihre Gültigkeit: Die EU sei «eine politische Grossrauminstitution sui generis … ausgestattet mit partiellen Souveränitäten zur Erfüllung von Funktionen, für deren Erfüllung im Kontext der modernen Zivilisation die Einzelstaaten faktisch ihre Souveränität längst verloren haben. Das reicht von der Wirtschaft über den Umweltschutz bis zur Verteidigungspolitik.» Andererseits, so Lübbe, stärke diese pragmatische institutionelle Antwort auf den partiellen Souveränitätsverlust zugleich den Willen zur «politischen Selbstbehauptung» der Einzelstaaten. – Nicht nur die Schweiz tut sich bis heute schwer, sich in diesem Feld zwischen Kooperation und Selbstbehauptung realistisch zu positionieren. In manchen Ländern wachsen nationalistische Tendenzen, verstärkt durch das Tempo der Veränderungen und die Migrationsbewegungen, welche von vielen Individuen als drohender Identitätsverlust erlebt werden. Eine sich verstärkende Gegenbewegung im nichtnationalistischen Lager ist die Moralisierung vieler Lebensbereiche (z.B. Konzerninitiative). Allgemein macht es die immer noch wachsende Tendenz zur Individualisierung schwieriger, politische Mehrheiten zu finden.
Schwerlich vorauszusehen war 1995 die rasante Entwicklung der Kommunikationsmittel. Die längerfristigen Auswirkungen der Digitalisierung und der Sozialen Medien sind noch unabsehbar. Ein besonders auffallender Aspekt ist die Informationsflut und die weltumspannende Dauerpräsenz. Alles ist sofort im Netz - und mehr oder weniger in jedem Dorf der Welt existieren mittlerweile Handys – auch Flüchtlingsströme lenken sich mit ihrer Hilfe.
Nicht neu, aber seit 1995 noch bedrängender geworden ist die ökologische Situation, u.a. die Klimaerwärmung mit dem steigenden Meeresspiegel, das Artensterben, die Verschmutzung der Meere usw. Von «Klimaflüchtlingen» war damals noch kaum die Rede.
Die zweite Globaltheorie unserer Epoche, jene von Francis Fukuyama, postulierte das sogenannte Ende der Geschichte. F meinte, dass nach 89 keine andere politische Vision mehr bestehe als das Ziel einer liberalen bürgerlichen (nichtsozialistischen) Gesellschaft. Es ist üblich, seine These voller Häme zu erwähnen, weil die Geschichte offensichtlich weiter geht und mittlerweile grosse autoritäre Systeme wie China, Russland oder die Türkei eine Alternative zu liberalen Gesellschaften darzustellen scheinen. Aber im Kern enthält sein Ansatz eine respektable Wahrheit: Im Grunde wünschten wohl so ziemlich alle Völker mehr Demokratie und mehr individuelle Freiheiten.
Diese Wahrheit müsste einer der Ausgangspunkte für friedenspolitische Arbeit sein - es kann für uns keine kulturellen Besonderheiten geben, welche angeblich über den Menschenrechten stehen würden. – Die andern beiden grossen Fragen sind heute: Was können wir tun, um in der Welt gerechtere Verhältnisse zu schaffen, und was können wir tun, um die Schöpfung zu bewahren?
Ich hatte den Text von Ernst mehrmals gelesen und verdankt. Als er nachfragte: "Wie hast du persönlich den Umbruch nach 1989 in Erinnerung? Warst du auch optimistisch und euphorisch?" "Mir ging es zu schnell. Ich hatte Angst vor soviel Unbekanntem," war meine Antwort. "Den Fall der Mauer habe ich als ein Wunder in Erinnerung. Ich sass betend vor dem Bildschirm und zuckte immer wieder zusammen. Ich konnte nicht glauben, was ich sah. Alle waren begeistert. Ich mitten drin mit meiner Angst, ich fühlte mich einsam."
Darnach: Rückfragen an Joe

Das Studium: Wie war das mit dem Pfrundhaus?

Mit Sparen konnte man Geld zum Reichenbringen. Das hatte ich daheim gelernt. Zeit sparen, Geld sparen, Kraft sparen. Das hiess, ich sollte möglichst billig nahe bei der Uni wohnen.Wo? Richtung Altstadt gab es verschiedene Verwaltungsgebäude, Richtung Zürichberg das Universitätsspital mit seinen vielen Instituten und überall viele grosse und kleine Baustellen. Eines Tages hatte HP den Latein-Dixionnaire in seinem Zimmer vergessen: "Warte, ich hole ihn schnell." Was hiess das? Ich begleite ihn und kam dem gesuchten Zimmer näher. Neben dem Unibähnchen standen entlang der Leonhardstrasse zwei Altersheime: Das Bürgerasyl und das Pfrundhaus. Ich folgte HP. Er meldete uns bei der Portière des Pfrundhauses an. Dann ging es links nach hinten zur Treppe, zwei Stockwerke hoch, links nach vorn, dann links durch eine Türe, eine schmale Treppe hoch zu einem Bödeli, rechts durch eine Türe auf einen breiten Gang mit zwei Neonröhren, einem breiten, braunen Schrank, daneben ein kleiner weisser Kühlschrank und auf der Gegenseite ein grosser Tisch und ein Ausguss. Wir waren im Dachgeschoss. Hier gab es fünf Angestellten Zimmer, die nur noch teilweise belegt waren. Deshalb hatten HP, sein Bruder Joe und Elisabeth je ein Zimmer mieten können. HP griff nach dem vergessenen Buch und liess mich einen Blick auf die gemeinschaftlichen Sanitären Anlagen werfen. Er wollte schnell in den Uni-Dachstock zurück, wo es oft freie, ruhige Arbeitsplätze gab. Wir hatten Glück. Wir mussten Latein lernen. Wegen dem Zimmer wollte ich nicht drängen, er zeige mir später alles.
Ich wohnte schliesslich fünf Jahre im Dachstock des Pfrundhauses. Zuerst im Zimmerchen gegen Norden, wo man jedes Tram in der Kurve quitschen hörte. Nachdem die Diakonissin das Heilpädagogischen Seminar abgeschlossen hatte, konnte ich ihr "grosses" Zimmer übernehmen. Stand ich auf den Stuhl, konnte ich nun den Zürichsee und die Alpenkette sehen. Im Winter schien die Sonne bis zur die Gegenwand. Ein grosser Luxus: Im Preis dieses Zimmers waren auch das Putzen und die Besorgung der Wäsche durch das Personal des Altersheim inbegriffen. Kochen war verboten, aber die Diakonisse hatte mir ihre Herdplatte zurück gelassen und gezeigt, wie sie diese in einer Schublade der Wäschekommode verstaute und fürs Kochen mit einem Holztablar auf die Marmorplatte stellte. Für Tee- oder Kaffeewasser hatte ich einen Tauchsieder geerbt. Im Mutterhaus in Deutschland brauche sie all das nicht mehr. Sie gab mir auch ein paar ihrer Zivilen Kleider, denn im Mutterhaus trage sie gerne und immer die Uniform. Während der Weiterbildung in der Schweiz und besonders zum Wandern habe sie Hosen vorgezogen.
Wie im Pfrundhaus alles geregelt war, wusste ich nicht, jedenfalls konnte mein Schatz, der in Mitteldeutschland arbeitete, für sein Auto einen Angestelltenparkplatz benutzen und niemand interessierte sich dafür, wo er übernachtete. An meinem Verhalten stiess sich nur eine Mitbewohnerin des Dachstockes. Ich hatte immer allen Besucher erklärt, sie sollten auf dem Weg zum Dachstock, möglichst diskret und höflich sein, die Türen wieder schliessen und das Licht löschen. Es gab Heiminsassen, die sich über die jungen Besucher freuten.
Das Studium, was gab es ausser Büchern?

Und ich? Als erstes reiste ich mit einer christlichen Studentengruppe von Auffahrt bis Pfingsten nach Florenz. Wandern in der Toskana, Besuche in Florenz und Gespräche standen auf dem Programm. Wir wohnten in einer stattlichen Villa auf dem Land. Nie mehr, war meine nicht ausgesprochene Antwort. Ich wurde das erste Mal mit bekennenden Christen konfrontiert. Jesus Christus sollte ich mein Leben als meinem persönlichem Gott übergeben, in einem Zeitpunkt, der nachher als solcher erwähnt werden könne, in einem verbalen Akt vor Zeugen. Es gebe ein spürbares Vorher und Nachher, denn Jesus Christus würde in meine Leben treten und dieses verändern. Das konnte ich nicht, denn ich war in den Glauben meiner Eltern hineingeboren worden. Ich hatte nichts zu machen und ich brauchte ihn weder zurechtzuzimmern noch festzuhalten noch konnte ich ihn verlieren. Er gehörte zu meinem Leben wie meine Vorfahren. Er war da. Ich war drin aufgehoben. Ich konnte dem Leiter jener christlichen Gruppe meine Glaubensgewissheit nicht glaubhaft erklären. Mich anzustrengen und andere Worte zu suchen, schien mir vertane Liebesmüh. Mein Glaube blieb ihm verborgen: "Seht ihr den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So ist es mit manchen Sachen, die wir getrost belachen, weil unsre Augen sie nicht sehen." Er verstand diese Liedstrofe nicht. Ich liess diese Leute über meinen Glauben urteilen und hielt es mit dem Lied vom Mond, der ohne unser Dazutun immer rund und schön ist, auch wenn wir ihn nicht sehen. Der Glaube meiner Familie, das Geschenk Gottes an mich, gab es einfach.
Ich ging dann zur Hochschulgemeinde, eine Art Kirchgemeinde, die von einem reformierten Pfarrer geleitet wurde, oder ins Haus der katholischen Hochschulgemeinde am Hirschengraben 86. Beide boten einen gemütlichen Aufenthaltsraum mit Zeitschriften und preiswerten Getränken. Es wurden gelegentlich Gottesdienst gefeiert, beide schlugen allerhand Vorträge und gemeinsame Wanderungen vor. Wir besuchten u.a. das Welttheater in Einsiedeln, ich besuchte es zweimal, so begeistert war ich. Wir wandeten zum Flueli Ranft, durch den Jura nach St. Ursanne und beobachteten Tiere im Nationalpark. Vier mal pro Woche konnte man mich im Konditionstraining für Männer und Frauen sehen, das mir besser entsprach als das Angebot mit sanfter Musik und tänzerischen Elementen exklusiv für Frauen. Mit der Legi besuchte ich unterschiedlichste kulturelle Angebote, den jungen Dimitri, den jungen Emil, unterschiedlichste Theater und und ... . Ich war weder glücklich noch unglücklich. Nachträglich bedauere ich, dass die Wochenend weiterhin oft auf dem Bauernhof verbrachte.
Das Studium, die Abendschule für Soziale Arbeit und der 3. November 2020, ging das? Christoph Häfeli

Am 3. November 2020 realisierte ich beim Einnachten: "Es gibt kein morgen, kein nachher mehr, es gibt nur jetzt!" und ich schaute ein Video von 90 Minuten "Heiliges Land zwischen drei Meeren". Warum hatte ich dies nicht aufgeschoben? Ich war doch im Begriff einen Text zum sozialen Gefüge der Abendschule zu tippen. Vergnügen schob ich doch leicht auf. Was hiess der Satz nun zwei Tage später, nachdem ich den Text vom 3. November 2020 aus Unvorsichtigkeit verloren hatte? Was hiess, "es gibt kein morgen" zwei, drei Tage, eine Woche später? Ich tippte und wartete auf die nächsten Worte.
Da fiel mir Jakob Alt, ein Mitstudierender der Abendschule ein. Das elektronische Telefonbuch brachte mich nur in Sackgassen. Nach Google war Jakob Alt ein deutsch-österreichischer Landschaftmaler Maler, der von 1798 bis 1872 gelebt hatte. Dann suchte ich nach unserem Klassenlehrer, Christoph Häfeli. Er war damals Sozialarbeiter. Zu ihm fand ich mehrere Einträge in Google. Er war mittlerweile emeritierter Professor und Verfasser des Buches "Grundriss zum Kindes- und Erwachsenenschutz" zweite überarbeitete Ausgabe 2016. Ich sah ein kurzes Video, das war eindeudig unser "Christoph" in einer älteren Ausgabe. Eine Adresse fand ich nicht. Mein Mann schaffte das. Ich rief an.
Er erkannte mich sofort: "Du bist die, die daneben Jura studiert hatte. Ihr ward meine erste Klasse 72-76. Das war in der Pionierzeit." Er hatte bis zu seiner Pensionierung immer mehr oder weniger viele Stunden unterrichtet. Christoph hatte die grosse Karriere gemacht, 1983 habe er sein Jus-Studium abgeschlossen und bis 1990 sei er Jugendsekretär in Dielsdorf gewesen. Im Rahmen des Bologno-Prozesses seien in Luzern drei der vier im Bereich Soziales bestehenden Mini-Schulen fusionniert und er sei bis zu seiner Penisonnierung deren Rektor gewesen. Neben dieser Aufgabe habe er sich immer für das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrechtes eingesetzt. Das alte Gesetz von 1912 sei 2008 von den Räten in Bern einstimmig mit nur zwei Stimmenhaltungen durch das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht abglöst worden. Den Kantonen sei für ihre gesetzlichen Anpassungen und die Umstellung, die Professionalisierung der ausführenden Behörden Frist bis 2013 gewährt worden. Ein langer Prozess fand damit ein gutes Ende. Noch atmete Christoph durchs Telefon hörbar erleichtert und freudvoll auf. Ich fügte an: "Dann begann in den Kantonen mit der Anpassung und Umstellung nochmals ein langer und teilweise sehr umstrittener Prozess."
Ich tönte an, ich hätte mit der Einführung des Neuen Eherechtes gekämpft. Er nahm mir das Wort aus dem Mund: "Dann weisst du, was ideologische Auseinandersetzungen sind, ein Hickhack zwischen extremen Feministinnen und katholisch Konservativen," damit seien sie nicht konfrotiert worden.
Also Christoph, wie begann damals der Gesetzgebungsprozess? Der Bundesrat habe anfangs der 90er Jahre beim Präsidenten des Verbandes der kantonalen Vormundschaftssekretäre einen Bericht mit einem Vorentwurf zu einem neuen Gesetz in Auftrag gegeben. Nach einem schweren Unfall des Auftragnehmers sei die Aufgabe 1993 auf die Schultern von drei Juristen mit einem beruflichen Bezug zum Thema verteilt worden. Er, Christoph sei einer der dreien gewesen. Nach einer erfreulichen, intensiven Zusammenarbeit hätten sie 1998 dem Bundesrat den Bericht inkl. dem Vorentwurf übergeben können. Der Bund habe die Infrastuktur ikl. Protokollführerung zur Verfügung gestellt. Es seien ihnen regelmässig Protokolle von 60 Seiten zum Kontroll-lesen zugestellt worden. Er schwelte in der Erinnerung an die erspriessliche Zusammenarbeit im Dreier-Gremium. Von 2000 bis 2003 hätten sie in der Expertenkommission, bestehend aus 20 Fachleuten, den Gesetzesentwurf mit der Botschaft fertig gestellt. Dieser sei in der Folge den Kantonen und interessierten Kreisen zur Vernehmlassung zugestellt worden. 2006 habe die Beratung in den beiden Kammern des Parlaments begonnen. Der ganze Gesetzgebungsprozess sei ruhig und zügig gelaufen und bereits 2008 sei das Gesetz verabschiedet worden. Dabei sei den Kantonen Zeit bis 2013 für die Anpassung gewährt worden. Von 2013 bis 2018 habe er Kantone und Gemeinden beraten und sein Buch "Grundriss zum Kindes- und Erwachsenenschutz" überarbeitet. Nun arbeite er an der dritten Ausgabe und zusätzlich schreibe er am "Berner Kommentar". Wie hiess der bekannte Familienrechtler während unserem Studium in den 1970er Jahren? Hegnauer und nochmals Hegnauer, was er schrieb und sagt, war richtig.
Das Studium und die Abendschule für Soziale Arbeit, ging das? Zwei Jüdinnen

In der Vorstellungsrunde sollten wir unsere Motivation erklären. Von "Motivation" sprach man damals in meiner Umgebung nicht. Ich kannte das Wort nicht. Auf Neugier und Zufall basierte meine Anmeldung. Rückfragen konnte ich nicht beantworten. Ich war eine Reformierte vom Land, eine Lehrerin, die nach Auslandaufenthalten, die Welt von Innen erkunden wollte. Was waren Randständige? Was waren Bedürftige? Ich wusste von vielen, die man so hätte bezeichnen können, für mich gehörten sie zur Dorfgemeinschaft, zur Vielfalt. Es war eine Frage des Standpunktes, der Sichtweise oder, wenn es ein Fremdwort sein musste, der Definition. Ich dachte an die Kartoffelernte: Grosse, zu grosse, kleine, zu kleine, Wohlgeformte, Verwachsene, Krüppel, Grüne, d.h. Knollen mit von der Sonne ausgelösten Pigmentschäden, angefressene, kranke, faule ... Für mein Empfinden war die Durchmischung bei den Menschen ähnlich divers, nur ganz anders, aber solche Vergleiche zu machen war unüblich, geschmacklos oder gar verboten: "Auch ein Mörder ist ein Mensch."
Unsere Klasse besuchten zwei Jüdinnen. Mehreren Menschen jüdischen Glaubens war ich in den USA begegnet. Wie sollte ich den Überlebenden und den Nachfahren einer solchen Katastofe wie dem Holocost begegnen? Meine Informationen stammten aus dem Religionsunterricht, dem Tagebuch von Anne Frank und dem Roman "Exodus" von Leon Uris. Seit dem Religionsunterricht bis in meine Zeit in den USA hatte ich Wörter wie "nachrichtenlose Vermögen, Raubgold, Bankgeheimnis, das Boot ist voll, Judenstern" kaum gehört. Meine tagtäglichen Mühen lulten mich ein und stumpften mich ab. In den USA spürte ich mein Unwissen und lernte mich meines kindlichen, allgemeinen Glaubens zu schämen. "Das Verschont geblieben sein" war nicht nur unser Verdienst, die Zusammenhänge waren viel komplexter, vielseitiger als erahnt. Die Reparationszahlung von 1946 hatten nicht genügt, um unsere Weste langfristig weiss zu waschen. In den USA verstand ich schnell, mich mit meinem mangelnden, englichen Wortschatz zu schützen und von der Kleinheit unseres Landes zu sprechen.
Der zweite Weltkrieg! Ich war eine Nachgeborene und hatte nicht gelernt, wie ich mit der Vergangenheit meines Volkes umgehen sollte. Als junges Kind wusste ich, die Wunden des Krieges waren teilweise noch offen. Viele eiterten und stinkten, weil Desinfektionsmittel und sauberes Wasser fehlten. Viele hatten Hunger, auch bei uns war gutes Essen knapp. Wie konnten wir da Flüchtlinge aufnehmen, die sich jahrelang nach vollen Tellern in einer warmen Stube gesehnt hatten? Es schauderte mich. Wir konnten unsere Abfallkartoffeln gegen Mitarbeit bei der mühsamen Handarbeit bei der Ernte auf den Feldern tauschen. Ein Gedankensprung, Vietnam und mein Entschluss, etwas für den Frieden zu tun, fielen mir wieder ein.
Wie begegne ich Menschen einer so gezeichneten Gruppen? Wie begegne ich den Tätern? Wie sind Opfer und Täter gekoppelt? Dies waren an der Abendschule keine Themen, wären aber für mich grosse Themen gewesen und sind es bis heute geblieben. "Freundlich, zurückhaltend" schien mir richtig. Dass die beiden Mitschülerinnen Ihr Jüdischsein in der Vorstellungsrunde 1972 erwähnten, hatte mich überfordert und befremdet, dies war jedoch erst 2020 Anlass einen ganzen Abend im Internet Infos zum Thema "Judentum" anzuschauen. Die Juden wurden weiterhin verfolgt. Hätte ich nicht 2019 persönlich mit einem Angehörigen des Sicherheitsdienstes vor der jüdischen Mädchenschule gesprochen, so würde ich entsprechende Nachrichten wohl hören, aber als masslos übertrieben wegwischen.
Das Studium und die Abendschule: Der Gruppenprozess und die Pille.

Am ersten Abend in der Vorstellungsrunde, die Frage nach der Motivation. Der Psychologielehrer begann. Ich spürte sofort, "Psychologie" ist inn. Ich war auf dem Gebiet antiautoritäre Erziehung belesen und bewegte mich gerne im Raum zwischen "Grenzen setzen und aufmuntern", Mut machen, und zwar reziprok in Bezug auf mich, die andern und das Umfeld. Dies waren fliessende Prozesse, die ich innerlich mit der "Kunst der Kriegsführung" verglich. Die Informationen zur Kriegsführung stammten aus den Vorlesungen eines hohen Militärs an der ETH. Dieser war überrascht gewesen von meinem Interesse, verstand aber meinen Transfer sofort und änderte - wie er mir später erzählte - sein Verhalten gegenüber seinen eigenen Kindern mit gutem Erfolg: Die klare militärische Sprache "Ziel, Vorgehen, Mittel" war mit Alltagswörtern zu füllen und die Schlacht war gewonnen. Wenn nicht, war das Vorgehen zu ändern, ev. waren andere oder mehr Mittel einzusetzen. Er und die Kinder verstanden sich in der Folge unerwartet gut. All dies passte nicht in den Bereich der "Psychologie der Abendschule". Das Interesse war auf die fünf persönlichen Gefühle gerichtet: Freude, Wut, Trauer, Angst und Scham. Diese Gefühle sollten benannt und ausgelebt werden. In Pausengesprächen, beim Austausch in kleinen Gruppen hiess dies über Sexualität sprechen. Ein Sozialarbeiter schien mir ein kleiner Psychologe zu sein oder zu werden, selbst wenn Sachhilfe gefragt war. War ein Problem psychologisch gut aufgearbeitet, löste es sich auf oder der Klient war befähigt, es selbständig zu lösen. Gut besprochen, wurden Budgetpläne eingehalten und vereinbarte Zahlungen gemacht. Ich konnte alldem theoretischen leicht folgen, aber es entsprach nicht den Erfahrungen, die ich mitbrachte.
Um den Gruppenprozess und die persönlichen Entwicklungen zu fördern, verbrachten wir eine Woche mit Klaus Vopel und seiner Frau im Tessin. Darnach war auch ich von dieser "auf der Aufarbeitung der Vergangenheit basierenden" Psychologie faszniert.
Zwei von meinen neuen Bekannten von der Uni, die Psychologie studierten, machten Lehranalysen als Vorbereitung auf ihre spätere berufliche Tätigkeit. Beide waren des Lobes voll, es tue gut, Lasten der Vergangenheit abzuwerfen. Ich bat und bat sie um Auskunft. Zögernd erzählten sie mir ein wenig. Die eine besprach zweimal wöchentlich ihre aktuellen guten und schwierigen Erfahrungen und mit der Unterstützung des Analytiker suchte sie Schritt für Schritt rückwärts gehend nach dem Ursprung: Wann trat das Gefühl das erste Mal auf und wie war ihre Lage damals. Die andere lag vier mal wöchentlich auf der Couch und der Analytiker hörte ihr am Kopfende sitzend zu. Sie mache die ganze Arbeit selber, erzählte sie nicht ohne Stolz. Ich meldete mich auch bei einem Psychoanalytiker an. Wichtig war mir, dass ich über die Krankenkasse abrechnen konnte, und dass seine Praxis in der Nähe meines Wohnortes, des Pfrundhauses war. Bei der Anmeldung gab mir die Vorzimmerdame eine Rolle Papier und Fingerfarben, ich solle für das ersten Treffen in sechs Wochen mindestens vier "Gemälde" anfertigen und einen Lebenslauf von mindestens zwei Seiten schreiben. Das machte mir Spass. Abstrakte Kunst und Sterne waren mein Thema. Zehn Bögen füllte ich. Der Psychiater war überrascht und legte Wert darauf, meine "Bilder" zu behalten. Das war der Anfang einer struben Zeit. Er fragte mich immer wieder, wollen sie so weit zurück? Schaffen sie das? Er verschrieb mir Tabletten und gab mir zwei Telefonnummern. Ich rief ihn nie an und die Tabletten ertrug ich nicht. Jeden Dienstag um drei Uhr ging ich hin. In den Nächten dazwischen schwitze ich und litt unter Muskelkrämpfen, die sich "im letzten Moment" lösten. Ich presste das Gesicht an ein Kissen, dass niemand hören konnte, wenn ich vor Schmerzen schrie. Gemäss meiner Fiktion musste jeder einzelne Muskel durch dieses Prozedere, denn der ganze Körper brauchte wiederhergestellt zu werden. Panzer hatten mich zerrieben und zerquetscht und nur durch Zufall, dank den Schutzengeln hatte ich überlebt. Diese Beschützer standen mir auch jetzt zur Seite. Der Psychiater forderte mich zur Zusammenarbeit mit den Schutzengeln auf, ich solle den Flügelwesen alles erzählen.
Solche Erfahrungen erwähnte ich an der Abendschule nicht. Dort wurden unter Gruppendruck polyamoriede Experimente gemacht und punktuell sichtbar ausgelebt. Die Antibaby-Pille war kein Thema und doch ein Thema. Dieses Gebaren verletzte mich in meiner Weltsicht, insbesondere in Bezug auf die Lebensweise meiner Ursprungsfamilie und auf meine Beobachtungen im Ausland in eher puritanischen Milieus. Vieles schien mir schönfärberisch und wenig alltagstauglich, galt aber gerade deshalb als echt und erstrebenswert. Um mich für ein mögliches gleichwertiges Nebeneinander dieser verschiedener Lebensentwürfe und Lebensweg einzusetzen, fehlten mir jedoch Vokabular und Kraft. Während meinem Praktikum bei der Beratunsstelle der Pro Infirmis wurde ich zusätzlich mit harten Realitäten konfrontiert. Ein behindertes Kind oder ein schwerer Verkehrsunfall veränderte eine ganze Familienstruktur. Was brachte da mein mutiges Ansprechen von Gefühlen? Sachhilfe war gefragt, Geld für Taxifahrten und für eine stundenweise Entlastung.
2020 Gemäss Christoph wurde die Sozialarbeit im Laufe der Zeit wieder lösungsorientierter. Aus den masslos überforderten Fürsorgerinnen von einst wurden neustens teileweise Sozialarbeiter, die es verstanden, alle Aufgaben zu delegieren, sei es zurück an den Kunden oder an andere Instanzen: Es bestehe die Gefahr, dass der Beruf dadurch viel an bereichernder, erfüllender Substanz verliere. Die Sozialarbeiter wissen wer, was, wie, wann, warum. Sie machen die Triage, stellen Rückfragen und wahren die Übersicht. -- In Bern wurden wieder einmal neue gesetzliche Regelungen betreffend Ehe und eingetragene Partnerschaften diskutiert. Christoph und ich wünschten uns "eine klare Lösung für alle" mit der Möglichkeit persönliche Vorlieben zusätzlich zu regeln und nicht für jeden denkbaren Fall ein eigenes Vorgehen.
Rückblickend auf die Abendschule muss ich mir eingestehen, dass die Antibabypille mich vereinsamen liess. Es wurde nicht darüber gesprochen, "man nahm sie". Wozu? Das war doch klar. Wollte ich das? Wollte ich bereit sein, um die nächste Gelegenheit zu nützen oder mich benützen zu lassen, weil ich sie nahm? War ich blöd? War ich ein Gegenstand? Gespräche verkürzten sich auf Nicken oder Schütteln. War ich eine Ware? Ein Gynäkolog hatte sie mir verschrieben. Er hatte mich nach meinem Beruf gefragt. Ich antwortete: "Von der Ausbildung her Lehrerin, zur Zeit Jura-Studentin." "Verstanden, dann brauche ich nicht mit ihnen zu sprechen," war seine Antwort. Ich fragte zurück. Er streckte mir das Rezept hin: "Ist in Ordnung!" und öffnete mir die Sprechzimmertüre. Da stand ich dann im Gang. Jeden Tag einen Schuss Hormone, wollte ich das meinem Körper zumuten? Wofür? Meine Eltern hatten Informationen zur Pille gesammelt. Die Mutter hatte mit dem Hausarzt und dem Frauenarzt darüber gesprochen. Nach langen Unterhaltungen hatten die Eltern sich entschlossen, mit 50 Jahren die Pille im Winter und Frühling zu nehmen und im Sommer und Herbst aus Rücksicht auf die Gesundheit meiner Mutter zu unterbrechen. Sie hatten darüber gewerweisst und meine Mutter hatte diesen Austausch mit mir geteilt. Sie hatte mir erklärt, solche vorbereitende Gespräche seinen wichtig. Richtig einzig meine Mutter schluckte die Pille am Abend um neun Uhr. Der Vater stellte nur eine Kontrollfrage. Für mein Empfinden nahmen sie die Pille im gegenseitigen Einverständnis gemeinsam. Mein Gynäkolog dagegen hatte einzig gesagt: "Dann brauche ich nicht mit ihnen zu sprechen." Er hatte mich nicht einmal auf die Packungsbeilage verwiesen. Ich wusste, die Eltern hatten die Packungsbeilage mehrmals miteinander gelesen. Ich ging zur Apotheke. Wortloser Tausch: Rezept und Geld gegen eine kleine Schachtel, diskret in eine Papiertüte gesteckt. Ich stand da und ging dann hinaus auf die belebte Strasse. Ich ging sofort heim und hinauf in mein Zimmer und begann zu weinen. Ich zog den Mantel aus und setzt mich aufs Bett. Ich brauchte Hilfe. Ich wurde zu meiner eigenen Sozialarbeiterin. Was löste die kleine Schachtel bei mir aus? Keine Freude. -- Wut, Angst, Scham, Trauer. Trauer, um die alte Zeit, als verheiratete Frauen ihren Körper genau kannten und so Schangerschaften verhindern konnten. Es war mühsam, hatte die Grossmutter gesagt. Sie habe immer im Kinderzimmer geschlafen, nur wenn sie sicher gewesen sei, habe sie der Grossvater im gemeinsamen Bett gefunden. Es sei dann doch passiert, dass es fünf Jahre nach den sechsten noch ein siebentes Kind gegeben habe. Wie ich ja wisse, sei dieses Kind während dem Grippeherbst -- drei habe sie verloren -- schliesslich zum Lichtblick geworden.
Ich war traurig, dass ich niemandem meine kleine Schachtel zeigen konnte. Ich schaute sie lange an und versteckte sie neben meinem Sparbüchlein. War ich sicher allein, holt ich sie hervor und jedes Mal wanderte sie wieder schnell in ihr Versteck zurück. Ich sollte doch die Packungsbeilage lesen! Nein, nein, das war nicht nötig, die Mutter und die Finnin hatten mir davon erzählt. Beide hatten mir geraten, die Pille keinen Falls leichtfertig zu nehmen. Ohne festen Freund sei das nicht nötig, und dies hatte ich nicht. Ich schämte mich. Ich wusste jedoch, es Frauen gab, welche die Pille vorsichtshalber schluckten, tagtäglich ein Hormonstoss. Davor hatte ich Angst. Es machte mich wütend, dass ich über all dies mit niemandem sprechen konnte. Ich war der Überzeugung, mir eine gute, moderne Sozialarbeiterin gewesen zu sein, aber das löste meine Probleme nicht.
Das Jurastudium war fordernd und schob mich immer wieder in eine andere Welt und das war gut so.
2020 Meine zwölfte Reise in den Kongo. Ich erschrak zunehmend mehr über die vielen Schwangeren und die vielen kleinen Kinder, die ich antraf. Was tun? Verhütung? Meine Gesprächspartnerinnen in Europa rieten "die Hände weg", ich solle mich nicht in Sachen einmischen, die mich nichts angingen.
Im Februar hatte ich meine Sorge einer Lebenskundelehrerin in Kinshasa vorgelegt. Was sagte sie den jungen Mädchen? Sie unterrichte in gemischten Klassen. Ihre Hauptthematik war die gemeinsame Verantwortung aller für das Wohl der Allgemeinheit und das einvernehmliche Gespräch von Mann und Frau. Ganz konkret: Wie sprachen die Menschen mit einander, wie tauschten sie sich aus? Noch konkreter: Wie war der aktuelle Aufenthaltsort der Klasse? Schmutzig oder sauber? Gab es Schatten und Sitzgelegenheiten? Wie war die Atmosphäre? Was konnte leicht und schnell verbessert werden? Wie waren der Tonfall, die Körperhaltung, die Wortwahl? Warum? Gab es ein aktuelles Problem oder Fragen zur letzten Stunde? Wenn nicht, begann sie mit dem Unterricht. -- Die Jugendlichen lernten sich vorzustellten und machten sich Gedanken zu ihren Interessen und Anliegen, ihren Stärken und Schwächen. Oft eröffne sie als Lehrerin die Diskussionen persönlich mit einer kleinen Beobachtung, einem Erlebnis oder einer Meldung im Radio. Zunächst dachten die Gruppenmitglieder einzel über das Gehörte nach und dann tauschten sie sich zu zweit und in grössern Gruppen kurz aus. Nachher einigten sie sich auf das Hauptthema und zerlegten dieses in Unterthemen: Ausgangspunkt, längerfristiges, realistisches Ziel, der nächste Schritt und mögliche Wege zum Ziel. Sie sprachen über ihre Ursprungsfamilie, und über die Schwierigkeiten mit denen ihr Clan zu kämpfen hatte. Warum? Was konnten sie als Jugentliche zur Lösung beitragen? Sie sprachen auch über ihre Zukunft, über die Möglichkeiten Geld zu verdienen, über eine eigene Wohnung, eine eigene Familie und über Kinder. Sie schlug mir vor, den Dorfbewohnern und Dorfbewohnerinnen die vier Sätze, die ihre Schüler und Schülerinnen lernten, in Erinnerung zu rufen. Also 1) AU SEIN DU COUPLE, LA FEMME ET L'HOMME DOIVENT S'ENTENDRE POUR AVOIR DES ENFENTS. Wie lauteten die vier Sätze auf Deutsch? Der Mann und die Frau haben gemeinsam darüber zu sprechen, ob sie sich Kinder wünschten. 2) Der Mann und die Frau haben gemeinsam darüber zu sprechen, wieviel Geld ihnen für das Erziehen und Ausbilden der Kinder zur Verfügung stehen. 3) Der Mann und die Frau haben gemeinsam darüber zu sprechen, in welchen Abstand sie sich die Kinder wünschen. 4) Der Mann und die Frau hatten gemeinsam darüber zu sprechen zu entscheiden, wann sie keine Kinder mehr wollen. "Du lernst die vier kleinen Sätze in Kikong auswendig und sagst sie den Leuten immer wieder vor. Du rezitierst ihnen diese Sätze, wie du ihnen das Vaterunser vorträgst. Sie werden überrascht sein, dir gut zu hören und darauf achten, was du ihnen ihrer Sprache vorleiherst." Im Laufe des Sommers hatte der Schulleiter mir diese Sätze in französisch und in kikongo per Mail geschickt und ich hatte sie seither mit viel Mühe auswendig gelernt. Noch konnte ich sie nicht fliessend dahinsagen, ich musste Wort für Wort mit Hilfe von Eselsblücken suchen. Diese Art von Lebenskunde hatte mir in meiner Jugend gefehlt: Der Mann und die Frau sprachen gemeinsam über die Familienplanung. Wer machte was? Konnte mit dem vorhandenen Einkommen ein weiteres Kind gross gezogen werden. Jedem der vier Punkte wurde eine Stunde gewidmet, damit alle die Gelegenheit hatten, sich zu äussern. Wovon träumten die jungen Leute, und was war realistisch möglich? Ich hatte in meiner Jugend ein Hauptziel: Ich wollte einen Lohn wie ein Mann und ich wollte selber über mein Geld bestimmen. Dieses Recht wurde uns Schweizer-Frauen erst mit der Einführung des neuen Eherechts um 1980 gesetzlich zugestanden. Ob Kinder ja oder nein, darüber hatte ich kaum mit jemandem gesprochen und wenn, so war immer klar, Kinder und Berufstätigkeit waren nicht vereinbar. Deshalb war mein Marktwert als Frau tief. Mein sparsamer Lebensstil und mein Studium waren weitere Negativpunkt. Für meinen jetzigen Mann war zu Beginn unserer Beziehung klar, niemals Kinder und keine Diskussion über dieses Thema. Unter dieser Voraussetzung war er bereit, mich, ein "Restposten" zu heiraten. Da ich eine verheiratete Frau sein wollte, liess ich mich heiraten. Da ich eine verheiratete Frau bleiben wollte, passte ich mich an und es gelang mir laufend Nischen für die Umsetzung meiner Träume zu finden.
2020: Im Laufe des Herbstes ergab sich die Gelegenheit, dass ich mit meiner Zahnärztin, die aus dem Ostblock stammte, über Gott und die Welt plaudern konnte. Ich erwähnte den Kongo und die Alphabetisierungsgruppen, in denen die Frauen wohl ein wenig lesen, aber hauptsächlich zählen und rechnen lernten. Meinen Wunsch, mit den Dörflern über deren Familien und die wünschenswerte Zahl von Kindern zu sprechen, verstand sie sofort. Nein, nein, in den abgelegenen Dörfern hatten die Frauen keinen Zugang zur Pille. Es ist wichtig, dass die Frauen nicht nur lesen sondern auch zählen und rechnen lernten. Ein Wort gab das andere. Ich war überrascht, die Zahnärztin war gegen tägliche Hormonschüsse. Sie könne aus eigener Erfahrung sagen, konsequent durchgeführt sei die Zählmethode zuverlässig. Ohne Hormone spiele sich der Zyklus nach jeder Geburt wieder ruhig ein. Auf meine fragende Haltung hin sprach sie weiter. Mit einem Studium in einem medizinischen Beruf habe sie gelernt, auf ihren Körper zu achten. Sie habe einen 28-Tage Zyklus. Beim Einsetzen der Blutung mache sie immer sofort einen kleinen Punkt in der Agenda und nach zehn Tagen einen zweiten. In dieser Zeit vor dem Eisprung passiere nichts. Da man drei Tage für die Lebensphase der Spermien einberechnen sollte, und der Eisprung ca. am 14 Tag sei, wäre dies Frist von zehn Tagen realistisch. Vom 18 Tag bis zum 28 Tag, dem nächsten Einsetzen der Blutung sei wieder eine unfruchtbare Phase. Persönlich würde sie den Eisprung spüren, einmal links und einmal rechts. Sie hätten vier Kinder, sie habe fünf geboren, zuerst vier Mädchen, wobei das vierte Mädchen kurz nach der Geburt gestorben sei. Später hätten sie noch einen Sohn bekommen. Das sei sehr schön. Ich bedankte mich. Ich hätte all dies wissen können, aber ich hatte es von mir geschoben, da ich nie von Kindern zu träumen gewagt hatte und schliesslich nach unserem ersten Kind sofort klar war, dass ich kein zweites Mal schwanger werden konnte.
Auf das Problem der Akademikerinnen war die Zahnärztin mit 15 Jahren gestossen. Die Kassenlehrerin und deren Tochter habe damals die ganze Klasse zum Jahresende nach Hause eingeladen. Da habe sie die Tochter, eine hüpsche Ärztin gefragt, warum sie nicht verheiratet sei. Wer will schon eine studierte Frau, sei die Antwort gewesen. Mit 15 habe sie als Ferienbekanntschaft ihren Mann, 23 getroffen. Sie habe das Problem gekannt, der acht Jahre ältere Mann habe ihr gefallen, also, denn auch sie habe ihm gefallen. Die Beziehung habe viele lange Trennungen überdauert. Schliesslich hätten sie sich geeinigt: Heiraten und im Westen einen Studienplatz suchen. Es habe alles geklappt.
Ich plante zwar nicht mit den Leuten im Kongo über Verhütung zu sprechen, aber ich war jetzt wenigstens informiert, ich war in der Lage darüber zu sprechen, ich konnte ihnen von meiner Zahnärztin erzählen, was mich beruhigte. Bei alle dem dachte ich immer wieder an ein Gespräch mit einem jungen Krankenpfleger in KongoKuku. Angesprochen auf seine Zukunftspläne, erklärte er mir, er wünsche sich eine schöne und gute Frau. Was das konkret heisse? Er sei im Begriff, ein schönes Haus für seine Frau, die Kinder und sich zu bauen. Es dürfe nicht zu klein sein, denn er möchte vier Kinder, zwei Mädchen und zwei Knaben. Er besitze schon einen Tisch, zwei Stühle und einen kleinen Kochtopf. Es gehe ihm gut. Er werde bald einer Schönen begegnen und da er bereits ein Haus habe, werde sie sich für ihn interessieren und sie werde bereit sein, alles mit ihm zu besprechen. Nun kam eine Mutter mit einem kleinen Jungen, der dringend ein Medikament brauchte.
Klappt alles und macht Covid nicht zuviel Spass, werde ich das Gespräch mit ihm im Februar 2021 weiterführen können.
Das Studium und die Abendschule und Afrika

Das Studium vergrösserte meinen Horizont Richtung Afrika, da ich regelmässig Vorlesungen zu entwicklungspolitischen Fragen belegte. Nach mehreren Rückfragen widmete ein Professor dem Thema "Transport und Entwicklung", eine ganze Doppelstunde, und er griff das Thema für ein spezielles Seminar auf. Ich konnten den diesbezüglichen Statistiken und Ausführungen nur ansatzweise folgen. Doch ich glaubte zu verstehen, dass Transportmittel, Transporterleichterungen, Transportangebote Entwicklungen begünstigen. Gut unterhaltene Strassen, öffentliche Verkehrsmittel, Lastkähne, Lastwagen und ähnliches erleichtern den Handel und dies verbessert die Verdienstmöglichkeiten breiter Bevölkerungsschichten. Viele kleine Leute konnten kleine Fortschritt machen. Das Leben wurde besser. In meinen Afrika-Träumen nach den 1970er Jahren sollte meine schwarze Schwester Alfi im Handel tätig werden. 2009 nahm unser erstes Lastschiff auf dem Fluss Kwenge im Hinterland von Kikwit den Betrieb auf. Ein Blick auf unsere Webseite www.bauerndoerfer-im-kongo.ch zeigt, dass mein Plan Nachahmer fand. Ein Kompliment, nicht wahr. Ob mehr angebaut wurde, weil es Lastschiffe für den Transport der landwirschaftlichen Produkte gab, oder ob dank der bequemeren Transportmöglichkeiten mehr angebaut wurde, die Frage nach dem Huhn oder dem Ei kann offen bleiben.
In der Abendschule für Soziale Arbeit streiften wir das Thema "Gemeinwesenarbeit". Im Alltag suchte ich nach Beispielen für das Gehörte: Wohngemeinschaften, neue gemeinsame Wohnbauten oder Weltläden. Mit Neugier und Zurückhaltung nahm ich als Passivmitglied an verschiedenen Projekten teil. Meine Vorgaben: Enges Budget einer Studentin, keine Zeit und kein Geld. Geben und Nehmen haben sich die Waage zu halten. Lange Diskussionen machten mich misstrauisch. Versuche, die von Dritten finanziert wurden, schienen zu klappen, solange Geld und oder Arbeit von aussen zuflossen. Ich beobachtete auch Entwicklungsprojekte, die Formulierung Entwicklungshilfe passte nicht in meine Denkart. Schulen in Afrika schienen mir immer auf Unterstützung von Aussen angewiesen, wenn nicht Geld von Staat kam, oder doch von den Eltern bezahltes Schulgeld. Schulen, die rentierten, schienen mir nicht allgemein zugänglich, weil zu teuer oder ideologisch gebunden.
Mein Projekt in Afrika sollte auf einem Gebiet in der Grösse eines Kantons den Entwickungsstand der Allgemeinheit um 10 Centimer heben und nicht ein Spitzenprodukt sein, das ein einsames Leistungsziel in zehn oder mehr Metern Höhe hiffte. Es muss sich ausbreiten. "Gemeinswesenarbeit" diente allen. Erst im Gespäch mit unserem ehemaligen Klassenlehrer in der Abendschule, Christoph Häfeli anfangs November 2020, wurde mir klar, dass ich diese Denkart an der Abendschule für Sozialearbeit erlernt hatte. Er erzählte und erinnerte mich an ein grossflächiges von der Stadt finanziertes Projekt für Senioren, das mit Unterstützung der Schule aufgebaut wurde, nachher aber von der Stadt weitergeführt werden musste, da es nicht, wie vorgesehen, zum Selbstäufer wurde. Träume funktionieren mühsam, denn sobald in Afrika Weisse auftauchen, werden marktwirschaftliche Prinzipien ausgeschaltet. Ausbeuten oder ausgebeutet werden, gilt bis heute. Huhn oder Ei?
2020 Corona -- meine beiden Projekte, Afrika und Frieden erfüllten mich. Sie gaben und geben mir viel mühsame Arbeit, aber sie sind eine sinnvolle Aufgabe in der Coronazeit.
Das Studium: Steuerrecht, Steuergesetz, wer weiss was noch? Friedel, Fritz, Alfred, Roger

An einem Wochenende im April 1990 platzierte die Vormundschaftsbehörde Zürich die beiden uns anvertauten Kinder auf Wunsch der leiblichen Mutter für uns unerwartet in einem Übergangsheim. Zum Warum konnten wir nur Vermutungen anstellen. Die Kinder und deren Klassenlehrer waren vor uns informiert worden. Wir spürten, Wiederstand leisten lohnte sich nicht. Gerne waren die Zürcher bereit, sofort alle Sachen der Kinder mitzunehmen. Fahrräder, Schlitten, Ski, Bade- und Spielsachen, die Kinder halfen mir willig alles in der Garage zusammenzutragen und wir waren uns einig, sie würden uns erst verlassen, wenn alles abtransportiert war. Die Amtsperson hatte zu spüren, da lohnte sich Wiederstand nicht. Ihr Wunsch, sich beim Einpacken auf das zu beschränken, was die Kinder gerade brauchen würden, hörten weder die Kinder noch ich. Die Amtsperson brachte ein erstes Auto voller Sachen nach Zürich und kam nochmals zurück. So hatten wir die Chance für ein gemeinsames Abschiedsessen in Musse. Ich fragte die beiden direkt und mehrmals, was ihnen bei uns nicht gefallen habe. Es habe ihnen gefallen, alles habe ihnen gefallen. Nach der Frage, was ihnen gut gefallen habe, begann es zu sprudeln. Ich bremste sie und bat, sich die Antwort kurz zu überlegen und nur zwei Sachen zu erwähnen. Der Junge war dankbar dafür, dass ich mich erfolgreich für seinen Übertitt aus der sechsten Klasse der Hiflsschule in die normale Oberstufe bemüht hatte. Er bedauerte auch sehr, dass er das gemietete Kyboard nicht mitnehmen durfte. Das Mädchen war stolz auf seine Fortschritt im Lesen. Sie sei nun die zweit beste der Klasse. Sie habe die Lehrerin gefragt, ob sie Lehrerin werden könne. Wenn sie weiter so gute Fortschritte mache, sicher. Diesen Satz wiederholte das Kind und begann zu weinen. "Es wird dir jemand anderer helfen," war mein Trost. Es läutete, tragt euch Sorge und macht es gut. Schnell, schnell tönte Stimme von unten. Das Auto fuhr weg. Als ich den Kindern in der Jacke nachgeeilte war, konnten wir uns gerade noch winken, bevor sie hinter der Kurve verschwanden. Weg waren sie.
Dann begannen meine 19 Jahre Erwerbsarbeit bei der Steuerverwaltung. Ich konnte meine neue Aufgabe im August antreten, obwohl ein Vermerk in meinem Dossier bei der Stadt von meiner Anstellung abriet. Nach einem zweiten Vorstellungsgespräch wurde ich mit einer verlängerten Probzeit angestellt.
Erinnern hiess, anderes in den Hintergrund schieben. Das geschah nun. Die Gespräche mit Christoph dem Lehrer an der Abendschule über die Revision des Kindes- und Erwachsenenschutzrechtes, weckte in mir meine Erinnerungen an die Revisionen des Steuergesetzes. Fritz und die Leute von der Steuerverwaltung fielen mir ein. Ich rief Roger, den Nachfolger von Fritz an und bat ihn das Steuergesetz 1995, das Abstimmungsmagazin zur Volksabstimmung vom 27. August 2000 zur Totalrevision des Gesetzes über die direkten Steuern und das Steuergesetz 2001. Er zögerte, sicher gebe es im Archiv einiges, aber er stehe unter Termindruck, es können eine Weile dauern. Durch einen Wasserschaden in seinem Büro habe er viele persönliche Bücher verloren. Ich räumte ihm eine Woche Zeit ein. Mit dem Vermerk "Manchmal liegen die Dinge näher als man meint", lag am Abend ein Umschlag mit den drei gewünschten Dokumenten in unserem Briefkasten.
14. November 2020: Hindernisse! Gestern hatten die Zahnärztin und ich mit der Gesamtsanierung meiner Backenzähne begonnen: Eine starke Lokalanäthesie und vier Stunden Einsatz des Teams. Ich war müde und hatte Hunger. Nach einer guten traumerfüllten Nacht sass ich wieder vor dem PC. Die katholische Wochenzeitung meldete mir das Erscheinen eines Artikels zu unserem Jubiläum 25 Jahre Abendgebet für den Frieden. Zu Handen der Bank füllte ich die Unterlagen für die Aktualisierung des Kontos "Bauerndörfer im Kongo" aus. Der Zoom-Termin für die Enkeltöchter fehlte noch. Der Nebel lichtete sich: Wanderwetter. Nicht für uns, ich hatte Roger versprochen, seine Unterlagen am Montag zurückzubringen.
Das Steuerrecht war mir wieder fremd geworden: Gemeindesteuern, Kantonssteuern, auch Staatssteuern genannt, direkte Bundessteuern als Nachfolger der Wehrsteuer, die eingeführt worden war, um die Kriegsausgaben zu decken, die Kirchensteuer, Schulsteuer, ... 1990 wusste ich, dass auf Bundesebene seit 1977 an einem Gesetz mit Richtlinien für eine teilweise Vereinheitlichung des Steuerrechtes gearbeitet wurde und die Räte schufen schliesslich das Bundesgesetz über die Harmunisierung der direkten Steuern vom 14. Dezember 1990 (StHG). Es trat am 1. Januar 1993 in Kraft. Hervorgehoben wurde allerseits, dass die Bestimmung der Steuertarife, Steuersätze und Steuerfreibeträge Sache der Kantone blieb. Grundsätzlich war und ist es ein Rahmengesetz, das den Kantonen für bestimmte Bereiche verbindlich vorschriebt, was sie in ihren Gesetzen wie zu regeln hatten. Die Kantone hatten ihre Steuergesetze bis zum 1. Januar 2001 anzupassen. Nach dem Grundsatz, wonach das höhere Recht des Bundes das niedrigere Recht der Kantone bricht, waren nach den 31. Dezember 2000 zwingende Vorschriften des StHG in den Kantonen direkt anwendbar.
Das neue Bundesgesetz über die direkten Bundessteuern vom 14. Dezember 1990 (DBG), in Kraft seit dem 14. Dezember 1995 erfüllte seinerseite die Voraussetzungen des StHG. Das kantonale Steuergesetz von 1919 wurde 1956 und ein zweites Mal per 1. Januar 2001 total revidiert.
2020: Wie lief das mit unserer Gesamtrevision des Steuergesetzes 2001? 1995 war mein Ziel gewesen, alle Vorgaben des Steuerharmunisierungsgesetzes (StHG) umzusetzen und das kantonale Gesetz möglichst dem Gesetz über die direkten Bundessteuern (DBG) anzupassen. Die Staatssteuern sollten neu Kantonssteuern heissen. Wir waren ein Kanton, wenn auch die ehrwürdigen Bürger, Staatsbürger des Staates Schaffhausen waren. Das Gesetz sollte in Anlehnung an das neue Eherecht geschlechtsneutral formuliert werden. Es war ein Hin-und-Her. In einem ersten Arbeitspapier setzte ich jeweils meine Vorstellung um. Im Grunde sollte ich keine eigene Meinung haben, aber ich hielt an dieser fest, wenn gleich eine Überzahl der Männer mir eine solche nicht zu billigte. Mein Wunsch nach Anpassung an den Bund musste Punkt für Punkt ausdrücklich rückgängig gemacht werden. Richtig, freiwillig wich ich in keinem Punkt zurück.
2020: Wer erinnerte was? Meine ehemaligen Vorgesetzten wenig, wozu auch, das war weit weg. Die Enkel, der Garten, Covid, sie hatten anderes zu denken. Ich liess mir von Roger die Gesetzbücher von damals bringen. Da lagen sie nun neben mir. Was erinnerte ich? Der ganze Gesetzgebungsprozess war ein Kraftakt gewesen, der durch die Tatsache, dass ich eine Frau war, häufig in einem unfreundlich Ton geführt wurde. Widerwillig wurde in Anlehnung an die Nachbarkantone ein Kinderbetreungsabzug von höchstens Fr. 2'000 für jedes Kinder unter 15 Jahren für die Kosten für die Betreung durch Drittpersonen eingeführt. Mit Genugtung stellten die Ratsmitglieder in den Verhandlungspausen fest, dass ich nicht mehr davon profitieren konnte. Im Gegenzug ärgerte ich sie, indem ich ihnen in fünfzig Jahren eine ökologische Steuerreform in Aussicht stellte. Jetzt war Halbzeit. Trotz Covid demonstrierte die Klimajugend für eine zügige Umsetzung des Pariser Klimaabkommens, und wer etwas auf sich hielt, zog ein grünes Mäntelein an. Hatte Drump die Wahl für eine zweite Amtsdauer im Weissen Haus verloren? Zurück 1995: Über die Umstellung von der zweijährigen Vergangenheitsbemessung auf die einjährige Gegenwartsbemessung wurde viel geschimpft, aber sie drängte sich auf, weil die überwiegende Mehrheit der Kantone umstellte. Dies brachte für die Steuerwaltungen neben dem höheren Veranlagungsrhythmus administrativen Mehraufwand, wie die jährliche Erstellung und der jährliche Versand der Steuerformulare, die Anpassung der EDV, grösseren Platzbedarf für Registratur und Archiv. Schliesslich war man sich einig, die einjährige Gegenwartsbemessunng ist klar das bessere, einfachere und gerechtere System. Die zunehmend steigende Mobilität der Bevölkerung hatte mehr und mehr Zwischenveranlagungen ausgelöst und bei Kantonswechsel zu Schwierigkeiten geführt. Persönlich konnte ich mich leider kaum der Veranlagung widmen. Meine Aufgabenbereiche waren die Anpassungen und Erläuterungen im internen Rechtsbuch, die Steuerbefreiung von juristischen Personen mit gemeinnützigen Aufgaben, die Bearbeitung von Steuerlassgesuchen und die Beantwortung von allgemeinen Anfragen. Vieles, vieles ging mir beim Tippen durch den Kopf. 1995 begann Fritz im Rechtsdienst und am 25. Februar 2000 verunglückte er schwer. 1995 hatten wir mit dem Abendgebet für den Frieden begonnen. 1995 hatte uns unsere Adopthivtochter verlassen. 1995 wechselte mein Mann den Arbeitplatz. Vieles ging mir durch den Kopf.
Der Nebel hatte sich aufgelöst und die Sonne blendete mich am Bildschirm.
Studium: Ein Telefonat mit Bea

2020 Fit durch die Corona-Zeit. Wie?

Corona: Widerwillig und trotz der bundesrätlichen Aufforderung "Bitte bleiben Sie zuhause" musste mein Mann täglich einen kleinen Spaziergang mit mir machen. Er führte mich im Auto an einen abgelegenen Ort. Bald unternahmen wir zweimal wöchentlich einen Marsch von zwei Stunden, Hin-und-Zurück zum Auto. Das tat gut. Als wir die Grenze wieder passieren durften, umwanderten wir in je drei Stunden die Vulkankegel im Hegau. Die "Phonolithe", die nicht ausgebrochenen Vulkane ohne Basalt heissen: Hohentwiel, Hohenkrähen, Mägdeburg und Staufen. Die Basaltberge sind ausbegochene, erloschene Vulkane mit den Namen Hohenstoffeln, Hohenhewen, Neuhewen, Höwenegg und Wartenberg. Mein Mann hatte mir die Namen aufgeschrieben und unten auf dem Notizblatt stand weiter: Entstehung und Aktivität vor ca. 11 - 8 Mio. Jahren, Höhe ca. 800 Meter. Oben auf jedem dieser Hügel stiessen wir auf eine Burgruine, die um die Jahrtausendwende errichtet und während dem 30-jährigen Krieg zerstört worden waren. Wie hatten sie es geschafft, diese Burgen zu bauen? Steine, Wasser, Holz alles musste hoch getragen werden. Das Internet: Die paar sauberen Zeilen erwähnten keine Entberungen. Zusätzlich wurden beim Bau des Autobahntunnels ein paar römische Münzen gefunden.
Zur Abwechslung folgten wir der Wutach oder einem ihrer Nebenflüsschen. Hier zwei Besonderheiten: In der Nähe von Stühlingen stiessen wir auf einem steilen, rutschigen, zerklüfteten Wegstück von Eberfingen Richtung die Burg Hohen Lupfen auf die sog. Judenlöcher. Dorthin sollen während den Pestepidemien in 15. und 16. Jahrhundert die Juden aus Stühlingen vor den Verfolgungen geflohen sei. Gemäss Angabe auf der Informationstafel war man der Überzeugung, die Juden seinen Träger der Seuche, die mehr als die Hälfte der Bevölkerung dahinraffte. Weitere Details lassen sich im Internet unter dem Stichwort "Judenlöcher Stühlingen" finden. Ein andermal waren wir in der Gegend von Löffingen / Döttingen auf den Parkplatz alte Post Unading gefahren und dem kleinen Flüsschen Mauchen gefolgt. Zunächst durch einen Hochwasser Tunnel und dann einem Hang entlang, rechtsaufsteigend bewaldet und links offene Felder. Dort erinnerte eine Tafel an das Dorf "Mauchen", gegründet im 11. oder 12. Jahrhundert und 16. Jahrhundert aufgegeben. Die Felder wurden später von Bauern aus Unadingen bewirtschaftet. Da das Gebiet anschliessend aufgeforstet wurde, eignet es sich besonders für archäologische Strukturuntersuchungen. Weitere Informationen lassen sich im Internet via "Mauchen (Wüstung)" finden.
Hier unterbrach ich das Tippen, um mich auf die Fortsetzung meiner Gebisssanierung "vorzubereiten".
2020 Die Enkelkinder im Coronajahr, wie ging das?

Die MML-Begleitgruppe wurde nach Zoom verschoben. Was lag näher, als auch die Enkelinnen nach Zoom zu verschieben? Am Sonntagabend waren sie müde: Wir glotzten uns kurz an, machten einen virutellenen Wohnungsrundgang und die Puppen der Mädels winkten uns Gute Nacht und Aufwiedersehen.
Bilderbücher. Die Bibliothek war geschlossen. Was gab es im Haus? "Der Hase und die Sonne" und "Der Baum und die Erde" zwei Abschlussarbeiten von Lehrerinnen im Kongo. Konnten die Deutsch? Sicher nicht, ich hatte die Texte aus dem Französischen übersetzt. Einiges fand ich im Estrich und anderes nahm ich von öffentlichen Tauschgestellen. Was zum Beispiel? Entschuldigung, ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nur ärgern, dass ich die Titel nicht aufschrieb. Schreibe doch wenigstens die Titel der Bücher auf, die Du für die Rückgabe in der Bibliothek bereitgelegt hast! "König Drosselbart" und "Die Schöne und das Biest" wandern mit dem Stempel "nicht geeignet" zurück. "Mein kleines grosses Geheinmis" die Geschichte von einer Maus und einem Apfel. Kommt in "Unsere kleine Höhle", sagte der kleine Bär und lud Familie Fuchs in ihre Schneehütte ein. Das tönt ja spannend. Als nächstes "Frosch und Biber", nochmals eine Geschichte, die vom unfreiwilligen Wohnungswechsel von Tieren erzählt. Schliesslich "Lilli Gans fliegt los", sie folgt das erste Mal den Wildgänsen in den Süden, weil sie glaubt, die Mutter würde sie immer beschützen. Das ist eine gute Idee. So vergessen die deine Enkeltöchter euch nicht. Ja, Lilli Gans versprach der Mutter voller Ernst, "wenn du, meine Mama alt bist, werde ich dich immer beschützen". Wie lange Corona noch dauert, das wissen wir nicht, aber ich will ein wenig Ordnung unter die erzählten Geschichten bringen. Ich notiere die Titel jede Woche.
Wie ich das so durchhalte, das macht mir Freude. Die Geschichten bringen mir auch etwas. Diese Formulierung hat mir Fritz am Wochenende geschenkt. "Ich halte durch, solange mir das Leben etwas bringt," hatte Fritz, der Paraplegiker gesagt. Das Märchen "die Bremer Stadtmusikanten" bringt mir viel. Ich habe Mut für den letzten Lebensabschnitt gefasst. Mit "Weg mit dem alten Esel, weg mit dem alten Hund und weg mit Katze und Hahn, die ihren Dienst nicht mehr tun," beginnt meine Antwort auf die Frage nach meinen Vorstellung für die persönliche Endzeit. Ich halte mich an die Bremer Stadtmusikanten. Die Vier machten sich auf den Weg und lebten schliesslich gemeinsam im Haus der Räuber.
Am Morgen des 22. Novembers 2020 gab es keine Internetverbindung, also kein Zoom. Schade, denn ich war auf "Lisettes Geburtstag, eine lustige Geschichte mit vielen Bildern" von Hans Fischer, Büchergilde Gutenberg Zürich 1947 gestossen. Ganz unerwartet klappte es gegen Abend. Die Mädchen kannten zwar die Geschichte bereits, aber sie hörten meinem Erzählen aufmerksam zu. Wir konnten sogar ein wenig miteinander sprechen. Ich schlug ihnen zusätzlich "DIES UND DAS" von Tomi Ungerer vor, 2019 aus dem englischen übersetzt. Dem Opa gefiel dieses Buch gar nicht, mir sosola. Bilder, die Gefühle zeigten: Spüren, lächeln, weinen, lieben, teilen, stark, klein, gross, sehen, anschauen, berühren, fühlen, waschen, putzen ... . Opa hatte gut reden, ich suchte nach geeigneten Büchern in den Bibliothek und das war nicht einfach. Ich hatte schon mehrere wenig erfolgreiche Versuche hinter mir. Mit vielen Geschichten, aus dem englichen übersetzt, mit mir fremd anmutenden Bilden, geschrieben und gezeichnet im 21. Jahrhundet, tat ich mir schwer. Ich hatte in der Bibliothek verschiedentlich nach Bilderbüchern gesucht und schliesslich nach Märchenbüchern gefragt. Eine freundliche Frau zeigte mir ein Gestell voller dicker Bücher. Es stand dicht an einer Glaswand und ich wurde zweimal gebeten, vorsichtig zu sein und nicht zu erschrecken, denn eine Berührung der Glaswand löse den Alarm aus. Mit soviel Altsein konnte ich in jenem Moment nicht umgehen und verschob das Suchen nach Märchenbücher mit Bilder auf später.
Die Mädels erlebte ich an jenem Tag als liebenswürdig. Sie beteiligten sich und zeigten uns noch die Kerzen, die sie am Nachmittag gezogen hatten. Papa habe erzählt, dass er jeweils auch Kerzen gemacht habe. Das nächste Mal war ich beim Suchen nach Büchern sehr erfolgreich: Markus Osterwalder, "Mit Bobo Siebenschläfer durch das Jahr, Rowohl Taschenbuch Verlag, 2020, - Marjaleena Burmeister, "Jetzt sind wir einfach glücklich, Vorlesegeschichten, Nilpferd 2019, - Erwin Moser "Bärenträume, Vorlesegeschichten, Nilpferd 2018. Weiter schleppte ich aus Brockenhaus ein Dutzend kleine Bilderbücher zu je einem Grimm-Märchen und aus der Buchhandlung zwei Bücher "Was, warum, wieso" eins zum Thema "Wald" das andere war den "Bäumen" gewidmet. Hochnebel, Hochnebel.Es war schön, zwei Enkeltöchter zu haben.
2021 Wie werde ich alt?

Wie werde ich alt? Ich plante eine Umfrage, bei meinen alten, das langjährigen Bekannten zu machen.
Das Studium und die Abendschule: Hast du abgeschlossen?

Gut so, denn nun wusste ich, die Fahrt zum Mond hat sich gelohnt, denn nun weiss ich ganz gewissenhaft, dass die Fahrt zum Mond sich nicht lohnt, darum hat die Fahrt zum Mond sich doch gelohnt. Ich brauche nicht wieder und wieder Verständnis heischend, zu bedauern, ich hätte wohl gekonnt, hätte aber keine Gelegenheit zum Studieren gehabt.
Ich habe es versucht und es geschafft. Ich kann nicht zurück.
Wie sah Deine Zukunft Ende 2020 aus?

Meine Pläne für "meet my life" im Jahr 2021: Ein Gartenprotokoll, allerlei Erinnerungen und Träume aus der Zukunft, vielleicht eine Sammlung von nützlichen Wörtern, vielleicht ... etwas über das Altwerden. Hoffentlich bin ich bescheiden genug.
Nun die gekürzte Kopie: 2021 werde ich mich analog zu 2020 an den Naturgesetzen, meinem eigenem Menschenverstand und neu an den Kapriolen von Covid orientieren. Covid wird mein neuer Gesprächspartner. Ich frage Covid: "Gehörst du zu Fridays for Future oder sogar zu Exition Rebellion? Bist du in Greta verliebt, weil sie so reich ist?" Ich hoffe, dass in Hongkong, Chile, Bolivien, im Iran, in Algerien, im Sudan, in Syrien und an den vielen Orten, die in den Medien nicht erwähnt werden, sich die Menschen bald in Ruhe um ihr tägliches Brot kümmern können und sich die Schere zwischen arm und reich nicht weiter öffnet. Corona? Covid lacht: "Ihr kennt mich ja noch gar nicht! "
Danke fürs Lesen. Tragen Sie sich Sorge.