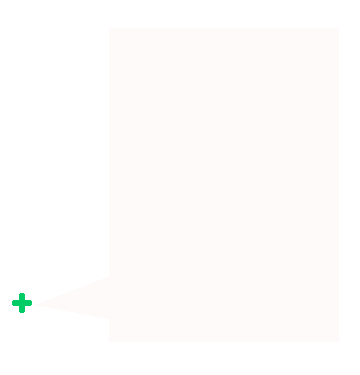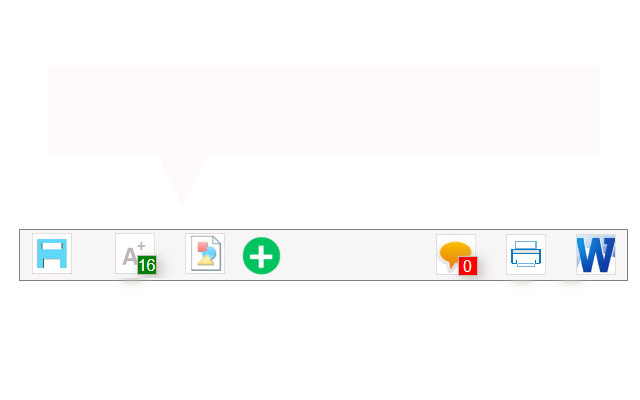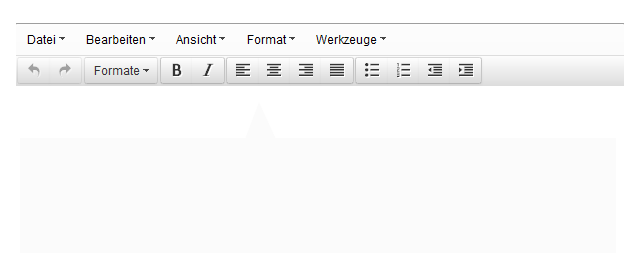Zurzeit sind 552 Biographien in Arbeit und davon 313 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 191


ERINNERUNG AN MEIN ELTERNHAUS
(Falkenweg 4, 6340 Baar) und anderes.

(1)
Der Falkenweg zwischen Neugasse und Bühlstasse, wo zuoberst das Restaurant Falken war, gehörte in unserer Kindheit der Familie Max Schmid, welche auf der linken Seite zwei Häuser weiter oben wohnte. Der Weg war eine Naturstrasse, welche leicht gegen die Neugasse abfiel. Der Familie Schmid fehlte das Geld, um sie asphaltieren zu lassen. Kein Wunder, hielt sich Rechtsanwalt Schmid doch den ganzen Tag im Falken auf, wo er nebst dem Trinken sich dem Geldspiel widmete. Leider verlor er viel, denn schlussendlich musste er das Haus verkaufen und zügelte mit der Familie in den Kanton Aargau. Uns taten seine zwei Töchter und der Sohn, mit denen wir gerne spielten, sehr leid. Wir hatten keinen Kontakt mehr zu diesen Kindern. Später arbeitete Ursula Schmid im Telegraphenbüro der PTT. Und just kam an der Hochzeit von Esther ein Telegramm, welches durch Ursulas Hände ging und sie sich deshalb erlaubte einen Glückwunsch anzubringen.
Der Vorteil der nicht asphaltierten Strasse war aber, dass der Schnee viel länger liegen blieb. Einerseits wurde nicht geräumt und anderseits speicherte der Kiesboden die Wärme schlechter als Asphalt, sodass der Schnee später schmolz. Das zog natürlich auch viele Kinder aus der Umgebung an, sodass weit in den Frühling hinein geschlittelt wurde. Am Ende des Grundstückes Schmid war auch eine 10cm dicke Schranke über der Strasse, mit einem Meter Durchgang für Fussgänger und Radfahrer. Für uns war die Schranke die Ideale Turnstange. Später, als die Familie Schmid bereits weg war, entschieden sich die Anwohner, die Strasse zu asphaltieren und der Gemeinde zu übergeben, welche diese auch unterhielt.
Das Haus baute Zeffirino 1944, nachdem er das Haus, welches er 1942 bei der Kreuzung Altgasse/Landhausstrasse erstellt hatte, an den Geometer Dänliker verkaufte.
Seine Mutter wohnte noch in der Sagenbrücke mit ihrer Tochter Hedy. Da diese heiratete nahm er seine Mutter nach Hause, welches aber für die zunehmend grösser werdende Familie zu klein wurde.
Vom Falkenweg aus ging ein Granit-Plattenweg über zwei Stufen direkt zum Eingang des Hauses. Links und rechts des Weges war ein Grünstreifen mit Farnkraut und der Strasse entlang ein paar Büsche. Ein Sommerflieder mit lilafarbenen Blüten schien Sommerfalter direkt anzuziehen. 
(2) Wohnhaus
Auffällig an der Fassade war das Sgraffito vom Künstler Adam aus Sargans, welches verschiedene Szenen auf dem Bau darstellte. Weiter rechts war die asphaltierte Zufahrt zu zwei Garageboxen mit Holzkipptoren und wiederum rechts davon eine kleine Rasenfläche mit einem Lorbeerbaum und einer riesigen Birke. Mit den Blättern des Lorbeerbaumes erstellte unsere Nonna Kränze für Beerdigungen. Die Blätter wurden mit Agraffen auf einem strohgefüllten und mit grünem Papier umwickelten Ring befestigt und mit verschiedenen Blumen verziert.
Die Birke lieferte uns während der Maikäferplage jede Menge dieses Ungeziefers. Ich bastelte einen Metallhaken, den ich an eine Schnur band und nach oben warf bis er an einem Ast hängen blieb. So konnte ich viele Käfer herunterschütteln. Die Käfer warfen wir in die Giesskanne, leerten heisses Wasser darüber und lieferten sie dem Fuhrhalter Staub, welcher diese in die Jauchegrube schüttete und uns mit 20 Rappen belohnte. Einmal allerdings hatten wir die Käfer im Fettkübel beim Brunnen vergessen. Als wir dann Tage später den Deckel öffneten, wimmelte es von Maden. Abliefern konnten wir sie aber trotzdem.

(3)
Die Eingangstüre war aus massivem Holz und hatte sich über die Jahre leicht verzogen. Es war eine typische Holztüre aus den 40iger-Jahren, mit einem kleinen Fenster drin, wo man den Besucher erkennen konnte. Als meine Eltern eine Deutsche Dogge beherbergten, sprang diese jedes Mal dieses kleine Fenster hinauf und erschreckte damit die Fussgänger, welche auf dem Falkenweg vorbeiliefen. Eigentlich verwunderlich, dass diese Türe noch funktionierte, denn es war Krisenzeit als das Haus gebaut wurde. Das Material war rar und von schlechter Qualität. Ob eine heutige Türe nach allen diesen Jahren auch noch brauchbar wäre? Ich zog den Schlüssel, welcher mir meine Mutter mitgegeben hatte aus der Jackentasche und steckte ihn in das neue Sicherheitsschloss. Meine Mutter war seit einigen Jahren im Altersheim, hatte das Haus weitgehend geräumt, und schickte mich zwischendurch heim, weil sie noch einen Gegenstand vermisste. Da niemand mehr darin wohnte war es gut, dass das alte Bartschloss durch ein Sicherheitsschloss ersetzt wurde. Mutter und Vater waren kaum vierzehn Tage im Altersheim, als mir schon die Polizei telefonierte und fragte, ob ich zwei Herren fremden Namens kenne und ob noch jemand in diesem Haus wohne. Als ich dies verneinte, sagten sie, dass sie dies gleich vermutet hätten, da diese Burschen unser Elternhaus als Wohnadresse angegeben hatten.
Rechts neben der Eingangstüre führt die Holztreppe in das Schlaf- und das Dachgeschoss. Ich kannte jede Stelle der Treppe wo ein Knacken zu hören war, sobald man draufstand. Dies war notwendig, wenn man spät heimkehren wollte um nicht die Eltern zu wecken.
Auf der linken Seite des kleinen Windfanges ging es in die Waschküche. Sie war im Erdgeschoss, weil das Haus nicht unterkellert war. Es roch darin immer nach Feuchtigkeit und Waschmitteln. Heute steht darin eine moderne Waschmaschine und an der Wand hängt ein Chromstahlbecken. Somit ist der Raum schlecht genutzt. Wer aber weiss, dass auf der linken Seite eine Waschmaschine der Verzinkerei Zug (wo Onkel Emil Hug-Bigliotti arbeitete)aus Kupfer mit Holzfeuerung stand, auf der Rückseite eine mit Wasser angetriebene kupferne Zentrifuge ihr rüttelndes Unwesen trieb und ein grosses Steinbecken die halbe linke Wand verdeckte sieht, dass die Waschküche nicht zu gross geplant war. Auch hatte es noch Platz für das Waschbrett, das Feuerholz und die aus Weiden geflochtene Wäschezeine. Über dem ganzen Raum waren noch die Drähte für die Wäschetrocknung gespannt. Das letzte Mal als ich in dieser Waschküche war, hob ich meine Mutter vom Boden auf. Sie war nach einem Schwindelanfall gestürzt und schlug den Kopf am Beckenrand auf. Mein Vater, welcher nicht die Kraft hatte sie aufzustützen, bat mich telefonisch um Hilfe. Diese wiederkehrenden Schwindelanfälle waren auch der Grund, weshalb die Eltern ins Altersheim zogen, wo sie jederzeit betreut waren.
Den, hinter der verglasten Abschlusstüre des Windfanges beginnenden, schmalen Korridor hatte ich mitgestaltet. Die leicht gewölbte Decke aus gewellt abgeriebenem Gips war gerissen und musste saniert werden. Vater nahm meinen, nach damaliger Mode gestalteten, rustikalen Vorschlag an und wir erhielten eine längsgerichtete Holzriemendecke, welche dunkelbraun gebeizt wurde. Die Decke erinnerte mich an alte gewölbte Bahnwagen-decken. Der Plattenboden aus den 60-er Jahren war typisch für diese Zeit. Der Plattenleger gestaltete den Boden aus verschiedenfarbigen zerschlagenen Porphyrplatten, indem er diese willkürlich nebeneinander in die Pflastermasse drückte. So glich nie ein Boden dem anderen. Es war Handarbeit, welche heute kaum mehr bezahlt würde. Deshalb hat es jetzt einen Belag aus quadratischen Solnhofnerplatten und die Decke wurde inzwischen auch weiss gestrichen.
Die erste Türe links führte in einen 30cm tieferen Keller, welcher als Geräteraum benutzt wurde. Vor allem Handwerkszeug lag auf hölzernen Gestellen. Zwischen dieser Kellertür und der Bürotür hing im Korridor das Wandtelefon. Es war schwarz mit zwei runden grossen Glocken darauf, einer Wählscheibe und unter dem Telefonkasten an einem Haken das Telefonbuch. Die Telefonnummer war 43400. Da es viel weniger Telefonanschlüsse gab als heute, waren wir mit dem Telefon der Nachbarschaft verhängt. Das heisst, wenn diese telefonierten, konnten wir das Telefon nicht bedienen. Da hörten wir oftmals die Eltern sagen „Hören die denn überhaupt nie auf zu telefonieren?“
Für das ständige Surren und den öligen Geschmack, welcher aus dem unteren Spalt der in der rechten Wand eingelassenen Tür kam, war natürlich die Heizung verantwortlich. Zu meiner Jugendzeit war in diesem Raum noch eine Kohlenfeuerung und das Kohlenlager, welches sowohl aus Briketts als auch gebrochener Steinkohle bestand. Jetzt stehen dort zwei Kunststoff-Öltanke mit je 1000 Liter Inhalt. Zwei gepflasterte Treppentritte führen in den Keller hinab. Und diese Treppentritte erinnern mich daran, dass meine Schwester Esther und ich mehrmals im Dunkeln darauf sassen. Wenn wir uns stritten und es der Mutter zu bunt wurde, schloss sie uns in den dunklen Kohlenkeller. Der Lichtschalter war zu hoch angebracht, so dass wir ihn von der unteren Treppenstufe aus nicht erreichen konnten. Nach anfänglich heftigem Poltern an die Türe beruhigten wir uns mit der Zeit und sassen grübelnd in der stillen Dunkelheit. Dann fielen plötzlich Kohlen ab dem Haufen, worauf wir heftig erschraken und panikartig an die Türe klopften. Wir wussten genau, wer die Ursache des Geräusches war: die Mäuse! Diese wurden via Kohlensack ins Haus geliefert, sodass fast ständig eine Mausefalle in der Heizung aufgestellt wurde. Die Mutter erreichte, indem sie uns in den Kohlenkeller steckte, dass wir uns solidarisch gaben und uns wieder ertrugen. Sie selber war meistens mehr geplagt als wir, denn sie musste anschliessend unsere Gesichter, unsere Hände und Kleider vom Kohlenstaub befreien.
An der gegenüberliegenden Wand ist das Kämmerli, welches unter der internen Holztreppe zum Obergeschoss liegt. Mutter brauchte dies für das Unterbringen von Putz- und anderen Haushaltgeräten. Natürlich gehörte dazu auch der Teppichklopfer aus Weiden, den die Teppiche weniger zu spüren bekamen als wir Kinder. Gefürchtet haben wir vor allem den gedrehten Stiel des Klopfers aus Weiden, wenn er unseren Hintern durchblutete. Ein langes Nachbrennen war garantiert. Doch lernten wir dadurch auch davonzurennen, so dass Mutter uns bald nicht mehr erwischte.
Die Türe links neben dem Kämmerli, deren Glaseinsatz Tageslicht in den Korridor befördert, führt in die Küche. Diese wurde mehrmals erneuert und beinhaltet zuletzt einen Tisch mit einer Bank entlang der verputzten Wand. Das alltägliche Essen fand immer hier statt. Man konnte durch das Fenster den ganzen Rasenplatz überblicken, auf dem wir Fuss-, Federball oder Versteckis spielten oder in einem Wasserbecken herumplanschten. Solange es nicht regnete war dort immer etwas los und nicht selten mussten die Eltern mit lauter Stimme oder durchdringenden Pfiff eingreifen. Dies war meistens dann der Fall, wenn der Fussball wieder in die von Mutter liebkosten Rosen fiel. Vaters Pfiff, der aus einem hohen und tiefen Ton bestand, hörten wir weit herum, da damals noch kein grosser Verkehrslärm die Ruhe störte. Natürlich machten wir am Küchentisch unter Mutters Aufsicht auch die Schulaufgaben oder spielten Karten. Während dem Essen wurde nicht gesprochen und auch nicht davongelaufen. Zudem liefen um halb Eins die Nachrichten und da musste es mucksmäuschenstill sein.
Gleich nebenan war der Aufenthalts- und frühere Büroraum, an dessen Wand der Vater mit Faustklopfen zum Essen rief, vor allem dann, als wir anfangs der 60-er Jahre den ersten Schwarzweissfernseher erhielten. Allerdings hielt sich Vater weit mehr vor dem Fernseher auf als wir. Am liebsten sah er Wildwester, denn als wir noch kein solches Gerät hatten, pilgerte er ein bis zweimal pro Woche in das Kino Gotthard vor der Neumühle. Nicht umsonst nannte man das Kino „Revolverküche“. Da die Strecke von uns zum Kino sehr kurz war, ging er gleich in den zugeschnallten Hauspantoffeln und der gestrickten Hausjacke ins Kino. Nun, da wir ja einen Fernseher hatten, konnte er auch zu Hause Filme anschauen. Hie und da sass auch Mutter neben ihm auf dem Diwan und strickte. Für Wildwester liess sie sich jedoch nie begeistern und sah lieber etwas Lustiges. Der Fernseher war in einem Hochschrank eingeschlossen, sodass zum Fernsehen erst die Doppeltüre aufgemacht werden musste. Nach ein paar Jahren war der Apparat meist schon defekt, weil er im Kasten zu wenig Luft erhielt, sodass er zu heiss wurde. Trotz dieser Erkenntnis wurde auch der neue Fernseher wieder in den Kasten gestellt. Ich erinnere mich auch an unseren ersten Fernseh-Sonntag. Wir bekamen, wie damals üblich, unangemeldeten Besuch einer Tante samt Onkel und Kindern. Drei geschlagene Stunden sassen wir alle vor dem Fernseher ohne ein Wort zu sprechen, nur unterbrochen durch Ess- und Trinkgeräusche. Dann hatten sie sich mit bestem Dank für die Gastfreundschaft verabschiedet.
Wenn der Vater an einer Musikprobe oder einem anderen Anlass war und wusste, dass nach 22 Uhr ein Krimi im Fernseher kam, musste er jeweils unter irgendeinem Vorwand dringend Heim. Dr. Mabuse und Edgar Wallace warteten ja nicht auf ihn!
Der Gestank nach abgestandenem Rauch war in diesem Raum allgegenwärtig. Vater rauchte entweder Pfeife oder Stumpen. Auch wenn die Mutter in die Aussenwand einen elektrischen Ventilator einbauen liess, dessen Geräusch mit den Jahren der Lautstärke des Fernsehers gleichkam, nützte dieser nur wenig. Vor allem dann nicht, wenn der Vater im Winter den Ventilator nicht einsteckte, weil er sonst fror. Ich machte in diesem Aufenthaltsraum auch meine erste Rauchererfahrung, da Vater mir als Kind anerbot ihm den Toscanelli bereits angebrannt zu überreichen. Ich erstickte fast von dem beissenden Rauch, was Vater zu einem Schenkel klopfenden Lachen animierte, woran er dann fast selbst erstickte. Dieser Aufenthaltsraum war aber für uns Kinder ein wichtiges Spielzimmer in das wir auch andere Kinder einladen durften. Nicht übersehbar hing an der linken Wand ein riesiges Ölgemälde von etwa 100x180cm mit der Darstellung einer Sonnenblume. Gemalt von einem Moll, wie man rechts unten lesen konnte.
Wie erwähnt, war früher das Architekturbüro in diesem Raum. Nebst Vater hatte noch ein Zeichner Platz darin. Es wurde noch mit Bleistift auf Kalkpapier gezeichnet. Um die Pläne zu kopieren hatten sie einen Heliographieapparat. Dieser bestand aus einer gebogenen Holzwand von der Grösse etwa 100 x 150 cm. Darüber mit zwei unteren Schrauben gespannt war eine durchsichtige Kunststofffolie. Der Plan wurde auf das gelbliche Kopierpapier zwischen diesem Plastik und der Rückwand gelegt und oben festgeschraubt. Dann stellte man das Gerät bei sonnigem Wetter an den Apfelbaum im Garten, sodass die Sonnenstrahlen alles Gelbe, welches nicht durch Bleistiftstriche abgedeckt war, wegbrannten. Dann rollte man den Plan zusammen und steckte ihn in einen runden Zylinder aus Blech, in dessen Deckel Watte mit Salpetersäure getränkt lag. Diese Säure entwickelte die gelben Striche zu einem schwarzen Plan. Der Deckel hing an einer Feder und wer nicht schnell genug den Plan hineinstiess, bekam garantiert nasse Augen und einen Hustenanfall. Bei nebligem Wetter im Herbst, mussten sie dann mit dem Heliographieapparat nach Aegeri an die Sonne fahren, sofern Kopien dringend notwendig waren.
Später wurde das Büro in einen Aufenthaltsraum im Stile der 60-er Jahre umfunktioniert. Als Möbel ein Nierentisch mit Grüner Kunststoffplatte eingelegt und drei dünnen Tischbeinen aus Holz. Ein Buffet mit schwarzer Kunststoffplatte und kurzen dünnen Füssen aus Eisen und ein Wandschrank, in den später der Fernseher hineinplatziert wurde. Natürlich dazu die passende Deckenlampe aus trompetenförmigen grünen Blechkelchen an messingfarbenen Röhren und eine ebensolche Tischlampe.

(4) Ausgang zum Wintergarten
Ausgang zum Wintergarten
Am Ende des Korridors hatten wir noch eine Bauernstube. Es war ein Durchgangsraum zum Gartensitzplatz oder zur internen Geschosstreppe. Hier roch es immer nach Tannenholz, denn die Treppe war aus natur belassenem Holz, das Treppengeländer aus einem dünnen Baumstammhandlauf und einem halbierten Stamm als Treppenwange, zwischen denen Staketen angezapft waren die oben und unten konisch verliefen. Auch die Balken der Holzdecke waren geschälte Stämme in welche Vater mit einem Brenneisen Sonne, Mond und Sterne mit dazugehörigen Sprüchen schreiben liess. Einen der Balken hatte er, wie er jeweils stolz bemerkte, selber beschriftet.

(5)
Esther vor der Aufgangstreppe
Ein Spruch, welcher er oftmals erwähnte war jedoch nicht eingeritzt: „Hab Sonne im Herzen und Zwiebeln im Bauch, dann hast du viel Freude und Luft hast du auch.“ Noch ein Spruch, welchen er als Kahlköpfiger gerne vor sich gab: „En rächte Maa mit Frau und Chind häd d`Haar of dä Bruscht und nöd of em Grind.“ Vor dem dreiteiligen Fenster und der zweiflügligen Ausgangstüre konnte je ein Holzrollladen heruntergelassen werden. Derjenige vor dem Fenster war sehr schwer und wurde deshalb von Vater bedient. Der Rollladen vor der Ausgangstüre hatte die Angewohnheit, dass er nicht mehr herunterging, sobald er mit der Gurte zu stark nach oben gerissen wurde. Man musste ihn dann mit den Fingern hinter dem Sturz hervorklauben und dann langsam herunter lassen um sich nicht die Finger zu brechen. Das Wandtäfer bestand aus astigen Tannenbrettern, deren Stösse mit profilierten Holzleisten abgedeckt waren. Sämtliche Möbel waren aus massivem lackiertem Tannenholz. Vor der Treppe war eine kleine 2-Türige Kommode mit gekreuztem Schmiedeisengitter als Füllung. Dahinter stand ein ausgestopfter Auerhahn auf einem Ast. Auf dieser Kommode war ein riesiger Radio, dessen magisches Auge für den Sendersuchlauf immer grün flackerte und ein gespenstiges Ambiente erzeugte. Esther und ich sassen davor auf dem Boden und hörten mit gekreuzigten Beinen viele Hörspielsendungen von Gottfried Keller wie „Ueli der Knecht“, „Annebäbi Joweger“ und viele andere. Auch befanden sich eine Eckbanktruhe, ein ausziehbarer Holztisch mit drei Stabellen und ein Möbel mit Klappdeckel und verschiedenen Türchen für Gläser, Rechauds und sonstiges in der Stube. An der Wand hingen Maiskolben, kleine Chiantiflaschen und in der Ecke die Mandoline, welche Vater hie und da zum Klingen brachte. Links vom Gartenausgang hing eine Schwarzwälderuhr, deren Verblieb nie klar war. Mutter behauptete, dass der Uhrmacher sie verlegt hatte, aber nicht dazu stand. Später hing die Pendeluhr von der Grossmutter aus Sulz dort. Sie vererbte mir diese einmal, weil ich so Freude an deren Schlagwerk hatte. Ansonsten war die Bauernstube, obwohl sehr heimelig, viel zu kalt, um sich darin länger aufzuhalten.
Gegenüber der Eingangstüre zur Bauernstube liegt das separate WC. Es war früher sehr schmal und hatte kaum Platz für ein kleines Lavabo, bis nach einer Gasexplosion der Raum vergrössert wurde.
Neben dem WC lag 80cm tiefer der Obstkeller, welcher über eine hölzerne Treppe begangen wurde. Vater liess den Boden als Naturboden aus Humus erstellen, damit durch die ständige Feuchtigkeit des Bodens, Früchte und Gemüse länger herhielten. Das war gut, denn wir nahmen von Grossmutters Bauernhof im Aargau oft einen 50-Kilosack Kartoffen nach Hause und Gemüse pflanzte Mutter im Garten mehr als genug. Im kalten Januar 1977 geschah nun etwas Unwahrscheinliches: Eine Explosion erschütterte in der Nacht das ganze Haus. Die alte Gasleitung im Falkenweg war durch die immer schwerer werdenden Milchtransporter, welche zur Molkerei fuhren, geborsten. Das Gas gelangte mit der Zeit unter den Vorgarten und Dreckboden in den Keller. Dort befand sich eine Kühltruhe, deren Thermostat beim Einschalten immer einen kleinen Elektrofunken sprühte, sodass dieser das im geschlossenen Keller aufgestaute Gas entzündete. Die Holzdecke über dem Keller wurde durch die Explosion zwanzig Zentimeter hochgehoben und alle Möbel des oberen Wohnzimmers wurden durcheinandergeworfen. Die Eltern hatten Glück, dass ihr Schlafzimmer auf der anderen Seite des Hauses lag und unser Erstgeborner Igor, der am Tag vorher bei den Grosseltern noch in den Ferien war und dessen Kinderbett in der oberen Stube aufgestellt war, hatten wir gottseidank einen Tag vorher nach Hause geholt.
In dieser Nacht wurde ich von Vater über das Unfassbare orientiert und gebeten vorbeizukommen und mitzuhelfen. Zwei Arbeiter der Wasserwerke Zug waren dabei die Leckstelle mit Kompressor und Schaufel zu suchen und anschliessend abzudichten. Neben dem Graben stand ein Mann in Mantel, Anzug und Krawatte und schaute zu. Da es sehr kalt war, brachte ich ihnen Kaffee mit Schnaps um sich aufzuwärmen. Ich gab dann auch dem nichtarbeitenden Zuschauer einen Kaffee, wobei es sich herausstellte, dass er der neugewählte Direktor der Wasserwerke war. Anderntags kamen Männer der Gebäudeversicherung, nahmen den Schaden auf und sagten, dass man es richtig und gut instand stellen solle. So wurde dann vor dem WC gegen den Gemüsekeller eine Nische für ein Lavabo gebaut, sodass im WC-Raum mehr Platz entstand.
Vor dem kleinen Fenster des WC waren schwarze Gitterstäbe aus Eisen angebracht. Der Abstand der Stäbe betrug etwa 20 cm. Meine Eltern waren eines abends bei den Nachbarn Rey eingeladen und ich schaute zum Baby Mario. Aus irgendeiner Beschwerde heraus hörte Mario nicht mehr auf zu schreien und weinen. Ich musste unbedingt meine Eltern erreichen. Da ich keinen Hausschlüssel hatte, kletterte ich zwischen den Gitterstäben des WC`s hindurch und holte die Eltern welche sehr erstaunt waren, dass ich mich durch diese Gitterstäbe hatte herauswinden können.
Durch die Bauernstube ging man via besagte Buchentreppe ins Obergeschoss. Auch hier oben erwartet uns eine Türe mit gelbem Glaseinsatz welcher Butzenscheiben imitierte. So gelang die Wärme des Erdgeschosses nicht ins kühlere Obergeschoss. Oben links war dann die schöne Stube, welche nur an Weihnachten oder wenn Besuch kam benutzt wurde. In der hinteren rechten Ecke war ein Cheminée, in welchem wir das Geschenkpapier an Weihnachten verbrannten. Papa sagte, dass sie sich entscheiden mussten, ob sie einen Konzertflügel aufstellen oder ein Cheminée bauen lassen sollten. Vermutlich wäre der Flügel mehr benutzt worden. Der Raum war geteilt durch eine Holzstütze, einen Holzsturz und ein niederes Büchergestell. Seitlich der Holzstütze war noch ein kleiner Schrank, dessen Türe immer abgeschlossen war. Darin wurden wichtige Dokumente aufbewahrt.
Auf der linken Seite war die Decke in Weissputz und auf der rechten Seite eine Holzkassettendecke. Der Holzsturz wurde nötig, weil der Schreiner beim Messen der Kassettendecke Länge mit Breite verwechselte und so die Decke zu kurz war und mit dem Sturz ergänzt werden musste. Auf der vorderen Seite waren Stilmöbel à la Louis XV und auf der hinteren Seite ein Rundtisch mit Stühlen. Der schöne Parkettboden war hauptsächlich mit grossen Perserteppichen belegt. Von der Stube ging es auf den Balkon mit Holzgeländer wo wir am 1. August die Lampions befestigten. Der Boden war die einzige Betonplatte im Haus, sonst waren alles Holzbalkenböden. Da es während dem Krieg (das Haus wurde 1943 gebaut) keinen Betonstahl gab, verwendete man als Armierung kurzerhand einen alten Maschendrahtzaun.
In der schönen Stube spielte Papa gerne die Geige und sang auch oft dazu. Vor allem am Sonntagmorgen brauchte er die Geige gerne um uns zu wecken. Natürlich musste er vorher noch die Balkontüre öffnen, damit auch die Nachbarn ihn hören konnten.
Der Stubenausgang ging in den Korridor bei dem die linke Türe direkt ins Treppenhaus zum Dachgeschoss mündete und rechts die Türe der Treppe zur Bauernstube hinunter. Dann kam weiter rechts hinten ein Kinderzimmer, das Bubenzimmer, indem auch Mario übernachtete. Ich erinnere mich auch an einen Ofen der hinter der Türe stand. Nicht selten, wenn Papa spät heimkam und wir noch wach lagen, weil wir ungehorsam waren, holte er uns aus dem Bett und klopfte uns mit seinem Hosengürtel den Hintern weich. Aber nachher haben wir immer gut geschlafen, denn die Busse hatten wir erwartet.
Als ich einen Detektor (Radio) von meinem Götti Hans zu Weihnachten bekam, konnte ich den Radiator als Antenne benutzen und mit einem kleinen Batterieverstärker hörte auch Mario was aus meinen Ohrhörern klang. Wichtig war das Bubenzimmer während Papas Räbevaterzeit 1961. Damals 16- jährig, musste ich spätestens um zehn Uhr ins Bett. Unten in der Bauernstube wurde allerdings getrunken und gelacht und ich verstand kein Wort. Weil aber unser Nachbar Heiri Rey Papa versprach, die ganze Inthronisation auf Tonband aufzunehmen, schaffte sich Papa noch vor der Fasnacht eines von Mediator an. Darin eingebaut war ein Verstärker und auch ein Mikrofon. Ohne dass es Vater merkte, legten wir das Mikrofon auf die Holztreppe und so konnten wir im Bubenzimmer alles mithören, was unten gesprochen wurde.

(6)
Nach unserem Zimmer kam das Elternzimmer mit einer Kommode im Gang. Dieses Zimmer hatte einen kleinen Balkon, wo Mutter die Kleider auslüftete. Zuletzt war das Zimmer im Biedermeierstil ausgestattet mit entsprechenden Stiltapeten an den Wänden. Wir hatten ja überall Fensterläden aus Holz, welche die Eltern alle drei Jahre einölen mussten. Da die Eltern die Zimmertüre nie schlossen und immer noch etwas im Bett zu besprechen hatten, krochen wir – vor allem, wenn wir etwas angestellt hatten - ganz leise zur Zimmertüre und lauschten mit. Am Anfang meiner Ausgehzeit, so etwa mit 20 Jahren, ergab sich, dass ich hie und da den Hausschlüssel vergass. Die einzige Lösung bestand darin, mit einem Steinwurf in Richtung Jalousien die Eltern zu wecken. Das ging oft sehr lange bis Papa mir die Haustüre öffnete, jedoch nicht ohne entsprechende Verwarnung.
Ganz schlimm ist die Erinnerung daran, als ich erstmals spät um 24 Uhr vom Romer Päuli heimkam. Päuli hatte ein Versicherungsagent zu Hause, mit dem wir uns sehr angeregt unterhielten und darob die Zeit vergassen. Mein Vater wartete verärgert mitten auf dem Falkenweg, die Mutter im Nachthemd in der offenen Eingangstüre und dahinter Esther, ebenfalls im Nachthemd. Papa schimpfte und wollte wissen, wo ich so lange geblieben sei, Mamma schüttelte nur den Kopf und Esther liess es sich nicht nehmen, mir einen Tritt in den Hintern zu geben, da sie sich in ihrer Nachtruhe gestört fühlte und der ganze Klamauk ihr an den Nerven zehrte.
Im hintersten Zimmer hielt sich Esther auf und spielte darin auch Klavier. Esther und ich tanzten dort auch heftig den Rock and Roll. Eigentlich hätte Esther ja Geige spielen sollen. Das gefiel ihr aber gar nicht, sodass ich mich selber daran wagte, denn alles was Esther nicht wollte war gut für mich. Papa gab mir als 6-jähriger den entsprechenden Unterricht, indem er mir Lieder wie «O sole mio», «Torna a soriento», «La bargetta a mezzo mare» vorspielte und ich ihm dann nachspielte. Esther lernte stattdessen Klavier an der Musikschule Baar. Natürlich konnte ich es nicht lassen, alle Stücke die sie übte nachzumachen. Und damit sie das auch mitbekam, spielte ich im angrenzenden Badezimmer, denn dank den Boden- und Wandplatten tönte es viel lauter als sonst. Dass Esther sich dadurch gestört fühlte, war der eigentliche Zweck meiner Übung. Doch eines Tages reichte ihr das wirklich: sie kam ins Badezimmer geprescht, riss mir die Geige aus der Hand und knallte mir diese so über den Kopf, dass die Schnecke abbrach. Natürlich gab das viel Zeter und Mordio. Papa brachte die Geige aber zum Schreiner Wettach, der die Schnecke wieder anleimte, was auch heute noch gut zu sehen ist.
Da ich schon einiges spielen konnte, meldete mich Papa an der Musikschule an. So konnte ich Ende 2. Primarschule zum Geigenlehrer Kurt Meierhans, welcher kurz vorher seinen Abschluss als Geigenlehrer machte. Er war der einzige Berufsmusiker an der Baarer Musikschule. Der Unterricht fand aber zu Hause bei seiner Mutter statt. Ich erinnere mich noch an die erste Unterrichtsstunde: Meierhans sagte, dass ich laut meinem Vater schon etwas spielen könne. So spielte ich ihm dann eines der italienischen Lieder vor, während er zwischendurch sich aus dem Zimmer schlich. Ich fand es sehr befremdlich, dass er nicht das ganze Stück mithörte. Erst später sagte er mir, als ich ihn darauf ansprach, dass er deshalb hinausging, weil er so lachen musste. Dann bei den ersten Unterrichtstunden sass er am Klavier, ich auf seinem Knie und sang alles mit was er vorspielte. Papa war nicht sehr begeistert als ich ihm sagte ich hätte nur gesungen, denn schliesslich schickte er mich zum Geige lernen.
Das Bad gegenüber dem Elternzimmer bestand aus der Badewanne, einem Lavabo mit Spiegelkasten und der Toilette. Die Wandplatten hatten das damals übliche Format 15/15cm, waren aber schwarz glasiert. Mit der Zeit schimmerten die Platten mehrfarbig wie Benzinflecken. Zwischen der Abriebdecke und den Wandplatten war noch ein Putzstreifen, welchen Papa aquarienähnlich mit Fischen, Wasserpflanzen etc. bemalte. Einmal, als Mutter klein Mario gebadet hatte und ihn ins Zimmer brachte, war die Badezimmertüre bei ihrer Rückkehr geschlossen. Sofort dachte man an einen Einbrecher, da ja unterhalb des Badezimmerfensters ein Ziegelvordach verlief und Mutter das Fenster offen gelassen hatte um den Dampf herauszulassen. Nun hatten wir in der Nachbarschaft einen Mieter, der Polizist war und mein Vater sofort herüberrief. Nach heftigem Klopfen und Rufen mit «Rauskommen, Polizei», brachen die beiden Herren mit Schulterwurf die Türe ein. Natürlich war niemand drinnen. Die ganze Aufregung war für die Katze und man einigte sich darauf, dass der Schlossriegel nur halb zurückgezogen war und das Schloss beim heftigen «Türe zuziehen» wieder zufiel.
Vom Korridor dieses 1. Obergeschosses gelang man ins Treppenhaus zur Wohnung der Grossmutter Nonna, oder wie Esther sagte: Kanona. Links hinten war ihre Küche mit Herd, Waschtrog und einem grossen Tisch in der Mitte. Auf diesem machte Nonna ihre Nudeln selber mit einem grossen Wallholz. Auf dem Herd sprudelten im heissen Wasser oftmals auch Schnecken, welche ihr Italiener gebracht hatten. Auch ergab es, dass in der Bratpfanne ein ausgeputzter Vogel brutzelte, welcher in eine Fensterscheibe geflogen war. Ich erinnere mich gar an einen Spatzen, dem sie noch aus dem Kopf etwas aussaugte. Im Gegensatz dazu ass sie Äpfel und Birnen nur geschält und Traubenbeeren drückte sie im Mund aus und warf die Hülsen fort. Wein war im Küchenkasten immer vorhanden. Wir genossen ihn als Weinwasser, d.h. sie leerte etwas Wein ins Glas, füllte es mit Wasser und rührte gehörig Zucker hinein. Ein Glas voller schwarzer Oliven war auch immer vorhanden, welche uns aber gar nicht schmeckten. Mit Zichorie, ein Kaffeeersatz aus einer Wurzel, streckte sie den Bohnenkaffe, welcher damals sehr teuer war.
Neben der Küche war ein Schlafzimmer mit Kasten und Doppelbett. Dieses vermietete sie zuerst an Italienerinnen, später an Italiener. Am Silvester bastelte Nonna aus alten Strümpfen, Stoffresten und Papier zwei Puppen, welche sie abends den Italienerinnen ins Bett legte. Der Angstschrei der Bewohnerinnen hörten wir jeweils bis im Parterre. Da aber ihre Mieterinnen wochenlang weinen und klagen konnten, wenn sie ihr Freund verlassen hatte, verzichtete die Grossmutter auf Mieterinnen und vermietete nur noch an Männer. Später, nach dem Ableben von Nonna, zügelte ich in dieses Zimmer und hatte einen wunderbaren Ausblick auf den vor dem Fenster stehenden japanischen Kirschbaum mit seinen wunderschönen rosafarbigen Blüten. Hier oben bemerkte man jedoch auch, wenn ein Zug vorbeidonnerte. Es vibrierte und die Vorhangkordeln zitterten. Im Raum war auch das Expansionsgefäss, welches stark blubberte, wenn das Heizwasser kochte.
Dem Korridor entlang, gelangte man rechts zuerst ins Bad. Darin war eine Toilette und ein Waschtrog sowie ein Holzständer für Waschutensilien. Gegenüber diesem Bad ging es in den für alle benutzbaren Estrich oder Dachboden. Dachisolation gab es noch keine. Man sah Holzschindeln und Ziegel und ein kleines Klappfenster in der Mitte. Bei geöffnetem Klappfenster konnte man den ganzen Kreuzplatz überschauen oder die Tanne beim Nachbar Furrer bestaunen, wie sie sich während dem Sturm bog.
Es gab einen Bretterboden und unverputzte Backsteinwände. In einer rechten Nische war eine Truhe mit verschiedenen Sachen von Nonno Maurizio. Er war ja Schreiner und deshalb befanden sich Hobel, Stechzirkel und andere Schreinerutensilien darin. Doch auch handgeschriebene Musiknoten lagen auf dem Truhenboden. Papa sagte, dass sein Vater komponiert hätte. Ich habe aber später herausgefunden, dass er Musiknoten für die Feldmusik, wo er 2. Posaune spielte, umschreiben musste, damit er sie mit seinem Instrument spielen konnte. Wäscheleinen zogen sich durch den ganzen Estrich und später wurde auch eine TV- Stabantenne durch das Dach montiert. An den Wäscheleinen hingen an Epiphania (6. Januar, alter italienischer Brauch) jeweils zwei alte Strümpfe, welche Nonna mit Kohle, Mandarinen und Nüssen füllte. Zuoberst war immer Kohle. Ein Symbol für ungehorsame Kinder. Entsprechend laut war ihr Kichern, wenn wir jeweils die Strümpfe öffneten. Der Estrich war natürlich auch ein willkommener Spielplatz für uns Kinder. So hatten wir einen Hochgestell aus Holz, in welchem wir als Babys unseren Brei löffeln konnten. Dieser Stuhl konnte man auseinanderklappen und als niederen Kindersitz mit Holzrädern benutzen. Damit stiessen wir uns gerne im Estrich herum.

(7)
Am Kopf des Korridors ging es dann in Nonnas Stube. Das dunkelbraune Buffet aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts hatte Nonno Mauricio selbst geschreinert. An einer Wand war noch der Divan, daneben ihre eiserne Strickmaschine eine « Dubied » und in der Mitte ein grosser Auszugtisch mit acht Stühlen. An diesem Tisch wurden die italienischen Kostgänger bewirtet. Es waren ja Saisoniers ohne Familie. Sie arbeiteten auf dem Bau wo sie auch das Mittagessen einnahmen und wohnten in irgendeinem Zimmer. Im Buffet lagen mehrere Schuhschachteln mit männlichen Vornamen. Die Italiener legten jedes Mal von ihrem Lohn etwas in ihre Schachtel, welche sie dann vor Weihnachten zusammenbanden und Heim brachten. Davon lebte dann zu Hause seine Familie. Natürlich wachte Nonna darüber und schloss den Kasten immer zu.
Wir Kinder waren an den Abenden gerne bei den Italienern. Einerseits liebten sie Kinder und verwöhnten uns auch mit Schokolade oder Bananen. Als Esther und ihre Cousine Irma Hug in die Pubertät kamen, schwärmten sie natürlich auch von einem dieser Italiener. So für den Zammei, den Fiorello und andere. Entsprechend wurden die beiden Mädchen von uns auch gerne gehänselt.
(8) Irma Hug, Nonna, Zeffirino, Esther
Irma Hug, Nonna, Zeffirino, Esther
Einer dieser Italiener fragte am Sonntag meine Mutter oft, ob er mit mir spazieren gehen könne. Dann lief er mit mir ins Restaurant Falken, wo er mir Sirup und Süssigkeiten spendierte. Der eigentliche Grund war allerdings, dass er für eine Serviertochter des Falkens schwärmte und mich nur als Alibi missbrauchte. Mir war es recht. An den Samstagabenden machten die Italiener gerne Pfänderspiele. Wer verlor musste irgendetwas machen oder geben. So schrie einer spät abends noch «Kickerikii» aus dem Fenster oder gab meiner Grossmutter einen heftigen Schmatz.

(9)
Mit der erwähnten Strickmaschine erstelle Nonna hauptsächlich Unterwäsche aus Garn der Spinnerei Baar. Sie arbeitete ja jahrelang in der Spinnerei und brachte so ihre Familie durch, denn ihr Mann war mit 42 Jahren bereits an Lungenentzündung gestorben. Penicillin gab es noch nicht.
Als Dank für ihre langjährige Treue in der Spinnerei erhielt sie vom Direktor persönlich eine goldene Uhr, die sie immer in der Schublade aufbewahrte.
Sie zog sie nie an, zeigte sie aber gerne stolz allen Interessierten. An die Unterhosen und Leibchen erinnern sich meine Klassenkammeraden heute noch. Vermutlich, weil sie gescheuert haben und manch einer wund davon wurde. Der Unterschied zwischen Knaben- und Mädchenunterhosen war einfach: Knaben mit, Mädchen ohne Loch. Die Strickmaschine wurde mit einem Hebel von Hand angetrieben und machte ein entsprechend grosser Lärm. Kaum schaute ein Stück der Unterwäsche unter dem Strickwagen hervor, hängte sie schwere Gewichte an, welche das Strickgut herunterzogen.
Nonna war nicht gebildet, denn sie kam schon nach der zweiten Klasse aus der Schule, weil ihr Vater keine Schulbücher mehr bezahlen wollte. Das färbte sich auch auf ihre Geschichten ab: So fragte sie uns oft folgendes:
„Schöni Maiteli mit er schöni Huet, verselle oder nid verselle?“ Wenn wir dann sagten „also verzell emal!“ sagte sie:“Du darfe der nid saage verselle, du mues er de saage : Schöni Maiteli mit er schöni Huet, verselle oder nid verselle? Und wenn wir dann meinten: „denn verzellsch es halt nöd“ sagte sie: Du darfe der nid saage nid verselle, du muesch er de saage:Schöni Maiteli mit er schöni Huet, verselle oder nid verselle? Natürlich gab das uns mit der Zeit auf die Nerven, doch sie lachte über uns bis sie kaum mehr Luft kriegte. Dafür briet sie uns aber auf dem Stubenofen einen Apfel und streute gehörig Zucker darauf.
Dann war da noch ihre geistreiche Geschichte von Toni, der abends total besoffen heim kam und das WC nicht fand und deshalb in die Stiefel und den Hut seines Chefbauern schiss, bei dem dann am Morgen „patschige patschäge“ der ganze Dreck das Bein rauf und „patschige patschäge“ den Kopf hinunter lief.
Wenn sie etwas nicht verstand, sagte sie: warumperchesignorafrau? 
(10) Und da ihr Sohn Zeffirino als Bube die Trommel spielen konnte und oftmals neben dem Fahnenträger die Feldmusik oder den Turnverein vom Eidgenössischen auf dem Bahnhof abholte, sagte sie, dass die Trommeln folgendes spielten: I bravi soldati da Svizzera, i maie (Dialekt für mangare) Polenta, Patate, Caffè (Die braven Schweizer Soldaten, sie essen Polenta, Kartoffeln, Kaffee).
Nicht vergessen darf ich Grossmutters grosse Sucht: der Schnupftabak. Den bewahrte sie in einer 500 Gramm Dose im Stubenschrank auf. Die Tabakkörner waren brandschwarz mit mindestens 1 Millimeter Durchmesser.
Kaum hatte sie geschnupft und die Restkörner mit dem Taschentuch von der Nase und Oberlippe weggewischt, kam das dreimalige heftige Niessen. Das übergrosse Taschentuch war meistens schwarz vom Schnupf.
Einst fragte mich ein Mitschüler, ob wir in unserem Haus eine Kirche hätten. Erstaunt über dessen Frage kam mir in den Sinn, dass Nonna jeden Abend Punkt neun Uhr «Radio Roma» auf volle Lautstärke schaltete und die Gebete ebenso laut mitsprach. In der Hand hielt sie den Rosenkranz und das Gebetbuch, obwohl sie kaum lesen konnte. Das wusste ich, weil ich ihr vom Zürcher Bahnhofkiosk einmal die Zeitung «corriere della sera» brachte, in der sie viel blätterte und die Bilder bestaunte, aber kaum lies. Obwohl sie wenig schreiben konnte, musste sie für den Milchlieferant das Milchgefäss vor die Haustüre stellen und auf einem Zettel schreiben, was sie noch benötigte wie Butter, Käse etc. Ich konnte den Zettel nicht entziffern, jedoch der Milchmann wusste inzwischen genau was sie wollte.
Nonna`s Stube habe ich später im alten Stil weiterausgebaut. Ich erzählte überall herum, dass ich gerne einen Sekretär (Schreibkasten) hätte. In kürzester Zeit bekam ich drei Angebote und liess mir den schönsten Kasten schenken. Natürlich bekam ich auch eine Petroldeckenlampe, die allerdings recht unangenehm roch, wenn sie brannte und eine ebensolche Tischlampe.
Vor dem Haus war ein grosser Garten mit herrlicher Spielwiese und vielen Gemüsebeeten, welche Mutter als ehemalige Bauerntochter sehr gerne pflegte. Vor allem Salate, Rüben und Tomaten wurden angebaut. Auch an Bohnen, die an langen Stöcken hinaufkletterten erinnere ich mich und solche, die auf dem Boden blieben. Wir hatten aber auch immer Mäuse im Garten, sodass viele Rüben angeknabbert waren.
Da aller Salat natürlich gleichzeitig spross, verschenke Mutter viel der Nachbarschaft. Auf der linken Seite des Gartens waren drei Zwetschgenbäume. Rechts im Garten ein Boskop-Apfelbaum und in der Mitte ein Zitronen-Apfelbäumchen, dessen Früchte höchstens 5 cm gross wurden. Ein weiterer Apfelbaum spross an der Fassade der Garagenseite. Es war ein Ontario. In den ersten drei Jahren hatte er keinen Ertrag. Dann aber bekam er riesige rote Äpfel, welche allerdings mit den Jahren immer kleiner wurden. Einer wog ein halbes Kilo, war aber im Geschmack dumpf und sehr mehlig. Links hinten war, mit einem Holztürchen versehen, der Ausgang auf den Floraweg. Genau neben diesem Ausgang hatte Mutter Zucchetti gepflanzt. An einem Samstag, als die die Eltern weg und ich allein zu Hause war, sah ich, dass zwei Frauen mit Einkaufstaschen das ganze Zucchettibeet leerten. Ich wusste, dass Mutter vielen Leuten sagte, dass sie einfach holen könnten, wenn sie etwas benötigen. Doch scheinbar waren das zwei Italienerinnen, welche dies von der Strasse aus schon lange beobachtet hatten und sich einfach bedienten. Wen wunderts, dass schnell ein Schloss für das Gartentürchen organisiert wurde. Am Drahtzaun vom Nachbar Furrer entlang wuchsen Himbeer- und Brombeersträucher. Auch Stachel- und Heidelbeeren gab es. Die Heidelbeeren waren mühsam zum pflücken und die Stachelbeeren konnte man nur essen, wenn sie wirklich genug reif waren. Selbst ein Quittenbaum war im hinteren rechten Teil des Gartens. Sowohl aus den Himbeeren und Brombeeren als auch den Quitten machte Mutter Konfitüre. Der Quittengelée war meine Lieblingskonfitüre. Mutter kehrte jeweils ein Taburett (Küchenstuhl) um, befestigte an den vier Stuhlbeinen die Zipfel einer Kinderwindel, lehrte das Quittenkrüsi hinein und presste es aus, sodass unten der Saft herauslief, der zu Gelée verdickte. Je älter Mutter wurde, und umso weniger Kraft sie hatte um den Gemüsegarten zu unterhalten, desto grösser wurde der Wiesenanteil. Anstelle der vielen Beeren wurden Magnolien- und Philodendronsträucher gepflanzt und eines Tages entdeckte ich einen Baum mit Tulpen drauf, was sehr lustig und ungewohnt aussah. Er nannte sich tatsächlich Tulpenbaum. Ihre Rosen vor dem Haus, welche sie liebevoll gegen Blattläuse bestäubte und worin meistens der Ball flog, wenn wir Fussball spielten, waren schon ziemlich alt. Auch einen Bananenbaum hatte sie gepflanzt der jedoch, gleich wie der Feigenbaum, keine Früchte trug.
Hinter dem Haus waren ja noch die beiden Garagen mit Giebeldach. Unter dem Dach war ein kleiner Stauraum für Autoreifen und Gerümpel. Dort oben hatten wir auch eine Hütte gebaut, in der wir uns mit anderen Kollegen der Primarschule gerne aufhielten. Eine Leiter führte nach oben und wir hatten gar einen alten Holzofen hinaufgeschleppt. Der hätte auch fast die Garage in Brand gesetzt, denn es roch offensichtlich einmal aus dem Dach, was ein Vater eines Schulkollegen rechtzeitig bemerkte und den bereits angesengten Boden löschte.
Dort oben machten wir auch Musik. Vom Spuhlengretener, welcher seine Fabrikation nach dem Restaurant Freihof in Richtung Zug hatte, bekamen wir Plastikrohre, welche auf einer Seite einen mit einem Loch versehenen Deckel hatte. Auf der anderen Seite spannten wir mit Gummibändern Seidenpapier darüber. So konnten wir vorne hereinsummen und hinten kam ein schnatternder Ton heraus. Wir sagten dem "Musik machen" indem wir verschiedene Lieder hineinsummten.
Hinter der Garage, beim Ausgang der Bauernstube, wurde später einmal ein eingeschossiger Wintergarten aus Holz mit Flachdach angebaut. Grosse Schiebefenster gegen den Garten hin, ein grosser Tisch mit Stühlen in der Mitte und ein grosses Cheminée waren die Ausstattung dieses Wintergartens. In diesem Cheminée wollte Mutter einmal einen dörren Ast verbrennen und steckte ihn ins Kamin. Ein explosionsartiges Feuer entstand und sie verbrannte sich den ganzen rechten Arm welcher zu wüsten Narben führte.
Obwohl wir es selber nicht merkten, war doch viel Italianita im Haus. Alle sprachen relativ laut und es war immer irgendetwas los. Erzogen wurden wir ganz klar von der Mutter. Vater spasste lieber mit uns oder aber strafte, wenn Mutter sich über unser Benehmen beklagte. Dass das nicht sehr pädagogisch geschah merkte ich, wenn er mich am Abend fragte, ob ich mit ihm kommen wolle, er müsse noch nach Zürich. Dann fuhr er mit mir zum Kinderheim in Walterswil, stellte kurz vor der Schule das Auto ab und erklärte mir, wenn ich mich nicht endlich bessere, könne ich gerade hierbleiben und der Koffer sei bereits im Kofferraum. Schon in der ersten Klasse wollten sie ein Bisschen Ruhe vor mir und Vater fuhr mit mir mit der Bahn auf die Rigi. In der Station Romiti stiegen wir aus und gingen in ein Kinderheim, welches von weissgekleideten Schwestern geführt wurde. Der Koffer war bereits dort und als ich begann mit den Kindern zu spielen, schlich Vater durch die Hintertür ab. Nach einiger Zeit, bemerkte ich dies, sprang zur Rigibahn und dieser hinterher. Ebenso hinter mir her die ganze Kinderbande und nur ein Strauch konnte meine Flucht bremsen. Für das tägliche Wasser holten wir Schnee, welches in einer Badewanne durch eine Filtermaschine gelassen wurde. Grausig erinnere ich mich an einen Bettnässer, dem die Schwestern beim Morgenessen die Unterhosen über den Kopf zogen. Natürlich liess ich mir die ganze Entführung nicht gefallen und benahm mich so unflätig, dass Papa mich bereits nach einer Woche wieder holen musste.


(1)
Hier wurden Zeffirino und Edwige geboren. Als Edwige bei der Familie Utiger (Kartonfabrik Sagenbrücke) in deren Lebensmittelladen mitarbeiten konnte, zügelte die ganze Familie in ein altes Haus bei der Kartonfabrik.
Da Maurizio bereits mit 44 Jahren an Lungenentzündung starb, Zeffirino erst 16 und Edwige erst 14 Jahre alt war, musste seine Frau Irma weiterhin in der Spinnerei arbeiten. Zu ihrem 25-jährigen Arbeitsjubiläum erhielt sie vom Direktor persönlich eine goldene Uhr, welche sie nie trug und immer in der Buffetschublade lag. Er gab ihr sogar die Hand, worauf sie sehr stolz war.


(1)
Um ein Bisschen Ruhe von den Kindern zu haben, gab es ja noch Ferienlager. In eines für zwei Wochen mit über 100 Kindern in Schlans (GR)erinnere ich mich. Da kam einmal eine ganze Bubenbande auf mich los und ich konnte mich nur retten, indem ich dem nächstbesten in den Finger biss. Es wurde verlangt, dass die Unterwäsche mit meinem Namen bezeichnet sein musste. Da ich am 9. 9. 1945 (4 5 = 9) geboren war, kaufte Mutter ein Stoffband mit lauter Neunen drauf, schnitt sie in Stücke von drei Neunen und nähte diese auf die Unterwäsche als Kennzeichen. Meine Eltern kamen auch einmal auf Besuch und brachten Bohnen und Cremeschnitten mit. Das Lager in Schlans war so gross, weil sie das Pfadilager, das Bubenlager und das Ministrantenlager zusammennahmen.

(2)
Ich war ja Ministrant, der Stolz jedes Jungen, denn Mädchen durften damals nicht ministrieren. Ein Pfarrhelfer instruierte uns und wir mussten lateinische Gebete auswendig lernen. Am Schluss gab es eine Prüfung in der wir die Gebete aufschreiben mussten. Die Aufnahmefeier fand in der St. Anna – Kapelle statt und ich erinnere mich noch, dass Papa alle mit seinem Gesang übertönte. Selbst in der St. Martins-Kirche, wenn der Raum voller Gläubigen war, hörte ich beim Messdienen, ob Vater in der Kirche war oder nicht obwohl er weit hinten sass. Wir Ministranten waren wochenweise eingeteilt und mussten am Sonntag bereits zur Frühmesse um 0600 Uhr antraben. Oft fehlte einer in dieser Messe und der Sigrist übernahm das Messdienen. Das gab es bei mir nicht, dafür sorgte meine Mutter schon. Das Ministrantengewand bestand aus einem roten Rock, einer weissen Bluse und einem roten Kragen. Die Bluse hatte als unteren Abschluss ein gehäkeltes Band mit grossen Löchern. Wenn wir in der Sakristei warten mussten, bohrten wir mit dem Finger gedankenverloren in diesen Löchern. Das mochte unser Pfarrer Fridolin Roos aber gar nicht. Ohne Vorwarnung und mit hochrotem Kopf haute er uns eine Ohrfeige oder mussten nach mehrmaligem Vorkommen am Samstag die Kirche wischen. Wir rächten uns damit, dass wir den Besen in die mittlere Türe des Beichtstuhles stellten, als erste am Nachmittag beichten gingen und uns riesig freuten, wenn dem Pfarrer der Besen entgegenkam als er seine Beichtstuhltüre öffnete.
Der alte Sigrist Hotz schnarchte immer währen der Predigt in seiner kleine Seitenbank Nähe des Altars. Einmal stritten wir uns in der Sakristei und er wollte wissen, um was es diesmal wieder gehe. Einer hatte behauptet, dass auf dem Altar immer eine Kerze brennen müsse. «Dummes Zeug» sagte er, nahm den Kerzenlöscher vom Haken und schlenderte zum Hauptaltar. Da er aber Kurzsichtig war, merkte er erst kurz vorher, dass keine Kerze brannte. In der Zwischenzeit hatten wir ein paar ungesegnete Hostien aus der Büchse gestohlen und geschaut, dass ja keine Krumen auf dem Boden lagen.
Das Hoch- oder Pontifikalamt war das Grösste für uns, denn nebst dem etwas älteren Zeremoniar und den beiden Ministranten waren noch etwa zwölf Ministranten als Kerzenträger dabei. Dieses Amt gab es nur an hohen Feiertagen wie Pfingsten oder Weihnachten. Der Zeremoniar, studierte vorgängig die ganze Zeremonie ein, wozu wir längere Zeit üben mussten. Ein Zeremoniar war ein kleiner Diktator, den niemand mochte. Auch dem hatten wir einmal eine Lektion erteilt: Vor der Wandlung trat er mit dem Rauchfass, begleitet von zwei Ministranten, vor den Altar und schwenkte den Rauch zweimal links, zweimal rechts und zweimal in der Mitte in Richtung gläubige. Im Rauchfass hatte es eine glühende Kohlentablette und Weihrauchharz, welcher den Rauch ergab. Auf Befehl des Zeremoniars, wurde auf einem kleinen Elektrogrill die Kohletablette zur Glut gebracht. Wir brannten aber die Tablette nur kurz auf beiden Seiten an, sodass der Rauch, als der Zeremoniar das Fass gegen die Leute schwenkte, nach kurzer Zeit ausging. Er hatte es gemerkt und uns fortan anständiger behandelt.
Im Kirchenschiff gab es auch eine Loggia, welche über die Treppe von der Sakristei aus begangen wurde. Man sagte dieser Loggia «Buebechörli» denn ausgewählte Buben sangen in der Primarschule mit Lehrer Knobel dort oben. Er hatte das Buebechörli als Knabenchor für bestimmte Messen gegründet. Selber war Knobel auch der Leiter vom Kirchenchor und unser Primarschullehrer. Was niemand wusste: dort oben hatte es ein Harmonium.

(3)
Der Lehrer Waldis, welcher das Orgelspiel nie richtig gelernt hatte und deshalb während der Messe an der Kirchenorgel oft den falschen Ton traf, brachte uns auf eine Idee: Da niemand wusste, dass im Buebechörli ein Harmonium war, drückten wir zwischen Waldis Orgelspiel irgendeine Taste und beobachteten , wie die ganze Kirchgemeinde grinsend sich umdrehte in Richtung Orgel und dachte, der Waldis hätte wieder einmal einen schlechten Tag erwischt.
Als Sohn aus einer Italienerfamilie wurde ich oft zur Italienermesse in die St. Anna-Kapelle geschickt. Das, obwohl ich kein Italienisch verstand, aber dank der Nonna viele Italienerinnen und Italiener kannte. Mir war das soweit egal, denn die Predigt des italienischen Pfarrers war sehr kurz und entsprechend auch die ganze Messe. Beim Opfer einziehen musste ich mir allerdings gefallen lassen, dass mir die alten Frauen den Po oder gar die Wange tätschelten mit nicht überhörerbarem «Brava».
Das Opfereinziehen in der grossen Kirche war sogar rentabel. Oft stritten wir uns in der Sakristei, wer auf der Männerseite einziehen durfte. Der Sigrist Hotz wusste aber genau, wer am letzten Sonntag wo das Opfer einzog. Auf der Männerseite ging das Einziehen schneller als auf der Frauenseite, sodass derjenige dann auch auf der Empore neben der Orgel einziehen durfte. Auf der Empore sassen aber zu Hinterst die Bauern, welche oft per Handschlag noch eine Kuh verkauften. Man musste auf dem Kniebrett bei jedem persönlich vorbeilaufen und die Geldbüchse hinstrecken. Dafür gab es dann 20 Rappen in die Büchse und 50 Rappen in die Hand.
Mit neuzehn Jahren ging ich dann mit meinem Vater und der Geige auf die Empore zum Kirchenchor, wo wir in Orchestermessen mitspielten. Die erste Messe in der ich mitgeigte war die Mitternachtsmesse, welche punkt vierundzwanzig Uhr begann. Es hatte etwa zwanzig Zentimeter Schnell als wir vom Falkenweg zur Kirche stapften. Da die Kirche in Mitternachtsmesse immer voll war und auch Reformierte gerne kamen, war es klar, dass die Predigt viel länger dauerte als sonst.
Es war üblich, dass während der Weihnachts-Predigt das Orchester vom Kontrabassisten Kobi Schäfer in sein nahe gelegene Restaurant Freihof zum Umtrunk eingeladen wurde. Nur, ausgerechnet an dieser Weihnachtsfeier predigte ein Gastprediger viel zu kurz. Pfarrer Roos und der Kirchenchor wollten weitermachen, doch weit und breit kein Orchester. Als wir dann endlich die hölzerne Wendeltreppe hinaufdonnerten liess es der Pfarrer nicht nehmen zu bemerken, dass nun, da das Orchester auch endlich eingetroffen sei, die Messe weiter gefeiert werden konnte. Für uns war das mitspielen im Kirchenorchester eine willkommene Abwechslung und wir machten jedes Jahr mit dem Kirchenchor einen Ausflug, wo wir in einer Kirche auftraten und von den Kirchgemeinden echt verwöhnt wurden.
Meine Frau Rita und ich spielten viele Jahre an den kirchlichen Feiertagen im Kirchenorchester. Da Rita auch in der Kirche Guthirt in Zug mitspielte, machte eine Zeitlang auch ich dort mit. Wir hörten aber auf, als der neue Dirigent begann die Musiker zu entschädigen, denn wir genossen es, lieber mit dem Kirchenchor einen genussvollen Abend zu verbringen oder eine Reise zu machen.

(4)
OBERHOFEN BEI THUN
In einem zweiten Lager waren wir nur fünfzehn Buben. Organisiert hatte es Lehrer Alig – genannt Papa Moll – in Oberhofen bei Thun. Wir waren in der Jugendherberge einquartiert. Nach dem Mittagessen hatten wir befohlene Bettruhe, damit Papa Moll im Restaurant sein Bierchen trinken konnte.
Bereits am zweiten Abend pfiff uns in der Nacht irgendetwas um die Ohren. Da wir natürlich alle mit Taschenlampen ausgerüstet waren, war die Ursache schnell gefunden: Ein Junge zog dauern Gummibänder aus der Matratze und schoss sie umher. Scheinbar hatte er über den Mittag mit seiner Gürtelschnalle zufälligerweise die Matratze aufgeschlitzt und da kamen Gummistreifen heraus, welche aus alten Pneus geschnitten waren. Man kann sich vorstellen, dass in dieser Nacht alle Matratzen mit dem Taschenmesser aufgeschlitzt wurden und eine wüste Schlacht stattfand. Die Jugendherberge hatte noch nie so teure Matratzen bekommen, welche unsere Eltern berappen mussten.
In einer Bäckerei in Oberhofen konnte man Glace kaufen. Die Bäckersfrau füllte uns Erdbeer- und Vanilleglace in Waffeltüren ab. Später bemerkte plötzlich einer, dass sich kleine schwarze Punkte auf der Tüte bewegten. Es waren tatsächlich kleine Maden. Kurz abgesprochen gingen wir in die Bäckerei zurück, fluchten über diese Schweinerei, schmissen die Glaces im Bäckerladen auf den Boden und entfernten uns fluchtartig.
Es war ein tolles Lager. Leider aber grassierte auch die Grippe, sodass über die Hälfte der Knaben nach einer Woche nach Hause geschickt wurden. Meine Eltern waren aber gerade auf einer Mittelmeerrundfahrt, sodass Grossmutter aus Sulz nach Baar kam, wo sie mich vom Elektriker Jung, welcher ebenfalls einen Sohn im Lager hatte, in Empfang nahm. Meine Eltern waren echt erstaunt, als sie von der Schifffahrt zurückkamen.

(5)
v.l.n.r.: Tante Frieda St. Ursanne; Tante Berty Fischbach; Mutter Lisbeth; Götti Hans Sulz; Tante Marie Serneus; Tante Margrit Schattdorf; Tante Josy Bremgarten.
Als wir noch jünger waren, war es üblich, dass man zu Tanten und Onkeln in die Ferien ging. Dass mein Götti Hans auch der Bauer und Erbe des Hofes in Sulz war, stellte sich als Glücksfall für mich heraus. Es war immer Beschäftigung vorhanden. Entweder half man mit dem Rechen beim Grasen oder Heuen, half den Stall ausmisten oder hatte sonst etwas zu tun. Beim Heimtransport des Grases sass ich meistens zuoberst auf dem Grashaufen. Einmal allerdings nahm Götti Hans die Kurve zum Hof so schnell, sodass der ganze Grashaufen vom Wagen kippte und ich natürlich davongeschleudert wurde. Gute erinnere ich mich, als Götti Hans zwei Löcher in Stoffsäcke schnitt durch welche man herausschauen konnte. Damit gingen wir aufs Feld, wo er einen alten Baum, der voller Hornissen war, sprengte. Der Sack schützte uns vor dem plötzlich aufgescheuchten Hornissenschwarm.
Als ich einmal nach Sulz kam, zeigte mir Götti Hans ein hübsches braunes Fohlen, welches er auf meine Namen «René» getauft hatte. Ich war riesig stolz darauf. Die Schellen, welches er dem Pferd um den Hals hängte, schenkte er mir einmal und ich habe es immer noch in meinem Besitz.
(6)
Oft verwendete man den Miststock zwischendurch als Trampolin oder sprang in den Silo auf das Futter hinunter und kletterte via Leiter wieder hinauf. Da auch die Kinder von Hans und Tante Margrit anwesend waren, machten wir viel «Verseckis» oder «Fangis». Es geschah einmal, dass ich durch die Küchentür die Treppe hinunterrannte und dort Kopf voran direkt in ein Scharreisen fiel. Auf dem Kopf blutete eine grosse Schramme, welche eigentlich hätte sofort genäht werden sollen. Doch Grossmutter ging mit mir zur Nachbarin, welche auf die Wunde Blätter vom Kirschbaum und darum einen grossen Verband legte. Es muss erbärmlich ausgesehen haben, denn die eher geizige Besitzerin des Dorfladens gab mir viele Zuckerstücke.

(7) GROSSMUTTER VERENA KOHLER-VOGEL
Grossmutter war auf dem Hof für die Hühner und Schweine zuständig. Sie wusste genau, wohin welches Huhn sein Ei legte. Das konnte auch zu hinterst auf dem Heuhaufen in der Scheune sein oder auf dem Miststock. Zu den Schweinen schleppte sie jeden Tag mehrere Kessel mit Kartoffeln und Wasser. Sie hatte für ihre Postur recht viel Kraft. Wenn der Metzger kam, welcher noch Hauslieferungen machte, durfte ich immer wünschen, welche Würste ich gerne hätte. Es waren eigentlich immer Landjäger oder der Cervelat. Der Metzger kam ja auch auf den Hof um Tiere zu schlachten. An die Blut- und Leberwürste mit vielem Schnittlauch und Zwiebeln in den grossen Därmen erinnere ich mit Grauen.

(8) Grossmutter Kohler mit 3 ihren Kindern
Wenn Götti Hans die Kühe gemolken hatte, fuhr Grossmutter die Kanne voller Milch mit einem Handwagen zur Molkerei. Erstaunlicherweise musste sie jedes Mal auch Käse zurücknehmen. Es war immer Emmentaler, der noch so frisch war, dass es Salzwasser in den Löchern hatte. Ich liebte ihn. Oft ging ich am Morgen zum Götti in den Stall, wo er mir meine Tasse direkt ab Kuheuter füllte.
Kam Besuch, so musste Grossmutter mit dem Besen zuerst die Hühner in der Küche unter der Bank hinausscheuen. Wenn ich von den Ferien abgeholt wurde, badete mich Grossmutter mitten in dieser Küche in einem Blechzuber voll warmem Seifenwasser. Das hinderte allerdings meine Mutter nicht, mich zu Hause nochmals zu baden. Scheinbar brauchte es mehr, um den Stallgeruch zu entfernen.
Gekocht hatte Grossmutter natürlich mit Kupferpfannen auf dem Feuerherd. Auch Käsewähen mit Brotteig wurden im Ofen gebacken. Der Holzherd befeuerte auch den Kachelofen in der Stube, welches lange Zeit die einzige Heizung im Haus war. In der Küche war auch eine Bodenklappe von 1 x 1m aus Holzbrettern mit Gegengewicht. Von dort stieg man über ausgetretene Holzstufen in den tunnelförmig gemauerten Keller hinunter. Darin gab es Holzgestelle für Früchte und Gemüse und zwei grosse Fässer für den sauren Most. Dieser war fast so stark wie Wein und wurde zum Znüni, zum Mittagessen und zur Vesper um vier Uhr getrunken. Das ergab pro Tag ohne weiteres zwei bis drei Liter Most.
(9)
Kein Wunder war der Grossvater immer etwas besäuselt. Wenn wir am Sonntag auf Besuch kamen, sass Grossvater meistens in der Stube auf der Ofenbank, trank Most und ass Cervelat und Brot. Meine Mutter erzähle, wie Ihre Mutter Verena auf den Hof kam: Die Frau ihres Grossvaters war relativ jung gestorben und es musste dringend wieder eine Frau auf den Hof. Sie stellten also eine Haushälterin ein. Doch leider war diese sehr faul, sodass Mutters Grossvater sie wegschickte. So kam dann Verena Vogel als Hausmädchen, welche sehr tüchtig war und deshalb der Grossvater zu Mutters Vater, welcher der älteste Sohn war, sagte, er solle die Verena heiraten. So wurde aus ihr die Bäuerin Verena Kohler-Vogel, hatte einen Jungbauern und Hoferben geheiratet, was damals hiess, dass sie gut geheiratet hat. Und so hatten sie sieben Kinder und lebten doch irgendwie zufrieden bis ans Lebensende. Die Familie Kohler nannte man «s`Chlause», obwohl Grossvater und Götti «Hans» hiessen. «S`Hanse» nannte man die Nachbars-Familie gleich unterhalb ihres Hauses. Mein Vater Zeffirino sprach deshalb spasseshalber oft vom «Chlause-Lisi» und meinte damit seine Frau, also meine Mutter Elisabeth.
Nebst einem üblichen Buffet und einem Holztisch mit sechs Stühlen in der Mitte der Stube, gab es noch ein Canapé. Mein Vater benutze es immer nach dem Mittagessen, denn er war es sich gewohnt ein Mittagsschläfchen zu machen.
Die Wände waren aus gestrichenem und maseriertem Holz. Eine Pendeluhr aus Holz prägte sich bei mir ein. Die langanhaltende Schwingung der Metallfeder zur vollen Stunde dröhnte durch das ganze Haus. Grossmutter schenkte sie mir einmal, weil ich so grosse Freude an ihr hatte und ich hängte sie zu Hause in die Bauernstube.
(10)
Durch die Stube gelangt man in das Stübli. Es war das Schlafzimmer der Grosseltern und für uns natürlich tabu. Über eine Holztreppe gelang man am Plumpsklo vorbei in den ersten Stock, wo eine Stube und anschliessend das Schlafzimmer von Götti Hans und Tante Margrith waren. An der Stubenwand hing ein schwarzer Pferdeschwanz und auf dem Tisch stand ein in einen Pferdehuf eingelassener Aschenbecher. Ein Foto an der Wand klärte uns darüber auf, wessen Pferdeteile dies waren.

(11)
Das Foto zeigte Götti Hans in Militäruniform auf seinem brandschwarzen «Choli», wie er ihn nannte. Durch die vielen Diensttage die sie zusammen verbrachten hatten sie eine freundschaftliche Beziehung, der Hans noch lange nachtrauerte als das Pferd gestorben war.
Im Gastzimmer auf dem gleichen Stockwerk waren ein Doppelbett und ein Tisch, unter dem zwei Korbflaschen voller Schnaps standen. Da der Verschluss dieser Flaschen aus papierumwickeltem Korken bestand, roch es im Zimmer immer nach Schnaps. Vermutlich war es mit ein Grund, dass ich in diesem Zimmer immer so gut schlief.
Und noch ein Stock weiter oben, im Dachstock, schief ursprünglich der Bruder vom Grossvater – Robert – der just ein Tag nach dem Fest zu seinem 80 Geburtstag gestorben war, weil er angeblich zu viel gegessen und getrunken hatte. Dann wurde dort das Zimmer für den Knecht eingerichtet. Darin schlief Blitz, ein junger Bursche der so genannt wurde, weil er nicht der Schnellste war. Die Grosstante aus Oberrickenbach, welche als Klosterschwester dort Schulunterricht gab, hatte ihn vermittelt. Vor seinem Fenster hing am Giebelbalken eine Kuhglocke, welche Götti Hans mit einem langen Stecken anschlug, wenn der Blitz wieder einmal verschlafen hatte. Als eine Kuh kalberte und der Götti im Gnadental in einem Restaurant am Jassen war, fuhren wir zu Ihm mit dem Fahrrad. Es ging fast alles durch den Wald. Da es dunkel war, am Boden noch viele Pfützen lagen und der Blitz aussergewöhnlich schnell fuhr, hatte ich Angst, ihm nicht mehr folgen zu können.

(12) SACKWAAGE
Oftmals fuhr ich, als ich älter war, mit dem Velo von Baar nach Sulz. Auf dem Heimweg gab mir Grossmutter jedes Mal einen Fettkübel voll Eier mit. Jedes Ei hatte sie in Zeitungspapier gewickelt. Auf dem Gepäckträger fuhr ich sie nach Eggenwil zur Post. Der Postangestellte wog den Kübel auf der Sackwaage und klebte ein Zerbrechlich-Kleber darauf. Alle Eier sind immer heil angekommen, was heute kaum mehr denkbar ist. Einmal hatte mir meine Mutter eine Speckseite mitgegeben, welche sie beim Metzger Zürcher gekauft hatte. Grossmutter hänge den Speck in die Rauchkammer unter dem Dach. Als ich dann nach ein paar Wochen wieder kam, und sie mir den geräucherten Speck mitgeben wollte, sagte ich ihr, dass der nur halb so gross sei, wie der, den ich ihr gebracht hatte. Ich wusste nicht, dass der Speck in der Rauchkammer fast die Hälfte seines Gewichts verlor.
Natürlich gab es noch mehr Onkeln und Tanten wo ich in die Ferien gehen konnte. Verwöhnt wurde ich jedes Mal in Schattdorf bei Tante Gritli und Onkel Emil. Sie hatten zwei Töchter: Margrit und Alice. Da war ein Junge natürlich herzlich willkommen.
(13)
Auch in den Jura nach St. Ursanne zog es mich mehrmals, obwohl ich kein Französisch konnte. Tante Frieda kaufte zu meinem Empfang immer einen Sauerrahmkuchen, den ich so gerne ass. Onkel Ferdy fuhr mit mir einmal mit dem Fahrrad über die Grenze nach Frankreich. Obwohl ich keinen Pass hatte, liessen sie mich gewähren. Am andern Tag machte ich dieselbe Tour mit ein paar Buben aus der Nachbarschaft. Als wir an den Zoll kamen fragte der in einer alten Napoleon-Uniform steckende Zöllner etwas auf Französisch. Da ich aber nichts verstand und er dachte, dass die ja nichts Böses anrichten konnten, liess er uns über die Grenze. Am Abend erklärte mir dann Onkel Ferdy, dass ich das nicht hätte tun dürfen. Um etwas Französisch zu lernen schickte mich Tante Frieda in den Coop zum Einkauf. Doch die sprachen mit mir alle Schweizerdeutsch.
Ein Nachbarjunge hatte ein Pedalo, welches ihm sein Vater konstruiert hatte. Damit fuhren wir gerne zusammen auf dem Doubs. Hie und da hörte man am Morgen Schüsse. Einheimische schossen Ratten, wenn diese über den Fluss schwammen. Über eine Holzschwelle im Fluss konnten wir diesen überqueren, denn auf der anderen Seite war eine Liegewiese. Vor allem am Sonntagmorgen befanden sich etliche Fischer aus Basel am Ufer. Meistens sah man schon von weitem, wenn ein Fisch, eine Barbe, dank ihrem silbrigen Unterteil geschwommen kam. Sie fischten mit künstlichen Fischen. Erstaunlicherweise holte meistens der Einheimische den Fisch raus, obwohl alle relativ nahe beieinanderstanden.
Vor dem Eingangstor zur Stadt, demjenigen zur Brücke und nach dem Ausfahrtstor gab es immer Künstler, welche die schmucke Stadt malten. Da ich selber gerne zeichnete und malte, tat ich es ihnen gleich und platzierte mich mit Karton und Wasserfarben vor ein Tor. Bescheiden durfte ich als Bube die meisten Zuschauer um mich scharen. In der alten Kirche, über welche Onkel Ferdy eine Broschüre verfasste und im Kirchenchor mitsang, erinnere ich mich an den Sigrist. Es war ein stattlicher Herr in der alten französischen Uniform bewaffnet mit einer Hellebarde. So stolzierte er den Korridor hin und her und stupste mit dem Hinterteil der Hellebarde Leute auf der Bank, damit sie nachrutschten. Während der Wandlung stand er kerzengerade vor dem Altar und salutierte mit gestreckter Hand an der Schläfe. Ich hatte riesigen Respekt vor ihm.
In der Stadt gab es auch einen Ausrufer für Neuigkeiten. Der fuhr mit dem Velo herum, wirbelte auf seiner kleinen Trommel die Leute zusammen und orientierte sie mit lauter Stimme über das Neuste im Städtchen. Onkel Ferdy war als Buchhalter aus Zürich in die Firma Thekla, eine Druckgussfirma, gekommen. Dort arbeitete er bis zu seiner Pensionierung. Später, als er pensioniert war und viel Zeit für Konversation hatte, erklärte er mir einmal, dass er trotz der vielen Jahre in St. Ursanne immer noch als Zürcher angeschaut werde.

(14)
In Serneus bei Tante Marie und Onkel Georg war ich erst als 17-Jähriger einmal mit einem Kollegen aus Zürich. Onkel Georg (Schorsch) erklärte uns, als wir ihm sagten wir gingen mit dem Zug nach Chur, dass dort nur alles Kranke seien. Es war damals noch ein Kurort vor allem für Lungenkranke. In dieser Zeit war auch die Schweizermeisterschaft in der Skiabfahrt. Kurz bevor wir ankamen, gewann ausgerechnet Jost Minsch aus Klosters die Abfahrt. Wir durften am Abend mit Onkel Georg und Cousin Christmartin zum Empfang auf den Bahnhof. Es spielte die Feldmusik und viele Leute warteten auf die Ankunft des Zuges mit Jost Minsch. Der Zug hielt, aber weit und breit kein Abfahrtssieger. Als typisch introvertierter Landbursche bekam er es mit der Angst zu tun, als er so viele Leute sah und stieg auf der anderen Seite des Zuges aus. Sobald er entdeckt wurde, schleppten sie ihn ins Dorf, wo wir ihn mit Onkel Schorsch und vielen anderen in einem Restaurant ausgiebig feierten.
Zu Tante Berta und Onkel Edi in Fischbach-Göslikon ging ich nicht in die Ferien, denn die hatten mit ihren fünf Buben mehr als genug zu tun. Ich erinnere mich nur, dass ich einmal dort auf einem gefrorenen Weiher mit den Cousins Schlittschuh fuhr.

(15)
Auch zu Tante Josy und Onkel Jean in Bremgarten ging ich nicht, denn auch die hatten mit ihren vier Kindern genug Betrieb, aber auch zu wenig Platz im Haus. Sie lebten in einem Altstadthaus gegenüber dem Schlösschen. Die Böden in der Wohnung waren so schräg, dass wir Spass hatten, die Glasmurmeln von einer Ecke zur anderen rollen zu lassen. Da ich oft mit dem Fahrrad nach Sulz fuhr, kam ich natürlich auch bei Bremgarten vorbei. Als ich in der Nähe des Bahnhofs das Geleise überquerte, sah ich den herannahenden Zug von weitem, wusste aber, dass ich noch genug Zeit hatte vorne durchzufahren. Der Fahrer der Bahn sah dies jedoch anders, denn er schellte mit der Fussglocke wie verrückt. Gottseidank erkannte er mich nicht, denn es war Onkel Jean, der damals als Lockführer bei der Bremgarten-Dietikon Bahn arbeitete.
(16)
Für Ferien bei den Verwandten waren wir irgendwann zu gross. Deshalb mietete Vater ein Haus im Tessin in Cimo zwischen Agno und Gademario. Das Haus gehörte einem Berner und war schon recht alt. Unterhalb des Giebeldachs war ein etwa ein Meter hohes blaues Band auf die Fassade gemalt auf dem lauter nackte Kinderengel, sogenannte Putten, dargestellt waren. Auch im Innern des Hauses gab es Deckenmalereien in der Stube und grossen Küche mit Darstellung von Früchten, Gemüse, Fasanen und weiteren köstlichen Essbarkeiten.
In der Küche gab es ein grosses Cheminee, in dem man hätte kochen können. In der Nacht hörte man von der Küche her ein krabbelndes Geräusch, das verdächtig nach Maus tönte. Vater kaufte deshalb eine Mausefalle und legte Käse hinein. Doch am anderen Tag war die Falle noch leer. Also wechselte Vater von Käse auf Speck, aber auch dies lockte keine Maus an. Die Nachbarin Claudine, eine alte Frau welche immer schwarz gekleidet war, erklärte, dass Tessiner Mäuse lieber Kastanien essen. Und so war es auch. Am andern Tag war eine Maus in der Falle und Vater ertränkte sie samt Falle im Brunnen.
Hinter dem Haus gab es im feinen Sand komische Vertiefungen. Sie sahen aus wie Trichter von 10 Zentimeter Durchmesser und 2 -3cm Tiefe. Als eine Ameise in den Trichter lief und wegen dem feinen Sand immer mehr ins Zentrum rutschte, war sie plötzlich verschwunden. Mit einem Stab stocherten wir in der Mitte des Kraters herum und da kamen etliche ausgesaugte und verdorrte Ameisenkörper hervor.
(17)
Es war ein Ameisenlöwe, eine Spinnenart, welche sich im Sand an überdachter Stelle diese Trichter gräbt und unsichtbar in der Mitte wartet, bis eine Ameise nicht mehr aus dem Trichter findet.
Es war das erste Mal, dass ich echte frische Feigen auf dem Baum wachsen sah. Ich kannte nur die gedorrten, welche an einer Schnur ringförmig im Laden hingen. In der Nähe hatte es Feigenbäume und so kletterten Cousin Ferdy aus St. Ursanne und ich auf einen Baum. Leider sah das der Bauer und wir flohen so schnell es ging vor seinem Gefluche. Aus getrockneten Traubenblättern drehten wir Stumpen, welche vor allem ein Husten und Brennen im Hals verursachten. Für mich sehr erstaunlich waren die vielen Glühwürmer, welche man nachts an den Hängen sah. Ich sammelte ein paar, verschloss sie in ein Trinkglas und stellte sie auf den Nachtisch. Leider leuchteten sie da aber nicht mehr weiter. Das Dorf Cimo war sehr klein. Man kannte alle Bewohner welche am Abend gerne auf dem Dorfplatz zusammensassen und hie und da auch mit uns «Versteckis» spielten. Alt und Jung machten mit und selbst der alte Professore, ein ehemaliger Sekundarlehrer, versteckte sich kichern hinter einem Holzstapel.

(18) TESSINER BÄUERIN MIT CHRÄTZE
Claudine, unsere Nachbarin lebte mit ihrem Cousin Jack zusammen. Sie führte einen kleinen Bauernbetrieb und wir sahen sie oft mit einer Chrätze, einem Korb voller Heu auf dem Buckel herumlaufen. Jack interessierte das weniger. Er war Maurer und ging nach der Arbeit direkt ins Restaurant zu seinen Kollegen um zu politisieren. Und natürlich gab es wie in jedem Dorf eine Kirche. Esther und ich wollten einmal die Kommunion empfangen, konnten aber vorher nicht beichten, weil wir nicht italienisch konnten. Doch der Dorfpfarrer erlaubte uns das kommunizieren auch ohne vorhergehende Beichte. Er wir gedacht haben, dass unsere Sünden ja kaum sehr schwerwiegend sein konnten. Papa und ich gingen nie ohne Geige nach Cimo. Wir spielten auch oft zusammen, sodass es kein Wunder war, dass einmal jemand mit der eisernen Hand an der schweren Eingangstüre klopfte. Es war der Pfarrer welcher meinte, wir sollten doch am nächsten Sonntag ein paar Kirchenlieder begleiten. So stellten wir am Sonntag einen Notenständer mitten in den Korridor der Kirche und spielten alle Lieder aus dem Kirchengesangbuch mit. Die Leute waren hell begeistert und wir waren nicht mehr Fremde, sondern sehr beliebt geworden.

(19)
Eines Morgens hörte ich aus Esthers Zimmer einen durchdringenden Schrei. Als sie aufwachte sass auf ihrer Bettdecke ein kleiner schwarzer Skorpion. Man kann sich vorstellen, wie sie sich erschrocken hat. Doch sie zauderte nicht lange, holte eine Kehrichtschaufel und schlug damit den Skorpion tot.
Fünfmal machten wir in Cimo Ferien, mussten in Zukunft aber leider verzichten, da das Haus abgebrochen wurde. Die Dorfstasse wurde verbreitert und eine Ecke des Hauses war im Weg. Der Berner weigerte sich zu verkaufen und so riss die Gemeinde einfach eine Ecke des Wohnzimmers ab. Später bin ich einmal mit Rita nach Cimo gefahren, als wir gerade im Tessin Ferien machten. Natürlich besuchten wir Claudine, die eine riesige Freude hatte mich und meine Frau zu sehen. Sie tischte uns ein fettiges Suppenhuhn auf, welches sie auf dem grossen Cheminee in der Küche kochte. Jack lebte da schon nicht mehr und da Claudine immer schwarz gekleidet war, konnte man nicht schätzen, wie alt sie war. Die Strasse im Dorf war verbreitert worden und unser ehemaliges Ferienhaus stand mit abgerissener Hausecke weiterhin am Platz.
(20)
Was man natürlich nie vergisst ist der dreitägige Ausflug mit dem Vater ganz alleine nach Innsbruck. Wir waren in der Stadt bei einer Familie eingemietet, die stolz war, ihr Haus zusammen mit Kollegen selbst gebaut und auch die Steine fabriziert zu haben. Tatsächlich sahen wir an der Baumesse in Innsbruck viele Apparate, welche auch Laien bedienen konnten. So war eine Eisenmulde mit einem Werkzeug darin wo man Zement einfüllen und mit einer Fusspedale das Werkzeug auf und ab bewegen konnte. Es entstand ein Zementsein, der nur noch an der Luft getrocknet werden musste. Jeden Tag assen wir zum Mittag und Abend dasselbe. Wir gingen ins Restaurant Stiegel-Bräu und assen Gulasch mit Brotknödel. Etliche Jahre später suchte ich mit Rita dieses Restaurant. Wir mussten aber feststellen, dass Stiegel-Bräu eine

(21)
Brauerei in Innsbruck und Salzburg war und mehrere Restaurants hatte, sodass wir es nicht fanden. Auf dem Heimweg fuhr Vater mit mir über den Gotthard. Das war damals noch die alte Tremola-Strasse ohne Geländer und nur alle paar Meter ein Granitstein. Es hatte stockdicken Nebel und Vater, welcher ja fuhr, musste sich voll konzentrieren um nicht ab der Strasse zu kommen. Da wir schon länger unterwegs und müde waren, sah ich, dass Vater plötzlich einnickte. Was blieb mir anderes übrig, als ihm einen heftigen Klapps zu geben und das mehrmals bis wir zum Nebel heraus waren.


(1) Anmeldung zum Musikunterricht 1954
Grundsätzlich hatte Mutter Elisabeth nichts gegen Musikinstrumente, da ja ihr Mann Zeffirino Geige und Mandoline spielte. Uns sagte sie, dass wir alles lernen können ausser Cello. Der Grund war, dass sie bei der Familie Dr. Blass in Zürich als Köchin angestellt war und deren Sohn täglich Cello übte, was vermutlich während ihrer Zeit eher ein Gekratze war.
Mehrmals habe ich das Geigenspiel erwähnt, auch der Beginn und die Musikstunde bei Kurt Meierhans. Später hatte ich Geigenstunden im Kollegium Friedberg, Gossau St. Gallen bei Pater Klöpsch, welcher mir kaum bis zur Schulter reichte, aber sehr impulsiv war. So korrigierte er die Haltung des linken Armes, indem er mit der Zirkelspitze in den Ellbogen oder in die Hand stach. Er lernet mich verschiedene Zigeunerlieder. Leider rutschte er mit etwa 40 Jahren in der Badewanne aus und ertrank.
Mit 16 Jahren bewarb ich mich bei Herrn Friedrich Keller in Wollishofen/ZH welcher Lehrer am Konservatorium war, aber wegen der Kinderlähmung einen Klumpfuss hatte und deshalb auch zu Hause privat unterrichtete. Er sagte, eigentlich hätte er genügend Schüler, lud mich aber wegen meiner Unnachgiebigkeit an einem Samstag zum Vorspiel ein. Ich weiss nicht mehr, was ich ihm vorgespielt hatte, fand aber, dass es mir nicht gut gelungen war und er hörte mir auch nicht lange zu, sondern sagte, ich könne wieder einpacken und er werde mir dann Bescheid geben. Erfreut bekam ich dann nach einer Woche positiven Bescheid. Nach etwa einem Jahr wunderte es mich doch, weshalb er mich genommen hatte. Er erklärte mir, dass er zugesehen habe, wie ich die Geige ein und auspackte und da bemerkte er sofort meine grosse Liebe zum Instrument. Er meinte, das sei für ihn sehr wichtig, alles andere könne er mir ja beibringen. Er war ein sehr gütiger Lehrer, fand aber, dass ich mein Zigeunertum nie abgelegt hätte. Wenn ich wieder einmal improvisiert hatte fragte er: «Wo steht denn das?» Immer, wenn ich um14.00 Uhr am Samstag in den Unterricht kam, hörte ich ihn schon von der Haustür her irgendein Violinkonzert spielen. Ich wartete jedesmal andächtig vor der Türe, bis er beendet hatte. Erst dann läutete ich an der Wohnungstürglocke. Hie und da machte mir eine ältere Dame, Fräulein Knecht, auf. Später stellte sich heraus, dass es eigentlich seine Frau war, sie aber aus finanziellen Gründen nie geheiratet hatten.
Er war aber auch ein ausgezeichneter Maler der abstrakten Kunst. Nach dem Unterricht liefen auf dem Weg zum Bahnhof 200 Meter zu seinem Atelier. Dort zeigte er mir seine neuesten Bilder. Wir diskutierten darüber und es ergab sich, dass er plötzlich den Pinsel und Farbe nahm und einen Strich verlängerte mit der Bemerkung «du hast recht». Einmal zeigte er mir einen wunderschön gemalten Christuskopf. Er hatte eine Ausstellung im Helmhaus Zürich und ich fragte ihn später, für wieviel er den Christuskopf verkauft hatte. Er sagte mir, er hätte ihn nicht verkauft, er mache keine Geschäfte mir Christus und werde dieses Bild einem seiner besten Freunde schenken. Keller war kein Kirchengänger, aber seine Antwort nahm ich immer gerne als Beispiel, welch grossen ehrlichen Respekt man vor Gott haben kann ohne Kirchengang.
In diesem Atelier durfte ich in einem Doppelquartett aus lauter Profimusikern die Bratsche spielen. Selber hatte ich eine für Fr. 700 gekauft. Er leihte mir sein Instrument von einem Geigenbauer Meier aus Zürich, welches einen wunderschönen grossen Ton hatte. Keller war auch dafür verantwortlich, dass mir mein Vater bei Hug Zürich eine
Geige kaufte. Ich spielte bisher auf einer 3/4- Geige, welche Vater einmal von einem Zigeuner bei den Baarer Höllgrotten abgekauft hatte, weil er glaubte, sie sei sehr alt. Das einzige Alte daran war der Geigenzettel, wie der Geigenbauer von Musik-Hug feststellte, als er mit einem Zahnarztspiegel die Geige durch die F-Löcher von innen anschaute. Die neue Geige, eine von «Dehommain et Germain» aus Paris von 1880, hat mich von da an bis heute begleitet. Immer wenn ich schlecht gelaunt nach Hause kam und zur Geige griff um mich abzuregen, hatte sie einen sehr aggressiven Ton. Wenn ich mich aber beruhigt hatte, konnte sie sehr schmeichelnde und liebevolle Töne ausstahlen. Ob ich noch Zeit hätte nach dem Unterricht, fragte mich einmal Herr Keller. Er hätte für mich eine Überraschung bei Musik-Hug. Wir gingen dann in die Altstadt zum Geigenbauer Spinner, welcher eine Geige hervorholte und mir zum Spielen gab. Der Ton gefiel mir nicht, aber sie war auf der Seite wunderschön geschnitzt und sah auch sonst sehr gepflegt aus. Als er mich aufklärte, wurde es mir doch fast schwindelig. Es war die «Greffulhe» von Stradivari aus dem Jahr 1709. Die sei aus der ersten Schaffensperiode von Stradivari und hätte deshalb noch keinen so grossen Ton. Sie wurde damals im Jahr 1965 für eine Million Franken nach Amerika verkauft.
Eine Bleistiftzeichnung auf der eine Dame am Konzertflügel dargestellt war, schenkte mir Friedrich Keller einmal zu Weihnachten. Ich legte sie zusammengerollt auf das Buffet in der Bauernstube. Leider meinte meine Mutter es sei ein Backpapier und entsorgte sie im Kehrichtkübel. Völlig verflecket konnte ich sie nicht mehr retten. Ein Andenken an ihn war so zerstört.
Ich blieb bei Herr Keller bis zur Rekrutenschule. Eigentlich wollte er aus mir einen Musiker machen und ärgerte sich über den Militärdienst. Nachdem ich dann noch in die Unteroffiziersschule ging, war das Ende der Geigenstunden besiegelt. Ich hatte darauf Friedrich Keller nie mehr gesehen.
Mit der Geige ging ich aber fortan in den Orchesterverein Baar, dem heutigen Baarer Kammerorchester. Vater spielte schon mit und nahm mich als 19-Jährigen mit. Natürlich ging ich mit Mamma oft schon vorher an Auftritte des Orchesters und deshalb waren mir die Mitspieler nicht unbekannt. Papa machte mir seinen Platz in der ersten Geige und rutschte zur Zweiten hinüber. Auch als Kind durfte ich mit Vater schon an Proben des Orchesters. Da sie unweit vom Wohnhaus im Entrée des Marktgasse-Schulhauses probten, sprang ich jedesmal während der Pause nach Hause. Ich durfte auf einem Stuhl neben dem damaligen Dirigenten und Studienkollege von Franz Lehar,
(2)
Herr Gesza Feszler sitzen und den Musikern zuschauen. Dank Feszler war Baar damals auch Operettenhochburg und er war auch im Musikrat des Eidgenössischen Orchesterverbandes.
Es gab damals nur ein bis zwei Damen im Orchester, bis dann zwei Schülerinnen von Kurt Meierhans, der nun in Zug unterrichtete, mitwirkten. Sie hiessen Therese Cinter und Rita Burkard. Beide gingen zum Sprachaufenthalt nach London. Natürlich wollten sie wissen, was im Orchester so läuft und ich gab ihnen als damaliger Präsident gerne brieflich Auskunft. Und so lernte ich Rita kennen. Wir heirateten und spielen heute noch zusammen im Orchester. Viele Konzerte und andere Orchesterauftritte, aber auch Ausflüge und Feste haben wir im Orchester gefeiert und auch unsere beiden Knaben Igor und Niccolo haben vieles miterlebt.
Als Orchestermitglied durfte ich 20 Jahre lang auch in der Musikschul-Kommission Einsitz nehmen. Auch hier gab es viele gemeinsame Erlebnisse die der ganzen Familie in bester Erinnerung bleibt. Als ich mit der Kommissionsarbeit aufhörte, meldete ich mich wieder als Schüler an. Auf meine Anmeldung hin, dass ich ja wisse, dass sie kein Alphorn unterrichten erklärte ich ihnen, dass der Musikschulleiter Hans Hürlimann ja Trompetenlehrer sei und auch ein Alphorn hätte. So verbrachte ich mit Hans manche lustige Unterrichtsstunde in der Waschküche des alten EWB-Gebäudes an der Aegeristrasse. Bei schönem warmem Wetter holte ich ihn mit einem Jeep ab, fuhren zur Oberbrüglen unterhalb Hirssattel und bliesen dort in Richtung Wald, da es dort das schönste Echo gab. Ich habe mache Duos für zwei Alphörner geschrieben, welche wir ausprobierten. Auch zu jedem Geburtstag von Onkeln und Tanten komponierte ich ein Alphornstück und führte es an deren Geburtstagsfeier vor.
Das Alphorn schenkte mir Rita zu, 40. Geburtstag. Zum 20. Geburtstag erhielt ich von meiner Mutter eine Klarinette Marke «Noblet», denn ich spielte als 15 – 20Jähriger Klarinette im Stegreif. Wir Jünglinge hatten in dieser Zeit zwei Dixilandbands gegründet, spielten mit in der Jazzmesse und auch in der Rekrutenschule verbrachten wir mache Stunde mit Dixilandspiel. Im Film atelier Kägi rümlang hatten wir ausgezeichnete Verstärkeranlagen, welche wir dank einem Schulkollegen benutzen konnten. Zum 30sten kaufte ich mir ein Ostdeutsches Saxophon, da ich früher in einer Band Rockmusik begleitete. Das gleichzeitige Blasen und Hineinsummen gab den idealen heiseren Ton. Das erste Saxaphon hatte ich von meinem Götti Hans. Das zweite Saxaphon hatte ich einem Schulkollegen abgekauft, welches es von seinem Vater hatte. Alle Saxaphone waren s-alto. Zum 40sten dann eben das Alphorn. Dann bekam ich von Mutter zum 50sten ein Keyboard welches ich bei Husar in Zug erlernte. Ich brauchte es aber primär als Begleitinstrument mit Kasetteneinschüben. Da konnte ich das Solo stumm oder Mute schalten und mit der Elektrogeige Marke Yamaha mitspielen.
Ich war 22 Jahre alt und noch im Studium. Deshalb kam mir die Anfrage von der Musikschule Baar sehr gelegen, ob ich nebst meinem ehemaligen Lehrer Kurt Meierhans als nebenamtlicher Lehrer unterrichten wolle. Der Zustupf von Fr. 10.- pro Schüler kam mir sehr gelegen. Ich hatte sieben Anfängerinnen, welche meine Nerven arg strapazierten. Von Kurt Meierhans übernahm ich auch das Jugendorchester. Darin spielten die zukünftigen Musiklehrer Josef Rosenberg, Geige und Hanspeter Treichler, Trompete. Wir spielten im ersten Teil der Konzerte etwas Klassisches und im zweiten Teil Unterhaltungsmusik. Mit dem neusten Schlager "Congratulation" hatten wir riesen Erfolg. Die Noten für Salonorchester erhielt ich jeweils in einem Drummershop im Zürcher Niederdorf oder schrieb sie selber um.
Leider war es mir nach zwei Jahren nicht mehr möglich zu Unterrichten. Das Jugendorchester hätte ich noch gerne weiter geleitet. Doch leider gaben sie dieses an meine Nachfolgerin Rosemarie Dürner weiter. 
(3)
1967-69 als Geigenlehrer der Musikschule

(4) 
(5)
Anstellungsvertrag vom 8. April 1967 Inserat im Zugerbieter 
(6) Inserat im Zugerbieter
Mit Schülern der Musikschule organisierte ich auch zwei Jazzmessen. Es waren Negerspirituals auf Deutsch, welche von den Schülern in den Primarschule eingeübt wurden. Entsprechend spielten wir in der Jugendmesse. Der Pfarrer Studer war nicht sehr davon begeistert. Vor allem weil wir vorne beim Altar spielten. Eine an der Gitarre hatte Hotpants und Maximantel an. Doch es war ein Erfolg und ein paar der Jazzband spielten an meiner Hochzeit. Aus dieser Band ist auch die spätere Jimmy`s Brassband entstanden, mit Jimmy Wettach am Bass und Hanspeter Treichler an der Trompete. Hanspeter hatte sich zu einem ausgezeichneten Jazztrompeter entwickelt, welcher auch lange in der Casabar in Zürich auftrat. Er war später viele Jahre als Musiklehrer an der gemeindlichen Musikschule Baar tätig.

(7)
Unter dem Orchesterleiter Jörg Stählin ging ich einmal mit der Bratsche zur Probe. Er war sehr erstaunt, doch ich erklärte ihm, dass ich etwas Neues brauchte und wir waren im Bratschenregister eh zu wenig Spieler. Natürlich meldete ich mich auch gleich zum Musikunterricht an.

(8) mit Walter Tresch, Bratsche
Walter Tresch, mein Bratschenlehrer, schätzte ich sehr. Er war Bratschist im Luzerner Sinfonieorchester und man merkte, dass es sein Hauptinstrument war. Ich hatte vorerst drei, später noch ein Jahr Unterricht bei ihm.
Zum 60. Geburtstag wollte ich Schwyzerörgeli lernen. Scheinbar musste das nicht sein, denn kurz vorher bekam ich den ersten Gehörsturz und ein halbes Jahr später den zweiten. Das hiess, 2-3faches Echo im rechten Ohr und Scherbeln bei hohen Tönen. Ich konnte somit drei Jahre nicht mehr im Orchester mitspielen, was ich sehr vermisste, war doch der Probeabend mit Rita immer sehr interessant und Ablenkung vom Alltag. Da mit der Zeit die tiefen Töne kein Scherbeln im Ohr verursachten, meldete ich mich an der Musikschule für Bassgeige an. Im Orchester konnte ich so auch hinter den tief tönenden Celli stehen. Zum Bassgeigenlehrer erhielt ich Reto Lehmann, ein wie auf mich zugeschnittener Lehrer, bei dem ich ganze zwölf Jahre in den Unterricht ging. Er war so nett, dass er gar zu mir an die Heimatstrasse in den Uebungsraum (Das Räbehöckli) kam. Natürlich genehmigten wir uns nach dem Unterricht jedesmal einen Kaffee aus der Maschine und Süssigkeiten dazu.
(9) Alphornblasen in Melniza
Nach 20-jährigem Einsitz in der Musikschulkommission erklärte ich meinen Kollegen, dass ich als Musikschüler wiederkomme. Auf die Frage, was ich denn lernen wolle erklärte ich ihnen: Alphorn. Natürlich wusste ich, dass dieses Instrument an der Musikschule nicht gelernt wurde. doch der Musikschulleiter Hans Hürlimann war Trompetenlehrer und hatte auch ein Alphorn. So lernte ich bei ihm zwei Jahre das Alphorn in der Waschküche des alten EW-Gebäudes an der Aegeristrasse. Im Sommer luden wir die beiden Alphörner in den Jeep und fuhren bis unterhalb des Restauant Hirssattel, wo wir gegen den Wald spielten. Ich habe manches Duo komponiert für Geburtstage von Onkeln und Tanten oder für das Kollegium St. Michael oder die Musikschule Baar. Zum 70sten Geburtstag schenkte mir Rita ein Karbonalphorn, welches wir in Yverdon les bains machen liessen. Es ist 1.2 Kg leicht und kann überall mitgenommen werden. Das Holzalphorn liess ich 1985 bei Franz Nussbaum in Gwatt bei Thun aus Arvenholz bauen.

(10) mit Reto Lehmann am Bass
Der Kontrabass ermöglichte es mir in verschiedenen Stilrichtungen mitzuspielen. So probierte ich das Begleiten von zwei Schwyzerörgeli-Spielern, wobei ich vorher nach Heften des VSV (Verein Schweizer Volksmusik) und deren CD übte. Für mich wurde es jedoch schnell langweilig, da es immer die gleiche Begleitung war. Ich begleitete das Mandolinenorchester in mehreren Konzerten. Es war sehr streng, da ich pausenlos spielen musste. Als ich dann zweimal an einer Hauptprobe den Krampf in der rechten Hand bekam, hörte ich sicherheitshalber auf. Auch das Zusammenspiel mit einem Kollegen des Baukaderverbandes, welcher Banjo spielte, brachte eine schöne Blueserfahrung. Auch drei Jahre beim Zuger Seniorenorchester war interessant, befriedigte aber technisch nicht. Ich spielte dort mit, als ich wieder auf Bratsche umstellte, um dass Bassgeigenspiel nicht zu verlieren.
(11) Mandolinenorchester 2016 (Bass)

(12) Zuger Seniorenorchester 2018 (Bass)

(13) Schülerorchester 2018 (Bass)
So kehrte ich dann wieder zur Bratsche zurück und meldete mich gleich wieder an der Musikschule Baar zum Unterricht. Walter Tresch war gerade in seinem letzten Semester als Musiklehrer, bevor er pensioniert wurde. Zu seinem Abschlusskonzert wollte ich etwas Besonderes für Ihn spielen. Leider lag ich an diesem Abend mit Grippe und Fieber im Bett.
Die Nachfolgerin war Anna Darani, eine Tessinerin aus dem Maggiatal. Sie hatte das Violine- und Violadiplom und spielte in verschiedenen Orchestern hauptsächlich die Bratsche. Für den Erwachsenenunterricht war sie nicht geeignet, denn sie ging nicht auf die Anliegen der Erwachsenen ein. Was ich spielen wollte gefiel ihr nicht und umgekehrt.
Ich hörte nach drei Jahren bei ihr im Unterricht auf.
(14) Anna Darani Anna Darani
Im Jahr 2019 kam die Corona-Pandemie. Anfänglich nicht sehr ernst genommen, waren plötzlich die älteren Leute davon betroffen. Für uns Ältere hiess dies: "Bleib zu Hause!"
So entdeckte ich beim Kastenaufräumen wieder eine Klarinette, ein Sopransax und ein Altsaxophon. Die Klarinette gehörte ursprünglich der Baarer Feldmusik, von welcher ich diese bei einer Neuinstrumentierung für Fr. 400.- abkaufen konnte. Sie war in einem tadellosen Zustand. Das Sopransax hatte ich einem Kollegen abgekauft, dessen Vater es für Ländlermusik gebrauchte. Das Altosax hatte ich einmal von der damaligen DDR für Fr. 1000.- als Neuinstrument gekauft. Gespielt hatte ich diese Instrumente höchstens mal an einer Bauaufrichte.
Ich nannte diese Blasinstrumente "Pubertätsinstrumente", denn ich spielte sie zwischen 14 und 20 Jahren in zwei Dixiland-Bands und zuletzt in der Rekrutenschule. Wir führten zwei Jazzmessen in der Baarer Kirche auf, welche aus Spirituals bestand und die Kinder mitsingen konnten. Da wir Buben diese Instrumente nie gelernt hatten, sondern einfach probierten bis es ging und nach Schallplatten spielten, reizte es mich, in der Pandemie diese Instrumente nach Noten zu lernen. Dabei entschied ich mich für die Klarinette, da sie einen grösseren Tonumfang hatte als das Saxophon und von den Stielrichtungen her mehr Möglichkeiten bot.
So meldete ich mich also als 75-jähriger zum Klarinette-Unterricht an der Musikschule Baar an. Lehrer, welche ich von früher her kannte, waren bereits pensioniert, sodass ich Nicola Katz, ein 33-Jähriger, als neuer Musiklehrer erhielt. Wir verstanden uns von Anfang an sehr gut. Obwohl ich erklärte, dass ich nur Blues spielen möchte und er eher von der klassischen Musik her kam spielten wir bereits in der ersten Stunde zusammen einen Blues, wobei er mich am Klavier begleitete. 14 Tage später kam auch gleich unser erster Auftritt am Hauskonzert, wo er sich vor allem den Eltern seiner neuen Musikschüler vorstellen wollte. Ich spielte natürlich noch nach Gehör, da das "nach Noten" spielen erst begann. Inzwischen spielten wir auch Klassik, wie die 12 Knebelduette von Mozart, sowie Bach und Lefèbre. Shostakovich`s Walz Nr.4, aber auch Duos von Beethoven kamen dazu.
Die vierjährige Lehrzeit endet im Sommer 2025. Dann lerne ich noch ein Instrument, welches ich in der Pubertät im Selbstunterricht ohne Noten gelernt habe: das Saxafon.
(15) Nicola Katz Nicola Katz
Die vierjährige Lehrzeit endet im Sommer 2025. Dann lerne ich noch ein Instrument, welches ich in der Pubertät im Selbstunterricht ohne Noten gelernt habe: das Saxofon.
Nach den Sommerferien geht es in den Unterricht von Richard Farnhammer an der Musikschule Baar.
(16) Richard Farnhammer
Die drei Jahre Bassgeige spielen im Seniorenorchester endete wegen der Pandemie. Eines Tages rief Ursi Wild, Saxophonistin vom Seniororchester an und fragte, ob ich Lust hätte, in kleiner Gruppe mitzuspielen. So übten wir dann im Wohnzimmer von Zita Schlumpf in Baar zu sechst: Bassgeige, Bassklarinette und Saxophon, Querflöte, Gitarre und Banjo sowie ich mit Geige und Klarinette. Wir traten auch in der Halle 44 in Baar bei einem Jubiläum auf.
Nach zwei Jahren machte ich mit Dolfi Müller am Banjo und der Gitarre weiter. Wir spielten Klezmer und Blues mit Klarinette und Banjo sowie Irish Folk und Bluegrass mit der Geige und Gitarre. Am schmutzigen Donnerstag 2022 traten wir dann in verschiedene Restaurants in Baar spontan auf und schlossen den Abend in der Zuger Ochsenbar.
(17) Erster Auftritt im Elefant am Schmudo 2022

Sie wohnte unweit von mir entfernt im Schwesternhaus an der Florastrasse zusammen mit Schwester Meletine oder wie wir sagten: Ovomaltine. Schwester Meletine leitete den Kindergarten im Condordia, wo mein Vater und später auch meine Schwester Esther ihre Erziehung genossen. Schwester Meletine wurde über90 Jahre alt. Als wir sie fragten, wie man dieses Alter erreiche sagte sie: jeden Tag kalt duschen und ein Glas Rotwein.

(1) Haube stimmt, aber so nett sah Benicia nie aus
Ich hasste Schwester Benicia. Sie war sehr parteiisch und launisch. Wenn wir zu viel schwatzten klebte sie uns ein Packpapier-Klebeband über den Mund, welches sie vorher mit der Zunge angefeuchtet hatte. Wir lutschten dann am Klebeband, bis es durchbrach. Geschah das zu schnell, kam ein zweites Klebeband darüber. Erstaunlich war, dass ich nie mit neuen Spielsachen spielen durfte. Erst später erfuhr meine Mutter, dass diejenigen Kinder, deren Eltern Naturalien oder Geld vorbeibrachten, bevorzugt wurden. Auch als ein Vater eines Kollegen in der Nähe eine Gartenbahn laufen liess welche er selbst angefertigt hatte, durften diese nur bestimmte Kinder begutachten.
Mein Nachbarjunge, Kindergartengespane und spätere Ständerat Rolf Schweiger begleitete mich jeweils auf dem Weg. Wir kamen bei Birnenbäumen vorbei die eines Tages abgeerntet wurden und wir um Birnen bettelnd zusahen. Eigentlich wollten wir nur ein oder zwei dieser Mostbirnen. Der Bauer meinte jedoch, wir sollten helfen diese aufzulesen und dann könnten wir so viele essen wie wir wollten. Natürlich waren wir sofort damit einverstanden und der Bauer hob uns über die Umzäunung. Doch vor lauter Birnenessen wurde es uns schlecht und so gingen wir dann wieder Heim anstatt in den Kindergarten. Bauchwehgeplagt lagen wir im Bett und die Eltern meinten, Schwester Benicia hätte uns nach Hause geschickt. Doch am Abend läutete es dann an der Haustüre und wir mussten gegenüber den Eltern und der Kindergartenschwester erzählen, weshalb wir vom Kindergarten fern geblieben waren.Es war verständlich, dass ich mich für Bruder Mario, welcher auch hätte in den Kindergarten gehen sollen, gewehrt habe. Da der Besuch freiwillig und Mutter auch keine Freundin der Schwester Benicia war, musste Mario nicht in den Kindergarten.
Später, noch lange nach den Kindergartenjahren, träumte ich oft von einer Hexe, welche einen riesigen Sarg auf dem Kopf stehen hatte und sich nachts über mich beugte und mit dem Sarg zudeckte. Zufälligerweise kam ich einmal mit einer Kinderpsychologin auf diese Hexe zu sprechen. Wir fanden heraus, dass dies niemand anders als Schwester Benicia war, deren Schwesternhaube sich so weit nach oben verlängert hatte, dass es wie einen Sarg aussah.


(1)
Erster Schultag im Schulhaus
Marktgasse 28.4.1952
Nach zwei Jahren Kindergarten kam der Übertritt zur Primarschule. Es gab auch dort noch Lernschwestern, doch ich hatte Glück. Fräulein Schmidlin war meine Erstklasslehrerin und sehr nett. Sie war noch ledig und heiratete erst mit etwa 40 Jahren den Bahnhofvorstand Meier. Nach dem ersten Schultag reklamierte ich bei meiner Mutter, dass der im Nebenbank furchtbar stinke und ich nicht mehr neben dem sitzen wolle. Es war ein Bauernjunge aus Blickensdorf, welcher noch Stallgeruch verbreitete. Frau Schmidlin platzierte mich bereits am dritten Tag um. Es war ein sehr angenehmes Schuljahr. Wir waren noch gemischt mit Mädchen zusammen. Zum Abschluss des ersten Schuljahres schenkte sie mir das Buch "Onkel Toms Hütte" und machte eine Widmung hinein. Da ich es noch nicht lesen konnte, riss ich vor Weihnachten die Widmung heraus und schenkte das Buch, zum Entsetzen meiner Eltern, meiner Schwester Esther zu Weihnachten.
In der zweiten Schulklasse kam ich zu Lehrer Josef Knobel. Normalerweise hatte er die 3. 4. Schulklasse. Da aber sein Sohn Hanspeter in die Schule kam, übernahm er bereits eine Klasse früher. Mir war das recht, denn Hanspeter war ein guter Kollege zu mir und einer aus der Nachbarschaft. Ich war viel bei ihm und er bei mir zu Hause. Lehrer Knobel war auch Präsident des Verkehrs- und Verschönerungsverein Baar, sowie Leiter des Kirchenchors. Mein Vater kannte ihn gut und mochte ihn ebenfalls. Wir waren eine reine Bubenklasse mit 54 Schülern im Schulhaus Marktgasse. Auch Esther war in diesem Schulhaus, aber vier Klassen höher. Wir gingen somit zwei Jahre ins gleiche Schulhaus und deshalb kannte ihre und sie meine Schulklasse. Am liebsten gab Knobel Geographie, worin ich allerdings nicht so gut war. Ausgerechnet ich, dessen Vater ein Auto hatte, sollte eigentlich mehr herumkommen und wissen. Tatsächlich hatten damals nicht alle Familien ein Auto und mein Vater sagte, dass er mit der Autonummer ZG 1207 lange eine der höchsten Nummern hatte. Ich war drei Jahre bei Lehrer Josef Knobel und genoss es sehr.
Aber dann in der fünften Klasse erhielt ich ausgerechnet unseren Nachbarn Josef Güntert als Lehrer. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was einem passieren kann. Wenn wir am Sonntag im Garten Tennis spielten mischte er sich gerne belehrend ein um dann am Montag, unzufrieden über meine Hausaufgaben erklärte, man müsse halt nicht den ganzen Sonntag Tennis spielen. Ich war ein guter Zeichner und das Fach liebte ich. Als wir einmal die Aufgabe erhielten eine Burg zu zeichnen, malte ich diese, meiner Vorstellung entsprechend, sehr düster. Er liess es sich dann nicht nehmen, mir vor allen Mitschülern zu sagen, ich könne diese zu Hause im WC aufhängen. Ich war so endtäuscht, dass ich daheim in ein klägliches Weinen ausbrach. Als Vater am Abend nach Hause kam und Mutter ihm dies erzähle, kam nicht sein übliches "Recht hat er gehabt" über die Lippen, sondern er ging schnurstracks zum Nachbarn hinüber und donnerte ihn zusammen. Natürlich bekam ich dies anderntags mit gleicher Münze zurückbezahlt.

(2)
Die beste Erinnerung habe ich an die Einweihung des Schulhauses Sternmatt I. Wir Schulklassen machten einen grossen Festumzug. Unsere Klasse stellte die Tellsgeschichte nach wobei ich den Wilhelm Tell spielen durfte. Ich bekam vom Coiffeur Andermatt einen Bart angeklebt und erhielt Holzschuhe, welche man schon von weitem auf der Natursteinstrasse hören konnte. Walterli spielte ein jüngere Bruder eines Schulkollegen. Er stupfte mich allerdings während dem ganzen Umzug mit dem Pfeil im Apfel. Wir erzählten allen, dass wir nach dem Umzug ein Apfelschiessen veranstalten würden. Doch darauf warteten sie vergebens. Ein Glas Most sowie Servelas und Brot war das Festmenü.
Lehrer Günter verwöhnte seine Kinder nach Strich und Faden. Ich war alleine zu Hause, als seine Töchter einmal bei uns drüben im Sandkasten spielten und eine kleine Schaufel zerbrachen. Ich nahm eine sie am Ohr und schimpfte mit ihr. Am Abend läutete es dann an unsere Haustüre und als ich diese aufmachte stand Lehrer Güntert draussen, packte mich und klopfte mich vor der Haustüre ab. Inzwischen hatte sich auch die Stimmung zwischen meinem Vater und Güntert verschlechtert, sodass Vater entschied, ich solle an einem anderen Ort die Schulzeit weiter verbringen. Wie so viele Kinder in diesen Jahren kam ich in ein Knabenistitut oder Kollegium, wie man es nannte. Auch Esther war seinerzeit in Luzern im Mädcheninstitut Villa Raezia. Weshalb sie mich bis nach Gossau, St.Gallen verpflanzten weiss ich nicht. Es wären ja Einsiedeln oder Schwyz näher gelegen. So wurde ich für ein Probequartal im Kollegium Friedberg des Palottiner-Ordens angemeldet.

(1) Gymnasium Friedberg Gossau/SG, Foto Stand 2020
Das Probequartal lief in geordneten Bahnen. Wir mussten uns ja vorerst an die Patres gewöhnen und so war das Quartal schnell um. Ich war anfangs der Pubertät und somit im Flegelalter, was sich bei den Halbjahres-Zeugnissen unter "Betragen" entsprechend negativ und mit Verwarnung auswirkte. Mit der Zeit hiess es allerdings "Hat sich gebessert." Mein bester Freund war der Markus Ruggle. Ein Basler, welcher meinen Blödsinnideen in nichts nachstand. Ein anderer war Markus Eichmann. Er war links von mir im Fünferzimmer und Neffe unseres Aufsichtspaters und somit meine Versicherung.
Einmal schickte Pater Eichmann ihn ins nächste Restaurant um Bier zu holen. Ich ging mit und wir trugen es im Sportbeutel zurück. Es war eine gute Gelegenheit auch ein Bier zu erhalten und deshalb kauften wir noch eine zusätzliche Flasche, welche Markus Eichmann in seinem Kasten versteckte. In der Nacht leerten wir diese, nicht ganz unbemerkt von den anderen, welche mit ihren Taschenlampen zündeten. Es verriet niemand etwas und wir waren für ein paar Tage die Helden.
(2)
Gruppe Günz: v.l.n.r. oben: René Bigliotti, Markus Ruggle, Günz, Markus Eichmann
Unsere Zimmer waren mit Kästen abgetrennt. Auf der Rückseite unserer fünf Kästen waren die fünf Kästen des nächsten Schlafzimmers. Einmal hängten wir in meinem Schrank eine kleine Glocke unter das Huttablar, an welche wir einen Faden befestigten, diesen durch das Schlüsselloch des Kastens und durch die Öse des Schraubverschlusses einer Leimtube zogen, welche wir an die Decke geschraubt hatten. Von dort baumelte sie zu meinem Bett hinunter. Das Gleiche taten wir im gegenüberliegenden Bett des Nachbarzimmers, wobei ein Loch durch die Rückwände gebohrt wurde um an die Glocke zu gelangen. In der Nacht wurde dann heftig geläutet. Fast tumultartig brach ein Aufschreien in den Zimmern aus, denn die anderes wussten nichts davon. Es dauerte nicht lange bis Pater Eichmann, welcher sein Zimmer vor unserem hatte, beim Eingang mit einem Ratsch sämtliche Kippschalter der Beleuchtung betätigte. War er im nächsten Zimmer, läutete ich. War er bei uns, läutete mein Gegenüber. So jagten wir ihn von Zimmer zu Zimmer. Doch er fand nichts. Niemand verriet uns. Es brachte ihn fast zur Verzweiflung. Dann aber schrie er: "Alle aufstehen und anziehen!" Es ging durch den Verbindungsgang ins Schulzimmer und dann hiess es, wie es immer bei groben Verstössen hiess: "Lateinwörter von Seite X bis Seite Y abschreiben!"
Eine weitere Bierszene geschah am Abend, als die Drittklässler ins Lyzeum übertraten. Für sie hiess es, Aufnahmeprüfung bestanden, was zu einem abendlichen Festessen im Speisesaal und erlaubtem Konsum eines Bieres führte. Natürlich waren wir "Untere Semester" von diesem Fest ausgeschlossen, doch vernahm Markus Eichmann vom Bier das ausgeschenkt und wo es zwischengelagert wurde. Es gelang uns, sechs dieser Flaschen zu konfiszieren und sie via Dachwasserablauf des Zwischentraktes zum oberen Weiher zu transportieren. Dort versenkten wir sie im Wasser und befestigten sie mit Schnüren an Sträuchern. Das Fest lief grossartig. Es war sehr laut und auch die Patres, welchen endlich ihr Bierverlangen stillen konnten, sangen aus voller Brust Heimatlieder. Wir, die beiden Markus und ich taten natürlich dasselbe, aber lautlos beim Weiher oben. Des Alkohols ungewohnt kamen wir dann zu später Stunde etwas zu laut vom Weiher zurück. Das Fest war vorbei und viele schliefen bereits ihren Rausch aus. Nur Pater Breitler, einer unserer Lieblingspater, stand breitbeinig auf dem Schulhof. Die Fäuste in die Seiten gestemmt schaute er uns tiefschnaufend an. Dann sagte er: "Aber jetzt ab ins Bett! Wir sprechen morgen darüber!" Was dann passierte: Pater Breitler kam nie darauf zu sprechen. Vermutlich wusste er, dass der Rausch für uns Strafe genug war, denn uns war es die ganze Nacht sehr schlecht und wir mussten mehrmals erbrechen. Das bekamen so ziemlich alle in den Schlafräumen mit, was sich schnell im ganzen Friedberg herumsprach und wir deswegen noch lange gehänselt wurden.
Jede Klasse musste abwechslungsweise für den Samstagabend einen "Bunten Abend" vorbereiten. Als wir dran waren, konnten wir uns vor lauter guten Ideen kaum einigen. Fast obligatorisch war ein Wettbewerb und gemeinsames Singen. Als Startschuss des Abends wollten wir etwas einmaliges. Es sollte mindestens ein Kanonenschuss sein. Also bastelten wir im Estrich oben aus Karton und Dachlatten drei Kanonen deren Rohr eine Kartonrolle war. Der akustische Schuss wurde mit dem Zerplatzen von Papiertüten gelöst. Es musste aber auch noch Rauch her. In der Kollegiküche wurden wir fündig. Kein Rauch, aber weisses Waschpulver, welches durch mit Schläuchen durch das Rohr geblasen werden sollte. Der Abend kam. Die Eröffnung mit den Kanonenschüssen klappte hervorragend nur: die Patres in ihren schwarzen Sultanen sassen natürlich zu forderst und waren schlagartig weiss gepudert. Nur der Kopf des Rektor Gemperli glühte dunkelrot. Er sprang auf und brach den Bunten Abend mit zorniger Stimme sofort ab. An das Nachspiel erinnere ich mich nicht mehr ausser, dass wir auf die Organisatin von zukünftigen Bunten Abenden verzichten mussten.

(3)
René (links) mit Jos. Kohler am Eingangstüre putzen
Eines Tages fragte uns ein externer Schüler, ob wir am Fastnachtsumzug der Gemeinde Gossau mitmachen würden. Sein Vater war in einem Verein, an deren letzter Generalversammlung die Spaghetti völlig verkocht waren. Dieses Suchet wollten sie auf einem Wagen darstellen. Unsere Aufgabe war es, auf dem Wagen an Tischen zu sitzen und Spaghetti zu essen. Der Pater und Onkel von Markus Eichmann bewilligte es uns und so stellten wir wir am Umzug Spaghetti essende Gäste dar. Der Umzug ging sehr lange und zu allem Übel machten sie die Runde zweimal. Plötzlich kam einer von uns auf die Idee, Spaghetti ab Gabel über seine Schulter in die Zuschauermenge zu werfen. Er selber sah es nicht, doch wir sahen, wie die Spaghetti von Hüten und Köpfen herunterhingen. Spontan flogen nur noch Spaghetti über unsere Schultern und wir konnten uns kaum erholen vom Anblick der hängenden Teigwaren. Scheinbar fanden es die Zuschauer nicht lustig, es wurde reklamiert und am andern Tag durften wir als einzige des Friedberg nicht an den Kinderumzug. Wir verbrachten den Montagnachmittag mit Schlittschuhlaufen hinter dem Haus. Der Asphaltplatz wurde von Pater Breitler immer gespritzt und in ein Eisfeld verwandelt. Zwei vorbeilaufende Mädchen mit Schlittschuhen luden wir ein, mitzufahren. So war der Nachmittag für uns fast besser ausgefallen, als wenn wir den Kinderumzug hätten besichtigen sollen.Unser Rektor Gemperli war als Pallottiner und Priester der Erste, welcher im Fernsehen das "Wort zum Sonntag" halten durfte. Der ganze Friedberg sass an diesem Sonntag vor dem einzigen Fernseher im Speisesaal. In der Woche darauf konnten wir es natürlich nicht lassen, unseren Rektor während dem Religionsunterricht über seinen Auftritt auszufragen.
Es gab damals nur Schwarzweiss-Fernseher. Um einen entsprechenden Kontrast zu erreichen erzählte er uns, wie er vorerst gepudert und ihm dann die Lippen rot geschminkt wurden. Unser sonst schon hoch verehrter Rektor Gemperli war ab sofort in unserer Achtung noch weiter gestiegen.
Ein anderer von uns verehrter Pater war Pater Holzbein. Wie er richtig hiess, weiss ich nicht mehr, doch er hatte tatsächlich ein Holzbein, welches wir auch akustisch genossen, wenn er ein Stock höher durch den Korridor lief. Er war Deutscher und wurde im zweiten Weltkrieg verwundet. Er erzählte viel aus dieser Zeit und am meisten beeindruckte, wenn er von den Grossmäulern erzählte, welche dann an der Front einen Schock bekamen, unbewegt stehen blieben und natürlich vom Feind vor seinen Augen erschossen wurden.
Von Pater Klöpsch, meinem Geigenlehrer, habe ich im Kapitel Musik erzählt. Aber es gab noch einen Pater den ich sehr verehrte: unser Zeichenlehrer. Er hatte auch ein Malatelier und da ich recht begabt war im Zeichnen, konnte ich ihm in der Freizeit nicht nur zuschauen, sondern durfte mit Ölfarben ein abstraktes Bild von ihm abkopieren. Im Zeichenunterricht machte er einmal einen Wettbewerb für das ideenvollste Bild. Als er mein Landschaftsgemälde sah war er endtäuscht, denn, wie er sagte, hatte er von mir mehr erwartet. Ich sagte ihm darauf, er solle einmal daran riechen. Ich war vorher im Waschraum und suchte verschiedene Farben aus Zahnpastatuben zusammen aus denen dann mein Bild entstand. Ich kriegte den ersten Preis!
Wenn wir spazieren gingen, dann nur als Gruppe und Gruppenleiter. Unser Gruppenleiter hiess Günz und war zwei Klassen höher als wir. Ann der Fasnacht hatte ich Wasserpistolen gesehen, welche ich schon lange gerne gehabt hätte. Eines späteren Nachmittag schlich ich zusammen mit Markus Eichmann ins Dorf. Dort gab es einen Billigladen der allerlei Spielsachen anbot und "Zur Stadt Paris" hiess. Wir bekamen unsere Wasserpistolen und
kehrten unbemerkt wieder zurück. Dass dieser Laden mir Jahre später einmal Glück bringen sollte war unvorhersehbar.
Das kam so: Ich wurde im Militär nach den WK`s für den Landsturm umgeteilt. Sie benötigen im Armeestab zwei Wachmeister. Der eine war einer der Gebrüder von Guezli-Hug und der andere natürlich ich. Das ging jedoch nicht, ohne vorher einen Stabskurs in Interlaken zu absolvieren. Wir zwei waren die einzigen Nichtoffiziere am Kurs und wurden am ersten Kurstag etwas schräg angeschaut. Als dann aber am zweiten Tag über die Armeereform 80 referiert wurde und dass ab sofort wir zwei Unteroffiziere neu im Stab zugeteilt seien, kamen alle uns freudig zu begrüssen. Am zweiten Abend hatten wir auch gemeinsam Ausgang in Interlaken. Da gab es doch tatsächlich einen Laden "Zur Stadt Paris". Ich erklärte einem Major neben mir, dass ich ganz erstaunt sei, dass es davon mehrere gäbe. Er fragte mich natürlich, woher ich denn den Laden kenne. Als ich ihm dann von Gossau erzähle kam es heraus, dass er als Externer auch im Friedberg studierte. Inzwischen war er Berufsoffizier mit Büro in der Militärverwaltung in Bern geworden. Wir wurden gute Freunde und als ich ihm einmal telefonisch erzählte, dass ich noch ein paar Dienstage benötigen würde, lud er mich sofort in die Militärverwaltung ein, wo ich eine Woche lang von ihm und den Mitarbeitenden echt verwöhnt wurde.


(1)

(2)
Platsch (links) und ich 1966 zu Hause
Während meinem weiteren Studium in Architektur gäbe es nicht viel zu berichten, denn irgend wann wird man ja erwachsen und ernsthaft, hätten nicht die Rodensteiner für etwas Abwechslung gesorgt. In der Rekrutenschule war mein bester Freund Armin Hug, ein Lehrer. Er war Eliteschwimmer und ein reines Muskelpaket. Ich war ziemlich das Gegenteil. Doch ergänzten wir uns vorzüglich. Als Kraftprotz half er mir auf den langen Märschen den Rucksack oder das Sturmgewehr zu tragen, während ich ihn mehr psychisch unterstützen konnte. Das war vorallem dann notwendig, wenn er wieder einmal durchdrehte und innert Sekunden den ganzen Kasteninhalt auf sein Bett schmiss. Aber auch während Pausen oder in der Freizeit diskutierten wir viel oder hörten Musik aus meinem Taschenradio.
Er erzählte mir, dass sie vor einem Jahr zu viert die Sängerschaft der Rodensteiner gegründet hätten und er sich freuen würde, wenn ich mitmache. So ging ich dann mit ihm nach dem Militärdienst nach Zürich an ein Studententreffen. Dort lernte ich Felix Nöthiger, genannt Filou, Manfred Zobel v/o Silo und Ueli Mooser v/o Schmo kennen. Armin Hug nannten sie "Platsch", weil er ja eine Wasserratte war. Alle kamen aus dem Lehrerseminar Küssnacht und der entsprechenden Mittelschulverbindung. Sie gründeten diese Univerbindung nach dem Namen von Ritter Herr von Rodenstein, einem Helden aus dem Buch von Werner Bergengrün.
(3) Mit Filou bei mir zu Hause 1966
Filou, der eigentliche Anführer dieses Gremiums erzähle mir schon in der ersten Begegnung über seinen Einsatz in der Fremdenlegion und zeigte mir von ihm ein Portraitfoto mit Perret und Uniform. Doch Platsch hatte mich vorgängig gewarnt, dass Filou seinem Vulgo auch entspreche und so war alles natürlich nur Schau, erstunken und erlogen. So holte ich ihn einmal an einem Samstagabend zu Hause in Rüschlikon ab, um nach Zürich ins Niederdorf zu gehen. Geld hatten wir nur wenig, gingen dort aber in ein Kellerlokal wo er bald einen geeigneten Mann fand, auf ihn zuging und diesen überschwänglich begrüsste. Leider war dieser ganz konsterniert, denn er kannte Filou nicht. "Ob er denn einen Bruder hätte, der im Segelclub sei" fragte Filou. Ja, das war so, aber nicht im Segel- sondern in irgend einem anderen Club. Filou fing sofort an in Erinnerungen zu schwelgen und dessen Bruder zu rühmen. So tranken wir uns dann den ganzen Abend auf dessen Kosten einen kleinen Rausch an, und kehrten spät abends wieder nach Rüschlikon zurück.
Der Silo, dessen Vulgo aus seiner schlanken und grossen Gestalt entstammte und später Generaldirektor einer Versicherungsgesellschaft wurde, hatte die Eigenart, am Ende eines Restaurantbesuchs immer eine Serviertochter abzuschleppen. Da ich mit dem Auto via Sihltal nach Zürich fuhr, durfte ich ihn dann samt Neueroberung nach Rüschlikon transportieren. Den Schmo nannten wir auch Pan, denn er war ein vorzüglicher Musiker, der Handarmonika und Klarinette spielte. Wir musizierten mehrmals zusammen, indem er mich an der Geige mit dem Akkordeon begleitete. Heute ist er in der Volksmusikszene als Ueli Mooser bestens bekannt und Träger des goldenen Violinschlüssels.
Absolut unvergesslich war die Kutschenfahrt im Zürcher Unterland. Wir hatten kurz zuvor neue Uniformen für die drei Chargen gekauft und diese mussten natürlich präsentiert werden. Sie bestanden aus: weisse Hose in schwarzen Stiefeln, schwarzem Kittel mit breiter rot-weiss-schwarzer Schärpe, der Studentenmütze und natürlich dem angehängten Säbel. Filou hatte einen Kutscher ausfindig gemacht, welcher mit uns eine Beizentour im Zürcher Unterland machte. Filou sass natürlich mit auf dem Kutschbock und wir anderen vier in der Kutsche. In der ersten Landbeiz gab es mehre Kaffee mit Schnaps. Dasselbe dann auch in der zweiten, wobei es immer teurer wurde. Deshalb kam einer auf die Idee dort zu fragen, ob wir auch eine Flasche Träsch kaufen konnten. Von da an wanderte die Flasche vom Kutschbock in die Kutsche und zurück, bis einer beim Aussteigen mit der Uniform in den Dreck viel. Das war für Filou dann zu viel und er befehligte dem Kutscher zurückzukehren. Der Kutscher, ein Bauer, hatte immer wacker mitgetrunken, sodass wir nur dank dem Heimweh des Pferdes wieder zum Bauernhof zurück gelangten.

(4)
v.l.n.r.: Bliz, Plato, Filou, ich, Grimm, ?, ?, Nabucco,?, Strongus, Smile, Saxo
Am 18. Dezember findet jedes Jahr die Gründungsfeier - die Stiftungskneipp - im Hotel Sonne in Küsnacht/ZH statt. Die Sonne war jahrelang unser Stammlokal und der Wirt v/o Strick wurde ebenfalls in die Verbindung aufgenommen. Die Beziehung zur Sonne begann 1963 während der Zürcher Seegfröri. Die vier Gründer wollten auf dem See ein Fass Bier aufschlagen. Leider kam kein Tropfen heraus, da das Bier bereits eingefroren war. Das wurde von einem Mann beobachtet, welcher dann zu ihnen ging, sie dumme Jungs nannte und befahl, das Fass in den Kofferraum seiner Mercedes zu legen und einzusteigen. Er stellte sich als Hotelier der Sonne Küsnacht vor und lud die Rodensteiner ein, bei ihm ein Bier zu genehmigen, bis das Fass aufgetaut war. Von da an wurde die Sonne zum Stammlokal und Strick spendete manche Bierrunde, sofern es seine Frau nicht bemerkte.Der 18. Dezember wurde anfänglich als Stiftungsball gefeiert. Da ich noch keine Partnerin wollte, sprang das erste mal meine Cousine Anneliese aus Schattdorf ein. Doch bereits beim zweiten Ball bekam ich von ihr eine Absage, da sie inzwischen einen Partner hatte.
So blieb für mich nichts anderes übrig, als nach einer Dame Ausschau zu halten. Ich suchte allerdings noch nicht nach einer Bindung. Die einzigen Damen die ich kannte waren im Orchester. So fragte ich dann Rita Burkard, welche ich als sehr nette Mitspielerin kannte, ob sie bereit wäre, mit mir an diesen Ball zu gehen. Daraus entstand eine Freundschaft, welche 1971 zur dauernden Bindung, also zur Hochzeit, führte.

Ministrant sein in den 1960er-Jahren
Als im Religionsunterricht der Pfarrer sagte, wer gerne Ministrant werden möchte solle sich bitte melden, wurden kaum ein paar Hände gehoben. Ministranten waren ja diejenigen, welche in der Kirche das Opfer einzogen und vorne am Altar während dem Gottesdienst herumhantierten. Genaueres wussten wir nicht und das ganze musste zuerst daheim besprochen werden. Meine Eltern glaubten, das wäre sicher etwas für mich und da ich relativ pflegeleicht war, glaubte ich es ihnen und meldete mich an. So trafen wir uns, gut ein Dutzend Knaben, denn Mädchen durften noch nicht ministrieren, im Pfarrhaus zum ersten Unterricht. Pfarrhelfer Schwegler erklärte uns in etwa, was wir zu tun hätten und sprach von einer Aufnahmeprüfung, welche uns am Schluss zum ministieren befugte. Für uns hiess das somit, nicht nur wissen, was wir zu tun hatten, sondern vor allem lateinische Gebete büffeln, da damals die Messe noch in Latein gefeiert wurde. Das „Confiteor“ war das längste der Gebete und geht mir heute noch nicht aus dem Kopf: Confiteor Deo omnipotenti, beate Mariae semper Virgini, beato Michaeli Archangelo etc. etc., wobei wir mit der rechten Hand mitten im Gebet auf die Brust das „Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa“ klopfen mussten. Unserem Pfarrer Fridolin Roos ging unser „Confiteor“ immer zu lange und fuhr mit seinem Gebet weiter, sobald er das „mea culpa“ hörte.
Irgendwie schafften wir alle die Ministrantenprüfung und erhielten bei der feierlichen Übergabe in der St. Anna –Kapelle ein Aufnahmezertifikat. Die Kapelle war voll gestopft mit Ministranten und den Eltern der Neulinge. Dass auch mein Vater anwesend war hörte ich, denn er hatte das lauteste Organ, welches bei den Liedern jedes Mal die Röte in mein Gesicht trieb, zumal sein Gesang meistens durch einen ebenso lauten Toscanellihusten unterbrochen wurde.
Ja, und dann kam irgendwann der Tag, an dem wir uns bewähren mussten. Um nicht schon das erste Mal zu viele Fehler zu machen, wurden wir in einem Pontifikalamt eingesetzt, wo drei altbewährte Ministranten das Ministrieren übernahmen und wir als Kerzenträger fungierten. Nervös auf unseren ersten Auftritt wartend verteilten wir uns in der Sakristei, wo wir den roten Rock, die gestickte Bluse und den roten Kragen anzogen. Die Bluse hatte ein gesticktes Bord am unteren Ende mit vielen Löchern darin. Wir warteten also auf unseren Einsatz. In der rechten Hand hielten wir den Kerzenständer, dessen Flamme bereits zu erlöschen drohte. In der Nervosität bemerkten wir nicht, dass sich die Finger der linken Hand automatisch in die gehäkelten Löcher der Bluse bohrten und merkten auch nicht, was das immer röter werdende Gesicht des Pfarrers zu bedeuten hatte. Und dann, wie ein Kanonenschuss, platschte dessen rechte Hand auf unsere Ohren, deren Hitze jegliches Wort des Pfarrers erstickte. Wir wussten auch so, weshalb sich der Pfarrer so aufregte. Die anschliessende Messe verlief in höchster Konzentration und damit die inzwischen abgekühlten Ohren wieder etwas Blutzufuhr erhielten, erklärte uns der Pfarrer, dass wir Lochbohrer zur Strafe am nächsten Samstag die Kirche wischen durften.
Die Strafe hielten wir bereits am andern Tag nicht mehr als gerechtfertigt, beziehungsweise arg übertrieben. Wir wurden zu Kumpeln und schworen uns Rache. So fanden wir uns am Samstag pünktlich um 13.00 Uhr in der Sakristei ein, wo wir vom alten Sakristan Hotz mit Besen ausgerüstet wurden. Da ab 15.00 Uhr gebeichtet wurde, mussten wir uns entsprechend sputen. Zudem wurde erwartet, dass auch wir zur Beichte gehen, was wir bereits in unsere Rache eingeplant hatten. So beendeten wir unsere Wischstrafe zur Zufriedenheit des kurzsichtigen Sakristans, gaben jedoch nicht alle Besen zurück, sondern platzierten einen, mit Bürste nach oben, hinter der Türe des Beichthäuschens, wo der Pfarrer die Beichten abhörte. Dann warteten wir als erste in der Kirchenbank auf die Ankunft des Pfarrers. Inzwischen hatten sich auch andere Beichtende in der Kirche eingefunden und kurz vor 15.00 stolzierte der Pfarrer vom Hintereingang in die Kirche. Sämtliche Anwesenden konnten darauf nur mühsam ein Kichern unterdrücken, als der Besen direkt auf den Pfarrerskopf fiel und jede Morgenröte war schwächer als das Gesicht des überraschten Geistlichen. Dass er etwas über die Vergesslichkeit des Sakristans brummte, tat uns erst recht gut.
Sakristan Hotz war wie erwähnt nicht nur alt sondern auch kurzsichtig. So stritten wir uns nach der Messe wieder einmal in der Sakristei herum, wobei der Sakristan Frieden stiftend eingriff. Nach unserem Streitgrund befragt erklärten wir, einer hätte behauptet, dass immer eine Kerze auf dem Hochaltar brennen müsse, was vermutlich nicht stimme. „Blödsinn“ sagte er, “natürlich muss keine Kerze brennen“. Er nahm den am langen Holzstil befestigten Kerzenlöscher, der aus einem Eisentrichter bestand, und torkelte zum Hauptaltar. Nun mussten wir pressieren. Die einen nahmen einen zünftigen Schluck aus dem Messwein und andere stahlen aus der Blechdose im unteren Kästchen einige ungesegnete Hostien. Der Mutigste aber nahm die runde Holzbüchse auf dem Tisch und entnahm ihr eine grosse Hostie, welche der Pfarrer während der Wandlung benötigte. Dabei wurde peinlich genau darauf geachtet, dass ja keine Brose einer Hostie oder ein Tropfen Wein übrig blieb und uns verriet. Inzwischen kam auch der Sakristan zurück und ärgerte sich über unsere Behauptung, wobei wir ihm erklärten, dass wir nicht meinten, dass gerade jetzt eine Kerze auf dem Altar brenne.
Am meisten erstaunte uns an Sakristan Hotz, dass er jedes Mal während der Predigt in der Bank neben dem Sakristeieingang einschlief und schnarchende Geräusche von sich gab. Kaum war jedoch die Predigt vorbei und er musste dem Pfarrer etwas helfen, erwachte er sofort und schlurfte zum Altar. Seine innere Uhr funktionierte! Da er sonst ein Frühaufsteher war, ersetzte er immer den Ministrant am Sonntagmorgen, welcher in der Frühmesse um 06.00 Uhr hätte ministrieren müssen, aber verschlafen hatte. Mir konnte dies leider nie passieren, denn meine Mutter kannte meinen Einsatzplan auswendig und weckte mich am Sonntagmorgen früh genug.
Auch wenn wir nicht jeden Sonntag ministrieren mussten, so hielten wir uns doch gerne während der Messe in der Sakristei auf oder sassen in der langen Bank rechts vom Altar. Wieder einmal war eine Messe mit vielen Liedern, welche von der Orgel begleitet wurden. Unter den Organisten gab es einen Lehrer Waldis, genannt Wädi, welcher das Orgelspiel nie erlernt hatte, jedoch des Klavierspielens kundig war. Das jedoch glaubte nur er, denn er konnte nicht verhindern, dass er zwischendurch falsche Tasten drückte und dies meistens unter Zuzug sämtlicher Register. Und als eben der Wädi wieder einmal daneben orgelte, schlichen wir uns via Sakristei in den Raum des Bubenchores, welcher über der Sakristeitüre als offener Bogen sichtbar war. Dort oben befand sich ein altes verstaubtes Harmonium, welches schon lange nicht mehr gestimmt wurde. So setzte sich dann einer an dieses Instrument und bewegte die Fusspedalen, sodass der Blasbalg die Luft in die Pfeifen presste. Dann drückte er irgendeinen Ton, denn vom Harmoniumspiel hatte er keine Ahnung. Wir andern streckten den Oberkörper so weit als möglich über die Brüstung des Bubenchores und freuten uns, als wir sahen, wie immer mehr Andächtige ihren Kopf in Richtung Orgel drehten und dachten“ Der Waldis spielt heute aber wieder fürchterlich“.
Der Höchste der Ministranten war der Zeremoniar, welcher der älteste und somit auch erfahrenste Ministrant war. Natürlich war er auf seine Stellung auch sehr stolz, was er uns damit zeigte, indem er dauernd herumkommandierte. Es war Zeit, auch ihm einen kleinen Denkzettel zu verpassen. Sein grosses Solo während der Messe war das Weihrauchfassschwingen in Richtung Kirchenvolk: einmal links, einmal rechts und zum Abschluss in Richtung Mitte. Damit das Weihrauchfass auch die ganze Messe hindurch qualmte, mussten wir neben dem Sakristeiausgang auf einem, mit einer Heizspirale versehenen Grill die Kohlentablette beidseitig anbrennen bis sie durchgeglüht waren. Wir brannten sie jedoch einmal nur kurz auf beiden Seiten an, damit sie genug Rauch entwickelte, wenn der Zeremoniar die Harzkörner draufstreute. Bereits fünf Minuten nach Beginn der Messe kam kein Räuchlein mehr aus dem Weihrauchfass und als der Zeremoniar seinen Kessel gegen die Gläubigen schwang konnten wir, die rechts und links von ihm standen, ein hämisches Grinsen nicht unterdrücken.
Dem Einziehen mit der Opferbüchse ging immer ein kleiner Machtkampf in der Sakristei voraus. Da das Opfereinziehen auf der Frauenseite immer viel länger dauerte als auf der Männerseite, durfte derjenige, der für die Männerseite zuständig war, auch das Opfer auf der Empore, links der Orgel, einziehen. Dort oben waren meistens nur Männer anwesend, wobei in den obersten zwei Reihen die Bauern sassen. Mehr als einmal habe ich beobachtet, wie zwei Bauern mit ihrer Hand einschlugen und so eine Kuh handelten. Bei diesen Reihen musste man auf der Kniebank gehend jedem Mann die Büchse separat hinhalten, worauf er meistens einen Fünfziger in die Kasse und einen Zwanziger uns in die Hand drückte. Dieser Zustupf konnten wir natürlich behalten und begründet auch den vorausgehenden Kampf in der Sakristei.
Die längste Messe war das Hochamt an der Weihnacht, die Mitternachtsmesse. In den vorderen Bänken sassen meistens Reformierte, die sich das Schauspiel nicht entgehen lassen wollten. Wir, die nichts zu tun hatten, sassen in der langen Bank im Chor. Wenn dann das „Vater unser“ gebetet wurde, welches wir inbrünstig mitbeteten, staunten die Reformierten nicht schlecht, dass wir plötzlich im Gebet hintennach hinkten. Gott sei Dank verstanden sie unsere Worte nicht denn wir beteten: „…gib uns heute unser tägliches Wurst und Brot und ä chli Senf dezue“.
Von Pfarrer Fridolins rotem Kopf habe ich schon berichtet. Am rötesten war dieser jedoch auf einer Ministrantenreise, als alle Ministranten nach der Melodie von „Der Ro- Ro- Ro- Ro- Robinson, Robinson…“ sangen: „Dä Fri- Fri- Fri- Fri- Fridolin, Fridolin, putzt siis Arsch mit Sigolin…“. Ich bedauere den riesigen Anpfiff, welcher unser Ministrantenpräses Arnold „vulgo Schnitz“ deswegen erhielt, heute noch.
Vor der Wandlung schenkten wir in den Kelch jeweils Wasser und Wein ein. Jeder Priester hatte so seinen Wunsch, was die Menge anbelangte. Absoluter Feinschmecker war unser Professor Stampfli, genannt Profax. Wenn man mit dem Weinkännchen einzuschenken begann, wartete man vergebens, dass er seinen Kelch hob um anzuzeigen, dass genug sei, sodass man die ganze Kanne hineinschüttete. Wenn man dann aber mit der Wasserkanne einschenken wollte, hob er den Kelch zum Voraus und kehrte sich wieder zum Altar um. Las der Profax am Seitenaltar die Messe, so
hatte er die Angewohnheit , uns schon in der Sakristei am Genick zu packen, uns vor dem Hochaltar zur Kniebeuge zu zwingen um uns dann zum Seitenaltar zu führen und erst dort loszulassen, was bei uns fast zur totalen Genickstarre führte.
Wer Glück hatte, durfte zwischendurch in der Italienermesse in der St. Annakapelle ministrieren. Man verstand zwar kaum ein Wort, doch die Predigt war sehr kurz, sodass die Messe nach zwanzig Minuten beendet war. Das Störende daran war das Opfereinziehen, denn die am Anfang der Bank sitzenden Italienerinnen tätschelten uns mit der Hand ins Gesicht oder auf den Hintern um uns mit einem überlauten „Brava“ oder „Tanti saluti “ weiterziehen zu lassen.

Kako si? – fala dobro.
Es war für unsere Buben Igor und Niccolo immer klar: eine Heirat kam für sie nie in Frage. Sie hatten ihre Kollegen mit denen sie die den grössten Teil ihrer Freizeit verbrachten. Hie und da waren auch Mädchen dabei, welche sie in der Disco kennen lernten, doch ihre Ansicht über diese jungen Damen tönte einheitlich gleich: „Karrierefrauen, welche viel Geld verdienen wollen um ihren Spass und ihre Unabhängigkeit im Leben zu haben, auf nichts verzichten zu müssen und sich alles leisten zu können. Solche wollten sie nicht!
Meine Frau und ich hatten uns mit deren Einstellung bereits abgefunden denn bei Diskussionen zu diesem Thema erneuerten und bekräftigten sie immer wieder ihre Einstellung. Wir waren uns klar, dass in einer Zeit der zunehmenden Zahl von Alleinerziehenden und Patchworkfamilien, unsere konservative Einstellung nicht mehr angebracht war. Unsere Jungs waren Machos!
Es war anfangs Sommer 2005, als ich einen Exjugoslawen auf der Strasse antraf, welchen ich schon länger kannte und mit ihm immer über alltägliches sprach. Beim Abschied sagte er mir dann: „Tschüss, wir sehen uns ja Ende Monat wieder.“ Stirnrunzelnd fragte ich ihn, was er denn damit meine. „Ach“, sagte er überrascht, “hat Nico dir gar nichts gesagt?“ und erzählte mir dann fast entschuldigend, dass mein Sohn doch Ende Monat heirate. Es störte mich schon, dass ich eine so wichtige Tatsache auf der Strasse vernehmen musste und sagte dies auch recht aufgebracht meiner Frau, welcher unsere Söhne ihre sämtlichen Probleme anvertrauten. Doch schon ihr Gesichtsausdruck sagte mir, dass sie davon nichts wusste und so einigten wir uns, Nico darauf anzusprechen. „Ja, er möchte da kein grosses Aufsehen machen und hätte dies deshalb nicht an die grosse Glocke gehängt“ und dann erzählte er uns, dass sie aus Mazedonien komme, noch kein Deutsch könne, 22 Jahre alt und bereit sei, eine Familie zu haben. Der Hochzeitstermin im Zivilstandsamt Baar sei auf Ende Monat anberaumt und seine Frau Anifa werde nächste Woche eintreffen.
Das darauffolgende tiefe Einschnaufen meiner Angetrauten war unüberhörbar und als dann auch noch ihre Wangen aufglühten kam es dann auch explosionsartig aus ihr heraus: „Du kannst doch nicht einfach stillschweigend heiraten!“ Mindestens deine Kolleginnen und Kollegen aus dem Geschäft werden gratulierend vor dem Rathaus stehen und anschliessend musst du sie dann ins Restaurant einladen!“ Nico hatte sich das Ganze doch zu einfach vorgestellt. Jedenfalls begann meine Frau Rita sofort zu organisieren: sie bestellte mehrere Tische im Rathauskaffee für Nico`s Kolleginnen und Kollegen, sowie ein Restaurant in Weggis, wo unsere Familie, sowie die Nebenhochzeiterin und deren Mann das Mittagessen einnahmen.
Die Anfangszeit war weder für Anifa, welche kein Deutsch konnte und uns, welche kein Mazedonisch konnten nicht einfach. Rita ging sogar in den Sprachunterricht zu einem Mazenonier, welcher eigens für sie einen Schulstoff entwickelte. Kaum ein Jahr später gab sie auf. Obwohl sprachgewandt hatte sie überhaupt keinen Bezug zur Sprache, welche weder germanischen noch lateinischen Ursprungs war. Slawisch ist für uns völlig unbekannt und es gibt keine Wörter, welche man von dort ableiten könnte. Aber Anifa lernte ja immer besser Deutsch durch sprechen mit Niccolo, welcher ja Serbisch konnte. Irgendwann kam es heraus, dass er von Kollegen im Malerbetrieb, mit denen er ein paarmal nach Exjugoslawien fuhr, Serbisch lernte. Dies war die Einheitssprache in Jugoslawien. Niccolo hatte Anifa in Mazedonien, weit weg von einer Stadt, im Dorf Melnizza kennengelernt und sich sofort verliebt. Der Kontakt lief per Telefon, und da er für Anifa kein Einreisevisum erhalten konnte, gab es nur die Lösung mit der Heirat.
Ein Jahr später wollte Anifa zu Hause kirchlich heiraten. Also flogen Rita und ich nach Skopie und mieteten ein Auto bei Herz. Die Vermieterin fuhr voran an einen Stausee in der Nähe von Veles, wo wir ein Hotel bezogen. Das Hotel hatte am Wochenende eine Aussenbar und Livemusik von bekannten Künstlern. Die Bediener an der Bar waren Studenten, welche nicht glaubten, dass sie jemals in einem anderen Land arbeiten können, da sie kaum ein Visum erhalten. Erst ein paar Jahre später wurde die Einreise nach Europa für drei Monate ermöglicht. Die Speisekarte des Hotels war Englisch/Mazedonisch. Leider waren die Zeilen zueinander verschoben, sodass anfangs das Falsche kam, bis wir die Verschiebung bemerkten. Als wir am zweiten Tag in die Stadt Veles fuhren, hatte ich einen Antiquitätenladen fotografiert, welcher sich später als Secondhandshop herausstellte. Alles wurde geflickt und wieder verwertet. Nach unsere Einschätzung war Veles mindestens 60 Jahre hinter der Schweiz zurück. Die Autos fuhren in einem schäbigen Zustand herum. Die Fahrregeln entsprachen dem Recht des Stärkeren. Benzin wurde nur so viel getankt wie man gerade benötigte um ans Ziel zu kommen. Wir trafen dann die Mutter von Anifa, tranken in einem Café fünf kleine Flaschen Süssgetränke, welche zusammen ganze Fr. 2.50 kosteten.
Am dritten Tag fuhren wir dann hinter Niccolo und Anifa her nach Melnizza. Die auf dem Hügel gelegenen Lehmhäuser und ausgefahrenen Naturstrassen überzeugten uns, dass das Dorf noch einmal 20 Jahre zurücklag. Einem alten Mann, der an der Strasse sass wurden wir vorgestellt. Mit der Zeit bemerkten, dass die alten Menschen sehr achtungsvoll behandelt werden. Dann trafen wir auch den Vater von Anifa und ihre zwei Schwestern zu Hause an. Es gab einen eingezäunten Innenhof mit einem, aus Lehmsteinen gebauten 3-Zimmer Haus. Die Küche mit Holzfeuerung war in einem separaten Backsteinhaus und auch die Toilette. Hinter dem Haus gab es auch einen Brunnen für die Morgentoilette. Das WC-Häuschen, auf das Nico eine TV-Antenne montieren liess, damit die Eltern Schweizer-Fernsehen schauen konnten, war sehr spartanisch. Eigentlich war ein Zementüberzug mit Bodenablauf vorhanden, sowie ein Wasserschlauch, mit dem alles herunter gespült werden konnte. Da Nico aber wusste, dass das für uns doch etwas zu primitiv war, liess er eigens ein Geberit-WC auf den Bodenablauf stellen und schloss den Schlauch am Spülkasten an. Wir wurden im Innenhof vielen Dorfbewohnern vorgestellt und alles war sehr herzlich. Die dunkelgekleideten Frauen und auch ihre Männer sahen jedoch schon mit 40 Jahren alt aus und hatten kaum noch Zähne. Wir wurden auf jeden Fall um einiges jünger geschätzt als wir eigentlich waren.
Am anderen Tag wurde morgens unser weisser Mazda mit Blumen dekoriert. Er war, obwohl schon älter, das schönste Auto in der Umgebung. Für die 180-köpfige Hochzeitsgesellschaft wurden Busse organisiert. Aber vorerst liefen wir mit der Familie in die Moschee. Wir zogen die Schuhe vor der Eingangstüre aus und setzten uns in der Kirche an den grossen mittleren Tisch. Rita und ich je kopfseitig gegenüber, das Brautpaar auf einer Längsseite und der Imam gegenüber. Der Imam in dunkler Kleidung und mit weisser Kopfbedeckung begrüsste uns und erzähle etwas, was wir nicht verstanden. Scheinbar bemerkte er dies, denn sofort wurde telefonisch in der Hochzeitsgesellschaft draussen ein Deutschsprechender gesucht. Schlussendlich war ich ja als Trauzeuge bestimmt und musste etwas unterschreiben. Die Eltern von Anifa und ihre jüngere Schwester standen hinter dem Brautpaar.
(1)
Dann konnte es weitergehen und der Imam erzähle und wünschte vieles, was auch unser Hochzeitspfarrer damals erzählt hatte. Als er dann allerdings zum arabischen Gesang ansetzte, welches für unsere Ohren völlig komisch klang, bemerkte ich, dass Rita mir gegenüber kaum das Lachen unterdrücken konnte. Natürlich steckte sie mich an und wir waren beide froh, als der Gesang vorüber war. Beim Auszug sagte ich unserem Übersetzer, er solle dem Imam ein Komplement machen und sagen, dass unser Priester damals viel ähnliches sagte. Dazu meinte der Imam, dass Allah gesagt hätte, dass der Abstand zwischen Moslem und Christentum ein Haar betrage.
Nun ging es mit 180 Personen und zwei Autocars zum Hochzeitsfest in ein ehemaliges Schulhaus. Eine Fünfmann-Musik mit Sängerin erwartete uns mit lauter serbischer Musik. Ein Fotograf filmte, einer fotografierte und es wurde viel reihum getanzt. Zwischendurch hielt ich die laut Musik jedoch nicht mehr aus und ging mit dem Fotoapparat bei dem angrenzenden Dorf auf Erkundungstour. Da fand ich etwas völlig überraschendes: Bei einem Bauernhof waren drei Körbe, welche ich nur aus Wilhelm Busch`s Buch kannte und nie glaubte, dass es sowas noch gab. Es waren aus Binsen geflochtene Bienenkörbe! Das bestätigte mir auch, wie weit zurück Mazedonien noch war. Zwischendurch haben wir uns wieder im Reihentanz bewegt, viel gegessen und getrunken um am späten Abend wieder ins Hotel zurückzukehren.

Die Sommer - Rekrutenschule der Gebirgsfüsiliere in Bellinzona war angenehm. Einerseits unterstützte mich Armin Hug bei körperlichen Anstrengungen und andererseits hatten wir einen tollen Korporal und einen ebensolch tollen Leutnant. Dieser hatte eine verdrehte Hüfte, war also ein Krüppel, und als Lehrer ein ausgezeichneter Pädagoge. Wenn jemand das Gewehr oder den Rucksack nicht mehr tragen konnte, nahm er diesem die Last ab. Meistens ging es nicht lange, da verlangte der Rekrut das Gewehr oder den Rucksack wieder zurück. Wir dachten, wenn ein Krüppel dies tragen konnte, sollte es für uns doch bedeutend einfacher sein. Wir waren eine kameradschaftliche Gruppe und hatten viel Spass miteinander. Dank dem guten Kontakt unseres Leutnants zum Kommandanten durften wir einmal eine Woche lang ein Bergdorf vom Dreck räumen, welches bei einem Sturm überflutet wurde. Neben mir wollte ein Kollege nicht mehr aufhören mit dem Bickel zu graben, bis ich ihm zurief, er sei ja bereit durch den Strassenasphalt. Zwischendurch kam eine alte Dame und steckte uns eine Schokoladen in die Jackentasche.
Ich hatte das Glück, als guter Zeichner den Kurs Mienenplan zu absolvieren. Dort lernten wir Minenfelder zu zeichnen und zu vermassen, um die Minen später wieder aufzufinden. Dann konnte ich mich noch als Nachrichtensoldat weiterbilden. Da wurden vor allem Karten mit Signaturen versehen, welche die verschiedenen Truppen und deren Aktionen darstellten. Wir hatten Kartenkunde und lernten funken. Während die anderen Rekruten auf dem Feld exerzierten, konnten wir uns in den Büroräumen weiterbilden. Eine tolle Woche war auch der Hochgebirgskurs, wo wie auf dem Cristallinapass vieles anwenden konnten, was wir wochenlang im Klettergarten geübt hatten. In der Dreier-Seilschaft mit Bickel über Schneekuppen gehen oder Rettung aus der Gletscherspalte üben, war schon sehr interessant. Wir übernachteten in Holzbaracken mit einem Kanonenofen in der Mitte. Der hatte bereits einen Riss, welche sich nach einer Woche gefährlich vergrössert hatte. Für den Urlaub Ende Woche hatte Vater eine Familienfoto beim Fotografen organisiert. Als er sah, wie braungebrannt ich aus dem Schneezurückkehrte, konnte er ein leises Fluchen nicht unterdrücken. Auf der Schwarzweissfoto war ich, trotz den Künsten des Fotografen, tatsächlich ziemlich dunkel im Gesicht abgebildet.
Als Abschluss der Rekrutenschule gab es eine Battailonsübung in Airolo und Umgebung.
Eines Abends wurde Armin, mein bester Freund zum Kommandanten beordert. Als er zurückkam erzählte er mir, dass er Korporal werden solle, was er aber sofort abgelehnt hatte. Später erzählte er mir dann, dass er gesagt hätte, dass er nur bereit wäre, wenn auch ich weitermachen würde. Am andern Tag wurden wir dann zusammen zum Kommandanten gerufen. Der erklärte uns, weshalb es gute Korporale benötige. Er wurde immer lauter, als er bemerkte, dass dies uns nicht sehr interessierte. Schlussendlich schrie er uns zusammen, legte uns ein Blatt vor die Nase und wir konnten nur noch verängstigt unterschreiben. Anderntags rief ich zu Hause an und erzählte meinem Vater von dieser Neuigkeit. Der war allerdings alles andere als erpicht, schrie ins Telefon, ob ich nicht klügeres zu tun hätte und nun wieder viel Zeit für die Weiterbildung verlor.

(1) René 1966 nach der Unteroffiziersschule
Im Frühjahr des folgenden Jahres ging es dann in die Unteroffiziersschule. Wir waren zu viert aus der gleichen Gruppe. Nebst Armin Hug und mir, noch Leo Brandenberg (Brändi) aus Zug und Beat Amstalder aus Schwyz. Bereits in der dritten von vier Schulwochen wurde Armin krank. Jeden Morgen hatte er 37,5 - 38 Grad Fieber und den Dünnpfiff. Er kam ins Stadtspital Bellinzona, wo er bis zwei Wochen vor dem Rekrutenschulende auskurierte. Er musste später den ganzen Dienst wiederholen. Wir hatten inzwischen unseren Leutnand kennengelernt, welcher sich als verwöhntes eingebildetes Etwas entpuppte.
Als die Rekruten eintrafen, stellten wir unsere 24 Anwärter auf ein Glied. Dann mussten sie von 1 - 4 durchzählen, denn wir waren vier Korporale. Jeder vierte war meiner gruppe zugeteilt und rein zufällig waren zur Schadenfreude der anderen, auch die dicksten drei dabei. Dann zwei Wochen später schickten sie Leo Brandenberg wegen ernsthaften Rückeproblemen nach Hause, sodass nur noch Beat und ich mit dem Leutnand den Rekrutenzug leiteten. Beat und ich waren nur noch frustriert und als sich der Leutnand als unfähig herausstellte, wurden wir auf die anderen Züge aufgeteilt. Meine Gruppe behielt ich aber. Es waren nette Kerle vom Land: Zuger, Urner, Schwyzer und Nidwaldner. Der Dickste, ein Kellner, bemühte sich enorm. Wenn ich ihn anfänglich am Nachmarsch auch mitziehen musste, so war er gegen Ende der Rekrutenschule eine der Schnellsten. Grossen Stolz hatte ich auf Rekrut Arnold. Er war ein Bauernjunge vom Haldi oberhalb Schattorf. Als sie nach einiger Zeit die Bestandteile des Sturmgewehres aufschreiben mussten, fragte ich mich beim Korrigieren, was Arnold da geschrieben hatte. Auf meine Frage hin sagte er, ich hätte die Bestandteile so gesagt. Da merkte ich, dass er alles auf Mundart aufgeschrieben hatte, weil er es nicht anders konnte. Z.B "Verschlossghüüs" was "Verschlussgehäuse" hätte sein sollen. Ich dachte, wenn Arnold auch Bauer wurde, so musste er doch Schreiben und Lesen könne. Also beauftragte ich ihn, jeden Abend im Tagesanzeiger die Spalte "Ueberfälle und Verbrechen" zu lesen und uns am Morgen darüber zu berichten. Das tat er dann auch. Als ich aber auf die Idee kam, sicherheitshalber diese Rubrik auch zu lesen, stellte ich fest, dass er alles nur erfunden hatte. Er konnte nicht mehr lesen! Ab sofort musste er alle Postentäfelchen anschreiben und jegliche Meldungen uns vorlesen. So lernte er bis Ende Rekrutenschule wieder Lesen und Schreiben und hat so mehr für`s Leben gelernt als nur "Liegenladen".
1967 waren die grossen Armeemanöver und das ganze 3. Armeekorps war im Dienst. Ich war als frisch gebackener Korporal dem Stab des Zuger Battailons zugeteilt. Im Stab des 3. Armeekorpsbenötigte es jedoch viele Leute für dieses ungewöhnliche Manöver, sodass ich meinen ersten Wiederholungskurs in der Stabskompagnie des AK3 absolvierte. Die Kompagnie bestand nur aus Motorfahrern und uns Nachrichtengruppe, welche ich zu führen hatte. Wir waren in den Holzbaracken in Andermatt untergebracht und benutzen die Kaserne als Büros. Meine Gruppe bestand vor allem aus Lehrern und Zeichnern, welche schon mehrere WK`s absolviert hatten. Am zweiten Abend hatten wir nach dem Hauptverlesen noch Kaderrapport, während die Soldaten in den Ausgang gingen. Wir machten im Restaurant 3 Königen ab. Als ich eine halbe Stunde später sie im Restaurant suchte, kam die Serviertochter auf mich zu und sagte, ich könne mit ihr kommen, sie hätte jetzt Zeit und die Kollegen würden alles übernehmen. Während meine Soldaten am runden Tisch fast erstickten vor Lachen, verstand ich nur Bahnhof. Die Serviertochter wurde ärgerlich, nannte mich dummen Schnösel und ich sei ein Idiot. Später hat sich herausgestellt, dass meine sauberen Soldaten mir ein Schäferstündchen mit der Serviertochter offeriert hätten. Der Abend wurde sehr lustig. Der Alkohol floss und plötzlich verabschiedete sich meine Gruppe, ihr Ausgang 3/4 Stunden kürzer war als meiner. Zwei Soldaten blieben allerdings bei mir, weil ich kaum mehr stehen konnte. Sie nahmen mich in die Mitte und begleiteten mich zu meinem Kantonnement. Leider wurden wir Vor der Unterkunft vom Furier abgefangen, welcher die beiden Soldaten und mich ins Kantonnement schickte und mit Folgemassnahmen drohte. Zum Glück passierte uns nichts.
Meinen 30sten Geburtstag feierten wir auf der Seebodenalp. Wir waren von Küssnacht aus mit Sack und Pack für eine Woche aufgebrochen, stellten Mannschaftszelte auf und machten von dort aus militärische Übungen. Da es nur ein Restaurant dort oben hatte, durfte nur das Kader nach dem Hauptverlesen dorthin. Ich wollte unbedingt meinen 30sten mit meiner Gruppe feiern und so beschaffte ich mit dem Rucksack genügend Flaschen Bier, womit wir anstossen und sie leise weiterfeiern konnten. Meine Bedingung an sie war aber klar: es durfte kein Flaschenscherben darauf hinweisen, dass ich ihnen Bier gebracht hatte. Sonst wäre ich für einige Zeit ins Gefängnis gewandert. Doch auf meine gruppe war Verlass. Wohin sie die Flaschen entsorgt hatten, habe ich nie vernommen.
Ich habe mich auch immer für meine Soldaten eingesetzt. Als wir einmal in die Kaserne Luzern einrückten, wusste ich, dass ich sie am Einrückungstag in der Soldatenstube treffen würde. Da dort niemand von ihnen anzutreffen war, sagte mir ein anwesender Soldat, dass ein Major sie für Kistenschleppen abkommandiert hatten. Für einen Selbständigerwerbenden frisch aus dem Zivil war das genau der richtige Start. Ich fand meine Gruppe und den Major und erklärt ihm mit überaus lauter Stimme, dass das was er gemacht habe nicht gehe und ich es verurteile. Es war der 3.WK in der Stabskopagnie und ich wusste, dass ich am Ende zum Wachmeister befördert werden sollte. Beim "werden sollte" blieb es allerdings, denn mein Kommandant erklärte mir, dass der Major sich über mein Gehabe beschwert hätte und als er vernahm, dass ich den WM bekomme solle, sagte er, dass dies überhaupt nicht in Frage komme. So musste ich dann ein Jahr länger warten, was aber bei der Truppe, als sie den Grund dafür erfuhr, mir grosse Achtung einflösste. Interessanterweise war der Major derjenige, der mich später für den Armeestab auserwählte.
Auch im Eigental verbrachten wir einmal unseren WK. Es gab Militärbaracken für die Offiziere, die Unteroffiziere und die Mannschaft. Im Zentrum jeder Baracke stand ein Ofen aus Gusseisen, welcher dauernd eingefeuert wurde, denn es war Winter. Ein Lastwagenchauffeur und Wachmeister stellte überaus wichtig eine Blechdose auf den Ofen und erklärte allen, dass dies sein morgendliches Rasierwasser sei und nicht angerührt werden dürfe. Am andern Morgen lagen wir auf der Matratze und schauten ihm beim Einseifen zu. Plötzlich ertönte ein schallendes Gelächter bis die ganze Baracke zitterte. Der Rasierende aber sagte, wir seien nur eifersüchtig und erst als er mit dem Rasierapparat hantierte, gaben ein paar Unteroffiziere zu, dass sie ihm in die Büchse gepinkelt hatten. Es war sein letztes warmes Rasierwasser!
Als ich die Wiederholungskurse absolviert hatte, ging es um eine Neuzuteilung in eine Landwehrtruppe. Ausgerechnet der Major, welcher mir seinerzeit den Wachmeister verhinderte, lud mich zum Gespräch ins Büro des Armeestabes in Zug ein. So wurden dann ich und ein Sohn des Guezli-Hug Malters als Nachrichtenunteroffiziere in den Armeestab aufgenommen. Es war eine sehr kameradschaftliche Zeit, in der jeder seinen Job verrichtete, egal welcher Dienstgrad er hatte. Aspirieren musste niemand mehr und so war die Zusammenarbeit mit viel Respekt und Anerkennung, denn man wusste, dass diejenigen, welche in den Armeestab eingeteilt waren, bewährte Leute waren. Wir waren eine Gruppe bestehend aus einem Oberst, zwei Majoren, zwei Hauptmänner und mir. Da wir 24-Stundenbetrieb hatten, musste auch die Ablösung gut funktionieren. Die Offiziere waren in einem Sechserzimmer, nur ich war in einem grossen Schlafraum zusammen mit anderen Unteroffizieren und Soldaten. Als es dann hiess, ich soll zur Erkennung den Helm vor die Bettstatt schnallen, sah ich sofort, dass dies auch andere getan hatten. So fanden sie mich denn nach der ersten Nacht nicht und ich verschlief natürlich den Start meiner Schicht. Die Lösung des Problems war einfach: ich musste im Zimmer der anderen fünf Offiziere schlafen. Doch das ging wieder wegen meinem Dienstgrad nicht. So wurde ich dann während dem Militärdienst dem HD (Hilfsdienst) in einer Offiziersfunktion zugeordnet, konnte im Zimmer mit den anderen Offizieren schlafen, mit den Offizieren essen und erhielt sogar einen höheren Sold.
Eine Armeestabsübung ging meistens nur 1 - 1 1/2 Wochen und fand im Bunker in der Nähe von Flüelen statt. Ausgang hatten wir höchstens in der Mitte der Woche einen Nachmittag samt Abend lang. Da wir in der Nähe von Altdorf waren, gingen wir einmal in das Dancing Spinne. Auch unsere Damen des Frauenhilfsdienstes hatten das gleiche Ziel. Als wir dann mit den Damen zu tanzen begannen, war das für die anwesenden Zivilisten so lustig, dass sie uns lachend zuschauten und auf eigenes Tanzen verzichteten.
Wir hatten im Bunker alles. Günstigen Kaffee, günstigen Wein, gutes Essen und gar eine Bibliothek. Das war aber auch notwendig, denn in den Korridoren war es sehr feucht, Taglicht sah man nicht und vor allem die Soldatinnen bekamen nach ein paar Tagen den Luftschutzkoller. Sie mussten immer die Haare hochstecken, damit diese unter die Mütze passten und durften weder Lippenstift noch Nagellack gebrauchen. Diese Vorschrift kam ausgerechnet von ihren weiblichen Vorgesetzten, was auch nicht zu einem angenehmen Aufenthalt beitrug. Als Brigadier Jeanmare der Spionage bezichtigt wurde, war es nicht mehr möglich, einfach in ein anderes Büro zugehen. Alle Räume wurden mit einer äusseren Sonnerie bestückt. Das Motto hiess, wenig wissen heisst wenig verraten. Noch schlimmer: überall hingen tafeln mit dem Spruch "Der Feind hört mit". Wir wurden immer frühzeitig über die zukünftigen Militärdienstzeit informiert und so erhielt ich vor meinem letzten Aufgebot die Meldung im Januar, wann dies für mich sein wird. Ich freute mich darauf, denn so konnte ich mich von allen Kolleginnen und Kollegen noch verabschieden. Als ich dann ein Monat vor dem entsprechenden Termin kein Aufgebot erhielt, telefonierte ich mit dem Armeestab worauf man mir erklärte, dass ich genug Diensttage hätte und keinen dienst mehr verrichten müsse. Schade, ich war endtäuscht. So war ich bis zum 42 Altersjahr aktiv und konnte mit fünfzig Jahren abgeben, ohne noch in den Zivildienst zu müssen. Natürlich liessen wir es am Abgabetag in Zug nicht nehmen, auf dem Heimweg eine Beizentour zu veranstalten. Gehörten doch die Wirte des Restaurant Schochermühle und des Baarer Falkens ebenfalls zu den Abgebenden.

(2)

(3)


(1) C
Conte (Graf) Della Gola Bigliotti
Nachfolgend zu BIGLIOTTI aus "Heraldische Spuren" Dossier: 804364; Adelsstand: Signori; Adel in Italia.
Alte Familie ursprünglich aus dem Piemont und Herren von Battifollo. Das Vorhandensein des Mottos in der dokumentierten Bibliographie der Familie bestätigt das edle Leben, das die Familie erreicht hat. In der Tat stammt der Ursprung des Mottos aus dem vierzehnten Jahrhundert und muss in jenen geistreichen Sprüchen gesucht werden, die auf den Bannern oder Fahnen der Ritter geschrieben wurden, die den Fenstern der Gasthäuser ausgesetzt waren, in denen sie sich aufhielten, anlässlich von Turnieren und während der Turniere selber. Das Motto war ein Gedanke, der in wenigen Worten ausgedrückt wurde und auf ein offenes oder verborgenes Gefühl, auf eine Qualität, auf ein Historisches Gedächtnis anspielte, als Anreiz zu Mut oder Ehre. Es wurde vom Familienoberhaupt, vom ankommenden Ritter gewählt oder vom Herrscher seinem treuen Mann gegeben. Familienmotto: Et nitida simplicitate. (Aus dem Italienisch mit Google übersetzt)
Zu Gola aus Heraldische Dossiers 1778: Adelsstand: Conti; Adel in Italia (Lombardia).
Der Innenminister des Königreicht Italien erklärte mit dem Dekret vom 17. Juli 1873 den Titel der zuständigen Dynastie. Mit dem Minesterialdekret wurde erklärt, mit der Familie den Titel der Geburt durch Geburtsrecht und die Behandlung von Don und Donna zu konkurrieren und mit diesen Titeln werden sie im goldenen Buch des Italienischen Adels in der Person von: Carlo, Emilio, di Carlo Antonio. Der Titel des Grafen gehörte zu dieser Familie, ein Titel, der von den Kaisern zu denen erhoben wurde, die an ihrer Seite waren. Aus diesen Grafen wurden diejenigen ausgewählt, die dazu bestimmt waren, die Ämter des Königlichen Palastes zu überwachen, und andere wurden an die Regierung des Provinzen des Reiches geschickt, um die Grenzen zu überschreiten. Dann gab es andere Konten, die den erwähnten Uffizien fremd waren, wie die der Annona zugewiesenen, um zu handeln; und auch die Aufseher der Armee hatten diesen Titel. (aus dem Italienisch mit Google übersetzt)
Es gab immer Komplikationen, aber auch Lustiges mit diesem Namen. Der Grossvater Maurizio hatte das Schulzeugnis seines Sohnes Zeffirino bis zur 2. Sekundarschule mit Della Gola Bigliotti unterzeichnet. Erst in der 3. Sekundarschule unterzeichnete er nur noch mit Bigliotti. Ich habe von der Feldmusik anlässlich ihres 150 -Jahrjubiläums die Mitgliederliste und Absenzenliste von 1920 bekommen. Maurizio wurde dort als Moritz Bigliotti aufgeführt. Er spielte 2. Posaune.
Als ich mich einmal bei der Kunstschule Zürich zum Innenarchitektur-Studium anmeldete, tat ich das mit dem ganzen Namen, denn das war ja auch amtlich. Sie sahen im Telefonbuch nach, fanden aber nur Bigliotti und fragten, ob "Della Gola" mein Künstlername sei. In den Schulen fragte man mich, sobald die Absenzenliste erstellt war, wie ich mich denn nenne. Ich gab immer den ganzen Namen an. Nicht lange danach sagten mir die Lehrer, ob sie mich mit dem Vornamen nennen, aber natürlich mit "Sie" anreden dürfen. Wen wunderts, dass sie mir bald "Du" sagten, was ich dann gerne akzeptierte.
Auf allen staatlichen Formularen hat das "Della Gola Bigliotti René Zeffirino" kaum Platz.
In Italien musste ich beim Hauskauf den Kaufvertrag so unterzeichnen, was ich vorher noch nie gemacht hatte. Der Briefkasten ist deshalb in Brezzo mit "Della Gola" angeschrieben, damit die Post uns findet. Wir sind also fast anonym. Bei einer Reise mit "Twerenbold" wurden wir gar nur als "Della" geführt. Wenn ich aus irgend einem Grund auf das Einwohneramt gehe, muss ich daran denken, dass sie mich nicht unter Bigliotti sondern dem ganzen Namen finden. Also unter "D" und nicht "B". Wen wunderts, dass 1949 ein Della Gola Bigliotti auf der Einreise nach New York mit Vornamen Della Gola und Nachnamen Bigliotti aufgeschrieben wurde. Entsprechend schwierig gestalten sich auch die Nachforschungen. Die einen nennen sich Dellagola (in Amerika) oder Delgol usw. Dann gibt es viele, welche nur Bigliotti heissen. Einen entsprechenden Kontakt habe ich über Facebook mit einem Bigliotti aus Argentinien.
Als "Tschampatsch", aus der Studentenverbindung, erfuhr, dass ich eigentlich Della Gola Bigliotti heisse, sagte er, er sei in Scuol/GR neben den Della Gola`s aufgewachsen. Diese Francesco war Bauer und kam aus Ponte in Valtellina wie mein Grossvater und andere, welche noch dort wohnen, aber mit uns nicht verwandt sind. Fast logischerweise nennen sich alle "Della Gola" und lassen das Bigliotti weg. Nur unser Grossvater Maurizio hatte das anders gemacht. Weshalb weiss ich nicht. Als wir einmal in Pontresina waren, haben wir die Della Gola`s aus Schuls zum Mittagessen nach Sent ins Cesa veglia eingeladen. Mein Studentenkollege, welche wieder in seinem Geburtsort Sent wohnte, hatte das Treffen organisiert. Am Anfang waren die Beiden recht wortkarg. Dann nach dem 2. Glas Wein taute vorallem sie auf und sprach im Bündnerdialekt, denn sie war in Schuls aufgewachsen. Aber auch er konnte Deutsch und nach dem Essen luden sie uns auf ihren Bauernhof ein und gaben uns beim Abschied noch einen Karton voller Eier mit . Er schrieb uns seine Verwandtschaft auf, woraus wir erkannten, dass wir leider doch nicht verwandt waren.
Wie Vater erzählte hatte sein Vater zwei Brüder. Einer sei im ersten Weltkrieg gestorben und auf dem Obelisk in Ponte verewigt. Der andere sei mit dem Schiff ausgewandert und verschollen. Es gäbe keine Della Gola Bigliotti mehr in Ponte. Als ich jedoch vor Jahren mit Rita nach Ponte ging, prangten überall Plakate eines verstorbenen Enzo Della Gola Bigliotti an den Wänden. Seit es Internet gibt, habe ich den Namen immer wieder gegoogelt. Da kommen vorallem Einwohner von Ponte, z.B. Della Gola Bigliotti Renata von der Azienda Agrituristica "Al Tiglio". Inzwischen ist auch einer im Facebook erschienen, welcher in Montreux als Somalier arbeitet. Ein Della Gola Bigliotti ist am 5. November 1949 mit dem Schiff "Napoli" in Australien gestrandet. Ein L.Della Gola Bigliotti hat ein Buch über "emigrazione temporanea in provincia die Sondrio" geschrieben. In der Australischen Zeitung "The Daily News, vom 16. August 1939 steht etwas über die Einbürgerung von Michale Dala Gola Bigliotti aus Ponte/Sondrio. Vermutlich der gleiche ist auf den "Australien Wählerlisten, 1993-1949 aufgeführt als: Michael Della Gola Bigliotti, Wahlregister des Jahres 1949 von Western Australia, Australia.
Inzwischen bin ich auch der Genealogie-Seite "MyHeritage", beigetreten. Da gelangte ich zu einer Felicity Della Gola, welche mir bestätigte, dass ihr Mann Matt Della Gola Bigliotti heisse, aber der Name zu lange war und abgekürzt wurde. Das tat schon dessen Grossvater Quirino, welcher nach Australien emigrierte. Felicity meinte, dass ich der Cousin von Matt`s Vater John sei. Ich hatte nach langer Zeit endlich den Mut gefasst, mein Gen über My Heritage untersuchen zu lassen. Da kamen als mögliche Verwandte Irena Küng, Tochter meiner Cousine Irma Hug an vorderster Front. Darauf folgte Mirjam Vonarburg, welche mit der Mutter meiner Grossmutter Verena Kohler-Vogel verwandt ist. Dann folgte eine Frau Beverly de Jager, welche auf der Seite von Pauline Diss Australien erschien. Als vierter möglicher Verwandter im 3. - 5. Grad erschien Peter Tuia aus Australien. Ich schrieb also Pauline Diss, dass ich in ihrem Stammbaum Maria Cantoni fand, welche vielleicht meine Urgrossmutter war. Sie schrieb darauf, dass sie die Stammbäume von den Familien Angelini, Cantoni und Toppi habe und da seien verschieden Maria Cantoni vorhanden. Ihre Urgrossmutter war mit einem Francesco Angelini verheiratet. Darauf schrieb ich ihr, dass ich nur Dank der DNA auf Beverly de Jager gekommen war und woher mein Name Della Gola Bigliotti kam.

(2) Heiratsurkunde von Luigi Della Gola Bigliotti

(3) mit Maria Cantoni aus Boffetto am 24.2.1884
Darauf schrieb mir John Angelini, der Bruder von Pauline Diss und erklärte mir, dass er die Stammbäume der verschiedenen Maria Cantoni, welche in Ponte waren, führe. Dass seine Maria Cantoni, welche mit einem Angelini verheiratet war, nicht die gleiche Maria Cantoni war, welche mit meinem Urgrossvater verheiratet war, schien mir einleuchtend. Er fragte mich nach meiner Mailadresse und sandte mir die drei verschiedenen Stammbäume. Ja, oh Wunder, mein Urgrossvater tauchte auf einem auf, mit einer Maria Cantoni und ihrem Sohn Maurizio Della Gola Bigliotti, meinem Grossvater. Geburts- und Heiratsdatum stimmten überein. Daneben stand Bari als Wohnsitz. Auf die Idee, dass das Baar heissen könnte und in der Schweiz war, kamen sie nicht. Das Verrückteste aber war, dass darauf Moritz noch drei Brüder und zwei Schwestern hatte, von den ich ja nichts wusste. Allerdings waren je ein Bruder und eine Schwester nach sechs Monaten bereits gestorben. So blieben nebst meinem Grossvater Maurizio noch die beiden Brüder Luigi und Natale, sowie die Schwester Consiglia Catterina. Ich werde also herausfinden müssen, wie derjenige Bruder hiess, der im ersten Weltkrieg gefallen war. Vermutlich Natale, denn Luigi Giuseppe, dessen Geburtsdatum mit demjenigen des Stammbaumes übereinstimmt, ebenfalls aus Ponte kam und dessen Vater auch Luigi hiess, war am 5. August 1912 von Le Havre mit dem Schiff Rochambeau nach New York ausgewandert.

(4)
Seine Schwester Consiglia Catterina, geboren am 8.10.1891 und geheiratet mit Giovanni Guiro am 15.5.1921 habe ich noch nicht gefunden, obwohl neben ihrem Namen "Milano" steht.

(5)
Im Bürgerbuch seht unter "Della Gola Bigliotti" Herkunft: Neuheim. Vater Zefferino, welcher 1913 in Baar geboren war und auch alle Schulen hier besucht hatte, wolle 1941 heiraten und sich einbürgern. Verschiedene male ging er ins Italienische Konsulat nach Zürich um seine Schriften abzuholen. Doch die Italiener sandten diese nicht, beziehungsweise zögerten es heraus, denn sie wollten ihn ins Italienische Militär aufbieten. Das ging soweit, dass er eines Tages von den einheimischen Faschisten nach Zug an eine Versammlung geschleppt wurde. Dort erhielt er drei Bücher über Mussolini und den Faschismus. Natürlich auf Deutsch!
(6)
Als er in Baar, seiner Wohngemeinde, ein Einbürgerungsgesuch stellte, wurde dieses abgelehnt. Ein Herr Staub (Vater von Dr. Martin Staub) der in Baar wohnte und in der Zuger Kantonalbank arbeitete, empfahl ihm, sich doch in Neuheim einzubürgern. Die Staub waren Neuheimer. Herr Staub stellte ihn der Bürgergemeinde Neuheim vor, welche ihn dann zur Einbürgerung in Neuheim empfahl. Vater Zeffirino war nie in Neuheim wohnhaft gewesen. Doch Neuheim war die ärmste Gemeinde im Kanton Zug und auf Einbürgerungsgelder angewiesen. Da seine Frau Elisabeth nach dem damaligen Gesetz durch Heirat automatisch Italienerin wurde und das Schweizer Bürgerrecht verlor und Esther bereits ihr erstes Kind war, mussten alle drei eingebürgert werden. Es kostete 1942 Fr.2200, was damals ein kleines Vermögen war.
(7) 
(8)
1973 entschieden wir uns drei Brüder René, Mario und Ivo sich in Baar einzubürgern. Obwohl Ivo noch nicht 15 Jahre alt war, gab es kein Problem und wir wurden vom Bürgerrat auf einfache Art eingebürgert. Wir hatten 30 Tage Zeit, um uns zu melden, wenn wir das Neuheimer Bürgerrecht behalten wollten. Da es aber kein angestammtes Recht war, liessen wir es verfallen. Vater Zeffirino blieb Neuheimer und war stolz darauf, einer der grössten Bürgersteuerzahler zu sein.
(9) Wappen im Bürgerbuch 1991
Im Auftrag von Mario und René an Sigi Andermatt, mit Begutachtung vom Grafiker Eugen Hotz ist ein neues Wappen entstanden aus dem Ortswappen von Ponte in Valtellina, sowie vier Traubenblättern als Symbol für die vier Kinder Esther, René, Mario und Ivo als erste Schweizer.

Es war vor dem 40 Geburtstag, als wir nach Saas Fee in die Sommerferien gingen. Einmal pro Woche war in der Bar ein Unterhaltungsabend. Da kamen vor allem volkstümliche Beiträge und zum Abschluss gab es einen Alphornwettbewerb. Derjenige, welcher am meisten Töne herausbrach, hatte gewonnen. Alphornblaserfahrung hatte ich keine, wusste aber, wie man etwas hineinbläst, da wir in der Studentenverbindung das Jagdhorn bliesen.
So kam es, dass ich am meisten töne herausbrachte und den Wettbewerb gewann. Das verpflichtete natürlich für mehr. Ich wusste, dass der Pianist Karl Rütti auch Posaune und Alphorn blies und fragte ihn, ob er mir sein Alphorn für einige Zeit ausleihen könne. So lernte ich das Alphornspiel rein Autodidakt nach dem System "learning by doing".
Da ich alle 10 Jahre ein neues Instrument erlerne, war es dann naheliegend, dass ich mir zum 40 Geburtstag ein Alphorn wünschte. Zuerst ging ich zum Alphornbauer Otto Emmenegger nach Eich/Lu. Er hatte für das Rohr eine Leere (konisches Holzstück) über das er drei Schichten Furniere klebte und so das Grundgerüst des Alphornrohres hatte. Bei Stocker in Kriens erlebte ich geradezu eine Alphornfabrikation mit vielen Maschinen. Um die 300 Stück pro Jahr baute er. Ich wollte aber ein traditionell hergestelltes Alphorn mit viel Handarbeit. Von den Kosten her waren etwa alle Hersteller gleich teuer. So fuhr ich dann zu Ernst Nussbaum nach Gwatt bei Thun. Er baute als einziger aus Arvenholz Hörner und hatte auch das von Karl Rütti gebaut.
Als ich mit Rita bei ihm vorsprach, stand er im Keller seines Einfamilienhauses und plauderte mit einem Kollegen. Der Boden war mit Holzspänen übersäht und die beiden rauchten Stumpen. Da wir natürlich angemeldet waren, konnte er uns bereits das Holz zeigen, aus welchem er die Röhre und den Becher schnitzte. Der Becher hatte ganz wenige Äste, was beim Arvenholz nicht einfach ist. Als Mitbringsel hatten wir natürlich eine Zuger Kirschtorte dabei, welche wir jedesmal auch mitbrachten, wenn wir ihn besuchten. Später musste ich nochmals bei ihm vorbeigehen um die Stärke des gespaltenen Peddigrohres, welche er für die Röhrenummantelung als Schutz brauchte, auszulesen. Ein 80-jähriger Hobbyschnitzer arbeitete auf den Becher auf meinen Wunsch drei Enziane und darunter einen Gamsbock vor Bergen ein. Das Arvenholz ist ja relativ weich und eignet sich vorzüglich zum Schnitzen. Später beim abholen des Alphorns lieferten wir natürlich wiederum eine Kirschtorte und so kam es, dass wenn ich einmal telefonierte und weder er noch seine Frau wussten, wer am Telefon war, einfach erklärte "Der mit der Kirschtorte". Dann war für sie wieder alles klar. Ernst Nussbaum ist viel zu früh mit etwa 70 Jahren gestorben und leider ein paar Jahre später auch sein Sohn, welcher die Alphornherstellung weiterführte.
Da ich im Orchester wieder Bratsche spielte und meine Bratsche eine billige Fabrikbratsche war, welche ich mir mit 18 Jahren für Fr.800 kaufte, wollte ich unbedingt eine bessere. Ich beauftragte Karl Koch, unseren Geigenbauer in Luzern, welcher unsere Geigen revidierte, für einen Bratschenneubau. Im Gegensatz zur Geige wird die Bratsche der Armlänge angepasst, da sie doch einiges grösser ist als die Geige. Meine bekam eine Korpuslänge von 42cm. Ich konnte sie im Rohbau, bevor Koch mit der Lackierung anfing, begutachten und fotografieren.

(1) Karl Koch mit meiner rohen Bratsche
Da es ein regnerischer Sommer war, hatte der Oellack mühe zu trocknen. Er hatte sie auf seinem Balkon an einer Schnur aufgehängt. Als ich sie dann in Empfang nahm, war sie noch etwas klebrig und bekam Abdrücke vom Geigenkasten. Der Ton jedoch war wunderschön und nicht weit vom Celloton entfernt.
Dank der Pandemie kam ich 2020 wieder zu einem Instrument, welches ich während der Pubertät bis nach der Rekrutenschule spielte: die Klarinette. Wir wollten als Jugendliche unbedingt Jazz spielen und gründeten eine Band ohne die Instrumente je gelernt zu haben. Ich ging zu Musik-Schmitz nah Zug und kaufte mir eine Klarinette (Deutsches System) für Fr. 90.- und für 10 Franken ein Anleitungsheft, denn Fr. 100.- war mein ganzes Ersparte. Bereits nach dem zweiten Tag viel eine Klappe ab, welche ich mit einem Heftpflaster zuklebte und den Ton anders hervorbrachte. Im Filmstudio Kägi in Rümlang konnten wir die Verstärker benutzen, da Kägi Junior bei uns die Gitarre spielte.
An der Aushebung für die Rekrutenschule liefen wir mit Instrumenten auf dem Mittelstreifen der Zugerstrasse nach Zug. Ich spielte dabei das Saxofon, welches ich ursprünglich von meinem Götti Hans in Sulz erbte. Nach der Rekrutierung bat der Oberst uns, nochmal etwas zu spielen. Wir waren jedoch endtäuscht, weil keiner dort eingeteilt wurde, wo er gerne gemocht hätte. Deshalb spielten wir zum Abschluss katzfalsch, sodass der Oberst händeringend davonlief.
Nun meldete ich mich also nach der Pandemie bei der Musikschule Baar zum Klarinettenunterricht. Ich bekam den jungen Nicola Katz als Lehrer, der es sehr gut verstand, auf meinen Wunsch Blues zu spielen, einzugehen, denn mit der Geige hatte ich ja mehr als genug klassische Musik gespielt. Mit der Zeit entdeckte ich noch den Klezmer, jüdische Musik, als ideale Musik für die Klarinette. Natürlich fehlte auch die Schweizer Volksmusik nicht im Unterricht. Um an der Technik besser zu feilen, brachte er dann doch noch klassische Musiknoten von Mozart (12 Kegelduette), Lefèbre und andere.


(1) 1994 Mit dem Glücksrad und Kandidaten vor den Wahlen bei der Rathusschüür
CVP - oder Christliche Volkspartei. Vater Zeffirino war bei den Christlichsozialen. Was ich erst später realisierte war, dass er auch im Katholischen Arbeiterverein war. Eigentlich erstaunlich als selbständig Erwerbender. Ich denke, das hat auch mit seiner Mutter, welche lange als Spinnerei-Arbeiterin tätig war, zu tun. Vor allem erinnere ich mich, dass Esther und ich an der Weihnachtsfeier im Concordia Gedichte aufsagten und Vater mit Geige begleitet von der Nachbarin Rey am Klavier Weihnachtslieder spielten. Wir erhielten immer ein kleines Geschenk.
Vater nahm mich bereits als 18jähriger mit an die Generalversammlung der Christlichsozialen Partei im Restaurant Lindenhof. Dort lernte ich die damals aktiven Parteiexponenten kennen: den Regierungsrat und ehemaligen Gemeindeschreiber Carl Staub, den Paul Jäger, Kantonsrat; den Alois Zürcher als Rathausabwart und etliche andere. Ich kannte aber auch viele von der Jungmannschaft, welche eine Knabenorganisation der Katholischen Kirche war. Sie gingen nach der Sonntagsmesse immer ins Café Fürst am Rathausplatz und ich ging mit. Dabei wurde mein bester Kollege Paul Romer. Ich war sowohl bei ihm, als auch später er an meiner Hochzeit eingeladen.
So etwa als 40-jähriger hatte ich mehr Interesse an der Politik. Ich bewarb mich für den Kantonsrat, hatte aber keine Chancen. Doch lernte ich dabei den Vorstand kennen. Als Alton Haag das Präsidium abgab, wollten sie den Veterinär Philipp Dossenbach als Präsidenten. Dieser fragte mich dann als Vizepräsidenten an, sodass ich im Vorstand mitarbeitete. Ich wusste aber, dass Philipp irgendwann Gemeinderat werden wollte, sodass für mich klar war, dass dann meine Parteiarbeit beendet war. Grundsätzlich übernahm ich das Vizepräsidium nur wegen meiner Sympathie zu ihm. Doch kam es dann anders als geplant: An der Nominationsversammlung in der Rathaus-Schüür waren sehr viele Bauern vertreten, welche man noch nie an einer Parteiversammlung sah. Sie waren aufgeboten, um ihren Sprengkandidaten Hans Krieger zu unterstützen. Mit was niemand gerechnet hatte geschah!
Philipp Dossenbach wurde nicht als Gemeinderats-Kandidat vorgeschlagen. Kaum war die Wahl vorbei, sind viele der Bauern aufgestanden und verliessen den Raum. Philipp beendete noch die Sitzung und verzichtete auf die Weiterführung seines Präsidiums. Da ich ja Vize war, hatte ich das Präsidium bereits geerbt. Am Tag nach der Wahl telefonierte ich mit mehreren Juristen der CVP. Leider konnte mir niemand helfen, denn der Nachweis, dass nicht alle stimmberechtigt waren, konnte nicht vollzogen werden. Das war der Grund, weshalb wir in Zukunft nur noch gegen Vorweisen des Mitgliederbriefes die Leute zur Wahl zuliessen.
Die Arbeit als Parteipräsident war sehr interessant aber auch stressig. Gute Kandidaten wurden nicht mehr für den Kantonsrat gewählt. Wir hatten aber die grösste Kantonsratsfraktion im Kanton. Überraschenderweise hatten wir auch vier Gemeinderäte, dank einem Restmandat. Es gab viele freundschaftliche Kontakte zu anderen Gemeindevertretern und man freut sich jedes mal, sie nun als Senioren in CVP 60 zu treffen. Ich hatte viel gearbeitet und auch viel Erfolg. Soweit war ich eigentlich mit der Parteiarbeit zufrieden. Doch die Belastung neben dem Beruf als selbständiger Architekt war zu gross. Eigentlich hatte ich im sinn, die Partei vier Jahre intensiv zu führen um dann dann abzugeben. Leider dauerte es noch ein Jahr länger, bis Frau Käthi Langenegger bereit war, das Präsidium zu übernehmen.
Dank meiner Parteiarbeit konnte auch meine Frau Rita in der Schulkommission und später im Bürgerrat Einsitz nehmen. Ich wurde damals auch für den Gemeinderat vorgeschlagen. Da aber Rita im Bürgerrat und Bruder Mario im Kirchenrat waren, hat der Wähler verhindert, dass unsere Familie auch noch im Gemeinderat vertreten war. Eigentlich verständlich! Ich freue mich aber, heute noch gute Kontakte zu Parteimitgliedern zu haben und immer wieder ehemalige Mitstreiter zu treffen. Auch wenn wir nicht immer der gleichen Meinung waren, so einigten wir uns als Mittepartei immer auf eine gemeinsame Lösung. Gerade die vielen Meinungen und das Suchen nach gemeinsamen Lösungen haben mich an dieser Partei fasziniert.


(1) Bereits als Alträbevater

(2) Räbevater in Kutsche mit RM Rita und ED Therese
Es war im September 2003, als Gipsermeister Josef Zeberg mich anrief und mir mitteilte, dass er und Korporationspräsident Erich Hug mit mir etwas besprechen wollten. Mir war gleich klar, um was es ihm ging, denn Zeberg war Oberhaupt der Räbenväter und Erich Hug war im sog. "geheimen Rat", welche die Aufgabe hatten , einen neuen Räbevater zu suchen.
Mich freute dies sehr, denn ich glaubte nicht, dass mich jemand dafür fragen würde. Mein Vater war schon 1961 Räbevater und lebte ja noch. Entsprechend sagte ich freudig zu, als sie bei mir zu Hause vorsprachen.Es war üblich, dass der neue Räbevater am 11.11. bekannt gegeben wurde. Vorher war das Suchen von Ehrendamen nicht möglich. Die Partnerin von meinem Stammtischkollegen Robi Schelbert, Therese Nussbaumer, hatte mir schon lange vorher gesagt, dass sie gerne Ehrendame werden würde, sofern ich jemals Räbevater werde. Unseren beiden Söhnen Igor und Niccolo sagten wir nichts, damit sie nichts für sich behalten mussten. Entsprechend war Niccolo, der gerade beim Alträbevater Josef Utiger in der Lehre war erstaunt, als ihn sein Lehrmeister am Tag nach dem 11.11. darüber orientierte.
Am 12.11. dann am Stammtisch im Falken fragten mich die Kollegen, ob ich nun der neue Räbevater werde. Sie hatten dazu gleich eine lehre Flasche Champanier aus dem Abfalleimer gezogen um angeblich darauf anzustossen. Doch ich erklärte ihnen, dass ich bereits vorgängig gesagt hätte, dass Markus Blaser werde, worauf sie die leere Flasche wieder wegstellten und auf ein Nächstesmal hofften. 20 Minuten später kam jedoch einer in den Falken, welcher bereits mehr wusste und mir gratulierte, worauf meine Kollegen meinten, ich sei ein "schlechter Keib". Ich hatte meinen Spass daran.
Als Ehrendamen bekam ich nebst Therese ihre Kollegin Vreny Müller. Karin Langenegger, Tochter von Parteikollege Paul Langenegger wohnte gerade bei mir an der Heimatstrasse in Untermiete und sagte auch zu und später kam noch .... Katholnig vom Büro Goldmann/Hotz dazu. Damit sie einander kennenlernten bastelten wir zusammen mit ihren Freunden mehrere Räbegäuggel aus Holz, welche wie der Knorrli als Turner funktionierten.
Es war eine heftige Vorbereitungszeit, doch sie hatte allen viel Freude bereitet. Es wäre unmöglich, alle Highlights der Fasnacht 2004 aufzuzählen. Es war schlicht gesagt ein einmaliges Erlebnis mit vielen freundlichen Leuten, Helfern, Wagenbauern, Räbenvätern und -Müttern. Inzwischen kennen mich so viele Leute, dass ich den meisten "Du" sage, auch wenn ich mir nicht sicher bin, woher ich sie kenne. Reklamiert hat jedenfalls nie jemand.
Bedauerlich war, dass mein Vater im Sterben lag, als die Fasnachtszeit begann. Am Donnerstag nach der Fasnacht wollte ich mit Rita ein paar Tage ausspannen. Wir mussten jedoch ins Spital, um uns von Vater zu verabschieden, welcher kurz darauf starb. Eigentlich war er schon vorher nicht mehr ansprechbar. Ich denke aber, er hat so lange durchgehalten, um mir die Fasnacht nicht zu vermiesen. Das war wirklich ganz toll und zeigt, was das Unterbewusstsein fertig bringt.


(1)
Wo ich meine Frau Rita kennen lernte war eigentlich kein Zufall. Mir war immer klar, dass meine Frau ein Streichinstrument spielen würde oder mindestens Fan davon war. Mädchen die Geige spielten kannte ich von der Musikschule, vom Kirchenorchester oder vom Orchesterverein Baar. Ansonsten hatte ich wenig Kontakt zu jüngeren Damen. Im Orchester spielte schon mein Vater Zeffirino, welcher mich als 19-Jähriger mitnahm. Ich kannte ja die meisten Mitspieler schon. Es gab nur wenige Frauen im Orchester. Der Grund war, dass den Knaben in den Familien der Geigenunterricht finanziert wurde. Entsprechend kamen diese aus eher begüterten Familien, da es noch keine subventionierte Musikschule gab. Mein Vater erlernte das Geigenspiel von einem Primarschullehrer. Für ihn als Italiener war die Geige, nebst der Mandoline, ein Volksmusikinstrument.
Mein Geigenlehrer war Kurt Meierhans, der später auch in Zug unterrichtete. Er war Konzertmeister und Vizedirigent im Orchester. Von Zug brachte er aus der Musikschule zwei vorgeschrittene Schülerinnen mit: Therese Zinter und Rita Burkard. Sie begannen in der zweiten Geige, während ich den Platz meines Vaters in der ersten Geige eingenommen hatte und dann bereits schon zwei Jahre im Orchester mitspielte.
1968 gingen Rita und Therese nach London zum Sprachaufenthalt. Ich war Präsident des Orchestervereins, da die Alten meinten, sie sollten die Führung jüngeren Kräften übergeben. Die Vereine hatten damals noch eine gesellschaftliche Bedeutung. So schrieben denn die beiden Damen mir als Vertreter des Orchesters wie es ihnen ging, während ich ihnen schrieb, was bei uns im Orchester so lief. Die Briefe mit Rita wurden immer persönlicher. Ich fuhr mit Platsch, einem Kollegen der Studentenverbindung und einem alten VW-Käfer in Richtung Nordkap. Von den verschiedenen Stationen schickte ich ihr nach London Ansichtskarten. Als sie dann nach einem halben Jahr wieder zurückkehrte, gingen wir zusammen an einen Studentenanlass nach Küsnacht in die Sonne. Von da an trafen wir uns häufiger was schlussendlich 1971, am 16. April, zur Hochzeit führte. Allerdings hielten wir gegenüber dem Orchester alles sehr geheim und erst als wir nach der Verlobung einen Ring am Finger trugen viel das natürlich auf und wir wurden mit Fragen bestürmt.
Rita arbeitete nach ihrer Rückkehr aus England in der Hoover SA an der Sihlbruggstrasse in Baar und hatte es dank ihren neuen Sprachkenntnissen bis zur Direktionssekretärin des Generaldirektors gebracht. Sie hatte bei Teppich-Grüter in Baar die Handelslehre absolviert.
Grüter verkaufte auch Haushaltartikel und so war es naheliegend, dass sie zu Hoover, welche vor allem Haushaltgeräte vertrieben, arbeiten ging. Als wir von Heirat sprachen, war es mir wichtig, dass sie auch von meinem Beruf als Architekt Kenntnisse hatte. So liess sicj ein Jahr vor unserer Hochzeit bei Architekt Paul Weber in Zug als Sekretärin anstellen. Für sie war der Sprung von der Direktionssekretärin zu einem eher langweiligen Sekretärinnenjob im Architekturbüro nicht einfach. Für mich war es jedoch wichtig, dass sie meinem Beruf kennen lernte. Nach der Hochzeit arbeitete sie fünf Jahre im väterlichen Architekturbüro. Erst dann, als mein Studium zu Ende war, konnten wir daran denken Nachwuchs zu erhalten, was mit Igor 1976 auch eintraf. Niccolo folgte 1979. Igor erhielt den Namen vom Komponisten Strawinsky, während Niccolo nach meinem Lieblingsgeiger Paganini genannt wurde.
Sie hatte mit der Erziehung der Kinder genug zu tun und hielt mich von häuslichen Aufgaben fern. Als die beiden Knaben in die Schule gingen, wurde sie als Vertreterin der CVP in die Schulkommission gewählt. Zurück in das Sekretariatswesen war nicht möglich, denn inzwischen wurde alles auf Computer umgestellt. Später wurde sie noch als Vertreterin der CVP in den Bürgerrat gewählt, sodass sie auch dort interessante Arbeiten erledigen konnte. Zehn Jahre sang Rita im Pflegeheim mit den alten Leuten und als sie einmal an einen Ehemaligentag der Französischschule nach Soyhiere ging, gründeten wir einen Ehemaligenverein, dem sie 17 Jahre vorstand. Dieser Verein wurde 2022 nach 25 Jahren aufgelöst und hatte in diesen Jahren für die Unterstützung des Institutes rund Fr. 250`000 eingebracht. Viele Jahre war sie auch Präsidentin des Orchestervereins, wo wir heute noch mitspielen.