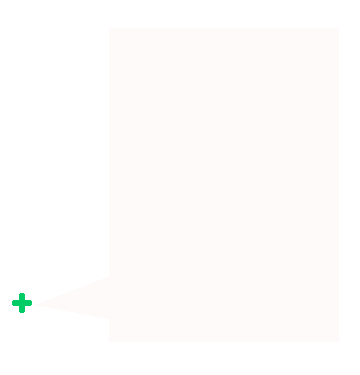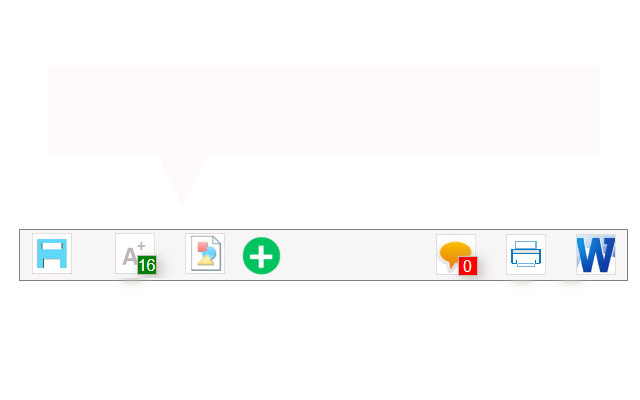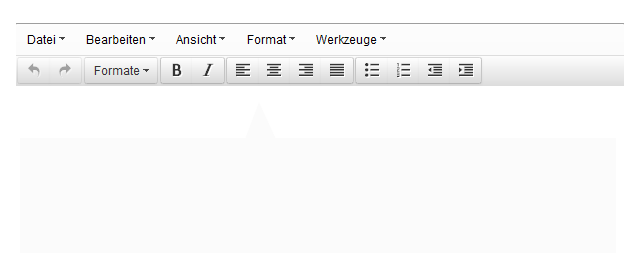Zurzeit sind 552 Biographien in Arbeit und davon 313 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 191
Inhaltsverzeichniss

Leserkommentare
Bernhard Brägger weckt Begeisterung mit seinen bildstarken Worten, die vergangene Erlebnisse so wiederbeleben, als würden sie sich im Augenblick abspielen. Er schildert seine Jugendzeit gespickt mit ergreifenden Geschichten, wie wenn er diese erst gestern erlebt hätte. Auf seinem weiteren Lebensweg ist ihm sein Beruf als Lehrer nicht gut genug. Immer wieder treibt es ihnzu neuen, teils waghalsiegen Herausforderungen. Ein roter Faden, der sich durch sein ganzes Leben zieht. und nicht abreissen will, ist seiner leidenschaftlichen Beziehung zu Oldtimern und Rallyefahrzeugen. Ich verweise auf ein paar Highlights: Bernhard war der Initiant des Internationalen Klausenrennen-Memorials, das 1993 erstmals stattfand. Vor ein paar Jahren legte er mit einem Ford T, einem über 90 Jahre alten Gefährt, rund 25 000 km zurück und gelangte damit zu den entferntesten Ecken unseres Kontinents. Am Steiermark Winterrallye vom letzten Winter lief er auf den für ihn faszinierenden Schnee und Eissträsschen zur Hochform auf und bewies in einem bescheidenen Fiat Panda Steyer Puch, dass sein Können und Alter den starken Motoren und den elektronischen Assistenzsystemen keinerwegs unterlegen ist. Ein lebensfroher Rückblick, eine aufbauende Geschichte! Die Lektüre dieser Story verspricht, zu einem spannenden Erlebnis zu werden!
Heinrich Erne
Dr. phil.
Basel
Bernhard Bräggers Erinnerungen sind gradlinig, ungeschönt und "süffig" erzählt. Ohne Effekthascherei. Er haut niemanden in die Pfanne. Manchmal liesst es sich wie ein Krimi.
Hugo Fuchs
Musiker
Obernau bei Kriens
Inhaltsverzeichnis
1. Meine Grosseltern und meine Eltern.
2. Meine Jugendzeit in Frutigen.
3. Godis Amilcar.
4. Am Bühlstutz und Willy Peter Daetwylers 4,5-Liter- Alfa Romeo.
5. "s Moser Käthi" u "ds Ruppi" beide aus Kanderbrügg.
6. Sturz am Pauschenpferd.
7. Rallye Monte Carlo.
8. Nach Kiew im ukrainischen Winter 1986.
9. In Tschetschenien und Inguschetien.
10. Die historischen Klausenrennen.
10.1. Das 1. Int. Klausenrennen-Memorial.
10.2. Das 2. Int. Klausenrennen-Memorial.
10.3. Das 3. Int. Klausenrennen-Memorioa.l
11. Das Teufelsspiel oder die Wand und die Brücke.
12. Die historische Jungfrau-Stafette 1931.
13. Mit dem 90-jährigen Oldtimer an die Barentsee.
14. Die Pandemie hält uns im Griff.
15. "Mit dem Elektroauto in die Sackgasse."
16. Im Alter finde ich wieder Zugang zu Gott.
17. Epilog.


(1) Mein Vater und seine schwere Motosacoche. Meine Mutter im jugendlichen Alter.
Kapitel 1 Meine Grosseltern und meine Eltern.
Gewidmet ist "Mein Leben eine Gratwanderung" meinen erwachsenen Kindern Anita, Beatrice, Bernhard, ihrer Mutter Anna und all meinen Enkeln Carina, Giulia, Ilaria, Joschua, Malia und der jüngsten Leana.
Meine Grosseltern mütterlicherseits Antonio Calderara und Chiara Clivio aus dem kleinen italienischen Dörfchen Orino - etwa 12 km nordwestlich der Stadt Varese - liessen sich nach der Heirat in Walzenhausen (Appenzell Ausserrhoden) nieder. Dort kamen Chiacomo, Antonio, Giuseppe, Chiara und als Jüngste meine Mutter Anna zur Welt. Die italienischen Vornamen wurden wie damals üblich im Geburtenregister der Schweizer-Gemeinden verdeutscht. So wurde aus dem Giacomo der Jakob, aus dem Antonio der Anton und aus der Chiara die Klara. Mutters Name Anna - als damals weltweit häufigster Name - blieb unangetastet. Für sein Baugeschäft holte sich mein Grossvater die Arbeiter aus seinem Heimatort Orino unweit der Stadt Varese nach Walzenhausen. Sie galten als gute Handwerker, und wurden von den Einheimischen oft beneidet. Nach der Geburt meiner Mutter Anna erkrankte Chiara Calderara am gefürchteten Kindbettfieber. Viele junge Mütter starben im Wochenbett an dieser weitverbreiteten Infektionskrankheit. Grund: Mangelhafte Hygiene der Ärzte und Hebammen! Im Hause Calderara brach Angst und Schrecken aus. Zur gleichen Zeit war eine gute Freundin meiner Nonna in Orino ebenfalls schwanger und gebar einen Knaben. Aus mir unbekannten Gründen starb das Büblein und als gleichzeitig in Orino die Nachricht vom Kindbettfieber der Chiara eintraf, kam eine Verwandte namens Angelika auf die Idee, die Anna in Walzenhausen zu holen und zum Stillen an die unglückliche Freundin weiter zu geben.
Erst zwei Jahre später – nachdem sich die Nonna vom Kindbettfieber erholt hatte - durfte die kleine Anna aus Orino zurück nach Walzenhausen. Doch sie wurde von ihren Geschwistern eher unfreundlich empfangen: „Du gehörst nicht zu uns. Wir kennen dich nicht.“ Kam noch hinzu, dass meine zweijährige Mutter nur wenige Brocken im “Dialetto Orinese“ stammelte, im Gegensatz zu ihren vier Geschwistern, die bereits einen italienischen und ostschweizer Dialekt sprachen. Eine schwierige Situation für die kleine Anna aus dem fernen Orino!

(2) Mein Vater Josef Brägger und seine schwere Motosacoche
Mein Vater und seine schwere Motosacoche.
Als ältestes von 11 Kindern kam mein Vater 1907 am 27.06. in eher ärmlichen Verhältnissen im Hintergurtberg der damaligen politischen Gemeinde Krinau im Toggenburg zur Welt. Auf den 1. Januar 2012 fusionierte die politische Gemeinde mit der Nachbargemeinde Wattwil. Die Katholiken wie die Reformierten waren nach Bütschwil kirchgenössig. Mein Grossvater väterlicherseits arbeitete bis zum achtzigsten Altersjahr als Webermeister in der Weberei in Krinau. „Fabrikli“ wird das heute noch bestehende Gebäude genannt. Nach der obligatorischen Schulzeit in Krinau war der katholische Pfarrer in Bütschwil der Meinung, Bräggers Josef vom Hintergurtberg gehöre ins Gymnasium nach Immensee um Theologie zu studieren. Mein Vater folgte diesem Ruf und Dank der finanziellen Unterstützung des Pfarrers höchst persönlich, machte er sich auf in die Innerschweiz nach Immensee am Zugersee. In den Semesterferien zog Bräggers Josef von Hof zu Hof um einige Fränkli fürs Studium zu bekommen. Kollektieren wurde diese eher unbeliebte Finanzbeschaffung unter den häufig aus einfachen Familien stammenden Studenten genannt. Doch Josef der Fabriklerbub brach vorzeitig das Studium ab. Den eigentlichen Grund konnte ich nie in Erfahrung bringen. Ob es die Finanzen waren? Oder lag es an den Noten? Ich glaube kaum! Bei einem Gespräch – mein Vater war bereits pensioniert - konnte ich zwischen den Zeilen heraushören, dass er vom Internatsbetrieb und dem autoritären Lehr- und Erziehungsstil mehrerer Theologen schwer enttäuscht war. Sein Wunsch Missionar zu werden, schwand täglich. Da brach er das Studium ab und kehrte nach Hause an den Hintergurtberg zurück. Eine schwere Zeit kam auf ihn zu. In Krinau und Umgebung wurde hinter vorgehaltener Hand getuschelt: „Wozu haben wir dem Brägger das Studium zum Geistlichen mit unserem Geld möglich gemacht? Ist das sein Dank an uns Spender?“ Schwer enttäuscht von Josefs Entschluss war auch seine Mutter Katharina, die so gerne ihren Josef als Geistlichen oder sogar als Missionar in Afrika gesehen hätte. Um etwas Geld zu verdienen, begann er in der Weberei in Krinau Garn „zu spulen.“ Die fertigen Garne wurden in Strängen angeliefert und mussten vor dem Weben sauber auf die klappernden Spulen aufgespult werden. Alsdann verarbeiteten die unter Höllenlärm laufenden Webmaschinen das Garn zum gewünschten Gewebe.
Doch diese Arbeit konnte den Josef auf die Dauer nicht befriedigen. So bewarb er sich bei der Carrosserie Firma Tüscher in Zürich als schlecht bezahlter Volontär, arbeitete sich in kurzer Zeit zum Chefbuchhalter hoch, traf sich in seiner Freizeit mit Gleichaltrigen zum Fotografieren, zum Entwickeln und stotterte ein Darlehen für seine erworbene, schwere Genfer-Mottosacoche mit Soziussitz ab. Und als einer seiner Kollegen prahlerisch prophezeite, zum nächsten Treffen ein rassiges „Tschinggeli“ mitzubringen – und dieses Machogehabe auch wahr machte - verliebte sich mein Vater Hals über Kopf und zum Leidwesen seines Kollegen in die stets modisch gekleidete Anna Calderara aus dem Appenzellischen. Nach ihrer Loslösung vom Elternhaus in Walzenhausen bildete sich die Anna in der Klinik Münsterlingen zur Pflegerin aus. An schönen Sonntagen fuhren die beiden mit der „Motosacoche“ rund um den Zürichsee oder zur Abwechslung mal über die staubige Gotthardstrasse und die kurvenreiche Tremola hinunter ins sonnige Tessin. Die beiden heirateten und bald kündigte sich meine Schwester Waltraud an, ihr folgte Antoinette und am 9.April 1942 erblickte ich in Zürich an der Segnesstrasse das Tageslicht. Es war Kriegszeit, mein Vater wurde als Gotthard-Mitrailleur eingezogen und in der Firma Tüscher bahnten sich in der Verwaltung Änderungen an. Da fassten Vater und Mutter einen schweren Entscheid. Nach über 10 Jahren Arbeit bei Tüscher kündigte mein Vater seine Stelle und wir zügelten aus der Stadt hinaus nach Frutigen im ländlichen Berner Oberland. Im benachbarten Kandergrund hatte Vater die Anstellung als Geschäftsführer der Zündholzwarenfabrik Kandergrund AG erhalten. Hier in Frutigen kam mein Bruder Beat zur Welt. Seine Welt waren Pferde. Damals gab es im Militär noch die Kavallerie. Beat bildete nicht die Soldaten aus, sondern er bereitete die jungen Pferde für den Einsatz in der Kavallerie vor.


(1) Das Elternhaus, das Fabrikli und meine Freude am Schnee und der "trendigen" Ausrüstung!
Kapitel 2 Meine Jugendzeit in Frutigen.
Wohnhaus und Fabrik.
Erinnerungen an die Wohnung an der Segnesstrasse in Zürich-Altstetten habe ich keine mehr. Erst nach der Züglete 1943 von Zürich nach Frutigen - inmitten der schweren Kriegszeit - sind mir dank meiner beiden Schwestern Waltraud und Antoinette einige wenige Erinnerungen wach geblieben. Waltraud wörtlich: "Walter Gehring aus Kandergrund - der neue Arbeitgeber meines Vaters - stellte uns ein zweistöckiges, geräumiges Haus zur Verfügung. Wir bekamen alle ein eigenes Zimmer. Zwei Mädchenzimmer mit Blick auf die Schnee und Eisberge Altels und Balmhorn und dein Zimmer mit Aussicht auf die Geleise der Bern-Lötschberg-Simplon Bahn! Bruder Beat kam drei Jahre später zur Welt."
Keine 10 Meter vom Haus entfernt, betrieb die Bergbaugesellschaft Kandergrund AG während des Zweiten Weltkrieges ein "schmutziges Geschäft". In einem verwahrlosten, vom Kohlenstaub schwarz gewordenem Fabrikgebäude wurden Kohlenreste aus dem Kohlenabbau am Horn ob Kandergrund gebrochen, gemahlen, getrocknet und von einer Presse unter Riesenlärm zu eierähnlichen Briketts geformt. Diese Fabrikation verursachte nicht nur viel Lärm, sie verursachte auch Luftverschmutzung gröberer Art. Der Kohlenstaub drang durch alle Ritzen der Fabrik ins Freie und verbreitete eine schwarze, oft übelriechende Wolke über unser Haus. Doch nicht genug. Die fertigen Eierbriketts wurden im Freien gelagert und erst später auf Lastwagen verladen und vorallem der Basler Pharmaindustrie ausgeliefert.
Meine Schwester Waltraud erzählte mir kürzlich eine spannende Geschichte aus meiner Jugendzeit, an die ich mich nur noch schwach erinnere. "In einem Waschzuber im Freien schmierte dich unsere besorgte Mutter regelmässig mit Blockseife ein und schruppte dir mit einer Bürste den Kohlenstaub und Dreck vom Leibe. Nicht verwunderlich, war doch dein Spielplatz inmitten Kohlebrocken und Eierbriketts. Dass sich Mutter dabei an die in Zürich gepflegten Spielplätze in sauberer Umgebung sehnte, war mehr als verständlich."
Waltraud erzählte weiter: „Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 schien der Bedarf an Schweizerkohle und Eierbriketts aus Kandergrund gesättigt zu sein. Jedenfalls schruppten jetzt Arbeiter das Fabrikareal vom Kohlenstaub frei. Ein neues Gewerbe hielt Einzug. Die Zündholzfabrik Kandergrund AG begann mit der Produktion pyrotechnischer Artikel wie bengalische Fakeln und Wunderkerzen. Erinnerst Du dich?“ „Ja genau, so Holzstäbchen in verschiedenen Grössen und Farben wurden für diverse Produkte von stets dorfenden Frauen in vorgelochte Brettchen gesteckt. "Stecken" nannten sie diese eintönige Arbeit. Anschliessend tunkte ein Vorarbeiter die Wunderkerzen und Bengalfakeln bis zur Hälfte in eine farbige und wahrscheinlich höchst giftige Brühe! Nach dem Tauchgang wurden die Wunderkerzen und Fakeln auf Metallständern in den Trocknungsraum gefahren. Dieser schmale Raum war stets geheizt. Ventilatoren saugten direkt von der Heizung heisse Luft an. Der rabenschwarze Ofen musste wie bei einer Dampflok mit Kohle gefüttert werden. Zum Vergnügen des Heizers und zum Ärger meiner Mutter, durfte ich beim Kohle schippen mit meiner roten, blechernen Kinderschaufel mithelfen, was mich stets in einen Kaminfeger verwandelte. Die Fabrik hatte einem vierjährigen Buben noch weiteres zu bieten. Da war eine kleine Werkstatt mit Werkzeug jeder Art. Auch geschälte Holzbrettchen lagen in jeder Grösse herum. Diese weckten meine Spiel- und Bastellfreude und den Ärger des Vorarbeiters, weil ich ihm in seiner kleinen, selten aufgeräumten Bude ein noch grösseres Durcheinander verursachte. Wenn meine Anwesenheit für ihn lästig wurde, schickte er mich ins Freie. Rund um die Fabrik fand ich zum Spielen genügend Holzabfälle und missratene Fakeln.
Fräulein Mäder meine Lehrerin kam mir mit ihren streng nach hinten gekämmten Haaren stets als ältere Frau vor, obwohl sie erst vor wenigen Jahren nach dem Lehrerinnenseminar nach Frutigen kam. Sie führte ein strenges Regime über uns 30 Schülerinnen und Schüler. Was wir genau in der Schule lernten und was für Geschichten und Märchen uns Fräulein Mäder erzählte, habe ich leider grösstenteils längst vergessen. Traurige Märchen waren es kaum. Solche mochte ich gar nicht anhören. Dies bemerkten bald einmal meine beiden Schwestern Waltraud und Antoinette, und vor dem Einschlafen erzählten sie mir oft ihre selbst erfundenen, himmeltraurigen Geschichten bis ich zu Tränen gerührt meinen Kopf ins Kissen drückte und mich die beiden "Märlietanten" mit gespielter Anteilnahme und Zärtlichkeit zu trösten versuchten!
Zurück zur Primarschule. Ich fand sie langweilig, träumte vor mich hin und musste zwangsläufig meine beiden Schwestern um Nachhilfe bitten. Rechnen hielt ich als unnötige Schulmeisterei. Mein Gekritzel auf der damals üblichen Schiefertafel konnte nur ich lesen und verstehen! Doch mein Schulweg fand ich spannend. Um den langen Weg ins neue Primarschulhaus Wydi zu verkürzen, benutzte ich oft das rechte Bachufer der Engstlige. Dies war eine sportliche Sache, konnte ich doch über grosse Steinbrocken klettern und vorsichtig durch die dunkle Geleise-Unterführung der Eisenbahnlinie Bern-Lötschberg-Simplon stolpern. Meinen Eltern erzählte ich nichts von dieser Abkürzung um der unvermeidlichen Strafpredigt aus dem Wege zu gehen. Als ein gleichaltriger Knabe aus der Nachbarschaft bei hohem Wasser in die Engstlige fiel, gelang es einem mutigen Bahnarbeiter das schreiende und zappelnde Rüedi - so hiess der Unglücksrabe - an trockenes Land zu zerren. Da verzichtete ich zukünftig diesen abenteuerlichen Schulweg zu benutzen!
Nicht verzichten wollte ich auf die Flugzeuge. Keine 300 Meter von unserem Haus entfernt – zwischen Engstlige und Kander – befand sich der Militärflugplatz Frutigen. Ein Eldorado für uns Buben aus der näheren Umgebung. Der Krieg war vorbei, doch auf dem Flugplatz herrschte stets Schulbetrieb und das Gelände war offen zugänglich. Hie und da erlaubte mir einer der vielen Pilot ins Cockpit seines „Bücker Jungmeisters“ zu klettern. Für einen kurzen Moment durfte ich von Ikarus und Dädalus träumen von den beiden "Flugpionieren" wie sie auf kleinen Sammelbildchen der westschweizer Schoggifabrikanten Nestle, Peter, Cailler, Kohler zu bewundern waren.

(2) Bücker Jungmeister mit Sternmotor
Bücker Jungmeister mit Sternmotor.
Die reissende Kander.

(3)
Doch da war noch ein zweiter reissender Bach in unserer Nähe. Die Kander. Sie entspringt an der Blüemlisalp oberhalb Kandersteg und sucht sich den Weg via Alpweiden und Schluchten zum Zusammenfluss mit der Engstlige unterhalb Frutigen. Die beiden Bäche waren öfters Schauplatz unseres „Ideenreichtums“. Mein 1946 geborene Bruder Beat ging noch nicht zur Schule. Franz aus der Nachbarschaft und einige wilde Knaben aus dem Dorf und ich waren die Akteure. Die Idee: „Wir bauen ein Floss.“ Aus dem kleinen Fabrikli organisierte ich Bretter, Pfähle, Holzlatten, Nägel und Schrauben sowie das nötige Werkzeug. Auf einem Leiterkarren brachten wir all diese Utensilien an die Kander um uns an ihrem Ufer ein "echtes" Floss zu zimmern um damit den anderthalb Meter hohen Wasserfall zu befahren! Anmerkung: Schwimmen und Tauchen konnte ich zwar, weil wenige Schritte von unserem Haus entfernt ein öffentliches Schwimmbad betrieben wurde. Ob meine Kollegen auch schwimmtüchtig waren, weiss ich nicht mehr so genau! Irgendwie nagelten und schraubten wir die Bretter zusammen, vergassen nicht eine Art Steuerruder anzubringen und wasserten das Floss an einer sandigen Stelle in die noch ruhig dahinfliessende Kander bevor sie sich nach ca. 300 Metern am Wasserfall mit der Engstligen vereinte.
Wie immer bei solchen Unternehmungen war auch mein kleiner Bruder Beat zur Stelle. Kinderbetreuung, Kinderkrippe könnte man dies heute nennen! Doch aufs Floss durfte er nicht und so blieb er schmollend am Ufer zurück und nur für uns "Grosse" ging die Post ab, dem in der Ferne rauschenden Wasserfall entgegen. Wahrscheinlich waren unsere statischen Berechnungen eher ungenügend, oder wir hämmerten die Nägel krumm ins Holz. Jedenfalls fing sich das Floss bei immer stärker werdender Strömung zu drehen an und begann sich in seine einzelnen Bestandteile aufzulösen. Wir verliessen rechtzeitig das "sinkende Schiff" und krochen klatschnass über spitze Steine und Geröll ans rettende Ufer. Doch das Floss war wie vom Wasser verschluckt. Seine Bretter und die zwei zur Stabilisierung des wackligen Flosses gefällten Birkenstämme entdeckten wir - auf und ab tanzend - im wilden Bachstrudel des Widerwassers! Ein Fischer musste uns beobachtet haben. Jedenfalls wurden wir einmal mehr zum Gesprächsthema im Fabrikli! Das regte die Fantasie und Mitteilungslust der Frauen beim Abfüllen der Wunderkerzen an. Ich bekam bald einmal eine Privataudienz bei meinem Vater, und versprach ihm hoch und heilig, mich während des Sommers dem Fußball und im Winter dem Skifahren zu widmen um nicht auf weitere solche haarsträubenden Ideen zu kommen!

(4) Kohlenbergwerk am Horn in Kandergrund Kohlenmineure am Horn.
Ich war sieben Jahre alt, als mich mein Vater im Sommer 1949 in seinem bereits 10-jährigen Opel Olympia zum Kohlenbergwerk nach Kandergrund mitnahm. „Bevor der Kohlenabbau am 1660 Meter hohen Horn beendet, die Eingänge zu den Stollen zugemauert und die Seilbahn abgerissen wird, möchte ich dir zeigen, woher der Kohlenstaub und die Kohlebrocken stammen, die deiner Mutter in der Waschküche die aufgehängten Kleider und die Bettwäsche verdreckten und sie dich mit einer Bürste und viel Seife in der Badewanne waschen musste. Erinnerst Du dich?“„Ja sicher – diese Prozedur hab ich nicht vergessen.“ So etwa lautete meine Antwort. Später vergas ich dieses Detail! „An der Talstation der Kohlenseilbahn sortierten während der Kriegszeit Frauen die Kohlenbrocken von Hand nach ihrer Grösse aus,“ hörte ich Vater sagen. Doch dies interessierte mich kaum, denn die Kohlengondel wartete bereits auf uns zwei "Bergbaukumpel." Wir setzten uns in der kleinen Blechkiste mit Kippvorrichtung auf zwei Kisten und Vater ermahnte mich ruhig zu bleiben, weil sonst das unstabile Gefährt noch mehr ins Schaukeln käme. Zusätzlich informierte mich Vater, dass die Seilbahnanlage weder als Pendel- noch als moderne Umlaufseilbahn gebaut sei. Diese Transportseilbahn war somit eine sehr einfache, höchst abenteuerliche Konstruktion. Der nicht sichtbare Maschinist setzte die leicht hin und her schwankende Fuhre in Fahrt. „So muss sich ein Adler fühlen, wenn er den Felsen entlang schwebt,“ dachte ich mir je näher wir uns der Bergstation näherten. Bald einmal sah ich deutlich das Mundloch. Das Mundloch am Horn – so heisst die Einfahrt zum Stollensystem – liegt auf etwa 1600 Metern Höhe“, dozierte Vater weiter und „dort oben wird uns der Betriebsleiter Willy Dubach erwarten.“ Weiter erfuhr ich, dass die Seilbahn nicht nur für den Abtransport der Kohle verwendet wurde. "All die Mineure und Arbeiter vertrauten sogar bei Föhn- und Schneesturm der robusten Seilbahntechnik.“ Schneller als gedacht, empfing uns der ehemalige Betriebsleiter und führte uns zu den Holzbaracken, die wie Stelzen aus Baumstämmen in die stotzigen Abhänge gebaut waren. Auch sein vom Kohlenstaub geschwärztes Büro besuchten wir, die Küche, der Essraum und die einfache, mit zwei Betten ausgestattete Sanitätsbaracke, um verunfallten Mineuren Erste Hilfe leisten zu können.
Zur Blütezeit des Abbaus wurden pro Monat 2000 Tonnen Braunkohle recht guter Qualität mit der nur einspurigen Gondelbahn ins Tal geschafft. Die Firma Sandoz in Basel war der Hauptabnehmer. Doch bereits in den frühen 50iger-Jahren war ausländische Kohle für Industriebetriebe in der Schweiz wesentlich billiger zu beschaffen als die Braunkohle aus den wenigen noch nicht stillgelegten Gruben in Aeugst am Albis oder bei Horgen am Zürchersee. Die kilometerlangen Schächte brachen ein, die Holzbauten im Freien am Horn und an der Talstation vergammelten, zerfielen. Die Luftseilbahn erhielt keine Betriebsgenehmigung mehr und wurde abgebrochen. Irgendeinmal wurde der rabenschwarze Stolleneingang - das Mundloch - zugemauert.
Während des Zweiten Weltkrieges schufteten an die 200 Kohlenmineure am Horn. Darunter waren auch viele dubiose Gesellen mit oft krimineller Vergangenheit. Willy Dubach soll nie den vollen Monatslohn ausbezahlt haben. Die meisten Mineure wären schon nach dem ersten Ausgang in die umliegenden Wirtschaften Pleite gegangen. Erst wenn der Mineur keine Lust mehr auf weitere Arbeit am Horn hatte und weiterziehen wollte, zahlte ihm Dubach den noch offenen Lohnanteil aus. Für damalige Zeiten eine sehr soziale Idee!

Kapitel 3 Godis Amilcar.www.automania.be/files/Image/AMILCAR/10-Amilcar CGS 1925 - DSCN3428.jpg" alt="Amilcar CGS 1925" width="444" height="241" />
Französischer Amilcar CGS von anno 1925
Nach dem 1. Weltkrieg kamen in Frankreich viele Kleinwagen auf den Markt. 1920 wurde die "Société Nouvelle pour des Automobiles" in Saint-Denis bei Paris gegründet. Einfach, stark und wirtschaftlich sollten ihre Fahrzeuge sein. Der Typ CC war ein kleiner Vierzylinder, ausgerüstet mit einem 903-ccm-Motor, der nur 18 PS leistete. 1923 gab es die ersten sportlichen Versionen. An kleinen Rennen verzeichneten Amilcars erste Siege. Doch für Spitzenplätze in den Gesamtwertungen reichten die noch zu schwach motorisierten Fahrzeuge nicht aus. Die Rennwagen von Bugatti aus dem französischen Molsheim waren bei Werksfahrern und vermögenden Playbois der Inbegriff eines modernen und erfolgreichen Rennwagens.
1926 erschien bei Amilcar der Typ CGSS mit einem tiefergelegtem Chassis, einem 6-Zylinder-Motor mit 83 PS und über 130 km/h schnell. Doch für einen Gesamtsieg am 24-Std-Rennen von le Mans reichten auch diese rassigen Rennwagen nicht aus.
Ich war keine zwölf Jahre alt und Godi Trummer ein tüchtiger Hilfsarbeiter - angestellt bei der Zündholz Fabrik Kandergrund - nur wenige Kilometer südlich von Frutigen. Godi war ein bekanntes Original: Alleinstehend, schmutzig, zahnlos, unrasiert, mit einem Sprachfehler. Zum Auslachen, zum Ausnützen geboren! Als WC benützte er hinter seinem Häuschen "zBifige" ein stinkendes Fass mit Holzdeckel. Auf der Wetterseite türmten sich Berge von undefinierbarem Gerümpel auf, notdürftig durch ein Wellblechdach gegen Regen und Schnee geschützt. "Godi hat leider in jungen Jahren nichts lernen können, aber in mechanischen Dingen ist er blitzgescheit," wusste mein Vater zu berichten.
Und dieser Godi besass einen Rennwagen. Einen richtigen Rennwagen. Einen Zweisitzer mit vergammelten Ledersitzen. Ohne Verdeck, ohne Auspufftopf. Die Abgase fanden den Weg ungefildert und laut knatternd ins Freie. Das war damals normal. Niemand drohte ihm mit der Faust oder zeigte dem Godi den Vogel. Schliesslich war sein Amilcar ursprünglich ein kleiner 1,1-Liter-Rennwagen, gebaut in St. Denis bei Paris und kein so langweiliger Opel, wie ihn mein Vater vorsichtig auf der engen Strasse des Kandertals fuhr. Bei Godis Rennwagen prangte vorne quer über den Kühler gross und unübersehbar der Schriftzug: AMILCAR. Ein Franzose also, gebaut in den Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts. In den Dreissigerjahren soll Godi damit Rennen gefahren sein! Nachweise gab es höchstwahrscheinlich keine. Was soll"s? Für mich war Godi der Rennfahrer. Er besass als einziger im Kandertal einen Rennwagen, alt zwar, klapprig, aber doch ein Rennwagen und erst noch mit vernickelter Kühlerfassung. Für sein oft bockiges, mageres Motörchen richtig in Schwung zu bringen, benötigte Godi die bei den meisten Autos üblichen Andrehkurbel. Viele Bauern und Handwerker aus der näheren Umgbung brachten dem Godi zum Flicken ihre stumm gewordenen Radioapparate, ihre defekten Bügeleisen, ihre Fahrräder - noch zum Bremsen mit Rücktritt ausgestattet - und ab und zu auch ein Kleinmotorrad. In kürzester Zeit - und für ein mageres Trinkgeld - flickte Godi in mitten einer fürchterlichen Sauordnung: Zum Glück leuchteten die beiden faden Glühlampen nicht in alle Winkel seiner schäbigen Behausung!
Eines Tages kam Vater aufgeregt nach Hause und erzählte folgende, unglaubliche Geschichte: "Dem Godi haben sie den Amilcar weggenommen." Ich war schockiert. "Dem Godi? Meinem Rennfahrer? Was war geschehen?" Mit wenigen Handgriffen konnte Godi das Heck des Amilcar zur Holzfräse umbauen. An Samstagen fuhr er zu den Bauern der nahen Umgebung und sägte Holz für ihre Kochherde und Gussöfen. Und auch bei uns zu Hause, beim Fabrikli nebem dem Schwimmbad, war Godi stets willkommen. Holz zum Sägen gab es stets genug. Dieser kleine Nebenverdienst musste ihm ein Wirtshauskollege missgönnt haben. Er schickte dem Godi eine gefälschte Aufgebotskarte der Kantonalen Motorfahrzeugkontrolle ins Haus.
Am vorgeschriebenen Termintag fuhr Godi ahnungslos mit seinem "Rennwagen" zu den strengen Experten nach Thun. Doch hier wartete niemand auf den Godi aus dem Kandergrund. "Er könne wieder nach Hause fahren, man werde ihn schon rechtzeitig vorladen," meine der pflichtbewusste Prüfungsexperte. Godi, verärgert über den fiesen Scherz eines seiner Arbeitskollegen, dreht wie wild an der Kurbel, in der Absicht, diesem Lumpenhund aus Frutigen so rasch wie möglich die Meinung zu sagen. Doch bei seiner wilden Kurbelei verölten die Kerzen. Der Motor machte keinen Wank mehr. Umsomehr fluchte der Godi weiter und kramte völlig entnervt in der Werkzeugkiste nach einem brauchbaren Kerzenschlüssel.
Dem Experten von vorhin waren natürlich vom Fenster aus die vergeblichen Startbemühungen nicht entgangen und so nahm das Unheil seinen Lauf. Der Experte erschien unter der Türe, trat auf den wütenden Godi zu und meinte höhnisch: "Da er jetzt schon da sei, wolle er den rassigen Rennwagen doch noch auf seine Verkehrstüchtigkeit hin kontrollieren." Und da fiel der Amilcar durch alle Gesetze und Vorschriften der kantonalen Motorfahrzeugkontrolle. Noch schlimmer. Das Rennwägelchen mit der rassigen Andrehkurbel wurde auf der Stelle aus dem Verkehr gezogen. Konfiszieren oder von Staates wegen das Fahrzeug unverzüglich einziehen oder Beschlagnahmen, hiess in der Beamtensprache dieser unbarmherzige Akt.
Godi musste wohl oder übel der Staatsgewalt nachgeben, fuhr mit der Bern-Lötschberg-Simplonbahn nach Frutigen und zu Fuss ins Kandertal zu seinem baufälligen Hüttli zurück. Hier hat er sich - laut meinem Vater - tagelang nicht blicken lassen. Ein kleines Häufchen Elend. Ich sah seinen Amilcar nie wieder. Und Godi? Er erschien mir noch geringer, noch magerer, noch verhudleter. Trotzdem oder gerade deswegen ist er für mich bis heute im Gedächtnis geblieben, mein Rennfahrer aus dem Kandergrund, dem Spott und Hohn neidischer Gaffer ausgeliefert.
Viele Jahre später - ich hatte damals auch so einen kleinen, blauen, französischen Rennwagen aus den Zwanzigerjahren. Es war allerdings kein Amilcar sondern ein Derby mit Kompressor, Damit fuhr ich eines Tages die schmale Strasse vom Bunderbach Richtung Ausser-Kandergrund. Neben mir sass wie üblich der Berner Sennenhund meiner Tochter Beatrice und beobachtete den Strassenverkehr. Zwei Frauen am Strassenrand nickten uns zu, hielten uns an und im echten Frutigdeutsch meinte die ältere mit verschmitztem Lächeln: "Itz hani gmint ds Trummergödi chemi mit sim Chäri derhar!"
Ich danke Dir. Und ich höre und sehe natürlich in Godi auch einwenig von Bernhard - nein nicht einwenig - viel! "Ein Original" bist Du auch und gewiss manchmal auch ganz gerne einwenig knorrig. Aber preisgeben wollen wir hier nicht alles! Der Godi seinerseits wäre möglich stolz und würde gewiss auch ein wenig erröten, könnte er diese Zeilen lesen. Teile mit uns, lieber Bernhard, noch möglichst viele solche wunderbaren Geschichten. Herzlich Hansjörg.
Lieber Hansjörg.
Da kommt mir noch eine Jugendgeschichte in den Sinn. Es ist eine Geschichte, die ich erst viele Jahre später verstanden habe, eine Geschichte mit der ich Sie liebe Leserin, lieber Leser, für einen kurzen Moment in die Nachkriegszeit entführen will. Wie schon im Kapitel 1 beschrieben, war meine Mutter italienischer Abstammung und hegte rege Kontakte mit Ihren Verwandten im Dörfchen Orino eine Fahrstunde südlich des Grenzortes Ponte Tresa. Während des 2. Weltkrieges konnte sie ihre Verwandten nicht besuchen. So war es nicht verwunderlich, dass sie nach dem Waffenstillstand von Cassibile vom 1. Mai 1945 den Wunsch hatte, nach Orino zu reisen um ihre Verwandten zu besuchen. Mussolini war auf seiner Flucht von Partisanen erschossen, das "Neue Römische Imperium" von den Faschisten ausgeträumt, Hitlers Wehrmacht von den Allierten besiegt.
Meine beiden Schwestern Waltraud und Antoinette, mein kleiner Bruder Beat - keine zwei Jahre alt - und Bernardo wie mich meine Zias und Zios nannten, wurden minutiös auf die Reise vorbereitet. Alle bekamen einen mit Kleidern und Geschenken vollgestopften Rucksack zum Mitschleppen angepasst. Die Empfänger der Geschenke wie Lebensmittel, Schuhe und einfache Kleider sollten den Verwandten die schwierige Nachkriegszeit etwas erleichtern.
Vater brachte uns mit seinem einem viersitzigen Tourenwagen der Marke Wanderer W 25 K aus dem Jahre 1936 ohne kochendes Kühlwasser nach Locarno. Hier in Locarno war geplant auf das Schiff umzusteigen, Laveno anzufahren und mit der Ferrovia Milano Nord bis nach Gemonio zu fahren und die letzten Kilometer nach Orino hinauf mit einem Taxi zu meistern. Doch in Locarno begann die Reise mit ungeahnten Schwierigkeiten. Kein grosses Schiff weit und breit. Das offizielle Kursschiff hatte Locarno Richtung Sesto Calende - südlichster Punkt des Lago Maggiore - schon längst verlassen. Gross war unsere Enttäuschung. Doch Vater wusste Rat, stopfte uns alle in den Wanderer und fuhr recht zügig über den Monte Ceneri nach Lugano. Hier bestiegen wir die Bahn nach nach Ponte Tresa. Von Vater mussten wir uns leider verabschieden. Er fuhr über den Gotthard zurück nach Frutigen um am nächsten Tag rechtzeitig im Büro der Zündholzfabrik in Kandergrund zu erscheinen. Bestimmt hatten wir jetrt alle ein mulmiges Gefühl im Magen!! Das Zepter hatte jetzt Mutter übernommen und so ratterten wir gleichmässig mit der Bahn dem Lago di Lugano entlang nach Ponte Tresa. An der Grenzkontrolle zu Italien schaffte es Mutter mit ihrem scharmanten Lächeln alle unsere Utensilien an den Zollbeamten vorbei zu "schmuggeln". Am Bahnhof auf der italienischen Seite löste sie die Fahrkarten für die Weiterfahrt mit der Bahn Ponte-Tresa-Cadegliano-Ghirla.
Stazione di Ghirla (Valganna)
Wie meine Mutter es schaffte mit uns Vieren weiter zu kommen, ist mir heute noch ein Rätsel. Die Geleise der "Ferrovia della Valganna" führten nicht nach Varese sondern nach Ghirla und anschliessend auf einem Umweg via Luino wieder nach Ponte Tresa zurück! So blieb ihr nichts anderes übrig als in Ghirla ein Taxi zu organisieren. Doch dies war kurz nach Kriegsende keine einfache Sache.
Ich denke, dass Mutter nach einer telefonischen Lösung suchte. In kleinen Ortschaften gab es bei den Verkaufsstellen "Tabacci&Giornale" auch öffentlich zugängliche Telefonapparate. Einen solchen Tabakladen gab es auch in Orino. Wie Mutter in Ghirla ein Telefono ausfindig machen konnte, weiss ich nicht. War es beim örtlichen "Tabacchi&Giornale" oder besass der Bahnhofvorstand ein Streckentelefon und konnte den Tabakhändler in Orino irgendwie erreichen? Jedenfalls erschien nach stundenlanger Wartezeit das Taxi aus Orino, nahm uns alle "an Bord" und nach einer knappen Stunde Fahrt auf der staubigen Landstrasse erreichten wir todmüde, hungrig und schmutzig unser Ziel. Wie der Taxifahrer von unserem "Zwischenhalt" in Ghirla erfahren konnte, war bestimmt dem Tabakhändler und seinem Telefon zu verdanken. Orino war ein kleiner Ort und da sprach sich das Malheure der Anna und ihren Bambini aus der Schweiz rasch herum. Da konnte der einzige Taxifahrer in Orino die Svizzeri in Ghirla nicht dem Schicksal überlassen. Er wäre sein Leben lang von der Dorfgemeinschaft geächtet worden!
Heute noch bin ich erstaunt darüber, wie es Mutter in der damaligen Nachkriegszeit fertig brachte, uns ohne weitere Zwischenfälle ins ialienische Orino zu bringen. Grazie Mama!
.


(1) Kapitel 4 Am "Bühlstutz":Willy Peter Daetwyler und sein von Giovanni Michelotti massgeschneiderte 4,5-Liter-Alfa Romeo.
Kapitel 4
Am Bühlstutz und Willy Peter Daetwylers 4,5-Liter-Alfa Romeo.
Wir Frutigerbuben sammelten sie anfangs der 50er-Jahre leidenschaftlich - all die vielen Bildchen von nationalen und internationalen Sportlern. Panini-Bildchen anno 1954! Der Bäcker Stucki bot sie an, in einem Päckchen versteckt, samt Kaugummi. Bazzoka hiess der Name oder so ähnlich. Doch dieser rote Kaugummi interessierte mich kaum. Auch ein Album gehörte dazu und da hinein klebte ich sie - fein säuberlich und haargenau - all die Fussballer und Radsportlegenden, die Skifahrer und Eishockeyspieler, die Leichtathleten und die Automobilrennfahrer. Für genau hundert schwarz/weiss Fotografien - 4,4cm x 2,6cm - war knapp Platz vorhanden im Album „MAPLE LEAF ALBUM-SPORT“. Natürlich besass ich sie alle, die Schweizer Radfahrerasse Ferdi Kübler, Hugo Koblet, Fritz Schär, die legendären Italiener Fausto Coppi, Gino Bartali, die Tour de France Legende Jean Robic, der Auto Rennfahrer Emanuel de Graffenried, die Fussballer Seppe Hügi, Fredi Bickel, Weltklassetorhüter Frankie Séchéhaye, der Skirennfahrer und spätere Politiker Fredy Rubi aus Adelboden, mein Skiidol der Slalomkünstler Georg Schneider aus der franzöischen Schweiz oder der Kunstturner Josef Stalder aus Luzern. Nur ein einziges Bildchen fehlte mir noch. Ein einziges und zugleich auch das letzte im Album jenes mit der Nummer 100 des Autorennfahrers Willi Peter Daetwyler aus Zürich. Zusätzlich war die Bildchenaktion mit einem Wettbewerb verbunden. Ein Aufsatz sollte „in deutlicher Schrift“ geschrieben werden. Titel: „Mein Liebster Sport.“ 1. Preis ein TEBAG-Rennvelo mit Übersetzungswechsel, Brooks-Sattel und Felgenbremsen. Wert 430 Franken. Doch dieser Wettbewerb interessierte mich kaum. Zu schlecht waren meine Aufsatznoten beim Sekundarlehrer Fritz Bach. Zusätzlich musste ich mir anhören, wie Herr Bach meine schreibgewandten Schwestern in allerhöchsten Tönen rühmte. Doch meine Aufsätze wurden deshalb kaum besser!
Und als dann 1953 zum vierten Mal das 2640 Meter lange Bergrennen am Büelstutz zwischen Mitholz und Kandersteg gestartet wurde, gab es für mich nur einen Wunsch, dem Daetwyler persönlich meine Meinung über dieses miese Bildchengeschäft mitzuteilen. Dazu kam es leider nicht. Den Zutritt ins Fahrerlager am Blausee verrammelte mir so ein grosskotziger ACS-Funktionär aus irgendeiner Schweizerstadt. Und so marschierte ich verärgert bergwärts an die Rennstrecke, platzierte mich demonstrativ an der Aussenseite einer Kurve, ungeschützt, möglicher Abflüge der Rennfahrerinnen und Rennfahrern ausgeliefert! Wenigstens gab es hier keine Funktionäre, die mich zum Teufel jagten. Die Sicherheit der Zuschauer war damals noch kaum ein Thema. Und als dann der Daetwyler auf dem Alfa Romeo 412 den Berg, oder wie die Einheimischen sagten, den Büelstutz hinauf donnerte, da wurde ich zu seinem grössten Fan. Wie Willy Peter Daetwyler – WPD wurde er gerufen - auf der holprigen, schmalen und keine drei Kilometer langen "Gasse" den potenten 4,5-Liter Rennsportwagen pilotierte, liess meinen Ärger mit den Bildchen vergessen. Und dazu der Ton des 12-Zylinder-Motors mit Doppelkompressor: Grollend, aggressiv, ein Genuss für meine Bubenohren. Ab sofort waren für mich all die kleinen, in den Kurven quietschenden Rennwägelchen der damals gängigen Rennmarken Cooper, Cisitalia oder Stanguellini kein Thema mehr. Und die aus BMW- und Porscheteilen gebastelten Eigenkonstruktionen noch weniger. Dass ihre Fahrer dem erfolgreichen „500er Club“ angehörten, war mir völlig gleichgültig. Für mich gab es nur noch einen Rennfahrer und einen Rennwagen: Willy Peter Daetwyler und sein Alfa Romeo.
Den zweiten Lauf beobachtete ich nach einer schnellen Linksrechts-Kombination kurz vor dem Ziel. Einzig Granitsteine, durch Wasserrohre miteinander verbunden, trennten mich vor der tödlichen Gefahr. Die war mir nie und nimmer bewusst, schliesslich lenkte mein Daetwyler das brutale Geschoss. Mein Vertrauen in WPD muss grenzenlos gewesen sein! Noch heute sehe ich ihn vor mir, der auf mich zuschiessende, von einer Strassenseite zur andern tanzende Alfa Romeo und noch minutenlang schwebte der unverwechselbare Geruch von verbranntem Rizinusöl in meiner Nase. Es ist mir, als wäre dies alles gestern geschehen, und der Geruch dieses Wolfsmilchgewächs hätte sich inmitten der Berge rund um Kandersteg immer noch nicht verflüchtigt! Zur eigentlichen Rangverkündigung im Grand Hotel Victoria in Kandersteg hatte ich keinen Zutritt. So blieb mir nichts anderes übrig, als den Daetwyler beim Betreten des Hotels zu beobachten. Seine grosse, leicht korpulente Figur war nicht zu übersehen. Er schien in bester Laune zu sein. Ihn um ein Autogramm zu bitten, fiel mir nicht ein. Nach Autogrammen zu jagen war uns Frutigerbuben noch kaum bekannt. Aus respektvoller Distanz bewunderte ich mein neues Idol. Meine Wut auf die Kaugummibildchen, die fantasielosen Profiteure und ihre üblen Tricks waren längst verflogen. Ich hatte vor wenigen Stunden meinen Willy Peter live erlebt und nur dies war für mich von Bedeutung. 1953 fuhr ich erneut an den Bühlstutz. Per Velo mit Rennlenker - aber ohne Übersetzungen! Daetwyler hatte dem Alfa Romeo nach einer Skizze vom Blechkünstler Giovanni Michelotti ein neues Alu-Kleid massschneidern lassen. Dazu gab es jetzt neu einen einzigartigen Doppelkompressor. Dieser kreischende und heulende Auflader soll dem Wagen noch "einige" zusätzliche PS eingehaucht haben. Mein Vater vermutete weit über 250 PS.
1953 auch war das Jahr des legendären Streckenrekords. 1.42,6. Dies entspricht einer Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 100 km/h. Und ich war dabei, am Strassenrand natürlich, fasziniert von dem spektakulären Fahrstil „meines“ Daetwylers in seinem optisch wunderschönen Alfa Romeo. Erst acht Jahre später wird der Glarner Harry Zweifel auf einem Cooper-Ferrari den Rekord unterbieten. Leider sah ich in den folgenden Jahren den Daetwyler nicht mehr am Bühlstutz. Meine Eltern fanden, dass das Rennen auch für Zuschauer zu gefährlich sei und legten für meinen Besuch ihr Veto ein. Nicht ganz zu Unrecht. Der Sicherheit schenkte die organisierende ACS Sektion Bern noch wenig Beachtung: Randsteine durch Wasserrohre miteinander verbunden, rot und weiss gestrichene Baulatten und Holzpfähle, verrostete Eisendrähte! Eigentlich sollten diese Maschenzäune Kühe und Ziegen vom Alltagsverkehr abhalten. Und was für das Vieh recht war, schien damals auch für Zuschauer und Rennfahrer zu genügen! Auch verlor ich vorübergehend das Interesse am Automobilrennsport, insbesondere an Daetwyler, den er schaffte sich bald einmal einen Maserati an und dies empfand ich als „Verrat“ an Alfa Romeo. Damals konnte ich nicht wissen, dass der 412er mit seinen beinahe 15 Jahren die besten Zeiten hinter sich hatte und dass die internationalen Sportreglemente den Trend zu kleinvolumigen Wagen einläuteten. Dazu kam, dass mich jetzt der Fussball zu fesseln begann. 1954 fand die Weltmeisterschaft in der Schweiz statt. Für Nachkriegdeutschland geschah „Das Wunder von Bern“. Fritz Walther, Helmut Rahn, Toni Turek und wie sie alle hiessen, wurden Weltmeister. Doch ich versuchte nicht die deutschen zu kopieren sondern die ungarischen Stars - allen voran ihren Kapitän Ferenc Puskas. Aber auch Santor Hidegkuti oder Gyula Lorant verehrte ich. Natürlich verfolgte ich am Radio auch die Schweizer Fussballer wie Eugen Parlier,Willi Kernen, Charles Antenen Roger Vonlanten Josef Hügi oder Robert Ballamann.
Erst Jahre später fand ich wieder an den Bühlstutz zurück – doch da waren die Rennen zwischen Mitholz und Kandersteg längst Legende geworden. Willy Peter Daetwyler hatte den Rennsport quittiert, war 1957 Bergeuropameister, überlegener Sieger und Streckenrekordinhaber an unzähligen Bergrennen wie St. Ursanne - Les Rangiers, Ollon – Villars, am San Bernardino-Pass usw. Auch das 22 Kilometer lange Bergrennen am Mont Ventoux in Frankreich gehörte zu seinem Palmares. An unzähligen Rundstreckenrennen war er kaum zu besiegen. Daetwyler war ein lupenreiner Privatfahrer und ging während all seiner Rennfahrerjahre einer geregelten Arbeit als Geschäftsleiter des Lagerhauses in Zürich nach. 2002 ist Willi Peter Daetwyler verstorben. Sein Alfa Romeo ist erhalten geblieben. Im „Musée national de l’Automobile“ in Mülhausen erfreut der exotische Rennwagen tagtäglich die Besucher dieses einmaligen Museums nordwestlich von Basel.
(2)
Und das 100ste Bildchen im “ML Album-Sport“? Das Bildchen vom Rennfahrer Willy Peter Daetwyler? Vor ein paar Jahren hab ich es gefunden, in Zürich, in einem Antiquariat. Zufällig! Nicht billig. Aber was soll’s. Nach 60 Jahren hat sich bei mir ein Bubentraum erfüllt. Willy Peter Daetwyler hat jetzt im ML Album Sport – aufgeschlagen auf der letzten Seite - seinen Ehrenplatz erhalten. Und links oben von ihm - mit stolzem Turnerblick in die weite Ferne - der Kunstturner Josef Stalder aus Luzern. Mit ihm habe ich mich schon längst versöhnt!


(1) "sMoser Käthi" und "dsRuppi" aus Kanderbrügg Kapitel 5
"sMoserKäthi" und "dsRuppi" - beide aus Kanderbrügg.
Wer weiss noch, dass sich im Frutigtal bis in die Sechzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts zwei Zündholzfabriken einen verbissenen Konkurrenzkampf lieferten? Mein Vater war Geschäftsführer in Kandergrund, ein anonymer Schwede in Kanderbrück. 1933 hatte die JH Moser AG ihre Zündholzfabrik in Kanderbrück dem Zündholzimperium des 1932 verstorbenen Financier, Unternehmers und Betrügers Ivar Kreuger verkauft. „Die Fabrik gehört dem Ivar Kreuger, den Schweden und das steht ganz deutlich auf den schwer lesbaren Etiketten ihrer Zündholzschachteln: „Kanderbrücks Tänstickfabriks Patent. Säkerhets Tändstickor ultan svafel och Fosfor.“ Vater wusste sich gegen die mächtigen Zündholz-Schweden zu wehren und liess sich ein grosses Sortiment verschiedener Zündholzartikel einfallen: Jede Menge von „Trümmeli“ Cheminéehölzer, Bengalhölzer, Wunderkerzen ja vor den Nationalfeiertagen sogar Raketen. Diese wurden allerdings bei Meister Hamberger in Oberried am Brienzersee hergestellt. Doch der Verkauf eines Teils der Raketen ging auch über Vaters Bürotisch. Mit den Schneebergen Altels und Balmhorn, Alpenrosen und Enzian und dem unübersehbarem Schriftzug „Schweizer Zündhölzer“ wehrte sich Vater gegen das drohende Aus der Zündwarenfabrik Kandergrund AG.
1972 war es trotz all seinen Bemühungen so weit. In Kandergrund wurde der Betrieb eingestellt, in Kanderbrück standen die Maschinen schon seit 1966 still. Dieser Konkurrenzkampf Kandergrund gegen Schweden drang bis an unseren Mittagstisch vor. Doch was da auf Geschäftsebene mit Haken und Ösen ausgefochten wurde, nahmen wir Kinder nicht so tragisch. So begleitete ich meine Mutter hie und da nach Kanderbrück zur Konkurrenz, eben zum stets hochelegant gekleideten Moser Käthi. Die beiden Frauen waren miteinander verwandt, beide italienischer Abstammung beide aus dem Dörfchen Orino, 30 km südlich von Ponte Tresa an der Grenze zu Italien.
Im Herrschaftshaus der Mosers standen in der nicht weniger herrschaftlichen Garage zwei mich schon damals faszinierende, sportliche Fahrzeuge: Der moderne MG TC von Käthi - 1250 ccm, ca. 50 PS stark und 130 km/h schnell - und der bereits Patina aufweisende Bugatti ihres Mannes Hermann Moser. Hermann war sogar Gründungsmitglied des Bugatti Club Suisse und muss ein ganz passabler Rennfahrer gewesen sein. Käthi – sie selber nannte sich Caty - fuhr den hart gefederten MG TC recht schnell und auch nicht ganz risikofrei. "Ds Käthi fährt unter einer Stunde von Kanderbrück nach Bern", wusste mein Vater zu erzählen. Das machte echt Eindruck auf mich. Unser Opel Olympia schaffte sowas nie – abgesehen von meinem Vater, ein gemütlicher Opelfahrer mit Herz und Hand, mit Stumpen und Hut – weit entfernt von irgendwelcher Rennleidenschaft!
Noch genau erinnere ich mich an ein Radiointerview mit dem Moser Käthy. Der Reporter von Radio Bern liess mit viel Einfühlungsvermögen die damals bereits reife Frau Moser von ihrer Jugend und ihrer Rennzeit zu erzählen. „Als 1950 das erste Rennen am Büelstutz geplant wurde, haben die Herren des ACS Bern sie gefragt, ob sie nicht auch dabei sein wolle und ihre Fahrkünste den Männern zu zeigen?“ Das habe ich dann auch getan – aber eine leidenschaftliche, furchtlose Rennfahrerin bin ich nie gewesen." Der eher vorsichtig verhalten fahrende Gemahl auf dem behäbigen Bugatti musste sich stets seiner Gemahlin und ihrem rassigen MG beugen. Vater, der dieses erste Rennen am Büelstutz als Zuschauer verfolgt hatte, meinte: „Hermann ist chancenlos gegen sein Käthi. In ihren Adern fliesst Rennfahrerblut, echtes italienisches Rennfahrerblut.“ 1952 durfte ich dann erstmals persönlich die beiden Mosers in der letzten Spitzkurve vor dem Ziel bewundern. Als 10-jähriger Knabe war ich echt stolz darauf, mit der Rennfahrerin Käthy Moser-Clivio aus Kanderbrück irgendwie verwandt zu sein. „ds’Moser Käthi“ wie sie von den Kanderbrücklern und Frutigern genannt wurde, fuhr erfolgreich auch das bekannte Bergrennen Rheineck – Walzenhausen – Lachen hoch über dem Bodensee. Weitere Rennen sind mir nicht bekannt, ausser klubinterne ACS-Orientierungsfahrten in der Umgebung von Bern. Aber dies waren ja keine Rennen und solche „Kafifahrten“ interessierten mich nicht im Geringsten.
Bis ins hohe Alter ist "ds Moser Käthi" dem Auto treu geblieben, auch als sie von Kanderbrück nach Hünibach zügelte und dort mit ihrem Opel Kadett Betagten und Erkrankten warme Mittagessen ins Haus brachte.
"ds Ruppi"
Kanderbrück blieb mir noch aus einem andern Grund im Gedächtnis hangen. Die gleichaltrigen Buben in Kanderbrück waren mir körperlich überlegen und bei meinen Besuchen bei Mosers versuchte ich ihnen und ihren Steinschleudern aus dem Weg zu gehen. Doch zu Handgreiflichkeiten kam es nie. Hingegen schüchterten sie mich mit ihren kräftigen Posturen ordentlich ein. Und wenn wir auf dem Flugplatz Frutigen Fussball spielten – wir hatten eine sechs oder achtköpfige Mannschaft unter dem Namen „Post“ gegründet - musste ich öfters mehr harte Fouls einstecken, als mir lieb war. Da half der gute Rat meines Freundes und Nachbarn Franz Schmid vom Wydi wenig, als er meinte: „Das nächste Mal werden wir genagelte Bergschuhe anziehen, und den Kanderbrücklern so richtig auf die Füsse treten!“ Das half wenig. Jetzt liefen sie uns noch müheloser um die Ohren!
Als dann in meinem neuten Schuljahr zum traditionellen Schüler-Skirennen gestartet wurde, glaubte ich an meine Chance die jahrelang eingesteckten Demütigungen durch die Kanderbrückler zu rächen – auch wenn es nur an einem Einzelnen möglich war und das war eben „ds Ruppi“ wie wir ihn nannten. Seit Jahren dominierte er das Frutigtaler Jugendskirennen von der „Zinsmaad“ hinunter zur „Hölle“ beim Sekundarschulhaus. „Ds Ruppi“ gewann 1958 erneut. Da nützte auch der gut gemeinte Rat des am Start anwesenden Lehrers Fritz Bach, „wenigstens hier mal richtig Gas zu geben!“ Doch „ds Ruppi“ konnte ich nicht bezwingen. Gefrustet vom zweiten Gesamtrang suchte ich nach Ausreden und fand sie in Ruppis windschlüpfriger Hocke auf den flachen Stellen der Piste. Und noch etwas: Sein Vater soll eine geheime Wachsmischung angewendet haben, selbst gemischt und mit einem Bügeleisen auf die Holzlatten aufgetragen, während ich auf ein schwarzes, "kläbrigs Gschmirr“ mit Namen „Nansen“ vertraute.
Dass ein norwegischer Polarforscher nichts vom alpinen Rennsport verstand, hätte ich eigentlich schon vor dem Start wissen müssen!!!


(1) Kapitel 6 Sturz am Pauschenpferd und seine Folgen.
Kapitel 6 Sturz am Pauschenpferd und seine Folgen.
Als sich an der Sekundarschule Frutigen mein Wunsch konkretisierte Turn- und Sportlehrer zu werden, befasste ich mich mit dem Gedanken in eines der zwei Lehrerseminare des Kantons Bern einzutreten. Doch da hatte ich nicht mit den damaligen religiösen Sitten bernischer Bildungsdirektoren gerechnet. Meinen Eltern wurde deutsch und deutlich mitgeteilt, dass im Kanton Bern keine katholischen Jugendliche zur Lehrerausbildung zugelassen werden!
Dass die damalige Antipathie gegen Katholiken auch an den Schulen von Frutigen gang und gäbe war, hab ich öfters zu spüren bekommen. Zweimal in der Woche wurden die aus katholischen Familien stammenden Schülerinnen und Schüler vom Religionsunterricht dispensiert und „durften“ nach Hause gehen. Dieses frühzeitige nach Hause gehen, weckte bei Mitschülerinnen und Mitschülern leichter Neid und Antipathie gegenüber den „Katholischen“.
Doch eine Geschichte aus meiner Seminarzeit möchte ich Ihnen liebe Leserin, lieber Leser nicht vorenthalten, bevor ich von meiner ersten Lehrstelle erzähle. Das Seminargebäude grenzte auf seiner östlichen Seite unmittelbar an den Zuger Friedhof St. Michael und an das Mädcheninstitut mit dem mir rätselhaften Namen "Maria Opferung". Nebst einer normalen Mittelschule wurde auch ein Sprachkurs in Deutsch für Tessinerinnen angeboten. Einzig eine schmale Strasse trennte die beiden Schulen voneinander, und so unglaublich es tönen mag, das Mädcheninstitut versteckte sich hinter mindestens drei, stellenweise vier Meter hohen Mauern. Einzig durch eine kleine Eisentüre am Eingang konnte dieses "Gefängnis" betreten werden. Zu unserem Leidwesen war dies unmöglich, denn die Türglocke mit ihrem schrillen Ton hätte uns beim Versuch, in dieses "Heiligtum" vorzudringen, gnadenlos verraten.
Eines Tages erhielt ich per Post ein kleines, gelbes Couvert. Ich öffnete es mit leicht zitternden Händen, und zu meinem Erstaunen lud mich eine mir unbekannte Signorina zu einem Rendez-vous ein! Datum, Ort und die nächtliche Zeit waren vermerkt, ebenso der Treffpunkt, die oberste Bank des Friedhofs unter der grossen Trauerweide. Und so nahm das Abenteuer seinen Anfang. Rosita hiess sie, erschien pünktlich an der Bank, und ich verliebte mich augenblicklich in diese wagemutige, dunkelhaarige Tessinerin aus Collina d'Oro bei Lugano. Meine Frage: "Wie kommst Du über diese schreckliche Mauer?" wollte sie mir beim nächsten Mal beantworten. Und so begann zwischen Rosita und mir eine abenteuerliche, über einen Monat andauernde, nächtliche Freundschaft auf dem stockdunklen Friedhof. Rosita erklärte mir, wie sie mit Hilfe einer Mitschülerin über eine sich in Reparatur befindende Lücke an der Mauer kletterte. Schon nach 15 Minuten erwartete ihre Freundin die Rosita wieder bei der Mauerlücke, und zusammen kehrten sie ins Institut zurück, wo die Mitschülerinnen die beiden mit fragenden Augen begutachteten. Doch eines Tages erschien Rosita nicht mehr. Ich wurde zum Direktor Kunz beordert. Fragen auf Fragen prasselten auf mich herab. Er schien alles über unser "Liebesleben" während der nächtlichen Stunden zu wissen. "Er werde meine Eltern unverzüglich informieren, mit dem Hinweis, dass solche Eskapaden am katholischen Lehrerseminar in Zug nicht geduldet werden, und ich hätte mindestens mit einem Ultimatum zu rechnen."
Wie der Direktor überhaupt auf unsere Versteckspiel gekommen ist, und was Rosita für Konsequenzen zu spüren bekam, weiss ich nicht mehr so genau. Ich denke, dass Rosita für Ihre "Klettertouren" bestraft wurde, waren doch der Seminardirektor Dr. Kunz und die Oberin der "Maria Opferung" Geschwister!!! So nahm die Liebesgeschichte unter der friedhöflichen Trauerweide ein frühzeitiges Ende. Ich habe Rosita später einmal im Tessin besucht. Doch wir hatten einander nicht mehr viel zu erzählen - ausser von den spannenden Begegnungen in dunkler Nacht, unter der Trauerweide mitten im Friedhof St. Michael im in katholischen Zug.
Weshalb ich Göschenen als erste Lehrstelle als Primarlehrer auswählte? Ich beabsichtigte mich in meiner Freizeit in den umliegenden Bergen wie dem Salbitschijen und dem Gemsplanggenstock im Felsklettern zu verbessern. Und da war auch der Gemsstock in Andermatt ein Anziehungspunkt. Er galt schweizweit als eines der besten mit einer Seilbahn erschlossene Paradies für Tiefschneefahrerinnen und Fahrer. Präparierte Skipisten waren damals kaum gefragt. Mit über zwei Meter langen Skis der österreichischen Marke Kneissl, der White Star mit Namen, stürzten wir uns in kleinen Gruppen die tief eingeschneiten Hänge hinunter. Selbstverständlich waren wir ausgerüstet mit Lawinenschnüren, Schneeschaufeln aus Aluminium und das damals für Tourenskifahrer, Bergführer und Skilehrer entwickelte Lawinensuchgerät "Barryvox".
Doch da wartete noch die Rekrutenschule auf mich. Und diese brachte mir Unglück – selbst verschuldetes Unglück! Mit meinem Leutnant Heinrich von Grünigen - der spätere Programmdirektor bei Radio DRS 1 - hatte ich das Heu nicht auf der gleichen Bühne. Und als er mich im Turnunterricht wegen ungenügendem Einsatz rügte – liess ich mich am Pauschenpferd zu einem freien Überschlag provozieren und landete mit ausgestreckten Armen auf dem Kiesboden. Absprung verpasst! Schulterluxation links! Super. Die Schmerzen waren gewaltig und bis der vollständig aus der Gelenkpfanne ausgekugelte Oberarmkopf von einem Sanitäter eingerenkt werden konnte, verging über eine Stunde. Diese Zeit genügte, um die Sehnen und Bänder wie Kaugummi auszudehnen. Den Turn- und Sportlehrer konnte ich mir in den Kamin schreiben. Eine Operation verschlimmbesserte die ganze Achsel. Mit einem steifen Schultergelenk lässt sich nur schlecht Leichtathletik und Bergsport betreiben. Von anforderungsreichen Skirennen ganz zu schweigen! Nur bei regionalen Skirennen konnte ich mit dem am Oberkörper fixierten linken Arm einigermassen mithalten. Damals war es üblich, dass viele örtliche Skiclubs in der Zentralschweiz Skirennen organisierten. Beliebt waren die Disziplinen Riesenslalom und Abfahrt mit oft weit über hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer! Zu den bekanntesten regionalen Rennen gehörte der Gemsstock-Riesenslalom in Andermatt und das schnelle Abfahrtsrennen von der Klewenalp nach Beckenried hinunter.
Nach meiner Schulterluxation blieb ich Primarlehrer in Göschenen, lernte die Skilehrerin und Rennfahrerin Anna Duss kennen. Am 15. Juli 1968 heirateten wir in der Klosterkirche Werthenstein im Entlebuch. Bernhard kam am 12. Januar 1970 zur Welt, Anita am 6. Oktober 1972 und die Nachzüglerin Beatrice zehn Jahre später am 31.01.1982.
Ein ganzes Leben lang als Primarlehrer in einer Berggemeinde zu wirken, war mir nicht geheuer. Und bevor mich die Eintönigkeit des beruflichen Alltags vollständig erfasste, suchte ich nach einer neuen beruflichen Lösung. In Gesprächen mit meiner Frau Anna und Berufskollegen kam nur ein Wohnortswechsel in Frage. Die fragwürdige Lebensgestaltung älterer Berufskollegen durfte mich nicht erfassen. "Ist die Monotonie und Langeweile einmal da, gibt es kaum einen Weg dieser Abwärtsspirale zu entrinnen", dachte ich mir. Um nicht von ihrem Sog erfasst zu werden, blieb mir nur die Möglichkeit die Lehrstelle zu kündigen, Göschenen zu verlassen und mich beruflich weiterzubilden. So verliess ich mit meiner Familie nach über zehn Jahren das Dorf am Eingang zum Gotthardtunnel und zügelte nach Altdorf, bildete mich zum Oberstufenlehrer aus und übernahm in Flüelen die erste Klasse der Oberstufe. Diese Altersstufe machte mir Spass, war es doch in Land- und Berggemeinden in den siebziger Jahren des 20-igsten Jahrhunderts noch möglich vielen Schülerinnen und Schülern, nebst den vorgeschriebenen Schulfächern wie Deutsch, Mathematik, Geschichte oder Geographie, in mehrtägigen Berg- und Skitouren mehrere Urner-, Glarner-oder Tessinerberge zu erleben. Solche Touren mussten mit einem Bergführer minutiös geplant und mit der Zustimmung der Eltern durchgeführt werden. Es gab nie Probleme weder mit der Schulbehörde noch mit den Eltern.
In Bürglen bei Altdorf bauten wir uns ein schönes Landhaus. Leider fing im Verlaufe der Zeit unsere Ehe zu "stottern" an, so dass wir uns im Frieden und mit der Zustimmung der dem Kindesalter entwachsenen Anita, Beatrice und Bernhard trennten.
Anita wurde eine erfolgreiche auch international bekannte 800-Meter-Läuferin. Höhepunkt ihrer Karriere waren die Olympischen Spiel in Athen. Nach ihrem Karrierenende heiratete sie den Langstreckenläufer und ehemaligen Schweizerrekordhalter über 10 000 Meter Christian Belz. Beide erfreuen sich heute an ihren drei Mädchen Ilaria, Giulia und Carina - alle drei sportliche und musische Talente. Auch Beatrice versuchte sich in der Leichtathletik. Doch dem professionellen Ernst des Spitzensportes ging sie aus dem Weg und freut sich bis heute am sportlich Tiefschneefahren und Kitesurfen. Zusammen mit ihrem Partner – dem ehemaligen Fussballspieler und heutigen Rechtsanwalt Cyrill Lauper - erfreuen sich die beiden an ihren Mädchen Malia und Leana. Bernhard ist mit Lea verheiratet und ihr Sohn Joshua hat soeben eine Lehre als Verkäufer begonnen und hilft mir hie und da die digitale Welt zu verstehen! Mit Bernhard selber hatten wir schwierige Jahre der Entfremdung durchzustehen. Doch heute hat auch er seinen Platz in der Gesellschaft gefunden, sei es im Winter als Angestellter bei Skiliftunternehmen oder im Sommer als Streckenchef an diversen Motorsportveranstaltungen.

Kapitel 7 Rallye Monte Carlo 1981. Alfa Sud. Beifahrer Peter Kruit.

(1) Und mit dem Alfa Sud und Beifahrer Peter Kruit

(2) Rallye Monte Carlo 1981. Alfa Sud. Beifahrer Peter Kruit.
Rallye Monte Carlo 1983. VW Golf. Beifahrer Bruno Arnold.
Es war nicht zu übersehen, dass mich bereits in jungen Jahren Annas Bruder Hans für regionale Autorennen zu begeistern wusste, fuhr er doch einen englischen Ford Cortina Lotus erfolgreich an Bergrennen wie Saint-Ursanne-Les Rangiers, das Gurnigel Bergrennen zwischen Dürbach und dem Berghaus Gurnigel oder das auf schmaler Strasse organisierte Rennen St. Peterzell-Hemberg. Dazu hatte ich aus der Zeit des Rennfahrers Willy Peter Daetwyler stets noch eine Beziehung zum Automobilrennsport. (s. Kapitel 4) So schaffte ich mir einen orangefarbigen NSU TT an, liess mir an Fahrkursen des Automobil Clubs der Schweiz diverse Renntechniken beibringen und versuchte an Slaloms einigermassen mit den schnellsten Tourenwagen mitzuhalten. Doch diese Kurzstreckenrennen befriedigten mich nicht. Ich wechselte in die Rallyeszene, fand im Kollegen Edy Schaller aus Zug einen versierten Beifahrer und tauschte den NSU gegen einen französischen Rallyewagen der Marke Renault 12 Gordini ein.
Es folgten in den späten Siebzigerjahren die ersten nationalen Rallies. Noch gab es jedes Wochende in der deutschsprachigen Schweiz irgendwelche von den Behörden bewilligte kleine Rallies. Diese Rennsportdisziplin auf Schotterstrassen, auf Schnee und Eis, tagelang, nächtelang, begeisterte mich auf Anhieb. Und als an den Läufen zur Schweizer Meisterschaft erste Erfolge eintraten, wagte ich auch in Deutschland, Frankreich und vor allem Italien zu starten. Stets grosse Freude machten meinem damaligen Beifahrer Edy Schaller und mir die Rallye di Lugano, den da hatte ich sogar einen kleinen Heimvorteil! Auf einer Schotterstrasse - sie glich zwar eher einem Bachbett - führte eine Spezialprüfung auf Geschwindigkeit am Dörfchen Orino vorbei, genau an diesem Dörfchen, wo meine Mutter als Wickelkind von einer Amme gestillt wurde. (s.Kapitel 1) Unvergesslich ist mir am Ziel der Spezialprüfung San Michele in unmittelbarer Nähe der Wallfahrtskirche San Antonio Edy Schallers Aufschrei "läk, das war schnell." Und wirklich, die Bremsscheiben glühten, mein ganzer Körper vibrierte, Edy jubelte.Wir hatten soeben die viertschnellste Zeit gefahren. Porsches, Lancias, Werkswagen von Opel oder Ford mussten sich hinter dem doch eher schwerfälligen Gordini einstellen! Doch zwei Kilometer später riss das Gaskabel und wir standen still, in stockdunkler Nacht, gefrustet im Wald von San Antonio. Ein Ersatzkabel hatten wir nicht bei uns. Aus!
1981 fuhr ich erstmals die Rallye Monte Carlo, diese anforderungsreichste Winterrallye mit dem weltweit grössten Renommee und den besten Werksfahrern aus Finnland, Schweden, England, Deutschland, Ialien, Frankreich und natürlich auch aus der Schweiz.

(3) Col de Turini
Col de Turini in den Alpes-Maritimes.
(4)
Col des Garcinets Alpes-de-Haute-Provence.
In einer Bar in Chur fing alles an. Gesprächspartner: Mein Freund Peter Kruit aus dem Val Sinestra im Unterengadin. Peter war Hobby-Rennfahrer wie ich. Doch weder Bier noch Getränke für "hartgesottene Männer" waren verantwortlich für unseren Bauchentscheid: "Wir fahren miteinander die Rallye Monte Carlo." Dass an jenem Oktobertag 1980 weder ein geeignetes Fahrzeug, noch genügend "Sackgeld" vorhanden war, wurde uns erst bewusst, als wir Peters Garage auf den Kopf stellten. Ausser einem getunten 1300 ccm-Alfa-Sud-Motor fanden wir keine brauchbaren Teile vor.
Peter hatte sich für den Beifahrerjob entschieden und versprach mir hoch und heilig, sowenig wie möglich meinen Fahrstil zu kritisieren. Eine Stunde nach dem Entscheid lachte uns erstmals das Glück. Die Autogarage Dosch in Chur schenkte uns einen gebrauchten Alfa-Sud. Die paar Beulen und Kratzer kümmerten uns wenig. Der Zeitdruck schon eher. In den nächsten Wochen baute unser Rallyekollege und Garagier Felix Strüby aus Erstfeld im Urnerland, ein vernünftiges Getriebe und einen Überrollkäfig ein, konstruierte eine brauchbare Handbremse auf die Hinterachse und welch ein Luxus: Wir leisteten uns eine hochmoderne Gegensprechanlage. Als Startort wählten wir unter den verschiedenen Städten Europas Lausanne aus. So konnten auch unsere Liebsten ein wenig Rallyeluft einatmen und uns mit den besten Glückwünschen verabschieden.
Richtig los ging die Rallye erst kurz nach Chambéry. Doch schon am Start zur 1. Spezialprüfung am Fusse des Chartreusegebirges zwischen Champéry und Grenoble, gab die Gegensprechanlage ihren Geist auf! Unser einziger Luxus war dahin. Schnee und Eis, drei Pässe, vier Ortsdurchfahrten und abertausende frenetische und frierende Zuschauer empfingen uns in diesem voralpinen Gebirgsmassif. Eine fantastische Ouvertüre. Ein Dreher um 360 Grad und kurz hinereinander zwei böse Verbremser in eine Schneemauer am Col de Porte, verkraftete Peter schlecht. Erstmals musste ich vom doch so ruhigen Bündner beim diktieren des Streckenaufschriebs wie "Kuppe voll - 100m Brücke links anfahren, dann sofort - rechts Kuppe voll usw." so Dinge wie "Hasardeur, bis du eigentlich taub" oder so Aehliches anhören. Doch wenigstens die Zuschauer freuten sich an meiner Aggressivität und beförderten den mehrmals von der Strecke abfliegende und nun im tiefen Schnee wühlende Frontriebler auf den richtigen Weg zurück. Was für kräftige Burschen mussten dies gewesen sein!
Die ersten Kilometer zum Col des Garcinets auf der D1 (Departement Hautes-Alpes) bereiteten mir schon bei der Besichtigungsfahrt Bauchweh. Die schmale Strasse führte zuerst in eine tiefe Schlucht hinein, ohne Leitplanken, ohne Randmauern. Einfach ohne irgendwelche Sichheitsmassnahmen. Eine vorzügliche Startrampe zum Flug ins bodenlose. Und auch Eisbrocken und Steine soll es hier von den Felsen auf die Strasse hinunter hageln. Das Signal "Route Dangereuse" war nicht zu übersehen - auch in unserem Notizbuch nicht. Dementsprechend vorsichtig war meine Fahrweise. Doch nach dem Kontrollieren der Rangliste am nächsten Zeitposten stieg mein Selbstbewusstsein für die weiteren "Specials" - abgesperrte Geschwindigkeitsstrecken - wieder an. Wir waren lange nicht die einzigen, die dem Col des Garcinets Respekt zollten.
Bei der Fahrt nach Bayon hinunter, trat ich plötzlich das Bremspedal ohne Vorwarnung in den "Keller". Nur stetes "Pumpen" mit dem rechten Fuss auf dem Bremspedal baute minimale Bremskräfte auf. Die Bremsflüssigkeit kochte! Zum Glück funktionierte die mechanische Handbremse perfekt und half heikle Situationen zu meistern. Auch in den engen Spitzkurven von "les Tourniquest" kurz nach der Passhöhe. Durch Hochreissen des Handbremshebels beim Einlenken in die Kurve, blockierten die Hinterräder, das Heck brach aus und es reichte ganz knapp den Alfa-Sud zwischen Schneehaufen und Betonmäuerchen durch die engen Kurven zu driften. Endlich, nach der sechsten Spezialprüfung fand auf einem Serviceplatz der Schwyzer Hansjörg Elmiger - Kollege und Montefahrer von 1980 auf einem Ford - die Ursachen des Bremsdefekts: Die Belüftungsbohrung am Bremsflüssigkeitsgefäss war verstopft und verweigerte ihren Dienst. Ganz einfach oder?
Der 1800 Kilometer lange Parcours-Commun wurde mit dem zur Legende gewordenen Col de Turini eröffnet. Kein Schnee! Kein Eis! Also mit aalglatten Racingreifen über den steilen Pass - und dies mitten im Januar! Auch die nächsten Strecken waren schneefrei. Die Werksfahrer mit ihren PS-Protzen von Renault, Audi, Alfa Romeo oder Opel drehten rücksichtslos ihre "Gashahnen" auf. Für uns Amateure eine hoffnungslose Geschichte! Endlich westlich der Rhône in St. Bonnet-le-Froid, türmten sich wieder Schneemauern in die Höhe und auf der 26 Kilometer langen, schnellen Spezialprüfung begann der Kampf am Lenkrad gegen Dreher und Abflüge in die heimtückischen, zugeschneiten Strassengräben. Nach jedem Überholmanöver kam unsere angeknackte Stimmung "aus dem Keller". Und als wir auf den 38 Kilometern in tiefster Nacht zwischen St. Jean-en-Royans und la Chapelle-en-Vercors Wagen um Wagen überholten, glaubten wir langsam an die Chance, uns doch noch für die berüchtigte "Nacht der langen Messer" auf den vereisten Strassen der Alpes Maritimes zu qualifizieren.
Nur kein nasser Asphalt mehr, war unser grösster Wunsch, denn das Fahrverhalten des Alfa Sud war vorallem auf Schnee perfext. Dank des abgeänderten Bremssystems an der Hinterachse - beim Anbremsen der Kurven blockierten zuerst die beiden Hinterräder - erst dann die Vorderräder. Dadurch liess sich der nun übersteuernde Fronttrieber schon ab Kurvenbeginn quer stellen und ziemlich problemlos über Schnee und Eis driften. Trotzdem verlangte dieses von den Polizeibehörden verbotene "Bremssystem" volle Konzentration. Doch wir waren ja in Frankreich, und hier kümmerte sich kein Verkehrspolizist um solche kleinen Details!
Bald stand uns die oft mit wechselnden Verhältnissen gespickte Prüfung von St. Barthélémy nach St. Michel-les-Portes bevor. Schnee im Überfluss- eine feine Sache. Doch bei St. Andéol unterschätzte ich die Einfahrt auf den Kirchenvorplatz und flog seitwärts gegen die Kirchenmauer. Zum Glück war sie mit einem hohen Schneewall "abgesichert"! Eine Beule mehr oder weniger und wenn kümmern solche Bagatellen an der Rallye Monte Carlo? Kurz vor dem höchsten Punkt auf 1352 Meter verrammten uns zwei Ford Escort die Durchfahrt. Die heckangetriebenen Wagen drehten auf dem Schnee hoffnungslos durch. Was nun? Aussteigen natürlich. Den einen Ford drückten wir mit aller Kraft an eine Schneemauer. Der andere war unterdessen selbstständig in den Strassengraben gerutscht. Endlich war die Gasse frei. Peter sprang auf die Motorhaube, klammerte sich irgendwie, irgendwo fest und mit viel Glück und wenig Gas - was beim getunten Motor mit der brutal zupackenden Sinterkupplung auf der steilen Rampe nicht so einfach war - retteten wir uns vor einer frühzeitigen Heimreise. Noch knapp 140 Fahrzeuge trudelten in Monaco ein. Mehr als die Hälfte aller Gestarteten war bereits irgendwo in dunkler Nacht ausgefallen. Im Zwischenklassement lagen wir auf dem 92. Platz und wir hatten die Weiterfahrt knapp geschafft. Freude herrschte auch bei unseren Servicekollegen.
Jetzt erwartete uns doch noch die "Nacht der langen Messer." Als "pièce de résistance" stand erneut der 1607 hohe Col de Turini in den Alpes-Maritimes auf dem Programm. Schnee und Eis waren vorallem auf der Passhöhe zu erwarten, denn wie jedes Jahr schaufelten Rallyefans Schnee und Eis in die Fahrbahn. Und so war es auch. Doch diese Schneehaufen sollten für denn Alfa Sud kein Problem bedeuten. Via Sospel erreichten wir den Start in Moulinet. Und los gings mit Vollgas dem Col de Turini entgegen. Bereits während der Anfahrt zum Startort Moulinet drang der Geruch nach verbranntem Gummi in unsere Nasen. Ein Kabelbrand befürchtete Peter. Wir hielten an und suchten nach der schmorenden Stelle. Nichts war zu entdecken - also weiter mit Vollgas dem Turini entgegen.
Peter litt fürchterlich unter dem Gestank. Zeitweise konnte er kaum die Notizen über die sich Schlag auf Schlag folgenden Kurven "vorbeten." Auf der Passhöhe sorgten - wie vermutet - Rallyefans für Stimmung und sie schaufelten Berge von Schnee in die Fahrbahn! Wir hatten natürlich Winterreifen montiert. Der Alfa Sud schoss problemlos über die Passhöhe hinweg und anschliessend die steile Strasse nach La Bollène-Vesubie hinunter. Kreideweis übergab Peter die Stempelkarte den Funktionären. Die Fahrzeit war nicht so schlecht, wurde sie doch vom vermeintlichen Kabelbrand negativ beeinflusst. Erst am Ziel in Monaco fanden wir die Ursache. Um die Kühlung des Motors zu unterstützen, brannten unsere Servicekollegen mit dem Schweissbrenner Längsöffnungen in den Ölwannenschutz und dabei blieben Gummiteile zwischen der Wanne und dem Chassis unendeckt und schmorten langsam vor sich hin. Dies schmalen Oeffnungen halfen mit den Motor besser zu kühlen. Besten Dank meine Freunde!
Eine spannende Spezialprüfung kam noch gegen Schluss der Rallye in St. Jeannet, südlich von Digne, zur Austragung. Sie wickelte sich in einer hügeligen Gegend ab, total vereist und von den Zuschauern ebenfalls mit Schnee angereichert. Steigungen fehlten, dafür Schlaglöcher und Material mordende Querrinnen. Auf jeden Fall ein ideales Gelände für eher PS-schwache Fahrzeuge mit kampffreudigen Fahrern! Der eine Minute vor uns gestartete, über 200 PS starke Talbot, konnte sich nur knappvom dem Alfa Sud ins Ziel retten. Die restlichen abgesperrten Strecken fuhren wir verhalten, beinahe im "Halbschlaf" aber unbeschadet ins Ziel am Quai Albert 1er. Die Gesamtrangliste spielte für uns beide keine grosse Rolle mehr. Der eingeplante Rang um fünfzig blieb fürs nächste Jahr reserviert. Trotzdem, die Zieleinkunft in Monaco bedeutete für uns und unsere Serviceequipe Freude und Genugtuung, obwohl der 72. Gesamtrang keinen einzigen Zuschauer auf der Tribüne von den gepolsterten Sitzen riss. Dass wir bei den Spezialtourenwagen bis 1300 ccm den dritten Gesamtrang erzielten, interessierte auch kein Mensch. Doch die Zielankunft in Monaco war ein unvergessliches Erlebnis. Es fühlte sich an wie Balsam auf unsere entkräfteten Seelen!
Zwei Jahre später versuchte ich nochmals einen Rang inmitten der schnellen Privatfahrern zu belegen. Beifahrer war diesmal Bruno Arnold. Wir unterrichteten beide an der gleichen Schule in Flüelen am Urnersee, und bekamen freie Tage um die Rallye zu fahren. Der sportlich denkende Schulratspräsident war mächtig stolz auf seine beiden Rennfahrer! Die Schüler selbstverständlich auch, schliesslich bekamen sie einige Tage schulfrei! Das waren noch Zeiten! Unser Fahrzeug: Ein potenter, roter VW Golf mit ca. 160 PS. Doch das Glück liess uns völlig im Stich. Nach einigen akzeptablen Rängen in den Zwischenklassementen kam es in Saint-Bonnet-le-Froid, südlich von St. Etienne, zur "Tragödie". Einen Kilometer vor dem Start - inmitten des tief eingeschneiten Dorfes - warteten wir ungeduldig auf unsere Winterreifen. Vergebens. Die Kollegen vom Service waren irgendwo im Zuschauerstau stecken geblieben! Nun waren wir gezwungen, mit profillosen, für Schneestrecken viel zu breiten und zu harten Racingreifen über die 20 km lange, total eingeschneite Strecke zu rutschen. Mindestens dreimal flogen wir von der Strecke. Zuschauer befreiten uns immer wieder aus dem knietiefen Schnee. Doch bei diesen Manövern lief uns die Zeit davon, und wir verpassten den "Parcours final" um wenige Ränge. Wir befestigten den VW Golf auf dem Anhänger und noch in der gleichen Nacht fuhr ich frustriert nach Hause. Bruno besass die besseren Nerven und genoss noch einen Tag oder zwei das südliche Klima im Fürstentum der Grimaldis. Und unsere Schülerinnen und Schüler? Trotz unseres frühzeitigen Ausscheidens hiessen sie uns am ersten Schultag freundlich und neugierig auf Informationen willkommen.

Kapitel 8 Nach Kiew im ukrainischen Winter 1986.
Doch einige Stunden später lief meine zweite Begegnung mit der ukrainischen Polizei erst in letzter Sekunden glimpflich ab. Sobald wir Kiew hinter uns hatten, liess ich den Renault auf dem kalten Schnee der ukrainischen Strassen ordentlich laufen! Schliesslich waren jetzt russische Winterreifen montiert und die griffen überrasachend gut bei 15 Grad minus. Dem Priester auf dem Rücksitz ging es immer schlechter, und ich wollte so rasch wie möglich Krakau erreichen. Doch nach 300 km wurde mein "leicht" agressiver Vorwärtsdrang schlagartig abgebrochen. Grund: Mehrere Polizisten stoppten uns mit Kalaschnikows im Anschlag. Einer hiess mich ziemlich barsch auszusteigen und mit den andern drei oder vier "Gesetzeshütern" einen Überwachungsturm zu erklimmen. Dann ging für mich ein "Riesenpalaver" los. Ich verstand kein Wort. Janina meinte: "Es steht nicht gut für uns. Unsere Durchfahrtszeit ausgangs Kiew ist mit der Uhr gestoppt worden und wir sind bereits nach knapp zwei Stunden und zwanzig Minuten hier an diesem Stützpunkt angelangt. In der Ukraine betrage die Höchstgeschwindigkeit auf Landstrassen 80 km/h. Ich solle selber ausrechnen, wie schnell ich gefahren sei. Jetzt würde ich dem Richter vorgeführt." Meine Reaktion auf den in Aussicht gestellten Haftbefehl weiss ich nicht mehr so genau. Das mir der Bischof in Warschau einen Ausweis ausgehändigt hatte, musste mich nicht so interessiert haben! Meine Sorge galt damals dem winteruntauglichen Fahrzeug. Nun kramte ich den Ausweis erstmals aus meiner Tasche und zeigte ihn dem Polizisten.
Der strenge Herr wurde plötzlich freundlich und entschuldigte sich wegen der geplanten Festnahme. "Weshalb dieser Stimmungswandel," fraget ich Janina. Leicht spöttisch bemerkte sie: "Du hast dem Polizisten einen auf Deinen Namen ausgestellten polnischen Diplomatenpass unterbreitet und Diplomaten kennen doch überall die Narrenfreiheit! Oder etwa nicht? Zurück in der Schweiz erfuhr ich, dass es den Aerzten nicht gelang, den an Leukämie erkrankten Priester zu retten.
 Erdbeben in Armenien 1988.
Erdbeben in Armenien 1988.1988. Die Not war unermesslich.
Zwei Jahre später war ich erneut im Osten tätig. Ein gewaltiges Erdbeben hatte grosse Teile der Armenischen Sozialistischen Sowjetrepublik zerstört. Die Städte Leninakan und Spitak - beide nördlich der Hauptstadt Erivan gelegen - beklagten über 25 000 Tote. Doch nicht genug des Unglücks. Grosse Teile der überlebenden Bevölkerung wurden von einer tödlichen Kältewelle erfasst. Unzählige Menschen und Tiere erfroren. Trotz des immer noch andauernden "Kalten Krieges" zwischen den Weltmächten bat Michail Gorbatschov den Amerikanischen Präsidenten Ronald Reagen um humanitäre Hilfe. Zum grossen Erstaunen Millionen von Menschen fand Gorbatschov Gehör beim amerikanischen Präsidenten.


(1)
Der Präsidentenpalast in Grosny.
Kapitel 9 In Tschetschenien und Inguschetien.
1991 kündigte ich den Job bei der Caritas - Schweiz in Luzern und eröffnete in Altdorf ein kleines Organisationsbüro für Sport und Kulturanlässe. Dank Aufträgen von der Caritas Schweiz konnte ich in der Anfangszeit meine Familie finanziell über Wasser zu halten. Unterdessen waren wir eine fünfköpfige Familie mit den Kindern Bernhard, Anita und Beatrice geworden. Eines Morgens bekam ich einen Telefonanruf aus der Auslandhilfe der Caritas Schweiz mit der Anfrage, ob ich Interesse an der Realisation einer eher aussergewöhnlichen Hilfsaktion am Kaukasus hätte?“ Da schluckte ich zuerst leer und wagte die Frage: „Höre ich richtig? Kaukasus? Da ist doch Krieg in Tschetschenien?“ „Ja genau“ antwortete mein Gegenüber am Telefon und fuhr fort: „Als Ende 1991 die UdSSR nach einem mehrjährigen Prozess zusammenbrach, erklärte sich Tschetschenien als eine der ersten von Moskau unabhängige Republik. Doch der Kreml akzeptierte diese Abspaltung nicht und der Konflikt eskalierte. Am 11. Dezember 1994 marschierten russische Truppen in Tschetschenien ein und eroberten die Hauptstadt Grosny. Ein mehrjähriger brutaler Krieg begann. 100.000 Zivilisten, Frauen, Kinder und Soldaten fielen dem beidseitigen, schrecklichen Gemetzel zum Opfer. Grosse Teile der Bevölkerung versuchten in Grenzgebiete zu fliehen. Die Not in den Auffanglagern an der Grenze zu Inguschetien war ab Kriegsbeginn sehr gross.“
Und weiter bekam ich von der zuständigen Person der Auslandhilfe der Caritas folgendes zu hören: „Mehrere Schweizer Hilfswerke - auch das Schweizerische Rote Kreuz - überlegen sich jetzt, wie die Not in den Flüchtlingslagern gemildert werden kann. Doch es gäbe noch einige organisatorische Probleme zu lösen. Die Anreiserouten für die mit Hilfsgütern beladenen Lastwagen müssten in Moskau von irgendeiner dubiosen Staatsstelle bewilligt werden. Um Plünderungen auf den unendlich langen und wenig befahrenen Strassen Russlands zu vermeiden, brauche es neue Ideen. Eine komme vom Direktor Jürg Krummenacher persönlich. Und so hörte sich die Idee an. " Zwischen der Türkei und den Ländern am Kaukasus findet seit Jahrzehnten ein reger und eingespielter Handelsaustausch statt. Eine türkische Transportfirma soll nun den Auftrag erhalten, ihre Lastwagen nach einer von der Caritas Schweiz entworfenen Liste mit Medikamente, Nahrungsmitteln, Babynahrung, Wolldecken und Kleider zu beladen und per Schiff die russische Stadt Sotschi am Schwarzen Meer anfahren. Alsdann soll der Weitertransport auf den Strassen am Fusse des Kaukasus bis Nasran in Inguschetien führen und dort in den Flüchtlingslagern an der Grenze zu Tschetschenien von einem Caritasmitarbeiter entgegen genommen werden. Zusammen mit den Lagerältesten, den Chauffeuren und einem Regierungsvertreter soll entladen und gerecht verteilt werden. Zusätzlich soll eine der kaukasischen Sprache mächtige Person den Kontakt zwischen den Lagerältesten, den Flüchtlingen und den Verteilern herstellen.“ Doch da gibt es laut des Mitarbeiters der Caritas noch folgendes "unwesentliches" Problem gelöst werden: „Die Russische Botschaft in Bern stellt für das Kriegsgebiet am Kaukasus keine Visum aus.“
Ohne am Telefon weitere Details zu erfahren, antwortete ich: „OK - ich mach das und übernehme die Verantwortung vor Ort für die Entgegennahme und Verteilung der Hilfsgüter.“ Ich war mir sicher, dass es für diese Aufgabe wenig zu organisieren - umso- mehr zu improvisieren gab! Und es begann bereits in der Schweiz. Ich musste mich bis Moskau mit einem Touristenvisum zufrieden geben! Wie ich dann in den Kauskasus reisen sollte, blieb mir vorerst ein Rätsel! Die Caritas informierte mich rechtzeitig über alle wichtigen Details wie die ungefähre Ankunft der Lastwagen im Kriegsgebiet, einen möglichen Abreisetermin nach Moskau und der Zeit- und Treffpunkt mit einer Dolmetscherin oder einem Dolmetscher am Flughafen Sheremetyevo in Moskau.
Zu unserer Überraschung trafen bereits am nächsten Tag die drei türkischen Sattelschlepper ohne Verspätung und laut den Chauffeuren ohne Zwischenfälle am vereinbarten Treffpunkt in Nasran ein. Wir konnten bereits an den folgenden Tagen mit der Verteilung der Hilfsgüter beginnen. Inguschetische Milizen begleitete uns dabei in die Flüchtlingslager an der Ostgrenze zu Tschetschenien. Die Lagerältesten aus den Zeltstätten waren sehr kooperativ, übernahmen zusammen mit den türkischen Chauffeuren das Abladen der Camions und das vorsorgliche lagern in trockenen Baracken. Alsdann begann eine erste Verteilung der nötigsten Hilfsgüter. Einen zweiten Transport führten wir einige Monate später ebenfalls problemlos durch. Die Zusammenarbeit mit den türkischen Chauffeuren klappte bestens. Der Trick mit dem Ausweis am Flughafen Sheremetyevo gelang erneut.
Doch die Vorbereitungsarbeiten für einen dritten Hilfskonvoi mussten wir abbrechen. Bereits beim zweiten Transport wurden die Sattelschlepper von nicht definierbaren, bewaffneten Kaukasiern angehalten und kontrolliert. Es schien - laut der türkischen Chauffeuren - dass die Transporte irgendwo in einem staatlichen Büro in Moskau bekannt geworden sind! Dies hätte zu echten Schwierigkeiten geführt.
Unvergessen bleibt mir die Begegnung mit einem alten Mann an der schwer bewachten und bewaffneten Grenze zwischen Tschtschenien und Inguschetien. Vorsichtig sich vorwärts bewegend, kam er mit offenen Armen und stechenden Augen auf mich zu, und mit kaum hörbaren, zerknirschten Worten stammelte er: "Warum lässt ihr im reichen Europa all diese fürchterlichen Gräule hier am Kaukasus zwischen den Inguscheten und Russen geschehen?" Welche Antwort hätten Sie dem verzweifelten Mann gegeben?
Beim Ausbruch des Zweiten Tschetschenienkriegs (26. August 1999 – 16.April 2009) kehrten viele Flüchtlinge aus den Grenzgebieten in ihre Heimat nach Tschetschenien zurück. Auch in diesem 10-jährigen, blutigen Krieg wurden schwerste Menschenrechtsverletzungen durch russische Einheiten und tschetschenische Rebellen verübt. Tausende junge Männern wurden von beiden verfeindeten Seiten verschleppt, gefoltert, ermordet. Bereits vor dem Ersten Tschetschenienkrieg - 11. Dezember 1994 bis 31. August 1996 – wurden in Inguschetien die Häuser und Geschäfte russischer Minderheiten von Inguscheten zerstört und zur Flucht gezwungen. Zurückkehrende russischstämmige Familien und Unternehmer wurde nach Kriegsende der Übertritt an der Grenze zu Inguschetien verweigert. Zu gross war immer noch der Hass vieler Inguscheten auf die ehemaligen, erfolgreichen russischen Unternehmer.


(1) Kapitel 10 Die historischen Klausenrennen. 
(2) Achille Varzi auf Bugatti 4x4 Achille Varzi.
1934 wird das zur Berg Europameisterschaft zählende Rennen am Klausenpass zum letzten Mal organisiert. Wirtschaftliche und politische Gründe lieferten die endscheidenden Argumente. Langsam geriet das Spektakel am Fusse des mächtigen Claridenstocks in Vergessenheit. Auch in den Fünfzigerjahren fand sich kein Organisator mehr. Der Grand Prix von Bern übernahm die Leaderrolle im Schweizerischen Motorrennsport.1954 wurde auch diese zur Europameisterschaft zählende Rennen im Bremgartenwald aus politischen, wirtschaftlichen und ethischen Gründen aus dem Internationalen Rennkalender gestrichen.
Eine Homage an vergangene Zeiten
Vorsichtig fahre ich im lärmigen Rennwagen Derby K4 durch das ruhige Linthal bis hin zum Hotel Bahnhof. Dort breche ich das Geheul das Kompressors ab. Schlagartig verstummt der 1928 gebaute Rennwagen.. Hier wohnen sie, all die grossen Asse Chiron, Caracciola, Stuck, Nuvolari oder Varzi feiern ihre Rekorde, trauern den verlorenen Sekunden nach, feilschen mit dem Rennleiter um das Startgeld. Nur wenige Rennfahrerinnen leisten den Herren Gesellschaft. Rizinus, das Rennöl aus Wolfsmilch ist ihr Parfum, der Bubikopf, die brennende Zigarette ihr Symbole für die errungene Emanzipation. Ihr nacktes Knie verführt, weckt männliche Lust!
Wenig später ein Knall aus dem Auspuff des erst startenden Bugatti. Die schlummernden Geister sind erwacht. Die Strecke ist frei, frei zum längsten und wildesten Bergrennen Europas. Unbewegt hängt das Startband über der staubigen Strasse. Arrogant die schreienden, gestikulierenden Kommissäre des Veranstalters vom Zürcher Automobil Club. Bereits jagt der Bugatti der aalglatten, gepflästerten Startkurve zu und verschwindet im ersten stockdunklen Tunnel.
Hier hat 1932 der Luxemburger Mazzapicchi sein blutjunges Leben ausgehaucht. Auf einer Tragbahre - notdürftig mit Laubästen zugedeckt - ist er mitten durch die nach Sensationen geifernden Zuschauer zu Tale getragen worden. Die Rennleitung spricht vom Heldentod! Was für ein Unsinn! Weitere Spitzkurven folgen. Die enge Landschaft öffnet sich, die Fruttberge tauchen auf, das Gasthaus Bergli nur wenige Meter vom Wasserfall entfernt. Gäste in klobigen Nagelschuhen, Motorradfahrer in hochgeschnürten Lederstiefeln füllen die Wirtsstube. Mit der Mistgabel wirft der Wirt Zweifel den Dreck zur Türe hinaus. Die Fruttbergbauern wünschen das Rennen zum Teufel. Wer bezahlt ihnen die von den frechen Stadtmenschen kaputt getrampelten Schindeldächer und die zerstampften Wiesen? Wer? Weiter geht's bergwärts auf der schmalen Strasse. Sie ist eng für die Fahrkünste des einheimischen Arztes. Totalschaden! Zuerst verspottet, später als Doktorrank verewigt. Plötzlich ist er da - der Urnerboden, die grösste ganzjährlich bewohnte Alp der Schweiz. Nicht alle schaffen es bis zur Urnergrenze. Die dünner werdende Luft, Vergaserbrände, geplatzte Reifen. Links und rechts der schnurgeraden Strasse ducken sich die bescheidenen Holzhäuser vor den mit über 200 km/h heranrasenden Grand Prix Rennwagen von Bugatti, Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Steyer oder Auto Union. Nicht zu vergessen die Elite der Motorradfahrer wie Zuber, Hänni, Bizzozero, Bullus oder das Gespann des Ehepars Stärkle auf all den Motosacoche, den NSU, den Harley-Davidson oder der Moto Guzzi.Die Hände der Fahrer krallen sich ins Lenkrad, das Gesicht versteinert, die Augen starr geradeaus gerichtet, im steten Kampf gegen den tödlichen Sturz. Ein eisiger Wind fällt vom Clariden zum Teufelsfriedhof hinunter. Gierig fressen die metallenen Ungeheuer die reine Bergluft in sich hinein. Graf Masetti im schleudernden Sunbeam, Adolf Rosenberger, Ferdinand Porsches Financier - der kurze Zeit später von Ferdinand Porsche höchst persönlich an die Deutsche Gestapo ausgeliefert wird! Und von Kalnein, der Graf aus dem fernen Ostpreussen, abgebrannt, ausgespielt, doch den langen Stuck will er hier nochmals besiegen. Mitten durch die Menschmassen brausen die Junek, die Munz und die Hellé-Nice - alle mit Bugattis - der Männerwelt Paroli bietend. Am Horizont das Ziel - die Erlösung, endlich. Der Kaplan vom Urnerboden sammelt Geld bei den Zuschauern und Rennfahrern für eine Kapelle oben auf der Passhöhe. Rudolf Caracciola, Tazio Nuvolari, Louis Chiron, Hans Rüesch, Whitney Straigth oder Earl Howe zeigen sich dem kleingewachsenen, Hansli gerufenen, aber höchst schlauen und intelligenten Kaplan von ihrer grosszügigen Seite.
Der Wind heult, rüttelt an den Fahnenstangen. Nebelfetzen jagen über den Pass. Leichter Schneefall setzt ein, deckt den kargen Boden zu und mit ihm die Rekorde, die Rennwagen, die Rennmotorräder, ihre nach Geld und Ehre strebenden Fahrer, ihre stets in Ängsten lebenden Frauen, die Älpler und die ausharrenden Zuschauer! Noch hätten sie alle genügend Platz unter der weissen Decke, alle, bis im Frühling der Schnee schmilzt und der Mythos Klausen neu erwacht!
(3) Klausenrennen 1927. Ernes Merck, Gattin des Industriellen Merck und der schwere 6,7-Liter Mercedes-Benz Typ S. Zuschauer "kleben an den Hängen" kurz vor der Vorfrutt
Klausenrennen 1927.
Ernes Merck die Gemahlin des Industriellen Merck und der schwere Mercedes-Benz.
Zuschauer kleben an steilen Hängen bei der Vorfrutt.


(1) Wagenpark in Glarus.
Vorne rechts der Alfa Romeo P3 des Siegers Rodny Felton. 
(2) Plakat 1. Int. Klausenrennen-Memorial 1993
Kapitel 10 Das 1. Int. Klausenrennen-Memorial 1993
Von der Geschichte der historischen Klausenrennen konnte ich mich kaum mehr lösen.Ich fing an ausgiebig zu recherchieren und entschloss ein echtes „Internationales Klausenrennen-Memorial“ für historische Rennautos und Rennmotorräder zu organisieren. Noch kannte ich mich in der historischen Motorsportszene ungenügend aus im Gegensatz zum modernen Rallyerennsport. So suchte ich mir kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, erarbeitet ein Konzept und nach anfänglich schwierigen Verhandlungen mit den politischen Behörden und natürlich den Anstössern, bekam ich die notwendigen Bewilligungen, fand mehrere grosszügige Sponsoren und begann für die 22 km lange Strecke ein Sicherheitsdispositiv nach den Richtlinien der FIA (Föderation International des Automobiles) für Teilnehmer und Zuschauer zu erarbeiten. Natürlich wurde das Memorial in Sachzeitschriften aber auch in der Tagespresse publik gemacht, so dass eine wahre Flut an Nennungen aus ganz Europa eintraf.
Nach Nennschluss konnten wir 446 Rennmotorräder, Gespanne, Dreiräder, Sport- und Rennwagen in die Startliste aufnehmen. Allein an die zwanzig Bugatti, darunter der nur in zwei Exemplaren hergestellte Typ 53 mit Vierradantrieb. Zu den absoluten Highlights zählten die "Silberpfeile" von Mercedes-Benz W125 und W154. Die bekannte deutsche Rennfahrerin Ellen Lohr fuhr zum ersten Mal ein solches Ungetüm – und dies mit viel Bravour. Als Ellen Lohr mit durchdrehenden Rädern am Start wegzog, kam der Chefarzt des Rennens auf mich zugerannt und brüllte mir begeistert ins Ohr: „Verreckter als eine Sinfonie von Anton Bruckner!!!“ Und am Ziel auf der Passhöhe rief die klatschnasse Ellen Lohr den nahestehenden Zuschauern zu: „Das Geilste was ich je erlebt habe!“ Das 1. Klausenrennen-Memorial 1993 war somit standesgemäss im Regen gestartet. Wie auch schon 1926 als die zweifellos beste europäische Rennfahrerin Elisabeth Junek aus Prag leicht übertrieben in ihren Memoiren schrieb:"Der Kurs führte über felsige Kämme wie ein schmales Band und war von halsbrecherischen Abhängen gesäumt. Auf dieser Strecke passierte man drei Klimazonen: unten tropischer Regen, in der Mitte Nebelbrei und oben meterhohen, frischen Schnee!"
Natürlich fehlten bei den Grand Prix-Rennwagen aus den 30-iger Jahren weder Alfa Romeo, Maserati, weder ERA noch Delahaye und bei den Motorrädern weder Motosacoche, noch Norton, noch NSU, noch die als „singende Kreissäge“ bekannt gewordene DKW. Trotz regnerischem Wetter und der 30 000 mit Extrazügen, Autocars Automobilen und Motorädern anreisenden Zuschauern, verlief das Rennen ohne nennenswerte Zwischenfälle. Die schwierige Strecke verschaffte sich viel Respekt bei den Fahrerinnen und Fahrer.

Das 2. Int. Klausenrennen-Memorial 1998.

(1) Kapitel 10.2 Anita und Beatrice mit dem Derby am 2. Klausenrennen-Memorial.
Nach der 1993 gelungenen Veranstaltung war der Ruf nach einer Wiederholung unüberhörbar. Dies konnte ich verstehen und so überlegten wir uns für die nächste Austragung diverse grundlegende Verbesserungen anzubringen. Wir entschieden uns unter anderem eine spezielle Rennkategorie einzuführen. War noch 1993 für die Fahrerinnen und Fahrer keine internationale Rennlizenzen notwendig, sollten für das Zweite Klausenrennen-Memorial 1998 - sowohl bei den Rennmotorrädern, den spektakulären Dreirädern aus England und den Sport- und Rennwagen echte Geschwindigkeitskategorien ausgeschrieben werden. Aus diesem Grunde wurde die Streckensicherheit den Richtlinien des Automobil Clubs der Schweiz (ACS) und der Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) angepasst. Die Fahrerinnen und Fahrer der schnellen Kategorien mussten im Besitze einer Rennlizenz sein und das Fahrzeug den Richtlinien ihres Landes und der FIA entsprechen. Die gleichen Vorschriften wurden auch bei den Rennmotorrädern angewandt. In England löste diese Neuerung in Motorsportkreisen Begeisterung aus und so wurden allein von der Insel 36 hochkarätige Rennwagen aus den 30er-Jahren angemeldet.

Kapitel 10.3 Das 3. Int. Klausenrennen-Memorial 2002

(1) Bill Touer und seine Frau fahren im Threeweeler Tagesbestzeit!
Hoch gingen die Emotionen im Vorfeld aller Klausenrennen-Memorials. Bürgerliche und Grüne Gegner wetzten die Messer und glaubten in einer den Regierungen von Uri und Glarus angedichteten Einmaligkeitsklausel den tödlichen Stoss zu finden. Die Urner Zeitung versuchte der Klausenrennen-Memorial AG einen Konkurs herbei zuschreiben. Einheimische waren der Meinung, der Brägger habe sich eine "goldige Nase" verdient. Eine weitere wolle man ihm mit Schikanen und Geldforderungen gründlich vermiesen. Und auf dem Urnerboden? Da baumelte er im Winde an einem papiernen Galgen - der Brägger. Ehret fantasievolles, einheimisches Schaffen!! Bei all diesen Aktionen ging weder dem OK noch mir der Schnauf aus. Im Gegenteil - sie verhalfen dem Klausenrennen-Memorial zu noch mehr Präsenz in Wort und Schrift! Die Medien in der Schweiz, in England, Frankreich oder Italien hatten die Bedeutung des nostalgischen Rennens für die Region, für seine Bewohner und für den historischen Motorsport erkannt. Die positiven Reaktionen von Zuschauern und den Fahrern aus ganz Europa bestärkten uns in der Absicht, das Klausenrennen-Memorial zum besten Bergrennen mit historischen Rennwagen- und Motorrädern aufzubauen.
Um den Zuschauern weiteren Spektakel zu bieten, bauten wir in Linthal einen beleuchteten Rundkurs, organisierten ein paar ältere Formel-1-Boliden und ab ging die Post vor voll besetzten Tribünen. Doch beinahe ging das Rennen im Regen bachab. Und da den drei Formel-1-Ferraris aus den späten 90er-Jahren nur Slicks zur Verfügung standen, liessen die Besitzer ihre teuren Boliden in einer Garage am Trockenen.
Die Show retteten die alten. Trotz überschwemmter Piste liessen Georg Kaufmann, Carlo Vögele, Jo Vonlanthen und Co. ihre historischen Grand-Prix-Wagen um die Kurven driften und begeisterten das Publikum auf der extra aufgebauten Tribüne. Der absolute Star des Abends war der Schweizer Historic-Racer Fredy Kumschick auf einem Formel 1-Williams des ehemaligen Weltklassefahrers Carlos Reutemann. Faszinierend wie Kumschick dieses Kraftpaket aus dem Jahre 1981 über den schmalen, teilweise überschwemmten Kurs „fliegen“ liess. Am Samstagabend sollte auch der Engländer Bill Tuer am Rundkurs für Stimmung sorgen. Doch schon in der ersten Runde knallte er sein Renndreirad in eine Leitplanke. Übel sah er aus, der Threeweeler
Das Chassis krumm, die vordere Aufhängung im Eimer. Aus? Auch für das morgige Rennen? Am frühen Sonntagmorgen schlich Bill im Fahrerlager herum auf der Suche nach einer Schweissanlage. Die fand er, borgte sie sich aus, bastelte auf dem Kiesplatz aus Zeltstangen und Holzleisten eine Lehre für das krumme Chassis und fing an zu messen, zu wärmen, zu schweissen, zu strecken, zu richten... Krumme Teile der Vorderachse konnte er mit Originalteilen ersetzen. Eine halbe Stunde vor seiner Startzeit versorgte er das Werkzeug. Seine mutige Frau, zuständig für eine gleichmässige Gewichtsverteilung im Threeweeler, verkroch sich wie üblich zwischen Spritzwand und Rückenlehne, und das Ehepaar Tuer fuhr los an den Start. Und es ist kaum zu glauben. Auf beiden Streckenabschnitten – aus Sicherheitsgründen neutralisierten wir die lange Gerade auf dem Urnerboden - fuhr der verrückte Engländer die absolute Tagesbestzeit. Weder sein Crash am Vorabend auf dem Rundkurs, noch seine Gegner auf hochkarätigen Rennwagen und Rennmotorrädern konnten ihn bei seinem Teufelsritt beeindrucken.
Dreimal hatte ich das Klausenrennen-Memorial organisiert. Zweimal war die Urnerin Karin Gaiser und heutige Politikerin meine rechte Hand. Dreimal Klausenrennen-Memorial - das war genug! Hunderte von fleissigen Helfern, bis zum Umfallen belastete OK-Mitglieder, all die Funktionäre, die Sicherheitskräfte, die Zeitmesser, die Sponsoren…. Ohne sie hätte nichts funktioniert. Doch Stress, das finanzielle Risiko, der stets auf der 22 km langen Strecke lauernde schwere Unfall, der Kampf um Sponsorengelder und gegen die "Trittbrettfahre", erleichterten mir den Entscheid zurückzutreten. Neue Kräfte waren gesucht. Die Pionierzeit war abgelaufen. Die Skepsis bei Behörden und Privaten war endlich der Erkenntnis gewichen, dass das Klausenrennen-Memorial für die wirtschaftlich schwache Region und für ihren Tourismus befruchtend wirkte.
Leider "glänzten" die neuen Organisatoren immer wieder mit Absagen der in Aussicht gestellten Termine! "ARGUS“ die Medienbeobachtungsstelle der Schweiz stellte schon 1993 klipp und klar fest: „Kein Schweizer Anlass erhielt 1993 in den in- und ausländischen Medien so viel Präsenz wie das Klausenrennen-Memorial." Mit zehnjähriger Verspätung kam endlich diese Botschaft in den Kantonen Uri und Glarus an! Doch die neuen Organisatoren hatten auch diese Botschaft nicht verstanden. Sie schrieben die attraktiven Geschwindigkeitskategorien nicht mehr aus. Das Klausenrennen-Memorial war zum Treffpunkt für sportliche Renn- und Tourenwagen geworden. Den Zuschauern zuzuwinken war angesagt! Den neuen Organisatoren fehlten die organisatorischen Motorsportkenntnisse, es fehlte der Idealismus, es fehlte der Mut zum „Tanz mit allen Teufeln“ wie Eliska Junkova - die erfolgreichste Automobilrennfahrerin der Vorkriegszeit - den Motorsport in den Dreissigerjahren genannt hatte. Auch die hochkarätige, englische Renn-Armada mit ihren Bugattis und Alfa Romeos blieb zu Hause. Das Klausenrennen-Memorial entwickelte sich zu einem Schönheitswettbewerb, zu einem Corso wie an jedem Wochenende auf Hochglanz polierte, historische Fahrzeuge einen Hügel hinauf kriechen!


(1) Die Teufelsbrücke
Kapitel 11
Das „Teufelsspiel“ oder „Die Wand und die Brücke.“
Idee und Spielort.
2002 hätte „Das „Teufelsspiel“ oder „Die Wand und die Brücke“ in einer einmaligen, sensationellen Naturkulisse von europäischer Tragweite stattfinden sollen. Die alte Teufelsbrücke über der Schöllenenschlucht wäre zur natürlichen Bühne, die imposanten steilen Felswände zur Kulisse geworden. Allein das Sitzen auf der eigens in die Schlucht gebauten Spezialtribüne, wäre für die Zuschauer zum einmaligen Erlebnis geworden. Aber eben wäre!
Zwei männliche Gestalten hängen in der Felswand über der Reuss. Prometheus und Hephaistos. Prometheus hat den griechischen Göttern das Feuer gestohlen. Das Feuer, das den Menschen den Fortschritt bringt. Für seinen Diebsstahl muss Prometheus büssen. Er wird von Hephaistos, dem Schmied der Unterwelt, an den Felsen geschmiedet. Hephaistos wechselt vom Ort der archaischen Urzeit an den Ort der geschichtlichen Zeit. Als Schmied von Göschenen baut er mit Hilfe des Teufels die Brücke über die Reuss. Die Menschen benützen den Transitweg für ihren Handel - auch für ihre Händel! Doch der Schmied betrügt den Teufel mit dem Geissbock. So hockt der Teufel in immer neuen Verkleidungen auf der Brücke und fordert von jedem Benützer seinen Tribut. Über die Bücke zieht der Zug der Geschichte. Auch er fordert von jedem seinen Tribut. Von Epoche zu Epoche bis in die Gegenwart. Er wirft seinen Schatten auf die Wand, in der noch immer Prometheus hängt, der die Geschichte in Gang gebracht hat und dafür büssen muss.
Der tiefgründige Sinn.
Kein materieller Fortschritt ohne Verlust der Seele. Dieses Dilemma zieht sich in Szenen und Bildern durch das ganze Stück hindurch. Der geprellte Teufel bekommt niemals genug. Er will die Seele der Menschheit Und weil er sie nie bekommen kann, weil die Menschheit immer wieder neue Wege findet, um den Brückenzoll zu zahlen, ohne dem Teufel ganz zu verfallen, greift dieser in seinem Zorn nach einem riesigen Stein um die Brücke zu zerstören. Des Teufels Stein trifft und mit ihm stürzen Wand Brücke, Mythos, die ganze Zivilisationsgeschichte in die Tiefe. Ein schwacher Lichtschein erhellt den pechschwarzen Himmel und weckt Hoffnung auf einen Neubeginn.
Fünf Personen.
arbeiteten während zwei Jahren an der Realisation des Projektes. Der leider viel zu früh verstorbene Autor Jürg Amann - 1982 mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis geehrt - Theater-Regisseur Gian Gianotti, die beiden Sekretärinnen Karin Gaiser und Delia Luthiger und meine Wenigkeit. Als Hauptdarsteller konnten für die 15 geplanten Abendvorführungen während des Sommermonats August 2003 die unvergesslichen Schauspieler Matthias Gnädinger und Wolfram Berger verpflichtet werden. Ein multimediales Erlebnis mit den Elementen Wasser, Wind und Wetter bahnte sich dank der Verbindung von Licht, Ton und Musik in der Schöllenenschlucht an. Dass die Produktion in dieser schweizweit einzigartigen Schöllenenschlucht nicht nur Befürworter auf die Bühne brachte, überraschte uns kaum.
Die überhebliche und inkompetente Kritik am Dramaturgen und dem Regisseur sowie an den Licht- und Tontechnikern kam aus der Reihe des örtlichen Theatervereins „Freilichtspiele Andermatt.“ Wörtlich: „Der Inhalt des Stücks mit der Verflechtung der Prometheus-Sage - entwertet diese Legitimation, nutzt aber die ungehörige, fast mythische Atmosphäre des Schauplatzes.“ Und weiter glaubte sich der Präsident des Vereins mit seinem "Wissen" zu profilieren: „Auch die Wetterverhältnisse werden Publikum, Spieler und Statisten vor unlösbare Strapazen stellen.“ Doch diese in Uri aufgetischten Weisheiten, brachte uns kaum in quälende Selbstzweifel. In die Knie gezwungen wurden wir vom wortbrüchigen Hauptsponsor!!!
Im Frühling 2002 gelang es meinen beiden Mitarbeiterinnen Karin Gaiser und Delia Luthiger einen potenten Hauptsponsor an Land zu ziehen. Eine internationale Schweizer-Bank hatte das Spiel in der Schöllenen für ihr grosses Jubiläum ausgewählt, und dachte an Extraaufführungen für ihre geladenen Gäste. Und so erschien nach der Schneeschmelze eine hochkarätige Bankendelegation in der Schöllenen und zeigte sich hell begeistert von der Teufelsschlucht und der Idee vom Teufelsspiel mitten in dieser einmaligen, sensationellen Naturkulisse. In der kleinen Wirtschaft in der Schöllenen sassen wir nach der Vorstellung der diversen Schauplätze durch den Dramaturgen und den Regisseur alle zusammen und durften vom Delegationsleiter erfahren, dass die Bank nicht nur an zwei Extraaufführung denke, es sei entschieden worden, auch als Hauptsponsor aufzutreten. Er werde uns am Montag die unterschriebenen Verträge zur Begutachtung zuschicken. In bester Laune verabschiedeten wir uns voneinander.
Eine mir unbekannte Person teilte mit, dass Herr Dr. XX eine neue Aufgabe übernehmen werde und sein Nachfolger habe kein Interesse an diesem Teufelsspiel. Dass wir die Aufführungen nicht aus den vielen kleinen und mittleren Sponsorenbeiträgen und den Eintritten stemmen konnten, ohne ein finanzielles Fiasco zu riskieren, lag auf der Hand. Es war der grösste Organisations-Flopp meines Lebens.


Kapitel 12 Die historische Jungfrau-Stafette 1931-1939.
Ein Läufer übergibt an der Jungfrau-Stafette auf dem Flugplatz Dübendorf die Mal an den Piloten. Dieser startet zum Jungfraujoch und wirft den Malsack zum wartenden Skifahrer hinunter.
Die in den Dreissigerjahren bekannten Sportförderer Othmar Gurtner und Fritz Erb - Pikelfritz genannt - brachten das Kunststück fertig, eine Sportstafette quer durch die Schweiz und gegen ihre Gegner aus diversen politischen Lagern von den Behörden bewilligt zu bekommen. Zehn Equipen meldeten sich zu diesem Abenteuer mit je drei Läufern, zwei Radfahrern, einem Sportflieger, zwei Skifahrern, zwei Bergläufern und je einem Motorrad- und Automobilfahrer an. Kernstück der Stafette sollte der Überflug des 3454 Meter hohen Jungfraujoch mit kleinen Sportflugzeugen sein. Gleichzeitig sollte die Meldetasche mit einem Zielabwurf der Meldetasche sein. Die Idee hatte nur einen grossen Haken. Bei Schneefall oder sogar Schneesturm konnten die Flugzeuge nicht fliegen.
21. Juni 1931. Vor dem Verlagshaus und der Redaktion der Zeitschrift „Sport“ in Zürich wurden die zehn Startläufer gestartet. Nach den ersten Ablösungen gaben die Läufer ihre Meldetaschen mit den Malbändern an die Radfahrer weiter und diese peilten den Flugplatz Dübendorf an. Dort erwarteten die Flugpiloten mit laufenden Motoren auf die Radfahrer, übernahmen die Meldetaschen und schon hoben die ersten einmotorigen Sportflugzeuge vom Boden ab. Allerdings muss der Plan B angewendet werden. Die Flugzeuge flogen direkt nach dem Flugplatz Blécherette bei Lausanne. Am Jungfraujoch herrschte Schneegestöber. Der Abwurf musste entfallen. Auf dem Jungfraujoch wurde ein neuer Startplan erstellt. Fritz Erb schickte alle zwei Minuten einen Skifahrer ins Rennen. Im Bereich des Konkordiaplatzes löste ein zweiter Skifahrer seinen Kollegen ab und übergab am Märjelensee dem Bergläufer zum schweren Aufstieg am Eggishorn. Alsdann waren die Talläufer an der Reihe. Nach 1877 Metern Höhendifferenz erreichten die zähen Burschen die in Fiesch wartenden Motorradfahrer, diese übernehmen und übergaben 18 km weiter in Brig den Autofahrer zügig ging die Fahrt nach Lausanne zum Flugplatz Blécherette. Die Flugzeuge standen für den Rückflug nach Dübendorf bereit. In Dübendorf kamen die Flieger doch noch zum Zielabwurf der Meldetaschen. Die Radfahrer schnappten sich die vom Himmel fallenden Meldetaschen, pedalten Richtung Zürich und übergaben den Läufern zum Schlussprint ans Ziel vor dem Verlagsgebäude des „Sport“. Unter grossem Applaus wurde die Equipe „Grasshoppers-Club“ Zürich Sieger der ersten Jungfrau-Stafette. Erst bei der dritten Jungfrau-Stafette 1935 wurde die von Fritz Erb und Othmar Gurtner ersehnte Originalstrecke über das Jungfraujoch zur Tatsache. 1939 stellte im Rahmen der Schweizerischen Landesausstellung der Skiclub Wengen einen Streckenrekord von 7 Stunden 17 Minuten und 45 Sekunden auf!
Dass ich von der exotischen Jungfraustafette erfuhr, habe ich meinem Aufenthalt 1958 im Institut Catholique de jeunes gens in Neuchâtel zu verdanken. Jeden Sonntagabend hatten wir die Möglichkeit einen Schweizerfilm in französischer Sprache anzuschauen: Gilberte de Courgenay, Landamman Stauffacher, Romeo und Julia auf dem Dorfe und wie die alten Schweizerfilme alle hiessen. Auch die damals beliebte und informative Schweizer Filmwochenschau gehörte zum Programm. Und da sah und hörte ich erstmals einen Beitrag über die Jungfrau-Stafette einem polysportiven Wettbewerb, welcher quer durch die Schweiz führte. Besonders der Talläufer Imhasly imponierte mir. Mit Riesenschritten stürzte er sich auf dieser Knochenbrecherstrecke vom Hotel Jungfrau am Eggishorn in der Falllinie ins 1100m tiefer gelegene Dorf Fiesch hinunter.
Diese Bilder wurde ich ein Leben lang nicht mehr los. Und so machte ich mich 2005 an die Arbeit, die Jungfrau-Stafette 2007 neu auferstehen zu lassen. 600 Helferinnen und Helfer und Alt Bundesrat Adolf Ogi als Ehrenstarter, verhalfen der Jungfrau-Stafette 2007 zu einem grossen positiven Echo bei den über dreihundert Teilnehmern und den Medien.


(1) Kapitel 13 Mit dem 90-jährigen Oldtimer an die Barentssee.
.
Polarlicht in Lappland.

(2) Ford Modell T 1927
"Da wartet die Hölle auf dich – die Eishölle!"
Mit dem 90-jährigen Oldtimer an die Barentsee.
Oft muss ich bei meinen Vorbereitungarbeiten zur Fahrt in den Norden stets die gleichen Fragen beantworten. Hier ein Beispiel. "Fährst du wirklich in deiner offenen Schaukel in den hohen Norden? Ohne Seitenscheiben, ohne Heizung, ohne Spikes, ohne Ketten und dies bei minus 20 Grad und mehr? Ob das gut gehen wird?“ "Kein Problem" gebe ich zur Antwort. "Luxusartikel braucht die bald hundertjährige Lizzy nicht, und je kälter der Schnee, desto griffiger die schmalen Reifen. Solche Dinger werde ich bei einer Vulkanisationsfirma herstellen lassen und sie am Gottschalkenberg ob Zug ausprobieren. Es wird bestens klappen. Und gegen die Kälte gibt es einen ganz speziellen Trick. Der Holzboden der Lizzy werde ich bei tiefen Temperaturen wegnehmen und schon wird warme Luft vom Motor her an die Füsse, an die Beine strömen. Auch die Frontscheiben können von dieser Wärme profitieren und werden nicht so schnell einfrieren. Natürlich stecke ich mich in warme Kleider. Auch eine Pelzhaube kommt mit. Alles andere werde ich spätestens im südlichen Finnland erfahren und für den Norden Lehren daraus ziehen."
Am 28. Januar 1915 ist es so weit. In Rovaniemi am nördlichen Polarkreis steht das „Tor zur Hölle“ offen. Die Wetterprognosen melden erträgliche Temperaturen und wenig Neuschnee. Erst ab Ivalo ist die E 75 schneebedeckt und richtig vereist – so wie ich es mir gewünscht habe. Ab Karasjok – dem Sitz des autonomen Parlaments der Ureinwohner, der Samen – weht ein zügiger Wind den Schnee von den öden Feldern in die Fahrbahn. Stundenlang fahre ich durch die immer kahler werdende Landschaft. Die dichten Fichten-, Birken- und Kieferwälder des südlichen Finnlands sind längst verschwunden. Eine baumlose tundraartige Vegetation beherrscht die Landschaft.
Eintönig rattert der offene 4-Zylinder bei gleichmässig gewählter Geschwindigkeit von 55 km/h. Schnurgerade die Strassen, keine Personenwagen, keine Lastwagen. Die Konzentration lässt nach. Ich träume, fantasiere vor mich hin. Ungewollt, nicht gerufen, beginnt sich in meinem Kopf das Wort „Schneehölle“ zu wiederholen. Bilder werden wach, tief in mir vergrabene, schreckliche Bilder: Die Fresken an den Wänden der Burgkirche zu Raron im katholischen Wallis, dort, wo der Dichter Rainer Maria Rilke begraben liegt. Teufel in abscheulichen, missgestalteten Tierleibern quälen nackte Menschen mit Feuer und Messer und treiben sie in den Schlund züngelnder Flammen.
Gibt es sie die Hölle in meiner kindlichen Fantasie? Damals vor 65 Jahren? Die Hölle von einem Freskenmaler an die Wand der Kirche von Raron gemalt? Die christliche Religion von Kirchenlehrern, Adeligen und Ratsherren aus eigener Ratlosigkeit zum Angstmacher ihrer Gläubigen und Untertanen degradiert? Während Jahrhunderten das Thema: Die guten Menschen, die der „wahren“ Religion angehörenden, kommen in den Himmel. Die Naturvölker, die Juden, die Atheisten, die Ungläubigen, die Ketzer, die Lesben, die Schwulen und die nach Gleichberechtigung strebenden Frauen sind die Bösen. Auf den Scheiterhaufen und zur Hölle mit ihnen, zu den Heulenden, den Zähneknirschenden. Und im gleichen Atemzug predigten und predigen heute noch all die Päpste und Kardinäle, die Bischöfe und Pastoren von der grenzenlosen Liebe Gottes. Was für ein Widerspruch! Ich denke es wird nach unserem Tode weder den bildlichen Himmel noch diese bildliche Hölle geben. Gott wird nicht im Geiste eines römischen Kaisers, mit einer Daumenbewegung nach oben oder unten über das Schicksal unserer Seelen entscheiden. Ob wir im Tode uns nicht selber beurteilen werden mit der einfachen Frage: „Wie hat sich unser verflossenes Leben auf die Mitmenschen ausgewirkt?“ Da überquert in der Ferne ein Elch die Strasse. Ruhig, Lizzy und mich kaum beachtend. Vorsichtig bremse ich den Ford ab, gebe dem wunderschönen Tier – dem König der Wälder – den Vortritt. Kann es in einer Hölle, einer Eishölle solch majestätische Tiere geben? Doch auch der Elch kommt aus meiner Fantasie. Er bringt mich in die Realität zurück. Es ist Zeit für eine Pause, für ein Glas heissen Tee, in der nächsten Siedlung, bei der nächsten Tankstelle!


(1) xx
Kapitel 14 Die Pandemie hält uns im Griff.
Ich meldete mich per Telefon zum Impfen an, erhielt kurzfristig zwei Termine mitgeteilt und machte mich rechtzeitig auf ins Impfzentrum in Baar. Freundlich wurde ich empfangen und nach einem kurzen Gespräch wurde mir im weitläufigen, mit Plastikwänden abgeschirmten Saal, ein Sitzplatz zugewiesen. Ungewollt begann ich vorsichtig gleichaltrige Kolleginnen und Kollegen zu mustern. Die einen sahen dem kommenden Impfprozedere locker entgegen, andere schienen nervös zu sein, mit fragenden Augen. Ich muss akzeptieren, dass auch ich mich aus Altersgründen zum Risikofaktor entwickelt habe! Da kam mir ein kürzlich gelesener Artikel der NZZ in den Sinn: "1876 wurden Frau und Herr Schweizer im Durchschnitt 47, beziehungsweise 43 Jahre alt. Dank der modernen Medizin rückt heute der eigene Tod in immer weitere Ferne. Wir wissen zwar theoretisch, dass wir irgendwann sterben werden. Doch gleichzeitig gibt uns der technische Fortschritt, die Medizin das trügerische Gefühl, der Tod sei etwas, das wir auf einen bestimmten Zeitpunkt hinausschieben können. Das Sterben ist ein Unfall, ein Versagen der Medizin, ein Kampf, der verloren gegangen ist. Den natürlichen Umgang mit dem Tod haben wir verlernt." Da wurde ich aus meinen Gedanken geweckt: "Sie sind an der Reihe", flüsterte eine Mitarbeiterin des Impfpersonals. Nach dem Nadelstich in den linken Oberarm und einer 15-minütigen Ruhezeit, konnte ich das Impfzentrum verlassen.
Unterdessen hat auch die zweite Impfung statt gefunden. Letzten Freitag die dritte, die sog. Booster-Impfung.
Corona und Sport. Es sollte meine letzte Rallye sein. Zum letzten Mal glaubte ich einen historischen Sportwagen der Marke Volvo während drei Tagen und Nächten im französischen Jura über eingeschneite, eisige Nebensträsschen zu driften. Um mich fit zu halten und die nötigen Reflexe neu zu animieren, suchte ich mir zu mitternächtlichen Stunden dafür geeignete, selten befahrene und verschneite Waldsträsschen aus. Doch da kam aus Frankreich die Mitteilung des Organisators, dass das Département du Doubs, die Rallye "Neige&Glace" wegen der aktuellen Corona-Situation nicht starten wird. Dem Veranstalter kann ich die Enttäuschung nachfühlen, hat er doch während Monaten diesen traditionellen Sportanlass vorbereitet. Gegenwärtig bin ich einer ähnlichen Situation ausgeliefert wie die Franzosen. Zusammen mit einem kleinen Organisationsteam beabsichtigen wir die Jungfrau-Stafette (s. Kapitel 12) nach beinahe 10 Jahren wieder zu organisieren. Vorgesehen ist der Oktober 2022. Ursprünglich war der 1. Mai 2021 im Gespräch. Unterdessen haben wir wegen der gegenwärtigen Coronasituation die Stafette abgesagt. Wie sich die Pandemie bis zum Oktober 2022 entwickeln wird, steht in den Sternen geschrieben. Zu denken geben mir die vielen neuen Corona-Mutationen. So bleibt uns höcht wahrscheinlich nichts anderes übrig, als die getroffenen Vorbereitungen einzumotten und zu hoffen, dass die Pandemie besiegt werden kann!
PS Dass Pandemien in Europa nichts Neues sind, steht z.B. in den Büchern vieler historischer Klöster. Interessant ist der Blick des ehemaligen Lokalhistoriker Kurt Zurfluh in die alten Schriften seiner Urner-Heimat. In seinem Buch "1000 Jahre Gotthardweg" schreibt er wörtlich: "Leider mussten die Gotthardkantone schon sehr früh mit einer verheerenden Folge des Transits Bekanntschaft machen. "Welsche Kaufleute" sollen die Pest aus dem Morgenland eingeschleppt haben! In Luzern sterben an der Lungen-und Beulenpest 3000, in Basel 14'000 Menschen. Betroffen werden auch die gastfreundlichen Klöster. Disentis stirbt bis auf zwei Mönche aus. Im Frauenkloster Engelberg sterben innert einem Jahr 116 Nonnen. Im Jahre 1439 beginnt das grosse Sterben auch im Urnerland."
Wenn heute Corona moderne Leute verunsichert, wenn sie keine andere Erklärungen als Verschwörungstheorien verbreiten und daran glauben, dass Bill Gates - einer der weltweit Reichsten - dahintersteckt, wenn sie den Holocaust aus der Hitlerzeit leugnen und der Meinung sind, dass der amerikanische Geheimdienst die Terroranschläge vom 11. September 2001 verübt habe, dann sind wir seit der Lungen- und Beulenpest vor 600 Jahren nicht viel weitergekommen! Im "christlichen" Europa wurden nicht erklärbare Todesfälle den Juden angedichtet! Tausende auf Scheiterhaufen verbrannt!
Seit meinen ersten Impfungen sind bereits 2 Jahre vergangen. Vor wenigen Tagen bekam ich die 3. Impfung, die Booster-Impfung. Die Pandemie ist nicht besiegt. Im Gegenteil!
Zum Schluss dieses Kapitel zitiere ich Bertrand Piccard: "Für mich ist die Pandemie eine Lektion in Demut, nachdem sich der Mensch jahrzehntelang als arrogantes Raubtier und Zerstörer verhält."


(1)
Kapitel 15 „Mit dem Elektroauto in die Sackgasse “
Der gegenwärtige Kult um das Elektroauto und seiner veralteten Elektrotechnologie aus der Zeit der Jahrhundertwende von 1896 bis 1910, wird heute von der Automobilindustrie, den Politikern, den Verkehrsplanern und selbst den Grünen so dargestellt, als würden dank modernster Elektronik nur noch saubere Fahrzeuge die Werkhallen verlassen. Als interessanter Nebeneffekt werde - dank der "sauberen" Elektromobile - die sich weltweit anbahnende Klimakatastrophe verhindert!!!
Drehen wir das Rad der Geschichte um über 100 Jahre zurück. Die damals eine neue Epoche repräsentierende Zeitung "France Automobile" machte bekannt, dass am 29. April 1899 auf der schnurgeraden, unbefestigten Strasse bei Achères nördlich von Paris ein Geschwindigkeitsrennen durchgeführt werde. Auch der bekannte Rennfahrer und Ingenieur Camille Jenatzy sei am Start und werde versuchen, über den fliegenden Kilometer einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufzustellen. Und dies gelang dem "roten Teufel" aus Belgien - so wurde er genannt - schon beim ersten Anlauf. Nach 34 Sekunden Fahrt bei einer für die damalige Zeit extrem hohen Geschwindigkeit von 105,882 km/h, machte er sein waghalsiges Vorhaben unter dem Jubel der Zuschauer wahr.
Winfried Wolf - Politikwissenschafter, ehemaliges Mitglied des Deutschen Bundestages und heute Chefredaktor der kritischen Zeitschrift "Lunapark 21",schreibt im Vorwort seines Buches "Mit dem Elektroauto in die Sackgasse" folgendes: "Mittlerweise ist es unernst, Elektromobilität als ein Projekt fortschrittlicher Verkehrsplanung darzustellen, dass gegen die "fossilen" Grosskonzerne durchgesetzt werden müsste. 2018 fuhren die zwölf grössten Autokonzerne Rekordgewinne ein und starteten gleichzeitig das grösste Inventionsprogramm ihrer Geschichte - pro Elektromobilität. Die Ölkonzerne investieren gleichzeitig massiv in ihr angestammtes Geschäft und steigen zugleich in die Stromerzeugung ein! Die Internationale Energie-Agentur (IAE), eine Energie-Lobyorganisation, freut sich, "dass die Zukunft elektrisch" und die Stromerzeugung (unter anderem mit neuen AKW) wegen der Elektromobilität massiv gesteigert wird. Damit ist die Elektromobilität Teil eines zerstörerischen Prozesses, den wir seit Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Automotorisierung erleben. Ebenso wie vor einem Jahrhundert eine auch von "progressiven" Kräften getragene Begeisterung für Henry Ford gab, so gibt es gegenwärtig einen auch von "fortschrittlichen" Gruppen befeuerten Hype um Elon Mask und Tesla. Ford und Musk verkörpern den US-amerikanischen Kapitalismus der jeweiligen Zeit; die Ideologie der beiden Milliardäre ist vergleichbar elitär und menschenverachtend!"
Es ist an der Zeit, die Offensive zugunsten des Elektroautos in einen dreifachen Gesamtzusammenhang zu stellen. Es handelt sich dabei erstens um einen weiteren Schritt zur Intensivierung einer Mobilitätsorganisation, bei der immer mehr Menschen vom Auto abhängig gemacht werden.
Zweitens um einen Prozess, in dessen Folgen die Belastungen, die mit jedem Autoverkehr zusammenhängen, weiter steigen - hinsichtlich Verkehrsopfern, Stadtqualität und Emissionen, die die Gesundheit und das Klima schädigen.
Drittens um eine Entwicklung, die vom Wachstumszwang der bestehenden Wirtschaftsordnung und den Profitinteressen der führenden Konzerne in der Automobildustrie, im Technologiesektor und der Energiewirtschaft vorangetrieben wird.

Kapitel 16 Im Alter finde ich wieder den Zugang zu Gott. 
(1) Hl. Benedikt Fresko in Subiaco
Als Messdiener (Ministrant) brachte ich Brot, Wein und Wasser zum Altar, half dem Priester bei der Händewaschung und zur Elevation des Leib Christi, läutete ich mit Altarschellen die Wandlungsworte des Priesters ein.
Wie streng es meine Eltern mit der katholischen Moral nahmen, zeigt die folgende kleine Episode. Im Skigelände von Habkern, oberhalb von Interlaken, fand jedes Jahr ein grosses Skirennen für junge Nachwuchsfahrer aus dem Berner Oberland statt. Auch 1951. Doch bei nassem Schnee verlor ich die Beherrschung über die damals noch schwerfälligen Holzskis, stürzte fürchterlich neben die Piste und verstauchte beide Fussgelenke. Die damaligen steifen Leder-Skischuhe boten bei schlechten Schneeverhältnissen und eher nachlässig präparierten Rennstrecken kaum genügend Halt für die oft eiskalten Füsse! Unter grossen Schmerzen musste ich mit Bus und der BLS-Bahn via Spiez die beschwerliche Heimreise nach Frutigen antreten. "Was dies mit katholischer Moral zu tun hat?" werden Sie sich fragen. Damals war das Versäumen des sonntäglichen Gottesdienstes eine von Rom aus diktierte, schwere Sünde, eine sogenannte Hauptsünde. Nur beim Priester im dunklen Beichtstuhl und einem Trenngitter zwischen Sünder und Beichtvater war es möglich, sich von diesem sträflichen Vergehen rein zu waschen! Um nicht meine Startzeit am Rennen zu verpassen, konnte ich dieser sonntäglichen Pflicht nicht nachkommen. Als mich Vater humpelnd zur Tür hereinkommen sah, musste ich ihm gestehen, dass ich nicht nur das Rennziel in Habkern, sondern in Interlaken auch den sonntäglichen Frühgottesdienst verpasst hatte. Streng musterte mich Vater mit scharfem Blick und lauter Stimme: "Du hast das Skirennen dem Herrgott vorgezogen. Da hast Du nun die Strafe für Dein Vergehen." Doktor Siegenthaler in Frutigen steckte mir irgendeine Salbe zu, und verpasste den bös geschwollenen Füssen Druckverbände an. Doch bald einmal waren die verstauchten Fussgelenke kein Thema mehr. Was ich aber mein Leben lang nie vergass, war die Moralpredigt meines damals noch streng gläubigen Vaters. Erst viele Jahre später erlebte ich ihn gegenüber der römischen Kurie als sehr kritisch denkend.
Nach der Sekundarschule ermöglichten mir meine Eltern im "Institut Catholique de jeunes gens" in Neuchâtel einen Jahresaufenthalt. Französisch, Geschichte und Handel waren die Hauptfächer. Doch bei den obligatorischen Gottesdiensten fehlte mir die Lust am Beten, an tiefgründigen Betrachtungen und am Gedenken an all die vielen längst heiliggesprochenen Figuren im Umfeld des Schulordengründers Johann Baptiste de La Salle aus Reims. Ihm hat die Stadt der französischen Könige die ersten Schulen für Kinder aus ärmlichen oder schwierigen Verhältnisse zu verdanken. La Salle wird heute noch als Gründer der französischen Volksschulen verehrt. Auch die von den Schulbrüdern in Neuchâtel - den Frères - unterrichteten Schulfächer, wie Handelskunde oder so ähnliche Schikanen, erweckten kaum meine Neugier am Lernen! Die französische Sprache dominierte den Schulalltag. Dies gefiel mir schon besser. Auch untereinander mussten wir französisch sprechen. Das störte mich wenig im Gegensatz zu vielen anderen "Zöglingen". Ich hielt dies sogar als eine sinnvolle Massnahme. Trotzdem, Fussball war nach wie vor mein einziges Lebenselixier.
Nach dem Eintritt ins katholische Lehrerseminar in Zug anno 1959 begannen für mich vier schwere Jahre. Insbesondere die mathematischen Fächer brachten mir wenig Freude, stattdessen täglich Stress pur. Zu allem Unglück verletzte ich mich dauernd beim Fussball und so musste ich diesen Sport noch vor Schluss der vierjährigen Seminarzeit aufgeben. Ich bereitete mich konzentriert auf die Abschlussexamen vor und konnte schliesslich zur Freude meiner Eltern und zu meiner Überraschung knapp durchrutschen!
1962 wurde Angelo Giuseppe Roncalli zum Papst gewählt. Er nannte sich Johannes XXIII. Als "Il Papa buono" verehrte ihn das katholische Italien. Auch ich glaubte an eine Reformation der römischen Kurie. Leider dauerte dieser "römisch-katholische Frühling" nur kurze Zeit, und die konservativen, nach Macht und Ruhm lechzenden Kardinäle in Rom, drehten das Rad der Zeit wieder weit zurück, zurück in die dunkle Vergangenheit der römisch-katholischen Kirche. Für mich bedeutete dies auch das Ende meiner romfreundlichen Zeit. Das heisst aber nicht, dass für mich der Glaube an ein Jenseits verloren ging. Zusammen mit meiner Frau Anna, suchten wir eine Ersatzreligion, und fanden diese in Seelisberg - hoch über dem Urnersee. In den Sechziger- und frühen Siebzigerjahren machte im alten Grand Hotel - mit Blick auf eine atemberaubende Landschaft - der indische Yogi namens Maharischi Mahesh Yogi sorgte für grosse Schlagzeilen. Die "Wissenschaft der schöpferischen Intelligenz" - so nannte er seine spirituelle Lehre - werde alle Probleme der Welt lösen, und ein weltweiter Zustand des Friedens werde für alle Menschen eintreffen. Allerlei Geschichten wurden vorallem in Uri zum Tagesgespräch. Besonders in den Beizen. Aber auch die Medien - nicht nur das Urner Wochenblatt - auch renommierte Tageszeitungen wie die NZZ - brachten dem Guru und seinen Jüngern viel Medienpräsenz. Und als Maharischi Mahesh Yogi der Urner Bevölkerung klarmachen wollte, dass er nicht nur meditieren, sondern auch dem Urner Föhnsturm den Garaus machen könne, war unser Interesse an dieser sensationellen Vorankündigung geweckt. Ausserdem machte uns ein weiteres Spektakel neugierig. Der Maharischi war der Meinung, dass seine Jünger ohne Hilfsmittel über den Urnersee fliegen können! Wenn das wahr sein sollte, waren auch Anna und ich dabei! Doch vorerst mussten wir wissen, was es an diesen spannenden Wirtshausgeschichten auf sich hatte.
Der Guru erschien leider nicht persönlich. Einer seiner engsten Jünger hatte die Aufgabe, einige Altdorferinnen und Altdorfer in die Geheimnisse und Praktiken der Seelisberger-Meditationslehre einzuweihen. Doch in Wirklichkeit war es ein ganz gewöhnlicher Meditationskurs, wie er auch von den Kapuzinern im Kloster Altdorf angeboten wurde. "Auch die nächtlichen Föhnstürme können sich weiterhin im Urner Reusstal austoben, und mit den fliegenden Yogis sei im Moment noch nicht zu rechnen," erklärte uns der junge Meditationslehrer mit einem leicht verschmitzten Lächeln. So eigneten wir uns ein gewöhnliches Meditieren an, und widmeten uns täglich 20 Minuten lang der Stille und der Ruhe. Dank des Mantra gelang es uns, in einen ruhigen körperlichen und seelischen Zustand zu versinken. Nach 20 Minuten fanden wir wieder den Kontakt mit der Umwelt. Von einer Ersatzreligion konnte nicht die Rede sein.
Auch beim Motorsport machte ich mir diese Meditationslehre nützlich. Trafen wir an einer Rallye in später Nacht zu früh an der Zeitkontrolle zur nächsten Spezialprüfung ein - zum Beispiel an der Rallye Monte Carlo - so konnte ich ohne Probleme und innert wenigen Sekunden hinter dem Lenkrad einschlafen. Beifahrer Peter Kruit überwachte meinen Tiefschlaf, und zur richtigen Zeit weckte er mich für die Fortsetzung des Rennens über die tief verschneiten und vereisten Pässe im Chartreuse-Gebirge oder über den legendären Col du Turini in den französischen Seealpen. Mit Fliegen nach einer fernöstlichen Methode hatte dies älteste und damals anspruchsvollste Rallye Europas allerdings nichts zu tun!!
In den letzten Jahren finde ich wieder Zugang zu Gott und zu meinen bereits lieben Verstorbenen. Das Akzeptieren des Todes macht mich ruhig, so wie damals die tägliche Meditation. Noch habe ich einiges aufzuräumen. Dies ist nicht nur bildlich gemeint. Dann kann ich in Frieden gehen! Allerdings glaube ich nicht daran, dass Gott auf mich wartet, mich richtet, straft, belohnt. Ich werde mir selber den Spiegel vors Gesicht halten müssen und mein Leben beurteilen. Ich werde all das Gute, das Schöne, aber auch meine dunklen Seiten wahrnehmen!

Liebe Leserinnen und Leser
Einige Kapitel - wie die groteske Geschichte von Godis Amilcar - waren nur möglich zu schreiben, weil mein Vater öfters vom "Rennfahrer Godi" erzählte. Diese Geschichte rührte mich als Zehnjährigen immer wieder zu Tränen.
Ihnen liebe Leserinnen und Leser sage ich herzlichen Dank, für das Interesse an meiner Arbeit mit Blick auf unsere Nachkommen, die sich dank Dr. Bohli mit dem Projekt "Meet my Life" ein realistisches Bild von uns Menschen in der Schweiz machen können, damals anfangs des 21-igsten Jahrhunderts das heimtückische Corona Virus Covid-19 und seine Mutationen unser tägliches Leben total zu verändern begann.
Herzlichen Dank gehört auch meiner ehemaligen Sekretärin Karin Aschwanden. Bei den drei Internationalen Bergrennen für historische Renn-, Sportwagen und Rennmotorrädern am Klausenpass anno 1994, 1998 und 2002 war Karin meine sportbegeisterte, unentbehrliche rechte Hand. Beim Projekt "Meet my Life" erleichterte mir meine Tochter Beatrice mit den modernen elektronischen Hilfsmittel Schreib- und Gestaltungsarbeiten zu realisieren. Auch bei meinem ehemaligen Rallye-Beifahrer Edy Schaller bedanke ich mich für sein digitales Engement für dieses Projekt.
Zum Schluss des Textes "Mein Leben ein Gratwanderung" noch einige persönliche Bemerkungen.
Meine Motorsport-Passion lernte mich in schwierigen Situationen furchtlos und überlegt zu reagieren. Eine Eigenschaft, die ich auch bei humanitären Einsätzen - sei es im Kriegsgebiet von Tschetschenien, bei einem Ueberfall einer Horde Mafiosi auf unsere Unterkunft in Inguschetien, beim schrecklichen Erdbeben in der "Armenischen Sozialistischen Sowjetrepublik" abrufen konnte. Unvergessen bleiben mir auch die "Abenteuer" auf den schnurgeraden, vereisten Strassen in der Ukraine, in Polen oder in Weissrussland mit all den rücksichtslos fahrenden Chauffeuren und ihren schwer beladenen Lastwagen und Sattelschleppern und ihren "fühlbaren" abgefahrenen Reifen. Bei einer Berührung wären wir fürchterlich in den nächsten Graben abgeflogen, ohne Sicherheitsgurte mit einem schwer kranken an Leukemie erkrankten polnischen Priester auf dem Rückpolster des Renault. Er sollte so rasch wie möglich in das Spital von Krakau gebracht werden. Leider starb der Priester wenige Tage nach seiner Ankunft in Krakau.
Dolmetscherin Janina zeigte häufig auf den Tacho und blickte mich mit grossen Augen fragend an! Doch bald einmal merkte sie, dass man auch auf Eis vorwärts kommt!
Dass sich die Caritas Schweiz - gestützt auf meine motorsportlichen Erfahrungen - mich für diesen nicht so einfachen Auftrag verpflichtet hatte, ehrte mich und gab mir die Gewissheit, nach der Katastrophe von Tschernobyl einen bescheidenen Beitrag an schwer erkrankte Menschen geleistet zu haben!
Ihr Bernhard Brägger
Vollendete Autobiographie