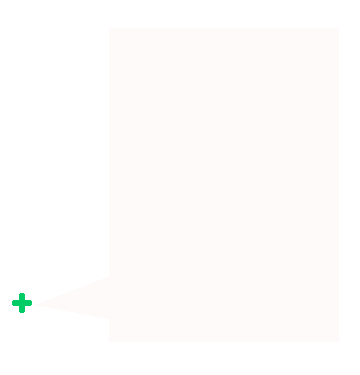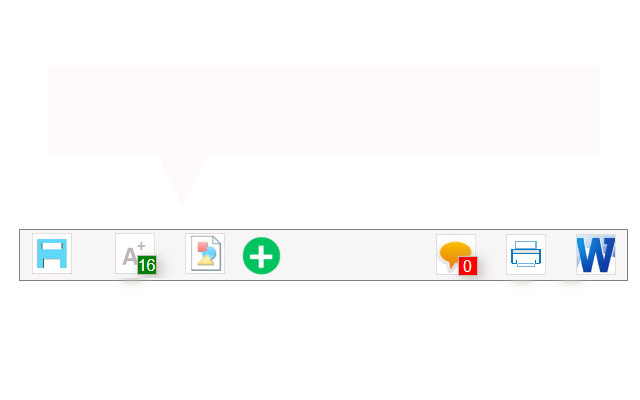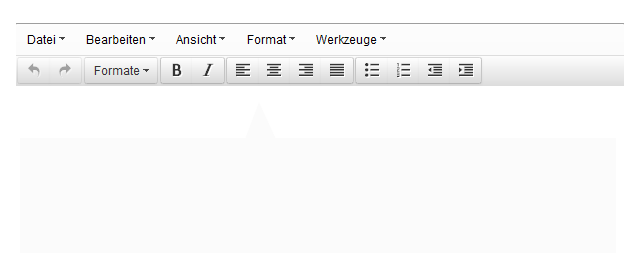Zurzeit sind 552 Biographien in Arbeit und davon 313 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 191

In der zweiten Corona-Welle setzte ich mich endlich hinter meinen PC und begann zu schreiben. Danach schrieb ich lange Zeit nicht mehr. Ich finde die Sammlung autobiograf. Lebenstexte sehr spannend. Ich lese selbst sehr gerne Biografien. Das Leben reflektieren und Tagebücher durchforsten hat bei mir Interesse geweckt und gewisse Muster aufgezeigt, die mir sonst verborgen geblieben wären. Zuerst dachte ich, es brauche ein gerüttelt Mass an Masochismus, in der Vergangenheit zu wühlen. Dann erging es mir, wie bei den zig-tausend Fotos: ich wurde demütig vor dem, was wir Leben nennen.
Die schwere Schulterverletzung Ende November verstärkte das Bedürfnis, etwas "Sinnvolles" zu tun, da mir wochenlanges Stillhalten verordnet wurde. Eine Kollegin beschreibt mich als "Krampferin", mein Sohn als "Maschine". Anfangen, Durchhalten, komme was wolle - egal wo und bei was, scheint eine meiner Devisen zu sein. Und stimmt das, was wir uns in der Familie oft sagten, heute noch? Was Dich nicht umbringt, macht Dich stärker. Nachgeben und Versöhnung habe ich erst (zu) spät gelernt. Vor allem das Vergeben mir gegenüber.
Spannend, das Projekt als Zeitdokument anzusehen. Die Frage, ob die Erinnerung so, wie ich das schrieb stimmt, kann ich nicht bejahen. Würde jemand anderes aus meiner Familie so einen Text wagen, sähe er bestimmt anders aus, mit anderen Schwerpunkten, anderen Erlebnissen. Das ist ja eben das Einzigartige, finde ich. Es wird mein Herzens-Projekt :-)

Grosseltern und Zuhause
Geboren bin ich zuhause bei meinen Grosseltern mütterlicherseits am in Thun im Hause meiner Grosseltern. Ich war das erste von vier Kinder eines "Dorfschulmeisters". Meine Mutter äusserte sich widerwillig zu meiner Geburt. Es sei "langweilig" gewesen. Immer wieder habe sie geglaubt, es gehe los und dann sei doch nichts passiert. Die Wehen seien langwierig gewesen. Zur Geburt kam die Hebamme schliesslich fast zu spät. Jedenfalls war es kein ausnehmend freudiges Ereignis. Alle waren froh, als ich endlich zur Welt kam. In meinen Geburtsakten steht 2880 Gramm und 48 Zentimeter lang. Das Baby wiegt in diesem Fall bei der Geburt zu wenig für seine Entwicklung im Mutterleib, dachte ich später als ausgebildete Hebamme. Mutter fand es schrecklich, dass ich diesen Beruf ergriff. Doch später mehr davon.
Meinen Namen Regina erhielt ich von meinem Vater. Er fuhr eine Horex Regina - ein damaliges Motorrad, als meine Mutter schwanger wurde. Weil ich unterwegs war, musste er aufs Autofahren umstellen, was er mir später oft vorwarf. Er fuhr zu meiner Geburt statt mit dem Töff in einem gelben Opel, später kaufte er BMWs. Ich staunte als Kind über das s/w Foto, auf dem meine Eltern als junges Paar neben dem Motorrad posierten. Meine Mutter hatte ein Kopftuch umgebunden und lächelte verhalten. Damals gab es noch keine Helmpflicht. Mein Vater stand daneben in einem schnittigen Lumber und einer auf dem Kopf befestigten Töff Brille. Wie meine ängstliche Mutter je auf dem Motorrad mitfahren konnte, war und ist mir ein Rätsel. Ich fuhr als Jugendliche einige Male mit Vater. Er hatte später eine Motoguzzi und lag tief in die Kurven, beschleunigte nach den Ortstafeln und bremste abrupt vorher. Ich war ziemlich geschockt. Zudem foppten Verwandte, dass ich froh sein sollte, dass er früher keine Motoguzzi gefahren sei. Sonst wäre mein Name anders ausgefallen. Die Horex Regina ist heute ein Oldtimer, genau wie ich.
Meine erste Erinnerung stammt aus den 60er Jahren, als ich als Kleinkind bei den Grosseltern väterlicherseits in Uetendorf aufwachte und mich im Spiegel an der Wand gegenübersah und mit mir selbst plauderte. Die Erwachsenen fanden das lustig. Ich war ein fröhliches Kind und lachte oft und viel. Ich hielt viel von meinem Grossvater, der mir auf seinen langen Holzskiern mit Zugbindungen das Skifahren beibringen wollte. Ich stand vor seinen Schuhen und jauchzte, weil es so schön war, den Hügel runterzufahren. Auch dass er mir den Mund mit Pflaster zuklebte, weil ich viel zu viel plauderte, gehört zu den frühsten Kindheitserinnerungen. Das fand ich allerdings schlimm. Habe ich zu viel geplaudert? Im Zimmer in Uetendorf hörte ich im Bett vor dem Einschlafen und nach dem Aufwachen die Telefondrähte singen. Als Kind dachte ich, es seien Funksprüche von Ausserirdischen, die mir etwas mitteilen wollten. Meine Grossmutter sagte, das seien Elfenstimmen. Für mich war das alte Haus auf der Allmend mit seinem Garten und den Hühnern ein kleines Paradies. Meine Grossmutter "verwöhnte" mich. Jedenfalls wurde es so erzählt. Ich empfand das Verwöhnt werden als Kind sehr normal. Bis zur Einschulung weilte ich sehr oft dort, fragte aber immer beim Abschied, ob mich die Eltern wohl wieder zurück holen würden. Ich war mir da nicht so sicher. Ich war sehr verträumt und hatte eine rege Phantasie. Ich durfte im Garten der Grosseltern Kamillenblüten für Tee oder Himbeeren sammeln, später auch Heidelbeeren im Eriz, wo ich mit ihnen in die Ferien durfte. Dort wohnten wir mitten auf einer Kuhweide und der Melkstand war ganz nah. Der Bauer nahm einen Sohn Köbi mit, mit dem ich mich anfreundete. Wir schwangen uns auf einen grossen Ast der Tanne, die dort stand. Später erfuhr ich, dass er als Mann erst Alkoholiker wurde, dann vom Alkohol entwöhnt war, aber schliesslich an einer Zuckerkrankheit starb.
Wir wohnten im Dorfschulhaus. Meine Eltern gaben etwa vierzig Jahre Schule und galten als Respektpersonen. Die Mutter unterrichtete die Unter- der Vater die Oberstufe. Wir Kinder besuchten diese Schule, ausser mein jüngster Bruder. Ihn schickten die Eltern in die Sekundarschule. Wir Kinder standen unter Dauerbeobachtung. Alles wurde kommentiert, was wir taten oder eben nicht taten. Weil zwei Wohnungen (je eine pro Lehrkraft) vorgesehen waren, hatten wir eine "alte" und eine "neue" Wohnung. Insgesamt hatten wir je zwei Küchen und Bäder sowie neun weitere Zimmer zur Verfügung. Ein Abstellraum, den wir "Gädi" nannten, lag hinter dem Bad in der "alten" Wohnung. In einem Zimmer stand ein Ping Pong - Tisch. Den nutzten wir bei schlechtem Wetter. Ich sah von meinem Zimmerfenster aus zum nördlichen Nachbarn, hätte aber lieber den Blick gehabt auf die Trauerweide, den Garten und Bach (den meine beiden Schwestern hatten). Als sieben Jährige hatte ich zwei Schwestern und einen Bruder. Meine Schwestern ärgerte ich gerne, indem ich sie foppte. Einem ihrer Lieblingspuppen schnitt ich die langen Haare ab. Das gab ein Allotria… Meine liebste Freundin wohnte gleich nebenan in einem Haus, wo deren Vater Posthalter war. Er fragte mich jeweils, ob ich süsse oder salzige Briefmarken wolle. Wir spielten oft bei uns im und rund ums Schulhaus. Ich war ein neugieriges Kind. Das wurde verboten, als die beiden Väter einen Streit anfingen. Zum anderen Nachbarn durften wir nicht mehr spielen gehen, weil der grosse Bruder der beiden Mädchen ein Etwas aus seiner Hose holte und darauf herum rieb. Er bat uns, ihm dabei zuzuschauen, aber wir interessierten uns nicht und wollten lieber mit den Puppen spielen. Der Posthalter pilgerte Abend für Abend zur Nachbarin und wir Kinder fragten, warum er bei der Nachbarin schlafe. Hat sie so grosse Angst, allein zu schlafen? Wir bekamen keine Erklärungen, sondern uns wurde gesagt, wir sollten schweigen, denn das ginge uns nichts an. Dass diese Dinge verboten waren, wurde uns durch das Besuchsverbot klar. Aber wir hatten keine Ahnung, womit wir es zu tun hatten.
Familienaspekte und Eskapismus (Lesen)
Mein Bruder war ein exaktes Abbild von Vater und wurde verwöhnt von ihm, wie er selbst verwöhnt worden war. Sie spielten bei schlechtem Wetter Fussball im Korridor unserer Wohnung. Da ging schon mal was zu Bruch. Wir Mädchen wollten dabei auch mitmachen. Vater tolerierte, dass mein Bruder in der vierten Klasse beim Velohändler ein Knabenvelo für sich bestellte, ohne zu fragen. Vater bezahlte es, ohne zu reklamieren. Das fand ich unverschämt, vor allem, weil wir Mädchen auf Damenvelos fahren lernten und keine Kindervelos bekamen. Ich erinnere mich, dass Vater meinem kleinen Bruder bei jedem Einkauf ein Spielzeugauto als Geschenk kaufte. Bis auf einen Tag, wo er es nicht mehr tat und mein Bruder wie ein Verrückter zu toben begann! Die Ungerechtigkeit, dass wir Mädchen keine solchen Geschenken bekamen, machte mich wütend. Ich glaube, Vater und Bruder wetteiferten ein Leben lang, wer der schnellere, versiertere und bessere Autofahrer sei. Mein Vater konnte behaupten, Männer seien wichtiger und schöner als Frauen. Dazu bemühte er sich, Beispiele aus der Tierwelt anzuführen. Jedes Männchen sei dort schöner gestaltet als das Weibchen. Welche Provokation! Es ärgerte mich, dass alle meine Freundinnen meinen Vater attraktiv fanden und dies auch noch sagten. Ich musste seine Launen aushalten und ihm bei Tisch die Dinge geben, auf die er zeigte. Beim Essen verbot er mir oft, zu sprechen. Das Lächerlichste war, dass er manchmal irgendwo seine Spucke drauf tat, damit keins der Kinder ihm (s)eine Speisen wegessen würde (zum Beispiel die feinen Torten). Ich fragte mich damals: Spinnt er jetzt? Später meinte meine Schwester, er sei ein wahrer Despot gewesen. Heute hat ihn das Alter geschwächt.
Ich erinnere mich an ein Heer von Dienstmädchen, die auf uns vier Kinder aufpassten. Jedes Jahr kam ein Neues. Die schulischen Stellvertretungen von Vater, der oft ins Militär ging, wohnten bei uns. Militär-Kollegen, Verwandte und Freunde gingen ein und aus. Zeugen Jehovas oder Just-Reisende kamen auf Hausbesuche. Vater lieferte sich endlose Diskussionen mit ihnen. Der Hausierer kam und verkaufte Bürsten und andere Dinge. Das wurde eins unserer Spiele: wir hausierten mit alten Ansichtskarten, von denen wir Hunderte hatten. Die Pornohefte, die wir gefunden hatten, durften wir nicht zum Hausieren mitnehmen.
Ich las als Kind fast alles, was mir unter die Finger kam, auch viele SJW-Hefte. Ich glaube, ich sammelte auch Mondo-Alben. Wir hatten die Zeitschriften "der Bund", "Du" und "Nebelspalter" abonniert. Die blätterte ich lange nur durch. Bis einmal ein Stellvertreter von Vater mich darauf aufmerksam machte, wie wichtig die Lektüre dieser Zeitschriften sei. Wir hatten zuhause über Jahre sämtliche Exemplare. Ich las die gesamte Bibliothek meiner Eltern durch. Darunter waren Bücher zum Holocaust. Ich las diese Bücher heimlich, aber die Eltern bemerkten es. Sie verwickelten mich in Diskussionen. Ich fragte mich die ganze Zeit, wo da Gott wohl gewesen war... So erlebte ich meine ersten unglaublichen Schrecknisse aus Büchern. Ich befand die Erwachsenen als lügenhafte Heuchler. Die Schulbibliothek gab auch viel her: "Der rote Seidenschal" von Federica de Cesco blieb mir in Erinnerung. Darin faszinierte mich, wie das Mädchen aus dem Zug springt, um den vergessenen Seidenschal an seine Besitzerin zu bringen. Indessen fuhr der Zug ab und sie erlebte wundervolle Abenteuer. Lange dachte ich, dass es mir gelingen sollte, von meinem "Zug" zu springen. Ich empfand das Zuhause einerseits als behaglich, schön. Andererseits fühlte ich mich ab der Pubertät eingeschlossen und sehnte mich weit weg in die weite Welt. Ich begann Brieffreunde in der ganzen Welt zu suchen und zu finden. Ich erschrak ob der Fremdheit der Brieffreunde. Einer schickte mir einen Koran aus Tunesien, denn er fragte mich, ihn zu heiraten, wenn ich den gelesen hätte. Ich schrieb nie mehr zurück. Eine Jüdin schrieb mir sehr viel zu ihrer Religion und der Situation im Nahen Osten. Das viele Kämpfen im Namen der Religion konnte ich damals nicht begreifen und verstehe es auch heute noch nicht recht. Wir hatten keinen Fernseher, weil Vater dagegen war. So hörten wir oft Radio, vor allem beim Abwaschen und Abtrocknen. Ich hörte regelmässig das Wunschkonzert und die Hitparade und fragte mich, wie es anderen Gleichaltrigen ginge. Ob die wohl auch so strenge Eltern hatten? Wir besassen eine Sammlung an Schallplatten (v.a. Klassik, Jazz und Bebop). Als Jux beschallte ich manchmal vom Balkon aus das ganze Dorf. Darüber freute sich vor allem der Knecht eines Bauernhofs. Das geschah selbstredend in Abwesenheit der Eltern.
Spiele und Kinder kriegen
Ich erfand als elf Jährige ein Spiel mit dem "Du", bei dem ich die Dorfkinder mit einbezog. Das Du beinhaltete die anderen. Das "Du" konnte mein Freund sein, aber auch gefährlich werden. Man musste sich hüten vor dem "Du". Ich malte die Buchstaben mit Farbe an einen Pfeiler des Schulhauses, weil ein Maler etwas streichen musste und die Farbe herumstand. Meiner Mutter gefiel das Spiel nicht. Oft sassen wir zur Mutprobe in der Dämmerung auf dem grossen Stein im Bach und warteten, bis es ganz dunkel wurde. Am Folgetag erzählten wir uns Geschichten, was wir erlebt hatten. Ob die erfunden waren, weiss ich nicht mehr. Ich erntete viel Kritik von meinen Eltern. Es gab mir zu denken, warum ich so war und nicht anders. Nämlich so, wie sich das meine Eltern vorstellten, aber ich fand keine Antwort. Ich fragte mich, welche Gedanken ich hätte haben sollen. Ich empfand das, was ich dachte als falsch oder als ungebührlich. Einerseits wollte ich eine gute Schülerin sein. Andererseits wurde ich zunehmend kritischer und hinterfragte alles. Spiritualität entwickelte ich während meiner Kindheit und Jugend. Je älter ich wurde, desto weniger glaubte ich an einen einzigen Gott, wie er im Christentum beschrieben wird. Und als Hebamme kam mir die unbefleckte Empfängnis unglaubwürdig vor. Jedenfalls betrachtete ich die Inquisition, die eine Blutspur durch die Geschichte der Christenheit gezogen hatte, als unverzeihlich. Und dieser Jesus am Kreuz, wie er in vielen Haushalten hing, fand ich abschreckend. Item. Ich dachte, Religion ist ein (schützender) Mantel. Wer ihn trägt, fühlt sich geborgen und beschützt. Dass dem nicht immer so ist oder war, erfuhr ich ja zur Genüge aus der Weltgeschichte. Und jetzt bekriegen sich im nahen Osten die gegensätzlichen Völker mit abscheulichen Kriegen, die viele zivile Opfer fordert.
Eines Tages kam ich nach dem Schwimmen zurück und fragte Mutter, ob ich schwanger würde, wenn ich auf demselben Badetuch läge, wie mein Freund. Ich bekam als Kind nie richtig raus, wie nah man sich eigentlich kommen musste, um schwanger zu werden. Aber ich hatte eine Heidenangst davor. Vater warnte uns fast so oft davor, wie vor Drogen und Alkohol. Ich dachte, schwanger werden sei mindestens so schlimm, wie eine ernste Krankheit zu bekommen. Meine Eltern gaben mir in der Pubertät ein Buch, das den Titel trug „Vom Mädchen zur Frau“. Das war nach einer ungeklärten Situation, wo meine Monatsblutung ausfiel. Sie fragten nicht, ob ich Sex gehabt habe, sondern gingen mit mir zum Dorfarzt für einen Schwangerschaftstest. Klar war der negativ. Der Arzt meinte, die fehlende Blutung sei wohl durch Stress ausgelöst worden. Mein Geigenlehrer ermahnte meine Eltern, nicht so streng mit mir zu sein. Da sass ich dabei und hörte, wie unterschiedlich ihre Ansichten waren. Vater wollte ihm verbieten, mir Musik vorzuspielen von den Beatles oder Stones… das verbiege den Charakter. Ha! Danach ging ich zu Frau Liebe in die Geigenstunde. Dort hörte ich keine "Katzenmusik". Meine Eltern waren überzeugt, dass der vorige Geigenlehrer mir das Falsche beigebracht hatte. Bei der neuen Geigenlehrerin hatte ich keine grosse Lust mehr zum Geige spielen. Ihr Mann war ein Sektenpfarrer, der mich abschreckte. Und sie war die Liebe selbst und hiess auch so. Mir war dort nicht wohl in dieser Atmosphäre, musste aber wöchentlich hingehen.
Familienerlebnisse heute und gestern
Das "Oberhaupt" (unser Vater) ist heute über neunzig Jahre alt und sitzt oft schweigend vor einem laufenden Fernseher ohne Ton, rennt noch immer täglich Treppen auf und ab, geht in den Wald und will sonst seine Ruhe. Das wollte er bereits früher. "Lasst mich in Ruhe" - sagte er zu uns Kindern oft. Dieser Wunsch wird ihm heute erfüllt. Meine Patin war eine Schwester von Mutter. Sie war Sekretärin und gebar zwei Söhne. Sie war eine wunderschöne Frau, wie Mutter auch. Mit zunehmendem Alter zerfiel sie (nach einem Schlaganfall) und starb später in einem Pflegeheim. Die andere Patin war die Schwester meines Vaters. Ich hütete bei beiden Patinnen in den Ferien ihre Kinder. Es regte mich auf, dass die Jungs neben die Aborte pissten und ich den Urin vom Boden putzen musste. Auch diese Frau starb (bei einem Autounfall). So rasch verschwinden wir von der Bildfläche. Und nehmen uns so wichtig, während wir da sind, dachte ich mir. Mein Pate war ein Basler Freund meiner Eltern. Er und seine Frau zelteten früher in Tenero, wo wir sie besuchten. Auf den Fotos tragen sie altertümliche Badekleider und wirken seltsam jung. Der Pate hatte einen Vater (der Bruder meines Grossvaters). Dieser Grossonkel war meine liebste Person als Kind. Er holte uns am Bahnhof ab und rief jeweils: "Jo. Lueg emool. Doo chunnt mis Reschindli." Damit meinte er mich. Ich lief dann in seine Arme. Wir besuchten täglich den Zoo in Basel. Ich versuchte mit den Tieren zu sprechen. Der Tiger faszinierte mich besonders. Ich redete auf ihn ein, aber er tat keinen Mucks. Der liebe Onkel "Kari" liess mich machen, drängte nie zur Eile, wartete und besprach die Dinge mit mir. Nur wenn wir nach Hause gehen mussten, unterbrach er mich und führte mich an der Hand ins "Gundeli". Noch heute hege ich Sympathien für Basel. Es ruft angenehme Gefühle hervor. Am Geburtstag wünschten wir Kinder unser Lieblingsessen. Von einem der Dienstmädchen lernte ich Biscuittorten backen und mit Buttercreme füllen und verzieren. Diese kamen bei den Besuchern gut an. Vater hatte oft Besuch von Militärkollegen, die mit oder ohne Frauen kamen. Die tranken Alkohol, das bei uns sonst nicht getrunken wurde. Der Keller war voller alter Weinflaschen voller Staub. Einmal, als Vater aufgehört bereits mit dem Rauchen aufgehört, schlichen wir uns auf den Estrich. Ich war dort gerne, weil ich da meine Ruhe hatte. Ich fand eine Schuchschachtel mit Gauloises ohne Filter. Ich weiss, dass ich eine Zigarette anzündete und eklig fand. Mir war ein Rätsel, dass man das freiwillig tat: Rauchen. Aber im Internat rauchte ich dann doch: Brunette oder Mary Long. Aber ich rauchte nie viel, sondern fühlte mich einfach erwachsen damit. Die kalte Winter mit Eis und Schnee, die wir damals hatten, liebte ich auch. Von weitem bereits das heimische Licht im Fenster brennen sehen und von der klirrenden Kälte an die Wärme kommen. Das finde ich auch heute noch prima. Jedoch konnte ich nicht aufhören mit weinen, als ein Auto wegen Eisglätte in uns hinein fuhr. Ich sass hinten im Auto und erinnere mich noch heute, wo das war. Ein anderes Mal waren wir in der Kurve, als Strohballen von einem Anhänger auf der Gegenfahrbahn auf unser Auto fielen. Das schien mir nicht so schrecklich. Das schlimmste waren für mich Vaters Flüche. Er regte sich fürchterlich über die Arschlöcher auf der Strasse auf.

Meine Eltern sind 1932, resp. 1933 geboren und haben den zweiten Weltkrieg als Kind erlebt. Die Armut der Landbevölkerung, die grosse Schuld der Überlebenden, die sich in der NSDAP von einem in die Irre leiten liessen war ihnen damals nicht bewusst, sagten sie. Das Abschotten der Schweiz und Nicht-wahrhaben-wollen, was Schreckliches passierte: all das ertrugen sie meist schweigend oder begannen in französisch miteinander zu sprechen. Die Lebensmittelmarken, die zugeteilt und getauscht wurden, waren meist das Einzige, worüber sie vor uns Kindern sprachen. Meine Eltern lernten sich an ihrer ersten Stelle als junge Lehrer in einem kleinen Dorf in den Voralpen kennen, wo sie bis zu ihrem Wegzug "die Fremden" blieben. Sie hatten dort vier Kinder: drei Töchter 1955, 1956 und 1959 sowie einen Sohn 1962, den sie als "die Krone der Schöpfung" bezeichneten. Ihre Interessen gingen diametral auseinander. Während meine Mutter das Kulturelle liebte, richtete mein Vater seine Aufmerksamkeit auf Sport. Seine Leidenschaft waren zudem Autos und Motorräder. Meine Mutter liebte Mozart, Beethoven und die wechselnden Dirigenten des Orchesters, in dem sie erste Geige spielte.
Mein Vater von 1932 versuchte durch militärische Aktionen (Manöver) das Leben zu beherrschen. "Motor und Sport" liegen noch mit über 90 auf seinem Tisch. Er hat eine fatalistische Sicht auf die Dinge. Früher half er, auf hohe Berge oder Pässe zu steigen, um Messstationen zu besuchen. Er liebte es, andere zu provozieren, aber auch zu unterhalten. Er hatte zwei Schwestern, mit denen er den Kontakt sein ganzes Leben lang hielt. Wenn man als Kind etwas wollte, musste man lange genug "stürmen" und viele Argumente vorbringen, dann ging er darauf ein. Als er oft weg war – im Militär oder am Bergsteigen – freuten wir uns Kinder. Vater sagte zwar immer, er lasse sein drittes Auge zuhause, das alles sähe, was wir anstellten, was ich aber nicht glaubte. Er arbeitete als Lehrer, von dem man heute an den Klassenzusammenkünften sagt, er hätte es sehr gut gemacht. In seiner Freizeit zuhause wollte er vor allen in Ruhe gelassen werden. Er ging an verschiedene Versammlungen. Als Kind erinnere ich mich an Stumpen rauchende Bauernversammlungen, Fortbildungskurse mit Jünglingen, die uns Mädchen herausforderten. Er unterrichtete fünfte bis neunte Klasse. Bei lernschwachen verlor er manchmal die Geduld und schickte sie in den Garten zum jäten, Bohnen ablesen oder Giessen. Im Winter lief er Schlittschuh auf dem selbst gebauten Eisfeld, ging mit uns Skilaufen, an Autorennen (am Gurnigel). Da sassen wir jeweils (sensationslüstern) in der gefährlichsten Kurve und besprachen die Linienführung, die Marke des Autos und ob er an der richtigen Stelle abgebremst und wieder beschleunigt hatte. Vater war der "Fachmann" dafür. Oft raste er auch mit mit seinem Auto wie ein "Verrückter" über die Strassen. Er bewunderte eine Frau aus unserem Tal, die in einem Mini daher kam, wie wenn sie vom Leibhaftigen verfolgt würde. Sie vertrat die Meinung, dass sie lieber sofort tot wäre bei einem Unfall. Darum habe sie ein so hohes Tempo.
Meine Mutter von 1933 war eher die Ruhigere, Ängstlichere und pflegte das Musikhören und Musik machen. Die Fotos aller in der Familie Verstorbener standen lückenlos aufgereiht im Schlafzimmer der Eltern. Jedoch verneinte sie hartnäckig, dass ihre Schwester, die ihr glich, so dass ich sie als Kind mal mit ihr verwechselte, einen Suizid verübte. Mutter hatte viele Geschwister, u.a. eine damals als uneheliche älteste Schwester, welche ihre Mutter (meine Grossmutter) mit 18 Jährige bekommen hatte und danach in die Ehe mitbrachte. Ihr grosser Bruder war ein "Heiliger" für sie, den sie ein Leben lang verehrte. Er hatte sie und die jüngere Schwester als Kleine auf dem Leiterwagen zum Einkaufen mitgenommen und Süsses gekauft. Wenn man als Kind etwas wollte, schickte Mutter uns zu Vater, da er alle unsere Entscheidungen fällte. Sie arbeitete als Lehrerin in dem Dorf und unterrichtete die erste bis vierte Klasse. Weil sie gern Geige spielte, lernte sie zur Not Auto fahren, war aber stets eine ängstliche Fahrerin. Dies war ihre einzige emanzipatorische Handlung, soviel ich weiss. Sie hielt die sozialen Kontakte mit Angehörigen, Freunden und den Dienstmädchen, die sie gern bekommen hatte. Sie spielte jahrelang im Orchester. Als Achtzig-Jährige wollte sie nicht mehr vorne sitzen als "alte" Frau. Sie wechselte in die zweite Geige und ich beobachtete, dass sie stets eine hervorragende Bogenführung hatte und die Melodien fast alle auswendig spielte. Ich lernte auch Geige spielen, kam aber nie an das Spiel meiner Mutter heran. Sie litt wahrscheinlich an einer bipolaren Störung, aber das war damals Tabu. Sie bekam Temesta zur Beruhigung und das nahm sie an Sonn- oder Feiertagen, wenn wir anderen von der Familie wegfuhren.

Meine Mutter betrieb zusammen mit meinem Vater eine Dorfschule in einem hügeligen Voralpengebiet. Früher wären sie drei Lehrer im Schulhaus gewesen. Sie habe meinen Vater gewählt, weil er gut ausgesehen habe. Der andere Lehrer kam selten auf Besuch. Aber ich erinnere mich daran, dass ich dachte: ich würde den viel lieber als Vater haben, als den echten Vater. Kaum hatte unsere Mutter uns Kinder geboren, musste sie drei Wochen nach der Geburt bereits wieder arbeiten. Als sie mit dem Jüngsten nach der Geburt nach Hause kam, umarmten und küssten sich meine Eltern. Der Kleine begann zu weinen und ich schaukelte den Wagen, wo er drin lag, hin und her. Mutter schimpfte mit mir und sagte, so heftig dürfe ich das nicht tun… Mutter war oft im damalig modischen Deux-Piece gekleidet, wenn wir ausgingen. Zuhause trug sie eine Schürze. Sie verband Wunden, wenn eins der Schulkinder sich verletzt hatte. Ein Neuntklässler fiel bei so einem Wundverband ohnmächtig neben unseren Küchentisch zu Boden wie ein Klotz. Ich fragte sie, ob er jetzt tot sei. Er war es nicht! Es machte mir mächtig Eindruck, dass ein Mensch ohne Vorwarnung plötzlich umfallen konnte.
Meine Mutter konnte sehr gut Eislaufen. Darum beneidete ich sie sehr. Diese tänzelnden, leichten Schritte vor und zurück, aber auch die Kreise, die sie zog, bewunderte ich an ihr. Zudem spielte sie Geige. Das tat sie zeitlebens mit viel Engagement. Deshalb wollte ich unbedingt auch Geige spielen lernen, was mir weniger gut gelang als ihr. Wenn sie Geige spielte, wurde sie zu einer anderen Person. Die Hände und der Bogen flitzten rege umher und es erklangen Melodien, die mir wie Engelsgesang schienen. Jedenfalls war diese Musik, wie zum Beispiel die Mozart – Konzerte himmlisch. Sie lernte wegen dem Geigenspiel Autofahren und konnte so mit ihrem Opel Kadett zu Orchestern oder sonst wohin fahren. In einem Geschäft in Thun wurden wir gefragt, ob wir vier alle Schwestern seien, dabei waren wir drei Schwestern mit unserer Mutter unterwegs. Auf Fotos sieht man die Jugendlichkeit unserer Mutter bis weit über die vierzig Jahre hinaus, die sie zählte. Sie war aber immer bescheiden und kleidete sich unauffällig. Ihre liebste Schwester war die Auffälligere von den beiden. Wir sangen oft Volkslieder beim Abwaschen. Mutter kannte oft sämtliche Strophen, wo doch die meisten Erwachsenen nur gerade die erste und letzte kennen. Ich fand es ungerecht, dass nur wir Mädchen abwaschen mussten, nicht aber mein Bruder. Sie getraute sich nie, meinem Vater zu widersprechen. Als wir Mädchen grösser wurden, forderten wir sie dazu auf.
Mutter pochte auf dem Mittagsschlaf, den ich nicht leiden konnte. Einmal versteckte ich mich mit meiner Schwester in einem Zimmer, das umgebaut wurde. Mutter kam rittlings über einen Bretter-Haufen in der Türe und holte uns raus. Sie war wütend. Alle hatten nach uns gesucht, als die Schule begann und wir nirgends waren. Wenn Vater im Militär war, durften wir an seiner statt bei Mutter im Ehebett schlafen. Dort fühlte ich mich wohl. Es gab da auch eine rosafarbene Creme, die herrlich duftete. Die durfte ich manchmal benutzen. Als ich meine Mutter einmal nackt sah, sagte ich ihr, wie wunderschön sie sei. Das ärgerte sie sehr und sie schimpfte mich aus. Ich erinnere mich, dass ich eines Nachmittags beim Spielen meine Mutter beobachtete, wie sie auf dem Sofa lag. Ich bekam Angst, sie könnte tot sein und darum rüttelte ich an ihr. Da wachte sie auf und schimpfte. Damals war sie oft sehr müde und erschöpft. Wir hatten Dienstmädchen, die unsere Schoppen kochten. Ich gab sie meinen Geschwistern und trank sie fertig, wenn sie nicht mehr davon wollten.
Später habe ich sie öfter geärgert, was sie mit einem ebenso häufigen Kommentar abtat: „Hör auf, Du impertinenter Totsch“. Ich fand dann Argumente, um ihr dies als Widerspruch in sich zu erklären. Sie verstand es wohl nicht, war aber beleidigt. Dann schwieg sie auch mal Stunden oder Tage. Das war schrecklich für uns. Bei Uniformierten kam sie ins Schwärmen. Das setzte eine komische Kraft in ihr frei, die mir unheimlich schien. Heute würde ich es Leidenschaft nennen. Ihr Lieblingssatz war: "Das ist ohnmächtig"! Ich glaube, sie fühlte sich ohnmächtig, gefangen in einem kleinen Dorf, vier Kindern und einem männlichen Narzissten, die ihr alle fünf das Leben schwer machten. Sie hatte fünf Geschwister, unter anderem eine Tante, die ihr sehr glich. Diese schrieb Karten und Briefe und benutzte das Wort Stress, das ich vorher noch nie gehört hatte. Ihre Lieblings-Schwester lebte in Steffisburg. Wir besuchten sie oft und Mutter gab uns dort in die Ferien. Meine Mutter las uns manchmal Witziges aus den Schüleraufsätzen vor. „Die Scheiterbeige vergagelt mir…“ und ähnliches. Das fand sie amüsant. Samstag in der Schule las sie stets aus einem Buch vor. So lernte ich „das Fliegende Klassenzimmer“, „die Turnachkinder im Sommer“ usw. kennen und lieben. Sonntags hörte sie Musik, vor allem Klassische. Sie konnte von Mozart, ihrem Lieblings-Komponisten nicht genug bekommen. Sie verehrte Dirigenten und Musiker. Vater nannte es "Hörigkeit". Der Traum meiner Mutter war, als Musikerin zu arbeiten. Aus Gründen, die mir nicht bekannt sind, machte sie das Lehrerseminar nach dem Pro-Gymnasium. Ob sie in das kleine Dorf flüchtete vor einer zerbrochenen Liebe habe ich nie erfahren. Es gab da eine Riesen-Endtäuschung, bevor sie zuhause wegging. Davon sprach sie manchmal in Metaphern.
Sie fragte stets meinen Vater, ob sie sich ein neues Kleidungsstück kaufen konnte, obwohl sie zeitlebens ihr eigenes Geld verdiente. Als ich meine Haare in der siebten Klasse schneiden wollte, gingen wir zur Coiffeuse (ohne Vater zu fragen). Ich bekam einen Pagenschnitt. Den trug ich nicht lange, weil Vater tobte. Wenn ich schon kurze Haare wolle, solle ich die so schneiden lassen, wie ein Junge. Ich weinte, dass ich so schreckliche Eltern hatte, die über mich und meine Frisur bestimmten. Als ich die Aufnahmeprüfung in die Schwesternschule machte, die es heute nicht mehr gibt, fragte die Schulleiterin meine Mutter, warum sie mich nicht besser gefördert habe. Ich sei zu intelligent gewesen für die Realschule. Ich hatte in der ganzen Schulzeit sehr gute Noten. Ich habe aber meinen Weg trotzdem gefunden, wie sich später zeigte.
Ein Mann, der meine Mutter vergötterte, kam oft zu uns auf Besuch. Vater sagte dann er „schwadroniere" und scharwenzle“. Ich wusste nicht, was es bedeutete. Aber mir fiel auf, dass sie manchmal mit Männern flirtete. Das war bei den Stellvertretern der Fall, wenn Vater im Militär weilte. Diese sassen jeweils lange in Gespräche vertieft mit Mutter im Wohnzimmer. Vater wollte dann von uns Kinder wissen, was gelaufen sei. Wir waren loyal zu Mutter. Es gefiel mir, dass jüngere, nette Männer sich mit meiner Mutter gut verstanden und sie zum Lachen brachten. Mir schien da stets Hoffnung am Horizont aufzuscheinen. Heute redet meine Mutter wehmütig von dem kleinen Dorf, wo sie so lange als Lehrerin gearbeitet hat. Als sie dort war, hat sie sich oft weg gewünscht an einen schöneren Ort.

Als Kind wurde mein Vater von seinen Eltern verwöhnt und ganz eindeutig bevorzugt (vor seinen beiden Schwestern). Er kaufte sich eine Zeitlang jährlich einen neuen BMW. es war stets das neuste Modell. Wir Kinder mussten Sorge tragen und keinen Kratzer machen. Er bedauerte, dass er vier Kinder hatte und kein Cabriolet kaufen konnte. Das schaffte er sich nach der Pension an. Er betrachtete sich als Oberhaupt der Familie. Er sah sportlich und immer braungebrannt aus. Heute hat er Hautkrebs-Operationen hinter sich. Sonnenschutz war etwas für "Memmen". Er will heute keine neuen Kleider mehr kaufen und sagt, er sterbe ja bald. Sein GPS sage immer, wenn er am Friedhof vorbeifahre: "Sie sind angekommen"! Meine Eltern wohnen neben dem Friedhof. Solche und ähnliche Sprüche machte er früher oft. Er hatte auch Scherze zum 1. April auf Lager. Er sah sich als «Oberlehrer», weil er die Klassen fünf bis neun unterrichtete, meine Mutter die von eins bis vier. In Gruppen war er ein beliebter "Alleinunterhalter".Er las gerne Krimis und obwohl wir zu ihm und Mutter zur Schule gingen, konnten wir ihn nach Feierabend nicht fragen, wenn wir Hilfe bei den Hausaufgaben benötigten. „Passt in der Schule besser auf“, sagte er dann. Es war sehr ungemütlich, wenn er ungehalten war. Meist wollte er aber einfach seine Ruhe. Er kannte überall Leute. Seine Leidenschaft war der Sommer und das Sonnenbaden. Wöchentlich besuchten wir mehrmals das Freibad, wo ich nebst Schwimmen auch das Turmspringen und Tauchen lernte. Ich wurde durch die vielen Schwimmbad-Besuche zu einer trainierten Schwimmerin. Im Winter gingen wir Skilaufen, denn er liebte das sehr. Auf dem Weg, wenn es genügend kalt war, machte er mit uns Kindern im Auto Powerslide – in einer Kurve oder auf einem Platz. Das bedeutete, rundherum Rutschen mit angezogener Handbremse und herum gerissenem Steuer. Das fanden wir Kinder großartig. Einmal misslang das Manöver und wir landeten in einem Schneehaufen. Bei Kälte um die Null Grad Celsius spritze unser Vater abends Wasser, so dass wir eine Eisbahn vor dem Haus hatten. Dort lernte ich Schlittschuhlaufen. In den Zirkus Knie führte er uns jährlich, so dass ich mir danach wünschte, Artistin zu werden. Die Ferien verbrachten wir zum Skifahren in einem Gruppenhaus mit anderen Lehrerfamilien. In den Sommerferien in Albonago im Reka-Dorf am Monte Bré. In den Sommerferien fuhren wir über den Susten und Gotthard ins Tessin. Wir sangen das Lied: "übere Gotthard flüüge d Bräme..." und "Ciao Bella". Er machte teils waghalsige Überholmanöver, was meine Mutter ärgerte und meinen Bruder zum Erbrechen forcierte. Wenn er wütend wurde, weil ich ihm widersprach, musste ich x-malig schreiben: "ich widerspreche meinem Vater nicht". Hinter dem Vater musste ich alle seine Funktionen nennen. Also: Ich widerspreche meinem Vater, dem Oberstleutnant, Oberlehrer, Kirchenchorleiter, Gemeindepräsidenten usw. nicht. Er bekleidete viele Ämter, amtete auch als Präsident für die Bauern- Gewerbe- und Bürgerpartei, Vorläufer der SVP. Ich fand es peinlich, dass man mich kannte, als Tochter dieses Vaters. Ich leistete offenbar grossen Widerstand gegen seine Standpunkte. Er drohte mir als Kind mehrmals, mich an die Tuareg zu verschicken (in einem Paket), wenn ich ihn wieder mal geärgert hatte. Dann könne ich selbst weiterschauen. Ich erinnere mich an seine vielen Monologe, die er uns hielt. Er liebte die Provokation und das Argumentieren. Er hatte viele Militär-Bekanntschaften. Sie kamen auf Besuch oder für irgendwelche Übungen mit Panzer auf unseren Pausenplatz, bewachten das Schulhaus etc. Denen sagte er Dinge wie, „meine Mädchen sollen einmal gut kochen und putzen können, damit ihre Männer später zufrieden sind mit ihnen“. So weit so schlecht – dachte ich mir. Mir war es stets ein Rätsel, warum mein Vater in einem Moment lustig sein konnte und danach gleich wieder streng zu uns Kindern. Er beäugte meine vielen Brieffreundschaften misstrauisch. Einmal hatte ich einem Jungen in Tunesien geschrieben. Er hiess Manoubi Trabelsi. Er wohnte damals in Medjez el Bab und wollte Tischler werden. Mein Vater foppte mich, dass mich Manoubi eines Tages holen werde und dann hätte mein Rebellenleben ein abruptes Ende. In Tunesien dürften Frauen nicht aufmüpfig sein, sondern müssten gehorchen. Wie man sich denken kann, hat mein Vater mich oft provoziert. Vater war sportlich und forderte uns heraus, indem er Wettkämpfe veranstaltete. Ich denke heute, dass ich einen Narzissten als Vater hatte. Meine Schwester sieht es etwas drastischer und nennt ihn einen Despoten. Dass er sich als höchster Gewaltherrscher in unserer Familie "aufspielte" war kein Geheimnis. Er klagte oft, dass wir ihm nicht wie im Militär aufs Wort folgten. Und trotzdem spürte ich, dass er verletzlich war. Ich beobachtete ihn genau und wusste, dass er mir etwas, was Mutter mir verboten hatte, erlauben würde, wenn ich ihm nur viel "Honig um den Mund" streichen würde. Narzissten wollen gefüttert werden mit Lob und Anerkennung. Davon bekommen sie kaum genug. Das habe ich als Kind intuitiv gespürt. Es war sehr schlimm, die Gleichgültigkeit uns gegenüber und manchmal auch die kalte Wut von ihm zu spüren. Kritik vertrug er kaum oder er lachte schallend.
Meine Eltern hatten jung geheiratet, weil sie mussten (wegen mir) und sind heute noch zusammen. Meine Mutter war eine schöne, junge Lehrerin. Sie hatte volle Lippen, einen makellosen Teint und lange braune Haare, die sie im Verlauf der Jahre kürzte (zur Dauerwellenfrisur). Mein Vater hatte blonde Haare und war stets gut gekleidet (sportlich) und sah gut aus, wie meine Mutter richtig bemerkt hatte. Mein Vater hatte bereits allerhand Blödsinn angestellt, bevor er meine Mutter kennen lernte, so dass er das Lehrerpatent erst ein Jahr nach dem Seminarabschluss erhielt. Der Grund ist vielleicht ein Klavier, das er zum Dachstock raus auf den Schulplatz geworfen hatte. Er erzählte uns, die Saiten hätten noch lange nachgeklungen und es habe ein Loch in den Asphalt von einem halben Meter gegeben. Einmal erklärte er, er habe seine Kollegen abschreiben lassen (bei Examen oder Prüfungen). Vielleicht hat er auch für andere Texte geschrieben, denn das konnte er gut. Aber vielleicht hatte er auch die Tochter des Direktors geschwängert? Dieses Geheimnis hat er nie gelüftet. Wenn man ihn heute fragt, sagt er, wen das wohl interessiere?
Anfangs war die Ehe meiner Eltern sehr innig und schön. Ich erinnere mich an Küsse und Umarmungen. Sonntags durften wir nie in ihr Schlafzimmer gehen. Aber später verkroch sich meine Mutter in ihre Welt der Musik und Kunst. Mein Vater hatte Motor und Sport abonniert, las Autozeitschriften und Krimis. Wir bemerkten die gegenseitigen Vorwürfe: „Du hast ja für nichts, was mir wichtig ist Zeit“ (mein Vater) oder „Du kommst ständig zu spät“ (meine Mutter). Ob sie sich uneinig waren in der Erziehung? Forderten ihre begrenzten Kräfte ihre Opfer? Hatte mein Vater Affären? Keine Ahnung. Mutter war psychischen Schwankungen unterworfen. Manchmal wollte sie Bäume ausreissen und redete viel. Dann lag sie plötzlich ein ganzes Wochenende im Bett. Der Arzt verschrieb Lexotanil (Benzodiazepin). Ein Allerweltsmittel, von dem damals viele Frauen süchtig wurden, Mutter gottlob nicht. Ich fand es schlimm, wenn meine Mutter nichts tun und hören wollte. Ich gab meist Vater die Schuld, wenn sie schlecht drauf war. Ich fand ihn nicht einfühlsam, sondern hart und egoistisch.
Meistens spielten wir die heile Familie in der Öffentlichkeit. Streitereien gab‘s aber zuhause je länger umso öfter. Uns Kindern wurde explizit verboten, irgendetwas davon jemandem zu erzählen. Ich denke, es wurde immer schlimmer bis zu ihrer vorzeitigen Pensionierung. Sie hatten das Lehrer-Leben gründlich satt! Die Bauern waren kritische Nachbarn, ebenso die wenigen Dorfbewohner. Ich glaube heute, dass die verschiedenen Erwartungen und Ansprüche für sie nicht einfach waren. Eine Nachbarin wollte, dass mein Vater Ersatz für ihre Kinder sei, da ihr Mann davonlief. Er aber wollte dies auf keinen Fall. Danach suchte die Nachbarin Trost beim Posthalter, der dann jede Nacht zu ihr ins Haus ging. Das ganze Dorf wusste Bescheid und es wurde getuschelt. Ich fragte mich oft, warum ein Vaterersatz des Nachts gebraucht wurde. In der Sägerei kamen sechs Mädchen zur Welt. Eins wurde genau gleich getauft wie meine Mutter. Das löste erneuten Streit aus. Man wusste, dass die Mutter der Mädchen Affären hatte… als Kind wusste ich nicht, was Affären sind. Auch fand ich, meine Eltern würden sich wegen Kleinigkeiten streiten. Ich ertrug die Spannung schlecht, die zwischen meinen Eltern herrschte.
Andere Lehrerfamilien wurden als Vorbild genannt. So hätten wir uns auch zu benehmen. Eine davon war Familie N. Ich hasste diese Familie aus vollem Herzen. Ihre Tochter spielte so oft Geige, dass sie eine Hautveränderung am Hals hatte. Als ich zehnjährig wurde, gingen wir zu einer Bauernfamilie auf Besuch. Ich wurde gefragt, ob ich lieber bei ihnen wohnen möchte. Das trieb mich um. Von dort hätte ich die Sekundarschule besuchen können. Mein Vater entschied aber, dass das nicht ginge, da einer seiner „Feinde“ in der Sekundarschule unterrichtete. Er wollte nicht, dass ich zu dem in die Schule ginge. Meine Mutter hatte nichts zu melden. Es war auffällig, dass es zwischen meinen Eltern offensichtlich nicht mehr zum besten stand. Heute als Alte beklagt sich Vater über die Unruhe der Mutter und sie sich über seine Brummigkeit und Passivität. Ich sage ihnen dann, dass ich glaube, der dauernde Streit halte sie zusammen und lebendig.
Unsere Lehrer-Eltern erzogen ihre Töchter streng und alle mussten im Haushalt helfen (Ämtli), ein Instrument lernen, kleinere Geschwister hüten; resp. zum Bruder schauen. Der Jüngste konnte tun, was er wollte. Heute lebt dieser vom Sozialgeld einer Gemeinde. Wir drei Mädchen wurden lebenstüchtige Frauen. Als ich mit sechzehn-Jährige einmal eine halbjährige Pause hatte bei der Menstruation, beschlossen meine Eltern, dass ich beim Arzt einen Schwangerschaftstest machen lassen sollte. Ab da verboten sie es uns, als Lehrerstöchter schwanger zu werden, bevor wir verheiratet seien. Wir würden sonst unser "blaues" Wunder erleben. Uns wurde eingebläut, dass wir stets berücksichtigen sollten, was Andere über uns denken. Oft wurde über jemanden aus der Familie gesprochen, der nicht anwesend war. Meine Schwester und ich durchbrachen dieses Muster. Es gab viel Ärger oder Zorn, noch öfter passiv-aggressives Verhalten, Spannungen und Misstrauen untereinander. Keins von uns Kinder dieser Familie führte eine "glückliche, harmonische" Partnerbeziehung. Ein Erbe unserer "vertrackten" Familiensituation? Meine Schwester sagte mir später, es sei eine grosse Überforderung gewesen, als wir älteren Schwestern sie mit den immer häufigen streitenden Eltern allein gelassen hätten. Mein Bruder besuchte die Sekundarschule und lebte in einer anderen Familie, aber für uns Mädchen reichte die Realschule, weil wir ja doch «nur» heiraten würden…

Sonntags, Weihnachten und Ostern fuhren wir abwechselnd zu den einen oder anderen Grosseltern auf Besuch. Einmal rief meine Schwester, als sie aus dem Auto stieg: „Wir haben einen Toten im Auto“. Sie meinte, wir hätten eine Torte im Auto, konnte aber Das R noch nicht sagen.
In Thun wohnten meine Grosseltern mütterlicherseits mit der Urgrossmutter. Diese sandte immer Gemüse an ihren jüngeren Sohn, dem Bruder meines Grossvaters - seinen Halbbruder - und wir mussten zuhören, wie Urgrossmutter den vergötterte. Grossvater war ein intelligenter und gerechter Mann. Er war mit natürlicher Autorität ausgestattet. Er arbeitete bei einer Baufirma als Maurerpolier. Zuhause rechnete er Sachen aus und Samstag und Sonntag ging er auf die Baustelle, um Geräte zu kontrollieren. Er wollte sein eigenes Baugeschäft gründen, aber meine Grossmutter war dagegen. Sie war eher ängstlich und im Alter wurde sie depressiv. Sie sammelte viele Papiersäcke (einen Schrank voll) und sonst viel unnützes Zeug, wie meine Mutter bemerkte. Das sei, weil sie den Krieg erlebt hatte und hungern musste. Grossmutter machte für uns Kinder oft Schoggi Pudding, der so schön wackelte. Grossmutter bekam mit 18 Jahren als Ledige ein Kind, das nicht von Grossvater war, aber welches er später wie sein eigenes anerkannte. Er selbst war ein Kind eines reichen Grossbauern, der vor seiner Geburt starb. Seine Mutter wurde von der reichen Familie des Erzeugers verstossen. Danach heiratete meine Urgrossmutter einen anderen und so wuchs mein Grossvater mit seinem Stiefvater in Kirchlindach auf. Einmal fuhr ich mit meiner Mutter an einen meiner Lieblingsplätze dort. Sie fragte: "Warum bringst Du mich zum Haus der Urgrosseltern, wo Fritz aufgewachsen ist?" Ich wusste vorher nicht, wo dieses Haus stand. Seither ist der Platz noch etwas familiärer.
Wir durften bei diesen Grosseltern vor dem Zubettgehen mit unseren Nachthemden auf dem Ofen sitzen. „Plätschen“ war bei uns beliebt, das bedeutete, mit nacktem Fudi auf den Ofen klatschen, was ein lustiges Geräusch gab. Mit meiner Cousine sollte ich einmal im Zimmer neben der Küche schlafen. Aber wir hatten es lustig und redeten und kicherten. Dann kam der Grossvater Fritz, packte mich und unter wildem Geheul trug er mich ins kleine Zimmer im oberen Stock. Da war ich sehr enttäuscht von ihm. Ich fragte mich, warum er mich gepackt hatte und nicht meine Cousine. Wenn wir im Garten herumtollten, Blumen gossen oder Holz hackten, freute ich mich und mein Herz schlug wild. Wenn ich ihn begleiten sollte, fürchtete ich mich immer ein wenig vor ihm. Er hatte riesige Hände. Er grüsste alle Leute. Ich verstand „Schadau“, dabei sagte er „Tag wohl“. Einmal fragte ich ihn: „Du, sind diese Löcher da auf der Strasse alles Arschlöcher“? Da musste er lachen. Ich hatte eine ausschweifende Fantasie. Grossvater zeigte mir Illustrierte und wollte von mir wissen, was die Leute für Augen haben. Er lachte dann jeweils über meine Beschreibungen. Aber ich kann mich leider nicht an meine damaligen Ausdrücke erinnern. Meine Grossmutter war zu uns sehr lieb. Sie verbot kaum etwas. Bei den Grosseltern träumte ich oft von einer langen Himmelsleiter, wachte dann aber bange auf und wusste nicht, wo ich war. Bei den anderen Grosseltern in Uetendorf passierte das selten bis nie.
Die Grosseltern väterlicherseits in Uetendorf sangen uns schöne Lieder zum Einschlafen. Ich liebte das helle, freundliche Zimmer mit dem angrenzenden Badezimmer, wo eine Wanne auf goldenen Füssen stand. Auf dem langen Balkon spielten wir gerne. Durch die bunten Fenster sah ich eine bunte Welt in rot, blau, gelb, violett. Ich wünschte mir solche farbigen Brillen, bekam aber leider nie eine geschenkt. Bei ihnen lernte ich Velo fahren. Früher gab es meines Wissens nur die Erwachsenenräder. Ich fiel oft hin und versuchte daher einen Erwachsenen zu finden, der bereit war, mir zu helfen beim Anfahren und Absteigen. Diese Grosseltern begannen französisch zu sprechen, wenn sie Geheimnisse vor uns Kindern hatten. Röseli et Marcel, unsere Verwandten aus der Romandie kamen auf Besuch im Messerschmidt angefahren. Das war sehr aufregend für uns Kinder. Aber die Familie zerriss sich den Mund über sie. Mein Grossvater meinte, dass dies kein Auto sei, sondern ein Spielzeug (der Messerschmidt). Und die beiden hatten einen schlechten Ruf. Ich begriff nicht warum.
Meine Grossmutter in Uetendorf hat mich von klein auf sehr oft und lange in die Ferien genommen. Sie war Damenschneiderin und immer schlank, hatte eine «Banane» frisiert und trug hübsche Kleider. Mit einem zum U geformten Magnet sammelte ich Stecknadeln. Sie nähte fast alle Kleider selbst. Meist durfte ich wählen, was sie uns Kinder nähen sollte. Auf Fotos sieht man weisse Blusen und blaue Röcke von uns drei Schwestern. Der Bruder trägt ein weisses Hemd und blaue Shorts. Die blauen Schleifen im Haar und die langen Zöpfe waren bei den Grosseltern stets ein Thema. Ab der siebten Klasse wollte ich diese Zöpfe abschneiden. Wir waren dann sogar mal bei einer Coiffeuse, die sich aber weigerte, die „schönen“ Zöpfe abzuschneiden. Ich trottete traurig zurück. Sie achtete stets darauf, was Andere trugen und kommentierte es. Als die Hosen enger wurden, sagte sie, das sei für die Männer nicht gut. Ich bin ihr sehr dankbar für ihre liebe Zuwendung, die sie mir als Kind gab, als meine Eltern kaum Zeit für mich hatten. Ich lernte von ihr nähen, stricken, gärtnern und kochen. Am liebsten zupfte ich im Garten Kamillenblüten und legte sie in ein geflochtenes Körbchen. Sie hatten auch Hühner und einen Hahn. Auf dem angrenzenden Bauernhof sah ich meinen ersten Stier. Dort half Grossvater bei der Arbeit mit. Im Herbst sass er stundenlang auf einem Gefährt für die Kartoffelernte. Unsere Katze bekam ihre Jungen dort im Tenn. Ich war schockiert, als Grossvater nur zwei leben liess und die anderen runter warf. Sie waren sofort tot. Ich war danach sehr böse mit ihm. Ich sagte zu Grossmutter, er sei ein Mörder. Danach wollte ich nicht mehr so gerne in die Ferien und hielt mehr Abstand zum Grossvater. Grossmutter liess sich alle Zähne ziehen und ein Gebiss machen. Das war damals gang und gäbe. Die Erwachsenen ergötzten sich daran, wie ich schrie und auf keinen Fall von ihr gehalten werden wollte. Sie sah als zahnlose Alte schrecklich aus. Zum Spielen hatten wir eine aufziehbare Lok.
Der Grossvater väterlicherseits arbeitete in der Selve, wo wir ihn manchmal abholten. Er war ein sehr exakter Mensch, trug meist einen Schnurrbart und einen Hut. Er riss Witze und konnte mit uns blödeln. Das mochten wir Kinder gern. Mein Vater machte das früher auch. Wir sagten dem „heuke“, was bedeutet, dass man freche Fragen stellt und nicht lockerlässt. Er starb früher als Grossmutter, angeschlossen an einer Beatmungsmaschine im Spital. Damals beschloss ich, Krankenschwester zu werden. Grossmutter wohnte nach dem Tod des Grossvaters eine ganze Weile bei uns zuhause, als ich schon weg war und schlief eines Nachts friedlich ein. Wenn ich Himbeeren esse, denke ich an sie. Sie hatte eine lange Hecke und ich stopfte mir jeweils den Mund voll. Heute besitze ich ein Foto meiner Grosseltern und eine vergoldete Brosche meiner Grossmutter.
Man erzählte sich, dass ich als kleines Kind meinen Grossvater fragte: "Sind das alles Arschlöcher, hier?" indem ich auf die Löcher in der Strasse zeigte. Man legte meinem Vater danach ans Herz, weniger Flüche dieser Art beim Autofahren zu verwenden.

Wir wohnten in einem kleinen Dorf in den bernischen Voralpen. Als Lehrerfamilie hatten wir es nicht leicht dort. Wenn ich Eier holte beim Bauern, die damals 21 oder 22 Rappen pro Ei kosteten, rechnete ich vorher aus, wie viel 20 davon kosten würden. Weil ich wusste, dass der Bauer sicher sagen würde, sie hätten nur gerade 18 oder 23 zur Verfügung, schrieb ich mir alle Resultate auf meine Hand. Er staunte immer, wie rasch ich das Resultat ausgerechnet hatte. Bei einem Junggesellen gingen wir gerne auf Besuch. Wir konnten bei ihm das Meer rauschen hören. Er hatte eine Sammlung Muscheln und erzählte von den wunderlichsten Orten, wo er gewesen war. Vater schimpfte ihn als Idioten und verbot die Besuche. Der erste August war jeweils ein Dorffest. Wir Kinder hatten frei und liessen unserer Freude freien Lauf. Schlitten fuhren wir halsbrecherisch eine kleine Strasse hinab. Ich fuhr zuvorderst und hängte mit den Beinen den nachfolgenden Schlitten an. Wir mussten aufpassen, dass kein Auto entgegenkam. Es machte uns riesigen Spass. Wir spielten rund ums Dorf und auf dem Pausenplatz unsere Spiele. Ich fiel einmal bei einem Velorennen im Dorf um und riss meine gehäkelten Kniesocken auf. Weil ich Angst hatte, ausgeschimpft zu werden, klebte ich die Löcher mit Klebestreifen zu. Leider sah es meine Tante beim Zvieri. Einmal jährlich kam die Zeltmission ins Dorf. Sie hatten eine schöne Truhe mit Kreuzen, die nachts leuchteten. Ich wollte als Schulkind unbedingt so eins und es hing die ganze Schulzeit über meinem Bett. Wenn ich Kummer hatte, betete ich. Meine Grosseltern hatten mich als Kleine in den evangelischen Brüderverein mitgenommen. Daher glaubte ich an einen gütigen, beschützenden, aber auch strafenden Gott. Das änderte sich, als ich bemerkte, dass viel Schlechtes in der Welt ungesühnt blieb. Der Film: "Aguirre, der Zorn Gottes", von Werner Herzog, bestätigte das Bild, das ich später von Gott und der Welt bekam, nämlich das von einem strafenden Gott, der unbarmherzig scheint. Denn wo war Gott, als die vielen Menschen in Kriegen sterben mussten und unschuldig weiterhin sterben?
Durch das Dorf floss ein Bach, wo ein Krebs lebte. Wir versuchten, Fische unter den Steinen zu fangen. Manchmal waren am Morgen unsere Fahrzeuge im Wasser. Wir glaubten, es seien böse Geister. Dabei waren es bloss Betrunkene. Weil wir im Schulhaus wohnten, hatten wir unten die öffentlichen Toiletten. Wenn die Eltern weg waren, war es meine Aufgabe, auf die drei kleineren Geschwister aufzupassen. An so einem Abend jemand schweren Schrittes die Treppe hoch. Dann schloss ich rasch unsere Wohnungstüre ab, weil ich Angst hatte. Man hatte mich früh gewarnt vor Männer, vor allem wenn sie betrunken waren. Eine Horde junger Samichläuse kam einmal angetrunken zu uns ins Wohnzimmer und wollte mich in den Sack stecken. Sie waren alle alkoholisiert. Ich riss aus und versteckte mich. Ein anderes Mal als wir im Winter durch den Wald streiften, trafen wir die Holzfäller rund ums Feuer an. Sie hatten wohl Feierabend oder Pause. Ich weiss noch, dass einer von ihnen sagte: "Aha, dahaben wir ja die Älteste vom Lehrer. Wollen doch einmal sehen, was die weiss". Ich war mit anderen Kindern dort, weiss aber nicht mehr, wer alles bei mir war. Instinktiv spürte ich, dass Angst jetzt keine Option war und rettete mich mit einer Unverschämtheit, worüber die Männer dort lachten. Die Chauffeure im Dorf foppten meinen Bruder, indem sie sagten, er sehe aus wie ein Mädchen. Er hatte weiche Züge und ärgerte sich sehr darüber. Einmal packte er sein Pimmelchen aus und schrie: "Nein. Ich bin ein Bub". Im Frühling wollten wir Kinder beim ersten schönen Tag kurzärmelige Sachen anziehen. Wir fragten jeweils: "Darf ich jetzt etwas mit ohne Ärmel anziehen"? Im Winter trugen wir selbst gestrickte Strumpfhosen, die juckten.
Vater hatte die Gabe, unsere Osternester so zu verstecken, dass man sie kaum fand. Ich wusste längst, dass es den Osterhasen nicht gab. Meine Eltern warnten mich, etwas zu verraten, sodass meine Geschwister immer in feierlichem Ernst ihre Nester suchten. Und sich nach dem Finden zu fragen, wie denn der Osterhase dahin gekommen sei. Einmal fand ich mein Nest nicht. Da kam Vater und sagte, ich müsste wohl den "Feuerschopf" besser anschauen. Dort war im Gebälk, von unten kaum zu sehen mein Nest. Wir benutzten eine Leiter, um es runterzuholen. Das ganze Dorf bekam immer alles mit, was bei den anderen Familien geschah. Im Turnen sommers mussten wir uns in einer Reihe aufstellen. Ich fand das peinlich. Das Hoch- und Weitspringen gelang mir schlecht und war mir zuwider; im Klettern war ich eine Nuss und die 80-Meterläufe hasste ich. Jedes Jahr gab es einen Turnwettbewerb. Das beste Spiel war Völkerball, das ich in den Pausen leidenschaftlich spielte. Da wir Dienstmädchen hatten, wurde ich Zeugin von Intimitäten. Sie hatten heimliche Treffen mit Freunden, von denen ich unseren Eltern nichts erzählen durfte. Ich begann, Erwachsene mit anderen Augen anzusehen. Ich dachte, dass alle ein Geheimnis hätten und lügen, so wie wir Kinder das niemals dürften. Ich verabscheute den Posthalter, der nachts zur Nachbarsfrau ging. Es wollte niemand etwas erklären, wenn ich nachfragte. Es hiess: „Das geht uns nichts an.“ Einer der Bauern rief meine Eltern jeweils an, wenn ihm etwas nicht passte. Er schrie sehr laut ins Telefon. Als wir alle zusammen einmal im Auto in den grösseren Ort neben seinem Grundstück durchfuhren, sagte mein Vater plötzlich: „schliesst sofort alle Fenster. Helmut jaucht!“ Und der goss die Gülle mit Freude bereits über unser Auto. Ich musste mich also in Acht nehmen, mit wem ich spielte. Bei den Bauern durften wir manchmal heuen helfen. Vor allem das Zusammenrechen gefiel mir gut. Nach dem Heuen gab's ein kräftiges Zvieri mit süssem Tee. Und abends badeten wir oftmals in der Sense. Das Baden in Seen und Flüssen gefällt mir noch heute. Mit meinen Geschwistern durchforsteten wir die umliegenden Hügel, Wälder und Höfe. Zum einen mussten wir damals Pro Juventute-Marken verkaufen. Zum anderen waren wir neugierig, wie die Bauern lebten. Einer der Grossbauern lernte ich näher kennen, weil ich mit seiner Tochter in der gleichen Klasse war. Er schaffte sich den ersten Ladewagen an, der damals als Sensation galt. Weil man nämlich mit der Sense, später der Mähmaschine mähte und das Gras von Hand zusammenrechte.
Weil ich mit zahlreichen Verboten aufwuchs, zog ich mich in die Welt der Bücher zurück. Das blieb mir ein Leben lang, im Alter wieder vermehrt, da ich auch mehr Zeit zum Lesen habe. Ich habe eigene Pullover gestrickt, der erste war weiss. Das hatte mich meine Grossmutter gelernt. In der Handarbeitsschule lernten wir Socken flicken, Schürzen und eigene Kleider nähen, zum Beispiel das Turnzeug, in dem ich mich sehr schämte. Es gibt gottlob keine Fotos davon. Zu Weihnachten wurde für die Patentanten und den Paten gebastelt. Ich weiss, dass ich mich zunehmend schwer tat damit. Ich erhielt aber tolle Geschenke von ihnen, darum bemühte ich mich. Einmal bekam ich ein rotes Handtäschchen, das mir meine Schwestern neideten und den Zorn meines Vaters herauf beschwor. "Mit diesem Hafersack läufst Du mir nicht herum", befand er. Ich war so stolz darauf. Auch auf die ersten Lackschuhe mit einer Schnalle war ich sehr stolz. Die ernteten abwertende Worte: "Modezeugs. Hängt euer Herz nicht daran, sonst seid ihr blöd", hiess es. Meine jüngere Schwester musste immer angehalten werden, zu essen. Ich versuchte, ihre Resten mit zu verzehren. Scheinbar "half" ich ihr auch beim Impfen. Weil sie sich fürchtete, stand ich zweimal in die Reihe. Anders kann ich mir das 12-malige Impfen desselben Impfstoffs während der Schulzeit nicht erklären, das später im Inselspital im alten Impfausweis hinterfragt wurde. Ich war wohl resilienter. Es gab Viehmärkte und Bauern, die Pferde einfingen, welche wild durch unser Dorf galoppierten und sich nicht einfangen lassen wollten. Ich erinnere mich an diese archaische Wildheit, die ich bewunderte und fürchtete. Wir hatten Fellini-Figuren im Dorf zum Beispiel drei Geschwister, die zusammen alt wurden und alle ziemlich eigen waren. Vor der Frau fürchteten wir uns und nannten sie eine Hexe. Sie hasste Kinder. Die Brüder waren merkwürdig; einer hinkte und sprach sehr wenig, aber machte meistens treffende Sprüche. Eine Frau, die weiter weg wohnte, schminkte sich übermässig. Das sah aus wie eine Clownin. Wir Kinder lachten sie aus. Heute denke ich, dass sie ein Handicap hatte und schäme mich, dass wir so gemein gewesen waren zu ihr. Das Transportunternehmen brachte Chauffeure ins Dorf, die genauso schnell, wie sie gekommen waren, wieder verschwanden. Der Firmenchef kehrte seiner Familie und dem Dorf den Rücken. Heute verkehrt wieder mehr Verkehr durchs Dorf, weil GPS eine Abkürzung anzeigt, die hindurchführt.

Am ersten Schultag forderte Mutter mich auf, weniger zu sprechen. Sie erklärte mir, dass ich ab sofort stillsitzen und schweigen sollte. Das Lied: "Bunter Falter", wo man im Schulzimmer als Falter herumrennen durfte, liebte ich ausgesprochen fest. Ich hätte viel darum gegeben, mich mehr bewegen zu dürfen. Doch das durfte ich nicht. Noch in der Unterstufe bei Mutter wollte ich in der Pause mal einem älteren Jungen, den ich verehrte, das Tintenfässchen am Pult nachfüllen. Gedankenverloren goss ich, bis ich merkte, dass die ganze Tinte zu Boden floss, weil das Tintenfass fehlte. In dem Moment schrillten die Pausenglocken und ich wäre am liebsten in den Boden versunken. Die nächste Stunde verbrachte ich zur Strafe im Korridor vor der Türe. Meine Eltern sagten mir, dass ich als Kleine diesen rothaarigen gelockten Knaben abholte, wenn er zur Schule kam. Ich erinnere mich an diese Freundschaft nur über die Aktion mit dem Tintenfass. Ich wollte ihm damals eine Freude machen. Dem Erwachsenen begegnete ich später noch einmal. Er hatte eine Glatze, fuhr Mercedes und war Bankangestellter. War das noch der gleiche, der mir so gefallen hatte? Meine Lieblingsfächer? Ich glaube mit Ausnahme des Turnens liebte ich alles. Ich hatte überall überdurchschnittlich gute Noten. Ich strengte mich kaum an in der Schule. Dafür las ich wie eine Verrückte. Ich versank in den Büchern und hörte nichts mehr, was um mich geschah. Das war eine sensationelle Entdeckung. Zumal ich mir ein anderes Leben wünschte. Eins, wo ich nicht täglich eine Stunde auf meiner Geige üben müsste. Eins, wo ich akzeptiert wäre, so wie ich bin. Eins, wo ich mit meinen Freundinnen ungehindert spielen könnte. Eins, in dem nicht ständig meine Eltern und Lehrer mich unter Kontrolle hielten. Vater sagte uns jeweils, dass er ein drittes Auge hätte, das alles sähe, was wir in seiner Abwesenheit täten. Er war ja "Gott-ähnlich". Das schien mir fürchterlich. In der Schule langweilte ich mich oft. Ich erinnere mich, wie ich eines Tages zu meinem Vater sagte, der ja auch mein Lehrer war: „das Thema Amerika hatten wir bereits letztes Jahr“. Er hatte genau dasselbe nochmals von vorn angefangen. In der Schule durften wir immer anfangs Schuljahr die Plätze wählen. Ich konnte einmal bei einem Jungen sitzen, der mir sehr gut gefiel. Er benutzte einen rosa Füllfederhalter und half mir beim Rechnen.
Pubertät
Ich begann mich in der Pubertät einsam zu fühlen, da ich von mir aus im Dorf nichts unternehmen konnte. Es gab bloss morgens und abends ein kleines Postauto in unserem Dorf. Die Kochschule und „Unterweisung“, das heisst der kirchliche Unterricht begeisterten mich wenig. Das Interessanteste waren die Anekdoten, die der Pfarrer, der sein Leben in Indonesien verbracht hatte, uns erzählte. Es war stinklangweilig, fand ich plötzlich, wo ich als Kind sehr gerne durch die Wälder, Flure und Hügel gezogen war. Nur das Skifahren übte ich weiterhin mit Begeisterung aus. Einmal wurde ich an einem Schülerrennen im Slalom Erste. Aber in der Gesamtklassifikation erreichte ich "nur" den dritten Platz. Als vierzehn Jährige durfte ich ins Skilager in Fiesch. Bei den Besten eingeteilt raste ich wie verrückt die Hänge runter. Zweimalig habe ich Skis kaputt gemacht. Vater sagte mal: „Das kannst auch nur Du“. Einmal bekam ich wunderschönen Skis. Das fanden meine Schwestern gemein. Alle meine Geschwister haben einmal das Bein gebrochen beim Skifahren, nur ich nicht. Ich fuhr zuhause an „unserem“ Skilift mit zwei Kollegen. Wir waren ein eingespieltes Team, bis ich mich in den einen verliebte und der andere sich in mich. Danach wurde es kompliziert. In der Pubertät fiel mir auf, wie oft es Unannehmlichkeiten gab in der Schule. Neuntklässler bedrohten meinen Vater. Er schickte sie zum Jäten in den Garten, wenn sie allzu unverschämt waren. Eine Neue verliebte sich in Vater und stellte seine Geduld auf eine harte Probe. Wir mussten alle unsere Noten laut und deutlich melden. Alle waren deshalb immer genau informiert, wer welche Note hatte. Für mich kein Problem, da ich mit hervorragenden Noten glänzte. Als meine erste Menstruation kam, war ich Elf. Ich litt unter heftigsten Bauchschmerzen und musste erbrechen. Dadurch gab es die einzige sehr schlechte Note in Französisch. Weil ich meinem Vater gegenüber immer frecher wurde (zuhause, nicht in der Schule), setzte er mich zuhinterst zu den „schwierigen“ Schülern. Ich spürte als Pubertierende einen starken Freiheitsdrang, der mir bis heute geblieben ist.
Schulexamen und Freundinnen
Jährlich gab es Examen und im Schulzimmer wurden Bänke für die Besucher aufgestellt. Da konnten sich Interessierte hinsetzen, meist waren es die Eltern, Onkel, Tanten, Grosseltern. Vater warf einmal einen solchen Besucher raus, der ihm nicht passte. Da ich zuhinterst sass, spürte ich ihren Atem im Nacken und roch ihren Stallgeruch. Meine Schulhefte wurden sehr gelobt, wandte ich doch sehr viel Sorgfalt auf, schöne Gestaltung und saubere Schriften zu kreieren. Das Tagebuch ist ein Beweis der Vielfalt. Ich zeichnete oft und gut. Irgendwann sah ich ein, dass Vater es wohl immer besser konnte und gab das Zeichnen auf. Mein Sohn ist heute Grafiker und Illustrator. Das Kreative blieb also in der Familie bestehen. Meine Kollegin sagte mir mal, so schöne Hefte habe sie selten gesehen (im Jahr 2020). Und ein paar davon habe ich behalten. Ich besitze noch einige Schulfotos und wir trafen uns nach Jahrgängen an Klassen-, resp. Unterweisungs-Zusammenkünften. Ich erinnere mich an bärtige Gesellen, die kaum mehr etwas von früher an sich hatten. Meine Klassenkameraden erkannten mich auf Anhieb. Ich hatte da eher Mühe. Einer wurde Käser, einer Angestellter, eine Bäuerin. Alle blieben rund um unser Dorf in der Gemeinde wohnhaft. Eine wollte, dass ich zu ihr in die Sägerei wohnen käme. Zufällig begegnete ich im Jura einer ehemaligen (jüngeren) Klassenkameradin, wo wir auf dem Hof Ferien verbrachten. Sie beschrieb unsere Eltern, als sehr verantwortungsvolle Lehrer. Sie hatte viel gelernt in der Schule und sagte, sie hätten uns viel mehr beigebracht als vorgesehen. Sie hätte dank ihnen nie auch nur die geringsten Probleme in der Ausbildung gehabt. Das war schön zu erfahren.
Heute habe ich mit meiner damaligen ersten Freundin vom Nachbarhaus erneut Kontakt. Wir gehen beide auf die 70 Jahre zu und wohnen in derselben Stadt. Wir schicken uns gegenseitig ab und zu alte Fotos und freuen uns an unserer Verbindung. Es gab allerdings eine grosse Lücke, wo wir uns aus den Augen verloren hatten, darum gabs jede Menge zu erzählen. So treffen wir uns und müssen jeweils etwas Geduld haben, bis wir ein Datum abmachen können, weil wir beide nicht so viele Lücken in der Agenda haben...

Internat
Die "Ecole préparatoire pour infirmière" war ein Jahr lang mein Zuhause und mein Schul- und Arbeitsort. Die Lage war wunderschön, mit Blick auf den Lac Léman. Natürlich hatte nicht ich mich für dieses Internat entschieden, sondern unser Schuldirektor, der es meinen Eltern "steckte". Meine Geschwister feierten meinen Wegzug zuhause. Im Internat kamen alle Mädchen aus der Sekundarschule. Ich als Einzige kam aus der Primarschule meiner Eltern. So hatte ich Chemie, Physik usw. auf Französisch, aber vorher noch nie eine Lektion auf Deutsch besucht. Wir durften zu einer Englischlehrerin, die plötzliche heftige, unwillkürliche Bewegungen machte. Sie hatte eine schwere chronische Krankheit, aber viel Humor. Einmal fegte sie während einer Stunde alles vom Tisch, was in ihrer Nähe stand, und machte einen lockeren Spruch dazu. Das imponierte mir sehr. Es war die Zeit, als man den weiblichen Singles Fräulein sagte. Und sie wollten so genannt werden. Was sich in diesem Jahr ereignete, war weniger schön. Es war das letzte Jahr der Schule, da der Direktor Gelder hinterzog. Und vor allem, weil es publik wurde, dass er auch uns "Jeunes filles" - so sagte man uns, ausnutzte . Wir hatten wöchentlich fast 62 Stunden Schule und Dienstzeit im Service (Bedienen der „Alten“ im Speisesaal oder in ihrem Zimmer). Dazu kamen die Hausaufgaben und Proben. Selbstverständlich durften wir kein Wort Deutsch sprechen, sondern mussten alles in Französisch formulieren. Da hatten wir eine Idee und gründeten eine Geheimsprache, die französisch klang, aber eigentlich Deutsch mit Anhängen in Französisch war. Ha! Es war sehr hart für mich, kam ich wegen meiner hervorragenden Noten in die beste Gruppe (von Dreien).
Es gab sonntags einen Kirchenbesuch (in Zweier-Kolonnen) und danach noch einen Spaziergang durch die Rebberge. Stets war unsere Klassenlehrerin anwesend. Wir mussten uns beim Portier stets abmelden. Es gab fixe Zeiten, wo wir da sein mussten. Aber wir fanden raus, dass man durch die Heizung unbemerkt das Gebäude verlassen und wieder betreten konnte. Somit waren wir etwas freier, was unsere Abende und Wochenenden betraf. Wir waren in 3-er und 4-er Zimmer untergebracht. Die Ordnung wurde kontrolliert und bewertet. Mal hatte ich zu viele Haare in meiner Bürste. Wir waren keine Heiligen. Zuerst enterten wir die Speisekammer, dann das ganze Haus. Ich nahm einige Kilos an Gewicht zu. Am Tisch im Lesesaal diskutierten wir einmal sehr offen zum Thema Onanie. Ich glaube, wir wollten provozieren. Niemand stoppte uns. Dort trat ich einem Club bei. Jede von uns sechs Mädchen hatte zwei Buchstaben ihres Nachnamens genannt: ich NA von meinem Nachnamen. Wir wurden sehr streng gehalten von einer ehemaligen Klosterfrau, die uns in Haushaltführung wie zum Beispiel Repassage (Bügeln) unterrichtete. Nach fast einem Jahr spielten wir ihr einen Streich, um ihr heimzuzahlen, was sie uns (scheinbar) angetan hatte und der sie in einen Nervenzusammenbruch trieb. Das bereue ich noch heute. Dank dieser Gruppe (dem Club) beendete ich dieses Internats-Jahr. Viele Mädchen gingen frühzeitig nach Hause. Eine flippte aus und musste in die Psychiatrie eingeliefert werden. Ich erinnere mich, wie sie auf einem Haufen zerbrochener Schallplatten sass und weinte. Sie hatte im Zimmer 12 a gewohnt, was eigentlich die 13 gewesen wäre. Eine verletzte sich mit einem Quecksilber-Thermometer an der Hand und musste sich im Spital behandeln lassen. Sie kam dann gar nicht mehr. Vor zwei Jahren rief mich eins der ehemaligen "Jeunes Filles" an und versprach eine Zusammenkunft.
Im Internat lernte ich Worte und Bedeutung von Streik und Demonstration kennen. Es war eine Offenbarung. Bei einer Prüfung war die beste Note von uns eine Vier, was bedeutete, dass die Prüfung schwer war. An einem Nachmittag, als wir zwei Prüfungen über uns ergehen lassen sollten, streikten wir. Da verlor unsere Klassenlehrerin zum ersten Mal die Nerven und schrie, wir seien faul und frech etc. Einen Sack Flöhe seien einfacher zu hüten, als uns, waren ihre Worte. Damit hatte sie wohl recht. Meine liebste Freundin war etwas älter, als ich. Sie war in F. verliebt (einen Sizilianer). Sein Kollege wollte mich für sich gewinnen, aber ich fand ihn langweilig. Bei einem Date verabschiedete ich ihn mit Erklärungen, ich hätte noch etwas zu erledigen. Heute schäme ich mich dafür. Auf den Liparischen Inseln lernte ich sehr viel später als Alleinerziehende mit über vierzig Jahren einen Sizilianer kennen, der mir (fast) das Herz brach. Er wollte unbedingt ein weiteres Kind von mir. Aber ich zog es vor, die Affäre als bunten Farbtupfer in meinem Leben anzusehen. Ich sagte ihm, wenn er mal in die Schweiz käme, könnten wir wieder darüber sprechen. Er kam nie. Ich hatte auch im Internat von meinen Eltern ein Verbot, Hosen zu tragen. Dazu gibt es einen Eintrag in meinem Tagebuch. Mutter hatte Geld geschickt, aber ich dürfte es nicht für Jeans nutzen. Ich sparte und wünschte mir sehnlichst welche. Einmal lehnte ich mir von einem Mädchen Mini Jupe, Jeansmantel und Stiefel aus. Genau dann kam mein Vater unangemeldet auf Besuch. Er sagte mir, dass er sich so mit mir nirgends zeige und dass ich auf keinen Fall in diesen Kleidern (Füdle-Mini Jupe) nach Hause kommen dürfe. Ich strickte mir einen braunen Pullover mit Puffärmel und nähte ein riesiges Herz drauf. Es sieht unverschämt aus. Im Grunde war ich sehr romantisch. Aber trotzdem wollte ich unabhängig bleiben! Ich lernte in diesem Jahr auch etwas über mich. Nämlich solide, konventionelle Männer langweilten mich. Freaks und Musiker fand ich spannend. Im Hinterkopf stand immer der Gedanke: Du darfst auf keinen Fall schwanger werden!
„With A Little Help From my Friends“ wurde einer meiner Lieblingssong als Sechzehnjährige. Im Verlauf des Jahres in Montreux lernte ich die Musik von John Mayall kennen. Er selbst gefiel mir auch sehr gut. So hängte ich ein Poster in Weltformat an die Aussenwand des Internats. Das gab einigen Wirbel. Es war der Sommer, wo das Casino in Flammen aufging, als Frank Zappa dort sein Konzert gab. Es war ein eindrückliches Feuerwerk und deshalb bekam später der Song „Smoke on the Water“ eine besondere Bedeutung für mich. Im Internat sangen wir Gospels mit einem schwarzen Musiklehrer. In der Frauenschule Bern war ich im Jugendorchester und spielte Geige. Dazu kam das Jazztanzen, was dort angeboten wurde. Später spielte ich Saxofon, Perkussion und Schlagzeug (schlecht) und heute singe ich in einem klassischen Chor im Alt. Von Mozart bis Volksmusik höre ich fast alles. Blues der "Chickerbord Blues Band" mit Philipp Fankhauser drückten meine damaligen Gefühle perfekt aus. Heute schreibe ich diesen Text und höre dazu den "gereiften" Fankhauser mit ausgezeichneten Musikern und perfektem Sound dazu. Eben läuft der Song "Horse of a different Color".
Berufswunsch
Meinen Berufswunsch fasste ich im Spital, als mein Grossvater im Sterben lag. Der wurde erneut geweckt, als in der Gemeinde ein dringender Aufruf gestartet wurde, man benötige dringend Krankenschwestern. Es gab dazu einen Vortrag, der nur die besten Seiten des Berufs erwähnte (also PR). Meine Eltern unterstützen mich stark darin. Sie wurden mich so ohne hohe finanzielle Unterstützung "los". Ich bekam nach wie vor sehr selten Taschengeld, meist war es "Goodwill". 10-er Noten heimlich zugesteckt oder 50.- Franken für einen Monat zum Kleider kaufen. Man erwartete von mir Dankbarkeit für das, was meine Eltern für mich taten. In den Sommerferien 1972 arbeitete ich vier Wochen als Praktikantin im Inselspital Bern. Ich war auf der damals septischen Thorax-Herz-Gefässchirurgie (L-Süd) eingeteilt. Die meisten Patienten hatten eins oder mehrere Beine amputiert. Dort erlebte ich zwei Todesfälle wegen Herzversagen. Damals sagte man mir, als Krankenschwester sollte man sich abhärten und ablenken. Also sei es angebracht, in der Freizeit verschiedene Dinge zu unternehmen, um das Vorgefallene zu vergessen. Ich heiterte die Patienten auf, fand die Arbeit vielseitig und anstrengend. Trotzdem machte ich mir tiefer gehende Gedanken zu Krankheit und Tod. Nach der Praktikumszeit begleitete ich meine Eltern mit ihren Schülern auf die Schulreise: nach Bern mit Mutter und nach Grindelwald mit Vater.
BFF
Als die Frauenschule losging, hatte ich Latein gebüffelt, sagt mein Tagebuch. Zum Abschluss der Frauenschule machten wir ein grandioses Fest. R. und ich bastelten "Schnitzelbänke" zum Abschluss, die wir an der Feier vortrugen. Hier eine Kostprobe:
Unser Lehrer Christian hat uns viel Böses angetan,
mit seinen blöden Kommaregeln behandelte er uns wie Flegel.
Komma hier und Komma dort und so fort bis in den Tod.
Doch ab und zu war er bereit zu einer kleinen Fröhlichkeit.
Und auf ging es den Bergen zu, mit Langlaufski, Stock und Schuh. Er war unser Superklassenlehrer, hatte aber fast keine Verehrer.
Am 26. März 1973 kam ein Artikel auf Seite 3 in einer Tageszeitung mit dem Titel: Siesta am Bundeshaus: ein Hauch von AMSTERDAM. Fünf von der Frauenschule waren auf einer der Fotos (ich auch). Im Tagebuch steht: Am Donnerstag hatte ich eine Orchesterprobe und am Freitag spielte ich an einer Abschlussfeier der BFF. Abends probten wir für den Gottesdienst der Jungen Kirche (JK). Dort lernte ich einen Jungen kennen, der mir neugierige Fragen stellte und Pilot werden wollte. Nur einen Monat später, am 1. Mai 1973 schreibe ich, dass ich per Velo unterwegs bin und Volleyball trainiere. Mit Freundinnen wanderte ich irgendwo hin und kehrte per Autostopp zurück oder umgekehrt. Wir waren stets zu zweit oder zu viert unterwegs. 1973 verbrachte ich sehr gemütliche Weihnachten zuhause und schrieb, dass es mich sehr freute. Da stand im Tagebuch vom seelischen Gleichgewicht und Eltern, die ich "zurückgewonnen" hätte. Und da verliebte ich mich beim Skifahren in den jungen Kollegen von Vater. Meine Geschwister spotteten und witzelten über mich. Über die Feiertage (26.12.-30.12.) waren elf Familien mit 21 Kindern in den Ferien. Bei schönstem Wetter war ich tagelang auf der Piste. Ich notierte, dass es eine erholsame, frohe Zeit war. Es gab keine Gleichaltrigen, darum war ich oft allein.

Freizeit - Lebenszeit
Als Kind kannte ich das Wort Freizeit gar nicht. Es gab einfach Lebenszeit. Begriffe wie Burn-out, Stress, Work-Life-Balance schienen noch weit weg. Aber es gab schon Leute, die über Stress schrieben, wie meine Tante, die heute nicht mehr lebt. In unserem Dorf spielten wir oft draussen. Sei es, dass wir verrostete Reifen von einem Hügel rollen liessen und schauten, wer es wie weit brachte. Mein Bruder schaffte es bis über eine Strasse und in einen Bach hinein. Auch erkundeten wir Wälder, Bäche, Hügel und Täler. Im Winter brachten wir uns das Skifahren selbst bei. Da fuhr ich mal in den Bach, weil ich noch nicht wusste, wie man bremste. Im Winter gab es auf dem Schulplatz eine Eisbahn und Vater hielt diese in Schwung. Aber oft waren auch wir am Wasser spritzen, wenn es über Nacht gefror. Schlittschuhe bekam ich von meiner Patin auf Weihnachten, aber ich fuhr lieber mit den Hockey-Schuhen. Ich erinnere mich, dass ich das sehr gut konnte. Vater meinte aber, dass Mädchen nicht Hockey spielten. Jeden Abend gingen wir in die Käserei Milch holen. Ausserdem mussten wir viele Ämtlis erledigen, die da waren: in den Schulstuben die Öfen anfeuern am frühen Morgen. Als wir zur Kochschule gingen, kochten wir für die sechsköpfige Familie, wenn die Dienstmädchen frei hatten. Dann gab es viel zu putzen. Im Sommer lasen wir Bohnen und Stachelbeeren ab. Wir hatte einen grossen Schrank mit «Sterilisiertem». Alles, was eingemacht werden konnte, wurde eingemacht. Mit den vielen Vorräten wurde auch das Kochen im Winter leichter. Meine Schwester war mager. Zu ihr sagte der humpelnde Knecht: "die schlanke Linie hat Erfolg"! Das blieb mein Ziel: Menschen rund um mich zu einem besseren Leben zu verhelfen. Aber weshalb fing ich nicht bei mir an? Ich war sehr erleichtert, dass ich endlich als Fünfzehnjährige die Schule, das Dorf und meine Eltern verlassen durfte.
Ich wurde als offene, ehrliche und sympathische junge Frau wahrgenommen. Das sagte eine Mutter meiner damaligen Freundin und mein geduldiges Tagebuch nahm es auf. 1973 wohnte ich bei einer älteren Frau, weil ich eine Schule weiter weg von zuhause besuchte. Ich war genervt, dass die ältere Frau mir ständig Ratschläge gab, wenn ich keine verlangte. Zum Beispiel schickte sie mich in die JK (Junge Kirche). Sie regte sich furchtbar auf, wenn ich erst um 21.00 Uhr heimkam, nicht um 19.30, wie sie es wollte. Am Wochenende half ich in Haus und Garten, wenn ich nicht mit meinen Freundinnen unterwegs war. Einmal lud mich jemand ins Stadttheater zu Don Pasquale von Donizetti ein. Ich erinnere mich zudem an Hamlet und die Räuber von Schiller im Stadttheater; ans Requiem von Brahms im Casino. In der «Schwesternschule» Freizeit verwandten wir viel Energie auf unser Aussehen. Ich nähte mir zusammen mit anderen selbst Kleider. Wir sahen teils aus, wie aus einem Mittelalter-Film. Einmal kaufte ich ein besticktes Kleid aus dem Gazastreifen. Darauf war ich sehr stolz. Und kaum lebte ich nicht mehr zuhause, kaufte ich mir selbstverständlich Jeans. Oft waren wir sommers nackt und eine Kollegin sagte zu mir: „so lange Haare passen dann Deinem Freund nicht“. Ein einzelnes Haar an der Brust war etwa 7 cm lang. Sie holte eine Pinzette und riss es aus. Sie zeigte mir, dass man damit auch die dichten Brauen zupfen konnte. Fortan tat ich das genauso, wie sie es mich gelehrt hatte. Die Brauen wuchsen nie mehr richtig nach, bis heute nicht. Ich hatte Idole, die ich nach Bedarf wechselte. Erst war es Florence Nightingale, zu deren Ehren der internationale Tag der Krankenpflege (am 12. Mai) eingeführt wurde. Früher war es "Pipi Langstrumpf", die ein starkes Mädchen symbolisierte. So wollte ich auch sein. "Girls just want to have fun" - so lautete bis vor kurzem ein Spruch auf einem Untersatz, den ich fast täglich benutzte und der mich an diese Zeiten erinnerte. Ich konnte ungehemmt für meine Idole schwärmen.
Filme
Ein Eintritt ins Kino kostete in meiner Jugend fünf Franken. Wir sahen als ersten Film: die Wüste lebt. Später Vier Fäuste für ein Halleluja, The Godfather, Soylent Green, James Bond 007 usw. Die Filme von Godard und Fellini habe ich wahrscheinlich alle gesehen. Der Ausschnitt mit dem Ausflug einer Familie mit einem Onkel aus der Psychiatrie, der auf einen Baum kletterte und schrie: "Voglio una donna" blieb mir jahrelang im Gedächtnis. Eine Nonne holte ihn dann vom Baum runter. Zweimal wurden wir in einen Film geschickt, den wir von der «Schwesternschule» aus sehen sollten. Grund: in einer Szene gab es einen "echt wirkenden" Epilesieanfall... mir wurde dabei fast schlecht im Kino. Und «Szenen einer Ehe» als Beispiel für die Psychologiestunde. Was mich erschütterte war die Tatsache, dass ich im Kino weinen konnte, was mir sonst eher unmöglich war. Nicht mal bei Beerdigungen kamen die Tränen. Durch Filme fand ich zu meinen Gefühlen, die ich mir zuhause nicht erlaubte. Die Gefahr, verletzt oder ausgelacht zu werden schien mir daheim zu gross. Ein Kollege nahm mich zu Peter Greenaway-Filmen mit. Nachdem ich Qualen ausgestanden hatte, ging ich nicht mehr mit. Es war etwas zutiefst Schockierendes darin. Unvergesslich ist Mamma Roma mit Anna Magnani, wo mich das pulsierende, dramatische Leben faszinierte. Und die Magnani glich irgendwie meiner Mutter. Ich erinnere mich an gesellschaftskritische Filme von Jean-Luc Godard. Ich sah in den Filmen die Doppelbödigkeit unserer Gesellschaft gespiegelt. Ich könnte noch viele Filme aufzählen, die als Klassiker eingingen. Woodstock und Sommer of Soul sah ich mehrmals. Easy Rider mit der Szene, wo LSD-Trips verfilmt wurden, fand ich spannend. Ich fragte mich oft, wie Film und Wirklichkeit zueinander stehen. Und natürlich auch, ob die Realität, wie ich sie wahrnehme, von jemand anderem genau so erlebt werde. Ich stellte mir vor, dass wir auch einen Film machen könnten. Ich unterhielt mich mit Kolleginnen darüber, aber es gab dann den Film nur in unseren Köpfen.
Musik und Konzerte
Musik war damals und heute meine beste Therapie. Am 1. März 1973 um 10.50 Uhr besuchte ich mit Kolleginnen die Generalprobe der Bernischen Musikgesellschaft im Casino Bern. Ich erinnere mich, wie mich die Klänge beeindruckten und gestaltete eine wunderschöne Seite in meinem Tagebuch. Gespielt wurden: von F. Liszt - Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 in Es-Dur (1.-3. Satz) und von M. Ravel - Konzert für Klavier und Orchester in G-Dur (1.-3. Satz) mit der Solistin Martha Argerich-Dutoit am Klavier. Ich verliebte mich in diese Musik. Und ich dachte bei mir, dass ich einen Musiker heiraten möchte. OpenAir Konzerte wurden später das Grösste, auf das wir uns Sommer für Sommer freuten. Am Gurten versammelten wir uns jeweils wie eine Grossfamilie mit allen unseren Freunden. Wir vergötterten die Musiker und ihre Musik, wie meine Mutter es noch heute tut. Ans Konzert von Ravi Shankar am Gurten Festival erinnere ich mich sehr gut. Es gefiel mir, von und mit Freunden zusammen Musik zu erleben. Später kam einer auf die glorreiche Idee, eine Zigarrenschachtel voller Joints mit an ein Raggae-Konzert mitzubringen. Bob Marley spielte, aber die Wailers gefielen mir besser. Ich hielt die Augen offen, damit niemand von meinen Freunden verloren ging. Wie viele andere blieb ich mein ganzes Leben lang Beatles-Fan. Cat Stevens mit Morning has broken wünschte ich im Wunschkonzert für meinen damaligen Schwarm (den jungen Kollegen von Vater). Dadurch flog meine Verliebtheit auf.
Bei uns zuhause liefen Chris Barber und Katharina Valente neben der klassischen Musik. Von den Rare Bird hatte ich die Platte: As your mind flies by. Man nannte die psychedelische Musik. Auf dem Plattencover stand eine Warnung (eine - wie mir schien - verkaufsfördernde Idee). Als Jugendliche hatten wir einen Wettbewerb laufen, wer die "geilste" Musik entdeckte. Darum muss jetzt ein wenig Musik eingebracht werden: Die Komposition "Schirocco" von Klaus Doldinger (1973) gefiel uns ausnehmend gut. Den Song "So What" von Miles Davis hätte ich gerne mal live gehört, was nie geschah. Sein Sound, den er 1987 am Konzert (Tutu) spielte, hörten wir x.malig. Irgendwie scheint diese Musik direkt in die DNA zu flutschen. Das Köln Konzert von Keith Jarret half mir entspannen. Frank Zappa and the Mother of invention waren eine Entdeckung und halfen mir, ein anderes Hörverständnis zu entwickeln. An einem Konzert in den 70-er Jahren in Bern beschimpfte er uns Schweizer und am liebsten wäre ich auf die Bühne gegangen und hätte ihm eine Ohrfeige gegeben. Viele Jahre später hörte ich auf derselben Bühne Sting. Da hatten wir eine Wette laufen: Wetten, dass ich mit Sting ein Lied singe heute Abend? Ha! Livekonzerte von Kraftwerk, den Stones, Uriah Heep (welche bis vor kurzem Konzerte gaben und deren Sänger kürzlich verstorben ist), Dire Straits, Anastacia und Amy Mc Donald schienen in Konzerten sehr präsent. Ich entdeckte Grace Slick (Jefferson Aeroplane) mit den Songs Somebody to love und White Rabbit. Wishbon Ash, die ein völlig "gescheitertes" Konzert in Basel gaben und deren Musik ich danach nicht mehr hören wollte, wurden aus der Plattensammlung aussortiert. Patty Smith (Horses) gefiel mir nicht nur als Musikerin, sondern als Mensch. Nebst vielen anderen Musiker haben mir - Pink Floyd, Chick Corea, Fleetwod mac, Weather Report, John Lee Hooker, Prince, Tina Turner, Nina Hagen, Joan Baez, Nina Hagen, Nena - den Alltag erleichtert. Ich bin ihnen sehr dankbar. Es war eine Flucht aus dem «harten» Alltag – eine Droge vielleicht?
Die lokalen Bands erlebte ich öfters live am Konzert. "Wiener" Ändu (Endo Anaconda) verschenkte uns seine erste LP. Polo Hofer (Schmetterband), Patent Ochsner, Züri West, Stop the Shoppers, Schmidi Schmiedhauser (Chicca Torpedo), Kisha, Adrian Stern und andere schienen zur Familie zu gehören. Es gab Zeiten, da fühlte ich mich nur beim Tanzen oder Musik-Hören glücklich. Der Jazztanz und die freie Improvisation, sowie ein Kurs in "Bewegung ohne Anstrengung" von Frank Hatch und Lenny Maietta brachten Neues in mein Leben. Hatch/Maietta wollten in den 70er -Jahren die Natürlichkeit der Bewegung mit geschmeidigen Bewegungen in der Schweiz bekannt machen. Eine meiner Freundinnen lud sie damals ein, weil sie sie persönlich kannte und deren Konzept spannend fand. Interessant ist, dass ich später Kinästhetik-Kurse besuchte, welche mich erneut mit den Gründern Hatch/Maietta und ihrer Idee in Verbindung brachten. Irgendeinmal "verirrte" ich mich zu den "Dadaisten", deren Sinn mir aber gänzlich verschlossen blieb. Verschiedene Vereine boten sich an. Der CVJM in Bern versammelte junge Leute um sich, die ihre Freizeit in christlicher Art und Weise verbringen sollten. Es wurde mir aber zu fundamentalistisch und ich blieb schon im ersten Jahr diesen Treffen fern. Schlittschuhlaufen, Skifahren, Schwimmen oder Sonnenbaden, wie zum Beispiel an der Schwesternschule auf dem Dach erlebte ich in Gruppen (oder wilden Horden, je nachdem wer es kommentierte). Die Wildheit lebte ich beim Skifahren aus!
Politisches, Tanz und Bücher
Freunde erzählten mir von der Partei der Arbeit (PDA), Karl Marx und Leo Trotzki. Ich war offen für solche Gedanken, besuchte aber nie ein Treffen. Ich erinnere mich, dass ich mal an einer Hochzeit mit einem Leader der PDA hingebungsvoll Tango tanzte und es genoss. Mein damaliger Freund sagte dann etwas neidisch: "Wenn der nicht so gut hätte tanzen können, hättest Du ihn wohl kaum beachtet." Kann gut sein. Tanzen liebte ich weiterhin als freie Interpretation zu Musik. Mir rief ein Freund an, als die Sendung "Darf ich bitten" lief. Ich ähnelte einer Frau, die dort auftrat (in der Ausstrahlung), meinte er. Es war Susanne Kunz und ich staunte, denn so hatte ich mich nie wahrgenommen. Ich hatte sehr befreiende Gefühle erlebt beim Tanzen. Bis ich als etwa Fünfzigjährige damit aufhörte. Mir schien der Körper zu "schwerfällig" geworden zu sein. Und Standard-Tänze langweilten mich. Ich wurde mehrmals angefragt, ob ich bei den SP-Frauen mitmachen wolle. Verneinte aber, weil ich bereits in einem Berufsverband eingespannt war.
Zum Lesevergnügen gehörten sämtliche Bücher von Andrea Camilleri, Donna Leon, Henning Mankell und weiteren Krimiautoren. Eine Zeitlang wurde Leon de Winter mein liebster Autor und es ging weiter, wie mit den Idolen. Sie wechselten, je nach Lebensphase und Interessen. Von Milena Moser las ich sämtliche Bücher. Von Alex Capus und Martin Suter wahrscheinlich auch, ich bin mir aber nicht sicher. Prinzip sollte sein: nach drei Belletristik-Bücher kommt ein Fachbuch. So las ich unter anderem in einem Sommer Frank Urbaniok "Darwin schlägt Kant". Der "Literaturclub" auf SRF1 bleibt fest im Leben verankert und die Buchempfehlungen auch. Es ist schwierig, sich für eins der Bücher als Lieblingsbuch festzulegen. Unmöglich alle zu erwähnen! Neu ist mir, dass ich Bücher zweimalig lese. Eins davon heisst "Über uns" von Eshkol Nevo. Dann mache ich mir Notizen. Pro Woche las ich eine Weile etwa drei Bücher - rund 160 Bücher im Jahr. Jetzt habe ich mir eine Pause auferlegt. Sonst müsste ich mich fragen: Warum lese ich so viel? Was suche ich in den Büchern? Lesungen von Ilma Rakusa (Mehr Meer) und T.C. Boyle (Wassermelodie) sind mir lebhaft in Erinnerung geblieben. Andere habe ich nur noch lückenhaft in Erinnerung, wie zum Beispiel von Peter Stamm (Agnes) oder von Paul Wittwer (Widerwasser). Es fällt mir auf, dass ich recht gerne Bücher zum Thema Wasser las. Was würde ich heute zum Lesen empfehlen? Ein Buch von Dörte Hansen (Altes Land) oder Louise Erdrich (Der Klang der Trommel)? Vielleicht wäre es auch die "Neapolitanische Saga" von Elena Ferrante. Seit ein paar Jahren habe ich alle meine Bücher konsequent in Umlauf gegeben. Es gibt nur ein paar wenige, die ich behalte. Und die Bibliotheken haben gottlob noch viele, die ich nicht gelesen habe… Aktuell bin ich in einem Lesekreis, wo aktuelle Literatur diskutiert wird.

Zuhause unter den Augen der Eltern, die alles kontrollierten und kommentierten war es schwierig für mich, Beziehungen unbeschwert zu pflegen. Mein allererster Freund, mit dem ich Petting erlebte und der wissen wollte, ob ich im Leben je einen Orgasmus gehabt hatte, lernte ich mit Siebzehn kennen. Er besuchte mich zuhause und meine Geschwister sassen an der Türe und belauschten uns. Das war noch unangenehmer, als wenn die Eltern zuhause gewesen wären.
Später fand ich es leichter, Kontakte zu knüpfen, aber weil damals von Verhütung keine Rede war, machte ich mir Sorgen, mich näher auf einen Jungen einzulassen. Am wohlsten war mir, wenn sie mir nicht zu nahe kamen. Küssen liebte ich, Streicheln und Zärtlichkeiten austauschen selbstverständlich auch, aber ich trug noch immer - von meiner Grossmutter angeregt - ein "Gürteli", ein Korsett, das eng an den Hüften lag und sehr schwierig auszuziehen war. Ich glaube dieses Teil war meine Rettung im Teenager-Alter.
Jedenfalls hatte ich viele Bekannte, Freunde und noch mehr Freundinnen. Im Tagebuch beschrieb ich, worüber wir gesprochen hatten oder was wir unternahmen. In Gruppen mit Freunden fühlte ich mich beschützt und wohl.
Im Tagebuch sind seitenlange Abhandlungen über die Wechselfälle in meinen Beziehungen zu Männer (und Frauen). Also verbrachte ich einen guten Teil der Freizeit damit, meine Beziehungen zu beschreiben und zu analysieren. Aber auch der Körper und seine Funktionen schienen interessant. Das Tagebuch enthält drei Seiten zum Thema: "Habe ich mein Jungfernhäutchen verloren und wenn ja wo und wann"? Wir verbrachten im Internat viel Zeit in den Pubs in Montreux, lernten Amis und Briten kennen. Durch sie lernten wir erste Brocken Englisch. Küssen konnte man in allen Sprachen und das probierten wir aus. "Love Bombing" als Ausdruck für ein Überhäufen an Komplimenten zu Beginn einer Beziehung lernte ich erst später kennen. Ich habe für diesen Text ein paar der Verflossenen "gegoogelt". Einer ist eben aus gesundheitlichen Gründen aus all seinen Ämtern zurückgetreten. Ich traf ihn, weil ich ihm die versiegelten Briefe zeigen wollte, die er mir damals schickte. Er freute sich und wir tranken einen Kaffee zusammen. Mir wurde bewusst, dass er Firmenchef war. Und ich hätte wohl kaum an seine Seite gepasst, ging mir damals durch den Kopf. Danach habe ich die Briefe und Tagebücher weg geworfen. Ich möchte nicht, dass jemand diese ausführlichen und sehr intimen Texte jemals läse.
Briefe
Meine Mutter zeigte mir kürzlich lange, ausführliche Briefe, die ich ihr geschickt hatte. Sie hatte alle aufbewahrt. Es waren lange Ausführungen, was ich in der Lehre erlebte. Aber auch wen und wie ich liebte und warum. Da stand zum Beispiel: "Er ist so verständnisvoll und lieb. Gestern hat er extra für mich dies und jenes gemacht". Ich warf alles weg. 1974 besuchte ich eine Ski-Chilbi mit meinen beiden Ski-Kollegen. In den Älteren war ich verliebt. Der andere, der in mich verliebt war, ist später Hotelier geworden. Ich war dann eine Weile unglücklich verliebt, was sich nicht gut auf meine Arbeit auswirkte. Ich schrieb ein paar Seiten in mein Tagebuch, litt unter Liebeskummer und flüchtete mich in die Musik... Wie ich den Text hier schreibe, finde ich auf dem Internet eine Ehrung dieses Mannes, in den ich damals verliebt war. Da steht: "Er kam als junger Lehrer ins Dorf und blieb..."
Im Tessin in den Ferien verliebte sich ein junger Franzose in mich, als ich noch zur Schule ging und erschien mehrmals an der Türe zum fragen, ob er mich mitnehmen könne auf seinem Motorrad. Klar, dass die Eltern ablehnten. Einmal weckten mich die Geschwister, weil dieser Franzose betrunken draussen im Garten meinen Namen rief. Das hielt er allerdings nicht lange durch. Ich bangte um ihn, falls mein Vater wach würde. Kann mich heute nicht mehr erinnern, was danach geschah. Nancy ist seither mit seinem Namen verbunden. Ich durfte Minigolf, Boccia und Ping Pong spielen (mit ihm und anderen). An einer abendlichen Tanzveranstaltung, an der meine Eltern teilnahmen, schaute ich zu. Ich hatte eine erhöhte Sicht auf die drehenden Paare und dachte bei mir: mit so einem strengen Vater werde ich nie jemanden kennen und lieben lernen. Ich wurde traurig und fühlte mich einsam. Die Realität war aber eine andere: Eigentlich lernte ich an jeder Ecke jemanden kennen. Mal im Eislaufen auf einer Eisfläche in der Stadt lief ich mit einem Unbekannten Hand in Hand, spielte Fangen und hatte es sehr lustig. Ich sah ihn vor- und nachher nie mehr. Mein Vater machte sich über uns lustig. Sagte, wie lächerlich dieses Verhalten sei. Er redete ein ganzes Abendessen über nichts anderes und meine Geschwister foppten mich danach immer wieder, wenn sie mich mit einem Knaben reden sah.
Ich hätte mir als Teenager gewünscht, dass sich jemand Zeit und Geduld für Antworten zum Thema Sexualität nähme, als ich Fragen zum Thema hatte. Tagebücher fand ich in dieser Zeit hilfreich, um das Auf und Ab der Gefühle zu verarbeiten. Deshalb schenke ich meiner Enkelin als Neunjährige ein Tagebuch und eine neue Zeitung für Mädchen von acht bis zwölf Jahren (Kosmos). Wir hatten immerhin das "Bravo", das uns aufzuklären versuchte. Aber die plumpe Bemerkung von meiner Mutter, als ich meine erste Menstruation bekam: "Ab jetzt kannst Du schwanger werden", habe ich mein Leben lang nie vergessen.
Wie sich ein Mensch fühlt, der nicht wie ich war, interessierte mich als heranwachsende Jugendliche. Darum begann ich viele Brieffreundschaften über die ganze Welt verstreut. So erweiterte ich meinen Horizont. Ein Mann aus dem Maghreb sandte mir den Koran. Mein Sohn war fasziniert vom Imam, den sie in der Schule hörten. Dazu stellte er viele Fragen und wir suchten Antworten, vor allem in Büchern. Heute ist mein Sohn konfessionslos, wie ich selber auch. Das bedeutet nicht, dass ich an nichts glaube, aber es bedeutet, dass ich mich keiner Religion zugehörig fühle.
Aussergwöhnliches
Der Psychologe, Autor und "Guru" T. Leary war in den 60-er und 70-er Jahren dafür bekannt, dass er "Bewusstseins-erweiternde" Drogen als Mittel zur "Neuprogrammierung" des Gehirns empfahl. Er befürwortete Experimente mit "Drogen" (LSD, Meskalin) unter professioneller Führung. Ich wandte mich aber rasch von seinen Ideen ab, weil sie mir zu riskant schienen. Ich nahm jedoch an einer Wanderung im Herbst (unter Einfluss von LSD) teil. Ich hörte im Wald klassische Musik und war fasziniert. Die Bäume verbeugten sich vor mir, die Pilze summten eine mystische Melodie und meine Gefühle waren stark. Ich fühlte mich als Teil des Ganzen, ein winziges Teilchen einer grossen Welt. Das Gehirn sendete ununterbrochen Gedanken - immerfort und war nicht zu stoppen. Mich beschäftigten die Fragen: Sind das Töne der kleinsten Teilchen, den Atomen? Wo sind hier die Grenzen? Wo fängt der Mensch an wo hört er auf - wo kommt er her - wo geht er hin? Was bedeutet unsere Welt im Vergleich zum Universum? Viele Fragen, die ich in Texten und Bilder bearbeitete.
Eine andere Sache war die mit meiner Freundin B. die sich dem Guru "Sri Aurobindo" zugeneigt fühlte, wir Hermann Hesse lasen und eine "Kult-Ecke" hatten in der WG. Dort war ich eher Trittbrettfahrerin und staunte darüber, dass man sich so intensiv mit Ideologien auseinander setzen wollte. Eine Stadt in Indien war damals ihr (unser) Ziel, nämlich Auroville (Stadt der Morgenröte). Wir dachten, wir würden dort dem "göttlichen Bewusstsein" dienen - stellten uns vor, dass wir in der spiralförmig angelegten Stadt unsere Bestimmung leben würden und befreit vom Kapitalismus viel glücklicher wären. in den 2020er-Jahren habe ich eine Dokumentation in "arte" über Auroville und ihre Bewohnenden gesehen. Die Realität ist etwas ganz anderes - wir hatten ja keine Ahnung, dachte ich mir.

Bekanntschaften
Ich machte rasch Bekanntschaften, ging unter anderem mit einem angehenden Politiker Skifahren. Er schien mir nervös. Er fuhr grauenhaft Ski, landete oft im Wald im Schnee. Er behandelte mich wie Porzellan. Mit meinen Freundinnen sprach ich oft über Freundschaften. Und notierte ins Tagebuch, dass ich "nur" mit ihnen "normal" reden konnte. Dann traf ich R. meinen ersten "wirklichen" Freund, mit dem ich mich in fast jeder freien Minute traf. Er holte mich direkt vom Spital ab und wir fuhren zum Bräteln in den Wald oder zum Baden an einen See. Wie ein Teenager schrieb ich ihm verliebte, romantische Briefe und er antwortete todernst und wie mir damals schien gefühlsarm. Er brachte mir das Autofahren bei (in einem orangen Deux-Chevaux). Einmal fuhr ich unabsichtlich in einen Wald hinein. Es gab keinen Schaden, aber er erschrak sehr. Seine genauen Vorstellungen, wie wir unser Leben verbringen würden, erschreckten mich. Sein Lieblings-Song hiess: „Look over your Shoulder” von Alan Price. Ich war achtzehn und er fünfundzwanzig. Ich lernte ihn an einem Fest kennen.
Die ganze Beziehung zu ihm war rein platonisch. Ich hatte Angst vor Sex. Der Grund lag daran, dass kurz vor meinem achtzehnten Geburtstag ein zweiundvierzig Jähriger mich mittels Alkohol gefügig machte. Heute würde man meinen ersten GV (Geschlechtsverkehr) als Vergewaltigung anklagen. Dies hat meine Beziehung bestimmt stark belastet, aber erzählt habe ich nichts. Ich ging auch nicht zur Polizei, weil ich mich schämte. Ich finde es scheusslich, dass noch heute Männer Alkohol nutzen, um Frauen (oder Mädchen) gefügig zu machen? Oder dass ich drei Tage kaum mehr sitzen konnte? Das war alles andere als schön. Da nützte auch der Blumenstrauss, den der "Mensch" vorbei brachte nichts an meinem Leid. Das Parfum dieses Mannes konnte ich lange Zeit nicht mehr riechen ohne Gänsehaut zu bekommen. Damals hatte ich bereits die Erfahrung gemacht, dass die Polizisten ein paar Sprüche klopften und weiter nichts. Ich wurde nämlich vorher mal in einer Umkleidekabine "unsittlich" berührt und konnte mich wehren. Mein damaliger Freund riet mir, eine Anklage zu deponieren, weil der Ladenbesitzer dies bestimmt bei anderen Frauen auch täte. Gesagt - getan. "Bei einem hübschen Mädchen wie Dir kann man das schon verstehen" gab einer der Polizisten von sich. Sie schickten mich weg. Ich wurde aufgeklärt, dass Vergewaltigung nur dann zur Anzeige gebracht werden könne, wenn man Spuren der Verteidigung nachweisen könne. Ich war erschüttert.
Als ich mit meiner Kollegin M. nach Kreta in die Ferien fuhr, kam mein Freund mich dort spontan besuchen. Ich war bereits in den Ferien und entspannt. Begrüsste ihn voller Freude. Er hing mit seinen Gedanken in der Schweiz bei der Schule, hatte Sorgen. Weil meine Kollegin ihn störte, wurde er ein richtiger "Schwerenöter", vertraute ich meinem Tagebuch an. Ich glaubte damals, dass in der Schweiz alles wieder bestens wäre. Er war aber weiterhin bedrückt und ernst. Alles "schiss" ihn an. Diese Beziehung dauerte sieben Monate und ich beendete sie, weil mir alles über den Kopf wuchs. Dann weinte ich einen Abend lang, bis ich nicht mehr konnte. Ich lenkte mich ab mit vielen Stunden Lernen. In der Rampe in Bern hörte ich Jacob Stickelberger und Fritz Widmer, die ihre und Mani Matters Lieder sangen. Dazwischen wurde ein Krimi erzählt. Ende Jahr gab es im Stadttheater "die chinesische Mauer" von Max Frisch zu sehen. Die Kolleginnen an der Schwesternschule nannten mich einen "Luftibus", was ich komisch fand. Ich habe zwar im Horoskop ein "luftiges" Zeichen, den Zwilling und im Aszendent die Waage.
Paulas
Ich plante, mit meiner Zimmergenossin nach Spanien zu fahren. Sie kam als Tochter eines bekannten Psychiaters als Quereinsteigerin in unsere Klasse und nannte uns alle Paulas. Zwei Tage vorher sagte sie, sie müsste nach Kanada reisen. So ging ich allein nach Spanien. Diese Ferien waren intensiv und ich ganz allein unterwegs. Ich landete in Ibiza und lernte dort einen Maler aus Holland kennen. Wir schrieben uns lange Briefe. Mein Tagebuch gibt preis, wie rasch ich mich damals in jemanden verliebte. Ich hatte aber auch Angst vor einer Beziehung und nicht mehr frei sein zu können. Mit Zwanzig schrieb ich tatsächlich: "ich sehe nicht mehr so glücklich und zufrieden aus, wie früher. Das zunehmende Alter macht sich bemerkbar." Im Mai 1975 schreibe ich über Kollegen mit sonderbaren Namen (XAE und Idefix), Schwade, Schnäuzlibande etc. und berichte von "fäze" Kollegen und lustigen Freizeit-Aktivitäten. Was es damit auf sich hatte, kann ich beim besten Willen nicht mehr rekonstruieren. Ich hörte gerne zu, wie sie jammerten, prahlten, Illusionen erzählten oder etwas kritisierten. Alles wurde fein säuberlich im Tagebuch notiert. Mein Vater sagte, ich sei noch genau so unvernünftig, wie zu Schulzeiten. Ich hingegen fand mich erwachsen und reif. Einmal meinte ich sogar, ich spräche so vernünftig wie meine Mutter. Ich verstand damals nicht, warum alle Jungen, die ich kenne lernte, Sex wollten, da mir dieser Wunsch unpassend schien. Ich wollte Petting, aber keinen Sex! Weil ich Manipulation und Provokation von zuhause kannte, funktionierte dies bei mir in der Regel nicht.
Freundschaften mit vielen Facetten
Ich erinnere mich, wie ein Freund, mit dem ich eine Zeitlang zusammen wohnte, mir sein Haus überschrieb, damit ich bei ihm bliebe, was ich aber nicht tat. Er hatte Wutanfälle und war ein paarmal kurz davor, tätlich zu werden (gegen mich). Das Haus wäre eine gute Million Wert gewesen, aber er war aufbrausend und "gefährlich", wie mir schien. Heute ist mir bewusst, dass er unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung litt (nach Traumen in seiner Kindheit). Diese Störung untersuchte ich sehr genau und tauschte mich mit einer Kollegin aus, die X-Jahre unter einem solchen Partner gelitten hatte. Was mich rührte, war ein Besuch, als wir schon ein paar Jahre getrennt waren. Ich hatte ihm angeboten, dass wir Freunde bleiben könnten. Das lehnte er ab. Ich glaube daran, dass man diese (und ähnliche) Konflikte ansprechen sollte, um sich bewusst zu werden, was einen veranlasst hatte, sich einem solchen Partner zuzuwenden, respektive wie man sich dabei fühlt. Und dann auch, sich mit dieser Situation auseinander zu setzen. Es gibt Leute, die mir sagen, ich sähe auch im schlimmsten Ereignis etwas Positives. Ist das so? Vielleicht bin ich einfach optimistisch?
Das Leben zeigte sich in vielen Facetten, was in unserem Dorf kaum vorstellbar gewesen wäre. Eine meiner Freundinnen, mit der ich heute noch Kontakt habe, lebt heute mit einer Frau zusammen und ist mit ihr verheiratet. Früher war sie Familienfrau mit Mann und Kinder. Eine Verwandte, welche von der weiblichen in die männliche Identität wechselte und sich einen männlichen Vornamen gibt, lebt in Berlin. Ob die 68-er Jahre da hilfreich waren? Durch Freunde und Freundinnen erlebte ich Dinge, die mir ohne sie verschlossen geblieben wären und die ich nie missen möchte. Ich denke, es ist sehr schön, Gleichgesinnte zu kennen. Und mit ihnen Gemeinsames zu erleben. Das ist auch heute so geblieben. Und ich bin Single seit Jahren. Es ist mir wohl dabei.

Cousin- und Cousinen-Treffen
Früher hatte wir einige Cousin- und Cousinen-Treffen. Aber aktuell sind sie auf Eis gelegt. Nur an Beerdigungen treffen sich die Verwandten heutzutage. Einer der Cousins ist mit seinem Mercedes verunfallt, als ich im Spital gearbeitet habe, wo seine Leiche hingebracht wurde. Die Sanitäter sassen beim Essen an meinem Tisch und erzählten, dass er sofort tot gewesen sei, weil die Aorta gerissen sei. Kurz darauf rief meine Mutter an. Ich sagte ihr, dass er schuld war am Unfall. Das hätte ich lassen können. Ich mag Beerdigungen nicht. Aber an seine ging ich und staunte, wie glorreich sein Leben dargestellt wurde. Wegen meiner Arbeitszeiten verpasste ich einige Beerdigungen, was meine Mutter wütend machte. Ich ertrage es nicht, todtraurige Menschen zu sehen, die mit genug Wein erhitzte Gespräche führen und die Toten in ein bizarres Licht stellen. Meist besuchte ich die Gräber später und verabschiedete mich auf meine Weise. Am 3. März 1973 brachen wir nach Winterthur zur Beerdigung meiner Tante auf. Es ging das Gerücht, meine Tante habe Selbstmord gemacht.
Nach der Beerdigung der Tante, wollte ich meine ehemaligen besten Freundinnen aus dem Internat treffen. Mit B. reiste ich nach Zürich und sah den Film: "Der Stoff aus dem die Träume kamen" von Simmel. Das Happy End konnte ich gut gebrauchen und den anschliessenden Sonntag auch, an dem wir ihren verheirateten Bruder und seine Frau trafen. Ich musste die Beerdigung der Tante "verdauen". Mir fielen die vielen Briefe ein, die sie an Mutter geschrieben hatte, wo stets das Wort Stress auftauchte. Sie hatte am Vorabend des Todes bei den Töchtern nachgefragt, was sie in Zukunft vorhätten. Ihr Mann hatte an der Beerdigung heftig mit einer Frau geflirtet, die unter den Trauergästen weilte. In diese Zeit fiel auch ein Besuch bei meiner Grosstante, die mir ihr Erbe versprach, wenn ich jeden Sonntag zu ihr auf Besuch käme. Sie wohnte in der "Berset-Müller"-Stiftung und hatte ein Leben lang einen stillen, verbitterten Kampf mit ihrem Bruder - meinem Grossvater geführt. Ich hatte dessen Warnungen im Kopf, dass sie manipulativ und böse sei. Somit wandte ich mich meinen Freundinnen und Freunden zu und vergass diese Grosstante. Sie hat dann auch nichts vererbt.
Erste eigene WG
In der Zeit der Schwesternschule gründete ich nach einer kurzen WG-Zeit bei B., meine erste eigene WG. Zuerst mit zwei Hebammen, die älter waren, als ich, danach lud ich alle meine Geschwister zu mir in die WG ein. Wir lebten sehr harmonisch - bis auf einige wenige Streitereien. Meine drei jüngeren Geschwister blieben zusammen, aber wechselten die Wohnung und den Ort. Daraufhin besuchte ich sie jeweils, weil ich ja zwecks Hebammenausbildung nach Zürich gezogen war. Und sie besuchten mich in Zürich. Zu einer Schwester habe ich heute noch ein oberflächlich-gutes Verhältnis. Zur anderen Schwester ist die Beziehung "belastet". Sie sagte oft, sie sei als Kind zu kurz gekommen. Sie regt mich auf, weil sie so viel schwatzt und Dinge haarklein erzählt, nach denen ich nie gefragt hätte (und die mich nicht interessieren). Zum Bruder habe ich den Kontakt zehn Jahre abgebrochen. Früher hatte er großartige Autos, eigene Firmen, schicke Freundinnen usw. und brüstete sich damit. Nachdem er ein "Burn out" hatte und schliesslich entlassen wurde, habe ich wieder Kontakt aufgenommen. Er sagt, er habe sich sehr bösartig verhalten unseren Eltern gegenüber. Nun, wo unsere Eltern alt sind und beide Unterstützung benötigen, geben wir unser Bestes, ihnen das Notwendige zukommen zu lassen. Vom Bruder hören meine Eltern erst seit kurzer Zeit, nachdem er Hausverbot bekam wegen einem Streit um Geld, das er forderte, eskaliert war.
Meine erste und beste Freundin im Nachbarshaus im Dorf habe ich im Alter wieder getroffen, Social Media sei Dank. Wir hatten uns viel zu erzählen und führen eine lockere, angenehme Freundschaft. Sie hatte in ihrer Kindheit schlimme Dinge erlebt, die sie mir erst jetzt im Nachhinein erzählte. Das Leiden war und ist auf dieser Welt omnipräsent. Und die Familie prägt das eigene Leben, mehr als man sich denkt. Das wird mir heute deutlich bewusst. Wir beide denken, dass die "speziellen" Familienverhältnisse sich auf unsere eigenen Beziehungen ausgewirkt haben. Sie meinte, sie wisse nicht mal, ob die anderen Nachbarskinder ihre Halbgeschwister seien, weil ihr Vater zeitlebens mit der Nachbarsfrau ein Verhältnis hatte.

Haushaltjahr
Am 4. April 1973 begann ich ein Haushaltsjahr bei einer Familie in Mendrisio. Mein Monatslohn betrug 250 Franken. Der Hausherr verbot mir männliche Freunde gleich zu Beginn. Ich trat dort der Jugendgruppe „gruppo dei giovani“ bei, wo man sich traf und über aktuelle Themen diskutierte. Besuch bekam ich von einem ehemaligen Jeune Fille aus Montreux. Beim Staubsaugen, Bettenmachen und Kochen dachte ich darüber nach, was ich im Leben machen wollte. Ich war verliebt in einen Jungen, der täglich an unserem Haus vorüberfuhr. Er hielt jeweils an, wenn er vom Gymi kam und sprach ein paar Worte. Meist hatte ich die beiden Kinder der Familie dabei und musste höllisch aufpassen. Dort erfuhr ich, dass es einen Tag gab, der nach mir benannt war: Santa Regina. Diese war eine Schafhirtin, Jungfrau und Eremitin. Weil sie sich weigerte, einen römischen Konsul zu heiraten, wurde sie mit Fünfzehn enthauptet. Die heilige Regina ist Schutzgöttin der Zimmerleute. Ihr Gedenktag feiert die kath. Kirche am siebten September. Ich lernte den Katholizismus kennen, sah die Prozessionen und hörte, was die Signora zu den sonntäglichen Besuchen in der Kirche sagte. Ich achtete die tiefe Religiosität, konnte sie allerdings bei mir nicht wecken. Die Signora kaufte viel und oft, war stark geschminkt, ging oft nach Rimini zur Erholung und in die Disco nach Rancate, wo ich nie mitdurfte. Ich hütete die Kinder. Im italienischen Fernsehen lief oft Milva, eine Sängerin, die ich beneidete. Ende Herbst kamen mich meine Eltern abholen. Sechs Monate genügten, um Italienisch zu lernen. Und das Haushalten hatte ich nun gründlich satt! Beides wurde verlangt für die Lehre zur «Krankenschwester», die ich bald beginnen sollte.
Schwesternschule
Am 5. Oktober 1973 war es dann so weit: ich trat in die Schwesternschule ein. Zu Beginn wurden Anatomie, Biologie, Medizin, Krankenpflege und Psychiatrie unterrichtet. Die beiden Fächer Chemie und Physik wurden geprüft, die ich mit sehr guten Noten abschloss. Literatur war ein Fach, das mich packte. Wir machten eine Reise durchs Elsass zu einem berühmten Altar und viele Kirchen. 1974 lernte ich den Spital-Alltag mit seinen Tücken kennen. Mein Tagebuch berichtet, dass um 06.15 Uhr Arbeitsbeginn war. Von 12.00 bis 15.00 hatten wir "Freistunden", 19.00 war Feierabend. Ich schloss in der Probezeit alle theoretischen Fächer ausgezeichnet ab; praktisch gelang mir das etwas weniger gut. Morgens vor dem Frühstück musste ich im Spital beispielsweise Urin messen und nach Farbe, Geruch und spezifischem Gewicht beurteilen. Ich gewöhnte mich nie daran. Auch diversen Menschen Fäkalien vom Gesäss waschen, ekelte mich. Da war ein alter Mann, den ich "intim" waschen musste. Er sagte, ich solle seinen Pimmel nicht so zögerlich anfassen. Den habe schon manche Frau in ihren Händen gehabt. Ich wurde puterrot. Im Dezember 1974 arbeitete ich im Spital Tiefenau auf der Medizin Männer, West 2. Nun war ich also in einen jungen Arzt verliebt. Er hatte mich nach ein paar Dates sitzen gelassen, weil ich nicht mit ihm ins Bett wollte. Er ist heute ein angesehener Chefarzt mit Auszeichnungen. Liebe und Ehe waren Dauerthemen unter uns Freundinnen. Am 18. März 1975 bestand ich die Auto-Prüfung. Später bekam ich eine Neue in mein Zimmer. Wir wohnten alle im "Schwesternhaus". Die Neue nannte alle "Paula", weil sie Namen nicht behalten konnte. Am 26. Mai 1975 wurde ich Zwanzig. An diesem Tag legte ich eine Prüfung in Krankenpflege ab. Die Kolleginnen gaben mir viele Küsschen. Meine Freundin hatte sich was Lustiges ausgedacht: ein Lederetui mit Besteck für eine Weltreise sowie einen Blumenstrauss. Die Eltern schenkten mir einen Fotoapparat. Eine der Schwestern warf mir böse Dinge an den Kopf. Die andere Schwester nahm ich aufgeweckter, lebensfroher und unkomplizierter wahr. Mein Bruder sprach plötzlich nur noch Hochdeutsch, nicht mehr Dialekt. Er wurde durch Vater, später durch die Mutter unterstützt, indem sie ihm "Nötli" zusteckte, wenn sie glaubte, es schaue niemand hin.
Inselspital
Anfang 1976 arbeitete ich im Inselspital. Mir war damals wichtig, dass ich eine Liebe zu Gott und den Menschen entwickelte. Zudem wollte ich Ehrlichkeit, Geduld und Wahrheit anstreben, während mir Einer sagte: "Was für einen Scheissdreck Du da erzählst." Er hingegen fand es wichtig, sich im Leben durchzusetzen, von den anderen zu profitieren, genug Geld zu verdienen, um sich alles leisten zu können, was man sich wünschte. Ich hatte viele solcher Diskussionen zu Werten und Normen und im obigen Fall beendete ich unsere Freundschaft. Im Sommer musste ich mich einer Bauchoperation unterziehen (Blinddarm). Ich bereitete mich auf das Examen vor. Genau in dieser Vorbereitung traf mich die Liebe wie ein Blitz. Trotzdem gelangen die Abschlussexamina sehr gut und ich erhielt mein Diplom in AKP (Allgemeiner Krankenpflege). Gleich darauf machten wir eine Diplom-Reise nach Wien und danach war ich Unterrichtsassistentin (im Pflichtjahr) an der Schwesternschule, wo ich ausgebildet wurde. Meine beste Freundin entzog sich dieser Pflicht, indem sie heiratete und auf eine Weltreise ging. Beides galt als Grund, um nicht zu einem Hungerlohn im Pflichtjahr schuften zu müssen. Sie empfahl mir dasselbe, aber ich fürchtete mich davor (vor beidem). Man muss vielleicht wissen, dass Spitäler früher ganz andere Orte waren, als heute. Von familienfreundlicher Pflege sprach niemand. Es gab die allgemein Versicherten, die in Sechser-Sälen lagen: drei Betten rechts an der Wand und drei links. Bei den Wöchnerinnen waren noch die Neugeborenen drin. Bei Besuch schien es wie auf einem Jahrmarkt zuzugehen: ein Durcheinander. Es war bei Strafe verboten, auf eins der Betten zu sitzen. Man darf ruhig sagen: es war hart, dort zu arbeiten. Zentralvenenkatheter-Verbände wurden kontrolliert von der Leiterin der Anästhesie, eine gefürchtete Frau. Einmal fragte sie: "Wer hat das gemacht"? Und die Kolleginnen sagten, dass ich es gewesen wäre. "Holt sie her". Gesagt-getan. Ich erwartete bereits einen ZS (Zusammenschiss), aber es kam ein gewaltiges Lob, das mich fast noch mehr beschämte. "Genauso sollte ein Verband gemacht werden; merkt Euch das", meinte sie und verschwand. Jeder kontrollierte jeden, das war klar. Die Hierarchie war militärisch, die Arztvisiten hatten nach genau festgelegten Regeln abzulaufen. Ich konnte die Veränderungen miterleben und freute mich, als es "menschlicher" wurde.
Fachhochschule
In reifen Jahren machte ich an der Fachhochschule berufsbegleitend den Bachelor of Science in Pflege. Das war ein Meilenstein und noch heute staune ich darüber. Ich hatte mathematische Kenntnisse, indem ich in der Schule viele "Treppen" rechnete, die veranschaulichten, wie sich Plus und Minus berechnen lassen. Algebra und Statistik waren mangelhaft. Algebra soll man sich nicht vorstellen, sondern einfach anwenden, meinte eine Kollegin. Statistik interessierte mich tatsächlich. Fachenglisch war bei mir eher schlecht. Trotzdem schrieb ich eine These, bei der ich englische Studien analysierte. Detailgenau eine Sache zu untersuchen, ohne das Ganze einzubeziehen, lief mir gegen den "Strich". Nicht verschweigen möchte ich, dass ich eifrig bei allen Lektionen mitmachte, als ich realisierte, dass ich nicht so bald rausfallen würde (aus der Fachhochschule). Ein Dozent, der mir eine Nachprüfung abnehmen musste, bleibt mir sehr gut in Erinnerung. Ich hatte beim Test nur die Fragen auf der Vorderseite beantwortet und die Rückseite nicht angeschaut. Nervös wie ich war, verliess ich den Raum, staunend, dass ich die Erste war. Dann kamen meine Kolleginnen und fragten: "was hast Du bei der letzten Frage geschrieben"? "Bei welcher"? "Bei Frage zwölf"? Ich hatte aber nur bis Frage sechs beantwortet, weil ich das Blatt nicht umgedreht hatte. Mir wurde siedend heiss. Der Dozent setzte einen Termin an: In seinem Büro musste ich also nochmals Fragen zu Korrelation und anderem Zeug beantworten. Er sagte, dass er mich per WhatsApp informieren würde, ob ich bestanden hätte. Kaum aus dem Büro kam die erleichterte Nachricht: alles gut.
Seither weiss ich was es bedeutet, wenn jemand von statistisch relevanten Ergebnissen, von einer Normalverteilung oder statistischen Ausreissern spricht. Aber als "studierte" Schwester, wie man mir im Pflegeheim hinter meinem Rücken sagte, wurde ich angefeindet. Pflegediagnosen wurden als der letzte Blödsinn bezeichnet. Arztvisiten abzuschaffen, fand keinen Anklang. Tatsächlich band dies viel der wertvollen Zeit und ich sah nicht ein, dass wir das Befinden der Patienten so ausführlich schildern sollten im Pflegebericht, wenn keiner es las. Ich hatte mit den Kolleginnen aus der Psychiatrie engeren Kontakt, weil wir viele Arbeiten zusammen schrieben. Wenn die Themen für Gruppenarbeiten von den Dozenten vorgestellt wurden, waren wir meist zu spät beim Auswählen und nahmen die übriggebliebenen Themen. Schlussendlich half mir diese Ausbildung zu einer vertieften Einsicht in wissenschaftlich bearbeitete Themen. Ob das der Pflege am Bett geholfen oder geschadet hat, kann ich nicht sagen. In der Zeit von Corona staunte ich über die "Wissenschafts-Gläubigkeit", resp. "Ungläubigkeit" der Leute. In Diskussionen versuchte ich mich eher zurück zu halten.

Erlebnisse als junge Berufstätige
Mit 21 Jahren hatte ich Kranke gepflegt und Leute sterben sehen. Ich versuchte, mich an gesunden Menschen zu orientieren, begegnete aber immer wieder schrulligen Figuren. Ich berichte hier von meinen Erlebnissen als "Lernschwester": Einmal hatte ich Spätdienst von 14.00 Uhr bis 23.30 Uhr auf einer Abteilung im Spital. Da war ich am "Runden" – das heisst in jedes Zimmer reinschauen und Arbeiten verrichten, die anstanden. Da kam eine Frau mit nervösem, flackerndem Blick auf mich zu und verlangte von mir sofort den "Gift-Schlüssel" vom Medikamentenschrank. Sie nahm ihn und holte Morphium-Ampullen raus, verschwand durchs Fenster in den Garten. Ich stand da wie gelähmt. So heftig erschrak ich. Diese Frau war eine Höher-Semestrige, die süchtig geworden war und sich "Stoff" besorgen musste. Früher bewahrte man halbe Morphium Ampullen auf, weil man sie noch benutzen durfte innerhalb von festgelegten Fristen (anstatt sofort weg zu werfen). Einige spritzten sich das "Gift" selber. Heute ist das untersagt. Es gab allerlei während meiner Lehrzeit als "Schwestern-Schülerin", was mich beschäftigte. Zuallererst die Pflege und der Tod einer lieben Patientin, einer Grossmutter, deren Enkel ich später kennen lernen sollte. Ich wurde zur Leichenwaschung allein ins Zimmer geschickt (zwecks Abhärtung) und erlebte starke Emotionen, darum begann ich mit der Toten zu sprechen. Dabei beruhigte ich mich selbst und konnte konzentrierter arbeiten. Das tat ich später auch, weil ich fand, es sei passend. Ich fand die verstorbene Frau sehr liebenswert und hing irgendwie an ihr. Somit dachte der Professor, er tue mir etwas Gutes, wenn er mich zur Obduktion mitnähme. Ich erinnere mich, wie ich dachte, bleib stark und falle ja nicht in Ohnmacht (wie es mir mal im Operationssaal passiert war, als ein Orthopäde das unpassende Teil einer Prothese quer durch den Raum schmiss). Als ich jedoch die Handschuhe anhatte und er mir das Hirn in die Hand legte, um es in Scheiben zu schneiden, versagte ich. Ich bat um dringenden Toilettengang, was er mir nicht verwehren konnte. Wie ein Arzt an der Wirbelsäule rumhämmerte und die Hand der Toten mit dem Ehering ruhig daneben lag - diese Bilder blieben lange haften! Gespräche in der Psychologiestunde halfen, diese Erlebnisse einzuordnen.
Als ich eines Morgens in den Warenlift stieg, stolperte ich über einen von Kopf bis Fuss tätowierten Mann. Er entpuppte sich als bekannter «Quartals-Säufer». Weil er zur Ausnüchterung und für damalig durchgeführte Antabus-Kuren zu uns kam, schien er es mit letzter Kraft gerade mal so bis zum Spital geschafft zu haben... er gestand mir einmal, dass er sich in meine Stations-Schwester verliebt hatte. Sie hätte eine erotische Ausstrahlung. Ihr Gang sei so leicht, wie der eines Rehs. Ich hörte zum ersten Mal solche Beschreibungen. Und erzählte es ihr brühwarm! Sie lachte darüber, aber die erotische Komponente lebte sie mit ihrem Lieblings-Arzt aus. Ein Arzt erklärte mir mal, wir hätten hier im Spital so viele Keime, dass es ungeheuer sei. Mit Keimen meinte er Viren und Bakterien. Am besten würde man das gesamte Spital räumen und eine Schafherde durchziehen lassen. Auch fühlte ich mich sehr unwohl auf den Arztvisiten, die früher sehr militärisch abliefen. Einmal mass ich den Blutdruck bei einem der Patienten vor einer solchen Visite. Der war viel zu tief. Ich wollte nochmals nachmessen, da sagte er: "Bitte, lass mich in Ruhe sterben. geh jetzt raus und sag kein Wort zu niemandem!" Weil ich dann so verschüchtert und bleich im Stationszimmer stand, fragte mich die Diplomierte, was los sei. Ich durfte es ihr nicht verschweigen und der ganze Apparat schaltete auf sofortige Wiederbelebung (was nicht gelang). Ich fühlte mich doppelt schuldig. Die Psychiatrie mit ihren Psychotron-Behandlungen (damalige "moderne" Elektroschocks) konnte ich gottlob nach dem Praktikum verlassen. Es ging früher eher rau zu und her. Die Pfleger schienen mir eher Aufseher zu sein. Die verordneten Schlafkuren nützten wohl nicht sehr viel. Gottlob hat sich in dem Bereich einiges zum Guten verändert. Ich hatte eine verständnisvolle Diplomierte, der ich auch heute noch ab und zu begegne. Sie kennt mich immer auf Anhieb, ich sie auch, obwohl zig Jahre vergangen sind. Ich fand die Gespräche und ihr Wohlwollen sehr hilfreich. Sie war allerdings bei Ihresgleichen eine Aussenseiterin - aber eine Lebensfrohe!
Ich kämpfte mit Überforderung und langen Arbeitszeiten. Das sollte mich noch eine Weile begleiten. Wahrscheinlich wäre eine psychologische Begleitung in der Zeit zwischen 18 und 21 Jahren für mich wichtig gewesen. Stattdessen schrieben wir Berichte oder sprachen uns in den Psychologiestunden Belastendes von der Seele. Das war auch eine Möglichkeit, das Erlebte zu verarbeiten. Aber ich kam nicht umhin, zu bemerken, dass die ersten Berufsjahre hart waren und die weiteren Jahre zeigten diesbezüglich keine wesentliche Verbesserung.

Kritische Betrachtungen zum Beruf
Ich wurde in drei Jahren zur «Krankenschwester AKP» ausgebildet. Im Pflichtjahr lernte ich den Erst-Semestrigen die Grundpflege und begann mit praktischem Unterricht als «Lehrschwester». Liliane Juchli war unser Vorbild (eine damalige "Pflegebuch-Bibel"). Da kam auch das Thema der Selbstpflege, später Selbstkompetenz zur Sprache. Sr. Liliane Juchli ist im November 2020 an Corona im Haus der Pflege gestorben. Sie war eine der bekanntesten Ingenbohl-Schwestern. Damals hat man jede Krankenschwester Schwester genannt. Später wurde daraus die Pflegefachfrau HF (oder FH). Ab 2008 konnte man den Beruf an der Fachhochschule (FH) Bern studieren. Ich besass einen Ansteck-Knopf, auf dem stand: Krankenschwester - eine aussterbende Gattung (mit frechem Bild). Das brachte die Leute oft zum Lachen. Daraus ergab sich manch interessantes Gespräch. Oft sagten wir von uns, wir seien die "kranken" Schwestern (im Sinne von hilflos). Wir meinten es halb ironisch, halb ernst. Als Diplomierte musste ich organisieren lernen. Das gelang mir anfangs kaum, dann immer besser. Ich hatte einen Freund, der mir auf die Station anrief und sich als Bruder M. meldete, der Schwester R. ans Telefon wollte. Die Kolleginnen neckten mich. Er gab mir einen Ausgleich in der «verrückten» Situation des Spitalbetriebs. Ich ging 1977 nach Zürich an die Frauenklinik Zürich, um die Ausbildung zur Hebamme zu absolvieren. Die Schulleiterin war und ist eine ganz besondere Frau und wurde mir zur Mentorin. Wir waren uns als junge Hebammen-Schülerinnen begegnet und sahen einander als ältere Frauen (vom Kurs 77 B) erneut wieder. Wir hatten es sehr amüsant, plauderten angeregt und versuchten, die frühere mit der heutigen Zeit zu vergleichen.
Auf dem Weg zur diplomierten Hebamme
Bei der Arbeit im Gebärsaal der Frauenklinik Zürich waren wir in Gruppen (A, B, C und D) eingeteilt. Ich war in der Gruppe D, die sich auch Dschungelgruppe nannte. Wir waren eine lustige, sehr kreative Crew, die sich gegenseitig unterstützte. Wir spielten unserem Professor Streiche. Er kam manchmal betrunken von einem Bankett zu uns und rief dann gern: "Schiff ahoi"! Ich hasste es, wenn er mich umarmte, küsste oder mir einhängte, wie ein Freund. Ich hatte schon als Kind Angst vor Betrunkenen. Das kam nun wieder hoch. Seine Frau war Psychiaterin und wir dachten immer, dass er das wirklich brauchte. Resp. dass sie mit ihm wohl besser "zu Rande" kam als wir. Nun gut, der schlimmste Streich, den wir ausheckten, war Folgender: Unsere Vorgesetzte wusste, dass unser Professor alles unterzeichnete, ohne je etwas durchzulesen. So schmuggelten wir ihm ein Projekt für sechs Monate in die Unterschriften-Mappe. Er unterzeichnete, dass die Gebärenden (unter anderem) wünschen konnten, ob sie mit Hebamme (und Arzt) oder allein mit der Hebamme (ohne Arzt) gebären wollten. Sie erhielten alle einen Fragebogen vor der Geburt. Das gab ziemlich Wirbel, aber er hatte es ja unterzeichnet und darum lief das Pilotprojekt auch sechs Monate genauso. Ich lernte während dieser Zeit viel selbständiger zu denken und zu arbeiten. Einmal wurde ich auch zu einer Hausgeburt gerufen. Ich nahm den Koffer mit, den wir "für alle Fälle" hatten. Kaum kam ich rein, rief die Frau: "Mach vorwärts, das Kind kommt. Ich presse jetzt!" Alles ging glatt und ich war sehr motiviert, mich auch mit Hausgeburten näher zu befassen. Somit half ich den frei praktizierenden Hebammen zukünftig bei den Hausgeburten. Ich vertrat stets die Meinung, dass wir Hebammen dort zu zweit sein sollten. Grund: Mutter und Kind benötigen je eine Person nach der Geburt, die sich um sie kümmern kann.
Allgemein schienen mir die Hebammen freier und selbständiger als die «Krankenschwestern». Ich entwickelte mich zu einer selbstbewussten Frau und nahm Stellvertretungen in Graubünden auf. Dort arbeiteten zwei Freundinnen, die gemeinsam Ferien machen wollten. Somit lernte ich eine "eingekleidete" Schwester aus Deutschland kennen, die mir bei den Geburten half. Ich half ihr dabei, aus dem Orden auszusteigen. Sie schrieb mir viele Dankesbriefe. Zum ersten Kind erhielt ich ein schönes Bilderbuch von ihr. Das Arbeiten in verschiedenen Schichten bedeutete, dass an mich hohe Flexibilität und Anpassung gestellt wurde. Auch Arbeiten auf Abruf (mit Pikettdiensten) gehörten für mich in einem kleinen Spital zur Realität. Ich hatte jeweils eine Woche lang Dienst. Ich erinnere mich, dass ich zwei Nächte durchgearbeitet hatte. Genau dann kam am Morgen des dritten Tages ein Gynäkologe in den Gebärsaal, der sich vorstellte und behauptete, er werde neu mein Chef. Ich klärte ihn auf und sagte, ich hätte nicht viel Zeit, weil zwei Gebärende da seien. Er meinte: "Das ist sehr gut so. Übermüdete Hebammen mit Augenringen sind meist die Besten..." Ich hätte ihn erwürgen können. Als ich danach heim wollte, kam nochmals eine Gebärende zur Türe rein. Die Arbeit funktionierte als junge Hebamme gut. Ich war belastbar, selbstbewusst und ruhig. Mein neuer Chef brachte Ordner mit, in denen er seine Regeln definiert hatte. Meine bisherige Kollegin schickte er fristlos weg. Er brachte eine ältere Hebamme mit, die mir das Leben schwer machte. Seine Kids liebten mich, weil ich bunte Söckchen trug. Er wollte mir das Vespa fahren verbieten. Das sei viel zu gefährlich, weil der Motor auf einer Seite liege und dadurch sei ich immer im Ungleichgewicht. Ich liebte meine gelb-schwarz-gestreifte Vespa. Und dachte nicht daran, die weg zu geben. Später geriet mein ehemaliger Chef selbst in Ungnade, weil er seiner Familie den Rücken kehrte und ein Kind mit einer Hebammen-Kollegin erwartete. Einmal hing ich das Telefon zuhause nicht ein, weil jemand im Dorf ständig anrief und auf Besuch kommen wollte (ein Bauer). Und dann kam eine Frau vom Dorf mitten am Tag vorbei und sagte, ich müsste sofort zur Arbeit. Ich erhielt Blumensträusse von Gebärenden und einmal wurde ich in eine "Sekte" aufgenommen und im Gebärsaal getauft. Ich hatte an Ostern einem Sekten-Führer den ersten Sohn in den Arm gelegt. Die Entbindung war ohne Besonderheiten verlaufen. Ich staunte und wusste nicht, wie mir geschah. Nachher dachte ich: Schön, wenn jemand für mich betet. Das kann nur helfen. Im Allgemeinen liebte ich meinen Beruf als Hebamme. Jedoch das Arbeiten bis zum Umfallen brachten meine schönen Vorstellungen vom Beruf ins Wanken. Es gab einen Punkt in den frühen Berufsjahren, wo meine Meinung kippte. Ich hatte unter dem arbeitsintensiven Einsatz als Hebamme das Gefühl, den falschen Beruf gewählt zu haben. Die Sekretärin mit fixen Arbeitszeiten verdiente besser als ich. Weil ich aber die Selbständigkeit und Verantwortung liebte, die mir dieser Beruf gewährte, blieb ich dabei. Ich machte mich selbständig in den Kantonen Zürich und Aargau, später in Bern. Ein erstes Geburtshaus entstand. Die Gründerin warb um mich, hatte aber andere Grundsätze als ich. Das wurde mir klar, als sie zum ersten Besuch im Wochenbett einer Wöchnerin einen Satz Schoppen-Flaschen mitbrachte. Ich wollte, dass die Mütter erfolgreich stillen konnten, nicht primär Schoppen propagieren.
Erste Erfahrungen als diplomierte Hebamme
Es gab plötzlich ein Projekt im Privatbereich, das mich mehr interessierte als der Beruf. Und darum lernte ich noch etwas besser Italienisch. Wir kauften ein "Podere" (Hof) in der Toscana und gingen zu sechst dorthin. Die Erfahrungen als Hebamme, die ich dort machte, möchte ich nicht missen. Nach fünfzehn Monaten kehrten wir in die Schweiz zurück, da mein Mann sich mit dem Kollegen mit derselben Ausbildung nicht verstand. So kamen wir nach Bern, wo ich auf der "Risiko-Schwangeren-Abteilung" arbeitete. Dort gab es erneut eine böse alte Schwester, die mit einem Arzt zusammen hinter dem Rücken der Vorgesetzten, die Ausschaffung einer Ausländerin organisierte. Die Frau lag bei uns wegen vorzeitigen Wehen und somit riskierten die beiden, dass sie ihr Kind auf der Reise verlor! Ich fand das so dreist, dass ich ihr aus dem Weg ging. Es war schwierig, dort zu arbeiten, aber ich war privat sehr glücklich, darum ertrug ich die Sticheleien. Bei einer Schwangeren, die Zwillinge erwartete, telefonierte ich direkt dem Oberarzt und sagte ihm, wie die Situation dieser Frau sei. Das Fruchtwasser war geplatzt und sie benötigte einen Kaiserschnitt. Ich organisierte die OP und bereitete die Frau im Zimmer vor. Das machte der bösen, alten Kollegin Eindruck. Sie hätte die Frau einfach in den Gebärsaal "abgeschoben". Das hätte bedeutet, dass noch viel mehr Stress auf sie gewartet hätte. Als ich mich mehr als dreimal über die böse, alte Kollegin beklagte, durfte ich als diplomierte Hebamme im Gebärsaal anfangen. Dort sagte man mir, ich würde einen "falschen" Dammschutz anwenden (den Internationalen, wie ich es gelernt hatte). In Bern würde man den "Berner" - Dammschutz machen. Sie meinten es ernst. Ausserdem wollten sie keine Krankenschwester (AKP), die Hebamme gelernt hatte. Ich könnte sogar besser ausgebildet sein, als sie selbst, befürchteten sie.
Mich warnte jemand aus Zürich vor den Bernerinnen mit den Worten: "Die geben der Gebärenden beim Eintritt erst einen Einlauf und dann erst die Hand". Ganz so schlimm war es nicht, aber diese Liter-Einlaufe verabscheute ich. Das gab den einen oder anderen Streit. Eine Kollegin weigerte sich, an meinem Dienstende eine Gebärende zu übernehmen, weil sie keinen Einlauf bekommen hatte. Sie wurde Jahre später gekündigt, weil sie ihre Kompetenzen betreffend Medikamentengaben überschritten hatte. Als ich mich gut eingearbeitet hatte, wurde ich als Verantwortliche für die Schülerinnen ausgewählt. Später habe ich von diesen viel Lob bekommen und sie sagten auch. "Wir haben bemerkt, wie Du dort gelitten hast!" Der eine Arzt wollte mich immer wieder testen oder verunsichern. Bei einer Geburt sagte er zum Beispiel: "Sehen Sie, da gibt es Blut am Boden - das sollten Sie gleich aufputzen". Wir hatten Putz-Personal, das dafür angestellt war. Natürlich halfen wir auch mit, wenn wir Zeit hatten. Ich fragte ihn, was ihm an meiner Arbeit nicht passe. Danach herrschte Funkstille, resp. er schrieb in die Patientenakte "souveräne Geburtsleitung mit einer einfühlsamen Hebamme" (und meinen Namen dahinter). Ich hatte ihn am ersten Arbeitstag, als ich den Lift öffnete, mit einer der Kolleginnen schmusen sehen. Das hatte mir die Sprache verschlagen. Oft feierten die Hebammen mit den Ärzten ausgelassene Feste. Ich war dann meistens mit der ältesten Hebamme eingesetzt und oft hatten wir alle Hände voll zu tun. Ich lernte aber Vieles von der Alten! Als ich eines Tages aus einem Gebärsaal kam und fragte: "So, was habt ihr eben über mich getratscht?" guckten sie erstaunt und fragten: "Hast Du das bemerkt?" Ich redete "Tacheles": Die Beziehungen zwischen Hebammen und Gynäkologen (damals sagte ich, wenn ich wütend war, Gynäkokokken). Einer sagte nette Worte zu mir und mit vielen Ärzten hatten wir ein freundschaftliches Verhältnis (Naja, viele hatten Liebesbeziehungen mit Hebammen). "Du musst wissen, dass wir bisher alle aus Zürich kommenden Hebammen weg geekelt haben", sagte eine Kollegin zu mir. Ich setzte mich durch, dass bei der Gebärenden, die ich betreute, keine «Visite» gemacht wurde, denn das fand ich unsinnig. Da sagte ein Arzt, als er die Töre öffnete: "Aha, Regina regiert. Da gehen wir nicht rein". Ich wurde plötzlich geschätzt und als Team-Mitglied anerkannt.
Als ich genug von der Doppelfunktion (Hebamme und klinische Schulschwester) hatte, ging ich an die Hebammenschule und arbeitet fortan dort. Den Begriff klinische Schulschwester gibt es heute nicht mehr. Ich war mit Leib und Seele Hebamme und brannte darauf, den Schülerinnen mein Wissen und die Erfahrungen weiterzugeben. Ich bemerkte aber auch, dass ich als "Teilzeitarbeitende" öfter auf die Stationen geschickt wurde, als die Vollzeitangestellten. Das thematisierte ich im Team. Ich hatte eine Statistik angefertigt. Eine Kollegin sagte zu mir, "ach, mit 100% reicht es, 80% zu leisten. Sonst macht man sich kaputt". Ich allerdings arbeitet mehr, weil ich zusätzlich an Sitzungen teilnehmen musste. Eine meiner Kolleginnen wurde wegen Überlastung drei Wochen krankgeschrieben und schickte eine Karte aus Fernost (aus den Ferien). Warum tat ich das nicht auch? Die Schulleiterin mochte mich nicht. Sie fragte mich einmal, ob ich ihren Job wolle. Da war ich sehr erstaunt, weil mir das nie eingefallen wäre. Später an einer Veranstaltung habe ich eine ehemalige Schülerin getroffen, die mir vorgeworfen hat, auch wegen mir sei sie nicht Hebamme geworden, weil ich ihr eine schlechte Note gegeben hätte. Ich erinnerte mich nur, dass sie immer gemotzt hatte, egal ob im Unterricht oder im Gebärsaal. Aber die positiven Beispiele überwiegen. Es gibt zahlreiche Mädchen, die durch mich auch Hebamme geworden sind.
Eine starke Belastung war für mich der juristische Prozess einer jungen Kollegin. Diese junge Kollegin arbeitete nachts einige Monate nach ihrem Diplom, als sie alarmierende Herztöne hörte und mehrmals dem Gynäkologen anrief. Der sagte ihr vom Bett aus irgendetwas, jedenfalls ist er nicht erschienen, wie sie es gewünscht hätte. Als er morgens kam, war es zu spät. Das Kind starb. Es geschah in einem Spital, wo heute keine Geburtshilfe mehr betrieben wird. Das Gericht sprach den Arzt frei und belastete die Hebamme. Also wurde sie angeklagt und ich war ihre Zeugin. Durch meine Aussage wurde sie frei gesprochen . Der Gerichtspräsident gab mir danach das Protokoll zur Unterschrift. Da ist mir leider entschlüpft: "Wenn mal der Chef angeklagt würde, käme ich gern als Zeugin. Was der sich leiste, gehe auf keine Kuhhaut." Später wurde er tatsächlich angeklagt und verurteilt. Damit hatte ich aber nichts zu tun. Ich hatte dort nur ein paar Monate ausgeholfen. Ich war froh, dass es für meine unschuldige Kollegin nebst einem Riesen-Schock ein Happy End gab.
Die selbständige Hebammentätigkeit lockte in den 90-er Jahren erneut sehr stark. Deshalb kündigte ich und erwarb ein paar Jahre meinen Unterhalt damit, Frauen im Wochenbett aufzusuchen. Es war eine schöne Zeit, nur manchmal getrübt von Eifersüchteleien. Wenn ich einmal ein freies Wochenende brauchte, suchte ich eine Stellvertretung. So gab ich alle Informationen an eine Kollegin weiter. Ich betreute damals sechs Wöchnerinnen. Diese fragte: "Warum betreust Du so viele Frauen?" Die ältere Kollegin habe nur zwei. Sie meinte, ich würde der Älteren die Frauen "wegnehmen". Da lachte ich und sagte: "Wir leben in einem freien Land. Konkurrenz hat noch nie geschadet". Jedenfalls verdiente ich meinen Lebensunterhalt selbst. Ich strebte zeitlebens Unabhängigkeit an.

Weiterbildungen
Ich besuchte zahlreiche Weiterbildungen innerhalb und ausserhalb des Gesundheitswesens. Die diversen Weiterbildungen und Rollen verhalfen mir dazu, neue Horizonte anzustreben - Weiterzumachen - Weiterzukommen und meinen Beruf nicht aufzugeben. So verdiente ich erfolgreich in drei verschiedenen Kantonen als frei praktizierende Hebamme meinen Unterhalt. Später als über Fünfzigjährige habe ich den Bachelor of Science in Pflege erworben. Ich hätte es mir nie zugetraut, wollte damals vorwiegend wissen, wo ich beruflich und privat stehe. Und es schien mir günstiger zu sein, an der Fachhochschule auf "Herz und Nieren" geprüft zu werden, als eine (teure) persönliche Beratung. Ich wollte nur einzelne Module besuchen. Damals war aber der Besuch von einzelnen Modulen noch nicht möglich. Darum dachte ich, ich studiere mal so lange, bis es mich rausspickt. Mir gefiel am Hebammenberuf das Tasten, Abhören, Untersuchen und Einschätzen der Situation unter der Geburt. Ich wollte dies auch bei Kranken tun: Lunge und Bauch abhören, Winkel von Gelenken ausmessen und so weiter. Ich hatte davon gehört, dass es die Möglichkeit gäbe, im «Vorzimmer» eines Arztes bereits die Anamnese und ersten Symptome der Patienten aufzunehmen. Das gab es aber in der Schweiz (noch) nicht. Die Rollenvielfalt erlebte ich mehrheitlich positiv. Ohne gezielte Weiterbildungen hätte ich dies alles nie geschafft. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Im Keller standen einige Ausgaben aus den 90-er Jahren der Zeitschrift des Berufsverbands, die ich ad Interim als Redaktorin führte, wo ich im Zentralsekretariat als Teilzeit-Angestellte arbeitete. Ein Thema einer Ausgabe lautete: "Familienpolitik". Als Redaktorin der verschiedenen Artikel gab ich mein Bestes. Allerdings gestaltete ich ein Titelbild, das ich so heute nicht mehr machen würde: ein Bild von Freunden als Grossfamilie… sie foppten mich danach noch lange. 1995 organisierte und moderierte ich am Schweizerischen Frauenkongress einen Workshop mit dem Titel: "Pränatale Diagnostik aus ethischer, medizinischer und rechtlicher Sicht". Eine Kollegin sagte mir: "Jetzt kannst Du stolz auf Dich sein. Du hast viel erreicht." Ich fand diese Aussage etwas eigenartig, denn ich fühlte mich gerade überhaupt nicht so. Im Zentralvorstand des Berufsverbands war ich für das Ressort PR und Information verantwortlich. Unter meiner Initiative konnte sich der Verband durchringen, ein "neues" Logo und neue Broschüren zu drucken. Das Logo besteht noch heute. Vorher hatte ich in der Sektion wichtige Grundlagendokumente ausgehandelt. Diese wurden erst kürzlich geändert.
Die grösste Herausforderung war, als mir klar wurde, dass mich der Hebammenberuf nicht mehr ausfüllte. Ich bemerkte allmählich und stets stärker, dass ich zur Überbevölkerung der Welt genug beigetragen hatte. Das Gefühl, immer wieder dasselbe zu erleben, weckte in mir nach der langen Berufszeit (in den Wechseljahren) das Bedürfnis, etwas zu verändern. So begab ich mich von der Geburt zum Tod. Das bedeutete, dass ich anstatt im Spital oder freiberuflich in Pflegeheimen arbeitete. Es wurde rasch klar, dass als Diplomierte dort die anspruchsvollsten Situationen auf mich warteten. Ich fand mich dort teils sehr einsam und allein auf weiter Flur. Es gab viel Umstrukturierung und genauso viele Konzepte. Geronto-psychiatrische Abteilungen wurden geschlossen, verlegt, respektive neu gebaut und neu eröffnet.
Diplom zur Erwachsenenbildnerin
2003 bis 2006 bildete ich mich zur Erwachsenenbildnerin HF aus. Dies beinhaltete Organisation, Leitung und Führung. Damals wollte ich weg von der Geburtshilfe hin zum Lebensende. Ich fand, das passte gut zum Lebensanfang, sozusagen als Abschluss des Lebens zum Übergang in die andere unsichtbare Welt. Zu dieser Zeit wandelten sich die Pflegeheime in professionelle Institutionen. Das Heimleiter-Ehepaar wurden durch Geschäftsführerinnen ersetzt. Die Bereiche Hauswirtschaft und Pflege wurden voneinander getrennt. Es begann die Zeit für Berufsbildnerinnen und Einschätzungssysteme der Pflegebedürftigkeit (RAI- und BESA-System). Eine Diplomierte hatte viel "Bürokram" zu erledigen. 2007 durfte ich beim Konzept und der Umsetzung einer IV-Ausbildung in den Kantonen Bern und Aargau mitarbeiten. Ausserdem bekam ich eine Stabstelle zur Weiterbildung und Implementierung von gerontotherapeutischen Inhalten auf drei Demenzabteilungen. Ziemlich ernüchtert von der Arbeitslast und den Arbeitszeiten gab ich nach fünf Jahren auf. Pflegeheime will ich vor allem von aussen sehen.
Berufskolleginnen
Mit einigen wenigen Berufskolleginnen habe ich regelmässigen Kontakt. Mit den Frauen vom Kurs 77 besuchen wir jährlich unsere damalige Schulleiterin im Maggia-Tal. Es wird jeweils unterhaltsam. Eine Hebamme aus Zürich treffe ich immer wieder mal. Kürzlich auf dem Bürkliplatz am Flohmarkt. Es gibt dann Einiges zu besprechen. Die ehemaligen "Oberhebammen" aus Bern und Zürich waren ausserordentliche Persönlichkeiten. Diese waren mehr als Vorbilder, wahrscheinlich Mentorinnen für uns damaligen Jungen. Sie haben es nicht leicht gehabt im Leben, aber das Leben gut gemeistert. Und gestern habe ich einer aus dem Beraterteam geschrieben. Wir treffen uns zum Kaffee trinken. Ein intensives Erlebnis war die Erstellung eines Konzepts für den Besuchsdienst AG und BE, das ich mit zwei anderen Frauen definierte und dann auch in den ersten Jahrgängen unterrichtete.

Ich erlebte viele Wechsel. Heutzutage ist das keine Seltenheit, doch zu "meiner" Zeit lernte man einen Beruf und blieb auch an der Stelle, bei der man sich wohl und anerkannt fühlte. Bei mir wäre es die Hebammenschule gewesen, wo ich als Lehrperson fungierte. Wenn ich das befolgt hätte, hätte ich in den Nullerjahren zuerst einen Bachelor- dann einen Master-Abschluss angestrebt und wäre Fachhochschullehrerin geworden. So kam es aber nicht. Ich kannte einige Hebammen, die unglücklich wurden, wenn sie nicht regelmässig eine Geburt hatten. Das gab ihrem Leben Sinn (so jedenfalls empfanden sie es). Ich wollte nicht andere dazu benutzen, meinem Leben einen Sinn zu geben. Nach ungefähr dreissig Jahren Hebammentätigkeit sowie einigen schwerwiegenden Erlebnissen im Bereich der Geburtshilfe, zog ich mich freiwillig aus dem Beruf zurück. Die Utensilien gab ich an jüngere, freipraktizierende Kolleginnen weiter. Es fühlte sich gut und richtig an. Wir sagten uns oft, dass ein Mensch sich verändern sollte.
Sozialpädagogin auf einer Wohngruppe
Ich wurde Miterzieherin auf einer Wohngruppe einer Schule mit IV-Anlernenden. Von dort kenne ich eine meiner besten Freundinnen, welche aktuell als Schulleiterin amtet. Weil ich vorher im Spital auf exakte Stellenbeschreibungen geachtet hatte, wunderte ich mich, dass es im sozialpädagogischen Bereich keine Stellenbeschreibungen zu geben schien. Das schlug ich vor und lieferte einen Vorschlag dazu ab. Das kam beim Betriebsleiter nicht so gut an. Ich beschloss, nach einiger Zeit weiter zu ziehen. Und wohin?
Beratung in drei Sprachen
In eine Beratungsfirma in der Privatwirtschaft. Dort beriet ich Laien zu medizinischen Fachthemen in drei Sprachen (deutsch, französisch und italienisch). Englisch war Voraussetzung. Zu Beginn stand ein halbtägiges Assessement zur Fach- Sozial und Selbstkompetenz. Herausragend wurde meine Fähigkeit kommentiert, mich rasch auf Wesentliches zu konzentrieren. Danach stand eine Weiterbildung zum Thema: Kundenfreundliche Beratung am Telefon an. Ich arbeitete dort vier Jahre. Berufsbegleitend besuchte ich zudem eine Ausbildung in Erwachsenenbildung, um eine zusätzliche Funktion zu bekleiden. Erneut war ich für Neu-Eintretende und deren Schulung mitverantwortlich. Neu war ich mit einem sensiblen, sich selbst überschätzenden Vorgesetzten konfrontiert. Durch ein "schlechtes" Management verlor ich meinen Job und das Unternehmen drei Viertel seiner Kunden an die Konkurrenz. Na. was sagte mir da mein Sohn? "Was Dich nicht umbringt, macht Dich stärker." Kenne ich irgendwie... Schlussendlich setzte ich mich mit mir und meinem Berufs-Überdruss auseinander.
Stabstelle im Pflegeheim
Ich begann in einem Pflegeheim, das vom Kanton dazu verknurrt wurde, sich im Bereich Pflege-Qualität zu verbessern. Heimleiter war damals ein ehemaliger Agronom. Die Jahre als Stabsstelle zur Implementierung der integrativen Gerontotherapie (IGT) liefen erfolgreich für den Betrieb. Bis sie zu Ende gingen und der Heimleiter eine weniger gut Ausgebildete - die bisher ein Restaurant geführt hatte - und keine Ahnung vom Thema hatte, als Leiterin der Demenz-Abteilungen einsetzte. Was soll man gegen Inkompetenz und Ignoranz tun? Kündigen mit Begründung und vorher eine Aussprache halten, die nichts nützt, wie Frau bereits zum Voraus ahnte? Was tun? Zurück in die Beratung zur Konkurrenz, welche "nur" Ärzte anstellt und ein Pilotprojekt mit Pflegefachfrauen anbot? Sechs Jahre dauerte die Anstellung. Die Arbeit geschah hauptsächlich im Home-Office. Diese schien mir einigermassen zufriedenstellend, dann wurde allen Pflegenden zu Weihnachten gekündigt. Grund: das Management hatte sich erneut dazu entschlossen, nur noch Ärzte beraten zu lassen (auch aus finanziellen Gründen). Das kam etwas überraschend. Meine letzten Jahre vor der Pension verbrachte ich nochmals im Beratungs-Setting bei der ursprünglich gewählten Privatfirma (medizinische Beratung rund um die Uhr).
Aussensicht von Kollegin
Meine Kollegin von der Hebammenschule sagte mir einmal: "Du bist immer irgendwo engagiert. Deine Flexibilität ist legendär. Aber hier hättest Du es angenehmer gehabt." Sie meinte in der Hebammenschule wäre ich wohl besser gefördert worden, da der Beruf seit 2008 auf das Tertiär-Niveau gehoben wurde. Für die Kompetenzen der Hebammen änderte sich nicht viel, so jedenfalls berichteten es mir Kolleginnen vom Kurs 77 B, die ich 2019 traf. Sie erlebten die Praxis hautnah in einem Zentrumsspital. Die "studierten" Hebammen in Ausbildung riefen die Ärzte viel zu früh, weil sie zu wenig Erfahrung hätten und sich nicht getrauten, die Erfahrenen zu fragen, meinten sie übereinstimmend. Das sei sehr ärgerlich. Ich solle mir nur mal die Kaiserschnitt-Rate ansehen, die über die Jahre immer höher gestiegen sei. Ich hatte mit dem Beruf abgeschlossen und meinte, die Jüngeren sollten sich darum kümmern, wie dieser Beruf sich weiter entwickelte. Als Pensionierte schien mir diese Meinung adäquat.
Sanfte Geburtshilfe mit Singen
Als meine Hebammen-Freundin Ende der 70-er Jahre den damals "berühmt-berüchtigten" Arzt kannte, der die "sanfte" Geburt propagierte, fuhr ich mit ihr nach Frankreich. Meine Absicht war, im Spital in Pithiviers ein Praktikum zu machen (bei einem seiner Schüler) und wir machten einen Ausflug dorthin. Der Chefarzt sang mit den Schwangeren (und den Wöchnerinnen, die daran teilnehmen wollten). Das war schon mal ungewöhnlich. Ich erinnere mich an eine Geburt mit Hebammen in Jeans und nackten Füssen. Sie stellten zur Entspannung der Gebärenden, während den Wehen ein aufblasbares Planschbecken auf. Daraus entwickelte sich die "Wasser-Geburten". Leider war die Schweiz nicht in der EU und die Hebammen scherzten, weil sie meinten, wir hätten eine ganz "schlechte" Ausbildung genossen in der Schweiz. Sie hatten mehr Kompetenzen rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, als wir Schweizerinnen. Leider wurde aus dem Ausland-Praktikum in Frankreich nichts. Der Pionier stellte privat im Gespräch klar, warum er sich so stark einsetzte für die sogenannte "sanfte" oder natürliche Geburt (ohne Gewalt) und fürs Stillen. Er selbst sei per Kaiserschnitt geboren und hätte nur Schoppen gekriegt, nie die Brust. Da sei ein gesundes "Bonding" nicht möglich gewesen. Bonding steht in der Entwicklungspsychologie für den ersten, Bindung stiftenden Kontakt zwischen Mutter und Neugeborenem (Bindungstheorie). Das alles hörte ich da zum ersten Mal und es interessierte mich. In den 90-er Jahren half ich eine Tagung zum Thema "Wasser-Geburt" organisieren und besuchte "Wasser-Shaitsu"- Kurse. Die damalige Leiterin erinnerte mich an ein "Wasserwesen", das an Land unfähig ist zu leben, aber im Wasser aufblüht. Wir hielten lange Kontakt zueinander. Und sie ist stets drangeblieben, egal aus welcher Richtung der Wind gerade wehte.
Aussteigen nach Italien auf einen Hof
Im Frühjahr 1984 brachen wir, drei Paare in die Toscana auf. Wir hatten seit Dezember 1983 unseren Sohn dabei. Ich fühlte mich wie zuhause in Italien, liebte die Leute und ihre Sprache. Ich fand auch zu meiner eigenen Emotionalität. Leider verstanden sich die "Männer", auf die es auf dem Hof ankam, nicht gut. Mein Mann wollte zurück in die Schweiz. Was mich am allermeisten betrübte, ist die Tatsache, dass er es nicht mir besprochen hatte. Er sagte an einer Sitzung: "wir fahren zurück in die Schweiz" - als Fakt. Er trank zudem sehr viel Alkohol. Meine damalige Freundin sagte: "Du, er ist ein Alki - pass auf!" Wie denn? Die Entscheidung brachte eine sofortige Rückkehr nach nur fünfzehn Monaten. In der Toscana arbeitete ich zeitweise als Hebamme (in der Maremma und Toscana). Natürlich war ich bei Hausgeburten dort allein. In der Maremma bekam eine Schweizerin ihr drittes Kind. Ich reiste mit meinem Sohn und dem Hebammenkoffer an. Sie gebar im Tipi. Alles ging glatt. Ich hatte jedoch Infusion und Medikamente dabei, im Fall etwas aufgetreten wäre, was eine sofortige Intervention benötigt hätte. Der Hof hatte kein fliessendes Wasser, aber einen Ziehbrunnen. Und kein Telefon, aber sehr schöne Araberpferde. Ihr Mann garantierte mir, dass er falls nötig sein schnellstes Pferd nehmen würde und beim Nachbarn Hilfe holen. Dieser wäre dann mit dem Cinquecento hergefahren, um uns ins Spital zu fahren, das gute vierzig Minuten entfernt lag. All das war nicht nötig. Eines ihrer Mädchen ist heute selbst auch Hebamme. Scheinbar wird auch diese Hebamme im Gebärsaal manchmal laut, wenn sie findet, die Ärzte gingen zu weit. Wir lachten darüber. Bevor wir aus der Toscana wegzogen, nahm mich unser Nachbar zur Seite (auf einem Fiesta dell'Unità) und stellte mich Verantwortlichen des Spitals vor. Ich solle denen mein Dossier senden, dann hätte ich den Job. Vorher ging ich aber auf die Geburtenabteilung. Und was ich dort antraf, strafte alles Gehörte Lügen. Ich wähnte mich im Mittelalter. Eine Hebamme war allein für Gebärsaal und Wochenbett zuständig. Weil sie sowieso keine Zeit für alle/s hatte, sass sie im Büro und rauchte. Sie erklärte mir die Situation voller Ironie und Resignation. Die Angehörigen brachten das Essen, weil das Spital kein Essen zubereitete. Ich empfand das Spital als sehr heruntergekommen, dabei hatte es keinen allzu schlechten Ruf. Von einer Arbeit dort sah ich deshalb ab. Ich machte 2011 den Bachelor of Sciense in Pflege, weil ich dachte, ich würde vielleicht eines Tages auswandern wollen. Das Ausland lockte. Es kam aber nie dazu.
Nach Italien kehrte ich später ferienhalber und bis heute immer wieder zurück, zum Beispiel in die Toscana zu Freunden mit meinen Kindern,. Eine Sizilienreise gab es mit einem Freund und meiner Tochter. Mit meiner Schwester war ich in Ligurien zum Wandern. Zwei weitere Male pilgerte ich nach Taormina zur Sprachschule und Kulturreise für über fünfzig-Jährige. Dreimalig ging ich allein eine Woche auf Reisen: Elba, Cinque Terre und Ligurien waren meine Ziele. Eine Veloreise mit Eurotrek an der etruskischen Küste entlang war 2018 ein Highlight. Alle Aufenthalte in Italien erlebte ich sehr intensiv. Und natürlich mehrmals und immer wieder die Liparischen Inseln, in ganz verschiedenen Gruppen. Auf Stromboli sagte mir eine Fischer auf Italienisch: Dein Körper ist gesund und froh, aber Deine Seele weint". Dort übernachteten wir auf dem Krater des Vulkans und ich besass magische Bilder dieses Ausflugs, aber die gab ich weiter. Wo sie heute sind, kann ich nicht sagen. Es beeindruckte mich unglaublich, dass unser Erdinneres eine solch unglaubliche Kraft in sich trägt, die ein Mensch bei diesem ausbrechenden Vulkan erleben konnte. Damals war der Stromboli noch aktiv. Ferienhalber war ich in Amerika und Afrika. Dazu gibt es einige Texte, die ich hier beiseite lasse.

Erfahrung im Privatspital mit Belegärzten
Ich erinnere mich an die 90-er Jahre. In einem der Privat-Spitäler, wo ich 500.- Franken weniger verdiente als vorher. Ich war zuerst nur Aushilfe, wurde dann aber fest angestellt. Dort kam es zu einer heftigen Krise mit einem der Belegärzte im Bereich Gynäkologie/Geburtshilfe. Ich spielte darin die Rolle der Hebamme. Begleitumstand war, dass ich zwei Dienste nacheinander absolvieren musste, weil eine Kollegin sich kurzfristig krankmeldete und kein Ersatz gefunden werden konnte. Ich arbeitete also von 07.00 bis 23.00 Uhr. Als ich den zuständigen Gynäkologen tags darauf zum wiederholten Mal aufforderte, eine Frau, die ich betreute und um die ich mich sorgte, unverzüglich ins Zentrums-Spital mit Intensiv-Pflege zu überweisen, fragte er mich, ob ich mich überfordert fühlte. Ich beantwortete ihm seine Frage, indem ich ihm vor Augen führte, dass deren Kind und sie selber in höchster Lebensgefahr schwebten (was ihm offensichtlich nicht bewusst war). Kurz und gut: ich suchte Hilfe und bekam keine - weder von der Vorgesetzten (sie hätte in ihrem Beruf erst zwei Geburten geleitet und fühlte sich überfordert. Sie bot mir keine Unterstützung an), noch von den Kolleginnen (das ist nicht unsere Sache) oder den anderen Gynäkologen (da mischen wir uns nicht ein). Daher sprach ich mit den Anästhesisten und einem Hämatologen darüber, weil ich vor einer massiven Gerinnungsstörung Angst hatte. Sie halfen mir, indem sie mich anwiesen, ein ärztliches Konsilium anzufordern. Das tat ich (Kompetenzüberschreitung inklusive) und dann ging der Zirkus los. Notfall-Szenario mit einem toten, über fünf Kilo schweren Kind war die Folge. Die Betreuung der Frau, die in Todesnähe gestanden hatte und sich möglicherweise dessen nicht bewusst war und ihr Mann hatten wohl Einiges mehr mitbekommen, als mir lieb gewesen wäre. Er klagte den Arzt und das Spital ein. Ich wurde zum Direktor bestellt und gefragt, ob ich dem Vater zur Klage geraten hätte. Ich fand das absurd und wähnte mich in einem schlechten Film. Ich kündigte daraufhin und gab alles, was ich hätte behalten können, zurück mit den Worten: "Von hier möchte ich nichts mehr mitnehmen, am liebsten auch keine Erinnerungen mehr!"
Dabei hatte alles gut angefangen. Ich hatte mich mit einem der schwierigsten Ärzte (vor dem sich die Kolleginnen fürchteten) bewährt und die Nerven behalten, was meine Kolleginnen mir hoch anrechneten. Zudem machte ich bei jedem Wunsch eines zukünftigen Vaters mit, der die anderen als "Furz" beschrieben. Der zukünftige Väter wollte die ganze Geburt filmen. Es war eine sogenannte VIP (Very Important Person). Geburtshilfe à la carte, wie es Ihnen beliebt, war die Devise. Trotzdem wurde mir schon vor der Kündigung bewusst, wie allein ich dort stand. Einmal blutete eine junge Frau nach der Geburt. Das Blut lief, wie aus dem Wasserhahn, den man aufdreht. Der Arzt entfernte sich mit den Worten: "Das bekommen Sie schon allein in den Griff." Atonie nennt sich der Fachbegriff, vor dem sich jede Hebamme fürchtet. Dank einer lieben Kollegin, die eine zweite Infusion legte und mir zur Hand ging, gelang es tatsächlich, die Situation in den Griff zu bekommen. Ihr Mann kaufte uns zwei Taschen voller Lebensmittel zum Dank. Und mir steckte er eine Note in die Brusttasche, die ich nicht nehmen wollte. Diese Anstellung war eher "schlecht" für mein Dossier. Ich hatte dort gearbeitet, weil ich nah wohnte, was praktisch war. Danach arbeitete ich weiter weg, weil eine Kollegin mich holte und dachte, ich würde mich im Regional-Spital gut als Vorgesetzte der Geburten-Abteilung eignen. Das wussten einige findige Kolleginnen zu vereiteln. Mit zwei Belegärzten mobbten sie mich weg. ZU jener Zeit wurde ein befreundeter Arzt als Chefarzt aus Bern gewählt, (den ich sehr gut mochte) welcher eine klare Linie in die Arbeit der Ärzte und Hebammen rein brachte. Ich wurde also unerwartet rasch wieder entlassen. Hinterher hörte ich, man habe sich gefürchtet vor einer Hebamme mit "Gewerkschafts-Interessen". Ich war damals aktiv im Berufsverband einer grossen Sektion mit über 500 Mitglieder. Eine Kollegin steckte mir die Information: Einer der Belegärzte dachte, ich würde über ihn sprechen, als ich meiner Kollegin flüsternd Rapport abgab, was zu Dienstende Routine ist. Ich berichtete flüsternd, um ihn nicht zu stören. Ein Missverständnis, mit wilden Phantasien befeuert, was alles passieren würde, falls ich bliebe. Ich dachte mir: Andere werden wegen viel schlimmerer Missverständnisse sogar ums Leben gebracht. Also hatte ich eigentlich Glück. Mir genügte diese Erfahrung, dass ich mich einem anderen Bereich zu wandte.
Kleines Pflegeheim auf dem Land
Ich war in einem kleinen Heim in einer Rand-Region, um mich zu erholen, wie ich dachte. Und genau dort wurde alles unaushaltbar. Hauswirtschaft und Pflege waren (noch) nicht getrennt in zwei Bereiche. Alle machten (fast) alles. Die Vorgesetzten, eine Heim-Paar behauptete, dass der Arzt in seiner Praxis die Sorgfaltspflicht für Morphium, das bei uns (offen) lagerte, habe. Seine Praxis war nicht im gleichen Dorf, wo das Heim stand. Ich durfte nicht lachen, denn das hätte den Konflikt verstärkt. Ich führte dort das "Vier-Augen-Prinzip" ein, was man mir als Respektlosigkeit vorwarf. Das galt für «Gift-Medikamente» schon längst schweizweit, war aber noch nicht bis dorthin gelangt. Lange hatte ich die Antwort des Apothekers gespeichert, worin steht, wie mit rezeptpflichtigen Medikamenten umzugehen sei. Ich versuchte dort an einem Team-Tag die Feedback-Regeln für die Pflegenden einzuführen. Das passte der "hinten-durch"-agierenden Heimleiterin gar nicht. Sie benutzte das "schmutzige" Instrumentarium, um mich loszuwerden, auch genannt Mobbing. Ich kündigte dann auch mit Hinweisen zu den aktuellen Missständen im Heim. Durch die Schilderung der Zustände, bekam ich eine Stelle angeboten von einem befreundeten Pflegedienstleiter.
Demenz-Erfahrungen
Demenz Kranke empfand ich nie als die grösste Herausforderung, sondern hilflose Vorgesetzte, ungebildetes, angelerntes Personal, Überlastung und fehlende Freizeit, resp. Anrufe in den Freitagen zu irgend welchen pflegerischen Aufgaben. Ich verzweifelte an all den schön formulierten Pflegeleitbilder, die beispielsweise für Demenzkranke eine vierundzwanzig Stunden Eins-zu-Eins Betreuung versprachen. Wie sah der Alltag oft aus? Zwanzig mittlere bis schwer demente Menschen mit vier bis sechs Pflege-Personen betreuen war ein Ding der Unmöglichkeit. Dazu kamen herausfordernde Situationen mit Menschen, deren Tod bevorstand. Angehörigen-Pflege und MitarbeiterInnen-Schutz waren weitere Arbeitsfelder. Offenbar sind die Zustände nicht wirklich besser geworden. Sonst mangelte es nicht konstant an professionellem Personal in der Langzeitbetreuung und -pflege. Wenn ich mit Stress zu kämpfen hatte, verzweifelt war ob der Zustände, sang ich, ging in die Natur oder sah mich um, atmete tief durch und dachte: In einem Jahr ist das alles überstanden. Und wer spricht noch davon? Niemand... Was ganz ausschlaggebend war, waren die vielen lieben Kolleginnen, vor allem aber auch die leitenden Vorgesetzten, die mir Vorbild wurden und mich bestärkten in meinem Leben und Wirken. Ich hatte auch Besuche zuhause und bedanke mich bei allen, deren Goodwill ich erleben durfte. Meine damaligen Kolleginnen sehe ich vereinzelt und wir fühlen uns privilegiert, die Wandlungen persönlich miterlebt zu haben, davon aber mit dem Rentendasein Abstand nehmen zu dürfen. Es bleibt wohl Vieles unerwähnt, was ebenso genannt und beschrieben werden sollte, nur: wen interessierts? 
Mein erster Mann und ein Kind, das stirbt
Meinen ersten Mann habe ich erst als Besucher in der WG mit meinen Geschwister wahrgenommen. Scheinbar hat er das andersrum erlebt. Ich tat mich erst schwer, mich in einen "Fremden" zu verlieben. Es brauchte viele Unternehmungen: Flussschwimmen, Wochenendausflüge mit Kollegen etc. bis ich mich getraute, ihn als meinen Freund zu betrachten. Ich war seine zweite Frau. Das war etwas schockierend, denn ich hatte nie eine Frau gesehen mit ihm. Er hatte etwas von einem "Bad Boy" an sich, das mich faszinierte. Zum Beispiel lief er manchmal im Sommer in einem Kaftan rum und zog sich Babouches an. Er sprach einige Brocken Arabisch, war aber Schweizer. Mit ihm bereiste ich Amsterdam, Tunesien, Algerien und Marokko. Durch ihn lernte ich ein Marktfahrer-Paar kennen, das jahrelang auf dem Rosenhof in Zürich ausländische Waren verkaufte. Es wurde nie langweilig mit ihm. Als ich Hebamme lernen wollte, schlug er vor, an der Langstrasse in Zürich zu wohnen. Das wollte ich aber keinesfalls. So zogen wir in ein Bauernhaus in einem kleinen Dorf. Dort wurde ich schwanger und gebar mein erstes Kind. Ich erinnere mich an Feste, an Musik, an Fotografien schöner Landschaften und sehr viel Intensität. Nach acht Monaten starb unser kleiner Junge. Mein Mann sagte zu mir: "Sei nicht traurig. Wir machen wieder eins..." Es war für mich ein Schock, da ich in der Nacht als der Kleine starb, im Gebärsaal arbeitete. Morgens holte mich mein Mann vom Bahnhof ab. Abgemacht war, dass wir zusammen mit dem Kleinen auf den Markt gehen würden. Er kam aber allein. Der Kleine schlafe noch, sagte er mir. Ich habe das Bild, wie der kleine weisse Sarg die Treppe runter getragen wird, fest in mir eingebrannt. Ich fühlte körperlichen Schmerz in der Herzgegend. Ich trennte mich von diesem Mann, als unser Kind plötzlich verstarb. Ich zog weg aus dem schönen Haus in eine WG mit Psychologen. Es kam eine Krisenzeit für mich, wo ich mich sehr instabil erlebte. Ich machte einen Trauerkurs in Zürich. Das war bei einer Leiterin, die selber ein Kind verloren hatte (an die Drogen). Die Tatsache, dass ich sie an ihr eigenes verstorbenes Kind erinnerte und sie mich bat, sie ausserhalb des Kurses weiter zu treffen fand ich eigenartig. Sie hat Videosequenzen von mir, aber ich distanzierte mich, als ich bemerkte, dass ich ihr als Ersatz für ihre verlorene Tochter dienen sollte. Kürzlich beim Einfahrt in den Bahnhof Zürich erinnerte ich mich plötzlich wieder an sie, da der Raum für den Kurs in einem damaligen SBB-Gebäude stattfand.
Gruppe D
Eine liebe Kollegin hat mir sehr stark geholfen und die Hebammen der Gruppe D in Zürich unterstützten mich, so gut sie konnten. Irgendwann fand ich wieder Tritt, nachdem ich total die "Pedale" verloren hatte. In der Zeit des "Verloren-seins" war ich oft stundenlang unterwegs (mit und ohne Hund). Ich sass am Feuer und versuchte, mich wieder zu fassen, was lange dauerte. Gut, dass ich Beruhigungspillen und Schlafmittel ablehnte. Ich war der Meinung, dass man als Mensch den Schmerz und die Trauer spüren sollte, damit alles irgendwann vorbei gehe. Wir hatten ja schon als Kind gelernt, dass der Indianer keinen Schmerz kennt. Mit meinem verheirateten Mann konnte und wollte ich nichts mehr zu tun haben. Unbewusst machte ich ihn für den Tod verantwortlich. Er war alleine zuhause und ich hatte Nachtwache, als der Kleine starb. Ich meine, dass ein Kind verlieren zu den heftigsten Schicksalsschlägen gehört, die einer Mutter widerfahren. Aber ich wusste auch, dass ich nicht die Einzige war, der dies geschah.
Mein zweiter Mann und kollektive Betreibsführung
Es dauerte etliche Zeit, bis ich mich in meinen zweiten Mann verliebte. Er war in einer WG, in der ich mit einer Freundin in der Freizeit Schmuck herstellte. Sie wohnten in einem Altstadthaus zu siebt. Es wurde oft gesungen nach dem Essen und mein Zukünftiger musizierte. Ich dachte, wenn einer so gefühlvoll spielt, ist er bestimmt ein einfühlsamer Mann. In meiner Erinnerung überwiegen die schönen Momente an jene Zeit. Baden und Wasserbrettsurfen in und auf dem Fluss im Sommer, viel Lachen, Singen und fröhlich sein bedeuteten einen Neuanfang für mich. Beruflich machte ich mich in dieser Zeit selbständig. Es tat so gut nach der finsteren Zeit vorher! An einem schönen Tag kam einer der WG-Leute mit der Info, dass er 120 000.- Franken erben werde. Wer mit ihm zusammen einen Hof kaufen möchte? Es lebten drei Agronomen in diesem Haus. Alle interessierten sich dafür, nicht bloss "Bürobauern" zu werden, sondern ihre Hände schmutzig zu machen. Mein Mann war auch dabei. Also kreierten wir das Projekt "gemeinsamer Hofbetrieb". Zu sechst erstellten wir einen Vertrag und verpflichteten uns, in kollektiver Betriebsführung einen Hof mit gemeinsamer Kasse zu organisieren. 2024 sind das vierzig Jahre her. den Hof werde ich deshalb im Frühjahr 2024 besuchen. Er heisst Lucciola, weil im Sommer jeweils eine Armada von Leuchtkäfer unterwegs waren.
Hausgeburt und Untreue
Als ich 1983 schwanger wurde, plante ich erneut eine Hausgeburt, wie bereits beim ersten Kind. Meine Freundinnen kamen und zwei der Hebammenkolleginnen. Es wurde eine rasche Spontangeburt im Dezember 1983 und im Frühjahr waren wir zu Dritt als Erste auf dem Hof (in der Toscana). Ob ich wieder heiraten würde, wusste ich damals noch nicht. Damals wurde man dazu gedrängt, wenn man Kinder kriegte. Meine Motivation zum Heiraten war eher gering. Ich dachte, dass man die Liebe nicht per Vertrag pachten könne. Es war auch modern, eine sogenannt "wilde" Ehe zu führen. Da war ich aber zu romantisch veranlagt. Beide Männer, die ich geheiratet habe, haben sich nicht an die Treue gehalten. Sie ässen schliesslich auch nicht jeden Tag das gleiche - so oder ähnlich wurde es von ihnen begründet. Sie begründeten Untreue mit dem herrschenden Zeitgeist. Damals redete man von: Sex, Drugs and Rock'n Roll. Ich fand es schick, davon zu reden, aber weniger schick, danach zu leben. Frauen bekamen die Kinder und mussten sich um die Familie kümmern. An dieser Rollenteilung wollten dann die "freien Geister" dieser "modernen" Männer festhalten. Ich schien stets eher pragmatisch zu sein. Dass ich, die sich als Kind vor Betrunkenen fürchtete, ausgerechnet als zweiten Mann einen "Pegeltrinker" auswählte, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Mit Humor und Sarkasmus blicke ich auf diese Zeiten zurück. Illusionen gehören wohl zur Jugend.
Es gab Situationen, die ich heute eher witzig finde. Einmal haben zwei Frauen nach meinem zweiten Mann gefragt (wo er sei). Eine läutete sogar an unserer Haustüre. Ich fragte sie, ob sie hier auf ihn warten und in der Zeit das schmutzige Geschirr abwaschen wolle? Aber es war demütigend. Ich realisierte, dass ich die Hauptlast trug (Kinder, Haushalt, Geld verdienen) und er sich ein "schönes" Leben machte (auf meine Kosten). Daher riet ich zur Ehe-Therapie, die auch stattfand, als die beiden Kinder noch klein waren. Auf Anraten von Freunden gingen wir zu einem System-Therapeuten, der in Wahrheit ein Psychiater war. Beim ersten Mal wollte er wissen, warum wir uns trennen wollten. Darüber waren wir uns ja nicht einig. Er machte Videoaufnahmen, die er analysierte und beim zweiten Mal waren wir beide alleine dort. Das dritte Mal war ich alleine dort, weil mein Mann nicht gekommen war. Ich bekam in aller Deutlichkeit zu hören, dass ich es mit einem Suchtkranken zu tun hatte. Ich sagte immer, ich fühlte mich wie mit drei Kindern, weil der Mann sich in meinen Augen wie ein Kind aufführte. An dieser Sitzung beschloss ich, mich zu trennen. In der Therapie trennte ich mich also vom zweiten Mann. Nach einem Jahr wollte er wieder zu uns zurück kommen. Da hatte ich mich aber bereits so gut organisiert, dass ich das Angebot ablehnte. Es schreckte mich, die Frau eines Alkoholikers zu sein (und zu bleiben) und dadurch selber zur Co-Alkoholikerin zu werden (was mir gottlob erspart blieb). Beide Kinder haben keine Sucht-Problematik. Ich bin darüber sehr froh. Ob es dem Umstand zu verdanken ist, dass sie in einem gesunden Umfeld (ohne Alkohol) aufgewachsen sind?
In schweren Zeiten vergrub ich mich in Bücher, ging in die Natur, hörte Musik und versuchte mir Hilfe zu holen. Das buddhistische Zentrum Beatenberg lud zu Schweige-Retreats ein, von denen ich mir Ruhe erhoffte. Ich erinnere mich an sehr unterstützende Gespräche mit Freunden, denen ich mein Leid klagte. Heute besuche ich das Grab meines ersten Mannes auf dem Bremgartenfriedhof. Ich habe nach seinem Tod 2015 auch seine letzte Partnerin getroffen und wir haben uns auf einem Bank ausgetauscht. Sie sagte mir, dass er fünfmal verheiratet gewesen war. Das wusste ich nicht. Wir witzelten darüber, was er wohl sagen würde, wenn er uns beide so sähe. Er war ein Verfechter der Rohkost, buk sein Brot selber, vertiefte sich in die Astrologie und bot dazu Beratungen an. Seine schwere Erkrankung hatte er vor allen seinen Freunden und Familienangehörigen verheimlicht. Auch mir sagte er nichts, die ich ihn im Tibits ab und zu traf, um mich mit ihm zu unterhalten. Nach dem verstorbenen Sohn bekam er einen weiteren Sohn. Leider kann er seine Enkelkinder nicht mehr erleben. Er hatte immer grosse Freude an Kindern. Dafür widmet sich seine letzte Partnerin, mit der er nicht verheiratet war, rührend um diesen Sohn und seine Familie.

Meine beiden Kinder kamen 1983 und 1986 zur Welt. Der Knabe im Dezember 1983 zu Hause als Hausgeburt kurz bevor wir nach Italien ausgewandert sind. Das zweite Kind im Juli 1986 im Spital drei Wochen zu früh. Ich hatte am Freitag aufgehört zu arbeiten und trat am Montag ins Spital ein mit Blasensprung. Hier nur soviel: das Mädchen kam als Mensch mit Down-Syndrom zur Welt. Heute ist die Tochter 37 und der Sohn 40 jährig. Die Situation um das verstorbene Kind von 1979 schwang stets im Hintergrund mit, denn ich bemühe mich bis heute, mich mit dem Schicksal zu versöhnen.
Erlebnisse mit den Kindern
Weil ich auf dem Land aufgewachsen war und das Draussen sein liebte, ging ich mit meinen Kindern oft und bei jedem Wetter hinaus, denn schlechtes Wetter gibt es nicht, nur schlechte Kleidung. Es gab schöne Momente, als wir im Wald für die Zwergen Häuser bauten, Drachen bastelten und sie im Wind fliegen liessen oder an eine bestimmte Stelle spazierten und erforschten, was uns begegnete. Als die Kinder klein waren wollten wir, dass sie die Nuggis loswürden. Wir Mütter erfanden ein Ritual, das den Kindern Wünsche erfüllte, wenn sie ihren Nuggi abgaben. Ein anderes Mal gingen wir zum Jahresende zum Fluss, hatten Zettel mit Wünschen dabei und selbst gebaute Schiffchen, die wir losschickten. Als wir die Kinder fragten, was sie sich gewünscht hätten, sagten sie: Wünsche verrät man nicht, sonst gehen sie nicht nicht in Erfüllung. Später erfuhr ich, dass mein Sohn sich gewünscht hatte, dass es Frieden gebe auf der Welt. Mein Sohn war noch klein, als der Vater (mein Mann) uns verliess. Er erzählte es dem Kinderarzt und ich hörte seine Verlustangst heraus. Darum bemühte ich mich, mit dem Vater der Kinder zeitlebens ein "gutes" Verhältnis zu haben. Wir lebten im Nordquartier einer Stadt und einigten uns darauf, die Kinder wochenweise zu betreuen. Immer Mittwochs kochte der eine Elternteil Mittagessen. So kamen Vater, Mutter, Kinder wöchentlich zusammen und konnten einander erzählen, was geschehen war. Was organisiert werden sollte oder was in der Schule anstand. Heute lebt mein Sohn mit seinen beiden Kindern in einem ähnlichen System im selben Quartier, in dem er aufgewachsen ist.
Wir hatten zwei Vereinbarungen, wie wir die Kinder erziehen wollten, ein 10-Regelsystem für die Erziehung der Kinder, das ich bei einem Umzug fand und schmunzeln musste. Eine humanistische Haltung war daraus zu lesen. Und dann noch eine Vereinbarung, wie wir Eltern uns verhalten sollten. Hab ich leider weg geworfen, aber ich fand beides sinnvoll. Jedenfalls half es über die gesamte Schulzeit hinweg, eine konstante Haltung aufrecht zu erhalten. Es wurde erst schwierig, als mein Sohn in die Pubertät kam. Ich erinnere mich an seine Schwarz-Weiss-Sicht, die recht anstrengend war. Einerseits schickte er mir zum Geburtstag eine selbst gestaltete Karte, aber am darauf folgenden Besuch beschimpfte er mich als strenge "Bünzlimutter". Weil ich mich erfrecht hatte, einen Freund zu haben, zog er zum Vater. Aus seiner Sicht war er der Mann in der Familie. Das war hart. Ich lud ihn wöchentlich ein, weil ich mich erinnerte an meine Zeit der Adoleszenz. Es schmeisst Deine Gefühle und Haltungen hin und her. Ich finde, dass diese Zeit sehr unterschätzt wird und bin froh darüber, dass es in der heutigen Zeit vermehrt Angebote gibt, wo sich Jugendliche hinwenden können. Noch immer zu wenige? Jedenfalls schauten wir mal gemeinsam Fotos von früher an. Und bei einem Foto, auf dem er Dreizehn war, sagte mein Sohn. "Ach. Ich war aber jung, als ich zu kiffen begann". Ich hatte nichts bemerkt davon. Er schilderte diese Zeit in wenigen Worten. Er hörte dann gottlob auch wieder damit auf, anders als sein Vater, der das "Hobby" meines Wissens lebenslang pflegte seit er Fünfzehn wurde. Dem sagt man "Selbstmedikation", lernte ich.
Theaterspielen
Jeden Herbst in den Ferien durften die Kinder im Theater am Schützenweg mitmachen. "Amarganth, der leuchtende Stein" blieb mir in Erinnerung, weil wir davon einige Fotos haben. Von den anderen Theateraufführungen blieb mir nicht mehr viel im Gedächtnis, aber es gibt sie heute noch. Mein Sohn ist nicht mehr als Kind, sondern als Erwachsener dabei, indem er Bühnenbilder gestaltet. Ein Jubiläumsplakat für den Spielplatz wo das Theater für Kinder stattfindet, erstellte er 2023. Mein Sohn war und ist stets der grösste Kritiker meines Lebens. Ich gebe mir alle Mühe, dem stand zu halten. Es ist nicht immer leicht. In den Ferien in Italien, als wir in einem Restaurant assen, setzte er sich als Schulknabe an einen anderen Tisch zu Unbekannten. Warum? Ich hatte einen Salat mit Meeresfrüchten bestellt und er hatte mich ausgeschimpft, dass ich dies esse. Es gäbe davon bald keine mehr im Meer. Was mir eigentlich einfalle? Die deutsche Familie, zu der er sich gesetzt hatte, nahm es gelassen. Aber ich wusste, dass es ihm todernst war. Als sein junger Cousin sich erschoss, sagte er mir: Das hätte gut auch ich sein können. Da erschrak ich. Wir sind sehr offen miteinander.
Samichlausentag
Am Tag des St.Nikolaus erlebte ich mit den Kindern und vielen anderen jeweils Inszenierungen eines Jugendarbeiters, der zeitlebens ein Original blieb. Er schrieb einmal einen Brief, dass er mit den Flughirschen noch in Russland sei und nicht wisse, ob er am 6. Dezember zurück bei uns angekommen sei. Wir sollten uns also zum "Schmutzli" in den Ostermundigenwald begeben. Dort war ein Weg mit Lichter gesäumt, der Schmutzli seilte sich über eine Felswand ab und der St. Nikolaus, der später eintraf, zeigte den Kindern einen Film von seiner Russlandreise und den armen Kindern dort. Er hatte alles selber gezeichnet. Er gab bekannt, dass nun alle Kinder sich bei Suppe, Hot-Dogs und Kinderschnaps (ohne Alkohol) bedienen dürften. Wenn es Kinder gäbe, die Reklamationen hätten zu ihren Eltern, sollten sie zu ihm kommen. Er würde dann schon zum Rechten sehen. Meine "behinderte" Tochter ging hin und beklagte sich über mich als zu strenge Mutter. Also liess ich sie an dem Abend tun und lassen, was sie wollte. Das Ergebnis war überraschend: sie erbrach sich im Taxi am Morgen auf dem Weg zur Schule. Nachmittags kam der Taxifahrer mit einem anderen Auto und sagte, so etwas habe er noch nie gesehen. Meine Tochter habe eine riesige Menge erbrochen, wie ein Erwachsener. Er habe das Taxi in die Reinigung gebracht, so schlimm sei es gewesen. Er sprach noch oft davon, wie erschüttert er gewesen sei. Der sagenhafte St. Nikolaus kam auch einmal im Floss mit der Melodie der schönen blauen Donau in grosser Lautstärke. Die ganze Szene erinnerte mich an den Film "Fitzcarraldo" und eine leicht bizarre Situation, als die Harassen mit Mandarinen und Nüssen beinahe vom Floss rutschten, als er anzulegen versuchte. Mit beherztem Eingreifen und ein paar nassen, kalten Füssen wärmten wir uns danach an einem Feuer.
Meine behinderte Tochter
Der Anfang ihres Lebens war schwer: sie kam zu früh, hatte eine "Linksverschiebung", also Anzeichen einer Entzündung im Blut und wurde mit Antibiose behandelt. Später sagte mir ein Arzt, dass das ein Fehler gewesen sei. Ihr Immunsystem sei dermassen geschwächt gewesen, dass sie deshalb die ersten zwei Jahre ihres Lebens mit Infektionen verbrachte. Am schlimmsten war eine bakterielle Hirnhautentzündung mit sechs Monaten. Jedenfalls empfand ich starke Beschützerinstinkte, wollte sie endlich gesund pflegen, was gottlob gelang. Sie wurde eine liebevolle Schwester ihres Bruders. Und eine fröhliche Tochter, welche sich scheinbar zum Ziel gesetzt hatte, fortan gesund zu leben.
Mit ihrem Paten in der Toscana besprach ich die Ferien, die sie dort verbrachte und meine Ängste. Ich fürchtete zum Beispiel, dass sie die lange Treppe in den Hof fallen könnte. Sie fiel aber zuhause aus dem Bett (Höhe ca. 30 cm) und brach sich ein Bein. Oder ich wollte nicht, dass sie ins Baumhaus ging, das einen Sommer lang "den Nabel der Welt" für die Kinder bedeutete. Aber sie durfte in Absprache mit den anderen Kindern eine Zeitlang hinauf. Und es geschah nur Erfreuliches. Ich glaube, sie hatte auch viel Glück. Sie riss nämlich als Kleine ständig aus. Mit dem Dreirad radelte sie mal entlang des Flusses, war also alle Strassen nach unten gerollt. Das geht ja auch viel einfacher, als rauf. Wir konnten sie ein anderes Mal nicht finden, weil sie den Bus in die Stadt genommen hatte. Von dort kam ein Telefon von ihrem anderen Paten (Ersatzgötti), der sie auf einem der orangen Stühle antraf, als er mit seiner Familie von einem Ausflug zurück kam. In Italien verlief sie sich an einem Markt, als ich dem Bruder etwas kaufte, so rasch, dass wir glaubten, zur Polizei gehen zu müssen. Wir fragten eine halbe Stunde alle, denen wir begegneten. Und da sie ein hellblaues Röckchen, Hütchen und Sandalen anhatte, war sie jemandem aufgefallen. Sie war demnach mit einem Herrn in die Bank eingetreten, hatte dort nach einem Schokoladeneis verlangt und war mit einem (diesem?) Herrn wieder raus gekommen. Wohin sie gegangen waren, wusste man allerdings nicht. Auf dem Weg zur Polizei kamen wir am Park vorbei. Wer sass da? Meine Tochter hatte ein braun verschmiertes Kleid und einen grossen Kieshaufen angehäuft, von dem sie Steine herabrieseln liess. Der Bruder fragte sofort: "Wo warst Du denn"? Und sie antwortete: "Hier bin ich ja". Wir kauften eine Kassette vom Schäfchen "Chruselhaar", das davonlief, fast verhungerte, beinahe vom Wolf gefressen wurde und nur mit knapper Not überlebte. "Wir wollen nicht, dass Dir das auch passiert", sagten wir zu ihr. War das "Hau-Ruck"-Psychologie?
Als kleines Kind hatte sie den Übernamen "Lustmölchli"- von Lustmolch. Sie erfand Schimpfworte wie "dumms Cheibeli", wenn sie wütend war, was auch etwas Liebliches hatte. Bei uns wurde gern und viel diskutiert, was ihre Kommunikationsfähigkeit befeuerte. Und in der Schule wurde der Mundschluss geübt. Singen und Theaterspielen gefielen ihr ausnehmend gut und heute darf sie beim Theater Frei_Raum mitspielen. Wir staunen ob ihrer Bühnenpräsenz. Sie nimmt das Theaterspielen ernst. In einer alten Burgruine fand das Theater "Merlin und die Ritter der Tafelrunde" als Freilichttheater statt. Da sie so von dem Thema "besessen" war, gingen wir zum Casting. Sie bekam eine Rolle und der Regisseur sagte mir beim Abschlussessen, seine Kollegen hätten ihn gefragt, wo er diese passende "Figur" her habe. Ein grosser Ordner voller Fotos zeugt davon. In der Institution, wo sie zehn Jahre lebte, wollte sie stets Bösewichte spielen: einen Bankräuber, einen Dealer (wer hat ihr gesagt, was das ist?), einen Säufer mit dem Text: "ich trinke um zu vergessen"! Meine Schwester verfiel in einen Lachanfall, als unsere Tochter, verkleidet al Al Capone die Bank überfiel (drei mal, wie bei Lola rennt). Und sagte: "Geht das ein bisschen schneller: dalli dalli". Und der Bankangestellte meinte: "ich kann leider nicht schneller, bitte entschuldige". Am Schluss verhaftete man den Bankdirektor. Also wir halten fest: sie liebt das Drama, darum manchmal wird sie manchmal auch Dramaqueen genannt. Und sie liebt die Bühne, darum auch Bühnensau genannt. Und sie liebt das Essen: Im a Foody von TaShan beschreibt genau, was wir damit meinen. Als die Eltern ihrer Nichte sie zur Patin erkor, war sie sehr stolz.
Mein Sohn
Der Sohn war mit einem echten Knoten in der Nabelschnur zur Welt gekommen. Der war gottlob lose und die Geburt verlief normal. Vor Weihnachten war mir dieses Kind ein echtes Weihnachtsgeschenk. Es kamen viele Leute, ihn zu begutachten, ihn auf den Armen zu wiegen oder mir Rosen zu bringen (für den "Stammhalter"). In der grossen WG, wo ich wohnte, probte man in dieser Zeit ein Theater zur "Apokalypse" (ohne Happy-End). Eine Mitbewohnerin sagte mir, dass die Geburt ihr Zuversicht gegeben habe. Wir zogen im Frühling darauf in die Toscana. Dort brach sich der Kleine das Schlüsselbein. Er wollte nie alleine einschlafen. Es war eine recht anstrengende Zeit für mich. Ich trug ihn oft im "Snugli" herum, auch auf den Markt im nahe gelegenen Ort. Dort wurde mir von Italienerinnen Kinderwagen angeboten. Auch versuchte ich unerkannt zu stillen, wenn er Hunger hatte. Das war in der Öffentlichkeit in Italien damals nirgends zu sehen. Bevor er zwei jährig wurde, reisten wir zurück in die Schweiz. Wir kamen bei Freunden unter (erst in Aarau, dann in Bern), bis wir eine eigene Wohnung fanden. Mein Sohn wurde vorwiegend vom Vater betreut, weil ich arbeiten ging. Der Sohn war ein willensstarkes Kind. Ich erinnere mich, dass er das erste Mal, als er Skier bekam und draussen im Schnee mit denen rumlief und seine ersten Versuche machte, nicht mehr ausziehen wollte. Er sass auf der Schwelle und wollte mit den Skiern an den Füssen zum Abendessen. Ich forderte ihn auf, die Skier draussen zu lassen. Er versuchte tatsächlich, mit ihnen zum Esstisch zu kommen...Ein anderes Mal nach dem Einkaufen, wo er mich erfolglos gelöchert hatte für Süssigkeiten, produzierte er einen Tobsuchtsanfall nach der Kasse. Er tobte wie wild und die Leute standen rundum. ich fragte: "Wer will ihn kaufen? Er ist zu haben.". Das war gemein von mir. Ich hatte mir eine gewisse Gelassenheit angewöhnt, denn das Leben mit den Kindern war nicht leicht. Ich arbeitete ununterbrochen, organisierte Ferien und managte den Haushalt. Zu den Ferien ist zu berichten, dass ich jährlich vier, die Kinder aber zwölf Wochen hatten. Ihre Patinnen oder Paten nahmen sie zu sich. Manchmal gab es auch ein Lager, als mein Sohn beispielsweise Eishockey spielte in Leysin. Und der Vater war oft in Italien bei unseren früheren Nachbarn.
Als mein Sohn schulpflichtig wurde, wohnten wir bereits getrennt im gleichen Quartier. In seinen Schulberichten stand, dass er zwischen streitenden Gruppen vermitteln könne, viel soziale Kompetenz besässe und so weiter. Ich habe mich oft gefragt, wie viel er mitbekommen hat von unseren frühen Beziehungsproblemen, als er klein war. Heute ist er ein beruflich und privat selbständiger Alleinerziehender mit bald vierzig Jahren. Er wurde früh Vater mit einer Frau, mit der er bereits in der Kinderspielgruppe im Sommerlager war. Sie lernten sich in Zürich näher kennen. Als er gerade erst in einer Beziehung war mit ihr, lud ich ihn zu einem Essen gemeinsam mit einer Freundin aus Zürich ein. Sie fragte ihn, wie es ihm mit der neuen Freundin gehe. Da sagte er, sie sei etwas speziell, denn wenn etwas nicht nach ihrem Kopf ginge, reklamiere sie. Er nannte ein alltägliches Beispiel. Da mussten wir lachen. Ich dachte dann: Ups, beide sind wohl eher "Sturköpfe", denn ich könnte dasselbe ja von ihm sagen. Beiden Kindern schenkte ich ihre Tagebücher, die ich für sie geschrieben hatte. Darin sind Fotos mit Text von der Geburt bis zu ihrem Heranwachsen enthalten. Zusätzlich gestaltete ich eine Fotoreihe zu ihrem 18ten Geburtstag, der sie in den verschiedenen Lebensphasen abbildet.
Kinder als Erwachsene
Manche mögen sich fragen, warum ich nicht ausführlicher über meine Kinder geschrieben habe. Wo soll ich bloss anfangen? Die Tochter hat mit 37-jährig grösstmögliche Selbständigkeit erlangt und darüber ist sie sehr stolz (glaube ich). In Gruppen ist sie fröhlich und motiviert. Das zeigte sich bei der Stein- und Wanderwoche in Salecina/Maloja, wo sie zwei Mal anstrebte, für ca. 30 Leute zu kochen (nicht allein). Es gab Gemüsecurry mit Basmatireis, Salat und Apfelcrumble sowie Gemüselasagne mit Salat und zwei Sorten Eis. Essen ist ihr Liebstes. Wandern ist nicht ihre Lieblingsbeschäftigung, trotzdem kam sie tapfer mit. Ihre Wanderstöcke begleiteten sie drei Stunden lang am ersten Tag. Der Leiter sagte am 2ten Tag: es geht alles geradeaus. Und da wanderten wir mit Auf und Ab dem Silsersee entlang. Sie spottete: "Aha, alles geradeaus, gäu..."? Jedenfalls ergab sich ein Wort nach dem andern und Gelächter, als der Leiter sagte: Wo keine Bergbahn nötig sei, gehe es für ihn immer geradeaus. Sie schafft vieles mit Humor. Steine sammelte und schleifte sie mit Leidenschaft. Meine Tochter ist psychisch sehr stabil und spürt intuitiv relativ gut, was rundum bei anderen Menschen abgeht.
Mein Sohn litt unter starken Stimmungsschwankungen, die er behandelte und sich um psychischen Ausgleich bemühte. Manchmal erinnert mich sein Leben an mein eigenes: als alleinerziehender Elternteil mit der Doppelbelastung von Beruf und Familie. Und dem Bemühen, alles unter einen Hut zu bringen. Zugespitzt hat sich die Lage bei ihm durch die Trennung von seiner Partnerin, Corona und dem Aufbau seiner Selbständigkeit. Ich denke, er hat eine Krise durchlebt im 2020 und 2021. Da wollte er allerdings von mir keine Hilfe, im Gegenteil. Und das belastete mich. Heute geht es ihm gut. Endlich kann er über seine Angst vor Verlusten sprechen. Er nennt sich eine "Verlustängstler", der sich um eine Frau bemüht und kaum geht diese ernsthaft auf sein Werben ein, kriegt er Angst und klemmt die Beziehung ab. Diesmal will er dies allerdings anders handhaben. Seine jetzige Freundin hat auch drei Kinder, nun haben sie eine Probezeit abgemacht zusammen. Auch das kenne ich von mir von früher... Es kommt noch etwas anderes dazu: die angeheiratete Familie hat einige cholerische Männer und mein eigener Vater war da nicht anders. Ich fragte mich schon, wie das weitergegeben wird innerhalb einer Familie.
Indem ich diesen Text schreibe, schickt mir mein Sohn einen Link zu einem Lied (Songs for Joy) mit deutschem Text. Der Titel: "Wann strahlst Du?" Ich schicke den Link von Amy Mc Donalds Lied "Fire" zurück. Mein Sohn ist ein "doppeltes" Feuerzeichen (im Horoskop). Er sagte einmal, als er die Badehose zum Schulschwimmen "vergessen" hatte, zu seiner Lehrerin, die ihn bat, diese zu holen. "Ich bin eben ein Feuerzeichen und diese baden nicht gerne". Er lernte irgendwann schon schwimmen. Aber an Land ist es ihm wohler.
Enkel
Ich habe einen guten Kontakt zu meinen Enkelkinder, die die sechste und neunte Klasse besuchen. Beide sind tolle Menschen, ganz klar. Das ist wohl der Stolz der Grossmutter, der da spricht, obwohl ich ja nichts dazu beigetragen habe. Ich besuche die Fussballmatchs des Enkels und stecke ihm ab und zu etwas Geld zu, wenn er es benötigt (zum Essen, Kleider oder Schuhe zu kaufen). Der Umgang mit Geld, den ich erst gelernt hatte, als ich ab Fünfzehn Taschengeld bekam, lernen meine Enkel früher. Beide lernte ich Skifahren, weil ich selbst Freude daran habe. Mit der Enkelin und ihrer Freundin verbringen wir aus diesem Grund die Sportferien in den Bergen. Der Enkel darf mit den anderen Grosseltern mitfahren. Ich weiss noch, dass er seine erste Skilehrerin nicht akzeptierte. Er wollte einen Mann als Skilehrer. Wir, die Enkelin und ihre Freundin verbrachten zwei malig schöne Ferien mit mir auf einem Hof im Jura, wo sie reiten konnten. Die zahlreichen anderen Tiere, die zum Hof gehörten gefielen ihnen ebenso gut. Auf einem "Zwergenweg" verbrachten sie beim Spielen ihre nachmittägliche Zeit. Rollenspielen gefallen den beiden gut, das Verkleiden auch. So spielte die Enkelin in einem Eisbärenkostüm in der Schulband mit (am Sommerfest).

Ich vergass alles um mich herum, wenn ich musizierte, was Geige-spielend nur bis in jungen Jahren gelang. Danach probierte ich es mit einem Saxophon und nahm eine Zeitlang Stunden. Ein wunderschönes Selmer-Sax war meins, bis ein Bekannter es ausleihen wollte. Er überzeugte mich, indem er sagte: ich hätte ja mit Kind und Hof nicht mehr Zeit zum täglichen Üben. Er selber spiele jeden Tag um die fünf Stunden. Er schlug einen Tausch vor und ich ging darauf ein. Darauf erhielt er mein tolles Selmer-Sax und ich bekam sein Yanagisawa-Sax, das bei tiefen und hohen Tönen schwieriger zu spielen war. Bis erneut ein Bekannter kam und sagte, das Instrument müsse überholt werden. Er werde das mal genauer anschauen. Was geschah? Ich erhielt eine Karte von ihm. Darauf des Sax in Einzelteilen abgebildet mit der Frage, was dieses Instrument mir wert sei. Es koste eine Stange Geld, das Sax wieder zusammen zu revidieren. Ich habe es ihm geschenkt und seither nie mehr Sax gespielt. Die beiden Genannten sind Musiker und ich besuchte ihre Konzerte. Ich begann in einem Percussions-Ensemble Djembe zu spielen. Das machte Spass. Ich lernte viele afrikanische Rhythmen und erinnere mich an ein Konzert mit Adamé Dramé. Damals dachte ich noch, dass diese Menschen die Lebensfreude für sich gepachtet hätten.
Im Reithallen-Frauenchor traten wir in den 80er-Jahren als Frauenchor mit Liedern auf, die uns gefielen. Um zu zeigen, wie schlagkräftig wir Frauen sind, durchschlugen wir ein Holz-Brettchen vor einem Konzert. Das geschah orchestriert: zuerst jede Zweite, dann der Rest (waren es 50 Frauen?). Weiss nur, dass ich sagte, ich hätte Bedenken, denn ich brauchte meine Hände als Hebamme. Aber es verletzte sich bei der Aktion niemand. Das gemeinsame Singen bereitete und bereitet mir noch heute große Freude. Heute singe ich nicht mehr in einem chaotischen Chor, wo Einzelne nicht mehr wissen, in welcher Stimmlage sie letztes Mal gesungen haben. Sondern in einem gut funktionierenden, grossen Chor im Alt, der regelmässige Konzerte gibt im Münster. Das nächste Konzert steht bereits an. Diese wöchentliche Regelmässigkeit mit Singen im Chor möchte ich nicht missen.
Neues kennen lernen und neugierig bleiben:
Das Reisen gefiel mir sehr gut, denn Neues entdecken fand ich ungemein interessant. Meist reisten wir als die Kinder klein waren aus Budgetgründen per Zelt, zusammen mit anderen oder zelteten am Fluss in der Stadt, wo wir lebten. Dort konnten "Einheimische" drei Wochen verweilen, dann mussten sie den Platz räumen. Einmal reisten wir in der Gruppe nach Frankreich, alle in verschiedenen Autos verteilt. Ich hatte meine Kinder und die Nichte dabei. Der alte Fiat wollte plötzlich auf der Autobahn in Frankreich nicht mehr weiter. Ich sagte: "Ach. Kinder bleibt drin. Ich gehe das rasch flicken". Und dann gelang mir das tatsächlich, denn das Gaspedal hatte sich mechanisch gelöst. Wir fuhren bis nach Goudarques, wo wir mit den Freunden abgemacht hatten. Jeden Abend erzählte ich unter einem grossen Baum am Fluss eine Geschichte für die Kinder. Die Schar wurde jeden Abend grösser. Und dieses Eintauchen in Geschichten gefiel nicht nur ihnen, sondern auch mir. Ich fühlte mich sorglos. In Afrika gab es intensive Begegnungen mit Menschen und ungewohnten Situationen. In einer geführten Reise besuchten wir Frauengruppen, Handwerker, ein selbst verwaltetes Camp (Spitzkoppe) und hörten am dritten Tag, dass der Reiseführer uns am Flughafen kommen sah und dachte: "Ups, da kommt ein Problem auf mich zu.." und lachten. Wir erfreuten uns an einem unvergesslichen Rundgang durch die Namib-Wüste, wo uns der Natur- und Umweltschützer Chris die Evolution und die fünf kleinsten Tiere vorstellte: witzig und ernst.
Heute sind es die Kurse beim Collegium 60 plus, die mich motivieren, anregen und Neues entdecken lassen. Dieser Verein müsste gegründet werden, wenn es ihn noch nicht gäbe. Ich bin ihm sehr zugewandt.
Verliebtsein und Konzerte:
Wo ich viel Lebensfreude spürte, war jeweils beim Verliebtsein. Dieses Gefühl, wie das Herz freudig hüpft und die Schmetterlinge im Bauch fliegen, war umwerfend. Ich sagte mal nach dem "Liebe machen" - ja so nannten wir Sex - dass alle meine Zellen applaudieren, weil es ihnen so gut gehe. Das brauche ich wohl nicht zu erklären, oder doch? Ich war sehr froh, dass ich eine freie, genussvolle Sexualität leben konnte, nachdem der Anfang "schlimm" gewesen war. Heute spüre ich eine geruhsamere, gemütlichere Freude oder ist es eher Genuss? Ich hatte früher manchmal das Gefühl, dass ich Vieles verpasse, zum Beispiel tolle Konzerte. Aber heute denke ich, es war gut, dass ich nicht alle meine Konzertwünsche erfüllen konnte. Sonst hätte ich heute ja keine offenen Wünsche mehr. Und das wäre doch schade. Sol Gabetta wollte ich unbedingt live hören und das ermöglichte mir meine Schwester. Oder ein Konzert mit Paolo Conte wünschte ich mir. Und auch dies gelang, weil mich eine Freundin einlud. Eins der letzten Konzerte von Züri West hörte ich und sang alle Strophen mit (wie übrigens alle rundem). DJ Bobo wollte meine Tochter unbedingt einmal live erleben. Ich gewann an einem Wettbewerb sechs Billette zu seiner Show. Und kaum jemand aus meinem Umfeld interessierte sich dafür. So lud ich entfernte Bekannte ein. Es war aber sehr eindrücklich und der Spruch vom Propheten im eigenen Land fiel mir ein.

Wenn überhaupt bin ich stolz auf meine beiden Kinder - wie wohl jede Mutter. Und auch, dass ich bei der Erziehung Nein gesagt habe, wenn ich der Meinung war, dass es besser für die Entwicklung der Kinder sei. Das geschah bei der Tochter beim masslosen Essen, beim Weglaufen usw. und beim Sohn in der Pubertät und als Jugendlichen betreffend Ausgang, Alkohol, Zigaretten oder Filmen mit Gewaltdarstellungen. Und dass die beiden heute so gut "unterwegs" sind, freut mich sehr. Ich beobachte, dass heutige Eltern da eine andere Haltung haben: wenn sie ihre Kinder als Prinzen und Prinzessinnen gross ziehen. Was soll später mit ihnen geschehen, wenn sie merken, dass die Welt noch andere Rollen für sie vorgesehen hat? Und dass sie keine Vorreiterrollen für sich gepachtet haben, wenn sie in einem anderen Umfeld ankommen (Schule, Lehre, Beruf, Freundschaft, Liebe usw.) Das bereitet mir Sorgen.
Und ich bin stolz, dass ich zu meinen beiden Kindern eine stabile Beziehung aufgebaut habe und andere Alleinerziehende darin bestärkt habe, dass es an ihnen ist, sich um die Kinder zu kümmern. Und egal, wie sie mit dem Ex-Partner stehen, ist es an ihnen, sich um die Beziehung zu den Kindern zu kümmern (nicht umgekehrt).
Darf ich stolz darauf sein, dass ich transparent kommuniziert habe, auch oder vor allem in Krisen. Gab es Leute, die nicht zuhören wollten? Das ist wohl der Unterschied zum heutigen Leben: die Menschen versuchen sich im besten Licht zu zeigen auf diversen sozialen Medien. Darum bewundere ich VIPs, die sich outen und kundtun, dass sie Ängste oder Depressionen haben und wie sie damit umgegangen sind. Was es bei ihnen ausgelöst hat, eine Therapie zu machen usw. wie z.B. die Musiker Robbie Williams, Stress und andere. Ein junger Bekannter hat sich selbst in die Psychiatrie eingewiesen (als Medizinstudent) und seine Mutter war schockiert. Ich habe ihr gesagt, sie soll doch stolz darauf sein, dass er bemerkt habe, dass er Betreuung und Hilfe brauche. Früher hat man das ja gern verschwiegen - auch in meiner Herkunfts-Familie. Heute ist dieser Mann ein ausgebildeter Mediziner.
Engegement für Wichtiges
Ob ich stolz sein kann, dass ich für den Naturschutz, die Politik und die Themen, die mir wichtig waren und sind, genug intensiv eingetreten war oder eintrete, kann ich nicht genau abschätzen. Womöglich hätte ich mehr dazu beitragen können. Ich versuchte es, so gut es mir möglich war. Und versuche es noch heute. Ich werfe seit Jahren stets dieselbe Liste ein bei Wahlen, habe aufgehört zu kumulieren und panaschieren. Die Partei scheint mir wesentlich. Und dann auch, dass es mehr Frauen in den wichtigen Politämtern gibt. Und nicht nur dort...und dann habe ich doch den einen oder anderen Schwerpunkt gesetzt, an Diskussionen, Demonstrationen usw. Es ist schön erleben zu dürfen, dass die Anti-AKW-Demos (z.B. gegen Gösgen) heute in ein Umdenken geführt haben. Das AKW Mühleberg wird abgebaut, was ich als junge Frau nie für möglich gehalten hätte. Die Energiewende ist breit abgestützt. Es ist nur nie ganz sicher, ob es auch bleibt. Aber hoffen wir, dass es auch beim Klimawandel gelingt. Was sagt Dieter Nuhr: Was geschieht, wenn der Erste der letzten Generation schwanger wird? Ich danke mir oft, dass das Pendel von links nach rechts schwingt und danach ein erneuter Schwung in die andere Richtung erfolgt.
Ich hatte mich in meinem Berufsverband im Vorstand und Zentralvorstand engagiert. Dank mir gabs ein Kommunikationskonzept und als kleine Genugtuung sehe ich das von einer Frau in den 90er-Jahren entworfene Logo noch heute. Stolz bin ich auf die durchgesetzten Forderungen für Lohn- resp. Bezahlungen für Kolleginnen im Verband. Ich wurde von älteren Kollegin dahingehend aufgeklärt, dass vor meiner Zeit die Kongresse zum Zeigen der Kleider, zum Festessen und dem Treffen der Berufskolleginnen dienten und daneben die "Sache" zu kurz gekommen sei. Ich sei immer an der "Sache" interessiert und engagiert gewesen ohne mich in den Vordergrund zu rücken. Schönes Kompliment. Dies alles geschah ehrenamtlich.
Stolz darauf, immer wieder in Neues einzutauchen, wie vor zwei Jahren beim Aufbauen eines Cafés und eines Raums mitzuwirken? Ich tue es einfach und fühle mich dadurch lebendig. Das Lernen fällt mir nicht mehr so einfach wie früher, denn heute brauche ich länger. Darum der Barista-Kurs, bei dem ich (endlich) lernte, wie Kaffee eingestellt wird, damit er gut schmeckt und wie ich das Schäumen der Milch hinkriege, um schöne Capuccini zu machen. Psychisch auszuhalten, dass sich die Betriebsgruppe inhaltlich auseinander bewegt und mich die neunstündigen Schichten in der Gastronomie mit kleinstem Verdienst belasten. Und dann loslassen und sagen: ich kündige. Darauf bin ich stolz, dass ich Zustände, die mich belasten loslassen kann.
Freundschaften
Am wesentlichen scheinen mir Freundschaften, die sich über einen langen Zeitraum hinwegziehen, wo man sich zuhört und gegenseitig unterstützt, wenn es nötig ist. Und neu kamen das gesamte Leben immer wieder Lebensabschnitt-Freunde dazu, deren Spuren sich verloren im Alltag, sobald man sich nicht mehr fach- oder themenbezogen nicht mehr automatisch traf. Die erste Freundin als Kind oder die Freunde aus der Toskana-Zeit sind mir lieb und teuer geworden. Treffen mit ehemaligen Kurskolleginnen sind jährlich im Juni eingeplant.
Ich bin froh, dass es einen Freundeskreis gibt, der sich für meine Tochter und ihre Geburtstage interessiert. Und stolz, dass ich jemanden gefunden habe, der nach meinem Ableben die Beistandschaft von ihr übernehmen wird. Aber wir treffen uns bereits bald: abgeben und sich auf das konzentrieren, was lebenswert scheint. Ich hoffe, das gelingt mir. Und darauf wäre ich auch stolz.
Loslassen können
Ich bin stolz darauf, dass ich mich heute bei aktuellen medizinischen Fragen, aber auch zu Berufsthemen zurückhalte, weil ich damit abgeschlossen habe. Bei medizinischen Themen in unserer Familie wird hingegen über alles offen gesprochen. Und ich erhalte Telefonanrufe zum Beispiel von meinem Sohn, der Symptome schildert und fragt, was man machen sollte und wie dringend dies beim Arzt gezeigt werden sollte.
Ich lese keine englischen Studien mehr, aber besuche Kurse in Italienisch für Fortgeschrittene, Biodiversität, und andere. Meine Devise ist stets: LLL Leben-Langes-Lernen ist wichtig und MMMM und zwar: Man muss Menschen mögen, nicht Milch macht müde Männer munter. Warum haben die damaligen PR-Leute nicht den Spruch kreiert: Milch macht starke Frauen stärker? Altes loslassen, dann hat man beide Hände frei für Neues: das habe ich mir oft gesagt. Es hat etwas Befreiendes.

Im Tagebuch findet sich ab 20 Jahren immer wieder Einträge betreffend Älterwerden - aber dass ich so alt würde, hätte ich früher nie gedacht. Mit 40/42 Jährige habe ich eine Kehrtwende im Leben vollzogen. Dies geschah beruflich und privat. Ich merkte, wie stark mich mein Aufwachsen geprägt hat mit den Pseudorollen, die mir von meinen Familienangehörigen intuitiv zugeteilt wurden. Es wurde oft als Motto: dr Gschider git nah, der Esu blibt schta - Der Gescheitere gibt nach, der Esel bleibt stehen, verwendet. Und mir als Älteste kam die Vermittlerrolle, die Betreuung der Jüngeren und die der Tröstenden, aber auch die der Aufklärerin zu. Ich übernahm die sexuelle Aufklärung meiner Geschwister, als ich selber noch daran war, herauszufinden, was Sache ist. So habe ich oft später funktioniert, also Verantwortung übernommen. Das geschah auch in Situationen, wo ich spürte, dass ich überfordert sein würde. Und das bringt mich zum nächsten Punkt:
Abgrenzen und Nein-Sagen
Ich habe gelernt mich abzugrenzen von Situationen und Menschen, welche Energien "fressen". Und auch gelernt, nicht mehr lange Erklärungen abzugeben, wenn ich etwas nicht möchte. Heute kann ich einfach : Nein - Sagen. Das hätte ich mir allerdings früher gewünscht. Früher sagte ich noch ab und zu Ja zu Dingen, wo ich eigentlich Nein hätte sagen (s)wollen. Was soll ich mich im Nachhinein ärgern? Und ein anderes Motto half mir und hilft bis heute: Wenn Du Gott zum Lachen bringen willst, dann mach Pläne...also die Einstellung, dass egal was man plant, das Leben seine eigenen Pläne hat mit uns Menschen. Das hilft mir auch, nicht verbittert oder hart zu werden, was ich ab und zu an älteren Leuten beobachtet habe. Ich dachte immer, ich würde eine schrullige Alte. Und heute muss ich feststellen, dass ich recht wach und aktiv bin.
Und das freut mich natürlich. Es geht alles langsamer, bedächtiger, was aber sein Gutes hat. Heute wird ja Achtsamkeit gross geschrieben. Ich bewundere dies, solange man das Umfeld trotzdem beachtet. Will sagen, solange man sich als blosse Egoistin - als blossen Egoisten outet.
Zuhören
Ich finde mich oft in der Rolle als Zuhörerin. Ich nehme wahr, dass viele Alleinlebenden und Alte ein grosses Mitteilungsbedürfnis haben. Entweder erzählen sie von ihren Beschwerden, Krankheiten, zum Teil ausufernd und mit Inbrunst. Oder sie haben im Alltag jemanden oder etwas, was sie aufregt und suchen Zustimmung ihrer Ansichten und die Bestätigung ihrer Gefühle. Ich habe mir oft in den Tagebücher Ziele gesetzt und diese später kommentiert und überprüft. Das eigene Verhalten zu reflektieren und sich gewahr zu werden über die eigenen Schwächen und Stärken hilft bestimmt, in der Gegenwart zu bestehen. Ich habe mich von der Erzählenden zur Zuhörerin gewandelt und diese Rolle gefällt mir. ich erfahre so viel mehr von Anderen. Und das bereichert mein eigenes Leben. Wie vielfältig doch unsere Lebensentwürfe sind!

Der gesunde Menschenverstand schien mir eine gute Richtschnur zu sein. Aber ich interessierte mich dennoch sehr stark für Spiritualität. Eine Kollegin lud mich zu einem Schnupper - Seminar ein. Und danach besuchte ich in den 90-er Jahren Seminare zum Wissen der Seher der Kelten (in der Schweiz). Die fanden alle in der Natur statt, was mir sehr behagte. Die Suche nach unserem kulturellen Erbe (hierzulande) prägte die Inhalte. Dort feierten wir Feste im Jahreskreis, die das Christentum sich später angeeignet hatte und seither in abgeänderter Form begeht. Jedoch fand ich die psycho-dynamischen Ereignisse in der Gruppe hinderlich und gab den Austritt. Eine meiner Hebammen-Kolleginnen war noch lange dabei und wir treffen uns wieder vermehrt.
Meditation
Viel ruhiger und gesitteter ging es in den Schweige-Retreats im Meditations-Zentrum Beatenberg oder der Stiftung Felsentor (Rigi) zu. Da erlebte ich in mir Ruhe und Gelassenheit. Zu Beginn sprang mein Geist wie ein Zicklein herum und bot mir die ganze Zeit irgendwelche ablenkende Gedanken vor. War ich aber fokussiert auf das Atmen, Sitzen und Gehen, beruhigte sich der "unruhige" Geist. Ich konnte in eine vorher nicht bekannte Versenkung eintauchen. Die tägliche Praxis kann in den Alltag integriert werden. das gelang mir eine Zeitlang. Das Leben hielt Herausforderung für mich bereit. Ich sah mich oft als kleine Gestalterin meines Lebens. Das System, das mich prägte, empfand ich als mindestens gleich stark wirksam, wie meine Worte, Gedanken und Taten.
Geschichte und Geschichten begann mich in den 90-er Jahren zu interessieren. Das Übereinanderschichten der Ereignisse und Verbiegen von Tatsachen in der Geschichte der Menschheit fand ich faszinierend. Ich glaubte daran, dass die Gegenwart uns vor Herausforderungen stellt, deren Geschichten in der Vergangenheit liegen. Die Zukunft gestaltet sich darüber hinaus, was wir in der Gegenwart bewältigen. So dachte ich jedenfalls und gab mir Mühe, meine Themen aufzuarbeiten. Und da gab es einige. Ich schrieb unter anderem einen Brief an meine Eltern und versuchte ihnen klar zu machen, dass sie keine Schuld trügen am Scheitern der Beziehungen von uns Kindern. Dass ich falls doch, ihnen längst vergeben hätte usw. Der ethische Aspekt in der Pflege und besonders seit der Geburt der Tochter mit Handicap begann mich zu beschäftigen. Meine Mutter meinte zuerst: "Wir haben als Familie Sünde auf uns geladen, dass Du ein solches Kind bekommst". Solche Gedanken lagen mir fern. Ich meine, dass ich durch meine Kinder zu einem "besseren" Menschen geworden bin.
Kleine Aufmerksamkeiten zu Weihnachten/zum Jahreswechsel mit selbst gestalteten Karten an die Menschen, die mir wichtig sind, scheinen mir ebenso Zeichen einer gelebten Spiritualität, wie die Beantwortung von existenziellen Fragen oder die Suche nach dem Sinn des Lebens. Da fällt mir ein, dass ich zum Diplomabschluss in der AKP-Ausbildung eine Arbeit schrieb mit dem Titel: "Der Sinn des Lebens". Fazit: Der Sinn ist die Bedeutung, die wir unserem Leben geben.

Und je länger ich am Text arbeitete, desto mehr fiel mir wieder ein, was ich ausgelassen habe. Die Alpzeit 1981 habe ich nirgends beschrieben. Die war doch damals wichtig für mich. Da las ich doch dieses Buch: "Der Märchenprinz ist tot", was private Folgen hatte. Der damalige Sommer hatte ein paar Highlights: Ende Sommer wurde unser Alpkäse ausserordentlich gut bewertet. Das hätte unser Alpmeister "Jogg" wohl nicht gedacht, oder doch? Er versuchte uns Frauen für sein zuhause zu gewinnen - als Frau ins Schanfigg. Keine biss an, aber es war unterhaltsam mit den Bauern dort. Der Umzug auf das Maiensäss mit allen Tieren blieb mir lange in Erinnerung. Wir mit den Schweinen voraus, die Kühe dahinter. Von den Männern, die damals mit auf der Alp waren, ist einer Lehrer gewesen, der heute Filme dreht. Einer hat eine Afrikanerin geheiratet und ein anderer ist "Guru" mit vielen Kindern. Zu keinem habe ich noch Kontakt.
Einen Titel für das Geschrieben gibt es immer noch keinen. Wie würde jemand anderes wohl das Geschreibsel lesen? Was ist die Essenz? Vielleicht ist es ein Versuch einer Biografie, eine unvollständige Sache. Ich habe mich oft und sehr ausführlich in Tagebüchern ausgelassen. Das habe ich für diesen Text für die Jugendjahren benutzt: aber gemerkt, dass ich dann nicht vorankomme, wenn ich zuerst alle Texte aus den Tagebüchern lese und dann überlege, was ich nun verwenden möchte. Darum habe ich spontan drauflos geschrieben und darauf geachtet, dass es nicht ausufert. Einige Phasen des Lebens könnte ich bestimmt ausführlicher beschreiben. Andere möglicherweise auslassen oder besser gliedern. Etikettierungen hätte ich womöglich weglassen sollen oder erklären; wie zum Beispiel warum ich sagte, meine Mutter pflegte einen Totenkult. Hätte ich beschreiben sollen, wie wichtig ihr die Grabpflege war? Oder dass die Toten an Ansehen gewannen durch ihr Ableben? Was hätte das gebracht? Hätte ich erwähnen sollen, dass ich in Absprache mit meiner Schwester und später mit den Eltern eine Patientenverfügung erstellt habe? Oder dass ich an Tagungen zum Thema "Sterben gestalten" teilgenommen habe? Dass nun rundum mit nahestehende Menschen gestorben sind und wie ich damit umgegangen bin?
Ich habe bisher niemandem etwas zu lesen gegeben. Ich dachte, dass ich keine Leute damit belästigen wolle. Das sei meine Sache, wie vieles im Leben, was mich selbst betraf / betrifft. "Man kommt allein und geht allein" meine ich. Stimmt doch, oder?

Mit 50-Jährige habe ich meine eigene Grabrede geschrieben. Hier eine gekürzte Version:
Regina wurde als Älteste in eine Lehrerfamilie in einem kleinen Dorf in den Berner Voralpen geboren. Sie hütete früh ihre jüngeren Geschwister und lernte dadurch Verantwortung zu tragen. Als Mädchen half sie gern den umliegenden Bauern, wirkte fröhlich und gesund. Die Berufswahl war früh klar, weil sie dies bereits in der achten Klasse beschloss. Als Krankenschwester der allgemeinen Krankenpflege lernte sie lateinische Bezeichnungen aller Knochen und Muskeln. Damals gab es nach dem Diplom ein sogenanntes Pflichtjahr, das sie an der Schwesternschule verbrachte, wo sie gelernt hatte. Dann heiratete sie ihren ersten Ehemann, der viel Schweres aus seiner belasteten Jugend in die Ehe brachte. In der Ausbildung zur Hebamme gebar sie ihm einen Sohn. Acht Monate später starb dieser Kleine am «plötzlichen» Kindstod und die junge Ehe zerbrach. Er heiratete noch weitere drei Male, insgesamt also fünf Mal und liegt heute auf dem Bremgarten Friedhof.
Dank der Unterstützung der Hebammenkolleginnen in Zürich gelang es Regina, die Trauer zu überwinden. Sie ermunterten sie, als Hebamme weiterzuarbeiten. Die frauen- und familienzentrierte Geburtshilfe entsprach ihr sehr und sie übte diese jahrelang aus. Als eine Frau ihr zweites Kind unbedingt zu Hause gebären wollte, begann sie auch als freiberufliche Hebamme zu arbeiten. Sie war lange Zeit mit ganzem Herzen und vollem Elan Hebamme. Auf ihr jahrelang ehrenamtliches Wirken für den Hebammenverband war sie stolz. Angefangen beim Organisieren des nationalen Kongresses in Interlaken engagierte sie sich jahrelang als Vorstandsmitglied. Als Dozentin unterrichtete Regina zu den Themen Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett in einer städtischen Krankenpflegeschule.
Mit ihrem zweiten Ehemann hatte sie zwei Kinder. Als Mutter arbeitete sie im Frauenspital Bern Teilzeit und später an der Hebammenschule Bern. Als die Kinder klein waren, trennte sich Regina von ihrem zweiten Ehemann und schloss mit ihm eine Vereinbarung ab, nach dem sie im gleichen Quartier mit den beiden Kindern weiter lebten. Viele liebe «Hüetimeitschi» und ihre Mutter halfen bei der Betreuung der Kinder. Die Entlastungsfamilie sorgte zusätzlich für etwas Freiraum. An erster Stelle stand die Familie. Es war Regina wichtig, Ferien zu ermöglichen, auch wenn das Budget klein war. Als die Kinder ausflogen, widmete sich Regina einer neuen beruflichen Betätigung. Es war ihr stets wichtig, berufstätig und unabhängig zu sein und zu bleiben. In der Müttergruppe, die sich aus dem Kurs mit dem Titel: "Behindertes Kind-Behinderte Mutter"? bildete, war für Regina jahrelang ein grosser Halt im Leben. Die Mütter witzelten manchmal und sagten: "Wir machen Nachhilfe für die sogenannt Normalen- indem wir ihnen zeigen, wie sie unseren Töchter und Söhnen mit Handicap begegnen können". Die Hälfte dieser Mütter wurden zu Einelternfamilien. Es entwickelten sich daraus Freundschaften, welche durch Höhen und Tiefen gingen. Im Schrebergarten konnte sie zusammen mit zwei anderen wirken, was ihr gefiel. Das Älterwerden ist nichts für Feiglinge, sagte sie oft. In Chören sang sie mit viel Freude und motivierte auch ihre beiden Freundinnen dazu. Musik und Bücher waren ihr wichtig.
Als ältere Frau engagierte sich Regina als Vorstandsmitglied in einem Verein, in einer Wohnbaugenossenschaft und im Quartier, wo sie bis zum Lebensende wohnte. Und ihren Verwandten sagte sie immer, wenn es um den Tod ging, sie möchte gerne auf eine Wolke, wo gesungen oder Musik gemacht werde. Ob das gelang, wissen wir nicht.