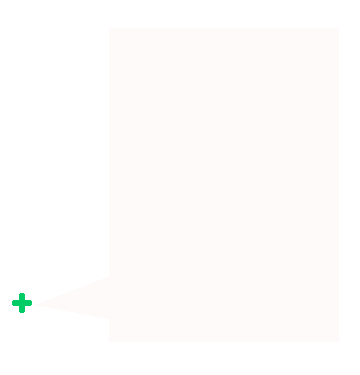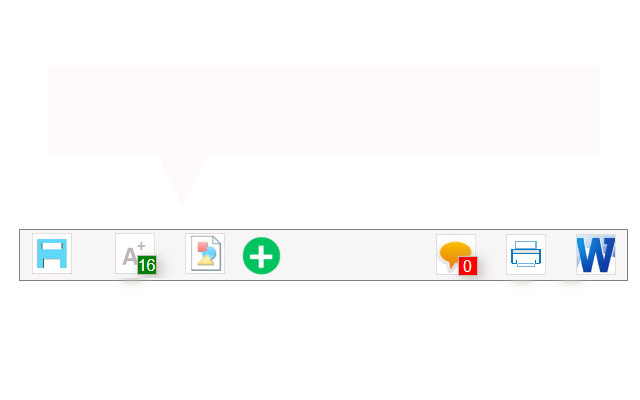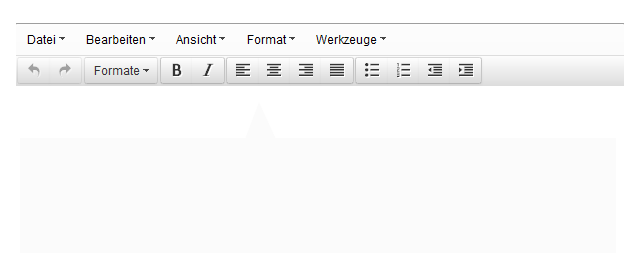Zurzeit sind 552 Biographien in Arbeit und davon 313 Biographien veröffentlicht.
Vollendete Autobiographien: 191
Vorwort von Rolf Spahn

Mit 16 Jahren habe ich den Unterweisungskurs unseres Kirchenverbandes in St. Stephan besucht.
Während dieser Wochen habe ich Danilo das erste Mal kennengelernt. Schon während dem Kurs haben wir uns gut verstanden. Wir haben uns nach dem Kurs zwar ein paar Jahre aus den Augen verloren, da ich in Zürich lebte und Danilo im Aargau seine Wurzeln hatte.
Als Danilo dann beruflich nach Zürich kam und wir uns in unserer Kirchengemeinde wieder begegneten wurden wir sehr gute Freunde.
Vieles Schöne und auch Leidvolle das Danilo in seiner Biographie erzählt, durfte ich zusammen mit meiner Frau, miterleben und manchmal auch mittragen.
Die gemeinsamen Jahre in der FMG in Zürich mit vielen gemeinsamen Anlässen sind eine tolle Erinnerung. So haben wir zB. zusammen ein Fussballteam unsere Jugendgruppe gegründet und gegen andere Jugendgruppen Matches ausgetragen und vieles mehr. Bis der Wegzug von Danilo und seiner Familie nach Bülach und dem Wechsel in eine dortige örtliche Gemeinde diese Zeit beendete. Unsere Freundschaft aber blieb bestehen.
Die Hochzeit von Danilo mit der «Entführung» der Braut auf den Rheinfelsen, das Fest auf dem Bauernhof mit Kutschenfahrt und Übernachtung im Heu. Ein unvergessliches Wochenende!
Die Freude bei der Geburt der Kinder, das Leid bei der Diagnose der Zuckerkrankheit des ersten Sohnes, und später auch 2 weiteren Kindern, aber auch immer wieder das Vertrauen auf Gott und dass seine Wege schon richtig sind, auch wenn es manchmal schwierig zu verstehen ist.
Mit Freude denke ich an all die gemeinsamen Ausflüge und Reisen zurück die auch unser Leben bereichert haben. Städtetrips, Wellnessferien oder Rundreisen mit Ehepartnern, aber auch abenteuerliche Ausflüge zu zweit bleiben in bester Erinnerung.
In vielen Gesprächen und Diskussionen konnten wir uns gegenseitig bereichern und unterstützen. Auch der Genuss von gutem Essen und Trinken hat uns all die Jahre begleitet und erfreut.
Mit Danilo verbindet mich eine Freundschaft die sich durch all die Jahre hindurch bis auf den heutigen Tag erhalten hat. Seine Begeisterung für alles was er tut und sein Glaube an Jesus Christus, der sich durch sein Ganzes Leben hindurch hält, sind für mich eine Freude und Ermutigung.
Es erfüllt mich mit Dankbarkeit, dass ich Danilo kennen darf und ich freue mich auf all das was noch vor uns liegt.
Dein Freund
Rolf

Gemäss Berechnungen des Arztes sollte mein Geburtstermin bereits im August sein. Somit waren meine Eltern fast einen ganzen Monat so ziemlich auf Nadeln. Ob die Berechnungen des Arztes falsch waren oder ich im August noch nicht reif genug war, wird wohl nie aufgeklärt. Bestimmt war es aber bequemer und weniger anstrengend, noch ein bisschen die Wärme und Geborgenheit im Bauch meiner Mutter zu geniessen. Was soll ich stressen, die nehmen mich auch etwas später noch. Dann kam der Donnerstag, 9. September 1965. An diesem Tag ging Mami zusammen mit meiner grossen Schwester Sandra, mit Stampfigrosi und Tante Lotti auf den Zofinger Monatsmarkt. Nachdem Sandra zu den neuen Gummistiefeln auch noch einen Luftballon bekam, gönnte sich das Frauenquartett im Kaffee Domino eine Pause. Dort habe ich mich mit einem grossen Knall angekündigt. Der Ballon von Sandra und die Fruchtblase platzten gleichzeitig. Ich habe mich früh am Tag angekündigt, aber den Beteiligten genügend Zeit gelassen, alles zu organisieren. Schwester, Grosi und Tante nach Hause bringen, Papi vom Geschäft abholen und zu Hause auf die Geburtswehen warten. Nach einem Anruf in das Spital empfahlen diese meinen Eltern zu kommen. Bei einer geplatzten Fruchtblase macht das Sinn. Auch im Krankenhaus lies ich dem Personal genügend Zeit. Um den 9.9. zu halten, hatte ich Zeit bis 23.59.59. Kurz vor 24 Uhr war es dann soweit und ich erblickte das erste Mal die Welt.



Nach dem Erlebnis auf der Griesalp zeigte sich, dass wohl die Höhe einen entscheidenden Einfluss auf meine Verdauung hatte. Diese Erkenntnis war sehr viel wert. Der nächste Urlaub sollte also möglichst im Flachland geplant werden. Mit 14 Monaten habe ich mich entschieden, nicht nur meine Verdauung laufen zu lassen, sondern auch meinen Beinen diesen Auftrag zu geben. Dieses Aufrechtgehen hatte doch schon sehr viele Vorteile. Der Horizont wurde erweitert und vor allem konnte man den Topf selbständig verlassen, egal ob das Geschäft schon erledigt war oder nicht. Ja, meiner Mutter ging die Arbeit nicht aus.
In dieser nicht einfachen Zeit für meine Eltern hat Gott sie in ihrer Entscheidung, mich nach Hause zu nehmen, immer wieder bestätigt. Vor allem für meine Mutter waren die Liebesbekundungen von Menschen in ihrer Umgebung immer wieder Mutmacher. Wie wenn Gott sagen würde: «Meine Zusage gilt, auch wenn die Zeit herausfordernd und keinesfalls ein Spaziergang ist. Ich bin da und ich gebe dir die Kraft, die du brauchst.» Dazu hat er oft Menschen gebraucht, die meine Eltern mit Unterstützung beigestanden sind. Solche guten Freunde besassen ein Haus im Tessin, die «Villa Dante». Wir durften als Familie dort ein paar Tage in der Sonnenstube der Schweiz verbringen. An einem heissen Tag beschlossen meine Eltern, einen Ausflug zu unternehmen. Was eignet sich besser als eine Schifffahrt auf dem Lago di Lugano. Da gibt es immer eine kühle Brise und zudem können die Kinder nicht weit weg laufen. Dies dachten sich wohl eine sehr grosse Menge Leute auch, und so war das Schiff bis auf den letzten Platz besetzt. Bei heissem Wetter soll man viel trinken. Und weil schliesslich Ferien waren, durfte es zur Feier des Tages auch mal etwas anderes als ungesüsster Holundersirup sein. Und welches Softgetränk trinkt man als guter Schweizer – nein, Coke Zero gab’s damals noch nicht, auch nicht Coke Fanta oder Sprite light. Ein Softgetränk mit folgendem Werbespruch «Kein Durst ist zu gross für RIVELLA!» beherrschte damals den Getränkemarkt in der Schweiz. Zudem war dies ein Produkt, dass in unserer Wohngemeinde in Rothrist produziert wurde. Und für meine Eltern als Unterstützer der einheimischen Wirtschaft war klar, wenn ein Süssgetränk, dann nur RIVELLA. Zudem war dieses mit ca. 30% Milchserum hergestellte Erfrischungsgetränk auch sehr gesund. Besonders für den Knochenbau. Doch irgendetwas in diesen so beliebten Getränken war ganz und gar nicht kompatibel mit meinem sehr sensiblen Verdauungsapparat. Kaum hatte ich mir den ersten Schluck genehmigt, entstand ein Rumpeln in meinem Bauch und die Geschichte war nicht mehr aufzuhalten. Ich muss noch dazu sagen, dass ich eigentlich «trocken» war, brauchte also keine Windeln mehr. Dies war aber in der Situation absolut kein Vorteil. Stellt euch vor, wie peinlich für meine Mutter. Hunderte von Touristen aus aller Welt und mitten drin ihr Zweijähriger, der buchstäblich in der Scheisse steht. Es gab nur einen Weg, der aufs WC. Doch dieser führte durch die Menschenmenge. Also den tropfenden Jungen unter den Arm, Augen zu und durch. Nach dem nötigen Reinigungsritual ging’s zurück auf das Deck, zuversichtlich, dass nach dieser Menge kein weiteres «Material» mehr kommen kann. Doch erstens kam es anders und zweitens folgte mein Magen nicht den gewöhnlichen Abläufen. Und so kam es dazu, dass die zweite Ladung sich ihren Weg durch die frisch gewaschenen Hosen den Beinen entlang in die Sandalen und auf das Schiffsdeck suchten und auch fanden. Wenn die Menschen beim ersten Mal noch mehrheitlich mitfühlende Blicke für meine Mutter übrig hatten, waren sie jetzt eher von Unverständnis geprägt. Sie schienen zu sagen: «Wie kann man mit einem so kranken Kind nur eine Schifffahrt machen? Der gehört doch ins Kinderspital!»
Ein Vorteil hatte dieser geruchsintensive Ausflug; nebst dem das Höhenmeter ab 1000 meiner Verdauung zusetzte, wussten wir jetzt, dass auch RIVELLA eine abführende Wirkung hervorrief. Dies ist mir bis heute geblieben. Sollte ich mal wegen «Verdichtung» nicht können, ein RIVELLA wirkt Wunder.

Mein Leben als Kleinkind war geprägt von meinen Verdauungsgeschichten. Aber ich lebte immer noch. Ob das der Professor der Kinderklinik in Aarau, welcher meinen Eltern meinen sicheren Tod vorausgesagt hatte, wohl jemals mitbekommen hat? Ich weiss es nicht. Natürlich hat meine Mutter auch einiges an Hausmitteln, Tee’s und so weiter ausprobiert. Wirklich angeschlagen hat dann aber erst eine kleine Tablette Namens Lacteol, welche mir meine Mutter auf einen Tipp einer Freundin verabreichte. Natürlich war damit mein Problem nicht 100% gelöst, aber wenigstens konnten meine Eltern mir bei Krämpfen oder Durchfallanfällen jetzt etwas geben, was Linderung versprach. Und mit der Zeit wurde es tatsächlich besser. Ganz weg ist es bis heute nicht. Aber es hindert mich nicht, mich der wunderbaren weltweiten Kulinarik hinzuwenden. Dazu aber später mehr.
Schon bald hat mein Umfeld festgestellt, der Junge kann ja sehr gut Geschichten und Verse rezitieren. Oft musste ich eine Geschichte nur zwei, drei Mal hören und ich konnte diese fehlerfrei wiedergeben. Vor allem in der Adventszeit als meine Mutter mit uns Kindern Lieder und Gedichte eingeübt hat. Für mich schienen diese Übungen keine grosse Herausforderung zu sein. Und so kam es dazu, dass ich mit gerade mal zwei Jahren an der Weihnachtsfeier meinen ersten Vortrag halten konnte. Auf einem Stuhl stehend in festlicher Kleidung rezitierte ich mit Inbrunst und Überzeugung folgende Zeilen:
«Oh Buebli, du herzigs, wie luegsch du mich a.
Ich cha fasch nid gnue a dim Chrippeli stah.
Ich neme dis Händli und striichles e chli.
Oh Buebli, du söttisch mis Brüederli si.»
Später und je älter ich wurde, wurden die Gedichte immer länger. Auch die Dramaturgie in die Erzählung zu packen, hat mich fasziniert. Da war das Gedicht «De Fritzli geit id Frömdi», die Geschichte einer Familie aus dem hintersten Emmental, welche wegen ihrer 17 Kinder keinen Platz mehr in ihrem bescheidenen Häuschen und vor allem zu wenig zu Essen für alle Kinder hatten. Wie sie sich schweren Herzens entschlossen, den Ältesten in die fremde weite Welt zu senden. Die Entscheidungsfindung, in welcher Stadt es wohl am besten wäre, und wie sie sich auf Anraten des Pfarrers für Zürich entschieden. Wie sie den mit der Situation überforderten Fritz auf seinen Auszug vorbereiteten mit gut gemeinten Ratschlägen und Warnungen vor den Gefahren der Grossstadt. Nur ein kleines Beispiel daraus: «Pass guet uf of die viele Gfahre, me werdi schins z Züri allpot überfahre, sigs nid vom Auto oder vom Tram, die Gschicht gieng so schnell wie nes Telegramm. Und Gang nie is Dörfli und nie i Kreis vier, dort heigs e Gesellschaft, es gruuset eim schier.»
Da waren aber auch die Stellen, wo sich der Fritz freute, endlich weg zu kommen vom harten Bauernleben. Schluss mit der schweren Feld- und Stallarbeit in ein Leben in Saus und Braus und eigenem Geld. Die Schlussszene war jeweils der Höhepunkt. Hier konnte ich meine ganzen Emotionen hineinbringen. Wie die drei dort am Bahnhof standen und weinten vor Trennungsschmerz. Wie die Mutter seufzend und schluchzend sagte: «Gell Fritzli, blieb immer husslig u ledig. Denk all Tag es paarmal a dis Vaterhus, und stieg ömel jo nid scho z Rüschlikon us.» Dass die Familie vor lauter Trauer den Zug verpasst hat und sie darauf beschlossen den Fritz ein weiteres Jahr zu Hause zu behalten und dementsprechend im Haushalt zusammenzurücken, haben alle Zuhörer jeweils mit Dankbarkeit und Erleichterung zur Kenntnis genommen. Nach einer solchen lebendigen und emotionsgeladenen Präsentation war mir der Applaus der Zuschauer gewiss. Und es hat mir immer sehr gefallen. Ich war stolz auf mich. Einen Nagel gerade Einschlagen konnte ich nicht. Oder Holz hacken ohne anschliessenden Nähtermin beim Arzt ging nicht. Aber reden, das konnte ich. Nicht nur Gedichte habe ich auswendig gelernt. Auch fast alle Nummern von Emil, dem Schweizer Pionier der Komiker, konnte ich fehlerfrei präsentieren. Ganze Radiosendungen habe ich auf meinem Kassettengerät produziert. Ich habe Hörspiele nacherzählt und jede Rolle selber gesprochen, was mir überhaupt keine Schwierigkeiten bereitete. Besonders geliebt habe ich das Nachsprechen der Reportage des Fussballspiels FC Zürich gegen den FC Basel von Karl Erb. Natürlich nur, wenn Zürich gewonnen hat. Das war aber in den 70er Jahren sehr oft der Fall, wurde mein geliebter FCZ doch 1974, 75 und 76 Schweizer Meister und 1970, 72, 73 und 76 Cupsieger. Daraus entstand auch mein Wunsch, Sportreporter zu werden. Schon sehr bald habe ich bemerkt, dass sich mit meiner Fähigkeit, mein Sprachorgan überzeugend einzusetzen, viele andere Defizite überdecken liessen. Zwar wurde aus dem Sportreporter nichts, jedoch kann ich heute knapp 10 Jahre vor der Pension sagen, dass ich mein ganzes Berufsleben lang mein Geld mit «Reden» verdient habe.
Während meine ersten vier Lebensjahre bis auf die Verdauungsprobleme relativ normal verliefen, fing mit dem fünften Lebensjahr eine neue Phase an. Meine Eltern stellten fest, dass sich meine Pupillen unnatürlich verschoben. Ein klares Indiz für aufkommender Strabismus, eine Augen-Muskel-Gleichgewichtsstörung, die sich in einer Fehlstellung beider Augen zueinander ausdrückt. Im Volksmund heisst das «Schielen». Die logische Folge, eine Brille muss her. Und weil mein Schielen ziemlich ausgeprägt war, mussten auch die Gläser eine gewisse Stärke haben, was sich besonders durch die Gläserdicke zeigte. Heute würde man die auch «flache Böden» nennen. Zu allem Elend waren diese dann auch noch quer und längs gestreift. Ende der 1960er Jahre gab es noch keinen Fielmann oder McOptic mit Marketingprogrammen für Kinder und Jugendliche. Entsprechend sah das Nasengestell auch aus. Ein gefundenes Fressen für andere Kinder mir zu zeigen, dass sich «Brillenschlangen» sehr gut eignen, um sich auf ihre Kosten lustig zu machen. Nein, Mobbing würde ich dies nicht nennen.
Dies alles führte dazu, dass die Brille den Launen meiner Mitschüler und meiner eigenen Ungeschicklichkeit zum Opfer fiel. Unzählige Male bin ich von Rothrist nach Aarburg zum Augenoptiker und Brillenverkäufer Spörri gelaufen mit allen möglichen Schäden an der Brille. Manchmal habe ich es mehrere Wochen geschafft und die Brille blieb ganz. Es kam aber auch vor, dass ich zu Hause gleich wieder umkehren konnte, weil das blöde «Stängeli» schon wieder abgebrochen war. Wäre uns Herr Spörri nicht so wohlgesinnt gewesen und hätte nicht so viele Reparaturen gratis gemacht, meine Eltern hätten ein halbes Vermögen ausgegeben.
Brillen kann man reparieren, mit den zwei linken Händen ist das etwas Anderes. Mein Vater war Handwerker mit Leib und Seele. Vieles an unserem Haus hat er selber gebaut. Nun ist es bei Männern so, dass sie normalerweise ihre eigenen Fähigkeiten gerne auch bei ihren Söhnen sehen würden. Jedoch hat der Schöpfer da manchmal andere Pläne. Dies ist dann für uns Väter gar nicht so einfach zu akzeptieren. Dass ich so gar nichts von den handwerklichen Fähigkeiten meines Vaters in die Wiege gelegt bekommen hatte, stellte er beim Arbeiten an unserem Haus fest. Ich durfte ihm jeweils das Znüni auf die Baustelle bringen. Und die Baustelle war auch sehr interessant, da gab es unzählige Dinge zu sehen. Natürlich wollte ich mich auch nützlich machen. Und ich durfte meinem Vater zudienen. Handlangern im Volksmund. Doch das war für mich wie eine neue Sprache zu lernen. Hammer und Nagel kannte ich ja noch, aber was in Gottes Namen war eine Schraubzwinge, eine Schublehre, und welche Mutter sollte ich meinem Vater jetzt reichen? Der absolute Höhepunkt war, als mein Vater mir sagte, er brauche noch Elektroden. Elek....Was? Ich schaute mich auf dem Dach um. Was könnte das denn sein? Elektroden? Das muss was mit Elektrizität zu tun haben. Also kombinierte ich Elektrizität mit Steckdose und was kommt normalerweise in eine Steckdose? Genau, ein Stecker. Also machte ich mich auf die Suche nach einem solchen. Nun gab es zwar unzählige Kabel in allen Formen, die da so rum lagen. Doch keines hatte einen Stecker dran. Auch nichts Ähnliches. Natürlich wurde mein Vater langsam ungeduldig, denn er wollte ja weiter Bleche zusammenschweissen. «Kommen diese Elektroden endlich?» hat er mir zugerufen. «Ich kann ihn nicht finden» gab ich zur Antwort. «Was heisst, du kannst ihn nicht finden? Sie liegen doch direkt vor dir in dem grauen langen Karton!» Ich schaute mir den Karton, der vor mir lag, genauer an. Da drin war nichts, was einem Stecker auch nur annähernd ähnlich war. Da waren ca. 30 cm lange graue Stäbe drin, die aussahen wie Bengalische Zündhölzer. Mein Vater hatte relativ schnell den Verdacht, dass sein ältester Sohn wohl gewisse Defizite in handwerklichen Arbeiten hat. Um ganz sicher zu gehen, gab er mir zwei Holzbretter, Nägel und Hammer und wollte, dass ich diese Bretter zusammennagle. Diese Übung hat seinen Verdacht erhärtet. Ja, er hatte Gewissheit, dass sein Sohn wohl nie in seine handwerklichen Fussstapfen steigen wird. Denn die Nägel waren alle gebogen, die Bretter gespalten und der Daumen blau. Nun, ich bin dann trotzdem in die beruflichen Fussstapfen meines Vaters getreten. Er war fast sein ganzes Leben lang Verkäufer in verschiedenen Positionen bis hin zum Verkaufsleiter und Geschäftsleitungsmitglied eines mittelständischen KMU. Diese verkäuferischen Fähigkeiten, andere Menschen von den Vorteilen der anzubietenden Produkten und Dienstleistungen zu überzeugen, und dies mit einer fokussierten Zielorientiertheit und dem Ehrgeiz erfolgreich zu sein, diese Stärken habe ich zweifellos von meinem Vater geerbt.

Es gäbe noch so vieles über meine Kindheit zu erzählen. Da waren die Osterfeste, wo wir mit unseren Cousinen und Cousins bei unserer Grossmutter Osternester suchten. Und ich zu meinem Elend alle anderen ausser mein Eigenes fand. Oder die Familienferien im wunderschönen Grächen mit der eindrücklichen Höhenwanderung Saas Fee - Grächen. Die Tomatensuppe mit Wienerli abkochen. Oder die Samstagnachmittage, wo wir vom Jugendunterricht der Kirche im Wald OL‘s absolvierten als Vorläufer der Jungschar, die dann später entstand. Oder die never ending Story vom Bauen des Gartenhauses. Oder dem Jäten im Garten, das dank meiner unglaublichen Dynamik und Motivation Stunden dauerte. Und und und. Wie im Eingangswort erwähnt nichts Weltbewegendes, aber alles Erlebnisse, die das Leben prägen und formen und zu dem entstehen lassen, was es heute ist. Die Geschichten gehören zu mir, ja sind ein Teil von mir und ich bin dankbar, sie erlebt zu haben. Ein ganz besonderes Erlebnis möchte ich hier aber gesondert festhalten. Ein Erlebnis, welches eindrücklich die Verheissung aus Jesaja 42.1, welche meine Mutter über meinem Leben erhalten hat, bestätigt.
Meine Eltern waren und sind heute noch sehr gastfreundliche Menschen. Wir hatten sehr oft Besuch. An diesen Besuchen wurde auch nie kulinarisch gespart. Mein Vater hat in der Kirche die Jugendarbeit aufgebaut und viele Jahre geleitet. Mami stand ihm immer zur Seite und hat ihm den Rücken freigehalten, dass er diese Aufgabe machen konnte. Der Initiative meiner Eltern ist es zu verdanken, dass im Verband der Freikirche, welcher wir angehörten, Jugend Missionslager durchgeführt wurden. Zuerst in der Schweiz und später viele Jahre in Österreich. Die Verbandsleitung war nicht begeistert, schon gar nicht, dass diese auch noch «gemischt» – also Frauen und Männer gemeinsam – stattfinden sollten. Mein Vater hat sich durchgesetzt. Als Konsequenz daraus sind in diesem Lager wohl einige Beziehungen entstanden, aus welchen später Familien wuchsen. Es haben aber auch junge Menschen in diesen Einsätzen den Ruf erhalten, selber als Missionare tätig zu sein. Einige davon waren mitverantwortlich für die Entstehung von Freikirchenverbänden und Organisationen in Österreich und sind heute nach über 40 Jahren noch immer aktiv. Wie viele Menschen durch diese Arbeit Veränderung und Heilung durch die Kraft und Liebe von Jesus erleben durften, weiss ich nicht. Ist auch nicht so wichtig. Denn die Bibel sagt, es ist unsere Aufgabe zu sähen, die Frucht schenkt Gott. Markus 4.26ff.
Im Zusammenhang mit der Vorbereitung eines solchen Lagers waren Martin und Annerose zwischen Weihnacht und Neujahr, ich glaube es war 1974, bei uns zum Nachtessen eingeladen. Alles lief den gewohnten Gang. Nach dem Nachtessen mussten wir Kinder uns ins Zimmer zurückziehen, damit meine Eltern ungestört mit dem Besuch das Lager besprechen konnten. An diesem Abend waren wir Kinder sehr aufgedreht. Warum? Ich weiss es nicht mehr. Vielleicht war es, weil auch unser Grosi bei uns übernachtete. Und dieses war immer wieder für so manche Spässe zu haben. Wir hüpften auf unseren Betten rum. Kletterten das Kajütenbett hoch und runter und hatten ein mächtiges Gaudi. Irgendwann habe ich die Kiste meiner Schwestern mit den Plastikperlen, mit denen sie Halsketten bastelten, genommen. Diese Perlen haben ein kleines Loch, um sie am Faden zu einer Kette aufzureihen. Wenn man nun durch ein solches Loch blies, gab es einen lustigen Ton. Bei dieser Tätigkeit ist es dann halt passiert. Statt zu blasen habe ich, um meine Lungen zu füllen, Luft geholt. Und mit dieser Luft ist auch die Perle in meinem Hals verschwunden. Die Perle war genau so gross, dass sie in meiner Luftröhre stecken blieb. Husten nützte nichts, sondern mit jedem Atemzug setzte sich die Perle fester in meiner Luftröhre fest. Die einzige Möglichkeit Luft zu kriegen war das kleine Loch für den Faden. Meine ältere Schwester merkte sehr schnell, dass etwas mit mir nicht mehr stimmte. Ich gab so komische Atemgeräusche von mir. Sofort alarmierte sie meine Eltern, welche im Wohnzimmer mit dem Besuch im Gespräch waren. Ein Blick reichte und sie wussten die Lage ist ernst, ja dramatisch. Nachdem sie den Notarzt verständigt hatten, sagte dieser: «Warten Sie nicht, fahren Sie so schnell wie möglich ins Krankenhaus nach Olten. Ich melde Sie dort an!» Die Eltern haben mich gepackt und in unseren weissen Fiat 125 Spezial geladen. Ich glaube, jemand hat dem Besuch noch zugerufen «Betet für Danilo». Mami am Steuer und Papi mit mir auf der Rückbank. So sind wir nach Olten gerast. Ich weiss nicht, wie viele Verkehrsregeln gebrochen wurden. Ich weiss nur noch, dass Papi mir immer wieder gesagt hat, dass ich ruhig atmen soll. Ich glaube seine Worte haben mir geholfen, nicht in Panik zu geraten. Das letzte, an das ich mich erinnern kann, ist die Frage des Arztes, woher ich käme. Meine Antwort war Rothrist, das weiss ich noch. Das erste, was ich nach dem Aufwachen dachte, war: Nein, im Himmel bin ich nicht, denn da würde mich diese Nadel im Arm bestimmt nicht schmerzen. Ich habe zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst, wie nah ich am Tod vorbeiging. Aber ich habe Gott gedankt, dass ich lebe. Und dann habe ich die Nadel aus dem Arm gezogen, was unweigerlich den Alarm ausgelöst hat. Innert weniger Sekunden stand die Nachtschwester neben meinem Bett. Ich glaube, ich habe ihr gesagt, dass Jesus wohl mein Leben gerettet hat. Am nächsten Tag haben mir meine Eltern und der operierende Arzt erzählt, dass meine Sauerstoffsättigung sehr tief war. Und dass es sehr schwierig war, diese Perle aus meiner Luftröhre zu saugen. Es war ein Wettlauf mit der Zeit. Der Arzt wollte unbedingt verhindern, dass die Perle in die Lunge wanderte, was wohl beträchtliche Schäden an dieser verursacht hätte. Er meinte: «Es haben vielleicht eine bis maximal zwei Minuten gefehlt, dann hätte die Sauerstoffknappheit zum Kreislaufzusammenbruch und schliesslich zum Tod geführt. Danilo, es ist ein Wunder, dass du heute so hier liegst ohne erkennbare bleibende Schäden.» Ich musste noch ein paar Tage im Spital bleiben. Schon bald hinderten mich die Medikamente nicht mehr daran, mein Lieblingsorgan, meinen Mund, zu gebrauchen und so habe ich die Krankenschwestern mit meinen Geschichten köstlich unterhalten.
Damals habe ich die Situation und was gerade passiert war wohl nicht 100% verstehen können. Aber eines wusste ich. Die Gebete an diesem Abend von meinen Geschwistern, dem Grosi sowie Martin und Annerose zu Hause und das ununterbrochene Flehen meiner Eltern im Warteraum des Spitals zu Gott haben meine Rettung unterstützt. Jesaja 42.1 wurde zum zweiten Mal in meinem Leben manifestiert.

In den ersten Jahren war meine grösste Herausforderung das Rechnen mit den farbigen Stäbchen. Weisse Einer, rote Zweier, hellgrüne Dreier und so weiter. Was haben irgendwelche farbigen Stäbe mit Zahlen zu tun? Was ergibt zwei Dreier zusammengelegt? Meine Antwort war: Eine hellgrüne Linie. Oder wie viele Einer haben in einem Zehner Platz? Meine Antwort: Keiner, da ich die Einer nicht in den Zehnerstab reintun kann. Irgendwie habe ich das Einmaleins dann doch geschafft dank viel Geduld von Frau Nöthiger unserer Unterstufenlehrerin. Jedoch konnte mich Mathematik nie mehr begeistern. Genügend sein war das Ziel. «Vier gewinnt». Die Mittelstufe war geprägt von Fussballspielen in den Pausen, vielen Schlägereien, in welchen ich und meine Brille meistens das Nachsehen hatten. Aber etwas habe ich gelernt, wer ein grosses Maul hat, sollte auch schnell rennen können. Wenn Mathematik mir keine Freude bereitete, war Schreiben der reinste Horror. Egal mit welchem Füller, ob dem teuren Pelikan oder einem günstigeren Plagiat, die Tinte hatte sich gegen mich verschworen. Schon beim Einsetzen der Patrone in den Füller fand ich nie den richtigen Druck. Meistens drückte ich zu fest, so dass die erste Ladung Tinte in hohem Bogen auf den Tisch und die darauf liegenden Gegenstände spritzten. Auch beim Schreiben war die Tinte mehr auf das Blatt gemalt als in feinen Strichen zu Wörtern geformt. Irgendwie schaffte ich, was sonst nur Linkshänder herausfordert, ich verschmierte mit meinem Handrücken das Geschriebene ungleichmässig auf dem Schreibheft. In meinen Heften konnte man keine Texte lesen, sondern rätseln, was das blaue Farbenspiel mit grossen und kleinen Flächen und Punkten wohl sagen will. Wenigstens war der Lehrer fair und verteilte allen kleine Stickers. Während die andern Schüler lauter Sonnen, Sterne und Sommervögel bekamen, waren meine Hefte gefüllt mit Schweinchen und Stinktieren. Einmal gab ich mir grosse Mühe und habe gefühlte vier Stunden an einer Reinschrift eines Aufsatzes geschrieben. Da gab es ganz wenige Tintenflecken und man konnte den Text fast ganz lesen, ohne zu raten, was die Striche wohl heissen würden. Ich war stolz auf mich und freute mich auf das Feedback des Lehrers. Dies lautete: «Sauber und ordentlich geschrieben Note 4.» Dieses Urteil, dass mein riesiger Aufwand gerade mal mit genügend bewertet wurde, hat meine ganze Schönschreib-Motivation gekillt. Ein weiteres Fach, in dem meine Devise fortan «vier gewinnt» lautete.

«Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei; hab keine Angst, denn ich bin dein Gott! Ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich!» Jesaja 41.10
Dieser Vers aus Jesaja setze ich über das Kapitel, sogar über die nächste Lebensphase. Er hat mein Leben begleitet und geprägt.
Ich war immer eher klein und ein typischer Spätentwickler. Während andere Jungs meiner Klasse schon deutliche Haarspuren rund ums Kinn hatten, war bei mir noch nicht einmal ansatzweise etwas vom Stimmbruch zu hören. Wenn wir nach dem Sport duschen gingen, hätte man mich in der achten Klasse wohl ohne weiteres für einen Primarschüler halten können. Hat es mich damals belastet? Nein, ich kannte nichts anderes. Schon als ich in der zweiten Klasse im Konsum einkaufen musste, meinte die Verkäuferin, weil ich ihr den Einkaufszettel nicht übergeben habe, ganz erstaunt: «Was du kannst schon lesen!» Die Tatsache meines Entwicklungsstandes hatte natürlich auch zur Folge, dass ich bei den Mädchen nicht erste Wahl war. Keine wollte mit einem Jungen gesehen werden, der aussah wie ein Fünftklässler. Dazu kam, dass ich nie in der Disco anzutreffen war. Nicht weil ich nicht gewollt hätte. Meine Eltern haben es schlichtweg verboten. An den Abschlussabenden in den Klassenlagern habe ich dann schnell einmal die Rolle des Discjockeys übernommen. Bald habe ich gemerkt, dass ich diese Rolle liebe, denn ich konnte den Musik- und somit den Tanzstil bestimmen. Ich habe somit die Klasse ganz ohne Schnurrbart, Flaum und tiefer Männerstimme nach meinen Vorstellungen geführt.
Nach der achten Klasse habe ich mich entschieden, ein Jahr die Berufswahlschule im Nachbardorf Aarburg zu besuchen. Zwar hatte ich schon Vorstellungen, welchen Beruf ich erlernen wollte, nämlich Koch. Aber ich fühlte mich mit vierzehneinhalb Jahren noch nicht bereit, eine Lehre zu beginnen. Zudem hat mich der Schnuppertag in der Berufswahlschule begeistert. Der Lehrer war 60, und machte einen sehr strengen Eindruck. Er hatte etwas Militärisches an sich. Jedoch habe ich gespürt, dass er die Jugendlichen sehr mochte. Irgendwie hat er in mir etwas geweckt, das mich erahnen liess, dass Schule durchaus auch spannend sein kann. Das hat sich dann das ganze Jahr über bewahrheitet. Heute kann ich sagen, dass dieses Jahr wohl mein Bestes der ganzen Schulzeit wurde. Sogar Handarbeit hat mir Spass gemacht. Vielleicht waren es die klaren Strukturen in seinen Stunden. Was begonnen wird, wird auch fertiggemacht. Wir versprechen nur, was wir halten können. Wir setzen uns klare Ziele. Wir müssen nicht jedes Fach beherrschen, aber wir machen überall das Mögliche. Disziplin, Leistung und Freude sind kein Wiederspruch. Er war streng, aber fair und vor allem ging er voraus. Eindrücklich bewiesen hat er das, als er mit uns ca. 40 Halbstarken mit dem Fahrrad ins Klassenlager nach Schaffhausen fuhr. Auch er hatte nur einen Dreigänger für die 100 Kilometer. Dieser Lehrer hat bald gemerkt, dass ich ein Mensch bin, der Beziehungen und Gemeinschaft braucht. Er sah in mir nicht nur den Unterhalter sondern auch den Gastgeber. Er sagte immer wieder: «In einer Küche verdorren deine Fähigkeiten. Du musst an die Gastro-Front. Da bist du zu Hause und kannst deine Entertainmentfähigkeiten entwickeln und ausleben.» Er vermittelte mir eine Schnupperlehrstelle als Kellner in einem sehr angesagten Hotel in Aarburg. Die Woche hat mir sehr gut gefallen. Dazu kam, dass ich den Vorteil einer Kellnerlehre auch in der Kürze der Lehrzeit sah, zwei Jahre Lehre und im Alter von siebzehneinhalb bereits das grosse Geld verdienen – vier gewinnt! Ich hätte die Lehrstelle erhalten, jedoch nur unter der Bedingung, dass ich vorher ein Jahr am Buffet gearbeitet hätte. Das wollte ich auf keinen Fall, da hätte ich ja ein Jahr verloren. Also habe ich noch im Rest. Bahnhof in Rothrist angeklopft. Und tatsächlich habe ich die Lehrstelle ohne einen Schnuppertag erhalten. Am 3. April 1981 habe ich meine berufliche Laufbahn in Angriff genommen.
Wie bereits erwähnt, waren wir als Familie aktive Mitglieder einer Freikirche. Da war es üblich, dass man als Jugendlicher auch den Biblischen Unterricht besuchte, welcher mit einem zweiwöchigen Glaubenskurs abgeschlossen wurde. Diesen Kurs habe ich noch vor Beginn des Berufswahlschuljahres besucht. Mehr oder weniger begeistert. Ich hätte viel lieber am Schulabschluss in der Schülerband «Lady in Black» von Uriah Heep gesungen. Aber das viel terminlich genau in diese Kurzzeit. Und meine Eltern setzten die Priorität für mich. Im Nachhinein bin ich meinen Eltern dankbar dafür. Denn in diesen zwei Wochen lernte ich Rolf aus Zürich kennen. Es entwickelte sich eine tiefe Freundschaft, die bis heute, über 40 Jahre, bestand hat. Aber noch wichtiger war, ich erkannte, dass unser Leben noch eine andere Bedeutung hat, als einfach gelebt zu werden. Ich erkannte, dass wir von Gott gewollte Geschöpfe sind. Dass er unser Leben schon kennt, wenn wir noch im Mutterleib sind (Psalm 139). Gott und Jesus waren mir nie fern, ich habe als Kind viel gebetet und die Hilfe von Jesus ja auch erlebt. Und ich ging gerne in die Sonntagsschule und den Biblischen Unterricht, auch wenn er manchmal alles andere als spannend vermittelt wurde. Aber es war eher ein «Man macht es, weil die Eltern es so wünschen»-Leben. In diesem Glaubensgrundkurs habe ich erkannt, dass ich selber verantwortlich für mein Leben bin. Ich muss mich für Jesus entscheiden. Ich muss entscheiden, ihm das Steuer meines Lebensschiffes zu übergeben. Nur er kann meine Schuldfrage lösen. In mir entstand ein tiefes Verlangen nach dieser Geborgenheit. Ich glaube, es war etwa am vierten Tag, als ich, nachdem schon die Nachtruhe angesagt war, noch einmal aufstand und das Zimmer eines Leiters aufsuchte. Ich wollte Jesus ganz bewusst in mein Leben lassen. Der Leiter hat mir dabei geholfen. In einem Gebet habe ich Jesus mein Leben hingelegt, ihn um Verzeihung gebeten für meine Fehler und Gemeinheiten, für meinen Ungehorsam, die Lügen, einfach alles, was mir in den Sinn kam. Und ich habe meine Zukunft in seine Hand gelegt. Er sollte ab diesem Tag die Führung meines Lebens übernehmen. Ein tiefer Friede überkam mich. Ein Gefühl, am Ziel angekommen zu sein. Ein unbeschreibliches Glücksgefühl. Ich wusste, dass das meine beste Entscheidung in meinem Leben war. Der Leiter hat ebenfalls gebetet und Gott für mich gedankt und mich im Namen Jesus gesegnet mit dem Vers aus Jesaja 41.10: «Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei; hab keine Angst, denn ich bin dein Gott! Ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich!» Dieser Vers wurde dann auch mein Konfirmationsspruch.
Die Gewissheit, ein Kind Gottes zu sein, hat mich auf meinem Lebensweg geprägt. Ich war überzeugt, nun kann mir nichts mehr passieren. Wie singt doch Herbert Grönemeyer «Mit Gott auf unserer Seite, mit Jesus in einem Boot sind wir unschlagbar.» Doch irgendwann kommen auch auf Jesus-Gläubige Schwierigkeiten zu. Nicht immer läuft das Leben auf einem geraden Strich. In Herbert Grönemeyers Lied gibt es ja auch diese Zeilen, wo er solche Situationen besingt: «So wahr mir Gott helfe, hab’ ich geschworen. Aber der ist eben ab und zu nicht bei mir und dann bin ich total verloren.» Was genau vorgefallen ist, dass ich mehr und mehr gleichgültig wurde, was Glaubensthemen anbelangt, weiss ich nicht mehr. Vielleicht war es meine Neugier auch anderes kennen zu lernen als nur Jugendgruppe am Samstagabend und Kirche am Sonntagmorgen. Zudem wurde durch meine Lehre als Kellner dieser Rhythmus arg durcheinandergewirbelt. Oft musste ich jetzt an den Wochenenden arbeiten und konnte nicht mehr die Anlässe der Kirchen besuchen. Die Aussagen vieler Kirchgänger und Verantwortlichen der Freikirche wie «Als Christ im Gastgewerbe zu arbeiten, wo du keine Möglichkeit hast, am Kirchenleben teilzunehmen, das kommt nicht gut. Ja, das ist gefährlich, um nicht zu sagen fahrlässig» haben meinen Wunsch nach Gemeinschaft mit anderen Christen nicht unbedingt gefördert. Ich mache diesen Menschen heute keinen Vorwurf. Sie sagten dies, weil sie sich ernsthaft um mein Seelenheil gesorgt haben. Trotzdem bin ich dankbar, dass sich diese Haltung in den meisten Freikirchen nicht durchgesetzt hat. Dazu kam sicher, dass sich auch bei mir, auch wenn ich immer noch kein Bartwuchs hatte, durch die Pubertät Hormone entwickelten. Diese waren wahrscheinlich auch verantwortlich, dass ich am Zigarettenautomat das erste Mal ein Packet Marocain Super für 1.90 Franken gekauft habe. Dies war wohl der Start zu einem unglaublich anstrengenden Doppelleben. Von nun an musste ich aufpassen, dass ich nicht vergass, die Zigaretten aus der Hosentasche zu nehmen, wenn ich diese meiner Mutter zum Waschen gab. Ich musste immer Kaugummi dabei haben, um den Rauchgeschmack zu überdecken. Die Kleider waren damals kein Problem, weil in den 80er Jahren in den Restaurants noch geraucht werden durfte. Also habe ich so oder so jeden Abend gerochen wie eine Rauchwurst frisch aus dem Kamin. Aber am anstrengendsten war, dass ich immer aufpassen musste, dass mich keiner aus dem Kirchenumfeld beim Rauchen sah. Zum Glück für mich kamen nicht allzu oft Menschen aus der Kirche auf Besuch ins Restaurant, wo ich die Lehre machte. Neben dem Rauchen gab es aber noch ganz viele andere Dinge, die ich zu entdecken begann. Alkohol – eine ganz neue Erfahrung. Nicht, dass meine Eltern zu Hause in Abstinenz gelebt hätten. Überhaupt nicht, mein Vater hatte sogar die Abstinenzerklärung meiner Mutter an das Gremium zurückgeschickt, welches meine Mutter dazu überredet hatte, dies zu unterschreiben als sie 15 oder 16 Jahre alt war. Aber ich habe in meinem familiären Umfeld nie die Folgen eines überdurchschnittlichen Alkoholkonsums erlebt. Betrunkene kannte ich nur aus der Rubrik «Unglücksfälle» und «Verbrechen» in der Sonntagschule. Unserer Sonntagsschullehrerin war es sehr wichtig, uns vor den schrecklichen Folgen eines übermässigen Alkoholkonsums zu warnen. Und ich bin ihr sehr dankbar dafür, denn ich glaube, diese Geschichten haben bei unseren Partys in mir oft eine Bremse ausgelöst, nicht bis zur Besinnungslosigkeit zu trinken. Trotzdem gab es eine Zeit, da war ich jeden Abend betrunken, manchmal konnte ich kaum mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Und immer am Morgen nahm ich mir vor, heute Abend lasse ich es. Und trotzdem bin ich am nächsten Tag wieder mit Kopfschmerzen aufgewacht. Erst als dann noch Cannabis dazu kam, konnte ich mit dem regelmässigen Überkonsum von Alkohol aufhören. High sein mit Gras war doch um einiges cooler.
Ja, es war sehr anstrengend auf der einen Seite in den familiären und kirchlichen Kreisen den «frommen und braven» Danilo vorzuspielen und auf der anderen Seite meine neuen Kumpels nicht zu enttäuschen und alles auszuprobieren, was man damals eben so ausprobiert hat. Ich bin Gott dankbar, dass er mich vor wirklich harten Dingen bewahrt hat. Nur einmal haben wir in der Gewerbeschule mit irgendwelchen Amphetaminen in flüssiger Form experimentiert. Irgendjemand hatte die Idee, diese wie Kokain zu sniffen. Ich wusste damals nicht, dass auch Kokain zu der Gruppe der Amphetamine gehört. Die Wirkung war unglaublich, es hat mich buchstäblich weggeblasen. Die Wirkung von Amphetaminen beruht im Wesentlichen auf der Freisetzung der Hirnbotenstoffe Dopamin und Noradrenalin und greift damit in das Belohnungszentrum des Gehirns ein. Bei niedriger Dosierung stellen sich Gefühle entspannter Aufmerksamkeit und Stärke ein. Konsumentinnen und Konsumenten erleben oft ein gesteigertes Selbstvertrauen, überschätzen aber meist ihre körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Genau so war es bei mir. Auf die Aufforderung des Lehrers, mich richtig hinzusetzen, habe ich ihm mit einer ungeheuerlichen «Selbstsicherheit» gesagt, er soll seine Schnauze halten und mich gefälligst in Ruhe lassen. Dass ich nicht von der Schule geflogen bin und somit auch die Lehre nicht hätte abschliessen können, verdanke ich wohl der Grosszügigkeit des Lehrers. Nachdem ich realisiert hatte, was passiert war, habe ich mich bei ihm entschuldigt und um Nachsicht gebeten mit dem Versprechen, dass sowas nie mehr passiert. Er sah in mir wohl das Potential und hat meine Entschuldigung akzeptiert. Es war nie mehr ein Thema bei ihm. Von diesem Moment an habe ich nie mehr härtere Drogen als Marihuana angerührt. Ich bin überzeugt, auch die Gebete meiner Eltern und meiner Grossmütter haben eine entscheidende Wirkung gehabt. Darum mein Appell an Dich, wenn Du das hier liest und jemand in Deinem Umfeld sich auf einem solchen Umweg befindet, wie ich es damals war, hör nicht auf, für sie/ihn zu beten.
Es gab aber durchaus auch Zeiten, in denen ich mich auf meine Entscheidung ein Leben mit Jesus zu führen, zurück besann. Da war ich dann überzeugter Jesusnachfolger. Extrem konservativ und hart mit allen Andersdenkenden. Dieser Lebensstil war aber für einen jungen Menschen ebenso anstrengend, dass ich diesen jeweils nicht lange durchgehalten habe. Heute weiss ich, dass die Menschen in meinem Umfeld diese Phasen beeinflusst haben. Fühlte ich mich angenommen, habe ich automatisch den Lebensstil dieser Menschen kopiert, ja ihn sogar noch ausgeprägter gelebt. Niemand hält ein solches Leben mit so vielen up’s and down’s über längere Zeit durch. Irgendeinmal kommt der Zeitpunkt, wo wir uns entscheiden müssen, wie unser Leben weitergehen soll. Welche Richtung wir einschlagen, wie wir unser Leben gestalten und welches Leben wir wählen wollen. Das war auch bei mir nicht anders.

«Du bist eine meiner grössten Enttäuschungen. Als Christ hätte ich von Dir etwas ganz Anderes erwartet. Du hast nicht nur den Teppich im Zimmer ruiniert, sondern auch mein Vertrauen in Dich!» Ich stand da in der Telefonkabine der Kaserne Losone. Der andere hatte den Hörer schon längst aufgelehnt, als ich immer noch regungslos dastand. Was ist hier gerade abgelaufen? Ich wollte mich doch entschuldigen dafür, dass ich vergessen habe zu melden, dass mir am Silvester ein Glas Rotwein runtergefallen ist und der Wein den Teppich ruiniert hat. Ich hatte keine Gelegenheit mehr, vor dem Einrücken in die Unteroffizierschule dem Vermieter das Missgeschick zu bekennen. Und in der Hektik der ersten UO-Tagen habe ich dies total vergessen. Mein Vermieter war natürlich alles andere als erfreut über den Schaden, den ich ihm zurückgelassen habe. Dieser Vorfall war der Höhepunkt in einem, ich würde sagen, hinderungsreichen Zusammenleben. In der Zeit zwischen der Rekrutenschule und der Unteroffizierschule war ich für sieben Monate in Lausanne, um Französisch zu lernen. Die Rekrutenschule war eine «Up-Zeit» in meinem Leben. Die Sanitätstruppen haben es so an sich, dass viele Christen ihren Militärdienst da absolvieren. Wir waren ungefähr fünf Rekruten, die ein Jesus- zentriertes Leben führten. Auch ein paar Leute aus dem Kader. Wir hatten wirklich eine gute Gemeinschaft und es war schon fast so wie in einem Jungschilager mit Gebetszeiten und gemeinsamem Bibellesen in Biwak-Wochen. Wir haben uns immer wieder gegenseitig unterstützt und ermutigt, unseren Glauben zu leben. Für mich war es also naheliegend meine Welschland-Zeit in einem frommen Umfeld zu absolvieren. Das Angebot war cool. Am Morgen Schule, welche mein Arbeitgeber und Vermieter zahlte, und am Nachmittag für 400 Franken im Monat plus Kost und Logis bei ihm Milchprodukte herstellen. Am Anfang ging alles gut und ich war eingebettet in der Familie und auch in der Freikirche, wo diese aktiv war. Es war eine meiner «guten Zeiten». Wie ich ja bereits im vorherigen Kapitel geschrieben habe, hielten diese Phasen nicht allzu lange an. Erschwerend war sicher auch, dass meine «Lausanne-Familie» ein völlig anderes Verständnis von Welschland-Aufenthalter und ihrer Freizeitbeschäftigung hatten. Sie sahen mich als Teil ihrer Familie und waren nicht besonders amüsiert, wenn ich in meiner Freizeit vorwiegend mit meinen Freunden zusammen war. Dies gab natürlich oft Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten. Ihnen als Mitverantwortliche der Freikirche war mein Lebensstil natürlich auch nicht immer so angenehm. Rauchen war jetzt nicht gerade Standard. Und ich kann gut verstehen, dass mein wieder immer mehr aufkommendes Doppelleben meinen Patron nicht glücklich oder gelassen gemacht hat. Zudem litt dadurch natürlich auch meine Zuverlässigkeit bei der Arbeit und meine Lernbereitschaft in der Französisch-Sprachschule. Ich glaube, mein Chef hatte andere Erwartungen an den Charakter und an das Verhalten eines jungen Jesus-Nachfolgers. Ich war in keiner Weise bereit, etwas dafür zu tun, dass dieses Bild von mir geändert hätte. Und so war schnell mal klar, dass ich mein Engagement sicher nicht verlängern konnte. Am 31. Dezember 1985 habe ich mit ein paar Freunden in meinem Zimmer Silvester und Abschied gefeiert. Dabei ist dann das Missgeschick mit dem Glas Rotwein passiert.
Als ich den Hörer auflegte, war mein Entschluss gefasst. Wenn Christen so reagieren, dann will ich mit dieser Spezies nichts mehr zu tun haben. Dass ich die Ursache für die Reaktion meines Vermieters war, habe ich ausgeblendet. Endlich hatte ich einen Grund, dieses fromme Leben hinter mir zu lassen und ich konnte die Verantwortung für diesen Entscheid jemand anderem unterjubeln. Darauf musste ich gleich ein paar Biere trinken.
Da es in den Sanitätstruppen nicht nur viele Christen gab damals, sondern auch viele Wehrdienst- und Waffenverweigerer, Studenten und Lebenskünstler, hatte es auch immer genügend Stoff zum Rauchen. Schon bald haben wir Kiffer uns gefunden und unsere Leidenschaft gelebt. Schon skurril, in der RS waren es die gemeinsamen Bibel- und Gebetstreffen mit den Christen und beim Abverdienen die Chillumraucher Treffen mit den Kiffern. Als Materialchef meiner Kompanie hatte ich nie Nachschubprobleme für den Stoff. Ich wurde versorgt und habe dafür jeweils ein Auge zugedrückt, wenn das Material nicht einwandfrei zurückkam. Es war auch schon bald bekannt, dass es beim Materialmagazin lauschige Plätzchen gibt, wo man tolle Bodenboums geniessen konnte. Ich hatte Stoff, ich war high, alles andere war mir egal. Als stellvertretender Feldweibel musste ich hie und da die Kompanie melden. Die Zugführer melden die Bestände ihrer Züge, und der Feldweibel muss dem Kompaniekommandant sagen, wie viele Männer anwesend sind und wo überall sich die anderen befinden. Die Rechnerei sollte nicht allzu lange gehen, da die Kompanie in Achtungsstellung auf das Run des Kadis wartete. Nun ihr erinnert Euch, Rechnen war nie meine Stärke. Und mit so viel Stoff intus, war es eine zusätzliche Herausforderung. Meine Meldung hat dann jeweils ungefähr so gelautet. «Melde Bestand 180 Mann, anwesend 143, Fahrzeugpark, 8, KZ 9, Fassmannschaft 7, 3 Urlaub, ..... und wo waren jetzt schon wieder die restlichen 10? Ah ja 10 Mann WTW». So hat im Frühling 1986 in der Kaserne Losone eine neue militärische Abkürzung ihren Platz gefunden: «WTW». Einmal hat mich ein Leutnant gefragt, was denn WTW heisse. Ich hab ihm gesagt, ganz einfach «weiss der Teufel wo».
Natürlich hatte mein Lebensstil auch Auswirkungen auf mein Familienleben. Oft verbrachte ich die Wochenenden im Tessin, denn da konnte ich in Ruhe kiffen, so viel ich wollte. War ich mal zu Hause, nervte ich mich über alles und jeden. Besonders über alles was mit Kirche zu tun hatte. Denn diese Tatsache war schuld, dass es mich immer wieder daran erinnerte, dass da mal etwas anderes mein Leben erfüllt hat. Es ärgerte mich, an diesen Jesus erinnert zu werden. Es ging so weit, dass ich meinen Rekruten empfahl, ja keine Bibel zu nehmen, als die Gideons diese in der Kaserne verteilten. Ich warnte sie, wenn ihr ein solches Büchlein nehmt und auch noch darin lest, werdet ihr nie mehr in Ruhe kiffen können. Ich glaube, es haben trotzdem viele ein neues Testament genommen.
Der Frühling 1986 war sehr nass und stürmisch im Tessin. Oft gab es so viel Niederschlag, dass Erdrutsche die Folgen waren. Öfter mussten wir auf einem Marsch grosse Umwege gehen, weil umgestürzte Bäume die Wege blockierten. Daher beschloss die Schulleitung, vor jedem Marsch ein Detagement voraus zu schicken, um den Weg zu räumen oder zu kennzeichnen, wo man nicht durchmarschieren konnte. Ich wurde dafür als Anführer gewählt und konnte mir meine ca. sechs Begleiter selber aussuchen. Natürlich wollte ich keine Streber oder sogar Christen dabeihaben, sondern nur solche, die auch kräftig mitkifften. Kaum waren wir ausser Reichweite der Kaserne machte der erste Joint seine Runde. Um dieses Feeling noch mehr geniessen zu können, haben wir uns Zivilisten mit kleinen Transportern organisiert, um auf deren Ladeflächen mindestens die gut befahrbaren Kilometer nicht laufen zu müssen. Um dann nicht zu früh wieder zurück zu sein, haben wir es uns jeweils in irgendeinem Garten gemütlich gemacht. Die Hausbesitzer waren sehr freundlich und immer bereit, ein paar Flaschen Merlot zu offerieren. Einmal nach einem solchen Einsatz kam ich zurück ins Camp und der Furier fragte mich, ob ich Lust hätte auf ein Glas Calvados in seinem Zelt. Ich dachte mir, klar warum nicht. Aus dem Glas wurde eine halbe Flasche. Ich sagte ihm, dass ich mich vor dem Materialrapport noch etwas aufs Ohr legen wollte. Ich bat ihn, er solle mich doch 10 Minuten vor dem Rapport wecken, was er auch gemacht hat. Am Rapport konnte ich trotzdem nicht teilnehmen. Mein Körper hatte genug, ich bin zusammengeklappt, hatte unglaubliches Herzrasen und war total weggetreten. Sofort wurde ich mit Verdacht auf einen Herzkreislaufkollaps ins Spital nach Locarno gefahren. Im Spital war ich dann wieder einigermassen bei mir und konnte auf die Fragen des Pflegepersonals Antwort geben. «Haben Sie etwas getrunken?» – «Ja, ein kleines Glas Calvados». «Nehmen sie Drogen?» – «Ich, Drogen?! NIE!» – «Wir müssen Ihr Herz und Ihre Lunge röntgen, um sicher zu gehen, dass nichts kaputt ist.» Als ich zum Röntgengerät gehen wollte, bin ich ein weiteres Mal zusammengeklappt und habe damit eine mittlere Panik beim Pflegepersonal ausgelöst. Sofort wurde ich auf die Intensivstation gebracht und an ein EKG angeschlossen. Was dann alles noch abging, weiss ich nicht mehr so genau. Ich kann mich erinnern, dass mich eine hübsche dunkelhaarige Ärztin untersucht hat. Und dass ich mich in der Nacht auf die Nachtschwester freute, aber dann enttäuscht feststellen musste, dass ein Pfleger Dienst hatte. Es war keine besonders schöne Nacht. Neben mir lag einer, der wohl sehr ernsthaft krank war. Er war an unzählige Schläuche angeschlossen. Und die Apparate gaben die typischen Intensivstationsgeräusche von sich. Zudem wusste ich nicht was meine Diagnose war. Klar war mir nur, dass ich wohl übertrieben habe mit dem Konsum von Drogen und Alkohol. In dieser Nacht dachte ich an Gott und ich fragte mich seit langem wieder, was er wohl von mir halten wird. Am nächsten Tag durfte ich das Spital verlassen mit der Auflage über das Wochenende im Krankenzimmer zu bleiben, um unter ärztlicher Beobachtung zu sein. Geändert hat sich aber dadurch in meinem Lebenswandel nur, dass ich seit diesem Wochenende wusste, dass gewisse Medikamente zusammen mit Cannabis konsumiert noch viel bessere Flashs bringen und man damit die Menge des Stoffes reduzieren konnte.
Nach diesem Erlebnis wollte ich nur noch Eins: Auswandern. Ich wollte nach meinem Militärdienst kurz etwas arbeiten und dann so bald als möglich abhauen ins damalige Kifferparadies in Europa nach Amsterdam. Und jetzt kommt wieder meine Grossmutter ins Spiel. Sie wusste, dass ich nach dem Militär noch keine Arbeitsstelle hatte und rief in einem christlich geführten Hotel an, in dem ich schon mal eine Sommersaison nach der Lehre im 1983 gearbeitet hatte, und fragt den Chef, ob er nicht Arbeit hätte für mich. Natürlich wollte ich auf keinen Fall in einem «frommen» Haus arbeiten mit lauter spiessigen Christen. Trotzdem habe ich das Angebot angenommen und mich für zwei bis drei Monate mit der Option verpflichtet, sofort gehen zu können, wenn ich etwas Anderes gefunden habe. Für mich war klar: Zwei Monate hältst du aus und dann geht’s so oder so nach Amsterdam. Dies war mein Plan. Ich geh‘ dorthin, verdiene Geld und zusätzlich zeig‘ ich diesen ewig gestrigen christlichen Gutmenschen, wie das Leben wirklich ist. Das könnten zwei ganz lustige Monate werden. Und wenn dann der Kontostand stimmt «uf und dervo». Anfangs Juni 1986 habe ich im Hotel Friedegg in Aeschi zum zweiten Mal nach dem Sommer 1983 zu arbeiten begonnen.


(1) 2. Tage alt September 1965

(2) Endlich zu Hause Dezember 1965

(3) Fütterung mit Schutzkonzept

(4) Erste Schritte mit 14. Monaten

(5) O Buebli Du herzigs.

(6) Die Brille meine Challenge

(7) 1.Klasse 1972

(8) Berufswahlschule 1980

(9) Kellnerlehre 1982

(10) Tessin 1986

(11) Hochzeit 10.September 1988

(12) Familienferien in Grächen

(13) Sommer 2020

(14) Die ganze Familie März 2021

Männerhirne funktionieren ja bekanntlich wie eine Kommode. Für jedes Lebensgebiet eine Schublade. Kein Thema berührt das andere. Wenn die Schublade «Motor» offen ist, reden die Männer über dieses Thema und wenn dann eine hübsche Frau vorbeiläuft, dann wird die Schublade «Motor» geschlossen und die Schublade «Frauen» geöffnet. Diese Tatsache macht uns auch berechenbar. Es war an einem Sonntagnachmittag auf dem Heiteren in Zofingen. Wir waren vier Jungs von ungefähr 20 Jahren und hatten die Schublade «Fussball» geöffnet, der FC Aarau war eben Cupsieger geworden. Da spazierten ein paar Girls vorbei. Irgendwie hatte der FC Aarau sofort keine Relevanz mehr. Schnell waren wir beim Austauschen von unseren Beziehungsgrundsätzen und Vorstellungen unserer zukünftigen Partnerinnen. Plötzlich stand die Frage im Raum, wie denn eine zukünftige Partnerin sein soll. Was soll sie mitbringen? Wie soll sie aussehen? An diesem Nachmittag entstand bei mir eine Liste, wie ich mir meine zukünftige Frau vorstellte. Da waren etwa 20 Punkte wie zum Beispiel blonde Haare, blaue Augen – typisch halt – aber auch kochen muss sie können, eine Familie gründen mit ein paar Kindern, am liebsten vier. Gutes Verhältnis zu meinen Eltern, vier Jahre jünger, und weil es eine meiner «Up-Phasen» war, stand auf der Liste auch, dass sie eine Jesusnachfolgerin sein sollte. Meine Kollegen fanden, dass ich doch nicht eine Frau wählen kann, wie wenn ich ein Auto kaufen würde. Ich habe geantwortet: Ich glaube, dass Gott mir eine Frau schenkt, aber damit er richtig auswählt, soll er auch meine Wünsche kennen. Wir haben an diesem Sonntag noch lange über Sinn und Unsinn von meiner Liste philosophiert. Aber ich habe mir fest vorgenommen, an dieser Liste festzuhalten und nichts Anderes zu akzeptieren. Heute muss ich sagen, dass mich das Festhalten an dieser Partner-Wunschliste oft vor falschen Beziehungen bewahrt hat. Von dem Moment als ich entschieden hatte, dem Glauben den Laufpass zu geben, war diese Liste auch kein Thema mehr. Eine feste Beziehung wollte ich so oder so nicht, ich hatte ja bekanntlich andere Pläne.
So bin ich also im Hotel Friedegg in Aeschi bei Spiez angekommen. Ich habe mich in den Tea-Room gesetzt und gewartet, bis ich abgeholt und mir mein Zimmer zugewiesen würde. Da ist sie hereingekommen. Sofort sah ich meine Liste vor meinem inneren Auge. Mindestens jeder äusserliche Punkt stimmte überein. Aussehen, Haarfarbe, Figur, Augenfarbe. Sicher war sie auch noch fromm und hatte eine für Fromme typische Familienvorstellung. Ich war wütend. Wütend auf Gott, weil er mir hier vor Augen hielt, dass er mich damals mit meinem Anliegen für eine Partnerschaft ernst nahm. Aber in diesem Moment wollte ich nicht, dass Gott sich in mein Leben einmischt. Dann fing sie an zu reden: «Kennst du mich noch?» Was sollte diese Frage, warum sollte ich die kennen? «Ich bin Katrin Frei, ich habe im Frühling 1983 hier gearbeitet als du kamst. Ich habe damals gerade das Haushaltlehrjahr hier abgeschlossen. Ich glaube wir haben noch ein oder zwei Wochen zusammengearbeitet», sagte sie weiter. Ich war froh, dass ich das Tea-Room bald verlassen konnte. Alles hätte ich mir vorstellen können. Aber nicht, dass Gott mir eine Frau in den Weg stellt, die meiner Liste entspricht, jetzt wo ich so gar nicht nach seinem Plan leben wollte. Ich wusste, ich muss meine Strategie ändern und alles dafür tun, dass ja keiner auch nur einen kleinen Gedanken daran verwenden könnte, dass dieser Stellenantritt eine Führung Gottes sein könnte. Mir war klar, ich musste meine Abneigung gegen alles Fromme ganz klar kundtun. Jeder soll spüren, dass ich nichts am Hut habe mit Bibelstunden etc. Wenn ich nur genug fies bin und diese Katrin so richtig fertigmache, dann wird sich diese Liste sehr schnell in Luft auflösen und ich habe Gott ein schönes Schnippchen geschlagen. Und dies habe ich dann sehr schnell umgesetzt. Normalerweise wurde vor den Personalmahlzeiten gebetet. Ich bin dann jeweils demonstrativ aufgestanden oder habe mir geschöpft oder Getränke eingeschenkt. Nach dem Essen wurde ein Text aus dem Andachtsbuch gelesen. Ich habe die Zeitung gelesen, am liebsten den Blick, den ich mir extra dafür besorgt habe. Und wenn gemeinsam gesungen wurde, ging ich eine rauchen. Es arbeiteten sehr viele Singlefrauen mittleren Alters da, denen ich gesagt habe, dass sie ja nur da seien, weil sie sich erhofften, einen frommen Junggesellen zu ergattern. Oft gab es Tränen. Nur eine Person ging nicht auf meine Sticheleien ein. Einmal sagte sie zu mir: «Du warst auch schon mal schlauer.» Auch wenn ich mich mit allem möglichen dagegen gewehrt habe, irgendetwas an ihr lies mich nicht mehr los. Ich wusste genau, was es war. Es war ihr unerschütterlicher Glaube an den Herrn Jesus. Sie hatte das, was ich auch empfand, damals als ich mein Leben Jesus übergeben hatte. Mit der Zeit fand ich die Sticheleien nicht mehr cool, weil sie ja nur bei allen anderen Wirkung zeigten, nicht aber bei Katrin. Damals fingen wir an, uns zu unterhalten. Stundenlang haben wir nur gesprochen. Wenn einer von uns Spätdienst hatte, hat der andere gewartet und dann haben wir oft bis in die Morgenstunden diskutiert. Ich fragte mich immer, wieso sich diese fromme junge Frau mit einem Kiffer wie mir abgibt. Ich habe mir eingeredet, dass es keine Liebe ist von meiner Seite, sondern reine Neugier. Und diese «Neugier» hat mich sogar in den Gottesdienst gehen lassen, nur um in ihrer Nähe zu sein. Als mir bewusst wurde, was ich da mache, habe ich den Gottesdienst fluchtartig verlassen. Einmal hat sie mir eine stündige Rückenmassage angeboten. Ich war so ziemlich durcheinander.
Ich wusste, so kann das nicht weitergehen. Meine Grundsätze gingen langsam den Bach runter. Seit einiger Zeit hatte ich keinen Stoff mehr. Ich musste unbedingt nach Interlaken, denn dort gab es eine kleine Grasdealer-Szene. Mit ca. 1000 Franken von meinem ersten Lohn bin ich nach Interlaken gefahren, um zu kaufen und dann mit dem Rest abzuhauen nach Amsterdam.
Es kam anders. Erstens als man vermutet und zweitens als ich geplant habe. Zwar konnte ich Kontakt knüpfen mit einem Szeneninsider. Er meinte: «Tut mir leid, heute kriegst du nichts. Komm am Samstag auf den Markt, dann sprechen wir darüber». Dies war aber für mich nicht möglich, denn ich konnte am Samstag unmöglich nach Interlaken. Ich war masslos enttäuscht. Was war mit der so vorurteilslosen und Menschen liebenden Kiffer-Peace-Weltanschauung? Ich wusste, er hätte mir mindestens für den Moment etwas geben können. Wenn ich heute darüber nachdenke, dann muss ich sagen, wenn es mir wirklich 100 Prozent ernst gewesen wäre mit Abhauen nach Amsterdam, dann wäre ich am Samstag einfach nicht arbeiten gegangen. Damals aber hatte ich wieder jemanden, dem ich die Schuld geben konnte, dass ich meinen Plan nicht umsetzten konnte. Ich fuhr zurück nach Aeschi und habe meinen Frust mit etwas Johnny Walker runtergespült, den der Casserolier des Hotels besorgt hatte. Es gab ja damals kein Alkohol in diesem christlich geführten Haus. Vieles ging mir durch den Kopf. Ist das, was ich hier mache, wirklich das Richtige? Oder besser gesagt, will ich das überhaupt? Was sind denn meine Lebensperspektiven? Wer ist schuld an meiner momentanen Situation? Mindestens auf die letzte Frage kannte ich im Tiefsten meines Inneren die Antwort sehr genau.
Ein paar Tage und ein paar durchdiskutierte Nächte mit Katrin später, war mir inzwischen klar, dass meine Gefühle ihr gegenüber nicht nur Sympathie waren. Ich sass draussen und schaute den Hotelfachassistentinnen beim Bladen zu. Eine sagte zu mir: «Du siehst aus, als bräuchtest du es ‹chrümeli› Hasch.» Ich schaute sie an und meinte: «Ja, wäre keine schlechte Idee», worauf sie meinte: «Vielleicht gibt es ja noch eine andere Lösung für dein Problem.» Ich schreckte auf. Ja, es gab eine andere Lösung. Was sie gemeint hat, wusste ich nicht, aber mir war schlagartig klar, jetzt ist der Zeitpunkt mich zu entscheiden, entweder den eingeschlagenen Weg durchziehen mit allen Konsequenzen oder um 180 Grad umkehren. Aber ich wusste, alleine würde ich diese Umkehr nicht schaffen. Noch an diesem Abend habe ich das Gespräch mit dem hoteleigenen Seelsorger gesucht. Dieser hat mir aufgezeigt, dass nicht Gott mich hängen lies, sondern ich ihm den Rücken gekehrt habe. Ich glaube, es war auch die Rede von den Worten Jesu in Johannes 10, wo Jesus sich seinen Zuhörer als der gute Hirte, der seine Schafe nie verlässt und um jedes kämpft. Dieser Seelsorger hat mir auch deutlich gemacht, dass meine Bekehrung als 15-Jähriger keinesfalls unecht oder gar bedeutungslos geworden wäre. «Es liegt an Dir, diesen Bund zu erneuern. Jesus wartet auf dich. Egal was du getan oder nicht getan hast. Nichts beeinflusst seine Liebe zu dir.» An diesem Abend habe ich kapituliert vor Gott. «Gott, Jesus, wenn du mich noch willst, dann nimm mich. Nimm meinen ganzen Scheiss und wirf ihn in die tiefsten Tiefen des Meeres. Und vergib mir, dass ich dich verlassen habe. Vergib mir, dass ich dich aussen vor gelassen habe in meinem Leben. Und übernimm du wieder und zu 100 Prozent die Führung meines Lebens.» Nach diesem Gebet wusste ich: «I was back!» Es waren nicht alle Fragen gelöst aber der Druck war weg. Noch etwas Anderes wusste ich. Ich wusste, dass ich die Beziehung mit Katrin klären wollte. Zurück in meinem Zimmer habe ich gebetet und Jesus gesagt. «Du bist jetzt wieder mein Herr und du hast mir mit Katrin eine Antwort auf meine Wunschliste gegeben. Nun lass uns Nägel mit Köpfen machen. Ich werde sie Morgen fragen, ob sie meine Frau werden will, ohne ihr etwas von meiner 180 Grad Wendung zu sagen. Und ihre Antwort nehme ich als deine Antwort.»
Ob ich in dieser Nacht gut geschlafen habe, weiss ich nicht mehr. Aber dass ich am nächsten Tag deutlich nervöser war und angespannt, was heute Abend passieren würde, wenn Katrin und ich wieder zusammen diskutieren. Und der Moment kam. Sie hatte sich inzwischen eine Wohnung ausserhalb des Hotels genommen und wir waren bei ihr verabredet. Ich weiss nicht mehr, wie der Start des Abends war. Aber ich weiss noch, dass ich sie irgendwann angeschaut habe und dann gefragt habe: «Willst du meine Frau werden?» Ihre Antwort kam ohne ein Zögern: «Von Herzen gern.» Nein, viel Romantik war nicht dabei. Aber dafür war es glasklar. Gott hat uns einander geschenkt, unsere Verbindung war sein Wille und das hatte er schon so geplant als wir noch im Mutterleib waren nach Psalm 139. Später als ich Katrin gefragt habe, warum sie ja gesagt hätte und das ohne zu zögern, obschon sie ja gar nicht gewusst hatte, dass ich mich wieder für ein Leben mit Jesus entschieden hatte, meinte sie: «Ich habe es einfach gespürt, dass du in deinem Innersten weisst, welcher Weg der richtige ist. Und ich habe gewusst, dass Jesus dich die richtige Entscheidung für dein Leben treffen lässt.»
Im Juli 2021 jährt sich unser Beziehungsstart zum 35. Mal. Und ich bin Gott unendlich dankbar, dass er mir diese Frau zur Seite gestellt hat. Mit ihr hat er meine Wunschliste um ein Vielfaches übertroffen, auch wenn der Punkt des Altersunterschiedes von vier Jahren als einziger nicht erfüllt wurde.

Zu welcher Stunde ich nach diesem Gespräch die Wohnung von Katrin wieder verlassen habe, weiss ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall erwiderte der Busschauffeur, der mir auf meinem Heimweg entgegen kam, auf mein «Guten Abend», «Es ist wohl ein bisschen früh für Abend». Ich hatte Frühdienst an diesem Tag. Und dieser begann normalerweise mit dem Personalfrühstück um 7 Uhr. Und die Gäste konnten dann ab 8 Uhr zum Frühstück kommen. Es war das erste Personalfrühstück an dem ich teilnahm, ohne bei der Andachtslesung den Tisch zu verlassen. Die Anderen schienen dies auch bemerkt zu haben, denn sie tuschelten gemeinsam und schauten mich dabei verstohlen an. Gefragt, was mit mir los sei, hat keiner. Mich haben diese Reaktionen nicht gross belastet, ich hatte etwas anderes im Kopf. Katrin und ich hatten beschlossen, den anderen Angestellten nicht proaktiv von unserer Beziehung zu erzählen. Aber was ich unbedingt wollte, war meine Eltern zu informieren. Noch an diesem Tag habe ich sie angerufen und sie für den Sonntag nach Aeschi bestellt. Sie sind gekommen, zusammen mit meiner Schwester Sandra und ihrer Familie. Ich muss hier noch erwähnen, dass ich keine wirkliche Beziehung, besonders zu meinem Vater, mehr hatte. Wie auch, gingen doch meine Lebensansichten in eine gänzlich andere Richtung als die meines Vaters. An diesem Sonntag habe ich meinen Vater gefragt, was er von Katrin halte. Er meinte: «Diese junge Frau hat sehr wohl die richtige Einstellung und ist mir sehr recht. Es liegt jetzt an dir und du musst dein Verhalten und deine Lebensart überdenken und wo nötig ändern.» Seit diesem Tag ist die Beziehung zu meinem Vater immer besser geworden. Immer mehr ist das gegenseitige Vertrauen wieder gewachsen. Und mein Vater wurde zu meinem besten und ehrlichsten Berater in allen Lebensthemen.
Mit der Zeit konnten wir unsere Beziehung nicht mehr geheim halten. Die anderen Mitarbeiter haben natürlich mitbekommen, dass wir die gemeinsamen freien Tage zusammen verbracht haben. Noch haben wir aber unsere Freundschaft nicht offizialisiert. An einem gemeinsamen freien Nachmittag konnte ich das Auto einer Mitarbeiterin ausleihen, und Katrin und ich sind nach Thun gefahren, um uns einen Freundschaftsring zu kaufen. Dies war dann der Moment, wo alle erkannten, was Sache war. Einige haben sich mit und für uns gefreut. Einige haben aber auch den Kopf geschüttelt und gefragt, wie sich eine gläubige Christin auf einen Freund mit solch zweifelhaftem Lebenswandel einlassen kann. Irgendwann haben aber auch diese Mitarbeiter erkannt, dass Gott in meinem Leben eine andere Rolle und Bedeutung bekommen hat. Mein verändertes Verhalten hat wohl Bände gesprochen.
Kurz darauf habe ich eine Stelle als Milchmann im Solothurnischen Hägendorf bekommen. Ich habe die Friedegg verlassen und bin wieder zu Hause eingezogen. Ich schaue sehr dankbar auf diese Zeit in der Friedegg zurück. Erstens bin ich meiner Grossmutter, welche schon lange im Himmel ist, dankbar für ihre Initialzündung, mich beim Fritz Baumann, dem damaligen Hoteldirektor ins Gespräch zu bringen. Dann aber auch bei Fritz und seiner Frau, welche mich besonders in der ersten Zeit meines Engagements nie verurteilt haben. Sie haben mir immer das Gefühl gegeben, dass sie mich trotz meiner schrägen Lebensweise ernst nehmen. Und natürlich bei Katrin, welche das Wagnis eingegangen ist mit mir. Sie alle waren Menschen, die sich von Gott brauchen liessen, um mich zu unterstützen auf dem Weg zurück zu ihm.
Für Katrin und mich war schnell klar, dass wir nicht lange warten wollten mit heiraten. Durch die geographische Trennung konnten wir uns höchsten noch alle 14 Tage sehen. Und als ich nach einem Jahr als Milchmann aus wirtschaftlichen Gründen die Kündigung erhielt und eine neue Stelle als Verkaufschauffeur in Zürich annahm, wurden diese Treffen noch etwas seltener. Damals gab es noch kein iPhone, Zoom oder Face Time. Und telefonieren war noch recht teuer und vor allem hatte man nicht die Privatsphäre mit den Wandtelefonen mit Drehscheibe. Wir haben uns sehr oft geschrieben. Natürlich war Katrin mir bald weit voraus mit der Anzahl. Ich würde schätzen, dass sie ungefähr zwei Drittel und ich ein Drittel der gesamten Anzahl Briefe geschrieben hat. Wir haben also beschlossen, am 9. September zivil in Rothrist und am 10. September 1988 in der Kirche Buchberg im Kanton Schaffhausen zu heiraten. In der ersten geistlichen Heimat in Zürich habe ich auch meinen Freund aus dem Glaubensgrundkurs wieder getroffen. Unsere Freundschaft wurde tiefer und ist bis zum heutigen Tag gewachsen. Viele gemeinsame Stunden beim Wein degustieren, Fahrrad fahren, Risiko spielen oder in gemeinsamen Urlauben allein oder mit unseren Frauen haben uns näher zusammengeführt. Eine richtige und wichtige Männerfreundschaft.
Wer meine Ausführungen bis hierher gelesen hat, hat meinen Charakter auch etwas kennen gelernt. Ein Plüss ist konsequent, klar und überzeugt von seiner Meinung. Manche würden sagen stur. Konsequent oder sogar stur sein ist nicht immer nur schlecht. Es hilft oft auch, schwierige Zeiten durchzuhalten, wo der Horizont verschwindet und der eigentliche Lebensplan und -traum platzt, und unbeirrt seinen Weg zu gehen. Aber diese Charaktereigenschaften prägen natürlich das eigene und das Leben der Mitmenschen. Eine grosse Gefahr dabei ist, dass man lieblos wird. Man sieht nicht mehr die Mitmenschen, sondern nur noch ihr Verhalten und vergleicht dies mit dem eigenen Verhalten. Und weil man überzeugt ist, dass das eigene Verhalten, die eigene Lebensweise der biblischen Norm entspricht und somit nur richtig sein kann, verurteilt man sehr schnell Menschen, welche nicht alle Auffassungen und eigenen Erkenntnisse teilen. Sture Menschen denken oft auch nur schwarz/weiss, gut/schlecht etc. Menschen, die so denken, lieben es, klare Rahmen und Grenzen zu haben, wo sie sich bewegen dürfen. Eine Frage, die uns damals immer wieder bewegt hat, war das Erscheinungsbild eines richtigen Christen. Welche Kleider? Dürfen Frauen Hosen tragen, wenn ja, wo sind die Grenzen? Wie hat die Haarlänge zu sein? Welche Musik ist christlich? Welcher Stil im Gottesdienst ist gottgefällig? Und so weiter. Wohl verstanden, wir waren Mitte zwanzig. Natürlich hat uns unsere Vergangenheit geprägt. Auch die Handhabung dieser Themen durch den Freikirchenverband, in dem wir uns bewegten. Wir zweifelten nicht an der Gnade Gottes und dass wir nur aus dieser Gnade vor Gott gerecht werden können. Und dass Jesus mit seinem Tod am Kreuz und der Auferstehung nach drei Tagen die Rettung der Menschheit ermöglicht hat, dies war unbestritten. Jedoch war da auch das Leistungsdenken. Der Vers 20 im Jakobus 2 war Grundlage und Motivation für viele unserer Handlungsweisen: «Wann endlich wirst du törichter Mensch einsehen, dass der Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns will?» (HFA). War das schlecht? Nein, ganz und gar nicht. Eine Fähigkeit von Gott ist es, dass er auch mit sturen Christen sein Reich bauen kann. So haben wir damals jeden Samstagabend im Niederdorf in Zürich Strasseneinsätze gemacht. Wir haben christliche Lieder gesungen, Anspiele, welche Glaubensthemen aufnahmen, vorgespielt und kurze Erlebnisberichte über unsere Erfahrungen mit Jesus erzählt. Oft haben wir Randständige anschliessend mit in die Kirche genommen und ihnen dort weiter von Jesus erzählt. Dass sie sich nicht wegen den Geschichten, sondern wegen der gratis Verpflegung zum Mitgehen überzeugen liessen, machte uns nichts aus. Die Kirche im Besonderen die Jugendgruppe hatte in unserem Leben einen sehr hohen Stellenwert. Das war unser Umfeld, wo wir uns bewegten. Andere Clubs oder Vereinsmitgliedschaften waren kein Thema. 2. Korinther 6.14 «Zieht nicht an einem Strang mit Leuten, die nicht an Christus glauben. Was haben denn Gottes Gerechtigkeit und die Gesetzlosigkeit dieser Welt miteinander zu tun? Was haben Licht und Finsternis gemeinsam?» (HFA) war zentral. Daran versuchten wir uns zu halten. Natürlich war dieses Leben oft auch anstrengend. Was war die richtige Balance zwischen Gnade und Eigenleistung. Oft diskutierten wir stundenlang darüber und das einzige Resultat, das dabei herauskam, war ein Streit, weil keiner von seiner Meinung auch nur ein Deut abgewichen ist. Trotzdem war diese Zeit gut und ich bin Gott dankbar dafür. Sie hat mich geprägt und ist Teil meines Lebens. Ich durfte vielen wunderbaren Menschen begegnen, mit denen ich heute noch losen Kontakt habe. Und wenn wir dann über diese Zeiten zusammen sprechen, müssen wir schmunzeln, wie wir damals unsere Meinung gegen jeden Widerstand vertreten haben. Und dabei sind wir dankbar, dass Gott uns mit dem Alter gnädiger gemacht hat.

Natürlich hatten Katrin und ich den Wunsch Kinder zu kriegen. Dies war ja auch ein Punkt auf meiner Liste; gemeinsamer Kinderwunsch. Wir wollten auch gar nicht lange warten. Jedoch hat manchmal die Natur etwas dagegen. Katrin hatte leider zwei Fehlgeburten im frühen Stadium. Aber nach zwei Jahren hat es geklappt. Es war kurz vor den Skiferien im Januar 1990 als Katrin mir sagte, dass sie wieder in Erwartung sei. Die Ferien waren mit meinen Eltern und einem befreundeten Ehepaar aus der Jugendgruppe von Zürich. Weil es noch sehr früh war und wir bereits zweimal enttäuscht wurden, wollten wir diese mögliche Schwangerschaft vorläufig für uns behalten. Aus Angst, das Kind wieder zu verlieren, kam Katrin jeweils nicht mit, wenn wir von Grächen auf das Seetalhorn auf etwas über 3'000 Meter Höhe fuhren, um etwas zu trinken und die Aussicht zu geniessen. Auch Schlittschuhfahren war nicht angesagt. Und noch etwas war anders. Katrin vertrug den Geruch von Kaffee nicht mehr. Es war manchmal gar nicht so einfach, gute Gründe für das veränderte Verhalten von Katrin zu finden, ohne zu verraten, dass eben eine Schwangerschaft bestand und die Vorsicht von unserer Seite nicht etwas zu tun, was wieder zu einem Verlust des Kindes führen könnte. So ungefähr im März haben wir dann das Rätsel aufgelöst und unsere Freunde aufgeklärt, warum wir uns so komisch verhielten in den Skiferien.
Wir freuten uns auf unser erstes Kind. Der Geburtstermin wurde auf irgendwann Ende September bis Mitte Oktober 1990 errechnet. Bei vielen Paaren beginnt ja nun der Fight der Namensfindung. Wir haben das sehr pragmatisch gelöst. Katrin war für die Bubennamen verantwortlich, ausser zwei waren alle erlaubt. Mit zwei Namen verband ich negative Erinnerungen aus meiner Jugendzeit. Ob ich hier wohl zu nachtragend war? Ich war für die Mädchennamen zuständig. Die Schwangerschaft lief bis etwa einen Monat vor Geburtstermin sehr gut. Dann am 17. September bei einem Routineuntersuch stellte der Arzt bei Katrin einen zu hohen Blutdruck fest. Er wies sie ins Spital ein zur Überwachung und dort wurde entschieden, die Geburt einzuleiten. Ich war damals beruflich bei der Kaffee Hag im Aussendienst tätig und weil es auch damals noch keine Selbstverständlichkeit war, dass man Autotelefone hatte, habe ich jeweils um die Mittagszeit angerufen. Katrin hat mich über den Entscheid des Arztes informiert und meinte noch: «Keine Angst, mir und dem Kind geht es gut. Du musst auch nicht pressieren. Es dauert, bis alles eingerichtet ist.» Ein Mann, der kurz davor ist, das erste Mal Vater zu werden, versteht in solchen Situationen jedoch ganz was anderes. Für mich war klar, jetzt musst du alles in Bewegung setzen, um die Geburt deines Kindes ja nicht zu verpassen. Sofort habe ich meine Termine vom Nachmittag telefonisch abgesagt. Zum Glück hatte ich genügend Kleingeld für den Telefonautomaten. Dann bin ich von Diessenhofen Richtung Bülach zurückgefahren. Natürlich nicht schön gemütlich und dem Strassengesetz entsprechend. Und tatsächlich, in Eglisau hat es dann geblitzt. Ich war nach Abzug der Toleranz ungefähr 20 km/h zu schnell unterwegs. Ich glaube heute würde diese Übertretung bedeutend teurer sein. Damals waren es 80 Franken. Und natürlich war noch gar nichts los im Spital. Ich wurde sogar mit dem Hinweis, dass es nicht vor dem nächsten Mittagessen soweit sein würde, nach Hause geschickt. Gut habe ich nicht erahnen können, dass ich dann noch Geduld haben musste bis am nächsten Tag am späten Abend. Um ca. 22 Uhr am 18. September 1990 hat David unser erster Sohn das Licht der Welt erblickt. Gesund, komplett ausgerüstet aber sehr klein. Durch die Schwangerschaftsvergiftung von Katrin hat er im letzten Monat fast nichts mehr zugenommen, dementsprechend waren seine Masse. 2260g und 45 Zentimeter. Mein erster Gedanke als ich ihn sah war, hoffentlich geht da nichts kaputt, wenn ich ihn anfasse. Wieder einer dieser glücklichen Momente in meinem Leben. Alles war perfekt, wir hatten ein Kind erst noch ein Stammhalter. Das Leben und Gott meint es wirklich gut mit uns.
Zwei Jahre später wurde Katrin wieder schwanger und wir mussten unsere Wohnsituation überdenken. Wir suchten uns eine grössere Wohnung. Am liebsten wären wir in die Stadt Zürich gezogen, um in der Nähe unserer Freikirche, zu wohnen, wo sich unser ganzes soziale Leben abspielte, wo wir unsere Freizeit verbrachten, wo unsere Freunde waren. Wir haben lange nach einer für uns zahlbaren Wohnung gesucht. Vergeblich, keine Wohnung in unserer Preisklasse frei. Auch nicht am Stadtrand. Es war damals einfach kein Mietermarkt. Gebaut wurde zwar sehr viel, auch in der Stadt. Aber dort mussten vor allem alte günstige Wohnungen neuen teureren Lofts und Luxusappartements Platz machen. Damit liess sich viel mehr Geld verdienen. Und als nicht Stadtzürcher war eine Aufnahme in eine Genossenschaft, von denen es in Zürich genügend gibt, nicht denkbar. Es ist wichtig, immer einen Plan B im Leben zu haben. Und den hatten wir. Nachdem wir erkannt hatten, dass Zürich schwierig werden würde, fingen wir an, auch in Bülach nach einer grösseren Wohnung umzuschauen. Und tatsächlich fanden wir sehr schnell eine passende 4-Zimmer-Wohnung etwa einen Kilometer vom alten Domizil weg. Nun war für uns klar, dass unser Platz, unsere neue Heimat in Bülach ist. Es war an der Zeit sich auch nach einer neuen geistlichen Heimat umzusehen. Dies war ein schmerzvoller Prozess. Wir wussten, dass ein Kirchenwechsel auch viele Trennungen von uns sehr lieb gewordenen Freunden bedeuten würde. Auch hatten wir uns in den vier Jahren eine gewisse Stellung in der Kirche erarbeitet. Wir hatten unsere Aufgaben, die uns erfüllten. Und nicht zuletzt hatte damals in den Freikirchen die Verbandstreue eine noch viel grössere Bedeutung. In Bülach gab es zwar viele verschiedene Freikirchen, aber keine von denen, in die wir bis jetzt gingen. Trotzdem wussten wir, dass wir diesen Weg gehen wollten. Wir entschieden uns für die kleine Freikirche, welche nach unserer Kenntnis theologisch der alten Freikirche am nächsten kam. Und so haben wir an der Silvesterfeier 1991/92 schweren Herzens Abschied genommen von unserer geliebten Kirche in Zürich. Wenn ich heute zurück blicke, dann macht es mich dankbar, dass wir dort diese vier Jahre ein- und ausgehen durften. Auch diese Zeit war ein Teil unseres Lebens und hat dazu beigetragen, uns zu dem zu machen, was wir heute sind.
Weil ich ein Mensch bin, der Gesellschaft über alles liebt und damals konnte es mir nicht genügend Aktivitäten geben, fielen mir vor allem die Sonntagnachmittage schwer. Keine Treffen und Diskussionen mit andern von der Kirche. Zwar war mir klar, dass es etwas Zeit braucht, bis wir uns eingelebt hatten, bis unsere Rollen in der neuen Kirche klar waren. Aber Geduld war nie eine besondere Stärke von mir. In dieser Zeit war mir Rolf eine grosse Stütze. Oft haben wir uns getroffen und ein Glas Wein zusammen getrunken und über unsere Lebenssituationen geredet.
Eine weitere Starthilfe in Bülach waren die Gideons. Dies ist eine Vereinigung von christlichen Geschäftsleuten, welche sich zum Ziel gesetzt haben, Bibeln an verschiedenen Orten zu verteilen. In Hotels, Spitäler, Arztpraxen, Schulen und im Militär. Katrin und ich wurden im Herbst 1991 zu einem Informationsabend eingeladen und haben uns daraufhin entschlossen, dieser Vereinigung beizutreten. Was gibt es besseres, als den Menschen das Wort Gottes zu verteilen. Eine Arbeit, die uns viele Jahre begleitet und mit Freude erfüllt hat. Schon nach wenigen Monaten wurde ich in den Vorstand der Gruppe gewählt und bekleidete das Amt des Vizepräsidenten und Verantwortlichen für die Schulübergaben.
Am 9. Juli 1992 hat Jonas, unser zweiter Sohn, das Licht der Welt erblickt. Wir waren an diesem Tag in Rothrist bei meinen Eltern. Gegen Abend haben wir uns auf den Heimweg gemacht. Vor dem Haus meiner Eltern gab es eine Baustelle. Dadurch war die Strasse sehr eng. Ich musste meinen Ford Sierra da durch zirkeln. Dabei habe ich auf der Beifahrerseite das tiefe Loch in der Strasse nicht gesehen. Natürlich gab das Reinfahren einen mächtigen Bums und hat wohl die Wehen bei Katrin ausgelöst. Nun, man weiss ja, dass schon noch etwas Zeit bleibt und ich habe gerechnet, dass 70 Kilometer, davon die meisten Autobahn, in einer Stunde zu schaffen sind. An den Stau am Baregg habe ich nicht gedacht. Auf dem Hintersitz David, neben mir auf dem Beifahrersitz Katrin, welche in immer kürzeren Abständen am Handgriff zog, vorwärts ging es nur schrittweise ohne Aussicht, die Autobahn verlassen zu können. Ja, da kommt dann schon eine gewisse Nervosität auf. Es hat gereicht. Sogar David konnten wir noch ins Bett bringen und der Nachbarin Bescheid und Wohnungsschlüssel geben, bevor wir in das Spital fuhren.
Wir hatten also innert kurzer Zeit eine neue Wohnung, eine neue geistliche Heimat, neue Aufgaben bei den Gideons und als Höhepunkt einen Zweikinder-Haushalt. Dies hätte eigentlich fürs erste Mal gereicht. Aber eben, wir befinden uns ja auf der Plüssseite des Lebens.

Im Jahr 1992 beschäftigte die Schweiz ein politisches Thema wie kein anderes. Die bevorstehende EWR Abstimmung. Auch ich habe mich informiert über die Vor- und Nachteile eines Beitritts der Schweiz zu diesem Verbund. Die Medien haben Wochen lang ohne Ausnahme vor einem Nein und seinen katastrophalen Folgen gewarnt. Um mich über beide Seiten zu informieren, habe ich eine Informationsversammlung von Dr. Christoph Blocher in Glattfelden besucht. Nach diesem Anlass war für mich klar, dieser Vertrag darf die Schweiz niemals unterschreiben. Am 6. Dezember 1992 sagten ja dann Volk und Stände bekanntlich nein zum EWR Beitritt. Diese politische Debatte hat mein Interesse für Politik geweckt und ich habe mich bei der eidgenössischen demokratischen Union (EDU) als Mitglied einschreiben lassen. Warum EDU und nicht EVP oder SVP. Bei der EDU fand ich die grösste Übereinstimmung der politischen Themen und Meinungen. Zudem wollte ich, dass auch in der politischen Arbeit der Glaube an Jesus Christus Grundlage ist. Ich war überzeugt, dass dies für mich am ehesten in der EDU möglich war. Wenn man sich in einer Partei engagiert, welche sich im Aufbau befindet, wird man schnell bemerkt und auch in Führungspositionen berufen. So war es auch bei mir. Bald schon nach meinem Beitritt wurde ich von der kantonalen Parteileitung beauftragt, eine Bezirkspartei in Bülach zu gründen. In dieser Rolle wurde ich in den kantonalen Vorstand gewählt und später auch in den nationalen Vorstand. An den Kantonsratswahlen 1995 konnten wir mit einer eigenen Kandidatenliste aus dem Bezirk Bülach teilnehmen. Für einen Sitz reichte es nicht, aber wir verhalfen mit der Listenverbindung dem damals parteilosen Bruno Dobler zu seinem Sitz im Kantonsrat.
Im Herbst 1992 hat Katrin mir eröffnet, dass sie bereits wieder schwanger sei. Was diese Mitteilung in mir bewirkt hat? Ich weiss es nicht mehr. Ich glaube aber, für mich war die Herausforderung weniger gross als für Katrin. Ich habe damals nicht bemerkt, dass ich durch die Annahme all der Ämter immer weniger Zeit für meine Familie hatte. Zudem befand ich mich in einer Weiterbildung zum eidgenössisch diplomierten Handelsreisenden. Da war ich zweieinhalb Jahre vom Frühling 1991 bis Herbst 1993 jeden Donnerstagabend und fast jeden Samstag in der Schule. Daneben hatte ich einen 100 Prozent Job im Aussendienst. Und hier waren die Erwartungen, die ich an mich stellte, auch nicht gerade klein. Ich wollte in jedem Monat unter den besten drei Verkäufern sein. Bei jedem internen Wettbewerb wollte ich Minimum den dritten Platz. Dafür habe ich auch keinen Aufwand gescheut und bin viele Extrameilen gegangen, um meine Ziele zu erreichen. Meistens habe ich die Wettbewerbe auch gewonnen und durfte zum Beispiel ein Wellnesswochenende in Österreich mit Katrin verbringen. Oder ich konnte uns zusätzliche Frankenbeträge erarbeiten. Dass bei all dem Beschäftigungsaufwand die Familie zu kurz kam und es Katrin Sorge bereitete, wie das gehen soll mit drei kleinen Kindern, war mehr als verständlich. Diese Tatsache hat auch hie und da Diskussionen ausgelöst. Dann habe ich mir jeweils ein paar Tage Mühe gegeben und versucht Katrin mehr Unterstützung zu geben. Aber schon bald hat mich wieder jemand gefragt, ob ich eine Aufgabe übernehmen würde und ich habe wieder ja gesagt. Was mich getrieben hat? Ich denke, es war die Erwartung an mich selber, mir Fähigkeiten anzueignen, welche ich glaube, dass sie mir andere nicht zutrauen würden. Aus meinem Grundsatz «vier gewinnt» wurde der Grundsatz «ich gewinne». Ein wichtiges Element dabei war auch, dass ich meinen Vater stolz machen wollte. Im Handwerklichen konnte ich das nicht, aber als erfolgreicher Verkäufer, engagierter Gideon, prägendes Kirchenmitglied und konsequenter Politiker konnte ich das. An dieser Stelle muss ich sagen, dass mein Vater mir nie Druck gemacht hat. Es war mein innerer Drang, dies zu tun. Und ich weiss, dass er sehr stolz ist auf seine Kinder, genauso wie auch unsere Mutter.
Michael ist dann am 17. Juni 1993 geboren. Wieder ein Junge. Das besondere bei ihm war, dass er ein sogenanntes Sternguckerkind war. Das sind Kinder, die bei der Geburt falsch rum zum Arzt, der Mutter oder eben zu den Sternen schauen. Nur etwa 0.5-1 Prozent aller Babys kommen als Sterngucker zur Welt. Dass er sich nicht nur mit der Geburtslage von seinen Geschwister unterschied, wussten wir damals noch nicht. Dazu schreibe ich später mehr.
Nun hatten wir drei gesunde Jungs. Ich war kurz vor dem Abschluss meiner Weiterbildung. Wir wurden von der Städtischen Wohnbaugenossenschaft ausgewählt für eine neue viereinhalb Zimmer Wohnung. Ich war ein gefragter Mann in Kirche und Politik, hatte Erfolg im Beruf und vor allem eine unglaublich selbstlose und aufopfernde Partnerin, welche mir den Rücken freigehalten hat. Es schien, als könnte mich nichts aufhalten.

Nach dem wir vier Jahre in der kleinen Freikirche in Bülach ein und aus gingen, haben wir uns entschlossen, eine Kirche zu suchen, welche mehr Möglichkeiten in der Kinderarbeit bot. Auch fehlte uns die Altersdurchmischung. Durch die Tätigkeit bei den Gideons lernten wir viele Mitglieder einer grösseren Freikirche mit viel Tradition in der Nachbargemeinde kennen und schätzen. Nach längerem Hin und Her und vielen Gesprächen haben wir uns entschlossen, uns dieser Kirche anzuschliessen. In derselben Zeit bekamen wir die Zusage, in ein Haus einzuziehen. Die sechs Doppeleinfamilienhäuser gehörten der Heimstätten Genossenschaft in Winterthur. Es waren Häuser, welche im 1947 gebaut wurden mit ca. 800 Quadratmeter Land. Und der Mietzins betrug ca. 1‘100 Franken inklusive Nebenkosten. Ein riesiges Geschenk für eine junge Familie, wie wir das waren. Damals habe ich als Inserateverkäufer beim Bülacher Tagblatt gearbeitet, war aber auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung. Ein Angebot aus Schönenwerd bei Aarau lag mir vor. Finanziell sehr lukrativ. Hätte ich die Stelle angenommen, hätten wir in der alten Kirche unseren Weggang nicht begründen müssen und hätten einfach verschwinden können, jeder hätte es verstanden. Doch ich fand innerlich keine Ruhe. Ich habe das Angebot ausgeschlagen, auch als mir der Chef dieser Firma nochmals 10 Prozent mehr Lohn geben wollte. So blieb uns nichts Anderes übrig, als den Weggang aus der Kirche zu begründen und alles daran zu setzen, so es in unserer Macht stand, uns in Frieden zu trennen. Dies ist gelungen, weil beide Seiten gewillt waren, sich gegenseitig Fehler zu vergeben. Kurz darauf fand ich eine Stelle als Verkaufs- und Marketingverantwortlichen bei der Gärtnermeister Fachzeitschrift «g-plus» in Zürich. Dies und die Zusage für das Haus sahen wir als klare Bestätigung, dass Gott uns noch weiter im Zürcher Unterland haben will.
Wir wohnten jetzt in einem Haus mit Platz und Umschwung und der Wunsch nach einem vierten Kind am liebsten einem Mädchen wurde grösser. Tatsächlich hat’s geklappt und Katrin wurde schwanger. Normalerweise wollten wir das Geschlecht nicht schon vor der Geburt wissen. Dieses Mal war es etwas anders. Am 22. Januar 1997 am Geburtstag von Katrin stand ein Routineuntersuch an. Hier hat der Arzt Katrin dann gesagt, dass sie die Haarspangen kaufen könne. An diesem Abend sind wir auswärts Essen gegangen, zum einen wegen des Geburtstages von Katrin und zum andern wegen der Nachricht, dass auch ich mal noch einen Namen für ein Kind wählen konnte. Dies war einfach, hatte ich diesen doch schon drei Male vorher bereit. Am 18. April 1997 bin ich am Morgen wie gewohnt ins Büro gefahren. Zirka um 9.30 Uhr hat mich Katrin angerufen und gemeint, es ginge wohl bald los. Ich habe noch gefragt, ob es pressiert. Sie meinte, es hätte wohl schon noch etwas Zeit. Also habe ich noch ein paar Mails geschrieben und ein paar Aufgaben erledigt und bin dann so gegen 10 Uhr in Zürich losgefahren. Meinen Bürokollegen habe ich gesagt: «Ich bin dann mal kurz weg, es könnte Morgen werden, bis ich wiederkomme.» Als ich um 10.30 Uhr zuhause ankam, sah ich sofort, dass es wohl nicht mehr allzu lange dauern konnte. Helen Mietlich, eine ehemalige Nachbarin, welche sich bereit erklärte, zu den Jungs zu schauen, meinte zu Recht vorwurfsvoll: «Wo bist du so lange? Mach vorwärts, es geht los!» Im Spital als Katrin im Gebärsaal lag, eröffnete uns die Hebamme, dass das Kind noch vor dem Mittag geboren sein wird. Und tatsächlich um ca. 11.30 Uhr hat Salome das Licht der Welt erblickt. Katrin und dem Kind ging es gut, sie bekamen ihr Mittagessen im Spital und ich konnte vorläufig nichts mehr tun, also beschloss ich, wieder ins Büro zu fahren. Um halb zwei war ich wieder im Büro. Meine Kollegen meinten, dass es wohl noch nichts war. Ich erwiderte: «Doch, doch, alles klar, eine Tochter, beide gesund und in guten Händen.» Der Eine oder Andere im Büro hat nicht wirklich verstanden, dass ich an diesem Nachmittag wieder zur Arbeit erschien. Besonders die weiblichen Arbeitskolleginnen fanden es rücksichtslos, dass ein Vater und Mann seine Frau und Tochter in dieser Situation alleine lies. Ich bin heute noch überzeugt, dass es richtig war, was ich tat. Zudem war es mit Katrin abgesprochen. Ich habe daraus gelernt, dass man in solchen Situationen ohne weiteres grosszügiger sein darf mit Mitmenschen, die nicht immer so reagieren, wie es dem eigenen Bild entsprechen würde.
Wieder einmal war unser Familienleben perfekt. Vier gesunde Kinder, endlich auch ein Mädchen, ein grosszügiges Haus, eine neue geistliche Heimat und ein Job, der mich erfüllte. Nun, liebe Leserin, lieber Leser, ihr ahnt, dass mir diese Situation schon bald langweilig war. Neben all den anderen Aufgaben habe ich damals einem Freund, der ein kleines Transportunternehmen hatte, geholfen, in der Nacht Zeitungen an die verschiedenen Austragestellen zu liefern. Wir holten die Bünde jeweils um 3 Uhr morgens am Flughafen und brachten diese den Zeitungsverträgern und den Poststellen. Meistens waren wir um 7 Uhr zurück und ich konnte direkt ins Büro fahren. Manchmal ging ich bis zu vier Mal in der Woche. Mit dem dazu verdienten Geld konnten wir uns als Familie auch mal Ferien im Ausland leisten. Dazu kam, dass Katrin, als Salome ungefähr zwei Jahre alt war, die Betreuung eines Tagesbuben aus der Umgebung übernahm. Für die meisten hätte dies alles längstens gereicht. Aber für mich gab es noch Luft und Kapazität. Also habe ich mich für die freie Position als Primarschulpfleger beworben. Eigentlich wurde ich von der Jungen SVP angefragt, ob ich bereit wäre, mich als Kandidat aufstellen zu lassen. Ich hatte zwei Bedingungen: Erstens war ich Mitglied der EDU und würde also Vertreter dieser Partei in der Schulbehörde, und zweitens müsste ich offiziell von der SVP unterstützt werden. Der Exponent der Jungen SVP meinte, dies sei kein Problem, es gehe bei dieser Wahl nicht um Parteipolitik, sondern darum, dass fähige Leute diese Ämter bekleiden und er sei überzeugt, dass die SVP mit der Unterstützung meiner Person keine Mühe hätte. Nun es kam anders. Die SVP Bülach hat an ihrer Parteiversammlung entschieden, mich nicht zu unterstützen. Ob es doch wegen meiner Parteizugehörigkeit zur EDU war oder ob meine politische Haltung zu konservativ-christlich war, ich weiss es nicht. Auf jeden Fall war für mich das Thema abgeschlossen. Es gab aber auch keine anderen offiziellen Kandidaten. Ein paar Tage später hat mich ein Journalist einer Regionalen Tageszeitung angerufen und mich gefragt, ob ich ein offizieller Primarschulpflegekandidat sei. Ich habe ihm gesagt, ich sei kein offizieller Kandidat, da mir weder die SVP noch eine andere grössere Partei ihre Unterstützung zusagen würde. Er war sehr erstaunt über meine Aussage, denn er hat einen Lesebrief einer Grünen Gemeinderätin erhalten, in dem sie schrieb, dass man den Plüss ja nicht wählen soll. Sein fundamentales und rückständiges Familien- und Weltbild sei untragbar für die Schule Bülach. Sie gab den Leser sogar Anweisungen, was sie machen können, um meine Wahl zu verhindern. Es sollen möglichst viele irgendeinen Namen aufschreiben, damit das Absolute Mehr möglichst hoch ist und ein zweiter Wahlgang nötig werde. Bis dann hätte die Interparteiliche Kommission dann eine valable Kandidatin oder Kandidaten gefunden. Er schlug mir vor, eine Gegendarstellung zu verfassen, welche er mit dem Leserbrief der Gemeinderätin veröffentlichen würde. Und das habe ich dann auch gemacht. Unter anderem habe ich geschrieben, wenn mein Fundamentalismus auf dem beruhe, dass die Bibel und mein Glaube an Jesus Christus mein Lebensfundament seien, dann sei dies tatsächlich so. Und wenn rückständig heisst, eigenverantwortlich zu leben in Familie und Beruf, dann hätte die Frau xy recht. Ich sei zwar kein offizieller Kandidat einer politischen Partei, aber als mündiger und urteilsfähiger Bürger durchaus wählbar. Und sollte ich gewählt werden, könnte ich mir eine Annahme der Wahl durchaus vorstellen. Nach dieser Veröffentlichung ging’s los. Jeden Tag war nun mindestens ein Lesebrief für mich und einer der gegen mich schrieb in der Zeitung. Es war erstaunlich, was Menschen, mit denen ich noch nie persönlichen Kontakt hatte, alles über mich und meine Einstellung zu politischen und schulischen Themen wussten. Für die einen war ich der Untergang der modernen Schule. Sie haben die Bürger vor meiner frommen Haltung gewarnt. Man hätte meinen können, wenn ich in diese Behörde gewählt werde, dann wird wahrscheinlich das tägliche Gebet in der Schule wiedereingeführt. Am nächsten Tag hat ein anderer darauf geantwortet, dass genau solche bodenständigen Menschen wie ich, in solche Ämter gewählt werden müssen. Den einen war mein Familienbild zu altertümlich und ewiggestrig, die anderen waren davon überzeugt, dass es genau diese Lebenseinstellung sei, die der Schulbehörde guttun würde. Es war ein Wahlkampf, ohne dass ich etwas dazu tun musste. Kein Inserat habe ich geschaltet, keine Podiumsdiskussion geführt. Alle warteten gespannt auf den Wahlsonntag. Und tatsächlich wurde ich mit deutlichem Mehr gewählt. An der ersten Sitzung spürte ich die Zwiespältigkeit gegenüber meiner Person sehr gut. Etwa die Hälfte der anwesenden Pfleger und ein paar Lehrer haben mich gegrüsst und mir alles Gute für das Amt gewünscht. Und die andere Hälfte ist mir bewusst aus dem Weg gegangen. Im Laufe meiner sechsjährigen Amtszeit hat sich dies sehr geändert. Es war sogar so, dass die, welche am Anfang meiner Amtszeit am meisten Abstand von mir suchten, am meisten bedauerten, dass ich aufhöre. Ich habe in diesen sechs Jahren sehr viel gelernt. Was es heisst, konsensfähig zu sein. Wo Kompromisse gut sind und wo Standfestigkeit gefragt ist. Welche Allianzen wann richtig sind. Um den biblischen Unterricht nicht dem Sparstift zu opfern, habe ich eine Allianz mit den Linken gebildet. Diese wollten auf keinen Fall, dass bei einer Streichung des biblischen Unterrichtes die Freikirchen und Fundamentalisten in den schulfreien Zeiten mit ihren Angeboten die Kinder zu ihnen locken würden. Ich habe die Aufrechterhaltung des biblischen Unterrichts deshalb unterstützt, weil ich überzeugt war, dass viele Lehrpersonen, besonders die Gläubigen unter ihnen, gerade in diesem Fach hervorragende Arbeit geleistet haben und dass in diesem Unterricht die biblischen Wahrheiten erzählt werden konnten. Und natürlich, weil dieses Fach zu unserer christlich Abendländischen Kultur gehört. In meiner Amtszeit konnte ich vor allem auch mithelfen, das Mitarbeiter-Beurteilungs-Tool (MAB) in der Primarschule Bülach einzuführen und zu etablieren. Weil jeder seit den Wahlen meine Einstellung kannte und über meinen Glauben Bescheid wusste, war es kein Problem, diesen auch zu vertreten. Viele Einzelgespräche über meinen Glauben, die Bibel, über Familie, Gesellschaft und Staat und was die Bibel dazu sagt, konnte ich führen. Und zusätzlich habe ich in eine Berufswelt gesehen, von der ich dachte, dass sie meiner eigenen so weit entfernt sei. Dabei stellte ich fest, dass auch hier ein Leitsatz stimmt, wenn man erfolgreich sein will, nämlich: «Man muss Menschen mögen.»
Nach sechs Jahren war mir aber auch klar, dass ich nicht genügenden Ehrgeiz oder die nötige Geduld und Nervenstärke für weitere Ämter in der Politik habe. Im 2006 habe ich mich aus allen aktiven Ämtern zurückgezogen. Heute bin ich zwar noch interessiert und habe meine politischen Ansichten, welche ich bei Bedarf auch äussere, aber meine Aktivitäten beschränken sich aufs Wählen und Abstimmen.

In diesem Kapitel beschreibe ich ein Thema, das zwar zu unserer Familie gehört, wir aber so niemals gewählt hätten. Nicht von ungefähr ist die Gesundheit eines der höchsten Güter der Menschen. Das merken wir ja alle in der anhaltenden Corona-Pandemie, welche die Gesellschaft weltweit beschäftigt, während ich diese Zeilen schreibe. Niemand möchte gerne krank sein und wenn es trotzdem einmal dazu kommt, dann macht man alles, um schnell wieder gesund zu werden. Besonders chronische Erkrankungen will kein Mensch haben. Weltweit wird viel Geld in die Forschung gesteckt und nach Heilmitteln und Therapien gesucht, welche helfen sollen, diese Krankheiten zu besiegen. Vieles kann man heute dank der Forschung und Entwicklung in der Medizin heilen. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ich habe grosse Achtung vor den Forschern, welche unermüdlich an diesen Themen arbeiten. Aber es gibt auch Krankheiten, welche nicht heilbar sind. Da hat man heute aber auch oft Therapien, die es den Betroffenen erlauben, ein einigermassen normales Leben zu führen. Nun, was hat das mit uns zu tun? Dies will ich Euch in den folgenden Zeilen erzählen.
Es war im Sommer 1994, David war im vierten Lebensjahr. Seit einigen Tagen schien er sehr müde zu sein. Auch hatte er übermässig Durst. Wir gingen davon aus, dass er wohl eine Sommergrippe aufgelesen hat und dachten uns, dass diese in ein paar Tagen wie üblich wieder abklingen würde. Jedoch verschlechterte sich sein Zustand rapide. Er machte plötzlich wieder ins Bett und konnte auch keine Nahrung bei sich behalten. Manchmal war er so müde, dass er sich auf den Boden legte und sofort eingeschlafen ist. Innert kürzester Zeit verlor er viel Gewicht und seine Haut war richtig ausgetrocknet. Nach ca. vier Tagen beschlossen wir zum Arzt zu gehen. Er hat nur gesagt: «Der Bub gefällt mir gar nicht, er muss sofort ins Spital. Wo wollen Sie hinfahren, nach Zürich oder Winterthur?» Wir entschieden uns für Winterthur. Der Arzt meldete uns an. Sofort fuhren wir los. Im Kopf kreisten die Gedanken unaufhörlich. Fragen wie, was fehlt ihm, hat er Krebs? In Gedanken beteten wir zu Gott, lass es etwas Harmloses sein, nimm uns unseren Sohn nicht weg. Zu dieser Zeit war David nicht mehr wirklich ansprechbar. In Winterthur angekommen ging Katrin mit David in den Notfall und ich wartete, mit Jonas der gerade mal zwei Jahre alt war und Michael ein Jahr alt, im Auto. Ich weiss nicht mehr, wie lange ich da im Auto gesessen bin und immer wieder gebetet habe. Ich wurde je länger je ungeduldiger. Nach gefühlten Stunden des Wartens, wahrscheinlich war es in Wirklichkeit höchstens eine Stunde, habe ich Jonas und Michael unter die Arme genommen, ging zum Empfang und wollte wissen, was mit David war. Die Dame am Empfang war sehr hilfsbereit und tat alles in ihrer Macht Stehende, um mir Auskunft zu geben. Sie fand heraus, wo David war und ich durfte zu ihm. Katrin diskutierte mit dem behandelnden Arzt. Im Bett lag David. Schon von Weitem erkannte ich, dass es ihm viel besser ging, er schien den Schwestern etwas zu erzählen. Katrin kam auf mich zu und sagte: «Alles ist gut, David ist Diabetiker Typ 1. Der Arzt hat mir nach den Untersuchungen gesagt, er hätte zuckersüsses Blut.» Sehr viel konnte ich mit dieser Information nicht anfangen. Diabetes ist doch eine Krankheit, die vor allem im Alter und bei übergewichtigen Menschen auftritt. Aber ich merkte, dass Katrin sehr ruhig war. Als Krankenpflegerin versteht sie etwas von dem und das hat mich auch beruhigt. Damals war mir noch nicht bewusst, dass das Leben von David nie mehr so sein wird wie vorher. Und damit natürlich auch unser Familienleben. Der Arzt hat uns an diesem Abend noch gesagt, dass es höchste Zeit gewesen sei. Ohne Insulin hätte David die Nacht wohl nicht überlebt. Er wäre buchstäblich innerlich verdurstet. Die von der Bauchspeicheldrüse hergestellten Insulinzellen werden vom Körper als Schädlinge betrachtet und darum vernichtet. Dadurch produziert die Bauchspeicheldrüse Insulinzellen im Akkord. Wie ein Motor, der zu lange übermässig belastet wird und irgendwann explodiert, ist es jedoch auch bei einer überstrapazierten Bauchspeicheldrüse. Diese hat buchstäblich überhitzt und den Geist aufgegeben. Ohne Insulin kann der aus Kohlenhydraten umgewandelte Zucker nicht in die Zellen gelangen und damit wird der Körper nicht mit Energie versorgt. Er bleibt im Blut. Und weil irgendwann zu viel Zucker im Blut ist, versuchen die Nieren diesen mit viel Flüssigkeit wieder auszuscheiden. Wenn dem Körper zu wenig Flüssigkeit zugeführt wird, holt er sich diese aus den Organen, auch aus der Haut. Irgendwann gibt es keine Flüssigkeit mehr zu holen und die fehlende Energie in den Zellen lässt den Körper langsam innerlich verdursten. Ohne die Erfindung der künstlichen Insulinzufuhr wäre diese Krankheit noch heute das Todesurteil für die Betroffenen.
Mit dem zugeführten Insulin hat sich David schnell wieder erholt. Jedoch musste er zur richtigen Einstellung der Werte und dem Lernen, wie er mit der Krankheit umgehen muss, für drei Wochen im Spital bleiben. Natürlich kann ein Vierjähriger dies nicht ohne Hilfe seiner Eltern schaffen. Das hiess, dass auch Katrin in diesen drei Wochen eine Ausbildung erhielt. Sie lernte, was unternommen werden muss, um David ein möglichst normales Leben zu ermöglichen. Da war die Ernährung. Süssigkeiten haben einen ganz kleinen Stellenwert im Speiseplan von David erhalten, dafür umso mehr Gemüse wie Peperoni oder Karotten, welche sich übrigens hervorragend für einen Znüni eignen. Aber das war nur ein kleiner Teil der Veränderung. Am grössten war die Herausforderung einen zeitlich geregelten Essensplan zu haben und dabei die Portionen so zu gestalten, dass sie die richten Kohlehydratwerte hatten. Dabei musste die Menge Insulin darauf abgestimmt werden. David musste regelmässig zu denselben Tageszeiten sein Insulin spritzen. Das gespritzte Insulin fängt irgendwann zu wirken an. Wenn jedoch keine Kohlenhydrate in Form von Brot oder Milch da sind welche, vom Insulin zu Zucker umgewandelt werden, besteht die Gefahr, dass der Körper unterzuckert ist. Dadurch hat der betroffene Diabetiker zu wenig Energie. Im Fachausdruck nennt man dies ein Hypo. Und damit der Diabetiker nicht bewusstlos wird muss er dringend Zucker oder Kohlenhydrate zuführen. Dadurch sind regelmässige Essenszeiten ein Muss. Immer zur gleichen Zeit Frühstück, Znüni, Mittagessen, Zvieri und Znacht. Solange wir in unserer Familie waren, war dies einigermassen einfach einzuhalten. Wenn wir jedoch eingeladen waren und das Mittag- oder Nachtessen sich verzögerte, entstand bei uns schon hie und da eine gewisse Nervosität. Das Insulin musste gespritzt werden aber das Essen verzögerte sich. Natürlich verstanden nicht alle, warum wir wegen 30 Minuten so nervös wurden. Damit wir uns nicht immer erklären mussten, haben wir jeweils immer ein paar Scheiben Brot, Farmerstängel oder Bananen und vor allem Traubenzucker als Sackbefehl dabei. Wie oft David darum jeweils vor dem gemeinsamen Mittagessen eine Scheibe Brot verdrücken musste und dann dafür weniger Reis, Teigwaren oder Kartoffeln beim Essen bekam, weiss ich nicht mehr. Besonders für Katrin war dies nicht immer einfach. Am besten funktionierte dabei McDonald. Diese haben eine Kohlenhydratwerte-Tabelle, was es einfach macht, die richtige Menge zu dem gespritzten Insulin zu verzehren.
Bei Diabetiker Typ 1 wird dieses starre System bei Kindern bis ca. 12 Jahre angewendet. Dabei lernen sie diszipliniert zu leben, was ihnen hilft, den Zucker im Blut unter Kontrolle zu haben. Und dies wiederum soll vor allem mögliche Spätfolgen vermeiden. Eine ausgewogene Ernährung ist dabei wichtiger als der reine Süssigkeitsverzicht. Auch braucht es nicht nur künstlich gesüsste Lebensmittel. Zum Beispiel ist Rivella blau nur beschränkt sinnvoll, da es in diesem Getränk Milchzucker hat, welcher in die Mahlzeit eingerechnet werden muss. Unbeschränkt trinken kann ein Diabetiker neben Wasser, zuckerfreiem Tee oder Kaffee nur Coke Zero oder light Produkte, weil in diesen Produkten keine Kohlenhydrate oder Zucker in irgendeiner Form drin sind.
Im Frühling 2003 konnte David das System ändern von fixen vorgegebenen Spritz- und Essenszeiten in ein flexibleres System. Dabei kam ein anderes schnellwirkendes Insulin zum Einsatz. Dabei kann der Nutzer die Menge Insulin pro Dosis selber bestimmen. Je nach Hunger oder Lust ist diese grösser oder kleiner. Und weil es sehr schnell wirkt, spielt die Essenszeit nicht mehr dieselbe Rolle. Um dies zu lernen, verbrachte David eine Woche im Kinderspital in Zürich. Wir freuten uns auf die neu gewonnene Flexibilität. Endlich wieder essen ohne an Zeiten gebunden zu sein. Meine Eltern feierten in diesem Jahr das 40-jährige Hochzeitsjubiläum. Aus diesem Grund verbrachten wir als Familie mit meinen Geschwistern und ihren Familien und meinen Eltern die Auffahrtstage in Spanien. Wir genossen es, nicht täglich um 18 Uhr am Buffet sein zu müssen. Es war eine ganz neue Lebensqualität.
2003 war der Jahrhundertsommer mit wochenlangen Hitzeperioden. Wir verbrachten auch nach Spanien viel Zeit im Wasser, meistens in der Badi Bülach. Salome war damals sechs Jahre alt. Seit einigen Tagen war uns aufgefallen, dass sie sehr oft aufs Klo musste. Wir dachten aber, dass sie sich durch das viele Baden vielleicht eine leichte Blasenentzündung geholt hatte. An einem Abend, wir hatten soeben die bestellten Pizzas in die Badi geliefert bekommen, meinte David nachdem Salome kurz hintereinander auf dem Klo war: «Lass uns den Zucker von Salome messen. Dieses dauernde aufs Klo springen ist nicht normal.» Wir taten es und was wir dabei feststellten, hat uns den Appetit auf die Pizza zerschlagen. Bei Menschen ohne Diabetes ist der Zuckerwert ca. 4.5 bis 6 Millimol. Nach dem Test bei Salome zeigte das Gerät keine Zahl mehr, sondern die Buchstaben h i g h. Wir dachten uns, dass das Gerät vielleicht zu viel Sonne erhalten hat und wollten zu Hause mit einem zweiten Gerät nochmals messen. Lust auf Pizza hatten wir keine mehr und so wanderte diese in den Abfall und wir sind nach Hause gefahren. Das Resultat mit dem anderen Messgerät zu Hause war nicht besser. Ziemlich niedergeschlagen haben wir die Kinder- und Jugenddiabetes Abteilung vom Kinderspital Zürich angerufen, wo uns die Mitarbeiter dank den vielen Kontrollbesuchen mit David ja bestens kannten. Die Reaktion auf unsere Meldung, dass wir befürchten, dass neben David auch unsere Tochter Salome Diabetikerin sein könnte, war schon etwas überraschend aber auch logisch. Sie wollten wissen, wie oft wir gemessen haben, wie der Wert sei und meinten, da wir ja sicher genug Insulin von David hätten, sollten wir ihr mal eine Dosis verabreichen. «Sie sind die Spezialisten, Sie können das bestens handhaben. Und dann kommen Sie nächste Woche vorbei und wir besprechen das weitere Vorgehen.» Diese Übergabe der Verantwortung an uns hat geholfen, nüchtern zu bleiben. Verzweiflung hätte niemandem etwas genützt. Noch mehr ist uns die Reaktion von Salome ans Herz gegangen. Sie sass nach dem Erhalten ihrer ersten Insulindosis auf der Couch und sagte zu David: «Jetzt bist du nicht mehr der Einzige, jetzt sind wir zu zweit.»
Da Salome erst sechs Jahre alt war, hiess das für uns zurück auf Feld eins und zum genau getakteten Tagesplan. Weiterhin genügend Brot, Riegel, Bananen etc. dabeihaben. Wir hatten es uns anders vorgestellt.
Wie heisst es doch so schön, aller guten Dinge sind drei. Und so war es auch bei uns. Im Frühling 2005 ist diese Stoffwechselkrankheit auch bei Jonas ausgebrochen. Er war damals 12 Jahre alt. Unser Telefonanruf in die entsprechende Abteilung des Kinderspitals Zürich tönte ungefähr so: «Wir sind es, die Plüsses von Bülach. Wir haben soeben festgestellt, dass auch Jonas Diabetiker ist. Insulin haben wir noch, wir denken, dass es sinnvoll ist, wenn wir in den nächsten Tagen einen Termin erhalten können. Jonas ist 12 Jahre alt und wird wohl dadurch gleich mit dem flexibleren System beginnen können.»
Diabetes prägte natürlich unser Leben. Nicht alles war negativ. Für Diabetiker ist es essenziell, dass sie auf ihren Körper Acht geben. Wichtig ist nicht künstlich gesüsste light Ernährung, sondern ausgewogene abwechslungsreiche Mahlzeiten, was auch für Nicht-Diabetiker von Vorteil wäre. Auch fanden jedes Jahr im Sommer spezielle Diabetiker-Lager statt. Unsere Drei waren mehrmals dabei und haben diese später auch geleitet. Aber das Beste war wohl der TV Auftritt in der Sendung «Gesundheit Sprechstunde» von Dr. Samuel Stutz im Sommer 2007. Zuerst haben die Macher der Sendung eine Reportage bei uns gedreht. Dabei lernte ich, meine Frau nach der Arbeit zur Begrüssung kamerawirkungsvoll zu küssen. Ich glaube, wir mussten es ein paar Mal üben. Und dann durften wir in der Liveshow Rede und Antwort stehen zu dem Thema Diabetes und wie man als Familie damit umgehen kann.
In dieser ganzen Zeit und bis heute durften wir immer wieder erfahren, wie Jesus durchträgt. Die Pubertät alleine ist für Jugendliche schon eine Herausforderung. Aber wenn noch Diabetes und die damit verbundene nötige und erwartete Lebensdisziplin dazu kommt, dann kann dies einen jungen Menschen sehr wohl an Grenzen bringen. Warum drei unserer vier Kinder Diabetes haben, obschon weder in meiner noch in der Familie von Katrin jemand betroffen war oder ist, wissen wir nichtWarum Michael bis heute verschont geblieben ist, wissen wir nicht. Übrigens hat ihm dieses Verschontsein bei seinen Geschwistern den Übernamen «Fedex» eingebracht. So im Sinne von, der kann nicht von den Eltern sein, der muss geliefert worden sein. Aber wir wissen ja, dass auch er eine Besonderheit hatte, war er doch ein Sterngucker-Kind bei der Geburt.

Wie wahrscheinlich inzwischen alle Leserinnen und Leser festgestellt haben, sind Freikirchen in meinem Leben ein wichtiger Bestandteil. Schon als Kinder wurden wir von unseren Eltern regelmässig in die Veranstaltungen der Kirchen, in die sie ein und aus gingen, mitgenommen. Wir durchliefen die typische Freikirchen-Karriere. Kinderhort, Sonntagschule, Biblischer Jugendunterricht, Jugendgruppe und zuletzt Mitglied mit Aufgaben als Erwachsener. Auch wenn ich eine zeitlang, wie in diesem Buch beschrieben, den Kirchen bewusst fernblieb, haben mich die Stunden, in denen ich da verbrachte, sehr geprägt. Ich denke, mein geistliches Wachstum und mein Verhalten haben einen grossen Zusammenhang mit den jeweiligen besuchten Freikirchen, ihrer Lehre und ihrem Verständnis vom Zusammenleben. An dieser Stelle muss ich noch sagen, dass sich die meisten Freikirchen stark verändert haben. Und dass ich glaube, dass es in der heutigen Zeit den meisten Kirchen und Institutionen sehr wichtig ist, ein offenes Herz für die Menschen zu haben, egal woher sie kommen und wie sie leben. In der Bibel steht in Matthäus 16.18 (HFA): «Ich sage dir: Du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können.» Es soll hier auch keine Abrechnung mit irgendwelchen Denominationen, welche ich im Verlaufe meines Lebens besuchte, wegen negativer Erlebnisse sein.
Als Kind und Teenager ging ich sehr gerne in die Kirche. Die biblischen Geschichten haben mich fasziniert. Ich habe auch nie gezweifelt, dass es Gott gibt und dass er aus Liebe zu uns Menschen seinen Sohn Jesus am Kreuz sterben lies, um für unsere Sünden zu bezahlen. Aber was das für mich bedeutet, welche unermessliche Gnade dahinter steckt, habe ich erst viele Jahre später zu begreifen begonnen. Bei der ersten Kirche, die ich bewusst besuchte, hat mein Vater stark im Aufbau mitgeprägt und mitentschieden. Dem Entstehen dieser Freikirche ging eine Trennung voraus, bei der sich Menschen nicht mehr einig wurden über die Art und Form des Kirchenbaus. Diese Kirche, die sich als nationaler Verband organisierte, war in ihrer Form eher konservativ. Es war da auch eher eine schwarz-weisse Lehre. Modernes und zu stark mit der Zeit gehen war nicht unbedingt gerne gesehen. Die Musikbegleitung sollte möglichst ohne Strom betrieben oder mit Holzknebeln bearbeitenden Instrumenten sein. Der vierstimmige Gesang wurde nicht nur in den gemischten Chören, sondern auch in den Gottesdiensten praktiziert. Natürlich gab es da auch Generationenkonflikte und manchmal war es für die vom Jahrgang her eher ältere Leitung nicht verständlich, warum die jungen Leute so komische Ideen hatten. Auch die Kleidung und Frisuren hatte einen hohen Stellenwert. Frauen in Hosen und kurzen Haaren wurden nicht so gerne gesehen. Trotz alldem habe ich in dieser Kirche die Liebe Gottes gespürt. Und ich habe mitbekommen, wie die Mitglieder füreinander da waren. Hier habe ich durch die wöchentliche Teestubenarbeit auch gelernt, auf der Strasse Menschen von Jesus zu erzählen. Ein Erlebnis aus dieser Zeit hat sich mir tief ins Herz geprägt. Ozzi Osbourne, der Leadsänger der Heavy Metal Gruppe Black Sabbath, hatte ein Konzert in der Mehrzweckhalle in Zofingen geplant. Wir wussten, dass seine sehr wohl ins Okkulte gehende Praktiken, welche der Sänger in seinen Konzerten angewandt hatte, keinen guten Einfluss auf die Zuhörer hatten. Zum Beispiel biss er einem lebenden Tier auf der Bühne den Kopf ab. Darauf wollten wir die Konzertbesucher aufmerksam machen und verteilten schon Wochen zuvor Handzettel, wo davor gewarnt wurde. Natürlich gab dies zu reden in der Bevölkerung. Es gab sogar einen Zeitungsbericht, in dem stand, dass ein paar fromme Extremisten das Konzert verhindern wollen. Am Tag des Konzertes gingen wir wieder auf die Strasse vor das Kongresszentrum und verteilten unsere Handzettel, während viele ältere Gemeindemitglieder sich zusammenfanden und für Bewahrung und Schutz der Konzertbesucher und uns beteten. Auch andere Freikirchen haben an diesem Tag solche Gebetsabende durchgeführt. Ozzi Osbourne kam tatsächlich nicht an diesem Abend, anscheinend musste er notfallmässig in den Spital nach Zürich. In der Zeitung war danach etwa folgende Schlagzeile zu lesen «Die Beter haben gewonnen». Wir waren glücklich, dass Gott so viele junge Menschen vor den schlechten Einflüssen bewahrt hatte.
Ein Highlight waren auch immer wieder die Nationalen Verbandskonferenzen an Pfingsten in Zürich und am Bettag in Biel oder die Jugendtagung in Aeschi bei Spiez. Hier traf man Freunde, die man aus den Kinder- und Jugendlagern kannte. Und die/der eine oder andere fand da auch seinen Lebenspartner/seine Lebenspartnerin. Das Verbandsdenken war ziemlich stark verankert. Aus diesem Grund war auch klar, dass ich damals im 1987, als ich nach Zürich ging, in diese Freikirche ging, die zu dem nationalen Verband gehörte.
Als wir Ende 1991, wie schon im Kapitel 13 beschrieben, aus familiären und geographischen Gründen unsere Kirche in Zürich verliessen, war dies doppelt schwer. Eine neue Gemeinde und auch Weggang von dem vertrauten Freikirchenverband.
Das soziale Angebot, welches eine Freikirche hat, ist für mich ein wichtiger Aspekt für den Entscheid, diese zu besuchen. Natürlich nur unter der Voraussetzung, dass die biblische Lehre der eigenen Überzeugung entspricht. Und wenn die Form des Kirchenbaus dem eigenen Herzschlag entspricht, dann kann es einen Wechsel sehr wohl sinnvoll machen. Beides fanden wir später in der Kirche im Nachbardorf. Und da konnten wir uns 18 Jahre bewegen. Ich durfte mich engagieren im biblischen Unterricht für Teenager. Später in der Jungschararbeit und als Diakon in der erweiterten Gemeindeleitung. Die Kirche hat eine grosse Stärke. Sie ist sehr gastfreundlich eingestellt. Ausser am dritten Sonntag im Monat wurde jeweils gemeinsam zu Mittag gegessen. Wenn man daran teil nimmt, ist man sehr schnell in der Gemeinde integriert, eignet sich gemeinsames Essen doch hervorragend für das Kennenlernen. Katrin war viele Jahre im ökonomischen Vorstand und dort für die Organisation der Küchendienste verantwortlich. Eine Kirche mit viel gelebten Traditionen hat natürlich auch ihre schwierigen Seiten. Neuem gegenüber sind solche Kirchen eher mal kritisch. Auch wenn man nicht Urmitglied ist, merkten wir hie und da, dass es schwierig war, da ganz rein zu kommen. Dies ist uns aufgefallen als wir nach einem Besuch der Familienferien mit Kultour Reisen in Griechenland, in denen die Freikirche GVC Winterthur mitunter verantwortlich für das geistliche Programm ist, inspiriert von vielen neuen Ideen zurück in die Kirche kamen. Die Art und Form des Gottesdienstes hat uns so sehr angesprochen, dass wir eigentlich am liebsten schon damals sofort nach Winterthur in die GVC wechseln wollten. Weil unsere Kinder aber gerade in einem Alter waren, in dem für sie vor allem der Kontakt und die Freundschaft zu anderen Jugendlichen sehr wichtig waren, und diese hatten sie in unserer Kirche, haben wir beschlossen da zu bleiben. Ich bin überzeugt, damals war es die richtige Entscheidung. Wir konnten noch 10 Jahre mithelfen, durch einen Veränderungsprozess der Kirche zu gehen. Und in schwierigen Jahren mit viel Meinungsverschiedenheiten über Lehrfragen und gegenseitiger Anklage unter den Mitgliedern, welche schlussendlich in einer Trennung endete, konnten wir die Gemeindeleitung tatkräftig und moralisch wie geistlich unterstützen. Nach dieser schwierigen Zeit erhoffte ich mir einen grossen Aufbruch in der Kirche. Ich sah die Möglichkeit, jetzt wo alle diese Leute gegangen waren, die aus meiner Sicht keine Veränderung und auf keinen Fall eine etwas modernere offener Kirche wollten. Ich musste dann feststellen, dass das Gros der Mitglieder dafür noch nicht bereit war. Im November 2015 habe ich eine kurze Auszeit in einem Kloster verbracht. Dort habe ich alle meine Sorgen, Wünsche und Anliegen auch zum Thema Kirche auf einen Zettel geschrieben und diesen symbolisch an das Kreuz in meinem Zimmer geheftet. Ich habe Gott gesagt: «Hier hast Du alles von mir, ich lade es am Kreuz ab und damit ich es nicht mehr mitnehme, hefte ich den Zettel mit einem Reisnagel an das Kreuz.» Damals konnte ich mir nicht vorstellen, was sich in meinem, in unserem Leben alles verändern würde. Kurz darauf ergaben die Umstände, dass ich keine Aufgaben in der Kirche mehr hatte. Dadurch hatte ich Zeit, wieder über die GVC nachzudenken. Katrin war ihre Aufgabe schon länger eine Belastung, aber erst als ich keine Aufgaben mehr inne hatte, konnte sie mitteilen, dass sie für eine weitere Amtsdauer im Frühling nicht mehr zur Verfügung steht. Dadurch erhielten wir den Freiraum, um die Gottesdienste in der GVC in Winterthur zu besuchen. Dabei stellten wir sehr schnell fest, so wie hier Kirche gebaut und gelebt wird, entspricht es genau unserer Vorstellung. Und wir haben uns entschlossen, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen war, die alte Kirche und ihre Mitglieder nicht länger unter Druck zu setzen mit Änderungen, die die Mehrheit gar nicht wollte. Nicht die Kirche musste sich uns und unsere Ideen anpassen. Nachdem wir dies erkannt hatten, konnten wir ohne Bitterkeit oder Enttäuschung unseren Weggang kommunizieren. Und die allermeisten Mitglieder haben unseren Entscheid verstanden. Beim letzten Abschied haben uns, wie an einer Hochzeit das Hochzeitspaar, nahezu alle Kirchenmitglieder persönlich umarmt. Wir konnten in Frieden auseinander gehen im Wissen, dass wir einmal gemeinsam Gott im Himmel loben werden. Sie eher mit Geigen und Flöten und wir mit Gitarren und Schlagzeug.
Das sei hier noch erwähnt. Der Entscheid, uns der GVC Winterthur anzuschliessen, war aus heutiger Sicht einer der besten geistlichen Entscheide, die Katrin und ich als Ehepaar getroffen haben. Nicht weil die Kirche im Nachbardorf, in der wir 18 Jahre ein und aus gingen, mitgearbeitet und mitgeprägt haben, schlecht war. Sondern weil wir dem Ruf unseres Herzens gefolgt sind. Gott hat uns in diesen Jahren seit dem Kirchenwechsel den geistlichen Horizont unglaublich geöffnet. Ich glaube, das hat damit zu tun, weil die Art und Weise, wie die GVC Kirche baut und lebt, genau unserem Herzschlag entspricht.

Viele Menschen stehen an vielen Morgen mit einem schlechten Gefühl auf, weil sie arbeiten müssen. Es wiedersteht ihnen, den Tag in Angriff zu nehmen, weil ihnen ihr Job so gar nicht gefällt. Sie leben von Wochenende zu Wochenende. Wie anstrengend muss das sein. Ich habe diese Einstellung nie gehabt. Wenn mich meine tägliche Aufgabe so stark belastet hat, dass ich am liebsten nicht aufgestanden wäre am Morgen, habe ich etwas dagegen unternommen. Vielleicht habe ich darum so viele unterschiedliche Dinge in vielen verschiedenen Firmen gemacht. Arbeit ist keine Strafe, sondern im Schöpfungsplan von Gott für uns Menschen vorgesehen. In 1. Mose 2 Vers 15 (HFA) steht: «Gott, der HERR, brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren.» Arbeit zu haben, kann also auch ein Geschenk Gottes sein. Alle, die schon einmal längere Zeit auf Stellensuche waren, können dies sicher bezeugen.
Schon während der letzten zwei Schuljahre habe ich mein Sackgeld in der Gastronomie verdient. Als Casserolier für 2.50 Franken in der Stunde. Wie bereits im Kapitel neun geschrieben, begann ich im Frühling 1981 eine Ausbildung zum Kellner. Dieser Beruf hat mir sehr viel Spass gemacht. Auch wenn es oft sehr streng war und ich eher als billige Arbeitskraft angesehen wurde. Einmal sagte meine Ausbildungsverantwortliche, als ich für die Abschlussprüfung die verschiedenen Gedecke üben wollte: «Dafür haben wir keine Zeit du kannst dies in der Freizeit zu Hause üben.» Das war aber relativ schwierig, weil in den wenigsten Haushalten Schneckengabeln, Hummerzangen, Fischmesser etc. vorhanden sind. Am Schluss habe ich die Abschlussprüfung trotzdem geschafft. Am liebsten hatte ich, wenn Kunden bei mir ein Beefsteak Tatar bestellten. Dies haben wir jeweils am Tisch zubereitet. Es machte mir Spass, den Gästen eine kleine Show zu bieten und meine Entertainment Fähigkeiten einzusetzen. Flambieren, Fische filetieren, Chateaubriand richtig schneiden und die Teller schön anrichten, dies habe ich geliebt. Wenn ich die Gäste gut unterhalten habe, war der tolle Nebeneffekt meist ein schönes Trinkgeld was bei ca. 200 Franken Monatslohn im ersten Lehrjahr und 300 Franken im zweiten Lehrjahr sehr gelegen kam. Natürlich bin auch ich nicht als Meister vom Himmel gefallen. Ja, der Start war sogar sehr harzig mit diversen Fauxpas. Einen, ja gerade den Ersten will ich hier erwähnen.
Wir hatten eine Reservation des Jägerclubs aus der Umgebung. So um die 15 Personen. Als Hauptgang haben sie Spanferkel bestellt. Dazu natürlich einen vollmundigen Burgunder im Weinkorb serviert. Für mich war es der erste Einsatz an der Front. Bis dahin war ich vor allem am Buffet tätig. Der Zufall wollte es, dass unter den Gästen ein ehemaliger Arbeitskollege meines Vaters mit seiner Frau war. Natürlich kannte dieses Ehepaar mich bestens und sie haben dies lautstark der Gruppe verkündet. Die erste Aufgabe, die mir gestellt wurde, war dass ich den Gästen ihren bestellten Apero servieren sollte. Als ich bei der besagten Frau den Cinar einsetzen wollte, fing der noch auf dem Tablett befindende Orangensaft sich selbständig zu machen und rutschte unaufhaltsam dem Tablettrand zu und im nächsten Augenblick kippte das Glas über den Rand und der gesamte Inhalt über den Rücken der Frau. Das Lachen ihres Mannes über mein Missgeschick war lauter als ihre Laute, die sie ausstiess. Mindestens der Rücken des Kleides war ruiniert. Ich wäre am liebsten im Erdboden verschwunden. Auf meine Entschuldigung hin meinte sie: Nicht schlimm, das kann passieren. Nach der Vorspeise wurde der Wein serviert. Bei Wein, den man im Körbchen liegend einschenkt, muss man das Glas schräg darunter halten und den Wein langsam ins Glas fliessen lassen. Dies soll verhindern, dass der Satz der sich durch die lange Lagerung am Boden der Flasche bildet, nicht mit ins Glas kommt. Beim Einschenken des Glases der bereits mit Orangensaft geduschten Frau habe ich die Flasche etwas zu energievoll gekippt und dabei wurde dann auch die Vorderseite des Kleides noch beschmutzt. Als mir dann beim Präsentieren der angerichteten Platte der bereits vom Rumpf getrennte Kopf des Spanferkels auch noch auf den Boden und unter den Tisch der Gäste gerollt ist, hatte ich genug. Ich habe fluchtartig das Lokal verlassen und wollte nie mehr dahin zurückkehren. Von dem Zeitpunkt an gab es Leute, die sich von mir nur noch mit Regenpellerine bedienen liessen.
Nach meiner Ausbildung arbeitete ich noch zwei Jahre als Kellner. Im Berner Oberland machte ich eine Sommersaison, dann wechselte ich in die Innerschweiz, wo ich 10 Monate blieb, bevor ich vor der Rekrutenschule Bankett Chef in einem Landgasthof im Oberaargau war. Gerne hätte ich die Hotelfachschule besucht, aber mir fehlte das nötige Kleingeld oder der Sponsor. In meinem Welschland-Aufenthalt lernte ich, wie man Joghurt herstellt und was mit der Milch passiert, wenn man sie pasteurisiert oder homogenisiert. Eine besondere Zeit war auch das Jahr als Milchmann. Ich weiss, wie man sich als Dorfheld fühlt. Und Dorfheld wird man, wenn man den Hausfrauen jeden Alters die gekauften Getränkeharassen in den Keller trägt. Ein weiterer Vorteil war, dass sich das Broteinpackpapier als hervorragendes Schreibpapier für Liebesbriefe an Katrin eignete, welche ich während des Wartens auf die Kundinnen geschrieben habe. Damals gab es noch kein Whatsapp. Die ersten wirklichen Schritte im Verkauf habe ich als Verkaufschauffeur für Käse und Frischprodukte gelernt. Hier hatte ich das erste Mal einen variablen Lohnteil. Weil ich mit einem Fahrzeug über 3.5 Tonnen unterwegs war, brauchte ich den Lastwagen-Führerschein. Dass ich diesen auf Anhieb erstanden habe, grenzte bei meinem technischen Verständnis an ein Wunder. Vielleicht war es auch so, weil es damals im Kanton Zürich noch keine schriftliche Theorieprüfung gab. Diese fand während der praktischen Prüfung mündlich im Fahrzeug statt. Im Sommer 1990 mit 25 Jahren habe ich dann meine Karriere im Aussendienst begonnen. Zuerst habe ich der Gastronomie Kaffee verkauft, dann Tiefkühlprodukte, Reinigungsanlagen und -Mittel. Dann ging ich in die Anzeigenverkaufsbranche, welcher ich acht Jahre in verschiedenen Funktionen treu blieb. In dieser Zeit lies ich mich am Medien Ausbildungszentrum (MAZ) in Luzern zum Fachjournalisten ausbilden. Mit diesem Ausweis konnte ich damals auch gratis Sportveranstaltungen besuchen. Die Fachzeitung, bei der ich verantwortlich war für den Verkauf und das Marketing, konnte ich innert fünf Jahren aus dem wirtschaftlichen Defizit in die Gewinnzone führen. Ich hatte mein Ziel erreicht und konnte weiterziehen. Mit 36 Jahren übernahm ich die Leitung der Ostschweiz bei einer Tochterfirma eines grossen Schweizerischen Milch Verarbeiters. Ich durfte ein Team von 14 Verkaufschauffeuren führen. Erste Schritte in der Personalführung und dabei lernen, dass dies kein easy Ding ist, wurde mir schnell bewusst. Besonders wenn um fünf Uhr morgens das Telefon klingelte und ein Mitarbeiter mir mitteilte, dass er den grossen Zehen an einer Palette gestossen hätte und dieser jetzt stark blute. Und er fragte, was er tun soll. Da mir die Fähigkeit fehlt, Fremddiagnosen bei Verletzungen zu stellen, habe ich ihn nach Hause geschickt mit der Folge, dass ich seine Tagestour übernehmen musste. Da war dann jeweils meine Laune von der Autobahneinfahrt Bülach bis zur Ausfahrt Zuzwil nicht die Beste. Und die änderte sich dann jeweils erst, wenn ich den Verkaufswagen soweit bereit hatte, dass ich die Tour des verletzten Mitarbeiters starten konnte. Dass ich nach zwei Jahren das Team Dübendorf übernehmen konnte, war perfekt. Weniger Arbeitsweg und vor allem gehörte mein Wohngebiet in meinen Verantwortungsbereich.
Im Jahr 2005 wurde mir von einem Headhunter eine Stelle als stellvertretender Geschäftsführer und Verkaufsleiter in einem kleinen Bäckereibetrieb mit ca. 80 Angestellten angeboten. Von diesem Titel lies ich mich blenden, denn bald schon hat sich herausgestellt, dass ich nicht einmal die Kompetenz hatte, einen Bleistift zu kaufen. Und Offerten durften nur gestellt werden, wenn der Geschäftsführer und Inhaber da war. Nach drei Monaten und einer verlängerten Probezeit habe ich diesen Job wieder quittiert. Im August 2005 habe ich als Regionalverkaufsleiter Gastronomie bei Coca-Cola HBC Schweiz zu arbeiten begonnen. Eine unglaublich spannende Zeit mit vielen Lerneinheiten hatte ich da. In vielen Projekten durfte ich mitarbeiten. Einige durfte ich auch leiten. Zum Beispiel war ich verantwortlich für die Umsetzung der Einführung von Coke zero in der Schweiz. Mein wahrscheinlich prägendstes Projekt im Berufsleben. Da habe ich gelernt, dass nichts unmöglich ist und vor allem, dass Begeisterung ein unglaublich starkes Motivationsmittel ist und vergessen lässt, dass 19 Stunden Arbeitstage länger machbar sind als ich dachte. Mein damaliger Vorgesetzter hat mich nicht nur gefordert, er hat mich auch gefördert und mir sehr viel Vertrauen geschenkt. Eine oft gehörte Aussage von ihm war, wenn ich ihn um eine Entscheidung bat, «You are the Manager, entscheide nach deinem Gefühl und dann setze um. Du kennst das Ziel, 6000 Leistungen in einer Woche in der Gastronomie.» Bekanntlich wurde die Coke zero Einführung zu der erfolgreichsten Produkteeinführung im Getränkebereich in der Schweiz. Während der SAP Einführung bei Coca-Cola Schweiz hatte ich die Gelegenheit mit einigen Arbeitskollegen die End User im Verkauf zu schulen. Dafür konnten wir uns das nötige Wissen dazu ein paar Wochen in Sofia aneignen. Diese Trainingstätigkeit hat mir so gut gefallen, dass ich die Möglichkeit ergriff, intern in die Trainingsabteilung zu wechseln. Zudem konnte ich ein nicht sonderlich geliebtes internationales «Verkaufsmeeting Projekt» mit Namen «Hellenic good Morning Meeting» (HGMM) in der Schweiz einführen. Die Verkäufer mussten jeden Morgen an einem Meeting erscheinen. Da mussten sie angeben, welche und wie viele Ziele sie heute erreichen wollen und was sie gestern erreicht hätten. Wer seine am Vortag angesagten Ziele nicht erreicht hatte, musste dies begründen und Massnahmen bekannt geben, wie er diese Ziele doch noch erreichen will. Hat einer die Ansagen des Vortages überschossen, wurde er von allen andern beklatscht. Ein System, dass uns vom Internationalen Commercial Direktor aufgedrückt wurde und dass alle Länder ohne Ausnahme einführen mussten. In der Schweiz wurde dies von der Verkaufsabteilung und den Aussendienstverkäufern nicht wirklich goutiert. Und um die Karriereschritte gewisser Manager nicht zu gefährden, brauchte man jemanden, der dies umsetzen konnte. Ich habe übernommen, weil ich mir genau diese Fähigkeit zugetraut habe. Ich habe aber auch im Gebet mit Gott gesprochen. Ich wollte nicht mehr Lohn dafür, aber ich wollte eine Sicherheit, dass ich bei einem Scheitern in meinen alten Job als Verkaufsleiter Getränkehandel zurückgehen konnte. Dass ich auf mehr Lohn verzichtete, hat die Chefs sehr erstaunt. Aber ich hatte es mit Gott so ausgemacht. Spannend dabei war, dass Katrin ca. ein halbes Jahr später genau den Betrag, den ich abgelehnt hatte für mich, auf ihrem Lohn mehr erhielt. Um das Ganze ein bisschen aufzulockern, habe ich ein Projektlied gemacht. Das heisst, der Text wurde von den Aussendienstmitarbeitern mittels Wettbewerb erstellt. Der Gewinner erhielt ein Wellness Weekend mit Partner in Vals. Die Musik gab ich meinem Göttibuben Nils Blumenstein in Auftrag. Was dabei herauskam, nannten wir den «Helvetic Good Morning Song». Er wurde im Manager und CEO-Meeting aller Länder der Coca-Cola Hellenic AG als eine der besten Mitarbeiterinitiativen gewählt und brachte die Schweizer Organisation weg vom Kritikerimage. Danach konnten wir das Projekt so gestalten, dass es unsere nationalen Abläufe immer weniger störte.
Nach neun Jahren Coca-Cola habe ich mich entschieden, für eine gewisse Zeit dem Umsatz- und gewinnbestimmten Business den Rücken zu kehren und habe die Aufgabe als Fundraising Verantwortlicher bei einem Kinderhilfswerk übernommen. In dieser Funktion war ich Mitglied der Geschäftsleitung. Ich hätte mir nicht vorgestellt, dass diese zweieinhalb Jahre so schwierig werden würden. Da wurde mir sehr deutlich vor Augen geführt, dass auch in christlichen Organisationen nur Menschen arbeiten. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass die Arbeit, welche das Hilfswerk in den verschiedenen Ländern tut, sehr wertvoll ist und das Leben von vielen dadurch verbessert wird. In meiner Tätigkeit war ich in Peru und in Nepal. Gerade in Nepal hat das Hilfswerk Riesiges geleistet nach dem schrecklichen Erdbeben im Frühling 2015. Im Schweizer Büro herrschte so viel Uneinigkeit, dass ich nach zweieinhalb Jahren beschlossen habe, das Hilfswerk zu verlassen. Trotzdem schaue ich dankbar auf diese Zeit. Ich lernte viel und vor allem entstanden auch sehr gute Freundschaften.
Nach der Kündigung bei dem Hilfswerk lernte ich die Herausforderung von über 50-Jährigen bei der Stellensuche kennen. Dass ich über 100 Bewerbungen schreiben musste und daraus nur drei Vorstellungsgespräche resultierten, darauf war ich nicht gefasst. Mein Glaube wurde stark auf die Probe gestellt. Mit jeder Absage mit den schönen Worten «Wir können Sie leider nicht berücksichtigen für die ausgeschriebene Stelle, da wir einen geeigneteren Kandidaten gefunden haben. Aber wir sind überzeugt, mit Ihren Fähigkeiten werden Sie bald eine neue Anstellung finden» wurde der Frust grösser. Gerade in dieser Zeit habe ich erlebt, was es heisst, gute Freunde zu haben. Wenn Du an einem Tiefpunkt bist und Dir ein Freund genau dann anruft und sagt: «Komm lass uns Essen gehen ins Restaurant Waid in Zürich. Ich glaube, du musst etwas den Blick erweitern und aus dem Nebel der Stadt Zürich steigen», dann fühlt man sich getragen. Ich bin Gott sehr dankbar für Stephan Müller, der mir in dieser Zeit zur Seite gestanden ist, mich und meinen Frust verstanden und mich immer wieder ermutigt hat. Ich habe einen externen Berater zugezogen. Auch seine Arbeit mit mir war sehr wertvoll. Auf sein Raten hin habe ich nicht nur einen neuen Job gesucht, sondern ich wollte mir meiner Berufung bewusstwerden. Gott fragen «Wo willst Du mich haben?» Natürlich hat mir auch Katrin sehr geholfen mit ihrer Zuversicht, dass Gott einen Plan hat und er nie zu spät kommt, höchstens pünktlich. Sie hatte an dem Tag als ich gekündigt hatte, in ihrer Zeit mit Gott eine Zahl erhalten. Sie wusste aber zu diesem Zeitpunkt nicht, was diese bedeutete. Ich hatte zu dieser Zeit in unserer Freikirche im Rahmen eines Weihnachtsmusicals ein Engagement. Da habe ich mit Gott besprochen, dass ich vorläufig keine Bewerbungen mehr schreibe, sondern mich voll und ganz auf das Weihnachtsmusical konzentrieren möchte. Und wenn die Aufführungen vorbei sind, ich mich wieder dem Stellenproblem widme. Ich hatte damals noch eine Option, jedoch war diese sehr vage, ich hatte auch schon zwei Absagen von dieser Firma erhalten. Am Wochenende vom 12. Dezember 2016 waren die Aufführungen. Am Montag 13. Dezember 2016 bekam ich einen Telefonanruf, der lautete: «Hallo Danilo, hier Roger, wenn Du willst kannst Du am 1. Januar bei uns anfangen. Du kannst morgen den Vertrag unterschreiben. Herzlich willkommen.» Die Firma, die mir schon zweimal abgesagt hatte, stellte mich ein. Im Vertrag stand beim Salär genau die Zahl, die Katrin damals erhalten hatte.
Nun arbeite ich seit dem 1. Januar 2017 bei einem der grössten Bierproduzenten weltweit. Zuerst als Regionalverkaufsleiter für Zürich und die Ostschweiz, und seit Herbst 2018 darf ich die Capability Abteilung aufbauen. In dieser Aufgabe coache und trainiere ich unsere Verkaufsabteilung. Es ist wunderbar, Menschen auf einem Teil ihres Berufsweges begleiten zu dürfen. Mitzuhelfen, dass sie sich entwickeln können und Karriereschritte möglich werden. Es ist etwas vom Schönsten, einen jungen Mitarbeiter zu begleiten und zu unterstützen auf dem Weg in die Führungspositionen der «Audiklassen». Daneben habe ich mich noch zum Biersommelier ausgebildet. Es macht mir sehr viel Spass, Bier und Food zu vereinen und damit bei den Degustationsteilnehmern eine Geschmacksexplosion in ihrem Gaumen zu bewirken. Ja, Arbeit ist eine sehr menschenfreundliche Erfindung von unserem Schöpfergott.
Die ganze Welt befindet sich in einer schwierigen, herausfordernden Zeit mit Corona. Niemand weiss, wie es enden wird. Auch ich befinde mich seit mehreren Monaten in Kurzarbeit. Und gerade heute (12. Mai 2021) wurde mir mitgeteilt, dass auch mein Job den Restrukturierungsmassnahmen zum Opfer gefallen ist. Die Angst vor der Zukunft will auch mich einholen. Werde ich in meinem Alter eine neue adäquate Stelle in nützlicher Frist finden? Wie lange muss ich warten, kämpfen, Geduld haben. Die «Warum-Frage» will ich bewusst nicht stellen, denn ich weiss, Gott ist da. Es gibt mir Boden und Sicherheit, dass ich weiss, dass Gott jeden Tag meines Lebens bereits seit Beginn bestens kennt. Er hat einen guten Plan mit mir. Und vor allem hat er den Plan im Griff, davon bin ich restlos überzeugt. Es wird spannend sein, wo ich als nächstes arbeiten werde.

War es schön, krank im Bett zu liegen?

Gab und/oder gibt es es in deiner Familie Krankheiten/Unfälle, die dich geprägt oder dein Leben beeinflusst haben?

Falls ihr umgezogen seid, was waren die Gründe für den Umzug/die Umzüge? Wie wurde darüber entschieden?

Wie unterscheiden sich deine früheren Wohnverhältnisse von den heutigen Ansprüchen?

Bist du an frühere Wohnorte zurückgekehrt?

Denkst du bereits ans Wohnen im Alter und triffst konkrete Vorkehrungen bzw. hast solche bereits getroffen?

Erinnerst du dich an deinen ersten Schultag?

Wie hast du lesen gelernt?

Wie hast du schreiben gelernt?