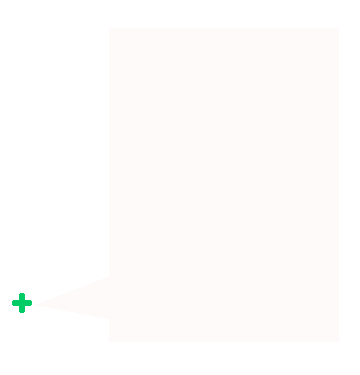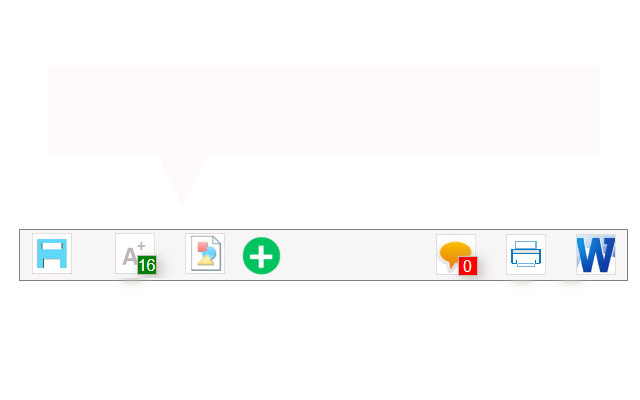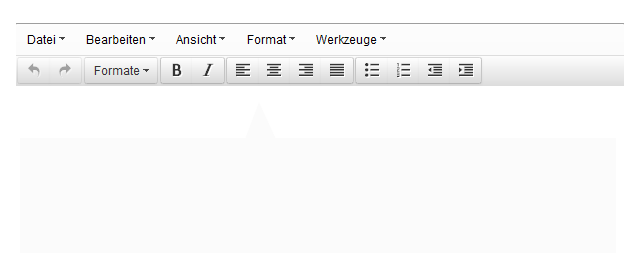3.
Kindergarten- und Primarschulzeit
7.
Sekundarschulzeit / Weiterbildung
11.
Meine Schwiegereltern
13.
Umzug ins Dorf und Zusammenbruch
14.
Enge Verbundenheit mit der Natur
16.
Nachträgliche Gedanken ...
17.
Mein Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Seite 0 wird geladen
Vorwort
Erinnerungssplitter aus einem ganzen Leben, aus denen eine kleine psychologische Aufarbeitung mit rotem Faden aus frühester schwieriger Kindheit mit allen Auswirkungen bis ins hohe Alter geworden ist.
Diese Niederschrift habe ich im Winter 2020/21 begonnen mit der Hoffnung, mich von den verstörenden Ereignissen dieser Welt distanzieren und gleichzeitig meine nächtlichen Gespenster auf Papier bannen zu können. Nachdem ich von meet-my-life gelesen habe, habe ich den Text hier veröffentlicht und um einige hoffentlich interessante zeitgeschichtliche Erinnerungen erweitert.
Die Namen der engsten Angehörigen sind teilweise geändert.
Ich danke Annemie, meiner Schwester, für ihre wertvollen Informationen.
Übergriffe
Seite 1
Seite 1 wird geladen
1.
Übergriffe
Klatsch! Diese Ohrfeige hat gesessen, sie wurde spontan und aus tiefster Empörung verabreicht. Erstarrt blicke ich in seine Augen und sehe die Wut darin, sehe die Zornesröte in sein Gesicht aufsteigen. Mich packt die Angst: was habe ich gemacht? Einen erwachsenen Mann geohrfeigt! Was passiert jetzt? Doch er zügelt sich, gibt mir wütend in seiner brabbeligen Sprache zu verstehen, dass es jetzt kein Geld mehr gibt. Bald darauf gehe ich langsam, bedrückt nach Hause, auf dem Bahnübergang bleibe ich stehen und blicke auf die Häuserreihe am Bahngleis hinüber auf das Haus meiner Verwandten. Voller Angst frage ich mich, was kommt jetzt auf mich zu?
Nichts kommt auf mich zu. Als Elfjährige wusste ich nicht, dass mein Onkel die grössere Angst haben musste, dass ich ausplaudern könnte, was alles in den vergangenen Jahren gelaufen ist. Bis vor kurzem war es nur ein Spiel, kein gern gespieltes und ein geheimes. Von Anfang an wusste ich insgeheim, dass das nicht richtig war, was er da mit uns machte; es hat mich irritiert, irgendwo auch fasziniert, meistens war es lästig. Er war ein erwachsener Mann, haben Erwachsene denn nicht immer Recht? Stets war er gut gelaunt und fröhlich, seine Augen haben gelacht. Doch auch immer wieder hat er den Finger auf den Mund gelegt: nicht darüber sprechen, und hat uns einige Münzen zum Chramen geschenkt. Er war ein gutmütiger, liebenswürdiger Onkel, hat mit uns im grossen, schönen Blumen- und Gemüsegarten gearbeitet, mit dem Leiterwagen im Wald Holz gesammelt, die von der Tante in Heimarbeit gesäumten Frotteetücher in die Fabrik gebracht. In seinen jungen Jahren hat er einen Hirnschlag erlitten, seither hing sein rechter Arm lahm und kraftlos hinunter und er sprach nur noch verschwommen. Fremde Leute haben ihn kaum verstanden, das waren die seltenen Momente, wo wir ihn ärgerlich gesehen haben. Wir, die ihn gut kannten, hatten keine Probleme mit seiner Sprache; grosse Gespräche wurden natürlich nie geführt.
Seit einigen Wochen haben sich seine Augen verändert, wurden starr und gierig. Mir ist mulmig geworden, instinktiv wusste ich: jetzt muss ich mich vor ihm hüten. Ein ums andere Mal habe ich ihn abgewehrt, musste wegrennen, dabei wurde er nur erregter und seine Augen wurden stechender - bis zu meiner Spontanreaktion.
Nichts passiert. Die folgenden Begegnungen sind unangenehm, wir beobachten uns misstrauisch aus Distanz, die vorherige einfache Beziehung ist vorbei. Zum Glück bekommen wir Schwestern bald darauf beim nächsten Klassenwechsel einen Schlüssel zu unserer Wohnung.
Nur einmal noch war ich mit meinem späteren Freund zu Besuch bei meinen Verwandten. Ich sehe die Augen meines Onkels, wie sie strahlend und lachend von meinem Freund zu mir und zurück wandern: Seine Gedanken liegen offen vor mir, sie sind mir so zuwider! Darauf ist diese Verwandtschaft aus meinem Leben verschwunden.
Was und wie meine jüngere Schwester alles erlebt hat, weiss ich nicht, sie wollte nie mit mir darüber sprechen, hat immer abgewehrt. Ich glaube, sie war kaum mit ihm allein zusammen.
Heute schreibt sie: Meine Erlebnisse waren weniger gravierend. Er zeigte sich zweimal in seiner Werkstatt auf ungebührliche Weise. Das war alles. Als ich damals von diesem Geschehen erfuhr, war mein Gedanke nur, jetzt macht er es auch mit mir. Auf meine Frage, ob ich ihr damals denn von der Ohrfeige erzählt habe, antwortet sie: Das weiss ich nicht mehr, ich weiss nur noch, dass du etwas Diesbezügliches erlebt hast. - Die Ohrfeige war jedoch das Allerbeste, nachher hat er wohlweislich Ruhe gegeben.
Viele Jahre später hat sie auf meine eindringlicheren Fragen zu unserer Kindheit so geantwortet: Um sich zu schützen, habe sie sich in eine Traumwelt zurückgezogen und darin in ihrem eigenen Kosmos gelebt. Tatsächlich hat sie viel länger, wie das für Kleinkinder normal ist, geflunkert und Fantasiegeschichten erzählt und damit unserer Mutter etliche zusätzliche Probleme beschert. Erst als sie als junge Erwachsene mit der Umwelt immer weniger zurecht kam, musste sie hart lernen, sich der Wirklichkeit zu stellen.
Einmal hat mein Onkel einen Fehler gemacht, der für ihn verhängnisvoll hätte ausgehen können: Er hat ein Nachbarmädchen in seine Handlungen mit uns miteinbezogen, wahrscheinlich nur ein einziges Mal. Eines Tages standen neben meiner Tante noch zwei weitere Personen vor mir und befragten mich nach meinem Onkel und seinen Handlungen. Was da gefragt worden ist, weiss ich nicht mehr, nur noch, dass ich eingeschüchtert ohne zu zögern: Nein! sagte, später noch einmal ganz bestimmt: Nein! Ich hatte keine Vorstellung, welche Konsequenzen eine Beschuldigung für ihn bedeutet hätte; ich habe ihn vor mir gesehen, er stand mir viel näher als Esther, also entlastete ich ihn. Am Abend noch ein ernsthaftes Tuscheln zwischen meiner Tante und meiner Mutter, dann war für mich diese Angelegenheit erledigt. Bald darauf habe ich Verschiedenes über Esthers Familie munkeln hören: dass nicht alles so gut stehe, etwas mit ihrem Vater, hat er getrunken? oder war da etwas mit seiner Tochter? sie habe sexuelle (abartige, war's wohl) Fantasien. Bald wurde sie in ein Kinderheim gebracht. Da habe ich mich erschrocken gefragt, ob ich schuld sei? Später haben wir sie mit unserer Tante zusammen dort einmal besucht, keine Ahnung, wo das war. Auf jeden Fall war mir überhaupt nicht wohl, ich hatte ein schlechtes Gewissen, fühlte mich schuldig. Ausser der Begrüssung haben wir kaum miteinander gesprochen, sie ist auch sofort wieder zu ihren Gespielinnen geeilt. Von den Betreuerinnen erfuhren wir jedoch, dass es Esther hier gut gehe und gut gefalle, sie sich im Heim wohl fühle und grosse schulische Fortschritte mache. Offenbar war das Heim für sie doch eine Chance und ich fühlte mich viel besser und befreit.
Ich bin überzeugt, dass nicht eine einzige Frau dieser Welt nie irgendwann sexuell belästigt wird. Selber erinnere ich mich an die verschiedensten Episoden in meiner Vergangenheit: Damals als wir mit unserer Mutter die Weihnachtsausstellung in den Schaufenstern beim Jelmoli bewunderten und sich ein Mann in der Menge von hinten an mich heranmachte; damals im Winter als ein Mann meine Schwester und mich vom Bahnhof her in der Dunkelheit verfolgte, obszöne Sprüche von sich gab und unter seinem Mantel nestelte, ich voller Angst einen Sturmschritt anschlug, dem meine Schwester kaum folgen konnte, wir nach Hause liefen und im letzten Moment - kurz vor einem unbeleuchteten Weg - in unsere Wohnung abbiegen konnten: mein Sturmläuten an der Haustür hat unsere Eltern aufgeschreckt, meine Panik war offensichtlich, sie haben zusammen von Polizei gesprochen, aber erkannt, dass der Unhold schnell über alle Berge verschwunden ist, mein Vater hat uns empfohlen, in einem solchen Fall im nächsten Wirtshaus Schutz zu suchen, mir war, meine kleine Schwester habe das alles gar nicht richtig kapiert, sie hat sich beklagt, dass sie den ganzen Weg rennen musste. Damals als mir von der Schule kommend von weitem ein Mann sofort ins Auge stach, der mir auf fast menschenleerer Strasse auf der Gegenseite entgegenkam, ich meinen Impuls, einen anderen Weg einzuschlagen, wegschob, er sogleich auf meine Seite wechselte und auf meiner Höhe mir prompt irgendwelche Obszönitäten zuraunte, die ich nicht mal richtig verstand, mich aber total verklemmt und verängstigt weiterlaufen liessen; damals als im Zugabteil einer sich von der Seite an mich heranmachte, ich mich so abdrehte, dass er es schliesslich auf der Gegenseite bei meiner Schwester versuchte, ich sie scharf fixierte, worauf sie zu mir herüberwechselte, beim Aussteigen dann einzig mein bitterböser Blick zurück auf den Mann, der uns nachschaute; damals als mein Vater im Lungensanatorium Clavadel kurte und meine Mutter, meine Schwester und ich uns im Spital auf TBC kontrollieren lassen mussten, ich in einen stockdunklen Raum eintreten musste, niemanden sah, aber jemand wortlos meine nackten, bereits gut entwickelten Brüste drückte und knetete, ich beschämt wieder hinausgehen durfte, mich an keinen weiteren Untersuch erinnere, wie ich das verwirrte Gesicht meiner Mutter nach ihrem Untersuch beobachtete, sie uns hingegen nicht weiter beachtete: Glaubte sie wohl, nur sie hätte das erlebt? Aus dem Gesicht meiner jüngeren Schwester konnte ich nichts ablesen. Damals, viele Jahre später beim ausgebuchten Rockkonzert in Montreux der Mann hinter mir - welcher? alle schauten in der mitrockenden Masse ganz unschuldig nach vorne - der versuchte, sich an mir zu reiben, ich mich abdrehen musste, der mir das tolle Konzert von Bob Dylan trotzdem nur fast versauen konnte. An den aus heutiger Sicht gravierendsten Fall erinnere ich mich nur wegen der kleinen silbernen Pfeffermühle, mit der ich als Kleinkind so gerne gespielt hätte. Nie durfte ich sie aus der Vitrine nehmen, an diesem Tag jedoch schon, mein elf Jahre älterer Bruder erlaubte es mir. Dann erinnere ich mich nur noch verschwommen, wie ich nackt auf dessen nackter Brust lag und endlich mit der kleinen Pfeffermühle spielen durfte, schwach erinnere ich mich an sein komisches Verhalten, das mich störte und irritierte, der Rest ist versunken. Ob es da vorher oder nachher noch andere ähnliche Vorkommnisse mit ihm gab, weiss ich nicht, ich erinnere mich nicht.
Es gibt auch verbale Egoismen, die nicht sexuell motiviert sind. So entsinne ich mich an jenen Vorfall bei der Arbeit im Büro, als mein Mitarbeiter - Buchhalter und rechte Hand des Chefs - sich bei mir lang und breit und sehr ausführlich über die aus seiner Sicht ungerechtfertigte und lautstarke Massregelung seines Chefs beklagte. Schliesslich sagte er: Jetzt ist mir wieder wohler, stand auf und verschwand aus meinem Büro. Völlig konsterniert sass ich auf meinem Stuhl und fühlte mich beschmutzt wie eine dreckige Türvorlage: seinen ganzen Frust hatte er auf mich abgewälzt, ich hatte nicht ein einziges Wort zu seinen Vorwürfen beigetragen. Ohne seinen letzten Satz - nur gedankenlos geäussert? er konnte auch fies sein! - hätte ich seine Empörung und Kränkung einfach zur Kenntnis genommen, die Kritik am cholerischen Chef verstanden und vielleicht sogar anerkannt, ich kannte diesen ja auch und wusste, dass mein Arbeitskollege äusserst kompetent und zuverlässig arbeitete.
Mir ist klar, dass ich nur "harmlose" Übergriffe erlebt habe, die vielleicht auch mit Glück glimpflich abgelaufen sind und keine schlimmen Ängste ausgelöst haben. Jeder Übergriff, auch wenn er harmlos erscheint, hinterlässt jedoch das Gefühl der Erniedrigung, des Ausgenützt seins, der Scham und auch Mitschuld (weil man sich nicht gewehrt hat). Hoffentlich ändert sich mit den heutigen Diskussionen das Bewusstsein für dieses Thema, sensibilisiert die Gesellschaft, erhellt die Hintergründe der Machtstrukturen und macht sie durchschaubar. Viele Frauen der jüngeren Generation sind heute selbstbewusst und aktiv unterwegs, schreiben sogenannte Catcalls mit Kreide auf die Strassen. So wird das Thema der verbalen Übergriffe auch für jene sichtbar, Männer und Frauen, die davon noch nie betroffen waren. Seit 2019 gibt's in der Westschweiz die App "Eyes Up", wo Übergriffe anonym registriert werden können. Überlegt sich die Schule, was für ein Frauen- und Gesellschaftsbild sie ihren Schülern vermittelt? Fördert sie das Bewusstsein für Grenzüberschreitungen? Auch Politik und Gesetzgeber müssen Missbräuche ohne Wenn und Aber anerkennen und ahnden. Nur so wird sich das Bewusstsein in der Bevölkerung längerfristig verändern. Übergriffe, Rassismus, Diskriminierungen und Ungerechtigkeiten werden jedoch nie ganz verschwinden, der egozentrische Mensch wird sich nicht völlig ändern: die Bibel nennt das Erbsünde.
Kindheit
Seite 2
Seite 2 wird geladen
2.
Kindheit
Erst mal muss sich Selbstvertrauen entwickeln können, um sich selber wehren zu können, und das fehlte mir. Um die Selbstsicherheit, mit der sich andere Junge gewehrt haben, habe ich sie heftig beneidet und sie dafür bewundert. Trotzdem: wenn es eng wurde für mich, habe auch ich mich instinktiv wütend verteidigt, ich hoffe, das ist in jedem Menschen verankert. Offen und selbstsicher kann ein junger Mensch wahrscheinlich nur werden, wenn mit ihm als Kind in einer intakten Familie ehrlich und vertrauensvoll über alle Themen ohne Tabus gesprochen wird. Leider ist in unserer Familie nicht über Alltägliches hinaus mit uns gesprochen worden, und da sind wir sicher keine Ausnahmefamilie gewesen. Beim Erinnern an meine Kindheit steigt das Gefühl des Verlassen-seins, des Im-Stich-Gelassen-seins, des Allein-seins auf. Unsere Mutter musste jeden Tag zur Arbeit in die Fabrik, damit der Zahltag am Ende des Monats einigermassen reichte. Allerdings hat sie damit vor allem die Trinkerei ihres Mannes - unseres Vaters - unterstützt. Kurz nach unserer Geburt wurden wir in die Krippe gesteckt, bis ich etwa vier Jahre alt war. Wie meine Mutter später erzählte, hat ihr das jeweils fast das Herz gebrochen, sie habe uns beim Weggehen von der Krippe noch auf der Strasse weinen hören. Sicher kann ich ihren Schmerz gut nachvollziehen, aber uns hat es natürlich noch mehr geschadet. Hätte es denn keine bessere Lösung gegeben? Vieles habe ich meiner Mutter bis heute nicht verziehen, obwohl sie schon vor einem Jahrzehnt verstorben ist. Allerdings habe ich ihr nie direkte Vorwürfe gemacht. Erst als sie schon alleine war, konnte ich erstmals besser mit ihr sprechen und Fragen stellen. Daher weiss ich, dass sie eine gute Mutter sein wollte, sie hat nie getrunken oder geraucht. Wie sie mir hie und da anvertraute, war ich sogar ihre Lieblingstochter - ein Wunschkind elf Jahre nach meinem Bruder. Genau das ist bereits einer der Punkte, den ich nicht verstehen kann: Warum wird bewusst ein Kind in eine Welt gesetzt, die schon genug Probleme bietet? - Allerdings weiss ich auch nicht, wie damals hätte verhütet werden können, dazu mit einem betrunkenen Partner.
Die Tage meiner Mutter waren voller Arbeit und Stress: Am Morgen uns Kleinkinder wecken, bereit machen und in die Kinderkrippe bringen, bis wir drei/vier Jahr alt waren; dann den ganzen Tag Akkordarbeit in der Näherei in der Fabrik; über Mittag manchmal noch schnell zum Einkaufen in die Migros, das Mittagessen herzaubern, kurz nach Zwölf kam mein Vater zum Essen nach Hause, zwanzig Minuten später eilte er bereits wieder auf den Zug. Diesen Stress hat sie auf sich genommen, um sicher zu sein, dass er über Mittag gegessen und nicht nur getrunken hat. Am Abend haushalten und auf den Ehemann warten, der meistens sehr spät und immer betrunken, oft torkelnd auftauchte, um ihm dann noch ein Abendessen aufzutischen. Schlimm war auch, dass er Ende Monat immer erst auf einer Beizenrunde seine Schulden abzahlen musste. Ich sehe noch ihren fassungslosen Blick in seine bereits geöffnete Lohntüte:
Ist das alles? - sicher mit ein Grund für ihre wiederkehrenden Konflikte. Ich sehe sie vor mir, wie sie sich manchmal übers Küchenbuffet gebeugt in Magenkrämpfen gewunden hat. Einige Male hat sie am Abend berichtet, dass sie wieder einmal im Krankenzimmer gelegen habe, wo ihr Coramin verabreicht worden sei. Mein Vater hat - nach einer Verwarnung von seinem Vorgesetzten - mit starken Medikamenten jeden Morgen trotz seines Alkoholkonsums regelmässig gearbeitet.
Eine grosse körperliche Strapaze waren immer die Waschtage: Erst wurde die Wäsche in grossen Waschtrögen eingeweicht und eingeseift auf Reibbrettern bearbeitet, dann die nassen schweren Wäschestücke auf langen Waschkellen in den Sudkessel, der am frühen Morgen erst befeuert werden musste, hinübergewechselt; anschliessend wurde die Wäsche in Gelten und den Trögen ausgespült und in von Wasser betriebenen Schwingen ausgeschwungen, bevor alles auf die Leinen gehängt werden konnte. Meinen Vater habe ich kaum in der Waschküche gesehen, meinen Bruder schon öfters. Der hat am Morgen den Sudkessel angefeuert und später für die Mutter in der dampfenden Waschküche mit den Holzkellen die schweren wassertriefenden Barchentleintücher in den Waschkessel gehievt. Als wir Mädchen älter waren, haben wir mitgeholfen, Leintücher und andere grosse Stücke mit der Mutter zusammen auszuwringen. Nach dem Waschtag war Mama jeweils einen bis zwei Tage lang krank. - Die heutigen modernen Waschmaschinen sind die grösste Erleichterung der letzten Jahrzehnte für die Frauen.
Am Samstag musste der grosse Bruder Fritz jeweils zuerst die Holztreppe reinigen, spänen, einwichsen und polieren, bevor er in den Ausgang durfte. Für die Bodenpflege in der Wohnung hatten wir einen schweren Bodenblocher, den wir als kleine Mädchen kaum bewegen konnten. Der Staubsauger war dann die nächste grosse Erleichterung für die Hausfrau.
An einem Samstagmorgen hörten wir Mama in ihrem Zimmer hinter geschlossener Tür laut weinen und schluchzen, ein richtiger Weinkrampf hatte sie erfasst. Angstvoll wollten wir zu ihr, aber Vater liess es nicht zu:
Seid ruhig und brav, Mama ist krank! Nervös ist er zwischen Zimmer und Küche hin und her getigert, hat auf Mama eingeredet. Rücksichtsvoll hat er gewartet, bis Mama sich etwas gefasst hat, bevor er erneut zu seiner Sauftour aufgebrochen ist ... Später ist Mama wie ein Gespenst blass und teilnahmslos aufgetaucht, hat uns beruhigt und sich bald darauf wieder ins Bett verkrochen, jetzt von uns begleitet.
Weil ich die Schwierigkeiten und das Leiden meiner Mutter gesehen habe, wollte ich ihr nicht noch mehr Probleme bereiten; so war ich mit meiner Schwester oft streng und auch herrisch.
Halt und Unterstützung hat meine Mutter bei einer fundamentalen evangelikalen Freikirche gefunden. Jeden Donnerstagabend zur Gebetsstunde und am Sonntagmorgen - bald mit uns kleinen Mädchen - hat sie diese Versammlungen besucht. Die strengen Gebote und Ansichten der bibeltreuen Prediger hat sie übernommen und verinnerlicht, sie war ja "bekehrt und hatte Jesus gefunden". Die starken Emotionen hat sie intensiv mitgelebt, während ich von klein auf einen Widerwillen dagegen empfunden habe, die ich nicht begreifen konnte und mich gar verängstigten. Ein richtiger Horror für mich war das "Zungenreden", bei dem auch geheult, geschrien, geweint und geschluchzt wurde - erwachsene Menschen! Dies erlebten wir vor allem später in den Sommerferien bei Onkel Köbi und Tante Helene - einem Bruder meiner Mutter und seiner Frau - deren Glaubensgemeinschaft grösser und noch extremer war. Schon ihre gegenseitige Anrede in den Versammlungen - Schwester Helene und Bruder Jakob - störte mich. Dann ihre ständigen Ausrufe auch bei persönlichen Gesprächen, wenn sie sich auf der Strasse trafen:
Halleluja! Preis den Herrn! Lob und Dank! Das hat mich abgestossen, es fühlte sich so fremd und unnatürlich an. Bei Onkel und Tante in den Ferien gab es jeden Abend eine Andacht mit uns Mädchen mit pfingstlichen Liedern, begleitet vom Onkel an der Gitarre, einer kleinen Schriftauslegung und anschliessendem Gebet: dazu knieten wir uns alle vor unseren Stuhl und brachten unserem Heiland in einem freien Gebet unseren Dank und unsere Anliegen dar. Dabei fühlte ich mich immer so hilflos und beengt, ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte und habe einfach die Worte der anderen, vor allem meiner Schwester, nachgeplappert. Ich war schon froh, wenn nur das Vaterunser aufgesagt werden musste.
So musste ich daheim und in den Ferien auch wohlüberlegt sprechen. In der Kindergartenzeit ist mir mal etwas aus der Hand gerutscht und ich habe gesagt:
Es ist mir 'abegheit'. Meine Mutter hat mich korrigiert:
Man sagt: Es ist mir hinuntergefallen. Schnell habe ich mich angepasst und nur unter Gleichaltrigen ihre eigene unbekümmerte Sprache benutzt. Das hatte ich schnell raus, war überhaupt kein Problem. Schwieriger war, wenn Mutter kritisierte:
Das macht ein Mädchen nicht! So benimmt sich kein Mädchen! Wie benimmt sich ein Mädchen? Ich wusste, es musste brav sein - brav sein wollte ich aber auch daheim nicht immer. Bald ist grimmiger Widerstand in mir aufgestiegen: Die ganze Woche über lässt sie mich allein, kann ich tun und lassen, was ich will, und am Wochenende befiehlt sie mir, wie ich mich zu benehmen habe!
Gerade so wie ich auch den Vater vor mir sehe, wie er beim Verlassen der Wohnung sich zu uns zurückdreht und sagt:
Seid brav und gehorcht der Mama! Sofort war da natürlich der Gedanke:
Benimm du dich anders, dann geht es Mama besser! Diese Zurechtweisungen hatten zudem weiterreichende Folgen, die mir erst heute aufgegangen sind: Ich habe bewusst, teils vielleicht unbewusst, gelernt, wie man an verschiedenen Orten spricht, was ja bis zu einem gewissen Grad normal ist. Das Verbot hat jedoch richtig dazu gereizt, ausser Haus frech und ungeschliffen zu reden, hie und da sogar zu fluchen (mit leichtem Schaudern beim Gedanken an Mama), einfach so, wie ein "braves hübsches Mädchen" nie sprechen würde. Wie oft ärgere ich mich heute selber über meine manchmal grobe Sprache, jetzt daheim. Wie oft habe ich Menschen mit meiner offenen und direkten Sprache brüskiert? Ob ich das mit der neu gewonnenen Einsicht nach so langer Zeit noch ein bisschen korrigieren kann? Das wird schwieriger als die Umsetzung eines Neujahrsvorsatzes. Wenn mir etwas wichtig ist, kann ich aber auch diplomatisch sein.
Niemals habe ich mich mit diesen Gläubigen und ihrer Frömmigkeit anfreunden können. Warum wohl? Meine Schwester machte schliesslich mit und ist heute noch dabei. Vielleicht wäre ich auch reingerutscht, wenn beide Eltern zusammen mitgemacht hätten? Immer wieder hat Mutter versucht, Vater zu ihrem Glauben zu bekehren, einige wenige Male hat er sie begleitet, ist aber immer wieder abgesprungen, der Alkohol war einfach stärker. Wahrscheinlich habe ich schlicht die dort ausgelebten Emotionen als Zuwendung in unserem Alltag vermisst. Als noch kleines Mädchen wollte ich meiner Mutter manchmal am Abend ein Erlebnis aus Kindergarten oder Schule erzählen, das mich am Tag beschäftigt oder bedrückt hat. Die Antwort war immer die gleiche:
Du weisst, dass ich nicht bei dir sein kann, aber der Heiland begleitet dich den ganzen Tag und beschützt dich, ihm kannst du alles sagen. Meine Mutter hat auch darunter gelitten, dass sie uns nicht besser begleiten konnte, diese Antwort hat vielleicht sie beruhigt. Bekommt ein Kind jedoch einige Male dieselbe Antwort, erzählt es eben nichts mehr, es kennt die Antwort ja bereits. So hatte ich buchstäblich niemanden, dem ich meine Kümmernisse anvertrauen konnte. Nicht an ein einziges lockeres oder auch intensiveres Gespräch mit einem Erwachsenen, das über Alltäglichkeiten hinauskam, kann ich mich erinnern, ich war ja nie locker: nicht mit Tante Anna, die ich fast nur im Zimmer bei der Heimarbeit oder in der Küche beim Kochen vor mir sehe; nicht mit der Grossmutter, die ich gern hatte, die sich aber gegen die Glaubensrichtung meiner Mutter wandte und ihr die Trunksucht ihres eigenen Sohnes vorwarf; noch viel weniger mit einer Kindergärtnerin oder einem Lehrer, da war ich viel zu ängstlich, zu schüchtern und zu verklemmt. Ich traute den Erwachsenen nicht. An meine Gotte - oder Patin - erinnere ich mich kaum, an einen Götti überhaupt nicht; Onkel Köbi war der Götti von Annemie, aber eben ... Besuche gab es bei uns nicht, Mama wusste ja nie - oder eben wusste sie - wie der Tag oder Abend abläuft. Damit blieb auch unser Bekanntenkreis sehr eng. Am nächsten und freisten fühlte ich mich bei meinem Onkel Emil in seinem Garten, wo wir oft mithelfen oder spielen durften. Aber ausführliche Gespräche mit ihm waren nicht möglich.
Manchmal bin ich ganz allein im Wohnzimmer meiner Tante (der Gotte meiner Mutter) vor einem kleinen Bild meiner Mutter gestanden, das dort an der Wand hing. Das Bild zeigte meine Mutter als Konfirmandin in entsprechender Mode gekleidet, die mir eigentlich fremd war. In der Frau habe ich jedoch meine Mutter erkannt und bin jeweils tief in Sehnsucht und Heimweh versunken, während mir die Tränen übers Gesicht liefen. Trotzdem war ich häufig am Abend, wenn uns die Mutter abholte, bockig und aggressiv gegen sie. Die beiden Frauen haben zusammen diskutiert, mit mir geschimpft und mich nicht verstanden; meine Mutter war natürlich jeweils deprimiert und verstimmt oder enttäuscht. Heute denke ich, dass sie die Zusammenhänge wohl doch durchschauen konnte. Später haben wir uns oft zugewinkt, wenn ich vor neun Uhr auf dem Schulweg unter ihrem Fabrikfenster vorbeigegangen bin und sie dafür extra eine Pause eingelegt hat. Ebenso erinnere ich mich, wie meine Schwester und ich manchmal auf der oberen Seite des Fabrikareals standen und über den grossen Platz auf den Nähsaal hinunterblickten, wo unsere Mutter arbeitete. Hie und da haben uns Mitarbeiterinnen entdeckt und Mutter gerufen, worauf wir uns freudig zuwinken konnten. - Mir ist heute klar, dass unsere Mutter sehr gelitten hat.
Die Erinnerung meiner Schwester:
Ängstliche Kinder, das waren wir. Erinnerst du dich, dass ich einmal von Zuhause weggelaufen bin? Der Grund war, dass ich in einer Bibelstunde einen Vers aufsagen sollte. (Offenbar nach meiner Konfirmation, als sie alleine hinging.)
So direkt aufgefordert, konnte ich nichts sagen. Mein Gedächtnis war leer. Das konnte/wollte ich nicht noch einmal erleben. - In der 3. Klasse mussten wir Schüler vorne in einer Reihe stehen. Das Lesebuch in der Hand. Jeder sollte einen Satz lesen. Als ich an die Reihe kam, stotterte ich, obwohl ich lesen konnte. Da kam eine Ohrfeige des Lehrers, dass das Buch nur so durch die Luft flog. Ist das Pädagogik?
Die grosse Aufregung nach ihrem Weglaufen und unsere Angst um sie sind mir sehr gegenwärtig. Zu unserer grossen Erleichterung hat der Vater sie am nächsten Morgen im Keller, auf dem Kohlenlager versteckt, noch schlafend, entdeckt - nach einem Tag Irrfahrt mit dem Zug ins Bündnerland und zurück.
Beim empörenden und auch für die damalige Zeit krassen Bild des Lehrers, der in eine offene Wunde haut, empfinde ich noch heute ein unendliches Mitleid mit ihr. Da taucht vor mir sofort ein kleines süsses Bildchen auf, wo wir beiden hübschen, lockigen Mädchen etwa im Kindergartenalter mit zwei gleichaltrigen Nachbarsmädchen, deren Mutter das Bild geknipst hatte, zusammen auf einem Mäuerchen in der Nähe des Hauses unserer Verwandten sitzen, ein kleines Hündchen vor uns. Darauf ist mir Annemie immer so herzig, so fein, so verletzlich erschienen, dass ich jedes Mal vor Mitgefühl zerschmolzen bin. Das Bild und die ganzen Gefühle musste ich jeweils ganz schnell wegschieben.
Sie war ebenso alleine und hat kein Ohr für ihren Kummer gefunden, keine Arme, in denen sie sich ausweinen durfte. So verängstigt war sie, dass sie ins Stottern kam: das habe ich gar nicht mitbekommen. Nicht mal wir beide konnten uns gegenseitig trösten und unterstützen, ich war wohl zu sehr mit mir selber beschäftigt, kaum eineinhalb Jahre älter, und zudem ungeduldig. Von meiner Mutter hatte ich den Auftrag bekommen - weil ich so zuverlässig sei -, auf meine kleine Schwester aufzupassen. Das war nicht immer einfach, weil sie nach der Schule oft nicht am vereinbarten Treffpunkt auftauchte. Zudem war eine solche Aufpasserrolle für meine Charakterbildung nicht gut, sie hat meine Ungeduld und latente Herrschsucht gefördert und verstärkt, die mir im Laufe meines Lebens immer wieder im Weg standen und nur schwer abzulegen sind. Schon in der Kindheit hatte ich manchmal ein diffuses Mitleid mit meiner Schwester, wusste, dass auch sie leidet, dann hat der Ärger über ihre Unzuverlässigkeit wieder Oberhand gewonnen. Ob unsere Gemeinsamkeit uns trotzdem ein wenig Halt gegeben hat, kann ich nicht beurteilen.
Später waren wir beide zuständig für den Abwasch in der Küche. Mir war das gar nicht so unangenehm, aber ich wollte dabei immer mit meiner Schwester zusammen laut singen. Sie aber weigerte sich oft. Ich habe es ihr befohlen, sie angeherrscht, bis sie schliesslich eingestimmt hat. Nach manchmal harzigem Start ertönte bald darauf auch ihre Stimme hell und frei; vielleicht hat uns das Singen unserer Kinderlieder ja tatsächlich gut getan. Der Mutter jedenfalls hat es gefallen, sie hat uns sogar Komplimente einer Nachbarin übermittelt: Sie freue sich immer, wenn sie uns so schön und unbeschwert singen höre, wir seien doch - trotzdem??? - fröhliche Kinder. Sie hat den erzwungenen Anfang nie miterlebt.
Meine Frage heute beantwortet meine Schwester so:
Überforderung und Empörung über Ungerechtigkeiten sind kein guter Nährboden für Ausgeglichenheit; ich war dir ja eine zusätzliche Belastung. So war auch unsere Mutter überfordert, auch durch Angst vor häuslicher Gewalt.
Ich erinnere mich an die Albträume meiner kleinen Schwester: Oft ist sie in der Nacht aufgeschreckt; mit vor Entsetzen aufgerissenen Augen, aber vielleicht noch im Tiefschlaf, hat sie panisch auf ihre Bettdecke gezeigt, wo riesige Spinnen auf sie zukrochen oder sich an langen Fäden von der Zimmerdecke auf ihr Bett niederliessen.
Einmal hat sich die Familie auch um mein Bett versammelt, als ich schreiend von einer gewaltigen Feuerwand aufgeschreckt wurde, die mich verschlingen wollte. Vielleicht hatte ich meinen Feuertraum nach einer Feuersbrunst im Nachbargebäude. Ich erinnere mich, wie wir einmal mitten in der Nacht mit der ganzen aufgeregten Nachbarschaft von der Seestrasse her auf das hoch auflodernde Feuer im Gebäude der grossen Fuhrhalterei und die Feuerwehr blickten. Ich selber verspürte dabei keine Angst, eher Faszination, doch auch etwas Anspannung: unsere beiden Nachbarhäuser standen ja auf der Gegenseite, zwischen ihnen und der Fuhrhalterei war eine breite Durchfahrt. Wahrscheinlich hat mich die Aufregung der Evakuation, der Eltern und Nachbarn, die Sirenen der Feuerwehr, nachträglich doch noch eingeholt.
Meinen anderen, regelmässig wiederkehrenden Albtraum habe ich jeweils alleine überstanden: Ich stehe rücklings an einer Wand in einem dunklen engen, weiter vorne leicht nach rechts abbiegenden Tunnel. Von ganz weit weg nähert sich ein noch kleiner Zug, den ich trotz Biegung sehen kann, schön farbig, kommt immer näher, wird immer grösser, biegt auf meine Zielgerade ein und die gewaltige Lokomotive donnert direkt auf mich zu, um mich zu zermalmen - ich schrecke jedes Mal in Panik mit heftig pochendem Herzen auf und brauche lange, um mich wieder zu beruhigen. Dieser Traum bedrängte mich in meiner Kinder- und Primarschulzeit sehr häufig, ohne Ausnahme jedoch, wenn ich Fieber hatte. Später wurde er immer weniger bedrohlich und verschwand dann. Mit etwa zwanzig Jahren tauchte er noch ein letztes Mal auf, ganz ruhig, wie eine Erinnerung an böse Zeiten - es war vorbei.
Einmal nach Schulschluss tauchte meine Schwester wieder nicht auf und so wartete ich alleine vor dem Fabriktor auf meine Mutter. Verstimmt marschierte sie mit mir nach Hause. Dort erwartete uns eine verstörte Annemie in der Küche, wir sahen die Katastrophe sofort: Der ganze Rahmen des Küchenfensters war verkohlt, dunkelgelb und braun angesengt und voller Hitzeblasen, die Fensterscheiben zerborsten, die Vorhänge verbrannt. Das Häufchen Elend stotterte, dass sie auf dem Fenstersims eine Kerze angezündet habe und auf einmal die Vorhänge zu brennen begonnen hätten. Vergebens hat sie versucht, diese zu löschen, hat sie in ihrer Not im letzten Moment heruntergerissen und auf dem Boden zertrampelt. Trotz meinem gewaltigen Schrecken war ich erleichtert über die schnelle und vernünftige Reaktion meiner kleinen Schwester und habe sie dafür bewundert. Böse konnte ich ihr nicht sein, denn sofort befiel mich das schlechte Gewissen: Einige Tage zuvor hatte ich selber mit ihr zusammen - allerdings auf dem Küchentisch - mit Zündhölzern gespielt; mein nachträgliches Verbot hat nicht gewirkt. Die Mutter schimpfte, wir alle fürchteten die Wut des Vaters. An diesem Abend hat meine Schwester eine Tracht Prügel bekommen; ich habe mich ins Zimmer verzogen.
Vor dem Einschlafen habe ich mir immer meine Bettdecke über den Kopf gezogen, wenn mein Vater noch nicht zuhause war, um den nächtlichen Lärm bei seiner späten Heimkehr nicht oder weniger zu hören. Nie ging er direkt von der Arbeit nach Hause, selten sieben, eher acht oder neun Uhr und noch später ist es immer geworden, daher war er auch unterschiedlich stark betrunken. Harte Gewalt habe ich nie gesehen, doch ganz wenige Male - ich erinnere mich an einen Samstagabend - ist meine Mutter zu den Nachbarn in den unteren Stock geflüchtet, nachdem mein Vater sie bedroht hatte. Und einmal hat sie unseren Bruder zu Hilfe gerufen nach einer ebensolchen Bedrohung. Uns Kinder hat er immer verschont, falls ich nicht irgendwelche Ereignisse stark verdrängt habe. Annemie, meine kleine Schwester, war sein Liebling: Sie war lieb und anschmiegsam ihm gegenüber, natürlich aus Angst vor ihm. Ich selber war eher abweisend und bald einmal immer häufiger ruppig und vorlaut. Meine Mutter:
Sei ruhig! Sei still! Meine Gefühle für ihn schwankten je länger je mehr zwischen Ablehnung, Verachtung, zeitweise sogar Hass und diffuser Zuneigung oder Mitleid.
Sehr lange habe ich nicht gewusst, was in unserer Familie nicht stimmte. Die Erinnerung ist neblig, nur manchmal öffnet sich ein kleines Fenster für einen kurzen Einblick. Dort, wo ein Kind hineingeboren wird und aufwächst, ist einfach seine Familie, alles ist normal, es kennt nichts anderes. Erst später merkt es, es könnte auch anders sein. Dass der Alkohol unser grösstes Problem war, wurde mir erst spät klar, denn für mich zählte die fundamentale Glaubensgemeinde, die uns die Mutter wegnahm, eben mindestens genauso dazu. Weil ich mich weder mit den Ansichten und Werten meiner Mutter noch denen des Vaters identifizieren konnte und keinen Zugang zu ihnen fand, war ich ganz auf mich selber zurückgeworfen. Denn sobald wir - jedenfalls war das für mich so - aus dem Haus gingen, traten wir in eine "sündige" Welt hinaus:
Die Welt da draussen ist sündig, damit für mich auch lange bedrohlich. Ich musste mir meinen Weg alleine suchen, das konnte ich nur in meinem Kopf mit meinen eigenen Gedanken - das war schwer und dauerte sehr lange, zu lange.
Mein Kindertraum: Früh schon wünschte ich mir häufig, ich wäre ein Adler und könnte weit oben über den Bergen kreisen und von dort auf die Erwachsenenwelt hinunterschauen. Wenn Kinder im Kindergarten oder noch in der Schule ihre Lieblingstiere nannten, habe ich auch immer den Löwen oder Tiger genannt. Mein Adler gehörte mir allein und blieb tief in meinem Inneren verborgen, ich wollte ihn nicht preisgeben oder gar einem möglichen Gespött oder Gelächter aussetzen.
Mein Bruder
Seite 3
Seite 3 wird geladen
2.1.
Kindheit
– Mein Bruder.
Mein Bruder taucht erst in meiner Erinnerung auf, als er bereits als Lehrling mit dem Velo zur Arbeit fuhr, elf Jahre Altersunterschied zwischen uns war gross. Von meiner Mutter habe ich viele Jahre später erfahren, dass er bis zur Primarschule bei den Grosseltern väterlicherseits gelebt hat. Und dort von der Grossmutter gehörig verwöhnt worden ist, so wie sie vorher ihren eigenen Sohn - unseren Vater - verwöhnt hat. So hat Mama sich erinnert, dass ihre damals zukünftige Schwiegermutter ihrem Sohn jeden Abend das schwere Militärvelo runter in den Keller getragen hat. Vom Grossvater weiss ich nichts, nur andeutungsweise, dass auch er getrunken hat und oft laut geworden ist. Er ist gestorben, bevor ich ihn bewusst kennengelernt habe.
Offenbar war unser Bruder von seinen kleinen Schwestern nicht gerade begeistert: Er selber hat uns viele Jahre später erzählt, dass er uns manchmal mit dem Kinderwagen ausfahren musste, was ihm jeweils sehr peinlich gewesen sei. Auf keinen Fall wollte er bei seinen Kameraden als Babysitter gelten und ist deshalb immer auf Nebenwege ausgewichen. Daran können wir Schwestern uns natürlich nicht erinnern, dafür an andere Liebenswürdigkeiten: Er hat mir eine tiefsitzende Angst vor Hunden und Tieren im Allgemeinen eingepflanzt. Dabei habe ich Tiere immer - mein Leben lang - so sehr geliebt! Wieder und wieder hat er mich bei gemeinsamen Familienausflügen eindringlich vor jedem entgegenkommenden "bissigen" Hund gewarnt und sich an meiner Angst erfreut. An einen Vorfall erinnere ich mich besonders gut: Zusammen steigen wir einen steilen Waldweg hinauf, und schon wieder warnt mich mein Bruder:
Da oben wartet ein wilder Geissbock, der greift alle an! Wirklich schauen uns oben einige Ziegen zusammen mit einem Bock in einem Gehege neugierig und friedlich entgegen. Voller Angst wage ich mich jedoch nicht näher heran und verstecke mich hinter den anderen. Warum nur war mein Bruder so fies? Und warum haben meine Eltern ihn nicht zurechtgewiesen und mich beruhigt? Vielleicht ist ihre Unterstützung aber einfach in meiner Angst untergegangen.
Sein Verhalten - auch später voller zum Teil empörender Unverständlichkeiten - hat bewirkt, dass ich nie eine gute Beziehung zu ihm aufgebaut habe; oft habe ich geschwiegen, manchmal ihm widersprochen, einige Male sind wir hart und laut aneinandergeraten; treffen können wir uns nicht, unsere Ansichten gehen viel zu weit auseinander. Wahrscheinlich merkt er meine Vorbehalte gar nicht, ich bin wenn immer möglich freundlich zu ihm, und so einfühlsam ist er nicht. Wir sehen uns nicht oft, hie und da taucht er unangemeldet zu einem Kaffee bei uns auf, mehr soll es auch nicht sein. Seine Gespräche münden schnell in allerlei Kritik und Beschimpfungen auf Die da oben, vor allem die Frauen im Bundesrat kommen schlecht weg; Ziel ist auch oft seine Schwiegertochter mit deutschen Wurzeln. Da bleibt mir nur, das Thema zu wechseln, ein ernsthafter Meinungsaustausch ist nicht möglich.
Wenn ich heute seinen "harmlosen" Übergriff in meinem frühen Kleinkindalter beschreibe, halte ich mich ganz an meine verschwommene Erinnerung; das Wissen und die Vorstellungen darüber heute offenbaren mir aber doch einen massiven Missbrauch, der mich erschreckt. Warum kann er mir so unbekümmert begegnen? War das nichts für ihn? Hat er diesen vergessen? Vielleicht schon, weil ich ihn nie darauf angesprochen habe, ich habe mich ja selber kaum daran erinnert, obwohl er im Unterbewusstsein immer da war.
Heute Morgen bin ich aus einem beklemmenden Traum aufgewacht (nachdem ich obigen kleinen Abschnitt am Vortag geschrieben habe): Ich sitze zu Besuch vor dem Haus einer Familie, am Tisch Erwachsene und ein Mädchen von etwa acht Jahren, von dem ich weiss, dass es vom Vater missbraucht und gequält wird. Da taucht dieser auf und fordert das Kind auf, mit ihm zu kommen. Das wehrt sich verzweifelt:
Nein! Nein! Er zerrt es aber mit und sie verschwinden im Haus. Schnell eile ich auf die andere Seite des Hauses, damit der Peiniger mich nicht hören soll: er muss unbedingt sofort während seiner Tat verhaftet werden, und wähle auf dem Handy die Notrufnummer der Polizei. Diese antwortet schnell und ich melde aufgeregt meine Anzeige. Da sei ich auf einer falschen Nummer, er gebe mir die richtige. Nervös schreibe ich eine ellenlange Nummer auf, verstehe schlecht und wiederhole diese, kann sie nicht gut lesen, sie stimmt einfach nicht. Panisch bitte ich einen vorbeikommenden Mann um Unterstützung, der winkt ab. Der Polizist fragt, wo ich sei. Nicht mal das weiss ich genau, so frage ich den neben mir stehenden Mann:
Wie heisst dieser Ort? Der tut ahnungslos und nennt das Quartier:
Himmelreich! (Ausgerechnet! Den Namen dieser deutschen Ortschaft habe ich am Abend zuvor im Deutschen TV zum ersten Mal gehört, er hat mir offenbar Eindruck gemacht.) Mir ist, ich höre den gedämpften Schrei des Kindes. Die Zeit läuft und dieser Quartiername hilft nicht weiter, drängend frage ich wieder und wieder nach der Ortschaft. Während ich unablässig an das gerade jetzt gequälte Kind denke, das ich sofort befreien muss, meine Bemühungen aber zu scheitern drohen, entgleitet mir die Situation und ich spüre, wie meine ganze Persönlichkeit zusammenbricht: Ich zerfalle in ein Nichts, fühle mich elend, unfähig, minderwertig, klein, dumm, schwach, zu nichts zu gebrauchen - aus diesem bodenlosen Tief bin ich aufgewacht. Ich brauchte einige Zeit, um mein Gleichgewicht wieder zu finden.
Zugleich ist auch ein anderes Bild, jetzt aus meiner realen Vergangenheit, wieder deutlicher in mein Bewusstsein getreten: Damals mit meinem Onkel Emil, diesmal nicht im Keller, sondern ich alleine mit ihm in seinem Zimmer; ich stehe auf seinem Bett und untersuche die Dinge oben auf einem Regal. Er steht hinter mir und fingert unter meinem Röckchen an mir herum - noch nie habe ich Erniedrigung und Beschämung so deutlich empfunden wie heute.
Jetzt muss ich unbedingt unseren Vater entlasten: Er hat sich uns Mädchen gegenüber nie das Geringste in dieser Richtung zu Schulden kommen lassen, im Gegenteil: er war eher prüde.
Ich frage mich, was ich hier mache? Soll ich mich all diesen Erinnerungen und den Gefühlen, die diese auslösen, wirklich aussetzen? Diese heute bewusster und damit stärker erleben als damals? Dabei war ich doch immer so konsequent: die Vergangenheit ist vorbei, wir sind jetzt erwachsen und haben die Gegenwart und die Zukunft selber und eigenverantwortlich anzupacken. Leute, die dauernd in ihrer Vergangenheit stochern, haben mich gelangweilt.
Seit meinem Zusammenbruch nach unserem ungewollten Umzug aus dem Dorf tauchen sehr häufig Bilder und Erinnerungen aus meiner Vergangenheit auf, damals ist mit der Tränenflut ein Schutzwall in meinem Unterbewusstsein weggebrochen. Irgendwann habe ich erste Zeilen aufgeschrieben, diese dann vergessen und eines Tages wieder entdeckt, weitere Zeilen angehängt ...
Schnell habe ich zudem gemerkt, dass die Konzentration meiner Gedanken auf einen anständig formulierten Satz mich wohltuend von den verstörenden Ereignissen dieser Welt distanziert, so wie das auch ein Spaziergang dem See entlang tun kann. Auftauchende, mich zunächst verunsichernde Emotionen über den Text verblassen im Alltag immer wieder schnell - sie gehören tatsächlich zur Vergangenheit. Die Erfahrung hat auch gelehrt, dass belastende Momente, mit denen ich mich beschäftige, mit der Zeit in den Hintergrund rücken, an Dringlichkeit verlieren. Die Psychologie warnt ja auch, man soll Erlebtes nicht verdrängen. Dass auch Tränen erleichtern können, habe ich dazugelernt.
Meinen von meinem Bruder eingepflanzten Ängsten habe ich mich später selber gestellt, habe mich gefragt: was kann denn eigentlich passieren? So konnte ich als junge Frau eines Tages angstfrei die getrocknete Wäsche auch tief in der Nacht vom Keller heraufholen. Die Spinnen und die Käfer in der Wohnung waren keine grausliche Bedrohung mehr, mit einem Glas und einer Karte konnte ich sie bald einmal nach draussen befördern. Vor kleineren Tieren ist auch meine Skepsis kleiner geworden: viele Jahre später habe ich eine Kröte, die sich in unsere Küche verirrt hatte, selbstverständlich mit einem Sieb eingefangen und in den kleinen Teich im Garten gesetzt, wo sie während der nächsten heissen Tage verblieben und erst mit dem einsetzenden Regen weitergezogen ist; wir haben ihr sogar einige Spinnen eingefangen und vorgesetzt. Nur die Hundeangst, die blieb lange: ein bellender, vor allem grösserer Hund in meiner Nähe, ein unerwartet vor mir auftauchender Hund, auch kleine Jagdhunde, die in einem Garten kläffend zum Zaun gerannt kamen, die haben bei mir panische körperliche Reaktionen mit Zittern und Gänsehaut vom Kopf bis zu den Füssen und heftigem Herzklopfen ausgelöst. Auch das ist fast ganz verschwunden: Ein Leben später, als wir mit unseren beiden Eseln unterwegs waren und uns wütend bellende Hunde entgegenrannten, haben wir jeweils die lange Führleine auf ihrer Höhe vor, neben und hinter dem Esel geschwungen, so sind die Kläffer uns nie zu nah gekommen; kein Hund rennt in ein schwingendes Seil. Immer haben sie die Esel verbellt, nicht uns. Diese hätten sich auch selber verteidigt und die Hunde angegriffen, machten anfänglich auch Anstalten dazu und wir mussten sie zurückhalten. Schnell haben die Langohren jedoch gelernt, dass wir sie mit dem Seilschwingen unterstützen, und sind Hunden gelassener begegnet. Damit haben wir uns gegenseitig Sicherheit gegeben - eine erlösende Erfahrung! Die Hundebesitzer haben das Signal zudem meistens richtig interpretiert und den Hund an die Leine genommen, so dass wir ohne Diskussionen freundlich grüssend aneinander vorbeispaziert sind.
Noch immer bin ich ein bisschen angespannt, wenn sich mir ein grösserer angeleinter Hund nähert, ich passiere ihn mit abgewandtem Kopf, stecke meine nähere Hand in die Tasche, und beobachte ihn aus den Augenwinkeln, tue so, als sähe ich ihn nicht. Freilaufende Hunde mit ihrer Nase am Boden sind problemlos, die interessieren sich nicht für mich. Im Hinterkopf bleibt auch, dass ich jederzeit ein Seil in der Tasche mitnehmen könnte, was ich bisher allerdings nie gemacht habe. Ich liebe auch Hunde, schaue ihnen gerne zu und freue mich, wenn sie ausgelassen auf einer Wiese miteinander umhertollen dürfen - sie sollen mir nur nicht zu nahe kommen.
Kindergarten- und Primarschulzeit
Seite 4
Seite 4 wird geladen
3.
Kindergarten- und Primarschulzeit
Zu unserer Zeit begann das Schuljahr im Frühling, wann auf Herbstbeginn umgestellt worden ist, weiss ich nicht mehr.
Ziemlich sicher bin ich, dass meine Tante mich am ersten Tag zum Kindergarten begleitet hat. Ich erinnere mich, wie ich bei ihrem Weggehen laut geweint habe. Darauf wurde ich in eine Puppenecke gesetzt. Irgendwann, bald, vergass ich das Weinen und habe mich gefragt, was ich wohl mit diesen Bäbis anfangen soll? Ausser mit einer braunen Gummi-Trinkpuppe, der man oben den Schoppen eingeben konnte und die darauf unten Pipi machte, hatte ich mich schon bisher kaum mit Puppen beschäftigt. Statt des Puppenwagens hätte ich lieber eine mit einem Schlüssel aufziehbare Autobahn zu Weihnachten gehabt; schliesslich habe ich diese dann bekommen! Doch jetzt wäre ich lieber dort drüben bei den Bauklötzen gewesen, aber dort spielten bereits andere Kinder. So erwachte mein Interesse und ich suchte mir halt eine andere Beschäftigung. Schnell fügte ich mich in diese Kinderschar ein; es war mir wohl unter Gleichaltrigen. Immer, während der gesamten Schulzeit, hielt ich mich eher an die ruhigen Mitschülerinnen, richtige Freundschaften habe ich keine geschlossen, die Nachbarskinder waren uns am nächsten, gemobbt wurde ich nie.
Die Jahreszahl 1950 steht deutlich vor mir, im Hintergrund sehe ich eine Wandtafel, also stehe ich im Schulzimmer der 1. Primarklasse. Ob da ein Ereignis dahinter steckt? Wahrscheinlich habe ich die Einschulung als bedeutend wahrgenommen - an den ersten Tag erinnere ich mich nicht. Vielleicht ist mir erstmals eine Jahreszahl bewusst geworden, dazu war's eine schöne, besondere Zahl: 1950. In meiner gesamten Primarschulzeit bin ich einmal mit dem Gesicht zur Wand in einer Ecke gestanden, einmal vor der Tür (und habe mich geniert und gehofft, dass mich niemand sehe), einmal mit einigen Mitschülern mit ausgestreckter Hand vor dem Lehrer, der uns mit dem Lineal Tatzen verabreicht hat. Warum das alles ist mir ein Rätsel, vielleicht habe ich geschwatzt? Sich zu erinnern ist eigenartig: Oft ist die eine Hälfte gut sichtbar, die andere im Dunkeln - schon seltsam. Dazu merke ich heute, dass sich die Erinnerung immer wieder leicht verschieben kann.
An einem Samstag (damals gab's am Samstagmorgen noch Schule) auf dem Heimweg vom Kindergarten ist mir an der Seestrasse auf Höhe des Schiffstegs eine Mücke ins rechte Auge geflogen. Daran erinnere ich mich ganz deutlich, es war ein einschneidendes Erlebnis: Ich rieb mir das Auge aus, rieb und bemerkte, dass ich auch mit dem linken Auge nur verschwommen sah; ich rieb und rieb, hektisch, beide Augen. Schliesslich war mein rechtes Auge wieder klar, aber mein linkes blieb verschwommen. Obwohl ich keinen Fremdkörper darin fühlte, rieb ich noch eine Weile weiter, aber der Schleier verschwand nicht. Was war das? Verzweifelt schloss ich auf dem Heimweg immer wieder das rechte Auge, um das linke zu kontrollieren, aber der Schleier blieb. Aufgeregt erzählte ich der Mutter mein Erlebnis. Zu meiner grossen Überraschung blieb sie ruhig, ja, sie wisse das, der Augenarzt habe das schon vor langer Zeit festgestellt, darum schiele mein linkes Auge auch ein bisschen. Verwirrt musste ich mich damit abfinden, kontrollierte mein schielendes Auge immer wieder, bis ich mich schliesslich daran gewöhnte und es zunehmend vergass. Ganz stolz habe ich später sogar festgestellt, dass dafür mein rechtes Auge besser sei als die der anderen: Bei schönem Wetter konnte ich die Kirchenuhr am anderen Ufer ablesen, die anderen nicht.
Auf meinen Kinderbildern halte ich den Kopf immer auffällig schief, offenbar um mit nur einem Sichtfeld eine Mitte zu halten, auch ist mein linkes Auge meistens geschlossen; diese Haltung war mir (eigentlich noch heute) so bequem, dass ich Mühe bekundete, mich umzugewöhnen und dieses offen zu halten. Erst in der Pubertät wurde mir mein Aussehen wichtiger und ich schaffte es schliesslich.
Andere Konsequenzen des einäugigen Sehens sind mir erst viele Jahre später selber aufgegangen: Immer ist mir passiert, dass ich nur die näherstehenden Gläser korrekt einschenken konnte, sobald diese weiter wegstanden, goss ich hinter das Glas - halt ein bisschen schusslig oder ungeschickt, wie ich das ja von früher kannte. Ich habe dieses Amt an meinen Mann abgetreten. Bis mir eines Tages plötzlich ein Licht aufging: Die Distanzen! Die kann ein einäugiger Mensch nicht korrekt einschätzen! Sofort erinnerte ich mich an die verhassten Turnstunden der Schulzeit: Nie habe ich den Ball in den Korb getroffen! Keiner wollte mich in seiner Gruppe haben. Meine grosse Angst vor den harten Bällen beim Völkerball: Ich konnte die schnell herannahenden Bälle nicht packen - die haben mich getroffen. Oft kann ich weiter entfernt liegende Objekte zwar sehen, aber nicht richtig einordnen. Sobald mein Mann diese Dinge benennt, erkenne ich sie auch: Mit nur einem Auge sehe ich zu flach, die Tiefenschärfe fehlt. Glücklicherweise hat mein schwaches Auge wenigstens ein intaktes Gesichtsfeld, so dass ich Bewegungen auch auf der linken Seite bemerken kann. Am einfachsten kann ich den Unterschied der beiden Augen nachts im Dunkeln erkennen: Im Halbdunkel ist das linke Auge nur wenig unschärfer als das rechte - nur entspricht diese nächtliche Unschärfe des rechten Auges tagsüber seinem äusseren Gesichtsfeld. - Als der Augenarzt mich viele Jahre später das erste Mal als "einäugig" bezeichnete, habe ich erschrocken an ein Monster gedacht: Aber im Spiegel sah ich kein Monster, nur einen leichten Silberblick auf der linken Seite.
Ein verborgenes Talent beim Turnen habe ich doch entdeckt: Als wir eines Tages bei einem Wettlauf auf allen Vieren in ein Ziel rennen sollten, merkte ich, dass ich allen davonrannte; da ich aber keinesfalls auffallen wollte, liess ich die Zweite aufholen und kurz vor mir ins Ziel einlaufen. Ebenso beim Rückwärtsrennen: auch da habe ich das Ziel gemütlich als Zweite erreicht - ha, niemand hat meine famose Begabung bemerkt! Doch beim Waldlauf oder OL, die ich eigentlich gerne gemacht hätte, lief es immer gleich ab: anfangs hielt ich gut mit, doch bald fiel ich weiter und weiter zurück und kam immer schwerer ins Keuchen. Schliesslich bin ich immer mit den Allerletzten total erschöpft beim Ziel angekommen. Meine Luftröhre schmerzte und brannte bis tief in die Lunge hinunter. Dieser Schmerz hat immer den ganzen Tag lang angedauert, erst am nächsten Morgen war er wieder weg. Später, als bei unserem jüngeren Sohn Asthma diagnostiziert worden ist, erinnerte ich mich und mir wurde klar, dass ich diese Veranlagung von meinem Vater, einem starken Asthmatiker, an meinen Sohn weitergegeben habe; selber habe ich nie darunter gelitten, ich konnte einfach nicht lange rennen, schon gar nicht in der Kälte.
Da gab's noch eine seltsame Neigung, von der nur ich wusste: Zwei oder dreimal bin ich von der etwa drei Meter hohen Mauer beim Kindergarten in den unten liegenden unbenutzten harten Sandplatz hinuntergesprungen, immer nur, wenn niemand in der Nähe war. Meiner Schwester, die einmal dabei war, habe ich diesen Sprung streng verboten, weil ich doch gemerkt hatte, dass der Schlag in den Rücken gefährlich werden könnte. Von der Teppichstange im Garten meines Onkels bin ich häufig runtergesprungen, musste nur aufpassen, dass ich nicht mit dem Kinn auf dem Knie aufschlug. Einmal bin ich oben auf der Kletterstange auf dem Pausenplatz des Schulhauses gesessen und habe auf die unten herumrennenden Kinder geschaut: das schien mir jetzt doch etwas hoch, viele hätten mich gesehen, und ich habe mir gesagt, wenn ich jetzt springe, wird sicher der Schulhausabwart mit mir schimpfen. Also bin ich die Stange wieder hinuntergerutscht. Auch dieses Spring-Gen habe ich offenbar meinem jüngeren Sohn vererbt: Er konnte erst auf dem Bauch robben - ist allerdings mithilfe eines Beinchens schon recht schnell herumgeflitzt - da ist er in der Wohnung bereits auf Sofa, Stühle und andere Möbel geklettert und runtergesprungen, immer musste ich ihn im Auge behalten. Ob da wohl unsere Urahnen durchschimmerten? - Während ich meine Wagnisse abgebrochen habe, hat er seine fortgesetzt und sich damit verschiedene Unfälle eingehandelt.
Allerdings bin ich einmal rückwärts von der Kinderschaukel gestürzt, wie ich das angestellt habe, frage ich mich. Klar, immer musste ich fliegen bis über den toten Punkt hinaus, am liebsten rundherum! Bei diesem Ruck muss ich einmal den Halt verloren haben und bin mit dem Hinterkopf auf dem Stellriemen des Gartenbeetes aufgeschlagen. Auf mein Geheul hin ist die erschrockene Tante herbeigeeilt, hat mich ins Haus geführt, das viele Blut abgewaschen und die Wunde versorgt. Dann musste ich mit sturmem Kopf auf dem Sofa liegen, bis die Mutter uns abgeholt hat. Ich hatte ein Loch im Kopf und sicher eine Hirnerschütterung.
Meine viel spätere Frage an den Augenarzt nach einer Katarakt-Operation hat er so beantwortet, wie ich es eigentlich schon wusste: Ja, hätte man damals in den ersten Kinderjahren eine Sehschule durchgeführt, wäre mein linkes Auge korrigiert worden, ich wäre normalsichtig geworden, hätte mit beiden Augen gleichwertig sehen können. Heute ist es so, wie es ist, trotzdem stelle ich die Frage: Warum hat meine Mutter damals nicht auf den Augen- oder Kinderarzt gehört? Hat ihr das Geld gefehlt? Wollte sie sich nicht weitere Probleme aufbürden? Ganz bestimmt hat sie intensiv darüber gebetet, vielleicht sogar nur darauf gesetzt? War sie so verblendet? Dieses Versagen habe ich ihr nie verziehen.
Ende der 50er/Anfang 60er Jahre gab es eine grosse Aufregung unter den Evangelikalen: Der weltberühmte Evangelist und Erweckungsprediger Billy Graham aus den USA kommt ins Hallenstadion nach Zürich, um die Kranken zu heilen! Meine Mutter ist mit ihrer engsten Freundin Mathilde einige Male hingegangen, sie hatten ganz ähnliche Probleme; ein- oder zweimal waren auch wir Töchter dabei. Ein gewaltiger Volksauflauf, darunter viele Menschen auf Rollstühlen oder an Stöcken, die auf Heilung hofften. Über der Bühne ein grosses Plakat: EINER FÜR ALLE - ALLE FÜR EINEN. Im Saal brodelte es, nach einer aufpeitschenden Erweckungs- und Fürbitte-Predigt dann der Aufruf, nach vorne zu kommen, um sich von Jesus heilen zu lassen. Massen strömten nach vorne, es wurde gebetet, es wurde gefleht, es wurde gejubelt, laut wurde Jesus gepriesen, ihm gedankt, wenn wieder jemand als geheilt entlassen wurde. Meine Mutter drängte mich, auch nach vorne zu gehen, ich weigerte mich. Schliesslich wurde der Druck zu gross und ich habe mich mürrisch nach vorne begeben: der Evangelist betet, dann streckt der Wunderheiler drei Finger vor dem Licht in die Höhe, ich sehe diese drei Finger verschwommen:
Wie viele Finger siehst du? - Drei! Eine gewaltige Dankes- und Lobpreiswelle brandet zur Decke auf - was für ein Hokuspokus! Was für eine Seelenfängerei! Soviel habe ich immer schon gesehen.
Meine Mutter war doch nicht dumm! Auch wenn ich ihre Lage zu verstehen versuche, kann ich nicht begreifen, warum sie so leichtgläubig nur aufs Beten zu ihrem Heiland gesetzt und Hilfe und Ratschläge von aussen abgewiesen hat. Vielleicht zeigt das aber auch ihre allgemeine Überforderung in ihrem Alltag auf. Und ich habe vielleicht gerade deswegen gelernt, kritisch zu denken, alles zu hinterfragen, vielleicht hat mich diese bedingungslose Gefolgschaft immun gemacht gegen Sekten, Dogmen, Ideologien, gegenüber irgendwelchen esoterischen Lehren, verschwörerischen Theorien und anderen, auch politischen, Führerschaften.
In diesen Jahren bot sich Mama die Gelegenheit, über ihre Gemeinde irgendwie an ein Harmonium zu kommen. Wir waren begeistert, schon freuten wir uns darauf, ein wenig darauf herumzuklimpern, doch schnell hat sie abgewinkt: Das komme nur ins Haus, wenn wir Musikstunden nehmen würden. Damit war unsere Begeisterung bereits stark gedämpft, sowieso hätte ich viel lieber ein Klavier gehabt. Ein Klavier! So ein weltliches Instrument, da werde ja noch getanzt dazu! Aber trotzdem waren wir einverstanden, und damit begann für uns Schwestern eine nicht so lustige Zeitspanne: wir mussten wieder ins Zentrum Zürich zu einer dort wirkenden strengen Musiklehrerin. Geübt haben wir nur am Vorabend, während einer halben Stunde habe ich mich intensiv hinter die Noten gesetzt. Immerhin war die Lehrerin am Tag darauf mit mir einigermassen zufrieden, sie hat gesehen, dass ich geübt habe, hat manchmal aber auch mit mir geschimpft, ich müsse mehr üben. Für Annemie, die kaum geübt hat, war es die reine Tortur, sie musste viel Kritik und Schimpf einstecken. Nach einiger Zeit hat die Musiklehrerin Mama mitgeteilt, dass unser Fall hoffnungslos sei, und das Unterfangen wurde zu unserer Erleichterung abgebrochen. Mama hingegen hat für sich zu Hause fleissig gespielt und geübt, ob ihr jemand Anleitung gegeben hat, weiss ich nicht. Schnell wurden die Melodien ihrer Lieder immer besser und bald konnte sie diese sogar singend begleiten, nur wenn andere mitsingen wollten, ist sie noch aus dem Rhythmus geraten.
In den ersten Primarschuljahren habe ich, wie viele andere Kinder auch, Blockflöte gespielt, daran habe ich keine negativen Erinnerungen, weitergeführt hat dieser Musikunterricht aber auch nicht. Wahrscheinlich habe ich damals die Noten lesen gelernt.
Die Schuljahre waren meine besten Jahre. Anfänglich musste ich mich aber gehörig anstrengen, um mitzukommen, meine Noten waren gerade gut genug. So erinnere ich mich, wie ich mich reingekniet habe, auf keinen Fall wollte ich schlechte Noten bekommen. Schliesslich - als ich besser lesen konnte - entspannte ich mich und die Noten verbesserten sich. Ich wurde zur Leseratte und habe mir bald regelmässig Bücher aus der Schulbibliothek ausgeliehen. Bis zur fünften Klasse lief es immer besser.
Dann in der sechsten kam der Einbruch: Immer häufiger habe ich überhaupt nicht mehr verstanden, was der strenge Lehrer da vorn gesagt hat. Oft musste die ganze Klasse aufstehen, und nach jeder beantworteten Frage durfte sich der entsprechende Schüler oder die Schülerin wieder hinsetzen - ich stand am Schluss immer alleine da, was für eine Schmach!
An eine gute Antwort in einer anderen Situation kann ich mich aber erinnern: Auf die Frage, warum es am Bodensee häufig so stark stürme, habe ich spontan zuerst und alleine die Hand hochgehalten:
Weil der See so gross ist und keine Berge den Wind abhalten. Richtig, ich weiss nicht, was der Lehrer von mir gehalten hat. Wir haben unsere Sommerferien während der Primarschulzeit immer am Bodensee bei Onkel Köbi und Tante Helene verbracht. Der See war so riesig - so stellte ich mir das Meer vor, er heisst ja auch "Das schwäbische Meer" -, dass das andere Ufer nur bei ganz schönem Wetter schwach zu erkennen war. Hier begleitete uns unsere Tante manchmal zum Baden, wobei wir am flachen Ufer weit hinausstapfen konnten, bis das Wasser tiefer wurde. Eines Nachts haben wir einen fürchterlichen Orkan erlebt. Die Tante hat uns aus den Betten geholt, wir mussten ihr helfen, das Wasser im Treppenhaus aufzunehmen, das laufend durch die geschlossenen Fenster drückte und die Treppen hinunterströmte. Währenddessen hat der Onkel die Fenster in der guten Stube - dem Salon - und den anderen Zimmern überwacht; wie gross der Schaden hier war, weiss ich nicht mehr. Noch gut sehe ich jedoch die Verwüstung am nächsten Morgen vor mir: Im gegenüberliegenden Park herrscht ein gewaltiges Chaos von vielen teils sehr grossen Ästen der Platanen auf dem Boden. An dieses Erlebnis habe ich mich bei der Bodensee-Frage sofort erinnert, meine Antwort aber wie immer so kurz wie möglich gehalten.
Hie und da habe ich nach einer Frage die Hand zuerst aufgehalten, aber nur, um schnell zu fragen, ob ich hinausgehen dürfe. Ich durfte immer, anschliessend hat sich der Lehrer jeweils erkundigt, ob wieder alles gut sei. Irgendwann wurde meine Mutter vom Lehrer vorgeladen: Etwas stimme nicht mit mir, manchmal sitze ich schneeweiss, dann wieder mit hochrotem Kopf an meinem Platz. Daran erinnere ich mich sogar gut, weil ich das auch später noch oft hatte: eine grosse Hitze im knallroten Kopf, warum? Sicher gab's einen Arztbesuch, dann der Bescheid: ich musste für sechs Wochen zur Kur in die Berge. Eine richtige Diagnose kenne ich nicht: Wachstums- oder Entwicklungsstörungen seien das - Hormonstörungen waren wohl bereits zu anrüchig.
Hier erinnere ich mich an eine rätselhafte Sitzung der Mutter mit uns beiden Mädchen einige Zeit vorher: in gewundenen Sätzen hat sie uns in unverständlichen Worten etwas zu erklären versucht. Damit hat sie ihre Aufgabe erledigt, uns jedoch ratlos zurückgelassen: wir haben kein Wort verstanden, nicht mal andeutungsweise den Gegenstand ihres Vortrags erkannt - oder war da etwas mit Kindlein?
Kuraufenthalt
Seite 5
Seite 5 wird geladen
4.
Kuraufenthalt
Die Aussicht, alleine von zu Hause weg und in ein unbekanntes Kinderheim gehen zu müssen, hat mich schon wieder geängstigt, am liebsten hätte ich mich verkrochen. Im gleichen Dorf war noch ein gleichaltriger Junge, Peter, der am selben Tag ins selbe Heim eintreten musste. Wir haben die Familie besucht und es wurde vereinbart, dass ich zusammen mit ihnen reisen konnte; dieses Treffen und die Mutter von Peter haben mich beruhigt. Warum Peter kuren musste, sogar noch länger als ich, weiss ich nicht. Im Januar kamen wir im tiefverschneiten Prättigau an: Schon die wunderschöne Fahrt in die Berge hinauf ins Walsertal hat mich fasziniert. Der überwältigende Ausblick auf die verschneiten Berge, dazu die gleissende Sonne, der hohe Schnee und der tiefblaue Himmel bei der Ankunft beim Heim haben mir fast den Atem geraubt. Der Empfang der beiden Heimleiterinnen war freundlich, ich habe mich schnell eingelebt, obwohl ich anfänglich an einem starken, geheim gehaltenen Heimweh litt. Peter und ich waren die Ältesten, Bruno ein Jahr jünger, die anderen noch jünger. Mein Heimweh verschwand bald, ich habe die unbeschwerte Zeit mit den anderen Kindern draussen im Schnee, die freundliche Atmosphäre im Haus nur genossen. Schon bald war ich sonnenverbrannt, eine Erzieherin hat mich aufgezogen, dass man meine Röte im Gesicht bei einer Anspielung auf Peter und mich gar nicht mehr sehen könne.
Was für eine Überraschung: Eines Tages habe ich einen dicken Briefumschlag bekommen! Gegen dreissig Briefe von meinen ehemaligen Schulkameradinnen und -kameraden zu lesen, war schon ein einmaliges Erlebnis. Dabei habe ich staunend festgestellt, wie unterschiedlich und ganz persönlich diese geschrieben waren, alle hatten einen eigenen, sogar speziellen Stil: In einem Brief wurde jeder einzelne Satz zwischen "Anführungs- und Schlusszeichen" gesetzt, in einem anderen fortlaufend nummeriert. Die Buben haben eher etwas unbeholfener geschrieben, vielleicht auch, weil sie einem Mädchen schreiben mussten. Natürlich habe ich einen Brief an die ganze Klasse zurückgeschrieben, habe von unserem Alltag im Heim, von den Spielen im Schnee, unseren Schneewanderungen berichtet, dass hier oben nur die Sonne scheine oder es hie und da in dicken Flocken schneie. Ich habe erzählt von dem weit entfernten Grollen und Donnern, das einige Male zu hören war: niedergehende Lawinen, denen die Leute hier sogar Namen geben, dass diese jedes Jahr herunterkrachen und die Bergbewohner gar keine Angst vor ihnen zu haben schienen, was mich tief beeindruckt hat. Ich habe geschrieben, dass das Thermometer an der Holzwand des Hauses am Nachmittag in der Sonne manchmal 30° anzeige. Das hat dann einer nicht geglaubt und mir seinen Zweifel sogar in einem zweiten Brief mitgeteilt. Ich glaube, darauf habe ich nicht mehr geantwortet, aber ich hab's ja selber gesehen.
Der kleine Felix im Heim, noch kein Jahr alt, war der Liebling von uns Mädchen. Die etwas jüngere lebhafte Susi wollte ihn unbedingt wickeln. Die Erzieherin warnte, er sei sehr zappelig und kräftig, erlaubte es ihr, stand aber dicht daneben. Susi scheiterte kläglich, Felix strampelte, drehte und wendete sich, sie hatte keine Chance, die Erzieherin musste übernehmen. Am nächsten Tag fragte sie mich, ob ich es versuchen wolle. Noch so gerne! Der Kleine war wirklich ein Temperamentsbündel, aber bald hatte ich den Dreh raus, ihn immer kräftig festzuhalten, manchmal auch nur mit einer Hand und mit der anderen ihn auszuziehen oder das Windelpaket zu schnüren. Von da an durfte ich ihn wickeln; die Erzieherin beobachtete immer, stand aber nicht mehr so dicht neben mir - das erfüllte mich mit Stolz! Wenig später war mir, als würde der kleine Sonnenschein lieber mich anstrahlen, als zu kämpfen, vielleicht war's einfach meine Routine. Der kleine Felix ist mir tief ins Herz gewachsen. Einmal beim Nachtessen fragte Susi:
Wo ist eigentlich Felix? Ja, wo? Die Erzieherin zu Susi gewandt:
Heute Morgen haben ihn seine Eltern abgeholt, er ist wieder gesund. Geschrei von Susi, während die Erzieherin jetzt mir in die erschrockenen Augen blickte. Schnell schaute ich auf meinen Teller hinunter, während mir die Tränen in die Augen schossen, ich sagte kein Wort, der Appetit war mir vergangen. Dass Felix einmal heimgehen könnte, auf diesen Gedanken bin ich gar nie gekommen. Susi jammerte weiter. Die Erzieherin erklärte, dass die Eltern sehr glücklich seien, dass ihr kleiner Sohn wieder gesund sei und sie ihn wieder bei sich haben dürfen. Meine Trauer war gross, aber mit dieser Erklärung bin ich darüber hinweggekommen. Die Erinnerung ist in den Hintergrund gerückt, aber vergessen habe ich ihn nie: Felix - hoffentlich ist er glücklich geworden!
Ich hatte den Eindruck, dass die Heimleiterinnen mich gut mochten. Einmal wurde mir gezeigt, wie ich beim Abtrocknen das Geschirrtuch richtig halten musste, ohne das Geschirr oder Besteck mit den Händen zu berühren. Aha, davon hatte ich noch nie gehört, also befolgte ich das. Am nächsten Tag bemerkte ich, wie sie mich beobachtete und offenbar zufrieden war. Aber klar, wenn ich etwas lernen konnte, machte ich das auch. Aber einmal war ihr Verhalten mir gegenüber sehr hässlich: Seit wenigen Tagen hatte ich immer so braunrötliche Spuren in meinem Höschen; ich rieb und putzte mich, aber immer waren sie wieder da. Da hat die Erzieherin doch eines Morgens mein Höschen in die Höhe gehalten und den anderen gezeigt:
Seht mal wie gruusig! Am liebsten wäre ich vor Scham im Boden versunken. Zum Glück war der ganze Spuk in wenigen Tagen vorbei. Warum hat diese Frau das unerfahrene Mädchen nicht zur Seite genommen und ihr die nötigen Hilfsmittel zur Verfügung gestellt?
Einige Monate später musste ich meine Mutter verstört um Hilfe bitten, da war wirklich Blut. Sie meinte nur:
Das habe ich euch doch vor noch nicht langer Zeit erklärt. Da dämmerte mir, was sie uns in jener rätselhaften Sitzung mitteilen wollte. Aber wenigstens hat sie mir jetzt geholfen. Gleichzeitig wurde mir klar, was sich in den Bergen vorerst nur schwach angekündigt hatte, und mein Groll auf die Erzieherin wurde noch grösser. Jetzt musste ich mich also mit dieser monatlichen Plage und den zeitweise sehr heftigen Bauchkrämpfen herumschlagen.
Eines Tages haben Peter und Bruno mich oben im Badezimmer stark bedrängt, dass ich, nur mit Hemdchen bekleidet, ins anschliessende Vestibül flüchten und mich verteidigen musste. Bis glücklicherweise eine Betreuerin dazukam, die aber mit mir zu schimpfen begann, weil ich die Badezimmertüre entgegen ihrer Ermahnung, die Wärme zusammenzuhalten, offen gelassen hätte. Ich habe diese nicht offen gelassen, nur nie einen Schlüssel gedreht, gar nicht daran gedacht. Warum hat sie nicht die offensichtliche Frage an die beiden gestellt, was diese im Badezimmer verloren hätten? Sie hat sie einfach nach unten gescheucht; ich habe die beiden nicht beschuldigt, die Vorwürfe wie schon oft einfach geschluckt. Wieder einmal konnte ich eine Erwachsene nicht verstehen und war insgeheim wütend auf sie. Nach dem Mittagessen mussten wir Kinder jeweils einen Mittagsschlaf halten, was ich immer genossen habe. Vor allem draussen im Schnee an der Sonne, auf unseren Liegen eingepackt in eine dicke Decke, habe ich immer herrlich geschlafen. Ausser Peter und Bruno hätten wieder und immer häufiger gestört, was Susi den Erzieherinnen schliesslich gemeldet hat. Also haben diese mich als Aufpasserin eingesetzt. Bald haben meine Warnungen nichts mehr bewirkt, und eines Tages musste ich sie eben verpetzen, schon der anderen Kinder wegen. Von da an herrschte stille Feindschaft zwischen uns.
Einmal pro Woche wurden wir von einem Arzt untersucht, dazu gehörte auch die Gewichtskontrolle. Bald hat sich am Tisch ein unsinniger Wettbewerb entwickelt, ausgehend von den Erzieherinnen:
Wer wiegt am Schluss mehr, Peter oder du? Mein Appetit war gross, das Essen fein und ich habe oft zu viel gegessen. Wer den Wettbewerb schliesslich gewonnen hat, weiss ich nicht mehr sicher, wahrscheinlich lag Peter etwas vorne, er war ja auch grösser als ich. Aber ich brauchte nachher Jahre, bis ich mit meiner Figur einigermassen zufrieden war.
Nach sechs Wochen hat sich Besuch für mich angemeldet: Mein Bruder und eine fremde Frau standen vor der Tür, die mich am kommenden Morgen abholen wollten. Traurig habe ich mich verabschiedet und bin mit gemischten Gefühlen mit meinem Bruder und seiner neuen Verlobten Emely nach Hause gereist. Ich habe nur Gritli gekannt, seine vorherige fröhliche Verlobte, die schwanger unter fragwürdigen Umständen gestorben ist. Gritli war mit ihrer Herzlichkeit in unserer Familie sehr beliebt, und alle waren über ihren unerwarteten Tod äusserst schockiert. Auf der Heimfahrt herrschte eine beklemmende Stimmung, von mir aus kam nichts; die beiden waren zum Glück mit sich selber beschäftigt. Die Familie zu Hause begrüsste mich freudig, aber überrascht: sie haben mich kaum wiedererkannt, so braungebrannt und wohlgenährt, wie ich war.
Ich musste die sechste Primarklasse wiederholen. Dazu kam ich in ein anderes Schulhaus und natürlich zu neuen Schulkameradinnen und -kameraden. Anfangs fühlte ich mich ein wenig fremd, obwohl ich Peter sofort gesehen habe. Wir haben nie Kontakt zueinander aufgenommen, uns nur aus Distanz beobachtet. Wollten wir den anderen nicht zeigen, dass wir uns bereits kannten und eine gemeinsame Zeit zusammen verbracht hatten? Oder haben die zuletzt in den Bergen zugenommenen Differenzen nachgewirkt?
Etliche Jahre später musste ich in der Lokalzeitung die verstörende Nachricht lesen, dass Peter bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist und dabei Frau und ein Kleinkind hinterlassen hat. Er tat mir so Leid; die Erinnerungen an unseren gemeinsamen Kuraufenthalt mit Bruno sind wieder aufgetaucht.
Schnell habe ich mich in die neue Klasse eingelebt. Im Geheimen habe ich jedoch immer befürchtet, dass jetzt dann, sicher bald, ein Thema auftauchen würde, das ich nicht verstehen konnte, so wie vor einem Jahr. So sind die Sommerferien gekommen, den ganzen Schulstoff hatte ich bisher leicht bewältigt. Nach den Ferien wappnete ich mich erneut: jetzt war es sicher soweit. Als es weiterhin so gut lief, entspannte ich mich und die Freude am Unterricht überwog mehr und mehr. Mit dem Herbst kam die Zeit für den Schoggitaler-Verkauf. Der Lehrer las die Rangliste vor, nur die Besten durften daran teilnehmen: die Erste, der Zweite, dann nannte er meinen Namen! Ungläubig hörte ich das, dann erfüllte mich eine tiefe Freude - es war vorbei, ich war wieder dabei! Im bisher allerschönsten Schuljahr.
Eines Tages ist Max auf mich zugekommen und hat mich gefragt:
Willst du mit mir gehen? Erschrocken und peinlich berührt habe ich ihn abgewiesen: ich ein Schulschatz! Was wollte er von mir? Er war mir nicht unsympathisch, meine Abfuhr tat mir sogar etwas Leid, aber ich wusste nicht, was ich mit ihm hätte anfangen, wie ich mich hätte verhalten sollen. Immerhin habe ich gemerkt, dass er mich mochte, aber ich konnte mich nicht erklären. So habe ich mich sehr oft - manchmal heute noch - bei sozialen Kontakten schwer getan, ich habe das in meiner Kindheit einfach nicht gelernt, hatte keine Vorbilder.
Meine Grossmutter
Seite 6
Seite 6 wird geladen
5.
Meine Grossmutter
Unsere Grossmutter väterlicherseits (1880-1959) hat im gleichen Dorf gewohnt. In der Primarschulzeit haben wir die freien Mittwochnachmittage und die Frühlings- und Herbstferien tagsüber bei ihr verbracht. Hier haben wir das Nachbarsmädchen Vreni kennengelernt und die beiden italienischen Schwestern Paula und Luisa vom obersten Stock, die nur im Sommer während ihren Ferien bei ihren Eltern in der Schweiz leben konnten. Obwohl keines die andere Sprache verstand, haben wir gut zusammen gespielt, ich habe sogar einige italienische Worte gelernt. Manchmal sind wir mit der Grossmutter zusammen im Wald spazieren gegangen, immer ein schönes Erlebnis. Mit der Zeit ist meine Zuneigung zu ihr immer grösser geworden und eines Abends habe ich ihr beim Abschied scheu einen Kuss auf die Wange gedrückt. Erstaunt hat sie mich angeblickt, ich glaube, sie hat sich gefreut - so war das bei uns. Von da an hat dieser Abschiedskuss immer dazugehört.
Immer hat sie uns am Abend zum Gartentor begleitet und uns nachgeschaut, oben an der Wegbiegung haben wir uns zugewinkt, dann sind wir dem Haus entlang gelaufen, bis wir zwischen den Häusern Grossmutter unten an der Hausecke warten sahen, wo wir uns nochmals zugewinkt haben, meinerseits oft mit leiser Wehmut.
In den Wintermonaten hat sie bis ins hohe Alter in einem Hotel in Davos als Plätterin gearbeitet. Ich erinnere mich an ein schwarzes, schweres Eisen-Bügeleisen in ihrer grossen Küche, das sie auf einem heissen Ofen aufheizen musste. Ich nehme an, dass ihre Arbeitsweise im Hotel bereits etwas moderner war. Sie hat auch in "Herrschaftshäusern" am Ort oder in der näheren Umgebung gebügelt. Einmal hat sie uns zu Frau Doktor mitgenommen, wir mussten aber im weitläufigen Park mit den vielen grossen Bäumen bleiben, durften dort spielen, aber nicht lärmen oder diesen verlassen.
Einmal hat sich ihr Bruder Eduard - ein Künstler - bei Grossmutter zu Besuch angemeldet. Sie wirkte etwas nervös, hat mir Geld in die Hand gedrückt, um in der nahen Wirtschaft ein Bier für ihn zu holen. Der Wirt dort hat mich erstaunt gefragt:
Für wen willst du denn das Bier? Ich habe geantwortet:
Für meine Grossmutter. Er hat gelacht:
So, so, für deine Grossmutter. Wo wohnt denn deine Grossmutter? Ich habe den Weg hinunter auf das Haus gezeigt, in dem sie wohnte, und erklärt, dass sie Besuch von ihrem Bruder bekomme. Da hat er mir das Bier gereicht und noch angehängt:
Grüsse deine Grossmutter von mir. Dann erinnere ich mich, wie Onkel Eduard am Stubentisch Wurst mit Senf und Brot (meine Nase erinnert sich gut daran) gegessen und Bier getrunken und uns dabei gemustert hat:
Das sind also die Kinder von Fritz? Wir beide haben uns schüchtern in der Stube herumgedrückt und sind dann ins Freie gerannt. Eduard hat Bilder gemalt, aber offenbar kaum welche verkauft, wie ich später Gesprächen zwischen Grossmutter und unserer Mutter entnommen habe. Vielleicht wollte er Geld von seiner Schwester? Soviel ich weiss, habe ich ihn nie mehr getroffen.
Regelmässig, doch nicht täglich, ist Grossmutter am Abend bei uns aufgetaucht, nicht immer zur Freude meiner Mutter, wie ich ihrer Miene ablesen konnte. Wie ich erst mit zunehmendem Alter mitbekam, hat sie meiner Mutter immer wieder die Schuld für die Trunksucht ihres Mannes, unseres Vaters und ihres Sohnes, zugeschoben. Sie hat erwartet, dass meine Mutter sich ihm gegenüber anders, wahrscheinlich härter und konsequenter, verhalten müsse, ich weiss nicht. Einmal hat sie Vater eigenmächtig beim Blauen Kreuz angemeldet: Was für ein Aufruhr und Krach, als eines Abends ein Fremder in der Stube stand, der meinen Vater als Mitglied gewinnen wollte! Er war schwer zu überzeugen, dass nicht seine Frau, sondern seine Mutter ihm das eingebrockt hatte. Seine Wut hatte aber seine Frau auszubaden. Danach hing unser Haussegen für lange Zeit sehr schief.
Einmal wollte ich, vielleicht hatte ich einfach keine Lust dazu, nicht in den Religionsunterricht nach Zürich, den wir Schwestern am Sonntagnachmittag vor der Konfirmation regelmässig besuchen mussten. So sind wir im Dorf herumspaziert, um die Zeit zu vertreiben, die uns schliesslich doch etwas lang wurde und wir bei Grossmutter untergeschlüpft sind. Erstaunt hat sie uns gefragt, ob wir denn nicht gern hingehen würden, nur hingehen müssten? Ihr Gesicht drückte deutlich ihre Ablehnung für die Evangelikalen aus, hat meine Mutter ihrer Ansicht nach ihren Mann doch damit in die Trinkerei getrieben. Am Abend hat sie uns nach Hause begleitet: Wieder war Feuer im Dach! Mama war sehr böse auf uns. Nachher haben wir diesen Unterricht wieder regelmässig besucht.
Eines Abends musste ich für unsere ungeliebte Nachbarin vom unteren Stock kurz vor Ladenschluss schnell noch Bratwürste posten. Also eilte ich los. Da rief mir an der Kreuzung weiter vorne meine Grossmutter - sie war Ende Saison eben gerade von Davos heimgereist - über die Strasse entgegen:
Ich bin froh, dass ich dich sehe, so muss ich nicht bis zu euch kommen. Sag es der Mama, ich habe Bauchweh und gehe gleich nach Hause. Erschrocken habe ich ihr zugerufen, dass ich für Frau Bollier noch Bratwürste einkaufen müsse. Sie solle doch am Bahnhof ein Taxi nehmen, statt auf den Bus zu warten. Ja, das mache sie, wir haben uns aus Distanz verabschiedet, ich habe ihr:
Gute Besserung! nachgerufen. Traurig und schuldbewusst habe ich ihr noch kurz nachgeschaut, wie sie ganz alleine mit ihren Bauchschmerzen zum Bahnhof gehen musste, ich sie nicht begleiten konnte, denn ich musste jetzt in der anderen Richtung diesen blöden Bratwürsten nachrennen. Das ist meine letzte Begegnung und bittere Erinnerung an meine Grossmutter.
Zu Hause habe ich ganz aufgewühlt natürlich sofort von Grossmutter berichtet. Meine Mutter hat sich beim Alterswohnheim, in dem Grossmutter lebte, erkundigt. Ich glaube, sie ist noch am selben Abend ins Spital eingeliefert worden. Die Mienen waren ernst. So gerne hätte ich sie besucht, aber es wurde uns Mädchen verwehrt. Wie konnte man denken, dass uns diese Krankheit, vielleicht auch Infusionsschläuche und das bevorstehende Sterben mehr schaden würden, als das, was wir bereits erlebt hatten? Ein natürliches Ableben mit 78 Jahren! Nie hat man versucht, uns gerade die wichtigen Dinge des Lebens zu erklären. Grossmutter hätte sich sicher über den Besuch ihrer Enkelinnen noch gefreut, aber nie mehr konnte ich letzte Worte mit ihr wechseln.
Die Mutter hat Grossmutter regelmässig besucht, wie sie mir später erzählt hat. Der Vater, ihr Sohn, dagegen hat offenbar nie Zeit dazu gefunden, was seine Mutter sehr enttäuscht habe. Ihr geliebter Enkel Fritzli ist hingegen einmal aufgetaucht; bei dieser Gelegenheit hat sie ihn gebeten, für sie eine noch offene Rechnung zu begleichen. Das Geld hat der liebe Enkel an sich genommen, die Rechnung hingegen liegenlassen. Vielleicht, hoffentlich, hat Grossmutter diesen Vertrauensbruch gnädigerweise nicht mehr mitbekommen.
Bald darauf schickten sie uns in die - diesmal - Frühlingsferien an den Bodensee. Wie wusste ich da plötzlich, was ich bei der Andacht beten musste: eindringlich habe ich gefleht und den Heiland gebeten, die Grossmutter doch schnell wieder gesund zu machen! Nachher hat mich der Blick meiner Tante getroffen, und mit einem Schlag habe ich gewusst, Grossmutter wird nicht mehr gesund. In der Nacht habe ich mein Kissen nass geweint - aber mit meinen verzweifelten Fürbitten nicht nachgelassen, bis mir die Tante irgendwann zu verstehen gab, dass Grossmutter gestorben sei.
Nach den Ferien stand ich neben einem Sarg, alle schauten hinein, ich konnte nicht. Mama drängte mich aber:
Schau sie an, sie ist so schön! Schliesslich habe ich mich doch überwunden und Grossmutter eine ganze Weile angeschaut: sie war wirklich sehr schön und so voller Frieden; ich bin ganz ruhig geworden. Es war gut, dieses letzte schöne Bild von ihr in meinem Herzen aufbewahren zu können.
Gute Zeiten trotzdem
Seite 7
Seite 7 wird geladen
6.
Gute Zeiten trotzdem
Meinen Namen Erika habe ich nie gemocht, ich fand ihn hart, kalt und eckig. - Das war dann mit meinem Geburtsdatum schon anders: 4.8.44, ist das nicht eine schöne Zahl? Damit habe ich als Kind sogar Wettbewerbe gewonnen! - Meine eigene Namenskreation, Ekala, war da schon viel wärmer und runder ... Ein Kleinkindervers ist zum geflügelten Wort geworden, so dass er nicht vergessen worden ist:
Ekala putti macht! Nachdem ich als Kleinkind etwas kaputt gemacht hatte, habe ich das jedes Mal wiederholt, wenn wieder irgendetwas Schaden genommen hat, auch wenn ich nichts damit zu tun hatte:
Ekala putti macht! Lachend wurde das noch lange so oft wiederholt, dass es einfach nicht mehr verschwunden ist; manchmal sage ich das heute noch! - In meiner Kindheit und Jugendzeit wurde ich Eri gerufen.
In meinen ersten sieben Jahren wohnten wir im obersten Stock eines alten, schönen Herrschaftshauses direkt am See. Neben einem normalen Küchen- und Stubenfenster seeseitig hatte jeder Raum Dachluken, durch die ich gerne in die Ferne über den See und in die Berge schaute. Im grossen Treppenhaus konnte ich so schön bäuchlings auf dem Treppengeländer hinuntersausen, vor allem im obersten und untersten Stock; allerdings durfte ich das nur, wenn ich alleine war. Im Parterre war ein Konsumverein, in den uns die Mutter manchmal zum Einkaufen schickte. Wir durften vom Treppenhaus aus den Laden durch die Hintertür betreten, warteten dann brav an der Tür, bis wir nach unseren Wünschen gefragt wurden. Das Warten wurde mir nie lang, interessiert beobachtete ich die Verkäuferinnen, wie sie die vor der Ladentheke wartenden Kundinnen, Männer waren es fast nie, bedienten, wie diese durch den gegenüberliegenden Haupteingang eintraten und den Laden wieder verliessen.
Im unteren Stock wohnte eine Familie mit drei Kindern; mit den beiden Mädchen besuchten ich und meine Schwester später die gleichen Klassen, der Bruder war etwas jünger (der spätere Mister Serengeti vom Zürichsee (Thalwiler Anzeiger 2.02.2017), Prof. Dr. Markus Borner, gest. 10.01.2020). Viel Kontakt hatten wir nicht, da wir ja nur abends und an den Wochenenden zu Hause waren. Aber manchmal nahm uns der Grossvater, der Hausbesitzer, der mit seiner Frau im untersten Stock lebte, mit seinen Enkelinnen und dem Enkel zusammen mit in seinen Garten am See, der mir wie ein undurchdringlicher grüner Urwald in der Erinnerung des kleinen Mädchens bleibt. Dort stand ein Bootshaus und das war das Allerschönste: er ist mit uns zusammen auf den See hinausgerudert! Zwischen dem Bootshaus und dem öffentlichen Bootsanlegesteg habe ich mit einem Korkschwimmgurt ganz alleine schwimmen gelernt.
Nach Weihnachten durften wir zwei Mädchen jeweils die Weihnachtsdekoration der Familie bestaunen: Ergriffen standen wir vor dem deckenhohen, dicht geschmückten Christbaum. Was es da alles zu entdecken gab: die verschiedensten Kugeln und Figürchen, Englein und Glöckchen, Tannzapfen und viele ganz unterschiedliche und farbige Vögelchen, sogar mit richtigen Schwanzfedern! Dann ebenso faszinierend: Die einer ganzen Wand entlang aufgebaute Weihnachtsgeschichte, in der Ecke die Weihnachtskrippe mit Maria, Josef und dem Jesuskind, daneben ein Ochse und ein Esel, sogar mit Stroh im Stall, der Weihnachtsstern über der Hütte und auf der linken Seite die Hirten mit den Schafen auf dem Feld, die ehrfürchtig dem Engel zuhören. Auf der rechten Seite nähern sich die drei Könige mit ihren Geschenken, ihre Kamele an langen Leinen führend. In meiner Erinnerung wirkt alles sehr gross, bunt und eindrücklich.
Ein Ereignis kenne ich nur aus der Erzählung: Meine Grossmutter ist mit mir am Ufer spaziert, ich mit einem grossen farbigen Kinderball - an solche Bälle erinnere ich mich gut, ich habe sie immer heiss geliebt - in den Händen. Prompt ist mir der Ball aus den Händen geglitten und auf dem Kiesstrand in den See hinuntergerollt. Aufgeregt sei ich
Balli! Balli! Balli! rufend dem Ball ins Wasser hinein nachgestürmt. Meine Grossmutter hat mich natürlich ebenso aufgeregt zurückgerufen. Ob ich den Ball selber erwischt habe und/oder ob Grossmutter ebenfalls ins Wasser stapfen musste, habe ich vergessen. Mit einer Nachbarin, die die ganze Episode aus dem Fenster der Gerberei beobachtet hat, habe sie noch eine Weile darüber gesprochen.
Vor der Gerbi auf dem Trottoir lagerte manchmal ein Haufen blutiger, stinkender Tierhäute, an denen ich mit zugehaltener Nase vorbeigerannt bin; meistens sind sie schnell weggebracht und das Trottoir abgespritzt worden. Eine Weile habe ich sie noch auf der seitlichen Rampe der Gerbi dem See entlang liegen sehen, bevor sie für mich ganz verschwunden sind. Vom Küchenfenster in unserer obersten Wohnung haben wir eine lange Röhre in den See hinaus gesehen, bei der dann weit draussen manchmal braunrote Brühe herausgeflossen ist. Die Badeanstalt lag nicht weit daneben ... Zustände, die es in unseren Breitengraden schon lange kaum mehr gibt. Beim Güterschuppen am Bahnhof habe ich die Häute beim Vorbeigehen manchmal gesehen und gerochen und gewusst, dass sie vom Fuhrhalter Müller mit dem Pferdefuhrwerk zur Gerberei gebracht werden.
Vom Küchenfenster aus beobachteten wir auch die Ledischiffe, die mitten auf dem See regelmässig vorbeifuhren. Wenn sie Richtung Zürich an die Hafenanlagen Wollishofen und Tiefenbrunnen fuhren, lagen sie ganz tief im Wasser, bei ihrer Rückfahrt waren sie viel höher, grösser und auch schneller. Wir rannten immer begeistert ans Fenster:
Ledischiff! Ledischiff! Nach einigen Jahren sahen wir sie viel seltener und mit der Zeit wurden sie für mich zur raren Beobachtung. Wie ich jedoch heute lese, mussten die Fahrten wegen dem zunehmenden Schiffsverkehr auf dem See vorwiegend auf die frühen Morgenstunden verlegt werden. Vor allem der Fährbetrieb zwischen Horgen und Meilen hat stark zugenommen und natürlich Vorfahrt: die Schiffsführer der Lastkähne peilen schon einen Kilometer vorher die Lücken an, korrigieren den Kurs leicht und schlüpfen mit Abstand und ohne Bremsmanöver durch; der Bremsweg beträgt rund zweihundert Meter. Die mit bis zu 800 Tonnen Sand, Kies und Schotter beladenen Ledischiffe starten in Nuolen am Obersee und passieren bei Hurden den Durchstich unter dem Seedamm. Früher, vor Ende des 19. Jahrhunderts und vor den eisernen Schiffen, wurden schwere Güter in Holznauen, flachen Lastkähnen, mit Wind und Muskelkraft auf dem See transportiert. Einige Nauen sanken bei Stürmen, meist wegen Wellenschlag und Überladung, und rissen viele Männer ins Verderben. Es war ein gefährliches und sagenumwobenes Gewerbe (nachzulesen in Thalwiler Anzeiger vom 20.08.2021).
Mit grosser Vorfreude haben wir kleinen Mädchen Mama oder beide Eltern jeweils in den Schuhladen begleitet: Dort gab es einen aufregenden grossen Kasten, in den wir die Füsse hineinstecken und diese dann von oben betrachten konnten: dabei erschien der Fuss mit dem Schuh in grünen Konturen und am wundersamsten: man konnte hindurch bis auf die Knochen sehen! Wir konnten nicht genug bekommen von diesem wundervollen Spektakel! Schade, bald durften wir den Apparat nur noch benutzen, wenn wir selber einen Schuh anprobierten, und dann wurde dieser ganz entfernt. Die Strahlen dieses Röntgenapparates seien schädlich, haben sie gesagt ...
Ein altes Bild sind auch die Holzbänke der SBB, die 3. Klasse, die wir noch gut gekannt haben und die nach einigen Jahren dann verschwunden ist. Lange Zeit gab's noch Raucherabteile im Zug, die aussen am Waggon angeschrieben waren. Der Kondukteur hat die Billette mit der Lochzange geknipst, bei ihm konnten auch Fahrkarten im Wagen gekauft werden. Am Bahnhof hat der Bahnhofsvorstand die Züge mit Kelle und Pfeife abgefertigt, vor dem Bahnhofsgebäude stand ein Signal mit einer Glocke, das die Züge angekündigt hat; hie und da konnte ich im Büro des Vorstandes einen Blick auf das Stellwerk der ganzen Strecke zwischen Zürich und Thalwil werfen, ein spannender Einblick, Thalwil war ein Bahnverkehrsknotenpunkt. Gerne wäre ich einmal mit dem Roten Pfeil mitgefahren, doch der ist immer an mir vorbeigebraust.
Damals waren die Türen während der Fahrt des Zuges noch nicht verschlossen, und immer wieder sind Männer im letzten Moment auf den anfahrenden Zug aufgesprungen. So hat auch Vater einmal erzählt, dass er einige Stationen auf dem Trittbrett festgeklammert ausserhalb des Wagens mitfahren musste. Hie und da waren auch Leute draussen auf den Plattformen zwischen den Waggons zu sehen.
Eines Tages haben uns die grösseren Nachbarsbuben zu einer Dia-Schau eingeladen. Wir kleinen Mädchen hatten keine Ahnung, was damit gemeint war, haben uns jedoch von der Begeisterung anstecken lassen und unsere Mutter bestürmt: nachdem sie sich erkundigt hatte, was da gezeigt werden sollte, hat sie ihre Einwilligung gegeben. Schon die Atmosphäre im abgedunkelten Raum war aufregend, dann erst die Bilder - wahrscheinlich waren es Ferien-, Blumen- und Tierbilder, daran erinnere ich mich nicht mehr.
Einige Zeit später wurde nochmals eine Schau angekündigt: wieder sind wir begeistert und voller Erwartung zu den Nachbarn gerannt. Dieses erste Bild habe ich mein Leben lang nicht vergessen: Es zeigt einen grossen Saal, eng eingerichtet mit kleinen Tischchen und Stühlen, mitten in diesem Lokal sitzen als Einzige zwei Personen an einem Tischchen. Da taucht im Hintergrund ein Kellner mit einem Tablett auf - und ich erstarre! Der Kellner kurvt, sein Tablett auf einer Hand über dem Kopf balancierend, zwischen den Tischchen auf die Gäste zu. Ungläubig und verstört schaue ich auf das Bild, das sich bewegen kann! Ich bin so erschrocken, dass ich die Augen fast ständig geschlossen gehalten habe und mich nicht an eine Fortsetzung erinnere. - Das war mein erster Stummfilm, der surrend von der Filmrolle eines Projektors abgelaufen ist. Das habe ich bald verstanden und auch die Filme über Buster Keaton geliebt.
Später durften Annemie und ich in der Schule am Mittwochnachmittag wie die anderen Kinder den Fip-Fop-Film-Club im örtlichen Kino besuchen, der von Nestlé, Peter, Cailler, Kohler gesponsert worden ist: alles noch mit Musik untermalte Stummfilme. Immer gab's da ein Schöggeli und den ersten Pin zum Anstecken, den wir jedes Mal mit Stolz getragen haben!
Diese ersten Kinderjahre am See habe ich als schöne und eigentlich unbeschwerte Zeit in Erinnerung, vielleicht täuscht mich diese (ja schon, die Albträume lagen in diesen Jahren). Dann sehe ich schwach ein ernstes Gespräch zwischen der Nachbarin aus dem unteren Stock und unserer Mutter vor mir: Die Frau hat freundlich aber bestimmt erklärt, dass wir uns eine andere Wohnung suchen müssten, weil ihr Mann - Linienpilot der Swissair - bei dem häufigen nächtlichen Lärm zu wenig schlafen könne, er brauche den Schlaf. So sind wir einige Strassen im Quartier weiter hinaufgezogen, ins Haus des ungeliebten und engstirnigen Ehepaars Bollier, das ebenfalls Mitglied derselben evangelikalen Gemeinschaft war. An diesem Ort hat es mir eindeutig nicht mehr so gut gefallen; hier haben auch die Spannungen in unserer Familie zugenommen. Vielleicht scheint mir das heute nur so, weil ich mit sieben Jahren doch langsam mehr gesehen habe.
Am neuen Ort haben wir bald viel mehr mit Nachbarskindern spielen können, Marieli und Roswita haben mit Annemie und mir die gleichen Schulklassen besucht. An derselben Strasse haben noch etliche weitere Kinder in verschiedenem Alter gewohnt; immer war damals die ganze Strasse unser Spielplatz: wo ist das heute noch möglich? Auch unser ehemaliger Spielplatz ist schon lange zum Autoparkplatz verkommen.
Die Mutter von Marieli war Zeitungsausträgerin, schon am frühen Morgen war sie erstmals unterwegs. Wenn es unser Stundenplan erlaubte, haben Marieli und ich zusammen die Elf-Uhr-Tour durchs Unterdorf und dem See entlang übernommen: immer haben wir ein Fünfzig-Rappen-Stück dafür bekommen und dieses in Süssigkeiten gesteckt, damals habe ich meine Zähne ruiniert. Diese Touren haben wir gerne zusammen gemacht, noch heute sind das angenehme Erinnerungen.
Weil Marielis Mutter nach ihrer Frühtour nochmals ins Bett gekrochen ist, habe ich sie immer geweckt, wenn ich Marieli zur Schule abholen wollte. Das war eine Hektik: im Nachthemd in den Keller eilen, wo die Mädchen ihr Schlafzimmer hatten, Marieli und die Schwester wecken und hopp, hopp, ankleiden, eine Milch trinken und ab in die Schule rennen, wo wir in letzter Sekunde eintrafen. So habe ich bald einige Minuten früher an der Haustür geklingelt ...
Nie habe ich das Gefühl gehabt, dass wir arm seien, dass uns Kindern etwas gefehlt habe: immer haben wir Spielsachen zum Spielen gehabt, haben Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke bekommen - immer habe ich mich über neue Farbstifte gefreut. Einmal hat jedes sogar einen eigenen Schlitten bekommen! Damals gab's noch schneereiche Winter und es wurde eine Strasse vom Sonnenberg (heutige Autobahn) bis zur Seestrasse hinunter für die Autos abgesperrt und zum Schlitteln freigegeben! Zudem haben Bauern ihre Wiesen zum Schlitteln geöffnet, die mit ihren Högern rassige Abfahrten und gfürchige Schanzen geboten haben.
Bald war mir aber auch bewusst, dass es für Mutter schon jeden Monat knapp war oder auch nicht für alle Rechnungen gereicht hatte. Vielleicht konnten Annemie und ich nicht an einem Skikurs teilnehmen, weil das Geld dafür nicht vorhanden war, was mir aber noch eher recht war. Erst später habe ich mich über die immer gleichen Röcke geniert, hätte gerne auch etwas hübschere Kleidchen gehabt.
Viele unbeschwerte Momente haben wir im Garten bei Onkel Emil und Tante Anna verbracht, haben mitgeholfen, Bohnen und Beeren abzulesen. Vor allem erinnere ich mich ans Wässern der Blumen, das Hantieren mit Wasser hat mir am besten gefallen, obwohl ich das Wasser in der grossen Regentonne etwas 'gruusig' fand. In der Rabatte der ganzen Hauswand entlang gediehen viele Blumen, die prächtigen Lupinen sehe ich noch deutlich vor mir, auch eine schöne Pfingstrose.
Erst heute realisiere ich, wie viel Arbeit in diesem grossen Garten gesteckt hat. Im Wandregal des grossen Kellers standen viele Gläser mit eingemachten Früchten, im geräumigen Estrich lagen im Herbst Früchte und Bohnen zum Trocknen auf Tüchern ausgebreitet oder waren an Schnüren aufgeknüpft. Hier oben wurde zeitweise auch die Wäsche getrocknet. Der Estrich, vor dem ich mich mit dem Älter werden zunehmend gehütet habe: der schmale Treppenabstieg war eine Falle, aus der uns eines Tages die Tante ahnungslos befreit hat, als sie herauf rief:
Was macht ihr da oben? Sie hat gehört, wie wir umherrannten, dem Onkel davonrannten, der uns gejagt hat - schon mit gierigen "wahnsinnigen" Augen - und uns nicht mehr an sich vorbei hinunterlassen wollte. Immer hat er bei seinen Attacken nach seiner Schwester gelauscht, so konnten wir mit Gesten die Hetzjagd schnell abbrechen. Der Typ war zwar nur einarmig, aber sehr kräftig, und hatte immer mich im Blick.
Er ist mit seinem einen Arm ganz gut zurechtgekommen, hat mit Hilfsmitteln und seinen Knien seine Arbeit unterstützt. Gut erinnere ich mich, wie die Tante und ihre beiden Brüder - noch Hans, der in der nahen Weberei gearbeitet hat - hie und da am Stubentisch gejasst haben: Emil hat mit seiner linken Hand seinen rechten völlig lahmen Arm auf den Tisch gelegt und seine Karten in eine vor ihm liegende Kleiderbürste gesteckt. Wir Mädchen haben in einem Heftchen geblättert oder in Malbüchern gemalt.
Ganz wenige Male - nur etwa zwei- oder dreimal in meiner Erinnerung - hat Tante Anna ihre Zither hervorgeholt und darauf gespielt, was mich jeweils tief berührt hat, ich hätte ewig zuhören können.
Als wir noch kleiner waren, haben uns die schönen Blümchen im Wiesenbord dem Bahngleis entlang gelockt. So sind wir über den Zaun geklettert und haben uns Sträusschen gepflückt. Die Züge fürchteten wir nicht, waren sie gewohnt. Vor allem die Autozüge haben uns fasziniert, manchmal sahen wir sogar noch eine Dampflokomotive. So bewegten wir uns unbekümmert auf dem Wiesenbord, auf die Blümchen konzentriert. Der erste Zug war dann schon etwas nahe und hat uns aufschauen lassen. Der Zugführer hat uns wahrscheinlich in der langgestreckten, aber doch engen Kurve nicht bemerkt, oder es war schon zu spät für eine Reaktion. Irgendwann am nächsten Tag - damals fuhren die Züge noch viel seltener - kam auf dem Nebengleis ein anderer Zug aus der Gegenrichtung, der mit grellem, langem Pfeifen an uns vorüberbrauste - der ist uns dann schon eingefahren, und wir wussten, was das bedeutete: Schleunigst sind wir wieder in den Garten zurückgeklettert, das gepflückte Sträusschen habe ich aufgewühlt in die Wiese zurückgeworfen. Eine Weile noch habe ich von irgendwoher eine Strafpredigt befürchtet, aber diese ist ausgeblieben.
Anna, Hans und Emil sind in einer grossen Familie aufgewachsen: insgesamt waren sie dreizehn Geschwister, wovon nur noch sieben Namen überliefert sind. Anna hat mit ihren beiden Brüdern zusammen gelebt und zu ihnen geschaut; auch Hans war auf irgendeine Weise beeinträchtigt, obwohl er bis zum Rentenalter in der Weberei gearbeitet hat. Doch gerade er muss als junger Mann ein Künstler gewesen sein: er hat sein ganzes eigenes Schlafzimmer selber aus Kirschholz geschnitzt! Ich sehe es noch vor mir, sehr dunkel - eigentlich hat es mir nicht gefallen - aber da war sein hohes Bett, ein Nachttisch, eine Waschkommode und ein grosser Kleiderschrank: diese Arbeit hat mich unglaublich beeindruckt.
Emilie, die in Zürich gelebt hat und an die ich mich ganz schwach erinnere, hat nach dem Tod der drei Geschwister deren Haus in Thalwil übernommen.
Tante Amalie ist mir am liebsten und von ihr weiss ich am meisten: Sie ist als junge Frau nach Neuseeland ausgewandert, hat auf der wochenlangen Schiffsreise Englisch gelernt und dort in oder bei Auckland als Haushälterin gearbeitet. Hie und da haben Annemie und ich von ihr ein Weihnachtspaket bekommen: das dreiviertellange grüne Pyjama ist lange mein Lieblingspyjama gewesen. Amalie hat in bereits höherem Alter für einige Wochen, mit dem Retourticket in der Tasche, die Schweiz besucht und bei Anna und ihren Brüdern gewohnt. In dieser Zeit ist sie eine Treppe hinabgestürzt und hat sich ein Bein gebrochen, das einfach nicht mehr heilen wollte; schliesslich musste Amalie in ein Pflegeheim gebracht werden: es wurde Zuckerkrankheit und beginnende Erblindung festgestellt; sie konnte nicht mehr nach Neuseeland zurückkehren. Doch Amalie war eine aufgestellte, fröhliche und allseits beliebte Heimbewohnerin, sie hat dem Pflegepersonal geholfen, wann immer sie konnte, und ihre Mitbewohner und Mitbewohnerinnen als Gesellschafterin unterhalten und diese bei Briefen ins Ausland als Dolmetscherin unterstützt.
Seit einiger Zeit lebte noch ein italienischer Zimmerherr bei Tante Anna im oberen Stock, sie hat seinetwegen ihr eigenes Schlafzimmer in ihr Nähzimmer verlegt. Ich habe seinen Namen nicht vergessen, weil er mir so gut gefallen hat: Aurelio D'Amelio. In den 50er Jahren sind erstmals vermehrt italienische Saisonniers in der Schweiz aufgetaucht, die nur über die Sommermonate, getrennt von ihren Familien, bei uns meistens auf Baustellen gearbeitet haben, ihre Familien mussten sie in der Heimat zurücklassen. Die fröhlichen und lebhaften Südländer wurden damals noch kritisch beobachtet und kommentiert von den Schweizern, heute sind sie längst integriert und akzeptiert. Aurelio (wie ich ihn angesprochen habe, weiss ich gar nicht mehr) war sympathisch und ist mir immer ein wenig anders als die anderen Italiener vorgekommen: immer sehr sauber und gepflegt gekleidet, zurückhaltend und stets freundlich, konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass er auf dem Bau arbeiten würde. Aber zu fragen habe ich mich natürlich nicht getraut.
In der sechsten Klasse ist manchmal Heidi aus der gleichen Klasse nach der Schule mit mir zur Tante gekommen. Sie hat bei jeder Gelegenheit versucht, mit Aurelio zu plänkeln und ihn herauszufordern, was mir nicht gefallen hat. Lieber hätte ich mich mit ihm ernsthafter unterhalten, was aber schon der Sprache wegen kaum möglich war. Meistens haben wir ihn in der Küche getroffen, wo er sich sein Abendessen zubereitet hat. Schnell habe ich gemerkt, dass ihm Heidis vorlautes Wesen unangenehm war, er mir hingegen eine gewisse unauffällige Sympathie entgegenbrachte. Aber schnell ist die Tante in der Küche aufgetaucht und hat uns weggewiesen. Wollte sie damit uns Mädchen schützen oder den italienischen Fremdarbeiter, der später zum Gastarbeiter aufgestiegen ist?
Einmal sind Heidi und ich in die abendliche halbdunkle Stube gestürmt, wo unerwartet Aurelio vom Sofa aufschoss, wo er gerade ein Nickerchen gemacht hatte, und schnell wortlos den Raum verlassen hat. Überrascht und etwas perplex haben wir ihm nachgeschaut. Uns war noch nicht klar, dass die Saisonniers sich sehr korrekt verhalten mussten und sich vor der Fremdenpolizei fürchteten - schnell war ihr Saisonnierstatus und damit die nächste Einreise in die Schweiz weg.
Aber trotzdem ist auch mir bald aufgefallen, wie diese Fremdarbeiter ausgenützt wurden: Auf dem Weg zur Fabrik, wenn ich am Abend Mama abholte, bin ich an einer Unterkunft vorbeigekommen (immer auf dem gegenseitigen Trottoir, um Zurufen möglichst auszuweichen), in der mindestens zehn Italiener in einem einzigen Raum zusammen hausen mussten. Das war ein erbärmlicher Schandfleck für unseren Ort und Aurelio hatte grosses Glück mit seinem eigenen Zimmer und dem freien Zugang zu Küche und Bad.
Einige Jahre später, bereits als Lehrtochter im zweiten oder dritten Jahr, habe ich ganz zufällig in einem Bahnabteil Aurelio getroffen. Überrascht haben wir uns begrüsst, und er hat mich gefragt, was ich heute mache. Ich habe ihm erklärt, wo ich arbeite, dass ich eine Ausbildung mache und heute in Zürich war, um in einem städtischen Amt einen Brief beglaubigen zu lassen. Er hat mich gut verstanden und wir haben uns über die unerwartete Begegnung gefreut.
Wenn nur nicht diese Andachten und die Besuche in den dortigen Pfingstversammlungen gewesen wären, ja, dann wären die Sommerferien am Bodensee für mich richtig unbeschwert gewesen. Das Baden im See, das Spielen auf den Spielplätzen dort, die beiden Nachbarkinder, die wir kennenlernten, die nette, fast mütterliche, benachbarte Tante Ruth, meistens sonniges Wetter; Spaziergänge, Schifffahrten nach Rheineck, auf die Insel Mainau, nach Meersburg und Friedrichshafen, einmal nach Krefeld an Tante Helenes Geburtsort; Fahrten an den Untersee und den Rhein hinunter: ich habe viele Ausblicke, die ich nicht mehr einordnen kann.
Tante Helene kannte so einige Sprüchlein, mit denen kleine Kinder beschwichtigt, beschäftigt und auf Abstand gehalten werden konnten; nur noch an eines entsinne ich mich: Wenn wir nach etwas fragen wollten:
Was ist das? eine Erklärung für irgendetwas erwarteten, hat sie oft geantwortet:
Das isch es goldigs Nienewägeli oder es silbrigs Nüteli. Lange haben wir kleinen Mädchen herumstudiert, was das wohl bedeuten möge.
"
Heim ins Reich" - an dieses Zitat erinnere ich mich gut: das hat sie manchmal gesagt, wenn wir abends ins Bett mussten, immerhin so oft, dass ich mich daran erinnere. Sie hat das jeweils ruhig und unaufgeregt gesagt: Ob ihr dabei wohl gewisse Assoziationen durch den Kopf schwebten oder sie diese Worte leichthin gesagt hat? Das sage man so in Deutschland ...
Auch ein kriegerisches Kinderliedchen, das mich manchmal beschäftigt hat, haben wir von ihr gelernt: "
Maikäfer flieg! Der Vater ist im Krieg. Die Mutter ist im Pommerland. Pommerland ist abgebrannt. Maikäfer flieg!" Die zweite Strophe liegt tief im Verborgenen, sie war mir unangenehm, wahrscheinlich war sie noch martialischer und ich wollte mich damit nicht auseinandersetzen. - Haben diese Gedankensplitter der Tante wohl bei der eigenen Vergangenheitsbewältigung geholfen?
Einmal im Jahr habe auch ich die Mutter erwartungsvoll und freudig erregt in die Versammlung begleitet: Der Missionar Hartmann kommt für einige Wochen aus Afrika - dem Königreich Lesotho, ein Binnenstaat in Südafrika (1868-1966 Basutoland) - in die Schweiz zurück und zeigt Bilder oder Filme aus seiner Missionsstation und erzählt über die Begegnungen mit den Einheimischen! Das hat mich schon gepackt, auch wenn ich kaum mehr etwas darüber weiss. Annemie berichtet, dass es noch heute Tageshorte für Vorschulalter, Primarschule, Mittelschule, eine Krankenstation für zweiundzwanzig Dörfer und ein Waisenhaus gibt. 1994 ist das Missionswerk, das 1924/25 gegründet worden ist, der einheimischen Gemeindebewegung übergeben worden, wird aber heute noch von Verantwortlichen aus der Schweiz begleitet; herzlichen Dank Annemie für Deine Infos. - Dafür sehe ich noch das Negerli-Kässeli vor mir, bei dem bei jedem Münzeinwurf das dankbare Negerlein den Kopf geneigt hat - es ist erschreckend, aber damals war das einfach normal und wurde mit keinem Gedanken hinterfragt!
Als schönste Erinnerung bleiben mir die Sommerferien im "Rothüsli" über drei oder vier Jahre auf einer Alp im Appenzellerland, die von Mitgliedern der Pfingstmission Thurgau organisiert worden waren. Wir waren jeweils etwa 15 bis 20 Kinder, dazu zwei oder drei Betreuerinnen, immer dabei unsere Tante Helene und die sympathische, nicht verwandte Tante Ruth. Wanderungen; fröhliches Spielen bei der eingezäunten Hütte; Spaziergänge und Spielen im Wald, wo wir auch Erdbeeren, Brombeeren und Heidelbeeren schmausen durften; die vielfältigen Blumenwiesen ausserhalb des Zauns, wo ich erstmals das zierliche Zittergras und die Silberdisteln kennenlernte, unzählige Heugümper oder Heuschrecken beobachtete, die vor uns aufsprangen, roten und blauen Libellen nachschaute und vor allem die verschiedenartigsten wunderschönen Sommervögel bewunderte - nur im Nationalpark habe ich vielleicht noch mehr Schmetterlinge gesehen. Auf diesen Wiesen und am nahen Waldrand ausserhalb des Zaunes bei der Hütte hielten wir uns nur auf, wenn die Kühe nicht in der Nähe waren. Denn diese mussten wir im Auge behalten, wenigstens eine von ihnen, die wir schnell erkennen konnten: Sofort hat sie den Kopf gehoben und uns angestarrt, und wenn wir unberechtigterweise ihr Revier betreten haben, ist sie auf uns losgerast. Zuerst mussten wir also abschätzen, ob sie weit genug entfernt war und uns Zeit blieb, von Zaun zu Zaun über die Wiese vom Bauernhof zur Hütte oder zurück zu rennen, oder ob es nicht reichen würde; manchmal mussten wir den Bauern um Hilfe bitten. Die Betreuerinnen durften zudem die Wäsche nicht zu nah am Zaun zum Trocknen aufhängen, weil bereits einmal ein Kuh ein Wäschestück von der Leine gemampft hatte. Vielleicht konnte es ihr noch rechtzeitig aus dem Maul gerissen werden, ich weiss nicht mehr, gut bekommen wäre es ihr wohl kaum. Der 1. August war für mich nie ein Festtag, immer habe ich mich vor der Knallerei gefürchtet und musste mich verstohlen hinter die anderen verdrücken. Das Höhenfeuer war schön, die bengalischen Zündhölzer und die Vulkane auch, damit wäre mir wohl gewesen. Nie konnte ich diesem sinnlosen Lärmen, das heute noch viel schlimmer ist als damals, etwas abgewinnen.
Wieder am Bodensee sind mir hie und da Männer auf Rollstühlen begegnet, bei deren Anblick ich schnell in Nebenwege abgebogen bin. Diese Männer mit ihren Beinstümpfen haben mir schreckliche Angst, ja Grauen, eingejagt. Von der Tante wusste ich, dass das Kriegsverletzte waren. Krieg! Das war für mich das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte. Was hat mich mit dem Krieg verbunden? Bei meiner Geburt im Sommer 1944 war dieser noch nicht vorbei. Ich vermute, dass jahrelange Anspannungen, Ängste und Bedrohungen, die auch in der bislang verschonten Schweiz geherrscht haben mussten, auf Ungeborene und Kleinkinder übertragen werden konnten. Das könnte auch die Panik erklären, die mich überfällt, wenn beim Training der Patrouille Suisse eine Maschine sehr tief über mich wegdonnert. Nur wenige hundert Meter höher wäre der Lärm leichter zu ertragen. Was ist mit den Tieren und dem weitläufigen Naturschutzgebiet rund um den See?
Einmal bin ich während der Primarschulzeit in unserem Nachbardorf mit einer Kameradin eine Strasse hochgegangen, wo wir an einem grösseren, sehr hoch mit einem Maschenhag rundum eingezäunten Grundstück, einer Wiese mit einigen Baracken auf einer Seite, vorbeigekommen sind. Da drin waren Männer eingesperrt! Wie Kühe auf einer Weide! Alle waren in gleiche, dunkle Gewänder gekleidet, die meisten bewegten sich bei den Baracken, einige spazierten über die Wiese, einer stand in der Nähe des Zauns und hat uns entgegengeschaut. Auf gleicher Höhe hat er mir in die Augen geblickt; verwirrt und voller Beklemmung bin ich weitergegangen. Waren das böse Männer? Waren das jetzt Feinde? Warum sind sie eingesperrt? Was haben sie verbrochen und was passiert mit ihnen? Den Mann am Zaun habe ich nicht als Feind empfunden. Später habe ich gehört, das seien Polen. Dieses Bild hat mich noch lange verfolgt, verstanden habe ich nichts.
Auch mit der Familie haben wir einige schöne Ferien verlebt. Als wir schon grösser waren, hat die Mutter mit Reka-Checks zwei- oder dreimal im Tessin eine Ferienwohnung gemietet. Die traumhaft schöne Aussicht bei Orselina auf den Lago Maggiore hinunter und in die Berge sehe ich noch vor mir. In diesen ein oder zwei Wochen war der Vater sehr familiär, hat da und dort einen Spass gemacht, war mehr oder weniger nüchtern: einen gewissen Pegel brauchte er natürlich, um normal funktionieren zu können. Er hat die gemütliche Ferienwohnung, den grossen wilden Garten im Berghang davor, den grandiosen Ausblick, auch am Abend mit den Lichtern in den unten liegenden Orten, spürbar genossen. Von unserem Ferienhaus aus haben wir Ausflüge mit dem Postauto in die verschiedenen Täler des Tessins unternommen - eine schöne bleibende Erinnerung! Nur an einen gröberen Ausrutscher erinnere ich mich: Beim Einsteigen ins Schiff zu den Brissago Inseln erstarre ich wegen einer Beleidigung meines Vaters in meinem Rücken. Erschrocken drehe ich mich um und sehe einen Grenzpolizisten mit Schildmütze und schöner, farbiger, goldbehangener Uniform hinter meinem Vater, der diesem eben das Schimpfwort "Stupido" hingeworfen hat. Der Uniformierte ist wütend, sieht dann mich und meinen Schrecken, sein Blick wandert zu meiner ebenfalls erschrockenen Schwester, dann wendet er sich ab - er hätte meinem Vater, und damit auch uns, beträchtliche Schwierigkeiten machen können. So peinlich! Wie war ich froh, als wir dieses Schiff endlich wieder verlassen konnten: am Nebentisch hat eine Familie dauernd getuschelt und zu uns herübergesehen.
Ebenso eindrücklich bleiben mir die Tage im Nationalpark beim Ofenpass in Erinnerung: noch immer sehe ich wunderbare Bilder von lichten Wäldern, einem fast trockenen, steinigen Flussbett mit üppigen Blumenwiesen und unzähligen Sommervögeln vor mir, Berge am Horizont. Ich glaube, Vater war bei unseren Wanderungen mit Picknick immer dabei, wahrscheinlich brauchten wir am Morgen einfach Geduld, bis wir starten konnten. Das einzige kleine Beizlein lag nahe, auch das Massenlager am Abend war nicht ideal. Hier will ich nicht zu tief bohren, ich will mir die wundervollen Bilder bewahren.
Sekundarschulzeit / Weiterbildung
Seite 8
Seite 8 wird geladen
7.
Sekundarschulzeit / Weiterbildung
Noch eine geraume Zeit vorher hatte ich mir irgendetwas ausgeheckt, was ich dann jedoch mit grossem Bedauern unterlassen habe:
Nein, das darf ich jetzt nicht mehr machen, vor einem Jahr wäre das noch möglich gewesen. Was das wohl gewesen ist? Gerne möchte ich das heute noch wissen! Aber dieser Moment zeigt mir einen bewussten Entwicklungsschritt an. Ich bin nicht gerne erwachsen geworden, ich habe mich davor gefürchtet.
Im Frühling kam der Übertritt in die Sekundarschule, einige Mitschüler verschwanden, andere traf ich wieder im Schulhaus, etliche wurden einem anderen Lehrer zugeteilt. Erst Monate später hörte ich erstaunt, dass einige eine Aufnahmeprüfung machen mussten, auch von einer anfänglichen Probezeit war die Rede. Von alldem habe ich nichts mitbekommen, bestätigte mir aber, dass ich auf gutem Weg war. Meine drei schönsten Schuljahre sind gestartet. Mein Hauptlehrer strahlte eine natürliche Autorität aus, er hat mir imponiert, nie wurde er laut, wenn er ins Schulzimmer trat, wurde es sofort ruhig. Fasziniert bin ich seinen Ausführungen in Deutsch gefolgt, wie er die Sätze zerlegte, Satzbau, Grammatik, Rechtschreibung und Interpunktion erklärte. Auch die Logik der Zahlen und was mit ihnen alles angestellt werden konnte, hat mich beeindruckt. Waren die Aufgaben vorgegeben, ging's flott voran, mit den Satzrechnungen mühte ich mich schon eher ab. Auch Geometrie war nicht mein Fach. Oft hat der Lehrer meine Aufsätze der Klasse vorgelesen. Mit Hingabe habe ich meine Geografiehefte ausgestaltet, immer sind sie mit den besten in der Vitrine ausgestellt worden. Nach Schulschluss sass ich fleissig in meinem Zimmer bei den Hausaufgaben, neben mir auf dem Fenstersims mein geliebter Wellensittich Butzli, der immer lauthals geschwatzt hat.
Während ich mich in der Schule sehr wohl fühlte, wurde es zu Hause immer schwieriger. Die Luft wurde immer stickiger, immer häufiger habe ich gegen den Vater rebelliert, während meine Mutter mich zurechtgewiesen hat. Weihnachten - das Fest, auf das sich Kinder am meisten freuen - wurde Jahr für Jahr zur grösseren Katastrophe. Als noch kleine Mädchen haben wir ungeduldig um sechs, um sieben auf den Vater gewartet, manchmal ist er erst um acht aufgetaucht, natürlich nicht mehr nüchtern. Das Christkind war immer häufiger bereits davongeflogen! Aber noch klein, waren wir nur glücklich, dass jetzt Weihnachten begann, die Kerzen am Baum angezündet werden konnten! Mit den Jahren habe ich seine besoffenen Kneipensprüche - manchmal auch bizarres frommes Gerede - immer weniger ertragen. Mit meinen verärgerten und aufgestauten Kommentaren habe ich - wahrscheinlich ohne mir klar darüber zu sein - die Stimmung selber noch aufgeheizt.
Einmal, in einer oberen Klasse bereits, kommt mein Vater langsam mit erhobener Hand drohend auf mich zu, die Mutter händeringend hinter ihm her. Ebenso langsam weiche ich rückwärts zurück, von der Küche durch die Stube, durch Annemies Zimmer, bis ich in meinem Zimmer an der Rückwand anstosse. Unentwegt starre ich ihm unverwandt in die Augen; er bleibt mit erhobener Hand vor mir stehen, die Mutter:
Lass sie! Lass sie! So stehen wir einen Moment voreinander, bis er langsam die Hand senkt und verwundert zu Mama sagt:
Wie die mich anschaut! Dann dreht er sich weg und verschwindet. Die Reaktion der Mutter war ungefähr:
Warum musst du auch immer ...? Ich hatte keine Angst (mehr) vor ihm.
Mit der Pubertät begannen mich noch andere Probleme zu plagen: Meine aufgestauten und nicht geklärten Gefühle liessen mich fast explodieren, nicht nur fast: Manchmal bekam ich richtige Tobsuchtsanfälle, ganz allein für mich in meinem Zimmer, soviel Kontrolle musste schon sein. Wild schlug ich mit den Fäusten an die Wände, zerriss in meiner Wut die Pelerine -
ich bin damit hängengeblieben, meine spätere Ausrede - bis ich richtig ausser mir war. Dann, plötzlich ist da ein winziges rotes Lämpchen in meinem Kopf aufgetaucht, je heftiger ich tobte, umso wilder hat es geflackert. Damit hat es mich schliesslich abgelenkt und wieder heruntergebracht. Sofort wusste ich, dass ich dieses Warnsignal ernst nehmen musste und niemals überschreiten darf. Mit der Zeit sind diese Anfälle seltener geworden, aber noch viel später in meinem Leben ist dieses Warnlämpchen vereinzelt aufgetaucht. Nur schon die Erwartung dieses Stoppsignals hat die Emotionen nicht mehr überkochen lassen.
Wie viele andere Jugendliche litt ich auch unter starker Akne, die sich sogar zu Furunkeln im Nacken und hinter den Ohren ausgeweitet hat, mit denen ich zum Arzt musste. Nie einem Arzt gezeigt habe ich hingegen meine geschwollenen Halsdrüsen seitlich unter dem Kinn (und Lymphknoten in der Leiste). Die sind mir erst aufgefallen, als sie zunehmend geschmerzt oder mich beim Kopfdrehen gestört haben. Manchmal sind sie etwas zurückgegangen, waren bei Berührung jedoch immer tastbar und haben geschmerzt; zeitweise waren sie so gross, dass einige Knötchen bis ins Ohrläppchen gewandert sind. Heute würde die Ursache dieser geschwollenen Lymphknoten sicher untersucht, zeigen sie doch eine gesteigerte Immunreaktion an. Erst mit dreissig Jahren hat sich das fast ganz normalisiert.
Ende Sekundarschule wurde ich konfirmiert, natürlich in unserer Pfingstgemeinde in Zürich. Vorher mussten wir den Religionsunterricht besuchen, der von einem gelehrten Prediger geleitet wurde. Niemand hat ihn verstanden, nur ein einziges, immer das gleiche Mädchen in unserer Gruppe hat jeweils die Hand gehoben und konnte ihm antworten; nichts ist geblieben. Dieser Prediger hat später in England doziert und ist in der hiesigen Pfingstmission sehr bekannt und, wie ich glaube, auch umstritten. Ich war nur froh, dass es vorbei war. Am ersten Sonntag darnach, als ich weiter in den Unterricht sollte, Mutter hat das von mir erwartet, habe ich mich standhaft geweigert. Schliesslich hat sie in ihrer Machtlosigkeit ihren Bruder Köbi am Telefon um Hilfe gebeten. Lange haben sie miteinander gesprochen, immer wieder hat sie mich ans Telefon gerufen, Onkel Köbi wolle mit mir reden. Da musste ich hart bleiben, und ich blieb hart: An diesem Sonntag habe ich mich von den Pfingstlern befreit - ein ganz wichtiger Schritt für mich. Annemie musste den Unterricht alleine besuchen.
Mit meiner Ablösung habe ich die Mutter sehr enttäuscht und ihr echte Nöte bereitet: Sie musste mich zum Glauben zurückbringen, sonst war ich "verloren". Nie hat sie aufgehört, mich wieder zu gewinnen, doch ich war ja gar nie "dabei". Deshalb war auch weiterhin ein normales Gespräch mit ihr kaum möglich, immer ist sie bald auf ihr Thema eingeschwenkt und hat mich damit zum Schweigen gebracht, weil ich nicht mit ihr streiten wollte. Sie hat mich sogar mit der Aussage schockiert:
Ich kann einmal nicht sterben, bevor alle meine Kinder gerettet sind. Eine schreckliche Erpressung, auf die ich nicht eingehen konnte, die ins Leere laufen musste. Erst viele Jahre später konnte ich ihr mein Dilemma erklären, sie hat daraus gelernt, und endlich konnten wir uns normal unterhalten. Da habe ich ihr auch ihre frühere Androhung vorgehalten und die damit verursachte Zwangslage aufgezeigt; sie ist erschrocken und hat sich dafür entschuldigt.
Gegen Ende der dritten Sekundarschulklasse habe ich bei den Hausaufgaben eine Satzrechnung einfach nicht kapiert. Die Mutter hat vorgeschlagen, unsere Nachbarin, eine Mathematiklehrerin, zu fragen. Wir haben sie tatsächlich angetroffen und sie hat mir mein Problem erklärt. Anschliessend haben beide eine Weile zusammen gesprochen: dass ich gerne zur Schule gehe und so fort. Im Verlauf des Gesprächs hat die Nachbarin meiner Mutter angeboten, sie würde sich einsetzen für meine Anmeldung und Stipendien für eine Weiterbildung an einer Kantonsschule. Ein Horizont, der sich weit öffnete! Obwohl ich auch sofort wieder Ängste vor der Zukunft verspürte. Mama musste das zuerst mit dem Vater besprechen. Seine knappe Reaktion:
Die kann mit dir in der Fabrik nähen! Diese Antwort hat mich schockiert und verletzt, ich habe ihn gehasst dafür. Und erneut hat mich Mama im Stich gelassen:
Nein, in die Fabrik muss sie nicht. Das war's. Aber: jetzt hätte ich mich vehement wehren müssen! Vielleicht hätte eine heftige Reaktion meinerseits mir mehr Unterstützung von meiner Mutter gebracht. Doch ich ahnte nicht, dass jetzt meine Zukunft auf dem Spiel stand, dazu kamen meine unbestimmten Ängste vor dem Ungewissen. Ich wusste selber nicht, was ich gerne gelernt hätte: insgeheim habe ich mich als Tierpflegerin im Zoo gesehen, aber mit meiner Angst vor den Tieren war mir das doch verwehrt.
So lief mein Leben in die falsche Richtung. Oft habe ich in diesen letzten Wochen der Sekundarschule nachts in mein Kissen geweint. Meine Mutter hat mich bald darauf über ein Inserat in der Lokalzeitung in der nahen Textilfabrik zur KV-Lehre angemeldet, zurück ins Leben der Erwachsenen: sie hat mich dazu begleitet! Das waren noch stockkonservative Zeiten! - Ein KV-Beruf, das war ihr Traumberuf.
Meine erste Abteilung, Garn- oder Rohmaterialeinkauf, war schon fast familiär: der Chef, seine Sekretärin und der Kalkulator standen schon kurz vor ihrer Pensionierung. Sie nahmen mich sehr wohlwollend auf, vor allem Fräulein (!) Goerig hat mich schon fast bemuttert, mir einmal sogar ein Buch geschenkt. Schnell habe ich mich gut eingelebt; fasziniert habe ich dem Kalkulator zugeschaut, wie er auf seiner grossen, schweren und altertümlichen Rechenmaschine mit beiden Händen blind - den Blick auf die Kalkulation gerichtet - seine Resultate herausgehämmert hat. Auch die eintretenden Angestellten aus anderen Abteilungen haben immer wieder gestaunt und ihn auf diese Maschine angesprochen. Natürlich hatten wir anderen moderne Rechenmaschinen mit oder ohne Papierstreifen, aber unser Kalkulator hat sein ganzes Leben lang mit seinem Apparat gerechnet und blieb dabei, wahrscheinlich war er damit schneller als die anderen. Häufig kam einer der beiden stets freundlichen und oft zu einem gutgelaunten Spruch aufgelegten Disponenten aus dem daneben liegenden grossen und hellen, seeseitig liegenden Raum, mit Fenstern auf allen drei Seiten, in unser Büro. Meistens besprachen sie sich mit dem Kalkulator oder suchten sich selber eine Kalkulation aus einem Ordner.
Nachdem ich das Schreibmaschinenschreiben beherrscht habe, durfte ich auch Nachrichten auf dem Telex schreiben, was ich sehr gerne gemacht habe: zuerst konnte der Text auf einem Lochstreifen vorgeschrieben und wenn nötig korrigiert werden, bevor er anschliessend nach dem Anwählen des Empfängers losgerattert ist. Da gab's auch eine Glocke, die am Schluss geläutet werden konnte, falls eine Antwort schnell erwartet wurde. Im besten Fall war in der Nähe des Empfängergerätes jemand, der die gewünschte Antwort umgehend eintippen konnte. Die Mitteilungen konnten auch direkt eingegeben werden, was jedoch sehr nervig gewesen ist, wenn ein längerer Text nur stockend und stotternd eingegangen ist.
Später ist der Telex durch ein noch einfacheres Fax-Gerät ersetzt worden, das auch noch heute in digitalisierten Zeiten da und dort im Einsatz ist.
Nach einem halben Jahr musste ich, ungern, in die nächste Abteilung wechseln. Aber schliesslich hat es mir überall gefallen, ich habe gerne genau und effizient gearbeitet und bald gemerkt, dass in der Privatwirtschaft flexibler und schneller gearbeitet wird als in der bürokratischen Verwaltung. Unser Textilbetrieb musste immerhin jährlich eine Sommer- und eine Winterkollektion auf den Markt bringen, da war immer Zug und Druck in den Abläufen. Nur in der Abteilung Verkauf wusste ich schnell, dass ich da gar nicht hingehöre: Diese abgehobenen Herren in ihren geschniegelten Anzügen waren mir sehr fern. Da war ich nicht allein, eine der beiden Sekretärinnen ist jedes Mal ein bisschen kleiner geworden, wenn ein bestimmter Verkäufer vom protzigen Verkaufsraum in unser Büro eingetreten ist. Während sie ihren Stress aushalten musste, wechselte ich nach einigen Monaten in die Spedition, wo ich Formulare für den Versand ins In- und Ausland bereitstellte. Für eine kurze Zeit durfte ich im Zollfreilager mithelfen, Sendungen entgegennehmen, Sendungen abfertigen, Muster schneiden für die Stoffmusterei, die Farbkarten und Qualitätslaschen für die Verkäufer und die Kundschaft anfertigte.
Zuletzt wechselte ich in die oberste Etage in die Buchhaltung. Sogar hier hat es mir ganz überraschend gut gefallen, obwohl ich mich immer auf Distanz zum Buchhalter halten musste: Nie durfte ich mich zu nahe neben ihn stellen, sonst hat er sofort einen Arm um meine Hüfte gelegt. Er war jedoch nicht gefährlich, denn er wusste ja nie, wann jemand durch eine der beiden Türen eintreten würde. Die kurz vor der Abschlussprüfung stehende Lehrtochter Trix kannte ihn, hat nur gelacht und das locker genommen, wir haben uns gut verstanden. An die Buchhaltung grenzte die Betriebsbuchhaltung; wie war ich froh, dass ich nie dort arbeiten musste: Die beiden Frauen führten ein strenges Regime, besonders die Vorgesetzte hatte Haare auf den Zähnen, und manchmal ist eine Angestellte des Betriebes weinend aus ihrem Büro gekommen.
An der Rückseite der Buchhaltung bergseits lag das kleinere Büro des Kassenwartes (noch immer wurden die Löhne monatlich in Lohntüten von ihm persönlich an die Angestellten verteilt) und Sekretärs der Patrons, deren beide Büros dahinter lagen. Mit den Patrons hatte ich natürlich nichts zu tun, aber immerhin haben sie bei einer Begegnung im Treppenhaus jeweils gegrüsst. Wie hätte ich ahnen können, dass das kleinere Chef-Büro gegen Ende "meiner Karriere" einmal mein Büro als Sekretärin sein würde? Ein absurder Gedanke!
Verwundert und sogar genervt habe ich manchmal beobachtet, wie einige Angestellte bei einer Begegnung mit einem der Prinzipals diese mit tief gesenktem Kopf, schon fast mit einem Bückling, gegrüsst haben, derjenige mit dem lautesten Maul über den ganzen Tag hat den tiefsten Kotau gemacht. Vor allem einem dieser hohen Herren, der immer betrunken war, bin ich nach Möglichkeit ausgewichen.
Am besten gefallen haben mir die schönen Stoffe in der Disposition und die farbigen Garnmuster: vor allem zu den in leuchtenden Regenbogenfarben aufgereihten Azetat-Garnspulen konnte ich nicht oft genug hinschauen. Von Umweltschäden, verursacht durch die Textilindustrie, hat man bei uns noch nicht gesprochen. Dabei sind schon, oder gerade damals immer mehr Produktionszweige von der Schweiz ins nahe Italien verschoben worden, weil sie dort noch nicht verboten waren. Dann kam die Dioxin-Katastrophe von Seveso, verursacht von einer Tochterfirma des Roche-Konzerns ... nicht weit weg von einem unserer Betriebe, der auch in Seveso lag.
Schliesslich habe ich eine gute Abschlussnote gemacht und noch einige Jahre in der Disposition im selben Betrieb weitergearbeitet. KV ist bestimmt ein guter Beruf und kann Ausgangspunkt in viele Richtungen sein. Zudem erweist sich das Wissen und die Praxis aus dem KV-Beruf auch im alltäglichen Privatleben als sehr nützlich - mein Traumberuf war er aber sicher nicht!
Kette durchbrochen
Seite 9
Seite 9 wird geladen
8.
Kette durchbrochen
Einige Zeit nach meinem Berufsabschluss hat sich bei uns ein Drama angekündigt: Die Mutter hat immer häufiger Annemie befragt und eindringlich auf sie eingeredet. Voller Schrecken ist mir klar geworden, dass meine Schwester schwanger ist, eine Katastrophe damals, in unserer Familie sowieso. Mein Gedanke war, dass es in meinem Fall ein bisschen weniger schlimm gewesen wäre, denn ich hatte immerhin einen Freund, der auch zu mir gestanden wäre. Bei Annemie hingegen gab's keinen Mann weit und breit. Intensive Debatten, einige Telefonate nach Arbon, dann ist Mutter mit Annemie zusammen an den Bodensee gereist: Die Tochter musste ausser Haus sein, wenn der Vater informiert werden sollte. An diesen Moment erinnere ich mich nicht, weiss nur, dass er sehr wütend, aber vor allem sehr, sehr enttäuscht von seiner Lieblingstochter war. Er hat auch realisiert, dass Annemie aus Angst vor seinen Reaktionen ausser Haus gebracht worden war. Eigentlich hatte man sich darauf geeinigt, dass Annemie ihr Kind in Arbon zur Welt bringen sollte und anschliessend mit diesem bei den Verwandten bleiben könnte; eine strenge Führung hätte sie erwartet. Es brauchte einige Wochen, bis Vater die neuen Aussichten akzeptieren konnte; eines Tages hat er dann aber entschieden, Annemie solle nach Hause kommen und ihr Kind hier zur Welt bringen, er werde ihr nichts antun. Die Liebe zu seiner Tochter hat gesiegt über die Angst vor der Schande. Bei ihrer Heimkehr haben beide, Vater und Tochter, und wahrscheinlich wir alle zusammen, geweint - wir waren tief erleichtert.
Wie sollte es jetzt weitergehen? Als meine Mutter die Kinderkrippe ins Gespräch brachte, bin ich aufgefahren:
Wenn du jetzt nicht zu Hause bleibst und dich um das Kind kümmerst, werde ich das tun! Dass ich meine Stelle kündigen würde, das wollte sie nun doch nicht. So hat sie ihre Fabrikarbeit aufgegeben, und die beiden Frauen haben sich zusammen auf die Geburt vorbereitet.
Jonas ist also im Ortsspital zur Welt gekommen. Vater hat die beiden sogar besucht, was er besser unterlassen hätte, weil er betrunken war und sich daneben benommen habe, wie Mutter nachher geklagt hat. Doch den kleinen Jonas haben alle sofort ins Herz geschlossen, auch der Grossvater; seine Grossmutter hat sich liebevoll um ihn gekümmert. Jonas war ein lebhafter, etwas nervöser Säugling, aber glücklicherweise kein Schreibaby. Vielleicht waren einfach oft zu viele Personen um ihn herum, kaum konnte er in Ruhe trinken, immer musste er überall herumschauen. Deshalb verhielten wir anderen uns vor allem während seinen Mahlzeiten ganz ruhig oder haben den Raum verlassen. Oder war er so nervös, weil seine Mutter während der gesamten Schwangerschaft stark unter Druck gestanden hat? Ich habe sie nachts manchmal weinen hören.
Zappelig war Jonas auch noch später. Vor allem als er, noch nicht zwei Jahre alt, den grossen Musikschrank mit dem Radio und dem Plattenspieler entdeckt hat: aufgeregt, ungeduldig, schon fast fiebrig wollte er alleine Platten auflegen und gab erst Ruhe, wenn die Musik ertönte, meistens Lieder von Heintje, die er bald mitsingen konnte. In den ersten Primarschuljahren hat er Gitarre spielen gelernt, Jahre später dann in einer Jugendgruppe einer Glaubensgemeinschaft, der er beigetreten war, mitgespielt; sie hatten zusammen sogar internationale Auftritte.
Alle wollten sich um den Kleinen kümmern, unerklärlicherweise bleibt für mich einzig seine Mutter im Hintergrund. Stimmt dieses Bild? Haben wir sie verdrängt? Ich weiss es nicht. Oder war sie überfordert und hat der Mutter die Hauptarbeit gerne überlassen? Sie musste sich mit Enttäuschung und verlorenen Illusionen auseinandersetzen. Tagsüber war sie bei der Arbeit, aber oft auch am Abend nicht zu Hause. Deshalb habe ich den Kleinen gerne in den Schlaf gesummt und gestreichelt, um ihn zu beruhigen, denn der laut eingestellte Fernseher in der Stube stand genau vor seiner Zimmerwand und das Holztäfer war teilweise fast zentimeterbreit gespalten.
Auch Opa hatte seine Freude am aufgeweckten und lebhaften Enkel, der das Krabbeln übersprungen hat und schon früh laufen konnte. Er war stolz auf ihn, hat sich mit ihm beschäftigt und ihn, und sich, auf seine Weise verwöhnt und überschätzt: Eines Nachmittags bin ich in die Stube getreten und habe den betrunkenen Vater mit dem kleinen Jonas am Fenster stehen sehen, wo sie gerade der Oma entgegenblickten. Der Kleine stand aufgeregt auf dem Sims vor dem offenen Fensterflügel, der Grossvater hat einen Arm um ihn gelegt und hielt sich mit der anderen Hand am geschlossenen Fensterflügel fest. Alarmiert habe ich spontan gewarnt, das sei doch gefährlich. Demonstrativ hat Vater den Kleinen losgelassen, sich zu mir gedreht und gesagt:
Der fällt doch nicht hinaus! Schleunigst bin ich ohne weiteres Wort in mein Zimmer verschwunden, um die Situation zu entschärfen. Angespannt habe ich nach hinten gehorcht, bis ich endlich, endlich - kurz darauf - Jonas losrennen hörte:
Oma! Oma! Oma! Schnell habe ich das Stubenfenster geschlossen und nachher die Mutter mit dem Erlebten gewarnt. Ich stand damals kurz vor meiner Hochzeit, hatte jetzt schon Heimweh nach dem kleinen Jonas und machte mir Sorgen um ihn.
Zum Glück sind die Eltern mit Annemie und Jonas bald den Berg weiter hinaufgezogen. Dort war der Vater mehr zu Hause und hat damit viel weniger getrunken. Auf einmal wurde die Familie mehr und mehr eine ganz normale Familie. Die hie und da auftauchende Vormundschaftsbehörde hat der Mutter ein vorzügliches Zeugnis für den Mehrgenerationenhaushalt ausgestellt. Jonas wurde ein guter Schüler. Anfangs ist er manchmal gefoppt worden, weil er keinen Vater habe. Oma hat ihm gesagt, er soll den anderen erklären, er habe dafür den besten Opa der Welt, der immer für ihn da sei.
Nach der Schule hat Jonas einen Umweg auf seinem Berufsweg gemacht, hat die erste ungeliebte Ausbildung als Heizungsmonteur, die ihm noch von den Grosseltern eingefädelt worden war, durchgestanden, bevor er seinen eigenen Weg gefunden und eine neue Ausbildung in der Informatik nachgeholt hat.
In einer christlichen Glaubensgemeinschaft in der nahen Stadt, die jünger und stark auf Lieder und Musik ausgerichtet ist, hat er seine spätere Frau kennengelernt; sie haben zusammen eine Tochter und einen Sohn bekommen. Die beiden gefreuten Kinder haben sich ebenfalls erfolgreich entwickelt und befriedigende Berufswege eingeschlagen.
Rückblickend ist es erleichternd zu sehen, wie durch eine gut betreute und geborgene Kindheit eine schwere Kette durchbrochen werden kann: alle Spuren des Alkohols sind bei ihm verschwunden. Ich freue mich immer, wenn ich an Jonas erfolgreiche Familie denke oder von ihr höre, obwohl ich natürlich weiss, dass jede Familie sich mit ihren eigenen Problemen herumschlagen muss. Von Jonas weiss ich, dass er sich eine Zeit lang mit seiner Herkunft auseinandergesetzt hat.
Eine eigene Familie
Seite 10
Seite 10 wird geladen
9.
Eine eigene Familie
Bei meiner Arbeit und über Mittag beim Baden am See hat sich Kari immer häufiger zu uns gesellt. Am Abend hat er auf mich gewartet, wir sind zusammen ins Kino, an die Chilbi und andere Veranstaltungen gegangen. Überrascht musste er zur Kenntnis nehmen, dass ich ihn lange nicht in jedes Wirtshaus begleiten wollte, das Restaurant musste seriös auf mich wirken: Jeder Mann mit einem Bierhumpen vor sich war lange für mich ein Süffel. Ich kannte die verrauchten und biergeschwängerten Spelunken und Räuberhöhlen: manchmal hat uns Mama dorthin geschickt, um Papa heimzuholen; wie ich diese Botengänge gehasst habe! Begegnete mir ein betrunken durch die Strasse Wankender, wollte ich nur weg, weg, weg! Früher waren Betrunkene im Dorfbild noch alltäglich, heute wird vermehrt in den eigenen vier Wänden getrunken, ausser die heutige Jugend abends und nachts in ihren Clubs. - Mit der Zeit lernte ich zu unterscheiden.
Kari war sympathisch, aber eigentlich wollte ich nichts von ihm. Je mehr wir unternommen haben zusammen, umso selbstverständlicher und angenehmer wurde mir dennoch seine Nähe: er war mein Begleiter, Beschützer und Türöffner zur unverbindlichen und unberechenbaren Aussenwelt, hinter ihm konnte ich mich auch verstecken. Schliesslich habe ich seinen Zärtlichkeiten nachgegeben. Das war ein Fehler, denn jetzt fühlte ich mich gebunden, war nicht mehr frei.
Ich habe ihn zuhause Mama und Papa vorgestellt, wo er sofort gut angekommen ist: Mama war Feuer und Flamme für ihn; er war ja so seriös, freundlich und nett! Auch Papa hatte sofort einen guten Draht zu ihm, obwohl er doch einst jeden Mann, den ich nach Hause bringen würde, rückwärts die Treppe runterwerfen wollte! Kari hat es verstanden, ihn auf seinem jeweiligen Niveau abzuholen und aufzufangen. Er hat ernsthaft mit Vater über die Themen diskutiert, die dieser gerade aus dem Wirtshaus nach Hause gebracht hatte.
Völlig perplex und fassungslos stand ich da, als ich das erste Mal Kari und Mama am Stubentisch intensiv miteinander diskutieren sah: Nach einer Weile habe ich mich voller unbändiger Wut in die Küche verzogen, aufgewühlt darüber, wie Mama jetzt mit Kari reden konnte und mit mir nie! Erst viel später habe ich realisiert, dass sie auch mit Kari über ihren Glauben gesprochen hat, ihm das aber nichts ausgemacht hat, er hat einfach mitdiskutiert.
Kari hat bald auf eine Heirat gedrängt. Erschrocken habe ich darüber nachgedacht: Heiraten für ein ganzes Leben lang? Mein ganzes Leben, für immer und ewig! Eine beängstigende Vorstellung, aber auch eine Versuchung und Möglichkeit, schnell von der bedrückenden Stimmung mit meinem Vater wegzukommen. Ich fühlte, etwas stimmte nicht; ich habe überlegt, hin und her, was stimmt nicht? Habe bei Kari gesucht, was stimmt nicht? Ich habe keinen Fehler gefunden und bin zu keiner Lösung gekommen - das Leben ging weiter, die Zeit schritt voran - wir haben uns verlobt. Sogar nach der Verlobung habe ich mich bei meiner Mutter noch einmal aufgebäumt: ich wollte diese Verpflichtung auflösen und mich befreien. Entsetzt hat sie auf mich eingeredet, für sie gab es keinen besseren Mann für mich. Und wieder einmal habe ich mich umstimmen lassen.
Mit meinem ersten selber verdienten Geld konnte ich mir endlich eine schönere Garderobe leisten. In einem Chanel-Kleidchen mit Jackett, dazu passenden Schuhen und Handtäschchen drehte ich mich vor meinem Spiegel: Elegant, aber das würde ich mir nicht mehr erlauben können; es gab ja viel Hübsches zur Auswahl, das erschwinglich war. Ebenso schaute ich auf die akkurat ausgerichteten Fläschchen und Döschen vor meinem Spiegel: Diesen Perfektionismus sollte ich mir auch schleunigst abgewöhnen, wenn ich nicht mich und meine zukünftige Familie verrückt machen wollte! Ordnung war mir immer wichtig, Übersicht brauchte ich, stets habe ich mich geärgert, wenn ich mal etwas suchen musste - inzwischen kenne ich auch die unmöglichsten Verstecke meiner Brille genau - millimetergenaue Ausrichtung musste es dann nicht sein, ausser viele Jahre später bei meinen Orchideen: die müssen sich perfekt harmonisch gebüschelt präsentieren; Putzen ist nie zu meinem Hobby geworden.
Lustlos habe ich mit Kari zusammen eine Wohnungseinrichtung ausgesucht, ohne jegliches Interesse habe ich ihn eigentlich nur begleitet. So antriebslos bin ich in die Ehe gestartet, sogar den Hochzeitstag habe ich insgeheim missmutig überstanden. Wir sind in eine der neuerstellten Familienwohnungen unseres Arbeitgebers eingezogen; wir hatten zwei Jahre Zeit für unseren Nachwuchs: brav ist unser erster Sohn Robi im richtigen Zeitfenster angekommen. Vorher habe ich meine Arbeit gekündigt, ich wollte für mein Kind zu Hause sein, wollte es besser machen als meine Mutter, alles wollte ich besser machen als meine Mutter.
Die Schwangerschaft war eine gute Zeit, schon lange hatte ich mich nicht mehr so wohl gefühlt. Beglückt habe ich in mich hineingehorcht und gespannt in einem Zeitschriftenartikel die jeweilige Entwicklungsstufe des Embryos und Fötus mitverfolgt. Die Geburt war ein weltbewegendes Ereignis, wie für alle werdenden Eltern. Doch schon der erste Tag zu Hause hat mich fast zur Verzweiflung gebracht: Musste ich mich jetzt den ganzen Tag nur noch um das kleine Bündel kümmern? Wickeln, baden, wickeln, stillen, wickeln, wickeln ... schon am Nachmittag ist Kari wieder zur Arbeit gefahren. Bereits der nächste Tag war jedoch sehr ausgeglichen, Robi war ein ruhiges Baby und hat viel geschlafen. Glücklich habe ich einige Wochen später beobachtet, wie er zufrieden vor sich hin gegluckst hat. Einige Monate darauf hat ihn der Lärm von der Baustelle nebenan oft schreiend aufschrecken lassen. Ich habe ihn auf den Arm genommen und ihm am geschlossenen Fenster die Arbeiten gezeigt:
bumm! - bumm! - bumm! Sobald er diese mitverfolgen konnte, ist seine Angst verflogen und wir haben Stunden zusammen am Fenster verbracht. Auch später als Kleinkind konnte er nicht lange genug vor einer Baustelle stehen und den Arbeitern zuschauen, interessiert hat er sich sogar unter die wartenden Lastwagen und Maschinen gebückt. - Die grösste Freude konnten wir ihm bald mit Legosteinen machen, die er nach eigener Vorstellung zusammengebaut hat, nie ist ein Werk nach Gebrauchsanleitung entstanden.
Nach einem Jahr ist Paschi gekommen, fein und zart und untergewichtig, dem ein grösserer Abstand zwischen den Schwangerschaften gut getan hätte, aber glücklicherweise war er gesund. Ich durfte den noch immer leicht Untergewichtigen nach zehn Tagen heimnehmen, weil ich mit dem Erstgeborenen bereits Erfahrung mitbrachte. Seinen Rückstand bei der Geburt hat er während der ganzen Primarschulzeit, vielleicht überhaupt nie ganz aufgeholt.
Schon vom ersten Tag an war der Unterschied zwischen den Brüdern frappant: Während Robi in den ersten zwei Wochen fast nur geschlafen hat, wir kaum je seine geöffneten Augen sahen, ich ihn beim Trinken immer wieder anstupsen musste, damit er nicht einschlief, hat Winzling Paschi bereits im Spital mit offenen Augen umhergeschaut, als würde er alles erkennen. So hat Paschi auch viel weniger geschlafen, vielleicht zu wenig? Was mich etwas beunruhigt hat. Seinem Nervensystem hätte mehr Schlaf bestimmt gut getan. - Ach, diese nachträglichen Fragen, diese Selbstquälerei und Schuldgefühle! Vielleicht hätte er in einem abgedunkelten Zimmer mehr geschlafen, aber ich habe ihn ans Fenster gestellt, damit er etwas sehen konnte.
Auch er war ein problemloses Baby. Nur hat sich bei ihm nach einem guten Jahr bei Erkältungen Asthma entwickelt, bei Fieber oft so heftig, dass er pfeifend schwer geatmet hat. Ich habe erkannt, dass ich ihm dieses Übel von meinem Vater her übertragen hatte. Gesund, ohne Fieber, hat Paschi bis zur Pubertät jedoch mühelos und ausdauernd auch mit älteren Spielkameraden bei Spiel und Sport mitgehalten, nachher sind die Kameraden stärker geworden. Als Erwachsener ist er wenig von Asthma geplagt, eine ausgeprägte Stauballergie bleibt ihm jedoch.
Wir hatten uns - vielleicht egoistisch und kurzsichtig von mir - vorgestellt, dass zwei Geschwister mit geringem Altersunterschied sich besser verstehen würden, was dann auch so war: der ältere, überlegtere und bedächtigere Robi und der lebhafte Paschi wuchsen ohne Probleme fast symbiotisch zusammen auf; ihre Mutter hat die Harmonie zwischen den Brüdern eher gestört. Für uns war die Familie nun komplett.
Wie hielt ich es mit der Religion? Es hat mir widerstrebt, auch nur harmlose Kindergebete mit den Kleinen zu sprechen, lieber habe ich ihnen Kindergeschichten erzählt - aber nicht die grimmigen Grimm-Märchen - oder vorgelesen, Liedchen gesungen. Sie sollten sich in ihrem Glauben ganz frei entscheiden; wie frei das ist, wenn ihnen das Thema vorenthalten wird, ist eine andere Frage. Mit Blick auf die Konfirmation, für die sie sich vielleicht einmal entscheiden könnten, haben wir sie in der Landeskirche taufen lassen. Damit mussten sie diese Zeremonie später nicht nachholen; zudem gab's zweimal ein Familienfest mit Gotte und Götti und ich hab's überlebt.
Äusserst unangenehm war mir immer Weihnachten, ein Fest, das wir den Kindern nicht vorenthalten durften: Wie sollte ich dieses gestalten? Nur die Kerzen am Baum anzünden und Päckli verteilen, widerstrebte mir dann doch. Weil wir das Fest immer auch bei Oma feierten, haben Robi und Paschi die Weihnachtsgeschichte gekannt. Deshalb haben wir uns darauf beschränkt, Weihnachtslieder abzuspielen und dazu zu singen, damit war es auch bei uns feierlich. - Mein Widerwille gegen alles Religiöse war damals und noch lange schon fast krankhaft.
Immer wieder habe ich bemerkt, dass die Zugehörigkeit zu irgendeiner Glaubensgemeinschaft weit verbreitet war und ist. Die Eltern der Nachbarskinder, mit denen unsere Buben dauernd spielten und sich bestens verstanden, waren bei den Methodisten. Meine beste Freundin im gleichen Haus, eine ehemalige Schulkameradin aus dem einzigen zusammen verbrachten Schuljahr, ebenfalls: zum Glück akzeptierte sie meine Haltung und liess mich in Ruhe. Einige Jahre später ist ein Zweig aus der Pfingstmission eines Tages aufgetaucht und hat Robi und Paschi zu Unterricht und Spiel eingeladen. Dabei blieben sie jedoch nicht lange, vor allem Robi hat bald protestiert, es werde zu viel gebetet und gepredigt statt gespielt.
Zusammen mit dem Religionsunterricht der Schule hatten sie also auch ohne mich genug Anschauungsmaterial; die Konfirmation war dann kein Thema, nicht einmal ein Pfarrer hat sich bei uns gemeldet, was mich dann doch erstaunt hat, es war mir nur recht. - Kirchensteuern bezahlen sie, wie auch Kari und ich, noch heute.
Alles lief so gut, und doch, irgendetwas bedrückte mich; wenn Kari alleine mit den Buben unterwegs war, verkroch ich mich ins Bett, ich hatte nur noch das Bedürfnis wegzutauchen. Das wurde immer schlimmer, mühsam habe ich meine Pflichten erfüllt. Dann bin ich langsam immer tiefer ins Graue versunken, das immer dunkler und schliesslich ganz schwarz wurde. Nach einem Jahr bin ich eines Morgens aus diesem Schwarz aufgewacht und blitzartig sah ich alles glasklar: Ich hatte den Fehler gefunden! Meine Depression war weg!
Ganz klar wusste ich: Ich hätte weiterhin die Schule besuchen müssen! Weiterhin mich unter Gleichaltrigen wohl fühlen und weiterentwickeln können, hätte meine Berufsrichtung gefunden, und ... und ... und ... Der tief verdrängte Wunsch stand so plötzlich vor mir, dass er mir die Tränen in die Augen getrieben hat.
Die weiteren Folgerungen waren natürlich, dass ich nicht geheiratet, keine Familie gegründet hätte. Zumindest nicht so schnell. Das war der Fehler, den ich vor der Verlobung so intensiv gesucht und nicht gefunden hatte.
Was jetzt? Meine Gedanken liefen in verschiedene Richtungen: eine Scheidung? Kam nicht in Frage, die Familie auseinanderzureissen, warum auch? Als alleinerziehende Mutter wäre ich zudem völlig überfordert gewesen, das wusste ich inzwischen sehr genau. Und mit zwei Kleinkindern eine schulische Weiterbildung zu beginnen, war eine für mich unvorstellbare Aussicht: diesen Zug haben wir - meine Eltern und ich, weil ich mich nicht gewehrt habe - abfahren lassen. Mit meinen Prägungen, meinem Manko, der Unsicherheit und dem fehlenden Urvertrauen, die ich aus meiner eigenen Kindheit mitgebracht habe, hätte ich sowieso besser keine Kinder gehabt. Über dieses Tabu-Thema habe ich neuerdings zu meiner Überraschung und Entlastung sogar gelesen: #RegretMotherhood / Ambivalenz, Clara Schumann.
All diese Gedanken behielt ich selbstverständlich für mich. Meine wunderbare Familie durfte nichts von solch ketzerischen Überlegungen wissen; jetzt wollte ich erst recht mein Bestes geben für sie. Diese neue Erkenntnis hat mich mit ihrer Klarheit aber erleichtert und von der Depression befreit: Schliesslich gibt es viele Weggabelungen in einem Leben; diesen Traum habe ich endgültig begraben, auch wenn ich ihm noch eine ganze Weile nachgetrauert habe.
Leichter ist mir meine Aufgabe als Mutter deswegen nicht gefallen, immer stand ich unter Druck, die Verantwortung zuvorderst; damit konnte ich schlecht umgehen. Ernüchtert und verzweifelt musste ich oft erst aus Fehlern lernen, nachdem sie bereits passiert waren. Ich habe Ratschläge über Kindererziehung aus Zeitschriften und Büchern gelesen, diese mit der Zeit auf die Seite gelegt; immer waren die mir irgendwo zu weit weg, dazu war ich zu spontan. Die Bücher von Remo H. Largo hätten mir vielleicht geholfen, wenn sie denn schon geschrieben worden wären damals. Sein letztes Buch: "Zusammen leben" habe ich gelesen; selten hat ein Buch meine eigenen Erfahrungen und Einsichten vom Anfang bis zum Ende so bestätigt.
Mein Verhängnis war, dass ich mich immer zuerst von meinem Verantwortungsbewusstsein, von Recht - Unrecht, Gerechtigkeit - Ungerechtigkeit, Schuld leiten liess. Das gelöste, fröhliche und unbekümmerte Lebensgefühl versuchte ich zwar auch in unsere Familie zu bringen - das brauchten Kinder doch - das hat mich jedoch angestrengt und war eher inszeniert. Daher war ich sehr dankbar für Karis lockere Unterstützung; ich hoffe, dass die Erinnerungen für meine Liebsten nicht zu schlecht sind. - Diese "verdammte, sündige Welt" blieb mir immer ein wenig fremd, ihre Fröhlichkeit war mir lange suspekt; "verdammt" ist natürlich nicht Mamas Wort.
Mit gutem Gewissen kann ich sagen, dass ich wirklich immer auf meine Kinder eingegangen bin, wenn sie mir etwas mitteilen wollten. Das habe ich klar besser gemacht als meine Mutter! Am Esstisch haben sie von ihren Erlebnissen mit den Spielkameraden ums Haus, aus Kindergarten und Schule berichtet. Solange sie zu Hause waren, sind wir nach dem Essen meistens noch länger am Tisch gesessen und haben angeregt miteinander diskutiert. Aus früheren Jahren sehe ich Kari vor mir, Robi an sein Knie gelehnt, wie er ihm irgendeine technische Funktion erklärt, Paschi daneben. Nur manchmal musste ich ihn ermahnen, Paschi in ihre lebhaften Gespräche miteinzubeziehen.
Für meine Nachbarinnen eher verwunderlich, habe ich meinen Buben eine grosse Freiheit draussen beim Spielen zugestanden: meistens sind sie, vor allem Paschi, so dreckig nach Hause gekommen, dass ich ihnen die Kleider noch vor der Wohnungstür ausgezogen und die beiden ins Bad geschickt habe. Das hat mir überhaupt nichts ausgemacht, im Gegenteil war ich überzeugt, mit dieser Grosszügigkeit etwas von meinem Unvermögen ausgleichen zu können. Darin habe ich mich nicht beirren lassen.
Robi zeigte sich bald als sehr sensibles Kind mit eigenwilligem, lotrechtem Denken, der mich beim Wort nahm. Genau musste ich mir zum Voraus überlegen, ob ich mein Wort auch einhalten konnte, das ich gab: So waren wir einmal abends bei Oma in der Küche beim Geschirrtrocknen, als Klein-Robi schon schniefend in der Tür stand:
Du hast gesagt, dass wir um sieben Uhr nach Hause gehen! Es war fünf nach sieben! ... und bereits ist seine Welt ins Wanken geraten. Mit viel Beschwichtigen konnte ich ihn beruhigen, dass ich Oma nur noch schnell helfen wolle, damit sie nicht alles allein machen müsse, in ganz wenigen Minuten sei ich bereit. Noch auf dem Heimweg habe ich ihm aufzuzeigen versucht, was manchmal wichtiger sei.
Er hat eine eigene logische Denkweise. Ein Lehrer einer höheren Klasse hat mir erklärt, wie er Robis Matheaufgaben korrigieren müsse: die Resultate stimmen jeweils, die Lösungswege dazu seien jedoch immer recht verschlungen. - Das kommt mir doch bekannt vor. Seinen Willen und seine Überzeugungen konnte ich nur mit hieb- und stichfester Logik meinerseits ändern - was übrigens noch heute gilt. Sein Leben ist wahrscheinlich nicht immer einfach.
Seine Sensibilität hat sich besonders auffällig in der zweiten Primarklasse gezeigt: Seine Lehrerin hatte in der ersten Klasse das Lesen mit dem Experiment der Ganzwort-Methode eingeführt.
Anneli, jedes Wort, das mit A begann, hiess Anneli, später wurden die Buchstaben auseinandergenommen (ich habe das nie durchschaut). Dieses komische Experiment wurde bald wieder abgebrochen, hat Robi aber fast zum Legastheniker gemacht. Nur mühsam hat er das Lesen gelernt (und ich habe mir Vorwürfe gemacht, weil ich, gegen alle Ratschläge, ihm die Buchstaben nicht vor der Schule beigebracht hatte). In der zweiten Klasse musste er ein Kindergeschichtchen aus dem Wald üben, in dem verschiedene Figuren lebten, die eigentlich nicht in den Wald gehörten. Stockend hat er Satz für Satz so langsam gelesen, dass er diese kaum verstanden hat. Aber dann ist er an eine Stelle gelangt, bei der er schon einige Worte vorher ins Schniefen kam: Das Bratwürstchen, das im Wald gelebt hat, wurde (vom Fuchs?) in einer Pfanne geschwenkt, um die Suppe zu würzen, und ist dann aufgegessen worden: und Robi ist in Schluchzen ausgebrochen, und das jedes Mal, jedes Mal, auch am darauffolgenden Tag; die Lehrerin hat sich gewundert. - Erst in der dritten Klasse hat er fliessend und zunehmend gerne und häufig gelesen.
Von früh an wollte ich bei beiden die Freude an Büchern und am Lesen wecken und habe ihnen Tier- und Naturkundebüchlein geschenkt und später kindergerechte Wissens-Bücher: Was ist das? GEO und andere Hefte über Flora, Fauna, Umwelt und Gesellschaft. Beide waren interessiert, vor allem Robi, Paschi hatte weniger Sitzleder. - Beide sind vielseitig interessierte Leser geworden, noch heute bringt uns Paschi hie und da ein Buch zum Lesen vorbei; während des Jahres stosse ich manchmal auf ein Buch, das den einen oder den anderen interessieren könnte, das dann ein willkommenes Weihnachtsgeschenk ergibt.
Mein leichtestes Jahr war das Kindergartenjahr, als Robi als Grosser im zweiten Jahr seinen kleinen Bruder beschützend an der Hand nahm und ihm alles Neue im Kindergarten genau erklärte.
Im Laufe der Wochen und Monate ist der Kindergärtnerin Paschi aufgefallen: Ein kleiner Sprachfehler, der mit nur zwei Sitzungen bei einer Logopädin mit Zungenübungen korrigiert war; sie hat ihn (und mich, weil ich das Ohr dafür hatte) sehr gelobt für seinen schnellen Erfolg. Dann ist der Kindergärtnerin sein allgemeiner Rückstand aufgefallen, dazu eine Indifferenz zwischen links und rechts. Schon früh habe ich das bei ihm gesehen beim Malen, schwebend hielt er die Farbstifte einmal links, dann wieder rechts. Damals habe ich ihn gefragt, ob er die Stifte nicht einfach rechts halten wolle, worauf er das fortan so getan hat. Doch jetzt wurde er in ein Gleichgewichts-Training geschickt, um seine Orientierung zu festigen. Gleichzeitig habe ich ihm für längere Zeit ein grosses
R auf den rechten Handrücken gemalt. Ein Schulpsychologe hat ihm eine überdurchschnittliche Intelligenz bestätigt, aber auch ADS diagnostiziert, ein Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom. - Was bedeutete das alles für die kommenden Schuljahre?
Paschi war ein lebhaftes, fröhliches Kind: Vom Kindergarten existiert ein hübsches Bildchen, auf dem er und seine Freundin Barbara bäuchlings unter einem Tischchen liegen und kreischend einen Käfer beobachten, Händchen haltend. Ebenso habe ich sie einmal beobachtet, als ich ihn abholen wollte: selbstvergessen sind sie zusammen händchenhaltend auf einer Bank in der Garderobe gesessen und haben den anderen zugeschaut. Als er dann in die erste Klasse kam, war Barbara nicht mehr dabei, sie hat eine andere Schule besucht. Damals war er ziemlich lange sehr traurig, er erlebte seinen ersten Liebeskummer.
Mir hat wehgetan, miterleben zu müssen, wie die Kinder immer häufiger und schneller ihr frühes kindliches Paradies verlassen, ihre arglosen Illusionen verlieren und sich einer teilweise schmerzhaften und mitleidlosen Wirklichkeit stellen mussten. Beide waren sehr sensibel.
Vor dem Schulübertritt wurden verschiedene Wege für Paschi diskutiert: die erste Primarklasse in einer Kleinklasse auf zwei Jahre verteilen, die erste oder eine spätere Klasse repetieren. Wir wurden vorbereitet, dass Paschi wahrscheinlich Probleme haben könnte. - Heute würde ich die erste Version mit einem sanfteren Einstieg bevorzugen, aber wahrscheinlich habe nicht ich selber entschieden. Eine Sonderklasse wurde auch später, für mich nicht verständlich, immer abgelehnt mit der Begründung: Diese Etikette würde ihn sein Leben lang begleiten. Ich jedoch war der Meinung, dass ein Kind in der Sonderklasse ganz offensichtlich eine besondere individuelle Betreuung braucht und auch bekommt, sonst wäre es nicht hier. Diese Unterstützung hätte Paschi doch gebraucht, wenigstens für einzelne Jahre. Wer spricht nach erfolgreichem Schulabschluss noch von der Primarschule?
Ja, für Paschi war die Schule nicht viel mehr als die Fortsetzung des Kindergartens: Für ihn war schwierig, so lange stillzusitzen, er konnte sich schlecht länger konzentrieren, an einer Aufgabe dranbleiben, kam Aufforderungen der Lehrerin erst nach, nachdem er sich bei den anderen vergewissert hatte, was diese nun machen. Das bestätigte Aufmerksamkeitsdefizit hat ihm zu schaffen gemacht. Hyperaktiv war er nie, auch wenn er sehr lebhaft war, hat die Klasse nicht gestört, war auch nie aggressiv, im Gegenteil: er hat Streithähne immer gemieden und sich friedlichen Kameraden angeschlossen. - Die Lehrerin hat mir erlaubt, jederzeit den Unterricht zu besuchen. So habe ich alles beobachtet, habe Paschis ureigenes Problem gesehen, das niemanden sonst beeinträchtigt hat.
Ich erinnere mich an ein Blatt in der Mengenlehre: Da wären Felder mit Vögeln auszufüllen gewesen, aber diese Vögelchen hatten doch Hunger, also hat Paschi ihnen lieber Futterkörner hingezeichnet ...
Der Lehrer der dritten Klasse wollte Paschi diese repetieren lassen, damit er mit ganzer Energie in die anspruchsvolle vierte Klasse starten könne. Weil die Noten bisher knapp noch gereicht hatten, habe ich argumentiert, dass mir vernünftiger erscheine, Paschi für diesen schwierigeren Übergang zwei Jahre Zeit zu geben, der bisherige Schulstoff würde jetzt ja gefestigt. Der Lehrer war einverstanden und Paschi hat die vierte Klasse zweimal besucht. Er wurde immer mehr zum durchschnittlichen Primarschüler und in der Wiederholungsklasse wurde er glücklicherweise einem sehr verständnisvollen Lehrer zugeteilt.
Robi hat seine Hausaufgaben - nachdem er gut lesen konnte - schnell und sicher erledigt. Paschi hat da länger daran gekaut und ich dazu - hier habe ich völlig versagt: Schnell wurde ich ungeduldig, war gar keine gute Pädagogin für ein Kind mit Schwierigkeiten. Schliesslich habe ich Robi gefragt, ob er Paschi helfen würde. Und Robi hat dieses Ämtlein selbstverständlich und zur vollsten Zufriedenheit übernommen und erledigt.
Jetzt, wo die Buben zur Schule gingen, habe ich den freigewordenen Hauswartjob übernommen. Ich merkte, dass es für mich besser war, mich noch auf eine andere Aufgabe konzentrieren zu müssen, damit ich mich nicht zu stark auf die Kinder fixierte. Dazu arbeitete ich gerne ums Haus herum: Rasen mähen, Sträucher schneiden, die Wege mit dem Besen fegen, Schnee schaufeln im Winter - manchmal türmten sich riesige Schneehaufen auf dem Garagenvorplatz; am liebsten Jäten auf dem Flachdach und die Lüftungsapparate putzen, da konnte mich niemand mit Geschwätz aufhalten! Nur zum Reinigen der Treppenhäuser musste ich mich immer überwinden. Wenn die Buben aus der Schule kamen, wussten sie immer, wo ich zu finden war. Meine Nebenbeschäftigung gab mir zudem persönliche finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit!
Bei meinen Arbeiten vor dem Haus ist mir öfters mein früherer Chef begegnet, der mir hie und da zu verstehen gab, dass er mich gerne wieder einstellen würde. Immer war meine Antwort:
Nicht, bevor die Kinder in die Schule gehen. Nun waren sie in der Schule und abgestimmt auf ihren Stundenplan begann ich wieder, stundenweise in der Disposition zu arbeiten. Die Buben kannten mein Büro und haben dort auf mich gewartet, falls ich einmal mit meiner Arbeit noch nicht fertig war.
Völlig überrascht hat mich die neue Atmosphäre im Betrieb: Mir wurde von allen Seiten - sogar aus dem Verkauf! - ein Respekt entgegengebracht, der mir neu war, ich hatte plötzlich viel Luft um mich herum; vorher war ich einfach die Stiftin, die einige Jahre angehängt hatte. Auch selber fühlte ich mich viel sicherer, hatte ich inzwischen doch einige Jahre selbstständig einen Haushalt geführt. Das tat meinem Selbstvertrauen gut! Einige Angestellte waren inzwischen pensioniert, andere sind neu dazugekommen.
Paschi war in der dritten Klasse, als ich eines Nachmittags nach einem kurzen Schwimmen aus dem See stieg: unter den Bäumen beim Parkeingang standen wie zwei blasse, kleine, geschockte Sünderlein Paschi und seine Spielkameradin Susi nebeneinander und schauten mir wortlos und ängstlich entgegen. Sofort sah ich den Grund für ihren Schock: Paschis rechte Hand hing auf die äussere Seite verschoben an seinem rechten Arm! Noch nie war ich so schnell in meinen Kleidern! In Krisensituationen habe ich bestens funktioniert. Zügig, aber nicht zu schnell für Paschi, haben wir uns auf den kurzen Heimweg gemacht, unterwegs habe ich gefragt, was denn passiert sei. Kleinlaut hat Paschi erklärt, wie er einige Male, etwa sechsmal, vom Baum gesprungen sei, immer sei es gut gegangen, aber einmal sei er mit den Händen falsch auf dem Boden aufgetroffen. Das Wiesenbord ist an dieser Stelle stärker ansteigend, deshalb hat er bei der falschen Landung die Handgelenke gebrochen.
Ich war Susi unendlich dankbar, wie sie sich um Paschi gekümmert und ihn begleitet hat, und habe sie gebeten, bei ihm auf der Treppe zur Strasse zu warten, bis ich wiederkäme, ich müsse ein Taxi rufen. Ich bin auch nie schneller die Treppe in den obersten Stock gerannt als an diesem Tag. Der Kinderarzt hat uns direkt ins Spital gewiesen. Im Auto hat Paschi dann leise gesagt, dass ihn auch der linke Arm schmerze. Er hat überhaupt nicht geweint oder gejammert, war sehr blass, hat leicht gezittert, war einfach nur geschockt. Im Spital haben die Ärzte bereits auf uns gewartet: ja, sie würden den linken Arm ebenfalls anschauen, bei dem dann auch einer der beiden Armknochen gebrochen war.
Ob er nur eine Nacht oder mehrere Tage im Spital war, weiss ich nicht mehr. Auf jeden Fall ist er mit einem eingegipsten und einem eingeschienten Arm heimgekehrt und konnte überhaupt nichts mehr selber machen. Damit ist eine schwierige Zeit angebrochen. In den ersten Tagen hatte er Fieber, damit sofort wieder etwas Asthma; sein Büsi hat ihm mitfühlend schnurrend an seiner Seite auf dem Bett Gesellschaft geleistet.
Irgendwie haben wir das alles gemeistert, Paschis Unternehmungslust ist zurückgekehrt. Nachdem sein linker Arm nur noch eingebunden war und er beweglicher wurde, wurde es immer schwieriger, ihn im Haus zu halten. Immer mit ihm im Wald spazieren gehen, wie das der Kinderarzt empfohlen hatte, konnte ich auch nicht. So liess ich ihn eines Tages hinaus mit den Worten:
Aber aufpassen! Er:
Ja, aufpassen! Nicht viel später habe ich aus dem Fenster geschaut und sehe die ganze Horde Nachbarskinder mit den Rollschuhen die Strasse runterfegen, Paschi mitten drin! Wieder bin ich die Treppe runtergeflogen und habe ihn unten abgefangen. Während ich ihm die Rollschuhe löste, die er kaum alleine angezogen hatte, machte ich ihm Vorwürfe:
Ich habe doch gesagt, du sollst aufpassen! Er:
Ich habe doch aufgepasst! - andernfalls hätte er das Trüpplein wohl angeführt. Ich habe ihm aber schon klar gemacht, dass der Doktor mit ihm schimpfen werde, wenn die Arme wieder brechen würden, und es damit immer länger dauern würde, bis er wieder gesund sei. Dass der Doktor vor allem mit mir schimpfen würde, brauchte er nicht zu wissen.
Paschi schien die Gefahren einfach nicht zu sehen oder ernst zu nehmen; erinnerte ich mich nicht an meine eigenen frühesten Eskapaden? Wie hat er Velofahren gelernt? Unermüdlich ist er auf dem grossen Parkplatz vor dem Haus auf seinem neuen kleinen Zweirad rumgefahren, hingefallen, aufgestanden, weitergefahren, hingefallen, weitergefahren, bis er sein Rad beherrscht hat. Etwas später testete er aus, ob er wohl die Augen im richtigen Moment wieder öffnen könne, und ist mit geschlossenen Augen in die Garagemauer geprallt und hat sich die Ecke eines Milchzahnes weggebrochen.
Je mehr er sich nach Draussen orientierte, umso mehr fürchtete ich um ihn. Einige Jahre später hatte er einen Velounfall in einer engen unübersichtlichen Kurve, sein Bein war verletzt, humpelnd kam er heim, was war, weiss ich nicht einmal mehr.
Etwa zu dieser Zeit hat er uns erneut einen riesigen Schreckmoment beschert: Wir waren mit den Schlitten in den Bergen, gerade mit dem Sessellift eine rassige Schlittelbahn hochgefahren. Oben haben Paschi und ich auf den Rest des Trüppchens gewartet, hier wollten wir unsere Zwischenverpflegung einnehmen. Warten? Wie langweilig! Er hat den seitlichen baumbestandenen Abhang hinuntergeschaut, der recht harmlos erschien. Also legte er sich spontan bäuchlings auf den Schlitten und fuhr trotz meinem Protest los. Bang und zunehmend alarmierter schaute ich ihm nach, wie er immer schneller den holprigen und steilen Hang hinunterschoss, wie es ihn schüttelte und auf dem und mit dem Schlitten herumwarf, wie er völlig unkontrolliert zwischen den Bäumen durchschoss, unten vom Schlitten flog - dann blieb die Welt für einige Sekunden stehen - bleibt er liegen? wird er sich wieder bewegen? kann er wieder aufstehen? Inzwischen standen die anderen neben mir und schauten ebenso gebannt nach unten, wo sich Paschi langsam zu bewegen begann, sich langsam regte und sich aufsetzte, sich langsam erhob und umschaute. Er hat uns gehört und gesehen, das Seil seines Schlittens genommen und ist langsam und mühsam den steilen und unwegsamen Hang hinaufgeklettert. Blass und geschockt ist er oben angekommen, hat kaum etwas gesagt, hatte offenbar keine äusseren Verletzungen, aber sicher eine Hirnerschütterung; noch eine ganze Weile haben wir ihm seine Verwirrtheit angemerkt. Zum Arzt wollte er nicht, hat sich zu Hause dann aber doch ein wenig geschont.
Als junger Erwachsener hat er eines Tages einen 250er-ccm Töff vor das Haus gestellt, mir ist vor Schreck fast das Herz stillgestanden! Wie haben wir mit ihm diskutiert, bis er dieses Vehikel eines Tages, ohne je damit gefahren zu sein, weiterverkauft hat und uns ein riesiger Fels vom Herzen gefallen ist.
Später hatte er einen Unfall mit Rollbrett, als er bereits in der eigenen Wohnung lebte: Er fuhr zum Einkaufen auf dem Trottoir den Berg hinunter, als ihm ein Velofahrer entgegenkam, der ihn gestreift hat. Beim Sturz hat er sich erneut den linken Arm gebrochen, der Velofahrer ist weitergetrampt; trotzdem hat Paschi seine Fahrt fortgesetzt, er musste ja einkaufen. Im Laden ist er dann an einer Wand zusammengesunken, die Leute sind an ihm vorbeigegangen, niemand hat sich um ihn gekümmert, da kauerte ja nur ein langhaariger Drögeler. Nachdem er sich etwas erholt und seinen Einkauf erledigt hatte, ging er mühsam zu Fuss wieder den Berg hinauf nach Hause. Unterwegs musste er sich nochmals auf einem Mäuerchen ausruhen. Zu Hause ist er in sein Auto gestiegen und ins Spital gefahren - eine Kürzestversion dieser Geschichte hat er mir am selben Tag über Mittag am Telefon mitgeteilt: er hätte den Arm gebrochen, sei im Spital, ich solle einfach vor dem Hallenstadion warten, er komme dann schon. Wir wollten an diesem Samstagabend zusammen ein Konzert von Bob Dylan besuchen. Paschi ist dann nicht erschienen, an dieses Konzert erinnere ich mich überhaupt nicht. - Masslos empört hat mich die grosse Gleichgültigkeit der Mitmenschen; einmal mehr hat mich die schier unmenschliche Zähigkeit von Paschi erschreckt.
Seine grässlichsten Unfälle standen ihm noch bevor; jetzt kehre ich nochmals in die Jahre der Primarschule zurück.
In den 80ern sind die Jugendunruhen mit ihren hässlichen Begleiterscheinungen von den USA in die Schweiz übergeschwappt. In der nahen Stadt am Platzspitz hat sich eine jugendliche Drogengruppe gebildet, ist immer grösser geworden, schockierende Szenen spritzender, schnupfender, rauchender und halbtot herumhängender junger Menschen in Dreck und Müll tauchten immer häufiger in Zeitungen und Fernsehen auf, die Bilder vom "Needlepark" gingen um die Welt. Die Stadt war überfordert, später wollte die Polizei diese Gruppen auflösen, sie vertreiben, hetzte sie von einer Ecke in die andere und wieder zurück - neue, fremde Bilder, die kaum auszuhalten waren. Die Jugendlichen haben sich in Verstecke verkrochen und sich später beim Schwimmbad Letten an der Limmat wieder gesammelt, wo sie erneut die erschütterndsten Schreckensszenarien für die Medien lieferten. - Mit der Zeit hat die Stadt eine weltweit vielbeachtete Drogenstrategie mit einer kontrollierten Drogenabgabe an die Süchtigen entwickelt; damit fanden viele von ihnen wieder in einen geordneten Tagesablauf zurück.
Einmal, als ich im unteren Stock des Hauptbahnhofs die Rolltreppe nehmen wollte, lag daneben auf dem blossen Boden ein junges, schlafendes Mädchen, halb auf dem Rücken, das Gesicht offen zur Decke gedreht, alle Vorübergehenden konnten der Jugendlichen voll und ungeniert ins Gesicht schauen - was macht das mit einer Mutter?!
Diese verstörenden Bilder haben mich aufgewühlt, kamen unsere Jungen doch eben in dieses gefährdete Alter; immer musste ich an die Mütter und Väter dieser Jugendlichen denken. Wie diese mit diesem unerträglichen Elend wohl umgingen, umgehen konnten? Ich könnte das doch nicht! Ich begann mich um den luftigen und ungefestigten Paschi zu sorgen, Robi war vor solchen Versuchungen gefeit.
Robi hat sich zu einem guten Schüler entwickelt, seine Noten waren mehr als gut, zumindest bis gegen Ende der sechsten Klasse, als vor dem Übertritt in die höheren Klassen häufiger Testserien gemacht werden mussten. Die Note der ersten Prüfung war immer gut bis sehr gut, die zweite kurz darnach schon tiefer, die dritte ist noch weiter abgefallen, und so ist das weiter und weiter gegangen. Nach einem Unterbruch der Testserie ist das Spiel von vorne losgegangen. Der Lehrer hat erkannt, dass Robi mit Druck nicht umgehen konnte, was ich ja schon immer gewusst habe. Er hat uns empfohlen, ihn in die Realschule zu schicken, in der Sekundarschule wäre er zu grossem Druck ausgesetzt. Jetzt war ich doch etwas konsterniert, die Sekundarschule habe ich immer als selbstverständlich vorausgesetzt; ich habe an meine eigene Schulzeit zurückgedacht.
Der Rat des Lehrers hat sich als richtig erwiesen: Robi ist aufgewacht und hat sich über die ganze Realschulzeit an der Spitze der Klasse gehalten. Anschliessend hat er die Berufswahlschule besucht, die ihm sehr entsprochen hat. In der zweiten Hälfte des Jahres hat der Lehrer Robi die Berufsmittelschule BMS empfohlen. Der aber wollte nicht auf einem Führungsposten landen und hat sich für eine Berufslehre als Konstruktionsschlosser, später Grossapparateschlosser, entschieden. Anschliessend wäre er gerne in die Solartechnik eingestiegen, aber damals gab es in der Schweiz erst ganz wenige Stellen dafür, er hat nur eine einzige Firma gefunden, deshalb hat er eine Elektrikerlehre angehängt. Zufrieden war er in verschiedenen Arbeitsbereichen beschäftigt, hat mit Zusatzausbildungen seine Fähigkeiten erweitert und seinen Berufsweg gefunden. - Was sollte ich mehr wollen? Mit seinen frühesten technischen Interessen habe ich ihn eben in einer Forschergruppe gesehen.
Gegen Ende von Paschis sechster Klasse habe ich mit dem Schulpsychologen über meine Ängste gesprochen, die mir im Genick hockten. Meine Angst, dass er mit einem Lehrer, der ihn nicht so gut verstehen würde wie der bisherige, die Schule schwänzen würde, abdriften würde, wir Paschi an die nahe Drogenszene verlieren könnten, zumal er noch keine festen Meinungen und Überzeugungen zeigte wie Robi. Der Schulpsychologe hat mir den Vorschlag gemacht, Paschi in ein ländliches Internat in die Sekundarschule zu schicken. Sekundarschule?
Wir haben diesen Vorschlag zu Hause intensiv besprochen, auch Paschi war dabei, hat nicht viel dazu gesagt. Kari hat jedes Mal mitdiskutiert, aber schliesslich war er immer meiner Meinung; mir haben seine Gegenvorschläge oft gefehlt, die Verantwortung lag immer auf meinem Rücken.
Aus lauter Angst, Paschi an die Drogenszene zu verlieren, habe ich meinen wahrscheinlich grössten Fehler gemacht: Paschi kam für drei Jahre ins Internat aufs Land in eine Sekundarschule, jedes zweite Wochenende war er zu Hause. Anfänglich schien es ganz gut zu laufen, Paschi hat sich eingelebt, hat sogar einen Freund gefunden. Dann wurden seine Briefe immer düsterer, die Schule war nur noch schlecht, er war dem Schulstoff und den Lehrmethoden nicht gewachsen, musste in Nachhilfestunden nachsitzen. Nach zwei Jahren haben wir das verunglückte Experiment abgebrochen. - Paschi hat mir diese Verbannung ins Internat noch viele Jahre immer wieder vorgeworfen, erst seit wenigen Jahren sind diese Vorwürfe verstummt. Ich bringe es nicht übers Herz, seine damaligen Briefe nochmals zu lesen.
Wie waren wir alle glücklich, als er wieder zu Hause war! Obwohl die beiden Jahre, in einer wichtigen Entwicklungsphase, irgendwie verloren waren. Anschliessend hat er wie Robi das Berufswahljahr gemacht, was ihm sehr gut getan hat. Mir war, als würde er damit wieder ein wenig geheilt. Jetzt stand die Berufsfrage an: Schreiner hätte ihm gefallen, doch seine Stauballergie sprach dagegen. Jahre später hat er trotzdem problemlos einige Jahre auf diesem Beruf gearbeitet. Mit nicht allzu grosser Begeisterung, was ich gar nicht verstehen konnte, hat er sich für den Landschaftsgärtner entschieden, die besten Voraussetzungen bei seinem normalerweise höchstens leichten Asthma und der Stauballergie. Die Lehrer dieser Berufswahlschule haben alle Schüler mit einem Lehrvertrag in der Tasche entlassen.
Paschi hat seine Lehre gut gemeistert, die strenge körperliche Arbeit an der frischen Luft liessen ihn braun, muskulös, stark und gesund werden. In der Schule fand er einen guten Freund, mit dem er auch später noch hie und da zusammen gearbeitet hat; Daniel hat sich zum Landschaftsarchitekten weitergebildet. Das grösste Problem für Paschi war das Lernen der vielen lateinischen Pflanzennamen. Vielleicht deshalb wollte er kurz vor den Abschlussprüfungen aufgeben. Kari und ich haben beide sehr intensiv mit ihm geredet, ihm aufgezeigt, dass er nur mit abgeschlossener Lehre später Erfolg in seinem Beruf haben werde. Er hat seine Prüfung dann mit gut genügenden Noten abgeschlossen, mit einem Abzug darin: Seine praktische Prüfungsarbeit, der Gartensitzplatz, den er erstellen sollte, der war zwar perfekt, aber leider seitenverkehrt!
Später hat sich immer deutlicher Paschis kreative Seite gezeigt: häufig hat er gemalt, eine Zeit lang in einem Antikmöbelgeschäft antike Schränke aufgebessert und frei mit einem Thema, meistens eine Betrachtung über einen Dylan-Song, bemalt. Diese ganz speziellen Schränke konnte er sogar ausstellen, eine Journalistin hat ihn in einem schönen Zeitungsartikel wohlwollend gewürdigt. Einer dieser einzigartigen Schränke steht in unserem Wohnzimmer.
Das praktische Handwerken haben beide von früher Kindheit an von ihrem Vater mitbekommen: In seiner Freizeit hat dieser viele Kästchen, Regale und andere Gegenstände des Haushalts und für seine Werkstatt selber hergestellt und seine Söhne mithelfen lassen. Bereits mit siebzehn Jahren hatte sich Kari, der Seebueb, ein einfaches Ruderboot gekauft, später, schon mit mir zusammen, ein neues grösseres. Doch dann hat er sich das Boot seiner Vorstellung komplett selber gebaut: einen komfortablen Weidling, mit zwei breiten Sitzbänken und grossen Liegeflächen, passend und bequem für die ganze Familie, mit Stehrudern und kleinem Aussenbordmotor. Bei Schlechtwetter oder im Winter konnte sogar ein schützender Kabinenbau aufgesetzt werden; bei diesen unwirtlichen Ausflügen war er immer alleine auf dem See - nur mit Fotokamera - unterwegs. Dieses Boot war, für ihn selbstverständlich, von Anfang an absolut wasserdicht, musste also nicht erst gewässert werden, was ihm vorher niemand glauben wollte. Bei den späteren Bootskontrollen hat er für sein Werk immer anerkennende Komplimente eingeheimst.
Für unsere Jungen stand das nächste schwierige Kapitel bereits vor der Tür: die 17-wöchige Rekrutenschule! Für beide eine Pflicht, die erfüllt werden musste. Robi wurde den Leichten Minenwerfern zugeteilt - das Bild hat mich fast umgehauen: Der sensible, tierliebende, natur- und umweltverbundene Robi musste jetzt den Krieg und das Töten lernen! Ich dachte zurück, wie ich ihnen niemals eine Kinderwaffe, nicht einmal eine Wasserpistole, gekauft hatte, immer mit dem Hinweis darauf, wie erwachsene Männer mit solchen Waffen andere Menschen terrorisieren und umbringen; das könne für mich niemals Spiel sein. Einmal hat mir Robi eine von einem Nachbarskind geschenkte oder überlassene Pistole vor dem Gesicht geschwenkt, ich hab sie ihm nicht weggenommen -
du kennst meine Meinung dazu -; interessanterweise ist sie bald wieder verschwunden. Als er dann aus einem langen Holzpflock selber ein Gewehr geschnitzt hat, habe ich ihm das überlassen; damit haben sie vor dem Haus Indianerlis gespielt, das gehörte einfach zu Buben und sooo stur wollte ich nicht sein.
Jetzt sollten sie also zu professionellen Kriegern ausgebildet werden! Fragen haben sich mir aufgedrängt: Nie habe ich beobachtet, dass in der Schule bisher das Verständnis für Frieden und ein einvernehmliches Zusammenleben besonders gefördert worden wäre, wahrscheinlich hat man das ruhigen Gewissens dem Religionsunterricht überlassen. Ich dachte an die unzähligen Geschichtsstunden über vergangene blutige und verheerende Kriege und siegreiche Eroberungen und ihre Legenden dazu, die das Bild erst geschaffen und dann gefestigt haben, so dass diese einfach selbstverständlich in den Köpfen dazugehören. Leider ist das ja auch so, immer haben Völker gegen Völker gekämpft, Völker haben andere Völker erobert, Krieg war und ist immer. Und klar, dass mit Waffen immense Vermögen verdient werden können, mit Friedensförderung in äusserst kurzsichtiger Weise jedoch nicht. - Die neutrale schweizerische Armee zur Verteidigung unseres Landes habe ich trotz meiner Ambivalenz doch nie in Frage gestellt. Klar ist mir aber auch, dass die Regierung, mit der Wählerschaft zusammen, die Inhalte und Werte bestimmt, die wir unseren Kindern vermitteln wollen. Deshalb müssen diese Werte immer wieder neu verhandelt werden. Eigentlich bin ich klar eine Pazifistin, ausgedehnt über unser ganzes Menschsein und die gesamte Natur.
Als das Militärthema näher rückte, habe ich beiden eine Belohnung von tausend Franken in Aussicht gestellt, wenn sie während der RS nicht mit dem Rauchen beginnen würden, ein Geschenk, das beide dann entgegennehmen konnten. Ich habe ja gehört, dass viele junge Männer im Militär zum starken Raucher geworden sind. Meine Überlegung war, dass, je später damit begonnen werde, umso weniger stark sich eine Nikotinabhängigkeit ausprägen würde; beide sind erfreulicherweise Nichtraucher geblieben.
Auch auf ihre gesunden Zähne waren wir alle stolz: Bei ihrem Auszug von daheim hatten beide keinen einzigen Flick vom Zahnarzt. Auf regelmässiges und sorgfältiges Zähneputzen habe ich immer sehr geachtet, besser als meine Mutter bei mir.
Robi hat seine RS ganz gut geschafft. Weil er eher aufmüpfig war und unlogische Befehle hinterfragt hat (so hat er als Beispiel seinen Regenschutz auf einem Marsch bei Regen bereits übergezogen, bevor der Befehl dazu erteilt worden war, was natürlich zum Disput geführt hat) - ohne jemals in die "Kiste" zu wandern -, wurde nach der obligaten Frage zu einer späteren Offizierslaufbahn nicht weiter in ihn insistiert.
Paschi hätte sich gut mit einem Asthma-Attest vom Militärdienst befreien lassen können, was ich ihm auch empfohlen habe, aber er wollte keinen Militärersatz bezahlen. So wurde er den Sappeuren zugeteilt, die mir etwas weniger nah am Kriegsgeschehen schienen. Hier konnte er zeitweise sogar brillieren: Beim Ausheben von Gräben hat der vergleichsweise schmale Paschi den massigeren Kameraden vorgemacht, wie das geht. Beim Brückenbauen im Ponton konnte er die anderen beim Rudern dirigieren und anweisen, damit sie sich nicht im Kreis herumdrehten. Rudern hat er schon in seiner Kindheit mit dem Kajak auf dem See gelernt.
Diese kurzen Erfolgsmomente haben ihn aber nicht gerettet: Er hat im Militär gelitten, die dauernden Befehle, auf die er allergisch reagierte, der Tempodruck, das Exerzieren, der Drill, das Rennen, die verlangten exakten Ausführungen, die oft nicht akzeptiert wurden ... nach etwa der Hälfte der RS war er so verzweifelt und hilflos am Ende, dass er sich bei einem Vorgesetzten, dem er vertraut hat, gemeldet hat. Mehr als eine Stunde hat dieser mit Paschi gesprochen, ist auf ihn eingegangen, hat sich um ihn gekümmert und ihn wieder einigermassen aufgebaut. Beim nächsten Urlaub haben wir sofort gesehen, dass es ihm schlecht geht, so blass und zitternd wie er heimkam. Wie habe ich mitgelitten, als er wieder einrücken musste; trotz allem wollte er noch immer nicht abbrechen, was er meiner Meinung nach auch jetzt noch gekonnt hätte.
Beim wöchentlichen Urlaubsappell wurde jeweils einem Soldaten als symbolische Anerkennung für eine besondere Leistung ein fortlaufend nummeriertes Holzstück überreicht. Dieser Holzabschnitt wurde von einem in siebzehn Stücke eingeteilten Balken während der Zeremonie abgesägt. Beim letzten Appell wurde zur allgemeinen Verwunderung Paschi aufgerufen: Der Vorgesetzte erklärte bei der Übergabe des Holzstückes Nr. 17, der Betreffende wisse, womit er sich diese Auszeichnung verdient habe. - Mag diese Belohnung fürs Durchhalten neben der Erleichterung zum Ende der RS auch Freude, Befriedigung und Stolz ausgelöst haben, waren die dreiwöchigen WKs später doch jedes Mal ein kleines Drama. Glücklicherweise gehörten beide den Kompanien an, die bald bei der kommenden Militärreform aufgelöst wurden.
Ganz andere Erfahrungen hat Kari Jahre früher gemacht: Er fuhr immer begeistert in den Militärdienst, das waren richtige Ferien für ihn! Weil er als 19-jähriger Stellungspflichtiger noch zu leicht und dünn war, nur 49 kg wog, wurde er in den Hilfsdienst HD zu den Brieftauben eingeteilt, ein Traumjob, wie er immer betont hat. Nur zum Ordonnanzputz fühlte er sich nicht berufen, was der Oberleutnant dann auch gemerkt hat und ihn, durchaus freundlich, weil die Arbeit trotzdem zufriedenstellend erledigt wurde, darauf angesprochen hat. Im Übrigen hat er sich zu jeder Aufgabe gemeldet, gerne mit seinem Berner Kameraden zusammen, nur nicht bei den Oberen herumhocken und langweilige Übungen machen. Die Truppe Brieftauben, natürlich eine Abteilung der Übermittlungstruppen, ist einige Jahre später aufgehoben und die älteren Jahrgänge sind entlassen worden. - Weil Kari acht Jahre älter ist als ich, habe ich nur noch drei seiner WKs hautnah miterlebt, aber auch seine früheren Erlebnisse oft gehört. Auf das Stichwort "Militär" sprudeln auch heute noch ungezählte kurzweilige und amüsante Abenteuer aus seiner Dienstzeit, die erst bei meinem Schlusspunkt enden.
Nach der RS haben wir unseren Söhnen gerne einen Wunsch erfüllt und ihnen ein verlängertes Wochenende nach Amsterdam geschenkt. Unbesorgt haben wir ihnen diese Gelegenheit geboten, zusammen als ausgleichendes Doppel ein wenig an der grossen weiten Welt zu schnuppern: der besonnene Robi mit dem unternehmungslustigen Paschi, das würde gut funktionieren, was auch so geschah. Begeistert haben sie später von ihren Erlebnissen berichtet.
Paschi hat sich später auf Nordamerika ausgerichtet und seine Ferien im grünen bergigen Montana verbracht, hat dort Freunde gefunden, Freundschaften, die bis heute andauern; er hat die Geschichte der Ureinwohner kennengelernt, noch einen Enkel oder eher Urenkel des alten Geronimo getroffen, er besuchte ein indianisches Pow-Wow und hat Rodeos spasseshalber mitgemacht, er war bei zwei Mountain-Men-Treffen, wo Indigene mit Weissen Tauschhandel betreiben; er hat mit Cowboys an Rindertreiben, Cattle-drives, mitgemacht, durfte sogar selber ein junges Quarterhorse-Hengstchen an den Menschen gewöhnen. - Paschis Blick auf die Welt wurde hier geschärft. Er besitzt Bücher über die Massenmorde an der indigenen Bevölkerung durch Siedler und Goldgräber, der Armee und der Regierung: ein staatlich gewollter Genozid an den Ureinwohnern, unterstützt durch bewusst verbreitete Krankheiten und die fast vollständige Ausrottung der Bisonherden, die den bisherigen Jägern die Lebensgrundlage entzogen hat. Mit der Sklaverei zusammen ein düsteres Bild der Gründerzeit der USA. Im März 2021 ist mit Deb Haaland die erste indigene Ministerin für die Rechte der Ureinwohner der USA überhaupt bestätigt worden.
Zwischen den beiden Berufsausbildungen hat Robi in Havanna einen dreiviertel Jahr dauernden Sprachkurs in Spanisch eingeschaltet. Dort hat er - wie könnte es anders sein - seine zukünftige, erst 18-jährige Frau kennengelernt; sie sind verheiratet zurückgekommen und haben noch ein Jahr bei uns gelebt, bevor sie eine eigene Wohnung in Zürich bezogen haben. Robi hat seine Elektrikerlehre abgeschlossen und Kelen habe ich, neben einem Deutschkurs, zu einer Coiffeuse-Lehre ermuntert, die sie erfolgreich abgeschlossen und später ein eigenes Geschäft mit drei Plätzen eröffnet hat.
Nach seinen Amerika-Jahren hat Paschi eine Frau getroffen, mit der er sich gut versteht, die jedoch wie er ihre Unabhängigkeit behalten wollte. Enkel sind bisher nicht aufgetaucht, was mir - ich flüstere es ganz leise, aber ganz überzeugt und ehrlich - mehr als recht ist, ich hoffe, es bleibt so. Selbstverständlich würde ich die kleinen Wesen lieben, wahrscheinlich sogar zu sehr, aber sie sind und bleiben ja nicht nur klein und immer bezaubernd und würden in eine sehr unsichere Welt hineinwachsen - und ich mag nicht mehr von vorne beginnen.
Robi hat sich dann einige Male mit seiner Oma auf Streitgespräche eingelassen, bei denen es um die Entwicklung und Herkunft des Menschen ging: Robis direkte Ansichten von der Abstammung des Menschen vom Affen haben Oma natürlich empört und völlig aus dem Häuschen gebracht. Ich bin jeweils wie auf Nadeln gesessen. Später habe ich Robi erklärt, dass solche Diskussionen zu gar nichts führen, höchstens zu Streit und Entfremdung. Solche Themen soll er vermeiden (er hat sie teilweise sogar selber aufgegriffen) oder Omas Ansichten einfach stehen lassen. Jeder darf glauben, was er will, soll seine Überzeugungen aber nicht anderen aufdrängen wollen.
Bei mir hat sich in den vielen Jahren im Büro meine Arbeitszeit laufend erhöht, inzwischen waren es zeitweise mehr als 100 % und langsam wurde es zu viel. Erst habe ich eine Mitarbeiterin zur Entlastung bekommen, doch diese hat immer häufiger bei der Fakturierung im Versand ausgeholfen und diesen Posten schliesslich nach der Pensionierung des Mitarbeiters übernommen. Meine Arbeitsbelastung aber wuchs und wuchs, das Geschäft boomte. Eine bestimmte Arbeit - die Aufträge zur Ausrüstung/Veredelung, zum Färben oder Bedrucken der Stoffe -, die mit voller Konzentration ausgeführt werden musste, habe ich immer häufiger am Samstagmorgen erledigt, wenn mich niemand unterbrechen konnte. Ein Fehler hier hätte viele Stoffmeter Verlust und massive Lieferverzögerungen bedeuten können. In der Disposition habe ich die Kundenaufträge vom Eingang über den Liefertermin, wie sie nachher vom Verkauf beim Kunden bestätigt worden sind, bis zur Zuteilung der Stoffe an den entsprechenden Kundenauftrag beim Eingang aus der Veredelung bearbeitet. Für die durchgehende Auftragsbearbeitung stand uns inzwischen ein intern entwickeltes vernetztes IBM-System zur Verfügung, das erlaubte, dass alle Abteilungen von jedem PC aus jede Verarbeitungsstufe einer Bestellung abfragen konnten. Der Verkauf konnte nur die Aufträge mit dem Liefertermin eintippen, diese so dem Kunden bestätigen, und den entsprechenden Versand auslösen. Selbstverständlich erkundigte sich andauernd irgendjemand aus dem Verkauf bei mir nach dem Stand dieses oder jenes Auftrags. Diese Unterbrechungen kosteten mich eine Unmenge an Zeit, weil ich oft mit meiner Arbeit wieder von vorne beginnen musste, und forderten meine Konzentration und meine Nerven über den ganzen Tag sehr stark.
Irgendwann, in einem Spätherbst, merkte ich, dass meine Leistung stagnierte, kaum konnte ich das gewohnte Tempo beim Eintöggelen noch halten, geschweige denn steigern; ich konnte mich noch so sehr anstrengen, es wollte einfach nicht mehr so gehen wie gewohnt. Mein Kopf setzte mir Barrieren und ich bekam Angst: Was passiert mit meinem Kopf? Wird er eines Tages einfach aussetzen? Ich wurde langsamer und langsamer, es wurde mühsamer und mühsamer, angstvoll ersehnte ich die sich von Ferne nahenden Weihnachtsferien. Ich fühlte mich wie auf weitem offenem Meer einsam auf einer Eisplatte, die ganz, ganz langsam dem Ufer entgegendriftet. Würde ich das rettende Ufer noch rechtzeitig erreichen?
Total erschöpft habe ich die Weihnachtsferien angetreten und mir während zwei Wochen jeden Gedanken an den Arbeitsplatz verboten. Erst am zweitletzten Tag habe ich mir kurz Gedanken ans Büro erlaubt, mich am letzten Tag dann stärker auf meine Arbeit eingestellt und mir vorgenommen und vorgestellt, wie ich in einem schützenden Igelkleid wieder zur Arbeit antreten würde und mir so die Mitarbeiter weit vom Leib halten wollte. - Diese enorme Belastung, heute wäre es wohl ein Burnout, hat mir geschadet, mich Nerven gekostet und noch anfälliger für Stress gemacht, wie ich später immer wieder gemerkt habe.
Ich hatte dann unglaubliches Glück, der Betrieb weniger: Der vorsichtige Wiederbeginn und die ersten Wochen des neuen Jahres mit meinem stachligen Igelkleid waren gut zu bewältigen, ich hatte mich tatsächlich ein wenig erholt - und bald darauf ist das Geschäft eingebrochen. Später wurden Leute entlassen, der Betrieb wurde verkleinert, so wie es vielen Textilfirmen in der Schweiz nach der Ölkrise ergangen ist. Es ist viel passiert und nach einigen Jahren, in den 90ern, waren wir nur noch zu Dritt: Der Chef, der Buchhalter, der mit einem auswärtigen IT-Techniker zusammen für das IBM-System verantwortlich gewesen war, und ich. Wir zogen in den obersten Stock in die letzten drei Büros, alle anderen Räume wurden renoviert und vermietet. Das Textilgeschäft war abgewickelt, wir schafften einen Internet-kompatiblen PC an, und ich war nun als Sekretärin des Chefs mit all den Liegenschaften, Stiftungen, Vereinen, Clubs und auch privat verantwortlich. Daneben arbeitete ich mit dem Buchhalter zusammen - der erste Buchhalter aus der Stifti war längst pensioniert - und war vor allem für die Buchungen, noch immer auf dem alten bewährten IBM-System, zuständig.
Im 1998 wurde Kari mit gutem Sozialplan frühpensioniert, weil sein Arbeitgeber, bei dem er inzwischen bereits seit zwanzig Jahren gearbeitet hatte, den Betrieb in die Ostschweiz verlegt hat. Damit hatte Kari Glück, war er doch erst zweiundsechzig und noch lange fit genug, um seine gewonnene Freiheit am und auf dem See und mit seinen ehemaligen Arbeitskollegen und Freunden zu geniessen. Zudem hat er die Küche übernommen und mich damit stark entlastet.
Langsam konnte ich meiner eigenen Pensionierung entgegenblicken. Welche Pläne hatten wir für die Zukunft? Für Kari musste sich überhaupt nichts verändern, für ihn konnte es ewig so weitergehen. Aber ich würde hier versauern; ausserdem wohnte ich viel zu nahe beim Geschäft: Ich sah voraus, dass mich mein Chef dauernd rufen würde, um nur schnell dies, nur schnell das zu erledigen. Nein, es musste eine klare Trennung stattfinden.
Im Sommer 2008 war es endlich soweit: mit dem ersten Jahrgang der Frauen, die in der Schweiz bis vierundsechzig arbeiten mussten, bin ich tief erleichtert in die grosse Freiheit gesprungen! Das letzte Jahr erwies sich als unerwartet schwierig für mich; es ist mir zunehmend schwerer gefallen, mich so zu konzentrieren, dass nicht am Schluss noch Fehler passieren. Ich habe mich an eine Telefonpartnerin erinnert, mit der ich häufig geschäftlich verbunden war, und die nur wenige Monate vor mir pensioniert worden ist: Wir haben von unseren baldigen Pensionierungen gewusst und uns deshalb etwas vertraulicher unsere Schwierigkeiten anvertraut. Diese Frau war - im Gegensatz zu mir - wirklich in grossen Nöten: Sie war verantwortlich für tägliche grosse Finanztransfers und schwebte in ständiger Angst, es könnte ihr ein Fehler unterlaufen. Ihre Angst verfolgte sie dermassen, dass sie nachts nicht mehr durchschlafen konnte und jeweils ab drei Uhr bis zum Morgen wach lag, was ihren Nerven und ihrer Konzentration im Büro auch nicht förderlich war. Ihre Stimme am Telefon hat mir ihre innere Not deutlicher offenbart, als ihre Worte es vermochten. Zu ihrer Pensionierung habe ich ihr per E-Mail gratuliert und meine Glückwünsche geschickt; sie hat sich voller Freude und Erleichterung bedankt und mir die Glückwünsche zurückgegeben.
Zeigt das nicht, dass die Pensionsaltersgrenze nicht einfach generell und unbeschränkt hinaufgesetzt werden darf? Wahrscheinlich würden viele ein flexibles Pensionsalter begrüssen.
Vor einigen Monaten schon haben wir unsere Siebensachen gepackt und sind aufs Land gezogen.
Mein Vater
Seite 11
Seite 11 wird geladen
10.
Mein Vater
(1906-1978)
Sein Grossvater mütterlicherseits war Sigrist in der Kirche Fluntern in der nahen Stadt. Sein Vater hat bei der SBB gearbeitet, worauf die Familie immer stolz gewesen ist: nur Schweizer mit gutem Leumund wurden dort angestellt. Tante Luise, die Schwester seiner Mutter, hat Zeit ihres Lebens im Quartier gewohnt, wir haben sie einige Male mit Grossmutter besucht.
Meine Mutter war immer zurückhaltend im Beschreiben von anderen Personen, sie hat diese nicht schlecht geredet, wollte sie wohl samt der eigenen Familie nicht beschmutzen. Trotzdem erinnere ich mich, wie sie schon hier von Trinkerei und Lärm oder Gewalt gegen seine Frau gesprochen hat. Kein gutes Vorbild für seinen einzigen Sohn, unseren Vater. Später musste dessen Verlobte, unsere Mutter, sich vor ihrem Schwiegervater in Acht nehmen, weil er sie oft bedrängt und attackiert hat - einen aufrechten Charakter stelle ich mir anders vor.
Mein Vater hat Gürtler gelernt, ein Beruf, der schon lange verschwunden ist. Stolz hat er später erzählt, wie dabei äusserst exakt gearbeitet werden musste: Er hat Badewannenabläufe in die damaligen Badewannen montiert, also im Sanitärbereich gearbeitet. Später ist er in eine Firma gewechselt, die verschiedene Lampen hergestellt hat.
Seine spätere Frau hat er über den Fussball kennengelernt. Ihre Familie war im Fussballclub und hat die Spiele auf dem Platz regelmässig verfolgt. Meist war die ganze Familie dort: Vater, Mutter, vier Söhne und ihre Tochter Ideli. Mit ihnen hat er sich angefreundet und nach dem Spiel bei ihnen zu Hause feuchtfröhlich weitergebechert. Meine Mutter hat erzählt, dass schon getrunken worden sei, aber ihre Mutter war stark und hatte die Männer unter Kontrolle. Sie konnte das, weil der Vater von seinen Söhnen strikten Respekt gegenüber der Mutter gefordert habe, immer sei er zu ihr gestanden.
Meine Eltern haben früh geheiratet, schon hat sich ihr erstes Kind angemeldet, der kleine Fritzli, unser späterer Bruder. Die Eltern meines Vaters, Grossmutter und Grossvater, den ich nicht mehr gekannt habe, haben Fritzli zu sich genommen, bis er mit sieben Jahren in die Primarschule und in unsere Familie kam. - Damit schliesst sich ein Kreis.
Die Person hinter dem Alkoholnebel habe ich nicht gekannt, kaum geahnt, wie sie auch sein könnte. Erst als ich einige Jahre alt war, habe ich gemerkt, dass Vater an den Wochenenden ruhiger war: Jeweils am Samstagmorgen hat er sich in einem Buchladen Western ausgeliehen (In seinem Büchergestell standen rund dreissig Karl-May-Bücher, die er von seinem Vater oder Grossvater geerbt hatte, die ich in der Primarschulzeit zwei- bis dreimal durchgelesen habe!) und ist meistens ohne Umweg wieder heimgekehrt. Dann sehe ich ihn am Küchentisch am Lesen mit einem Bier vor sich. Sobald wir Mädchen lesen konnten, hat die Mutter uns mitgeschickt mit der Hoffnung auf einen direkten Heimweg, was tatsächlich meistens der Fall war. So haben Annemie und ich eine Wildwest-Serie für Kinder heimgebracht; die Geschichten und Figuren habe ich vergessen, ein Sheriff Watson kam darin vor. - Leider hat Vater am Nachmittag trotzdem oft nochmals seine Runden gedreht.
Am Sonntag hat er - während Mutter in der Predigt war - regelmässig ein feines Mittagessen zubereitet, mit Vorliebe Bohnen aus dem eigenen Garten, immer das Buch auf dem Küchentisch und daneben ein Bier oder das Weinglas. Am Sonntagnachmittag hat er wenn immer möglich mit Mama zusammen am Radio ein mitreissendes Fussballspiel verfolgt. Damit sind meine gemütlichsten und angenehmsten Erinnerungen daheim verbunden: Auf zwei zusammengeschobenen Stühlen habe ich mich unter dem Tisch hinter dem Tischtuch zusammengerollt und die friedlichen Stunden verdöst. Schon früh hatten wir einen Schwarz/Weiss-Fernseher, für dessen Kauf sich die Mutter eingesetzt hat, natürlich auch hier mit der Hoffnung, ihren Mann nach Hause zu locken. Tatsächlich war er etwas häufiger zu Hause, zumindest am Sonntag; die Fernsehprogramme waren aber noch sehr beschränkt, und TV gab es auch schon in den Beizen.
Im Rückblick sehe ich die angenehmen, freundlichen und sogar humorvollen Seiten unseres Vaters, eigentlich war er ein friedfertiger Mensch. Diese Momente haben mich jedoch eher provoziert, als ich älter wurde, und aufmüpfig gemacht. Für uns Kinder wogen die angespannten Abende während der Woche eben schwerer als die ruhigeren Wochenenden, zudem er ja oft am Samstagnachmittag nochmals loszog. Es war einfach peinlich, wenn wir ihn am Abend vom Fenster aus torkelnd aufs Haus zukommen sahen, manchmal brauchte er die ganze Strassenbreite - und die gesamte Nachbarschaft konnte ihm hinter den Vorhängen zuschauen!
Die Sonntage verbrachte er mit der Familie, lesend, kochend, Fussball hörend, hie und da unternahmen wir einen Ausflug zusammen. Selbst diese waren nicht stressfrei: immer warteten wir bereits im Treppenhaus auf ihn, bis er sich endlich entschliessen konnte, mitzukommen oder nicht. Meine Mutter war jeweils sehr stolz - wie sie mir später erzählt hat - mit der ganzen Familie demonstrativ vor der gesamten Nachbarschaft friedlich und geeint, wie jede normale Familie, zu einem Ausflug aufzubrechen. Nicht gerne ging ich aufs grosse Schiff, am Sonntag war es immer übervoll, wir mussten ruhig auf unserem Platz sitzen, sonst war dieser nachher weg, und die grossen Erwachsenen versperrten uns die Aussicht. Am liebsten besuchte ich einen Zoo oder Tiergarten, aber selbst hier war es stressig: nie konnte ich die Tiere solange beobachten, wie ich gerne gewollt hätte, immer war Vater schon wieder verschwunden und bereits weitergegangen, und wir mussten ihn zwischen den vielen Leuten suchen. Ich sehe noch, wie er manchmal gelacht hat, wenn er uns dabei zugeschaut hat. Am einfachsten war es, wenn er sich verabschiedet hat, er warte vorne im Restaurant. Noch am Bahnhof brauchte es Nerven: oft liess er einen, zwei oder sogar drei Züge am Bahnhofbuffet vorbeifahren, bevor wir in letzter Sekunde losrennend endlich einsteigen konnten. Das hat mich schnell sehr wütend gemacht.
Schliesslich wurde für mich die Luft neben meinem Vater so stickig, dass ich mit ihm in einem Raum allein kaum mehr atmen konnte und nur froh war, wenn meine Mutter wieder eintrat. Diese Situation hat mich bald aus dem Haus getrieben - doch war es in der damaligen Zeit noch nicht möglich, als alleinstehende Frau eine Wohnung zu mieten, nicht mal für ein unverheiratetes Paar!
Mit dem Abstand hat sich unser Verhältnis zunehmend entspannt. Als erstes erinnere ich mich an unser zufälliges, etwas verlegenes, aber doch längeres Gespräch vom Trottoir herauf zum Balkon in meiner neuen Wohnung. Schliesslich habe ich ihn heraufgebeten, ich hätte auch ein Bier für ihn.
Nein, nein, er müsse jetzt nach Hause. Ich habe ihm nachgeschaut, es war gut. - Später habe ich mir gesagt, dass seine Alkoholsucht eine Krankheit sei, und bin so von meinen Beschuldigungen und Vorwürfen weggekommen.
Wenige Jahre vor seiner Pensionierung sind die Eltern mit Annemie und Jonas den Berg hinaufgezogen. Meine Mutter war glücklich: freudig hat sie mir erzählt, wie Vater ihr erstmals strahlend und stolz eine noch verschlossene Lohntüte überreicht habe. Mit seinem Asthma hat er spät nachts den Heimweg den steilen Berg hinauf kaum mehr geschafft und musste deshalb den letzten Bus erwischen. Damit hat er seine bevorzugten Kumpels weniger oft angetroffen und ist immer früher heimgekehrt. Am neuen Ort hat er auch erstmals viel Freude und Befriedigung am eigenen Garten bekommen, weil ihn niemand mehr vom nahen Küchenfenster aus beobachtet hat. Zudem hatte er viel Freude an Jonas, seinem kleinen Enkel, der seit seiner Geburt bei den Grosseltern gelebt hat, und den beide sehr liebten. Die Grosseltern waren für ihren Enkel die besseren Eltern als für uns Töchter und Opa nach der Pensionierung der bessere Vater als viele andere Väter mit ihren langen Arbeitszeiten, denn sie waren den ganzen Tag für Jonas da.
Vater hat sich auch sonst gerne handwerklich betätigt, hat seinen grossen Keller immer in Schuss gehalten, im Wohnzimmer die Rückwand hinter dem Kachelofen neu gekachelt. Gerade bei dieser Winterarbeit hat sich seine ausgeprägte Psoriasis jedoch, wahrscheinlich zusammen mit einer Allergie auf den Baustoff, sehr verstärkt, so dass er sogar mit "kaltem" Fieber für einige Tage in die Dermatologie eingeliefert werden musste, wo er unter anderem mit Vollbädern therapiert worden ist. Auch im darauffolgenden Winter musste er sich dieser Therapie nochmals unterziehen. Im Sommerhalbjahr mit der Sonne im Garten waren diese Probleme viel geringer.
Mit Stolz hat er hier erstmals seine Lebensrettermedaille gezeigt: Als noch jüngerer Mann hat er beim Restaurant Seegarten beim damaligen alten Schiffssteg in Thalwil einen Mann aus dem Wasser gerettet. Überrascht habe ich davon erfahren und seine Silbermedaille im Schächtelchen auf dem roten Filz bewundert. Über das ganze Geschehen weiss ich nichts Genaueres, doch auch wenn es eine versoffene Geschichte gewesen sein sollte, hat er immerhin einem Menschen das Leben gerettet: darauf durfte er ganz sicher stolz sein. Gerne würde ich diese Ehrenmedaille nochmals sehen, vor allem die Jahreszahl darauf interessierte mich schon, aber niemand in der Familie weiss, wo sie ist.
Während Vater seinen Keller aufräumte - auch denjenigen des inzwischen verstorbenen Nachbarn -, hat ihn manchmal Kari dabei unterstützt. Dabei haben sie lebhaft miteinander diskutiert und Vater hat aus seinem Leben erzählt. Vieles, was ich aus seiner Vergangenheit weiss, habe ich von Kari erfahren. So ist Vater im Militär bei den Fahrradfahrern eingeteilt gewesen. Dieser Stosstrupp wurde eingesetzt, um mittelschwere Kampfmittel lautlos von Einsatzort zu Einsatzort zu transportieren.
Aus dieser Zeit stammt gemäss seinem Hausarzt sein vergrössertes Herz. Auf seine Velofahrerzeit im Militär schaute Vater mit Stolz zurück.
Ich erinnere mich, wie er jeweils seinen Felltornister gepackt hat und wir mitgeholfen haben, seinen Kaputt - den schweren langen Mantel - einzurollen, den er ganz präzise nach Vorschrift auf dem Tornister aufschnallen musste, wie auch alle weiteren Gegenstände wie Gamelle, Helm und Militärschuhe, Bajonett am Ceinturon (Gürtel) mit seinen vielen Patronentaschen, etc. an ihrem vorgeschriebenen Platz festgezurrt werden mussten, Karabiner über der Achsel. Nach dem Aktivdienst musste er noch bis in seine Fünfzigerjahre alle zwei Jahre einen Inspektionstag absolvieren - den er hasste, wie ich noch weiss.
Nach seinem Militärdienst hat Vater in einer Fahrrad-Kunstturnergruppe mit seinem eigenen schweren Militärvelo noch einige Jahre mitgemacht.
(Unsere Söhne hatten später Glück, dass sie bereits mit gut dreissig Jahren der Militärreform wegen aus dem Militär verabschiedet wurden. Uns allen war damals viel zu wenig oder gar nicht bewusst, in welch friedlicher und ruhiger Zeit wir hier in der Schweiz lebten - es war uns einfach selbstverständlich!)
Zunehmend hat ihn seine Atemnot immer mehr eingeschränkt, bis er sich schliesslich Anfang Sommer 1978 beim Hausarzt meldete. Das war noch ein Hausarzt, wie es früher üblich war, der die ganze Familie und ihre Geschichte gekannt hat. Dieser Arzt hat ihn für einen gründlichen Untersuch im Unispital angemeldet, wo dann Lungenkrebs diagnostiziert wurde. Lungenkrebs konnte mein Vater nicht akzeptieren, dieses Wort hat er nicht ein einziges Mal ausgesprochen, immer hat er die Krankheit als "Blume" beschrieben - ähnlich wie das Corona-Virus heute - wie es ihm der Onkologe erklärt hatte. Vielleicht hatte er seinen Arzt im Ohr, der ihn viele Jahre zuvor nach seiner Kur in Clavadel ermahnt hat, wenn er mit dem Rauchen aufhöre, werde sich seine Lunge wieder vollständig erholen.
Meine Mutter hat ihren Mann täglich im Spital besucht, meistens habe ich sie begleitet. Wir mussten akzeptieren, dass der Krebs weit fortgeschritten war: Während einem Untersuch ist Vater vor den Ärzten zusammengebrochen, worauf sie in seinem Hirn bereits Metastasen festgestellt haben. Nach den damals üblichen Therapien, die ich nicht mehr weiss, kehrte Vater euphorisch nach Hause zurück. Wenige Wochen nur hat dieser Zustand angedauert, nochmals hat er sich mit Elan im Haushalt eingesetzt, hat einen Riegel an einem Schränkchen geflickt, wollte dies und das noch erledigen. Sein Körper hat ihm signalisiert, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibe. Bald konnte er kaum mehr alleine aus dem Bett, ich habe ihn zu Hause besucht. Noch sehe ich seinen Blick, wie er mich ruhig anschaut und zu Mama sagt:
Sie ist eine treue Seele. Zweimal ist er in der Wohnung zusammengebrochen, meine Mutter musste bei den Nachbarn Hilfe holen, um ihn wieder ins Bett zu bringen; sie bekam starke Rückenschmerzen. Der Hausarzt hat die Situation erkannt und den Patienten ins Ortsspital einweisen lassen. Der schwerste Tag im Leben meines Vaters: Er wusste, das war ein Abschied für immer.
Auch für den dreizehnjährigen Jonas war es schmerzhaft, den kranken Opa zu sehen.
In der folgenden Zeit habe ich meine Mutter täglich ins Spital begleitet. Anschliessend haben wir in einem Café über die Situation gesprochen, wir brauchten das beide. Anfänglich konnten wir noch gut mit ihm sprechen, aber zunehmend musste ich mit dem Ohr an Vaters Mund für Mama dolmetschen, weil sie ihn nicht mehr verstehen konnte. Wollte er etwas genau wissen - so etwa:
Wie geht es den Wellensittichen? - hat er direkt mich gefragt, er hat gewusst, dass ich ehrlich und gradlinig antworte. Einmal nur ist kurz Fritz erschienen: Er steht am Fussende des Bettes seines Vaters und verkündet aufmunternd:
Kopf hoch, alles wird wieder gut! Vater hat ihn nur lange wortlos und ernst angeschaut. Fritz hat sich bald wieder verabschiedet.
Selbst wenn es schwer ist, ist es doch etwas vom Schönsten, einen Angehörigen am Schluss so eng begleiten zu können - für den Sterbenden wie die Zurückbleibenden. Es ist einfach, es braucht ja nur das Zuhören, das Eingehen auf seine Gedanken. Er hat auch hier vor allem sein Bier getrunken, allerdings nur noch alkoholfrei. Der Arzt hat uns ermahnt, der Patient müsse viel trinken, sonst müsste er ihn an Infusionen hängen, was dieser keinesfalls wollte. Vater hat ungläubig gemeint:
Mir hat in meinem ganzen Leben bisher noch niemand gesagt, dass ich mehr trinken müsse! Es kamen die Tage, da er mehr Morphium bekam und sich immer weniger klar ausdrücken konnte. In dieser Zeit spielten wir ihm einmal auf einem Musikbändchen ein Stück aus einer Ouvertüre von Rossini vor: Lebhaft stimmte er mit wackliger Stimme ein und versuchte einen Moment lang, mit den Händen dirigierend, mitzusingen, am folgenden Tag war die Begeisterung schon kleiner, am dritten Tag war nur noch Abwehr. Dann versank er in seiner Vergangenheit und musste noch einmal seine Kneipenzeit mit seinen damaligen Kumpanen durchleben: wir mussten die Diskussionen und Streitereien mitanhören, die sie zusammen führten, ohne diese richtig zu verstehen, manchmal war er aggressiv gegen uns, ohne uns zu erkennen. Dieser Kampf war jetzt schwierig, vor allem für meine Mutter; auch ich musste das erst verstehen, bevor ich es ihr erklären konnte, die Pflegerin hat uns mit ihrem Wissen stark unterstützt. Wir haben es "sein Fegefeuer" benannt. In diesen Tagen war unser nachträgliches Gespräch im Café besonders wichtig, weil für Mama die Verbindung zu ihrem Mann nun abgebrochen war und sein dunkler Kampf die letzten und besten Jahre ihres gemeinsamen Lebens zu überschatten drohte. Kurz darauf mussten die Medikamente nochmals erhöht werden und an einem späten Abend ist Vater - Mama war bei ihm - ruhig eingeschlafen.
Einmal habe ich in dieser Schlussphase den freundlichen ehemaligen Nachbarn getroffen, der auch einige - wahrscheinlich eher wenige - Stunden mit unserem Vater im Wirtshaus verbracht hat. Er hat sich nach ihm erkundigt, er habe ihn schon länger nicht mehr gesehen. Da habe ich ihm direkt und offen mitgeteilt, er läge mit Lungenkrebs im Krankenhaus: Der Nachbar ist erbleicht und hat erschrocken gefragt, ob er ihn besuchen könne. Darauf erklärte ich ihm, dass die Krankheit bereits weit fortgeschritten sei, der Vater schon so abgemagert, dass er - der Nachbar - ihn gar nicht mehr erkennen würde, Vater selber erkenne mittlerweile nicht mal mehr uns. Mit diesen Informationen musste ich den aufgewühlten Nachbarn zurücklassen.
In den Jahren zuvor habe ich meinen inneren Frieden mit dem Vater gemacht. Ich habe keine Vorwürfe mehr, es bleiben nur Trauer und ein grosses Bedauern, dass der Alkohol unsere Familie so zerstören konnte. Oben am Berg, als der Alkohol kaum mehr Auswirkungen zeigte und ich Vater nüchtern erlebte, sah ich einen grossen, schönen Mann: der Suff verwüstet jeden Menschen. Ich lernte einen freundlichen, humorvollen, intelligenten und fleissigen Menschen kennen, der auch offen für neue Gedanken war. Zweifellos haben ihn - zumindest früher, er hat sich manchmal nach einer schlimmen Nacht bei Mama entschuldigt - oft Schuldgefühle geplagt; er war ein Familienmensch, der seine Familie liebte, insbesondere seinen Enkel, und ein freundschaftliches Verhältnis zu seinem Schwiegersohn, meinem Mann Kari, pflegte - trotz seinen früheren Androhungen!
Es ist so unendlich schade um all die Gespräche, die nie geführt werden konnten! Ich kenne seine wirklichen Ansichten überhaupt nicht.
Einige Zeit nach seinem Tod habe ich öfters von Vater geträumt, Träume, die mir lange sehr präsent waren. Inzwischen sind sie verschwommen, aber einer zeigt noch immer deutlich die Entwicklung, die wir durchlebt haben: in einer Unterführung nähert sich mir von weitem mein Vater, ich gehe ihm sehr angespannt entgegen, doch je näher wir uns kommen, umso ruhiger werde ich, auf gleicher Höhe schauen wir uns an und gehen lächelnd und freundlich grüssend voller Frieden aneinander vorbei.
Meine Schwiegereltern
Seite 12
Seite 12 wird geladen
11.
Meine Schwiegereltern
Mein Schwiegervater Jakob (1907-1975) und meine Schwiegermutter Lina (1910-1985) kamen beide aus Bauernfamilien. Jakob ist eigentlich ein Bauernbub geblieben, hat entsprechende Ausbildungen auf den Landwirtschaftsschulen Strickhof und Arenenberg mit hervorragenden Leistungsausweisen gemacht. Gerne hätte er den Betrieb seines Vaters übernommen, aber mit ihm zusammenarbeiten wollte er nicht, er hatte modernere Ansichten von einer nachhaltigen Landwirtschaft. Als er Jahre später nochmals Gelegenheit für eine Hofübernahme gehabt hätte, hat seine Familie mit schon grösseren Kindern nicht mitgezogen.
Deshalb musste er auf andere Weise für den Lebensunterhalt seiner Familie sorgen. Als Knecht hat er bei Bauern gearbeitet, später als Hilfsarbeiter in einer Molkerei und hat dort die Milch als Milchmann auch an die Haushalte verteilt. Jahre später ist die noch kleine Familie an den Zürichsee gezogen und Jakob hat in einer Seidenstrangfärberei gearbeitet, wo die Seidenstränge in einem Zinnschlammbad beschwert worden sind und der Zinnschlamm anschliessend im Ofen getrocknet worden ist.
Hier am Zürisee hatte Jakob viel Garten an verschiedenen Plätzen, in denen später auch Kari tüchtig mithelfen musste, wie er oft erzählt hat. Damit hat er die Familie mit Kartoffeln, Gemüse, Früchten und Beeren versorgt, was besonders in der Zeit des Krieges sehr wichtig gewesen ist. Auch bei nahen Bauernbetrieben hat er in Randstunden und am Wochenende auf dem Hof mitgearbeitet, die Kühe gemolken und die Bauern mit guten Ratschlägen zu besseren Ernteergebnissen gebracht; als Lohn hat er auch hier Gemüse und Obst bekommen.
Im Aktivdienst wäre Jakob sicher gerne zu den Trainsoldaten eingeteilt worden, er hat seine Dienstzeit jedoch als Festungskanonier im Gotthardmassiv abgedient.
Jährlich hat er auf einer Holzgant Lose gekauft, um das im Staatswald am Albis reservierte Holz abzuholen. Dieses Holz musste erst mit einem von einem Bauern geliehenen Pferdefuhrwerk nach Hause geschafft werden, um dann in ofengerechte Bürdeli gehackt zu werden: eine mit viel schwerer Arbeit verbundene Holzbeschaffung, bei der später auch die Söhne mithelfen mussten. Damals in Kriegs- und Nachkriegszeiten waren die Wälder sauber geputzt, viele sind mit ihren Leiterwagen durch den Wald gestreift und haben Holz und Tannzapfen gesammelt, weil alle noch mit Holz geheizt haben.
In der Kriegs- und Nachkriegszeit haben Kari und seine Geschwister nach der Getreideernte auf dem Feld des Bauern die noch auf dem Acker verbliebenen Ähren aufgesammelt, wobei sie sehr aufmerksam barfuss über das Stoppelfeld geschlurft sind, um Kratzwunden an ihren Füssen zu vermeiden. Nach dem Dreschen wurden die privat eingesammelten Getreidekörner der Müllerei zum Mahlen gebracht, das Mehl anschliessend zum Bäcker, der dieses auf Wunsch auch zu Brot gebacken hat. - Diese Informationen über das Bauernleben habe ich alle von Kari erhalten.
Als Jakob älter geworden ist, wurde ihm die Arbeit mit dem Zinnschlamm schaufeln zu streng, er hat auf Nachtwächter gewechselt und in der gleichen Fabrik nachts seine Runden gedreht. Diese Umstellung des Tag- und Nachtrhythmus in den letzten Jahren hat ihm gesundheitlich geschadet: mit nur 68 Jahren ist er an einem Herzinfarkt gestorben.
Lina und ihre beiden Schwestern haben ihre Mutter sehr früh verloren, sie waren erst drei bis sechs Jahre alt. Während das Schicksal mit Marie und Trudi gnädiger war und sie vom Waisenamt zusammen zu Privatleuten geschickt wurden, wurde Lina auf einen Bauernhof gebracht, wo sie als billige Arbeitskraft ausgenützt ein trauriges Dasein als Verdingkind erleben musste, das sie für das ganze Leben geprägt hat.
Als junges Mädchen durfte Lina in Saas Fee in einem Hotel eine Ausbildung an der Reception machen, wo sie auch Französisch gelernt hat. Wie sich Lina und Jakob kennengelernt haben, weiss heute niemand mehr.
Jakob und Lina haben vier Kinder bekommen, zuerst ein Zwillingspärchen, Marlies und Kari, nach sieben Jahren kam Kurt und nach weiteren drei Jahren die Nachzüglerin Edith. Edith hat zeitlebens darunter gelitten, dass ihre Mutter unverblümt herumerzählt hat, wie unerwünscht dieses letzte Kind - dann noch ein Mädchen! - gewesen sei. Dafür war Edith der Liebling des Vaters, zu ihm hatte sie immer eine schöne Beziehung, das mag einen Teil der Enttäuschung etwas erträglicher gemacht haben. Auf langen Spaziergängen hat der Vater seinen Kindern die Pflanzen der Wiesen und Felder und die Bäume des Waldes erklärt. Auch das hat zu einer bleibenden schönen Erinnerung geführt.
Marlies hat geheiratet und zwei Mädchen und einen Sohn bekommen. Sie ist nach späterer schwerer Enttäuschung in Krankheit und Dunkelheit versunken und mit nur 69 Jahren nach einer Operation gestorben.
Kurt hat ebenfalls geheiratet und zwei Töchter bekommen und später ein Enkeltöchterchen.
So war auch Edith verheiratet und hat ein Mädchen und einen Sohn bekommen. Der Sohn ist später in die USA ausgewandert, hat dort eine Amerikanerin geheiratet und sie haben zwei Mädchen bekommen. Die Tochter hat Edith zwei Enkelinnen beschert. Edith selber hat sich später scheiden lassen und ist allein geblieben.
Lina hat neben der Hausarbeit ebenso wie Jakob bei den verschiedenen benachbarten Bauern Gemüse geputzt, um das Familienauskommen mit Naturalien aufzubessern.
Jakob hat seine Verwandtschaft sehr ernst genommen und alle Angehörigen mindestens einmal jährlich besucht. Damit hat er Einblick in die verschiedensten Familiensituationen gehabt. Wenige Male waren Kari und ich dabei, als wir noch keine Kinder hatten; so einmal auch auf dem Hof der Pflegeeltern von Lina: aber ich kenne alle diese Menschen nicht, sie sind mir weit weg, die Geschichten dazu habe ich auch erst später erfahren, inzwischen sind alle gestorben.
So hat Jakob auch regelmässig einen Hof im Nachbarort besucht, bei dem sein halbwüchsiger Neffe als Verdingbub gearbeitet hat, nachdem seine Mutter Marie sich nach gewalttätiger Ehe scheiden liess. Dieser Neffe hatte offenbar Vertrauen zu seinem Onkel gefasst und ist eines Tages verzweifelt bei ihm zu Hause aufgetaucht, weil er wieder einmal misshandelt worden war. Jakob hat den Neffen zurückbegleitet und dem Bauern tüchtig die Kappe gewaschen, worauf sich dieser fortan anständig benommen hat, der Respekt und die nachbarschaftliche Nähe hat wohl gewirkt.
Es ist erschreckend, wie viel Gewalt überall geherrscht hat (von der man auch heute in Corona-Zeiten allgemein wieder vermehrt hört), ausgelöst oder verstärkt meistens durch Alkoholismus. So haben Jakob und Lina auch gewusst, dass eine Nachbarin von ihrem Mann äusserst schlecht behandelt wurde. Eines Morgens haben sie diese mit einem herausgeschlagenen Auge getroffen: Ihr rasender Mann hat ihr einen Arbeitsschuh ins Gesicht geschleudert und dabei das Auge ausgeschlagen. Nach aussen hat sie erklärt, sie sei die Treppe hinuntergestürzt, nur Jakob und Lina hat sie ihre Geschichte anvertraut. Ihr Auge war verloren.
Eines Tages kam über Mittag ein Telefon von Edith: Der Vater liege tot hinter der Badezimmertür, Kari soll bitte sofort vorbeikommen. Kari hat diese Aufgabe übernommen. Nach Jakobs Tod hat Lina ihren Lebensmut immer mehr und schneller verloren. Sie hat ihren Mann zwar um zehn Jahre überlebt, dabei ist sie aber zunehmend in Apathie und Dunkelheit abgeglitten, die letzten Monate hat sie in einem Spital verbracht.
Ich selber hatte immer einen freundlichen, aber keinen engen Kontakt zu den Schwiegereltern: es war auch meine schwierige Zeit, während der ich die Kinder gerne Kari überliess und mich ins Bett verkroch.
Mit Kurt sind Kari und ich als junge Leute samstags oder sonntags sehr oft zusammen ins Kino gegangen; Edith und ich haben Jahre später regelmässig im Herbst unvergessliche Wanderferien zusammen erlebt.
Kari und Kurt treffen sich heute noch sehr häufig, hie und da gibt's auch einen Familientreff mit Edith.
Meine Mutter
Seite 13
Seite 13 wird geladen
12.
Meine Mutter
(1912-2011)
Nach dem Tod meines Vaters hat Mutter (jetzt 66) lange um ihn getrauert; er hat sie in ihren besten Jahren verlassen. Glücklicherweise hatte sie nun ihre Pfingstgemeinde, bei der Mutter ja schon ewig dabei war; sie war hochgeschätzt und geachtet, war bibelfest und konnte manche Bibelstellen zitieren, ihre dicke Bibel mit vielen Notizen darin lag immer neben ihr. Die Leitung der Gemeinde war schon vor einiger Zeit in jüngere Hände übergegangen; jetzt hat ein erneuter Predigerwechsel stattgefunden. Mit dem Neuen hat sie sich noch besser verstanden. Mit ihm hat sich ihre strikte, fundamentale Sichtweise gar ein kleines bisschen gelockert: nicht dass die Bibel nicht mehr Recht gehabt hätte! Das dann nicht, aber um neue Mitglieder zu gewinnen, galt es, das starre Bild der Evangelikalen ein wenig zu mildern; sogar der Name wurde geändert auf das nicht vorbelastete "Christliches Zentrum". Dazu hat der neue Prediger ein ausgedehnteres Weltbild: er hat mit seiner Frau, einer US-Amerikanerin, vorher in den USA gelebt, auch in New Orleans, gerade zu der Zeit, als der Wirbelsturm Katrina den Ort verwüstete; weil sie auf einer Anhöhe wohnten, blieben sie verschont.
Doch, doch, Mutter war schon ziemlich festgelegt: So besass sie zwei Zimmerpflanzen nur wegen ihren geheiligten Namen: einen Christusdorn und einen Weihnachtskaktus! Den grossen, zerzausten Stachligen habe ich nach ihrem Tod entsorgt, der Weihnachtskaktus blüht noch immer jeden Winter bei mir. - Einmal habe ich ihr zu Weihachten eine Freude gemacht mit einer trockenen "Rose von Jericho", die wir jedes Jahr für einige Monate ins Wasser gelegt haben.
Jetzt wo Mama alleine war, noch mit Jonas und Annemie zusammenlebte, und ihr mehr Zeit zur Verfügung stand, ist sie in den Vorstand aufgenommen worden und wurde beauftragt, eine Frauengruppe zu organisieren, die sich wöchentlich an einem Nachmittag bei ihr zu Hause zur Unterweisung getroffen hat. Mit Begeisterung hat sie diese Gruppe geleitet, sie war gerne "Lehrerin". Der neue Prediger hat sie zudem, nachdem sie in eine Alterswohnung umgezogen ist, regelmässig einmal in der Woche besucht. Diese Besuche wurden ihr so wichtig, dass sie sogar die jeden Herbst um den Todestag ihres Mannes herum auftauchenden Depressionen überwinden konnte. Darum war ich natürlich sehr froh. Mit diesen herausfordernden Aufgaben ist sie richtig aufgeblüht und hat einen ganz neuen, den dritten Lebensabschnitt begonnen. Die Frauengruppe hat sie, mit Unterstützung in den letzten Jahren von ihren Frauen für den Kaffee und das Geschirr, noch fast dreissig Jahre lang geführt.
Nach ihrem Tod habe ich mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass sie erst im 1994 aus der evangelisch-reformierten Landeskirche ausgetreten ist, offenbar damals, als sie in den Vorstand der Pfingstgemeinde gewählt worden ist.
Bald nachdem Jonas geheiratet hat und in die nahe Stadt gezogen ist, haben sich Annemie und Mama auch neu orientiert: Die Wohnung war alt und renovationsbedürftig, der Besitzer hatte während Jahrzehnten nichts daran ausgebessert, dazu musste noch in jedem Zimmer in einem Ofen mühsam selber geheizt werden. Auch der Garten bereitete Mutter mehr Arbeit als Freude. So ist die Schwester ebenfalls in die Stadt gezogen, nur einige Tramstationen von Jonas Familie entfernt; sie hat sich entschieden, alleine zu bleiben. Mama konnte im Dorfkern eine schöne Alterswohnung in der Siedlung einer Baugenossenschafts-Stiftung beziehen. Einziger Wermutstropfen war, dass sie die wunderbare Aussicht von ihrer obersten Wohnung über den ganzen See und in die Berge verloren und noch eine ganze Weile vermisst hat.
Seitdem Mutter alleine lebte, habe ich mich vermehrt um sie gekümmert, ich war jetzt am nächsten. Schon immer haben wir häufig miteinander telefoniert, regelmässig hat sie mich zuerst gefragt:
Wie geht es dir? Darauf habe ich von mir gesprochen, erzählt und wahrscheinlich gejammert, bis sie mir bald unweigerlich mit ihren Heilserfahrungen helfen wollte, die mich jedoch genauso regelmässig verstummen liessen; vorläufig war ich noch blockiert wie als kleines Mädchen, über ihre religiösen Themen konnte ich einfach nicht reden. Doch eines Tages habe ich auf ihre erste Frage geantwortet:
Gut. Einige Sekunden überraschte Stille, dann die vorsichtige Rückfrage:
Gut? Auf meine Bejahung wieder Stille, bestimmt hat sie ein tiefes Dankesgebet zum Himmel geschickt. Da erst ist mir meine Jammerei bewusst geworden, offenbar habe ich endlich für mich einen Schritt vorwärts getan.
Dann musste ich sie zum ersten Mal zum Arzt begleiten, weil sie sich alleine zu schwach dazu fühlte: Nach Divertikulitis waren ihre Blutwerte viel zu hoch, nach einigen Kontrollen dann in Ordnung, aber die Nierenwerte seien noch sehr schlecht. Nierenwerte? Das war mir neu, aber Mutter kam einfach nicht richtig auf die Beine. Im August haben wir mit der ganzen Familie ihren 90. Geburtstag gefeiert, gut erinnere ich mich noch an die versalzene Rösti. Hat diese ihr womöglich den Rest gegeben? Auf jeden Fall ist sie bald darauf kaum noch aus dem Bett gekommen, es ging ihr nicht gut, ich habe ihr beim Duschen geholfen. Der Arzt, leider nicht mehr der frühere Hausarzt, musste gerufen werden, der wollte sie ins Spital einweisen lassen, aber sie wollte nicht. Täglich war ich nun nach meiner Teilzeitarbeit bei Mutter; es wollte ihr einfach nicht besser gehen, ihr Blutdruck verharrte tief im Keller. Die Verantwortung hat mich fast erdrückt: Ich musste die kranke Mutter alleine in ihrem Bett zurücklassen, wenn ich spätabends wieder nach Hause eilte, nur weil sie sich weigerte, ins Spital zu gehen. Der böse Gedanke ist aufgetaucht:
Ich mache mehr für sie als sie seinerzeit für mich und nur, weil sie so stur ist. Nie würde ich meinen Kindern eine solche Last aufbürden: Eltern sind für die Kinder da, wenn die Kinder ihre Eltern später unterstützen, umso schöner, aber es muss freiwillig sein, ich darf es nicht verlangen - so denke ich. Selbstverständlich haben uns unsere Söhne in praktischen Dingen auch wiederholt unterstützt, so wie man sich gegenseitig eben hilft.
Eines Tages wollte Mama einfach wieder aufstehen und hat ein starkes Medikament geschluckt, das mir der Arzt überreich hatte:
Davon darf sie bis zu vier Stück pro Tag einnehmen. Doch schon nach der ersten Pille wurde ihr so übel, dass ich alarmiert dem Arzt telefonierte: Wir sollten sofort in die Praxis kommen (mit dem Taxi, wir hatten nie ein Auto), er werde sie im Krankenhaus anmelden. Mühsames Ankleiden und mit der Brechtüte zum Arzt - sie hat im Auto gewartet, während ich Papiere bei ihm abholte; auf meine Beschreibung ihres Zustandes meinte er:
Ist es schon so weit? - und ins Spital: Dort wurde bereits ein Nierenstillstand (Urämie) festgestellt; die Ärzte brauchten vierundzwanzig Stunden, bis die Nieren wieder zu arbeiten begannen. Der Nierenspezialist war entsetzt über Mutters Medikamente, die ich ihm vorgelegt habe: Alle waren ungeeignet für Nierenpatienten, vor allem das letztmals eingenommene starke Medikament V sei so giftig, das dürfte eigentlich gar nicht im Handel erscheinen. Er hat uns empfohlen, den Arzt zu wechseln, wenn wir mit dem bisherigen nicht zufrieden seien. Das haben wir - nach anschliessender vierwöchiger Kur - auch gemacht und einen anerkannten Nierenspezialisten am Wohnort gefunden. Der hat Mutters Medikamente so perfekt eingestellt, dass sie noch mehr als acht Jahre mit ihrer bleibenden Nierenschwäche gut leben konnte. Einmal im Monat habe ich sie zur Blutkontrolle begleitet; auf die Frage des Arztes zu ihrem Befinden hat sie oft geantwortet:
Gut, mein Mundwerk läuft noch! Noch an eine Episode erinnere ich mich: Mama hatte Probleme mit einem Auge nach einer Katarakt-OP vor einiger Zeit bei einer schlechtbeleumdeten Augenärztin. Ihr Nierenarzt hat uns einen anderen Augenarzt empfohlen. Der konnte ihr helfen, musste das andere Auge jedoch ebenfalls operieren, aber "tiefer" als ein normaler Katarakt: Augen sind sehr kompliziert. Am Abend nach der OP im Spital, als ich sie abholen wollte, hat ihr die Pflegerin dringend empfohlen, die Nacht über im Spital zu bleiben, sie dürfe nicht alleine sein, sie müsse regelmässig Augentropfen eingeben. So habe ich ihr auch ganz eindringlich erklärt, ich würde nach Hause gehen zum Schlafen, am anderen Morgen musste ich zur Arbeit. Was ist so schlimm daran, eine Nacht im Spital zu verbringen, wenn man denn schon da ist? Erst noch, weil sie am Morgen darauf nochmals vom Arzt kontrolliert werden musste. Sie könne hier nicht schlafen, wandte sie ein: auch das ist für einmal doch nicht schlimm. Aber sie wollte nicht und hat eigenwillig durchgesetzt, dass wir sie nach Hause brachten. Zu Hause habe ich ihr gezeigt, wie sie die Tröpfchen eingeben müsse, habe schon gesehen, wie unwillig und umständlich sie tat. Aber spät in der Nacht nach einer letzten Eingabe bin ich trotzig nach Hause gegangen, wie ich es ihr vorausgesagt hatte!
Am frühen Morgen darauf dann das Desaster: Mama ging es sehr schlecht, sie hatte so unsägliche Kopfschmerzen, dass sie sich dauernd erbrach. Mühsames Anziehen, den Arzttermin hinausschieben, mit der Brechtüte im Auto des Sohnes in die Praxis des Augenarztes fahren. Kari hat mich bei meinem Arbeitgeber entschuldigt. Wie wurde der Arzt beim Befund dann wütend und hat richtig mit ihr geschimpft: möglicherweise habe sie mit ihrem Verhalten die ganze OP aufs Spiel gesetzt! Nervös hat er ihr Auge untersucht, ihr Tröpfchen und Medikamente verabreicht, und das Auge - nach ein paar Konsultationen - schliesslich wieder in Ordnung gebracht. Anschliessend Fahrt ins Spital, um Medikamente abzuholen ... An diesem Tag habe ich der Mutter Vorwürfe statt Mitleid entgegengebracht, ihr die Plagen insgeheim sogar fast ein wenig gegönnt: Alle haben es ihr gesagt und sie gewarnt!
Umso schneller hat sie später ihr Hörgerät akzeptiert und konnte bald problemlos damit umgehen: weil ihr das wichtig war! Sie wollte ihre Frauen in der Gruppe richtig verstehen und sich mit ihnen austauschen können.
Schnell hat sich Mutter in ihrer neuen Wohnung eingelebt und wohl gefühlt. Sie wurde auch von ihrem vorzeitig pensionierten Schwiegersohn sehr verwöhnt: Nur ein Telefon, Kari hat sich auf sein Moped geschwungen und ist eine Viertelstunde später vor ihrer Tür gestanden. Nach seiner Hilfeleistung haben sie meistens noch länger angeregt miteinander geplaudert. Ihm ist es nie schwer gefallen, mit ihr zu diskutieren, auch wenn sie ihm ihre religiösen Betrachtungen vermitteln wollte, da hatte er keine Hemmnisse, eben auch keine negativen Erfahrungen.
Natürlich war mir sehr recht, dass die beiden ein so gutes Verhältnis zueinander hatten, das entlastete mich auch. Schon seit Beginn ihres Kennenlernens hat mich jedoch massiv irritiert, wie Mutter sich mit ihm so unbekümmert austauschen konnte und mit mir nie. Frustriert habe ich ihr schliesslich, endlich, erklärt, wie sie mich jedes Mal blockiert, sobald sie mich mit ihrem Glauben konfrontiert, dass ich deshalb nie so mit ihr sprechen konnte, wie ich gerne gewollt hätte. Überrascht hat sie mir zugehört, das war neu für sie und schwierig: Sie musste sich umstellen, ist hie und da noch ins alte Muster zurückgefallen, aber bald konnten wir freier miteinander reden. Nur ganz selten hat sie noch eingeflochten:
Jetzt muss ich kurz aber etwas sagen ... und hat eine entsprechende Heilserfahrung beigetragen, die ich grosszügig überlebt habe, mit der Zeit bin ich auch toleranter geworden.
Auf meine Fragen hat sie jetzt vor allem über ihre Herkunft und Vergangenheit gesprochen, von der ich bisher nicht viel wusste. Mama ist unten am See als Drittgeborene mit vier Brüdern aufgewachsen. Ihre Eltern haben einige Jahre lang die alte Holzbadeanstalt geführt, an die ich mich sogar erinnere: an die düsteren Holzkabinen mit einer Bank darin, die Holzdielen, die Holztreppe innerhalb der Hütte ins Wasser hinunter, den äusseren Schwimmbereich, der durch eine hohe Wand vom Männerabteil abgetrennt war. Auf einem langen Holzbrett liegend, sind wir herumgepaddelt, schwimmen konnte ich damals noch nicht. Ich war nur wenige Male in dieser Holzbadi: 1950 ist sie abgerissen worden. - Ideli war eine Wasserratte, immer braungebrannt, und ist einmal ganz alleine über den See geschwommen, hin und zurück, was viel Aufregung ausgelöst hat, weil sie unterdessen vermisst worden war. Sie wollte den See gar nicht überqueren, ist einfach hinausgeschwommen, geschwommen und geschwommen ... Auf dem Rückweg wurde sie dann von Angst gepackt, weil in der Ferne ein Dampfschiff aufgetaucht ist, und sie nicht mehr wusste, ob sie vor oder zurück schwimmen sollte. Den See hat sie nie mehr schwimmend überquert.
Ihr Vater war im Fussballclub, meistens hat die ganze Familie die Spiele besucht. Damals hat sie ihren zukünftigen Mann kennengelernt, der nach den Spielen oft mit der Familie zusammensass und mit ihr gefeiert hat. Das ist jedoch nie überbordet, weil ihre Mutter die Familie mit starkem Rückhalt durch ihren Mann geführt hat; er hat von den Söhnen strikten Respekt für die Mutter gefordert: Mama hat mehrmals erwähnt, wie stark ihre Eltern zusammengehalten hätten.
Auch meine Mutter hat als junges Mädchen die Attacke eines Onkels erlebt: Er ist eines Nachts durch ihr Schlafzimmerfenster im untersten Stock eingestiegen und wollte sie vergewaltigen. Auf ihr Schreien hin sind ihre Eltern glücklicherweise aus dem Nebenzimmer zu ihr gerannt und haben den Eindringling, einen Bruder des Vaters, gestellt. Die Eltern haben darauf die Schlafzimmer getauscht und selber das äussere Zimmer bezogen.
Dann - am 16. August 1931 - braute sich ein heftiger Sturm zusammen: Ein Jubiläum des Fussballclubs sollte am gegenüberliegenden Ufer gefeiert werden. Eine Gruppe war bereits drüben, mit einem zweiten Boot sollten die restlichen Teilnehmer übergesetzt werden. Dieses Boot war bereits vor der Abfahrt mit angeheiterten Männern überbelegt und lag tief im Wasser. Auch Mamas Mutter befand sich darin und hat angstvoll mehrmals nach ihrer Tochter gerufen:
Ideli! Ideli! Komm zu mir! Lass mich nicht allein! Ihre Mutter konnte nicht schwimmen und hat sich vor dem stürmischen Wind und dem bereits aufgewühlten See gefürchtet, sich am Bootsrand festgeklammert - und ist nicht ausgestiegen. Ihre Tochter hat sich geweigert, nein, in das überfüllte Boot steige sie nicht ein. Vielleicht wollte sie der Mutter noch aus dem Boot helfen, aber der Bootsführer hat zur Abfahrt gedrängt, er wollte vor Ausbruch des Gewitters das andere Ufer erreichen, und trotz bereits hohen Wellen und dunklen Wolken am Himmel hat das Boot abgelegt. Das andere Ufer haben sie nicht mehr erreicht ...
Eine Sturmwarnung, gesteuert vom Flughafen Kloten aus, gibt es erst seit den 50ern, hätte diese feiertrunkenen Männer auch kaum von der Überfahrt abgehalten.
Am frühen Morgen der folgenden Nacht hat der Vater Ideli aus dem Schlaf gerissen:
Mutter kommt nicht mehr nach Hause, sie ist ertrunken und du bist schuld daran!!! Mir ist der Atem gestockt, als Mama mir das erzählt hat: ruhig, bedrückt und melancholisch. Wie wird man mit solchen Vorwürfen fertig? Wie weiterleben mit einem solchen Grauen? Eine Schuldfrage für Mama hat sich mir nie gestellt, ich war einfach entsetzt über die Vorwürfe ihres Vaters.
Die letzten Hilferufe der Mutter nach ihrer Tochter Ideli müssen sie jedoch verfolgt haben! Vielleicht haben diese sich, je nach Situation vor dem Ablegen des Schiffes, zusammen mit Vaters Vorwürfen doch zu schwerer Schuld vermischt - sie hätte nicht nur den so fahrlässig verursachten Ertrinkungstod ihrer Mutter, sondern auch und vor allem ihre eigene Schuld tragen müssen. Das Ausmass dieser entsetzlichen Sichtweise ist mir erst heute beim Schreiben voll aufgegangen und hat meine ganze eigene Vergangenheit in ihren Grundfesten verschoben.
Viele Jahrzehnte nach dem Unfall konnte Mama darüber mit ihrem Prediger sprechen, mit intensiven gemeinsamen Gesprächen und Gebeten vermochte er sie zu entlasten. In ihren letzten Lebensjahren ist sie dank dieses Seelsorgers immer freier und heiterer geworden.
Die Untersuchungen des Unfalls haben ergeben: Der heftige Sturm ist losgebrochen, bevor das Boot das Ufer erreicht hatte. Der Bootsführer, gleichzeitig Eigentümer des Motorbootes, hat beim Näherkommen am anderen Ufer aus Angst, sein Schiff könnte von den tosenden Wellen an die Ufermauer geschleudert werden und zerschellen, den Motor ausgeschaltet! Damit war das führerlose, tiefliegende Boot im tobenden Wasser dem Inferno völlig ausgeliefert, hat sich in die Wellen gelegt und ist vom hohen Wellengang überrollt worden. Die Insassen haben sich in ihrer Todesangst aneinandergeklammert; vielleicht konnte einer schwimmen, was damals noch nicht viele konnten. Später sind mehrere Personen in einem grossen Knäuel zusammen aus dem Wasser geborgen worden, sie haben sich gegenseitig nach unten gezogen. In dermassen aufgewühltem See kann auch ein guter Schwimmer alleine kaum länger überleben. Mamas Mutter wurde einzeln ein wenig abgesondert gefunden; wahrscheinlich hat sie in ihrer Todesangst, noch festgekrallt am Bootsrand, einen Herztod erlitten. Ob jemand gerettet werden konnte, weiss ich nicht.
Nach dieser Tragödie ist die Familie auseinandergebrochen. Ideli hat die Rolle der Mutter im Haushalt übernommen, aber ohne Rückhalt durch den Vater. Er und die jungen Männer sind immer mehr dem Alkohol verfallen, sind verwahrlost und haben Ideli jeweils eine verwüstete Küche hinterlassen. Sie konnte sich nicht durchsetzen:
Du hast gar nichts zu sagen. Sie hat den Dreck weggeputzt und sich Fritz zugewendet, der sich für sie interessierte und immerhin noch "der Beste" von allen war.
Einige Zeit später ist der Vater mit seinen Söhnen aufgebrochen: Zu Fuss wollten sie nach Russland marschieren und sich Lenin anschliessen. An der österreichischen Grenze sind sie aufgegriffen und zurück nach Hause spediert worden.
Darauf hat sich der älteste Sohn, Gottlieb, in die französische Fremdenlegion verabschiedet, ist nach einigen Jahren kurz aufgetaucht und dann ganz verschwunden. Die Reisläuferei war schon damals in der Schweiz verboten, die Legionäre mussten die Namen beim Eintritt in die fremde Armee ändern, um Nachforschungen auszuschalten. Die französische Fremdenlegion hält bis heute ihre Archive unter Verschluss. Der Zeitpunkt der Todeserklärung ist nicht festgehalten, respektive bis heute nicht nachgeforscht.
Vom zweiten Sohn, Heinrich oder Hangerie vom französischen Henri, existiert ein Bild von Weihnachten 1973 (geb. 1906), kurz vor seinem Tod; wie er gelebt hat, weiss ich nicht.
Ruedi, der jüngste Sohn, hat sich später aufgefangen, geheiratet und einen Sohn bekommen; diese Familie haben wir nur wenige Male getroffen, Mama hatte selten Kontakt zu ihr, Ruedi hat immer gegen ihren Glauben gestänkert.
Am meisten hat Ideli sich um ihren Lieblingsbruder Köbi gesorgt, der zweitjüngste und sensibelste ihrer Brüder; er ist zum starken Trinker und Raucher geworden.
Ideli und Fritz haben geheiratet und der kleine Fritzli wurde geboren. Mutter musste auch arbeiten, deshalb wurde Fritzli schon bald von den Grosseltern väterlicherseits betreut. Sie hat bei verschiedenen Arbeitgebern gearbeitet, bevor sie in die Textilfabrik eingetreten ist, wo sie zur Akkordnäherin befördert worden ist.
In diesem Nähsaal hat sie Helene kennengelernt, beide sind Freundinnen geworden und haben sich gegenseitig ihre Lebensgeschichten ausgetauscht. Helene hat ihrer Freundin erzählt, wie sie Hilfe gefunden hat in ihren Nöten, und sie in ihre Glaubensgemeinschaft eingeladen. Offenbar hat Ideli diese Atmosphäre schnell angesprochen, sie hat sich "bekehrt", hat Jesus und damit "Erlösung von ihrer Schuld" gefunden.
Diese Befreiung und Erlösung würde Ideli so gerne auch ihrem Bruder Köbi, um den sie sich so sorgte, vermitteln. Helene war bereit, den jungen Mann kennenzulernen. Beim ersten Treffen lehnte sie ihn kategorisch ab: Solange er trinke und rauche, wolle sie ihn nicht wieder sehen. Die Schwester hat ihrem Bruder zugeredet und ihn dazu gebracht, sie verschiedentlich in die Versammlungen zu begleiten. Offenbar hat es zwischen ihm und Helen gefunkt, Köbi wurde zum abstinenten, seriösen jungen Mann und hat auch bald seine religiöse Bekehrung und "Wiedergeburt" erlebt.
Auch Helene hatte eine schwierige Vergangenheit: Als junges Mädchen ist sie in ihrer Familie in Deutschland vom Vater vergewaltigt und schwanger geworden. Noch vor dem zweiten Weltkrieg kam sie zu Verwandten in die Schweiz, wo sie ihr Kind geboren hat, das zur Adoption freigegeben worden ist; unter dieser Schuld hat sie schwer gelitten. Den Jungen hat sie später in Krefeld einmal getroffen, es soll jedoch keine befriedigende Beziehung entstanden sein: über Helens Geschichte weiss ich wenig, sie wurde Ideli mit der Bitte um Verschwiegenheit anvertraut. Mama hat erst nach Helens Tod vage darüber gesprochen. - Köbi und Helene haben geheiratet und sind an den Bodensee gezogen; er hat bis zu seiner Pensionierung in einer nahen Lederfabrik als Färber gearbeitet. Helene blieb Hausfrau und hat zeitweise Kinder betreut; wenn immer möglich war das eng verbundene Ehepaar gemeinsam unterwegs. Gerne hätten sie eigene Kinder gehabt, aber das wurde ihnen versagt. - Nachträglich verstehe ich die starke Bindung von Mama zu den beiden viel besser.
Jahre später ist Mamas Vater krank geworden und irgendwann haben meine Eltern ihn, trotz der belasteten Vergangenheit, zu sich genommen; Mama hat ihn bis zu seinem Tod durch Nierenversagen mit viel Aufopferung gepflegt. Ob Nierenschwäche eine familiäre Veranlagung ist? Mutter hat sich diese Frage nie gestellt, hat Vaters Krankheit seinem Alkoholkonsum zugeschrieben. Vielleicht hat diese Disposition ja, zusammen mit ihren später ungeeigneten Medikamenten, zu ihrer eigenen Nierenerkrankung geführt. Sie wusste selber nicht genau, wozu sie diese Medikamente von ihrem ersten Arzt überhaupt brauchte. Das beobachte ich auch heute oft bei älteren Menschen, dass sie Medikamente einnehmen, ohne zu wissen, wozu diese dienen sollen. Das kann ich nicht nachvollziehen.
Von den jetzt chronologisch zusammengefügten Erlebnissen habe ich natürlich erst in vielen Gesprächen über die Jahre von Mama erfahren. Dabei ist mir immer klarer geworden, wie enorm wichtig der unerschütterliche Glaube, die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten und die seelsorgerische Unterstützung durch einen guten Prediger für sie war, was ihr das bedeuten musste.
Noch einige Splitter: Als ganz junge Ehefrau hat sie sich eines Abends verfolgt gefühlt, ist mit schnellen Schritten vor einem Mann geflüchtet, bis sich der Verfolger schliesslich lachend als ihr Ehemann zu erkennen gab! - So etwas kann sich doch nur ein krankes oder besoffenes Hirn ausdenken.
Einmal ist sie mit dem kleinen Fritzli an der Hand in düsteren Gedanken lange dem Bahngleis entlang gegangen ...
An diese Tage im Welschland erinnere ich mich sogar noch schwach: Es war eine mehrtägige Veranstaltung, vielleicht eine Ferienwoche der Pfingstgemeinde mit Unterweisungen und abendlichen Predigten, viele Mitglieder und Kinder waren dabei, auch meine Schwester und ich, wir fanden es locker. Doch dann, Mama ging es plötzlich schlecht und eines Nachts musste sie als Notfall ins Spital eingeliefert werden, sie hatte eine Eileiterschwangerschaft und es wurde knapp. Damit begann für uns Schwestern eine angstvolle Zeit: wir wurden für mehrere Wochen zu Tante Helene und Onkel Köbi an den Bodensee gebracht und lebten dort voller Bangen, bis wir endlich hörten, dass es Mama wieder besser gehe.
In dieser Zeit der Krankheit und Rekonvaleszenz hatte Mama viel seelische und geistliche Unterstützung durch einen von ihr besonders verehrten Prediger. Sie hat ihm aus ihrem Leben erzählt, wie sie nicht mehr so weitermachen könne und sich scheiden lassen wolle. Das Gespräch mit dem Prediger kenne ich natürlich nicht, aber eine Scheidung war auf jeden Fall nicht biblisch, Mama hat eingelenkt und mit ihrer übergrossen Bürde weitergelebt. Wieviel die Gewissheit, dass intensiv für einen gebetet und gerungen wird, wohl entlasten kann?
Einige Zeit nach ihrer Kur - jetzt wieder als gut neunzigjährige Rentnerin - ist von der Verwaltung der Baugenossenschaft eine umfassende Renovation für die beiden Häuser angekündigt worden. Die älteren Bewohnerinnen und Bewohner wurden beruhigt und sehr sorgfältig orientiert, alle durften nach der Renovation mit nur einem geringen Mietzinsaufschlag ihre ehemalige Wohnung wieder beziehen. Für die Übergangszeit wurden ihnen kleine Wohnungen im Dorf oder in Altersheimen angeboten, die sie selber auswählen konnten. So gab es auch einige freie Zimmer im örtlichen Alterswohnheim, die ich Mutter empfohlen habe. Sie war einverstanden mit dem bestimmten Hinweis, dass sie auf jeden Fall wieder in ihre jetzige Wohnung zurückwolle. Da warten wir mal ab! Für mich war das ein unglaublicher Glücksfall: Seit ihrer Kur habe ich ihr spät abends regelmässig nierenverträgliche Mahlzeiten gekocht, Kari hat sie anderntags überbracht. Meine Verantwortung war noch immer gross, auch wenn Mama jetzt ärztlich gut betreut wurde. Ich hoffte, sie würde sich im Verlauf des Jahres schon an ihre kleine hübsche Wohnung mit Balkon und Küchenecke mit zwei mobilen Herdplatten und Badezimmer, dazu je einem Notschalter fürs Pflegepersonal im Schlafbereich und Badezimmer, gewöhnen und diese akzeptieren. Es brauchte dann doch noch etwas Druck und Zureden, auch vom Prediger, was ich dankbar vermerkte. Ich hätte ihr meine Unterstützung für den Rück-Umzug verweigert, soweit brauchte es glücklicherweise nicht zu kommen. Noch immer - mit mehr als neunzig Jahren - benötigte sie keine weitere Pflege als die Hilfe frühmorgens für die Stützstrümpfe.
Mit ihrem Rollator ist sie noch lange flink um ihre Mitbewohnerinnen und Mitbewohner herumgekurvt, zusammen haben wir verschwörerisch gekichert:
Achtung, die Hundertjährigen kommen! Trotzdem machte sich das Alter langsam bemerkbar: der Rücken tat weh, ihr Atem ging schwerer, mit jedem Kilo Körpergewicht weniger verbesserte sich das zwar, aber eine eingeschränkte Lungenkapazität blieb (selbstverständlich hat Vater immer auch in der Wohnung geraucht, wir waren also alle Mitraucher). Manchmal konnte sie nachts nicht gut schlafen wegen Schmerzen in einem Bein, wofür ihr der Arzt hie und da eine Spritze verabreichte, nachdem er andere Störungen ausschliessen konnte. Von Zeit zu Zeit hat sie geseufzt:
Weisst du, diese Schmerzen verleiden einem das Leben schon, manchmal hat man einfach genug.
In diesem Alterswohnheim haben Mama und ich einmal wöchentlich gemeinsam im separaten Restaurant zu Mittag gegessen und zusammen geplaudert: über Verschiedenstes aus Alltag, Familie und Politik, manchmal erkundigte sie sich nach meiner Ansicht zu einem bestimmten Thema. Im Sommer, in dem die ganze Familie mit ihr zusammen ihren neunundneunzigsten Geburtstag gefeiert hat, haben ihre mystischen Visionen zugenommen: Schon immer hat sie in den Wolken oft Tiere oder andere Bilder entdeckt. Jetzt zeigten sich ihr vermehrt Engel oder andere himmlische Wesen. Einmal hat sie mir ergriffen ihren Traum erzählt: Engel haben ihr ein himmlisches, wundervolles, blumengeschmücktes Haus gezeigt, drei Seiten bereits fertig erstellt: Das werde einmal ihr Haus, ihre Wohnung sein, sie müsse noch ein wenig warten, bis die letzte Seite fertig erbaut sei! Das hat sie so freudig und gleichzeitig sehnsüchtig erzählt, dass mir klar geworden ist, wie es sie mit aller Macht zu ihrem HERRN zieht, und wir uns auf den Abschied vorbereiten müssen.
In den letzten Jahren ist ihr ein Bibelwort besonders wichtig geworden, Psalm 23:
Der Herr ist mein Hirte ... jedoch weniger wegen dem Stecken und Stab, sondern des Schlussverses wegen: ...
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. Nur wenig später hat sie ihr grosses Heimweh nochmals gezeigt: Ganz aufgeregt hat sie mich empfangen und auf den Balkon gezogen:
Schau! Schau dieses Blümchen! Schau, wie es seine Ästchen wie Ärmchen zum Himmel streckt! - Das hat mich gerade ein wenig erschüttert.
In diesen Wochen hat sie mich auch gebeten, einmal nicht zu traurig zu sein; unbeholfen habe ich gemeint, wir dürften doch dankbar sein, dass sie ein so hohes und gutes Alter erreicht habe; mir scheine, als hätte sie einige Jahre vom Leben ihrer Mutter anhängen dürfen. Zustimmend hat sie geantwortet, das hätte sie auch schon gedacht.
Noch einen Wunsch hatte sie: Annemie und ich sollten den Kontakt zueinander halten, uns nicht aus den Augen verlieren. Sie hatte Recht, wir beide hatten uns in den vergangenen Jahren auseinander gelebt. - Heute treffen wir uns hie und da zum Schwatz bei einem Kaffee, zu einem Ausflug, tauschen uns vor allem gelegentlich per E-Mail aus.
Manchmal hat Mama Angst vor der Nacht gezeigt, vor einem Anfall von Angina Pectoris ganz alleine, sie musste jeweils aufstehen, ihre Tabletten einnehmen, diese immer griffbereit haben, sich am Fensterrahmen festhalten. Gegen Ende Oktober sind die Schmerzen in ihrem Bein wieder aufgetaucht, der Arzt hat ihr am Freitag im Zimmer eine Spritze gesetzt. Mama und ich haben telefoniert, es ging ihr nicht gut, sie wirkte ängstlich. Am Montagmorgen ein Telefon von ihrer Betreuerin: beim Baden sind grossflächige rote Flecken aufgefallen, eine Allergie. Ein Telefon mit ihrem Arzt, der Mutter untersucht hat und ins Spital einweisen liess.
So schnell wie möglich bin ich ins Spital geeilt, wo Mama gerade, von Ärzten umringt, untersucht wurde. Sie habe eine leichte Lungenentzündung, mehr aber sorgten sie sich um ihre Allergie. Ob etwas vorgefallen sei? Ich habe die Spritze vom Freitag erwähnt, die sie jedoch schon mehrmals erhalten habe. Sie haben sich bei ihrem Arzt danach erkundigt.
Mama wurde behandelt wie ein Brandopfer, der ganze Körper wurde eingeschmiert und mit Verbänden bandagiert, immer wieder mussten diese gewechselt werden. Mit den verabreichten Medikamenten ging es ihr vorläufig gut, sie hatte keine Schmerzen, war angeregt, hat munter geplaudert und die Behandlung der Pflegerinnen, ihre feinen Berührungen und Massagen, wie Streicheleinheiten sogar genossen.
Schnell ist die Nachricht durchgedrungen und ihre beiden Prediger, der Vorgänger R und der ihr inzwischen besonders unentbehrlich gewordene Beistand O, und andere Besorgte sind aufgetaucht. So hatte Mama ihre wichtigsten Leute stets um sich und ich habe mich jeweils am Nachmittag mit gutem Gewissen verabschiedet. Bis Mittwoch war sie unverzagt und hat sich intensiv mit ihren Predigern und ihren Frauen ausgetauscht, sie haben ihr ihr Lieblingslied nach der Melodie von Amazing Grace gesungen. Am Tisch hat sie uns eine imaginäre Zeitung vorgelesen, mit dem Finger der Zeile auf dem Titelblatt folgend:
Europa wird nicht untergehen ... unverständliches Murmeln und ...
jetzt kann ich es nicht mehr gut lesen ... - Das Pflegepersonal erklärte, jetzt komme es darauf an, ob die Haut halte und sich nicht ablöse.
Am Donnerstag hat sich irgendetwas verschlechtert. Mama hatte wieder ihre Visionen, hat Blumen und Gebilde an den Wänden und auf dem See das Apostelboot mit den Menschenfischern gesehen. In der Nacht sei ein Engel an ihrem Bett gesessen, der auf sie warte und sie heimführen werde. Ich musste den Gedanken akzeptieren, dass sie nicht mehr nach Hause zurückkehren würde. Gegen Abend ist Annemie aufgetaucht; Mama hat gewünscht, dass ihr einige Bibelverse vorgelesen werden, zum Glück hat meine Schwester das, oft schniefend, gemacht. Sogar jetzt war ich froh, dass sie das übernommen hat - so verknorkst war ich!
Am Freitagvormittag hat Mama angekündigt, dass sie jetzt zwar noch sprechen könne, das aber immer weniger gut, sie könne uns aber weiterhin gut hören und verstehen. Ihr Atem hat immer stärker zu rasseln begonnen, wie ein Wind, der durch einen dichten Wald mit hohen Baumstämmen pfeift. Mit wachsendem Entsetzen habe ich miterlebt, wie sie tatsächlich immer weniger sprechen konnte und am Abend nicht mehr gesprochen hat - wie furchtbar! Mir sind ihre Antworten seinerzeit beim Arzt auf seine Frage nach ihrem Befinden in den Sinn gekommen:
Gut, mein Mundwerk läuft noch! - Ich habe beschlossen, sie ab jetzt in der Nacht nicht mehr alleine zu lassen. Dankbar hat sie mir die Hand gedrückt auf diese Mitteilung.
So habe ich in der Nacht auf Samstag an Mamas Bett gedöst, später haben mir die Pflegerinnen ein Notbett hingestellt. Am Morgen bin ich nach Hause gefahren, habe meinen Haushalt erledigt und vor allem die Kaninchen und ihren Stall versorgt. Gegen Abend, nachdem ihre Besucher sich verabschiedet hatten, hat es mich wieder mächtig ins Spital gezogen. Inzwischen hat Mama mit pfeifendem Atem immer häufiger nur noch gedöst; es haben sich erste Wassereinlagerungen an Handgelenken, Händen und im Gesicht gezeigt.
Mitten in der Nacht bin ich aufgeschreckt, weil es plötzlich ganz still war, das pfeifende Rasseln verstummt, war Mama jetzt entschlafen? Schnell stand ich bei ihr: nein, sie war aus dem Schlaf aufgewacht, sie atmete ruhig, die Augen blieben geschlossen. Ich habe ihre Hand ergriffen und sie beruhigt:
Du bist nicht alleine, ich bleibe bei dir. Mit einem ganz feinen Händedruck hat sie darauf reagiert. Jetzt musste ich die Gelegenheit benutzen:
Schau, siehst du den Engel an deinem Bett sitzen? Er wartet auf dich und will dich jetzt heimführen! Dein himmlisches Haus ist fertig und wunderschön geworden! Alle ... nicht mal jetzt konnte ich Herr, Jesus oder Vater sagen
... ALLE warten auf dich und freuen sich, wenn du jetzt kommst! Einen Moment Stille, dann hat sie mir noch einmal ganz sachte die Hand gedrückt - das war unser Abschied! Ich wollte nicht, dass sie meinetwegen nicht gehen konnte.
Kurz darauf hat ihr regelmässig pfeifender Atem wieder eingesetzt, sie ist eingeschlafen und ich habe eigentlich erwartet, dass sie in den nächsten Stunden entschlafen würde. Doch sie rasselte auch am Morgen noch und ich bin nach Hause gefahren. Dort hat mich das Telefon eines Arztes erreicht, der mir mitteilte, dass Mutter beim Untersuch Schmerzen gezeigt habe, ob er die Morphingaben erhöhen dürfe. Ich brauchte nur kurz zu überlegen: nein, Mama musste keine Schmerzen mehr erleiden; ja, er soll die Medikamente erhöhen. Ich informierte unsere Söhne und Familie, dass heute der Tag für Omas Abschied gekommen sei. Nervös eilte ich zurück ins Spital, hoffentlich kam ich nicht zu spät!
Im Zimmer waren bereits unsere Söhne mit der Schwiegertochter und Prediger R mit seiner Frau anwesend. Frau R hat im Medizinbereich gearbeitet und gesehen, dass es nicht mehr lange dauern würde. Ein letztes Mal haben sie Amazing Grace gesungen und sich dann traurig verabschiedet. Nicht viel später haben wir bewegt Omas letzte, immer länger auseinanderliegende Atemzüge mitverfolgt, bei ihrem letzten stand der Zeiger gerade auf zwanzig Uhr.
Aufgewühlt haben wir im Café noch eine Weile zusammen gesprochen, die Familie hat sich verabschiedet, ich wollte auch diese Nacht nochmals bei Mama bleiben. Inzwischen war sie von der Pflegerin zurechtgemacht und ihr eine Rose in die Hände gelegt worden. Ihre Bibel, die sie ihr ganzes Leben lang begleitet hat, sollte sie auch jetzt mitnehmen, ich habe sie ihr neben das Kopfkissen gelegt.
Am anderen Morgen bin ich zuerst ins Pflegeheim gefahren, um der Heimleiterin die Nachricht zu überbringen: Völlig überrumpelt konnte sie es kaum fassen, sie haben fest damit gerechnet, dass unsere Mutter bald wieder gesund heimkommen werde. Sie hätten sich bereits Gedanken zu einem würdigen Fest zu ihrem 100. Geburtstag gemacht!
Nein, soweit konnte ich nicht mehr vorausschauen, ein Jahr ist in diesem Alter eine sehr lange Zeit! Mama hat den Winter nie gemocht und seit einigen Jahren habe ich ihn auch gefürchtet: Sie ist bereits auf sehr schmalem Grat gewandert. Ihr allgemeines Organversagen am Schluss passt für mich genau in dieses Bild: sie hat dank der gut eingestellten Medikamente und der regelmässigen Kontrollen sehr lange mit ihrer eingeschränkten Nierenfunktion gelebt; die letzte Spritze ihres Arztes hat ihr nur den entscheidenden Stups gegeben und sie aus dem Gleichgewicht gebracht. Ob sie das Norovirus noch einmal überlebt hätte? Gerade da zweifelte ich. Bereits zweimal hat sie dieses hochansteckende Virus mit Fieber, heftigem Erbrechen und schwerem Durchfall, das vorwiegend in Altersheimen auftritt, durchgestanden. Die Krankheit dauert nur drei Tage und ist normalerweise nicht lebensgefährlich, trotzdem einfach nur scheusslich, besonders für ältere Menschen, die geschwächt und nicht mehr so beweglich sind: Mama hat sich vor allem beim ersten Mal furchtbar geschämt, erst noch, weil sie von einem männlichen Pfleger unterstützt worden ist. - Die Vorstellung, dass sie so sterben müsste, hat mich schon länger geängstigt, zudem die Heime während eines solchen Virusausbruches für die Besucher geschlossen sind.
Deshalb war ich unbeschreiblich erleichtert, fast schon euphorisch, dass Mama sich da nicht mehr durchquälen musste, sondern nach einer intensiven Woche mit ihren Liebsten, bei angenehmster Pflege und Betreuung, ihr langersehnter Wunsch in Erfüllung ging und sie so sanft und leise zu ihrem HERRN heimgehen durfte. Ich empfand überhaupt keine Trauer.
Wie geliebt und geschätzt Mama war, hat sich bei der Abdankung in der Friedhofskapelle gezeigt: kaum alle Trauergäste haben einen Sitzplatz gefunden! Ihre beiden Prediger haben ihr eine würdevolle und emotionale Abschiedsfeier bereitet: Zuerst hat Prediger R unter Tränen ein eigenes Gedicht an seine Ida, die ihm "Halt und Stütze" gewesen sei, und die er bald voller Freude wiedersehen werde, vorgetragen. Darauf hat Prediger O, Mamas wichtigster Begleiter der letzten Jahre, die Abdankung übernommen, bei der ihm seine Tränen oft die Stimme geraubt haben. Kein Auge der versammelten Trauernden ist trocken geblieben.
Mama hätte diese Abschiedsfeier gefallen und wäre vielleicht sogar ein wenig stolz gewesen über die grosse Zuneigung, Liebe und Anerkennung, die darin zum Ausdruck kamen. Sogar an ihrem Sohn Fritz hätte sie sich gefreut, hat er doch ihr zu Ehren seinen schönsten Anzug angelegt: Offenbar hat ihre häufige Kritik an seinen kurzen Hosen bei jedem Familientreffen doch nachgeklungen.
Sie hat bei vielen eine grosse Lücke hinterlassen. Auf ihrem Grabstein ist ihr Lieblingswort Ps 23 eingraviert.
Schwer fiel uns dann kurz darauf die Auflösung ihres Hausrates, die Trennung von ihren persönlichen Gegenständen; die nächste Bewohnerin wartete bereits auf ihren Einzug. - Gerettet habe ich neben dem Weihnachtskaktus die Orchideen, die ich bisher wöchentlich gewässert hatte, und die Fuchsia vom Balkon. Alle blühen noch immer regelmässig ganz prächtig; auch wenn ich die Fuchsia in unserer inzwischen kleineren Wohnung überwintern muss, bleibt sie, solange sie jeden Sommer so üppig blüht.
Nach einigen Monaten bin ich immer unruhiger und nervöser geworden, ohne den Grund zu erahnen. Bei einem Familientreffen haben Jonas und ich darüber gesprochen. Schnell hat er gesagt:
Dir fehlt Oma, mir fehlt sie auch! Wie Schuppen fiel es mir von den Augen: Natürlich, er hatte so Recht! Noch immer hatte ich erleichtert einseitig nur auf Mamas guten Heimgang geschaut und nicht an mich gedacht. Wie ist mir jetzt die Sehnsucht nach unseren regelmässigen Gesprächen aufgestiegen, wie habe ich Mama und unsere wöchentlichen Treffen vermisst!
Noch heute würde ich gerne mit ihr über unsere völlig aus den Fugen geratene Welt diskutieren: das konnte sie gut. Oft hat sie mich nach meiner Ansicht über dieses oder jenes gefragt und hat interessiert mitgeredet. Bei ihren älteren Mitschwestern hat das Interesse offenbar gefehlt oder es war Mama zu einseitig. Unsere Gespräche haben unsere Ansichten geschärft und geweitet und sie hat kaum mehr eingewendet:
das steht schon in der Bibel geschrieben, oder ich konnte das einordnen und stehen lassen - im weiteren Sinn hatte sie ja Recht, wenn es sich um Moral und Ethik drehte. Um uns in religiösen Fragen zu treffen, hätten wir vielleicht nochmals ein halbes, aber interessantes Leben gebraucht.
So gerne würde ich heute mit ihr zusammen den demokratiezerstörenden allgemeinen und evangelikalen Fundamentalismus beleuchten, möchte hören, wie sie darüber spricht, was sie dazu sagen würde. Würde sie eventuell einige Auswüchse ablehnen? Eigentlich glaube ich das heute. - Trotzdem bin ich nur froh, dass Mama nicht mehr zusehen muss, wie die ganze Welt auseinanderfällt.
Umzug ins Dorf und Zusammenbruch
Seite 14
Seite 14 wird geladen
13.
Umzug ins Dorf und Zusammenbruch
Im Internet habe ich das Haus gesehen und sofort hat es - auch bei Kari - gefunkt: Ein dreistöckiger Hausteil, der seitliche Anbau eines dreiteiligen Flarzhauses, mit vielen Fenstern an der Aussenwand, einem kleinen Gärtchen vor und einem Rasenplatz hinter dem Haus und einer grossen Terrasse. Wir bekamen den Zuschlag und konnten unser Glück kaum fassen. Auch für Kari war es wie ein Traum: ein geräumiger Keller zum Werken mit einer ganzen Fensterfront mit breitem Sims, auf dem wir alle unsere nicht winterharten Pflanzen überwintern konnten. Er bekam ein grosses, helles, eigenes Schlafzimmer mit kleinem Balkon, in dem er weiterbasteln und ungestört seine Musik hören konnte. Neben dem Keller lag die Waschküche mit Waschturm, grossem Waschtrog und separatem WC, speziell und ungewohnt für uns. Hinter der Kellertür die für damalige Zeit moderne Küche mit klappbarem abgerundeten Holztisch und festmontierter Wandbank, so romantisch! Auf gleichem Boden der Hauseingang mit geräumiger Garderobe und daneben ein Zimmer mit Blick auf das hübsche Gärtchen, in dem bald mein bisheriger schattenspendender Japanische Blutahorn sich vom zu kleinen Topf auf dem Balkon erholen und gedeihen würde. Eine bequeme Holztreppe, darunter viel Stauraum, führte von der Küche in den oberen Stock zu den Schlafzimmern und dem Badezimmer und weiter hinauf zu unserem absoluten Bijou: ein heller gemütlicher holzverkleideter Wohnraum über die ganze Länge des Hauses mit hoher Giebeldecke, von der zwei elegante, weisse, grosse Glaskugeln an meterlangen Kabeln von der Decke hingen, der Raum lichtdurchflutet durch drei normalgrosse und zwei zierliche kleine Fensterchen auf der Seite der dicken Steinmauern und der Tür zur Terrasse hinaus - noch heute lässt mich die Erinnerung daran erschauern.
Nach einigem Hin und Her hatten wir uns entschieden, aufs Land zu ziehen, und hier war der Anschluss an den ÖV gut, Kari als notorischer Frühaufsteher war schnell am See bei seinem Boot und seinen Freunden. Das Haus lag im Zentrum des Dorfes, alle wichtigen Anlaufstellen waren in kaum fünf Gehminuten zu erreichen, einzig zum Tierarzt brauchten wir eine Viertelstunde. Nur meiner Mutter hat unser Umzug sehr missfallen, jetzt konnte sie Kari nicht mehr so häufig und kurzfristig abrufen. Dafür habe ich sie von diesem Zeitpunkt an jeden Mittwoch besucht und mit ihr zusammen zu Mittag gegessen; in diesen noch verbleibenden Jahren haben wir unsere endlich stattfindenden Gespräche weiter intensiviert, sie sind uns beiden unverzichtbar geworden.
Endlich konnte ich einmal eine Wohnung von Grund auf heimelig und gemütlich einrichten: seit ich meine Depression am Anfang unserer Ehe hinter mir gelassen habe, ist mir ein behagliches Heim immer wichtiger geworden. Mit der Zeit haben wir einige Dinge verändert und meinem Geschmack, der auch Kari angesprochen hat, angepasst. Ich habe gemerkt, dass ich einen guten Blick für ein harmonisches Wohnen habe. Vielleicht wäre das sogar eine Berufsrichtung gewesen: Innendekorateurin.
Sogar meiner jungen Freundin ist das aufgefallen, als ich sie erstmals in ihrer eigenen Wohnung besucht habe. Bereits beim Eintreten ist mir aufgefallen, dass der lange Tisch parallel zum zimmerbreiten bodentiefen Fenster nicht am richtigen Platz stand. Der ganze Raum, die ganze Wohnung war sehr ansprechend in leicht orientalischem Ambiente eingerichtet. Im geräumigen Wohnraum mit moderner Küchenfront standen alle Einrichtungsgegenstände den Wänden entlang gruppiert, die Mitte des grossen Raumes war einfach leer, die Balkontür konnte des Tisches wegen jedoch nicht ganz geöffnet werden. Erwartungsvoll hat Claudia mir die Wohnung gezeigt, die mich wirklich beeindruckt hat, und auf die sie stolz sein durfte. Dann habe ich sie diplomatisch gefragt, was sie meine, ob der tolle Glastisch vielleicht längsgedreht im Raum nahe dem Fenster nicht noch besser zur Geltung käme? Gesagt und ausprobiert: Es war richtig so, nun strahlte der Wohnraum die Eleganz aus, die er verdiente, und die Balkontür liess sich ungehindert öffnen. Claudia war so begeistert, dass sie mich betrübt zum Abstellraum geführt hat, der ihr auf dem Magen lag: Im kleinen Raum, kaum einen Meter breit und drei Meter lang, ohne jedes Tablar, grümpelten alle möglichen Gerätschaften, Staubsauger, Schuhe, Kartons und Taschen wild auf dem Boden drunter und drüber - eine richtige Rumpelkammer eben.
Hallo Claudia, das ist doch ein Leichtes für deinen superpraktischen, handwerklich begabten Tochter-Papi! Zwei einen Meter tiefe raumbreite Tablare für Koffer und Taschen an der Rückwand so hoch übereinander montiert, dass beim unteren Tablar eine Kleiderstange für Jacken und Wintermäntel befestigt werden kann, mit Schuhrosten auf dem Boden finden auch die Winter- und Sportschuhe ihren Platz, an einer Seitenwand ein schmales Tablar über die ganze Länge des Raumes, mit Haken darunter und jeder Krimskrams findet seinen Platz und der Raum wirkt immer ordentlich und aufgeräumt. Claudia war beeindruckt, am liebsten hätte sie ihrem Vater den Auftrag sofort übermittelt.
Soeben hatte sie ihre Lizentiats-Arbeit beendet, aber eine praktische Lösung finden? Dafür hat sie mich immer himmlisch bekocht, meistens mit orientalischer oder indischer Geschmacksrichtung, was an unsere gemeinsame Ferienwoche in Marokko erinnern liess, wo wir sogar beim dreitägigen Kamelreiten, eigentlich waren's einhöckrige Dromedare, in der Wüste von den beiden Berbern erstaunlich vielseitig, köstlich und besser als im Hotel bewirtet worden sind. Wir hatten fröhliche Zeiten zusammen und haben viel gelacht.
Unvergessen ist unser ausgelassener Hamam-Besuch in Marrakesch: wie konnten wir da lachen! Das Frauengelächter war bestimmt draussen auf der Strasse zu hören. Wie haben wir diesen Abend genossen: die zahllosen kalten und heissen Wassergüsse haben unsere Körper dermassen aufgeheizt, dass wir unsere warmen Knochen im Körperinnern deutlich gespürt haben, ein bisher unbekanntes äusserst angenehmes Gefühl. Diese innere Wärme hat uns beim nachfolgenden Nachtessen auf der kühlen Terrasse ohne jedes Frösteln durchgetragen. - Habe ich hier gerade die unbekümmerte, sorglose Fröhlichkeit entdeckt?
Claudias Uni-Studium hat mich interessiert, wir haben über ihre Projekte gesprochen, ich habe ihre nicht ungefährlichen Auslandeinsätze mitverfolgt, wir haben uns zusammen über ihren Erfolg gefreut. Doch ich habe sie nicht darum beneidet, ich habe meinen eigenen Weg akzeptiert.
Kennengelernt haben wir uns 1992 bei einem internationalen Solidar-Projekt auf einem kubanischen Camp in den Orangenplantagen: vier äusserst intensive Wochen, die uns einen vielfältigen Einblick in die kubanische Wirklichkeit boten - die planwirtschaftlich organisierte Arbeit im Camp; noch ängstlich geheim gehaltene Einblicke in Familien von neu gewonnenen Freunden; die langen fröhlichen Abende mit den Kubanerinnen und Kubanern mit viel lauter Musik und Tanz; organisierte Besuche in Schulen, die inklusive Universitätsausbildung bei Fähigkeit kostenlos sind; Besuche bei Familienärzten/-ärztinnen, die jeden Kubaner, jede Kubanerin zu Hause aufsuchen, falls diese sich nicht selber regelmässig melden: das Gesundheitssystem in Kuba ist hochentwickelt (sichtbar sauber, aber nicht chromglänzend aufgerüstet wie bei uns) und für alle Kubaner/innen gratis; Besuch und Orientierung bei einer Naturschutzorganisation: Durch die jahrzehntelange harte US-Wirtschaftsblockade, die auf alle weiteren Handelspartner weltweit ausgeweitet worden ist, war die Insel Kuba isoliert und hat sich auf ihre eigenen Möglichkeiten, so auch in der Landwirtschaft, besonnen (von der Unterstützung durch die Sowjetunion und später Venezuela mit Öllieferungen wissen wir ja). In ihren grossen Notzeiten mussten die kubanischen Bauern ihre Traktoren stehen lassen und die Felder wieder mit Ochsen bearbeiten. Damit bot sich ihnen aber auch die Chance, ihren Boden auf natürliche Weise ertragsreich zu halten. Dem Land ist eine gesunde Landwirtschaft und der Natur- und Umweltschutz wichtig geworden. Kuba könnte ein ökologisches Vorbild für die Welt werden, wenn es aus den Fehlern der restlichen Welt wirklich gelernt hat und der nachhaltigen Landwirtschaft treu bleibt (es müssen nicht unbedingt die Ochsen bleiben). - Was ich nie verstehen konnte und mich beim Gedanken daran heute noch ungeduldig macht: Mit den umständlich planwirtschaftlich abgewickelten Arbeitsabläufen werden die eingebrachten Ernten zentral gelagert und von dort im ganzen Land verteilt, dabei geht jährlich bis zur Hälfte der Ernte in der herrschenden Hitze zugrunde.
Beim Warten auf dem Flughafen von Havanna vor dem Abflug bin ich doch tatsächlich im Stehen eingeschlafen! - Nach meiner Rückkehr hat mich die Direktionssekretärin im Betrieb gefragt:
Hat man Sie jetzt indoktriniert? Ich:
Nein, informiert! Sie hat sich entschuldigt. Damals war eine Kubareise noch suspekt; nachdem sich das Land für den Tourismus etwas geöffnet hat, reisen alle hin, geniessen Sonne und Strand und machen sich keine weiteren Gedanken, obwohl sich die Politik des Landes grundsätzlich nicht verändert hat.
Wie bin ich nur auf Kuba gekommen? Seit einigen Jahren haben meine Schwägerin und ich im Herbst zusammen Wanderferien an den verschiedensten Orten verbracht. Diese organisierten Wanderungen sollten sportlich nicht allzu anspruchsvoll, aber doch keine Kaffeehaus-Touren sein, ausserdem wählten wir solche, bei denen wir immer wieder aufs Meer trafen: Hinter einem Berg oder Hügel hervortreten und unverhofft das offene weite Meer vor sich sehen, das ist jedes Mal ein überwältigendes Erlebnis. Weil Kari nicht in ein Flugzeug steigen wollte, haben eben seine Schwester und ich uns zusammengetan.
Kuba im neuen Katalog hat mich neugierig gemacht, diesmal hat mich Robi begleitet. Noch auf dem Flughafen hat uns die Reiseleiterin Mirta, die diese Reise schon mehrmals geführt hatte, die Verhaltensregeln für Kuba durchgegeben: vor allem keine politischen Fragen stellen! Auf den Wanderungen und den Busfahrten hat uns immer zusätzlich ein regimetreuer Kubaner oder eine Kubanerin begleitet, die bei jedem Provinzübertritt ausgewechselt worden sind. Unterwegs haben sie uns wie alle Reiseleiter über Land und Leute orientiert. Kubaner wandern nicht und haben uns deshalb oft mitleidig auf unsere hochgeschnürten Wanderschuhe angesprochen: sie haben geglaubt, wir wären alle gehbehindert! Bei Fehlverhalten - nicht genehme politische Äusserungen, Tauschgeschäfte mit Touristen, Besuche von Touristen bei ihren Familien in ihren Wohnungen oder ähnliches - wurden sie vom Staat für mehrere Jahre als Reiseleiter gesperrt; das hat uns Mirta erzählt, die eben einen ihrer letztjährigen Begleiter vermisst hat.
Politik war dann kein grosses Thema, reiste doch die fröhliche, mit unschlagbarem Humor und grosszügigen Rundungen gesegnete Rosmarie in unserer Gruppe, sie sollte sich als unerwarteter Magnet erweisen: die Kubaner haben sich auf sie gestürzt wie die Fliegen auf den frischen Kuhfladen! Immer war Rosmarie von einigen Kubanern umringt, manchmal hatte sie Mühe, uns zu folgen. - Wie viel natürliche Offenheit Fremden gegenüber ehrlich und wieviel schlaue Berechnung dahinter steckte, haben wir uns oft gefragt, doch die herzliche kubanische Mentalität hat uns eher trockene Schweizer doch schwer beeindruckt.
Wenige Jahre darauf waren dann die ersten, von der Regierung misstrauisch beobachteten Individualtouristen in Kuba zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs. Noch etwas später wurden neben den abgegrenzten Ferienstränden in Varadero nahe Havanna weitere Badestrände im Osten des Landes für den Tourismus geöffnet und mit Cubatur einheimische Busreisen durchs ganze Land und Autovermietungen angeboten, deren Autoschilder sofort den Touristen ausweisen.
Doch die schönste und intensivste Herbstwanderwoche erlebten meine Schwägerin und ich in der Cinque Terre: wir schwärmten noch lange von der wilden, faszinierend schönen Gegend am Meer, den schroffen Rebhängen, den pittoresken Dörfern, den wundervollen Wanderungen und der heiteren und fröhlichen Gruppe, in die wir es getroffen hatten. Vor allem Marianne blieb unvergessen in unserer Erinnerung. Marianne kam ursprünglich aus dem Elsass, wohnte einige Jahre in Basel und später in Zürich, sie war gut zehn Jahre älter als wir, aber voll durchtrainiert: sie hat mit ihrem Mann zusammen oft grosse Velotouren unternommen. Schnell sind Edith und ich mit ihr so selbstvergessen diskutierend und lachend vorausmarschiert, dass wir immer wieder mal stehen bleiben mussten, um die Nachzügler aufschliessen zu lassen. Marianne konnte so fröhlich Witze am Laufmeter erzählen, wir haben so viel gelacht und gar nicht gemerkt, wie wir über Stock und Stein bergauf und bergab gewandert sind.
Eines Tages habe ich Marianne gefragt, woher sie nur all ihre Witze, Anekdoten und Episoden her habe. Da ist Marianne ruhig geworden und hat zu erzählen begonnen: Sie sei nicht immer fröhlich gewesen und habe schlimme Zeiten erlebt. Sie hat erzählt, wie sie als Kind mit ihrer Mutter zusammen mit vielen anderen in Viehwaggons zusammengepfercht durch ganz Europa gekarrt worden seien, hin und her. Mit zunehmendem Entsetzen haben wir zugehört, ohne die Wahrheit richtig fassen zu können. Natürlich haben wir von Judenverfolgung, KZ und Deportationen gehört, das lag aber weit weg und in der Vergangenheit. Jetzt stand Marianne vor uns, die das am eigenen Körper erlebt hat. In unserem Schock und unserer Betroffenheit haben wir keine Fragen gestellt, ihr nur zugehört. Erst nach einer langen Weile habe ich kleinlaut gefragt, wie man mit solch fürchterlichen Erinnerungen nur weiterleben könne? Da hat sie geantwortet, dass ihre Fröhlichkeit sie gerettet habe, damit könne sie ihre bösen Erinnerungen überdecken. Damit wandte sie sich nach vorne und begann ihren nächsten Witz: wir konnten nicht mehr unbeschwert mitlachen. Zudem sie jetzt noch makabre Judenwitze beigefügt hat. - Witze vergesse ich schnell wieder, ich kann mich an keinen einzigen erinnern.
Und heute, im Jahr 2022, hat wieder ein grössenwahnsinniger Despot einen Krieg in Europa begonnen und droht dem Westen sogar mit seinen Atomwaffen. Wohin das führen wird? Sind wir damit am Ende der Menschheit angekommen? Putin ist skrupellos und nicht der Typ, der sich beim Abzeichnen seiner Niederlage in einem Bunker den Kopfschuss geben wird, nein, er würde die ganze Welt mit in den Abgrund stürzen.
Einige Jahre vor unserer Pensionierung haben eine ehemalige Nachbarin und ich ein gemeinsames faszinierendes Projekt beschlossen: Wir wollten zusammen auf dem Jakobsweg quasi ins Rentenalter hinüberwandern. Wir sind beide klein und unser Rucksack sollte deshalb nicht viel mehr als zehn Kilo wiegen, sehr wenig und kaum zu schaffen. Warum nicht zwei Esel als Begleiter und Lastenträger mitnehmen? Mit einem kleinen mitgeführten Zelt wären wir zudem unabhängig von den stets überfüllten und unangenehmen Pilgerherbergen. Dazu mussten wir natürlich erst einmal Erfahrungen mit Eseln sammeln und diese kennenlernen. Wir haben verschiedene, auch mehrtägige Eseltrekkings mitgemacht, immer wunderschöne, eindrückliche und unvergessliche Erlebnisse. In zwei Etappen sind wir ohne Esel in den Sommerferien auf dem Jakobsweg vom Zürichsee zum Brienzersee und vom Brienzersee nach Genf - jetzt durch das Simmental und dem südlichen Ufer des Genfersees entlang, weil wir den Eseln und damit uns später den Fluglärm und den Verkehr von Genf ersparen wollten - gewandert, immer mit Blick auf die imaginären Schattenesel als Begleiter neben uns. Alle unsere Wanderungen habe ich aufgeschrieben und lese sie heute noch gerne. Während ich fleissig vieles vorbereitet habe, musste Sarah ihre Zähne in Ordnung bringen lassen, unablässig hatte sie Kieferprobleme; bevor diese nicht saniert waren, war an einen Start nicht zu denken.
Nach unserem Umzug haben wir Rocco und Pedro, zwei Eselwallache, gekauft: Wir mussten unsere Langohren doch kennenlernen und für Wanderungen vorbereiten. Leider haben wir keine Unterkunft in der Nähe gefunden und mussten sie auf einem Eselgehöft unterbringen, jeweils mehr als eine Stunde ein Reiseweg von unserem Wohnort entfernt. Mein Traumhaus - ein altes Bauernhaus im Bernbiet - in dem wir unsere Esel auf unserem eigenen Hof hätten unterbringen können, war Kari, und meiner Mutter, zu weit weg; das habe ich schon verstanden. Wie waren wir dann stolz, als wir am ersten Abend neben unseren eigenen Eseln im Stall standen: Unsere eigenen wunderschönen Esel, der schwarze Rocco und der grau-braun-melierte Pedro, mit ihren lebhaften langen Ohren, den seidenweichen samtenen Lippen und den seelenvollen tiefen Augen, ich bin fast geplatzt vor Stolz!
Während Kari und ich mit unseren neuen Freunden unterwegs waren und uns gegenseitig immer besser kennenlernten, kamen von Sarah laufend neue Hiobsbotschaften: einmal ist sie gestürzt und hat sich Rippen gebrochen, bei der Sanierung ihres Kiefers gab's Rückschläge: langsam fragte ich mich, ob sie wohl an Osteoporose leide? Warum weiss sie selber nicht, was los ist? Dann ist sie erneut gestürzt und hat sich das Schlüsselbein gebrochen: Das war's dann wohl, damit wird sie nie wieder einen Rucksack tragen. Ob sie die Diagnose Osteoporose jetzt oder erst beim nächsten Sturz bekommen hat, weiss ich nicht mehr: Als nächstes hat sie sich einen Beckenbruch eingefangen, dessen Schmerzen über die Wochen und Monate statt weniger immer stärker wurden. Nach gründlichen Untersuchungen wurde ihr schliesslich eine weit schlimmere Krankheit offenbart. Seither hat sie sich weitgehend zurückgezogen, nur noch zu Weihnachten schicken wir uns eine Karte. So traurig!
Während Sarah mit ihrem Schicksal fertig werden muss - ich habe miterlebt, wie ihre Eltern nacheinander gestorben sind, dann nach langen Krankheitsjahren ihre ältere Schwester und vor noch nicht allzu langer Zeit auch ihre jüngere Schwester - habe ich mich schnell damit abgefunden, dass der Traum vom Jakobsweg ausgeträumt ist, hatten Kari und ich doch viele schöne Erlebnisse mit unseren grossen kuschligen, aber oft auch eigenwilligen und anstrengenden Langohren.
Neben unseren zahlreichen Eselwanderungen hat Kari hinter dem Haus, nach Rückfrage mit der Hausbesitzerin, einen grosszügigen Kaninchenstall gebaut. Bald sind die ersten drei Zwergkaninchen eingezogen, ein langhaariger Rammler mit seinem kurzhaarigen Weibchen und ihrem Jungen mit ebenfalls kurzem, aber ungewöhnlich flauschigem Fell, das täglich gekämmt werden musste. Um sicher zu sein, dass der Rammler wirklich kastriert und alle gesund waren, haben wir die Kaninchen dem Tierarzt gezeigt. Der Rammler war ok, die Tiere gesund, doch das Jungtier, das uns von privat als Weibchen übergeben worden war, hat sich als Männchen herausgestellt und musste vom Tierarzt sofort kastriert werden. Zwei Rammler würden sich auf Dauer nicht mehr vertragen, deshalb hat Kari den Stall vorsorglich auf drei Etagen erweitert. Mit der Zeit hat sich die Kaninchenfamilie verändert und vergrössert und ich habe mich täglich intensiv mit den zutraulichen kleinen Hopplern beschäftigt. Damit bin ich spät meinem Traumberuf als Tierpflegerin doch noch nah gekommen. Schön war auch zu sehen, wie unser Büsi die neugewonnene grosse Freiheit ums Haus herum genossen hat.
Im Dorf, Haus und Quartier haben wir uns sehr leicht eingelebt. Die Nachbarn kamen auf uns zu und haben sich vorgestellt, wir haben uns sofort aufgenommen und dazugehörig gefühlt. Dazu beigetragen hat vor allem die offene und entgegenkommende Art von Kari. Meine persönlichen Begegnungen und Bekanntschaften sind hauptsächlich im Gärtchen entstanden, wenn vorbeigehende Frauen zu einem Schwätzchen, die später auch zu einem intensiveren Austausch führen konnten, stehen geblieben sind. Mit Staunen und grosser Dankbarkeit bin ich jeweils aufs Haus zugegangen und habe mir ungläubig versichert:
Hier, an diesem wunderbaren Ort darf ich leben! Nie ist mir dieses Glück selbstverständlich geworden.
Über Mittag hat uns wieder einmal eine Schreckensbotschaft erreicht: Ein Arzt aus einem Spital hat mitgeteilt, dass Paschi mit einer schweren Handverletzung eingeliefert worden sei: Er hat beim Gärtnern mit dem Gertel auf die Knöchel seiner linken Hand eingehackt. Zum Glück habe er Handschuhe getragen, doch würde es eine schwierige Operation werden, vor allem die minuziöse Entfernung aller Flusen des Handschuhs und die absolut keimfreie Desinfizierung der Knöchel sei entscheidend, damit keine Infektion entstehe. Die Ärzte haben schliesslich ohne Komplikationen ein Meisterwerk abgelegt; heute erinnert nur noch an den Unfall, wenn Paschi die Hand zur Faust ballt und dabei der Mittelfinger leicht vorsteht. Seine vielen Unfälle machen seine Arme, Hände und Handgelenke jedoch nicht robuster. - Später hat er erzählt, wie er den Gertel erst richtig von sich weg gehalten habe, wie sie das gelernt hätten, dann die Richtung im allerletzten Moment warum auch immer gedreht habe.
Mit einigen Jahren Abstand ist Paschi eines Tages an einem Stock humpelnd bei uns aufgetaucht. Mit Daniel, seinem Freund aus den Lehrjahren, hat er sich eine zu grosse Nummer vorgenommen: Sie wollten zusammen einen offenbar mächtigen Baum zurückschneiden (obwohl Baumgärtner ein Spezialberufszweig ist). Daniel stand oben im Baum auf einer Leiter, Paschi hat diese unten gesichert. Nachdem bereits viele Äste gefallen sind, hat Daniel einen grossen Ast - selber dick wie ein Baum, wie Paschi später gesagt hat - in Angriff genommen. Der Ast war durchgesägt und begann zu fallen, verfing sich im Geäst des Baumes, drehte sich weg und stürzte unkontrolliert knapp vor Paschis Kopf vorbei auf seinen rechten Fuss, der tief in den Erdboden hineingerammt wurde. Während Paschi unten schrie, ist Daniel oben auf seiner Leiter mit der laufenden Baumsäge in der Hand haltlos hin und her geschwankt, bis er sich irgendwie an Ästen festhalten und zum Stamm heranziehen konnte. - Paschi hat sich im Spital den Stock besorgt, seinen Fuss aber trotz Nachfrage nicht weiter untersuchen lassen! Noch lange ist er gehumpelt, noch viele Monate nach dem Unfall hat sich sein Fuss bei längerem Autofahren verkrampft. - Genug! Es reicht! Karis und mein Glück war, dass wir erst nachträglich von dieser Horrorgeschichte erfahren haben. Doch inzwischen bin ich oft nervös, wenn sich unser Junior bei uns anmeldet, vor allem, wenn er noch etwas besprechen will ...
Nach fast drei Jahren, unsere ersten drei Kaninchen haben sich in ihrem Stall längst gut eingelebt, kam die Ankündigung der Hausbesitzerin, dass sie das Haus nun doch verkaufen werde, obwohl sie am Anfang betont hatte, dass dieser Hausteil vor Jahren für ihre Eltern renoviert worden sei und nicht verkauft würde. Wir sollten uns jedoch keine Sorgen machen, das würde noch Jahre dauern. Das ganze grosse Areal der Gärtnerei nebenan sollte verkauft und überbaut werden.
Das war ein schwerer Schock für uns. Immer treffen mich solche Schläge jedoch viel tiefer als Kari. Manchmal scheint mir, als würde alles an ihm abprallen, obwohl er versichert, dass ihm manches auch nicht gefällt. Mit den Monaten und nächsten Jahren habe ich mich beruhigt, die Furcht vor der endgültigen Kündigung ist in den Hintergrund gerückt, weil sich überhaupt nichts ums Haus herum verändert hat. - Selber wollten wir das Haus nicht übernehmen, weil doch viel zu viel daran hätte modernisiert werden müssen. Als Rentner hätten wir von der Bank keine Hypothek bekommen und wir wollten uns schon gar nicht im Alter mit Problemen belasten. Vielleicht mussten wir ja selber irgendwann zum Schluss kommen, wegen der Treppe mit ihren achtundzwanzig Stufen eine bequemere Wohnung zu suchen, das aber noch ganz lange nicht, schliesslich waren wir noch fit und gar nicht alt!
Das angenehme, manchmal auch fordernde Leben im Haus mit dem über 90-jährigen Nachbarn, der oft froh um meine Unterstützung war; mit den Kaninchen, die mir viel Freude bereiteten, aber auch mal zum Tierarzt mussten; mit dem glücklichen zufriedenen Büsi; den Nachbarn, mit denen wir Feste feierten; unseren vielen Eselwanderungen; meine beiden Fitnessmärsche durch den Wald und in die Höhe mehrmals die Woche; meine regelmässigen Besuche bei meiner Mutter und Karis Treffen mit seinen alten Kameraden brachte Zufriedenheit und eine neue Struktur in unseren Alltag.
Doch jetzt fand ich plötzlich immer weniger Zeit für mein Keyboard: Hatte ich vor dem Umzug doch stundenlang gespielt, schrumpfte mein Spielen inzwischen auf eine nur noch gelegentliche halbe Stunde zusammen. Damit liess meine Fingerfertigkeit merklich nach, was wiederum meine Ungeduld und Unzufriedenheit so steigerte, dass ich meine Freude am Musizieren verloren habe. Seit dem zu lauten, aber fantastischsten Konzert von Bob Dylan im Zelt in Konstanz, bei dem er sichtlich gut gelaunt und beschwingt mit einem Sologeiger zusammen aufgetreten ist, kann ich keine Kopfhörer mehr tragen, weil sich meine Ohren jeweils sofort verschliessen. Auch das hat die Freude am Keyboard vermindert. Nach einiger Zeit habe ich mich entschlossen, das Instrument der Musikschule zu verschenken, wo sie sich darüber gefreut haben.
Das Keyboard habe ich bereits vor Jahren gekauft, als ich jeweils auf dem Weg zu meiner Mutter am Musikhaus vorbeigekommen bin und im Schaufenster immer wieder dieses Instrument bewundert habe. Gleichzeitig mit dem Kauf habe ich mich zum Musikunterricht angemeldet: Ich erinnerte mich an meine Harmoniumstunden, also war ich doch keine ganz grüne Anfängerin mehr. Wirklich sehe ich meinen Musiklehrer in der ersten Stunde noch aus dem Augenwinkel, als ich die ersten Tonleitern vorspielen musste, wie er stehenblieb und mir zuschaute, dann fragte:
Können Sie das auch noch schneller? Warum nicht? Auch den Fingerwechsel habe ich noch korrekt beherrscht. So habe ich mich im Eilzugstempo durch die ersten Hefte gespielt, denn ich hatte ein Ziel: Eigentlich wollte ich die Songs von Bob Dylan nachspielen, schon bald habe ich mir im Musikhaus in Zürich die ersten Songbooks von ihm gekauft. Doch leider fehlte mir immer noch dieser oder jener Akkord, den ich beim Musiklehrer manchmal erfragte ...
Dann nach fünf Jahren erschienen Bauherren auf dem Grundstück nebenan, unser Haus wurde neu eingeschätzt, wir hätten ein Vorkaufsrecht darauf. Heiri, unser alter Nachbar ist mit fast 95 Jahren gestorben, eine neue Nachbarin eingezogen. Lilly hat mit ihrem Partner zusammen ihren Hausteil selber renoviert, dicke Steine aus den Wänden gehauen, sie haben gehämmert und geklopft, unserem Büsi - und uns - war manchmal nicht mehr geheuer, Büsi wusste kaum mehr, wo sie sich verstecken sollte. An normale Arbeitszeiten haben sie sich kaum gehalten und Fortschritte zeichneten sich keine ab, ein Ende war überhaupt nicht abzusehen, oft war es unglaublich laut und unangenehm. - Als dann hie und da Kaufinteressenten durchs Haus geführt wurden, wussten wir, dass es soweit war: Schweren Herzens und unwillig habe ich immer häufiger im Internet nach einer neuen Bleibe gesucht.
Und was passiert mit unseren Eseln? Wie lange konnten wir mit ihnen noch wandern? Wie lange hatten wir sie noch im Griff? Auf einem eigenen Hof wäre das jetzt kein Problem. Auch wenn Esel äusserst liebenswürdig und anhänglich sind, testen sie doch bei jeder Wanderung aus, ob sie vielleicht heute ihren Kopf durchsetzen und sich dem verlockenden Gras oder dem saftigen Löwenzahn zuwenden können. Immer braucht es eine konsequente Haltung, eine Schwäche oder Nachlässigkeit wird gnadenlos ausgenutzt. Wie oft hat Kari mich ausgelacht, wenn ich wieder einmal mit dem kleineren Pedro auf der Wiese gekämpft, diesen um den Hals gefasst und zurück auf den Weg geschleppt habe. Etwas, das mit dem grossen starken Rocco nicht möglich war - und wenn einer den Ausbruch geschafft hat, schafft ihn sofort auch der andere. Eine altersbedingte Schwäche unsererseits würde unbarmherzig ausgenutzt, wir hätten verloren und die Langohren würden übernehmen. Eines Tages hat uns die Bäuerin vom Eselhof mitgeteilt, dass jemand von einem Tierpark zwei Esel fürs Eselreiten zu kaufen suche, ob sie unsere beiden zeigen dürfe? War das jetzt die Lösung? Wir haben eingewilligt, dass Rocco und Pedro zum Testen abgeholt werden dürfen. Natürlich waren beide inzwischen so gut trainiert, dass sie mit Begeisterung übernommen wurden. Beim Verkauf unserer anhänglichen und treuen Begleiter ist mir fast das Herz zerbrochen, es war mir, als würde ich unsere Kinder verkaufen. Immerhin durften wir weiterhin auch vom neuen Ort aus mit den beiden spazieren gehen, einfach nicht an den Tagen des Eselreitens - das haben wir noch einige Jahre gemacht und wie vorher, jeden Ausflug aufgeschrieben.
Als dann Lilly zwei italienische Arbeiter eingestellt hat, die tagelang an zwei Stellen gleichzeitig an unserer Rückwand geschliffen haben, und unser Büsi nicht mehr wusste, wohin sie sich vor dem gefährlichen Raubtier verstecken sollte, eilte es plötzlich. Wieder habe ich das Wohnungsangebot im Internet aufgerufen, dessen Aussicht mich immer fasziniert hatte, das ich aufgrund der Zimmeranzahl aber nie genau geprüft habe. Die Wohnung war relativ klein, nur noch halb so gross, dafür gab es zwei grosse Terrassen, auf denen auch Platz für die Kaninchen war. Wir haben die Grundmasse der Wohnung angeschaut, unsere Möbel ausgemessen und uns beworben. Nach einer Woche war der Vertrag unterschrieben: Ausgerechnet das Büsi gab Anlass für einen Vorbehalt, nur aufgrund ihres Alters wurde sie akzeptiert. Nein, unser Büsi, das von klein auf seit fünfzehn Jahren mit uns lebte, das hätten wir nicht weggegeben!
Nach dem Unterzeichnen des Vertrages wurde mir das Herz bleischwer: Wenn die Wohnungsbesitzer kaum eine Katze tolerieren wollten, wie sah es da bei Kaninchen aus? Kaum besser, im Gegenteil: die Leute, vor allem die Frau hat gezeigt, dass sie an einer allgemeinen Tierphobie leidet. Sollten wir die Häsli einfach auf der Terrasse einquartieren? Das konnte nicht unbemerkt geschehen, es musste ja ein Gehege mit Stall erstellt werden. In meiner Not habe ich beim Vermieter nachgefragt, aber nein, seine Frau wolle auf keinen Fall Tiere in der Wohnung. Hektisch habe ich mich jetzt umgesehen: Ich habe mich bei einer ausgewiesenen Kaninchenfachfrau - einer Tierärztin, die eine Kaninchenauffangstation betreibt und die Kaninchen und deren artgerechte Haltung studiert - erkundigt, ob sie unsere Häschen aufnehmen würde. Nachdem ich ihr erklären musste, dass in der Gruppe die Zoonose Schiefhals (Encephalitozoon cuniculi, E.C.) existiert, hat sie abgelehnt. Verständlich, aber jemandem anderen würde ich meine Lieblinge nicht anvertrauen. So habe ich mit der örtlichen Tierärztin, die unsere Gruppe gut kannte, über mein Problem gesprochen. Nach genauer Prüfung hat sie sich einverstanden erklärt, diese Tierchen einzuschläfern - ein furchtbarer Weg für mich!
Noch hatten wir etwas Zeit: wir räumten, entsorgten, verschenkten, liessen abholen und packten unsere Sachen. Hinter dem Haus zerlegten wir den Kaninchenstall, säten wieder eine Blumenwiese aus, liessen die Hoppler bis zum Schluss in ihrem Winterstall im Haus. Der bedrückende Zeitpunkt rückte näher und näher, immer wieder schob ich ihn hinaus: schliesslich blieb mir kein Ausweg und ich musste ihn beim Tierarzt fixieren: das halbzimmergrosse Gehege musste abgebaut werden.
Wie jeden Tag bin ich frühmorgens ins Zimmer getreten, alle Langohren sind mir erwartungsvoll entgegengerannt, haben ihre von mir gereichten Kräutlein entgegengenommen und gemampft und sich nachher dem Gemüseteller zugewandt. Wie immer bin ich auf meinem Baumstrunk gesessen und habe Häschen um Häschen aufs Knie genommen, um es zu kontrollieren, zu putzen und zu kämmen. Wie immer habe ich ihren Stall ausgemistet und zum Schluss ein frischgewaschenes Frotteetuch als Konferenzteppich auf dem Boden ausgelegt, wie immer sind alle drei darauf gestürzt und haben sofort ihre Köpfe zur nächsten Debatte zusammengesteckt - alles diesmal mit meinem bedrückenden Wissen, dass es das letzte Mal ist: heute Abend würde ich ihnen nochmals einige Kräutlein reichen und sie dann auf ihren letzten Weg zum Tierarzt bringen.
Nochmals liess ich die Erinnerungen an meine Hoppler an mir vorbeiziehen: Begonnen haben sie mit dem langhaarigen Wuschli und seinem Häsli, die eine so innige und liebevolle Gemeinschaft pflegten, dass Wuschli nach dem Tod seiner Gefährtin nach wenigen Monaten krank wurde und die elende Krampfkrankheit Schiefhals (E.C.) entwickelte, eine Krankheit, die gemäss Fachleuten mit etwa 80 bis 85 % bei allen gezüchteten Kaninchen im Darm steckt und bei Stress ins Blut übertreten und ausbrechen kann. Mit Wuschli und Häsli kam ihr kleines vifes Flöckli (von Schneeflöckchen) zu uns, das nach der Geschlechtsumwandlung zum Koböldli wurde, der bald mit unglaublicher Geschwindigkeit vor seinem Vater davonrennen musste, später sich stellte und mit ihm gefährliche Rangkämpfe austrug, so dass wir sie trennen mussten und ihnen eine Gefährtin suchten. Wuschli ist ein Jahr nach seiner Partnerin gestorben und wurde im Garten in die Grube von Häsli gelegt; von ihr war ausser einigen ganz winzigen weissen Knochensplitterchen im dunklen krümeligen Erdreich bereits nichts mehr zu sehen.
Dann kamen die schon von Anfang an etwas zu schwere und für ein Zwergkaninchen zu grosse Goldie: Die Betreuerin der Auffangstation seinerzeit hatte sie mitgegeben, weil sie eine enge Freundin der kleinen, aber kämpferischen braunen Linda, Lindeli, war, für die ich mich entschieden hatte. Goldie hat dann einige Zeit nach Wuschlis Tod die schrecklichen Krampfanfälle ebenfalls gezeigt und wurde mit den Medikamenten immer schwerer. Lindeli und Goldie wollte ich mit Wuschli oder Koböldli vergesellschaften, was auch nach mehreren verschiedenen Versuchen nicht funktioniert hat, die beiden Weibchen wollten einfach zusammen sein. Mit noch einem Versuch haben wir Häxli, die Grösste von allen, ein Widderchen mit Hängeohren, und ihr kleines Mädchen, Zimmy, dazu geholt. Zimmy (ein zimtfarbenes Zwergwidderchen) sollte Opi Wuschli Gesellschaft leisten, was sehr gut angelaufen ist, doch leider ist bei Wuschli bald darauf die Krankheit ausgebrochen. Zimmy hat sich später mit ihrer viel grösseren Mutter überhaupt nicht mehr vertragen (es war natürlich umgekehrt: die Mutter hat ihre Tochter verstossen). Zimmy war ein Alphatierchen und wollte kämpfen statt zu flüchten, was bei der ungleichen Körpergrösse zu schweren Verletzungen geführt hätte: wir durften sie der Züchterin zurückbringen, wo Zimmy später hübsche kleine Widderchen geboren hat. In den letzten Jahren lebten Goldie, Lindeli und Häxli in schönster Harmonie zusammen. Koböldli musste durch ein Gitter abgetrennt nebenan und auf oberen Etagen alleine leben und ist je nach Lust und Laune mit den anderen mitgerannt.
Kaninchen zu vergesellschaften ist wirklich Glückssache, ausser es steht viel Platz draussen im Gelände mit verschiedenen Möglichkeiten zum Graben zur Verfügung. Die Kaninchenhaltung, auch die Fütterung, ist generell nicht einfach: Kaninchen, die dauernd streiten oder aggressiv gegen Menschen sind, haben zu wenig Platz. Zudem sind Kaninchen keine Kuscheltierchen und lassen sich nicht gerne in die Höhe heben, dabei geraten sie oft in Schockstarre. Die Züchter machen es sich mit den Einzelboxen sehr einfach, tiergerecht ist das keinesfall.
Diese Harmonie in der Gruppe hat Linda geschafft und kontrolliert: Die Kleinste von allen ist die kämpferische Chefin. Bei jeder Veränderung in der Gruppe hat sie die Rangordnung wieder neu hergestellt: Im Gegensatz zu Revierkämpfen, die ohne Rücksicht auf lebensgefährliche Verletzungen - lebensgefährlich, weil leicht Infektionen bei den schlimmen Biss- und Kratzwunden entstehen können - hart geführt und deshalb gestoppt werden müssen, habe ich Lindelis gelegentlichen Kämpfen zur Sicherung der Rangordnung fasziniert zugeschaut: Dabei hat sie die anderen nicht frontal angegriffen, sondern ist in die Höhe und auf die Angepeilten gesprungen. Diese haben jeweils schnell aufgegeben, sind weggerannt und die Rangordnung war bereinigt. Nur dem mehr als doppelt so grossen Häxli musste Linda tüchtig die Meisterin zeigen: Ihr hat sie anfänglich sehr oft gedroht und hat sie herumgejagt, wobei Häxli angstvoll gepiepst oder vielleicht gekreischt und sich nachher in dunklen Ecken versteckt hat; noch lange hat Häxli beschwichtigend und unterwürfig gebrummt, wenn Linda nur in ihre Nähe kam; das hat sich schliesslich ganz gelegt.
Eine Beobachtung hat mich dann fragen lassen, ob nicht eigentlich die schwerfällige grosse Goldie die Matriarchin der Gruppe sei und sie die aktive Chefrolle ihrer kleinen kämpferischen Freundin Linda überliess, die Goldie übrigens auch nie attackiert hat: Eine Zeitlang durfte Koböldli jeweils das Revier der Damen betreten, musste sich aber an die Regeln halten. So habe ich einmal beobachtet, als er bereits nicht mehr erwünscht war, wie er sich trotzdem wieder an ihrem Gemüseteller vergriffen hat. Schnell waren Lindeli und Häxli zur Stelle und haben ihn mit Ohrfeigen vertrieben. Koböldli hat sich schleunigst auf seine oberste Etage verzogen und von dort gebannt auf das Grüppchen zuunterst hinabgeschaut. Also beobachtete ich weiter und sah, wie Goldie sich von der Gruppe löste und sich langsam und schwerfällig auf den Weg machte in den Stall, den ersten Stock und hinauf in die oberste Etage, wo Koböldli sie reglos und unverwandt nicht aus den Augen liess. Goldie näherte sich in ihrem Trott dem Kleinen, der sie schuldbewusst erwartete, als würde er einen Schimpf von seiner Grossmutter bekommen: Goldie verpasste ihm die Ohrfeige, die noch gefehlt hatte, drehte sich um und machte sich wieder langsam auf den Rückweg, weiterhin beobachtet von Koböldli. Erst als sie unten war, entspannte er sich und wandte sich erleichtert seinem Teller zu - und ich habe das Trenngitter wieder installiert.
Ebenso ist mir aufgefallen, dass Häxli zu Goldie eine sehr innige und hilfsbereite Beziehung aufgebaut hat, immer hat sie mit ihr vertrauter gekuschelt als mit Lindeli. Bei Goldies Krampfanfällen sind ihr beide immer zur Seite gestanden, haben sie mit den Nasen angestossen, um ihr auf die Beine zu helfen und sind eng bei ihr geblieben. Häxlis Hilfeversuche waren noch eindrücklicher, geradezu verzweifelt wollte sie ihr helfen. Wenn ich dazu gekommen bin, habe ich Goldie natürlich auf die Beine gedreht, habe sie mit langsamem Streicheln (auf dem Boden) zu beruhigen versucht und Linda und Häxli haben zugeschaut. So ein Anfall, der an Epilepsie erinnert, ist elend mitanzusehen. Jeder Anfall hat Goldie erschöpft und sie hat sich nachher jeweils zum Schlafen in eine dunkle Ecke zurückgezogen. Immer wurde sie von Häxli begleitet und ich musste aufpassen, eventuell mit einem Fingerstups, dass sich das schwere Häxli nicht über, sondern nur neben sie legte. - Goldie wurde von der Tierärztin betreut, und auch ich habe sie genau beobachtet: solange sie weiterhin so gerne futterte und sich in der Gruppe wohl fühlte, sollte sie leben, ich wollte die drei Freundinnen nicht auseinanderreissen.
Der kleine Koböldli tat mir leid, weil er nicht mit den anderen zusammen sein durfte. Er musste jedoch bereits zweimal nach Beissattacken vom Tierarzt genäht werden: Das erste Mal nach einem Kampf mit seinem Vater Wuschli, später nach einer unerwarteten Attacke von Häxli hinter meinem Rücken. Immerhin konnte ich auf diese Weise sein Revier gut auf seine Kügelchen kontrollieren: Nach einigen Bauchkrämpfen, die jedes Mal auch schlimm anzusehen waren, haben wir, der Tierarzt und ich, die Ursache endlich herausgefunden: Haarballen, die Kaninchen im Gegensatz zur Katze nicht herauswürgen können, hatten sich im Verdauungstrakt jeweils gestaut. Bisher hatte ich sein unwahrscheinlich flauschiges Fell mindestens dreimal in der Woche durchgekämmt und bin dabei manchmal fast erstickt an den vielen Flusen in der Luft. Nachdem ich das Fell täglich ausgiebig gekämmt und Koböldli die vom Tierarzt verordneten Pellets mit einem Wirkstoff für leichten Durchfluss durch den Verdauungstrakt verabreicht habe, sind diese Krämpfe glücklicherweise verschwunden; das ist unterdessen fast zwei Jahre her.
Am Abend haben wir unsere geliebten Hoppler zum Tierarzt gebracht. Weil wir sie nicht mehr im Garten vergraben konnten - wir wollten unseren Nachfolgern eine schockierende Entdeckung ersparen -, haben wir sie am folgenden Tag kremieren lassen. Ihre Asche haben wir Jahre später, zusammen mit derjenigen unseres Büsis, das uns im Winter darauf ebenfalls verlassen hat, in den grossen Pflanzentopf gestreut, der neben dem Stall im Kaninchenzimmer gestanden hatte und heute noch in unserem Wohnzimmer steht. - Alle Erlebnisse mit unseren Tieren, ob Esel, Kaninchen oder Büsi, habe ich aufgeschrieben: ihre Verhaltensweisen, die Tierarztbesuche, ihre Medikationen. Die Geschichte der Kaninchen wollte ich im kommenden Winter fertigstellen und in einem Heft binden.
Jetzt stand viel Arbeit an, die mir meine Verlust- und Schuldgefühle ein bisschen überdeckten. Wie schwer war es schliesslich auch, mein Gärtchen zurückzulassen: noch habe ich einen schönen Farn hier, eine andere Pflanze dort und ein paar Stecklinge der Kletterrose gerettet, alle gedeihen heute noch prächtig. Meinen Ahorn, der sich so gut entwickelt hatte, musste ich natürlich zurücklassen, hoffentlich durfte er weiterleben. Am Vortag des Zügeltermins hat Paschi mich mit dem Büsi und ein paar Sachen ins neue Heim gefahren. Kari konnte den Rest mit den Zügelmännern am Samstag alleine organisieren. Ich musste unbedingt fürs Büsi vorab eine ruhige Ecke im Schlafzimmer schaffen, wo sie sich hinter Kartons und Tüchern verstecken konnte, damit sie nicht allzu gestresst war: Beim Umzug und einige Tage lang hat sie stark gekeucht, Stress und vor allem die grosse Hitze, die ihr sehr zu schaffen machte, aber auch eine Ankündigung ihres baldigen Abschieds im kommenden Winter - nochmals ein tiefer Schmerz für uns.
Weil das Haus weiterverkauft worden ist, konnten wir es besenrein abgeben, immerhin eine riesige Erleichterung. Annemie hat mir trotzdem geholfen, ein wenig Ordnung und Sauberkeit zu hinterlassen. Kaum konnte ich mich trennen vom Haus, nochmals und nochmals bin ich in mein Zimmer und in den oberen Stock gerannt, habe auf den Kirchturm geschaut, den ich jetzt schon vermisste! Dann hat Annemie mich zum ersten Mal in unser neues Heim begleitet: Wow! Diese Aussicht! Diese Terrassen! Auch die Wohnung ist hübsch und hell, wenn sie auch viel kleiner ist. Ja, darauf habe ich genau geachtet: das neue Heim musste mir samt Aussicht gefallen, sonst wäre ich durchgedreht. Aber glücklich war ich nicht: beim Abmelden auf dem Einwohneramt sind mir die Tränen übers Gesicht gelaufen, dabei habe ich doch nie geweint!
Möglichst schnell haben wir uns eingerichtet, das Büsi - natürlich auch wir - sollte sich wieder wohl fühlen. Möbel wurden gerückt und Karton um Karton geleert. Dumpf hat mich im Hintergrund meine schwere Schuld belastet: mein Vertrauensbruch an den kleinen arglosen Samtnasen, wie konnte ich bloss damit fertigwerden? Mein Verlustschmerz, wenn ich ans Dorf, den Wald und die grünen Hügel, die Nachbarn und ans Haus dachte ...
Ende Sommer sind die ersten Besucher eingetroffen: Ja, ja, sicher, es ist sehr schön hier, wir hatten unglaubliches Glück! Unsere, meine, geheimen Gedanken haben wir den Gästen nicht so genau offenbart: Es war so kalt hier, so öd und leer, halt nicht mehr im Dorf. Mit den Hausbewohnern oder Nachbarn der Umgebung hatten wir keinen oder nur zufälligen Kontakt. Am Zügeltag haben wir zwar am Abend an allen Wohnungstüren geklingelt und uns vorgestellt. Wir wollten vermeiden, dass wir uns zufällig am Lift begegnen, ohne uns zu kennen. Die Nachbarn waren überrascht, zurückhaltend, nur zwei haben uns in die Wohnung gebeten: Das sind auch die Paare, mit denen wir später etwas mehr Kontakt hatten und sie einmal auf unsere Terrasse einluden.
Im November ist Kari eines Morgens um 9.15 Uhr mit dem Bus zum Einkaufen gefahren. Ich habe die Küche aufgeräumt und bin dann ins Schlafzimmer - der Zeiger hat 9.30 Uhr angezeigt -, um die Betten zu machen. Noch sehe ich mich zuletzt, wie ich das Spanntuch unterschiebe, dann ist der Schalter gekippt, es wurde dunkel, und von den kommenden drei Stunden erinnere ich mich an nichts. Alles, was ich über diese drei Stunden weiss, hat mir Kari erzählt: Als er vom Einkaufen zurückkam, hat er mich völlig aufgelöst tränenüberströmt nackt im Badezimmer vorgefunden; ich hätte sturzflutartig geschluchzt, wie er so etwas nie gesehen habe. Ich sei komplett orientierungslos gewesen, hätte ununterbrochen gefragt, wo wir denn hier seien. Kari hat mir meine Fragen beantwortet, aber immer aufs Neue habe ich die gleichen Fragen wieder gestellt - es muss ein grosser Schock für ihn gewesen sein. Er habe mich kontrolliert, ich musste die Arme hochhalten, er hat mein Gesicht beobachtet: er befürchtete einen Hirnschlag.
Wo sind wir hier? Warum sind wir denn hier? Haben wir denn gezügelt? Da war ich aber nicht dabei. Sind wir nicht mehr bei Martin und Elsbeth, den Gärtnern? Wurde das Haus denn verkauft? (Sogar den Namen der Hausbesitzer konnte ich nennen.)
Wo sind die Häschen? Auf diese Antwort sei ich erneut in einen Weinkrampf gefallen. Dauernd habe ich gefragt und Kari musste immer dieselben Fragen wieder beantworten. Dann habe ich gefröstelt und Kari musste mir die Kleider aus dem Schrank holen. Er fragte mich, ob ich hätte waschen wollen: ich hatte noch die Wäsche sortiert und dann offenbar die Waschmaschine hinter der Badezimmertür nicht gefunden und damit die Orientierung vollends verloren. Dann erinnere ich mich ganz, ganz verschwommen an Karis Gesicht neben mir bei der Waschmaschine, als ich das Pulver selbstständig eingefüllt habe - dann war wieder dunkel. Irgendwann bin ich vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer gependelt, habe im Vorbeigehen wie immer - plötzlich ganz bewusst - auf den See hinausgeschaut und bin in die Küche gekommen: Dort habe ich verwundert mein einzelnes Gedeck auf dem Tisch gesehen.
Hast du schon gegessen? - Ja. - Und ich? Wo war ich denn? - Du bist dauernd in der Wohnung herumgetigert. Ich schaute auf die Uhr, die offenbar stehengeblieben war, schaute deshalb auf die andere, aber auch diese zeigte 12.30 Uhr an:
Ist jetzt halb ein Uhr? Stimmt denn diese Zeit? Warum? Wo sind denn die vergangenen Stunden geblieben? Jetzt hat Kari gemerkt, dass ich wieder da war und hat mir erzählt, wie er mich vorgefunden und die drei Stunden erlebt hat.
Lange haben wir miteinander gesprochen: Dieses Erlebnis hat uns schwer beunruhigt, hat mir Angst gemacht. Wie kann so etwas passieren? Noch war ich sehr weinerlich, die Tränen standen immer zuvorderst. In der darauffolgenden Nacht hat mir das Erlebte keine Ruhe gelassen und am anderen Morgen habe ich früh bei der Hotline der Krankenkasse mein Erlebnis geschildert: Die Fachperson hat nicht lange gewartet, sondern schnell erklärt, ich sollte mich unbedingt im Notfall eines Spitals melden und nicht zuwarten, das müsse abgeklärt werden.
Über diese Dringlichkeit bin ich jetzt gerade nochmals erschrocken und Kari hat mich ins Spital begleitet: Wir sind schnell in ein Untersuchungszimmer geführt worden, ein Ärztepaar ist erschienen und ich habe meine Episode erzählt. Dann habe ich gefragt, ob so etwas psychische Ursachen haben könne. Das sei unter Fachleuten noch umstritten. Darauf habe ich meine ungewollte Umzugs- und belastende Häsli-Geschichte erzählt, habe meinen Verrat an den Tierchen geschildert, habe erklärt, wie ich meine Häschen, die mir blind vertraut hatten, einfach umgebracht habe. Kari hat erzählt, wie er meine immer gleichen Fragen zum Umzug immer wieder neu beantworten musste. Ich wurde auch körperlich untersucht, dann haben sich die Ärzte zur Beratung zurückgezogen.
Zurück kamen sie mit einer Diagnose: Transiente Globale Amnesie (TGA), vorübergehende umfassende Amnesie, verursacht wahrscheinlich durch grosse emotional-psychische Belastungen; körperlich war ich gesund. Ich wurde beruhigt, dass damit kein erhöhtes Demenzrisiko verbunden sei, sollte etwas Ähnliches wieder passieren, sollte ich mich erneut melden.
Immerhin konnte ich mich damit weiter informieren: englisch heisst dieses Phänomen auch "Amnesia by the Seaside", weil es durch einen Kopfsprung ins kalte Wasser ausgelöst werden kann, sogar Sex kann es auslösen! Kaltes Wasser auf der Kopfhaut war mir immer sehr unangenehm.
Noch eine ganze Weile war ich dauernd den Tränen nah, beim Geschirrspülen konnten sie mir einfach so hinunterlaufen. Jetzt erinnerte ich mich auch, wie ich schon Tage oder Wochen vorher nahe am Wasser gebaut war. Neu kam jetzt dazu, dass ich mich fürchtete, allein aus dem Haus zu gehen, vor allem, alleine mit dem Zug zu fahren. Was, wenn jetzt der Schalter gedrückt würde? Vor dem Einsteigen in den Zug habe ich Kari telefoniert, nach dem Aussteigen ebenso, ich musste eine Verbindung zu ihm und zur Aussenwelt herstellen. Nach einigen Monaten habe ich mich langsam beruhigt und das Erlebnis ist in den Hintergrund gerückt.
Anfang Winter habe ich die Geschichte der Kaninchen fertig geschrieben und ein hübsches Heft gebunden. Bald darauf ist noch dasjenige fürs Büsi dazugekommen, wir waren tieftraurig, aber bei ihm musste ich mir wenigstens keine Vorwürfe machen: Ich durfte sogar noch einige innige Momente mit ihm erleben. Noch lange hat mich die Sehnsucht geplagt, wenn ich ins Dorf zurückkam, bis unser Haus umgebaut und damit für uns zerstört wurde. Im Garten wurden fast alle Pflanzen entsorgt, nur einige Rosen verpflanzt und Rasen angesät. Aber mein Ahorn, der durfte bleiben, er wird sogar gepflegt und fachmännisch geschnitten, so gut habe ich es nicht gekonnt. Noch heute, wenn ich ins Dorf komme, schaue ich vorbei, wie es ihm geht, und ganz verstohlen streiche ich ihm vom Trottoir her über ein Ästchen und flüstere ihm meinen Gruss zu. Seinen Weg kann ich zurückverfolgen bis zum kleinen Bäumchen auf meinem Balkon vor mehr als zwanzig Jahren.
Wie sich mit der Zeit herausstellte, ist dieser Nervenzusammenbruch nicht spurlos an mir vorübergegangen: Mir ist, als hätte die gewaltige Tränenflut einen Schutzwall in meinem Unterbewusstsein weggespült. Ich fühle mich seither luftig, wolkig und durchlässig, und ungefiltert und unkontrolliert tauchen längst vergessene, wichtige oder auch völlig belanglose Bilder aus meiner Vergangenheit auf. Ich bin sensibel, lärmempfindlich und schreckhaft geworden - nicht gemacht für diese Welt - und muss mich bewusst vor äusseren Einflüssen schützen, wobei ich weiterhin wissen will, was in der Welt geht und läuft.
Erst mehr als zwei Jahre nach dem Umzug merkte ich eines Tages: Jetzt bin ich hier zu Hause, ich bin angekommen, mir ist wohl!
Schon lange vorher haben wir unsere neue Umgebung erforscht, haben unsere Eselwanderungen wieder aufgenommen; im Sommer bin ich wieder fast täglich geschwommen. Alle diese Aktivitäten haben uns einen regelmässigen Alltag zurückgebracht, der mich meine Orientierung wieder finden liess. Wir geniessen unsere schönen Terrassen, wo es immer etwas zu zupfen, zu schneiden und zu putzen gibt: Im Sommer ist Wässern mein Fitnessprogramm. Wir sind dankbar für das, was wir haben. Sogar ein Einkaufslädeli ist in unserer Nähe, wo uns in Pandemiezeiten sogar Heimlieferung auf Wunsch angeboten worden ist, die wir glücklicherweise bisher nicht in Anspruch nehmen mussten. Wenn wir an die Jüngeren in diesen schwierigen und sehr oft belastenden Zeiten denken, müssen wir uns eingestehen, wie gut wir es als Senioren haben: unsere Rente fliesst regelmässig und bisher ist unsere Bewegungsfreiheit nicht stark eingeschränkt worden. Den nahen Wald und die vielfältigen Wandermöglichkeiten vom Land vermissen wir allerdings noch heute.
Im Tierpark zeichnete sich eine Veränderung ab: Nach einer Mitarbeitersitzung sollten neuerdings Eselspaziergänge aus Sicherheits- und Verantwortlichkeitsgründen immer von einem Tierpfleger begleitet werden. Das ist das Ende, das wussten wir sofort: Mit unseren Langohren hatten wir doch längst unsere Gewohnheiten entwickelt: die Vierbeiner kannten uns und unser Verhalten genau. Unterwegs durfte nicht gefressen werden (versuchen kann man es immer), in der Hälfte der Wanderung erlaubten wir ihnen jedoch an einem sicheren Ort einige Minuten freies Futtern mit der Leine über dem Rücken; begegneten uns Reiter, sind wir entweder ausgewichen oder am Wegrand stehengeblieben, um die Pferde nicht zu erschrecken; bei bellenden Hunden haben wir das Führseil auf ihrer Höhe geschwungen, um sie vom Esel fernzuhalten, bei ruhigen unbeeindruckten Hunden konnten wir ganz entspannt passieren. Sollte unser Grüppchen stocken, übergebe ich Kari meine Leine und gehe alleine weiter, ohne zurückzuschauen, und fast immer fällt der Widerstand und Rocco folgt und darauf auch Pedro. Für die Feinschmecker das Beste: Immer am Ende der Wanderung steuern die beiden auf ihr Bänkchen zu: dort gibt's ein Dessert - der Apfel! Schon früh habe ich dieses Ritual eingeführt, nachdem ich zufällig gemerkt habe, wie Pedro mit von Hand verabreichtem Fallobst anhänglicher und williger geworden ist. Anfänglich war er mürrisch und ist nur mit nach hinten gelegten Ohren mitgeschlurft. Wir haben vermutet, dass er, der gut ausgebildet war und Wagen fahren konnte, seinen ehemaligen Besitzer vermisst hat, der sich ja dementsprechend viel mit ihm beschäftigt haben musste. Ich habe jeweils einen Bissen des Apfels an - zuerst - Pedro verteilt, dann einen Bissen an Rocco, wieder einen an Pedro und so fort. Mit dieser besonderen Zuwendung haben wir sein Herz gewonnen.
Jetzt hat uns also Beat begleitet: Von Anfang an blieb die Aufmerksamkeit der Langohren auf ihn gerichtet, obwohl Kari und ich sie geführt haben. Die Zwischenverpflegung fiel aus, die Pfleger wollten nicht, dass die Esel unterwegs fressen durften, Punkt. Am meisten geärgert hat uns Beats Getue um die Hunde: Immer, aber immer mussten wir am Wegrand stehen bleiben, wenn uns Leute mit ihrem Hund entgegenkamen, auch wenn dieser ganz ruhig an der Leine lief, auch beim letzten ganz winzigen friedlichen Hündchen! So lächerlich! Wir haben Beat die Methode des Seilschwingens bei angriffigen Hunden erklärt, aber nein: das würde die Esel nur verstören! Dabei habe ich mich nie sicherer gefühlt bei Begegnungen mit Hunden als zusammen mit den Eseln. Zweimal hatten wir in unserer Eselzeit eine ernsthaftere Hundebegegnung: einmal war hinter uns durch den Wald wütendes Hundegebell zu hören und eine Frau, die ihren Hund verzweifelt und vergeblich zurückrief. Schon ist der grosse Hund weiter wütend bellend in noch beträchtlichem Abstand hinter uns in unseren Waldweg eingebogen, Pedro hat sich nach ihm umgedreht und mit aufmerksam nach vorne gerichteten Ohren abgewartet, und ich habe begonnen, das Seil vor seinem Kopf zu schwingen: Der gerade noch blindwütig lärmend heranrasende Hund hat die Verteidigungsfront erkannt und ist ruckartig stehen geblieben. So hatte die Frau Zeit, ihren Liebling einzuholen und an die Leine zu nehmen, schnell sind sie verschwunden.
Ein anderes Mal sind wir mitten im Wald unverhofft einem Ehepaar begegnet, die beide einen Boxer mit sich führten. Während die Frau ihr Tier fassen und wegführen konnte, hat der Mann seinen aggressiv belfernden Hund mit hochrotem Kopf nur mühsam unter Kontrolle bringen können. Wir befanden uns kaum zwei Meter voneinander entfernt, Rocco stand ruhig mit tief gesenktem Kopf neben mir, das zum Angriff wild entschlossene Raubtier vor sich konzentriert beobachtend. Wir waren uns so nahe und alles ist so schnell passiert, dass ich das Seil noch nicht mal geschwungen habe, von unserer Seite sollte vorläufig keine Unruhe ausgehen. Der Moment war bedrohlich, aber ich hatte keine Angst, wartete nur angespannt, Rocco hätte sich gewehrt. Der Mann konnte seine Bestie schliesslich bändigen, an die Leine nehmen und wegziehen.
Hinterlistig waren angriffige Hunde auch beim Vorübergehen: Während die Hundebesitzer unsere Begegnung bereits vergessen hatten, habe ich einen solchen Hund weiterbeobachtet und das Seil auch hinter dem Esel weitergeschwungen. Denn diese Hunde haben nur gewartet und wollten den Esel von hinten angreifen, was ihre Halter meistens überrascht hat.
Natürlich fiel auch unser Apfel-Ritual bei unserem letzten Eselspaziergang ins Wasser.
So begann für mich wieder einmal eine schwierige Zeit: Es bereitete mir nur noch Stress, die Esel zu besuchen. Zuerst begrüssten sie uns freudig und lautstark am Gatter, die langohrigen Freunde liessen sich flattieren, dann drehten sie sich weg und warteten vor der Stalltür auf unser Erscheinen, bereit zum Putzen, Halftern und Losmarschieren. Jetzt mussten wir sie enttäuschen, was mich vielleicht am meisten geschmerzt hat. So haben wir sie nur noch hie und da beim Eselreiten besucht, wo sie uns kaum beachtet haben und wir uns einfach wieder entfernen konnten. Manchmal sind wir vor einem Gehege gestanden, haben uns dann verabschiedet und die zwei Freunde, vor allem Rocco, haben uns lautstark ihre Abschiedsrufe hinterhergeschickt; oft konnten wir sie noch hören, als wir schon längst verschwunden waren.
Weil ich nicht wusste, ob Rocco und Pedro uns vermissten, hielt ich das nicht mehr aus und wollte sie nicht mehr besuchen. Kari überbringt seither das Eselheft, das wir noch abonniert haben, alleine und erkundigt sich bei den Tierpflegern nach dem Ergehen unserer ehemaligen Weggefährten: Die guten Nachrichten akzeptiere ich und hinterfrage sie nicht gross. Manchmal hat Kari die beiden auch flattiert, noch immer reagieren sie auf ihn, meistens rufen sie ihm nach, aber Kari kann damit umgehen. Esel haben ein ausgezeichnetes Gedächtnis und vergessen ihre Menschen nicht. Vor einem guten Jahr habe ich die Langohren das letzte Mal von weitem hinter einer Hausecke versteckt beobachtet. Das werde ich bei Gelegenheit weiterhin so machen. Ich muss unbedingt Distanz schaffen und von meinem Leiden an den Eseln wegkommen. Falls die Esel uns vermissen sollten, kommen auch sie mit Distanzhalten darüber hinweg.
Alle Eselbegegnungen habe ich aufgeschrieben: Ein erstes Heft vom Anfang unserer gemeinsamen Zeit bis zum schmerzhaften Verkauf von Rocco und Pedro existiert schon lange; das zweite Heft ab diesem Zeitpunkt habe ich eben abgeschlossen.
Hie und da tauchen vor dem Einschlafen noch immer vor allem zwei schöne Erlebnisse mit den Langohren vor mir auf, die noch aus der Zeit vor dem Verkauf stammen: Sie erinnern mich an die Vertrautheit, die in all den Jahren zwischen uns entstanden ist, eine verlorene Verbundenheit, die schmerzt. Wenn ich diese Erinnerungsbilder nicht unmittelbar verscheuchen kann, liege ich lange wach, bis manchmal die Tränen laufen. Jetzt hoffe ich, diese Bilder auf Papier bannen zu können, damit sie mich in der Nacht in Ruhe lassen:
Einmal bin ich vor Kari alleine mit den Halftern und dem Putzzeug von der Sattelkammer ins Sommergehege hinuntermarschiert. Auf halber Höhe hat mich Rocco entdeckt und ist mir vom Waldrand her über die ganze Wiese entgegengestürmt. Sogar einem vorbeigehenden Wanderer ist das aufgefallen:
Da freut sich aber jemand riesig! Das zweite Bild zeigt den Moment nach einer Wanderung: Kari und eine Begleiterin haben sich bereits von den Tieren verabschiedet und sind in die Sattelkammer verschwunden. Wir befinden uns auf der obersten Eselwiese, wo wir Rocco, Pedro und den kleinen Lucky, der uns unbedingt immer begleiten wollte, vorher aus der gesamten Gruppe herausgeholt haben. Jetzt sind die anderen Esel aber nicht mehr da, und weil ich kurz vorher einige Jäger mit ihren geschulterten Gewehren über die untere Eselwiese gehen sah, frage ich mich, ob die Gespanen wirklich in ihrem unteren Sommerrevier sind. Ich vergewissere mich, dass der Zaun nach unten offen ist, kann aber von hier aus nicht nach ganz unten sehen. So trete ich ganz nahe an den Zaun, beuge mich vor, vergeblich. Und jetzt zeigt sich, wie Tiere die Menschen besser lesen können als wir sie: Pedro tritt neben mich an den Zaun, daneben Rocco und anschliessend Lucky: Dann beginnen alle drei zu rufen, fast zerschlägt es mir die Ohren, zuerst Pedro, unmittelbar darauf Rocco und dann der kleine, erst ein gutes Jahr alte Lucky, der noch nicht richtig rufen kann, erst Quietschtöne zu schmettern versucht. Und sofort ertönt die vielstimmige Antwort von unten! Erleichtert wende ich mich den dreien zu und lache:
es sind ja alle da! und trete einige Schritte zurück, um sie vorbei zu lassen. Pedro dreht sich ab und beginnt, nach unten zu traben. Rocco schaut zu mir zurück, dreht sich um, kommt zu mir, stupst mich mit der Nase an:
tschüss! und trabt Pedro hinterher. Wieder imitiert der kleine Lucky den Grossen, schaut zu mir zurück, kommt zu mir, stupst mich mit der Nase an:
tschüss! und trabt Rocco hinterher. Ergriffen und bewegt schaue ich den drei Eseln nach, wie sie in regelmässigem Abstand den Hang hinuntertraben: Ein wunderschönes Bild!
Das Schreiben über meine Gefühle und das nochmalige Durchleben schwieriger Zeiten ist im Moment aufwühlend, bringt mir später jedoch Abstand und Ruhe. Gerne gehe ich auch immer in die Natur hinaus und beobachte Tiere und Vögel: Ihr Gesang und fröhliches Gezwitscher sind für mich Balsam.
Enge Verbundenheit mit der Natur
Seite 15
Seite 15 wird geladen
14.
Enge Verbundenheit mit der Natur
Jetzt habe ich doch mehr als sechzig Jahre nach meiner Pubertät etwas entdeckt: In einem Buch habe ich den Ausdruck "skrofulöses Mädchen" gelesen, einen Ausdruck, den ich erst im Fremdwörter-Lexikon nachschlagen musste. Dort habe ich elektrisiert konstatiert: Skrofel: Halsdrüsengeschwulst, verdickter Halslymphknoten / Skrofulose: tuberkulöse Haut- und Lymphknotenerkrankung bei Kindern. Also waren die über viele Jahre geschwollenen Lymphknoten nicht ein vom Immunsystem ausgesandtes Symptom für eine Störung im Körper, sondern
die Krankheit selber; aber natürlich bin ich keine Medizinerin.
Klar habe ich weitergeforscht: Nur, eine Kinderkrankheit allein ist das allerdings nicht; auch wenn bei mir nach dreissig diese Verdickungen viel kleiner geworden sind, verschwunden sind sie nie ganz oder tauchen öfters unerwartet leicht wieder auf. Im Gegenteil, es lassen sich damit ganz viele kleinere und grössere Störungen in den Folgejahren erklären: ein chronisches Nasenlaufen ausser an den wärmsten Tagen des Jahres; am lästigsten ist eine starke Neigung zu Nebenhöhlenentzündungen bei jedem starken Schnupfen. Einmal hat sich daraus eine äusserst hartnäckige Sinusitis entwickelt, so dass ich zunehmend Angst vor einer Hirnentzündung bekommen habe. Damals habe ich den Geruchssinn komplett verloren, der sich nur langsam erst im zweiten Jahr wieder aufzubauen begann, das schlimmste Jahr mit nur schlechten, metallenen und chemischen Gerüchen, die ewiglange in der Nase hängengeblieben sind; erst nach vollen drei Jahren hat sich der Geruchssinn wieder vollständig erholt. Der fehlende Geschmackssinn hat mich weniger beeinträchtigt, weil Kari ja das Kochen übernommen hat. Eine HNO-Ärztin hat mich verständnisvoll begleitet und mir Hoffnung auf Besserung gemacht. Seither fürchte ich jeden auch nur leichten Schnupfen. - Eine nicht unangenehme Erscheinung erlebe ich heute noch hie und da: ich bekomme vor allem im Winter ganz rote heisse Wangen mit einer angenehmen Wärme und Müdigkeit im Kopf, in die ich mich vor allem abends ergeben kann. Eher unangenehm ist das tagsüber draussen, aber auch egal, ich bin sowieso diejenige mit den roten Backen.
Instinktiv habe ich mich richtig verhalten: immer fühlte ich mich am gesündesten bei meinen Gartenarbeiten vor dem Haus an der Sonne. Noch heute suche ich immer die Sonne, auch bei heissem Sommerwetter lasse ich mindestens meine Füsse von der Sonne wärmen und aufheizen, während ich die Zeitung lese.
Seit meiner TGA-Amnesie beobachte ich meinen Kopf vielleicht zu genau. Dieser Schock, dass das Bewusstsein auf Knopfdruck, ohne jede Vorankündigung, ausgeschaltet werden kann, sitzt tief. Aber, wie geht Demenz? Es gibt ja unzählig viele Variationen. Lebhafte Gedanken im Kopf - was, wenn die Verbindung nach aussen kappt und ich mit ihnen gefangen wäre, wenn ich nicht mehr lesen oder den Computer bedienen könnte, nicht mehr aus meinem Kopf fliehen könnte? Altern muss gelernt werden.
Langsamer werden! Dem Kopf Zeit geben! Beim Geld abheben am Automaten habe ich jüngst die Karte automatisch so blitzschnell herausgezogen und ins Portemonnaie gesteckt, dass ich mich kurz darauf nicht mehr daran erinnern konnte, (ich habe mich von Leuten am Nebenapparat etwas ablenken lassen), wartete, bis sie ausgegeben würde: was kam erst, das Geld oder die Karte? normalerweise die Karte, ich wartete, das Geld kam aber die Karte nicht. Schliesslich habe ich am Schalter mein Problem gemeldet, worauf mir eine neue Karte bestellt worden ist. Im Zug wollte ich dann meine Kartenbestätigung nochmals lesen und in der Tasche ordentlich versorgen, schaute in mein Portemonnaie, sah den gelben Rand und zog fassungslos meine Postkarte heraus - und für einen kurzen Moment schwebte wieder einmal die Demenzkeule über mir! Wahrscheinlich fürchten sich viele ältere Menschen vor dieser unheimlichen Krankheit. Mit keinem Schimmer konnte ich mich an diese heutige Kartenentnahme erinnern. Doch sofort tauchten frühere Erlebnisse auf, nach denen ich mir doch vorgenommen habe, LANGSAMER und überlegter zu werden, dem Kopf mehr Zeit zu geben; mich beim Lesen im Zug nicht zu tief in der Lektüre zu verlieren.
Nach meiner unvergesslichen Verwirrung auf dem Perron in Pfäffikon wusste ich, dass ich unbedingt darauf achten musste, meinen Lesestoff einige Minuten vor der Ankunft am Zielbahnhof wegzustecken. Damals habe ich mein Heft kurz vor dem Anhalten hastig in die Tasche geschoben und bin aus dem Zug geeilt - und auf dem falschen Perron gelandet: da wartete kein Anschlusszug auf dem Nebengleis, ich stand doch auf meinem Bahnsteig in die entgegengesetzte Richtung! Tief verwirrt schaute ich mich erst ratlos um, bis ich in der Unterführung den elektronischen Fahrplan konsultierte, wo sich mir das Unerklärliche endlich langsam entzifferte: Meinen Zug hatte ich doch nur noch im Eilschritt die Treppe runter erreicht, weil er einige Minuten verspätet war! Deshalb ist er auf ein ungewohntes Gleis umgeleitet worden. Die nächste Abfahrt für mich zeigte jetzt 11.17 Uhr an, auf demselben Perron, auf dem ich eben ausgestiegen war, korrekt, ein Regionalzug, wie ich aus Erfahrung wusste. Trotzdem bin ich einige Minuten später nochmals aus dem Häuschen geraten, als auf meinem gewohnten Abfahrtsperron nebenan ein Zug einfuhr. Warum kann ich nicht mal einen Fahrplan ablesen? Verzweifelt und hilflos hätte ich weinen mögen, bis ich merkte und mich erinnerte, dass dieser Zug einige Minuten Aufenthalt hatte und erst 11.21 Uhr abfahren würde, mein normalerweise regulärer Anschlusszug. Jetzt hätte ich mich für meine umständliche Reaktion ohrfeigen können; aber um solche unangenehmen Erlebnisse künftig zu vermeiden, durfte ich mich im Zug nie mehr so vergessen: Der Text hatte mich dermassen gefesselt, dass mir die ganze Fahrzeit auf wenige Minuten zusammengeschmolzen ist.
Nachdem ich mehr Zeit für mich und zu ausgiebigem Lesen hatte, habe ich mich oft gefragt, warum Mama (Grossmutter, Tante Helen, Onkel Köbi) nie von ihren Erfahrungen und Bedrohungen aus den beiden Kriegen erzählt haben. Warum habe ich nicht nachgefragt? Inzwischen würde mich brennend interessieren, wie sie die damaligen Jahre erlebt haben. Leider war ich für solche Fragen noch nicht soweit. Mama hat mir zudem ja viel aus ihrem eigenen Leben berichtet. Wer solch belastende und unruhige Zeiten erleben musste, spricht wahrscheinlich nicht gerne selber davon, will die trübe Vergangenheit hinter sich lassen. Unsere gesamte ältere Verwandtschaft hat zwei bedrohliche Weltkriege und die Spanische Grippe 1918/20 erlebt! Ich habe mich auch gewundert, warum all die Kriegsgeschichten im Geschichtsunterricht der Staatsschulen immer vor dem ersten Weltkrieg geendet haben, als wäre die Geschichte hier zu Ende.
Deshalb habe ich mir meine Geschichtslücken eben aus Büchern aufgefüllt: zum Beispiel "Der taumelnde Kontinent, Europa 1900 - 1914" von Philipp Blom; Bücher über den ersten Weltkrieg; "Die zerrissenen Jahre 1918 - 1938" ebenfalls von Philipp Blom über die Zwischenkriegszeit; Bücher über den zweiten Weltkrieg; von Keith Lowe "Der wilde Kontinent, Europa in den Jahren der Anarchie 1943 - 1950"; die Nachkriegszeit, dazu Zeugendokumente und persönliche Erfahrungsberichte aus Briefen und Archiven.
Besonders beeindruckt hat mich der Lebensbericht des Historikers Andreas Petersen über Erwin Jöris: "Deine Schnauze wird dir in Sibirien zufrieren. Ein Jahrhundertdiktat. Erwin Jöris." Das Buch ist nach mehreren Auflagen 2012 zuletzt herausgekommen, da war Erwin Jöris gerade hundert Jahre alt. Der Historiker hat mit Jöris zusammen und nach akribischer Überprüfung und Abgleichung der mündlichen Berichte mit den Archiven die unglaubliche Irrfahrt des Jungkommunisten Erwin Jöris nachgezeichnet: Jöris, ein kritischer Genosse mit lockerem Berliner Mundwerk, von seiner Festnahme im Sommer 1933 bis zur von Bundeskanzler Adenauer in Moskau ausgehandelten Rückführung deutscher Kriegsgefangener in die DDR im 1955, nach vier Jahren Gulag in den nördlich des Polarkreises gelegenen Eiswüsten von Workuta. Jöris hatte dann genug vom Kommunismus und hat sich nach wenigen Tagen nach Westberlin abgesetzt.
Alle diese aufwühlenden Bücher haben mir aufgezeigt, warum nicht früher über die vergangenen Kriegsjahre geschrieben oder gesprochen wurde: Europa - inklusive die Schweiz - musste seine schreckliche, dunkle Vergangenheit erst klären und aufarbeiten, und immer spielt da Schuld und Mitschuld hinein. Erst in diesen heutigen Tagen mit grösserer Distanz, wo sich laufend Ereignisse jähren, erscheinen Artikel, Bücher und Filme zu ihrem Gedenken.
Besorgt schaue ich auf den Zustand unserer heutigen Demokratien: Von vielen Seiten werden sie attackiert, wobei das verheerende Bild aus den USA nach den Wahlen 2020 und bereits während den vier Jahren zuvor für rechtsextreme Gruppierungen und Parteien eine willkommene Vorlage abgibt. Ich hoffe sehr, dass unsere Demokratien stark genug sind, um Widerstand leisten zu können! Der Hass und die Hetze in den sozialen Medien sind eine echte Gefahr.
Vor einem guten Jahr hatte ich eher zufällig mit einer jungen sensiblen Frau zu tun, nicht halb so alt wie ich. Bezeichnend für sie, waren unsere Gespräche von Anfang an und ohne Ausnahme ungewöhnlich direkt und offen, wenn sie nicht sprechen wollte, hat sie sich einfach verweigert:
Lass mich in Ruh! und mich auch aggressiv abgewiesen. Vor unseren Treffen war ich nervös, habe mich darauf vorbereitet, so gut ich konnte, nie wusste ich, wie sie drauf war, ob sie sich überhaupt zeigen würde. Trotzdem, ihre Art zu reden, diese Art, mit ihr ins Gespräch zu kommen, hat mich fasziniert: erstmals konnte ich mit einem Menschen so direkte, offene und bald auch tiefe ganz persönliche Gespräche führen, wie ich es mir immer gewünscht hätte. Sie hat sich für Umweltfragen, die Klimaveränderung, das Tierwohl, das Artensterben, die Biodiversität interessiert und mir viele Fragen dazu gestellt. Beim letzten Mittagessen zusammen in einem Restaurant hat sie sich engagiert über den Tisch gebeugt:
Eine Frage treibt mich endlos um: Was war zuerst: das Ei oder das Huhn? Zögernd habe ich gesagt:
Sicher nicht das Ei. Aber halt, das stimmt nicht, so kurz durfte ich sie nicht abspeisen. Also habe ich ihr meine Gedanken zum Thema ganz laienhaft dargelegt: Meiner Ansicht nach gehören beide ganz eng und unzertrennlich zusammen, beide verändern und bestimmen sich laufend gegenseitig. Wir hätten vor nicht langer Zeit einen Film über die Keas in Neuseeland gesehen. Keas waren ursprünglich Bodenbrüter, doch durch eingeschleppte Ratten zunehmend gefährdet und vom Aussterben bedroht. Forschergruppen haben nun festgestellt, dass diese Vögel in den letzten Jahrzehnten gelernt haben, ihre Nester auf die Bäume zu verlegen, und sich wieder vermehren würden. Diese Verhaltensänderung ist also bereits in die Gene der Vögel eingegangen.
Es gibt Affen, die mit Werkzeugen, also Ästchen, Ameisen und andere Insekten aus Löchern und Ritzen ziehen; einige Jungtiere ahmen ihre Eltern nach und lernen das Verhalten. Später gibt es Nachkommen, denen dieses Verhalten bereits angeboren ist. Wie wenig Zeit hat der Mensch gebraucht, um durch Züchtungen seine Haustiere seinen Wünschen anzupassen; wie viele neue Hunderassen hat er in Kürze erschaffen, ob sie nun sinnvoll oder auch qualvoll für das Tier sind.
Die Ei-Huhn-Frage lässt sich auf den eigentlichen Ursprung des Lebens zurückverfolgen. Wo beginnt das Leben? Wie und wann hat das Leben auf unserem Planeten begonnen? Eine packende, philosophische Frage, die das gesamte Universum umfasst; mir scheint das die wichtigste Frage der Menschheit überhaupt zu sein. - Natalie hat sich zufrieden zurückgelehnt:
Endlich wird mich dieses Thema nicht mehr verfolgen!
Nach dem Essen sind wir noch durch den Park beim Bahnhof spaziert: Natalie hat von ihrer Familie erzählt, von ihrer verehrten und heiss geliebten Grossmutter, von ihren drei noch kleinen Nichten, von ihrer als junge Frau durchgemachten Vergewaltigung. Sie hatte Pläne, wollte eine Weiterbildung machen, um Menschen mit psychischen Schwierigkeiten zu helfen, sie interessierte sich stark für Psychologie. Ich habe von mir erzählt, dass ich mich in ihrem Alter ebenfalls für Psychologie, später dann für Soziologie und heute vor allem für Philosophie interessiere; sie hat abgewinkt, das war ihr zu fern.
Obwohl unsere Mission mit diesem Tag abgeschlossen war, wollte sie sich wieder mit mir treffen. Hin- und hergerissen habe ich zugesagt, kannte ich inzwischen ihre nervenzehrende Unberechenbarkeit doch zur Genüge. Kurz nach diesem Treffen hat der erste Corona-Shutdown entschieden und unsere nicht ganz einfache Verbindung gekappt. Heute erinnere ich mich noch manchmal an unsere tiefsinnigen Gespräche.
Nach sechzehn Monaten stosse ich ungläubig auf ihre Todesanzeige: mit 38 Jahren "hat sie uns unerwartet und auf tragische Weise für immer verlassen". Paschi hat ihren Weg von Ferne verfolgt und mir später mitgeteilt, dass sie durch einen Unfall à la Natalie umgekommen sei. Er wusste, sie wollte leben und hatte Pläne für ihre Zukunft. Ein Schock für ihn und auch für mich.
Weil ich mir seit meiner Kindheit selber ein Bild über die Welt da draussen machen musste, habe ich mich kritisch an den mir als wahrscheinlich und am ehesten zutreffend erscheinenden Sachverhalten orientiert und mich bald über seriöse Zeitungen und Bücher informiert. Vom späteren Geschrei auf den Sozialen Medien habe ich mich immer fern gehalten. Früh schon habe ich mir eine laienhafte Denkweise angeeignet, mit der ich das Wichtigste aus den Informationen herausfiltern und miteinander vergleichen und abstimmen konnte. Mit diesem einfachen überschaubaren Weltbild komme ich gut zurecht und kann mir vieles erklären, manches sogar voraussehen - obwohl die Inhalte dieses Weltbildes mich manchmal zu erdrücken drohen.
Mit meiner gläubigen, besten Freundin kann ich leider nicht über die grossen Weltthemen reden; wir bleiben immer im engen persönlichen und familiären Rahmen. Als ich vor Monaten einmal ziemlich erbost über den weltbedrohenden Twitterer von ennet dem grossen Teich hergezogen bin, hat sie schockiert geantwortet:
Das ist nicht dein ernst? Das meinst du nicht so? Ich:
Doch, das ist mir ernst! Nach einer Pause hat sie gesagt:
Weisst du, er ist mir auch nicht sympathisch! Wie kann es bei einem so gefährlichen Typen, er war ja nicht einmal ernsthaft ein Politiker, um Sympathie oder Antipathie gehen? Als sie dann nicht mal die Namen Bolsonaro und Salvini kannte, habe ich schnell das Thema abgebogen; ich wollte sie ja nicht blossstellen.
Auf diese Weise habe ich mich auch mit Gott und der Religion auseinandergesetzt, einem Thema, dem ich aufgrund meiner Vergangenheit nicht ausweichen konnte. Schon als junge Mutter habe ich einmal den Nachbarskindern, die mich umringt und nach Gott gefragt hatten, geantwortet:
Gott ist ganz tief in dir drin, tief in eurem Herzen, und sonst nirgendwo. Diesem Bild kann ich auch heute noch zustimmen, ich bin also trotz allem keine Atheistin: Mit Sicherheit gibt es eine ausgleichende, bestimmende Energie, die man Gott nennen kann: Menschen brauchen Namen, um sich ein Bild machen zu können. Menschen brauchen einen Gott, um ihn anzuflehen, sie können ihren Kindern ihren Glauben an ihn und damit Trost und Hoffnung weitervermitteln, die Kirchen trösten und richten ihre Schäfchen mit ihren Predigten und ihrer Seelsorge auf.
Mir gefällt die einfache Vorstellung vom ursprünglichen Leben, wie ich oben beschrieben habe. Mit meinem Denken decken sich sogar die wissenschaftlich basierte Evolutionstheorie und der Kreationismus, die in der Genesis anschaulich dargestellte biblische Entstehungsgeschichte der Welt und der Menschheit in sieben Tagen. Die Bibel hat doch Recht! Die Erde war wüst und leer: Ganz am Anfang nach dem Urknall ist das Licht, die Sonne, erschienen, Meer und Land haben sich getrennt, Mikroorganismen, das erste Leben im Meer, haben sich entwickelt, daraus Fische und andere Meerestiere, später sind einige von ihnen aufs Land gekrochen, nachdem erste Grünpflanzen die Erde überzogen haben, mit den Pflanzen haben sich die Landtiere weiterentwickelt, Säuger sind entstanden, und am Schluss ist der aufrechtgehende Mensch erschienen. Das hat Millionen und Millionen von Jahren gedauert und dauert weiter an, die Zeit steht nie still. Die Bibel wird wissenschaftlich bestätigt, wir sollten diese offen, nicht wortwörtlich, verstehen und an die Zeiten ihrer Niederschrift denken: Ist es nicht erstaunlich, wie die Menschen vor zweitausend Jahren und viel mehr diese heut wissenschaftlich bestätigten Entwicklungen bereits beschreiben konnten? Die damaligen Lebensumstände und Denkweisen waren grundlegend verschieden von unseren heutigen; die Lebenszeit der Menschen war viel kürzer, hundert Jahre waren eine unüberschaubare Ewigkeit. Lassen wir die exakten Zahlen - in sieben Tagen - der Bibel weg und alles stimmt überein. Sogar die biblischen Wunder sind mit einiger Logik heute erklärbar. - Die fundamentalsten Evangelikalen werden eine solche Sichtweise immer ablehnen, für sie steht jedes einzelne Wort ihrer Bibel felsenfest und dafür ziehen sie auch in den Krieg.
(Hinweis: Artikel von Konrad Schmid, Professor für alttestamentliche Wissenschaft und frühjüdische Religionsgeschichte an der Universität Zürich; sein Buch: Die Bibel: Entstehung, Geschichte, Auslegung; aus Kirchenbote SG 01/22)
Nur die Botschaft der Bibel ist wichtig und die soll zählen: Jesus im Neuen Testament verkörpert diese Botschaft. Für mich ist alles weitere kirchliche Drumherum nur menschengewollter Überbau, der hilft, den Gläubigen die Botschaft zu vermitteln, aber auch, um die eigene Macht auf- und auszubauen und zu erhalten. Mit der Zeit ist diese Macht wichtiger geworden als die eigentliche Botschaft, so wichtig, dass sie versteinert ist und vehement verteidigt werden muss gegen alle äusseren Einflüsse.
Vor wenigen Monaten habe ich ein interessantes Büchlein entdeckt: "Raus aus dem Schneckenhaus! - Nur wer draussen ist, kann drinnen sein." Mit dem Zusatz: "Von Pharisäern mit Vorsicht zu geniessen!" von Martin Werlen, vorher Abt des Klosters Einsiedeln. Darin beschreibt er genau mein Problem, das ich als Kind hatte mit dem sektiererischen Fundamentalismus meiner Mutter, für die nur die wortgetreue Auslegung der Bibel zählte und die mich damit abblockte und mir den Zugang zu ihr verunmöglichte (ich spreche nur für mich, nicht für meine Schwester). Natürlich zielt Martin Werlen mit seinen Vorwürfen auf die Pharisäer im innersten Kreis der eigenen Kirche, auf die Abschottung in der katholischen Hierarchie, die jede Reform und Kritik fürchtet. Wir kennen alle den Ausdruck von den Pharisäern und Schriftgelehrten aus der Bibel. Diese Pharisäer setzt Werlen mit den fanatischen Evangelikalen gleich, denen ihre Ansicht, oder eben ihr Machterhalt, wichtiger ist als Jesu Botschaft: Nur wer den Kreis der Pharisäer im Schneckenhaus verlässt, kann drinnen sein, im Glauben der eigentlichen Botschaft von Jesu.
Ich denke, dass jeder und jede mit ihrer Religion glücklich werden soll. Aber sie sollen diejenigen nicht damit behelligen und bekehren wollen, die andere Ansichten leben. Und Eltern dürfen sich nicht hinter frommen Phrasen verstecken und ihre Kinder so mit ihren Problemen alleine lassen. Ich glaube, Religionen sind sogar ein wichtiger Teil unseres Menschseins; alle Völker haben sich seit je ihre Mythen und Überlieferungen über ihre eigene Geschichte und Herkunft weitererzählt. Umso unverantwortlicher ist die Missionierung der westlichen Kirchen bei Naturvölkern, denen damit ihre feste Grundlage entzogen wird und sie dadurch in Abhängigkeit, Armut, Krankheiten, Alkohol und Drogen stürzen. Mir scheint, unsere modernen westlichen Völker sind ins Taumeln geraten, seit die Religion ihre zentrale Bedeutung verloren hat. Vor einigen Jahrzehnten haben sich die Jungen von der Kirche losgesagt und ihre vermeintliche neu gewonnene Freiheit und Unabhängigkeit ausschweifend gefeiert und sind dabei mehr und mehr in die Drogen abgerutscht, in eine andere Abhängigkeit; diese Drogen- und Medikamentensucht ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Offenbar brauchen wir einen Halt und suchen ihn in unserer Leere und Verzweiflung heute irgendwo und überall in unserer Konsum- und Vergnügungswelt. Es werden uns die unterschiedlichsten esoterischen Kurse und Übungen zur Entspannung und Aufmerksamkeits-Therapien angeboten, damit wir unser modernes Leben überhaupt noch meistern können.
Ebensowenig soll sich der Mensch hinter Gott verstecken: Der so vernunftbegabte Homo sapiens hält gewaltig viel von seiner Freiheit, seinen eigenständigen Entscheiden, seinem unabhängigen Denken und Urteilen, doch sobald es um die Konsequenzen und Verantwortung für sein Handeln, für Katastrophen, Krieg, Leid und Elend geht, fragt er:
Warum lässt Gott das zu? Wo bleibt Gott? - Ist das nicht schizophren?
Der bedeutende politische Philosoph John Rawls, ein tief religiöser Denker, hat 1997 in "Über meine Religion" geschrieben: "Ich für meinen Teil kann nicht erkennen, inwiefern Inhalt und Gültigkeit der Vernunft davon abhängen können sollen, ob es Gott gibt oder nicht." Denn "das grundlegende Urteil der Vernunft muss dasselbe sein, unabhängig davon, ob es von Gott oder von uns stammt." (aus Artikel TA vom 6.2.2021: An der Front verlor er seinen Glauben)
Die Bibel habe ich seit meiner Jugendzeit nicht mehr gelesen (die Bergpredigt von Jesus ist für mich die Kernaussage), nach wenigen Versuchen habe ich sie immer wieder aus der Hand gelegt. Vieles wäre sicher interessant, aber ich habe keine Geduld, lese lieber Artikel anderer Autoren, die darüber berichten. Es gibt unglaublich viel Spannendes zu lesen, soviel Zeit bleibt mir gar nicht mehr. So fehlt mir auch die Ausdauer für ein eigentliches Geschichtsbuch, ich ziehe einen einfacher zu lesenden, gut recherchierten historischen Roman über ein Thema vor, so bleiben die Details eher hängen. Schwer habe ich mich auch mit "Don Quijote" von Miguel de Cervantes getan (kein weltbewegendes Thema): erst beim vierten Versuch über mehrere Jahrzehnte verteilt habe ich es endlich geschafft, und zwar nur, weil mich die ernsthaften Gespräche von Sancho Pansa mit seinem Esel im zweiten Teil der Geschichte zu interessieren begannen; die wunderliche Sprache und der Rhythmus des Buches haben mich schliesslich sogar gepackt.
Umgekehrt bei Dostojewskijs "Die Brüder Karamasow", das mich seinerzeit doch total fasziniert hatte und das ich wieder einmal lesen wollte, doch ich kam einfach nicht mehr über die verschlungenen dichten ersten Seiten hinaus.
Wo liegt denn eigentlich der Sinn des Lebens? Ich glaube, den muss jeder und jede für sich selber finden. Wer ein zufriedenes oder gar glückliches Leben führt, hat seinen Sinn gefunden, so sehe ich das. Befriedigung finden Menschen in einer anspruchsvollen, sinngebenen Arbeit; im Einsatz in einem wichtigen Projekt; wenn Künstler ihre Inspirationen leben können; bei Arbeiten in Wald und Natur; als Selbstversorger auf dem Land mit eigenen Tieren in artgerechter Haltung; natürlich in einem erfüllten Privatleben.
Mir scheint jedoch, zufrieden und erfüllt zu sein, wird in der heutigen Zeit immer schwieriger: sehr viele Menschen verbringen tagtäglich Stunden mit einer unbefriedigenden Arbeit und warten nur auf den Abend, das Wochenende oder auf die nächsten Ferien. Die Arbeitsabläufe werden immer unpersönlicher, schneller und hektischer, der Druck steigt, der Frust nimmt unaufhörlich zu. Das muss doch zu Explosionen führen. Ausser, man verdeckt seinen Frust hinter ausgelassener, aufgesetzter Lebensfreude, hektischer Reiserei, angestrengten Freizeitgestaltungen oder Alkohol und anderen Drogen - und verschiebt den Zusammenbruch damit nach hinten.
Wann haben wir unsere gelebte Naturverbundenheit verloren? Vielleicht mit der technischen Industrialisierung, bei der immer mehr Menschen in einen automatisierten, unpersönlichen Arbeitsprozess eingesetzt wurden. Ich denke, es geht noch viel weiter zurück: Vielleicht damals, als die Menschen vom reinen Tauschhandel übergegangen sind auf Zinsgeschäfte. Damit wurde die Gier nach Geld und Macht geweckt, die laufend gewachsen und mit der Entdeckung des Erdöls überbordet ist. - Hat nicht schon Jesus die Händler aus dem Tempel gejagt?
Sicher haben wir die Kontrolle verloren, als wir uns von der Natur entfernt und begonnen haben, diese auszubeuten. Es ist uns nicht mehr bewusst, dass wir Teil der Natur sind. Schauen wir zurück auf die Evolutionsgeschichte und darauf, woher wir kommen. Einige Naturvölker leben noch immer in Einklang mit Mutter Erde (wenn wir sie lassen und nicht vertreiben). Doch wir 'zivilisierten' Menschen haben uns über Natur und Tierwelt erhoben, als wäre Zivilisation ein Privileg dafür.
Macht euch die Erde untertan! Das haben wir in unserem Egoismus völlig falsch verstanden, es gibt auch Worte in der Bibel, die uns zu Naturschutz und Verantwortung für Mensch und Tier auffordern. Der Mensch heute: nach dem Ebenbild Gottes geschaffene "Krone der Schöpfung": einfach nur noch pervers ...
Mit der Überbevölkerung und seiner grenzenlosen Anspruchshaltung hat sich der moderne Mensch zum Parasiten entwickelt, der - ausser sich selber - keine Feinde hat. Dazu habe ich eine Fabel aus einem Buch über wildlebende Kaninchen, das vor einigen Jahrzehnten Gesprächsstoff lieferte: "Unten am Fluss, Watership Down" von Richard Adams. Im 6. Kapitel wird beschrieben, wie Frith, die Sonne, alle Tiere geschaffen hat, alle waren gleich und lebten friedlich zusammen auf einer grünen Welt, mit Gras und Samen und Fliegen in Hülle und Fülle. Doch die Kaninchen vermehrten sich mit der Zeit dermassen, dass das Gras auf der Erde immer dünner wurde und bald nicht mehr für alle reichen würde. Da warnte Frith den Kaninchenfürsten: wenn er sein Volk nicht kontrollieren könne, werde er selber die Kontrolle übernehmen. Doch der Fürst war stolz auf sein mächtiges Volk und uneinsichtig. Da hat Frith alle Tiere zu einem grossen Treffen zu verschiedenen Zeiten zu sich einberufen. Dort hat er jeder Tierart ein Geschenk gemacht, das diese von den anderen Tieren unterscheiden sollte, hat ihnen Waffen wie Hörner oder Stärke und List zur Verteidigung gegeben, Gesang den Vögeln, und vielen das Verlangen zu jagen und zu töten und die Kinder des Fürsten der Kaninchen zu fressen. Frith hat den Fürsten als Letzten getroffen, als dieser sich gerade angstvoll halb in einem Erdloch eingegraben hatte, weil er von anderen Tieren gehört hatte, dass er gefressen werden soll. Frith hatte Mitleid mit dem Kaninchenfürsten, der nicht aus dem Loch kommen wollte, und hat ihm sein aus dem Erdloch ragendes Hinterteil gesegnet: da ist seine Blume (Schwänzchen) leuchtend weiss geworden und seine Hinterbeine wurden lang und kräftig und haben warnend auf den Boden getrommelt. So blieb seine Fruchtbarkeit erhalten, er bekam die Geschwindigkeit, um vor seinen Feinden flüchten zu können und mit seinem Trommeln konnte er die Artgenossen warnen, aber seine grosse Familie konnte nicht mehr die Erde kahl fressen. Und Frith rief dem Kaninchenfürsten nach:
Dein Volk kann die Welt nicht regieren, da ich es nicht so haben will ... sei schlau und voller Listen und dein Volk wird niemals vernichtet werden! Da wusste der Fürst, dass Frith dennoch sein Freund war, und jeden Abend kommen er und seine Kinder aus ihren Erdbauten und spielen in der untergehenden Sonne.
Das ist mein Lieblingsbuch: Ich habe es schon mehrmals gelesen und werde es wieder lesen, sobald ich mehr Zeit finde. Damit kann ich wunderbar abschalten und mich in die Kaninchenwelt versetzen und deren aufregende Abenteuer miterleben, auch wenn ich inzwischen weiss, wie es auf der folgenden Seite weitergeht. Nur der Schluss ist jedes Mal traurig. Das Buch basiert auf eigenen Geschichten, die der Autor seinen Mädchen erzählt hat; er ist ein fantastischer Tier- und Naturbeobachter. - Die damaligen Kontroversen über eine politisch korrekte Ausdrucksweise der Kaninchen haben mich nur irritiert: ich lese das Buch einzig aus Sicht der Kaninchen; falls es menschlichen Normen angepasst wäre, hätte ich es als kitschig aus der Hand gelegt.
Diese Fabel zeigt klar die Vernetzung der gesamten Natur: Frith, die Sonne, Gott, hat die Erde so erschaffen, dass immer ein Ausgleich herrscht: Je nach Witterung, auch Naturkatastrophen wie Vulkanausbrüche, verändert sich das Nahrungsangebot, damit wächst oder schrumpft oder verschwindet gar eine Tier- oder Pflanzenart. Auf diese Weise bleibt der gesamte Planet Erde in stetigem Gleichgewicht. Falls der Parasit Mensch sich nicht zurückhält und die Natur über Gebühr ausbeutet, was inzwischen schon lange der Fall ist, wird diese sich unweigerlich wehren und zurückschlagen. In dieser Phase stecken wir schon seit vielen Jahren so auffällig, dass es inzwischen wohl alle gemerkt haben.
Wie kommen wir da wieder heraus? Ich bin sehr pessimistisch: Inzwischen existieren viele gute Projekte zum Klimaschutz, Reparationen und Renaturierungen in der Natur, Tierschutz- und Aufforstungsprojekte - mir scheinen sie wie Pflästerchen im Gegenzug zur gleichzeitigen gigantischen Zerstörung der Umwelt, die weltweit stattfindet. Vor allem skeptisch sehe ich die technischen Projekte, die Umweltprobleme - so wie CO
2-Filterung aus der Atmosphäre - wieder mit menschlicher Technik angehen wollen: die unendlichen Zusammenhänge und Auswirkungen durchschauen wir doch gar nicht; sind unsere Umweltprobleme nicht gerade alle durch menschliche Eingriffe entstanden? Wenn ich an die monströsen Waldrodungen denke, die verschiedensten Schürfungen, Bohrungen und Umweltverschmutzungen, die massive weltweite Vergiftung der Böden und des Wassers durch Pestizide und Kunstdünger, die plastikverseuchten Meere, das rasante Aussterben vieler Insekten und Tierarten. Wenn ich die Zielsetzungen zur Klimapolitik lese: 2030, 2050 oder noch später - zweifle ich, ob die Natur wohl so lange Geduld haben wird?
Was passiert denn jetzt? Frith, Gott, die Natur hat bereits übernommen und wehrt sich: Die rasante Erwärmung des Nordpols, das Abschmelzen des Polareises und der damit ausser Kontrolle geratene Eispolar-Jetstream, der das weltweite Klima durcheinanderwirbelt und überall für grosse Katastrophen sorgt: das Auftauen des Permafrostes; Hochwasser und Murgänge; die jährlich zunehmenden und sich ausbreitenden Waldbrände. Die unbarmherzige Massentierhaltung, die immer grössere Anbauflächen für Futter fordert, deswegen aber einheimische Tierarten, wie Fledermäuse, weichen müssen, diese damit in vorher nie dagewesenen Kontakt mit Menschen kommen und so Pandemien auslösen können.
Kürzlich haben wir eine TV-Diskussion verfolgt über unsere Erde, unseren Boden und die Biodiversität "Böden im Burnout - wie Chemie Bienen und Äcker bedroht": Eine Biologin und Professorin hat dabei demonstriert, wie sie bei ihren Seminaren jeweils einen Apfel auf ihr Pult legt und damit einen eindrücklichen Vergleich zu unserer Erde zieht: Das Fruchtfleisch des Apfels symbolisiert das Innere der Erde, die Haut des Apfels den Erdmantel und der Staub, der sich auf dem Apfel niederlässt, den Humus unserer Erde: Der Humus, der die gesamte Erde ernährt!
Anschaulich hat die Biologin erklärt, dass der natürliche Boden alles bereithält, was die Pflanzen für ihr Wachstum brauchen, dass er überhaupt keine Zusatzstoffe vom Menschen benötigt. Doch vor einigen Jahrzehnten haben einige clevere Profiteure gemerkt, dass mit Kunstdüngerzugaben die Pflanzen üppiger und grösser werden und riesige Geschäfte gemacht werden können, wenn sie die Bauern in Wettbewerb und damit in ihre Abhängigkeit bringen können. Dieses Doping laugt die Böden jedoch immer schneller aus und in einigen Jahren werden diese trotz laufend höherem Düngereinsatz nichts mehr hergeben und einbrechen. Das lässt sich mit dem Hochleistungssport vergleichen: Einige Jahre funktioniert das gut, dann ist aber Schluss.
Unseren beschränkten Boden vergiften wir gedanken- und verantwortungslos und damit natürlich auch unser Trinkwasser, die gesamte Tierwelt und uns selber. Ohne Insekten, die bald alle vergiftet und verschwunden sein werden, gibt es keine Bestäubung mehr. Hören wir auf seriöse Biologen und Umweltexperten! Wenn alternative Lösungen erarbeitet werden, entstehend automatisch auch neue Arbeitsplätze, die zudem sicher grössere Befriedigung verschaffen.
Wieder bin ich auf einen erhellenden Text des Historikers und Philosophen Philipp Blom gestossen: Ein Interview mit dem Migros-Magazin vom 15.3.21: "Wir leben in einer Zeit, in der viel auf dem Spiel steht". Darin erklärt er, dass wir uns am Ende der Zeitperiode befinden, die geprägt war vom biblischen Satz:
Macht euch die Erde untertan! Eine Zeit, die charakterisiert ist durch Eroberung, Herrschaft, Unterdrückung und Ausbeutung - auch durch eine einseitige Beziehung zur Natur. Das Ende dieser Epoche sieht er in den eskalierenden Nebenwirkungen, insbesondere die Folgen für Umwelt und Klima sind zunehmend existenzbedrohend. Er glaubt, dass diese Krise uns jetzt an die Schwelle zu einem neuen Zeitalter gebracht hat, an dem wir erkennen müssen, dass wir in einer endlichen Welt kein unendliches Wachstum haben können. Es wird auf sein Buch verwiesen: "Das grosse Welttheater. Von der Macht der Vorstellungskraft in Zeiten des Umbruchs."
Die Natur wird immer stärker sein! Sie wird sich wehren und zurückschlagen. Eher werden wir Menschen untergehen, vielleicht sind wir bereits auf diesem Weg. Die Erde wird sich nach uns wieder erholen, schneller als wir denken, vielleicht mit einigen Veränderungen, aber sie hat alle Zeit des Universums.
Wieder halte ich ein packendes Buch in der Hand, das ich keinesfalls im Zug lesen dürfte, weil ich riskieren würde, tief in den Text versunken durch die ganze Schweiz zu gondeln: "WOW! Unglaubliche Fakten genial illustriert" von Dan Marshall / National Geographic. Marshall illustriert in einfach verständlicher humorvoller Art auf jeweils nur einer Doppelseite pro Thema viele unbekannte und erstaunliche Fakten, die eine völlig neue Sicht auf unsere Welt und unser Leben bieten und uns ganz klein und unbedeutend erscheinen lassen, kleiner als ein Sandkorn, eigentlich nur noch Sternenstaub. Leider hat der Mensch jedoch massive Auswirkungen auf unsere Erde: Wissenschaftler haben festgestellt, dass täglich 150 bis 200 Pflanzen-, Insekten-, Vogel- und Säugetierarten aussterben, eine so dramatische und schnelle Sterberate wie zuletzt bei den Dinosauriern. Seit 1970 sind 60 % aller Tierarten verschwunden und der Mensch ist direkt daran beteiligt. Umweltexperten auf der ganzen Welt warnen, dass die Vernichtung der Tierwelt einen Punkt erreicht hat, der unsere ganze Zivilisation bedroht - und die Zukunft unseres Planeten.
Wissenschaftler haben unser Zeitalter nach dem Holozän, Ackerbau und Viehzucht, bereits beschrieben als Anthropozän, eine vom Menschen veränderte Umwelt, eine Geologie der Menschheit, die vom Weltall aus dokumentiert werden kann - Eingriffe verursacht vom Menschen, der erst in den allerletzten Sekunden des bestehenden Erdzeitalters erschienen ist!
Gerade eben habe ich mein neustes Buch erhalten: "Der Pilz am Ende der Welt" der Anthropologin Anna Lowenhaupt Tsing, das Buch, das bei der TV-Diskussion mit der Apfel-Biologin vorgestellt worden ist. Ich habe erst darin geschmökert, bin aber bereits fasziniert: Tsing arbeitet im Team einer Forschergruppe in wissenschaftlichen Feldstudien über den Matsutake, einem Pilz, der als erstes neues Leben dort entsteht, wo der Mensch die von der Industrialisierung ruinierten Böden hinterlässt, wie zum Beispiel nach der nuklearen Katastrophe von Hiroshima. Dieser Pilz, einer der wertvollsten Speisepilze Asiens, ist nicht kultivierbar und wächst bevorzugt als erstes Leben in von Menschen zerstörtem Boden. An diesen über die Welt verstreuten Katastrophenorten forscht das Team über diesen Pilz; dieses Buch soll erst den Anfang bilden. Wenn man dieses Buch liest, versteht man, dass alles mit allem zusammenhängt.
Mit Verwunderung und Staunen realisiere ich heute, wie ich mich mit meinem eigenständigen Denken aus meiner dunklen Ecke der Kindheit herausarbeiten und befreien konnte. Die grösste Herausforderung für mich ist jetzt, die Fehlentwicklung der Menschheit mitanzusehen und diese Sichten so auf Abstand zu halten, dass ich sie aushalten kann. Meine Hoffnung liegt bei den Jungen, die noch kämpfen können und müssen, für ihre Zukunft und die des Planeten.
Abendrot
Seite 16
Seite 16 wird geladen
15.
Abendrot
Vor drei Jahren hat mich ein Telefon meiner lieben ehemaligen Arbeitskollegin erreicht: Fränzi und ich haben am Schluss als die letzten beiden Frauen in der Firma noch kurze Zeit im unteren Stock gearbeitet, bevor sie die Arbeitsstelle gewechselt und ich in den oberen Stock gezogen bin. Fränzi war eine grosse starke, aber sensible Frau: immer wenn der Boss im oberen Stock seine cholerischen Anfälle bekam und, meistens am Telefon, herumbrüllte, ist Fränzi ins Zittern geraten. Weil ich das bemerkt habe, bin ich jeweils zu ihr ins Büro geeilt, habe die Türen geschlossen und ihr Gesellschaft geleistet, habe über den so ehrwürdigen Chef gespottet und sie mit Gelassenheit oder Fröhlichkeit aufzumuntern versucht. Auf diese Weise ist sie wirklich ruhiger geblieben und weil das oft vorkam, sind wir immer persönlicher ins Gespräch gekommen. Sie hat mir von ihrer schwierigen Vergangenheit als uneheliches Kind berichtet; von ihrem Pflegesohn, der sich als junger Mann das Leben genommen hat; von ihrem alkoholkranken und nachts auch oft lärmenden Ehemann. Fränzi hat erzählt und so diese schrillen Momente überbrücken können. Ich habe gewusst, dass sie Brustkrebs hatte, der momentan ruhig war. Später nach ihrem Weggang sind wir in Kontakt geblieben, wir, auch Kari war immer dabei, haben uns regelmässig mindestens zwei- bis dreimal im Jahr getroffen an den Anlässen des Berner Vereins, bei dem sie sich stark engagiert hatte im Unterrichten von Kindern und Erwachsenen im Volkstanz. Hans, ihr Mann, hat im Jodelchörli mitgesungen, und ihr Sohn spielt auf verschiedenen Bühnen Volkstheater, dessen Vorstellungen wir natürlich ebenfalls besucht haben.
Einmal haben wir beiden Ehepaare zusammen mit der alten Gotthardpost, einem schmucken Pferdegespann mit fünf Pferden, von Andermatt - Gotthard-Hospiz - via Tremola - nach Airolo den Gotthard überquert. In Airolo haben wir zusammen Znacht gegessen und übernachtet, damit den Ausflug verlängert und zur unvergesslichen Erinnerung gemacht.
Irgendwann hat Fränzi mir mitgeteilt, dass ihr Brustkrebs aggressiver als je zurückgekehrt sei. Bei den Volkstänzen hat sie schliesslich nur noch zugeschaut, mit Tränen in den Augen hat sie gelitten. Dann habe ich ihren Anruf bekommen: Schwer atmend teilte mir Fränzi mit, dass sie im Spital liege und nicht mehr nach Hause komme. Meine aufkommende Panik hat sie sofort abgeklemmt:
Sei ruhig, ich bin es auch. Ich will mich nur noch von meinen engsten Freundinnen und Freunden verabschieden. Was bleibt da zu sagen? Wir haben uns gegenseitig für unsere Freundschaft bedankt und ich konnte ihr nur noch versichern, dass ich sie in meinen Gedanken begleiten werde. Die sensible Fränzi war so stark! Ich vermisse sie noch heute.
Nur wenige Wochen später habe ich mich von Emely, der Frau meines Bruders, auf der Intensivstation verabschiedet; sie war wach, konnte aber nicht mehr sprechen, mir nur noch die Hand drücken; ihr Lebenslichtlein hat bereits stark geflackert und würde bald erlöschen.
Geschockt vernehmen wir soeben, dass auch ihr Sohn Alexander mit nur 62 Jahren eines Morgens nicht mehr erwacht ist. Es wurde eine fortschreitende Krankheit ermittelt, die wahrscheinlich hätte behandelt werden können, aber von Alex war bekannt, dass er nie einen Arzt, nicht mal einen Zahnarzt aufgesucht hat. Das war seine Entscheidung, nun hat er Ruhe und ewigen Frieden gefunden.
Überrascht hat mich jetzt der einfühlsame Nachruf seines Vaters, den er diesmal ohne Vorwürfe gegen alle Seiten geschrieben hat. Er hat vielmehr beklagt, dass Alexander ganz alleine in seinem Zimmer einschlafen musste. Dieser emotionale Rückblick und die Würdigung seines Sohnes haben mich meinem Bruder gegenüber gerade milder und versöhnlicher gestimmt.
Kari und ich haben schon vor längerer Zeit über Organtransplantationen gesprochen und unsere letzten Wünsche in einem Vorsorgeausweis festgehalten. Immer am Tisch nach dem Essen schneiden wir solche grösseren Themen an. Eigentlich wollte ich diese heikle Thematik hier in diesem Text nicht erwähnen, habe mich aber anders besonnen: alles hier widerspiegelt meine ganz eigenen Meinungen und Ansichten. Für uns in unserem höheren Alter spielt eine Organtransplantation sowieso keine Rolle mehr: Meine Überzeugung ist zuerst, dass nur Personen ein fremdes Organ erhalten sollten, die auch bereit wären, selbst eines zu spenden. Natürlich ist das kompliziert, weil viele gesunde Menschen Gedanken an Krankheit und Tod weit von sich weisen und sich nicht damit auseinandersetzen wollen. Meine und Karis Lebensart und unsere Erkenntnisse über den weltweiten Organhandel mit seinen gewaltigen Profiten, bei dem auch arme Bevölkerungsschichten zu Organspenden gegen Geld ausgebeutet - sogar getötet - werden, damit die begüterten Leute in den reichen Ländern weiterleben können, haben uns abgestossen und von diesem Geschäft abwenden lassen. Wir vertreten noch die altmodische Ansicht, dass wir ein Leben bekommen haben, das unabwendbar endlich ist und wir uns dieser Tatsache stellen müssen. Machen wir das, achten wir vielleicht ein wenig auf uns und unsere Lebensweise, ohne asketisch werden zu müssen. Wir hatten das Glück, dass die ganze Familie gesund ist. Was es heisst, ein krankes Kind zu haben, das nur mit einem fremden Organ längerfristig überleben kann, das sind ungeheure Fragen, denen sich diese Familien stellen müssen. Wie ich da entscheiden würde, weiss ich nicht: diese Kinder und Transplantierten benötigen anschliessend lebenslang starke Medikamente, die sie auch beeinträchtigen und ihr Leben oft nur kurze Zeit verlängert.
Ich liebe meine Geschichte inzwischen tief und schmerzlich. Mir gefällt, quasi mein ganzes Leben in Händen halten zu können. Es gäbe noch einiges zu erzählen, das besser im Hindergrund bleibt, wer will sich schon selber sezieren, bis er sich nicht mehr zusammensetzen kann? Zudem erscheint mir der herausgearbeitete rote Faden recht schlüssig.
Einige Tage lang habe ich im tiefsten Inneren eine rätselhafte wehmütige Sehnsucht nach der frühen Kindheit verspürt, in die ich mich am liebsten zurückversetzt hätte, die ich gerne nochmals durchlebt hätte. Erst hat mich dieses Gefühl sehr befremdet, bis ich mir erklärt habe, dass ich insgeheim einen zweiten Versuch wohl mit der Hoffnung verbunden habe, dass alles besser hätte verlaufen können, natürlich ein Trugschluss - beim Rückblick jetzt verspüre ich leise, tiefe Trauer.
Habe ich mich verändert? Nein, überhaupt nicht, ich bin noch immer dasselbe kleine Mädchen von damals, nicht mehr so ängstlich, selbstbewusster, mit einem starken Gerechtigkeitssinn; gewisse Eigenschaften und Charakterzüge sind deutlicher hervorgetreten, ich habe - vielleicht mit mässigem Erfolg - versucht, meine dominante Haltung zu kontrollieren; etwas Lebenserfahrung und ein ausgedehnterer Durchblick sind dazugekommen. Ich habe mich immer eher am Rand der Gesellschaft gefühlt, nicht ausgeschlossen, oft sogar angenehm überrascht, einfach nur nicht mitten drin: ich bin sicher, dass das sogar selbst so gewollt war - ja, einst habe ich mich vor dem Spiegel doch selber aus dem Wettbewerb genommen, anfangs des Geldes wegen, später aus Überzeugung. In meinem Leben gibt's keine unterschwelligen Konfliktherde, keine latenten Vorwürfe quälen mich, ich bin mit meinem Umfeld im Reinen. Ich fühle mich gut, bin ausgeglichen und ruhig, geniesse mit Kari die uns umgebenden Schönheiten wie Natur und See, sowie das gesicherte Rentendasein, das uns in Pandemiezeiten - Covid-19 - nicht mehr selbstverständlich ist. - Ich mache mir aber nichts vor, bei auftauchenden Belastungen wäre ich schnell wieder nervös und hektisch am Anschlag.
Wenn ich an unseren näher rückenden Abschied denke, sehe ich aus dem Weltall auf die nächtliche Erde hinunter, auf der viele starke Lichter leuchten, einige erscheinen erst ganz fein und werden langsam heller, andere werden schwächer, beginnen zu flackern und verlöschen schliesslich ganz. So tröstlich erlebe ich das Kommen und Gehen von uns Menschen auf diesem Planeten.
Kari und ich fürchten uns nicht vor dem Tod, hoffen nur auf ein humanes Sterben, das ruhig noch eine Weile warten darf, keiner von uns möchte jedoch alleine zurückbleiben. Wir haben einen Wunsch angemeldet und diesen den Söhnen präsentiert: Wir wünschen uns, dass unsere Asche jeweils aufbewahrt wird, bis der Partner nachkommt, um dann beide zusammen an einem bestimmten Ort dem See zu übergeben. In unserer Vorstellung gehen wir so miteinander nochmals auf Reise, durch den See, auf dem wir zusammen so viele Stunden verbracht haben, und weiter bis zum Meer; dort werden wir gemeinsam mit vielen anderen unsterblichen Seelen mit der Sonne und dem Wind in den unendlichen Kreislauf unseres Universums eintreten, was sogar an meinen Kindertraum vom Adler hoch in den Lüften erinnert. Dafür haben wir Millionen von Jahren Zeit, einen Kreislauf wird es immer geben. - Haben wir da ein Tränchen in den Augen der Söhne gesehen?
Wir hoffen sehnlichst, dass sie uns diesen Wunsch erfüllen werden!
* * *
Non, rien de rien
Non, je ne regrette rien
Ni le bien qu'on m'a fait
Ni le mal
Tout ça m'est bien égal
Non, rien de rien
Non, je ne regrette rien
C'est payé, balayé, oublié
Je me fous du passé
Avec mes souvenirs
J'ai allumé le feu
Mes chagrins, mes plaisirs
Je n'ai plus besoin d'eux
Balayé les amours
Avec leurs trémolos
Balayé pour toujours
Je repars à zéro
Non, rien de rien
Non, je ne regrette rien
Ni le bien qu'on m'a fait
Ni le mal
Tout ça m'est bien égal
Non, rien de rien
Non, je ne regrette rien
Car ma vie
Car mes joies
Aujourd'hui
ça commence avec toi
(gesungen von Edith Piaf)
* * *
Bücher:
Richard Adams: Unten am Fluss, Watership Down, S. 45 Fabel: Wie El-ahrairah
gesegnet wurde
Philipp Blom: Der taumelnde Kontinent, Europa 1900-1914
Die zerrissenen Jahre 1918-1938
Das grosse Welttheater, Von der Macht der Vorstellungskraft in Zeiten
des Umbruchs
Remo H. Largo: Zusammen leben
Keith Lowe: Der wilde Kontinent, Europa in den Jahren der Anarchie 1943-1950
Anna Lowenhaupt Tsing: Der Pilz am Ende der Welt
Dan Marshall / National Geographic:
www.nationalgeographic-buch.de:
WOW! Unglaubliche Fakten genial illustriert
Andreas Petersen: Deine Schnauze wird dir in Sibirien zufrieren. Ein Jahrhundertdiktat.
Erwin Jöris
John Rawls: Über meine Religion, 1997
(aus Artikel TA vom 6.2.2021: An der Front verlor er seinen Glauben)
Konrad Schmid: Die Bibel: Entstehung, Geschichte, Auslegung
(aus Kirchenbote SG, 01/22)
Martin Werlen: Raus aus dem Schneckenhaus! - Nur wer draussen ist, kann drinnen sein
(Von Pharisäern mit Vorsicht zu geniessen!)
Treffen sich zwei Planeten im Weltall.
Sagt der eine zum anderen: "Du siehst schlecht aus."
Sagt der andere: "Ja, ich habe Homo sapiens."
Der Erste: "Hatte ich auch mal. Das geht vorbei."
* * *
Nachträgliche Gedanken ...
Seite 17
Seite 17 wird geladen
16.
Nachträgliche Gedanken ...
... über innere SpannungenWarum nur dieser Zerstörungsdrang? So schöne Farbstifte! Jedes Mal eine Riesenfreude: doch warum werden sie so schnell, so unnötig abgespitzt? Andere persönliche Dinge ebenfalls: immer wieder werden sie bald zerstört. Wunderschöne, farbige, heissgeliebte Kinderbälle: schnell sind sie kaputt. Nachträglich oft hässig bedauert und betrauert, aber es passiert wieder. Diese innere Unruhe, Ungeduld, unterdrückte Aggression, manchmal auch offen hervortretend. Höchste körperliche Anspannung, die sich jeden Abend alleine im Dunkeln entladen muss. Eine in die Enge getriebene Seele, die sich wehren und befreien will.
... über ÄngsteWovor denn Angst oder Furcht? Diese Verlassenheit, die Einsamkeit, das Gefühl des im Stich-gelassen-seins in den frühen Jahren, die dauernde Unsicherheit und diffuse Sehnsucht hinterlässt. Dazu vielleicht auch von den Eltern und der Umgebung übertragene Kriegsangst? Die tiefliegende, doch lange unbewusste Furcht vor dem Lärm des Abends. Die Sorge und Anspannung der Mutter zu spüren, die Ängste der kleinen Schwester mitzubekommen und daran mitzuleiden. Später die Beklemmung, allein aus dem Haus unter die 'Sünder' gehen zu müssen, in den Kindergarten, zur Schule. Die Hemmungen und Befangenheit gegenüber den Lehrerinnen und den Lehrern, die nie freiwillig angesprochen werden. Vertrauen in die Erwachsenen wird nie vollständig aufgebaut. Die vom Bruder eingepflanzte Furcht vor Tieren kann später selber weitgehend abgebaut werden.
... über spätere ErfahrungenEin erstes Gleichgewicht im Gefühlsleben entsteht im Spiel und Zusammensein mit gleichaltrigen Kindern. Das bringt auch zunehmend Abstand zu den Ängsten und der Verlassenheit in der eigenen Familie. Kindlicher Trotz und Widerstand zu Hause wird offensichtlicher. Leider reicht das nicht fürs eigene Leben: die Konsequenzen in den späteren Jahren für die Zukunft werden noch nicht erkannt: Die Angst vor dem Ungewissen hemmt noch immer.
... über Nähe und Distanz und GefühleBleibt das schwierigste Kapitel fürs ganze Leben. Alles wird hinterfragt und kontrolliert: So, wie weit darf ein Kleinkind geknuddelt werden, ohne es zu verwöhnen? Alles sollte ja richtig und besser gemacht werden, als es seinerzeit die Mutter gemacht hat. Wann kippt es ins andere Extrem? Es sind viele Fragen und Situationen, die im Rückblick schmerzen. Ein gutes Vorbild hat gefehlt. Der Partner hat zwar mitgeholfen, aber auch nichts verstanden. Dieses gefühlsmässige Defizit hinterlässt heute bittere Gefühle der Schuld und des Scheiterns, mit denen gelebt werden muss. Trägt jemand Schuld - Erbsünde - für die Schwierigkeiten der Nachkommen, die ja auch erwachsen werden und eigene Verantwortung übernehmen müssen? Traumata sind übertragbar. Nachträglich weiss man alles besser.
... über Erinnern und VergessenBeim Zurückblicken erscheinen manche Dinge sehr klar, andere sind verschwommen und noch andere nur noch geahnte Nebelfetzen oder einfach im Unterbewussten versunken. Dazu sind Erinnerungen ganz persönlich und können mit der Zeit verschieben: Auch eine gemeinsam verbrachte Kindheit würde bestimmt ganz erstaunlich unterschiedliche Autobiographien hervorbringen. Jedes Familienmitglied steht an einem anderen Punkt in unterschiedlicher Beziehung mit verschiedenen Bedürfnissen und eigenen Erfahrungen zu den anderen.
... über miteinander SprechenWie oft, sehr oft, wird aneinander vorbeigesprochen, manchmal nur haarscharf, aber jeder hat eine eigene Vorstellung vom Thema. Um sich dem Kernpunkt eines Themas anzunähern und ein gemeinsames Bild entstehen zu lassen, braucht es Respekt, Zeit, Geduld und Anteilnahme zum Zuhören. Damit können Freundschaften erhalten und vertieft werden oder neue entstehen - vielleicht aber auch zerstört werden. Gute Gespräche sind bereichernd, erfüllend und führen oft zu ganz neuen Erkenntnissen.
... über Vertrauen und MisstrauenImmer wieder einmal wird in der Familie über Misstrauen und fehlendes Vertrauen gesprochen. Dabei scheint klar zu sein, dass generelles Misstrauen falsch, Vorsicht aber eben geboten ist. Wer zu vertrauensselig ist, wird früher oder später gnadenlos übertölpelt und ausgebeutet. So ist diese Welt. Was ist passiert nach dem unverantwortlichen Vertrauensvorschuss, der in der Weltpolitik in der Vergangenheit skrupellosen Autokraten entgegengebracht worden ist und teils noch wird? Heute muss an allen Fronten um Schadensbegrenzung gekämpft werden.
... über Verstehen und BegreifenManchmal ist's wie ein Schweben, hell, leicht, luftig, leer; Erinnerungen steigen auf, Einsichten fliegen zu, formen sich neu; viele drängende Gedanken im Kopf; alles muss langsamer und aufmerksamer angegangen werden. Ist das normales Erinnern und Verarbeiten oder der Beginn von Alzheimer? Wie macht sich eine Demenz bemerkbar? Vom Vergessen von Namen sprechen manche, und das soll normal sein. Alle, die älter werden, müssen sich damit auseinandersetzen: Eine leise neue Furcht, die da aufsteigt.
... über Übersicht und Distanz zum WeltgeschehenDiese wunderschöne, chaotische, zerstörerische und zerstörte Welt macht es schwierig, eine Übersicht zu gewinnen, zu behalten und gleichzeitig eine notwendige Distanz zu wahren. Der Standpunkt eines älteren Gesprächspartners kürzlich bietet eine Art Rettung: Wir lebten in einer interessanten Weltlage. Richtig: ein Beobachterposten, der auf Distanz halten kann. Zugleich hilft ein Blick auf den persönlichen ökologischen Fussabdruck: Der zeigt, wo jeder Einzelne, jede Einzelne mit entsprechendem Lebensstil etwas Gutes für die Umwelt tun kann, was zumindest Befriedigung und eine kleine Entlastung bietet.
... über das SterbenAlte Leute verlieren dauernd Lebensbegleiter. Viele sind gegangen: gute Bekannte, Schulkameraden, Freundinnen, Freunde, ehemalige Nachbarn, neue Nachbarinnen, Grossmutter, Vater, Mutter, Schwiegereltern, Schwägerin, ihr Sohn. Die ruhigen und sanften Abschiede der nahen Angehörigen haben gezeigt, dass ein angenommenes Sterben ein friedlicher und sogar erlösender Prozess sein kann, der nicht gefürchtet werden muss. Den Hinterbliebenen bleiben Trauer und Verarbeitung.
... über autobiographisches SchreibenDas Schreiben der eigenen Geschichte kann die Erinnerung nicht unmittelbar auf Papier bannen, so dass diese uns nicht mehr verfolgen könnte. Im Gegenteil, die Vergangenheit tritt anfänglich noch stärker hervor, erst mit der Zeit verschwimmen die Konturen. Das spätere, in grösseren Abständen wiederholte Lesen des Textes rückt dann die Geschichte jedes Mal ein ganzes Stück weiter weg, bald als wäre über eine fremde Person geschrieben worden: Die Geschichte wird banalisiert und unwichtiger. Klar ist geworden, dass zu tiefes Bohren ins Unterbewusste gefährlich ist, man könnte sich hilflos verlieren und in Depressionen versinken. Mit dem Schreiben sollte im Gegenteil ein versöhnlicher Rückblick möglich werden.
* * *
Mein Inhaltsverzeichnis
Seite 18
Seite 18 wird geladen
17.
Mein Inhaltsverzeichnis

1. ÜbergriffeKlatsch! - harmlose und weniger harmlose Übergriffe vom Kleinkind- bis ins Erwachsenenalter
2. KindheitAlkoholkranker Vater, Mutter Fabrikarbeiterin und Mitglied einer Sekte, Kinderkrippe ab Geburt bis Kindergarten, nachher bei Onkel und Tante, Ängste und Verlorenheit von uns beiden Schwestern
3. Mein BruderElf Jahre älter, egozentrisch, hat mir Ängste eingepflanzt
4. Kindergarten- und PrimarschulzeitNach schwierigem Start langsam besser bis zur 6. Klasse
5. KuraufenthaltEnde 6. Klasse Kuraufenthalt und Repetition
6. Meine GrossmutterLetzte Begegnung, rennen nach den blöden Bratwürsten, intensives Gebet in Arbon, Abdankung
7. Gute Zeiten trotzdemGemütliche, schöne und angenehme Stunden zusammengesucht
8. Sekundarschulzeit / WeiterbildungMein Abbruch mit den Pfingstlern, keine weitere Schule, zurück zur Erwachsenenwelt
9. Kette durchbrochenDie erfreuliche, erfolgreiche Familie des Sohnes meiner Schwester, gute Grosseltern für Jonas
10. Eine eigene FamilieDie Zeit lebt und treibt mich, folgenschwere Entscheidungen, Überforderung, Stress, Urvertrauen fehlt
11. Mein VaterOben am Berg nach Pensionierung guter Grossvater, sein Sterben, Versöhnung, nachträgliche Träume
12. Meine SchwiegerelternFast ein Bauernleben
13. Meine MutterEndlich gute Gespräche, ihre Vorahnungen in Träumen, Abschied, einige Vorbehalte bleiben; zwei Weltkriege und Spanische Grippe 1918/20: alte Wunden, Fragen hätten von mir kommen müssen; Familientragödie
14. Umzug ins Dorf und ZusammenbruchNach Pensionierung Umzug ins Dorf: endlich angekommen, dann Verkauf des Hauses, Abschied von unseren Tieren, zurück an den See, Zusammenbruch, Verletzlichkeit
15. Enge Verbundenheit mit der NaturWelche verpasste Chance? Akzeptanz, neue Orientierung, neue Sichten, neues Verständnis
16. AbendrotKommende und verglimmende Lichter, Naturkreislauf, Adler hoch über den Bergen - letzter Wunsch und Hoffnung auf Erfüllung
17. Nachträglich Gedanken über ...verschiedene Themenkreise
* * *